Die Verwaltungsjuristin Theanolte Bähnisch (1899-1973) und der Deutsche Frauenring: Vom reformorientierten Preußen zur bundesdeutschen Westbindung - eine Wirkungsgeschichte 9783839442173
Theanolte Bähnisch, President of the German Women's Circle (DFR), played a major role in the Western ties of the F.
161 102 7MB
German Pages 1152 [1148] Year 2018
Inhalt
Vorwort und Danksagung
1. Einführung in das Thema
2. Vom katholischen Münsterland in die Weltmetropole Berlin: Sozialisation im Kaiserreich und in der Weimarer Republik
3. Ehemann, beruflicher Partner und politischer Freund: Albrecht Bähnisch (1900–1944)
4. Familienleben und Trennungen, politischer Umbruch und neue berufliche Wege: Von Merseburg über Berlin nach Köln (1930–1945)
5. Eine unbekannte Behörde und ihre populäre Leiterin – Theanolte Bähnisch als Regierungspräsidentin des Bezirks Hannover in den ersten Nachkriegsjahren
6. Überparteilich, aber nicht unpolitisch: Genese und Arbeit, Mitglieder, Förderer und Gegenspieler von Bähnischs Club deutscher Frauen
7. „eine hochwichtige staatspolitische Aufgabe“: Vom Hannoveraner Club zur zonenweit agierenden „Organisation gegen den Demokratischen Frauenbund“
8. Bähnischs wachsende Prominenz in der Außenpolitik und die Entwicklung des Frauenrings zum ‚Deutschen Frauenring‘
9. Fazit
Abkürzungsverzeichnis
Quellen und Literatur
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Nadine Freund
File loading please wait...
Citation preview
Nadine Freund Die Verwaltungsjuristin Theanolte Bähnisch (1899–1973) und der Deutsche Frauenring
Histoire | Band 130
Nadine Freund (Dr. phil.), geb. 1978, forscht am Institut für Zeitgeschichte in München. Ihre Schwerpunkte bilden Themen der Kultur- und Ideengeschichte, der Verwaltungs- und Unternehmensgeschichte des 20. Jahrhunderts sowie der Erinnerungskultur. Sie war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kassel tätig, bevor sie im Auftrag des Regierungspräsidiums Kassel die Geschichte der Behörde im Nationalsozialismus untersuchte.
Nadine Freund
Die Verwaltungsjuristin Theanolte Bähnisch (1899–1973) und der Deutsche Frauenring Vom reformorientierten Preußen zur bundesdeutschen Westbindung – eine Wirkungsgeschichte
Dissertation an der Universität Kassel, Fachbereich 5, Nadine Freund, Datum der Disputation: 28.10.2015
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2018 transcript Verlag, Bielefeld Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. Umschlaggestaltung: Maria Arndt, Bielefeld Umschlagabbildung: Cover: Theanolte Bähnisch, Foto von Kurt Julius, o. J., Hannover; Back-Cover: »Robert Kempner with Theanolte Baehnisch and Karl Severing«, Leo Baeck Archives, Robert M. W. Kempner Collection AR 3977, circa 1940, Accession Number: F 2277 Druck: CPI Clausen & Bosse, Leck Print-ISBN 978-3-8376-4217-9 PDF-ISBN 978-3-8394-4217-3 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Besuchen Sie uns im Internet: https://www.transcript-verlag.de Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter: info@ transcript-verlag.de
Inhalt
1.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.4.1 1.7.4.2 1.7.4.3 1.7.4.4 1.8 1.9 1.10 1.11
Einführung in das Thema | 21 Ein Brief geht nach Hannover | 21 Posthume Rezeption Theanolte Bähnischs und Forschungsstand | 30 Eigene Vorarbeiten zum Thema | 41 Vom ‚Westernisierungs-Ansatz‘ zum biographischen Zugang | 46 Ziel der Arbeit, zentrale Thesen, Eingrenzung des Gegenstands | 53 Fragestellung | 56 Leitende Theorien und Methoden | 60 Antonio Gramscis ‚Hegemonie-Theorie‘ | 60 Diskurstheorie und Begriffsgeschichte | 63 Netzwerkanalyse | 67 Biographie-Theorie | 73 Rekonstruktion von Lebenskonstruktion | 73 Autobiographische Texte und andere Selbstzeugnisse | 77 Biographie und Geschlecht | 80 Deutungsgemeinschaften/Erinnerungskartelle | 82 Inhaltliche Dimensionierung der Arbeit | 85 Zentrale Literatur | 88 Quellen | 98 Aufbau der Arbeit | 104
2.
Vom katholischen Münsterland in die Weltmetropole Berlin: Sozialisation im Kaiserreich und in der Weimarer Republik | 109
2.1
Kindheit und Jugend zwischen Industrialisierung, Nationalstaatskonsolidierung und Katholizismus (1899 bis 1919) | 109 Aus dem aufstrebenden Beuthen ins ländliche Warendorf | 109 Franz Noltes Engagement für die Mädchenbildung | 116 Darstellung der Eltern-Familien in autobiographischen Texten Bähnischs | 119 Die gestaltende Macht des Glaubens und der Kirche in Theas Jugend | 125 Die Noltes in der Warendorfer Gesellschaft | 130 Die Genese der Entscheidung für das Jura-Studium | 132 „Es beugt ein brauner Lockenkopf sich übers Corpus Iuris“ – Studium, Gerichts- und Verwaltungsreferendariat (1919-1926) | 134 Jura-Studium in Münster unter unbequemen Bedingungen | 134 Entscheidung gegen das Strafrecht und für die Verwaltung – Viele Anekdoten und wenig faktische Anhaltspunkte | 140
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2
2.2.3
Prostitution als Gegenstand von Verwaltungshandeln: Praktische und theoretische Unternehmungen der Referendarin in Köln und Brauweiler | 147 2.2.3.1 Prostitution als Gefahr für die Volksgesundheit – Die etablierte staatliche Haltung | 147 2.2.3.2 Prostitution als Thema der Frauenbewegung: Fürsorge statt Bestrafung | 149 2.2.3.3 Veränderungen in der Anstalt Brauweiler unter dem Eindruck der Reformgesetze | 153 2.2.3.4 Die Kölner Frauenwohlfahrtspolizei | 155 2.2.3.5 Ziele der Frauenbewegung und der staatlichen Reformpolitik in der Synthese | 158 2.2.3.6 Die Staatsexamensarbeit: Noltes Position zwischen Tradition und Reform | 163 2.3 Beruf, Politik und neue Freundschaften: Die (ersten) Berliner Jahre (1926–1930) | 170 2.3.1 Berufseinstieg im Polizeipräsidium zwischen Politik, Verwaltung und Kultur | 170 2.3.1.1 Kompetenzerweiterung, Modernisierung, Volksnähe: Aufgaben und Reformen der preußischen Polizei | 170 2.3.1.2 Im Zentrum der Macht und der Krise des Staates: Dorothea Nolte als Teil des ‚Bollwerk Preußen‘ | 175 2.3.1.3 „Die[…] Einmaligkeit der Zwanziger Jahre begreift nur der, der das Glück hatte, dabei zu sein“: Die Arbeit in der Theaterabteilung | 180 2.3.1.4 Eine Frau im Männerreich? Die Verwaltungsjuristin in der Kritik | 184 2.3.1.5 Der technische Fortschritt und die Angst des Bürgertums vor Vermassung und Technisierung – Vorboten der späteren Kommunismus-Kritik? | 187 2.3.2 Beste Schwestern: Rückhalt und Freundschaften im Soroptimist-Club | 192 2.3.2.1 Ein Service-Club verspricht Unterstützung für berufstätige Stadtberühmtheiten | 192 2.3.2.2 Theanolte als prominentes Mitglied eines ungewöhnlichen Clubs | 196 2.3.2.3 Selbstverständnis des Clubs und Berufsstruktur seiner Mitglieder | 200 2.3.2.4 Ilse Langner: Eine enge Vertraute Bähnischs aus dem Kreis der Soroptimistinnen | 203 2.3.2.4.1 Frauen auf dem Weg zu neuem Selbstverständnis – Grund- und Stolperstein der Karriere Langners | 203
2.3.2.4.2 Kämpferinnen und kriegsmüde Frauen – Ilse Langner zwischen modernen und antiken Frauengestalten und in der Sicht Theanoltes | 206 2.3.2.4.3 Theanolte in der Darstellung Ilse Langners – im Drama und im Lexikon | 210 2.3.2.5 Netzwerk, Schaubühne, Rekrutierungs- und Vermittlungspool: Die Bedeutung eines nur drei Jahre währenden Zusammenschlusses für seine Mitglieder | 214 2.3.2.5.1 Das Beispiel Lotte Jacobi | 214 2.3.2.5.2 Bähnisch als Anwältin der Ärztinnen | 216 2.3.2.5.3 Der Club als Anlaufstelle und Übungsfeld für Multiplikatorinnen |223 2.3.2.5.4 Zerfall und Wiederaufleben des Clubs in veränderter Zusammensetzung/Schicksale seiner Mitglieder | 224 3
Ehemann, beruflicher Partner und politischer Freund: Albrecht Bähnisch (1900–1944) | 233
3.1
„ganz besonders schöne Jahre“ – Die Bähnischs als Ehe- und Arbeitspaar | 233 Herkunft und Ausbildung Albrecht Bähnischs | 243 Albrechts Familie: Protestantische Bildungsbürger mit Neigung zum Rechtswesen | 243 Studium der Rechtswissenschaften in Marburg und Berlin | 248 Mit Verantwortung beladen und an der Grenze des wissenschaftlichen Ehrgeizes: Albrecht als Regierungsreferendar |253 Mitarbeit an der Verwaltungsgesetzreform im Preußischen Innenministerium | 258 Neue politische Wege erfordern neues Personal: Glänzende Ausgangsbedingungen im Innenministerium | 258 Ein „heiß erstrebtes Ziel“ – Beamtenrechte der Schutzpolizei | 260 „Gelungenste[s] Reformprojekt“ der preußischen Innenpolitik: Die Neufassung des Polizeiverwaltungsgesetzes | 263 Albrecht Bähnischs schriftliche Beiträge zur Polizeiverwaltungsreform: Gesundheit und Sittlichkeit im Fokus | 269 Berufliche Sozialisation in liberal-sozialen Kreisen – Die Bähnischs im Zirkel preußischer Politik- und Verwaltungseliten | 276 Inhalte von nachhaltiger Wirkung, Kontakte von langfristiger Bedeutung (auch) für Theanolte | 291 Albrecht Bähnischs Mitarbeit in der ‚Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost‘ (SAG) | 294 Die gespaltene Gesellschaft und die ‚bürgerliche Sozialreform‘ | 294 Nächstenliebe, Sozialromantik, Forschergeist? Verschiedene Beweggründe für dasselbe Projekt | 294
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2.1 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.4 3.4.1 3.4.1.1
3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4 3.4.1.5 3.4.2 3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5
3.4.2.6 3.5 3.5.1 3.5.1.1 3.5.1.2 3.5.1.3 3.5.2
3.5.3 3.6
Sex and Crime. Der Berliner Osten in der bürgerlichen Wahrnehmung | 296 Die bürgerliche Sozialreform zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik | 299 Selbstverständnis, Zielsetzung, Träger und alltägliche Arbeit des Settlements | 305 Albrechts Engagement in der Genese: Zunächst ‚Resident‘, dann ‚Associate‘ | 309 Ein asymmetrisches Projekt von nachhaltiger Wirkung | 312 Aktuelle Kritik an der SAG und zeitgenössische Reflexionen – auch Theanolte positioniert sich | 312 Zwischen SAG, Verwaltung, Wissenschaft und Erwachsenenbildung – Köpfe in der SAG mit besonderer Bedeutung für die Bähnischs | 318 Effekte der SAG-Arbeit über Berlin und die Weimarer Republik hinaus | 324 Die SAG als Übungsfeld und Sprungbrett für Albrecht | 327 Albrechts Position zwischen Bürgerlicher Sozialreform und dem Sozialstaat 1928 – eine Folge der „Krise [staatlicher] Wohlfahrtsarbeit“? | 331 Die Bedeutung der SAG in Theanolte Bähnischs Biographie | 337 Albrecht Bähnisch setzt sich für die Heimvolkshochschule Dreißigacker ein | 344 Gründer, Pädagogisches Konzept, Zielgruppenorientierung und Gegner | 344 Eduard Weitschs Position zwischen zwei Richtungen der Volksbildungsbewegung | 346 Vier lebensverändernde Monate? Das Prinzip gemeinsamen Lebens und Lernens | 348 Freie Volksbildungsarbeit versus sozialdemokratische Kaderschmiede | 349 Der Aufstieg der Nationalsozialisten und das Ende der Reformpädagogik – Albrecht Bähnisch unterstützt den Verein zur Erhaltung des Volkshochschulheims | 354 Das Erbe der ‚Neuen Leipziger Richtung‘ in der Frauenbildung ab 1945 | 358 Zusammenschau der Handlungslogik des Ehepaars in der Weimarer Republik; Ausblick auf die daraus resultierenden Rahmenbedingungen für die Zukunft Theanoltes | 361
4
Familienleben und Trennungen, politischer Umbruch und neue berufliche Wege: Von Merseburg über Berlin nach Köln (1930–1945) | 365
4.1
Der Weggang nach Merseburg in der ausgehenden Weimarer Republik | 365
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.3
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5
Neue Rollen für Albrecht und Theanolte: Ein blutjunger Landrat und eine politisch informierte Ehefrau und Mutter | 365 „[E]in politisch schwieriger Bezirk“ – Aufstieg und Fall Albrecht Bähnischs | 371 Lieber ein Ende mit Schrecken – Das Ehepaar zwischen Bangen und Hoffen | 380 Ebert wird abgehängt – Merseburg unter neuen Machthabern | 382 Berufsarbeit und Einkommen Theanolte Bähnischs – Zahnkranz im Räderwerk der Demontage und Anlaß zu neuer Hoffnung | 383 „Wir werden […] unser Leben neu aufbauen“: Zurück in Berlin | 386 Die Anwaltspraxis für Verwaltungsrecht | 386 Zwischen der Neigung zum Rechtswesen und lukrativeren Tätigkeiten in der Privatwirtschaft | 389 Die ‚Gruppe Harnack‘, der ‚Freiheitsverlag‘ und die juristische Vertretung ‚rassisch‘ und politisch Verfolgter | 393 War Theanolte Bähnisch eine Widerstandsaktivistin? | 393 Bähnisch als Vertraute von Widerstands-Aktivisten | 399 Der Widerstand in der Familienerinnerung | 403 Neue Chancen und Pflichten für den Landrat a. D. – Frustration und Einsamkeit auf der Seite seiner Frau: Das Leben in Köln ab 1935 | 404 Albrechts Karriere in einem ‚kriegswichtigen Unternehmen‘ | 404 Der Prokurist an der Front – und in Gedanken an neuen Ufern | 409 Albrechts ungeliebter Beruf und Theanoltes ungeliebte Erinnerung | 411 „Ich sah dieses Unglück immer so unentrinnbar auf mich zukommen“ – Theanoltes Strategien der Ablenkung und Einkehr | 416 „Ich war gezwungen, meine Kinder stark zu vernachlässigen“: Die Juristin zwischen dem „Dienst an der Allgemeinheit“ und der Rolle als Mutter | 420
5
Eine unbekannte Behörde und ihre populäre Leiterin – Theanolte Bähnisch als Regierungspräsidentin des Bezirks Hannover in den ersten Nachkriegsjahren | 427
5.1
1945 als Chance: Über den Aufbau und den Selbstentwurf Bähnischs als erste deutsche Regierungspräsidentin | 427 „Wir […] möchten Sie besser verwendet sehen, als bisher“ – Die Einladung nach Hannover | 427 Deutsche und britische Personalpolitik in der Provinz Hannover | 431 Entwurf des ‚unternehmerischen Selbst‘ – Darstellung der Vergangenheit im Dienst von Gegenwart und Zukunft | 436 ‚Frischer Wind‘, aber auch starke Beharrungstendenzen: Bähnischs Sicht auf die Verwaltung, ihre Art der Amtsführung und Außendarstellung | 439
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2
5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.7.1
5.2.7.2 5.2.7.3 5.3 5.3.1 5.3.2
5.3.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3
5.4.4
5.5 5.6 5.6.1 5.6.2
Ein Traditionsamt im Angesicht neuer Herausforderungen | 439 „So menschlich wie möglich“ – Mutmaßungen zur Popularität Theanolte Bähnischs | 441 Eine politische Beamtin als Fürstreiterin für politischen Pluralismus und die Zusammenarbeit mit den Kirchen | 446 Regionales Amt – überregionale Wirkung | 449 Zwischen Unterstützungserwartung und Souveränitätsstreben: Die Kooperation mit der Militärregierung | 450 Bähnischs Engagement für den Einsatz von Frauen in der Verwaltung | 456 Wie gewonnen, so zerronnen? Die Zukunft der Mittelinstanz steht in den Sternen | 459 Die Militärregierung holt zum Schlag gegen die deutsche Verwaltungsordnung aus – Diskussion für und wider die Regierungspräsidien | 459 Bähnischs Rolle in der Diskussion um die Abschaffung der Mittelinstanz | 465 Die Verwendung als Regierungspräsidentin, ein logischer Schritt in der Biographie? | 472 Noch eine neue Aufgabe: Die Übernahme der Bezirkspolizeileitung | 473 Eine wichtige Etappe im Streben nach Autonomie | 473 Zwischen mißglückter Entnazifizierung und fragwürdigem Desinteresse: Die Kontinuität von ‚Verwaltungseliten‘ aus dem Dritten Reich in der niedersächsischen Polizei | 478 „In gelöster Haltung“ – Bähnisch und die Polizei zwischen Tradition und Reform | 483 Bildung und ‚Soziales‘: Kernaufgaben der Regierungspräsidentin in der Nachkriegszeit | 487 Der Bezirk Hannover als Drehscheibe der Flüchtlingsströme | 487 (Zweifelhafte) Traditionen und demokratische Aspekte in der Wohlfahrtsarbeit | 493 Die Fürsorge für deutsche ‚Opfergruppen‘, das Beschweigen der Opfer des Nationalsozialismus und die Tradierung von Feindbildern | 498 Professionell, reformorientiert, alleinstehend: Anna Mosolf, Käthe Feuerstack und Katharina Petersen als Verbindungspersonen zwischen Kultusministerium, RP und dem Club deutscher Frauen | 503 Die niedersächsische Schulreform: Anknüpfen an ‚Weimarer‘ Gepflogenheiten in einem vertrauten Team | 510 Der Schwerpunkt Jugendfürsorge und -bildung in der Wiederaufbau-Arbeit Bähnischs | 517 Das Jugendflüchtlingslager Poggenhagen | 517 Der Club junger Menschen | 520
5.6.2.1 5.6.2.2 5.6.2.3 5.6.2.4 5.6.2.5
Wie aus Hitler-Jungen Demokraten werden sollten | 520 Orientierung am demokratischen Aufbau statt provokative Aufklärung über die Vergangenheit | 524 Rekrutierung des Vorstands, Zusammensetzung und Vernetzung | 527 Die ‚Lage der Jugend‘ – (Auch) ein Stellvertreterdiskurs für die Lage der Gesellschaft | 530 Bähnischs Club-Gründungen als Trend und Gegen-Trend zugleich | 532
6
Überparteilich, aber nicht unpolitisch: Genese und Arbeit, Mitglieder, Förderer und Gegenspieler von Bähnischs Club deutscher Frauen | 535
6.1
Einführung und Ausblick: Eintreten für die Mitarbeit von Frauen – Die Regierungspräsidentin stellt sich einer (weiteren) großen Herausforderung | 535 Frauenzusammenschlüsse in Deutschland ab 1945 | 541 „Überleben ist nicht genug“: Hunger und Feminismus nach 1945 | 541 Frauen in der Nachkriegszeit als Forschungsgegenstand zwischen ‚Frauenforschung‘, ‚Bielefelder Schule‘ und ‚Alltagsgeschichte‘ | 543 ‚Überlebenspolitik‘, ‚Frauenpolitik‘ und ‚Politik als Deutungskampf‘ – vielschichtige Zielsetzungen der Organisationen erfordern einen offenen Forschungszugang | 546 Frauen-Zusammenschlüsse als landesweites Phänomen | 549 Der besondere Fokus auf Frauen in der britischen Militärregierung | 552 Die Umerziehungspolitik der Alliierten | 552 Die Arbeit der britischen Women’s Affairs Officers und eine Instruktion, die auch Bähnisch erreicht haben muß | 554 Hannover im Zentrum der Aufmerksamkeit: Wer soll die Frauen bilden? | 556 Umworbene Eliten der Frauenbildung – Die niedersächsische Volkshochschule und die Gründerinnen des ‚Club deutscher Frauen‘ | 556 Fritz Borinskis Konzept der ‚Mitbürgerlichen Bildung‘ und sein Einfluß auf die ‚staatsbürgerliche Frauenbildung‘ Bähnischs | 559 Jeanne Gemmel stellt sich gegen die Volkshochschule und sucht Hilfe in der britischen Frauenbewegung | 565 „We are aiming at nothing less than the changing of German society“: Die Militärregierung, die WGPW und der Wiederaufbau der sozialen Arbeit in Deutschland | 571 Der ‚Club deutscher Frauen‘ etabliert sich | 581 Die Volkshochschule verliert ihre Hoffnungsträgerinnen für die Frauenbildung an Bähnisch | 581
6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3
6.2.4 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4
6.5 6.5.1
6.5.2
6.5.3 6.5.3.1 6.5.3.2 6.5.3.3 6.5.3.4 6.5.3.5 6.5.3.6 6.5.4 6.5.5 6.5.5.1 6.5.5.2 6.5.5.3 6.5.5.4 6.6 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.7
6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4
Ankündigungen und Appelle des Clubs: Menschlichkeit, das Engagement von Frauen im öffentlichen Leben und die Wiedererweckung des nationalen Stolzes | 583 Vom überparteilichen Geist und drei Frontal-Referaten geprägt: Die erste Club-Kundgebung | 588 Frauenbewegung und Berufstätigkeit als Alternative zu Partnerschaft und Familie | 589 Eine Absage an die Parteiendemokratie? Die Idee des weiblichen Einflusses auf die ‚Gemeinschaft‘ | 592 ‚Mütterlichkeit‘ und ‚Friedfertigkeit‘ – Anknüpfen an Schlüsselbegriffe der bürgerlichen Frauenbewegung | 595 Anna Mosolfs kulturkritische Analyse der Vergangenheit | 599 Elfriede Paul fordert die Abkehr vom Faschismus | 602 Trotz organisatorischen Desasters eine vielversprechende Veranstaltung? Die Kundgebung in der Nachlese | 605 Club-Gründung und Gründungsvorstand | 606 Club-Angebote für Mitglieder und Gäste | 612 Mehr als eine Gedenkveranstaltung – Der Club erweist Helene Lange die Ehre | 616 Mehr Lobbyismus als Bildungsangebote: Die Club-Arbeit in der frühen Phase | 619 Die politische Bildungsarbeit nimmt zu – Schlaglichter aus den Jahren 1947 und 1949 | 621 Mitgliederinteressen, Einflußmöglichkeiten, (Willens-)Bildungsprozesse – eine Doppel-Strategie bestimmt das Club-Leben | 626 Der Club in der Auseinandersetzung mit anderen politischen und gesellschaftlichen Kräften | 629 Nur eine Frauenorganisation unter vielen? Der Club und die ‚Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände‘ in Hannover | 629 Der Umgang des Clubs mit ‚seinen‘ Kommunistinnen | 633 Die Reaktion der ‚Abteilung Frauenkreis‘ in der CDU auf die Club-Arbeit | 634 Elisabeth Selbert (SPD) wird auf die überparteiliche Frauenarbeit aufmerksam | 637 „Their feud has become legendary“: Die Auseinandersetzung zwischen der SPD-Frauensekretärin Gotthelf und ihrer Genossin Bähnisch | 639 Hannover wird Startpunkt und Hauptschauplatz eines landesweiten Kräftemessens | 639 Vorurteile führender Genossinnen gegen die ‚Überparteilichen‘ und der Ruf nach harten Sanktionen | 645 Schumacher bezieht Stellung, trifft jedoch keine Entscheidung | 648 Ideologischer Eklektizismus oder sozialdemokratische Überzeugung? Ein gemeinsames Ziel, aber zwei verschiedene Wege | 650
6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.8 6.8.1 6.8.2 6.8.2.1 6.8.2.2 6.8.2.3 6.8.2.4 6.8.2.5 6.8.2.6 6.8.2.7 6.9
6.9.1 6.9.2 6.9.3 6.9.4
Bähnischs Umgang mit dem Nationalsozialismus als Kritikpunkt der Sozialdemokratinnen | 653 Zur Vielschichtigkeit frauenpolitischen Engagements in der SPD | 654 „Ich habe keine Lust, ein zweites 33 zu erleben“: Gefahr durch Infiltration oder durch politische Abstinenz? | 656 Die Orientierungslosigkeit der Militärregierung in Sachen ‚Frauenfragen‘ und die rettende Hilfe durch ‚Visiting Experts‘ | 658 Jeanne Gemmel bittet erneut die WGPW um Unterstützung | 658 Der ‚Deneke-Norris-Report‘: Ein Kerndokument der britischen Frauen-Re-education-Politik in Deutschland | 662 Weichzeichnungen und Vorschuß-Loorbeeren: Deneke empfiehlt die Unterstützung des Clubs deutscher Frauen | 664 Hinter den Kulissen: Die Genese des Reports und die Bewertung des Clubs in unveröffentlichten Dokumenten | 666 Tips für die Leitung der ‚Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände‘ an Bähnisch | 667 „a one man’s show“ – Ämterhäufungen unter dem Vorsitz Bähnischs | 671 Abschließende Empfehlungen, ihre Umsetzung und die Erweiterung des Einflusses der WGPW | 671 Auch ein Effekt der Hilfe Denekes: Die Regierungspräsidentin als ‚Gate-Keeper‘ zu Kontakten und Auslandsreisen | 674 Herrschaft der Verbände? Deneke als Lobbyistin der Frauenbewegung | 676 Die Reise nach Großbritannien: Auftakt zur internationalen Kooperation in der Frauenbewegung und eine Chance für den Regierungsbezirk Hannover | 678 Kritik an der Mission – Die Political Branch stellt sich gegen die Reise Bähnischs | 679 Der International Council of Women re-etabliert seine Verbindungen nach Deutschland | 680 Die Sorgen des Regierungsbezirks im Gepäck | 685 Selbstdarstellungen und persönliche Stellungnahmen: Die Juristin will Eindruck machen | 690
7
„eine hochwichtige staatspolitische Aufgabe“: Vom Hannoveraner Club zur zonenweit agierenden „Organisation gegen den Demokratischen Frauenbund“ | 695
7.1
Die Frauenbewegung in der SBZ, die Gründung des DFD im März 1947 und die Reaktionen im ‚Westen‘ | 695 Ähnliche Ziele wie der Club, aber andere Vorgaben: Der DFD als Organisation der SED | 695 Die ‚Anwältin der Frauen‘ tritt aktiv den Kommunistinnen entgegen und erntet Beifall von Officer Walker | 699 Die Gründung des DFD als überregionaler Frauenverband in Berlin – unter ‚bürgerlicher‘ Beteiligung | 702 (K)ein Gebot der ersten Stunde: Feminismus und Antikommunismus in der Selbstkonstruktion Bähnischs und in der Organisationsgeschichte des Frauenrings | 706 „Im Osten geht es um eine Vergottung des Kollektivismus“ – (Nicht nur) Bähnischs inhaltliche Abgrenzung zum DFD und zum Kommunismus | 714 Ein Ausblick: Interzonale Frauen-Konferenzen in Westdeutschland 1947 bis 1949: Meilensteine auf dem Weg zur Re-organisation der Bürgerlichen Frauenbewegung | 723 Zwischen selbstbewußtem Aufbruch und dem schwierigen Umgang mit der Vergangenheit: Die Konferenz von Bad Boll (20. bis 23. Mai 1947) | 731 Eine andere Besatzungszone, aber ein vertrauter Kreis – Bähnischs Friedensappell an die ‚Frauen am Scheideweg‘ | 731 Ein großer Schritt für die Frauenbewegung oder ein Beitrag zur Restauration traditioneller Geschlechterrollen? Die Bewertung der Konferenz in der Forschung | 736 Vom Umgang mit Nationalsozialistinnen und Kommunistinnen in Bad Boll – Verhinderungs-, Überwindungsund Vermeidungsstrategien der Regierungspräsidentin | 739 Die Bewertung durch zeitgenössische deutsche und ausländische Beobachter | 745 Die Tagung von Bad Pyrmont (20. bis 23. Juni 1947) und die Gründung des Frauenrings der britischen Zone durch die Leiterin des Club deutscher Frauen | 750 Politische, pädagogische und philosophische Betrachtungen über die ‚Renaissance des Menschen‘ unter der Schirmherrschaft des Kultusministers | 750 Praktische Ansätze zur Unterstützung leidgeprüfter Bevölkerungsgruppen im Alltag | 759 Die Konstituierung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ – Herbe Enttäuschungen und ein Traditions-Bruch | 765
7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4
7.1.5
7.2
7.3
7.3.1 7.3.2
7.3.3
7.3.4 7.4
7.4.1
7.4.2 7.4.3
7.4.4 7.4.4.1
7.4.4.2 7.4.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.6
7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.6.6
7.7
7.7.1 7.7.2 7.7.2.1 7.7.2.2 7.7.2.3
Entscheidende Statements: Unterstützung des ‚Frauenrings‘ | 773 „trotz Frühgeburt, das Kind ist da“ – Die Akzeptanz von Bähnischs „rascher Führung“ in der deutschen bürgerlichen Frauenbewegung | 773 ‚Pyrmont‘ und die Konferenz der Sozialdemokratinnen in Fürth in der Bewertung von Senior Women’s Oficer Ostermann | 775 Helena Deneke lobt ‚Pyrmont‘ überschäumend | 779 Quo vadis Theanolte Bähnisch? Erschöpfung, Zerissenheit und die Suche nach Alternativen zu den etablierten Arbeitsfeldern | 783 Eine ausgebrannte Vorsitzende hegt Fluchtgedanken | 783 Die Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ | 785 Organisation im Nachgang – Der ‚Ring‘ gibt sich einen Vorstand und schärft sein Profil | 792 „Sie will die Frau im Westen werden“ – Bähnisch, der Frauenring und die Frauenkonferenzen in den Westzonen aus der Sicht von KPD-, SED- und DFD-Funktionärinnen | 795 Ein Mitglied des ‚Club deutscher Frauen‘ wechselt die Fronten | 796 Kooperation angestrebt: Führende Kommunistinnen buhlen um Bähnischs Gunst | 798 Hilfestellung aus der KPD bei der Überwachung westdeutscher Frauenorganisationen durch die SED | 804 Aus nächster Nähe: Empfehlungen aus dem KPD-Bezirk Hannover | 809 Der Frauenring: Wenig Angriffs-, aber viel Reibungsfläche für Kommunistinnen | 812 „Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, daß sie vom Osten nichts hören wollen“: Der gesamtdeutsche Anspruch des DFD und die Haltung Bähnischs | 816 Frauen-Tagungen in Berlin und Frankfurt zwischen ‚München‘ und ‚London‘: ‚Frieden‘ versus ‚Freiheit‘ und der Bruch zwischen ‚Ost‘ und ‚West‘ | 820 Die DFD-Tagung im Rahmen des ersten ‚Volkskongreß für den Frieden‘ (Dezember 1947) | 820 Die interzonale Tagung der Frauenverbände in Frankfurt (Mai 1948) | 825 Umstände und Teilnehmer | 825 Staatsbürgerinnen statt Parteipolitikerinnen – Bähnischs Kampfbegriff für ein neues Deutschland prägt die Konferenz | 828 Vorsichtige Abkehr von der Rhetorik der Bürgerlichen Frauenbewegung in Hessen – nicht jedoch in Niedersachsen | 834
7.7.2.4 7.8
7.8.1
7.8.2 7.8.3 7.8.4 7.8.5 7.8.6
Ein Konzept für eine Schule für staatsbürgerliche Frauenbildung – und eine Bilanz des bisher in der Frauenpolitik Geleisteten | 835 Rückblick auf den Austausch zwischen Hannover, Berlin, London und Washington: Die deutsche Frauenbewegung ist Chefsache in Großbritannien und Thema in den USA | 840 „I am disappointed that we do not appear to have done anything“ – Britische Spitzenpolitiker zwischen Uninformiertheit und brennender Sorge | 840 Herta Gotthelf kritisiert die Förderung des Frauenrings durch die ‚Bruderpartei‘ | 849 Was ist Politik, was Demokratie? – Bähnisch und die CCG (BE) sind sich einig | 854 „we should […] back the Frauenring under the leadership of Frau Bähnisch“ – General Robertson spricht ein Machtwort | 857 Mehr Kapazitäten für Frauen-Re-education: Veränderungen im britischen Militärapparat | 860 OMGUS gründet eine Women’s Affairs Section und wirbt um Bähnisch | 861
8
Bähnischs wachsende Prominenz in der Außenpolitik und die Entwicklung des Frauenrings zum ‚Deutschen Frauenring‘ | 867
8.1
Binational, international, supranational, aber vor allem europäisch: Bähnisch mehrt ihren Bekanntheitsgrad | 867 Mit der Verantwortung wächst die Arbeitsbelastung | 867 Engagement in der ‚Europäischen Bewegung‘ | 871 Was wird aus dem Frauenring? Hoffnungen, Enttäuschungen und neue Entwicklungen auf britischer Seite | 884 Leere Kassen, eine unausgewogene Mitgliederstruktur und dennoch förderungswürdig? Erneute Lageanalyse und Entwicklungshilfe für den Ring durch Deneke | 884 Ein objektiverer Blick auf den ‚Ring‘? Stellungnahmen der Regional Women’s Affairs Officers und Vorwürfe durch andere Mitarbeiter/Ratgeber der CCG (BE) | 890 Der Frauenring – nur eine Hoffnung unter vielen überparteilichen Organisationen? | 898 „the methods adopted were undemocratic“ – Die Briten unterstützen die Gründung einer größeren Organisation durch Bähnisch dennoch | 900 Bähnisch und ihr Frauenring als Säule der westalliierten Containment-Politik | 904 Die Regierungspräsidentin als Hoffnungsträgerin in der internationalen Frauenbewegung | 907
8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1
8.2.2
8.2.3 8.2.4
8.2.5 8.2.6
8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4
8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.8.1
8.3.8.2 8.3.8.3 8.3.9 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5
8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4
Der zweite Kongreß von Pyrmont und die Gründung des Deutschen Frauenrings (DFR) als Frauenverband für (West-)Deutschland | 910 „Es wird höchste Zeit, daß wir unter ein Dach kommen“ – Ungeduld und große Erwartungen | 910 Eine reibungsvolle Genese: Die Gründungsmitglieder und ihre Verhandlungen über den Vorstand des DFR | 914 Vom Charakter eines überparteilichen Führungs-Komitees und seinem Unbehagen mit den ‚Massen‘ | 927 Die Akzeptanz Bähnischs als neue Führungsfigur (auch) in der ‚Bürgerlichen Frauenbewegung‘ – Schnittstellen und Symbiosen von Eliten-Kontinuitäten | 933 Schwammige Begriffe mit Integrationspotential | 937 Ein Dach ohne Haus – Der DFR erfüllt eine zentrale Erwartung nicht | 942 Die Reaktionen ausländischer Gäste auf ‚Pyrmont II‘ | 948 „Sinn und Aufgaben des Deutschen Frauenrings“ – Bähnischs Rede auf dem Gründungskongreß des DFR | 953 Rechte, Pflichten und Chancen dreier Frauengenerationen: Von angeleiteter Sublimation über doppelte Rollen bis zur Umgestaltung der Welt | 953 Die ‚gemeinsame Frauenhaltung‘ als Ausdruck von Solidarität im privaten und im öffentlichen Leben | 962 „Wir sind alle Deutsche“: Die Aufgaben der Frauen(bewegung) in der Schicksals- und Wiederaufbaugemeinschaft | 965 Die Arbeits-Ausschüsse des DFR – Ein wichtiges Forschungsfeld für eine Organisations-Geschichte | 975 „Nun begann die eigentliche Arbeit“: Das Wirken des DFR auf Bundes-, Landes- und Ortsebene anhand ausgewählter Beispiele | 982 Die Entwicklung der Landesringe bis 1952 – Schlaglichter | 985 Die Arbeit der Ortsringe an den Beispielen Freiburg und Oldenburg | 989 Die Arbeit des Bundesvorstands, seiner Präsidentin und seiner Ausschüsse | 997 Bähnisch, der DFR und die Ministerien – Personalpolitik, Zusammenarbeit und die Institutionalisierung von Bewegungszielen | 1006 Die ‚gesamtdeutsche Arbeit‘ des Frauenrings wird Regierungs- und Geheimsache | 1006 Bähnischs personalpolitische Einflußnahme auf das Frauenreferat im Bundesinnenministerium | 1009 Personalpolitik beim ‚Informationsdienst für Frauenfragen‘ | 1014 Das BMI-Frauenreferat zwischen Widersachern und Unterstützern | 1018
8.6
8.7
Auf internationaler Mission und am Ende der Kräfte: Eine Entscheidung steht an | 1029 Reisen über Reisen und Krankheiten über Krankheiten | 1029 Auf zu neuen Ufern: Vom Vorsitz des DFR in den Vorstand des ICW | 1033 „bis die Sache steht“ – Bähnisch gründet eine deutsche UN-Liga | 1038 Epilog | 1041
9
Fazit | 1045
8.6.1 8.6.2 8.6.3
Abkürzungsverzeichnis | 1071 Quellen und Literatur | 1075
Vorwort und Danksagung
Mein Dank gilt allen Unterstützern dieser Arbeit, insbesondere meinem Betreuer Prof. Dr. Jens Flemming sowie den weiteren Gutachtern der Studie, beziehungsweise Beisitzern der Disputation, Prof. Dr. Bernd Overwien, Prof. Dr. Hans-Joachim Bieber und Prof. Dr. Winfried Speitkamp. Bedanken möchte ich mich bei allen Archivmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, die meine Arbeit über die Dauer ihrer Entstehung unterstützt haben. Insbesondere danke ich Dr. Kerstin Wolff, die mich auf die Person Theanolte Bähnisch aufmerksam gemacht hat. Danken möchte ich auch den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren der Universitätsbibliothek Kassel, den Mitarbeiterinnen des Dekanats und der Sekretariate im Fachbereich 05 der Universität, vor allem Silke Stoklossa-Metz für ihre immerwährende Hilfe und beschwingende Freundlichkeit. Schließlich danke ich meinem Mann, meiner Familie, meinen Kolleginnen und Kollegen sowie meinen Freundinnen und Freunden, nicht nur für die moralische Unterstützung, sondern auch für Korrektur- und Formatierungsarbeiten bei der Erstellung des Manuskripts im Jahr 2014. Ich danke dafür ganz besonders Reinhold Sievers, Andrea Freund, Katharina Schleich, Dr. Esther Mikuszies, Lena Billo, Lisa Kellermann und Dr. Isabel Steinhardt sowie allen anderen, die ich an dieser Stelle womöglich vergessen habe. Besonders danken möchte ich auch Theanolte Bähnischs Tochter, Dr. Orla-Maria Fels und Ihrem Ehemann, Dr. Hans-Heino Fels, die mir ihre Zeit für ein langes Gespräch über Theanolte Bähnisch zur Verfügung gestellt haben. Ich bedanke mich auch dafür, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, in diesem Zusammenhang diverse Unterlagen und Fotos aus dem Privatbesitz zu sichten und für die vorliegende Dissertation zu nutzen. Im Folgenden möchte ich, um die Lesbarkeit des Textes nicht zu stark zu beeinträchtigen, in der Regel nur die männliche Form von Funktionsbezeichnungen verwenden. Selbstverständlich sind, wann immer männliche Funktionsbezeichnungen gebraucht werden, auch die weiblichen mitgemeint. Kassel, 11.06.2018
1. Einführung in das Thema
1.1 EIN BRIEF GEHT NACH HANNOVER Köln 1945, am Tag vor Heiligabend. Theanolte Bähnisch1 reflektiert in ihrer von Bomben beschädigten, notdürftig wieder hergerichteten Dachgeschoß-Wohnung schriftlich den Stand ihres privaten, beruflichen und politischen Lebens. Der Empfänger ihrer Auslassungen ist kein Geringerer als der spätere SPD-Parteivorsitzende Kurt Schumacher, der von 1933 bis 1943 in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert gewesen war und im April 1945, noch vor der Kapitulation Deutschlands, von Hannover aus mit dem Wiederaufbau der Sozialdemokratischen Partei begonnen hatte, die von den Nationalsozialisten 1933 verboten worden war. Auf der Funktionärsversammlung im Oktober desselben Jahres hatte er von den Genossen ‚grünes Licht‘ dafür bekommen, als politischer Beauftragter der Westzonen tätig zu werden.2
1
2
Es gibt verschiedene Erklärungen zur Frage, warum die geborene Dorothea Nolte ihren Geburtsnamen zum Vornamen hinzuzog und mit dem Nachnamen ihres Mannes kombinierte. Ihrem autobiographischen Diktat nach pflegte sie als junges Mädchen die Abkürzung ihres Vornamens ‚Thea‘ und ihren Nachnamen ‚Nolte‘ in einem Atemzug aufzusagen, wenn sie nach ihrem Namen gefragt wurde. Deshalb sei sie für sich schon seit der Schulzeit ‚Theanolte‘ gewesen. Nach der Heirat habe sie ‚Theanolte‘ bleiben wollen, „auch als Frau Bähnisch“. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Waiblingen, Autobiographisches Diktat o. T., o. J. [1972], Teil I, S. 2, Trotz allem: Fußstapfen meines Lebens. (Da die Seitenzählung im autobiographischen Diktat keiner einheitlichen Logik folgt, werden in den Belegen jeweils die Überschriften mit angegeben.) Auch in einem Artikel des ‚Spiegel‘ ist zu lesen, daß sie nach der Heirat mit Albrecht Bähnisch die Namenfolge ‚Thea Nolte‘ beibehalten wollte, weshalb sie ihren Geburtsnamen zum Vornamen hinzugezogen habe. Vgl.: O. V.: Theanolte Bähnisch, in: Der Spiegel, 01.01.1961, S. 67. Im überlieferten beruflichen und privaten Schriftverkehr Bähnischs dominiert die Verwendung des Namens ‚Theanolte‘, amtliche Dokumente sind jedoch auf den Namen ‚Dorothea‘ ausgestellt. Zum Parteivorsitzenden wurde Schumacher im Mai 1946 in Hannover, im Speisesaal der Hanomag, gewählt. Vgl.: Röhrbein, Waldemar: Hannover nach 1945. Landeshauptstadt und Messestadt, in: Mlynek, Klaus/Röhrbein, Waldemar: (Hrsg.): Geschichte der Stadt Hannover, Bd. 2: Vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, Hannover 1994,
22 | Theanolte Bähnisch
Der Adressat des Briefs, der Zeitpunkt, zu dem er entsteht und der Inhalt, den er transportiert, machen dieses Schriftstück zu einem Schlüsseldokument, welches tiefe Einblicke in die Vorstellungswelt, die Ziele und die Argumentationsstrategie der zu jener Zeit 46 Jahre alten Verwaltungsjuristin zuläßt. Die Art, auf die sie in ihrem Schreiben Vergangenes und Gegenwärtiges reflektiert sowie Zukünftiges antizipiert, läßt vermuten, daß die mit den Mühlen der Verwaltung vertraute Verfasserin ahnt, daß jenes Schriftstück sorgfältig abgelegt, archiviert und der Nachwelt überliefert werden würde. Die Relevanz dieses Schreibens für ihr eigenes Leben muß ihr und auch ihren Nachfahren bewußt gewesen sein, anders ist es jedenfalls kaum zu erklären, daß ausgerechnet das Schreiben Kurt Schumachers, auf das Bähnisch mit dem hier vorgestellten Brief antwortet, im sehr schmalen Privatnachlaß der Juristin überliefert ist.3 „Ich warte dauernd auf die Rückkehr meines über 2 Jahre in Rußland vermißten Mannes“, schreibt sie an Schumacher, der als Invalide aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt und in Folge der KZ-Haft schwer krank war. „Für ihn und die Kinder, die ich zwar zärtlich liebe, aber die letzten Jahre infolge des Bombenkrieges sowie meiner starken, politischen und beruflichen Inanspruchnahme etwas vernachlässigen mußte, habe ich unter schwierigsten Verhältnissen begonnen so etwas wie ein Heim wieder aufzubauen.“4 Theanolte Bähnisch hatte ihre dreizehn und zwölf Jahre alten Kinder erst nach dem Kriegsende in die Kölner Wohnung der Familie zurückgeholt. Während des Krieges hatten Orla-Maria und ihr um ein Jahr jüngerer Bruder HansAlbrecht zunächst bei ihrer Tante, dann bei Freunden des Ehepaars Bähnisch im Taunus gelebt.5 Mit der ‚Inanspruchnahme‘, die die zweifache Mutter gegenüber Schumacher erwähnt, spielt sie auf etwas an, was sie zu jener Zeit bereits publik zu machen begonnen hatte, nämlich, daß sie sich im Dritten Reich im Widerstand gegen den Nationalsozialismus engagiert habe und daß sie dabei als Verwaltungsrechtsrätin Personen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, Beistand geleistet habe. In der Aegidienberger Straße, wo Theanolte Bähnisch Ende 1945 lebte, war auch der 1939 zur Wehrmacht eingezogene sozialdemokratische Landrat a. D. Albrecht Bähnisch während der Kriegsjahre gemeldet.6 Jetzt teilt seine Frau das Schicksal vieler Frauen, deren Ehemänner gefallen oder aus der Kriegsgefangenschaft noch nicht zurückgekehrt waren. Auf sich allein gestellt hatte sie nach Kriegsende ihre Tätigkeit als Anwältin für Verwaltungsrecht wieder aufgenommen – was die Zulassung durch
3 4 5 6
S. 579–800, hier S. 661. Vgl. auch: Loeding, Matthias: Otto Grotewohl contra Kurt Schumacher. Die Wennigser Konferenz im Oktober 1945, Hamburg 2004. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Schumacher an Bähnisch, 15.12.1945, Kopie in AddF, SP-01. Ebd. Gespräch mit Orla-Maria Fels, 11.11.2009 sowie DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34. Bähnisch an Langner, 09.01.1945. Darauf deutet ein vermutlich während eines Fronturlaubes verfaßtes Schreiben des Merseburger Landrats Bähnisch a. D. hin, welches die Kölner Adresse im Briefkopf trägt. LHASA MER, Rep C 48 I a II, Lit 13, Nr. 5, Albrecht Bähnisch an das Reichsministerium des Innern, 17.06.1941.
Einführung | 23
die britische Militärregierung, zu deren Besatzungszone Köln zählte, vorausgesetzt hatte. Über ihre Arbeit schreibt sie an Schumacher: „Ich bin mit Leidenschaft Anwältin. Wie ein Spürhund gehe ich einer Sache nach und schleuse sie langsam an vielen Klippen vorbei zum Ziel. Ich bin nicht Juristin, sondern juristische Artistin“7. Da sie ihr Gewerbe „im Umherziehen“ ausübe, bekomme sie interessante Einblicke in die deutsche, englische und amerikanische Bürokratie, fährt sie fort, im Bewußtsein, daß Schumacher ebenfalls auf das Wohlwollen der Militärbehörden angewiesen ist und daß gute Beziehungen zu den Briten und Amerikanern in Geld zu jener Zeit nicht aufzuwiegen sind. Als Sozialdemokratin, die in den späten zwanziger Jahren ihre berufliche und gesellschaftliche Heimat unter reformorientierten Politik-, Verwaltungsund Pädagogikeliten des demokratischen ‚Bollwerk Preußen‘ gefunden hatte, profitiert Bähnisch vom eklatanten Mangel an politisch unbelasteten Juristinnen und Juristen in Deutschland – offenbar auch finanziell8 – stark. Und doch zieht sie eine berufliche Veränderung in Betracht. Sie verspürt den Drang, sich politisch zu engagieren und gibt dem designierten Partei-Vorsitzenden auch gleich Nachhilfe in Sachen Partei-Politik. Auf ihre Erfahrungen mit den Militärverwaltungen verweisend, erklärt sie ihm, daß auch die „Partei als Knochengerüst eine Bürokratie“ brauche, „daneben aber bürokratische Außenseiter, die echte Politiker sind“, denn, so fährt sie fort: „Vorwärts getrieben werden die Dinge von Ideenträgern, Persönlichkeiten, die eine starke Ausstrahlung besitzen“9. Solch eine ‚Persönlichkeit‘ – das zeigt auch ihr Bedürfnis, ihren Lebenslauf10 und ihre Entscheidungsfindungsprozesse in den folgenden Jahren bei vielen Gelegenheiten öffentlich zu verbreiten11 – erkennt sie in sich selbst: „Mir geht es um die Erkenntnis größerer Zusammenhänge und die politische Mitarbeit in einer mir gemäßen Form. Ich will nichts werden, nur etwas sein. Mein Ideal wäre, neben meinem Beruf, sogar mit Hilfe meines Berufes an der politischen Entwicklung der Partei mitzuarbeiten.“12 Ihre Zugehörigkeit zur SPD demonstriert sie, indem sie einen Blick zurück wagt, auf die Zeit, in der die NSDAP die Stimmenmehrheit im Reichstag erlangen konnte: „Wir sind ihnen letztlich 1933 doch nur des-
7 8
AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, S. 5. 9 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945. 10 Der Schweizer Soziologe Martin Kohli bezeichnet den Lebenslauf als Instrument der „moralischen Integration moderner Gesellschaften“. Vgl.: Kohli, Martin: Ruhestand und Moralökonomie, in: Heinemann, Klaus (Hrsg.): Soziologie wirtschaftlichen Handelns, Opladen 1987, S. 393–416, hier S. 395. 11 Siegfried Kracauer beschreibt, zweifellos überspitzt, den Versuch, durch autobiographisches Schreiben eine ‚Persönlichkeit‘ zu werden, als ein bürgerliches Phänomen: Vgl.: Kracauer, Siegfried: Die Biographie als neubürgerliche Kunstform, in: Frankfurter Zeitung, Literaturblatt, 29.06.1930, S. 6. Vgl. auch folgende Interpretation der Kritik Kracauers: Marian, Esther: Jeder Angestellte will eine Persönlichkeit sein. Zu Siegfried Kracauers Biographiekritik, in: Fetz, Bernhard/Huemer, Georg (Hrsg.): Theorie der Biographie. Grundlagentexte und Kommentar, Berlin 2011, S. 125–131. 12 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945.
24 | Theanolte Bähnisch
halb unterlegen, weil wir die Idee der Demokratie nicht lebendig genug in das Volk hinein getragen haben. Glaubten doch selbst unsere damaligen führenden Politiker mit einer starken Bürokratie und gesunden Sachlichkeit allein die Probleme meistern zu können“,13 analysiert sie und bricht damit gleichzeitig eine Lanze für mehr Bevölkerungsnähe in der politischen Agitation der Sozialdemokratie. Aus ihren Worten läßt sich schließen, daß sie durch ihre Partei-Mitarbeit einen Beitrag dazu leisten will, Deutschland nach der zwölf Jahre währenden Diktatur auf den Pfad der Demokratie (zurück) zu führen. „Sie sollten politische Strahlungspunkte in den verschiedenen Provinzen aus Leuten Ihres Vertrauens bilden, die die örtliche Bürokratie befruchten und beleben“, legt sie Schumacher nah und bietet sich selbst als eine solche Person an: „Ich bilde mir ein, in diesem Rahmen am besten verwertbar zu sein und bin bereit, nicht nur meine ganze Freizeit dafür zu opfern, sondern auch meine Berufstätigkeit gegebenenfalls einzuschränken.“14 So könne sie ihre politische Leidenschaft leben und doch wirtschaftlich unabhängig bleiben, erklärt die Juristin und ergänzt: „Auf eine äussere Stellung, und wenn es die eines Ministers wäre, kann ich gern verzichten. Mein Selbstbewußtsein hat so etwas nicht nötig.“15 Sie gibt sich überzeugt davon, daß sie, nicht zuletzt aufgrund ihres Geschlechts, in besonderem Maß für eine Vertrauensposition in der Partei geeignet sei: „Ich bewege mich mit den Männern auf der ihnen vertrauten geistigen Ebene mit voller Sicherheit, transponiere aber Geist und Verstand in meiner weiblichen Art unter Verzicht auf erotische Mätzchen“, teilt sie Schumacher mit und fügt hinzu „[d]as soll das Geheimnis meiner Erfolge sein.“16 Aus diesen Zeilen an einen der wichtigsten Protagonisten des deutschen Wiederaufbaus ab 1945 wird deutlich: Theanolte Bähnisch hat Großes vor. Sie sieht Ende 1945 ihre Zeit gekommen, will gehört werden und Einfluß nehmen. Ihre Zukunftspläne bringt sie mit dem Wiederaufbau ihres zerstörten Heimatlandes in Einklang. Sie zeigt, daß sie die Zeit, in der sie nun lebt, als eine Chance begreift, nach den Erfahrungen von ‚Weimar‘ eine neue Demokratie aufzubauen und dafür zu sorgen, daß die Gesellschaft mehrheitlich hinter dieser Staatsform steht. Ob sie voraussieht, daß sie mit Schumacher den späteren Kanzlerkandidaten der Bundesrepublik anspricht, der schließlich um Haaresbreite gegenüber seinem Kontrahenten Adenauer scheitern sollte, ob ihr Engagement zu jener Zeit aus der Überzeugung resultiert, daß die SPD die treibende Kraft im Staat sein müsse, den es unter den Augen der Besatzer aufzubauen gilt, sei dahingestellt: Fakt ist, daß die Juristin ihr selbst definiertes berufliches und politisches Entwicklungspotential 1945 in ihre Überlegungen zur politischen Profilierung und zum organisatorischen Wiederaufbau jener Partei einreiht, die ihren Ehemann in der Weimarer Republik stark gefördert hatte und die sie selbst trotz der ‚Doppelverdienerkampagne‘ immerhin bis 1930 als eine von wenigen verheirateten Frauen im gehobenen Verwaltungsdienst gehalten hatte.
13 14 15 16
Ebd. Ebd. Ebd. Ebd.
Einführung | 25
Kurt Schumacher erhält den Brief der Verwaltungsrechtsrätin am 31.12.194517, an der Schwelle zum ersten Jahreswechsel in Frieden seit sieben Jahren und damit zu einem Zeitpunkt, der Bähnischs Fähigkeit zur Selbstinszenierung entspricht. Für sie bestand kein Anlaß, gegenüber dem hoch gehandelten Politiker Bescheidenheit walten zu lassen, denn er selbst hatte ihr Mitte Dezember 1945, auf Anregung zweier weiterer Parteigrößen, Adolf Grimme und Hinrich Wilhelm Kopf, deutlich gemacht, daß man es gern sehen würde, wenn sie nach Hannover, in das neue Zentrum der Sozialdemokratie käme.18 Zwei Wochen lang war sie eine Antwort auf Schumachers Frage schuldig geblieben, ob sie die „stärkste politische Vertrauensposition“19 annehmen wolle, die in Hannover zu vergeben sei. Kopf, der zu dieser Zeit Oberpräsident der Provinz Hannover war, hatte bereits damit gerechnet, daß er Ministerpräsident eines neu zu gründenden Landes werden würde,20 als er „einen persönlichen Referenten“ suchte, „durch dessen Hand alles in der Provinz bzw. im Lande Hannover zu gehen hat. Wie wäre es damit?“21, hatte Schumacher die Position beworben und hinzugefügt: „Jedenfalls werden Sie aus diesem Brief ersehen, daß wir hier alle für Sie und Ihre Fähigkeiten das größte Interesse haben und Sie positiver verwertet sehen möchten, als das bisher der Fall ist.“22 ‚Wir‘ – damit waren jene führenden Köpfe in der Sozialdemokratie gemeint, die sich bis zum Dezember 1945 im Bezirk Hannover versammelt hatten, allen voran Hinrich Wilhelm Kopf sowie Adolf Grimme23, der preußische Kultusminister a. D., der seit August 1945 als kommissarischer Re-
17 Ebd. So lautet das Datum des Posteingangsstempels. 18 Nach der Konferenz von Wennigsen im Oktober 1945, auf der Schumacher, wie erwähnt, den Auftrag erhalten hatte, „als Beauftragter der Westzonen“ tätig zu werden, war aus dem ‚Büro Schumacher‘ in Hannover die offizielle Parteizentrale der SPD geworden. Der am 15.06.1945 gebildete Zentralausschuß der SPD in Berlin, geleitet von Otto Grotewohl, war fortan nur noch für die Parteiarbeit in der Sowjetischen Besatzungszone zuständig. Vgl.: Loeding: Grotewohl. 19 AddF, SP-01, Kurt Schumacher an Theanolte Bähnisch, 15.12.1945. 20 Hinrich Wilhelm Kopf trat seine Position als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen zum 01.01.1946 an. 1955, am Ende seiner zweiten Amtsperiode zog sich Kopf zunächst aus der Politik zurück, um dann 1957 Innenminister des Landes zu werden und ab 1959 erneut für zwei Jahre das Amt des Ministerpräsidenten auszuüben. 21 AddF, SP-01, Kurt Schumacher an Theanolte Bähnisch, 15.12.1945. 22 Ebd. 23 Dr. h.c. Adolf Grimme war ab 1924 Oberstudienrat in Hannover, ab 1925 Oberschulrat in Magdeburg. 1928 wurde er zum Ministerialrat im preußischen Kultusministerium ernannt, 1929 war er Vizepräsident des Provinzialschulkollegiums von Berlin und der Mark Brandenburg. Von 1929 bis 1932 leitete er das preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Die Jahre 1942 bis 1945 verbrachte er in Gestapo-Haft wegen Nichtanzeige eines Vorhabens des Hochverrats. Nach dem zweiten Weltkrieg war er bis 1948 Kultusminister des Landes Niedersachsen. Im gleichen Jahr wurde er zum Generaldirektor des neugegründeten Radiosenders NWDR ernannt. Grimme war einer der führenden Köpfe beim Wiederaufbau des deutschen Erwachsenenbildungswesens, auch als Mitherausgeber der Zeitschrift ‚Denkendes Volk – Organ für die Selbstbildung‘.
26 | Theanolte Bähnisch
gierungsdirektor der Provinz Hannover mit der Leitung der Abteilung ‚Kultus‘ betraut war. ‚Positiver‘ – damit spielte Schumacher auf den Umstand an, daß Bähnisch den Großteil ihrer Energien zu jener Zeit nicht in die Politik, sondern in eine privatwirtschaftliche Tätigkeit steckte. „Grimme kennt Sie noch sehr gut und ist außerordentlich für Sie eingenommen“, deutete sich in Schumachers Brief an, wer die Juristin in den folgenden Jahren maßgeblich unterstützen würde. Daß Schumacher die von Grimme so geschätzte Frau in seinem Brief „Madame“24 genannt und sie gebeten hatte, sich doch direkt an Kopf zu wenden, wenn sie sich zu den verschiedenen Positionen, die man ihr angeboten hatte, „irgendwie positiv einzustellen wünsche[...]“, läßt auf eine gewisse Distanz Schumachers zu Bähnisch schließen, die in den folgenden Jahren bestehen bleiben sollte. Gleichzeitig sollte der Parteivorsitzende Bähnischs nonkonformes Verhalten bis zu seinem frühen Tod 1952 nie sanktionieren, obwohl einige Genossen entsprechende Forderungen stellten und Schumacher für seine Forderung nach eiserner Parteidisziplin bekannt war. Da der Juristin der Anschluß an die SPD in Köln nicht auf die von ihr gewünschte Art geglückt war, dürfte ihr das unverhohlene Interesse an ihrer Person, das ihr aus der zu jener Zeit noch in einer Grauzone operierenden Parteizentrale in Hannover entgegenschlug, geschmeichelt haben. „So oft bin ich noch nie hinter einem Manne hergelaufen“25, beklagt sie sich bei Schumacher über den Vorsitzenden des SPDBezirks Obere Rheinprovinz, Robert Görlinger. Sie ist hochgradig unzufrieden mit den Vorschlägen, die Görlinger ihr für eine Mitarbeit in der Partei unterbreitet hat. Denn während sie sich wünscht, daß man sie mit den allgemeinen politischen Absichten der SPD im Bezirk Köln vertraut mache, will Görlinger sie partout für den Wiederaufbau der Frauenarbeit in der Partei gewinnen. Vielleicht hatte er in ihr eine neue Marie Juchacz26 erkannt, vielleicht hatte er der Juristin auch ‚nur‘ die Position einer Bezirkssekretärin mit besonderer Zuständigkeit für ‚Frauenfragen‘ übertragen wollen. Bähnisch tat dem ehemaligen Geschäftsführer der Kölner Arbeiterwohlfahrt (AWO) jedenfalls nicht den Gefallen, sich für seine Idee zu begeistern. „Das liegt mir […] gar nicht“, läßt sie Schumacher wissen und fügt hinzu: „Ich bin Frauen in Massen immer aus dem Weg gegangen“.27 Die Tatsache, daß sie bald eine Frauenorganisation leiten würde, die 1951 bereits 50.000 Mitglieder hatte, ist vor dem Hintergrund dieser Äußerung denkwürdig. Ebenso bemerkenswert ist es, daß sie im gleichen Brief ein Thema aus der Parteiarbeit anspricht, für das sie sich besonders interessiert. Die Sozialdemokraten hätten die bürgerlichen Parteien „machtmässig“ kaum mehr zu fürchten, führt Bähnisch aus, „den Kommunismus zu schwächen und
24 AddF, SP-01, Kurt Schumacher an Theanolte Bähnisch, 15.12.1945. 25 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945. 26 Marie Juchacz war von 1917 bis 1933 die ‚Frauensekretärin‘ der SPD im Parteivorstand gewesen und hatte 1919 die Arbeiterwohlfahrt (AWO) gegründet. Vgl.: Dertinger, Antje: Marie Juchacz, in: Schneider, Dieter (Hrsg.): Sie waren die ersten. Frauen in der Arbeiterbewegung, Frankfurt a. M. 1988, S. 211–230. 27 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945.
Einführung | 27
ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen“28 ist ihrer Meinung nach die aktuell wichtigste Aufgabe der SPD. Mit ihren Ausführungen über die kommunistische Bedrohung will Bähnisch, so scheint es, ihre Fähigkeit und ihren Willen, in größeren Zusammenhängen zu denken, zum anderen aber auch ihre Verbundenheit mit der Haltung Schumachers demonstrieren. Anders als jener Flügel der SPD, der im ‚Bruderkampf‘ von SPD und KPD in der Weimarer Republik eine Ursache nationalsozialistischer Wahlerfolge erkannt hatte und in der Zukunft mit den Kommunisten zusammenarbeiten wollte, stellte sich Schumacher entschieden gegen eine solche Kooperation.29 Während seiner KZ-Haft hatte er jeglichen Kontakt zu Kommunisten verweigert, weil er sie mit für den Aufstieg der Nationalsozialisten verantwortlich machte. Daß Schumacher mit dem „religiösen Sozialismus“, in dem Bähnisch erklärtermaßen die Zukunft des besiegten Staates sieht30, ebenfalls nichts anzufangen wußte, steht auf einem anderen Blatt. Für seine Argumentation gegen den Kommunismus spielte der christliche Glaube – anders als für Bähnisch – keine zentrale Rolle. Dem späteren Parteivorsitzenden, der mit hohen politischen Beamten der Weimarer Republik abrechnen wollte und den Kirchen skeptisch gegenüber stand, blieb jedoch nichts anderes übrig, als Bähnischs Kritik an seiner Parteitagsrede, die sich ihrer Meinung nach zu sehr gegen Beamte und andere für die SPD potentiell interessante Wählergruppen richtet, dennoch aufzunehmen.31 Und als die Genossin, weil sie die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit der SPD mit den Kirchen hegt, für Schumacher ein Treffen mit Kirchenvertretern arrangiert, läßt er sich darauf ein.32 Darin deutet sich an, daß Bähnisch zu jenen gehört, die die Partei auf den Weg nach ‚Bad Godesberg‘ bringen, zu einem Parteiprogramm, das den ‚Marxismus‘ nicht mehr länger als Ziel der SPD benennt. Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit wird deutlich werden, daß sich diese Entwicklung nicht allein auf den allgemeinen Trend zur
28 Ebd. 29 Vgl.: Potthoff, Heinrich: Kurt Schumacher. Sozialdemokraten und Kommunisten, in: Dowe, Dieter (Hrsg.): Kurt Schumacher und der „Neubau“ der deutschen Sozialdemokratie nach 1945. Referate und Podiumsdiskussion eines Kolloquiums des Gesprächskreises Geschichte der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn am 12./13. Oktober 1995, Bonn 1996, S. 133–150. 30 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945. 31 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 11.02.1946. Vgl. dazu: Freund, Nadine: Der Kalte Krieg in der ‚Stimme der Frau‘. Eine Frauenzeitschrift im Kontext der Westintegration Deutschlands, unveröffentlichte Magisterarbeit, Universität Kassel, 2005. 32 Ebd. sowie GStA PK, VI. HA, NL Grimme, Nr. 2517, Kurt Schumacher an Adolf Grimme, 21.03.1946. In ihrem Brief an Schumacher geht es bereits um eine mögliche Zusammenkunft mit den Pastoren Laurentius Siemer und Eberhard von Welty, im Brief Schumachers an Grimme um ein anvisiertes Treffen mit Siemer in Walberberg bei Vechta. Siemer hatte sich im Widerstand gegen den Nationalsozialismus engagiert und war deshalb in GestapoHaft geraten. Ab 1945 gab er gemeinsam mit Welty die Zeitschrift ‚Neue Ordnung‘ heraus. Siemer versuchte, wie Walter Dirks und Jakob Kaiser, die neu gegründete CDU hinsichtlich einer stärkeren Orientierung der Partei am Sozialismus zu beeinflussen.
28 | Theanolte Bähnisch
‚Westernisierung‘33 Deutschlands und Europas mitsamt des jeweiligen Parteien- und Organisationsgeflechts zu jener Zeit zurückführen läßt. Die Basis für jene Entwicklung lag in den persönlichen Überzeugungen jener begründet, die in der Weimarer Republik, in der Hoffnung, die Visionen des Sozialliberalen Friedrich Naumann umsetzen zu können, Politik in Form großer Koalitionen betrieben hatten oder die – wie das Ehepaar Bähnisch – in jenem Klima politisch sozialisiert worden waren. 1945 knüpften jene Politiker – zu denen unter anderem Adolf Grimme zählte – wiederum an die Vision Naumanns34 und die Erfahrungen, die sie mit ihrer Umsetzung in den Großen Weimarer Koalition sowie in den preußischen Koalitionsregierungen gefunden hatte, an. Daß die spätere Regierungspräsidentin des Bezirks Hannover in ihrem Brief an Schumacher späterer Stelle doch noch einmal auf die Arbeit mit Frauen zurückkommt zeigt, daß Görlingers Anliegen nicht ohne Wirkung auf sie geblieben war. Ihre weiteren Ausführungen zeigen, daß der Gärungsprozeß einer Idee, die sich 1948 in Form der Herausgabe einer Frauenzeitschrift durch Bähnisch manifestierte, schon 1945 in Gang gesetzt war. „Das Problem hat mich […] doch beschäftigt“, schreibt sie, mittlerweile auf der vierten von vier eng beschriebenen Seiten angekommen. „Sollte man nicht eine Zeitschrift für die schaffende Frau herausbringen? Sie liesse sich hier auf die Beine stellen“, spielt sie auf die Rolle Kölns als Medienstadt an und nimmt mit ihrer Wortwahl – bewußt oder unbewußt – auf ein Blatt Bezug, in dem sie selbst einmal einen Artikel veröffentlich hatte: die 1929 bis 1933 von Margarete Kaiser in Berlin herausgegebene Zeitschrift ‚Die schaffende Frau‘. Daß Bähnisch nicht nur Frauen, sondern auch Jugendliche im Blick hat, wenn sie über Bildungsarbeit nachdenkt, macht sie deutlich, als sie Schumacher gegenüber schließlich ausführt, daß „die Gewinnung der Jugend“ sie momentan besonders beschäftige. Man dürfe den 20 bis 30-jährigen jedoch „nicht gleich mit einer parteipolitischen Richtung“ kommen, sondern müsse dafür Sorge tragen, daß sie „über ihre eigene Erkenntnis, richtig geführt durch politische Aufklärung und gute Bücher, zwangsläufig zum Sozialismus kommen“35. Was sie hier erklärt, nämlich sozialdemokratische Überzeugungen durch ,allgemein‘ gehaltene politische Bildungsarbeit in die Köpfe der Menschen bringen zu wollen, das wird vielen Genossen, die eine parteinahe Form der politischen Bildung bevorzugen, bald sauer aufstoßen. Daß politische Bildungsarbeit für die belesene Frau, die als Bürgerin Berlins in den 1920er Jahren mit einem sehr breiten kulturellen Angebot konfrontiert gewesen war, ein ebenso
33 Vgl. zum Begriff: Doering-Manteuffel, Anselm: Amerikanisierung und Westernisierung, Version: 1.0, in: Docupedia Zeitgeschichte, 18.01.2011, auf: http://docupedia.de/zg/ Amerikanisierung_und_Westernisierung, am 30.07.2014. 34 Naumann hatte im Kaiserreich die Vision eines politischen Konsenses von demokratischen Parteien, die auf der ideellen Basis des Christentums in einer Großen Koalition zusammenarbeiten. Naumann, Friedrich: Bassermann und Bebel, in: Berliner Tageblatt, Nr. 503, Morgenausgabe, 04.10.1910. Vgl. auch: Theiner, Peter: Sozialer Liberalismus und deutsche Weltpolitik. Friedrich Naumann im wilhelminischen Deutschland (1860–1919), Baden-Baden 1983, S. 194–217. 35 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945.
Einführung | 29
weit gefaßtes wie für den Aufbau einer stabilen demokratischen Gesellschaft wichtiges Thema ist – wird aus der Bemerkung deutlich, mit der sie ihren Brief abschließt. Sie wolle auch zum Thema Theater und Kino noch manches sagen, habe aber die Befürchtung, daß die knappe Zeit Schumachers ihr weitere Ausführungen verbiete. So faßt sie ihre weit gefaßten Ambitionen mit der Aussage, daß sie „[a]m liebsten […] ein kulturelles Propagandahaus selbst aufziehen“36 wolle, zusammen. Was sie über das Thema Theater zu sagen gehabt hätte, wäre vermutlich interessant gewesen – hieß es doch in einem Artikel aus dem Jahr 1929 über das „Fräulein Nolde“, daß es „Berlins Theater“37 regiere. Der Mann, der dem ‚Fräulein Nolde‘ (der Geburtsname Theanolte Bähnischs lautete ‚Dorothea Nolte‘) den Weg in die Theaterabteilung des Berliner Polizeipräsidiums geebnet hatte, war der preußische Innenminister Carl Severing. Dieser hatte Bähnischs Drängen, sie als erste preußische Verwaltungsreferendarin zuzulassen, nach längeren Diskussionen schließlich stattgegeben – so jedenfalls stellt sie es dar – und in der Folgezeit eine Freundschaft zu der jungen Frau entwickelt. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der Theanolte Bähnisch 1946 dem designierten SPD-Parteivorsitzenden gegenübertritt, posiert sie auf einem um 1940 entstandenen Photo38 mit dem preußischen Innenminister a. D. Sie hält den Arm des etwas gebrechlich wirkenden Severing umfaßt, Oberkörper und Kopf in seine Richtung geneigt, den Blick fest und lächelnd in die Kamera gerichtet. Etwa eine Hüftbreite von dem ‚Paar‘, entfernt steht auf dem Bild der Regierungsrat des preußischen Innenministeriums a. D., Robert Kempner. Dieser sollte 1945 Chefankläger in den Nürnberger Prozessen werden. Darin, daß sich die Juristin bereits in der Weimarer Republik und offenbar auch während des Drittens Reichs unter solch prominenten Personen bewegt hatte, ist ein gewichtiger Grund dafür zu sehen, daß sie Schumacher gegenüber 1946 ihren Anspruch anmelden konnte, den Wiederaufbau der SPD und der Nation mitzugestalten.
36 Ebd. 37 O. V.: Wer regiert Berlins Theater? Das Regime des Fräulein Nolde, in: Berliner Herold, 22. Jg., Nr. 9, März 1927. 38 Center for Jewish History, Leo Baeck Institute, Robert M. W. Kempner Collection, AR 3977, 891971, Nr. F 2277 [Kempner with Theanolte Baehnisch and Karl Severing, Portraits Groups (Abb.)], auf: http://access.cjh.org/query.php?term=Baehnisch&qtype=basic &stype=contains&paging=25&dtype=any&repo=all&go=#1, am 05.09.2014. Das Leo Baeck-Institut datiert das Bild auf das Jahr 1940. Weitere Informationen zum Entstehungskontext kann das Institut nicht nennen. Schreiben des Leo Baeck-Instituts, Michael Simonson an Nadine Freund, 14.03.2014. Aus der Bildaufschrift geht hervor, daß das Bild 1946 beschriftet worden sein dürfte, da Bähnisch als Vizepräsidentin einer regionalen Verwaltungsinstanz bezeichnet wird.
30 | Theanolte Bähnisch
1.2 POSTHUME REZEPTION THEANOLTE BÄHNISCHS UND FORSCHUNGSSTAND Schon 1953 erhielt Theanolte Bähnisch für ihre „herausragenden Verdienste“ im Wiederaufbau Niedersachsens und der deutschen Frauenbewegung das große Bundesverdienstkreuz mit Stern. Als sie 1973 starb, rühmte der Niedersächsische Ministerpräsident Alfred Kubel die Juristin dafür, daß sie „ihrem Leitbild von einem freiheitlichen Rechtsstaat und einer sozialen Demokratie […] trotz Verfolgungen und Demütigungen während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft […] ein Leben lang treu geblieben“39 sei. Heutzutage ist Theanolte Bähnisch als Persönlichkeit der Zeitgeschichte weitgehend unbekannt. „Sollte man die kennen?“, „muß ich die kennen?“, „kennt man die?“, oder einfach „Thea – was?“, lautet häufig die Antwort, wenn man erzählt, daß man sich mit jener Person auseinandersetzt. Sicher, man sollte sie kennen. Aber kaum jemand weiß heutzutage von der Verwaltungsjuristin, obwohl sie zu ihrer Zeit in vielen Zusammenhängen präsent war, die bis in die Gegenwart hinein wirksam sind. Dies schlägt sich beispielsweise in der Literatur zur Europäischen Integration Deutschlands nieder: Obwohl Bähnisch ab 1949 als eine Vizepräsidentin des ‚Deutschen Rates der Europäischen Bewegung‘ fungierte und obwohl sie in den entsprechenden Quellen in einem Atemzug mit Eugen Kogon, Ernst Friedländer, Walter Dirks, Carlo Schmid und Elly Heuss-Knapp genannt wird, findet ihr Name – anders als jene, die beim Leser aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrades sofort einen ahaEffekt hervorrufen – keinen Eingang in die Publikationen zur Europa-Bewegung und zur Europäischen Integration.40 Da viele Autoren, die Einführungen in ein historisches Thema verfassen, nicht ‚ad fontes‘ gehen, sondern sich auf die Zusammenfassung bereits erschienener Literatur konzentrieren, reproduziert sich das beschriebene Phänomen stetig. In den Forschungen zur Europa-Bewegung scheint Bähnischs Wirken somit in einem ‚Teufelskreis der Nichtrezeption‘ untergegangen zu sein. Daß ihr in Klaus Mlyneks zweibändigem biographischen Lexikon für die Stadt Hannover, wo Bähnisch von 1946 bis 1959 lebte, ein Artikel gewidmet ist, erscheint obligatorisch. Daß der knappe Raum dazu genutzt wird, Stationen des von Bähnisch selbst tradierten Lebenslaufs ungeprüft zu reproduzieren und ihr Engagement in der Frauenbewegung nach 1945 darzustellen, während die zentralen Inhalte ihrer Arbeit als Regierungspräsidentin des Bezirks Hannover im Dunklen bleiben, irritiert je-
39 Nachruf auf Dorothea Bähnisch von Alfred Kubel, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 12.07.1973. 40 Vgl.: Conze, Vanessa: Das Europa der Deutschen. Ideen von Europa in Deutschland zwischen Reichstradition und Westorientierung (1920–1970), München 2005; Niess, Frank: Die europäische Idee – aus dem Geist des Widerstands, Frankfurt a. M./New York 2002; Loth, Wilfried: Der Weg nach Europa. Geschichte der europäischen Integration 1937– 1957, Göttingen 1990 sowie Brunn, Gerhard: Die Europäische Einigung von 1945 bis heute, Bonn 2004.
Einführung | 31
doch.41 Eine ganz ähnliche Behandlung erfährt ihre Person in der vom Autor des erwähnten Artikels herausgegebenen ‚Geschichte der Stadt Hannover‘. Hier wird die Juristin als eine Frau mit „modischem Chic und aparten Hüten“42 vorgestellt – als gebe es außer den immer wieder gern zum Besten gegebenen Anekdoten nichts Relevantes über sie zu berichten.43 Über ihr immerhin 13 Jahre währendes Handeln als Regierungspräsidentin im Bezirk Hannover erfährt der Leser auch hier kaum etwas. Andere Werke zur Geschichte Niedersachsens reflektieren Bähnischs Arbeit – wie die anderer Regierungspräsidenten im Land – allenfalls in Randbemerkungen.44 Publikationen zur Verwaltungsgeschichte in der Britischen Besatzungszone oder im Land Niedersachsen nennen teilweise Bähnischs Namen, führen ihr Engagement jedoch ebenfalls nicht näher aus.45 Daß Forscher, die in den 1980er und 1990er Jahren von offizieller Seite mit der Erforschung der Landesgeschichte betraut waren, Prävalenzen vor allem in der Arbeiterbewegungs- und Sozialgeschichte setzten – Subdisziplinen, die dem Genre Biographie eher skeptisch gegenüber traten46 – ist ein Erklärungsansatz dafür, daß Theanolte Bähnisch trotz ihrer ungewöhnlich langen Amtszeit bisher noch nicht in den Fokus einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Nachkriegsgeschichte Niedersachsens gerückt ist. Ähnlich stiefmütterlich wurden auch andere bedeutende Protagonisten der niedersächsischen Zeitgeschichte behandelt, beispielsweise der ‚Landesvater‘ Hinrich Wilhelm Kopf. Daß 2013 die Kopf-Biographie Theresa Nentwigs in der Reihe der ‚Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen‘ erschien, zeigt, daß sich die Forschungszugänge zur Landesgeschichte zwischenzeitlich viel stärker diversifiziert haben.47 Dies
41 Vgl.: Mlynek, Klaus: Theanolte Bähnisch, in: Böttcher, Dirk u. a. (Hrsg.): Hannoversches Biographisches Lexikon, Hannover 2002, S. 35. 42 Vgl.: Röhrbein: Hannover, S. 654/655. 43 Ganz ähnliche Bemerkungen finden sich auch in folgendem Zeitungs-Artikel: Tasch, Dieter: Schon 1902 sorgte sich der Präsident um gute Butter, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 17.04.1985. Der letzte Absatz ist Bähnisch gewidmet und lautet: „Bisher gab es nur eine Frau als Regierungspräsident: Dorothea Bähnisch – besser bekannt als Theanolte – Fesche Hüte mit Schleier waren ein Markenzeichen der ebenso hübschen wie klugen und energischen Sozialdemokratin.“ 44 Vgl.: Hucker, Bernd-Ulrich/Schubert, Ernst/Weisbrod, Bernd (Hrsg.): Niedersächsische Geschichte, Göttingen 1997; Weisbrod, Bernd (Hrsg.): Grenzland. Beiträge zur Geschichte der deutsch-deutschen Grenze, Hannover 1993, Hauptmeyer, Carl-Hans: Geschichte Niedersachsens, München 2009; Hoffmann, Peter: Kleine Geschichte Niedersachsens, Hannover 2006 und Schnath, Georg (Hrsg.): Geschichte des Landes Niedersachsen, 6. Aufl., Freiburg 1996. 45 Siehe dazu die in Kapitel 1.9 und 5.2.7.1 genannten Titel und Anmerkungen. 46 Siehe dazu Kapitel 1.7.4.1. 47 Der ‚Landesvater‘ war in der SPD aus dem gleichen Grund wie ‚seine‘ Regierungspräsidentin nicht sehr wohlgelitten. Beide Personen fielen als ‚konservative Sozialdemokraten‘ auf, die die Nähe zur Partei nicht suchten und mit ihrem Desinteresse an der ‚Parteilinie‘ oft aneckten. Zur Forschung über Kopf bis 2014 vgl.: Nentwig, Teresa: Hinrich Wilhelm Kopf (1893–1961). Ein konservativer Sozialdemokrat, Hannover 2013, S. 29.
32 | Theanolte Bähnisch
drückt sich nicht nur im gewählten Genre, sondern auch in der differenzierten Bewertung Kopfs durch Nentwig aus. Als zweiter hemmender Faktor für die Erforschung von Bähnischs Wirken ist der Umstand zu werten, daß Behördengeschichte insgesamt nach wie vor ein randständiges Dasein fristet. Dazu, daß die Geschichte der niedersächsischen Mittelinstanzen insgesamt noch kaum erforscht ist, dürfte auch beigetragen haben, daß das Land jene Verwaltungsstufe im Jahr 2004 aufgelöst und stattdessen Regierungsvertretungen eingesetzt hat.48 Die meisten jüngeren Studien zur Geschichte von Bezirksregierungen in anderen Bundesländern, die auch den Zeitraum nach 1945 thematisieren, sind im Zusammenhang mit Behörden-Jubiläen erschienen49, also im Rahmen einen Anlasses, der in Niedersachsen in den letzten 14 Jahren schlichtweg nicht gegeben war.50 Interesse an der Erforschung von Mittelinstanzen besteht aktuell vor allem in der DDR-Forschung.51 In jüngster Vergangenheit hat sich das Leibnitz-Institut für Regi-
48 Ende 2013 sind die unter der Regierung Wulff eingesetzten Bezirksvertretungen aufgelöst und durch ‚Regionalbeauftragte‘ ersetzt worden. 49 Vgl.: Ost, Peter/Bezirksregierung Münster (Hrsg.): 200 Jahre Bezirksregierung Münster. Rückblick und Perspektive, 2. Aufl., Münster 2003; Siemer, Ernst/Regierungspräsident des Bezirks Detmold (Hrsg.): 175 Jahre alt – Bezirksregierung in Ostwestfalen 1816–1991, Detmold 1991 sowie Feldmann, Reinhard (Hrsg.): 175 Jahre Regierungsbezirk Arnsberg. Streiflichter aus der Geschichte, Arnsberg 1991. Hedwig Schrulles Werk, das nicht im Auftrag einer Bezirksregierung entstand, setzt sich vornehmlich mit einer Bezirksregierung im Nationalsozialismus auseinander, thematisiert jedoch auch die Nachkriegszeit. Vgl.: Schrulle, Hedwig: Die Bezirksregierungen Münster und Minden/Detmold von 1930 bis 1960, Paderborn 2008. Ähnlich verhält es sich mit dem Sammelband von Dreist, Markus (Hrsg.): Die Düsseldorfer Bezirksregierung zwischen Demokratisierung, Nazifizierung und Entnazifizierung. Eine staatliche Mittelbehörde an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik, Essen 2003. 50 Zum 100jährigen Jubiläum der Behörde im Jahr 1985 erschien neben einem Begleitheft zu einer Ausstellung über die Geschichte der Behörde auch ein Aufsatz. Vgl.: Poestges, Dieter: Die Mittelinstanz im Wandel der Zeit. Zum hundertjährigen Bestehen der Bezirksregierung Hannover, Ausstellung im Niedersächsischen Landtag, 16.4.–18.5.1985, Hannover 1985 sowie Faber, Heiko: 100 Jahre Bezirksregierung Hannover, in: Die öffentliche Verwaltung, 38. Jg. (1985), Heft 23, S. 989–997, hier S. 992–995. Anläßlich der Auflösung des Regierungspräsidiums erschien: Blazek, Mathias: Von der Landdrostey zur Bezirksregierung. Die Geschichte der Bezirksregierung Hannover im Spiegel der Verwaltungsreformen, Stuttgart 2004. 51 Vgl.: Mestrup, Heinz/Gebauer, Ronald: Die thüringischen Bezirke und ihre ersten Sekretäre, in: Richter, Michael (Hrsg.): Länder, Gaue und Bezirke, Halle 2007, 191–212; Rowell, Jay: Der erste Bezirkssekretär: Zur Scharnierfunktion der Bezirksfürsten, in: Richter: Länder, S. 213–230 und Niemann, Mario: Zur Kaderpolitik der SED in Sachsen. Die Sekretäre der 1952 gebildeten Bezirksleitungen, Chemnitz, Dresden, Leipzig, in: Richter: Länder 231–254, schließlich: Kurzweg, Christian/Werner, Oliver: SED und Staatsapparat im Be-
Einführung | 33
onalentwicklung und Strukturplanung (IRS), an dem derzeit Forschungen zur Rolle der Bezirksregierungen in der Raumordnungsplanung der DDR laufen, vergleichend mit der Rolle von Mittelinstanzen in verschiedenen politischen Systemen in Europa nach 1945 auseinandergesetzt.52 Ob sich hierin eine Trendwende in der Auseinandersetzung mit den ‚unbekannten Behörden‘ ankündigt, bleibt abzuwarten. Über die Geschichte der Bezirksregierung Hannover im für mich relevanten Zeitraum existieren ein Aufsatz53 und eine schmale Broschüre54. Letztere ist als Begleitheft zu einer Ausstellung über die Geschichte des Regierungspräsidiums anläßlich des 100. Jubiläums herausgegeben worden. Die Publikation Mathias Blazeks, welche die Geschichte des Regierungspräsidiums Hannover „von der Landdrostey zur Bezirksregierung“ abbilden will, enthält über die Amtsjahre Bähnischs nicht einmal zwei Seiten.55 Einen gewissen Bekanntheitsgrad hat sich Theanolte Bähnisch in der sozialdemokratischen Partei erhalten. Es scheint jedoch, als wolle man sich in diesen Kreisen gar nicht an das ehemalige Parteimitglied erinnern. Meine Frage nach Quellenmaterial zum Thema ‚Theanolte Bähnisch‘ wurde von Seiten des diensthabenden Mitarbeiters im Lesesaal des Archivs der sozialen Demokratie in Bonn mit den Worten kommentiert: „was wollen sie denn mit der, die war doch gar keine Sozialdemokratin“. Eine Referentin im historischen Forschungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung, die zu jener Zeit an einer Ausstellung und an einem Kalender über Frauen in der Sozialdemokratie arbeitete, antwortete auf meine Frage, ob sie auch eine biographische Skizze Bähnischs mit aufnehmen werde, mit dem Satz „die kommt nicht in meinen Kalender!“ Solchen von offenkundiger Geringschätzung geprägten Aussagen steht der Umstand entgegen, daß sich die SPD Hannover-Stadt auf ihrer Homepage der „großen, durchsetzungsfähigen Sozialdemokratin“ Bähnisch rühmt, zumal sie „NaziGegner“56 verteidigt habe. Ein nunmehr 45 Jahre alter Artikel des SPD-Pressedienstes aus dem Jahr 1969 vermittelt den Eindruck, als habe es in der Partei durchaus Tradition, sich zu Bähnisch immerhin in Zusammenhängen zu bekennen, in denen es um die Verdienste von SPD-Mitgliedern im Widerstand gegen den National-
52
53 54 55
56
zirk. Der Konflikt um den Rat des Bezirkes Leipzig 1958/1959, in: Richter: Länder, S. 255–276. Bahr, Andrea: Tagungsbericht Staatliche Mittelinstanzen in Europa nach 1945 – Machtkonstellationen und Planungskulturen am 22.11.2013 in Berlin, in: H-Soz-u-Kult, 28.03.2014, auf: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5283, am 29.03.2014. Vgl.: Faber: Bezirksregierung. Vgl.: Poestges: Mittelinstanz. Vgl.: Blazek: Landdrostey. Blazek thematisiert für jenen Zeitraum nur die besonderen Nachkriegsaufgaben, die Veränderungen im Zuschnitt der Abteilungen, die Rückgabe von Kompetenzen (Forsten, Polizei) an das Regierungspräsidium sowie die Einrichtung von Sonderbehörden 1946 – ohne diese jedoch aufzuführen. Vgl.: Pollähne, Lothar: Theanolte Bähnisch, in: 150 Persönlichkeiten der hannoverschen Sozialdemokratie, auf: SPD Stadtverband Hannover, http://spd-hannover-stadt.de/content/ 392037.php, am 13.03.2013.
34 | Theanolte Bähnisch
sozialismus geht.57 In SPD-nahen Forschungsarbeiten spielt die Regierungspräsidentin kaum eine Rolle. In einer frauengeschichtlichen Publikation der Historikerin Gisela Notz taucht Bähnischs Engagement auf, es fristet jedoch ein randständiges Dasein.58 Im Jahr 2012 legte die Historikerin Karin Gille-Linne im Dietz-Verlag eine Publikation vor, aus der zwar nicht explizit, aber zwischen den Zeilen deutlich wird, warum Bähnisch in ihrer Partei keinen guten ‚Stand‘ hat. Im Buch geht es nämlich um den Konflikt zwischen der SPD-Frauenreferentin Herta Gotthelf und Bähnisch über den Schaden und Nutzen ‚überparteilicher Frauenarbeit‘. Im Zusammenhang mit Elisabeth Selberts Arbeit thematisiert Gille-Linne auch das gern vergessene Engagement der Regierungspräsidentin für die Durchsetzung des Gleichberechtigungsartikels im Grundgesetz.59 Die Autorin stellt Bähnischs Arbeit allerdings weitgehend negativ dar, was wiederum mit der umstrittenen Rolle der ehemaligen Präsidentin des Deutschen Frauenringes (DFR) in der Frauenbewegung zusammenhängt. In dieser ist Bähnisch als historische Figur vergleichsweise gut bekannt. Im ‚Deutschen Frauenring‘ bewahrt man seiner Gründungspräsidentin bis in die Gegenwart ein breitgefächertes Andenken – im Internet, in Form von Vorträgen60, durch Flyer61 und durch die Pflege eines hauseigenen kleinen Archivs. Die Luise-BüchnerBibliothek des DFR in Darmstadt sammelt Werke zur Frauenbewegung, vor allem auch zum DFR und macht diese der Öffentlichkeit zugänglich. Viele relevante Unterlagen, darunter diverse Jahrgänge der von Bähnisch herausgegebenen Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ sowie den Nachlaß Gabriele Streckers, die im Frauenring aktiv war, überliefert das Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel (AddF), das auch eigene Forschungsarbeiten durchführt. Im ‚Frauenort Bad Pyrmont‘, den der Landesfrauenrat Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Historikerin Karin Ehrich gestaltet hat, wird eine ‚FrauenORT-
57 Vgl.: O. V.: Theanolte Bähnisch. Niedersachsens Bevollmächtigte beim Bund verläßt Bonn, o. V., in: SPD Pressedienst P/XIX/72, 15.04.1964, S. 3. Dem unbekannten Autor schien jedes Mittel Recht gewesen zu sein, das Parteimitglied als NS-Gegnerin darzustellen, denn die im Artikel enthaltene Information „1933 wurde Sie von den Nationalsozialisten selbstverständlich entlassen“, entbehrt jeder Grundlage. 58 Vgl. dazu beispielsweise: Notz, Gisela: Frauen in der Mannschaft. Sozialdemokratinnen im Parlamentarischen Rat und im Deutschen Bundestag 1948/49 bis 1957, Bonn 2003. 59 Vgl.: Gille-Linne, Karin: Verdeckte Strategien: Herta Gotthelf, Elisabeth Selbert und die Frauenarbeit der SPD 1945–1949, Bonn 2012. Der Monographie ging ein Aufsatz derselben Autorin voraus, der Bähnisch ebenfalls thematisiert. Vgl.: Gille, Karin: „Kennen Sie Herta Gotthelf?“. Eine Parteifunktionärin im Schatten von Elisabeth Selbert, in: Metis: Zeitschrift für historische Frauen- und Geschlechterforschung, 10. Jg. (2003), Heft 20, S. 48–65. 60 Vgl.: O. V.: 32. Europatag in Bad Pyrmont, auf: http://www.deutscher-frauenring.de/ aktuelles/nachrichten/32.-europatag-in-bad-pyrmont, am 07.04.2014. 61 Vgl.: O. V.: Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland. Von den Wurzeln bis heute, auf: http://www.deutscher-frauenring.de/der-verband/info-werbe-material/flyer/flyer -geschichte-der-frauenbewegung, am 07.04.2014.
Einführung | 35
Tour‘ samt Kaffeegedeck auf den Spuren der DFR-Präsidentin.62 Inwiefern dies Bähnischs Bekanntheitsgrad vor Ort und allgemein erhöht hat, bliebe zu prüfen. Dasselbe gilt für die mittlerweile fünf nach Bähnisch benannten Straßen, von denen vier auf die Region Hannover und eine auf die Hauptstadt Berlin entfallen. Der Großteil der bisher erschienenen Publikationen, die sich mit Bähnisch auseinandersetzen, ist der eng mit der Frauenbewegung verschränkten ‚Historischen Frauenforschung‘ zuzurechnen. 63 Diese Veröffentlichungen reflektieren im Wesentlichen Bähnischs Rolle als Präsidentin des ‚Deutschen Frauenrings‘ und seiner Vorläuferorganisationen sowie ihre Aussagen über die Rolle von Frauen in der Gesellschaft. Ihre Arbeit als Regierungspräsidentin, ihre Eigenschaft als Herausgeberin einer Frauenzeitschrift und ihre guten Beziehungen zur britischen Militärregierung werden, obwohl die beiden zuletzt genannten Aspekte eng mit Bähnischs Engagement in der Frauenbewegung zusammenhingen, darin kaum thematisiert. Alle Aufsätze stellen die Aussagen Bähnischs über ihr Engagement im Widerstand gegen den Nationalsozialismus als gesicherte Tatsachen dar.64 Zu konstatieren ist, daß den zahlreichen zeitgenössischen Zeitungs- und Zeitschriften- sowie Lexikonartikeln wenig Forschungsliteratur über Theanolte Bähnisch entgegensteht. Viele der bisher erschienenen Aufsätze über die Regierungspräsidentin sind für den wissenschaftlichen Gebrauch unzureichend mit Belegen ausgestattet, sie differenzieren und hinterfragen kaum. Bähnisch wird in den meisten der bisher erschienenen Publikationen entweder stark positiv oder stark negativ bewertet.65 Mit ihrer Lebensgeschichte bis 1945 setzen sich die Aufsätze, wenn überhaupt, nahezu
62 Vgl.: Schmidt, Elke/Bad Pyrmont Tourismus AG (Hrsg.): Die Frauenwelt schaut(e) auf Bad Pyrmont, auf: http://www.frauenorte-niedersachsen.de/files/flyer_theanolte.pdf, am 07.04.2014. Die Texte in der Broschüre stammen von der Historikerin Karin Ehrich. 63 Vgl.: Erich, Karin: Die Mitarbeit der Frau ist überall! Regierungspräsidentin Theanolte Bähnisch. Netzwerkerin für die Frauen, in: Niedersachsen vorwärts, März 2011, S. 5; Fleischer, Barbara: Immer die erste – Die Juristin Theanolte Bähnisch, in: dies.: Frauen an der Leine. Stadtspaziergang auf den Spuren berühmter Hannoveranerinnen, 2. Aufl., Berlin 2009, S. 105–121; Paulus, Julia: Theanolte Bähnisch, geb. Nolte (1899–1973), in: Paschert-Engelke, Christa (Hrsg.): Im Garten der Rosindis. 63 Frauenporträts aus dem Kreis Warendorf, Münster 2008, S. 76/77; Clemens, Bärbel: Wir Frauen müssen ein kluges Herz haben, in: Schröder, Hiltrud: Sophie und Co. Bedeutende Frauen in Hannover, Hannover 2002, S. 201–213; Röwekamp, Marion: „Ich brauchte meinen ganzen Mut.“ Das unkonventionelle Leben von Theanolte Bähnisch, in: Happ, Sabine (Hrsg.): „Laßt sie doch denken!“100 Jahre Studium für Frauen in Münster, 2. Aufl., Münster 2009, S. 262–268. 64 Dies gilt auch für einen Artikel, den Theanolte Bähnischs Tochter verfaßte. Vgl.: Fels, Orla-Maria: Theanolte Bähnisch, in: (Hrsg.:) Deutscher Juristinnenbund. Juristinnen in Deutschland. Die Zeit von 1900 bis 1998, 3. Aufl., Baden-Baden 1998, S. 197–200. 65 Vgl. für eine negative Bewertung Bähnischs: Henicz, Barbara/Hirschfeld, Margrit: Der Club deutscher Frauen in Hannover, in: Kuhn, Annette (Hrsg.) Frauen in der deutschen Nachkriegszeit, Bd. 2: Frauenpolitik 1945–1949, Düsseldorf 1986, S. 127–134 sowie dies.: „wenn die Frauen wüßten, was sie könnten, wenn sie wollten“ – zur Gründungsgeschichte des deutschen Frauenrings, in: Kuhn: Nachkriegszeit, Bd. 2, S. 135–156.
36 | Theanolte Bähnisch
ausschließlich auf der Grundlage von Selbstdarstellungen Bähnischs und den erwähnten Zeitungs-, Zeitschriften- und Lexikonartikeln auseinander. Dafür, daß auch von Seiten der Frauenforschung bisher noch kein ausführlicheres Porträt Bähnischs entstand, spielt wohl nicht zuletzt die Distanz der ‚neuen deutschen Frauenbewegung‘66 gegenüber dem Genre ‚Biographie‘ eine Rolle. Die Germanistin Nina von Zimmermann schreibt, daß in der Frauen- und Geschlechterforschung, die in den 1970er Jahren aus der ‚neuen Frauenbewegung‘ heraus entstand, biographische „Texte von Frauen“ und sogar „Texte über Frauen, die der bürgerlichen Frauenbewegung nahestanden, über einen langen Zeitraum als in einem ‚männlichen Genre‘ verfaßt wahrgenommen wurden […] wenn sie nicht der sich [zu jener Zeit] entwickelnden Vorstellung von feministischer Biographik“67 entsprochen hätten. Sie seien deshalb von jener Forschungsrichtung als Forschungsgebiet ausgeblendet worden.68 Frauenbiographik – also eine von feministischen Theorien beeinflußte Biographik – werde, so Zimmermann, „in jenen Kreisen“ als ein Instrument angesehen, mit dessen Hilfe „spezifisch gegenwartsorientierte feministische Anliegen anhand der Lebensläufe historischer Frauenfiguren exemplifiziert“69 werden können. Zimmermanns Statement fand sich auf einer Tagung des Deutschen Historischen Instituts (DHI) für Promotionsstudierende bestätigt. Als ich dort erklärte, es ginge mir nicht in erster Linie darum, das Wirken Bähnischs unter emanzipatorischen Gesichtspunkten darzustellen, schlug mir von Seiten einer anwesenden Professorin, die sich mit dem Sujet Frauengeschichte beschäftigte, blanke Fassungslosigkeit entgegen. Sie zeigte sich entsetzt darüber, daß ich „als Frau“ nicht die von ihr als obligatorisch angesehene Form des Zugangs zu einer Protagonistin der Frauenbewegung wählte und damit – so die Wissenschaftlerin sinngemäß – all das mit Füßen trat, was sie und ihre Mitstreiterinnen aus der Frauenbewegung und der Frauenforschung über Jahrzehnte aufgebaut hätten. Mit den Worten „Sie müssen mir helfen“, wandte sie sich an die anderen anwesenden Professorinnen, welche allesamt ebenfalls Forschungsschwerpunkte in der Frauen-/beziehungsweise Geschlechtergeschichte ausgebildet hatten. Daraufhin änderte sich – noch während meines Vortrags, der sich im Wesentlichen mit antikommunistischen und antislawischen Feindbildern in der von Bähnisch herausgegebenen Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ beschäftigte – die Sitzordnung. Ein Gespräch am darauffolgenden Abend nahm der Situation im Nachhinein zwar etwas von ihrer Schärfe, die Lektion blieb jedoch folgende: Setzt man sich mit dem Leben einer Frau, noch dazu einer solchen, die sich selbst in der Frauenbewegung engagiert hat, auseinander, so sieht man sich zwangsläufig mit der Erwartung konfrontiert, sich dieser Herausforderung aus feministischen Beweggründen zu stellen und das Thema entsprechend zu bearbeiten.
66 Der Begriff umschreibt die in den 1960er Jahren einsetzende, mit den Studentenprotesten verknüpfte ‚Welle‘ der Frauenbewegung. 67 Zimmermann, Nina, von: Zu den Wegen der Frauenbiographikforschung, in: dies./Zimmermann, Christian von (Hrsg.): Frauenbiographik. Lebensbeschreibungen und Porträts, Tübingen 2005, S. 17–32, hier 18/19. 68 Vgl.: ebd. 69 Ebd, S. 21.
Einführung | 37
Daß die Gründungspräsidentin des DFR in Kreisen der Frauenbewegung und/oder forschung entweder als ein ‚Vorbild‘, wenn nicht gar als eine ‚Heldin‘70 dargestellt, oder aber als eine Negativ-Folie71 gezeichnet wird, läßt sich auf die verschiedenen politischen Lager, beziegungsweise Traditionen in der Frauenbewegung zurückführen. Ute Gerhards Gedanke, daß mit der Distanz, welche die ‚neue‘72 zur ‚alten‘ Frauenbewegung pflegte, auch ein weitreichender „Geschichtsverlust“ der Bewegung einhergegangen ist73, läßt sich nicht von der Hand weisen. Dies dürfte sich auch auf den Umgang mit Theanolte Bähnisch ausgewirkt haben. Auch eine andereExpertin für die Geschichte der Frauenbewegung, Kerstin Wolff, schreibt, daß sich die „autonome Frauenbewegung“ zunächst als „geschichtslos“74 empfunden habe, obwohl ihre Forderungen auf denen der ‚ersten‘ Frauenbewegung aufgebaut hätten. Erklären läßt sich die beschriebene Distanz unter anderem dadurch, daß die Traditionen der linken Frauenbewegung in der direkten Nachkriegszeit marginalisiert worden waren – wofür die ‚neue‘ Frauenbewegung die ‚Bürgerlichen‘ verantwortlich machte. Die 68erinnen suchten ihre Vorbildfiguren bald in der proletarischen Frauenbewegung, vor allem in Rosa Luxemburg und Clara Zetkin, und bewerteten den Rückgriff der in der direkten Nachkriegszeit dominanten überparteilichen Frauenbewegung auf bürgerliche Traditionen als Fehlverhalten. Daß die ‚bürgerlichen‘ Frauen sich nicht um Arbeiterfrauen bemüht hätten und so an der historischen Spaltung der Frauenbewegung in ‚bürgerliche‘ und ‚proletarische‘ Frauen auch in der Zeit nach 1945 festhalten hätten, wurde ebenso zum Vorwurf gegen die ‚Bürgerlichen‘ erhoben wie deren Tendenz, traditionelle Zuschreibungen von ‚Weiblichkeit‘ weitgehend zu wahren.75 Die Mitarbeiterin des Archivs der deutschen Frauenbewegung, Kerstin Wolff, relativiert den Bruch, den das Aufkommen der ‚neuen Frauenbewegung‘ für viele Frauen bedeutete, in einem aktuelleren Text zur Frauenbewegung in der ‚Neuesten Ge-
70 Entsprechendes scheint auch die Lehrerin einer Hannoveraner Schule ihren Schülerinnen erklärt zu haben. Einige Schülerinnen hatten sich unter mehreren angebotenen ‚Heldinnen‘ Theanolte Bähnisch als Gegenstand für ein Referat ausgesucht und mich im Anschluß an eine Internet-Recherche telefonisch um ergänzende Informationen gebeten. 71 Wie bereits erwähnt ist dies in den beiden regionalgeschichtlichen Aufsätzen über die Entstehung des DFR besonders deutlich. Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Club sowie dies.: Wenn die Frauen wüßten. 72 Damit meint die Historikerin die in den 1970er Jahren stark gewordene, linke Strömung. 73 Vgl.: Gerhard, Ute: Frauenbewegung, in Roth, Roland/Rucht, Dieter (Hrsg.): Die sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945. Ein Handbuch, Frankfurt a. M./New York 2008, S. 187–217, hier S. 188. Gerhard bezeichnet die Phase, in der Bähnisch in der Frauenbewegung aktiv war, als ‚Vorbereitung des Terrains‘ (für die sogenannte ‚Neue Frauenbewegung‘). Vgl.: ebd., S. 159. 74 Wolff, Kerstin: Ein Traditionsbruch? Warum sich die autonome Frauenbewegung als geschichtslos erlebte, in: dies./Paulus, Julia/Silies, Eva-Maria (Hrsg.): Zeitgeschichte als Geschlechtergeschichte. Neue Perspektiven auf die Bundesrepublik. Frankfurt a. M. 2012, S. 257–275. 75 Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Frauen sowie dies.: Club.
38 | Theanolte Bähnisch
schichte‘.76 Darin, daß das Archiv sich der Erforschung verschiedener Traditionen der Frauenbewegung widmet, deutet sich an, daß sich die Fronten zumindest im Bereich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Frauenbewegung langsam aufweichen. Der Umstand, daß sich die Gender-Theorie in den geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern mittlerweile als ein verbreiteter Forschungsansatz etabliert hat und mit wachsender Selbstverständlichkeit auch mit anderen Ansätzen fruchtbar kombiniert wird, hat dazu beigetragen, daß das ‚Schubladen-Denken‘ in Bezug auf die Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Frauen‘ und ‚Frauenbewegung‘ nachgelassen hat. Viele Forscher und Forscherinnen stehen diesen Themen allerdings noch immer desinteressiert bis ablehnend gegenüber – was nicht zuletzt mit der beschriebenen, oftmals stark tendenziösen Auseinandersetzung mit ‚Frauengeschichte‘ zu tun haben dürfte. Auch ich wurde von – meist männlichen – Kollegen mehr als einmal mit den Worten „Sie bearbeiten doch so ein Frauenthema“ angesprochen, womit man mir, wie sich im weiteren Verlauf der Gespräche zeigte, in vielen Fällen bedeuten wollte, daß jemand, der sich einem ‚Frauenthema‘ widme, kaum ein ernsthaftes wissenschaftliches Interesse verfolgen könne. Wie der (Selbst-)Zweck einer Subdisziplin ‚Geschlechterforschung‘ im weiteren Verlauf des Gesprächs in Frage gestellt wurde, so wurde auch der Einwand, daß die Auseinandersetzung mit vermeintlich reinen ‚Frauenthemen‘ durch eine breitere geschichtswissenschaftliche Kontextualisierung meist (auch) Zusammenhänge von allgemeinpolitischer Tragweite zutage fördere, nicht nur einmal mit einer abwehrenden Handbewegung quittiert. Seit den 1990er Jahren haben sich verschiedene Monographien und Aufsätze mit der Rolle des Kalten Krieges für die Entwicklung der deutschen Frauenbewegung in der Nachkriegszeit – und umgekehrt – auseinandergesetzt. In diesen spielt jeweils auch Theanolte Bähnisch eine Rolle. Zu nennen sind die pionierhaften Arbeiten Irene Stoehrs, die ihren Fokus allerdings auf Berlin richtet und Bähnisch, welche von Hannover aus arbeitete, nur am Rande erwähnt.77 In der Zeitschrift des Archivs der deutschen Frauenbewegung, ‚Ariadne‘, sind ebenfalls Aufsätze erschienen, die das Auseinanderbrechen der Frauenbewegung in ‚Ost‘ und ‚West‘ thematisieren.78 Daß sich
76 Vgl.: Wolff: Traditionsbruch. 77 Vgl.: Stoehr, Irene: „Feministischer Antikommunismus“ und weibliche Staatsbürgerschaft in der Gründungsdekade der Bundesrepublik, in: Feministische Studien, 16. Jg. (1998), Heft 1, S. 86–94; dies.: Wiederbewaffnung und Weiblichkeit in Westdeutschland: die 50er Jahre, in: Eifler, Christine: Frauenbündnis Projekt Osnabrück (Hrsg.): Militär – Gewalt – Geschlechterverhältnis. Dokumentation der Vortragsreihe vom Frauenbündnis Osnabrück „350 Jahre Krieg und Frieden – ohne Frauen?“, Osnabrück 1999, S. 96–111 sowie dies.: Friedenspolitik und Kalter Krieg: Frauenverbände im Ost-West-Konflikt, in: Genth, Renate: Frauenpolitik und politisches Wirken von Frauen im Berlin der Nachkriegszeit 1945– 1949, Berlin 1996, S. 229–254. 78 Vgl.: Bouillot, Corinne/Schüller, Elke: „Eine machtvolle Frauenorganisation“ – oder: „Der Schwamm, der die Frauen aufsaugen soll.“ Ein deutsch-deutscher Vergleich der Frauenzusammenschlüsse in der Nachkriegszeit, in: Ariadne, 10. Jg. (1995), Heft 27, S. 47–55; Bouillot, Corinne: „Im Osten wird stark um die politische Seele der Frau gerungen“. Frau-
Einführung | 39
auch diese Aufsätze stark an den Entwicklungen in Berlin orientieren, ist vor allem dem Umstand geschuldet, daß der DFD, die Frauenorganisation der SBZ/DDR, dort ihren Sitz hatte. Die Aufsätze nehmen jedoch auch Vorgänge in verschiedenen Regionen Westdeutschlands in den Blick, darunter Bähnischs Arbeit in Hannover. Gleich vier Studien erforschen die Umerziehungs-Arbeit der Alliierten speziell für Frauen in der deutschen Nachkriegszeit und zeigen – je nach Schwerpunktsetzung – deren allgemeinpolitische Bedeutung im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Erwachsenenbildung in Deutschland79, ihre Funktion als strategischen und auf andere Verhältnisse übertragbaren Schwerpunkt von Besatzungspolitik80, ihren Stellenwert in der Politik des Kalten Krieges und des ökonomischen Wiederaufbaus81 von Deutschland und für den internationalen Anschluß der deutschen Frauenbewegung82 auf. In diesen Untersuchungen wird jeweils die wichtige Rolle Bähnischs als Gründungspräsidentin der westdeutschen Frauenorganisation DFR sowie als bedeutende Partnerin der britischen Militärregierung aufgezeigt. All diese Studien verweisen auch auf den Umstand, daß mit der überparteilichen Frauenbewegung im Westen und dem Streben nach einer von Bähnisch geleiteten Großorganisation ein Kontrapunkt zur Organisation DFD in der SBZ/DDR gesetzt werden sollte. Die Studien thematisieren jeweils einige der für die Entwicklung der Frauenbewegung im Nachkriegsdeutschland wesentlichen Konferenzen und zeigen, daß Bähnisch auf deren Vorplanung und Ablauf sowie auf die Inhalte und Ergebnisse der Konferenzen maßgeblichen Einfluß ausübte. Denise Tscharntke betont in ihrer Studie den starken Führungsanspruch Bähnischs in der Frauenbewegung der Nachkriegszeit und mißt diesem vor dem Hintergrund der ursprünglichen Forderung der Militärregierung, die Frauenbewegung müsse demokratisch organisiert sein, einen fragwürden Charakter bei. Daraus, daß die Militärregierung dennoch nicht von der Unterstützung Bähnischs abließ, leitet Tscharntke ab, daß beide Partner weniger an der Emanzipation und der Demokratisierung von Frauen, sondern stärker an der Abwehr der Kommunistinnen, die Militärregierung zudem von Beginn ihrer Re-education-Arbeit an vor allem auch an der Verwendung
79 80
81 82
enorganisationen und parteipolitische Strategien in der SBZ und frühen DDR, in: Ariadne, 16. Jg. (2001), Heft 40, S. 46–51. Vgl.: Ziegler, Christl: Lernziel Demokratie. Politische Frauenbildung in der britischen und amerikanischen Besatzungszone 1945–1949, Köln/Weimar/Wien 1997. Vgl.: Stark, John Robert: The overlooked majority: German women in the four Zones of occupied Germany, 1945–1949. A comparative study, Dissertation, Ohio State University, 2003, auf: OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center, https://etd.ohiolink.edu/ ap/10?0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:osu1045174197, am 09.04.2014. Vgl.: Tscharntke, Denise: Re-educating german Women. The work of the Women´s Affairs Section of British Military Government 1946–1951, Frankfurt a. M. 2003. Vgl.: Grundhöfer, Pia: Ausländerinnen reichen die Hand. Britische und amerikanische Frauenpolitik in Deutschland im Rahmen der demokratischen Re-education nach 1945, Hänsel-Hohenhausen 1999, zugl. Diss. Uni Trier 1995. Die Benutzung der 700 Seiten starken Dissertation ist beschwerlich, da sie nur auf Microfiche erhältlich ist. Da Grundhöfers Dissertation Mitgrundlage von Tscharntkes Ausführungen war, finden sich die wichtigsten Ergebnisse Grundhöfers in der Dissertation Tscharntkes wieder.
40 | Theanolte Bähnisch
von Frauen als Arbeitskräfte interessiert gewesen seien. Die Officers hätten insgesamt, so Tscharntke, eher die Pflichten als die Rechte von Frauen im Blick gehabt.83 Die Erziehungswissenschaftlerin Ziegler richtet ihren – insgesamt weniger kritikgeleiteten – Fokus stärker auf die Inhalte der von der Militärregierung und der überparteilichen Frauenbewegung verantworteten ‚staatsbürgerlichen Frauenbildung‘. Tscharntke, Ziegler, Starke und Grundhöfer stellen die britische Militärregierung jeweils als Vorreiter in Sachen Frauen-Re-education-Arbeit vor der Amerikanischen Militärregierung dar. Die jüngste umfangreichere Studie zum Thema Frauen-Re-education/Frauenbewegung in der Nachkriegszeit fokussiert – wie die älteren Arbeiten von Rebecca Boehling84 und Hermann-Josef-Rupieper85 – auf die amerikanische Besatzungszone. Die Verfasserin, Marianne Zepp, widmet sich insbesondere der Politik hinter den beiden zentralen Begriffen ‚Mütterlichkeit‘ und ‚Staatsbürgerin‘, mit denen die ‚bürgerliche Frauenbewegung‘ nach 1945 – an die Vorkriegstraditionen anknüpfend – argumentierte.86 Der Fokus auf die US-Besatzungszone bringt es mit sich, daß die führende Rolle Bähnischs bei der Verbreitung des Begriffs ‚staatsbürgerliche Frauenbildung‘ von Zepp jedoch nicht thematisiert wird. Dies führt zu einer verzerrten Darstellung der machtpolitischen Realitäten in der Frauenbewegung der Nachkriegszeit, ähnlich wie bei Rupieper, der Bähnisch, obwohl sie auch in der USBesatzungszone die Führung in der Frauenbewegung übernahm, überhaupt nicht als Protagonistin der Bewegung in der Nachkriegszeit erwähnt. Die in den letzten drei Absätzen genannten Studien sind allesamt lesenswert und erkenntnisfördernd in Bezug auf Bähnischs Rolle in der Frauenbewegung, beziehungsweise den Kontext der britischen Re-education-Politik, in dem diese sich entfaltete. Allerdings bringt es die Ausrichtung der genannten Arbeiten auf die Frauenbewegung und die Militärverwaltung mit sich, daß sie sich in der Auseinandersetzung mit Bähnisch wesentlich auf ihre Rolle im Aufbau und in der Leitung des Deutschen Frauenrings konzentrieren. Die anderen Wirkungsgebiete der DFR-Präsidentin werden, abgesehen von Bähnischs Initiative zur Einrichtung einer Schule für staats-
83 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 16–18, S. 227–235. 84 Vgl.: Boehling, Rebecca: Geschlechterpolitik in der US-Besatzungszone unter besonderer Berücksichtigung der Kommunalpolitik, in: Clemens, Gabriele (Hrsg.): Kulturpolitik im besetzten Deutschland 1945–1949, Stuttgart 1994, S. 69–82; dies.: „Mütter“ in die Politik: Amerikanische Demokratisierungsbestrebungen nach 1945. Eine Antwort auf HermannJosef Rupieper, in: Geschichte und Gesellschaft, 19. Jg. (1993), S. 522–529 und dies.: Die amerikanische Kulturpolitik 1945–1949, in: Junker, Detlef u. a. (Hrsg.): Die USA und Deutschland im Zeitalter des Kalten Krieges 1945–1990, Bd. 1: 1945–1968, München 2001, S. 592–600. 85 Vgl.: Rupieper, Hermann-Josef: Bringing democracy to the Frauleins. Frauen als Zielgruppe der amerikanischen Demokratisierungspolitik 1945–1953, in: Geschichte und Gesellschaft, 17. Jg. (1991), S. 61–91 sowie ders.: Die Wurzeln der westdeutschen Nachkriegsdemokratie. Der amerikanische Beitrag 1945–1952, Opladen 1993. 86 Vgl.: Zepp, Marianne: Redefining Germany. Reeducation, Staatsbürgerschaft und Frauenpolitik im US-amerikanisch besetzten Nachkriegsdeutschland, Göttingen 2007.
Einführung | 41
bürgerliche Frauenbildungsarbeit, allenfalls in Randbemerkungen oder Fußnoten thematisiert. Ihr Leben vor 1945 bleibt auch in diesen umfangreicheren Studien nahezu gänzlich unreflektiert. Dies führt jeweils zu einer Einordnung ihres Handelns, das der Komplexität der Zusammenhänge nicht gerecht werden kann. Die gebotene Zusammenschau zeigt, daß es überfällig ist, sich intensiver mit Theanolte Bähnisch auseinanderzusetzen, um zu einem differenzierteren Bild jener mal gelobten, mal verurteilten, mal übergangenen, mal beschwiegenen Frau zu gelangen. Daß sie, wie Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf, als eine ‚konservative Sozialdemokratin‘87 bezeichnet wird, daß man der Regierungspräsidentin im ‚Who is who in Lower Saxony‘ der britischen Militärregierung einen „high standard of official integrity“ bescheinigt und sie gleichzeitig als einen der „most colourful characters of Hanover region“ sowie als „sometimes overpowering“88 bezeichnet, macht neugierig auf die Hintergründe, die zu diesen Bewertungen führten. Will man zu einem facettenreicheren Bild Bähnischs gelangen, so ist es naheliegend, nicht nur ihre Rolle im Wiederaufbau der Frauenbewegung – der sich der Löwenanteil der existierenden Literatur und der publizierten Quellen widmet – in den Blick zu nehmen, sondern ihre verschiedenen Wirkungsgebiete zu betrachten. Dies soll jedoch keineswegs bedeuten, daß ihr Engagement in der Frauenbewegung nicht für sich genommen schon Grund genug dafür wäre, sie bekannter zu machen. Daß die Präsidentin des DFR in ihrer Rolle jenseits der Frauenbewegung und -forschung bisher kaum wahrgenommen wird, ist nämlich keineswegs als ‚normal‘ anzusehen. Schließlich haben Personen, die ähnliche Positionen in der organisierten Frauenbewegung bekleideten und/oder sich über einen langen Zeitraum für die Gleichberechtigung von Frauen einsetzten, große Popularität erlangt. Dies gilt gleichermaßen für die Ikonen der proletarischen Frauenbewegung Rosa Luxemburg und Clara Zetkin, wie auch für die umstrittene BDF-Vorsitzende Gertrud Bäumer, die SPD-Politikerin und ‚Mutter des Grundgesetzes‘ Elisabeth Selbert sowie für die Begründerin des Magazins ‚Emma‘, Alice Schwarzer.
1.3 EIGENE VORARBEITEN ZUM THEMA Mit dem Handeln Theanolte Bähnischs hat sich die Verfasserin der vorliegenden Arbeit bereits in Form einer 2005 abgeschlossenen, unveröffentlichten Magisterarbeit auseinandergesetzt. Diese beschäftigt sich, an den 2004 gemeinsam mit Kerstin Wolff publizierten Artikel89 anknüpfend, mit der von Bähnisch ab 1948 herausgege-
87 Vgl.: Pollähne: Bähnisch. 88 Röpcke, Andreas: Who’s Who in Lower Saxony. Ein politisch-biographischer Leitfaden der britischen Besatzungsmacht 1948/49, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 55 (1981), S. 243–309, hier S. 258. 89 Freund, Nadine/Wolff, Kerstin: „Um harte Kerne gegen den Kommunismus zu bilden...“ Die staatsbürgerliche Arbeit von Theanolte Bähnisch in der Zeitschrift „Die Stimme der Frau“, in: Ariadne, 19. Jg. (2004), Heft 44, S. 62–69.
42 | Theanolte Bähnisch
benen Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘90. Ein weiterer Artikel liefert einen Überblick über erste Ergebnisse meiner fortgesetzten Auseinandersetzung mit Bähnisch im Zuge der Promotionsarbeit.91 Ein dritter Artikel beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Weiblichkeit, Öffentlichkeit und Privatheit, wie es durch Theanolte Bähnisch und anhand ihrer Person dargestellt wurde.92 Ausgangspunkt für meine Auseinandersetzung mit Theanolte Bähnisch, beziehungsweise mit der von ihr herausgegebenen Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ war die Überzeugung, daß der Zusammenhang zwischen der alltagskulturellen Dimension des Kalten Krieges, der Frauen-Re-education Arbeit der Westalliierten und der deutschen Frauenbewegung in der Nachkriegszeit noch nicht hinreichend erforscht war. Zwar lag bereits 2003 die genannte Studie Denise Tscharntkes93 vor, doch war bis 2005 noch nie eine westdeutsche Frauenzeitschrift systematisch hinsichtlich ihres antikommunistischen Gehalts in den ersten Nachkriegsjahren untersucht worden. Die Rolle von Frauen-Zeitschriften als prägender Faktor im Kampf um Deutungsmacht zwischen ‚Ost‘ und ‚West‘ ist dementsprechend weitgehend unbekannt. Eine stichprobenartige Untersuchung der ersten Ausgaben der ab Juli 1946 zunächst von Annemarie Weber, ab November des Jahres dann von Lisbet Pfeiffer herausgebenenen Zeitschrift ‚Die Welt der Frau‘ hat gezeigt, daß die ‚Stimme der Frau‘ in dieser Hinsicht keineswegs ein Unikat ist. Ihre Untersuchung ist jedoch insofern besonders interessant, als die Herausgeberin Bähnisch gleichzeitig eine wichtige Rolle in der Frauenbewegung der Nachkriegszeit spielte. Nachdem zuvor jahrzehntelang vor allem quantifizierende, politikwissenschaftliche Studien über den Kalten Krieg vorgelegt wurden, erschienen ab der Jahrtausendwende verstärkt interdisziplinär angelegte Arbeiten über die Nachkriegszeit, die den Einfluß des Kalten Krieges auf die deutsche Medienlandschaft verdeutlichen.94 Vor dem Hintergrund des gestiegenen Interesses an der Auseinandersetzung mit audiovisuellen Medien war jedoch ebenfalls bereits zu jener Zeit eine Schwerpunktverschiebung von der Analyse von Printmedien zugunsten der Analyse von Fernsehen und Kino zu beobachten.95 Die ‚klassischen‘ Medien wurden in diesem Zuge eher stiefmütterlich behandelt. Studien zur
90 Freund: Krieg. 91 Freund, Nadine: Theanolte Bähnisch (1899–1973) und ihr Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands im Rahmen der Westorientierung nach 1945, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 80 (2008), S. 403–430. 92 Freund, Nadine: „Mit Hut, Charme und Diplomatie.“ Zum Verhältnis von Weiblichkeit und Öffentlichkeit, Integration und Partizipation in der direkten Nachkriegszeit: Die Regierungspräsidentin Theanolte Bähnisch (1899–1973), in: Bussiek, Dagmar/Göbel, Simona (Hrsg.): Kultur, Politik und Öffentlichkeit. Festschrift für Jens Flemming, Kassel 2009, S. 446–464. 93 Vgl.: Tscharntke: Re-educating. 94 Vgl. dazu: Lindenberger, Thomas (Hrsg.): Massenmedien im Kalten Krieg. Akteure, Bilder, Resonanzen, Köln 2006. 95 Dies zeigt sich exemplarisch in: Schneider, Irmela/Spangenberg, Peter (Hrsg.): Medienkultur der 50er Jahre, Wiesbaden 2002. Trotz des allgemein gehaltenen Titels beschäftigt sich kein einziger der 20 Aufsätze mit Printmedien.
Einführung | 43
‚Westernisierung‘96, beziehungsweise ‚Amerikanisierung‘97 und ‚Sowjetisierung‘98 Deutschlands und Europas, zur deutsch-deutschen Geschichte99 und zum Kalten Krieg100, zur Geschichte des Antikommunismus101, zur Propaganda- und Feindbildforschung102 sowie zur Analyse kulturpolitischer Zeitschriften der Nachkriegszeit103 stellten einen Kernbereich der Literatur dar, die ich zur Analyse der ‚Stimme der Frau‘ in meiner Magisterarbeit verwendete. Arbeiten wie die Gunilla-Friederike Buddes104 und Ina Merkels105 zu Frauenleitbildern in der ost- und westdeutschen Ge-
96 Vgl. insbesondere: Doering-Manteuffel, Anselm: Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert, Göttingen 1999. 97 Junker u. a.: USA sowie Trommler, Frank (Hrsg.): Amerika und die Deutschen. Bestandsaufnahme einer 300jährigen Geschichte, Opladen 1986. 98 Vgl.: Jarausch, Konrad Hugo/Siegrist, Hannes (Hrsg.:): Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945–1970. Frankfurt a. M. 1997. 99 Vgl.: Kleßmann, Christoph: Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945– 1955, Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 19915; Steininger, Rolf: Deutsche Geschichte. Darstellung und Dokumente in vier Bänden, Neuausgabe, Frankfurt a. M. 2002 sowie Schildt, Axel: Moderne Zeiten. Freizeit, Massenmedien und „Zeitgeist“ in der Bundesrepublik der 50er Jahre, Hamburg 1995. Schildts Studie thematisiert auch den Zeitraum zwischen 1945 und1950. 100 Vgl.: Stöver, Bernd: Rollback: Eine offensive Strategie für den Kalten Krieg, in: Junker: USA, S. 160–168 sowie ders.: Die Befreiung vom Kommunismus. Amerikanische Liberation Policy im Kalten Krieg 1947–1991, Böhlau 2002. 101 Vgl.: Stöver, Bernd: Der Kalte Krieg, München 2002 sowie Nolte, Ernst: Deutschland und der Kalte Krieg, München 1974. 102 Vgl.: Jahn, Peter: Rußlandfeindbild und Antikommunismus, in: Quinkert, Babette: „Wir sind die Herren dieses Landes“. Ursachen, Verlauf und Folgen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, Hamburg 2002, S. 223–235; ders.: „... wenn die Kosaken kommen.“ Tradition und Funktion eines deutschen Feindbildes, in: Bleuel, Hans-Peter (Hrsg.): Feindbilder, oder: Wie man Kriege vorbereitet, Göttingen 1985, S. 25–46; Körner, Klaus: „Die rote Gefahr”. Antikommunistische Propaganda in der Bundesrepublik 1950–2000, Hamburg 2003 und Schumacher, Frank: Kalter Krieg und Propaganda. Die USA, der Kampf um die Weltmeinung und die ideelle Westbindung der Bundesrepublik Deutschland, 1945–1955, Trier 2000; Sywottek, Arnold: Die Sowjetunion aus westdeutscher Sicht seit 1945, in: Niedhard, Gottfried (Hrsg.): Der Westen und die Sowjetunion. Einstellungen und Politik gegenüber der UdSSR in Europa und in den USA seit 1917, Paderborn 1983, S. 290–362, hier S. 331/332 und für einen allgemeineren Zugang: Bernhard, Hans-Michael: Voraussetzungen, Struktur und Funktion von Feindbildern, in: Jahr, Christoph/Mai, Uwe/Roller, Kathrin (Hrsg.): Feindbilder in der deutschen Geschichte. Studien zur Vorurteilsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 1994, S. 9–24. 103 Vgl.: Laurien, Ingrid: Politisch-kulturelle Zeitschriften in den Westzonen 1945–1949. Ein Beitrag zur politischen Kultur der Nachkriegszeit, Frankfurt a. M. 1991. 104 Vgl.: Budde, Gunilla-Friederike: „Tüchtige Traktoristinnen“ und „schicke Stenotypistinnen“. Frauenbilder in den deutschen Nachkriegsgesellschaften – Tendenzen der „Sowjetisierung“ und „Amerikanisierung“?, in: Jarausch/Siegrist: Amerikanisierung, S. 243–273;
44 | Theanolte Bähnisch
sellschaft, auch in Frauenzeitschriften106 und die bereits erwähnten Arbeiten Irene Stoehrs sowie Corinne Bouillots zur Frontstellung der Frauenbewegung in Ost und West in der Nachkriegszeit bilden eine Art Scharnier zum zweiten LiteraturSchwerpunkt meiner Magisterarbeit: den Studien, die sich mit der Rolle von Frauen in den beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften107, mit der Geschichte der Frauenbewegung108, der Frauenzeitschriften109 und der Frauen-Re-education-Arbeit der Alliierten beschäftigen110. Ferner erwiesen sich Publikationen zum Pressewesen in der Nachkriegszeit111 als relevant für die meine diskursanalytisch angelegte Untersuchung112 der Stimme der Frau von 1948 bis 1952. Die Ergebnisse der Analyse lassen sich wie folgt skizzieren: Einer allgemein hohen Wertschätzung europäischer, als ‚abendländisch‘ charakterisierter Kultur steht in der Zeitschrift eine deutliche Abwertung des Kommunismus und der Sowjetunion,
105
106
107
108
109
110 111
112
dies.: Zwischen den Stühlen. ‚Die Frau von heute‘ und ‚Für Dich‘ in den fünfziger und sechziger Jahren, in: Barck, Simone/Langermann, Martina/Lokatis, Siegfried (Hrsg.): Zwischen „Mosaik“ und „Einheit“. Zeitschriften in der DDR, Berlin 1999, S. 129–137; dies. (Hrsg.): Frauen arbeiten. Weibliche Erwerbstätigkeit in Ost- und Westdeutschland nach 1945, Göttingen 1997. Vgl.: Merkel, Ina: ... und Du, Frau an der Werkbank. Die DDR in den 50er Jahren, Berlin 1990 sowie dies.: Leitbilder und Lebensweisen von Frauen in der DDR, in: Kaelble, Hartmut/Kocka, Jürgen/Zwahr, Hartmut (Hrsg.): Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart 1994, S. 359–381. Vgl. dazu auch die Längsschnitt-Analyse der Zeitschrift ‚Brigitte‘: Feldmann-Neubert, Christine: Frauenleitbild im Wandel. Von der „Familienorientierung“ zur „Doppelrolle“, Weinheim 1991. Vgl.: Ruhl, Klaus-Jörg: Frauen in der Nachkriegszeit 1945–1963, München 1998; ders.: Verordnete Unterordnung. Berufstätige Frauen zwischen Wirtschaftswachstum und konservativer Ideologie in der Nachkriegszeit (1945–1963), München 1994 und Sachse, Carola: Der Hausarbeitstag. Gerechtigkeit und Gleichberechtigung in Ost und West 1939–1994, Göttingen 2002. Vgl.: Bouillot/Schüller: Schwamm; Bouillot: Osten; Möding, Nori: Die Stunde der Frauen? Frauen und Frauenorganisationen des bürgerlichen Lagers, in: Broszat, Martin/Henke, Klaus-Dietmar und Woller, Hans (Hrsg.): Von Stalingrad zur Währungsreform. Zur Sozialgeschichte des Umbruchs in Deutschland, 3. Aufl., München 1990, S. 619–647 sowie Pawlowski, Rita: Der demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD), in: Genth, Renate (Hrsg.): Frauenpolitik und politisches Wirken von Frauen im Berlin der Nachkriegszeit 1945–1949, Berlin 1996, S. 75–104. Vgl.: Feldmann-Neubert: Frauenleitbild sowie Lott, Sylvia: Die Frauenzeitschriften von Hans Huffzky und John Jahr. Zur Geschichte der deutschen Frauenzeitschrift zwischen 1933 und 1970, Berlin 1984. Vgl.: Tscharntke: Re-educating sowie Ziegler: Lernziel. Vgl.: Koszyk, Kurt: Presse unter alliierter Besatzung, in: Wilke, Jürgen (Hrsg.): Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999, S. 31–58. Siehe dazu auch Kapitel 1.7.3 dieser Arbeit.
Einführung | 45
zuweilen auch der Slawen, gegenüber. Zentral für diese Gegenüberstellung ‚Ost‘ gegen ‚West‘ sind die in der Zeitschrift umrissenen Diskurse um ‚Weiblichkeit‘ und ‚Mütterlichkeit‘. Hierüber wird greifbar, wie sich die von Bähnisch und ihren Mitstreiterinnen vertretene Forderung, Frauen sollten durch ihre ‚Weiblichkeit‘ auf jeweils individuelle Weise der ‚Versachlichung, Technisierung, Entseelung und Vermassung‘ der modernen Welt entgegenwirken, gegen die kommunistische Lehre verwenden ließ. Denn jene postulierte – so suggeriert die Zeitschrift grob vereinfacht – als eine wissenschafts- und technikorientierte die Gleichheit der Geschlechter, rief die Frauen in die Fabriken, wollte die wirtschaftliche Sicherung der Bürger nicht durch privat organisierte Fürsorge ‚von Mensch zu Mensch‘, sondern durch staatliche Garantien gewährleistet sehen und propagierte das ‚Kollektiv‘ gegenüber der von Bähnisch verteidigten ‚Freiheit des Individuums‘. Dessen ökonomische Unabhängigkeit und Sicherheit sollte, so legt es die Zeitschrift nah – der Pakt mit den USA gewährleisten. Von einer kulturellen Orientierung an den Vereinigten Staaten wird hingegen eher abgeraten. Es zeigte sich, daß in der Zeitschrift insgesamt stärker für den ‚Westen‘ als gegen den ‚Osten‘ Partei ergriffen wird und daß dies nicht zuletzt über die positive Darstellung westeuropäischer Gesellschaften – im Sinne von möglichen Referenzsystemen – stattfindet. Außerdem fällt eine ausgeprägte Wiederaufbaurhetorik in der ‚Stimme der Frau‘ auf. Die Zeitschrift beschwört ihre Leser zum einen, im Sinne einer ‚deutschen Schicksalsgemeinschaft‘ zusammenzuhalten. Zum anderen ruft sie sie zu einer besonderen Solidarität mit Frauen auch in anderen Ländern auf und wirbt – mit beinahe erstaunlich visionärer Gabe – für das, was man Jahre später die ‚Europäische Integration‘ nennen sollte. Während die Zeitschrift auf die militärische und ökonomische Protektion des deutschen Wiederaufbaus durch die USA setzt, wird die Staatengemeinschaft kulturell als negativ dargestellt – folgt man Axel Schildt, war dies eine in bildungsbürgerlichen Kreisen zu jener Zeit sehr verbreitete Haltung.113 Die Darstellung des ‚Ostens‘ in der Zeitschrift als glaubensfern, unempathisch, nicht selten gar als grausam, vollzieht sich auch über den Fokus auf die ‚deutsche Schicksalsgemeinschaft‘ aus Kriegsgefangenen, Spätheimkehrern, Flüchtlingen und Vertriebenen, Kriegerwitwen und Waisenkindern. Deren Leid wird nicht etwa als Folge deutschen Großmachtstrebens dargestellt, sondern mit dem als ‚unmenschlich‘ charakterisierten Verhalten der Russen auch nach Einstellung der Kriegshandlungen begründet. Das Leiden von Opfern der nationalsozialistischen Politik wird hingegen konsequent beschwiegen – eine zu jener Zeit verbreitete Tendenz114. Der Teil-Diskurs um ‚Weiblichkeit in westlicher Prägung‘ in der ‚Stimme der Frau‘ transportiert die Vorstellung, daß Frauen, wenn sie berufstätig sind, ‚schicke Stenotypistinnen‘ und eben nicht ‚tüchtige Traktoristinnen‘ (Gunilla-Friederike Budde) sein sollten. Dieser Diskurs prägt als Leitmotiv die Zeitschriftenberichterstattung und nimmt als ein hochgradig popularisierbares Konstrukt die Funktion eines Bildraums (Peter Link) ein, der zwischen verschiedenen Diskursen aus den Feldern Politik, Wirtschaft und Kultur vermittelt. ‚Weiblichkeit‘ wird dabei nicht nur als kom-
113 Vgl.: Schildt: Zeiten, S. 414. 114 Siehe Kapitel 5.4.3.
46 | Theanolte Bähnisch
plementär zu ‚Männlichkeit‘, sondern auch als mit dem Kommunismus unvereinbar dargestellt. Denn dieser, so suggeriert die ‚Stimme der Frau‘, nötigt Frauen zum Dienst an der Waffe, zu ‚verrohenden Männerarbeiten‘ und zur Abkehr vom christlichen Glauben. Der Forderung nach rechtlicher Gleichberechtigung für Frauen in Ehe, Familie, Beruf und Politik, auch dem allgemeinen Plädoyer für die Berufstätigkeit von Frauen, welches die ersten Ausgaben der Zeitschrift prägt, steht – durch die Brille der Gegenwart betrachtet – in der Zeitschrift die Tradierung herkömmlicher Charakterzuschreibungen der Geschlechter und ein prinzipielles Festhalten am Konzept der Ernährer-Zuverdienerinnen-Ehe entgegen. Mütter sollten, so suggeriert die Zeitschrift, nicht berufstätig sein. In einem Atemzug wird im Blatt ‚gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘ gefordert und das Leben der voll berufstätigen, alleinstehenden Frau als trostlos gezeichnet. Dem wird die offenbar naturgegebene Sehnsucht aller Frauen nach häuslicher Wärme im Kreise einer Familie gegenübergestellt. Ein solches Glück scheint, so der Eindruck des Gesamtbildes vor allem späterer Ausgaben der Zeitschrift, durch die Annehmlichkeiten, welche die moderne Haushaltsindustrie bietet, komplettiert und durch die Produkte der Mode- und Kosmetikindustrie gekrönt zu werden. Was im ersten Heft der ‚Stimme der Frau‘ zu lesen ist, nämlich, daß das ‚Mondäne‘ für lange Zeit verschwunden sei, scheint 1953 völlig überholt zu sein. Die Zeitschrift verändert ihren Charakter jedoch schon deutlich früher: Bereits nach einigen wenigen Ausgaben werden Artikel zu Politik, Wirtschaft, Kultur immer seltener und kürzer, der Hochglanz- und Werbeanteil steigt dagegen bis zum Ende des Untersuchungszeitraums immer weiter an.
1.4 VOM ‚WESTERNISIERUNGS-ANSATZ‘ ZUM BIOGRAPHISCHEN ZUGANG Die genannten Studien Anselm Doering-Manteuffels, Frank Trommlers und Detlef Junkers sowie Axel Schildts sind für mich vor allem deshalb richtungsweisend, weil sie nicht auf die ökonomische, militärische und politische Integration Westdeutschlands in europäisch-transatlantische Bündnisse fokussieren, sondern stärker kulturelle, mentalitätsgeschichtliche Aspekte der Anbindung an den ‚Westen‘ erforschen. Von den Autoren wird diese Anbindung/Orientierung als ‚Amerikanisierung‘ (Junker, Trommler) beziehungsweise ‚Westernisierung‘ (Doering-Manteuffel, Angster) bezeichnet. Ich folge den genannten Autoren in der Überzeugung, daß der Kalte Krieg vor allem auch ein ‚Kampf um Deutungsmacht‘ und ein ‚Krieg der Worte‘ war – zumal sich dies auch in der ‚Stimme der Frau‘ niederschlägt. Dies wiederum zeigt, daß Theanolte Bähnisch Anteil an jenem ‚Kampf um Deutungsmacht‘ hatte und lädt dazu ein, zu prüfen, inwiefern dies auch ihre Wirkungsgebiete jenseits der ‚Stimme der Frau‘ betrifft. Ein gern gewähltes Beispiel für die Rolle des ‚Westens‘ im ideologischen Kampf zwischen ‚Ost‘ und ‚West‘ ist der vom CIA finanzierte ‚Congreß of Cultural Free-
Einführung | 47
dom‘ (CCF).115 Unter dem Schlagwort ‚Freiheit‘ – dem Begriff, der im Kalten Krieg zum Synonym für die westliche Welt116 avancierte und gleichzeitig anprangern sollte, was das kommunistische System eben nicht verkörpere – organisierte der CCF Kongresse und vertrieb Bücher und Zeitschriften. Über den US-amerikanischen Publizisten Melvin Lasky gab er die in Deutschland in intellektuellen Kreisen vielgelesene kulturpolitische Zeitschrift ‚Der Monat‘117 heraus. Die ‚Produkte‘ des CCF sollten die Menschenfeindlichkeit, die kulturelle Beschränktheit sowie den ‚totalitären‘ Herrschaftsanspruch des kommunistischen Systems verdeutlichen und diesen Mißständen den kulturellen Reichtum und die Vorteile des auf dem Prinzip der ‚Freiheit‘ und der ‚Rechtsstaatlichkeit‘ basierenden politischen und kulturellen Systems der USA gegenüberstellen.118 Der CCF unterhielt ganze 170 Stiftungen, um den Geldgeber CIA bei seiner kulturpolitischen Arbeit nicht sichtbar werden zu lassen. Seine Arbeit war jedoch nicht darauf ausgerichtet, ein breites Publikum anzusprechen, sondern konzentrierte sich auf kleinere Kreise von Wissenschaftlern, Künstlern, Schriftstellern und Politikern – also auf die ‚Chefdenker‘ der im Entstehen begriffenen Republik, die als Multiplikatoren wirken konnten.119 Theanolte Bähnisch stand nachweislich in engerem Kontakt zu mehreren Personen, die dem CCF als Multiplikatoren und Mitorganisatoren zuarbeiteten.120
115 Sowohl Schildt, als auch Doering-Manteuffel gehen auf den CCF ein. Eine ausführliche Studie über den Congreß liegt ebenfalls vor. Vgl.: Hochgeschwender, Michael: Freiheit in der Offensive? Der Kongreß für kulturelle Freiheit und die Deutschen, München 1998. 116 So ein Symbol war beispielsweise die Berliner Zeitung ‚Der Telegraf‘, welcher – so die Expertin Susanne Grebner – „als Gegenpol zur sowjetischen Herrschaft“ betrachtet wurde. „Während der Blockade trug er hauptsächlich zur moralischen Unterstützung der Bevölkerung bei und rief zum Widerstand gegen die sowjetischen Besatzer auf, was damals gleichbedeutend mit dem Einsatz für die Freiheit war.“ Grebner, Susanne: Der Telegraf. Entstehung einer SPD-nahen Lizenzzeitung in Berlin 1946 bis 1950, Münster 2002, S. 9. Im Westen Berlins wurde die ‚Freie Universität Berlin‘ als Gegenpol zur HumboldtUniversität im Ostsektor gegründet und der Nordwestdeutsche Rundfunk in ‚Sender Freies Berlin‘ (SFB) umbenannt. Vgl.: Ebd. Klaus Körner nennt als weiteres Beispiel die ‚Freie Volksbühne‘ und weist darauf hin, daß der DGB das Leben in den USA als „Leben in Freiheit“ bewarb. Vgl.: Körner.: Gefahr, S. 115. 117 Hochgeschwender widmet dem ‚Monat‘ als „Instrument der Re-orientation“ ein ganzes Kapitel: Hochgeschwender: Freiheit, S. 182–198. 118 Die amerikanische Propagandaoffensive, die auch von den amerikanischen Gewerkschaften unterstützt wurde, nachdem die Politik des ‚New Deal‘ sie mit der Regierung versöhnt hatte, ist als Antwort auf die ‚Friedenskongresse‘ der kommunistischen Parteien ab 1947 zu verstehen. Die Kommunisten nutzten den großen Zulauf zu den Kongressen in Ost- und Westeuropa sowie in den USA, um vor den Gefahren durch die ‚imperialen Strategien‘ der USA zu warnen. 119 Hochgeschwender: Freiheit, S. 231. 120 Zu diesen Personen zählten Adolf Grimme, Eugen Kogon und Carlo Schmidt. Vgl.: ebd., S. 656–677. Adolf Grimme gehörte sogar zum deutschen Organisationskomitee des ersten CCF-Kongresses in Deutschland. Vgl.: Hochgeschwender: Freiheit, S. 224.
48 | Theanolte Bähnisch
Die Einflussnahmeder Westalliierten auf deutsche Politiker, Verbände etc. – über Institutionen wie den CCF, aber auch auf direkteren, transparenteren Wegen wie Austauschprogrammen und kulturellen Einrichtungen der Besatzungsländer – unterstützte die ohnehin starken antikommunistischen Tendenzen von westdeutschen/bundesdeutschen Parteien und Verbänden. Die in den Nachkriegsjahren immer stärker werdende Ausrichtung der westdeutschen Politik auf die Bekämpfung kommunistischer Tendenzen wird von verschiedenen Autoren gar als Basis-121 oder Legitimationsideologie122 der Bundesrepublik bezeichnet. Der renommierte Historiker Christoph Kleßmann, der sich sehr verdient darum gemacht hat, daß deutsch-deutsche Geschichte heutzutage kaum noch als Parallelgeschichte, sondern viel stärker als Interaktionsgeschichte erforscht und dargestellt wird, schreibt über die Formen, welche die antikommunistische Agitation in der BRD annahm: „Insgesamt ging der Antikommunismus [...] über die legitime Abwehr kommunistischer Machtansprüche hinaus, er verselbständigte sich zur Weltanschauung und zu einem sozialen Disziplinierungsmittel von beträchtlicher gesellschaftlicher Bedeutung.“123 Insbesondere die Allgegenwärtigkeit des Kalten Krieges in Büchern und Zeitschriften, im Film und im Fernsehen, aber auch in Straßennamen, kurzum: im alltäglichen Sprachgebrauch124 wurde im Einzelfall in ihrer Wirkmacht kaum noch wahrgenommen. Deshalb ist eine Erforschung der Geschichte des Kalten Krieges in Deutschland und der deutschen Westbindung auch als Aspekt der Kulturgeschichte125 besonders spannend. Meine Dissertation soll jedoch nicht so stark auf den Aspekt der ‚Westernisierung‘ fokussieren, sondern, in Anbetracht der begrenzten Erklärungskraft der bei der Analyse der ‚Stimme der Frau‘ verfolgten Ansätze für das ‚Gesamtphänomen Bähnisch‘ neue Schwerpunkte setzen. Nach Anselm Doering-Manteuffel beschreibt
121 Vgl. beispielsweise: Körner: Gefahr, Buchrücken. 1962 beschloß die Kultusministerkonferenz die Sichtweise der Verwandtschaft von Nationalsozialismus und Bolschewismus als Totalitarismen in die Richtlinien für die Behandlung im Unterricht aufzunehmen. Im entsprechenden Dokument heißt es zum Bolschewismus unter anderem: „Im Unterricht über den Bolschewismus ist dem Schüler der weltweite Anspruch und die damit verbundene Gefahr für die Menschheit zu zeigen.“ Dieser und andere Auszüge aus dem Dokument finden sich in: Pasierbsky, Fritz: Krieg und Frieden in der Sprache, Frankfurt a. M. 1983, Zitat S. 101. 122 Vgl. beispielsweise: Kleßmann: Staatsgründung, S. 257. 123 Ebd. 124 Vgl. dazu: Grebner: Telegraf, passim. 125 Im Unterschied zur Sozialgeschichte, die eher ‚greifbare‘ Verhältnisse und Situationen erforscht, läßt sich Kulturgeschichte als ‚Geschichte von Mentalitäten‘ beschreiben. Eine einheitliche Definition von ‚Kulturgeschichte‘ gibt es jedoch nicht und eine starre Abgrenzung von ‚Kulturgeschichte‘ zum Spektrum verwandter Forschungsansätze, welche Lamprechts Anregung folgen, Geschichte nicht vom Staat, sondern von der Gesellschaft her zu denken, ist ohnehin nicht sinnvoll. Vgl. dazu: Flemming, Jens: Kulturgeschichte als Integrations- und Leitwissenschaft? Anmerkungen zu Verlauf und Ergebnissen einer deutschen Diskussion, in: Sturma, Dieter(Hrsg.): Kultur und Kulturwissenschaft, Lüneburg 1991, S. 8–23.
Einführung | 49
‚Westernisierung‘ die „konsequente Beeinflussung der westdeutschen publizistischen und akademischen Öffentlichkeit mit dem Ziel einer kritischen Reversion der deutschen Wendung gegen den westlichen Liberalismus, wie sie im Ersten Weltkrieg vollzogen worden war“126 und „den nahezu simultan verlaufenen Prozess der politisch-ideellen Sozialliberalisierung sozialistischer oder sozialdemokratischer Parteien und Gewerkschaften während des Kalten Kriegs“127, mitsamt „dem Ziel, in der ideellen Neuordnung der Gesellschaft nach dem Faschismus nun den Kommunismus zu bekämpfen und die sozialistischen Parteien für die politisch und wirtschaftlich liberale Ordnung des euro-atlantischen Westens einzunehmen.“128 Theanolte Bähnisch, war, wie sich zeigen wird, an beiden von Doering-Manteuffel beschriebenen Phänomenen beteiligt. Die Dynamiken, die zu jenem Wirken Bähnischs führten, lassen sich jedoch mit dem Westernisierungskonzept – wie es in der Regel angewendet wird – allein nicht erklären. Zwar verweist Doering-Manteuffel darauf, daß der Westernisierungsbegriff nicht nur „regionalgeschichtlich – auf konkret eingrenzbare, präzise rekonstruierbare Entwicklungen zwischen 1945 und 1970“ angewendet wird, sondern daß er auch „globalgeschichtlich – auf ideelle Transformationsprozesse seit 1900 bezogen“ Verwendung findet.129 Dies ist jedoch nur selten der Fall. Viele Studien, die dem Westernisierungs-Konzept folgen, ordnen vorschnell und einseitig Entwicklungen in Westdeutschland nach 1945 der allgemeinen ‚Westernsierung‘ zu. Sie berücksichtigen nicht, daß einige der beschriebenen Tendenzen – vor allem die liberalen Strömungen innerhalb der sozialdemokratischen Partei, welche mit der sozialen Orientierung einiger Anhänger liberaler Parteien eine Schnittmenge bildeten – bereits in der Weimarer Republik, beziehungsweise schon im Kaiserreich eingesetzt hatten. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und argumentieren, daß diese Tendenzen in Form der verschiedenen Flügel der Parteien und/oder Bewegungen von Beginn an existent waren. Entsprechende Prägungen vor allem der reformorientierten preußischen Eliten lassen sich auf den großen Einfluß des von Theanolte Bähnisch verehrten130 sozialliberalen Politikers und Theologen Friedrich Naumann zurückführen. Dieser hatte, wie bereits angerissen, im ausgehenden Kaiserreich die Hoffnung geäußert, das zerklüftete Volk durch einen Zusammenschluß reformorientierter Kräfte „von Bebel bis Bassermann“ auf der Basis des Christentums einen zu können.131 Anhänger jener Überzeugungen aus verschiedenen Lagern ermöglichten das Zustandekommen der Großen Weimarer Koalitionen sowie der preußischen Koa-
126 127 128 129
Doering-Manteuffel: Amerikanisierung, 1999, S. 7. Ebd. Ebd., S. 8 Doering-Manteuffel verweist auf: Laue, Theodore, von: The World Revolution of Westernization. The Twentieth Century in Global Perspective, New York/Oxford 1987 sowie auf Latouche, Serge: The Westernization of the World. The Significance, Scope and Limitis of the Drive towards Global Uniformity, Cambridge 1996. Vgl.: DoeringManteuffel: Amerikanisierung, 1999, S. 7. 130 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. 131 Naumann, Friedrich: Bassermann und Bebel, in: Berliner Tageblatt, Nr. 503, Morgenausgabe, 04.10.1910. Vgl. auch: Theiner: Liberalismus, S. 194–217.
50 | Theanolte Bähnisch
litionsregierungen, die als Zusammenschluss zwischen DDP, SPD und Zentrum von 1919 bis 1921 und von 1925 bis 1932 regierten – also auch in jener Zeit, in der Theanolte Bähnisch im Berliner Polizeipräsidium arbeitete. Dieses wiederum stand in engem Austausch mit dem preußischen Innenministerium. Die Effekte jener parteiübergreifenden Zusammenarbeit reformorientierter Eliten fanden ihren Niederschlag nicht nur in den im Hauptteil meiner Arbeit näher ausgeführten staatlichen Reformen, sondern auch in darüberhinausgehenden gesellschaftlichen Reformprojekten, deren Behandlung ich an dieser Stelle ebenfalls nicht vorgreifen möchte. 1945 traten einige jener Eliten, die, wie Bähnisch, im ‚Klima‘ der Koalitionsregierungen sozialisiert worden waren und dementsprechend für die parteiübergreifende Zusammenarbeit besonders offen waren, an, um ihre ‚zweite Chance‘ zu nutzen und ihre Arbeit dort fortzusetzen, wo sie 1932/33 aufzuhören gezwungen waren. Dabei erhielten sie Unterstützung durch die Westalliierten. Vor allem die britische Labour-Regierung förderte, sehr zum Leidwesen vieler Sozialdemokraten, nicht vorrangig die ‚Schwesterpartei‘ SPD. Je mehr sich der Kalte Krieg zuspitze, desto stärker setzten die Briten auf die Etablierung einer pluralen Demokratie unter Ausschluß der Kommunisten, also auf die Zusammenarbeit möglichst vieler gemäßigter Parteien und somit auf die Integration möglichst vieler Bürger in den neuen Staat. Als etwas Neues und als eine Tendenz der ‚Westernisierung‘ mag in der Retrospektive auch das Verhalten von deutschen Eliten, die bereits in der Weimarer Republik aktiv waren, in den Nachkriegsjahren auf internationale Kooperationen zur Durchsetzung ihrer Ziele zu setzen, erscheinen.132 Neu war dieser internationale Austausch in der zweiten deutschen Nachkriegszeit jedoch weder für die ehemals führenden Köpfe und ‚Zöglinge‘ der preußischen Verwaltung, die 1945 ihre ‚zweite Chance‘ ergriffen, noch für jene Protagonisten des Wiederaufbaus ab 1945 die bis 1933 in der bürgerlichen Sozialreformbewegung und/oder im Bildungsbereich organisiert waren. Keine Neuheit, sondern vielmehr eine Tradition, deren Fortsetzung die betreffenden Personen nach zwölf Jahren NS-Diktatur herbeisehnten, bedeutete die internationale Kooperation in der konstituierenden Phase der BRD für führende Protagonistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung. Denn diese war vor 1933 sogar organisatorisch in die internationale Frauenbewegung eingebunden – woran die britische Militärregierung 1945 anknüpfte, beziehungsweise anknüpfen ließ. Die genannten Kreise aus Verwaltung, Erwachsenenbildung und Sozialreform sowie der Frauenbewegung wiesen starke Schnittmengen auf und waren – nicht zuletzt deshalb – für Bähnischs Biographie und Nachkriegskarriere von zentraler Relevanz. Daß Personen wie Bähnisch 1945 nur teilweise neue Wege einschlugen, zum Teil aber auch reformpolitische Traditionen, nach denen sie bereits in der Weimarer Republik gehandelt hatten oder von denen sie beeinflußt worden waren, wiederaufleben ließen, zeigt sich, wenn man die Biographien der betreffenden Akteure systematisch in den Blick nimmt wie es der Historiker Volker Depkat tut. Er analysiert Autobiographien deutscher Politiker, welche um 1880 geboren wurden, darunter auch Vorgesetzte, Vertraute und Unterstützer Bähnischs. Er kommt zu dem Ergebnis, daß das
132 Vgl.: Schüler, Anja: Frauenbewegung und soziale Reform. Jane Addams und Alice Salomon im transatlantischen Dialog, 1889–1933, Stuttgart 2004.
Einführung | 51
Jahr 1945 für diese Personen jeweils einen tiefgreifenden Einschnitt markierte und als „Zeitenwende“133, welche eine neue Chance bereithielt, empfunden und genutzt wurde. Depkat plädiert auf der Basis seiner Ergebnisse für eine stärkere Berücksichtigung der Biographien solcher Eliten bei der Erforschung deutscher Nachkriegsgeschichte und dafür „die Nachkriegsentwicklungen in der BRD und der DDR nicht allein als Ergebnis von Amerikanisierungs- und Sowjetisierungsanstrengungen sowie als Ergebnis der äußeren Zwänge des Kalten Krieges“134 zu verstehen. Schließlich hätten jene Entwicklungen, so Depkat, „auch in den Lern- und Umorientierungsprozessen deutscher politischer Eliten, die das gesamte Katastrophenzeitalter des 20. Jahrhunderts biographisch durchmaßen“135, gegründet. Die Zeit von 1933 bis 1945 sei von den von ihm untersuchten Eliten, wenn auch teilweise erst mit Abstand zu jener Zeit, als ein erratischer Block wahrgenommen worden.136 Inwiefern tatsächlich ‚Lernprozesse‘ ausschlaggebend für das Verhalten jener Eliten waren oder ob nicht in einigen Fällen vielmehr ‚Bestätigungsprozesse‘ ihren Lauf nahmen, sei dahingestellt. Auf diesen und andere Aspekte im Vorgehen und in der Argumentation Depkats wird an anderer Stelle zurückzukommen sein. Als einer der besonderen Verdienste des Historikers ist jedenfalls zu bewerten, daß er auch Autobiographien solcher Politiker untersuchte, die sich nach 1945 für ein Leben in der DDR entschieden. Er analysiert deren Erinnerungen in dieser Hinsicht unvoreingenommen und zeigt damit, daß die Wahrnehmung des Dritten Reichs als ‚Fehler‘ durchaus zu verschiedenen, nachvollziehbar begründeten Wegen für die Zeit nach 1945 führen konnte. Ich möchte, vor dem Hintergrund der Tatsache, daß sich Bähnischs Wirken in den Jahren ab 1945 nicht allein aus dem Kontext jener Zeit überzeugend erklären läßt, Depkats Überzeugung folgen, daß eine zu starke Konzentration auf ‚Westernisierungsprozesse‘ bei der Erforschung von Nachkriegsgeschichte den Blick auf die sehr komplexen Zusammenhänge im westdeutschen Wiederaufbau verstellt und daß es ein fruchtbares Unterfangen ist, den Focus auch auf die Biographien jener Akteure zu richten, die sowohl in der Weimarer Republik, als auch in der zweiten deutschen Demokratie wichtige Rollen übernahmen. Die Historikerin und Schülerin DoeringManteuffels, Prof. Dr. Julia Angster bestätigt in ihrer Dissertation ‚Konsenskapitalismus und Sozialdemokratie‘ die Thesen Doering-Manteuffels zwar prinzipiell, läßt aber ihre eigene Untersuchung schon um 1900 beginnen.137 Der ‚rechte Flügel‘ der SPD und der Gewerkschaften – so Angster sinngemäß im Jahr 2011 – habe sich schließlich 1945 nicht neu erfunden, sondern zu dieser Zeit an Traditionen der Liberalisierung in der Partei und der Gewerkschaft angeknüpft, welche sich bereits in der Weimarer Reichsverfassung und der großen Weimarer Koalition manifestiert hat-
133 Depkat, Volker. Lebenswenden und Zeitenwenden. Deutsche Politiker und die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, München 2007, S. 518. 134 Ebd. 135 Ebd. 136 Vgl.: ebd., S. 189. 137 Vgl. auch die Dissertation: Angster, Julia: Konsenskapitalismus und Sozialdemokratie. Die Westernisierung von SPD und DGB, München 2003.
52 | Theanolte Bähnisch
ten.138 Dieses Vorgehen einer ausgewiesenen Expertin auf dem Gebiet der ‚Westernisierungsforschung‘ bestärkt mich darin, in meiner Arbeit einen Zwischenweg zwischen der Berücksichtigung zweifellos starker ‚Westernisierungstendenzen‘ nach 1945 und der Erforschung der Biographie Bähnischs zu gehen. Die Netzwerke, in denen sich die Juristin vor und nach 1945 bewegte, unterstreichen die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens: Zum ‚rechten Flügel‘ der SPD, der auf eine breitenwirksam akzeptierte Reformpolitik anstelle von ‚revolutionären‘ Veränderungen setzte und durch seinen Kooperationswillen mit anderen Parteien auffiel, gehörte nämlich nicht nur der ‚Chef‘ Bähnischs ab 1946, Hinrich Wilhelm Kopf. Dieser konnte als niedersächsischer Ministerpräsident bei seinem Tod 1961 auf eine lange Amtszeit (mit einer Unterbrechung zwischen 1957 und 1959) an der Spitze von Vielparteienkabinetten mit einem auffällig breiten politischen Spektrum zurückblicken. Auch einer der entschiedensten und mächtigsten Förderer der Verwaltungsjuristin Bähnisch vor 1945, der bereits erwähnte preußische Innenminister und zeitweilige Reichsinnenminister Carl Severing (SPD, MSPD), der in Preußen Teil verschiedener Koalitionen war, ist diesem politischen Lager zuzuordnen. Severing war 1914 ein vehementer Befürworter der Burgfriedenspolitik gewesen, welche die SPD von dem Vorwurf, daß sie ‚vaterlandslose Gesellen‘ seien, befreien sollte. Nicht zuletzt auf sein Betreiben ist es zurückzuführen, daß sich auch das Sammelbecken katholischer Wähler, die Zentrumspartei, an der ersten Weimarer Koalitionsregierung beteiligte.139 Weiter ist zu berücksichtigen, daß Theanolte Bähnisch gerade zu jener Zeit an ihrer juristischen Karriere feilte, als das ‚System Severing‘ dafür sorgte, daß ein Austausch politischer Beamter stattfand, welcher darauf abzielte, Monarchisten nicht nur durch Sozialdemokraten, sondern auch durch Vertreter anderer demokratischer Parteien zu ersetzen. Diese Politik wurde unter Severings Nachfolger, dem Innenminister Albert Grzesinski, der zuvor Bähnischs Chef im Polizeipräsidium gewesen war, noch verstärkt.140 Auch der Vorgesetzte und selbsterklärte Ziehvater Bähnischs, Ferdinand Friedensburg (DDP, CDU)141, hatte in den 1920er Jahren – als er zunächst Vizepolizeipräsident in Berlin und dann Regierungspräsident in Kassel war – in seiner Politik auf eine Sammlung bürgerlicher Parteien gesetzt. 1945 knüpfte er – unter anderem gemeinsam mit Bähnisch in der Europabewegung – an diese Politik an.142 In den 1960er Jahren sondierte Theanolte Bähnisch schließlich gemeinsam mit den weiter rechts stehenden SPD-Politikern Herbert Wehner und Fritz Erler die Möglichkeiten
138 Gespräch mit Prof. Julia Angster am 27.06.2011 an der Universität Kassel. Vgl. auch die o.g. Dissertation. 139 Vgl.: Alexander, Thomas: Carl Severing. Sozialdemokrat aus Westfalen mit preussischen Tugenden, Bielefeld 1992, S. 29 sowie Koszyk, Kurt: Carl Severing, in: Westfälische Lebensbilder, Band XI, Münster 1975, S. 172–201, hier S. 186. 140 Siehe Kapitel 3.3.5. 141 BArch, N 1114, Nr. 27, Ferdinand Friedensburg an Theanolte Bähnisch, 23.04.1946. 142 Vgl.: Depkat, Volker: Entwürfe politischer Bürgerlichkeit und die Krisensignatur des 20. Jahrhunderts, in: Budde, Gunilla-Friederike/Conze, Eckhardt/Rauh, Cornelia (Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter. Leitbilder und Praxis seit 1945, Göttingen 2010, S. 101–116, hier S. 109/110.
Einführung | 53
einer Großen Koalition unter Willy Brandt143, was darauf hindeutet, daß ihre politische Einstellung über Jahrzehnte recht stabil geblieben ist.
1.5 ZIEL DER ARBEIT, ZENTRALE THESEN, EINGRENZUNG DES GEGENSTANDS Das Ziel meiner Auseinandersetzung mit Theanolte Bähnisch ist es, zu zeigen, daß die heutzutage kaum bekannte Persönlichkeit der Zeitgeschichte im Wiederaufbau und in der Westbindung Westdeutschlands zwischen 1946 und 1952 eine kaum zu überschätzende Rolle gespielt hat. Ich möchte darlegen, daß dafür vor allem auch ihre Sozialisation bis 1945, ihre Fähigkeit, sich selbst zu darzustellen und der Wille inund ausländischer Eliten, die auf eine Westbindung Deutschlands hinarbeiteten, Bähnisch zu unterstützen, ausschlaggebend waren. In Zusammenarbeit mit mehrheitlich demokratisch gesinnten Eliten aus verschiedenen politischen Lagern, aus der Verwaltung, der Pädagogik und der Frauenbewegung, die Bähnisch teilweise bereits seit den 1920er Jahren kannten, sowie mit Unterstützung der britischen Militärregierung und der britischen Frauenbewegung, knüpfte sie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an parteiübergreifende Initiativen zur Reform von Staat und Gesellschaft an, die ihre Wurzeln teils in der Weimarer Republik, teils im Kaiserreich hatten. Dabei kontinuierte und modifizierte sie Diskurse und Strukturen, die sich in jenen Zusammenhängen etabliert hatten, auf eine Art, die der Westbindung und -integration Westdeutschlands förderlich sein sollte. Dies bedeutete für sie auch, den Kommunismus als unvereinbar mit den von ihr als ‚westlich‘ definierten, christlichen, humanistischen und liberalen Traditionen der bürgerlichen Frauenbewegung sowie mit ‚Weiblichkeit‘ an sich erscheinen zu lassen. Der Negativ-Formel ‚Kommunismus‘ setzte die Regierungspräsidentin ein vereintes Europa als zu erreichendes Ziel entgegen, nicht zuletzt, weil sie hoffte, ihr im Ausland diskreditiertes Heimatland könne sich mit Hilfe von ‚Europa‘ wieder zu einer wohlhabenden und geachteten Kulturnation entwickeln. Die Erwartung, sie möge zentrale Funktionen in der Nachkriegsgesellschaft übernehmen, wurde aus verschiedenen Kreisen, deren Interessen teilweise stark differierten, an sie herangetragen. Auch ihre Kontrahenten begriffen ihren Einfluß als weitreichend. Für die Unterstützer wie für die Gegner der Juristin waren in der Auseinandersetzung mit Bähnisch vor allem drei Aspekte handlungsleitend: 1. Ihre in der Zeit des Umbruchs proklamierten und gelebten Ziele, Frauen ‚staatsbürgerlich‘ zu bilden, einen parteiübergreifenden Konsens für einen stärkeren Einfluß von Frauen in der Gesellschaft und für die Abwehr des Kommunismus zu erreichen, Staat und Gesellschaft (wieder) aufzubauen und dafür Sorge zu tragen, daß sich das Land dabei zu einem gleichberechtigten Staat an der Seite anderer, ‚westlicher‘ Nationen etabliere. Vor allem Vertreter der Britischen Militärregierung gingen davon aus, daß Bähnisch auf die deutsche Gesellschaft im Wiederaufbau integrativ
143 AdSD, Nachlaß Fritz Erler, Nr. 217 A, Bähnisch an Erler, 31.08.1966.
54 | Theanolte Bähnisch
wirken144, dabei als zukunftsträchtig bewertete deutsche Traditionen wieder zum Leben erwecken könne und durch ihre Unternehmungen Multiplikatoren-Effekte freisetzen würde. 2. Die Fähigkeit der Juristin, ihr ‚unternehmerisches Selbst‘ (Bröckling) in einer Art zu vermarkten, wie es den politischen und gesellschaftlichen Konstellationen in der zweiten deutschen Nachkriegszeit aus ihrer Sicht zuträglich zu sein schien. 3. Die Bereitschaft verschiedener einflußreicher Eliten im In- und Ausland, sie zu fördern und/oder sie in ihre ‚Erinnerungskartelle‘ (Schaser) und ‚Deutungsgemeinschaften‘ (Depkat) zu integrieren. Ein weiteres Ziel meiner Arbeit leitet sich aus dem Umstand ab, daß Bähnischs Wirken vor 1945 bisher noch kaum erforscht wurde und ihr Wirken ab 1933, wie beschrieben, bisher kaum Gegenstand objektiver Darstellungen geworden ist. Eine differenziertere Auseinandersetzung mit ihrer Person und ihren Rollen, den in sie gesetzten Erwartungen, den mit ihrer Person verbundenen Befürchtungen und den an ihr festgemachten Enttäuschungen ist deshalb notwendig. Neben ihrer Rolle im Wiederaufbau Deutschlands, in den internationalen Beziehungen des Landes und der Frauenbewegung sollen auch die tradierten Aussagen Bähnischs zu ihrem Engagement im Widerstand gegen den Nationalsozialismus einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. Was Bähnischs Wirken im Aufbau der Frauenbewegung angeht, so ist dem Umstand Rechnung zu tragen, daß die Geschichte des DFR bisher noch kaum erforscht ist. Mit dem Fokus auf die Präsidentin der Organisation sollen deshalb der Aufbau und zumindest ausschnitthaft auch die Arbeit des DFR und seiner Vorgängerorganisationen beleuchtet werden. Denn dem Aufbau dieser Organisationen widmete Bähnisch in jenen Jahren einen Großteil ihrer Energie. Ihre Biographie ist eng mit dem Aufbau des DFR verbunden, während der DFR wiederum wesentlich vom Einfluß seiner Präsidentin geprägt war. Im Zuge einer solchen Auseinandersetzung soll auch die von der Frauengeschichtsforschung der 1980er Jahre verbreitete Meinung, das Wirken der überparteilichen Frauenbewegung der Nachkriegszeit unter der Führung Theanolte Bähnischs sei eine ‚Emanzipationsbremse‘ gewesen, kritisch hinterfragt werden. Aufgrund der zentralen Rolle, welche die (interzonalen) Frauenkonferenzen zwischen 1946 und 1949 bei der Re-Organisation der bürgerlichen Frauenbewegung durch Theanolte Bähnisch in Deutschland spielten sowie der vergleichsweise guten und vielschichtigen Überlieferung zu jenem Thema sollen insbesondere jene FrauenKonferenzen ihre Vor- und Nachbereitung und ihre Wahrnehmungen und Bewertungen durch Zeitgenossen im Zentrum meiner diesbezüglichen Betrachtungen stehen. Es ist also nicht mein Ziel, mich mit dem Leben und Wirken Bähnischs in seiner Gänze auseinanderzusetzen, sondern ich möchte mich auf die erwähnten Aspekte und den Zeitraum 1899 bis 1952 konzentrieren. Der ‚formativen Phase‘ der Bonner Republik, also den Jahren 1945 bis 1952, wird, bedingt durch meine Thesen und meine Fragestellung, ebenso viel Raum zuteilwerden, als den Jahren 1899 bis 1945. Die
144 Darauf deutet die Bewertung Bähnischs im ‚Who is who in Lower Saxony‘, einem Handbuch der britischen Militärregierung für Niedersachsen hin. Vgl.: Röpcke: Saxony, S. 258.
Einführung | 55
zeitliche Beschränkung bis 1952 erklärt sich daraus, daß in diesem Jahr eine segmentäre Zäsur (Hans Peterr Schwarz) in der Geschichte Deutschlands mit einer einschneidenden Veränderung im Leben Bähnischs einhergeht: Die Grundsteine der als formative Phase der BRD beschriebenen Entwicklungen der 1950er Jahre – der Aufbau der parlamentarischen Demokratie, der sozialen Marktwirtschaft und der politischen Integration Westdeutschlands in westeuropäisch-transatlantische Bündnisse sowie die Vertiefung der soziokulturellen Westernisierung145 – wurden in der Besatzungszeit gelegt. Diese endete 1952 mit der Auflösung der Alliierten Hohen Kommission, der Unterzeichnung des Deutschland-Vertrages, welcher die Wiedererlangung einer teilweisen Souveränität für Westdeutschland bedeutete sowie dem EVGVertrag, der die Westbindung Westdeutschlands festschrieb.146 In das gleiche Jahr fällt auch die Ablehnung der Stalin-Noten. Darin äußerte sich, unabhängig davon, ob Stalins Vorschlag ein ernst zu nehmendes Angebot war oder nicht147, daß man in Westdeutschland, auch aufgrund des Korea-Krieges, nicht mehr daran glaubte, daß ein neutrales, vereintes Deutschland eine realpolitisch sinnvolle Alternative zur ökonomischen und militärischen Protektion durch die USA und Westeuropa sein könnte. Die Teilung Deutschlands akzeptierte man damit als das ‚kleinere Übel‘. Theanolte Bähnisch legte im gleichen Jahr ihr Amt als Vorsitzende des Deutschen Frauenrings nieder und beendete damit die Hochphase ihres Engagements in der deutschen Frauenbewegung. Das soll keinesfalls bedeuten, daß das Handeln Bähnischs nach dieser Zeit uninteressant oder irrelevant gewesen wäre. Doch die intensive Zusammenarbeit zwischen der britischen Militärregierung, Theanolte Bähnisch und der deutschen überparteilichen Frauenbewegung war zu jener Zeit beendet, die ‚Zusammenbruchgesellschaft‘ (Kleßmann) hatte sich stabilisiert, die Weichen ‚Richtung Westen‘ waren gestellt und die ‚Entscheidung für Europa‘ (Depkat/Graglia) war gefallen. Anders als in der Frauenbewegung gab es im Amt als Regierungspräsidentin zu jener Zeit keine solche Zäsur. Doch vor dem Hintergrund der geschilderten Zusammenhänge veränderte sich in jenem Zeitraum auch der Charakter von Bähnischs Arbeit in der Verwaltung eines Bundeslandes an der Grenze zur DDR, welches mit einem immensen Zustrom an Flüchtlingen aus den ‚Ostgebieten‘ konfrontiert gewesen war. Dieser Strom war 1952 abgeebbt. Das Lastenausgleichsgesetz war bereits verabschiedet, die Umsetzung des 1950 beschlossenen Emsland-Plans148, der auch zu einer Entlastung des Ballungsgebietes Hannover führen sollte, war 1951 auf den Weg
145 Vgl.: Recker, Marie-Luise: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, 3. Aufl., München 2009, S. 23. Der für die Erforschung der Kulturgeschichte jener Zeit ausgewiesene Historiker Axel Schildt läßt die „Gründerjahre der BRD“ 1957 enden und die ‚dynamischen Zeiten‘ 1957/58 einsetzen. Vgl.: Schildt, Axel/Siegfried, Detlef: Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik – 1945 bis zur Gegenwart, Bonn 2009. 146 Deshalb werden die beiden Verträge auch als ‚Westverträge‘ bezeichnet. 147 Zu den verschiedenen Positionen vgl.: Loth, Wilfried/Graml, Hermann/Wettig, Gerhard: Die Stalin-Note vom 10. März 1952: neue Quellen und Analysen, München 2002. 148 Der Emsland-Plan sah die Kultivierung des von Ödland und Moor geprägten Emslandes vor. Neue Dörfer und 1250 Neusiedlerhöfe sowie 5000 Nebenerwerbsstellen entstanden bis 1964. Vgl. dazu Hauptmeyer: Geschichte, S. 118.
56 | Theanolte Bähnisch
gebracht worden. Die Lage der Flüchtlinge und die Lage der Bevölkerung insgesamt hatten sich bereits spürbar verbessert, auch wenn noch immer viele Wohnungen fehlten. Um die Abwanderung ‚ihrer‘ Bevölkerung in die Bundesrepublik einzudämmen, hatte die DDR 1952 eine Grenzsperre eingerichtet. Die deutsche Wirtschaft hatte sich stabilisiert, in der niedersächsischen Landwirtschaft war 1952 sogar erstmals der Stand der Vorkriegsproduktion im Agrarsektor wieder erreicht worden.149 Die Konzentration meiner Arbeit auf die Jahre 1899 bis 1952 ist indes nicht sklavisch zu verstehen. Wo es für die Analyse hilfreich ist, greift die Argumentation über das Jahr 1952 hinaus, andere Aspekte der Untersuchung machen es notwendig, den Blick auf die Zeit vor 1899 zu richten. Im Aufbau meiner Arbeit wird – um die Orientierung zu erleichtern und dabei auch verschiedenen Lese(r)interessen gerecht zu werden – eine chronologische Darstellung mit einer thematischen verknüpft.
1.6 FRAGESTELLUNG Bürgerlichkeit und Rechtsstaatlichkeit, soziale Demokratie und christlicher Glaube, preußische Koalitionsregierungen und Verwaltung sowie die öffentlichkeitswirksame Berufsarbeit von Frauen, das sind die Termini, mit denen sich die Bildungs- und Berufsrealität der Verwaltungsjuristin Theanolte Bähnisch in der Weimarer Republik beschreiben läßt. Erwachsenenbildung und Sozialreform gehören ebenfalls zu den Themen, mit denen sie in den 1920er und frühen 1930er Jahren in Kontakt kommt. Die Verbindung jener Ideenhorizonte nach dem Zweiten Weltkrieg mit denen der Bürgerlichen Frauenbewegung, der Europabewegung, des Antikommunismus und der Westintegration prägen das Wirken Bähnischs nach 1945, als sie in ihrer Funktion als Leiterin des ‚Deutschen Frauenrings‘ (DFR) und seiner Vorläuferorganisationen die Re-Organisation der überparteilichen Frauenbewegung in Deutschland vorantreibt und die ‚staatsbürgerliche Frauenbildung‘ zu ihrer Maxime erhebt. In ihren ersten fünf Amtsjahren als Regierungspräsidentin widmet sie sich primär dem Wiederaufbau des Bezirks Hannover, übt jedoch weit darüber hinaus reichenden Einfluß aus. Als Vizepräsidentin des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung sucht sie den Schulterschluß mit anderen westeuropäischen Staaten und versucht, die deutsche Gesellschaft auf den Weg Richtung ‚Westen‘ zu bringen. Trennen lassen sich diese verschiedenen Aspekte ihres Wirkens nicht, vielmehr sind sie stark ineinander verwoben. Wie sich die genannten Dimensionen aufeinander beziehen, welche Sozialisationserfahrungen und Selbstkonstruktionen Bähnischs (auch) in Bezug auf ihr Leben im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im ‚Dritten Reich‘ dabei eine Rolle spielen und wie sich die Bündelung und Zuspitzung ihrer Prägungen und Ideen im Rahmen einer vor allem kulturell wirkmächtigen ‚Westernisierungsarbeit‘ gegen die ‚Rote Gefahr‘ ab 1945 gestaltet, das soll die leitende Fragestellung der vorliegenden Arbeit sein.
149 Schneider, Karl: Der langsame Abschied vom Agrarland, in: Weisbrod, Bernd (Hrsg.): Von der Währungsreform zum Wirtschaftswunder. Wiederaufbau in Niedersachsen, Hannover 1998, S. 133–160, hier S. 136.
Einführung | 57
Vor dem Hintergrund der Breite der Untersuchung ist es notwendig, die Fragestellung weiter aufzufächern und zu untergliedern: Biographie vor 1945: Angelehnt an meine Thesen frage ich zunächst danach, welche Sozialisation Theanolte Bähnisch in drei verschiedenen politischen Systemen und zwei Weltkriegen bis 1945 erfuhr. Mich interessiert, wie die Lebensrealität Dorothea Noltes als junges Mädchen aussah. Welche Aspekte aus diesen Zusammenhängen könnten Bähnischs späteres Engagement in der Verwaltung und in der Frauenbewegung befördert haben? Was läßt sich über jene sagenumwobene Zeit, in der sie die erste Verwaltungsreferendarin Preußens war, herausfinden? Wie gestalteten sich ihr Berufsleben sowie ihr gesellschaftliches und privates Leben in der Hauptstadt Berlin? Welche Rolle spielten die Beziehung zu ihrem Ehemann Albrecht Bähnisch, die gemeinsamen Orts- und Berufswechsel sowie das Familienleben für ihre weitere Entwicklung? Welche wesentlichen Aspekte von Albrecht Bähnischs Biographie, die auch für seine Frau relevant gewesen sein dürften, lassen sich herausarbeiten? Wie ging das Paar mit Albrecht Bähnischs ‚Karriereknick‘ 1932 um und wie gestaltete sich das gemeinsame Leben während des Dritten Reichs? Läßt sich die von Theanolte Bähnisch behauptete und vielfach unkritisch tradierte Rolle im Widerstand belegen und wie sah diese gegebenenfalls aus? Welche Veränderungen traten für die zweifache Mutter ein, als ihr Mann zum Kriegsdienst eingezogen wurde? Aufbruch nach Kriegsende: Wie gestaltete sich das Engagement Theanolte Bähnischs nach 1945, vor allem im Wiederaufbau Deutschlands, durch ihr Amt als Regierungspräsidentin, bei der Re-Organisation der Frauenbewegung ab 1946 und darüber hinaus? Läßt ihr breitgefächertes Engagement eine ‚übergreifende Handlungslogik‘150 erkennen? Wie ist der immense Karriereschub, den sie nach 1945 erfährt, zu erklären? Welche Sozialisationserfahrungen, welche Selbstkonstruktionen, welche Unterstützer und welche Gegner spielten hierbei eine Rolle? Selbstkonstruktion: Welches ‚unternehmerische Selbst‘151 entwirft die Juristin, besonders, als sie 1945 ihre Chance sieht, beruflich (noch einmal) durchzustarten und sich dabei am Wiederaufbau des Landes zu beteiligen? Welche Erfahrungen, Fähigkeiten und Überzeugungen stellt sie dabei in den Vordergrund? Was und wie berichtet sie über ihr Leben in den Jahren bis 1945? Welche Aspekte thematisiert sie nicht? Auf welche Art und auf welchen Wegen ‚vermarktet‘ sie ihr Selbst? Lassen sich Widersprüche in ihrer Argumentation erkennen? Argumentiert sie, unabhängig von Zeit und Raum, immer gleich? Kann ein differenzierteres Bild ihres Lebens in den Jahren 1933 bis 1945 ihre Nachkriegskarriere vielleicht sogar schlüssiger erklären helfen,
150 Zur gebotenen Vorsicht bei einem solchen Ansatz vgl.: Bourdieu, Pierre: Die biographische Illusion, in: Bios, 1/1990, S. 75–81 sowie Kapitel 1.7.4.1. 151 Zum durch den Soziologen Ulrich Bröckling geprägten Begriff vgl.: Bröckling, Ulrich: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt a. M. 2007. Bröckling weist darauf hin, daß das „unternehmerische Selbst“ im Zuge eines ständigen Anpassungsdrucks an vermeintliche Erfordernisse von außen immer auch ein „erschöpftes Selbst“ sei. Bröckling, Ulrich: „Die perfekte Biographie gibt es nicht!“, in: TAZ, 31.12.2009, auf: http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel /?ressort=sw&dig=2009/12/31/a0129, am 04.08.2014.
58 | Theanolte Bähnisch
als es die Vorstellung von der „fanatisch antifaschistisch[en]“152 Widerstandaktivistin vermag? Welche Rolle spielt der Umstand, daß die Regierungspräsidentin für ihren ‚humanen‘ Umgang mit ehemaligen NSDAP-Parteigenossen im Rahmen der Entnazifizierung bekannt wurde153 und daß sie keine Anstrengungen unternahm, sich von Personen wie Gertrud Bäumer und Agnes Miegel sowie von Organisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz, die durch ihre Kollaboration mit dem Regime in Verruf geraten waren, abzugrenzen? Ist der Umstand, daß von Bähnisch herausgegebene ‚Stimme der Frau‘ zu den Verbrechen der Nationalsozialisten nicht Stellung nimmt, deckungsgleich mit dem Verhalten der Herausgeberin der Zeitschrift in anderen Zusammenhängen? Netzwerke und strategische Allianzen: Inwiefern betreibt Bähnisch bereits vor 1945 strategische Kontaktpflege? Welche Kontakte (re)aktiviert sie ab 1945? Wer ‚erinnert‘ sich an sie? Wie und wo findet sie neue Partner? In welchen Kreisen lassen sich ihre Förderer, in welchen ihre Widersacher verorten? Welche Gemeinsamkeiten zwischen Bähnisch und ihren Verbündeten und welche Differenzen zu ihren Gegenspielern sind dafür zentral? Sind die Allianzen, die sie pflegt, stabil oder wechselhaft? Welche Erwartungen werden an die Verwaltungsjuristin gestellt, welche Hoffnungen glauben Dritte über eine Zusammenarbeit mit Bähnisch und/oder ihre Unterstützung verwirklichen zu können? Welche Befürchtungen nähren ihre Widersacher? Welche Bühnen, welche Gelegenheiten ermöglichen ihr, Gehör zu finden und ihre Ideen zu verbreiten? Ziele und Erwartungen: Welchen Beitrag will Theanolte Bähnisch selbst zum Wiederaufbau Deutschlands leisten? Welche Ziele hat sie darüber hinaus, in Bezug auf die Frauenemanzipation und allgemeinpolitisch? Welches Deutschland, welche Gesellschaft, welche Frauen und welche SPD gehören zu ihrer Zukunftsvision? Wen will sie mit ihrer Arbeit ansprechen? Erfüllt sie die von ihr gesetzten Ansprüche? Welche Prinzipien ihres Wirkens lassen sich als über-, welche als untergeordnet begreifen? Wo tun sich Zielkonflikte auf? Argumentations- und Aktionsstrategien: In welchen Zusammenhängen setzt Bähnisch auf Kontinuität, zu welchen Neuerungen ruft sie auf? Wann und wie paßt sie bewährt Erscheinendes an neue Situationen an? Welche Rolle spielen Inhalte, die ihr aus der Weimarer Republik vertraut sind - Verwaltung, Demokratie, rechtsstaatliche Ordnung, bürgerliche Gesellschaft, berufliche Professionalisierung von Frauen, christlicher Glaube und soziale Demokratie – als sie sich ab 1945 weiteren Themen – der organisierten Frauenbewegung und der Europa-Bewegung – widmet? Welche Rolle nehmen diese Themen ein, als sie gegen den Kommunismus kämpft und der
152 BArch, N 1114, Nr. 26, Bähnisch an Friedrich A. Knost, 14.02.1945. Das Schreiben ist ein ‚Persilschein‘ aus der Hand Bähnischs für Knost, der im Reichssippenamt des Berliner Inneministeriums tätig war und einen Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen verfaßt hatte. Die Überlieferung in Friedensburgs Nachlaß erklärt sich aus der Tatsache, daß Knost und Friedensburg bis 1932 in Kassel zusammengearbeitet hatten, wo Friedensburg bis zu seiner Amtsenthebung 1933 Regierungspräsident war. 153 Bähnisch, Theanolte: Theanolte Bähnisch erzählt. Die Entscheidung für Hannover. Als die Flüchtlingszüge rollten, in: Hannoversche Presse, Nr. 299, 23.12.1964.
Einführung | 59
deutschen Gesellschaft den Weg Richtung ‚Westen‘ weist? Welche Argumente führt sie gegen den Kommunismus ins Feld? Welche rhetorischen Figuren bemüht sie, welche Bilder vom ‚Westen‘ und vom ‚Osten‘ hilft sie damit aufzubauen und in welche Trends und Traditionen reiht sie sich damit ein? Welche Rolle spielen Selbst-, Fremd- und Feindbilder? Argumentiert sie in verschiedenen Wirkungszusammenhängen ähnlich? Synergie-Effekte und Rollen-Konflikte: Inwiefern sind Synergie-Effekte ihrer verschiedenen Arbeitsinhalte und Rollen – als Verwaltungsjuristin/Regierungspräsidentin, als Vorsitzende des Frauenrings, als Vizepräsidentin des Deutschen Rats der Europäischen Bewegung, als Herausgeberin der ‚Stimme der Frau‘ und als Ehefrau und Mutter zu beobachten? Was sagt beispielsweise die Erkenntnis, daß sie Versammlungen ‚ihres‘ Frauenverbandes in den Räumlichkeiten des Regierungspräsidiums abhielt und daß ihre Vorzimmerdame die Schriftarbeit für den Verband ‚ehrenamtlich‘ mit erledigte, über die Machtstellung und die Einflußmöglichkeiten Bähnischs als Regierungspräsidentin aus? An welchen Punkten treten Arbeits-Inhalte, Rollen-Erfordernisse und Netzwerke zueinander in Konkurrenz? Welche Veränderungen, Umgewichtungen und gegebenenfalls auch Umbewertungen nimmt Bähnisch im Konfliktfall vor? Welche Rolle spielt der Umstand, daß sie eine Frau ist und eine Frauenorganisation leitet, für ihre Wahrnehmung und Bewertung als Regierungspräsidentin? Lage Deutschlands ab 1945 und weltpolitische Ausgangsbedingungen: Wie ist es zu erklären, daß Theanolte Bähnisch, ein Mitglied der SPD, die überparteiliche Frauenbewegung in Deutschland wiederaufbaut und warum akzeptieren gestandene Protagonistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung sie als neue Führungsfigur? Wie ist ihreStellung in der SPD zu beurteilen? Welche Rolle spielt für ihr Wirken der Umstand, daß Deutschland in der Hochphase ihres Schaffens ein zunächst nicht- und später teilsouveräner, von vier Mächten besetzter Staat ist, der aus dem Ausland argwöhnisch beobachtet wird und der gleichzeitig eine wichtige Rolle im Kalten Krieg spielt? Wie gestaltet sich ihr Engagement in der Europabewegung? Was bedeutete dieses Engagement für ihre Arbeit auf anderen Wirkungsfeldern? Stellenwert ihres Wirkens für die Geschichte des deutschen Wiederaufbaus: Wie macht Theanolte Bähnisch in den erwähnten Zusammenhängen und über diese hinaus ihren Einfluß in den entscheidenden Jahren der Konsolidierung Deutschlands geltend? Welchen Part übernimmt sie im Zusammenspiel von gesellschaftlichem Wiederaufbau, (bürgerlicher) Frauenbewegung, -bildung und -emanzipation, (niedersächsischer) Verwaltung, der Eliten-Kontinuität durch verschiedene politische Systeme, der westalliierten Besatzungspolitik, des Kalten Krieges, der Westbindung Deutschlands und der deutsch-deutschen Beziehungen? Wie könnte ihre Arbeit vor dem Hintergrund der in jenen Jahren verbreiteten Nöte und Bedürfnisse in der Bevölkerung wahrgenommen worden sein? Regierungspräsidium: Was bedeutete das Amt als Regierungspräsidentin für Bähnisch und mit welchem Selbstverständnis führte sie es aus? Wie positioniert sie sich zur von den Briten angestrebten Demokratisierung der Verwaltung? Welche waren die zentralen Inhalte ihrer Arbeit? Nutzte sie die Möglichkeiten, die ihr das Amt bot, dafür, ihre politischen Überzeugungen durchzusetzen? Wie ging die Regierungspräsidentin mit ‚NS-belasteten‘ Mitarbeitern um? Ließ sie Frauen im Rahmen ihres Amtes eine besondere Förderung zu Teil werden?
60 | Theanolte Bähnisch
Deutscher Frauenring: Wie vollzog sich der Aufbau des ‚Deutschen Frauenrings‘ und seiner Vorläufer unter Theanolte Bähnisch? Wer unterstützte sie dabei und wer stellte sich gegen sie? Wie schaffte sie es, ihren Einfluß in der Frauenbewegung stetig zu mehren? Welche Hoffnungen, Erwartungen und Enttäuschungen wurden mit ihrer Arbeit verbunden? Was leisteten die von Bähnisch geleiteten Frauenorganisationen für die Frauen in der Region, in der britischen Besatzungszone und in Westdeutschland? Welche Ziele steckte sich Bähnisch für ihre Arbeit in der Frauenbewegung? Welche Erfolge und Mißerfolge bei der Umsetzung ihrer Ziele lassen sich konstatieren? Spiegelt sich in ihrer Arbeit in der organisierten Frauenbewegung die frauenpolitische Zielsetzung, welche aus der ‚Stimme der Frau‘ deutlich wird, wieder? Warum legt sie 1952 ihr Amt als Präsidentin des DFR nieder? Kooperation mit den Briten: Die Besatzungsmächte brachten ihre Ideen von Demokratie, Bildung und Erziehung, von Produktions- und Reproduktionsarbeit, von organisiertem Vereinsleben, von Geschlechterbeziehungen und Familienleben mit in ‚ihre‘ Besatzungszonen und versuchten sich dort und darüber hinaus als kulturelle Mittler, als Anleiter und Vorbilder.154 Wie sich Bähnisch der Britischen Militärregierung andiente, wie sie durch diese gefördert wurde und warum die Militärregierung sich so sehr auf die Juristin verließ, auch diese Fragen (die in groben Zügen bereits Denise Tscharntke155 beantwortete) sollen in die Fragestellung meiner Arbeit mit einfließen.
1.7 LEITENDE THEORIEN UND METHODEN 1.7.1 Antonio Gramscis ‚Hegemonie-Theorie‘ In der Überzeugung, daß Theanolte Bähnisch mit ihrem Handeln in der Bevölkerung einen Konsens für die Westbindung Deutschlands befördern wollte, möchte ich den Überlegungen des Philosophen und Politikers Antonio Gramsci folgen. Dieser hatte sich in den 1920er und 1930er Jahren vor dem Hintergrund des Aufstiegs des Faschismus mit der gesellschaftlichen Struktur Italiens und der Frage, warum es den Kommunisten nicht gelungen war, die Macht im Staat zu übernehmen, auseinandergesetzt. Er gelangte zu der Überzeugung, daß sich gesellschaftliche Entwicklungen und Machtkonstellationen wesentlich auf die Dominanz konsensfähiger gedanklicher Strömungen zurückführen lassen. Ein wichtiges Mittel der Theoriebildung des Benedetto-Croce-Schülers stellte die Analyse von Sprache dar. Gramsci untersuchte beispielsweise klassische literarische Werke oder Theaterstücke, deren Inhalte weit verbreitet waren, auf Begrifflichkeiten, denen er eine gesellschafts-stabilisierende Wirkung im Sinn einer ‚bürgerlichen Gesellschaftsordnung‘ zusprach. Seiner Meinung nach leisten solche Kulturgüter einen Beitrag dazu, daß sich in der Bevölkerung ein Set von Werten und moralischen Empfindungen, politischen Haltungen und Glaubensüberzeugungen durchsetzt, welches dazu beiträgt, den Status Quo der Machtver-
154 Vgl.: Clemens: Kulturpolitik. 155 Vgl.: Tscharntke: Re-educating.
Einführung | 61
hältnisse im Staat zu unterstützen. Gramsci betont in seinen Schriften die Existenz eines ‚alltagskulturellen‘ Standbeins von Hegemonie in der Zivilgesellschaft (‚senso commune‘). Jene Hegemonie der Alltagskultur stuft er als mindestens ebenso einflußreich und machtbildend beziehungsweise – erhaltend ein wie militärische oder ökonomische Hegemonien. Langfristig stabile Machtverhältnisse – so lautet die Quintessenz seiner Lehre – lassen sich niemals auf Zwang allein zurückzuführen, sondern erfordern immer auch ein gewisses Maß an Konsens. Veränderungswillige Akteure können in Gramscis Überzeugung eine ‚Gegenhegemonie‘ nur dann etablieren, wenn sie in der Lage sind, (auch) die ‚Alltagskultur‘ in ihrem Sinn zu beeinflussen.156 Studien, die sich mit Gramscis Theorie157 auseinandersetzen, beschreiben das – jeweils mehr oder weniger erfolgreiche – Ringen verschiedener Interessengruppen um Einstellungen und Werthaltungen in der Bevölkerung zur Erhaltung bestehender oder zur Etablierung neuer Machtverhältnisse, vor allem in Zusammenhang mit staatlichen Umbrüchen und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu Um-/oder Neuorientierungen von Gesellschaften. In diesem Zusammenhang werden auch die deutsche Nachkriegszeit sowie die amerikanische Wiederaufbauhilfe in Europa im Allgemeinen thematisiert.158 Verschiedene, bereits erwähnte Autorinnen und Autoren wie Gabriele Clemens, Axel Schildt und Anselm Doering-Manteuffel gehen davon aus, daß der Umorientierungsdruck, den die Besatzungsmächte im Zusammenspiel mit deutschen Eliten auf die deutschen Bevölkerung ausübten, mit einer erhöhten Wirkmacht jener Aspekte einherging, die Gramsci als ‚alltagskulturell‘ bezeichnet.159 Schließt man sich dieser Annahme an und will man die Anlehnung Westdeutschlands an den ‚Westen‘ verstehen, so verspricht es lohnenswert zu sein, den Blick auf das Handeln jener Akteure zu richten, die sich – wie Theanolte Bähnisch – den Willen zur kulturellen Beeinflussung der Bevölkerung auf die Fahne geschrieben hatten.160 Vielversprechend erscheint ein solcher Fokus vor allem dann, wenn Protagonisten, wie es bei Bähnisch der Fall war, sowohl die Möglichkeit dazu hatten, viele Bürger mit ihren Ideen direkt zur erreichen, als auch, ihre Vorstellungen durch Medien und Multiplikatoren zu verbreiten. In der Nachkriegszeit waren dafür gute Kontakte zur Militärregierung, zu angesehenen Politikern und anderen einflußreichen Kräften im Ausland sowie zu deutschen Eliten, die – vor dem Hintergrund der von den Alliierten angestrebten Entnazifizierung – als ‚politisch unbelastet‘ galten, be-
156 Einführend zu Gramsci vgl.: Kebir, Sabine: Antonio Gramscis Zivilgesellschaft. Alltag – Ökonomie – Kultur – Politik, Hamburg 2001. 157 Gramscis Ideen werden heutzutage allgemein als ‚Hegemonietheorie‘ bezeichnet, sie stellen jedoch keine geschlossene Theorie dar, sondern erstrecken sich über verschiedene Publikationen, darunter seine ‘Gefängnishefte‘. 158 Vgl.: Borg, Erik: Gramsci Global? Transnationale Hegemoniebildung aus der Perspektive der Internationalen Politischen Ökonomie, in: Das Argument Nr. 239 (2001), S. 67–78. 159 Vgl.: Clemens: Kulturpolitik sowie Schildt: Zeiten und Doering-Manteuffel: Amerikanisierung, 1999. 160 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Schumacher an Bähnisch, 15.12.1945, Kopie in AddF, SP-01.
62 | Theanolte Bähnisch
sonders hilfreich. Als besonders durchsetzungsfähig dürfen vor dem Hintergrund von Gramscis Überzeugungen vor allem solche Vorstellungen und Konzepte deutscher Eliten gelten, die sich mit jenen der Okkupationsmächte deckten und die zusätzlich anschlußfähig an solche Ideen waren, mit denen die Bevölkerung bereits vertraut war. Dies traf, um einen für meine Arbeit zentralen Aspekt herauszugreifen, auch auf das Feindbild des Kommunismus, beziehungsweise der ‚Slawen‘ oder Rußlands/die Sowjetunion zu. Schließlich hatte der Antikommunismus in Deutschland eine lange Tradition und war zudem ein zentraler Aspekt der nationalsozialistischen Propaganda gewesen.161 Die Westalliierten und deutsche, antikommunistisch eingestellte Eliten konnten deshalb erfolgreich an bereits etablierte Feindbilder anknüpfen, um ihre antikommunistischen und pro-‚westlichen‘ Ziele durchzusetzen. „Eine neue Kultur zu schaffen“, so Gramsci „bedeutet nicht nur, individuell ‚originelle‘ Entdeckungen zu machen, es bedeutet auch und besonders, bereits entdeckte Wahrheiten kritisch zu verbreiten, sie sozusagen zu ‚vergesellschaften‘ und sie dadurch Basis vitaler Handlungen, Element der Koordination und der intellektuellen und moralischen Ordnung werden zu lassen. Daß eine Masse von Menschen dahin gebracht wird, die reale Gegenwart kohärent und auf einheitliche Weise zu denken, ist eine ‚philosophische‘ Tatsache, die viel wichtiger und ‚origineller‘ ist, als wenn ein philosophisches ,Genie‘ eine neue Wahrheit entdeckt, die Erbhof kleiner Intellektuellengruppen bleibt.“162 Theanolte Bähnisch nutzte ihre Sozialisation, ihren Status und ihre Kontakte dazu, hegemoniale Diskurse in der deutschen Nachkriegsgesellschaft um den Kommunismus, den ‚Westen‘, den christlichen Glauben, die Frauen etc., zu beeinflussen. Sie knüpfte dazu an Bekanntes an und kombinierte das Bekannte mit Elementen aus Spezialdiskursen – vor allem aus der Frauenbewegung. Folgt man Gramscis Überzeugungen, konnte sie damit starken Einfluß auf die Gesellschaft nehmen. Der Trend, Gramscis Überlegungen, die keine geschlossene Theorie darstellen, nicht nur aus ihrem historischen Kontext zu lösen, sondern, unter der Flagge der ‚Neogramscianischen Hegemonietheorie‘, sogar zu internationalisieren163, wurde vielfach kritisiert.164 Seine Ideen für die Analyse internationaler Politik nicht zu nutzen, hieße jedoch das Potential zu verschenken, das Gramscis Überlegungen für solche Analysen zweifellos innewohnt. Daß Theanolte Bähnisch durch ihre Zeitschrift,
161 Siehe Kapitel V.4.3. 162 Gefängnishefte. Antonio Gramsci, hrsg. vom Deutschen Gramsci-Projekt unter der wiss. Leitung von Klaus Bochmann, Band 1–10, Hamburg 1991ff; hier Bd. 6, Heft 1, §12. 163 Als ersten Ansatz dieser Art vgl.: Cox, Robert W.: Labor and Hegemony, in: International Organization, Bd. 31 (1977) Heft 3, S. 385–424. Vgl. auch: Scherrer, Christoph: Neogramscianische Theorie der Internationalen Beziehungen, in: Albrecht, Ulrich/Volger, Helmut (Hrsg.): Lexikon der Internationalen Politik, München 1997, S. 371–372 sowie: ders.: Neo-gramscianische Interpretationen internationaler Beziehungen. Eine Kritik, in: Hirschfeld, Uwe (Hrsg.), Gramsci-Perspektiven, Hamburg 1998, S. 160–174. 164 Vgl.: Borg, Erik: Steinbruch Gramsci. Hegemonie im internationalen politischen System, in: Sozialistische Positionen. Beiträge zu Politik, Kultur und Gesellschaft, 10/2001, auf: http://www.sopos.org/aufsaetze/3bbdcd9ea0c9f/1.phtml, am 13.01.2014.
Einführung | 63
durch Vorträge und die Pflege binationaler Beziehungen die Bemühungen der Briten unterstützte, den Deutschen die britische Kultur anzuempfehlen – was von britischer Seite beispielsweise durch Zeitungen, Lichtspielvorführungen, kulturelle Einrichtungen und Austauschprogramme geschah – legt nah, in diesem Zusammenhang Gramscis Ideen zu folgen. Dabei sollte jedoch eine starke Orientierung an den Grundüberzeugungen Gramscis stattfinden. Im Rahmen neo-gramscianischer Ansätze erfolgt nicht selten eine Internationalisierung von Gramcis Überlegungen in Form einer Institutionen- und/oder Organisationsanalyse.165 Dies widerspricht meines Erachtens jedoch dem Umstand, daß sich Gramsci unter dem ‚zivilgesellschaftlichen Standbein‘ von Hegemonie eben gerade nicht Organisationen oder Institutionen vorgestellt hatte. Ihm ging es vielmehr um den ‚Alltagsverstand‘ eines jeden Einzelnen, die „unkritisch von den verschiedenen gesellschaftlichen und kulturellen Milieus aufgenommene Weltauffassung, in der sich die moralische Individualität des Durchschnittsmenschen entfaltet.“166 Der Politologe und Gramsci-Kenner Erik Borg erklärt Gramscis Vorstellung vom ‚Alltagsverstand‘ als ein „Konglomerat von Vorstellungen, Begriffen etc., welches trotz und wegen seiner inneren Widersprüche die Basis von Normalitätsvorstellungen bildet und damit wesentlich die gesellschaftlich anerkannten ‚Grenzen des Möglichen‘ markiert“167. Daß sich entsprechende Vorstellungen auch in Organisationen und Institutionen manifestieren und darüber wiederum auf Einzelpersonen wirken können, steht außer Frage und ist auch für meine Analyse von Bähnischs Wirken im DFR sowie in anderen Organisationen von Bedeutung. 1.7.2 Diskurstheorie und Begriffsgeschichte Die Politiktheoretiker Ernesto Laclau und Chantal Mouffe haben Gramscis Überlegungen – unter Einbeziehung Foucault’scher Traditionen – mit einem diskursanalytischen Ansatz im sozialwissenschaftlichen Sinn verknüpft. Diesem und anderen Ansätzen, welche die Diskursanalyse nicht als eine geschlossene Methode, sondern als eine Theorie oder gar ‚Haltung‘ anwenden – dies trifft beispielsweise auf Peter L. Berger und Thomas Luckmann168 sowie auf Siegfried und Margarete Jäger169 zu – möchte ich folgen. Wie die genannten Autoren verwende ich im Folgenden den nicht primär sprachwissenschaftlich fundierten Diskursbegriff Michel Foucaults.170 Eingängiger als im Original erklärt der diskursanalystisch arbeitende, sich an den Vorarbeiten Mouffes und Laclaus orientierende Historiker Philip Sarasin das foucaultsche
165 Vgl. dazu beispielsweise: Scherrer, Christoph: Globalisierung wider Willen? Die Durchsetzung liberaler Außenwirtschaftspolitik in den USA, Berlin 1999. 166 Gramsci, Gefängnishefte §1393, zitiert nach Borg: Steinbruch. 167 Borg: Steinbruch. 168 Berger, Peter L./Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt a. M. 1980. 169 Vgl.: Jäger, Siegfried: Kritische Diskursanalyse, 4. Aufl., Münster 2004. 170 Zu den verschiedenen diskursanalytischen Ansätzen vgl.: Keller, Rainer: Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen, 4. Aufl., Wiesbaden 2011, S. 13–64.
64 | Theanolte Bähnisch
Vorgehen wie folgt: Foucault interessiere die historische Begrenztheit, die „faktische Knappheit“ einzelner existierender Aussagen und Aussageserien. Diskurse bewegten sich nach Foucault, so Sarasin, in einem Zwischenbereich zwischen den Worten und den Dingen, wo diese eine kompakte Materialität mit eigenen beschreibbaren Regeln darstellten, um auf diese Weise die gesellschaftliche Konstruktion der Dinge ebenso zu steuern, wie dem sprechenden Subjekt einen Ort zuzuweisen, an dem sich sein Sprechen und seine Sprache erst entfalten könne.171 Die Konzentration auf diskursanalytische Ansätze hat sich für die Analyse der mit dem Kalten Krieg verknüpften Diskurse in der ‚Stimme der Frau‘ als sehr hilfreich erwiesen. Ich folge auch für die Auseinandersetzung mit Bähnischs Biographie Michel Foucaults Definition von ‚Diskurs‘ als ein „sprachlich produzierter Sinnzusammenhang, der eine bestimmte Vorstellung forciert, welche wiederum bestimmte Machtstrukturen und Interessen gleichzeitig zur Grundlage hat und erzeugt“172. Mit diesem Ansatz lassen sich die Texte in der ‚Stimme der Frau‘ in verschiedenen, in der westdeutschen Nachkriegszeit verbreiteten Diskurssträngen verorten, ihre Anschlußfähigkeit und ihre ‚innovativen‘ Aspekte herausarbeiten, sowie Hypothesen über die Wirkmacht der Zeitschrift, vor allem, was die Einstellung der (weiblichen) Bevölkerung zur Westbindung und zum Kommunismus anging, aufstellen. Damit kann Bähnischs medienpolitischer Beitrag zum ‚antikommunistischen Grundkonsens‘ in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, zur Westbindung und Westintegration Deutschlands, zum Geschlechterverhältnis sowie zur Rolle von Frauen in der Gesellschaft sichtbar gemacht werden. Es läßt sich zeigen, wie die Herausgeberin der ‚Stimme der Frau‘ jene Aspekte so miteinander in Verbindung brachte, daß eine diskursive Kopplung des von ihr als positiv dargestellten, bipolaren Geschlechterverhältnis diskursiv an ein als ‚westlich‘ dargestelltes Werteverständnis stattfand, daß Bähnisch an verbreitete Argumente gegen den Kommunismus aus verschiedenen politischen und konfessionellen Lagern anknüpfte, diese erweiterte kombinierte und modifizierte – und sie dabei speziell auf Frauen zuschnitt. Würde man diesen methodischen Zugang und den gewählten inhaltlichen Fokus schlichtweg auf die anderen Wirkungsgebiete Bähnischs als Regierungspräsidentin, als Präsidentin des Deutschen Frauenrings und als Protagonistin inter- und supranationaler Initiativen ausweiten, bestünde die Gefahr, einige Zusammenhänge, insbesondere, was die Zusammenarbeit Bähnischs mit britischen Militärs und Zivilisten sowie mit deutschen Eliten betrifft, fehlzudeuten oder zumindest nicht hinreichend erklären zu können.173 Zentrale Aspekte, die für das Verständnis ihres Verhaltens und für ih-
171 Vgl.: Sarasin, Philipp: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt a. M. 2003, S. 33/34. Vgl. auch: Foucault, Michel: Archäologie des Wissens, Frankfurt a. M. 1981, S. 43. 172 Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt a. M. 1991. Bei der Publikation handelt es sich um die Schriftform der Antrittsvorlesung Foucaults am Collège de France am 02.12.1970. 173 Um nur ein Beispiel zu nennen, so bestätigte sich meine ursprüngliche Annahme, daß Bähnisch ab 1946 eng mit der niedersächsischen Volkshochschule zusammengearbeitet hatte, nicht. Zunächst deutete alles darauf hin, daß dies aufgrund der frappierenden Ähn-
Einführung | 65
ren Erfolg nach 1945 relevant sind, würden ohne die Rekonstruktion ihrer Biographie, der Gegenstände, mit denen sie sich bis 1945 auseinandersetzte, des Umfelds, in dem sie sich vor 1945 bewegte und ohne die Rekonstruktion der Netzwerke, denen sie ihren Erfolg ab 1945 verdankte, im Dunkeln bleiben. Ihr Handeln und ihre Argumentation nach 1945 können aus dem Kontext der Nachkriegsjahre nicht allein erklärt werden. Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß die vorliegende Arbeit keine Medienanalyse leisten, sondern sich mich mit Bähnischs Leben bis 1945 und mit ihrer Arbeit als Regierungspräsidentin sowie als Leiterin von Frauenorganisationen auseinandersetzen soll, wird der methodische Schwerpunkt der nicht in der Diskursanalyse, sondern stärker im biographischen Zugang und in der Netzwerkanalyse liegen. Daß eine diskursanalytische Haltung insbesondere in Verbindung mit einem netzwerkanalytischen Zugang sinnvoll ist, macht nicht zuletzt das Konzept des ‚Interdiskurses‘ deutlich, welches der Politologe und Literaturwissenschaftler Jürgen Link entwickelt hat: Link bezeichnet etablierte Kommunikationsstrukturen zwischen Netzwerkakteuren in unterschiedlichen Handlungs- und Diskursfeldern als ‚Interdiskurse‘.174 Er zeigt damit auf, daß Schnittstellen verschiedener Diskurse zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen bestehen und führt vor Augen, welche Rolle Akteure, die zwischen verschiedenen ‚Experten‘ und einem breiteren Publikum vermitteln, übernehmen, indem sie ‚Spezialdiskurse‘ einerseits mit anderen Spezialdiskursen kopplungs- und diese andererseits allgemeinsprachlich anschlußfähig machen. In der Auseinandersetzung mit jenen Feldern und Gruppen, in denen Bähnisch aktiv war, soll auch aufgezeigt werden, daß die Regierungspräsidentin mit an der Etablierung von ‚Interdiskursen‘ und somit an einer Verbindung und Verständigung verschiedener Personengruppen mit verschiedenen Schwerpunktinteressen beteiligt war. Besonders interessant sind diskursanalytische Verfahren für Arbeiten, die sich mit Staaten und Gesellschaften im Umbruch beschäftigen vor allem auch deshalb, weil sie stark dekonstruktiv arbeiten. Philip Sarasin zeigt sich überzeugt davon, daß die Gesellschaft „kein Wesen“ habe, „das von ihrer Imagination, ihrer Erfindung verschieden wäre, keine Identität, die sich auf einen nationalen Kern, auf Interessen oder auf eine ethnische Substanz zurückführen ließe“175. Er geht davon aus, daß jede Gesellschaft ihre Identität selbst konstruiere und auch selbst definiere, was die eigene
lichkeit von Äußerungen Bähnischs mit denen eines führenden Pädagogen der niedersächsischen Volkshochschule sowie mit dem niedersächsischen Kultusminister, der für die Einrichtung verantwortlich war, der Fall gewesen sei. Die Auseinandersetzung mit Bähnischs Biographie förderte zutage, dass Sie bereits in der Weimarer Republik, nicht zuletzt über ihren Bruder, in Kontakt zu dem betreffenden Minister stand und daß sie über ihren Ehemann vermutlich auch den betreffenden Pädagogen und das Umfeld, in dem dieser sich bewegte, kennengelernt hat. 174 Vgl.: Link, Jürgen: Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird, 2. Aufl., Opladen 1999. 175 Ebd., S. 48. Weniger präzise im Original formuliert, vgl.: Laclau, Ernesto/Mouffe, Chantal: Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus, 2. Aufl., Wien 2000, S. 146.
66 | Theanolte Bähnisch
Nation konstituiere. Sarasins Position zu folgen ist besonders für die Analyse der der zweiten deutschen Nachkriegszeit hilfreich. Schließlich ‚erfanden‘ sich zu jener Zeit in Deutschland gleich zwei Gesellschaften, welche sich 1949 Staatsformen in Form der ‚DDR‘ und der ‚BRD‘ gaben, nicht zuletzt, indem sie sich von der jeweils anderen abgrenzten. Dazu leistete auch Theanolte Bähnisch ihren Beitrag. Der Terminus ‚westlich‘ – der Kommunikationssoziologin Elena Esposito zufolge „rein formal gesehen ein leerer Begriff“176 – spielte dabei eine zentrale Rolle.177 Anknüpfend an entsprechenden Vorarbeiten178, spielt auch in der vorliegenden Arbeit die Frage, inwiefern Theanolte Bähnisch am Diskurs um ‚Weiblichkeit‘, und damit an der Konstruktion, Rekonstruktion und Dekonstruktion der ‚Frau‘ als soziales Geschlecht beteiligt war, eine Rolle. Dabei gilt es zu berücksichtigen, daß die Kerndiskussion der feministischen Theorie um Differenz und Gleichheit der Geschlechter nicht abgeschlossen ist179 und vermutlich nie abgeschlossen sein wird. Während Vertreterinnen ‚traditionellerer‘ Gender-Ansätze ‚sex‘ als das natürliche Geschlecht und ‚gender‘ als das sozial konstruierte Geschlecht begreifen und die Dekonstruktion von Letzterem fordern, gehen andere Theoretikerinnen, allen voran Judith Butler, einen Schritt weiter und stellen die Existenz eines ‚natürlichen‘ Geschlechts, beziehungsweise die ZweiGeschlechter-Ordnung als solche in Frage.180 „So wie die diskursive Verfertigung von Geschlecht ist auch die Reflexion aufs Geschlecht performativ, löscht es nicht aus, schafft es nicht neu, sondern dekonstruiert es“181, faßt die Politologin Birgit Rauschenbach Butlers Thesen zusammen. Dekonstruktion spielt also auch in der GenderTheorie, die häufig mit diskursanalytischen Verfahren verknüpft wird, eine wichtige Rolle. Die Diskursanalyse verdankt ihren Erfolg nicht zuletzt Vorarbeiten von Historikern, die begriffsgeschichtlich arbeiten.182 Während die ‚Begriffsgeschichte‘ als Me-
176 Esposito, Elena: Westlich vom Osten. Perspektivische Begriffe und Selbstbeschreibung der Gesellschaft, in: Schäfer, Alfred/Wimmer, Michael (Hrsg.): Identifikation und Repräsentation, Wiesbaden 1999, S. 129–149, S. 129. „Der Westen an sich ist bloß eine räumliche Lokalisierung, die außerdem von einer bestimmten Perspektive abhängig ist“, schreibt Esposito. Ebd. 177 Über die Jahrhunderte wurde dieser Begriff, so Esposito, so mit Sinngehalt gefüllt, daß er eine große Integrationskraft erfüllen konnte – und noch erfüllt. Ebd. 178 Vgl.: Freund: Hut. 179 Vgl. dazu beispielsweise: Rauschenbach, Brigitte: Gleichheit, Differenz, Freiheit? Bewusstseinswenden im Feminismus nach 1968, gender…politik…online, August 2009, auf: http://www.fu-berlin.de/sites/gpo/pol_theorie/Zeitgenoessische_ansaetze/Gleichheit __Differenz__Freiheit/rauschenbach_august.pdf?1361541199, am 13.03.2014. In ihrem Aufsatz unterscheidet Rauschenbach Differenzfeminismus, Gleichheitsfeminismus und dekonstruktiven Feminismus. 180 Vgl.: Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt a. M./New York 1991. 181 Rauschenbach: Gleichheit, S. 8. 182 Vgl.: zu den Schnittmengen: Bödeker, Erich (Hrsg.): Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte, Metapherngeschichte, Göttingen 2002. Vgl. auch das Standardwerk zur Begriffsgeschichte: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-
Einführung | 67
thode Erich Bödeker zufolge der Überzeugung anhängt, daß sich die Geschichte „in Begriffen niederschlägt“183, läßt sich mit Hilfe diskursanalytischer Ansätze auch das abbilden, was nicht gesagt wird. Um nur ein Beispiel zu nennen, so bedeutet für Bödeker die Verwendung des Begriffs ‚Bürgertum‘, den Gedanken an das Bürgertum lebendig zu halten.184 Es wird sich jedoch zeigen lassen, daß Theanolte Bähnisch auch dann von ‚Bürgertum‘ sprach und für ein ‚bürgerliches‘ Wertesystem warb, wenn sie den Begriff wohlweislich nicht in den Mund nahm. In anderen Zusammenhängen bietet es sich wiederum – wie die Analyse ebenfalls zeigen wird – an, stärker dem begriffsgeschichtlichen Ansatz zu folgen, der den Weg dazu ebnet, Begriffe „in ihrem historischen Kontext, im umfassendsten Sinn“185 zu verstehen und zu interpretieren. 1.7.3 Netzwerkanalyse Da die vorliegende Arbeit, was Bähnischs frauenpolitisches Wirken angeht, auf den Aufbau und die Arbeit der von ihr geleiteten Frauenorganisationen fokussiert, mag es naheliegend erscheinen, bei der Analyse organisationsanalytischen Ansätzen186 zu folgen, die ihre Entstehung wesentlich Max Webers Bürokratiet-Theorie187 zu verdanken haben. Ich möchte im Folgenden darlegen, warum ich stattdessen einen netzwerkanalytischen Ansatz mit in den methodischen Kanon aufnehme. Ein ‚Netzwerk‘ ist einem Aufsatz des Schweizer Historikers Georg Kreis aus dem Jahr 2013 zufolge dadurch definiert, „daß externe Steuerungsaktivitäten fehlen“ und daß innerhalb des Netzes „polyzentrisch in alle Richtungen Selbststeuerung betrieben wird“188. Als ich begann, Theanolte Bähnischs Wirken in die für die deutsche Nachkriegsgesellschaft prägenden Elitekonstellationen189 einzuordnen, war der
183 184 185 186
187 188
189
sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. von Otto Brunner, Werner Conze und Reinhart Koselleck, 8 Bd., 1972–1997. Als stärker anwendungsorientiertes Werk vgl.: Asendorf, Manfred/Müller, Achatz von/Flemming, Jens (Hrsg.): Geschichte. Lexikon der wissenschaftlichen Grundbegriffe, Hamburg 1994. Bödeker, Erich: Reflexionen über Begriffgeschichte als Methode, in: ders.: Begriffsgeschichte, S. 73–121, hier S. 76. Vgl.: ebd., S. 95. Ebd., S. 106. Für eine Kurzübersicht vgl.: Tacke, Veronika: Organisationssoziologie, in: Kneer, Georg/Schroer, Markus (Hrsg.): Handbuch Spezielle Soziologie, Wiesbaden 2010, S. 341. Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922. Kreis, Georg: Alles ist Netzwerk. Überlegungen zu einer (neuen) Metapher, in: Grunder, Hans-Ulrich/Hoffman-Ocon, Andreas/Metz, Peter (Hrsg.): Netzwerke in bildungshistorischer Perspektive, Bad Heilbrunn 2013, S. 20. In der politikwissenschaftlichen Elitenforschung ist die Trennung nach Positions-, Entscheidungs- und Reputationsmethode zur Bestimmung von Eliten mittlerweile weitgehend aufgehoben und es haben sich Forschungen durchgesetzt, die zur Bestimmung von Eliten nach herausragenden Positionen in verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren su-
68 | Theanolte Bähnisch
Netzwerk-Ansatz, der sich zunächst in der Soziologie etabliert hat, aber auch von Politologen genutzt wird, in den Geschichtswissenschaften noch weitgehend unbekannt. Daß sich dies zwischenzeitlich verändert hat, läßt sich als einen Beweis für die Tragfähigkeit und Zukunftsfähigkeit jener interdisziplinär anwendbaren Methode werten. „Böse Zungen behaupten, Historiker würden gebraucht, um in den Archiven Belege für die Theorien der Politikwissenschaftler zu finden“, schreibt Wilfried Loth.190 In dieser Aussage scheint zumindest ein wahrer Kern zu stecken, denn das von Soziologen und Politologen etablierte theoretische Modell erfährt durch die Analyse der Netzwerke, in denen Bähnisch sich bewegte, Bestätigung. Folgt man dem Bildungshistoriker Andreas Hofmann-Ocon, so ist in den Geschichtswissenschaften ein Trend zu beobachten, der – abstrakten und häufig stark quantifizierenden – Netzwerk-Idee mit einen „intelligente[n] Eklektizismus und ein[em] pragmatisch-instrumentellen Verhältnis“191 entgegenzutreten. Man braucht die Historiker offenbar auch dazu, methodische Ansätze für die Praxis handhabbar zu machen, sie zu entschlacken und sie somit ihrer Sperrigkeit zu berauben – Kritiker würden sagen: sie aufzuweichen – sowie ihre Anschlußfähigkeit an andere Methoden aufzuzeigen. Der Historiker Marten Düring entwickelt eine methodische Grundlage, die den Netzwerk-Ansatz für die Geschichtswissenschaften besser nutzbar machen soll192. Denn auch die qualitativen Netzwerk-Ansätze, welche die Nachbar-Disziplinen verwenden, sind für die Rekonstruktion historischer Zusammenhänge – beispielsweise in Ermangelung der im Zentrum der Methode stehenden ‚Interviewpartner‘ – für historische Themen kaum geeignet.193 2016 hat Düring gemeinsam mit anderen Autoren ein Grundlagenwerk für die ‚Historische Netzwerkanalyse‘, die er kurz ‚HNF‘ nennt, vorgelegt.194
190
191
192 193
194
chen, Experten befragen, wer ihrer Meinung nach eine zentrale Rolle in der Gesellschaft spielt und. ergänzend analysieren, wessen Entscheidungen ausschlaggebend für „Entscheidungssituationen“ waren. Vgl.: Loth, Wilfried: Beiträge der Geschichtswissenschaft zur Deutung der Europäischen Integration, in: ders.: Wessels, Wolfgang (Hrsg.): Theorien europäischer Integration, Opladen 2001, S. 87, zitiert nach: Kreis: Netzwerk, S. 17. Hoffman-Ocon, Andreas: Netzwerke in bildungshistorischer Perspektive – Versuch einer disziplintheoretischen Annäherung, in: Grunder: Netzwerke, S. 23–32 hier S. 27. Hofmann-Ocon nimmt Bezug auf einen erwähnenswerten Aufsatz in einem wichtigen Grundlagenwerk zur Netzwerk-Theorie: Vgl.: Reitmeyer, Morton/Marx, Christian: Netzwerkansätze in der Geschichtswissenschaft, in: Stegbauer, Christian/Häussling, Roger (Hrsg.): Handbuch Netzwerkforschung, Wiesbaden 2010, S. 869–880. Vgl.: Düring, Marten/Euman, Ulrich: Diskussionsforum Historische Netzwerkforschung, in: Geschichte und Gesellschaft, 39. Jg. (2013), S. 369–390. Vgl. dazu auch: Kaiser, Wolfram: Christdemokratische Netzwerke und die Genese Kerneuropas, in: Gehler, Michael/Kaiser, Wolfram/Leucht, Brigitte (Hrsg.): Netzwerke im europäischen Mehrebenensystem. Von 1945 bis zur Gegenwart, Wien/Köln/Weimar 2009, S. 87–104, hier S. 89. Vgl.: Düring, Marten/Eumann, Ulrich/Stark, Martin/Keyserlingk, Linda, von (Hrsg.): Handbuch Historische Netzwerkforschung. Grundlagen und Anwendungen, Berlin/ Münster 2016. Die Publikation ist in der Reihe des kulturwissenschaftlichen Instituts Es-
Einführung | 69
Daß sich Historiker, welche bereits Netzwerkanalysen zur Erforschung von sozialen Bewegungen, Organisationen und anderen Lobbygruppen leisten, besonders mit dem „Überlappen von Netzwerken“195 beschäftigen und dabei „herausstechende Führungsfigur[en]“196 beziehungsweise „Politische Unternehmer“197 identifizieren, oder aber die Rolle von „Meinungsbildnern aus der Zivilgesellschaft“ als sogenannte „Track II-Kontakte“198 in der zwischenstaatlichen Politik hinterfragen, bestärkt mich in meiner Überzeugung, daß der Netzwerk-Ansatz gerade für die Analyse von staatlichen und gesellschaftlichen Umbruchssituationen orientierungsleitend wirken kann. Daß die Historikerin Daniela Gasteiger ihre Dissertation über Graf Kuno von Westarp, mit der sie eine Verknüpfung von politischer Kulturgeschichte und Biographie leisten will, ebenfalls netzwerkanalytisch anlegt199, zeigt, daß die Methode auch gut dazu geeignet ist, einen biographischen Ansatz zu erweitern. Auffällig am Beispiel Westarp ist, nebenbei bemerkt, daß jene „Schlüsselfigur des deutschen Konservatismus“200, wie Theanolte Bähnisch, nicht nur Jurist und Verwaltungsbeamter, sondern auch Politiker und Publizist war. Die Netzwerkanalyse wird auch von Gasteiger als prädestiniert dazu angesehen, eine Person der Zeitgeschichte anhand der Schnittmengen zwischen verschiedenen Netzwerken darzustellen. Der Historiker Marten Düring sieht die Methode sogar als geeignet dazu an „manche alte historische Frontstel-
195 196 197
198
199
200
sen erschienen, das seit 2009 Veranstaltungen zum Thema ‚Historische Netzwerkanalyse‘ durchführt. Für die vorliegende Arbeit konnte das Handbuch aufgrund des Erscheinungsdatums jedoch keine Anwendung mehr finden. Vgl. deshalb auch Dürings Vorarbeiten in einem Sammelband: Düring, Marten/Keyserlingk, Linda von: Netzwerkanalyse in den Geschichtswissenschaften. Historische Netzwerkanalyse als Methode für die Erforschung von historischen Prozessen, in: Schützeichel, Rainer/Jordan, Stefan (Hrsg.): Prozesse, Formen, Dynamiken, Erklärungen, Wiesbaden 2012. Knudsen, Ann-Christina: Politische Unternehmer in transnationalen Netzwerken, in: Gehler/Kaiser/Leucht: Netzwerke, S. 105–120, hier S. 108. Ebd., S. 107. Ebd. Knudsen merkt an, daß verschiedenen Definitionen von ‚politischen Unternehmern‘ existieren. So beschreibe Adam Sheingate solche Personen als „individuals whose creative acts have transformative effects on politics, policies or institutions“. Christopoulus definiert sie als Menschen, die eine „gute Kenntnis eines bestimmten Politikfelds“ sowie „intellektuelle Kompetenz, strategische Vision und die Gabe Teams zu initiieren und zu leiten“ haben. Ebd. Rathkolb, Oliver: Sozialdemokratische Netzwerke in der europäischen Nahostpolitik, in: Gehler/Kaiser/Leucht: Netzwerke im europäischen Mehrebenensystem, S. 121–137, hier S. 122. Meier, Desiderius: Tagungsbericht: Leben verbinden. Beziehungen als Problem des Biografen, DoktorandInnen des Promotionsprogramms ‚ProMoHist‘, Ludwig-MaximiliansUniversität München in München am 14./15.07.2011, auf: http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/tagungsberichte/id=3789, 04.09.2011, am 13.03.2014. Projektbeschreibung von Daniela Gasteiger auf der Homepage der LMU München, http://www.promohist.geschichte.uni-muenchen.de/personen/doktorandinnen/gasteiger/ index.html, am 13.03.2014.
70 | Theanolte Bähnisch
lung“201 zu überwinden – womit er offensichtlich auf den zwischenzeitlich weitgehend beigelegten Konflikt zwischen Forschern, die biographischen Ansätzen folgen und solchen, die sich strukturgeschichtlichen Ansätzen verpflichtet fühlen, verweisen möchte. Ein großer Vorteil eines netzwerkanalytischen Zugangs zu meinem Thema ist, daß er den speziellen Nachkriegsbedingungen, unter denen Theanolte Bähnisch arbeitete, besonders gut gerecht werden kann. Denn netzwerkanalytische Ansätze setzen – im Gegensatz zur Organisations- und Institutionen-Analyse – kein regelgerecht funktionierendes System voraus, sondern fokussieren stattdessen auf die beteiligten Akteure. Sie werden damit den besonderen Umständen einer Staatswerdung und/oder Systemtransformation sowie einer (zivil-)gesellschaftlichen Neuorientierung, die den schrittweisen (Wieder-)Aufbau von Organisationen, Vereinen und Parteien umfaßt, gerecht.202 Am Beispiel Bähnischs läßt sich zeigen, daß die Netzwerkanalyse auch dazu geeignet ist, strategische Platzierungen von Lobbyistinnen der Frauenbewegung in verschiedenen Organisationen und Behörden aufzuzeigen. Der netzwerkanalytische Zugang läßt sich insofern besonders gut mit der Theorie Gramscis sowie mit einer diskursanalytischen Haltung kombinieren, als daß sich die deutsche Gesellschaft nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, im Zuge eines teilweisen Elitenaustauschs und einer teilweisen Elitenkontinuität vor dem Hintergrund eingeschränkter staatlicher Souveränität und der Anwesenheit alliierter Besatzungsmächte mit einer ganzen Flut von Orientierungsmöglichkeiten konfrontiert sah. Die Struktur der Arbeitswelt stand nach dem Kriegsende ebenso auf dem Prüfstand wie das Bildungssystem, das Pressewesen, die Kultur politischer Aushandlungsprozesse, das Familienleben und das Geschlechterverhältnis. Keineswegs war 1945 klar, welche Ideen in Deutschland – um mit Gramsci zu sprechen – ‚hegemonial‘ werden würden. Schließlich kämpften verschiedene Netzwerke um die Durchsetzung ihrer jeweiligen Überzeugungen. Dabei bildeten sich Allianzen zwischen deutschen und ausländischen Eliten, in denen sowohl Partei-Politiker, als auch Organisationsfunktionäre und Militär-Eliten eine Rolle spielten. Ihr gemeinsames Handeln wurde jedoch nicht notwendigerweise immer von den Mehrheits-Überzeugungen der entsprechenden Institutionen und Organisationen bestimmt und nicht alle einflußreichen Eliten gehörten solchen Zusammenschlüssen oder Institutionen überhaupt an. Die Rolle Theanolte Bähnischs in diesen Netzwerken herauszuarbeiten ist, insbesondere um die Logik ihres Handelns beim Aufbau des Deutschen Frauenrings begreifbar zu machen, unerläßlich. Eine Konzentration auf Netzwerke bietet sich aber auch deshalb an, weil Bähnisch sich nicht nur in der Frauenbewegung, sondern auch in der Europa-Bewegung verortete. Der Vorteil des netzwerkanalytischen Ansatzes gegenüber einem bewegungsanalytischen Zugang203 liegt nicht zuletzt darin begründet, daß sich
201 Düring/Eumann: Netzwerkforschung. 202 Vgl. dazu auch den Konferenzbericht von Kaufmann, Stefan: Konf.: Netzwerke – Modalitäten soziotechnischen Regierens, ETH Zürich 26.–28.09.2005, http://hsozkult. geschichte.hu-berlin.de/termine/id=4339, 02.09.2005. 203 Vgl. zu einer Theorie der sozialen Bewegungen: Raschke, Joachim: Soziale Bewegungen. Ein historisch-systematischer Grundriss, Frankfurt a. M. 1985. Vgl. als aktuellen Titel
Einführung | 71
mit Hilfe dieses Zugangs sowohl Verschränkungen zwischen verschiedenen Bewegungen204 durch das Herausarbeiten teilidentischer Netzwerke rekonstruieren lassen. Auch lassen sich Unterstützer von Bewegungen, die in die bewegungsinterne Dynamik nicht unmittelbar eingebunden waren, mit einem solchen Ansatz leichter ausmachen. Schließlich wäre auch Bähnischs Rolle als Regierungspräsidentin mit einem Organisationssoziologischen, bzw. bürokratietheoretischen Ansatz nach Weber nicht Genüge getan. Denn Bähnisch stellte sich, wie im entsprechenden Zusammenhang deutlich werden wird, explizit gegen vieles, was für Max Weber eine ‚Bürokratie‘ ausmachte und handelte entsprechend.205 Marten Düring nennt drei netzwerktheoretische Zugriffe von US-Wissenschaftlern, die sich seiner Meinung nach als „inspirierend und empirisch fruchtbar“206 für die Übertragung auf die Geschichtswissenschaften erwiesen haben: 1.) Mark Granovetters Theorie der ‚Strength of weak ties‘, die zeigt, daß gerade über die „lockeren – weniger dauerhaften, weniger intensiven“207 Verbindungen, die eine Person pflegt, neue Personen-Kreise erschlossen werden, 2.) Ronald Burts Theorie der ‚Structural holes‘, die sich mit Personen beschäftigt, welche „Brückenfunktionen“208 haben, also
204
205 206 207 208
auch: Kern, Thomas: Soziale Bewegungen. Ursachen, Wirkungen, Mechanismen, Wiesbaden 2008. Roland Roth und Dieter Rucht wollen erst dann von ‚Bewegungen‘ sprechen, „wenn ein Netzwerk von Gruppen und Organisationen, gestützt auf eine kollektive Identität, eine gewisse Kontinuität des Protestgeschehens sichert, das mit dem Anspruch auf Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels verknüpft ist“. Roth, Roland/Rucht, Dieter: Einleitung, in: Dies.: Bewegungen, S. 9–36, hier S. 13. Dieser Aspekt darf in beiden Fällen für das Engagement Bähnischs und ihren Mitstreitern als erfüllt gelten. Die Aussage Arno Klönnes, die deutsche Gesellschaft sei in den Jahren 1945 bis 1949 „aufs Ganze hin gesehen kein günstiges Terrain für die Entstehung politischer und sozialer Eigeninitiativen der Bürgerinnen und Bürger, soweit diese auf gesellschaftliche Gestaltung hätten zielen wollen“ gewesen (Klönne, Arno: Die unmittelbaren Nachkriegsjahre, in: Roth/Rucht: Bewegungen, S. 39–49, hier S. 40), wird im Kontext meiner Analyse zu hinterfragen sein, insbesondere wenn man berücksichtigt, daß Bähnisch – unter anderem – mit genau dem Umstand für ein Engagement in der Frauenbewegung warb, den Klönne als ‚Totschlagargument‘ für gesellschaftliches Engagement identifizierte: Der Fokus vieler Menschen in den direkten Nachkriegsjahren darauf, das eigene Überleben zu sichern. (Ebd., S. 41.) Klönnes Argumentation liegt offensichtlich ein basisdemokratisches Verständnis von ‚Bewegung‘ zugrunde, das Roth und Rucht nicht als Voraussetzung dafür ansehen, eine Bewegung als solche zu charakterisieren. Mit Recht weisen die Herausgeber des Sammelbands darauf hin, daß Bewegungen – entgegen der populären Sichtweise – nicht spontan und unorganisiert vorgehen, sondern Organisationen zur erfolgreichen Mobilisierung benötigen. Vgl.: Roth/Rucht: Einleitung, S. 25. Vgl. zur Verwendung des Begriffs durch Weber: Krätke, Michael: Art.: „Bürokratie“, in: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, Bd. 2, Hamburg 1995, Sp. 405–430. Düring/Eumann: Netzwerkforschung, S. 372. Ebd. Ebd.
72 | Theanolte Bähnisch
Verbindungen zwischen verschiedenen Netzwerken herstellen und 3.) Stanley Milgrams Theorie des ‚Small World-Phenomenon‘, die beschreibt, wie eng Menschen, die räumlich weit voneinander entfernt sind, miteinander verbunden sein können. Außerdem verweist Düring auf die Komplementarität von Bourdieus Begriff des ‚sozialen Kapitals‘ mit der Netzwerkanalyse. Bourdieu habe betont, so Düring, daß der Umfang des Sozialkapitals eines Akteurs von der Ausdehnung des Netzes der Beziehungen abhängt, die er mobilisieren kann, sowie von dem Umfang des ökonomischen, kulturellen oder symbolischen Kapitals, das seine Kontakte besitzen.209 Als besonders relevante Personen in einem Netzwerk stuft Düring vor dem Hintergrund der beschriebenen Ansätze solche Menschen ein, die besonders viele Kontakte pflegen, solche, die in einer Position stehen, welche ihnen ermöglicht, zu möglichst vielen anderen ‚Gruppenmitgliedern‘ Kontakt aufzunehmen und solche, die mit besonders wichtigen Personen in Verbindung stehen – allesamt Aspekte, die auch auf Theanolte Bähnisch zutreffen.210 Daß die theoriegeleiteten Konzepte, die Düring auf dieser Grundlage entwickelt, nicht immer zu den (ersten) empirischen Befunden passen, wertet er als einen Vorteil des Zugangs: Gerade dieses ‚Problem‘, so Düring, könne ein Hinweis auf eventuell existierende, aber nicht notwendigerweise wahrgenommene oder in den Quellen belegbare Handlungspotentiale sein.211 Warum ‚Akteur X‘ seine gute Position also nicht genutzt hat, warum ‚Akteur Y‘ trotz seiner scheinbar peripheren Position großen Einfluß nehmen konnte, solche Fragen können Düring zufolge, „Hinweise auf handlungshemmende Faktoren, fehlende Quellenbestände oder bisher unerkannte Abläufe und Zusammenhänge liefern“212 Auf eine graphische Darstellung von Netzwerken mit „Knoten und Kanten“213, wie Düring sie entwickelt hat, möchte ich für meine Analyse verzichten. Was für eine biographische Arbeit unerläßlich ist, nämlich sich – trotz einer breiten Kontextualisierung – vor allem auf eine Person zu konzentrieren, würde dazu führen, daß die untersuchte Person in einer graphischen Darstellung eine Relevanz in den untersuchten Netzwerken erhalten würde, die die Realitäten möglicherweise verzerrt. Dürings Visualisierungsansatz ist nämlich darauf ausgerichtet, daß viele Personen mit der gleichen Intensität untersucht werden, bevor die Visualisierung der Ergebnisse erfolgt.
209 Vgl.: Düring/Eumann: Netzwerkforschung, S. 372. Zum Begriff des ‚sozialen Kapitals‘ vgl.: Bourdieu, Pierre: Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital, in: Baumgart, Franzjörg (Hrsg.): Theorien der Sozialisation, Bad Heilbrunn 1997, S. 217–231, hier S. 226. 210 Vgl.: Düring/Eumann: Netzwerkforschung, S. 382. 211 Ebd. 212 Ebd. 213 Ebd., S. 379.
Einführung | 73
1.7.4 Biographie-Theorie 1.7.4.1 Rekonstruktion von Lebenskonstruktion Von der mangelnden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Genre ‚Biographie‘, die der Medienhistoriker Stefan Zahlmann noch im Jahr 2003 konstatierte214, kann heute keine Rede mehr sein. Der Germanist Christian Klein gab 2002 ein auch für Historiker geeignetes Grundlagenwerk zu Theorie und Praxis des biographischen Schreibens heraus215, 2009 legte er ein vielbeachtetes, hochgelobtes, ebenfalls interdisziplinär verwendbares Handbuch zur Biographie-Theorie nach.216 Neben der sehr aktuellen Einführung des Münchner Historikers Thomas Etzemüller217 und zwei grundlegenden Sammelbänden218 des Wiener Germanisten Bernhard Fetz sind verschiedene Werke erschienen, die die Biographie-Theorie mit anderen Theorien, beispielsweise der ‚Gender-Theorie‘219, kombinieren. Andere Studien widmen sich speziell autobiographischen Zeugnissen.220 Neben den Historikern und den Germanisten setzen sich traditionell wie aktuell vor allem auch Soziologen221 und Erziehungswissenschaftler222 mit dem Genre auseinander. Theoretische und methodische Literatur zum Thema ‚Biographie‘ erschien nicht erstmalig im 21. Jahrhundert – wie man 2003, als der Buchmarkt einen „Boom der
214 Vgl.: Zahlmann, Stefan: Rezension zu: Klein, Christian (Hrsg.): Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens. Stuttgart 2002, in: H-Soz-uKult, 16.06.2003, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2003-2-154, am 20.03.2014. 215 Vgl.: Klein, Christian (Hrsg.): Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens, Stuttgart 2002. 216 Vgl.: Klein, Christian (Hrsg.:) Handbuch Biographien. Methoden, Traditionen, Theorien, Stuttgart 2009. 217 Vgl.: Etzemüller, Thomas: Biographien, Frankfurt a. M. 2012. 218 Vgl.: Fetz, Bernhard (Hrsg.): Die Biographie. Zur Grundlegung ihrer Theorie, Berlin 2009; ders./Huemer, Georg(Hrsg.): Theorie der Biographie. Grundlagentexte und Kommentar, Berlin 2011. 219 Vgl.: Dausien, Bettina: Biographie und Geschlecht. Zur biographischen Konstruktion sozialer Wirklichkeit in Frauenlebensgeschichten, Bremen 1996 sowie Lühe, Irmela von/Runge, Anita (Hrsg.): Biographisches Erzählen, Köln 2001. 220 Vgl.: Heinze, Carsten/Hornung, Alfred: Medialisierungsformen des Autobiographischen, Konstanz 2013 sowie Depkat: Lebenswenden. Vgl. auch: ders.: Autobiographie und die soziale Konstruktion von Wirklichkeit, in: Geschichte und Gesellschaft, Bd. 29 (2003), S. 441–476. 221 Für Soziologen, aber mit Mehrwert für den ‚Oral-History‘-Ansatz in den Geschichtswissenschaften erschien: Fuchs-Heinritz, Werner: Biographische Forschung. Eine Einführung in Praxis und Methoden, 4. Aufl., Wiesbaden 2009. 222 Vgl.: Paschelke, Sarah: Biographie als Gegenstand von pädagogischer Forschung und Arbeit: Möglichkeiten einer konstruktiven pädagogischen Biographiearbeit, Bad Heilbrunn 2013.
74 | Theanolte Bähnisch
Lebensbeschreibungen“223 erfuhr – hätte glauben können. Bereits im 19. Jahrhundert existierten Handreichungen über das Verfassen einer Biographie.224 Eine Geschichte der Biographieforschung in den Geschichtswissenschaften soll an dieser Stelle nicht erfolgen, konstatiert werden soll nur soviel: Die Kritik sozial- und strukturgeschichtlicher Ansätze in den 1960er und 1970er Jahren an der Biographie-Forschung hatte das Genre in der deutschen Geschichtswissenschaft fast zum Aussterben gebracht. Schon Ende der 1970er und verstärkt in den 1980er Jahren kamen jedoch Titel auf den Markt, die sich anschickten, die wissenschaftiche Biographie als Genre zu rehabilitieren. Sie griffen die Kritik aus den Sozialwissenschaften, daß der Fokus auf eine Person den Blick auf gesellschaftliche Strukturen versperre, auf und suchten vor diesem Hintergrund nach einer neuen, kritischeren Biographik. Diese sollte die künstlich erzeugte Kluft zwischen ‚Individuum‘ und ‚Gesellschaft‘ überwinden helfen und sich ihrem Gegenstand insgesamt aus einer kritischeren Perspektive nähern. Der Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers konstatierte bereits 1974 in diesem Sinn: „Gegenstand von Biographien sind Personen in Handlungskontexten, weder nur Personen noch nur Handlungskontexte. Es ist sinnlos, die Dialektik von Individuum und Gesellschaft zu einer Alternative von Individuum und Gesellschaft zu machen“, weshalb, so Oelkers „die Rekonstruktion von historischen Figuren im Verhältnis von Interaktions- und Systemebene mit den je gegenwärtigen Mitteln der historischen Arbeit“225 die Aufgabe eines Biographen sei. Vier Jahre später schrieb der NeuzeitHistoriker Hagen Schulze, das gleiche meinend, daß die „Frontstellung“ zwischen Personengeschichte auf der einen und Sozial- und Strukturgeschichte auf der anderen Seite sogar „wissenschaftstheoretisch und wissenschaftspolitisch“ schädlich sei.226 Das Bedürfnis, aus der Defensive heraus gegen alle Unkenrufe biographisch zu arbeiten, um Aussagen über die Gesellschaft treffen zu können, schlägt sich auch in einem Sammelband der Soziologen Martin Kohli und Günther Robert aus dem Jahr 1984 nieder.227 Für die Geschichtswissenschaften besonders interessant ist der darin enthaltene Aufsatz Heinz Budes.228 Der Makrosoziologe Bude folgte schon damals einer Idee, die in der Biographie-Theorie zwischenzeitlich stark an Relevanz gewon-
223 Zahlmann: Rezension zu Klein: Grundlagen. Jener Boom spiegelt sich auch in dem Umstand wieder, daß das Thema auf geschichtswissenschaftlichen Fachtagungen diskutiert wurde. Vgl. den Tagungsband: Bödeker, Hans Erich (Hrsg.): Biographie schreiben, Göttingen 2003. 224 Vgl.: Stein, Ludwig: Zur Methodenlehre der Biographik. Mit besonderer Rücksicht auf die biographische Kunst im Dienste der philosophiegeschichtlichen Forschung, in: Biographische Blätter, Bd. 1 (1895), S. 22–39. 225 Oelkers, Jürgen: Biographik – Überlegungen zu einer unschuldigen Gattung, in: Neue Politische Literatur, Bd. 19 (1974), S. 296–309, hier S. 309. 226 Hagen Schulze 1978, ohne genauere Quellenangabe zitiert in Ullrich: Königsdisziplin. 227 Vgl.: Kohli, Martin/Roberts, Günter (Hrsg.): Biographie und soziale Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven, Stuttgart 1984. Vgl. auch Voges, Wolfgang: Methoden der Biographie und Lebenslaufforschung, Opladen 1987. 228 Vgl.: Bude, Heinz: Rekonstruktion von Lebenskonstruktion – eine Antwort auf die Frage, was die Biographieforschung wirklich bringt, in: Kohli/Roberts: Biographie, S. 7–28.
Einführung | 75
nen hat229, nämlich der ‚Konstruktion des Selbst‘ durch Personen, die über ihr eigenes Leben Auskunft geben und die Gefahr, daß der Forscher die Perspektive der betreffenden Person zu unkritisch übernehmen könnte. Dasselbe befürchtet auch Pierre Bourdieu, wenn er den Biographen davor warnt, sich zum ‚Komplizen‘ des Biographierten zu machen230 und einer ‚biographischen Illusion‘231 – also der Vorstellung eines kohärenten Zusammenhangs von Erfahrungen, Erlebnissen und Handlungen im Leben einer Person – aufzusitzen. Sich diese Gefahren bewußt zu machen gehört zu den Kernaufgaben eines wissenschaftlichen Biographen. Nichtsdestotrotz möchte ich – um mit Volker Ullrich zu sprechen – in meiner Arbeit „nach entscheidenden Prägungen, nach Determinanten des Handelns“232 von Theanolte Bähnisch fragen und vor allem auch Zusammenhänge zwischen der Sozialisation der Juristin und ihrem Handeln nach 1945 aufzeigen. Sich dabei an den Forderungen Heinz Budes zu orientieren, ist hilfreich dafür, die ein oder andere Klippe zu umschiffen. Bude erklärt es zur Aufgabe des Forschers, gerade die – mehr oder weniger bewußte – Inszenierung des Selbst durch die analysierte Person zum Thema zu machen und eine ‚Rekonstruktion von Lebenskonstruktion‘ zu leisten.233 Der Germanist Christian von Zimmermann vertritt mit seinem Statement, daß die Biographie-Forschung „nach der narrativen und rhetorischen Konstruiertheit“234 von Lebensläufen fragen müsse, eine ganz ähnliche Position. In jener sich fächerübergreifend durchsetzenden Sichtweise235 ist es also weniger die Aufgabe des Biographen, den Lebensweg der betreffenden Person nachzuzeichnen, als den Inszenierungs- und Konstruktionscharakter dieses Lebens zu beschreiben und zu erklären. Mich der Forderung Budes anzuschließen und das Genre der wissenschaftlichen Biographie (auch) als eine Rekonstruktion von Lebenskonstruktion zu begreifen, ermöglicht mir, den Umstand, daß Bähnisch selbst versuchte, ihr Leben und Handeln als möglichst stringent und ‚passend‘ zur jeweiligen Situation darzustellen, kritisch zu reflektieren. Es erscheint insbesondere vor diesem Hintergrund besonders lohnenswert, zu analysieren, inwiefern sie womöglich Aspekte ihres Lebens vor 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zweckgebunden unerwähnt läßt, oder, aus der Retrospektive betrachtet, als weniger bedeutsam darstellt oder besonders betont. Eine solche Herangehensweise verspricht nicht nur Aufschlußreiches über die Biographie Bähnischs an sich zu Tage zu fördern, sondern kann auch zu neuen Schlüssen aus der Genese größerer Zusammenhänge
229 Vgl.: Alkemeyer, Thomas/Budde, Gunilla/Feist, Dagmar (Hrsg.): Selbst-Bildungen: Soziale und kulturelle Praktiken der Subjektivierung, Bielefeld 2013. 230 Vgl.: Bourdieu, Pierre: Die biographische Illusion, in: Bios, 1/1990, S. 75–81, hier S. 76. 231 Vgl.: ebd. 232 Ullrich, Volker: Biografie. Die schwierige Königsdisziplin, in: Die Zeit, 09.04.2007. 233 Vgl.: Bude: Rekonstruktion. 234 Zimmermann, Christian von: Exemplarische Lebensläufe. Zu den Grundlagen der Biographik, in: ders./Zimmermann: Frauenbiographik, S. 3–16, hier S. 16. 235 Vgl. dazu beispielhaft auch die Position des Historikers Wilhelm Füßl: Füßl, Wilhelm: Zwischen Mythologisierung und Dekonstruktion, in: ders./Ittner, Stefan (Hrsg.): Biographie und Technikgeschichte (BIOS. Sonderheft Nr. 11/2008), Leverkusen 1999, S. 59– 69, hier S. 62/63.
76 | Theanolte Bähnisch
führen, an denen Bähnisch maßgeblich beteiligt war. Dies trifft vor allem auf die Entwicklung der organisierten Frauenbewegung in Deutschland nach 1945 zu. Die Vorstellung, man sei durch den beschriebenen Zugang vor allen Fallstricken gefeit, die beim Schreiben einer Biographie auftreten können, trügt jedoch. Auch die ‚Rekonstruktion einer Lebenskonstruktion‘, beziehungsweise der Versuch, ‚gestaltetes Leben‘ abzubilden, kommt nicht ohne ein gewisses Maß an Konstruktion durch den Biographen aus. Die Vorerfahrungen, Einstellungen und Vorlieben des Bearbeiters fließen zwangsläufig in dieses Konstrukt mit ein. „Jede Lebensbeschreibung“ gibt, so konstatiert der Historiker Volker Ullrich „auch etwas Preis von ihrem Autor selbst, und es wäre gut, wenn er diesen Zusammenhang nicht unreflektiert ließe, sondern sich ihn bewußt machte und darüber Auskunft gäbe.“236 Ullrich erwähnt jedoch selbst zwei in diesem Zusammenhang wichtige Punkte nicht: Erstens, daß nicht nur Lebensbeschreibungen, sondern auch andere (geschichtswissenschaftliche) Publikationen subjektiven Prägungen durch ihre Autoren unterliegen,237 und zweitens, daß die offensive Reflexion des Biographen über Faktoren wie die eigene Geschlechtsidentität, den eigenen Bildungsweg, die eigene Vorliebe für die Auseinandersetzung mit einer bestimmten Epoche, seine politische Haltung, seine persönlichen Erfahrungen und vieles mehr auch zur Annahme von Kausalitäten verführen kann, die womöglich nicht gegeben sind. Man hüte sich deshalb auch vor jener Form der ‚biographischen Illusion‘ (Bourdieu), welche die Annahme mit sich bringt, die Herangehensweise eines Autors an ein Thema müsse sich zwangsläufig auf diese oder jene Erfahrung oder Prägung zurückführen lassen. Die Verfasserin zieht es vor diesem Hintergrund vor, die ohne Zweifel notwendige Reflexion über eigene Prägungen und ihre möglichen Auswirkungen auf ihre wissenschaftliche Arbeit im Stillen vorzunehmen. Der beschriebene Ansatz Heinz Budes ist schon per se eine vielversprechende Grundhaltung, um sich einer Biographie verstehend-kritisch238 anzunähern, sie vermag jedoch auch dem Umstand, daß sich die vorliegende Arbeit mit einer hohen Beamtin auseinandersetzt und den Fokus der Analyse auf die Jahre 1945 bis 1952 legt, besonders gut Rechnung zu tragen. Denn während der Besatzungszeit bestand für Personen, die 1945 in einer Funktion in der Politik und/oder Verwaltung oder an einem anderen neuralgischen Punkt der Gesellschaft – beispielsweise im Rundfunk oder in der Presse – arbeiten wollten, eine besonders starke Motivation, ihr bisheriges Leben zu reflektieren und sich gegebenenfalls selbst als Person (neu) zu ‚entwerfen‘, um den (womöglich nur vermeintlich) bestehenden Verhältnissen Rechnung zu tragen.
236 Ullrich: Königsdisziplin. 237 Daß Ullrich selbst die Meinung vertritt, eine Biographie dürfe nur schreiben, wer sich sprachlich gut auszudrücken vermag (vgl.: ebd.) ist hierfür ein gutes Beispiel. Denn diese Bemerkung transportiert mehr Informationen über die persönlichen Präferenzen des Autors als über das Genre ‚Biographie‘. 238 Nentwig: Kopf, S. 42, in Anlehnung an Wehler, Hans Ulrich: Zum Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Psychoanalyse, in: ders.: Geschichte und Psychoanalyse, Köln 1971, S. 19/20.
Einführung | 77
1.7.4.2 Autobiographische Texte und andere Selbstzeugnisse Die Analyse autobiographischer Zeugnisse und anderer Selbstzeugnisse oder auch ‚Ego-Dokumente‘239 ist, wenn es um die ‚Rekonstruktion von Lebenskonstruktion‘ geht, naheliegend. Volker Depkat liest aus den von ihm untersuchten autobiographischen Texten preußischer Eliten in der Weimarer Republik heraus, daß jene Personen einer starken intrinsischen Motivation nachgingen, als sie ihr eigenes Leben an jener „Zeitenwende“240 reflektierten.241 An dieser Äußerung Depkats zeigt sich jedoch, daß autobiographische Zeugnisse, wie prinzipiell alle historischen Quellen, mit Vorsicht interpretiert werden müssen. Schließlich darf nicht vergessen werden, daß der von Depkat beschriebenen intrinsischen Motivation gerade zu jener Zeit eine nicht minder wirkmächtige extrinsische Motivation, Auskunft über das eigene Leben vor 1945 zu geben, gegenüberstand, ob im ‚Fragebogen der Militärregierung‘242 oder gegenüber anderen kritischen Zeitgenossen. Dies galt insbesondere für Personen, die (wieder) im Licht der Öffentlichkeit standen. Ebenfalls kritisch zu hinterfragen ist der Versuch Depkats, in seiner Sammel-Interpretation verschiedener Autobiographien das ‚Leiden‘ zu beschreiben, welches die untersuchten Personen dem Autor zufolge durchlebt hätten, als sie sich ihrer Geschichte ‚stellten‘.243 Eine kritische Distanz zu Selbstzeugnissen zu wahren, bedeutet doch, folgt man der Kulturhistorikerin Dagmar Günther, zumindest in Erwägung zu ziehen, daß dort, wo Tränen behauptet werden, eventuell gar keine geflossen sind244 und daß Erlebnisse und Gefühle, die in einem Selbstzeugnis beschrieben werden, ebenso gut einer angenommenen Erwartung der Rezipienten entspringen können. Wiederholt wurde gefordert, autobiographische Texte sowie andere Selbstzeugnisse vor allem auf ihren Entstehungskontext hin kritisch zu prüfen.245 Nimmt man
239 240 241 242
Zum Begriff siehe Anm. 73 in Kapitel 7.1.4. Depkat: Lebenswenden. Ebd., S. 126. Der Schriftsteller Ernst Salomon führte in seinem autobiographischen Roman ‚Der Fragebogen‘ den Glauben der Alliierten, sie könnten auf der Basis der Fragen in diesen Bögen einschätzen, welches Leben eine Person bis 1945 gelebt habe und ob diese ein ‚Nazi‘ gewesen sei, ad absurdum. Der Roman gehört zu den meistgelesenen Werken seiner Zeit. Vgl.: Salomon, Ernst: Der Fragebogen, Hamburg 1951. 243 Depkat schreibt, der Prozeß des Scheibens sei für die Protagonisten jeweils „schmerzhaft“ bis „traumatisch“ gewesen. Depkat: Lebenswenden, S. 504. Er spricht auch von der „Autobiographie als Selbsttherapie.“ Ebd., S. 101–117. 244 Vgl.: Günther, Dagmar: And for now something completely different. Prolegomena zur Autobiographie als Quelle der Geschichtswissenschaft, in: Historische Zeitschrift, Bd. 272 (2001), S. 25–61, hier S. 42. Vgl. dazu auch Etzemüller: Biographien, S. 64. 245 Vgl. dazu beispielsweise die Beiträge des Sammelbands: Brechtken, Magnus (Hrsg.): Life Writing and Political Memoir – Lebenszeugnisse und Politische Memoiren, Göttingen 2012.
78 | Theanolte Bähnisch
an, daß Personen der Zeitgeschichte ihr ‚unternehmerisches Selbst‘246 jeweils nach den gefühlten Notwendigkeiten einer Zeit, eines Ortes und eines Verwendungszusammenhangs entwerfen, so ergänzt diese Forderung Budes Ansatz, der diesen Gedanken implizit bereits beinhaltet, mustergültig. Besonders aussagekräftig wird die Analyse, wenn sich zeigen läßt, daß Personen zu verschiedenen Zeiten gleiche Zusammenhänge verschieden darstellten oder ihre Darstellungen nachweisbar zu einem späteren Zeitpunkt überarbeiteten. Nachbearbeitungen oder Kommentierungen – eventuell auch Kassationen – durch Nachfahren lassen schließlich auch Schlußfolgerungen über die Tradierung der Selbstdarstellung einer Person im Familiengedächtnis zu. In autobiographischen Texten auf die Suche nach ‚Wahrheiten‘ zu gehen, ist – entgegen der Behauptung des Soziologen und Biographieforschers Carsten Heinze247 – in aktuellen geschichtswissenschaftlichen Publikationen nicht verbreitet. Die kritische Distanz, mit denen sich nicht nur Soziologen und Kulturwissenschaftler, sondern auch Historiker Autobiographien nähern, hat sogar eine lange Tradition: Bereits Leopold von Ranke hatte davor gewarnt, ‚Memoiren‘ mit ‚Geschichte‘ zu verwechseln.248 Zu Recht verweist Heinze in seiner Rezension jedoch auf einen weiteren problematischen Aspekt im Vorgehen Depkats. Dieser strebt nämlich an, über die Analyse von Autobiographien einen „Durchgriff auf eine dahinterstehende historische Realität“249 zu leisten. Depkat vertritt die Meinung, daß Autobiographien keineswegs – wie es die Soziologin und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann darstellt250 – frei konstruiert seien, sondern, daß es sich dabei um „empiriegesättigte
246 Der Soziologe Ulrich Bröckling versteht darunter die Neigung, den eigenen Lebenslauf so zu optimieren, daß er zu den angenommenen Erfordernissen der Zeit und des Umfelds paßt. Vgl.: Bröckling: Selbst. 247 Vgl.: Heinze, Carsten: Identität und Geschichte in autobiographischen Lebenskonstruktionen, Wiesbaden 2009, S. 101. 248 „Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Memoiren und Geschichte? In den ersteren walten die Erinnerungen des Autors vor, und es ist ihres Amtes, die persönlichen Verhältnisse zu erläutern. Der Geschichtsschreiber muß dagegen auf der Hut sein, sich von diesen Erinnerungen fortreißen zu lassen. Denn in dem Persönlichen liegt es, daß es häufig nicht einmal verifiziert werden kann: der Eindruck, den der Handelnde von Freunden oder Gegnern erfuhr, ist dabei immer im Spiele; selbst wenn man beide Parteien hört, wird es nur selten möglich, ein Urtheil zu fällen.“ Ranke, Leopold von: Vorrede zu den Denkwürdigkeiten, in: Sämtliche Werke, Bd. 46, 3. Aufl., Leipzig 1879, S. XI–XIII, hier S. X, zitiert nach: Herzberg, Julia: Autobiographik als historische Quelle in ‚Ost‘ und ‚West‘, in: dies./Schmidt, Christoph (Hrsg.): Vom Wir zum Ich. Individuum und Autobiographik im Zarenreich, Köln 2007, S. 15–62, hier S. 20. 249 Vgl.: Depkat: Lebenswenden, S. 22. Depkat gelangt zu weiteren problematischen Aussagen. Beispielsweise ist seine These, allen untersuchten Autobiographien liege das Bemühen zu Grunde, zu einem „subjektiv wahrhaftigen Bericht über das eigene Leben und die eigene Zeit zu kommen“, fragwürdig. Vgl.: Ebd, S. 504. 250 Vgl.: Assmann, Alaida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 2009, S. 15; S. 27–29
Einführung | 79
Konstruktionen“ handle, mit denen „tatsächlich gelebte Leben und reale Zeitverläufe im 20. Jahrhundert narrativ ausgedeutet wurden“251. Diese Aussage Depkats birgt wiederum einen wahren Kern in sich: Selbstverständlich beziehen sich Verfasser von Autobiographien auf Mitmenschen, die nachweislich lebten, auf Orte, die nachweislich existier(t)en, und auf Ereignisse, die nachweislich stattgefunden haben. Von einer völlig freien Konstruktion zu sprechen, wie Assmann es tut, erscheint daher als zu radikal. Assmanns Theorie des kulturellen Gedächtnisses und Depkats Suche nach der ‚Realität‘ in Autobiographien sind völlig konträre Herangehensweisen. Sie beinhalten jedoch – für sich genommen und an ihrem jeweiligen Erkenntnisanspruch gemessen – jeweils Feststellungen, die nicht von der Hand zu weisen sind. Die unterschiedlichen Ansätze laden dazu ein, einen Zwischenweg beim Schreiben einer biographischen Arbeit zu gehen: Das Ziel Leopold von Rankes, zu erzählen „wie es eigentlich gewesen“ ist, muß nicht nur für die Auseinandersetzung mit Autobiographien, sondern insgesamt als unerfüllbar verworfen, die Existenz einer absoluten Realität verneint werden. Wer eine Biographie schreibt, ist angehalten, sich stets vor Augen zu halten, daß Personen, die ihr eigenes Leben reflektieren, bewußt oder unbewußt, Sinninhalte konstruieren und daß ein Forscher ebenfalls Prägungen unterliegt, die Einfluß auf seine Darstellung der Zusammenhänge haben. Sich über diese Zusammenhänge klar zu sein, muß jedoch nicht bedeuten, daß eine biographischeArbeit ausschließlich Aussagen darüber liefern darf, wer wann, was, wo, wie, mit wem zusammen und warum konstruiert haben könnte. Ich möchte das Wirken Theanolte Bähnischs nicht nur im Hinblick auf ihre Selbstkonstruktion untersuchen, sondern – im Wissen, daß dies kaum zu trennen ist – auch den Versuch unternehmen, ihr darüberhinausgehendes Handeln in den historischen Kontext einzuordnen und nachvollziehbar machen, warum in diesem Kontext ein entsprechender Handlungsspielraum der untersuchten Person bestand. Eine biographische Arbeit, die einen solchen Anspruch verfolgt, kann sich nicht auf die Analyse autobiographischer Texte und anderer Selbstzeugnisse beschränken. Sie muß andere Quellen und Literatur hinzuziehen, aus der die Umstände, unter denen eine Person zu einer Zeit, an einem Ort, im Kontakt mit anderen Menschen und – eventuell – eingebunden in die Logiken von Institutionen, Organisationen und Initiativen gelebt hat. Dabei Interpretationen zu leisten und Hypothesen aufzustellen, läßt sich nicht nur nicht vermeiden, sondern gehört, auch auf die Gefahr hin, Zusammenhänge zu konstruieren, zu stark zu betonen, zu wenig zu reflektieren oder schlichtweg nicht zu verstehen, zu den Kern-Aufgaben des Biographen. Er tut gut daran, dem Schriftsteller und Mozart-Biographen Wolfgang Hildesheimer zu folgen und sich ein „Kalkuliertes Scheitern“ zur „Maxime“252 seiner Arbeit zu setzen. Daß er versuchen muß, sich einer objektiven Darstellung zumindest anzunähern, steht außer Frage. Wenn die Quellenlage es ermöglicht, bietet es sich an, Ereignisse und Zusammenhänge nicht nur aus dem Blickwinkel der hauptsächlich agierenden Person, sondern aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und anhand der Zusammenschau
251 Ebd., S. 505. 252 Nalepka, Cornelia: Kalkuliertes Scheitern als biographische Maxime. Zu Wolfgang Hildesheimer: „Die Subjektivität des Biographen“ in: Fetz/Huemer: Biographie, S. 297–301.
80 | Theanolte Bähnisch
der Quellen aufzuzeigen, daß es nicht nur eine Interpretationsmöglichkeit der Vergangenheit gibt. Auf diesem Weg lassen sich Aussagen darüber treffen, wie stark verschiedene überlieferte Deutungsmöglichkeiten voneinander differieren, welche Verbreitung die verschiedenen Positionen erfuhren und wie einflußreich sie auf dieser Grundlage gewesen sein könnten. Bezogen auf die Entwicklungsschübe, welche die überparteilich agierende Frauenbewegung in Westdeutschland jeweils auf den von ihr gestalteten, interzonalen Konferenzen erfuhr, läßt sich eine solche Zusammenschau vergleichsweise gut leisten. Die Verschiedenheit der Erwartungen, mit denen Bähnisch in diesem Zusammenhang konfrontiert war, zeigt, ebenso wie die Bewertung ihres Tuns, daß nicht nur eine ‚Wahrheit‘ der Abläufe auf den interzonalen Frauenkonferenzen existiert und daß Bähnisch als eine der Hauptverantwortlichen kein Interpretationsmonopol der Vorgänge und ihres Handelns hatte. Gerade ihr offenkundiger Versuch, ihre Interpretation der Dinge in der Verbandsgeschichte des DFR und damit in der kollektiven Erinnerung zu verankern, deutet darauf hin, daß (auch) andere Interpretationen der Zusammenhänge naheliegend waren. Daß ihr Vorgehen am Ende akzeptiert wurde, steht wiederum auf einem anderen Blatt. Es läßt sich erklären, indem man ihre Position in verschiedenen Netzwerken, beziehungsweise ihre Kontakte zu verschiedenen Entscheidungsträgern und Beratern analysiert. 1.7.4.3 Biographie und Geschlecht Thomas Etzemüller schreibt in seiner Einführung in die Biographie-Theorie, daß, „wo Daten gebraucht werden […] Lücken in autobiographischen Aufzeichnungen und im Quellenkorpus durch immer emsigere Recherche oder […] Hypothesen verfüllt werden sollten“253. Selten werde, so Etzemüller, die „biographische Essenz“254 in der Lücke selbst gesucht. Es bietet sich jedoch durchaus an, ‚Lücken‘ selbst zum Thema zu machen.255 Eventuell gibt es über eine Zeit, aus der zu einem bestimmten Thema keine Quellen existieren, schlichtweg nichts besonderes zu berichten, da die betreffende Person in diesem Zusammenhang gar nicht in Erscheinung getreten ist. Dieser Gedanke kann auch dann weiterführend sein, wenn man – wie in Bähnischs Fall – mit einer Paarbeziehung konfrontiert ist, in der nicht immer beide Partner in einer für die Nachwelt ‚sichtbaren‘ Form handelten. Auf Frauen trifft dies, wie verschiedene Soziologinnen herausgearbeitet haben, insgesamt häufiger zu als auf Männer. Die Forscherinnen zeigen, daß Biographien von Frauen häufig von einer ‚Springer-Mentalität‘ zwischen Beruf und Familie geprägt sind256 und daß sie ihr Leben deshalb als ‚halbiertes‘, ‚doppeltes‘, oder ‚brüchiges‘ Leben etc. wahrnehmen, beziehungsweise darstellen.257 Es lohnt sich, zu fragen, inwiefern dies immer auch die tatsächlichen Lebensverhältnisse von (berufstätigen) Frauen und Müttern widerspiegelt
253 254 255 256
Etzemüller: Biographien, S. 47. Ebd. Vgl.: ebd. Vgl.: Ostner, Ilona: „Emanzipation durch Arbeit?“. Ariadne, 15. Jg. (2000), Heft 37/38, S. 72–76 sowie Dausien: Biographie. 257 Vgl. zu den verschiedenen Befunden von Sozialwissenschaftlerinnen: Dausien: Biographie, S. 44–74.
Einführung | 81
oder ob diese scheinbar soziologisch gesicherten Tatsachen nicht zumindest in einigen Fällen ebenfalls ‚Selbstkonstrukte‘ der betreffenden Personen sein könnten. Theanolte Bähnischs ‚Fall‘ ist insofern besonders interessant, da sie selbst dazu neigte, sich als stets umtriebig und selbständig darzustellen. Doch läßt sich dies tatsächlich für alle Phasen ihres Lebens bestätigen? Und war nur ihre Mutterrolle ausschlaggebend für Phasen der beruflichen Stagnation? Das für die vorliegende Arbeit gewählte Vorgehen, einige Quellen- und Selbstdarstellungslücken durch solche Quellen zu ‚schließen‘, welche primär Erkenntnisse über Theanolte Bähnischs Ehemann zulassen, birgt ohne Zweifel die Gefahr, zu stark auf einem von Theanolte Bähnisch selbst vorgezeichneten Weg zu argumentieren. Wie im entsprechenden Zusammenhang weiter ausgeführt werden wird, war ihr daran gelegen, den Eindruck zu vermitteln, daß sie und Albrecht Bähnisch eine ‚Einheit‘ gewesen seien, vor allem, was die berufliche Zusammenarbeit in den 1920er und 1930er Jahren angeht, und daß die gemeinsamen Jahre der Zusammenarbeit mit ihrem Mann die schönsten ihres Lebens gewesen seien. Ohne Zweifel birgt das gewählte Vorgehen aber auch besondere Chancen: Beispielsweise läßt sich durch eine Analyse der Quellen, die Auskunft über Albrecht Bähnisch geben, die Tragweite der von Theanolte Bähnisch beschriebenen ‚Einheit‘ mit ihrem Mann, aber auch der Stellenwert ihrer Person unter den preußischen Eliten und der Grad ihrer Selbständigkeit kritisch hinterfragen. Die Ergebnisse lassen sich mit ihren Aussagen zur Berufstätigkeit von Frauen sowie von Ehe und Familie in Beziehung bringen. Ob ihre Ehe mit Albrecht Bähnisch tatsächlich so ‚kameradschaftlich‘ organisiert war, wie Bähnisch es nahelegt, ob der gemeinsame Beruf tatsächlich eine so wichtige Rolle in ihrer Partnerschaft und in ihrer Biographie spielte, schließlich, ob gemeinsame Interessen und Überzeugungen zwischen ihr und ihrem Mann tatsächlich so stark waren, wie von ihr geschildert, läßt sich mit einem Blick auf Quellen, denen vor allem Aussagen über Albrecht Bähnisch zu entnehmen sind, besser einschätzen. Auch zur Frage, wie das Leben Theanolte Bähnischs im Nationalsozialismus aussah, erhoffe ich mir zusätzliche Informationen aus der Auseinandersetzung mit Quellen, die primär über Albrecht Bähnisch Auskunft geben. Orientierungsleitend ist für mich im Zusammenhang mit der Frage nach dem Leben der Bähnischs als Paar unter anderen eine Arbeit, welche die Geschlechterhistorikerin Yvonne Hirdmann über das schwedische Politiker-Ehepaar Alva und Gunna Myrdal vorlegte.258 Hirdmann konnte zeigen, daß die privaten Korrespondenzen des Paars weder die nach außen demonstrierte Gleichberechtigung in der Partnerschaft noch das von beiden Seiten behauptete Verständnis der Partner für die beruflichen Ambitionen des jeweils anderen widerspiegeln.259 Hirdmanns Studie ist nur ein Beispiel dafür, warum es erkenntnisfördernd sein kann, den Gender-Aspekt von Biographien unter die Lupe zu nehmen. Es mag naheliegend erscheinen, den Zugang zu einer Frau, die sich als Leiterin einer Frauenorganisation und als Herausgeberin einer Frauenzeitschrift hervorgetan hat, in erster Linie
258 Vgl.: Hirdmann, Yvonne: Alva Myrdal. The passionate mind, Bloomington 2008. 259 Vgl.: ebd. Aus nachvollziehbaren Gründen möchte die Tochter Theanolte Bähnischs, Orla-Maria Fels, die ihren eigenen Aussagen nach sehr umfangreiche Korrespondenz ihrer Eltern nicht zur wissenschaftlichen Verwendung zur Verfügung stellen.
82 | Theanolte Bähnisch
über Ansätze der Biographieforschung zu suchen, die im Kontext der ‚Frauen‘- oder ‚Geschlechtergeschichte‘, beziehungsweise der ‚Gender-Theorie‘ entstanden sind.260 Daß Theanolte Bähnisch eine Frau war und als solche wahrgenommen wurde, daß sie versuchte, vor allem das weibliche Geschlecht anzusprechen – mit Themen, von denen sie glaubte, daß sie Frauen interessieren würden oder sollten – ist von großer Relevanz für meine Arbeit. Ebenso ist für mich von Interesse, wie die Präsidentin des Deutschen Frauenrings mit ihrer eigenen Geschlechtsidentität umging – ob sie beispielsweise ihr ‚Frausein‘ nutzte, um ihre Ideen – auch jenseits der Frauenbewegung – zu verbreiten und wie sie Erfahrungen, die sie mit ihrem Geschlecht in Zusammenhang brachte, reflektierte. Doch war die Frauenbewegung weder Bähnischs einziges Wirkungsgebiet, noch sollten ihre Ziele, Argumente und Verhaltensweisen nur ein Geschlecht ansprechen, noch bewegte sie sich ausschließlich oder auch nur überwiegend in ‚Frauennetzwerken‘. Die vorliegende Arbeit soll aus diesen und aus anderen Gründen keine ‚Frauenbiographie‘ im Sinn des bereits beschriebenen gleichnamigen Konzepts261 sein, sondern verschiedene, für die gewählte Fragestellung hilfreiche methodische und theoretische Ansätze in durchaus eklektizistischer Weise zusammenführen. Zwei Kernüberzeugungen von Wissenschaftlern, die sich mit Geschlechtergeschichte beschäftigen, spielen – wie im Zusammenhang mit der Diskursanalyse bereits angesprochen – auch eine Rolle in dieser Studie: 1.) Der Umstand, daß das (soziale) ‚Geschlecht‘ ein Konstrukt ist, welches historischen Wandlungen unterliegt und in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich konstruiert und bewertet wird und 2.) daß ‚Gender‘ als Analysekategorie einen Beitrag dazu leistet, entsprechende Phänomene sichtbar zu machen und vermeintliche ‚Wahrheiten‘ zu dekonstruieren. Daß man sich bei einer solchen Herangehensweise zwangsläufig in einem Spannungsfeld zwischen der Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlecht auf der einen und der Negierung eines naturgegebenen Unterschiedes von (sozialen) Geschlechtsidentitäten, beziehungsweise dem Versuch, (soziale) Geschlechter‘ zu dekonstruieren, auf der anderen Seite wiederfindet, läßt sich nicht vermeiden. In der theoretischen Diskussion führt dieses Spannungsfeld stets von Neuem zu Verwirrung darüber, welche Bilder und Begriffe dekonstruiert und welche Begriffe geschärft werden sollten, um Analysekategorien für die wissenschaftliche Untersuchung zu generieren.262 1.7.4.4 Deutungsgemeinschaften/Erinnerungskartelle Daß der bereits mehrfach erwähnte Volker Depkat zu bedenken gibt, Autobiographien seien nicht zuletzt als „kollektive Texte“ zu begreifen, weil sich ihre Autoren
260 Vgl. ergänzend zu den oben bereits genannten Arbeiten auch: Runge, Anita: Geschlechterdifferenz in der literaturwissenschaftlichen Biographik. Ein Forschungsprogramm, in: Klein: Grundlagen, S. 113–128. 261 Zur ‚Frauenbiographik‘ siehe Kapitel 1.2. 262 Vgl.: Wartenpfuhl, Birgit: Destruktion – Konstruktion – Dekonstruktion. Perspektiven für die feministische Theorieentwicklung, in: Fischer, Uta Luise und andere: Kategorie: Geschlecht. Empirische Analysen und feministische Theorien, Opladen 1996, S. 191–209.
Einführung | 83
auf die Aussagen anderer Zeitgenossen beziehen, ist ein sehr bemerkenswertes Ergebnis seiner Arbeit. Es spricht jedoch, obwohl der Forscher mit jener Aussage das Gegenteil intendiert, gegen Depkats Argumentation, daß Autobiographien, wenn auch narrativ und aus der eigenen Perspektive überarbeitet, die ‚Realität‘ darstellten. Depkats Beobachtung stützt den Ansatz Angelika Schasers, Gesellschaften auf die Existenz von ‚Erinnerungskartellen‘ zu untersuchen.263 Weil sich Elite-Netzwerke in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht zuletzt über gemeinsame Erinnerungen definierten, soll das Konzept der ‚Erinnerungskartelle‘264, welches die Hamburger Neuzeit-Professorin Schaser entwickelt hat, mit in meine Vorüberlegungen einfließen. Schaser zufolge entwickeln verschiedene – parteipolitisch oder konfessionell geprägte – Erinnerungskartelle ihre je eigene Handlungslogik in der Deutung kollektiver Vergangenheiten, grenzen sich dabei von anderen Erinnerungskartellen ab und konstruieren nicht selten Gemeinsamkeiten dort, wo sie für die Gegenwart gewinnbringend verwendet werden können.265 Volker Depkat selbst kategorisiert die von ihm untersuchten Personen in ‚Erinnerungssilhouetten‘. Er setzt sich dabei auch mit geistigen Ziehvätern und Vorbildern Theanolte Bähnischs auseinander, die allesamt im Schnitt etwa 15 Jahre älter sind als Bähnisch. Ob sich die Juristin argumentativ in den Grenzen des von Schaser als ‚sozialdemokratisch‘ definierten Erinnerungskartells bewegte, und/oder ob die autobiographischen Texte der Regierungspräsidentin in eine der von Depkat aufgemachten Erinnerungssilhouetten, nämlich ‚sozialistische Männer‘, ‚bürgerliche Männer‘ und ‚weibliche Politikerinnen‘266 paßt,
263 Depkat schreibt, daß der kollektive Charakter von Autobiographien dadurch entstehe, daß die Autoren sich an Autobiographien, Briefen und Tagebüchern anderer Personen orientierten, um das selbst erlebte Geschehen „möglichst authentisch und wahrheitsgemäß zu rekonstruieren“. Depkat: Lebenswenden, S. 504. Daß dadurch quasi automatisch verschiedene Realitäten durch verschiedene Gruppen zementiert werden, erwähnt Depkat nicht. 264 Vgl.: Schaser, Angelika (Hrsg.): Erinnerungskartelle. Zur Konstruktion von Autobiographien nach 1945, Bochum 2003. 265 Vgl.: Depkat: Lebenswenden, S. 504. 266 Vgl.: ebd., passim. Dabei muß berücksichtigt werden, daß Depkat Autobiographien von Personen analysierte, die deutlich älter waren, als Bähnisch und daß er den Autobiographien der ‚Sozialisten‘ und der ‚bürgerlichen Politiker‘ eine deutlich frühere Politisierung entnahm, als den ‚bürgerlichen Männern‘. Die frühe Politisierung der beiden erstgenannten Gruppen führte Depkat darauf zurück, daß diese bereits im Kaiserreich die Erfahrung von ‚Ungleichheit‘ gemacht hatten. Auf Bähnisch passen die Kategorien allein deshalb schon deshalb nicht, weil sie, die 1918 gerade einmal 19 Jahre alt war, nach allem was bekannt ist, ihre Politisierung offenbar erst deutlich später, in ihren Mittzwanzigern erfuhr. Depkats Neigung, die Darstellung einer frühen Politisierung durch die untersuchten Personen selbst stets als ‚bare Münze‘ anzunehmen ist ohnehin als kritisch zu betrachten. Auch die Beschreibung einer ‚frühen Politisierung‘ durch die Protagonisten gehört in den Kontext der von Depkat beschriebenen Deutungsgemeinschaften. Es ist insofern wahrscheinlich, daß die ‚frühe Politisierung‘ nicht nur, aber doch auch ein Bestandteil der jeweiligen Selbstkonstruktion jener Personen ist.
84 | Theanolte Bähnisch
bleibt zu prüfen. Der Kreis zur Netzwerkanalyse schließt sich an diesem Punkt insofern, als daß der Historiker Marten Düring der Meinung ist, ein netzwerkanalytischer Zugang sei geradezu prädestiniert dazu, die „Persilschein-Netzwerke der Entnazifizierung“ – die sich ebenfalls als ein ‚Erinnerungskartell‘ beschreiben ließen – zu erforschen.267 Zwar läßt sich nicht nachweisen, an welchen Texten sich Theanolte Bähnisch orientiert haben mag, als sie ihre eigenen autobiographischen Texte diktierte, doch legt eine Aussage ihrer Tochter Orla-Maria Fels nah, daß auch ihre Aufzeichnungen ‚intertextuell‘, in Bezugnahme auf andere biographische Texte, angelegt waren. Ihre Mutter las, so Fels, viel, am liebsten Biographien, wobei sie die Friedrich Naumanns268 besonders beeindruckt habe.269 Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß Naumann als der Vertreter des Sozialliberalismus schlechthin gilt, stellt sich auch die Frage, was der sozialliberale Politiker Naumann sowie sein nicht weniger bekannter Biograph und langjähriger Mitarbeiter Theodor Heuss, der sich nicht zuletzt mit seinem Buch über Naumann in der sozialliberalen Tradition verortete, für Bähnischs Tochter bedeuteten. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß es auch mit der politischen Ausrichtung Naumanns und Heuss‘ zu tun hatte, daß Fels die Naumann-Biographie mit der ihrer Mutter in Verbindung brachte. Daß diese sich tatsächlich überdurchschnittlich stark für Biographien interessierte, ist vor dem Hintergrund ihres Interesses an ‚Persönlichkeiten‘, auf die später zurückzukommen sein wird, sehr wahrscheinlich. Die Anzahl von zeitgenössischen und historischen Frauenporträts in der ‚Stimme der Frau‘ spricht in dieser Hinsicht ebenfalls eine deutliche Sprache. Daß Bähnisch den Wert der ‚Individualität‘ häufig beschwor, kulminierte schließlich in ihrer bereits erwähnten, eigenen autobiographischen Arbeit. Diese vor allem als Quelle über die Zeit, in der sie geschrieben, beziehungsweise diktiert wurde, zu begreifen, kann jedoch nur teilweise gelingen, denn zeitlich genau einordnen lassen sich die Aufzeichnungen nicht. Fels gibt an, daß ihre Mutter die Texte 1972 diktiert habe.270 Es ist sehr wahrscheinlich, daß zumindest einige Teile des Textes in der vergleichsweise kurzen Zeit zwischen ihrer Pensionierung 1964 und ihrem Tod 1973 entstanden sind. Daß die Aufzeichnungen weite Teile von Bähnischs Leben nicht thematisieren, läßt sich ebenfalls als Indiz dafür werten, daß die Entstehung des Textes von Orla-Maria Fels zeitlich richtig eingeordnet wurde. Es steht zu vermuten, daß Bähnisch dem Geschriebenen noch etwas hinzufügen wollte, womöglich hatte sie
267 Vgl.: Düring/Eumann: Netzwerkforschung, S. 390. Vgl. dazu auch den offensichtlichen Ursprung dieser Aussage Dürings: Hirte, Katrin: Persilschein-Netzwerke. Bruchlosigkeit in Umbruchszeiten, in: Schönhuth, Michael/Gamper, Markus/Kronenwett, Michael/Stark, Martin (Hrsg.): Visuelle Netzwerkforschung, Bielefeld 2013, S. 331–354. 268 Vgl.: Heuss, Theodor: Friedrich Naumann. Der Mann, das Werk, die Zeit. 2. Aufl., Stuttgart/Tübingen 1949. 269 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. Ob Bähnischs Lob stärker dem Porträtierten, Naumann, oder dem Autor, Theodor Heuss galt, ist nicht klar, doch im Hinblick auf die oben geschilderten Zusammenhänge lassen sich beide Aspekte ohnehin kaum trennen. 270 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009.
Einführung | 85
vor, zunächst noch – mit Depkat gesprochen – autobiographische Texte ihrer Deutungsgemeinschaft zu konsultieren.271 Möglich ist auch, daß weitere autobiographische Texte, beziehungsweise Textteile zwar existierten, aber nicht überliefert wurden.
1.8 INHALTLICHE DIMENSIONIERUNG DER ARBEIT Vor dem Hintergrund des biographischen Zugangs zu meinem Thema wird der Blick zunächst auf Theanolte Bähnischs Sozialisation zu richten sein. Denkt man an die Kindheit der 1899 Geborenen, so gerät zwangsläufig das Kaiserreich in den Blick, die Umstände unter denen die Familie des Lehrers Franz Nolte zunächst im katholisch geprägten Westfalen und in Oberschlesien lebte, die im Elternhaus vorherrschenden politischen und konfessionellen Einstellungen, schließlich die Geschichte der Mädchenbildung und des Frauenstudiums. Denn es war zu jener Zeit, als Dorothea Nolte den höheren Bildungsweg einschlug, nicht selbstverständlich, daß Mädchen, beziehungsweise Frauen eine solche Ausbildung erfuhren. Die Entwicklungen im von der Abiturientin gewählten Studienfach, den Rechtswissenschaften, werden wiederholt Gegenstand der Analyse sein, denn die Veränderungen, welche die Disziplin in der Lehre wie auch in der Anwendung erfuhr, blieben für die junge Frau auch über das Ende ihres Studiums hinaus relevant. Ein besonderer Stellenwert kommt dabei dem Thema ‚(Polizei)verwaltungsreform‘ zu, vor allem was den Umgang des Staates mit der Prostitution und der ‚Volksgesundheit‘ betrifft. Auch organisatorische und personelle Kontinuitäten und Brüche in der (Polizei)verwaltung spielen eine Rolle. Daß Dorothea Nolte nach dem Abschluß ihres Verwaltungsreferendariats Albrecht Bähnisch heiratete, fügt der Analyse weitere Dimensionen hinzu, mit denen es sich auseinanderzusetzen gilt: Die Paarbeziehung, die Familiengründung und die reformorientierten Politik-, Verwaltungs- und Pädagogikeliten, unter denen sich das Ehepaar in der protestantisch geprägten, gemeinsamen Wahlheimat Berlin bewegte, werden ebenso Gegenstand meiner Analyse sein wie Albrecht Bähnischs berufliches und gesellschaftliches Engagement. Wie sich zeigen wird, war sein Tun auch für den Lebensweg seiner Frau langfristig von großer Relevanz. Neben Theanoltes Austausch mit berufstätigen Frauen in einem Service-Club und ihrem Engagement für die berufliche Gleichstellung von Frauen gehört deshalb auch Albrechts Engagement in der ‚bürgerlichen Sozialreform‘ und in der Erwachsenenbildung zu den Aspekten, die Berücksichtigung findet. Neben der Tätigkeit Theanolte Bähnischs im Berliner Polizeipräsidium, vor allem ihren Aufgaben in der Theaterabteilung und ihrer anschließenden Hinwendung zur Mutterrolle wird auch Albrechts Verwaltungskarriere mit den Stationen ‚preußisches Innenministerium‘ und ‚Landratsamt Merseburg‘ so-
271 Vgl. dazu: Depkat: Lebenswenden, S. 126 sowie Becker, Nicola: Rezension zu: Depkat, Volker: Lebenswenden und Zeitenwenden. Deutsche Politiker und die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, München 2007, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 7/8.
86 | Theanolte Bähnisch
wie das Ende dieser Karriere durch seine Amtsenthebung 1933 Gegenstand meiner Arbeit sein. Im Anschluß kommt die Suche beider Partner nach neuen Einkommensquellen und Betätigungsmöglichkeiten im Dritten Reich im Rechtswesen wie auch in der Privatwirtschaft in den Blick – weshalb auch das Thema ‚Anpassung und Widerstand‘ Teil des Kapitels ist. Auch das Auseinanderfallen der Familie wird Thema sein: der Kriegsdienst des Familienvaters, die Überlebensstrategien der Mutter, das Schicksal der Kinder, die das Paar 1931 und 1932 bekam, schließlich die retrospektive Selbstinszenierung von Theanolte und Albrecht Bähnischs Leben im Nationalsozialismus durch Theanolte Bähnisch. Für die Zeit nach 1945 ist der Blick auf die Netzwerke, die Theanolte Bähnisch ab 1945 (re-)aktiviert und die sie (mit-)etabliert, zu richten. Um ihre Arbeit für eine möglichst breite gesellschaftliche Integration sowie gegen den Kommunismus zu verstehen, ist es notwendig, die Traditionen aufzuzeigen, auf die sie bewußt oder unbewußt Bezug nimmt, die Ideen, auf die sie sich stützt, die Modelle, gegen die sie sich abgrenzt, die Diskurse, die sie anstößt, aufgreift und beeinflußt, sowie die Bilder, die sie dabei transportiert. Soziale und kulturelle Bewegungen als kollektive Akteure spielen hierbei ebenso eine Rolle wie einzelne wissenschaftliche, politische oder philosophische Vordenker, auf die Bähnisch rekurriert, ebenso die Rolle Bähnischs als Multiplikatorin verschiedener Ideen. Damit weist die vorliegende Arbeit auch eine ideengeschichtliche beziehungsweise im weiteren Sinne diskursanalytische Dimension auf. Weiter gilt es, die verschiedenen Plattformen, auf denen sich die Verwaltungsrechtsexpertin ab 1945 bewegt, sowie die verschiedenen Themen, mit denen sie sich ab diesem Zeitpunkt auseinandersetzt, zu beschreiben: Da ist zunächst die Fortsetzung ihrer Karriere als Verwaltungsjuristin, die mit der Übernahme des Amtes als Regierungspräsidentin 1946 in Hannover ihren vorläufigen Höhepunkt findet, bevor sie 1959 zur Staatsekretärin als Bevollmächtigte des Landes Niedersachsen ernannt wird. Eine Arbeit über die Regierungspräsidentin Bähnisch berührt verschiedene Aspekte der deutschen Verwaltungsgeschichte: den Wiederaufbau der Verwaltung ab 1945, die Verwaltungsaufgaben der Mittelinstanz in der Nachkriegszeit, insbesondere die Verwaltung des Mangels, die von den Briten beabsichtigte Demokratisierung der Verwaltungsstrukturen und die Beharrungstendenzen deutscher Verwaltungseliten dagegen, die Qualifikation von Frauen als Verwaltungsfachangestellte – womit erneut das Thema weibliche Professionalisierung auf den Plan tritt – sowie die berufliche Kontinuität von Verwaltungseliten zwischen dem Dritten Reich und der BRD, schließlich die Weiterverwendung von Verwaltungsbeamten und -angestellten aus der Weimarer Republik in der Nachkriegszeit. Bähnischs Karriere in der Verwaltung steht wiederum im engem Zusammenhang mit einer weiteren Dimension dieser Studie: ihre Stellung in der SPD. Führende SPD-Politiker sorgen mit dafür, daß jener Protagonistin aus der ‚hinteren Reihe‘ der preußischen Verwaltungselite ein bemerkenswerter Aufstieg in der niedersächsischen Verwaltung ab 1946 möglich wird. Damit kommt auch die Geschichte der Sozialdemokratie und ihrer innerparteilichen Auseinandersetzungen ins Spiel. Daß die von Adolf Grimme, Hinrich-Wilhelm Kopf und Kurt Schumacher protegierte Regierungspräsidentin schließlich die Aufmerksamkeit von Partei-Funktionärinnen, welche sich wesentlich mit der Frauenarbeit beschäftigen, auf sich zieht,
Einführung | 87
deutet auf eine weitere wichtige Dimension von Bähnischs Wirken und damit auch meiner Arbeit hin: Die Frauenbewegung in Deutschland, der sich die Behördenleiterin in den Jahren 1946 bis 1952 intensiv widmete. Für die Analyse ihres Handelns in der Frauenbewegung, vor allem in der Organisation Deutscher Frauenring, soll nicht nur der Bewegungs-Aspekt von Bähnischs Handeln, also der Versuch, im Sinne der Emanzipation von Frauen, einen gesellschaftlichen Wandel zu unterstützen272, untersucht werden, sondern auch die allgemeinpolitischen Zielsetzungen der von Bähnisch geleiteten Organisationen DFR und ihrer jeweiligen ersten Vorsitzenden. Schließlich handelte die neue Führungsfigur der überparteilichen Frauenbewegung beim Aufbau des DFR im Einklang mit der britischen Militärregierung, was eine weitere Dimension in den Blick bringt: Die Besatzungspolitik der West-Alliierten, welche die Bevölkerung, vor allem Kinder, Jugendliche und Frauen zum demokratischen Denken, erziehen und dem Umstand, daß zwei Drittel der Bevölkerung in der Nachkriegszeit Frauen waren, durch eine stärkere Stellung der Frauen im öffentlichen Leben gerecht werden wollten. Insbesondere die Briten hatten ein Interesse an der (Wieder-)Entstehung einer organisierten Frauenbewegung in Deutschland, weshalb sie der Bewegung ‚Ressourcen und Mobilitätskontexte‘273 zur Verfügung stellten. Vor diesem Hintergrund entwickelte Bähnisch ihre Ideen zur ‚staatsbürgerlichen Frauenbildung‘ weiter, so daß eine wissenschaftliche Arbeit über Theanolte Bähnisch, die auch einen Jugendclub leitete, das Thema Erwachsenenbildung nicht aussparen kann. Daß die Re-education-Arbeit der Westalliierten ebenso wie Bähnischs Arbeit ab 1947 stark vom Kalten Krieg beeinflußt wurde, bedeutet, daß auch dieser ‚negative Frieden‘ und seine Auswirkungen eine Rolle in der vorliegenden Arbeit spielen. Indem Bähnisch gegen die kommunistische Frauenbewegung, namentlich den ‚Demokratischen Frauenbund Deutschlands‘ (DFD) in Ostdeutschland agiert, nimmt sie Einfluß auf die deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte. Sie sorgt dafür, daß die Organisationsgeschichte des Deutschen Frauenringes (DFR) maßgeblich mit dem Kalten Krieg in Verbindung steht, und trägt Sorge dafür, daß sich die Bewegung – nicht zuletzt dieser Logik folgend – institutionalisiert. An der Funktion des DFR im Kalten Krieg hat auch die britische, beziehungsweise die internationale Frauenbewegung ihren Anteil. Diese und ihr klassisches Thema ‚soziale Arbeit‘ gehören ebenfalls zu den Dimensionen, mit denen sich meine Arbeit beschäftigt. Ab 1948 schreibt Bähnisch schließlich Pressegeschichte als Herausgeberin der ‚Stimme der Frau‘. In der Zeitschrift laufen die Themen, mit denen sie sich beschäftigt, zusammen: Gesellschaft und Staat, Familie und Beruf, Kultur und Philosophie, Frauenbildung und Frauenbewegung. Über die Verbindung jener Themen mit kurzweiliger Unterhaltung, mit Hauswirtschafts- und Modebeiträgen, schließlich auch mit Werbung trägt die Herausgeberin mit ihrer Zeitschrift nicht nur zur Bildung, sondern
272 Vgl. zu diesem Aspekt der Definition von sozialer Bewegung: Roth, Roland/Rucht, Dieter: Einleitung, in: (Hrsg.): Dies.: Bewegungen, S. 10–36, hier S. 13. 273 Zum Begriff, den Roth und Rucht im Kontext von Bewegungen ‚armer Leute‘ verwenden, die darauf angewiesen sind, sich in Unterstützungs- und damit auch Abhängigkeitsverhältnisse zu externen Unterstützern zu begeben, vgl.: Roth/Rucht: Einleitung, S. 25.
88 | Theanolte Bähnisch
auch zur Unterhaltung, also zur Gestaltung des Alltags im Kalten Krieg bei. In der Zeitschrift läßt sich die antikommunistische Überzeugung nachvollziehen, welche nicht nur Bähnisch, ihre Co-Herausgeberin und Chef-Redakteurin, sondern auch einige Beiträger und Beiträgerinnen vertraten. Komplementär dazu kommt in der ‚Stimme der Frau‘ auch die Europa- und UNO-Begeisterung von der Bähnischs Handeln getragen wird zum Ausdruck. Über ihr Wirken in der Europabewegung, in der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) und im International Council of Women (ICW), das sich in der Berichterstattung in der ‚Stimme der Frau‘, vor allem aber auch in ihrem Amt als eine der Vizepräsidentinnen des ‚Deutschen Rates der Europäischen Bewegung‘ niederschlägt, ist die Geschichte Theanolte Bähnischs schließlich auch Teil der Geschichte der Integration (West)Deutschlands in inter- und supranationale Bündnisse.
1.9 ZENTRALE LITERATUR Den Umständen entsprechend, daß zum einen über Theanolte Bähnisch selbst kaum Literatur existiert, daß ihr Leben und Wirken zum zweiten reich an Facetten war und aus diesen beiden Gründen zum dritten ihre Biographie in einen breiteren Forschungskontext eingebettet werden soll, weist die zu berücksichtigende Literatur eine ungewöhnlich große Breite auf. Den weiteren Ausführungen vorauszuschicken ist, daß – aufgrund der methodischen Ausrichtung der Arbeit – eine große Menge an Literatur über Personen, Organisationen und andere Zusammenschlüsse zu berücksichtigen ist, mit denen Bähnisch interagierte und/oder von denen sie beeinflußt wurde. Diese Literaturtitel werden jeweils im entsprechenden Zusammenhang in der Literatur-Übersicht thematisiert. Für meine Auseinandersetzung mit der Sozialisation Bähnischs vor 1945 ist zunächst einmal regionalgeschichtliche Literatur über die Orte Warendorf in Westfalen und Beuthen in Oberschlesien, die Bähnischs Kindheit und Jugend prägten, relevant. Der Umstand, daß in beiden Regionen Pädagogen an der Erforschung der Ortsgeschichte beteiligt waren beziehungsweise sind und daß diese Pädagogen vor allem auch die Entwicklung der Bildungslandschaft an den genannten Orten reflektier(t)en, birgt für die Erforschung von Theanolte Bähnischs Biographie sehr hilfreiche Synergie-Effekte, sowohl, was das Arbeitsumfeld Franz Noltes angeht, als auch, was die Mädchen-Schule betrifft, an der seine Tochter Dorothea unterrichtet wurde. Ähnliches gilt für die Lehrtätigkeit von Theanolte Bähnischs Schwiegervater Alfred Bähnisch sowie für die Schullaufbahn seines Sohnes Albrecht, beziehungsweise die Orte, an denen die beiden Männer lernten, lehrten und lebten. In Bezug auf Warendorf und seine Schulen sind vor allem die Publikationen des Pädagogen und Mitglied des Heimatvereins, Ekkehard Gühne, ertragreich.274 Um die wissenschaftliche Sozialisa-
274 Vgl.: Gühne, Ekkehard: Theanolte Bähnisch (1899–1973). Von der Marienschülerin zur Regierungspräsidentin in Hannover. Notizen zu den Warendorfer Wurzeln einer engagierten „Frauenrechtlerin“, in: Warendorfer Schriften, Bd. 40 (2010), S. 49–54. Theanolte
Einführung | 89
tion der Ehepartner einschätzen zu können, sind Studien über die Geschichte der Universitäten Münster und Berlin sowie über dort tätige Dozenten weiterführend.275 Da das Ehepaar Bähnisch in die Reform der Preußischen Polizeiverwaltung involviert war, ist die Verwendung von Stefan Naas‘ Arbeit über die Polizeiverwaltungsgesetzreform von 1932 naheliegend. Sie erleichtert die Einordnung des Wirkens und der Positionen beider Partner wesentlich.276 Da im Zusammenhang mit der Polizeiverwaltungsreform und der Karriere beider Partner auch die Themen ‚Sittenpolizei‘, ‚Prostitution‘ und ‚Geschlechtskrankheiten‘ relevant sind, setze ich mich auch mit Studien auseinander, aus denen die Diskussionen um das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, die Fürsorgeerziehung und -verwahrung, die Rolle von Frauen und der Frauenbewegung in der Polizei(verwaltungsreform) sowie die Zuständigkeitsverschiebungen zwischen der Sittenpolizei und der Gesundheitspolizei im Zuge der Verwaltungsreformen deutlich werden. Besonders zu betonen ist in diesem Zusammenhang der Wert der Ergebnisse einer Untersuchung von Ursula Nienhaus über die Polizistin Josefine Erkner.277 Um das gesellschaftliche Wirken des Ehepaars Bähnisch, das jeweils mit dem gewählten Beruf in Verbindung steht, aber auch über diesen hinausweist, zu erforschen, müssen in der Literatur zwei weitere Schwerpunkte gesetzt werden. Die frühe Geschichte des Soroptimist-Clubs, in dem sich Theanolte Bähnisch engagierte, bis er sich 1933 auflöste, ist bis dato noch kaum erforscht.278 Allerdings liegen verschiedene, für meine Auseinandersetzung mit jenem Club sehr hilfreiche biographische Arbeiten über Club-Mitglieder sowie die Gegenstände, mit denen sich der Club im Zu-
275
276 277 278
Bähnisch spielt in jenem Aufsatz nur eine untergeordnete Rolle. Im Grunde erforscht Gühne die Stellung Franz Noltes in der Warendorfer Gesellschaft und am Laurentianum. Vgl. auch: ders.: „Eine Schule in Bewegung“. Hundert Jahre Mariengymnasium Warendorf, in: Warendorfer Schriften Bd. 36/37 (2007), S. 129–140; ders.: Marienschule Warendorf. Nachwort zu einem Jahrhundert Mädchenbildung in einer westfälischen Kreisstadt, Warendorf 1991. Zum Laurentianum, dem Dienstort des Vaters vgl.: Gruhn, Klaus (Hrsg.): Gymnasium Laurentianum Warendorf. Von der Lateinschule zum Gymnasium Laurentianum Warendorf, 1329–1979, Warendorf 1979. Für Beuthen vgl.: Lehrerkollegium der katholischen städtischen Realschule zu Beuthen O/S (Hrsg.): Heimatkunde von Beuthen O/S, Beuthen O. S. 1903. Vgl.: Happ/Jüttemann: Sie, S. 226/227 sowie Steveling, Lieselotte: Juristen in Münster. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster/Westfalen, Münster 1999, S. 197. Zu den Dozenten vgl. beispielhaft: Sellert, Wolfgang: James Paul Goldschmidt (1874–1940), in: Heinrichs, Helmut u. a. (Hrsg.): Deutsche Juristen jüdischer Herkunft, München 1993, S. 598. Naas, Stefan: Die Entstehung des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes von 1931. Ein Beitrag zur Geschichte des Polizeirechts in der Weimarer Republik, Tübingen 2003. Vgl.: Nienhaus, Ursula: Nicht für eine Führungsposition geeignet. Josefine Erkens und die Anfänge der weiblichen Polizei in Deutschland 1923–1933, Münster 1999. Vgl. die verbandseigene Publikation: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist International Deutsche Union, Anfang und Fortgang 1930 bis 1990, Detmold o. J.
90 | Theanolte Bähnisch
ge seiner Arbeit für berufstätige Frauen auseinandersetzte, vor. An erster Stelle zu nennen sind zwei Arbeiten über die gute Freundin Bähnischs, Ilse Langner279, dann Publikationen über Lotte Jacobi280, mit der Bähnisch zusammenarbeitete, schließlich eine Arbeit über die berufliche Benachteiligung von Kassenärztinnen281, für die Theanolte Bähnisch sich besonders einsetzte. Diese Arbeiten helfen auch das über den Club hinausgehende Engagement Bähnischs für die beruflichen Rechte von Frauen, aber auch die (wirtschaftlichen) Vorteile, die Bähnisch selbst aus solchen Verbindungen zog, zu beleuchten. Für die Einordnung des Engagements von Albrecht Bähnisch in der SAG BerlinOst sind vor allem die Arbeiten Christoph Sachßes282, Elmar Tenorths283 und Jens Wietschorkes284 von Interesse, zumal letzterer einen bisher kaum beschrittenen Weg einschlägt und auch nach den Vorteilen des ‚Helfens für die Helfenden‘ fragt. Insbesondere die jüngere Literatur über die SAG liefert wertvolle Ansätze zur Einordnung des Engagements von SPD-Parteimitgliedern wie Albrecht Bähnisch in einem prinzipiell ‚bürgerlichen‘ Projekt.285 In der Literatur zeigt sich aber auch, daß der offenbar doch nicht geringe Einfluß des späteren Merseburger Landrats auf die politischprogrammatische Ausrichtung der SAG in ihrer Spätphase bisher noch gar nicht untersucht wurde. Jener Einfluß des Studenten der Rechtswissenschaften und späteren Landrats sowie sein ‚Standing‘ in der Arbeitsgemeinschaft war wohl ausschlaggebend für die ‚Zusammenarbeit‘ des SAG-Leiters Friedrich Siegmund-Schultze und Theanolte Bähnischs nach 1945. Aus Anja Schülers Forschung, die sich mit der Ar-
279 Vgl. insbesondere: Melchert, Monika: Die Dramatikerin Ilse Langner. „Die Frau, die erst kommen wird…“, Berlin 2002 sowie Schulte, Birgitta: Ich möchte die Welt hinreißen... Ein Porträt: Ilse Langner 1899–1987, Rüsselsheim 1999. Vgl.: auch: Pokorny, Rita: Die Rationalisierungsexpertin Irene M. Witte (1894–1976). Biografie einer Grenzgängerin, Diss., TU Berlin 2003. 280 Eskildsen, Ute: Lotte Jacobi, in: Kaetzle, Hans-Michael (Hrsg.): Das Lexikon der Fotografen. 1900 bis heute, München o. J. [2002], S. 217/218. 281 Vgl. zur Rolle von Kassenärztinnen in der Weimarer Republik: Ziegeler, Beate: Weibliche Ärzte und Krankenkassen. Anfänge ärztlicher Berufstätigkeit von Frauen in Berlin 1893–1935, Weinheim 1993. 282 Vgl.: Sachße, Christoph: Friedrich Siegmund-Schultze, die ‚Soziale Arbeitsgemeinschaft‘ und die bürgerliche Sozialreform in Deutschland, in: Krauß, Jürgen/Möller, Michael/Münchmeier, Richard (Hrsg.): Soziale Arbeit zwischen Ökonomisierung und Selbstbestimmung, Kassel 2007, S. 231–256. 283 Vgl.: Tenorth, Heinz-Elmar: Friedrich Siegmund-Schultze – Eine erziehungswissenschaftliche Annäherung, in: ders. (Hrsg.): Friedrich Siegmund-Schultze (1885–1969). Ein Leben für Kirche, Wissenschaft und soziale Arbeit, Berlin 2007, S. 70–83, hier S. 82. 284 Vgl.: Wietschorke, Jens: Soziales Settlement und ethnographisches Wissen. Zu einem Berliner Reformprojekt 1911–1933, in: Hengartner, Thomas/Moser, Johannes (Hrsg.): Grenzen & Differenzen. Zur Macht sozialer und kultureller Grenzziehungen, Dresden 2005, S. 309–316. Der Aufsatz stellt eine Vorstudie zur breiter angelegten, Ende 2013 publizierten Dissertation Wietschorkes dar. 285 Vgl.: Tenorth: Siegmund-Schultze.
Einführung | 91
beit von Protagonistinnen der Frauenbewegung in der Bürgerlichen Sozial-Reform auseinandersetzt, wird zumindest ansatzweise deutlich, wie Albrecht Bähnischs soziales und politisches Engagement in der Weimarer Republik sowie Theanolte Bähnischs Engagement in der Frauenbewegung nach 1945 inhaltlich zusammenhingen.286 Anhand der von mir analysierten Quellen und der älteren Literatur zur SAG läßt sich zeigen, daß die stark biographisch ausgerichteten Ansätze in der älteren Literatur über die SAG gegenüber neueren Ansätzen durchaus auch Vorteile für eine treffende Einschätzung der ‚Relevanz‘ des Projekts hatten, Christoph Sachßes aktuelle Schlüsse über die seiner Meinung nach eher geringe Relevanz der SAG über ihre Hochphase hinaus bedürfen, vor dem Hintergrund älterer Schriften und der von mir ausgewerteten Quellen betrachtet, einer kritischen Relativierung.287 Weiterführend ist die Literatur über die SAG auch insofern, als daß sie dabei hilft, die Zusammenhänge zwischen Albrecht Bähnischs Engagement in der SAG, seinem Engagement für die Heimvolkshochschule Dreißigacker und Theanolte Bähnischs Wirken in der staatsbürgerlichen Frauenbildung ab 1945 – wiederum nicht zuletzt über personelle Kontinuitäten – transparent zu machen. Auf die Hilfestellung, die Albrecht Bähnisch der Erwachsenenbildungseinrichtung Dreißigacker zukommen ließ, wurde ich durch Bettina Irina Reimers Studie über Thüringische Heimvolkshochschulen288 aufmerksam. Neben den politischkulturellen Rahmenbedingungen, in die das Engagement Albrecht Bähnischs für Dreißigacker einzuordnen ist, beschreibt die Studie auch die Rolle einzelner Personen im Prozeß der Auflösung Dreißigackers sowie die Verbindungen der Schule und ihrer Mitarbeiter zu anderen reform-orientierten Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Dies erleichtert wiederum die Einordnung von Kontakten und pädagogischen Ansätzen, an denen Theanolte Bähnisch sich in Niedersachsen orientierte, als sie ‚staatsbürgerliche Frauenbildung‘ betrieb und betreiben ließ. Weiterführend sind in diesem Zusammenhang auch Arbeiten des bereits erwähnten Paul Ciupke.289 Wenn man so will, waren die Entwicklungen in Thüringen, die Albrecht Bähnisch anhand der Heimvolkshochschule Dreißigacker erlebte, ein ‚Vorgeschmack‘ auf das, was auch in Preußen – wo Albrecht Bähnisch Landrat war – noch kommen sollte. Der Historiker Stefan Raßloff bezeichnet Thüringen als ‚Testfeld‘ für die Na-
286 Vgl.: Schüler: Frauenbewegung und soziale Reform. 287 Vgl.: Delfs, Hermann (Hrsg.): Aktiver Friede. Gedenkschrift für Friedrich SiegmundSchultze (1885–1969), Soest 1972. 288 Vgl.: Reimers, Bettina Irina: Die neue Richtung der Erwachsenenbildung in Thüringen 1919–1933, Diss. Tübingen 2000, auf: http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2001/ 254/pdf/complete.pdf, am 30.11.2013. 289 Vgl. insbesondere: Ciupke, Paul/Jelich, Franz-Josef: Experimentiersozietas Dreißigacker, Essen 1997. Vgl. für einen kritischen Blick auf Dreißigacker auch: Wollenberg, Jörg: Vom Volkshochschulheim des Arbeitsdienstes zur Heimvolkshochschule des Wiederaufbaus. Ein anderer Blick auf die Gründungsväter von Hustedt und der Göhrde, in: Kuchta, Detlev (Hrsg.): Politische Bildung im Wandel. 50 Jahre Heimvolkshochschule Jägerei Hustedt – 1948–1998, Recklinghausen 1998, S. 37–48.
92 | Theanolte Bähnisch
tionalsozialisten290, da dort bereits 1930 zwei nationalsozialistische Minister an der Regierung beteiligt waren.291 Die Studien über den vergleichsweise frühen Aufstieg der Nationalsozialisten in Thüringen verlassen die Ebene der Landesregierung allerdings kaum292 und taugen deshalb, ebenso wie jene, die sich mit der preußischen Provinz Sachsen im Nationalsozialismus beschäftigen, kaum als Informationsquelle über die Entwicklungen in den mittleren und unteren Behörden. Dies ist sicherlich nicht nur, aber vermutlich doch auch dem Umstand geschuldet, daß der Austausch der Regierungspräsidenten und Landräte erst nach dem ‚Preußenschlag‘ stattfand und sich bis in den Sommer 1933 hineinzog. Was der Nationalsozialismus für die Stadt und den sächsischen Landkreis Merseburg bedeutete, der aufgrund der Leuna-Werke und des hohen Arbeiteranteils ursprünglich ein ‚roter‘ Landkreis293 war, bildet Ralf Schade in seiner Biographie über den SPD-Politiker Karl Mödersheim ansatzweise ab.294 Aus Schades und aus weiteren Hinweisen, die ich aus verschiedenen Einzelstudien bezog, läßt sich das Spannungsfeld, welchem Albrecht Bähnisch als Landrat in einer zunächst überdurchschnittlich stark reformorientierten Region, in der bald die Konservativen und die NSDAP die Oberhand gewannen, ausgesetzt war, zumindest erahnen. Reimers Studie über die Erwachsenenbildungslandschaft wurde bereits genannt, erwähnenswert ist auch die Dissertation von Celina Kress über den Bauunternehmer Werner Sommerfeld295, aus der sich – in Kombination mit den von mir genutzten Quellen – ableiten läßt, welche Herausforderung es für den jungen Landrat bedeutet haben dürfte, ein Siedlungsprojekt abzuwickeln, das vor seiner Amtszeit in Zusammenarbeit mit dem jüdisch-stämmigen, Bauhaus-affinen Sommerfeld begonnen worden war. Für die Tätigkeit des Ehepaars nach der Amtsenthebung Albrecht Bähnischs ist solche Literatur relevant, die sich mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialis-
290 Vgl.: Müller, Hanno: Thüringen war Testfeld für die Nazi-Regierung, in: Thüringer Allgemeine Zeitung, 31.03.2013, auf: http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/ detail/-/specific/Thueringen-war-Testfeld-fuer-Nazi-Regierung-1679422470, am 04.04. 2014. 291 Vgl. dazu auch: Dickmann, Fritz: Die Regierungsbildung in Thüringen als Modell der Machtergreifung. Ein Brief Hitlers aus dem Jahre 1930, in: Vierteljahrshefte für Zeitge‐ schichte, 14. Jg. (1966), S. 454–464. 292 Vgl.: Heiden, Detlev/Mai, Gunther (Hrsg.): Thüringen auf dem Weg ins Dritte Reich, Erfurt 1996 sowie Mittelsdorf, Harald: Zwischen Landesgründung und Gleichschaltung. Die Regierungsbildungen in Thüringen seit 1920 und das Ende der parlamentarischen Demokratie 1932/33, Rudolstadt 2001. 293 Für das Beispiel Thüringen vgl.: Walter, Franz: Von der roten zur braunen Hochburg. Wahlanalytische Überlegungen zur Resonanz der NSDAP in den beiden thüringischen Industrielandschaften, in: Heiden/Mai: Thüringen, S. 119–146. 294 Schade, Ralf: Karl Mödersheim (1888–1952): ein erfolgreicher Kommunalpolitiker und Bürgermeister der Stadt Leuna, Leuna 2004. 295 Kress, Celina: Zwischen Bauhaus und Bürgerhaus – Die Projekte des Berliner Bauunternehmers Adolf Sommerfeld. Zur Kontinuität suburbaner Stadtproduktion und rationellen Bauens in Deutschland 1910–1970, Diss. TU Berlin, Berlin 2008.
Einführung | 93
mus, vor allem durch die ‚Rote Kapelle‘296 und hierbei im Besonderen mit der Gruppe um den Merseburger Regierungspräsidenten Ernst von Harnack auseinandersetzt. Die Durchsicht dieser Literatur war erforderlich, weil Theanolte Bähnisch angab, sich in jenem Kreis engagiert zu haben. Erfreulich ist, daß das Bild der vermeintlich ‚kommunistischen Spionageorganisation‘ Rote Kapelle, das die ältere Literatur verbreitete, in der jüngeren Literatur korrigiert wird.297 Mittlerweile wird die ‚Rote Kapelle‘ zu Recht als ein Netzwerk von Widerstandskreisen verschiedener politischer und konfessioneller Ausrichtungen dargestellt. Aus der jüngeren Literatur geht hervor, daß einige Personen, mit denen das Ehepaar Bähnisch in engem Kontakt stand, sich in der ‚Roten Kapelle‘ engagiert hatten.298 Angebracht erscheint die Auseinandersetzung mit jenen Werken auch deshalb, weil in ihnen vermehrt die Rolle von Frauen im Widerstands-Netzwerk erforscht wird.299 Für die ‚andere‘ Seite des Handelns Theanolte und Albrecht Bähnischs im Nationalsozialismus, die ein gewisses, im Hauptteil näher zu beleuchtendes Maß an Kooperation mit dem System voraussetzte, ist es, was Albrecht Bähnisch betrifft, nötig, Literatur über die Geschichte des arisierten Unternehmens Kaufhof, beziehungsweise EHAPE/Kaufhalle300 heranzuziehen. Um den Umgang Theanolte Bähnischs mit ihrem Leben im Dritten Reich in der Retrospektive zu kontextualisieren, arbeite ich auch mit Studien zur individuellen und kollektiven Erinnerung an den Nationalsozialismus, wie sie beispielweise Angelika Schaser und Volker Depkat vorlegen.301 Was die Literatur über behördliche Mittelinstanzen und Verwaltungshandeln betrifft, so sind eingangs bereits jene wenigen Arbeiten erwähnt worden, die sich überhaupt mit dem Regierungspräsidium Hannover beschäftigen. Daneben ist für mich solche Literatur relevant, welche die Aufgaben der Mittelinstanz im Wandel der Zeit302 sowie die Diskussionen um ihre Abschaffung in den Nachkriegsjahren thema-
296 Vgl.: Roloff, Stefan: Die Rote Kapelle, Frankfurt a. M. 2002 sowie Nelson, Anne: Die Rote Kapelle. Die Geschichte der legendären Widerstandsorganisation, München 2010. 297 Vgl. die beiden zuletzt genannten Titel. 298 Vgl.: Griebel, Regina/Coburger, Marlies/Scheel, Heinrich: Erfasst? Das Gestapo-Album zur Roten Kapelle, Halle 1992, S. 202. 299 Vgl.: Blair-Brysac, Sherin: Resisting Hitler: Mildred Harnack and the Red Orchestra, Oxford 2000 sowie Schilde, Kurt: Eva-Maria Buch und die Rote Kapelle, Berlin 1992. Vgl. auch: Wickert, Christl: Frauen gegen die Diktatur – Widerstand und Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland, Berlin 1995. 300 Vgl.: Fuchs, Peter: 100 Jahre Kaufhof Köln 1891–1991, Köln 1991. Vgl. zur Arisierung des Unternehmens auch Bopf, Britta: „Arisierung“ in Köln. Die wirtschaftliche Existenzvernichtung der Juden 1933–1945, Köln 2004. 301 Vgl.: Depkat: Lebenswenden sowie Schaser: Erinnerungskartelle. 302 Vgl.: Fonk, Friedrich: Der Regierungspräsident und seine Behörde. Funktionen, Zuständigkeiten, Organisation, Berlin 1967 sowie Thiele, Willi: Die staatliche Mittelinstanz und die parlamentarische Kontrolle, in: Deutsches Verwaltungsblatt, 82. Jg. (1967), S. 502– 506. Als hilfreich hat sich auch die Konsultation einer Dissertation über die Bezirksregierung Düsseldorf erwiesen. Vgl.: Strick, Christina: Jenseits der Routine? Die Bezirksregie-
94 | Theanolte Bähnisch
tisiert.303 Dazu gehören auch Werke, die sich mit der von der britischen Militärregierung (geplanten) Verwaltungsreform auseinandersetzen.304 Ferner orientiert sich die Literaturauswahl im Zusammenhang mit Bähnischs Verwaltungshandeln an den Kernaufgaben Bähnischs als Regierungspräsidentin, welche wiederum mit den besonderen regionalen Voraussetzungen zusammenhingen. Verwendet wird vor diesem Hintergrund vor allem solche Literatur über den Wiederaufbau der Region Hannover nach 1945, welche den hohen Vertriebenenanteil in der Bevölkerung berücksichtigt305, welche die niedersächsische Polizeigeschichte306 beschreibt oder über die Jugendbildung in Niedersachsen informiert.307 Mit dem von Bähnisch gegründeten ‚Club junger Menschen‘ hat sich Friedhelm Boll im Rahmen seiner Arbeit über demokratische Bildung für Jugendliche nach 1945 auseinandergesetzt.308 Da Adolf Grimme maßgeblichen Anteil am Wiederaufbau der Bildungslandschaft hatte, spielen in diesem Zusammenhang auch Publikationen über sein Handeln eine wichtige Rolle.309 Was Bähnischs Rolle im Wiederaufbau der Frauenbewegung angeht, so findet aufgrund der starken Überschneidungen auch in diesem Zusammenhang Literatur
303 304
305
306
307
308 309
rung Düsseldorf 1945 bis 1955, Dissertation, Düsseldorf 2007, online auf: http://docserv. uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=7032, am 10.12.2013. Vgl.: Hillmann, Gert: Der Regierungspräsident und seine Behörde. Die allgemeine staatliche Mittelinstanz in der Verwaltungsreform, Göttingen 1969. Vgl.: Rudzio, Wolfgang: Export englischer Demokratie. Zur Konzeption der britischen Besatzungspolitik in Deutschland, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 17. Jg. (1969), S. 219–236; ders.: Die Neuordnung des Kommunalwesens in der Britischen Zone. Zur Demokratisierung und Dezentralisierung der politischen Struktur: eine britische Reform und ihr Ausgang, Stuttgart 1968 und Reusch, Ulrich: Deutsches Berufsbeamtentum und britische Besatzung. Planung und Politik 1943–1947, Stuttgart 1985. Vgl.: Hauptmeyer, Carl-Hans/Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Niedersachsen Landesgeschichte und historische Regionalentwicklung im Überblick, Hannover 2004; Marschalck, Peter: Bevölkerung und Wanderung im Raum Niedersachsen seit dem Zweiten Weltkrieg, in: Bade, Klaus (Hrsg.): Fremde im Land, Osnabrück, 1997, S. 51 sowie stellvertretend für diverse Beiträge Brelie-Lewiens und Grebings: Brelie-Lewien, Doris von der/Grebing, Helga: Flüchtlinge in Niedersachsen, in: Hucker/Schubert/Weisbrod: Geschichte, S. 619–634. Vgl.: Riesener, Dirk: Die Polizeidirektion Hannover. Gesellschaft, Industrie und Polizei vom Deutschen Reich bis zur Bundesrepublik Deutschland, Hannover 2006 sowie Fürmetz, Gerhard/Reinke, Herbert/Weinhauer, Klaus (Hrsg.): Nachkriegspolizei. Sicherheit und Ordnung in Ost- und Westdeutschland 1945–1955, Hamburg 2001. Vgl. insbesondere: Dühlmeier, Bernd: Und die Schule bewegte sich doch. Unbekannte Reformpädagogen und ihre Projekte in der Nachkriegszeit, Hannover 2001 sowie Pieper, Wilhelm: Niedersächsische Schulreformen im Luftflottenkommando. Von der Niedersächsischen Erziehungsstätte zur IGS Franzsches Feld, Kempten 2009. Vgl.: Boll, Friedhelm: Auf der Suche nach Demokratie. Britische und deutsche Jugendinitiativen in Niedersachsen nach 1945, Bonn 1995. Vgl.: Burkhardt, Kai: Adolf Grimme (1889–1963). Eine Biografie, Köln 2007, S. 275.
Einführung | 95
über Frauen- und Erwachsenenbildung in Niedersachsen Verwendung. Über die Pädagoginnen Anna Mosolf, Katharina Petersen und Käthe Feuerstack, mit denen Grimme und Bähnisch beruflich zusammenarbeiteten und mit denen Bähnisch gemeinsam die Frauenbewegung in Deutschland wieder aufbaute, informiert neben Bernd Dühlmeier auch Inge Hansen-Schaberg.310 Neben diesen Werken sind vor allem noch die um den renommierten Erziehungswissenschaftler Paul Ciupke in der Reihe ‚Geschichte und Erwachsenenbildung‘ entstandenen Publikationen sowie die Veröffentlichungen eines anderen vielgelesenen Experten auf diesem Sektor, Peter Faulstich311 zu nennen. In Ergänzung zu den im Kapitel über die Rezeption Bähnischs bereits genannten Werken ist für mich zur Rekonstruktion der Genese des DFR unter Bähnischs Leitung vor allem solche Literatur relevant, die sich der Geschichte des DFR und seiner Vorläufer sowie der Organisationen widmet, welche sich ihm angeschlossen, mit ihm zusammengearbeitet oder sich zumindest mit ihm ausgetauscht haben. Anzumerken ist, daß Publikationen zur Geschichte des DFR nahezu ausschließlich von (leitenden) DFR-Mitgliedern und in Form von Jubiläumsschriften verfaßt wurden.312 ‚Unabhängige‘ wissenschaftliche Literatur zum Verband existiert, abgesehen von einigen bereits genannten Aufsätzen, die den DFR thematisieren,313 nicht. Eine Geschichte des DFR zu schreiben steht also noch aus. Daneben sind für mich solche Arbeiten von Interesse, die sich mit zentralen Protagonistinnen des DFR und seiner Vorläuferorganisationen auseinandersetzen. Diese Arbeiten liegen oft, aber nicht ausschließlich in Form von (Auto-)biographien vor.314 Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Arbeit der Theologin Gisa Bauer über Agnes von Zahn-Harnack315. Berücksichtigung findet im Zusammenhang mit Bähnischs Wirken in der Frauenbewegung (neben den bereits im Zusammenhang mit meinen Vorarbeiten genannten Werken, die sich allgemein mit der Besatzungspolitik der Alliierten sowie mit deren Frauen-Re-education-Arbeit auseinandersetzen) insbesondere eine Arbeit Irene
310 Hansen-Schaberg, Inge: Rückkehr und Neuanfang. Die Wirkungsmöglichkeiten der Pädagoginnen Olga Essig, Katharina Petersen, Anna Siemsen und Minna Specht im westlichen Deutschland der Nachkriegszeit, in: Jahrbuch für Historische Bildungsforschung, Bd. 1, München 1993, S. 319–338, hier S. 330/331. 311 Stellvertretend seien genannt: Ciupke, Paul/Derichs-Kunstmann, Karen (Hrsg.): Zwischen Emanzipation und „besonderer Kulturaufgabe der Frau“: Frauenbildung in der Geschichte der Erwachsenenbildung, 2001 sowie Faulstich, Peter/Zeuner, Christine (Hrsg.): Erwachsenenbildung, Weinheim 2010. 312 Vgl. beispielsweise: Borgmann, Grete: Freiburg und die Frauenbewegung, Ettenheim 1973 sowie Deutscher Frauenring, Ortsring Oldenburg (Hrsg.): Deutscher Frauenring, Ortsring Oldenburg e. V., Isensee 1997. 313 Vgl.: Schüller/Bouillot: Schwamm; Henicz/Hirschfeld: Frauen; Möding: Stunde. 314 Vgl. stellvertretend die Biographie: Berthold, Günther: Freda Wuesthoff. Eine Faszination, Stuttgart 1984 sowie die Autobiographie: Ulich-Beil, Else: Ich ging meinen Weg, Berlin 1961. 315 Bauer, Gisa: Kulturprotestantismus und frühe Bürgerliche Frauenbewegung. Agnes von Zahn-Harnack (1884–1950), Leipzig 2006.
96 | Theanolte Bähnisch
Stoehrs und Rita Pawlowskis, welche die Entwicklung des ‚Informationsdienst Frauenfragen‘ und die Installation eines Frauenreferates im Bundesinnenministerium behandelt.316 Außerdem sind solche Publikationen für meine Argumentation von Interesse, welche die politische Arbeit für die Durchsetzung des Gleichberechtigungsparagraphen im Grundgesetz reflektieren und die Möglichkeiten und Grenzen der weiblichen Emanzipation in Zusammenhang mit der Bürgerlichen Frauenbewegung in den 1940er und 1950er Jahren allgemein thematisieren.317 Auch Arbeiten, die sich mit beruflich erfolgreichen Frauen in der Nachkriegszeit auseinandersetzen, finden, vor dem Hintergrund einer entsprechenden Ausrichtung des DFR, Berücksichtigung.318 Gesondert zu erwähnen ist jene Literatur, die sich mit dem Wiederaufbau der – in Europa und den USA traditionell eng mit der Frauenbewegung verbundenen – sozialen Arbeit in Form eines dualistischen Systems aus staatlichen und freien Trägern beschäftigt. Die einschlägige Literatur setzt sich allerdings mit dem Einfluß Großbritanniens auf den Wiederaufbau der sozialen Arbeit in Deutschland nach 1945 bisher nur in Bezug auf die Professionalisierungstendenzen dieser Arbeit auseinander, die von Großbritannien aus angeschoben wurden. Daß die Dachorganisation britischer Frauen- und Wohlfahrtsverbände, WGPW, versuchte, im Einklang mit der Militärregierung und mit Hilfe eines Rückgriffs auf entsprechende deutsche Traditionen über Theanolte Bähnisch und die überparteilichen Frauenorganisationen eine Orientierung am britischen Modell zu erreichen, wird in diesen Studien nicht berücksichtigt. Dies verwundert insofern, als daß der Nestor der Forschung über die soziale Arbeit, Christoph Sachße, nicht nur pionierhaft die Bedeutung des Mütterlichkeitskonzepts für die soziale Arbeit, welche die Bürgerliche Frauenbewegung verantwortete, herausgearbeitet319, sondern sich auch mit der SAG-Berlin-Ost auseinandergesetzt hat. In dieser schlug sich die Zusammenarbeit von britischer und amerikanischer Frauenbewegung bereits in der Weimarer Republik nieder. Schließlich erforschte Sachße auch den Wiederaufbau der sozialen Arbeit in Deutschland ab 1945.320 Weder in seinen noch in anderen Studien zur sozialen Arbeit werden jedoch die Zusammenhänge zwischen jenen Aspekten aufgezeigt.321 Die bereits erwähnte Historikerin Denise Tscharntke machte in ihrer Studie über die Frauen-Re-education-Arbeit der Briten auch auf den Einfluß der WGPW aufmerksam.322
316 Stoehr, Irene/Pawlowski, Rita: Die unfertige Demokratie. 50 Jahre „Informationen für die Frau“, Berlin 2002. 317 Als Beispiel sei genannt: Ruhl: Unterordnung. 318 Vgl.: Maul, Bärbel: Akademikerinnen in der Nachkriegszeit. Ein Vergleich zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, Frankfurt a. M. 2002. 319 Sachße, Christoph: Mütterlichkeit als Beruf. Sozialarbeit, Sozialreform und Frauenbewegung 1871–1929, 2. Aufl., Opladen 1994. 320 Vgl.: Sachße, Christoph/Tennstedt, Florian: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, 3 Bd., Stuttgart 1980–1992. 321 Vgl. stellvertretend: Hering, Sabine/Münchmeier, Richard: Geschichte der sozialen Arbeit. Eine Einführung, Weinheim und München 2000. 322 Vgl.: Tscharntke: Re-educating.
Einführung | 97
Für die Auseinandersetzung mit Bähnischs Stellung in der SPD ist vor allem die bereits genannte Studie Gille-Linnes323 (die erst während der Arbeit an meiner Dissertation entstand) erwähnenswert. Gille-Linne verwendete ebenfalls die Korrespondenzen Herta Gotthelfs mit den SPD-Bezirkssekretärinnen, um die Wahrnehmung der überparteilichen Frauenarbeit durch die SPD aufzuzeigen, verzichtete allerdings auf die Analyse der im Foreign Office überlieferten Korrespondenzen zum diesem Thema. Diese Korrespondenzen, aus denen die Haltung der Militärregierung zur SPDFrauenarbeit deutlich wird, wurden teilweise von Denise Tscharntke zur Auswertung herangezogen.324 Gille-Linnes Studie stellt zwar die Frauenarbeit der SPD als ‚fortschrittlicher‘ dar, als die der überparteilichen Frauenbewegung, verweist jedoch auch auf den für meine Argumentationslinie wichtigen Umstand, daß Bähnisch und der DFR mit den SPD-Politikerinnen zusammenarbeiteten, als es um die Durchsetzung des Gleichberechtigungsartikels im Grundgesetz ging. Aufgrund der zentralen Rolle Elisabeth Selberts in diesem Zusammenhang zog ich auch den von der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung herausgegebenen Sammelband über Selbert heran. Der darin enthaltene biographische Aufsatz über die Politikerin325 erleichterte es, Selberts Position zur überparteilichen Frauenbewegung einzuordnen. Um die Interaktion des DFD, der SED und der KPD mit Bähnisch nachzuvollziehen erwies sich die bereits erwähnte militärhistorische Arbeit John-Robert-Starkes326 als dienlich, da Starke als erster und bisher einziger Forscher mit den in der SAPMOBestandsgruppe des Bundesarchivs überlieferten Quellen zur Geschichte des DFD arbeitete (DY30/DY 31). Der breite Fokus Starks auf die Frauen-Arbeit aller vier Militärregierungen bringt es allerdings mit sich, daß die Machtverhältnisse und Unterschiede in der (west-)deutschen Frauenbewegung kaum klar werden und daß die Ausführungen vor diesem Hintergrund zum Teil fragwürdig gewichtet sind. Was die Auseinandersetzung mit Bähnischs Rolle in der Europäischen Bewegung angeht, so ist zunächst auf den bereits weiter oben konstatierten Umstand zu verweisen, daß die Vizepräsidentin des Deutschen Rats der Europäischen Bewegung in dieser Literatur kaum erwähnt wird. Hilfreich für meine Einordnung Bähnischs innerhalb der Bewegung sind die vorliegenden Studien dennoch, denn mit Hilfe der vor allem in den 1990er Jahren vorgelegten Arbeiten läßt sich zunächst einmal die Rolle der Organisation ‚Europäische Bewegung‘, der Bähnisch angehörte, zwischen verschiedenen anderen pro-europäischen Organisationen verorten. Neben den bereits genannten Werken Vanessa Conzes, Wilfried Loths und Gerhard Brunns über die Anfänge der Bewegung sind solche Arbeiten von Bedeutung, welche die Positionen verschiedener Personen, die mit Bähnisch in der Organisation zusammenarbeiteten, abbilden. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der von Volker
323 Vgl.: Gille-Linne: Strategien. 324 Vgl.: Tscharntke: Re-educating. 325 Drummer, Heike/Zwilling, Jutta: Elisabeth Selbert. Eine Biographie, in: Bussfeld, Barbara (Hrsg.): Ein Glücksfall für die Demokratie, Elisabeth Selbert (1896–1986). Die große Anwältin der Gleichberechtigung, 2. Aufl., Frankfurt a. M. 2008, S. 9–160. 326 Vgl.: Starke: Majority.
98 | Theanolte Bähnisch
Depkat und Piero Graglia herausgegebene Sammelband ‚Entscheidung für Europa‘.327
1.10 QUELLEN Das umfangreichste Quellenkorpus für die bereits erwähnte Vorarbeit zur Dissertation über Theanolte Bähnisch stellten die Jahrgänge 1948 bis 1952 der von Bähnisch ab 1948 herausgegebenen Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ dar. Die Zeitschrift soll in der vorliegenden Arbeit jedoch nur auszugsweise Verwendung finden. Zur Darstellung von Bähnischs Kindheit und Jugend sind vor allem folgende Quellen relevant: Einwohnermeldeakten der Gemeinde Warendorf, das SchülerinnenBuch des Mädchen-Gymnasiums am Ort, einige Informationen aus Zeitungsartikeln, die auf Aussagen Bähnischs beruhen, verschiedene Lebensläufe Bähnischs sowie ihr autobiographisches Diktat von 1972. Zu den meisten ihrer Aussagen über jene Jahre fehlen Parallelquellen. Um einen Eindruck davon geben zu können, in welchem Umfeld die spätere Regierungspräsidentin aufwuchs, wurden ergänzend Aufsätze des Vaters und zeitgenössische heimatgeschichtliche Publikationen über die Regionen, in denen Dorothea Nolte lebte, herangezogen. Korrespondenzen mit Adolf Grimme, Ferdinand Friedensburg und Carl Severing sowie weiteren Politikern und Verwaltungsmitarbeitern, die teils Theanolte, teils Albrecht Bähnisch, teils auch beiden Partnern vorgesetzt waren, vermitteln einen – eher vagen – Eindruck der Beziehungen, welche das Juristen-Ehepaar in der Weimarer Republik pflegte. Ergänzende Informationen liefern Korrespondenzen Albrecht Bähnischs, beispielsweise mit Albert Grzesinski und Friedrich Siegmund-Schultze. Die Korrespondenzen mit Grzesinski finden sich im International Institute of Social History in Amsterdam (Grzesinski Papers) sowie im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin (Depositum ‚Ökumenisches Archiv‘ von Friedrich Siegmund-Schultze). Eine wichtige Quelle über das persönliche Erleben Theanolte Bähnischs stellen ihre Korrespondenzen mit der Schriftstellerin und Soroptimistin Ilse Langner dar, die im Deutschen Literaturarchiv Marbach (DLA) überliefert sind. Sie erstrecken sich über mehrere Jahrzehnte und zeigen, wie sich die Beziehung zwischen den beiden entwickelte, geben aber auch Aufschluß über die Beziehungen beider Frauen zu Dritten – besonders zu Adolf Grimme und zu anderen Soroptimistinnen sowie über die politische und philosophische Haltung Bähnischs, ihre Arbeit als Beamtin und in der Frauenbewegung, schließlich natürlich auch über das Leben und die Arbeit ihrer guten Freundin Ilse Langner. Für die in der Literaturübersicht erwähnten Biographien über Ilse Langner sind die im DLA überlieferten Briefe Bähnischs an Langner nicht berücksichtigt worden. Briefe Langners an Bähnisch lassen sich in den öffentlich zugänglichen Archiven nicht finden. In Marbach sind auch Briefe Bähnischs an die umstrittene Heimat-Dichterin Agnes Miegel überliefert, welche auf eine freundschaftli-
327 Depkat, Volker/Graglia, Piero (Hrsg.): Entscheidung für Europa. Erfahrung, Zeitgeist und politische Herausforderungen am Beginn der europäischen Integration, Berlin/New York 2010.
Einführung | 99
che Beziehung der Regierungspräsidentin zu der Dichterin schließen lassen. Bei der Arbeit mit Briefen als Quellen gilt es allerdings allgemein, die Warnung des Biographie-Experten Thomas Etzemüller im Blick zu behalten, daß Briefe „wie eine Lupe“ wirken können, „die eine Beziehung auf Kosten des Kontextes überproportional vergrößert“328. Wahrscheinlich ist, daß Bähnisch enge Vertraute hatte, die unbekannt bleiben, weil schriftliche Hinweise auf die Beziehung fehlen. Ebenfalls aufschlußreich, was Bähnischs Gedanken und Gefühle betrifft, sind ihre Briefe an die Photographin und Soroptimistin, zeitweilig auch Geschäftspartnerin, Lotte Jacobi, zu der Bähnisch den Kontakt hielt, nachdem Jacobi auf der Flucht vor den Nationalsozialisten in die USA ausgewandert war. Diese Briefe sind im Bestand ‚Lotte Jacobi Papers‘ der Handschriftensammlung (MSS) der University of Massachusetts enthalten. Erhellend in Bezug auf die beruflichen und gesellschaftlichen Interessen der Juristin erwiesen sich ihre im Bundesarchiv und im GStA PK überlieferte Staatsexamensarbeit sowie die Gutachten über ihre Prüfungen, schließlich auch drei von Bähnisch um 1930 verfaßte kürzere Artikel zur Berufstätigkeit von Frauen in der Verwaltung, beziehungsweise als Kassenärztinnen. Um Albrecht Bähnischs Zeit als Landrat in Merseburg darzustellen, konsultierte ich die Merseburger Dependance des Thüringischen Hauptstaatsarchivs, wo Akten aus dem Regierungspräsidium Merseburg sowie eine Personalakte Albrecht Bähnischs vorhanden sind. Unterlagen aus dem Landratsamt Merseburg über die für die vorliegende Arbeit relevante Zeit sind nach Auskunft des Archivs aufgrund von Kriegsverlusten nicht überliefert. Weitere Unterlagen, welche über jene Zeit, aber auch über Albrecht Bähnischs Studium, seine Arbeit im Preußischen Innenministerium, sein Verwaltungsreferendariat sowie über die Anwaltspraxis für Verwaltungsrecht, welche das Ehepaar unterhielt, Auskunft geben, finden sich im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK). Zwei lange und zwei kurze Artikel aus der Feder Albrecht Bähnischs sowie diverse von ihm verfaßte Lexikonartikel, die in verwaltungswissenschaftlichen Publikationen, beziehungsweise in Publikationen für die Verwaltungspraxis erschienen, lassen Rückschlüsse auf die Gegenstände zu, mit denen sich Albrecht Bähnisch hauptsächlich beruflich beschäftigte. Aus den bereits erwähnten Akten des Evangelischen Zentralarchivs (EZA) in Berlin gehen – wie aus zwei von Albrecht Bähnisch verfaßten Artikeln – Informationen über sein Engagement in der SAG-Berlin-Ost hervor. Im EZA sind neben den bereits erwähnten Korrespondenzen Albrecht Bähnischs mit Siegmund-Schultze auch solche von Theanolte Bähnisch mit dem berühmten Theologen sowie Briefe Dritter an den Leiter der SAG-Berlin-Ost überliefert. Aus der Art der Ablage durch Siegmund-Schultze lassen sich Rückschlüsse auf seine Beziehung zu den für meine Analyse relevanten Personen ziehen. In den Akten finden sich auch Protokolle und andere Materialien, die Informationen über Treffen der SAG an denen Albrecht und Theanolte Bähnisch teilgenommen haben, enthalten. Zur Arbeit des Paares als Verwaltungsrechtsräte im Dritten Reich sind kaum Informationen greifbar. Zwei Akten des Preußischen Oberverwaltungsgerichts im GStA PK enthalten Schriftverkehr mit den Eheleuten. Ferner liegt eine Postkarte
328 Etzemüller: Biographien, S. 82.
100 | Theanolte Bähnisch
Theanolte Bähnischs an Ilse Langner vor, die einen ‚Fall‘ thematisiert. Schließlich liefert die Personalakte Katharina Petersens (NLA HStAH) Hinweise darauf, daß Albrecht Bähnisch die spätere Studiendirektorin anwaltlich vertreten hat. Theanolte Bähnisch selbst thematisierte ihre Arbeit als Verwaltungsrechtsrätin für von den Nationalsozialisten verfolgte Personen in diversen autobiographischen Dokumenten und anderen Selbstzeugnissen. Parallelquellen, die ihre Aussagen unterstützen, sind nicht überliefert. Über das von Bähnisch beschriebene eigene Engagement im Widerstand gegen den Nationalsozialismus liegen insgesamt nur Informationen, die Bähnisch selbst in der Retrospektive verfaßte, sowie Berichte Dritter vor, die auf den Berichten der Juristin aufbauen. Einige wenige Dokumente zur Erwerbsarbeit beider Partner in der freien Wirtschaft im Nationalsozialismus sind jeweils im Privatnachlaß Theanolte Bähnischs bei Orla-Maria Fels in Waiblingen überliefert. Sie liefern fragmentarische Informationen über Albrecht Bähnischs Arbeit als Prokurist bei der Kaufhalle/EHAPE sowie über Theanolte Bähnischs Arbeit als Vertreterin für Pressephotos. Von zentraler Relevanz, was die Auseinandersetzung mit Albrecht Bähnisch angeht, ist ein weiteres Dokument aus dem Privatbesitz der Familie Fels, nämlich eine nicht veröffentlichte Biographie Albrecht Bähnischs, die Hans Heino-Fels für seine Frau verfaßt hat. Sie enthält Auszüge aus Briefen zwischen Albrecht und Theanolte Bähnisch, die das Ehepaar Fels aufgrund ihres privaten Charakters für Forschungszwecke nicht zugänglich machen möchte, aus Archivalien, die ich größtenteils in den entsprechenden Archiven selbst ausgewertet habe, und aus Dokumenten, die im Familienbesitz überliefert sind. Letztere habe ich vor Ort, in Waiblingen, einsehen können. Schließlich muß noch auf das lange Gespräch verwiesen werden, zu dem sich Orla-Maria Fels dankenswerterweise bereiterklärt hat. Zusammengekommen sind fast sechs Stunden Tonmaterial, die sich in Form digitaler Audiodokumente im Besitz der Verfasserin befinden. Hans-Heino Fels war zeitweilig bei dem Gespräch anwesend und ergänze Informationen. Diese Unterhaltung bezeichne ich bewußt nicht als ein ‚Interview‘ im Sinne des ‚Oral History‘-Ansatzes. Entsprechend dem Bekanntheitsgrad, den Theanolte Bähnisch ab 1946 erlangte, existieren zahlreiche Zeitungs- und Zeitschriften-Artikel, die sich mit ihr auseinandersetzen. Sie erschienen größtenteils in regionalen Publikationen. Die meisten Artikel lassen sich zwei Gruppen zuordnen: Erstens die, welche Bähnisch als Person porträtieren und über ihr Leben vor 1945, ihre Arbeit als Regierungspräsidentin und als Leiterin von Frauenorganisationen berichten. Häufig geben diese Artikel ihre Einstellung zur Rolle von Frauen in der Gesellschaft wieder. Eine zweite große Gruppe bilden jene Artikel, die von frauenpolitischen Veranstaltungen berichten, auf denen sie eine maßgebliche oder leitende Rolle spielte. Häufig, jedoch nicht immer wird Bähnisch darin namentlich genannt. Bei den meisten Artikeln aus dieser Gruppe handelt es sich um interzonale Konferenzen der überparteilichen Frauenbewegung. Nur wenige Zeitungs- und Zeitschriftenartikel widmen sich Einzelhandlungen Bähnischs als Regierungspräsidentin. Meiner Arbeit liegen vor allem bestehende Sammlungen zur Person Bähnischs und/oder zum DFR/zur überparteilichen Frauenbewegung zugrunde, die in verschiedenen Archiven überliefert sind, auch in Bähnischs Personalakte sind diverse Zeitungsartikel enthalten. Über Bähnischs Wirken im DFR geben neben den beschriebenen Artikeln sowie den in der Literaturübersicht bereits genannten Publikationen von DFR-Mitgliedern
Einführung | 101
über die Organisation und/oder ihre Biographien vor allem die im Archiv des Deutschen Frauenrings überlieferten Quellen Auskunft. Das Archiv ist ein Wanderarchiv, das sich jeweils in den Geschäftsräumen am Wohnort der aktuellen Präsidentin des DFR befindet. Während meiner Recherche-Phase befanden sich die Quellen in Freiburg, DFR-Präsidentin war zu jener Zeit Grete Borgmann. Die in Ordnern abgelegten, in einem Findbuch verzeichneten Akten setzen sich für die von mir untersuchten Jahre im Wesentlichen aus Protokollen und aus Korrespondenzen Bähnischs mit anderen leitenden Mitgliedern des DFR, welche auch die Gründung des DFR und seiner Vorgängerorganisationen sowie deren Vorgeschichten und die Nachklänge dokumentieren, zusammen. Ebenfalls im DFR-Archiv überliefert sind Materialsammlungen zur Rolle von Frauen in der Gesellschaft, Dokumente über die Arbeit des DFR und seiner Vorgängerorganisationen sowie ein Korpus von Unterlagen, die Bähnisch für eine Reise nach Großbritannien zusammengestellt hatte. Die Sammlung enthält auch persönliche Aufzeichnungen Bähnischs. Diese Akten sind von herausragendem Informationswert, in Bezug auf die Genese der überparteilichen Frauenbewegung, vor allem des DFR und seines Vorstands. Publikationen von leitenden Mitgliedern des DFR erschienen, wie in der Literaturübersicht bereits erwähnt, aus Anlaß von Jubiläen der DFR-Landes- oder Ortsringe. Die Schriften unterliegen einer stark subjektiven Färbung, vermögen jedoch einen Einblick in die Entstehung, die Arbeit und die Vorstandsstrukturen der jeweiligen Ringe zu geben. Teilweise sind ihnen Informationen über das Selbstverständnis, beziehungsweise die Traditionsbildung einzelner Ringe zu entnehmen. Theanolte Bähnisch selbst veröffentlichte die Rede, welche Bähnisch anläßlich des zehnjährigen Bestehens des Deutschen Frauenrings 1959 verfaßte und vortrug, im Jahr 1960 in der Zeitschrift ‚Mädchenbildung und Frauenschaffen‘329. Wie die im DFR-Archiv überlieferte Ansprache, welche die DFR-Präsidentin 1952 anläßlich ihres Rücktritts von dieser Funktion hielt, ist auch die Rede aus dem Jahr 1959 sehr aufschlußreich, was die Selbstdarstellung Bähnischs als Initiatorin des Wiederaufbaus der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland ab 1946 betrifft. Einige der Gegenstände, mit denen sich der DFR in den 1950er Jahren beschäftigte, lassen sich aus verschiedenen Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln rekonstruieren. Bähnischs Rolle in der Re-education-Politik der britischen Besatzungsmacht, die auf den Wiederaufbau der überparteilichen Frauenbewegung in Deutschland setzte, wird vor allem in der Bestandsgruppe ‚Foreign Office‘ (FO) in den British National Archives (NA) in London (Kew) greifbar. In den sehr umfangreichen Akten ist vornehmlich Schriftverkehr zwischen den Women’s Affairs Sections der Länder untereinander, mit anderen Einrichtungen der Militärregierung in Deutschland sowie zwischen der Control Commission of Germany (CCG), British Element (BE) und dem British Foreign Office überliefert. Es finden sich darin jedoch auch Korrespondenzen der Einrichtungen der Militärregierungen sowie des Foreign Office mit Frauenorganisationen, Parteien, Gewerkschaften und anderen Organisationen in Deutschland sowie mit Vertreterinnen der britischen Frauenbewegung. Deutsch- und englisch-
329 Bähnisch, Theanolte: Vom Wiederaufbau der Frauenarbeit nach dem Zusammenbruch 1945, in: Mäd-chenbildung und Frauenschaffen, 10. Jg. (1960), S. 162-180.
102 | Theanolte Bähnisch
sprachige Zeitungsartikel zur Frauenbewegung und zur Rolle von Frauen in Deutschland sowie Statistiken und anderes Material sind ebenfalls enthalten. Neben diesen Akten sind für meine Recherchen auch Akten derselben Bestandsgruppe, die von den Land und Regional Headquarters der CCG (BE) für das Land Niedersachsen und den Bezirk Hannover überliefert wurden, relevant. Die Hoffnung, in den Akten der ‚Press Section‘ auf neue, in meiner ersten Qualifikationsarbeit nicht präsentierte Informationen zur ‚Stimme der Frau‘ zu stoßen, erfüllte sich nicht. Die Zeitschrift taucht lediglich in zusammenfassendem statistischem Material über Frauenzeitschriften auf. In der British Library in Oxford habe ich Korrespondenzen, Reiseberichte und Tagebücher der Oxforder Germanistik-Professorin Helena Deneke analysiert, die im Auftrag der Women’s Group on Public Welfare (WGPW) und der CCG (BE) mehrfach nach Deutschland gereist war, um sich ein Bild der Lage der Frauenbewegung vor Ort zu machen und beim Wiederaufbau der Bewegung Hilfestellung zu leisten. Die Unterlagen sind im Nachlaß Clara Sophie Denekes in der Manuscript Collection der British Library überliefert. Schließlich habe ich im Women’s Archive in London mit dem Bestand ‚Women’s Group on Public Welfare (WGPW)‘ gearbeitet, um ergänzende Informationen zur Zusammenarbeit der WGPW mit der CCG (BE) und Bähnisch zu erhalten. Die genannten britischen Bestände sind – mit Ausnahme der Akten der Press Section, die der Land und Regional Headquarters sowie jenen zur Europabewegung und zu Jugendorganisationen, die ich ergänzend aufgrund der weiteren Wirkungsgebiete Bähnischs heranzog – auch von Denise Tscharntke ausgewertet worden. Da Tscharntke ihren Fokus jedoch nicht auf Theanolte Bähnisch richtete, sind die von ihr gewonnen Informationen über Bähnisch weniger detailliert, als für die vorliegende Arbeit notwendig ist. Die Wahrnehmung Bähnischs durch führende Mitglieder der kommunistischen Frauenbewegung sowie die Reaktionen aus diesen Kreisen auf ihre Politik läßt sich aus den Akten der ‚Abteilung Frauen‘ beim Zentralkomitee der SED rekonstruieren, die im Bundesarchiv in Lichterfelde in der Abteilung SAPMO überliefert sind. Ergänzend zu diesen Akten nutze ich solche aus dem Nachlaß Elfriede Pauls, die zunächst dem von Bähnisch gegründeten ‚Club deutscher Frauen‘, später aber dem Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD) angehörte. Jenen Akten lassen sich zum einen Informationen über die Gründung und die Arbeit des ‚Club deutscher Frauen‘ entnehmen, zum anderen läßt sich – zumindest ansatzweise – die Spaltung der Frauenbewegung in ‚Ost‘ und ‚West‘ anhand der Beziehung zwischen Paul und Bähnisch nachvollziehen. Der Nachlaß Pauls wurde, zumal er, wie die SAPMO Bestände, erst seit 1990 frei zugänglich ist, bisher noch nicht zum Zweck der Rekonstruktion des Wiederaufbaus und der Spaltung der Frauenbewegung in der Nachkriegszeit genutzt. Die Akten aus der ‚Abteilung Frauen im ZK der SED‘ hat John Robert Starke für seine Arbeit über Frauenumerziehungsarbeit der Militärregierungen in Deutschland ausgewertet, er hat jedoch bei seiner Arbeit nicht auf die Rolle Bähnischs fokussiert. Über Theanolte Bähnischs Wirken im Regierungspräsidium, auch über ihre Laufbahn als Beamtin, liefert die sehr umfangreiche Personalakte, die im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv Hannover (NLA HStAH) überliefert ist, wertvolle Informationen. Zur Rekonstruktion des ‚Standes‘, den Bähnisch als Regierungspräsidentin unter ihren Kollegen und Vorgesetzten hatte, sowie über zu jener Zeit besonders vi-
Einführung | 103
rulente Themen erwiesen sich die Protokolle der Dienstbesprechungen der Regierungspräsidenten als wertvoll. Diese sind im Bestand Regierungspräsidium Hannover allerdings nur teilweise überliefert. Ergänzungen waren aus den Beständen ‚Land Niedersachsen‘ sowie ‚Regierungspräsidium Lüneburg‘ möglich. Auch um verschiedene Sachfragen im Zusammenhang mit Bähnischs Rolle als Regierungspräsidentin zu beantworten (beispielswiese die Rolle des Regierungspräsidiums Hannover in der Verwaltungsreform oder in der Schulpolitik), erwies es sich als sinnvoll, neben Sachakten des RP Hannover ergänzend die Bestände der anderen Regierungspräsidien im Land Niedersachsen sowie die Bestandsgruppe ‚Land Niedersachsen‘ im NLA HStAH zu nutzen. Weitere Informationen entnahm ich Korrespondenzen des Regierungspräsidiums Hannover mit dem niedersächsischen Innenministerium, mit der Militärregierung, den Landräten, den Oberbürgermeistern, den nachgeordneten Behörden sowie den Dezernaten und Dienststellen des Regierungspräsidiums. Auszugsweise konsultierte ich auch Korrespondenzen, Sachakten und Handakten von Adolf Grimme (auch im GStA PK) sowie von Hans Alfken, um mehr Informationen über das für Bähnisch zentrale Thema (Erwachsenen-)Bildung zu gewinnen und ihre Zusammenarbeit mit Erwachsenenbildnern und Bildungspolitikern zu rekonstruieren. Aus den bereits genannten Akten der Bestandsgruppe ‚Foreign Office‘ in den British National Archives, die einen Niedersachsen- oder Hannover-Bezug aufweisen, lassen sich ebenfalls einige, wenn auch nur wenige Rückschlüsse auf die Arbeit der Regierungspräsidentin sowie die Einschätzung dieser Arbeit durch die Militärregierung ziehen. Um die Selbstdarstellung Bähnischs in ihrem Amt sowie ihre Arbeit in der Verwaltung vor 1945 zu rekonstruieren, ziehe ich neben den eingangs erwähnten Zeitungsartikeln häufig einen autobiographischen Text heran, den Bähnisch ihrer Tochter Orla-Maria Fels zufolge 1972, also ein Jahr vor ihrem Tod, diktiert hat. Ihr Engagement in der Frauenbewegung thematisiert Bähnisch in jenem Text nicht. Fels konnte nicht sagen, in wessen Hand ihre Mutter diktiert hat, nachträglich eingefügte Korrekturen im Text scheinen, der Handschrift nach zu urteilen, von Bähnisch selbst zu stammen. Um Theanolte Bähnischs Stellung in der SPD sowie ihre parteipolitische Haltung einschätzen zu können, habe ich Schriftwechsel Bähnischs mit den Parteigenossen Kurt Schumacher, Adolf Grimme, Herbert Wehner, Fritz Erler, Heinrich Brill, Hinrich Wilhelm Kopf und Herta Gotthelf ausgewertet. Diese Korrespondenzen sind größtenteils im Archiv der Sozialen Demokratie (AdSD) in Bonn überliefert, zum Teil aber auch im Nachlaß Bähnischs, der sich im Privatbesitz von Orla-Maria Fels befindet. Weitere Korrespondenzen mit Bähnisch sind in den Nachlässen der genannten Personen in den Niederlassungen des Bundesarchivs in Berlin und Koblenz sowie im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin (GStAPK) nutzbar. Mindestens ebenso aussagekräftig sind jedoch die Briefe, die Herta Gotthelf mit anderen Parteimitgliedern – insbesondere den Frauenreferentinnen der Bezirke – und der CCG (BE) sowie dem Foreign Office über Theanolte Bähnisch austauschte. Auch diese Briefe sind im AdSD, größtenteils im Bestand Kurt Schumacher, überliefert. Ein Teil der von mir verwendeten Korrespondenzen Gotthelfs mit der Militärregierung und anderen Briten findet sich in der Bestandsgruppe ‚Foreign Office‘ der National Archives. Um Theanolte Bähnischs Engagement in der Europabewegung einzuordnen, habe ich ebenfalls Akten aus dem AdSD, Bestand ‚Deutscher Rat der Europäischen Be-
104 | Theanolte Bähnisch
wegung‘ sowie Korrespondenzen aus dem Nachlass Heinrich Brills im Bundesarchiv (BArch) verwendet. Als wichtigste Selbstzeugnisse Bähnisch seien folgende genannt: Das häufig zitierte, von Orla Maria Fels auf 1972 datierte autobiographische Diktat aus dem Privatnachlaß Theanolte Bähnischs in Waiblingen, die ‚Kurze Lebensskizze‘, die sowohl in jenem Privatnachlaß als auch in der Sammlung SP-01 im Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel überliefert ist, das Schriftstück ‚Notizen der Frau Regierungspräsidentin a. D. Th. Bähnisch, Verwaltungsrechtsrat […] aus Köln am Rhein‘, ebenfalls aus dem Privatnachlaß, der in englischer Sprache verfaßte Lebenslauf ‚Curriculum vitae of Frau Regierungspräsident Bähnisch‘, o. D. [1946] sowie die Erzählung ‚How I came to be a lawyer‘, o. D. [1946], die beide im DFR-Archiv in den ‚Materialien für eine Englandreise‘ (Ordner A3) enthalten sind. Dazu kommen diverse Zeitungsartikel, die Bähnisch selbst verfaßt oder mitgestaltet hat, Briefe Bähnischs an ihre Freundin Ilse Langner aus dem Literaturarchiv Marbach, Nachlaß Ilse Langner, Briefe Bähnischs an Adolf Grimme im GStA PK, NL Grimme sowie einzelne Briefe an andere Personen.
1.11 AUFBAU DER ARBEIT Kapitel 2.1 stellt vor, was sich über Dorothea Noltes Kindheit und Jugend, ihre Schulzeit und ihre Familie herausfinden läßt. Weitere Unterkapitel von Kapitel 2 beleuchten ihr Studium, ihre juristischen Referendariate und ihr Staatsexamen, in dessen Rahmen sie erstmals ‚frauenpolititisches‘ Terrain betritt. Unterkapitel 2.3.1 hat ihre Arbeit als Assessorin und später als Regierungsrätin im Berliner Polizeipräsidium zum Inhalt, Unterkapitel 2.3.2 ihr Engagement in einer Interessenorganisation für berufstätige Frauen, dem Soroptimist-Club. Kapitel 3 behandelt in 3.1 zunächst die Beziehung Theanolte Bähnischs mit Albrecht Bähnisch, die Schnittmengen der Sozialisation, der Ausbildung, der Berufsarbeit und der Kontakte des Ehepaars. In 3.3 erfolgt die wesentliche Verortung des Paares im Kreis der beruflichen und politischen Ziehväter sowie Kollegen in der Weimarer Republik, während die Verortung unter den Protagonisten der bürgerlichen Sozialreform in Unterkapitel 3.4.2 vorgenommen wird. Da Kapitel II auch Albrecht Bähnischs Biographie über das Zusammenleben mit seiner Frau hinaus vorstellen soll, ist das Unterkapitel 3.2 der Ausbildung und der Arbeit Albrecht Bähnischs in der Preußischen Verwaltungsreform gewidmet, während Unterkapitel 3.4 sein Wirken in der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost (SAG) – mitsamt den Effekten, welche diese Arbeit für Theanolte Bähnisch freisetzt – vorstellt. Unterkapitel 3.5 beschäftigt sich mit Albrecht Bähnischs Engagement für die Heimvolkshochschule Dreißigacker. Kapitel 4 thematisiert die starken Umbrüche, mit denen das Paar, das 1931 eine Familie gründete, zwischen 1930 und 1945 konfrontiert ist und damit auch die Frage, wie sich das Leben der Bähnischs in der ausgehenden Weimarer Republik und im Nationalsozialismus gestaltet. In Unterkapitel 4.1.1 geht es um die veränderte Rollenverteilung, die mit dem Ausscheiden Theanolte Bähnischs aus dem Polizeipräsidium, dem Umzug nach Sachsen und der Familiengründung einhergeht. Die Unterkapitel 4.1.2 und 4.1.3 beleuchten die politische Lage, mit der sich Albrecht Bäh-
Einführung | 105
nisch als junger Landrat konfrontiert sieht, schließlich die Umstände und Folgen seiner Amtsenthebung. In 4.2 ‚findet‘ das Paar wieder nach Berlin zurück und schlägt neue berufliche Wege ein, von denen Theanolte Bähnisch berichtet, sie hätten in engem Zusammenhang mit ihrem Widerstand gegen den Nationalsozialismus gestanden. Deshalb gehört auch das Thema ‚Widerstand‘ zu Kapitel 4. Kapitel 4.4 richtet den Blick zunächst wieder auf Albrecht Bähnisch, denn das Paar zieht aufgrund seiner neuen Anstellung nach Köln, von wo aus Albrecht Bähnisch schließlich zum Wehrdienst einberufen wird. Theanolte ist fortan auf sich gestellt. Ihre Strategien des Umgangs mit den neuen Situationen in jener Zeit, aber auch in der Retrospektive werden in den Kapiteln 4.3.3 bis 4.3.5 beleuchtet. In den darauffolgenden Kapiteln wird Theanolte Bähnischs Wirken ab 1945 beschrieben. Die Übergänge zwischen ihren Rollen als Regierungspräsidentin, als Vorsitzende des Frauenrings und seiner Vorgängerorganisationen sowie als Vizepräsidentin der Europäischen Bewegung sind in einigen Aspekten fließend, weshalb eine zu strikte Trennung ihrer verschiedenen Wirkungsgebiete im Aufbau der Arbeit weder machbar noch wünschenswert ist. Im Gegenteil: In den Kapiteln sollen besonders auch die Verschränkungen zwischen ihren Arbeitsgebieten deutlich werden. Kapitel 5. ist vor allem Theanolte Bähnischs Wirken als Regierungspräsidentin gewidmet. Zunächst wird es darum gehen, darzustellen, wie Amt und Person ‚zueinander fanden‘ (5.1) und in welche Traditionen sich Bähnisch mit ihrer Zusage, die Behörde zu leiten, einschrieb. Anschließend wird das Medienecho beschrieben, welches der ersten Regierungspräsidentin im Land zu Teil wurde. Dann soll, beginnend mit Unterkapitel 5.2.5 die Rolle der Militärregierung dargestellt werden, einerseits als Unterstützer des Wiederaufbaus, andererseits als Kritiker der ‚Bezirksfürsten‘ per se, womit ein Einblick in die Tradition, den Aufbau und die Funktion der ‚Mittelinstanz‘ – und dementsprechend Bähnischs Aufgaben – einhergeht. Beschrieben wird die besondere Lage, mit der sich Bähnisch in der Nachkriegszeit konfrontiert sah, ihre eigene Schwerpunktsetzung im Rahmen der Möglichkeiten und ihre wichtigsten Kontaktpersonen. Unterkapitel 5.3 beschreibt die Übernahme der BezirksPolizeileitung durch Bähnisch sowie, beispielhaft, den Umgang (oder vielmehr Nicht-Umgang) der Regierungspräsidentin und Leiterin der Bezirkspolizei mit nationalsozialistisch belasteten Mitarbeitern der Behörde. Das darauffolgende Unterkapitel 5.4 beschäftigt sich mit der Verschränkung von Wohlfahrtsarbeit und Frauenförderung durch Bähnisch im Bezirk Hannover und in der Behörde selbst, erste Schnittmengen mit ihrer Arbeit in der Frauenbewegung deuten sich darin an. Zwei weitere Unterkapitel, 5.5 sowie 5.6 gehen auf die Jugendpolitik und -fürsorge in Niedersachsen, im Bezirk Hannover und durch die Regierungspräsidentin persönlich – in Form der Einrichtung des Lagers Poggenhagen sowie des ‚Club junger Menschen‘ – ein. Hier werden Parallelen zu und Folgen von Albrecht Bähnischs Handeln in der Weimarer Republik deutlich. Die daran anschließenden Kapitel setzen sich in erster Linie mit Bähnischs Engagement in der Frauenbewegung und für die Westbindung Westdeutschlands auseinander, welches sich vor allem, aber nicht nur in den von ihr geleiteten Frauenorganisationen niederschlägt. Entsprechend der dreistufigen Entwicklung des von ihr geleiteten Frauenzusammenschlusses vom regionalen ‚Club deutscher Frauen‘ (Kapitel 6), über den zonenweit agierenden ‚Frauenring der britischen Zone‘ (Kapitel 7) zur
106 | Theanolte Bähnisch
westdeutschen Organisation ‚Deutscher Frauenring‘ (Kapitel 8) ist diese Darstellung in drei Kapitel unterteilt. Kapitel 6 beschreibt einleitend die Verschränkung der entbehrungsreichen Umstände der Nachkriegsjahre und der ‚Frauenpolitik‘ (6.2.1) sowie die Erforschung dieses Zusammenhangs in den 1980er und 1990er Jahren 6.2.2), im Anschluß die Reeducation Politik, welche die britische Militärregierung speziell für Frauen entwickelt hatte. Dies geschieht, um den Rahmen abzustecken, in dem sich Bähnischs Handeln bewegt (6.3). Dann geht es um den Fokus einiger Mitarbeiterinnen der Militärregierung auf Hannover und die besondere Rolle, die die britische Frauenbewegung und eine Delegierte aus der WGPW dafür spielte, daß der ‚Club deutscher Frauen‘ in Hannover über sehr gute Ausgangsbedingungen dafür verfügte, in das Zentrum des britischen Interesses beim Wiederaufbau der Frauenbewegung zu geraten (6.4). In diesem Kontext wird auch der Zusammenhang zwischen der niedersächsischen Volkshochschule und der Entwicklung des Clubs durch Pädagoginnen und andere einflußreiche Frauen, die für beide Institutionen interessant waren, beschrieben. Des Weiteren werden in Unterkapitel 6.5 die Mitbegründerinnen, die ersten Veranstaltungen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Angebote und Ziele des ‚Club deutscher Frauen‘ vorgestellt. Anschließend wird es um die Rolle Bähnischs als Netzwerkerin und Führungsfigur in der Hannoveraner Frauenbewegung über den ‚Club deutscher Frauen‘ hinaus gehen. Unterkapitel 6.6 beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung des Clubs mit anderen politischen und gesellschaftlichen Akteuren, anschließend sollen die unterschiedlichen Positionen der SPD-Frauenreferentin Herta Gotthelf und Theanolte Bähnischs im Mittelpunkt eines eigenständigen Unterkapitels stehen (6.7). Im vorletzten Teil von Kapitel 6 (6.8) wird erneut der Fokus auf die Militärregierung gerichtet und auf die für Theanolte Bähnisch äußerst förderlichen Empfehlungen, welche die Beraterin der Militärregierung, Helena Deneke, für die weitere Entwicklung der Frauen-Re-education-Arbeit in Deutschland aussprach. Das letzte Unterkapitel (6.9) setzt sich mit der Reise Bähnischs nach Großbritannien Ende 1946 auf Einladung einer britischen Frauenorganisation, gefördert von der Militärregierung auseinander. Kapitel 7 beschäftigt sich wesentlich mit der Etablierung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ durch Bähnisch, welcher den ‚Club deutscher Frauen‘ sowie andere überparteiliche Frauenorganisationen als Orts- oder Landesringe integrierte. Nachdem eingangs die Frauenbewegung in der SBZ mitsamt der Folgen, welche diese Entwicklungen im ‚Westen‘ nach sich zogen, skizziert wird (7.1.1–7.1.3), soll gezeigt werden, daß der zweifelsohne für Bähnischs Wirken als zentral anzusehende Antikommunismus nicht von Beginn an für ihr Engagement in der Frauenbewegung handlungsleitend war und daß er als treibende Kraft ihres Engagements auf Kosten anderer Motivationen in ihrer Selbstkonstruktion offenbar überbetont wurde (7.1.4). Anschließend soll anhand einer Rede Bähnischs vorgestellt werden, wie sie den Kommunismus wahrnahm und mit welchen Argumenten sie ihre Zuhörerinnen davon überzeugen wollte, daß die kommunistische Ideologie per se im Widerspruch zur ‚weiblichen Natur‘ stehe (7.1.5). In den sich anschließenden, umfassenden Unterkapiteln (7.2–7.4) geht es um die interzonalen Frauenkonferenzen in Bad Boll und Bad Pyrmont, auf denen Bähnisch präsent war – und damit um wichtige Stationen auf dem Weg zur Gründung einer zunächst zonenweiten, dann westdeutschlandweit agierenden Organisation. In diesem Zusammenhang wird Bähnischs Rolle im Auseinan-
Einführung | 107
derdriften der Frauenbewegung in Ost- und Westdeutschland, sowie in der Internationalisierung der Frauenbewegung im Westen deutlich werden. Es wird auch um die Erwartungen gehen, die verschiedene Lager in der Frauenbewegung sowie die Briten auf Bähnisch und die Gründung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ projizierten. Die Bewertungen welche die ‚Gründungskonferenz‘ von Bad Pyrmont 1947 erfuhr, sind ebenfalls Teil des Kapitels (7.4). Ein weiteres Unterkapitel wird zeigen, daß sich an die Gründung des Frauenrings der britischen Zone eine Phase der Entmutigung und des Stockens in Bähnischs Wirken – und damit in der Entwicklung der Frauenbewegung – anschloß, bevor sich die Regierungspräsidentin zu neuer, reger Betriebsamkeit aufraffte (7.5). Das darauffolgende Unterkapitel (7.6) ist den Reaktionen der kommunistischen Frauenorganisation DFD auf die von Bähnisch wesentlich gestalteten frauenpolitischen Verhältnisse im ‚Westen‘ gewidmet. Daran anschließend stehen in 7.7 wiederum zwei interzonale Frauen-Konferenzen im Mittelpunkt: Jene, die der DFD in Berlin organisierte und jene, die in Frankfurt – unter maßgeblicher Beteiligung Bähnischs – stattfand. Die Entwicklungen auf jenen Konferenzen werden in den Kontext der Münchner Ministerpräsidenten-Konferenz und der Londoner Außenminister-Konferenz gestellt und in Zusammenhang damit der bald auch in der Frauenbewegung endgültige Bruch zwischen Ost- und Westdeutschland beschrieben. Es wird erklärt, welche wichtige Rolle der vor allem von Bähnisch verbreitete Begriff ‚staatsbürgerliche Frauenbildung‘ in diesem Zusammenhang spielte (7.7.2.2). Abschließend werden in Unterkapitel 7.8 die weiteren Entwicklungen in der Deutschland-Politik der Briten in Bezug auf die ‚Frauenfrage‘ beleuchtet. Auf einen Disput über die Förderung Bähnischs folgte eine weitere Welle der Unterstützung, diesmal initiiert von den Führungsspitzen, die nicht ohne Wirkung auf den SeniorPartner USA blieb. Kapitel 8 widmet sich zunächst Bähnischs wachsender Popularität im Ausland, die mit ihrem Engagement für die Westintegration Deutschlands einhergeht. Sowohl ihr Wiederanknüpfen an die bis 1933 gewachsenen internationalen Beziehungen der bürgerlichen Frauenbewegung, als auch ihre Arbeit in der ‚Europäischen Bewegung‘ und in anderen – vor allem bi-nationalen – Projekten steigerten ihren Bekanntheitsgrad. Hierbei zeigt sich erneut, wie eng ihre Arbeitsgebiete zusammenhängen, aber auch, daß die teilweise selbst gesetzten, teilweise gestellten Aufgaben stets zunehmen, was die Juristin wieder und wieder an den Rand ihrer Belastbarkeit treibt (8.1). All dies geschieht während des Wartens auf die nächste große interzonale FrauenKonferenz, für die die Gründung einer westdeutschen Frauenorganisation unter Bähnischs Führung angestrebt wird. Auf die Vorstellung einer Bestandsaufnahme der Arbeit des Frauenrings durch Bähnischs erklärte Unterstützerin Deneke sowie durch verschiedene Mitarbeiterinnen der CCG (BE) in den Unterkapiteln 8.2.2.1 bis 8.2.2.3 folgt die Auseinandersetzung mit der sich erneut verändernden Politik der Militärregierung in Bezug auf Frauen in 8.2.2.4 und 8.2.2.5. Die Unterkapitel 8.2.2.5 und 8.2.2.6 zeigen, daß Bähnischs Popularität in der Internationalen Frauenbewegung und damit auch in der UN ausschlaggebend für die weitere Förderung von Bähnischs Frauenarbeit durch die Militärregierung war. Im Anschluß geht es in Unterkapitel 8.3. um die Vorbereitung und Durchführung der ‚Konferenz von Pyrmont‘ 1949, auf der der DFR als Gegenorganisation zum DFD gegründet wird und um die damit einhergehenden Erwartungen und Bewertungen. In diesem Kontext werden die führenden Mitglieder und damit das Netzwerk, mit dem Bähnisch den DFR aufbaut, be-
108 | Theanolte Bähnisch
schrieben, auch der Kampf um einige Ämter, an dem sich zeigt, daß die Juristin zwar großen Einfluß auf die Bewegung hatte, aber gleichzeitig von der Mitarbeit gestandener Protagonistinnen der Frauenbewegung abhängig war und entsprechend Abstriche in der Verwirklichung ihrer Ideen machen mußte (8.3.1–8.3.2). Dann wird es um den Charakter und die Interessen des Führungskomitees (8.3.3) und in diesem Zusammenhang um die Eignung der Organisation für verschiedene Zielgruppen gehen. Daran schließt sich in Unterkapitel 8.3.9 eine Analyse der Gründungsrede Bähnischs an, in der sie, Gemeinsamkeiten aller Frauen voraussetzend, ein Programm für die Frauen und die Frauenbewegung der Nachkriegszeit entwirft. Das darauffolgende Unterkapitel ist den Arbeitsausschüssen des DFR und somit den Gremien, welche die praktische Arbeit in der Organisation in den verschiedenen Bereichen leisteten, gewidmet (8.3.10). Darauf folgt eine Darstellung der Entwicklung und der Arbeit des DFR auf der Orts-, Landes- und Bundesebene jeweils anhand ausgewählter Beispiele (8.4) Unterkapitel 8.5 setzt sich mit der Institutionalisierung der Frauenbewegung im Bundesinnenministerium und den Entwicklungen auseinander, die – unter Beteiligung Bähnischs – zur Entstehung des von der US-Militärregierung initiierten ‚Informationsdienstes Frauenfragen‘ führte. 8.6 beschreibt die Schwerpunktverlagerung in den Aufgaben Bähnischs von der Leitung der Organisation DFR auf nationaler Ebene hin zur internationalen Arbeit in den bereits beschriebenen, aber auch in neuen Zusammenhängen wie der ‚Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen‘. Es widmet sich zudem der Frage, warum Bähnisch ihr Amt als Leiterin des DFR 1952 niedergelegt hat.
2. Vom katholischen Münsterland in die Weltmetropole Berlin: Sozialisation im Kaiserreich und in der Weimarer Republik
2.1 KINDHEIT UND JUGEND ZWISCHEN INDUSTRIALISIERUNG, NATIONALSTAATSKONSOLIDIERUNG UND KATHOLIZISMUS (1899 BIS 1919) 2.1.1 Aus dem aufstrebenden Beuthen ins ländliche Warendorf „[L]ändlich heiter“ sei Theanolte Bähnischs Jugend „als eines unter sieben Kindern des Gymnasialprofessors Franz Nolte in Warendorf/Westfalen“1 gewesen, schreibt die Hannoveraner Journalistin Barbara Groneweg 1959 in der Stuttgarter Zeitung. Beinahe unvermeidbar drängt sich beim Lesen dieser Schilderung das Bild eines fröhlichen Mädchens auf, das im Sommerkleid über Felder und Wiesen springt, Blumen sammelt, johlend Schafe oder Kühe jagt und sich ganz seinem Treiben in der Natur hingibt. Allein: es ist nur wenig bekannt über die Kindheit der späteren Verwaltungsjuristin. In den vermutlich 1946 entstandenen, drei Seiten umfassenden Aufzeichnungen, die, mit ‚Kurze Lebensskizze‘ überschrieben, in ihrem Nachlaß überliefert sind2, widmet Theanolte Bähnisch ihren ersten Lebensjahren keinen Raum. Auch aus überlieferten Briefen an Freunde und Bekannte ist über diese Zeit nichts zu erfahren. Allerdings setzte sie sich mit ihrer Kindheit im Rahmen der Erinnerungen3, die sie ihrer Tochter Orla-Maria Fels zufolge 1972 diktiert hatte4, mit dem Thema ausei-
1
2
3 4
Groneweg, Barbara: Eine Frau im öffentlichen Leben. Theanolte Bähnisch wurde 60 Jahre, in: Stuttgarter Zeitung, 28.04.1959, Kopie o. S. im Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 90. AddF, SP-01 [Kopien aus Bähnischs Privatnachlaß und aus anderen Archiven], Theanolte Bähnisch, Kurze Lebensskizze. Seinem Inhalt nach scheint das Dokument im Jahr 1946 verfaßt worden zu sein. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat, o. T., o. D. [1972]. Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. Orla-Maria Fels hat sich etwa acht Stunden Zeit genommen, um mir Fragen über ihre Mutter zu beantworten und mir dabei
110 | Theanolte Bähnisch
nander. Im maschinenschriftlichen Diktat, das nachträglich von Hand geringfügig überarbeitet wurde5, ist zu lesen, daß die spätere Regierungspräsidentin als Mädchen besonders gern gemeinsam mit ihren Geschwistern und anderen Kindern auf dem Gutshof in Germete bei Warburg gespielt hatte, von dem ihre Mutter abstammte.6 Ihren Eltern und Lehrern will sie es nicht leicht gemacht haben: Ihr Vater habe sie mit 14 Jahren von der Schule genommen, weil er keine Beschwerde-Briefe über das Verhalten seiner Tochter mehr habe bekommen wollen, so Bähnisch.7 Mit 16 Jahren habe er sie, weil das Kaffeekränzchen ihrer Mutter der Meinung gewesen sei, daß aus ihr endlich eine Dame werden müsse, auf eine Internats-Schule geschickt.8 Um sicherzustellen, daß sie sich dort gut einlebe, habe sich der Vater genötigt gefühlt, das Personal darüber zu informieren, daß seine Tochter bisher mehr „auf den Bäumen, als auf der Erde zu Haus gewesen“ sei und daß sie oft die Anführerin von „Jungensstreichen“9 gewesen sei. Daß zu den Aktivitäten ihrer Kindheit neben dem Lesen „verbotene[r] Bücher“ auch die „Jungensspiele“ ihrer Brüder und deren Freunde – „Fußball, Räuber und Gendarm und ähnliche“10 – gehört hätten, erwähnt Theanolte Bähnisch in ihrem Diktat explizit.11 Sie schien es im Rentenalter als stimmig für ihre Biographie empfunden zu haben, sich selbst nicht als ‚zartbesaitetes‘ Mädchen, sondern als eine abenteuerlustige, wenn nicht gar draufgängerische Natur zu beschreiben. Dies wird auch im Zusammenhang mit anderen Anekdoten über ihre Kindheit und Jugend in ihrem Diktat von 1972 über Schülerinnenstreiche, freche Antworten und „Schinkenbrote im Beichtstuhl“12 deutlich. Inwiefern dies tatsächlich ihre Kindheit und Jugend treffend charakterisiert, läßt sich kaum nachvollziehen. Eine Einwohnerin Warendorfs, Eugenie Haunhorst, erzählte – ihrer Tochter Mechthild Wolff zufolge – daß Dorothea schon in jungen Jahren durch rege Aktivitäten und eher unkonventionelles Verhalten an ihrem Wohnort Aufsehen erregt habe. Allerdings hat es zwischen Eugenie und Dorothea keinen engen Kontakt gegeben, da ‚Thea‘, wie sie
von ihrer Mutter nachgelassene Unterlagen zur Verfügung gestellt, die sich in ihrem Privatbesitz befinden. Beim Gespräch, das mir in digitalisierter Form vorliegt, war der Ehemann Orla-Maria Fels‘, Hans-Heino Fels, teilweise zugegen. Es handelte sich bei dem Gespräch nicht um ein strukturiertes Interview. 5 Die wenigen handschriftlichen Ergänzungen und Veränderungen könnte Theanolte Bähnisch – der Handschrift nach zu urteilen – selbst vorgenommen haben. Als sicher kann dies jedoch nicht gelten. 6 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Eltern, S. 2. Da die Seitenzählung im Diktat mehrmals wechselt, werden, um die Stellen jeweils zweifelsfrei zuordnen zu können, jeweils die Kapitelüberschriften mit angegeben. 7 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Gute Vorsätze, S. 1 a. 8 Ebd., Trotz allem: „Heiter“. Fußstapfen meines Lebens, S. 1. 9 Ebd., S. 2. 10 Ebd. 11 Ebd., Gute Vorsätze, S. 1 a. 12 Ebd., Schinkenbrote im Beichtstuhl, S. 10.
Sozialisation | 111
von Familie und Freunden auch im Erwachsenenalter noch genannt wurde, wesentlich älter als Eugenie war.13 Als erwachsene Frau erinnerte sich Bähnisch, dem Neuen Tageblatt zufolge, mit „besonderer Dankbarkeit an die schönen Jahre“ im „alte[n] idyllische[n] Warendorf“. Sie habe sich das „Kleinstadtidyll“ hin und wieder als eine Phantasiereise, eine „Fata Morgana, die mich immer wieder lockt und verschwindet“ vor Augen geführt, um Kraft für ihren Arbeitsalltag zu finden. „Allein dadurch, daß ich im Geiste für einen Moment in den lieben alten Gassen umhergehe oder aber in den Gartenstiegen, die gerade in der Nähe unseres Hauses so zahlreich sind, strömt aus dieser Erinnerung so viel Ruhe und Frieden in mich ein, daß es wieder weitergehen kann. Ich glaube wir alle, die wir in einem Arbeitseinsatz stehen, brauchen solche Quellen, aus denen uns immer wieder Stärkung zufließt.“14 Doch ihre ersten Lebensjahre verbrachte ‚Thea‘, wie die als Dorothea Nolte geborene oft genannt wurde, gar nicht in Warendorf, sondern im fast 1000 Kilometer entfernten Beuthen in Oberschlesien. In ihrem Diktat von 1972 erwähnt sie – in einem ganz anderen Zusammenhang – nur am Rande15, daß sie in der heute polnischen Großstadt Bytom geboren worden war. In der ‚Dreikaiserecke‘ gelegen, war Beuthen nur 20 Kilometer von Österreich im Südosten und vier Kilometer von Rußland im Nordosten entfernt. Theas Vater Franz Nolte unterrichtete dort seit 1898 als Oberlehrer an der erst 1897 eröffneten städtischen katholischen Realschule.16 Vermutlich war durch einen Mangel an Lehrern in Schlesien eins zum anderen gekommen, denn Noltes Karriere war, bevor er mit seiner Frau Theresia und seinen 1896 und 1897 gebo-
13 Mechthild Wolff an Nadine Freund, 04.06.2008. Eugenie Haunhorst stellte ihre Erinnerungen dem Heimat-Verein Warendorf zur Verfügung. Vgl.: Erlebte Geschichte in Warendorf von Eugenie Haunhorst, auf: http://www.heimatvereinwarendorf.de/erlebtegeschichte/ erlebtegeschichte.htm, am 15.05.2014. Mechthild Wolff ist Vorsitzende des Heimatvereins Warendorf. 14 O. V.: Wer wußte es? Deutschlands erster weiblicher Regierungspräsident stammt aus Warendorf, in: Neues Tageblatt, 26.11.1946. 15 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Besuch bei Minister Severing, S. 16. 16 Im Jahr 1903 wurde die Schule bereits von 320 Schülern besucht. Vgl.: Flaschel, Hermann: Geschichte der Stadt Beuthen in den letzten 40 Jahren, in: Lehrerkollegium der katholischen städtischen Realschule zu Beuthen O/S (Hrsg.): Heimatkunde von Beuthen O/S, Beuthen O.S. 1903, S. 29–36, hier S. 32. Die Heimatkunde, die als Beilage zum Jahresbericht der Schule erschien, knüpft an die Tradition gemeinsamen wissenschaftlichen Publizierens von Lehrern einer Anstalt in einem schulnahen Rahmen an. Auch Franz Nolte leistete einen Beitrag. Vgl.: Nolte, Franz: Erdkundliches, in: Heimatkunde von Beuthen, S. 1– 14. Im Lauf seiner Dienstzeit verfaßte Nolte weitere kurze Aufsätze zu erdkundlichen Themen. Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Fragen (BBF), Personalbögen der Lehrer höherer Schulen Preußens, Personalbogen Franz Nolte, auf: http://www.bbf.dipf.de/cgiopac/digiakt.pl?id=p171973. Laut einer Anmerkung auf dem Personalbogen wurde der am 27.01.1864 in Germete bei Warburg geborene Franz Nolte am 01.05.1924 in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Er starb 1928, mit 54 Jahren. Ebd.
112 | Theanolte Bähnisch
renen Töchtern Maria und Elisabeth nach Beuthen gezogen war, äußert schleppend verlaufen. Aus dem ‚Personalblatt für Direktoren, wissenschaftliche Lehrer und Kandidaten des höheren Schulamts‘17 über den aus Westfalen stammenden Franz Nolte geht hervor, daß er bis 1898 jeweils nur für kurze Zeit als Hilfslehrer an verschiedenen preußischen Schulen angestellt war.18 In den Jahren 1893 bis 1899, dem Geburtsjahr Dorotheas19, legte er neben seiner Lehrtätigkeit diverse Ergänzungsprüfungen ab, um das Spektrum der Fächer, die er unterrichten durfte, zu erweitern. Folgt man einem im Jahr 2010 erschienenen Aufsatz Ekkehard Gühnes, so korrigierte Nolte damit offenbar Versäumnisse aus seinem Studium. Denn im Abschlußzeugnis waren ihm erhebliche methodische und fachliche Mängel bescheinigt worden. Die volle Lehrbefähigung hatte man ihm damals nur für zwei, anstatt, wie von ihm angestrebt, für sechs Fächer erteilt.20 Die Stelle in Beuthen war, zwölf Jahre nach dem Staatsexamen, seine erste Festanstellung. Er scheint den Umzug von seinem letzten Wohnort Uerdingen also aus Karrieregründen auf sich genommen haben, was sich nicht zuletzt darin andeutet, daß er schon 1904 wieder nach Westfalen, wo auch die Eltern und Schwiegereltern lebten, zurückzog, als er dort eine Festanstellung antreten konnte. Aus dem Jahresbericht der Realschule Beuthen von 1899 geht hervor, daß sich die katholische Schule, an der auch evangelische und jüdische Religionslehre zum Fächerkanon gehörte, ihren Schülern wie auch der Beuthener Bürgerschaft gegenüber als humanistisch, preußisch und national präsentierte. Schuldirektor Dr. Hermann Flaschel hatte sich erklärtermaßen zum Ziel gesetzt, unter den Einwohnern Beuthens die „Zuneigung für die oberschlesische Erde und die Liebe zum deutschen Volkstum“21 zu fördern. Deshalb gab er im Jahr 1903 einen heimatkundlichen Sammelband über Beuthen heraus, in dem er selbst die Geschichte der Stadt in den letzten 40 Jahren, also vor allem den Zeitraum seit der Nationalstaatsgründung 1871 beschrieb. Womöglich hatte er damit kompensieren wollen, daß die Stadt, wie er beklagte, „an nationalen Denkmälern […] arm“22 war. Auch im Unterricht der von Flasche geleiteten Beuthener Realschule spielte die Geschichte des jungen Nationalstaats eine wichtige Rolle. Die Jahresberichte der Schule zeigen, daß dies auch den Lehralltag
17 BBF, Personalbogen Franz Nolte. 18 Dem Personalbogen zufolge legte Franz Nolte sein Probejahr in Brilon ab und war dann als unbesoldeter Hilfslehrer 1892 am Gymnasium zu Bochum tätig, bevor er als wissenschaftlicher Lehrer nach Kerpen in der Nähe von Köln ging. Auf eine kurze Aushilfstätigkeit in Coesfeld folgten ebenso kurze in Bocholt, Koldue (Holland) und Bergisch-Gladbach. In Uerdingen, wo seine erste Tochter geboren wurde, war er drei Jahre, von 1995–1898, als Hilfslehrer tätig gewesen. BBF, Personalbogen Franz Nolte. 19 Dorothea Nolte wurde am 25.04.1899 geboren. 20 Gühne: Bähnisch, S. 50. Gühne zufolge hatte Franz Nolte in Münster, Berlin und Leipzig studiert. Vgl.: ebd. 21 Flaschel, Hermann: Vorwort, in: ders.: Heimatkunde von Beuthen, o. S. 22 Die vorhandenen Denkmäler seien in nationaler Hinsicht „nicht wirksam“, so Flaschel. Flaschel, Hermann: Beuthen in den letzten 40 Jahren, in: ders.: Heimatkunde von Beuthen, S. 29–36, hier S. 35.
Sozialisation | 113
Franz Noltes prägte. Zu seinen Aufgaben gehörte nicht nur, in der Quinta und Sexta französische Konjugationen abzuhören, über „die ersten Menschen“ und über „Dädalus und Ikarus“ zu sprechen sowie die Geschichte der „Gründung Roms“ zu unterrichten. Er hatte auch die Rezitation von „Deutschland über alles“, „Mein Vaterland“, und „Heil Dir im Siegerkranz“ mit den Schülern zu üben. Auch dafür, daß die Schüler das Preußenlied auswendig lernten, war der Lehrer Franz Nolte verantwortlich.23 Im Auftrag der Schule hielt der Neuzugang aus Westfalen anläßlich der Kaiser-Friedrich-Feier am 18.10.1899 auch einen Vortrag über das Leben des Kaisers.24 Seine ein halbes Jahr zuvor geborene Tochter Dorothea war in einer stark von der Industrialisierung geprägten Umgebung zur Welt gekommen. Das Stadtwappen, welches das Titelblatt der vom Schuldirektor und dem Kollegium der Realschule herausgegebenen Heimatkunde ziert, zeugt von der Bergbautradition der aufstrebenden Metallindustriestadt Beuthen.25 Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in Beuthen und der Umgegend vor allem Eisen und Zinkerz gewonnen. Die Industrieproduktion und die Bevölkerungszahl waren seither stetig gewachsen. Im Jahr 1900 hatte die Stadt noch 51.004 Einwohner gehabt, 1908 war ihre Zahl bereits auf 63.110 gestiegen. Unter Bürgermeister Brüning, der von 1883 bis 1919 amtierte, entwickelte sich Beuthen zu einer modernen Industriestadt. Bedeutende infrastrukturelle Veränderungen prägten vor allem die erste Hälfte der Amtszeit Brünings und damit auch die Zeit der Familie Nolte in Beuthen. Daß Industrialisierung und Bevölkerungsanstieg beileibe nicht nur positive Entwicklungen nach sich zogen und daß die von der Stadt zu leistenden Baumaßnahmen trotz einer soliden finanziellen Basis mit der rasanten Entwicklung zunächst nicht Schritt halten konnten, hatte auch Franz Nolte erfahren müssen. Selbst Liebhaber von Streifzügen durch die freie Natur, merkte er in einem erdkundlichen Abriß über Beuthen, seinem Beitrag für die ‚Heimatkunde‘, an, daß „das übelriechende Wasser“ im Bach des „früher recht lieblichen und bewaldeten Iserbachtal[...]s“26, dem Spaziergänger neuerdings den Besuch verleide. Wegen einer unzureichenden Kanalisation mußte der Bach nämlich neuerdings die Abwässer der Stadt aufnehmen. Zudem habe die für den Bergbau notwendige „Entwaldung“ das „Gepräge“ der Gegend entscheidend verändert; „mit Wehmut“ erinnerten sich die alten Bürger der Stadt an die „schönen Wälder“, schrieb Nolte.27 „Kalksteinbrüche, Ziegeleien, Sandgruben, qualmende Schornsteine, Chausseen, sich vielfach kreuzende Eisenbahnlinien, Ortschaften mit unfertigen Strassen“ gehörten zu den „unvermeidlichen Begleitformen“ des Bergbaus und des Hüttenbetriebes, „auf dem doch der Wohlstand des gesamten Gebiets“ beruhe.28 Fürwahr: Ohne jene Entwicklungen
23 Vgl.: Städtische katholische Realschule zu Beuthen O. S. (Hrsg.): Dritter Jahresbericht über das Schuljahr 1899, erstattet von dem Direktor Dr. Hermann Flaschel, Beuthen O.S. 1900, S. 7/8. 24 Vgl.: ebd. 25 Vgl.: Flaschel: Heimatkunde. 26 Nolte: Erdkundliches, S. 3. 27 Ebd., S. 5/6. 28 Ebd., S. 5.
114 | Theanolte Bähnisch
wäre die Schule, die der schon bald nach ihrer Ankunft sechsköpfigen Familie Nolte das Auskommen sicherte, wohl kaum eröffnet worden. Lob fand Nolte immerhin für die artifiziellen Grünflächen, die zur Kompensation der verlorenen Naturräume im wahrsten Sinne des Wortes eingerichtet worden waren. „Plätze der Erholung und Erfrischung sind für die außerordentlich dichte Bevölkerung des von Rauch und Staub erfüllten Industriegebiets von grösster Wichtigkeit“29, setzte der Lehrer seinem erdkundlichen Beitrag auch eine gesundheitspädagogische Note auf. Vielleicht war die Erinnerung Theas an das ‚idyllische‘ Warendorf, die vermutlich auch durch eine entsprechende Einstellung der Eltern befördert wurde, nicht zuletzt aufgrund der Zustände in Beuthen etwas verklärt. Die oberschlesische Stadt schien um die Jahrhundertwende den Charakter einer einzigen großen Baustelle gehabt zu haben. Denn dort wurden nicht nur Bodenschätze abgebaut, sondern es wurde auch eine repräsentative Innenstadt aufgebaut. Im Zuge des Stadtausbaus hatte die Beuthener Straßenbahn bereits 1894 ihren Betrieb aufgenommen, der Oberschlesische Bahnhof war 1895 ausgebaut und vergrößert worden. In Ergänzung zum bereits bestehenden Gymnasium (erbaut 1867) und der Fortbildungsschule (1871 errichtet) waren um 1900 die Oberrealschule sowie die Brüningschule begründet worden. Der Bau eines Theaters, eröffnet 1901, eines Konzerthauses (1900) und einer Volksbibliothek (1899) sorgte für Staub und Lärm, stellten das kulturelle Leben jedoch auch auf ein neues, einer modernen Stadt angemessenes Fundament.30 Vielleicht konnte das Bildungs- und Unterhaltungs-Angebot die ländlich/kleinstädtisch sozialisierten Noltes ein wenig für ihren Umzug in die Ferne und den Raubbau an der Natur, dem Franz Nolte sich ausgesetzt sah, entschädigen. Ob das Ehepaar Nolte tatsächlich die Gunst der Stunde genutzt und der Eröffnung des Konzerthauses mit Schillers ‚Jungfrau von Orleans‘ an der Schwelle zum 20. Jahrhundert beigewohnt hatte31, läßt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Es ist ebenso gut möglich, daß die Familie zu dieser Zeit wesentlich auf ihren Zuwachs konzentriert war, denn im Jahr 1900 wurde das vierte Kind der Noltes geboren. 1904 kehrten die Noltes nach Westfalen zurück und ließen sich in der von der Landwirtschaft geprägten, für seine Hengstparaden bekannten Kleinstadt Warendorf nieder. Dort unterrichtete Franz Nolte fortan am 1329 als Lateinschule gegründeten Traditions-Gymnasium Laurentianum32 die Fächer Latein, Griechisch, Französisch, Deutsch, Geschichte und Erdkunde. Der Umzug in die Kleinstadt bedeutete für den Lehrer, dem 1907 die Titel ‚Professor‘ und ‚Rat IV. Grades‘ verliehen wurden33 einen nochmaligen beruflichen Aufstieg. In der Zumlohstraße wohnte die Familie in
29 Ebd. 30 Vgl.: Perlick, Alfons: Beuthen O/S. Ein Heimatbuch des Beuthener Landes, 2. Aufl., Recklinghausen 1982, S. 24. In dem in der Partnerstadt Beuthens erschienenen Werk werde „ein Bild von Beuthen und Umgebung gegeben, wie Stadt und Landschaft in der Erinnerung der Vertriebenen fortleben“, so Perlick. Vgl.: ebd., S. 3. 31 Ebd., S. 58. 32 Zur Geschichte der nach dem heiligen Laurentius benannten Schule vgl. den Sammelband: Gruhn: Laurentianum. 33 BBF, Personalbogen Franz Nolte.
Sozialisation | 115
unmittelbarer Nähe des erst 1902 neu errichteten Bahnhofsgebäudes und nur einen Spaziergang weit vom Arbeitsplatz des Vaters in der Von-Ketteler-Straße entfernt. Glaubt man Dietmar Pfannenstein, der sich mit der Geschichte des Laurentianums von 1875 bis 1927/28 auseinandersetzt, so hatte sich zum Zeitpunkt von Noltes Stellenantritt Kaiser Wilhelm II auch an dieser katholischen Schule als Integrationsfigur bewährt und den ‚Kulturkampf‘ der preußischen Regierung gegen die katholischen Geistlichen in Vergessenheit geraten lassen.34 Pfannenstein schreibt dem Gymnasium unter den Rektorat von Dr. Alfons Egen sogar eine Atmosphäre „patriotischen bis chauvinistischen Nationalismus“ zu.35 Die Brüder Dorotheas, Werner (geboren am 28.02.1907 in Warendorf)36, Reinhard (geboren am 17.01.1910 in Warendorf)37 und Otto Nolte38 besuchten aller
34 Pfannenstein, Dietmar: Preußen und Weimar: Eine Untersuchung über das Verhältnis von Staat und Schule am Beispiel des Gymnasium Laurentianum zu Warendorf in den Jahren 1875–1927/28, in: Gruhn: Laurentianum, S. 109–129, hier S. 115. Der ‚Kulturkampf‘, wie die Politik, mit der die preußische Regierung eine Trennung von Kirche und Staat erreichen und den Einfluß vor allem der katholischen Kirche begrenzen wollte, im Volksmund genannt wird, hatte sich unter anderem im 1871 von Kultusminister Adalbert Falk erlassenen ‚Schulaufsichtsgesetz‘ niedergeschlagen. 35 Ebd., S. 116. 36 Kreisarchiv Warendorf, Meldekarte der Familie Franz Nolte, nicht eingesehen, nach einer Information von Kreisarchiv Warendorf, Karoline Ritsch an Nadine Freund, 30.01.2007. 37 Ekkehard Gühne vom Heimatverein Warendorf gibt, basierend auf den Unterlagen des Einwohnermeldeamtes Warendorf, diese Geburtsdaten an. Ekkehard Gühne an Nadine Freund, 28.05.2008. Der Pädagoge verfaßte einen Aufsatz sowie eine Monographie über die Marienschule. Vgl.: Gühne: Bewegung sowie ders.: Marienschule. 38 Im Kreisarchiv Warendorf konnte zu Otto Nolte kein Geburtsdatum ermittelt werden. Kreisarchiv Warendorf, Karoline Ritsch an Nadine Freund, 30.01.2007. Auf dem Personalblatt Franz Noltes, der zur Zeit der Ausstellung des Blattes zwei Kinder hatte, ist angegeben „1 Kind geb. 8/7 1900“. BBF, Gutachterstelle des BIL – Preußische Volksschullehrerkartei, Personalblatt Franz Nolte, auf: http://bbf.dipf.de/hans/VLK/VLK-0013/vlk-00130562.jpg, am 30.10.2012. Dabei scheint es sich um das Geburtsdatum Otto Noltes zu handeln, denn die Geburtsdaten aller anderen Kinder sind bekannt und stammen nicht mit diesem Datum überein. Otto Nolte arbeitete unter Adolf Grimme 1930 als Regierungsrat im Kultusministerium in der Abteilung U II, Höheres Schulwesen. Der älteste Sohn Franz Noltes wählte also einen Beruf, der sowohl einen Bezug zu dem des Vaters, als auch zu dem seiner Schwester Dorothea aufwies. Später wurde Nolte zum Ministerialrat befördert. Vgl.: Art.: „Nolte, Otto“, in: Wer ist’s, Berlin 1955, S. 860. Nach Kriegsende unterstützte er seine Schwester Dorothea offenbar zunächst bei der Etablierung ihrer Geschäfte als Verwaltungsrechtsrätin. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 23.12.1945. Er lebte noch 1955 in der Kölner Wohnung seiner Schwester. Vgl.: Art.: „Nolte, Otto“, in: Wer ist’s. Bis 1961 war er erster Vorsitzender der 1954 gegründeten ‚Vereinigung privater Wohnungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen e.V. im Zentralverband der Deutschen Haus- und Grundbesitzer‘ (heute Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Nordrhein-Westfalen e.V.) Ziel des Verbandes, der unter dem Dach
116 | Theanolte Bähnisch
Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls die Einrichtung, an der ihr Vater lehrte. Insbesondere die späteren Laufbahnen Ottos und Werners39 setzten ein Studium – und damit auch eine höhere Schulbildung als ‚Eintrittskarte‘ in das Studium – voraus. Von den Töchtern Maria (geboren am 16.08.1896 in Ürdingen40 bei Krefeld), Elisabeth (geboren am 06.10.1897 in Warendorf)41 und Dorothea ist überliefert, daß sie zur ebenfalls in der Von-Ketteler-Straße gelegenen katholischen Marienschule gingen42. Vermutlich traf das auch auf die jüngste Tochter Irmgard (geboren am 16.07.1908 Warendorf) zu. 2.1.2 Franz Noltes Engagement für die Mädchenbildung Für die Errichtung einer solchen Mädchenschule in Warendorf hatte sich Franz Nolte aktiv im Rahmen eines Schulvereins eingesetzt.43 Ähnliche Institutionen, die ihm bereits bekannt waren, könnten ihm dabei als Vorbilder gedient haben. Schließlich hatte es an seinem vorigen Dienstort Beuthen bereits seit 1869 eine ständige Töchterschule
39 40
41 42
43
von ‚Haus und Grund Deutschland‘ gegründet wurde, war es, „einen möglichst weiten Kreis von Wohnungsunternehmen und Großhausbesitzern zu erfassen“. Broschüre des Landesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen NRW e.V., o. D. Seinen ersten Sitz hatte der Verband in Köln. 1961 legte Otto Nolte, der zu dieser Zeit bereits in Freiburg wohnhaft war, sein Amt nieder. Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmer Nordrhein-Westfalen an Nadine Freund, 15.05.2009. Daneben war Otto Nolte Vorstandsmitglied der Tuchfabrik Jos. Königsberger AG in Aachen und Aufsichtsratsmitglied der Westdeutschen Kaufhof AG. Vgl.: Art. „Nolte, Otto“, in: Wer ist’s. Die Ausgabe des ‚Wer ist wer‘ von 1958 führt ihn als Komplementär der Tuchfabrik. Vgl.: Art.: „Nolte, Otto“, in: Wer ist wer, Berlin 1958, S. 926. Zu Otto Nolte siehe vorherige Anmerkung. Zu Werner Nolte siehe Anm. 120. Nach Angaben des Stadtarchivs Krefeld, Paul Günter Schulte an Nadine Freund, 26.03.2009 war Franz Nolte am 03.06.1896 nach Ürdingen gezogen, wo er bis 1898 als Hilfslehrer tätig war. BBF, Personalblatt Franz Nolte. Von dort zog er am 16.04.1898 nach Beuthen. Kreisarchiv Warendorf, Meldekarte der Familie Franz Nolte, nicht eingesehen, nach einer Information von: Kreisarchiv Warendorf, Karoline Ritsch an Nadine Freund, 30.01.2007. Nach Auskunft von Ekkehard Gühne, Heimatverein Warendorf an Nadine Freund, 28.05.2008 sind Maria, Elisabeth und Dorothea als Schülerinnen der Marienschule im Jahr 1911 nachgewiesen. 67 Schülerinnen gab es damals insgesamt an der Schule. Vgl.: Gühne: Marienschule, S. 61. Nach Auskunft von Karoline Ritsch, Kreisarchiv Warendorf an Nadine Freund, 30.01.2007 liegen in den Akten der Höheren Töchterschule von 1900 bis 1920 keine Einträge über Schülerinnen vor. Gühne bezieht seine Informationen vermutlich aus einer Kartei des Vereins ehemaliger Schülerinnen, die im Schularchiv des Mariengymnasiums überliefert ist. Bähnisch selbst schreibt, daß sie mit 14 Jahren die Höhere Töchterschule verlassen habe. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Gute Vorsätze, 1 a. Kreisarchiv Warendorf, Karoline Ritsch an Nadine Freund, 30.01.2007. Demnach war Nolte Mitglied des Schulvereins der höheren Töchterschule.
Sozialisation | 117
gegeben44. In Warburg, einer vom Geburtsort des Vaters nur drei Kilometer entfernten Stadt, in der er seiner Tochter Dorothea zufolge selbst zur Schule gegangen war45, war sogar schon zwei Jahre nach der Geburt Franz Noltes, 1866, eine solche Schule begründet worden.46 Warendorf mag in seinen Augen also dringenden Nachholbedarf gehabt haben – besonders, da er im Jahr 1906 schon Vater dreier Töchter war, für die er sich mehr als nur eine Volksschulausbildung wünschte. Der Bürgermeister Warendorfs hatte bereits 1870 die Einrichtung einer Mädchenschule als „längst gefühlte[s] Bedürfnis[...]“47 erkannt und gemeinsam mit engagierten Bürgern erfolgreich auf die Entstehung einer Töchterschule hingewirkt. 1874 hatte er erreicht, daß Mädchen ab zehn Jahren aufgenommen werden konnten, nachdem zunächst nur den nicht mehr schulpflichtigen Mädchen erlaubt worden war, die Schule zu besuchen. Seine Begründung, daß in Warendorf viele Beamte wohnhaft seien, „welche ihren Kindern nur eine gute Ausbildung mitgeben können“ und daß „in anderer Weise für die höhere Ausbildung von Töchtern hier nicht gesorgt werden“48 könne, muß überzeugend gewesen sein. Weil viele Bürger – in Folge beschränkter Erwerbsmöglichkeiten – Warendorf zwischen 1855 und 1900 verließen, aber auch aufgrund von Differenzen zwischen den Konfessionen vor Ort und schließlich wegen finanzieller Auseinandersetzungen zwischen Stadt und Staat, hatte die Mädchenschule, ebenso wie ihre Folgeeinrichtungen, kein leichtes Spiel. Ständig waren Einrichtungen, die der Mädchenbildung in Warendorf dienen sollten, von Soldkürzungen der Lehrerinnen, Umzug oder Schließung bedroht.49 1905, ein Jahr nach dem Zuzug der Familie Nolte, gab es neue Pläne, die Mädchenbildung in Warendorf auf ein solides Fundament zu stellen. Die angestrebte Einrichtung einer katholischen Ordensschule am Ort wies die preußische Regierung jedoch aus Angst vor den von ihr angenommenen kirchenpolitischen Absichten katholischer Geistlicher zurück. Um den 98 potentiellen Schülerinnen, welche ein Verzeichnis von mittleren und höheren Beamten in Warendorf aufwies50, sowie den Töchtern der Gewerbetreibenden und Unternehmern eine den elterlichen Ansprüchen gemäße Ausbildung zu Teil werden zu lassen, wurde auf maßgebliches Dafürhalten des Pfarrer Strumann 1906 der
44 Die 1869 gegründete Katholische Höhere Töchterschule wurde von den Armen Schulschwestern unserer lieben Frau geleitet. Nach der Auflösung im ‚Kulturkampf‘ 1879 wurde sie 1892 wiedereröffnet. Vgl.: Perlick: Beuthen, S. 52. 45 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Eltern, S. 1. 46 Vgl.: Möller, Hartmann: Das Hüffertgymnasium Warburg, in: Mürmann, Franz (Hrsg.): Die Stadt Warburg. Beiträge zur Geschichte einer Stadt, Warburg 1986, Bd. 2, S. 251–278. 47 Zitiert nach Gühne: Marienschule, S. 4. 48 Ebd., S. 7. 49 Zur weiteren, schwierigen Entwicklung des Mädchenschulwesens in Warendorf vgl.: Gühne: Marienschule, S. 12–29. 50 Das Verzeichnis wurde im Rahmen des Antrags auf die Einrichtung einer Ordensschule 1905 erstellt. Vgl.: Gühne: Marienschule, S. 30.
118 | Theanolte Bähnisch
Schulverein gegründet51, In dem Franz Nolte sich engagierte. Im Rahmen des Vereins sollte, „nach Maßgabe der Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches versucht werden, die Mittel und Wege zu finden, um eine den heutigen Verhältnissen und den modernen Ansprüchen entsprechende, lebensfähige, katholische höhere Mädchenschule, die jedoch der weiblichen Jugend ohne Unterschied der Konfession zugänglich sein soll, unter Leitung weiblicher Lehrpersonen einzurichten und zu unterhalten.“52 Dafür, daß es so lange gedauert hatte, bis sich in Warendorf eine ständige Töchterschule etablierte, macht der Pädagoge und Heimatkundler Ekkehard Gühne die Tatsache verantwortlich, daß zunächst die Mehrheit der Eltern, welche ihre Töchter auf eine solche Schule schicken wollten, wohlhabende Leute gewesen seien. Diese hätten auch die Kosten dafür in Kauf genommen, ihre Kinder in Bildungseinrichtungen außerhalb von Warendorf beschulen zu lassen, erklärt der Lehrer. Auch einige Beamte hätten auf sehr soliden Füßen gestanden. „[A]uf die wenigen einfachen Beamten schien man […] keine Rücksicht nehmen zu müssen“53, erklärt Gühne. Als die Familie Nolte an den Ort kam, lagen die Fälle bereits etwas anders: auch unter weniger gut situierten Beamten hatte sich zu diesem Zeitpunkt die Überzeugung durchgesetzt, daß Mädchen eine höhere Schulbildung erhalten sollten. Daß ihr Vater nicht ‚reich‘ gewesen sei, betonte Bähnisch in ihren Erinnerungen von 1972. Seine Entscheidung, sie zur Vorbereitung auf das Abitur auf die Studienanstalt der Ursulinen in Köln zu schicken, sei gefallen, um Geld für ihr Studium zu sparen. „Tust Du das nicht und muss ich Dich mit höheren Kosten woanders unterbringen, dann ist es aus mit Deinen Studienplänen“, zitierte sie ihren Vater – und stellte damit sein Interesse an der Bildung und der beruflichen Entwicklung seiner Töchter als handlungsleitendes Moment dar. „Du hast noch sechs Geschwister. Alle, auch Deine drei Schwestern müssen einen Beruf erlernen. Und ich bin kein reicher Mann.“54 Im Jahr 1908 wurde das preußische Schulsystem für Mädchen neu gegliedert: Eine ein- oder zweijährige Haushaltungsschule, ein höheres Lehrerinnenseminar (Oberlyzeum) sowie eine Studienanstalt, die direkt auf ein Universitätsstudium vorbereitete, sollten zur Wahl stehen – zumindest in den großen Städten. Die Veränderungen gingen Hand in Hand mit der Zulassung von Frauen zum regulären Universitätsstudium im gleichen Jahr, die eine entsprechende Schulbildung voraussetzte. Die Zeichen standen also – was sich auch in einem staatlichen Zuschuß für den Schulverein niederschlug – besonders günstig, als der Verein im Jahr 1908 ein Schulgebäude mit
51 Gründungsaufruf, in: Emsbote, 27.11.1906, zitiert nach Gühne: Marienschule, S. 35. Die Mitgliedschaft im Schulverein war nur katholischen Personen erlaubt. Dem Vorstand gehörte Franz Nolte nach den Aufzeichnungen Gühnes nicht an, aber als eines von 33 Mitgliedern des Vereins ist er im Registereintrag des Amtsgerichts genannt. Neben Kaufleuten und Gewerbetreibenden waren vor allem Lehrer – neben Nolte noch sieben weitere – Mitglieder des Vereins. Zum Verzeichnis der Mitglieder vgl.: Gühne: Marienschule, S. 36–39. 52 Gründungsaufruf, in: Emsbote, 27.11.1906, zitiert nach Gühne: Marienschule, S. 35. 53 Gühne: Marienschule, S. 26. 54 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Trotz allem: „Heiter“. Fußstapfen meines Lebens, S. 1.
Sozialisation | 119
Direktorinnenwohnung in der Stadt erwarb.55 Nach drei Jahren Volksschule konnten die Warendorfer Mädchen nun auf die Marienschule56 wechseln, in der 1909 Bertha Schlothmann das Direktorat übernahm und die Schule bis 1923 leitete.57 In der Erinnerung der ehemaligen Schülerin Eugenie Haunhorst tat sie dies mit „unnachgiebiger Strenge und eisernen Prinzipien“58. Ob Theanolte, die etwa zeitgleich mit der Eröffnung der Schule ins entsprechende Schulalter kam, ähnliche Erinnerungen an die Direktorin hatte, ist nicht überliefert. Akademisch vorgebildete Lehrkräfte gab es zum Eintritt von Thea in die Marienschule jedenfalls noch nicht59. Dies schrieb die preußische Schulordnung für ‚Höhere Töchterschulen‘, eine Schulform, welche zehn aufsteigende Klassen umfassen sollte, jedoch vor. Die ‚Marienschule‘ war also in den ersten Jahren der Definition nach noch keine ‚Höhere Töchterschule‘, sondern eine ‚gehobene Mädchenschule‘‚ beziehungsweise eine ‚Privat-Mädchenschule‘. So waren dem preußischen Gesetz nach Mädchenschulen zu bezeichnen, welche die für ‚Höhere Töchterschulen‘ vorgeschriebenen fünfzig Prozent an akademisch vorgebildetem Personal nicht vorweisen konnten.60 Das „Niveau der Unterweisung“ sei, so Ekkehard Gühne, vor diesem Hintergrund zunächst vermutlich „hinter der Norm“61 zurückgeblieben. Doch die überlieferte Stunden- und Fächerverteilung aus dem Jahr 1911 entsprach fast genau den preußischen Vorschriften von 1908 für ‚Höhere Töchterschulen‘.62 Und es steht zu vermuten, daß Theanolte das, was sie in der Schule vielleicht nicht lernte, aufgrund der entsprechenden Ausbildung des Vaters und seines Interesses an ihrer Bildung durch die Betreuung im Elternhaus problemlos kompensieren konnte. 2.1.3 Darstellung der Eltern-Familien in autobiographischen Texten Bähnischs Als „eine Tochter aus bürgerlichem Hause“ bezeichnet die Hannoversche Allgemeine Zeitung Theanolte Bähnisch im Jahr ihrer Pensionierung, 196463. Sie selbst scheint nach Kriegsende, vielleicht nicht zuletzt, um damit eine größere ‚Volksnähe‘ zu erreichen, Wert darauf gelegt zu haben, ihre Wurzeln anders zu definieren. „Ich
55 Schon 1907 hatte neben dem Schlachthof am Münsterwall Unterricht stattgefunden, Thea dürfte, da sie zu dieser Zeit erst acht Jahre alt war, jedoch nicht unter den 42 Schülerinnen gewesen sein. 56 Ihren Namen erhielt die Schule allerdings erst 1910. 57 Vgl.: Gühne: Bewegung, S. 132. 58 Haunhorst, Eugenie: Es wehte noch der Wind der Höheren Töchterschule, in: Erlebte Geschichte Gühne stellt Schlothmann auf der Grundlage von Erinnerungen von Schülerinnen (die er aber nicht namentlich nennt) als „starrsinnig“ und „hyperkatholisch“ dar. Gühne: Marienschule, S. 57. 59 Vgl. Gühne: Bewegung, S. 130/131. 60 Vgl. Gühne: Marienschule, S. 44 61 Gühne: Marienschule, S. 61. 62 Vgl.: ebd. 63 O. V.: Theanolte Bähnisch, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 13.04.1964.
120 | Theanolte Bähnisch
stamme aus einer alten westfälischen Bauernfamilie und zwar sowohl väterlicherwie auch mütterlicherseits“64, leitet sie die um 1946 entstandene ‚Lebensskizze‘ ein. Grundsätzlich stimmen ihre Aussagen mit dem, was sich andernorts nachvollziehen läßt, überein: Beide Elternteile stammten aus dem kleinen Dorf Germete65 bei Warburg, das an der heutigen Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen liegt. Franz Nolte war dort am 27.01.1864, seine spätere Frau, Theresia Kalthoff, am 17.02.1870 geboren worden.66 Auf dem ‚Personalblatt‘ Franz Noltes ist als Beruf seines Vaters – also Theanoltes Großvater – Adam Nolte67 „Oekonom“68 eingetragen. Ekkehard Gühne, der den Großteil seiner Informationen aus der Personalakte Franz Noltes bezieht, schreibt ebenfalls, daß Adam Nolte „Landwirt“69 gewesen sei. Die Eltern von Theresia Kalthoff scheinen ebenfalls Landwirte gewesen zu sein,70 Bähnischs Aussagen in ihrem Diktat 1972 deuten jedoch darauf hin, daß es sich bei Bähnischs Vorfahren jedoch keinesfalls um Kleinbauern, sondern um Besitzer größerer Ländereien handelte.
64 AddF, SP-01, Lebensskizze. 65 Zum für seine Mineralquellen bekannt gewordenen Germete vgl.: Leifeld, Josef: Germete, in: Mürmann: Warburg, S. 454–457. 66 Stadtarchiv Hannover, Jung-König, Christel an Nadine Freund, 25.05.2009. Jung-Königs Auskuft stützt sich auf Einwohnermeldekarten. Dieselben Daten über Theresia Kalthoff sind Ekkehard Gühne zufolge im Standesamt Dortmund/West unter Nr. 703/1958 überliefert. Vgl.: Gühne: Bähnisch, S. 54, Anm. 5. Die Lebensdaten Franz Noltes finden sich laut Gühne auch in Noltes Personalakte im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Schulkollogium Münster, Acta betreffend Franz Nolte. Vgl.: Gühne: Bähnisch, S. 54, Anm. 4. Vgl. zu den Lebensdaten Theresias auch Stadt Hannover, Fachbereich Recht und Ordnung, Hausbuch Schopenhauer-Str. 9 (Als Faksimile übersandt vom Stadtarchiv Hannover an die Verfasserin, 25.05.2009.) Dort lebte Bähnisch 1948. 67 Einer Zusammenstellung von Lebensdaten aus der Überlieferung der Familie Fels, Waiblingen nach zu urteilen, war Johann Adam Nolte am 21.11.1833 in Germete geboren und am 24.09.1898 dort verstorben. Seine Frau Augustine Ernestine Kayser war im Mai 1830 in Herstelle geboren und am 06.02.1904 in Germete gestorben. Das Paar hatte sechs Kinder. Private Unterlagen von Hans-Heino Fels, Vorfahrentafel Georg, Hans, Margarethe, Elisabeth, Helene und Albrecht Bähnisch, Stand 12.05.2006, zusammengestellt von Hans Jürgen Feilke. 68 BBF, Personalbogen Franz Nolte. Zu jener Zeit wurde der Begriff in der Bedeutung von ‚Landwirt‘ verwendet. 69 Gühne: Bähnisch, S. 54. Im Waldeckischen Ortssippenbuch ist ebenfalls ein Bauer namens Adam Nolte für das kleine Dorf Germete erwähnt, jedoch ist unklar, auf welche Zeit sich diese Angabe bezieht. Vgl.: Wetekam, Robert: Wethen, Waldeck in Hessen, Arolsen 1960 (Waldeckische Ortssippenbücher, Bd. 8), Auszug auf: http://www.wethen.de/sippentw.htm, am 15.05.2014. 70 Vgl.: Vorfahrentafel Bähnisch. Demnach waren die Eltern von ‚Therese‘ Kalthoff [in anderen Quellen fällt der Name ‚Theresia‘] Franz Kalthoff, geboren am 08.03.1831 in Scherfede, gestorben am 08.03.1885 in Germete sowie Maria Helene Fecke, geboren am 09.11.1833 in Germete, gestorben daselbst am 17.09.1885.
Sozialisation | 121
Die Höfe ihrer Eltern, der Kalthoff-Hof und der Nolte-Hof seien, so berichtet Bähnisch „[i]m Grunde […] miteinander verfeindet“ gewesen. „Aber das Merkwürdige war, dass immer in der 2. oder 3. Generation zwei junge Leute von den beiden Höfen zusammenfanden, heirateten.“ Ihre Eltern seien zusammen zur „höheren Schule“ in Warburg gegangen. „Auf diese Weise entstand eine Kinderliebe, die später zur Ehe führte.“71 Daß Bähnisch die Geschichte von den miteinander verfeindeten Höfen in ihren Erinnerungen erzählte, könnte den Zweck gehabt haben, die Funktionen der beiden Familien in der Dorfgemeinschaft als herausgehoben zu beschreiben: Die Familie ihres Vaters sei neidisch auf die Familie ihrer Mutter gewesen, da zum Hof der Kalthoffs große Jagdgründe gehörten. Um sich die Feld-Jagd zu sichern, habe sich immer jemand aus der Familie Nolte um den Bürgermeister-Posten beworben, meistens mit Erfolg.72 Doch darauf habe die Familie Kalthoff ehrgeizig reagiert und sich ihrerseits, ab und an erfolgreich, um das Amt beworben. Bähnisch stellt die Verhältnisse in ihrem Diktat so dar, als sei das Amt des Bürgermeisters quasi ausschließlich zwischen den beiden Flügeln ihrer Familie hin- und hergewechselt. Damit legt sie – wenn man so will – die Interpretation nah, daß ein Grundstein ihrer eigenen politischen Karriere bereits in ihrer Familie gelegen habe – und zwar in beiden Elternhäusern. Dies wiederum stellt eine auffällige Abwandlung ihrer Aussage in der früher verfaßten, kurzen Lebensskizze dar, in der sie sich nur auf die bäuerliche Tradition in ihrer Familie beruft.73 Daß die Kinder der Familien Nolte und Kalthoff Bähnischs Ausführungen im Diktat zufolge eine Höhere Schule in Warburg besuchten74, zeigt an, daß beide Familien durchaus wohlhabend waren. Im gleichen Diktat nimmt Theanolte Bähnisch verschiedene vielsagende Gegenüberstellungen der Familien ihrer Eltern vor. Die Familie ihres Vaters stellt sie als gebildet und feinsinnig dar, die Kalthoffs hätten eher dem „Typ des derben Bauern und Gutsbesitzers“ entsprochen. „Es waren kluge, kultivierte Frauen, die auch z. B. ihr Kränzchen nicht in Germete, sondern in Warburg hatten“75, beschreibt sie die Frauen in der Familie Nolte – und macht damit auch deutlich, daß jene Frauen offenbar nicht zum Einkommen der Familie beitragen mußten. Dem Kaffeekränzchen der Noltes in Warburg stellt Bähnisch die Verbundenheit der Kalthoffs mit Germete und den Nachbardörfern gegenüber. Besonders hebt sie den Umstand hervor, daß ihr Onkel, der der einzige Bruder ihrer Mutter gewesen sei, eine „mehr bäuerlich eingestellte“ Frau aus dem Nachbardorf geheiratet habe, welche jedoch ihre „Heiterkeit“
71 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Eltern, S. 1. 72 Offenbar war der Enkel Franz Noltes, Otto Nolte, der 1904 geboren war, Bürgermeister von Germete gewesen. Private Unterlagen von Hans-Heino Fels, Vorfahrentafel Georg, Hans, Margarethe, Elisabeth, Helene und Albrecht Bähnisch, Stand 12.05.2006, zusammengestellt von Hans Jürgen Feilke. 73 AddF, SP-01, Kurze Lebensskizze, o. D. [1946]. 74 Diktat, 1972, Teil I, Eltern, S. 1. 75 Ebd.
122 | Theanolte Bähnisch
mit in die Familie gebracht habe. Die Schwestern ihres Vaters dagegen hätten in entferntere Höfe eingeheiratet.76 Womöglich war es Bähnischs Ziel, die ‚Herkunft‘ ihrer eigenen, verschiedenen Charaktereigenschaften den verschiedenen Familienflügeln zuzuschreiben. Folgt man jener Logik, dann hätte sie ihre ernste, sachliche Seite in ihrer Wahrnehmung von der als klug und feinsinnig, aber auch als eher kühl beschriebenen Familie ihres Vaters geerbt, bei der man nur ‚Anstandsbesuche‘ zu machen pflegte77. Ihre fröhliche, unbeschwerte Seite, die sie in ihrem Diktat von 1972 stark betont78, hätte sie demnach eher von der Familie der Mutter übernommen. Eine weitere polarisierende Zuschreibung nimmt sie anhand eines Vergleichs der Häuser beider Familien vor: Während das Haus der Noltes „stattlich, aber geschichtslos“ gewesen sei, hätte die Familie Kalthoff einen „über 200 Jahre“ alten „Fachwerkbau mit einer riesigen Diele“79 bewohnt. Tradition und Moderne, so ließe sich hieraus ableiten, fanden also erst in den Nachkommen Franz Noltes und Theresia Kalthoffs zusammen. Zu Bähnischs Selbstdarstellung zu Beginn der 1970er Jahre gehörte es, zu betonen, daß die Frauen in der Familie Nolte nicht nur klug und feinsinnig, sondern auch selbständig und mutig waren. Indem sie berichtet, daß die Schwester ihres Vaters als frühe Witwe einen Gutshof selbständig, „mit starker Hand“80 geführt und in diesem Zusammenhang auch die Idee gehabt habe, Kleinkinder in Dortmund mit Milch von Bauernhöfen zu versorgen, stellte sie ihre Tante als erfolgreich und unabhängig dar. Als emanzipiert wird ‚Tante Johanna‘81 auch über Bähnischs Hinweis darauf charakterisiert, daß sie sich gegenüber männlichen Würdenträgern am Ort mit ihren Über-
76 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Eltern, S. 2. Diese Angaben stützt auch die in der Familie Fels überlieferte Vorfahrentafel Bähnisch. Josefa Nolte war demnach auf einem Gut bei Lippspringe, Johanna Nolte auf einem Gut bei Dortmund gestorben. Private Unterlagen von Hans-Heino Fels, Vorfahrentafel Georg, Hans, Margarethe, Elisabeth, Helene und Albrecht Bähnisch, Stand 12.05.2006, zusammengestellt von Hans Jürgen Feilke. 77 Der Vorfahrentafel Bähnisch zufolge muß der jüngere Bruder Franz Noltes, Otto Nolte, den Hof übernommen haben. (Ebd.) Von dessen Frau wiederum berichtet Theanolte Bähnisch, daß sie Kinder nicht besonders gemocht habe, weshalb die Familie Franz Nolte dort nicht oft zu Besuch gewesen sei. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Eltern, S. 7. 78 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Trotz allem: „Heiter“, Fußstapfen meines Lebens, passim. 79 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Eltern S. 3. 80 Ebd., S. 6. 81 Dabei muß es sich um Johanna Wortberg, geborene Nolte, die auf Gut Buschmühle bei Dortmund gestorben war, handeln. Private Unterlagen von Hans-Heino Fels, Vorfahrentafel Georg, Hans, Margarethe, Elisabeth, Helene und Albrecht Bähnisch, Stand 12.05.2006, zusammengestellt von Hans Jürgen Feilke.
Sozialisation | 123
zeugungen behauptet habe.82 Indem Bähnisch den Kontakt zu den Schwestern ihres Vaters, vor allem zu ihrer Tante Johanna, als eng beschreibt, rückt sie sich selbst in die Nähe dieser selbständigen, mutigen und kultivierten Frauen.83 Die Großeltern Theanolte Bähnischs starben beiderseits so früh, daß Thea sie kaum gekannt haben wird.84 Die Rolle ihres eigenen, mit 55 Jahren verhältnismäßig jung verstorbenen Vaters, wie ihn Bähnisch in ihrer kurzen Lebensskizze und in Zeitungsartikeln erinnert, war die des Lehrers – im beruflichen wie im häuslichen Kontext. Dies mag damit zu tun gehabt haben, daß der Vater die Verbindung zu seiner Tochter offenbar vor allem über häusliche Lektionen herstellte.85 Er schien sie über Jahre selbst unterrichtet zu haben. In ihrem Diktat von 1972 berichtet Bähnisch, daß ihr Vater zwar der älteste Sohn der Familie war, daß er aber nicht daran interessiert gewesen sei, sein dementsprechendes Erbe anzutreten. Sie beschreibt ihn als „hochgebildet“. Er habe Professor werden wollen, sei jedoch „nicht darüber orientiert“ gewesen, „was dazu gehört, an einer Hochschule anzukommen.“86 Unter anderem habe er den Fehler gemacht, „aus katholischer Sicht“ an einer protestantisch geprägten Hochschule eine Vorlesung über die Geschichte der Päpste zu halten.87 Nach seiner Ablehnung in Leipzig habe er es an keiner anderen Universität mehr versucht. Diese Schilderung wirft ein ganz anderes Licht auf Franz Nolte als das Hochschulabgangs-Zeugnis, welches ihm so gravierende fachliche Mängel in seinen Studienfächern bescheinigt hatte. Für Theanolte Bähnisch stand fest, daß ihr Vater „ein sehr guter Pädagoge“ war und daß er es geliebt hatte, zu unterrichten.88 Der neue Direktor des Laurentianums, Dr. Julius Kaumann, der dem offenbar sehr national eingestellten Dr. Egen nachgefolgt war, kam jedoch 1924, als er im Zuge von verfügten Sparmaßnahmen Lehrer mit reduzierten Bezügen in den Wartestand versetzen sollte, zu einer vernichtenden Einschätzung, was die pädagogischen Fähigkeiten Noltes betraf. Der Lehrer habe sich, so Kaumann „als Erzieher arger Missgriffe schuldig gemacht“. Er bewertete die „Ergebnisse seiner Lehrtätigkeit“ insgesamt als „minderwertig“ und kam zu dem Schluß, daß Nolte zu jenen Lehrern gehöre, „[d]eren Entfernung ein Gewinn für das höhere Schulwesen bedeutet.“89 Ob diese Bewertung
82 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Eltern, S. 6. 83 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Eltern, S. 3. 84 Der Aufstellung von Hans Jürgen Feilke zufolge verstarb das letzte Großelternteil Bähnischs im Februar 1904. Vgl.: Vorfahrentafel Bähnisch. Zu dieser Zeit hatte Thea noch gar nicht in deren Nähe, sondern in Oberschlesien gelebt. 85 Hierbei soll es sich um die Zeit ab ihrem 14. Lebensjahr bis zu ihrem Eintritt in die Ursulinenschule in Köln, zwei Jahre später, gehandelt haben. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Gute Vorsätze, S. 1a. 86 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Eltern, S. 3. 87 Ebd. 88 Ebd., S. 4. 89 Personalakte Franz Nolte, zitiert nach Gühne: Bähnisch, S. 52.
124 | Theanolte Bähnisch
Noltes, die völlig konträr zu der ist, die seine Tochter vornahm, auf den Lehrer wirklich zutraf, läßt sich heute kaum mehr rekonstruieren. Franz Nolte vermutete jedenfalls einen anderen Grund hinter seinem ‚Rausschmiß‘, den er erbittert, aber erfolglos90, mit dem Hinweis, er habe noch mehrere Kinder zu unterhalten, zu verhindern versucht hatte. Er war nämlich Mitglied der 1918 gegründeten DNVP und glaubte, daß dies in dem von der Zentrums-Partei dominierten Warendorf und im katholisch geprägten Jungengymnasium Laurentianum der wahre Stein des Anstoßes sei. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen: Hält man sich vor Augen, daß sich die DNVP bei den lokalen Wahlen 1924 mit nur 4,1 Prozent gegenüber dem Zentrum als mit 72, 7 Prozent der Stimmen stärkste Partei geschlagen geben mußte91, so dürfte Nolte tatsächlich als Fremdkörper am Ort und in der katholischen Schule wahrgenommen worden sein. Offenbar wollte der neue, weniger national eingestellte Schulleiter92 aber auch die Beschwerden, die ihn aus der jüdischen Familie Cohen erreicht hatten, nicht auf ‚seiner‘ Schule sitzen lassen. Gühne jedenfalls vermutet in den von Franz Nolte selbst thematisierten Auseinandersetzungen mit einem jüdischen Schüler93 die Erklärung für die Mißstimmung gegen Nolte und weist in diesem Kontext auf die „judenfeindlichen Töne“94 hin, die in der DNVP bekanntermaßen angeschlagen wurden. Daß Theanolte Bähnisch ihrem Vater, wie Gühne schreibt, politisch nicht folgte95, ist zweifellos richtig. Daß sie seine Zugehörigkeit zur DNVP, von der sie als eine an den Vorgängen des öffentlichen Lebens interessierte Frau vermutlich wußte, in den aus der Nachkriegszeit überlieferten Quellen nicht erwähnt, verwundert kaum. Schließlich hatte die konservativ-nationale Partei mit der NSDAP, von der es sich nach 1945 tunlichst zu distanzieren galt, eng zusammengearbeitet. Daß sie ihren Vater auch im Jahr 1972 noch bruchlos idealisierte und seine Zugehörigkeit zur DNVP unerwähnt läßt, offenbart den Wunsch, die eigene Biographie als möglichst widerspruchslos darzustellen. Sie habe ihren Vater sehr geliebt, schreibt Bähnisch.96 Es ist, auch vor diesem Hintergrund, nachvollziehbar, daß eine kritischere Würdigung seiner Persönlichkeit durch die spätere Regierungspräsidentin nicht erfolgte.
90 Am 01.05.1924 wurde der am 27.01.1864 in Germete bei Warburg geborene Nolte in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Er starb 1928, mit 54 Jahren. 91 Vgl.: Gühne: Bähnisch, S. 52. 92 Ebd. 93 Dabei dürfte es sich um Otto oder Kurt Cohen gehandelt haben. Vgl.: Reiser, Wolfgang: „Die Familie des Siegmund Cohen (1873–1938), Schicksale Warendorfer Juden im Schatten der Schoah“. Vortrag von Dr. Ekkehard Gühne am 29.11.12, auf: http://www.heimat vereinwarendorf.de/juedisches-leben/vortrag-guehne-cohen-29-11-12.html, am 15.05.2014. 94 Gühne: Bähnisch, S. 52/53. 95 Ebd., S. 53. 96 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Gute Vorsätze, S. 1a.
Sozialisation | 125
2.1.4 Die gestaltende Macht des Glaubens und der Kirche in Theas Jugend Die in der Bürgertumsforschung beschriebenen Gräben zwischen den als genuin protestantisch definierten ‚Bildungsbürgern‘ auf der einen und den ‚katholischen Gebildeten‘ auf der anderen Seite97 mögen in Warendorf aufgrund der verhältnismäßig geringen konfessionellen Durchmischung länger erhalten geblieben sein, als andernorts. Die preußische Regierung hatte, gemäß ihrem Anspruch, den Einfluß der Kirchen auf die Bildung zu begrenzen, bewußt sogenannte Wanderbeamte, die dem evangelischen Glauben anhingen, an katholische Schulen versetzt. Inwiefern diese Taktik auch in Warendorf eingesetzt wurde, muss einer anderen Forschungsarbeit vorbehalten bleiben. Fest steht, daß Franz Nolte allein schon aufgrund seiner Stellung als preußischer Beamter zu einer gewissen Offenheit in konfessionellen Dingen angehalten war. Ob er aus einer entsprechenden Grundhaltung heraus Gefallen an der Vorstellung gefunden hatte, Beamter im preußischen Staatsdienst zu werden, oder ob er die Politik der preußischen Regierung, dem konfessionellen, vor allem dem katholischen Einfluß einen Riegel vorzuschieben, (erst) im Lauf seiner Dienstzeit verinnerlichte, läßt sich nicht klären. Für seine Tochter jedenfalls war klar, daß er sich nicht von konfessionellen Zwängen leiten ließ. Theanolte Bähnischs Kindheit schien nichtsdestotrotz stark von der katholischen Kirche geprägt gewesen zu sein, was in der Darstellung der Juristin offenbar in erster Linie auf ihre Mutter zurückzuführen war. Diese beschrieb Bähnisch 1972 als eine „selbständig denkende ganz kluge Frau mit grossem Temperament“98, als „stolz“99, „sehr fromm“ und „sehr moralisch“100. Der sonntägliche Kirchgang war den Erzählungen der Pensionärin Bähnisch nach ein fester Bestandteil ihrer Kinder- und Jugendzeit, auch der Vater soll dem Drängen der Mutter, zur Sonntagsmesse zu gehen, am Ende immer nachgegeben haben.101 Doch die größere Freizügigkeit des Vaters im Umgang mit religiösen Themen, seine weniger strenge Moral war – glaubt man Bähnischs Erinnerungen – ein Auslöser für Meinungsverschiedenheiten zwischen ihren Eltern.102 Der Entschluß, sich nicht – wie am Ort üblich – dem Zentrum, sondern einer Partei anzuschließen, die vorrangig nationale Ziele verfolgte und nach dem Ende des Kaiserreichs die meisten konservativen Protestanten in ihren Reihen versammelte, brachte die Weigerung des Vaters, sein Leben vordergründig am katholischen Glauben zu orientieren, deutlich zum Ausdruck.
97 Vgl.: Mergel, Thomas: Zwischen Klasse und Konfession. Katholisches Bürgertum im Rheinland 1984–1914, Göttingen 1994. 98 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Eltern S. 4. 99 Ebd., Teil I, Eltern, S. 5. 100 Ebd., Teil I, Eltern, S. 4. 101 Ebd., Teil I, Eltern, S. 5/6. 102 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Eltern, S. 4–6.
126 | Theanolte Bähnisch
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Dorothea Nolte auch vom erbitterten Streit über die Abhaltung von evangelischem Religionsunterricht an der katholischen Marienschule Wind bekommen hatte, welcher sich zwischen der Schule (an der die Lehrerinnen vor Amtsantritt das „tridentisch-vatikanische Glaubensbekenntnis“103 ablegen mußten) und dem protestantischen Pfarrer Blase104 entsponnen hatte. Womöglich hatte Bähnisch vor diesem Hintergrund schon früh ein Gefühl für die negative Dynamik scharfer Konfrontationen zwischen den Konfessionen entwickelt. Aus dem Vorfall, daß eine Schulfreundin von ihr habe wissen wollen, ob es denn eine Sünde sei, einen Protestanten zu küssen105, baut die Pensionärin Bähnisch in ihrem Diktat eine stilistische Brücke, die sinnbildlich aus der konfessionellen Enge der Warendorfer Gesellschaft in ihre spätere Freiheit führte, die darin bestand, einen Protestanten zu heiraten. Daß die Legende umgeht, Bähnischs Mutter habe sich, als sie von der Entscheidung ihrer Tochter gehört habe, für längere Zeit in ihrem Zimmer eingeschlossen und geweint, läßt die Überwindung der konfessionellen Enge als ordnungsstiftendes Moment auf Theanoltes Leben als einen Befreiungsschlag, der gleichzeitig die Ablösung von der Mutter und von der Warendorfer Gesellschaft bedeutete, erscheinen. Eine Abgrenzung zu den politischen Ansichten des Vaters zu seinen Lebzeiten schien dagegen entbehrlich gewesen zu sein: er starb 1928, also bevor Bähnisch in die SPD eintrat. Eine Weile lang hatte Dorothea, deren Name ‚Gabe Gottes‘ oder auch ‚Gottesgeschenk‘ bedeutet, Marion Röwekamp zufolge sogar den Wunsch gehegt, Theologie zu studieren.106 In der ‚Lang-Version‘ ihrer Erinnerungen von 1972 erwähnt Bähnisch selbst dies jedoch nicht. Gesetzt den Fall, die spätere Juristin hatte tatsächlich diesen Wunsch gehabt, so paßte er in der Retrospektive offenbar nicht in die Erzählung über ihre Berufsfindung, zumal sie einen ihrer Schwerpunkte im Diktat 1972 darauf legt, ihr Unverständnis für die katholische Kirche als Institution und ihre Auflehnung gegen den Katholizismus zum Ausdruck zu bringen. Beispielsweise berichtet sie, im Rahmen ihrer Abiturprüfung eine Stelle im Religionsbuch über „die alleinseligmachende Kirche“ mit den Worten Nietzsches „Hochmut war’s wodurch die Engel fielen“107, kommentiert zu haben. Ihr Interesse für das Studienfach Theologie
103 Gühne: Marienschule, S. 60. 104 Vgl.: ebd., S. 61–65. 105 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Darf man sich von einem Protestanten küssen lassen? 106 Vgl.: Röwekamp: Mut, S. 263. Röwekamp gibt für ihre Aussage keinen Beleg an, sie verweist in einer Fußnote allgemein auf Dokumente aus dem Privatnachlaß Bähnischs sowie auf Texte von Orla-Maria Fels. Eventuell stammt die Information aus einem Gespräch mit Fels. Andere Aussagen Röwekamps finden sich nämlich nicht in den genannten Quellen wieder, sind mir aber aus dem Gespräch mit Dr. Fels vertraut. Vgl.: Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. Vgl. auch den folgenden Lebenslauf, in dem sie schreibt, sie habe sich für Geisteswissenschaften interessiert. NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Lebenslauf Theanolte Bähnischs, o. D. [1946]. 107 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Das Abitur, S. 6.
Sozialisation | 127
wäre – wohlwissend, daß die Institution Kirche nicht mit dem Studienfach gleichzusetzen ist – vor diesem Hintergrund entweder unpassend erschienen oder hätte umständlich begründet werden müssen. Eine ergänzende Interpretationsmöglichkeit der verschiedenen Erzählungen von 1946 und 1972 liegt darin, daß Bähnisch um 1946 bewußt ein Interesse am Fach Theologie betont haben könnte, weil sie davon ausgehen konnte, daß dies auf offene Ohren bei der Britischen Militärregierung stoßen würde. Sie selbst pflegte zu dieser Zeit, in der Hoffnung, daß dies dem Wiederaufbau dienen könnte, allgemein an den christlichen Glauben in der Bevölkerung zu appellieren.108 Ihre Entscheidung fiel also auf das Studium der Rechtswissenschaften und damit auf die Auseinandersetzung mit normativ gültigen Regeln, die alle Mitglieder der Gesellschaft, unabhängig (auch) von ihrer Konfession gleichermaßen betreffen sollten. Berührungsängste mit anderen Konfessionen schienen ihr fremd gewesen zu sein. Als gewichtigstes Indiz dafür darf die spätere Ehe mit Albrecht Bähnisch gelten, aufschlußreich ist aber auch die Bewunderung, die sie Adolf von Harnack, dem Begründer des Kulturprotestantismus entgegenbrachte. Ihre Freundschaft zu Lotte Jacobi und ihr Umgang mit diversen anderen jüdischen Frauen in Berlin deutet darauf hin, daß sie dem Judentum, das in der Hauptstadt des „heiligen evangelischen Reich[es] deutscher Nation“109 allerdings ohnehin stark säkularisiert war, durchaus aufgeschlossen gegenüberstand. Die spirituelle Haltung der erwachsenen Theanolte Bähnisch ließe sich mit Dieter Langewiesches Worten als „nicht mehr kirchlich gebunden, aber religiös durchsäuert“110 beschreiben. Ihre Mutter und viele andere Warendorfer Bürger hatte Theanolte hingegen – um in der Sprache Langewiesches zu bleiben – als „gläubig tätige Mitglieder der katholischen Kirche“111 erlebt. In Berlin war Theanolte nicht mit der ge-
108 Vgl.: Bähnisch, Theanolte: Himmel und Erde nahe (Aus einem Vortrag, gehalten zu Köln am 24. Juni 1950), in: Sattler-König, Jenny (Bearb.)/Dt. Frauenring Hildesheim (Hrsg.): Frauen sprechen zu Frauen, Hildesheim 1951, S. 4/5. 109 Adolf Stoecker, zitiert nach Langewiesche, Dieter: Vom Gebildeten zum Bildungsbürger? Umrisse eines katholischen Bildungsbürgertums im wilhelminischen Deutschland, in: Lenger, Dieter (Hrsg.): Dieter Langewiesche. Liberalismus und Sozialismus. Gesellschaftsbilder – Zukunftsvisionen – Bildungskonzeptionen, Bonn 2003, S. 177–205, hier S. 178. 110 Langewiesche: Bildungsbürger, S. 178. Am Beispiel des akademischen BonifatiusVereins zeigt Langewiesche in seinem Aufsatz, wie gebildete Katholiken sich „offen zu ihrer Kirche bekannten und zugleich moderne Kleinbürger sein wollten“. Ebd., S. 180. Er grenzt sich damit von anderen Autoren ab, welche die Unvereinbarkeit von bekennendem Katholizismus und aufgeklärtem Lebenswandel im wilhelminischen Deutschland voraussetzen, beziehungsweise unterstellen, daß katholische Gebildete, die eine ‚moderne‘ Lebensweise pflegten, gezwungen gewesen seien, ein Leben in zwei Welten zu leben. Vgl. zu dieser Sichtweise: Mergel: Klasse, S. 315 ff. sowie als grundlegende Lektüre zum Thema: Conze, Werner/Kocka, Jürgen (Hrsg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, 4 Bd., Stuttgart 1985-1992. 111 Langewiesche: Vom Gebildeten zum Bildungsbürger, S. 178.
128 | Theanolte Bähnisch
sellschaftlichen Erwartung konfrontiert, den sonntäglichen Kirchgang zu vollziehen. Sie lebte als Erwachsene nach den Maßstäben einer von Reinhard Koselleck als „unsichtbare Kirche der Gebildeten“112 charakterisierten Gemeinschaft. Sie bekannte sich zum christlichen Glauben, setzte sich mit theologischen Fragen auseinander und zählte zu ihrem Freundeskreis viele überzeugte Christen. Zumindest in der Retrospektive belächelte sie jedoch die strenge Religiosität ihrer Mutter113 und stellte die fromme, scheinbar lebensfeindliche Haltung, die ihr in der Kölner Ursulinenanstalt begegnet war, als fremd bis kurios dar. Daß Mädchen sich dort „sittsam“ und „leise“114 bewegen sollten, beschreibt sie in ihrem Diktat auf eine Art, die nicht nur den Einfluß der Säkularisierung im Allgemeinen, sondern auch den der (neuen) Frauenbewegung auf ihre Wahrnehmung im Jahr 1972 erahnen läßt. Ihre Erinnerungen erwecken den Eindruck, als habe sie ihren Vater als Vorbild wahrgenommen, womit ihre Biographie im Einklang mit anderen Lebenserinnerungen ‚Höherer Töchter aus gutem Haus‘115 steht, die vor allem die berufliche Stellung der Väter als orientierungsleitend für das eigene Leben beschreiben. Die Ausbildung einer gewissen ‚Häuslichkeit‘ scheint, glaubt man einem Bericht in der Rundschau aus dem Jahr 1964, in den Jugendjahren Bähnisch ebenfalls stattgefunden zu haben und es ist auffällig, wie dieser Umstand in den 60er Jahren als Komplement zur schulischen und beruflichen Bildung Bähnischs dargestellt wird. Wenn es in der Rundschau heißt, „[d]ie Schulung ihres Verstandes“ habe weder Thea noch ihre drei Schwestern davor bewahrt, „abwechselnd Küchendienste im elterlichen Hause übernehmen zu müssen“116, ist zweierlei zu bedenken: Erstens läßt sich ein Bedürfnis der porträtierten Staatssekretärin, selbst als ‚alltagstauglich‘ und damit ‚volksnah‘ zu erscheinen, annehmen, zweitens betont die Autorin des Artikels das ‚Häusliche‘ in ihrem Bericht vermutlich, um zu unterstreichen, daß ‚Frau Staatssekretär‘ – wie Bähnisch im Bericht genannt wird – kein ‚strenger‘ Charakter sei, sondern über als ‚weiblich‘ definierte Eigenschaften, spezieller: über die Fähigkeit, einen Haushalt zu führen, verfüge. Ein Fernsehbeitrag über die Staatssekretärin Bähnisch betont ebenfalls den ‚häuslichen‘ Aspekt ihres Charakters und demonstriert dies am Beispiel der
112 Koselleck, Reinhart: Einleitung – Zur anthropologischen und semantischen Struktur der Bildung, in: ders. (Hrsg.): Bildungsgüter und Bildungswissen, Stuttgart 1990, S. 11–46, hier S. 25. 113 In ihrem Diktat vermittelt sie den Eindruck, ihre Bindung an den Vater sei insgesamt größer gewesen, als die an ihre Mutter. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Eltern, S. 5. 114 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Trotz allem: „Heiter“. Fußstapfen meines Lebens, S. 2. 115 Vgl.: Stekl, Hannes/Schnöller, Andrea (Hrsg.): „Höhere Töchter“ und „Söhne aus gutem Haus“. Bürgerliche Jugend in Monarchie und Republik, Wien/Köln/Weimar 1999, S. 22– 25. 116 Schareina, Maria-Luise: Regierungspräsident Theanolte Bähnisch 60 Jahre. Eine Frau – die ihren Mann steht, in: Die Rundschau, Nr. 96, 25./26.041959.
Sozialisation | 129
ebenfalls als ‚weiblich‘ bewerteten Neigung, die Wohnung zu dekorieren.117 Daß die Porträtierte hiermit einverstanden war, ist wahrscheinlich: Nicht zuletzt die Sozialisation in der Marienschule wird zur späteren Überzeugung Bähnischs, daß die ‚klassischen‘ Aufgaben von Ehefrauen und Müttern im Haushalt, in der Kindererziehung und -gesundheitspflege quasi naturgemäß mit dem weiblichen Geschlecht verbunden seien beigetragen haben. Der Lehrplan der preußischen Höheren Töchterschulen sah eine entsprechende Ausbildung jedenfalls vor. Die Tatsache, daß Bähnischs Mutter nach dem Tod ihres Mannes am 29.07.1928 mitsamt ihren Töchtern Maria und Irmgard sowie ihren Söhnen Reinhard und Werner 1929 nach Berlin umzog,118 wo zu dieser Zeit sowohl Theanolte, als auch ihr Bruder Otto lebten, deutet darauf hin, daß die Bindung der Familienmitglieder aneinander insgesamt eng gewesen sein muß, ebenso wie der Umstand daß Theanoltes Schwester Elisabeth während des Zweiten Weltkrieges die Kinder der Bähnischs aufnahm. Nach Kriegsende wohnten und arbeiteten Theanolte Bähnisch und ihr Bruder Otto Nolte zusammen in Köln. Nachdem Theanolte Regierungspräsidentin geworden war, zogen ihre Mutter sowie Theas Schwester Maria 1948 gemeinsam mit den Kindern Bähnischs in die Wohnung der Regierungspräsidentin in der Spohrstraße 9 in Hannover nach.119 Mitte der 1950er Jahre verzogen die Familienmitglieder gemeinsam nach Dortmund, 1961 folgte ihnen Werner Nolte, der 1952/53 ebenfalls in Hannover gelebt hatte, aber dann einige Jahre in Oldenburg und Aurich verbracht hatte. The-
117 Archiv des NRD-Hamburg, Stavenow, Hans: Eine bemerkenswerte Frau: Porträt der niedersächsischen Staatssekretärin Theanolte Bähnisch, Erstausstrahlung am 16.01.1963 im deutschen Fernsehen, ca. 25 Minuten. 118 Laut Auskunft von Ekkehard Gühne, Heimatverein Warendorf, verzog Irmgard Nolte am 27.03.1929 nach Berlin, Werner Nolte folgte ihm am 28.04.1929, Reinhard Nolte am 19.04.1929. Theresia und Maria Nolte zogen am 18.11.1929 um. Ekkehard Gühne an Nadine Freund, 03.06.2008. Gühne bezieht seine Informationen aus Unterlagen des Einwohnermeldeamtes Warendorf, die im Archiv der Stadtverwaltung lagern. Aus anderen Informationen Gühnes, die auf der Kartei des Vereins ehemaliger Schülerinnen im Schularchiv des Mariengymnasiums basieren, geht hervor, daß Maria und Irmgard Nolte, also die älteste und die jüngste Tochter der Familie, 1963 als ledige Frauen gemeinsam in Dortmund in der Alexanderstraße 27 wohnten. Laut ihrer durch das Standesamt Warendorf überlieferten Sterbeurkunde starb Irmgard Nolte am 01.11.1980 in Warendorf. Womöglich ist sie nach dem Tod ihrer Schwester Maria in die Heimatstadt zurückgezogen. Die Todesdaten anderer Familienmitglieder sind Ekkehard Gühne zufolge nicht durch das Standesamt überliefert. Vgl. zu den anderen Daten: Stadtarchiv Hannover, Jung-König, Christel an Nadine Freund, 25.05.2009 und Stadt Hannover, Fachbereich Recht und Ordnung, Hausbuch Schopenhauerstraße 9. Otto Nolte wohnte gemeinsam mit seiner Frau Maria, geb. Bracht, die ebenfalls zeitweilig in der Kölner Wohnung Theanolte Bähnischs gelebt hatte, einige Jahre in Aachen, dann in Freiburg. Stadt Aachen, Nicole Brillo an Nadine Freund, 28.05.2009 sowie Stadtarchiv Aachen, Auszug aus dem Hausbuch Eupener Straße 124 sowie Auszug aus dem Hausbuch Eberburgweg 49. 119 University of New Hampshire, Special Collections, MC 58 [Lotte Jacobi Collection], Box 27, f7, Theanolte Bähnisch an Lotte Jacobi, 20.07.1948.
130 | Theanolte Bähnisch
resia und ihre beiden ledigen Töchter Maria und Irmgard, die als Bibliothekarin in Köln tätig war, wohnten Anfang der 1960er Jahre gemeinsam mit Werner Nolte in der Alexanderstraße.120 2.1.5 Die Noltes in der Warendorfer Gesellschaft Inwiefern die Familie Nolte in die Warendorfer Gesellschaft integriert war, läßt sich nur ansatzweise beantworten. Von einer gelungenen Integration auszugehen, erscheint zunächst naheliegend, vor allem, wenn man die Mitgliedschaft von Franz Nolte in der Warendorfer ‚Gesellschaft Harmonie‘ nicht als Alleingang des Hausvorstandes deutet. Bereits im Jahr 1904 – als er gerade erst mit seiner Familie nach Warendorf gekommen war – gehörte er, wie viele der Lehrer am Laurentianum, der Gesellschaft an.121 Der Heimatforscher Wilhelm Zuhorn wertet die Mitgliedschaft der Lehrer in diesem Verein als Beweis dafür, daß die – oft von außerhalb angeworbenen – Pädagogen den Kontakt zu anderen Warendorfer Bürgern suchten und pflegten. Die ‚Gesellschaft Harmonie‘ war bereits 1810 im Zuge der Auflösung von Gilden und Zünften, auf der Suche nach einem neuen, Zerstreuung in der Gruppe versprechenden Rahmen, „aus den ersten Kreisen“122 heraus gegründet worden. „Die Gesellschaft Harmonie in Warendorf ist eine Vereinigung, welche den Zweck hat, in einem ausgesuchten Kreise gesitteter Menschen die Freuden des geselligen Lebens zu genie-
120 Werner Nolte ist in den Adreßbüchern Dortmunds von 1962 bis 1965 als Landgerichtsdirektor aufgeführt. Stadtachiv Dortmund, Ute Pandel an Nadine Freund, 16.08.2009. 1952/53 taucht er mit derselben Berufsbezeichnung auf einem Meldebogen der Stadt Hannover auf. Tätig war er als Landgerichtsdirektor in Aurich. Vgl.: Adressbuch für die Stadt Aurich Ostfriesland und angrenzende Gemeinden, Aurich 1951, S. 63. Theresia, Maria und Irmgard Nolte sind im Adreßbuch der Stadt Dortmund von 1958 nachgewiesen. Irmgard Nolte war als Mitarbeiterin der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund an der Herausgabe diverser Publikationen der Bibliothek beteiligt. Vgl.: Kudera, Lucian/Heim, Harro/Nolte, Irmgard (Hrsg.): Geschichte in der Auseinandersetzung unserer Zeit, Dortmund 1960, Hellfaier, Karl-Alexander/Heim, Harro/Nolte, Irmgard (Hrsg.): Tabus unserer Gesellschaft, Dortmund 1964; Heim, Harro/Nolte, Irmgard (Hrsg.): Ferdinand Freiligrath zum 150. Geburtstag, Dortmund 1960, dies.: Französisches Geistesleben in Gegenwart und Vergangenheit, Dortmund 1959. Ihre Diplomarbeit hatte Irmgard Nolte 1951 zum Thema „Die Gestaltung der Nachkriegsprobleme im Roman. Eingehend behandelt nach Gerd Gaisers Roman ‚eine Stimme hebt ab“ in Köln eingereicht. Vgl.: Katalog der Fachhochschulbibliothek Köln, auf: http://www.ub.uni-koeln.de, am 27.08.2014. 121 Vgl.: Leopold, Carl: Warendorfs Gymnasium und die Warendorfer Bürgerschaft im 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur bürgerlichen Kultur einer deutschen Kleinstadt, in: Gruhn: Laurentianum, S. 105–108, Liste der Mitglieder aus dem Kollegium des Laurentianum in der Gesellschaft Harmonie, S. 109. 122 Zuhorn, Wilhelm: Die Gesellschaft Harmonie zu Warendorf. Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Gesellschaft am 06. Januar 1910, Warendorf 1910, S. 12. Beamte waren zu dieser Zeit, mit Ausnahme des Postmeisters Amersbeck, nicht in der Gesellschaft vertreten.
Sozialisation | 131
ßen“123, lautete die Losung in Artikel 1 des Klub-Statuts. Der Klub bot den Mitgliedern ein Spielzimmer, ein Billardzimmer, eine Kegelbahn und eine Lesegesellschaft, wobei Familienmitglieder im Vereinshaus zumindest nachmittags und außerhalb des Herrenzimmers willkommen waren. Für ihr Lesezimmer hielt die ‚Harmonie‘ vor allem liberale und katholische Blätter,124 woraus sich – wie der Präsident der Gesellschaft, Amtsgerichtsrat Wilhelm Zuhorn, in seiner Festschrift für die ‚Harmonie‘ konstatierte – „unschwer ein Rückschluß auf die politischen und kirchlichen Anschauungen der […] Mitglieder ziehen [ließ], da sie ja in den Generalversammlungen über die Auswahl der Lektüre bestimmten“125. Diese Auswahl entsprach freilich nicht der (späteren) parteilichen Bindung Franz Noltes an die DNVP, der mit seiner politischen Einstellung also auch in der ‚Harmonie‘ in der Minderheit gewesen sein dürfte.Über ihren Armenfonds betätigte sich die Gesellschaft auch karitativ, über eine Beteiligung der Familie Nolte daran ist jedoch nichts überliefert. Es ist anzunehmen, daß es die mit sieben Kindern gesegnete Familie selbst zu einem eher bescheidenen Wohlstand gebracht hatte. Ob die Kriegswirtschaft der Jahre 1914-1918 zu einer Lebensmittelknappheit auch im Hause der Noltes führte, wie die Familie überhaupt den Ersten Weltkrieg erlebte und ob es vielleicht (auch) finanzielle Gründe gehabt haben könnte, daß Franz Nolte seine Tochter Dorothea zu dieser Zeit, mit 14, von der Schule nahm, läßt sich nicht klären. Bähnisch thematisiert an keiner Stelle, welche Auswirkungen der Erste Weltkrieg auf ihr Leben hatte.126 Ekkehard Gühne, dem die Mitgliedschaft Noltes in der Gesellschaft Harmonie ebenfalls aufgefallen ist, sieht darin keinen Beweis für dessen Integration in die Warendorfer Gesellschaft. „Der Schein trügt“ 127, gibt Gühne im Hinblick auf Noltes Mitgliedschaft in der DNVP zu bedenken. Spätestens mit dem Eintritt des neuen Direktors des Laurentianum hätten Konflikte die Lehr-Tätigkeit Noltes überschattet. Was Gühne allerdings nicht zu bedenken scheint, ist der Umstand, daß die DNVP erst 14 Jahre nach Noltes Aufnahme in die ‚Harmonie‘ gegründet worden war. Ob, beziehungsweise wie sich Nolte um die Jahrhundertwende politisch positioniert hatte, erwähnt Gühne nicht. Theanolte Bähnisch thematisiert die Mitgliedschaft des Vaters in der Harmonie und im Schulverein in ihren Erinnerungen nicht. Von ihr und ihrem Bruder Reinhard ist überliefert, daß die Geschwister gemeinsam die örtliche Tanzschule besuchten. Dies kann als Zeichen der Integration zumindest der beiden Jugendlichen interpretiert werden. Als Erwachsene distanzierte sich Theanolte Bähnisch öffentlich von den
123 Gesetze für die Harmonie-Gesellschaft in Warendorf. Erste Umarbeitung aus dem Jahre 1812, zitiert nach Zuhorn: Harmonie, in: ders.: Harmonie, S. 117–139, hier S. 117. 124 Vgl.: Zuhorn: Harmonie, S. 88. 125 Ebd., S. 91. 126 Zum Kriegsalltag in Warendorf vgl.: Roerkohl, Anne: Der Erste Weltkrieg in Westfalen. Lebensmittelmangel und Hunger an der „Heimatfront“, Münster 1987, auf: http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/input_felder/seite1_westf_ bild.php?urlID=327, am 15.05.2014. 127 Gühne: Bähnisch, S. 52.
132 | Theanolte Bähnisch
Warendorfer Bürgern, was zwar nicht mit einer mangelnden Integration ihres Vaters zu tun haben muß, aber doch damit in Zusammenhang stehen könnte. So sehr sie rückblickend die Landschaft und die Ruhe in Warendorf schätzte, so explizit lehnte sie die politische Einstellung der Warendorfer Bürger, insbesondere in Bezug auf die Frauenberufstätigkeit, ab. Sie mißtraute deshalb dem Wahrheitsgehalt von Glückwunschschreiben alter Warendorfer Bekannter, die sie zu ihrem Amtsantritt als Regierungspräsidentin Hannovers 1946 erhalten hatte: „Ich glaube, daß die Warendorfer nicht allzu stolz auf mich sind, denn gerade bei ihrer alten, konservativen Einstellung sollten sie der Tatsache eines weiblichen Regierungspräsidenten, der aus ihrer Kleinstadt hervorgegangen ist, doch sehr skeptisch gegenüberstehen. Ich sehe, wie sie alle bedenklich die Köpfe schütteln. Doch jeder kennt wohl das schöne Wort: ‚Der Prophet gilt nicht in seinem Vaterlande.‘“128 Wenigstens einigen Bürgerinnen der Stadt tat sie damit allerdings Unrecht. Schließlich war in Warendorf 1924 zur Stadtverordnetenwahl eine eigene Frauenliste, unter anderem aus Vertreterinnen des Zentrums und des Katholischen deutschen Frauenbunds (KDFB) angetreten. Angeführt wurde die Liste, die sich gebildet hatte, weil die anderen Parteien sich geweigert hatten, Frauen aufzustellen, von der Oberlandesgerichtsrätin Klara Schmid. Hans Joachim Werner wertet den Erfolg der Liste, die schließlich mit vier Sitzen in das Stadtparlament einzog, als den ersten parlamentarischen Erfolg einer eigenständigen Frauenliste in Deutschland überhaupt.129 Indem sie aus den „Anforderungen der Versorgung des Mannes im Felde, der Ernährung der Familie daheim und oft noch des Gelderwerbs draußen“130 durch Frauen einen Anspruch, auf die Politik ausgleichenden Einfluß zu nehmen, ableitete131, argumentierte die ‚Wahlkampfsprecherin‘, Frau Regierungsrat Dr. Laarmann, ganz auf der Linie führender Aktivistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung. Theanolte, die später ähnliche Argumente finden sollte, mag davon nichts mitbekommen haben, denn sie lebte zu jener Zeit nicht mehr in Warendorf. 2.1.6 Die Genese der Entscheidung für das Jura-Studium Ein Lebenslauf, den Theanolte Bähnisch in den ersten Nachkriegsjahren verfaßt haben muß, beschreibt ihren Weg zum Studium als weniger geradlinig, als das Diktat, das Orla-Maria Fels auf das Jahr 1972 datiert. Im Lebenslauf berichtet Bähnisch, daß sie im zweiten Jahr des Ersten Weltkriegs, im Alter von 16 Jahren, Warendorf verließ, um ihre Ausbildung am Technischen Lehrerinnenseminar fortzusetzen. Nach einem halben Jahr habe sie die Ausbildung zur Lehrerin abgebrochen, weil sie das Stu-
128 O. V.: Wer wußte es? Deutschlands erster weiblicher Regierungspräsident stammt aus Warendorf, in: Neues Tageblatt, 26.11.1946. 129 Werner, Hans-Joachim: Politisches Bewußtsein Warendorfer Frauen 1924, in: Warendorfer Schriften, Bd. 19/20 (1989/90), S. 52–58. Die Gesamtzahl der Sitze ist hier nicht angegeben, es wird lediglich darauf verwiesen, daß die Sozialdemokraten zwei und die bürgerliche Verständigungsliste zwölf Sitze erhielt. 130 Neuer Emsbote vom 25.04.1924, zitiert nach Werner: Bewußtsein. 131 Ebd.
Sozialisation | 133
dium der ‚Geisteswissenschaften‘ sehr anziehend gefunden habe. Also habe ihr Vater sie wiederum im Hausunterricht weiter bis zur Unterprimarreife vorbereitet. Sie sei dann für zwei Jahre in die Studienanstalt der Ursulinen in Köln eingetreten, wo sie 1919 ihr Abitur gemacht habe.132 Den ‚Umweg‘ über das Lehrerinnenseminar erwähnt sie in ihren Erinnerungen von 1972 nicht. Liest man nur das Diktat, so gewinnt man den Eindruck, daß Theanoltes Weg direkt aus der Studierstube des Vaters in die Ursulinenschule und von dort ins Studium der Rechtswissenschaften geführt hat. Daß Bähnisch im Diktat das ‚Intermezzo‘ im Lehrerinnenseminar unerwähnt ließ, läßt sich verschieden interpretieren. Für ein junges Mädchen aus bildungsbürgerlichem Haushalt im späten Kaiserreich wäre die Weiterbildung zur Lehrerin beileibe kein untypischer Werdegang gewesen – zumal sie damit sogar in die Fußstapfen ihres Vaters, den sie offenbar bewunderte – getreten wäre. Doch es scheint, als habe die Pensionärin Bähnisch 1972 den Eindruck erwecken wollen, der Entschluß für die Rechtswissenschaften habe bereits früh und unumstößlich festgestanden. Ebenfalls denkbar ist, daß sie im Jahr 1946, als sie von diesem Umweg (noch) berichtete, ihr Interesse an Pädagogik herausstellen und vielleicht auch einen Hinweis darauf geben wollte, daß das Lehramt für Frauen eine vielversprechende Berufsmöglichkeit sei. Schließlich arbeitete sie zu dieser Zeit eng mit Pädagoginnen wie Anna Mosolf, Katharina Petersen und Käthe Feuerstack zusammen, welche – wie die britische Militärregierung – auf eine stärkere Beteiligung von Frauen im Schulwesen drängten. Ob Theanolte in ihrer Jugend, jener „Phase des menschlichen Lebens, in der körperliche, psychische und soziale Entwicklungsprozesse zur Gestaltung einer autonomen Persönlichkeit führen“133, tatsächlich schon über so viel Selbständigkeit, Mut und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten verfügte, wie es die erwachsene Theanolte Bähnisch 1972 darstellte, oder ob die Pensionärin ihr insgesamt als erfolgreich betrachtetes Leben auch auf die Jugend zurückprojizierte, ist schwer einzuschätzen. Daß ihre Beredsamkeit und Überzeugungskraft bereits im Schulalter beeindruckend gewesen sein müssen, zeigt sich in der Sichtweise von Mädchen aus demselben Abiturjahrgang auf ihre Mitschülerin Thea.134 Sie hatten zur Abiturfeier ein Theaterstück über das „Wiedersehen der Oberprimanerinnen im Himmel nach 100 Jahren“ geschrieben, in dem sie Dorothea als Rechtsanwältin darstellten.135 Daß ihre Eltern auch die literarischen und künstlerischen Interessen förderten, welche sich in Bähnischs Freundschaften mit Künstlerinnen und Schriftstellerinnen, aber auch in der ‚Stimme der Frau‘ niederschlugen, ist wahrscheinlich. Bähnisch selbst berichtet
132 AddF, SP-01, Kurze Lebensskizze. 133 Stekl/Schnöller: Töchter, S. 16. 134 Vgl.: Fels, Orla-Maria: Art. „Theanolte Bähnisch“, in: Juristinnen in Deutschland, BadenBaden 2003, S. 209–212. 135 Der Titel des Stücks lautete „Wiedersehen der Oberprimanerinnen im Himmel nach 100 Jahren“. Vgl.: Schareina: Regierungspräsident sowie: Röwekamp, Marion: Art. „Bähnisch, Theanolte“, in: Dies./Deutscher Juristinnenbund (Hrsg.): Juristinnen – Lexikon zu Leben und Werk, Baden Baden 2005, S. 24–27, hier S. 24. Die entsprechende Seite ist im Privatnachlaß Bähnischs überliefert.
134 | Theanolte Bähnisch
1972, daß sie im Studium sehr gern die Organisation von Ausflügen sowie von Konzert- und Theaterbesuchen übernommen hatte.136 Fremd schienen ihr solche Unternehmungen von Haus aus demnach nicht gewesen zu sein.
2.2 „ES BEUGT EIN BRAUNER LOCKENKOPF SICH ÜBERS CORPUS IURIS“ 137 – STUDIUM, GERICHTS- UND VERWALTUNGSREFERENDARIAT (1919–1926) 2.2.1 Jura-Studium in Münster unter unbequemen Bedingungen Ab 1919, als die Verfassung der Weimarer Republik, die Frauen die gleichen staatsbürgerlichen Rechte wie Männern zugestand, noch druckfrisch war, studierte Dorothea Nolte in Münster an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät. Die dort lehrenden Professoren hatten in ihrem Treue-Eid auf das neue politische System, die Weimarer Republik, geloben müssen, ihr Amt „unparteiisch nach bestem Wissen und Können“138 zu verwalten. Lieselotte Steveling, die eine Dissertation über die Fakultät verfaßte, kommt zu dem Schluß, daß sich die Münsteraner Professorenschaft zu jener Zeit noch dem Kaiserreich geistig und moralisch verpflichtet gefühlt hatte, daß sich jedoch die Überzeugung durchgesetzt hatte, die Republik sei die einzige Möglichkeit der Stabilisierung in Deutschland nach dem Ende des Krieges.139 Dem Parlamentarismus, so Steveling, hätten die Professoren jedoch teilnahmslos bis ablehnend gegenübergestanden.140 Einige Hochschullehrer seien allgemein negativ gegen die Republik eingestellt gewesen und hätten 1920 mit den Kapp-Putschisten sympathisiert. Professor Naendrup, der deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht sowie deutsches Bürgerliches Recht lehrte und der DNVP angehörte, hatte sich sogar öffentlich gegen die Republik positioniert.141 Daß dort, wo Dorothea nun studierte, weiterhin Feierlichkeiten zur Reichsgründung und zu Kriegsereignissen anstelle von Feierlichkeiten zur Verabschiedung der Weimarer Verfassung142 stattfanden, wertet Steveling als ein deutliches Indiz dafür, daß mit dem neuen System eben kein neuer Geist in die Fakultät eingezogen war. Theanolte Bähnisch selbst äußerte
136 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Die Familie, S. 12. 137 „Es beugt ein brauner Lockenkopf sich übers Corpus Iuris, die mit dem blonden Mozartzopf, Forscht, was denn Moll und Dur ist, Wer schilt die säum’ge Köchin und; wer flickt meinen alten Flaus? Oh jerum, jerum, jerum, o quae mutatio rerum.“ Vers aus dem Verbindungslied ‚Oh junge Mädchenherrlichkeit‘, in: Liederbuch für Studentinnen, Straßburg 1910, S. 38–40, zitiert nach: Happ/Jüttemann: Sie, S. 226/227. 138 Steveling: Juristen, S. 197. 139 Vgl.: ebd., S. 197. 140 Vgl.: ebd., S. 200. 141 Vgl.: ebd., S. 208. 142 Vgl.: ebd., S. 206–222.
Sozialisation | 135
sich rückblickend allerdings ebensowenig über die politische Haltung ihrer Hochschullehrer wie über die ihres Vaters. In ihren einleitenden Bemerkungen zu ihrem ersten Studiensemester hebt sie auf die vom Krieg gezeichneten, in umgearbeiteten Uniformen erschienenen Studenten ab, die durch das Soldatenleben „um ihre Jugend gekommen […] und überernst für ihr Alter“ gewesen seien. „Ihr Bestreben war jetzt, möglichst schnell das Studium hinter sich zu bringen und zu einer Existenz zu kommen.“143 Ihre Kommilitonen hatten also nicht nur ein anderes Geschlecht als sie selbst, sondern auch einen ganz anderen Erfahrungshintergrund. In ihrem Diktat von 1972 gibt sich Bähnisch davon überzeugt, die „einzige Juristin“ an der Fakultät gewesen zu sein und daß „manch böser Blick“144 sie getroffen habe. Das Hörerverzeichnis zählt für den Zeitraum ihres Studiums jedoch noch einige andere Studentinnen auf.145 Vielleicht studierten diese nicht aktiv, vielleicht konnte sich Bähnisch im fortgeschrittenen Alter aber auch schlichtweg nicht mehr an sie erinnern. Sie war in verschiedenen Zusammenhängen ihres ereignisreichen Lebens nicht nur die erste, sondern oft auch die einzige Frau weit und breit, weshalb ihr in der Retrospektive die Annahme nicht ferngelegen haben mag, daß sie auch im Studium allein unter Männern gewesen war. Ob die Tatsache, daß ihr Bruder Otto ebenfalls in Münster Rechtswissenschaften studierte, ihre Studienfachwahl – bei der vermutlich auch die Eltern etwas mitzureden gehabt hatten – beeinflußt hatte, läßt sich nicht klären. Ihr selbst jedenfalls war es ein Anliegen, darauf zu verweisen, daß sie und ihr Bruder Otto trotz des gemeinsamen Studienfachs und -orts „einen ganz verschiedenen Freundeskreis“146 gehabt hätten. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie mit dieser Feststellung ihre Unabhängigkeit von Otto demonstrieren wollte. Die Autorin eines Porträts von Theanolte Bähnisch, Marion Röwekamp, scheint ihre Aussage, daß die Studentin Dorothea Nolte jeden Tag gemeinsam mit ihrem ein Jahr jüngeren Bruder Otto und dessen Freund mit dem Zug von Warendorf nach Münster147 pendelte, dem 1972 verfaßten Diktat Bähnischs entnommen zu haben.148 Daß die angehende Juristin darauf verzichtete, ein Zimmer in Münster zu mieten, mag finanzielle Gründe gehabt haben, könnte aus Anhänglichkeit an das Elternhaus erfolgt sein oder darin begründet gelegen haben, daß die Eltern nicht wollten, daß ihre Tochter dort allein lebte. Auch der Mangel an Wohnraum in Münster nach dem Ersten Weltkrieg kann ein Grund dafür gewesen sein, daß die Geschwister und Ottos
143 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Erstes Semester 1919, S. 11. 144 Ebd. 145 Vgl.: Röwekamp: Mut, S. 264. Röwekamp bezieht sich auf das amtliche Verzeichnis des Personals und der Studierenden der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Sommersemester 1919. 146 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Die Familie, S. 12. 147 Vgl.: Röwekamp: Art. „Bähnisch, Theanolte“, S. 24. 148 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Erstes Semester 1919, S. 11.
136 | Theanolte Bähnisch
Freund Aloys149 die immerhin dreißig Kilometer lange Strecke täglich zurücklegten.150 Sie habe gern wissen wollen „nach welchen Prinzipien Menschen ihr Leben in einer Gemeinschaft ordnen“, wird Bähnisch von ihrer guten Freundin, der Schriftstellerin Ilse Langner, 1957 in der ‚Zeit‘ zu ihrer Studienfachwahl zitiert.151 Die Ordnung der ‚Gemeinschaft‘ – auf die später zurückzukommen sein wird – hatte sich, zugunsten von Frauen, nicht erst in der Weimarer Republik verändert: Nachdem 1908 in Preußen Frauen zum regulären Studium zugelassen worden waren, hatten sich in Münster für das Wintersemester 1908/1909 die ersten Studentinnen für ein Regelstudium immatrikuliert.152 Meist hatten sie dabei das auch von den Gegnern der akademischen Frauenbildung zähneknirschend als ‚Frauenstudium‘ akzeptierte Lehramtsstudium gewählt, vorwiegend mit dem Schwerpunkt Neuere Philologie.153 An anderen Universitäten – Münster verfügte nicht über eine entsprechende Fakultät – war auch Medizin ein bei Frauen beliebtes und in bürgerlichen Kreisen für Frauen akzeptiertes Studienfach.154 Die Aufnahme eines Studiums der Rechtswissenschaften durch Frauen war dagegen äußerst unüblich. Erst im Wintersemester 1916/17 hatte sich die erste Studentin für das Fach an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster eingeschrieben.155 Neben den Ärzten ereiferten sich die Juristen am deutlichsten über den Zustrom von Studentinnen in ihr Metier156: „Eine Frau eignet sich nicht zur Rechtsanwaltschaft oder zum Richteramt. Da sie gefühlsmäßigen Einflüssen in größerem Maße ausgesetzt ist als der Mann, besteht die Gefahr, daß sie danach Recht spricht“157, lautete die Begründung des mit 45 zu 22 Stimmen gefaßten Beschlusses der 14. Vertreterversammlung des deutschen Anwaltsvereins gegen die Zulassung von Frauen zu den entsprechenden Ämtern im Jahr 1922. Frauen, die sich dennoch für ein Studium entschieden, welches für diese Ämter qualifi-
149 Ebd. 150 Zu Beginn des Wintersemesters 1918/1919 waren nach einem Bericht des Studentischen Wohnungsamtes von den 2.500 für Studenten geeigneten Wohnungen, die man vor dem Krieg gezählt hatte, aufgrund des Anwachsens der Bevölkerung und dem Bedarf des Militärs nur noch 600 zu haben. Vgl.: Zigan, Gisa Margarete: Die soziale Situation der Studentin: Wohnen und Studium mit Kind, in: Happ/Jüttemann: Sie, S. 125–150, hier S. 126. 151 Langner, Ilse: Regierungspräsident Theanolte Bähnisch, in: Die Zeit, Nr. 8/1957, 21.02.1957. 152 Vgl.: Happ, Sabine/Jüttemann, Veronika: „Laßt sie doch denken!“ 100 Jahre Studium für Frauen, in: dies. (Hrsg.): Sie, S. 13–42, hier, S. 19. 153 Vgl.: Damm-Feldmann, Friderike: Die Entwicklung des Frauenanteils. Teil 1: Studierendenzahlen, Studienabschlüsse, Promotionen, in: Happ/Jüttemann: Sie, S. 43–52, hier S. 48. 154 Vgl.: ebd., passim. 155 Vgl.: Schweighöfer: Berufswege von Studentinnen, in: Happ/Jüttemann: Sie, S. 151–165, hier S. 162. 156 Vgl.: Happ/Jüttemann: Sie, in: dies.: S. 14. In Münster wurde eine vollständige medizinische Fakultät laut Happ/Jüttemann erst 1925 eingerichtet. Vgl.: ebd., S. 20. 157 Zitiert nach: Schweighöfer: Berufswege, S. 162.
Sozialisation | 137
zierte, hatten also entweder etwas anderes – beispielsweise eine wissenschaftliche Karriere – im Sinn, oder aber sie nahmen den Gegenwind, von dem sie ahnen konnten, daß er ihnen entgegenschlagen würde, in Kauf und setzten darauf, daß weitere Veränderungen kommen würden. Obwohl in Münster diverse fächerübergreifende Studentinnen-Vereine entstanden waren158, welche Frauen unterstützten, die ein Studium aufnehmen, an der Universität Kontakte knüpfen oder ein Zimmer anmieten wollten, waren die Bedingungen für Frauen dort – wie auch an anderen Universitäten zu jener Zeit – schwierig. Meldeten sich Studentinnen zu Wort, so wurde nicht selten von den männlichen Kommilitonen mit den Füßen gescharrt. Otto Nolte wird sich als Sproß eines aufgeklärten Elternhauses in dieser Hinsicht vermutlich anders verhalten haben, darauf deutet jedenfalls das wertschätzende Verhalten, das sich die Geschwister entgegenbrachten hin. Eine gemeinsame Herausforderung bestand für die Geschwister darin, daß das Studium der Rechtswissenschaften, verglichen mit anderen Universitäten, in Münster als besonders schwierig galt. Von Frauen konnte das Jura-Studium zunächst allgemein nur mit der Promotion abgeschlossen werden, das Absolvieren von Staatsexamina war den Studentinnen verwehrt. Daß neben der schriftlichen Doktorarbeit und deren mündlicher Verteidigung in Münster auch eine schriftliche Interpretation je eines Textes aus dem römischen, deutschen und kanonischen Recht verlangt wurde, schien Theanolte, die vermuten mußte, daß sie ihr Studium mit der Promotion abschließen würde, nicht abgeschreckt zu haben.159 Vielleicht ist es auf die Rechtslage um 1920 zurückzuführen, daß in diversen Artikeln über Bähnisch fälschlicherweise geschrieben wird, sie sei promoviert gewesen. 1922 jedoch wurde der Weg zu den juristischen Berufen über das Staatsexamen für Frauen freigegeben: Auf maßgeblichen Druck des Deutschen Juristinnenvereins160 und auf das Betreiben von Reichsjustizminister Gustav Radbruch hin wurde mit Stimmenmehrheit der SPD das im Volksmund als ‚Lex Lüders‘161 bezeichnete Gesetz verabschiedet, welches auf der Grundlage der Weimarer Reichsverfassung162 fortan den Frauen Zugang zu den Berufen der
158 Neben dem Deutschen Akademischen Frauenbund waren dies vor allem katholische Studentinnen-Vereine. Vgl.: Reichmann, Wiebke: „O junge Mädchenherrlichkeit“. Die Gründungen der Damenverbindungen in Münster, in: Happ/Jüttemann: Sie, S. 81–94. 159 Vgl.: Röwekamp: Mut, S. 264. 160 Der Juristinnenverein war 1914 als Verband zur Durchsetzung beruflicher und wirtschaftlicher Interessen von Juristinnen gegründet worden. 161 Das ‚Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Berufen der Rechtspflege‘ wurde nach seiner stärksten Fürstreiterin im Juristinnenbund, Marie Elisabeth Lüders, benannt. 162 Art. 109 „Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten“ und 128 „Alle Staatsbürger ohne Unterschied sind nach Maßgabe der Gesetze und entsprechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zuzulassen. Alle Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte werden beseitigt […]“ waren die Paragraphen der Weimarer Reichverfassung auf deren Grundlage die Zulassung von Frauen gefordert wurde. Vgl.: Die Verfassung des deutschen Reiches (Weimarer Verfassung) vom 11. August 1919, in: Hildebrandt, Horst: Die deutschen Verfassungen des 19. und 20. Jahrhunderts, Paderborn 1985, S. 69–111, hier S. 96 und 99.
138 | Theanolte Bähnisch
Rechtspflege gewährte.163 Dorothea konnte ihr Jura-Studium also als eine der ersten Frauen überhaupt mit dem Staatsexamen abschließen. Die Zulassung zum Examen bedeutete jedoch noch nicht, daß die Studentinnen sich auch dafür entschieden, die Berufe, welche das Examen voraussetzten, auszuüben. 1924 wußten fünfzehn der dreißig Absolventinnen des rechtswissenschaftlichen Studiums in Münster noch nicht, wie ihre weitere Berufslaufbahn aussehen sollte. Acht Frauen wollten Jugendpflegerinnen werden, zwei in den Verwaltungsdienst gehen und drei als Lehrerinnen arbeiten.164 Dorothea aber entschied sich 1922, am Ende ihres sechs Semester dauernden Studiums, das Gerichtsreferendariat zu absolvieren. Eine Karriere in der Verwaltung war offenbar, entgegen anderslautender Aussagen165, nicht von vornherein Dorotheas Ziel. Man darf davon ausgehen, daß die Studentin Nolte trotz der Kürze ihres Studiums von einigen zentralen Ideen ihrer Lehrer beeinflußt worden war. Der bereits erwähnte Johann Plenge, der nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr nur als Nationalökonom, sondern auch als Soziologe in Münster tätig war, war mit seinen Gedanken zur Überwindung der Krise der Industriegesellschaft durch den ‚organisierten Sozialismus‘, welche er unter dem Titel ‚Die Ideen von 1914‘ veröffentlichte, bekannt geworden.166 Sein späterberühmtester Schüler war Kurt Schumacher, der mit einer Arbeit über den Nationalstaatsgedanken in der SPD bei Plenge 1920 promoviert worden war.167 Es ist immerhin möglich, daß Bähnisch den ‚Reisedoktor‘168 Schumacher bereits während ihres Studiums kennengelernt hatte, denn sie berichtet davon, daß sie sich in einem Kreis von Studierenden verschiedener Fachrichtungen bewegt habe, welcher „angeregt durch den Ideenreichtum von dem Volkswirtschaftler Professor Plenge viel diskutierte“169 und ihr eine zweite Familie geworden sei.170 Darin,
163 Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen der Rechtspflege vom 11. Juli 1922, in: Reichsgesetzblatt (RGBl), 1922 I, S. 573. 164 Vgl.: Schweighöfer: Berufswege, S. 163. 165 Vgl.: Paulus: Bähnisch. Paulus zufolge habe Theanolte Bähnisch bereits im Studium das Ziel gehabt, in der Verwaltung tätig zu werden. Quellen für ihre Aussage gibt Paulus nicht an. 166 Vgl.: Art.: „Plenge, Johann“, in: Internationales Soziologenlexikon, 2. Aufl. Bd. 1, 1980, S. 198–200. Zu einer genaueren Einordnung Plenges vgl.: Krüger, Dieter: Nationalökonomen im wilhelminischen Deutschland, Göttingen 2011, passim sowie Schildt, Axel: Ein konservativer Prophet moderner nationaler Integration. Biographische Skizze des streitbaren Soziologen Johann Plenge (1874–1963), in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 35. Jg. (1987), S. 523–570. 167 Vgl.: Schumacher, Kurt: Der Kampf um den Staatsgedanken in der deutschen Sozialdemokratie (Diss. Münster 1920), Stuttgart 1973. 168 Schumacher, der zuvor Referendar am Berliner Kammergericht gewesen war, hielt sich zwecks Abwicklung seiner Promotion bei dem Nationalökonomen Plenge im Sommersemester 1920 in Münster auf. Vgl.: Schober, Kurt: Der junge Kurt Schumacher, 1895– 1933, Bonn 2000, S. 115–124. 169 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Die Familie, S. 12.
Sozialisation | 139
daß der spätere Vorsitzende der SPD zu jener Zeit seine Doktorarbeit bei dem „konservative[n] Propheten nationaler Integration“171 verfaßte, deutet sich für Axel Schildt die „Spannbreite politischer Interpretationsmöglichkeiten“172 von Plenges Ideen an. Für Schildt steht allerdings – freilich ohne, daß er von Bähnischs Ausführungen Kenntnis hätte – fest, daß es keine „Plenge-Schule“ und keinen „PlengeKreis“ gegeben habe, obwohl dem Professor doch nichts wichtiger gewesen sei als die wissenschaftliche oder politische Wirkung seiner Theorie.173 Ob es jenen Kreis, von dem Bähnisch spricht, tatsächlich gegeben hat, ließ sich nicht klären, zumal sie die vollen Namen der ihrer Darstellung nach Beteiligten nicht nennt. Immerhin möglich ist doch, daß eine Gruppe über Plenges Ideen diskutierte, ohne daß dem Professor dies überhaupt bekannt war. Ebensowenig läßt sich herausarbeiten, welche Schlüsse die Studentin Nolte aus den Lehren Plenges zog. Fakt ist, daß Theanolte Bähnisch sich – wie Plenge – der Vision eines klassenübergreifenden gesellschaftlichen Zusammenhalts verhaftet fühlte und daß sie sich in den 1920er Jahren in Kreisen bewegte, denen – wie Plenge – von Zeitgenossen aus dem linken politischen Lager nicht selten eine ‚kathedersozialistische‘ Haltung unterstellt wurde. Wie der Vater der ‚Ideen von 1914‘ sah auch Bähnisch eine ihrer Aufgaben in der ‚Erziehung zu einer positiven Staatsgesinnung‘, doch hing sie, im Gegensatz zu dem Professor, stärker liberalen Ideen an. Sie betonte die Bedeutung der persönlichen Beziehung von Mensch zu Mensch und setzte sich für humanistische Bildungstraditionen ein, die insbesondere auf die Entfaltung von Individualität und auf die Erziehung zur Individualverantwortung gegenüber der Gesellschaft bauten. Ihr späteres Bekenntnis zum christlichen Sozialismus und zur offensiven Nutzung von Propaganda für politische Zwecke174 finden wiederum ihre Äquivalente in Plenges Überzeugungen.175 Natürlich war Johann Plenge nicht Dorotheas einziger akademischer Lehrer, jedoch mag in seiner Person eine verläßliche Kontinuität für die Studentin gelegen haben. Im Fachgebiet Verwaltungsrecht sah dies ganz anders aus: Zunächst hatte Godehard Josef Ebers176 (Zentrum), der noch 1918 für eine Veränderung der Weimarer Verfassung in Richtung eines monarchischen Konstitutionalismus eingetreten war, den Lehrstuhl innegehabt. Er ging jedoch bereits 1919 nach Köln. Ottmar Bühler, Experte für internationales Finanz- und Steuerrecht, hatte als parteiloser Ordinarius für Verwaltungsrecht 1920 die Nachfolge Ebers angetreten. Schon 1921/22 übernahm Bühler jedoch einen Lehrauftrag in Halle177. Möglich ist, daß nicht zuletzt dieser unstete Zustand Dorothea Nolte zunächst davon abgehalten hatte, sich auf die-
170 Bähnisch schreibt, der Kreis habe sich sogar „die Familie“ genannt und – was sie sich scheinbar gern hatte gefallen lassen – sie selbst zur Mutter der Familie gekürt. Ebd. 171 Schildt: Prophet, S. 523. 172 Ebd. 173 Ebd., S. 524. 174 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945. 175 Vgl.: Schildt: Plenge, S. 557 und 569. 176 Vgl.: Art. „Godehard Ebers“, in: Rektorenporträts, Universität zu Köln, auf: http:// rektorenportraits.uni-koeln.de/rektoren/godehard_ebers/, am 15.05.2014. 177 Vgl.: ebd., S. 269.
140 | Theanolte Bähnisch
ses Fachgebiet zu konzentrieren. Im Sommersemester 1922 übernahm schließlich Gerhard Lassar178 aus Berlin die Verpflichtungen Bühlers. Lassars Famulus, der spätere Ehemann Theanolte Bähnischs, der zur gleichen Zeit in Berlin Rechtswissenschaft studierte, folgte seinem Chef nach Münster.179 Das Fachgebiet Strafrecht hatten während Dorotheas Studium in Münster Ernst Heinrich Rosenfeld, Spezialist (auch) für ausländisches Strafrecht180 und Andreas Thomsen, der parteilose und selbst ernannte „einzige Spezialist Deutschlands“181 in der Verbrechensbekämpfung ausgefüllt. 2.2.2 Entscheidung gegen das Strafrecht und für die Verwaltung – Viele Anekdoten und wenig faktische Anhaltspunkte Im Juli 1922 trat Dorothea ihr Referendariat am Amtsgericht ihrer Heimatstadt Warendorf an.182 Ein halbes Jahr später wechselte sie zum Landgericht in Münster. Während des Referendariats kam sie jedoch zu der Entscheidung, für eine berufliche Zukunft im Strafrecht nicht geeignet zu sein. Wenn man so will, spielte sie mit der Begründung ihrer Entscheidung, die sie in den 1940er und 1950er Jahren dafür lieferte, jenen, die eine zu große Gefühlsnähe von Frauen als hinderlich für eine Arbeit im Strafrecht ansahen, geradezu in die Hände. In einem Artikel in der ‚Zeit‘ wird die für Bähnisch ausschlaggebende Entscheidung so beschrieben: Auf Geheiß des Gerichtsrats habe sie ein Vernehmungs-Gespräch mit einem wegen Diebstahl angeklagten Mann geführt. Angeleitet vom Einfühlungsvermögen der jungen Frau habe dieser nicht nur sehr bereitwillig gesprochen, sondern schließlich auch, unter Tränen, die wegen „besonderer Notlage und Krankheit seiner Familie“183 begangene Straftat gestanden. Der Gerichtsrat habe daraufhin die Schuld des Angeklagten festgestellt und
178 Zu Lassar siehe Kapitel 3.2.2. 179 Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch, Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels], o. O., o. J., S. 3/4. Bei der Quelle handelt es sich um ein biographisches Porträt von Albrecht Bähnisch, das Hans-Heino Fels seiner Frau Orla zum Geschenk machte. Die Darstellung basiert auf Unterlagen aus dem Nachlaß Albrecht Bähnischs, die sich im Privatbesitz von Orla-Maria und Hans-Heino Fels befinden, sowie auf verschiedenen Archivalien. Fels nennt zwar im Text die genauen Quellen nicht, jedoch läßt sich die Herkunft der getroffenen Aussagen durch die Verweise auf eine Sammlung von Dokumenten; die im Privatnachlaß Bähnischs überliefert sind, in den meisten Fällen nachvollziehen. 180 Vgl.: Art. „Ernst Rosenfeld“, in: Internationales Biographisches Archiv, 36/1952, auf: Munzinger Online/Personen, http://www.munzinger.de/search/portrait/Ernst+Rosenfeld/ 0/3875.html, am 15.05.2014. 181 Steveling: Juristen, S. 280. 182 Vgl.: NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Ernennung zum Referendar, Oberlandesgerichtspräsident, Hamm, 20.07.1922. Mit dem Schreiben wurde ein sechswöchiger Erholungsurlaub vom Tag der Vereidigung genehmigt, der Arbeitsalltag begann für die Referendarin also erst im August 1922. 183 Langner: Regierungspräsident, in: Die Zeit, 21.02.1957.
Sozialisation | 141
der Referendarin gratuliert. Sie habe, so Bähnisch später, die Dynamik, welche sich während der Vernehmung entwickelt hatte, jedoch bereut, zumal sie innerlich auf der Seite des Angeklagten gestanden habe: „Er machte auf mich den Eindruck eines hilflos dem Verhängnis ausgelieferten Menschen. Wir vergaßen beide, daß es eine Vernehmung war. […] Ich vergesse nie den Blick des Überführten. Ich empfand es als ein unerträgliches Unrecht, sein Vertrauen mißbraucht zu haben.“184 Während einer schlaflosen Nacht sei ihr klar geworden, daß sie für den Richterberuf nicht geeignet sei, weshalb sie beschlossen habe, anstelle der Gerichts- die Verwaltungslaufbahn einzuschlagen.185 Die Erzählung sollte den Lesern offensichtlich glauben machen, daß von Frauen durchgeführte Verhöre, wenn sie auch mit wohlmeinender Absicht eingesetzt würden, einen zerstörerischen Charakter entfalten könnten. Das Schicksal des Verhörten stehe dabei – so die Moral der Geschichte – ebenso auf dem Spiel wie das der vernehmenden Frau selbst. Für diese gilt es Bähnischs Darstellung nach offenbar vor allem, sich ihre ‚vertrauenswürdige‘ Natur zu erhalten. Die Entscheidung für eine Verwaltungskarriere mußte ihr demnach als die für die eigene Persönlichkeit wie auch für ihre Mitmenschen ‚schadlosere‘ Wahl erschienen sein. Daß der Artikel in der ‚Zeit‘, welcher Bähnischs Erlebnis auf diese Weise beschreibt, die Haltung der Regierungspräsidentin verzerrt wiedergegeben haben könnte, ist sehr unwahrscheinlich. Denn die Autorin des Artikels ist keine andere als Bähnischs enge Freundin Ilse Langner.186 Ob die beschriebene Begebenheit jedoch wirklich der (einzige) Grund für die Juristin war, sich gegen eine Zukunft im Strafrecht zu entscheiden, ist, vor allem vor dem Hintergrund einer komplexeren Darstellung der Zusammenhänge durch Bähnisch selbst zu einer späteren Zeit, zu bezweifeln. Vielleicht war der Gegenwind durch Kollegen im Strafrecht doch stärker, als die Referendarin auszuhalten bereit war, vielleicht hatte sie auch festgestellt, daß ihr die Inhalte, mit denen sie sich auseinandersetzen mußte, nicht lagen. Nicht unwahrscheinlich ist auch, daß Bähnisch ihre Entscheidung 1957 auf die Linie ihrer Aussagen über die Wesensart von Frauen, die sie ab 1946 verbreitet hatte und an denen sie in den 50er Jahren festhielt, hatte bringen wollen. 1972 erzählte sie die Geschichte des ‚verratenen Angeklagten‘ erneut, mit ganz ähnlichen Worten und band dabei, wie nur selten in ihren Erinnerungen, auch den historischen Kontext mit ein: „Er erzählte von der Krankheit seiner Mutter und daß er kein Geld für Arzt und Medizin gehabt hätte. Es war 1923, die Zeit der großen Arbeitslosigkeit. Er habe aus Verzweiflung […] gestohlen. […] Den Blick des Angeklagten werde ich nie vergessen. Er hatte mir vertraut und fühlte sich verraten.“187 In der Version des Diktats von 1972 nahmen die Entwicklungen im Anschluß an diese Erfahrung jedoch eine andere Wendung.188 Ihr sei, schrieb sie 1972, nach dem Ereignis „klar“ geworden „daß ich nicht dazu ge-
184 185 186 187
Ebd. Vgl.: ebd. Siehe Kapitel 2.3.2.4. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Meine erste Vernehmung, S. 14. 188 Vgl. dazu auch: Röwekamp: Mut, S. 265. Röwekamp scheint sich ebenfalls auf das Diktat von 1972 zu beziehen, belegt dies aber nicht.
142 | Theanolte Bähnisch
schaffen sei, zu richten, sondern zu helfen.“ Deshalb habe sie sich zunächst für den Anwaltsberuf entschieden: „Ich beschloß, Strafverteidigerin zu werden.“189 In dieser späteren und längeren Version ihrer Umorientierung, die schließlich in der Verwaltung mündete, erzählt sie auch davon, wie sie sich erstmalig nach einer Verhandlung mit dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern zu einer Beratung zurückgezogen hatte und dabei in einer Runde von Männern, welche die junge Referendarin „ironisch gemustert“190 hätten, Opfer eines frauenfeindlichen Witzes geworden sei. Schließlich habe ein „übler Sittlichkeitsprozeß“191, in dem ihr Bruder Otto, um sie zu ‚schützen‘, an ihrer Stelle die Protokollführung übernommen habe, dazu geführt, daß sie sich ganz vom Strafwesen weg orientiert habe. „Ich konnte und wollte in Zukunft nicht immer damit rechnen müssen, daß mein Bruder oder ein anderer Kollege in ähnlichen Fällen für mich einsprängen. Auch der Gedanke, Strafverteidigerin zu werden, hatte jetzt an Glanz für mich verloren. Immer würde ich mit den negativen Seiten des Lebens zu tun haben. Der Wunsch, zu helfen, trat zurück gegenüber dem Wunsch, etwas Positives in einer aufbauenden Arbeit zu leisten.“192 Sie habe sich, so schreibt Bähnisch in der 1972er Version, daran erinnert, wie ihr Vater ihr erklärt habe, welche positive Arbeit vom Rathaus für die Stadt Warendorf ausginge. „Das Interesse für eine verwaltende Tätigkeit rückte nun in den Vordergrund.“193 Nachdem Dorothea Nolte ihr Gerichtsreferendariat beendet und das dazugehörige Examen, wie es seit 1902 für Studierende der Universität Münster vorgesehen war, 1923 am Oberlandesgericht Hamm abgelegt hatte,194 ersuchte sie die Zulassung zum Regierungs- bzw. Verwaltungsreferendariat. „Das war nicht so einfach, denn es war bis dahin überhaupt noch keine Frau zugelassen worden. Ich […] erreichte in hartnäckigen Verhandlungen […] vor allem in einer persönlichen Unterredung mit [dem preußischen Innen-]Minister Severing die Zulassung195, schrieb sie in ihrer ‚Lebensskizze‘ und verdeutlichte damit, daß sie nicht nur die Chancen, welche ihr die Weimarer Verfassung bot, zu ergreifen gewillt war, sondern, daß sie auch danach strebte, die bereits gewonnenen Spielräume in der Praxis noch zu erweitern. Die Reise nach Berlin muß für sie ein echtes Abenteuer gewesen sein. Ihre zuvor getroffene Aussage, daß sie Westfalen bis dahin nie verlassen habe, korrigierte sie zwar 1972196, aber vermutlich hatte sie, die sich in ihrem Diktat von 1972 als ein „richtiges Provinz-
189 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Meine erste Vernehmung, S. 14. 190 Ebd., Teil I, Im Beratungszimmer des Landgerichts, S. 15. 191 Ebd., Teil I, Der Sittlichkeitsprozess, S. 15. 192 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Was nun?, S. 15/16. 193 Ebd. 194 Vgl.: Steveling: S. 105–107. 195 AddF, SP-1, Kurze Lebensskizze, verfaßt von Theanolte Bähnisch, o. D. Vgl. auch: Groneweg: Bähnisch. 196 In ihrem Diktat erwähnt sie, daß sie mit dem „Verein heimattreuer Oberschlesier […] zur Abstimmung in Oberschlesien“ gefahren sei. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Besuch bei Minister Severing, S. 16.
Sozialisation | 143
mädchen“197 bezeichnet, tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt keine Reise dieser Art allein auf sich genommen. „Mit der Reichsverfassung und einer Mappe voller Butterbrote statt Bücher“ sei sie „4. Klasse mit dem Nachtzug nach Berlin“198 gefahren, schildert sie ihr Erlebnis dramaturgisch wirkungsvoll. Mit ihrem Aufsatz-Titel „Ich brauchte meinen ganzen Mut“199, welcher auf einem Zitat Bähnischs beruht, unterstreicht Marion Röwekamp die Darstellung Bähnischs, daß ihr Vorsprechen im Innenministerium von weichenstellender Relevanz für ihre Biographie gewesen sei. Hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Innenministeriums zunächst mit Amüsement bis Fassungslosigkeit auf das Auftreten der jungen couragierten Frau im Vorzimmer des Ministers reagiert, so sei es ihr, nachdem man sie zunächst zum Oberregierungsrat, zum Ministerialdirektor und zum Staatsekretär geschickt habe200, schließlich gelungen, den Innenminister persönlich zu überzeugen, erzählt Bähnisch. „Man kann es ja mal versuchen“201, soll der seit 1920 amtierende Sozialdemokrat Carl Severing auf das entschiedene Begehren der angehenden Verwaltungsjuristin Marie-Luise Schareina zufolge geantwortet haben. „Ich will es mit Ihnen versuchen“202, zitierte Bähnisch selbst 1972 Severing in ihrem Diktat und unterstrich damit das persönliche Moment der Unterredung zwischen ihr und dem Politiker. Sie bekam schließlich einen Referendariatsplatz bei der Bezirksregierung in ihrer Studienstadt Münster zugewiesen – und arbeitete damit weiterhin in nicht allzu großer Ferne von ihrem Elternhaus. Der Zentrums-Politiker Heinrich Haslinde203, der 1927 zum Reichernährungsminister ernannt werden sollte, war zu dieser Zeit Regierungspräsident des Bezirks. Leider sind in den Archiven keine Akten überliefert, die über den Ausbildungsabschnitt Bähnischs im Regierungspräsidium Münster, wo sie sechs Monate lang ver-
197 198 199 200
Ebd. Ebd. Röwekamp: Mut, S. 265. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Besuch bei Minister Severing, S. 17. 201 Schareina: Regierungspräsident. 202 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Besuch bei Minister Severing, S. 18. 203 Der einschlägigen Literatur sei inur wenig über Heinrich Haslinde zu entnehmen, leitet das Findmittelinfo des Bundesarchivs zum Nachlaß BArch N 1666 die Biographische Beschreibung ein. Haslinde, geboren in Berlin am 21.05.1881, studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg, München und Berlin. Er war Landrat des Kreises Arnsberg in Westfalen von 1913 bis 1922, im Anschluß daran bis 1926 Regierungspräsident in Münster. Vom 20.01. bis zum 17.12.1926 fungierte er für das Zentrum als Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft. 1933 wurde er in den Ruhestand versetzt, 1941 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger. Er starb 1958. Vgl.: Märke, Antje: Einleitung, in: Bundesarchiv (Hrsg.): Nachlaß Heinrich Haslinde, N 1666 1926–1933, Koblenz 2008, o. S., auf: http://startext.net-build.de:8080/barch/MidosaSEARCH/N1666-59110/index.htm?kid= titelblatt, 15.05.2014.
144 | Theanolte Bähnisch
schiedenen Referenten zugeteilt gewesen sein dürfte204, Aufschluß geben. Auch eine Personalakte aus der Zeit vor 1946 ist nicht überliefert, weshalb sich der genaue Gang der Ausbildungsstationen – anders als bei Bähnischs späterem Ehemann Albrecht Bähnisch – nicht nachvollziehen läßt.205 Über die verschiedenen Einsatzbereiche und Arbeitsinhalte der Referendarin können deshalb weitgehend nur allgemeine Aussagen gemacht werden. Interessanterweise gibt Bähnisch selbst in einem Artikel, mit dem sie Frauen für die Arbeit in der ‚Staatsverwaltung‘ begeistern wollte, eine Übersicht der Stationen, welche Verwaltungsreferendare jeweils durchlaufen müssen: „Als Regierungsreferendar wird man zunächst 3-4 Monate verschiedenen Dezernenten der Regierung [des Regierungspräsidiums] zur Ausbildung zugeteilt, so z. B. dem Kommunaldezernenten, dem Polizeidezernenten, dem Dezernenten für Handel und Gewerbe. Die folgende Station ist eine zehnmonatige Beschäftigung bei einem Landrat. Dies ist die wohl wichtigste Vorbereitungszeit für die spätere Verwaltungstätigkeit, weil man hier Gelegenheit hat, alle Aufgaben und Verhältnisse eines Kreises in den Einzelheiten kennen zu lernen und sie in ihrer Gesamtheit zu überblicken. […] Im Anschluß hieran wird man für drei Monate einem Polizei-Präsidium überwiesen, um auch den Aufbau und die Aufgaben dieser Behörde kennen zu lernen. Dann kehrt man zur Regierung zurück, wo man den Rest der dreijährigen Vorbereitungszeit zubringt und teils theoretisch in Kursen, teils praktisch bei den einzelnen Referenten arbeitet. Zum Schluß wird man auf mehrere Monate dem Bezirksausschuß zur Ausbildung überwiesen.“206 Vor dem Hintergrund ihrer späteren inhaltlichen Schwerpunktsetzung im Beruf ist es nicht unwahrscheinlich, daß Bähnisch genau den Dezernenten zugeteilt war, die sie in ihrem Artikel beispielhaft erwähnt.
204 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Die Zulassung als Regierungsreferendar, S. 18. Vgl. auch: Bähnisch, Dorothea: Frauen in der Staatsverwaltung, in: Die schaffende Frau, 1. Jg. (1929), Heft 1, S. 15/16. 205 Ein Teil der Personalakten aus dem Berliner Polizeipräsidium, wo Theanolte Bähnisch vor 1946 zuletzt beschäftigt war, wurde nach Moskau verbracht. Im Sonderarchiv Moskau, Fond 505, sind 12 Personal-Akten aus dem Polizeipräsidium aus der fraglichen Zeit überliefert. Laut einer Antwort des Archivs ist Theanolte Bähnischs Akte jedoch nicht darunter. Sonderarchiv Moskau, Korotajev, W. I./Kolganova, N. W. an Nadine Freund, 05.05.2009. Auch eine Suche im Landesarchiv Berlin, wo ein Teil der Akten des Polizeipräsidiums überliefert ist, verlief erfolglos. Ein weiterer Teil der Akten ist im GStA PK Berlin überliefert, dort finden sich jedoch lediglich die Prüfungsakte Bähnischs und eine Akte die anläßlich der Aufnahme ihrer Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrätin 1932 angelegt wurde. Die im niedersächsischen Hauptstaatsarchiv Hannover überlieferte PersonalAkte setzt mit Schriftstücken aus dem Jahr 1946 ein, wenige Schriftstücke aus früherer Zeit liegen darin in Abschrift vor. Auf eine Prüfung der Sachakten aus dem Berliner Polizeipräsidium (Landesarchiv Berlin) hinsichtlich der Einsatzorte Bähnischs wurde aufgrund der Materialfülle auf der einen und des vermutlich geringen Ertrags auf der anderen Seite verzichtet. 206 Bähnisch: Staatsverwaltung.
Sozialisation | 145
Einen weiteren Anhaltspunkt für ihre Ausbildungsinhalte und Schwerpunktinteressen bieten die überlieferten Prüfungsunterlagen ihres zweiten Staatsexamens. Aus diesen geht hervor, daß sie sich im Regierungsreferendariat mit den Vorteilen der Tätigkeit von Frauen in Berufsfeldern, welche das öffentliche Leben prägten, auseinandergesetzt hatte. Um ihre Examens-Arbeit zum Thema ‚Sittenpolizei und Prostitution‘ vorzubereiten, hatte sie sich in die Sittenabteilung des Kölner Polizeipräsidiums abordnen lassen. (Ursprünglich dürfte für den entsprechenden Ausbildungsabschnitt das Polizeipräsidium Münster vorgesehen gewesen sein.) Präsident der Polizei war zu dieser Zeit Friedrich Zörgiebel – bis er 1926 nach Berlin abberufen wurde, wo er erneut, diesmal als Berliner Polizeipräsident, Bähnisch vorgesetzt war.207 Da Köln auf der Grundlage des Versailler Vertrags seit 1919 (bis 1926) unter britischer Besatzung stand, an der deutschen Verwaltung jedoch festgehalten worden war, prägten Kompetenzstreitigkeiten zwischen Besatzern und Besetzten den (Polizei-)Verwaltungsalltag. Die Auseinandersetzungen führten jedoch auch zu Neuerungen, die für die Referendarin besonders interessant waren, da sie den ‚Stoff‘ für ihre Staatsexamensarbeit lieferten. Deshalb sollte Dorothea Nolte später in Ergänzung zu ihrer Tätigkeit in Köln eine „informatorische Beschäftigung“208 in der Arbeitsanstalt Brauweiler aufnehmen. Zwischenzeitlich verbrachte sie jedoch, wie es die oben skizzierten Ausbildungsvorschriften vorsahen, einen Ausbildungsabschnitt in einem Landratsamt. Sie gibt an, daß sich zunächst Ernst Klausener, seinerzeit Landrat von Recklinghausen, dazu bereit erklärt habe, sie auszubilden. Aufgrund der Entwicklungen im Ruhrgebiet209 habe er seine Zusage jedoch, mit der Begründung, daß er unter „diesen Umständen“210 nicht mit einem weiblichen Referendar arbeiten könne, wieder zurückgenommen. Nachdem die Deutschen ihren im Vertrag von Versailles festgehaltenen Reparationspflichten nicht nachgekommen waren, war das Ruhrgebiet nämlich ebenfalls von alliierten Truppen besetzt worden. Schließlich habe Regierungspräsident Haslinde den Landrat des Landkreises Münster, Graf Westfalen, überreden können, Dorothea Nolte zu übernehmen.211 Dieser habe sie nach ihrem Amtsantritt zunächst mit Aufgaben der Registratur betraut, was für den Ausbildungsgang nicht üblich war und als Schikane hätte begriffen werden können. Jenen Umstand erwähnte Bähnisch nicht erst
207 Als Theanolte Bähnisch ihren Dienst in Berlin antrat, hatte jedoch noch Albert Grzesinski das Amt des Polizeipräsidenten inne. 208 GStA PK, Berlin, I. HA, Rep. 125, Nr. 3527, Gutachten über die Prüfungsarbeit der Regierungsreferendarin Nolte, Gutachter Mertens, Münster den 10.04.1926 sowie Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Annette Hennigs an Nadine Freund, 17.04.2009. 209 Im Kreis Recklinghausen, der 344.000 Einwohner hatte, waren 12.000 belgische und französische Soldaten stationiert. Da Klausener gegen die ‚Mißhandlung‘ der Beamten im Kreis protestiert hatte, mußte er nach einem Verfahren vor dem Kriegsgericht zwei Monate in Haft verbringen und konnte erst im November 1923 nach der Beendigung des ‚passiven Widerstandes‘ nach Recklinghausen zurückkehren. 210 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Die Station beim Landrat, S. 19. 211 Ebd.
146 | Theanolte Bähnisch
1972 in ihrem Diktat212, sondern bereits in einem Artikel aus den 1920er Jahren, mit dem sie Frauen eine Karriere in der Verwaltung schmackhaft machen wollte.213 Damit, daß sie ihre Tätigkeit in der Registratur als eine für sie am Ende positive Erfahrung schilderte, wollte sie wohl Bodenständigkeit demonstrieren, zumal sie dabei zum Ausdruck brachte, daß sie von dem „intelligente[n] Registrator“214 vieles gelernt habe. Schon bald habe sich, so Bähnisch, ein „echtes Vertrauensverhältnis“ zwischen ihr und dem zunächst so skeptischen Grafen ergeben. Der Landrat habe sich schließlich nicht an die Weisung des Regierungspräsidenten gehalten, im Zuge der Personal-Abbaubestimmungen, „den weiblichen Regierungsreferendar“ zu entlassen, weil er von Dorothea Noltes Qualifikation überzeugt gewesen sei. Er habe dem Regierungspräsidenten entsprechend berichtet und seinem Schreiben einen auch befürwortenden Beschluß des Kreisausschusses, in dem sich Dorothea Nolte ebenfalls einen Namen gemacht hatte, beigelegt. Daraufhin sei sie im Dienst geblieben. Die Abschrift dieses „kostbaren Dokumentes“, das sie sorgfältig aufbewahrt habe, sei gemeinsam „mit meinen Tagebüchern und allen übrigen Privatsachen dem Bomben zum Opfer gefallen“215, schrieb Bähnisch 1972. Daß sie glaubte, über die NichtÜberlieferung ihres Tagebuchs Rechenschaft ablegen zu müssen, deutet darauf hin, daß sie davon ausging, irgendwann einmal würden systematische Recherchen über ihre Person angestrengt. Daß Bähnisch in ihrem Diktat auch den Landrat Erich Klausener erwähnt, obwohl es gar nicht zu einer Zusammenarbeit mit diesem gekommen war, hängt vermutlich damit zusammen, daß er im Verwaltungswesen und in der Erinnerung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu einiger Berühmtheit gelangt war. Klausener, der durch seine Mitarbeit in der Polizei-Verwaltungsreform bekannt wurde, wurde von der SS an seinem späteren Arbeitsplatz, dem preußischen Innenministerium, erschossen.216 Bähnisch kommt im späteren Verlauf ihres Diktates sogar noch einmal auf seine Person zurück. Sie berichtete, daß er im Rahmen einer Landrätekonferenz, auf der sie den erkrankten Landrat Westfalen habe vertreten müssen, „in alter Herzlichkeit“217 auf sie zugekommen sei, während die anderen Herren reserviert auf ihre Anwesenheit reagiert hätten. Ihr war ganz offensichtlich daran gelegen, ihre Verbundenheit mit dem späteren Vorgesetzten ihres Mannes Albrecht Bähnisch und noch späteren ‚Ankläger einer Epoche‘ zu unterstreichen. Daß sie – wie sie es in ihrem in der Einleitung zitierten Brief an Schumacher deutlich gemacht hatte – darauf bestand, in beruflichen Zusammenhängen weibliche Verführungskünste außen vor zu lassen, unterstrich sie auch in ihrem Diktat, indem sie eine Geschichte zum besten gab, laut der sie sich geweigert hatte, mit Referen-
212 213 214 215
Ebd. Bähnisch: Staatsverwaltung. Ebd. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Das erste Abbaugesetz, S. 21. 216 Siehe Kapitel 3.3.5. 217 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, Landrätekonferenz, S. 22.
Sozialisation | 147
darskollegen ein Spiel zu spielen, in dem sie einen anderen Referendar hätte küssen müssen. Ihren Bericht über die letzte Station im Referendariat, das Bezirksverwaltungsgericht, nutzte sie schließlich, um zu zeigen, daß sie mit einer Mischung aus Sachkenntnis, Intelligenz und Charme in der Lage sei, auch (vermeintlich) „frauenfeindlich eingestellt[e]“ Männer – hier den Verwaltungsgerichtsdirektor – von ihren Fähigkeiten zu überzeugen.218 2.2.3 Prostitution als Gegenstand von Verwaltungshandeln: Praktische und theoretische Unternehmungen der Referendarin in Köln und Brauweiler 2.2.3.1 Prostitution als Gefahr für die Volksgesundheit – Die etablierte staatliche Haltung „Brauweiler – das ist eben für die Allermeisten der Ort wenn nicht des Grauens, so doch der büssenden Sünde, der kalten Justiz, der unerbittlichen Staatsräson. Eine Cayenne kleinbürgerlichen Formats“219, schrieb der Mitherausgeber und Redakteur der sozialdemokratischen ‚Rheinischen Zeitung‘, Hugo Efferoth, 1927 über die Rheinische Provinzial-Anstalt. Er setzte damit die Arbeit ihres Personals an den aus dem Rahmen der bürgerlichen Ordnung gefallenen Insassen mit den Folterpraktiken der Aufseher des französischen Strafgefangenenlagers Bagno in frz. Guyana/Südamerika gleich. Brauweiler war, untergebracht in einer ehemaligen Benediktinerabtei, seit 1815 die größte ‚Arbeits- und Korrektionsanstalt‘ Deutschlands gegen den „Hang zum Müßiggang“ 220 – wie es Hans von Jarotzky, der die Anstalt von 1904 bis 1924 leitete, in einer Schrift über Brauweiler formuliert hatte. Vor allem Bettler, Landstreicher und Prostituierte sollte die Anstalt Brauweiler auf den Weg (zurück) zu Arbeit und Ordnung bringen. Aber auch straffällig gewordene Jugendliche zählten zu den ‚Korrigenden‘. Für die Referendarin Nolte sollte die dritte große Gruppe der Inhaftierten in Brauweiler Gegenstand ihres wissenschaftlichen Interesses werden: Sie trat den Weg in die Anstalt 1925 aufgrund der dort verwahrten Prostituierten an. Diese wiederum waren meist auf der Grundlage von § 361, Abschnitt 6, Reichsstrafgesetzbuch (RStGB) in der Fassung von 1876 in die Arbeitsanstalt gekommen. Der Abschnitt lautete: „Mit Haft wird bestraft, [...] eine Weibsperson, welche wegen gewerbsmäßiger Unzucht einer polizeilichen Aufsicht unterstellt ist, wenn sie den in dieser Hinsicht zur Sicherung der Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen Anstandes erlassenen polizeilichen Vorschriften zuwiderhandelt, oder welche, ohne einer solchen Aufsicht unterstellt zu sein, gewerbsmäßig Unzucht treibt.“
218 Ebd., Der Herr Verwaltungsgerichtsdirektor, S. 24–26, Zitat S. 24. 219 Zitiert nach: Daners, Hermann: „Ab nach Brauweiler…!“. Nutzung der Abtei Brauweiler als Arbeitsanstalt, Gestapogefängnis, Landeskrankenhaus…, Pulheim 1996, S. 107. 220 Jarotzky, Hans von: Die Rheinischen Provinzialanstalten in Brauweiler, Brauweiler 1908, zitiert nach Daners: Brauweiler, S. 112.
148 | Theanolte Bähnisch
In Deutschland 1871 konzessioniert221, war die Kontrolle der Prostitution auch in der Weimarer Republik Bestandteil polizeilichen Verwaltungshandelns geblieben, nicht gern gesehen, aber im Rahmen der Möglichkeiten wohl geordnet: Prostituierte mußten zur Ausübung ihres Gewerbes über eine Lizenz verfügen, sich in regelmäßigen Abständen Zwangsuntersuchungen unterziehen und sich an Wohn-, Aufenthalts- und Verhaltensbeschränkungen halten. Wer sich widersetzte oder gegen die Regelungen verstieß, hatte mit der Einweisung in eine Anstalt wie Brauweiler zu rechnen. Diese Maßnahmen sollten den Anspruch des Staates umsetzen helfen, die Bevölkerung vor ansteckenden Geschlechtskrankheiten zu schützen. Denn als deren Trägerinnen und Verbreiterinnen waren vor allem Prostituierte ausgemacht worden. Erst über ein Jahr nach dem Abschluß von Noltes Staatsexamen, 1927, wurde die Kontrolle der Prostitution der Sittenpolizei aus der Hand genommen. Die nicht-gewerbsmäßige Prostitution wurde, nach dem Beispiel Norwegens und Dänemarks, entkriminalisiert und die staatliche Reglementierung, wozu auch die Kasernierung von Prostituierten, also der Zwang, an bestimmten Orten in der Stadt unter Aufsicht zu wohnen, gehörte, wurde abgeschafft. Die Kontrolluntersuchungen wurden auf der Basis des jahrelang im Reichstag diskutierten, immer wieder überarbeiteten und 1927 schließlich verabschiedeten ‚Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten‘ (GBG)222 dem Zuständigkeitsbereich der neu eingerichteten Gesundheitsbehörden übertragen. Von diesem Zeitpunkt an konnten nicht mehr nur Frauen, sondern auch Männer, die im Verdacht standen sexuelle Krankheiten zu übertragen, zur Untersuchung gezwungen werden.223 Das Eingehen sexueller Kontakte bei einer vorliegenden sexuell übertragbaren Krankheit war nun für beide Geschlechter strafbar. Die Polizei sollte nur dann, wenn solche Fälle bekannt wurden, tätig werden, oder wenn Personen, die unter Verdacht standen, Krankheiten übertragen zu können, eine Untersuchung verweigerten. Die Auseinandersetzung der Referendarin mit der Thematik ‚Sittenpolizei und Prostitution‘ fiel also mitten in eine Zeit, in der engagiert bis erbittert über den Sinn der sittenpolizeilichen Vorgehensweisen gegenüber den Prostituierten und über mögliche Alternativen oder Veränderungen gestritten worden war, bis es zu den veränderten Bestimmungen 1927 kam. Sie widmete sich einem Thema, das ethisch-moralischen, psychologischen, politischen und sozialrechtlichen Zündstoff enthielt, zumal es in gleich doppelter Hinsicht ein Thema der weiblichen Emanzipation war. Denn es berührte, wie im Folgenden deutlich werden wird, auch die Frage nach der Einbeziehung von Frauen in staatliches Verwaltungshandeln im allgemeinen und in die Exekutive im Speziellen. Um Dorothea Noltes Position einordnen zu können, soll zunächst ein Einblick in das Thema Prostitution als ein Thema der Frauenbewegung gegeben werden, dann sollen die von der britischen Militärbehörde ausgehenden Entwicklungen in der Kölner Frauenwohlfahrtspolizei beschrieben werden und daran anknüpfend die Schnitt-
221 In Frankreich war die Konzessionierung bereits 1802 erfolgt. 222 Vgl.: Hartmann, Ilya: Prostitution, Kuppelei, Zuhälterei: Reformdiskussion und Gesetzgebung seit 1870, Berlin 2006. 223 Lindner, Ulrike: Gesundheitspolitik in der Nachkriegszeit. Großbritannien und die Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, Oldenburg 2004, S. 297/298.
Sozialisation | 149
menge beider Aspekte mit der von führenden preußischen Politikern und Verwaltungseliten angestrebten Reformpolitik aufgezeigt werden. 2.2.3.2 Prostitution als Thema der Frauenbewegung: Fürsorge statt Bestrafung Die bürgerliche Frauenbewegung und in ihr vor allem die auf die Abschaffung der Prostitution zielende Sittlichkeitsbewegung224 hatte schon seit den 1870er Jahren Versuche zur Bekämpfung der Prostitution unter der Devise „Die Unsittlichkeit ist die Feindin des Familienglücks“ unternommen. Initiativen zu einer allgemeinen Erziehung zur Keuschheit sowie zur Bestrafung und zur Zwangserziehung der „teuflischen“ Prostituierten waren Kernbestandteile des Vorgehens.225 Nachdem die Zahl der ‚Dirnen‘ im Zuge der Industrialisierung bis in die 1890er Jahre stark angestiegen war226 und aus der Bevölkerung Rufe nach einem härteren Vorgehen der ‚Sitte‘ gegen die Prostituierten zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung von Geschlechtskrankheiten laut geworden waren, war es einer fortschrittlicheren Richtung der Frauenbewegung, den international operierenden Abolutionistinnen227, gelungen, auch in Deutschland Fuß zu fassen. In der Internationalen Abolutionistischen Föderation (IAF) organisiert, verurteilten sie vor allem die staatliche Doppelmoral, welche es als ‚natürlich‘ darstellte, wenn Männer ihre Sexualität mit Prostituierten ausleben wollten, gleichzeitig aber die Prostituierten dafür, daß sie Sex gegen Bezahlung anboten, verurteilte und auf die Unterdrückung dieser ‚Arbeit‘ abzielte. Die in der IAF organisierten Frauen setzten sich weltweit für die Abschaffung der staatlichen Reglementierung von Prostitution ein und hofften, über dieses mittelfristige Ziel eine langfristige Abschaffung der Prostitution selbst erreichen zu können. Der deutsche Zweig der IAF kritisierte – anders als der BDF, dessen ‚Kommission zur Hebung der Sittlichkeit‘ zu dieser Zeit noch von Hanna Bieber-Böhm geleitet wurde und für eine repressive Politik gegenüber den Prostituierten eintrat – die Sittenpolizei für ihre Zwangsund Stigmatisierungsmaßnahmen228 gegenüber den Dirnen stark. Sie verurteilte auch
224 Diese wurde angeführt von der konservativen Hanna Bieber-Böhm, der Begründerin des Vereins ‚Jugendschutz‘. 225 Vgl.: Schmackpfeffer, Petra: Frauenbewegung und Prostitution: über das Verhältnis der alten und neuen deutschen Frauenbewegung zur Prostitution, Oldenburg 1989, S. 31. 226 330.000 Prostituierte soll es zu Beginn des Ersten Weltkrieges gegeben haben, für die Jahrhundertwende werden Zahlen von 100.000 bis 200.000 genannt. Vgl.: Schmackpfeffer: Frauenbewegung, S. 13. 227 Abolutionismus ist als Kürzel für ‚the Abolition of the State Regulation of Vice‘ zu verstehen. 228 Petra Schmackpfeffer beschreibt die Richtlinien wie folgt: „Prostituierte durften keine Promenaden betreten, nicht in offenen Kutschen oder Straßenbahnen fahren, auf Friedhöfen oder in öffentlichen Badeanstalten erscheinen, Militärparaden anschauen, mit anderen Prostituierten zusammen wohnen und auch nicht mit ihnen gemeinsam in ihrer Wohnung essen, nicht auf Parterre wohnen oder in der Nähe von Schulen, Kirchen und Kasernen. Sie durften generell nie nachts ausgehen. Jede Entfernung aus der Stadt und jede Rückkehr mußte bei der Polizei persönlich angemeldet werden. Daneben existierten spezifi-
150 | Theanolte Bähnisch
die sich stetig mehrenden Fehlgriffe gegenüber ‚unbescholtenen‘ Frauen.229 Die Bereitschaft von Frauen, sich zu prostituieren, wertete die IAF nach der Überzeugung der ‚Mutter der Abolutionistinnen‘, Josephine Butler230, als eine Folge schlechter sozialer Verhältnisse sowie mangelnder Fürsorge.231 Die Reglementierung, also die staatliche Lenkung der Prostitution, sei ein „Kompromiß des Staates mit dem Laster im Namen der Volksgesundheit“232, erklärte die Leiterin des deutschen Zweiges der IAF, Anna Pappritz, 1922, also zu jener Zeit, als Dorothea Nolte gerade ihr Studium beendet hatte. Die Praktiken der Sittenpolizei, welche ausschließlich männliches Personal auf die Streife schickte, bewerteten die Abolutionistinnen zudem als eine Entehrung von Frauen. Sie forderten, den Einfluß von Frauen in der Öffentlichkeit auch durch einen verstärkten Einsatz von Frauen in der staatlichen Bekämpfung der Prostitution zu mehren. Dabei solle sich der Staat jedoch anderer Mittel bedienen als zuvor. Das sittlich fragwürdige Verhalten der sich prostituierenden Frauen, so die Überzeugung der Abolutionistinnen, resultiere nämlich aus einer sozialen Notlage und dürfe deshalb nicht mit Sanktionen beantwortet werden, sondern es müßten vielmehr unterstützende Maßnahmen zum Einsatz kommen. Zu diesem Zweck müsse ein weitgehend in Frauenhand liegendes Vorsorge- und Fürsorgesystem etabliert werden. Dabei differierte die Position der deutschen Frauen von der der Französinnen und Britinnen. Der ‚konservative Feminismus‘ der deutschen Frauen drückte sich darin aus, daß sie
229
230
231 232
sche Verhaltensgebote, wie das Verbot, auf der Straße stehenzubleiben, Zigarren zu rauchen, Verbindungen zu Zöglingen von Zivil- und Militärinstitutionen zu unterhalten. Zudem bestand eine Beitragspflicht zu einer Kranken- und Reisekasse, letztere diente zur Finanzierung bei Abschiebung einer Prostituierten in ihre Heimat. Mancherorts war die gesundheitliche Kontrolle mit Gebühren belegt. Die Untersuchungen mußten ein- oder zweimal wöchentlich durchgeführt werden. Mit Beginn der Registrierung wurde eine Polizeiakte für die Prostituierte angelegt, in der – angefangen von der Familiengeschichte bis hin zu den Überschreitungen und Krankenhausbehandlungen – alles Erdenkliche festgehalten wurde.“ Schmackpfeffer: Frauenbewegung, S. 20. Der wohl prominenteste Irrtum in dieser Hinsicht war die Festnahme der Juristin Anita Augspurg auf dem Weg zu einer Versammlung. Elke Schüller zufolge hatte Augspurg jedoch aus politischen Beweggründen angestrebt, verhaftet zu werden. Vgl.: Schüller, Elke: Anita Augspurg, auf: Bundeszentrale für politische Bildung, http://www.bpb.de/themen/ DMA2UA,1,0,Anita_Augspurg.html, am 20.05.2009. Vgl.: ebd., S. 25–29. Butler (1828–1906) hatte in Großbritannien eine Kampagne gegen die staatlichen ‚Contagious Disease Acts‘ initiiert. Diese Gesetze machten die sich prostituierenden Frauen, nicht aber ihre Kunden sowie die Bordellbetreiber für die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten verantwortlich. Vgl.: ebd., S. 32. Zitiert nach: Nienhaus, Ursula: Einsatz für die „Sittlichkeit“: Die Anfänge der weiblichen Polizei im Wilhelminischen Kaiserreich und in der Weimarer Republik, in: Lüdtke, Alf (Hrsg.): Polizei, Gesellschaft und Herrschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt 1992, S. 243–266, hier S. 245. Die Schriftstellerin Anna Pappritz leitete gemeinsam mit Annette Scheven den deutschen Zweig der Abolutionistischen Föderation und war von 1907 bis 1914 Schriftleiterin des Bundes deutscher Frauenvereine (BDF).
Sozialisation | 151
sich „die Verbesserung der Situation der Frauen nicht von einer Aufhebung, sondern von einer konsequenten Durchsetzung der traditionellen gesellschaftlichen Arbeitsteilung“233 versprachen. Auf der Basis seiner gemäßigten Linie näherte sich der deutsche Zweig der Abolutionistinnen bald der größten konfessionellen deutschen Frauenorganisation, dem Deutsch-Evangelischen Frauenbund an und fand weitere Unterstützerinnen unter gemäßigten Feministinnen.234 So stritt auch eine Grande Dame der bürgerlichen Frauenbewegung235 Dr. rer. pol. Elisabeth Lüders, die 1926 den Akademikerinnen-Bund begründete, auf der Basis ihres DDP-Reichstagsmandats für die „Befreiung von Krankheit und Lüge“236, welche die Reglementierung der Prostitution für sie bedeutete. Auch die Tochter des berühmtem Theologen und Begründer des ‚Kulturprotestantismus‘ Adolf von Harnack und spätere Leiterin des BDF, Agnes von Zahn-Harnack, war der Meinung, daß die herrschende Gesetzlage die Prostituierte zum „gehetzten Tier“ mache, „das aus einer Wohnung in die andere verjagt wird und jeder versucht, daran zu verdienen“.237 Zwar wurde das Ziel jener Frauen, die Reglementierung reichsweit abzuschaffen, erst 1927 erreicht, in einigen deutschen Bundesstaaten hatte das Engagement der Frauenbewegung jedoch bereits in den 1910er Jahren zu einer stärkeren Einbeziehung von wohlfahrtspflegerisch geschulten Frauen in die polizeiliche Arbeit geführt. Dies hatte zur Folge gehabt, daß das Handeln gegenüber Prostituierten im Namen des Staates zwischenzeitlich an strafendem Charakter verloren und an fürsorgerischer Qualität hinzugewonnen hatte. Von der Polizei wegen gewerbsmäßiger Unzucht oder ähnlichen Vergehen aufgegriffene Frauen wurden in einigen deutschen Städten schon auf der Wache von Fürsorgerinnen betreut und unter Umständen durch diese direkt an wohltätige Organisationen, Krankenhäuser oder Pflegeämter überwiesen. Die Grenzen zwischen polizeilicher und fürsorgerischer Tätigkeit verschwammen und die
233 Schmackpfeffer: Frauenbewegung, S. 44. 234 Radikalere Abolutionistinnen wie Lida Gustava Heymann, die von einer ‚Geschlechtsknechtschaft‘ der Frauen sprach, welche aus der Reglementierung ihre kräftigste Nahrung erhalte, schlossen sich der von Helene Stöcker geführten Bewegung ‚Neuer Ethik‘ oder der Stimmrechtsbewegung an. Vgl.: ebd., S. 45. 235 Der Begriff ‚bürgerliche Frauenbewegung‘ wird hier in Anlehnung an die Politik des BDF verstanden. Während die ‚proletarische Frauenbewegung‘ sich für die Lösung der ‚sozialen Frage‘ einsetzte, die Anpassung der Löhne und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen forderte, wollte die ‚bürgerliche Frauenbewegung‘ vor allem die Partizipation von Frauen aus dem Bürgertum am ‚öffentlichen Leben‘ und ihre Etablierung in der (akademischen) Berufswelt erreichen. Die konservative Frauenbewegung stellte sich allgemein gegen eine politische Betätigung von Frauen und konzentrierte sich fast ausschließlich auf karitative und kulturelle Aspekte. 236 Vgl.: Lüders, Marie-Elisabeth: Befreiung von Krankheit und Lüge, in: Die Frau, Bd. 34 (1926/27), S. 302–305. 237 Zahn-Harnack, Agnes: Die Frauenbewegung. Geschichte, Probleme, Ziele, Berlin 1928, S.112.
152 | Theanolte Bähnisch
Frauen entgingen einer Strafe im eigentlichen Sinn.238 Streifendienst durchführen und Zwangsgewalt anwenden durften die teilweise von Fürsorgevereinen zur Polizei entsandten, teilweise von der Polizei direkt angestellten Frauen jedoch nicht. Im Staat Preußen hatte sich die erwünschte Zusammenarbeit mit den Fürsorgerinnen in einer Verfügung des Innenministers vom 15.06.1918 manifestiert. In dieser war die Sorge zum Ausdruck gebracht worden, daß in Folge des Krieges womöglich bald „eine große Anzahl von Mädchen und Frauen sittlich herabsinken“ und „der gewerbsmäßigen Unzucht nachgehen“ würde. Diesem Umstand sei allein mit strafrechtlichen Maßnahmen nicht beizukommen, weshalb „mit ihnen die Fürsorgearbeit Hand in Hand gehen müsse“, hieß es im ministeriellen Erlaß, der eine Zusammenarbeit von polizeilichen Fürsorgerinnen mit Fürsorgeschwestern und Fürsorgevereinen als Mittel der Wahl empfahl. Es ist wahrscheinlich, daß Marie Elisabeth Lüders, welche seit 1914 die Frauenarbeitszentrale im preußischen Kriegsministerium leitete, auf den Erlaß Einfluß genommen hatte und daß sich nicht zuletzt ihretwegen eine frühe Bereitschaft Preußens zum Umdenken abzeichnete. Denn die Frauenarbeitszentrale war auch für die Koordination des Wohlfahrtswesens zuständig und ihre Leiterin, die zeitgleich als Wohnungspflegerin in Charlottenburg tätig war, war eine viel gehörte Person. Ebenfalls auf der Linie Lüders lag die Ergänzung, welche der Erlaß enthielt, nämlich daß in vielen Fällen die geschlossene Fürsorge eintreten müsse, wobei als Möglichkeiten „Unterkunftshäuser zu vorübergehendem Aufenthalt, Zufluchtshäuser und Heime zu länger dauernder Unterbringung, vor allem auch […] Heime[…] nach dem Muster der Arbeiterkolonien auf dem Lande“ angesprochen wurden.239 An An-
238 „Um gefallenen Frauen und Mädchen die Rückkehr zu anständigem Lebenswandel zu erleichtern, ist die dauernde Mitwirkung einer mit den Bestrebungen der Rettungsvereine vertrauten Dame erwünscht und herbeizuführen, welcher täglich Zutritt und freiester Verkehr mit den eingelieferten weiblichen Personen zu gestatten ist“, hatte die Order des Preußischen Ministers des Innern vom Dezember 1907 gelautet, welche „Fürsorgedamen“ zum festen Bestandteil des polizeilichen Alltags machte. Mancherorts regelten fest angestellte Polizeiassistentinnen ohne polizeiliche Befugnisse die Vermittlung von Personen zwischen der Polizei und den Fürsorgevereinen bzw. -einrichtungen. Im Berliner Polizeipräsidium beispielsweise existierte eine Wohlfahrtsstelle, die als Fürsorgestelle der Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge 1909 eingerichtet worden war und alle Fälle männlicher und weiblicher Jugendlicher behandelte. Daneben gab es seit 1910 eine Frauenhilfsstelle, der die Gefährdetenfürsorge für die von der Sittenpolizei zugeführten Frauen und Mädchen oblag. Beide Stellen unterstanden dem städtischen Jugendamt. Barck, Lothar: Ziele und Aufgaben der weiblichen Polizei in Deutschland, Freiburg 1928, S. 21. Bereits in den 1890er Jahren hatte der Polizeipräsident von Berlin die seelsorgerische Betreuung von ‚besserungswilligen Prostituierten‘ ermöglicht, ab 1903 hatte Preußen sogar finanzielle Mittel bereitgestellt, die es den konfessionellen Verbänden ermöglichten, eine Fürsorgetätigkeit von Frauen bei der Polizei zu etablieren. Den Anfang eines solchen Modells hatte der deutsch-evangelische Frauenverband 1904 in Hannover gemacht. Vgl.: Wieking: Kriminalpolizei, S. 9. 239 Verfügung des Ministers des Innern vom 15.07.1918, zitiert in: Wieking: Kriminalpolizei, S. 135–138.
Sozialisation | 153
stalten wie Brauweiler wurde also festgehalten und daran änderten auch das Ende des Ersten Weltkriegs und die Gründung der Weimarer Republik zunächst einmal nichts. 2.2.3.3 Veränderungen in der Anstalt Brauweiler unter dem Eindruck der Reformgesetze Von seinem einstigen Schrecken hatte Brauweiler mit der Etablierung der Republik und der Verabschiedung des von nahezu allen Zweigen der öffentlichen und privaten Wohlfahrtspflege ersehnten ‚Bewahrungsgesetzes‘ 1920 bereits etwas verloren. Gegenstand des Gesetzes war eine notfalls unter Zwang durchzuführende fürsorgerische Behandlung in geschlossenen oder halboffenen Anstalten. Wie die ‚Bewahrung‘ genau aussehen sollte, war unter den Parteien zwar umstritten, doch gegen das Gesetz als solches hatte sich allein die KPD gestellt.240 Die Neuerung, die der ‚Bewahrungsgedanke‘ brachte, war eine Entkriminalisierung von ‚Bettlern‘, ‚Landstreichern‘ und Prostituierten, was gleichzeitig den Einfluß der Fürsorgerinnen, die über die „Verfügungshoheit gegenüber sozial Randständigen“241 seit Jahrzehnten mit den Juristen gestritten hatten, erweiterte. Die bedeutendste Unterstützerin des Bewahrungsgedankens war die Zentrumspolitikerin und Leiterin des katholischen Frauendienstes, Agnes Neuhaus, für die Dorothea Nolte in ihrer Examensarbeit später lobende Worte finden sollte. Auch die bereits erwähnte DDP-Politikerin und spätere Mitstreiterin Bähnischs, Marie-Elisabeth Lüders stand hinter dem Gesetz.242 Der Aufenthalt der Referendarin Dorothea Nolte in der Anstalt Brauweiler fiel in die Zeit nach der Entlassung des für seinen harten Führungsstil wiederholt in Verruf geratenen Leiters Hans von Jarotzky. Obwohl dessen Nachfolger sich nur zwei Jahre im Amt halten konnte243, hatte sich die Korrektionsanstalt seit Mitte der 20er Jahre auf der Grundlage des Bewahrungsgesetzes und weiterer Gesetze zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Frauen, die zwischen 1922 und 1925 den Reichstag passiert hatten, stärker zu einer Fürsorgeeinrichtung entwickelt. Unter diesen Gesetzen waren die bedeutendsten das Reichsjugendwohlfahrtgesetz (RJWG) sowie das Jugendgerichtsgesetz (JGG). Daß die DDP-Politikerin und ehemalige Leiterin des Bundes deutscher Frauenvereine (BDF), Gertrud Bäumer, als Ministerialrätin für die Kommentierung und Durchführung des RJWG zuständig war244, unterstreicht den Einfluß, den die Reichsregierung der Bürgerlichen Frauenbewegung auf ihre Re-
240 Vgl.: Willing, Matthias: Das Bewahrungsgesetz. Eine rechtshistorische Studie zur Geschichte der deutschen Fürsorge, Tübingen 2003, S. 81–83. 241 Ayaß, Wolfgang: Rezension zu: Willing: Bewahrungsgesetz, in: H-Soz-u-Kult, 26.01. 2004, auf: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2004-1-045, am 30.09. 2013. 242 Willing: Bewahrungsgesetz, S. 208. 243 Als Begründung für seine kurze Amtszeit werden Alkoholprobleme genannt. Vgl.: Daners: Brauweiler, S. 161. 244 Vgl.: Kessel, Fabian/Maurer, Susanne: Soziale Arbeit, in: Kessel, Fabian/Reutlinger, Christian/Maurer, Susanne/Frey, Oliver (Hrsg.): Handbuch Sozialraum, Wiesbaden 2005, S. 11–129, hier S. 115, Anm. 3 sowie Hopf, Caroline: Frauenbewegung und Pädagogik. Getrud Bäumer zum Beispiel, Bad Heilbrunn 1997, S. 198.
154 | Theanolte Bähnisch
formpolitik zu geben bereit war. Die auf der Grundlage der neuen Gesetze errichteten Instanzen wie die Jugendämter (§ 8 RJWG) sollten die vor allem von der SPD und vom Zentrum verfolgten Bestrebungen245, die Gefährdeten-Fürsorge auszubauen sowie den karitativen und edukativen Aspekten von Resozialisierungsmaßnahmen eine stärkere Gewichtung einzuräumen, umsetzen helfen. Insbesondere erstmalig straffällig gewordene Personen sollten nach den neuen Richtlinien milder behandelt werden.246 Verarmung, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot hatten nach dem Ende des Weltkrieges so viele junge Menschen auf die Straßen und damit an den Rand der bürgerlichen Gesellschaft getrieben, daß den demokratischen Parteien ein Ausweichen auf die Inhaftierung und Bestrafung im Vergehensfall allein weder praktikabel noch legitim erschien. Neben die noch immer praktizierte ‚Erziehung durch Arbeit‘ in Brauweiler traten für die jungen Delinquenten Erziehungsunterricht und Seelsorge. Als härteste Strafe sah die Hausordnung immerhin noch das Leben bei Brot und Wasser für maximal 14 Tage vor247 - vielleicht ein Ansatzpunkt zur Erklärung der eingangs erwähnten, negativen Presseberichterstattung über die bereits reformierte Anstalt. Es ist zudem davon auszugehen, daß die Aufseher und Aufseherinnen in ihren Methoden um 1925 keine völlige Kehrtwende vollzogen hatten, sondern zumindest teilweise an den während der strengeren Führung der Anstalt praktizierten Verhaltensweisen gegenüber den Insassen festhielten. In der Frauenabteilung der Anstalt wurden ab Mitte der 1920er Jahre Gruppen zu je 25 bis 30 Mädchen und Frauen gebildet, denen je eine wohlfahrtspflegerisch geschulte Erzieherin zugeordnet wurde. Diese sollte für die jungen Frauen „die Rolle einer Ersatzmutter übernehmen.“248 Der Anstalts-Unterricht für Mädchen bis zum 23. Lebensjahr deckte die Fächer Deutsch, Rechnen, Gesang, Religion und Lebenskunde ab, wobei der Lebenskunde, welche Themengebiete wie ‚Die Aufgaben der Hausfrau‘, ‚Die Pflichten der Tochter‘, ‚Aufgaben der Gattin und Mutter‘ sowie ‚der Staat‘ und ‚das Reich‘ umfaßte, besonderen Stellenwert für die Resozialisierung beigemessen wurde. 1925, als Dorothea Nolte die Anstalt besuchte, nahmen 80 bis 100 Schülerinnen an diesem Unterricht teil.249 Vermutlich verschaffte sich die Referendarin einen Eindruck von diesem Unterricht, vermutlich hielt sie sich im Rahmen ihrer Studien auch im von den Briten beschlagnahmten ‚Frauenarbeitshaus Freimersdorf‘ sowie im ‚Mädchenasyl Freimersdorf‘ auf. In das Mädchenasyl waren schon seit 1915 – sozusagen den neuen, weniger scharfen Gesetzen vorauseilend – zunehmend
245 Vgl.: Trapper, Thomas: Erziehungshilfe: Von der Disziplinierung zur Vermarktung. Entwicklungslinien der Hilfen zur Erziehung in den gesellschaftlichen Antinomien zum Ende des 20. Jahrhunderts, Rieden 2002, S. 21. 246 Unter anderem wurde verstärkt auf Bewährungsstrafen gesetzt. Vgl.: Allgemeine Verfügung des Justizministers vom Oktober 1920 über die bedingte Aussetzung der Strafvollstreckung, in Auszügen abgedruckt in: Wieking: Kriminalpolizei, S. 138–139. 247 Vgl.: Daners: Brauweiler, S. 102/103. 248 Ebd., S. 102/103, Zitat auf S. 103. 249 Vgl.: ebd., S. 150.
Sozialisation | 155
18 bis 20-jährige wegen ‚gewerbsmäßiger Unzucht‘ erstverurteilte Frauen verbracht und dort von Fürsorgevereinen betreut worden.250 Es ist unklar, ob für Dorothea Nolte zuerst die Idee im Raum gestanden hatte, sich mit dem Thema ‚Sittenpolizei und Prostitution‘ auseinanderzusetzen und sie dann nach einem geeigneten Objekt für praktische Studien gesucht und in Köln und Brauweiler fündig geworden war, oder ob sie von den verwaltungsjuristisch höchst interessanten Entwicklungen, die sich im Nachbar-Regierungsbezirk Köln zur Zeit ihres Verwaltungsreferendariates herauskristallisiert hatten, gehört und diese zum Anlaß genommen hatte, das Thema ihrer Arbeit entsprechend auszurichten. Weder im Staatsarchiv Düsseldorf noch im Staatsarchiv Münster oder im Archiv des Landschaftsverbandes Pulheim-Brauweiler sind Informationen zu Noltes Aufenthalt in Köln beziehungsweise Brauweiler überliefert251. Die Staatsexamensarbeit sowie die dazu verfaßten Gutachten sind deshalb die einzigen Quellen, die über die RechercheArbeiten Noltes herangezogen werden können. Auf dieser Grundlage sind keine genaueren Angaben zum Zeitpunkt ihrer Aufenthalte in Köln und Brauweiler sowie zum Rahmen ihrer Recherchen möglich. Um ihre Arbeit besser einordnen zu können soll, nachdem die Haltung der Frauenbewegung gegen das sittenpolizeiliche Vorgehen sowie die juristischen Entwicklungen, mit denen Bähnisch während ihrer praktischen und theoretischen Ausbildung konfrontiert sah, geschildert wurden, ein Abriß über die Entwicklungen in Köln der Jahre 1923 bis 1925 und deren Nachklänge in Preußen und dem Reich folgen. Anschließend soll die Position, welche Nolte in ihrer Examensarbeit entfaltete, im Spektrum der Haltungen zum Umgang des Staates mit der Prostitution und zur Verwendung von Frauen im Polizeidienst verortet werden. 2.2.3.4 Die Kölner Frauenwohlfahrtspolizei Köln und damit auch Brauweiler boten sich als Untersuchungsgegenstände für die Studentin im Rahmen der gewählten Thematik besonders an, da in der ‚Kölner Frauenwohlfahrtspolizei‘ ab 1924 die ersten weiblichen Kriminalbeamtinnen in Deutschland, die nicht nur über fürsorgerische, sondern auch über polizeiliche Befugnisse verfügten, eingesetzt wurden. Dorothea Nolte saß damit an der Quelle eines in späteren Diskussionen immer wieder reflektierten ersten Versuchs, den Umgang mit der Prostitution durch die verantwortliche Verwendung von Frauen in der Polizeistreife und auf dem Amt zu verändern. Die Vorgeschichte dieser Frauenwohlfahrtspolizei lag zum einen im tatsächlich eingetretenen Anstieg der Prostitution nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in Folge von Armut und Wohnungsnot sowie der damit ein-
250 Die Arbeitsanstalt Brauweiler hatte dafür seit 1918 den Fürsorgevereinen die vom rheinischen Provinzialverband überwiesenen Gelder zur Verfügung gestellt, um eine selbständige Führung des Asyls, in dem 1924 ca. 300 Mädchen einsaßen, durch die Fürsorgevereine zu ermöglichen. Vgl.: ebd., S. 114. 251 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, K. Pilger, an mich, 12.05.2009, LVR-Archivbera tungs- und Fortbildungszentrum Brauweiler, Rudolf Kahlfeld an Nadine Freund, 06.04. 2009, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen, Annette Hennings, an Nadine Freund, 17.04.2009.
156 | Theanolte Bähnisch
hergehenden ‚sittlichen Verrohung‘252, zum anderen in der Interalliierten Ordonnanz Nr. 83, auf deren Grundlage nicht mehr nur die Kölner Polizei, sondern auch die britische Militärbehörde, unter deren Aufsicht das Gebiet stand, Frauen aufgriff. Das besonders Brisante an der Ordonnanz, welche die britischen Besatzer vor allem verabschiedet hatten, um die eigenen Truppen vor Geschlechtskrankheiten zu schützen, war, daß Frauen und Mädchen schon beim bloßen ‚Verdacht auf Umhertreiben‘ aufgegriffen und in eine Korrektionsanstalt eingewiesen werden konnten. Die Anstalt Brauweiler war von der Militärbehörde angewiesen worden, dauernd Plätze und Aufsichtspersonal für 200 Personen bereit zu halten.253 Das ‚Frauenarbeitshaus Freimersdorf‘, welches der Anstalt angegliedert war, wurde zu diesem Zweck 1921 von der Militärbehörde beschlagnahmt. Zu Beginn der 1920er Jahre intensivierte die Stadt Köln damit zunächst einmal ihre Stellung als Zubringer ‚sittlich verrohter Frauen‘ und ‚gefallener Mädchen‘ nach Brauweiler, zumal die Kölner Sittenpolizei, wohin Nolte sich hatte abordnen lassen, im Zuge der Ordonnanz ebenfalls ihr Vorgehen gegen (vermeintlich) auffällige Frauen und Mädchen verschärft hatte. 1924 setzte jedoch eine Kehrtwende ein: Nachdem Kölner Frauen der Vorsitzenden der International Alliance of Women (IAW), Mrs. Corbett-Ashby, über die dort herrschenden sozialen wie polizeilichen Mißstände berichtet hatten, wandte sich diese an die britische Regierung mit dem Vorschlag, eine weibliche Polizei in Köln einzurichten. Das britische Kriegsministerium entsandte daraufhin mehrfach die Leiterin des ‚Women‘s Auxiliary Service‘ der Metropolitan Police in London, Mary S. Allen, nach Köln. Diese vermittelte schließlich die Einstellung von Frauen in den Exekutivdienst254, eine Maßnahme, welche die Strafeinweisungen von Kölner Frauen nach Brauweiler stark eindämmen sollte. Denn, so hatten Mitarbeiterinnen der Militärbehörde festgestellt: die aufgegriffenen und nach Brauweiler eingewiesenen Mädchen und Frauen fielen den Behörden oft schon kurz nach ihrer Entlassung erneut in die Hände. Das anfängliche Verfahren der Militärbehörde war also nicht nur fruchtlosgewesen, sondern es schien die Lage sogar verschlimmert zu haben. Die in Anlehnung an den Londoner Polizeihilfsdienst zur Abhilfe eingesetzte ‚Kölner Frauenwohlfahrtspolizei‘ wurde als dreigliedriges System255 etabliert: Die weibliche Polizei für den Exekutivdienst (Ebene I) bestand aus sechs britischen sowie drei deutschen Polizistin-nen. Ebene II bildeten die Polizeifürsorgerinnen, denen die Aufgegriffenen von der Exekutive zugeführt werden sollten. Als Ebene III fungierte das Schutzheim, in dem die eingewiesenen Frauen vorläufig ‚verwahrt‘ wurden. Die Leitung der Frauenwohlfahrtspolizei wurde der Fürsorgerin Josefine Erkens
252 In diesem Sinne vgl.: Weber, Marianne: Die besonderen Kulturaufgaben der Frau, in: dies. (Hrsg.): Frauenfragen und Frauengedanken, Tübingen 1919, S. 238–261. 253 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum Brauweiler – Archiv des Landschaftsverbandes, Nr. 8217, Der Landeshauptmann der Rheinprovinz an die Direktion der Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler, 02.02.1924. 254 Vgl.: Nienhaus: Sittlichkeit, S. 250. 255 Dazu vgl.: Barck: Ziele, S. 26. „Erfassung, Unterbringung und erste Betreuung einschließlich ärztlicher Untersuchung“ lautet dazu die zusammenfassende Formulierung bei Wieking: Kriminalpolizei, S. 21.
Sozialisation | 157
übertragen.256 Sie sollte, dem Wunsch des Leiters der Polizeiabteilung im Innenministerium und späteren Vertrauten des Ehepaars Bähnisch, Willy Abegg (DDP), folgend, 1926 die erste examinierte Kriminalpolizistin in Preußen werden. Aufgrund der speziellen Lage vor Ort, die aus dem Besatzungstatus Kölns resultierte, wurde die deutsch-britische Frauenpolizei nicht in den Polizeiapparat eingegliedert, sondern unterstand direkt dem Kölner Regierungspräsidenten. Zu den Einsatzgebieten der Frauenwohlfahrtspolizei gehörten neben der Prostitution auch Fälle von Kindesmißhandlungen sowie die Jugend- und Gefährdeten-, Gefangenen- und Haftentlassenenfürsorge. In Einzelfällen konnten auswärtige Polizeiverwaltungen und Staatsanwaltschaften die Kölner Frauenwohlfahrtspolizei zu sich rufen, damit sie Vernehmungen durchführten. Dabei beschränkten sich, wie der Münchner Ministerialrat Lothar Barck schrieb, die Fälle meist auf solche Straftaten, „in die Kinder, Jugendliche und Frauen als Geschlechtswesen verwickelt waren“257. Der Charakter dieser Sittlichkeitsdelikte gebe der Beamtin „kraft ihrer weiblichen Einfühlung in die Sprache des Kindes, des Jugendlichen, der Frau die Möglichkeit stärker als der Mann in den Tatbestand […] einzudringen und somit der Wahrheitsfindung zu dienen“. So charakterisierte Barck die Vorzüge weiblicher Polizistinnen gegenüber den männlichen ganz auf der Linie des BDF, in dem er erklärtermaßen „die deutsche Frauenschaft“ vertreten sah.258 Dem Einsatz von Frauen in und für die Polizei, stellte Barck, nachdem das Kölner Beispiel Schule gemacht hatte und ähnliche Modelle einige Jahre lang erprobt worden waren, ein gutes Zeugnis aus und subsumierte ihn dabei unter die allgemeinen Ziele und Erfolge der Polizeiverwaltungsreform: „Vorbeugen und verhüten ist besser als Strafen, dieser Grundsatz muß insbesondere für die weibliche Polizei gelten. […] Im Ganzen betrachtet ist zweifellos, daß auch in Deutschland die weibliche Polizei in ihrer bisherigen kurzen Tätigkeit den modernen Polizeicharakter besonders betont hat. Wir wollen aber nicht dabei stehen bleiben, sondern für die gesamte Polizei auch in Deutschland die Anerkennung erreichen, daß alle Polizeiorgane Helfer und Schützer der Allgemeinheit, auch der Jugendlichen und Frauen und dieser als der Schwachen besonders sind.“259 Daß das Kölner Vorgehen von Erfolg gekrönt war, zeigte sich daran, daß das Arbeitshaus Freimersdorf parallel zum Abzug der britischen Truppen im Dezember 1925 geschlossen werden konnte.260 Seine Belegungszahlen waren seit der Einführung der Frauenwohlfahrtspolizei ständig gesun-
256 Erkens hielt ihre in Köln gemachten Erfahrungen schriftlich fest. Vgl.: Erkens, Josephine (Hrsg.): Weibliche Polizei. Ihr Wesen, ihre Ziele und Arbeitsformen als Ausdruck eines neuen Wollens auf dem Gebiete der Polizei, Lübeck 1925. Ursula Nienhaus widmet sich Erkens Schicksal, das schließlich mit einem Doppelselbstmord in der Spree endete, im Rahmen einer Studie. Vgl.: Nienhaus: Erkens. 257 Barck: Ziele, S. 48. 258 Barck: Weibliche Polizei in Deutschland, zitiert nach Barck: Ziele, S. 49. 259 Barck: Ziele und Aufgaben der weiblichen Polizei, S. 86–88. 260 Zum Frauenarbeitshaus vgl.: Daners: Brauweiler, S. 114–118.
158 | Theanolte Bähnisch
ken.261 Die Frauenwohlfahrtspolizei selbst war bereits ein halbes Jahr vorher, am 01.05.1925 aus politischen Gründen und aus Geldmangel eingestellt und ihr Schutzheim aufgelöst worden.262 2.2.3.5 Ziele der Frauenbewegung und der staatlichen Reformpolitik in der Synthese Als die Räumung Kölns am 31.01.1926 abgeschlossen war, befand sich Dorothea Nolte mitten in den Prüfungen und stand damit kurz vor ihrer Tätigkeit als Assessorin im Ber-liner Polizeipräsidium. Das Thema ‚weibliche Polizei‘ ließ sie damit nicht hinter sich, denn das ‚Modell Köln‘, welches sie hatte begutachten können, war nur der Auftakt zu einem immer weiter verstärkten Einsatz von Frauen in der Polizei der Weimarer Republik. Zum Ende der Republik waren immerhin 161 Kriminalpolizistinnen, verteilt auf mehrere Großstädte, tätig. Ursula Nienhaus zufolge hatte die Frauenwohlfahrtspolizei mit ihrer Arbeit an das von der bürgerlichen Frauenbewegung vertretene Konzept der ‚organisierten Mütterlichkeit‘263 angeknüpft. Ebenso entscheidend für die weitere Entwicklung ist jedoch, daß das Kölner Projekt auch im Einklang mit den Ideen der großen Koalition Preußens stand: Die Ziele der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland gingen Hand in Hand mit den Interessen ho-
261 Mit der Aufhebung der sittenpolizeilichen Kontrolle von Prostituierten 1927 sank die Zahl der nach Brauweiler eingewiesenen Prostituierten von 179 im Jahr 1927 auf fünf zu Beginn des Jahres 1932. Vgl.: Daners: Ab nach Brauweiler, S. 106. 262 Vgl.: Nienhaus: Sittlichkeit, S. 251. 263 Irene Stoehr vertritt die Position, daß es der bürgerlichen Frauenbewegung mit dem Begriff der ‚organisierten Mütterlichkeit‘ gelang, schon lange gehegte Vorstellungen von ‚Weiblichkeit‘ und ‚Mütterlichkeit‘ offensiv zu wenden und damit zu einer Politisierung verschiedener Lebensbereiche von Frauen beizutragen. Daß die Frauen in ihrer Rhetorik lediglich einen verstärkten Einfluß im Kulturbereich forderten, bewertet Stoehr als nur vordergründig. Aus der Rhetorik, so Stoehr, spreche der Versuch, der Zuschreibung ‚weiblicher Räume‘ durch Männer eine Absage zu erteilen und selbst Bereiche zu definieren, in denen Frauen kraft ihrer weiblichen Eigenarten an der Entwicklung und den Privilegien des kulturellen Lebens teilhaben können. Eine geschlechtsspezifische Arbeitsverteilung sei für die bürgerliche Frauenbewegung nicht mit einer Ungleichverteilung von Macht zwischen den Geschlechtern gleichgesetzt gewesen. Damit differierte die Haltung der in der bürgerlichen Frauenbewegung organisierten Frauen von der ihrer sozialistischen und radikalfeministischen Mitstreiterinnen. Die Wiederherstellung einer ‚Frauenöffentlichkeit‘ in Beruf und Politik, zu der in der Logik der bürgerlichen Frauenbewegung auch die Hoheit über die Mädchenbildung gehörte, sei das erklärte Ziel des Konzepts unter dem Leitbegriff ‚organisierte Mütterlichkeit‘ gewesen. Vgl. dazu: Stoehr, Irene: „Organisierte Mütterlichkeit“. Zur Politik der deutschen Frauenbewegung um 1900, in: Hausen, Karin (Hrsg.): Frauen suchen ihre Geschichte. Historische Studien zum 19. und 20. Jahrhundert, München 1983, S. 221–249. Zur Internationalen Bewegung vgl. als zeitgenössisches Dokument: Owings, Chloe: Women Police. A Study of the Development and Status of Women Police Movement, with a preface by Lieutenant Mina C. van Winkle, New York 1925.
Sozialisation | 159
her, vor allem preußischer Staatsbeamter, staatliche Reformen umzusetzen. Daß die bürgerliche Frauenbewegung ihre Befähigung, staatliche Politik zu beeinflussen und auch ihr Anrecht, entsprechend Einfluß zu nehmen, aus den Leistungen der Frauenbewegung im Krieg ableitete264, schien auf offene Ohren insbesondere bei Willy Abegg gestoßen zu sein. Dem ‚primus inter pares‘ in der Polizeiverwaltungsreform war von Seiten des Innenministeriums eine möglichst schnelle, effektive und kostengünstige Reform der preußischen Polizei aufgetragen worden. Als Regierungsrat war er zunächst von 1912 bis 1919 im Berliner Polizeipräsidium tätig gewesen, seit 1923 leitete er als Ministerialdirektor die Polizeiabteilung des preußischen Innenministeriums. 1926 wurde er zum ständigen Vertreter von Innenminister Carl Severing ernannt. Seinen Posten als Leiter der Polizeiabteilung übernahm der von Nolte in ihrem Diktat 1972 gleich zweimal erwähnte ehemalige Landrat von Recklinghausen, Erich Klausener. Daß Abegg im Zuge seiner Arbeit Marie Elisabeth (Else) Lüders und andere ehemalige Mitarbeiterinnen des preußischen Kriegsamtes, die in der bürgerlichen Frauenbewegung organisiert waren, kennenlernte, liegt auf der Hand. Dies hing nicht zuletzt damit zusammen, daß die Demobilmachung des preußischen Heeres und die Reform der Polizei – vor allem über die Person Albert Grzesinskis, der zunächst Demobilisierungskommissar im Kriegsministerium, später Polizeipräsident von Berlin und schließlich Innenminister war – ineinander über gingen. Außerdem waren Abegg, Lüders und Agnes von Zahn-Harnack, aber auch Lüders’ Kontrahentin Gertrud Bäumer in derselben Partei, der DDP, organisiert. Eine genauere Analyse der Beziehungen prominenter liberaler Frauenrechtlerinnen und führender Persönlichkeiten in der preußischen Polizeiverwaltungsreform steht noch aus. Ursula Nienhaus hat mit ihrer Arbeit über Josephine Erkens wichtige Vorarbeiten in dieser Hinsicht geleistet.265 Fest steht: Wilhelm Abegg bediente sich der Expertise und der praktischen Erfahrungen von Vorstreiterinnen im BDF gern, ebenso wie seine Mitstreiter, die Sozialdemokraten Carl Severing und Albert Grzesinski. Voller Interesse für das in Köln erprobte Modell versuchte Abegg die Kriminalpolizistin Erkens, die er zu seinem persönlichen Star erklärt hatte, dazu zu bewegen, in Berlin eine vergleichbare Polizei aufzubauen. Die Funktion und Bezeichnung der von Erkens geleiteten und nach dem Vorbild des Londoner ‚Women‘s Auxiliary Service‘ aufgebauten Kölner Frauenwohlfahrtspolizei stand mit der Idee einer Polizei im Dienst des Volkes, wie sie Abegg, Grzesinski und Severing verwirklichen wollten, absolut im Einklang. Nicht als Bedrücker, sondern als „Freund, Helfer und Kamerad der Bevölkerung“266 sollte die neue preußische Polizei wahrgenommen werden. Ähnlichkeiten zum heute gebräuchlichen Slogan ‚Die Polizei, Dein Freund und Helfer‘ sind deutlich. Vor dem Hintergrund der Annahme einer starken Dualität der Geschlechter und der Überzeugung, daß Frauen sich eher von Frauen befragen, helfen und beraten lassen würden,
264 Vgl.: Frevert, Ute: Frauen-Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und neuer Weiblichkeit, Frankfurt a. M. 1986, S. 146–162. 265 Vgl.: Nienhaus: Führungsposition. 266 Abegg, Wilhelm: Vorträge der ersten Polizeiwirtschaftlichen Woche (27.10.–1.11.1924), in: Kursus Hefte der Verwaltungs-Akademie Berlin 1925, S. 15, zitiert in Barck: Ziele, S. 13.
160 | Theanolte Bähnisch
waren die Reformer um Abegg und Grzesinski an einer verstärkten Indienstnahme von Frauen für die Polizei in Preußen sehr interessiert. Josefine Erkens zog es allerdings vor, nach Hamburg zu gehen, denn auch dort bestand ein Interesse am Einsatz von Frauen in der Polizei.267 Ihr Wissen über die gesellschaftliche Verfaßtheit Deutschlands sowie über die im Land bereits etablierten Fürsorgestrukturen qualifizierte wiederum die in der bürgerlichen Frauenbewegung organisierten Frauen dafür, sich bei der Anpassung im Ausland erprobter Konzepte an die – vielleicht vermeintlichen – Erfordernisse im Deutschen Reich im Zuge der Verwaltungsreform einzubringen. Kontakte, welche die deutsche Frauenbewegung, beispielsweise über die Integration des BDF in den ICW, pflegte, dürften dabei hilfreich gewesen sein. Auch die Haltung der bürgerlichen Frauenbewegung zur Prostitution bildete zu jener Zeit eine Schnittmenge mit den Ideen der Sozialdemokraten und der Koalitionspartner aus DDP und Zentrum. Im Zuge der Bemühungen, einen sozialen Rechtstaat aufzubauen, war die SPD für die Wahrung der Rechte aller Bürger ohne Unterschied des sozialen Status und des Geschlechts eingetreten und hatte in diesem Zusammenhang auch die Prostitutionsfrage zum Thema im Reichstag gemacht. Insbesondere das Bordellwesen war Anlaß für die SPD gewesen, die Ursachen von Prostitution zu thematisieren und diese nicht als ‚Delikt‘ den Frauen, die sie ausübten zum Vorwurf zu machen, sondern die Prostituierten zu Opfern ihres sozialen Milieus zu erklären und ihre Ausbeutung durch Bordellbetreiber wie Zuhälter anzuprangern. 268 Zwar erklärte die Partei in ihren Verlautbarungen das Thema Prostitution, wie die Frauenfrage insgesamt, zum ‚Nebenwiderspruch‘ des Klassenkampfes. Im Streben nach der Abschaffung der Mißstände war sie sich mit den Vertreterinnen der Frauenbewegung jedoch einig. Einige Abgeordnete, wie die bereits erwähnte Agnes Neuhaus, setzten sich sowohl über ihr politisches Mandat als auch über die Frauenbewegung für das Wohl von Prostituierten ein. Für die katholische Agnes Neuhaus (Zentrum, KDFB) heiligte das gemeinsam angestrebte Ziel jedoch nicht die Mittel, welche die Sozialdemokraten einsetzen wollten: Einer Entkriminalisierung der Prostitution und mit ihr das Ende der Kasernierung sowie der Arbeitshausunterbringung für Prostituierte, stand Neuhaus skeptisch gegenüber.269 Die Position der bereits erwähnten Else Lüders war näher an der der SPD. Wie die Sozialdemokratin Luise Schroeder trat sie für eine Veränderung der Rechtslage ein, wie sie die Abolitionistinnen forderten. Ebenso wie verschiedene Ansichten über den richtigen Weg zur Abschaffung der Prostitution existierten, kursierten unterschiedliche Meinungen über eine sinnvolle Art der Verwendung von Frauen bei der Polizei. Anna Mayer und Helene Weber, Regierungsrätinnen im preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt, sowie Gertrud Bäumer, Regierungsrätin im Reichsinnenministerium, die alle in der bürgerlichen Frauenbewegung engagiert waren, vertraten offensiv die Meinung, daß Frauen im Staatsdienst in erster Linie als Vertrauenspersonen gegenüber der Bevölkerung auf-
267 Vgl.: Nienhaus: Erkens, S. 35. 268 Vgl.: Willing: Bewahrungsgesetz, S. 81. 269 Vgl.: Ayaß: Rezension zu Willing: Bewahrungsgesetz.
Sozialisation | 161
treten sollten und deshalb von der Festnahme und vom Verhör von Verbrechern ausgeschlossen werden müßten. Eine Einstellung weiblicher Beamter in den Polizeidienst sei nur dann wertvoll, wenn sie auf der „besonderen Eignung der Frau und eine ihrer Wesensart entsprechende und von der Bevölkerung als wesengemäß empfundene Betätigung“ aufbaue, verkündete der BDF, dem alle drei genannten Frauen angehörten, in seinen ‚Richtlinien für die Verwendung von Frauen als Polizeibeamte‘.270 Hier mag man sich an die Skrupel Dorothea Noltes gegenüber einer Karriere im Strafrechtswesen erinnert fühlen: Vertrauen, Hilfsbereitschaft und Mildtätigkeit waren Komponenten des Konzepts der ‚organisierten Mütterlichkeit‘, auf dessen Basis die Frauenbewegung auf einen verstärkten Einfluß von Frauen im öffentlichen Leben drängte. Dieser Logik folgend sollte der Einsatz von Frauen keinesfalls auf Kosten der Preisgabe ihrer ‚Weiblichkeit‘ erfolgen. In den auf den Kölner Versuch folgenden Jahren wurden verschiedene Modelle einer möglichen Verwendung von Frauen im polizeilichen Kontext erdacht und einige davon in die Praxis umgesetzt. Während Experten wie Lothar Barck Frauen in der Sittenpolizei verortet und ihnen polizeiliche Befugnissen übertragen wissen wollten271, waren andere der Meinung, daß Frauen nur als Fürsorgerinnen bei der Polizei beschäftigt werden sollten. Als schärfste Kritiker einer Verwendung von Frauen bei der Polizei traten der konservative Schrader-Verband als Berufsverband preußischer Polizeibeamter sowie der Regierungsrat Walter Antz, Mitarbeiter der Polizeidirektion München, hervor. In der Gruppe von Spezialisten, die für eine Aufgabenteilung zwischen einer von Männern dominierten Sittenpolizei und einer wie auch immer gearteten weiblichen Polizei beziehungsweise einer mit der Polizei kooperierenden Fürsorge eintraten, gab es wiederum verschiedene Positionen dazu, wie die Aufgaben von Frauen und Männern, beziehungsweise der Polizei und der Fürsorge voneinander abzugrenzen seien.272 Beispielsweise stellte sich die Frage, ob Frauen auch Männer vernehmen sollten, oder ob
270 Wieking: Kriminalpolizei, S. 145. Josefine Erkens versuchte die deutsche Zurückhaltung, die sie selbst nicht teilte, mit der Wahrnehmung der deutschen Polizei als „auferlegte Ordnungsmacht“ durch die deutsche Frauenbewegung zu erklären. In Großbritannien und den USA hätten dagegen „demokratische Ideengänge die Polizei als ein von der Gesellschaft bzw. vom Volke gewolltes Wohlfahrts- und Schutzorgan“ geprägt, was zu einer anderen Einstellung der Frauenbewegung in den entsprechenden Ländern gegenüber der Polizei führe. Erkens: Polizei, S. 20, zitiert nach Nienhaus: Sittlichkeit, S. 249. 271 Lothar Barck schreibt als erklärter Befürworter dazu: „Aus den Dienstaufgaben der weiblichen Polizei leitet sich ihre Zwangsgewalt ab […] Es ist selbstverständlich, daß den weiblichen Polizeibeamtinnen bei strafbaren Handlungen, die durch die Strafprozeßordnung eingeräumte Befugnis der vorläufigen Festnahme usw. zusteht.“ Barck: Ziele, S. 55. 272 Auf einer vom BDF angeregten Konferenz mit Vertretern des Innenministeriums sowie des Ministeriums für Volkswohlfahrt wurden die Vorteile einer Eingliederung der Beamtinnen in die Dienststellen der männlichen Polizei befürwortet, aber die ‚Fachgruppe Gefährdetenfürsorge‘ verwehrte sich gegen eine solche Verwendung von Frauen in den Dienststellen beispielsweise als Polizei-Gehilfinnen, welche auch detektiv- und andere Ermittlungsarbeiten erledigen sollten. In einigen Präsidien waren Frauen zu solchen Zwecken bereits angestellt worden. Vgl.: Wieking: Kriminalpolizei, S. 145.
162 | Theanolte Bähnisch
dies den männlichen Polizisten vorbehalten bleiben solle273. Daneben wurde diskutiert, ob weibliche Polizistinnen uniformiert und eventuell sogar bewaffnet sein sollten, sowie darüber, ob die weibliche Polizei einem gesonderten Frauenkommissariat zu unterstellen sei – wie es der BDF forderte. Den unterschiedlichen Vorstellungen über den Einsatz von Frauen in der Polizei entsprechend, variierten die Bezeichnungen des weiblichen Personals in den theoretischen Entwürfen und späteren Erlassen und ihre Verortung bei den Polizeipräsidien, städtischen Ämtern oder privaten Trägern.274 Ein einheitliches System etablierte sich nicht. In Preußen sollten nach den Plänen von Innenmister Severing und dem Minister für Volkswohlfahrt, Heinrich Hirtsiefer (Zentrum) sowohl Gefährdetenpolizistinnen275 als auch weibliche Kriminalpolizistinnen276 beschäftigt werden. Die eigentli-
273 Die Vernehmung von Frauen und Kindern ausschließlich durch Frauen und von Männern ausschließlich durch Männer sei umständlich, kritisiert Antz. Das Risiko der bloßen Anwesenheit von Frauen bei der Vernehmung von Männern könne jedoch nicht eingegangen werden, denn „in der Achtung des Mannes vor der sexuellen Reinheit der Frauen gegenüber dem männlichen Geschlechtsdrang beruht eine wesentliche Grundlage unserer Zivilisation […] die Männer werden gezwungen, auf das Schamgefühl der Frau keine Rücksicht zu nehmen“. Dadurch könne gerade jenes Gefühl geschädigt werden, durch dessen Stärkung allein den Sittlichkeitsverbrechen entgegengetreten werden könne. Schon der Gedanke, daß eine Frau in den „Schmutz der menschlichen Sexualverwirrungen herabsteige“, sei peinlich, stellte Antz fest. Walter Antz zitiert nach Barck: Ziele und Aufgaben der weiblichen Polizei, S. 50/51. 274 Für eine völlige behördliche Trennung von Polizei, städtischen Ämtern und privaten Einrichtungen bei gleichzeitig engster praktischer Zusammenarbeit sprach sich beispielsweise der Essener Polizeipräsident Melcher aus. Vgl.: Wieking: Kriminalpolizei, S. 42. 275 Die Aufgaben der Gefährdetenpolizei beliefen sich auf die Verhütung des Bettelns und die Überwachung des Straßenhandels durch Minderjährige sowie deren Schutz vor körperlicher und sittlicher Verwahrlosung, die Verhütung des Begehens strafbarer Handlungen durch Minderjährige, die Mitwirkung bei der Durchführung des Kinderschutzgesetzes sowie des (zum Zeitpunkt von Noltes Referendariates noch nicht bestehenden) Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten sowie die Mitwirkung bei der Überwachung von Bühnen und Gastwirtschaften hinsichtlich des Jugendschutzes und der weiblichen und jugendlichen Angestellten. Die Aufgaben der Kriminalpolizei waren entsprechend der Bezeichnung solche, die sich in Verbindung mit strafbaren Handlungen ergaben. Darunter fielen die Bearbeitung der Anzeichen von strafbaren Handlungen an Kindern, männlichen und weiblichen Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr, die Vernehmung von Kindern und weiblichen Jugendlichen als Verletzte oder Zeugen, vor allem in Fällen, in denen diese Personen „als Geschlechtswesen“ beteiligt sind, die Vernehmung von beschuldigten erwachsenen weiblichen Personen, vor allem in Sexualdelikten (ausgenommen bei ‚gewerbsmäßigen Vergehen‘), Ermittlungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse von Jugendlichen und erwachsenen weiblichen Personen, „wo schonende und unauffällige Ermittlungen geboten erscheinen“. Transport und Vorführung von minderjährigen weiblichen Personen vor Gerichten gehörten ebenfalls zum Aufga-
Sozialisation | 163
che Fürsorge sollte unabhängig von der Polizei arbeiten.277 Möglich ist, daß die Berliner Polizeiabteilung Dorothea Noltes Arbeit in ihre Planungen mit einbezogen hatte. Die Gutachter der Staatsexamensarbeit Noltes hatten jedenfalls dazu geraten, die Arbeit im Ministerium entsprechend zu verwenden.278 Mit der ursprünglich Josefine Erkens zugedachten Aufgabe, eine weibliche Polizei in Berlin aufzubauen, wurde schließlich Friedrike Wieking betraut.279 Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Nolte und Wieking sich kennenlernten, während Nolte als Assessorin Berliner im Polizeipräsidium arbeitete. 2.2.3.6 Die Staatsexamensarbeit: Noltes Position zwischen Tradition und Reform Von ihren praktischen Studien in Köln und Brauweiler ausgehend wollte die Referendarin in ihrer zweiten Staatsexamensarbeit die Frage beantworten, inwiefern die Sittenpolizei dazu geeignet sei, die ‚gewerbsmäßige Unzucht‘ einzudämmen. Sie stellte zunächst den bisherigen Umgang des Staates mit der Prostitution, insbesondere über die Sittenpolizei als ausführendes Organ vor, bevor sie auf Kritik und Reformvorschläge aus der einschlägigen Literatur sowie aus Redebeiträgen von Experten einging. Dazu wolle sie, so schreibt sie in ihrer Einleitung, das staatliche Reglementierungssystem einer „kritische[n] Würdigung“280 unterziehen. Ihren Fokus richtete sie auf die Teilfrage, wie die Sittenpolizei dazu beitragen könne, den aus der „Gewerbsunzucht“281 resultierenden „Schaden am Gesundheitskörper des Volkes“282 zu minimieren. Daß sie den Untersuchungsgegenstand entsprechend eingrenzen wollte, hatte sie in der Einleitung nicht erwähnt, was einen ihrer Gutachter dazu veranlaßte, zu schreiben, daß sie von ihrer ursprünglichen Frage abgewichen sei. Vielleicht war ihr erst während der Niederschrift, im Zuge der Lektüre
276
277
278 279 280 281 282
benbereich der Kriminalpolizistinnen. Wegweiser durch die Polizei, 2. Aufl., 1928, zitiert nach Barck: Ziele, S. 54. Barck merkt an, daß die weibliche Polizei die Erfassungsarbeit in Preußen erst allmählich aufgenommen habe, daß im Jahr 1925 aber immerhin 25 Beamtinnen in Berlin (gegenüber beispielsweise fünf in Köln und elf in Frankfurt a. M.) im Dienst waren. Vgl.: Barck: Ziele und Aufgaben der weiblichen Polizei, S. 56. Der Preußische Minister des Innern, Berlin den 22.02.1926, AZ: II C II 19 Nr. 230/VII/25, abgedruckt in: Wieking: Kriminalpolize, S. 148–151 sowie Rundschreiben des preußischen Ministers für Volkswohlfahrt, Berlin am 24.07.1924, in: ebd., S. 139– 141. Vgl.: GStA PK, I. HA, Rep. 125, Nr. 3527, Gutachten über die Prüfungsarbeit der Regierungsreferendarin Nolte von Regierungsrat Dr. Fraeser Berlin, 20.05.1926. Vgl.: Wieking: Kriminalpolizei. BArch, R 115, Nr. 519 Sittenpolizei und Prostitution. Prüfungsarbeit vorgelegt von Dorothea Nolte, Regierungsreferendar, Inhaltsverzeichnis, o. S. GStA PK, I. HA, Rep. 125, Nr. 3527, Gutachten über die Prüfungsarbeit der Regierungsreferendarin Nolte, Gutachter: Mertens, Münster, 10.04.1926. BArch, R 115, Nr. 519 Sittenpolizei und Prostitution. Prüfungsarbeit vorgelegt von Dorothea Nolte, Regierungsreferendar, S. 105.
164 | Theanolte Bähnisch
von größtenteils verwaltungs- und polizeiwissenschaftlicher Literatur, aufgefallen, daß das Interesse der Polizeilichen Verwaltung an der Prostitution vor allem darin bestand, die Bevölkerung vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Denkbar ist auch, daß Dorothea Nolte, die sich zur Sittenpolizei im Kölner Polizeipräsidium – und eben nicht zur Frauenwohlfahrtspolizei im Regierungspräsidium – hatte abordnen lassen, eher von der Haltung der männlichen Beamten bei der Sitte, als von der der weiblichen Polizei beim Regierungspräsidium beeinflußt worden war. Letztere sah ihre primäre Aufgabe, zumal sie unter dem Einfluß der Frauenbewegung stand – eher in der Fürsorge für die ‚gefallenen Frauen und Mädchen‘. Nolte beschränkte sich jedoch nicht auf Stellungnahmen aus der Verwaltungswissenschaft zu ihrem Thema, sondern integrierte – den aktuellen Debatten entsprechend – soziologische, psychologische und sozialfürsorgerische Ansätze in ihre Abhandlung. Ihre Arbeit weist damit nicht nur einen interdisziplinären Ansatz auf, sondern wird auch dem Umstand gerecht, daß das Thema Prostitution, in größere Zusammenhänge eingebettet, politisch virulent war. Schließlich wurde es von liberalen und sozialdemokratischen Reformern als ein Teilthema der angestrebten, in Teilaspekten bereits auf den Weg gebrachten Staats- und Gesellschaftsreform angesehen. Insbesondere indem Nolte in ihren Ausführungen auch eine Brücke zum aktuellen Thema ‚Wohnungsreform‘ schlug, zeigte sie, daß ihr die Zusammenhänge zwischen der von ihr behandelten Teilfrage und der politischen Generallinie der sozialdemokratischen Partei und ihrer Kooperationspartner bewußt waren. Daß die ‚Wohnungsreform‘ nicht erst seit der Begründung der Republik, und nicht nur als Thema der SPD, auf die politische Agenda gerückt war, wird in der Argumentation Noltes deutlich. Ganz in der Manier der bürgerlichen Sozialreformer, einer Bewegung, die ihre Hochphase im Kaiserreich erlebte283, betonte die Referendarin nämlich vor allem den ‚Sittlichkeitsverfall‘, der aus den schlechten sozialen Verhältnissen resultiere und damit wiederum die vermeintlich gefährlichen Auswirkungen des Elends sozial schwacher auf die bürgerliche Gesellschaft. Sie stellte fest, es sei Aufgabe des Staates durch großzügige Wohnungsreformen284 und einer Besserung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse einen Wandel herbeizuführen. Darüber hinaus müsse die private wie öf-
283 Vgl.: Bericht des Deutschen Vereins für Wohnungsreform e. V.: Verein ReichsWohnungsgesetz, Frankfurt am Main für das zehnte Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1907, Frankfurt a. M., 1908. Der Experte für die Geschichte der sozialen Arbeit, Christoph Sachße, rechnet jenen Verein der bürgerlichen Sozialreform zu. Vgl.: Sachße: Siegmund-Schultze, S. 231. 284 BArch, R 115, Nr. 519, Sittenpolizei und Prostitution. Prüfungsarbeit vorgelegt von Dorothea Nolte, Regierungsreferendar, S. 125/126. Die Wohnungsreform war auch Thema der zweiten schriftlichen Klausur-Arbeit Noltes – was einiges Wissen über die sozialen und ökonomischen Verhältnisse im Staat voraussetzte, aber gleichzeitig vermutlich keine große Überraschung für die Examenskandidatin war. „Das Thema […] darf als zurzeit stark im Vordergrunde des allgemeinen Interesses stehend bezeichnet werden; es konnte daher füglich vorausgesetzt werden, daß sein Gegenstand jedem angehenden Verwaltungsbeamten wohl bekannt war“, schreibt der Gutachter Pauly am 02.06.1926 über die gestellte Klausur. BArch, R 115, Nr. 519.
Sozialisation | 165
fentliche Fürsorge den Einzelnen helfend zur Seite stehen. „Nur dadurch“, schlußfolgerte sie, „können viele Quellen versiegen, die später zu solchem antisozialen Verhalten führen, daß polizeiliches Eingreifen [!] zur letzten Notwendigkeit wird.“285 Aufgabe der Kirchen und Schulen sei es, teilte Nolte die Summe der Verantwortlichkeiten weiter auf, durch Erziehung sittliche Ideale und Halt zu geben und die weibliche Jugend auf ihre „Pflicht zur Teilnahme an der steten Neuschöpfung des Menschengeschlechtes und ihrer Verantwortung für das Sittlichkeitsniveau der ganzen Nation“ hinzuweisen. Die männliche Jugend solle dementsprechend zu einer „neuen Ehrfurcht vor der Frau als Vermittlerin und Trägerin neuen Lebens“ geleitet werden.286 Die Rolle der Polizei als eine der Kräfte, die die Prostitution als „soziale Erscheinung“ begrenzen helfen könne, definierte sie weitgehend klassisch. Sie befürwortete eine enge Zusammenarbeit von Fürsorge und Polizei in diesem Kontext.287 Unter Bezugnahme auf das Kölner Modell bewertete sie die Mitarbeit von Frauen in der Sittenpolizei selbst als „durchaus zweckmäßig“.288 Polizistinnen seien besonders geeignet für die Vernehmung Minderjähriger und erstmalig Aufgegriffener, argumentiert Nolte. Sie könnten Vernehmungen ohne Verletzung des weiblichen Schamgefühls vornehmen, wodurch sich – die von der Frauenbewegung gebrandmarkten – Unzuträglichkeiten des sittenpolizeilichen Vorgehens verhindern ließen. „Im Außendienst ist die weibliche Beamtin vorzüglich zu[r] unauffälligen Beobachtung der heimlichen Prostituierten im Strassenleben, an Bahnhöfen und in Lokalen geeignet“, hielt Nolte, die ganz offensichtlich davon überzeugt war, daß Frauen nicht als Bedrohung wahrgenommen werden könnten, fest. Außerdem glaubte sie an einen positiven Einfluß der Polizistinnen auf ihre offenbar ‚sittlich gefährdeten‘ Kollegen: Auf gemeinsamen Streifen mit den männlichen Sittenbeamten können sie durch ihre Anwesenheit verhindern, dass schamlose Belästigungen und dadurch sich ergebende sittliche Gefährdungen der männlichen Beamten erfolgen, wie es bekannterweise von raffinierten Dirnen vielfach geschieht.“289 Dem Modell der Kölner Frauenwohlfahrtspolizei, wollte Nolte, obwohl sie von einer Verwendung von Frauen im Polizeidienst überzeugt war, nicht folgen. Sie lehnte die organisatorische Trennung weiblicher Polizistinnen von ihren männlichen Kollegen, die in Köln vorgenommen war, ebenso ab, wie die Re-Integration der Fürsorge in den Polizeiapparat selbst. Schließlich sei die Fürsorge in den vorangegangenen Jahrzehnten bewußt aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizei ausge-gliedert worden, argumentierte sie.290 Nolte war vielmehr da-
285 BArch, R 115, Nr. 519, Sittenpolizei und Prostitution. Prüfungsarbeit vorgelegt von Dorothea Nolte, Regierungsreferendar, S. 127. 286 Ebd., S. 126. 287 In ihrer Argumentation bezieht sie sich explizit auf die mit Hilfe der britischen Besatzungsbehörden nach der Ordonnanz Nr. 85 im Jahr 1923 geschaffene FrauenWohlfahrtspolizei in Köln. Ebd., S. 121/122. 288 Ebd., S. 122. 289 Ebd., S. 122/123. 290 Ebd. Zu dem Modell vgl.: Nienhaus: Sittlichkeit; Dies.: Erkens sowie: Wieking: Kriminalpolizei und – zeitgenössisch – Barck: Ziele.
166 | Theanolte Bähnisch
von überzeugt, daß bisher männlichen Beamten vorbehaltene Kompetenzen der staatlichen Exekutive (auch) auf Frauen übertragen werden sollten. Ihre Haltung begründete sie damit, daß Polizistinnen die entsprechenden Spielräume aufgrund ihres Geschlechtes effektiver nutzen könnten. Mit ihrer Haltung positionierte sie sich zum Teil auf, zum Teil neben der Linie des BDF. Dieser vertrat die Meinung, daß Frauen gerade aufgrund der mit ihrem Geschlecht vermeintlich verbundenen Eigenschaften stärkeren Einfluß im öffentlichen Leben – auch über polizeiliche Befugnisse – nehmen sollten. Die Eingliederung von Frauen in die männlich dominierte Sittenpolizei hieß der BDF jedoch nicht gut. Er forderte eine Unterstellung weiblicher Polizisten unter ein rein weibliches Kommissariat. Daß die Prüfungskandidatin an der traditionellen Aufgabe der Polizei als Schutz- und Ordnungsmacht festhalten wollte, ist deutlich: Die von der Frauenbewegung – insbesondere von den Abolutionistinnen – geforderten Maßnahmen wollte sie nicht als Alternative zum reglementierenden Vorgehen der Sittenpolizei anerkennen. In Teilforderungen der Frauenbewegung sah sie jedoch sinnvolle Mittel zur Ergänzung und zur Prophylaxe von polizeilichem Handeln. Auf das Thema ‚Volkshygiene‘ fokussierend, argumentierte sie zwar gegen das Bordellwesen, aber für die Fortsetzung von Kasernierung sowie Zwangsuntersuchung und -behandlung von Prostituierten. Die Überführung aufgegriffener Mädchen in Erziehungsheime, auch in Anstalten wie Brauweiler, sah sie ebenfalls als eine sinnvolle Methode an. Daß sie sich für die Beibehaltung hergebrachter Methoden aussprach, zeugt von ihrem ungetrübten Grundvertrauen in die staatliche Ordnungsmacht: „Sicherlich bedeutet das [die geschlossene Fürsorge in Erziehungsheimen] einen scharfen Eingriff in die persönliche Freiheit, der eine besonders vorsichtige Handlungsweise der Polizei bedingt. Aber bei dem in langer praktischer Tätigkeit gewonnenen sicheren Blick der Sittenbeamten ist ein Vorkommen von Irrtümern kaum zu befürchten. Auf der anderen Seite aber ist der hierdurch im Kampfe gegen die heimliche Prostitution erreichbare Erfolg so bedeutend, dass kleinere Härten ausser Betracht bleiben müssen.“291 Ob sie der Meinung war, daß die ‚gefallenen‘ Mädchen in Brauweiler und in vergleichbaren Heimen besser aufgehoben seien als auf der Straße, oder ob sie fand, daß die Mädchen dort im Hinblick auf das gesundheitliche Wohl der Bevölkerung sicherer ‚verwahrt‘ wären, ist ihren Ausführungen nicht zu entnehmen. Mit ihren Äußerungen ging die Referendarin entschieden auf Distanz zu den Ideen der Abolutionistinnen – und damit auch zu prominenten bürgerlichen Politikerinnen und Frauenrechtlerinnen wie Marie-Elisabeth Lüders und Agnes von ZahnHarnack. Denn diese machten allein die gesellschaftlichen Zustände dafür verantwortlich, daß Frauen der Prostitution nachgingen. Deshalb kritisierten sie die Reglementierungspraktiken des Staats sowie die Ausbeutung der Frauen durch Freier und Zuhälter scharf. Dorothea Nolte wiederum äußerte, bezugnehmend auf eine Aussage
291 BArch, R 115, Nr. 519, Sittenpolizei und Prostitution. Prüfungsarbeit vorgelegt von Dorothea Nolte, Regierungsreferendar, S. 120.
Sozialisation | 167
der bereits erwähnten Zentrums-Abgeordneten Agnes Neuhaus von 1921292, die Befürchtung, durch die Aufhebung der Kasernierung könnten die Prostituierten dem Zugriff der Fürsorgerinnen entzogen werden. Das Reglementierungssystem beschrieb die Referendarin sowohl als das menschenwürdigste als auch als das praktischste Vorgehen in sicherheits- und gesundheitspolizeilicher Hinsicht.293: „Der von den Abolutionisten […] erhobene Vorwurf, durch die Reglementierung schaffe der Staat erst die Gelegenheit zur Unzucht und fördere diese in unmoralischer Weise, zeigt eine vollkommene Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse“ bezog Nolte Stellung. Die „höhere moralische Verpflichtung“ des Staates sah sie darin, „im Interesse seiner Bürger Dinge, die sich nicht verhindern lassen, wenigstens in ungefährlichere Bahnen zu lenken“.294 Was Josephine Butler als ein „gottloses Vorurteil“ verdammt hatte, schien für Nolte außer Frage zu stehen: Daß die Prostitution ein notwendiges Übel sei, bei dem der Freier „immerhin noch im Rahmen seines Trieblebens [agiert], während die sich prostituierende Frau aus diesem Rahmen herausfällt, indem sie um materiellen Vorteilswillen unter Abwesenheit sexueller Empfindungen ihr Weibtum preisgibt und sich dadurch selber zur Ware stempelt.“295 Daß Nolte von „erkrankten Kontrolldirnen“ sprach, welche jeweils für eine Zeit „aus dem Verkehr gezogen“ und damit „unschädlich“296 gemacht werden müßten, unterstreicht, daß sie die ‚gefallenen Frauen‘ mehr als Objekte, denn als Subjekte ansah. Wenn die Examenskandidatin als Vorteil der Kasernierung beschrieb, daß diese die „vollkommene[…] Abtrennung der Prostitution vom übrigen bürgerlichen Leben in seiner reinsten Form“297 zu verwirklichen helfe, dann schien daraus weniger die angehende Verwaltungsjuristin als die Bürgerin Dorothea Nolte zu sprechen. Die junge Frau, die sich mit Mitte zwanzig in ihrem ‚bürgerlichen Leben‘ gerade einrichtete, wollte sich zwar verwaltungsjuristisch mit dem Tabu-Thema Prostitution auseinandersetzten, aber im eigenen, privaten Alltag nicht mit Prostituierten in Kontakt kommen. Die ‚Dirne‘ blieb für Dorothea Nolte trotz ihres Aufenthaltes in Köln und Brauweiler offenbar ein unverständliches Wesen, welches in einer Welt lebt, die mit der ihren keine Berührungspunkte aufweist und aufweisen sollte, zu deren Verwaltung sie sich jedoch berufen fühlte. An dieser Stelle wird die – zweifellos durch die Aufgabenstellung begünstigte – Asymmetrie zwischen der Beobachterin und dem ‚Beobachtungsgegenstand‘, der die Arbeit durchzieht, am deutlichsten spürbar. Dorothea Noltes Argumentation, der von ihr aufgezeigte Weg zwischen dem Festhalten an der Verwaltung der Prostituierten durch den Staat einerseits und einer ‚sanften‘ Reform jener Politik durch die stärkere Einbeziehung von Polizistinnen in
292 Agnes Neuhaus hielt ihre Rede auf dem Bevölkerungspolitischen Kongreß in Köln, 17.– 21.05.1921. Möglich ist, daß Nolte, die zu dieser Zeit in der Region lebte, der Veranstaltung beigewohnt hatte. 293 BArch, R 115, Nr. 519, Sittenpolizei und Prostitution. Prüfungsarbeit vorgelegt von Dorothea Nolte, Regierungsreferendar, S. 114/115. 294 Ebd., S. 107. 295 Ebd., S. 102. 296 Ebd., S. 104. 297 Ebd., S. 114.
168 | Theanolte Bähnisch
der ‚Sitte‘ andererseits sowie ihre Haltung, daß Prostitution unvermeidbar sei und deshalb von der ‚bürgerlichen Welt‘ möglichst fern gehalten werden müsse, schien die Gutachter überzeugt zu haben. Die Kandidatin, deren Leistungen in der Referendarprüfung insgesamt mit ‚vollbefriedigend‘298 bewertet worden waren, wurde von beiden Gutachtern auch für ihre gut 100 Seiten starke Examens-Arbeit gelobt: „Ein großer Vorzug der Arbeit ist es, daß die Verfasserin bei aller Wärme des Gefühls und idealer Lebensauffassung nie den klaren Blick für die Realitäten verliert. Ich kenne kein Beispiel, daß sich eine Frau mit solcher Sachlichkeit und solchem Wirklichkeitssinn über das Gebiet der Prostitution verbreitet hat. […] Es würde im Interesse des Dienstes liegen, wenn sie [die schriftliche Arbeit] später dem Referat für Sittenpolizei [im preußischen Innenministerium] zur Benutzung zugänglich gemacht werden könnte“299, schrieb ein Gutachter. Das zweite Gutachten fiel ähnlich aus und unterstellte Nolte „großes soziologisches und psychologisches Verständnis einerseits und gleichzeitig auch […] einen bemerkenswert klaren Blick für das, was die Polizei als solche ihrem Wesen nach auf dem Gebiete […] zu leisten vermag“.300 Wenn auch die Bedeutung der Examens-Arbeit Noltes nicht überbewertet werden sollte, so ist doch festzuhalten, daß sie mit ihrem Thema ein hochaktuelles Diskussions- und Streitfeld im Verwaltungsrecht beschritten hatte, das nicht nur von Experten aus diesem Gebiet, sondern auch von Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung und anderen gesellschaftlichen Gruppen als diskussions- und reformwürdig eingestuft worden war. Daß sich die Referendarin 1925/26 Zeit zumindest theoretisch mit der Frauenbewegung auseinandergesetzt hatte, könnte ihre Entscheidung, sich Ende der 1920er Jahre bei den Soroptimistinnen und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der überparteilichen Frauenbewegung zu engagieren, begünstigt haben. Sie selbst stellte jedoch keine Verbindung zwischen den Zusammenhängen, zwischen denen 20 Jahre lagen, her. Ab 1945 orientierte sie sich im Zuge ihrer Auseinandersetzung mit der Rolle von Frauen in der Gesellschaft allerdings stärker an feministischen Ideen, vor allem aus dem Kreis des BDF, als 1925/26. Interessant ist dies nicht zuletzt, als sie sich 1946/46 in ähnlichen politischen Konstellationen wie zur Zeit ihres Aufenthaltes in Köln wiederfand: Auch 1945 übernahm eine britische Militärbehörde die Kontrolle der Verwaltung und der Polizei in Deutschland teilweise. Wie in den 1920er Jahren in Köln resultierte daraus in den 1940er Jahren in Hannover und schließlich in der gesamten britischen Besatzungszone eine enge Zusammenarbeit von deutschen und britischen Protagonistinnen der Frauenbewegung, die Bähnisch durch Besuche in Großbritannien und Empfänge in Hannover maßgeblich vorantrieb.
298 BArch, R 115, Nr. 4. [Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte, Prüfungsliste Nr. 2601–3728]. Nolte hat in der Liste die Register-Nr. 3475. Albrecht Bähnischs Prüfungsergebnisse finden sich in derselben Akte unter der Nummer 3479. Demnach schloß er die Prüfungen einen Monat nach Dorothea Nolte, am 03.07.1926, im Schnitt mit ‚befriedigend‘ ab. 299 GStA PK, I. HA, Rep. 125, Nr. 3527, Gutachten über die Prüfungsarbeit der Regierungsreferendarin Nolte, Gutachter: Regierungsrat Dr. Fraeser, Berlin, 20.05.1926. 300 GStA PK, I. HA, Rep. 125, Nr. 3527, Gutachten über die Prüfungsarbeit der Regierungsreferendarin Nolte, Gutachter: Mertens, Münster, 10.04.1926.
Sozialisation | 169
Nachdem sie 1946 mit Berichten der Gesundheitsbehörden und der Polizei im Gepäck nach Großbritannien reiste, war sie 1951 schließlich selbst berufen, die Geschicke der Bezirkspolizei zu leiten. Wieder wurde in diesem Kontext über den Einsatz von Polizistinnen diskutiert. Daß das Thema ‚Geschlechtskrankheiten‘ für Bähnisch auch in der Nachkriegszeit – nachdem sich um 1930 ihr Mann damit auseinandersetzte – wieder eine Rolle spielte, zeigt sich unter anderem in einem Zeitungsbericht, in dem die Gründe der Regierungspräsidentin, das Jugendflüchtlingslager Poggenhagen einzurichten, dargestellt werden.301 Daß Dorothea Bähnisch 1926 eine Anstellung im Polizeipräsidium der Hauptstadt erhielt, war vielleicht auch auf ihr Examensthema zurückzuführen. Schließlich hatte der Staatssekretär und Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, Willy Abegg, wie bereits erwähnt, Interesse an der Etablierung einer weiblichen Polizei geäußert. Dorothea Nolte mag ihm und anderen reformorientierten Kräften, da sie sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hatte, gerade recht gekommen sein. Unter Polizeipräsident Grzesinski, dem im Oktober 1926 Karl Friedrich Zörgiebel nachfolgte, wurden die ersten Frauen bei der Berliner Polizei eingestellt. Auch politisch hatte sich Nolte mit ihrer Arbeit für eine Tätigkeit bei einer so wichtigen Behörde qualifiziert. Schließlich paßte ihr Thema in die Politik der preußischen Koalition unter Führung der Sozialdemokraten,302 die mit ihren Koalitionspartnern eine politische Schnittmenge in der Überzeugung darin gefunden hatte, daß die Verbesserung der sozialen Lage der Armen zum Wohl aller Bürger geschehe. Nolte hatte sich mit ihrer Examensarbeit in diesen Diskurs eingeschrieben und sich sicherlich nicht zuletzt auch damit für den Dienst in der reformorientierten Verwaltung qualifiziert.
301 O. V. [‚P. H.‘]: Diese Frau paßt in kein Schubfach. Gespräch mit Frau Theanolte Bähnisch, Regierungspräsident von Hannover, in: Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung, 26.11.1949. Ihrem Zitat nach zu urteilen hatten nicht zuletzt finanzielle Erwägungen hinsichtlich der Mittel, die zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten aufgewendet werden müßten, wenn Menschen auf die ‚schiefe Bahn‘ gerieten, eine Rolle bei der Einrichtung des Lagers gespielt. 302 Zur Diskussion über die Rolle der SPD als Regierungs- und/oder Oppositionspartei in der Weimarer Republik vgl.: Schönhoven, Klaus: Reformismus und Radikalismus. Gespaltene Arbeiterbewegung im Weimarer Sozialstaat, München 1989, in Anlehnung daran vgl. auch: Grebing, Helga: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Von der Revolution 1848 bis ins 21. Jahrhundert, Berlin 2007, S. 78/79.
170 | Theanolte Bähnisch
2.3 BERUF, POLITIK UND NEUE FREUNDSCHAFTEN: DIE (ERSTEN) BERLINER JAHRE (1926–1930) 2.3.1 Berufseinstieg im Polizeipräsidium zwischen Politik, Verwaltung und Kultur 2.3.1.1 Kompetenzerweiterung, Modernisierung, Volksnähe: Aufgaben und Reformen der preußischen Polizei Im Anschluß an ihr Assessorexamen 1926303 reiste Dorothea Nolte erneut nach Berlin, diesmal, um dort eine Stelle als Beamtenanwärterin im Berliner Polizeipräsidium am ‚Alex‘ anzutreten. Berlin war zu dieser Zeit die drittgrößte Stadt der Welt. Als ein Pandämonium aus „Häusergewirr und Menschentrubel, Zeitungs- und Reklamegeschrei, unterirdisch brodelnde[m] Verbrechertum, Schlachthausdunst und Jazzrhythmen, Hurenwinkel[n] und Kaschemmenphilosophie, Zuhälterpack, Flittermoral und strahlende[m] Lichterglanz“304 beschrieb Alfred Döblin im bis heute wohl bedeutendsten deutschen Großstadtroman ‚Berlin Alexanderplatz‘ die Hauptstadt der Republik und des preußischen Staates. Die Stadt, die in den 1920er Jahren Kultur-, Politik-, Wirtschafts- und Informationszentrum Deutschlands war, wird in der kritischen Betrachtung Döblins gleichzeitig als Gegenspieler des schwachen Menschen gezeichnet. Den frisch aus dem Zuchthaus entlassenen Franz Biberkopf stürzt sie immer wieder aufs Neue ins Verbrechen und damit ins Verderben, sie spielt das Potential, über das sie als Hort der Armut und des Elends, der Lasterhaftigkeit und des Verbrechens verfügt, gegenüber dem strauchelnden Menschen voll aus. Immerhin: als Unterstützer von Biberkopfs erklärter Absicht, entgegen allen Versuchungen, welche die Metropole bietet, „anständig zu sein“, fand die ‚Gefangenenfürsorge‘ als eine der vielen Einrichtungen des Berliner Polizeipräsidiums Eingang in den Roman des Armenarztes Döblin. Die ‚Berliner Welten‘ – auf der einen Seite Bettlermetropole und verwahrloste Mietskasernenlandschaft, auf der anderen Seite Pressehochburg, Modezentrum und Hort mondänen Nachtlebens, drifteten im Lauf der 1920er Jahre, trotz der Entspannungen, die die Jahre 1924 bis 1929 mit sich brachten, immer weiter auseinander. Dorothea Nolte war als Mitarbeiterin des Polizeipräsidiums, das sie mit dem Titel ‚Regierungsrat‘ 1930 wieder verließ, auch mit der Verwaltung der Schattenseiten des großstädtischen Lebens beschäftigt. Wie die expandierende, brodelnde Großstadt den armen Biberkopf unablässig auf die Probe stellte, so forderte sie ihrer Polizei immer neue und immer größere Leistungen ab: Das erhöhte Verkehrsaufkommen in der Metropole durch Fuhrwerke und Automobile machte den Einsatz von Verkehrspoli-
303 Der Beginn der Anwärterzeit wurde auf den 05.06.1926 festgesetzt. GStA PK, I. HA, Rep. 184, Personalakte Nr. 54, Abschrift: Der Preußische Minister des Innern, Berlin, 23.06.1926. 304 Brant, Bastian: Art.: „Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf“, in: Kindlers Literaturlexikon, CD-Rom, 2000.
Sozialisation | 171
zisten notwendig. Die Einrichtungen des kulturellen Lebens wie Theater und Lichtspielhäuser sollten, im Interesse der allgemeinen ‚Sittlichkeit‘ und besonders des Jugendschutzes, zensorisch sowie hinsichtlich ihrer baulichen Sicherheit für die Besucher betreut werden. Auch die zum Teil stark heruntergekommenen Wohnhäuser der Berliner und Infrastruktureinrichtungen wie Schwimmbäder und Sportplätze bedurften einer bau- und feuerpolizeilichen Überwachung. Die Gesundheitspolizei kontrollierte den Betrieb von Gasthäusern, kümmerte sich um Krankenhäuser und – nachdem sich mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 1927 die Zuständigkeiten verschoben hatten – auch um das Leben auf der Straße.305 Neben den ordnungspolizeilichen Aufgaben standen die auch heute, nach der Einrichtung von Ordnungsämtern im Bereich polizeilicher Zuständigkeit verbliebenen bereitschaftspolizeilichen, schutzpolizeilichen306 und kriminalpolizeilichen307 Aufgaben: Regierungsgebäude und -vertreter des deutschen Reiches wie des preußischen Staates mußten gesichert, kulturelle und politische Versammlungen betreut werden. Schließlich war die Hauptstadt Kulminationspunkt politischer und krimineller Entwicklungen. Eine hohe Kriminalitätsrate, Serientäter und neue verbrecherische Tricks machten der Polizei in der Stadt, in der „pro Jahr rund 40 Morde […] glücken“308, zu
305 1927 gingen mit diesem Gesetz Befugnisse, die vorher der ‚Sitte‘ übertragen waren, in den Zuständigkeitsbereich der Gesundheitspolizei über. 306 Die Interalliierte Militärkontrollkommission (IMKK) hatte in der Sicherheitspolizei, die aus Offizieren und Unteroffizieren der alten Armee aufgebaut und militärisch gegliedert, kaserniert sowie scharf bewaffnet worden war, einen Verstoß gegen die Entwaffnungsbestimmungen des Versailler Vertrags gesehen. Dementsprechend hatte sie die Auflösung der Sicherheitspolizei verlangt. Innenminister Carl Severing ‚erdachte‘ daraufhin die ‚Schutzpolizei‘ als Kern der ‚Einheitspolizei‘ und begründete sie im Jahr 1920. Der Begriff ‚Einheitspolizei‘ ist abgeleitet von der Maxime, die Polizei nicht im Sinne einer eigenständigen Gendarmerie aufzubauen, sondern sie in die Behördenstruktur einzubinden. Mit der ‚Vereinheitlichung‘ der Polizei sollte der Polizeiapparat überschaubarer, kostengünstiger und funktionsfähiger gestaltet werden, ohne daß dies gegen die Auflage der IMKK, die deutschen Polizei dürfe keine zentralisierte sein, verstieß. Vgl.: Götz, Volkmar: Polizei und Polizeirecht, in: Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 4: Das Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus, Stuttgart 1985, S. 397–420, hier S. 401–403. 307 In Preußen wurde die Kriminalpolizei erst 1925 als ‚Landespolizei‘ neu organisiert, während beispielsweise Sachsen schon 1921 die zuvor ortspolizeilich organisierten Verbände in eine Landespolizei überführt hatte. Das Landeskriminalpolizeiamt beim Polizeipräsidium in Berlin fungierte zwar als Zentrale des Erkennungsdienstes und als Nachrichtensammelstelle, nicht aber als Aufsichtsbehörde für die anderen Ortspolizeien. Nur bei Schwerverbrechen, überregionaler Kriminalität und schwer zu lösenden Fällen war ‚Berlin‘ zu informieren. Das entsprechende Gesetz war als Bestandteil des Republikschutzgesetzes in Reaktion auf die Morde an den Politikern Walter Rathenau und Matthias Erzberger erlassen worden. Ebd. S. 408/409. 308 Kästner, Erich: Berlin in Zahlen, 1930, zitiert nach: Seitz, Robert/Zucker, Heinz (Hrsg.): Um uns die Stadt. Eine Anthologie neuer Großstadtdichtung, Berlin 1931, Seite 72–73.
172 | Theanolte Bähnisch
schaffen. Durch die Lösung spektakulärer Mordfälle mit neuen wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden und modernen technischen Geräten erlangten einige Kommissare der Berliner Kriminalpolizei über die Stadtgrenzen hinaus Berühmtheit und Anerkennung.309 Die Abteilung AI hingegen, welche den preußischen Staat und die Republik durch die Überwachung antidemokratischer Umtriebe vor ihren Feinden von rechts und links schützen sollte und damit die große Hoffnung der preußischen Polizeireformer in puncto Sicherung der jungen und fragilen Demokratie war, war am Ende nicht so mächtig, wie es sich ihre Begründer Severing, Grzesinski und Abegg erhofft hatten. Sie sollte den Kampf um die demokratische Ordnung im Reich, dessen Organe sich schließlich selbst zu Feinden des ‚Bollwerk Preußen‘ entwickelten, verlieren.310 Der Polizeipräsident, dessen Amt von Gabriele Hoffmann zu Recht als ein „hochpolitisches“311 bezeichnet wird, war für die Lenkung und Leitung der Polizei in 131 Revieren und damit auf 883,5 Quadratkilometern Fläche zuständig312. Neben den lokalen kriminal- und ordnungspolitischen Zuständigkeiten für Berlin hatte das Präsidium nach den Umstrukturierungsmaßnahmen Abeggs und Grzesinskis über die Abteilung AI auch politische Polizeiaufgaben für ganz Preußen wahrzunehmen.313 Zusätzlich zu all seinen polizeilichen Aufgaben oblag dem Polizeipräsidenten auch die Leitung des Großbezirks Berlin als Regierungspräsident314, was bedeutete, daß er die Zuständigkeiten des preußischen Innenministeriums, dem er unterstellt war, für den ganzen Bezirk Berlin zu bündeln und zwischen dem Ministerium und den 20 Verwaltungsbezirken315 zu koordinieren hatte. Mit insgesamt 21.000 Mitarbeitern, darunter 4.000 Verwaltungsbeamte, versuchte er seinen vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden.316
309 Vgl.: Liang, Hsi-Huey: Die Berliner Polizei in der Weimarer Republik, Berlin/New York 1977, S. 8. 310 Vgl.: Götz: Polizei, S. 415. 311 Hoffmann, Gabriele: Sozialdemokratie und Berufsbeamtentum. Zur Frage nach Wandel und Kontinuität im Verhältnis der Sozialdemokratie zum Berufsbeamtentum in der Weimarer Zeit, Hamburg 1972. 312 Vgl.: Liang: Polizei, S. 9. 313 Die politische Polizei war in den Ländern jeweils zentralisiert worden. In Preußen wurde sie dem Polizeipräsidenten von Berlin übertragen und von der Abteilung IA wahrgenommen. Nach Christoph Graf war die politische Polizei Preußens bis zum ‚Preußenschlag‘ 1932 gleichermaßen gegen links- und rechtsextremistische Entwicklungen vorgegangen. Vgl.: Graf, Christoph: Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur, Berlin 1983, S. 46. 314 Zu ausführlicheren Informationen zur Behörde des Regierungspräsidenten siehe Kapitel V. 315 Bei der Bildung von Groß-Berlin 1920 waren sieben Städte aus dem Umland sowie 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke aus den Landkreisen Niederbarnim, Teltow und Osthavelland eingemeindet worden. Berlin war in 20 Verwaltungsbezirke gegliedert worden. 316 Vgl.: Büsch, Otto: Berliner Demokratie. 1919–1933, Berlin 1987, S. 189.
Sozialisation | 173
Auf die steigenden Ansprüche an die polizeiliche Verwaltung der Großstadt traf der Anspruch einer Gruppe von Politikern und Verwaltungsfachleuten, der preußischen Polizei ein neues, demokratisches Image zu verschaffen. Die Polizei sollte sich, wie erwähnt, von einer Sicherheitsmacht, die den Staat vor seinen Bürgern schützt, hin zu einem Schutzorgan des Volkes, das seinen Bürgern wohlwollend gegenübersteht, entwickeln. Wilhelm Abegg hatte als Leiter der Polizeiabteilung im Preußischen Innenministerium unter anderem den Auftrag erhalten, die Sicherheitspolizei317, welche kaserniert, stark bewaffnet und schlagkräftig zur Niederschlagung der Aufstände gegen die neue Staatsmacht 1919 eingesetzt worden war, in eine entmilitarisierte ‚Schutzpolizei‘ umzuformen.318 Diese sollte fortan den Kern der preußischen Einheitspolizei319 bilden. Um der Bevölkerung den ‚neuen Schutzmann‘ näher zu bringen und die Arbeit des Polizeipräsidiums und anderer Polizeibehörden transparenter zu machen, wurde 1926, just nach der Einrichtung des Landeskriminalpolizeiamtes in Berlin, die ‚Große Polizeiausstellung‘ veranstaltet. Der Historiker Liang Hsi-Huey nennt sie den „Höhepunkt der Kampagne im Kampf der Polizeireformer um die Gunst der Bevölkerung“.320 In Verbindung mit der vierten preußischen Polizeiwoche, der allgemeinen Polizeikonferenz und einem internationalen Polizeikongreß organisiert, zielte die Ausstellung auch darauf ab, neue Impulse zur Professionalisierung des Personals und der polizeilichen Strukturen zu liefern und damit die reichsweite und internationale Kooperation von Polizeien zu fördern.321 In Willy Abeggs Worten diente die Ausstellung der „Übersicht über die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand des Polizeiwesens“, der „Aufklärung des Publikums und Fortbildung der Beamtenschaft“, dem „Zusammenschluß der deutschen Länder auf dem Gebiet des Polizeiwesens“ und schließlich der „Ausgestaltung der Beziehungen zum Ausland im Sinne friedlicher Gemeinschaftsarbeit."322 Den vielgestaltigen Aufgaben des Polizeipräsidiums entsprechend war die Ausstellungsfläche, die gleichzeitig eine Leistungsschau nicht nur der Polizei, sondern auch der deutschen, vor allem der Berliner In-
317 Die Sicherheitspolizei, aufgebaut aus Offizieren und Unteroffizieren der Armee, militärisch gegliedert, kaserniert und scharf bewaffnet, war im Oktober 1920 aufgelöst worden. Die Siegermächte hatten in ihr eine Umgehung der Demobilisierungsbestimmungen des Versailler Vertrages gesehen und mit der ‚Note von Boulogne‘ der Interalliierten MilitärKontroll-Kommission (IMKK) vom 12.08.1920 die Abschaffung der Sicherheitspolizei verlangt. Vgl.: Götz: Polizei, S. 402. 1924 wurden die grünen Uniformen der Schutzpolizisten nach einer erneuten Intervention der Alliierten gegen blaue eingetauscht. Vgl.: Naas: Entstehung, S. 403. 318 Vgl. dazu auch: Buder, Johannes: Die Reorganisation der preußischen Polizei 1918– 1923, Frankfurt a. M. 1986. 319 Siehe dazu auch Kapitel 3.3.2. 320 Liang: Polizei, S. 91. 321 Abegg, Wilhelm: o. T. [Vorwort], in: Hirschfeld, Hans Emil/Vetter, Karl/Preußisches Ministerium des Innern (Hrsg.): Tausend Bilder/Grosse Polizei-Ausstellung Berlin 1927, S. 7. 322 Ebd.
174 | Theanolte Bähnisch
dustrie war323, immens. Drei Ausstellungshallen am Kaiserdamm wurden vom 24.09. bis zum 17.10. angemietet. Die Schau, der von dem Journalisten Adolf Stein wegen ihres kaum zu bestreitenden Ansatzes zur Befriedigung von Sensationsgier, „phantasievergiftende Verbrecherromantik schlechtesten Stils“324 unterstellt wurde, sollte den neuen Charakter der preußische Polizei als ein ‚Freund und Helfer‘ der Bevölkerung demonstrieren. Die Bürger sollten sich mit ‚ihrer‘ Polizei positiv identifizieren und stolz darauf sein, daß sie den demokratischen Staat verkörpere. Der Polizeibeamte als „Bürgerschreck“ sollte endgültig ausgedient haben. „Bitte treten sie näher“325 hatte als Slogan der Ausstellung die Aufgabe, die vom antidemokratischen Polizeipräsidenten Traugott Achatz von Jagow326 überlieferte Botschaft „Ich warne Neugierige“327 überwinden zu helfen. Zudem informierte die Ausstellung darüber, welche Veränderungen personeller und organisatorischer Art zu den bereits genannten Zwecken, aber auch zur Kosteneinsparung und aufgrund anderer Erfordernisse bereits durchgeführt oder für die Zukunft geplant waren. Die Polizeireformer verfolgten mit der Ausstellung – die von einem Konferenzprogramm begleitet wurde – schließlich noch ein drittes Ziel, nämlich mit dem Ausland in Gespräche darüber einzutreten, wie dem Status Quo und den zu erwartenden Entwicklungen einer von der Industrialisierung positiv wie negativ geprägten Großstadt mit polizeilichen Mitteln am sinnvollsten begegnet werden könne. Die Veranstaltung sollte also als Initialzündung zu einer internationalen Kooperation Berlins in der Verbrechensbekämpfung dienen. Die preußische Polizei empfahl sich den Gästen aus dem Ausland als Partner, indem sie sich als ein fortschrittliches, stabilisierendes Element der deutschen Demokratie präsentierte. Daß auch Dorothea Nolte als ‚frischgebackene‘ Mitarbeiterin des Präsidiums die Ausstellung besuchte, ist sehr wahrscheinlich. Die Ziele, die sich die Schau setzte, stimmten in wesentlichen Aspekten mit denen überein, die sich Bähnisch als Regierungspräsidentin und Leiterin des Deutschen Frauenringes nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges setzte: Ihr erklärter Versuch, die Verwaltung so gut wie möglich, aber auch so menschlich wie möglich zu führen328, war von dem Bedürfnis geleitet,
323 Im offiziellen Ausstellungskatalog werden detailliert die Qualitätsprodukte der Zuliefererbetriebe der Polizei beschrieben und beworben. Circa 50 Prozent des Kataloges sind Werbung im modernen Sinn. Vgl.: Preußisches Ministerium des Innern (Hrsg.): Große Polizei-Ausstellung Berlin 1926, 25. September–10. Oktober, Ausstellungshallen Kaiserdamm, Berlin 1926. 324 Rumpelstilzchen [Adolf Stein]. Berliner Glossen, 20.09. bis 14.10.1926, in: Rumpelstilzchen, 7. Jg. (1926/27), zitiert nach: Brückweh, Kerstin: Mordlust. Serienmorde, Gewalt und Emotionen im 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2006, S. 391. 325 Vgl.: Naas: Entstehung, S. 187. 326 Traugott Achatz von Jagow war von 1909 bis 1916 Polizeipräsident von Berlin und 1920 am Kapp-Putsch beteiligt. In der kurzen Kapp-Regierung war er Innenminister. Er wurde zu fünf Jahren Haft wegen Hochverrats verurteilt, aber frühzeitig aus der Haft entlassen. 327 Traugott Achatz von Jagow, zitiert nach: Bihler, Michael: Stadt, Zivilgesellschaft und öffentlicher Raum. Das Beispiel Berlin Mitte, Münster 2004, S. 65. 328 Langner: Regierungspräsident.
Sozialisation | 175
mehr Bürgernähe in behördliche Strukturen zu bringen. Zudem war sie bestrebt, die Organisation der Verwaltung möglichst reibungslos zu gestalten, wofür sie gut geschultes Personal als eine wichtige Voraussetzung ansah. Zu diesem Zweck brachte sie ihre Fähigkeiten auch in eine Verwaltungsfachschule ein. Auch sie setzte auf deutschlandweiten und internationalen Erfahrungsaustausch in der Verwaltung329, was sich unter anderem in ihren Auslandsaufenthalten niederschlug, die ihr ermöglichen sollten, behördliche, politische und gesellschaftliche Strukturen anderer Länder kennenzulernen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß sie zu solchem Denken durch die Verwaltungsreformer angeregt wurde, unter denen sie sich ab 1926 bewegte und die auch die Polizei-Ausstellung verantworteten. 2.3.1.2 Im Zentrum der Macht und der Krise des Staates: Dorothea Nolte als Teil des ‚Bollwerk Preußen‘ Die Kontakte, die Dorothea Nolte pflegte330, und damit der Personenkreis, dem sie sich zugehörig fühlte, waren an der Schnittstelle zwischen der Polizeiabteilung des Innenministeriums, wo ihr Mann arbeitete, den sie 1926 heiratete, und dem Polizeipräsidium, wo ihr Arbeitsplatz war, lokalisiert. Welchen Stellenwert die Weimarer Koalition, insbesondere die Sozialdemokratie, dieser Schnittstelle beimaß, wird deutlich, wenn man sich – einer umfassenderen Darstellung in Kapitel 3.3.5 vorgreifend – vor Augen hält, welche für die preußische Reformpolitik zentralen Personen zwischen den Ämtern der beiden Einrichtungen rotierten: Albert Grzesinski (SPD) war zwischen zwei Amtsperioden als Berliner Polizeipräsident (1925/26331 und 1930 bis 1932) von 1926 bis 1930 preußischer Innenminister, womit er Carl Severing (SPD), den preußischen Innenminister von 1920 bis 1926, abgelöst hatte. Severing wurde zwei Jahre später Reichsinnenminister und leitete wiederum zwei Jahre später (1930 bis 1932) erneut das preußische Innenministerium. Von 1925 bis 1932 gestalteten Carl Severing, Albert Grzesinski und Wilhelm Abegg (DDP), den Grzesinski auf Kosten des konservativen Friedrich Wilhelm Meister (DVP) zum Staatssekretär und Leiter der Polizeiabteilung befördert hatte332, gemeinsam mit einigen Mitarbeitern den Aufbau und die Kompetenzen der Preußischen Polizei im Staat neu aus. Unklar ist, wann genau sich der Austausch zwischen diesen Personen und Theanolte Bähnisch intensivierte. Er begann – Bähnischs Darstellung nach zu urteilen – nachdem sie Innenminister Severing, der als ‚Patron‘ hinter der Politik Abeggs und Grzesinskis stand, von ihren Fähigkeiten und ihrem Durchhaltewillen überzeugt hatte. Der Austausch dürfte eine Vertiefung erfahren haben, als Albrecht Bähnisch kurz nach der Trauung mit Dorothea Nolte Assessor in der Polizeiabteilung des Innenministeriums wurde. Die Ehe zwischen Dorothea Nolte und Albrecht Bähnisch verfestigte für das Paar, wenn man so will, auf privatem Weg die Brücke zwischen zwei
329 Siehe Kapitel 5 –8. 330 Siehe Kapitel 3.3.5. 331 Zuvor (von 1922 bis 1924) war Grzesinski Präsident des aufgelösten preußischen Landespolizeiamtes gewesen. 332 Es war üblich, einem Minister einen Staatssekretär aus einer anderen Partei der Koalition zu unterstellen. Vgl.: Naas: Entstehung, S. 181.
176 | Theanolte Bähnisch
ohnehin sehr eng zusammenarbeitenden Behörden. Gegen Ende der 1920er Jahre umgab sich das Paar mit jenen Personen, die von dem Otto Braun-Biographen Hagen Schulze in ihrer Ämterkonstellation von 1926 als „Die Macht im Staat [Preußen]“333 betitelt wurden: Wilhelm Abegg (Staatssekretär im Preußischen Innenministerium), Albert Grzesinski (Preußischer Innenminister), Carl Severing (Reichsinnenminister), Karl Zörgiebel (Polizeipräsident in Berlin zwischen den Amtszeiten Grzesinskis), Erich Klausener (Leiter der Polizeiabteilung im Preußischen Innenministerium) und Bernhard Weiß (Polizeivizepräsident von Berlin). Zur Bedeutung jener Kontakte für das Ehepaar Bähnisch soll in Kapitel 3.3.5 ausführlicher Stellung genommen werden. In den Jahren 1926 bis 1930, als Dorothea zunächst Assessorin und später Regierungsrätin im Präsidium war,334 schien die männliche Führungsriege im Polizeipräsidium ein besonderes Verantwortungsgefühl gegenüber der jungen Frau gehegt zu haben. Belegen läßt sich dieser Umstand, den Bähnisch auch in ihrem autobiographischen Diktat beschreibt335, zumindest für den Vizepolizeipräsidenten Ferdinand Friedensburg (DDP).336 Als Sammler der ‚bürgerlichen Mitte‘ gegen den Extremismus von rechts und links337 war Friedensburg nicht nur Vorgesetzter, sondern ganz offensichtlich auch einer der geistigen Väter Dorothea Noltes, die ihrerseits in ihrer Öffentlichkeitsarbeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges konsequent auf überparteiliches und interkonfessionelles politisches Handeln setzte. Theanoltes Bruder Otto Nolte, der als Ministerialrat unter Adolf Grimme im preußischen Kultusministerium arbeitete, hatte seiner Schwester offenbar den Kontakt ins Kultusministerium geebnet. Mit Grimme, der zunächst Oberstudienrat, dann 1925 Oberschulrat für Höhere Mädchenschulen in Magdeburg, anschließend, 1928, Ministerialrat im Preußischen
333 Vgl.: Schulze, Hagen: Otto Braun oder Preussens demokratische Sendung. Eine Biographie, Frankfurt a. M. 1977, Bild Nr. 26. 334 Die Ernennung zum ‚Regierungsrat‘ fand im November 1930, also kurz vor dem Ausscheiden Bähnischs aus dem Präsidium im Jahr 1930 statt. Im Handbuch über den preußischen Staat von 1930 wird Bähnisch noch als Regierungs-Assessorin geführt. Vgl.: Handbuch über den preußischen Staat, 136. Jg. (1930), S. 445. 335 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, passim. 336 In einem Brief gratulierte er Bähnisch zu ihrer Ernennung zur Vizeregierungspräsidentin Hannovers und schrieb, er fühle sich „als ihr alter Chef aus der Berliner Zeit noch immer ein wenig verantwortlich“ für sie und sei „sogar etwas stolz auf die Schülerin“. BArch, N 1114, Nr. 27, Ferdinand Friedensburg an Theanolte Bähnisch, 23.04.1946. 337 Vgl.: Zirlewagen, Marc: Ferdinand Friedensburg, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), XXVI (2006), Sp. 313–321. Drei Wochen vor Beginn von Dorothea Noltes Amtszeit war es Friedensburg gelungen den Claß-Putsch, ein Plan des imperialistisch, antiliberal, national und antisemitisch ausgerichteten ‚Alldeutschen Verbandes‘, zu vereiteln. Was für die Abteilung IA ein politischer Erfolg war und die Befürchtungen der sozialliberalen preußischen Regierung bestätigte, zog die ‚Weglobung‘ Friedensburgs von Berlin nach Kassel nach sich. Dafür hatte Reichspräsident Hindenburg, dem jedoch nicht nachgewiesen werden konnte, daß er mit Claß zusammengearbeitet hätte, persönlich gesorgt. Vgl.: Schulze: Braun, S. 504–506.
Sozialisation | 177
Kultusministerium gewesen war und schließlich 1930 selbst Preußischer Kultusminister wurde, pflegte Theanolte nach 1945 einen sehr persönlichen Austausch. Der Umstand, daß Grimme 1946 niedersächsischer Kultusminister wurde, womit die beiden zum zweiten Mal in derselben Stadt lebten und zusammen arbeiteten, beförderte die auf einer längeren Bekanntschaft fußende Freundschaft. Zwar läßt sich, wie erwähnt, kaum nachvollziehen, wie die Assessorin in der damals größten Behörde Deutschlands genau eingesetzt war. Die zentralen Entwicklungen, mit denen das Polizeipräsidium in den Ausbildungsjahren Bähnischs konfrontiert waren, dürften die wissensdurstige Anwärterin, welche rückblickend schreibt, sie habe „alle[…] relevanten Abteilungen“338 des Polizeipräsidiums durchlaufen, unabhängig von ihren genauen Einsatzorten erreicht haben. Die politischen Auseinandersetzungen auf institutioneller Ebene zwischen Preußen und dem Reich, die Bemühungen der politischen Polizei, demokratiefeindliche Parteien zu überwachen, und schließlich die wiederholt den gewaltsamen Einsatz der preußischen Polizei nach sich ziehenden Straßenkämpfe zwischen Kommunisten und NSDAPAnhängern sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Kollegenkreis regelmäßig Gesprächsthema gewesen. Daß 1929 die Auseinandersetzungen im ‚Berliner Blutmai‘, einem fünftägigen Straßenkrieg zwischen der Schutzpolizei und KPD-Anhängern in Wedding und Neukölln, gipfelten, daß dabei mehr als 30 Zivilisten getötet und knapp 200 Personen verletzt worden waren, muß auch Theanolte Bähnisch als Bürgerin der Stadt, besonders aber auch als Mitarbeiterin der Behörde, die den Einsatz der Schutzpolizei zu verantworten hatte, erreicht haben. Darüber, daß die preußische politische Polizei die kriminellen Energien der nationalsozialistischen Sturmabteilung (SA) unterschätzt und mit übermäßiger Härte gegen die Mitglieder des Rotfrontkämpferbundes vorgegangen war, herrscht in der Forschung heute Einigkeit. Peter Leßmann macht für die unverhältnismäßige Gewalttätigkeit der Schutzpolizei die militärähnliche Ausbildung der Polizisten durch ehemalige Offiziere an den Polizeischulen verantwortlich. Daß Severing, Grzesinski und Abegg der Polizei einen neuen Namen gegeben und ihre Aufgaben anders definiert hatten, hatte – was in der Retrospektive wenig verwunderlich erscheint – nicht zu einem Sinneswandel in den Rängen geführt. In den Straßenkämpfen habe sich, so Leßmann, schließlich die „jahrelang aufgebaute Kampfesstimmung unter den Schutzpolizisten […] entladen.“339 Zwar beinhalteten die Pläne Abeggs zur Reorganisation der Polizei auch Veränderungen in der Schulung der in der Regel aus der Wehrmacht rekrutierten Polizisten, doch war der Drill als ein zentraler Bestandteil der Ausbildung beibehalten worden. Die Ausbildungspraxis stand damit im Mißverhältnis zu den Durchführungsbestimmungen der neuen Preußischen Polizeiverwaltungsgesetze, welche einen zurückhaltenden Einsatz von Gewalt und Waffen forderten340 und an deren Kommentierung für den Dienstgebrauch im Polizeidienst Albrecht Bähnisch mitge-
338 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Lebenslauf Theanolte Bähnischs, o. D. [1946]. 339 Vgl.: Leßmann, Peter: Die preußische Schutzpolizei in der Weimarer Republik. Streifendienst und Straßenkampf, Düsseldorf 1989, S. 249–251, Zitat auf S. 249/250. 340 Vgl.: ebd.
178 | Theanolte Bähnisch
wirkt hatte.341 Leßmann schlußfolgert: „Eine Politik, die die Schutzpolizei ‚jedes militärischen Charakters entkleidet hätte‘ ist von den preußischen Innenministern […] nicht mit Nachdruck betrieben worden.“ Vielmehr sei beim Aufbau der Schutzpolizei an die „Befriedungskapazität“ der Verbände von 1919, dem Jahr der wiederholten Auseinandersetzungen zwischen Aufständischen und Freikorps, sowie 1921, dem Jahr der kommunistischen Erhebung in Sachsen, angeknüpft worden. Mit einer schlagkräftigen Schutzpolizei habe preußische Selbständigkeit und Stärke in der inneren Sicherheit demonstriert werden sollen.342 „Das ‚Bollwerk Preußen‘ war, um im Bild zu bleiben, in seinen Verteidigungspositionen mit einer Besatzung bemannt, die sich mit zunehmender Dauer des Kampfes um den Bestand der Weimarer Demokratie als unzuverlässig erwies oder in seiner Einsatzbereitschaft durch interne Probleme geschwächt wurde“.343 Was die Assessorin über diese Zusammenhänge dachte, nachdem deutlich geworden war, daß von Seiten der kommunistischen Demonstranten im Mai 1929 keine Schußwaffen eingesetzt worden waren und die Polizeitruppen überreagiert hatten, ist nicht überliefert. In ihrem Diktat von 1972 geht sie auf die politischen Zusammenhänge nicht ein. Auch über den Polizeipräsidenten Zörgiebel, der Albert Grzesinski 1926 abgelöst hatte, ließen sich keine Kommentare Noltes finden, bis auf den Umstand, daß er sie im Präsidium „sehr freundlich“344 empfangen habe. Gemeinsam mit seinem Vorgänger Grzesinski, der zu dieser Zeit amtierender Innenminister war, hatte Zörgiebel von der Schutzpolizei ein rigoroses Vorgehen gegen die Demonstranten gefordert. Die politischen Entwicklungen und die Reaktionen der Vorgesetzten, welche die Referendarin in ihrer Zeit im Polizeipräsidium wahrnahm, dürften dennoch eine Rolle für den späteren privaten wie beruflichen Weg gespielt haben. Insbesondere ihre Haltung gegenüber dem Kommunismus und dem Nationalsozialismus nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges läßt erahnen, daß sie in einem Milieu sozialisiert worden war, in dem man zwar gegen den Nationalsozialismus eingestellt war, aber den Kommunismus für nicht minder bedrohlich, wenn nicht gar zeitweise als gefährlicher, als die Bedrohung von rechts hielt. Die nach 1945 zutage tretende Einstellung Bähnischs gegen extreme politische Positionen kann also durchaus als eine Fortsetzung der innerhalb der Abteilung AI gelebten Überzeugung angesehen werden, daß der Staat gegen seine Feinde von links gleichermaßen scharf, wenn nicht gar schärfer, als gegen jene von ‚rechts‘ vorgehen müsse. Theanolte Bähnisch verwendete in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg weit mehr Energie darauf, kommunistischen Einflüssen auf Westdeutschland einen Riegel vorzuschieben, als gegen politischen Extremismus von rechts vorzugehen oder die Erinnerung an das Dritte Reich lebendig zu halten. Dieses Verhalten Bähnischs wurde ergänzt von ihrer auffällig starken – von den genannten preußischen Reformern ebenfalls verkörperten – Bereitschaft, mit allen gemäßigten Parteien eng zusammen zu arbeiten.
341 342 343 344
Siehe Kapitel 3.3.4. Vgl.: Götz: Polizei, S. 417. Ebd., S. 419. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Schwierigkeiten beim Dienstantritt als Regierungsassessor, S. 26.
Sozialisation | 179
Wendet man den Blick weg von den politischen Eindrücken, die die Referendarin im Polizeipräsidium sammeln konnte, und hin zu den praktischen Aspekten ihrer Ausbildung dort, so läßt sich sagen, daß die von Bähnisch reflektierte Erfahrung, in „allen wichtigen Abteilungen“345 des Berliner Polizeipräsidium tätig gewesen zu sein, von großem Vorteil für ihren weiteren Berufsweg war. Dies wußte sie 1946 zu betonen und damit zu ihrem Vorteil zu verwenden. Durch die Funktion Zörgiebels als Regierungs- und Polizeipräsident in einer Person genoß die Assessorin tatsächlich eine Vorbereitung auf ihr späteres Amt als Regierungspräsidentin und auf ihre Aufgabe als Chefin der Bezirkspolizei in Hannover ab 1951346, wie sie passender nicht hätte sein können. Ob sie jedoch die Zeit im Berliner Polizeipräsidium tatsächlich dieser späteren Selbstdarstellung entsprechend nutzen konnte, sei dahingestellt. Schließlich dürftesie zu diesem Zeitpunkt nicht fest davon ausgegangen sein, daß sie einmal Regierungspräsidentin werden würde. Nachdem die Assessorin im Rahmen ihrer ersten Ausbildungsmonate einen Einblick in viele verschiedene Abteilungen bekommen hatte, war sie doch wesentlich in zwei Abteilungen des Polizeipräsidiums angestellt. Entweder noch im Lauf des Jahres 1928 oder erst 1929 wurde sie – vermutlich bis zu ihrem Ausscheiden aus der Behörde 1930 – in der Abteilung I eingesetzt. Die Aufgaben der Abteilung umreißt sie selbst mit „Aufgaben des Regierungspräsidenten, Enteignungskommissar, KoDezernent in Bausachen, Einbürgerungssachen, Medizinalsachen“.347 Daß sie dem Enteignungskommissar zugearbeitet hatte, nutzte sie 1972, um sich als unparteilich und nicht bestechlich darzustellen. Sie erzählt davon, daß ein ReichstagsAbgeordneter sie eines Tages in einer ‚Enteignungssache‘ habe beeinflussen wollen, daß sie aber, obwohl es dem Abgeordneten gelungen sei, den zuständigen Regierungsdirektor Abramowitz auf seine Seite zu ziehen, hart geblieben sei. Daß sie den Namen des Abgeordneten nicht nennt, ließe sich als Loyalität Bähnischs gegenüber der entsprechenden Person deuten, läßt jedoch auf der anderen Seite auch Zweifel daran aufkommen, ob sich die Geschichte tatsächlich so zugetragen hat. Den Namen Abramowitz‘, bei dem es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den Sozialdemokraten Alfred Abramowitz handelte, nannte sie womöglich gerade deshalb, weil ihr be-
345 NLA HA HStaH, Nds. 50, Acc. 75/88, Lebenslauf von Theanolte Bähnisch, o. D. [1946]. 346 Das ‚Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung‘ machte die niedersächsischen Regierungspräsidenten (wieder) zu Chefs der Polizeibehörden. Vgl. zu Bähnisch: O. V.: Frau Polizeichef, in: Das Abendblatt, Nr. 68, 21.03.1951, S. 1. Vgl. zu den allgemeinen Veränderungen: Clauss, Hans Wolfgang/Müller-Heidelberg, Klaus (Hrsg.): Das niedersächsische Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 21.3.1951; mit den Durchführungsverordnungen und Ausführungsbestimmungen sowie sämtlichen einschlägigen Erlassen, Boorberg 1956. Zuvor hatte die Britische Militärregierung die Polizei auf kommunaler Ebene organisiert. Mit dem genannten Gesetz entstand die Niedersächsische Landespolizei. 347 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Versetzung nach Abteilung I, S. 35.
180 | Theanolte Bähnisch
wußt war, daß er 1930 mit einem Korruptionsskandal in Verbindung gebracht worden war.348 Diesen Umstand erwähnt sie allerdings nicht. 1972 war Bähnisch daran gelegen, zu zeigen, daß sie als Regierungspräsidentin für die Probleme von Frauen besonders sensibel war und sich entsprechend engagierte. Sie berichtete von einer Hebamme, die „nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Mitleid“ einer Frau zur Abtreibung verholfen habe. Sie habe sich deshalb geweigert, den Antrag, den ein Obermedizinalrat auf Entlassung dieser Hebamme gestellt habe, zu vertreten. Der Antragsteller habe sich schließlich von ihrer Position überzeugen lassen, schrieb Bähnisch, „worüber ich sehr froh war. Denn mich hätte es sehr bedrückt, wenn sie durch meine Mithilfe ihre Existenzbasis verloren hätte.“349 Gleichzeitig zeigte Bähnisch durch jene Erzählung, daß sie – zumindest zum Zeitpunkt der Entstehung des Diktats – nicht prinzipiell gegen Abtreibung aus sozialen Gründen eingestellt war. 2.3.1.3 „Die[…] Einmaligkeit der Zwanziger Jahre begreift nur der, der das Glück hatte, dabei zu sein“: Die Arbeit in der Theaterabteilung 1927 und 1928 war Dorothea Nolte in der Abteilung II des Polizeipräsidiums in der Magazinstraße beschäftigt.350 In die Zuständigkeit der Abteilung fielen die Verkehrsund Wasserpolizei, die Jagd-, Feld- und Forstpolizei, Landeskultursachen, die Gewerbeverwaltung und Gewerbeaufsicht und schließlich die Theater-, Kunst- und Lichtspielangelegenheiten. Als Dezernentin unterstand sie dem Leiter der Abteilung II, Regierungsdirektor Dr. Wilhelm Mosle, der später die Abteilung III (Verkehrspolizei) leitete. Derselbe Mosle wurde 1932 nach der Absetzung Grzesinskis und des Polizei-Vizepräsidenten Bernhard Weiß übergangsweise zur Leitung des Polizeipräsidiums eingesetzt. 1933 stellten die Nationalsozialisten jedoch auch ihn außer Dienst und setzten Rudolf Diels351 zu seiner Nachfolge ein. Dem vorausgegangen waren
348 O. V.: Korruption im Ministerium des Innern. Wann geht Regierungsdirektor Abramowitz, in: Berliner Tribüne, 26.04.1930. Alfred Abramowitz (1887–1945) war in der Weimarer Republik unter anderem Ministerialrat im preußischen Innenministerium. 1934 emigrierte er über die Schweiz nach Großbritannien. 349 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Versetzung nach Abteilung I, S. 35. 350 Das Handbuch über den preußischen Staat weist Nolte als Regierungsassessorin für die Jahre 1927 bis 1928 in der Abteilung II nach. Ob sie über den kompletten Zeitraum ihrer Anstellung in der Abteilung II für das Theaterreferat zuständig war, geht daraus nicht hervor. Vgl.: Handbuch über den preußischen Staat, 133. Jg. (1927), S. 170 sowie Handbuch über den preußischen Staat, 134. Jg. (1928), S. 178. 351 In der Forschung gilt Diels, der zeitweise dem Berliner ‚demokratischen Club‘ unter der Leitung des jüdischen Polizeivizepräsidenten Bernhard Weiß angehörte, als Opportunist. Schon früh kooperierte er mit von Papen und Göring. Er war am Aufbau des KZ Sonnenburg beteiligt, doch vereinzelt hatte auch er Verfolgten des NS bei der Emigration geholfen. 1948/49 stand er im Dienst der Besatzungsmächte und blieb Besoldeter des Landes Niedersachsen. Er selbst definierte sich als Widerständler gegen den NS. Zur Selbstdar-
Sozialisation | 181
Konfrontationen zwischen Mosle und dem neuen Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, dem späteren SS-Oberst-Gruppenführer Kurt Daluege.352 Diels hatte der Gruppe um von Papen und von Schleicher die Information zugespielt, daß sein Vorgesetzter Wilhelm Abegg sich mit KPD-Politikern getroffen habe. Diese Information wurde als Vorwand dazu genutzt, die preußische Regierung ihrer Ämter zu entheben und einen Reichskommissar für Preußen einzusetzen. Nicht zuletzt, weil Bähnisch Mosle aus der Theaterabteilung kannte, steht zu erwarten, daß die späteren Vorgänge um ihren ehemaligen Vorgesetzten für sie besonders interessant waren. Sie erwähnt dies jedoch im Zusammenhang mit Mosle in ihrem Diktat nicht, sondern beschränkt sich darauf, Anekdoten zu reflektieren, die sie im Zusammenhang mit dem Abteilungsleiter erinnerte. Daß ihr die politischen Zusammenhänge bekannt waren, zeigt sich in einem ihrer frühen Briefe an Kurt Schumacher: Er hätte einen Ministerialrat, der im ‚Fall Diels‘ eine Rolle gespielt hatte, in seiner Rede nicht öffentlich an den Pranger stellen sollen, hatte sie dem Parteivorsitzenden geschrieben.353 Innerhalb der Abteilung II war Nolte im Theaterdezernat, das unter der Leitung von Bruno Adriani stand, eingesetzt. Für Bähnisch dürfte Adriani, der als Mitglied des Verwaltungsrats der Deutschen Theater GmbH Berlin, als Kunstsammler, Mäzen und Ehemann der US-amerikanischen Malerin Sadie Adriani über vielfältige Kontakte in die Kulturszene verfügte, eine interessante Figur gewesen sein. Daß er auch Mitglied der ‚Preußischen Oberprüfstelle für Schund- und Schmutzschriften‘354 war, mag den Umstand, daß Bähnisch sich mit Hilfe des DFR auch nach 1945 zum schädigenden Einfluß schlechter Literatur auf Jugendliche zu Wort meldete, begünstigt haben. In den Artikeln, die sich mit Noltes Arbeit im Polizeipräsidium auseinandersetzen, ist jeweils nur vom Theater, nicht von Kunst und Kino die Rede, weshalb davon ausgegangen werden kann, daß sich die Arbeit der Assessorin vor allem auf das Theater konzentrierte. Die Breite der Ausführungen, die sie in ihrem Diktat von 1972 dieser Tätigkeit widmet, verdeutlicht, daß sie sich an diese Zeit gern er-innerte und ihre Aufgaben sehr interessant gefunden haben muß. Im Berlin der 20er Jahre boomte der Theaterbetrieb. Kulturinteressierte konnten allabendlich zwischen 30 Bühnen wählen, was auch auf die finanziellen Subventionen zurückzuführen war, welche Länder und Kommunen an die Kulturhäuser leisteten, nachdem die Kaiserlichen Hoftheater in staatliche und städtische Bühnen umgewandelt worden waren.355 Aber auch neue, private Theater entstanden, eine Entwick-
352 353 354 355
stellung vgl.: Diels, Rudolf: Lucifer ante Portas, Zürich 1949. Zur Forschung vgl.: Wallbaum, Klaus: Der Überläufer. Rudolf Diels (1900–1957) – der erste Gestapo-Chef des Hitler-Regimes, Frankfurt a. M. 2010. Zu den Zusammenhängen vgl.: Graf: Polizei. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 11.02.1946. Heute übernimmt die 1954 gegründete Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften ähnliche Aufgaben. In der Spielzeit 1929/30 hatten die öffentlichen Zuschüsse für Theater und Konzerte im Reich bei 95 Millionen Reichsmark gelegen. Vgl.: Schöndienst, Eugen: III, § 2 Kulturelle Angelegenheiten – A Theater und Orchester, in: Jeserich, Kurt (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 4, S. 373–384, hier S. 381.
182 | Theanolte Bähnisch
lung, die Führer zufolge „fast ausschließlich ein großstädtisches Phänomen, ja fast könnte man sagen, […] ein Berliner Phänomen“356 waren. So fiel in Noltes Dienstzeit unter anderem die Eröffnung des berühmten Theaters am Nollendorfplatz mit 1100 Plätzen. Wie Karl Christian Führer schreibt, waren Theaterkarten für den Normalverbraucher allerdings ein „unerschwinglich teures Luxusgut“357. Arbeiter konnten die Spielstätten kaum besuchen. Der Verlust von Ersparnissen im Bürgertum legte den Theatern358 Ende der 20er Jahre den Zwang auf, die Eintrittspreise zu senken – eine Entwicklung, die Hand in Hand ging mit der wachsenden Überzeugung, daß Theater als Kultur- und Bildungsfaktor alle Volksschichten erreichen sollte.359 Das Publikum mischte sich also.360 Daß über die Rezensionen der Kritiker „alle Kreise Berlins, ob Wirtschaftler oder Kaufleute, Studenten oder Arbeiter am künstlerischen Geschehen teilnahmen“361, wie Bähnisch in ihrem Diktat festhält, ist jedoch unwahrscheinlich, zumal es Führer zufolge nicht einmal den Volksbühnen gelungen war, ihr Zielpublikum, die Arbeiter, zu erreichen. Vielmehr hätten Mitglieder des Bürgertums dieses Angebot genutzt, um kostengünstig ihrer traditionellen Freizeitbeschäftigung nachzugehen.362 Mehrere Schauspiel-Häuser hatten sich einen Ruf weit über die Grenzen der Stadt erarbeitet, was sich sowohl auf innovative Stücke als auch auf die Leistungen der Schauspieler und Tänzer sowie den Einsatz neuer Methoden in der Bühnengestaltung zurückführen ließ. Jede Aufführung in einem „guten Theater“ sei, so berichtet Theanolte Bähnisch, durch die Qualität der Darbietungen „ein Erlebnis“363 gewesen. Ein Hauch des unaufhaltsamen Aufstiegs des Deutschen Theaters in Berlin, der wesentlich auf den Ideen Max Reinhardts, des Begründers des modernen Regietheaters und den Neuerungen, welche Erwin Piscator brachte, basierte, wird sich auch in den Konzessionierungsakten, die durch die Hände der Dezernentin Bähnisch gingen, niedergeschlagen haben. Nicht nur die Klassiker, sondern auch aktuelle Stücke Ibsens, Hauptmanns, Wedekinds und Strindbergs gelangten 1927, als Bähnisch neu im Dezernat war, im Theater am Nollendorfplatz zur Aufführung. Damit standen Stücke mit hohem gesellschaftskritischem Potential auf den Spielplänen – und damit in den
356 Führer, Carl-Christian: „Kulturkrise“ und Nationalbewusstsein. Der Niedergang des Theaters in der späten Weimarer Republik als bürgerliche Identitätskrise, in: ders./ Hagemann, Karen/Kundrus, Beate (Hrsg.): Eliten im Wandel. Gesellschaftliche Führungsschichten im 19. und 20. Jahrhundert, Münster 2004, S. 155–178, hier S. 155. 357 Führer: Kulturkrise, S. 158. Ein guter Theatersitz habe Ende der 1920er Jahre an den großen Bühnen neun bis zehn Reichsmark gekostet, für die schlechteren Plätze habe man etwa eine Reichsmark anlegen müssen, so Führer. Ebd. 358 Ebd., S. 158. 359 Vgl.: Schöndienst: Angelegenheiten, Ebd., S. 377. 360 Vgl.: Ebd., S. 381. 361 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Das Regime der Thea Nolte 362 Vgl.: Führer: Kulturkrise, S. 159. 363 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Das Regime der Thea Nolte, S. 34.
Sozialisation | 183
Akten, die Bähnisch zu bearbeiten hatte. In ihrem Diktat thematisiert sie diesen Umstand, indem sie schreibt, daß „Regisseure wie Piscator und Dichter wie Brecht […] die Politik in das Theater“364 gebracht hätten. Glaubt man Bähnischs Ausführungen, so war sie im hohen Alter froh darüber, zu jener Zeit am rechten Ort gewesen zu sein. „Die Einmaligkeit der Zwanziger Jahre begreift nur der, der das Glück hatte, dabei zu sein“365, hielt sie 1972 fest. Damit zeigte sie, daß sie aus jener Zeit vor allem die glanzvolle Welt der „[g]roße[n] Künstler und Künstlerinnen“, zu denen sie über den Anwalt, Schriftsteller und Eigentümer des deutschen Künstlertheaters, Max Epstein, auch persönlichen Kontakt bekommen habe366, in Erinnerung behalten wollte. Auch die Kritiker der Branche wie „Kerr, Fechter und Faktor“367 hatten sie offenbar beeindruckt – oder ist die Erwähnung der Kritiker an dieser Stelle darauf zurückzuführen, daß Bähnisch ihre Belesenheit unterstreichen wollte? Das Thema Politik dagegen erwähnt sie nur am Rande, indem sie schreibt, daß „in der damals unruhigen Zeit […] eigentlich Jeder (!) am politischen Geschehen irgendwie teil“368 gehabt habe. Ihrem Diktat zufolge hatte sie durchaus auch das Berliner Nachtleben zu genießen gewußt und es – zumindest rückblickend – als herausragend wahrgenommen. „In den verschiedenen Kabaretts, in der Scala, in den Bars war eine so intensive Atmosphäre, daß jedes Lebensgefühl bis zum Äussersten gesteigert wurde. Jeder Augenblick wurde genossen und gelebt.“369 Durch Aussagen wie „ich trug einen Bubikopf und ein schickes Kleid“370, „mit ihm war ich gestern noch zum Tanzen in einer Bar“371 und “die Bettszene war wirklich sehr albern und in keinster Weise anstößig“372 stellt sie sich selbst als modern, unverkrampft und aufgeschlossen dar. Gleichzeitig beschreibt sie, wie ernst sie die ihr übertragenen Aufgaben nahm und wie sie in der Tanz- und Theaterszene für die Einhaltung guter Sitten eingetreten war.373 1928 tauchte die Dreigroschenoper als wohl bekanntestes gesellschaftskritisches Stück der Weimarer Republik am Berliner Theaterhimmel auf. Am Schiffbauer Damm uraufgeführt, entwickelte sie sich, von Max Reinhardt neu inszeniert, zur erfolgreichsten deutschen Theateraufführung bis 1933 überhaupt. Die Bettler, Huren und Räuber, die bis zum Verbot des Stückes durch die Nationalsozialisten über die Bühne tanzen durften, waren in der literarischen Vorlage zwar im Londoner Stadtteil Soho beheimatet, sollten aber (auch) als Kritik an der bürgerlich-kapitalistischen Ge-
364 365 366 367 368 369 370
Ebd. Ebd. Ebd., S. 33. Ebd. Ebd. Ebd. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, o. S., „Fortsetzung von Seite 29“. 371 Ebd., S. 30. 372 Ebd., S. 31. 373 Ebd., S. 29/30.
184 | Theanolte Bähnisch
sellschaft der Weimarer Republik verstanden werden, die Brecht und Weill als eine heuchlerische zeichneten. Interessanterweise spielt auch der Berliner Polizeipräsident eine – als Polizeipräsident von London verklausulierte – Rolle im Stück. Er wird als korrupt und bestechlich dargestellt, weshalb die Aufführungen der Dreigroschenoper an den verschiedenen Berliner Bühnen im Präsidium mit einiger Aufmerksamkeit verfolgt worden sein dürften. Dem Theater-Dezernat, für das die Zensur einen Großteil der Arbeit ausmachte, dürfte Brechts Stück also allein schon aufgrund der darin bearbeiteten Themen häufig begegnet sein. Folgt man Bähnischs Aussage, daß sie einmal im Monat der Einladung Max Epsteins in seine Villa in Grunewald gefolgt sei, um an den „offenen Sonntagen“374 persönliche Kontakte zu Schauspielern und Schauspielerinnen zu etablieren, so dürfte die Verwaltungsjuristin tatsächlich einen Einblick in die Welt der Schauspielerei jenseits der Akten und der Theater-Besuche, die sie zu zensorischen Zwecken unternahm, bekommen haben. In ihrem Diktat von 1972 thematisiert sie ihren Austausch mit dem Film- und Theaterschauspieler Paul Henckels375, der mit Regisseuren wie Murnau, Lang, Weiss und Sternberg gearbeitet hatte. 2.3.1.4 Eine Frau im Männerreich? Die Verwaltungsjuristin in der Kritik Daß man 1927 im Berliner Polizeipräsidium ausgerechnet eine Frau mit der Regelung der Theater-Angelegenheiten betraut hatte, rief bei einigen Zeitgenossen Bestürzung hervor. So titelte im März 1927 die Sonntags-Zeitschrift ‚Berliner Herold‘: „Wer regiert Berlins Theater? Das Regime des Fräulein Nolde.“376 Im Artikel wird die Verärgerung eines Theaterdirektors über die in Berlin herrschenden ‚Zustände‘ gleich zur Verärgerung aller Berliner Theaterdirektoren hochstilisiert. Einem „Fräulein Dr. Nolde“ seien die entscheidenden Vorarbeiten für die Theaterkonzessionierungen übertragen worden, heißt es ohne Rücksicht auf Korrektheit des Namens, des Familienstandes – denn Dorothea Nolte hatte im Januar 1927 geheiratet und trug nun den Namen Bähnisch – und des Titels im Artikel. Daß der BDF bereits im Kaiserreich darauf gedrängt hatte, unverheiratete Frauen nicht als ‚Fräulein‘ zu bezeichnen, schien den Verfasser nicht tangiert zu haben. Die Dame, noch nicht einmal dreißigjährig, solle nun mit den viel älteren Männern und Theaterdirektoren maßgebend verhandeln, echauffierte er sich. Das Theater sei und bleibe jedoch „eine Männerangelegenheit!“ und insbesondere über die Konzessionierung, die zu den geschäftlichen Fragen gehöre, sollten sich wohl am besten „Männer mit Männern!“ auseinandersetzen, zumal es einer Frau nicht möglich sei, sich in die Interna des Berliner Theaterlebens so zu versenken, „wie ein Mann es könnte“. Der im folgenden geschilderte „Skandal“ war wohl eher ein vor dem Hintergrund der Geschlechterfrage und der Opposition der Zeitschrift gegen das Polizeipräsidium etwas übertrieben dargestelltes ‚Skandälchen‘: Ein „Faustschlag einer bürokratischen Regentin“ gegen einen „braven alten Herrn“ sei die Frage der Dezernentin an den Direktor Sams gewesen, ob er
374 Ebd., Teil I, Das Regime der Thea Nolte, S. 33. 375 Ebd. 376 O. V.: Wer regiert Berlins Theater?
Sozialisation | 185
sich denn für den Posten eines Theaterdirektors nicht zu alt fühle. Dem „brausenden Applaus“ von „ganz Berlin“ könne sich der Direktor für seine Gegenfrage, ob sie sich denn nicht zu jung fühle, eine solche Frage an ihn zu richten, sicher sein, schrieb der unbekannte Autor. Daß der Direktor die Konzession für die Aufführung eines Theater-Gastspiels im Apollo-Theater nicht bekäme, müsse eine politische Entscheidung sein, räsoniert der Verfasser. „Wenn einem die Theaterbehörden nicht wohlwollen haben sie immer die Kautschukschlinge baulicher Bestimmungen an der Hand, die sie dem mißliebigen Bewerber um den Hals legen“, verlieh er seiner offenbar allgemeinen Skepsis gegenüber dem Sinn behördlicher Entscheidungen Ausdruck. Daß die ohnehin vorhandene Ambivalenz im Mit- und Gegeneinander von öffentlichen Erwartungen und künstlerisch notwendigem Freiraum nun auch noch durch die Hand einer jungen Frau verkompliziert zu werden schien, trieb den unbekannten Verfasser des Artikels zu schierer Verzweiflung an. „Heiliger Zörgiebel, weißt Du Bescheid um die Logik Deiner Untergebenen?“, echauffiert er sich schließlich über den Polizeipräsidenten, der doch versprochen hätte, „rheinisch gesunden Menschenverstand“ in die Behörde zu bringen, nun aber auf „Unterröcke am grünen Tisch“ zurückgreife, anstatt diese in Ressorts zu beschäftigen, wo es an „fraulichen Spezialitäten“ fehle, „etwa in Dingen der Wohlfahrt oder der Sittenpolizei?!“377 Bedenkt man, daß letztere, wie bereits beschrieben, bereits im Jahr 1927 abgeschafft worden war, mehren sich doch Zweifel an der Genauigkeit der Recherchen des Autors und der Richtigkeit seiner Darstellung. Der Berliner Herold, der sich Karsten Schilling zufolge durch eine „kritischbissige Berichterstattung“378 auszeichnete, wurde offenbar vor allem von jenen konsumiert, die sich für die Hintergründe der Berliner Kultur- und Gastronomieszene interessierten. Diesen Schwerpunkt hatte sich der 1904 erstmals erschienene ‚Herold‘, der – so konstatiert Schilling – als Unterstützer der entsprechenden Szene fungierte und immer wieder die Abschaffung der Sperrstunde sowie der Lustbarkeitssteuer forderte379, gesetzt.380 Der Pressehistoriker attestiert der Zeitschrift, die 2011 erstmals Erwähnung in einer pressehistorischen Studie fand, einen Tiefgang in ihrem Themenschwerpunkt, der durchaus an den Charakter eines Fachjournals herangereicht habe.381 Theanolte Bähnisch hatte die bisher so gering erforschte Zeitschrift offenbar
377 Ebd. 378 Schilling, Karsten: Das zerstörte Erbe. Berliner Zeitungen der Weimarer Republik im Porträt, Norderstedt 2011, S. 161. Schilling zufolge ist der ‚Berliner Herold‘, der den Untertitel ‚die interessante deutsche Wochenzeitung‘ trug und von Otto Dubro herausgegeben wurde, bisher in keiner Darstellung zur Berliner Pressegeschichte berücksichtigt worden. Vgl.: ebd. Verantwortlicher Redakteur der Zeitschrift war 1927 Alfred Heuschert. Vgl.: Objektdatenbank des DHM München, Do 63/755 [Wochenzeitung „Berliner Herold“ u. a. über das Hotel „Adlon“ und seine Gäste, Berliner Herold (1927), Nr. 8], auf: http://www.dhm.de/datenbank/dhm.php?seite=5&fld_0=D2B01749, am 15.05.2014. 379 Vgl.: Schilling: Erbe, S. 163. 380 Schilling macht dies nicht zuletzt an dem großen Anzeigenteil für Gast- und Spielstätten, den der Herold enthielt, fest. Vgl.: ebd. S. 162. 381 Vgl.: ebd., S. 162/163.
186 | Theanolte Bähnisch
gekannt. Aus einem Fehler, den sie im Diktat von 1972 macht, läßt sich ihr Hintergrundwissen erkennen. Fälschlicherweise gibt sie nämlich an, der hier zitierte Artikel über sie sei im ‚Kleinen Journal‘ erschienen. Dies war jedoch die Zeitschrift, in deren Druckerei der ‚Herold‘ gedruckt wurde.382 Im Artikel wird einerseits deutlich, wieviel Unverständnis die Besetzung eines verantwortungsvollen Postens in einer öffentlichen Behörde mit einer jungen Frau zu dieser Zeit hervorrufen konnte, andererseits reihte sich die Kritik an der Assessorin in die insgesamt kritische Berichterstattung des Blattes über die behördliche Aufsicht über den Kulturbetrieb im Allgemeinen und am Berliner Polizeipräsidium im Speziellen ein.383 Wie sehr sich Bähnisch vielleicht doch über ihre Pflichten hinaus in die ‚Interna‘ des Berliner Theaterlebens versenkte, darüber kann nur spekuliert werden, zumal unklar ist, was mit ‚Interna‘ genau gemeint war. Sie selbst kommt über Andeutungen in ihrem Diktat von 1972 nicht heraus, rächt sich jedoch, wenn man so will, an den Anschuldigungen gegen sie, indem sie den Direktor, der sie aufgesucht hatte, als „Schmierenkomödiant“ bezeichnet und betont, daß Abteilungsleiter Adriani den Umgang mit „diesen zweit- und -drittklassigen Direktoren“384 in der Regel ihr überlassen habe. Sowohl der Sprecher des deutschen Bühnendienstes und Theater-Wissenschaftler Eugen Schöndienst als auch der Jurist Wilhelm Kewenig vertreten die Überzeugung, daß es nur wenige Dinge gebe, die sich wesensgemäß so fremd seien wie Kunst und Recht. „Während sich das Recht um Systematisierung und Kontinuität bemüht, gehören Intuition, Wechsel und Experiment zum Lebenselixier des künstlerischen Bereichs“, gibt Kewenig zu bedenken.385 Der in Fachkreisen schon im Kaiserreich gehegte Wunsch, daß als Konzessionsbehörden deshalb die Kultusministerien der Länder anstelle der Gewerbepolizei treten sollten, erfüllte sich auch in der Weimarer Republik nicht.386 Daß der Verständigung zwischen Juristen und Schauspielern Grenzen gesetzt waren, reflektiert auch Bähnisch in ihrem Diktat und zwar anhand einer Auseinandersetzung mit Paul Henckels. Als ein Theater habe geschlossen werden müssen, habe sie sich geweigert, Geld, das für die Künstler als finanzielle Sicherung hinterlegt gewesen sei, freizugeben und von diesem Geld weitere Aufführungen finanziert. Dafür, daß sie nach dem Gesetz gehandelt habe, habe sie sich von den Schauspielern, die sie nach dem Gespräch „sehr böse“ verlassen hätten, eine „Lücke in ih-
382 Vgl.: ebd., S. 162. 383 Schilling schreibt, der Herold sei mit seiner Forderung nach der Verschiebung der Sperrstunde schließlich erfolgreich gewesen. In der Jubiläumsausgabe im Jahr 1929 habe der Polizeivizepräsidenten Weiß sogar persönlich im Herold zu dem Thema Stellung genommen. Vgl.: ebd., S. 163. 384 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Heiratsprobleme, S. 32. 385 Kewenig, Wilhelm: Theater und Staat, in: Archiv für Urheber-, Film-, Funk-, und Theaterrecht, Bd. 58 (1970), S. 91 ff, zitiert in: Schöndienst: Angelegenheiten, S. 374. 386 Schöndienst: Theater und Orchester, S. 379. Schöndienst verweist auf die Novelle der Gewerbeordnung von 1869 in der Fassung vom 06.08.1896.
Sozialisation | 187
rem Weltbild“ vorwerfen lassen müssen.387 Max Epstein – für Bähnisch offenbar der Inbegriff des Brückenschlags vom Rechtswesen in die Schauspielerei – habe Henckels jedoch klarmachen können, daß die Assessorin nicht anders habe handeln können.388 Doch die mit der Konzessionierung der Berliner Theaterbetriebe beauftragte Verwaltungsjuristin hatte nicht nur, wie ihr Chef Bruno Adriani, großes Interesse an Kunst und Kultur, sondern umgab sich auch privat gern mit den Frauen, die daran Anteil hatten, daß das Berliner Theater der 1920er Jahre für die Zuschauer ein Genuß war. Sie kannte die Tänzerin Tilla Durieux, die Rezitatorin Mary Schneider-Braillard und die Dramatikerin Ilse Langner, deren Stücke bald auf den Berliner Bühnen der Zeit aufgeführt werden sollten, persönlich. In Lotte Jacobi, die große Berühmtheit nicht zuletzt mit ihren Photos von tänzerischen Darbietungen erlangte, hatte Bähnisch eine weitere Freundin, die sich beinahe tagtäglich beruflich mit dem Theater auseinandersetzte.389 Auch nach dem Zweiten Weltkrieg besuchte Bähnisch gern das Theater. Überliefert ist beispielsweise eine Fahrt zu den Bad Hersfelder Festspielen mit dem Hamburger Verleger Kurt Ganske, der Bähnischs Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ ab 1949 verlegte.390 Diese Zeitschrift berichtete ebenfalls über Kunst und Kultur, auch über den modernen Tanz. Die Stelle in der Theaterabteilung schien mit Bähnisch also nicht nur in Bezug auf ihre verwaltungsjuristische Qualifikation passend besetzt gewesen zu sein. 2.3.1.5 Der technische Fortschritt und die Angst des Bürgertums vor Vermassung und Technisierung – Vorboten der späteren Kommunismus-Kritik? Berlin als Bühnenstadt dürfte die Begeisterung Theanolte Bähnischs für Kunst und Kultur gleichermaßen befriedigt wie befördert haben. Auch die technischen Neuerungen, die in die Theater einzogen, werden der Dezernentin viel Schreibarbeit beschert haben: Die neuen Installationen des Meisters der Avantgarde, Erwin Piscator, revolutionierten in den 20er Jahren die Bühnenbilder – was deren polizeiliche Abnahme nicht unwesentlich verkompliziert haben dürfte.391 Bestandteile jener Inszenierungen waren aufwendige Film- und Bildprojektionen, Laufbänder und Fahrstühle sowie die 1927 zum ersten Mal verwendete Segment-Globus-Bühne, eine drehbare Halbkugel, die sich an mehreren Stellen aufklappen ließ und den Blick auf wechseln-
387 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Heiratsprobleme, S. 34. 388 Ebd. 389 Siehe Kapitel 2.3.2.5.1. 390 AdSD, Nachlaß Fritz Erler, Nr. 217 A, Theanolte Bähnisch an Fritz Erler, 05.09.1966. 391 Am 15.06.1928 verlor Piscator die Konzession für sein Theater. Vgl.: Berndt, Christian: SWR2 Zeitwort, 15.06.2009, 6.45 Uhr, 15.06.1928: Der Regisseur Erwin Piscator gibt das Theater am Nollendorfplatz in Berlin auf, auf: http://www.swr.de/swr2/programm/ sendungen/zeitwort//id=4833930/property=download/nid=660694/1wxkxb6/swr2zeitwort-20090615.pdf, am 03.07.2009. Nolte scheint zu dieser Zeit noch in der Theaterabteilung gearbeitet zu haben.
188 | Theanolte Bähnisch
de Orte und Szenen freigab. Andere Regisseure zogen nach: Max Brandt holte mit ‚Maschinist Hopkins‘ die stählernen Fragmente von Großmaschinen aus den Fabriken auf die Bühne, wo sie die Darsteller in ihrer Größe um ein Vielfaches392 überragten und damit die Frage aufwarfen, was nun Akteur und was Kulisse sei. Anklänge solcher Inszenierungen an Fritz Langs Film ‚Metropolis‘, der vom „reinen, mechanischen und apparathaften Rotieren von Maschinen, Menschen und Mutanten“393 erzählt, sind nicht zufällig, sondern waren Zeichen der Zeit und zeugten von jener Mischung aus Faszination über und Furcht vor dem technischen Fortschritt, in dem man – je nach Perspektive – nicht nur aufbauende, sondern auch zerstörerische Aspekte erkennen konnte. Vielleicht liegt hierin ein Ursprung von Bähnischs späterer Neigung, die Themen ‚Vermassung‘, ‚Technisierung‘ und ‚Entseelung‘ wiederholt anzusprechen und darüber die Verfaßtheit der modernen Welt und des modernen Menschen zu beklagen. Damit schloß sie sich erst nach der Erfahrung des Nationalsozialismus und des Krieges jenen an, die schon Jahrzehnte zuvor befürchtet hatten, die ‚Mechanisierung‘ würde dem Seelenleben der Menschen nachhaltig schaden und die gelebte ‚Apparathaftigkeit‘ auf Dauer zu einer ‚Entmenschlichung‘ führen. Mit Erwin Tollers Stücken ‚Masse Mensch‘ und ‚Die Maschinenstürmer‘ waren ‚Vermassung‘ und ‚Technisierung‘ schon zu Beginn der 20er Jahre ein – durchaus positiv besetztes – Thema des Theaters gewesen. Toller schrieb und Piscator inszenierte seine Stücke, mit spürbarer Begeisterung für den Kommunismus, als Hohelieder auf Technik und Industrie, wofür die liberale Presse Lob bereithielt, während die Arbeiter die Stücke mieden. Doch bald schon mehrten sich kulturpessimistische Stimmen aus dem eher konservativen Bürgertum, die in den 1920er Jahren als bedrohliches Moment in der Gesellschaft ausmachten, was schon im 19. Jahrhundert in die Fabriken Einzug gehalten hatte: Fließbandproduktion und die Standardisierung von Abläufen, Kleinteiligkeit und damit – so die Schlußfolgerung – auch Gleichheit und Steuerbarkeit nicht nur der Produktionsabläufe, sondern auch ihrer menschlichen Bearbeiter. Die Einswerdung von Mensch und Maschine war eine sozialistische Utopie, dem konservativen Bürgertum war diese Vorstellung mehrheitlich ein Graus. Dies ging so weit, daß die Schreibmaschine – in der Frauenbewegung als Statussymbol der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen gefeiert – von Kulturkritikern als Kennzeichen einer als geistlos beschriebenen Angestelltenkultur dargestellt wurde.394 Indes: Die Realität
392 Zwar war Brandt ein Technik-Liebhaber, der eine fast amouröse Beziehung zwischen Mensch und Maschine in seinen Stücken inszenierte, doch wirkt das von Kritikern oft in Beziehung zu Fritz Langs Film ‚Metropolis‘ gesetzte Bühnenbild eher kalt und bedrohlich. Vgl. die Szenenphotos aus Aufführungen in Berlin und Frankfurt in: Kunstamt Kreuzberg/Institut für Theaterwissenschaft der Universität Köln: Theater in der Weimarer Republik, Berlin 1977, S. 788. 393 Metzger, Rainer: Berlin. Die Zwanzigerjahre. Kunst und Kultur 1918–1933, München 2007, S. 148. 394 Vgl.: Schüller, Liane: Vom Ernst der Zerstreuung. Schreibende Frauen am Ende der Weimarer Republik: Marieluise Fleißer, Irmgard Keun und Gabriele Tergit, Berlin 1995, S. 13. und S. 247–304. Schüller widmet den dritten Teil ihrer Untersuchung „dem Ar-
Sozialisation | 189
des ‚Fräuleins vom Amt‘, der ‚Stenotypistin‘, war und blieb doch eine andere als die der wenigen Frauen, die es schafften, mit Romanen oder dem journalistischen Schreiben erfolgreich zu sein. Die kulturelle Dynamik der Maschine, die „mit lieblichem Glockenton das Ende der Zeile“395 meldet, sollte also als Motor der Emanzipation keinesfalls überschätzt werden. Bähnisch mag sich der Beschwörung der Schreibmaschine als Instrument des technischen Fortschritts, welches Frauen zu neuen Möglichkeiten verhelfen könne, in den Nachkriegsjahren jedoch erinnert haben: Die Bilder, welche berufstätige Frauen zeigen, bilden häufig Sekretärinnen beziehungsweise Schreibkräfte ab.396 Der nicht zuletzt mit der ‚Angestelltenkultur‘ assoziierte ‚Aufstieg des kleinen Mannes‘, der in den Jahren des wirtschaftlichen Aufstiegs von 1924 bis 1929 spürbar wurde, erzeugte ambivalente Reaktionen. Überzeugte Republikaner begrüßten die wachsende Partizipation breiterer gesellschaftlicher Schichten als Erfüllung ihres Strebens nach einer gleichberechtigten Beteiligung aller Bürger am politischen und am kulturellen Leben. Die vermeintlichen Kehrseiten der Entwicklung beschrieb beispielsweise der Soziologe Ortega y Gasset, einer der bekanntesten Vertreter der (kritischen) Massentheorie unter dem Eindruck der Weimarer Republik 1929 in seinem Werk ‚Der Aufstand der Massen‘. Darin leitete er die Entstehung des ‚Massenmenschen‘ aus der Industrialisierung, der experimentellen Naturwissenschaft, vor allem auch aus der liberalen Demokratie ab. Als Elitensoziologe sah Ortega y Gasset in der ‚Gleichheit aller Menschen‘ eine Gefahr für die moderne Zivilisation. Er befürchtete, vor dem Hintergrund seiner Annahme, die ‚Massen‘ seien von politisch geschickten Anführern leicht manipulierbar und steuerbar, daß die Gesellschaft von einer ziellosen Aggressivität geprägt werden könnte. Am Vorabend des Dritten Reiches geschrieben, erlangte das umstrittene Werk des spanischen Soziologen einen hohen Bekanntheitsgrad. Bähnisch knüpfte in der Nachkriegszeit, als sie die Bevölkerung vor den Kommunisten warnen wollte, an Massentheorien an.397 Der nicht weniger bekannte Soziologe und Schriftsteller Siegfried Kracauer machte den befürchteten gesellschaftlichen Verfall vor allem an seinem – von Kracauer diagnostizierten – Niederschlag in der Erwerbswelt und Freizeitgestaltung
beitswerkzeug Schreibmaschine als wesentliches Attribut beruflicher Lebensrealität der weiblichen Angestellten“ und der Beantwortung der Frage, „inwieweit die Apparatur Schreibmaschine als Zeichen für emanzipatorischen Fortschritt oder für zunehmende Kontrolle über den Arbeitsvorgang der Frau gewertet werden kann“. (Ebd., S. 13). Zur Kritik und der damit einhergehenden Zuschreibung der Schreibmaschine als eine Maschine, die von Frauen bedient wird, vgl.: Kracauer, Siegfried: Die Angestellten. Aus dem neuesten Deutschland, Frankfurt 1930, S. 228. 395 Brück, Christa Anita: Schicksale hinter Schreibmaschinen, zitiert in: Schüller: Zerstreuung, S. 255. Vgl. auch: Kracauer, Siegfried: Ein Angestelltenroman, [Rez. über: Brück: Schicksale], in: Frankfurter Zeitung, 06.07.1930. 396 Daneben werden auch Verkäuferinnen, Krankenpflegerinnen, Ärztinnen, Künstlerinnen und Politikerinnen abgebildet. Vgl. zur Darstellung ‚weiblicher‘ Berufsbilder in der ‚Stimme der Frau‘ auch: Freund: Krieg. 397 Siehe Kapitel 7.1.5 sowie 6.5.3.4.
190 | Theanolte Bähnisch
fest. So beschrieb er in ‚Die ‚Angestellten‘398 die neue Schicht des aufstrebenden Mittelstandes als technokratisches, uniformes Heer mit routinierten Verhaltensweisen und einem allzu geregelten Tagesablauf. Funktionalisiert im Dienstalltag, glatt, gesichtslos, willfährig und schließlich unreflektiert ihre Freizeit in den bürgerlichen Vergnügungsstätten absolvierend, seien sie als ungebildetes, dankbares Publikum leicht zu unterhalten und damit machtstrategisch leicht zu instrumentalisieren.399 Das große Potential der Demokratie, die Masse, so läßt sich auch aus Kracauers Ausführungen schlußfolgern, schien also gleichzeitig die bürgerlichen Werte Demokratie und Freiheit zu bedrohen. Assoziationen solcher Art rief auch eine weitere Bühnenneuheit der Zeit hervor: Tänzerische Formationen von jeweils etwa zwanzig Frauen, die im Tanz zu einem sich uniform bewegenden Körper zu verschmelzen schienen. Alfred Polgar, einer der großen Kritiker und Provokateure der Zeit, bezeichnete die Revue-Tänzerinnen, deren Aufführungen ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich Bähnischs fielen, als ein „langes fleischfarbenes Band“.400 Persönlichkeit und künstlerisches Können schienen für Polgar auf der Revue-Tanz-Bühne401 keine Rolle gespielt zu haben.402 Theanolte Bähnisch will, ihrem Diktat zufolge, dafür gesorgt haben, daß etwas weniger Haut in der Revue zu sehen war. Dies habe sie in einem persönlichen Gespräch mit den Tiller-Girls, die in der Haller-Revue im Berliner Admiralspalast auftraten, erreicht. „Ich lobte zunächst sehr ihre Leistungen“, beschreibt sie ihr ihren Schachzug. „Sie können sich nicht vorstellen, wie bezaubert ich bin und von mir aus braucht an ihrer Kleidung nichts geändert zu werden. Aber leider müssen wir Beschwerden von Reichstagsabgeordneten berücksichtigen. Bitte helfen sie doch der Theaterabteilung und seien sie etwas höher geschlossen“403 strapazierte Bähnisch gleichzeitig den Umstand, daß ein Reichstagsabgeordneter sie persönlich angerufen habe404 und ihren
398 Kracauer, Siegfried: Deutschland. Vgl. auch ders.: Das Ornament der Masse. Essays, Frankfurt a. M. 1977. 399 Zur Kritik Krakauers am ‚Kult der Zerstreuung‘ vgl. auch: Stegmann, Dirk: Angestelltenkultur in der Weimarer Republik, in: Faulstich, Werner (Hrsg.): Die Kultur der 20er Jahre, S. 21–39, Göttingen 2008, S. 26. Stegmann resümiert, daß es eine eigenständige Angestelltenkultur in der Weimarer Republik nicht gegeben habe. Vgl.: ebd., S. 36. 400 Polgar, Alfred: Kreislauf, Reinbek 1983, S. 247, zitiert nach Unseld, Melanie: Im Karussell der Gegensätze, in: Faulstich, Werner (Hrsg.): Die Kultur der 20er Jahre, München 2008, S. 151–160, hier S. 156. 401 1928 war der Revue-Boom, der Mitte der 20er Jahre über 10.000 Besucher täglich anzog, weitgehend vorbei und die Ära der Operette begann. Vgl.: Stegmann: Angestelltenkultur, S. 31. 402 Der konservative Kulturkritiker Adolf Stein umriß das Phänomen wie folgt: „Es ist ein saftiger Blödsinn, aber sehr farbenbunt, mit viel Mädchenfleisch, allerlei Reigen, ganze Klaviaturen nackter Beine“. Rumpelstilzchen [alias Adolf Stein]: Bei mir – Berlin, Berlin 1924, zitiert nach: Stegmann: Angestelltenkultur, S. 31. 403 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Heiratsprobleme, S. 30. 404 Ebd., Teil I, Besuch von den Tillergirls in der Haller-Revue, S. 29.
Sozialisation | 191
Einfluß in der Theater-Branche. „Nach einigem Hin- und Her“ hätten sich die „Damen“ bereit gefunden. „Sie wollten mir einfach helfen. Dadurch habe ich die Tillergirls immer in guter Erinnerung behalten“405, schließt sie ihre Ausführungen über die bekannteste Revue-Formation der Zeit. Die Vorstellung, der prekäre Wohlstand einer Angestellten-Schicht, welche die Kinos, Konzertsäle und Theater besuchte, gefährde Kultur und Demokratie, mutet retrospektiv, angesichts der hohen Arbeitslosenzahlen in der Weimarer Republik ab 1929, wie eine Farce an. Zweifellos, die Berliner Welt begann demokratisch zu werden, „mit all ihren Auswüchsen in Hinblick auf den Schacher, der damit zu treiben ist, und auf die Manipulationen die an jeder Ecke warten.“406 Doch viel weniger der Aufstieg und die gesellschaftliche Partizipation einer kleinen Mittelschicht als vielmehr der soziale Abstieg vieler Arbeiter, kleiner Gewerbetreibender, schließlich auch der mittleren Einkommensgruppen in den späten Jahren der Republik öffnete der politischen Instrumentalisierbarkeit und damit der Radikalisierung der Gesellschaft Tür und Tor und hielt schließlich die Mitarbeiter des Polizeipräsidiums in Schach. Wie intensiv Bähnisch bereits zu jener Zeit, angeregt durch die Ausführungen der zitierten Kulturkritiker, deren Ausführungen sie erklärtermaßen „hochinteressant“407 fand, über den Zusammenhang von ‚Massen‘, ‚Maschinen‘, ‚Technik‘ und Theater nachgedacht hatte, läßt sich nicht rekonstruieren. Aber es ist anzunehmen, daß sie über ihre Tätigkeit in der Theaterabteilung mit jenem Thema, das sie knapp 20 Jahre später nachweislich beschäftigte, erstmals in Kontakt gekommen war. Daß Bähnisch 1929 in die Abteilung I versetzt wurde, wo sie auch 1930 noch tätig war,408 könnte mit dem Einbruch im Theaterwesen, der durch die Wirtschaftskrise ab 1929 verursacht worden war, in Zusammenhang gestanden haben. Es ist davon auszugehen, daß das Präsidium zu dieser Zeit den Erfordernissen um das Theaterleben mit weit weniger Personal Herr werden konnte, als in den ‚goldenen‘ Jahren davor. Da in der Abteilung I, in Berlin-Schöneberg, unter anderem Personenstands-, Kirchen-, Versicherungs-, Kassen-, Vereins-, Wohlfahrts-, Gesundheits- und Stiftungssachen bearbeitet wurden, ist es möglich ist, daß Bähnisch sich dort unter anderem auch mit den Belangen eines Vereins beschäftigte, dem sie selbst angehörte und der ihr Raum dazu bot, sich auch nach ihrer Versetzung intensiv über ihre professionellen wie künstlerischen Interessen mit Gleichgesinnten auszutauschen.
405 Ebd., S. 30. 406 Metzger: Berlin, S. 314. 407 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Das Regime der Thea Nolte, S. 33. 408 Vgl.: Handbuch über den preußischen Staat, 135. Jg. (1929), S. 181 und 136. Jg. (1930), S. 445.
192 | Theanolte Bähnisch
2.3.2 Beste Schwestern: Rückhalt und Freundschaften im Soroptimist-Club 2.3.2.1 Ein Service-Club verspricht Unterstützung für berufstätige Stadtberühmtheiten Nach ihrer Einstellung in der Preußischen Verwaltung war Theanolte Bähnisch ihren eigenen Schilderungen zufolge nicht nur einmal mit persönlichen Anfeindungen, wie sie aus dem Berliner Herold deutlich wurden, konfrontiert. Der erste Abteilungsleiter mit dem sie sich im Polizeipräsidium auseinandersetzen mußte, habe ihr schon kurz nach ihrem Dienstantritt nahegelegt, sich versetzen zu lassen, liest man 1948 in den Hessischen Nachrichten, da „im Dienst ergraute Männer […] mit zwanzig jähriger Berufserfahrung“ nicht unter einem „jungen Mädchen“ arbeiten wollten. „Das geht nicht Verehrteste, bei allem Respekt vor ihrem Examen, das geht nun wirklich nicht.“ Ob aus den kritischen altgedienten Beamten tatsächlich nach nur einer Woche „ergebenste Mitarbeiter“409 Bähnischs geworden waren, wie die Hessischen Nachrichten vermeldeten, oder ob diese Darstellung nicht eher einer Euphorie in Bezug auf die Frauenemanzipation nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geschuldet war, sei dahingestellt. Bähnisch selbst unterstreicht den Umstand, daß ihr ‚Fall‘ Aufsehen erregte, auch dadurch, daß sie 1972 schrieb, „Frau Dr. Lüders, eine berühmte Vorkämpferin der Frauenbewegung“ habe sich 1926 nach ihrem Amtsantritt bei ihr erkundigt, „ob ich auch gleichberechtigt behandelt würde und vor allem ob ich auch das gleiche Gehalt bekäme.“410 Alles in allem war das gesellschaftliche und politische Klima für berufstätige Frauen in der Weimarer Republik jedenfalls kein freundliches. Frauen, zumal in solchen Positionen, die einen intensiven kollegialen Austausch auf hohem Niveau erforderten, wurden prinzipiell als Eindringlinge in die (Berufs-)Welt der Männer wahrgenommen, strukturelle und persönliche Diskriminierungen prägten ihren Berufsalltag. „Wir gingen in den Lebenskampf und bewährten uns, soweit man sich, geduldet halb und halb gehaßt, bewähren kann“411, war in diesem Sinne 1933 in der ‚Frauentribüne‘ zu lesen. So verweigerten Krankenkassen Frauen die Zulassung von Kassenarztpraxen, Rechtsanwältinnen war der Notariatsberuf versagt und technische begabte Frauen hielt die Industrie von den verantwortlichen Stellungen weitgehend fern.412 Unter den fast 40 Prozent der Berliner Frauen, die in der Weimarer Zeit berufstätig waren, wurden die angestellten Frauen um etwa zehn Prozent, die Arbeiterinnen um
409 Sybill: Porträt einer Regierungspräsidentin, in: Hessische Nachrichten, 10.11.1948. 410 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Waiblingen, Autobiographisches Diktat von Theanolte Bähnisch, o. T., o. D. [1972], Teil I, Schwierigkeiten beim Dienstantritt als Regierungsassessor, S. 26. 411 Tergit, Gabriele: Die Frauen-Tribüne, in: Die Frauen-Tribüne, 1. Jg. (1933), Heft 1/2 [Januar 1933]. 412 Vgl.: Flemming, Jens: „Neue Frau“? Bilder, Projektionen, Realitäten, in: Faulstich, Werner (Hrsg.): Die Kultur der 20er Jahre, Göttingen 2008, S. 55–70, hier S. 66.
Sozialisation | 193
etwa 30 bis 40 Prozent schlechter als die Männer bezahlt.413 Die für Frauen ohnehin schon schwierige Lage verschärfte sich noch durch die Weltwirtschaftskrise 1929, als Frauenarbeit sich zu einem „Popanz der öffentlichen Meinung“414 entwickelte. Die ‚Doppelverdienerkampagne‘, inszeniert von Konservativen, heizte das negative Klima gegen erwerbstätige Frauen weiter auf, indem sie jede berufstätige Frau zur Diebin eines ‚Männer-Arbeitsplatzes‘ und damit des Unterhaltes einer Familie stempelte. Im Rahmen der ‚Personal-Abbauverordnung‘415 von 1923 war die recht gängige Praxis von Arbeitgebern, Frauen im Falle der Eheschließung zu entlassen, für den öffentlichen Dienst schon früh legalisiert worden. Widerstand gegen diese Praxis kam nicht nur aus den Reihen der bürgerlichen Frauenbewegung, sondern auch von Intellektuellen, Schriftstellerinnen und anderen Frauen in herausragenden Positionen. So verlieh die Redakteurin des ‚Berliner Tageblatts‘, Gabriele Tergit, wiederholt in Artikeln wie ‚Freundliches Frauengespräch über die Tötung eines Mannes‘416 ihrem Ärger über die frauenfeindliche Atmosphäre in allen Gesellschaftsschichten Luft. In anderen Artikeln beklagte dieselbe Autorin, die die Protagonistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung Gertrud Bäumer und Hilde Walter über das Pestalozzi-FröbelHaus kennengelernt und sich in dieser Denkrichtung scheinbar zunächst wohlgefühlt hatte, ab 1925 verstärkt, daß von der Bürgerlichen Frauenbewegung kaum Hilfe in Bezug auf die angeprangerten Nöte zu erwarten sei.417 1929, im Jahr der ‚Doppelverdiener-Kampagne‘, entschloß sich Tergit auf Anregung der Berliner Chirurgin Dr. Edith Peritz, dazu, gemeinsam mit anderen Frauen einen Club zu gründen, in dem berufstätige Frauen sich gegenseitig unterstützen sollten. Peritz hatte die Idee wiederum von ihrer Freundin Suzanne de Noël übernommen, die in Paris bereits einen solchen Club leitete. Nach französischem, amerikanischem und britischem Beispiel – denn auch dort waren solche Clubs bereits etabliert
413 Vgl.: Steiger, Karsten: Kooperation, Konfrontation, Untergang. Das Weimarer Tarif- und Schlichtungswesen während der Weltwirtschaftskrise und seine Vorbedingungen, Stuttgart 1998, S. 290. 414 Lowenthal-Hensel, Cécile: Frauen 1930 – Frauen 1980. 50 Jahre Soroptimismus in Deutschland, 50 Jahre Soroptimist-Club Berlin, in: Soroptimist intern. Mitteilungsblatt der Deutschen Union der Soroptimist-Clubs, Nr. 22, 1980, S. 1–7, hier S. 2. 415 Verordnung zur Herabminderung der Personalausgaben des Reichs, in: Reichsgesetzblatt 1923 I, 27.10.1923, S. 999. Die Verordnung wurde landläufig als ‚Personal-AbbauVerordnung‘ bezeichnet. 416 Tergit, Gabriele: Freundliches Frauengespräch über die Tötung eines Mannes, in: Berliner Tageblatt, 22.02.1927. 417 Vgl.: Brüning, Jens: Nachwort, in: ders.: (Hrsg.): Gabriele Tergit. Frauen und andere Ereignisse. Publizistik und Erzählungen von 1915 bis 1970, S. 213–217 sowie Ujma, Christina: Neue Frauen, alte Männer. Gabriele Tergits „Frauen und andere Ereignisse“, in: literaturkritik.de, Nr. 2, 01.02.2002, auf: http://www.literaturkritik.de/public/rezension. php?rez_id=4585, am 15.05.2014.
194 | Theanolte Bähnisch
worden418 – sollten sich Frauen auch im Berliner Club fortan über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Berufen austauschen können. Die ClubMitglieder sollten ein Publikum bilden, welches den Einzelkämpferinnen in ihrem Metier – denn das waren Frauen in herausgehobenen beruflichen Stellungen zumeist – gebührende Anerkennung zollt. Weitere Ziele des Clubs, der sich als ein ServiceClub, also als eine dem Dienst an der Gemeinschaft verpflichtete Einrichtung verstand, waren der internationale Austausch, besonders unter Frauen, die Unterstützung Bedürftiger und das aufklärende Wirken in der Öffentlichkeit für Frauen- und Menschrechte. Es scheint in der Natur der Ziele von Service-Clubs und im Prinzip, nach dem die Clubs ihre Mitglieder auswählen, zu liegen, daß sich in den Vereinigungen zu jener jeweils stadtbekannte Persönlichkeiten versammelten. Kapital spielte dabei trotz des wohltätigen Charakters der Clubs eine weniger wichtige Rolle als die Stellung der Personen in der Gesellschaft. Das Emblem der Soroptimistinnen wird von den ClubMitgliedern heute, bezugnehmend auf seine Ziele, wie folgt beschrieben: „Vor einem Hintergrund in Gold steht eine junge Frau mit erhobenen Armen, von Sonnenstrahlen umgeben, Symbol für den Geist des Soroptimismus, strahlend anderen zugewendet, Arme und Herz weit geöffnet. Die in der Girlande links abgebildeten Lorbeerblätter versinnbildlichen Sieg und Erfolg. Die Zweige mit Eicheln rechts stehen für die Stärke unserer Organisation.“419 Wie die ursprünglich rein männlichen ServiceClubs der Rotarier, der Lions oder der Kiwanis und der 1915 gegründete FrauenClub ‚Zonta‘ folgten und folgen auch die noch heute aktiven Soroptimistinnen dem Selbstauswahl-Prinzip ihrer Mitglieder. Dies bedeutet, daß die Aufnahme eines Bewerbers, der zunächst als Gast an Veranstaltungen teilnehmen darf, nur dann erfolgen kann, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung dazu geben. Um eine größtmögliche Streuung und Breite des Austauschs zu gewährleisten, soll in Service-Clubs generell jede Berufsgruppe nur einmal vertreten sein. „Meine Frau ist in einem Klub, wenn Goethe drin gewesen wäre, hätten sie Schiller nicht aufgenommen“420, zitiert Gabriele Tergit ihren Ehemann zu dieser Gepflogenheit. Die Frauenbewegung im 19. Jahrhundert hatte eine zentrale Bedeutung für die Entstehung von Service-Clubs in den USA gehabt. Denn in solchen Frauen-
418 Der erste Soroptimist-Club war am 03.10.1921 in Oakland, Kalifornien von Adelaide Goddard gegründet worden. 1924 wurden die Clubs in Paris und London eingerichtet. Vgl.: Schulte: Welt, S. 107. 419 Hegele, Irmintraut: Emblem der Soroptimisten. Festrede zur Charterfeier des SoroptimistClub, Landau am 03.07.2004, S. 1, zitiert nach: Gradinger, Sebastian: Service Clubs – zur Institutionalisierung von Solidarität und Sozialkapital, Diss. Universität Trier 2005, auf: http://ubt.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2006/374/, am 26.07.2009, S. 116. Für Edwin Biedermann unterstreicht die Farbkombination blau und gelb die Bedeutung der Symbole. Blau steht demnach für Stärke und Treue, gelb für das Licht. Vgl.: Biedermann, Edwin: Logen, Clubs und Bruderschaften, 2. Aufl., Düsseldorf 2007, S. 77–83, hier S. 77. Im Artikel lassen sich auch die aktuellen Clubstrukturen nachvollziehen. 420 Tergit, Gabriele: Etwas Seltenes überhaupt. Erinnerungen, Frankfurt a. M./Berlin/Wien 1983, S. 208.
Sozialisation | 195
Zusammenschlüssen war es jungen Frauen möglich gewesen, mit einem plausiblen Grund „die Enge des häuslichen Umfeldes zu verlassen, um in ihrer Gemeinde durch soziales Engagement eine öffentliche Rolle zu spielen“421, schreibt Sebastian Gradinger in seiner Studie über den Aspekt der institutionalisierten Solidarität in ServiceClubs. „Da es den Frauen damals nicht möglich war, im puren Eigeninteresse öffentlich aktiv zu werden, diente die gemeinnützige Orientierung, der Dienst an der Gemeinschaft – also ‚Service‘ – als Legitimation des öffentlichen Engagements“422, zitiert Gradinger die Professorin für Sozialpolitik Annette Zimmer. Anfang des 20. Jahrhunderts begann der Gedanke des gesellschaftspolitischen Auftrags solcher Frauen-Clubs eine zunehmende Rolle für die Club-Arbeit zu spielen. Durch Öffentlichkeitsarbeit und Auftritte prominenter Frauen, vor allem in Großstädten, versuchten die Clubs gesellschaftliche Reformen anzuschieben.423 Die Entstehung von Männer-Service Clubs wertet Gradinger als eine Reaktion auf die schon früher virulenten Bemühungen des anderen Geschlechts im Bereich der Wohltätigkeits-, Emanzipations-, und Bildungsarbeit, wobei sich die rein männlichen Clubs die Erfindung des ‚Service‘ aber zunächst auf die eigene Fahne geschrieben hätten.424 In der Berliner Dependance des 1921 in Kalifornien ins Leben gerufenen Soroptimist-Clubs fanden auch Theanolte Bähnischs Interessen und Überzeugungen bezüglich der Frauenberufstätigkeit ihren gesellschaftlichen Ort. Als eines der Gründungsmitglieder wird sie im Protokoll einer Sitzung vom 13.06.1929 als Mitglied des provisorischen Vorstands aufgeführt.425 In dieser Funktion erklärte sie sich in der nämlichen Sitzung bereit, die für den Club verfaßten Statuten „nach der juristischen und vereinstechnischen Seite hin zu überprüfen“426, ein Angebot, welches als weiteres Indiz dafür gewertet werden kann, daß sie in der Schöneberger Dependance des Polizeipräsidiums mit Vereinssachen beschäftigt gewesen sein könnte und ihre in diesem Zusammenhang sowie im Studium erworbenen Fähigkeiten in den Dienst des Clubs stellte. Aus dem Briefverkehr des Club-Mitglieds Irene Witte aus zu jener Zeit, der von den Soroptimistinnen in Auszügen veröffentlicht wurde, ist ersichtlich, daß sich die Berliner Soroptimistinnen in ihrer Club-Struktur und -organisation eng an den Rotariern orientierten.427 Baron von Gleichen aus dem Berliner Rotary Club beriet Witte
421 Gradinger, Sebastian: Service Clubs – zur Institutionalisierung von Solidarität und Sozialkapital, Saarbrücken 2007, S. 10. 422 Zimmer, Annette: Service-Clubs heute – Tradition und Perspektiven, in: Münsteraner Diskussionspapiere zum Nonprofit-Sektor, 3. Jg. (2002), Nr. 18, S. 5, zitiert nach: Gradinger: Service-Clubs, S. 10. 423 Vgl.: ebd., S. 12. 424 Ebd.. S. 13. 425 Vgl.: Gebhardt, Hertha von: Der Anfang, Nach Akten und Erinnerungen aufgezeichnet 1963, in: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist International Deutsche Union, Anfang und Fortgang 1930 bis 1990, Detmold o. J., S. 3–16, hier S. 10. 426 Theanolte Bähnisch, zitiert in: ebd. 427 Rita Pokorny wertet den Soroptimist-Club gar als weibliches Pendant zu den Rotariern. Vgl.: Pokorny: Rationalisierungsexpertin.
196 | Theanolte Bähnisch
wiederholt beim Aufbau und der Organisation des Frauen-Clubs.428 Die Pflege von Beziehungen zu Männer-Service Clubs scheint für Soroptimistinnen indes nicht ungewöhnlich gewesen zu sein: Zumindest vom Club New York ist bekannt, daß er ebenfalls gern Rotarier zu seinen Veranstaltungen einlud.429 2.3.2.2 Theanolte als prominentes Mitglied eines ungewöhnlichen Clubs In der Startphase des Berliner Soroptimist-Clubs gingen Irene Witte und die anderen Gründungsmitglieder zunächst auf Werbetour, um prominente Mitglieder zu akquirieren. Sehr bezeichnend für die Bedeutung von Service-Clubs als regionale Netzwerke war dabei die Strategie Wittes, mit der sie am 03.08.1929 die prominente Nationalökonomin Hilde Oppenheimer430, die zu dieser Zeit als ‚Oberregierungsrat‘ im Reichsarbeitsministerium tätig war, zu einem Empfang amerikanischer Frauen einlud. Witte versuchte Oppenheimers Bereitschaft zur Teilnahme an der Veranstaltung dadurch anzukurbeln, daß sie mit den anderen interessanten Frauen warb, die bereits an der Etablierung des Clubs mitarbeiteten oder ihren Beitritt angekündigt hatten: „In unserer Berliner Gruppe sind eine ganze Anzahl Frauen, die Sie kennen werden: Käte Rosenheim, die Übersetzerin Hirschberg […] Grete Ring wird wahrscheinlich beitreten, Thea Bähnisch vom Polizeipräsidium Schöneberg […]“. Sie schien also davon ausgegangen zu sein, daß Oppenheimer von Bähnisch wußte, was wiederum darauf schließen läßt, daß diese bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Berliner Gesellschaft, zumindest in Kreisen der Ministerialbürokratie erreicht hatte. Dementsprechend schien es nur folgerichtig, daß Bähnisch einem Zusammenschluß wie den Soroptimistinnen angehören sollte. Die Gründung des Berliner Clubs fand, zunächst als „Klub berufstätiger Frauen“ am 22.10.1929 statt.431 Am 13.01.1930 erfolgte schließlich die Aufnahme in den internationalen Verband ‚Soroptimist International‘. Zur Feier des Tages reiste die Chirurgin Madame de Noël aus Paris an, um einen Vortrag zu halten. Eine weitere Rednerin, Margarete Kaiser, sprach über ‚Das Berufsethos der Frau‘. Der Auftritt Kaisers als Rednerin ist insofern besonders interessant, als daß diese den Soroptimistinnen eine journalistische Plattform bot, auf der sich die einzelnen Mitglieder selbst vorstellen, in denen sie aber auch ihre Ideen über das Thema Frauenberufstätigkeit ver-
428 Vgl.: Gebhardt: Anfang, S. 11–13 und 25. 429 Vgl.: Käthe Böhm an Irene Witte, 28.12.1930, zitiert in: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist International Deutsche Union, S. 31. 430 Oppenheimer arbeitete 1918/19 im Demobilmachungsamt, von 1919 bis 1922 im Auswärtigen Amt und ab 1923 im Reichsarbeitsministerium. 1933 wurde sie aufgrund ihrer jüdischen Abstammung entlassen und floh 1934 nach Palästina. Todesdatum und -ort sind nicht überliefert. Vgl.: Art. „Oppenheimer(-Bluhm), Hilde“, in: Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik online, auf: http://www.bundesarchiv.de/aktenreichs kanzlei/1919–1933/0000/adr/adrmr/kap1_3/para2_24.html, am 15.05.2014. Im Auftrag des BDF hatte Oppenheimer 1918 eine Untersuchung mit dem Titel: Die Probleme der Frauenarbeit in der Übergangswirtschaft veröffentlicht. 431 Vgl.: Gebhardt: Anfang, S. 16.
Sozialisation | 197
breiten konnten.432 Davon machte auch Bähnisch Gebrauch.433 Als sie 1945 erste Überlegungen anstellte, eine Frauenzeitschrift herauszugeben434 und diese Idee schließlich 1948 in die Tat umsetzte, orientierte sich Bähnisch an der von Kaiser herausgegeben Zeitschrift. Die von Bähnisch herausgegebene ‚Stimme der Frau‘ und die von Kaiser herausgegebene Zeitschrift ‚Die schaffende Frau‘ weisen auffällige Ähnlichkeiten im Aufbau und in der Themenauswahl auf – zumindest was die ersten beiden Jahrgänge der ‚Stimme der Frau‘ angeht.435 Auch die Anwesenheit von Professor Carl Mennicke von der Hochschule für Politik auf der Gründungsveranstaltung des Clubs ist aufschlußreich. Mennicke lieferte einen Redebeitrag über die neue Kameradschaft zwischen den Geschlechtern436, aus dem zunächst einmal zweierlei deutlich wird: Erstens standen auch Männer dem Frauen-Club durchaus aufgeschlossen gegenüber, was nicht nur die Rednerschaft Mennickes, sondern auch die Tatsache, daß zu einigen Veranstaltungen auch männliche Besucher geladen wurden und den Einladungen folge leisteten, unterstreicht. Zweitens galt in gewissen höheren, liberalen Kreisen der Weimarer Republik Frauenberufstätigkeit eben nicht als lästig, sondern als zeitgemäß und die ‚Kameradschaftsehe‘ in der Mann und Frau sich privat wie beruflich gegenseitig unterstützen, als das Modell der Wahl. Die meisten Frauen, die sich im Club engagierten, waren
432 Margarete Kaiser gab von 1929 bis 1933 die Zeitschrift ‚Die schaffende Frau‘ heraus. Rita Pokorny zufolge erschien Zeitschrift monatlich im Mayo-Verlag Berlin. Der Name habe sich aus den Anfangssilben der Vornamen des Ehepaares Margarete und Joachim Kaiser zusammengesetzt, die Anschrift des Ehepaares sei auch die Verlags-Anschrift gewesen. Da sich der Verlag nicht im Adreßbuch des Deutschen Buchhandels findet, geht Pokorny davon aus, daß die Zeitschrift als Privatdruck herausgegeben und wahrscheinlich auch privat finanziert wurde. Vgl.: Pokorny: Rationalisierungsexpertin, S. 83, Anm. 151. Unklar ist, ob die von Aimée Köster bis 1925 in Dresden herausgegebene, gleichnamige Zeitschrift der Vorläufer der Berliner ‚schaffenden Frau‘ war. Eine Verbindung zwischen beiden Zeitschriften ist allein schon insofern naheliegend, als daß Aimée Köster in den ‚späten‘ schaffenden Frau die von ihr entwickelten Büstenhalter bewarb. Zu Aimee Köster vgl.: Wolf, Siegbert/Witkop, Milly/Barwich, Hertha/Köster, Aimée u. a. (Hrsg.): Der syndikalistische Frauenbund, Münster 2007. Der Ehemann Aimée Kösters, der Anarchosyndikalist Fritz Köster, war zunächst Redakteur der Magdeburger Volksstimme, später der ‚Tribüne‘ und der Zeitschrift ‚Der Pionier‘. Er gab die Tageszeitung der ‚Freien Arbeiter-Union Deutschlands‘ (FAUD) ‚Die Schöpfung‘ heraus, in der Artikel über syndikalistische Frauenbünde (wo sich auch Aimée Köster verortete), Erziehungs- und Siedlerprojekte sowie über den individualistischen Anarchismus erschienen. Vgl. dazu: Bock, Hans-Manfred: Anarchosyndikalismus in Deutschland. Eine Zwischenbilanz, in: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Heft 3/1989, S. 293–358. Siehe auch Kapitel 7.5.2. 433 Bähnisch: Staatsverwaltung. 434 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945. 435 Siehe Kapitel 7.5.2. 436 Vgl.: O. V.: Bei den Soroptimistinnen zu Gast, in: Vossische Zeitung, 15.01.1930, zitiert nach: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist, S. 21/22.
198 | Theanolte Bähnisch
verheiratet. Wie die Ehe für die Clubmitglieder der ‚Normalfall‘ gewesen war, so schienen es auch Scheidung und Wiederverheiratung gewesen zu sein: Viele der Frauen, mit denen sich Bähnisch im Club umgab, lebten in zweiter oder dritter Ehe.437 Daß ausgerechnet Mennicke auf der Veranstaltung zum Thema ‚Kameradschaftsehe‘ sprach, ist deshalb von besonderer Bedeutung für Bähnischs Biographie, weil Mennicke sich – wie Bähnisch selbst nach 1946 – zum Kreis der ‚religiösen Sozialisten‘ zählte und gemeinsam mit Paul Tillich dem ‚Kairos-Kreis‘ angehörte. Als Professor für Sozialpädagogik brach Mennicke, wenn man so will, eine Frauendomäne auf: Als Leiter des Seminars für Jugendwohlfahrt bot er eine, der Ausbildung an der ‚sozialen Frauenschulen‘ ähnelnde, Ausbildung für Männer an. Seine Schüler stammten mehrheitlich aus der Jugendbewegung. Möglich ist – auch wenn andere Soroptimistinnen Mennicke aufgrund ihrer Verbindungen in die Wohlfahrtarbeit ebenfalls als Redner angeworben haben könnten – daß der Kontakt zu dem Professor über Theanolte Bähnisch, respektive ihren Ehemann Albrecht Bähnisch zustande gekommen sein könnte. Denn beide Männer gehörten der SPD an, pflegten Kontakte zu den religiösen Sozialisten, engagierten sich in einem Projekt der bürgerlichen Sozialreform, der Sozialen-Arbeitsgemeinschaft Ost (SAG) und schrieben für die ‚Neuen Blätter für den Sozialismus‘. 1927 begann Mennicke allerdings sich vom Religiösen Sozialismus zu entfernen.438 Als Dependance des Internationalen Verbandes war der Berliner Club gezwungen, auch den offiziellen, internationalen Namen der Vereinigung zu tragen, was die Umbenennung am 31.01.1930 in ‚Soroptimist-Club Berlin – Klub berufstätiger Frauen‘ erklärt. Internationale Bekanntheit erfuhr die Existenz des ungewöhnlichen Berliner Clubs auch über seine Integration in den Soroptimist International-Club hinaus, beispielsweise durch die Medien. Die Journalistin Phyllis Lovell vom ‚Women‘s Movement Correspondent‘ fragte für einen Artikel, der in einer Serie über die internationale Stellung der Frau in der Berufs- und Geschäftswelt erscheinen sollte, auch bei den Berliner Soroptimistinnen an, ob sie deren Club besuchen und Photomaterial bekommen könne.439 Mit der prominenten Photographin Lotte Jacobi ‚an Bord‘ des Clubs war dies für Irene Witte eine leicht zu lösende Aufgabe, der die „Organisatorin im Kaufhaus N. Israel Berlin“440 überdies gern nachgekommen sein wird. Verei-
437 So hatte Ilse Langner in zweiter Ehe den um 16 Jahre älteren Physiker Werner Siebert zum Mann genommen, welchen nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Freundin Thea ‚Vati‘ nannte. Vgl.: DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 15.02.1946. Lotte Jacobi heiratete nach der Trennung von ihrem ersten Mann 1934 im Jahr 1940 ihren zweiten Ehemann. 438 Vgl.: Comou, H. C.: Art. „Mennicke, August Carl (1887–1959)“, in: Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000, auf: Historici.nl, http://www.historici.nl/ Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn5/mennicke, am 12.11.2013. Zu den Angaben über Albrecht Bähnisch vgl. die späteren Kapitel dieser Arbeit. 439 Vgl.: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist, S. 33/34. 440 Titelporträt Wittes in der Zeitschrift ‚Die schaffende Frau‘, 1. Jg., Heft 2, 1929, zitiert nach: Pokorny: Rationalisierungsexpertin, S. 77.
Sozialisation | 199
nigungen mit internationaler Ausrichtung waren, auch in einer „Zirkulationsmetropole der westlichen Welt“441 wie Berlin, keine Selbstverständlichkeit. Deutsche Frauenorganisationen hatten aufgrund der deutschen Rolle im Ersten Weltkrieg insgesamt kein leichtes Spiel in internationalen Organisationen. Um so interessanter ist es, daß Theanolte Bähnisch, nachdem sie bereits 1929 einem internationalen Frauenverband angehörte, 1951 auch die Aufnahme des von ihr gegründeten ‚Deutschen Frauenrings‘ (DFR) in die internationale Dachorganisation ‚International Council of Women‘ (ICW) erreichte. Schließlich war der Ruf Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust noch stärker als nach dem Ende des Ersten Weltkrieges diskreditiert. Auch nach der offiziellen Gründung des Soroptimist-Clubs Berlin gehörte Bähnisch weiterhin zum Vorstand. Gemeinsam mit der schreibenden Ärztin Elisabeth (‚Lizzi‘) Hoffa442 war sie die stellvertretende Vorsitzende des Clubs. Erste Vorsitzende, bzw. „erste Clubschwester“443 war Edith Peritz. Informell nannten sich die Berlinerinnen, deren offizieller Name aus dem Begriff ‚sorores optimae‘ – beste Schwestern444 – abgeleitet war nämlich „Klubschwestern“, was den Willen zur Ge-
441 Anselm, Sigrun: Emanzipation und Tradition in den 20er Jahren, in: dies./Beck, Barbara (Hrsg.): Triumph und Scheitern in der Metropole, 1987 Berlin, S. 253–274, hier S. 253, zitiert nach Pokorny: Irene M. Witte, S. 35. 442 Vgl.: Hoffa, Lizzie: Moderne Clubentwicklung, in: Schmidt-Beil, Ada: Die Kultur der Frau. Eine Lebenssymphonie der Frau des XX. Jahrhunderts, Berlin 1931, S. 510–513; dies: Der freiwillige Arbeitsdienst für Mädchen, in: Die Ärztin, 9. Jg. (1933), S. 19–35 sowie dies.: Der Zauberberg von Thomas Mann, in: Nordbayerische Zeitung, 24.08.1925. Hierin kritisiert Hoffa die negative Darstellung von Ärzten und Schwestern im ‚Zauberberg‘. Hoffa (1889–1988) mußte wegen ihrer jüdischen Abstammung aus dem Bundesvorstand des Ärztinnenbundes ausscheiden. Vgl.: Huerkamp, Claudia: Bildungsbürgerinnen. Frauen im Studien und in akademischen Berufen, 1900–1945, Göttingen 1996, S. 256. Hoffa war von 1930 Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Ärztinnen und 1930 Mitglied in der Ärztekommission des deutschen Schwimmverbandes. 1933 wurde ihr auf der Grundlage des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums die Kassenzulassung entzogen und sie wurde wegen ihrer Abstammung aus allen Ämtern entlassen. 1934 durfte sie nicht mehr praktizieren. Sie wanderte 1935 nach Großbritannien aus, eröffnete eine Massagepraxis in London und starb in Leeds. Vgl.: Seidler, Eduard: Jüdische Kinderärzte 1933–1945: Entrechtet, geflohen, ermordet, Freiburg 2007, S. 161. 443 Vgl.: Irene Witte an C. Mejers, Soroptimist-Club Amsterdam, zitiert nach: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist, S. 23. 444 Der Kunsthistorikerin Frida Schottmüller gefiel das elitäre Moment dieser Ableitung nicht. Sie schrieb an Emmy Hirschberg am 04.08.1930: „Eine Vereinigung wie die Soroptimisten hat den Nachteil, daß man sich selbst – um eintreten zu können – als besonders geeignete Vertreterin seines Faches fühlen muß, wobei freilich die Überzeugung tröstet, daß noch Geeignetere aus Zeitmangel oder anderen Gründen nicht in Betracht kommen. Jedenfalls ist die Ableitung von Optimist mir sympathischer als von Optima.“ Vgl.: Frida Schottmüller an Emmy Hirschberg, 04.08.1929, zitiert nach: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist, S. 15. Für Edwin A. Biedermann signalisiert die Ableitung sogar zweierlei: Erstens, die Versammlung der besten Frauen ihres Faches und
200 | Theanolte Bähnisch
staltung des Klub-Lebens als einen vertrauten, familiären Rahmen sowie zum Zusammenhalt unter den Mitgliedern unterstreicht. 2.3.2.3 Selbstverständnis des Clubs und Berufsstruktur seiner Mitglieder Eine parteipolitische oder konfessionelle Ausrichtung hatte der Club nicht. „Der unter den Schwestern im Klub herrschende Geist war ein bürgerlich-demokratischer, selbstverständlich gehörten Jüdinnen dazu“445, schreibt Monika Melchert in ihrer Biographie über das Club-Mitglied Ilse Langner. 1932 verzeichnete der Berliner Club über 40 Mitglieder, darunter verschieden spezialisierte Ärztinnen (Edith Peritz, die erste Präsidentin des Clubs, war Chirurgin, die Kinderärztin Lizzie Hoffa war als Stadtschulärztin tätig) und Juristinnen (neben Bähnisch gehörten die Rechtsanwältin Margarete Berent und die Patent-anwältin Freda Herzfeld-Hoffmann zu den Mitgliedern). Dies zeigt, daß die Formel ‚nur eine Vertreterin jeder Berufsgruppe‘ durchaus Auslegungssache war und daß vermutlich die eine oder andere engagierte und bekannte „Berliner Stadtberühmtheit“446 auch aufgenommen wurde, wenn dies nach strikter Auslegung der Regeln nicht hätte der Fall sein dürfen. Selbständige Frauen und Künstlerinnen, darunter eine Bildhauerin, eine Malerin und eine Graphikerin, prägten den Club ebenfalls stark. Schließlich schlugen sich insbesondere die neuen Berufsmöglichkeiten für Frauen, welche in der Mitarbeit an den unzähligen, in Berlin erscheinenden Zeitschriften und Zeitungen lagen, in der Berufsstruktur der Mitglieder nieder: Hilde Walter arbeitete als Redakteurin beim Berliner Tageblatt, einem Produkt des Mosse-Konzerns, Ilse Langner schrieb zunächst für die Scherl-Presse, später für Ullstein447. Gabriele Tergit, die mit bürgerlichem Namen Elise Reifenberg hieß, aber seit ihrer Studienzeit unter einem Pseudonym auftrat, lieferte Beiträge an die ‚Weltbühne‘, die ‚Berliner Zeitung‘, die ‚Vossische Zeitung‘ und die ‚Dame‘, während Lotte Jacobi für den Bildjournalismus auf Photo-Tour ging.448 Bewerberinnen, die als Gäste an den Veranstaltungen des Clubs teilnehmen wollten, gab es in ausreichender Zahl, was zeigt, daß einige Berlinerinnen durchaus eine Notwendigkeit in der Einrichtung eines solchen Clubs sahen. Zu den Gästen einer
445 446 447
448
zweitens, den Einsatz des Clubs dafür, das Beste für Frauen zu erreichen. Vgl.: Biedermann: Logen. Schulte: Welt, S. 107. So bezeichnet Rita Pokorny einige der Mitglieder des Clubs. Vgl.: Pokorny: Rationalisierungsexpertin, S. 34. Ilse Langner war seit 1927 Mitarbeiterin des Scherl-Verlags, dem sie sich durch Rezensionen und feuilletonistische Artikel empfohlen hatte, welche sie zuvor in freier Mitarbeiterschaft für den Verlag verfaßt hatte. Der Verlag gehörte zum Hugenberg-Konzern, der in seinen Zeitungen, wie die Langner Biographin Birgitta Schulte festhält, „die[…] Republik und ihre repräsentativen Einrichtungen bekämpften.“ (Schulte: Ich möchte die Welt hinreißen, S. 99.) 1929 erfolgte der Umschwung: Langner begann für das Magazin ‚Tempo‘ bei Ullstein zu schreiben und schon wurden aus den Theater-Rezensenten der Scherl-Presse Langners schärfste Kritiker. Vgl.: ebd. Ebd., S. 107.
Sozialisation | 201
Veranstaltung am 22.11.1932 zählte auch Charlotte Kraemer, die Direktorin der Rotophot-Verlags-GmbH und Ehefrau des bekannten Industriellen Hans Kraemer.449 Weitere, namentlich nicht näher bekannte Gäste an diesem Tag waren: Eine Fürsorgeschwester, eine Professorin der Biologie, eine Bibliothekarin, eine Ballettmeisterin, eine Schauspielerin, eine Rundfunkkritikerin, eine Tonfilm-Cutterin und eine Silhouetten-Schneiderin.450 Besonders reizvoll schien es für die Bewerberinnen wie für die Mitglieder gewesen zu sein, daß sie sich im Club fast ausschließlich unter Akademikerinnen und anderen gebildeten Frauen bewegenund dabei in verschiedenste Lebenswelten hineinschnuppern konnten. Der Ilse Langner Biographin Birgitta Schulte zufolge traf man sich dazu im Hotel Kempinski oder im Haus Vaterland am Potsdamer Platz451 und hielt durchaus etwas auf sich und sich selbst für „die feinere Gesellschaft emanzipierter Frauen“452. Die Club-internen Veranstaltungen fanden jeden Dienstag statt, immer im Wechsel ein Treffen mittags und ein Treffen abends. Aus den Korrespondenzen Wittes geht hervor, daß zumindest in der ersten Zeit Treffen in Hahnen‘s Konditorei am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg – also nah an Bähnischs Arbeitsort – stattgefunden hatten.453 Den Briefen ist außerdem zu entnehmen, daß die Veranstaltungen mal formeller – mit Vorträgen zu verschiedenen Berufen, Kostproben aus dem Schaffen vor allem der künstlerisch tätigen Frauen im Club und Diskussionen über frauenpolitisch relevante Themen –, mal informeller – mit einer mehr oder weniger großen Anzahl an Gästen abliefen. Auf das leibliche Wohl der Gesellschaft schien dabei großer Wert gelegt worden zu sein.454 Bei ihren ‚Teestunden‘ setzten die Berliner Soroptimistinnen auf gemischte Gesellschaften: 1930 hatten sich Gabriele Tergit zufolge auf einer Club-Veranstaltung zu Ehren des Besuchs der ‚Vereinsmutter‘, Madame de Noël, 200 Frauen und 50 Männer versammelt. Daß neben allem Austausch dabei auch das ‚Sehen und Gesehen werden‘ nicht zu kurz kam, wollte Tergit in ihrem Artikel in der überregional verbreiten und angesehenen ‚Vossischen Zeitung‘, einem Organ des liberalen Bürgertums, gar nicht verhehlen: „[M]an hat sich großartig amüsiert, wahrscheinlich besonders gut, wenn man eine Frau war; denn dann ging einem das Herz auf, was das für ein Staat ist mit diesen modernen Frauen. Wie hübsch sie sind, wie elegant und wie gescheit, und wenn sie gar nicht hübsch sind, dann sind sie immer noch
449 Vgl.: Schulte: Welt, S. 107. Vgl. auch Art.: „Kraemer, Charlotte“, in: Degeners Wer ist’s, 10. Ausgabe, Berlin 1935 sowie Eifert, Christiane: Deutsche Unternehmerinnen im 20. Jahrhundert, München 2011, S. 167. Charlotte Kraemer war die Ehefrau des Industriellen, Regierungsberaters und Schriftstellers Hans Kraemer. Nach der ‚Arisierung‘ des Unternehmens verstarb der jüdisch-stämmige Hans Kraemer 1938 an Krebs. Charlotte Kraemer wanderte im gleichen Jahr in die USA aus. Vgl.: Text-Auszug aus Krenz, Detlef: Die Goldene Meile – das Exportviertel Ritterstraße, auf: http://www.postkartenarchiv.de/ross-rotophot-und-film-sterne-verlag.html, am 27.08.2014. 450 Vgl.: Schulte: Welt, S. 107. 451 Ebd. 452 Ebd. 453 Vgl.: Gebhardt: Anfang, S. 11. 454 Vgl.: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist, S. 10–47, passim.
202 | Theanolte Bähnisch
hübsch, weil sie so gescheit aussehen, und wenn sie gar nicht elegant sind, dann sind sie immer noch elegant, weil sie sicher sind in ihrem Auftreten, befriedigt von Tätigkeit und Arbeit, oder befriedigt vom Suchen und Streben und Weiterwollen oder befriedigt vom Sichquälen.“455 Außer Frage steht, daß für alle dem Club angehörenden Frauen der Beruf, mitunter auch das ‚Sichquälen‘, einen zentralen, wenn nicht den wichtigsten Lebensinhalt überhaupt darstellte. Anders als die Assessorin Bähnisch standen einige Frauen zu dieser Zeit bereits auf dem Zenit ihrer Karriere und leisteten, auch was ihr Selbstmarketing über Einrichtungen wie den Soroptimist-Club betraf, Erstaunliches. Bei – oder eben auch wegen – aller Kritik an der Diskriminierung von Frauen sah Gabriele Tergit, die 1931 mit dem Roman ‚Käsebier erobert den Kurfürstendamm‘ schlagartig berühmt wurde, nicht nur die Zeit der Frauen, sondern auch die Zeit weiblicher Zusammenschlüsse gekommen: „Wenn man denkt, wie solch ein Klub vor zwanzig Jahren ausgesehen hätte. O Gott, wieviel Protest und wie viel innere Unsicherheit und wie viel Krampf und wie viel Gemöchte.“456 Als „Frauenversammlung“, der in Tergits Wahrnehmung offenbar sowohl ein kämpferischer, als auch ein krampfhafter Aspekt innezuwohnen scheint, wollte die Autorin die internen Veranstaltungen der Soroptimistinnen nicht betrachtet wissen. Von einer „Versammlung von Frauen“457 zu sprechen erschien ihr passender. „Die elegante Frau dort oben kennt keine Rivalitätsgefühle. Sie liebt die Frau, weil sie ist wie sie selber, weil sie kennt [!] und versteht die enttäuschte Liebe, das geplagte Herz, die Konflikte als Tochter, als Schwiegermutter, als Frau, als Mutter und als Geliebte“, verleiht Tergit ihren Glauben an einen Zusammenhalt von Frauen, der aus gemeinsamer Erfahrung der – wohlgemerkt ‚eleganten Frau dort oben‘ resultiere, Ausdruck. Sie schließt: „Die Männer sind die gleichen geblieben […] geändert hat sich überall in allen Ländern der Menschheit ein anderer Teil, die Frau“458 – womit sie nicht mehr nur die ‚elegante Frau‘, sondern alle Frauen ins Visier nimmt. In einigen anderen Ländern schienen die Frauen dabei noch fortschrittlicher gewesen zu sein, als in Deutschland. Bei allem Zugzwang unter den die Deutschen Soroptimistinnen dadurch gerieten, waren die Amerikanerinnen für die Wahrnehmung Irene Wittes allerdings schon zu fortschrittlich459 – ein Bild, wie es sich in der Tendenz auch nach
455 Tergit, Gabriele: Sorores optimae, in: Berliner Tageblatt, 22.01.1930, auch abgedruckt in: Brüning: Gabriele Tergit, S. 143–145. 456 Ebd. 457 Vgl.: ebd. 458 Ebd. 459 „Ich kann mir nicht helfen, jedesmal, wenn ich dieses Material [ausländischer Soroptimist-Clubs] durchsehe, habe ich das Gefühl, daß wir, über unseren engsten Kreis hinaus, zu wenig tun, und wenn auch das amerikanische Tempo sicherlich das andere Extrem ist, so müßte es doch bestimmt einen goldenen Mittelweg geben.“ Irene Witte an Lizzie Hoffa, 01.01.1932, zitiert nach: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist, S. 40.
Sozialisation | 203
dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Bähnischs ‚Stimme der Frau‘ feststellen läßt.460 2.3.2.4 Ilse Langner: Eine enge Vertraute Bähnischs aus dem Kreis der Soroptimistinnen Birgitta Schulte beschreibt den Soroptimist-Club als einen „Club der Frau Emmas“461 und spielt damit auf das erste Bühnen-Stück eines Club-Mitglieds, der Dramatikerin und wohl engsten Freundin Theanoltes, Ilse Langner, an. Die Freundschaft zwischen den beiden Frauen, aber auch der im Kontext der Zeit besonders interessante, exemplarisch für die selbst gewählte Rolle der Soroptimistinnen in der Gesellschaft stehende Gehalt von Langners Schaffen, laden zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit der von Alfred Kerr als „Penthesilea Langnerin“462 bezeichneten Dramatikerin ein. Die Identifikation mit den Zielen und Mitgliedern des Soroptimist-Clubs schien für Bähnisch durch die Pflege der Freundschaft mit Langner eine nachhaltige, über die am Ende doch kurze gemeinsame Zeit im Club hinausreichende Intensivierung und Vertiefung erfahren zu haben. Allerdings erschöpfte sich der Austausch der Frauen bei weitem nicht in der Thematisierung der Club-Zusammenhänge und -ziele, auch nicht in der Auseinandersetzung mit der Thematik ‚Frau und Gesellschaft‘, wenn dieses Thema auch immer eine zentrale Konstante der Freundschaft bleiben sollte. Im Folgenden soll ein Einblick in die Ideenwelt Langners im Kontext ihrer Zeit gegeben werden. Dabei wird deutlich werden, wie die beiden Frauen, vor allem in den frühen Jahren ihres Schaffens, aufeinander und auf die gemeinsamen Interessen Bezug nahmen. 2.3.2.4.1 Frauen auf dem Weg zu neuem Selbstverständnis – Grund- und Stolperstein der Karriere Langners Ilse Langner hatte mit ihrem ersten Drama ‚Frau Emma kämpft im Hinterland‘463 die veränderte Selbstwahrnehmung von Frauen, die aus den Kriegserfahrungen resultierte, thematisiert und die in diesem Kontext auftretenden persönlichen und partnerschaftlichen Probleme auf die Bühne geholt. In Abwesenheit ihrer Ehemänner, Väter und Brüder waren die Frauen weitgehend auf sich allein gestellt und hatten dadurch an der ‚Heimatfront‘, beziehungsweise dem ‚Hinterland‘, wie Langner es nennt,
460 Siehe Kapitel 7.1.5. 461 Schulte: Welt, S. 107. 462 Vgl.: Melchert, Monika: Besprechung zu: Schulte: Welt, in: Freitag, 09.06.2000, auf: http://www.lyrikwelt.de/rezensionen/ichmoechtediewelt-r.htm, am 22.08.2009. 463 Vgl.: Staub, Kurt (Hrsg.): Ilse Langner. Frau Emma kämpft im Hinterland. Chronik in drei Akten, Darmstadt 1979. Die anderen Trümmerdramen Langners wurden erstmals veröffentlicht in: Langner, Ilse: „Von der Unverwüstlichkeit des Menschen“, Dramenzyklus, hrsg. von Melchert, Monika, Berlin 2002. Im Band der ambitionierten Reihe „Spurensuche. Vergessene Autoren wiederentdeckt“ sind insgesamt drei ‚Trümmerdramen‘ Langners enthalten: ‚Carneval, ‚Ein Berliner Trümmerstück‘ und ‚Angst‘. Das Stück ‚Heimkehr‘ war bereits 1983 veröffentlicht worden, ist jedoch wegen seiner Bedeutsamkeit mit in den von Melchert editierten Zyklus mit aufgenommen worden.
204 | Theanolte Bähnisch
zwangsläufig zu einem zwar brüchigen, doch neuen Selbstbewußtsein gefunden. Die Protagonistin des Stücks, Frau Emma, ist, als der Ehemann aus dem Krieg zurückkehrt, nicht bereit von ihrer neuen Rolle als zupackende, allein überlebensfähige Frau wieder abzurücken. Sie will, wie in der Kriegszeit, berufstätig bleiben464 und weiterhin für sich selbst entscheiden, auch was den Umgang mit ihrem Körper betrifft. 1929, im gleichen Jahr wie Fritz Wolfs ‚Cyankali‘ und zwei Jahre vor Irmgard Keuns ‚Gilgi‘ erschienen, thematisiert, man ahnt es schon, auch Langners Stück die Abtreibungsfrage und damit den berühmt gewordenen Paragraphen 218, der längst zu einem Symbol der sozialen Krise in der Weimarer Republik avanciert war.465 In Langners Drama siegt ‚Frau Emma‘ schließlich über den eigenen Gatten und die von Langner als überlebt dargestellten moralischen Grundsätze: Der Ehemann ist einsichtig und akzeptiert sogar das Kind des anderen Mannes, von dem seine Frau während seiner Abwesenheit ungewollt schwanger geworden war.466 ‚Frau Emma‘ darf als das erste Antikriegsstück aus weiblicher Perspektive gelten. Es transportierte also gleichzeitig eine emanzipatorische und eine pazifistische Botschaft und war zudem noch autobiographisch beeinflußt, denn Langner, die 1928 nach der Trennung von ihrem ersten Ehemann467 nach Berlin gekommen war, hatte die Schrecken des Krieges am eigenen Leib erfahren. Alfred Kerr, der große Kritiker der 1920er Jahre, so schreibt Birgitta Schulte, habe den Feminismus in Langners Stück „wohl bemerkt, das Talent aber trotzdem gerühmt“.468 Besonders bekannt ist Langner, deren Karriere der Aufstieg der Nationalsozialisten ein jähes Ende gesetzt hat – ein Schicksal, das sie mit vielen anderen Soroptimistinnen teilte – heute nicht. Dabei war sie 1929 durch die Uraufführung von ‚Frau Emma‘, am 04.12.1929 im Theater unter den Linden „mit einem Schlag“469 bekannt geworden. Am 05.11.1931 war ein zweites Stück Langners, ‚Die Heilige aus USA‘, von Max Reinhardt im Theater am Kurfürstendamm aufgeführt worden. Damit war für Ilse Langner der Traum eines jeden jungen Theaterautors der Weimarer Republik in Erfüllung gegangen: Wer von Reinhardt inszeniert wurde, mußte eine große Bühnen-Hoffnung sein. Mit Hilfe der Schauspielerin Agnes Straub war es Langner gelungen, das Stück über Mary Baker-Eddy, der Gründerin der Christian ScienceBewegung, einer Figur öffentlichen Interesses, die gerade erst Gegenstand eines Essays von Stefan Zweig geworden war, durchzusetzen. Nicht zuletzt die Musik Ernst
464 Vgl.: Langner: Unverwüstlichkeit, S. 26. 465 Vgl.: Rehse, Birgit: „Dein Körper gehört Dir!“ Ärztinnen klären über Geburtenregelung auf, in: Bock, Petra/Koblitz, Katja (Hrsg.): Neue Frauen zwischen den Zeiten, Berlin 1995, S. 112–128, hier S. 116 sowie zur literarischen Verarbeitung: Schüller: Zerstreuung, S. 134–139. 466 Vgl.: Melchert: Dramatikerin, S. 28. 467 Herta von Gebhardt, ebenfalls Mitglied bei den Soroptimistinnen, hatte laut Melchert Langners Trennungsentschluß unterstützt. Vgl.: ebd., S. 16. Die beiden Frauen müssen sich also schon vor der Gründung des Clubs gekannt haben. 468 Schulte: Welt, S. 9. 469 Melchert: Dramatikerin, S. 21.
Sozialisation | 205
Tochs, „die den teuflischen Jazz immer wieder anders spielte“470, machte aus dem Drama Langners und der Inszenierung Reinhardts einen Skandal und die Künstler berühmt. Die Dramaturgin, die Schauspielerin der Hauptrolle und der Intendant erhielten eine Anzeige wegen Gotteslästerung. Eine bessere Werbung hätte sich das Dreigespann kaum wünschen können. ‚Heimkehr‘, ein drittes Stück Langners, wollte die Nummer zwei unter den namhafteen Intendanten der Weimarer Republik, der Begründer des ‚politischen Theaters‘, Erwin Piscator471, in den 1950er Jahren auf den Bühnen des Dramatic Workshop in New York aufführen. Dort hatte er sich nach einigen Jahren Aufenthalt in der Sowjetunion und in Frankreich niedergelassen.472 Doch weil er als bekennender Kommunist unter McCarthy verfolgt wurde, sah er sich gezwungen, 1951 nach Deutschland zurückzukehren, wo er ‚Heimkehr‘ immerhin als Hörspiel für den NWDR realisieren konnte. Der Generaldirektor des Senders, Adolf Grimme, könnte darauf fördernd eingewirkt haben, denn er war mit Langner befreundet.473 Die Jahre 1948 bis 1952 bedeuteten für Ilse Langner, nachdem 1937 noch ihr Stück ‚Der Mord in Mykene‘ in Gera aufgeführt worden war, ein kurzes Revival. Während des Krieges war ihr „Schreibtischarbeit unmöglich“474 geworden, weil, so schrieb sie, „Bombeneinschläge“ die Stunden „skandierten“475. Den Weg auf die Bühne fanden ihre neuen wie auch ihre älteren Stücke jedoch vor ihrem Tod nicht mehr. Johannes R. Bechers ‚Aufbau-Verlag‘, der den Gedicht-Band Langners ‚Zwischen den Trümmern‘, die Antiken-Adaptionen ‚Iphigenie kehrt heim‘ und ‚Klytemnestra‘ 1948 und 1949 veröffentlicht hatte, druckte auch ‚Heimkehr‘. Doch mit der Verschärfung des Kalten Krieges riß die Verbindung zwischen der in Westdeutschland lebenden Autorin, in deren Stücken immer zeitgenössische und historische Frauenfiguren im Vordergrund standen, und dem in der DDR beheimateten Verlag gänzlich ab. Damit war die Karriere Langners in drei Schritten drei verschiedenen politischen Systemen und Weltanschauungen zum Opfer gefallen.
470 Bie, Oskar, in: Breslauer Nachrichten, 10.11.1931, zitiert nach Schulte: Ich möchte die Welt hinreißen, S. 111. 471 Sein finanzielles Scheitern in Berlin quittierte er mit seiner Ausreise 1931 in die Sowjetunion, wo er für die russische Filmfirma Meshraprom tätig war und ‚Die Fischer von Santa Barbara‘ drehte. 1933 konnte er als bekennender Kommunist nicht in das mittlerweile nationalsozialistisch regierte Deutschland zurückkehren. Er wählte die Sowjetunion als erstes Exil, bevor er 1936 nach Paris und 1939 in die USA ging. 472 Vgl.: Melchert, Monika: Über den Dramenzyklus, auf: http://www.Trafoberlin.de/389626-382-X.html, am 24.07.2009, S. 11. 473 DLA, A: Langner, Nachtrag 1966–1999, Josefine Grimme an Ilse Langner, 20.12.1956. 474 Langner in ihrem Tagebuch, zitiert nach: Melchert: : Dramenzyklus, S. 12. 475 Vgl.: ebd.
206 | Theanolte Bähnisch
2.3.2.4.2 Kämpferinnen und kriegsmüde Frauen – Ilse Langner zwischen modernen und antiken Frauengestalten und in der Sicht Theanoltes „Schwestern für’s Leben“476 habe Langner im Club gefunden, schreibt Birgitta Schulte, wofür sie Gabriele Tergit und Edith Peritz als Beispiele nennt. Die Freundin Theanolte, die wie sie selbst 1899 als Tochter eines Lehrers in Oberschlesien geboren und damit ebenso wie Langner unter den meist viel älteren Frauen ein ‚Küken‘ im Club war,477 findet in der Langner-Biographie Schultes, die vor allem die Verbindungen Langners mit anderen Schriftstellerinnen thematisiert, keine Erwähnung. Es ist wahrscheinlich, daß die beiden Frauen sich erst im Club kennengelernt hatten, von wo aus ihre Freundschaft sich langsam, aber nachhaltig intensiviert hat. Dies läßt sich insbesondere an der Entwicklung der Grußformeln im Briefverkehr der Beiden nachzuvollziehen. Ilse Langner entwickelte sich über die Jahre zu einer wichtigen Stütze und zu einer der engsten Vertrauten Bähnischs. Der Gedankenaustausch der Freundinnen ist durch einen Briefverkehr bis 1965, also bis zur Pensionierung Bähnischs, neun Jahre vor ihrem Tod, überliefert. Ob die Frauen über diese Zeit hinaus noch Kontakt hatten, ist nicht bekannt, aber nicht unwahrscheinlich, zumal Bähnisch zu jener Zeit trotz fortgesetzter politischer Aktivität mehr Zeit zum Reisen und um Besuch zu empfangen, gehabt haben dürfte. Als Bähnisch 1973 starb, müßte sich die reisebegeisterte Ilse Langner noch auf ihrer einjährigen Tour durch Asien befunden haben.478 In den Briefen Bähnischs an Langner wird deutlich, wieviel Respekt sie ihrer Freundin Ilse, die sie unter anderem mit „liebste beste Ichi“479 anschrieb, entgegenbrachte und wie sehr sie am künstlerischen Schaffen und Fortkommen der Schriftstellerin interessiert war. „Bitte laß mich mehr wissen von dem, was Du jetzt schreibst. Was macht Deine weltanschauliche Ausarbeitung? Beschäftigst Du Dich noch mit dieser Gedankenwelt oder suchst Du Deine Probleme augenblicklich in Deiner Umwelt?“480, schrieb Bähnisch in diesem Sinne 1946 an Langner. Die Schriftstellerin, die doch vielmehr Dramatikerin sein wollte, bat ihre Freundin Theanolte wiederum, Unveröffentlichtes zu lesen, bevor sie es für druckfertig erklärte481. Sie schätzte also den Rat der Juristin, was vor allem aus dem gemeinsamen Interesse an der Stellung von Frauen in der Gesellschaft resultierte. „Frauen, Frauen, Frauen möchte ich auf die Bühne bringen, doch leider sind die Theater zu dieser Art Stücke noch nicht zu bekehren; die moderne Frau als Komödie oder Tragödie ist von Dra-
476 Schulte: Welt, S. 107. 477 Cécile Lowenthal-Hensel zufolge waren die Clubmitglieder die „um 1930 bereits eine gewisse Rolle spielten, eine bestimmte berufliche Position erlangt hatten“ zwischen 35 und 55 Jahren alt. Lowenthal-Hensel: Frauen. 478 Vgl.: Melchert: Dramatikerin, S. 230. 479 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Theanolte Bähnisch, Bähnisch an Langner, 15.02.1946, Nr. 87.5.324/15. 480 Ebd. 481 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 03.09.1936.
Sozialisation | 207
maturgen eben noch nicht entdeckt worden“482, schrieb Ilse Langner einmal frustriert über ihre mangelnden Möglichkeiten auf der Bühne an ihren schlesischen Landsmann Alfred Kerr. Womöglich nicht zuletzt aus dieser ernüchternden Einsicht heraus widmete sie sich in den folgenden Jahren vermehrt historischen Frauenfiguren. Die Freundin Bähnisch – zu jener Zeit siezte man sich jedoch noch – zeigte sich vollends überzeugt von Langners Tun: „Ich bin begeistert, äußerst begeistert! […] Wie wahr ist das alles. Sie haben das Drama unserer Generation geschrieben“483, urteilte Bähnisch am 19.02.1936 über Langners revidierte Fassung der ‚Amazonen‘.Sie lobte, daß die Dramatikerin ihre Hauptfigur, die Amazonen-Königin Penthesilea, als eine Frau zeichnet, die „groß und königlich bleibt und zu sich selber steht. Wer steht zu sich selbst, wenn er erkennt, daß er dafür alles […] Glück opfern muß?“, schlug Bähnisch die Brücke von der fiktionalen Welt der Literatur in die Realität und hatte die Antwort auf ihre Frage schon parat: „Nur Ausnahmemenschen“484: Die Prüfungen, denen sich Langners antike Frauengestalten in ihrer Fiktion unterziehen mußten, ihre Irritationen, ihre Ängste, ließen sich – und eben dies war Langners Absicht – übertragen auf die Nöte, Ängste und Herausforderungen, mit denen berufstätige Frauen, so auch die Freundin Bähnisch, in der Weimarer Republik konfrontiert waren und mit denen sie – in der Überzeugung der meisten Soroptimistinnen – nicht trotz, sondern Kraft ihres Geschlechtes fertig werden sollten. Gerade die Unterschiedlichkeit der Geschlechter war es, welche Langner betonte und aus der sie die Stärke der Frauen ableitete. „Im Irdischen leistet das Überpersönliche nur, wer stark und entschlossen in seinem Ich und seinem Geschlecht verharrt“485, erklärte die Dramatikerin in diesem Zusammenhang auch noch Jahre nach dem Höhepunkt ihres Schaffens, 1958 in der ‚Zeit‘. Frauen, die mit List und Tücke, mit Waffen und Mord, in Langners Deutung dem Repertoire der Männer, arbeiten, sind, das lehrt die Komödie ‚Amazonen‘, ebenso dem Verderben ausgeliefert wie die Männer. Der Amazonenstaat als politisches Utopia der Frauen, die Idee des Mutterrechts und der Gedanke, daß Frauen in der Antike vermutlich höher geachtet worden waren,486 war auch Thema anderer Autorinnen der Zeit wie Bertha Eckstein-Diener, die unter dem Pseudonym ‚Sir Galahad‘ 1932 ihr Werk ‚Mütter und Amazonen. Liebe und Macht im Frauenreich‘ verfaßt hatte. Mathilde Vaerting, die später eine Professur für Pädagogik in Jena bekommen sollte, hatte schon 1921 unter Zugrundelegung desselben antiken Motivs ihr Werk ‚Frauenstaat und Männerstaat. Neubegründung der Psychologie
482 Undatierter Brief Langners an Alfred Kerr. Auszugsweise abgedruckt in: Melchert: Dramatikerin, S. 35. 483 Die ‚Amazonen‘ waren 1933 fertiggestellt und im gleichen Jahr verboten worden. Langner arbeitete das Stück bis 1939 immer wieder um. Zu einer Aufführung der ‚Amazonen‘ kam es nie. Veröffentlich ist ‚Amazonen‘ in: Langner, Ilse: Dramen II, hrsg. von Schulz, Günther Eberhard, Würzburg 1991, S. 9–100. 484 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 03.09.1936. 485 Langner: Regierungspräsident. 486 Vgl.: Schulte: Welt, S. 119. Melchert nennt auch Elisabeth Langgässer als prominentes weibliches Beispiel für die Auseinandersetzung mit den Amazonen.
208 | Theanolte Bähnisch
von Mann und Weib‘ publiziert. Sicher ist, daß Langner mit Vaerting in Kontakt stand und daß sie Eckstein-Dieners Werk gelesen hatte.487 Während Langners ‚Frau Emma‘ 1929 des Kämpfens durchaus müde war und sich nichts mehr als Harmonie wünschte, die freilich für sie in der Akzeptanz ihrer neu gewonnenen Selbständigkeit durch den Gatten lag, zeichnet Langner ihre Amazonen, die 1933 auf die Bühne gebracht werden sollten, als nimmermüde Kämpferinnen: „Amazonen überspringen 3000 Jahre Männerherrschaft und stehen vor uns unverändert. Jung kämpferisch, schimmernd von Sieg und Glorie.“488 Am Vorabend der ‚Götterdämmerung‘ bringt Langner damit noch einmal ihre Hoffnung zu Papier, daß die Frauen sich endlich ihrer Stärke bewußt werden und dementsprechend handeln würden. Zur ursprünglich für den April 1933 im Theater in der Nürnberger Straße geplanten Aufführung der ‚Amazonen‘ kam es jedoch nicht. Während Birgitta Schulte schreibt, das Stück sei kurz nach der Einrichtung des Reichministeriums für Volksaufklärung und Propaganda am 13.03.1933 von den Nationalsozialisten verboten worden489, war es der Schilderung Melcherts zufolge Langner selbst, die das Drama zurückzog, weil sie die Zeit für „nicht passend“490 hielt. Es liest sich, als hätte Langner 1933, wie so viele ihrer Zeitgenossen, die negative Dynamik der aufstrebenden nationalsozialistischen Weltanschauung noch unterschätzt. In den ‚Amazonen‘ kritisiert sie das Frauenbild der NS-Ideologie mit seinem Mutterkult. Gleichzeitig deutet sich in ihrem Stück an, was das Jahr 1933 einläutete: das Ende der unabhängigen und selbständigen ‚Neuen Frau‘, wie sie in der Weimarer Republik als ‚Kameradin des Mannes‘ erdacht worden war. Die Stunde der ‘Frau, die erst kommen wird‘491, war mit dem Anbruch des ‚tausendjährigen Reiches‘ auf unbestimmte Zeit verschoben. Es scheint, als hätte sich Theanolte Bähnisch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nachdem zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre ‚Frau Emmas‘ die Geschicke des Landes in Abwesenheit vieler Männer wesentlich mitgestaltet hatten – obwohl die NS-Ideologie ihnen zunächst andere Rollen zugedacht hatte – an die Werke ihrer Freundin Ilse erinnert. In der von ihr publizierten Zeitschrift zog die Regierungspräsidentin 1948 Verbindungen zwischen den Frauengestalten der griechischen Mythologie und den realexistierenden Frauen in den vier Besatzungszonen Deutschlands. So ließ sie in der ‚Stimme der Frau‘ stellvertretend für alle deutschen Frauen, die auf die Heimkehr ihrer Männer aus dem Krieg hofften, die Gattin Odysseus‘, Penelope, auf die Rückkehr des Auserwählten warten.492 Und Iphigenie, die
487 488 489 490
Vgl.: ebd., S. 121 und Melchert: Dramatikerin, S. 50. Vgl.: Schulte: Welt, S. 31 und 52. Vgl.: ebd., S. 113. Langner habe „bis zum Herbst“ warten wollen, um zu sehen, wie sich die politische Lage entwickle und wie die Anordnungen des Propagandaministeriums aussehen würden. Melchert: Dramatikerin, S. 66. 491 ‚Die Frau, die erst kommen wird‘ lautet, in Anlehnung an Langners Stück, der Untertitel der Biographie Melcherts über Ilse Langner. 492 Vgl.: Wege, Lotte: Es wartete Penelope, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 8/9.
Sozialisation | 209
1948 Gegenstand von Langners Drama ‚Iphigenie kehrt heim‘493 geworden war, mußte sich auch in der ‚Stimme der Frau‘ zwischen ‚Pflicht‘ und ‚Neigung‘ entscheiden, um schließlich mit gutem Beispiel für die Leserinnen voranzugehen und diesen damit einen Weg aus dem Nachkriegselend aufzuzeigen.494 Die Themen, denen sich Langner widmete, waren zur Weimarer Zeit wie auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges also hochaktuell, und das Klima war zu beiden Zeiten günstig, um über die Emanzipation, den Kampf zwischen den Geschlechtern, den Krieg und damit über die Sehnsucht nach einem doppelten Frieden zu diskutieren. „Das Thema ist einfach, doch quält es uns tief innerlich“, brachte Langner ihren gefühlten Zwang, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, einmal auf den Punkt. „Wir werden es nicht los, zu selbstverständlich ist es. […] Frau und Krieg, mich traf es. Was sie leidet, wie sie es trägt.“495 Mit Zweigs Roman ‚Der Streit um den Sergeanten Grischa‘ und Remarques Werk ‚Im Westen nichts Neues‘ waren häufig rezipierte Antikriegsstücke zweier Autoren, die ihren Fokus auf die Kriegs-Schicksale von Männern richteten, wie Langners Drama ebenfalls erst Ende der 20er Jahre erschienen. Es schien den zeitlichen Abstand eines Jahrzehnts gebraucht zu haben, um ein breiteres Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Krieg‘ hervorzubringen. Dann allerdings schlugen die Stücke ein, bis 1929 verkaufte sich ‚Grischa‘ nur 55.000 mal, nach dem Erfolg des 1929 in 26 Sprachen übersetzte Romans ‚Im Westen nichts Neues‘, stieg die Auflage von Zweigs Roman, bis er 1933 das Land verließ und seine Bücher verboten wurden, auf 300.000 Exemplare. Die Ende der 1920er Jahre erschienenen Antikriegsstücke, auch Langners Drama, dem nach der Aufführung zum Vorwurf gemacht wurde, das männliche Leid im Krieg zu vernachlässigen, korrespondierten jeweils zumindest ansatzweise mit dem bereits 1918 erschienenen Drama Brechts ‚Trommeln in der Nacht‘496. Am Rande hatte Brecht über die frühere Geliebte seines Protagonisten, des Kriegsheimkehrers Kragler, auch die Nöte von Frauen im Krieg thematisiert. Indem sie Pazifismus und Feminismus verknüpfte, zog Langner inhaltlich gleich mit dem Club-Mitglied Freda Herzfeld-Hoffmann, die unter dem Namen Freda Wuesthoff als Atomphysikerin, Patentanwältin und Gegnerin atomarer Waffen einige Berühmtheit erlangte.497 Nachdem Wuesthoff kurz vor der Auflösung des Soropti-
493 Vgl.: Langner: Dramen II, S. 175–259. 494 Vgl.: Denis, André: Der Zustand der Frauen ist beklagenswert, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 2, S. 9. 495 Johann, Ernst: Mein Thema und mein Echo. Darstellung und Würdigung, Darmstadt 1979, S. 9, zitiert nach Melchert: Dramatikerin, S. 22. 496 Vgl.: Brecht, Berthold: Trommeln in der Nacht, 18. Aufl., Frankfurt a. M. 2007. 497 Nach nationalsozialistischer Rassedefinition war Herzfeld-Hoffmann Halbjüdin. Die Kanzlei, welche sie gemeinsam mit ihrem Mann betrieb, konnte weiterarbeiten, da er als ‚Vierteljude‘ seine Zulassung nicht verlor. Nach außen hin trat Franz Herzfeld ab 1933 als alleiniger Betreiber der Kanzlei auf, seine Frau arbeitete jedoch weiterhin in der Kanzlei mit. Sukzessive veränderte er den Namen der Kanzlei zunächst zu HerzfeldWuesthoff, bis die Kanzlei nur noch ‚Kanzlei Wuesthoff‘ (nach dem Mädchennamen der ‚arischen‘ Großmutter väterlicherseits) firmierte. Vgl.: Art.: „Wuesthoff, Freda“, in: Ju-
210 | Theanolte Bähnisch
mist-Clubs noch dessen Präsidentin geworden war, setzte sie sich nach Ende des Zweiten Weltkrieges in ihrem ‚Stuttgarter Friedenskreis‘ wieder für Frauen-Emanzipation und Frieden ein, sah Ersteres gar als Voraussetzung von Letzterem. Im ‚Friedenskreis‘498, dessen Leitlinien sich nicht zufällig in der Rhetorik des einleitenden Artikels zur ersten Ausgabe der ‚Stimme der Frau‘ wiederfinden499, wirkte auch Bähnisch mit. Daß der ‚Deutsche Frauenring‘ (DFR) jedoch aus dem ‚Friedenskreis‘ entstanden sei, wie es einige Autoren behaupten, ist hingegen nicht richtig.500 Wuesthoff übernahm allerdings 1947 den Vorsitz des Landsfrauenrings Südbaden501 und gehörte 1949 dem Vorstand des DFR an. Sie arbeitete auch nach der Auflösung des Friedenskreises eng mit Bähnisch zusammen. 2.3.2.4.3 Theanolte in der Darstellung Ilse Langners – im Drama und im Lexikon Die Briefe Langners an Bähnisch sind nicht überliefert, so daß kaum gesicherte Aussagen darüber möglich sind, wie Langner die persönliche und berufliche Entwicklung ihrer Freundin wahrnahm. Auch die zweite Biographin Langners, Ulrike Melchert, geht nicht auf Bähnisch ein, sondern konzentriert sich, ähnlich wie Schulte, auf die Beziehungen Langners zu Personen aus dem Literatur- und Theater-Betrieb. Melchert und Schulte blenden also den Umstand aus, daß Langner wie viele andere Frauen gerade deshalb zu den Soroptimistinnen gefunden hatte, weil im Club ein Austausch mit Frauen aus ganz verschiedenen Arbeitszusammenhängen möglich war. Daß Theanolte Bähnisch, ihr Beruf und ihre Partnerschaft Ilse Langners Denken beeinflußten, zeigt sich auch in den ‚Amazonen‘. Es scheint, als spiele das Ehepaar Bähnisch eine kleine Rolle im Vorspiel des so oft überarbeiteten, aber nie aufgeführ-
498
499 500
501
ristinnen. Lexikon zu Leben und Werk, Baden-Baden 2005, S. 439–443, hier S. 441. Wuesthoff publizierte mehrere Schriften über die atomare Bedrohung. ‚Es ist keine Zeit mehr zu verlieren‘ und ‚Atomenergie und Frieden‘, erschienen 1957, 1958 wurde ‚Wir haben die Wahl‘ veröffentlicht. Zur Biographie Wuesthoffs vgl. auch: Berthold: Wuesthoff. Mitglieder des ‚Stuttgarter Friedenskreis‘, der sich ab 1946 traf, waren neben Bähnisch weitere Frauen, mit denen Bähnisch 1949 den DFR gründete: Dorothee von Velsen, Agnes von Zahn-Harnack, Marie Elisabeth Lüders. Die Kreise waren jedoch nicht völlig deckungsgleich. Andere Mitglieder des Friedenskreises aus der bürgerlichen Frauenbewegung waren Clara von Simson, Elly Heuss-Knapp (die Gattin des späteren Bundespräsidenten) sowie Gertrud Bäumer. Vgl.: Hagemann, Karen/Schüler-Springorum, Stefanie: Home/front. The military, war and Gender in Twentieth Century Germany, Oxford/New York 2002, S. 313. Die 1897 in Rom geborene Dr. Clara von Simson arbeitete 1039– 1945 in der Kanzlei Wuesthoff mit. Wolf, Herbert: Mit seinen Augen. Herbert Wolf über Theanolte Bähnisch, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 3. Vgl.: Art. „Wuesthoff, Freda“, in: Scheibmayer, Erich: Wer? Wann? Wo?. Persönlichkeiten in Münchner Friedhöfen, München 1989. So auch in Art. „Freda Wuesthoff“ in: Wikipedia, auf: http://de.wikipedia.org/wiki/Freda_Wuesthoff, am 05.08.2009. Vgl.: Art.: „Wuesthoff, Freda“, in: Juristinnen, S. 442.
Sozialisation | 211
ten Stücks. Um 1900 in Berlin502 angesiedelt ist nämlich die Szene, in der der „Regierungsassessor Alfred (Achill)“ – Theanoltes Mann, Albrecht Kurt Alfred Bähnisch, war Regierungsassessor im Innenministerium – „Schmisse bedeckt, mit hohem Stehkragen“503 die Tanten Penthas, also seiner Frau, zur Verantwortung zieht, weil sie billigen, daß Pentha (Penthesilea) ihr wissenschaftliches und berufliches Treiben über ihre ehelichen und familiären Pflichten stellt. Trotz der Heirat wolle sie ihren Beruf behalten, beklagt sich Alfred bei den Tanten. Er habe gehofft, daß ihre Expertise ausschließlich ihm und den gemeinsamen Kindern zu Gute komme und wolle sie nun „zur Erkenntnis ihrer Pflicht als Gattin und Mutter“504 bringen. Die Figur des Regierungsassessors im Vorspiel zu den ‚Amazonen‘ dürfte weder der ehelichen Realität des befreundeten Paares Bähnisch noch der Wahrnehmung Langners von Theanoltes Mann entsprochen haben – zumal Albrecht Bähnisch ebenfalls ein begeisterter Leser von Langners Stücken war.505 Und Theanolte sah gerade in der beruflichen Zusammenarbeit mit ihrem Mann eine der wesentlichen Qualitäten ihrer Ehe und ihrer eigenen Existenz.506 Vom ‚Kampf der Geschlechter‘, einem zentralen Thema Ilse Langners, das Monika Melchert zufolge auf Langners Schicksal als Scheidungskind zweier sich auch noch nach dem Ende ihrer Ehe bekriegender Eltern zurückzuführen sei507, scheint Bähnisch, glaubt man ihrer eigenen Darstellung, zumindest im Privatleben nicht sehr viel verspürt zu haben. Und doch gibt es Parallelen, die darauf hindeuten, daß Langner die Bähnischs im Kopf gehabt hatte, als sie ihr Vorspiel niederschrieb: Erstens scheint es einen anderen Regierungsassessor als Albrecht Bähnisch im Bekanntenkreis Langners gar nicht gegeben zu haben. Allein schon deshalb ist die Vermutung, die Gestalt orientiere sich an Theas Mann, doch recht naheliegend, zumal die Figur Alfreds/Achills den dritten Vornamen Albrecht Bähnischs, der von dessen Vater Alfred Bähnisch stammte, trägt. Zweitens ist es vermutlich ebenfalls kein Zufall, daß der abgekürzte Vorname Penthesileas, ‚Pentha‘, dieselben Vokale in derselben Reihenfolge enthält wie Dorotheas abgekürzter Vorname ‚Thea‘, den ihre Freunde für gewöhnlich verwendeten.508 Zwar scheint Albrecht Bähnisch mitnichten gegen die Berufstätigkeit seiner Ehefrau eingestellt gewesen zu sein, doch ist überliefert, daß Dorothea erst in die Ehe eingewilligt hatte, als feststand, daß sie ihren Beruf
502 503 504 505
Vgl.: Langner, Ilse: Amazonen, in: dies.: Dramen II, S. 9–100, hier S. 12. Ebd., S. 13. Ebd., S. 14/15. DLA, A: Langner Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 03.09.1936. 506 Siehe Kapitel 3.1. 507 Vgl.: Melchert: Dramatikerin, S. 13. 508 Bähnisch selbst unterschrieb die Briefe an Langner mit ‚Thea‘, sie erhielt aber auch Briefe, z. B. von Adolf Grimme, in denen sie mit ‚Thea‘ angesprochen wird. Vgl.: GStA PK, Berlin, IV. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Adolf Grimme an Theanolte Bähnisch, 16.12.1948.
212 | Theanolte Bähnisch
im Polizeipräsidium trotz der Personalabbauverordnung behalten könne.509 Viertens lesen sich die Aussagen Penthas, vergleicht man sie mit späteren Aussagen Bähnischs, als wären sie der Regierungsassessorin und Freundin Langners geradezu in den Mund gelegt gewesen: „Frau sein und mit Dir arbeiten, so habe ich unser Zusammenleben gesehen“ sagt Pentha zu Achill, alias Alfred – und bringt damit zum Ausdruck, was auch Thea, folgt man den Darstellungen Theanolte Bähnischs510, auch zu ihrem Mann hätte sagen können. Auch die Aussage Penthas „[w]as ich gelernt habe, soll zunächst einmal mir zugute kommen, damit ich erst einmal ein Mensch werde, denn wenn ich selbst nichts bin, kann ich Dir nichts sein, wie auch anderen nichts!“, erinnert an Bähnisch. Denn diese pflegte den Unterschied von ‚Menschen‘ zu ‚Leuten‘ zu betonen und hing dem humanistischen Ideal einer Persönlichkeit, die sich nur durch die harmonische Entfaltung aller Anlagen und Kräfte verwirklichen lasse, an.511 Pentha beschreibt sich und ihren Beruf als unzertrennbar, verlangt Achtung für ihr Gehirn wie für ihren Körper und skandiert – wie es außer Bähnisch freilich auch andere Soroptimistinnen vorbringen hätten können schließlich „Meine Freiheit, mein Studium, mein Beruf!“ Wir Frauen lassen uns nicht mehr einsperren!“ Am Ende des Vorspiels erklärt Pentha die Amazonen schließlich zu ihren „Urschwestern“ und verkündet deren unaufhaltsamen Aufstieg. „Ich bin ja nicht allein, wir Frauen sind ja schon ein kleines Heer, es wird wachsen, Ihr werdet es noch erleben, die Amazonen marschieren. Hört Ihr’s?“512 Eine Fanfare ertönt, die Bühne verdunkelt sich und die Sonne geht wieder auf, diesmal in der Amazonenwelt: „Wir haben gesiegt“513 rufen die Amazonen. Damit endet das Vorspiel und der erste Akt beginnt. Die „erregte und erleichtert triumphierende Aufbruchsstimmung“, die Cillie Rentmeister in Mathilde Vaertings ‚Mütter und Amazonen‘ beobachtet514 – sie findet sich also auch in Langners ‚Amazonen‘ und wird greifbar vor allem am hier beschriebenen Schluß des ersten Aktes. Neben dieser vermuteten Bezugnahme auf die Freundin Thea durch Langner wird Bähnisch noch ein zweites Mal als Objekt in Langners beruflichem Schaffen greifbar. Bereits Anfang der 1930er Jahre, „für die damalige Zeit unbedingt ein Novum“515, hatte Langner mit dem Gedanken gespielt, ein internationales Frauenlexikon, das als Nachschlagewerk für berühmte Frauen und deren Verdienste dienen sollte, herauszugeben. Über die Jahre sammelte sie dafür eine große Menge an Material, welches sie gemeinsam mit einer anderen Freundin, der Wiener Jüdin Anna Helene
509 „[I]ch heiratete nicht eher, bis ich den Erlaß in den Händen hatte, daß ich nach meiner Heirat nicht entlassen werde“ schreibt Bähnisch dazu. Vgl.: AddF, SP-01, Kurze Lebensskizze von Theanolte Bähnisch o. D. [vermutlich Mitte der 50er Jahre]. 510 Siehe Kapitel 3.1. 511 AdSD, Büro Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 11.02.1946. 512 Langner: Amazonen, in: dies.: Dramen II, S. 13. 513 Ebd. 514 Vgl.: Rentmeister, Cillie: Frauenwelten – fern, vergangen, fremd? Die Matriarchatsdebatte und die Neue Frauenbewegung, auf: http://www.cillie-rentmeister.de/Frauenwelten _fern_vergangen.html, am 24.07.2009. 515 Melchert: Dramatikerin, S. 73.
Sozialisation | 213
Askanasy veröffentlichen wollte.516 Spezialistinnen aus dem Ausland sollten für die Zuarbeit zum Projekt, das „streng wissenschaftlich – mit Liebreiz“517 ausgerichtet sein sollte, angeworben werden. Die Bemühungen brachen ab, als Askanasy nach Kanada ins Exil floh, und wurden, per Briefverkehr zwischen Berlin und Vancouver, erst nach Kriegsende weiter verfolgt. Als Projekt der beiden Frauen wird das Lexikon schließlich nicht realisiert. 1953/54 aber erscheint ein zweibändiges ‚Lexikon der Frau‘ im Encyclios Verlag in Zürich „unter Mitarbeit von Ilse Langner“. Herausgeberin des Werks, das heute in keiner Bibliothek, die sich mit ‚Frauenfragen‘ beschäftigt, fehlt, ist Dr. Blanche-Christine Olschak. Daß die Ideen Langners in das Lexikon fruchtbar eingebracht wurden, ist vor allem an zwei Artikeln erkennbar: An jenem über Langner selbst518 sowie am Artikel über die Regierungspräsidentin Bähnisch, die 1953 bereits eine ‚gemachte Frau‘ war. Dementsprechend heißt es im Lexikon, Bähnisch die „als erste Frau zur Assessorprüfung zugelassen“ worden war, sei nun „führend in der deutschen Frauenbewegung“519. Birgitta Schulte rechnet die von ihr porträtierte Ilse Langner übrigens selbst nicht zur ‚bürgerlichen Frauenbewegung‘, Monika Melchert weist jedoch darauf hin, daß Langner der Frauenbewegung einen Großteil ihres Erfolges zu verdanken hatte.520 Die Begründung Schultes, Langner habe das Geheimnis des „Gekleidetseins“ erkannt und „sich nicht in die Sackkleider der Reformbewegung gehüllt“521, klingt als Beweis für die behauptete Distanz Langners zur Frauenbewegung zum zumindest wenig überzeugend. Die bürgerliche Frauenbewegung war in ihrer Gespaltenheit durchaus ein Sammelbecken für unterschiedliche Positionen. Daß die hochgewachsene Ilse Langner zumindest zeitweilig den ‚Garçonne-Stil‘ pflegte,522 unterschied sie allerdings optisch stark von ihrer kleinen, zudem eher zierlichen Freundin Theanolte Bähnisch, die modisch kurze Haare trug, aber immer sehr weiblich gekleidet war.
516 517 518 519 520 521 522
Vgl.: DLA, Briefwechsel Langner–Askanasy, zitiert in Melchert: Dramatikerin, S. 72–74. Langner an Askanasy, zitiert in Melchert: Dramatikerin, S. 74. Art.: „Langner, Ilse“, in: Lexikon der Frau, Bd. 2, Zürich 1954. Vgl.: Art. „Bähnisch, Dorothea (Theanolte)“, in: Lexikon der Frau, Bd. 1, Zürich 1953. Vgl.: Melchert: Dramatikerin, S. 21–36, passim. Schulte: Frau. Einige Bilder in den Biographien Schultes und Melcherts zeigen Langner mit Kostümjacke, Hose, Hemdbluse und Fliege. Dazu trug sie einen kurzen Haarschnitt mit Welle. Als der Soroptimist-Club gegründet wurde, war die Hochphase des Garçonne-Stils, die von 1924–1928 dauerte, allerdings bereits passé.
214 | Theanolte Bähnisch
2.3.2.5 Netzwerk, Schaubühne, Rekrutierungs- und Vermittlungspool: Die Bedeutung eines nur drei Jahre währenden Zusammenschlusses für seine Mitglieder 2.3.2.5.1 Das Beispiel Lotte Jacobi Nicht nur in Ilse Langner, auch in dem Club-Mitglied Lotte Jacobi523, der jüdischen Photographin, die nach ihrer Reise mit der Kamera durch Moskau und Tadschikistan von 1932 bis 1933 im Jahr 1935 aus Berlin über London in die USA emigrierte, hatte Theanolte Bähnisch eine Freundin gefunden. Jacobi, die 1940 im Exil den Berliner Verleger Erich Reiß heiratete, gilt heute als die berühmteste Berliner Portraitphotographin.524 Ihre Aufnahmen zeigen Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik, darunter Albert Einstein, Martin Buber, Thomas Mann, Jerome David Salinger, Ernst Thälmann, Kurt Weill und Leni Riefenstahl. Auch mit Tanz- und Theaterbildern, vor allem aus den Häusern Max Reinhardts und Erwin Piscators machte sich Jacobi einen Namen. Im Berlin der 2.633 Zeitschriften und 147 Tageszeitungen525 veröffentlichte sie ihre Bilder unter anderem in der ‚Berliner Illustrierten‘, der ‚Dame‘ und dem ‚Uhu‘ und trug dadurch dazu bei, mit dem PhotoJournalismus ein neues Genre auf dem Zeitschriften-Markt zu schaffen. Dabei konnte sie sich, dem Kunsthistoriker Rainer Metzger zufolge, als Frau besonders hervortun, weil sie durch die neue Technik – kleine lichtstarke Kameras, die schnelle, nicht gestellte Aufnahmen ermöglichten – die Zugangsbeschränkungen im Bereich der Photographie, einer traditionell auf Männer fixierten Domäne, umgehen konnte.526 Ein
523 Lotte Jacobi, 1896 in Westpreußen als Tochter, Enkelin, Urenkelin und Nichte von Photographen geboren, zog 1921 mit ihrer Familie nach Berlin. Nach der Scheidung ihrer ersten Ehe begann sie 1924 ein Filmstudium in München, während sie gleichzeitig an der Staatlichen Höheren Fachschule für Phototechnik lernte. 1927 trat sie in das Atelier ihres Vaters ein. Von Berlin wanderte sie mit ihrem Sohn nach New York aus, wo sie Ende 1936 ein Photostudio in Manhattan eröffnete. 1955 verzog sie mit ihrem Sohn und ihrer Stieftochter (Erich Reiß war 1951 gestorben) nach Deering bei New Hampshire, wo sie wiederum ein Studio eröffnete. Nach einer Ausstellung im Folkwang-Museum in Essen 1973 (frühere Ausstellungen fanden statt in München 1930, New York, MoMa 1942, Manchester 1959, New York 1964 und Hamburg 1972) wurde Jacobi international rezipiert. Sie reiste viel und starb erst 1990, im Alter von 93 Jahren. Die Universität New Hampshire verwahrt ihren Nachlaß, darunter auch Briefe Theanolte Bähnischs. In den überlieferten Korrespondenzen sind auch Briefe Jimmy Carters, Bette Davis’ und Eleanor Roosevelts enthalten. Vgl.: Einleitung zum Online-Findbuch der University of New Hampshire, Library, MC 58 [Jacobi, Lotte 1896–1990, Papers 1898–2000], auf: http://www.library.unh.edu/special/index.php/lotte-jacobi am 22.08.2009 sowie Eskildsen: Jacobi und Art. „Jacobi, Lotte“, in: The Oxford Companion to the Photograph, Oxford 2005, S. 327. 524 Metzger, Rainer: Berlin. Die Zwanziger Jahre. Kunst und Kultur 1918–1933, Berlin 2007, S. 195/196 und S. 387. 525 Vgl.: ebd., S. 317. 526 Vgl.: ebd., S. 195–197.
Sozialisation | 215
neues Interesse der gebildeten Schichten an den künstlerischen Leistungen von Frauen mag Lotte Jacobis Erfolg ebenfalls befördert haben. Zweifelsohne war ihr Ansehen aber vor allem auch auf ihren geschickten Umgang mit Licht und Schatten zurückzuführen. Sie legte sich nicht auf eine Stilrichtung fest und bildete auch keine neue aus, sondern produzierte künstlerisch wertvolle Photos für den breiten Geschmack mit populären Motiven. In Berlin konnten Bähnisch und Jacobi nur wenig Zeit miteinander verbringen. Allerdings etablierten sie in der kurzen Zeit eine Berufsbeziehung, die wesentlich zur Sicherung der Existenz von Theanolte und ihrer Familie beitrug, nachdem die Bähnischs 1932 eine neue wirtschaftliche Grundlage aufbauen mußten.527 Die Tätigkeit Theanoltes als Vertreterin für Pressephotos auf Provisionsbasis im Auftrag Lotte Jacobis wurde zu einem wichtigen Standbein für die Familie. Mit dieser Tätigkeit sowie einer sich daran anschließenden Vertretertätigkeit für die Berliner Dependance des Münchner Bildberichts hielt sich die Ju-ristin über Wasser, als – so argumentierte Bähnisch – die gemeinsam mit ihrem Ehemann eingerichtete Anwalts-Praxis nicht genügend Profit abwarf. 528 1948 knüpfte sie an die berufliche Verbindung an und bat Lotte Jacobi um die Zusendung von Bildern berühmter Frauen in den USA für die ‚Stimme der Frau‘. Die Berufsbeziehung zwischen den beiden Frauen kann als exemplarisch für die Unterstützung der Club-Mitglieder untereinander, auch über die Club-Zusammenhänge hinaus, gelten. Auch wenn es bis 1970 dauerte, ehe Bähnisch Jacobi gegenüber zum ‚Du‘ fand, darf man von einer für Bähnisch wichtigen Freundschaft der beiden Frauen ausgehen, die bis ins hohe Alter anhielt. Bis 1971, zwei Jahre vor Bähnischs und 29 Jahre vor Jacobis Tod, ist der Briefkontakt zwischen den beiden Frauen, der in den letzten Jahren stark von Bähnischs zunehmend schlechtem Gesundheitszustand geprägt war, überliefert.529 Trotz der großen räumlichen Entfernung kamen auch persönliche Treffen nach der gemeinsamen Berliner Zeit zustande, von der Bähnisch einmal an Jacobi schrieb, sie habe ein „ein Band geknüpft, das so
527 Siehe Kapitel 4.2.2. 528 Im Fragebogen der Militärregierung gibt Bähnisch an, für den ‚Fotovertrieb Fa. Jacobi, Berlin Kurfürstendamm‘ als Vertreterin auf Provisionsbasis tätig gewesen zu sein. Als weitere Tätigkeit wird dort angegeben: „Berliner Vertretung Münchner Bildbericht Dr. Kohlschein, Vertreterin“. NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88. Wie der undatierte Lebenslauf in ihrer Personalakte nahelegt, hat Bähnisch diese Tätigkeiten, zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrätin, nacheinander ausgeübt. „Da zuerst zahlende Mandanten nicht kamen, sondern nur Freunde und Bekannte, übernahm ich Anfang Mai als allein auf Provision gestellte Vertreterin den Fotovertrieb des jüdischen Geschäfts Jacobi Berlin, Kurfürstendamm und später die Vertretung in Berlin für einen gleichen Münchner Vertrieb, den Münchner Bildbericht.“ Vgl.: NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Lebenslauf Theanolte Bähnischs, o. D. [1946]. Es ist unklar, ob Lotte Jacobi an der Vermittlung Bähnischs an den Münchner Bildbereicht beteiligt war, beziehungsweise ob sie von Bähnischs Arbeit beim Bildbericht profitierte. 529 Vgl.: University of New Hampshire, Library, MC 58, Box 27, f7, Briefe von Theanolte Bähnisch an Lotte Jacobi.
216 | Theanolte Bähnisch
leicht nicht zerreißt“530. Zwar mußte sie aus Krankheitsgründen die geplante Reise in die USA mehrfach verschieben, 1957 aber war es dann endlich so weit. 531 Auch in Paris532, vermutlich noch an anderen Orten, trafen sich die Freundinnen. 2.3.2.5.2 Bähnisch als Anwältin der Ärztinnen Die ‚Schwestern‘ setzten sich auch über die Club-Zusammenhänge hinaus, im Rahmen der Möglichkeiten, die ihnen der eigene Beruf eröffnete, für berufstätige Frauen in der Weimarer Republik ein. Wie Gabriele Tergit über die Benachteiligung von Frauen im Beruf schrieb, wie die Ökonomin Hilde Oppenheimer über ‚Probleme der Frauenberufstätigkeit in der Übergangsgesellschaft‘ forschte533, wie Lotte Jacobi prominente Frauen ablichtete und so zu deren Berühmtheit beitrug534, so vertrat Theanolte Bähnisch, als sie ab 1932 als Verwaltungsrechtsrätin tätig war, Ärztinnen, die um die Gewährung gleicher Rechte in ihrem Beruf kämpften. Als ein Ärzteverband 1932 Revision gegen die Zulassung verheirateter Frauen zu den Kassen eingelegt hatte, verteidigte Bähnisch die Seite der Ärztinnen, praktisch wie journalistisch. „Ich freue mich, daß ich bei meiner nächsten Sache als Verwaltungsrechtsrätin für die Rechte der berufstätigen Ehefrau einzutreten habe“535 machte sie ihre besondere Motivation für diesen Fall 1932 gegenüber Ilse Langner, von der sie sich zu dieser Zeit schon mal mit „Frauengrüßen“536 verabschiedete, deutlich. Daß Lizzie Hoffa und Edith Peritz, die Ärztinnen, die Bähnisch aus dem Club kannte, eine Rolle für ihren Einsatz gespielt hatten, darüber kann man nur mutmaßen: Peritz, die mit dem Neurologen und Professor der Berliner Universität Dr. Georg Peritz verheiratet war, muß eine Kassenzulassung gehabt haben, denn es ist bekannt, daß ihr diese aufgrund
530 University of New Hampshire, Library, MC 58, Bähnisch an Jacobi, 30.12.1960. 531 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Bähnisch an den Niedersächsischen Minister des Innern, 10.04.1957. Ob es zu einem Besuch bei Jacobi kam, als sie im April 1957 schließlich für 45 Tage in die USA reiste, ist nicht eindeutig belegt, aber wahrscheinlich. Im Brief kündigt Bähnisch ihre Reise in die USA an, schlägt aber noch keinen Zeitpunkt für ein Treffen vor. University of New Hampshire, Library, MC 58, Theanolte Bähnisch an Lotte Jacobi, 27.03.1957. 532 University of New Hampshire, Library, MC 58, Box 27, f7, Bähnisch an Jacobi, 30.11.1962. 533 Vgl.: Oppenheimer, Hilde/Radomski, Hilde: Die Probleme der Frauenberufstätigkeit in der Übergangsgesellschaft, Mannheim/Berlin/Leipzig 1918. 534 Ähnliches galt für die Malerin Annot Jacobi, die unter anderem Freda Wuesthoff gemalt hatte. Vgl. den Abdruck eines Gemäldes Wuesthoffs von Annot Jacobi aus dem Jahr 1929, in: Berthold: Wuesthoff, S. 71. 535 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 25.10.1932. 536 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 11.03.1932.
Sozialisation | 217
ihrer jüdischen Abstammung 1933 entzogen wurde.537 Hoffa, die ebenfalls jüdischer Abstammung war, erlitt das gleiche Schicksal. Wie Bähnischs Einsatz als Verwaltungsrechtsrätin für Frauen in der Praxis aussah, läßt sich nicht in Erfahrung bringen, da die Rechtsbeistände in juristischen Fällen, im Unterschied zu den Prozeßparteien, nicht kartiert wurden. Aufschluß über die wahrscheinlichen Inhalte der von Bähnisch vertretenen Fälle geben jedoch zwei von ihr verfaßte Artikel zur Zulassung von Ärzten. Die Artikel entstanden auf der Grundlage der Zulassungsordnung vom 30.12.1931.538 Anders als die vorher gültige, legte die neue Ordnung eine Versorgung von jeweils höchstens 600 Patienten durch einen Arzt fest. Diese Anordnung bedeutete, daß der Bevölkerung zukünftig doppelt so viele Kassen-Ärzte zur Verfügung stehen sollten. Die Realität sah zu dieser Zeit vielerorts sogar besser aus, als es, gemessen an den alten Richtlinien, die ein Arzt-Patienten-Verhältnis von nur 1:1.350 zugrunde legten, zu vermuten stand.539 Über ein mangelndes Rekrutierungspotential zur angestrebten, besseren medizinischen Versorgung der Bevölkerung konnte die Republik nicht klagen. Im Gegenteil: viele Ärzte waren zu dieser Zeit arbeitslos oder arbeiteten unter schlechten Bedingungen für ein geringes Entgelt. Die Kassenzulassung bedeutete 1932, anders als in der frühen Zeit des Kassensystems, in der auf die ‚Armenärzte‘ in der weißen Zunft verächtlich hinabgeschaut worden war, für die Mediziner in der Regel einen sozialen Aufstieg, weshalb sie äußerst begehrt war. Eine heikle Frage war, welche der vielen wartenden Ärzte zugelassen werden sollten, denn die Zahl derer, die auf eine Zulassung hofften, war weitaus größer als die Anzahl der zu vergebenden Plätze. Vor dem Hintergrund eines Kriterienkatalogs, der Faktoren wie „Zeit der Approbation, Zeit der Eintragung in das Arztregister, Lebensalter, Niederlassungszeit im Bezirk, Ortsansässigkeit, Lage der Wohnung, Überlastung durch andere ärztliche Tätigkeit, längere Tätigkeit als Assistenzarzt oder sonstiger Nachweis einer besonderen Ausbildung sowie besondere wirtschaftliche Verhältnisse“ definierte, hatte ein paritätisch aus Ärzten und Vertretern der Kassen besetztes Gremium, der Zulassungsausschuß540, darüber zu entscheiden, wer eine Kassen-Zulassung erhalten sollte. Auch nach den Richtlinien der Ordnung von 1931 waren zunächst die Kriegsversehrten und Kriegsteilnehmer zu berücksichtigen, dann
537 Vgl.: Gruner, Wolf: Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland, Bd. 1: Deutsches Reich, 1933–1937, München 2008, S. 135, Anm. 13. 538 Vgl.: Ausführungs- und Überleitungsbestimmungen über das kassenärztliche Dienstverhältnis vom 30. Dezember 1931, in: Reichsgesetzblatt 1932 I, S. 2. 539 Im Berliner Abkommen von 1913 war das Arzt-Patientenverhältnis noch mit 1:1.350 angegeben. Vgl.: Haenlein, Andreas: Zur Vereinbarkeit der Zulassungsbeschränkungen für Vertragsärzte gemäß § 101 bis 103 SGB V in der Fassung des Gesundheitsstrukturgesetzes mit höherrangigem Recht, in: Vierteljahresschrift für Sozialrecht, 31. Jg. (1993), S. 169–193, hier S. 171. 540 Vgl.: Ziegeler: Ärzte, S. 98. Daß die Ärzteschaft ab 1913 über die Zulassung von Ärzten zu den Krankenkassen mitbestimmen durfte, sei „angesichts der überwiegend feindseligen Haltung weiter Ärztekreise gegenüber den Kolleginnen für diese vermutlich nicht von Vorteil“ gewesen, schreibt Ziegeler. Ebd., S. 97.
218 | Theanolte Bähnisch
jene Ärzte, die vor dem 01.10.1931 ihre Approbation erhalten hatten. Zusätzlich sollten jährlich ein Drittel der ab dem 01.10.1931 in das Register eingetragenen Ärzte zugelassen werden. Der Spielraum, der den regionalen Zulassungsausschüssen damit zugebilligt worden war, war relativ groß, entsprechend unterschiedlich wurde er lokal gehandhabt und entsprechend zahlreich wiederum waren Klagen gegen die Entscheidungen der Ausschüsse. Bähnisch spricht sich in beiden Artikeln, die sie zum Thema verfaßte,541 für eine vorrangige Berücksichtigung des Approbationsalters als Zulassungskriterium aus. Eine solche Praxis hätte Frauen insgesamt begünstigt, denn vor allem sie warteten nach erfolgter Approbation oft seit Jahren vergeblich und nicht selten verzweifelt auf die kassenärztliche Zulassung, die einen festen Patientenstamm und einen garantierten Lohn bedeutete. „Aerztin sucht Verdienst: Haushaltstätigkeit, Handarbeiten, Laboratoriumsarbeit, Steno, etwas Schreibmaschine, auch Krankenpflege, Reisebegleitung“542, hatte dementsprechend 1924 eine Annonce in der ‚Berliner Aerzte-Korrespondenz‘ gelautet. Tatsächlich schien die neue Ordnung die Zulassung von Frauen begünstigt zu haben: Die Zahl der Kassenärztinnen stieg, entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtärzteschaft, in den Monaten nach dem Inkrafttreten der neuen Ordnung prozentual nicht unwesentlich an. Doch gegen die Zulassung auch verheirateter Frauen zu den Kassen lief bald schon der Ärztebund Sturm. Diese Frauen seien durch die Ehe in ihrer wirtschaftlichen Existenz gesichert und dürften deshalb generell nicht als Kassenärztinnen zugelassen werden, argumentierte der Ärztebund in seiner Klage gegen die Zulassung verheirateter Ärztinnen vom August 1932. Die Zulassungs-Ordnung selbst sah keine Benachteiligung verheirateter Frauen vor,543 sondern legte, im Gegenteil, fest, daß lediglich das persönliche dienstliche Einkommen des Bewerbers oder der Bewerberin 500 DM nicht übersteigen dürfe, wenn eine Zulassung erreicht werden solle. Daneben waren ‚besondere wirtschaftliche Verhältnisse‘ des Bewerbers zwar als ein Kriterium angegeben, das für oder gegen die Zulassung einer Person in die Waagschale geworfen werden konnte, jedoch sah die Ordnung nicht vor, daß dieses Kriterium stärker gewichtet werden dürfe oder gar solle, als die anderen oben angeführten. In diesem Sinne argumentierte auch Bähnisch in der Monatsschrift des Bundes Deutscher Ärztinnen, ‚Die Ärztin‘ im Jahr 1933. Ein besonderer Dorn im Auge der Verwaltungsjuristin war es, daß der Ärztebund darauf abhob, insbesondere Ehefrauen von Staatsbeamten dürften überhaupt nicht berufstätig sein. Bähnisch – die zu jener Zeit selbst Ehefrau eines höheren Staatsbeamten gewesen war und ihren Beruf, als ihr Mann Landrat und sie Mutter wurde, aufgegeben hatte, um einer Entlassung wegen ‚Doppelverdienertum‘ zuvorzukommen544 – machte in einem ihrer Artikel deutlich, daß lediglich den Ehefrauen
541 Vgl.: Bähnisch, Theanolte: Die Zulassung verheirateter Aerztinnen zur Kassenpraxis auf Grund der Zulassungsordnung vom 30.12.1931, in: Die Ärztin, 9. Jg. (1933), S. 75–78 sowie dies.: Zum § 27 der Zulassungsordnung, in: Deutsche Krankenkasse, Nr. 52, 1932, Sp. 1418–1420. 542 Zitiert nach: Ziegeler: Ärzte, S. 104. 543 Die Zulassungsordnung vom 31.12.1933, § 23, Abs. 2 untersagte sogar explizit die Benachteiligung von Frauen lediglich aus dem Grund der Verheiratung. 544 Siehe Kapitel 4.1.1.
Sozialisation | 219
von Wehrmachtsangehörigen die Ausübung eines Berufes untersagt werden könne und daß eine Genehmigung zur Berufstätigkeit der Gattin eines Staatsbeamten nur für den Gewerbebetrieb erforderlich sei.545 Sie führte aus, daß von wirtschaftlicher Sicherheit einer Ärztin nicht allein aufgrund ihrer Verheiratung, auch und insbesondere nicht im Fall von Staatsbeamten-Gattinnen ausgegangen werden dürfe, schließlich, daß die Verheiratung als solche in keinem Fall zum Ausschluß vom KassenSystem führen dürfe. „Es würde auch niemand auf den Gedanken kommen, einem männlichen Arzt das Recht auf Zulassung zur Kassenpraxis abzusprechen, weil seine Frau Studienrätin, Redakteurin oder angestellte Chemikerin, mit einem festen Einkommen von mindestens 500 RM. ist oder die Ehefrau als Nutznießerin eines großen Vermögens eine hohe Zinseinnahme oder große Dividende bezieht“546, hielt die Verwaltungsrechtsrätin in durchaus kämpferischem Ton fest. Nur die sorgfältige Prüfung aller gegeneinander abzuwägenden Gesichtspunkte entspreche den gesetzlichen Bestimmungen der Zulassungsordnung, schloß die Anwältin.547 Daß Bähnisch sich so gegen die Annahme verwehrte, daß Ehefrauen von Staatsbeamten automatisch finanziell gesichert seien, hatte vermutlich auch mit ihrer eigenen Lage 1932/33 zu tun. Zu jener Zeit war nämlich unklar, ob ihr Mann seine Stellung als Staatsbeamter behalten würde, beziehungsweise wie hoch seine Bezüge im einstweiligen Ruhestand sein würden.548 Beate Ziegeler zufolge war in der Zeitschrift ‚Ärztin‘ bereits mehrfach Kritik an der Umsetzung der Zulassungsordnungen geäußert worden, vor allem, was die weiterhin aufrecht erhaltene Bevorzugung von Kriegsversehrten und Kriegsteilnehmern betraf. Insbesondere in dieser Regelung sah der Bund deutscher Ärztinnen eine Möglichkeit, Frauen bei der Zulassung zu benachteiligen, waren doch nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zahlreiche Assistenzärztinnen aus den Kliniken entlassen worden, um den heimkehrenden männlichen Kollegen, die an der Front gedient hatten, einen Arbeitsplatz zu garantieren. Der Begriff ‚Kriegsteilnehmer‘ sei schließlich nicht definiert, kritisierte der Ärztinnenbund, in den Lazaretten hätten doch auch Frauen gearbeitet. Ziegeler gibt allerdings an, daß die Zulassungs-Ordnung diesem Umstand in ihrem Wortlaut durchaus Rechnung getragen habe.549 Allgemein seien zwar Diskriminierungen von Ärztinnen gegenüber ihren männlichen Kollegen bis 1931 zu beobachten, jedoch seien Frauen schon vor 1931 weniger stark benachteiligt worden, als der Ärztinnenbund dies dargestellt habe.550 Schließlich hätte sich die neue Zulassungsordnung von 1931 insgesamt sehr günstig auf die Zulassung von Frauen ausgewirkt,551 besonders in Berlin seien viele Frauen neu zugelassen worden.552 Ziegeler
545 546 547 548 549 550 551 552
Bähnisch: Zulassung, S. 76. Ebd. Ebd., S. 78. Siehe Kapitel 4.1.5. Ziegeler: Ärzte, S. 102. Vgl.: ebd., S. 106. Vgl.: ebd., S. 105. Vgl.: ebd., S. 106.
220 | Theanolte Bähnisch
schreibt dementsprechend von einer „verhältnismäßig günstigen Situation“553 für Ärztinnen in der Weimarer Republik, ringt sich jedoch auf der Basis des ihr vorliegenden Materials zu keiner endgültigen Wertung durch. Allerdings weist sie auf einen weiteren Umstand hin, der auch Bähnisch beschäftigt haben dürfte, zumal die Club-Schwestern Edith Peritz und Lizzi Hoffa davon betroffen waren: Die meisten Frauen, die 1933 ihre Zulassung verloren oder erst gar nicht erhielten, waren Jüdinnen. Der starke Rückgang der bei den Krankenkassen beschäftigten Ärztinnen sei deshalb auf den Umstand zurückzuführen, daß überdurchschnittlich viele Jüdinnen als Ärztinnen tätig waren, schreibt Ziegler. Auf die Zulassung von Frauen zu den Kassen habe sich also viel mehr der rassistische als der geschlechtliche Aspekt ausgewirkt. Zu diesem Thema habe sich der Ärztinnenbund jedoch ausgeschwiegen, kritisiert Ziegeler.554 Ob Bähnisch sich in dieser Hinsicht im Rahmen ihrer Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrätin engagierte, ist nicht überliefert. Sie selbst gibt zwar an, sich gemeinsam mit ihrem Mann als Verwaltungsjuristin für ‚rassisch‘ und politisch Verfolgte eingesetzt zu haben555, von jüdischen Ärztinnen ist jedoch nicht explizit die Rede. „Die Schwestern stärkten sich durch Gespräche, stützten sich durch Kontakte, halfen sich durch Informationsaustausch“556, faßt Birgitta Schulte den primären Sinn und Zweck des Soroptimist-Clubs, der an den geschilderten Beispielen deutlich wird, zusammen. Sie selbst nennt als Beispiel für die gegenseitige Unterstützung, daß Edith Peritz für Ilse Langner 1933 an die ihr bekannte Schauspielerin Lilian Harvey in Hollywood schrieb, um einen Kontakt für Langner in die USA herzustellen und die Dramatikerin so ideell zu fördern.557 Der Soroptimist-Club spielte für seine Mitglieder nicht zuletzt auch ganz substantiell gesehen als Rekrutierungs- oder zumindest Vermittlungspool von Kunden oder Klienten eine wichtige Rolle. Man darf davon ausgehen, daß sich sogar ein gewisser Gruppendruck etablierte, die professionellen Leistungen anderer Club-Mitglieder in Anspruch zu nehmen, sei es, sich von Annot Jacobi malen558 oder von Lotte Jacobi photographieren zu lassen559, wie viele der Club-Mitglieder es taten, sei es vielleicht auch, sich von Peritz, der Schönheitschirurgin, optisch korrigieren zu lassen. Der Mitgliedschaft im Club dürften also sowohl direkte finanzielle Vorteile für die Frauen und damit für deren Familien als auch ein indirekter Zwang, zum Wohl der anderen spendabel zu sein, innegewohnt haben. Spätestens als die Malerin Annot Jacobi 1932 als Jüdin nach und nach ihrer Exis-
553 554 555 556 557 558
Ebd., S. 107. Vgl.: ebd. S. 107/108 Siehe Kapitel 4.2.3. Schulte: Welt, S. 109. Vgl.: ebd. 1934 beklagte sich Lilian Gilbreth, die ‚Mutter des modernen Managements‘, daß in einer Ausstellung Jacobis 1934 kein Bild Wittes enthalten sei, was Gilbreths Anspruch verdeutlicht, die Soroptimistinnen dort ‚komplett‘ zu haben, Vgl.: Pokorny: Rationalisierungsexpertin, S. 34, Anm. 87. 559 Irene Wittes Portrait erschien, photographiert von Lotte Jacobi, 1929 auf dem Titelblatt von „Die schaffende Frau“. Vgl.: ebd., S. 34.
Sozialisation | 221
tenzgrundlage in Deutschland beraubt wurde, wurde diese latente Erwartung manifest. „[D]aß sich unsere schwesterliche Teilhabe auch praktisch auswirkt“560, sollten die Clubschwestern nach dem Willen des Vorstandes durch den Kauf oder – wohlwissend um die Finanzknappheit auch vieler anderer Mitglieder – die Vermittlung von Jacobis Bildern unter Beweis stellen.561 Neben Bähnisch trugen auch andere Soroptimistinnen ihr Engagement für berufstätige Frauen und wenn man so will auch ihre Vorbildfunktion über die Grenzen des Clubs hinaus: Im März 1931 hatte an der Lessing-Hochschule562 in Berlin im Programm ‚Hochschule der Frau‘ eine Vortragsreihe über Frauenberufe stattgefunden. Die Soroptimistinnen waren aufgefordert worden, gegen Honorar Mitglieder zu Vorträgen zu entsenden.563 Der Club nutzte dieses Angebot zur Außenwirkung gern: An insgesamt vier Abenden der Reihe sprachen jeweils vier bis fünf Club-Mitglieder über ihre Berufe.564 Theanolte Bähnisch, die zu dieser Zeit, im Wesentlichen mit Hausfrauen- und Mutterpflichten ausgefüllt, in Merseburg lebte, war nicht darunter. Womöglich aber war sie, die als korrespondierendes Mitglied des Clubs von den Veranstaltungen gehört haben dürfte, von der Reihe dazu angeregt worden, später in der ‚Stimme der Frau‘ eine Serie über ‚Frauenberufe‘ abzudrucken. Die Einrichtungsratschläge, welche die ‚Stimme der Frau‘ gab, die Tips für Wohnmöglichkeiten lediger Frauen stehen womöglich ebenfalls in einem Zusammenhang zu einem weiteren, breitenwirksamen Engagement des Soroptimist-Clubs: seiner Beteiligung an der Ausstellung ‚Wohnen und Mode‘ in Berlin, auf der die
560 Zirkular Nr. 33, Schriftführerin Margareta Frenzl, 29.10.1932, in: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist International Deutsche Union, S. 41. 561 „Wir vermuten, daß bereits viele Clubschwestern und deren Freunde ein Bild von Annot gekauft hätten, und daß die für heutige Zeiten schwer [Herv. i. O.] aufzubringenden Beträge sie wahrscheinlich bis jetzt daran gehindert haben. Infolge der Geschehnisse ist nun Annot fast all ihrer Käufer und Schüler verloren gegangen, wie auch ihr Mann, der Maler Jacobi, und ihre Umstellung auf neue Pläne erfordert von ihnen als Eltern zweier begabter Kinder einen klaren Kopf für Entscheidungen. Den haben sie aber nicht infolge drückender Sorgen, da sie seit Monaten ohne Einkünfte sind. […] Es wäre für Annot und für uns alle eine große Freude […] daß sich unsere schwesterliche Teilnahme auch praktisch auswirkt.“ Ebd. 562 Dr. Ludwig Lewin, der jüdische Leiter der Lessing Hochschule hatte 1928 in Berlin das dreibändige Sammelwerk: ‚Der erfolgreiche Mensch‘ herausgegeben. Die Einzelbände waren: Bd. 1: Voraussetzungen des persönlichen Erfolges: Einführung, Körper, Geist, Seele, Erziehung, Bildung, Lebenskunst, Bd. 2: der persönliche Erfolg, Bd. 3: Der wirtschaftliche und der öffentliche Erfolg. Lewin kann damit als eine Art früher Karriere-Coach gelten, was für die Soroptimistinnen durchaus interessant gewesen sein dürfte. 563 Vgl.: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist, S. 38/39. 564 Vgl.: Programm der Hochschule der Frau, März 1931, in: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist, S. 38.
222 | Theanolte Bähnisch
Clubschwestern mit Hilfe von Berliner Firmen ein „Wohn- und Bibliothekszimmer der berufstätigen Frau“565 eingerichtet hatten. „Der Soroptimist-Club war und ist […] ein Netzwerk“566, hält Birgitta Schulte fest und fügt hinzu: „er wollte die Stellung der Frau verbessern, aber sie waren keine Frauenrechtlerinnen, die politische Schriften verfaßten oder kämpferische Vorträge hielten“567. Als ‚politisch‘ können die Artikel Tergits in den Berliner Zeitungen sowie der Artikel Bähnischs im Organ des Ärztinnenbundes jedoch durchaus gewertet werden, schließlich traten sie mit Nachdruck für die Akzeptanz und Förderung der Frauenberufstätigkeit in der Gesellschaft ein. Die Mittel, derer sich der Club zur Verbreitung seiner Ideen über seine Veranstaltungen und seine Mitglieder bediente, waren eher sublim. Weniger wirkmächtig waren sie damit jedoch nicht zwangsläufig, zumal im Club wichtige Multiplikatorinnen verkehrten, die ihre und die Überzeugungen ihrer ‚Schwestern‘ auch in anderen Vereinen, Verbänden und politischen Zusammenschlüssen verbreiteten. Daß Ilse Langner vom Deutschen Staatsbürgerinnenverband 1931 immerhin eine ‚lobende Erwähnung‘ für ihr Schauspiel ‚Katharina Henschke‘ erhielt und daß im gleichen Jahr auch einem zweiten Club-Mitglied, der Schriftstellerin Hertha von Gebhard, eine solche lobende Erwähnung zuteil wurde, zeugt davon, daß man von Seiten der bürgerlichen Frauenbewegung die Protagonistinnen des Soroptimist-Clubs durchaus als Förderinnen des EmanzipationsGedankens wahrnahm.568 Mitglied der Jury war neben Alfred Döblin, Rudolf Kayser, der Schriftstellerin Alice Behrend und der Dichterin Ina Seidel auch die damalige Präsidentin des BDF, Gertrud Bäumer. Die Tatsache, daß Irene Witte in einem Rundschreiben an die Club-Mitglieder dazu aufgerufen hatte, im Rahmen eines ClubTreffens über den Weltfrauenkongreß zu sprechen, verdeutlicht ebenfalls, daß den Soroptimistinnen ein ‚frauenbewegtes‘ Element innewohnte, auch wenn dieses Engagement auf die beruflich prinzipiell erfolgreichen Frauen fokussierte und den Nöten der Arbeiterinnen, Bäuerinnen und Hausfrauen nicht das gleiche Interesse entgegenbrachte. Mit der bürgerlichen Frauenbewegung als solcher wollten neben Gabriele Tergit auch andere Frauen im Club nicht in Zusammenhang gebracht werden. Als Bähnisch 1959 auf zehn Jahre Arbeit im von ihr begründeten Deutschen Frauenring zurückblickte, gab sie zu Protokoll, daß sie vor 1946 nicht in der Frauenbewegung aktiv gewesen sei.569 Analysiert man den Kontext, in dem sie diese Aussage machte und stellt man sie in Zusammenhang mit anderen von ihr getroffenen Aussagen zum Thema Frauenbewegung, so wird deutlich, daß Bähnisch unter ‚Frauenbewegung‘ einen tendenziell massenhaften Zusammenschluß von Frauen verstand. Der Soroptimist-Club war dagegen eine eher kleine Vereinigung von Frauen, die es zu städtischer, zum Teil auch nationaler oder gar internationaler Berühmtheit gebracht hatten
565 566 567 568
Ebd. Schulte: Welt, S. 107. Ebd. Vgl.: Deutscher Staatsbürgerinnenverband e.V., Allgemeiner Frauenverein 1865, Deutscher Zweig des Weltbundes für Frauenstimmrecht und Staatsbürgerliche Frauenarbeit an Ilse Langner, 16.06.1932, abgedruckt in: Schulte: Welt, S. 106. 569 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 162/163.
Sozialisation | 223
und die sich vor allem für Frauen einsetzte, die mit ähnlichen Chancen, Ansprüchen und Problemen konfrontiert waren, wie die Club-Mitglieder selbst. 2.3.2.5.3 Der Club als Anlaufstelle und Übungsfeld für Multiplikatorinnen Karitative Aktivitäten der Soroptimistinnen, wie sie im Statut festgeschrieben sind, sind aus der Weimarer Zeit nicht überliefert. Ein Grund hierfür kann in der kurzen Zeit, in der der Club überhaupt existierte, liegen. Entsprechende Konzepte hätten womöglich einer längeren Planungsphase bedurft. Einige der im Club organisierten Frauen setzten sich jedoch in anderen Zusammenhängen für sozial schwache Frauen ein. Im konfessionellen Rahmen tat dies beispielsweise Margarete Berent, eine der wohl wichtigsten Multiplikatorinnen im Club, die in der jüdischen Frauenwohlfahrt (Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Berlin) verantwortlich mitwirkte. Es ist davon auszugehen, daß Bähnisch nicht nur wegen der ähnlichen Ausbildung, sondern auch aufgrund der gemeinsamen Mitgliedschaft im Juristinnen-Bund mit der ersten Rechtsanwältin Preußens und Vorsitzenden des Ju-ristinnen-Bundes in engerem Kontakt stand als mit manch anderem Club-Mitglied.570 Berent war auch im Akademikerinnen-Bund, zu dessen Gründungsvorstand sie ebenfalls gehörte sowie im Jüdischen Frauenbund organisiert. In ihrem Beruf war sie auf Familienrecht spezialisiert, ein Metier, über das die ‚Stimme der Frau‘ nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aufklärte.571 Mit ihrem Engagement auch in anderen Zusammenschlüssen stand Berent nicht allein da: Die Rezitatorin und Leiterin der Berliner ‚Tribüne‘, Mary SchneiderBraillard beispielsweise, war ebenfalls nicht nur bei den Soroptimistinnen engagiert, sondern gehörte auch der 1926 gegründeten Künstlerinnengemeinschaft GEDOK an. Möglich ist, daß es wiederum auf dieser Verbindung aus dem Soroptimist-Club beruhte, daß Bähnisch sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges der Gemeinschaft erinnerte und diese 1949 – erfolgreich – einlud, sich dem DFR korporativ anzuschließen.572 Mary Wigman, eine berühmte Tänzerin der Weimarer Republik, über die 1948 ein Beitrag in der ‚Stimme der Frau‘ erschien,573 war ebenfalls Mitglied in der Vereinigung. Daß Frauen, welche den Soroptimistinnen angehörten, auch noch in anderen Vereinen und Verbänden, nicht selten in solchen mit ebenfalls feministischen Zielen Mitglieder waren, schien eher der Normalfall als die Ausnahme gewesen zu sein. Viele Club-Mitglieder waren auch über feministische Zusammenhänge
570 Im Nachlaß Margarete Berents im Leo-Baeck Institute ist kein Schriftwechsel mit Theanolte Bähnisch überliefert. Jedoch belegt die Überlieferung von Briefwechseln Berents mit Marie Elisabeth Lüders und Elisabeth von Harnacks, daß die beiden Frauen gemeinsame Bekanntschaften hatten. Vgl.: Leo Baeck Institute Archives, AR 2861/AR 2862/MF 592, Margarete Berent Collection, 1906–1965. 571 Vgl.: die Artikelserie über Rechte der Frau in der Ehe, z. B.: Feith, L.: Darf Marianne tippen? Auch wenn der Ehemann „nein“ sagt?, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 9, S. 10. 572 Siehe Kapitel 8.3.6. 573 O. V.: Aus der Welt. Mary Wigman und Harald Kreutzberg in Zürich, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 4, S. 29.
224 | Theanolte Bähnisch
hinaus politisch engagiert. Eine Kombination aus der berufsübergreifenden Gemeinschaft der Soroptimistinnen, der Mitgliedschaft in einer Organisation des eigenen Berufsstandes und einem zusätzlichen Engagement im politischen oder sozialen Bereich, wie bei Berent, war kein Einzelfall. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch Bähnisch Mitglied in vielen Zusammenschlüssen verschiedener, meist demokratischer Zielsetzung, in einigen davon in leitender Funktion. Wahrscheinlich war ihr nicht zuletzt über die Soroptimistinnen bewußt geworden, wie stark man persönlich und beruflich von solchen Mitgliedschaften profitieren und sie als Bühne für die Vermittlung der eigenen Überzeugungen nutzen konnte. Für den ‚Club deutscher Frauen, Hannover‘, den Bähnisch 1946 gründete, mag der Name des SoroptimistClubs sogar Pate gestanden haben. In ihrer Rede über das zehnjährige Bestehen des Deutschen Frauenringes sagte Bähnisch, sie habe den Namen ‚Club‘ aufgrund seines zwanglosen Charakters gewählt.574 Nicht nur die offiziösen, sondern auch die persönlichen Kontakte, die Bähnisch außerhalb des Clubs pflegte, überschnitten sich mit denen einiger anderer Mitglieder: Ilse Langner beispielsweise pflegte wie Bähnisch den Kontakt mit dem Ehepaar Grimme, sie war mit den Grimmes – zumindest 1956 – sogar per ‚Du‘.575 Bähnischs Kontakt zu den Grimmes könnte, wenn nicht über den Bruder Otto Nolte im Kultusministerium, auch über Langner zustande gekommen sein. Auch Lotte Wege, die ab 1948 in Bähnischs ‚Stimme der Frau‘ schrieb, war eine Freundin Langners. Die Rechtsanwältin Margarete Berent stand wiederum in freundschaftlichem Austausch mit Elisabeth von Harnack576, welche, wie der Ehemann Theanoltes, in der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Ost (SAG) engagiert war. Elisabeths Bruder Ernst von Harnack wurde später Chef Albrecht Bähnischs und ein politischer Freund des Ehepaars. Auch die liberale Politikerin Elisabeth Lüders, ebenfalls Rechtsanwältin, mit der Thea Bähnisch 1949 den DFR gründete, tauschte sich mit der Kollegin Berent aus577, was zeigt, daß das Berliner Netzwerk, in dem sich Bähnisch beruflich wie privat bewegte, engmaschig war. 2.3.2.5.4 Zerfall und Wiederaufleben des Clubs in veränderter Zusammensetzung/Schicksale seiner Mitglieder Die meisten Clubschwestern waren, wie Theanolte Bähnisch, politisch entschieden gegen den Nationalsozialismus eingestellt. Für viele Clubmitglieder erübrigte sich die Frage allein schon aufgrund ihrer jüdischen Herkunft oder ihrer Verwandtschaftsverhältnisse (das traf auf ein gutes Drittel der Mitglieder zu), für viele andere aufgrund der Beschneidung ihrer Berufstätigkeit und/oder ihrer künstlerischen Freiheit durch die Nationalsozialisten. Was die anderen Frauen im Club betrifft, so wird man zumindest von einer wie auch immer gearteten Solidarität gegenüber den politisch und rassisch verfolgten Clubschwestern ausgehen dürfen. Monika Melchert fällt
574 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 163. 575 DLA, A: Langner, Nachtrag 1966–1999, Josefine Grimme an Ilse Langner, 20.12.1956. 576 Vgl.: Leo Baeck Institute Archives, Margarete Berent Collection (1906–1965), Übersicht auf: http://access.cjh.org/home.php?type=extid&term=1236390#1, am 30.12.2013. 577 Vgl.: ebd.
Sozialisation | 225
es allerdings schwer, gerade die Freundin Bähnischs, Ilse Langner, politisch zu verorten,578 da diese sich, abgesehen von einer Rundfunkansprache, in der sie sich mit positivem Tenor, aber scheinbar recht inhaltsleer über Hitler als den „interessantesten Mann der Welt“579 verbreitet hatte, in den 1930er Jahren nicht öffentlich zum Nationalsozialismus positionierte. Folgt man Melchert, so glaubte Langner, die seit 1933 Mitglied des Reichsverbandes deutscher Schriftsteller (RDS) war,580 noch 1934 an ein pazifistisches Moment in der nationalen Bewegung in Deutschland, welches mit den besonderen Eigenschaften von Frauen eine für die Nation produktive Verbindung eingehen werde.581 Melchert merkt aber im gleichen Atemzug an, daß sich viele der Club-Schwestern der Schriftstellerin gegenüber sehr frei über ihre Abneigung gegen den Nationalsozialismus geäußert hatten. Dies trifft auch auf Bähnisch zu.582 Sie hatte die in Berlin lebende Freundin Langner 1932 sogar gebeten, ihr in der Großstadt kritische Lektüre zur Auseinandersetzung mit den politischen Verhältnissen zu besorgen, welche 1933 der Bücherverbrennung zum Opfer fiel.583 In Merseburg waren die Bücher vielleicht nicht ohne Weiteres zu bekommen gewesen, oder aber Bähnisch wollte sie dort nicht erwerben. Mit Erwin Planck, der im Umfeld des Hitler-Attentats am 20.07.1944 verhaftet und 1945 hingerichtet worden war, verlor auch Ilse Langner einen guten Freund. Melchert vertritt sogar die Meinung, Planck sei der Geliebte Langners gewesen.584 Auch Ernst von Harnack, der Bruder von Langners Freundin Agnes von Zahn-Harnack wurde im Kontext des Hitler-Attentats hingerichtet. Nur nebenbei erwähnt sei, es verwundert kaum bei soviel Prominenz in den Reihen, daß die Tochter Erwin Plancks, die technische Assistentin und Staatsse-
578 Mit einer „gewissen Selbstgerechtigkeit“ habe Langner über die Exilierten geurteilt, schreibt Monika Melchert. So sei Langner dem Irrglauben aufgesessen, die Exilschriftsteller hätten es im Ausland besser gehabt, während doch sie selbst durch die Position ihres Mannes als Direktor eines Chemie-Unternehmens ein mehr als erträgliches Auskommen im Dritten Reich gehabt habe. Vgl.: Melchert: Dramenzyklus, S. 6. 579 Schulte: Welt, S. 137 und 172. 580 Melchert: Dramatikerin, S. 87. Die Aufnahme in den Reichsverband deutscher Schriftsteller (RDS) ermöglichte Langner 1937 ‚Die purpurne Stadt‘ zu veröffentlichen. Für eine zweite Auflage des Werks, das sich gut verkaufte, bekam sie allerdings kein Papier zugeteilt, was sie selbst als ein Druck-Verbot interpretierte. Vgl.: ebd. 581 Brief Langners an Askanasy am 08.12.1934, zitiert in: Schulte: Welt, S. 139. 582 Vgl.: DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 19.02.1933. 583 Verbrannt wurde 1933 Eugen Fischer Balings erst 1932 erschienenes ‚Volksgericht‘. Neben diesem Werk hatte Bähnisch von Langner noch Eugen Rosenstocks 1931 erschienenes Buch ‚Die europäischen Revolutionen‘ erbeten. Vgl.: DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 17.11.1932. 584 Eine Liebe „im praktischen Leben“ hätte die beiden jedoch nicht verwirklicht, so Melchert. Langner und Planck hatten sich Melchert zufolge auf Langners Reise nach China kennengelernt. Melchert: Dramenzyklus, S. 5.
226 | Theanolte Bähnisch
kretärin bei Brüning und Schleicher, Nelly Planck, ebenfalls Mitglied im Soroptimist-Club war.585 Die Klubabende, auf denen üblicherweise einige Klubschwestern ihre Profession mitsamt den Ausbildungsmöglichkeiten und Aussichten vorstellten (welche schon wenig später vor allem für die Jüdinnen unter ihnen nicht mehr existieren sollten), fanden mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten ein schnelles und jähes Ende. „Nun konnten sich die Frauen nur noch unauffällig im kleinen Kreis, in privaten Wohnungen treffen, bald trennten sich die Wege der meisten von ihnen. Doch zwischen einigen, die in Berlin blieben, riß die Verbindung nicht ab“586, beschreibt Melchert die Entwicklung des Clubs und der in ihm geknüpften Bande. Viele Clubmitglieder, neben Lotte587 und Annot Jacobi588 auch Tilla Durieux589, Hilde Walter590, Gabriele Tergit-Reifenberg591, Margarete Berent592, Mary Schneider-Braillard593, die
585 Vgl.: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist International Deutsche Union, S. 45. 586 Melchert: Dramatikerin, S. 37. 587 Lotte Jacobi wanderte 1935 über London und Kanada nach New York aus. Dort kamen die gewünschten Kontakte zum Theater und zu Tanzstudios jedoch nicht zustande. 588 Die Malschule, die Annot Jacobi seit 1928 mit ihrem Mann Rudolf Jacobi betrieb, mußte 1933 geschlossen werden, nachdem sich die Jacobis geweigert hatten, jüdische Schüler auszuschließen. Die Familie verließ daraufhin das Land, um in New York zu leben. Dabei hinterließ Annot Jacobi der Club-Schwester Freda Wuesthoff einige Koffer, die diese 1934 auf ihre Amerika-Reise mitnehmen sollte. Vgl.: Berthold: Wuesthoff, S. 71. 589 Tilla Durieux floh mit ihrem jüdischen Ehemann über Prag und die Schweiz nach Jugoslawien. Beim Einmarsch deutscher Truppen in Jugoslawien 1941 wurde der Bankier Ludwig Katzenellenbogen in das KZ Sachsenhausen verschleppt, wo er 1943 starb. Durieux engagierte sich in jugoslawischen Widerstandsgruppen. Vgl.: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist, S. 59. 590 Hilde Walter hatte nach dem Besuch der sozialen Frauenschule Salomons Literatur- und Kunstgeschichte studiert. 1933 setzte sie sich für die Freilassung des Publizisten Carl von Ossietzky ein, der nach dem Reichstagsbrand verhaftet worden war. Später war sie als Hilfsredakteurin bei Ossietzkys ‚Weltbühne‘ tätig. Sie flüchtete 1933 nach Paris, von dort über Marseille und Spanien in die USA. Vgl.: ebd., S. 66/67. 591 Tergit war ebenfalls Schülerin der Sozialen Frauenschule gewesen, bevor sie ihr Studium der Geschichtswissenschaften und Philosophie in München begann, welches sie 1924 mit der Promotion beendete. Nach einem Anschlag der SA auf ihre Wohnung emigrierte Tergit mit ihrem Mann, dem Architekten Heinrich Julius Reifenberg und den Kindern nach Prag, von dort aus nach Palästina. 1938 ging die Familie nach London. 592 Berent lehrte an der sozialen Frauenschule von Alice Salomon bzw. an der Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit. Als Jüdin wurde sie 1933 aus der Anwaltskammer ausgeschlossen. Bis zu ihrer Ausreise 1939 in die USA über Basel, Genua und Chile engagierte sie sich als Vorstandsmitglied im Jüdischen Frauenbund und im Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden. Margarete Berents Bruder und dessen Familie wurden in Auschwitz ermordet. Vgl.: ebd., S. 61.
Sozialisation | 227
Architektin Marie Frommer594, Lizzie Hoffa und schließlich die Initiatorin des Clubs, Edith Peritz595, verließen Deutschland auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. Freda Herzfeld-Hoffmann, alias ‚Wuesthoff‘ blieb im Land, mußte allerdings verdeckt arbeiten. Ein anderes jüdisches Club-Mitglied, die Reformpädagogin Paula Fürst, wurde im Juni 1942 deportiert und vermutlich in einem Konzentrationslager in Osteuropa ermordet. „Sie alle waren 1933 erfolgreich gewesen, Persönlichkeiten, einzigartig, eine nie wieder genauso vorkommende Zusammensetzung von Zellen“596 urteilte Gabriele Tergit viele Jahre später über die jüdischen wie nichtjüdischen Mitglieder des Clubs. Nur drei Jahre nach seiner Gründung konnte der Club, der nicht nur konfessionell neutral war, sondern auch den internationalen Austausch berufstätiger Frauen pflegte – ein zweiter Dorn im Auge der Nationalsozialisten – sich nicht mehr offiziell zusammenfinden. Reflektiert man die Dauerhaftigkeit der Bindungen, die aus dem Club resultierten und das Maß an Unterstützung, das die Frauen einander zu Teil werden ließen, so geht man nicht fehl in der Annahme, daß für die Clubmitglieder vermutlich gerade die Bedrohtheit ihrer gemeinschaftlichen Treffen und ihr jähes Ende die Bedeutung der Gemeinschaft für das Leben einer jeden einzelnen Clubschwester unterstrich. Die einmal im und über den Club etablierten Kontakte hielten – vor allem auf Betreiben Ilse Langners hin – oft ein Leben lang an und zwar, wie es Hertha von Gebhardt beschreibt, „nicht […] primär durch das Medium privater Fühlungnahme und Sympathie, nicht wie es unter Frauen doch meist geschieht, vom Herzen und vom Gefühl, sondern eher vom gemeinsam Erstrebten, vom Geist und vom Denken her“597. Dies, aber auch der einander entgegengebrachte Respekt, mag erklären, warum im schriftlichen Kontakt Bähnischs mit Langner und Jacobi erst langsam das ‚Sie‘ dem ‚Du‘ wich. Insbesondere die Beispiele Gabriele Tergit, Ilse Langner, Lotte Jacobi und Tilla Durieux zeigen, daß der Soroptimist-Club Berlin seinem hochgesteckten Anspruch, die ‚besten Schwestern‘ der Berufsstände zu vereinigen, durchaus gerecht wurde. Tilla Durieux beispielsweise wird heute als „gefragteste Schauspielerin der Weimarer Republik“598 gehandelt. Aus Österreich war
593 Schneider-Braillard hatte 1927 die ‚Europäische Tribüne‘ begründet, der unter anderem Heinrich Mann, Jakob Wassermann, Romain Rolland, Jules Romains und George Duhamel angehörten. Das unabhängige Forum tagte im Preußischen Herrenhaus und stand allen Interessierten offen. Braillard wurde 1933 verhaftet. Nach gelungener Flucht über Dänemark, Estland, die Tschechoslowakei und Paris wurde sie erneut gefangen genommen und in das KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie 1945 von den Alliierten befreit wurde. Vgl.: ebd., S. 64. 594 Frommer wurde als erste Architektin in Deutschland promoviert. Sie verlor aufgrund ihrer jüdischen Herkunft 1934 die Berufserlaubnis, woraufhin sie zunächst nach London, dann nach New York auswanderte. Vgl.: ebd., S. 62. 595 Peritz emigrierte gemeinsam mit ihrem Mann 1936 nach New York und war dort weiterhin als Ärztin tätig. Vgl.: Gruner/Aly: Verfolgung, Bd. 1, S. 145, Anm. 13. 596 Tergit: Seltenes, S. 208. 597 Vgl.: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist, S. 8. 598 Vgl.: Art. „Tilla Durieux“, auf: LEMO/Lebendiges virtuelles Museum online, Deutsches Historisches Museum, auf: http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/DurieuxTilla/, am
228 | Theanolte Bähnisch
die gebürtige Ungarin 1903 in Berlin angekommen und hatte sich einen Namen gemacht, indem sie, wie George Salmony es fomuliert, „das bürgerliche Establishment der Kaiserzeit mit ihrem animalischen Charme und ihrer intellektuellen Aggressivität wohlig schockierte“599. Durieux, die in erster, nicht einmal ein Jahr währender Ehe mit dem Maler Eugen Spiro und in zweiter Ehe mit dem Verleger und Galeristen Paul Cassirer verheiratet war, spielte in Inszenierungen des Deutschen Theaters, des Lessing-Theaters, des Königlichen Schauspielhauses sowie des Staatstheaters in Stücken Wedekinds, Schillers, Hebbels, Wildes, Tolstois und Sophokles’. Mit ihrem dritten Ehemann, dem jüdischen Großindustriellen Ludwig Katzenellenbogen600, den sie 1930 geheiratet hatte, unterstützte sie den von ihr für sein Talent sehr bewunderten Intendanten, Regisseur und Schauspiellehrer Erwin Piscator bei der Gründung seines ersten Theaters am Nollendorfer Platz 1927 mit 400.000 Mark – und schuf sich damit selbst eine neue Spielstätte. Ab 1928 übernahm sie in Piscators Theater Rollen, spielte unter anderem die Zarin in Tolstois ‚Rasputin‘.601 1933 sah sie sich gezwungen, mit ihrem Mann nach Jugoslawien auszuwandern. Nachdem dieser im Exil in die Fänge der Gestapo geraten und im Konzentrationslager gestorben war, kehrte sie 1952 als Witwe nach Deutschland zurück und setzte ihre Karriere in Berlin und Hamburg fort.602 Ab 1951 war sie Senior-Mitglied des wieder gegründeten Soroptimist-Clubs603, was zeigt, daß auch sie die Möglichkeit, an die Gemeinschaft wieder anzuknüpfen, nicht missen wollte. Theanolte Bähnisch bewegte sich in Berlin also unter ebenso gebildeten wie prominenten Frauen, die sie offensichtlich als eine der ihren wahr- und in ihre Mitte aufnahmen. Nach ihrem Umzug nach Merseburg sah sie die anderen Club-Mitglieder nicht mehr so häufig, wie zuvor. Entsprechend wird sie zu dieser Zeit nicht als ordentliches, sondern nur als „korrespondierendes Mitglied“604 geführt. An einer Generalversammlung im März 1932 hatte sie allerdings teilgenommen. Vermutlich hatte sich der Termin in die ‚Dienstgeschäfte‘, die sie in Berlin zu erledigen hatte, gut
599
600
601 602 603 604
20.09.2013. Tilla Durieux wurde am 18.08. 1880 als Ottilie Godefroy 1880 in Wien geboren, war also 20 Jahre älter als Bähnisch. Sie starb 1971 in Berlin. George Salmony zitiert nach Sucher, Bernd (Hrsg.): Theater-Lexikon. Autoren, Regisseure, Schauspieler, Dramaturgen, Bühnenbildner, Kritiker, 2. überarbeitete Aufl., München 1999, S. 152. Katzenellenbogen, der Generaldirektor der Brauerei Schultheiß-Patzendorfer, war ab 1932 in Finanzskandale mit antisemitischem Hintergrund verwickelt. Er wurde 1941 aus Kroatien nach Berlin verschleppt und starb 1944 im KZ Sachsenhausen. Vgl.: Koldehoff, Stefan: Ein Schuß in’s Herz, in: Die Welt online, 15.01.2006, auf: http://www.welt.de/ print-wams/article137281/Ein_Schuss_ins_Herz.html, am 18.09.2013. Vgl.: ebd. sowie Durieux, Tilla: Meine ersten neunzig Jahre. Erinnerungen. Die Jahre 1952–1972 nacherzählt von Werner Preuß, München/Berlin 1971, S. 317. Vgl.: Sucher: Theater-Lexikon, S. 152. Vgl.: Mitgliederliste 1951, Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist, S. 53. Vgl.: Jahresbericht 1931, Berlin 26.05.1932, abgedruckt in: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist, S. 36/37.
Sozialisation | 229
integrieren lassen.605 1933, nach ihrer Rückkehr aus Merseburg, taucht sie wieder als ordentliches Mitglied, wenn auch nicht als Vorstands-Mitglied als in Berlin-Steglitz wohnend, in der Mitgliederliste auf.606 Ilse Langner war zu dieser Zeit nicht vor Ort: im März 1933 hatte sie sich auf eine Reise nach Asien und Amerika begeben, von der sie erst im Herbst 1933 zurückkehrte.607 1945 wurde der Club in Berlin auf die Initiative Ilse Langners, die die Mitglieder zunächst zu Treffen in ihrem Privathaushalt versammelte, neu gegründet. „Ich ließ das freundschaftliche Ganze nicht auseinanderfallen, außerdem stehen mir fast alle der anwesenden Klubschwestern persönlich nahe. Jetzt sind sie freilich über ganz Deutschland in alle Besatzungszonen verteilt. Aber ein Kern ist doch in Berlin geblieben, und ich will aus ihm wieder einen ansehnlichen Baum wachsen lassen“608, schrieb Langner 1945 an die Gründerin des Clubs, Edith Peritz, die zu dieser Zeit in New York lebte. Daß die Mitglieder nicht nur über ganz Deutschland, sondern auch über das Ausland verstreut lebten, zeigt, daß Langner, drei Monate nach Kriegsende offenbar nicht über alle Schicksale Bescheid wußte. Bähnisch, im Jahr 1945 in Köln, ab 1946 in Hannover wohnhaft, nahm aufgrund des erschwerten Interzonen-Verkehrs und der Enklave-Situation Berlins nach 1945
605 Vgl.: DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 25.10.1932. 606 Vgl.: Mitgliederliste 1933, in: Soroptimist International, S. 44. In der Mitgliederliste ist, abweichend von den Angaben zu den anderen Club-Mitgliedern, kein Beruf, sondern, scheinbar als Arbeitgeber, „Folkwang-Archiv“ angegeben. Dabei muß es sich um das als ‚Auriga-Volkwang-Verlag‘ gegründete Unternehmen gehandelt haben, welches nach dem Publikationsverbot durch die Nationalsozialsten 1933 und bis zur Emigration des Verlagsleiters Ernst Fuhrmann 1938 unter dem Namen ‚Folkwang-Archiv‘ als reiner Bildverlag tätig war. Vgl.: O. V.: Die Welt der Pflanze. Photographien von Albert RengerPatzsch und aus dem Auriga-Verlag auf: http://www.skkultur.de/photographie /ausstellungen_info.php?id=50&goback=ausstellungen_archiv&actBtn=ausstellungen_ar chiv&pasBtn=ausstellungen_archiv, am 05.08.2009. Im Fragebogen der Militärregierung gab Bähnisch an, für Lotte Jacobi als Vertreterin für Pressephotos tätig gewesen zu sein. Da Jacobi ihrerseits zeitweilig Mitarbeiterin des Folkwang-Archivs war (Vgl.: Peters, Dorothea: Kunstverlage, in: Fischer, Stephan/Fischer, Ernst (Hrsg.): Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 2: Die Weimarer Republik, 1918– 1933, München 2007, S. 463–508, hier S. 504) ist es möglich, daß Bähnisch der Freundin im Verlag zugearbeitet hat. Leider läßt sich nicht ermitteln, wie lange Jacobi für den Verlag arbeitete. Ob die Nennung des Arbeitsplatzes von Bähnisch anstelle des ausgeübten Berufs darauf zurückzuführen ist, daß Bähnisch im Verlag abhängig beschäftigt war, sie mit ihrer Arbeit also die ‚Richtlinien‘ des Clubs, selbstverantwortlich tätig zu sein, 1933 nicht erfüllen konnte, ist unklar. Daß ihre Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrätin, die sie 1932 aufgenommen hatte, in der Liste der Mitglieder 1933 keine Erwähnung fand, ist verwunderlich. 607 Melchert: Dramatikerin, S. 67–71. 608 DLA, Langner, Langner an Edith Peritz, 19.08.1945, zitiert nach Melchert: Die Dramatikerin Ilse Langner, S. 38.
230 | Theanolte Bähnisch
nicht regelmäßig an den Treffen teil, sie begrüßte das Auffrischen der Kontakte jedoch sehr, wie einem ihrer zahlreichen Briefe an Langner zu entnehmen ist,609 und versuchte, die Berliner Frauen wiederzutreffen. Einen eigenen Beitrag zur Verbindung von Berlinerinnen mit den Frauen in den westlichen Besatzungszonen leistete sie durch die Herausgabe der ‚Stimme der Frau‘, für die sie Beiträge von Berlinerinnen einwarb. Auch mit Ilse Langner stand sie in diesem Zusammenhang in Kontakt.610 Daß sie nicht nur mit Jacobi und Langner, sondern auch mit anderen Frauen aus dem Club nach 1933 noch sporadische Kontakte aufrecht erhielt, ist ihren Briefen an Langner zu entnehmen.611 Für Bähnisch war es allerdings – ganz anders als für Langner – einfacher, jene Frauen zu treffen, die nicht mehr in Berlin lebten. Vor allem die bereits erwähnte Freda Wuesthoff sah Bähnisch wiederholt. Überliefert sind Treffen in Stuttgart, Frankfurt und Bad Pyrmont.612 Von Hertha von Gebhardt, die eine gute Freundin Langners blieb, schrieb Bähnisch in einem Brief an Langner 1946 dagegen eher abschätzig.613 Durch die Zusammenarbeit mit Gabriele Strecker etablierte Bähnisch nach dem Zweiten Weltkrieg einen engen Kontakt zu einer Leiterin eines zweiten deutschen Soroptimist-Clubs, denn Strecker, die mit Bähnisch im DFR zusammenarbeitete, hatte 1952 eine Niederlassung des Clubs in Frankfurt gegründet. Neben dem Frankfurter und dem Berliner Club (1951 wieder gegründet) entstand 1955 ein Club in Bonn Bad-Godesberg. 1956, als der fünfte deutsche SoroptimistClub in Hannover entstand wurde Theanolte Bähnisch erneut Gründungs- und ständiges Mitglied der Soroptimistinnen.614 Allem Anschein nach hat Bähnisch im Berliner-Soroptimist-Club nicht nur Rückhalt in ihrem Karriere-Streben durch andere berufstätige Frauen gefunden, son-
609 „Schreib mir bitte, wann die nächste Zusammenkunft ist. Ich möchte doch zu gern einmal dabei sein und will möglichst meinen Berliner Reiseplan danach richten“ schrieb Bähnisch an Ilse Langner, als sie in Köln lebte. DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 15.02.1946. 610 Siehe Kapitel 7.5.2. 611 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Ilse Langner, 23.07.1965 und 03.01.1946. 612 Jene Treffen werden in den Kapitel 6 bis 8 beschrieben. 613 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 15.02.1946. 614 Eine Liste der Gründungsmitglieder des 1951 gegründeten Hannoveraner Clubs, die wiederum sehr verschiedene Berufe hatten, findet sich, zusammen mit einem Überblick über die Gründungen nach 1945 auf der Homepage des Soroptimist Club Hannover. Vgl.: O. V.: Clubgeschichte, auf: http://www.si-club-hannover.de/index.php?option=com_content &view=category&layout=blog&id=109&Itemid=128, am 20.09.2013. In Hannover hatte offenbar Jennie Thilot-Thierfelder, eine aus Finnland stammende Sängerin und Regisseurin wesentlich dafür gesorgt, daß sich Künstlerinnen, Frauen die im medizinischen Bereich tätig waren, Pädagoginnen und Wissenschaftlerinnen sowie eine Schriftstellerin, eine Dolmetscherin eine Museumsdirektorin, die Regierungspräsidentin und andere Frauen zu einem Club zusammenschlossen. Vgl.: ebd. Welche Rolle Bähnisch dabei spielte, wäre interessant, herauszuarbeiten, muß jedoch einem anderen Projekt vorbehalten bleiben.
Sozialisation | 231
dern konnte durch den persönlichen Kontakt mit Künstlerinnen und Schriftstellerinnen auch ihre Kenntnisse über Kunst und Kultur erweitern sowie ihrem Interesse an Gesprächen über diese Themen Rechnung zollen. Hatte sie als Dezernentin der Theaterabteilung beruflich einen eher technischen Zugang zu Kunst und Kultur, so schien es ihr insbesondere über Bekannte wie die Bildhauerin Milly Steger, die Gebrauchsgrafikerin und Malerin Martel Schwichtenberg, die Malerin Annot Jacobi, die Schauspielerin Tilla Durieux, die Vortragskünstlerin Schneider-Braillard und die Sängerin Rose Walter, möglich gewesen zu sein, zwischen ihren Aufgaben als Assessorin und ihren kulturellen Interessen als Bürgerin eine Brücke zu schlagen. Elias Canetti beschrieb die kulturelle Glanzzeit Berlins einst als eine „Zeit vieler großer Namen“615. Theanolte Bähnisch lernte einige dieser Namensträger, vor allem einige der Frauen unter ihnen, kennen, identifizierte sich mit ihren Werken und nahm Anteil an ihrem Leben. So schien sie Ende der 1920er Jahre in Berlin angekommen zu sein: beruflich wie gesellschaftlich. Der Soroptimist-Club hatte dafür eine kaum zu überschätzende Rolle gespielt.
615 Canetti, Elias: Die Fackel im Ohr, Frankfurt a. M. 1982, S. 281, zitiert nach Metzger: Berlin, S. 23.
3
Ehemann, beruflicher Partner und politischer Freund: Albrecht Bähnisch (1900–1944)
3.1 „GANZ BESONDERS SCHÖNE JAHRE“ – DIE BÄHNISCHS ALS EHE- UND ARBEITSPAAR Im Januar 19271, ein halbes Jahr nach ihrem Dienstantritt im Polizeipräsidium, heiratete Dorothea Nolte Albrecht Bähnisch, der zu dieser Zeit Regierungsassessor im preußischen Innenministerium war. Kennengelernt hatten sich die beiden in Münster, wo sie zwischen 1924 und 1926 jeweils Stationen ihres Verwaltungsreferendariats absolviert hatten. Mit ihren Ausbildungskollegen habe sie ein „ein netter, kameradschaftlicher Ton“2 verbunden, berichtet Theanolte Bähnisch in ihrem Diktat von 1972. In diesem erwähnt sie auch ein großes Zimmer im Regierungspräsidium, in dem die Referendare gemeinsam arbeiteten und zweimal wöchentlich ihren Unterricht erhielten.3 Vermutlich hatten sich Theanolte und ihr zukünftiger Mann Albrecht also in jenem Zimmer, in dem sie zusammen mit Kollegen viele Stunden verbracht hatten, näher kennengelernt.4 Orla-Maria Fels weiß nicht zu sagen, wie und wann die Beziehung ihrer Eltern begann – nur daß es in Münster gewesen sein müsse.5 Immerhin möglich ist, daß Albrecht Theanolte bereits getroffen hatte, als er sich im Sommer – während Theanolte noch dort studierte – 1922 an der Universität Münster aufgehalten hatte, als sein akademischer Vater, Dr. Gerhard Lassar, dort einen Lehrauftrag ausfüllte.6
1 2 3 4
5 6
Die kirchliche Trauung fand am 26.02.1927 statt. LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit B, Nr. 5, Beglaubigte Abschrift der Heiratsurkunde vom 08.03.1927. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Rückkehr an die Regierung, S. 23. Vgl.: ebd. Auf einem Bild, das sich im Privatbesitz von Orla-Maria Fels befindet, sind die Eltern gemeinsam mit drei anderen Referendariats-Kollegen – vielleicht eine Lerngruppe – abgebildet. Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen 11.11.2009. Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 3/4.
234 | Theanolte Bähnisch
Was genau die beiden jungen Leute füreinander eingenommen hat, läßt sich ebenfalls nicht rekonstruieren. Auf einem Bild mit anderen Referendariats-Kollegen geben die beiden jedenfalls ein durchaus ansprechendes Paar ab: Albrecht, von schlanker, sportlicher Statur, in schlichter Eleganz gekleidet, mit dezentem Schnauzbart und einer bereits in jungen Jahren stark ausgeprägten Glatze, Theanolte mit hochgestecktem Haar, makellosem Teint, ebenfalls eleganter Kleidung und deutlich rot geschminktem Mund. Albrecht Bähnisch scheint bei Kollegen und Vorgesetzen gleichermaßen beliebt gewesen zu sein. Dr. Kerstiens, der sein Referendariats-Zeugnis ausstellte, schrieb Albrecht ein „zurückhaltendes Wesen“ und „verbindliche und liebenswürdige Umgangsformen“7 zu. Vielleicht gefiel auch Theanolte nicht zuletzt Albrechts „zuverlässiges und bescheidenes Verhalten“, mit dem er sich als Schüler „die Liebe und das Vertrauen seiner Lehrer erworben“8 haben soll. Aufgrund seiner sehr guten Leistungen war Albrecht Bähnisch trotz der geltenden Abbaubestimmungen nach dem Ende seines Studiums als „überzähliger Referendar“9 bei der Regierung Münster eingestellt worden. Während dieser Zeit hatte er sein praktisches Talent durch Tätigkeiten unter Beweis stellen können, die dem jungen Mann jeweils ein großes Maß an Verantwortung abverlangt hatten. So hatte er beispielsweise den erkrankten Amtmann beim Landratsamt in Halle/Westfalen vertreten und damit – noch während seiner Ausbildung – faktisch selbständig das Hallenser Bürgermeisteramt verwaltet. Wie seine zukünftige Frau, die im Zuge ihres Verwaltungs-Referendariates – ihren bereits zitierten Ausführungen zufolge – nicht nur den Landrat Graf von Westphalen, sondern sogar den als äußerst schwierig geltenden Verwaltungsgerichtsdirektor zu beeindrucken vermocht hatte, so hatte auch Albrecht einen sehr guten Eindruck bei seinen Vorgesetzten hinterlassen.10 Kollegen und Freunden dürften beide Partner, die sich noch während ihrer Ausbildung, am 05.02.1926 verlobten,11 als ähnlich zielstrebig, ehrgeizig und beliebt aufgefallen sein. Wenige Monate nach ihrer Verlobung schlossen Albrecht und Theanolte ihre Abschlußprüfungen fast zeitgleich ab, wobei sich Albrecht, von den Ausläufern einer schweren Grippe gebeutelt, mit letzter Energie durch das Examen schleppte.
7 8
LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit B, Nr. 5, Zeugnis von Kerstiens. LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit B, Nr. 5, Zeugnisheft des Regierungs-Referendars Bähnisch, Zeugnis der Reife, Königliches und Gröningsches Gymnasium zu Stargard in Pommern. 9 LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit B, Nr. 5, passim. 10 LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit B, Nr. 5, Zeugnisheft des Regierungs-Referendars Bähnisch, Der Landrat, Halle in Westf., den 27.05.1925, Zeugnis: „Regierungsreferendar Bähnisch hat sich der ihm gestellten Aufgabe voll gewachsen gezeigt, so daß ich ihm nur das beste Zeugnis ausstellen kann.“ 11 Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 12/13, S. 4.
Albrecht Bähnisch | 235
Jene Grippe-Erkrankung, von der er sich infolge seines „rastlosen Fleißes“12 während des Referendariats nicht ausreichend erholt hatte, wurde von seinem Schwiegersohn Hans- Heino Fels als Grund dafür angeführt, daß er die ‚große Staatsprüfung‘ nach der Beendigung des Referendariats am 03.07.1926 „nur“13 mit ‚gut‘ absolviert hatte. Seinen glänzenden Karriereaussichten tat dies indes keinen Abbruch. Nach Abschluß des Referendariats wurde er zunächst noch für sechs Monate an das Landratsamt Flensburg überwiesen, wo er das Wohlfahrtsamt leitete und mit der Förderung der Ansiedlung im Kreis14 betraut war. Danach wurde ihm jeweils für einige Monate die vertretungsweise Leitung des Landratsamts in Halle und des Versicherungsamts in Flensburg übertragen15. Dann konnte er seine Assessoren-Stelle im Preußischen Innenministerium in Berlin antreten und so den Arbeits- und Wohnort mit seiner Verlobten teilen. Als er mit Theanolte am 21.01.1927 schließlich das Standesamt aufsuchte, arbeitete Albrecht erst seit elf Tagen in Berlin.16 Einen Monat später, am 26. Februar, ließ sich das Paar kirchlich trauen, zwei Tage später bezog man die erste gemeinsame Wohnung in Berlin-Schöneberg.17 Schon nach einem knappen Jahr, am 28.02.1928 kam der nächste Umzug. Diesmal ging es nach Berlin-Mitte18, wo auch Theanoltes jüngerer Bruder Werner, der zu dieser Zeit Student war, mit im Haushalt lebte. Im Januar 1928 wurde, zur Entlastung der beiden vollberufstätigen Partner, aber wohl auch nicht zuletzt, weil es in „Haushalten des gehobenen Bürgertums“19 so „üblich“ war, „Fräulein Frieda“20 als Haushälterin eingestellt. Bereits im März arbeitete an
12 LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit B, Nr. 5, Schlusszeugnis für Albrecht Bähnisch, Münster, 10.05.1926. 13 Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 4, Anführungszeichen i. O. 14 Seine offizielle Aufgabe war es, Hauszinssteuerhypotheken zu vergeben und Bodenmeliorationen zu fördern. 15 Seinen Dienst im Landratsamt trat er am 23.07.1926 an, den stellvertretenden Vorsitz des Versicherungsamtes übernahm er ab dem 30.09.1926. LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit B, Nr. 5, Übersicht über den Gang des Vorbereitungsdienstes des Regierungsreferendars Albrecht Paul Alfred Kurt Bähnisch. 16 Sein Dienstantritt im Innenministerium war am 10.01.1927. Ebd.. 17 Das Paar lebte dort in der Frobenstraße.Frobenstraße. Albrecht hatte zunächst im Nordwesten, am Schleswiger Ufer, in der Nähe des Tiergartens gewohnt. Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 3 und S. 4. 18 Das Paar lebte dort in der Kochstraße 66. Vgl.: ebd., S. 4. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges befand sich in unmittelbarer Nähe zu dieser Adresse der ‚Checkpoint Charlie‘. 19 Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 4. Die Anwesenheit einer Haushälterin sei sowohl Albrecht als auch Theanolte aus ihren Elternhäusern vertraut gewesen, schreibt Fels. Vgl.: ebd. 20 Laut Hans-Heino Fels handelte es sich dabei um Frieda Klinge, geboren 1897. Ebd., S. 4.
236 | Theanolte Bähnisch
ihrer Stelle „Lisbeth“21, die für die folgenden neun Jahre, trotz mehrmaliger Wohnortwechsel, für die Bähnischs tätig bleiben sollte. Die Mutter der katholisch getauften und erzogenen Braut soll – so berichtet jedenfalls deren Enkelin – zunächst recht unglücklich darüber gewesen sein, daß ihre Tochter Thea sich dazu entschlossen hatte, einen Protestanten zu heiraten.22 Für Theanolte selbst schienen die Jahre, die vor ihr lagen jedoch zu den besten ihres Lebens gehört zu haben. „Es kamen nun für mich ganz besonders schöne Jahre durch die Zusammenarbeit und die gemeinsamen Interessen mit meinem Mann“23, notierte sie später und verdeutlichte damit, welch zentrale Rolle die Berufsarbeit und das Interesse an gesellschaftlichen Zusammenhängen für sie in der Paarbeziehung spielte. „Frau sein und mit Dir arbeiten, so habe ich unser Zusammenleben gesehen“24, lautete die Formulierung, welche die enge Freundin Ilse Langner im Drama ‚Amazonen‘ ihrer ‚Pentha‘, alias Thea, in den Mund gelegt hatte. Und eben damit scheint das Ideal der Kameradschaftsehe, wie Theanolte es allem Anschein nach zunächst einmal bis zu ihrem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst im Jahr 1930 gemeinsam mit Albrecht verwirklichen konnte, treffend beschrieben worden zu sein. In den Folgejahren bis 1932/1933, als Albrecht Landrat des Kreises Merseburg war, konzentrierte sich Theanolte auf die Erziehung der Kinder. In der Retrospektive war es ihr jedoch wichtig zu betonen, daß sie sich auch in dieser Zeit „sehr stark mit allgemeinen politischen Fragen“25 beschäftigt habe. Die bereits erwähnte Bitte Bähnischs an Ilse Langner, diese möge ihr politische Literatur beschaffen, deutet darauf hin, daß sich die junge Mutter auf dem Laufenden hielt und sich aktiv eine Meinung über die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen bilden wollte. Gleichzeitig liest sich ihre Aussage, als sei eine Erklärung darüber vonnöten gewesen, daß sie sich nicht ausschließlich auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter konzentriert habe. Wie intensiv ihr Selbststudium zu jener Zeit auch war: Man darf davon ausgehen, daß der Ehealltag auch in den Jahren, in denen Theanolte nicht oder nur sehr eingeschränkt berufstätig war, vom gemeinsamen Interesse an Verwaltung, Gesellschaft und Politik geprägt war. Theanolte Bähnischs Selbstwahrnehmung kam später besonders stark in ihrer Aussage, man möge sie und ihren Mann für die Jahre des Dritten Reiches als eine „Einheit“26 betrachten, zum Ausdruck. Mit dieser Argumentation versuchte sie – immerhin teilweise erfolgreich – in den 1950er Jahren die Ent-
21 Mit bürgerlichem Namen hieß die Haushälterin Elisabeth Reinicke. Sie war 1899 geboren und damit genauso alt wie ihre Arbeitgeberin. Vgl.: ebd., S. 5. 22 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. 23 AddF Kassel, SP – 01, Kurze Lebensskizze, o. D. 24 Siehe Kapitel 2.3.2.4.3. 25 AddF Kassel, SP – 01, Kurze Lebensskizze, o. D. 26 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Der Regierungspräsident an den Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, 20.05.1949, betreffend „Wiedergutmachung“. Mit dem Schreiben versuchte Theanolte Bähnisch die Wiedergutmachungsansprüche, die Albrecht Bähnisch als von den Nationalsozialisten dienstenthobener Landrat 1933 gegenüber der BRD gehabt hätte, für sich selbst zu reklamieren. Albrecht Bähnisch galt zu diesem Zeitpunkt noch als in Rußland vermißt.
Albrecht Bähnisch | 237
schädigung, die ihrem Mann aufgrund der 1933 erfolgten Amtsenthebung durch die Nationalsozialisten zustand, für sich selbst einzuklagen.27 Die Briefe, welche sie 1932 an ihre Freundin Ilse Langner schrieb, verdeutlichen, wie sehr sie tatsächlich die politische und berufliche Lage ihres Mannes Anfang der 30er Jahre auch zu ihrer eigenen machte. Sie schien hinter den Entscheidungen ihres Mannes gestanden zu haben und bangte mit ihm um seine Zukunft als Landrat. Dabei spielte vermutlich auch die Angst vor einem finanziellen Engpaß mit, doch folgt man den Äußerungen Theanoltes in ihren Briefen an Ilse Langner28, so wog die Sorge um die Entwicklung der politischen Verhältnisse im Land schwerer. Mit der Stellung Albrecht Bähnischs war nicht nur die in Merseburg neu aufgebaute Existenz als kleine Familie29 bedroht, sondern auch eine weitere gemeinsame Sache: das Eintreten für die Demokratisierung der Verwaltung und die Politik der Großen Weimarer Koalition, mit der sich Albrecht wie Theanolte identifizierten. „Meine Eltern waren in ihrem Denken sehr nah beieinander, sie waren sich immer sehr einig“30, faßt Orla-Maria Fels die IdeenVerbundenheit ihrer Eltern auch in Bezug auf Politik und Gesellschaft zusammen. Theanolte behielt – trotz steigender Arbeitslosigkeit in der Republik und entsprechendem Druck auf die Regierung – zunächst ihre Stelle beim Polizeipräsidium Berlin. Sie wurde am 10.11.1930, mit 31 Jahren, sogar zum ‚Regierungsrat‘ ernannt.31 Daß sie trotz ‚Beamtinnen-Zölibat‘ ihren Posten sogar durch den Wechsel auf eine planmäßige Stelle ausbauen und verstetigen konnte, führt Bähnisch auf ihr hartnäckiges Auftreten zurück: Sie habe sich schriftlich versichern lassen, daß im Zuge ihrer Heirat nicht von den gesetzlich verfügten Abbaubestimmungen gegen sie Gebrauch gemacht werde.32 Ob sie ihr ‚Ja-Wort‘ gegenüber Albrecht Bähnisch wirklich von der Zustimmung des Innenministers Grzesinski zu ihrem Verbleib im Beruf abhängig gemacht habe, wie Bärbel Clemens es beschreibt,33 sei dahingestellt. Nach einer kurzen Phase einer weitgehend ‚traditionellen‘ Arbeitsteilung sollte sich Theanolte wieder stärker für das Familieneinkommen engagieren und wollte dabei die Einkommensgrundlage ihres Mannes gleich mit sichern, indem sie und vor dem Hintergrund der drohenden Amtsenthebung Albrechts für sich wie für ihren Mann die Zulassung als ‚Verwaltungsrechtsrat‘34 beantragte. Die Amtsenthebung Albrechts stellte sich für Theanolte zunächst also auch als eine Chance dar, sich selbst wieder stärker aktiv im Beruf zu engagieren, erneut eine Ehe, wie sie sie bis 1930 gelebt hatte zu führen, in die gemeinsame Wahlheimat Berlin zurückzukehren und an die in Merseburg so schmerzlich vermißten Kontakte anknüpfen zu können.
27 Siehe Kapitel 4.1.3. 28 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34. 29 Orla-Maria war, als das Bangen um die Landratsstelle begann, eineinhalb Jahre alt, Alfred noch nicht geboren, aber ‚unterwegs‘. 30 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. 31 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Abschrift: Ernennung zur Regierungsrätin, 10.11.1930. 32 Vgl.: Schareina:Regierungspräsident. 33 Vgl.: Clemens: Frauen, S. 203. 34 Für eine Beschreibung des Berufsbildes siehe Kapitel 4.2.1.
238 | Theanolte Bähnisch
Schon bevor die Familie Merseburg verließ, schien Theanolte Klienten in Berlin vertreten zu haben. Albrecht folgte der Idee seiner Frau und zog 1933 mit ihr, der Tochter Orla-Maria und dem gerade geborenen Sohn Alfred nach Berlin in eine Zweizimmerwohnung, die fortan nicht nur als Lebensraum, sondern auch als Anwaltspraxis dienen sollte. Theanolte arbeitete, da die neu etablierte Praxis nicht ausgelastet war, zusätzlich als Vertreterin für Pressephotos. Um die Kinder kümmerte sich sich zeitweise ihre Schwester Irmgard, laut Hans-Heino Fels eine ausgebildete Kinderkrankenschwester.35 Albrecht gab derweil neben seiner Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrat noch Nachhilfestunden und erstellte ein kartellrechtliches Gutachten für einen größeren Wirtschaftsverband sowie ein kommunalpolitisches und steuerrechtliches Gutachten für die Leunawerke.36 Auf diese Gutachten dürfte er verwiesen haben, als er sich bald mit Erfolg auf eine Stelle in der freien Wirtschaft bewarb. Hier wiederum folgte Theanolte ihrem Mann und verließ schweren Herzens Berlin. Denn durch die Stelle, die Albrecht in Köln antrat, war die Existenz seiner Familie gesichert. Theanolte berichtet, daß sie zu jener Zeit noch Klienten in verschiedenen Städten betreut habe.37 Doch kaum hatte sich die Familie in Köln eingerichtet, kam der Krieg. Albrecht wurde eingezogen und Theanolte, die ihren Angaben nach zu dieser Zeit immer noch als Verwaltungsrechtsrätin tätig war, besuchte, wie sie ihrer Freundin Ilse Langner mitteilte, Seminare in Kunstgeschichte an der Universität Köln, um sich von den oft sorgenerfüllten Gedanken an den Ehemann wenigstens zeitweilig abzulenken.38 Die Briefe39, welche Albrecht und Theanolte ab 1939 – als der Zweite Weltkrieg seinen Tribut und damit auch Albrecht in den Dienst an der Waffe forderte – zwischen Front und Heimat austauschen, vermögen einen Eindruck des innigen Verhältnisses der Eheleute zueinander geben. Jene Briefe „voller Zärtlichkeit und Zutrauen“40, wie es der Schwiegersohn Hans-Heino Fels formuliert, zeugen von einer großen emotionalen Nähe des Paares sowie dem beiderseitigen Bedürfnis, in ständigem Austausch miteinander zu stehen und den Partner auch über eine große räumliche Distanz hinweg am eigenen Leben und an den eigenen Gedanken teilhaben zu las-
35 Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J, S. 8. 36 Vgl.: ebd. 37 Bähnisch, Theanolte: Theanolte Bähnisch erzählt. Heimkehrerin nach Hannover. Der Weg in das Regierungspräsidium, in: Hannoversche Presse, 22.12.1964. Bis zum Kriegsende hätten diese Betreuungen angedauert, so Bähnisch. Ebd. 38 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 28.11.1938. 39 Die Briefe Albrecht Bähnischs an Theanolte sind im Familienbesitz überliefert, zu Forschungszwecken jedoch nicht zugänglich. Mit Auszügen aus den Briefen hat Hans-Heino Fels seine biographische Arbeit über Albrecht Bähnisch komplettiert. 40 Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 14.
Albrecht Bähnisch | 239
sen.41 Als Albrecht, der fast täglich Feldpost an seine Frau schickte, einmal seiner Befürchtung Ausdruck verlieh, er könne Theanolte mit Banalitäten aus seinem Soldaten-Leben langweilen, wies diese seine Angst gleichermaßen entschieden wie liebevoll zurück: „Für mich strahlt jeder Brief Dein ganzes Wesen aus und beglückt mich damit sehr. Auch Deine deprimierten Stimmungen und die Tage, an denen nichts passiert möchte ich in Deinen Briefen gerne miterleben, denn nur so habe ich doch das wirkliche Bild von Deinem Leben und da ich Dich doch kenne, weiß ich genau, wie all das auf Dich wirkt.“42 Für Hans-Heino Fels war insbesondere der Umstand, daß sein Schwiegervater 1937 sogar Briefe auf die in Fahrt befindlichen Schiffe schickte, mit denen Theanolte damals in die USA reiste, Ausdruck der Verbundenheit seiner Schwiegereltern. „Wie vertraut und mitteilsam muß es dann erst gewesen sein, wenn man beieinander war!“43 fragt er in seinem biographischen Porträt über Albrecht Bähnisch. Die Eheleute Bähnisch nahmen jeweils – sei es, daß sie am gleichen, sei es, daß sie an verschiedenen Orten weilten – lebendigen Anteil auch an Zusammenhängen, in denen nicht sie persönlich, sondern nur der Partner aktiv Handelnder war. Eine sie verbindende Berufsentscheidung, eine ähnliche Sicht auf die Gesellschaft sowie gemeinsame Interessen in Kunst und Kultur, auch wiederholte entsprechende Äußerungen Theanoltes, legen nah, daß sich die Partner in ihrem Handeln und Denken gegenseitig bestärkten und beeinflußten. Orla-Maria Fels, die 1931 geborene Tochter der Bähnischs, teilt diese Wahrnehmung und sieht in der Beziehung ihrer Eltern ganz klar den Vater als dominierenden Part dieser gegenseitigen Beeinflussung an. So sei beispielsweise Theanoltes Entschluß in die SPD einzutreten ohne die vorausgegangene Mitgliedschaft des Vaters in der Partei nicht erklärbar.44 Hans Heino Fels ergänzt: „der Herr Landrat wurde […] als Sozialdemokrat zu den besseren Kreisen nicht eingeladen und da hat meine Schwiegermutter gesagt, so, wenn er geschnitten wird, dann geh ich jetzt auch zur Sozialdemokratie.“45
41 Orla-Maria Fels zufolge schrieb Albrecht Bähnisch beinahe täglich an seine Frau, zusätzlich oft auch an die Kinder und an andere Verwandte sowie an Freunde. (Ebd.) In Fels‘ biographischem Porträt ist auch die Rede von Kreissymbolen, die das Ehepaar – durch variierende Anordnung – scheinbar als ‚Geheimcodes‘ nutzte, um sich auf dieser Ebene vertrauliches mitzuteilen. 42 Theanolte Bähnisch an Albrecht Bähnisch, zitiert nach Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 16. Fels nennt das Datum des Briefs leider nicht. 43 Ebd., S. 14. 44 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. 45 Ebd., Einwurf von Hans-Heino Fels. Das Archiv der sozialen Demokratie vermag nicht zu ermitteln, ob Theanolte Bähnisch tatsächlich bereits zu jener Zeit Mitglied der SPD war. Laut Karteikarte sei sie am 01.01.1946 in die SPD eingetreten, Hinweise auf eine Mitgliedschaft vor 1933 seien dieser Karte nicht zu entnehmen, die dafür vorgesehenen Felder nicht ausgefüllt. Schriftliche Auskunft des Archivs der sozialen Demokratie, Klaus Mertsching an Nadine Freund, 20.02.2007.
240 | Theanolte Bähnisch
Der enge Austausch, den Theanolte Bähnisch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit Personen pflegte, welche während der Weimarer Republik und des Dritten Reiches vor allem für Albrecht Bähnischs beruflichen Alltag prägend waren, zeugte davon, daß sie langfristig von den Ideen, Leistungen und Kontakten ihres Mannes, beziehungsweise den gemeinsamen Kontakten profitieren konnte. Keinesfalls unterschätzt werden sollte die Rolle, welche die Amtsenthebung Albrecht Bähnischs durch die Nationalsozialisten für Theanoltes spätere Karrierechancen spielte. Wohl kaum zufällig wird in Artikeln über sie hierauf oft rekurriert. Eine politische Verfolgung durch die Nationalsozialisten in den 30er Jahren galt, sofern der entsprechende Kandidat nicht kommunistisch orientiert war, geradezu als Eintrittskarte zur Mitgestaltung der westdeutschen Demokratie nach 1945, insbesondere dort, wo die Besatzungsmächte noch ein wachsames Auge auf die Personalauswahl hatten. Der Einfluß von Albrecht Bähnischs Karriere, insbesondere aber auch von diesem ‚Karriereknick‘ darf deshalb als äußerst wichtig für die berufliche Entwicklung Theanolte Bähnischs gelten. Der Kriegstod Albrechts dürfte mit dazu beigetragen haben, daß seine Ehefrau den gemeinsamen Jahren nicht nur einen herausgehobenen Platz in ihrer Erinnerung einräumte, sondern daß sie nach Albrechts Ableben auch alle positiven Attribute, mit denen man den Landrat Bähnisch in der zweiten deutschen Demokratie aufgrund seiner vorherigen Laufbahn belegt hätte, in Form eines ‚gemeinsamen Erbes‘ auf sich vereinen konnte. Unzweifelhaft ist, daß Theanolte spätestens ab 1945, als sie weitgehend auf sich allein gestellt war, neue Arbeitsschwerpunkte ausbildete und mit einer eigenen Strategie zu weiterem, beeindruckendem Erfolg gelangte. Und doch fühlt man sich, wenn man ihr Wirken betrachtet, immer wieder auch inhaltlich an das vielfältige berufliche und soziale Engagement ihres Mannes während der Jahre 1921 bis 1933 erinnert. Auch posthum blieb Albrecht Bähnisch damit im Leben seiner Frau stark präsent. Einen wesentlichen Teil ihres gesellschaftlichen Engagements gestaltete sie nach seinen Vorerfahrungen, Präferenzen und Überzeugungen aus. Auch seine Kriegserfahrungen, die schließlich mit seinem Tod auf dem Rußlandfeldzug der Wehrmacht ihr Ende fanden, spielten eine Rolle für ihre Arbeit ab 1945, ihren Einsatz für den Frieden, für die Einigung Europas und den Kampf gegen die Sowjetunion und den Kommunismus. Der Sozialisation, der Ausbildung, dem Beruf Albrecht Bähnischs, aber auch seinen Interessen an den Zusammenhängen gesellschaftlichen Lebens über unmittelbare berufliche Zusammenhänge hinaus, soll vor dem Hintergrund der beschriebenen Konstellationen im Folgenden entsprechender Raum zuteilwerden. Dies erscheint auch deshalb geboten, weil die Quellen, die über Theanoltes Leben zu jener Zeit Auskunft geben, rar sind und auf ihrer Basis nur dann ein Eindruck jener Jahre entsteht, wenn sie in Beziehung zu den Quellen gesetzt werden, die vor allem über das Leben Albrecht Bähnischs informieren. Ich folge damit einem Plädoyer der GenderTheorie, nämlich ‚Arbeit‘ in einer Biographie nicht nur im Sinne einer klaren Wirkungs- und Überlieferungsgeschichte nachzuzeichnen, sondern auch „historisch we-
Albrecht Bähnisch | 241
niger sichtbare Arbeit“46 zur berücksichtigen. An diese Arbeit, nämlich den Austausch mit ihrem Mann und seinen Kollegen über sein Wirken – und den Einfluß, den sie hierauf teilweise ausgeübt zu haben schien47 – konnte Theanolte Bähnisch an 1945 in ‚historisch sichtbarer‘ Weise anknüpfen, indem sie auf die Erfahrungen und das Schaffen ihres Mannes rekurrierte und diese zum Gegenstand ihrer eigenen Arbeit machte. Die Zusammenhänge zwischen ‚privater‘ und ‚öffentlicher‘ Sphäre sind für das Leben Bähnischs in diesem Zusammenhang besonders stark, so daß eine Reduktion der Analyse auf die ‚sichtbaren‘, weil ‚öffentlichen‘ Handlungen Theanoltes ihrer Biographie nicht gerecht werden könnte.48 Soviel sei den nächsten Kapiteln noch vorweggenommen: Die Nähe der Gedanken, das gegenseitige Interesse und Verständnis für das Berufsleben des Anderen, lagen sicherlich nicht zuletzt in den Parallelen der Biographien Albrechts und Theanoltes begründet. Beide waren in Oberschlesien als Kinder von Pädagogen geboren worden, Albrecht nur ein und ein halbes Jahr später als Theanolte. Zwar war die Beamtenlaufbahn mit der Geburt in einen bildungsbürgerlichen Haushalt für Albrecht ebenso wenig vorgezeichnet gewesen wie für Theanolte. Doch die Berufe der Väter Nolte und Bähnisch und die Berufspläne der älteren Geschwister Theas und Albrechts, die bereits den Weg in den Staatsdienst eingeschlagen hatten und jeweils entweder Lehrer oder Juristen werden wollten, haben vermutlich ihren Teil dazu beigetragen, daß nicht nur Dorothea, sondern auch Albrecht mit den Pflichten und Chancen, die mit dem Beamtendasein einhergingen, schon in jungen Jahren vertraut waren. Beide Partner studierten nicht nur dasselbe Fach, sie arbeiteten auch jeweils in Behörden, für die die Anstrengungen demokratischer Politiker, die Verwaltung zu reformieren, maßgeblich waren. Beide Partner wurden aus ihren Assessoren-Stellen heraus in Planstellen übernommen und zu Regierungsräten befördert. Ein gemeinsames Interesse an speziellen Themen der Verwaltung und ihrer Reform läßt sich anhand von Fachtexten aus der Hand der Ehepartner nachvollziehen. Ein gemeinsamer Kollegen- und Bekanntenkreis, mehrheitlich aus bekennenden ‚religiösen Sozialisten‘ und Sozialliberalen zusammengesetzt, scheint die Verbindung privater und beruflicher Interessen der Partner verstärkt zu haben. Stand in den ersten Dienstjahren der Bähnischs in der Verwaltung noch die Ausgestaltung des Staates zum Wohle seiner Bürger und zur Stabilisierung der Demokratie im Vordergrund – und läßt sich dementsprechend aus ihren Schriften eine durchaus hoffnungsvolle Freude über die Möglichkeit, das Staatswesen im rechtstaatlichen und demokratischen Sinn zu verändern, herauslesen, so geriet das junge Paar im Lauf der kurzen Lebenszeit der Repub-
46 Ni Dhúill, Caitríona: Biographie von ‚er‘ bis ‚sie‘. Möglichkeiten und Grenzen relationaler Biographik, in: Fetz/Huemer(Hrsg.): Biographie, S. 199–226, hier S. 204. 47 Ein solche Arbeit Theanolte Bähnischs wird teilweise aus Quellen deutlich, die mit dem Wirken Albrecht Bähnischs in Zusammenhang stehen, teilweise können jedoch nur Annahmen über eine mögliche ‚Mitarbeit‘ Theanoltes an Albrechts Arbeit aufgestellt werden. 48 Folgt man Di Nihúll, so bilden die – natürlich nicht rekonstruierbaren – Gespräche Bähnischs mit ihrem Ehemann, aber auch mit seinen Kollegen und den gemeinsamen Bekannten und Freunden einen Teil des Rohmaterials, des Werks und des Wirkens von Theanolte Bähnisch. Vgl.: ebd., S. 205.
242 | Theanolte Bähnisch
lik zunehmend in eine Abwehrrolle gegen die erstarkenden Gegner der Demokratie. Viele Freunde und Kollegen der Bähnischs kostete ihre Abstammung, oder ihr Widerstand gegen die Nationalsozialisten den Beruf und die Heimat, einige verloren sogar ihr Leben. Was Albrecht Bähnisch bei aller Gemeinsamkeit von Theanolte unterschieden zu haben schien, war seine Bereitschaft, neben aller theoretischen Arbeit für die Demokratisierung der Verwaltung und des Staates – was im Kontext der Bähnischs hieß: einer zunehmenden Professionalisierung, einer transparenten, an den Bedürfnissen und Notlagen der Menschen orientierten Gestaltung des Polizei-, Wohlfahrts- und Versicherungswesens – auch noch einen persönlichen, praktischen Beitrag für die Bildung und den Unterhalt ärmerer Bürger und damit für die ‚Versöhnung zwischen den Klassen‘ zu leisten. Dieses Engagement ihres Vaters bezeichnet Orla-Maria Fels als dessen „soziale Ader“49. Auch seinen Entschluß, in den 20er Jahren in die SPD einzutreten, sieht Fels in jener ‚sozialen Ader‘ begründet. Sicherlich sind neben religiösen, moralischen und politischen Motiven Albrecht Bähnischs auch Überlegungen hinsichtlich der eigenen Aufstiegsmöglichkeiten im neuen System für seine beruflichen, politischen und persönlichen Entscheidungen in dieser Hinsicht relevant gewesen, doch das soll in einem späteren Kapitel abgehandelt werden. Theanolte war sehr interessiert an der Analyse und der Veränderung gesellschaftlicher Zusammenhänge im Zuge der Verwaltungsreform. In ihrer Staatsexamensarbeit hatte sie die ‚soziale Not‘ und die ‚sittliche Verwahrlosung‘ ärmerer Bevölkerungskreise als Gründe für gesellschaftliche und damit verwaltungsrechtliche Probleme angeprangert. Jedoch begann sie sich, nach allem was bekannt ist, erst 1945, als sie nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches die zweite deutsche Demokratie mit aufbauen half – neben ihrem beruflichen Einsatz für eine reibungslos laufende und bürgernah arbeitende Verwaltung – auch in praktischen Zusammenhängen für die Belange bedürftiger Personen einzusetzen. Darunter fiel beispielsweise ihr Engagement für die Errichtung und den Betrieb des Jugendflüchtlingslagers Poggenhagen in Niedersachsen und – was an anderer Stelle jedoch zu relativieren ist – ihre Arbeit im Club deutscher Frauen, Hannover. Sie schien erst nach dem Ende des Krieges – und um diese Erfahrung reicher – gesucht zu haben, was Albrecht Bähnisch schon in den 1920er Jahren gesucht hatte: das Gespräch mit ärmeren Bevölkerungskreisen, in der Überzeugung, kraft der eigenen, privilegierten Stellung einen positiven, ‚sittlichen‘ Einfluß auf ärmere Bürger zu haben sowie wiederum durch die Kenntnis ihrer Nöte und Belange als deren Sprachrohr und damit als ihr Bindeglied zu den ‚bürgerlichen Kreisen‘ fungieren zu können. Daß Theanolte Bähnisch sich nach 1945 nicht selten in einer Form für ‚ihre‘ Bürger einsetzte, die jenseits ihrer Zuständigkeit als Regierungspräsidentin lagen, kann als ein Anknüpfen an die Erfahrungen interpretiert werden, die ihr Mann in der Dekade zwischen 1923 und 1933 gesammelt hatte. Denn die Strukturen, die sie ab 1945 förderte und etablierte, um eine persönliche Einflußnahme auf die Bürger im Bezirk möglich zu machen, ähnelten jenen, die das Korsett für Albrechts entsprechende Arbeit bildeten. Vermutlich liegt nicht zuletzt im gemeinsam mit ihrem Mann erlebten
49 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009.
Albrecht Bähnisch | 243
Scheitern der Weimarer Republik, in der Erfahrung der Bähnischs, daß eine – nur ansatzweise umgesetzte – demokratische Verwaltungs- und Verfassungsreform nicht ausreicht, um einen Staat demokratisch umzugestalten und zu stabilisieren, der Schlüssel für ein breiteres Engagement Theanolte Bähnischs für gesellschaftliche Belange nach 1945. Ein Kernelement der Weimarer Republik, die Zusammenarbeit demokratiefähiger und -williger Personen aus verschiedenen Kreisen, Konfessionen und Parteien für eine nachhaltige Reform unter Federführung der Sozialdemokratie war für Theanolte bei ihrer Arbeit am Aufbau der zweiten deutschen Demokratie richtungsweisend. Daß – nach den Erfolgen der Nationalsozialisten auf diesem Gebiet – die Psyche des Individuums und die alltäglichen Bedürfnisse der Menschen für Theanoltes Arbeit im Rahmen ab 1945 einen breiteren Raum einnehmen sollten, entbehrt nicht einer gewissen Logik. Sie hing der Überzeugung an, daß Demokratie nur als gemeinsames Projekt so vieler Gruppen wie möglich funktionieren könne. Deshalb waren ihre Programme breitenwirksam angelegt, nahmen aber auch zwei Zielgruppen besonders ins Visier: Jugendliche und Frauen. Was sich im Laufe der 1920er und 1930er Jahre bereits andeutete und ab 1946 zu einer tragenden Komponente von Theanoltes Arbeit reifte, war die Fokussierung auf eine von den Demokraten in der Weimarer Republik nur teilweise berücksichtigten Ziel-Gruppe: die Frauen. Bereits in der Weimarer Republik setzte sich die Verwaltungsjuristin für die Rechte von Frauen ein, indem sie beispielsweise Ärztinnen juristisch vertrat und durch ihre Mitarbeit im Soroptimistinnen-Bund ein Netzwerk zur gegenseitigen Unterstützung professioneller Frauen mit etablierte. Ab 1945 rückten Frauen auch als eine wichtige Wählergruppe in ihr Blickfeld. Inwiefern auch hierfür das Engagement ihres Mannes Albrecht eine Rolle gespielt haben könnte, wird ebenfalls Gegenstand der folgenden Kapitel sein.
3.2 HERKUNFT UND AUSBILDUNG ALBRECHT BÄHNISCHS 3.2.1 Albrechts Familie: Protestantische Bildungsbürger mit Neigung zum Rechtswesen Als jüngster Sohn des Gymnasialdirektors Alfred Bähnisch50 und dessen Frau Elisabeth51, genannt ‚Else‘, wurde Albrecht Paul Alfred Kurt Bähnisch als Sproß einer
50 Kurt Alfred Fritz Wilhelm Bähnisch wurde am 30.04.1836 als Sohn von Wilhelm (geboren 1828 in Kassawe bei Militsch) und Mathilde Bähnisch (geborene Wedlich, 1832) in Birnbäumel bei Militsch geboren. Johann Wilhelm Bähnisch starb bereits 1859, im Alter von 31 Jahren an Schwindsucht, seine Frau Mathilde erst 49 Jahre später, in Stargard, dem derzeitigen Wohn- und Arbeitsort ihres Sohnes Alfred. Alfred Bähnisch starb am 25.01.1938 in Breslau. Vgl.: Privatnachlaß von Theanolte und Albrecht Bähnisch, Personalbogen Albrecht Bähnischs mit Angabe „~ 18.07.1933“ von unbekannter Hand sowie Stammtafel der Familie Bähnisch. Offenbar handelt es sich bei dem Personalbogen um ein Zweitexemplar eines Bogens, den Albrecht Bähnisch nach einer Aufforderung des Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg und Berlin vom 12.07.1933 für das Oberverwaltungsgericht hatte
244 | Theanolte Bähnisch
Beamten-Familie seit der Großeltern-Generation, am 23.10.1900 in Kreuzburg geboren. Wilhelm Bähnisch, der Großvater väterlicherseits, war ebenfalls Lehrer gewesen, während Albrecht Altmann52, der Großvater mütterlicherseits, als Rechtsanwalt, Notar und Kreisrichter gewirkt hatte. Damit waren pädagogische und juristische Traditionen in der Familie Bähnisch länger gewachsen als in der Familie Nolte. Albrechts ältere Geschwister Johannes und Elisabeth waren in die Fußstapfen des Großvaters mütterlicherseits getreten und hatten ein Studium der Rechtswissenschaften aufgenommen53, während die anderen beiden Geschwister, Helene und Georg sich – dem Beispiel des Vaters und des Großvaters väterlicherseits folgend – für die pädagogische Laufbahn entschieden hatten. In Albrechts Elternhaus schien eine höhere Bildung (auch) für die Mädchen und ihr Hinarbeiten auf einen akademischen Beruf also ebenso selbstverständlich gewesen zu sein, wie in Dorothea Noltes Elternhaus. Als „einziger unpromovierter in der Galerie“54 der Direktoren des Gymnasiums von Kreuzburg hatte der Vater von fünf Kindern55, Alfred Bähnisch,56 eine Schule
51
52
53 54
55
56
ausfüllen müssen. Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 8. Elisabeth (‚Else‘) Johanna Bähnisch wurde am 14.08.1963 in Kröllin als Elisabeth Altmann geboren. Sie starb am 23.04.1946 in Demmin in Vorpommern. Dort lebte ihre Tochter Helene Feilke, geb Demmin. Privatnachlaß Theanolte und Albrecht Bähnisch, Personalbogen Albrecht Bähnischs sowie Privatbesitz von Orla-Maria und Hans-Heino Fels, Waiblingen, Stammtafel der Familie Bähnisch, Stammtafel der Familie Bähnisch. Albrecht Bähnischs Großmutter mütterlicherseits war Johanna Klara Maria Friederike Altmann, geborene Reich (am 17.04.1837 in Breslau). Dr. jur. Karl Ernst Eduard Albrecht Altmann, geboren 1834 in Ludwigsdorf, starb laut dem Personalbogen von Albrecht Bähnisch im Jahr 1900 in Glogau, wo Albrecht Bähnisch als Lehrer tätig gewesen war. Johanna Altmann verstarb laut der gleichen Quelle im Jahr 1916 in Potsdam. Vgl.: ebd. Die Stammtafel der Familie Bähnisch weist als Todesjahr Johanna Altmanns 1906 aus. Elisabeth Bähnisch promovierte, bevor sie eine Zeit lang als Lehrerin arbeitete und eröffnete schließlich, nach ihrer Verheiratung, in Köln ein Steuerbüro. Mit Mitteln des Kreuzberger Wohltäters Simon Cohn wurde die im Jahr 1860 gegründete Höhere Bürgerschule im Jahr 1873 in ein Gymnasium umgewandelt. Aus dem städtischen Gymnasium wurde 1891 ein königliches und 1918 ein staatliches Gymnasium. Heute heißt die Schule ‚Gustav-Freytag-Schule‘. Vgl.: Menz, Heinrich: Von der ‚Höheren Bürgerschule‘ zur ‚Deutschen Oberschule für Jungen‘. Zur Geschichte der ‚Gustav-Freytag-Schule‘ zu Kreuzburg OS., Festschrift zum 100. Geburtstag dieser Schule, Velen 1974. Eine weitere Schwester Albrecht Bähnischs, Margarete, starb noch in ihrem Geburtsjahr, 1893. Privatbesitz von Orla-Maria und Hans-Heino Fels, Waiblingen, Stammtafel der Familie Bähnisch. Alfred Bähnisch stammte aus Militsch in Niederschlesien, ca. 55 km von Breslau entfernt, wo er am 30.05.1856 als Sohn eines Lehrers geboren wurde und später auch sein Abitur ablegte. Sein Probejahr absolvierte er in Ohlau. Von 1882 bis 1884 war er als Oberlehrer am Gymnasium in Ohlau tätig, danach in Glogau. 1895 übernahm er die Leitung des Gymnasiums in Ohlau. In Kreuzburg verdiente er für seine Tätigkeit schließlich 5.700 Mark jährlich. Laut seinem Personalbogen, der allerdings kein Datum trägt, hatte er fünf Kinder.
Albrecht Bähnisch | 245
geleitet, welche in einer Stadt „fern von gebildeten Menschen“57 über die Jahre zu einem „respektablen Ort gelehrter Studien“58 avanciert war. Folgt man der Aussage des Kreuzburger Mediä-visten Horst Fuhrmann, daß sich zu jener Zeit der Rang einer Bildungsanstalt nicht zuletzt an den altphilologischen Aktivitäten ihrer Lehrer habe ablesen lassen, dann muß das Ansehen des Gymnasiums bereits recht hoch gewesen sein, als Alfred Bähnisch dort seinen Dienst antrat.59 Rektoren der Schule waren vor seinem Amtsantritt unter anderem der Graezist Carl Rehdanz60 sowie der Geheime Studienrat Wilhelm Gemoll, Verfasser des gleichnamigen Griechisch-DeutschenHandwörterbuchs gewesen.61 Direktor Bähnisch selbst hatte, um seine ‚altsprachliche Pflichtübung‘ abzuleisten – denn nach preußischem Reglement konnte nur ein Altphilologe Direktor eines Humanistischen Gymnasiums werden – eine Studie über den Historiker und Biographen Cornelius Nepos verfaßt.62 Diese war, ebenso wie sein kleines Buch über deutsche Vornamen63 im renommierten Leipziger TeubnerVerlag erschienen. Im Selbstverlag des evangelischen Gymnasiums Glogau64, wo
57
58 59 60 61 62
63 64
Vgl.: Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF), Personaldaten von Lehrerinnen und Lehrern Preußens, Personalblatt Alfred Bähnisch, auf: http://www.bbf.dipf.de/ cgi-opac/digiakt.pl?id=p85194, am 26.08.2009. Womöglich handelt es sich bei dem 1882 geborenen Wilhelm Artur Kurt Bähnisch, dessen Personalkarte in der Bibliothek für Bildungsgeschichtliches Fragen ebenfalls überliefert ist, um den ältesten Sohn Alfred Bähnischs. Darauf deutet insbesondere der Name ‚Kurt‘ hin, den auch die anderen Söhne Alfred Bähnischs als Beinamen trugen. Vgl.: BBF, Gutachterstelle des BIL – Preußische Volksschullehrerkarte, Personalkarte Kurt Bähnisch, auf: http://www.bbf.dipf.de/hans/ VLK/VLK-0096/VLK-0096-0637.jpg, am 26.08.2009. Ein Geburtsort ist auf der Karte nicht angegeben. Fuhrmann, Horst: „Fern von gebildeten Menschen“. Eine oberschlesische Kleinstadt um 1870, München 1989. Der Mittelalter-Historiker Fuhrmann stammt selbst aus Kreuzburg. Der Titel des Buches nimmt Bezug auf ein Distichon Goethes mit der Zeile „fern von gebildeten Menschen, am Ende des Reiches“, welches er im Gästebuch der oberschlesischen Knappschaft zu Tarnowitz 1790 hinterließ. Vgl.: ebd., S. 13. Ebd., S. 133. Er war Direktor von 1900 bis 1913 und unterrichtete an der Schule die Fächer Latein, Griechisch, Deutsch, Französisch und Religion. Vgl.: Menz: Gustav-Freytag-Schule, S. 68. Rehdanz war Direktor der Schule von 1873 bis 1879. Auch die Xenophon-Ausgaben für den Schulunterricht entstammten der Feder Gemolls, der von 1884 bis 1889 Direktor war. Bähnisch, Alfred (Hrsg.): Sämtliche Sätze des Cornelius Nepos in vollständiger oder verkürzter Form, zusammengestellt und geordnet nach den Regeln der Grammatik von Alfred Bähnisch, Leipzig 1890. Die Studie kann als Gebrauchsliteratur für den Schulunterricht angesehen werden, da die Briefe des Biographen und Historikers Cornelius Nepos wegen ihrer schlichten Sprache eine gängige Schullektüre darstellten. Bähnisch, Alfred: Die deutschen Personennamen, Leipzig 1910. Das Werk wurde mehrfach aufgelegt und unter anderem von Theodor Bögel positiv rezensiert. Die Festschrift zur 250jährigen Jubelfeier des Gymnasiums: St. Maria Magdalena zu Breslau weist Alfred Bähnisch für Ostern 1875 als Abiturient der Schule nach. Als Dienstbe-
246 | Theanolte Bähnisch
Bähnisch als Oberlehrer tätig gewesen war, bevor er seine erste Direktorenstelle in Ohlau65 antrat, hatte er sich schriftlich über die Frage verbreitet, inwiefern die Existenz und Verwendung einer speziellen Bibel für den Schulunterricht von Nöten sei.66 Rezensionen hatte er unter anderem in der Zeitschrift für deutsche Philologie veröffentlicht.67 Dies verdeutlicht wiederum zweierlei: Zum einen, daß nicht nur Albrecht Bähnisch, sondern auch schon sein Vater durchaus eine Neigung zum schriftstellerischen Schaffen gehabt hatte, zum anderen, daß Albrecht wie Dorothea in Haushalten aufgewachsen waren, in denen die Auseinandersetzung mit religiösen ebenso wie mit pädagogischen Fragen auf der Tagesordnung standen. Theodor Bögel68, ein Lehrer des Kreuzburger Gymnasiums, der für seine Arbeit am berühmten ‚Thesaurus Linguae Latinae‘69 vom Direktor Bähnisch mehrmals beurlaubt worden war, beschreibt seinen Vorgesetzten in seiner ‚Historia Thesauri‘ als eine „stattliche Figur von hohem Wuchs, ein überwiegend ernster Mann, Altphilologe, Deutschlehrer, wissenschaftlich germanistisch als Onomatologe tätig“70. Theanolte Bähnisch erinnerte, ihrer Tochter Orla-Maria Fels zufolge, ihren Schwiegervater als einen Patriarchen, der mit strenger Regie über die Familie wachte. Dennoch schien sie große Sympathie für ihren Schwiegervater gehegt zu haben.71 Nach seiner Zeit in Kreuzburg leitete Alfred Bähnisch noch für einige Jahre das ‚Königliche und Gröning’sche Gymnasium‘ in Stargard bei Oppeln. 1921, drei Jahre nachdem mit
65
66
67
68 69
70
71
zeichnung ist dort angegeben: „Oberlehrer an dem evang. Gymnasium in Glogau“. Vgl.: Lehrerkollegium des Gymnasiums zu St. Magdalena zu Breslau (Hrsg.): Festschrift zur 250jährigen Jubelfeier des Gymnasiums zu St. Maria Magdalena zu Breslau am 30. April 1893, Breslau 1893. Vgl.: Menz: Gustav-Freytag-Schule, S. 20. „Dreizehn Jahre lang an der Anstalt tätig hat er durch seine unermüdliche Pflichttreue segensreich gewirkt und sich ein dauerndes Andenken gesichert“, schreibt Menz auf S. 23 über Bähnisch. Ebd. S. 23. Bähnisch, Alfred: Ist eine Schulbibel notwendig und wie muß sie beschaffen sein?, Glogau 1892. Die Studie erschien auch in der Reihe ‚Zeitfragen des christlichen Volkslebens‘, Stuttgart 1892. Vgl.: Bähnisch, Alfred, Rezension über: Nüske, Hugo: Die Greifswalder Familiennamen, in: Zeitschrift für deutsche Philologie, 55. Jg. (1930), S. 95–96 sowie ders.: Rezension über: Reimpell, Almuth: Die Lübecker Personennamen, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 55. Jg. (1930), S. 95–97. Bögel (1876–1973) war von 1905 bis 1918 Lehrer für Latein, Griechisch und Deutsch am Kreuzburger Gymnasium. Vgl.: Fuhrmann: Menschen, S. 195, Anm. 453. Der Thesaurus wurde 1894 begonnen und ist – als eines der größten editorischen Projekte der Geisteswissenschaften – bis heute nicht abgeschlossen. Für das Vorhaben wurde Bögel vom Direktor Bähnisch, der ‚seine‘ Schule durch die Mitarbeit Bögels am Projekt geehrt sah, mehrfach beurlaubt. Von 1909 bis 1912 war Bögel ausschließlich bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften tätig. Vgl.: ebd., S. 135 und S. 195, Anm. 454. Die maschinenschriftliche Historia Thesauri ist im Archiv des Thesaurus Linguae Latinae in München verwahrt. Sie verknüpft das persönliche Erleben Bögels mit der Geschichte der lateinischen Lexikographie. Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009.
Albrecht Bähnisch | 247
dem Ende des Ersten Weltkrieges die Verwaltung Stargards durch den Völkerbund begonnen hatte und sein Sohn Albrecht bereits in Berlin studierte, schied Alfred Bähnisch altersbedingt aus dem Schuldienst aus. Nach der Pensionierung zog er mit seiner Frau nach Breslau. Als Albrecht nach einem längeren Aufenthalt im Elternhaus, der sich an sein Studium angeschlossen hatte, sein Referendariat in Münster aufnahm, scheint die Haushaltslage des Pensionärs – womöglich im Zuge der Sparmaßnahmen der Weimarer Koalition sowie der starken Inflation im Reich – stark angespannt gewesen zu sein. Albrechts Schwester Elisabeth hatte sich 1923 nach Köln verheiratet, was für die Eltern mit erheblichen Kosten für den Umzug und die Aussteuer verbunden gewesen zu sein schien.72 „Vermögen hat er in irgend einem nennenswerten Umfang nicht“, teilte Albrecht Bähnisch dem Oberlandesgericht in seinem Gesuch um einen Unterhaltszuschuß über die finanzielle Lage seines Vaters mit und fügte hinzu, daß seine „noch lebende Mutter […] gleichfalls kein Vermögen“ habe. Sein Antrag wurde positiv entschieden und so war Albrecht Bähnisch einer der ersten Referendare, die eine vom Staat für solche Fälle vorgesehene Unterstützungsleistung zum Zweck seiner weiteren Ausbildung bewilligt bekam. Kurz vor der inflationsbedingten Währungsreform, im August 1923, beantragt und mit noch kürzerem Abstand dazu bewilligt, erhielt er fortan halbmonatlich im Voraus „1.257.000.000 – in Worten: eine Milliarde und zweihundersiebenundfünfzig Millionen Mark“73 zusätzlich zu dem Grundgehalt, das mit 362.000 Reichsmark angegeben wurde. Aus dem Werdegang des Vaters erklären sich die Schulwechsel, die sich im Lebenslauf Albrecht Bähnischs wiederfinden: Von 1910 bis 1913 besuchte er das Gymnasium in Kreuzburg und wechselte dann auf das Gymnasium zu Stargard, dem neuen Dienstort seines Vaters. Dort legte er, drei Jahre nachdem sein zweitältester Bruder, der Gerichtsassessor Johannes (‚Hans‘) in der Schlacht um Tarnopol gefallen war74, im April 1918 mit 17 Jahren die ‚Kriegsreifeprüfung‘ ab.75 Das Zeugnis cha-
72 LHASA, MER, Rep. C 48 Ia II, Lit B, Nr. 5, Albrecht Bähnisch an den Präsidenten des Oberlandesgerichts in Breslau, im Juli 1923. In der Überzeugung, seinem Vater, der durch die Aussteuer an seine Tochter und den „Transfer“ derselben nach Köln stark belastet gewesen sei, nicht finanziell auch noch zur Last fallen zu können, bittet Albrecht in diesem Schreiben um einen Unterhaltszuschuß. 73 LHASA, MER, Rep. C 48 Ia II, Lit B, Nr. B 5, Der Oberlandesgerichtspräsident an Albrecht Bähnisch, 10.10.1923. Im November 1923 wurde die Währungsreform durchgeführt. 74 Johannes Bähnisch war am 07.04.1891 in Glogau geboren worden. Dem Abiturientenverzeichnis der Georg-Freytag-Schule zufolge muß er Ostern 1909 sein Abitur abgelegt haben. Vgl.: Menz: Gustav-Freytag Schule, S. 103. Daß es sich bei dem Abiturienten Johannes Bähnisch um den Sohn Alfred Bähnischs handelt, ist dem Todesdatum des Sohnes auf dem Personalbogen des Vaters zu entnehmen. Der Bogen trägt den Vermerk „7.9.15. Sohn gefallen.“ Bibliothek für Bildungsgeschichte [BBF], Personaldaten von Lehrern und Lehrerinnen Preußens, Personalblatt Alfred Bähnisch. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften hatte Johannes sein Verwaltungsreferendariat in Stargard begonnen, bevor er zum Kriegsdienst eingezogen worden war. Er starb am 07.09.1915 als Leutnant der Reserve des Colbergschen Grenadier-Regiments Graf Gneisenau (2. Pommersches) Nr. 9 in der Schlacht um Tarnopol. Vgl.: Verlustliste des Colbergschen Grenadier-Regiments Graf
248 | Theanolte Bähnisch
rakterisiert ihn als zuverlässig und bescheiden, fleißig und aufmerksam. Als insgesamt guter Schüler schien Albrecht auch eine kreative Begabung besessen zu haben: Die Fächer Singen und Zeichnen hatte er, wie das Fach Latein, mit ‚sehr gut‘ abgeschlossen.76 Sowohl Albrechts elf Jahre älterer Bruder Georg, der in französische Kriegsgefangenschaft geraten war, als Albrecht die Schule abschloß,77 als auch die 1895 geborene Schwester Elisabeth waren zu dieser Zeit als Lehrer in Stargard angestellt. Elisabeth verließ, wie Albrecht, Stargard im Jahr 1918, um sich dem Studium der Rechtswissenschaften zu widmen78 und damit in die Fußstapfen des älteren, gefallenen Bruders zu treten. 3.2.2 Studium der Rechtswissenschaften in Marburg und Berlin Albrecht Bähnisch hatte Glück: Nach seiner Kriegsreifeprüfung neigte sich der Krieg dem Ende zu. Nach kurzer Beschäftigung im Vaterländischen Hilfsdienst79, einem
75 76 77
78
79
Gneisenau, Nr. 9, auf: Onlineprojekt Gefallenendenkmäler, auf: http://www.denkmal projekt.org/Verlustlisten/vl_colbergsches_gren-reg_wk1_teil2.htm, am 14.10.2013. Alfred Bähnisch selbst schien lediglich Kriegshilfe geleistet zu haben, wofür er 1917 ein Verdienstkreuz erhielt. Vgl.: BBF, Personaldaten von Lehrern und Lehrerinnen Preußens, Personalblatt Alfred Bähnisch. LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit. B, Nr. 5, Lebenslauf von Albrecht Bähnisch, o. D. [1922]. LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit. B, Nr. 5, Zeugnis der Reife des Gymnasiums zu Stargard. Georg Albrecht Kurt Bähnisch wurde am 12.05.1889 in Glogau geboren und studierte in Breslau und Berlin von 1907 bis 1911. Neben seiner Stelle in Stargard war er, laut dem Personalblatt, das ihn als Vater zweier Kinder ausweist, als Studienrat in Breslau tätig. BBF, Personaldaten von Lehrern und Lehrerinnen Preußens, Personalblatt Georg Bähnisch, auf: http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/digiakt.pl?id=p85195, am 26.08.2009. Gestorben ist er am 19.01.1946 in Neundorf. Vgl.: Metz: Gustav-Freytag-Schule, S. 68; Privatbesitz von Orla-Maria und Hans-Heino Fels, Waiblingen, Stammtafel der Familie Bähnisch. HansHeino Fels zufolge schrieben sich Albrecht und Georg Bähnisch viele Briefe. Fels, HansHeino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 1. Elisabeth Bähnisch wurde am 18.08.1895 in Ohlau geboren. Nachdem sie 1915 ihr Lehrerinnenexamen bestanden hatte, unterrichtete sie drei Jahre in Stargard. Vgl.: Hauptstaatsarchiv Marburg, 307 d, Nr. 283, Lebenslauf Elisabeth Bähnisch o. D. [1922]. Elisabeth, verheiratete Bohmhammel, eröffnete nach ihrer Eheschließung ein Steuerbüro in Köln. Sie starb dort, sehr betagt, am 26.11.1998. Privatbesitz von Orla-Maria und Hans-Heino Fels, Waiblingen, Stammtafel der Familie Bähnisch. Das Hilfsdienstgesetz vom 05. Dezember 1916 machte für alle Deutschen vom vollendeten siebzehnten bis zum vollendeten 60. Lebensjahr, soweit sie nicht zum Dienst an der Waffe einberufen waren, die Mitarbeit im ‚vaterländischen Hilfsdienst‘ obligatorisch. Vgl.: Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916, auf: http://www.dhm.de/ lemo/html/dokumente/hdg/index.html, am 05.03.2009.
Albrecht Bähnisch | 249
Arbeitsdienst für nicht kriegsfähige Männer, in dessen Rahmen er als Landarbeiter auf dem Gut Stöben bei Stettin beschäftigt gewesen zu sein schien,80 war er, laut eigenen Angaben, vom 21.06.1918 bis Weihnachten desselben Jahres Soldat.81 Von Januar 1919 bis März 1920 studierte er Rechtswissenschaft in Marburg und besuchte dort unter anderem ein Seminar und eine Vorlesung über theoretische und praktische Nationalökonomie bei Hans Köppe sowie eine Vorlesung über Bank- und Börsenwesen bei dem Nationalökonomen Walter Troeltsch.82 Dessen Spezialgebiet waren die Ursachen und Wirkungen von Arbeitslosigkeit.83 Albrechts bereits erwähnte Schwester Elisabeth, die 1922 bei Troeltsch ihre Doktorarbeit über das Wohlfahrtsengagement der Landkreise beendete,84 war zur gleichen Zeit in Marburg als Studentin der Nationalökonomie eingeschrieben. Im Wintersemester 1919 und im Sommersemester 1920 studierte sie jedoch in Berlin. Dorthin wechselte auch Albrecht im Sommer 1920. Während seines Studiums lebte er zunächst in der prunkvollen Villa des für seinen ‚Burgen-Stil‘ bekannten Architekten Gustav Lilienthal (dem Bruder des Flugpioniers Otto Lilienthal) in Lichterfelde-West.85 Im Rahmen seines in einem späteren Kapitel erläuterten Engagements in der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost
80 LHASA, MER, Rep. C 28 I a II, Lit B, Nr. 5, Albrecht Bähnisch an den Oberlandesgerichtspräsidenten in Breslau. Vermutlich stellte sein Schreiben eine Antwort auf Rückfragen zu seinem Lebenslauf dar. Er gibt in dem Brief an, vom 01.05.1918 bis zum 16.06.1918 auf Stöven tätig gewesen zu sein. 81 LHASA, MER, Rep. C 28 I a II, Lit B, Nr. 5, Lebenslauf, o. D. [1922]. In einer anderen Quelle ist vermerkt, Albrecht sei vom 21.06.1918 bis 30.11.1918 im Hilfsdienst beschäftigt gewesen. LHASA, MER, Rep. C 28 I a II, Lit B Nr. 5, Übersicht über den Gang des Vorbereitungsdienstes des Regierungsreferendars Albrecht […] Bähnisch bei der Regierung Münster. 82 Vgl: LHASA, MER, Rep. C 28 I a II, Lit B, Nr. 5, Lebenslauf o. D. [1922]. 83 Einen Namen machte er sich unter anderem mit der 1897 publizierten Studie ‚Die Calwer Zeughandlungskompagnie und ihre Arbeiter‘, eine grundlegende Arbeit zu Standortfaktoren und ihren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Troeltschs berühmteste Schüler waren Gustav Heinemann und Wilhelm Röpke. 84 Von Ostern 1921 bis Ostern 1922 hielt sich Elisabeth Bähnisch in Stargard auf, um Material für ihre Doktorarbeit zu sammeln. Im Anschluß daran war sie bis Ostern 1922 im Kreiswohlfahrtsamt Danzig als Hilfsarbeiterin angestellt. Vgl.: Hauptstaatsarchiv Marburg, 307 d Nr. 283, Lebenslauf Elisabeth Bähnisch o. D. [1922]. Ein Auszug aus der Arbeit ist im Jahrbuch der philosophischen Fakultät der Universität Marburg abgedruckt. Vgl.: Bähnisch, Elisabeth: Die Betätigung der Landkreise in der Wohlfahrtspflege mit besonderer Berücksichtigung von Pommern, in: Jahrbuch der philosophischen Fakultät Marburg, 1922/1923, S. 113–115. Ihrem Lebenslauf ist zu entnehmen, daß sie zunächst eine Stelle an der gewerblichen Fortbildungsschule in Saarbrücken antreten wollte. 85 Dies geht aus den Aufzeichnungen Hans Heino Fels‘ hervor. Die dort angegebene Adresse Albrecht Bähnischs ‚Marthastraße 5‘ stimmt mit der Adresse Lilienthals überein. Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J.
250 | Theanolte Bähnisch
(SAG), zog er nach Friedrichshain. Die jüngere Schwester Albrechts, Helene86, schien den Aufenthalt ihrer beiden Geschwister in Berlin zu einer Stippvisite genutzt haben: In der Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung ist ein Brief überliefert, mit dem sie am 08.02.1921 bei dem Reformpädagogen Berthold Otto anfragte, ob sie in der Woche vom 14. bis 19.02.1921 für drei Tage an der Berthold-OttoSchule hospitieren könne.87 Auch Georg Bähnisch, der älteste Sohn der Familie, hatte einen Teil seines Studiums in Berlin absolviert. Albrecht bewegte sich also während seines Studiums auf einem auch für seine Geschwister vertrauten Terrain. Bis zum Ende des Sommersemesters 1922 besuchte er Vorlesungen von akademischen Lehrern unterschiedlichster politischer Couleur. Bei dem Soziologen und Volkswirt Werner Sombart88, der aufgrund seiner Anhängerschaft an die Konservative Revolution89 als intellektueller Wegbereiter des Nationalsozialismus gilt,90 hörte er eine vertiefende Vorlesung zur Nationalökonomie. Auch bei Rudolf Stammler, der als Begründer der neukantianischen Rechtsphilosophie zu den zentralen Reformatoren der universitären Rechtslehre gehörte, besuchte er eine Veranstaltung. Stammler wurde später Mitglied des rechtsphilosophischen Ausschusses der vom NSJustizminister gegründeten ‚Akademie für deutsches Recht‘. Daneben lernte er bei den Professoren James Goldschmidt und Martin Wolff91, die beide unter den Nationalsozialisten ihre Lehrstühle verloren. Goldschmidt wurde
86 Helene Klara Bähnisch wurde am 03.02.1897 in Ohlau geboren und starb am 16.12.1970 als Helene Feilke in Greifswald. 87 Sie habe schon einige seiner Schriften gelesen, sei aber an der Praxis interessiert, schrieb sie an Otto. Am Rand des Briefes ist in anderer Tinte und Schrift vermerkt „willkommen“. Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF), Nachlaß Berthold Otto, Helene Bähnisch [Pritzwalk] an Berthold Otto, 08.02.1921. Auskunft von Bettina Irina Reimers per e-mail an Nadine Freund, 29.11.2009. Ob Helene Bähnisch tatsächlich nach Berlin fuhr, ist nicht überliefert. 88 Unter dem Titel ‚Der proletarische Sozialismus‘ erschien die zehnte Auflage von ‚Sozialismus und soziale Bewegung‘. In den Veränderungen der Neuauflage manifestiert sich Sombarts Wandlung zum Anhänger der Konservativen Revolution. Verbindendes Element mit seinen früheren Ansichten ist die Verneinung der Regulierungskräfte des Markts. Dem Rassismus der Nationalsozialisten stand Sombart allerdings ablehnend gegenüber, zumal es Angriffe auf seine Person aufgrund seiner jüdischen Herkunft gab. Vgl.: Sombart, Werner: Vom Menschen, Berlin 1938. 89 Vgl.: Mohler, Armin: Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Grundriß ihrer Weltanschauungen, Stuttgart 1950. Der Begriff ist als Sammelbezeichnung von Intellektuellen verschiedener Strömungen antiliberalen und antiegalitären Denkens bis heute umstritten. Zur Kritik vgl.: Breuer, Stefan: Die „Konservative Revolution“ – Kritik eines Mythos, in: Politische Vierteljahresschrift, 31. Jg. (1990), S. 585–607 sowie ausführlicher: ders.: Anatomie der Konservativen Revolution, Darmstadt 1993. 90 Raehlmann, Irene: Arbeitswissenschaft im Nationalsozialismus: Eine wissenschaftssoziologische Analyse, Wiesbaden 2005, S. 157. 91 LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit B, Nr. 5, Anmeldebuch. Bei dem Anmeldebuch handelt es sich um ein heute unter dem Namen ‚Studienbuch‘ bekanntes Dokument.
Albrecht Bähnisch | 251
1934 als erster Professor der Berliner juristischen Fakultät wegen seiner jüdischen Abstammung von seinem Lehrstuhl vertrieben. Nach seiner ‚Strafversetzung‘ nach Frankfurt und anschließenden Zwangsemeritierung verließ er Deutschland. Seine Bemühungen um eine Abgrenzung der ‚Übertretungen‘ – heute ‚Ordnungswidrigkeiten‘ – vom Strafunrecht fanden im Zuge der Verwaltungsreformbemühungen in den zwanziger Jahren Eingang in das 1931 verabschiedete Preußische Polizeiverwaltungsgesetz (PVG). An dessen Kommentierung arbeitete später wiederum Albrecht Bähnisch mit und brachte dabei womöglich in Goldschmidts Unterricht Besprochenes ein. Prof. Martin Wolff wurde, da er schon vor 1914 vereidigt worden war, erst 1935 von seinem Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handelsrecht und Internationales Privatrecht verdrängt. Er genoß einen Ruf als begnadeter akademischer Lehrer, dessen Vorlesungen stets überfüllt waren.92 Wolff emigrierte 1938 nach England und wurde Fellow des All Souls College in Oxford. Daß Albrecht Bähnisch Wolffs Vorlesung besucht hatte, mag ihm die Orientierung erleichtert haben, als er Mitte der 1930er Jahre sein Auskommen in der Privatwirtschaft fand.93 Schon während seines Studiums in zwei Städten hatte Albrecht also ein breites Spektrum wissenschaftlicher und politischer Auffassungen über die Rechtswissenschaften kennengelernt. Daß gerade jene Professoren, die versucht hatten, die Kernelemente der Weimarer Demokratie auch in der Rechtslehre zum Tragen zu bringen, aus ihren Ämtern entfernt wurden, dürfte ihn beschäftigt haben. Der Oberstaatsanwalt beim Landgericht Berlin bat 1933, als er gegen die Vorstandsmitglieder des „Bundes Vereinigung freiheitlicher Akademiker, e.V“ in Berlin ermitteln ließ, wohl kaum zufällig beim Regierungspräsidenten von Merseburg „um gefällige Mitteilung, ob dort die Anschrift […] des Albrecht Bähnisch bekannt ist“94. ‚Der Bund‘, wie die Vereinigung genannt wurde, stand der DDP nah und wollte laut Barbara Vogel „gegenüber dem antisemitischen und ‚völkisch‘ orientierten ‚deutschen Hochschulring‘ die republikanischen Akademiker mobilisieren“95. Somit handelte es sich um eine in erster Linie politische Vereinigung. Wenn auch unklar ist, ob das spätere SPD-
92 Wolff las im größten Vorlesungssaal der Universität, dem ‚Auditorium Maximum‘, der bis zu 2000 Studenten faßte. Es heißt, man hätte während seiner Vorlesungen eine Stecknadel fallen hören können. Vgl.: Art. „Wolff, Martin“, in: Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, Bd. 2, WBIS online, Zugang über die Universitätsbibliothek Kassel/DBIS sowie Tetzlaff, Walter: Kurzbiographien bedeutender Juden des 20. Jahrhunderts, Lindhorst 1982, WBIS online, Zugang über die Universitätsbibliothek Kassel/DBIS. Vgl. auch: Medicus, Dieter: Martin Wolff (1972–1953) ein Meister an Klarheit, in: Heinrichs, Helmut (Hrsg.): Deutsche Juristen jüdischer Herkunft, München 1993, S. 543–554. 93 Siehe Kapitel 4.3.1. 94 LHASA, MER, Rep C 48 I a II, Lit. B, Nr. 5, Der Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht Berlin an den Regierungspräsidenten von Merseburg, 18.09.1933. 95 Vogel, Barbara: Ernst Cassirer. Philosoph und liberaler Demokrat. Ernst Cassirer und die Hamburger Universität von 1919 bis 1933, in: Frede, Dorothea/Schmücker, Reinold (Hrsg.): Ernst Cassirers Werk und Wirkung, S. 185–214, hier S. 194/195.
252 | Theanolte Bähnisch
Mitglied Albrecht Bähnisch auch Mitglied dieser Vereinigung war, so spricht es doch Bände, daß der Oberstaatsanwalt dies 1933 für wahrscheinlich hielt. Als ‚Famulus‘ – eine Stellung, die man heute als ‚studentische Hilfskraft‘ bezeichnen würde – arbeitete Albrecht Bähnisch 1921/22 zunächst ein halbes Jahr lang für den jüdischen Privatdozenten für Öffentliches Recht, Dr. Gerhard Lassar96 in Berlin-Wilmersdorf. Er blieb, allerdings in vermindertem Umfang, weiterhin für Lassar tätig, als dieser im Sommer 1922 einen Lehrauftrag in Münster wahrnahm, wo zu dieser Zeit Dorothea Nolte Rechtswissenschaft studierte.97 Zumal Professor Bühler kurz vor Dr. Lassars Kommen von Münster nach Berlin gewechselt hatte, scheinen Dorothea und Albrecht dieselben Dozenten gekannt und damit bereits entsprechenden Gesprächsstoff gehabt zu haben, als sie aufeinander trafen.98 Gerhard Lassar galt als einer der fortschrittlichen Köpfe in der Verwaltungswissenschaft zu seiner Zeit. Seine Schrift ‚Reichseigene Verwaltung‘ war, wie Michael Stolleis es formuliert, Zeuge des „verstärkten Eindringen[s] sozialwissenschaftlicher Fragestellungen in das Verwaltungsrecht der Weimarer Zeit“99. Die ‚reichseigene Verwaltung‘ (auch ‚Verfassungsverwaltung‘ genannt) war in Abschnitt 6 der Weimarer Reichsverfassung vorgesehen und bedeutete eine enge Orientierung der Verwaltung an den zentralen Inhalten der Verfassung. Dazu gehörten in der Weimarer Republik auch Paragraphen von sozialpolitischer Relevanz, welche die geplante Ausgestaltung des Staates als ‚soziale Demokratie‘ festhielten. Schon während seines Studiums hatte Albrecht Bähnisch also intensiven Kontakt mit einem wichtigen Reformer des Verwaltungsrechts gehabt.
96 Lassar, geboren am 16.02.1888 in Berlin, wurde 1925 als Extraordinarius an die Universität Hamburg berufen. Zudem war er ab 1926 Studienleiter der Hamburgischen Verwaltungsakademie. Mit seiner wissenschaftlichen Arbeit unterstützte er die Emanzipation des Verwaltungsrechts im Zivilrecht. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit war der schleichende Verfassungswandel im Zuge der Stärkung der Reichsgewalt gegenüber den Ländern in der Weimarer Republik. Einem Ruf auf eine ordentliche Professur an die Universität Greifswald folgte er nicht, da er glaubte in Hamburg größere wissenschaftliche Freiheit zu haben. Dort wurde er jedoch als Nichtarier zum 01.01.1934 entlassen. 97 LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit B, Nr. 5, Lebenslauf. 98 Entsprechende Einträge im Studienbuch finden sich zwar nicht, jedoch schließt dies die Möglichkeit, daß Albrecht Veranstaltungen bei den entsprechenden Dozenten besucht hatte, nicht aus. 99 Stolleis, Michael: Verwaltungsrechtswissenschaft und Verwaltungslehre in der Weimarer Republik, in: Jeserich, Kurt u. a.: Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 4, S. 77–91, hier S. 91.
Albrecht Bähnisch | 253
3.2.2.1 Mit Verantwortung beladen und an der Grenze des wissenschaftlichen Ehrgeizes: Albrecht als Regierungsreferendar Als „[e]twas überfein und spitzfindig“100 bewertete der zuständige Gutachter schließlich die Studienabschlußarbeit des vielseitig geschulten „cand. jur. Bähnisch“ – was am Ende doch eher für als gegen den Absolventen gesprochen haben dürfte. So hatte dann auch das Innenministerium „keine Bedenken“ Bähnisch, „welcher nach dem guten Erfolg seiner Referendarprüfung als Anwärter für den höheren Verwaltungsdienst besonders geeignet erscheint“, „ausnahmsweise“101 als überzähligen Regierungsreferendar der Bezirksregierung Münster zu übersenden. Vermutlich absolvierte er sein Referendariat in Münster, um weiterhin in der Nähe Lassars sein zu können, bei dem er eine Doktorarbeit verfassen wollte. Im Seminar-Zeugnis des Privatdozenten Dr. Lassar vom 20.02.1923 war Hans-Heino Fels zufolge bereits das Thema der geplanten Dissertation notiert: „Die außersteuerlichen Ziele der sozialdemokratischen Steuerpolitik seit der Revolution und ihre Einwirkung auf das Steuerrecht.“102 Die Idee zu seiner Dissertation scheint Albrecht weiter verfolgt zu haben, als er im Mai 1923 für einen Monat in die Nähe seines Elternhauses zurückkehrte, um bei seinem Onkel mütterlicherseits, dem Rechtsanwalt und Notar Konrad Altmann in Steinau an der Oder (Oberschlesien) seinen Vorbereitungsdienst zum Referendariat zu absolvieren.103 Im September 1923 bat er den Regierungspräsidenten in Münster, ihm Urlaub vom 01.11.1923 bis 28.02.1924 zu gewähren, damit er, „auf den dringenden Rat“ Lassars hin, in Berlin Material für seine Doktorarbeit sammeln und an einem volkwirtschaftlichen Seminar teilnehmen könne. „Ich glaube dies am Besten vor Beginn meiner Ausbildung bei der Regierung zu tun, um den Vorbereitungsdienst später nicht unterbrechen zu müssen.“104 1924 reichte er ein weiteres Urlaubsgesuch ein, um an seiner Promotion weiterarbeiten zu können. Sein wissenschaftlicher Eifer schien jedoch (zunächst) davon gebremst worden zu sein, daß sein Schreiben irrtümlicherweise in Landsberg landete, worüber er erst vier Monate später informiert wurde.105 Warum er schließlich den Plan, zu promovieren, ad acta legte, ist unklar, eine Begründung der Entscheidung gegen die Doktorarbeit findet sich nirgendwo. Wahrscheinlich ist, daß sich Alfred eher schleichend von seinem Vorhaben trennte, weil ihm die verantwortungsbeladenen Posten, die er während des Referendariats ausfüll-
100 LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit B, Nr. 5, Gutachten zur Staatsexamensarbeit von Albrecht Bähnisch. 101 LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit B, Nr. 5, Der Minister des Innern an den Regierungspräsidenten in Münster, 18.04.1923. 102 Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 4. 103 Vgl.: LHASA, MER, Rep C 48 I a II, Lit. B, Nr. 5, Albrecht Bähnisch an den Präsidenten des Oberlandesgerichts zu Breslau, 05.04.1923. 104 LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit. B, Nr. 5, Albrecht Bähnisch an den Regierungspräsidenten in Münster, 11.09.1923. 105 Ebd.
254 | Theanolte Bähnisch
te, schlichtweg keine Zeit ließen, ‚nebenbei‘ noch zu promovieren. Durch die im Rahmen des Referendariats vorgesehenen häufigen Veränderungen des Arbeitsortes, des Arbeitsumfelds und der Inhalte, die immer wieder Phasen der intensiven Einarbeitung erforderten, mag es ihm besonders schwer gefallen sein, Kapazitäten für die Doktorarbeit freizuschaufeln: Zunächst arbeitete er vom 01.03. bis zum 30.04.1924 im Kommunaldezernat beim Regierungspräsidenten, dann wurde er vom 01.05. bis 10.06.1925 dem Landrat Dr. Karl Ernst von Nasse in Hagen/Westfalen überwiesen, bevor er vom 11.06.bis zum 23.08. desselben Jahres zur Bezirksregierung Münster, diesmal ins Polizeidezernat, zurückkehrte. Im Anschluß verfaßte er vom 24.08. bis zum 05.10. bis 1925 seine ‚größere schriftliche Arbeit‘, um dann vom 06.10. bis zum 30.11.1925 im Kommunaldezernat des Regierungspräsidiums Verwendung zu finden. Anschließend arbeitete er beim Bezirksausschuß der Bezirksregierung Münster (01.11.1925 bis 31.03.1926). In derselben Behörde war er dann in der Kirchen- und Schulabteilung (01.04 bis 05.05.1926) sowie bei der Regierungshauptkasse (12.04. bis 25.04.1926) beschäftigt. Vom 11.03. bis 10.06.1926 wurde er schließlich für zwei Monate beim Landratsamt in Halle bei Bielefeld zur Vertretung des erkrankten Amtmannes Alfred von Campe eingesetzt.106 Ob er am Ende seines Verwaltungsreferendariats noch einmal an seinen Plan, zu promovieren, angeknüpft hatte, ist ungewiß, aber eher unwahrscheinlich. Denn gleich nach der ‚großen Staatsprüfung‘ leitete er stellvertretend ab dem 30.09.1926 das Versicherungsamt für den Landkreis Flensburg,107 um danach, zum 10.01.1927, als Assessor nach Berlin ins Preußische Ministerium des Innern zu gehen. Spätestens an diesem Punkt dürfte er den Plan, zu promovieren, fallengelassen haben. Wie Hans-Heino-Fels berichtet, sind zwischen den Familien Bähnisch und Lassar dennoch „jahrzehntelange freundschaftliche Beziehungen“108 entstanden. Es ist anzunehmen, daß Lassars plötzlicher Tod im Januar 1936 auch für das Ehepaar Bähnisch ein einschneidendes Erlebnis darstellte. Ob Albrecht und Theanolte die wahren Hintergründe für Lassars frühen Todes kannten, läßt sich nicht beantworten. Aus Angst, ihre Pensionsansprüche zu verlieren, hatte die Witwe Lassars mit Hilfe eines befreundeten Arztes den Tod ihres Mannes als Fischvergiftung getarnt. Erst 1988 wurde publik, daß Gerhard Lassar im Januar 1936 Suizid begangen hatte. Begründet wird seine Entscheidung zum ‚Freitod‘ mit dem Verlust seines Lehrstuhls in Hamburg im Zuge seiner Versetzung in den Ruhestand, weshalb er nach Berlin zurückgekehrt war.109
106 Vgl.: LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit. B, Nr. 5, Übersicht über den Gang des Vorbereitungsdienstes des Regierungsreferendars Albrecht Paul Alfred Kurt Bähnisch. 107 In dieser Funktion verzeichnet ihn auch noch das Handbuch über den preußischen Staat aus dem Jahr 1927 auf S. 647. 108 Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 3. 109 Vgl.: Grüttner, Michael/Kinas, Sven: Die Vertreibung von Wissenschaftlern aus den deutschen Universitäten 1933–1945, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 55. Jg. (2007), S. 123–186, hier S. 144 und Anm. 67. Vgl. auch: Matthes, Eike: Zehn Stolpersteine für NS-Opfer der Hamburgischen Universität, in: Jura-Magazin 5/2010, auf:
Albrecht Bähnisch | 255
Die Entscheidung Albrechts, auf die Promotion zu verzichten, fiel vermutlich auch deshalb, weil er, auch ohne zusätzlichen akademischen Titel, bei den Kollegen schnell zu Ansehen und Respekt gelangte und als Assessor, beziehungsweise ab 04.06.1929 als Regierungsrat110 im personellen Umfeld des preußischen Innenministeriums an zentralen verwaltungsrechtlichen Publikationsprojekten beteiligt wurde.111 Während des Studiums und des Referendariats hatte er Kompetenzen im wissenschaftlichen Schreiben erworben. Dies dürfte eine Erklärung dafür sein, daß er während seiner Assessoren-Tätigkeit oft mit Aufgaben betraut worden war, die selbständiges Arbeiten, Formulierungssicherheit, Genauigkeit und gute Recherchekenntnisse voraussetzten. Darunter fiel unter anderem das Verfassen von Lexikon-Artikeln.112 Die von Oberregierungsrat Christian Kerstiens als „außerordentlich erfreulich“113 bezeichnete Abschlußarbeit Albrechts, welche sich mit der „Schlüsselung des Länderfinanzausgleichs in Bund, Ländern und Gemeinde“, einem durchaus schwierigen und zudem umstrittenen Thema befaßte, wurde nicht zufällig als eine der Grundlagentexte bei der Neuregelung jener Schlüsselung verwendet. „Seine Darlegung dürfte nach der grundsätzlichen Seite hin auch für die Zukunft noch als Unterlage zur weiteren Klärung des Problems von Wert sein“114, hieß es zur Expertise Albrechts auf diesem Feld in Kerstiens Gutachten. Wie schließlich aus dem Schlußzeugnis von Kerstiens, mit dem Albrecht Bähnisch in Berlin später wissenschaftlich zusammenarbeiten sollte, hervorgeht, hatte der Referendar bereits „eingehende[…] wissenschaftliche Studien während seiner Universitätszeit“115 durchgeführt und während des Referendariats noch Zeit gefunden, neben der Vertiefung allgemeiner Kenntnisse „einzelne wissenschaftliche Fragen theoretisch zu untersuchen“. Für den höheren Verwaltungsdienst, so Kerstiens,
110 111
112 113 114 115
http://studium.jura.uni-hamburg.de/magazin/index.php?ausgabe=201005&artikel=834, am 08.08.2010. Seine Planstelle bekam er bereits am 01.04.1929. Er verfaßte ein 182 Seiten langes Kapitel über das Medizinalpolizeirecht in von Brauchitschs‘ Kommentar zu den Verwaltungsgesetzen von Preußen und ein 35 Seiten langes Kapitel über die Gesundheitspolizei in Drews‘ Preußischem Polizeirecht. Des Weiteren war er Autor zweier Werke mit den Titeln ‚Das Impfwesen‘ und ‚Beamten-Ausschüsse der Schutzpolizei‘. Für den Band der Zeitschrift ‚Verwaltungsarchiv‘ von 1930 schrieb er einen größeren Aufsatz über den Polizeilastenausgleich, diverse kleinere Aufsätze von ihm erschienen im Reichsgesetzblatt. Zur dritten Auflage von von Bitters Handwörterbuch der Preußischen Verwaltung trug er über 70 Artikel aus dem Bereich Medizinalwesen und Gesundheitspolizei bei. In seinem Privatnachlaß (Hans-Heino und Orla-Maria Fels, Waiblingen) ist auch ein 16seitiges ‚Merkblatt zur Zwangsvollstreckung gegen Gemeinden überliefert‘ – ein weiterer Beleg für seine vielfältigen fachwissenschaftlichen Unternehmungen. Genaue Titelangaben finden sich jeweils im entsprechenden Kontext. LHASA, MER, Rep C 48 I a II, Lit B, Nr. 5, Beurteilung der Prüfungsarbeit des Regierungsreferendars Baehnisch, Münster, 10.05.1926. Ebd. Ebd. LHASA, MER, Rep C 48 I a II, Lit B, Nr. 5, Schlußzeugnis, Münster, 10.05.1926.
256 | Theanolte Bähnisch
sei Bähnisch „vor allem geeignet durch seine hervorragende Befähigung, rechtlich oder tatsächlich schwierige Tatbestände klar zu erfassen und Lösungen entgegenzuführen, die besonders auch in praktischer Hinsicht uneingeschränktes Lob verdienen“. Er schließt: „Es steht zu erwarten, dass der Referendar an jedem Posten, auf den er gestellt wird, sich durchaus bewähren wird. Seine Vorbildung kann unbedenklich als voll gut bezeichnet werden.“116 Auch die Suche der Reformer in der preußischen Verwaltung nach jungem, demokratisch denkendem Personal, dürfte den schnellen Aufstieg Albrecht Bähnischs begünstigt haben. Von Albrecht selbst sind zu diesem Umstand leider keine Äußerungen überliefert, aber andere Persönlichkeiten aus Politik und Verwaltung der Weimarer Zeit reflektierten die enorme Aufstiegsmobilität, welche die preußische Verwaltung gerade jenen Personen bot, denen während des Kaiserreichs der Weg in die öffentlichen Ämter versperrt geblieben waren.117 Der 1899 geborene Jurist Robert Kempner, der mit dem um nur ein Jahr jüngeren Albrecht Bähnisch im Innenministerium bald eng zusammenarbeiten sollte, beschrieb in seinen Erinnerungen den Schlüssel zu seinem eigenen Erfolg so: „Während dieser Zeit wurden unter der Hand, man hörte das in Kollegenkreisen, jüngere Leute gesucht, die in den Staatsdienst eintreten wollten […]. Man wollte was Besseres schaffen. Er herrschte dort [bei der Staatsanwaltschaft, wo Kempner zunächst für kurze Zeit tätig war] doch unter vielen älteren Richtern […] ein ausgesprochener Antirepublikanismus. Da fing man an, unter anderen Leuten zu rekrutieren, hat Referendare gesucht, die irgendwie liberal oder sozialdemokratisch waren, die nicht mehr dieser alten Clique angehörten. Die Jüngeren waren inzwischen anders geworden, hatten durch den Krieg und die Inflation viel erlebt“.118 Glaubt man Kempner, für den in der Weimarer Republik ein steiler Karriereweg begann, welcher sich in der BRD fortsetzen sollte, so waren schließlich seine journalistische Erfahrung und der Umstand, daß er einen SPDAbgeordneten kannte, für seine Einstellung im Innenministerium maßgeblich. Dort galten in den 20er Jahren ähnliche Auswahlkriterien für den juristisch vorgebildeten Nachwuchs wie von Kempner für die Staatsanwaltschaft beschrieben. Albrecht Bähnisch war also zur rechten Zeit am rechten Ort und kannte die richtigen Leute, um sein zweifelsohne vorhandenes Potential voll entfalten zu können. Zumal, wie Kempner es formulierte, „die Ministerien noch nicht reine gemacht worden waren“ als er und Albrecht Bähnisch ihren Dienst im Innenministerium antraten. „Es gab natürlich unter den sozialdemokratischen Ministern den Staatssekretär Wilhelm Abegg, einen Demokraten, den Ministerialdirektor Erich Klausener, einen Zentrumsmann, meinen Freund Hans Simons, einen Sozialdemokraten“, fährt Kempner fort. „Aber es gab auf der anderen Seite noch viele Reaktionäre.“119 Eben diese sollten nach und nach durch Personen wie Kempner und Bähnisch ersetzt werden.
116 Ebd. 117 Bis 1918 war Juristen, die der SPD nahestanden, die Zulassung zum Verwaltungsreferendariat versperrt gewesen. 118 Kempner, Robert: Ankläger einer Epoche. Lebenserinnerungen, Frankfurt a. M./Wien 1983, S. 44. 119 Ebd., S. 47/48.
Albrecht Bähnisch | 257
Mit Abegg und Klausener listet Kempner in seinen Erinnerungen Personen auf, die Albrecht Bähnischs Vorgesetzte und Kollegen und bald auch Theanoltes gute Bekannte werden sollten: Albrechts Dienstort, die Polizeiabteilung – die Schnittstelle des Innenministeriums ins Berliner Polizeipräsidium und damit auch zu Theanoltes Dienstort – war, vor allem in personeller Hinsicht, ein demokratischer Vorposten im Innenministerium. „In der Personalabteilung hatte sich schon einiges geändert. Grzesinski, der ein energischer Mann war, energischer als sein Nachfolger Severing, hatte frische Luft einziehen lassen“120, erinnert sich Kempner. Der Umstand, daß Grzesinski, wie erwähnt, zwischen zwei Amtsperioden als Innenminister auch als Polizeipräsident von Berlin fungierte, war wesentlich dafür verantwortlich, daß sowohl Albrecht als auch Theanolte sich rühmen konnten, an Stellen zu arbeiten, die – nicht zuletzt über die Zusammenarbeit der beiden Behörden – als besonders fortschrittlich im demokratischen Sinn gelten dürfen. Albrecht Bähnisch fiel als Sohn eines Gymnasialdirektors und als Absolvent einer genuin verwaltungsrechtlich ausgerichteten Ausbildung natürlich nicht unter die Gruppe der vieldiskutierten ‚Außenseiter‘, mit denen Severing und Grzesinski im Laufe ihrer Dienstzeit einige gehobene ‚politische‘ Beamten-Stellen besetzte.121 Doch er hatte mit seinem über sein Studium und seinen Beruf herausgehenden Engagement in der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Ost (SAG), von dem noch an anderer Stelle die Rede sein wird, bewußt die Nähe zu Berliner Arbeiterfamilien gesucht und somit um die Nöte dieses Bevölkerungsteils wissend, seinen Dienst ausgeübt. Dies dürfte auchsein Ansehen bei den Reformern im Innenministerium befördert haben. Aufgrund der Verschiedenheit der Arbeit Albrechts im Innenministerium und seines Engagements in der SAG, einem Projekt der bürgerlichen Sozialreform, sollen die beiden Themenfelder, obwohl sie zeitgleich relevant waren, im Folgenden nacheinander behandelt werden. Im Anschluß daran soll aufgezeigt werden, wo die Schnittstellen beider Betätigungsfelder lagen. Dabei soll deutlich werden, warum jenes private Engagement Albrechts dem Verwaltungsjuristen handfeste Vorteile bei der Bewältigung seines beruflichen Alltags verschaffte und es sollen Reflexionen darüber angestellt werden, wie sein Engagement seine Karriereaussichten und schließlich auch die seiner Frau – befördert haben könnte.
120 Ebd., S. 47. 121 Jene Außenseiter, die Grzesinski gegen den erbitterten Widerstand der konservativen Parteien einstellte, hatten nicht die ‚klassische Laufbahn‘, also ein Studium der Rechtswissenschaften und ein Verwaltungsreferendariat absolviert, sondern wurden als ‚Männer der Praxis‘, oft aus der Gewerkschaftsbewegung kommend, in erster Linie wegen ihres erklärten Bekenntnisses zur Republik sowie ihrer Erfahrung in der gewerkschaftlichen Politik- und Verwaltungsarbeit eingestellt. Die ‚Außenseiter‘-Personalpolitik sollte der Überzeugung der Sozialdemokraten, daß der Proporz der Politiker und politischen Beamten in Staat und Parlament die Verhältnisse der Bevölkerungsgruppen im Staat abbilden sollten, Rechnung tragen.
258 | Theanolte Bähnisch
3.3 MITARBEIT AN DER VERWALTUNGSGESETZREFORM IM PREUSSISCHEN INNENMINISTERIUM 3.3.1 Neue politische Wege erfordern neues Personal: Glänzende Ausgangsbedingungen im Innenministerium Aus der Personalakte Albrecht Bähnischs gehen die genauen Aufgaben des Assessors in der Polizeiabteilung des preußischen Innenministeriums nicht hervor. Handakten Bähnischs sind, auch aus seiner Zeit als Regierungsrat, nicht überliefert. Doch folgt man der Spur der Aufsätze und Bücher, die unter seiner Mitwirkung im Rahmen seines Dienstalltags oder neben diesem entstanden sind, läßt sich ein Bild seiner Arbeit zeichnen, welches Aufschluß gibt über deren maßgebliche Inhalte sowie über die beruflichen und damit wissenschaftlichen und politischen Kontakte, die er während seiner Arbeit knüpfte. Dabei wird deutlich, daß Albrecht Bähnisch nicht nur an einer Schlüsselstelle tätig war, von der aus zentrale demokratische Reformen den Staat Preußen verändern sollten, sondern daß er, der bei seinen Kollegen und Vorgesetzten großes Ansehen genossen haben muß, diese Reformen sogar aktiv mitgestaltete. Theanoltes Ehemann war damit an einem Projekt beteiligt, mit dem der Staat Preußen, was die Umsetzung der in der Verfassung festgeschriebenen Neuerungen im Verwaltungswesen betraf, zunehmend in Vorsprung gegenüber dem deutschen Reich geriet. Nachdem die Nationalsozialisten das Rad zwischenzeitlich wieder zurückgedreht hatten, wurde dieses Projekt richtungsweisend für die Verwaltung der zweiten deutschen Demokratie – und damit wiederum für Theanoltes spätere Arbeit.122 Während seiner Tätigkeit in der Polizeiabteilung des Preußschen Innenministerium standen für Albrecht drei Themenfelder im Vordergrund: 1. Die Berufsvertretungsrechte der preußischen Polizeibeamten und damit der größten Beamtengruppe im Staat überhaupt, 2. der Polizeilastenausgleich123 als Teilfrage der Verteilung von Aufgaben, Einnahmen und Ausgaben zwischen und innerhalb der verschiedenen staatlichen Ebenen sowie 3. die Gesundheitspolizei als neu eingerichteter Teilbereich der preußischen Polizeiverwaltung. Den Rahmen seiner Arbeit setzten die beiden Kernprobleme, vor die sich die Spitzen der preußischen Verwaltung in der Weimarer Zeit gestellt sahen: 1. Die Verwaltungsgesetzlage, die aufgrund ihres Zuschnitts auf das Kaiserreich nicht zur neuen, demokratischen Verfassung paßte und daher einer möglichst schnellen, praktisch gut durchführbaren und nachhaltigen Überarbeitung bedurfte und 2. die personelle Situation in den Verwaltungen. Die neuen ‚Väter‘ der Republik erwarteten von ihren Staatsdienern Treue zur demokratischen Staatsform, doch die Mehrheit der Beamten und sonstigen Mitarbeiter des Staates hatten ihren Diensteid noch auf das Königreich Preußen geschworen und waren der Demokratie gegenüber skeptisch, wenn nicht gar ablehnend eingestellt. Beide Herausforderungen gingen Hand in Hand. Denn von der Mehrzahl der kaisertreuen Beamten in leitenden Funktionen, die noch
122 Vgl. dazu in aller Kürze beispielsweise: Möller, Horst: Preußen, in: Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 4, S. 540–557. 123 Vgl. dazu: Bähnisch, Albrecht: Polizeilastenausgleich, in: Verwaltungsarchiv, Bd. 35 (1930), S. 49-104.
Albrecht Bähnisch | 259
in Bismarcks Kampf gegen die Sozialdemokratie und die ‚Ultramontanen‘ eingespannt waren, war eine besondere Begeisterungsfähigkeit für die Ausarbeitung und Umsetzung von Gesetzesreformen, wie sie vor allem von der SPD und dem Zentrum, aber auch von der DDP forciert wurden, kaum zu erwarten. An einigen wichtigen Nahtstellen zwischen Verwaltung und Politik wurden deshalb ab der Übernahme der Regierung nach und nach Umbesetzungen vorgenommen.124 Politische Beamte125 hatten schon nach den geltenden Rechtsbestimmungen der Monarchie jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können. Diese Regelung galt weiterhin in der Weimarer Republik. An anderen Stellen aber mußte die Verwendbarkeit der aus dem Kaiserreich ‚übernommenen‘ Beamten für den neuen Staat optimiert werden. Als Mittel der Wahl wurden dafür nicht nur Schulungen, sondern auch Zugeständnisse angesehen. Daß die altgedienten Beamten ohne ‚politischen‘ Status nicht ohne Weiteres durch andere, systemtreuere ersetzt werden konnten, lag zum Einen darin begründet, daß den Interessen der Beamtenverbände bei der Ausarbeitung der Weimarer Verfassung Rechnung getragen und die ‚wohlerworbenen Rechte‘ der Beamten in Art. 124 der neuen Verfassung gesichert worden waren. Zum Zweiten wäre es schier unmöglich gewesen quasi über Nacht, das immens große Heer von Beamten auszutauschen, welches den preußischen Staat im Kaiserreich so akribisch verwaltet hatte, denn die demokratischen Parteien verfügten schlichtweg nicht über ausreichendes Personal, um alle Stellen zu besetzen. Die Furcht der neuen Machthaber vor dem Chaos, das den Neuaufbau einer Verwaltung ohne die im Dienst geschulten Mitarbeiter bedeutet hätte, war am Ende größer als die Sorge um die Treue jener Beamten gegenüber dem neuen Staat. Diskussionen um dieses Thema kamen zwischen den Parteien und auch in der (M)SPD selbst während der gesamten Weimarer Zeit nicht zum Erliegen. Der Frage, welche Rolle die nur halbherzig durchgeführte preußische Verwaltungsreform für den Bestand und das Scheitern der Weimarer Republik hatte, widmete sich Helmut Klaus in Jahr 2006.126 Daneben ist das Thema in der aktuelleren Forschung, jenseits biographischer Arbeiten über die preußischen Reformer, aber auch in Überblicksdarstellungen kaum präsent.127
124 Siehe Kapitel 3.3.5. 125 Unter diese Bezeichnung fielen Beamte, die an den Nahtstellen zwischen Politik und Verwaltung tätig waren, also Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten, Polizeipräsidenten und ihre jeweiligen ersten Vertreter sowie Landräte, Staatssekretäre und Ministerialdirektoren. 126 Klaus, Helmut: Der Dualismus Preußen versus Reich in der Weimarer Republik in Politik und Verwaltung, Mönchengladbach 2006. 127 Vgl. dazu die forschungsorientierte Darstellung: Gessner, Dieter: Die Weimarer Republik, Darmstadt 2002. Über das Thema Verfassung wird hier ohnehin nur im Zusammenhang mit dem ‚Ende der Republik‘ berichtet, den Begriff ‚Verwaltung‘ sucht man sowohl im Register, als auch im Kapitel über Verfassung, vergeblich. Ebenso verhält es sich – kaum zu glauben – mit dem Begriff ‚Preußen‘. Für die ältere Literatur vgl. stellvertretend: Schulz, Gerhard: Zwischen Demokratie und Diktatur. Verfassungspolitik und Reichsreform in der Weimarer Republik, 2. Bd., Berlin/New York 1987. Bezeichnend ist
260 | Theanolte Bähnisch
Im Zwiespalt zwischen dem vor allem personellen Festhalten an der althergebrachten Ordnung und der vor allem inhaltlichen Reform einer den Erfordernissen der Demokratie nicht angemessenen Verwaltung läßt sich auch Albrecht Bähnischs Wirken verorten. Deutlicher noch als im Rahmen von Albrechts Mitarbeit an der Verwaltungsreform wird anhand seines Engagements in der SAG sichtbar werden, daß das Wirken in jenem Zwie-spalt durchaus auch als ein Bekenntnis zu einer lagerübergreifenden Zusammenarbeit für den gemeinsamen gesellschaftlichen Fortschritt bewertet werden kann. 3.3.2
Ein „heiß erstrebtes Ziel“ – Beamtenrechte der Schutzpolizei
Auf seinem Posten als Beamtenassessor im Preußischen Innenministerium bearbeite Albrecht Bähnisch zunächst vor allem Disziplinar- und Beschwerdefälle der Preußischen Polizei.128 Damit habe er sich, meldete der ‚Volksbote Zeitz‘ später, „das besondere Vertrauen der Beamtenorganisationen erworben“129: Dem Volksboten zufolge war Bähnisch an der Neuordnung des Rechtes der Beamtenausschüsse in der Schutzpolizei beteiligt gewesen. Dies läßt sich anhand seiner Personalakte zwar nicht nachvollziehen, doch sein Wissen in diesem Bereich schlug sich 1929 in einem Buch nieder, das er gemeinsam mit dem Oberregierungsrat Fritz Tejessy herausgab.130 Der Ministerialdirektor und Leiter der Polizeiabteilung, Dr. Erich Klausener, betont in seinem Geleitwort die Bedeutung solcher Regelungen für die Polizeibeamtenschaft. Die veröffentlichten Vorschriften, so Klausener, seien ein „heiß erstrebtes Ziel“ der Polizeibeamten, „die ihre Wünsche seit Jahren in der Hoffnung zurückgestellt“ hätten, „daß eine reichsrechtliche Regelung des Beamtenrechts erfolge“. Nachdem eine solche noch immer ausstünde, gebe der preußische Erlaß den Beamten nun zum ersten Mal ein „bis ins einzelne ausgearbeitete[s] Recht zur Wahrnehmung ihrer speziellen Interessen“131. Das preußische Innenministerium kam damit dem Artikel 130, Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung: „Die Beamten erhalten nach näherer reichsgesetzlicher Bestimmung besondere Beamtenvertretungen“ nach.
128
129 130
131
auch hier die Konzentration auf die Endphase der Weimarer Republik. Für einen kurzen Überblick vgl.: Wengst, Udo: Staatsaufbau und Verwaltungsstruktur, in: Bracher, Karl Dietrich/Funke, Manfred/Jacobsen, Hans-Adolf (Hrsg.): Die Weimarer Republik 1918– 1933, 3. Aufl., Bonn 1998, S. 63–77. O. V.: Der neue Merseburger Landrat. Morgen offizieller Amtsantritt, in: Volksbote Zeitz, Nr. 26 vom 31.01.1930. In diesem Kontext entstand auch der Artikel Bähnisch, Albrecht: Vernehmungen durch unbeteiligte Beamte im nichtförmlichen Dienststrafverfahren, in: Die Polizei, 26. Jg. (1929), S. 385. Ebd. Tejessy, Fritz/Bähnisch, Albrecht (Hrsg.): Beamtenausschüsse der Schutzpolizei. Erlaß vom 15. Januar 1929 nebst Ausführungsbestimmungen, Wahlordnung und Anlagen, Berlin 1929. Klausener, Erich: Zum Geleit, in: Tejessy/Bähnisch: Beamtenausschüsse, o. S.
Albrecht Bähnisch | 261
Was den Anschein sehr trockener Ausführungen über die sehr speziellen beruflichen Rechte irgendeiner Gruppe von Staatsdienern erwecken mag – von Bähnisch und Tejessy wurde das Gesetz dementsprechend auch als „Spezialgesetz“132 bezeichnet – – war unter den preußischen Verwaltungsreformern ein wichtiges Thema. Denn gerade die Polizei-Beamten standen demokratischen Verhaltensregeln und der Demokratie als solcher oft fern. Dies lag vor allem darin begründet, daß die preußische Polizei zu Zeiten des Kaiserreichs militärisch zugeschnitten und die Ausbildung stark auf Drill und Gehorsam ausgerichtet war, sowie darin, daß viele Soldaten nach der Auflösung der Armee in die Polizei übernommen worden waren. Mit dem von Bähnisch und Tejessy kommentierten Erlaß vom 15.01.1929 machte der preußische Staat den Schutzpolizei-Beamten, die ihre berufliche Sicherheit lange Zeit als ungenügend empfunden hatten und deren schlechte finanzielle Situation sich über lange Zeit nicht gebessert hatte, ein Angebot zur Zusammenarbeit im Sinne der Demokratie: Ein Katalog verbriefter Berufsvertretungs-Rechte, der den Polizisten demonstrieren sollte, daß der Staat auf ihrer Seite stand, ihre Interessen hörte und seine Diener nach bestem Wissen zu beschäftigen gedachte, zielte im Gegenzug auf die Republiktreue und den persönlichen Einsatz der Beamten zur Verteidigung ihres neuen Arbeitgebers gegen seine Feinde. Denn auf den Schultern der Schutzpolizei ruhte, gerade in den Krisenjahren der Weimarer Republik die Hoffnung der Demokraten, welche Angst vor Aufständen gegen die Regierung hatten. Doch konnten sie sich darauf verlassen, daß die Schutzpolizisten im alltäglichen Dienst wirklich im Sinn der demokratischen Verfassung handeln würden, daß sie im Ernstfall bereit wären, die Republik mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen? In der Retrospektive zeigte sich, wie bereits beschrieben133, daß dem nicht so war. Doch in einer Zeit, in der die Verwaltungsspitzen noch hoffen konnten, daß ihre Reformpolitik von Erfolg gekrönt sein würde, lag der Versuch nah, die Bereitschaft der Polizisten, den neuen Staat zu schützen, durch finanzielles Entgegenkommen und andere Erleichterungen zu fördern. Die Regelungen zu den Beamtenausschüssen, die im Mai 1933 im Zuge der von den Nationalsozialisten anvisierten Gleichschaltung der Berufsverbände aufgehoben wurden134, waren nur eine Ausprägung einer breit angelegten Reform des Polizeiwesens in der Republik, die neben der Festschreibung der Berufsvertretungsrechte auch eine Neufassung der Polizeiverwaltungsgesetze, eine Neustrukturierung der
132 „Die unruhigen Zeiten der letzten zehn Jahre, in denen die reichgesetzgebenden Körperschaften oft Gesetze verabschieden mußten, von denen Leben oder Sterben des deutschen Volkes abhing, waren der ruhigen Beratung eines derartigen Spezialgesetzes wie des Beamtenvertretungsgesetzes auch nicht gerade günstig.“ Tejessy/Bähnisch: Vorwort, in: Dies. (Hrsg.): Beamtenausschüsse, S. 7. 133 Siehe Kapitel 2.3.2.2. 134 Der Innenminister ordnete die Einstellung von Vertrauensmännern an. Vgl.: Volquarts, Elisabeth: Beamtenverbände im Nationalsozialismus. Gleichschaltung zum Zwecke der Ausschaltung aufgrund politischer oder weltanschaulicher Gegnerschaft, Kiel 2001, S. 76.
262 | Theanolte Bähnisch
Polizeieinheiten sowie eine reformierte Ausbildung135 für die Beamten vorsah.136 Auf der Grundlage der neu eingerichteten Polizeiverwaltungsschulen wurde die Schutzpolizei nach und nach vom Heer als Rekrutierungspool und von der militärischen Ausbildung als Grundlage für die Zulassung zum Dienst unabhängig, so daß 1928 das preußische Polizeikorps ‚nur‘ noch zu 55 Prozent aus Armee-Offizieren bestand. Damit hatte sich die soziale und politische Struktur der Polizei immerhin schneller gewandelt, als die der übrigen Beamtenschaft.137 Zudem hatte das Polizeibeamtengesetz vom 31.12.1927 die Rechtsstellung der Polizeibeamten erheblich verbessert138 und die finanzielle Situation der Ordnungshüter sah – nach zwei Besoldungsreformen und einer Wirtschaftskrise139 – für die Polizisten in den unteren Diensträngen immerhin etwas besser aus, als noch zu Beginn der Weimarer Republik. Die Neustrukturierung der Einheiten war im Zuge der von den Alliierten verfügten Demobilmachung, welche nicht nur die Armee, sondern auch die Polizeikräfte betraf, zuerst umgesetzt worden. Sie war bereits weitgehend abgeschlossen, als Albrecht Bähnisch seinen Dienst im Innenministerium antrat. Auch bei der Ausbildung der Polizisten waren zu diesem Zeitpunkt bereits die erwähnten Veränderungen eingetreten. Die Polizeiverwaltungsgesetzreform aber war das schwierigste, langwierigste Paket im Rahmen der Reform des Polizeiwesens. An ihm versuchten sich seine Vorgesetzten gerade, als Bähnisch, neun Jahre nach der Gründung der Republik, seinen Weg in das Innenministerium fand. Aus Bähnischs und Tejessys Publikation, die nur einen kleinen Ausschnitt der Reform darstellte, spricht in der Einleitung die demokratische Idee, von welcher nach der Überzeugung der Sozialdemokraten das alltägliche Leben der Bürger auch im Beruf geprägt sein sollte. Aus ihr spricht ebenso die Überzeugung, daß sich die Möglichkeit des Einzelnen, seine Rechte auf demokratischem Weg einzufordern, systemstabilisierend auf die demokratische Staatsform als Ganzes auswirken müsse. „Jeder Beamte soll die Möglichkeit haben, sich auf Grund dieses Buches ein Bild von seinen Rechten und Pflichten, soweit sie sich auf die Beamtenausschüsse beziehen, zu machen, ohne andere Gesetze oder Erlasse hinzuziehen zu müssen“140, heißt es auf den einzelnen Staatsdiener bezogen. Und an der Gesamtheit orientiert schreiben die Ver-
135 Ab 1920 wurden zehn Provinzial-Polizeischulen in Preußen eingerichtet, 1921 der Fächerkanon der Höheren Polizeischule in Eiche bei Potsdam erweitert und 1927 das Polizei-Institut Berlin Charlottenburg eröffnet. 136 Siehe Kapitel 2.3.2.2. 137 Vgl.: Götz, Volkmar: Polizei und Polizeirecht, in: Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 4, S. 397 – 420. 138 Im Polizeibeamtengesetz von 1927 wurde die Übernahme in die Landjägerei, die Kriminalpolizei, den Verwaltungsdienst oder den kommunalen Polizeidienst nach acht Dienstjahren in der Schutzpolizei gewährt, nach 10 Dienstjahren in der Schutzpolizei waren die Polizeioffiziere und nach 12 Jahren die übrigen Beamten unkündbar. Vgl.: ebd. 139 Dazu vgl. Hoffmann, Gabriele: Sozialdemokratie und Berufsbeamtentum. Zur Frage nach Wandel und Kontinuität im Verhältnis der Sozialdemokratie zum Berufsbeamtentum der Weimarer Zeit, Hamburg, 1972, S. 187 und 191. 140 Tejessy/Bähnisch: Einleitung, in: Dies.: Beamtenausschüsse, S. 9.
Albrecht Bähnisch | 263
fasser, es dürfe „die Hoffnung als berechtigt gelten, daß die neuen Beamtenausschüsse [über deren Sinn und Gestalt das Werk aufklärt] für die gesamte Schutzpolizeibeamtenschaft Helfer und Berater sein, daß sie den einzelnen Beamten sowohl bei der Wahrnehmung der eigenen Interessen, wie in der Förderung des Dienstes unterstützen und so auch innerhalb der Behörde das Ventil sein werden, das in einem demokratisch regierten Staate jede Organisation braucht, um Spannungsunterschiede in ihrem Organismus auszugleichen“141. Daß ohne den Willen zur gegenseitigen Unterstützung und Zusammenarbeit die Idee der Gesetze unfruchtbar bleiben müsse, wußte wiederum Klausener in seinem Geleitwort zu betonen: „Formen sind Formen. Erst der Geist, der sie erfüllt, gibt ihnen Leben. Nicht von der Summe der zahlenmäßig aufgeführten Rechte werden die Verhältnisse zwischen Staat, Vorgesetzten und Beamten bestimmt, sondern von dem Geist, in dem die neue Vorschrift gehandhabt wird. Sie ist erlassen in dem Willen, in jedem Beamten einen Mithelfer und Förderer am gemeinsamen Werk zu sehen, mögen sie also von jeder Dienststelle in diesem Geist ausgelegt werden.“142 So gesehen stellte der Erlaß einen Vertrauensvorschuß des preußischen Staates gegenüber einem jeden seiner Polizeibeamten dar. Dafür, daß der Erlaß durch die Dienststellen nicht allzu fern von den Zielen der preußischen Reformer ausgelegt wurde, sollten wiederum unter anderem die Personal-Umbaumaßnahmen sorgen. Aus der Neustrukturierung der Polizeieinheiten ergab sich die Notwendigkeit zur Auseinandersetzung Bähnischs mit einem zweiten Interessengegenstand, dem Polizeilastenausgleich. Wie im Zusammenhang mit Theanolte Bähnischs Arbeit im Polizeipräsidium bereits beschrieben, waren alte Polizei-Einheiten aufgelöst, neue gebildet und dabei die Weisungsbefugnisse verändert worden. Diese Umbaumaßnahmen machten eine Neuregelung der Kostenübernahme zwischen Reich, Staaten und Gemeinden notwendig143, so daß sich Albrecht Bähnisch in puncto Polizeilastenausgleich eher mit den finanziellen Folgen der Reformbemühungen konfrontiert sah, für die eine pragmatische Lösung gefunden werden mußte. Womöglich war er mit dieser Aufgabe betraut worden, weil er bereits im Zuge seiner Examensarbeit seine Fähigkeiten in Bezug auf finanzrechtliche Fragestellungen unter Beweis gestellt hatte.144 3.3.3 „Gelungenste[s] Reformprojekt“145 der preußischen Innenpolitik: Die Neufassung des Polizeiverwaltungsgesetzes Als besonders innovativ und als seine wichtigste Aufgabe im Innenministerium ist Albrecht Bähnischs Mitarbeit an der Polizeiverwaltungsgesetzreform zu bewerten. Diese Reform war wegweisend auch für die Polizei in der zweiten deutschen Demo-
141 Ebd., S. 9/10. 142 Klausener: Geleit. 143 Im Polizeikostengesetz vom 02.08.1929 wurden die Kosten so geregelt, daß der Staat die unmittelbaren, die Gemeinde die mittelbaren Polizeikosten trug. Vgl.: Götz: Polizei, S. 400. 144 Siehe Kapitel 3.2.2.1. 145 Naas: Entstehung, S. 357.
264 | Theanolte Bähnisch
kratie. Im Zuge der breit angelegten Reform, die Stefan Naas als das gelungenste Reformprojekt der Innen- und Rechtspolitik des preußischen Staates zwischen 1924 und 1932 überhaupt beschreibt,146 griffen die federführenden Persönlichkeiten Wilhelm Abegg, Albert Grzesinski, Erich Klausener, Walter Kerstiens und Robert Kempner auf die Vorarbeiten von Bernhard, genannt ‚Bill‘ Drews aus dem Kaiserreich zurück. Drews war 1917 alspreußischer Innenminster berufen worden, um die Verwaltung Preußens auf breiter Basis zu reformieren, wozu es jedoch kriegsbedingt nicht mehr kommen konnte. In der Weimarer Republik zunächst Staatskommissar für die Verwaltungsreform (1919–1921), dann Vorsitzender des Obersten Verwaltungsgerichtes, unterstützte Drews die Bestrebungen der Genannten, eine solche Reform durchzuführen, nach Kräften, indem er ihnen seine Aufzeichnungen zur Verfügung stellte und sich wiederholt zu Beratungsgesprächen bereit hielt. Einige Passagen aus den schriftlichen Vorarbeiten Drews wurden sogar wörtlich in das PVG übernommen. Aus seiner Tätigkeit als oberster Verwaltungsrichter floß schließlich auch einiges Erfahrungswissen in die Polizeigesetzreform mit ein. Doch was sozusagen mit dem Ende des Kaiserreichs begann, sollte schließlich, folgt man Naas‘ Argumentation, auch den Ausklang der demokratischen Weimarer Republik begleiten. „Das PVG steht am Ende der Weimarer Republik. Inmitten der sich verschärfenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krise raffte sich das demokratische Preußen noch einmal zu einem großen Reformgesetz auf“147, so Naas. Er hebt damit auf den Umstand ab, daß es zur Zeit der Verabschiedung des PVG, im Juni 1931, eine Parlamentsmehrheit gegeben hatte, die der Weimarer Koalition ein letztes Mal erlaubt habe, eine liberal-rechtsstaatliche Vorstellung vom Polizeiwesen in Gesetzesform zu bringen. Albert Grzesinski und Carl Severing hatten seit 1924 das Polizeirecht vor dem Hintergrund der neuen, demokratischen Staatsform modernisiert und dazu 1927 das Polizeibeamtengesetz, 1929 das Polizeikostengesetz und das Gesetz über die Aufhebung veralteter Polizei- und Strafgesetze von 1931 verabschiedet. Das PVG sollte die Krone dieser Bestrebungen sein. Doch der Reformerfolg währte nicht lang: Erste Änderungen des 1931 verabschiedeten PVG wurden bereits am 03.09.1932 vorgenommen. Kurios wirkt, daß von den Nationalsozialisten die von Grzesinski und Abegg begonnene Aufhebung von ‚veralteten‘ Polizei- und Strafgesetzen unter eben diesem Namen – zur Wahrung des demokratischen Anscheins, aber zum Zweck der Umgestaltung der Polizei nach nationalsozialistischen Vorstellungen – fortgesetzt wurde. Bestand und Inhalt des PVG blieben zwar am Ende weitgehend erhalten, doch mit der Außerkraftsetzung der Grundrechte in der Weimarer Verfassung im Rahmen der Notstandsverordnung vom 28.02.1933 und dem Ermächtigungsgesetz von 24.03.1933 war das Kernelement der Demokratie ausgemerzt und ihre Ausgestaltung durch das neue Polizeirecht, zu dem das PVG gehörte, wirkungslos geworden. Göring hatte zudem mit einem ‚Durchführungserlaß‘ am 03.03.1933 vor dem Hintergrund der Reichstagsbrandverordnung po-
146 Vgl.: Naas: Entstehung, S. 357. 147 Ebd.
Albrecht Bähnisch | 265
lizeiliche Maßnahmen ‚erlaubt‘, die in inhaltlichem Widerspruch zum PVG standen.148 Zur inhaltlichen Demontage des PVG kam schließlich die Abrechnung mit seinen ‚Erfindern‘: Oberregierungsrat Kempner fiel als Sozialdemokrat jüdischer Abstammung den Umbesetzungen im Innenministerium zum Opfer. Als das Polizeilehrbuch, welches er gemeinsam mit Drews, Klausener, Bähnisch und anderen als ergänzendes Werk zur Gesetzesreform herausgab, 1933 erschien, war er längst aufgrund „politischer Unzuverlässigkeit in Tateinheit mit fortgesetztem Judentum“149 von seiner Funktion als politischer Beamter entbunden. Albrecht Bähnisch ‚wartete‘, als der SPD zugehöriger Landrat ebenfalls bereits außer Dienst gestellt, auf seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand. Die politischen Initiatoren der Reformen, Grzesinski, Severing und Abegg waren bereits im Zuge des Preußenschlags im Juli 1932 von ihren Ämtern vertrieben worden. Oberregierungsrat Klausener war zunächst innerhalb der Verwaltung versetzt, 1934 aber auf Geheiß Görings von SSLeuten in seinem Büro erschossen worden. Bill Drews blieb als einziger der Gruppe im Staatsdienst. Er leitete das Oberverwaltungsgericht bis 1937. Nicht nur mit Drews, sondern auch mit den anderen genannten Personen arbeitete und publizierte Albrecht Bähnisch zusammen zum Thema Polizeiverwaltungsgesetze. Neben den Beamten des Innenministeriums wirkten auch Fachkräfte aus anderen Ministerien und Ausbildungseinrichtungen an der Ausarbeitung und Verbreitung der Gesetze mit, beispielsweise der ‚akademische Vater‘ Bähnischs, Dr. Gerhard Lassar. Die genannten Personen sollen gemeinsam mit weiteren Personen an anderer Stelle in ihrer Relevanz für die Verwaltungsreform und den Weimarer Staat sowie für Albrecht und Theanolte Bähnisch vorgestellt werden. Zunächst jedoch zum Inhalt des Reformgesetzes: Weite Teile des Polizeiverwaltungsgesetzes waren darauf ausgerichtet, materielles Polizeirecht zu kodifizieren, also zu sammeln, zu ordnen und schriftlich zu fixieren, um die Verfügbarkeit und Verständlichkeit der seit dem ‚Kreuzberg-Urteil‘150
148 Kern der Reichstagsbrandverordnung, die sich auf den § 48 in der Weimarer Reichsverfassung berief, war die Erklärung eines permanenten zivilen Ausnahmezustandes, mit dem begründet wurde, daß zur ‚Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung‘ Grundrechte außer Kraft gesetzt und Polizeigewalt in einer Form ausgeübt werden konnte, wie sie die Verfassung und das PVG nicht erlaubten. 149 Vgl.: Pressemeldung der Uni Osnabrück: Ausstellung: „Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit“ – Universitätsbibliothek Osnabrück zeigt Dokumente zu Leben und Werk von Robert Kempner, Nr. 1/1998, 26.06.1998, auf: http://www.uni-osnabrueck.de/en/ study_programs/presseportal/pressemeldung/artikel/kempner-ausstellung-ewige-wach samkeit-ist-der-preis-der-freiheit-universitaetsbibliothek-osnabr.html, am 14.10.2013. 150 Mit dem Kreuzberg-Urteil vom 14.06.1882, auch ‚Kreuzbergbekenntnis‘ genannt, schränkte das Preußische OVG die polizeiliche Gewalt ein, um die Gewaltenteilung zu gewährleisten und die Entpolizeilichung der öffentlichen Verwaltung einzuleiten. Das Urteil hob eine Verordnung des Berliner Polizeipräsidiums auf, mit deren Hilfe Berliner Bürgern verwehrt worden war, Gebäude zu errichten, die den Ausblick auf das Kreuz-
266 | Theanolte Bähnisch
entwickelten Normen zu gewährleisten. Dazu kamen diverse Neuerungen im formellen Polizeirecht, deren wichtigste wohl die Neuordnung der Rechtsmittel war: Ein Kernelement des neuen Gesetzes stellte die Ersetzung der strafrechtlichen Übertretungsstrafe durch ein Zwangsgeld dar. Damit wurde Widerstand gegen Polizeiverordnungen nicht mehr länger als ein krimineller Akt, sondern aufgrund des ‚geringeren Unrechtsgehaltes‘ als dem Verwaltungsrecht zugeordnete ‚Übertretung‘ verfolgt. Die bereits erwähnte Goldschmidt’sche Lehre vom ‚Verwaltungsunrecht‘151, also Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften, auf die als Rechtsfolge keine Strafe (Freiheitsstrafe oder Geldstrafe), sondern nur eine Geldbuße folgen sollte, fand hiermit ihre erste gesetzliche Anerkennung.152 Daß Beklagte im Fall von Zwangsgeldverfügungen einen Rechtsschutz durch das Verwaltungsgericht in Anspruch nehmen konnten, wurde in das Gesetz aufgenommen. Als eine weitere Neuheit im Rechtsmittel-Bereich wurde Ortspolizeibehörden in Orten mit weniger als 5000 Einwohnern das Recht, Verordnungen zu erlassen, entzogen, stattdessen wurde den Ministerien das Verordnungsrecht zugesprochen. In dieser Neuerung deutet sich bereits an, daß ein weiterer, zentraler Punkt des neuen Polizeirechts in der Sicherung des staatlichen Polizeimonopols gegen Kommunalisierungsbestrebungen bestand. Die entsprechenden Artikel des PVG läuteten damit das Ende der regionalen Vielfalt in der Ausgestaltung polizeilicher Zuständigkeiten ein. Den preußischen Reformern hatte dieser Teil der Gesetze nicht zuletzt deshalb am Herzen gelegen, weil die innere Sicherheit nach der Auflösung des Militärs allein auf den Schultern der zunächst noch als ‚Sicherheits-Polizei‘153, später als ‚Schutzpolizei‘ firmierenden Polizeieinheiten ruhte. Die Regierung befürchtete nämlich, daß von Seiten einer nicht von Staatshand durchstrukturierten Polizei erhöhte Gefahr bestand, daß sich die Einheiten im Zweifel gegen die Interessen des Staates hätte stellen können. „Dezentralisierungsbestrebungen“, so Stefan Naas „mußten in den Augen der Regierung dazu führen, die Macht und Funktion des Staates zu zersplittern und an die Stelle einer einheitlichen Verwaltung eine unübersehbare Anzahl von getrennten Körperschaften treten zu lassen“154. Daneben erschien es der preußischen Regierung wichtig, im Fall von Unruhen Einheiten schnell verstärken, beziehungsweise von einem Ort an einen anderen abziehen und dort konzentrieren zu können.
151 152
153 154
bergdenkmal versperrten. Das OVG stellte klar, daß lediglich Gefahrenabwehr, nicht aber die Wahrung ästhetischer Interessen in die Zuständigkeit der Baupolizei fiel. Vgl.: Goldschmidt, James: Das Verwaltungsstrafrecht, Berlin 1902, Neudruck Aalen 1962. Vgl.: Naas: Entstehung, S. 356. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Übertretungen – heute Ordnungswidrigkeiten – neben den ‚Vergehen‘ und den ‚Verbrechen‘ dem Reichsstrafgesetzbuch zugeordnet. Die DNVP versuchte die gesetzliche Festschreibung des neuen Verfahrens zu verhindern, doch die Klage vor dem Staatsgerichtshof gegen das Zwangsgeld verlief erfolglos. Vgl.: ebd., S. 335–344. Zur Sicherheitspolizei siehe Kapitel 2.3.1.1. Naas: Entstehung, S. 81.
Albrecht Bähnisch | 267
Eine entsprechende Erwartung wird auch in einem Text Bähnischs über den Polizeilastenausgleich deutlich, wenn er schreibt, daß in industriellen Ballungszentren, gerade in Zeiten von „Arbeitsmangel“ und „Konjunkturrückgang“ und der daraus folgenden „Entlassung so erheblicher Arbeitermengen […] der polizeiliche Einsatz zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung sofort stark vermehrt werden muß“155. Hieran wird nicht nur sichtbar, wie eng die von Bähnisch bearbeiteten Themenkomplexe zusammenhingen, sondern auch, daß der Jurist annahm, die Arbeiterschaft könne eine Bedrohung der ‚öffentlichen Sicherheit‘ in der Republik darstellen. Hierin besteht aller Wahrscheinlichkeit nach ein Grund für sein noch zu thematisierendes Engagement in der SAG Berlin-Ost, die sich unter anderem zum Ziel gesetzt hatte, in der Arbeiterschaft Verständnis für das Handeln von Arbeitgebern zu erreichen. Daß die preußische Regierung auch eine Kommunalisierung der Verwaltungspolizei156 ablehnte, war dem zeitgenössischen Experten Kautsch zufolge ein Ausdruck der Furcht vor einer „in der Nachkriegszeit fast zur Regel gewordene[n] kommunalpolitische[n] Einmischung, etwa gar mit politischem Beigeschmack“157. Die Verregelung von Grundsätzen praktischer Rechtsprechung aus dem Tagesgeschäft des Oberverwaltungsgerichts im PVG ging, wie erwähnt, vor allem auf den OVG-Präsidenten Bill Drews zurück. Paragraphen zum ‚Entschliessungsermessen‘ sollten eine größtmögliche Effektivität der polizeilichen Maßnahmen sicherstellen. Diese Paragraphen legten, meist in ‚Soll‘-Formulierungen, der Behörde ein bestimmtes Vorgehen in Reaktion auf einen Sachverhalt nah, verordneten dieses aber nicht, sondern gewährleisteten einen größeren Ermessensspielraum. Die Festschreibung des Erforderlichkeits-Grundsatzes sollte dafür sorgen, daß jeweils das mildeste Mittel zum Einsatz kam.158 Schließlich setzte die Normierung ‚polizeipflichtiger Personen‘, also eine Beschreibung des Verhaltens, welches nach dem Gesetz die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährde, polizeilicher Willkür und dem Vorgehen gegen ‚Nichtstörer‘ (deren Entschädigungsanspruch im Fall des Fehlverhaltens der Polizei auf Betreiben von Drews gesondert aufgenommen wurde) – engere Grenzen.159 Dieser Passus (§ 18 ff) korrespondierte mit der Neufassung der polizeilichen Generalklausel (§ 14), nach der die Polizei nun nicht mehr länger für „Erhaltung der öffent-
155 Bähnisch: Polizeilastenausgleich, S. 81. 156 „Unter der Verwaltungspolizei wurden in der preußischen Polizeiorganisation nach dem Neuaufbau der Polizei die nichtuniformierten Angehörigen der Polizeidienststellen verstanden, welchen das Meldewesen und die Aufgaben des Verwaltungsvollzugsdienstes (Verwaltungsaußendienstes) übertragen waren, soweit letztere nicht der Kriminalpolizei oder der Schutzpolizei oblagen, im übrigen allgemein der Verwaltungsdienst der Polizei.“ Götz: Polizei, S. 400. 157 Kautsch: Gegenwartsfragen der kommunalen Polizei, in: Die Polizei 1926 (1929), S. 25, zitiert nach Naas: Entstehung, S. 81. 158 Der Grund dafür, die Polizei nicht auf das mildeste Mittel festzulegen, war Volkmar Götz zufolge die Befürchtung, die Gefahrenbeseitigung könne leiden, wenn die Polizei vor ihrem Einsatz durch Abwägungen und Ermittlungen zunächst das mildeste Mittel zu definieren gezwungen sei. Vgl.: Götz: Polizei, S. 420. 159 Ebd., S. 356/357.
268 | Theanolte Bähnisch
lichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung“ und „Abwendung der dem Publiko, oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahr“160 zuständig war, sondern nur noch für die Gefahrenabwehr. All diese Änderungen und Neuregelungen sind als Ausdruck des Versuchs zu lesen, die demokratische Grundordnung mit Hilfe der Polizeiverwaltung auf einen sichereren Boden zu stellen und die Prinzipien auch für die Exekutive festzuschreiben. Im Zuge der Gesetzreform erschienen neben den reinen Gesetzestexten dementsprechend Durchführungsbestimmungen, Kommentare und Lehrbücher für den Dienstgebrauch der Polizisten, die sicherstellen sollten, daß sich die amtierenden und angehenden Beamten mit den neuen Regeln auseinandersetzten und sie zur Grundlage ihres dienstlichen Handelns machten. Robert Kempner beschreibt die Neufassung des Polizeigesetzes in seinen Erinnerungen als eine Folgereaktion Grzesinskis und anderer Politiker auf die Demonstrationen politischer Gegner und die in diesem Kontext umstrittenen Polizeiaktionen. Ob die Verwaltungsreform vor diesem Hintergrund am Ende als ‚geglückt‘ bezeichnet werden kann, läßt sich nicht eindeutig beantworten. 1931, als das Gesetz verabschiedet und verbreitet wurde, war die Republik bereits Opfer einer Zersetzung ‚von innen‘ geworden. Weder rechte noch linke Regimegegner hatten der Republik ihre von der jeweiligen Seite gefühlte Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Gegenlager verziehen. Enttäuschte Hoffnungen des linken wie des rechten Lagers, mangelnde Bindung der Bürger an demokratische Werte und eine fragwürdige Gewichtung in der Interessenpolitik von Seiten der Regierung waren mit verantwortlich für den Niedergang der Republik. Eine zügiger durchgeführte Polizeiverwaltungsreform hätte wohl nur bedingt Abhilfe schaffen können. Am Ende blieb die Weimarer Republik doch, was sie nach der Idee der Polizei(verwaltungs-)reform gerade nicht sein wollte: Ein Staat, der sich gezwungen sah, sich vor seinen Bürgern mit Waffengewalt zu schützen. Doch ist die Niederlage der Reformpolitik kein Beweis für ihre Unrichtigkeit. Als Instrument und Ausdruck einer modernisierten Verwaltung in einem demokratisierten Staat müssen sowohl die Arbeit an der Polizeiverwaltungsreform als auch die weitgehende Bereitschaft nachgeordneter Behörden, diese Reform umzusetzen, gewürdigt werden. Die Reform stellte einen Beitrag zu einer bürgernäheren, demokratischeren Verwaltung und damit zur Demokratisierung des Alltags dar. Sie unterstrich – vor allem vor dem Hintergrund der Reformmüdigkeit der Reichsbehörden – den Willen preußischer Politiker, liberale und soziale Inhalte der Weimarer Reichsverfassung in Gesetzen zu verankern und damit in den Dienstalltag von Polizisten und den Alltag der Bevölkerung zu befördern. Der Prüfung nach heutigen Maßstäben hält die Reform zumindest insofern stand, als daß sie wesentliche Impulse für aktuell gültige, als demokratisch notwendig angesehene, allgemein anerkannte Gesetze lieferte. Ihrem Inhalt nach hätte die Preußische Verwaltungsreform durchaus zu einem Instrument lebendiger Demokratie werden können. Doch in ihrer Gestalt, die sie erst durch die einzelnen Träger der Polizeige-
160 Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten (ALR), § II 17, zitiert nach Götz: Polizei, S. 419.
Albrecht Bähnisch | 269
walt im Staat Preußen erhielt, erinnerte sie noch zu sehr an die konservativobrigkeitsstaatliche Polizei des Bundesstaats Preußen während des Kaiserreichs, als daß ihre Deeskalationsanstrengungen tatsächlich überzeugend sein konnten. 3.3.4 Albrecht Bähnischs schriftliche Beiträge zur Polizeiverwaltungsreform: Gesundheit und Sittlichkeit im Fokus Die Brücke zwischen dem Gesetzestext und dem Dienstalltag der Polizisten zu schlagen und damit einen Beitrag dazu zu leisten, daß die Gesetzesreform tatsächlich umgesetzt wurde, bemühte sich auch Albrecht Bähnisch. Mit seinen Texten über die Gesundheitspolizei, die im Zuge der PVG-Reform neu etabliert worden war, versuchte er jedoch nicht nur Polizisten, sondern auch andere Mitarbeiter der Verwaltung zu erreichen. Die Gesundheitsverwaltung, ein Thema, in das Albrecht sich im Innenministerium einarbeitete, war schließlich kein rein polizeiliches Thema, sondern an einer Schnittstelle zwischen verschiedenen Institutionen lokalisiert und nahm auch private Träger mit in die Verantwortung. So dürften Polizisten, Verwaltungsfachleute, Auszubildende im gehobenen Verwaltungsdienst, Mitarbeiter privater Wohlfahrtsorganisationen im weitesten Sinne, Ärztinnen und Ärzte, und zu guter Letzt interessierte, politisch motivierte Bürger, zum Leserkreis seiner Texte gehört haben, die im Rahmen umfassenderer verwaltungsrechtlicher Abhandlungen und Nachschlagewerke erschienen waren. Bezüge zur wissenschaftlichen Arbeit Dorothea Noltes bestanden insofern, als daß sich Albrecht in seinen wissenschaftlichen Werken unter der Überschrift ‚Gesundheitspolizei‘ auch mit der Prostitution, der Rolle der Fürsorge, der Polizei und den neu eingerichteten Gesundheitsämtern bei der Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten sowie der Prävention solcher Krankheiten und der ‚sittlichen Erziehung‘ auseinandersetzte. Er widmete sich damit demselben – wenn nicht völlig tabuisierten, dann gleich besonders kontrovers diskutierten – Gegenstand, mit dem sich seine Frau auseinandergesetzt hatte und das, wie in Dorothea Bähnischs Staatsexamensarbeit deutlich wird, für die Frauenbewegung ein wichtiges Thema war. Der längste, 181 Seiten umfassende Text Albrecht Bähnischs zum Thema ‚Gesundheitspolizei‘ erschien im ‚Besonderen Teil‘ der immer wieder neu aufgelegten bekannten ‚Verwaltungsgesetze für Preußen‘ von M. von Brauchitsch,161 das in der 22. Auflage von Bill Drews und Gerhard Lassar herausgegeben wurde. Bähnischs Kapitel zum ‚Medizinalpolizeirecht‘ ist in verschiedene Unterkapitel gegliedert: Das ‚Gesetz über gemeingefährliche Krankheiten‘, das ‚Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten nebst Ausführungsverordnung‘, das ‚Impfgesetz‘, das ‚Gesetz über das Hebammen-Wesen‘ sowie das ‚Lebensmittelgesetz‘ und das ‚Feuerbestattungsgesetz‘.162
161 Drews, Bill/Lassar, Gerhard (Hrsg.): W. von Brauchitsch. Verwaltungsgesetze für Preußen, Zweiter Band, Zweiter Halbband, 22., vollständig neubearbeitete Auflage, elfte Bearbeitung, Berlin 1932. 162 Bähnisch, Albrecht: Medizinalpolizeirecht, in: ebd., S. 1–183, hier S. 70/71.
270 | Theanolte Bähnisch
Im Unterkapitel zum Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten kam Bähnisch den „aus Benutzerkreisen geäußerten Wünschen“163 entgegen, dieses Gesetz in erweitertem Umfang zu erläutern. Bemerkenswert ist, daß in der kurzen Zeit zwischen Theanoltes Examen und Albrechts schriftlichen Beiträgen zum Medizinalpolizeirecht die verwaltungsrechtlichen Voraussetzungen zum Umgang mit der Interdependenz von Geschlechtskrankheiten und Prostitution weitgehend verändert worden waren. Anstelle der von der Frauenbewegung heftig kritisierten Kasernierung und Überwachung von Prostituierten durch die 1927 abgeschaffte Sittenpolizei, war eine stärkere Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Fürsorgeeinrichtungen mit den Gesundheitsämtern und der neu eingerichteten Medizinalpolizei zur Bekämpfung von „Tripper, Schanker und Syphilis“ getreten. Nach wie vor standen zwar weibliche Prostituierte im Fokus der Aufmerksamkeit, wenn es um die Bekämpfung der „Volksseuche[…] der Gegenwart“164 ging, doch rückten mit den neuen Gesetzen auch Freier, männliche Prostituierte und andere Personen als mögliche Träger entsprechender Krankheiten stärker in den Blick. Anstelle des Gebots von Verfolgung und Bestrafung von Prostituierten galten im 1927 verabschiedeten Gesetz stärker Prävention, Aufklärung und Fürsorge als Mittel der Wahl. Daß aus verschiedene Kreisen der Wunsch nach einem Kommentar zum Gesetz laut geworden war, deutet daraufhin, daß es Unklarheiten über Zuständigkeiten, Pflichten und Grenzen der Einflußnahme verschiedener Stellen und Personen, die mit der Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten beschäftigt waren, gegeben haben muß. Albrecht Bähnischs Kommentare in den ‚Verwaltungsgesetzen für Preußen‘ waren ‚Durchführungsanweisungen‘, also nicht reine Interpretationen der Gesetze, sondern rechtlich bindende Leitlinien zur Umsetzung durch die verschiedenen Beteiligten. Eine weite Verbreitung seiner Ausführungen war dem Autor damit sichergestellt. Tatsächlich gibt Bähnisch in seinem Text der Klärung der Zuständigkeiten und den Regeln, nach denen die Gesundheitsbehörde, die Polizei und die Fürsorgestellen zusammenarbeiten sollten, viel Raum. Ganz im Sinn der neuen Gesetzesgrundlage und neuer Entwicklungen im Wohlfahrtswesen schildert er in seinem Kommentar eindringlich die Notwendigkeit und den Nutzen kostenfreier Untersuchungen für mittellose Bürger165. Daneben geht er auf die moralische Komponente des Gesetzes näher ein. Den Sinn im vom Gesetzgeber durch § 3 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten angestrebten Zusammenwirken von gesundheitlichen Maßnahmen mit solchen sozialfürsorgerischer Natur sieht er nicht zuletzt in der Prävention weiterer Fälle, die aufgrund „sittlicher[r] Gefährdung“ oder „Verwahrlosung“166 eintreten könnten. Verbote von Handlungen, die zur Verbreitung von Geschlechts-
163 Vorwort in: Drews/Lessar: Brauchitsch, S. V. 164 Albrecht Bähnisch bezeichnet in seinem Kommentar zum Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten die Tuberkulose und die Geschlechtskrankheiten – in § 1 des Gesetzes näher als „Syphilis, Tripper und Schanker“ bezeichnet – als „Volksseuchen der Gegenwart“. Bähnisch: Medizinalpolizeirecht, S. 70/71. 165 Ebd., S. 71, § 2. 166 Ebd., S. 75.
Albrecht Bähnisch | 271
krankheiten führen, werden im Kapitel ausdifferenziert und der erwünschte Umgang der verschiedenen beteiligten Stellen mit den definierten Risikogruppen erklärt. In Konsequenz zu den geschilderten, allgemeinen Leitlinien des neuen PVG wird im Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und im Kommentar auch die Willkürbegrenzung polizeilicher Handlungen sichtbar. Dies geschieht anhand der Bemerkung, daß sich zwar strafbar macht, „wer öffentlich in einer Sitte oder Anstand verletzenden oder andere belästigende Weise zur Unzucht auffordert“167, aber daß „nicht jede Aufforderung zur Unzucht […] Sitte und Anstand“ verletzt. So sei „in dem bloßen Auf- und Abgehen [von Prostituierten auf einer Straße] usw. lediglich ein strafloses ‚Sicherbieten‘ zu erblicken“168. Der größte inhaltliche Unterschied von Albrecht Bähnischs zu Dorothea Noltes Text über den Zusammenhang von Prostitution und Geschlechtskrankheiten, der einer völlig anderen Textgattung zuzuorden ist und durch den nicht, wie bei Bähnischs Text, der Gesetzgeber spricht, besteht darin, daß Albrecht Bähnisch schreibt, „alle zwangsweisen Kasernierungen“ von Prostituierten seien künftig „zu vermeiden“169. Albrecht Bähnisch erläutert die zu jener Zeit gültige Rechtslage, was heißt, daß sich die von Dorothea Nolte vertretene Position, man möge an der Kasernierung der Prostituierten festhalten, nicht durchgesetzt hatte. Vielmehr regten das neue Gesetz und sein Kommentar dazu an „schon jetzt Straßen, Häuserblocks, und Häusern (Bordelle), die besonders für Zwecke der Gewerbsunzucht eingerichtet sind, diese Eigenschaft allmählich durch wohnungswirtschaftliche und bauliche Maßnahmen zu nehmen“170. Die preußischen Reformer trachteten also nach einer Entgrenzung paralleler Lebenswelten im Staate Weimar, nicht zuletzt über die Neuregelung des Umganges mit der Prostitution und ihren vielbeschworenen ‚Nebeneffekten‘. Mit Theanoltes Bedürfnis, die Welt des Lasters fern von der bürgerlichen Lebenswelt „in seiner reinsten Form“171 zu halten, deckten sich die Bestrebungen der preußischen Verwaltungsreformer also nicht. Wie sehr Albrecht Bähnisch hinter diesen neuen Leitideen stand, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Nicht unwahrscheinlich ist, daß die Beiden tatsächlich aufgrund verschiedener Prägungen in ihren jeweiligen Funktionen unterschiedlicher Meinung über das Thema waren und vielleicht auch die eine oder andere Diskussion darüber führten. Im Kapitel-Vorwort präsentiert sich Albrecht Bähnisch allerdings nicht per se als Gegner des Interventions-Staates. Die „wesentliche Voraussetzung für den Kampf gegen die übertragbaren Krankheiten“ sei gewesen, so Bähnisch, „daß der Staat bereit und willens war, durch Eingriffe in die Handlungs- und Aufenthaltsfreiheit des Erkrankten die Ansteckung weiterer Personen zu verhindern“172. Denn nicht nur das Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten, sondern unter anderem auch
167 168 169 170 171
Ebd., S. 93. Ebd. Ebd., S. 94. Ebd. BArch R 115, Nr. 519, Sittenpolizei und Prostitution. Prüfungsarbeit vorgelegt von Dorothea Nolte, Regierungsreferendar, S. 114. 172 Bähnisch: Medizinalpolizeirecht, S. 1
272 | Theanolte Bähnisch
das – ebenfalls von Bähnisch abgehandelte – Impfgesetz umfaßte für die Bürger den Zwang, sich den vom Staat als notwendig definierten Behandlungen auszusetzen. Obwohl mit der Verabschiedung des Gesetzes über Geschlechtskrankheiten die Abschaffung der Sittenpolizei und die Übertragung entsprechender Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich der Gesundheitspolizei einhergingen, beschränkte es sich nicht auf die Bekämpfung von Krankheiten. Es verfolgte, allerdings in geringerem Maß als die älteren Gesetze, auch moralische Ziele. Dies ist vor allem an den zitierten Artikeln, welche sich nicht explizit mit Krankheiten, sondern mit der Frage, welches Verhalten von Prostituierten und anderen Personen gegen ‚Sitte und Anstand‘ verstößt, abzulesen. Die Begriffe ‚Geschlechtskrankheiten‘, ‚Prostitution‘ und ‚Moral‘ wurden also auch nach der Reform in der preußischen Verwaltung in einem Atemzuge genannt und und entsprechend diskutiert. Ein weiterer Text von Albrecht zum Thema findet sich im Lehrbuch ‚Preußisches Polizeirecht‘ von 1933173, das Bähnisch zusammen mit Bill Drews, dem Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Froehlich, den leitenden Mitarbeitern des Preußischen Innenministeriums, Oberregierungsrat Kempner und Oberregierungsrat Dr. Kerstiens sowie dem Ministerialrat Dr. Vollbach aus dem Landwirtschaftsministerium herausgegeben hatte. Der praxisorientierte Leitfaden für Polizeibeamte, der wohl vor allem angehende Polizisten ansprechen sollte, enthält, anders als das ‚Preußische Verwaltungsrecht‘, das auf einen breiteren Leserkreis zugeschnitten war, keine Gesetzestexte, sondern – davon ausgehend, daß der Zielgruppe diese vorlagen – lediglich Verweise darauf. Insgesamt nimmt die Klärung von Zuständigkeiten weniger Raum ein als im ‚Preußischen Verwaltungsrecht‘. Der schriftstellerische Gestaltungsspielraum dürfte bei der Mitarbeit am Lehrbuch ‚Preußisches Polizeirecht‘ deutlich größer gewesen sein als bei dem Kapitel, das Bähnisch zu den ‚Preußischen Verwaltungsgesetzen‘ beitrug. Im Rahmen seiner Arbeit am Lehrbuch hatte er die Möglichkeit, seine didaktischen Kompetenzen unter Beweis zu stellen, indem er Polizeischülern – um beim gewählten Beispiel zu bleiben – im Abschnitt über die Geschlechtskrankheiten erklärte, daß diese nach neuer Gesetzeslage nicht mehr durch polizeiliche Maßnahmen, sondern durch die Gesundheitsfürsorge bekämpft werden sollen. „Die Ziele des Gesetzes sollen in erster Linie durch Rat und Belehrung, insbesondere durch Mitwirkung der Ärzte erreicht werden. Der polizeiliche Zwang soll die Ausnahme bilden“174, schreibt er. Weil dieses Vorgehen stark von der bisherigen Regelung abwich
173 Drews, Wilhelm Arnold u. a. (Hrsg.): Preußisches Polizeirecht. Zweiter Band. Besonderer Teil. Ein Leitfaden für Verwaltungsbeamte, Berlin 1933. Wilhelm Arnold, genannt ‚Bill‘ Drews, blieb trotz seiner liberalen Haltung und seiner Mitarbeit an der Verwaltungsreform auch während der NS-Diktatur Präsident des preußischen Oberverwaltungsgerichts. Dies dürfte die Erklärung dafür sein, warum Theanolte und Albrecht Bähnisch ihre Zulassungen als Verwaltungsgerichtsräte, die beim OVG beantragt werden mußte, problemlos erhielten, obwohl insbesondere Albrecht Bähnisch als politisch mißliebig galt. Zur Zeit der Herausgabe des Werks 1933 wurde Bähnisch noch als „Landrat von Merseburg“ im Inhaltsverzeichnis geführt, er war jedoch zu diesem Zeitpunkt schon seines Amtes enthoben worden. 174 Bähnisch, Albrecht: Gesundheitspolizei, in: Drews: Polizeirecht, S. 199–234, hier S. 217.
Albrecht Bähnisch | 273
– was bei bereits amtierenden Polizisten oder schon vorgebildeten Polizeischülern Irritation ausgelöst haben dürfte – führte er die Aufgaben oder vielmehr NichtAufgaben der angehenden Polizisten noch genauer aus: „Die Polizei ist also […] Hilfsorgan; sie kann auf diesem Gebiet keine selbständigen Anordnungen treffen, sondern lediglich als ersuchte Behörde bei der Ausführung der von der allein zuständigen kommunalen Gesundheitsbehörde getroffenen Anordnungen mitwirken.“175 Die Sittenpolizei sei abgeschafft und das neue Gesetz verfolge „einen ganz anderen Zweck“176, macht Bähnisch deutlich. Statt Verfolgung und Bestrafung stünden nun Aufklärung, Prävention und Heilung im Vordergrund. Polizeilich eingegriffen werden solle nur, wenn sich nachweislich erkrankte Personen der vorgeschriebenen Behandlung entzögen. Doch auch in diesem Punkt will Bähnisch die Neuerungen, die das als ‚GeschlKrG‘ abgekürzte Gesetz brachte, gut verstanden wissen: Der Behandlungszwang wird besonders häufig gegenüber gewerbsmäßiger Prostitution angewandt werden. Jedoch beschränkt sich das Gesetz keineswegs […] auf diese Maßnahme. Sie ist vielmehr z. B. ebenso bei Männern zulässig, die, obgleich geschlechtskrank, ständig wechselnden Geschlechtsverkehr ausüben.“177 Obwohl er Kommentare zu den Bestimmungen insgesamt vermeidet, scheint es, als sehe Albrecht die Neuerungen, welche auch Lockerungen in sittlicher Hinsicht darstellten, grundsätzlich positiv. Dies läßt sich nicht zuletzt daran erkennen, wie er die Gesetzlage zur Werbung für Mittel zur Ansteckungsvermeidung, welche gleichermaßen auch der Verhütung von Schwangerschaften dienen können, unterstreicht. „Durch eine Reichsgerichtsentscheidung ist dies [die Aufklärung über geeignete Mittel] als Sinn der neuen Bestimmung zweifelsfrei festgestellt.“178 Schließlich unterstreicht er in seinem Beitrag, auch die mit dem PVG von 1931 allgemein angestrebte größere ‚Freiheit der Person‘: „Bestraft wird die Ausübung der gewerblichen Unzucht nur dann, wenn sie in einer Sitte oder Anstand verletzenden oder andere belästigenden Weise erfolgt. Was darunter zu verstehen ist, wird ohne übertriebene Empfindlichkeit nach dem Urteil der Allgemeinheit zu entscheiden sein, wobei der Ort der Handlung eine erhebliche Rolle spielt. Wer eine Straße aufsucht, in der Prostituierte herumzustehen pflegen, wird sich nicht belästigt fühlen dürfen, wenn er angesprochen wird […]“179. Mit seinem Lehrbuch-Beitrag klopfte Albrecht also wichtige Verhaltensregeln fest, die sicherstellen sollten, daß die angehenden Polizisten sich in ihrem Dienstalltag im Sinn des neuen PVG, welches unter Bezugnahme auf die demokratischen Grundrechte in der Weimarer Verfassung entstanden war, verhielten. Im Rahmen eines einfachen Lehrbuchs, das weite Verbreitung erfuhr, leistete er damit einen wichtigen Beitrag zur Beschränkung polizeilicher Willkür und zu einer Annäherung von Polizei und Bevölkerung auf der Grundlage der ‚Freund und Helfer-Strategie‘ der preußischen Reformer auf der einen sowie zur individuellen (Charakter-)Bildung der Polizeischüler auf der anderen Seite.
175 176 177 178 179
Ebd., S. 218. Ebd. Ebd., S. 220. Ebd., S. 222/223. Ebd., S. 222.
274 | Theanolte Bähnisch
Daß er allgemein Verschwiegenheit im Umgang mit dem brisanten Thema Geschlechtskrankheiten hochhielt und ihn dieses Thema mehr als andere beschäftigte, läßt sich insbesondere an einem 1929 in der Zeitschrift ‚Die Polizei‘180 erschienenen Artikel feststellen. Er widmete sich darin dem Thema ‚Konsequenz der Schweigepflicht im Geschlechtskrankheiten-Gesetz‘181 und bewertete die kompromittierende Auskunft einer Dienststelle über eine entsprechende Erkrankung eines Staatsbediensteten an eine andere Dienststelle als rechtswidrig. Vor dem Hintergrund von Albrechts Interesse am Thema Prostitution und Geschlechtskrankheiten, welches wiederum an die Vorarbeiten Theanoltes angeknüpft haben mag, überrascht ein besonderes Interesse der Regierungspräsidentin Bähnisch auch nach 1945 an diesen Themen kaum mehr. Es ist stark anzunehmen, daß sie sich, als sie damit betraut wurde, die Bezirkspolizei zu leiten, nicht nur an ihre eigenen Forschungen zum Thema, sondern auch an die ihres Mannes erinnerte.182 Eine besondere Kompetenz Albrecht Bähnischs im Bereich Gesundheitswesen und -polizei läßt sich zuguterletzt auch in einem Standardwerk nachvollziehen, das der bereits mehrfach erwähnte Bill Drews gemeinsam mit dem Oberregierungsrat Franz Hoffmann herausgegeben hatte, nämlich die dritte – im Zuge der verwaltungsrechtlichen Änderungen notwendig gewordene – Auflage von Rudolf von Bitters Handwörterbuch der Preußischen Verwaltung.183 Das Werk sollte ein „Führer für die Praxis und nicht allein ein wissenschaftliches Nachschlagewerk“184 sein. Albrecht Bähnisch war einer jener „zahlreiche[n][…] hohe[n][…] Reichs- und Preußischen Staatsbeamten“185, die am Lexikon maßgeblich mitgewirkt hatten. Im Verzeichnis der 78 Mitarbeiter fällt auf, daß Albrecht Bähnisch neben seinem Kollegen Dr. Borchardt unter all den Ministerialdirigenten, -räten und -direktoren sowie anderen
180 Seit 1904 bis heute wird diese sehr verbreitete Zeitschrift von leitenden Polizei- und Ministerialbeamten herausgegeben. 181 Bähnisch, Albrecht: Konsequenz der Schweigepflicht im Geschlechtskrankheiten-Gesetz, in: Die Polizei, 26. Jg. (1929), S. 380–381. 182 Ähnliches ist von den Artikeln, die Albrecht Bähnisch zu Bill Drews ‚Preußischem Polizeirecht‘ 1933 sowie zum ‚Handwörterbuch der Preußischen Verwaltung‘ beitrug, anzunehmen. 183 Drews, Bill/Hoffmann, Franz (Hrsg.): Von Bitter. Handwörterbuch der preußischen Verwaltung, dritte, vollständig umgearbeitete Auflage, 2 Bd., Berlin/Leipzig 1928. Die erste, von Rudolf von Bitter selbst herausgegebene Auflage des Werks erschien 1906, kurz bevor von Bitter Präsident des Oberverwaltungsgerichts wurde und damit die Position einnahm, die der Herausgeber der dritten Auflage, Bill Drews, später innehatte. Die zweite Auflage erschien 1911, die dritte hätte schon 1914 in Angriff genommen werden sollen, dieser Plan scheiterte aber am Zweiten Weltkrieg, der – so die Herausgeber der dritten Auflage – „durchgreifende Umwälzungen in der Verwaltung und Verfassung des Reichs und Preußens zur Folge hatte, deren Abschluß naturgemäß erst abgewartet werden mußte“. Auch die Inflation schien die Neuherausgabe des Werks verzögert zu haben. Vgl.: ebd., Vorwort, o. S. 184 Ebd. Vorwort, o. S. 185 Ebd., S. 1.
Albrecht Bähnisch | 275
hochgestellten Beamten der preußischen Verwaltung der einzige Regierungsassessor war, der an dem Lexikon mitgewirkt hatte. Das kann als großer Vertrauensbeweis gegenüber dem jungen Mitarbeiter gewertet werden. Bähnisch lieferte über 70 Artikel für das Lexikon, von ‚A‘ wie ‚Akademie, medizinische, in Düsseldorf‘ bis ‚Z‘ wie ‚Zahnheilkunde‘. Neue und überholte Verfahren medizinischer Untersuchungen nahm er dabei ebenso in den Blick, wie übertragbare Krankheiten, die Verwendung gesundheitsgefährdender Stoffe, den Aufbau medizinischer (Ausbildungs-)Einrichtungen, Heilberufe, Kurpfuscher und Scharlatane sowie Institutionen und Organe des preußischen Gesundheitswesens. Die Lexikonartikel korrespondieren nahezu alle mit den Inhalten von Albrecht Bähnischs sonstigen Ausführungen zu medizinalpolizeilichen Gesetzen. Auch wenn im Lauf der Tätigkeit Bähnischs im Verwaltungsdienst neue Themen hinzukamen, so ist doch insgesamt eine starke Kontinuität seiner Interessen sichtbar. So setzte er sich auch während seiner späteren Tätigkeit als Landrat weiterhin mit dem Thema Gesundheitspolizei auseinander. Entsprechend seiner neuen Funktion wurden dabei zusätzlich verwaltungsrechtliche Aspekte, welche die Zuständigkeit des Landrates betrafen, relevant, beispielsweise seine Zusammenarbeit mit dem Kreisarzt oder die Funktion des Landrats als Leiter der Kreispolizeibehörde. 1930 publizierte Bähnisch in einer neuen Reihe, den ‚Polizeiverordnungen Preußens in Taschenausgaben‘ der Weidmann‘schen Buchhandlung. Diese hatte sich zum Ziel gesetzt, für den preußischen Unterrichtsgebrauch ‚Rohmaterialien‘, also Gesetze und Bestimmungen im vollen Wortlaut zur Verfügung zu stellen. Bähnisch gab in der Reihe die Gesetzestexte zum Impfwesen, ergänzt um Statistiken, Literatur und einigen Erläuterungen heraus.186 Neben seiner Berufsarbeit hatte sich Bähnisch, dem ‚Volksboten Zeitz‘ zufolge in städtischen Kommissionen und nachweislich auf literarischem Gebiet für einen Ausbau der staatlichen Wohlfahrtsarbeit eingesetzt.187 In welchen Kommissionen genau er sich engagierte, ist der Zeitung nicht zu entnehmen. Vermutlich war er auch ehrenamtlicher Mitarbeiter im Hauptausschuß188 der heute noch existierenden, sozialdemokratischen ‚Arbeiterwohlfahrt‘ (AWO), denn er veröffentlichte in der entsprechenden Zeitschrift Beiträge.189 Er beschränkte sich also in seinem schriftstellerischen Tun nicht auf die Polizeiverwaltung, sondern setzte sich auch mit anderen Themen auseinander, die den preußischen Reformern, vor allem den Sozialdemokraten, am Herzen lagen.190 Sein eigener Eintritt in die SPD schien erfolgt zu sein, als er
186 Bähnisch, Albrecht: Das Impfwesen, Berlin 1930. 187 Vgl.: o. V.: Der neue Merseburger Landrat. 188 Die AWO strebte keinen Vereinsstatus an, sondern blieb ein Ausschuß. Folglich hatte sie keine Mitglieder, sondern lediglich ehrenamtliche Mitarbeiter. 189 Bähnisch, Albrecht: Krise der Wohlfahrtsarbeit, in Arbeiterwohlfahrt, 8. Jg. (1933), S. 65–70 sowie ders.: Bedürftigkeitsprüfung in der Arbeitslosenversicherung, in: Arbeiterwohlfahrt, 7. Jg. (1932), S. 200–204. 190 Eine Auseinandersetzung mit jenen Texten Bähnischs soll im Zusammenhang mit der Darstellung seines Engagements in der SAG-Berlin-Ost erfolgen.
276 | Theanolte Bähnisch
Assessor im Innenministerium war.191 Der Partei-Beitritt dürfte seine Integration in den Kreis der im Folgenden aufgeführten Personen positiv beeinflußt haben. 3.3.5 Berufliche Sozialisation in liberal-sozialen Kreisen – Die Bähnischs im Zirkel preußischer Politikund Verwaltungseliten Das Ehepaar Bähnisch, welches sich, Theanolte Bähnischs Aussagen zufolge, als eine politische und berufliche Gemeinschaft definierte, teilte nicht nur das Interesse am Verwaltungswesen im Staat Preußen, sondern hatte, wie bereits deutlich geworden sein dürfte, auch gemeinsame Vorgesetzte. Allgemein ist davon auszugehen, daß wichtige Berufskollegen eines Partners jeweils auch dem anderen Partner bekannt waren – wenn die betreffenden Personen nicht ohnehin sowohl im Polizeipräsidium als auch in der Polizeiabteilung des Innenministeriums verkehrten. Im Folgenden sollen die wichtigsten Vorgesetzten und Kollegen der Bähnischs für die Jahre 1926 bis 1930 benannt und in ihrer Bedeutung für die Verwaltungsreformprozesse in der Weimarer Republik und damit für Albrecht und Theanolte Bähnisch beschrieben werden. Albert Grzesinski Albert Grzesinski (SPD) war zum Zeitpunkt von Theanolte Bähnischs Amtsantritt als Assessorin im Präsidium Polizeipräsident von Berlin und somit, wie bereits erwähnt, Theanoltes erster Vorgesetzter. Er behielt diesen Posten bis zum Oktober 1926, als er zum Preußischen Innenminister ernannt, damit Albrechts erster Vorgesetzter wurde und die Arbeiten an der (Polizei)Verwaltungsreform maßgeblich verantwortete. Grzesinskis Amtszeit im Innenministerium dauerte bis Februar 1930. Ab November 1930 und damit erst nach dem Ausscheiden Theanoltes aus der Behörde, wurde er erneut mit dem Amt des Polizeipräsidenten von Berlin betraut, das in der Zwischenzeit der ehemalige Polizeipräsident von Köln, Carl Friedrich Zörgiebel (SPD), bekleidet hatte.
191 LHASA, MER, Rep. C 28 I a II Lit B 5, Nr. 5, Der Regierungspräsident von Merseburg im Einvernehmen mit dem Gauleiter der NSDAP in Halle a. S., o. D. als Anlage zu einem Schreiben des Regierungspräsidenten von Merseburg an den Preußischen Minister des Innern, 24.08.1933. „Die Vermutung liegt nahe, daß dieser Eintritt nur erfolgte, um ihm ein schnelleres Fortkommen im marxistischen Staat zu sichern“, wird der Parteieintritt Bähnischs darin im nationalsozialistischen Jargon erklärt. Daß der Partei-Beitritt Bähnischs Karriereaussichten zunächst verbesserte, darf als unzweifelhaft gelten. Seine womöglich doch unterschiedlichen Motive lassen sich jedoch nicht rekonstruieren. Laut einem Vordruck, den Bähnisch ausgefüllt an den Reichsverband deutscher Schriftsteller zurücksandte, war er 1927 in die SPD eingetreten und gehörte ihr bis zum 21.04.1933 an. BArch BDC, RK, J 0013, Reichsverband Deutscher Schriftsteller e. V. an Albrecht Bähnisch, 27.12.1933 sowie Bähnisch, mit gleichem Papier, an den Reichsverband Deutscher Schriftsteller e. V., 29.12.1933. Auf seinen Austritt wird an anderer Stelle zurückzukommen sein.
Albrecht Bähnisch | 277
Trotz der herausgehobenen Position Grzesinskis entstanden erst im letzten Jahrzehnt Studien, die sich intensiver mit seinem Handeln im ‚Bollwerk Preußen‘ auseinandersetzen: So legte Thomas Albrecht 1999 eine politische Biographie über Grzesinski vor, die dem von Robert Kempner bereits 1983 geäußerten Umstand, daß „man ihn nicht kennt“192, Abhilfe schaffen sollte.193 Albrecht will mit seiner Arbeit über den seiner Einschätzung nach sehr machtbewußten Grzesinski beweisen, daß die handelnden Protagonisten im Staat Preußen während der Weimarer Republik viel zu lange unterschätzt worden seien. Die Auseinandersetzung mit diesen Personen zeige, daß die Mär von der „machtscheuen Sozialdemokratie“194 in Bezug auf Preußen, insbesondere was Grzesinski und Carl Severing angehe, nicht tauge. Der bereits vielfach zitierte Stefan Naas unterstreicht mit seiner Studie über das Polizeiverwaltungsgesetz von 1931 ebenfalls die Rolle, die Grzesinski für die Demokratisierung der Verwaltung in Preußen spielte. Er zeigte, daß es sich hierbei um ein ambitioniertes Projekt handelte, das preußische Politiker der SPD, der DDP und des Zentrum auf das ganze Reich ausgedehnt wissen wollten.195 Nicht nur, was inhaltliche Reformen anging, sondern auch in Personalfragen war Grzesinski Vorreiter darin, demokratisch denkendes Personal in wichtige Stellen der Verwaltung zu bringen. Von Hause aus Metalldrücker, gilt er aufgrund seines Quereinstiegs in Politik und Verwaltung als „ein typischer Repräsentant der sozialdemokratischen Führungsschicht im Preußen der Weimarer Republik“196. Sein eigener Karriereweg mag ihn dazu bewogen haben, noch stärker als sein Amtsvorgänger Severing auf die Rekrutierung verwaltungsfremder, aber republiktreuer Mitarbeiter zu setzen.197 Folgt man Albrecht, so hat Grzesinskis Personalpolitik einen „statistisch belegbaren Fortschritt in der Durchdringung der Verwaltung mit überzeugten Anhängern der Republik gebracht“. Die preußischen Demokratisierungserfolge seien trotz aller Kritik an personalpolitischen Versäumnissen „ohne Parallele“198 gewesen, so Albrecht. Der Otto Braun-Biograph Hagen Schulze ließ sich sogar zu der Äußerung hinreißen, Severing habe dem neuen Regierungssystem zwar seinen Namen (‚System Severing‘), Grzesinski ihm aber erst den eigentlichen Inhalt gegeben.199 Die meisten seiner auf Modernsierung und Vereinfachung der Verwaltung abzielenden Reformvorhaben konnte Grzesinski während seiner Dienstzeit jedoch nicht verwirklichen. So ist neben der Polizeiverwaltungsreform lediglich noch die umstrittene Gebietsreform durchgeführt worden. Mit dem am 27.12.1927 verabschiedeten
192 Kempner: Ankläger, S. 169. 193 Albrecht, Thomas: Für eine wehrhafte Demokratie. Albert Grzesinski und die preußische Politik in der Weimarer Republik, Bonn 1999. 194 Ebd., S. 8. 195 Naas: Entstehung, passim. 196 Vgl.: Albrecht: Demokratie, S. 9. 197 Unter Grzesinski stieg der Anteil höherer Verwaltungsbeamter ohne entsprechende fachliche Vorbildung auf immerhin 15 Prozent. Vgl.: Grotkopp: Beamtentum, S. 74. (Zahlen nach Wolfgang Runge: Politik und Beamtentum im Parteienstaat, Stuttgart 1965, S. 156.) 198 Albrecht: Demokratie, S. 230. 199 Schulze: Braun, S. 515.
278 | Theanolte Bähnisch
Gesetzentwurf zur Auflösung der Gutsbezirke als Verwaltungseinheiten, zog Grzesinski die erbitterte Feindschaft konservativer Kreise auf sich und seine Partei, die SPD. Grzesinski war eine wesentliche Konstante der beruflichen Karrieren von Albrecht und Theanolte Bähnischs, leitete er doch beide Behörden, für die sie tätig waren. Er dürfte als Vorbild jener auffällig großen Konsensfähigkeit Albrechts und Theanoltes, die in letzter Konsequenz bedeutete, stärker den demokratischen Pluralismus als die Durchsetzung sozialdemokratischer Ideen zu forcieren, gedient haben. Die Überzeugung des Grzesinski-Biographen Albrecht, daß die Stabilität der preußischen Regierungsverhältnisse nicht in erster Linie auf Zufällen200 beruht habe, sondern „auf der Koalitionsfähigkeit und -willigkeit der von pragmatisch denkenden Politikern geprägten Regierungsfraktionen“201, hat enormes Erklärungspotential für die prägenden Effekte der Sozialisation Theanolte Bähnischs in diesen Kreisen. Den Erfahrungsschatz und den Erkenntnisgewinn aus Kontakten mit Politikern wie Grzesinski aus der großen Koalition in Preußen-Weimar, nahm sie zum Anlaß, um später aktiv den Aufbau und die Konsolidierung der zweiten deutschen Demokratie auf der Basis entsprechender Überzeugungen und Fähigkeiten zu unterstützen. Zumindest der sozialdemokratischen Presse nach zu urteilen, tat ihr Mann es ihr gleich und nutzte den Vorsitz, den er später im Merseburger Kreistag haben sollte, um zwischen den Parteien zu vermitteln und konsensfähige Lösungen zu finden.202 Albrecht Bähnisch hielt auch in seiner Merseburger Zeit den Kontakt zu Grzesinski aufrecht. So übersandte er ihm in seiner Eigenschaft als Merseburger Landrat im Januar 1933 eine Dorf-Zeitung der KPD aus ‚seinem‘ Kreis, in der ein Schriftverkehr zwischen dem neuen Berliner Polizeipräsidenten Kurt Melcher203 und dem in der Zeitung als „Minister des Blutmai 1929“ 204 bezeichneten Grzesinski abgedruckt und kommentiert war.205 Im Artikel ging es um fortgesetzte Zahlungen in
200 Das preußische Gegenbeispiel zur Machtscheue der SPD im Deutschen Reich sei, so Albrecht, von der Forschung lange Zeit nicht gewürdigt, sondern als zu „vernachlässigende Anomalie“ abgehandelt worden. Die lange Lebensdauer der Weimarer Koalition sei nicht ihren Protagonisten angerechnet worden, sondern „einer Reihe von glücklichen Umständen, wie z. B. Wahlterminen, Wahlrecht und Verfassungsbestimmungen. Damit wurden Politiker des Weimarer Preußen unausgesprochen als im Grunde nicht weiter beachtenswerte Randfiguren abqualifiziert, die sich zufällig wegen günstiger Umstände lange an der Macht gehalten hatten.“ Ebd., S. 8. 201 Albrecht: Demokratie, S. 9. 202 O. V. [„Rsch“]: Rückblick auf den gestrigen Kreistag, in: Merseburger Korrespondent, Nr. 63, 15.03.1930. Siehe auch Kapitel 4.1.2. 203 Kurt Melcher löste nach dem Preußenschlag Albert Grzesinski als Polizeipräsident von Berlin ab. Melcher amtierte nur bis Februar 1933. Sein Nachfolger wurde Magnus von Levetzow (NSDAP), der die Berliner Polizei im Sinne der Nationalsozialisten umformte. 204 IISH, Albert Grzesinski Papers, Nr. 2372, O. V.: Eine Kapitulation, die sich lohnte, in: Dorfzeitung, o. D., o. S. 205 IISH, Albert Grzesinski Papers, Nr. 2372, Albrecht Bähnisch an Albert Grzesinski, 04.01.1933.
Albrecht Bähnisch | 279
Höhe von 2000 Reichsmark an Grzesinski durch die neue Regierung nach dem Preußenschlag. Die Dokumente sollten beweisen, warum – hiermit spielte der Verfasser auf die gewaltfreie Machtaufgabe der SPD im Rahmen des Preußenschlags an – „Grzesinski, Severing und Braun am 20. Juli weder kämpfen wollten noch konnten.“ Sie hätten keinen Widerstand geleistet, heißt es in der Zeitung, „weil sie mit goldenen Fäden an das bürgerliche Regime gebunden und gefesselt sind“206. Die von anderer Seite als positiv bewertete Koalitionsfähigkeit der sozialdemokratischen Reformer mit den liberalen Parteien war von Seiten der Kommunisten stets als negativ bewertet worden. Dies bietet sich wiederum als eine von mehreren Erklärungen für die Abneigung Theanoltes gegen die kommunistische Idee an. In der Nachkriegszeit konnte kein Wiedersehen zwischen Theanolte Bähnisch und Grzesinski mehr zustande kommen. Er starb schon 1947, kurz nachdem er der Bitte Kurt Schumachers entsprochen hatte, seine Rückkehr aus dem Exil in New York nach Deutschland vorzubereiten.207 Carl Severing Carl Severing (SPD) amtierte von 1920/21 bis 1926, also vor Grzesinski, als preußischer Innenminister und von 1928 bis 1930 als Reichsinnenminister. 1930 löste er Grzesinski als preußischen Innenminister ab und blieb in diesem Amt, bis er, trotz der Wachsamkeit ‚seines‘ preußischen Polizeistabs gegenüber den Nationalsozialisten, gemeinsam mit Grzesinski als einer der ersten im Rahmen der nationalsozialistischen Säuberungsmaßnahmen vom Juli 1932 aus seinem Amt entfernt wurde. Severing hatte als Nachfolger des als modernisierungsschwach geltenden Innenministers Wolfgang Heine208 bereits unmittelbar nach seinem Amtsantritt Personalumbesetzungen vornehmen lassen. Zuerst ließ Severing diejenigen Beamten suspendieren, die den Aufstand Kapps besonders unterstützt hatten. In einem zweiten Schub wurden – noch vor dem Ende der von Severing angeordneten Untersuchung, welche die Oberpräsidenten der Provinzen im Rahmen des Kapp-Putsches durchführen mußten, um die Loyalität ihrer jeweiligen Beamten zur Republik zu klären – drei Ober-, drei Regierungs- und zwei Polizeipräsidenten sowie ganze 88 Landräte in den Ruhestand versetzt.209 Severing versuchte im Rahmen der Stellenneubesetzungen, wegen der angestrebten Aussöhnung der verschiedenen politischen Gruppen, nicht
206 IISH, Albert Grzesinski Papers, Nr. 2372, O. V.: Eine Kapitulation, die sich lohnte, in: Dorfzeitung, o. D., o. S. 207 Vgl.: Beckstein, Hermann: Albert Grzesinski (1879–1947), in: Jeserich, Kurt G.A./ Neuhaus, Helmut: Persönlichkeiten der Verwaltung. Biographien zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1648–1945, Stuttgart 1991, S. 375–379, hier S. 378. 208 Heine hatte sich den Forderungen nach einer verschärften Demokratisierung der Verwaltung ständig widersetzt, weshalb die SPD-Fraktion schon 1919 auf seinen Rücktritt drängte. Dieser erfolgte jedoch erst nach dem Kapp-Putsch. Vgl.: Grotkopp, Jörg: Beamtentum und Staatsformwechsel. Die Auswirkungen der Staatsformwechsel von 1918, 1933 und 1945 auf das Beamtenrecht und die personelle Zusammensetzung der deutschen Beamtenschaft, Frankfurt a. M. u. a. 1992, S. 32. 209 Vgl.: Albrecht: Demokratie, S. 37.
280 | Theanolte Bähnisch
nur Sozialdemokraten, sondern auch Beamte anderer demokratischer Parteien unterzubringen. Vor dem Hintergrund eines Mangels an geeignet erscheinenden Bewerbern öffnete Severing die höhere Beamtenlaufbahn schließlich auch für fachfremde Bewerber. Das ‚System Severing‘, gegen das sich die Beamtenverbände und die DNVP lautstark zu Wort meldeten, sorgte aufgrund seines Neuigkeitswerts auch für Furore in der Presse. Als Grzesinski die Arbeit seines Vorgängers fortsetzte und – vor allem auch was das Personal des Innenministeriums anging – verstärkte, habe sich dies aufgrund der mittlerweile eingetretenen Gewöhnung an den teilweisen Elitenaustausch in der Presseberichterstattung kaum noch niedergeschlagen, schreibt der bereits zitierte Thomas Albrecht. Frühere Studien über preußische Personalpolitik hätten aufgrund der Nutzung von Zeitungen als zentrale Quelle deshalb fälschlicherweise Severing die fortschrittlichere Politik unterstellt, erklärt Albrecht.210 Nichtsdestotrotz spielte auch Severing in der Erinnerung der Bähnischs eine tragende Rolle, zumal er derjenige war, der sie als erste Regierungsreferendarin in Preußen zum Dienst zugelassen hatte. Auch als sie in ihrer Lebensskizze über den ‚Preußenschlag‘ berichtete, bezog sie sich auf Severing.211 Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren sich Severing und Bähnisch einig in ihrem Bestreben, eine Zusammenarbeit der SPD mit den Kirchen zu erreichen. Ob die beiden sich in dieser Frage besprachen, ist jedoch nicht klar. Kurt Schumacher nutzte schließlich eine Kampagne, in der Severing vorgeworfen wurde, am Ende doch mit dem NS-Regime paktiert zu haben, um den Politiker aus dem SPDFührungslager herauszudrängen. Vermutlich ging in diesem Zusammenhang auch Theanolte Bähnisch auf Distanz zu Severing, der zunächst seinen Einfluß in der SPD in Ostwestfalen hatte aufrecht erhalten können. Er starb im Juli 1952. Albert Grzesinski und Carl Severing waren, dem OttoBraun-Biographen HansPeter Ehni zufolge, die engsten Vertrauten des preußischen Ministerpräsidenten Braun (1925–1932), dessen Regierung als ‚sozialdemokratisches Bollwerk Preußen‘212 einen Widerpart zum mehr und mehr demokratiedefizitären Reich dargestellt hatte. Der fortwährende Austausch der Bähnischs mit diesen engsten Vertrauten des Ministerpräsidenten läßt wiederum Rückschlüsse zu über die Stellung des Ehepaars in der Berliner Gesellschaft: Im Kreise Grzesinskis, Severings und der anderen, im folgenden beschriebenen Personen gehörten sie, trotz ihrer Jugend und ihrer vergleichsweise kurzen Verwaltungskarrieren zur plural-demokratisch denkenden und handelnden Avantgarde im Staat Preußen und der Hauptstadt Berlin. Willy Abegg Wilhelm, genannt ‚Willy‘ Abegg (DDP), der von 1912 bis 1919 als Regierungsrat am Berliner Polizeipräsidium tätig gewesen war, wurde 1923 Ministerialdirektor in der Polizeiabteilung des preußischen Innenministeriums. Im Rahmen seines Amtes,
210 Vgl.: ebd., S. 231. Allerdings beschrieb der von Albrecht nicht erwähnte Jörg Grotkopp bereits 1992 Grzesinskis Kurs als schärfer. Vgl.: Grotkopp: Beamtentum, S. 70–76. 211 AddF Kassel, SP-01, Kurze Lebensskizze, o. D., S. 2. 212 Vgl.: Ehni, Hans Peter: Bollwerk Preußen? Preußen-Regierung, Reich-Länder-Problem und die Sozialdemokratie 1928–1932, Bonn 1975.
Albrecht Bähnisch | 281
mit dem ihm die Personalverantwortung über die Preußische Polizei oblag, erneuerte er deren Führungsebene, ganz auf der Linie seiner Vorgesetzten Severing und Grzesinski, sukzessive. Mit der Ernennung Abeggs zum ersten Staatsekretär 1926 zollte Severing der Raison der Weimarer Reichskoalition zwischen den Sozialdemokraten, dem Zentrum und der DDP Tribut, welche vorsah, den Posten des Staatssekretärs jeweils mit einem Vertreter einer anderen Partei zu besetzen, als den des Ministers. Nach und nach baute Abegg die Schutzpolizei als staatliches Polizeiorgan auf. Vor diesem Hintergrund ist er als der Begründer der modernen Polizei anzusehen, die nach dem ‚Freund und Helfer‘-Prinzip eine besonders bürgernahe Polizei sein sollte. Aufgrund der an anderer Stelle bereits erwähnten Durchsetzung der Polizei mit ehemaligen Armee-Angehörigen war die preußische Polizei jedoch im wahrsten Sinne des Wortes schlagkräftig und dabei in der Tendenz eher republikfern aufgestellt. Auch die neu eingerichteten Polizeischulen schafften diesem Umstand kaum Abhilfe. So blieb die ‚neue Polizei‘ am Ende mehr Schein als Sein: Was die von Abegg verantwortete Publikations-Reihe über die Polizei und die große Berliner Polizeiausstellung darstellte, hatte wenig mit dem zu tun, was die Arbeit der Schutzpolizei im Alltag betraf. Ob Abeggs noch junges Konzept über die Dauer einer stabilen demokratischen Republik Wirkung gezeigt hätte, oder ob nicht zuletzt auch in Bezug auf die Polizei demokratische Chancen auf der Basis von naiver Gutgläubigkeit vertan worden sind, läßt sich kaum beantworten.213 In jüngerer Zeit hat die Forschung immerhin wieder Energie auf die Klärung der Rolle der politischen Polizei, die ebenfalls Abegg unterstand, verwendet. Diese hatte die Rolle einer Geheimpolizei und sollte den Staat vor ‚Republikfeinden‘ von rechts und links schützen. Die These von der „Selbstpreisgabe der Demokratie“214 stellen diese Studien in Frage. Mit der Platzierung von Rudolf Diels als ‚Dezernent zur Bekämpfung der kommunistischen Bewegung‘ in der politischen Polizei bahnte sich der Abgang Abeggs an: Unter dem steigenden Druck von rechts hatte Abegg, wie bereits angedeutet215, erwogen, einen Schwenk nach links zu vollziehen, weshalb er Vertreter der kommunistischen Partei216 in sein Büro gebeten hatte, mit denen er Möglichkeiten einer Zu-
213 Vgl.: Graf, Christoph: Kontinuitäten und Brüche. Von der politischen Polizei der Weimarer Republik zur Geheimen Staatspolizei, in: Paul, Gerhard/Mallmann, Klaus-Michael (Hrsg.): Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 1995 sowie Dams, Carsten: Staatsschutz in der Weimarer Republik. Die Überwachung und Bekämpfung der NSDAP durch die preußische politische Polizei von 1928 bis 1932, Marburg 2002. Vgl. auch den ‚Klassiker‘: Pyta, Wolfram: Gegen Hitler und für die Republik, Die Auseinandersetzung der deutschen Sozialdemokratie mit der NSDAP in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1989. 214 Vgl.: Erdmann, Karl Dietrich/Schulze, Hagen (Hrsg.): Selbstpreisgabe einer Demokratie. Eine Bilanz heute, Düsseldorf 1980. 215 Siehe Kapitel 2.3.2.3. Dort finden sich auch ergänzende Angaben zu Diels. 216 Es handelte sich hierbei um Ernst Torgler, den Vorsitzenden der KPD-Reichstagsfraktion und den KPD-Reichstagsabgeordneten Wilhelm Kasper. Torgler war mitangeklagt im Reichstagsbrandprozess. Später arbeitete er, womöglich auf Druck, dem NSPropagandaministerium zu.
282 | Theanolte Bähnisch
sammenarbeit sondieren wollte. Den Bericht Diels‘ über dieses Treffen nahm, wie ebenfalls bereits erwähnt, der Reichskanzler und Major a. D. von Papen zum Anlaß, den Staatsstreich gegen die preußische Regierung auszuführen. Diels wurde im August 1932 Chef der preußischen politischen Polizei, aus der später die Gestapo hervorging. Wilhelm Abegg hielt den Kontakt zu Theanolte Bähnisch, die er vermutlich über Albrecht Bähnisch kennengelernt hatte, noch Jahre später aufrecht: 1950 teilte er ihr in einem Brief, in dem er seine „völlige Vermögenslosigkeit“ beklagte, mit, daß er „in Sachen Diels“ beim Entnazifizierungsausschuß vorgeladen sei. Er schrieb ihr von seiner Befürchtung, „daß Diels und Severing ein stilles gentleman agreement bezügl. gegenseitiger Schonung geschlossen haben. Heute ist nichts unmöglich!!!“217. Daneben bat er sie, Informationen über einen mutmaßlichen Vertrauensmann des Sozialdemokraten und Europa-Aktivisten Carlo Schmid einzuholen. Aus dem Brief wird deutlich, daß Theanolte Bähnisch auch Abeggs Familie kannte und in dieser wohlgelitten war.218 Daß Abegg sie als besonders bewandert, beziehungsweise einflußreich in (personal-)politischen Fragen einschätzte, geht aus einem weiteren Brief an Bähnisch hervor. In diesem erbat der ehemalige DDP-Politiker von der nunmehrigen Regierungspräsidentin Anregungen für die Fortsetzung seiner politischen Karriere: „Meinen Sie, daß ich irgendwie helfen könnte, wenn ich mich für den neuen Bundestag zur Verfügung stellte? Wenn mich die SPD wünschen sollte, würde ich bereit sein, ihr beizutreten, aber das hätte gewiß die Schaffung von mancherlei Voraussetzung zur Bedingung.“219 Ihren Einfluß in der SPD um 1950 schien er – wie sich in den späteren Kapiteln zeigen wird – falsch eingeschätzt zu haben. Eine Antwort Bähnischs an Abegg ist leider nicht überliefert. 1962 aber schrieb sie an den Sohn Willy Abeggs, Walter Abegg, um ihm ihr Beileid über den Tod seiner Mutter auszusprechen und in diesem Zusamenhang zu erwähnen, daß sie sich in seinem Elternhaus in Berlin immer sehr wohl gefühlt habe. „Dann erinnere ich mich an soviel gute Gespräche und vor allem an die große Herzlichkeit und Wärme, mit
217 Entsprechend äußerte sich Abegg auch gegenüber Otto Klepper. Vgl.: Pufendorf, Astrid von: Otto Klepper (1888–1957) deutscher Patriot und Weltbürger, München 1997, S. 121, Anm. 158. 218 „unsere alte Tante ist im 93. Jahre vor einigen Tagen gestorben, m. Frau und Hilde auch Walter mit seinen 5 Kindern geht es gut, alle lassen herzlich grüssen.“ AdSD, Personalia 480, Wilhelm Abegg an Theanolte Bähnisch am 15.12.1950. Dem Schreiben muß ein Brief Bähnischs an Abegg vorausgegangen sein, der sich jedoch nicht auffinden ließ. 219 AdSD, Personalia 480, Wilhelm Abegg an Theanolte Bähnisch, 31.12.1950. Die Rolle von Hermann Höpke-Aschoffs als wichtiger Mann in der FDP hinderte Severing scheinbar daran, den freien Demokraten beizutreten. Wie zuvor schon die DDP, nahm er die FDP als „etwas halbwertig“ wahr. Ebd. Höpker-Aschoff, 1925–1931 Finanzminister Preußens, war als Leiter der ‚Haupttreuhandstelle Ost‘ direkt an der Germanisierungspolitik der Nationalsozialisten gegenüber Polen beteiligt. Ob das jedoch der Grund für Abeggs Abneigung gegen Höpker-Aschoff war, ist aus dem Brief nicht zu ersehen. 1951 wurde Höpker-Aschoff Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
Albrecht Bähnisch | 283
der ihre Eltern sich ihren Gästen widmeten.“220 Der Einladung, die Theanolte Wilhelm Abegg scheinbar in Reaktion auf seinen Brief ausgesprochen hatte,221 konnte dieser nicht mehr Folge leisten: Er starb 1951, zehn Monate, nachdem er seiner Vertrauten seine Enttäuschung über sein Leben in der Bundesrepublik offenbart hatte. Auch mit Carl Severing hatte Wilhelm Abegg nach 1945 noch Kontakt. Überliefert ist ein Brief Abeggs an den „verehrte[n], liebe[n] Herr[n] Severing“, der ganze 16 Seiten umfaßt. „Sie gestatten wohl, dass ich nach dem furchtbaren Intermezzo in Deutschland, das alle Hecken bis fast zu den Wurzeln herab gerade geschnitten und die Kämpfer gegen diese Pest zur Einheit ohne Rangunterschiede zusammengeschweißt hat, zu dieser Anrede übergehe, in dem Gedenken, dass unser gemeinsames Streben in den 12 Jahren von 1920 bis 1932 doch eine dauernde Kameradschaft begründet hat“222, schrieb Abegg an Severing. Diese Einleitung unterstreicht die eingeschworene Gemeinschaft, die nach 1945 jene fühlten, die sich in der ersten deutschen Demokratie für deren verwaltungsrechtliche Ausgestaltung in Preußen eingesetzt hatten. Aus dieser Perspektive erklärt sich auch Abeggs Überzeugung, daß er und Severing in Form eines persönlichen Gesprächs noch einiges „miteinander erörtern müssen, wenn unsere gemeinsamen Erlebnisse in irgendeiner Weise nutzbar für die Mit- und Nachwelt gemacht werden sollen.“223 Doch was als Brief in freundschaftlichem Ton beginnt, entpuppt sich im weiteren Verlauf als ein Beweisstück für die Feindseligkeiten, die nun zwischen Abegg und Severing standen: „In der Weimarer Republik lag das Fundament und der Angelpunkt aller Geschehnisse zunächst in Preussen“, beginnt Abegg seine weiteren Ausführungen, um dann seine Sicht auf die seiner Meinung nach viel zu zögerliche Personalpolitik, vor allem die Rolle der SPD darin, zu schildern. „Die unheilvolle Konsequenz der Unangreifbarkeit der Beamten dieser Kategorie [der Räte, die herausgehobene Positionen hatten, aber als nicht politische Beamte unkündbar waren] ist von Tag zu Tag mehr hervorgetreten; sie stellt einen der Gründe und nicht den letzten für den Untergang der Weimarer Republik dar. Minister und Staatsekretäre amteten sozusagen auf jederzeitigen Abruf, während die gesetzlich und organisatorisch zum Gehorsam verpflichteten Räte eine kompakte, in Wirklichkeit die herrschende Masse der Beamtenschaft und ihrer Zentralstellen verkörperte“224, resumiert Abegg. Sein Brief an Severing gleicht einer Abrechnung. Er enthält eine Salve von Vorwürfen gegen die von Abegg wahrgenommene Naivität und Beratungsresistenz Severings in Personal- und Verhandlungsfragen und schließlich gegen sein Verhalten im Rahmen des Preußenschlags, das Abegg als überstürzt, feige, ja sogar verlogen darstellt.225
220 221 222 223 224 225
AfZ, NL Wilhelm Abegg, Nr. 68, Theanolte Bähnisch an Walter Abegg, 28.02.1962. Dies geht aus dem Brief an Walter Abegg hervor. Vgl.: ebd. AfZ, NL Wilhelm Abegg, Nr. 59, Wilhelm Abegg an Carl Severing, 31.05.1947. Ebd. Ebd. Ebd.
284 | Theanolte Bähnisch
Ferdinand Friedensburg und Bernhard Weiß Ferdinand Friedensburg (DDP)226 und Bernhard Weiß zählten als Vize-Polizeipräsidenten ebenfalls zum Führungszirkel der preußischen Polizei. Friedensburg, Vizepolizeipräsident von 1925 bis 1927, war sich einerseits seiner Fähigkeiten bewußt und hatte andererseits die im Zuge der Begründung der Republik entstandene Aufstiegsmobilität demokratisch eingestellter Fachleute in der Verwaltung erkannt: „Bei einem schmerzlichen Mangel an geeigneten Männern für die Besetzung der höheren Posten der Verwaltung konnte es nicht ausbleiben, daß in Berlin schon bald nach den ersten Ergebnissen meiner Rosenberger Tätigkeit [als Landrat] meine Berufung zu größeren Aufgaben erwogen wurde“227, schreibt er in seinen im ‚Tagesspiegel‘ veröffentlichten Erinnerungen. Da er nicht der Sozialdemokratie angehört habe, habe ihn Severing jedoch nicht zum Polizeipräsidenten ernennen wollen, weshalb er Vizepräsident geworden sei, berichtet Friedensburg später.228 Willy Abegg schien damit nicht einverstanden gewesen zu sein, die Zusammenarbeit blieb stets von Konflikten geprägt. „Die Polizeiabteilung des Ministeriums regierte mit allen ihren Referenten am liebsten in der Exekutive mit, was nach der Verteilung der Verantwortung, außer in Fragen von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung, nicht anging“229, schildert der Polizei-Vizepräsident a. D. seine Sicht der Dinge. Über die Konflikte in der Zusammenarbeit zwischen der Polizeiabteilung des Innenministeriums und des Berliner Polizeipräsidiums, ist bisher noch kaum geforscht worden. Doch es ist anzunehmen, daß Friedensburgs Wahrnehmung der Verhältnisse aus der Sicht des Polizeipräsidiums kein Einzelfall war und daß auch Theanolte und Albrecht Bähnisch von solcherlei Konflikten nicht unberührt blieben. 1927 wurde der unbequeme Friedensburg von Berlin ‚weggelobt‘ und übernahm den Posten des Regierungspräsidenten von Kassel. Dort unternahm er – in der Retrospektive wenig überzeugende – Anstrengungen, durch eine Zusammenarbeit verschiedener Gruppen aus der ‚bürgerlichen Mitte‘, den Aufstieg der NSDAP zu verhindern und engagierte sich im von Sozialdemokraten dominierten Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 1933 wurde er seines Amtes enthoben, 1935 kurzzeitig von der Gestapo inhaftiert. 1945 war er Mitbegründer der CDU. Er leitete das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW) und wurde 1946 zum Stellvertretenden Oberbürgermeister Berlins ernannt. In diesem Amt vertrat er während der Berlin-Blockade die erkrankte Oberbürgermeisterin Luise Schröder. Ein Brief Friedensburgs an die „liebe, verehrte Frau Kollegin“230, zeigt, daß der Politiker und Bergbauingenieur Theanolte – zumindest in der Retrospektive – als seinen persönlichen Schützling begriff. „Als Ihr alter Chef aus der Berliner Zeit fühle ich mich noch immer ein wenig verantwortlich für Sie und bin sogar etwas stolz auf
226 Ferdinand Friedensburg (1886–1972) wurde 1920 Landrat des Landkreises Rosenberg und übernahm 1925 das Amt des Polizeivizepräsidenten in Berlin. 227 Friedensburg, Ferdinand: Damals in Berlin ein delikates Amt. Meine Zeit als Chef des Polizeipräsidiums, in: Der Tagesspiegel, Nr. 7353, 16.11.1969, S. 43. 228 Vgl.: ebd. 229 Ebd. 230 BArch, N 1114, Nr. 27, Ferdinand Friedensburg an Theanolte Bähnisch, 23.04.1946.
Albrecht Bähnisch | 285
die Schülerin“231, schrieb er ihr im April 1946 anläßlich ihrer Ernennung zur Regierungsvizepräsidentin. Dieser Brief, in dem er auf den „verewigten gemeinsamen Freund Harnack“232 anspielt, scheint die erste Kontaktaufnahme zwischen den beiden nach dem Ende des Krieges gewesen zu sein.233 Im Verlauf des Briefs erkundigte sich Friedensburg nach anderen Personen, die er als gemeinsame Freunde bezeichnete, namentlich waren dies der Regierungsdirektor und frühere Schmalkaldener Landrat, Ludwig Hamann, sowie ein „Freund Strickrodt […] von den Hermann GöringWerken“, womit vermutlich Georg Strickrodt gemeint war. Dieser leitete die Rechtsabteilung der Göring-Werke und galt als rechte Hand des Werksleiters Paul Pleiger.234 Strickrodt war von 1946 bis 1950 niedersächsischer Finanzminister. Im Rahmen ihres Amtes stand Theanolte Bähnisch in regelmäßigem Austausch mit ihm, was für Friedensburg auf der Hand gelegen haben dürfte. Ob Friedensburg und Bähnisch über die Tätigkeiten des 1936 amtsentlassenen Strickrodt im Kontext der von den Göring-Werken verantworteten Zwangsarbeiterlagern im Dritten Reich Bescheid wußten, läßt sich nicht herausfinden. Der ebenfalls von Friedensburg genannte Landrat Hamann war aufgrund einer von ihm geführten, rassistisch motivierten Anklage gegen den jüdischen SPD-Landtagsabgeordneten Ludwig Pappenheim ebenfalls zu zweifelhaftem Ruhm gelangt.235 Orla-Maria Fels erinnerte sich im November 2009 noch deutlich an die gemeinsame Arbeit ihrer Mutter und Friedensburgs für den ‚Deutschen Rat der Europäi-
231 Ebd. 232 Ebd. 233 Er brachte im Brief seine Freude darüber zum Ausdruck, daß sie sich „über die schweren Zeiten habe[…] hinweg retten können“. Vgl.: ebd. 234 Albert Norden machte bereits 1965 in seinem – stark propagandistisch aufgemachten – ‚Braunbuch‘ publik, das Strickrodt für die Genehmigung des Arbeitserziehungslagers Hallendorf und damit auch für die Verbrechen der Nationalsozialisten an Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen mitverantwortlich war. Vgl. dazu auch die kaum weniger polemisch aufgemachte Broschüre der Linksfraktion im Niedersächsischen Landtag: Klausch, Hans-Peter: Braune Wurzeln – Alte Nazis in den niedersächsischen Landtagsfraktionen von CDU, FDP und DP. Zur NS-Vergangenheit von niedersächsischen Landtagsabgeordneten in der Nachkriegszeit, o. O., o. D., S. 17/18, pdf unter: http://linksfraktionniedersachsen.linkes-cms.de/fileadmin/linksfraktion-niedersachsen/Texte/ Broschueren_PDF/Broschuere_Nazis_internet.pdf, am 16.12.2011. Basis-Informationen liefert: Simon, Barbara (Bearb.)/Präsident des Niedersächsischen Landtages (Hrsg.): Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994, Hannover 1996, S. 373. Zum Lager Hallendorf vgl.: Wysocki, Gerd: Arbeit für den Krieg. Herrschaftsmechanismen in der Rüstungsindustrie des „Dritten Reiches“. Arbeitseinsatz, Sozialpolitik und staatspolizeiliche Repression bei den Reichswerken „Hermann Göring“ im Salzgitter-Gebiet 1937/38 bis 1945, Braunschweig 1992. 235 Vgl.: Krause-Vilmar, Dietfrid: Ludwig Pappenheim (1887–1934). Vortrag in der Gedenkstätte Breitenau, 11.06.2002, Skript unter: https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/ bitstream/urn: nbn:de:hebis:34-2006120416046/1/ansprache_vortrag_pappenheim_2002. pdf, am 11.11.2013.
286 | Theanolte Bähnisch
schen Bewegung‘, in dem sich beide ab 1946 engagierten: „Die reisten gemeinsam nach Europa […] Die fuhren […] nach Straßburg und nach Brüssel und kämpften für Europa.“236 Bernhard Weiß (DDP, Staatspartei) war Vize-Polizeipräsident von 1927 bis 1932. Er engagierte sich stark in der Schulung der Polizeibeamten im Sinne des neuen Polizeiverwaltungsgesetzes und damit im Sinne der Demokratie.237 Dies machte Weiß zu einer wichtigen Schlüsselfigur in der Zusammenarbeit zwischen der PolizeiAbteilung des Preußischen Innenministeriums und dem Berliner-Polizeipräsidium, in dem Theanolte arbeitete. Weiß stand während seiner Dienstzeit in permanentem Kompetenz-Konflikt mit Oberst Magnus Heimannsberg (Zentrum), dem Kommandeur der Berliner Schutzpolizei. Dessen Erfolge bei der Umsetzung von Abeggs Deeskalationsstrategie waren, insbesondere im Zuge des ‚Berliner Blutmai‘ 1929, umstritten. Bekannt wurde Weiß, der seit 1920 die Abteilung AI der Kriminalpolizei, also die politische Polizei in Preußen leitete, durch seine Arbeit an der Aufklärung der politischen Morde an Erzberger und Rathenau. 1925 stieg er zum Leiter der Kriminalpolizei auf. Vor allem aufgrund seiner jüdischen Herkunft war Weiß wiederholt Angriffen durch die Nationalsozialisten ausgesetzt. Gegen seine Absetzung leistete er, anders als Grzesinski und Abegg, Widerstand. Weiß floh nach einer kurzfristigen Internierung 1933 über die Tschechoslowakei ins Exil nach Großbritannien, wurde 1933 ausgebürgert und starb 1951, kurz nachdem er die deutsche Staatsbürgerschaft wiedererlangt hatte, in London.238 Daß Weiß 1927 zum Vizepolizeipräsidenten ernannt worden war, hatte nicht zuletzt mit seiner Parteizugehörigkeit zu tun. In dem Polizeipräsidenten Zörgiebel (SPD), dem Vizepolizeipräsidenten Weiß (DDP) und dem Präsidenten der Schutzpolizei, Heimannsberg, spiegelte sich die große Weimarer Koalition auch in der Führungsspitze des Polizeipräsidiums wieder. Erich Klausener, Walter Kerstiens, Robert Kempner und Fritz Tejessy Weitere wichtige Kontakte konnte Albrecht Bähnisch durch seine Mitarbeit an den genannten schriftlichen Darstellungen zum Verwaltungsrecht festigen. Die ‚drei K‘, Klausener, Kerstiens und Kempner, die sich vor allem durch ihre Arbeit am Preußischen Polizeiverwaltungsgesetz von 1931 – in Anknüpfung an die Vorarbeiten des Oberverwaltungsgerichtspräsidenten Bill Drews – ein Denkmal gesetzt hatten, arbeiteten im Innenministerium mit Albrecht Bähnisch zusammen. Für den von Klausener, Kerstiens und Kempner 1931 herausgegebenen Kommentar zum Gesetz brauchte Kempner zufolge „keine Reklame gemacht werden […]. Im Ministerialblatt für innere Verwaltung stand, daß jeder Polizist das Buch brauchte. Es wurde ein in Preußen sehr bekanntes Buch, der Klausener-Kerstiens-Kempner (K-K-K) Kommentar zum
236 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. 237 Bernhard Weiß (1880–1951) war Vize-Polizeipräsident von 1927 bis zu seiner Absetzung 1932 durch den Reichskanzler von Papen. 238 Vgl.: Rott, Joachim: Bernhard Weiß 1880 Berlin – 1951 London. Polizeivizepräsident in Berlin. Preußischer Jude – kämpferischer Demokrat, Berlin 2008.
Albrecht Bähnisch | 287
Polizeiverwaltungsgesetz“239. Bähnisch gab mit Kempner und Kerstiens gemeinsam das Lehrbuch ‚Preußisches Polizeirecht‘ heraus. Kempner war in der Weimarer Republik Justitiar der Polizeiabteilung im Preußischen Innenministerium und als selbständiger Referatsleiter unter Klausener für polizeiliche Schadensersatzansprüche und in Disziplinarverfahren als Verteidiger der Anklage tätig. Da sich Albrecht Bähnisch diesem Thema in einer eigenen Publikation gewidmet hatte, ist es naheliegend, von einer engen Zusammenarbeit der beiden im Innenministerium auszugehen. Im Zusammenhang mit seinen Ausführungen über seine Tätigkeit als Chefankläger der USA in den Nürnberger Prozessen240 erinnerte der gleichaltrige Kempner später an seine „sehr gute[ ] Freundin“241 Theanolte. Die Beziehung war wahrscheinlich über die gemeinsame Arbeit Kempners und Albrecht Bähnischs zustande gekommen. Aufgrund seiner Funktion im Widerstand gegen die Nationalsozialisten, der von ihm geführten Prozesse und seines Einsatzes für Demokratie und Menschenrechte im Allgemeinen ist eine Freundschaft zu Kempner als politisch höchst bedeutsam für Theanolte Bähnisch anzusehen. Umso mehr verwundert es, daß sie selbst in den überlieferten Dokumenten nicht in der gleichen Weise auf Kempner Bezug
239 Kempner: Ankläger, S. 59. 240 Kempner (1899–1993), zunächst Staatsanwalt in Berlin, war seit 1928 im preußischen Innenministerium tätig. Er engagierte sich im Republikanischen Richterbund und unternahm Versuche, Hitler wegen Hochverrats vor Gericht zu stellen sowie die NSDAP verbieten zu lassen. Er verfaßte mehrere Schriften gegen die NSDAP und Hitler. 1933 von den Nationalsozialisten aus dem Staatsdienst entlassen worden, wurde er 1935 verhaftet und erst im Zuge internationaler Proteste wieder freigelassen. Über Italien floh er in die USA, wo er als Regierungsberater in der Regierung Franklin R. Roosevelts fungierte. Ab 1943 war er Mitglied der War Crimes Commission, 1946/1947 trat er als Chefankläger der USA gegen die Hauptkriegsverbrecher in den Nürnberger Prozessen auf, 1947/48 führte er den Wilhelmstraßen-Prozess gegen Beamte des Auswärtigen Amtes. In Zivilprozessen setzte er Entschädigungen für die Opfer des Nationalsozialismus durch und initiierte mit einem Brief an die Deutsche Bank Entschädigungszahlungen der deutschen Wirtschaft an ausländische Zwangsarbeiter aus der Zeit des NS. 241 Vgl.: Kempner: Ankläger, S. 370. Kempner zufolge hatte ihn „Nolte-Bähnisch (ihr Mann war noch in den letzten Kriegstagen gefallen)“, gemeinsam mit einigen „sozialdemokratischen Bekannten“, die wegen des SPD-Parteitages im Sommer 1947 nach Nürnberg gekommen waren, an seinem Dienstort aufgesucht. „Sie wollten sich einmal ansehen, was wir in Nürnberg so machten und haben sich eine Stunde in die Verhandlung gesetzt, die Sozialdemokraten, wie Hunderte anderer Besucher auch. Sie waren alle ohne Ausnahmen Freunde der Prozesse.“ Ebd. Allerdings erinnert sich Kempner nicht richtig, denn er schreibt, Bähnisch sei „in Preußen Regierungspräsidentin in Hannover“ gewesen. Ebd. Ob man wirklich so eng befreundet war, erscheint vor diesem Hintergrund fraglich. Am darauffolgenden Tag sei, so Kempner, in seinem Garten mit den Sozialdemokraten die Frage diskutiert worden, ob und wann eine russische Invasion bevorstünde. (Vgl.: ebd., S. 371.) Ob Bähnisch bei diesem Gespräch dabei war, ist nicht überliefert.
288 | Theanolte Bähnisch
nimmt, zumal sie Klausener mehrfach erwähnt.242 Eine mögliche Erklärung dafür ist, daß sie in der Nachkriegszeit zwar als Gegnerin des Nationalsozialismus wahrgenommen werden, sich aber nicht explizit gegen einen Teil der Bevölkerung stellen wollte. Kempner selbst bezeichnete Bähnisch allerdings als eine Freundin der Prozesse.243 Robert Kempner könnte auch mit am Kontaktaufbau Albrecht Bähnischs zum Merseburger Regierungspräsidenten Ernst von Harnack, dem Bähnisch später als Landrat von Merseburg unterstand, beteiligt gewesen sein. In seinen Erinnerungen zählt Kempner Harnack zu seinem „Kreis von Freunden in ganz Preußen“244, der sich gegenseitig über die Entwicklungen im Reich auf dem Laufenden gehalten habe. In seinen Lebenserinnerungen erwähnt Kempner im Zusammenhang mit Theanolte und Albrecht Bähnisch auch Fritz Tejessy als „mein Nachbar im Innenministerium, der dauernd Krach mit den reaktionären Polizeioffizieren hatte“245. Ein Zufall? Wohl kaum, denn Albrecht Bähnisch arbeitete auch mit Tejessy246, der zu dieser Zeit Oberregierungsrat im Preußischen Ministerium des Innern war, zusammen. 1929 gab er mit ihm die Schrift über ‚Beamtenausschüsse in der Schutzpolizei‘ heraus. Tejessy (SPD) war ausgebildeter Maschinenbauer und gelernter Journalist. Im Rahmen seines publizistischen Vorgehens gegen den NS-Juristen Roland Freisler hatte er sich Wissen aus dem Bereich des Rechtswesens angeeignet. Grzesinski kannte Tejessy noch aus seiner Zeit aus Kassel247 und holte ihn 1928 ins Innenministerium, wo er Personalsachen der Schutz- und Kriminalpolizei bearbeitete. Als Polizeireferent des preußischen Innenministers war er dafür zuständig, eine nationalsozialistische Unterwanderung der Polizei zu verhindern.248 1932 ging Tejessy zunächst in die CSR, dann in die Slowakei, später nach Dänemark und Schweden, schließlich über die UdSSR und Japan in die USA. 1949 kam er, obwohl Carl Severing im Zuge seines allmählichen Machtverlustes die Angebote, die er Tejessy gemacht hatte, zurückziehen mußte, nach Deutschland zurück. Er arbeitete in der Polizeiabteilung des NordrheinWestfälischen Innenministeriums. Nicht unwahrscheinlich ist, daß sich in der BRD wiederum Tejessys und Theanolte Bähnischs Wege kreuzten. In seiner Funktion als Chef des ersten Amtes für Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen, die er von 1950 bis 1960 innehatte, hatte er sich zum Ziel gesetzt, ‚kommunistische Tarnorgani-
242 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Die Station beim Landrat, S. 19. 243 Kempner: Ankläger, S. 370. 244 Ebd., S. 84. 245 Vgl.: ebd., S. 371. 246 Vgl.: Buschfort, Wolfgang: Fritz Tejessy (1895–1964). Verfassungsschützer aus demokratischer Überzeugung, in: Krüger, Dieter/Wagner, Arnim (Hrsg.): Konspiration als Beruf. Deutsche Geheimdienstchefs im Kalten Krieg, Berlin 2003, S. 111–131. 247 Während Grzesinski der Kasseler Stadtverordnetenversammlung vorstand, arbeitete Tejessy als Redakteur in Kassel, kurzzeitig auch als Chefredakteur der SPD–Zeitung Kasseler Volksblatt. Vgl.: ebd., S. 111. 248 Vgl.: ebd., S. 112.
Albrecht Bähnisch | 289
sationen‘249 zu verfolgen. Dies war auch ein erklärtes Ziel Theanolte Bähnischs ab 1946. Ministerialrat Christian Kerstiens, Referent für materielles Polizeirecht im preußischen Innenministerium und enger Mitarbeiter Erich Klauseners ist der heute wohl unbekannteste der sogenannten ‚Drei K‘. Kerstiens hatte sein Verwaltungsreferendariat wie Theanolte und Albrecht in Münster absolviert und war wohl zuerst im Zuge seiner Tätigkeit beim Landratsamt Recklinghausen mit Erich Klausener in Kontakt gekommen. Ab 1924 wirkte er als Fakultätsassistent in Münster. 1926 wurde er von seiner Stelle als Leiter des Polizeiamtes in Bottrop nach Berlin ins Ministerium des Innern berufen.250 Kerstiens hatte Albrecht Bähnisch als Gutachter ein tadelloses Referendariats-Zeugnis ausgestellt251 und seine Einstellung im auf personelle Verjüngung ausgerichteten Innenministerium vermutlich entscheidend mit beeinflußt. Erich Klausener (Zentrum) war Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium und damit ein wichtiger Vorgesetzter Albrecht Bähnischs. Als Vertreter des politischen Katholizismus war er zudem ein erklärter Kritiker der nationalsozialistischen Rassenpolitik.252 Die zweite deutsche Demokratie erlebte er nicht mehr: Er wurde 1934 im Zuge des Röhm-Putsches auf Kommando Reinhard Heydrichs in seinem Dienstzimmer erschossen, nachdem ihn Göring 1933 in das Reichsverkehrsministerium versetzt hatte. Es ist zu vermuten, daß Klausener einer der wichtigen, religiös motivierten Vorbilder Albrecht Bähnischs war, zumal er, wie Bähnisch, im Rahmen seines Berufes, soziales Engagement mit verwaltungsrechtlicher Expertise verband. Diese Verbindung läßt sich auch in den Ausführungsbestimmungen zu den Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzen nachvollziehen, welches die Mitarbeiter des Innenministeriums mit den Maßgaben der demokratischen Verfassung in Einklang brachten. Theanolte Bähnisch erwähnt Klauseners Erschießung in ihrem Diktat von 1972 im Zusammenhang mit dessen bereits an anderer Stelle angesprochenen Weigerung,
249 Zwischen dem Nordrhein-Westfälischen Landesamt für Verfassungsschutz und dem Bundesamt für Verfassungsschutz entstand eine starke Konkurrenzbeziehung. Entgegen der Zentralisierungsbestrebungen des Bundesamtes setzte Tejessy auf die Schaffung einer Koordinierungsstelle, die jedoch nie eingerichtet wurde. Vgl.: ebd., S. 123–125. 250 Vgl.: Naas: Entstehung, S. 184/185. 251 LHASA, MER, Rep. C 48 I a II, Lit. B Nr. 5. 252 Bekannt wurde seine Rede auf dem 32. märkischen Katholikentag am 24.06.1934. Er galt neben Grzesinski und Abegg als Vertrauensmann des Zentrums im Innenministerium. Noch immer ungeklärt ist Klauseners Rolle im Zuge des Preußenschlags: Von Severing wurde ihm vorgeworfen, seine Möglichkeiten zum Widerstand gegen die Nationalsozialisten nicht ausgeschöpft zu haben und sich unter dem Nachfolger Severings illoyal verhalten zu haben. Sicher ist, daß Klausener den Nationalsozialisten nicht in allen Aspekten ablehnend gegenüberstand. Wie viele seiner Amtskollegen glaubte er zudem an eine mögliche ‚Zähmung‘ Hitlers durch die Bürokratie. Vgl.: Große Kracht, Klaus: Erich Klausener (1885–1934), Preußentum und Katholische Aktion zwischen Weimarer Republik und Dritten Reich, in: Faber, Richard/Puschner, Uwe (Hrsg.): Preußische Katholiken und katholische Preußen im 20. Jahrhundert, Würzburg 2011, S. 271–296.
290 | Theanolte Bähnisch
vor dem Hintergrund des Ruhrkampfes 1923 eine Frau als Referendarin einzustellen.253 Während seiner Amtszeit als Landrat 1919 bis 1924 hatte der überzeugte Katholik Klausener den Aufbau eines flächendeckenden Gesundheits- und Fürsorgewesen gefördert, sich damit den Titel ‚sozialer‘ oder auch ‚roter Landrat‘ erarbeitet, so preußenweit auf sich aufmerksam gemacht und die Ablehnung rechter Kreise auf sich gezogen. Unter Minister Heinrich Hirtsiefer war er zum Ministerialdirektor ernannt worden und hatte ab 1924 als Leiter der Abteilung für Jugend- und Erwerbslosenfürsorge im Wohlfahrtsministerium gearbeitet, bis er am 08.10.1926 in das Innenministerium wechselte, um die Leitung der Polizeiabteilung zu übernehmen. „Fortan stand Klausener an der Schnittstelle von Politik und Verwaltung in Preußen“254 schreibt der Verfasser einer Studie über den Polizeibegriff im NS-Staat, Andreas Schwegel, in einem Artikel in der ‚Politischen Meinung‘, um Klauseners Einfluß in Preußen zu betonen. Albrecht Bähnisch arbeitete an dieser ‚Schaltstelle‘ mit Klausener zusammen. Bill Drews Bill Drews, der im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als preußischer Oberverwaltungsgerichtspräsident und mit seinen Vorarbeiten zur Verwaltungsreform ein wichtiger Berater des preußischen Innenministeriums war, hatte, mindestens im Rahmen zweier wichtiger Publikationen, ebenfalls mit Albrecht Bähnisch zusammengearbeitet. 1917/18 war der Liberale Drews von Reichskanzler Max von Baden ins Reichskabinett geholt worden, um den Staat zu reformieren. Seine Vorarbeiten zu einer Verwaltungsreform konnten im Zuge des Ersten Weltkriegs nicht mehr umgesetzt werden. 1921 wurde er Präsident des Preußischen Oberverwaltungsgerichts und gab 1927 den ersten Band eines wegweisenden Lehrbuchs zum Polizeirecht heraus, dessen zweiter Band 1933 unter Mitarbeit Robert Kempners, Christian Kerstiens, Albrecht Bähnischs und anderen aufgelegt wurde. Als wichtiger Berater des Innenministeriums in der Weimarer Republik und durch seine Vorarbeiten zur Verwaltungsreform unter Wilhelm II übte, wie erwähnt, nachhaltigen Einfluß auf das von Klausener, Kempner und Kerstiens erarbeitete PVG von 1931 aus. Er blieb als einziger der hier beschriebenen Personen auch während des Dritten Reichs im Staatsdienst. Daß er bis 1937 Präsident des OVG blieb, wirkte sich positiv auf die Zulassung Albrechts und Theanoltes zu Verwaltungsrechtsräten 1932/33 trotz Albrechts Amtsenthebung als Landrat und trotz seiner Zugehörigkeit zur SPD aus. Denn die Anträge auf Zulassung zum Verwaltungsrechtsrat mußten beim Oberverwaltungsgericht gestellt werden. Drews, der mehrfach von NS-Juristen attackiert wurde, welche sich gegen ein
253 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat, o. T., o. D. [1972], Teil I, Die Station beim Landrat, S. 19. 254 Schwegel, Andreas: Christ, Patriot und preußisches Reformer. Vor 70 Jahren wurde der Berliner Katholikenführer Erich Klausener ermordet, in: Die Politische Meinung 419/2004, S. 84–91, hier S. 87. Kursiv i. O.
Albrecht Bähnisch | 291
Festhalten am überlieferten Polizeirecht wandten und der so in einem Klima zwischen Anpassung und Anfeindung arbeitete, starb 1938.255 3.3.6 Inhalte von nachhaltiger Wirkung, Kontakte von langfristiger Bedeutung (auch) für Theanolte So wie das 1931 verabschiedete PVG und seine Ausführungsbestimmungen das Polizeirecht und die Ausgestaltung polizeilicher Arbeit in der zweiten deutschen Demokratie mitbestimmten, so wurden Drews, Klauseners, Kerstiens und Kempners Arbeiten mittelbar für Theanolte Bähnisch maßgeblich, als diese neben ihrem Amt als Regierungspräsidentin 1951 auch die Leitung der Bezirkspolizei übernahm. Vor allem die Bestimmungen des § 15, den Kempner in seinen Erinnerungen sein „Baby“256 nennt, blieben zentrale auch im Verwaltungsrecht der BRD. Der Paragraph regelte die Beschränkungen, denen die Polizei bei Festnahmen unterworfen war. Ausgerichtet auf die Einschränkung staatlicher Gewalt gegenüber den Bürgern, gilt er als eine zentrale Bestimmung, welche die Polizeigewalt in einer demokratisch verfaßten Gesellschaft betrifft. Sicherlich erinnerte sich Theanolte in diesem Zusammenhang an die Arbeiten ihres Mannes und die seiner Kollegen zur Polizeiverwaltungsreform. Als Regierungspräsidentin verfolgte Theanolte Bähnisch insgesamt ähnliche Zielen wie die Mitarbeiter des Preußischen Innenministeriums. Die preußischen Reformer waren darum bemüht, mit ihrer Arbeit Verwaltungsabläufe bürgernäher und reibungsloser zu gestalten, Gesetze und Ausführungsbestimmungen besser zu verbreiten, den Beamten und sonstigen Mitarbeitern der Preußischen Verwaltung darüber Orientierung zu geben, wie die neuen demokratischen Leitlinien der Preußischen Verwaltung im Alltag umzusetzen waren und somit die Verwaltung insgesamt transparenter und demokratischer zu gestalten. Theanolte Bähnisch wollte erklärtermaßen mit dem Regierungspräsidium eine ‚Brücke‘ von der Verwaltung in die Bevölkerung bauen.257 Sie verschickte regelmäßig Anweisungen über den Umgang mit neuen Richtlinien zunächst der Militärverwaltung und später der Niedersächsischen Landesregierung an die Landräte und Stadtdirektoren Sie veranlaßte Aushänge über neue Gesetze für die Bevölkerung und setzte sich für die Aus- und Weiterbildung von Verwaltungs-Personal, insbesondere von Frauen ein. Es ist davon auszugehen, daß bei der Festlegung auf Theanolte Bähnisch als Regierungspräsidentin in Hannover durch die britischen und deutschen politischen Eliten 1946 nicht nur die Erfahrungen in die Waageschale geworfen wurden, die Bähnisch selbst im Beruf gemacht hatte, sondern, daß auch die Arbeitsinhalte und die beuflichen Kontakte ihres Mannes Albrecht Bähnisch eine Rolle für Kurt Schuma-
255 Ule, Carl Hermann: Art. „Drews, Wilhelm Arnold“, in: Neue Deutsche Biographie 4 (1959), S. 117/118. Onlinefassung auf: http://www.deutsche-biographie.de/pnd1162194 59.html, am 11.10.2013. 256 Kempner: Ankläger, S. 57. Zur Bedeutung Drews für das PVG vgl. auch: Naas: Entstehung, passim. 257 Siehe Kapitel 5.2.2.
292 | Theanolte Bähnisch
chers und Oberst Humes Betreiben258 spielten, Theanolte Bähnisch ein so wichtiges Amt anzutragen. Der Kreis der überlebenden Politiker und Verwaltungsfachleute, die sich gegen den Nationalsozialismus eingesetzt hatten, war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges überschaubar, kleiner noch war der Zirkel jener, die nicht Zuflucht im Exil gesucht hatten. Daß Theanolte Bähnisch, eine grundständig geschulte Verwaltungsfachbeamtin, die zudem in solchen Kreisen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus verkehrte, in denen man vom Nutzen einer Zusammenarbeit aller demokratisch denkenden Akteure gegen die extreme Rechte überzeugt war, machte sie zu einer idealen Kandidatin für den Wiederaufbau Deutschlands. Politisch unbelastet und im Kreis weitgehend Unbelasteter verkehrend, aber sich gleichzeitig nicht moralisierend gegen Mitläufer des Systems positionierend, war sie die passende Besetzung für eine Nahtstelle zwischen Politik und Verwaltung, wie die Leitung des Regierungspräsidiums sie darstellte: ein Verwaltungsamt, das seinen Funktionsträger mit den nötigen Würden und Ressourcen ausstatte, um Gehör und Anerkennung zu finden, eine Funktion, in der ein großer Gestaltungsspielraum jenseits der direkten Amtsverpflichtungen, welcher nicht dem Odem der ‚Parteilichkeit‘ unterliegen sollte, bestand. Theanolte Bähnisch diese Machtfülle zu gewähren und sie auszuhalten war eine gleichermaßen chancen- wie risikoreiche Aufgabe für die SPD, zu der Bähnisch 1945 (erneut) ihre Zugehörigkeit erklären, deren Linie sie sich jedoch nie völlig unterwerfen sollte. Die Vergangenheit des Ehepaars Bähnisch, Theanolte Bähnischs Darstellung dieser Vergangenheit und die Unterstützung jener, die das Paar kannten und Theanolte Bähnisch als eine der ihren anerkannten, war zentral für das Vertrauen, mit dem man Theanolte Bähnisch 1946 ein Amt, das sie schließlich bis 1959 ausfüllen sollte, antrug. Nicht zuletzt, da Theanolte Bähnisch in der Retrospektive dazu neigte, die jeweiligen Kompetenzen verschwimmen zu lassen, bietet es sich an, die Unterschiede in Theanoltes und Albrechts Wirken für die Preußische Verwaltung sowie die Beziehungen zwischen den Institutionen noch einmal zusammenfassend aufzuzeigen. Mit ihren Stellen im Berliner Polizeipräsidium beziehungsweise in der Polizei-Abteilung des Innenministeriums hatten Theanolte und Albrecht zum Teil dieselben Vorgesetzten und verrichteten beide ihren Dienstalltag vor dem Hintergrund einer größer angelegten personellen wie inhaltlichen Verwaltungsreform. Da das Berliner Polizeipräsidium – wie andere Polizei- und Regierungspräsidien – als nachgeordnete Behörde dem Innenministerium unterstand, so ist im Grundsatz das Polizeipräsidium vor allem als eine ordnende, regulierende Instanz der Exekutive anzusehen. Vom Innenministerium wiederum kamen die Rahmen-Vorgaben für die Arbeit des Polizeipräsidiums. Was das Innenministerium an Reformgesetzgebung ausarbeitete, mußte von den Polizeipräsidien in die Praxis umgesetzt werden. Das Berliner Polizeipräsidium hatte allerdings aufgrund seiner Zuständigkeit für ‚Sicherheit und Ordnung‘ in der Hauptstadt und für die politische Polizei in ganz Preußen eine größere Bedeutung als die anderen Polizeipräsidien im Staat und eine dementsprechend engere Beziehung zum Innenministerium, beziehungsweise zur preußischen Regierung. Zudem waren durch die gleichzeitige Funktion des Polizeipräsidi-
258 Siehe Kapitel 5.1.1. und 5.1.2.
Albrecht Bähnisch | 293
ums als Regierungspräsidium sowie als Orts-, Kreis- und Landespolizeibehörde im Berliner Polizeipräsidium mehr Kompetenzen gebündelt, als in irgendeiner vergleichbaren Einrichtung im Staat Preußen. Die räumliche Nähe zueinander und die gefühlte Verantwortung beider Institutionen für den Schutz der Republik führte nicht selten zu Kompetenzgerangel zwischen den Behörden, brachte aber gleichzeitig eine enge Bande zwischen den Institutionen und seinen Mitarbeitern mit sich. Als Theanolte und Albrecht in diesen beiden Behörden arbeiteten, waren die Reformen im Polizeiwesen in vollem Gange. Die Gliederung der Polizei wurde mehrfach verändert, Zuständigkeiten verschoben sich, gesetzliche Grundlagen veränderten sich. Erst am 12.12.1928 erfolgte die einheitliche Gliederung der Preußischen Polizei in eine Verwaltungs-, Schutz- und Kriminalpolizei. 1931, mit dem Polizeiverwaltungsgesetz wurden inhaltliche Änderungen manifest. Dementsprechend war eine dauernde, enge Koordination zwischen den Behörden nötig. Während ihrer Zeit in der Theater- bzw. Vereinssachen-Abteilung wird Theanolte im Dienstalltag weniger mit den Veränderungen in der Polizeiverwaltung in Berührung gekommen sein, als in ihrer ersten Zeit im Präsidium, in der sie verschiedene Abteilungen durchlief. Dennoch ist davon auszugehen, daß sie, nicht zuletzt über die Kontakte ihres Mannes, über die Reformdiskussionen Bescheid wußte, sich darüber informierte und in den entsprechenden Zirkeln womöglich auch mitdiskutierte. Was die Weimarer Republik auf der Verwaltungsebene und darüber hinaus prägte, erlebte das Ehepaar Bähnisch nicht nur ‚live‘, sondern, durch die beruflichen Positionen im Brennpunkt der Auseinandersetzungen, sogar aus nächster Nähe mit: Konflikte auf institutioneller Ebene zwischen Preußen und dem Reich, nicht zuletzt in Fragen des Fortschritts in Verwaltungsfragen, aber auch die Bemühungen der politischen Polizei, die demokratiefeindlichen Parteien zu überwachen, und die der Schutzpolizei, Ausschreitungen von rechts wie von links und zwischen den Extremen im Zaum zu halten.
294 | Theanolte Bähnisch
3.4 ALBRECHT BÄHNISCHS MITARBEIT IN DER ‚SOZIALEN ARBEITSGEMEINSCHAFT BERLIN-OST‘ (SAG) 3.4.1 Die gespaltene Gesellschaft und die ‚bürgerliche Sozialreform‘ 3.4.1.1 Nächstenliebe, Sozialromantik, Forschergeist? Verschiedene Beweggründe für dasselbe Projekt Im letzten Jahr seines Studiums begann Albrecht Bähnisch sich zunächst für ein Jahr259 in der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost (SAG) zu engagieren. Damit war er an einem Projekt beteiligt, in das Geistliche, Wissenschaftler und Studenten verschiedener Fachrichtungen, Experten und Auszubildende aus dem Wohlfahrtssektor, Verwaltungsfachleute sowie andere in das Projekt und seine Pendants in anderen Städten involvierte Personen große Hoffnungen gesetzt hatten. Seit 1911 bestand die SAG als ein Nachbarschaftshilfe- und Siedlungsprojekt am Schlesischen Bahnhof, einem der ärmsten Viertel Berlins. Ziel ihres Begründers, des Theologen Friedrich Siegmund-Schultze, war es, auf der Basis von Freundschaftspflege, Wohlfahrtsarbeit und Volksbildungsarbeit zwischen verarmten, kulturell benachteiligten Arbeitern auf der einen und gebildeten, gut situierten Bürgern auf der anderen Seite, Austausch, Verständnis und Versöhnung herzustellen. Siegmund-Schultze sah es als unabdingbar an, daß die Mitarbeiter der SAG ihren Wohnsitz nach Friedrichshain verlegten, um Präsenz vor Ort zeigen zu können. Mit seinem Projekt wollte der Begründer, in dessen Wahrnehmung sich die Kirche und das gebildete Bürgertum schuldig gemacht hatten, indem sie ihre christliche Verantwortung gegenüber den minder privilegierten Bürgern aufgegeben hätten, ein lebendiges Beispiel zur Überwindung von Klassengrenzen und zur aktiv gelebten, christlichen Nächstenliebe in einer sozial, politisch und kulturell gespaltenen Industriegesellschaft geben.260 Doch so verschieden die Mitarbeiter der SAG waren, so unterschiedlich waren die Ziele, welche sie mit ihrem Engagement im Einzelnen verbanden. Die Bestrebungen reichten von purer Neugierde, der Hoffnung auf wissenschaftliche Erkenntnisse und pragmatische Anregungen für die eigene berufliche Laufbahn, über den schlichten Willen, Hilfe organisatorischer, pädagogischer und finanzieller Natur zu leisten, Diskussionen in der Gesellschaft zu provozieren oder staatliche Reformen anzuschieben, bis hin zu religiöser Sinnsuche oder gar an Allmachts-Phantasien grenzende Überlegungen, durch die SAG-Arbeit die Spaltung der Klassen auflösen zu können.
259 Einem Lebenslauf, der seiner Personalakte beiliegt, zufolge, arbeitete er zunächst von Mai 1921 bis Mai 1922 in der SAG mit. LHASA MER, C 48 I a II Lit. B, Nr. 5, Lebenslauf o. D. [1922]. Für diesen Zeitraum ist auch die Teilnahme Albrecht Bähnischs an Sitzungen der SAG belegt. Evangelisches Zentralarchiv Berlin (EZA), Ruth Pabst [Henrike Hoff i. A.] an Nadine Freund, 09.09.2009. 260 Für einen gelungenen, kurzen Überblick vgl.: Sachße: Siegmund-Schultze, in: Krauß: Soziale Arbeit.
Albrecht Bähnisch | 295
Wo Albrecht Bähnischs Motivation für die Mitarbeit in der SAG zu suchen ist, wie er sich mit seiner Position zwischen der im Kaiserreich entstandenen bürgerlichen Sozialreform und der Sozialdemokratie, die wesentlich den Aufbau der Weimarer Republik zum Sozialstaat vorantrieb, verortete, welchen Beitrag er selbst zum Projekt leistete und welche Anregungen und Kontakte er und seine Frau Theanolte aus seiner Arbeit, mit der auch sie aktiv in Berührung kam, mitnahmen, diese Frage soll im Zentrum des nächsten Kapitels stehen. Damit werden Zusammenhänge greifbar, die für Theanoltes Arbeit ab 1946 relevant wurden. Das Wirken Albrecht Bähnischs in der SAG, die Kontakte, die er in diesem Zusammenhang etabliert hatte und die Ideen, die in jenen Kreisen zirkulierten, blieben nicht nur über Albrecht Bähnischs Tod hinaus für seine Frau relevant, sondern sie fanden sogar erst zu jener Zeit sichtbaren Niederschlag in ihren Handlungen und Äußerungen. Der Umstand, daß Theanolte Bähnisch durch die SAG auch mit einigen Personen und Ideen konfrontiert wurde, welche für sie bereits in anderen Zusammenhängen in den 1920er Jahren relevant geworden waren, zeigt einmal mehr, daß die verschiedenen Kreise, in denen sich das Ehepaar bewegte, auffällig starke Schnittmengen bildeten. Diese lassen sich oft auf ein besonderes Interesse der beteiligten Personen, Staat und Gesellschaft demokratisch zu reformieren und den Sozialstaat weiter auszubauen, zurückführen. Theanolte Bähnisch trug wesentlich dazu bei, Kerngedanken des Projekts SAG und seiner Unterstützer nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder anschlußfähig zu machen. Mit der Frage, warum sich Albrecht Bähnisch in der SAG engagierte, wird auch ein von Seiten der Forschung lange vernachlässigter und erst in jüngster Zeit von Jens Wietschorke näher untersuchter Aspekt des Engagements in der SAG näher beleuchtet werden: der eigene Vorteil, den sich die Protagonisten in Bezug auf ihre jeweils angestrebte Karriere mit ihrer Arbeit in der SAG verschafften.261 Das Projekt lediglich als einen Auswuchs nostalgisch verklärter Sozialromantik von ‚Katheder‘und ‚Schönwetter-Sozialisten‘ zu sehen, wäre nämlich ebenso verfehlt, wie den teilweise prominenten und einflußreichen Handelnden Selbstlosigkeit in ihrem Engagement zu unterstellen. Für viele der Mitarbeiter, auch für jene, die sich dort nur für eine sehr kurze Zeit engagierten, hatte das Wirken in der SAG handfeste politische und berufliche Vorteile. Dies traf – solange die Weimarer Demokratie in ihren Grundfesten erhalten blieb – auch für Albrecht Bähnisch zu. In der zweiten deutschen Nachkriegszeit profitierte schließlich auch Theanolte Bähnisch von Ideen, Konzepten und Kontakten aus der SAG, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erneut anschlußfähig wurden. Um den Kontext zu erklären, in dem Albrechts Arbeit stand, soll jedoch zunächst das Bild, welches in bürgerlichen Kreisen vom Stadtteil Friedrichshain und seinen Bewohnern vorherrschend war, skizziert werden, anschließend die Genese, die Träger und die Ziele von Projekten der bürgerlichen Sozialreform sowie die tägliche,
261 Wietschorke: Settlement. Der Aufsatz stellt eine Vorstudie zur breiter angelegten, Ende 2013 publizierten Dissertation dar. Vgl.: Wietschorke, Jens: Arbeiterfreunde. Soziale Mission im dunklen Berlin 1911–1933, Frankfurt a. M. 2013.
296 | Theanolte Bähnisch
praktische Arbeit der SAG und ihre Entwicklung als eine veränderungsbereite Strömung innerhalb der Sozialreformbewegung. 3.4.1.2 Sex and Crime. Der Berliner Osten in der bürgerlichen Wahrnehmung Zwischen 1871 und 1919 hatte sich im Zuge der Industrialisierung die Zahl der Einwohner Berlins auf 3,7 Millionen vervierfacht. Immer mehr Menschen hatten ihr Leben auf dem Land, das ihnen im Vergleich zu den urbanen Verlockungen ärmlich und beschränkt erschienen war, hinter sich gelassen, um in die Städte, vor allem in die aufstrebende Me-tropole Berlin überzusiedeln. Für die meisten, die in der Hauptstadt ihren Traum von Freiheit und sozialem Aufstieg verwirklichen wollten, war jedoch ein kärgliches Leben in einem der dunklen Hinterhof-Häuser im Norden oder Osten der Stadt Realität geworden. 45 Prozent aller Berliner lebten um die Jahrhundertwende in solchen Gebäuden, über die der Berliner Heimatdichter Zille hatte verlauten lassen, daß außer der Akustik nichts an ihnen gut sei.262 Als der Student der Rechtswissenschaften Albrecht Bähnisch 1921 seinen Wohnsitz in der Friedrichshainer Fruchtstraße nahm, um dort als Mitarbeiter der SAG ‚Tätige Nachbarschaftshilfe‘ im Sinne Siegmund-Schultzes zu leisten, war das heutige Berliner Szeneviertel einer jener Stadtteile, die geprägt waren von solchen Mietskasernen und den umliegenden Industriebetrieben, in welchen die Bewohner des Stadtteils mehr schlecht als recht ihr Auskommen fanden. Von den Neuerungen, die der ‚Weimarer Sozialstaat‘ bringen sollte, war dort im letzten Studienjahr Bähnischs noch kaum etwas zu spüren. Die bereits seit zehn Jahren im Stadtteil arbeitende SAG sah sich – drei Jahre nach dem Kriegsende und der Ausrufung der Republik – im Wesentlichen vor die gleichen sozialen Probleme und damit Aufgaben wie in den Vorjahren gestellt.263 Das Hilfsdienstgesetz von 1916 hatte die Emanzipation der Arbeiter befördert und den sozialpolitischen Bestrebungen aller Strömungen der Sozialreform eine neue Grundlage beschert, die sich nach der Ausrufung der Weimarer Republik noch stärker fundieren sollte. Doch zu einem strukturellen Bruch der Lage in Friedrichshain hatte die Revolution von 1918/19 nicht geführt. Bis Albrecht Bähnisch sich in der SAG zu engagieren begann, war durch das Stinnes-LegienAbkommen zwar die Macht der Gewerkschaften gewachsen (und gemeinsam mit der Rolle der Unternehmer in Form einer in der Verfassung verankerten Tarifpartnerschaft festgeschrieben worden) sowie der Achtstundentag bei vollem Lohnausgleich eingeführt worden. Wirkliche finanzielle Besserstellungen der Arbeiter sowie Programme für den sozialen Wohnungsbau ließen jedoch noch bis Mitte der 20er Jahre auf sich warten. Die Arbeitslosenversicherung sollte erst 1927 beschlossen werden und auch die ‚Reichsfürsorgepflichtverordnung‘ sowie die ‚Reichsgrundsätze über
262 Einen guten Einblick in Zilles Prosa bietet: Tschechne, Wolfgang (Hrsg.): Heinrich Zille. Hofkonzert im Hinterhaus. Geschichten aus (manchmal) gemütlichen Jahren, Hannover 1976. 263 Allerdings waren durch Kriegsverluste die Reihen der SAG-Mitarbeiter ausgedünnt. Auch viele der ursprünglichen Bewohner Friedrichshains hatten ihr Leben im Krieg gelassen.
Albrecht Bähnisch | 297
die Voraussetzungen, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge‘, wurden erst 1924 Gesetz. Selbst nach der Verabschiedung dieser Richtlinien und Gesetze stellten die darin festgeschriebenen Leistungen für die Bedürftigen, von denen unzählige durch die Raster der staatlichen Sozialversicherungen fielen, kein einklagbares Recht dar. Viele Bewohner der Elends-Quartiere waren und blieben deshalb auch während der ‚goldenen Jahre‘ der Republik auf Fürsorgeleistungen aus städtischer oder privater Hand angewiesen und sahen sich nicht selten gezwungen, auf andere, mitunter weniger tugendhafte oder rechtmäßige Einkommensquellen auszuweichen. Wahrgenommen wurden von den besser gestellten Berliner Bürgern vielmehr das kriminelle Potential sowie die Häufung der Sittlichkeitsdelikte im Stadtteil, als die sozialen Probleme, welche die Elendsquartiere prägten. Das Wissen um die alltäglichen Nöte des ‚kleinen Mannes‘ in Friedrichshain und den angrenzenden Quartieren war in den ‚besseren‘ Berliner Stadtteilen264 denkbar gering. Rolf Lindner spricht vom Osten Berlins gar als einer „terra incognita“ für das Berliner Bürgertum und zitiert dazu den Pastor Günther Dehn, der 1913 sinngemäß geschrieben hatte, die Wahrscheinlichkeit, daß ein deutscher Großstädter aus einem bürgerlichen Stadtteil nach Spanien oder Afrika komme, sei vielleicht größer, als daß er mit eigenen Augen sehe, wie eine Stunde östlich oder nördlich seine Mitbürger durchs Leben kämen.265 Das Viertel um den Schlesischen Bahnhof, in dem 1921/22 auch Albrecht Bähnisch lebte, galt im gehobenen Bürgertum nicht etwa als ein vernachlässigter Stadtteil, dessen Bürger die besondere Aufmerksamkeit und Förderung durch die Stadt verdient hätten, sondern als ein gefährliches ‚Tor zur Unterwelt‘. Denn dort konnte – um nur drei Beispiele zu nennen – im Jahr 1906 der ‚Hauptmann von Köpenick‘ nach seinem Überfall auf die Stadtsparkasse dingfest gemacht werden, dort wurde 1921 der wegen 23fachen Mordes angeklagte Wurstverkäufer Karl Großmann in flagranti neben einer nackten Frauenleiche ertappt und dort hatte 1928 der kommunistische Ringer-Verein ‚Immertreu‘ eine Massenschlägerei und Messerstecherei mit über 200 beteiligten Personen angezettelt.266 Neben dem kriminellen wurde in der Presse besonders auch der politische Zündstoff, der in den Arbeitervierteln schwelte, als Gefahr für die bürgerliche Ordnung thematisiert. 1919 waren, angezettelt von jenen, denen Friedrich Eberts ‚Revolution‘ als eine halbherzige erschienen war267, in Friedrichshain die erbittertsten Barrikadenkämpfe ganz Berlins ausgetragen worden. In den 1920ern hatte der Rotfrontkämpferbund im ‚roten Stadtbezirk‘, in dem für die KPD Stimmenanteile von bis zu 45 Prozent erreicht wurden, wiederholt seine Mitglieder zu Aufmärschen gegen die politischen Eliten, die für die trostlose Lage verantwortlich gemacht wurden, zusammengetrommelt.
264 Dazu zählten vor allem der Prenzlauer Berg, Charlottenburg und Lichterfelde. 265 Vgl.: Lindner, Rolf: Friedrich Siegmund Schultze – Facetten einer Persönlichkeit, in: Tenorth: Siegmund-Schultze, S. 7–11, hier S. 7. 266 Vgl.: Feustel, Jan: Spaziergänge in Friedrichshain, Berlin 1994, S. 61. 267 Flemming, Jens: Die halbierte Revolution: Deutschland 1918–1920, in: Sozialwissenschaftliche Informationen für Unterricht und Studium, 8 Jg. (1979), S. 95–101.
298 | Theanolte Bähnisch
Während in Fritz Langs ‚Metropolis‘ – nicht bloß Futureske, sondern gleichzeitig Parabel auf die in den 20er Jahren268 in Großstädten herrschenden Zustände – das soziale Elend der Arbeiter in der ‚Unterstadt‘ und das diesen Zuständen innewohnende revolutionäre Potential im Allgemeinen beschrieben wurde, fanden das kriminelle Potential und das lasterhafte Treiben in Friedrichshain im Speziellen Eingang in die gesamtstädtische Populärkultur. Das Leben der kleineren und größeren Gauner, die im sagenumwobenen ‚Koppenkeller‘ verkehrten, sowie der Prostituierten, die sich mit Vorliebe am Andreasplatz versammelten, lieferte den Dichtern, Filmemachern und Romanschreibern ein Sujet, von dem neben aller Abscheu auch eine große Faszination ausging. In Hundertscharen stürmte das Publikum in den 20er Jahren die Kinos, um in Filmen über das ‚Arme-Leute-Berlin‘ das Leben des ‚einfachen Mannes‘, der vom ‚guten Wege‘ abkommt, mitzuerleben. Von Heinrich Zille waren solche ‚Milljöh-Studien‘ schon früher als im Film in Gedichten und der Malerei sowie in kolorierten Bilderzählungen – und dabei stets an der Grenze zwischen humoristischer Unterhaltung und Sozialkritik aufgezogen worden: „Hätt’n wir nich so dreckig jewohnt un’ wär’n nicht so arm gewesen, dann wär woll manches anders jeworden“269, ließ Zille (der unter einem Pseudonym schrieb) eine seiner Protagonistinnen in den 1921 im Privatdruck veröffentlichten und daraufhin von der Zensur sofort verbotenen ‚Hurengesprächen‘ sagen. So hatte er sein Talent und seinen Einfluß genutzt, um die himmelschreienden Zustände in den Arbeitervierteln anzuprangern. Manch einen mag die trostlose Lage der Arbeiterfamilien auf diesem Weg erreicht und vielleicht sogar zum Umdenken oder gar zum persönlichen Engagement bewogen haben. Auch Siegmund-Schultze war sich der Notwendigkeit von Propaganda für sein Unterfangen in Friedrichshain sehr bewußt. Über Mundpropaganda, aber auch mit Wurfsendungen und Anzeigen in diversen Zeitungen und Zeitschriften unterrichtete er über die Arbeitstreffen und sonstigen Aktivitäten der SAG, weil er hoffte, damit ein Interesse am Berliner Osten, das nicht auf den Boden des Unterhaltungsbedürfnisses, sondern auf den der Hilfsbereitschaft fiel, befördern zu können.270 Siegmund-Schultze und seine Mitarbeiter warben vor allem in der Hauptstadt für ihre Sache, beschränkten sich jedoch nicht darauf.
268 Der Film wurde 1925/1926 gedreht und verarbeitete Impressionen von Langs AmerikaReise. Im Film beutet eine Klasse die andere aus und der unteren Klasse ist es im Grunde unmöglich, aufzusteigen. Die Hauptfigur Freder überzeugt jedoch die ‚Bourgeoisie‘ vom Nutzen der Fürsorge gegenüber den Arbeitern und die Arbeiter davon, daß die Revolution nicht das geeignete Mittel zu ihrer Besserstellung sei. Als Mittler zwischen den Klassen erreicht Freder die Versöhnung der Klassen, indem er mit ‚Herz‘ zwischen ‚Hand‘ und ‚Hirn‘ vermittelt. 269 Vgl.: Pfeifer, W. [Zille, Heinrich]: Hurengespräche – gehört, geschrieben und gezeichnet von W. Pfeifer, Berlin 1921, Neuauflage [Faksimile], München 2000. Das Werk erschien mit der falschen Jahresangabe ‚1913‘. 270 EZA, 51/S II b 13. Die Akte enthält Listen mit Ansprechpartnern in der Verwaltung, im Verlagswesen und in der Jugend- sowie Erwachsenenbildungsbewegung, die mit Informationsmaterial zu den Aktionen der SAG versorgt werden sollten.
Albrecht Bähnisch | 299
Denn Probleme, wie sie sich in Friedrichshain zeigten, gab es nicht nur in Berlin. Die Lage in der Hauptstadt war in den dunkelsten Befürchtungen Siegmund-Schultzes nur traurige Avantgarde für die zu erwartende Entwicklung auch in anderen deutschen Städten. Deshalb waren nach und nach auch an anderen Orten ‚Ableger‘ der SAG entstanden. Albrecht Bähnischs Schwester beispielsweise engagierte sich in der SAG in Marburg.271 Gleichzeitig erlebte und bekämpfte die SAG in deutschen Städten Phänomene, die in London und Chicago schon viel früher beobachtet worden waren,272 was dort schon im 19. Jahrhundert soziale Initiativen auf den Plan gerufen hatte. An diese knüpften die Mitarbeiter der SAG personell wie inhaltlich an. Sie integrierten sich auf diesem Weg in ein internationales Netzwerk der SettlementBewegung, während sie gleichzeitig ein deutsches aufbauten. 3.4.1.3 Die bürgerliche Sozialreform zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik 1889 hatte Jane Addams gemeinsam mit Ellen Gates Starr in Chicago die Kolonie ‚Hull House‘ und damit eines der ersten und das weltweit bekannteste ‚Settlement‘Projekt begründet. Hull House bot in seinen Siedlungshäusern – denn der Kerngedanke des ‚Settlement‘ war die permanente Anwesenheit der Helfer vor Ort – jede Woche für etwa 2.000 Menschen Bildungs- und Sozialleistungen an. Inspiriert worden waren die Amerikanerinnen von der seit 1884 bestehenden ‚Toynbee Hall‘ in London. Die Arbeit durch und für Frauen nahm jedoch in der amerikanischen Kolonie bedeutend mehr Raum ein, als in der britischen. Auch in Deutschland stand die SAG nicht allein da: Protagonisten der als ‚bürgerlich‘ definierten Sozialreformbewegung hatten sich, beginnend schon im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, weiterhin für eine schrittweise ‚soziale Verbesserung‘ der ärmeren Schichten durch Fürsorgeleistungen und Bildungsangebote eingesetzt. Der ‚Centralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen‘, einer der ältesten und bekanntesten Träger, war bereits 1844 gegründet worden und bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges tätig geblieben. Auf lokaler Ebene hatte er im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Vertretern der ärmeren Schichten Spar-, Pensions-, Krankenund Unterstützungskassen eingerichtet und ein Angebot an Fortbildungskursen etabliert. Der 1872 etablierte ‚Verein für Socialpolitik‘ und die 1901 gegründete ‚Gesellschaft für soziale Reform‘, die erst 1936 beziehungsweise 1933 aufgelöst wurden, verfolgten ähnliche Interessen. Sie versuchten jedoch – im Unterschied zum Centralverein – mit ihren Konzepten auch Einfluß auf die staatliche Lenkung im Sinne einer
271 Soziale Arbeitsgemeinschaft Ost. Anschriftenliste der auswärtigen Mitarbeiter der Sozialen Arbeitsgemeinschaft, Berlin 1927, S. 5. 272 Vgl.: Booth, Charles: Life and labour of the people in London, 17 Bd., London, 1902– 1904. Booth bezog sich vor allem auf Quellen aus dem ‚Toynbee Hall‘-Settlement, präsentierte eine erdrückende Fülle von Karten und graphischen Darstellungen über die Lage und Zusammensetzung einzelner Berufsgruppen in London und prangerte – vor allem auch gegenüber den Behörden – in einer bis dahin unbekannten Weise die sozialen Nöte der Arbeiter an.
300 | Theanolte Bähnisch
Förderung staatlicher Sozialpolitik und der Abschaffung des Dreiklassen-Wahlrechtes zu nehmen.273 Die bürgerliche Ordnung als solche stellten die bürgerlichen Sozialreformer kaum in Frage. Ziel ihrer Initiativen war es vielmehr, die Bedrohung jener Ordnung und der Geschlossenheit des Nationalstaates abzuwenden. Denn Armut und Abhängigkeit der unteren Schichten provozierten in ihren Augen die Gefahr revolutionärer Umtriebe und ‚gesamtgesellschaftlicher Dekadenz‘.274 Dem wollten die Initiativen begegnen, indem sie, auf eine staatsbürgerliche Eingliederung der Arbeiter in den Staat abzielend, diesen ‚bürgerliche Werte‘ vermittelten. Karitative Bestrebungen, der Wille zur Erhaltung und zum Ausbau der ‚Kulturnation‘ aus ‚sittlicher Verantwortung‘ sowie in Ansätzen auch die Suche nach einem wirtschaftpolitischen Konzept das, die Folgen des entfesselten Manchester-Kapitalismus vor Augen, „weder Kommunismus noch Kapitalismus“275 sein sollte, vermischten sich in den Initiativen und bestimmten, je nach Gewichtung durch die Hauptverantwortlichen, die Ausrichtung und Schwerpunktsetzung ihrer Arbeit.276 Träger der beschriebenen Projekte waren vor allem akademisch Gebildete, Akteure, die der linksliberale Nationalökonom Lujo Brentano im Jahr 1890 aufgrund ihrer „Stellung fern von den streitenden Interessen“ als „besonders geeignet“ bezeichnet hatte, „in unserer Frage zwischen Kapital und Arbeit als Vermittler zwischen den im Machtbesitz befindlichen und den aufstrebenden Klassen zu dienen.277“ Die von Brentano unterstellte Neutralität war jedoch weder den Vorsitzenden der großen Wohlfahrtsorganisationen, noch den Hochschullehrern, Studenten und höheren Verwaltungsbeamten, die sich im Rahmen solcher Initiativen engagierten, eigen. Ihre Vermittlungsarbeit dürfte – auch in der Weimarer Republik – nicht zuletzt dem Interesse entsprungen sein, die Positionen, welche sie im Gefüge der bürgerlichen Ordnung erklommen hatten, zu sichern, indem sie den Staat auf der Leitlinie der hergebrachten Gesetze verwaltbar und regierbar hielten. Das Risiko einer politischen Revolution, die das Ende jenes Verwaltungsapparates und damit berufliche wie private Unsicherheit bedeutet hätte, suchten sie – was ein ernsthaftes soziales Engagement
273 Zu den Verbänden vgl.: Schulz, Günther: Bürgerliche Sozialreform in der Weimarer Republik, in: Bruch, Rüdiger vom (Hrsg.): Weder Kommunismus noch Kapitalismus. Bürgerliche Sozialreform in Deutschland vom Vormärz bis in die Ära Adenauer, München 1985, S. 181–217, hier S. 181 und 187. 274 Vgl.: Reulecke, Jürgen: Die Anfänge der organisierten Sozialreform in Deutschland, in: Bruch: Kommunismus, S. 21–59. 275 Vgl.: Jentsch, Carl: Weder Kommunismus noch Kapitalismus. Ein Vorschlag zur Lösung der europäischen Frage, Leipzig 1893. Der Kapitalismus im Sinne privaten Eigentums an Produktionsmitteln wurde jedoch nicht hinterfragt. 276 Vgl. dazu auch: Tennstedt, Florian: Sozialreform in Deutschland. Einige Anmerkungen zum Verhältnis von wissenschaftlichen (Vereins-)Initiativen und politischer Herrschaft seit dem 19. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Sozialreform, 32. Jg. (1986), S. 10–24, hier S. 10. 277 Brentano, Lujo: Die Stellung der Gebildeten zur sozialen Frage, Berlin 1890, S. 3–4.
Albrecht Bähnisch | 301
nicht ausschließt – mit Hilfe ihrer Ideen zur Reform und ihrer tätigen Hilfe vor Ort abzuwenden. Schließlich war in den Projekten der gestiegene Einfluß von Frauen im Wohlfahrtssektor erkennbar. Nicht von ungefähr leitet Christoph Sachße die Ursprünge moderner Sozialarbeit aus dem Zusammenspiel von ‚bürgerlicher Sozialreform‘ und ‚bürgerlicher Frauenbewegung‘ im Kaiserreich her.278 Soziale Arbeit wurde zu dieser Zeit als ein spezifisch weibliches Feld besetzt und im Sinne der weiblichen Emanzipation zur beruflichen Professionalisierung von Frauen genutzt. Während des Ersten Weltkrieges war es – wie im Zusammenhang mit Dorothea Noltes Staatsexamensarbeit beschrieben – der bürgerlichen Frauenbewegung gelungen, ihren Einfluß im Staat durch ihre Arbeit im sozialen Sektor zu mehren. In der Weimarer Republik knüpften die in der Wohlfahrtsarbeit tätigen Frauen an Erfahrungen an, die sie während des Krieges im Versorgen, Pflegen und Betreuen gesammelt oder vertieft hatten. Einige von ihnen nutzten nach Kriegsende nicht nur ihre gewonnene Expertise, um den Sozialstaat mit aufzubauen, sondern sie engagierten sich parallel in Projekten der bürgerlichen Sozialreform. Dies trifft, um nur einige prominente Namen zu nennen, für den Kontext der SAG beispielsweise auf Gertrud Bäumer279, Alice Salomon280 und Agnes von Zahn-Harnack zu, die allesamt im Nationalen Frauendienst (NFD) aktiv gewesen waren. Dieser hatte sich – in Absprache mit dem Kriegsamt – ein Aufgabengebiet an der ‚Heimatfront‘ geschaffen, das als Äquivalent zum Dienst der Männer im Heer angesehen wurde. Bei ihrer Arbeit in der Sozialreform orientierte sich die deutsche bürgerliche Frauenbewegung an der Vorreiterrolle ihrer Mitstreiterinnen im Ausland. Die erwähnte Jane Addams hatte den deutschen Frauen als Begründerin von Hull House seit 1889 vorgelebt, wie eine den weiblichen Einfluß mehrende, weil staatliche Konzepte beeinflussende Integration bürgerlicher Frauen in die Wohlfahrtsarbeit aussehen konnte.281 Auf internationalen Settlement-Konferenzen konnten Protagonisten der deutschen Sozialreform-Bewegung, insbesondere Frauen, von Addams‘ Erfahrungen profitieren.282 Da sich Addams insbesondere für den Schutz von Prostituierten engagiert hatte283 und ihr Name in der theoretischen Auseinandersetzung um das Thema eine wichtige Rolle für die Frauenwohlfahrtspolizei in Köln gespielt hatte,
278 Sachße: Mütterlichkeit. 279 Gertrud Bäumer war zwar nicht Mitarbeiterin der SAG, gehörte jedoch zum ‚Freundeskreis‘ und sprach auf Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft. Vgl.: Wietschorke: Arbeiterfreunde, S. 12. 280 Alice Salomon wird von Franz-Jakob Gerth gar als „Nestorin der deutschen Methodenentwicklung“ in Bezug auf die Sozialarbeit bezeichnet. Gerth, Franz-Jakob: Ansätze methodisch unterbauter Sozialarbeit, in: Delfs: Friede, S. 331–340, hier S. 338. 281 Vgl. dazu: Schüler: Frauenbewegung. 282 1931 konnte eine solche Konferenz unter der Leitung von Dr. Alix Westerkamp in Berlin stattfinden. Vgl.: Westerkamp, Alix: IV. Internationale Settlement-Konferenz veranstaltet von der Internationalen Settlement-Vereinigung vom 16. bis 20. Juli 1932 in der Siedlung Ulmenhof der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin Ost, Berlin 1932. 283 Vgl.: Addams, Jane: A new conscience and an ancient evil, New York 1912.
302 | Theanolte Bähnisch
war ihr Name, wenn nicht gar ihre Person, Dorothea Nolte vermutlich in diesem Zusammenhang geläufig geworden. Die Projekte der bürgerlichen Sozialreform und ihre Träger unterschieden sich in der Weimarer Republik zunächst – auch aufgrund einer weitreichenden Kontinuität von Hochschul- und Verwaltungs-Eliten – kaum von jenen des Kaiserreichs. Neben sozialliberal eingestellten Protagonisten engagierten sich vor allem aus dem Glauben motivierte Personen in den Initiativen und versuchten auf diese Weise Einfluß auf staatliches Handeln zu nehmen. 284 Nach der Aufhebung der Sozialistengesetze konnten die Initiativen zunächst vereinzelt, mit Beginn der Weimarer Republik vermehrt Anhänger der So-zialdemokratie, vor allem Vertreter des gemeinhin als ‚revisionistisch‘ bezeichneten Flügels285, an sich binden. Der Anteil bekennender Anhänger jener „halbe[n] Regierungs- und halbe[n] Oppositionspartei“286 lag in der SAG bedeutend höher, als in anderen Initiativen der Sozialreform.287 Die Weiterentwicklung der Universitäten im Sinne der Weimarer Demokratie sorgten für den nötigen Nachwuchs in den Projekten, vor allem auch der SAG. In der Lehre der Studienfächer Nationalökonomie, Rechtswissenschaft, Staatswissenschaft und Medizin nahm – insbesondere vor dem Hintergrund des Sozialstaatsgedankens, der in der Weimarer Verfassung verankert war – die Vermittlung von Wissen über soziale Probleme in der Gesellschaft immer breiteren Raum ein. Darüber hinaus erhielten junge Studienfächer wie Ethnologie und Soziologie, in deren Zentrum von jeher Fragen des sozialen Zusammenlebens standen, immer größeren Zulauf. Zunehmend versuchten Studenten verschiedenster Studienfächer, zumal sie durch entsprechend offene Professoren dazu ermutigt wurden, über das an der Hochschule vermittelte theoretische Wissen hinaus praktische Kenntnisse über das Leben und die Arbeit ‚einfacher Leute‘ zu sammeln. Dafür eignete sich die Mitwirkung in sozialreformerischen Initiativen gut, die in solchen mit ‚Siedlungs-Charakter‘ noch besser.288
284 Konnte die katholische Kirche – und damit ihre Soziallehre – in der Weimarer Republik über das Zentrum ihren politischen Einfluß direkt in Parlament und Regierung, vor allem über den Reichsarbeitsminister und Priester Günther Brauns, geltend machen, so fehlte dem Protestantismus eine entsprechende Interessenvertretung. Über das Sammeln und die Präsentation von statistischem Material gegenüber Behörden, über Publikationen, die im Rahmen der Initiativen sowie über die Zusammenarbeit mit kommunalen Trägern entstanden, fanden über die praktische Sozialarbeit vermehrt auch protestantische Ansätze zur Gestaltung der Gesellschaft ihren Weg zu den Verantwortlichen. Vgl.: Schulz: Sozialreform, S. 197–199. 285 Vgl.: Gräser, Marcus: Wohlfahrtsgesellschaft und Wohlfahrtsstaat: Bürgerliche Sozialreform und Welfare State Building in den USA und in Deutschland 1880–1940, Göttingen 2009, S. 200. 286 Klaus Schönhoven zitiert nach: Grebing: Arbeiterbewegung, S. 77. 287 Allgemein sei, so Wolfgang Gräser, in deutschen Kommunen „so etwas wie eine Schnittmenge“ aus Bürgerlicher Sozialreform und Sozialdemokratie herangewachsen. Vgl.: Gräser: Wohlfahrtsgesellschaft, S. 200. 288 Der Historiker Marcus Gräser vertritt die Meinung, daß die SAG in vielerlei Hinsicht das einzige deutsche Settlement war, da hier im Gegensatz zu anderen Projekten, die so etwas
Albrecht Bähnisch | 303
Siegmund-Schultze hatte sich bereits 1912 von einem entsprechenden Nutzen seiner Initiative, nicht nur im direkten, alltäglichen Sinn, sondern vor allem auch auf lange Sicht hin, überzeugt gegeben: „Der Weg zur Erkenntnis der wirtschaftlichen Notwendigkeiten ist der, die wahren Verhältnisse mit eigenen Augen zu sehen. Erst wenn über alle sozialen Fragen im Landtag und Reichstag eine Generation zu entscheiden hat, die selbst zwischen Arbeitern gewohnt hat – und zwar mit dem Willen zur Hilfe – wird eine durchgreifende Besserung der Verhältnisse stattfinden.“289 Eine führende Position in der industrialisierten Gesellschaft auszuüben, sei es in einer Behörde, in einem Krankenhaus, in einem Unternehmen, oder gar in der Politik, wurde ohne praktische Kenntnisse über die Lebensweise breiter Bevölkerungsschichten zunehmend schwieriger. Mit der Großen Koalition in der Weimarer Republik und in Preußen gedieh ein politisches Klima, in dem es honoriert wurde, wenn Eliten in Politik und Verwaltung sich entsprechende Kenntnisse aneigneten. Man könnte sagen, daß das Fachstudium in jenen Kreisen die Pflicht, die Mitarbeit in einem sozialen Projekt eine besondere Vorteile verschaffende Kür für angehende Akademiker war. Der Pionier auf diesem Gebiet, Siegmund-Schultze, hatte schon im Kaiserreich festgehalten, daß „ohne soziales Studium […] ein Berufsstudium des Studenten heute nicht mehr denkbar“290 sei. Soziale Fragen sollten in der akademischen Ausbildung nicht nur quantitativ in den folgenden Jahren mehr Raum einnehmen als zuvor, was auch mit einer langsamen Veränderung der politischen Ausrichtung der Lehre in Zusammenhang stand. Bedeutende republiknahe Soziologen, Staatswissenschaftler, Juristen und Nationalökonomen verbreiteten die Überzeugung, daß für den Aufbau und den Erhalt einer stabilen Demokratie die politische und soziale Integration so vieler Bürger wie möglich von Nöten sei. Vor allem der Staatsrechtler Hermann Heller, Mitglied des von Friedrich Meinecke begründeten ‚Vereins freiheitlicher Akademiker‘ – von dem der Oberstaatsanwalt des Landgerichtes Berlin vermutete, daß auch Albrecht Bähnisch ihm angehörte291 – setzte sich in seinen Schriften und in seiner Lehre nachdrücklich
angestrebt hatten, tatsächlich eine über viele Jahre stabile Lebensgemeinschaft in einem festen Haus bestand. Vgl.: Gräser: Wohlfahrtsgesellschaft, S. 187. 289 Siegmund-Schultze, Friedrich: Klassenhaß, in: Evangelisch-sozial, 21. Folge der Mitteilungen des evangelisch-sozialen Kongresses, Bd. 8/9 (1912), S. 274–298, hier S. 296. Erich Gramm schreibt, auf die Jugenddelinquenz bezugnehmend, mit der die SAG sich auseinandersetzte: „Für den Studenten, der später vielleicht einmal als Richter, als Pfarrer, als Lehrer oder Arzt mit straffälligen Jugendlichen zu tun haben würde, gab es kaum eine andere Möglichkeit, die ihm in solchem Maße wichtige Einblicke in die Umwelt der Jugendlichen […] vermittelte.“ Gramm, Erich: Die soziale Arbeitsgemeinschaft Ost, in: Foth, Heinrich (Hrsg.): Lebendige Ökumene. Festschrift für Friedrich Siegmund-Schultze zum 80. Geburtstag, Witten 1965, S. 84–118, hier S. 96. 290 Siegmund-Schultze, Friedrich: Aus der sozialen Studentenarbeit, in: Grünberg, Wolfgang u. a. (Hrsg.): Friedrich Siegmund-Schultze: Friedenskirche, Kaffeeklappe und die ökumenische Vision, Texte 1910–1969, München 1992, S. 302–325, hier S. 322. 291 Siehe Kapitel 3.2.2.
304 | Theanolte Bähnisch
für eine Verbreiterung politischer Partizipation ein.292 Albrecht Bähnisch, der bei vielen jener republikfreundlichen Professoren Vorlesungen gehört hatte, sollte wohl kaum zufällig auf die Lehre Hellers rekurrieren, als er sich 1928 berufen sah, einen Aufsatz über die Ziele der SAG zu schreiben.293 Über den Umstand, daß in Hellers ‚Arbeitskreis junger Volksbildner‘ Protagonisten der Erwachsenenbildung wie Fritz Borinski, die sowohl in der SAG als auch in Volkshochschulen mitwirkten294 und das Gedankengut Hellers entsprechend verbreiteten, schließt sich ein weiteres Mal der Kreis zwischen Albrecht Bähnischs Engagement in der SAG und Theanolte Bähnischs Arbeit im DFR. Denn Bähnisch lehnte sich ab 1946 stark an Borinskis Ideen zur Erwachsenenbildung sowie allgemein an die Hermann Heller nahestehende ‚Neue Leipziger Richtung‘ der Erwachsenenpädagogik an. 295 Ein zentraler Ideengeber der SAG war Paul Natorp, der Philosophie-Professor und Lehrer Siegmund-Schultzes. Nach Meinung einiger SAG-Mitarbeiter hatte er ihre Theorie „am klarsten“ mit ausgebildet.296 Natorp hatte als oberstes Ziel der SAG die „Erziehung der Jugend zum Gemeinsinn“ definiert. Damit hatte er allerdings wesentlich die akademische Jugend im Blick gehabt, was sich an seiner nach dem Ende des Ersten Weltkrieges geäußerten Überzeugung, daß „die studierte Jugend nachgerade verpflichtet sei, auf den Arbeiter zuzugehen und mit ihm das neue Deutschland aufzubauen“297, ablesen läßt. Das „Herabsteigen“298 (wie Siegmund-Schultze es formulierte) von jungen Akademikern zu den Arbeitern, um deren Lebenskontext und -notwendigkeiten kennenzulernen sowie um durch Bildungsangebote etwas für die ‚kulturelle und sittliche Hebung‘ der Armen zu tun, um danach gemeinsam ‚aufsteigen‘ zu können, schien zum einen für die eigene Bildung junger Akademiker dringend geboten. Zum anderen verbesserte es auch deren Aufstiegschancen im
292 Vgl. dazu beispielsweise: Hennig, Eike: Nationalismus, Sozialismus und die ‚Form aus Leben‘. Hermann Hellers politische Hoffnung auf soziale Integration und staatliche Einheit, in: Müller, Christoph/Staff, Ilse (Hrsg.): Staatslehre in der Weimarer Republik. Hermann Heller zu Ehren, Frankfurt a. M., S. 100–113. 293 Siehe Kapitel 3.4.2.5. 294 Borinski hatte im akademisch-sozialen Verein der Universität Leipzig von der SAG gehört und bald darauf schon den von der Studienrätin Lies Benzler begründeten SAGAbleger in Wernigerode im Harz geleitet. Vgl.: Borinski, Fritz: Einige Gedanken über das Wechselverhältnis zwischen Settlementbewegung und Erwachsenenbildung, in: Delfs: Friede, S. 255–260, hier S. 256. 295 Auf Borinskis Erfahrungen in der Erwachsenenbildungsarbeit der SAG und den Volkshochschulen griffen Pädagogen und Verwaltungsfachleute in der zweiten deutschen Nachkriegszeit zurück. Theanolte Bähnischs Konzept zur Frauenbildung erinnert stark an die hauptsächlich von Borinski entwickelte Tradition der ‚Mitbürgerlichen Bildung‘, was an anderer Stelle ausführlicher behandelt werden soll. 296 Vgl.: Jegelka, Norbert: Paul Natorp. Philosophie, Pädagogik, Politik, Würzburg 1992, S. 195. 297 Natorp zitiert nach ebd. 298 Siegmund-Schultze, Friedrich: Wege zum Aufbau der neuen Volksgemeinschaft, in: Grünberg: Friedenskirche, S. 351–366, hier S. 363.
Albrecht Bähnisch | 305
Weimarer Staat. Albrecht Bähnisch jedenfalls hatte auf seine Mitarbeit in der SAG im Rahmen seines Studiums gesondert hingewiesen, als er sich um die Zulassung zum Verwaltungsreferendariat an seinem Wunsch-Ausbildungsort Münster bewarb299 und dort zugelassen wurde, obwohl bereits alle planmäßigen Stellen besetzt waren. Über seinen Lebenslauf fand sein Engagement in der SAG Eingang in seine Personalakte, die auch bei weiteren Einstellungsentscheidungen zu Rate gezogen wurde. Als der Innenminister Grzesinski Albrecht Bähnisch für das Landratsamt in Merseburg in Vorschlag brachte, kannten sich Bähnisch und sein neuer Dienstherr, der Regierungspräsident von Merseburg, Ernst von Harnack, womöglich schon. Denn dessen Schwestern Elisabeth und Agnes von Harnack arbeiteten ebenfalls in der SAG mit.300 3.4.1.4 Selbstverständnis, Zielsetzung, Träger und alltägliche Arbeit des Settlements Als der damals erst 26-jährige Siegmund-Schultze in Friedrichshain antrat, um dort seine ‚Soziale Arbeitsgemeinschaft‘ zu etablieren301, verriet bereits der Name der Initiative einiges über deren Konzept. Denn wo zu jener Zeit von ‚Arbeitsgemeinschaft‘, oder kurz ‚AG‘ gesprochen wurde, da waren in der Regel gesellschaftliche Reformbestrebungen Motor der Unternehmungen. Allesamt zielten die ‚AG’s‘ darauf ab, verschiedene Gruppen und Lager an einen Tisch zu bringen, um durch Verständigung vieler einen tragfähigen, weil durch faire Aushandlungsprozesse erzielten Konsens herzustellen.302 Siegmund-Schultzes AG war darauf ausgerichtet, Bürgerliche
299 LHASA MER, C 48 I a II, Lit. B, Nr. 5, Lebenslauf o. D. [1922]. 300 Harnack, Elisabeth von: „Fröhliche Jugend“ in der Sozialen Arbeitsgemeinschaft BerlinOst 1914–1964. Ein Brief, in: Foth: Ökumene, S. 151–157, hier S. 152. Im Aufsatz beschreibt Elisabeth von Harnack die Arbeit ihrer Schwester in der SAG. 301 Siegmund-Schultze war zuvor als Prediger in der Gemeinde des Kaisers tätig gewesen und hatte sein privilegiertes Amt in Potsdam zugunsten der SAG aufgegeben. 302 In seiner Bedeutung nicht selten ideologisch überhöht, hatte der Begriff ‚AG‘ nach dem Ende des Ersten Weltkriegs Eingang in verschiedenste gesellschaftliche Teilbereiche gefunden. Die wohl bekannteste, so bezeichnete Initiative in der Weimarer Republik war die ‚Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer‘ (ZAG), aus der das ‚Stinnes-Legien-Abkommen‘ erwuchs, welches die Gemeinsamkeit der Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern beschwor und in der Forschung einhellig als Teil des ‚Bündnis der neuen mit den alten Eliten‘ reflektiert wird. Wie an der ZAG bald deutlich werden sollte, war ihre Symbolkraft bedeutend größer als ihre Substanz. Als die Wirtschafts- und mit ihr die Arbeitsmarktkrise kam, erwies sie sich als nicht geeignet, die stärker werdenden Konflikte zwischen Arbeitern und Unternehmern zu regeln. Sie zerbrach 1924. Vgl.: Feldman, Gerald/Steinisch, Irmgard: Industrie und Gewerkschaften 1918–1924. Die überforderte Zentralarbeitsgemeinschaft, Stuttgart 1985. Vgl. auch: Flemming, Jens/Krohn, Claus-Dieter/Stegmann, Dirk/Witt, PeterChristian: Die Republik von Weimar, Bd. 2: Das sozialökonomische System, Königstein/Düsseldorf 1979. Siegmund-Schultze hatte den Begriff ‚Soziale Arbeitsgemeinschaft‘ vermutlich von seinem Lehrer Paul Natorp übernommen, der den Begriff schon in
306 | Theanolte Bähnisch
und Arbeiter voneinander lernen zu lassen und auf dieser Basis gegenseitiges Verständnis und eine schrittweise Annäherung zu ermöglichen, was zur Versöhnung zwischen den ‚Klassen‘ beitragen sollte.303 Um seine Idee zu verwirklichen, hatte Siegmund-Schultze an Überzeugungen der ‚Settlement‘-Bewegung304 angeknüpft und die SAG zur populärsten deutschen Ausformung der ursprünglich in Großbritannien entstandenen Siedlungs-Projekte entwickelt. Das neue Element dieser Initiativen gegenüber anderen Projekten der bürgerlichen Sozialreform war ihre Orientierung am sozialen Raum. Die Träger jener Initiativen hofften, die soziale Segregation zwischen Arm und Reich, die in den großen Städten als Folge der Industrialisierung besonders virulent geworden war, durch ihre Präsenz vor Ort und damit im alltäglichen Leben der Arbeiter aufbrechen zu können. Der Leiterin der Berliner ‚sozialen Frauenschule‘ und Freundin der SAG, Alice Salomon zufolge, hatte „eine Niederlassung von gebildeten Menschen in einem Arbeiterviertel […] den Zweck […], daß diese Ansiedler die Arbeiter kennenlernen und ihnen von ihrer Kultur etwas geben können“305. Als erste Initiative jener Art in Deutschland gilt das ebenfalls am englischen Vorbild orientierte und von Walter Classen306 initiierte ‚Hamburger Volksheim‘ im Stadtteil Hammerbrook.307
303
304
305 306
307
‚Religion innerhalb der Grenzen der Humanität, Tübingen 1894‘ verwendet hatte. Vgl.: Gräser: Wohlfahrtsgesellschaft, S. 187. Rolf Lindner zufolge habe mit dem Begriff ‚Soziale Arbeitsgemeinschaft‘ sowohl die sozialpädagogische Gemeinschaftskultur, als auch das angestrebte Gesellschaftsmodell beschrieben werden sollen. Lindner: Siegmund-Schultze, S. 8. Fürsorgebeziehungen sollten in einem solchen Rahmen wieder personalisiert und eine Nachbarschaftshilfe etabliert werden. In diesem Zusammenhang steht auch der programmatische Titel der ‚akademisch-sozialen Monatsschrift‘ ‚Neue Nachbarschaft‘, die von Prof. Friedrich Siegmund-Schultze und Dr. jur. Alix Westerkamp in Berlin herausgegeben wurde. In Form der ‚Toynbee-Hall‘ hatte die Settlementbewegung, die sich konzeptuell vor allem in den Soziallehren Thomas Carlyles und John Ruskins ausgearbeitet findet, in Ost-London zum ersten Mal Gestalt angenommen. Samuel A. Barnett etablierte im Jahr 1884 dieses erste britische Settlement, das er nach dem Ruskin-Schüler Arnold Toynbee (nicht nach dem Geschichtsphilosophen Arnold J. Toynbee) benannt hatte. 1911, im Jahr der Gründung der SAG, gab es in Großbritannien bereits 40 derartige Initiativen. (Zahl nach Werner Picht, vgl.: Sachße: Mütterlichkeit, S. 235.) Salomon, zitiert nach Sachße: Siegmund-Schultze,in: Krauß: Soziale Arbeit, S. 232. Classen begann seine Arbeit im Jahr 1901, angeregt durch seine Eindrücke in britischen Settlements. Diese faßte er in einer Schrift zusammen. Vgl.: Classen Walter: ‚Soziales Rittertum in England‘, Hamburg 1901. Dem Volksheim gelang es allerdings nicht, Mitarbeiter dauerhaft im Arbeiterstadtteil anzusiedeln. Alix Westerkamp, die zweite Vorsitzende der SAG, kritisierte nicht nur das Fehlen eines konsequenten „Draußen Wohnens“, sondern insbesondere auch den Umstand, daß die Volksheim-Angebote sich in erster Linie an „begabte und regsame Arbeitersöhne“ richteten. Vgl.: Westerkamp, Alix: Geschichte der Settlementbewegung in Deutschland, in: Soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost E.V. (Hrsg.): Nachbarschafts-
Albrecht Bähnisch | 307
Der Initiator der SAG, Siegmund-Schultze erklärte die „Hebung der umwohnenden Bevölkerung“ durch eine „Insel der Gebildeten“308 zu seinem Ziel. Denn in seiner Überzeugung begründete nicht das unterschiedliche Einkommen als solches die Kluft zwischen Arm und Reich, sondern die – nicht zuletzt aus den wirtschaftlichen Verhältnissen resultierenden – Unterschiede in Bildung und Alltagskultur. Die mangelhafte Infrastruktur und ihre mangelnde Ausnutzung durch die Friedrichshainer Bürger gaben Siegmund-Schultze scheinbar Recht: Nach einer höheren Schule mußte man im Stadtteil suchen und die Kirchen standen weitgehend leer. Die Mitarbeiter Siegmund-Schultzes309 sollten im Namen der SAG den Einwohnern alternative, ‚kultivierte‘ Angebote als Ersatz für die Unterhaltungsmöglichkeiten, welche ihnen das Viertel bereits bot, schmackhaft machen: „den Klub für die Bande, für das Schundheft den Abenteuerroman, für die Tanzdiele den Volkstanzoder Singkreis“310. Die sogenannte ‚Kaffeeklappe‘, später dann eine andere Gaststätte der SAG, sollte als Alternative zu den Trinkhäusern und Destillen im Stadtteil fungieren und so dem verbreiteten Alkoholismus unter den Arbeitern entgegenwirken. Für einen eher symbolischen Gegenwert konnten in den Einrichtungen alkoholfreie Getränke und einfache Speisen erworben werden.311 Von rein materiellen Leistungen gegenüber den Arbeitern, wie sie die Speisehallen der Wohltätigkeits-Komitees boten, grenzten sich die SAGler vor dem Hintergrund ihrer nicht nur fürsorgerischen, sondern auch auf Bildung abzielenden Beweggründe ab. Wo die persönliche Berührung fehle, hielt der prominente SAG Mitarbeiter Robert von Erdberg fest, da werde ein Ausschank „notwendig zur Kaschemme“312. Weiterbildungskurse und Diskussionsabende313 zu verschiedensten Fragen
308
309
310 311
312
siedlung in der Großstadt. Grundsätzliches aus der Arbeit der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, Berlin 1929, S. 6–28, hier S. 7. Siegmund-Schultze, Friedrich: Ein praktischer Versuch zur Lösung des sozialen Problems. Separatdruck aus: Die Innere Mission im evangelischen Deutschland, zitiert in: Hetscher, Elke/Steigerwald, Norbert: Die Kaffeeklappe der SAG, in: Lindner, Rolf (Hrsg.): „Wer in den Osten geht, geht in ein anderes Land.“ Die Settlementbewegung in Berlin zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik, Berlin 1997, S. 179–192, hier S. 186. In den Jahren vor 1933 lag die Zahl der regelmäßig mitarbeitenden Personen laut Erich Gramm bei etwa 70 bis 80 Personen, davon waren acht Frauen und drei Männer festangestellt. Vgl.: Gramm: Die Soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, in: Foth: Ökumene, S. 84–127, hier S. 115. Sachße: Siegmund-Schultze, in: Tenorth: Siegmund-Schultze, S. 43. Laut einem eignen Bericht über die Arbeit der Berliner SAG waren 1925 täglich 1000 Portionen warmen Essens verteilt worden. Vgl.: o. V.: Kurze Mitteilungen über die Berliner Arbeit der SAG, in: Nachrichten aus der Sozialen Arbeitsgemeinschaft, Nr. 18/1925, S. 12/13, hier S. 13. Robert von Erdberg war ab 1920 Leiter des neu geschaffenen Referats für Volksbildung im preußischen Kultusministerium. Erdberg zählte zu den Vertretern der ‚Neuen Richtung‘ in der Erwachsenenbildung in der Weimarer Republik. Vgl.: Olbrich, Josef: Robert von Erdberg und das Freie Volksbildungswesen, in: Schmidt, Benno (Hrsg.): Paedagogen
308 | Theanolte Bähnisch
des alltäglichen Lebens, aus Politik und Philosophie, Recht und Wirtschaft, wie man sie auch aus dem Angebot anderer Initiativen der bürgerlichen Reformbewegungen kannte, waren deshalb ein zentraler Bestandteil des SAG-Angebots. Sie fanden, ebenso wie die Stenographie- und Englischkurse und die Kegel- und Männerunterhaltungsabende, in den Clubräumen des Hauses Ostbahnhof 17 statt. Daneben unterhielt die SAG – jeweils über einen längeren Zeitraum – weitere Einrichtungen wie eine Schreibstube, eine Arbeitsvermittlung, eine Abteilung für Jugendgerichtshilfe und eine allgemeine Rechtsauskunftsstelle314, einen Frauennähbund, Kinderheime und -gärten, ein Männerheim315, eine soziale Bücherei316 sowie in Notzeiten auch eine Hungerhilfe.317 Ein erst in den 1920er Jahren aufgekauftes Grundstück mit Gebäuden in Berlin Wilhelmshagen, auf dem Siegmund-Schultze ab 1922 lebte, diente zunächst als Kinder- und Jugendfürsorgeheim, später als Volkshochschule für Jugendliche und Erwachsene beider Geschlechter. In ihrer Spätphase, nach dem von Christoph Sachße konstatierten „sozialen Bedeutungsverlust“318, knüpfte die SAG mit einer eigenen Volkshochschule, dem ‚Ulmenhof‘, an den ‚Trend‘ zur Erwachsenenbildung in der Weimarer Demokratie an und machte sich damit, auch weil ein Austausch von Mitarbeitern zwischen dem Ulmenhof und anderen Volkshochschulen in Preußen stattfand, in Pädagogik-Kreisen einen Namen. Die SAG intensivierte in dieser Zeit ihre Bemühungen, die Bewohner Friedrichshains zur politischen Partizipation und damit zur Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens, vor allem auf kommunaler Ebene, zu motivieren. Dieses Unterfangen war mit der Hoffnung verbunden, das Wählerpotential des Arbeiter-Bezirks auf der Seite der Demokratie halten und dadurch die Gefahr eines Umsturzes entschärfen zu können. Hans Wollenweber zufolge hatte das Angebot des Ulmenhofs zur Zeit der Weltwirtschaftskrise319mit 52 Kursen und 724 Hörern, beziehungsweise 1213 Belegungen seinen Höhepunkt erreicht.320 Herbert Fenske spricht im Zusammenhang mit der Schwerpunktverlagerung hin zur Jugend- und Erwachsenenpädago-
313
314 315 316 317 318 319
320
in Berlin. Auswahl von Biographien zwischen Aufklärung und Gegenwart, Baltmannsweiler 1991. Bei den Diskussionsabenden, die Abende für Männer gewesen zu sein scheinen, waren 1925 jeweils zwischen 30 und 50 Personen anwesend. Vgl.: o. V.: Kurze Mitteilungen, S. 13. Hetscher/Steigerwald: Die Kaffeeklappe der SAG, S. 189. Das Ledigenheim Moabit beherbergte im Jahr 1925 mehr als 200 Bewohner, vgl.: o. V.: Kurze Mitteilungen, S. 12. Vgl.: ebd. Jegelka: Natorp, S. 193. Sachße: Siegmund-Schultze, in: Krauß: Soziale Arbeit, S. 253. Einige der jeweils eine und eine Viertelstunde tagenden Arbeitsgemeinschaften beschäftigten sich mit dem Thema Arbeitslosigkeit, mit der Rechtsstellung von Arbeitnehmern und der Wirtschaftskrise. Für Erwerbslose wurden Sonderlehrgänge veranstaltet. Vgl.: Wollenweber, Horst: Friedrich Siegmund-Schultze und die Volksbildungsarbeit der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, in: Delfs: Friede, S. 261–274, hier S. 271. Wollenweber: Siegmund-Schultze, S. 270.
Albrecht Bähnisch | 309
gik von der „Überleitung der Gruppen- oder der Klubarbeit in eine betonte Bildungsarbeit“.321 Denn über einen langen Zeitraum hinweg war die Arbeit in Knabenclubs322 von zentraler Bedeutung für den Alltag in der SAG gewesen. Die Clubs wurden jeweils von einem Studenten, der damit auch eine Teilverantwortung für die Familien der jeweiligen Jungen übernahm, weitgehend eigenverantwortlich geleitet. Die Mitarbeiter der SAG versuchten den oft von ihren Familien vernachlässigten Jungen im Berliner Osten neuen Halt im Leben zu geben, indem sie im Rahmen der Clubtreffen zentrale bürgerliche Werte wie Verantwortung, Nächstenliebe und Respekt vermittelten. Sie regten die Jugendlichen dazu an, das Club-Leben auf der Grundlage dieser Werte und mit Hilfe demokratischer Aushandlungsprozesse selbst mit zu strukturieren.323 Untergliedert waren die Treffen jeweils in einen ernsten, belehrenden und einen spielerisch-unterhaltsamen Teil „mit Basteln, Spielen, Singen“324. Ab 1913 gab es von Frauen geleitete Mädchenclubs, die nach ähnlichen Prinzipien gestaltet waren.325 Im Jahr 1920 überstieg ihre Anzahl mit insgesamt sechzehn sogar die der Knabenclubs mit zwölf326 an der Zahl. Im Jahr 1930 gab es nach Aussage von Frank Fechner insgesamt 27 Klubs für Jungen, Mädchen und ‚Jugendliche‘.327 3.4.1.5 Albrechts Engagement in der Genese: Zunächst ‚Resident‘, dann ‚Associate‘ Albrecht Bähnisch leitete, das geht aus Unterlagen des Evangelischen Zentralarchivs sowie aus der Zeitschrift „Nachrichten aus der sozialen Arbeitsgemeinschaft“ hervor, 1922 eine Jugend-Turngruppe der SAG mit – vermutlich rein männlichen – Mitgliedern328 zwischen 14 und 17 Jahren.329 Was genau den Inhalt der Turnstunden prägte,
321 Fenske, Herbert: Saat ohne Ernte? Rückblicke eines Nachbarn, in: Foth: Ökumene, S. 143–151, hier S. 147. 322 Dazu vgl.: Hegner, Victoria: Der Knabenclub oder „Wenn wir wirklich die Führung des Lebens dieser Jungen in die Hand bekommen […] wollen, dann müssen wir unsere Vereine so organisieren, wie es die Jungen selbst tun würden“, in: Lindner: Osten, S. 109– 127. 323 Ebd. 324 Lindner, Rolf: Die Anfänge der Sozialen Arbeitsgemeinschaft, in: ders.: Osten, S. 81–94, hier S. 91. 325 Sachße: Siegmund-Schultze, in: Tenorth: Siegmund-Schultze, S. 43. 326 Westerkamp: Settlementbewegung, S. 16. 327 Vgl.: Fechner, Frank: Leben auf dem Ulmenhof, in: Tenorth: Siegmund-Schultze, S. 131–146, hier S. 134. 328 Der Zeitschriften-Eintrag erweckt den Eindruck, als seien keine Mädchen unter den Teilnehmern gewesen. Veranstaltungen am Ostbahnhof, in: Nachrichten aus der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Nr. 14 (1922), S. 10. Hegner zufolge wurde zumindest bis zum Ersten Weltkrieg in der SAG das Turnen als eine „männliche Angelegenheit“ angesehen. Vgl.: Hegner: Knabenklub, in: Lindner: Osten, S. 123. 329 EZA, 51/S II b 2; EZA, Berlin, Ruth Pabst [Henrike Hoff. i. A.] an Nadine Freund, 09.09.2009. Altersangabe der Teilnehmer in: o. V.: Veranstaltungen am Ostbahnhof, in:
310 | Theanolte Bähnisch
ist nicht überliefert. Ebensowenig läßt sich nachvollziehen, ob das Turnen, dem Humboldtschen Bildungsideal folgend, in die SAG-Arbeit integriert worden war330, oder ob die angeleitete Bewegung eher dazu gedacht war, Energien, die sich in den Befürchtungen der SAG-Mitarbeiter sonst andere Bahnen gebrochen hätten, zu kanalisieren. Mit Blick auf die pädagogischen Leitideen der SAG-Klubarbeit steht zu vermuten, daß die Turnstunde darauf angelegt war, den Teilnehmern kleine Erfolgserlebnisse zu bescheren. Ob Albrecht Bähnisch jenseits dieser Turngruppe noch einen anderen Kurs oder einen Knaben-Club geleitet hat, läßt sich nicht rekonstruieren. Belegt ist allerdings, daß er im Januar 1921 sowohl am „Sozialen Ferienkursus“ des ‚Akademisch-sozialen Verbandes‘ in Benneckenstein vom 06. bis 12. Januar, mit über 300 beteiligten Personen, als auch an einer Konferenz der SAG in Berlin einige Tage zuvor teilgenommen hatte. Daß seine Anmeldung zum Kurs in Benneckenstein/Harz auf Briefpapier der SAG Berlin-Ost331 erfolgte, deutet darauf hin, daß er zu dieser Zeit bereits Mitarbeiter der SAG war. Auf der Tagung in Benneckenstein wurden unter anderem Schriften besprochen, die die Arbeit der SAG grundsätzlich prägten, unter anderem Paul Natorps Werk ‚Sozialidealismus‘. Wie aufmerksam Bähnisch den Vorträgen folgte, ist zwar nicht nachvollziehbar, jedoch dürfte er, bemessen am Vortrags-Tableau doch das ein oder andere über grundlegende theoretische Schriften sowie über die Geschichte der SAG und der Settlement-Bewegung in den USA und Großbritannien mitgenommen haben.332 Offenbar legte er seine Arbeit in der SAG mit seinem Weggang zum Referendariat nach Münster 1922 zunächst nieder. Erst nach seiner Rückkehr nach Berlin nahm er sie – allerdings in einer lockereren Weise und begleitet von einiger Skepsis333 – wieder auf.334 Um in der Sprache der SAG zu sprechen, hatte er sich über die Jahre
330
331 332
333 334
Nachrichten aus der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Nr. 14 (1922), S. 10. Laut der Auflistung gab es neben der von Bähnisch geleiteten Turngruppe für Jugendliche auch noch eine für ‚Knaben‘ von 11 bis 14 Jahren. Vgl.: ebd. Was die Siedler selbst betrifft, so wollte SAG-Mitarbeiter Gerhard Spinner die Bildung in der SAG als das „klassisch griechische Ideal des vollkommenen Menschen, gebildet an Körper, Seele und Geist, theoretisch und praktisch, wissenschaftlich, aesthetisch und politisch“ verstanden wissen. Spinner, Gerhard: Forschungs- und Ausbildungsarbeit, in: Soziale Arbeitsgemeinschaft: Nachbarschaftssiedlung, S. 62–68, hier S. 64/65. Es ist – vor dem Hintergrund des erklärten Ziels der ‚kulturellen Hebung der Arbeiterschaft‘ – anzunehmen, daß dieses Bildungsideal in seinen Grundzügen auch für die Arbeiter in der SAG gelten sollte. EZA, 51/S II b 13, Anmeldekarte Albrecht Bähnisch. EZA, 51/S II b 13, Einladung zum Sozialen Ferienkursus, veranstaltet vom akademischsozialen Verband vom 6. bis 11. Oktober 1921 im Jugendheim in Benneckenstein am Harz. Siehe Kapitel 3.4.2.4. Seine Beteiligung im Jahr 1928 ist belegt durch protokollierte Redebeiträge Bähnischs auf der Lauensteiner Konferenz von 1928 (EZA, 51/S II b 20, Protokoll der SAG-Konferenz auf Burg Lauenstein vom 22. bis 25. Mai 1928), durch eine Vortragsankündigung für die Konferenz (EZA, 51/S II b 19, Programm der Vor-Konferenz vom Dienstag den
Albrecht Bähnisch | 311
vom ‚Resident‘ zum ‚Associate‘ der Arbeitsgemeinschaft entwickelt. 1921/22 hatte er gemeinsam mit anderen Mitarbeitern unter einfachen Verhältnissen in der Friedrichshainer Fruchtstraße335 gelebt. 1927 war er gemeinsam mit seiner Ehefrau in eine Wohnung in Berlin-Mitte gezogen. Aktive Arbeit in Friedrichshain hat er im Rahmen seiner Assessoren-Stelle im Innenministerium vermutlich nicht mehr geleistet, sein Name taucht in den entsprechenden Gesprächsprotokollen aus dieser Zeit nicht auf. Es ist deshalb davon auszugehen, daß seine Mitwirkung sich in der späteren Zeit auf die überlieferten Rede- und schriftlichen Beiträge beschränkt hat. Ein definitiver Endpunkt von Bähnischs Mitarbeit in der SAG läßt sich nicht ausmachen. Den Kontakt zu seinen Mitstreitern aus seiner aktiven Zeit 1921/22 hatte er, wie aus einem Brief Bähnischs an Friedrich Siegmund-Schultze von 1928 hervorgeht336, Ende der 20er Jahre jedenfalls nicht verloren. Ein weiterer Brief Bähnischs an SiegmundSchultze belegt, daß die Bähnischs 1929 eine größere Runde, darunter auch die Familie Siegmund-Schultze zu sich nach Hause eingeladen hatten.337 Noch im gleichen Jahr zog Albrecht Bähnisch aus Berlin weg und übernahm ein Amt, das mit vielen Verpflichtungen verbunden war. Damit dürfte sich seine Mitarbeit in der SAG weitgehend erledigt haben. Allerdings sind aus der Zeit nach Albrecht Bähnischs Tod Briefwechsel zwischen Theanolte Bähnisch und Friedrich Siegmund-Schultze überliefert338. Zudem hatten die Bähnischs und die Siegmund-Schultzes gemeinsame Bekannte. Es ist also nicht unwahrscheinlich, daß ein wie auch immer gearteter Kontakt mit Siegmund-Schultze auch in den 30er Jahren erhalten geblieben war. Inwiefern Albrecht Bähnisch das wissenschaftliche Interesse vieler SAGMitarbeiter am Berliner Osten teilte, ist schwer zu sagen. Seine im entsprechenden Kontext vorgestellten Aufsätze in SAG- und SPD-nahen Publikationen lassen allenfalls vage Schlüsse zu. Viele SAGler, die aus dem Rahmen ihres Studiums heraus in den Berliner Osten fanden, wollten sich dem alltäglichen Leben der Berliner ‚Unterschicht‘ wissenschaftlich widmen, einige die Frage beantworten, welche individuellen und strukturellen Veränderungen die Präsenz bürgerlicher Akademiker im Stadtteil mit sich bringen könne. Schon im zeitgenössischen Kontext wurde das Tun der
335
336 337
338
22. Mai bis Sonnabend, den 26. Mai auf Burg Lauenstein in Thüringen), durch Bähnischs Schriftverkehr mit Siegmund-Schultze (EZA, 51/S II b 19, Siegmund-Schultze an Bähnisch, 14.03.1928 und 07.03.1928; Albrecht Bähnisch an Siegmund-Schultze, 06.03. 1928) schließlich durch einen 1928 in der ‚Neuen Nachbarschaft‘ unter Bähnischs Namen erschienenen Artikel über die SAG, auf den an anderer Stelle ausführlicher eingegangen werden wird. Seinen Wohnsitz in Berlin-Lichterfelde scheint er zumindest pro forma nicht aufgegeben zu haben, denn in Zusammenhang mit den Unterlagen, die seine Teilnahme an SAGVeranstaltungen 1921/22 belegen, taucht diese Anschrift auf. EZA, 51/S II b 13. EZA 51/S II b 19, Albrecht Bähnisch an Siegmund-Schultze, 06.03.1928. Siegmund-Schultze lehnte die Einladung wegen zu vieler Termine ab. Ob die Familien sich im Verlauf des Jahres noch trafen, ist unklar. EZA, 51/S II c 26, Friedrich SiegmundSchultze an Albrecht Bähnisch, 06.05.1928. EZA, 626/75.
312 | Theanolte Bähnisch
‚Bürgerlichen‘ in Friedrichshain als eine ‚missionarische Arbeit‘339 charakterisiert. Der Kultursoziologe Rolf Lindner stufte im Jahr 2007 den Grundton der von ihm als „Entdeckungsreisende“ bezeichneten Wissenschaftler auf der Basis des von ihm ausgewerteten Quellenmaterials sogar als „kolonial-militärisch“340 ein. Tatsächlich näherten sich die Studenten und Doktoranden ihrem ‚Untersuchungsgegenstand‘, dem Arbeiter und seinem Lebensalltag mit ethnographisch-soziologischen Methoden. Denn ‚helfen können‘ bedeutete in der Überzeugung der Siedler erst einmal ‚verstehen lernen‘. Daß in diesem Zusammenhang in einem interdisziplinär ausgerichteten wissenschaftlichen Sammelband aus der Gegenwart von „interkultureller Kompetenz“341 als Voraussetzung für die Studien in Friedrichshain die Rede ist, verwundert den Leser nur so lange, bis ihm aus den der Studie zugrundeliegenden Quellen deutlich wird, daß die Studenten in Berlin-Ost – gemäß der in der Soziologie gebräuchlichen Methode der ‚teilnehmenden Beobachtung‘ – ‚Rollenwechsel‘ auf sich nahmen. Beispielsweise arbeiteten sie zum Zweck der Selbsterfahrung zwei Wochen lang in einer Fabrik, legten dabei ‚Feldtagebücher‘ an und vergaßen im Zuge der methodischen Reflexion ihrer Unternehmungen auch nicht die ‚Angst der Forscher vor dem Feld‘342 zu reflektieren. Neben den Einzelstudien entstanden auch statistische Erhebungen der SAG über Wohnverhältnisse, Kirchenbesuche und die Gewohnheiten der Friedrichshainer, sich zu unterhalten. Zu letzterem Gegenstand fertigte die ‚Vergnügungskommission‘ der SAG sogar genaue Karten von den Lokalen in der Fruchtstraße an, in der die SAG ein Haus bezogen hatte und wertete die soziale Zusammensetzung, wie auch das Verhalten von Theater- und Kinobesuchern aus.343 Eine Mitarbeit in der SAG bot also auch allerhand Möglichkeiten, Stoff für Studien- und Examensarbeiten zu finden. Ähnlich wie die Heimvolkshochschule Dreißigacker, für die Albrecht Bähnisch sich wenige Jahre später einsetzen sollte, war auch die SAG nicht zuletzt ein Experimentierfeld für junge Wissenschaftler und akademisch gebildete Praktiker, auf dem sie im Austausch mit erfahreneren Akteuren neue Fragen stellen und neue Arbeitsmethoden sowie Forschungsansätze testen konnten. 3.4.2 Ein asymmetrisches Projekt von nachhaltiger Wirkung 3.4.2.1 Aktuelle Kritik an der SAG und zeitgenössische Reflexionen – auch Theanolte positioniert sich Vor allem der Professor für die Geschichte und Theorie der sozialen Arbeit, Christoph Sachße, beleuchtet das Konzept der SAG in der Retrospektive sehr kritisch. Die Organisationen der bürgerlichen Sozialreform seien im „sozialkulturellen Ambiente
339 Geisthövel, Alexa/Siebert, Ute/Finkbeiner, Sonja: „Menschenfischer.“ Über die Parallelen von innerer und äußerer Mission um 1900, in: Lindner: Osten, S. 27–47. 340 Lindner: Siegmund-Schultze, S. 8. 341 Vgl.: Wietschorke: Settlement, S. 312. 342 Vgl.: ebd., S. 311. Die Quelle auf die sich Wietschorke bezieht, ist abgedruckt in den Nachrichten aus der Sozialen Arbeitsgemeinschaft, Bd. 8 (1916), S. 204–223. 343 Vgl.: Wietschorke, Jens: Stadt- und Sozialforschung in der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, in: Tenorth: Siegmund-Schultze, S. 51–67, hier S. 54/55.
Albrecht Bähnisch | 313
des Deutschen Kaiserreichs“ konzipiert worden und die SAG, die an jene Projekte anknüpfte, „eine Spätimplementation eines etwas angegrauten Reformkonzeptes“ gewesen.344 Daß sich das Projekt in der Weimarer Republik fortsetzte, muß Sachße folglich noch unpassender erscheinen: „Für die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit gab es nun andere Wege als die ‚soziale Gesinnung‘ der Gebildeten“345, schreibt Sachße und verweist erklärend auf den Verfassungsrang des Wohlfahrtsstaates in der Weimarer Republik.346 In der SAG selbst war wiederholt die Frage diskutiert worden, ob die Initiative als solche einen Auftrag zur Mitgestaltung des politischen Tagesgeschäfts habe. „Die Frage, will die SAG wirklich im Politischen, Sozialen, Geistigen gestalten, ist die Grundfrage“ 347, brachte es Harald Oswalt auf einer Tagung im kleinen Führungskreis der SAG, an der auch Albrecht Bähnisch teilgenommen hatte, auf den Punkt. Während einige Mitarbeiter vor allem der ‚späten SAG‘ die Reform der Gesellschaft und des sozialen Systems durchaus als Ziel ihrer Arbeit ansahen, wollten andere ihren Beitrag eher als einen Akt der persönlichen Nachbarschaftshilfe, basierend auf dem Gedanken der christlichen Nächstenliebe, verstanden wissen. Sie empfanden es, wie Werner Krukenberg formulierte, als eine „Roheit“, „die Verantwortung für die Arbeit von Mensch zu Mensch […] einzelnen beruflichen Fürsorgern zuzuschieben“348. Theanolte hatte Albrecht Bähnisch nachweislich zur Konferenz begleitet349 und sich aktiv in die Gespräche eingebracht – was darauf schließen läßt, daß die anderen Teilnehmer ihr eine entsprechende Akzeptanz entgegenbrachten. Die Teilnahme an der Lauensteiner Konferenz ist jedoch die einzige nachweisbare Teilnahme Theanolte Bähnischs an einer Veranstaltung der SAG. Sie argumentierte auf der Konferenz ganz im Sinne Werner Krukenbergs und definierte den Kern der SAG-Arbeit so: „Eine innere Notwendigkeit, eine Beunruhigung über die Zustände treiben hier zum Helfen. Aus diesem Geist finden sich Menschen verschiedenster Anschauungen zusammen; alle irdischen Zielsetzungen sind ausgeschlossen.“ Die SAG, so wird sie weiter zitiert, sei „eine Keimzelle im Sinne Jesu, Gott lieben und seinen Nächsten wie sich selbst“. Sie dürfe „nicht abgehen von dieser inneren Stellung, von der Idee der Gerechtigkeit her zu helfen, ohne sich zu kümmern, was sie erreicht hat, da geht Stoßkraft von ihr aus, innere soziale Erneuerung“350.
344 345 346 347
Sachße: Siegmund-Schultze, in: Tenorth: Siegmund–Schultze, S. 48. Ebd. Vgl.: ebd. EZA, 51/S II b 20, Protokoll der SAG-Konferenz auf Burg Lauenstein vom 22. bis 25. Mai 1928, S. 7. 348 Ebd. 349 „Selbstverständlich nehmen wir gern Ihre Frau gleichfalls auf unserer Konferenz auf“, hatte Siegmund-Schultze an Albrecht Bähnisch geschrieben und damit auf einen Wunsch Bähnischs, den er im Brief als „Mitarbeiter“ tituliert, reagiert. EZA, 51/S II b 19, Friedrich Siegmund-Schultze an Albrecht Bähnisch, 07.03.1928. 350 EZA, 51/S II b 20, Protokoll der SAG-Konferenz auf Burg Lauenstein vom 22. bis 25. Mai 1928.
314 | Theanolte Bähnisch
Während Christoph Sachße in der Retrospektive eine „völlig veränderte Welt der Republik“ erkannte, waren die Sozialreformer in ihrer Zeit der Meinung, in der ‚sozialen Gesinnung‘ der Bürger habe sich vor dem Hintergrund eines neuen politischen Systems kaum etwas geändert und am Elend der Arbeiter nicht viel mehr. Die ‚innere soziale Erneuerung‘ der Gesellschaft, die Theanolte Bähnisch thematisiert hatte, schien, während staatliche Sozialleistungen bereits etabliert worden waren, aber, wie eingangs beschrieben, nicht flächendeckend für Verbesserungen sorgten, noch auf sich warten zu lassen. Die Unruhen während der Weltwirtschaftskrise und die Aufkündigung der Loyalität gegenüber den Gewerkschaften von Seiten der Arbeitgeber sollten Siegmund-Schultze und anderen Sozialreformern in jener Hinsicht recht geben. Indem viele Handelnde in der SAG ihr Engagement aus dem Glauben heraus begründeten, sperrten sie sich gegen eine ‚irdische‘ Bewertung und politische Deutung ihres Handelns, zu dem sie sich angesichts der ‚unmittelbaren Not‘ getrieben fühlten. Doch auch, wenn für Siegmund-Schultze und viele seiner Mitstreiter bis zur Auflösung der SAG der christliche Glaube als Argument im Vordergrund stand, so verlor er doch zunehmend an Relevanz gegenüber anderen Motivationen. Frühere Unterstützer der SAG, insbesondere ihre „Landfreunde“351 reagierten hierauf mit Irritation. Daß die SAG sich nicht nur vom Primat des Glaubens entfernt hatte, sondern dem klassenkämpferischen Standpunkt vieler Friedrichshainer Bürger zunehmend Verständnis entgegen brachte352, hatte womöglich auch die Protagonisten anderer Sozialreforminitiativen353 von einer Kooperation mit der SAG abgehalten. Daß die ‚Randständigkeit‘, die Marcus Gräser der SAG innerhalb der deutschen bürgerlichen Sozialreform bescheinigte354, auf die von Gräser genannten Aspekte zurückzuführen ist, erscheint – zumindest in der Auseinandersetzung mit der SAG in der Spätphase – eher unwahrscheinlich. Daß Gräser der SAG „Anti-Intellektualismus“ und den „Verzicht auf Sozialforschung“355 unterstellt, will, sowohl was die Analyse der Quellen aus der Spätphase der SAG, als auch, was die Forschungsergebnisse Jens Wietschorkes – der sich mit der SAG sehr intensiv beschäftigte – angeht, nicht einleuchten. Albrecht Bähnisch, der die christliche Grundhaltung der SAG nach eigener Aussage „ohne jeden Vorbehalt“ anerkannte, diese aber offenkundig nicht teilte356, hatte im Rahmen der Lauensteiner Tagung im Mai 1928 die Offenheit der SAG gegenüber jenen Mitarbeitern, die nicht aus dem christlichen Glauben heraus handelten, hinterfragt: „Könnt ihr glauben, dass wir ohne Beziehung zur Absolutheit genau so arbei-
351 Wietschorke: Arbeiterfreunde, S. 357/358. 352 Vgl.: Gräser: Wohlfahrtsgesellschaft, S. 188. 353 Florian Tennstedt beschreibt die Existenz sowohl einer konfessionellen, als auch einer stärker an der Wissenschaft orientierten Strömung der Sozialreformformbewegung. Letztere sei um 1900 maßgeblich geworden. Vgl.: Tennstedt: Sozialreform. Die SAG scheint eine Zwischenstellung eingenommen zu haben. 354 Vgl.: Gräser: Wohlfahrtsgesellschaft, S. 189. 355 Ebd. 356 EZA, 51/S II b 20, Protokoll der SAG-Konferenz auf Burg Lauenstein vom 22. bis 25. Mai 1928.
Albrecht Bähnisch | 315
ten im Osten, wie ihr? Dürft ihr uns zu Euch zählen, ohne etwas Bestes in Frage zu stellen?“357 Doch Hermann Gramm hatte bereits im Vorfeld auf derselben Konferenz selbstkritisch festgehalten: „Wir, die vom Christentum kommen, sind immer viel zu schnell bereit „Gott“ zu sagen. […] Ihr seid noch nicht bis an den Punkt der wirklichen Ohnmacht gelangt, Ihr laßt immer Gott zu früh eingreifen. Hier liegt eine unendliche Mahnung, die vom Sozialismus her kommt.“ Siegmund-Schultze selbst hatte seine Arbeit in Berlin-Ost bereits 1911 mit der Überzeugung angetreten, daß offensichtliche Missionierungsarbeit die Arbeiter abschrecken würde. Am Ende der sozialethischen Tagung auf der Burg Lauenstein hielt er – ganz in diesem Sinne – fest: „Geht doch einmal in den Osten und lebt mit den Arbeitern zusammen; dann wird Euch diese brutale Art das Leben zu meistern und die Bibel zu bringen, ehe Brot und Hemd da sind, vergehen. Wenn wir die innere Not des Klassenkampfes, wie sie uns in diesen Tagen gezeigt wurde, ganz erfassen, dann sind wir einfach nicht imstande, auf diese Not mit ‚Wortverkündung‘ zu antworten.“358 Auf der Konferenz in Lauenstein vertrat Siegmund-Schultze die Meinung, ein Anschluß der SAG an die SPD „wäre das Natürlichste für uns gewesen, sie war die Partei des Ostens.“ Doch revidierte er diese Aussage im gleichen Zuge, indem er festhielt: „Aber der Anschluß der SAG hätte ihre Linie genommen. Jeder einzelne sollte in einer Partei stehen.“359 Die Überparteilichkeit der SAG bei gleichzeitiger Bindung ihrer Mitarbeiter an eine Partei war schließlich die Grundlinie, auf die sich die Mehrheit der SAGler einigen konnte.360 Diese Idee wollte auch Theanolte Bähnisch als Leitlinie für den Frauenring, welchen sie 1947 gründen sollte, umgesetzt sehen. Dieser Umstand sowie das Eintreten Theanolte Bähnischs für einen ‚christlichen Sozialismus‘361, also die Ableitung der Notwendigkeit einer sozialistischen Gesellschaft aus der christlichen Lehre heraus, könnte durchaus auf die Interaktion mit Friedrich Siegmund-Schultze, den sie, wie seinen akademischen Lehrer, den Theologen Adolf von Harnack, sehr geschätzt hatte362, zurückzuführen sein. Die Projekte der bürgerlichen Sozialreform standen also keinesfalls per se im Widerspruch zur staatlichen Sozialpolitik in der Weimarer Republik.363 Doch die ‚Sozialreform‘ und mit ihr die SAG waren und blieben Gegenstände widerstreitender Interessen und Überzeugungen, die sich jeweils an der richtungsgebenden Ideologie der Projekte und der dementsprechend angenommenen Wirkung festmachten. Vertre-
357 Ebd. 358 Gramm, Hermann: Friedrich Siegmund-Schultze und die Studenten, in: Foth: Ökumene, S. 129–142, hier S. 141. 359 EZA, 51/S II b 20, Protokoll der SAG-Konferenz auf Burg Lauenstein vom 22. bis 25. Mai 1928. 360 Vgl.: ebd. Viele Mitarbeiter der SAG, auch solche mit einem hohen Bekanntheitsgrad wie Wenzel Holek und Hermann Gramm waren Mitglieder der SPD. 361 AdSD, Büro Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 11.02.1946. 362 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. 363 Diese Position vertritt Christoph Sachße, der sich jedoch mit der Spätphase der SAG nicht intensiv auseinander gesetzt zu haben scheint. Vgl.: Sachße: Siegmund-Schultze, in: Krauß: Soziale Arbeit, S. 249.
316 | Theanolte Bähnisch
ter des linken Parteiflügels der SPD, beziehungsweise der USPD, standen der privaten Fürsorgearbeit allgemein kritisch gegenüber, vertraten sie doch die Haltung, daß eine strukturelle soziale Besserstellung der Bürger nur durch staatliches Handeln erreicht werden könne. Fürsorgearbeit war in ihrer Überzeugung bestenfalls ein Herumkurieren an den Symptomen, schlimmstenfalls ein Beitrag zur Aufrechterhaltung eines im Kern unsozialen Systems, keinesfalls jedoch zur Bekämpfung der Ursachen von Armut selbst geeignet.364 Ob der Charakter jener Initiativen, auch der SAG, ‚zeitgemäß‘, ‚überholt‘, oder gar ‚kontrazyklisch‘ war, lag in der Weimarer Republik und liegt auch heute noch im Auge des Betrachters. Siegmund-Schultze hat einen wichtigen Beitrag zur (sozialen) Demokratisierung einflußreicher ‚Bürgerlicher‘ geleistet, der eventuell sogar die Bereitschaft einiger, die Sozialdemokraten zu wählen, nach sich sich gezogen hat. Letzteres läßt sich zwar nicht mit Bestimmtheit sagen, doch was Theanolte Bähnisch betrifft, die in einem durch den Vater nationalkonservativ und durch die Mutter katholisch geprägten Elternhaus aufgewachsen war, ist es wahrscheinlich, daß der Einfluß Siegmund-Schultzes förderlich für ihren Entschluß war, der SPD beizutreten. Ob es sich in einer aufgeklärten Zivilgesellschaft von selbst verstehen sollte, daß wirtschaftlich besser Gestellte eine Individualverantwortung gegenüber schlechter Gestellten übernehmen sollten, oder ob die Sozialreform mit ihrer Nähe zur Armenfürsorge dem Erhalt eines im Kern nicht nur ungerechten, sondern auch entwürdigenden Systems galt – (dies wird, nicht zu Unrecht, auch aktuellen Initiativen wie der ‚Tafel‘ angelastet)365 – das wurde damals und wird noch heute kontrovers diskutiert. Fraglos war eine asymmetrische Sicht der SAGMitarbeiter Grundlage für ihr Handeln gegenüber den Arbeitern, auch wenn oft von einem Austausch auf ‚Augenhöhe‘ die Rede war. Die „fatale Pointe“ des SAGProgramms liegt für Jens Wietschorke darin, daß „ausgerechnet der Kerngedanke klassenübergreifender Versöhnung einen bestimmten Klassenstandpunkt verrät“366. Dabei muß jedoch zum einen Berücksichtigung finden, daß selbst die jüngeren Mitarbeiter der SAG im Kaiserreich sozialisiert worden waren und in den Anfangsjahren der Weimarer Republik im demokratischen Denken und Handeln ungeübt waren. Zum anderen wohnt wohl jeder Form von Pädagogik ein gewisses Maß an Asymmetrie inne. Fortschrittlich war Siegmund-Schultzes Arbeit immerhin insofern, als daß
364 Schon die Vorläuferorganisation der SPD, die SDAP; hatte entsprechend argumentiert: „Die politische Freiheit ist die unentbehrlichste Vorbedingung zur ökonomischen Befreiung der arbeitenden Klassen. Die soziale Frage ist mithin untrennbar von der politischen, ihre Lösung durch diese bedingt und nur möglich im demokratischen Staat“ lautete die entsprechende Formulierung im Eisenacher Programm von 1869. Zu den sozialpolitischen Forderungen der Arbeiterbewegung vor Beginn der Weimarer Republik vgl. auch: Tenntstedt, Florian: Vom Proleten zum Industriearbeiter. Arbeiterbewegung und Sozialpolitik in Deutschland, 1800–1914, Köln 1983. 365 Vgl.: Kessel, Fabian/Schoneville, Holger: Soziale Arbeit und die Tafeln – von der Transformation der wohlfahrtsstaatlichen Armutsbekämpfung, in: Lorenz, Stephan (Hrsg.): TafelGesellschaft. Zum neuen Umgang mit Überfluss und Ausgrenzung, Bielefeld 2010, S. 35–48. 366 Wietschorke: Settlement, S. 315.
Albrecht Bähnisch | 317
sie auf die staatsbürgerliche Mündigkeit von Arbeitern abzielte und damit als eine ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ angelegt war. Diese bestand auch darin, die Zielgruppe der Arbeit in dem Glauben zu bestärken, daß die SPD ihre Interessen vertrete und daß es deshalb – den Unkenrufen Konservativer zum Trotz – sinnvoll sei, diese Partei zu wählen. Jene Wahlempfehlung als ‚restaurativ‘ oder ‚fortschrittlich‘ zu bewerten, bleibt einem jeden Betrachter selbst überlassen. Rolf Lindner, der sich intensiv mit Siegmund-Schultze auseinandergesetzt hat, bezeichnet ihn zwar – auf John Conway Bezug nehmend – als eine „autoritäre Führungspersönlichkeit“367, er hält ihn jedoch – im Gegensatz zu Christoph Sachße – für einen „großen Initiator auf den Feldern der Sozialarbeit, der Ökumenischen Bewegung und der Friedensbewegung“368. 1928, als Albrecht Bähnisch seinen Vortrag auf der Lauensteiner Konferenz hielt, hatte die Mehrheit der in der SAG engagierten Personen jedenfalls keine Angst mehr vor den Sozialdemokraten, sondern vielmehr um sie, hatten sie in der SPD doch längst jene Kraft erkannt, die für gesellschaftliche Reformen stand und gleichzeitig zur Zusammenarbeit mit den Bürgerlichen bereit war. Angstgegner der SAG waren die Kommunisten geworden, zumal in Friedrichshain ein vermehrtes „Hinübergehen [der Arbeiter] von der SPD zum Kommunismus“369 zu beobachten war. Der SAG war daran gelegen, jenen potentiellen Wählern der KPD die Entscheidung für die gemäßigten Sozialdemokraten, welche sich aufgrund ihres Bekenntnisses zur KonsensDemokratie bestens als Bollwerk gegen die Kommunisten zu eignen schienen, schmackhaft zu machen. Deshalb wurde auf der Lauensteiner Vorkonferenz von Seiten Hermann Gramms Kritik an der „Verknöcherung der SPD“370, welche insbesondere die jüngeren Wähler in die Hände der Kommunisten triebe, geäußert. Wenzel Holek, selbst SPD-Mitglied, konstatierte zusammenfassend: „Der Kommunismus hat jetzt die Rolle, die wir [die SPD] vor dem Kriege gespielt haben: Opposition und Kritik. Die SPD leistet Praktisches für die Arbeiter.“371 Siegmund-Schultze, der zu Beginn seiner Arbeit in der SAG die SPD noch als Anheizer des Klassenkampfes verurteilt hatte372, jedoch über die Jahre hinweg die politische Programmatik der SPD mehr und mehr teilte, sah die Weimarer Republik
367 Conway, John: Friedrich Siegmund-Schultze (1885–1969), in: Evangelische Theologie 43 (1983), S. 249, zitiert nach Lindner: Siegmund-Schultze, S. 10. 368 Lindner: Siegmund-Schultze, S. 10. Gleichzeitig weist Lindner darauf hin, daß Siegmund-Schultze als Pazifist auftrat, aber auch von den ‚Ideen von 1914‘ nicht frei gewesen sei und im Krieg eine Möglichkeit sah, die innere Einheit des Volkes zu stärken. Vgl.: ebd., S. 9. 369 EZA, 51/S II b 20, Protokoll der SAG-Konferenz auf Burg Lauenstein vom 22. bis 25. Mai 1928. 370 „Gerade die jüngeren Menschen gehen zum Kommunismus, das ist nicht nur Zersetzung, sondern kommt aus der Verknöcherung der SPD“. EZA, 51/S II b 20, Protokoll der SAG-Konferenz auf Burg Lauenstein vom 22. bis 25. Mai 1928, Diskussionsteilnehmer Gramm. 371 Ebd. 372 Sachße: Siegmund-Schultze, in: Tenorth: Siegmund-Schultze, S. 46.
318 | Theanolte Bähnisch
als einen gedeihlichen politischen Rahmen für seine Arbeit an, der gegenüber der Arbeit im Kaiserreich neue Impulse brachte.373 Immer wieder wiesen er und seine Mitarbeiter auf die Notwendigkeit staatlicher Reformen für eine langfristige Besserung der sozialen Verhältnisse hin, unterstützten die daraufhin ausgerichteten Reformen der Weimarer Koalition und engagierten sich selbst aktiv durch die Übernahme von Schlüsselpositionen in der Verwaltung, in der Wissenschaft und der Bildung. 3.4.2.2 Zwischen SAG, Verwaltung, Wissenschaft und Erwachsenenbildung – Köpfe in der SAG mit besonderer Bedeutung für die Bähnischs Eine gewisse Ämterhäufung und Aufgabenvielfalt war für die führenden Köpfe der SAG374 charakteristisch, was wiederum zeigt, daß die Spitzen der SAG nicht nur gut in die Gesellschaft der Weimarer Republik integriert waren, sondern man ihnen große Kompetenzen bei der weiteren Ausgestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens zuerkannte. Friedrich Siegmund-Schultze, dem 1925 eine Honorar-Professor für Jugendkunde und Jugendwohlfahrt an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, später auch für Sozialkunde und Sozialethik in Münster übertragen wurde, arbeitete während seines leitenden Engagements in der SAG maßgeblich an der Entstehung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes (RJWG) mit.375 1917/18 war Siegmund-Schultze der erste Leiter des Berliner Jugendamtes, von 1918 bis 1932 hatte er den Vorsitz des ‚Deutschen Vereins zur Fürsorge für jugendliche Psychopathen‘ inne, außerdem wurde er Präsident des Internationalen Kongresses für Heilpädagogik. Ab 1921 leitete er den Akademisch-Sozialen Verband in Deutschland und war Geschäftsführer des Deutschen Komitees der Internationalen Volkshochschule. Aufgrund seiner federführenden Aktivität im „Internationalen Hilfskomitee für deutsche (evangelische, katholische und mosaische) Auswanderer jüdischer Abstammung“ wurde er 1933 von der Gestapo verhaftet und des Landes verwiesen.376 1945 versuchte sich SiegmundSchultze an einer Re-etablierung der SAG, welche mißlang. Jedoch stand er, wie der Austausch mit Theanolte Bähnisch zeigt, Pate für andere Projekte, die im Sinne seiner Überzeugungen entstanden, beispielsweise für den durch Theanolte Bähnisch gegründeten ‚Club junger Menschen‘.
373 Vgl. dazu beispielsweise: Gerth: Ansätze, S. 339. 374 An dieser Stelle sollen nicht alle leitenden Mitarbeiter und Freunde der SAG vorgestellt werden, sondern lediglich solche Personen, die weit über die SAG hinauswirkten und deren Wirken als vorbildhaft für Theanolte Bähnisch angenommen werden darf. 375 Diese in der Forschung einhellige Überzeugung teilt der Siegmund-Schultze Kritiker Christoph Sachße nicht. Seiner Meinung nach läßt sich die Beteiligung SiegmundSchultzes am Jugendwohlfahrtsgesetz nicht belegen. Vgl.: Sachße: Siegmund-Schultze, in: Krauß: Soziale Arbeit, S. 247. Die Veränderungen, die jenes Gesetz nach sich zog, wurden bereits im Zusammenhang mit Dorothea Noltes Staatsexamensarbeit thematisiert. 376 Vgl.: Röhm, Eberhard/Thierfelder, Jörg: Juden-Christen-Deutsche, Band 1: 1933–1935: Ausgegrenzt, Stuttgart 1990, S. 316 ff.
Albrecht Bähnisch | 319
Die Juristin Dr. Alix Westerkamp, die sich mit ihren stark soziologisch argumentierenden Studien zur Prostitution und zur Reproduktionsarbeit von Arbeiterfamilien einen Namen als Expertin in der sozialen Arbeit wie in der Frauenarbeit und bewegung gemacht hatte, setzte sich auch als stellvertretende Vorsitzende der SAG für eine verstärkte Einbindung und Akzeptanz von Frauen in die Öffentlichkeitsarbeit ein. Zu diesem Zweck arbeitete sie eng mit Protagonistinnen der Settlement-Bewegung in den USA zusammen. Nach dem Ende ihres Studiums hatte sie eine Rechtsauskunftstelle für Frauen in Frankfurt geleitet – ein ähnliches Angebot machte der von Theanolte Bähnisch gegründete ‚Club deutscher Frauen‘ 1946 in Hannover. Theanolte Bähnisch hatte also aus verschiedenen Gründen Gelegenheit, sich mit Westerkamp, die 1944 starb, auseinanderzusetzen. Im Gegensatz zu Siegmund-Schultze ist Westerkamp, eine der ersten deutschen Juristinnen überhaupt, heute kaum bekannt.377 Dr. Alice Salomon, in ihrer Funktion als Leiterin der interkonfessionellen ‚Sozialen Frauenschule‘ in Berlin-Schöneberg eine der wichtigsten Protagonistinnen im Berliner Wohlfahrtswesen, schickte ihre Schülerinnen, von denen einige Mitglieder der Soroptimistinnen wurden, mit Vorliebe als Praktikantinnen in die SAG.378 Sie sprach häufig auf Veranstaltungen der Initiative. Sie hatte zum Vorstand des Bundes deutscher Frauenvereine (BDF) bis ihr 1920 – aufgrund ihrer jüdischen Abstammung – Marianne Weber für das Amt der Vorsitzenden vorgezogen wurde. 1925 gründete sie die „Deutsche Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit“ als Weiterbildungseinrichtung für Frauen in sozialen Berufen. Als sie im Februar des gleichen Jahres aus gesundheitlichen Gründen die vollamtliche Leitung ihrer Schule aufgeben wollte, wandte sie sich auf der Suche nach einer Nachfolgerin an die SAG.379 Daß sie davon überzeugt war, dort fündig zu werden, unterstreicht den Umstand, daß ihr, die sich hauptamtlich mit sozialer Arbeit auseinandersetzte, die SAG als ein etablierter ‚Betrieb‘ in jenem Zusammenhang galt. Wie Siegmund-Schultze wurde auch Salomon, die sich in Schultzes ‚Hilfskomitee‘ engagierte, nach Gestapo-Verhören zur Emigration gezwungen. Sie wurde 1944 Ehrenpräsidentin der International Alliance of Women (IAW) – in der wiederum der von Bähnisch gegründete DFR Aufnahme fand – und starb 1948 in New York.380
377 Für ein Kurzporträt, das leider ohne Belege auskommt, vgl.: Röwekamp, Marion: Art.: „Westerkamp, Alix“, in: dies. (Hrsg.): Juristinnen. Lexikon zu Leben und Werk, BadenBaden 2005, S. 430. 378 Vgl.: Sachße: Siegmund-Schultze, in: Krauß: Soziale Arbeit, S. 29. Sachße bezieht sich hier auf die Magisterarbeit Anja Schülers. 379 „Irgend jemand sagt, es gäbe bei Ihnen ein Fräulein Lepsius, das vielleicht in Frage kommt […] Ich weiss, Sie würden mir helfen, wenn Sie eine Möglichkeit haben und deshalb bitte ich Sie herzlich, die Sache einmal zu erwägen und zu sehen, ob Ihnen nicht irgend jemand einfällt, der dafür in Frage kommt.“ EZA, 51/S II c 8, II Alice Salomon an Friedrich Siegmund-Schultze, 04.02.1925. 380 Vgl.: Berger, Manfred: Alice Salomon. Pionierin der sozialen Arbeit und der Frauenbewegung, 3. Aufl., Frankfurt a. M., 2011 sowie zur internationalen Arbeit Salomons vor 1933: Schüler: Frauenbewegung.
320 | Theanolte Bähnisch
Etta Gräfin von Waldersee, die von 1922 bis 1928 die Wohlfahrtsorganisation ‚Mütterliche Hilfe‘ leitete, schien sowohl eine enge Bekannte von Siegmund-Schultze, als auch eine ‚Freundin der SAG‘ gewesen zu sein. Darauf deutet ein Brief SiegmundSchultzes hin.381 Waldersee, die Geschichte und Psychologie studiert und 1939 begonnen hatte für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zu arbeiten, war 1945 an der Wiedergründung des DRK-Verbandes Nordrhein beteiligt. Sie blieb dessen Vizepräsidentin bis 1960. 1950 wurde sie Vizepräsidentin des DRK-Bundesverbandes. Im Rahmen ihrer Arbeit für Flüchtlinge und Vertriebene im DRK arbeitete sie mit Theanolte Bähnisch zusammen382 – ein weiterer Beleg für die personelle Kontinuität der Wohlfahrtsarbeit zwischen der Weimarer Re-publik und der BRD, insbesondere, was die weiblichen Führungskräfte angeht. Dr. Agnes von Zahn-Harnack, die Tochter des berühmten und von Theanolte Bähnisch sehr geschätzten Theologen Adolf von Harnack, der gleichzeitig Lehrer Siegmund-Schultzes gewesen war, unterrichtete zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Oberlehrerin am vornehmen, privaten Institut Wellmann von Elpons. Daneben betreute sie zwei Jahre lang 14- bis 16-jährige Mädchen im Rahmen der SAGClubarbeit,383 bis sie 1914 im Zusammenhang mit ihrem Engagement im ‚Nationalen Frauendienst‘ die Leitung der Abteilung ‚Frauenarbeit‘ im Kriegsamt übernahm. „Das Backfisch-Alter lag ihr besonders nahe, denn ihre Schülerinnen im Westen waren im gleichen Alter“384, schrieb Elisabeth von Harnack über das Engagement ihrer Schwester in der SAG, für welches diese jeden Samstagabend allein eine Stunde Fahrweg vom Stadtteil Halensee aus aufwendete.385 Sie trug dafür Sorge, daß ihre Schülerinnen aus der „1. Lyzeumsklasse“ im Charlottenburger Institut mit dem von ihr geleiteten ‚Klub Fröhliche Jugend‘ in Friedrichshain in Briefkontakt kamen und jeweils ein reges Interesse an „den andern“386 entwickelten. Agnes von ZahnHarnack war ab 1946 von zentraler Bedeutung für Theanolte Bähnisch, als sie gemeinsam mit der Berlinerin die bürgerliche Frauenbewegung in Deutschland wieder aufbaute. Dr. Elisabeth von Harnack war durch ihre Rolle im Wohlfahrtswesen in der Gesellschaft zu einigem Ansehen gelangt. Wie ihre Schwester Agnes war sie eine der wichtigsten Protagonistinnen in der Berliner Frauenbewegung.387 Von 1921 bis 1933
381 EZA, 51/S II c 8, II Friedrich Siegmund-Schultze an Gräfin Waldersee, 25.05.1927. Der Brief wurde, vermutlich von Siegmund-Schultze selbst, wie die Briefe an Bähnisch, in der Rubrik „Freunde der SAG“ abgelegt. 382 Siehe Kapitel 5.4.2. 383 Ihre Erfahrungen mit dem Mädchenclub ‚Fröhliche Jugend‘ veröffentlichte sie erstmals 1914: Harnack, Agnes von: Der Mädchenklub „Fröhliche Jugend“, in: Nachrichten aus der Sozialen Arbeitsgemeinschaft, Bd. 6 (1914), S. 192–198. 384 Harnack, Elisabeth von: Jugend, S. 152. 385 Vgl.: ebd., S. 154. 386 Harnack, Agnes von: Jugend, S. 193. 387 Zeitweilig war Elisabeth von Harnack Geschäftsführerin des Stadtverbandes Berliner Frauenverbände. Agnes von Zahn-Harnack begründete 1926 gemeinsam mit anderen Frauen den Akademikerinnen-Bund und übernahm 1931 den Vorsitz des Bundes deut-
Albrecht Bähnisch | 321
war sie Vorsitzende der Berliner Wohlfahrtsvereinigung (später Paritätischer Wohlfahrtverband Berlin). Sie engagierte sich ebenfalls in der SAG Mädchenarbeit.388 Der Bruder der beiden Harnack-Schwestern, Ernst von Harnack, war seit 1921 Vorsitzender des Bundes religiöser Sozialisten. Seit 1929 war er, der zuvor Landrat in Hersfeld gewesen war, Regierungspräsident des Bezirks Merseburg. Von 1929 bis 1932 war er in dieser Eigenschaft Albrecht Bähnisch vorgesetzt. Jahre nach ihrer beider Amtsenthebung soll er Theanolte Bähnisch für die Arbeit im Widerstand gegen den Nationalsozialismus geworben haben.389 Eine Mitarbeit Ernst von Harnacks in der SAG ist nicht überliefert. Paul Ciupke zufolge kamen jedoch einige Mitarbeiter der SAG, insbesondere jene, die sich in der Jugend- und Erwachsenenbildung engagierten, aus dem Kreis der religiösen Sozia-listen.390 Auch Margot Cohn, damals Sekretärin Martin Bubers, später promovierte Politologin, hatte sich an der Arbeit der SAG beteiligt.391 Theanolte Bähnischs wichtigste Verbindung zu den religiösen Sozialisten dürfte wiederum der preußische, später niedersächsische Kultusminister Adolf Grimme gewesen sein, mit dem sie von den 1920ern bis in die 1960er Jahre freundschaftlich verbunden war. Heinz Elmar Tenorth und Arnold Pfeiffer rechnen sogar Friedrich Siegmund-Schultze selbst zu den religiösen Sozialisten, wobei unklar bleibt, ob sich diese Zuordnung nur auf die ideelle Verortung der politischen Haltung Siegmund-Schultzes bezieht oder auch auf eine Mitgliedschaft.392 Die Schnittmengen
388 389 390
391 392
scher Frauenvereine (BDF) zu dessen Nachfolger sich der von Theanolte Bähnisch geleitete Deutsche Frauenring (DFR) 1949 erklärte. Soziale Arbeitsgemeinschaft Ost: Anschriften der auswärtigen Mitarbeiter der sozialen Arbeitsgemeinschaft, Berlin 1927, S. 5. Die Liste ist im Stadtmuseum Berlin überliefert. Das schreibt Theanolte Bähnisch in einem Lebenslauf. AddF Kassel, SP-01, Kurze Lebensskizze, o. D. [1947]. Paul Ciupke verweist in diesem Zusammenhang auf Carl Mennicke, den Herausgeber der ‚Blätter für religiösen Sozialismus‘ und Otto Heinrich von der Gablentz, der in den 1940er Jahren enge Kontakte zum Kreisauer Kreis entwickelte. Vgl.: Ciupke, Paul: Friedrich Siegmund-Schultze und die Volksbildung der Weimarer Zeit, in: Tenorth: Siegmund-Schultze, S. 85–101, hier S. 98. Gablentz begründete 1945 die Berliner CDU und wurde an der Deutschen Hochschule für Politik einer der ersten Professoren für Politikwissenschaft. Mennicke hatte bereits 1930 eine Professur am berufspädagogischen Institut der Uni Frankfurt inne. 1933 emigrierte er in die Niederlande, 1941 wurde er nach Deutschland verschleppt, wo er schließlich in das Konzentrationslager Sachsenhausen verbracht wurde. Nach dem Ende des Dritten Reiches lehrte er in Frankfurt Sozialpädagogik. Vgl.: Soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, Anschriftenliste der auswärtigen Mitarbeiter, Berlin 1927, S. 7. Vgl.: Tenorth, Heinz Elmar: Friedrich Siegmund-Schultze – Eine erziehungswissenschaftliche Annäherung, in: ders.: Friedrich Siegmund-Schultze, S. 70–83, hier S. 82. Vgl. auch den Artikel Arnold Pfeiffers, auf den Tenorth verweist: Pfeiffer, Arnold: Religiöse Sozialisten, in: Kerbs, Diethard, Reulecke, Jürgen (Hrsg.): Handbuch der deutschen Reformbewegungen, 1880–1933, Wuppertal 1998, S. 523–526. Fritz Borinski bezeichnet Siegmund-Schultze als Vertreter eines „religiösen Pazifismus“, der vom religiösen Sozia-
322 | Theanolte Bähnisch
der Bekanntenkreise Ernst von Harnacks, Adolf Grimmes und Albrecht bzw. Theanolte Bähnischs dürften vor dem Hintergrund der jeweiligen Nähe aller Beteiligten zur SAG einerseits und zu den religiösen Sozialisten andererseits jedenfalls eher groß gewesen sein. Zu den akademisch gebildeten Frauen, die sich in der SAG betätigten, gehörte auch Al-brecht Bähnischs Schwester Elisabeth Bähnisch. Noch 1927 taucht sie, als mittlerweile verheiratete Elisabeth Bohmhammel, mit ihrer Kölner Adresse in der Mitarbeiterliste der SAG auf.393 Dies läßt einerseits auf eine eher ‚stille‘ Mitgliedschaft zu dieser Zeit schließen, andererseits deutet die Anmerkung „Mbg. und Bln.“394 darauf hin, daß sie sowohl den Kontakt zur Marburger als auch zur Berliner Gruppe der SAG aus ihrer jeweiligen Studienzeit hielt.395 Möglich ist, daß Albrecht Bähnisch schon in Marburg – denn auch er hatte dort einige Semester studiert – mit den Ideen der SAG in Kontakt gekommen war. In Marburg hatte die SAG einen ihrer erfolgreichsten Ableger entwickelt.396 Dieses Phänomen führt Norbert Jegelka, der Biograph Paul Natorps, darauf zurück, daß der akademische Vater SiegmundSchultzes, Natorp und andere Professoren dort besonders erfolgreich mit ihrem Versuch waren, „die Jugend an die soziale Frage heranzuführen.“397 Vielleicht hatte Albrecht Bähnisch ja an einem der von Natorp veranstalteten ‚akademisch-sozialen Abende‘ in Marburg teilgenommen.398 Dem leitenden SAG-Mitarbeiter Hermann Gramm zufolge war es nicht unüblich, daß Studenten gerade wegen der Möglichkeit in der ‚Zentrale‘ der SAG arbeiten zu können, ihren Studienort nach Berlin verlegten.399 Ob dies auch für Elisabeth und/oder Albrecht Bähnisch ein Beweggrund für den Wechsel nach Berlin war, läßt sich nicht nachvollziehen. Nicht nur was die ‚religiösen Sozialisten‘ betrifft, überschnitten sich andere Kreise, in denen sich die Bähnischs bewegten, mit dem Kreis der SAG: Beispielsweise war Albrecht Bähnisch, ab 1928 Regierungsrat, ab 1929 Landrat, nicht der einzige höhere preußische Verwaltungsbeamte, der sich im oder für den Berliner Osten engagierte. Insbesondere Mitarbeiter des Ministeriums für Volkswohlfahrt, wie die Ministerialrätin Gertrud Bäumer, waren gern gesehene Redner bei Veranstaltungen der
393 394 395 396
397 398 399
lismus Paul Tillichs verschieden gewesen sei. Dies habe mit zum konflikhaften Verhältnis zwischen Siegmund-Schultze und den Vertretern der ‚Neuen Leipziger Richtung‘ in der Erwachsenenbildungsbewegungbeigetragen. Borinski: Wechselverhältnis, S. 256. Vgl.: Soziale Arbeitsgemeinschaft Ost. Anschriftenliste der auswärtigen Mitarbeiter der Sozialen Arbeitsgemeinschaft, Berlin 1927, S. 5. Ebd. Ortsgruppen der SAG existierten auch in Barmen, Bielefeld, Frankfurt am Main, Görlitz, Jena, Halle, Leipzig, Breslau, Köln, Niesky, Stettin, Vlotho, Wernigerode und Basel. Nachgewiesen ist ihre Mitarbeit in einer Akte über die SAG-Arbeit in Marburg, EZA, 51/S II m 7. Demnach leitete sie einmal pro Woche für eineinhalb Stunden eine Gruppe namens ‚Rubinstein‘ mit 18 Mädchen und Jungen, darunter viele Geschwisterkinder. Jegelka: Natorp, S. 195. Natorp lehrte von 1883 bis 1922 an der Marburger Universität und veranstaltete dort seine ‚akademisch-sozialen‘ Abende. Gramm: Siegmund-Schultze, S. 131.
Albrecht Bähnisch | 323
SAG und des akademisch-sozialen Kreises.400 Das Polizeipräsidium, in dem Theanolte Bähnisch arbeitete, war der SAGallein schon insofern vertraut, als die Mitbegründerin der SAG und Ehefrau Siegmund-Schultzes, Maria Siegmund-Schultze, als Leiterin des Pflegeamtes im Jugend- und Wohlfahrtsamt ihren Dienstort im Präsidium hatte. Es ist überliefert, daß Ausflüge des akademisch-sozialen Vereins, der mit der SAG eng verknüpft war, wiederholt in wichtige Behörden führten – auch in das Berliner Polizeipräsidium.401 Eine Verbindung zu den Soroptimistinnen bestand, wie erwähnt, insofern, als Alice Salomon, die Leiterin der sozialen Frauenschule, viele ihrer Schülerinnen als Praktikantinnen in der SAG unterbrachte und daß wiederum einige Soroptimistinnen zumindest einen Teil ihrer Ausbildung bei Alice Salomon genossen hatten. Es ist deshalb wahrscheinlich, daß Theanolte im Club mit Frauen in Kontakt gekommen war, die ein Praktikum in der SAG absolviert hatten und daß Mitarbeiter der SAG zusammen mit Club-Mitgliedern Fortbildungskurse bei Alice Salomon besuchten. Für diese Kurse warb Salomon nämlich erfolgreich in der SAG402, so daß sie sich ihr Engagement in der SAG auch auf diese Art beruflich zunutze machen konnte. Schließlich fanden sich unter den Mitgliedern der SAG viele Gegner des Nationalsozialismus. Siegmund-Schultze und Salomon wurden des Landes verwiesen, andere Mitarbeiter und Freunde der SAG sahen sich gezwungen, zu fliehen, einige wurden inhaftiert, einige hingerichtet, viele verloren Freunde und enge Verwandte. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Elisabeth und Agnes von Zahn-Harnack hatten ihren Bruder zu beklagen, der Pädagoge Adolf Reichwein, mit dem Siegmund-Schultze zusammenarbeitete, gehörte selbst zu den Hingerichteten. Damit bestätigte sich auch im Kreis der SAG – einmal abgesehen davon, daß sich zeitweise auch politisch rechts eingestellte Personen wie Horst Wessel für die SAG interessierten403 – was die Kontakte der Bähnischs bei den Soroptimistinnen und in der preußischen Verwaltung ausmachte: Es waren vornehmlich reformorientierte Eliten, darunter einige Juden und NS-Gegner, mit denen man sich im Berlin der 20er Jahre umgab. Da die SAG Mitglied im ‚Verein Volkshochschule Thüringen‘ war, gab es enge Beziehungen der Initiative zu den Einrichtungen der Volkshochschule und zu ihren Leitern. Eine persönliche Beziehung bestand zwischen Friedrich Siegmund-Schultze und Eduard Weitsch, dem Leiter des Volkshochschulheims Dreißigacker. Es mag in diesem Zusammenhang begründet liegen, daß sich Albrecht Bähnisch für die Rettung Dreißigackers einsetzte, als die Heimvolkshochschule der Demontage-Politik der
400 Überliefert ist unter anderem ihre Teilnahme mit einem Vortrag zum Thema ‚Arbeit des Nationalen Frauendienstes‘ an einem der akademisch-sozialen Abende am 05.11.1914. EZA, 51/S II f 2. 401 Vgl.: Gerth, Franz-Jakob: Bahnbrechendes Modell einer neuen Gesellschaft, Hamburg 1975, S. 32. 402 Aus einem undatierten Schreiben Salomons an die SAG läßt sich schließen, daß Salomon mit der regelmäßigen Teilnahme von Mitarbeiterinnen der SAG an ihren Kursen rechnen konnte. Vgl.: EZA, 51/S II c 8 I [SAG-Freunde VIII, Korrespondenz und Briefe 12.1921– 12.1927], Alice Salomon an Alix Westerkamp, o. D. 403 Vgl.: Wietschorke: Arbeiterfreunde, S. 50.
324 | Theanolte Bähnisch
NSDAP zum Opfer fallen sollte. Aufgrund der engen Beziehung zwischen der SAG und den Schulen seien zwischen 1919 und 1929 „manche junge Leute von Berlin-Ost nach Dreißigacker und Tinz“ – eine andere Heimvolkshochschule, gegangen, beschreibt Host Wollenweber die Mitarbeiterfluktuation zwischen den Einrichtungen vor dem Hintergrund der offensichtlichen Ähnlichkeit der Aufgaben. Dem renommierten Erwachsenenbildungsforscher Paul Ciupke zufolge bestand in der SAG eine „vernetzte Vielfalt auf (junge) Erwachsene bezogene[r] Bildungsaktivitäten, aus der sich, […] ab Mitte der 20er Jahre, eigene institutionelle Kerne der Volks- bzw. der Erwachsenenbildung herausschälten.“404 Mit der Jugendhochschule, der Abendvolkshochschule und dem Volkshochschulheim Ulmenhof hatte sich die SAG ein solides Standbein in der Erwachsenenbildung erarbeitet, „man sprach mit Recht“, so schreibt Fritz Borinski „von einer Abendvolkshochschule Berlin-Ost.“405 Die Kontakte, welche die SAG in dieser Hinsicht über ihre Reihen hinaus pflegte, kamen wiederum auch der Weiterqualifikation ihrer eigenen Mitarbeiter zu Gute. Weil es, wie Fritz Borinski anmerkt, zwischen den Vertretern der ‚Neuen Leipziger Richtung‘ und Siegmund-Schultze, auch „tiefgreifende Gegensätze [gab], die man nicht verharmlosen darf“406, mag Siegmund-Schultze besonders die Nähe zu Weitsch gesucht haben. Denn dieser orientierte sich zwar an der ‚Neuen Richtung‘, wollte sich aber doch nicht ganz auf ihre Linie festlegen, sondern arbeitete und lebte in Dreißigacker sozusagen in einer Zwischenwelt zwischen den dominierenden Denkschulen in der Erwachsenenbildung. Wie an anderer Stelle näher ausgeführt werden wird, suchte die niedersächsische Volkshochschule, die auf die thüringische Volksbildungsarbeit inhaltlich wie personell aufbaute, ab 1946 den Kontakt zu Theanolte Bähnisch. Diese tradierte ihrerseits Inhalte der thüringischen Reformpädagogik und ihrer Weiterentwicklung durch deutsche Erwachsenenbildner im Exil in ihrer Frauenbildungsarbeit. 3.4.2.3 Effekte der SAG-Arbeit über Berlin und die Weimarer Republik hinaus Viele Mitarbeiter der SAG bauten schon während ihres Wirkens in der Arbeitsgemeinschaft oder auch nach dem Ende ihres Engagements in der SAG auf die Ideen Siegmund-Schultzes auf und brachten ihre aus der SAG-Arbeit resultierenden Erfahrungen und Überzeugungen in ihre weitere soziale, pädagogische und politische Arbeit ein – sei es noch in der Weimarer Republik oder erst in der zweiten deutschen Demokratie. So hielt beispielsweise einer der bedeutendsten Erwachsenenbildner der BRD, Fritz Borinski, der ab 1947 die Heimvolkshochschule Göhrde leitete, nach eigener Aussage seine Erfahrungen in der SAG für unentbehrlich für sein weiteres Wirken.407 Agnes von Zahn-Harnack408 konnte – ebenso wie Theanolte Bähnisch, die über ihren Mann mit der SAG in Kontakt gekommen war – ihre Erfahrungen aus der
404 405 406 407 408
Vgl.: Ciupke: Siegmund-Schultze, S. 90. Borinski: Wechselverhältnis. Ebd. Vgl.: Ebd. Zahn-Harnack war gemeinsam mit Theanolte Bähnisch in federführender Rolle an der Etablierung des DFR als Nachfolgeorganisation des BDF beteiligt.
Albrecht Bähnisch | 325
SAG-Arbeit in den Wiederaufbau der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland nach 1945 einbringen. Jene tatsächlich greifbaren Wirkungszusammenhänge beschrieb Maria Siegmund-Schultze in ihrer Zeit idealisierend so: „Die Referendare beim Kammergericht, die Jugendclubs regieren, finden später erfrischende Wege jugendrichterlichen Schaffens; der Märchenonkel aus dem Breslauer Arbeiterviertel kommentiert die Fürsorgepflichtverordnung.“409 Schließlich wurden einige Gründungen der SAG, wie die Einrichtungen der jugendlichen Psychopatenfürsorge oder das ‚weibliche Ledigenheim Moabit‘ nach ihrer Etablierung samt ihren Mitarbeitern von der SAG in eine städtische Trägerschaft überführt410, worüber sich die SAG personell und institutionell in der Kommune verankern konnte. Daß sich die SAG einen Namen in den verschiedenen Verwaltungsebenen gemacht hatte und daß staatliche und städtische Entscheidungsträger durchaus daran interessiert waren, mit ihr zusammenzuarbeiten, zeigte sich unter anderem auf der ‚Internationalen Settlement-Konferenz‘ in Berlin 1932, die von der zweiten Vorsitzenden der SAG, Alix Westerkamp, auf dem Gelände der SAG organisiert worden war.411 Zur Konferenz erschien neben der Ministerialrätin und ‚Dauerfreundin der SAG‘, Gertrud Bäumer, als Vertreterin des Reichs und der Länder auch ein Vertreter der Stadt Berlin, der sozialdemokratische Stadtrat Emil Wutzky, dessen Hauptzuständigkeitsbereiche das Ernährungswesen, die Wohnungsbauverwaltung, das Landeswohlfahrtsamt und das Jugendamt waren.412 Siegmund-Schultzes Siedlungsarbeit hatte – entgegen Christoph Sachßes Einschätzung413 – durchaus nachhaltigen Einfluß auf die Sozialreform und die Soziale Arbeit in Deutschland. Die Träger und Mitarbeiter der SAG waren zu bekannt, zu einflußreich, zu zahlreich, und – was ihr weiteres Wirken in der Bundesrepublik betrifft – auch zu persistent in ihrem Drang, die Gesellschaft mitzugestalten, als daß von der Prägung ihrer Biographie durch die SAG-Arbeit kein nachhaltiger Einfluß hätte ausgehen können. Es läßt sich allenfalls darüber streiten, ob die Effekte der SAG-Arbeit sich vielleicht noch stärker in der Erwachsenenpädagogik, als in der sozialen Arbeit niederschlugen – sofern sich zwischen beiden Bereichen überhaupt eine Trennlinie ziehen läßt. Es ist nicht zuletzt auf den persönlichen Einfluß von Akteuren zurückzuführen, die, wie Siegmund-Schultze, eine große Schnittmenge zwischen sozialer Arbeit und Erwachsenenbildung forcierten, daß die Verbindung beider Bereiche in der zweiten Nachkriegszeit wieder auflebte – zumal die Militärregierungen im
409 Siegmund-Schultze, Maria: Die Wohlfahrtspflege (im Rahmen der Großstadtsiedlung), in: Soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost: Nachbarschaftssiedlung, S. 37–41, hier S. 40. 410 Vgl.: Oswalt, August: Zur Nachbarschaftsfrage, in: Soziale Arbeitsgemeinschaft BerlinOst: Nachbarschaftssiedlung, S. 29–36, hier S. 38. 411 Vgl.: Westerkamp, Alix: IV. Internationale Settlement-Konferenz. Veranstaltet von der internationalen Settlement-Vereinigung vom 16. bis 20. Juli 1932 in der Siedlung Ulmenhof der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin Ost, Berlin 1932. 412 Zwischen 1924 und 1932 war Wutzky auch stellvertretendes Mitglied des Reichsrates. Als Aufsichtsratsvorsitzender wirkte er in den städtischen Gesellschaften für Stadtgüter sowie für die Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke. 413 Sachße: Siegmund-Schultze, in: Tenorth: Siegmund-Schultze, S. 49.
326 | Theanolte Bähnisch
Rahmen ihrer Deutschland-Politik die Verbindung beider Bereiche ebenfalls forcierten und entsprechend solche Akteure förderten.414 Auch Jens Wietschorke, der in jüngster Zeit zur SAG geforscht und dabei in vielerlei Hinsicht methodisch und thematisch Neuland betreten hat, ist der Meinung, daß die SAG in sozialreformerischen Kreisen „erhebliche Resonanz“ erfahren hat, vor allem indem sie zu einer „bekannten Forschungs- und Ausbildungsstelle für soziale Berufe“415 avanciert sei. Daß Albrecht Bähnisch mit seiner Arbeit in der SAG in seinem Lebenslauf für seine Person ‚warb‘, ist darauf zurückzuführen, daß dem angehenden Verwaltungsjuristen dieser Umstand bewußt war. Auch wenn ein direkter ‚Erfolg‘ der SAG nicht meßbar sein mag, so lebte die Idee der SAG, die selbst an andere Projekte der Zeit anknüpfte, doch in ihren Mitwirkenden fort und führte so zur Entwicklung weiterer sozialer und pädagogischer Projekte auf der Grundlage des Ideengutes der SAG, von denen einige über Jahrzehnte nachwirkten. Franz-Jakob Gerth schreibt, es habe nach dem Zweiten Weltkrieg ein „Re-Import“416 in Deutschland – auch in der SAG – entwickelter Methoden in der Sozialarbeit stattgefunden, als SAG-Mitglieder aus dem Exil nach Deutschland zurückkehrten. Die Auseinandersetzung mit Theanolte Bähnischs Biographie bestätigt diesen Eindruck Gerths. Der bekannte Erziehungswissenschaftler Paul Ciupke schreibt, die SAG sei ein „Durchlauferhitzer für Ideen, Kompetenzen und Menschen“ gewesen. Ciupke greift sich das Beispiel der Erwachsenenbildung heraus und stellt als Nutznießer der Verhältnisse in personeller und ideeller Hinsicht die Volkshochschule und das Volksbildungsamt Leipzig dar. Siegmund-Schultze und die SAG, so Ciupke weiter, hätten eine „ausgezeichnete Vernetzung“ mit den Strukturen und Persönlichkeiten der Weimarer Volksbildung“ und einen „nachhaltigen, vielleicht weniger konzeptionellen, aber doch personellen und allgemein weltanschaulichen Einfluss“417 gehabt. Insbesondere wenn man die SAG in Beziehung zu vergleichbaren Initiativen im Ausland setzt, war Siegmund-Schultze nicht der Außenseiter, als den Sachße ihn bezeichnet,418 sondern der Theologe war mitverantwortlich für die Entwicklung einer Basis internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sozialreform und der Erwachsenenbildung, die sich in der zweiten deutschen Nachkriegszeit – unter Einbeziehung Theanolte Bähnischs – fortsetzen sollte. Ferner spielte Siegmund-Schultze eine wichtige Rolle für die Motivation vieler Studenten, sich überhaupt mit der ‚sozialen Frage‘ auseinanderzusetzen und ihre ‚Entschärfung‘ als eine zentrale Aufgabe für das gesellschaftliche Zusammenleben und für den Aufbau einer stabilen Demokratie zu sehen. Sein ‚soziales Werk‘ ist deshalb mitnichten, wie Sachße es be-
414 Siehe Kapitel 6.4.3. und 6.4.4. 415 Wietschorke, Jens: Friedrich Siegmund-Schultze. Ein biographisch-bibliographischer Abriß, in: Tenorth: Siegmund-Schultze, S. 147–151, hier S. 148. 416 Gerth: Ansätze, S. 338. 417 Ciupke: Siegmund-Schultze, S. 99. Als Beispiele für seine These nennt er einige Autoren der Akademisch-sozialen Monatsschrift wie Gertrud Bäumer, Alice Salomon, Eduard Spranger, Theodor Heuss und Adolf Reichwein. 418 Sachße: Siegmund-Schultze, in: Tenorth: Siegmund-Schultze, S. 49.
Albrecht Bähnisch | 327
schreibt,419 mit ihm selbst zu Ende gegangen, sondern hat, wenn auch die SAG als Einrichtung trotz entsprechender Versuche Siegmund-Schultzes nicht fortbestand, wie beschrieben, in seinen Schülern und Mitarbeitern, beziehungsweise Freunden der SAG – wozu der Theologe auch Theanolte Bähnisch zählte420 – fortgelebt. Ohne Zweifel liegt Sachße nicht falsch, wenn er schreibt, die Idee der SAG sei ‚paternalistisch‘ und als Konzept der Klassenversöhnung durch den „persönlichen Dienst“ am Volksganzen von seiner Herkunft her „wilhelminischer Natur“ gewesen. Doch die Aussage, die Projekt-Arbeit habe eine „charakteristische Verarbeitung unentwickelter demokratischer Strukturen des politischen Systems“421 beinhaltet, trifft nur teilweise zu. Der Fortbestand der SAG über 22 Jahre und die Motivation so vieler, sich an der SAG-Arbeit zu beteiligen, zeigen, daß die Ideen in den beschriebenen Kreisen anschlußfähig waren und es über lange Zeit blieben. Naturgemäß waren die einflußreichsten, in ihrer Persönlichkeit bereits gereiften Protagonisten der SAG im Kaiserreich sozialisiert worden und sicherlich waren sie geneigt, an entsprechende Sozialisationseffekte anzuknüpfen. Daneben stand jedoch ein erklärter Wille der Mitarbeiter, demokratische Entwicklungen ‚an der Basis‘ voranzutreiben. In den Clubs wurden die jugendlichen Mitglieder dazu angehalten, die Meinungen anderer zu anzuhören, zu diskutieren und Mehrheits-Entscheidungen zu fällen. SiegmundSchultzes Idee, sich persönlich ein Bild von den Lebensgewohnheiten und den Einstellungen von Arbeitern in Friedrichshain zu machen, um daraus wissenschaftlich fundierte sozialpolitische Konzepte sowie eine politische Programmatik zu entwerfen, entbehrt ebenfalls nicht jeder Logik und verdient, zumal sie zu einer Zeit stattfand, in der im Bürgertum kaum Kenntnisse über das Alltagsleben von Arbeiterfamilien vorhanden waren, Anerkennung. Gemeinsam war den Anhängern der SAG schließlich, daß sie eine große Toleranz gegenüber politisch anders eingestellten Menschen hatten und sich nicht nur dafür einsetzten, daß die SAG überparteilich blieb, sondern, daß sie, wie das Ehepaar Bähnisch den Gedanken der Überparteilichkeit und der Pluralen Demokratie auch in andere Projekte und Organisationen hineintrugen. 3.4.2.4 Die SAG als Übungsfeld und Sprungbrett für Albrecht Albrecht Bähnisch dürfte verschiedene Gründe gehabt haben, in der SAG mitzuarbeiten: Mutmaßlich wird ihn, zumal er zu Beginn seiner Mitarbeit noch Student war, die Möglichkeit gereizt haben, in der SAG Persönlichkeiten mit Rang und Namen aus dem Wohlfahrts- und Bildungssektor sowie anderen zukunftsträchtigen Verwaltungsund Politikbereichen, die mit der Reform des Staats und der Gesellschaft in Verbindung standen, kennenzulernen. Die überlieferten Unterlagen zeigen, daß er eine Karriere im Verwaltungswesen und/oder der Verwaltungswissenschaft anstrebte und auf bemerkenswert interdisziplinäre Weise bei vielen reformorientierten Professoren aus
419 Ebd. Sachße billigt Siegmund-Schultze immerhin eine bleibende Bedeutung im Rahmen seines politischen und theologischen Wirkens für Ökumene und Frieden zu. 420 Das ist aus der durch Siegmund-Schultze angelegten Korrespondenz-Verwaltung ersichtlich: EZA 626/75. 421 Sachße: Siegmund-Schultze, in: Tenorth: Siegmund-Schultze, S. 48.
328 | Theanolte Bähnisch
dem Bereich der Rechts-, Wirtschafts- und Staatswissenschaften sowie aus der Theologie und Soziologie studiert hatte. Die Arbeit in der SAG ermöglichte ihm nicht nur, Kontakte zu etablieren, sondern auch praktische Kenntnisse über das Bildungs- und Wohlfahrtswesen zu sammeln. Zu Friedrich Siegmund-Schultze suchte er nachweislich auch über den Rahmen der SAG hinaus persönlichen Kontakt.422 In einer Zeit, in der die SAG bereits ihren Stand in der Jugend- und Erwachsenenbildungsarbeit gefestigt hatte, konnte Albrecht Bähnisch in der Initiative wichtige Jugend- und Erwachsenenbildner kennenlernen, deren Ideen nicht nur in der SAGeigenen Heimvolkshochschule Ulmenhof, sondern in der ganzen Republik und sogar darüber hinaus Gehör fanden. Neben Wenzel Holek sind in diesem Kontext vor allem Hermann Gramm und Werner Krukenberg zu nennen. Das Ehepaar Bähnisch traf 1928 anläßlich einer Vorkonferenz zu einer späteren Tagung in einem kleinen, durchaus als elitär charakterisierbaren Zirkel auf dem Lauenstein mit eben jenen Personen zusammen, um über die Zukunft der SAG zu diskutieren. Siegmund-Schultze hatte Albrecht Bähnisch persönlich gebeten, ein Referat zum Thema ‚die politische Zukunft der SAG‘ zu halten und ihm mitgeteilt, daß den zur Vorbesprechung geladenen Führungskräften dieses Treffen aufgrund seines wegweisenden Charakters wichtiger sei, als die SAG-Konferenz im größeren Kreis, welche später in Probstzella stattfand.423 Albrecht Bähnisch nahm die Einladung – zumal er den Kontakt zur SAG zwischen 1922 und 1926 wie er es bezeichnete – „mehr als lose“424 gepflegt hatte, zunächst mit einiger Verwunderung zu Kenntnis.425 Doch offensichtlich – dies war wiederum Siegmund-Schultzes Einladung zu entnehmen – hatte man sich im Kreis der SAG lebhaft und sehr positiv an Albrecht Bähnisch erinnert und ihn als den geeigneten Redner zum Thema ausgemacht. Neben denen Siegmund-Schultzes, Alfred Oswalts, Wenzel Holeks, Werner Krukenbergs, Erich Gramms und Tula Simons‘426 sollte auch Albrecht Bähnischs Vortrag die Grenzen abstecken helfen, innerhalb derer später die Aussprache im größeren SAG-Kreis stattfinden sollte. SiegmundSchultze schien es bei dem Treffen nicht zuletzt darum gegangen zu sein, eine stärkere Geschlossenheit der SAG hinsichtlich ihrer Ziele nach außen zu erreichen. „In der Tat sind einige Hauptprobleme der SAG noch nicht soweit geklärt, dass wir von einer gemeinsamen Anschauung sprechen könnten, die die Soziale Arbeitsgemeinschaft vor de[m] weiteren Kreis der Freunde oder Gegner deutscher Großstadtsiedlungen
422 Siegmund-Schultze kam der von Bähnisch ausgesprochenen Einladung jedoch nicht nach, wofür er Zeitprobleme verantwortlich machte: „Ich bin jeden Abend durch eigene Vorträge oder Veranstaltungen, die ich selbst zu leiten habe, besetzt. Das ist verbrecherisch, lässt sich aber in diesem Augenblick nicht ändern. Ich hoffe nur, dass unter diesen Umständen die von uns längst beabsichtigte Einladung an Sie noch eine geeignete Stunde findet, die Ihnen und uns paßt.“ EZA 51/S II c 26, Friedrich Siegmund-Schultze an Dr. Bänisch [!], 06.05.1929. 423 EZA, 51/S II b 19, Siegmund-Schultze an Albrecht Bähnisch, 14.02.1928. 424 EZA, 51/S II b 19, Albrecht Bähnisch an Friedrich Siegmund-Schultze 06.03.1928. 425 Ebd. 426 EZA, 51/S II b 19, Programm der Vor-Konferenz vom Dienstag den 22. Mai bis Sonnabend den 26. Mai auf Burg Lauenstein in Thüringen.
Albrecht Bähnisch | 329
zu bringen hätte“427, erklärte Siegmund-Schultze Bähnisch den richtungsweisenden Charakter der Vor-Konferenz. Das Besprechungsprotokoll spiegelt Bähnisch als einen konstruktiven, aber durchaus auch streitbaren Referenten und Teilnehmer der Konferenz wieder. Daß er „vielfach in Opposition zu der Arbeit des Berliner Ostens“ gestanden, sich „die Sache lange überlegt“ und den Vortrag „trotz mancherlei Bedenken“428 übernommen habe, hatte er bereits in seiner Antwort auf Siegmund-Schultzes Einladung erklärt. Als er auf der Tagung verkündete, die Grundüberzeugung der SAG, aus dem christlichem Glauben heraus zu handeln, zwar zu respektieren, aber nicht sein eigen zu nennen, stellten die offensichtlich in ihrem Denken gefestigten wie offenen Führungskräfte die Fortsetzung seiner Mitarbeit in der SAG keineswegs in Frage. Er war und blieb offenbar gerade wegen seiner gemischten Gefühle und seiner kritischen Haltung, über die jedoch weder im Brief noch im Besprechungsprotokoll genauere Informationen zu finden sind ein geachteter Gesprächspartner jener bedeutenden Persönlichkeiten der Wohlfahrtspflege und der Erwachsenenbildung. Daß aus seinem Vortrag heraus schließlich ein Artikel zum Thema ‚soll die SAG sich an die SPD anschließen?‘ entstanden war und dieser in der SAG-Zeitschrift ‚Neue Nachbarschaft‘ zum Abdruck kam, unterstreicht den Umstand, daß seine Kompetenz gefragt war und seine Meinung respektiert wurde. Der Wille des engsten Führungskreises, Bähnischs Meinung zur SAG-Arbeit zu hören, zeigt, wie sich die SAG im Lauf der Jahre weiterentwickelt hatte. Bähnisch, der sich in der Zeit nach seiner aktiven Mitarbeit in der SAG 1921/22 mutmaßlich stärker an der Arbeit der SPD und deren eigener Wohlfahrtsorganisation, der AWO angelehnt hatte (darauf deuten seine Veröffentlichungen im AWO-Organ hin429), war vielleicht sogar entgangen, daß die SAG sich selbst immer stärker auf die Linie der SPD eingeschwungen hatte und sich führende Mitglieder die Frage stellten, ob gar ein Anschluß der SAG an die Partei stattfinden solle. Mit seinem Vortrag auf dem Lauenstein und seiner Teilnahme an der Diskussion hatte Albrecht Bähnisch jedenfalls von der Möglichkeit Gebrauch machen können, die Gestalt der SAG gemeinsam mit anderen Teilnehmern (neu) zu formen.430 Aus der Arbeit in der SAG nahm Albrecht Bähnisch nicht nur weiterführende Kontakte, sondern auch wichtige Erfahrungen mit: Die Arbeit scheint ihm als eine Art Vorschule für das genutzt zu haben, was ihn zehn Jahre später als sozialdemokratischer Landrat von Merseburg, einem Kreis mit sehr hohem Arbeiteranteil und entsprechend hohem Wählerpotential für die KPD, beschäftigen sollte. Im Kontext der SAG hatte er sich in einem Feld üben können, auf dem er – glaubt man der sozialde-
427 EZA, 51/S II b 19, Friedrich Siegmund-Schultze an Albrecht Bähnisch, 14.02.1928. 428 EZA, 51/S II b 19, Albrecht Bähnisch an Friedrich Siegmund-Schultze, 06.03.1928. 429 Vgl.: Bähnisch, Albrecht: Krise der Wohlfahrtsarbeit?, in: Arbeiterwohlfahrt, 8. Jg. (1933), S. 65–70 und ders.: Bedürftigkeitsprüfung in der Arbeitslosenversicherung, in: Arbeiterwohlfahrt, 7. Jg. (1932), S. 200–204. 430 Auch Franz-Jakob Gerth sieht die Konferenz auf der Burg Lauenstein neben der in Probstzella 1929 als „Ort grundsätzlicher systematischer Besinnung“ zur Frage der Aufgaben der SAG an. Gerth: Ansätze, S. 336.
330 | Theanolte Bähnisch
mokratischen Presse des Landkreises Merseburg431 und seiner eigenen Einschätzung432 – später geradezu brillieren sollte, nämlich der Interessen-Vermittlung zwischen sehr unterschiedlichen Personen und Gruppen unter Würdigung ihrer je eigenen Handlungslogik. Wie sich in der SAG tätige Betriebssoziologen aus einem ethnographischen Blickwinkel433 in das Innere der Produktion, in die Arbeitsverhältnisse und die Verhaltensweisen der Arbeiter auf spätere Führungspositionen vorbereitet haben, so konnte sich Albrecht Bähnisch in der SAG praktisch auf seine späteren Führungspositionen in der Verwaltung vorbereiten. Jens Wietschorke folgend, ließe sich sagen, daß Bähnisch in der SAG die Gelegenheit hatte, Erfahrungen darin zu sammeln, wie ein „‚gesamtgesellschaftliches Betriebsklima unter bürgerlicher Regie“434 aufrecht zu erhalten war. Doch die Motivation der SAG-Mitarbeiter, so hält Wietschorke, der sich vor allem mit der „Bedeutung des Gebens für den Gebenden“ im Rahmen der SAG auseinandergesetzt hat, ebenfalls fest, lasse sich nicht allein auf ein praktisches Kalkül reduzieren. Neben dem paternalistischen Eigennutz habe durchaus der „aufrichtige[…] Willen“ der Mitarbeiter, konkrete Lebenshilfe zu geben und sich den sozialen Realitäten zu stellen, gestanden. Jenes „verwickelte Verhältnis beider Motivationen“435 scheint – das legen die im Folgenden vorgestellten Veröffentlichungen nahe – auch Bähnischs Haltung zur SAG dominiert zu haben. Daß auch Theanolte Bähnisch von den Erfahrungen ihres Mannes in der SAG profitieren konnte und sie für ihre spätere Arbeit nutzte, läßt sich nicht belegen. Aber eine entsprechende Haltung war auch ihr eigen. Auch sie übernahm, vor allem ab 1946, Aufgaben, in denen Verhandlungsgeschick gefragt war, und versuchte in ihrer Rolle als Präsidentin des DFR ‚bürgerliche Werte‘ zu vermitteln – in der Hoffnung, daß ein entsprechendes Werteempfinden in den Köpfen möglichst vieler zu einer stabilen Gesellschaft führen möge. Sie vermittelte nicht nur staatliche Leistungen, sondern sie leistete, wie bereits erwähnt, auf verschiedene Weise auch persönlich Hilfestellung in ihren Ämtern als Regierungspräsidentin und als Vorsitzende von Frauenvereinigungen. Nicht vergessen werden sollte schließlich, daß die Mitarbeit in der SAG für Albrecht Bähnisch auch einen ganz pragmatischen Charakter als praktische studentische Übung gehabt haben dürfte. Für den jungen Akademiker bot die Mitarbeit in der SAG eine Möglichkeit, gegen Ende seiner universitären Ausbildung in der Praxis sein Bild von dem zu überprüfen, was er in der Theorie erlernt hatte und – wie schon erwähnt – die Chance in der Zeitschrift der SAG, ‚Neue Nachbarschaft‘ einen Artikel zu veröffentlichen.
431 O. V. [„Rsch“]: Rückblick auf den gestrigen Kreistag, in: Merseburger Korrespondent, Nr. 63, 15.03.1930. 432 Albrecht Bähnisch an Theanolte Bähnisch, 13.06.1942, zitiert nach Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von OrlaMaria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 12/13. 433 Vgl.: Wietschorke: Sozialforschung, S. 65. 434 Wietschorke: Settlement, S. 315. 435 Ebd.
Albrecht Bähnisch | 331
3.4.2.5 Albrechts Position zwischen Bürgerlicher Sozialreform und dem Sozialstaat 1928 – eine Folge der „Krise [staatlicher] Wohlfahrtsarbeit“? Zwei Aufsätze, die Albrecht Bähnisch in der Zeitschrift ‚Arbeiterwohlfahrt‘ veröffentlichte,436 zeigen ihn als einen überzeugten Verfechter der Sozialpolitik der Weimarer Republik. Aus beiden Aufsätzen spricht ein Verantwortungsgefühl Bähnischs, der mittlerweile Landrat von Merseburg war, für die Entschärfung persönlicher Notlagen ärmerer Bürger – zu einer Zeit, in der der ‚Wohlfahrtsstaat‘ durch Zutun der nationalsozialistischen Propaganda in der Bevölkerung bereits zunehmend als Einrichtung für ‚Volksschädlinge‘ und ‚Ballastexistenzen‘ wahrgenommen wurde.437 Ganz anders als sein Landrats-Kollege aus Ueckermünde, dessen Äußerungen Bähnisch zum Anlaß nahm, sich selbst zu positionieren, wollte der Merseburger Landrat Fürsorgeleistungen als einklagbares Recht verbrieft wissen. Er sah – wiederum ganz im Gegensatz zu Landrat Dr. Breitfeld – kaum die Gefahr eines Mißbrauchs staatlicher Leistungen durch ihre Empfänger.438 Einem seiner Aufsätze ist jedoch ein gewisses Maß an Skepsis gegenüber einer zentralisierten Verwaltung von Sozialleistungen zu entnehmen. Bähnisch empfand die Anonymität in der Beziehung zwischen Staat und Bürgern als problematisch, weshalb er sich dafür einsetzte, den Kommunen eine starke Position als Entscheidungsträgerinnen in der Wohlfahrtspolitik zu übertragen.439 Daß er sich neben seiner Arbeit in der Verwaltung und neben seinen Schriften zum Thema Sozialpolitik in der SAG engagierte – welche auf den persönlichen Austausch setzte zwischen bedürftigen Personen und solchen, die die Bereitschaft zur ‚nachbarschaftlichen‘ Hilfe hatten – paßt zu jener Haltung. Er fühlte sich im doppelten Sinn für sozial Schwächere verantwortlich: Als Bürger in der Gesellschaft und als Diener eines Staates, in dessen Umbau zum sozialen Rechtsstaat er sich aktiv einbrachte. Für Bähnisch dürfte die Arbeit der SAG deshalb eine sinnvolle Ergänzung zur staatlichen Reformpolitik gewesen sein. Er hoffte – und damit argumentierte er auf der Linie der Ziele Siegmund-Schultzes – daß aus jener Arbeit einerseits positive Effekte auf die Einstellung wohlhabender Bürger gegenüber Arbeitern ausstrahlen würden und daß andererseits auch ein größeres Verständnis der Arbeiter für unternehmerische Notwendigkeiten und eine dem entsprechende Entradikalisierung entstehen werde. „Uns allen, die wir die Not des Proletariats unmittelbar gespürt haben, genügt es nicht, nur als Mensch dazu Stellung zu nehmen. Wir wollen die Zustände, die zu dieser Not führen, ändern, wollen […] den Versuch machen, das Übel
436 Vgl.: Bähnisch: Krise und ders.: Bedürftigkeitsprüfung. 437 Vgl.: Tennstedt: Sozialreform, S. 21. 438 Breitfeld, der die Rechtsmittel Bedürftiger eingeschränkt und die staatlichen Leistungen gekürzt wissen wollte, wirft Bähnisch „schwere[…] Angriffe auf den guten Willen der Hilfsbedürftigen“ vor. Bähnisch: Krise, S. 70. Zur Position Breitfelds vgl.: Breitfeld, Artur: Irrwege der sozialen Fürsorge, in: Zeitschrift für Selbstverwaltung, Bd. 15 (1932) [Angabe o. S. nach Albrecht Bähnisch]. Die Zeitschrift für Selbstverwaltung war das Organ des deutschen Landkreistages. 439 Vgl.: Bähnisch: Bedürftigkeitsprüfung.
332 | Theanolte Bähnisch
mit der Wurzel auszurotten“ 440, schrieb er in seinem Aufsatz in der ‚Neuen Nachbarschaft‘. Die SAG sah er als Brücke zwischen der „Welt des Arbeiters“ und „denen, die sich zu einer anderen Partei rechnen, und vor allem gegenüber dem Bürgertum“441 an. Entsprechend seiner Überzeugung für den Nutzen überparteilicher Arbeit wollte er, daß sich die SAG „keiner aufbauenden Kraft“442 verschließt. In seinem Artikel erhob er also nicht nur Überparteilichkeit, sondern auch die Bereitschaft, sich persönlich auf andere Lebenswelten443 einzulassen, zu einer Maxime sozialer Arbeit. Ein grundlegendes Verständnis zwischen verschiedenen Interessengruppen sah er als den zu erwartenden Erfolg solcher Anstrengungen an. Die „Menschen aus dem Bürgertum“, träfen sich in der SAG mit den Arbeitern „ohne ihre bürgerlichen Auffassungen aufzugeben“, erklärte Bähnisch, ohne jedoch auszuführen, was er unter ‚bürgerliche Auffassungen‘ verstand. Dadurch bekämen sie ein „Verständnis für die Nöte der Arbeiterschaft“ und verlören durch diese Erfahrung die Möglichkeit, „in der sozialistischen Weltanschauung lediglich ein Ergebnis demagogischer Verhetzung zu sehen“. Die SAG sei darüber hinaus auch eine Chance für jene Arbeiter, welchen „trotz [!] Karl Marx“ das Verständnis dafür fehle, „daß das Verhalten eines Unternehmers einer unabänderlichen wirtschaftlichen Notwendigkeit unterworfen ist“.444 Bähnisch zeigte sich also zuversichtlich, daß die SAG eine der wesentlichen Säulen stützen könne, auf denen in der Überzeugung ihrer Gründerväter die Weimarer Demokratie ruhte: das Zusammenwirken zwischen Unternehmern und Arbeitern im Sinne des politischen und sozialen Friedens. Interessant ist, daß Bähnisch sich und die anderen Mitarbeiter der SAG zwar zu den „Bürgerlichen“ rechnete, sich aber vom ‚Klassendünkel‘ distanzierte: „Wir gehören alle nicht zum Unternehmertum im eigentlichen Sinne, wenn wir auch meist aus dem Bürgertum stammen. Nehmen wir nicht offen Stellung, so rechnet man uns zur Bourgeoisie, und wir stärken eine Richtung, die nicht die unsere sein kann.“445 In dieser Aussage Bähnischs mag man die bereits zitierte Ansicht Lujo Brentanos, daß akademisch gebildete Personen aus dem Bürgertum besonders zur Vermittlung zwischen den Klassen geeignet seien, bestätigt finden. Gegen die nach Karl Marx als ausbeuterisch, konservativ und reaktionär charakterisierte ‚Bourgeoisie‘ sollte die SAG nach dem Dafürhalten Bähnischs also offen Stellung nehmen. Daß sie im gleichen Atemzug für die Sozialdemokratische Partei, der er selbst beigetreten war, agitieren sollte, wies er jedoch zurück. Der korporative Anschluß der SAG an die SPD – wie ihn einige SAG-Mitglieder in der Spätzeit, in der Bähnisch zur Initiative ‚zurück-
440 Vgl.: Bähnisch, Albrecht: Die politische Aufgabe der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, in: Neue Nachbarschaft. Akademisch-Soziale Monatsschrift, 11. Jg. (1928), Heft 7, S. 122–126, hier S. 122. 441 Ebd., S. 123. 442 Bähnisch: Aufgabe, S. 123. 443 Als „ein ferner Kontinent in der eigenen Stadt“ beschreibt Christoph Sachße die Arbeiterviertel in der Wahrnehmung der „gutbürgerlichen Schichten.“ Sachße: SiegmundSchultze, in: Krauß: Soziale Arbeit, S. 233. 444 Bähnisch: Politische Aufgabe, S. 124. 445 Bähnisch: Politische Aufgabe, S. 122.
Albrecht Bähnisch | 333
fand‘, forderten – würde, „einen unlösbaren Widerspruch zu der geistigen Haltung bedeuten, aus der heraus sie entstanden ist und in der die Arbeit im Berliner Osten getan wird“, argumentierte er. Die Menschen in der SAG verbinde nicht eine Partei, sondern eine „Verantwortung gegenüber der Umwelt“ sowie eine „bestimmte Haltung“.446 Was genau der von Bähnisch mehrfach verwendete Begriff ‚Haltung‘ für ihn bedeutet, läßt sich aus dem Textzusammenhang nicht abschließend klären. Er scheint den Begriff gleichbedeutend mit ‚Gesinnung‘, also einer durch Werte und Moral geprägten Grundeinstellung des Menschen verwendet zu haben. Wie im Textverlauf deutlich wird, schien die ‚Haltung‘ der SAG-Mitarbeiter in Bähnischs Wahrnehmung vor allem von Optimismus, Verantwortungsgefühl, Nächstenliebe und dem Willen zur Aufklärung geprägt gewesen zu sein. Das Grimm‘sche Wörterbuch beschreibt eine Begriffsbedeutung von ‚Haltung‘ als „das gemessene würdige verhalten beim umgange mit andern“447. Theanolte Bähnisch argumentierte nach 1946 häufig mit dem Begriff ‚Haltung‘, wenn sie sich über gemeinsame Überzeugungen von Mitgliedern verschiedener Parteien äußerte. In der SAG sah Bähnisch durch die Möglichkeit, sich mit sozial Schwachen persönlich auseinanderzusetzen, auch einen Mittler in das Bürgertum auf einer gefühlspsychologischen Ebene: Statistiken und wissenschaftliche Darstellungen, an denen „kein Mangel“ herrsche, waren seiner Meinung nach kaum dazu geeignet, die ‚breite Masse‘ aufzurütteln. „Zahlen erschüttern nicht, abstrakte Darstellungen sind nur selten imstande, den Willen zu beeinflussen. Darum aber geht es: Menschen, die in bürgerlicher Atmosphäre leben, die Wirklichkeit des Proletariats so zu zeigen, daß sie nicht mehr zu Ruhe kommen, daß sie diese Tatsache nicht mehr losläßt.“448 Das Menschenbild des Autors war also im Kern positiv und in der SAG sah er die Instanz, die über die Mittel verfügte, nicht nur mit Unkenntnis aufzuräumen, sondern auch den ‚guten Willen‘ im Menschen anzusprechen. Bähnischs Vorschlag „durch Schilderung von Einzelfällen, die typisch sind“449. Der Versuch, Menschen aus dem gehobenen Bürgertum für die Arbeit der SAG einzunehmen, war zu dieser Zeit bereits fester Bestandteil der SAG-Arbeit. Wiederholt waren Schriften von führenden Mitarbeitern erschienen, die den von Bähnisch geäußerten Anspruch erfüllten, indem sie Einzelschicksale von Jungen und Mädchen in Friedrichshain schilderten und aufzeigten, wie die SAG unterstützend eingriff. Nicht selten wurden dabei ‚im Grunde gute‘, in ihrer Persönlichkeit aber noch nicht gereifte Jugendliche vorgestellt, die mit Hilfe der korrigierenden Wirkung von SAG-Mitarbeitern zu ‚tugendlichem Verhalten‘ (zurück)finden.450 Einige jener Schilderungen konstatieren jedoch in erstaunli-
446 Ebd., S. 124. 447 Art.: „Haltung, f“, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Bd. 10, Sp. 303–306. Digitalisierte Version auf: http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB& mode=Vernetzung&lemid=GH01626. 448 Bähnisch: Politische Aufgabe, S. 125. 449 Ebd. 450 Vgl.: Gramm, Hermann: Die Jugenderziehung in der Großstadtsiedlung. Die Jugendclubs, in: Soziale Arbeitsgemeinschaft: Nachbarschaftssiedlung, S. 42–49, hier S. 44.
334 | Theanolte Bähnisch
cher Offenheit die oftmals gefühlte Aussichtslosigkeit der Situation451 und stellen die Frage, ob es denn tatsächlich Aufgabe der SAG sein könne ‚auf verlorenem Posten‘ zu kämpfen, oder ob ‚Gefallene‘ nicht besser aus den Clubs ausgeschlossen werden sollten.452 Zwar läßt sich ein Zusammenhang nicht nachweisen, aber beim Lesen der von Theanolte Bähnisch ab 1948 herausgegeben ‚Stimme der Frau‘ fällt doch auf, daß in der Zeitschrift Flüchtlingsschicksale in ähnlicher Weise dargestellt werden. Ausführliche Berichte über Einzelschicksale sind in der Zeitschrift deutlich häufiger zu finden, als solche über Flüchtlinge und Vertriebene im Allgemeinen.453 Wohl kaum zufällig wird aus Albrecht Bähnischs Aufsatz auch der besonders in der Spätphase der SAG stark ausgeprägte erwachsenenbildnerische Ansatz deutlich, wenn er schreibt, die SAG solle ihre Angehörigen „zum Gemeinsinn, zu Staatsbürgern erziehen“454. Die Mitarbeiter der SAG und Nachbarn sollten sich „um die rechte Auffassung bemühen, die Vorgänge des öffentlichen Lebens als etwas zu empfinden, für das sie verantwortlich sind, statt lediglich darüber als etwas Fremdes zu schimpfen“455. Hier klingt etwas an, was Theanolte Bähnischs Arbeit ab 1946 wesentlich prägte: Die Wertschätzung lokaler Initiativen für die ‚Erziehung‘ der Bevölkerung zu Staatsbürgern und somit einer Festigung der Demokratie durch die intrinsisch motivierte Teilhabe Einzelner an der Gestaltung des Gemeinwesens. Die Kritik Albrecht Bähnischs daran, daß „der Staat der Bevölkerung gegenüber in erster Linie durch das gebildete Bürgertum“456 repräsentiert wird, deutet, besonders in Verbindung mit der Forderung, politische Teilhabe auf eine möglichst breite Grundlage zu stellen, auf eine zumindest ansatzweise Auseinandersetzung mit den Lehren des SPD-nahen Juristen Hermann Heller hin.457 Rudimentär ist in seiner Argumentation auch die für die bürgerliche Sozialreform des Kaiserreichs leitende Idee, die Arbeiter durch Vermittlung bürgerlicher Werte in den Staat zu integrieren, enthalten. Bähnischs Argumentation unterstreicht, daß zu einer Zeit, in der die nicht zuletzt von der SAG als ‚Partei der Arbeiter‘ wahrgenommene SPD Regierungs-Verantwortung übernommen hatte, eine breite politische und soziale Integration der Arbeiter in den Staat noch auf sich warten ließ.458 In seiner Wahrnehmung war der Staat nach wie vor ‚bürgerlich‘ geblieben.
451 Vgl.: Lindner, Rolf, (Hrsg.): Wenzel Holek. Meine Erfahrungen in Berlin Ost, Köln 1998, S. 63–66. 452 Ebd. 453 Vgl. beispielsweise: Helbing, Klaus: Die Uhr gehört Herrn Sedamore, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 6, S.10. Vgl. auch: Freund: Krieg, S. 114/115. 454 Ebd., S. 124. 455 Ebd., S. 125. 456 Ebd. 457 Eine geistige Verwandtschaft zwischen der SAG und der Gruppe um Hermann Heller, welche die Leipziger Volksbildungsszene entscheidend beeinflußt habe, erkennt auch Paul Ciupke. Vgl.: Ciupke: Siegmund-Schultze, S. 96. 458 Welche Form der Integration von Arbeitern zu Beginn der Weimarer Republik bereits geleistet war, ist in der Forschungsmeinung abhängig von der jeweiligen Definition der entsprechenden Begriffe. Für Günther Schulz beispielsweise war mit der Verabschiedung
Albrecht Bähnisch | 335
Unterstützung und politische Bildung sozial Benachteiligter, Aufklärung der ‚Bürgerlichen‘ und Vermittlung zwischen den Klassen sind also die Eckpfeiler, die für Albrecht Bähnisch den Zweck der SAG begründeten. „[H]ier und da“ sah er in der SAG-Arbeit auch „eine bedeutsame Möglichkeit, die Gesetzgebung in sozialpolitischen Fragen maßgebend zu beeinflussen“459. Dafür sei eine Zusammenarbeit der SAG mit anderen Organisationen und Verbänden zentral. „Ich glaube aber, daß die SAG nicht in erster Linie die Aufgabe hat, bestimmten Forderungen zur Verwirklichung zu verhelfen, sondern allen Menschen, die an der Not der Zeit leiden, offen zu stehen und die Atmosphäre zu schaffen, aus der eine neue Ethik im politischen Kampf erwachsen kann“460, faßt Bähnisch seine Ausführungen zusammen. Mit dem Verweis auf die ‚neue Ethik‘ zeigt er, daß er im persönlichen Verantwortungsgefühl des Individuums für das Ganze großes Potential für die Überwindung gesellschaftlicher Probleme sah. Diese Sicht dürfte, auch wenn sich Bähnisch von der christlichen Motivation der SAG distanzierte, mit der Sozialisation in einem protestantischen Elternhaus zusammen gehangen haben. Indem er das Leiden an der ‚Not der Zeit‘ thematisiert, macht der Jurist deutlich, daß das Engagement der Gebildeten in der SAG nicht uneigennützig war. Jenes Leiden wird zwar nicht genauer definiert, aber der Textzusammenhang deutet darauf hin, daß Bähnisch hiermit einerseits auf die Spaltung der Gesellschaft und die schwierige Lage der Arbeiter hindeuten, andererseits aber auch das ansprechen wollte, was er an anderer Stelle als ‚Verfallsprozeß der bürgerlichen Kultur‘ beschrieben hatte. „Angesichts der heutigen Verfallerscheinungen kann der Gedanke auftauchen, daß die bürgerliche Welt doch nicht mehr zu retten ist, daß sie mit all ihren Kulturwerten im Untergang begriffen ist“, schreibt Bähnisch in Zusammenhang mit der Frage, ob die SAG sich nicht „ganz auf den Boden proletarischer Auffassung stellen, die Beziehungen zur bürgerlichen Welt abbrechen und ihre Aufgabe vom Lager der Arbeiter anfassen soll“461. Hintergrund jener Äußerungen dürfte eine – auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder weitverbreitete und lang anhaltende – Krisen-Rhetorik gewesen sein, die auch Siegmund-Schultze nicht fremd war.462 Doch, so konstatierte Bähnisch abschließend zu seiner eingangs gestellt Frage, ob „nicht nur aus der Arbeiterschaft ein neuer Aufstieg, eine neue Kultur, eine neue Gemeinschaft“ kommen könne: „Wir wissen es nicht“. Solange diese Gewißheit nicht da sei, dürfe sich die SAG „keiner aufbauenden Kraft, woher sie auch komme, verschließen“ und müsse ihrer Aufgabe, „der Boden zu sein, auf dem sich die aufbauenden Kräfte von allen Seiten zusammenwirken können“463, gerecht werden.
459 460 461 462 463
der Weimarer Republik die staatsbürgerliche Gleichberechtigung/Integration der Arbeiter vollzogen, während die ‚kulturelle‘ Gleichberechtigung – damit meint Schulz den Abbau rechtlicher, wirtschaftlicher und sozialer Disparitäten – noch nicht erfolgt war. Vgl.: Schulz: Sozialreform. Bähnisch: Aufgabe, S. 125. Ebd., S. 126. Ebd., S. 123. Ciupke: Siegmund-Schultze, S. 86. Ebd.
336 | Theanolte Bähnisch
Der Verwaltungsjurist vertrat also die Überzeugung, durch die Mitarbeit in der SPD soziale Mißstände auf politischem Weg beseitigen zu können und erhob gleichzeitig den Anspruch, daß man sich als Bürgerlicher persönlich für seine ‚Nachbarn‘ einsetzen müsse. Ein gleichzeitiges Engagement in der SPD und in der SAG erschien ihm also nicht widersprüchlich, sondern logisch, zumal die staatliche Sozialversicherung, als er sich zu Beginn der 1920er Jahre erstmals in der SAG engagierte, noch im Aufbau begriffen war und, als er um 1928 in die SAG zurückfand, in Schwierigkeiten steckte, welche als ‚Krise des Sozialstaats‘ in die Forschungsliteratur Eingang fanden. Die Sozialversicherung konnte dem Heer der Anspruchsberechtigten zu jener Zeit nicht gerecht werden.464 Albrecht Bähnischs Engagement in der SAG fiel damit jeweils in Phasen bedeutender Veränderungen in der staatlichen Sozialpolitik. In jenen Phasen hatten kommunale und private Fürsorgearbeit keine geringere Existenzberechtigung als in der Zeit vor der Ausrufung der Republik. Gerade in seiner Eigenschaft als hochrangiger Verwaltungsmitarbeiter dürften ihm die Grenzen des Weimarer Sozialstaats bewußt gewesen sein. Persönliches Engagement in Friedrichshain hatte sich für ihn deshalb (noch) nicht überlebt. In der Person Bähnischs manifestierte sich, was der Historiker Marcus Gräser konstatiert: daß in der kommunalen Wohlfahrtspflege der revisionistische Flügel der SPD und die bürgerliche Sozialreform zusammen fanden.465 Das hing auch damit zusammen, daß die Sozialreformbewegung und die von ihr etablierten Projekte sich im Zuge einer zunehmenden gesellschaftlichen Differenzierung verändert hatten. Günther Schulz stellt eine „Ausdehnung der Trägergruppen [der bürgerlichen Sozialreform] vom politisch – anders als wirtschaftlich – nicht mehr abgrenzbaren Bürgertum auf andere gesellschaftliche Gruppen im Kontext allgemein zunehmender verbandsmäßiger Organisierung und unter Verblassen bürgerlicher Konturen“ fest. Zudem sei, so Schulz „eine Umorientierung vom engeren sozialreformerischen zum weiteren sozialpolitischen Konzept“ vonstatten gegangen.466 Als Albrecht Bähnisch während seiner Tätigkeit im Innenministerium der SPD beitrat, traf jedenfalls nicht mehr zu, was Gräser noch für das Kaiserreich und die frühen Jahre der Weimarer Republik festgestellt hatte, nämlich daß, „wer als Bürgerlicher zur Sozialdemokratie ging, was immer er oder sie auch an Bürgerlichkeit und Erbe mitnahm“, einen „Bruch“467 vollzog. Auch wenn sich Albrecht Bähnischs aktives Engagement in der SAG mit seinem Weggang aus Berlin aufgrund der räumlichen Distanz erledigt haben wird – sein Interesse für Fragen der Sozialpolitik blieb auch in der Zeit, in der er das Landratsamt Merseburg verwaltete bestehen. Seinen Veröffentlichungen, die in dieser Zeit entstanden sind, ist, seiner neuen Stellung entsprechend, eine zunehmende Verschiebung hin zur Frage, wo die Position der Kreise und Kommunen im Sozialversicherungssystem zu suchen sei, eigen. So setzte er sich mit den Befugnissen der Gesundheitspolizei vor dem Hintergrund der landrätlichen Weisungskompetenz auseinander
464 Vgl. dazu beispielsweise: Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1914– 1949, 2. Aufl., München 2003, S. 428–424. 465 Vgl.: Gräser: Wohlfahrtsgesellschaft, S. 200. 466 Schulz: Sozialreform, S. 204. 467 Gräser: Wohlfahrtsgesellschaft, S. 203.
Albrecht Bähnisch | 337
und gab in seinem bereits erwähnten Kapitel zur Medizinalpolizei den Befugnissen des Kreisarztes Raum.468 Der Kreis zur SAG schließt sich insofern, als daß die Kompetenzverlagerungen von der Polizei hin zu den Gesundheitsämtern, die in den 20er Jahren vorgenommen wurden und die Bähnisch kommentierte, in engem Zusammenhang mit den neuen Gesetzen zur Jugendpflege standen. Diese waren wiederum in Zusammenarbeit mit Friedrich Siegmund-Schultze entwickelt worden.469 3.4.2.6 Die Bedeutung der SAG in Theanolte Bähnischs Biographie Die Bedeutung der Arbeit Albrecht Bähnischs in der SAG für die spätere Arbeit Theanoltes zu ermessen, fällt nicht leicht. Einige Interdependenzen sind bereits über die gemeinsamen Bekannten des Ehepaars aus dem Kontext der SAG aufgezeigt worden. Aber auch über die gemeinsamen Kontakte hinaus dürfte Theanolte Bähnisch sich mit ihrem Mann über dessen Arbeit in der SAG ausgetauscht haben, erinnert man sich an ihre Äußerungen über die Intensität der gemeinsamen Gespräche und das gemeinsame Interesse für Politik und Gesellschaft, Recht und Verwaltung. Ihr Interesse an der SAG, vielleicht vor allem auch das an ihren Führungsfiguren – denn es ist überliefert, daß sie stark für Friedrich Siegmund-Schultze eingenommen war470 – wird durch ihre aktive Teilnahme an der Lauensteiner Vorkonferenz der SAG 1928 verdeutlicht.471 Diese gemeinsame Gesprächssituation mit SAG-Führungspersönlichkeiten auf dem Lauenstein ist die einzige ihrer Art, die Eingang in die überlieferten Akten gefunden hat. Ein tieferes Interesse Theanoltes für Verwaltungsgegenstände, die soziale Fragen berühren, ist bereits ihrer Examensarbeit zu entnehmen. Darin hatte sie das soziale Elend als Hauptentstehungsgrund der Prostitution benannt und daraus geschlossen: „Hier heisst es nicht nur, durch großzügige Wohnungsreformen und Besserung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse Wandel zu schaffen, sondern in aufopferungsvoller und hingebender Fürsorgearbeit privater wie öffentlicher Organe den einzelnen Menschen helfend zur Seite zu stehen. Nur dadurch allein können viele Quellen versiegen, die später zu solchem antisozialen Verhalten führen, dass polizeilichen [!] Eingreifen zur letzten Notwendigkeit wird“. Ob sie mit ihren Äußerungen nur an Erfahrungen anknüpfte, die sie selbst während ihres Referendariates in Münster, Köln und Brauweiler gesammelt hatte, oder ob hier bereits der Austausch mit ihrem späteren Ehemann, der im Rahmen seiner Arbeit in Berlin-Ost Erfahrungen mit der sozialen Not der Arbeiter und ihrem Leben jenseits bürgerlicher Normen und Wertvorstellungen gemacht hatte, eingeflossen ist, läßt sich nicht rekonstruieren. Ihre Aussagen entsprechen jedenfalls, indem sie sowohl strukturverändernde staatliche Eingriffe als auch öffentliche und private persönliche Fürsorgearbeit als notwendige Hilfestellung einforderten der Leit-Linie der SAG in den 1920er Jahren. Auch Theanolte Bähnisch schien also die beste Form
468 Bähnisch: Medizinalpolizeirecht, S. 70/71. 469 Vgl.: Uhlendorff, Uwe: Geschichte des Jugendamtes. Entwicklungshilfen öffentlicher Jugendhilfe 1871–1929, Weinheim/Basel/Berlin 2003, S. 302, Anm. 79. 470 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen 11.11.2009. 471 Dem Protokoll zufolge meldete sie sich mindestens zweimal zu Wort. Vgl.: EZA, 51/S II b 20. Protokoll der S.A.G. – Konferenz auf Burg Lauenstein vom 22. bis 25. Mai 1928.
338 | Theanolte Bähnisch
der Unterstützung sozial Schwacher in der Verbindung individueller Hilfeleistungen mit staatlichen Reformen gesehen zu haben. Zumindest mit Friedrich Siegmund-Schultze blieb Bähnisch, wie erwähnt, auch nach dem Tod ihres Mannes in Kontakt. Es liegt jedoch nah, daß die Ähnlichkeit ihrer Einstellung zur Leitlinie der SAG auch darauf zurückzuführen ist, daß die SAG von Protagonistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung beeinflusst wurde. In diesem Personenkreise bewegte sich Bähnisch vor allem nach 1945, mit den Ideen der (bürgerlichen) Frauenbewegung hatte sie sich jedoch bereits im Rahmen ihrer Staatsexamensarbeit und zumindest ansatzweise auch im Kreis der Soroptimistinnen auseinandergesetzt. Expertinnen aus der bürgerlichen Frauenbewegung hatten ihr Wissen über Fürsorge und Wohlfahrt in die SAG eingebracht und dabei auch weiter ausgebildet. Im Zusammenhang mit der SAG konnte Theanolte Bähnisch nicht zuletzt deshalb an die Beobachtungen, die sie in Köln gemacht hatte, anknüpfen. So fühlte sie sich im Gespräch auf der Lauensteiner-Vorkonferenz vielleicht nicht zufällig dazu berufen, gerade zu einem Teilproblem der ‚Sittlichkeitserziehung‘, nämlich zur Frage, ob die SAG im Rahmen ihrer Volkshochschularbeit den ‚modernen Tanz‘ fördern oder gar unterbinden sollte, Stellung zu nehmen.472 Das Gespräch der Mitarbeiter auf der Konferenz über 15-jährige Mädchen in Friedrichshain, die „immer leistungsstärkere Freier“473 suchen würden, dürfte die Regierungsassessorin an ihren Aufenthalt bei der Sittenpolizei in Köln und im Mädchenerziehungsheim Brauweiler sowie an die Positionen in der Literatur, mit denen sie sich in diesem Zusammenhang auseinandergesetzt hatte, erinnert haben. Nicht nur die zweite Vorsitzende der SAG, Alix Westerkamp, sondern auch Friedrich Siegmund-Schultze hatten sich selbst zur Sittlichkeitserziehung und zur Prostitution geäußert.474 Dies zeigt einmal mehr, daß in der Bekämpfung der Prostitution eine nicht unerhebliche Schnittmenge zwischen Theanolte Bähnischs Ausbildung und Albrecht Bähnischs Arbeit bestand. Vielleicht hatte allein schon der Umstand, daß in der SAG prominente, beruflich erfolgreiche Frauen mitarbeiteten, die Arbeitsgemeinschaft und die Teilnahme an der Lauensteiner Vor-Konferenz für Theanolte interessant gemacht. Als diese stattfand, war Theanolte bereits den Soroptimistinnen beigetreten, von denen einige, wie erwähnt, Schülerinnen einer engen ‚Freundin‘ der SAG, Alice Salomon, waren. Was zur Gründung des Soroptimist-Clubs geführt hatte – der zunehmende berufliche Erfolg von Frauen in akademischen und anderen anspruchsvollen Berufen – hatte sich auch in der SAG niedergeschlagen. (Kranken-)Pflege, soziale Arbeit und Pädagogik hatten schließlich zu den ersten Feldern gehört, in denen Frauen sich nicht nur bewähren, sondern mit ihrer Linie auch durchsetzen konnten. Dies zeigte sich beispielsweise im erfolgreichen Einsatz der Bürgerlichen Frauenbewegung für Veränderungen im Umgang des Staates mit Prostituierten und ‚sittlich gefährdeten‘ jungen Mädchen, in der herausgehobenen Rolle, die Frauen in der Settlement-Bewegung
472 Ebd. 473 Ebd. 474 Siegmund-Schultze, Friedrich: Um ein neues Sexualethos. Bericht über die Elgersburger Konferenz zur Beratung sexualethischer Fragen vom 5.–12. Oktober 1926, Berlin 1927.
Albrecht Bähnisch | 339
spielten, und in der wegweisenden Rolle Alice Salomons als Leiterin der sozialen Frauenschule für die Entwicklung der sozialen Arbeit in Deutschland. Reflektiert man jene Zusammenhänge, lassen sich Erklärungsansätze dafür finden, warum und wie Theanolte Bähnisch ab 1946 an das zu dieser Zeit bereits in die Jahre gekommene Mütterlichkeits-Konzept anknüpfte.475 Die Verbreitung des „Konzept[s] der sozialen Mütterlichkeit“ als einer Verbindung des Konzepts des ‚sozialen Friedens‘ nach Carlyle und Ruskin mit dem Konzept der ‚geistigen Mütterlichkeit‘ nach Henriette Schrader-Breymann476, welches im gemäßigten Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung tradiert wurde, schreibt Christoph Sachße nämlich explizit Alice Salomon zu. Salomon habe, so Sachße, „die Vorstellung von der ethischsittlichen Verpflichtung von Gebildeten zur Sozialreform mit dem „eigentümlich konservativen weiblichen Emanzipationsideal der ‚sozialen Mütterlichkeit‘ wie es die bürgerliche Frauenbewegung entwickelt hatte“477 kombiniert. Die spätere Leiterin der sozialen Frauenschulen war in Jeanette Schwerins ‚Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit‘ sozialisiert worden. Die ‚Gruppen‘ hatten junge Mädchen und Frauen aus dem Bürgertum für die Unterstützung erfahrener Kräfte in der Wohlfahrtspflege begeistern wollen und dabei mit der Verpflichtung der Frauen gegenüber den ärmeren Klassen argumentiert. Salomon übernahm die ‚Gruppen‘ im Jahr 1908, nachdem sie 1906 die reichsweit erste interkonfessionelle soziale Frauenschule gegründet hatte. Auch Theanolte Bähnisch definierte ‚Mütterlichkeit‘, als sie 1946 mit dem ‚Club deutscher Frauen‘ die „brachliegenden mütterlichen Kräfte“ produktiv machen wollte, als eine Aufgabe von Frauen gegenüber der Gesellschaft und begründete diese Aufgabe mit der Verantwortung, die aus einer besonderen, geschlechtsspezifischen Eigenschaft resultiere. Die besondere Situation eines – etwas überbewerteten – ‚Frauenüberschusses‘ berücksichtigend, argumentierte Bähnisch zudem, daß aus ‚Mütterlichkeit‘ hervorgehende Arbeit zu einer besonderen Zufriedenheit vor allem solcher Frauen beitragen könne, denen eine biologische Mutterschaft nicht vergönnt war.478 Ohne Zweifel unterstützten auch SAG-Freundinnen beziehungsweise Mitarbeiterinnen wie Gertrud Bäumer und Agnes von Zahn-Harnack den ideellen Fortbestand jenes Konzeptes in der ab 1946 wesentlich von Theanolte Bähnisch ausgestalteten Bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland. Katharina Petersen479, mit der Bähnisch 1946 den ‚Club deutscher Frauen‘ in Hannover gründete, und Margarete Daasch, mit der Bähnisch 1947 den ‚Frauenring der britischen Zone begründete‘, hat-
475 Siehe Kapitel 8.3.6.1. 476 Schrader-Breymann (1827–1899) war eine der Initiatorinnen der ‚Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit‘. 477 Sachße: Siegmund-Schultze, in: Tenorth: Siegmund-Schultze, S. 41. 478 Siehe Kapitel 8.3.9.1, vgl. dazu auch: Freund: Hut. 479 Petersen leitete als Ministerialrätin im Kultusministerium Niedersachsen das Volks- und Mittelschulwesen des Landes. Sie engagierte sich in der SPD, in der UNESCO und bei der UNICEF.
340 | Theanolte Bähnisch
ten im Studium ebenfalls Kontakte zur SAG gepflegt.480 Sie dürften insofern mit Salomons Lehre vertraut gewesen sein. Salomon selbst emigrierte aufgrund ihrer jüdischen Wurzeln 1938 und konnte bis zu ihrem Tod 1948 keinen direkten Einfluß auf die bürgerliche Frauenbewegung in Deutschland mehr nehmen. Sie wurde jedoch Ehrenpräsidentin der International Alliance of Women (IAW), einer Frauenvereinigung, der der von Bähnisch gegründete DFR korporativ beitrat. Die Regierungspräsidentin Bähnisch schien jedoch nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell an die Ideen jener, die die SAG-Berlin-Ost wesentlich geprägt hatten, angeknüpft zu haben: Der ‚Club deutscher Frauen‘ war nicht nur – ebenso wie die SAG – überparteilich und interkonfessionell ausgerichtet. Auch in ihm sollten weniger erfahrene von erfahrenen Frauen etwas über gesellschaftliche Partizipation lernen und die Frauen sollten – unabhängig von ihrer politischen Einstellung – ungezwungen diskutieren und sich austauschen können. Im ‚Club deutscher Frauen‘ und in seinen Nachfolgeorganisationen verbanden sich die beiden Elemente, welche die SAG in ihrer Spätphase wesentlich prägten: Soziale Arbeit auf dem Boden der angenommenen besonderen, ‚mütterlichen Verantwortung‘ von Frauen gegenüber der Gesellschaft und staatsbürgerliche Bildung als Schlüssel zum Frieden, zur Rechtstaatlichkeit und zur Demokratie.481 Mehr noch als der ‚Club deutscher Frauen‘ erinnerte der ebenfalls von Bähnisch initiierte ‚Club junger Menschen‘ an die Knaben- und Mädchenklubs der SAG. Im ‚Club junger Menschen‘ sollten ab 1946 männliche Jugendliche und junge Männer aus der Region Hannover zusammenkommen und über Politik und Gesellschaft sprechen. Doch nicht nur die Regierungspräsidentin, der die Leitung des Clubs formal oblag, nahm sich wiederholt Zeit für die Jungen, die von Gotthard Kronstein betreut wurden.482 Der Kreis zwischen Albrecht Bähnischs Aktivitäten in Berlin und Theanoltes Aktivitäten in Hannover schloß sich sogar insofern, als daß der aus dem Schweizer Exil zurückgekehrte Friedrich Siegmund-Schultze hin und wieder nach Hannover kam, um mit Bähnischs Mündeln im buchstäblichen Sinne über ‚Gott und die Welt‘ zu reden. Dies belegt ein Brief Siegmund-Schultzes an Theanolte Bähnisch.483 So bestätigt sich auch am Beispiel des ‚Club junger Menschen‘ der Eindruck, daß, auch wenn die Versuche Siegmund-Schultzes, die SAG nach 1945 neu zu beleben, scheiterten, seine Ideen in Form von anderen Initiativen, auch mit Hilfe Theanolte Bähnischs, fortlebten. Theanolte Bähnisch war zudem nicht die einzige Protagonistin aus dem Wohlfahrts- und Pädagogik-Netzwerk in Niedersachsen, zu der Siegmund-Schultze Kontakt hatte. Ein Brief an die Regierungsdirektorin Käthe Feuerstack – die ebenfalls an der Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘ beteiligt war – belegt, daß Siegmund-
480 Das Engagement Petersens geht aus dem folgenden Brief hervor: EZA, 626/111, Adolf Grimme an Friedrich Siegmund-Schultze, 07.10.1957. Von Daasch ist die Teilnahme an einer SAG-Konferenz belegt: EZA, 51/S II b 23. 481 Siehe Kapitel 6, 7 und 8. 482 Siehe Kapitel 5.6.2.2. 483 EZA, 626/75, Siegmund-Schultze an Bähnisch, 29.12.1949.
Albrecht Bähnisch | 341
Schultze auch mit dieser guten Bekannten Bähnischs Kontakt hatte.484 Wie die Briefwechsel mit Theanolte Bähnisch, waren auch die mit Feuerstack und Adolf Grimme von Siegmund-Schulze im Ordner „Korrespondenz mit Freunden“ abgelegt worden.485 Aus einem Interview mit der Tochter Theanolte Bähnischs, Orla Maria Fels, geht, wie erwähnt, hervor, daß Theanolte Bähnisch stark für Siegmund-Schultzes Persönlichkeit und seine Ideen eingenommen war.486 Die Anrede Theanoltes als „verehrte, liebe Frau Bähnisch“487 durch den Theologen zeugt wiederum von der großen Wertschätzung, die Siegmund-Schultze ihr entgegenbrachte. Besonders in ideengeschichtlicher Hinsicht ist schließlich interessant, wie sich Bähnischs und SiegmundSchultzes Überzeugung, daß Persönlichkeitswerdung den entscheidenden Beitrag zum Aufbau einer funktionierenden Gesellschaft leiste, deckten. Der Erziehungswissenschaftler Paul Ciupke paraphrasiert einen Vortrag Siegmund-Schultzes aus dem Jahr 1922 wie folgt: „Die Arbeiter bilden die Masse, die aber nichts anderes als ‚Konglomerat, atomisierte Menschheit‘ ist. Die Masse muß zerschlagen werden, damit Gemeinschaft wächst. Und aus der Gemeinschaft soll Volk werden, Volksgemeinschaft. Dazu müssen als Zwischenschritt Persönlichkeiten gebildet werden. […] Das ‚Werden der Persönlichkeit‘ vollzieht sich in kleinen Kreisen, die sich in unserer Arbeitsgemeinschaft bilden. […] Das Schaffen dieser neuen Welt und eines neuen Menschen ist eine Bildungs- und Erziehungsaufgabe.“488 Bei Theanolte Bähnisch war es um 1948 vor allem die Angst vor der Verführbarkeit der ‚Massen‘ durch Stimmenfänger von rechts und links – und dementsprechend die Angst vor dem Niedergang der Demokratie – die sie Begriffe wie ‚Menschlichkeit‘, ‚Geist‘ und ‚Individuum‘ hochhalten sowie die ‚Geistlosigkeit der Zeit‘ und die ‚Entmenschlichung‘ des Lebens beklagen ließ.489 Bei Siegmund-Schultze, der auf dem Höhepunkt seines Schaffens – ganz im Gegensatz zu Bähnisch – noch nicht die Erfahrung der Diktatur gemacht hatte, stand die Hoffnung auf die Entstehung einer ‚Volksgemeinschaft‘ aus Bürgerlichen und Arbeitern, anstelle der in seiner Wahrnehmung gespalteten Nation, im Vordergrund. Seine Argumentation war also vor allem auf ein anvisiertes Ziel ausgerichtet, während Theanoltes Argumentation nach 1945 stärker von dem Bedürfnis, eine Erfahrung zu überwinden, beeinflußt war. Theanolte Bähnisch hatte allem Anschein nach Siegmund-Schultzes ‚Theorie der kleinen Kreise‘ ab 1946 auf ihre Clubs übertragen – und mit ihr auch einen gewissen Zwiespalt gegenüber der Sozialdemokratie, wie er vor allem den früheren Äußerun-
484 EZA, 626/111, Friedrich Siegmund-Schultze an Käthe Feuerstack, 09.01.1959. Im Schreiben grüßt er sie „in Erinnerung an frühere Zeiten“, was auf eine lange Bekanntschaft der beiden hindeutet, aber keinen Aufschluß darüber gibt, ob er an die Zeit des Bestehens der SAG anknüpft. 485 EZA, 626/75. 486 Gespräch mit Orla-Maria Fels in Waiblingen, 11.11.2009. 487 EZA, 626/75, Friedrich Siegmund-Schultze an Theanolte Bähnisch, 10.01.1950. 488 Ciupke: Siegmund-Schultze, S. 100. 489 Vgl. dazu auch: Freund: Krieg, S. 190–193. Siehe auch Kapitel 7.1.5 der vorliegenden Arbeit.
342 | Theanolte Bähnisch
gen Siegmund-Schultzes eigen war. Sah sie in der Partei einerseits den Motor notwendiger gesellschaftlicher Veränderungen, was ein Erklärungsansatz für ihre Mitgliedschaft in der Partei ist, so fürchtete sie andererseits, durch allzu offen bekundete Parteibindung in ihrem Umfeld zu polarisieren und damit Zusammenschlüsse wie den ‚Club deutscher Frauen‘ oder den ‚Club junger Menschen‘ eher zu spalten als zu stärken. Ihrer Hoffnung, im Rahmen dieser Clubs und später auch im Frauenring über ihre staatsbürgerliche Bildungsarbeit auf Menschen verschiedener politischer Auffassungen persönlichkeitsbildend wirken zu können, stand eine zu enge Parteibindung diametral entgegen. Bähnisch schien vielmehr dem pädagogischen Konzept einer dynamischen oder produktiven Neutralität angehangen zu haben, wie es sich in der Thüringischen Volksbildungsbewegung der 1920er Jahre finden läßt. Walter Mann erklärt jenes Konzept wie folgt: „Man geht hier […] von der Anschauung aus, daß wir als Pädagogen das Vorhandensein großer weltanschaulicher und politischer Gruppen im gleichen Volkskörper weder leugnen noch bekämpfen dürfen. Will man […] dem einzelnen Volksgenossen zu wirklicher vertiefter Bildung verhelfen, so kann diese nur in und mit seinem Glauben und seiner Weltanschauung erwachsen. Es ist also das erste Gesetz jeder Bildungsarbeit, daß man nicht mit dem Zerstören beginnt, sondern an dem Vorhandenen weiterbaut; daß man also die mitgebrachten Überzeugungen jedes einzelnen Teilnehmers achtet und fördert.[…] Und da geht nun die neutrale Volkshochschule den Weg, daß sie Menschen verschiedener Einstellungen, verschiedener Weltanschauungen und verschiedener politischer Bekenntnisse zu sachlicher Aussprache und ehrlichem Ringen zusammenführt.“ 490 Verbindend zwischen Theanoltes pädagogischen Ideen und jenen der SAG, die seit dem Beginn der Weimarer Republik den erwachsenenbildnerischen Schwerpunkt ihrer Arbeit fortlaufend gestärkt hatte, wirkte sicherlich auch der Umstand, daß sie 1945 vor der Herausforderung stand, Krieg und Niederlage als Chance zu nutzen und am Neuaufbau der Gesellschaft mitzuwirken. In dieser Hinsicht bestanden starke Parallelen zur Entstehung der Volksbildungsbewegung in der Weimarer Republik, die, wiederum Paul Ciupke zufolge, „etwas Großes war, das nach dem Rausch des Ersten Weltkrieges und der Ernüchterung der Niederlage als Ausweg aus der Krise beschworen wurde“491. Das Ende des Zweiten Weltkrieges sollte die Aufbaugeneration vor ähnliche Herausforderungen stellen und zu einer ähnlichen Aufbruchsstimmung in der Pädagogik führen.492 Inhaltlich orientierte sich Theanolte Bähnisch bei ihrer Bildungsarbeit, beziehungsweise in ihrer Rolle als Initiatorin solcher Angebote, nicht zuletzt an den Kon-
490 Vgl.: Mann, Walther: Thüringen 1930 – das Vorspiel zum Untergang der deutschen Volkshochschule, in: Delfs: Friede, S. 287–293, hier S. 290. 491 Ciupke: Siegmund-Schultze, S. 86. „Unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieg gab es nicht nur diversen nationalen Jammer über die Niederlage, auch die verschiedensten gesellschaftlichen Krisendiagnosen kursierten: Geistige Krisen aller Art wurden diagnostiziert und kulturkritische Klagen über Kulturzerfall, Vermassung, Kulturbolschewismus, Zivilisation und Amerikanisierung und anderes mehr geführt“, schreibt Ciupke in diesem Kontext. Ebd. 492 Siehe Kapitel 6.4.2.
Albrecht Bähnisch | 343
zepten Fritz Borinskis, eines bekannten Erwachsenendbildners der Weimarer Zeit, der, wie bereits erwähnt, ebenfalls im Kreis der SAG sozialisiert worden war.493 Der Kern seines Konzepts der ‚Mitbürgerlichen Bildung‘494, das er im schwedischen und britischen Exil erarbeitete, war das des „im demokratischen Alltag sich frei und verantwortlich bewährenden Mitmenschen“ als Produkt einer „überparteilichen, zur Sachlichkeit und demokratischen Verantwortung führenden Erziehung“.495 Diesem Ansatz zeigte sich in der zweiten deutschen Nachkriegszeit – zumal die britische Besatzungsmacht dies honorierte – auch Theanolte Bähnisch verpflichtet. Daß Borinskis Erfahrungen in der SAG – obwohl er diese selbst sie als sehr wichtig für seinen weiteren Weg erachtete – im Zusammenhang mit seiner Erwachsenenpädagogik in der BRD nicht reflektiert werden, deutet darauf hin, daß die Zusammenhänge zwischen der pädagogischen Arbeit der SAG und der Entwicklung des bundesdeutschen Volkshochschulwesens insgesamt noch nicht hinreichend erforscht wurden. Gerade den von Borinski gern bemühten Begriff ‚Sachlichkeit‘ verwendete Theanolte Bähnisch häufig, wenn sie sich über die Vorteile der Ausbildung von Frauen für den Verwaltungsdienst äußerte, sich selbst in ihrer Rolle als Regierungspräsidentin charakterisierte oder sich entsprechend zitieren ließ.496 Wohl kaum zufällig lobte Hans Lilje anläßlich der Pensionierung Bähnischs 1964, daß diese ‚Sach-
493 Vgl.: Borinski: Wechselverhältnis, S. 255. „Meine Begegnung mit dem zwingenden Ernst der sozialen Frage, die in den Diskussionen der SAG von Wernigerode geschah, hat mich in Leipzig in die Volkshochschule, zur Arbeiterbildung und damit schließlich zur sozialistischen Arbeiterbewegung geführt“, schreibt Borinski dort. Borinski hatte über die akademisch-sozialen Abende an der Universität Leipzig zur Sozialen Arbeitsgemeinschaft gefunden und wenig später die Leitung der SAG-Gruppe in Wernigerode im Harz übernommen. Nach dem Ende seines Studiums hatte er als Lehrer und Leiter an Volkshochschulheimen und als Assistent an der Universität Leipzig gewirkt, bevor er sich 1934 zur Emigration gezwungen sah. Aus dem englischen und schwedischen Exil arbeitete er mit an Reformen der Erwachsenenbildung. Aus seinem Aufsatz wird deutlich, daß sich die Rhetorik Borinskis auch in Bezug auf die ‚Vermassungs- und Technisierungsdebatte‘ mit der Bähnischs deckte. Im Text ist von der „Rationalisierung und Technisierung unserer Gesellschaft“ die Rede und Borinski beklagt, daß daß die „Qualität der Menschlichkeit“ davon einen Schaden davon trage. Daß er die von ihm wahrgenommene Entwicklung der Gesellschaft – wie Bähnisch – auch mit der „Verführung und Manipulation“ von Menschen durch massenpsychologische Beeinflussung in Verbindung brachte, geht ebenfalls aus dem Aufsatz hervor. Ebd., S. 259. 494 Die deutsche Version erschien unter dem Titel ‚Der Weg zum Mitbürger‘ 1954 in Jena. 495 Borinski zitiert nach Kersting, Christa: Pädagogik im Nachkriegsdeutschland: Wissenschaftspolitik und Disziplinentwicklung, Kempten 2008, S. 132. 496 Vgl. z. B.: O. V.: Aus der Frauenwelt. Kurzer Überblick über eine große Arbeitstagung des internationalen Frauenrates, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 2, S. 35. Darin heißt es über Bähnisch: „[E]s erschien ihr besonders wichtig, daß der Internationale Frauenrat dieses Problem als internationales anerkannt hat, und der Auffassung war, daß es nur von einer rein sachlichen Basis gelöst werden könne.“
344 | Theanolte Bähnisch
lichkeit‘ und ‚Fraulichkeit‘ in glücklicher Weise verbunden habe.497 Nun wäre es sicherlich verfehlt, aus der Verwendung eines verbreiteten Begriffs sowohl durch Borinski, als auch durch Bähnisch eine Bezugnahme Bähnischs auf Borinski abzuleiten. Allerdings ist signifikant, daß beide Personen den Begriff ‚Sachlichkeit‘ bedeutungssynonym mit ‚Nicht-Parteilichkeit‘ verwendeten, wenn es darum ging, ohne Rücksicht auf politische Anschauungen problemorientiert und auf die Sache fokussiert zu diskutieren, zu handeln und Lösungen für komplexe Probleme zu finden. ‚Sachlichkeit‘ findet sich in Bedeutungswörterbüchern nicht von ungefähr in nächster Nähe zu Begriffen wie ‚Objektivität‘, ‚Neutralität‘, ‚Vorurteilslosigkeit‘, dem von Bähnisch ebenfalls häufig bemühten Wort ‚Gerechtigkeit‘ und schließlich auch ‚Überparteilichkeit‘.
3.5 ALBRECHT BÄHNISCH SETZT SICH FÜR DIE HEIMVOLKSHOCHSCHULE DREISSIGACKER EIN 3.5.1 Gründer, Pädagogisches Konzept, Zielgruppenorientierung und Gegner Die Forderung nach ‚Überparteilichkeit‘ bei gleichzeitiger, ‚vernunftgeleiteter‘ Nähe zum Sozialismus prägte auch die Arbeit der Heimvolkshochschule Dreißigacker. Wie die SAG-Volkshochschule Ulmenhof und andere demokratische Erwachsenenbildungseinrichtungen wurde sie 1933 von den Nationalsozialisten aufgelöst. Ein Engagement Albrecht Bähnischs, welches darauf ausgerichtet war, die Auflösung zu verhindern, entstand, da es sich bei dem Leiter der Heimvolkshochschule Dreißigacker, Eduard Weitsch, um einen persönlichen Bekannten Friedrich Siegmund-Schultzes handelte und zwischen der SAG und Dreißigacker ein reger Personenaustausch bestand, wohl kaum zufällig. Wie Bähnischs Mitarbeit in der SAG ist auch sein – nur kurzfristiges Wirken – für Dreißigacker aufschlußreich in Bezug auf Theanolte Bähnischs Wirken in der Erwachsenenbildung ab 1946. Dazu gehört beispielsweise, daß ausgerechnet einer der ersten Schüler Dreißigackers, Heiner Lotze498, unter Kultusminister Adolf Grimme Referent für Erwachsenenbildung und Leiter der Volkshochschule Niedersachsen wurde. Im Rahmen dieser Aufgaben versuchte er einen kleinen Kreis von Frauen, die einflußreiche Stellungen innehatten, für die Bildungsarbeit mit erwachsenen Frauen im Land Niedersachsen zu gewinnen. Ausgerechnet mit diesen
497 AddF Kassel, SP-01, Landesbischof Dr. Hanns Lilje an Theanolte Bähnisch, 23.04.1964. 498 Heiner Lotze (1900–1958) war Schüler des ersten Kurses in Dreißigacker. Er wurde 1926 Lehrer an der Heimvolkshochschule Sachsenburg und 1929 Leiter der Volkshochschule Jena. Nach 1945 baute er als Begründer und Leiter der Volkshochschule Hannover (1945 bis 1950), als Referent für Erwachsenenbildung im Niedersächsischen Kultusministerium (1945 bis 1958) und als Leiter des Fachausschusses für Erwachsenenbildung im Zonenerziehungsrat (ab 1946) das Volkshochschulwesen in der BRD mit auf und publizierte diverse Schriften zur Erwachsenenbildung. Er gab die Zeitschriften 'Freie Volksbildung' und 'Denkendes Volk' sowie die Schriftenreihe 'Bausteine der Volkshochschule‘ heraus.
Albrecht Bähnisch | 345
Frauen sollte Theanolte Bähnisch jedoch 1946 den ‚Club deutscher Frauen‘ gründen und so die ‚Sache‘, derer sich Lotze im Auftrag Grimmes angenommen hatte, selbst in die Hand nehmen. Dabei knüpfte sie, in Zusammenarbeit mit den anderen Begründerinnen des Clubs, an Inhalte der Thüringischen Volksbildung an, wie sie in Dreißigacker – auch in speziellen Frauenlehrgängen – zum Tragen gekommen waren. Im Folgenden soll deshalb zunächst ein Überblick über das pädagogische Konzept der Heimvolkshochschule Dreißigacker gegeben und im Anschluß daran aufgezeigt werden, in welchem Zusammenhang sich Albrecht Bähnisch für die Bildungseinrichtung einsetzte. Denn es steht zu vermuten, daß Theanolte Bähnisch nicht zuletzt aufgrund des Engagements ihres Mannes in der Erwachsenenbildung allgemein und für Dreißigacker im Speziellen mit den Ideen und Schwerpunktsetzung der Schule konfrontiert worden war. „Der Zentralraum des Hauses, der gewöhnlich die Schüler besonders überrascht, ist der Lesesaal. In ihm stehen nicht nach alter Schulart ein Katheder für den Lehrer und Bänke für die Schüler, sondern ein großer ‚demokratischer Tisch‘, um den Lehrer wie Schüler gemeinsam sitzen, an dem nach Dreißigackerer Art gearbeitet wird. Jeden Vormittag von 8 - 12 Uhr, oft auch an den Nachmittagsstunden, findet hier der ‚Unterricht‘ statt.“499 Mit dieser Passage erläutern Ilse Theiß und Heiner Lotze 1930 als Herausgeber der Festschrift für die zu dieser Zeit seit zehn Jahren bestehende Heimvolkshochschule Dreißigacker, was an Dreißigacker ‚anders‘ war. ‚Unterricht‘ war für die beiden Erwachsenenbildner eine Vokabel, die in Gänsefüßchen verpackt gehörte, denn in Dreißigacker sollte ein gleichberechtigtes Gespräch aller Teilnehmer stattfinden – ob am ‚großen Konferenztisch‘, am ‚Arbeitsgruppentisch‘ oder am ‚Budentisch‘. Denn orts- und mobiliar- sowie hierbei wiederum abwechslungsabhängig sei eine produktive Lernatmosphäre, gab sich Eduard Weitsch überzeugt,500 der die „Experimentiersozietas gleichberechtigter Gewöhnungen, Einsichten und Erfahrungen“501 1920 in einem ehemaligen Jagdschloß in Thüringen eingerichtet hatte. Mit der Festschrift zum zehnjährigen Jubiläum war jedoch auch schon der Abgesang auf das ‚Experiment‘ eingeläutet. Die geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten fanden nicht statt, denn im Zuge der kulturellen Kahlschlagpolitik der in Thüringen schon früh erfolgreichen Nationalsozialisten hatte Dreißigacker, das zuvor aufgrund seiner Stellung als „neutrale liberal-demokratische, das politische System der Weimarer Republik stützende Einrichtung“502 verhältnismäßig hohe Zuwendungen des Landes
499 Vgl.: Theiß, Ilse/Lotze, Heiner: Die Heimvolkshochschule Dreißigacker, in: dies. (Hrsg.): Dreißigacker. Volkshochschule/Erwachsenenbildung, Jena 1930, S. 7–9, hier S. 8. 500 Vgl.: Seitter, Wolfang: Dreißigacker als pädagogische Experimentiersozietas. Eduard Weitschs Beitrag zur Methodendiskussion und Professionalisierung der Erwachsenenbildung in der Weimarer Republik, in: Ciupke/Jelich: Experimentiersozietas, S. 87–102, hier S. 90–95. 501 Vgl.: Olbrich, Josef: Die Heimvolkshochschule Dreißigacker – Ein pädagogischer Begriff?, in: Ciupke/Jelich: Experimentiersozietas, S. 49–68, hier S. 62. 502 Olbrich, Josef: Geschichte der Erwachsenenbildung in Deutschland, Opladen 2001, S. 168.
346 | Theanolte Bähnisch
Thüringen erhalten hatte503, seit 1930 unter finanziellen Kürzungen und politischem Druck zu leiden. Zur Gruppe derer, die versucht hatten, die viel gepriesene Institution zur Förderung der Persönlichkeitsbildung vor dem finanziellen Ruin zu retten, hatte auch Albrecht Bähnisch gehört. Darin hatte sich sein Interesse an der Jugend- und Erwachsenenbildung, welches seinem Aufsatz über die politische Aufgabe der SAG zu entnehmen ist, ein weiteres Mal manifestiert. 3.5.1.1 Eduard Weitschs Position zwischen zwei Richtungen der Volksbildungsbewegung Aus den Photos in der Festschrift, die Weitsch mit Schülergruppen an einem seiner Lieblingsorte, der Eiche vor der Schloßtür zeigen, wird deutlich, daß neben dem ‚demokratischen Tisch‘ offenbar auch die freie Natur als Lernort in Dreißigacker geschätzt wurde. Die Bilder veranschaulichen gleichzeitig, daß der Erwachsenenbildner entgegen dem ersten Eindruck, den die Jubiläums-Schrift vermittelt, durchaus auch hierarchisch strukturierte Gesprächssituationen mit seinen Schülern pflegte. Auf den Bildern ist Weitsch jeweils an exponierter Stelle unter einem Baum oder auf einer Wiese sitzend zu sehen, während seine Schüler in einer Gruppe von jeweils nicht mehr als dreißig vor ihm Platz genommen haben. Die Illustrationen exemplifizieren – wenn man so will – das hierarchische Element neben dem die ‚Gleichberechtigung‘ beschwörenden Text und weisen damit auf die Zwischenposition hin, welche Weitsch zwischen der Tradition der ‚Gesellschaft zur Verbreitung von Volksbildung‘ und der als ‚Leipziger Neue Richtung‘504 bekannt gewordenen Form der Erwachsenenbildung einnahm. Während die ‚Gesellschaft zur Verbreitung von Volksbildung‘ vortragszentriert arbeitete und darauf ausgerichtet war, daß ihre Hörer einen etablierten, eingegrenzten und seit langer Zeit nicht hinterfragten Bildungskanon rezipierten, stellten die Vertreter der ‚Neuen Richtung‘ die Lebenserfahrungen, den Lebensalltag sowie die Interessen und Bedürfnisse der einzelnen Persönlichkeit in den Vordergrund ihrer interaktiv gestalteten Pädagogik. Gesellschafts-, Kultur- und Zivilisationskritik gingen in der ‚Neuen Richtung‘ eine Symbiose mit neuen, teilnehmerorientierten Methoden ein. ‚Kultur‘ und ‚Individuum‘ sollten auf diese Weise wieder zusammenfinden und eine Renaissance wahrhaft humanistischer Bildung einleiten. Auf diesem Weg könne, so hofften die Volksbildner, aus Individuen und gegeneinander streitenden Gruppen wieder ‚ein Volk‘ werden.505 „Der Volksbildner kann mit seinen bescheidenen Mitteln an diesem Gesundungsprozeß mitwirken, durch eine Vorwegnahme der ersehnten neuen Volksordnung in kleinen Kreisen, in denen Menschen miteinander arbeiten und sprechen. Arbeitsgemeinschaft und Gespräch sind formale Mittel, die Volkszerstörung auf dem indirekten, bescheidenen Weg der Zellenbildung zu überwinden“506, beschrieb der Erziehungswissenschaftler Jürgen Henningsen die Grundidee der ‚Neuen Richtung‘ als Destillat seiner Quellenarbeit. Wilhelm Flitner, Professor für Pädagogik an der Universität Hamburg und einer der bedeutendsten
503 504 505 506
Vgl.: ebd., S. 171. Der Begriff lehnte sich an die Eröffnung des ersten Volksbildungsheimes in Leipzig an. Vgl.: ebd., S. 200–208. Jürgen Henningsen, zitiert nach Olbrich, Erwachsenenbildung, S. 201.
Albrecht Bähnisch | 347
Vertreter der ‚Neuen Richtung‘, hielt erklärtermaßen nichts von der ‚Befreiung des Proletariats‘ durch den sozialistischen Kampf, sondern beschwor die Idee eines ‚geistig und sittlich verbundenen Volkes‘. Die Parallelen der ‚Neuen Richtung‘ in der thüringischen Volkshochschularbeit zur Arbeit der bürgerlichen Sozialreform im Allgemeinen und zur Arbeit der SAG im Speziellen sind also nicht zu übersehen. Eduard Weitsch hatte, seiner Zwischenposition zwischen der klassischen und der ‚Neuen‘ Richtung entsprechend, das Konzept des ‚vordenkenden Vortrags‘ entwickelt. Josef Olbrich zufolge nahm dieses Konzept eine Mittelstellung zwischen dem „völlig offenen, situativen und okkasionellen Lernorganisationsansatz“507, also der oft als ‚Arbeitsgemeinschaft‘ bezeichneten Lernform und dem geschlossenen Ansatz ein. Den auch von Siegmund-Schultze bemühten Begriff ‚Arbeitsgemeinschaft‘ empfand Weitsch als ideologisch überhöht, weshalb er für die kommunikativen Lehrformen in Dreißigacker den Begriff ‚Rundgespräch‘ einführte. In der Spätphase Dreißigackers, als Albrecht Bähnisch sich für die Schule einsetzte, hatten allerdings Vorträge und die systematische Vermittlung von Inhalten an Relevanz und Raum im Lehrplan gegenüber den ‚Rundgesprächen‘ gewonnen.508 Grundlage dieser Entwicklung war ein richtungsändernder Aufsatz Eduard Weitschs aus dem Jahr 1928 gewesen. Dieser hatte der ‚Prerower Formel‘, mit der 1931 die konzeptionelle Abgrenzung der Heimvolkshochschulen in Thüringen von anderen Bildungseinrichtungen allgemein für beendet erklärt wurde, was eine teilweise Relativierung der ‚Neuen Richtung‘ bedeutete, Vieles vorweg genommen.509 Zwar beschritten die Vertreter der ‚Neuen Richtung‘ auch nach 1931 – solange dies noch möglich war – ihre bewährten pädagogischen Pfade, doch rückte der „geordnete Unterricht“510 wieder stärker ins Zentrum des pädagogischen Programms. Die Volkshochschullehre sollte nicht mehr allein der Persönlichkeitsbildung dienen, sondern auch die „verantwortliche[…] Mitarbeit aller am staatlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Gegenwart“511 sichern helfen. Ein „planmäßiger Aufbau der Lehrgebiete“512 schien zu diesem Zweck unerläßlich. An den in der ‚Neuen Richtung‘ etablierten pädagogischen Methoden hielten die Erwachsenenbildner jedoch weiterhin fest. Dreißigacker blieb eine liberale Bildungseinrichtung mit freien Lehrmethoden und einer grundsätzlichen Offenheit in politischen Fragen. Sie folgte dem Prinzip der relativen Neutralität, was eine Ablehnung dogmatischer Lehren beinhaltete, und war deshalb ein Dorn im Auge der aufstrebenden Nationalsozialisten.
507 508 509 510 511 512
Olbrich: Dreißigacker, S. 58–60. Vgl.: ebd., S. 60 sowie ders.: Erwachsenenbildung, S. 161. Olbrich: Erwachsenenbildung, S. 161/162. Reimers: Richtung, S. 116, Anm. 171. Ebd. Weitsch: Der Lehrplan der Abendvolkshochschule, 1928, zitiert nach Olbrich: Dreißigacker, S. 61.
348 | Theanolte Bähnisch
3.5.1.2 Vier lebensverändernde Monate? Das Prinzip gemeinsamen Lebens und Lernens Der Name ‚Heimvolkshochschule‘ leitete sich vom Charakter der Schule als ein Langzeit-Domizil her: In der Regel hielten sich die meist 18 bis 24-jährigen Schüler ganze vier Monate in der Heimvolkshochschule auf. Sie lernten, lebten und arbeiteten zusammen im Haushalt und in der Natur. Die Aufenthalte wurden von den Schülern meist als einschneidend erlebt, ganze Lebenspläne wurden in diesen vier Monaten modifiziert und nicht selten sogar komplett umgeworfen. „Nach ihrem Aufenthalt in Dreißigacker war die innere und äußere Entwicklung der Schüler oft durch eine Phase der Unsicherheit und des Suchens gekennzeichnet. Zum Beruf, zu den politischen Organisationen, zu ihrer weltanschaulichen und politischen Einstellung mußte nach den Erkenntnissen und Erfahrungen im Heim eine neue Stellung gefunden werden“513, schreibt der Erziehungswissenschaftler Josef Olbrich zu diesem Phänomen. So entschlossen sich nach dem Abschluß der Kurse viele Absolventen für einen Wechsel von ihrem bisher ausgeübten Beruf hin zu einer karitativen oder gesellschaftspolitischen Arbeit, beispielsweise in einer Gewerkschaft, einem Wohlfahrtsverband oder einer Genossenschaft.514 Nicht selten schieden jedoch auch Schüler, welche gehofft hatten, in Dreißigacker in ihren Entscheidungen bestärkt und in ihrer Linie gefestigt zu werden, voller Gram aus der Anstalt, weil sie sich haltlos fühlten.515 In diesem Zusammenhang erscheint folgerichtig, was Horst Wollenweber über die Entscheidung einer anderen in der Jugend- und Erwachsenenbildung tätigen Initiative, nämlich der im vorangegangenen Kapitel behandelten SAG, schreibt. Die SAG habe, so Wollenweber, nicht zuletzt aufgrund der Einsicht „daß mit der vierteljährlichen Herausnahme der Jugendlichen aus ihren gewohnten Verhältnissen“ durch das ansonsten geschätzte Dreißigacker ein beängstigender Schade verbunden war“516, beschlossen, mit dem Ulmenhof eine eigene Volkshochschule einzurichten. Das Ziel Eduard Weitschs, in Dreißigacker Persönlichkeiten heranzubilden, die ihren karitativen und/oder demokratischen Gestaltungswillen zum Beruf machen und die Ideen Dreißigackers in die Gesellschaft tragen würden, schien grundsätzlich aufgegangen zu sein. In der einschlägigen Literatur wird dafür das pädagogische Talent Weitschs und seiner Mitstreiter verantwortlich gemacht, welches sich im Entwickeln von „Notfragen“, also von existentiellen Themen aus „modischen Schlagwörtern“ und im „Dekonstruieren scheinbarer Wahrheiten“517 äußerte. Diskutiert wurden in
513 Olbrich: Dreißigacker, S. 65. 514 Nach Josef Olbrich wechselten 20 Prozent der Schüler den Beruf, viele studierten, mindestens zwölf promovierten. Er weist allerdings zu Recht darauf hin, daß es unmöglich sei, zu sagen, wie die Entwicklung der Persönlichkeit ohne Einwirkung der Schule von statten gegangen wäre. Vgl.: Olbrich: Dreißigacker, S. 65. Vgl. auch: Ciupke, Paul: „Was gibt das Volkshochschulheim?“ Die bildungstheoretischen Grundlagen von Weitschs andragogischer Arbeit – eine Annäherung auf Nebenwegen, in: Ciupke/Jelich: Experimentiersozietas, S. 69–84, hier S. 77. 515 Vgl.: Seitter: Dreißigacker, S. 97. 516 Wollenweber: Siegmund-Schultze, S. 266. 517 Ciupke: Volkshochschulheim, S. 80.
Albrecht Bähnisch | 349
diesem Kontext politische, ökonomische, philosophische, pädagogische, literarische und ästhetische Themen.518 Doch hatte nicht schon ein entsprechender Wille zur Veränderung die jungen Leute in die Bildungsstätte getrieben, welche Weitsch mit Plakaten bewarb, auf denen eine von Bäumen gesäumte Allee die illustrative Ergänzung zu einem Text bot, welcher der „werktätigen Jugend Thüringens und Deutschlands“519 Hilfe auf ihrem Lebensweg versprach? Daneben sollte Berücksichtigung finden, daß eine viermonatige Pause vom Arbeiter- oder Angestelltenberuf vor allem in Zeiten der wirtschaftlichen Krise beileibe nicht von allen Arbeitgebern – Berufsbildungsgesetz hin oder her – akzeptiert wurde. So bestand die Gefahr, daß die Rückkehr in das ‚alte Leben‘ versperrt blieb.520 Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Seminarbesucher auf der Suche nach Veränderung oder einer Schwerpunktverlagerung ihrer Lebens- und Berufsinhalte dieses Risiko bewußt und billigend einkalkulierten.521 3.5.1.3 Freie Volksbildungsarbeit versus sozialdemokratische Kaderschmiede Den Erwachsenenbildnern des linken Flügels in der SPD mißfiel nicht nur die Arbeit der Volksbildungsbewegung an sich, sondern auch jene der ‚Neuen Richtung‘ mitsamt der Weitsch’schen Ausprägung. Der Reichstagsabgeordnete der SPD und Pädagoge August Siemsen hatte 1927 auf einer Reichskonferenz der Bezirksbildungsausschüsse der SPD „starke Gefahren in den neutralen Volkshochschulen, weil sie Ablenkung von Klassenkampf bedeuten“522 heraufbeschworen. Die sozialdemokratischgewerkschaftliche Richtung der Erwachsenen- beziehungsweise Arbeiterbildung setzte deshalb auf den Ausbau eigener Bildungsinstitutionen. Dazu zählten die Wirtschaftsschule des ‚Deutschen Metallarbeiter-Verbandes‘ (DMV), die Bundesschule des ‚Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes‘ (ADGB) und die Wanderkurse des ‚Reichsausschusses für sozialistische Bildungsarbeit‘. „In ihnen bilden wir die […] Bereiten, Wenigen, aber nicht, damit sie für sich gebildet seien, sondern damit sie ihr Wissen in der Arbeiterbewegung verwerten“523, ließ Valtin Hartig, der Leiter
518 519 520 521
Vgl.: ebd. Vgl.: Olbrich: Dreißigacker, S. 59, Abbildung. Vgl.: ebd., S. 64. Auch Josef Olbrich geht davon aus, daß Weitsch „die sozialen Eliten […] die bereit waren, große persönliche Opfer zu erbringen“, ansprach. Olbrich: Erwachsenenbildung, S. 171. 522 Zitiert nach Jelich, Franz-Josef: Persönlichkeit und Organisationsinteresse. Milieuverbundene Institutionalisierung in der Erwachsenenbildung der 20er Jahre, in: Ciupke/ Jelich: Experimentiersozietas, S. 129–139, hier S. 134. 523 Hartig, Valtin: Arbeiterbildung, in: Die Tat, Bd. 18 (1926), Heft 4, S. 241–253, hier S. 248, zitiert nach Jelich: Persönlichkeit, S. 129–139, hier S. 129. Hartig hatte seine Position damit ausgerechnet in jener Monatsschrift umrissen, die als Organ der Jungkonservativen in der Weimarer Republik gilt und sich 1929 unter Hans Zehrer radikalisierte.
350 | Theanolte Bähnisch
des Arbeiter-Bildungsinstituts in Leipzig 1926 über jene Kurse verlauten, aus denen Franz Josef-Jelich zufolge „handlungsfähige Funktionäre“524 entlassen wurden. Dem Verständnis von bewegungsbezogener Bildung stand ein Bildungsbegriff, wie ihn Eduard Weitsch und andere Vertreter der ‚Leipziger Neuen Richtung‘ vertraten und der auf die freie Charakterbildung des Individuums abzielte, unvereinbar gegenüber. Zwar benannten die leitenden ‚Volksbildner‘ in Dreißigacker – mal mehr, mal weniger offen paternalistisch argumentierend – Arbeiterbildung ebenfalls als eine wichtige Aufgabe. Sie wiesen ihre Mitarbeiter an, mit den Schülern, die nicht selten aus dem Arbeitermilieu kamen, „kameradisch“ umzugehen, in die „Seelenlage und Denkweise intelligenter proletarischer Menschen“ einzudringen und „Achtung“525 vor diesen zu gewinnen. Ihr bildendes Wirken sahen sie als einen Beitrag zur „kulturpädagogischen Fundierung einer dem Industriezeitalter entsprechenden demokratischen Gesellschaftsordnung“526 an. Doch sie vertraten ein Bildungsideal, welches den Platz eines Menschen in einer Gesellschaft nicht vordefinierte, sondern den Bildungsauftrag gerade darin sah, den ‚Kern der Persönlichkeit‘ eines jeden Menschen ergebnisoffen herauszuarbeiten. Während die Bildungseinrichtungen der SPD ihre Schüler im Klassenkampf brillieren sehen wollten, ging die Grundprämisse der Weitsch‘schen Bildungstheorie von der Freiheit und Autonomie der Person aus. „Bildung“, so Josef Olbrich, wurde von Weitsch „als dynamisch-organisatorischer Prozeß verstanden, als die Entfaltung der im Menschen angelegten Kräfte, als Prozeß der Selbstfindung und Selbstgestaltung“527. Erwachsenenbildung war in diesem Kontext also zugleich immer auch „Bildung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung“528 – aber nicht in eine bestimmte Richtung. Eduard Weitsch sprach sich gegen „Tendenzpädagogik“, aber für eine „Anknüpfung an das Alltagsbewußtsein der Teilnehmer“ und eine dementsprechend „lebensweltlich“529 ausgerichtete Pädagogik aus. In Weitschs Argumentation lassen sich deutliche Parallelen zum Konzept der ‚Mitbürgerlichen Bildung‘ erkennen, welches Fritz Borinski, der von den Ideen der Neuen Leipziger Richtung ebenfalls beeinflußt war, in den 1940er Jahren etablierte. Die unverhohlene Skepsis der SPD-Parteilinken gegenüber der Volksbildungsbewegung ist, Hans Mommsen zufolge, als Teil des „Prozeß zunehmender innerer Distanzierung von der nunmehr als ‚bürgerlich‘ bezeichneten Demokratie“530 anzusehen. „Republik, das ist nicht viel – Sozialismus heißt das Ziel“531, lautete der Slogan, mit der die Parteilinke darauf aufmerksam machte, daß aus ihrer Sicht die sozia-
524 525 526 527 528 529 530
Jelich: Persönlichkeit, S. 131. Olbrich: Dreißigacker, S. 62. Ebd., S. 56. Ebd. Ebd. Ebd., S. 58 Mommsen, Hans: Die Sozialdemokratie in der Defensive: Der Immobilismus der SPD und der Aufstieg des Nationalsozialismus, in: ders. (Hrsg.): Sozialdemokratie zwischen Klassenbewegung und Volkspartei, Frankfurt a. M. 1974, S. 106–133, hier S. 110. 531 Vgl.: Walter, Franz: „Republik das ist nicht viel“. Partei und Jugend in der Krise des Weimarer Sozialismus, Bielefeld 2011.
Albrecht Bähnisch | 351
le Demokratie mit der Republik noch lange nicht verwirklicht war. Nach jener Überzeugung konnten eben nicht ‚Brückenbauer‘, wie sie die SAG, Dreißigacker und andere Einrichtungen der freien Volksbildung heranzogen, sondern nur ‚Klassenkämpfer‘ das Ziel einer gerechten Gesellschaft verwirklichen helfen. Die Sicht auf die ‚pädagogische Arbeitsgemeinschaft‘ als ‚Urzelle wirklicher Volksgemeinschaft‘, welche die Volksbildner beschworen, war und blieb für die SPD-Linke äußerst anstößig. Neben der ‚Ablenkung vom Klassenkampf‘ schien der Ansatz der Volksbildner sogar die Gefahr einer zunehmenden ‚Klassenentfremdung‘ der Arbeiter zu beinhalten. Die ‚scheinbare Neutralität‘ der volksbildnerischen Institutionen wurde in jenen Kreisen – nicht völlig zu Unrecht – als versteckter bürgerlicher Dogmatismus bewertet.532 Mehr noch als in den Anfangsjahren fühlte sich die Parteilinke zur Zeit des zehnjährigen Jubiläums von Dreißigacker nach den Erfahrungen der Wirtschaftskrise, der leeren Sozialkassen und der ‚Notopfer‘ in ihrer Wahrnehmung bestätigt, nach einer unvollendeten Revolution533 in einem Staat zu leben, welcher die Interessen der Arbeiter anderen politischen Zielen unterordnete. Daß Albrecht Bähnisch sich 1931, mit all diesen Erfahrungen im Gepäck, in Form seines Engagements für Dreißigacker weiterhin für eine ‚Überwindung der Klassenspaltung‘ einsetzte, ist aufschlußreich – zeugt es doch von einer offenbar nimmermüde werdenden Hoffnung auf die Überwindung gesellschaftlicher Schieflagen durch Bildung und das Engagement einzelner berufener Bürger. War dies darauf zurückzuführen, daß er, der mittlerweile Landrat geworden war, von der Politik der Großen Koalition profitierte und die ‚Nöte des kleinen Mannes‘ nicht wahrnahm? Oder waren die schärfer werdenden Auseinandersetzungen zwischen ‚rechts‘ und ‚links‘, denen er auch als sozialdemokratischer Landrat ausgesetzt war, handlungsleitend für ihn? In mancherlei Hinsicht läßt sich Weitschs evolutionäres Bildungs-Konzept, was die Möglichkeit einer Veränderung des Staatswesens und damit der Gesellschaft anging, als weitsichtiger, als das ‚revolutionär‘ gedachte Konzept der Parteilinken in der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften interpretieren. Weitschs Anstrengungen, die auf die ‚freie Persönlichkeitsbildung‘ abzielten, ist durchaus ein innovationsträchtiger Aspekt abzugewinnen: Die Rekrutierung und Förderung von ‚Zöglingen‘ aus bereits etablierten Parteien und Organisationen – seien es bürgerliche, seien es Arbeiterorganisationen – zum Zweck der Verwendung des ‚Erlernten‘ in den jeweiligen Zusammenschlüssen, hatte notwendigerweise eine sowohl institutionelle als auch inhaltliche Bestätigung des existierenden Organisationsgefüges zur Folge. Einem organisations- und parteifernen Bildungsansatz534 wohnte eine größere Chance zur UmStrukturierung der Gesellschaft und Diversifikation der Demokratie durch junge, weitgehend unvoreingenommene und entsprechend kreative Akteure inne. Diese hätten ihren Weg prinzipiell auch zwischen den etablierten Organisationen suchen und damit Kräfteverhältnisse verändern sowie die Träger der Demokratie mehren können.
532 Jelich: Persönlichkeit, S. 135. 533 Flemming: Revolution. 534 Ilse Theiß und Heiner Lotze weisen in ihrer Festschrift darauf hin, daß die Schüler in Dreißigacker „nur selten von bestimmten Organisationen delegiert“ waren. Theiß/Lotze: Dreißigacker, S. 7.
352 | Theanolte Bähnisch
Zu überprüfen, inwiefern sich einzelne Schüler Dreißigackers entsprechend betätigten, steht jedoch noch aus.535 Paul Ciupkes Überzeugung, daß die Anstrengungen der Thüringischen Volksbildner darauf ausgerichtet gewesen seien, die Gesellschaft durch Bildung zu demokratisieren – was wiederum eine Demokratisierung der Bildung vorausgesetzt habe – teilen allerdings nicht alle Experten. Ciupke konstatiert, daß Weitsch „zu dem wohl nicht sehr großen Kreis bewußter und überzeugter Demokraten in der Weimarer Republik gehörte“.536 Der SPD-nahe Historiker Bernd Faulenbach formuliert vorsichtiger: „Auf’s Ganze gesehen stand die Volksbildung auf dem Boden der Republik“537, schreibt Faulenbach, verweist aber auch darauf, daß dem Pädagogik-Professor Franz Pöggeler zufolge der Begriff ‚Demokratie‘ von den Sprechern der Erwachsenenbildung nur selten verwendet wurde. Das ersehnte ‚Neue‘ habe weniger in demokratischen Strukturen, als vielmehr in der Vereinigung von Schichten und Gruppen zu einer einheitlich gedachten Volksgemeinschaft gelegen.538 So ist von Eduard Rosenstock die Haltung überliefert, daß die „Arbeitsgruppe“ als „Volkswerdung im kleinsten Rahmen“539 zu betrachten sei. Wenn Klaus Körber allerdings schreibt, die Konzeptionen der Weimarer Volksbildner, zu denen Weitsch zählte, seien allgemein „an den Realstrukturen der Weimarer Gesellschaft und an der Repräsentativverfassung der Weimarer Demokratie vorbei“540 gegangen, so ist diese Feststellung – gemessen an den Verfassungsrealitäten – kaum zutreffend. Denn Weitsch und seine Kollegen proklamierten schließlich nichts anderes, als es beispielsweise das preußische Kultusministerium im Jahr 1919 getan hatte: „Das Ministerium […] hofft, daß die deutsche Volkshochschule als freie Volksbewegung ihren Teil beitragen wird zur Wiedergeburt ihres Volkes“541, hieß es in einer offiziellen Schrift des Ministeriums. Und der liberale Staatsrechtler Hugo Preuß hatte im November 1919 im Berliner Tageblatt seine Überzeugung wie folgt kundgetan: „Nicht Klassen oder Gruppen, nicht Parteien und Stände in gegensätzlicher Isolierung, sondern nur das gesamte deutsche Volk […] kann den deutschen Volksstaat schaffen. […] Gewiß muß eine moderne Demokratie vom Geiste eines kräftigen sozialen Fortschritts erfüllt sein; aber ihre politische Grundlage kann niemals der soziale Klassenkampf, die Unterdrückung einer so-
535 Heiner Lotze hatte sich bereits 1930 mit der Frage, was aus den Schülern Dreißigackers würde, auseinandergesetzt. Er nennt jedoch bei seinen Reflexionen keine Namen. Vgl.: Lotze, Heiner: Die ehemaligen Schüler von Dreißigacker, in: Theiß/Lotze: Dreißigacker, S. 29–34. 536 Ciupke: Volkshochschulheim, S. 81. 537 Faulenbach, Bernd: Erwachsenenbildung in der Weimarer Republik. Zur Ambivalenz einer Beziehung, in: Ciupke/Jelich: Experimentiersozietas, S. 11–28, hier S. 15. 538 Vgl.: ebd. 539 Ebd., S. 20. 540 Körber, Klaus: Zwischenruf: Zurück hinter die Verwestlichung? An welche Traditionen kann die bundesrepublikanische Erwachsenenbildung anknüpfen?, in: Ciupke/Jelich: Experimentiersozietas, S. 191-200, hier S. 194. 541 Zitiert nach Olbrich: Erwachsenenbildung, S. 139.
Albrecht Bähnisch | 353
zialen Schicht durch die andere bilden, sondern nur die Einheit und Gleichheit aller Volksgenossen.“542 Daß der Herstellung eines ‚Volksganzen‘ als pädagogische Intention bei allem wohlmeinenden Willen zur Solidarität ein deutliches Moment der Leugnung der sozialen Wirklichkeit innewohnte und daß die Arbeit der Volksbildner beileibe nicht die tiefen Risse in der Gesellschaft zu kitten vermochte, steht außer Frage. Der Begriff ‚Volk‘ kann – und muß – im geschilderten Zusammenhang allerdings von der ihm heute zugeschrieben, nationalsozialistisch-biologistisch geprägten Aussage freigesprochen werden. Denn ‚Volk‘ meinte in der Erwachsenenbildung die Gemeinschaft handelnder Individuen in einem gesellschaftlichen System. Daß das ‚Volk‘ in der Utopie der Volksbildungsbewegung bei weitem nicht mit dem übereinstimmte, was die Nationalsozialisten sich erdacht hatten – auch wenn es innerhalb der Volksbildungsbewegung Anhänger der Partei gab – ist vor allem in der schnellen Zerschlagung jener Bewegung durch die NSDAP erkennbar. Folgt man dem ausgewiesenen NS-Forscher Michael Wildt, so hatte der Begriff ‚Volksgemeinschaft‘ seine erste Hochkonjunktur bereits im Ersten Weltkrieg erfahren.543 Freilich bestehen rhetorische Parallelen zwischen jener Mobilisierungsrhetorik, die als ‚Geist von 1914‘ bezeichnet, Eingang in die Forschungsliteratur fand und dem was man aus Dreißigacker hörte. Und dem Wunsch nach einer ‚Volksgemeinschaft‘ ist auch eine Form des Unmuts über ‚Parteiengezänk‘ zu entnehmen, aus dem man eine grundsätzliche Kritik an der Verfaßtheit der Republik ablesen kann. Man muß es jedoch nicht tun. In der Einschätzung Dieter Langewiesches dominierte der vom Begriff der Nation und des Volkes geprägte Ansatz der Erwachsenenbildung ohnehin „die Praxis keineswegs in dem Maße […] wie das die Theoriedebatten der 20er Jahre und der Schwerpunkt der späteren Forschung vermuten lassen.“544 Und wie der bereits zitierte Michael Wildt im Laufe seiner Ausführungen deutlich machte, war der Begriff ‚Volksgemeinschaft‘ „politisch deutungsoffen.“ Er habe „national“ oder „sozialistisch“, „konservativ“ oder „völkisch“545 interpretiert werden können und alle politischen Richtungen zur Identifikation eingeladen.546 Das Problematische an Dreißigacker ist wohl weniger darin zu sehen, daß hier, in der Hoffnung auf eine utopisch anmutende Versöhnung der ‚Klassen‘, ergebnisoffen – aber, wie Kritiker nicht ganz zu Unrecht meinten, am Ende doch auf dem Boden einer gemeinhin mit dem Begriff ‚bürgerlich‘ konnotierten Einstellung – unterrichtet wurde. Es liegt stärker in der Art der Rekrutierung von Schülern, die nach Weitschs
542 Preuß, Hugo: Volksstaat oder verkehrter Obrigkeitsstaat, in: ders. (Hrsg.): Staat, Recht und Freiheit. Aus 40 Jahren deutscher Politik und Geschichte, Tübingen 1926, S. 367. 543 Vgl.: Wildt, Michael: Die Ungleichheit des Volkes. „Volksgemeinschaft“ in der politischen Kommunikation der Weimarer Republik, in: Bajohr, Frank/Wildt, Michael (Hrsg.): Volksgemeinschaft. Neue Forschungen zur Gesellschaft des Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 2009, S. 24–40, hier S. 24. 544 Langewiesche, Dieter/Tenorth, Heinz-Elmar (Hrsg.): Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Bd. 5, München 1989, S. 337/338. 545 Wildt: Ungleichheit, S. 26. 546 Ebd.
354 | Theanolte Bähnisch
Meinung im Anschluß an den Aufenthalt in Dreißigacker ihre Stimme bei der Mitgestaltung des Staats erheben sollten. Das Bildungs-Konzept der SAG war – trotz seines lokalen Bezugs – insgesamt breitenwirksam angelegt, weil es jedem Arbeiter, der im Gebiet einer aktiven SAG-Gruppe lebte, offenstand. Dreißigacker hingegen war ein ‚geschlossenes System‘ und es erscheint sehr fraglich, ob mit Weitschs Idee, wenige junge Menschen für vier Monate aus dem Berufsleben zu nehmen und dafür immerhin eine Zahlung von 40 Tageslöhnen für den Unterhalt in Dreißigacker zu verlangen, eine Republik zu gewinnen war, die doch auf den Schultern vieler ruhen sollte. Albrecht Bähnisch hatte in seinem Aufsatz über die politische Aufgabe der SAG moniert, daß der Staat in den Augen vieler Arbeiter als etwas angesehen werde, das nicht von ihnen, sondern vom gebildeten Bürgertum getragen würde. Dreißigacker war, anders als die SAG und als andere Volkshochschulen in Thüringen, nicht darauf ausgerichtet, dieses Phänomen durch eine breitenwirksame Bildungsarbeit zu mildern, sondern darauf, eine „aktive Minderheit“547, eine ‚demokratische Elite‘ – wenn auch aus Arbeiter- und Angestelltenkreisen kommend – weiter zu bilden. Auch Josef Olbrich konstatiert, daß man „[z]weifelsohne […] von den Schülern [Dreißigackers] als einer sozialen und politischen Elite sprechen“548 könne. Ein Auswahlverfahren, in dem die ‚Bewerber‘ ihren Wunsch nach Dreißigacker zu kommen „eingehend begründen“549 mußten, half, nicht nur die Anzahl der Schüler überschaubar zu halten, sondern auch jene auszuwählen, in deren Aussagen sich die Pädagogen in der Einrichtung wiederfanden. Insgesamt hatte Dreißigacker zwischen 1920 und 1933 nur 650 Schüler in insgesamt 22 Kursen mit durchschnittlich je 28 Teilnehmern.550 Daß jene ‚aktive Minderheit‘ nicht nur repräsentativ wirken, sondern wiederum als Multiplikatoren tätig werden und andere mit ihrem Engagement anstecken würde, gehörte mit zu Weitschs Rechnung. „[S]auerteiglich weiterwirkende Führer, die den größten Radius des Weiterwirkens versprechen“551 wollte er für seine Schule gewinnen 3.5.2 Der Aufstieg der Nationalsozialisten und das Ende der Reformpädagogik – Albrecht Bähnisch unterstützt den Verein zur Erhaltung des Volkshochschulheims Nicht die (direkte) Demokratie, sondern der Führerstaat sollte schließlich das Ende Dreißigackers besiegeln. Im Februar 1930 waren unter Wilhelm Frick, der zu dieser Zeit in Thüringen als Innen- und Volksbildungsminister fungierte, die Streichung der
547 Olbrich verweist in diesem Zusammenhang auf Fritz Borinski, der den Begriff „aktive Minderheit“ prägte. Vgl.: Olbrich: Dreißigacker, S. 66, vgl.: auch Borinski, Fritz: Die Bildung aktiver Minderheiten als Ziel demokratischer Erziehung. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 17. Jg. (1965), S. 528–542. 548 Olbrich: Dreißigacker, S. 64. 549 Lotze/Theiß: Dreißigacker, S. 7. 550 Zahlen nach Olbrich: Erwachsenenbildung, S. 172. 551 Eduard Weitsch, zitiert nach: Olbrich: Erwachsenenbildung, S. 171.
Albrecht Bähnisch | 355
staatlichen Zuschüsse für freie Volksbildung – also auch für Dreißigacker552 – sowie der Abzug des Regierungsvertreters aus dem ‚Ausschuß zur Förderung des Volkshochschulheims‘ beschlossen worden. Weitsch sollte auf Beschluß des Staatsministeriums in den Wartestand versetzt werden. Bettina Irina Reimers beschreibt jene Vorgänge in ihrer erziehungswissenschaftlichen Dissertation als einen wichtigen Aspekt der „Demontage der demokratischen Bildungs- und Kulturarbeit in Thüringen“.553 Vor dem Hintergrund der Beteiligung der Nationalsozialisten an der Thüringischen Landesregierung554 und der bildungspolitischen Kehrtwende im Land hatten sich seit 1931 namhafte Persönlichkeiten für die Erhaltung des Heims eingesetzt. Gemeinsam mit Eduard Weitsch, dem ebenfalls in Dreißigacker lehrenden Paul Steinmetz, dem Landesschulrat Dr. Siegfried Berger aus Merseburg, dem Lehrer Alfred Benda aus Weißenfels, dem Mitgründer des Reichsverbandes deutscher Volkshochschulen Franz Mockrauer sowie Erich Nippold (Gotha) und dem Pädagogen und Historiker Max Wilberg engagierte sich Albrecht Bähnisch im ‚Verein zur Erhaltung des Volkshochschulheims e. V.‘. Gemeinsam mit Benda hatte er den geschäftsführenden Vorsitz des Vereins übernommen, dessen Zweck insbesondere die Sicherung der Finanzierung war.555 Über die Motivation Bähnischs, sich im Verein zu engagieren, läßt sich nur mutmaßen: Seine aus der Familiengeschichte resultierende Nähe zum Bildungswesen mag eine Rolle dafür gespielt haben, dann seine Freundschaft zu Siegmund-Schultze, der wiederum mit Weitsch gut bekannt war. Schließlich war Bähnisch, wie aus seinem Aufsatz über die SAG deutlich wird, davon überzeugt, daß Volksbildung die Voraussetzung für eine verantwortungsvolle Partizipation an der Demokratie sei. Die Unterstützung eines Trägers, der sich diesem Ziel widmete, erscheint vor diesem Hintergrund konsequent. Bähnischs Rolle als gemäßigter sozialdemokratischer Landrat könnte ihn zu einer Zeit, in der sowohl Bildungs-Einrichtungen der SPD und der Gewerkschaften, als auch parteiunabhängige Reform-Schulen unter Beschuß durch die Nationalsozialisten geraten waren, für ein solches Gremium empfohlen haben. Schlußendlich könnte der Landrat Anfang 1931 bereits um seine eigene Position gefürchtet haben. Ob Trotz oder Kalkül im Vordergrund seines Handelns gestanden haben könnte, läßt sich nicht sagen: Die NSDAP hatte zum Zeitpunkt der Vereinsgründung in Thüringen bereits für die Absetzung vieler sozialdemokratischer Mitarbeiter
552 1925/26 hatte Dreißigacker 28 000 RM aus dem Gesamtvolumen von 41 000 RM, die das Land Thüringen den Volkshochschulen zur Verfügung stellte, erhalten. Vgl.: Olbrich: Erwachsenenbildung, S. 161. 553 Reimers: Richtung, S. 204. 554 In der seit dem 30.01.1930 amtierenden ‚Baum-Frick-Regierung‘ stellte die NSDAP erstmals in der Weimarer Republik in einer Landesregierung zwei Regierungsämter. Als das Mißtrauensvotum gegen beide Minister am 01.01.1931 erfolgreich verlief, was zum vorläufigen Ausschluß der NSDAP aus der Landesregierung führte, gab es für Dreißigacker Anlaß zur Hoffnung. Doch bei den Landtags-Wahlen 1932 trug die NSDAP den Sieg als stärkste Fraktion davon. 555 EZA, 51/Vh 14, Protokoll der Gründungssitzung. Vgl. dazu auch: Reimers: Richtung, S. 205.
356 | The anolte Bähnisch
in der Verwaltung gesorgt. Denkbar ist, daß Albrecht Bähnisch glaubte, der Demontage der Demokratie etwas entgegensetzen zu müssen und daß ihm der Einsatz für die demokratische Erwachsenenbildung als ein sinnvolles Mittel erschienen war. Ebenfalls denkbar ist, daß er mit dem Gedanken an eine berufliche Alternative im Bildungswesen spielte. Praktische Erfahrungen in diesem Bereich hatte er in der SAG bereits gesammelt und mit seinen Publikationen hatte er sich ebenfalls nicht zuletzt an Personen gewendet, die sich in der Ausbildung befanden. Eine dauerhafte Funktion scheint er im Verein nicht gehabt zu haben. Es sieht vielmehr so aus, als habe sich seine Mitwirkung weitgehend auf die Zeit um die Vereins-Konstituierung herum beschränkt, denn in den späteren Arbeitstreffen taucht sein Name nicht wieder auf. Dies wiederum erklärt sich aus dem Protokoll der ersten Mitgliederversammlung vom 02.07.1931. Es listet auf, aus welchen Kreisen Personen für den Verein gewonnen werden sollten – und Albrecht Bähnisch entsprach keinem der beschriebenen Profile.556 Zudem hatte bereits das Protokoll der Gründungsversammlung festgehalten, daß der Vorstand (nur) „bis zur ersten Mitgliederversammlung“557 aus Benda und Bähnisch bestehen solle. Vermutlich hatte sich der Jurist Bähnisch vor allem um die rechtlichen Aspekte der Vereinsgründung gekümmert. In einem Brief des Reichsverbandes der deutschen Volkshochschulen an den Vorstandsvorsitzenden des Reichsverbandes, Dr. Alfred Mann, vom 19.02.1931 heißt es nämlich: „Der ‚Dreißigacker-Verein‘ ist übrigens noch nicht eingetragen, sondern in der Eintragung begriffen, und nach Mitteilung von Landrat Bähnisch machen sich in der Satzung wohl noch einige Änderungen notwendig. Ich zweifle aber nicht daran, daß wir Anfang März in Frankfurt am Main schon mit dem Verein als juristischer Person rechnen können. Der Übergang von der Volkshochschule Thüringen an den ‚Dreißigacker e. V.‘ kann natürlich erst erfolgen, wenn der Dreißigacker e. V. als juristische Person besteht.“558 Wenn das heute noch greifbare Engagement Albrecht Bähnischs für Dreißigacker auch nur kurz war, so sah zunächst alles danach aus, als sei es zumindest wirkungsvoll gewesen. Denn die vom Verein angestrebte und gegenüber dem Land Thüringen durchgesetzte Herauslösung Dreißigackers aus dem ‚Verband Volkshochschule Thüringen‘ schien eine Neuorientierung der Heimvolkshochschule möglich zu machen. Der Reichsverband der deutschen Volkshochschulen sowie das Preußische Ministerium des Innern, Albrecht Bähnischs ehemaliger Arbeitgeber, hatten der über den ‚Verein Dreißigacker‘ nun selbständig wirtschaftenden Schule finanzielle Unterstützung zugesichert. Dies läßt auf die Bedeutsamkeit, die Innenminister Severing – und, nach allem was bekannt ist, auch der Kultusminister Adolf Grimme – der Schule beimaßen, schließen. Josef Olbrich zufolge genoß Dreißigacker in verschiedenen
556 EZA, 51/Vh 14, Protokoll der 1. Mitgliederversammlung des Vereins zur Erhaltung des Volkshochschulheims Dreissigacker e. V. am 2. Juli 1931 nachm. 6 Uhr im Volkshochschulheim Dreissigacker bei Meiningen. 557 EZA, 51/Vh 14, Protokoll über die Gründung des Vereins zur Erhaltung des Volkshochschulheims Dreissigacker e. V. am 2. Januar 1931 in Merseburg. 558 EZA, 51/Vh 14, Der Reichsverband der deutschen Volkshochschulen an Alfred Mann, S. 2.
Albrecht Bähnisch | 357
Ministerien einen „hervorragenden“559 Ruf. Doch kurze Zeit später wuchs der Druck durch die Nationalsozialisten auf der Reichsebene und schließlich auch in Preußen. Deshalb sah sich die Leitung der Heimvolkshochschule gezwungen, fortan auf dem schmalen Grat zwischen dem Festhalten an der Idee der freien Erwachsenenbildung und einem Entgegenkommen gegenüber den Nationalsozialisten zu wandeln, welches die Aufrechterhaltung der Schule ermöglichte. Dreißigacker ließ sich, um seine Finanzierung zu sichern, schließlich in den Freiwilligen Arbeitsdienst einbinden560, was den Tagesablauf im Heim stark veränderte. Einig waren sich die tragenden Kräfte in der Frage, wieviel Veränderung für das Heim nötig und tragbar sei, nicht. Der zum 31.04.1930 in den Wartestand versetzte561 Direktor Weitsch selbst zog sich, wie auch Alfred Benda, aus den Planungen für die Zukunft Dreißigackers mehr und mehr zurück. Er wollte die Veränderungen, die er als Aufgabe seiner Ideale begriff, nicht mittragen. Paul Steinmetz dagegen ließ sich für neue Erziehungsideale im Sinne des Nationalsozialismus durchaus begeistern und zeigte sich kooperationsbereit. Er schlug die Umwandlung Dreißigackers in eine Siedlerschule vor, was eine weitgehende Aufgabe der einst im Kontext der Freien Volksbildung vertretenen Ziele Dreißigackers bedeutete.562 Aber auch diese Idee, die für Steinmetz einen Karriereschub bedeutet hätte,563 half am Ende nicht weiter. Die Mitglieder des Vereins zur Erhaltung des Volkshochschulheims Dreißigacker kamen am 30.09.1933 zum letzten Mal in Merseburg zusammen, um einen einzigen Tagesordnungspunkt zu erledigen: die formelle Auflösung des Vereins. Bereits ein halbes Jahr zuvor, am 30. März des Jahres, war Dreißigacker von Nationalsozialisten gestürmt worden. Das ‚Kommunistennest‘, wie das Heim von Innenminister Frick tituliert wurde564, hatte ausgedient, seine Mitarbeiter sollten fortan ihren Beruf nicht mehr ausüben dürfen. An die Stelle der ‚freien Bildung‘, wie sie die Vorzeigeheimvolkshochschule der Weimarer Erwachsenenbildung einst gepflegt hatte, waren neue, auf Kadavergehorsam setzende Ideale getreten. In ihrer Abwicklung fanden die freie Volksbildung sowie die Bildungsarbeit der SPD und der Gewerkschaften schließlich wieder zusammen.565 Die NSDAP machte sich, wie an der Verunglimpfung des
559 560 561 562
Olbrich: Dreißigacker, S. 66. Vgl.: Reimers: Richtung, S. 150. Vgl.: ebd., S. 205. Franz Mockrauer aus dem Vorstand des Reichsverbandes deutscher Volkshochschulen sah für den Fall der Umsetzung jener Pläne ein Ausscheiden Dreißigackers aus dem Reichsverband vor, da der Verband mit der Finanzierung einer Einrichtung, die von dem, was sie einst gewesen sei, nur noch den Schein trage, zu Unrecht belastet sei. Vgl.: Reimers: Richtung, S. 209. 563 Bettina Irina Reimers zufolge hatte sich Steinmetz in seinem Konzept selbst für die Position des Geschäftsführers vorgesehen. Vgl.: Reimers: Richtung, S. 209. 564 Vgl.: Fischer, Georg: Wenn nur der leidige Respekt nicht wäre – Fragen zum Ende des Projekts Dreißigacker, in: Ciupke: Experimentiersozietas, S. 201–219, hier S. 203. 565 Für die NSDAP galt, laut Bernd Faulenbach, nicht nur die Bildungsarbeit der Gewerkschaften, sondern auch die der Volkshochschulen als republikanisch. Vgl.: Faulenbach: Erwachsenenbildung, S. 26. Der NSDAP-Abgeordnete Fritz Wächtler hatte im Weimarer
358 | The anolte Bähnisch
Heims in der parteinahen Presse zu sehen war, nicht die Mühe, verschiedene Traditionen einer ihr gesamthaft unliebsamen Bildungsarbeit voneinander zu unterscheiden. Sie ließ alle Einrichtungen, die demokratischen Idealen, gleich welcher politischen Couleur anhingen, schließen und verfolgte ihre Mitarbeiter. Erst 1945, nach dem Ende des Dritten Reiches, wurde ein Anknüpfen an die Ideen der Freien Volksbildung wieder möglich. „Eine wichtige Aufgabe ist die Mitarbeit am Schaffen einer geistigen Plattform für alle. Wir brauchen wieder freie, selbstverantwortliche, ja überhaupt sich verantwortliche Menschen! Menschen, die bereit sind, ihr Bestes einzusetzen für die allgemeine Sache, Menschen also, die weit genug sehen, um Demokratie mitzuleben und mitzutun“, verkündete Eduard Weitsch 1945, was zeigt, daß ihn die Begeisterung für die Erwachsenenbildung auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht losgelassen hatte. In eine tragende Stellung fand er jedoch nicht wieder zurück.566 Weitsch hatte im Dritten Reich zurückgezogen in Oberhaching-Deisenhofen gelebt und seiner Frau Ilse, die Journalistin war und während des Nationalsozialismus von der Werbeschriftstellerei lebte, zugearbeitet. Paul Steinmetz, sein Kollege aus Dreißigacker, hatte zur selben Zeit mit dem NSRegime kollaboriert und sich an führender Stelle im Reichsarbeitsdienst engagiert. Dies verhinderte nicht, daß er in der niedersächsischen Erwachsenenbildung ab 1948 tragende Rollen übernahm.567 3.5.3 Das Erbe der ‚Neuen Leipziger Richtung‘ in der Frauenbildung ab 1945 Anders als ihr Mann war Ilse Weitsch in der Erwachsenenbildung der Bundesrepublik durchaus gefragt. Ihr Profil „passte“, wie die Kulturwissenschaftlerin Annegret Braun festhält „in das politische Konzept der amerikanischen Besatzer und so machten sie ihr das Angebot, selbst in der Programmgestaltung aktiv zu werden und den Frauenfunk [des Bayerischen Rundfunks] aufzubauen“568. So wurde Ilse Weitsch für den Bayrischen, was Gabriele Strecker für den Hessischen Rundfunk werden sollte.
Kreisrat in einer Erklärung verlauten lassen, daß die Volkshochschule nicht neutral, sondern „liberal-marxistisch“ sei. Wächtler zitiert nach Reimers: Richtung, S. 178. 566 Schoßig, Bernhard: Eduard Weitsch und die Münchner Volkshochschule nach 1945 oder: Mutmaßungen, warum ein „rein preußischer Herr“ nicht Gründungsdirektor der Nachkriegsvolkshochschule in München wurde, in: Ciupke/Jelich: Experimentiersozietas, S. 243–254. 567 Steinmetz arbeitete ab 1948 in der Niedersächsischen Volkshochschule mit und war zentral an der Ausbildung von Lehrkräften beteiligt. Vgl.: Archiv für Erwachsenenbildung, Oldenburg: Informationsblatt zum Nachlaß von Dr. Paul Steinmetz, auf: http://www. ibe.uni-oldenburg.de/archiv/archivbestaende/abstracts/nachlass_steinmetz.pdf, am 30.11. 2013. 568 Braun, Annegret: Frauenfunk und Frauenalltag von 1945 bis 1968. Zeitgeschichte aus der Perspektive von Frauen, in: Behmer, Markus/Hasselbring, Bettina (Hrsg.): Radiotage, Fernsehjahre: Studien zur Rundfunkgeschichte nach 1945, Münster 2006, S. 163–178, hier S. 165.
Albrecht Bähnisch | 359
Eduard Weitsch brachte sich dann und wann ebenfalls mit kleineren Beiträgen, zum Beispiel mit Buchbesprechungen, beim Bayrischen Rundfunk ein.569 Schnittmengen der Arbeit Theanolte Bähnischs und Ilse Weitschs bestanden nicht nur im Engagement beider Frauen für politische Frauenbildung über moderne Medien, sondern auch in der Zusammenarbeit im Deutschen Rat der Europäischen Bewegung. Ob die beiden sich dort über das Thema Frauenbildung austauschten, läßt sich nicht sagen. Daß sie in die BRD transportierten, was in der bürgerlichen Frauenbewegung entstanden und in Dreißigacker und anderen Volkshochschulen der ‚Neuen Richtung‘ weiterentwickelt wurde, ist unstrittig. Aus der Melange, welche die Grundlage für die Erwachsenenpädagogik in der BRD darstellte – nämlich vor allem aus Ansätzen der Freien Volksbildung der Weimarer Republik, der schwedischen Volkshochschulen und aus der britischen Erwachsenenbildung570 – bedienten sich die ‚neuen‘ und ‚alten‘ Erwachsenenbildner sowie andere Protagonisten, die sich ab 1945 in der Bildungsarbeit tummelten, in jeweils unterschiedlicher Gewichtung. Theanolte Bähnisch knüpfte – vielleicht ohne es genau zu wissen, ebenfalls an die (Frauen-)Bildungsarbeit der Thüringischen Volkshochschulen, die in Dreißigacker wichtige Impulse erfuhr, an. „Jeder, ob Mann oder Frau, soll uns gleich willkommen sein; denn es ist die gleiche geistige Not, die uns alle treibt und dasselbe Ziel, das wir alle anstreben, nämlich die Ausbildung der ernsten Persönlichkeit“571 – auf diese Art hatte Elisabeth Stück in den 1920er Jahren für die Volkshochschule Thüringen auch um die Gunst weiblicher Hörer geworben. Stück, eine der ersten Volksbildnerinnen, lehrte in Pößneck und Arnstadt. Sie hatte an die Argumente der bürgerlichen Frauenbewegung angeknüpft und dementsprechend neben den Rechten der Frauen vor allem auch ihre Pflichten gegenüber der Gesellschaft betont. Helene Lange, die Grande Dame der Bürgerlichen Frauenbewegung, hatte jene Pflicht vor allem darin gesehen, daß das weibliche Geschlecht „aus der Welt des Mannes eine Welt schafft, die das Gepräge beider Geschlechter trägt“572. Diesem von Lange definierten Ziel wollten Volkshochschullehrerinnen wie Stück dienen. Dabei ließ Stück auch die in der bürgerlichen Frauenbewegung verbreitete Überzeugung, daß die ‚männliche Kultur‘ von Naturentfremdung, Technisierung und Versachlichung geprägt sei und daß Frauen jenen unerfreulichen Zustand mit „mütterlich-menschlicher“ Wirksamkeit beantworten sollten573, in ihre Arbeit einfließen. 20 Jahre später sollte Theanolte Bähnisch es ihr gleichtun. Auch in Dreißigacker gab es seit 1921 Kurse für Frauen. Die von der Volksbildnerin Ilse Theiß geförderten Inhalte dieser Kurse beschäftigten sich – zu jener Zeit, in
569 Vgl.: Bayrischer Rundfunk, Historisches Archiv (Hrsg.): Findbuch Hörmanuskripte, bearbeitet von Sebastian Lindmeyer, o. O. 2006, passim. 570 Mustergültig vereinten sich jene Ansätze in Fritz Borinskis pädagogischen Schriften. 571 Elisabeth Stück, zitiert nach: Reimers, Bettina Irina: Das Frauenbildungskonzept der Volkshochschule Thüringen in der Weimarer Republik, in: Ciupke/Derichs-Kunstmann: Emanzipation, S. 115–131, hier S. 117. 572 Helene Lange, zitiert nach Reimers: Frauenbildungskonzept, S. 118. 573 Vgl.: Reimers: Frauenbildungskonzept, S. 118.
360 | Theanolte Bähnisch
der Albrecht Bähnisch sich um die Erhaltung der Heimvolkshochschule bemühte – mit Themen wie der Gestaltung des privaten Heims, der Gesunderhaltung der Familie und den Pflichten von Frauen als Gemeindemitglieder und Staatsbürgerinnen574 – allesamt Gegenstände, welche die von Bähnisch herausgegebene Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ ab 1948 ebenfalls prägen sollten.575 Auch das Vorgehen Bähnischs, die Frauen von alltäglichen Problemen ausgehend langsam an Fragen der Politik und Ökonomie heranzuführen576, hatte seine Wurzeln in der ‚Neuen Richtung‘ der Volkshochschularbeit. Jener Bereich, der sich im bereits erwähnten Konzept Fritz Borinskis, der ‚Mitbürgerlichen Bildung‘ niederschlug sei, so Bettina Reimers, den Thüringer Volksbildnern als besonders wichtig erschienen. „Sie gingen davon aus, daß die Vermittlung der Einsichten in ökonomische und politische Zusammenhänge nach dem Ende des Ersten Weltkrieges erforderlich waren, um bei den Menschen […] ein Verständnis für die Rechtsordnung der noch jungen Demokratie und Einsichten in die Zusammenhänge des Wirtschaftslebens zu vermitteln.“577 Kaum anders dachten Erwachsenenbildner wie der 1947 aus dem britischen Exil heimgekehrte Fritz Borinski – den die Erziehungswissenschaftlerin Christine Zeuner klar der ‚Neuen Leipziger Richtung‘ zuordnet578 – nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. 1929 hatte sich die Frauenbildungsarbeit in Thüringen insofern verändert, als im Rahmen zweier Mitarbeitertagungen der Volkshochschule Thüringen gefordert worden war, die „Zusammenarbeit mit Vertreterinnen der Wohlfahrts-, Frauen-, und Lehrerinnenverbände zu intensivieren und die von Gertrud Bäumer angestrebte ‚Gemeinschaft des weiblichen Dienstes an der Volksbildung‘“579 auszubauen. Die Frauen-Kurse sollten sich also nicht nur konzeptionell, sondern auch institutionell an der Frauenbewegung orientieren. Jene Gemeinschaft fand ihren Niederschlag schließlich auch in Bäumers Zeitschrift ‚Die Frau‘. Es ist wohl nicht falsch, davon auszugehen, daß Theanolte Bähnisch vor dem Hintergrund ihres eigenen Interesses an der weiblichen Emanzipation diese Zeitschrift zumindest kannte und – nicht zuletzt, weil ihr Mann Albrecht Bähnisch sich in diesem Kontext engagierte – über die Symbiose zwischen Volkshochschularbeit und Frauenbewegung informiert war. Die stärkere Betonung der Rolle von Frauen in Beruf und Politik in der thüringischen Volkshochschularbeit war nicht zuletzt auf den Generationenwechsel in der Volksbildnerinnen-Arbeit zurückzuführen, den Ilse Theiß und Anette Hemberg, als sie zur Volkshochschule Jena kamen, einleiteten. Theiß und Hemberg hatten die Methode der Formulierung von ‚Notfragen‘ in Dreißigacker kennengelernt und mit nach Jena gebracht. So kam das auf der ‚Elite-Volkshochschule‘ erprobte Instrument in Jena zur Anwendung auf ein breite-
574 575 576 577 578
Vgl.: ebd. Vgl.: Freund: Krieg, passim. Ebd., S. 10. Reimers: Frauenbildungskonzept, S. 121. Vgl.: Zeuner, Christine: Die 'Leipziger Richtung' – Kontext erwachsenenbildnerischer Tätigkeit Fritz Borinskis vor 1933, in: Jelich, Franz-Josef (Hrsg.): Fritz Borinski: zwischen Pädagogik und Politik – ein historisch-kritischer Rückblick, Essen 2000. 579 Vgl.: ebd., S. 123.
Albrecht Bähnisch | 361
res Publikum und fand dort wiederum Interessentinnen und Nachahmerinnen. Dreißigacker war also auch in Sachen Frauenbildungsarbeit eine Maßstäbe setzende Avantgarde gewesen, die bis in die zweite Demokratie hinein wirkte.580
3.6 ZUSAMMENSCHAU DER HANDLUNGSLOGIK DES EHEPAARS IN DER WEIMARER REPUBLIK; AUSBLICK AUF DIE DARAUS RESULTIERENDEN RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT THEANOLTES Aus dem gesellschaftlichen Wirken Albrecht Bähnischs, aus dem Anknüpfen an jene Arbeit durch Theanolte Bähnisch nach 1945, aber auch durch eigene Schwerpunktsetzungen der späteren Regierungspräsidentin, welche sich in den 1920er Jahren erst allmählich abzeichneten, läßt sich ersehen, daß sich das Ehepaar Bähnisch stark für die Verfaßtheit von Staat und Gesellschaft interessierte und daß das Thema auch in der und für die Partnerschaft eine wichtige Rolle spielte. Beide Partner setzten auf ausgleichende Mechanismen, wenn es darum ging, gesellschaftliches Zusammenleben zu regulieren. Theanolte Bähnischs frühe Haltung zur Prostitution ist in dieser Hinsicht allerdings widersprüchlich. Einige Argumente waren auf eine (gesellschaftliche Re-)Integration der betroffenen Mädchen und Frauen ausgerichtet, andere Aussagen zielten explizit darauf ab, bestehende Segregationstendenzen festzuschreiben. Die Zusammenarbeit von Mann und Frau, wie Ilse Langner sie in ihren Werken und Briefen beschrieb und wie sie Theanolte Bähnisch in den 1920er Jahren als wünschenswert ansah581, war dagegen eindeutig auf einen Ausgleich ausgerichtet. Die Arbeit Albrecht Bähnischs für eine Zusammenarbeit von Arbeitern und Bürgerlichen, seine Auslassungen zur Sozialgesetzgebung der Weimarer Republik sowie seine Überzeugung, daß in der überparteilichen und interkonfessionellen Zusammenarbeit aller ‚aufbauenden Kräfte‘582 der Schlüssel zu einer politisch stabilen Gesellschaft
580 In „Zur Sozialisierung des Geistes“ hatte Weitsch selbst seine ersten Ideen hinsichtlich der Frauenbildung festgehalten und sich in diesem Zuge für die Einrichtung einer ‚Hochschule für Frauen‘ ausgesprochen. Zwar schwebten ihm gleiche Lerninhalte für Frauen und Männer vor, doch sollten unterschiedliche Lehrmethoden angewandt werden, wobei der Stoff für die Frauen „weniger philosophisch-gedanklich“ als vielmehr „praktischgefühlsmäßig“ vermittelt werden sollte. Vgl.: Reimers: Richtung, S. 93. Im Frühjahr 1921 hatten Gertrud Hermes, Rose Topf, Eduard Weitsch und Franz Angermann in Dreißigacker den ersten Lehrgang für Frauen gegeben. Hermes hatte den Unterricht in Soziologie und Volkswirtschaft übernommen, Topf bot gymnastische Übungen sowie Gespräche über Anatomie, Körperpflege, Kleidung und Ernährung an. Weitsch unterrichtete Pädagogik und Angermann Literatur und Kulturgeschichte. Vgl: Reimers: Richtung, S. 92/93. Die Leitung des fünften (März bis Juni 1930) und sechsten (April bis Juni 1931) Frauenlehrgangs hatte Ilse Theiß inne. Vgl.: Reimers: Richtung, S. 92, Anm. 80. 581 Vgl.: Bähnisch: Staatsverwaltung. 582 Bähnisch: Aufgabe, S. 123.
362 | Theanolte Bähnisch
stecke, läßt sich in dieser Grundhaltung verorten. Eine kurze Zeit lang lebte Albrecht Bähnisch jene theoretische Überzeugung, als er unter Arbeitern in Friedrichshain wohnte, sogar praktisch. Seine Frau Theanolte bewegte sich unter den Soroptimistinnen – im Gegensatz zur ihrem Vater – offenbar vorurteilslos unter Personen verschiedener politischer und religiöser Überzeugungen. Die gemeinsame Überzeugung dafür, daß die Berufstätigkeit von Frauen gefördert werden müsse und daß darüber hinausgehend gesellschaftliche Reformprozesse von Nöten seien, war für die Soroptimistinnen, in deren Reihen weniger gebildete und wirtschaftlich schlechter situierte Frauen jedoch keinen Platz hatten, eine tragfähige Grundlage zur Zusammenarbeit über Konfessions- und Parteiengrenzen hinweg. Die (soziale) ‚Demokratie‘ wird als Begriff in Albrecht Bähnischs Texten selten bemüht, ist aber doch als Postulat sichtbar im Einsatz des Verwaltungsjuristen für eine gerechtere Verteilung von Gütern in der Gesellschaft mit Hilfe des Weimarer Sozialstaats, in seinem Eintreten für (politische) Bildungsarbeit und schließlich für die Preußische (Polizei-)Verwaltungsreform, die in der Überzeugung ihrer Väter Vorbild und Vorbote einer Reform der Reichsverwaltung sein sollte. Dem Gedanken an eine wie auch immer geartete Revolution stand Albrecht Bähnisch fern. Er war ein Anhänger des gemäßigten Flügels, beziehungsweise der Mehrheits-SPD, also der Sachwalterin des ‚Pakts mit den alten Mächten‘, die im Rahmen der Weimarer Koalition mit den bürgerlichen Parteien zusammenarbeitete und sich um eine langsame, aber stetige Reform von Gesellschaft und Staat bemühte. Auch er schloß, gemeinsam mit seiner Frau und gemäß seinen Überzeugungen, Freundschaften und Bekanntschaften jenseits von Parteigrenzen und Konfessionen und arbeitete doch erkennbar eng vor allem mit Sozialdemokraten zusammen. Wann genau er den Weg in die SPD fand, bleibt unklar583. Anzunehmen ist, daß sein Eintritt in die Partei in den ersten Jahren seiner Tätigkeit im Preußischen Innenministerium – und damit früher als der seiner Frau – erfolgte, von der es heißt, sie sei nach dem Umzug der Familie nach Merseburg eingetreten.584 Wollte man es politiktheoretisch greifen, wäre Albrecht Bähnisch zum ‚revisionistischen Flügel‘ der SPD zu zählen. Dieser Begriff erscheint jedoch überhöht, zum einen vor dem Hintergrund der Tatsache, daß beinahe die gesamte Führungsspitze der (1924 aus USPD und MSPD ‚wiedervereinigten‘) Partei in der Weimarer Republik bereit war, mit anderen demokratischen Parteien konstruktiv zusammenzuarbeiten. Zum anderen meldete mit Albrecht Bähnisch eine neue Generation ihren Willen zur Mitwirkung an den von Albert Südekum, Paul Göhre, Carl Severing und anderen geebneten staatlichen Reformen an. Die Jugendjahre jener ‚neuen‘ Generation lagen im Ersten Weltkrieg, die politischen Bedingungen im Kaiserreich waren für sie nicht sehr prägend gewesen. Da – bei aller nachgewiesenen und nachgesagten Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten – weniger politische Theorie als vielmehr alltagspraktisches Denken den Vorstellungshorizont Albrecht Bähnischs prägte, liegt es näher, ihn als ‚Vernunftsozialdemokraten‘ und/oder als ‚reformistischen Praktiker‘
583 Im Archiv der Sozialen Demokratie in Bonn finden sich keine Mitgliedsdaten. Auskunft AdSD, Sabine Kneip an Nadine Freund, 14.09.2009. 584 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009, Einwurf Hans-Heino Fels.
Albrecht Bähnisch | 363
(Gerhard Ritter) zu bezeichnen. Wie andere bürgerliche Akademiker in der SPD, die Max Bloch als „pragmatische Sozialdemokraten“ beschreibt, war auch Albrecht Bähnisch ein „Exponent einer auf evolutionärem Wege zu erreichenden Transformation von Gesellschaft und Staat“585. Jene pragmatischen, oder, wie ich sie nennen möchte, ‚Vernunftsozialdemokraten‘ machten das ‚Bündnis mit den alten Eliten‘ möglich und standen so nicht nur in ihrem Alltagshandeln, sondern auch institutionell Pate für den angestrebten Brückenschlag zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft, den Albrecht Bähnisch auch auf persönlicher Ebene zu fördern versucht hatte. In alledem schien ihm Theanolte zur Seite gestanden zu haben. Die beschriebenen Kontakte pflegten sie gemeinsam, Theanolte Bähnisch hatte Anteil an den Aktivitäten ihres Mannes und engagierte sich in den 1920er Jahren selbst in jenen Kreisen, in denen ihr Mann sich bewegte. Bei den Soroptimistinnen, in Form von ZeitschriftenArtikeln und in ihrer Arbeit als Verwaltungsrechtsrätin agierte sie in einer Weise frauenpolitisch, die sich mit den Überzeugungen preußischer Verwaltungseliten wie Severing und Abegg deckte, die sie jedoch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Retrospektive nicht als ‚organisiert‘ wahrnahm, beziehungsweise darstellte.586 Auch wenn Theanolte nicht, wie Albrecht Bähnisch, Anteil an der Ausgestaltung der Verwaltungsreform gehabt, sondern in der Exekutive gearbeitet hatte, hatte sie doch, genauso wie ihr Mann, ‚mittendrin‘ gesteckt, hatte zum Teil die gleichen Vorgesetzen und Kollegen gehabt und sich, von den SPD-Partei-Spitzen und von prominenten Politikern der Weimarer Koalitionsparteien geachtet, in denselben Kreisen wie ihr Mann bewegt. Dabei spielte ihr Geschlecht offenbar eine Rolle, die ihr zunächst sogar zu Gute gekommen war. Die SPD war, wie am Beispiel der weiblichen Polizistinnen und der Expertinnen in der sozialen Arbeit deutlich wird, stolz darauf, anhand von erfolgreichen Frauen in ‚ihrer‘ Verwaltung Exempel statuieren zu können. Realpolitisch ging die Partei allerdings bald andere Wege. Mit der Einführung des Gesetzes zum Doppelverdienertum hatte die Berufstätigkeit von Frauen in vielen Fällen und, wenn auch mit Verzögerung, auch für Theanolte Bähnisch bald ein Ende. In diesem Zusammenhang war es eine Schwangerschaft, die dem Konflikt Theanolte Bähnischs zwischen der von der Partei geforderten Loyalität, ihrer angestrebten Karriere und ihrer Selbstdefinition über den Beruf, zumindest ihrer Darstellung nach, ein Ende setzte. Der Umstand, daß sich für Theanolte Bähnisch die Frage, ob sie Mutter und/oder berufstätig sein wollte, nach ihrem Ausscheiden aus dem Staatsdienst zunächst nicht mehr stellte, ersparte ihr Kopfzerbrechen in jenem Punkt und trug vermutlich dazu bei, daß sie sich noch in den 1950er Jahren als erklärte Gegnerin der Berufsarbeit von Müttern zeigte – womöglich nicht zuletzt, um den Verlauf ihres eigenen Lebens in der Retrospektive zu sanktionieren. Daß sie nach 1945 wieder in der SPD ‚heimisch‘ wurde, obwohl sie mitnichten linientreu war, daß sie dabei gleichzeitig bewußt auf überparteiliche Zusammenarbeit setzte, ist – auch karriereökonomisch gedacht – maßgeblich auf die Kontakte und Er-
585 So charakterisiert Bloch Albert Südekum, den preußischen Finanzminister. Vgl.: Bloch, Max: Albert Südekum (1871–1944). Ein deutscher Sozialdemokrat zwischen Kaiserreich und Diktatur. Eine politische Biographie, Düsseldorf 2009. 586 Siehe Kapitel 7.1.4.
364 | Theanolte Bähnisch
fahrungen aus der preußischen Verwaltung in der Weimarer Republik zurückzuführen, auch auf ein Anknüpfen an das gesellschaftspolitische Vermächtnis von Albrecht Bähnisch. Auf ihn, seine Arbeit und seine Kontakte sollte sie sich in der Bundesrepublik häufig berufen. Ein Neubeginn in einer anderen Partei hätte ihr vermutlich keinen vergleichsweise schnellen Aufstieg im ‚neuen‘ Deutschland beschert, auch als Parteilose wäre eine solche Erfolgsgeschichte unwahrscheinlich gewesen. Die Geschichte der frühen Bundesrepublik, so wird an Bähnischs Beispiel deutlich, ist eng verbunden mit der demokratischen Geschichte der Weimarer Republik. Jene, die in den 1920er Jahren ihren Willen zur Reform von Gesellschaft und Staat demonstriert hatten, wurden in den 1940er Jahren – teilweise schon vor Kriegsende – von den Westalliierten ermutigt, an diese Arbeit anzuknüpfen. Daß das sozialdemokratische Netzwerk – das Schnittmengen mit anderen Netzwerken aufwies, aus denen heraus sich Widerstand gegen den Nationalsozialismus generiert hatte – stark war, zeigte sich darin, daß es den Nationalsozialismus überdauerte und personell dezimiert, aber ideell gestärkt aus dem Dritten Reich hervorging. Seine Kernklientel, aber auch seine Aspiranten trommelte es aus allen Winkeln des Landes und aus dem Exil zusammen, um am Wiederaufbau des deutschen Staates und der deutschen Gesellschaft mitzutun. Theanolte Bähnisch kam 1945 aus dem scheinbar ‚richtigen‘ Lager, kannte die ‚richtigen‘ Personen und hatte sich in der Nähe der ‚richtigen‘ Projekte, sei es staatlicher, sei es privater Natur aufgehalten, was natürlich nicht nur, aber doch zu einem ganz wesentlichen Teil Ergebnis ihrer Partnerschaft mit Albrecht Bähnisch war. Eine gewichtige Rolle spielt dabei die Frage, wie das Paar gemeinsam den Nationalsozialismus erlebt hat, denn von jener Zeit sprach und schrieb, beziehungsweise ließ Theanolte Bähnisch ebenso häufig schreiben, wie von der Weimarer Republik. Die Kapitel des am Ende kurzen gemeinsamen Lebens in Merseburg, Berlin und Köln in den Jahren der ausgehenden Weimarer Republik bis 1945 knüpfen inhaltlich an die vorangegangene gemeinsame Zeit, die gemeinsamen Erfahrungen und die gemeinsamen Bekannten an, bilden jedoch aus Theanolte Bähnischs Sicht betrachtet auch eine Einheit für sich, weil in ihrer Darstellung jener Jahre das gemeinsame Aufbegehren des Paares gegen die neuen Machthaber im Vordergrund stand. Politisch gesehen und in Bezug auf die ursprünglichen beruflichen Ambitionen beider Partner, läßt sich, unabhängig von Bähnischs Darstellung, konstatieren, daß das Ehepaar, nachdem beide Partner mehr oder weniger aktiv an der Mitgestaltung von Staat und Gesellschaft beteiligt gewesen waren, auf die Defensive zurückgeworfen wurde. Wie stark jene Defensive jedoch war, ob das Paar tatsächlich offensiv gegen den Nationalsozialismus eintrat und ob – und wenn ja wie – sich die Bähnischs gleichzeitig zumindest doch wenigstens partiell im neuen Regime einrichteten, die Beantwortung dieser Fragen soll Gegenstand des nächsten Kapitels sein. Dabei muß der Umstand, daß Theanolte Bähnisch bisher weitgehend unhinterfragt als ‚Widerstandsaktivistin‘ dargestellt wurde, Beachtung finden und kritisch beleuchtet werden.
4
Familienleben und Trennungen, politischer Umbruch und neue berufliche Wege: Von Merseburg über Berlin nach Köln (1930–1945)
4.1 DER WEGGANG NACH MERSEBURG IN DER AUSGEHENDEN WEIMARER REPUBLIK 4.1.1 Neue Rollen für Albrecht und Theanolte: Ein blutjunger Landrat und eine politisch informierte Ehefrau und Mutter Bevor sich die politische Lage durch den Aufstieg der Nationalsozialisten zuerst in Thüringen, bald auf Reichsebene und schließlich auch in Preußen stark verändern sollte, hielt das ‚sozialdemokratische Bollwerk Preußen‘ für den angesehenen und erfolgreichen Albrecht Bähnisch eine weitere Opportunität bereit. Im Jahr 1930 wurde er, gerade einmal 29jährig, nach Merseburg abgeordnet1, wo er ab dem ersten Februar zunächst kommissarisch als Landrat zu arbeiten begann. Glänzende Zeugnisse und ein guter Ruf, nicht zuletzt was seine politische Einstellung betraf, waren ihm vorausgeeilt. Bähnisch sei „in jeder Beziehung für die Verwendung als Landrat geeignet“, hatte Innenminister Grzesinski dem Ministerpräsidenten Otto Braun und den Staatsministern über seinen Vorschlagskandidaten für das Landratsamt mitgeteilt und, wohl zur Untermauerung seines Vorschlags, hinzugefügt: „Politisch gehört er zur S.P.D.“ 2. Theanolte blieb, als ihr Mann nach Merseburg ging, zunächst weiterhin beim Berliner Polizeipräsidium tätig, das Paar führte in dieser Zeit zwei Haushalte. Doch diese Phase währte nicht lang. In ihrem Diktat von 1972 beschreibt Theanolte Bähnisch, wie ihre Vorgesetzen zwar von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hätten, sie ausnahmsweise trotz ‚Doppelverdienertums‘ im Staatsdienst zu halten, sie aber gleichzeitig gewarnt hätten, daß dies vermutlich nur eine vorübergehende Lösung sein würde. Von einem weiteren Abbaugesetz könne sie durchaus betroffen sein.
1 2
GStA PK I. HA Rep 77, Nr. 5176, Der preußische Minister des Innern an Regierungsrat Bähnisch, 09.01.1930. GStA PK I. HA Rep 77, Nr. 5176, Der Preußische Minister des Innern an den Preußischen Ministerpräsidenten und an alle preußischen Staatsminister, 18.11.1929.
366 | Theanolte Bähnisch
„Ehe und Beruf geht für eine Frau nicht zusammen“3, zitiert Bähnisch ihren Vorgesetzen Mosle, der ihr von der Ehe abgeraten haben soll. Grzesinski soll ihre Heiratspläne gar als „blödsinnig“ bezeichnet haben. „Ich wollte Sie zum ersten weiblichen Landrat, ja zum ersten weiblichen Regierungspräsidenten machen und nun haben Sie mir dieses Experiment verdorben“4, zitiert Bähnisch den Minister in ihrem Diktat. Dieses Zitat auf seine Authentizität zu prüfen, ist schier unmöglich. Aber es ist doch sehr interessant, daß Bähnisch 1972 Grzesinski als Erfinder einer Idee darstellte, die 1946 die niedersächsischen Sozialdemokraten und die britische Militärregierung an sie herantrugen. Folgt man ihrer Darstellung von 1972, so wäre ihr Weg in der Bundesrepublik bereits in der Weimarer Republik vorgezeichnet gewesen. Dies steht in einem gewissen Widerspruch zu den Ausführungen im nächsten Kapitel ihres Diktats. In diesem gibt sie an, daß sie 1946 habe überlegen müssen, ob sie wirklich die Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrätin in Köln aufgeben und eine „kleine Beamtin“5 in Hannover werden solle. Offenbar betreute sie in Köln den Kaufhof sowie andere Unternehmen. (Daß ihr Bruder Otto Nolte später Aufsichtsratsmitglied der Westdeutschen Kaufhof AG wurde6, verleiht ihrer Aussage, sie habe mit ihm 1945 in Köln eine gemeinsame Anwalts-Praxis geführt, zusätzliche Plausibilität.) Zwei nicht gänzlich unvereinbare, aber doch unterschiedliche Erzählmotive stehen sich hier gegenüber: Auf der einen Seite das des vorgezeichneten Weges, den Bähnisch, nachdem sie sich für die Verwaltungslaufbahn entschieden hatte, quasi schicksalhaft gehen mußte und auf der anderen Seite das der opferbereiten und verantwortungsbewußten Frau, die als Selbständige finanziell gesehen viel mehr aus sich hätte machen können, sich jedoch für den Dienst an der Allgemeinheit entschied. 1930 wurde die Juristin jedoch zunächst beruflich aufs ‚Abstellgleis‘ gestellt: Während die Karriereleiter für ihren Mann steil nach oben ging, mußte sie – so stellt sie es in ihrem Diktat dar – erfahren, daß ihre Überzeugung, das Polizeipräsidium könne für Frauen doch kein „Nonnenkloster“7 sein, ein fataler Irrglaube gewesen war. Kurz nachdem sie zum Regierungsrat befördert worden war, schied Theanolte am 20.11.1930, wie sie um 1946 schrieb, „schweren Herzens“ aus ihrem Beruf aus, „weil […] es bei den damaligen wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen nicht tragbar erschien, daß ich als Frau des preußischen Landrats zugleich Regierungsrätin […] sei“8. In ihrer etwa 1946 verfaßten Lebensskizze stellt sie die Situation im Jahr 1930 so dar, als sei sie damals hin- und hergerissen gewesen. Einerseits hatte sie sich die Fortführung ihrer Berufstätigkeit nach der Ehe ihrer Darstellung nach in persönlichen
3 4 5 6 7 8
Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. J. [1972], Teil I, S. 29, Heiratsprobleme. Ebd., S. 30, Das zweite Abbaugesetz. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, S. 1, Anfrage aus Hannover. Art. „Nolte, Otto“, in: Wer ist’s, 1959, Bd. 12, S. 860. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, S. 31, Das zweite Abbaugesetz. AddF, SP-01, Kurze Lebensskizze, o. D. [1946].
Familienleben | 367
Verhandlungen mit dem Innenminister Grzesinski hart erkämpft. Andererseits wird sie sich – das deutet sich in der Äußerung an, es sei „nicht tragbar“ erschienen, sie weiter zu beschäftigen – gegenüber den Zielen und dem Ansehen der SPD um 1930, als die Machtstellung der demokratiebejahenden Koalition in Preußen bereits prekär war in der Pflicht gesehen haben. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit konnte es sich die SPD nicht erlauben, mit Negativ-Schlagzeilen in puncto Doppelverdienertum Aufmerksamkeit zu erregen – und mit solchen wäre angesichts des herausgehobenen Amtes von Albrecht Bähnisch zu rechnen gewesen. Dieser wiederum mußte den ungewöhnlich großen Vertrauensbeweis, den es bedeutete, im Alter von gerade einmal 29 Jahren zum Landrat bestellt zu werden, honorieren. Vor diesem Hintergrund dürfte es das Ehepaar Bähnisch als eine nicht zuletzt existentiell bedingte Notwendigkeit angesehen zu haben, sich hinter die von den Parteifreunden angestrebte ‚Gleichverteilung‘ von Arbeitsplätzen in der Bevölkerung zu stellen und eben keinen ‚NegativBeweis‘ zu liefern. Ob jemals über die Möglichkeit einer Beschäftigung Theanoltes anstelle der von Albrecht gesprochen worden war, läßt sich nicht nachvollziehen. Doch, so lassen sich ihre weiteren Ausführungen deuten: ihre ‚Weiblichkeit‘, die dafür sorgte, daß sie entlassen werden sollte, führte schließlich auch dazu, daß am Ende alles einen tieferen Sinn ergab. Es sei ihr „ungeheuer schwergefallen“, schrieb sie retrospektiv über ihren Weggang aus dem Polizeipräsidium, „aber mir kam der Himmel selbst zur Hilfe. Als ich mein Abschiedsgesuch schrieb, wußte ich, daß ich ein Kind erwartete“9. Die Schwangerschaft schien der Juristin den Abschied aus ihrem Beruf, der sich ihr zunächst als persönliches Opfer für die Politik der Partei ihres Mannes und seiner Karriere dargestellt haben mußte, erleichtert zu haben. Denn eine Berufstätigkeit von Müttern, so wird beim Lesen der von ihr herausgegebenen ‚Stimme der Frau‘ an verschiedenen Stellen deutlich, hielt sie für im Grundsatz kaum denkbar. Daß sie in den folgenden Jahren jedoch zweimal entgegen ihrer Äußerungen in der ‚Stimme der Frau‘handeln sollte, führte sie jeweils auf den Zwang durch andere Umstände zurück.10 Dies untermauert zwar die Logik ihrer zitierten Darstellung, läßt es jedoch gleichzeitig fragwürdig erscheinen, ob sie als Schwangere wirklich zufriedener aus dem Beruf schied – oder ob sie hiermit eher einer angenommenen Erwartung der Leser ihrer Ausführungen entgegenkommen wollte. Auch der Umstand, daß die partnerschaftliche Aufgabenverteilung nun auf ein ‚klassisches‘ Modell hinauslief, dürfte für ihre Argumentation eine Rolle gespielt haben. Auf dem Boden der Überzeugung, sie könne als Mutter ‚naturgemäß‘ nicht arbeiten, dürfte es ihr leichter gefallen sein, die Partnerschaft mit ihrem Mann, in der zuvor die gemeinsame Berufstätigkeit zentral war, anders zu gestalten, als bisher. Der Umzug nach Merseburg und das Ausscheiden Theanoltes aus dem Staatsdienst 1930 bedeutete also zunächst einmal das Ende der offiziellen beruflichen Zusammenarbeit der Ehepartner. Jahre später legte sie – womöglich gerade deshalb – Wert darauf, zu betonen, daß sie sich in der Merseburger Zeit nicht gänzlich auf die Hausfrauen- und Mutterrolle be-
9 AddF, SP-01, Kurze Lebensskizze. 10 Welche je eigene Dynamik der jeweiligen Entscheidung zugrunde lag, soll in den entsprechenden Abschnitten behandelt werden.
368 | Theanolte Bähnisch
schränkt habe, sondern sich „intensiv mit politischen Fragen auseinander“11gesetzt habe. Sie hatte ihre in Berlin lebende Freundin Ilse Langner gebeten, sie mit quasi druckfrischer wissenschaftlicher, beziehungsweise politischer Literatur zu versorgen.12 Da es in Merseburg um die entsprechenden Einkaufmöglichkeiten wohl nicht zum Besten bestellt gewesen zu sein schien, hatte sie sich ‚Die Europäischen Revolutionen und der Charakter der Nation‘ von Eugen Rosenstock-Huessey, das erstmals 1931 erschienen war sowie Eugen Fischer-Balings 1932 veröffentlichtes ‚Volksgericht. Die Deutsche Revolution von 1918 als Erlebnis und Gedanke‘ zu lesen gewünscht. Damit hatte sie Literatur ausgewählt, die die NS-Ideologie sehr kritisch betrachtete. Letzteres Werk wurde 1933 von den Nationalsozia-listen in der Sektion ‚Belehrende Abteilung, Geschichte‘ auf die ‚Schwarze Liste‘ gesetzt und verbrannt, da sich der als ‚Vater der Politologen‘ bekannt gewordene Fischer-Baling deutlich von der Dolchstoß-Legende distanzierte und die Schuld der Deutschen am Ersten Weltkrieg betonte.13 Zunächst einmal sah alles danach aus, als ob den Bähnischs mit der Entscheidung, nach Merseburg zu gehen, trotz der Wirtschaftskrise, mit 6080 RM14 Gehalt, eine finanziell gut abgesicherte und, gemessen an der politischen Bedeutung Berlins, vergleichsweise ruhige Zeit fernab der Großstadt bevorstand. Die Verbindung in ihre Wahlheimat Berlin hielt Theanolte über ihre Familie, die nach dem frühen Tod des Vaters in die Hauptstadt gezogen war, sowie über Ilse Langner und die Soroptimistinnen.15 Ihren Einsatz für die Frauenberufstätigkeit und für weibliche Karrierenetzwerke setzte sie auch nach ihrem Umzug fort. 1933 hatte sie einem Brief an Langner zufolge auf einer Veranstaltung des Akademikerinnen-Bundes in Halle einen Vortrag über das ‚Werkjahr der Abiturientinnen‘ gehalten.16 Der Umstand, daß sie ihrer Freundin nicht nur davon berichtete, sondern ihr sogar das Manuskript zur Lektüre
11 AddF, SP-01, Kurze Lebensskizze. 12 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Theanolte Bähnisch an Ilse Langner, 17.11.1932. 13 Vgl.: O. V.: Wider den undeutschen Geist, Homepage zur Ausstellung der HumboldtUniversität-Berlin „Wider den undeutschen Geist“, auf: http://www.buecherverbrennung 33.de/schwarzelisten_4.html, am 14.10.2013. 14 Als kommissarischer Landrat hatte Bähnisch 5684 RM verdient. LHASA, MER, Rep. C. 48 I a II, Lit B, Nr. 5, Ausgabenanweisung vom 03.07.1930. 15 So hatte sie an der Generalversammlung des Soroptimist-Clubs im März 1932 teilgenommen. DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 11.03.1932. Im Brief ist von der Generalversammlung des „Klubs“ die Rede, womit aller Wahrscheinlichkeit nach der Soroptimist-Club gemeint ist. 16 Ebd., Theanolte Bähnisch an Ilse Langner, 19.02.1933. Im Fragebogen der Militärregierung ist weder diese Rede noch sind andere Reden Bähnischs aufgeführt. Die Anweisung „Geben Sie auf einem Extrabogen […] alle von Ihnen gehaltenen öffentlichen Ansprachen und Vorlesungen […] an, falls keine Reden […] setzen sie das Wort ‚keine‘ ein“, ließ Bähnisch gänzlich unbearbeitet. NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Military Government of Germany, Fragebogen, S. 10. Natürlich läßt sich darüber streiten, ob die beschriebene Versammlung eine öffentliche war, oder nicht.
Familienleben | 369
anbot, zeigt, wie wichtig es ihr war, sich über das Thema auszutauschen. Mit ihrem Vortrag mag sich Theanolte in die Argumentationslinie jener Rednerinnen im Akademikerinnen-Bund eingereiht haben, die, wie Elisabeth Schwarzhaupt17, vor den Plänen der Nationalsozialsten in puncto Frauenbeschäftigung warnten. Denn das ‚freiwillige Werkjahr‘, über das Bähnisch referierte, wurde, wie auch die ‚freiwillige Bauernhilfe‘, von der NSDAP forciert, um die Jugend im (nationalsozialistischen) „Geiste der Heimatliebe und der Verbundenheit mit Volk und Staat zu erziehen“18. Die Freiwilligkeit war jedoch Axel Schildt zufolge, nur als ein Durchgangsstadium für die Einrichtung einer Arbeitsdienstpflicht gedacht.19 Welchen Inhalt Theanoltes Referat tatsächlich gehabt hatte, ob sie dem Werkjahr nicht vielleicht doch positive Seiten abgewinnen konnte, läßt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Immerhin denkbar ist, daß Bähnisch die Position der BDF-Präsidentin Gertrud Bäumer teilte. Diese hatte in ihrer Zeitschrift ‚Die Frau‘ den von den Nationalsozialisten geplanten und schließlich auch eingeführten Reichsarbeitsdienst als die Erfüllung der alten Idee eines Frauendienstjahres, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg von der Frauenbewegung aufgeworfen worden sei gelobt.20 Unter anderem deshalb geriet Bäumer nach 1945 stark in die Kritik.21 Die Idee eines Pflichtdienstjahres für Frauen wurde nach 1945 von Seiten deutscher Erwachsenenpädagogen und der britischen Militärregierung wieder aufgegriffen.22 Es wäre nicht zuletzt, weil Bähnisch ab 1946 in jenen Zusammenhängen wirkte, interessant, zu wissen, wie Bähnisch sich zum Thema 1933 und in den Nachkriegsjahren positioniert hatte.
17 Elisabeth Schwarzhaupt (1901–1986, zunächst Mitglied der DVP, seit 1945 der CDU) arbeitete bis 1933 als ‚beauftragter Richter‘ in Frankfurt a. M. und Dortmund. 1954 setzte sie sich – wobei sie vom Deutschen Frauenring starke Unterstützung erfuhr – gegen das in der Familienrechtsreform vorgesehene Letztentscheidungsrecht des Mannes ein. 1953–1969 war sie Mitglied des Bundestags, außerdem war sie ab 1957 Mitglied des Bundevorstands der CDU. 1961 wurde sie als erste Frau Ministerin in einem Bundeskabinett. Unter Kanzler Adenauer und auch unter Ludwig Erhardt leitete sie bis 1966 das neu eingerichtete Gesundheitsressort. Die Oberkirchenrätin Schwarzhaupt war von 1947 bis 1953 die einzige Frau im Leitungsgremium der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD). 18 Schildt, Axel: Die Weimarer Republik, Bd. III, online bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung, auf: http://192.68.214.70/blz/web/100083/10.html, am 14.10.2013. 19 Vgl.: ebd. Im Mai 1933, nur kurze Zeit nach Theanoltes Vortrag, trat der Gesamtvorstand des Akademikerinnen-Bundes unter dem Eindruck des nationalsozialistischen Machtzuwachses zurück. Nachdem der Bund 1935 dem deutschen Frauenwerk unterstellt worden war, erfolgte seine Auflösung. 1949 wurde er auf Drängen von Agnes von Zahn-Harnack und Marie-Elisabeth Lüders in Hamburg neu gegründet. Den Vorsitz übernahm Emmy Beckmann (1880–1967, DDP, FDP), die 1946 auch an der Gründung des Hamburger Frauenringes beteiligt war. 20 Gertrud Bäumer sinngemäß zitiert nach Tscharntke: Re-educating, S. 156. 21 Vgl.: ebd. 22 Vgl.: ebd.
370 | Theanolte Bähnisch
Wie Theanoltes Alltag in Merseburg jenseits der Kindererziehung und der Haushaltsführung aussah ist unklar.23 An der Tagesordnung waren vermutlich Besuche, die sie mit ihrem Mann bei dessen Parteikollegen in anderen Landkreisen des Regierungsbezirks machte.24 Über Ausflüge in die landschaftlich durchaus reizvolle, von Schlössern, Burgen und der Saale geprägte Umgebung der 30.000 Einwohner zählenden Dom-Stadt Merseburg ist in Briefen oder sonstigen Aufzeichnungen Theanoltes nichts vermerkt, auch die überlieferten Photo-Alben der Familie25 verraten hierüber wenig. Vielmehr wird aus Theanoltes Briefen deutlich, daß sie sich zwischenzeitlich zur Erholung in Schlangenbad am Rhein, in Tirol und in Oberhof aufgehalten hatte. Von ihrem neuen Wohnort und seinem Umland distanzierte sie sich vor allem emotional. Am deutlichsten drückte sich dies wohl darin aus, daß sie ihre Tochter Orla-Maria 1931 und ihren Sohn Albert 1933 jeweils in Berlin zur Welt brachte, weil sie „nicht wollte, daß die Kinder Sachsen als Geburtsland hatten“.26 Daß sie kein großes Interesse daran gehabt zu haben schien, in Merseburg heimisch zu werden, mag auch damit zu tun gehabt haben, daß sie aufgrund der fehlenden beruflichen Auseinandersetzung mit den Verhältnissen vor Ort um eine Möglichkeit verlegen war, sich mit der neuen Wohngegend und ihren Einwohnern zu identifizieren. Sollte Severing tatsächlich die Idee gehabt haben, sie zum ‚ersten weiblichen Regierungspräsidenten‘ zu machen, so liegt es zudem nah, daß sie Merseburg – eine solche Karriere auch für ihren Mann als wahrscheinlich annehmend – als eine berufliche Durchgangsstation, als Zwischenstufe zu einer neuen beruflichen Herausforderung begriff und deshalb keine Notwendigkeit sah, sich dort zu verwurzeln. Wie schnell das Ehepaar Merseburg tatsächlich wieder verlassen würde, war 1930 allerdings noch nicht abzusehen.
23 Einer Postkarte Theanolte Bähnischs an Ilse Langner ist zu entnehmen, daß sich erstere im Oktober 1932 im Kurbad Schlangenbad im Rheingau-Taunus-Kreis aufgehalten hatte. DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 25.10.1932. Vielleicht hatte Bähnisch dort einen Kuraufenthalt genossen und/oder ihre im Taunus lebende Schwester besucht. Im März 1932 schrieb sie aus Steinach in Tirol, wo sie sich scheinbar ohne ihren Mann aufhielt, an ihre Freundin Ilse. Vgl.: DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 11.03.1932. Im Januar des Jahres hatte sich Bähnisch gemeinsam mit ihrem Mann in Oberhof aufgehalten. Vgl.: ebd., Theanolte Bähnisch an Ilse Langner, 19.02.1933. 24 Der Inhalt eines Briefs an Ilse Langner läßt darauf schließen, daß sie diese Personen kennengelernt hatte. DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 19.02.1933. 25 Beim Gespräch mit Orla-Maria Fels am 11.11.2009 in Waiblingen konnte ich in einigen Büchern und Kisten mit Photos blättern. 26 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Lebenslauf Theanolte Bähnischs, o. D. [1946]. In einem Zeitungsartikel entschärft sie diese Aussage jed, dort heißt es, sie habe gewollt, daß die Kinder Berliner würden. Vgl.: Bähnisch: Heimkehrerin.
Familienleben | 371
4.1.2 „[E]in politisch schwieriger Bezirk“ – Aufstieg und Fall Albrecht Bähnischs Als wesentliche Inhalte von Albrecht Bähnischs Arbeit im Landratsamt sind zunächst die üblicherweise mit dem Amt verbundenen Aufgaben zu nennen. Der Landrat fungierte als Organ der Staatsverwaltung für die Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung, daneben oblag ihm die Leitung des Kreistags und des Kreisausschusses. Er hatte zudem den Landkreis nach außen zu vertreten, denn der Landrat war und ist traditionell nicht nur die auf der Hierarchieebene unterste Behörde der Staatsverwaltung, sondern auch der höchste Beamte eines Landkreises. Schließlich oblag ihm die Leitung der Landespolizei auf Kreisebene. Der Landkreis Merseburg, für den Albrecht Bähnisch die genannten Aufgaben wahrnehmen sollte, zählte zur Zeit seines Amtsantritts etwa 90.000 Einwohner. Die Stadt Merseburg selbst war 1921 aus dem Landkreis ausgeschieden und bildete seither einen eigenen Stadtkreis. Die Inhalte, welche die Amtszeit des neuen Landrats individuell prägten, können nur punktuell nachvollzogen werden. Der Bestand Rep. C 50 [Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung des Kreises Merseburg] enthält für den relevanten Zeitraum keine einzige Akte, was laut Auskunft des Thüringischen Staatsarchivs auf Feuerschäden und Verluste in der Kriegs- und Nachkriegszeit zurückzuführen ist. Als Quellen über Bähnischs Tätigkeit dienen Zeitungsberichte, daneben sind einige verstreute Briefe des Landrats an den Regierungspräsidenten des Bezirks Merseburg überliefert. Einem Bericht Bähnischs an diesen Vorgesetzten folgend, waren für seine Dienstzeit insbesondere der Ausbau von Straßen sowie der Umbau von Schulen im Kreisgebiet geplant gewesen.27 Damit handelte es sich allerdings um Pläne, die zu jener Zeit preußen- und reichsweit insbesondere von der SPD vorangetrieben wurden. Im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Landrat hatte Bähnisch diverse Ämter inne: Er war Mitglied des Aufsichtsrates der ‚Rentengesellschaft Merseburg‘, der ‚Gasfernversorgung Saale GmbH‘ in Halle an der Saale, der ‚GWH für Werksangehörige des Ammoniakwerkes Merseburg‘ in Leuna, der ‚Merseburger Überlandbahnen AG in Ammenford‘ und der ‚Landkraftwerke Leipzig AG‘ in Kulkwitz. Daneben war er als Geschäftsführer und Vorsitzender des Aufsichtsrates der vom Kreiskommunalverband gegründeten ‚Siedlungsgesellschaft Landkreis Merseburg‘ tätig.28 Zur Ausstattung des Landrats gehörten eine von Theanolte später als „übergroß“ beschriebene Dienstwohnung und ein Dienstwagen, der Bähnisch seinem Schwiegersohn zufolge den Titel ‚rasender Landrat‘ einbrachte.29 Ihre Haushälterin hatte das
27 GStA PK I. HA Rep. 77, Nr. 5176, Landrat Bähnisch an den Regierungspräsidenten, 03.06.1930, Anlage: Nebenämter und Nebenbeschäftigung des Landrats Bähnisch in Merseburg. 28 GStA PK I. HA Rep 77, Nr. 5176, Abschrift: Nebenämter und Nebenbeschäftigung des Landrats Bähnisch in Merseburg, verfaßt von A. Bähnisch, 10.07.1930, Anlage zu: Der Regierungspräsident Merseburg, 16.07.1930 an den Preußischen Minister des Innern. 29 Ein Bild des im Vergleich zu seinem Fahrer riesig erscheinenden Wagens ist im Porträt, das Hans Heino Fels über Albrecht Bähnisch verfaßte, abgebildet: Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch, Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von OrlaMaria Fels, Waiblingen], o. O., o. J., Bilderserie o. S., eingefügt zwischen S. 5 und S. 6.
372 | Theanolte Bähnisch
Paar aus Berlin mit nach Merseburg gebracht. Sie dürfte dort, vor dem Hintergrund der mit dem Amt verbundenen Repräsentationsaufgaben, noch dringender als in Berlin benötigt worden sein. Ein Zuarbeiter im Büro war Albrecht, anders als seinem Vorgänger, zunächst nicht zugeteilt worden. Aber mit Hinweis auf die Menge der anfallenden Arbeit gelang es dem Landrat schließlich doch noch, trotz der verhängten Sparmaßnahmen, beim Preußischen Ministerium des Innern einen Assessor als Hilfsarbeiter für sich durchzusetzen.30 Die SPD muß zu jener Zeit große Hoffnungen in den jungen Verwaltungsfachmann gesetzt haben, denn der Landkreis Merseburg galt als politisch schwieriger Bezirk, der sich in den Augen der Sozialdemokraten aufgrund seines hohen Wähleranteils an Industriearbeitern stets in der Gefahr stand‚ den Kommunisten in die Hände zu fallen.31 Mit sieben Sitzen verfügte die Kommunistische Partei im Kreistag bei Bähnischs Amtsantritt tatsächlich über nur einen Sitz weniger als die SPD32. Bernhard Koenen, den die KPD wiederholt als ihren Landtagskandidaten aufgestellt hatte, war als Mitglied im KPD-Parteivorstand, in der Partei-Bezirksleitung Merseburg, als Abgeordneter im Sächsischen Provinziallandtag sowie hauptberuflich als Redakteur des ‚Klassenkampf‘ politisch durchaus erfolgreich.33 Albrecht Bähnisch war offensichtlich nicht zuletzt aufgrund seiner Erfahrungen mit dem Landkreis Halle, der ebenfalls stark von der Industrie und einem entsprechenden Wählerpotential geprägt war, als prädestiniert dafür angesehen worden, die Herausforderung in Merseburg anzunehmen. „Seine Berufung erfolgte im Hinblick auf die besondere Wichtigkeit dieses Kreises, in dem bekanntlich das Leunawerk liegt“ 34, schrieben die ‚Leipziger Neuesten Nachrichten‘ am 04.12.1929 über den neuen Landrat. Der Chemie-Konzern ‚Leuna‘, ein Unternehmen der IG-Farben, war damals der bedeutendste Arbeitgeber in der Region und stellte zunächst Ammoniak, später Hybrid-Benzin her.
30 GStA PK I. HA Rep 77, Nr. 5176, Landrat Bähnisch an den Regierungspräsidenten von Merseburg, 03.06.1930. Über den Antrag Bähnischs wird positiv entschieden, ihm wird Regierungsassessor Nethe zur Unterstützung überwiesen. Ebd. 31 1921 hatte die KPD zehn von 28 Sitzen im Kreistag inne, drei entfielen auf die USPD und nur zwei auf die MSPD. LHASA, MER, Rep. C 40 I b, Regierungsvizepräsident Corneel an den Preußischen Minister des Innern, 18.06.1921. 32 LHASA, MER, Rep. C 40 I b, Kreistagsprotokoll als Anhang eines Schreibens des kommissarischen Landrats von Merseburg an den Regierungspräsidenten des Bezirks Merseburg, 03.06.1930. Jeweils drei Sitze entfielen demnach auf die DVP und die „Mittelstandspartei der wirtschaftlichen Vereinigung“ (gemeint ist vermutlich die ‚Reichspartei des deutschen Mittelstandes‘), einer auf die DDP. 33 In der DDR, wo Koenen nach seiner Rückkehr aus dem sowjetischen Exil wieder politisch erfolgreich war, wurde nach dem 1964 verstorbenen, der 1933 beim ‚Eisleber Blutsonntag‘ ein Auge verloren hatte, ein Bergwerksschacht benannt sowie ein Denkmal in der Nähe von Eisleben für ihn errichtet. Ab 1929 war Koenen für die Versöhnung mit der SPD eingetreten und in diesem Zuge durch Ernst Thälmann von einigen seiner Funktionen in der Partei entbunden worden. 34 Leipziger Neueste Nachrichten, Nr. 283, 04.12.1929, o. T. überliefert in: LHASA, MER, Rep. C 40 I b.
Familienleben | 373
Die von der preußischen Regierung als Horte der Reaktion wahrgenommenen selbständigen Gutsbezirke im Kreisgebiet waren bereits vor Bähnischs Amtsantritt im Zuge der Gebietsreform aufgelöst und den jeweils benachbarten Landgemeinden zugeteilt worden. Die so ihrer Machtstellung beraubten ‚ostelbischen Junker‘, welche sich selbst mit diesem Begriff charakterisierten, fanden ihre Interessen während der Weimarer Republik in der DNVP und im Landbund vertreten. Beide Zusammenschlüsse standen für eine revisionistisch orientierte Politik. Sie traten für nationale, monarchische und meist auch antisemitische Ziele ein. Als Albrecht Bähnisch nach Merseburg kam, führten die DNVP und der Landbund, was in Sachsen nicht unüblich war, eine gemeinsame Liste und waren mit fünf von insgesamt 28 Sitzen im Kreistag des Landkreises Merseburg vertreten. Damit konnten die Großagrarier über den Kreistag einen nicht unbeträchtlichen Einfluß ausüben. Mit zusätzlich jeweils drei Abgeordneten der DVP und der am rechten Rand des bürgerlichen Lagers angesiedelten ‚Reichspartei des deutschen Mittelstandes‘35 sowie einem Abgeordneten der DDP waren die anderen politischen Kräfte im Jahr 1930 im Kreistag des Landkreises Merseburg präsent. Die NSDAP hatte zu dieser Zeit erst einen Abgeordneten vorzuweisen.36 Der neue Landrat schien die von Seiten der SPD in ihn gesetzten Erwartungen voll erfüllt und seine Sache zunächst auch in der Wahrnehmung der anderen Parteien gut gemacht zu haben. Berichte in der lokalen Presse deuten darauf hin, daß er divergierende Meinungen sachlich und konstruktiv zu einen vermochte, weshalb die Kreistags-Sitzungen – glaubt man dem linksdemokratischen ‚Merseburger Korrespondenten‘ – unter seinem Vorsitz geradezu harmonisch abliefen: „Mit Hangen und Bangen hat man dem gestrigen Kreistag entgegengesehen“, hieß es dort in der Ausgabe vom 15.03.1930. „Das letztemal waren scharf die Gegensätze aufeinandergeprallt, eine kräftige Linke hatte sich aus Sozialdemokraten und Kommunisten gebildet, die auf die bürgerliche Minderheit einen starken Druck ausübte. So hatten sich auch die Vertreter der äußeren Rechten bis zu den Demokraten einschließlich zusammengefunden zu einer starken Abwehrfront.“ Aber dann, vor verhärteten Fronten, ein Licht am Ende des Horizonts, ‚Auftritt Bähnisch‘ – so in etwa läßt sich die Dramaturgie des Artikels interpretieren, denn, so erfährt man weiter: „gestern stand der Kreistag unter neuer Leitung! Man muß es dem komm.[issarischen] Landrat, dem Regierungsrat Bähnisch lassen, daß er es glänzend verstand, sich bei seinen Abgeordneten einzuführen. Mit diplomatischer Gewandtheit verstand er es, die Verhandlungen zu leiten und zu einem baldigen Abschluß zu bringen. Dem kam zu Gute, daß sich die Gegensätze im Kreistag […] erheblich gemildert haben. […] So kam es, daß auf beiden Seiten kleine Minderheiten absplitterten, eine breite Mitte aber sich zusammenfand zu fachlicher Arbeit. Möge das immer so bleiben“37, schließt der unbekannte Verfasser des Artikels.
35 Die Partei löste sich 1933 auf, viele führende Mitglieder traten der NSDAP bei. 36 LHASA, MER, Rep. C 40 I b, Kreistagsprotokoll, Anlage zum Schreiben von Albrecht Bähnischs an den Regierungspräsidenten von Merseburg, 03.06.1930. 37 O. V. [„Rsch“]: Rückblick auf den gestrigen Kreistag, in: Merseburger Korrespondent, Nr. 63, 15.03.1930.
374 | Theanolte Bähnisch
Allein, es kam bald anders: Am 10.05.1930 hatte der ‚Volksbote Zeitz‘ noch anläßlich der Frage, ob Bähnischs kommissarisches Amt in ein stetiges überführt werden würde,38 zu vermelden gewußt, daß der Anwärter im Rahmen seiner bisherigen Tätigkeit „durch seine erfolgreiche sachliche Arbeit sein umfassendes Wissen und seine geschickte Verhandlungsführung sich große Sympathien im Kreistage und in allen Schichten der Bevölkerung erworben“39 habe. Zunächst sollte der ‚Volksbote‘ Recht behalten: Denn 14 Abgeordnete im Kreistag stimmten für Bähnisch, sieben für den einzigen weiteren Kandidaten Koenen. Weitere sieben, darunter vermutlich die Abgeordneten der DNVP und der Abgeordnete der NSDAP, enthielten sich.40 Doch schon ein gutes halbes Jahr später, im Januar 1931, hatte sich die politische Stimmung im Kreistag aufgeheizt. Der Unmut der politischen Gegner der SPD und damit bald auch des neuen Landrats, begann sich in scharfen Diskussionen um das vor kurzer Zeit neu gebaute Merseburger Kreishaus und die darin liegende LandratsWohnung zu entladen. Kaum im Amt, wurde Albrecht Bähnisch, der seit 1930 in der Wohnung lebte, wiederholt mit Vorwürfen gegen seinen Amtsvorgänger, Dr. Wilhelm Guske41, der ebenfalls Sozialdemokrat war, konfrontiert. Guskes Gegner wollten im Kreistag darüber diskutieren, ob Guske beim Bau des Kreishauses, welches er nach seiner Fertigstellung selbst bewohnt hatte, Steuergelder veruntreut habe. Eine im GStA PK überlieferte Akte gibt auf ganzen 145 Seiten Auskunft über diese Auseinandersetzungen.42 Doch blättert man in dem Konvolut, so erscheint unklar, um was damals wirklich gestritten wurde: um die scheinbar zu große Anzahl der Badezimmer in der „luxuriösen Dienstwohnung des früheren […] Landrates“43, den angeblich geplanten Tennisplatz auf dem Anwesen und die Kosten für die Realisation des Gesamtbaus, welche die im Kostenvoranschlag festgesetzte Summe tatsächlich deutlich überstiegen hatte – oder aber um die Macht der Sozialdemokratie im Staat Preußen an sich. Ganz im Stil des nicht selten gegen Parteimitglieder der SPD erhobenen Vorwurfs ‚Wasser predigen und Wein trinken‘, war am 17.02.1931 ein Artikel
38 Dies geschah am 25.06.1930. 39 O. V.: Kreistag am 3. Juni. Präsentation des Landtags, in: Vossische Zeitung, Nr. 109, 10.05.1930. 40 LHASA, MER, Rep. C 40 I b, Kreistagsprotokoll vom 03.06.1930. 41 Guske (1880–1957) war seit 1922 Landrat des Kreises Merseburg gewesen. Im Amt studierte er und wurde zum Dr. jur. promoviert. 1930 wurde er Vizepräsident der Rheinprovinz in Koblenz, dort auch Vorsitzender der ‚Eisernen Front‘. Am 07.03.1933 wurde er seines Amtes enthoben. Nach einer Verurteilung wegen Veruntreuungwar er erwerbslos, bis er 1938 eine Anstellung als Syndikus in einer Berliner Firma fand. Nach einem Zwischenspiel als Landrat von Bernau 1945 und danach Oberbürgermeister von Koblenz wurde er 1946 Ministerialrat im Hessischen Ministerium für politische Befreiung. Er trat 1948 in den Ruhestand. Vgl.: Art. „Guske, Wilhelm/1880–1957“, in: Rheinland-Pfälzische Personendatenbank, auf: http://www.rlb.de/cgi-bin/wwwalleg/srchrnam.pl?db=rnam&recnums =0000748, am 24.10.2013. 42 GStA PK I. HA Rep. 77, Nr. 5176. 43 O. V.: Der Wintergarten des ‚Arbeiterführers‘, in: Berliner-Börsen-Zeitung, Nr. 79, 17.02.1931.
Familienleben | 375
der Berliner-Börsen-Zeitung mit dem Titel ‚Der Wintergarten des ‚Arbeiterführers‘‘ erschienen. Diesem konnte die interessierte Leserschaft entnehmen, daß die Dienstwohnung des sozialdemokratischen Landrats ganze 235.000 Mark, ihre Innenausstattung allein 27.900 Mark gekostet habe und der Bau des Kreishauses mit insgesamt 1.259.000 RM um 315.000 RM teurer gewesen sei, als geplant.44 Albrecht Bähnisch merkte, nachdem er mit den Vorwürfen gegen Guske und die SPD konfrontiert worden war, gegenüber seinem Vorgesetzten, dem Regierungspräsidenten von Harnack, an, daß die Abgeordneten doch wohl früher schon hätten sehen müssen, daß der Bau „unwirtschaftlich“ geplant gewesen sei und wie viele Bäder und Toiletten vorgesehen waren. Als habe er die Auseinandersetzungen der Folgezeit schon vor Augen gehabt, als habe er bereits geahnt, daß es am Ende des Streits längst nicht mehr um einen konstruktiven Umgang mit der großen Belastung der Kreiskasse, sondern um eine Verunglimpfung der Sozialdemokratie an sich gehen würde, fügte er seinem Schreiben an Ernst von Harnack hinzu: „Die Presse namentlich die rechts und links radikale Presse wird sich natürlich die Gelegenheit zu einem politischen Vorstoß nicht entgehen lassen.“45 Daß Bähnisch mit seinem Amtsvorgänger zumindest im Jahr 1930 in Kontakt stand, ist einem Schreiben des Kreisdeputierten Karl Niele an Albrecht Bähnisch zu entnehmen. Demnach schien am 20. Mai ein Treffen zwischen Bähnisch und Guske stattgefunden zu haben.46 Vermutlich stand die Verabredung in Verbindung mit der 1927 begonnenen Errichtung der Siedlung Dürrenberg, welche Guske während seiner Amtszeit maßgeblich vorangetrieben hatte. Die baulich47 und architektonisch für ihre Zeit äußerst fortschrittliche ‚Gartenstadt Bad Dürrenberg‘ hatte, in unmittelbarer Nähe zur Leuna-Fabrik sowie an der Bahnstrecke zwischen Weissenfels und Leipzig gelegen, Beschäftigten des Leuna-Werkes und anderen Firmen zur Ansiedlung dienen sollen. Dafür waren insgesamt 500 Wohneinheiten errichtet worden. Auch in diesem Zusammenhang war Guske von politischen Gegnern Verschwendung von Geldern vorgeworfen worden. 1936 wurde Guske dafür gerichtlich verurteilt. Die prominente Schützenhilfe des aus London angereisten Zeugen Dr. Walter Gropius, der ebenfalls in das Projekt eingebunden war, hatte Guske, der sich ab 1933 bereits einmal in
44 Vgl.: ebd. 45 GStA PK I. HA Rep. 77, Nr. 5176, Landrat Bähnisch an den Regierungspräsidenten des Bezirks Merseburg, 17.02.1931. Ernst von Harnack machte indessen die Bauauflagen verantwortlich für die Misere: Man habe fünf Meter weit weg von der historischen Stadtmauer bauen müssen. Zudem seien die Pläne in einer finanziell günstigen Lage des Kreises gemacht worden, die vielen Toiletten, die sich auf vier Geschosse verteilten, seien teilweise für Dienstpersonal gedacht gewesen. 46 LHASA, MER, Rep. C 50, Nr. 30, Karl Niele an Albrecht Bähnisch, 16.05.1930. Dem Schreiben zufolge konnte Niele nicht am Treffen teilnehmen. Bähnisch berichtete Niele am 21.05.1930 schriftlich von dem Treffen mit Guske. Ebd., Albrecht Bähnisch an Karl Niele, 21.05.1930. 47 Die Siedlung war mit Fernwärme und einer zentralen Warmwasserversorgung ausgestattet. Der übliche Aufwand für den Transport von Brennmaterial, Beheizung und Reinigung der Öfen entfiel damit für die Bewohner.
376 | Theanolte Bähnisch
‚Schutzhaft‘ und einmal in Untersuchungshaft befunden hatte, nicht helfen können. Nicht unwahrscheinlich ist, daß auch in diesem Fall weniger finanzielle als vielmehr politische Gründe für die Verhaftung Guskes entscheidend gewesen waren. Weniger die Höhe der Ausgaben an sich, sondern vielmehr der Umstand, daß Guske über die Siedlungsgesellschaft gemeinsam mit dem russisch-jüdischen Architekten Alexander Klein sowie dem ebenfalls jüdischen Bauunternehmer Adolf Sommerfeld48 ein ‚Bauhaus‘-Projekt hatte umsetzen lassen, schien den rechten Parteien ein Dorn im Auge gewesen zu sein. Erst 1931, also unter der Aufsicht Bähnischs als Geschäftsführer der Siedlungsgesellschaft, wurde das Projekt schließlich vollendet. Deshalb erschwerten auch die in diesem Zusammenhang gegen Guske erhobenen Vorwürfe dem Amtsnachfolger und Parteikollegen die Amtsführung. Dabei war die Region Merseburg durch das Siedlungsprojekt in Bad Dürrenberg und ein ähnliches Projekt in Merseburg zu einem angesehenen Vorreiter industriellen Bauens avanciert.49 Wie sehr sich Albrecht Bähnisch mit dem Projekt identifizierte, ist nicht klar. Daß Theanolte Bähnisch nach 1945 für das rationelle Bauen Partei ergriff, kann als Indiz, jedoch nicht als Beweis für eine ähnliche Neigung Albrecht Bähnischs angesehen werden. Nicht unwahrscheinlich ist allerdings, daß persönliche Kontakte zwischen der Familie Adolf Sommerfeld, dem Inhaber der später zwangsarisierten AHAG Sommerfeld, und der Familie Bähnisch bestanden. Wie die Sommerfelds pflegten auch die Bähnischs ihre Skiurlaube über Weihnachten im schweizerischen Arosa zu verleben.50 Dort hatten sich, der Ingenieurin und Sommerfeld-Expertin Celina Kress zufolge, „in den vergangenen Jahren regelmäßig um diese Zeit Angehörige des sozialdemokratischen Berliner Kulturbürgertums und Vertreter der Moderne in Deutschland getroffen“51. Ihren letzten Weihnachtsurlaub hatte die Familie Sommerfeld Kress zufolge 1932 in Arosa verbracht. Landrat Bähnisch, Regierungspräsident von Harnack und Innenminister Severing hielten die Einleitung eines Dienststrafverfahrens gegen Guske, wie es einige Abgeordnete des Merseburger Landkreistages, darunter ein Vertreter der NSDAP, einer der Volkspartei sowie mehrere der DNVP, bereits im September 1932 beantragt hatten, nicht für angemessen. Der Antrag der Abgeordneten von Trotha, Förster, Crewell, Degen, Busch, von Richter und Lüddecke wurde abgelehnt, ebenso wie der Antrag auf die Einleitung eines Strafantrags gegen Guske, den die kommunistische
48 Sommerfeld emigrierte im Anschluß an immer schärfer werdende Drohungen von Nationalsozialisten 1933 nach Palästina. An der von ihm seit 1932 maßgeblich vorangetriebenen Siedlung in Kleinmachnow wurde durch die inzwischen arisierte Firma bis 1938 weitergebaut. 49 Vgl.: Kress: Bauhaus, S. 125. 50 Dies geht aus Photos mit Bildunterschriften im Privatnachlaß von Albrecht und Theanolte Bähnisch hervor. Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch, Unveröffentlichtes Manuskript o. D. im Privatbesitz von Orla und Hans-Heino Fels, Waiblingen, Bilderserie, eingefügt zwischen S. 13/14. 51 Vgl.: Kress: Bauhaus, S. 147. Kress verweist auf einen Tagebucheintrag von Ilse Gropius. Vgl.: ebd., S. 147, Anm. 518.
Familienleben | 377
Fraktion gestellt hatte.52 Dieser Umstand vergrößerte vielleicht die Skepsis, welche die entsprechenden Abgeordneten gegenüber dem neuen SPD-Landrat Bähnisch im Zuge der erhitzten Diskussionen etabliert hatten. In den rechten Reihen des Kreistags wuchs in der Folgezeit jedenfalls die Kritik am neuen Landrat. Meist basierte der Unmut auf tagespolitisch eher unbedeutenden Sachverhalten oder auf einem jeweils recht umständlich herbei interpretierten Fehlverhalten Bähnischs. Haupt-Drahtzieher einer größer angelegten, regelrechten Verleumdungskampagne gegen Bähnisch war der Abgeordnete des Kreistags und Rittergutsbesitzer von Schkopau, Thilo von Trotha (DNVP). Er warf dem Landrat vor, sich in Personal- und Finanzierungsfragen parteiisch verhalten, Steuergelder zu seinen Gunsten eingesetzt und die Rufe der Rechten nach Sparmaßnahmen, insbesondere den Personalabbau betreffend, ignoriert zu haben. Zudem ließe sich Bähnisch mit Hilfe der Bildung ‚unlauterer Mehrheiten‘ im Kreistag Geld für seine Zwecke bewilligen, argumentierte von Trotha, und schließlich habe der Landrat ihn auch noch persönlich beleidigt. Anhand einer insgesamt 18seitigen, von Trotha initiierten Beschwerde mußte sich, nachdem Regierungspräsident von Harnack bereits aus dem Amt entlassen worden war, der von den Nationalsozialisten als Vertrauensmann eingesetzte neue Regierungspräsident Merseburgs, Robert Sommer53 (DVP) mit den Anschuldigungen gegen Bähnisch auseinandersetzten. Sommer stellte fest, daß von Trothas Vorwürfe gegen den Landrat weitgehend unbegründet seien. Er kam zu dem Schluß, daß Bähnisch gute Arbeit leiste, ihm ein Handeln aus parteipolitischer Abhängigkeit nicht nachgewiesen werden könne und daß er für den Landkreis nicht entbehrlich sei. Von einer Abberufung des politischen Beamtenempfahl er dem Oberpräsidenten abzusehen: „Ich möchte […] betonen, daß Landrat Bähnisch an diesen schwierigen Verhältnissen des Kreises Merseburg keine Schuld hat, er hat sie vielmehr von seinem Amtsvorgänger Guske […] übernommen. Die Bereinigung dieser Dinge stellt an die Nerven- und Arbeitskraft des Landrats die denkbar schwersten Anforderungen. Ich habe den Eindruck […] daß der Landrat […] mit Erfolg […] tätig ist, so daß eine Abberufung gerade im gegenwärtigen Augenblick für den Kreis nur schädliche Wirkung haben könnte. […] Die […] Reibungen zwischen dem Landrat und seinen […] Gegnern […] können […] nicht als so stark angesehen werden, [als] daß […] dadurch die ordnungsgemäße Verwaltung des Kreises in Frage gestellt wäre.“54
52 Vgl.: GStA PK I. HA Rep. 77, Nr. 5176. 53 Dr. Robert Sommer (1883–1956) war vom 26.07.1932 bis in den September 1943 Regierungspräsident von Merseburg. Er hatte Rechtswissenschaften und Volkswirtschaft in Freiburg/Breisgau, Berlin und Halle studiert. Im Ersten Weltkrieg war er Offizier an der Westfront gewesen. Er gehörte zunächst der DVP an und trat am 01.05.1933 der NSDAP bei. Nach einer kurzen Zwischenzeit als Bürgermeister von Merseburg nach Kriegsende, war er ab dem 01.08.1945 Leiter der Abteilung Finanzen der Provinzialverwaltung der Provinz Sachsen, bis er im Juni 1946 pensioniert wurde. Vgl.: Art. „Sommer, Robert“, in: Das deutsche Führerlexikon 1935/1935; Art.: „Sommer, Friedr. Ludw. Robert“, in: Wer ist’s? Unsere Zeitgenossen, 10. Ausg., Berlin 1935. 54 GStA PK I. HA Rep. 77 Nr. 5176, Robert Sommer an den Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, Friedrich von Velsen, Zweitausfertigung für den Minister des Innern, 05.01.1933.
378 | Theanolte Bähnisch
Diese Fürsprache Sommers vom 05.01.1933 sollte jedoch nicht Bähnischs politische Rettung bedeuten. Denn das mittlerweile von Nationalsozialisten durchsetzte und unter der Leitung Hermann Görings stehende Preußische Innenministerium arbeitete gegen den einstigen Zögling der Behörde. Albrecht Bähnisch stand schließlich, völlig entkoppelt von seiner beruflichen Qualifikation, wie alle seine sozialdemokratischen Kollegen, im sprichwörtlichen Sinn auf der ‚Abschußliste‘. Wie überall in Preußen hatte die Sozialdemokratie auch im Kreis Merseburg die Bedrohung von links über-, die von rechts dagegen unterschätzt. Wie die Macht der SPD im Kreis und im Bezirk Merseburg von der ‚Revolution von rechts‘ zum Einsturz gebracht worden war und welch tragende Rolle die Besetzung herausragender Posten in der Verwaltung mit nationalsozialistischen Beamten dabei gespielt hatte, läßt sich in knapper aber deutlicher Form auf einem undatierten, vermutlich im März 1933 entstandenen Schriftstück aus dem Nachlaß Alfred Hugenbergs nachvollziehen.55 Auf diesem Papier werden leitende Beamte der Verwaltung in den verschiedenen preußischen Provinzen aufgelistet und hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit für den Aufbau des ‚neuen Staates‘ begutachtet. Unter „Provinz Sachsen […] Regierungsbezirk Merseburg“56 sind jene Personen aufgelistet, mit denen Albrecht und Theanolte Bähnisch beruflich und zum Teil auch privat in ständigem Austausch standen: „v. Harnack, Reg[ierungs]. Präs[ident]. SPD, muß unbedingt sofort weg“ heißt es auf dem Papier über den direkten Vorgesetzten und Vertrauten Bähnischs, „Corneel, Reg.[ierungs] Vizepräs.[ident] St.[aats] P.[artei], Jude, früher Rechtsanwa.[lt] sofort raus“ über dessen Stellvertreter. Und im gleichen Duktus geht die Auflistung weiter: „Oexle, Pol.[izei] Präs.[ident] In Halle SPD muß sofort weg, Krüger, Pol.[izei] Präs.[ident] In Weissenfels, SPD, muss sofort weg“ 57. Daß Bähnisch – wie alle anderen Landräte – in der Liste nicht aufgeführt ist, läßt sich aller Wahrscheinlichkeit nach darauf zurückführen, daß er hinsichtlich der von den Nationalsozialisten gefühlten Dringlichkeit seiner Entfernung, die sich ganz offensichtlich an der Verwaltungs-Hierarchie orientierte, schlichtweg eine Stufe unter den im Papier jeweils genannten Regierungs- und Polizeipräsidenten stand. Die Entlassung unliebsamer Landräte in die Wege zu leiten, beziehungsweise voranzutreiben, sollte jeweils zu den ersten Aufgaben der von den Nationalsozialisten neu eingesetzten Regierungspräsidenten gehören. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen, welche zur Folge hatten, dass die fachliche Eignung eines politischen Beamten nicht länger als wichtiges Kriterium für seinen Verbleib im Dienst bewertet wurde, änderte auch Regierungspräsident Sommer, der am 01.03.1933 der NSDAP beigetreten war, seine Meinung über Bähnisch. Einige Monate nachdem er sich noch explizit für den Landrat eingesetzt hatte, kam er
Der Bericht entstand in Reaktion auf die Vorwürfe des Abgeordneten von Trotha und wurde vom Oberpräsidenten von Velsen an Hermann Göring weitergeleitet. Ebd., Der Oberpräsident der Provinz Sachsen an den Preußischen Minister des Innern, 14.03.1933. 55 BArch, N 1231, Nr. 85, Wechsel in den politischen Stellen seit dem Anfang Februar 1933, Datum der Bearbeitung 07.03.1933. 56 Ebd. 57 Ebd.
Familienleben | 379
im August 1933 „im Einvernehmen mit dem Gauleiter der NSDAP in Halle“ zu dem Urteil, daß Bähnisch zwar ein „befähigter Beamter“ sei und ihm „unehrliche Amtsführung […] bisher“ nicht zum Vorwurf habe gemacht werden können, daß ihn „wohl aber […] die auch im Kreise Merseburg zu Gunsten der SPD betriebene Ausgabenwirtschaft“ belaste. Sommer stellte nun fest, daß Bähnisch „sein Amt nicht sachlich, sondern zugunsten der Linksparteien führte“. Er sei „neben dem Regierungspräsidenten Harnack eine der wenigen geistig hochstehenden Stützen des marxistischen Staates [nachträglich maschinenschriftlich eingefügt:] im Reg. Bez. Merseburg“ und habe mit „untergeordneten Kreaturen dieses Systems auf dem DuzFuß“, der NSDAP dagegen „feindlich“58 gegenüber gestanden. Und so befürwortete Sommer schließlich mit dem gleichen Schreiben die Entlassung des Landrates auf der Grundlage von § 459 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Mit diesem konnten bekanntlich „zur Wiederherstellung eines nationalen Berufsbeamtentums und zur Vereinfachung der Verwaltung“ Staatsdiener aus rassischen und/oder politischen Gründen sowie aufgrund als unzureichend empfundener Vorbildung „aus dem Amt entlassen werden [...] auch wenn die nach dem geltenden Recht hierfür erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen“60. Warum auf Albrecht Bähnisch § 4 des Gesetzes Anwendung finden sollte, der sich auf die Kernformel ‚politische Unzuverlässigkeit‘ reduzieren läßt, begründete Sommer wie folgt: „Ein leitender Beamter, der sich in dieser Weise als treuer Diener des marxistischen Systems betätigte und für die Ziele der Linkspartei als Redner auftrat bietet keine Gewähr dafür, daß er künftig rückhaltlos aus innerer Überzeugung für den nationalen Staat eintreten wird“.61 Jenes neue Resumée Sommers, das gegenüber seiner ersten, wohlwollenden, eine nun deutlich veränderte und Bähnisch disqualifizierende Einschätzung darstellte, war vermutlich im Wesentlichen von der Motivation Sommers geleitet, sich selbst das Vertrauen der Nationalsozialisten zu erhalten. Er blieb bis 1943 im Amt.62 An den Rittergutsbesitzer von Schkopau, Thilo von Trotha, schrieb der – neue – Preußische Minister des Innern am 05.04.1933 abschließend, daß er von einem
58 LHASA, MER, Rep. C 48 I a II B, Nr. 5, Regierungspräsident von Merseburg an den Preußischen Innenminister, 24.08.1933. 59 Der Gesetzestext lautete: „Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, daß sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen werden. Auf die Dauer von drei Monaten nach der Entlassung werden ihnen ihre bisherigen Bezüge belassen. Von dieser Zeit an erhalten sie drei Viertel des Ruhegeldes (§ 8) und entsprechende Hinterbliebenenversorgung.“ Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, in: Reichsgesetzblatt I (1933), S. 175. 60 Ebd. 61 LHASA, MER, Rep. C 48 I a II B, Nr. 5, Regierungspräsident von Merseburg an den Preußischen Innenminister, 24.08.1933. 62 1945, nach Kriegsende, war Sommer, der 1965 verstarb, kurzzeitig Bürgermeister von Merseburg und übernahm eine leitende Position in der Provinzialverwaltung der Provinz Sachsen, bevor er 1946 endgültig pensioniert wurde.
380 | Theanolte Bähnisch
dienststrafrechtlichen Verfahren gegen Bähnisch absehen wolle, „da die erhobenen Vorwürfe nicht zur Dienstentlassung führen würden. Wie Ihnen bekannt geworden sein dürfte, ist Landrat Bähnisch durch Beschluss des Staatsministeriums vom 15.03.1933 in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Hiermit dürfte Ihre Beschwerde den gewünschten politischen Erfolg gehabt haben.“63 4.1.3 Lieber ein Ende mit Schrecken – Das Ehepaar zwischen Bangen und Hoffen Die Zwischenzeit, bis die Klärung bringende Nachricht bei den Bähnischs eintraf, erlebte insbesondere Theanolte Bähnisch als eine quälende Zeit. Ihr Wunsch nach einer wenn auch existentiell einschneidenden Klarheit war groß. Die Geschäfte gegen den Widerstand der Kreistagsmitglieder, die ihre Ablehnung überdeutlich zeigten, zu führen, dürfte dem Landrat sehr schwer gefallen sein. „Wir warten jeden Tag auf die Abberufung und wünschen, daß diese augenblickliche Zwischenzeit bald zu Ende ist“64, hatte Theanolte Bähnisch am 19.02.1933 an ihre Freundin Ilse Langner geschrieben. Die Bähnischs hatten zunächst allem Anschein nach nicht recht gewußt, wie sie auf die politischen Entwicklungen und die damit einhergehenden Säuberungsaktionen reagieren sollten. „Mir geht es trotz der politisch fürchterlichen Zeiten ganz gut. Wir waren zur Ernennung Hitlers zum Kanzler 8 Tage in Oberhof und dort haben wir beide uns beim Skilaufen so ausgezeichnet erholt“65, hatte Bähnisch an einer anderen Stelle des bereits zitierten Briefes an Ilse Langner ausgeführt. Dies klingt, als habe sie sich darin geübt, Abstand zur politischen Entwicklung im Reich, zur beruflichen Zukunft ihres Mannes sowie zu ihrer eigenen, nun ebenfalls wieder ungewissen Zukunft zu finden. Doch bereits wenige Zeilen später folgte im gleichen Brief auf die wohl nur scheinbare Gefaßtheit die Ernüchterung, nämlich als Theanolte auf jene Sozialdemokraten Bezug nahm, die, wie auf der zitierten ‚EntlassungsListe‘ vorgesehen, bereits ihrer Ämter enthoben worden waren. „Bitter war der vorige Sonntag an dem die Abberufung von Vizepräsident Corneel […] und […] dem netten Polizeipräsidenten Oexle, Halle und dem Pol. Präsidenten Krüger aus Weißenfels […] kam.“66 Der Abstand, den es gebraucht hätte, um die Logik der Entlassungen auf die Rangfolge der Dienstgrade zurückzuführen, fehlte ihr: „Ich hatte eher an uns als an diese drei gedacht. Aber die Landräte sind bisher sonderbarer Weise noch nicht an die Reihe gekommen.“67 Es scheint sie regelrecht verwirrt zu haben, daß sie und ihr Mann – man beachte die Formulierung ‚uns‘ – von den Nationalsozialisten nicht als dringender zu entfernende politische Gegner wahrgenommen worden waren als die genannten Kollegen und politischen Freunde.
63 GStA PK I. HA, Rep. 77, Nr. 5176, Der Regierungspräsident von Merseburg an den Abgeordneten Thilo von Trotha, 05.04.1933. 64 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 19.02.1933. 65 Ebd. 66 Ebd. 67 Ebd.
Familienleben | 381
Die Zeilen an die Freundin Ilse Langner verdeutlichen zum einen, wie sehr sich Theanolte mit den leitenden sozialdemokratischen Beamten(familien) in der Region verbunden fühlte und zum anderen, wie bewußt ihr war, daß die ‚eigene‘ Abberufung nur noch eine Frage der Zeit sein konnte. Zudem wird – und darauf kann nicht oft genug hingewiesen werden – an der Verwendung des Wortes ‚uns‘ deutlich, daß sie die bevorstehende Abberufung Albrecht Bähnischs nicht als ‚seine‘ Abberufung allein wahrnahm, sondern als einen Vorgang, der sie als Ehefrau und als berufliche und politische Verbündete ihres Mannes mit einschloß. Sie schien tatsächlich empfunden zu haben, was, in den 50er Jahren als Begründung für den Anspruch auf eine höhere Witwenrente vorgebracht, wie reines Kalkül klingt.68 Sie betrachtete sich und ihren Mann als eine „Einheit“69 in beruflicher und politischer Hinsicht. An ein ‚normales‘ Leben der Beiden war zu dieser Zeit jedenfalls nicht mehr zu denken, zumal die Entwicklungen Albrecht Bähnisch offenbar gesundheitlich stark in Mitleidenschaft gezogen hatten. Am 28.09.1932, kurz nach der Entfernung seiner einstigen Vorgesetzten und politischen Freunde Carl Severing, Willy Abegg und Ernst von Harnack aus ihren Ämtern, hatte Bähnisch um Beurlaubung vom 06. bis zum 29.10. des Jahres gebeten, um eine Erholungskur in Schlangenbad in Anspruch nehmen zu können.70 Das amtsärztliche Schreiben, welches dem Brief des Landrats an den Regierungspräsidenten beilag, beschreibt den schlechten Gesundheitszustand des um Erholung Ersuchenden eindrücklich: „Herr B. gibt an, er schlafe in letzter zeit [!] sehr unruhig, träume viel und fahre öfters mit einem Schrei aus dem Schlaf auf. Er sei sehr reizbar geworden, bei Besprechungen sei es ihm manchmal wie ein Schleier vor den Augen und bei schwierigen Auseinandersetzungen stottere er manchmal […] Nach anstrengendem Dienst sei er völlig erschöpft und bekomme er Herzklopfen. Beim Schreiben versagten ihm in letzter Zeit öfters die Finger.“ Der ärztliche Befund lautete: „Hautfarbe blaß [...], Zunge etwas belegt, [...] Reflexe deutlich gesteigert.“ Zwar „kein deutliches Zittern der Finger und der Zunge [...]“, aber „Blutarmut und Zeichen von Nervenschwäche“. [...] Der Kreisarzt kam zu dem Schluß: „Um eine Verschlimmerung des Zustandes [...] zu verhüten [...] halte ich eine dreiwöchige Beurlaubung [...] für erforderlich.“71 Daß der Landrat gegen Ende seiner nur etwas über zwei Jahre währenden Amtszeit auch am Ende seiner Kräfte gestanden zu haben schien, mag durchaus Teil der Strategie seiner Gegner gewesen sein. Wie genau die kreisärztliche Diagnose allerdings Bähnischs tatsächlichen Gesundheitszustand beschrieb, läßt sich im Nachhinein nicht sagen. Wahrscheinlich ist jedenfalls, daß der Landrat die verordnete ‚Auszeit‘ im Oktober nicht nur zur Erholung, sondern auch konspirativ, zum Austausch mit Gleichgesinnten, beispielsweise mit dem ihm ehemals vorgesetzten Regie-
68 NLA HA HSTAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Wiedergutmachungsbescheid des Bundesministers des Innern vom 31.08.1953, Abschrift. 69 Ebd. 70 LHASA, MER, Rep. C 28 I a II, Lit B, Nr. 5, Der Landrat des Kreises Merseburg an den Regierungspräsidenten von Merseburg, 28.09.1932. 71 LHASA, MER, Rep. C 28 I a II, Lit B, Nr. 5, Der Kreisarzt [Merseburg] 28.09.1932.
382 | Theanolte Bähnisch
rungspräsidenten, Ernst von Harnack, nutzte. Dieser war bereits am 22.07.1932 in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden.72 Ein knappes halbes Jahr später, am 06.03.1933, wurde schließlich die Beurlaubung Bähnischs „aus politischen Gründen“ bekanntgegeben und festgestellt, daß eine „Wiederverwertung auf einem anderen Landratsposten nicht in Betracht kommt“73: Das entsprechende Schreiben unterzeichnete der preußische Minister des Innern, beziehungsweise der ‚Kommissar des Reiches‘, später Feldmarschall und Vizekanzler, Hermann Göring, daselbst.74 Per Funkspruch „ssd berlin nr 155 am 15/3/33 2043 uhr“ – so jedenfalls notiert der Entwurf vom 15.03.1933 – wurde Albrecht Bähnisch unter der Losung „sofort! Noch heute!“75 gleichzeitig mit dem Landrat Koch in Eisleben in den einstweiligen Ruhestand versetzt.76 4.1.4 Ebert wird abgehängt – Merseburg unter neuen Machthabern Soviel sei bezüglich der Entwicklungen im Kreis Merseburg noch erwähnt: Werner Oberst von der NSDAP, der Bähnisch nachfolgte und kommissarisch mit dem Amt dem Landratsposten betraut wurde, stellte die „marxistische Mißwirtschaft während der vergangenen 14 [sozialdemokratisch regierten] Jahre“ in den Mittelpunkt seiner Begrüßungsansprache im Merseburger Kreistag am 29.04.1933. Der bereits erwähnte Abgeordnete Crewell pflichtete ihm in derselben Sitzung bei und verwies ein weiteres Mal auf die Siedlung Dürrenberg und den Kreishausneubau als die Kreiskasse besonders belastende Faktoren. Da Crewell auf Nachfrage eines SPD-Abgeordneten im Verlauf der Sitzung angekündigt hatte, auf das „Recht der Ausschaltung“ von SPDAbgeordneten nicht verzichten zu wollen, erklärte der sozialdemokratische Abgeordnete Mödersheim, daß die SPD „unter diesen Umständen von der Benennung von Kandidaten absehe“77. Bereits vor dieser Wahl hatten sich die Kräfteverhältnisse im Kreistag deutlich verändert: Die NSDAP stellte 1933 ganze zwölf Abgeordnete, drei die Kampffront schwarz-weiß-rot, einen die Wirtschaftspartei und nur noch jeweils
72 LHASA, MER, Rep. C 48 I a II., Lit H, Nr. 25 [Akten betreffend den RegierungsPräsidenten von Harnack], Der Preußische Minister des Innern an das Regierungspräsidium Merseburg], 22.07.1932. 73 GStA PK I. HA, Rep. 77, Nr. 5176, Der preußische Minister des Innern, [Hermann Göring], an den Preußischen Ministerpräsidenten und die übrigen Kommissare des Reichs, 06.03.1933. 74 Ebd. 75 GStA PK I. HA, Rep. 77, Nr. 5176, Der preußische Minister des Innern an den Regierungspräsidenten von Merseburg und den Oberpräsidenten in Magdeburg, 15.03.1933 sowie per Funkspruch. 76 Ebd. 77 LHASA, MER, Rep. C 48 1b, Nr. 1084, Niederschrift über die Sitzung des Kreistags am 29.04.1933.
Familienleben | 383
sechs die SPD und die KPD.78 Aus der Einladung zum Kreistag am 22.06.1933 läßt sich schließlich ersehen, daß die Bahnhofstraße, an der das Kreishaus damals lag und auch heute wieder liegt, zwischenzeitlich in ‚Adolf-Hitler-Strasse‘ umbenannt worden war.79 Die Bilder Friedrich Eberts, Symbole (sozial-)demokratischer Identität, waren, wie im Kreistag ebenfalls verkündet worden war80, von der neuen politischen Führung sofort entfernt worden. Als sich schon verhältnismäßig kurze Zeit später, nämlich im September 1934 zeigte, daß Bähnischs Amtsnachfolger Werner Oberst seinen Aufgaben nicht gewachsen war81 und sich damit die Befürchtungen, die der Regierungspräsident Sommer in seinem ersten Schreiben über die ‚Causa Bähnisch‘ an das Innenministerium geäußert hatte, bewahrheiteten, mag das wenigstens eine kleine Genugtuung für Bähnisch gewesen sein. Robert Sommer, der Nachfolger von Ernst von Harnack, wirkte in der Folgezeit bei Entlassungen politisch unerwünschter Funktionsträger mit und war mitverantwortlich für Repressalien gegen die Bevölkerung im Sinne der nationalsozialistischen Rassegesetzgebung. Er kooperierte mit den nationalsozialistischen Eliten über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren. 1945 wurde er trotz dieser Vergangenheit für kurze Zeit Bürgermeister von Merseburg, bevor er in die Verwaltung der Provinz Sachsen wechselte und 1946, als er das rentenfähige Alter erreicht hatte, pensioniert wurde. Karl Mödersheim (SPD), der 1933 beim Amtsantritt Werner Obersts als Landrat das Feld als verloren für die Sozialdemokratie erklärt hatte, wurde 1945 Bürgermeister von Leuna und 1946 Vorsitzender des Kreistags von Merseburg. Er unterstützte Theanolte Bähnisch – wenn auch vergeblich – im gleichen Jahr bei der Suche nach ihrem verschollenen Ehemann und zeigte sich gegenüber der Vereinigung der SPD mit der KPD aufgeschlossen.82 4.1.5 Berufsarbeit und Einkommen Theanolte Bähnischs – Zahnkranz im Räderwerk der Demontage und Anlaß zu neuer Hoffnung Weitgehend unklar bleibt, inwiefern sich die politischen Gegner Albrecht Bähnischs den Umstand, daß Theanolte und Albrecht im Jahr 1930 noch bis November gleich-
78 O. V.: Kreistagswahl, in: Amtsblatt für den Landkreis Merseburg, 18.03.1933 sowie GStA PK I. HA Rep 77, Nr. 5176, Der preußische Minister des Inneren an den Ministerpräsidenten und an alle Staatsministerien, 12.05.1933. Mit dem Schreiben bringt der Minister Werner Oberst als Kandidaten für das Landratsamt in Merseburg in Vorschlag und klärt in diesem Zuge über die politischen Verhältnisse im Kreistag auf. 79 LHASA, MER, Rep. C 48 1b, Nr. 1084. 80 LHASA, MER, Rep. C 48 1b, Nr. 1084, Niederschrift über die Sitzung des Kreistags am 29.04.1933. 81 GStA PK I. HA, Rep. 77, Nr. 5176, Der Regierungspräsident von Merseburg an den Minister des Innern, 01.09.1934. 82 AddF, SP-01, Der Bürgermeister von Leuna, Mödersheim an Theanolte Bähnisch, 19.09.1946.
384 | Theanolte Bähnisch
zeitig im Staatsdienst beschäftigt waren, zur Demontage des Landrats zu nutzen versucht hatten. Der ‚Volksbote Zeitz‘ hatte im Januar 1930 seinen Bericht über den bevorstehenden Amtsantritt Bähnischs mit einer zunächst einmal neutral klingenden Information geschlossen: „[d]er neue Landrat, der in Marburg und Berlin Rechtswissenschaft und Nationalökonomie studiert hat, ist verheiratet; seine Frau ist zurzeit als Regierungsassessor am Polizeipräsidium Berlin beschäftigt“83. Jene, die diese Tatsache wohlwollend zur Kenntnis hätten nehmen wollten, konnten daran ablesen, daß der aus Berlin Abgeordnete scheinbar eine fortschrittliche Haltung zu Ehepartnerschaft und Frauenberufstätigkeit einnahm. Gleichzeitig dürfte die Anmerkung den Gegnern Bähnischs Kanonenfutter geliefert haben, denn der Umstand, daß beide Partner an verschiedenen Orten im Staatsdienst tätig waren, führte zu der bereits erwähnten doppelten Haushaltsführung, welche wiederum die Staatskasse belastete.84 Die landrätliche Dienstwohnung im Kreishaus bezogen der zunächst kommissarisch tätige Landrat und seine Frau erst im Juni 1930.85 Vor diesem Hintergrund entspann sich ab Oktober 1931 ein Schriftwechsel, in dem die „überhobene[n] Dienstbezüge der Frau Regierungsrätin a. D.“86 thematisiert wurden. Albrecht Bähnisch hatte erklärt, daß das Geld in die gemeinsame Wohnung geflossen sei.87 Weil das Innenministerium entgegen der wohlwollenden Haltung des Polizeipräsidiums auf die Rückzahlung der ‚überzahlten Beträge‘ bestanden, hatte Landrat Bähnisch sich damit einverstanden erklärt, daß diese Bezüge von seinem eigenen Gehalt in Abzug gebracht würden. Dieses Einverständnis zog er 1933, nach seiner Entlassung, zurück. Denkbar ist, daß es zu der Unstimmigkeit überhaupt nur gekommen war, weil Gegner Bähnischs Nachforschungen über seinen und den Verdienst seiner Ehefrau in die Wege geleitet hatten. Daß er sein Einverständnis, die Gehälter gegenzurechnen, 1933 zurückzog, wird zwei Gründe gehabt haben: Erstens dürfte er die zurückgezahlten Bezüge nicht in den Händen der Nationalsozialisten gewußt haben wollen. Zweitens mußte er nach seiner Versetzung in den Ruhestand buchstäblich um jede Reichsmark feilschen, denn es wurde ihm nur für drei Monate ein ‚Wartegeld‘ gezahlt, bevor er aus dem Staatshaushalt gar keine Unterstützung mehr erhielt. Immerhin fielen die Geburt seines Sohnes Albrecht am 31.03.1933 so-
83 O. V.: Der neue Merseburger Landrat. 84 In Albrecht Bähnischs Personalakte findet sich ein Schreiben aus dem Februar 1930, in dem er um die Bewilligung von Beschäftigungsgeldern für seine Mehrausgaben in Merseburg für Miete, Wäsche und Verpflegung von 222,50 RM bat. Er sei verheiratet und führe seinen Hausstand in vollem Umfang in Berlin, Kochstraße 66 weiter, begründet er seinen Antrag. LHASA, MER, Rep. C 28 I a II, Lit B, Nr. 5, Der Landrat des Kreises Merseburg an den Regierungspräsidenten von Merseburg, Antrag auf Gewährung von Beschäftigungsgeldern, 05.02.1930. 85 Ebd., Der Landrat des Kreises Merseburg an den Regierungspräsidenten von Merseburg, 03.07.1930. 86 Ebd., Preußisches Ministerium des Innern, Wilhelm Abegg an den Polizeipräsidenten von Berlin, (Abschrift), 23.10.1931. 87 Ebd.
Familienleben | 385
wie sein Umzug nach Berlin am 20.04.1933 noch in jene Zeit in der er noch von staatlichen Beihilfen profitieren konnte.88 Während zwischen Albrecht Bähnisch, dem Berliner Polizeipräsidium und dem preußischen Innenministerium noch über die Bezüge der ehemaligen Regierungsrätin Bähnisch diskutiert wurde, hatte diese bereits das Heft in die Hand genommen und sich den Weg zu einer neuen Einkommensquelle gebahnt: Beim Preußischen Oberverwaltungsgericht hatte sie am 22.07.1932 ihre Zulassung zur Verwaltungsrechtsrätin89 beantragt. In ihrer Lebensskizze90 stellt sie jenen Entschluß ursächlich in den Zusammenhang mit dem Preußenschlag und gibt an, die Zulassung exakt an jenem Tag beantragt zu haben, an dem Innenminister Severing gewaltsam aus seinem Büro entfernt worden war. Jene Darstellung scheint entweder dem Interesse an einer überzeugenden Dramaturgie in der Lebensskizze entsprungen zu sein, oder aber das Datum in der Akte stimmt – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – nicht mit dem Tag der tatsächlichen Antragstellung überein. Tatsächlich historisch eingängig war allerdings das Datum von Bähnischs Vereidigung vor dem Bezirksausschuß: der 09.11.1932.91 10 Monate später, am 26.09.1933 wurde auch Albrecht Bähnisch vereidigt92, denn Theanolte hatte auch für ihn die Zulassung als Verwaltungsrechtsrat beantragt. In einem ihrer bereits zitierten Briefe an die Freundin Ilse Langner wird deutlich, wie Theanolte durch die zwar veränderten, aber nun immerhin klaren Umstände, neue Hoffnung schöpfte: „Wir werden mit 180 Mark Wartegeld nach Berlin ziehen und unser Leben neu aufbauen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf diesen neuen Anfang freue und wie stark das alle meine Kräfte belebt. Allerdings werde ich ja in den ersten Monaten nach der Geburt mit den Kindern u. dem Haushalt, da mein Gatte ja nicht in Frage kommt, genügend zu tun haben […] Es lebe die Arbeit!“93
88 Ebd., Landrat i. e. R. Bähnisch an den Regierungspräsidenten von Merseburg, 31.03.1933. Bähnischs Ruhestandsgehalt wird auf 3440 RM festgesetzt. Ebd., Der Regierungspräsident von Merseburg an Landrat i. e. R. Bähnisch, 05.10.1933. Die Familie wohnte in Berlin in der Flemmingstrasse. 89 Für eine Beschreibung des Berufsbildes siehe Kapitel 4.2.1. 90 AddF, SP-01, Kurze Lebensskizze. In einem Lebenslauf, der ihrer Personalakte beiliegt, schreibt sie, sie habe acht Tage nach Severings Entlassung ihre Zulassung beantragt. NLA HA HStAH, Nds, 50, Acc. 75/88, Lebenslauf Theanolte Bähnischs, o. D. [1946]. 91 GStA PK I. HA, Rep. 184, P Nr. 54. Die Nachricht, daß sie in die Liste der Verwaltungsrechtsräte eingetragen worden sei, erfolgte am 06.09.1932 durch den Präsidenten des Ersten Senats des Preußischen Oberverwaltungsgerichts. Vgl.: ebd. 92 GStA PK I. HA, Rep 184, P Nr. 53 [Verwaltungsrechtsrat Bähnisch], Protokoll des Bezirksausschusses zu Berlin, Abteilung I, Berlin, 26.09.1933. Beantragt wurde die Zulassung – offenbar durch Theanolte Bähnisch in Albrecht Bähnischs Namen – bereits am 19.03.1933. Landrat i. e. R. Bähnisch, Merseburg, 19.03.1933 an den Herrn Präsidenten des Preußischen Oberverwaltungsgerichts Berlin-Charlottenburg, Merseburg, 19.03.1933. 93 Theanolte Bähnisch an Ilse Langner, 19.02.1933. Worauf sie die Aussage, daß ihr Gatte nicht in Frage käme, bezieht, geht aus ihrem Brief nicht hervor, alles deutet darauf hin, daß sie an das Stillen ihres noch ungeborenen, zweiten Kindes dachte. Daß Bähnisch 180 Mark
386 | Theanolte Bähnisch
Das Ende der Weimarer Republik bedeutete also für das Ehepaar Bähnisch zunächst einmal auch das Ende der wirtschaftlichen Prosperität. Doch gleichzeitig war Theanolte voller Optimismus und Tatendrang, was die Rückkehr nach Berlin und den Aufbau einer neuen Existenz in ihrer Wahlheimat betraf.
4.2 „WIR WERDEN […] UNSER LEBEN NEU AUFBAUEN“: ZURÜCK IN BERLIN 4.2.1 Die Anwaltspraxis für Verwaltungsrecht Um die Rückkehr der Bähnischs nach Berlin ranken sich diverse Erzählungen, sie auf ihren faktischen Gehalt zu prüfen fällt aufgrund der schlechten Quellenlage, beziehungsweise der Nichtzugänglichkeit vorhandener Dokumente schwer. Die Familie scheint ihren privaten wie beruflichen Neuanfang auf engstem Raum verwirklicht zu haben und zahlende Kundschaft scheint in der neu etablierten Anwaltspraxis ebenfalls nicht sehr zahlreich gewesen zu sein. Den Aufzeichnungen Hans-Heino Fels‘ zufolge soll der spätere BRD-Familienminister Franz Würmeling (CDU) der erste Mandant der Bähnischs gewesen sein.94 Man habe den ‚Würmelpeter‘ – wie OrlaMaria Fels ihn nennt – nach seinem Eintreten zunächst im Schlafzimmer untergebracht und regen Mandanten-Verkehr im anderen Raum der Wohnung vorgetäuscht, bevor man ihn ins Arbeitszimmer eingelassen und zu seinem Anliegen befragt hätte.95 Im Archiv für Christlich-Demokratische Politik sind in Würmelings Nachlaß keine Korrespondenzen mit den Bähnischs überliefert. Einen Beleg für die Familienanekdote zu finden, ist also schwierig. Daß Theanolte, wie sie einmal an Ilse Langner schrieb, als Verwaltungsrechtsrätin Ärztinnen vertrat, welche, weil sie verheiratet waren, nicht als Kassenärztinnen zugelassen wurden96, läßt sich durch Parallelquellen ebenfalls nicht belegen, es scheint jedoch naheliegend, wenn man berücksichtigt, daß die Juristin zu jenem Thema mehrere Artikel in einschlägigen Zeitschriften verfaßt hatte.97 In ihrer Le-
94 95 96
97
Wartegeld erhielt findet sich in NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Wiedergutmachungsbescheid des Bundesministers des Innern vom 31.08.1953 (Abschrift) bestätigt. Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 8. Vgl.: ebd. „Ende November bis Anfang Dezember bin ich in Berlin um dort meine nächste Sache aus dem Kriegsschadsamt [Kriegsschadensamt] zu vertreten. Es handelt sich um die Vertretung der Interessen von sechs Ehefrauen gegen deren Zulassung zu den Kassen ein Ärzteverband Revision eingelegt hat. Ich freue mich, daß ich bei meiner nächsten Sache als Verwaltungsrechtsrat für die Rechte der berufstätigen Ehefrau einzutreten habe.“ DLA, A: Langner, Ilse, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 25.10.1932. Siehe Kapitel II.3.2.5.2.
Familienleben | 387
bensskizze98 und in verschiedenen Zeitungsartikeln99 berichtet Bähnisch, daß sie und ihr Mann in ihrem neuen Beruf vor allem rassisch und politisch verfolgten Personen Beistand geleistet hätten. Sie, Theanolte, habe sich mit dieser Arbeit, die sie nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen deutschen Städten verrichtet habe, mehrmals in große Gefahr begeben. Die Praxis in Berlin habe man schließlich zu dritt betrieben: Heinrich Troeger100, der spätere Generalsekretär des Länderrats der Bizone (1947– 1949) und noch spätere Hessische Finanzminister, soll Kompagnon der beiden frisch gebackenen Verwaltungsrechtsräte gewesen sein.101 Immerhin soviel läßt sich nachvollziehen: Troeger war von 1934 bis 1945 als Fachanwalt für Devisen- und Steuerrecht in Berlin tätig, zuletzt, so ist überliefert, mit der Bezeichnung ‚Verwaltungsrechtsrat‘.102 In seinen Tagebüchern, die im Archiv der sozialen Demokratie in Bonn überliefert sind, findet sich kein Hinweis auf eine Zusammenarbeit mit den Bähnischs,103 tatsächlich geht aber aus seiner Personalakte hervor, dass er unter derselben Adresse als Verwaltungsrechtsrat tätig war, wie die Bähnischs.104 Auffällig ist, daß auch Tröger seines Amtes (als Bürgermeister von Neusalz an der Oder in Sachsen) 1933 enthoben worden war und daß Albrecht Bähnisch somit nicht der einzige Sozialdemokrat war, der im Anschluß an seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand um seine Zulassung als Verwaltungsrechtsrat beim OVG ersucht hatte. Ob jenes Vorgehen ‚Methode‘ hatte, ob man sich untereinander entsprechend beriet – zumal der Präsident des OVG Bill Drews Sozialdemokraten und Liberalen wohlgesonnen war – wäre eine Prüfung wert, führt an dieser Stelle jedoch zu weit. Leider ist es sehr schwierig, nachzuvollziehen, ob – und wenn ja, wann Theanolte und Albrecht Bähnisch bei Verhandlungen vor dem Oberverwaltungsgericht oder vor anderen Gerichten als Verwaltungsrechtsräte präsent waren. Denn es gibt keine Kartei, aus der sich systematisch ermitteln ließe, welcher rechtliche Beistand in einem
98 AddF, SP-01, Kurze Lebensskizze. Hier schreibt sie, sie habe die Vertretertätigkeit – womit sie wohl die Arbeit als Vertreterin für Pressephotos meint – nach zwei Jahren ganz aufgegeben. 99 Vgl. beispielsweise: O. V.: Schubfach. Aus dem Artikel geht hervor, daß sie der Autorin/dem Autor offenbar die Lebensskizze zur Verfügung gestellt hatte, denn im Artikel wird ein Satz wortwörtlich zitiert. Offenbar setzte Bähnisch die Skizze regelmäßig für solche Zwecke ein, denn in vielen Artikeln stimmen Passagen mit der Skizze wortgleich überein. 100 Heinrich Troeger (1901–1975) war 1933 ebenfalls seines Amtes enthoben worden. 1945 war er kurzzeitig Bürgermeister von Jena. 1956 übernahm er die Leitung der Hessischen Landeszentralbank, 1958 wurde er Vizepräsident der Bundesbank. Auf Betreiben der großen Koalition blieb er zwei Jahre über sein Pensionsalter hinaus, bis 1969, im Amt. 101 Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 10. 102 Art. „Troeger, Heinrich“, in: Internationales Biographisches Archiv 01/1976, auf: Munzinger Online/Personen: http://www.munzinger.de/document/00000001532, abgerufen von Universitätsbibliothek Kassel, 21.10.2013. 103 Vgl.: AdSD, Nachlaß Heinrich Troeger. 104 GStA PK I. HA, Rep. 184, P Nr. 2934.
388 | Theanolte Bähnisch
Verfahren jeweils für die Kläger oder Beklagten auftrat. Prof. Dr. Katharina Petersen, die später eine Vertraute Theanolte Bähnischs wurde, gibt selbst an, von Albrecht Bähnisch im Zusammenhang mit ihrer Ausreise in die Niederlande und der Ausübung eines Berufes dort verwaltungsrechtlich vertreten worden zu sein. Dies ist – nach dem bisherigen Stand der Forschung – der einzige konkrete Hinweis durch eine Mandantin, der zur Aussage Theanolte Bähnischs, man habe im Dritten Reich politisch Verfolgte beraten und vertreten, paßt. Schriftverkehr mit dem Oberverwaltungsgericht hatten die Bähnischs nachweislich im September 1935, gut zweieinhalb Jahre nach ihrem Weggang nach Berlin, als sie gerade ihre Praxis in die Joachimtalerstr. in Berlin-Charlottenburg verlegt hatten.105 Diese Begebenheit hatten die beiden Verwaltungsrechtsräte genutzt, um mit einem Rundschreiben auf sich und ihre Dienste aufmerksam zu machen. Die versendete Änderungsanzeige rief jedoch prompt die Behörde auf den Plan. Das Ehepaar Bähnisch mußte sich wegen unerlaubter Werbung verantworten, denn in ihrem Schreiben zeigten die Beiden nicht nur ihren Umzug an, sondern beschrieben auch die Zuständigkeiten, die mit dem Beruf einhergingen. Das Oberverwaltungsgericht argumentierte, es sei sehr fraglich, ob die Bähnischs das Rundschreiben, welches sich eben nicht auf das Nötigste beschränke, wahrheitsgemäß nur an Kollegen und die bereits vorhandene Klientel verschickt hätten und wies darauf hin, daß ein Werben um Klienten unstatthaft sei.106 Ob das Rundschreiben tatsächlich ein Schachzug war, um den Kundenstamm zu mehren – was vor dem Hintergrund des gewählten Stils nicht abwegig erscheint – oder ob sich die Bähnischs tatsächlich keiner Schuld bewußt waren: beide dementierten in getrennten Schreiben, aber mit sehr ähnlichen Worten einen Verstoß gegen die geltenden Bestimmungen. Der Brief, mit dem Albrecht Bähnisch auf den Vorwurf des Oberverwaltungsgerichts reagierte, verriet einigen Unmut über die eigene Berufsbezeichnung: Bähnisch erklärte, die Anzeige habe seine Mandanten darüber aufklären sollen, vor welchen Behörden und Gerichten die Zulassung als Verwaltungsrechtsrat zum Verhandeln und Auftreten berechtige. „Bei unserer wenig glücklichen Berufsbezeichnung ist eine solche Aufklärung leider nötig. Jeder hat eine Vorstellung davon, was ein Rechtsanwalt ist […] Bei dem Verwaltungsrechtsrat wissen das nicht nur die Mandanten nicht, sondern auch die meisten Behörden haben von dieser Institution keine Vorstellung.“107 Warum allerdings gerade die bereits vorhandenen Mandanten Informationen dazu benötigen sollten, läßt er im Unklaren. Nichtsdestotrotz ist es erfreulich, daß die Anzeige überliefert ist, denn auch heute ist es keine Selbstverständlichkeit, zu wissen, was sich hinter der Berufsbezeichnung ‚Verwaltungsrechtsrat‘ verbirgt.
105 GStA PK I. HA, Rep. 184, P Nr. 53, Rundbrief, Anzeige vom September 1935. 106 Ebd., Der Präsident des ersten Senats des Preuß. Oberverwaltungsgerichts an den Verwaltungsrechtsrat Bähnisch, Landrat a. D., 19.10.1935. 107 GStA PK I. HA, Rep. 184, P Nr. 53, Verwaltungsrechtsrat Bähnisch an den Herrn Präsidenten des Ersten Senats des Preußischen Oberverwaltungsgerichts Berlin-Charlottenburg, 23.10.1935. Theanolte Bähnisch reagierte ähnlich: GStA PK I. HA, Rep. 184, P Nr. 54, Verwaltungsrechtsrat Bähnisch, 23.10.1935. „Unsere Sekretärin hat die Adressen nach den Karthothekkarten geschrieben“, erklärt sie den großen Verteiler.
Familienleben | 389
Die zum Stein des Anstoßes avancierte Anzeige erklärt dies, die besonderen Schwerpunkte der Bähnischs berücksichtigend, geradezu mustergültig. Ihr ist zu entnehmen, daß das Paar zur Vertretung bei allen Behörden und Verwaltungsgerichten berechtigt sei (aufgeschlüsselt wird dies in: Kommunal- und Staatsbehörden, Ministerien und Disziplinargerichte, Finanzämter und Finanzgerichte, Steuer und Kataster-Ämter, Devisen und Überwachungsstellen), daß man vor allem in Beamten-Angelegenheiten (Besoldung, Entlassung, Pensionierung, Dienststrafverfahren) tätig sei, sich daneben aber auch auf die verwaltungsrechtlichen Aspekte von Ein- und Ausbürgerungen, auf Polizeifragen, auf Schankkonzessionen sowie auf Steuer- und Devisensachen verstehe. Man berate in Finanz- und Wirtschaftsfragen, begutachte und könne besondere Erfahrungen im Arzt-, Krankenkassen und Sozialversicherungsrecht vorweisen. Wer von beiden Partnern welche Fälle bearbeitete, wird aus der Anzeige nicht deutlich. Vielmehr trat das Ehepaar nach außen als Arbeitspaar auf – die ‚alte Einheit‘ der beruflichen Zusammenarbeit, die in den Merseburger Jahren unterbrochen worden war, schien, so macht es das Rundschreiben glauben, nach dem Berliner Neuanfang wieder hergestellt worden zu sein. In der Realität waren, wie im Folgenden deutlich werden wird, die Schnittmengen zwischen Albrechts und Theanolte Bähnischs Erwerbsarbeit im Dritten Reich jedoch nicht sehr groß. Daß dennoch ein reger Austausch über das gemeinsame berufliche Streben stattgefunden haben und die, wie sich bei näherer Betrachtung zeigt, eher ‚nebenbei‘ ausgeübte Tätigkeit berufsethisch wie partnerschaftlich höher bewertet worden sein dürfte als die Tätigkeiten, mit denen das Paar in den nächsten Jahren tatsächlichen den wesentlichen Teil des Familieneinkommen bestreiten sollte, steht auf einem anderen Blatt. 4.2.2 Zwischen der Neigung zum Rechtswesen und lukrativeren Tätigkeiten in der Privatwirtschaft Daß zwei Jahre nach dem Weggang aus Merseburg, also im Jahr 1935, eine Verlegung der Kanzlei in den teureren Stadtteil Charlottenburg möglich wurde108, könnte als Indiz dafür angesehen werden, daß sich die Familie Bähnisch wirtschaftlich wieder ‚gefangen‘ hatte. Dies war, wie bereits angedeutet, jedoch weniger auf die Tätigkeit der Eheleute als Verwaltungsrechtsräte zurückzuführen. Weil zahlende Mandanten vor allem in der Anfangszeit der Praxis rar gewesen seien, so schreibt Theanolte Bähnisch, habe sie begonnen, als Vertreterin für Pressephotos zu arbeiten. 109 Das Berufsbild dürfte ihr vorher allenfalls aus Erzählungen von Mitgliedern der Soroptimistinnen vertraut gewesen sein, In der Tätigkeit bestand jedoch zeitweilig ihre Haupteinnahmequelle110. „Mutter leistete in der ersten Zeit nach Vaters Entlassung ihren
108 Vgl. die Kopfbögen ab 1935 in GStA PK I. HA, Rep 184, P Nr. 53. 109 AddF, Kassel, SP-1, Kurze Lebensskizze. Zur mangelnden Vergütung vgl.: Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Fragebogen der Militärregierung, 20.02.1946, S. 3. 110 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Fragebogen der Militärregierung, 20.02.1946, Einkommensquellen. Demnach hatte sie 1933 mit ihrer Vertretertätigkeit 900 RM, 1934 2000 RM verdient. Für 1935 gibt sie Gesamteinnahmen „aus Vertretertätigkeit und Ver-
390 | Theanolte Bähnisch
Beitrag zum Familienunterhalt vor allem durch die Vermarktung von Fotos bedeutender Fotografen an Zeitschriften und Illustrierte“111, beschreibt auch der Schwiegersohn Hans-Heino Fels die Arbeitsteilung zwischen den Ehepartnern. Ihrer Arbeit als Verwaltungsrechtsrätin verlieh Bähnisch, indem sie deren Widerstands-Charakter betonte, in der Retrospektive dagegen den Charakter einer ‚politischen Arbeit‘ welche sie, zumindest in der Anfangszeit, ohne größeren geldwerten Vorteil erledigt habe.112 Der Einstieg in die Photo-Branche war ihr über eine persönliche Beziehung, die sie bei den Soroptimistinnen geknüpft hatte, gelungen: sie war für den Photovertrieb „Jacobi, Berlin […] Kurfürstendamm“113 tätig, den ihre Freundin Lotte Jacobi leitete. Die Angaben Theanolte Bähnischs hierzu legen den Schluß nahe, daß sie das Geschäft in Vertretung Jacobis allein und auf Provisionsbasis führte. Hierin läßt sich einerseits ein großer Vertrauensbeweis Jacobis gegenüber der Freundin, die sich im Metier gar nicht auskannte, erkennen. Andererseits fand die jüdische Photographin, die aufgrund der antisemtischen Verfolgungen im Reich nicht in Berlin bleiben konnte und nach diversen längeren Reisen 1935 in die USA auswanderte, mit der Vertretung durch die gelernte Juristin Bähnisch eine Möglichkeit, ihren Betrieb noch eine Weile aufrecht erhalten zu können, bevor sie das Geschäft 1935 schließen mußte. Das Arrangement dürfte also zum Vorteil beider Frauen gereift sein. Im Fragebogen der Militärregierung, in dem sämtliche während des Dritten Reiches ausgeübte Tätigkeiten aufzuführen waren, gab Bähnisch knapp als Grund für das Ende dieser Tätigkeit: „[…] jüdischer Betrieb, ging nicht mehr“114, an. Während Jacobi sich eine neue Existenz aufbauen mußte, ging es für Theanolte in derselben Branche weiter: Ihr bot sich die Möglichkeit, für den Münchner Bildbericht zu arbeiten.115 Wieder verkaufte sie Photos an die Presse, aber auch an andere Abnehmer.
111
112 113 114
115
waltungspraxis“ von etwa 6.000 RM an, 1936, so schreibt sie habe sie mit ihrer „Praxis für politisch Verfolgte“ ein Einkommen von etwa 3500 RM erzielt. Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 8/9. Die Kopfbögen der Anwaltskanzlei hätten teilweise auch nur Albrecht Bähnisch aufgelistet schreibt Fels. Vgl.: ebd., S. 8. AddF, SP-01, Kurze Lebensskizze sowie Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Fragebogen der Militärregierung, 20.02.1946, S. 3. Ebd. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Military Government of Germany, Fragebogen, 05.08.1945, S. 3. Es handelt sich bei dem Schriftstück um einen Fragebogen, den Bähnisch ausgefüllt hatte, als sie noch in Köln lebte. Eventuell ist der Bogen nicht eingereicht worden, denn ein Fragebogen aus dem Februar 1946, der die gleichen Inhalte enthält, wurde ist maschinenschriftlich ausgefüllt. Laut Fragebogen ging die eine Tätigkeit nahtlos in die andere über. Demnach wechselte sie am 01.10.1934 zum Münchner Bildbericht und arbeitete dort bis zum April 1935. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Military Government of Germany, Fragebogen, 05.08.1945. Ebd. Korrespondenz Bähnischs mit dem Bildbericht ist jedoch noch aus dem August 1935 überliefert. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch.
Familienleben | 391
Wirft man einen Blick auf die recht spärliche Überlieferung zu dieser Tätigkeit im Privatnachlaß Theanolte Bähnischs bei Orla-Maria Fels, so fällt auf, daß zu den Käufern der Photos auch die Veranstalter einer Ausstellung zählten, die der nationalsozialistischen Propaganda mitsamt ihrer Rassenlehre diente.116 In einem Schreiben quittierten die Herausgeber des Katalogs zu der am 23.03.1935 von Innenminister Wilhelm Frick eröffneten Ausstellung ‚Das Wunder des Lebens‘ die Verwendung von acht von Bähnisch zur Verfügung gestellten Photos.117 Die Ausstellung fand, wie 1926 die Große Polizei-Ausstellung, in den Berliner Messehallen am Kaiserdamm statt. Heute ist nicht mehr ohne Weiteres nachvollziehbar, was diese Bilder zeigten.118 Zweifelsohne hatten sie jedoch im Gesamtkontext der ersten großen nationalsozialistischen Propagandaausstellung – und damit im Erzählrahmen der Rassentheorie und der Legende von der Überlegenheit der ‚arischen‘ Menschen gegenüber den anderen Völkern – Verwendung finden sollen und vermutlich auch gefunden. Es ist möglich, jedoch nach den medienwirksamen Vorankündigungen für die großangelegte Ausstellung eher schwer vorstellbar, daß Bähnisch nicht wußte, welchen Zwecken sie zuarbeitete. Denkbar ist jedoch, daß die ‚Gemeinnützige Berliner Ausstellungs- und Fremdenverkehrs GmbH‘ die Vertreterin des Bilderdienstes nicht vorab über die geplante Verwendung der bestellten Bilder informiert hatte und Bähnisch erst mit dem Erhalt der Kauferklärung vom 03.04.1935 erfuhr, in welchem Zusammenhang die Photos verwendet werden würden. Daß sie, wenn sie für den Münchner Bilderdienst tätig war, einer Agentur zuarbeitete, die tagtäglich Photo-Material über die Entwicklungen, die mit der nationalsozialistischen Politik einhergingen für eine wohl kaum neutrale Berichterstattung lieferte, kann ihr jedoch kaum entgangen sein. 1935 endete – laut ihrer Angabe im Fragebogen119 – auch diese Tätigkeit Theanolte Bähnischs. Ob die Erkenntnis, daß sie durch eine solche Arbeit die Propagandamaschinerie der Nationalsozialsten speiste, hierfür eine Rolle spielte, läßt sich nicht nachvollziehen. In ihren Erinnerungen schreibt sie nichts Entsprechendes. Vor dem Eindruck ihrer Aussagen, die sie nach 1945 Journalisten gegenüber gemacht hatte, und aus ihren eigenen Aufzeichnungen könnte – und sollte? – man den Eindruck gewinnen, daß sich die Praxis der Verwaltungsrechtsräte Bähnisch im Jahr 1935 als profitabel genug erwiesen hatte, um der vierköpfigen Familie ein Auskommen zu ermöglichen. Ihre Lebensskizze, die sie ab 1946 Journalisten zur Verfügung stellte und die auf diese Weise zur Grundlage vieler Artikel über Bähnisch wurde, legt eine solche Entwicklungnah:120 „Da die Praxis in der ersten Zeit […] nur aus
116 Vgl. dazu Frick, Wilhelm: Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung ‚Das Wunder des Lebens‘, in: Der öffentliche Gesundheitsdienst, Bd. 1 (1935/36), Teilausgabe A, S. 100– 103. 117 Vgl.: Bayer, Herbert: Ausstellungskatalog. Das Wunder des Lebens, Berlin 1935. 118 Die Bilder im überlieferten Ausstellungskatalog sind nicht einzeln mit Herkunftsnachweisen versehen. 119 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Military Government of Germany, Fragebogen, o. D. [Herbst 1946]. 120 AddF, SP-01, Kurze Lebensskizze.
392 | Theanolte Bähnisch
einem Schild an der Tür bestand, übernahm ich eine Vertreterinnentätigkeit. […] Inzwischen lief die Praxis langsam an, und es sprach sich bald herum, dass politisch und rassisch Verfolgte in uns eine gute Beratung und Vertretung hatten. Im Laufe der nächsten 2 Jahre (nach zwei Jahren gab ich die Vertretertätigkeit [gemeint ist hier wohl die als Vertreterin des Bilderdienstes, Anm. d. V.] ganz auf) bin ich bei vielen Gestapos der deutschen Großstädte gewesen, um mich nach Verhafteten und ins KZ Verschleppten zu erkundigen und mich für sie einzusetzen.“121 Sämtliche Zeitungsartikel, die Bähnischs Lebenslauf wiedergeben sowie einige längere Aufsätze berichten – wenn Bähnischs Vertreterinnentätigkeit darin überhaupt erwähnt wird – entsprechend. Bähnischs Aussagen über ihre Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrätin für rassisch Verfolgte, aber auch über die Existenz des ‚Freiheitsverlages‘ und über ihr Engagement im Widerstand werden jeweils unhinterfragt reproduziert.122 In den Fragebögen der Militärregierung weist Bähnisch allerdings nicht nur auf das Ende ihrer Vertretertätigkeit 1935, sondern auch darauf hin, daß sie ab 1935 wesentlich von den Einkünften ihres Mannes als „Kaufmann“123 gelebt habe. Weil nähere Angaben dazu fehlen, entsteht – obwohl Albrecht Bähnisch eine herausgehobene Funktion innehatte – der Eindruck einer eher unbedeutenden Tätigkeit ihres Ehemannes. Daß Albrecht Bähnisch seit 1935 und bis 1942 – mit einer Unterbrechung nach seiner Einberufung zum Kriegsdienst – dauernd hauptberuflich in der freien Wirtschaft beschäftigt war und daß Köln deshalb Hauptwohnsitz der Familie wurde, erwähnte die spätere Regierungspräsidentin weder in ihrer etwa 1946 verfaßten Lebensskizze, noch scheint sie es gegenüber der Presse thematisiert zu haben – jedenfalls taucht die Information in keinem der vielen Zeitungsartikel auf, die sich mit ihr beschäftigen. In einem Brief, der in ihrem Privatnachlaß überliefert ist, begründete Bähnisch das Ende ihrer Vertretertätigkeit mit dem Umzug nach Köln.124 Als Albrecht Bähnisch noch wegen seines Rundschreibens als Verwaltungsrechtsrat mit dem
121 Ebd. 122 Im Artikel über Bähnisch im Munziger-Archiv heißt es, sie habe „eine Vertretertätigkeit“ übernommen, „bis die Praxis anlief in der man sich auf die Vertretung rassisch und politisch Verfolgter spezialisierte.“ O. V.: Vgl.: Art. „Dorothea Bähnisch“ in: Internationales Biographisches Archiv, 29.07.1961, Sp. 2882. Der bereits erwähnte Artikel des SPD-Pressedienstes übernimmt Bähnischs Darstellungen vollkommen unhinterfragt, bescheinigt ihr eine „tadellose Vergangenheit“ und stilisiert sie zur „Helferin der Bedrängten“. Der Artikel ist voll von Fehlinformationen und Mutmaßungen. Laut Artikel war es (nicht Albrecht, sondern) Theanolte, die 1933 „von den Nationalsozialisten selbstverständlich entlassen“ worden war und es heißt, sie habe Gefährdete in ihrer westfälischen Heimat versteckt. Zudem wird eine „enge Freundschaft“ zu Kurt Schumacher behauptet. Vgl.: O. V.: Bevollmächtigte. Lediglich Marieluise Schareina erwähnt in ihrem biographischen Artikel weder den ‚Freiheitsverlag‘ noch das Engagement im Widerstand. Vgl.: Schareina: Regierungspräsident. 123 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Fragebogen, 05.08.1945. 124 Ebd., Theanolte Bähnisch an Weber, Bildbericht, 29.08.1935.
Familienleben | 393
OVG darüber korrespondierte, ob das Rundschreiben unerlaubterweise werbende Elemente enthalte lebte er also gar nicht mehr in Berlin. Tatsächlich scheint die gemeinsame Tätigkeit des Ehepaars als Verwaltungsrechtsräte, welche Theanolte Bähnisch als so maßgeblich für jene Jahre darstellte und darstellen ließ, weder in den Jahren 1933–1935, als beide Ehepartner noch mit anderen Beschäftigungen Geld hinzu verdienten (Albrecht Bähnisch war freiberuflich als Gutachter für die Leuna-Werke „und für einen größeren Wirtschaftsverband“125 tätig, er scheint auch Nachhilfestunden gegeben zu haben126), noch in den Jahren ab 1935 im Vordergrund des Alltags der späteren Regierungspräsidentin gestanden zu haben. Vielmehr übernahm Albrecht Bähnisch 1935 erneut die Rolle des Hauptverdieners, wenn nicht gar des Alleinverdieners – ein Umstand, der in den Großteil der Darstellungen Theanolte Bähnischs nach 1945 keinen Eingang fand. Daß sie selbst auch während der Jahre 1935 bis 1945 als Verwaltungsrechtsrätin tätig war, läßt sich ebensowenig widerlegen127, wie sich Nachweise für eine aktive Tätigkeit finden, zumal sie, was sich selbstverständlich auch auf die mit dem Beruf verbundene Schweigepflicht zurückführen ließe, kaum Namen, konkrete Zeiträume oder Inhalte ihrer Arbeit nennt. In einem Schreiben an die SPD über die „Leistungen von weiblichen Mitgliedern der SPD während der Hitlerherrschaft“ gab Bähnisch an, sie habe „viele Parteigenossen vertreten, die sonst niemand zu vertreten wagte […] von 1933 bis Februar 1945, als die Russen unmittelbar vor Berlin standen“128. Namen nennt sie in jener Erklärung nicht. 4.2.3 Die ‚Gruppe Harnack‘, der ‚Freiheitsverlag‘ und die juristische Vertretung ‚rassisch‘ und politisch Verfolgter 4.2.3.1 War Theanolte Bähnisch eine Widerstandsaktivistin? In verschiedenen Lebensläufen und sonstigen Selbstzeugnissen gab Bähnisch nicht nur an, sich als Verwaltungsrechtsrätin für politisch und rassisch Verfolgte eingesetzt zu haben, sondern sie erklärte auch, in der Gruppe ‚Ernst von Harnack‘ im Widerstand gegen den Nationalsozialismus tätig gewesen zu sein. Von Harnack habe sie persönlich angeworben, „um wichtige Verbindungen herzustellen; eine Frau sei unauffälliger“129, berichtet sie 1964 in der Hannoverschen Presse. Außerdem habe sie,
125 Fels, Hans-Heino: Orlas Vater, S. 8. 126 Ebd. 127 Unter Ihrem eigenen Namen scheint Bähnisch jedenfalls zumindest ab dem Ende der 1930er Jahre keine Mandanten vertreten zu haben, da der Kaufhof, wie Albrecht Bähnisch notierte, die Berufstätigkeit seiner Frau ‚unterband‘. Notizen von Albrecht Bähnisch, o. D. [Ende 1939/Anfang 1940], zitiert nach Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 12. 128 AdSD, Personalia 480 [Theanolte Bähnisch], Zum Material der Leistungen von weiblichen Mitgliedern der SPD während der Hitlerherrschaft. Frau Bähnisch teilt dazu folgendes mit, o. D. 129 Bähnisch: Heimkehrerin.
394 | Theanolte Bähnisch
so gibt sie in ihrer Lebensskizze an, im von ihr selbst gegründeten ‚Freiheitsverlag‘ Schriften, deren Inhalt sich gegen den Nationalsozialismus gerichtet habe, verantwortet.130 Laut einem tabellarischen Lebenslauf, den sie nicht selbst verfaßt haben wird, der jedoch vermutlich auf ihren Angaben beruht, habe sie die von ihr in der Lebensskizze erwähnten Schriften zwischen Anfang 1931 und 1933 verbreitet.131 In einem Lebenslauf gibt sie an, daß Wilhelm Abegg die Gründung des Verlags angeregt habe132 und daß Ministerialrat Spieker für die Vernichtung der Unterlagen gesorgt habe.133 Finanziert worden sei ihre Arbeit aus dem „berühmten 5 Millionen-Fonds“134, womit Bähnisch offenbar auf einen Kapitalstock anspielte, aus dem das preußische Innenministerium Maßnahmen zur Bekämpfung verfassungsfeindlicher Aktivitäten finanzierte.135 Auch für diese Aktivitäten Bähnischs konnten bisher keine Belege gefunden werden. In der Abteilung ‚R‘ des Bundesarchivs, Bestand 56 V (Reichschrifttumskammer/Überwachung und Verbot von Schrifttum) blieb die Suche nach dem genannten Verlag erfolglos. Zwar existierte ein Verlag unter dem Namen ‚Freiheitsverlag‘, dabei handelt es sich jedoch um ein regimetreues Unternehmen.136 Dass belastende Un-
130 AddF, SP-01, Kurze Lebensskizze. 131 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, tabellarischer Lebenslauf, o. D., o. V. Im Lebenslauf ist von Bähnisch in der dritten Person die Rede. Offenbar handelt es sich um eine Art Eignungspapier für den öffentlichen Dienst, da auch auf den Fragebogen der Militärregierung Bezug genommen wird. Nachweise für die getroffenen Aussagen über Bähnisch werden nicht angeführt. 132 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Notizen der Frau Regierungspräsidentin a. D., Th. Bähnisch, Verwaltungsrechtsrat (Fachanwältin für Verwaltungssachen) aus Köln am Rhein [1945]. Den Notizen ist, offenbar von dritter Hand, ein Notizzettel mit der Aufschrift „persönl. Lebensskizze 1945, Thema Widerstand“ angeheftet worden. 133 NLA HA HStAH, Nds 50., Acc. 75/88, Lebenslauf Theanolte Bähnischs, o. D. [1946]. 134 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Notizen der Frau Regierungspräsidentin a. D., Th. Bähnisch, Verwaltungsrechtsrat (Fachanwältin für Verwaltungssachen) aus Köln am Rhein. [1945] Der Text dieser Notizen entspricht in seinem Inhalt teilweise dem in englischer Sprache verfaßten Lebenslauf, der in Bähnischs Unterlagen für die Großbritannienreise überliefert ist. 135 Die Existenz des Fonds, der jedoch nicht landläufig so wie von Bähnisch bezeichnet wird, wurde von der NSDAP genutzt, um die ‚Verschwendung von Steuergeldern‘ durch die Preußische Regierung anzuprangern. Wilhelm Leuschner, mit dem Theanolte nach eigener Aussage gut bekannt gewesen war, hatte aus diesem Fond ebenfalls Mittel erhalten. Vgl.: Leithäuser, Joachim: Wilhelm Leuschner: Ein Leben für die Republik, Köln 1962, S. 96. Zu Bähnischs Aussage über Leuschner, von dem sie angibt, ihn im Rahmen der „republikanischen Lehrertagung in Darmstadt“ kennengelernt zu haben, vgl.: Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Notizen der Frau Regierungspräsidentin a. D., Th. Bähnisch, Verwaltungsrechtsrat (Fachanwältin für Verwaltungssachen) aus Köln am Rhein [1945]. 136 BArch, R 56 V, Nr, 367. Es handelt sich hierbei um eine Akte der Geschäftsführung der Reichsschrifttumskammer, Referent für Überwachung.
Familienleben | 395
terlagen durch Mitarbeiter des Innenministeriums vernichtet wurden, läßt sich schwerlich widerlegen und die überlieferte Dokumentation von regimekritischen Schriften durch die NSDAP und ihre Apparate, die sich im erwähnten Bestand 56 V niederschlägt, setzt erst 1933/1934 ein.137 Stutzig macht allerdings, daß in den Fragebögen der Militärregierung, die Theanolte Bähnisch anläßlich ihrer beantragten Zulassung zur Verwaltungsrechtsrätin in Hannover sowie anläßlich der angestrebten Aufnahme ihrer Tätigkeit als Vizeregierungspräsidentin in Hannover ausfüllen mußte, auf die Frage nach verfaßten Artikeln oder herausgegebenen Publikationen keine solchen eingetragen sind.138 Auch die nachweislich von Bähnisch verfaßten Artikel zur Berufstätigkeit verheirateter Ärztinnen finden hier keine Erwähnung. Den in anderen Zusammenhängen erwähnten ‚Freiheitsverlag‘ erwähnte sie in den Fragebögen der Militärregierung nicht, obwohl in den Bögen explizit nach ‚Veröffentlichungen aller Art‘ gefragt wurde. Die in verschiedenen Lebenszeugnissen und Zeitungsberichten erwähnte, unentgeltliche oder kaum entlohnte Arbeit für rassisch Verfolgte, die sie ihren Angaben zufolge im Rahmen ihrer Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrätin geleistet hatte, schmückte sie in den Fragebögen nicht weiter aus, sondern sie beschränkte sich auf die Angabe, daß ihre Arbeit „antinazistisch“ gewesen sei.139 Dieses Verhalten verwundert vor allem deshalb, weil sich Bähnisch, die 1946 im öffentlichen Dienst des neu gebildeten Landes Niedersachsen arbeiten wollte, durch den Nachweis solcher Aktivitäten noch stärker für eine Mitarbeit am demokratischen Wiederaufbau des Landes hätte empfehlen können. Selbstverständlich kann das beschriebene Verhalten verschiedene Gründe haben, es könnte aber ein Anzeichen dafür sein, daß Bähnisch eine Prüfung dieser an anderen Stellen gemachten Angaben durch die Militärregierung vermeiden wollte. Die Entlarvung von Falschaussagen im Fragebogen hätte scharfe, eventuell gar vernichtende Konsequenzen für ihre Karriere nach sich gezogen. (Dies zumindest machten die Besatzungsbehörden zu jener Zeit glauben.) Im tabellarischen Lebenslauf, der ihrer Personal-Akte beiliegt, ist die ‚antinazistische‘ Tätigkeit ausführlicher beschrieben, hier heißt es, daß sich die Verwaltungsjuristin von 1933 bis 1945 gemeinsam mit dem Ehemann als „Verwaltungsrechtsrat“ betätigt und sich „der rassisch und politisch Verfolgten in besonderer Weise angenommen“140 habe. Ihr Mann habe, so heißt es in einer Bähnisch zugeordneten Notiz, die im Privatnachlaß überliefert ist, „ausschließlich abgesetzte und von den Nationalsozialisten verfolgte Republikaner“141 vertreten und dabei eng mit Dr. Rudolf Bleistein, dem Leiter einer jüdischen Organisation der offenbar Buch-
137 Einleitung, in: Bundesarchiv (Hrsg.): Findbuch Reichsschrifttumskammer, R 56 V, bearb. v. Wolfram Werner und Tim Storch, Koblenz 1987 (2006), auf: http://www.argus.bundes archiv.de/R56V-18940/rightframe.htm?vid=R56V-18940, am 21.10.2013. 138 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Fragebogen der Militärregierung, 20.02.1946. 139 Ebd. 140 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Tabellarischer Lebenslauf. 141 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Notizen der Frau Regierungspräsidentin a. D., Th. Bähnisch, Verwaltungsrechtsrat (Fachanwältin für Verwaltungssachen) aus Köln am Rhein [1945].
396 | The anolte Bähnisch
Illustrator, beziehungsweise Gebrauchsgraphiker war, zusammengearbeitet. Sie, Theanolte, habe Bleistein 1935 in seinem Exil in New York aufgesucht.142 Daß die Juristin gegenüber den Briten allgemein in einigen Aspekten näher an dem blieb, was ihr Leben, dem derzeitigen Forschungsstand nach zu urteilen, im Dritten Reich wesentlich prägte, zeigt auch ein auf Englisch verfaßter Lebenslauf143, der Bähnischs Unterlagen für die geplante Reise nach Großbritannien 1946 beiliegt. Darin erwähnte sie die Stellung ihres Mannes als „Direktionssekretär“ bei der EHAPE, die sie wiederum als „one-price-business like WOOLWORTH“144 charakterisiert. In dieser Version ihrer Erinnerungen ist es allerdings das ‚ausgehöhlte Recht‘ im Dritten Reich, welches dazu führte, daß Albrecht Bähnisch seine Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrat frustriert niederlegte145 und nicht etwa die Unmöglichkeit, in Berlin als Verwaltungsrechtsrat Fuß zu fassen, die seine Tochter Orla-Maria Fels als Grund für die berufliche Umorientierung ihres Vaters angibt.146 Die Frage, ob eine Mitgliedschaft in einer Widerstandsorganisation bestanden habe, beantwortete Bähnisch im Fragebogen, den sie für ihre Tätigkeit in Hannover ausfüllen mußte, mit „ja […] Gruppe Ernst von Harnack […] [seit] 1939“.147 In einem Fragebogen der Militärregierung, den sie 1945 ausfüllte, gab sie an, seit 1939 Mitglied der „SPD-Kampfgruppe“148 gewesen zu sein. In einer 1945 verfaßten Notiz stellt sie ihre Arbeit im Widerstand sogar explizit in den Zusammenhang mit einem geplanten Attentat auf Hitler, welches jedoch gescheitert sei und schließlich zum „20. Juli 1944“149 geführt habe. Auf die Frage „wurden Sie jemals aus rassistischen oder religiösen Gründen oder weil Sie aktiv oder passiv den Nationalsozialisten Widerstand leisteten, in Haft genommen oder in Ihrer Bewegungs- oder Niederlassungsfreiheit oder sonstwie in Ihrer gewerblichen oder beruflichen Freiheit be-
142 Ebd. 143 DFR-Archiv, A3, Curriculum vitae of Frau Regierungspräsident Theanolte Bähnisch, o. D. [1945/46]. 144 Ebd. 145 „[M]y husband could not hear [!- gemeint ist vermutlich “bear”] the legal practice of a larger [! – gemeint ist wohl “lawyer”] any more, as he saw how the very meaning of law and Justice was being dissolved”, schreibt Theanolte Bähnisch. Ebd. Wie an anderer Stelle ebenfalls erwähnt, war Albrecht Bähnisch immerhin 1936 Mitglied des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen gewesen. BArch, NS 16, Nr. 112. Eine Pflicht zur Mitgliedschaft im NS-Rechtswahrerbund, wie der Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen später hieß, bestand nicht. Nicht-Mitglieder hatten allerdings mit beruflichen Nachteilen zu rechnen. Zu den Hintergründen vgl.: Sunnus, Michael: Der NSRechtswahrerbund (1928–1945). Zur Geschichte der nationalsozialistischen Juristenorganisation, Frankfurt a. M. 1990. 146 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. 147 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc 75/88, Military Government of Germany, Fragebogen. 148 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Fragebogen der Militärregierung, 20.02.1946. 149 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Notizen der Frau Regierungspräsidentin a. D., Th. Bähnisch, Verwaltungsrechtsrat (Fachanwältin für Verwaltungssachen) aus Köln am Rhein [1945].
Familienleben | 397
schränkt?“, antwortete sie in dem ihrer Personalakte beiliegenden Fragebogen mit „nein/mein Mann“150. Dies kann, muß jedoch nicht als Widerspruch zu ihrer Aussage in einem Schreiben an die SPD bewertet werden, in dem sie angibt, man habe ihr bei der Gestapo mehrfach gedroht, daß sie das Gebäude nicht mehr verlassen werde.151 Ihrem englischen Lebenslauf zufolge hatte sie im „underground movement“ gewirkt, bis Anzeige gegen sie beim Reichsgericht erhoben worden sei. „The matter went reasonably well“, führt sie aus, denn Reichsgerichtsrat Hans Dohnanyi, der im Widerstand organisiert war, habe die Anzeige gegen sie entgegengenommen. „When I was denounced, I was withdrawn from work“152, beschreibt sie das Ende ihrer aktiven Zeit im Widerstand in jenem Lebenslauf sehr ungenau. Da Dohnanyi153im November 1941 aus seinem Amt schied, kann Bähnisch, folgt man ihren Aussagen, längstenfalls von September 1939154 bis zu diesem Zeitpunkt – also gut zwei Jahre lang – im ‚Untergrund‘ gearbeitet haben. In einem Zeitungsartikel heißt es über die Regierungspräsidentin Bähnisch sogar, sie habe mit dem Ministerialbeamten Globke im Reichsministerium des Innern „unverdrossen über die Schicksale von rassisch und politisch Verfolgten“ verhandelt.155 Daß der Artikel von ihr autorisiert wurde, ist, da ihm kein Interview zugrunde zu liegen scheint, eher unwahrscheinlich. Aus einer anderen Quelle geht jedoch hervor, daß Bähnisch und der Verfasser des Kommentars zu den Nürnberger Rassegesetzen sich kannten und schätzten.156 Pater Laurentius Siemer, Provinzial des Klosters Walberberg behauptet gar eine Zusammenarbeit Bähnischs und Globkes bei der Erstellung des Kommentars zu den Rasse-Gesetzen, einer Arbeit, die – so wird Siemers zi-
150 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Military Government of Germany, Fragebogen, Seite 9. 151 AdSD, Personalia 480 [Theanolte Bähnisch], Zum Material der Leistungen von weiblichen Mitgliedern der SPD während der Hitlerherrschaft. Frau Bähnisch teilt dazu folgendes mit, o. D. 152 DFR-Archiv, A3, Curriculum vitae of Frau Regierungspräsident Theanolte Bähnisch, o. D. [1945/46]. 153 Dohnanyi, 1902 in Wien geboren, wurde im April 1945 aufgrund seiner Beteiligung am Widerstand und dem Hitler-Attentat am 20.07.1944 im KZ Sachsenhausen nach einem Standgerichtsverfahren hingerichtet. 154 Begonnen habe sie ihre Arbeit „shortly after the outbreak of the war“, so Bähnisch. DFR-Archiv, A3, Curriculum vitae of Frau Regierungspräsident Theanolte Bähnisch, o. D. [1945/46]. 155 O. V.: Theanolte Bähnisch, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 23.04.1964. Zur Zeit der Entstehung des Artikels war Globke, der Staatssekretär unter Adenauer wurde, eine stark umstrittene Figur. 156 Archiv der christlich-demokratischen Politik (ACDP), Bonn, I–070–120/2, Theanolte Bähnisch an Globke, 26.03.1946. Nicht eingesehen, angeführt von Lommatzsch: Globke, S. 69, S. 362. Globke soll sie dazu angehalten haben, Berlin zu verlassen, wofür Bähnisch sich in diesem Brief dankbar zeigte.
398 | Theanolte Bähnisch
tiert – „die Juden vor der Willkür der Nazirichter“157 habe schützen sollen. Der Globke-Biograph Erik Lommatzsch bezeichnet jene Aussage allerdings zu Recht als „vage“158. An der Stelle des Fragebogens, an der sie über ihre Auslandsaufenthalte Auskunft geben soll, gab Bähnisch an, daß sie 1939 eine Reise nach Italien und Tripolis zur „Erholung verbunden mit pol.[itischen] Beobachtungen gegen den Nationalsozialismus“159 unternommen habe. Was hiermit genau gemeint ist, bleibt unklar. An derselben Stelle schreibt sie, daß sie im April 1935 zu „Umschau nach einer neuen Existenz“ nach „Amerika“ gereist sei.160 Außerdem habe sie dort „alte jüdische Mandanten“161 besucht. Mehr Aufschluß über die Zusammenhänge könnten vielleicht die Briefe geben, die Theanolte und Albrecht Bähnisch austauschten, wenn einer der Ehepartner sich nicht dauerhaft in Köln befand. Doch jene Briefe sind zur Benutzung für wissenschaftliche Zwecke – aus verständlichen Gründen – durch das Ehepaar Fels nicht freigegeben worden.162 Insgesamt fällt auf, daß in den recht ausführlichen Lebenserinnerungen Theanolte Bähnischs, welche sie ihrer Tochter Orla-Maria Fels zufolge um 1972 diktiert hatte, die Jahre 1930 bis 1945 überhaupt keinen Niederschlag gefunden haben. Fels hält es für möglich, daß es handschriftliche Notizen über die Jahre gegeben hat, welche nicht, wie die anderen, kapitelweise abgefaßten Erinnerungen, diktiert wurden.163 Dies erscheint insofern plausibel, als Theanolte Bähnisch 1973 relativ überraschend starb.164 Vielleicht hatte sie an jenem Kapitel länger feilen wollen als an den anderen und es schließlich nicht mehr geschafft, einen strukturierten Überblick über die entsprechenden Jahre in eine endgültige schriftliche Form zu bringen. Möglich ist auch, daß sie das entsprechende Kapitel ganz auslassen wollte, um einen fließenden Übergang zwischen ihrer Tätigkeit in der Verwaltung in der Weimarer Republik und in der Bundesrepublik zu ermöglichen. Für diese Interpretation spricht beispielsweise, daß die Einleitung zu ‚Teil II‘, den sie – ein deutliches Zeichen für die Wahrnehmung des Jahres als wesentliche Zäsur – 1945 beginnen läßt, Bezug nimmt auf die letzten als ‚Teil I‘ überlieferten Seiten. Denkbar ist auch, daß es ein diktiertes Kapitel über den Nationalsozialismus gegeben hat, das – aus welchem Grund auch immer –
157 Siemers, zitiert nach Lommatzsch, Erich: Hans Globke (1898–1973). Beamter im Dritten Reich und Staatssekretär Adenauers, Frankfurt a. M./New York, 2009, S. 69. 158 Bähnisch habe sich, so soll Siemer geschrieben haben, an ihn gewandt, um bei ihrer Partei die Einstellung der Kampagne gegen Globke zu erwirken. Vgl.: Lommatzsch: Globke, S. 69. Siemer zitiert nach Lommatzsch, ebd. Tatsächlich hatte Bähnisch Globke 1946 Hilfe bei der Stellensuche angeboten. ACDP, Bonn,I–070–120/2, Theanolte Bähnisch an Globke, 26.03.1946. Nicht eingesehen, angeführt von Lommatzsch: Globke, S. 69, S. 362. 159 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Fragebogen der Militärregierung, 05.08.1945, S. 4. 160 Ebd. 161 Ebd. 162 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. 163 Ebd. 164 Ebd.
Familienleben | 399
nicht überliefert ist. Die Seitenzählung von ‚Teil II‘ beginnt jedenfalls wieder mit ‚Seite 1‘, so daß aus der Zählung allein nicht auf eine ‚Lücke‘ geschlossen werden kann.165 4.2.3.2 Bähnisch als Vertraute von Widerstands-Aktivisten Der Regierungspräsident Ernst von Harnack, auf den sich Theanolte Bähnisch bezieht, wenn sie ihre Arbeit im Widerstand gegen die Nationalsozialisten erwähnt, wurde von den Nationalsozialisten als Beteiligter am Attentat auf Hitler am 20.06.1944 festgenommen und zusammen mit anderen Gegnern Hitlers hingerichtet. Überlieferte Briefe Agnes von Harnacks, der Schwester Ernst von Harnacks an Ina Seidel, eine gemeinsame Freundin der von Harnacks und der Bähnischs, verdeutlichen, wie sehr die Gefangennahme Ernst von Harnacks die Familie quälte – zumal auch andere Familienmitglieder betroffen waren.166 Die Netzwerke im Widerstand waren teilweise weitläufig, teilweise aber auch sehr eng gespannt. So waren viele der Verschwörer des ‚20. Juli‘ miteinander verwandt: Arvid und Ernst von Harnack, Klaus und Dietrich Bonhoeffer sowie Hans von Dohnanyi, allesamt Köpfe des Widerstands, waren Cousins. Sie alle wurden, nachdem man ihre Beteiligung am Widerstand aufgedeckt hatte, ermordet. Der Freund und ehemalige Kollege der Bähnischs, Adolf Grimme, mit dem Theanolte ihrer Tochter Orla-Maria zufolge während des Krieges eine enge Verbindung pflegte167, wurde ebenfalls angeklagt und entging dem gleichen Schicksal nur knapp. Sollte Theanolte tatsächlich in der Gruppe um Ernst von Harnack tätig gewesen sein, dürfte auch sie die Verfolgung durch die Nationalsozialisten gefürchtet haben. Ernst von Harnacks Gruppe wird als eine von verschiedenen Untergruppen der ‚Roten Kapelle‘ zugeordnet. Eine bekannte Aktivistin der ‚Roten Kapelle‘, Elfriede Paul (KPD), erinnert an eine Zusammenarbeit mit Theanolte Bähnisch nach 1945 und verknüpft diese Erinnerung mit der Kontinuität von Kontakten zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten von der gemeinsamen Inhaftierung aufgrund von Widerstandsaktivitäten bis in die Nachkriegszeit. Daraus ließe sich schließen, daß Paul Bähnischs Angabe, im Widerstand um von Harnack tätig gewesen zu sein, bestätigt. Aber auch eine andere Interpretation ist möglich, nämlich, daß Paul Bähnisch eher zufällig als Beispiel für eine ihr bekannte Sozialdemokratin nannte, mit der sie – wie mit anderen Sozialdemokraten im Dritten Reich – in der Nachkriegszeit zusammengearbeitet hatte. Die entsprechende Aussage Pauls findet sich bereits in einem Manuskript Pauls zu ihren Erinnerungen an ihre Zeit im Widerstand, die später unter dem Titel ‚Ein Sprechzimmer der Roten Kapelle‘ 1953 erschienen. Im Manuskript schreibt Paul: „In dieser Anfangszeit der Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens bestanden auf Kreis- und Bezirksebene zwischen uns Kommunisten und den Genossen der SPD enge Kontakte. Nicht anders als in der Haft. Zum Beispiel gründeten wir gemeinsam die Frauenfriedensfront; die SPD-Genossin Thea Nolte-Bähnisch – sie war zudem Mitglied des Landtages – übernahm den Vorsitz, ich war ihre Stellver-
165 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972]. 166 DLA, A: Seidel, Briefe an, HS003636823. 167 Ebd.
400 | Theanolte Bähnisch
treterin.“168 Pauls Erinnerung, daß Theanolte Landtagsmitglied gewesen sei, trügt allerdings und von der gemeinsamen Gründung einer ‚Frauenfriedensfront‘ hätte Bähnisch vermutlich auch nicht gesprochen, denn die organisierte Zusammenarbeit der beiden Frauen fand im ‚Club deutscher Frauen‘ statt. Bähnisch sprach, anders als Paul, die ihre Publikation in der DDR veröffentlichte, nie von der ‚Roten Kapelle‘, sondern immer nur von der Gruppe ‚Ernst von Harnack‘ als ihrem Bezugspunkt und Wirkungskreis. Vermutlich liegt dies darin begründet, daß die ‚Rote Kapelle‘ auch kommunistische Gruppierungen umfaßte und deshalb nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Westdeutschland stark in der Kritik stand. Von Seiten kommunistischer Kreise in der Roten Kapelle waren der Sowjetunion nämlich Informationen über die deutsche Politik übermittelt worden, was der Gruppe den Vorwurf des ‚Landesverrats‘ und der ‚Ost-Spionage‘ eingebracht hatte. Mit der ‚Roten Kapelle‘ in Verbindung zu stehen, erhöhte deshalb in westdeutschen, bürgerlichen Kreisen nicht gerade das Ansehen der eigenen Person, was wohl als Grund dafür zu sehen ist, daß die ‚Rote Kapelle‘, die nach ihren Hauptakteuren auch ‚SchulzeBoysen/Harnack-Gruppe‘169 genannt wurde, in Theanolte Bähnischs Sprachgebrauch keinen Eingang fand. In der DDR hat der erklärte Antifaschismus der Roten Kapelle zu einer dichten Erforschung des Phänomens geführt, die jedoch ebenfalls nicht ohne ideologisch instrumentalisierte Deutungen auskommt.170 Insgesamt ist die Dominanz kommunistischer Kreise in der Gruppe, sei es, um ihre Arbeit zu würdigen, sei es, um die Aktivisten zu diffamieren, über Jahrzehnte als zu hoch eingeschätzt worden. Jüngere Forschungen relativieren diese Einschätzungen,171 so daß sich langsam eine von den älteren Darstellungen abweichende Charakterisierung der Gruppe auch in Arbeitendurchsetzt, die für eine breitere Öffentlichkeit gedacht sind. „Ministerialbeamte und Wehrmachtsbedienstete gehörten ebenso zur Schulze-Boysen/HarnackGruppe wie Künstler und Arbeiter, gläubige Christen und Liberale genauso wie Jungkommunisten wie Hans Coppi und Hilde Coppi oder Walter Husemann (1909– 1943)“ beschreibt das vom Deutschen Historischen Museum betriebene OnlinePortal LEMO die Gruppenzusammensetzung treffend.172 Der Kontakt der Gruppen untereinander war eher lose und informell.173 Außerdem – und dies ist nun wiederum in Bezug auf Theanolte Bähnisch besonders wich-
168 BStU Zentralarchiv, MfS, HA IX/11, SV 23/80, Manuskript, Bd. 5, S. 254. 169 Die Benennung erfolgte nach Harro Schulze-Boysen und Arvid von Harnack, dem Cousin Ernst von Harnacks. 170 Vgl.: Biernat, Karl-Heinz: Die Schulze-Boysen-Organisation im antifaschistischen Kampf, Berlin 1970. 171 Vgl. dazu beispielsweise: Roloff: Kapelle, S. 146 sowie Nelson: Kapelle. 172 Die Rote Kapelle, auf: http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/widerstand/rotekapelle/, am 24.10.2013. 173 Vgl. dazu neben den oben angegebenen Titeln auch folgende Kurzdarstellungen: Überschär, Gerd R.: Für ein anderes Deutschland – Der deutsche Widerstand gegen den NSStaat 1939–1945, Frankfurt a. M. 2006, S. 139; Benz, Wolfgang/Pehle, Walter H.: Lexikon des deutschen Widerstands, Frankfurt a. M. 2004, S. 284.
Familienleben | 401
tig – pflegte die Rote Kapelle Kontakte zu anderen Widerstandskreisen.174 Die Fähigkeit, verschiedene Widerstandsgruppen zusammenzuführen, ist eine Eigenschaft, die Peter Grassmann explizit Ernst von Harnack zuschreibt.175 Ernst von Harnack scheint, ganz im Gegensatz zu seinem Vetter Arvid von Harnack, eher in der Peripherie der Roten Kapelle gestanden zu haben. Zwar findet sich sein Name in der einschlägigen Literatur zur Roten Kapelle immer, doch werden in diesem Zusammenhang meist Verbindungen zu anderen Kreisen und Persönlichkeiten des Widerstands, zu denen die ‚Rote Kapelle‘ Kontakt hatte, aufgezeigt. Der Darstellung Grassmanns zufolge hatte Ernst von Harnack für Hans von Dohnanyi und den General Oster die Verbindung zur politischen Linken und zu den Gewerkschaften herstellen sollen.176 Insgesamt schien der ehemalige Regierungspräsident von Merseburg also eher eine koordinierende Funktion im Widerstand gehabt zu haben. Dazu paßt wiederum Bähnischs Aussage, sie sei als Verbindungsfrau und Nachrichtenübermittlerin für von Harnack aktiv gewesen.177 Auch der Freund Bähnischs, Adolf Grimme, schien eine eher koordinierende Funktion im Widerstand gehabt zu haben. Er soll die Verbindung zwischen dem antifaschistischen Zirkel Adam Kuckhoffs und der Bekennenden Kirche gehalten und diese Kreise mit Flugblättern des jeweils anderen Kreises versorgt haben.178 Theanolte Bähnischs Name hat in die bisher erschienene Literatur über die Rote Kapelle keinen Eingang gefunden.179 Doch belegen Briefwechsel, daß sie sich mit einigen Protagonisten der Gruppe, nachweislich mit Adolf Grimme und Elfriede Paul austauschte, wobei unklar ist, ob letzerer Kontakt bereits vor 1945 bestand. Daß auch nach dem Weggang des Paares aus Berlin der Kontakt zu Ernst von Harnack bestehen blieb, ist wahrscheinlich. Ferdinand Friedensburg bezeichnet Ernst von Harnack in einem Brief an Bähnisch immerhin als einen „gemeinsame[n] Freund“180. Läßt sich eine aktive Beteiligung Bähnischs am Widerstand also nicht nachweisen, so steht doch außer Frage, daß einige von denen, die im Widerstand organisiert waren, mit Bähnisch gut bekannt oder gar befreundet waren – und zwar schon in den 1920er und 1930er Jahren. In den meisten Fällen resultierten diese Kontakte aus dem Be-
174 Vgl. dazu neben den genannten Werken auch Danyel, Jürgen: Die Rote Kapelle innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung, in: Coppi junior, Hans/Danyel, Jürgen/Tuchel, Johannes (Hrsg.): Die Rote Kapelle im Widerstand gegen Hitler, Berlin 1992, S. 12–38. 175 Vgl.: Grassmann, Peter: Sozialdemokraten gegen Hitler, München 1976, S. 47. 176 Vgl.: ebd., S. 48. 177 Siehe Kapitel 4.2.3.1. 178 Vgl.: Griebel/Coburger/Scheel: Gestapo-Album, S. 202. 179 Insgesamt hat die Erforschung des Engagements von Frauen im Widerstand allgemein sowie in der Roten Kapelle im Besonderen zugenommen. Beispielsweise wurden die Rollen Mildred Harnacks und Eva Maria Buchs in der Roten Kapelle erforscht. Vgl.: BlairBrysac: Hitler; Schilde, Kurt: Eva-Maria Buch und die Rote Kapelle, Berlin 1992. Vgl. auch: Wickert: Frauen. 180 BArch, N 1114, Nr. 27, Ferdinand Friedensburg an Theanolte Bähnisch, 23.04.1946. Nicht auszuschließen ist allerdings, daß jene Aussage (auch) politisch motiviert war und Friedensburg Bähnisch damit einen Gefallen tun wollte.
402 | Theanolte Bähnisch
rufsumfeld der Bähnischs beziehungsweise der Noltes. Einem Brief Adolf Grimmes an Theanolte Bähnisch zufolge muß diese vor allem mit Josefine Grimme gut befreundet gewesen sein.181 Ernst von Harnack und seine Familie kannten die Bähnischs über das Regierungspräsidium Merseburg, beziehungsweise über die SAG, in der sich die Schwestern Ernst von Harnacks, Elisabeth und Agnes von Harnack engagierten. „The friendly personal bounds between our two families were now being strengthened by political work“182, schreibt Bähnisch in ihrem englischen Lebenslauf über die ersten Kriegsjahre. Die Antwort Grimmes auf einen Brief, in dem ihn Theanolte Bähnisch bittet, ihr Auskunft über das Schicksal der Personen „aus dem alten politischen Freundeskreis“183 zu geben, ist leider nicht überliefert. So bleibt unklar, auf welche Personen genau ihre Frage abzielte. Grimmes eigenes Vertrauen in die Freundin ging jedenfalls so weit, daß er sie 1947 sogar mit der Vertretung seines Amtes als Kultusminister Niedersachsens betrauen wollte und ihr damit die Möglichkeit eröffnete, entscheidenden Einfluß auf die für den Aufbau der Demokratie so wichtigen Bildungseinrichtungen zu nehmen.184 Zweifel an ihrer politischen Loyalität kann Grimme also nicht gehabt haben. Außer Zweifel steht ebenfalls, daß die spätere Regierungspräsidentin dem Nationalsozialismus immer ablehnend gegenübergestanden hat. Ihre Briefe an Ilse Langner, die auch eine Freundin Grimmes war, sprechen eine deutliche Sprache.185 Daß Bähnisch sich allerdings im Februar 1946 genötigt sah, gegenüber einem ehemaligen Mitarbeiter des Reichssippenamtes, Friedrich Knost, im Rahmen eines Briefs, der Knost als ‚Persilschein‘ dienen sollte, ihre eigene „fanatisch antifaschistisch[e]“186 Haltung zu betonen, wirkt wiederum, zumal in einer Zeit, in der allenthalben ‚Entlastungsschreiben‘ dieser Art ausgetauscht wurden, konstruiert. In jenem Schreiben, von dem Knost „bei allen Behörden Gebrauch machen solle“, bescheinigt Bähnisch, daß Knost „die nazistischen Tendenzen und Massnahmen in rassepolitischer Hinsicht mit großem Mute sabotiert“ habe. „Das weiß niemand besser als ich, da ich viele Juden und Mischlinge bei ihrem Amte vertreten habe. Ich gedenke
181 „Ich wäre in diesen Jahren gerne viel, viel mehr mit Ihnen zusammen gewesen, weil ich immer wieder berührt gewesen bin von der Gemeinsamkeit in der Sache und im Menschlichen. Ich denke vor allem auch immer dankbar daran zurück, was sie Josefine gewesen sind. Sie waren uns eine wirkliche Freundin“ schrieb Grimme an Bähnisch, als er 1948 von Hannover nach Hamburg zog und bedauerte, sich mit Bähnisch „nicht mehr in geographisch so naher Verbindung zu wissen.“ GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Adolf Grimme an Theanolte Bähnisch, 16.12.1948. 182 DFR-Archiv, A3, Curriculum vitae of Frau Regierungspräsident Theanolte Bähnisch, o. D. [1945/46]. 183 GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Theanolte Bähnisch an Adolf Grimme, 23.12.1945. Der einzige Name, den Bähnisch im Schreiben selbst nennt, ist der Ernst von Harnacks. 184 GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Theanolte Bähnisch an Adolf Grimme, o. D. [ca. Juli 1947 laut Vermerk von unbekannt]. 185 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34. 186 BArch, N 1114, Nr. 26, Theanolte Bähnisch an Friedrich Knost, 14.02.1946.
Familienleben | 403
heute noch mit grosser Dankbarkeit ihrer Mithilfe, Juden dadurch vor dem KZ zu retten, dass sie zu Mischlingen gemacht wurden.“ Mit dem Satz „Wir alle die wir jüdische Interessen vertraten“ nutzt sie das Schreiben auch um sich selbst als Mitglied einer Gemeinschaft der Widerständigen darzustellen. Sie zögert nicht, zu betonen, daß sie „an 2 Verschwörungen teilgenommen“187 habe. Wie Hans Globke hatte auch Knost einen Kommentar zu den Nürnberger Gesetzenverfaßt188 und wie Globke argumentierte auch Knost nach 1945, er habe den Juden mit seiner Arbeit nutzen wollen.189 Der ehemalige Assessor Friedensburgs, Knost, der 1933 in die NSDAP eingetreten war, wurde 1948 als Entlasteter eingestuft und 1950 zum Regierungsdirektor im Land Niedersachsen ernannt. Später war er Regierungsvizepräsident des Bezirks Stade, dann – nach Grimmes Weggang – Mitarbeiter im Kultusministerium. Weitere hohe Ämter sowie das Bundesverdienstkreuz folgten. 4.2.3.3 Der Widerstand in der Familienerinnerung Für die Familienerinnerung spielt die Rolle Theanolte Bähnischs im Widerstand mitsamt den Gefahren, die mit einer solchen Aktivität zusammenhingen, eine zentrale Rolle. Orla-Maria Fels erzählt: „Ich war damals, als meine Mutter mir zum ersten Mal erzählte, daß mein Vater und sie im Widerstand gegen die herrschende Regierung sind […] vielleicht acht Jahre alt. Ich habe das sehr gut verstanden, denn sie hat mir sehr deutlich gesagt ‚ich habe zu Dir Vertrauen aber ich kann es nur haben, wenn Du eisern den Mund halten kannst. Du darfst mit niemand und nicht mit Deiner innigsten Freundin je ein Wort darüber sprechen.‘ Und so war es, davon konnte das Leben abhängen, nicht?“ Während des Gesprächs beschrieb Fels mehrmals die Gefahr, die für ihre Mutter bestanden habe: „sie hat immer nur gesagt, daß man höchst geheim […] möglichst nicht am Telefon, […] möglichst nicht schriftlich, sondern immer nur persönlich … weitergegeben hat … Nachrichten-Informationen, da ist jemand der Hilfe braucht oder kann man da einspringen oder – also das wurde möglichst …. wirklich subversiv, das war ja lebensgefährlich.“190 Auf die Frage nach dem konkreten Gegenstand der Widerstands-Arbeit ihrer Mutter, berichtet Fels, ihre Mutter habe Juden bei der Emigration geholfen – eine Handlung, die man auch Ernst von Harnack zuschreibt. Fels zufolge hat Theanolte Bähnisch ihren Kindern den Inhalt dieser Arbeit mit folgenden Worten erklärt: „weißt Du, unter dieser Regierung wird nur anerkannt, wer Arier ist. Und wer keine arische Großmutter hat, kann in große Gefahr kommen. Ich helfe Menschen, eine arische Großmutter zu finden. Und bei uns in der Familie hieß es immer, sie hatte Juden geholfen, indem sie ihnen auch die Ausreise zum Teil ermöglicht hat, indem arische Großmütter erfunden wurden. […] Durch Fälschung von … gefälschte Ab-
187 Ebd. 188 Vgl.: Knost, Friedrich August/Lösener, Bernhard: Die Nürnberger Gesetze über das Reichsbürgerrecht und den Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre nebst den Durchführungsverordnungen sowie sämtlichen einschlägigen Bestimmungen und den Gebührenvorschriften, Berlin 1936. 189 BArch, N 1114, Nr. 26, Friedrich Knost an Ferdinand Friedensburg, 15.04.1946. 190 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009.
404 | Theanolte Bähnisch
schriften von Kirchenbüchern.“191 Fels erzählt, daß sich im Nachlaß ihrer Mutter ein Judenstern befunden habe, den ihr eine Jüdin als Zeugnis ihrer Dankbarkeit für die Hilfe bei der Ausreise überreicht habe.192 Daß sie Menschen bei der Auswanderung behilflich gewesen sei, erwähnt Theanolte Bähnisch selbst lediglich in einer Notiz, die in ihrem Privatnachlaß überliefert ist.193 Auch die oben zitierten Äußerungen gegenüber Friedrich Knost lassen sich in diesem Sinne deuten. Von der Anerkennung dieser Arbeit durch einen geschenkten Judenstern – ein hochgradig symbolträchtiger Vorgang194 – berichtete Bähnisch in den überlieferten und für die Forschung zugänglichen Selbstzeugnissen nichts.
4.3 NEUE CHANCEN UND PFLICHTEN FÜR DEN LANDRAT A. D. – FRUSTRATION UND EINSAMKEIT AUF DER SEITE SEINER FRAU: DAS LEBEN IN KÖLN AB 1935 4.3.1 Albrechts Karriere in einem ‚kriegswichtigen Unternehmen‘ Albrecht Bähnischs Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrat erwies sich, so schätzt es seine Tochter ein, aufgrund fehlender Mandanten als nicht besonders lukrativ. Die Aussage Orla-Maria Fels‘, er habe als Anwalt nicht Fuß fassen können, stützt die Wahrnehmung, daß die Praxis der Bähnischs mehr Zu-als Hauptverdienst war, und vielleicht nicht zuletzt dazu diente, zumindest partiell noch dem ‚alten‘ Berufsprofil verbunden bleiben zu können. Als ein Freund ihm im März 1935 eine Stellenanzeige zusandte195, schien Albrecht bereits offen für neue Inhalte gewesen zu sein: Er bewarb sich bei der Westdeutschen Kaufhof AG um die ausgeschriebene Stelle des Direktions-Assistenten in Köln und konnte die Verantwortlichen von seiner Person überzeugen. Welche Gründe er in seiner Bewerbung für den gewünschten Berufswechsel nannte, erwähnt Hans Heino Fels, der über die Zusammenhänge berichtet196 leider nicht.
191 Ebd. 192 Ebd. 193 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Notizen der Frau Regierungspräsidentin a. D., Th. Bähnisch Verwaltungsrechtsrat (Fachanwältin für Verwaltungssachen) aus Köln a. Rhein [1945]. 194 Beispielsweise machte Solomon Passy, der derzeitige bulgarische Außenminister und OSZE-Vorsitzende im Jahr 2004 Joschka Fischer als Anerkennung seiner Arbeit gegen den Antisemitismus den Judenstern seines Großvaters zum Geschenk. 195 Hans Heino Fels zufolge ließ sich die Identität dieses Freundes nicht klären. Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 9. 196 Vgl.: ebd.
Familienleben | 405
Schon ab dem 23. April 1935 stand Albrecht Bähnisch bei der EHAPE unter Vertrag197 und arbeitete damit für eine Tochterfirma jenes Unternehmens, das einst Leonhard Tietz mit einem Textilwarenhaus 1879 in Stralsund begründet hatte. Unter dem Dach der 1905 gegründeten ‚Leonhard Tietz AG‘ waren bis 1929 insgesamt 43 Kaufhäuser eröffnet worden. Zusätzlich verwaltete die AG eigene Hersteller-Firmen in verschiedenen Branchen. In Köln, wohin die Tietz AG noch vor der Jahrhundertwende und der Gründung der Aktiengesellschaft ihren Firmensitz verlagert hatte, erwirtschaftete die Gesellschaft, die mit einem Jahresumsatz von etwa 350 Millionen Reichsmark die zweitgrößte ihrer Art im Reich war198, ihr Vermögen auch aus der hundertprozentigen Beteiligung an der 1926 gegründeten Untergesellschaft Einheitspreisgesellschaft (EHAPE).199 Im Frühjahr 1933 hatten sich SS-Leute vor den Filialen der Kaufhäuser, auch vor der Kölner Filiale der EHAPE, die Arbeitgeber des just zu dieser Zeit in den einstweiligen Ruhestand versetzten Landrates Bähnisch werden sollte, aufgebaut. Sie hatten zum Boykott des jüdischen Kaufhauses aufgerufen, Mitarbeiter und Kunden des Geschäfts bedroht und letztere öffentlich für ihr Konsumverhalten diffamiert.200 Die Brüder Tietz zogen sich im gleichen Jahr aus dem Unternehmensvorstand zurück, Alfred Tietz wanderte mit seiner Familie über die Niederlande nach Palästina aus.201 Immerhin blieb mit Dr. Otto Baier ein Vertrauensmann der Familie im Vorstand, der 1936 Generaldirektor wurde und die Arisierung des Unternehmens – offenbar in stetiger Absprache mit Tietz, den die Soziologin Gunhild Korfes Baiers Freund nennt, maßgeblich vorantrieb.202 Jenem Dr. Baier, der aufgrund seiner Verbindung zu Tietz Korfes zufolge als ‚Judenknecht‘ galt203, waren 1935 die Bewerbungsunterlagen Albrecht Bähnischs zugegangen, mit ihm hatte er sich offenbar auch zu einem zweiten Gespräch getroffen, bevor er mit dem Vorstandsmitglied des Unternehmens Dr.
197 Vgl.: ebd. Am 21.07.1937 nannte Albrecht Bähnisch dem Oberverwaltungsgericht in Köln als seine neue Adresse die von Groote-Straße in Köln-Marienburg. Die Berliner Anwaltspraxis lief formell unter Albrecht Bähnischs Namen weiter, wurde jedoch, HansHeino-Fels Ausführungen zufolge, von Heinrich Tröger und Theanolte Bähnisch betrieben. Vgl.: ebd., S. 10. Fels beruft sich auf einem Brief Albrecht Bähnischs an seine Schwägerin Irmgard Nolte vom 07.05.1935, der im Familiennachlaß überliefert ist. Am 01.10.1935, nach bestandener Probezeit, folgte Hans Heino Fels zufolge der ‚Familienumzug‘ nach Köln. Die Haushälterin Lisbeth blieb in Berlin. In Köln wechselte die Familie weitere zweimal den Wohnort. Vgl.: ebd., S. 10. 198 Vgl.: Bopf: Arisierung, S. 88. 199 Zur Geschichte der Kaufhof AG vgl.: Fuchs: Kaufhof. Vgl., insbesondere zu den Vorstandsmitgliedern, auch: O. V.: Warenhäuser. Alles für Frau Piesecke, in: Der Spiegel, 07.01.1953. 200 Vgl.: Fuchs: Kaufhof, S. 84. 201 Vgl: ebd., S. 85–87. 202 Korfes: Kampf, S. 113/114. Zur Arisierung des Kaufhofs vgl. auch Kapitel 5.1.1. 203 Vgl.: ebd., S. 114.
406 | Theanolte Bähnisch
Schulz204, der bereits 1926 der Tietz AG angehörte, zusammengetroffen war.205 Baier war Jahrgang 1896 und hatte Volks- und Staatswissenschaften studiert206 – vielleicht war der nicht näher bekannte Freund, der Albrecht Bähnisch auf die Stelle aufmerksam gemacht hatte207, auch ein Bekannter Otto Baiers. Im Zuge der Arisierung des Unternehmens, die zugleich die Enteignung Tietz‘ bedeutet hatte, war, parallel zu dem im September 1934 abgeschlossenen Umbau in der Führungsriege, auf Druck der neuen Mehrheitsaktionäre Commerzbank, Deutsche Bank und Dresdner Bank208 die Umbenennung der ‚Leonhard Tietz AG‘ in ‚Westdeutsche Kaufhof AG‘ erfolgt.209 Aus der EHAPE sollte, zwei Jahre nachdem der Verwaltungsfachmann Albrecht Bähnisch seine Arbeit im Unternehmen aufgenommen hatte, 1937 die ‚Rheinische Kaufhalle AG‘ werden. Otto Baier konnte zu dieser Zeit gute Zahlen vorweisen, er hatte insofern den Auftrag seines Freundes Tietz, das Unternehmen ‚gesund‘ durch die Arisierung zu führen, erfüllt.210 Zur Zeit des Firmeneintritts von Albrecht Bähnisch lieferte sich die ‚Westdeutsche Kaufhof AG‘ ein Gefecht mit dem ‚Stürmer‘, dem antisemitischen Hetzblatt Julius Streichers. Der ‚Stürmer‘ diffamierte den Kaufhof immer wieder, behauptete, der Vorstand sei nur zum Schein arisiert worden, während im Hintergrund die jüdischen Kaufhaus-Gründer noch immer vom Umsatz profitierten.211 Als großes Warenhaus war die Kaufhof AG ihrer Form an sich nach schon ein Dorn im Auge der Nationalsozialisten, welche sich die Rettung des Einzelhandels auf die Fahnen geschrieben hatten. Das NSDAP-Parteiprogramm hatte in Paragraph 16 sogar das generelle Verbot oder zumindest eine Begrenzung solcher Geschäfte zum Schutz der deutschen Wirtschaft gefordert.212 Als die neuen Machthaber jedoch den wirtschaftlichen und somit auch politischen Nutzen der Warenhäuser für die Verwaltung des Mangels im
204 Zu Schulz vgl.: Boetticher, Karl: Porträt: Werner Schulz. Engagierter Handelsherr, in: Die Zeit, 11.01.1965. 205 Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 9. Fels thematisiert in seinem Porträt Bähnischs die enge Beziehung zwischen Baier und Tietz nicht. 206 Korfes: Kampf, S. 113. 207 Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 9. 208 Vgl.: Schoen, Anke: Deutsche Banken und die Arisierung, in: Aktuell in der Zivilgesellschaft, 15.05.2012, auf: bnr.de, http://www.bnr.de/artikel/aktuell-aus-der-zivilgesellschaft /deutsche-banken-und-die-arisierung, am 24.10.2013. 209 Vgl.: Fuchs: Kaufhof, S. 87. 210 Vgl.: Korfes: Kampf, S. 114. 211 Vgl.: Bopf: Arisierung, S. 91–95. Tatsächlich bestand eine Zusammenarbeit des arisierten Unternehmens mit der von Alfred Tietz und Julius Schloss ins Leben gerufenen ‚Beratungs-Gmbh‘. Vgl.: ebd., S. 94. Das arisierte Unternehmen ging jedoch mit Erfolg gegen die Diffamierung durch den Stürmer vor, das Blatt durfte keine entsprechenden Kommentare mehr drucken. 212 Vgl.: Fuchs: Kaufhof, S. 84.
Familienleben | 407
Krieg erkannten – denn die Warenhäuser verfügten über eine ausgereifte Distributionsroutine – ebbten die Kampagnen ab. 213 Albrecht Bähnisch schien sich in seiner Probezeit im Konzern sehr gut bewährt und mit den „hervorragenden Anlagen und Charaktereigenschaften“214, die ihm sein ehemaliger Chef Ernst von Harnack in einem Referenzschreiben bescheinigt hatte, unentbehrlich gemacht zu haben. Er stieg schnell auf, bereits ab dem 07.07.1936 fungierte er als stellvertretender Betriebsführer der Kette EHAPE, am 27.01.1937, keine zwei Jahre nach seinem Eintritt in das Unternehmen, erfolgte schließlich die förmliche Mitteilung über seine Ernennung zum Prokuristen.215 Bei einer Warenhaus-Kette wie der EHAPE ‚Prokura‘, also eine sehr umfangreiche geschäftliche Vertretungsmacht zu haben, das hieß, einen gewaltigen Vertrauensvorschuß zu genießen und auch eine dementsprechende Verantwortung zu tragen. Da sämtliche Buchhaltungs- und Personalunterlagen des Kaufhofs, trotz ihrer Auslagerung nach Siegen und Lüdenscheid, während des Krieges verlorengegangen sind, ist eine genauere Rekonstruktion der Arbeitsinhalte Albrecht Bähnischs aus Unternehmensakten nicht möglich. Ausführliche Berichte über das Geschäftsgeschehen von Bähnisch an das Aufsichtsratsmitglied Dr. Drescher sind zwar Hans-Heino Fels zufolge im Familienbesitz überliefert216, wurden jedoch nicht zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt. Den Auszügen aus Bähnischs persönlichen Unterlagen, welche Fels im bio-graphischen Porträt seines Schwiegervaters liefert, ist zu entnehmen, daß dem Landrat a. D. die unmittelbare Aufsicht über „die gesamte Geldbewegung von 74 Filialen […] Gehalts- und Lohnabrechnung für ca. 3000 Gefolgschaftsmitglieder. Gesamtes Bürowesen… Revisionen aller Filialen in Kasse und Büro durch 5 unmittelbar unterstellte Revisoren […] Inventurkontrolle […] Rechtsfragen“217 übertragen worden war. Er war zudem für den gesamten Posteingang und -ausgang, den Eingang von circa 2000 Rechnungen pro Tag und für die Verwaltung von Büromaterialien verantwortlich. Er leitete die Druckerei, das Personalbüro für die Unternehmenszentrale und den Organisationsausschuß des Unternehmens.218 Schließlich vertrat er über einen längeren Zeitraum das Vorstandsmitglied Dr. Drescher, dem er von 1935 bis 1942 direkt unterstellt war und mit dem sich über die Jahre eine „vertrauensvolle private Verbundenheit […] eingestellt hatte“219. Er verhandelte mit Behörden, hatte
213 Vgl.: ebd., S. 88. Britta Bopf sieht das Nachlassen der Agitation gegen die Warenhäuser bereits in der wirtschaftlichen Konsolidierung, die sich 1936 auch auf den Einzelhandel positiv auswirkte, begründet. Vgl.: Bopf: Arisierung, S. 95. 214 Referenzschreiben für Albrecht Bähnisch von Ernst von Harnack, 10.04.1935, zitiert nach Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 9. 215 Ebd., S. 10. 216 Ebd., S. 11. 217 Notizen von Albrecht Bähnisch, o. D., zitiert nach Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 10. 218 Vgl.: ebd. 219 Ebd., S. 11.
408 | Theanolte Bähnisch
die Aufsicht über die Hauptbuchhaltung sowie über die Statistik inne und wirkte bei wichtigen Personalentscheidungen, bei Bilanzfragen und der Immobilienverwaltung mit. Geschäftsreisen, oft in weit entfernte Städte, gehörten ebenfalls zu seinem Tagesgeschäft.220 Seine Stellung im Unternehmen war mit einem Jahresgehalt, das schon zu Beginn bei 10.200 RM lag und durch Tantiemen – 1941 erhielt er zusätzlich zum Gehalt 13.000 RM als Sonderleistung – noch aufgebessert wurde221, durchaus lukrativ. Die finanziellen Einbußen, welche die nationalsozialistische Herrschaft für die Familie Bähnisch zunächst bedeutet hatte, dürften also bald vergessen, die wirtschaftliche Existenz in Köln gesichert gewesen sein. Umso auffälliger ist es, daß Theanolte Bähnisch diesen Umstand nach 1945 jenseits zweier Fragebögen der Militärregierung von 1945/46 und dem auf Englisch verfaßten Lebenslauf222 nicht erwähnte. Die Richtigkeit der in einem Fragebogen gemachten Angaben war, wohl kaum zufällig, vom Vorstand der Kaufhof AG, Dr. Schulz, der 1945 kurzzeitig Kölner Stadtverordneter und Berater Adenauers war, bevor er Direktor des Kaufhofs wurde, per Unterschrift bezeugt worden.223 In diesem Fragebogen gab Theanolte an, daß sie zu dieser Zeit wesentlich von den Einkünften ihres Mannes gelebt habe.224 In den zahlreichen Zeitungsartikeln, in denen sie über ihr Leben berichtet, auch in von ihr selbst verfaßten Dokumenten, ist, wie erwähnt, über diese Tatsache nichts vermerkt. Es entsteht beim Lesen jener Artikel vielmehr der Eindruck, als hätten die Bähnischs nicht nur ab 1935 ausschließlich als Verwaltungsrechtsräte gearbeitet, sondern als sei Theanolte Bähnisch ab dem Sommer 1939, als Albrecht Bähnisch zum Kriegsdienst eingezogen worden war, sogar finanziell ganz auf sich allein gestellt gewesen.225 Sogar ein Brief an Ilse Langner legt diese Interpretation nah.226 De facto hatte Albrecht jedoch seinen Posten bei der EHAPE bis 1942 inne. 1940/41 war er vom Militärdienst befreit worden, nachdem seine Firma überzeugend argumentiert hatte, die Tätigkeit ihres Prokuristen sei aufgrund der von den Warenhäusern mitgetragenen Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung kriegswichtig.
220 221 222 223
Vgl.: ebd., S. 11. Vgl.: ebd., S. 10. DFR-Archiv, A3, Curriculum vitae of Frau Regierungspräsident Theanolte Bähnisch. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Fragebogen der Militärregierung, 20.02.1946, S. 4. Zweiter Bürge für die Richtigkeit von Bähnischs Angaben war der von der Militärregierung eingesetzte Polizeipräsident von Köln, Karl Winkler. 224 Ebd., S. 3. 225 Einzig im Fragebogen der Militärregierung sowie in einem auf Englisch verfaßten Lebenslauf berichtet Theanolte Bähnisch von diesem Umstand. Vgl.: Archiv des Deutschen Frauenringes, Freiburg, A3 [Materialien für eine Englandreise]. Curriculum vitae of Frau Regierungspräsident Theanolte Bähnisch. Zur Begründung führt sie an, daß ihr Mann es nicht mehr ausgehalten habe, als Jurist zu arbeiten, weil die Bedeutung von Recht und Ordnung in Deutschland sinnentleert worden sei. Diesem Lebenslauf nach war Theanolte Ende 1935 ihrem Mann gemeinsam mit ihren Kindern nach Köln gefolgt. 226 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34. Bähnisch an Langner, 12.07.1939 [1940!].
Familienleben | 409
4.3.2 Der Prokurist an der Front – und in Gedanken an neuen Ufern Nachdem Albrecht von November 1940 an, für über ein Jahr, bis Ende 1941, aus der Armee entlassen worden war, wurde er im Februar 1942 erneut eingezogen.227 Ab diesem Zeitpunkt stieß die Rheinische Kaufhalle AG bei den verschiedenen Instanzen, die sie anrief und die der Befreiungsantrag durchlaufen mußte, zwar nicht auf gänzlich taube Ohren, aber am Ende doch auf Unnachgiebigkeit. In einem Dringlichkeitsantrag an den Reichswehrminister hatte der Vorstand argumentiert, daß Bähnisch im Kriegsdienst „in absolut untergeordneter, seinen Fähigkeiten keineswegs entsprechender Stellung eingesetzt“ sei, „eine Verwendung, deren Vorteil für die Wehrmacht in keinem Verhältnis steht, zu dem schweren Verlust, den unser Unternehmen erlitten hat“228. Doch auch dieser couragiert formulierte Antrag hatte keinen Erfolg. Die Unsicherheit, welche die ständigen Verhandlungen zwischen dem Kaufhof und dem Reichswehrministerium nach sich zogen und – nachdem ein weiterer Antrag positiv entschieden war – der Austausch des Reichswehrministeriums mit dem zuständigen Kommandanten, frustrierten Albrecht Bähnisch, der sich hier wie da am falschen Ort fühlte, tief. Vielleicht erinnerten ihn die zähen Verhandlungen an die Zeit der Ungewißheit in Merseburg und rüttelten überwunden geglaubte Empfindungen wieder wach. In mehreren Briefen teilte er sein tiefes Unbehagen seiner Frau mit.229 Diese setzte sich – Stillschweigen hätte ihr nicht ähnlich gesehen – ebenfalls für Albrecht Bähnischs Entlassung aus dem Dienst an der Waffe ein. Sie sprach, den von Hans Heino Fels zitierten Auszügen aus einem Briefwechsel zwischen Schulz und Theanolte Bähnisch zufolge, zu diesem Zweck sogar zweimal persönlich im Reichswirtschaftsministerium vor.230 Dies schien Schulz wiederum sehr imponiert zu haben.231 Wahrscheinlich hat Schulz nicht zuletzt vor diesem Hintergrund 1945 die Dienste Theanolte Bähnischs als Verwaltungsrechtsrätin in Anspruch genommen.232
227 Fels zufolge gibt es hierüber keine „Urkunden“, die Daten rekonstruierte er aus Briefen Albrecht Bähnischs. Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S 18/19. 228 Kaufhof an den Reichswehrminister, 18.04.1942, zitiert nach Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von OrlaMaria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 20. 229 Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 17. 230 Theanolte Bähnisch an Albrecht Bähnisch, 15.03.1942, nach Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 21. 231 Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 21. 232 In ihrem Diktat berichtet Bähnisch, sie sei damals „für Kaufhalle und Kaufhof“ tätig gewesen und habe auch über das Angebot, in Hannover Regierungspräsidentin zu werden,
410 | Theanolte Bähnisch
Per Post ließ Albrecht Bähnisch seine Frau bald an Überlegungen teilhaben, die darauf hindeuteten, daß er sich mit seiner Lage versöhnen wollte. Er könne ja vielleicht „Kriegsverwaltungsrat“ oder gar -inspektor werden, wenn es mit der „Reklamation“233, nicht klappen sollte, räsonierte er.234 Vielleicht wollte er mit jenen Gedanken über eine Tätigkeit in der Kriegs-Verwaltung auch seine Frau beschwichtigen. Wie aus Briefen an ihre Freundin Ilse Langner hervorgeht, hatte sie große Angst um ihren Ehemann, der seinerseits seine Überzeugung äußerte, daß „wir den Russen schlagen“, der aber doch fürchtete, daß „das deutsche Volk“ sich übernehme, zumal ihm nicht klar war, bis zu welcher „Grenze“ sich die Armee noch gen Osten bewegen solle. „Wieweit sollen wir in dieses grenzenlose Land vorstoßen? […] Kampf ist schön, trotz aller Anstrengungen, trotz der Gefahr – zermürbend ist das ‚Warten‘, das […] Ausharren, das Spähen nach einem Feind, der uns nicht den Gefallen tut, anzugreifen“235, traute sich Bähnisch an den von ihm verehrten, vielgelesenen Historiker Johannes Haller zu schreiben.236 Indem er sie bat, seinen Brief abzutippen und weiterzuleiten, teilte er seine Eindrücke auch mit seiner Frau, die Hallers Werk ebenfalls mit Begeisterung gelesen hatte.237 Mit seinen Überlegungen zu einer Verwaltungskarriere beim Militär bewies Albrecht eine bemerkenswerte Fähigkeit, sich auf veränderte Lebensumstände einstellen und aus seiner Situation das Beste machen zu wollen. Ob und wie sich dies mit der kritischen Distanz in Einklang bringen läßt, welche Albrecht Bähnisch seiner Frau zufolge gegenüber der ‚Politik‘ der Nationalsozialisten gehalten hatte, verraten womöglich andere Briefe, die er ihr schrieb. Denn Militär und Krieg waren mit dem Nationalsozialismus ja doch untrennbar eng verbunden.238 Unzweifelhaft ist: der intelli-
233 234 235 236
237 238
mit Schulz gesprochen. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, S. 1, Anfrage aus Hannover. Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 15. Vgl.: ebd., S. 17 und 21. BArch, N 1035, Nr. 19, Albrecht Bähnisch an Johannes Haller, 12.05.1942. Bähnisch bezog sich in einem Brief auf die Einleitung Hallers zu seinem Werk ‚Die Epochen der deutschen Geschichte‘ (Erstauflage Stuttgart 1923), in dem Haller geschrieben hatte, daß die Deutschen noch immer gescheitert seien, wenn sie sich zu viel vorgenommen hatten. Ob die Einleitung, die Bähnisch offenbar in einer älteren Auflage gelesen hatte, 1942 noch unverändert war, bliebe zu prüfen, denn Haller war ein erklärter Unterstützer des deutschen Expansionsstrebens in den Osten. Vgl.: Müller, Heribert: Eine gewisse angewiderte Bewunderung: Johannes Haller und der Nationalsozialismus, in: Pyta, Wolfram/Richter, Ludwig (Hrsg.): Gestaltungskraft des Politischen. Festschrift für Eberhard Kolb, Berlin 1998. BArch, N 1035, Nr. 19, Albrecht Bähnisch an Johannes Haller, 12.05.1942. Daß viele Wehrmachtssoldaten eine andere Position vertraten, beziehungsweise noch vertreten schlug und schlägt sich in den Auseinandersetzungen um die Frage nieder, ob die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ‚sauber‘ geblieben war, oder ob die Soldaten als Teil des nationalsozialistischen Machtapparats Kriegsverbrechen verübt hatten. Vgl.: Müller,
Familienleben | 411
gente und zuvor so erfolgreiche und beliebte Mann war frustriert darüber, beim Militär als Untergebener oft in barscher Art behandelt zu werden.239 Ein höherer Rang hätte seine Lage freilich verändert. Aus Albrechts Ideen für eine anderweitige, mit geringen Gefahren für Leib und Leben verbundene Verwendung seiner Person bei der Wehrmacht wurde jedoch nichts. Im Gegenteil: Während er zuvor in einem Versorgungsgsamt, also mit einiger Entfernung von der Front eingesetzt war, scheint er im Januar des Jahres 1943 erstmals in Kampfhandlungen verwickelt gewesen zu sein.240 Zwischenzeitlich hatte er einmal für wenige Tage im Februar, in denen er sich mit seiner Frau in Hannover traf und einmal für drei Wochen im August Urlaub bekommen. Der zweite Urlaub wurde allerdings von einer Scharlach-Erkrankung zweier Familienmitglieder überschattet.241 Theanolte erholte sich nur schleppend davon und begab sich im September 1942 in eine Kur.242 4.3.3 Albrechts ungeliebter Beruf und Theanoltes ungeliebte Erinnerung Das weitgehende Schweigen Theanolte Bähnischs über die Tätigkeit ihres Mannes in der EHAPE/Kaufhalle kann verschiedene Gründe gehabt haben. Zum einen war sie stets darauf bedacht, als selbständige, berufstätige und politisch aktive Frau aufzutreten. Das Bild einer vom Erwerb ihres Mannes abhängigen Gattin paßte nicht zu jener Frau, die sie sein und als die sie gesehen werden wollte. Andererseits war ihr Schweigen vielleicht auch darauf zurückzuführen, daß Albrecht Bähnisch die Einbindung des Kaufhof in die NS-Gesellschaftsordnung nicht nur hinzunehmen, sondern auch mitzugestalten hatte. „Ein Fülle von Appellen, Aufrufen und Anordnungen, die von ihm (mit)unterzeichnet waren, zeigt dies deutlich. Ausdruck des nun geltenden Führerprinzips sind die Bezeichnungen: Es gibt keine Arbeitskollegen mehr sondern nur noch Arbeitskameraden; sie sind Gefolgschaftsmitglieder. Es wird ‚Antreten‘ befohlen, Teilnahme am ‚Aufmarsch‘ ist ‚Dienst‘, d. h. ‚Pflicht‘“243 beschreibt Hans-Heino Fels die Zusammenhänge. Als Betriebsleiter der EHAPE oblag
239 240
241 242 243
Rolf-Dieter/Volkmann, Hans-Erich (Hrsg.): Die Wehrmacht. Mythos und Realität, München 1999. Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 20. Albrecht Bähnisch an Theanolte Bähnisch, 30.01.1943, zitiert nach Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von OrlaMaria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 24. Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 21. Vgl.: ebd., S. 21. Fels beruft sich auf einen Brief Albrecht Bähnischs an seine Frau vom 15.09.1942. Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 11. Fels beruft sich auf überlieferte Rundschreiben in Albrecht Bähnischs Nachlaß.
412 | Theanolte Bähnisch
Albrecht Bähnisch unter anderem auch die Aufgabe, anläßlich eines Betriebsappells zu einer Rede des Führers im Rundfunk eine Ansprache an die ganze Belegschaft zu halten. Diese Ansprache, von der nicht mit Sicherheit zu sagen ist, daß Bähnisch sie selbst verfaßt hat und ob sie (genauso) gehalten worden war, ist gemeinsam mit dem Brief, mit dem Bähnisch die Rede an seine Frau geschickt hatte im Familiennachlaß überliefert und trägt, wie Hans Heino Fels schreibt, deutliche Züge nationalsozialistischer Rhetorik.244 Die ebenfalls von Fels erwähnte Unterzeichnung der Unternehmens-Korrespondenz durch Bähnisch mit ‚Heil Hitler‘ ist allerdings mitnichten ein Unikat, das nur in diesem Zusammenhang auftritt, sondern es läßt auch schon im Schriftverkehr Albrechts wie auch Theanolte Bähnischs mit dem Oberverwaltungsgericht beobachten.245 Zufrieden schien der Landrat im Ruhestand mit seiner Tätigkeit bei der EHAPE in Köln nicht gewesen zu sein. Aus einer Auflistung, die um 1940 entstand und vermutlich eine Vorarbeit für Bewerbungen auf andere Positionen darstellte, wird deutlich, daß sich der ehrgeizige Verwaltungsfachmann mehr Verantwortung wünschte. In den betriebsinternen Abläufen der Kaufhalle erkannte er erklärtermaßen Stagnation, kleinliche Bürokratisierung und geringe Entwicklungsmöglichkeiten.246 Wie er zu den politischen Dimensionen seines Handelns stand, erfahren wir aus den Briefen und Notizen nicht. Daraus auf Gleichgültigkeit zu schließen, wäre jedoch falsch. Weil unklar war, ob das Briefgeheimnis gewahrt bleiben würde, ist es nicht weiter verwunderlich, wenn er in den Briefen an seine Frau keine Kritik an den politischen Hintergründen seiner Tätigkeit übte. Aus seinen Notizen wird deutlich, daß er auch mehr Freiraum anstrebte, um seinem Interesse am Rechtswesen nachzugehen.247 Bis 1933 hatte Albrecht Bähnisch neben seiner Tätigkeit als Mitarbeiter im Innenministerium bzw. als Landrat diverse schriftliche Abhandlungen über verschiedene Themen aus dem Bereich der Verwaltung verfaßt. Dies schien er weiter verfolgen zu wollen, anders ist es kaum zu erklären, daß er 1933 als wissenschaftlicher- und Fachschriftsteller dem ‚Reichsverband deutscher Schriftsteller‘ beigetreten war und sich sogar ein Pseudonym, nämlich ‚Kurt Felten‘ zugelegt hatte.248 Ist sein Austritt aus der SPD auf diesen Entschluß zurückzuführen? Oder hatte er Sorge, daß die Parteizugehörig-
244 Vgl.: ebd. 245 GStA PK I. HA, Rep. 184, P Nr. 53. 246 Notizen für Berlin, verfaßt von Albrecht Bähnisch o. D., zitiert nach Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 12. 247 Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., S. 11/12. Fels zufolge sind die Ende 1939/Anfang 1940 abgefaßten Notizen von anderer Hand mit der Schreibmaschine abgetippt und dabei leicht abgewandelt worden. Der Verfasser wird in den maschinenschriftlichen Aufzeichnungen ‚Bänisch‘ – also ohne ‚h‘ genannt, so daß offenbar kein Familienangehöriger oder enger Bekannter die Notizen übertragen hat. 248 Vgl.: BArch, BDC, RK, J 0013, Mitgliedsausweis Albrecht Bähnischs für die Reichskulturkammer/Reichsschrifttumskammer, Ausstellungsdatum: 16.09.1936. Derselben Akte liegt auch ein Mitgliedsausweis vom 05.08.1935 bei.
Familienleben | 413
keit seiner Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrat im Weg stehen könnte? Nach eigenen Angaben hatte er der Partei am 31.04.1933, also zwei Monate vor dem Verbot durch die NSDAP, den Rücken gekehrt.249 Den Austritt ihres Mannes aus der SPD erwähnt Theanolte Bähnisch, es verwundert kaum, nirgendwo. In den Aachener Nachrichten läßt sie sich gar zu der Zeit, in der ihr Mann „sozialdemokratischer Landrat in Merseburg war“ wie folgt zitieren: „Es kann kommen was will […] wir schließen politisch keine Kompromisse. Geh du ohne Rücksicht auf uns deinen geraden Weg“250. Wäre der Austritt nach 1945 publik geworden, hätte dies vielleicht nicht nur Theanolte Bähnischs Ansehen, sondern auch ihre Argumentationsbasis bezüglich des Aufstiegs, den Albrecht Bähnisch über die Jahre in der Verwaltung beschieden gewesen wäre, womit sie schließlich erfolgreich ihren Anspruch auf eine höhere Witwenrente durchsetzen konnte, geschmälert.251 Mit seiner Stellung in Köln war Albrecht Bähnischs schriftstellerische Neigung nicht vereinbar. Auf der Negativ-Liste, die er über seine Stellung im Kaufhof angelegt hatte, hatte er auch die „völlige Unmöglichkeit aller schriftstellerischen Arbeit“252 aufgeführt. Am Ende sollte ihn der ungeliebte Beruf sogar seinen offiziellen Status als Schriftsteller kosten, denn die Reichsschrifttums-Kammer teilte ihm 1937 mit, er sei aus der Kammer entlassen worden, da er hauptberuflich einer anderen Tätigkeit nachgehe. Auch der beruflichen Entwicklung Theanoltes Bähnischs schien der Kaufhof im Weg gestanden zu haben. Unter den Gründen, weshalb Bähnisch eine Kündigung seiner Stellung in Erwägung zog, findet sich auch der Punkt „Unterbin-
249 Nachlaß Albrecht Bähnischs, Personalbogen Albrecht Bähnisch, vermutlich von anderer Hand datiert auf „~ 18.07.33“. Wie bereits an andere Stelle erwähnt hatte Albrecht Bähnisch Hans-Heino Fels zufolge den Bogen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrat ausfüllen müssen. Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 8. Aus dem Bogen geht auch hervor, daß Bähnisch bereits 1933 Mitglied des Reichsverbandes deutscher Schriftsteller war und daß er auch dem Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNDJ), der Vorläuferorganisation des NSRechtswahrerbundes, angehörte. Ein entsprechender Bogen ist Fels zufolge auch Theanolte Bähnisch zugegangen, er befand sich jedoch nicht unter den zur Verfügung gestellten Unterlagen. Vgl.: ebd. Daß Albrecht Bähnisch Mitglied des BNDJ war, geht auch aus BArch, NS 16, Nr. 112 hervor. Die Akte verzeichnet ihn im März 1936, noch unter seiner Berliner Adresse, Joachimsthaler Str. 1 als Mitglied des Gau Groß-Berlin, Bezirk I, Ortsgruppe Steinplatz, März 1936. Danach dürfte für ihn eine Mitgliedschaft in der Organisation nicht mehr dienlich/notwendig/möglich gewesen sein, da er nach seinem Umzug nach Köln in der freien Wirtschaft tätig war. 250 O. V.: Die Gegenwart ruft die Frau. Der einzige weibliche Regierungspräsident zur Frauenfrage. Aachener Nachrichten, 16.08.1946. 251 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Wiedergutmachungsbescheid des Bundesministers des Innern, 31.08.1953 (Abschrift). 252 Notizen von Albrecht Bähnisch, o. D. [Ende 1939/Anfang 1940], zitiert nach Fels, HansHeino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 12.
414 | Theanolte Bähnisch
dung der Berufstätigkeit meiner Frau“253. Ein zusätzliches Einkommen dürfte die Familie Bähnisch kaum benötigt haben, doch wird Albrecht Bähnisch den Wunsch seiner Frau, berufstätig zu sein, nur allzugut gekannt, verstanden und deshalb auch geteilt haben. Seinem Arbeitgeber dürfte es jedoch nicht gefallen haben, daß die Ehefrau eines Mitarbeiters auf so hohem Posten ebenfalls berufstätig sein wollte. Die ‚Doppelverdienerkampagne‘ war bereits in der Weimarer Republik dazu genutzt worden, Frauen aus dem Erwerbsleben zu drängen, wobei die Privatwirtschaft von Gesetzen, welche die Berufstätigkeit von Ehefrauen im Staatsdienst einschränkte, beziehungsweise untersagte, nicht betroffen war. Doch die NS-Propaganda verbreitete allgemein die Ansicht, daß die Arbeit von Frauen in nicht-traditionellen Arbeitsbereichen und/oder mit einem hohen Gehalt die Autorität ihrer Männer untergrabe.254 Von der Prokuristen-Stelle in Köln gingen also weder für Albrecht Bähnisch selbst sonderlich befriedigende Impulse aus, noch kann sie als fruchtbar für die gemeinsame berufliche und damit auch partnerschaftliche Basis gewertet werden, die sich Theanolte so sehr wünschte und von der sie gehofft hatte, daß sie sie durch das gemeinsame Projekt der Selbständigkeit als Verwaltungsrechtsräte in Berlin zurückerlangen könne. Damit nicht genug, schien sich das Paar auch privat in Köln nicht wohl gefühlt zu haben. „Wir haben nun mal in Köln eigentlich keinen vernünftigen Verkehr“255, hielt Albrecht Bähnisch 1942, nachdem er nach seiner Befreiung wieder zur Wehrmacht eingezogen worden war, in einem Brief an seine Frau fest. Er plädierte nicht zuletzt deshalb für einen erneuten Wechsel des Arbeitsplatzes und des Wohnortes – er wollte nach Berlin zurück.256 Vermutlich hatte Theanolte zur gleichen Zeit bereits ähnlich gefühlt. Doch erst ein Brief von 1946 belegt, daß sie über Köln dieselbe Meinung hatte, wie ihr Ehemann. „Ich kenne hier [in Köln] fast nur Leute und kaum Menschen“257, schrieb sie sich ihren Frust über für sie offenbar eher belanglose Kontakte an Kurt Schumacher von der Seele, nachdem sie diesen und Adolf Grimme unlängst getroffen hatte. Mit ihrem Bruder Otto Nolte und dessen Frau waren in Köln zwar Verwandte vor Ort, doch Freunde hatten die Bähnischs dort kaum. Dem Paar fehlte in Köln der gesellschaftliche Umgang, an den es sich im bunten, gebildeten Berliner Freundes- und Kollegenkreis gewöhnt hatte. Am Ende des bereits zitierten Briefes von 1942 scheint Alfred Bähnischs Entschluß, Köln in Richtung Berlin wieder zu verlassen, gefallen zu sein: „Bleibt – als entscheidender Grund ‚novarum rerum cupidus! Ich fühle mich größeren und anderen Aufgaben gewachsen. Ein Teil meiner Fähigkeiten – und ich meine, meine besten – sind jetzt nicht oder nicht voll ausge-
253 Ebd. 254 Vgl.: Kompisch, Kathrin: Täterinnen. Frauen im Nationalsozialismus, Köln/Weimar/ Wien 2008, S. 41. 255 Albrecht Bähnisch an Theanolte Bähnisch, 13.06.1942, zitiert nach Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von OrlaMaria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 12. 256 Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 12. 257 AdSD, Büro Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 11.02.1946.
Familienleben | 415
nutzt. Mein Verhandlungsgeschick – oder besser meine Gabe, Verhandlungen zu führen und zu leiten – liegt brach.“258 Daß Albrecht Bähnisch seine Stelle bei der EHAPE doch nicht aufgab, wird verschiedene Gründe gehabt haben: Zum einen mußte das Einkommen der vierköpfigen Familie gesichert werden, was die Prokuristen-Stelle garantierte – und eine vergleichbar gut bezahlte Stellung scheint nicht in Sicht gewesen zu sein. Zum anderen schwand, das wird aus den Briefen Albrechts Bähnisch deutlich, nie die Hoffnung, aufgrund der ‚kriegswichtigen‘ Bedeutung der Kaufhalle für die Warendistribution im Reich, aus dem Kriegsdienst entlassen zu werden. Die Stelle in Köln aufzugeben, hätte vermutlich bedeutet, auch diese Hoffnung und damit die Hoffnung auf ein Leben mit seiner Frau und seiner Familie, sei es nun in Köln, sei es in Berlin, bis zum noch nicht absehbaren Ende des Krieges aufzugeben. Schlußendlich war und blieb Bähnisch Soldat und hielt sich ohnehin fern der Heimat auf. Eine andere Stellung zu haben, wenn er sie faktisch doch nicht hätte ausfüllen können, hätte seine Situation kaum verändert. Die Vorstellung, die sich das Paar von einem Leben in Berlin machte, dürfte ohnehin etwas zu rosig gewesen sein: In Köln fehlte zwar der gewünschte gesellschaftliche Umgang, aber auch das Berlin von einst gab es nicht mehr: Namhafte Vertreter der Sozialdemokratie, des Zentrums und der Liberalen hatten Zuflucht im Exil gesucht, der Soroptimist-Club hatte sich aufgelöst und viele seiner Mitglieder waren ebenfalls ausgewandert, oder in Konzentrationslager verschleppt worden. Beschäftigunbgsmöglichkeiten für Frauen, wie Theanolte sie wahrnehmen und unterstützen wollte, waren auch in Berlin nur noch rudimentär gegeben, das kulturelle Leben von Kürzungen aufgrund der Kriegswirtschaft betroffen, kritische Zirkel hatten ohnehin die Zensur und Schlimmeres zu befürchten. Und nicht zuletzt war Berlin jetzt das Zentrum des neuen Regimes, des neuen Deutschland, in dem die Bähnischs nicht an ihre Rolle in der Weimarer Republik anknüpfen konnten. ‚Berlin‘ so scheint es, war für das Ehepaar nicht einfach ein anderer, vertrauter und liebgewonnener Ort, an den es zurückzukehren galt, sondern gleichsam ein Phantom. Die Stadt stand stellvertretend für die Zeit der frischen Verliebtheit, für spannende berufliche Erfahrungen, für anregenden Austausch, für Geborgenheit, alles in allem: für die gute gemeinsame Geschichte des Paares und damit auch für die Möglichkeit einer besseren Zukunft. Doch seine Rolle als Soldat sollte Albrecht die Entscheidung, ob er aus Köln weggehen oder ob er dort bleiben solle, nicht nur übergangsweise abnehmen. Er kehrte nie mehr nach Deutschland zurück, sondern starb, aller Wahrscheinlichkeit nach, wie es heißt, als „Versprengter der Kampfgruppe Mathieu“259 auf einem Winterfeldzug der Wehrmacht in der Ukraine, in der Nähe von Charkow260, 2.500 Kilometer entfernt
258 Albrecht Bähnisch an Theanolte Bähnisch, 13.06.1942, zitiert nach Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von OrlaMaria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 12/13. 259 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Wiedergutmachungsbescheid des Bundesministers des Innern, 31.08.1953, Abschrift. 260 Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 25.
416 | Theanolte Bähnisch
von seiner Wahlheimat Berlin.261 Als sein Todesdatum wird – in Ermangelung eines genauen Datums – der 30.01.1943 angegeben.262 4.3.4 „Ich sah dieses Unglück immer so unentrinnbar auf mich zukommen“ – Theanoltes Strategien der Ablenkung und Einkehr Über die Beschäftigungen, denen Theanolte Bähnisch in den Jahren 1935 bis 1945 nachging, während ihr Mann für die EHAPE arbeitete und seinen Kriegsdienst ableistete, läßt sich nur wenig in Erfahrung bringen. Lebenserinnerungen über diese Zeit existieren nur in einer sehr knappen Form263 und von den Tagebüchern und anderen privaten Unterlagen der Juristin heißt es, daß sie 1944 verbrannt seien.264 Was noch übrig war, scheint der Haushaltsauflösung nach ihrem Tod zum Opfer gefallen zu sein, die, wie die Tochter Orla-Maria Fels berichtet, schnell abgewickelt werden mußte, was wiederum zur Folge gehabt hatte, daß zu einer eingehenden Sichtung der Unterlagen wenig Zeit geblieben und ein Großteil, auch Korrespondenzen und private Aufzeichnungen, vernichtet worden sei.265 Immerhin sind einige Photos sowie die bereits erwähnten Briefe zwischen den Ehegatten, die sich im Privatbesitz von Orla-Maria Fels befinden, aus den entsprechenden Jahren überliefert. Diese Briefe konnten jedoch nur in den von Hans-Heino Fels zitierten Auszügen herangezogen werden. Neben Korrespondenz aus der Arbeit Bähnischs als Photovertreterin sind im Privatnachlaß auch die bereits erwähnten Fragebögen der Militärregierung überliefert. Von diesen ist allerdings, anders als von dem in der Personalakte überlieferten Fragebogen, unklar, ob sie in dieser Form abgegeben wurden.266 Einige Informationen können schließlich den Briefen entnommen werden, die Theanolte an ihre Freundin Ilse Langner schrieb.
261 Benannt wurde die Gruppe nach dem diensthabenden Major des Grenadier-Regiments Nr. 537, Albert Mathieu, der am 05.12.1943 gefallen war. 262 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Wiedergutmachungsbescheid des Bundesministers des Innern, 31.08.1953, Abschrift. 263 AddF, SP-01, Kurze Lebensskizze. Im Privatnachlaß ist zudem folgendes Dokument, das jene Jahre behandelt, überliefert: Notizen der Frau Regierungspräsidentin a. D., Th. Bähnisch, Verwaltungsrechtsrat (Fachanwältin für Verwaltungssachen) aus Köln am Rhein [1945]. 264 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil I, Das erste Abbaugesetz, S. 21. 265 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. 266 Im Fragebogen, der der Personalakte beiliegt, beantwortet Bähnisch die Frage, ob sie bereits einen Fragebogen abgegeben habe, mit „ja […] Köln Sommer 1945 […] Hannover März 1946“. NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Nr. 1, Military Government of Germany, Fragebogen, o. D. Insgesamt sind drei Fragebögen überliefert. Einer diente ihrer Bewerbung um die Zulassung als Verwaltungsrechtsrätin, einer ihrer Zulassung als Regierungsvizepräsidentin, der dritte muß ihrer Zulassung zur Regierungspräsidentin gedient haben. Er ist undatiert, entstammt aber einer Auflage aus dem Juni 1946.
Familienleben | 417
Nach dem ersten kriegsbedingten Weggang ihres Mannes suchte Theanolte offenbar verschiedene Formen der Ablenkung. Folgt man ihren Schilderungen, so fand sie diese nicht zuletzt in Arbeit. Sie reiste – so jedenfalls hält sie es in ihren Erinnerungen fest – nach Berlin und in andere Städte267 – doch längst nicht so oft, wie sie es sich wünschte, was sie selbst auf ihre psychische Verfassung zurückführt. Die politischen Entwicklungen im Reich beschrieb Bähnisch ihrer Freundin Ilse Langner gegenüber als eine sie sehr belastende Situation. Sie schien sich nicht nur verunsichert gefühlt, sondern unter depressiven Episoden und massiven Ängsten gelitten zu haben: „Ich habe seit der Rückkehr von Berlin ein beklemmendes u.[nd] behinderndes Gefühl, das sich nachts oft zum Alpdruck steigert u. mich wohl auf lange nicht verlassen wird“268, schrieb sie im November 1938 an ihre Freundin. „Ende Mai Anfang Juni 1932 hatte ich ganz das gleiche Gefühl“269 fuhr sie fort, wohl um auf die Zeit vor der Welle der Amtsenthebungen anzuspielen. In ihrer psychischen Verfassung erkannte sie eine starke Motivations- und Produktivitäts-Barriere. „Mein ganzes Arbeiten leidet stark darunter […] und ich lasse meinen Partner arg im Stich“270, nimmt sie sich selbst in die Kritik, wobei unklar bleibt, ob sie mit dem Partner Albrecht Bähnisch oder aber, was wahrscheinlicher ist, ihren Sozius in Berlin, Heinrich Troeger, meinte. Aus den Treffen mit ihrer Freundin und engen Vertrauten Ilse Langner konnte sie Kraft schöpfen: „Ich möchte ja gern jeden Tag einige Stunden bei Dir sitzen und mich mit Dir unterhalten. […] auch wenn Du krank bist geht von Dir noch ein stark belebendes und anregendes Element aus. So gern würde ich wissen, mit welchen künstlerischen Plänen Du Dich augenblicklich befaßt und vor allem Deine letzten Stücke lesen“271 teilte sie ihr 1938 mit, nachdem längere Zeit kein Treffen zwischen den Beiden möglich gewesen war. Vielleicht fand Theanolte, weil sie merkte, daß die Freundschaft mit Ilse Langner ihr Halt gab, Mitte der 30er Jahre endlich vom ‚Sie‘ zum ‚Du‘ in ihren Briefen an die langjährige Freundin. Der zuvor zitierte Brief aus dem November 1936 beginnt noch, wie alle zuvor geschriebenen Briefe mit der ‚Sie‘-Form, schwenkt dann aber noch im ersten Viertel des Briefes auf das ‚Du‘ um, das sie von nun an ausschließlich gegenüber Langner verwendete. 1939 schrieb sie an ihre große Stütze: „wenn ich Dir gegenübersitze, betrete ich jedes Mal eine neue Welt, mein Lebensgefühl […] meine Phantasie ist so angeregt, daß ich in den Stunden wieder ganz ich selbst bin und wirklich glaube, daß mir nichts unmöglich ist. Augenblicklich habe ich großes Verlangen danach, bei dir mal wieder so beschwingt zu werden. […] Es sind mir im Leben nur wenige Menschen begegnet die es [das Ge-
267 In ihrer Lebensskizze heißt es, sie sei bei vielen Gestapos der deutschen Großstädte gewesen, um sich dort für verhaftete und Verfolgte einzusetzen. AddF SP-01, Kurze Lebensskizze. 268 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 28.11.1938. 269 Ebd. 270 Ebd. 271 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 28.11.1938.
418 | Theanolte Bähnisch
fühl] mir geben. Deshalb bist Du so wesentlich für mich im wahrsten Sinne des Wortes.“272 Doch die Freundin, welche für sie ‚so wesentlich‘ war, lebte nicht in ihrer Nähe, Treffen waren nur selten möglich. Also versuchte sie anderweitig Kraft zu schöpfen und Ablenkung zu finden. 1938 entschloss sie sich dazu, sich an der Universität zu Köln als Gasthörerin für das Wintersemester einzuschreiben. Zu diesem Zweck hatte sie beim Oberverwaltungsgericht um die Zusendung einer Abschrift des Nachweises ihrer arischen Abstammung gebeten.273 Aus dem bereits zitierten Brief an Langner geht hervor, daß sie nicht etwa ihre Kenntnisse in den Rechtswissenschaften zu vertiefen suchte, sondern kunsthistorische Vorlesungen hören wollte. Doch das Oberverwaltungsgericht teilte ihr mit, die entsprechende Bescheinigung nicht ausstellen zu können. Die arische Abstammung für die Eheleute Bähnisch sei durch die Behörde nicht im Rahmen der für Beamte geltenden Bestimmungen, sondern nur aufgrund des Gesetzes vom 12.06.1933 nachgeprüft worden. Da in diesem Zusammenhang von einer Einforderung der Abstammungsurkunden abgesehen worden sei, bestünden gegen die Ausstellung einer für andere Zwecke geltenden Bescheinigung grundsätzliche Bedenken.274 Ob Theanolte auf einem anderen Weg die von der Universität geforderte Bescheinigung einholte, oder aber die Veranstaltungen als inoffizielle Hörerin besuchte, ließ sich nicht herausfinden. Die Vorlesungen schienen sie jedenfalls abgelenkt und ihr Trost gespendet zu haben: „Das Einzige was ich für mich höre, sind wenige kunstgeschichtliche Vorlesungen u.[nd] ein kunstgeschichtliches Seminar“, schrieb sie an Langner. Sie höre „wunderbare Kollegs über Florenz, Süditalien u. Sizilien wodurch die Eindrücke meiner Italienreise stark vertieft werden. In diesen kunstgeschichtlichen Betrachtungen kann ich alles andere vergessen u. komme mir vor wie in einer Oase des Friedens“275. Das Schwelgen in dieser schöner Erinnerung, die gleichzeitig den Zweck einer Flucht in die als Gegenwelt zum Nationalsozialismus sich präsentierende bildungsbürgerliche Welt gehabt zu haben schien276, stilisierte sie damit zum einzigen Lichtblick in einer sich ihr heillos präsentierenden, einsamen Zeit, die jedoch erst ein Vorgeschmack auf noch schwerere Zeiten zu sein schien: „Ansonsten habe ich das starke Gefühl, daß alles was wir vor Kurzem erlebt haben nur ein Auftakt ist zu noch schlimmeren Dingen“277, verlieh sie ihren Befürch-
272 Ebd., Bähnisch an Langner, 08.03.1939. 273 GStA PK, I. HA, Rep. 184, P Nr. 53, Bähnisch, Verwaltungsrechtsrat an das Preußische Oberverwaltungsgericht Berlin Charlottenburg 2, 28.11.1938. 274 Ebd., Der Präsident des IV. Senats des Preuß. Oberverwaltungsgerichts, Berlin-Charlottenburg an Verwaltungsrechtsrätin Bähnisch zum Schreiben vom 28. des Monats, Abschrift. 275 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 28.11.1938. 276 Angelika Schaser weist darauf hin, daß die Autobiographien vieler bekannter Politiker eine solche ‚Flucht in den Humanismus‘ im Nationalsozialismus als Ausweich-Verhalten beschreiben. Vgl.: Schaser: Erinnerungskartelle, S. 12. 277 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 28.11.1938.
Familienleben | 419
tungen Ausdruck. „Am liebsten möchte ich einen Winterschlaf beginnen u. nicht mehr vor Mitte Mai nächsten Jahres aufwachen. […] März/April werden sehr krisenhaft. Wir werden alle noch viel durchmachen müssen, bevor die richtige Befriedung kommt. Zur gleichen Zeit sind noch kosmische Störungen da, wie ich aus astronomischen Kreisen hörte.“278 Kosmische Störungen hin oder her: Theanolte Bähnisch sollte Recht behalten. Die diktatorischen Verhältnisse im Land und der Antisemitismus, der sich in einer beispiellosen Hetzjagd auf seine Opfer entlud – was sie, die viele jüdische Freunde und Kollegen hatte, jedoch nicht explizit ansprach – sollten nicht alles sein was ‚die neue Zeit‘ mit sich brachte. Das Deutsche Reich stand kurz vor dem Krieg, der weitreichende, unwiederbringliche Veränderungen auch für Bähnisch und ihre Kinder nach sich ziehen sollte. In einem weiteren Brief an Langner, am 12.07.1940, spricht sie aus, was sie vorher nur vage andeutete: „wie heißt es doch so schön: Bereit sein ist alles. Dieser Kriegsgedanke war die eigentliche innere Belastung in diesen letzten Monaten. Ich sah dies Unglück immer so unentrinnbar auf mich zukommen, daß ich innerlich erstarrte. Nun raffe ich mich langsam zu Taten auf. Albrecht muß sofort zum Militär.“ Sie plante deshalb, in Berlin ihren „privaten Mobilisierungsplan“ umzusetzen, „um mich und meine Kinder zu ernähren.“279 Vor dem Hintergrund der Vergleiche, welche Theanolte zwischen dem ‚Vorabend des Preußenschlags‘ und dem ‚Vorabend des Krieges‘ anstellt, fällt eine weitere Parallele ins Auge: Wie schon durch die Amtsenthebung änderte sich der Alltag ihres Ehemannes mit seiner Einberufung drastisch, und wieder war sie es, die sich – zumindest ihrer Ausführungen nach – in Anbetracht der existentiellen Bedrohung herausgefordert fühlte, nicht aufgab, sondern die Flucht nach vorn antrat. Mit dem Beginn des Krieges wurden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr, doch gleichzeitig schien die Gewißheit über die neue Situation – so jedenfalls stellt es sich im Sommer 1940 dar – neue Energien in ihr wachgerufen zu haben. Ihr schienen nun Handlungen abverlangt zu werden, nachdem vorher in ihren Augen ängstliches Abwarten, Stagnation und Trägheit ihren Alltag bestimmt hatten. Nicht einmal zu einem Brief an die Freundin, so teilte sie dieser später mit, habe sie sich in jener Zeit der Angst und der Lethargie aufraffen können, sie sei „zu schwerfällig gewesen, um […] wenigstens ei-
278 Ebd. 279 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 12.07.1939 [1940]. (Offenbar hatte sie sich im Jahr geirrt. Der Zweite Weltkrieg begann erst im September 1939, so daß der Brief am 12.07.1940 geschrieben worden sein dürfte.) Hans-Heino-Fels zufolge erhielt Albrecht Bähnisch seine Einberufung zum Wehrdienst am 31.05.1940. Ab dem 20.07.1940 war er Soldat und reiste am 29.07.1940 nach Frankreich, in der Zeit des Waffenstillstands. Dort war er in der Verwaltung eines Lagers mit französischen Kriegsgefangenen eingesetzt. Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 15/16.
420 | Theanolte Bähnisch
nen kurzen Gruß zu schicken“280. Und wieder einmal sollte ‚Berlin‘ der Schlüssel zum Neubeginn sein, wie schon in den Jahren 1926 und 1932/33. 4.3.5 „Ich war gezwungen, meine Kinder stark zuvernachlässigen“: Die Juristin zwischen dem „Dienst an der Allgemeinheit“ und der Rolle als Mutter Von ihren Plänen schien sie in den folgenden Monaten nicht allzu viele verwirklicht zu haben. Denn die Zeit verlief ganz anders, als Bähnisch ihrer Freundin Ilse Langner angekündigt hatte: Im August und September 1940 machte ihr zunächst die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Sie begab sich, ohne zu ahnen, welche Bedeutung dieser Ort einmal für sie bekommen sollte, für zwei Monate nach Bad Pyrmont in die Behandlung des bekannten Fastenarztes Dr. Otto Buchinger.281 Ihr Mann wurde, wie erwähnt, auf Beitreiben seines Arbeitgebers ab November 1940 noch einmal für etwas über ein Jahr vom Dienst an der Front freigestellt. Dann aber, ab Februar 1942, war Theanolte endgültig gezwungen, ihren Alltag weitgehend allein zu gestalten.282 Bevor Albrecht zum Militär mußte, hatte sich phasenweise ein starkes Bedürfnis, mit sich allein zu sein, in ihr breit gemacht. Im Juli 1940 hatte sie zwei Wochen lang ihren damals kranken Mann gepflegt und die Spannungen zwischen ihm und ihrer ebenfalls erkrankten Mutter ertragen. Auseinandersetzungen mit dem Hausmädchen sowie mit den Kindern, die sie „für die Ferien in ein Kinderheim abzugeben“ plante, hatten ihre Nerven zusätzlich strapaziert. Sie habe „ein […] starkes Bedürfnis nach Einsamkeit entwickelt“ und „die fixe Idee“ bekommen, „nur die Wüste“283 könne helfen, begründete sie Ilse Langner gegenüber ihre Reise nach Tripolis, von der sie später im Fragebogen der Militärregierung schreiben sollte, sie habe dort politische Beratungen gegen die NSDAP geleistet. Was nun eher zutrifft, läßt sich nicht sagen, doch daß der Wunsch nach Unabhängigkeit und innerer Einkehr tatsächlich eine große Rolle für Bähnisch gespielt hatte, wird deutlich, wenn man den Schriftverkehr der folgenden Jahre mit Langner unter die Lupe nimmt. Sich bei ihren Kindern, die während des Krieges284 zunächst bei Verwandten, dann bei Freunden im
280 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 12.07.1939 [1940]. 281 Vgl.: Fels, Hans-Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch. Unveröffentlichtes Manuskript [im Privatbesitz von Orla-Maria Fels in Waiblingen], o. O., o. J., S. 18. 282 Orla-Maria Fels erinnert sich jedoch noch an einen gemeinsamen Skiurlaub mit beiden Eltern 1942 in Obersdorf Mittelberg. Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. 283 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 12.07.1939 [1940]. 284 Zuerst seien sie und ihr Bruder bei ihren Tanten in Minden, Westfalen untergebracht gewesen, erklärte Orla-Maria Fels. Doch “dies erwies sich als nicht sehr günstig aus pädagogischer Sicht für uns denn Kinni und Josef hatten keine Kinder und hatten von Kindern keine Ahnung. Und wir haben denen auf dem Kopf rumgetanzt. Wir haben gemacht, was wir wollten. Und meine Mutter und mein Vater waren ernstlich beunruhigt. Und erinner-
Familienleben | 421
Taunus, untergebracht waren, aufzuhalten, empfand die Juristin offensichtlich auch als eine Anstrengung: „Mir tut nach Idstein [im Taunus] das Alleinsein hier gut“285, schrieb sie im Januar 1945 aus Berlin-Friedenau an Langner. Schon wenig später, im Februar des Jahres, wird Bähnischs Fernbleiben zum Konfliktherd zwischen den beiden Freundinnen. Der entsprechende Brief Langners ist nicht überliefert, doch aus der Antwort Bähnischs fällt es leicht, zu schließen, daß die Freundin ihr vorgeworfen haben muß, ihre Kinder auf Kosten ihrer ‚Geschäfte‘ zu vernachlässigen und sich auch bei ihr, Ilse, nicht gemeldet zu haben. Wieviel Zeit Theanolte während des Krieges mit ihren Kindern verbrachte, ist schwer zu rekonstruieren. In einem Brief an ihre Freundin Lotte Jacobi schreibt sie 1948, die Kinder seien „fast den ganzen Krieg durch allein“ gewesen und nach „fast 8-jähriger“ 286 Trennung sei sie froh, nun, 1948, wieder mit ihnen zusammenleben zu können. Orla-Maria Fels erinnert, daß sich ihre Mutter, während sie selbst in Idstein war, „von einem Monat zwei Wochen immer in Berlin [...] etwa“287 aufgehalten habe. Unklar bleibt jedoch, ob sie die anderen zwei Wochen jeweils bei ihren Kindern verbrachte. Die Antwort Theanoltes auf Ilse Langners Vorwurf war gleichzeitig eine Verteidigung wie auch ein – wohl eher ungewolltes – Eingeständnis. „Noch nie warst Du so bitter gegen mich und ungerecht“288, schrieb sie an die Freundin. Nicht „Geschäfte“ hätten sie daran gehindert, für ihre Kinder da zu sein, sondern „der Dienst an der Allgemeinheit“, zu dem sie sich „berufen“ gefühlt habe. In den folgenden Zeilen wird die Entfremdung zwischen der Mutter und den Kindern, von denen die Mutter offenbar eine große Reife erwartete, greifbar. Ihr sei klar gewesen, schrieb Bähnisch an Ilse, daß „wenn meine Kinder mich brauchten“, sie ihre Aufgabe in Berlin hätte aufgeben müssen. „Ich hatte schon lange alle Vorbereitungen getroffen und nur noch auf ein Zeichen von den Kindern gewartet. Ich war aber gar nicht so sicher, daß es kommen würde.“ Die Kinder hätten sich nämlich „sehr eng an Frau R. und die ganze Familie angeschlossen.“ Bei ihrem letzten Besuch, als sie „ihre Erholung geopfert habe […] um mit den Kindern zusammen zu sein“, seien diese gar über sie „hinweggegangen“. „Die Kinder hatten mich nicht nötig“, verlieh sie ihrer Enttäuschung Ausdruck. So sei „ihr Opfer sinnlos“ gewesen. Daß die Tochter ihr „erst“ gegen Ende ihres Besuches wieder näher gekommen war, wertete sie nicht als Erfolg und als Bestätigung für ihre Präsenz in Idstein, sondern als Ausdruck ihrer Machtlosigkeit. Offenbar hatte sie die Entscheidung über zukünftige Besuche bei den Kindern in
285 286 287 288
ten sich alter Freunde im Taunus, in Idstein im Taunus, wo sie ausgebildete Lehrerin war und er im technischen Hilfswerk in ner höheren Position ein strenger Mann, die selber drei Kinder hatten und wo sie dachten also der wird ja wohl Ordnung in diesen...“ Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34. Bähnisch an Langner, 09.01.1945. University of New Hampshire, Special Collections, MC 58, Box 27, f7,Theanolte Bähnisch an Lotte Jacobi, 20.07.1948. Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 27.02.1945.
422 | Theanolte Bähnisch
die Hände ihrer damals 14 Jahre alten Tochter gelegt. „Ich hatte mit ihr abgemacht, daß sie mir offen schreiben solle. Ich wollte nicht noch einmal umsonst für mich Wichtiges aufgeben.“289 Von dieser Verantwortung Gebrauch zu machen, sollte es für die Tochter allerdings bald keinen Grund mehr geben: Im Mai 1945 war der Krieg zu Ende, was Theanolte dazu veranlaßte, ihre Kinder wieder zu sich zu nehmen und in Köln zu bleiben. Der Reiseverkehr war zu jener Zeit ohnehin stark eingeschränkt, so daß sie ein Leben ‚auf Wanderschaft‘ nicht hätte führen können. In der Rückblende schreibt sie, sie sei während des Krieges aufgrund beruflicher und politischer Aufgaben „gezwungen“ gewesen, ihre Kinder „stark zu vernachlässigen“290. Worin dieser Zwang bestand, darüber läßt sich nur spekulieren. Andeutungen Theanolte Bähnischs aus dem zitierten Brief sowie aus Lebensläufen lassen auf eine wie auch immer geartete Tätigkeit schließen, die nicht mit der Politik des Dritten Reiches konform ging. Orla-Maria Fels beschreibt die Zeit des Krieges als eine Zeit, in der die Mutter in Berlin ihrer Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrätin nachging. Sie schließt sich dabei der Aussage ihrer Mutter, sie habe in diesem Zusammenhang ‚politisch Verfolgte‘ verteidigt, an: „sie war dann ja in Berlin und machte Praxis. Sie hat ja politisch Verfolgte da verteidigt. Es war eben Krieg und […] wir war‘n ja nicht die Einzigen. Kinderlandverschickung war das Normalste von der Welt, also ganze Klassen wurden, was weiß ich, nach Ostpreußen oder auch in die Alpen oder so geschickt und wir wurden eben in den Taunus geschickt zu der Zeit“. Ihre eigene Biographie reiht die Tochter damit in die Lage ihrer Generation ein, die Trennung von den Eltern interpretiert sie als ein ‚Gesetz der Zeit‘. Zum Verständnis der Situation verweist sie auf die Gefahren, die für die Kinder mit einem Leben in Köln verbunden gewesen wären: „Wir konnten tagtäglich in der Zeitung lesen, wo bombadiert wurde, Köln wurde bombardiert. Köln war restlos zerstört. Ich erinnere mich gut, daß meine Mutter einmal, weil sie in Köln gewesen war, bei uns in Idstein auftauchte und sie war noch verrußt, sie war noch schwarz, weil sie zu Fuß von Klettenberg da in der Aegidienberger Straße einen Bahnhof erreichen mußte und durch die brennenden Straßen lief und als sie dann bei uns in Idstein ausstieg, war sie immer noch dreckig. Und Kinder haben, glaube ich, damals das hingenommen, daß Trennung nötig war.“291 Theanolte Bähnischs Tochter ist es wichtig, zu betonen, daß zwischen ihr und ihrem Bruder sowie den Eltern ein enges emotionales Verhältnis bestanden habe. Dies setzt sie in Bezug zu ihrer eigenen Mutterrolle: „Also wir hatten ja selber Gelegenheit über Kinderbetreuung und Kindererziehung in einem Haushalt wo beide berufstätig sind und wo man viel unterwegs ist, nachzudenken, ich denke, daß ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe, daß die Intensität mit der man sich Kindern zuwendet das Entscheidende war. Also meine Mutter hatte sicher wenig Zeit für uns. Aber die Zeit, die war intensiv und wir fühlten uns ihr einfach sehr eng verbunden. Und auch meinem Vater. Es war, im Grunde das Entscheidende ist die Zuwendung, Du
289 Ebd. 290 University of New Hampshire, Special Collections, MC 58, Box 27, f7, Theanolte Bähnisch an Lotte Jacobi, 20.07.1948. 291 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen 11.11.2009.
Familienleben | 423
bist angenommen, du gehörst zu uns, wir bejahen Dich, wir finden Dich prima. Und dieses Gefühl haben unsere Eltern uns intensiv mitgegeben. Das, habe ich immer das Gefühl gehabt, das muß ich meinen Kindern so weitergeben.“292 Auch Theanolte selbst schrieb 1960, also mit großem zeitlichen Abstand zu der langen Trennungsphase während des Krieges in einem Brief an Lotte Jacobi: „Mit meinen Kindern verbindet mich ein sehr inniges Verhältnis und das ist wohl das beste [!], was man von seinen Kindern sagen kann.“293 Sie selbst habe nie das Gefühl gehabt, von ihrer Mutter im Stich gelassen worden zu sein, sagt Fels – und reagiert damit vorbeugend defensiv auf eine Frage, die ihr nach eigener Aussage oft gestellt worden sei. Auch vor der Freundin Ilse Langner nimmt sie die Mutter in Schutz: „Tante Ischi war eine Frau, die überspitzte Formulierungen liebte und selber keine Kinder hatte. Ich erinnere mich gut, daß meine Mutter und sie und ich bei einem Essen zusammensaßen und sie meiner Mutter Erziehungsvorschläge machte, worüber wir, meine Mutter und ich, uns nur ankuckten und kicherten. Und dachten ‚Ja, also da spricht ein Blinder von der Farbe.‘“294 Orla Maria Fels zufolge wohnte Theanolte Bähnisch, wenn sie beruflich in Berlin zu tun hatte, in der Wohnung ihrer Mutter Therese Nolte. In Köln soll die Familie nacheinander drei Wohnungen in verschiedenen Stadtteilen gehabt haben.295 Als Theanolte Bähnisch 1945 mit ihren beiden Kindern aus dem Taunus nach Köln zurückgekommen sei, sei die Wohnung der Familie Bähnisch im Erdgeschoß des Hauses von mehreren Familien aus anderen Teilen des Hauses bewohnt gewesen, deren Wohnungen im gleichen Haus in Folge des Krieges beschädigt gewesen seien. Sobald dies möglich gewesen sei, seien die Familien in ihre renovierten Wohnungen zurückgezogen. Im Winter 1945/46 sei der älteste Bruder Theanolte Bähnischs, Otto Nolte, mit seiner Frau Ria zur Familie Bähnisch gezogen.296 Die Beziehung Theanolte Bähnischs zu ihren Kindern, der Rechtfertigungsdruck, unter den sie geriet, lassen sich als Indizien für eine widersprüchliche Haltung Theanolte Bähnischs zum Thema Mutterschaft und Berufstätigkeit deuten. Dieser Aspekt aus dem Privatleben Bähnischs ist für die Berufsbiographie insofern relevant und aufschlußreich, als auch die nach 1945 von Bähnisch vertretene Position zum Themenkomplex Mutterschaft, Mütterlichkeit und Frauenberufstätigkeit stets widersprüchlich blieb. Sie stritt für das Recht von Frauen, einen Beruf auszuüben, und sah Frauen vor allem in Verwaltung und Politik, in einer ehemals männlichen Domäne, die im Laufe ihres eigenen Lebens langsam bröckelte, sinnvoll verwendet. Die (soziale) ‚Mütterlichkeit‘ von Frauen stellte sie als eine dafür wesentliche, geschlechtsspezifische Kernkompetenz dar. Gleichzeitig negierte sie die Vereinbarkeit von Beruf und (biologischer) Mutterrolle weitgehend, während sie die Mutterschaft im Rahmen des bürgerlichen Ideals der Kleinfamilie als ein erstrebenswertes, aber aufgrund der
292 Ebd. 293 University of New Hampshire, Special Collections, MC 58, Box 27, f7, Theanolte Bähnisch an Lotte Jacobi, 30.12.1960. 294 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen 11.11.2009. 295 Orla-Maria Fels an Nadine Freund, 14.09.2017. 296 Ebd.
424 | Theanolte Bähnisch
Relation von Männern zu Frauen in der Nachkriegszeit schwer zu erreichendes Ziel darstellte. Sie selbst folgte der Idee der Unvereinbarkeit von Mutterschaft und Berufstätigkeit argumentativ im Zusammenhang mit ihrer ersten Schwangerschaft im Jahr 1930, später schlug sie jedoch einen anderen Weg ein und war, obwohl sie Mutter war, berufstätig. Ihr Handeln stellte sie dabei stets als von einer höheren Macht bestimmt dar. Bezogen auf ihre Arbeit während des Zweiten Weltkriegs schrieb sie, wie erwähnt, sie sei gezwungen gewesen, ihre Kinder stark zu vernachlässigen. Gleichzeitig begriff sie zumindest die Zeit, die sie mit ihren Kindern verbrachte, als sie erholungsbedürftig war, als ein Opfer, was womöglich auch damit zusammen hing, daß die Familie ‚unvollständig‘ war und sie das Beisammensein mit ihren Kindern daran ständig erinnerte. Das Zusammenleben mit ihren Kindern erschien ihr zu jener Zeit offenbar kräftezehrend und undankbar – im Gegensatz zu der sie scheinbar beflügelnden Arbeit, von der jedoch unklar bleibt, wie sie aussah und in welchen Maß sie stattfand. Denkbar ist, daß sie 1946 ähnlich fühlte, als sie, nachdem sie die Kinder wieder zu sich genommen hatte, nach Hannover ging und das Amt der Regierungspräsidentin antrat. Denn dies bedeutet abermals eine Trennung von den Kindern – und abermals begründete sie ihre Entscheidung für den Beruf damit, daß sie sich der Allgemeinheit verpflichtet gefühlt habe. Außerdem habe sie für den Fall, daß ihr Mann nicht mehr zurückkehre, eine Aufgabe gebraucht, die sie ausfülle, erklärt sie – anders als in früheren Erinnerungen, 1972.297 Erst 1947, als die Kinder bereits weitgehend selbständig lebten, zogen sie gemeinsam mit ihrer Großmutter wieder zu ihrer Mutter. Dazwischen lagen – vom Beginn des Krieges bis 1947 gerechnet – acht Jahre, in denen Mutter und Kinder ihren Alltag nicht teilten. Doch jene Familienzeit schien nicht lange angehalten zu haben. Aus einem Zeitungsartikel, dem ein Interview zugrunde liegt, geht hervor, daß sie die Kinder, die sie im Artikel ihre „Freunde“ nennt, auch um 1949 „nur in den Ferien“298sah. In jenem Artikel bezeichnet sie die Trennung von ihren Kindern als ein ‚Opfer‘, das mit ihrem Beruf einhergehe – sie argumentierte 1949 also genau anders herum als 1945 – allerdings richteten sich ihre Ausführungen nun nicht an eine gute Freundin, sondern an die breite Öffentlichkeit. Gewiß, von außen betrachtet sind die geschilderten Umstände, wie zu Recht auch Orla-Maria Fels betont, gar nicht so außergewöhnlich: Der Krieg zerriß viele Familien in Deutschland und jene, die sich am Ende wiederfanden, konnten von Glück reden. Gemessen an der Rolle, die ihre keineswegs gewöhnliche Berufstätigkeit in Bähnischs Leben spielte, kommt dem Verhältnis zwischen der Mutter und den Kindern jedoch ein anderer Stellenwert für die Analyse ihres Handelns zu. Orla-Maria Fels folgte ihrer Mutter, was ihren eigenen Lebensweg betraf, jedenfalls auffällig stark: Sie studierte ebenfalls Rechtswissenschaften, setzte sich in ihrer juristischen Promotion wissenschaftlich sowie als Mitarbeiterin des Rundfunks auch anderweitig
297 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, S. 4, Die Entscheidung. 298 Henny-Hoffmann, Johanna: Frau Präsident… einen Augenblick, bitte, in: Mannheimer Morgen, 15.10.1949.
Familienleben | 425
mit der Frauenbewegung auseinander und wurde ebenfalls Ehefrau eines Juristen und Mutter. Auch der Sohn Theanoltes, Alfred Bähnisch wurde Jurist. Theanolte Bähnisch ging Zeit ihres Lebens – soweit bekannt ist – keine neue Partnerschaft mehr ein. Der gewichtigste Grund dafür wird sicherlich darin zu suchen sein, daß sie, wie so viele andere Frauen in den ersten Friedensjahren, nicht sicher über das Schicksal ihres Mannes sein konnte. Zwar ließ das Amtsgericht Köln Albrecht Bähnisch 1952 auf Antrag von Theanolte Bähnisch für tot erklären,299 jedoch konnte nie abschließend geklärt werden, ob er tatsächlich 1943 gestorben oder aber noch in Kriegsgefangenschaft geraten war. Von Seiten der Wehrmacht, die ihn zuletzt in der Nähe der ukrainischen Stadt Charkow eingesetzt hatte, galt er ab dem 06.03.1943 als vermißt.300 Für seine Familie habe, so erzählt Orla-Maria Fels, diese Unsicherheit einen schrecklichen Zustand des Hoffens und Wartens bedeutet, der erst Mitte der 1950er Jahre nachgelassen habe.301 Vermutlich bestand ein Zusammenhang mit der politischen Intervention Adenauers 1955, nach der die letzten Kriegsgefangenen aus Rußland nach Deutschland zurückgekehrt waren. Da Albrecht Bähnisch nicht unter ihnen war, dürfte sich die Hoffnung auf seine Rückkehr für seine Familie endgültig zerschlagen haben.
299 Die Information findet sich im Rahmen des Wiedergutmachungsverfahrens, das Theanolte Bähnisch angestrengt hat. NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Wiedergutmachungsbescheid des Bundesministers des Innern, 31.08.1953 (Abschrift). 300 Nds. 50, Acc. 75/88, Beschluss des Amtsgerichtes Köln, 19.12.1952, AZ 4 II 1027/52. 301 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009.
5
Eine unbekannte Behörde und ihre populäre Leiterin – Theanolte Bähnisch als Regierungspräsidentin des Bezirks Hannover in den ersten Nachkriegsjahren
5.1 1945 ALS CHANCE: ÜBER DEN AUFBAU UND DEN SELBSTENTWURF BÄHNISCHS ALS ERSTE DEUTSCHE REGIERUNGSPRÄSIDENTIN 5.1.1 „Wir […] möchten Sie besser verwendet sehen, als bisher“ 1 – Die Einladung nach Hannover „Der Regierungspräsident ist eine Frau“2 – wußten die Bremer Nachrichten am 27.08.1954, als eine einfache, wie im Kontext der Zeit gleichermaßen außergewöhnliche Tatsache zu verkünden. Die Schlagzeile schien gut dafür geeignet, die Gemüter der Leser im Stadtstaat Bremen in Staunen zu versetzen. Denn auch noch sechs Jahre nachdem Bähnisch am 01.10.1946 ihr Amt als Regierungspräsidentin des Bezirks Hannover angetreten hatte, war sie die einzige Frau, die in Deutschland eine solche Stellung bekleidete. Im Februar des Jahres 1946 hatte sie selbst kaum glauben können, was ihr wiederfahren sollte. „Man will mich absolut für Verwaltung und Politik haben. Einige Stellen habe ich schon abgelehnt. Jetzt hat man mir den Posten als Regierungspräsidentin angeboten. Erstaunlich, daß eine Frau solchen Posten hätte“3, brachte sie ihre Verwunderung über das Angebot aus Hannover, wo sozialdemokratische Politiker die SPD wieder aufbauten und auf die Mitarbeit Bähnischs zählten, zum Ausdruck. Doch die Juristin, die zu jener Zeit in Köln als Verwaltungsrechtsrätin tätig war, ließ sich zu Jubelschreien nicht hinreißen, sondern gab sich ihrer Freundin Ilse Langner
1 2 3
AddF, SP-01, Kurt Schumacher an Theanolte Bähnisch, Hannover, 16. 12.1945. O. V.: Der Regierungspräsident ist eine Frau, Theanolte Bähnisch, Chefin des Hauses Archivstraße 2 in Hannover – Keine Starallüren, in: Bremer Nachrichten, 27.08.1954. DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 15.02.1946.
428 | Theanolte Bähnisch
gegenüber reserviert: „Ich bin noch sehr unschlüssig, da das Beamtengehalt finanziell eine große Verschlechterung ist. Hinzu kommt die neue Wohnungssorge und vor allem Organisation der Ernährung. Schwere Fragen. Was meinst Du?“4 Kurt Schumacher, der SPD-Parteivorsitzende, hatte bereits geahnt, daß die Umworbene mit ihrer selbständigen Arbeit eine lukrative Tätigkeit gefunden hatte. „Wahrscheinlich werden sie mit ihrer Justizerei ein schweinemässiges Geld verdienen, so daß sie auf die armen Schächer in den Beamtenpositionen verächtlich hinunterblicken“5, hatte er ihr, seine Befürchtungen polemisierend, geschrieben – vielleicht, um sie auf diese Weise herauszufordern. Das Salär für Staatsbedienstete direkt nach Kriegsende war zum Reichwerden tatsächlich nicht geeignet. Bähnisch, die an Schumacher geschrieben hatte, daß sie seit dem Ende des Krieges „Butterbrot-PGs“6 gegenüber der Militärregierung verteidige, verrichtete ihre Dienste, sich selbst als „juristische Artistin“7 betrachtend, für eine große, zahlungskräftige Klientel. „Als es mir gelungen war, einen in Recklinghausen [im Militärcamp, Anm. d. V.] Internierten binnen 48 Stunden wieder nach Hause zurückzubringen, konnte ich mich vor Aufträgen nicht mehr retten“, schrieb sie 1964 in einem Zeitungsartikel über ihre Arbeit. „Außerdem beschäftigte mich ein großer Konzern, bei dem mein Mann tätig war“8, spielte sie im gleichen Atemzug – und damit erstmals vor einem breiteren Publikum – auf die Rheinische Kaufhalle AG an, für die Albrecht Bähnisch während des Dritten Reiches tätig gewesen war. Für die Richtigkeit ihrer Angaben im Fragebogen, den sie im Zusammenhang mit ihrer Zulassung zur Verwaltungsrechtsrätin im August 1945 ausfüllen mußte, hatte sich, wie bereits erwähnt, Dr. Werner Schulz, Vorstandsmitglied, später sogar Direktor der ‚Kaufhalle AG‘ verbürgt.9 Dieser hatte zu jener Zeit auch das Amt des Vizepräsidenten der Handelskammer Köln inne, war Stadtverordneter in Köln und wirtschaftspolitischer Berater des späteren Bundeskanzlers, Oberbürgermeister Konrad Adenauer. Im ‚Dritten Reich‘ hatte Schulz, nachdem er aufgrund seiner Ehe mit einer Jüdin unter Beschuß durch die Nationalsozialisten geraten war und sich geweigert hatte sich von seiner Frau zu trennen, seinen Vorstansposten, den er 1933 angenommen hatte, niederlegen müssen.10
4 5 6
Ebd. Eine Antwort Ilse Langners ist nicht überliefert. AddF, SP-01, Kurt Schumacher an Theanolte Bähnisch, Hannover, 16.12.1945. “So nannte ich der Militärregierung gegenüber die, die um ihrer Existenz willen der Partei beigetreten waren“, erklärt Bähnisch den Begriff im ersten Teil einer dreiteiligen Erinnerungsserie, die in der Hannoverschen Presse erschien. Bähnisch: Heimkehrerin. 7 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Schumacher, 23.12.1945 8 Bähnisch: Heimkehrerin. 9 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Military Government of Germany, Fragebogen, 05.08.1945. 10 Werner Schulz wurde am 21.05.1901 in Goldberg/Oberschlesien geboren. 1928 wurde er Prokurist bei der ‚Leonard Tietz AG‘, der späteren ‚Kaufhof AG‘, 1933 avancierte er zum Vorstandsmitglied der Tochtergesellschaft EHAPE, die heute ‚Kaufhalle‘ heißt. 1945 wurde er in den Vorstand der Kaufhof AG berufen. Vgl.: Boetticher: Handelsherr. Zur Arisierung des Konzerns siehe Kapitel 4.3.1.
Regierungspräsidentin | 429
Wie eng Bähnischs Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrätin 1945/46 mit dem Unternehmen verzahnt war, dessen Arisierung Frank Bajohr als eine ‚kalte Arisierung‘ bezeichnet,11 bleibt unklar. Immerhin spricht sie in den Erinnerungen, die sie in der Hannoverschen Presse veröffentlichte, von „ihrem Konzern“12. Über die Kontakte zum Konzern-Vorstand konnte sie Beziehungen zu mächtigen Wirtschaftseliten pflegen. Für die guten Beziehungen der Bähnischs zum Konzern spricht, daß neben Albrecht Bähnisch auch Otto Nolte, Theanoltes jüngerer Bruder, im Konzern Karriere machte. Er war 1945 als Mitarbeiter seiner Schwester an der juristischen Verteidigung von Kaufhalle-Vorstandsmitgliedern beteiligt gewesen13 und stieg in den 60er Jahren zum Aufsichtsrat im Konzern auf. Nicht sicher, aber aufgrund der herausgehobenen Stellung Albrecht Bähnischs im Konzern sehr wahrscheinlich, ist, daß Theanolte Bähnisch auch Abraham Frowein kennengelernt hatte, der von 1933–1948 Vorsitzender der Westdeutschen Kaufhof AG war. Frowein war in der Weimarer Republik Präsident der Deutschen Gruppe der Internationalen Handelskammer gewesen und wurde 1946 Präsident des Deutschen Wirtschaftsrates in der Britischen Besatzungszone.14 Sollte die Äußerung Schumachers in Bezug auf das Einkommen Bähnischs tatsächlich ein taktischer Schachzug gewesen sein, so war dieser am Ende erfolgreich: „Die Geldfrage spielt für mich […] keine Rolle“, gab sie im Antwortschreiben an den Parteivorsitzenden, anders als im Brief an Ilse Langner, an. „Wenn ich Materialistin wäre, müsste ich heute Besitzerin eines kleinen Dorfes sein15“, zerstreute sie Schumachers Bedenken mit einer gönnerhaften Nonchalance. Ihr Zögern, nach Hannover zu gehen, begründete sie ihm gegenüber vielmehr mit ihren gefühlten Ver-
11 Tietz hatte, im Wissen, daß es keinen Ausweg aus der Arisierung seines Konzerns geben würde, auf Druck der Banken den Arisierungsprozeß selbst eingeleitet, noch bevor entsprechende ‚staatliche‘ Gesetze erlassen wurden. Dem Leiter des Zentrums für Holocauststudien in München (Institut für Zeitgeschichte), Frank Bajohr, zufolge hatte Tietz kaum eine andere Wahl, da die Banken einen bereits bewilligten Kredit aus politischen Gründen zurückgehalten hätten, Vgl.: Repplinger, Roger: Zu „Tietz“ geht niemand mehr. Die Hansestadt feiert ‚100 Jahre Alsterhaus‘. Dass das Kaufhaus einmal anders hieß, wissen die wenigsten, in: Jüdische Allgemeine, 17.05.2012, auf: http://www.juedische-allgemeine.de/ article/view/id/13016, am 05.12.2013. 12 „In Köln sagte mir der Vorsitzende meines Konzerns: ‘Frau Bähnisch sie wollen wohl in Reformkleidern herumlaufen, ganz zu schweigen von ihren Hüten. Das Beamtengehalt ist mäßig.‘ Ich entschied mich trotzdem für Hannover.“ Bähnisch, Theanolte: Theanolte Bähnisch erzählt. Die Entscheidung für Hannover. Als die Flüchtlingszüge rollten/Mit Amtsniederlegung gedroht, in: Hannoversche Presse, Nr. 299, 23.12.1964. 13 GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Theanolte Bähnisch an Adolf Grimme, 23.12.1945. 14 Die zentrale Aufgabe der Einrichtung war es, die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Der Wirtschaftsrat war mit seinem parlamentarischen Zuschnitt – als Etappe auf dem Weg zum Wirtschaftsrat der Bizone und schließlich zum Deutschen Wirtschaftsrat – ein Vorläufer des Deutschen Bundestages. 15 AddF, SP-01, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1946.
430 | Theanolte Bähnisch
pflichtungen gegenüber ihren Kindern und der Ungewißheit über das Schicksal ihres Mannes, dem sie in Köln ein Zuhause bieten wolle, falls er aus Rußland zurückkehre. „Ich muss diese Wohnung als ruhenden Pol für die Familie […] halten. Dies bedingt meinen Wohnsitz in Köln.“16 Ihre Zukunft hatte sie 1945/46 zunächst nicht in der Verwaltung, sondern in einem stärker politisch ausgerichteten Amt gesehen. Dies hatte sie Schumacher gegenüber so begründet: „Auch die Partei braucht als Knochengerüst eine Bürokratie, daneben aber bürokratische Außenseiter, die echte Politiker sind, die Parteibürokratie kennen, aber nicht von ihr verschlungen werden. Dies geschieht bis zu einem gewissen Grade jedem, der in der Bürokratie laufend arbeiten muß. Für mich ist das mit ein wesentlicher Grund, warum ich mich gegen eine hauptberufliche Arbeit in der Verwaltungs- oder Parteibürokratie wehre. Die Bürokratie sichert nur den normalen Ablauf, aber vorwärts getrieben werden die Dinge von Ideenträgern, Persönlichkeiten, die eine starke Ausstrahlung besitzen.“17 Daran anknüpfend empfahl sie Schumacher, aus den Erfolgen der Nationalsozialisten zu lernen und „in erster Linie Persönlichkeiten herauszustellen, die lebendige Verkörperer unserer Weltanschauung darstellen“18 – um daraus schließlich ihr eigenes Stellenprofil zu entwerfen: „Sie sollten politische Strahlungspunkte in den verschiedenen Provinzen aus Leuten ihres Vertrauens bilden, die die örtliche Bürokratie befruchten und beleben. Diese sollten zu wichtigen Verhandlungen hinzugezogen werden. Ich glaube, in diesem Rahmen am besten verwertbar zu sein. […] Ein Mensch meiner Art ist m. E. in der Bürokratie nicht an dem Platze, wo er das Höchstmaß seiner Leistungs- und Auswirkungsmöglichkeit erreicht. Das ist aber in Zukunft bei uns allen nötig.“19 Bähnischs Zeilen strotzen geradezu vor Tatendrang und Selbstsicherheit und gipfeln schließlich in der Bemerkung, ihr „Selbstbewußtsein“ habe „eine äussere Stellung, selbst wenn es die eines Ministers wäre […] nicht nötig“. sie wolle schließlich „nichts werden“, sondern nur „etwas sein“20. Die Äußerungen zeigen, wie sehr die Juristin der Überzeugung anhing, für die Zukunft des Landes mitverantwortlich zu sein. Und was sie zunächst als Grund dafür ins Feld führte, nicht in der ‚Bürokratie‘ wirken zu wollen, nämlich daß sie ein möglichst hohes Maß an Leistung und Wirkung erreichen müsse, genau das führt sie später zur Untermauerung ihrer Entscheidung an, das Amt als Regierungspräsidentin des Bezirks Hannover anzunehmen. Wo für Bähnisch selbst die Grenzen zwischen ‚Bürokratie‘ und ‚Politik‘ verliefen, wird aus ihren Äußerungen nicht klar.21 So stehen sie teilweise im Widerspruch zur einflußreichen Stellung ihres Mannes in der Ministerialbürokratie, in der preußischen Verwaltungsreform(politik) insgesamt sowie auch zum Verwaltungshandeln des Re-
16 17 18 19 20 21
Ebd. Ebd. Ebd. Ebd. Ebd. Vermutlich bezog sich Bähnischs Aussage auf Schumachers Angebot, sie mit einem „gehobenen Akademiker-Referenten-Posten“ zu betrauen. AddF, SP-01, Schumacher an Bähnisch, 16.12.1945.
Regierungspräsidentin | 431
gierungspräsidiums Hannover unter ihrer Leitung. Allerdings trägt die hier geäußerte Sichtweise Bähnischs, die Bürokratie sichere „nur den normalen Ablauf“, dazu bei, zu verstehen warum sie, wie so viele andere, einen weitreichenden Austausch von Verwaltungsbeamten nach dem Ende des Dritten Reiches nicht für notwendig hielt. 1972 verspürte Theanolte Bähnisch das Bedürfnis, auch eine Art Läuterungserlebnis, das sie zur Annahme der Position in Hannover bewegt habe, zu beschreiben.22 Sie berichtet, daß sie einen Anwalt, der an einer Zusammenarbeit mit ihr interessiert gewesen sei, in seinem „friedensmäßigen Villenhaushalt“ besucht habe und zunächst von dessen Haus und Habe beeindruckt gewesen sei. Dann aber sei sie „aufgewacht, wie aus einem Traum“ und sich „der Gegenwart bewusst“ geworden. „Ist das Dein Lebensziel, viel Geld verdienen? Immer Einzelfälle bearbeiten?“, habe sie sich gefragt. „In Hannover wartete eine große Aufgabe auf mich, die mich ausfüllen konnte, wenn mein in Rußland vermißter Mann nicht zurückkam.“23 Daß die Unsicherheit über das Schicksal ihres Mannes ihren Entschluß, sich auf eine neue Herausforderung in einer fremden Stadt einzulassen, befördert haben soll, ist nachvollziehbar, auch wenn sie zuvor die Wohnung in Köln für den Fall der Rückkehr ihres Mannes hatte halten wollen. Beide Argumentationsrichtungen spiegen zwei Seiten derselben Medaille wieder. Die Ungewißheit über das Schicksal ihres Mannes verlangte ihr eine Entscheidung ab, die ins Festhalten am Bewährten oder in die Annahme einer neuen Herausforderung münden konnte. Die Juristin entschied sich für das Wagnis: „Auf einmal war alles klar! Ich brauchte eine Aufgabe und nicht einen Haufen Geld […] Ich war mit mir ins Reine gekommen.“24 5.1.2 Deutsche und britische Personalpolitik in der Provinz Hannover Oberst Hume, der Regional Commissioner der Britischen Militärregierung, habe in ihr, so schrieb Bähnisch sinngemäß in einem Artikel aus dem Jahr 1964, die ParadeBesetzung für das höchste Amt im Bezirk gesehen. Nur „mit einer Frau auf diesem Posten“25 habe er sich zugetraut, die gravierenden Probleme im Bezirk lösen zu können und sie deshalb glauben gemacht, sie sei „keine gute Deutsche“26, wenn sie die Stelle ablehne. 1972 schreibt Bähnisch, daß Hume bereits in Berlin, als er in den 1920er Jahren junger Attaché in der britischen Botschaft war, von Bähnisch als erstem weiblichen Assessor gehört habe und sich sofort nach seiner Ankunft in
22 Diese Erzählung korrespondiert inhaltlich mit der ebenfalls von Bähnisch im Diktat geschilderten Begebenheit, daß ihr Auftraggeber Werner Schulz ihr prophezeit habe, sie könne mit ihrer Anwaltspraxis eine „reiche Frau“ werden. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, S. 1, Anfrage aus Hannover. 23 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, S. 1, Die Entscheidung, S. 5. 24 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, S. 5, Die Entscheidung. 25 Bähnisch: Entscheidung. 26 Ebd.
432 | Theanolte Bähnisch
Deutschland 1945 nach ihr erkundigt habe. Er habe ihr deutlich gemacht, daß er das Land, in dem er selbst studiert habe, wieder aufbauen wolle.27 Außerdem habe er sie als die „second Mrs. Pankhurst“28 bezeichnet, um sich bei ihr einzuschmeicheln. Interessanterweise ‚entschärft‘ sie diese beschriebene Bezugnahme Humes auf die bekannte britische Frauenrechtlerin an anderer Stelle desselben Schriftstücks, indem sie ein Gespräch mit Hinrich Wilhelm Kopf29 wiedergibt, in welchem dieser sie als „charmant“ und als „kein Blaustrumpf“30 bezeichnet habe. Mit dem Begriff ‚Blaustrumpf‘ wurden vor allem im 19. Jahrhundert, aber auch darüber hinaus gebildete, als ‚unweiblich‘ geltende Frauen belegt und auf diese Weise abgewertet.31 Nach dem Gespräch mit Hume habe Kopf, der designierte Ministerpräsident, sie empfangen und ebenfalls in Humes Sinn auf sie eingeredet, schrieb Bähnisch wiederum im Artikel aus 1964. „Wie der mir zugesetzt hat, kann sich jeder denken, der Kopf kannte“32, stellte sie ihre Entscheidung für Hannover am Ende als alternativlos dar. Für Kopfs Interesse, Theanolte Bähnisch nach Hannover zu holen, spielte sicherlich der Umstand eine Rolle, daß Kopf gut mit dem beruflichen und politischen Ziehvater Bähnischs, Carl Severing, bekannt war.33 Der preußische Innenminister schien, nach allem, was Theanolte Bähnisch selbst schreibt, große Stücke auf sie gehalten zu haben. Es steht zu vermuten, daß er sich gegenüber Kopf, der 1919/20 Severings persönlicher Referent gewesen war, positiv über die Juristin geäußert hatte. Mit Hinrich Wilhelm Kopf, der aufgrund seiner Stellung der politisch mächtigste Deutsche im Land Niedersachsen war, verband Hume offenbar ein enges Vertrauensverhältnis.34 Kopf selbst war schon 1945 und blieb auch noch während seiner vier
27 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, S. 3, Unterredung mit Oberst Hume. 28 Ebd. 29 Kopf war Oberpräsident der preußischen Provinz Hannover, bis er mit der Gründung des Landes Niedersachsen und der Auflösung der Provinzen in diesem Zuge am 01.11.1946 das Amt des Ministerpräsidenten übernahm. 30 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, S. 4, Unterredung mit Oberpräsident Kopf. 31 „Irgendwann zwischen 1968 und heute kam das so populäre Schimpfwort abhanden“, schreibt Eva Weickart, Leiterin des Frauenbüros der Stadt Mainz. Weickart betont, daß viele Frauen, den Vorwurf ein ‚Blaustrumpf‘ zu sein, von sich wiesen. Vgl.: Weickart, Eva: Der Blaustrumpf. Ein fast vergessenes Schimpfwort, in: vernetzungsstelle.de. Das Portal aus Niedersachsen für Gleichberechtigung, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, auf: http://www.vernetzungsstelle.de/index.cfm?uuid=4566B782C2975CC8A429C69F0FF72C 9D&and_uuid=BA20B15BC2975CC8A9F47B1D4F74AECE, am 20.05.2015. 32 Bähnisch: Entscheidung. 33 Die Kopf-Biographin Teresa Nentwig weist darauf hin, daß Kopf bemüht war, bei seinen Personalentscheidungen zu berücksichtigen, daß die Konfessionen gleichmäßig verteilt waren. Vgl.: Nentwig: Kopf, S. 471. Der Umstand, daß Bähnisch katholisch war, könnte also ebenfalls eine Rolle für Kopfs Wahl gespielt haben. 34 Vgl.: Foedrowitz, Michael: Bunkerwelten: Luftschutzanlagen in Norddeutschland, Berlin 1998, S. 157/158.
Regierungspräsidentin | 433
Amtsperioden als Ministerpräsident, die bis 1955 andauerten, stark an Bähnischs Mitarbeit beim Wiederaufbau des Landes interessiert. Dies beweist nicht zuletzt sein Ansinnen, Bähnisch zu seiner persönlichen Referentin zu ernennen, als er noch das Amt des Oberpräsidenten inne-, das des Ministerpräsidenten aber schon vor Augen hatte. Damit hätte ihr Kopf die „wichtigste Vertrauensposition im Land Niedersachsen überhaupt“35 übertragen, hatte Schumacher an Bähnisch geschrieben, als der Posten der Regierungspräsidentin noch nicht zur Disposition stand. Was Werner Ellinghaus‘ Rolle bei ihrer Anstellung in Hannover betrifft, so bemüht Theanolte Bähnisch in ihrem Diktat 1972 einen öfter wiederkehrenden Erzählmodus, wonach jeweils ein männlicher Vorgesetzter, Mitarbeiter oder Kollege zunächst nicht von ihr überzeugt gewesen sei, jedoch nach einer Unterredung mit ihr oder einer ‚Feuerprobe‘ in der Praxis zu einem um so stärkeren Verfechter ihrer Verwendung in der entsprechenden Position und/oder einer Zusammenarbeit mit ihr geworden sei. Ellinghaus habe zunächst eine andere Kandidatin für seine Nachfolge im Amt des Regierungspräsidenten vor Augen gehabt, sei aber nach einem Gespräch mit ihr so sehr davon überzeugt gewesen, daß genau sie die richtige Besetzung für das Amt sei, daß er persönlich mit ihr zu Oberst Hume gefahren sei, um sicher zu stellen, daß sich Bähnisch dem Gespräch mit Hume stelle.36 Sie habe mit Ellinghaus eine „ungewöhnlich harmonische Zusammenarbeit“ gehabt, schrieb sie in einem Brief an den Kultusminister Adolf Grimme.37 Folgt man den Erinnerungen der Germanistikprofessorin Helena Deneke, die von der Militärregierung damit beauftragt wurde, Theanolte Bähnisch beim Wiederaufbau der Frauenbewegung zu unterstützen38, so hatte Oberst Hume, den sie fälschlicherweise als „Brigadier“ bezeichnet, darauf bestanden, daß Frauen in der britischen Besatzungszone verstärkt an der Verwaltung beteiligt würden. Auch was die Leitung der Bezirksregierung anging, habe er von vornherein entsprechendes im Sinn gehabt. Kopf und Schumacher hätten damit einen Auftrag zu erfüllen gehabt, der kein leichter war. „Frau Bähnisch was imported from the Rhineland“39, weil sich in der Region keine geeignete Frau habe finden lassen, schreibt Deneke in ihrem Tagebuch. Ob sich die Dinge nun genau so zugetragen hatten, läßt sich nicht nachweisen, aber es darf als sicher gelten, daß es im Land nur sehr wenige Frauen mit der entsprechenden Qualifikation gab und daß Schumachers und Kopfs Werben um Bähnisch ganz im Sinne der Demokratie- und Geschlechterpolitik der britischen Militärregierung in der Region war. Für die Briten, die im September 1945 mit 1.212 Offizieren, 1.637 Unteroffizieren und ihren Mannschaften in der ‚Hanover Region‘40 stationiert waren, sei
35 AddF, SP-01, Kurt Schumacher an Theanolte Bähnisch, 16.12.1945. 36 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, Unterredung mit Oberst Hume, S. 2. 37 GStA PK, VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Theanolte Bähnisch an Adolf Grimme, o. D. 38 Siehe Kapitel 6.8.2. 39 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Deneke Adds 1, Manuscript Diary of Helena Deneke, S. 37. 40 Die ‚Hanover Region‘ wurde aus der preußischen Provinz Hannover sowie den Ländern Braunschweig und Oldenburg gebildet.
434 | Theanolte Bähnisch
die Besetzung des Regierungspräsidiums mit Bähnisch „a showpiece of […] propaganda to help women into positions of local government and administration“41 gewesen, schreibt die Historikerin Denise Tscharntke. Daß ‚der Regierungspräsident‘ eine Frau war, spielte dem Bestreben der Militärregierung, Frauen zu politisch mündigen Bürgern zu erziehen und zu einer Mitarbeit in Politik und Verwaltung zu bewegen, mit einem Beispiel in die Hände, wie es gelungener kaum sein konnte. Dies wurde noch durch die Tatsache aufgewertet, daß sich die Regierungspräsidentin besonders der beruflichen und politischen Bildung von Frauen widmete, wie sie überhaupt ein Auge auf Frauen und Jugendliche im Bezirk richtete. In diesem Zusammenhang war sie bestrebt, kommunistische Einflüsse abzuwehren.42 Hume, den auch Helena Deneke als „ultimate responsible for her [Bähnischs] appointment in the German Civil Service“43 bezeichnet, fand sich in seiner Wahl offenbar bestätigt. „Hume got to like her and believed in her“44, notierte Deneke zum Thema ‚Theanolte Bähnisch‘ 1946 in ihr Tagebuch. Auch Adolf Grimme, ein erklärter und anerkannter Gegner des NS-Regimes, der – zunächst als Kultusminister, dann als Leiter des NWDR45 – zu den führenden Köpfen des Wiederaufbaus im neu gegründeten Land Niedersachsen gehörte, bestärkte die Militärregierung in ihrem Vertrauen in die Juristin, die Grimme ihrerseits als einen „alten Bekannten“46 bezeichnete. Das Ehepaar Grimme und Theanolte Bähnisch
41 Tscharntke: Re-educating, S. 158/159. 42 Vgl.: Röpcke: Saxony, S. 258. 43 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Deneke Adds 1, Manuscript Diary of Helena Deneke, S. 37/38. 44 Ebd., S. 38. 45 Grimme war preußischer Kultusminister von Januar 1930 bis Juli 1932 und wurde im Rahmen des ‚Preußenschlags‘ entmachtet. 1946 trat er sein Amt als niedersächsischer Kultusminister an, das er bis 1948 behielt. Seinen Wechsel zum NWDR begründet der Grimme-Biograph Kai Burkhardt mit Grimmes Verbindung zur Ehefrau des Ministerpräsidenten, Josefine Kopf, die pikanterweise, zu dieser Zeit (1926–1929) und noch unter dem Namen Josefine Freifrau von Behr, Josef Goebbels Sekretärin gewesen war. Die nationalsozialistischen Eliten kannte sie auch privat. Vgl.: Burkhardt, Kai: Hörbares Schweigen. Adolf Grimme und die „Rote Kapelle“ als erinnerte Geschichte der Nachkriegszeit, in: Brechtken, Markus (Hrsg.): Life writing and political memoir. Lebenszeugnisse und Politische Memoiren, S. 79––106, hier S. 99 und 277. Grimme selbst nannte jedoch (auch) andere Gründe für die Amtsniederlegung und stand mit Hinrich Wilhelm Kopf stets in gutem Kontakt, so daß nicht mit Sicherheit davon auszugehen ist, daß Josefine Kopf der Hauptgrund für Grimmes Entschluß war, 1948 zum NWDR nach Hamburg zu gehen. Vgl.: Meissner, Kurt: Zwischen Politik und Religion. Adolf Grimme. Leben, Werk und geistige Gestalt, Berlin 1993, S. 86. 46 Die Formulierung soll wohl die Interpretation nahelegen, daß Grimme und Bähnisch sich bereits vor 1945 gekannt hatten. Dies ist wahrscheinlich, da Bähnischs Bruder Otto Nolte im preußischen Kultusministerium gearbeitet hatte, als Grimme Minister des Ressorts war. Außerdem war Grimme gut mit Ernst von Harnack, dem späteren Vorgesetzten Albrecht
Regierungspräsidentin | 435
wurden in der gemeinsamen Hannoveraner Zeit gute Freunde.47 Der Kultusminister ging mit seiner Überzeugung, was die Fähigkeiten Bähnischs betraf, so weit, daß er sie sogar bat, ihn in seinem Amt als Kultusminister zu vertreten.48 In der Darstellung Bähnischs war es Grimme, der die Initiative ergriffen und ihr ein Telegramm gesendet haben soll, welches sie auf den zitierten Brief Schumachers habe vorbereiten sollen.49 Schließlich scheint die Unterstützung des evangelischen Landebischofs, Hanns Lilje, für Theanolte Bähnisch eine nicht unwesentliche Rolle bei der Besetzung des Postens gespielt zu haben. Friedrich Siegmund-Schultze stand in engem Kontakt zu den Evangelischen Akademien, es ist nicht auszuschließen, dass auch er seinen Einfluß in Bezug auf Bähnisch geltend machte. Der Einfluß Liljes, der im ‚Who is Who‘ der Militärregierung als „außergewöhnlicher Theologe von internationalem Ruf“50 bezeichnet wird, auf Personalfragen ist allgemein kaum zu überschätzen. Schon als es um die erste Besetzung des Oberpräsidiums ging, hatte Lilje den am Ende erfolgreichen Kandidaten Eberhard Hagemann51 empfohlen, ebenso verhielt es sich mit Hinrich Wilhelm Kopf, den Lilje und der katholische Bischof von Hildesheim, Godehard Mahrarens, für das Amt des ersten Regierungspräsidenten vorgeschlagen
47
48
49 50 51
Bähnischs bekannt. Beide engagierten sich gemeinsam im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Nach Grimmes Umzug nach Hamburg blieb die Verbindung jedoch eher ideeller Natur: „Ich wäre in diesen Jahren so gerne viel, viel mehr mit Ihnen zusammen gewesen, weil ich immer wieder berührt gewesen bin von der Gemeinsamkeit in der Sache und im Menschlichen. Ich denke vor allem auch immer dankbar daran zurück, was Sie Josefine gewesen sind“, schreibt er an Bähnisch und bittet Sie um einen Besuch in Hamburg. GStA PK, VI. HA, NL Grimme, Nr. 1665, Adolf Grimme an Theanolte Bähnisch, 16.12.1948. Bähnisch wiederum antwortete: „Ihre warmherzigen Zeilen haben mir so wohlgetan […] Für mich ist in Hannover eine große Lücke entstanden. Umso mehr freue ich mich über ihre herzliche Einladung“. GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Theanolte Bähnisch an Adolf Grimme, 21.12.1948. Die Bitte schien Grimme mündlich ausgesprochen zu haben, die Antwort Bähnischs erfolgte schriftlich. GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Theanolte Bähnisch an Adolf Grimme, o. D., nachträglich datiert auf „ca. Juli 1947“. Das Datum ist vermutlich falsch, denn die enge Zusammenarbeit Bähnischs als Regierungsvizepräsidentin mit Ellinghaus als Regierungspräsident – auf die sie im Brief anspricht – endete im September 1946, als Ellinghaus sein Amt niederlegte und Bähnisch seine Nachfolgerin wurde. Der Brief könnte also aus dem Juli 1946 stammen. Auch der Umstand, daß Bähnisch für den Brief einen Bogen mit ihrer Adresse in Köln und der Berufsbezeichnung „Verwaltungsrechtsrätin“ verfaßte, deutet auf einen früheren Entstehungszeitpunkt, als den angegebenen hin. Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, Anfrage aus Hannover, S. 1. Röpcke: Saxony, S. 288. Dem SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher war Hagemann jedoch ein Dorn im Auge. Er rechnete ihn zu einer „Clique von Welfen“ die „in Wirklichkeit deutschnational“ sei. Vgl.: Riesener: Polizeidirektion, S. 212/13.
436 | Theanolte Bähnisch
hatten.52 Theanolte Bähnisch fühlte sich dem Bischof auf Lebenszeit sehr verbunden53, und Lilje brachte seinerseits Theanolte Bähnisch eine hohe Achtung entgegen.54 5.1.3 Entwurf des ‚unternehmerischen Selbst‘ – Darstellung der Vergangenheit im Dienst von Gegenwart und Zukunft Daß Bähnisch in ihrem Diktat 1972 auf zwei aufeinanderfolgenden Seiten erwähnt, daß sie nicht nur auf der britischen, sondern auch auf der amerikanischen „Vertrauensliste“ gestanden habe und daß zum einen Oberst Hume, zum anderen ein Anwaltskollege sie darauf angesprochen hätten, bedient die Logik der (von Bähnisch beschriebenen) Zusammenhänge, welche Bähnischs Nachkriegskarriere möglich machten. Sie stellt damit heraus, daß sie 1945/46 sowohl im Süden als auch im Norden der britischen Besatzungszone als eine politisch vertrauenswürdige Person angesehen wurde und daß ihr damit verschiedene, jeweils mit großem Einfluß verbundene Stellungen offengestanden hätten. Damit, daß sie im Diktat Hume, Kopf, Grimme, Ellinghaus und Schumacher als wichtigste Protagonisten ihrer ‚Anwerbung‘ nach Hannover vorstellt und darauf verweist, daß Annemarie Renger, die Sekretärin Schumachers sie persönlich am Bahnhof abgeholt habe, entwirft sie in der Retrospektive ein Bild ihrer Person, wie es in Anbetracht der Machtverhältnisse in der direkten Nachkriegszeit sowie den mit dem Wiederaufbau verbundenen Notwendigkeiten passender kaum hätte sein können. Jene Personen, die sie hofierten, bekleideten nicht nur herausgehobene Stellungen in der Politik, sondern waren auch entweder in den demokratischen Wiederaufbau Niedersachsens involviert und/oder für ihre oppositionelle Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus bekannt. In ihrem Diktat von 1972 bezeichnet sich Bähnisch selbst – stilistisch über den Umweg eines Zitats von Hume aufgewertet – als eine „Frau mit Initiative und Mut während der Zeit des Nationalsozialismus“.55 Sie stellte sich jedoch nicht erst 1972, sondern bereits nach Ende des Krieges als zum rechten Flügel der SPD zugehörig dar. Dieser leitete aus seiner Reformpolitik in Preußen, aus seiner Fähigkeit und Bereitschaft als Akteur in einer pluralen Demokratie56 zu agieren und aus seinem Widerstand gegenüber dem Nationalsozialismus die
52 Vgl.: ebd., S. 211. 53 Diese Verbundenheit zeigt sich unter anderem in der Dankbarkeit, die sie Lilje für seinen Besuch im Jugendflüchtlingslager Poggenhagen entgegenbrachte. Landeskirchenarchiv (LKA) Hannover, L3 III, Nr. 544, Bähnisch an Lilje, 10.09.1951. 54 Vgl.: AddF, SP-01, Landebischof Dr. Hanns Lilje an Theanolte Bähnisch, 23.04.1964. 55 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Unterredung mit Oberst Hume, S. 3. 56 Vgl. dazu auch den gleichnamigen Sammelband: Lehnert, Detlef/Megerle, Klaus (Hrsg.): Pluralismus als Verfassungs- und Gesellschaftsmodell. Zur politischen Kultur der Weimarer Republik, Opladen 1993. Auf die von mir genannten Personen nehmen die Autoren allerdings nicht Bezug, Thema ist vielmehr die Zusammenarbeit führender sozialdemokratischer Politiker mit dem liberalen Verfassungsexperten Hugo Preuß. Vgl. besonders den
Regierungspräsidentin | 437
Berechtigung und den Auftrag ab, eine zweite deutsche Demokratie aufzubauen. Jene Eliten betrachteten – nicht nur in der Darstellung Bähnischs – die Verwaltungsjuristin als kompetent und befugt, an jenem Aufbauwerk mitzuarbeiten. Dies ist zum einen auf ihre Kontakte vor 1933 und auf das politische Schicksal ihres Mannes zurückzuführen57, zum anderen auf Theanolte Bähnischs Selbstdarstellung – zu der auch ‚Inkorporation‘ der Amtsenthebung ihres Mannes gehörte und auf ihre Aussagen im Fragebogen, den sie 1945 im Zusammenhang mit der Aufnahme ihrer Tätigkeit als Verwaltungsrechtsrätin in Köln ausfüllte. Die in Politik und Verwaltung erfahrenen ‚konservativen Sozialdemokraten‘ (Teresa Nentwig) fanden einander nach Kriegsende vergleichsweise schnell wieder und vergewisserten sich einer mehr oder weniger gemeinsam gelebten, beziehungsweise ähnlich interpretierten Vergangenheit. Sie unterstützen sich gegenseitig erfolgreich in der retrospektiven ‚Optimierung‘ der jeweiligen Biographien, die nicht selten auch eine teilweise lebensnotwendig gewesene Anpassung an die neue, nationalsozialistische Ordnung in Deutschland beinhalteten – oder sogar von einer aktiven Zuarbeit zum System geprägt waren. Letzteres wird beispielsweise in der Dissertation Teresa Nentwigs über Hinrich Wilhelm Kopf58 deutlich. Wesentlich war für jene Eliten – wie Volker Depkat am Beispiel einiger politischer Eliten der Weimarer Republik herausarbeitete – die jeweilige Erfahrung der Jahre 1933 und 1945 als eine historische Zäsur.59 Für Theanolte Bähnisch läßt sich ein entsprechendes Empfinden aus Briefen an Ilse Langner und an SPD-Politiker ebenfalls bestätigen. Sie teilte also ein ‚autobiographisches Verständnis‘ mit den von Depkat untersuchten Personen, die im Schnitt allerdings 15 Jahre älter waren als sie selbst. Auch retrospektiv bestätigt sie die im Kontext der Zeit empfundenen Brüche. Dies zeigt sich unter anderem in der Unterteilung ihres autobiographischen Diktats in zwei Teile, von denen letzterer 1945 beginnt. Die Deutung des eigenen Handelns und Erlebens zu jener Zeit erfuhr rückblickend allerdings graduelle Umdeutungen und andere Schwerpunktsetzungen, die sich zum einen an den Gepflogenheiten der Zeit der Niederschrift, aber auch an Erfahrungen, welche Bähnisch erst in den Jahren nach der ‚Zäsur‘ machte, orientieren. So dürfte die von ihr überlieferte Aussage Humes, sie sei die ‚Second Mrs Pankhurst‘, für sie erst zu jenem Zeitpunkt eine größere Bedeutung erhalten haben, nachdem sie bereits als Präsidentin des Frauenrings bekannt geworden war. Dies war 1945, als Hume sich entsprechend geäußert haben soll, jedoch noch nicht der Fall. ‚Belege‘ für ihr Engagement im Widerstand schienen 1945/46 entbehrlich, der rechte Flügel der SPD nahm sie mit offenen Armen auf. So wurde sie Teil eines Elitennetzwerkes, in dem sich die einzelnen Protagonisten immer wieder ihrer Zusam-
Beitrag: Lehnert, Detlef: Verfassungsdispositionen für die Politische Kultur der Weimarer Republik. Die Beiträge von Hugo Preuß im historisch-konzeptiven Vergleich, in: ebd. S. 11–48. 57 Siehe Kapitel 4.1.2 und 4.1.3. 58 Nentwig: Kopf. 59 Depkat: Lebenswenden, S. 484.
438 | Theanolte Bähnisch
mengehörigkeit versicherten60, sich gegenseitig protegierten61 und gemeinsam den Wiederaufbau Deutschlands vorantrieben. Daß sie über theoretisches Wissen und praktische Erfahrungen in der Verwaltung verfügte, wirkte sich ebenso positiv auf ihre Karriere-Chancen aus, wie ihr Ruf als Widerstandsaktivistin und der Umstand, daß sie als Frau über ein Alleinstellungsmerkmal verfügte, gegen das die ‚Konkurrenz‘ machtlos war. Zudem identifizierte sie sich gegenüber SPD-Parteigrößen in einer geschickten Art mit der Partei ihres Mannes, beispielsweise, indem sie Überlegungen zur Bildung neuer Allianzen und damit zur Rekrutierung neuer Wählergruppen anstellte. Obgleich sie gerade jene Aspekte ihrer Biographie in ihrer ‚Öffentlichkeitsarbeit‘ aussparte, die nicht in das Bild der beruflich unabhängigen NS-Widerstandsaktivistin passten, gelang es ihr, sich bodenständig und bevölkerungsnah zu präsentieren. Indem sie – anders als im Fragebogen – in der niedersächsischen Öffentlichkeit nicht verbreitet, im Ausland für sich und ihren Mann nach einer neuen beruflichen Möglichkeit gesucht zu haben, vermied sie, vermutlich bewußt, sich auf Distanz zur Logik der ‚Daheimgebliebenen‘, also des Großteils der Bevölkerung zu begeben. Mit der Wahrnehmung des Jahres 1945 nicht nur als eine persönliche, sondern auch als historische Zäsur, hing Bähnischs Überzeugung, daß sie zu jenem Zeitpunkt nicht nur ihr eigenes Leben neu einrichten, sondern sich aktiv am Wideraufbau ihres Heimatlandes beteiligen müsse, eng zusammen. In ihrem Diktat von 1972 beschwört sie nicht selbst die ‚positiven deutschen Traditionen‘, an die es im Wiederaufbau anzuknüpfen gelte, sondern legt diese Worte sinngemäß Oberst Hume, den sie über seine Studienzeit in Heidelberg und Freiburg sprechen läßt, in den Mund. Dies deutet darauf hin, daß sie in den 70er Jahren ihre kurz nach Kriegsende geäußerte Hoffnung, daß Deutschland wieder eine geachtete Nation werden könne und ihre Wahrnehmung, daß das Dritte Reich ein unpassendes, barbarisches Zwischenspiel einer ansonsten positiven deutschen Geschichte war, vorsichtiger präsentieren wollte, als in den 50er und 60er Jahren, als sie weitgehend im Stil Friedrich Meineckes argumentierte.62
60 Anna Mosolf, die Mitbegründerin des Clubs deutscher Frauen und Mitherausgeberin der ‚Stimme der Frau‘, schrieb 1955 an Grimme, daß die „räumliche Entfernung bedeutungslos gegenüber einer Gemeinsamkeit im geistigen Bereich“ sei. „In schweren Jahren war es ja das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit mit den Wenigen im Kampf gegen den Ungeist, das aufrechterhielt und zu ‚überleben‘ gebot. Dass sie mich auch in diesem Sinne als Weggenossin sehen, hat mich mit ganz besonderer Freude erfüllt.“ GStA PK VI. HA NL Grimme, Nr. 2145, Anna Mosolf an Adolf Grimme, 30.11.1955. 61 So schrieb Josefine Grimme an (ihren Ex-Ehemann) Hinrich Wilhelm Kopf, als dieser mit Vorwürfen bezüglich seiner Tätigkeit bei der Treuhandstelle Ost konfrontiert wurde, daß sie ihm „jederzeit als Entlastungszeuge“ zur Verfügung stehe. Sie habe durch ‚Thea‘ erfahren, daß Kopf zugetragen worden sei, seine zweite Frau, also Josefine, stecke „hinter den Angriffen“ gegen seine Person. GSTA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 3340, Josefine Grimme an Hinrich Wilhelm Kopf, 07.11.1948. 62 Vgl.: Meinecke, Friedrich: Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen, Wiesbaden 1946.
Regierungspräsidentin | 439
5.2 ‚FRISCHER WIND‘, ABER AUCH STARKE BEHARRUNGSTENDENZEN: BÄHNISCHS SICHT AUF DIE VERWALTUNG, IHRE ART DER AMTSFÜHRUNG UND AUSSENDARSTELLUNG 5.2.1 Ein Traditionsamt im Angesicht neuer Herausforderungen Von der Sicherung des „normalen Ablaufs“ durch die „Bürokratie“, von dem sich Bähnisch, wie sie Schumacher gegenüber erklärt hatte, nicht absorbieren lassen wollte, konnten führende Verwaltungs-Persönlichkeiten in den ersten Nachkriegsjahren nur träumen. Normal, im Sinne von ‚routiniert‘, war zu dieser Zeit in der Region, die an der Grenze zur sowjetischen Besatzungszone lag und die zu den Wohnungs-, Ernährungs- und Gesundheitssorgen der dort verwurzelten Bevölkerung auch einen großen Zustrom an Flüchtlingen verkraften mußte, kaum etwas. Verwaltungshandeln war, als Theanolte Bähnisch nach Hannover kam, in erster Linie der Existenzsicherung gewidmet. Mit ihrer Entscheidung, das Amt als Regierungspräsidentin anzunehmen, wählte die Juristin eine ebenso spannende, wie voraussehbar entbehrungsreiche, kräftezehrende Arbeit, die Bärbel Clemens zutreffend als „Bürde und Herausforderung“63 zugleich charakterisierte. Gleichzeitig stellte sie ihr Handeln in den Dienst einer preußischen Behördentradition, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Zuge der SteinHardenberg‘schen Reformen begründet worden war64 und lange Zeit als ein Charakteristikum des modernen Staates galt, weil sie dazu beitrug, staatliches Handeln zu optimieren. „…das Detail ist für das erste Collegium des Landes, das sich nur mit dem Ganzen beschäftigen sollte, zu groß, das ganze Collegium kann keine Kenntnis davon nehmen, wenn es wichtige Gegenstände nicht vernachlässigen soll und in den Departements, die nicht genug controlliret sind, entsteht daher mancher Nachtheil“65, hatte der Geheime Kammerrat von Hardenberg in einer im Jahr 1780 entstandenen Denkschrift die von ihm gefühlte Lücke in der Verwaltungshierarchie beschrieben. Eine neue Behörde, die zwischen den bisher existierenden Instanzen stehen sollte, galt es seiner Meinung nach zu etablieren. Die Kernaufgabe der im Zuge der Stein-Hardenberg’schen Verwaltungsreformen 1808 tatsächlich – in Kombination mit den Oberpräsidien – eingesetzten ‚Bezirksregierungen‘ war fortan, das ‚Bündeln und Lenken‘ von Verwaltungsaufgaben zwischen den Staatsregierungen und ministerien (später den Landesregierungen und -ministerien) als höchste sowie den Departements (später den Kreisen) als niedrigste Verwaltungsstufe zu übernehmen. Die gemäß ihrer Stellung als ‚Mittelbehörden‘ bezeichneten Ämter sollten im We-
63 Clemens: Frauen, S. 202. 64 Dieter Poestges geht davon aus, daß diese Verwaltungsordnung zwar durch das nach der Französischen Revolution eingeführte Departement-/Präfektursystem angeregt worden sei, aber doch eine eigene Entwicklung darstellt, die 1723 mit der Einrichtung von Kriegs- und Domänenkammern als mittelinstanzliche Verwaltungsbehörde begonnen habe. Vgl.: Poestges: Mittelinstanz, S. 3. 65 Geheimrat von Hardenberg, zitiert nach Poestges: Mittelinstanz, S. 5.
440 | Theanolte Bähnisch
sentlichen erstens die Gesetze und Verwaltungsanordnungen der Regierung und ihrer Fachressorts für einen regional begrenzten Bereich – den Regierungsbezirk – umsetzen helfen. Dazu gehörten meist auch Genehmigungs- und Bewilligungsvorgänge in Bezug auf staatliche Fördermittel.66 Zweitens sollten sie die Umsetzung der Verwaltungsanordnungen und Gesetze durch die unteren Landesbehörden laufend kontrollieren. Die Bezirksregierungen sollten also sowohl die Dienst- und Fachaufsicht über nachgeordnete Behörden, als auch die Kommunalaufsicht über die Landkreise, die kreisfeien Städte, Zweckverbände und Gemeinden des Regierungsbezirks ausüben. Bei ihrer Arbeit sollten die Regierungspräsidien die nebeneinander herlaufenden Fachstränge auf zwei Wegen – von den oberen zu den unteren Landesbehörden und umgekehrt – bündeln. Dazu wurden in den Regierungspräsidien verschiedene Fachabteilungen und -sektionen eingerichtet. Dierk Freudenberg zufolge lag und liegt die Herausforderung für die Regierungspräsidien beim ‚Bündeln‘ darin, „nicht koordinierte, zum Teil sogar widersprüchliche Vorgaben von Fachministerien in konkreten Verwaltungsentscheidungen auf einen Nenner zu bringen.“67 Für die Bürger fungierten, beziehungsweise fungieren die Regierungspräsidien zudem als Widerspruchsbehörde gegen die Entscheidungen nachgeordneter Instanzen. Aufgabe der Regierungspräsidenten beziehungsweise -präsidentinnen als Leiter und Leiterinnen der Behörden war es im Wesentlichen 1.) die übergeordnete Regierung im Bezirk zu repräsentieren und 2.) die Arbeit der verschiedenen Abteilungen und Fachressorts in der Bezirksregierung zu koordinieren – was auch hieß, in strittigen Fragen, welche Aufgabenbereiche verschiedener Fachdezernenten berührten, Entscheidungen herbeizuführen. Insgesamt gesehen übernahmen die Regierungspräsidien damit einen Großteil der Verwaltungsarbeit für die übergeordneten Regierungen, was für die Ministerien bedeutete, daß diese sich stärker auf ihre Regierungsfunktion konzentrieren konnten. „Le roi regne, mais il ne gouverne pas“68, zitiert Bähnisch sich selbst zu jenem Phänomen. Die Bezeichnung der Behörden variierte von Region zu Region. Mal war ‚Regierungspräsidium‘, mal ‚Bezirksregierung‘, manchmal auch – in preußischer Tradition an der Person des Behördenleiters orientiert – ‚Der Regierungspräsident‘ der offizielle Titel der entsprechenden Institution.69
66 In Niedersachsen war dies jedoch weniger der Fall, was die mehrfache offene Kritik einiger Regierungspräsidenten nach sich zog. NLA HA HStAH, Nds. 120 Hannover, Acc. 176/91, Nr. 27, Niederschrift über die Dienstbesprechung mit den Regierungspräsidenten im Niedersächsischen Ministerium des Innern, 26.06.1952, S. 16. 67 Freudenberg, Dierk: Planen und Entscheiden in der öffentlichen Verwaltung, Herford 1983, S. 350, zitiert nach Dittrich, Marcus: Bündeln & Lenken. Das Regierungspräsidium Kassel zwischen Verwalten und Gestalten, Kassel 2008, S. 45. 68 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, S. 10, Erste Oberkreisdirektorenkonferenz. 69 Zur Vereinfachung soll im Folgenden vom ‚Regierungspräsidium‘ gesprochen werden, wenn die Behörde als Ganze und vom ‚Regierungspräsidenten‘ bzw. der ‚Regierungspräsidentin‘ gesprochen werden, wenn die Person des Behördenleiters gemeint ist.
Regierungspräsidentin | 441
Theanolte Bähnisch konnte dem Amt, das sie laut ihren Erinnerungen so zögernd angetreten haben will, bald den besonderen Reiz abgewinnen, sich einer großen Breite von Aufgaben gleichzeitig widmen zu können: „Ich habe in meiner jetzigen Stellung die Möglichkeit, auf den verschiedensten Gebieten der Verwaltung Einfluß zu nehmen u. bleibe dadurch in Kontakt zum allgemeinen polit. Leben. Das entspricht ganz meiner Mentalität u. Veranlagung“70, brachte sie ihre Zufriedenheit mit der Position Adolf Grimme gegenüber zum Ausdruck. 5.2.2 „So menschlich wie möglich“71 – Mutmaßungen zur Popularität Theanolte Bähnischs Gemessen an der Öffentlichkeitswirkung anderer Regierungspräsidenten blieb die Art, mit der Theanolte Bähnisch in ihrem Amt und darüber hinaus in den folgenden Jahren Einfluß nahm und das politische Leben in der Region und bald in ganz Deutschland mitgestaltete, beispiellos. Allein schon die Medienberichterstattung spricht Bände. Über 30 Zeitungs-Artikel erschienen über die Regierungspräsidentin Theanolte Bähnisch in den Jahren 1946 bis 1964. Auffällig ist jedoch nicht nur die schiere Anzahl der Artikel, sondern vor allem auch der Umstand, daß es in den Artikeln meist um die Person Bähnischs an sich geht – und nur selten um aktuelle behördliche Entscheidungen, Strukturen oder Initiativen. Die regionale Presse bot der Regierungspräsidentin Raum, in biographischen Porträts und Interviews ihre Ideen und Überzeugungen zu verbreiten. Der SPD-nahe Spiegel, der ebenfalls in Hannover verlegt wurde, zeichnete jedoch ein kritisches Bild der Amtsträgerin.72 Zu Bähnischs Medienpräsenz trug sicherlich auch der Umstand bei, daß ‚der Regierungspräsident‘ für die Bevölkerung in der Nachkriegszeit eine existentielle Rolle spielte und – in Ermangelung einer Landesregierung – eine Adresse war, an die man sich wenden konnte, wenn Kommunal- oder Kreisverwaltung nicht weiterhelfen konnten – oder wollten. Ein Vergleich der Öffentlichkeitswirkung Bähnischs mit der anderer deutscher Regierungspräsidenten in der direkten Nachkriegszeit wäre sicherlich weiterführend. Das Thema muß jedoch einer eigenständigen Arbeit vorbehalten bleiben. Die Verwaltungswissenschaftlerin Christina Strick schreibt – um nur ein Beispiel zu nennen – daß in den Medien des Raums Düsseldorf in jenen Jahren nur selten und wenn, dann sogar eher kritisch über das örtliche Regierungspräsidium berichtet worden sei73. Strick führt dies darauf zurück, daß „generelle Forderungen nach einem Abbau von Bürokratie und einer Verringerung zentralstaatlicher Gewalt populär waren“. Die Regierungspräsidentin Bähnisch versuchte – offenbar erfolgreich – diese von Strick beschriebene gesellschaftliche Mißstimmung für sich zum Vorteil zu wenden: Sie warnte von sich aus in Zeitungsartikeln und Reden vor einer zu starken
70 GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Theanolte Bähnisch an Adolf Grimme, o. D. 71 „Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Es wird mein Bestreben sein, die Verwaltung so gut wie möglich, aber auch so menschlich wie möglich zu führen!“, soll Theanolte Bähnisch bei ihrem Amtsantritt gesagt haben. Langner: Regierungspräsident. 72 O. V.: Gleichberechtigte Frauen von 40 bis 60, in: Der Spiegel, Nr. 26, 28.06.1947. 73 Vgl.: Strick: Routine, S. 78.
442 | Theanolte Bähnisch
Bürokratisierung des öffentlichen Lebens, beziehungsweise strebte eine „Vermenschlichung der Bürokratie“74 an, wohl wissend, daß die Bürger handfeste Unterstützung anstelle von Paragraphendschungel erwarteten. Das Regierungspräsidium verstand sie als eine „Brücke in die Bevölkerung“75 und versprach – sinngemäß – Transparenz, Menschlichkeit und Bürgernähe.76 Die Oxforder Germanistik-Professorin Helena Deneke, die sich in der britischen Frauenbewegung engagierte, sieht Bähnischs Popularität vor allem darin begründet, daß diese wiederholt zur Teilhabe von Frauen am ‚öffentlichen Leben‘ Stellung bezog. „Her public appointment was a triumph on this cause and made a marked figure of her“77, beschrieb die Britin die Wirkung von Bähnischs Amt zur faktischen Untermauerung ihrer Thesen und Forderungen. Der Umstand, daß Bähnisch eine so große Öffentlichkeitswirkung erreichte wie keine anderer ihrer – allesamt männlichen – Kollegen, förderte den Bekanntheitsgrad der Regierungspräsidentin ebenfalls erheblich. Denn ihre Karriere und ihr Amt verschafften ihr Gehör – insbesondere, wenn sie über die Rolle von Frauen in der Gesellschaft sprach, zumal sie andere Frauen mit Entschiedenheit und klaren Worten aufforderte, ihr nachzueifern und sich stärker in das ‚öffentliche Leben‘ – ein Begriff mit dem sie Politik, Verwaltung und gesellschaftliches Engagement umschrieb – einzubringen.78 Das weibliche Geschlecht war damit nicht nur eines ihrer zentralen Themen, sondern auch ein besonders werbewirksamer Aspekt ihrer eigenen Persönlichkeit.79 „Das Entscheidende bei Thea Bähnisch ist, daß sie nicht, wie es so schön heißt, ‚ihren Mann steht‘, sondern ihren Posten mit fraulicher Wärme und echtem Menschentum spezifisch weiblicher Art ausfüllt“80, war in den Hessischen Nachrichten vom 10.11.1948 zu lesen, andere Medien argumentierten ganz ähnlich. Dem „öffentlichen Leben“ habe bisher „die weibliche Substanz gefehlt“81; über die Mitarbeit der Frauen, so argumentierte die Regierungspräsidentin und mit ihr die Presse, halte unweigerlich der Frieden Einzug in die Politik. „Es ist meine feste Überzeugung, daß die Frauen, wenn sie mit die Verantwortung getragen hätten, nicht dem Machtrausch verfallen wären“82, zitieren die Hessischen Nachrichten. Die Verfasser und Verfasserinnen von Porträts über Bähnisch betonten die Fachkompetenzen und die Durchsetzungsstärke der Regie-
74 Botzat, Robert: Diese Frau macht von sich reden. Die einzige Regierungspräsidentin der Bundesrepublik, in: N. N., Nr. 297 vom 15.12.1950, Kopie ohne Angabe der Zeitung in Stadtarchiv Hannover, Presse-Personen, Ba–Be, Nr. 718. 75 Schareina: Regierungspräsident. 76 Vgl.: ebd. sowie Wiese, Eberhard von: Die Präsidentin regiert. Männer „in gelöster Haltung“, in: Hamburger Abendblatt, Nr. 109, 12./13.05.1951, S. 11 und O. V.: Der Regierungspräsident ist eine Frau. 77 Bodleian Library, Oxford, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Deneke Adds 1, Manuscript Diary of Helena Deneke, S. 37. Hervorhebung durch mich. 78 Vgl.: Bähnisch: Staatsverwaltung. 79 Vgl.: Freund: Hut. 80 Sybill: Porträt. 81 Ebd. 82 Ebd.
Regierungspräsidentin | 443
rungspräsidentin und waren dabei stets darauf bedacht, die Sorge, Frau Bähnisch – und damit Frauen, die ihr nacheifern – könnten „vermännlicht“83 wirken, zu zerstreuen.84 Der Mannheimer Morgen charakterisierte Bähnisch deshalb auch über „ihre Stirnlöckchen, ihren duftigen Kragen und ihre frauliche Gestalt“85, während andere Medien ihre Hüte, die sie gern zu tragen pflegte, abbildeten86, oder betonten, daß sie „alles weniger als ein Blaustrumpf“87 sei. Eine Frau die nicht mütterlich sei, „ist für ein Wirken in der Öffentlichkeit nicht geeignet“88, zitiert Robert Botzat einen Grundsatz Theanolte Bähnischs, die der Meinung war, daß der Verwaltungsberuf den Frauen auch deshalb nahe liege, weil die Verwaltung ähnlich wie ein Haushalt zu führen sei.89 Daß sie danach trachte, in Zusammenarbeit auch mit den Männern, einen neuen Frauentyp zu schaffen, der selbständig denkt und es versteht, dem Manne Frau und Kameradin zugleich zu sein, erinnert an entsprechende Bestrebungen in der Weimarer Republik, eine ‚neue Frau‘90 zu etablieren – ein Unterfangen, an dem, wir erinnern uns, Bähnischs Freundin Ilse Langner ebenfalls mitwirkte.91 Daß in Bonn 1964 „fast so etwas wie eine Institution“92 verloren gemeldet wurde, als Bähnisch in Pension ging, sagt nicht nur etwas über die Art ihrer Amtsführung während ihrer Bonner Jahre aus. In diesen war sie, im Anschluß an ihre Zeit in Hannover, fünf Jahre lang als Staatssekretärin für das Land Niedersachsen tätig. Auch im Bezirk Hannover zeigte sie in der Öffentlichkeit starke Präsenz und pflegte vielfältige Kontakte zu anderen Eliten aus der Politik, der Verwaltung, der Wirtschaft und der Kultur. Nicht von ungefähr wies die Britische Militärregierung in ihrem ‚Who is who‘ auf Bähnischs „high standard of official integrity“93 hin. Sie präsentierte sich als Befürworterin eines starken, im Alltag der Bürger ebenso gegenwärtigen wie zugänglichen Staates. Dies erinnert an das ‚Freund und Helfer-Prinzip‘, welches die preußischen Polizeireformer verfolgt hatten, um den Ruf der Polizei in der Gesellschaft zu verbessern. Die Ziehtochter jener Reformer schien es auf die allgemeine Verwaltung übertragen zu wollen. Sie wird sich jedoch ebenso der Tatsache bewußt gewesen zusein, daß sie als Leiterin der Mittelinstanz in einigen Zusammenhängen unbefangener handeln konnte als die leitenden Beamten auf der Kreis- und Kommunalebene. Die Regierungspräsidien mußten auch unpopuläre Entscheidungen, die das Zusammenleben verschiedener Interessengruppen regulieren sollten, verantworten. Für die direkte Nachkriegszeit betraf dies beispielsweise die Betreuung, Verteilung,
83 Henny-Hoffmann: Präsident. 84 Zu den komplizierten argumentativen und grammatischen Konstruktionen, die aus jener selbst gestellten Aufgabe erwuchsen vgl.: Freund: Hut. 85 Henny-Hoffmann: Präsident. 86 Vgl.: Sybill: Porträt. 87 Botzat: Frau. 88 Ebd. 89 Henny-Hoffmann: Präsident. 90 Vgl.: Flemming: Frau. 91 Siehe Kapitel 2.2.3.2.4. 92 O. V.: Theanolte Bähnisch, in: Die Welt, 10.04.1964. 93 Röpcke: Saxony, S. 258.
444 | Theanolte Bähnisch
Einquartierung von Flüchtlingen im Bezirk Hannover.94 Für Bähnisch schien das Regierungspräsidium gerade nah genug an den Bürgern gewesen zu sein, um deren Lebensverhältnisse einschätzen zu können, aber auch entfernt genug, um weitgehend unbeeinflußt und notfalls auch gegen Widerstände Verwaltungsentscheidungen umzusetzen. Der patriarchalische – oder auch matriarchalische – Aspekt ihres Amtes schien auf Bähnisch einen besonderen Reiz ausgeübt zu haben. Sie wurde nicht müde, zu signalisieren, daß sie durchaus bereit sei, Bürger mit ihren Anliegen persönlich zu empfangen, daß ihr jeder Bitt-Brief vorgelegt werde95 und daß sie ihren persönlichen Spielraum bei der Auslegung von Gesetzen und Verordnungen im Dienste einer ‚menschlichen‘ Verwaltung voll ausschöpfe. „[D]ie Regierungspräsidentin hat sich ruhig über viele Bedenken und manche Paragraphen hinweggesetzt“96, schreibt die ‚Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung‘ mit lobendem Tenor in einem solchen Zusammenhang. Mehr als auf die vom Gesetzgeber festgeschriebene Funktion setzte Bähnisch in ihrem Amt auf persönliches ‚Charisma‘ – sie bemühte sich, wenn man so will, ihrer Kurt Schumacher gegenüber gemachten Aussage, „nichts werden“, sondern „etwas sein“ zu wollen, zu entsprechen. Dies wurde auch darin deutlich, daß sie nicht selten in Zusammenhängen nach Mitbestimmungsmöglichkeiten suchte, die ihren vom Gesetz her definierten Kompetenzbereich überstiegen oder in eine andere Zuständigkeit fielen. Daß sie sich entsprechend verhalten hatte, betonte sie auch in der Retrospektive. In ihrem Diktat 1972 beschreibt sie ihre regelmäßige Teilnahme an den Konferenzen der Oberkreisdirektoren entsprechend. An anderer Stelle berichtet sie, das Jugendflüchtlingslager ‚Poggenhagen‘97, das jenseits der Grenzen ‚ihres‘ Bezirks lag, begründet zu haben. Dafür, daß sie schließlich auch jenseits ihres eigentlichen Kompetenzbereichs als „Institution“98 wahrgenommen wurde und wohlgelitten war, machte sie zum einen ihre fachliche Qualifikation und ihren Intellekt, zum anderen aber auch besondere Charaktereigenschaften verantwortlich. „Ich bewege mich mit den Männern auf der ihnen vertrauten geistigen Ebene mit voller Sicherheit, transponiere aber Geist und Verstand in meiner weiblichen Art unter Verzicht auf erotische Mätzchen“, erklärte sie Kurt Schumacher gegenüber einmal „das Geheimnis“ ihrer „Erfolge“99. 1972 beschrieb sie allerdings eine Unterredung mit Kopf, die jener Argumentation von 1945 widerspricht: Demnach habe sie Kopf, der sie dazu habe überreden wollen, Regierungspräsidentin zu werden, erklärt, daß eine Frau, wenn sie ‚nein‘ meine, eigentlich ‚vielleicht‘ sage, und wenn sie ‚vielleicht‘ sage, dann meine
94 NLA HA HStAH, Nds. 120 Hannover, Acc. 176/91, Nr. 27, Niederschrift über die Dienstbesprechung mit den Regierungspräsidenten im Niedersächsischen Ministerium des Innern am 12.03.1952 und 28.03.1952, S. 19. 95 Wiese: Präsidentin. 96 O. V.: Schubfach. 97 Siehe Kapitel 5.6.1. 98 O. V.: Theanolte Bähnisch, in: Die Welt, 10.04.1964. 99 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945.
Regierungspräsidentin | 445
sie ‚ja‘.100 Ob sich die Juristin zu jener Zeit widersprüchlich verhielt oder ob sie sich, als sie im Rentenalter ihre Erinnerungen diktierte, mehr Koketterie zugestand als mit Mitte vierzig, läßt sich nicht klären. Daß sie vor Feuerproben, mit denen sie ihre Standhaftigkeit im wahrsten Sinne des Wortes unter Beweis stellen konnte, nicht zurückschreckte, soll wohl ihre Anekdote über die Versammlung eines Gemeinderats in einem Landkreis, bei der sie zugegen gewesen sei, unter Beweis stellen. Sie habe mit den anwesenden Herren drei Schnäpse getrunken, bevor sie einen „anständigen Kaffee“ verlangt habe, schreibt Bähnisch. Ihrer Darstellung nach hatte sie sich mit der „Schnapsrunde“101 den Respekt und das Vertrauen der Lokalpolitiker verdient. Die SPD, die ihrer Genossin allgemein gesehen kein besonders lobendes Andenken bewahrte, würdigte anläßlich ihres 65. Geburtstages immerhin die Leistung Bähnischs dahingehend, daß sie „nach dem Kriege“ daran mitgewirkt habe „daß eine funktionsfähige Verwaltung wieder aufgebaut, [und] Hunger, Not und Verzweiflung gebannt werden konnten“102. Tatsächlich waren diese Inhalte prägend für den Alltag ihrer ersten Amtsjahre, zumal sie sich selbst – das geht nicht nur aus ihren, sondern auch aus dem Tagebuch Helena Denekes hervor103 – an einen einfachen Lebensstil gewöhnen mußte. Mit ein paar Jahren Abstand zu den Ereignissen berichtete sie ihrer mittlerweile weit entfernt lebenden Freundin Lotte Jacobi, sie habe in dieser Zeit „2 Jahre […] wie eine Studentin gelebt“ und sich „von der Arbeit auffressen lassen“104, bevor sie sich soweit ‚freigeschwommen‘ und etabliert gehabt habe, daß sie ihre Kinder, ihre Mutter und ihre älteste Schwester zu sich nach Hannover habe holen können. Nicht selten hatte sie ihren Diensteifer und ihren Einsatz darüber hinaus mit längeren Phasen von Krankheit bezahlt.105 Schon im Sommer 1947 stand die eher zierliche Frau zum ersten Mal seit Kriegsende am Rande ihrer Kräfte. Im August des Jahres nahm sie, auf Anraten ihres Freundes Adolf Grimme, schließlich eine mehrwöchige Auszeit im Kurbad Pyrmont, nachdem sie selbst das Gefühl gehabt hatte sich „infolge Überarbeitung seit Monaten […] in einem Stagnationsprozeß zu befinden“, der den „inneren Quell der Kraft und Intuition hat versiegen lassen“. Wie sie an ihren Vertrauten Grimme schrieb, war dies „ein entsetzliches Gefühl“106.
100 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, S. 4, Unterredung mit Oberpräsident Kopf. 101 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, S. 11, Erster Termin in einem Landkreis. 102 AdSD, Personalia 480, Mitteilung für die Presse, SPD, 24.04.1964. Demnach war auch ein Telegramm im Namen Willy Brandts, Fritz Erlers und Herbert Wehners an Bähnisch geschickt worden. 103 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Deneke Adds 1, Manuscript Diary of Helena Deneke, S. 38. 104 GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Theanolte Bähnisch an Adolf Grimme, 12.08.1947. 105 Siehe Kapitel 7.5.1 und 8.1.1. 106 GStA PK VI. HA, NL Grimme, 1239, Theanolte Bähnisch an Adolf Grimme, 12.08.1947.
446 | Theanolte Bähnisch
5.2.3 Eine politische Beamtin als Fürstreiterin für politischen Pluralismus und die Zusammenarbeit mit den Kirchen Mit einer auf Pluralismus und politische Teilhabe ausgerichteten Arbeit wollte Bähnisch die Zukunft der Region und des Landes mitgestalten. Mit ihrem Einsatz für Frauenbildung, für einen deutschlandweiten Lastenausgleich107, für eine gerechtere Verteilung von Flüchtlingen auf die britische Besatzungszone sowie für die Verbesserung der Existenzbedingungen der im Bezirk lebenden Flüchtlinge, für Kriegsheimkehrer, für ‚vagabundierende‘ Jugendliche, für Aus- und Weiterbildungsangebote (auch von Verwaltungsangestellten) und den sozialen Wohnungsbau stellte sie sich der Herausforderung, Interessengegensätze zu befrieden und Bürger gleichzeitig zur politischen Teilhabe zu motivieren. Als erklärt konsensorientierte Persönlichkeit genoß sie – wie in den folgenden Kapiteln deutlich werden wird – die Unterstützung vieler Politiker aus anderen demokratischen Parteien. Sie selbst warnte vor extremen Nationalisten auf der einen108 und vor Kommunisten auf der anderen Seite. Daß sich Bähnisch stärker an den Überzeugungen der Gründerväter der Weimarer Verfassung, der großen Koalition in Preußen sowie an ihren Erfahrungen in Kreisen wie den Soroptimistinnen und der SAG orientierte als an der politischen Linie der SPD sorgte allerdings – auch dies wird an anderer Stelle vertieft werden – für Unmut bei vielen Sozialdemokraten. Daß die Regierungspräsidentin zu wichtigen Vertretern der Kirchen ein gutes Verhältnis pflegte – neben Lilje wären vor allem der Pastor und Flüchtlingsminister Heinrich Albertz109 sowie die Vikarin Grete Daasch zu nennen – und dem Christentum eine identitätsstiftende und richtungsweisende Rolle zuschrieb110, dürfte ihren Erfolg noch vermehrt und ihr Ansehen vergrößert haben. Denn insbesondere die Militärregierung glaubte an den positiven Einfluß der Kirchen im Wiederaufbau Deutschlands als Hilfe zur „moralischen Erneuerung“ der Gesellschaft. Bähnischs Wille zur Kooperation mit den Kirchen dürfte daher nur zu gern gesehen gewesen sein. Der Theologe Hans Otte hält fest, daß insbesondere Landesbischof Lilje – der wohl wichtigste Vertraute Bähnischs aus dem Umfeld der Kirchen neben Friedrich Siegmund-Schultze und der Vikarin Grete Daasch – für den notwendigen Aufbruch, „ohne den Bruch mit der Vergangenheit allzu tief erscheinen zu lassen“111, gestanden habe. Langfristig, so Otte, habe dieser Aufbruch jedoch die Instrumente bereitge-
107 Bähnisch, Theanolte: Neue Hoffnung, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 3, S. 3. 108 Deshalb warnte sie vor einer Radikalisierung der Flüchtlingsorganisationen, insbesondere vor Waldemar Kraft, dem Leiter des BHE. NA, UK, FO 371/103932. The Chancery, Office of the U. K. High Comissioner, Wahnerheide, Rheinland an das Central Department, Foreign Office, London, 17.08.1953, AZ CW 10113/118. 109 Ein Brief an Agnes von Zahn-Harnack bestätigt, daß Bähnisch regelmäßig zu Dienstbesprechungen mit Albertz zusammenkam. DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Zahn-Harnack, 01.09.1948. 110 Vgl. dazu beispielsweise: Bähnisch: Himmel, S. 4/5. 111 Vgl. dazu auch: Grosse, Heinrich W./Otte, Hans/Perels, Joachim: Neubeginn nach der NS-Herrschaft? Die Hannoversche Landeskirche nach 1945, 2. Aufl. 2003, S. 48.
Regierungspräsidentin | 447
stellt, die eine gesellschaftliche Neuorientierung der evangelischen Kirche ermöglichten.112 Kurt Schumacher nahm die Empfehlungen Bähnischs, die SPD solle enger mit den Kirchen zusammenarbeiten, ernst und plante gemeinsam mit Grimme Zusammenkünfte mit Vertretern der Kirchen.113 Daß Bähnisch an die Kraft der Kirche als Institution der geistigen Erneuerung glaubte, zeigt ihre rege Anteilnahme an Veranstaltungen vor allem der evangelischen Kirche. In der Evangelischen Akademie Bad Boll reflektierte sie gemeinsam mit anderen Persönlichkeiten aus den Kirchen, aus Politik und Verwaltung, aus Kunst und Kultur, aus dem Journalismus und der Wirtschaft nicht zuletzt die Umstände, welche die Entstehung des Nationalsozialismus begünstigt hatten.114 Ein kirchenfreundliches und konfessionsoffenes Profil sowie eine Orientierung an christlichen Werten wünschte sich Bähnisch auch von ihren Kollegen in Verwaltung und Politik. Auf seine Predigt anläßlich der Eröffnung des Niedersächsischen Landtages Bezug nehmend, hatte sie dem Landesbischof Lilje mitgeteilt: „Sie [die Predigt, Anm. d. V.] hat mich, wie alles, was der Herr Landesbischof sagt, tief beeindruckt und ich hoffe, daß sie dazu beigetragen hat, die Abgeordneten des Niedersächsischen Landtages in dem Willen zu einer sachlichen Arbeit zu bestärken.“115 Als Regierungspräsidentin der britischen Besatzungszone, in einem Bundesland, welches unter Hinrich Wilhelm Kopf von einer Vielparteienregierung116 geführt wurde und mehrheitlich protestantisch geprägt war, das sich aber der großen Herausforderung stellen mußte, die meist katholischen Flüchtlinge aus den Ostgebieten zu integrieren, war die katholisch getaufte, aber von protestantischen Vordenkern begeisterte Bähnisch mit ihren Überzeugungen für eine parteiübergreifende, interkonfessionelle Zusammenarbeit am richtigen Ort. Ihre Stellung als politische Beamtin dürfte Bähnischs Visionen und Zielen insgesamt stark entgegen gekommen sein. Das Amt eröffnete ihr nämlich eine Möglichkeit, mit ihren Zielen an die Öffentlichkeit zu treten, ohne daß sie sich einer Parteidisziplin unterwerfen mußte, ja, ohne daß sie es durfte, denn der ‚politische Beamte‘ war nur insofern ‚politisch‘, als es dem Ministerpräsidenten zustand, ‚seine‘ politischen Beamten entsprechend eigener politischer Überzeugungen ein- bzw. abzusetzen. Teresa Nentwig sieht die Distanz von Bähnischs direktem Vorgesetzten, Hinrich Wilhelm Kopf, gegenüber ‚seiner‘ Partei, der SPD zumindest teilweise im „aus dem Kaiserreich stammenden Amtsverständnis“ begründet, daß „eine dem Staat verpflich-
112 Vgl.: ebd. 113 GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 2517, Kurt Schumacher an Adolf Grimme, 21.03.1946. 114 LKA Hannover, NL Lilje, L3 III, Nr. 1104, Evangelische Akademie Loccum, Gespräch für Journalisten über das Thema ‚Hitler‘, 11. bis 15.06.1953, Protokoll. 115 LKA Hannover, NL Lilje, L3 III Nr. 544, Bähnisch an Dr. Ruppel, Kanzlei des Landesbischofs, 05.07.1947. 116 Die Minister des ersten Kabinetts Kopf kamen aus SPD, CDU, NLP/DP, FDP, KPD und dem Zentrum. 1948 bestand die Regierung aus Vertretern der SPD, der CDU und dem Zentrum, 1950 waren nur noch SPD und Zentrum an der Regierung beteiligt. Vgl.: Riesener: Polizeidirektion, S. 230, Anm. 3.
448 | Theanolte Bähnisch
tete öffentliche Tätigkeit“ eine „herausgehobene Parteifunktion“117 ausschließe. Explizit verlieh Kopf seiner Gegnerschaft gegenüber der „Parteipolitisierung der Beamtenschaft“118 1946 in einem Brief an die CDU Ausdruck. Daß die Regierungspräsidentin sich nicht zuletzt auch aufgrund einer entsprechenden Haltung Kopfs betont parteineutral gab, ist nicht unwahrscheinlich. Kopf hatte gar, so schreibt Nentwig, gegenüber der Militärregierung im Juni 1945 gefordert, Parteien noch nicht zuzulassen, weil die persönlichen Sorgen der Bürger noch zu groß seien.119 Nentwig beschreibt Kopf auch in seinem Politikstil so, daß ihm „Kompromisse im Allgemeinen wichtiger“ gewesen seien „als die Durchsetzung der Parteilinie“120. Der SPD-Parteivorstand, in dem konsens- und Europa-orientierte Politiker wie der bekennende ‚religiöse Sozialist‘ Adolf Grimme bald unter Beschuß gerieten, konnte gegen die ebenfalls konsensorientierte und europabewegte Regierungspräsidentin nichts ausrichten, wenn sie im besten Sinne ihres Auftrags als Verwaltungsbeamtin ‚ohne Bevorzugung‘ und ‚ohne Benachteiligung‘ besonderer Personen oder Gruppen für Frauen, für Flüchtlinge, für Kriegsheimkehrer und für Bombenopfer eine Form von Politik betrieb, die mal mehr und mal weniger als solche wahrgenommen und bezeichnet wurde. So mußte der linke Flügel der Partei zusehen, als Bähnisch – mit der Hilfe der Militärregierung – aus dem Regierungspräsidium heraus einen Frauenverband aufbaute, dessen Ziel es eben nicht war, die Mitglieder zum Sozialismus zu führen, sondern in dem Frauen verschiedener politischer Couleur sich zusammenfinden sollten, um sich über Politik und Alltag auszutauschen, unterschiedliche Meinungen respektieren zu lernen und gemeinsam Programme aufzustellen.121 Hinrich Wilhelm Kopf schien mit ‚seiner‘ Regierungspräsidentin zufrieden gewesen zu sein.122 Bähnischs Amtsphase war mit 13 Dienstjahren überdurchschnittlich lang und überdauerte auch die Ablösung Kopfs durch Heinrich Hellwege (DP) als Ministerpräsident 1955. 1959 kehrte Kopf für eine weitere Amtsperiode, die bis zu seinem Tod 1961 andauern sollte, an die Spitze der Landesregierung zurück und ernannte Bähnisch schließlich zur Staatssekretärin. In dieser Eigenschaft vertrat sie fortan das Land Niedersachsen in Bonn, bis zu ihrer Pensionierung 1964 – also auch nach Kopfs Tod, unter dem neuen Mi-nisterpräsidenten Georg Diederichs. Daß Bähnisch es verstand, ihr Amt zu ihrem Nutzen auszugestalten, daß sie nicht, wie so mancher Regierungspräsident vor allem der späteren Jahre, verhältnismäßig farblos blieb und im Hintergrund agierte, ist ohne Zweifel ihrer Fähigkeit, sich geschickt zu positionieren und zu vermarkten, ihren Wert als eine ‚Gallionsfigur‘ für
117 118 119 120 121 122
Nentwig: Kopf, S. 490. Kopf, zitiert nach: ebd., S. 472. Ebd., S. 491. Vgl. zum gleichen Thema auch: ebd., S. 492/493. Ebd., S. 497. Siehe unter anderem Kapitel 6.5.2. Die Tatsache, daß die Regierung Hannover zur Einführung einer einheitlichen Geschäftsführung in allen übrigen Regierungen einen „Überdruck“ ihrer Geschäftsordnung übersenden sollte, darf als Hinweis darauf gewertet werden, daß das Regierungspräsidium in Hannover als geradezu mustergültig empfunden wurde. NLA HA HStAH, Nds. 120 Lün., Acc. 30/67, Nr. 215.
Regierungspräsidentin | 449
die niedersächsische Landesregierung und für die Militärregierung zu erkennen und auszugestalten, sowie ihrer Fähigkeit, zu vermitteln und zu überzeugen, zuzuschreiben. Daneben machte die Tatsache, daß sie eine Frau war und sich – ohne sich an einer Partei zu orientieren – für Frauen stark machte, sie – vor allem in einer gesellschaftlichen Umbruchsituation, die mit der Suche nach einer neuen Ordnung und neuen Werten einherging – besonders interessant für die Militärregierung, wie auch für Journalisten, die auf der Suche nach Themen waren, die den Zeitgeist trafen und gleichzeitig der Überwindung des Nationalsozialismus dienen konnten. 5.2.4 Regionales Amt – überregionale Wirkung In Hannover hatte sich eine Politik- und Verwaltungselite zusammen- und zu wesentlichen Teilen an eine frühere Zusammenarbeit im Staat Preußen anknüpfend, wiedergefunden, die mit ihrem Modell überregional Schule machen wollte. Einige jener preußischen Politik- und Verwaltungseliten, die sich in der Weimarer Republik mit ihrer Reformpolitik den Entwicklungen auf Reichsebene deutlich überlegen gefühlt hatten, sahen sich nun – nach der Zerschlagung des größten deutschen Flächenstaates Preußen und der Etablierung der Bundesländer – in der Reichweite ihrer Politik noch stärker beschränkt. Vor dem Hintergrund klar abgegrenzter Bund-LänderKompetenzen schwanden die Hoffnungen, die eigenen Ziele und Visionen auf den ganzen Staat ausdehnen zu können, zunehmend. Nach einer euphorischen Anfangszeit zeigte sich beispielsweise Adolf Grimme, einer der wohl bekanntesten und einflußreichsten Kulturpolitiker Deutschlands, der bis 1933 Kultusminister in Preußen gewesen war und während seiner Exiljahre in Großbritannien hoch gehandelt wurde, frustriert darüber, daß er „immer stärker den verhängnisvollen Rückschlag auch auf die Kulturpolitik der einzelnen Länder verspüre, den der überspitzte Föderalismus hervorruft“123. Sein Amt als Kultusminister legte er deshalb 1948 nieder, in der Hoffnung, sich als Leiter des NWDR, den er als eine „volksbildnerische Möglichkeit“124 betrachtete, eines „überregionale[n] Instrument[es]“ zur Verbreitung seiner Ideen bedienen zu können.125 Eliten in Niedersachsen, die auf Grimme als einen starken Reformmotor gesetzt hatten, reagierten auf diese Entwicklung allerdings mit Bedauern oder Enttäuschung.126 Von einem ganz ähnlichen Sendungsbewußtsein getrieben, suchte sich Bähnisch bald verschiedene Möglichkeiten, ihre Ziele auch überregional zu verfolgen: Durch
123 GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 2517, Adolf Grimme an Kurt Schumacher, 09.10.1948. 124 Burkhardt: Biografie, S. 275. 125 Vermutlich spielte auch der Umstand eine Rolle, daß Grimme Sorge hatte, ob er sich politisch im Amt halten könne, nachdem er sich von seiner ersten Ehefrau hatte scheiden lassen und Josefine Kopf, die Ehefrau des Ministerpräsidenten geheiratet hatte. Der Freundschaft zwischen den beiden Männern tat dies Umstand allerdings keinen Abbruch. Dies schlägt sich im Briefwechsel zwischen Grimme und Kopf nieder. GSTA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 3440. 126 Vgl.: Burkhardt: Biographie, S. 273 ff.
450 | Theanolte Bähnisch
den schrittweisen Aufbau einer bald bundesweiten Frauenorganisation, durch die Herausgabe einer Zeitschrift, die helfen sollte, die Verbindung zu den Frauen in Berlin zu halten127, durch die Mitarbeit im Deutschen Rat der Europäischen Bewegung sowie in zahlreichen Verbänden war Bähnisch bundesweit bekannt. In puncto Frauen- und Europapolitik machte sie sich sogar in anderen europäischen Ländern einen Namen. Die Breite ihrer Ämter, von denen sie einige allerdings eher pro forma innehatte, deutet darauf hin, daß sie, ähnlich wie Grimme128, glaubte, den Wiederaufbau, vor allem in kultureller Hinsicht, nicht allein mit staatlichen Mitteln bewerkstelligen zu können. Um ihren Interessen nachzukommen und ihren vielfältigen Ämtern zu entsprechen, unternahm sie viele Reisen, vor allem in den Raum Köln/Bonn, das neue politische Zentrum Deutschlands, aber auch in andere deutsche Städte und Regionen – Berlin eingeschlossen – sowie in das Ausland. Viele ihrer Reisen, für die sie teils Diensturlaub beantragte, die sie teils aber auch in Urlaube integrierte, unterstützte die Militärregierung, einige wurden von der Bundesregierung gefördert.129 Anders als Grimme blieb Theanolte Bähnisch Hannover und Niedersachsen bis 1959 treu, wohl nicht zuletzt, weil sie sich unter jener besonderen Spezies „konservativer Sozialdemokraten“ (Teresa Nentwig) wohl fühlte und weil sie, wie andere ihrer Mitstreiter vor Ort, zu hoffen schien, im niedersächsischen Modell von Politik und Verwaltung die ‚besten Elemente‘ preußischer Traditionen aus der Weimarer Republik konservieren zu können. 5.2.5 Zwischen Unterstützungserwartung und Souveränitätsstreben: Die Kooperation mit der Militärregierung Die Aufgabenfülle, mit der die Regierungspräsidentin konfrontiert war und die Vielgestaltigkeit ihres Engagements, welches sie jenseits der amtlichen Notwendigkeiten für zusätzliche Aufgaben erkennen ließ, verblassen oft in den zeitgenössischen Zeitungs-Artikeln, aber auch in der Literatur über die Regierungspräsidentin hinter ihren vielbeschworenen frauenpolitischen Aktivitäten. Dabei waren Theanolte Bähnischs Aufgaben, so verschiedenen sie auch waren, auf das Engste miteinander verwoben. Dies gilt nicht zuletzt für ihre Ausrichtung auf die Wiederherstellung und Pflege internationaler Kontakte. Als Kooperationspartner und Referenzmacht bot sich dafür, aufgrund der Präsenz britischer Truppen im Raum Hannover, vor allem Großbritannien an. Im Zuge ihres Bestrebens, nicht nur selbst konsensorientiert zu arbeiten, sondern auch in der Bevölkerung den Willen zur überparteilichen und interkonfessionellen Kooperation zu fördern und überhaupt erst einmal ein Interesse an demokratischen Partizipationsprozessen anzustoßen, arbeitete Bähnisch engagiert und überzeugt mit der Britischen Militärregierung zusammen. „She had declared that she was eager to
127 DFR-Archiv, A2, passim. 128 Vgl.: Burkhardt: Biographie, S. 274. 129 Siehe Kapitel 8.6.2.
Regierungspräsidentin | 451
co-operate with the British in work for […] Germany“130, schrieb die bereits zitierte Helena Deneke über Bähnisch und zeigte damit, daß das Interesse an einer Zusammenarbeit auf Gegenseitigkeit beruhte, denn an anderer Stelle erklärte Deneke, die britische Perspektive auf Bähnisch beschreibend, „[o]ur people expected great things of her“131. Während aus diversen Quellen, die im entsprechenden Zusammenhang vorgestellt werden sollen, vor allem die Rolle Bähnischs in der deutsch-britischen Zusammenarbeit auf dem Feld der staatsbürgerlichen Frauenbildung herausgearbeitet werden kann, geben die Berichte, welche die ‚Regional Commissioners‘ und die ‚Land Commissioners‘ regelmäßig an die nächsthöhere Instanz der Militärregierung schickten, Auskunft über eine größere Bandbreite deutsch-britischer Zusammenarbeit im Verantwortungsbereich der Regierungspräsidentin. Die ‚Monthly Reports‘ aus der ‚Hanover Region‘, zu einem geringeren Teil auch jene aus dem ‚Niedersachsen Headquarter‘ zeigen: Theanolte Bähnisch hatte nicht nur einen ausgeprägten Willen zum Austausch und zur Zusammenarbeit mit den Briten, was in Verwaltungssachen vor allem eine häufige Abstimmung mit dem Regional Comissioner Hume bedeutete. Sie pflegte – bis auf wenige Ausnahmen – auch die Militärregierung und die politischen und zivilgesellschaftlichen Verhältnisse in Großbritannien in ein äußerst positives Licht zu rücken und erwies sich damit als eine loyale Partnerin. Zu Bähnischs Arbeit für eine deutsch-britische Zusammenarbeit gehörte es nämlich zunächst einmal, den Argwohn vieler Deutscher zu widerlegen, welche glaubten, die Besatzungsmacht ließe die deutsche Bevölkerung hungern, während die Engländer selbst in einer Art Schlaraffenland lebten. Um die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, daß auch die britische Nachkriegsgegenwart von Entbehrungen geprägt war, sprach die Regierungspräsidentin beispielswiese wiederholt vor Publikum über ihre Erfahrungen auf einer England-Reise, die sie Ende 1946 unternahm.132 In der von beidseitigem Vertrauen und gegenseitiger Anerkennung geprägten Atmosphäre schreckte die Regierungspräsidentin auch nicht davor zurück, die Militärregierung in Bezug auf einige wesentliche Aspekte ihrer Politik zu kritisieren. Erwartungen sowohl finanzieller als auch organisatorischer und ideeller Unterstützung durch die Besatzer mischten sich peu á peu mit dem Bestreben, eigene Gestaltungskompetenzen in der Verwaltung zu wahren und Souveränität zurückzuerlangen. Dabei suchte die Juristin nicht selten den großen Auftritt. Geradezu legendär geworden ist folgende Vorstellung Bähnischs vor den Generälen der amerikanischen und der britischen Militärregierung: Um die Knappheit der von der Militärregierung zugeteilten Lebensmittel zu visualisieren, hatte sie die tägliche Nahrungsmittelration eines Bürgers der Britischen Besatzungszone auf einen Teller drapiert und, das Kamerateam gleich im Schlepptau, den verdutzten Generälen Clay und Robertson „Meine Herren, sehen sie sich das an“133 entgegengerufen. Die Regierungspräsidentin wurde
130 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Deneke Adds 1, Manuscript Diary of Helena Deneke, S, S. 35. 131 Ebd. 132 Siehe Kapitel 6.8. 133 Wolf: Augen.
452 | Theanolte Bähnisch
dafür wie eine Heldin gefeiert. „This meeting gave Bähnisch the unique chance to show herself as an advocate of German women and in this way to win their sympathies”134, nimmt Denise Tscharntke dazu Stellung. Die Begebenheit, die ihren Niederschlag auch in den Akten der britischen Militärregierung fand, verbreitete Bähnisch über die ‚Stimme der Frau‘ auch in fernere Regionen. Einem Zeitungsartikel zufolge will sie in Bezug auf die Flüchtlingspolitik gegenüber der Militärregierung sogar noch impulsiver gehandelt haben. „Es kam der Tag, da wir die weitere Aufnahme von Flüchtlingen nicht mehr verantworten konnten. Ich ging zum Nachfolger von Oberst Hume […] und erklärte ihm, ich würde mein Amt niederlegen, wenn weiter von mir verlangt würde, Flüchtlinge aufzunehmen“135, berichtete sie. Auffällig hieran ist, wie stark Bähnisch den Auftrag des Regierungspräsidiums, die Personen zu verteilen und zu versorgen, personalisierte – als habe nicht das entsprechende Dezernat, sondern sie selbst für die Ankommenden Sorge tragen müssen. Auch was die Entnazifizierung betraf, stellte Bähnisch sich gern als bürgernahe Behördenchefin, welche mutig die Grenzen der ‚zumutbaren‘ Interventionen durch die Militärregierung absteckte, dar. Jeder Beamte oder Angestellte, der vor dem 01.01.1938 eine höhere Stelle als die eines Büroangestellten im öffentlichen Dienst bekleidet hatte und der weiterhin in einer solchen Position tätig sein wollte, war gezwungen, einen Fragebogen der Militärregierung auszufüllen, der über sein Leben während des Dritten Reichs Auskunft geben sollte. Die neuen Behördenleiter hatten diese auf Richtigkeit zu überprüfen und an die Militärregierung weiterzuleiten, die über das weitere Schicksal des Betreffenden entschied. Ursprünglich sollten alle Personen, die vor dem 01.04.1933 Mitglieder der NSDAP gewesen waren, in der SA, SS oder HJ oder einer anderen nationalsozialistischen Organisation einen Offiziersrang bekleidet hatten oder bei der Gestapo oder beim Sicherheitsdienst der SS gewesen waren, sofort entlassen werden.136 Erst im Frühjahr 1947 trat in der Britischen Besatzungszone das System der Kategorisierungen nach I. ‚Hauptschuldigen‘, II. ‚Belasteten‘, III. ‚Minderbelasteten‘ IV. ‚Mitläufern‘ und V. ‚Entlasteten‘ in Kraft.137 Für die Entnazifizierungsverfahren zuständig waren laut Geschäftsverteilungsplan der Regierung Hannover 1949 Regierungsrat Dr. Dinter sowie die Oberinspektoren Krause und Oetker.138 Zu untersuchen, wie genau die Entnazifizierung an der
134 135 136 137
Tscharntke: Re-educating, S. 169. Bähnisch: Entscheidung. Vgl.: Schrulle Bezirksregierungen. Zur Entnazifizierung in den vier Zonen vgl.: Vollnhals, Clemens (Hrsg.): Entnazifizierung. Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Besatzungszonen 1945–1949, München 1991. Vgl. zur britischen Zone auch: Jones, Jill: Eradicating Nazism from the British Zone of Germany. Early Policy and Practice, in: German History 8 (1990), S. 245–162. Zur Entnazifizierung in der amerikanischen Besatzungszone vgl. den ‚Klassiker‘: Niethammer, Lutz: Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizierung am Beispiel Bayerns, Bonn 1982. Literarisch verarbeitet wurde die Entnazifizierung in Ernst Salomons autobiographischem Roman ‚Der Fragebogen‘, der 1951 erschien. 138 Vgl.: O. V.: Organisationsplan der Regierung Hannover, Hannover, 01.05.1949, S. 4.
Regierungspräsidentin | 453
Regierung Hannover vor sich ging, sprengt den Rahmen dieser Arbeit, zumal ein Großteil der Verantwortung für die Durchführung der Entnazifizierung nicht Bähnisch, sondern ihrem Amtsvorgänger Wolfgang Ellinghaus zufiel und die Entnazifizierung in Niedersachsen bisher noch nicht systematisch erforscht wurde.139 Es ist jedoch davon auszugehen, daß auch die Regierung Hannover von der Gepflogenheit britischer Besatzungsoffiziere, die Weiterverwendung einer „nicht geringen Zahl politisch belasteter Beamter“140 zu genehmigen, was die Möglichkeiten, den Verwaltungsapparat am Laufen zu halten anging, profitierte. Wurden bei den Entnazifizierungsverfahren in der Britischen Besatzungszone zwar „die Überspitzungen der Amerikaner vermieden“141, wie es Lutz Niethammer formuliert, so stand doch auch die britische Entnazifizierungspraxis in der Kritik, nicht nur durch die Bevölkerung, sondern auch durch die Behördenleiter. Die Historikerin Hedwig Schrulle weist allerdings darauf hin, daß der Regierungspräsident von Arnsberg, Fritz Fries, die Entnazifizierung mit starkem Nachdruck betrieb.142 Von Bähnisch ist eine andere Haltung überliefert: Nachweislich widersetzte sich Bähnisch zumindest in einem Fall offen einer Anordnung, einen ihrer Mitarbeiter zu entlassen.143 1964 berichtet sie, „ohne stichhaltige Gründe“ gar keinen Beamten entlassen zu haben. „Trotz wiederholten Drängens [von Seiten der Militärregierung] blieb ich fest, da Gründe mir nicht mitgeteilt wurden. Die Beamten sind geblieben.“144 In ihrem Diktat von 1972 gab sie an, daß sie für „Denunziationen“ und „Intrigen“ in ih-
139 Eine entsprechende Arbeit will Julie Boekhoff als Dissertation vorlegen. 140 Vgl.: Schrulle: Bezirksregierungen, S. 484. 141 Niethammer, Lutz: Deutschland danach. Postfaschistische Gesellschaft und nationales Gedächtnis, Bonn 1999, S. 55. 142 Vgl.: Schrulle: Bezirksregierungen, S. 487–489. 143 Eine Ladung der Regierungspräsidentin desParlamentarischen Untersuchungsausschusseszeigt, daß Bähnisch trotz Aufforderung der ‚Entnazifizierungssache des Oberregierungsrats Dr. Tegethoff‘ nicht nachgegangen war. NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc 75/88, Büro des Niedersächsischen Landtages, Geschäftsstelle des 4. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses an Frau Regierungspräsidentin Bähnisch, Ladung, 07.12. 1953. Im Organisationsplan der Regierung Hannover war ein Mitarbeiter namens Tegethoff als leitender Dezernent des Oberversicherungsamtes verzeichnet. Vgl.: Organisationsplan der Regierung Hannover, S. 63. Im Staatsarchiv Hannover ist auch eine Personalakte von einem im Jahr 1901 geborenen ‚W. Tegethoff‘, der bis 1945 in der Polizeidirektion Hannover tätig war, überliefert. Womöglich handelte es sich dabei um den späteren Polizeipräsidenten von Bonn, Wilhelm Tegethoff (Amtszeit 1954–1962). Einer polnischen Website zufolge war ein anderer, 1906 geborener Wilhelm Tegethoff, SSUntersturmführer bei der Waffen SS. Vgl.: Najbarowski, Łukasz/Sadaj, Waldemar: Numery członków SS od 250 000 do 250 999.podana jest najwyższa udokumentowana ranga jaką uzyskali n/w członkowie SSwszystkie pozycje są nadal uzupełniane, auf: http://www.dws-xip.pl/reich/biografie/numery/numer250.html, am 13.12.2013. Ob diese Angabe richtig ist und ob es sich um den Dezernenten des Oberversicherungsamtes handelte, ließ sich nicht klären, da eine Personalakte des Dezernenten nicht überliefert ist. 144 Bähnisch: Entscheidung.
454 | Theanolte Bähnisch
rer Behörde „nicht zu haben“ gewesen sei, und nimmt dabei auf einen Fall Bezug, in dem sie ein Mitarbeiter darauf angesprochen habe, daß einer der Regierungsräte ein „alter Nazi“145sei. Führt man sich vor Augen, daß mit jedem entlassenen Beamten ein Mitarbeiter weniger zur Bearbeitung der anfallenden Aufgaben zur Verfügung stand, so darf die Aussage Bähnischs nicht nur unter dem Gesichtspunkt der ‚Fairneß‘ gegenüber den Mitarbeitern betrachtet werden, sondern muß auch vor dem Hintergrund des In-teresses der Behördenleiterin an einer ‚reibungslosen Verwaltung‘ gesehen werden. Hedwig Schrulle geht sicher nicht fehl, wenn sie schreibt, daß „in den ersten Monaten nach Kriegsende das Engagement deutscher Verwaltungsspitzen für die Entnazifizierung in hohem Maße von ihrer ideologischen und gesellschaftlichen Ausrichtung abhängig war“146. Als deutlich überzogen empfand Bähnisch die Kritik, welche die ‚Interessengemeinschaft der Entnazifizierungsgeschädigten‘ am 20.03.1954 in Bremen auffuhr. Dem ‚Informa-tionsdienst für Frauenfragen‘ teilte sie auf Nachfrage147 mit, daß ein Dr. Odenwald auf der Veranstaltung „in scharfen Formulierungen zu den ‚Leidtragenden des Entnazifizierungsschwindels‘“148 gesprochen habe und dabei die Entnazifizierung als „schmutziges Geschäft“ und „nationale Schande“149 bezeichnet habe. Die Aussage, daß die Interessengemeinschaft „besonders in letzter Zeit mit Forderungen, die z.T. scharfe Angriffe gegen die demokratische Grundordnung enthielten, an die Öffentlichkeit getreten sei“150, läßt auf eine deutliche Mißbilligung dieses Umstandes durch Bähnisch schließen. Dies zeigt, daß ihr – obwohl sie der Entnazifizierung selbst kritisch gegenüberstand – durchaus nicht jede Form der Kritik an den alliierten ‚Säuberungsmaßnahmen‘, die mit Hilfe der deutschen Behörden durchgeführt wurden, berechtigt erschien. Ein ähnlicher Informationsaustausch hatte zwischen der Leiterin des Informationsdienstes Frauenfragen, Anneliese Glaser und Bähnisch im ersten Quartal 1953 stattgefunden. Glaser hatte Bähnisch zu diesem Zeitpunkt über die Planungen zu einer „Gedächtnisstätte für ostpreußische und niedersächsische Gefallene […] die der Erinnerung an das gemeinsame Opfer für Deutschland im Kriege […] dienen soll“151, unterrichtet, von denen sie in einer Notiz des ‚Informationsdienst des Göttinger Arbeitskreises ‚Archiv‘ vom 08.01.1953 gelesen hatte. Diese Notiz gab Glaser
145 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], Teil II, S. 8/9, Schaffung einer Vertrauensbasis in der Behörde. Womöglich spielt sie auch mit dieser Schilderung auf den Oberregierungsrat Tegethoff an. 146 Schrulle: Bezirksregierungen, S. 492. 147 Glaser an Regierungspräsidentin Theanolte Bähnisch, 25.03.1954. 148 BArch, B 211, Nr. 101, Der Regierungspräsident, Bähnisch, an den Informationsdienst für Frauenfragen e. V., Bonn, 20.05.1954. 149 Ebd. 150 BArch, B 211, Nr. 101, Der Regierungspräsident, Bähnisch, an den Informationsdienst für Frauenfragen e. V., Bonn, 20.05.1954. 151 BArch, B 211, Nr. 101, O. V.: Gedächtnisstätte für ostpreußische und niedersächsische Gefallene, in: Informationsdienst des Göttinger Arbeitskreises Archiv, 08.01.1953, zitiert nach: Annelise Glaser an Regierungspräsidentin Bähnisch, 13.01.1953, vertraulich.
Regierungspräsidentin | 455
in ihrem Schreiben an Bähnisch, weil sie ihr offenkundig suspekt war, wortgetreu wieder.152 Eine Antwort Bähnischs auf diese Anfrage ist leider nicht überliefert. Doch drei Monate später konnte die Regierungspräsidentin Glaser ein weiteres Mal mit Informationen aushelfen, zu denen ihr ihre Position als Chefin der Mittelinstanz Zugang ermöglichte. Diesmal ging es um den „Verein der europäischen Soldaten der ehemaligen Waffen-SS für Vermißtensuch- und Hilfsdienst“. Man müsse, so schrieb Bähnisch an Glaser, berücksichtigen, daß verschiedene Nationen während des Krieges Soldaten für die Waffen-SS abgestellt hätten. Die Oberfinanzdirektion habe behauptet, die Gemeinnützigkeit des Vereins sei gegeben und der Verein unterstehe einer sich wiederholenden Überprüfung. Sie sei, so Bähnisch, „nicht in der Lage“, sich wegen der „Anerkennung der Gemeinnützigkeit“153 einzuschalten, habe aber die politische Abteilung des Innenministeriums benachrichtigt. Daß Bähnisch Glaser entsprechende Informationen geben konnte, zeigt, daß sie – mit der Bezirksstelle der politischen Polizei im Rücken – an einer wichtigen Quelle saß, was Informationen über problematische Entwicklungen in der Vereins- und Gedenkstättenkultur im Land betraf – daß sie sich dafür zuständig fühlte, ihr Wissen darüber weiter zu geben. Von einer allgemeinen Blindheit Bähnischs auf dem ‚rechten Auge‘ auszugehen, wäre also falsch. Ihre Informationskanäle, ihren Einfluß und ihren Platz in einem weitgespannten Netzwerk, zu dem auch das – an anderer Stelle eingehender zu beleuchtende154 – Frauenreferat im Bundesinnenministerium gehörte, nutzte sie auch dazu, sich verfassungsfeindlichen Bestrebungen entgegenzustellen. Die Regierungspräsidentin schien bei der Militärregierung – das gilt auch für an anderer Stelle gesondert vorzustellende Aspekte – eine gewisse ‚Narrenfreiheit‘ besessen zu haben. Sie durfte sich auch öffentliche Kritik gegenüber der Militärregierung erlauben, weil sie auf der anderen Seite Kernziele der Besatzungspolitik – darunter eine stärkere Beteiligung der Frauen am politischen und beruflichen Leben155, die Re-etablierung einer funktionierenden Zusammenarbeit staatlicher Sozialpolitik mit Trägern der freien Wohlfahrt sowie den Kampf gegen die Kommunisten – umzusetzen half. Helena Deneke, eine Delegierte der Women’s Group of Public Welfare, die von der Britischen Militärregierung mehrfach nach Deutschland entsandt wurde, um Bähnisch bei ihrer Arbeit unter die Arme zu greifen, bezeichnete Bähnisch als eine „most remarkable women“156. Lobend hob sie in ihrer Charakterisierung folgende
152 BArch, B 211, Nr. 101, Annelise Glaser an Regierungspräsidentin Bähnisch, 13.01.1953, vertraulich. 153 BArch, B 211, Nr. 101, Theanolte Bähnisch, Regierungspräsident, an den Informationsdienst e. V. Bonn, Anneliese Glaser, 28.04.1953. 154 Siehe Kapitel 8.5.2. und 8.5.4. 155 Dazu gehörte auch die Herausgabe einer Frauenzeitschrift durch Theanolte Bähnisch welche zumindest in ihren ersten Ausgaben einen politisch bildenden Charakter hatte. Vgl.: Freund: Krieg. 156 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Deneke Adds 1, Manuscript Diary of Helena Deneke, S. 35. Das Tagebuch Helena Denekes ist voll von Streichungen, Korrekturen und Ergänzungen. So hatte sich Deneke zunächst entschieden, Bähnisch eine „extraordinary person“ zu nennen, bevor sie diesen Passus strich und ihn durch „a most
456 | Theanolte Bähnisch
Eigenschaften hervor: „her amazing vitality, her shrewed intellect, her high ambitions, her undamned courage in the relentless pursuit of her aims.“157 Im Personenleitfaden der Militärregierung für ‚Lower Saxony‘ wurde die Regierungspräsidentin als eine „extremly talented women“ gehandelt, der man ihre „attractive, if at times overpowering personality“158 offenbar gern verzieh. 5.2.6 Bähnischs Engagement für den Einsatz von Frauen in der Verwaltung Daß sich die Regierungspräsidentin bereits in den 1920er Jahren für eine Verwendung von Frauen im öffentlichen Dienst engagiert hatte und daß sie ihre Überzeugung in den 1940er Jahren praktisch ausgestaltete, dürfte ihr ebenfalls Pluspunkte bei den Briten eingebracht haben. Im bereits erwähnten Artikel in der Zeitschrift ‚Die schaffende Frau‘ hatte Bähnisch 1929 skizzenhaft über die Ausbildung und Arbeit von höheren Verwaltungsbeamten informiert. Sie wollte damit dem Umstand Abhilfe schaffen, „daß sowohl die Art der Ausbildung als auch die Art der beruflichen Betätigung den meisten Frauen unbekannt ist.“159 Anschließend versuchte sie ihren eigenen Beruf den Leserinnen schmackhaft zu machen: „Vielleicht hält manche Frau die Vorstellung ab, daß die Verwaltungstätigkeit wenig Verlockendes für eine Frau habe. Und doch ist ganz das Gegenteil der Fall“, schwärmte sie von den „mannigfachen Möglichkeiten“160, die die höhere Verwaltungslaufbahn biete. Gerade die Verwaltungstätigkeit gebe Frauen Gelegenheit, „ihre Persönlichkeit in weitgehendem Maße auszuwirken und sich zugleich ein Gebiet zu erwählen, das ihren besonderen Interessen entspricht“161, schrieb Bähnisch und zeigte damit, wie eng für sie die Berufswahl mit der freien Entfaltung der Persönlichkeit – eine Kernformel des Liberalismus – zusammenhing. Daß Vertreter der Militärregierung von jenem Plädoyer Bähnischs für die weibliche Emanzipation und/oder ihrem Engagement bei den Soroptimistinnen gehört hatten, läßt sich nicht belegen. Fakt ist jedoch, daß die Westalliierten – dies wird in den folgenden Kapiteln deutlich werden – großes Interesse daran hatten, daß die im Nationalsozialismus in ihrer beruflichen Entfaltung stark eingeschränkten Frauen (wieder) eine stärker selbstbestimmte Rolle in der Gesellschaft spielen würden. Andere Gründe sprachen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ebenfalls dafür, Frauen für den Verwaltungsdienst anzuwerben: Viele der männlichen Mitarbeiter der Verwaltung waren im Zuge der Entnazifizierung entlassen worden, viele waren gefallen oder befanden sich noch in Kriegsgefangenschaft. Daß im Film ‚Sternstunde ihres Lebens‘ neben der von Iris Berben verkörperten Hauptfigur Elisabeth Selbert
157 158 159 160 161
remarkable women“ ersetzte. Wann die Korrekturen vorgenommen wurden, ist nicht klar. Ebd. Ebd., i. O. gestrichen. Röpcke: Saxony, S. 258. Bähnisch: Staatsverwaltung, S. 15. Ebd., S. 16. Ebd.
Regierungspräsidentin | 457
als Nebencharakter eine ‚Frieda‘ auftritt, die im Büro des Parlamentarischen Rats innerhalb kürzester Zeit zur leitenden Dolmetscherin aufsteigt, diese Stelle aber sofort an ihren Ehemann Kurt abtritt, als dieser aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrt, ist ein dramaturgisches Mittel.162 Wirksam ist es vor allem deshalb, weil es den gesellschaftlichen Realitäten jener Zeit sehr nah kommt. An der Überzeugung, daß das „Verwalten eigentlich zu den Berufen zählen müßte, die den Frauen ‚liegen‘“163, hielt Bähnisch auch in der zweiten deutschen Demokratie fest. Allerdings, so wird die Regierungspräsidentin sinngemäß zitiert, müsse man „das Handwerk von Grund auf verstehen.“164 Bähnisch focht daher für die Beibehaltung der ‚klassischen‘ Ausbildung für den höheren Verwaltungsdienst. Daß sie sich in der Nachkriegszeit auch als Dozentin in spezielle Frauenkurse einbrachte, welche die Verwaltungsschule Hahnenklee im Harz abhielt165, deutet darauf hin, daß ihr auch an einer verbesserten Ausbildung von Frauen für den einfachen und mittleren Dienst in der Verwaltung gelegen war. Frauen, die sich – als Parteipolitikerinnen oder im Rahmen von Vereinen – lokalpolitisch engagieren wollten, gehörten ebenfalls zur Zielgruppe der Verwaltungsschule. Damit engagierte sich Bähnisch – ähnlich wie ihr Mann Albrecht Bähnisch – in einer Art für die politische Bildung Erwachsener, die den Gewerkschaften bereits in den 1920er und 30er Jahren mißfallen hatte.166 Dieses Mißtrauen gegenüber nicht gewerkschafts- oder parteinahen Erwachsenenbildungsinstitutionen setzte sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fort. Von der Idee, ihre Mitglieder in Kurse der lokalen Verwaltungsschulen zu entsenden, welche „in order to teach the German people the procedure and methods of local Parish, Town and County Councils“ von der Britischen Militärregierung unterstützt wurden und in denen sich Theanolte Bähnisch engagierte, hielten sie nämlich gar nichts. „Trade Unions generally have their own establishments for training their people and they are very jealous of these organizations and mistrustful of the adult Education movement, as they prefer to have new officials trained by more experienced Trade Union officials on outside Councils as possible“167, wird die unveränderte Lage in einem Versammlungsbericht von der Militärregierung zusammengefaßt. Daß die Regierungspräsidentin selbst vor allem im Bereich Bildung und ‚Soziales‘ mit Frauen zusammenarbeitete, ist der – auch von Bähnisch vertretenen – Überzeugung geschuldet, daß Frauen für diese Bereiche besonders geeignet seien. „So
162 Vgl.: Sternstunde ihres Lebens, Regie: Erika von Moeller, BRD 2014, Erstausstrahlung: ARD, 21.05.2014, 20:15. 163 Vgl.: O. V.: Schubfach. 164 Ebd. 165 NA, UK, FO 1050/31, Proposal for a school for Education in Citizenship, Theanolte Bähnisch, o. D., Abschrift, Anhang zu einem Schreiben des Office of the Educational Advisor an den Religious Affairs Advisor, 09.08.1948. Vgl. dazu auch Ziegler: Lernziel, S. 75. 166 Siehe Kapitel 3.5.1.3. 167 NA, UK, FO 1049/1246, Second meeting of the standing Comitte on women’s affairs held at 1000 hrs 7th May 1948 in the main Conference Room, Stirling House, o. D.
458 | Theanolte Bähnisch
liegt der Eintritt in die Schulverwaltung Frauen besonders nahe, weil ihnen hier die Möglichkeit gegeben wird, auf die Ausbildung der Jugend, insbesondere unserer weiblichen Jugend, maßgebenden Einfluß zu nehmen.“168 Prinzipiell sollten Frauen ihrer Überzeugung nach jedoch alle Bereiche der Verwaltung offenstehen, zumal ihr Einfluß in den verschiedensten Bereichen nötig sei: „So halte ich es für sehr wesentlich, daß auch eine Frau im Ministerium für Handel und Gewerbe und im Landwirtschaftsministerium ein selbständiges Referat führt […] und daß Frauen an Landesarbeitsämtern beschäftigt werden“169, hatte sie 1929 geschrieben. Auch in ihrer Funktion als Schirmherrin einer Veranstaltung in Norddeutschland präsentierte sich die Regierungspräsidentin als Verfechterin einer stärkeren Einbindung von Frauen in Politik und Verwaltung. Im Juni 1950 lud Bähnisch Vertreter der Hauptstadt Hannover, der Stadt Hameln sowie der Landkreise des Bezirks zu einer internationalen kommunalpolitischen Konferenz in Norderney ein.170 Während der im August und September 1950 stattfindenden Tagung sollten in vier Wochenkursen vor allem deutsche und britische Redner, daneben Kommunalpolitiker aus den USA, Frankreich, Belgien und gegebenenfalls auch aus Finnland sprechen. Zu „bestimmten Fragen“ sollten sich im Anschluß Arbeitsgemeinschaften bilden. Schließlich war noch ein Abschluß-Plenum vorgesehen: „Jeweils am letzten Tage jedes Wochenkurses findet eine allgemeine Aussprache aller Teilnehmer statt“ 171, hieß es in der Einladung. Die Veranstaltung knüpfte an ähnlich gestaltete Tagungen an, welche bisher vom britischen Auswärtigen Amt in Hahnenklee abgehalten worden waren. Der nachdrücklichen Forderung Bähnischs, daß „bei der Auswahl der Teilnehmer“ für Norderney „dafür Sorge getragen werden solle, daß eine angemessene Zahl von Frauen, die im öffentlichen Leben stehen“172, berücksichtigt werden sollten, leistete die Stadt Hannover zwar zunächst Folge, doch als sich abzeichnete, daß die Teilnehmerzahl von Seiten der Organisatoren vermindert werden würde, zog die Stadt den Vorschlag, neben dem Ratsherren Hans Stephan auch die Ratsfrau Lisbeth Pieper zur Konferenz zu entsenden, wieder zurück.173 Theanolte Bähnisch stand mit ihrem Ziel, Lokalpolitikerinnen, beziehungsweise Verwaltungsfachkräfte besonders zu schulen, in jener Zeit nicht allein da. Bereits vom 4. bis 06.11.1946 hatte die CDU im Land Hannover einen „politischen Lehrgang für […] weibliche Gemeinde- und Vorstandsmitglieder und sonstige interessier-
168 Bähnisch: Staatsverwaltung, S. 16. 169 Ebd., S. 16. 170 Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 217. Der Regierungspräsident an die Hauptstadt Hannover, die Stadt Hameln und die Landkreise des Bezirks zur internationalen kommunalpolitischen Konferenz in Norderney, 28.06.1950. 171 Ebd. 172 Ebd. Unterstreichung i. O. 173 Vgl.: Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 217, Der Regierungspräsident des Bezirks Hannover an die Hauptstadt Hannover, 01.08.1950 und Hauptstadt Hannover an den Regierungspräsidenten des Bezirks Hannover, 27.07.1950.
Regierungspräsidentin | 459
te Frauen“174 angeboten. Auf der Veranstaltung sprach Dr. Auguste Jorns, die 1952 die Leitung der Frauen-Union im Land übernehmen sollte, aus ihrer Erfahrung als Bürgerschaftsvertreterin in der Weimarer Republik unter dem Thema ‚Die Frauen in der Gemeindeverwaltung‘. Ihre Ausführungen betrafen vor allem allgemeine und wirtschaftliche Aufgaben in der Gemeindeverwaltung, sowie Aufgaben im Bereich Wohlfahrt und Kultur. Dr. Rehling aus Hagen hielt einen Vortrag zum Thema Religionsunterricht.175 Daß 80 Teilnehmerinnen zum Lehrgang erschienen waren176, verdeutlicht, daß der Bedarf für solche Lehrgänge durchaus vorhanden war. Inwiefern die Veranstaltungen zueinander in Konkurrenz standen oder ob es zu Synergieeffekten kam, läßt sich nicht klären. Am deutlichsten zeigte sich Bähnischs Wille zur Zusammenarbeit mit Frauen in Verwaltung und Politik in der Allianz, die sie mit den leitenden Verwaltungsmitarbeiterinnen des Landes Niedersachsen Katharina Petersen, Anna Mosolf und Käthe Feuerstack bildete. Darauf wird später zurückzukommen sein. 5.2.7 Wie gewonnen, so zerronnen? Die Zukunft der Mittelinstanz steht in den Sternen 5.2.7.1 Die Militärregierung holt zum Schlag gegen die deutsche Verwaltungsordnung aus – Diskussion für und wider die Regierungspräsidien Daß die Beziehung zwischen der Militärregierung und der Regierungspräsidentin nicht frei von Problemen gewesen sein kann, zeigt sich in der Diskussion um die Abschaffung der Regierungspräsidien. Als die Wunschkandidatin Humes ihr Amt in Hannover angetreten hatte, geschah nahezu sämtliches Verwaltungshandeln im Auftrag der Militärregierung, welche Nordwestdeutschland nach dem Einmarsch der Armee in drei Distrikte eingeteilt hatte. Die ‚Hanover Region‘177, zusammengesetzt aus der preußischen Provinz Hannover und den Ländern Braunschweig und Oldenburg, bildete einen dieser Distrikte. Die Briten hatten sich vorgenommen, die Verwaltung in ihrer Besatzungszone grundlegend zu reformieren und sich dabei am Vorbild des eigenen Landes zu orientieren. Im Zuge der Zerschlagung des Staates Preußen waren zunächst die preußischen Provinzen als Verwaltungseinheiten und mit ihnen die Oberpräsidien als ihre Verwaltungsorgane abgeschafft worden. Jener ‚doppelten Mittelinstanz‘ – wie die Kombination aus Oberpräsidien und Regierungspräsidien bezeichnet worden war – trauerten auch deutsche Verwaltungs-Eliten kaum hinterher, denn die Kompetenzabgrenzungen zwischen beiden Behörden waren von jeher unklar gewesen. Schwerer schon tat man sich mit dem Umstand, daß nach den britischen Vorgaben nicht nur die Länderregierungen einer parlamentarischen Kontrolle unterworfen werden sollten, sondern auch die anderen Verwaltungsstufen. Zur
174 Niedersächsische Rundschau vom 26.10.1946, S. 4, zitiert nach Kulhawy, Andreas: Geschichte der Frauen-Union in Niedersachsen, Hannover 2011, S. 14/15. 175 Vgl.: Kulhawy: Frauen-Union, S. 15. 176 Ebd., S. 14. 177 ‚Nordrhein‘ und Schleswig-Holstein mit Hamburg stellten weitere ‚Regions‘ dar.
460 | Theanolte Bähnisch
Kontrolle des ‚politischen Regierungspräsidenten‘ war daher ein Bezirkslandtag eingerichtet und das Amt des ‚politischen Regierungspräsidenten‘ um das des ‚Oberregierungsdirektors‘ ergänzt worden. Letzterer sollte in der neu entworfenen Doppelspitze auf der Bezirksebene eine rein administrative Funktion erfüllen.178 „Im Hinblick auf die noch nicht endgültige Gliederung des Landes Hannover“ hatte der hannoversche Bezirkstag in seiner Sitzung am 13.11.1946 allerdings beschlossen, den gerade erst etablierten Bezirkstag vorläufig ruhen zu lassen und „die Aemter des berufsbeamteten und politischen Regierungspräsidenten in der Person der bisherigen Oberregierungsdirektorin Bähnisch zu vereinigen.“179 Die von der Militärregierung angestrebte Doppelspitze jener Verwaltungsstufe durch ein administratives (Oberregierungsdirektor) und ein politisches Oberhaupt (Regierungspräsident) sowie die Unterwerfung des politischen Regierungspräsidenten unter eine parlamentarische Kontrolle, schien damit ad acta gelegt. Ellinghaus180, der bisherige politische Regierungspräsident und damit Sprecher des Bezirkstags, konnte sich damit fortan ganz seiner neuen Aufgabe als ‚Generalinspekteur für Entnazifizierung‘ widmen. Daraus, daß die Militärregierung gegen die Selbstauflösung des Bezirksparlaments nicht interveniert hatte, ließe sich ableiten, daß diese großes Vertrauen in die neue Regierungspräsidentin hatte. Um so überraschter dürfte die Verwaltungsjuristin gewesen sein, als sich abzeichnete, daß die Briten sich lediglich Zeit dabei gelassen hatten, noch einschneidende Veränderungen zu beschließen, für die es gar keine Bezirkslandtage mehr brauchte. Im März 1948 versendeten die Headquarters der Länder nämlich eine Information an die Headquarters der Bezirke, aus der deutlich wurde, daß die Regierungspräsidien als Verwaltungsstufe – und damit auch das Amt Theanolte Bähnischs – insgesamt am seidenen Faden hingen.181 Die deutsche Verwaltungsorganisation, welche sich zur Umsetzung ihrer Politik in den Ländern und Kommunen auf eine Mittelinstanz stützte und im Kern so auch während des ‚Dritten Reichs‘ fortexistiert hatte, erfuhr im Zuge des demokratischen Wiederaufbaus nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs starke Kritik, vor allem durch
178 Zur Verwaltungsneuordnung in der britischen Besatzungszone vgl. die Titel: Rudzio: Export; ders.: Neuordnung; Reusch: Berufsbeamtentum. 179 Vgl.: O. V.: Theanolte Bähnisch jetzt auch Regierungspräsidentin, in: Hannoversche Presse, 15.11.1946, Kopie ohne Seitenangabe in: NLA HA HStAH, ZGS 2/1, Nr. 243. 180 Dr. Wilhelm Ellinghaus wurde am 27.06.1888 in Coesfeld/Westfalen geboren und starb am 08.09.1961 in Karlsruhe. Er hatte Rechtswissenschaften unter anderem in Berlin und Münster studiert. Ellinghaus war als Richter und Notar zugelassen, wurde 1928 Landrat des Kreises Angerburg und 1930 Regierungsvizepräsident des Bezirks Gumbinnen, bevor er 1933 seiner Ämter enthoben wurde. 1946 wurde er Regierungspräsident in Hannover, dann Generalinspekteur für Entnazifizierung, schließlich niedersächsischer Justizminister (1946/47) und Landtagsabgeordneter (ab 1947). 1951 ging er als Richter an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. 181 NA, UK, FO 1049/1368, HQ Nordrhein-Westfalen an HQ der Regierungsbezirke, 24.03.1948.
Regierungspräsidentin | 461
die britische Militärregierung.182 Daß der Regierungspräsident zwar den unteren Verwaltungsbehörden gegenüber weisungsbefugt war, jedoch nicht demokratisch gewählt, sondern als politischer Beamter eingesetzt wurde, behagte den Vertretern des Vereinigten Königreiches nicht. „The concentration of supervisory powers in respect of local authorities in the hands of an individual official has been frequently regarded as incompatible with democracy. [...] The Regierungs-Praesident [...] inherits many of the undesirable traits of former Prussian bureaucracy“183, begründete das Schreiben des Headquarter North-Rhine Westfalia an die Headquarters der Regierungs-Bezirke im Land den Plan, die Mittelinstanzen im Zuge der einer allgemeinen ‚Entstaatlichung‘ und stärkeren Kommunalisierung von Politik und Verwaltung, schlichtweg abzuschaffen.184 Daraufhin machte sich unter deutschen Verwaltungseliten und -experten Entrüstung breit. Sie verwehrten sich gegen die „Aufoktroyierung eines fremden Systems“185 ohne Rücksicht auf die ihrer Meinung nach guten demokratischen Traditionen der deutschen kommunalen Selbstverwaltung. Auf diese Äußerungen reagierten wiederum die Briten mit Unverständnis, Brigadier Bridge in einer an die Chefs der Länder und Provinzen gerichteten Rede sogar mit blankem Sarkasmus: „This criticism seems to be due to misunderstanding of the British system. I would, however, remark that whatever democratic tradition you may have had in Germany was not strong enough to withstand the attacks of nacism and it is therefore necessary to amend it“186, machte er den anwesenden deutschen Verwaltungsspitzen, bevor er seine Rede eine Woche später vorden Regierungspräsidenten wiederholte, unmißverständlich klar.
182 Vgl.: Hillmann: Regierungspräsident, S. 82. Schon früher hatte es Überlegungen zur Abschaffung der Mittelinstanz gegeben. Nach dem Entwurf von Innenminister Bill Drews (1917) wären dabei die Aufgaben der Regierungspräsidien den Oberpräsidenten übertragen worden. Vgl.: Thiele: Mittelinstanz, S. 503. 183 NA, UK, FO 1049/1368, HQ Nordrhein-Westfalen an HQs der Regierungsbezirke, 24.03.1948. Vgl. dazu auch: Strick: Routine, S. 66. 184 Vgl. für das Düsseldorfer Beispiel: Strick: Routine, S. 61–97 sowie allgemeiner für die britische Besatzungszone: Rudzio: Export; ders.: Neuordnung und Reusch: Berufsbeamtentum. 185 Strick: Routine, S. 79. Zu Hannover vgl. die kurze Textstelle in: Faber: Bezirksregierung, S. 992–995. 186 Vgl.: Rede von Brigadier Bridge auf der Konferenz der Chefs der Länder und der Provinzen der britischen Zone in Detmold 19./20.11.1945 am 19.11.1945, vormittags. Die Rede wurde eine Woche später, am 26.11.1945, vor den Regierungspräsidenten wiederholt. NLA HA HStAH, Nds. 120 Lün., Acc. 30/67, Nr. 29, Adress to Regierungspräsidenten, Bünde, 26. Nov. 45. Im Vorlauf waren die Regierungspräsidenten per Telegramm darüber informiert worden, daß ihre „persönliche Teilnahme“ an der Konferenz in Bünde erforderlich sei. Ebd., Deutsche Reichspost, Telegramm 6103 Hannover F 84/79 W 0950 = Regierungspraesient [!] Fehrmann = Luenebirg [!]. Vgl. auch: Strick: Jenseits der Routine, S. 48/49.
462 | Theanolte Bähnisch
Im ‚Monthly Report‘ des Headquarter Niedersachsen für den September 1947 hatte dessen Verfasser, Colonel Hume, seine Beobachtung beschrieben, daß nun, gut zwei Jahre nach dem Beginn der Verwaltungsreform, viele Deutsche in hohen Positionen realisieren würden, daß „their structure of government will never be democratically sound if the Regierungsbezirk level of administration with its galaxy of officialdom unchecked by any local popularly elected body, is to remain in its present form.“ Gleichzeitig hatte der überzeugte Förderer Bähnischs jedoch die Warnung ausgesprochen, daß die Unterstützer der Verwaltungsstufe zahl- und einflußreich seien. Hume bescheinigte der Frage eine „fundamental importance in german mind“ und konstatierte: „It would be to much to expect that […] officialdom will not fight bitterly in opposition, with every weapon which may come to hand.“187 Hume sollte mit beiden Äußerungen recht behalten: Von deutscher Seite bliesen einige Journalisten und Wissenschaftler mittlerweile in das gleiche Horn wie die Militärregierung. Besonders hart gingen die ‚Aachener Nachrichten‘ mit der preußischen Verwaltungstradition ins Gericht. Regierungspräsidenten zählten sie, mit den deutschen Beamten allgemein abrechnend, zu einem Berufsstamm, der „nicht an den Prinzipien und den Spielregeln der Demokratie geschult ist, sondern dessen Wirksamkeit nur auf der Voraussetzung des beschränkten Untertanenverstandes und des militärischen Gehorsams ihre verwaltungspolitischen Erfolge buchen konnte“188. Der Göttinger Pädagogikprofessor Weniger griff nicht nur die tradierte VerwaltungsKonzeption als solche, sondern auch die amtierenden Regierungspräsidenten scharf an. Er attestierte diesen „ein großes Maß von Selbständigkeit und Selbstherrlichkeit“. Seiner Meinung nach verfügten die Regierungspräsidenten über „einen Rest autoritärer Vollmachten aus dem alten Obrigkeitsstaat, der sich gewiss gelegentlich auch positiv, in der Regel aber retardierend auswirkt“189. Der Deutsche Städtetag kritisierte wiederum – in einer Zeit der Knappheit materieller und personeller Ressourcen – vor allem die Flut an Papier, die durch verschiedene Instanzen laufe und so „die meiste Zeit und […] beinahe die größtmögliche Zahl von mitwirkenden Beamten beansprucht.“190 In der Tat hatten die Behörden vor dem Hintergrund ihrer Informationspflicht auf der einen und ihrem Umsetzungsauftrag auf der anderen Seite schier unvorstellbare Mengen an Papier zu bearbeiten. Der Verwaltungswissenschaftlerin Christina Strick zufolge hatte die Bezirksregierung Düsseldorf im Januar 1951 den übergeordneten nordrhein-westfälischen Landeministerien 519 schriftliche Berichte erstattet und währenddessen selbst „Schreiben im Umfang von 7.775 Blatt, darunter täglich im Schnitt 130 Erlasse der Zentralbehörden, welche ausnahmslos vom Regierungspräsi-
187 NA, UK, FO 1005/1669, Monthly Report Headquarters Land Niedersachsen, September 1947. Covering the period 1st September–30st September 1947, Part A, 06.10.1947, S. 5. 188 Aachener Nachrichten, 06.09.1946, zitiert nach Strick: Routine, S. 68. 189 Prof. Weniger, Universität Göttingen, in: Die Sammlung, 4. Jg. (1949), Heft 10, zitiert nach Strick: Routine, S. 68. 190 Nachrichtendienst des Deutschen Städtebundes, Sonderdruck-Beilage zu Nr. 7/8 1949, BAK B 172-40, zitiert nach Strick: Routine, S. 69.
Regierungspräsidentin | 463
denten persönlich zu sichten und gegenzuzeichnen waren“, erhalten.191 Für Strick materialisiert sich in der Menge des Papiers – ohne daß sie hieran eine Kritik aufhängt – sehr augenscheinlich die Funktion des Regierungspräsidiums als Bündelungsbehörde, die „Weisungen entgegennahm, weiterleitete und über deren Umsetzung in den untergeordneten Ebenen wiederum den übergeordneten berichtete“192. Ob das Regierungspräsidium dabei überhaupt als ein aktiv handelndes Verwaltungsorgan auftrat, oder ob es nicht vielmehr nur ein Umschlagplatz für Papierberge sei, hinterfragten Zeitgenossen kritisch. Der Oldenburger Regierungspräsident Wegmann merkte 1949 an, daß in ‚seinem‘ Regierungsbezirk „die Einheit der Verwaltung in der Mittelinstanz […] schon soweit zerstört worden sei“, daß der Oberstadtdirektor von Oldenburg habe vorschlagen können, man solle statt des Regierungspräsidenten doch probehalber „lediglich die Post als Briefträger zwischen Ministerium und Kreis einschalten und dann urteilen, ob die Regierungen überhaupt noch nötig seien“193. Nicht nur Wegmann, sondern auch die anderen Regierungspräsidenten wollten die Kritik an ihrem Amt nicht gelten lassen. Sie bemängelten – auf die drängenden Nachkriegsaufgaben Bezug nehmend – einen noch viel zu geringen KompetenzRahmen der Regierungspräsidien und ihrer Leiter. Die Summe und Dringlichkeit der Anliegen, welche die Bürger an ihre Bezirksregierungen herantrugen, und die Möglichkeit der Regierungspräsidenten, auf jene Anliegen zu reagieren, standen für sie in einem eklatanten Mißverhältnis. Nachvollziehbar ist dies insofern, daß die „singuläre Eigenart“194 der Institution Regierungspräsidium darin bestand und noch besteht, daß sie neben ihren Kernaufgaben (also der Kommunalaufsicht, der Gefahrenabwehr, der Polizei, staatlicher Hoheitsangelegenheiten, des Vermessungs- und Katasterwesens, der Bauangelegenheiten, des Bereichs Gesundheit, der Schulverwaltung, der Landwirtschaftsangelegenheiten und des Forstes) die „Allzuständigkeit für sämtliche Aufgaben, die nicht ausdrücklich anderen Behörden übertragen sind“195, besitzen. Kein Wunder also, daß die notleidenden Bürger in den Bezirken regen Gebrauch von den Diensten der Behörde, die sich ‚bürgernah‘ verhalten sollte, machten. Der Darstellung der Regierungspräsidentin Bähnisch zufolge, schadete der ihrer Meinung nach zu eng abgesteckte Kompetenzrahmen sogar dem Ansehen der Regierungspräsidenten in der Bevölkerung. Die Regierungspräsidenten stünden grundsätzlich schlecht da, wenn Bürger im Zuge eines Beschwerdeverfahrens gegenüber der nächsthöheren Instanz etwas durchsetzen könnten, was ihnen die Regierungspräsidenten doch gern selbst gewährt hätten – wenn da nicht die entsprechenden Hand-
191 In Hannover drohte jener für die Verwaltung nötige Schriftverkehr in den ersten Amtsmonaten Bähnischs an Banalitäten zu scheitern: Da Papier knapp war, wurden behördliche Anweisungen oft auf den Rückseiten von bereits benutztem Papier niedergeschrieben. Dabei kam zum Teil sehr dünnes, zum Teil mit groben Holzanteilen versetztes Papier zum Einsatz. 192 Strick: Routine, S. 14. 193 NLA HA HStAH, Nds. 100, Acc. 57/89, Nr. 63, Dienstbesprechung der Regierungspräsidenten und Präsidenten der Verwaltungsbezirke, 21./22.07.1949, Protokoll. 194 Hillmann: Regierungspräsident, S. 172, zitiert nach: Dittrich: Bündeln, S. 37. 195 Dittrich: Bündeln, S. 37, unter Bezugnahme auf Hillmann: Regierungspräsident, S. 170.
464 | Theanolte Bähnisch
lungsbeschränkungen durch die höhere Instanz gewesen wären. So kritisierte Bähnisch in einem konkreten Fall, daß den Regierungspräsidenten nur die Vorprüfung bei Wohnungsangelegenheiten, nicht jedoch deren endgültige Genehmigung zugestanden wurde.196 In einem anderen Fall forderte sie, gemeinsam mit ihrem Kollegen Wegmann, daß die Regierungspräsidien das Geld für den Wohnungsbau in den Bezirken nicht nur verteilen, sondern auch Einfluß auf die Gestaltung der Verteilungsschlüssel haben und die Gelder selbst bewilligen dürfen sollten.197 Während Wegmann aus diesem Zusammenhang heraus sogar konstatierte, daß die Regierungspräsidenten in Niedersachsen zu „Prügelknaben für alle unerfüllten Hoffnungen und Fehlentwicklungen geworden sind“198, fand Bähnisch es schlicht „besonders bedauerlich, daß das Sozialministerium bisher über den einhelligen Standpunkt der Regierungspräsidenten“ hinweg gegangen sei.199 Den Plan der niedersächsischen Regierungspräsidenten, einer Einladung des Regierungspräsidenten Fritz Fries nach Arnsberg zu folgen – höchstwahrscheinlich um sich dort zur Frage der Verwaltungsreform zu besprechen – hatte Kopf, der zu dieser Zeit noch Oberpräsident war, vereitelt. „Ich habe ihnen die Genehmigung zur Dienstreise versagt“, hatte er dem zuständigen Brigadier in einer Besprechung bei der Militärregierung mitgeteilt. Dieser wiederum hatte, wohl ebenfalls allzuviel Selbständigkeit der Behördenleiter befürchtend, entgegnet: „Das ist in Ordnung. Die Regierungspräsidenten haben in ihrem eigenen Bereich genug zu tun.“200 Nachdem Kopf im Dezember 1946 noch verkündet hatte, daß er für einen Ausbau der Mittelinstanzen sorgen wolle, legte er dem Landtag im Oktober 1947 einen Regierungsentwurf vor, nach dem die Regierungspräsidenten und die Präsidenten der Verwaltungsbezirke als selbständige Instanz wegfallen sollten. Er trug damit einem Wunsch des Innenausschusses Rechnung.201 Was Kopf jedoch nicht verhindern konnte, war, daß sich die Regierungspräsidenten schriftlich zu ihrer geplanten Abschaffung äußerten. Die sechs Regierungspräsidenten Nordrhein-Westfalens hatten gemeinsam eine Denkschrift mit dem Titel ‚Leitgedanken zur Verwaltungsreform‘ verfaßt, in der sie die Beibehaltung der Ver-
196 NLA HA HStAH, Nds. 100 (01), Acc., 57/89, Nr. 62, Der Regierungspräsident an den Niedersächsischen Minister des Inneren, Hannover 08.07.1949, Betr. Dienstbesprechung der Regierungspräsidenten in Juist, 21.–22.07.1949. 197 NLA HA HStAH, Nds. 120 Hannover, Acc. 176/91, Nr. 27, Niederschrift über die Dienstbesprechung mit den Regierungspräsidenten im Niedersächsischen Ministerium des Innern, Hannover, 26.06.1952. 198 Ebd., S. 16. 199 Ebd., S. 17. 200 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 96/88, Nr. 768, Auszug aus dem Protokoll über die Besprechung bei der Militärregierung zwischen Oberpräsident Kopf und Brigadier Lingham am 18.10.1945, 19.10.1945. 201 Der Entwurf wurde jedoch nach zwei Lesungen von der Landesregierung zurückgezogen. Vgl.: Faber: Bezirksregierung, S. 994. Wolfgang Rudzio macht für das Scheitern der Vorlage „Gegenvorstellungen der Regierungspräsidenten“ verantwortlich. Rudzio: Neuordnung, S. 168.
Regierungspräsidentin | 465
waltungsstufe forderten. Der Regierungspräsident von Stade, Dr. Pollack, hatte seiner Schrift den aussagekräftigeren Titel ‚Die Notwendigkeit einer großen selbständigen Mittelinstanz‘ gegeben. Pollack argumentierte, daß mit der Abschaffung der Regierungspräsidien die notwendige Kontroll- und Beschwerdeinstanz der Kommunen wegfallen würde, während die Übertragung von Aufgaben der Regierungspräsidien auf die Ministerien im Gegenzug „ganz und gar dem Grundsatz widersprechen [würde], dass die Zentralinstanz in erster Linie regieren und lenken und möglichst wenig unmittelbare Verwaltungsarbeit leisten soll“202. Regierungspräsident Fritz Fries, dessen Einladung an die anderen Regierungspräsidenten erfolglos geblieben war, schien seine Denkschrift ‘Leitgedanken für die Beibehaltung der Mittelbehörden‘ auch seiner Kollegin Bähnisch zugeschickt zu haben, denn sie findet sich, neben anderen Unterlagen zum Thema, in ihren Handakten.203 5.2.7.2 Bähnischs Rolle in der Diskussion um die Abschaffung der Mittelinstanz Aus den Akten des Regierungspräsidiums in Lüneburg wird deutlich, was im Bestand ‚Regierungspräsidium Hannover‘ im Niedersächsischen Staatsarchiv nicht überliefert ist, nämlich, daß auch Theanolte Bähnisch sich gegen die Abschaffung der Regierungspräsidien „ohne offene Aussprache“204 zur Wehr setzte.205 Sie hatte in Absprache mit anderen Regierungspräsidenten ein Memorandum an den Zonenbeirat in Hamburg formuliert, welchem die Kollegen in Arnsberg, Köln, Düsseldorf, Münster, Minden, Osnabrück, Hildesheim, Lüneburg, Stade, Aurich und Schleswig schriftlich zugestimmt hatten. Sie schilderte die bestehenden Verhältnisse in blumiger
202 NA, UK, FO 1049/1368, Die Notwendigkeit einer großen selbständigen Mittelinstanz im Lande Niedersachsen, Rede des Vizeregierungspräsidenten Pollack vor dem Wirtschaftsrat des Regierungsbezirks Stade, 19.12.1947; Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, BR 1021, Pollack: Die Notwendigkeit einer großen selbständigen Mittelinstanz im Lande Niedersachsen (Schriftenreihe des Informationsdienstes der Regierung in Stade), nach Strick: Routine, S. 77. 203 NLA HA HStAH, Nds. 120 Hannover, Acc. 1/76, Nr. 305, Fries, Fritz: „Leitgedanken für die Beibehaltung der Mittelbehörden“, Arnsberg 1948. „Die Auflösung der Behörde des Regierungspräsidenten muss die Auflösung der Verwaltung überhaupt nach sich ziehen. Die Auflösung der Verwaltung bedeutet aber die Auflösung des Staates selbst“ formuliert Fries sehr pathetisch. Ebd., S. 21 204 NLA HA HStAH, Nds. 120 Lün, Acc. 30/67, Nr. 18/2 [Verwaltungsreformen in Niedersachsen], Der Regierungspräsident von Arnsberg an den Oberpräsidenten Amelunxen, 1946. 205 Auf die wichtige Rolle Bähnischs in der Diskussion verweist auch Heiko Faber. Ihm zufolge hatte Bähnisch auf einer Tagung des Instituts zur Förderung öffentlicher Angelegenheiten im April 1950 nach dem Grundsatz ‚Gleichheit in der Fläche‘ für den Erhalt der Regierungspräsidien gesprochen. Sie habe als Beispiele, weshalb es keine sinnvolle Alternative zum Regierungspräsidium geben könne die neuralgischen Bereiche ‚sozialer Wohnungsbau‘ und ‚Ernährungsversorgung‘ angesprochen. Vgl.: Faber: Bezirksregierung.
466 | Theanolte Bähnisch
Sprache und übte ihre Kritik an den geplanten Veränderungen etwas weniger drastisch als der Kollege aus Arnsberg, der von „heimlichen Annexionsbestrebungen“, „direkter Feindschaft“ und „Nichtachtung“206 der Regierungspräsidenten gesprochen hatte. Bähnisch malte ein Bild des Regierungspräsidiums, das sich auf „universell gebildete Persönlichkeiten“ – im Unterscheid zu „Spezialisten (wie in den Sonderbehörden)“ stütze, welche die Sorgen des „einfachen Mannes“ kennen würden und ihre Tätigkeit in einem „wohlkonstruierten Uhrwerk“ in das „große Ganze“207 einzuordnen vermochten. Der Regierungspräsident, Garant jener wohldurchdachten Abläufe, sollte ihrer Empfehlung nach „auf Lebenszeit“ oder wenigstens „für 12 Jahre gewählt“ und seine Amtsbezeichnung ‚Regierungspräsident‘ beibehalten werden, „weil diese Bezeichnung für die Bevölkerung ein lebendiger Begriff ist“ und ihr „der Behördenapparat somit vertraut bleibt“208. Das Funktionieren der jeweiligen Behörde war für Bähnisch stark von der Persönlichkeit ihres Leiters abhängig209 und eine konstante Leitung der Behörde durch eine Person, wie sie Bähnisch vorschwebte, würde, in jener Logik gedacht, die größtmögliche Stabilität der Abläufe gewährleisten. Auf die Befürchtungen der Briten, die gerade vor langen Amtszeiten von Behördenleitern Sorge hatten, ging Bähnisch nicht ein. „[I]f you allow officials to have the supreme power for a long period, they inevitably become bureaucrats and then dictators. This must be avoided and it is for that reason that the last word must lie with representatives elected for a short period”210, hatte General Templer schon 1945 gewarnt. Schließlich spielte das Regierungspräsidium in Hannover in seiner „Denkschrift zur Frage der Beibehaltung der staatlichen Mittelinstanz im Zuge einer Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen“211 Argumente, die eng mit dem Amtsverständnis
206 Vgl.: ebd. 207 Vgl.: NLA HA HStAH, Nds. 120 Lün., Acc., 30/67, Nr. 18/2, Zur Frage der Verwaltungsreform, August 1946. 208 Ebd. 209 Jene von Bähnisch gewollte Ausrichtung der Behörde auf ihre Leiterin wird auch aus einem Brief deutlich, den die Regierungspräsidentin an ihre Freundin, die Dichterin Agnes Miegel schickte: „Ich verkörpere eine Institution“, schrieb Bähnisch darin und beklagte, daß ihr das Amt zur Pflege persönlicher Kontakte kaum Gelegenheit biete. DLA, A: Miegel, Briefe Dritter, 74.9236/4, Theanolte Bähnisch an Agnes Miegel, 03.09.1957. 210 NLA HA HStAH, Nds. 120 Lün., Acc. 30/67, Nr. 29, Adress to Regierungspräsidenten, Bünde, 26.11.1945. 211 NLA HA HStAH, Nds. 120 Hannover, Acc. 1/76, Nr. 305, Denkschrift des Regierungspräsidenten Hannover zur Frage der Beibehaltung der staatlichen Mittelinstanz im Zuge einer Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen. Da die entsprechende Akte mit ‚Denkschriften […] 1948–1952‘ betitelt ist, und sich die anderen Denkschriften eindeutig datieren lassen, stammt die Denkschrift des Regierungspräsidenten von Hannover vermutlich aus dem Jahr 1952. In jedem Fall ist sie – dies ist aus dem Inhalt abzuleiten – nach der Gründung der Bundesrepublik verfaßt worden. Ergänzt ist die Denkschrift durch einen Aufgabenkatalog mit dem Titel ‚Die Aufgaben der staatlichen Mittelinstanz und ih-
Regierungspräsidentin | 467
Bähnischs als ‚bürgerfreundliche‘ Regierungspräsidentin zusammenhingen, aus: Die Denkschrift, von der nicht klar ist, ob Bähnisch sie allein oder in Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitern verfaßte, betont vor allem die besondere Nähe der Regierungspräsidien zur Bevölkerung als Grund für die Notwendigkeit ihrer Erhaltung. Den Bürgern müßten „schon aus pekuniären Gründen“212 kurze Wege zu den Behörden garantiert werden, argumentierte sie, in Zeiten einer deutlich eingeschränkten Mobilität, nicht ungeschickt. Aus den Regierungspräsidien ausgegliederte Sonderbehörden und Verlagerungen von Kompetenzen in solche Behörden dürfe es aus diesem Grund ebenfalls nicht geben. Im Memorandum kritisierte Bähnisch bereits erfolgte Veränderungen: „Wo die verschiedenen Behörden residieren weiß das Publikum nicht. Die Folge ist eine maßlose Verärgerung des einfachen Mannes. Er wird mit seinen Sorgen von einer Behörde in die andere geschickt, während er früher den richtigen Weg nicht verfehlen konnte, wenn er zur Regierung ging. Der einfache Bürger bekommt allmählich Anfälle von Tobsucht“.213 Im Wissen, daß sie einen Eid geschworen hatte, „Gerechtigkeit gegen jedermann“214 zu üben, und daß die Militärregierung das Land mit ihrer Reform demokratischer gestalten wollte, malte sie die Verlagerung von Kompetenzen aus dem Regierungspräsidium in die Ministerien als diesem Ziel widerstrebend schwarz und mutmaßte, daß solche Reformen, zumal dies die „sozial schwächer gestellten Teile der Bevölkerung“215 schädigen und schließlich die „Autorität des Staates“ schwächen würde. Das Abheben auf die Einfachheit des Bürgers – im Kollektivsingular, auch die Verniedlichung ‚seiner‘ Anliegen zur ‚Sorge‘ sowie ‚seine‘ offensichtliche Orientierungslosigkeit, die einer ordnenden Hand bedürfe, schließlich die Idee, die Behördenchefs auf Lebenszeit zu ernennen, dies alles läßt darauf schließen, daß Bähnisch an ihrem recht patriarchalen Amtsverständnis und Führungsstil festhalten wollte. Ihre Kritik an der „Bürokratisierung“216 des öffentlichen Lebens – womit sie eine Überregelung meinte, die dem persönlichen Entscheidungsspielraum keinen Raum gewähre und individuelle Persönlichkeiten zu spezialisierten Prinzipienreitern mutieren ließe – trug einen nachvollziehbaren Kern in sich. „Ich halte das für ungesund und sehe darin einen Erstarrungsprozeß wirklich lebendigen Verwaltungslebens“,
212
213 214
215
216
re Grundlagen‘, O. V., o. O. Die Denkschrift umfaßt insgesamt 48 Seiten, der Aufgabenkatalog, dem eine Aufgabenverteilung für 1952 beigegeben ist, weitere 64 Seiten. NLA HA HStAH, Nds. 120 Hannover, Acc. 1/76, Nr. 305, Denkschrift des Regierungspräsidenten Hannover zur Frage der Beibehaltung der staatlichen Mittelinstanz im Zuge einer Verwaltungsreform, S. 18. NLA HA HStAH, Nds. 120 Lün., Acc. 30/67, Nr. 18/2, Zur Frage der Verwaltungsreform. NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Niederschrift über die Vereidigung der Regierungspräsidentin Dorothea Bähnisch, Der Niedersächsische Innenminister, 19.12.1951, unterzeichnet von Dorothea Bähnisch. NLA HA HStAH, Nds. 120 Lün., Acc. 30/67, Nr. 18/2, Zur Frage der Verwaltungsreform. Denkschrift des Regierungspräsidenten Hannover zur Frage der Beibehaltung der staatlichen Mittelinstanz im Zuge einer Verwaltungsreform, S. 18. Ebd.
468 | Theanolte Bähnisch
schrieb sie im Sommer 1947 über die ihrer Meinung nach zu starre Bürokratie in den Ministerien an ihren Vertrauten, den Kultusminister Adolf Grimme. Doch schoß sie, gemessen an den Reformansprüchen der Briten, über das Ziel hinaus, wenn sie erklärte: „Meines Erachtens sollte in der unteren und mittleren Instanz die Vielgestaltigkeit des Lebens mit einem Minimum an Demokratie sich natürlich entwickeln und von den Ministerien nur eine Kontrolle ausgeübt werden, die alle falschen Auswüchse verhindert.“217 Was genau eine ‚natürliche Entwicklung‘ sei und wie der minimaldemokratische Konsens aussehen sollte, ließ Bähnisch unausgesprochen. „Leider wird viel zu sehr von oben regiert“218, fügte sie noch hinzu und wollte mit dieser doppeldeutigen Aussage wohl ausdrücken, daß sie sich für die Regierungspräsidien eine größere Unabhängigkeit von den Ministerien wünschte. Den Landräten wollte sie allerdings nicht mehr Freiheiten bei der Amtsführung zuerkennen, sondern forderte vielmehr, dass diese sich stärker an den Regierungspräsidien orientieren sollten.219 Die von den Briten angestrebte größere Unabhängigkeit der Kreise – ein Kernelement der geplanten Dezentralisierung/Entstaatlichung – wurde vom Regierungspräsidium Hannover nicht befürwortet. Im Gegenteil: Die Denkschrift rief dazu auf, daß sich die örtlichen Organe den „überörtlichen Notwendigkeiten“220 anpassen sollten. Eine zu große Unabhängigkeit der Kreise würde eine Zerklüftung der Verwaltung nach sich ziehen, die mit Nachteilen für die Bürger verbunden sei, so Bähnisch.221 Deshalb müsse die „parlamentarisch-demokratische Staatsform Rousseau’scher Prägung zu einer gewissen Konzentration drängen.“222 Vor diesem Hintergrund vermag das Hauptargument der Hannoveraner Denkschrift für die Beibehaltung der Mittelinstanz, nämlich die originäre Zuständigkeit der Mittelinstanz für die Verwaltung, nicht mehr ganz zu überzeugen. Die „Neigung, in den Bereich der Politik überzugreifen“223, bestünde bei den Mittelinstanzen nicht, hieß es in der Denkschrift. Der Regierungspräsident sei „letztes Organ“ der Staatsgewalt und garantiere, daß „der Wille des Gesetzgebers, des Landtags und damit des Staatsvolks selbst“ tatsächlich durchgeführt werde.224 Auf welche Weise genau dieser ‚Wille‘ im Einzelfall durchgeführt werden würde, darauf sollten die Regierungspräsidenten nach Bähnischs Dafürhalten durch einen Zuwachs an Autonomie und Kompetenzen mehr Einfluß nehmen können – mit ‚Politik‘ schien dies in Bähnischs Interpretation nichts zu tun zu haben. Schließlich wird in der Broschüre noch die besondere Lage der Nachkriegszeit angesprochen: Es dürfe nicht verkannt werden, daß in Folge des „unnatürlichen und unfreiwilligen Eintretens fremder Glieder, der Flüchtlinge und Evakuierten aus der Stein’schen Bürgerschafts- eine Einwohnergemeinde wurde und die dadurch er-
217 218 219 220 221 222 223 224
Ebd. Ebd. Denkschrift des Regierungspräsidenten von Hannover, S. 28. Ebd. Vgl.: ebd., S. 25–34. Ebd., S. 28. Ebd., S. 4. Ebd., S. 3.
Regierungspräsidentin | 469
wachsenen Aufgaben einfach den Rahmen der örtlichen Möglichkeiten sprengten“225, war dort zu lesen. Dies sollte bedeuten, daß die Kommunen die regulierende Hand der Regierungspräsidien, welche „frei von persönlichen Hemmungen und Bindungen“226 seien, benötigten. Was hinter jenem Argument steckte, war der Sachverhalt, daß die vielbeschworene ‚deutsche Opfergemeinschaft‘ gar keine Gemeinschaft war, sondern daß Gefühle des Neids verbreitet waren, daß die Flüchtlinge sich nicht willkommen fühlten und daß diejenigen, die schon immer vor Ort waren, den Flüchtlingen, auch den DP’s, die besondere Aufmerksamkeit der Behörden mißgönnten. Die integrative Rolle des Behördenleiters spielte in solchen Zeiten eine wichtige Rolle: „Nur der Leiter der Mittelinstanz ist in der Lage, eine schnelle und fachlich richtige Entscheidung unter Abwägung aller Interessen zu treffen“227, hält die Denkschrift entschieden fest. Als Beleg hierfür wird angeführt, daß es insbesondere, als „im Frühjahr 1949 die Ablieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse ins Stocken geriet“, der „Autorität des Regierungspräsidenten in diesen wie in anderen Notfällen“ bedurft habe, um die „Erfüllung überörtlicher Notwendigkeiten zu sichern“.228 Während sich die Behördenleiter mit ihrer Aufgabenfülle aufgrund des Personalmangels nicht selten überlastet fühlten, waren sie gleichzeitig mühsam auf die Wahrung ihrer Kompetenzen bedacht und forderten, wie in Bähnischs Fall, gar die Übertragung von Zuständigkeiten von der Ministerialebene und den Landratsämtern auf die Regierungspräsidien.229 Mit ihrem in vielen Interviews geäußerten Anspruch, ihr Amt insgesamt persönlicher auszugestalten, als es die Gesetze vorsahen, und dabei den Kompetenzrahmen der Regierungspräsidien eher noch auszuweiten, anstatt ihn einzuschränken oder gar die Behördenstufe als solche abzuschaffen, stand Bähnisch unter ihren Kollegen nicht allein da.230 Dieser Umstand wird nachvollziehbarer, wenn man sich vor Augen führt, mit welchen Ansprüchen sich die Regierungspräsidenten in der direkten Nachkriegszeit konfrontiert sahen. Der Spagat zwischen den alliierten Reformansprüchen, die zu einer demokratisch kontrollierten Verwaltung führen sollten, auf der einen und der Hilfserwartung seitens der Bevölkerung, die, von blanker Existenznot getrieben, einen Ansprechpartner suchte, auf der anderen Seite, muß schwierig zu meistern gewesen sein. Mit der Mehrbelastung der Behörden durch die Kriegsfolgen zu argumentieren, sowohl, was die traditionellen Aufgabengebiete anging, als auch, was
225 226 227 228 229
Ebd., S. 29. Ebd., S. 42. Ebd., S. 15. Unterstreichung i. O. Ebd. Bähnisch sprach sich für eine Verlagerung von Zuständigkeiten in Personal- und Versorgungsangelegenheiten, im Hochbauwesen, in der Bäderverwaltung, der Kommunalaufsicht, bei ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Maßnahmen der Soforthilfe, des Schulwesens und der Wirtschaftsangelegenheiten in das Regierungspräsidium aus. Im Gegenzug könnten der Verkehr, das Wohnungswesen, der Hochbau sowie die Roh- und „Gebrauchsabnahme einfacher Bauwerke“ als Auftragsarbeit in die Kreisstufe verlagert werden. Ebd., S. 35. 230 Vgl.: Strick: Routine, S. 67.
470 | Theanolte Bähnisch
ganz neu entstandene Verpflichtungen betraf, war daher eine vielsprechende Strategie. Denn Bähnischs dahingehende Argumentation traf einen wunden Punkt der britischen Wiederaufbaupolitik. Denn die Militärregierung war sich über den politischen Sprengstoff, den unzufriedene Flüchtlinge, Vertriebene und Kriegsheimkehrer bilden konnten, durchaus im Klaren.231 Der Verwaltungswissenschaftler Hillmann gab 1963 Bähnischs Argumenten vor dem Hintergrund der besonderen Situation in der Nachkriegszeit Recht. Er schreibt, daß die Nachkriegssituation „den verantwortlichen Landesregierungen in der Regel gar keine andere Wahl“ gelassen habe, „als die überkommene Verwaltungsorganisation als stabilisierenden Faktor beizubehalten. […] [D]ie großen Leistungen der Nachkriegsverwaltung beim Aufbau eines rechtsstaatlichen Gemeinwesens“ seien in der Tat „nicht zum geringsten Teil den Bezirksregierungen zuzurechnen“232 gewesen. Schließlich bildeten die Regierungspräsidien nach Kriegsende – abgesehen von den Oberpräsidien, die ebenfalls Behörden der Mittelinstanz waren – zunächst die einzige staatliche Verwaltungsebene, da weder Bund noch Länder existierten. Der erste niedersächsische Landtag trat erst am 09.12.1946, neun Monate nach dem Amtsantritt Bähnischs als Regierungsvizepräsidentin zusammen. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Bürger längst daran gewöhnt, sich mit ihren Anliegen an das Regierungspräsidium zu wenden. Christina Strick konstatiert, daß „Handlungsträger der Mittelinstanz“ vor allem in solchen Bereichen über ihre Bündelungsfunktion hinaus administrativ oder gar politisch handelten, „die stärker als die übrigen Verantwortungsfelder die Bezirksregierung vor neue Aufgaben stellten, auf die nicht unmittelbar mit Routine reagiert werden konnte und deren Akteure und Adressaten sich im Zuge dieser neuen Aufgaben der nationalsozialistischen Vergangenheit stellen mussten“233. Dies sei, so Strick, vor allem im Rahmen der `Wiedergutmachung´ nationalsozialistischen Unrechts, der Entnazifizierung und der Wiedereingliederung von Beamten nach dem 131er-Paragraphen geschehen.234 Der Paragraph regelte die Wiedereingliederung von Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes, die im Rahmen des Entnazifizierungsverfahrens nicht als Hauptschuldige oder Belastete eingestuft worden waren. Bähnisch brachte zwar entsprechende Gründe nicht vor, als sie sich gegen die Abschaffung der Regierungspräsidien einsetzte, doch wie ihre Kollegen war auch sie mit der Reparatur von Beamtenkarrieren, wie Lutz Niethammer die Durchführung des ‚131er‘ charakterisiert, befaßt gewesen.
231 232 233 234
Vgl.: ebd., passim, exemplarisch S. 74. Hillmann: Regierungspräsident, S. 102. Strick: Routine, S. 4. Vgl.: ebd. Interessanterweise sind dies völlig andere Themen, als jene, die Bähnisch als Gründe ins Feld führt, wenn es darum geht, die Mittelinstanzen nicht abzuschaffen. Daß allerdings auch sie Schwierigkeiten in einer schnellen Wiederverwendung von Beamten, deren Biographien unklar seien, sah, schlägt sich in einem Beitrag Bähnischs in einer Dienstbesprechung der Regierungspräsidenten in Niedersachsen nieder. NLA HA HStAH, Nds. 120 Hannover, Acc. 176/91, Nr. 27, Niederschrift über die Dienstbesprechung der Regierungspräsidenten im Niedersächsischen Innenministerium am 12.03.1952, 28.03.1952.
Regierungspräsidentin | 471
Die Militärregierung jedenfalls legte ihre Pläne, die Regierungspräsidien abzuschaffen, bald ad acta. Eine definitive Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt läßt sich aus den Akten nicht herauslesen, vielmehr ist ein ‚Schleifenlassen‘ und schließlich das Aufgeben der Pläne mit der wieder entstandenen Souveränität Deutschlands zu beobachten.235 Nach und nach wurden den Behörden Zuständigkeiten wieder übertragen, die ihnen im Dritten Reich oder unter der Besatzung entzogen worden waren. Die Katasterverwaltung war schon 1945 zurück in die Hände der niedersächsischen Regierungspräsidien gefallen. Erst nach dem vorläufigen Ende der Diskussionen um das Schicksal der Regierungspräsidenten folgte 1950 die Wiedereingliederung der Forstverwaltung in die Behörden. Wie von Bähnisch erhofft, gewann das Regierungspräsidium also durch die Reintegration der Aufgaben aufgelöster Sonderbehörden Kompetenzen zurück. Es wurden jedoch neue Sonderbehörden eingerichtet, wie beispielsweise das Landesverwaltungsamt, das bis 1958 bestand. Auch innerhalb der Abteilungen der Regierungspräsidien wurde umorganisiert, schließlich wurden zur Ergänzung der existierenden Abteilungen im Regierungspräsidium Hannover eine fünfte und sechste eingerichtet.236 Daß die Argumente des Regierungspräsidiums Hannover über die Grenzen des Bezirks hinaus Gehör fanden, belegt nicht zuletzt deren Erwähnung in der verwaltungswissenschaftlichen Literatur der 60er Jahre und der neuesten Zeit: Birgit-Anne Pieckenäcker schreibt in ihrer Dissertation von 2006, daß „der damalige Regierungspräsident von Hannover“ gegenüber der Landesregierung anhand von Beispielen „nachgewiesen“ habe, „dass jede Ausschaltung der Bezirksregierungen Fehlleistungen in wichtigen Verwaltungsfragen nach sich ziehen würde und damit ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand entstünde, diese Handlungen wieder rückgängig zu machen.“237
235 Regierungsinspektor zur Nedden konnte am 17.06.1950 im Auftrag Theanolte Bähnischs an den Niedersächsischen Innenminister berichten, daß „die Dienststellen der Besatzungsmacht“ sich „in zunehmendem Maße aus den deutschen Verwaltungsgeschäften heraus“ hielten. „Das gilt auch für das Vereins- und Versammlungswesen und den Geschäftsbereich der Exekutiv-Polizei.“ NLA HA HStAH, Nds. 120 Hannover, Acc. 9/90, Nr. 56 [Korrespondenz des Regierungspräsidenten mit der britischen Militärregierung 1946-1960], Regierungsdirektor zur Nedden an den Niedersächsischen Minister des Innern, 17.06.1950, unterzeichnet von Theanolte Bähnisch. 236 NLA HA HStAH, Hannover 180, Hannover II g Nr. 205 C, Geschäftsverteilungsplan des Regierungspräsidiums Hannover, 1949. 237 Pickenaecker, Birgit Anne: Das Dilemma der Bezirksregierung in NRW zwischen Tradition und Transformation – Ansätze für eine pragmatische Modernisierungsperspektive, Diss., Düsseldorf 2006, online unter http://miami.uni-muenster.de/servlets/Derivate Servlet/Derivate-3071/diss_pickenaecker.pdf, S. 31. Vgl.: auch Hillmann: Regierungspräsident, S. 93.
472 | Theanolte Bähnisch
5.2.7.3 Die Verwendung als Regierungspräsidentin, ein logischer Schritt in der Biographie? Um die scharfe Gegenwehr Bähnischs gegen die Abschaffung der Regierungspräsidien nachvollziehbar zu machen, reicht es nicht aus, die jeweils inhärente Logik britischer Demokratisierungs-Erwartungen und preußischer Verwaltungs-Traditionen gegenüberzustellen und das Handeln der Regierungspräsidentin des Bezirks Hannover durch das ihrer Kollegen in der Britischen Besatzungszone zu kontextualisieren. Denn in der britischen Verwaltungsreform scheint die erste Regierungspräsidentin Deutschlands nicht allein eine Gefahr für die von ihr stets als positiv dargestellten preußischen Verwaltungstraditionen, in denen sie und ihr Mann beruflich sozialisiert worden waren, gesehen zu haben. Sicherlich war Bähnischs Gegenwehr gegen die Reformpläne auch von der Sorge um den Verlust des eigenen politischen Gestaltungsspielraumes im deutschen Wiederaufbau getragen. Doch auch die Hinzuziehung dieses Aspekts vermag die ganze Dimension der persönlichen Enttäuschung Bähnischs über die geplante Reform nicht hinreichend zu erklären. Als drittes Moment muß die persönliche Erfahrung eines drohenden ‚doppelten Bruchs‘ in der eigenen Biographie Berücksichtigung finden: Ende der 1920er Jahre war Bähnisch von den preußischen Führungsspitzen der SPD stark enttäuscht worden, als man ihr nahegelegt hatte, ihr Rücktrittsgesuch als Regierungsrätin einzureichen, weil ihre Berufstätigkeit im Staatsdienst vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosenzahlen, dem Doppelverdiener-Paragraphen und der beruflichen Stellung ihres Mannes für die Partei politisch nicht mehr tragfähig erschien. Severing hatte damit – so stellt es Bähnisch dar – einen Plan, der in wirtschaftlich soliden Zeiten ein durchaus positives Medienecho von Seiten fortschrittlicher Kräfte hätte nach sich ziehen können, auf Eis gelegt: nämlich, Theanolte Bähnisch zur ersten Regierungspräsidentin in Preußen zu ernennen.238 Das Warten auf den Rückgang der Arbeitslosenzahlen und damit die Chance, daß Severing seinen Plan doch noch umsetzen würde, entpuppte sich als eine Illusion: Weder Albrecht Bähnisch, der zu Beginn der 30er Jahre als Landrat, also in einer üblichen ‚Karriere-Vorstufe‘ zum Amt des Regierungspräsidenten, tätig war, geschweige denn Theanolte Bähnisch, die bereits Ende der 20er Jahre aus dem Staatsdienst ausgeschieden war, konnten ihre Verwaltungskarriere in der ausgehenden, durch die Ermächtigungsgesetze bereits demontiertenRepublik von Weimar fortsetzen. Die Erfahrung der Amtsenthebung Albrecht Bähnischs durch die Nationalsozialisten und die auf unbestimmte Zeit bestehende Unmöglichkeit für beide Ehepartner, im Staatsdienst wieder Fuß zu fassen, prägte die Erinnerung Theanolte Bähnischs stark. Daß nun ausgerechnet im demokratischen Wiederaufbau, der doch nach Maßgabe der Militärregierung insbesondere auch den Frauen neue Möglichkeiten bieten sollte, die berufliche Stellung Bähnischs erneut gefährdet sein sollte, das dürfte die Regierungspräsidentin zutiefst irritiert haben. In der Auseinandersetzung mit ihren Lebensläufen wird deutlich, daß sie, sobald sie das Amt innehatte, dies als quasi logische Folge ihrer bisherigen Karriereschritte darstellte – wie sie auch der Überzeugung anhing, ihr Mann, der Landrat, wäre Regierungspräsident geworden, wenn sei-
238 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. D. [1972], S. 30, Das zweite Abbaugesetz.
Regierungspräsidentin | 473
ne Karriere nicht im Dritten Reich unterbrochen worden wäre. Die im Berliner Polizeipräsidium gesammelten Erfahrungen werden von Bähnisch retrospektiv in eine logische, quasi teleologische Entwicklung einsortiert, wenn sie erklärt, sie sei für das Amt als Regierungspräsidentin bestens vorbereitet gewesen, da sie in ihrer Ausbildung im Polizeipräsidium, das gleichzeitig auch die Funktion eines Regierungspräsidiums innehatte, bereits mit allen relevanten Abläufen in einer solchen Behörde vertraut gemacht worden sei.239 Theanolte Bähnisch war, sozialisiert unter jenen, die die Verwaltung durch langsame Reformen an die Erfordernisse einer parlamentarischen Demokratie anpassen wollten, überzeugt vom staatstragenden und gesellschaftsstabilisierenden Kern preußischer Verfassungstraditionen und vom Reform-Potential, das der Verwaltung selbst innewohnte. Sie selbst wollte jene Verwaltung vom ‚weiblichen Geist‘ durchdrungen wissen und sie insgesamt ‚menschlicher‘ gestalten. Den Schlüssel zu mehr Bürgernähe sah Bähnisch nicht in einer parlamentarischen Kontrolle, sondern in einer ‚mütterlichen‘ Art der Amtsführung.240 Natürlich war sie, das wird auch an ihrer Idee, die Regierungspräsidenten auf Lebenszeit zu ernennen, deutlich, an der Aufrechterhaltung ihres großen persönlichen Gestaltungsspielraums interessiert. Die Machtfülle, welche damit verbunden war, schien für sie nicht mit dem Odem mangelnder demokratischer Legitimation, sondern mit dem Segen der Möglichkeit einer gerechten und bürgernahen Regierung fern von ‚Parteiengezänk‘, gewährleistet durch die hohe persönliche Integrität des Amtsinhabers, behaftet gewesen zu sein. Daß sie im Handbuch der Britischen Militärregierung für Niedersachsen als „not above personal intrigue [but with] a high standard of official integrity“241 beschrieben wird, erklärt, warum schließlich auch die Briten hin- und her gerissen gewesen sein könnten: zwischen einer sperrigen, bürokratischen, aber basisdemokratisch organisierten Verwaltung des Regierungsbezirks auf der einen Seite und einer womöglich reibungsloseren Verwaltungsleitung durch eine Person, welche nicht nur über hohes Ansehen in der Bevölkerung verfügte, sondern es auch noch – wie in späteren Kapiteln deutlich werden wird – verstand, die Bevölkerung zur Teilhabe am öffentlichen Leben zu motivieren, zwischen verschiedenen Konfliktparteien zu vermitteln und die Besatzer in ein gutes Licht zu rücken.
5.3 NOCH EINE NEUE AUFGABE: DIE ÜBERNAHME DER BEZIRKSPOLIZEILEITUNG 5.3.1 Eine wichtige Etappe im Streben nach Autonomie Ab 1951 war das Regierungspräsidium auch (wieder) für die Verwaltung der Polizei im Bezirk zuständig. Für die Einsätze blieb unmittelbar der jeweilige Polizeipräsident, beziehungsweise ‚Polizeichef‘, wie die Bezeichnung bis 1951 lautete, verant-
239 AddF, SP-01, Kurze Lebensskizze, o. D. 240 Vgl.: Freund: Hut. 241 Vgl.: Röpcke: Saxony, S. 258.
474 | Theanolte Bähnisch
wortlich. Mit der Rückgabe der Polizeigewalt in die Zuständigkeit deutscher Behörden hatten sich die Briten, da die Polizeieinheiten im Dritten Reich zur gewaltsamen Durchsetzung nationalsozialistischer Ziele mißbraucht worden waren, besonders viel Zeit gelassen. Sie nahmen – zu Recht242 – die deutschen Polizeieinheiten als einen Hort des Militarismus wahr.243 Deshalb hatte die Militärregierung, genauer ihre ‚Public Safety Branch‘, nach dem Einmarsch zunächst die Aufsicht über alle (Sicherheits-)Polizeiaufgaben übernommen. Die Verwaltungspolizei war den Städten unterstellt worden. Damit folgten die Briten dem Trend einer immer weiter fortschreitenden Trennung zwischen Verwaltungs- und Sicherheitspolizei. Diese Entwicklung hatte in Westeuropa um 1900 eingesetzt und in Deutschland in den Anfangsjahren der Weimarer Republik zu starken Veränderungen im Polizeiapparat geführt. In einer Rede anläßlich des 50. Geburtstages des Gebäudes, in dem die Polizeidirektion Hannover untergebracht war, brachte die Regierungspräsidentin im Oktober 1953 ihr Bedauern darüber zum Ausdruck, daß „die praktische Polizeitätigkeit“ lange „dadurch erschwert“ gewesen sei, „daß kaum etwas geschehen oder angeordnet werden durfte, ohne Vorprüfung der Militärregierung“.244 Lediglich die leidigen Finanz- und Unterbringungsfragen, so Bähnisch, seien den Deutschen überlassen worden. Der Regierungspräsidentin war aufgestoßen, daß der deutschen Polizei „besonders das Vorgehen gegen nicht-deutsche Personen“ von der Militärregierung „nicht erlaubt“ worden war, „[o]bwohl gerade von Angehörigen dieses Personenkreises in Hannover und Umgebung in der ersten Zeit nach 1945 viel Schrecken verbreitet wurde“245. Die Sichtweise, die diesen Aussagen innewohnt, verdeutlicht eine gewisse ‚Blindheit‘ Bähnischs für die Ausgangssituation 1945, die der Militärregierung im Grunde gar keine andere Wahl gelassen hatte. Denn auch die Polizeikräfte in Hannover waren, wie ihre Kollegen andernorts, in die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft tief verstrickt gewesen. Daß gerade jenen Personen, die mit für die Drangsalierungen und Deportationen der Hannoveraner Juden und anderer rassisch Verfolgter verantwortlich gewesen waren, Bähnisch Meinung nach die Erlaubnis hätte erteilt
242 Siehe Kapitel 2.3.1.2. 243 Trotz der Kontrolle durch die Militärregierung hatte Polizeichef Adolf Schulte – unter starker Kritik der SPD in Hannover – eine Politik der Wiedereinstellung politisch vorbelasteter Personen betrieben. Im Mai 1946 erließ die britische Militärregierung aus diesem Grund, und da er seine Zugehörigkeit zur Ordnungspolizei in den Niederlanden verschwiegen hatte, einen Haftbefehl gegen Schulte. Etliche von Schulte eingestellte Polizeibeamte wurden entlassen. Vgl.: Riesener: Polizeidirektion, S. 214. Polizeichef wurde, nach einem kurzen Zwischenspiel mit Fritz Kiehne, im Mai 1946 Karl Brunke. Als dieser 1951 die Position des Inspekteurs der Bereitschaftspolizeien der Länder übernahm, folgte ihm der bereits 1945 für dieses Amt von Kurt Schumacher empfohlene Robert Meinke als Polizeichef im Bezirk Hannover nach. Vgl.: ebd., S. 212/213. 244 NLA HA HStAH, Hann. 87, Hannover Acc. 92/84, Nr. 18, Auszug aus der Ansprache von Frau Regierungspräsident Bähnisch aus Anlaß des 50. Geburtstages des Gebäudes der Polizeidirektion Hannover am 29.10.1953, o. D. 245 Ebd.
Regierungspräsidentin | 475
werden sollen, gegen ‚nichtdeutsche Personen‘ vorzugehen, mutet in der Retrospektive wie eine Verhöhnung der Ziele der Militärregierung an. Hinter den Äußerungen Bähnischs steckten aller Wahrscheinlichkeit nach vor allem zwei Beweggründe: Zum einen der unbedingte Wille Bähnischs, ihren Beitrag zur Wiederherstellung und/oder Aufrechterhaltung ‚öffentlicher Ordnung‘ zu leisten, zum anderen die Angst davor, daß das Ansehen der Regierung und der Polizei in der Bevölkerung leiden könne, wenn die ‚öffentliche Ordnung‘ bedroht sei, ein polizeiliches Eingreifen aber verhindert werde. Folgender, von Dirk Riesener geschilderter Vorfall, vermag einen Eindruck davon zu geben, wie groß – vor dem Hintergrund der jahrelang geschürten antislawischen Propaganda – auf der einen Seite die gefühlte Bedrohung durch ausländische Kriminelle und auf der anderen Seite die gefühlte Machtlosigkeit, mit der die deutsche Polizei dem gegenüberstand, gewesen sein dürfte: 1945 drangen 30 mit Gewehren bewaffnete Russen in das Polizeipräsidium ein, weil sie einen Landsmann rächen wollten, der wegen Fahrraddiebstahls festgenommen worden war: Die ‚Rächer‘ entführten einige Polizisten, um diese zu erschießen, aber in letzter Minute gelang es Offizieren der Militärregierung, die die Polizisten zur Hilfe gerufen hatten, dies zu verhindern.246 Dirk Riesener, ein Experte für die Geschichte der niedersächsischen Polizei, merkt an, daß die Ausländerkriminalität in der direkten Nachkriegszeit tatsächlich ein Problem darstellte. Mitte 1948 habe sie jedoch – durch die Einrichtung von Lagern – eingedämmt werden können.247 Einer Kriminalstatistik der ersten Nachkriegsjahre für die Stadt Hannover zufolge befanden sich schon unter den Tätern der Jahre 1945– 1947 verhältnismäßig wenige Ausländer. Im Zuge der Rückführung der Displaced Persons fiel die Ausländer-Kriminalität in der Stadt auf einen marginalen Anteil an der Gesamtkriminalität zurück.248 Riesener nimmt an, daß vor dem Hintergrund der „überkommenen rassistischen Vorstellungen und Ängste die Plünderungen seitens der DP sowohl von der Bevölkerung als auch der deutschen Polizei übertrieben wurden.“249 Wie die Berichterstattung in der ‚Stimme der Frau‘ zeigt, scheint jene Propaganda auch Theanolte Bähnischs Bild von den ‚Ausländern‘, die als Zwangsarbeiter vor allem aus Rußland, Polen und der Ukraine nach Deutschland verschleppt worden waren, beeinflußt zu haben.250 Die Regierungspräsidentin lobte in ihrer Jubiläums-Rede 1953, daß das Land Niedersachsen insgesamt nicht nachgelassen habe „von 1947 an immer wieder die
246 247 248 249
Riesener: Polizeidirektion, S. 234. Ebd., S. 231. Ebd., S. 233. Ebd., S. 231. Die ‚Unterstützung und Überwachung von Flüchtlingen ausländischer Staatsangehörigkeit‘ gehörte jedoch laut einer Anweisung der Militärregierung aus dem Frühjahr 1945 zu den Aufgaben der deutschen Polizisten. Vgl.: ebd., S. 218, Anm. 1. 250 Zum Bild der Slawen als Unmenschen, Vergewaltiger, aber auch als Kinderfreunde in der ‚Stimme der Frau‘, vgl.: Freund: Krieg, S. 123–133.
476 | Theanolte Bähnisch
Rückgabe der Polizei an das Land Niedersachsen zu fordern“251. Diese ‚Rückgabe‘ war schließlich 1951 erfolgt. „Durch das Niedersächsische Gesetz für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 21. März 1951 wurde die Polizei wieder Landessache. Polizeibehörde ist der Regierungspräsident, und zwar letzte Polizeibehörde nach unten. In der Praxis […] hat sich das Fehlen einer unteren Polizeibehörde manchmal schmerzlich bemerkbar gemacht“252, verkündete Bähnisch im Rahmen ihrer FestRede und was sie hier als Erfolg beschrieb, das vergrößerte natürlich ihren eigenen Einfluß im Regierungsbezirk zusätzlich. Als Chefin der Polizeibehörde im Bezirk war Bähnisch jedoch – anders als in ihrer Funktion als Regierungspräsidentin – durch einen beigeordneten Polizeiausschuß einer parlamentarischen Kontrolle unterworfen.253 Dieser Ausschuß sollte der Polizei aus ihrer Rolle des staatlichen Machtinstrumentes ‚heraushelfen‘ und zu einer lokalen und demokratischen Konzeption der Polizei beitragen.254 Wie viele von der Militärregierung durchgesetzten Neuerungen, welche die Verwaltungen demokratisieren helfen sollten, wurden die Polizeiausschüsse jedoch schon bald wieder abgeschafft und stattdessen Polizeibeiräte, deren
251 NLA HA HStAH, Hann. 87, Hannover Acc. 92/84, Nr. 18. Auszug aus der Ansprache von Frau Regierungspräsident Bähnisch aus Anlaß des 50. Geburtstages des Gebäudes der Polizeidirektion Hannover am 29.10.1953, o. D. 252 Ebd. 253 Die Stadt- und Landkreise entsandten je einen Vertreter in den Polizeibeirat. Am Beispiel Wuppertals im Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen zeigt Kurt H. Groll auf, daß der Ausschuß dort zwar „durchaus ein unter organisatorischen Gesichtspunkten taugliches Kontrollinstrument darstellte“, er seine Kontrollfunktion jedoch nicht „adäquat ausgeübt“ hat. Das Engagement der Ausschußmitglieder blieb, so Groll, „mangelhaft“, seine Pflicht habe der Ausschuß „erkennbar unwillig“ erfüllt. Groll, Kurt: Bedingungen demokratischer Kontrolle. Lehren aus den Polizeiausschüssen der britischen Zone, in: Bürgerrechte & Polizei/CILIP 67 (3/2000), auf: http://www.cilip.de/ausgabe/67/groll.htm, am 13.12. 2013. Inwiefern dies auch für Hannoveraner Verhältnisse zutraf, ob auch hier die von Groll für Nordrhein-Westfalen konstatierte zu große Aufgabenvielfalt dem Ausschuß die Arbeit erschwerte und seine Selbstwahrnehmung auf andere Funktionen, als die der Kontrolle fokussierte – denn dem Ausschluß waren auch Aufgaben der Verwaltung und Leitung der Polizei übertragen worden – dazu liegen noch keine Forschungen vor. „Er vertrat die Polizei im Rechtsverkehr, ihm oblag die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges sowie die Dienstaufsicht über das Verwaltungspersonal und das Haushalts, Kassen- und Rechnungswesen der Polizei“ schreibt Groll. Vgl.: Groll: Bedingungen. Der Wuppertaler Polizeiausschuß jedenfalls schien sich der Polizei so verbunden gefühlt zu haben, daß nicht der Bürgerschaft, sondern der Polizei selbst seine oberste Loyalität galt. Dies war von der Militärregierung natürlich nicht intendiert gewesen, es zeigt, daß die Einrichtung neuer Gremien allein nicht zu einer demokratischeren Verwaltung führte. 254 „Örtlich und vom Volke kontrolliert“ stellte sich die Militärregierung die neue deutsche Polizei vor. Es sollte „kein staatliches Polizeisystem und keine Zentralstelle geben, welche die Befugnis hat, Exekutivbefehle zu erteilen.“ General Inspector der britischen Zone, O' Rourke, zitiert nach Steinborn, Norbert/Schanzenbach, Karin: Die Hamburger Polizei nach 1945 – ein Neuanfang, der keiner war, Hamburg 1990, S. 14/15.
Regierungspräsidentin | 477
Kompetenzen geringer waren, eingerichtet. Die ‚Polizeichefs‘ erhielten in diesem Zuge auch ihren althergebrachten, von der Militärregierung verschmähten Titel ‚Polizeipräsidenten‘ zurück. 255 Der SPD-Parteivorsitzende in den Westzonen, Kurt Schumacher, fokussierte indessen viel stärker auf die Auswahl der Personen, welche in den Dienst der Polizei gestellt wurden, als auf die Etablierung neuer Regulations-Mechanismen. Anders als Theanolte Bähnisch stand er vor allem den ersten von der Militärregierung eingesetzten Polizeichefs äußert ablehnend gegenüber. 1946 wurde nachgewiesen, daß der erste Nachkriegspolizeichef Adolf Schulte die Bildung nationalsozialistischer Zellen in der Hannoverschen Polizei offensiv angestrebt hatte. Schumacher selbst war zum Personenschutz eine fünfköpfige Polizeimannschaft zur Seite gestellt worden, von denen vier nicht nur ehemalige SS-Angehörige waren, sondern dies in der Öffentlichkeit auch noch betonten – was Schumacher mit einer Klage gegenüber der britischen Kontrollkommission beantwortete und damit die Meldung der lokalen Public Safety Branch, die die Hannoveraner Polizei zuvor als ‚von den Nationalsozialisten bereinigt‘ darstellte, widerlegte.256 Auch dem dritten Nachkriegs-Polizeichef in Hannover Karl Barth brachte Kurt Schumacher kein Vertrauen entgegen.257 Bähnisch dagegen lobte Barth in ihrer Ansprache anläßlich des 50. Geburtstags des Gebäudes der Polizeidirektion Hannover als einen „Gewährsmann für eine demokratische Entwicklung bei der Polizei“. Sie zeigte keinen Ärger über seine Personalpolitik, sondern brachte, im Gegenteil, ihr Bedauern darüber zum Ausdruck, daß Barth „nur wenige Kräfte zur Verfügung“ standen, „denn auf Grund der Anordnungen der Militärregierung wurden viele Beamte entlassen. Es war für die Polizei eine sehr harte Zeit“, stellte Bähnisch fest und fügte hinzu „an dieser Stelle müssen wir Herrn Polizeipräsident Barth ganz besonderen Dank dafür sagen, was er in diesen schweren Tagen nach 1945 für die Polizei und die Stadt Hannover leistete“258. Wenige Monate nachdem die Landesregierung begonnen hatte, auf der Grundlage des ‚131er‘ Beamte wieder einzustellen, die wegen ihrer Betätigung im NS-Staat zunächst aus dem Beamtenverhältnis entlassen worden waren, starb Schumacher. Zur Wiedereinsetzung von NS-Funktionären beim Regierungspräsidium Hannover, auch in der Polizeiverwaltung, konnte er sich deshalb nicht mehr äußern.
255 Vgl.: Groll: Bedingungen. Die Polizeiausschüsse bestanden bis 1953. Auf Landesebene waren Landespolizeibeiräte zur Beratung der Fachminister eingerichtet worden. 256 Vgl.: Liebert, Frank: „Die Dinge müssen zur Ruhe kommen, man muß einen Strich dadurch machen“. Politische „Säuberung“ in der niedersächsischen Polizei 1945–1951, in: Fürmetz/Reinke/Weinhauer: Nachkriegspolizei, S. 71–103, hier S. 83/84. 257 Vgl.: Riesener: Polizeidirektion, S. 212/213. 258 NLA HA HStAH, Hann. 87, Hannover Acc. 92/84, Nr. 18, Auszug aus der Ansprache von Frau Regierungspräsident Bähnisch aus Anlaß des 50. Geburtstages des Gebäudes der Polizeidirektion Hannover am 29.10.1953, o. D.
478 | Theanolte Bähnisch
5.3.2 Zwischen mißglückter Entnazifizierung und fragwürdigem Desinteresse: Die Kontinuität von ‚Verwaltungseliten‘ aus dem Dritten Reich in der niedersächsischen Polizei An der Entnazifizierung von Polizeibeamten selbst war Bähnisch dadurch, daß die Polizeiverwaltung erst spät in deutsche Hände zurück gegeben wurde, kaum beteiligt. Umso mehr mußte sie sich, kurz nachdem sie die Leitung der Polizei übernommen hatte, mit der Wiedereingliederung entlassener Polizisten in den öffentlichen Dienst befassen. Denn das Ende der Entnazifizierung in Niedersachsen kam mit dem ‚Gesetz zur Durchführung der Entnazifizierung im Lande Niedersachsen‘ vom 18.12.1951 schließlich viel schneller als gedacht und – in Kombination mit dem Artikel 131 des Grundgesetzes, in der Wahrnehmung der Regierungspräsidenten, sogar zu schnell.259 Nachdem die Entnazifizierung erst im Januar 1948 dem Land Niedersachsen zur weitgehend selbständigen Durchführung übertragen worden war, sollten nun Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die im Rahmen der Entnazifizierung entlassen worden waren, im Eilverfahren wieder eingestellt werden. „Es erhebt sich die Frage, ob die Unterbringung der Beamten auf Wv [Wiederverwendung nach § 131 GG] ohne gewissenhafte Prüfung des einzelnen Falles mit gutem Gewissen so beschleunigt werden kann, wie es erwartet wird“260, kritisierte Bähnisch bei einer Besprechung der Regierungspräsidenten 1952 die Situation. Ein Ausschuß für besondere Berufe, dessen Mitglieder von Stadt- und Kreisvertretern vorgeschlagen worden waren, war schließlich damit betraut worden, sämtliche Polizeikräfte im Regierungsbezirk Hannover im Schnellverfahren zu entnazifizieren.261 In ihrer Rede von 1953 kritisierte die Regierungspräsidentin unterschwellig, daß die Deutschen auf Personalfragen bei der Polizei nach Kriegsende keinerlei Einfluß gehabt hätten – wobei sie offen läßt, ob sie die von der Militärregierung kontrollierten und von deutschen Ausschüssen durchgeführten Entnazifizierungsmaßnahmen als zu lasch oder als zu rigoros ansah.262 Noch in den 1960er Jahren wurden jedenfalls ehemalige Kriegsverbrecher in den Reihen der Niedersächsischen Polizei ‚enttarnt‘,
259 Bähnisch und ihre Kollegen erklärten, daß sie die unerwartete Anordnung, Beamte nach dem verfügten Abschluß der Entnazifizierung nun möglichst schnell unterzubringen, nicht sachgemäß umzusetzen imstande wären und sich auf der Grundlage des enormen Zeitdrucks ohne Kenntnis der Entnazifizierungsakten nicht in der Lage sähen, verläßliche Angaben zu Bediensteten oder Bewerbern zu machen. NLA HA HStAH, Nds. 120 Hannover, Acc. 176/91, Nr. 27, Niederschrift über die Dienstbesprechung der Regierungspräsidenten im Niedersächsischen Innenministerium am 12.03.1952, 28.03.1952. 260 Ebd. 261 Für die Polizei in der Stadt Hannover wurde ein Sonderausschuß eingerichtet, der sich um 1.375 noch nicht abgeschlossene Fälle kümmern sollte. Vgl.: Liebert: Dinge, S. 91. 262 NLA HA HStAH, Hann. 87, Hannover Acc. 92/84, Nr. 18, Auszug aus der Ansprache von Frau Regierungspräsident Bähnisch aus Anlaß des 50. Geburtstages des Gebäudes der Polizeidirektion Hannover am 29.10.1953, o. D.
Regierungspräsidentin | 479
deren Vergangenheit in den 40er Jahren offensichtlich nicht ausreichend überprüft worden war.263 Dies traf auch auf Polizeikräfte zu, die im Verantwortungsbereich des Regierungspräsidiums Hannover tätig waren: Von 1954 bis 1960, also ein Jahr über die Amtszeit Bähnischs hinaus, war Friedrich Pradel in der Abteilung ‚Polizei‘ beim Regierungspräsidium Hannover beschäftigt.264 Pradel war im Dritten Reich als Referatsleiter im Reichssicherheitshauptamt an der Entwicklung, der Beschaffung und dem Umbau von Gaswagen265, mit denen antisemitisch motivierte Massenmorde durchgeführt wurden, beteiligt gewesen. Die Wagen waren dem Historiker Mathias Beer zufolge entworfen worden, weil ihre Erfinder hofften, durch die Massentötungen von Juden in solchen Wagen, in deren Innenraum über einen Schlauch Auspuffgas zur Tötung der sich im Wagen befindenden Personen eingeleitet wurde, das Nervenkostüm der Exekutierenden schonen zu können. Mehrere zur Exekution von Juden eingesetzte Kommandeure hatten nämlich bereits Nervenzusammenbrüche erlitten, waren dem Alkoholismus verfallen oder hatten gar versucht, sich das Leben zu nehmen.266 Die ‚Zeit‘ schrieb 1962, als Pradel schließlich inhaftiert wurde, er sei ein „enger Mitarbeiter seines Regierungspräsidenten“267 gewesen. Schon der Umstand, daß der Autor des Artikels bei seinen Recherchen offenbar nicht festgestellt hatte, daß Pradel mit Bähnisch die meiste Zeit über eine Frau vorgesetzt gewesen war, läßt Zweifel an der Belastbarkeit dieser Aussage aufkommen. Es ist jedoch anzunehmen, daß die Stellung Pradels als Polizeioberkommissar tatsächlich dazu geführt hatte, daß er hin und wieder mit Bähnisch persönlich zusammengetraf. Doch wie war es überhaupt dazu gekommen, daß Pradel trotz seiner Vorgeschichte eine Tätigkeit im Regierungspräsidium Hannover aufnehmen konnte? Schon 1945 war Pradel ein von ihm unterzeichnetes Dokument, das in Zusammenhang mit den angesprochenen Gaswagen stand, vorgelegt worden, welches im Kontext der Nürnberger Prozesse aufgetaucht war. Aus dem Fragebogen, den Pradel hatte ausfüllen müssen, ging hervor, daß er Teile seiner Ausbildung bei der WaffenSS abgeleistet hatte. Als Datum seines Eintritts in die NSDAP hatte er im Fragebogen fälschlicherweise ‚1939‘ angegeben, obwohl er der Partei, wie eine von anderer Hand angebrachte Korrektur zeigt, schon 1937 beigetreten war. Mehrere LeumundsZeugen hatten Pradel auf seine Bitte hin bestätigt, daß er ‚parteipolitisch nicht in Er-
263 Vgl.: Riesener: Polizeidirektion, S. 250–263. 264 Vgl.: ebd., S. 254 sowie NLA HA HStAH, Nds. 100, Acc. 2000/098, Nr. 29. 265 In zeitgenössischen Dokumenten war meist von ‚Sonderwagen‘, ‚S-Wagen‘, oder auch, zur Tarnung, von ‚Entlausungswagen‘ die Rede gewesen. Vgl.: Beer, Mathias: Die Entwicklung der Gaswagen beim Mord an den Juden, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 35. Jg. (1987), S. 402–417, hier S. 401. 266 Vgl.: Beer: Gaswagen, S. 410. Beer bezieht sich auf Aussagen von Pradel vor der Staatsanwaltschaft Hannover 1961. 267 Strothmann, Dietrich: Kriminelle Kriminalisten. Gestern SS-Sturmbannführer – heute Polizeidirektor, in: Die Zeit, 06.06.1962, als Faksimile o. S., in: Riesener: Polizeidirektion, S. 254.
480 | Theanolte Bähnisch
scheinung getreten‘ war und fast ausschließlich im technischen Dienst beschäftigt gewesen sei.268 Seiner Bitte auf Abschluß seines Entnazifizierungsverfahrens wurde im April 1949 entsprochen.269 Im Jahr 1952 erhielt er erneut Post vom Innenministerium, mit der Aufforderung, sich einer amtsärztlichen Untersuchung zu unterziehen, weil man seine Weiterbeschäftigung in Erwägung ziehe.270 Nachdem Pradel noch im gleichen Jahr beim Regierungspräsidium Hildesheim für den Polizeidienst eingestellt worden war, wurden 1953 die Ermittlungen gegen ihn wieder aufgenommen. Auf die Vorwürfe zur ‚Beihilfe beim Mord‘ sagte er gegenüber dem Kommandeur bei der Schutzpolizei im Regierungsbezirk Hildesheim aus, daß ihm „von diesen Dingen [der Judenvernichtung mit Hilfe des RSHA] erst durch die Presse nach 1945 Kenntnis geworden“ sei und daß er „als kraftfahrtechnischer Sachbearbeiter nicht in diese Dinge eingeweiht war, weil ich sonst meine weitere Verwendung beim Hauptamt Sicherheitspolizei unter allen Umständen inhibiert hätte“271. Insgesamt stellte er die Verhältnisse so dar, als habe man ihm im Reichssicherheitshauptamt stets mißtraut und ihm deshalb Schriftstücke und Informationen vorenthalten, im Zweifel sogar seine Unterschrift gefälscht. In einem Gutachten von über 50 Seiten erklärte die Staatsanwaltschaft Hannover minutiös, warum sie glaubte, dem ehemaligen SS-Mann Pradel trotz zahlreicher Verdachtsmomente kein strafbares Verhalten nachweisen zu können.272 Das Verfahren gegen ihn wurde deshalb eingestellt273, Pradel im Juli des Jahres 1953 zum Polizeioberkommissar befördert. 1954 versetzte man ihn zur Polizei im Regierungsbezirk Hannover und damit in Bähnischs Wirkungskreis. Sein neuer Dienstort war seinem Wohnort Barsinghausen näher, aber ein Vermerk in der Dienstaufsichtsakte deutet darauf hin, daß es noch andere Gründe für die Versetzung Pradels gab. Womöglich stand das Bestreben der Abteilung III 6, ein Disziplinarverfahren gegen Pradel anzustoßen, und ihn infolge dessen aus dem Dienst entlassen zu können, hinter der Versetzung. Offensichtlich hatte ein Referendar auf dem Dienstweg seinem Vorgesetzten belastendes Material gegen Pradel unterbreitet.274
268 NLA HA HStAH, Nds. 171, Hannover, lfd. Nr. 68692, Polizei-Oberrat und Leiter des Polizeiamts für den Regierungsbezirk Hannover, Krumrey, Erklärung, Hannover 28.03.1949 (Zitat) sowie Arnold Hatesohl, ehemaliger Polizeiinspekteur, Eidesstattliche Erklärung, 28.03.1949. 269 NLA HA HStAH, Nds. 100, Acc., 2000/098, Nr. 29, Friedrich Pradel an den Entnazifizierungsausschuß für die Polizei Hannover, Polizeipräsidium, 28.03.1949. 270 Ebd., Der Niedersächsische Minister des Innern an Friedrich Pradel, 21.08.1952. 271 NLA HA HStAH, Nds. 171, Hannover, lfd. Nr. 68692, Meldung von Friedrich Pradel an den Kommandeur der Schutzpolizei beim Regierungspräsidium Hildesheim, PolizeiOberrat Saupe, 11.04.1953. 272 NLA HA HStAH, Nds 171, Hannover, lfd. Nr. 68692. 273 Ebd., Oberstaatsanwalt Landwehr an Polizeikommissar Friedrich Pradel, 01.05.1953, Abschrift. 274 NLA HA HStAH, Nds. 100, Acc. 2000/098, Referat III/6 an das Referat III/9, 17.07.1949.
Regierungspräsidentin | 481
Während sich der Niedersächsische Ministerpräsident275, der Minister des Innern276 und die Regierungspräsidentin von Hannover in Schweigen hüllten, schenkte der Niedersächsische Minister der Justiz, Langeheine (DP, früher NSDAP) den Aussagen Pradels und den Einschätzungen der Staatsanwaltschaft erklärtermaßen keinen Glauben. „Die Urkunden vom 16.5. und 15.6. lassen den Zweck der Gaswagen und die Tatsache des Einsatzes zu diesem Zweck eindeutig erkennen. Ich vermag dem Beschuldigten nicht zu glauben, dass er trotz seiner Vermerke auf diesen Urkunden von ihrem Inhalt keine Kenntnis erhalten habe.“ Das Verfahren wieder aufzurollen hielt Langeheine jedoch trotzdem nicht für sinnvoll, zumal er an eine nur sehr geringe Strafe von etwa sechs Monaten für Pradel im Resultat glaubte, da dieser als „ziemlich untergeordneter Sachbearbeiter“ involviert und sein Tatbeitrag „nicht sehr erheblich“277 gewesen sei. Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß Pradel immerhin als Stellvertreter des SS-Obersturmbannführers Rauff fungiert hatte, welcher zu den Hauptverantwortlichen der Massenmorde an Juden in den Ostgebieten gehörte, klingt auch das Statement Langeheines in der Retrospektive wenig überzeugend. Als 1959 das Verfahren gegen Pradel erneut aufgerollt worden war, reagierte Dr. zur Nedden, der Regierungsvizepräsident des Bezirks Hannover, auf die Anforderung von Pradels Akten durch den Oberstaatsanwalt in Düsseldorf mit der Bemerkung, daß die angeforderten Personalakten Pradels „keinen sachdienlichen Aufschluß für das Ermittlungsverfahren […]“278 geben könnten. Dennoch übersandte er die Akten pflichtgemäß. Nachdem Ludwigsburger Staatsanwälte 1960 bei der Sichtung amerikanischen Archivmaterials RSHA-Hausmitteilungen entdeckt hatten, die Pradels Verwicklung in die Organisation der Morde vom Schreibtisch und der RSHAeigenen KFZ-Werkstatt aus bewiesen, gab Pradel schließlich zu, von der Vernichtung der Juden mit Hilfe der Gaswagen gewußt zu haben. Er habe jedoch versucht, sich der Aufgabe zu entziehen, woraufhin man ihm mit einer Meldung bei Heydrich gedroht habe, veränderte er nun seine Verteidigungsstrategie.279 1966 wurde Pradel
275 Die Historikerin Teresa Nentwig hat zwischenzeitlich eine Biographie Kopfs vorgelegt, die zeigt, daß Hinrich Wilhelm Kopf als Enteignungskommissar der Treuhandverwaltung Ost im von den Deutschen besetzten Lublin ebenfalls im Sinne des NS-Regimes arbeitete. Vgl.: Nentwig: Kopf. Vgl. auch: Brinkmann, Hans: Braune Flecken trüben den Blick auf Kopf, in: Kreiszeitung.de, 17.01.12, auf: http://www.kreiszeitung.de/nachrichten/ lokales/niedersachsen/braune-flecken-trueben-blick-kopf-1564989.html, am 13.12.2013. Die Briten hatten nach Kriegsende einen Vorstoß aus Polen zur Aufklärung von Kopfs Vergangenheit abgeblockt. Kopf selbst bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. 276 Zu dieser Zeit war dies August Wegmann (CDU). Er hatte Richard Borowski (SPD) am 26.05.1966 abgelöst. 277 NLA HA HStAH, Nds. 100, Acc. 2000/098, Nr. 29, Der Niedersächsische Minister der Justiz an den Niedersächsischen Minister des Innern, 18.07.1955. 278 NLA HA HStAH, Nds. 100, Acc. 2000/098, Nr. 29, Der Regierungspräsident, im Auftrag zur Nedden, an den Niedersächsischen Minister des Innern, 03.07.1959. 279 NLA HA HStAH, Nds. 100, Acc. 2000/098, Nr. 29, Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Hannover an das Landgericht, Strafkammer, in Hannover, 01.03.1965, Anklage gegen Fr. Pradel, geb. 16.04.1901.
482 | Theanolte Bähnisch
schließlich aufgrund der Beihilfe zum Mord in mindestens 6.000 Fällen zu sieben Jahren Haft verurteilt. Daß er 1960 bereits wegen ‚Trunkenheit am Steuer‘ während des Dienstes im August 1959 verurteilt worden war280, stellt mehr eine Fußnote in seiner Geschichte dar, die jedoch mit dazu führte, daß ihm Ehrungen, die andere Jubilare erhielten, verweigert wurden. Theanolte Bähnisch war zu dieser Zeit bereits als Staatssekretärin in Bonn tätig. Auslassungen von ihrer Seite zum Thema Pradel sind keine bekannt, auch in der Dienstaufsichtsakte Pradels taucht Bähnischs Name nicht auf. Ihre Zurückhaltung ließe sich damit begründen, daß für Personalsachen schließlich traditionell der Regierungsvizepräsident zuständig war, in diesem Fall Regierungsdirektor zur Nedden. Und doch hat das Schweigen einer Regierungspräsidentin, die sich an anderer Stelle durch geradezu übereifriges Engagement hervortat, einen negativen Beigeschmack, auch wenn die ‚Entnazifizierung‘ Pradels und seine Wiedereinstellung in den öffentlichen Dienst 1952 nicht in ihren direkten Verantwortungsbereich gefallen waren. „Unwillkürlich stellt sich jeder denkende Bürger der Bundesrepublik die Frage, ob bei der Einstellung von führenden Polizeioffizieren […] so fahrlässig vorgegangen wird, daß nicht einmal deren politische Vergangenheit überprüft wird“281, hatte ein Leser der ‚Hannoverschen Presse‘ sich zu den Vorgängen geäußert. Auch wenn im ‚Fall Pradel‘ nie wirklich Ruhe eingekehrt, sondern die Strafverfolgung immer wieder neu aufgenommen worden war, ist der Umstand, daß Pradel trotz einer solchen Vergangenheit fast bis zum Rentenalter in einer Behörde unter anderem mit der Anleitung junger Polizeibeamter betraut war, alarmierend. Aus heutiger Sicht ist kaum nachvollziehbar, daß Pradel scheinbar hatte glaubhaft versichern können, das ihm bereits 1949 vorgelegte Dokument, welches seine Verstrickungen in den Betrieb der Gaswagen nahelegte, zwar unterschrieben, aber „nicht gelesen“ zu haben.282 Damit war auch die britische Militärregierung für Pradels Nachkriegskarriere mit verantwortlich. Ein Unikum stellte der ‚Fall Pradel‘ nicht dar: Der aufsehenerregendste Fall der Weiterbeschäftigung eines nationalsozialistisch belasteten Polizisten im öffentlichen Dienst war wohl der des Leiters der Landeskriminalpolizeistelle in der Polizeidirektion Hannover, Walter Zirpins, der 1933 als Sachverständiger im Reichstagsbrandprozeß aufgetreten war. 1940/41 war der SS-Obersturmbannführer als Polizist im Ghetto Litzmannstadt tätig gewesen und hatte diverse Aufsätze über die nationalsozialistische Rechtsauffassung verbreitet. Eine Zugehörigkeit zum ‚Einsatzkommando 8‘, das im Ghetto Litzmannstadt Massenmorde verübt hatte, konnte man ihm, nachdem zwei Bürger entsprechend Anzeige erhoben hatten, zwar nicht nachweisen. Doch die antisemitische Färbung seiner schriftlichen Berichte über das Ghetto rücken den Umstand, daß er in der Bundesrepublik ein solches Amt hatte erreichen können,
280 NLA HA HStAH, Nds. 100, Acc. 2000/098, Nr. 29, Der Regierungspräsident an den Niedersächsischen Minister des Innern, 30.03.1960. 281 Wöttke, Joachim: Leserbrief: Ein prägnanter Fall, in: Hannoversche Presse vom 25.02.1961. 282 Vgl.: Strothmann: Kriminalisten.
Regierungspräsidentin | 483
allein schon in ein mehr als fragwürdiges Licht. Auch Bodo Struck, der Mitangeklagter in einem Verfahren gegen den Leiter des Einsatzkommandos Nr. 9283 im Krieg gegen die Sowjetunion, Alfred Filbert war, konnte trotz seiner Vorgeschichte im Dritten Reich nach dem Ende des Krieges seine Karriere fortsetzen. Er wurde Kriminalhauptkommissar bei der niedersächsischen Kriminalpolizei.284 5.3.3 „In gelöster Haltung“285 – Bähnisch und die Polizei zwischen Tradition und Reform Was die Reorganisation der Polizei durch die Militärregierung in der Britischen Besetzungszone anging, so ähnelten die leitenden Diskurse auffällig jenen, mit denen Theanolte Bähnisch in der Weimarer Republik konfrontiert gewesen war. Karl Brunke, der 1946 das Vertrauen der Militärregierung als ‚Chef der Polizei‘ in Hannover genoß und die Entnazifizierung der Behörde vorantrieb, wollte erklärtermaßen „einen neuen Umgang mit der Öffentlichkeit“ herstellen, die polizeiliche Praxis zur öffentlichen Diskussion stellen und so eine Grundlage für das angestrebte demokratische Fundament finden.286 Brunkes Wunsch „der breitesten Öffentlichkeit in die Tätigkeit der Polizei Einblick zu gewähren“ erinnert stark an die Überzeugungen Wilhelm Abeggs287, die unter anderem in der – an anderer Stelle bereits erwähnten – berühmt gewordenen Polizeiausstellung in Berlin 1926 mündeten. Nicht den „Kinderschreck“ wollte Brunke in den Reihen der Polizei sehen, sondern „der höfliche, bittende, allen Situationen gewachsene, gut ausgebildete und körperlich sportgestählte, stets hilfsbereite“ Polizeibeamte „dessen größter Stolz der Dienst am öffentlichen Wohl und der Allgemeinheit ist“288 sollte die Regel sein. Entsprechend solcher Vorstellungen sollten Anwärter in den von der Militärregierung kontrollierten Polizeischulen ausgebildet werden. Doch der Sozialwissenschaftler Kurt H. Groll bescheinigt der niedersächsischen Polizei im Rückblick mehr restaurative als innovative Züge: „Ziel der verantwortlichen deutschen Politiker blieb die Rückkehr zum preußischen Modell der Polizei als Instrument des Staates“289, faßt Groll die Haltung deutscher Verantwortlicher, unter die nicht nur Politiker im engeren Sinn, sondern auch hohe Verwaltungsbeamte fielen, zusammen. Dieses Ziel verfolgten mitnichten nur die ‚Konservativen‘. Als besonders renitenter Gegner ministerieller Beschränkungen in puncto Polizeigewalt trat ein SPD-Politiker, nämlich der nordrhein-westfälische Innenminister Menzel auf.290 In Niedersachsen gehörte – im Zusammenhang mit der erwähnten Ausländerkriminalität – der SPD-Landtagsabgeordnete Georg Diederichs zu den stärksten Kritikern der
283 284 285 286 287 288 289 290
Das Kommando war maßgeblich für Massenerschießungen verantwortlich gewesen. Vgl.: Liebert: Dinge, S. 96–100. Wiese: Präsidentin. Riesener: Polizeidirektion, S. 226. Siehe Kapitel 2.2.3.5 und 3.3.5. Karl Brunke, zitiert nach Riesener: Polizeidirektion, S. 227/228. Groll: Bedingungen. Ebd.
484 | The anolte Bähnisch
Einschränkungen, welche die deutsche Polizei durch die Politik der Militärregierung erfuhr.291 Sogar die Verwaltungspolizei, welche die Militärregierung im Sinne der ‚Entpolizeilichung‘ des öffentlichen Lebens aufgelöst und ihre Aufgaben den kommunalen Behörden übertragen hatte, fiel 1951 in die Verantwortung der Polizeiverwaltung zurück. „Gewiß, der britische Anstoß hat Spuren hinterlassen“, schlußfolgert der Historiker Jeffrey S. Richter, doch „das Hauptanliegen der Briten, die vollständige Trennung der ziviladministrativen Tätigkeiten, hat die Besatzungszeit in der ursprünglichen Schärfe […] nicht lange überdauert“292. Schließlich entstand im Jahr 1952 auch eine Niedersächsische Nachrichtenpolizei mit jeweils einer Bezirksnachrichtenstelle in jedem Regierungspräsidium. Zu den Aufgaben der Nachrichtenpolizei zählte die Beobachtung verfassungsfeindlicher Organisationen sowie des politischen Vereins- und Versammlungswesens, um einen drohenden Umsturz oder politisch motivierte Kriminalität zu verhindern. Im Berliner Polizeipräsidium hatte Theanolte Bähnisch eine solche Arbeit über das besondere Steckenpferd Wilhelm Abeggs, die Abteilung ‚AI‘ – politische Polizei, kennengelernt. Die Nachrichtenstellen der Niedersächsischen Nachrichtenpolizei hatten Personen- und Gruppenkarteien über Angehörige links- und rechtsradikaler Organisationen zu führen, um die Arbeit besser strukturieren zu können. Eine wichtige Aufgabe der Nachrichtenpolizei bestand in der Abwehrarbeit gegen kommunistische Verbände. Damit existierte ein wichtiger inhaltlicher Zusammenhang zwischen der Arbeit der Dienststelle und der antikommunistischen Arbeit, die Bähnisch in anderen Zusammenhängen, vor allem über den Deutschen Frauenring, leistete. Die (Niedersächsische) Nachrichtenpolizei war maßgeblich an der Beschaffung von Beweismitteln im Parteiverbotsverfahren gegen die Sozialistische Reichspartei (SRP) und die KPD beteiligt, die zum Verbot der beiden Parteien 1952 und 1956 durch das Bundesverfassungsgericht führte. 1951 setzte die Regierungspräsidentin das Verbot der FDJ im Bezirk Hannover um293 – woraus sich schließen läßt, daß das Regierungspräsidium Hannover schon vor der Einrichtung einer entsprechenden Dienststelle ein waches Auge auf kommunistische Organisationen gerichtet hatte. Von der Möglichkeit zur Einrichtung staatlicher Polizeidirektionen in Städten über 100.000 Einwohner nach dem Gesetz von 1951 machte Hannover – um Bähnisch zu zitieren „sofort nach Erlaß des Gesetzes“294 Gebrauch, die Möglichkeit zur Einrichtung einer Kommunalpolizei in den kreisfreien Städten blieb im Regierungs-
291 O. V. [„fe“ – Eigenbericht]: „Diskussion um Ausländerlager“, in: Hannoverschen Neuesten Nachrichten, 09.01.1948, Auszug in: O. V.: Displaced Persons – Ein Problem der Nachkriegszeit, auf: http://www.geschichtsatlas.de/~ga2/haz2.htm, am 13.12.2013. 292 Richter, Joeffrey S.: „Entpolizeilichung“ der öffentlichen Ordnung. Die Reform der Verwaltungspolizei in der britischen Besatzungszone 1945–1955, in: Fürmetz/Reinke/ Weinhauer: Nachkriegspolizei, S. 35–50, hier S. 50. 293 NLA HA HStAH, Nds. 120, Hannover, Acc. 18/77, Nr. 54. 294 NLA HA HStAH, Hann. 87, Hannover, Acc. 92/84, Nr. 18. Auszug aus der Ansprache von Frau Regierungspräsident Bähnisch aus Anlaß des 50. Geburtstages des Gebäudes der Polizeidirektion Hannover am 29.10.1953, o. D.
Regierungspräsidentin | 485
bezirk, wie Bähnisch ebenfalls gesondert betonte, ungenutzt.295 Zwar wertete sie beide Umstände in ihrer Rede nicht, doch die Art, wie sie die beiden Informationen zusammenhängend vortrug, läßt erahnen, daß sie nicht nur die britischen Pläne zur Verwaltungsreform im Allgemeinen, sondern auch jene zur Entstaatlichung und Kommunalisierung der Polizei im Speziellen ablehnte und das 1951 in Kraft getretene Gesetz, mit dem viele dieser Veränderungen rückgängig gemacht wurden, begrüßte. Die Leitung der Polizei übernahm Theanolte Bähnisch erst zu einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs und führte sie dann durch „vergleichsweise ruhige Zeiten“296. Ungeachtet der weiterhin bestehenden Wohnungsnot und der andauernden Flüchtlingsproblematik seien „kaum politische Konflikte aufgekommen, die das polizeiliche Einschreiten erfordert hätten“297 hält der Experte für die Geschichte der Polizei in der Region, Dirk Riesener, fest. Selbst der Kalte Krieg habe sich eher in der Ausbildung der Polizisten als in der täglichen Routine niedergeschlagen, ergänzt Riesener. Seinen Ausführungen zufolge dürften Bähnischs Polizei-Aufgaben eng im Zusammenhang mit der „Umgestaltung der Stadt im Hinblick auf den wachsenden Automobilverkehr“ unter dem Einfluß der Messe Hannover gestanden haben. „Die hannoversche Polizei begleitete diese Entwicklung und stellte sich auf moderne Nachrichtentechnik (Fernmeldewesen) und neue, auf dieser Technik fußende motorisierende Strukturen um“298, schreibt Riesener. Mit dem Chaos, dem die Polizei in den ersten Nachkriegsjahren ausgesetzt war – Major Lamb hatte es dem Journalisten Robert Mosley zufolge mit den Worten „plündern, rauben, morden“299 beschrieben – war Theanolte Bähnisch zumindest als Leiterin der Polizeigewalt nicht konfrontiert gewesen – wenn sie auch regelmäßig über Berichte der Polizei über die Lage informiert worden war. Was Bähnisch im Rahmen dieses Amtes durchaus beschäftigt haben dürfte, sind die sogenannten Halbstarken-Krawalle in Hannover in der zweiten Hälfte der 50er Jahre.300 Schließlich war sie in diesem Zusammenhang nicht nur als ‚Chefin‘ der Polizei gefragt, sondern sie hatte, wie sie in ihrem Amt als Regierungspräsidentin, aber auch durch eine entsprechende Schwerpunktsetzung bei der Herausgabe der ‚Stimme der Frau‘ zeigte, auch ein besonderes Interesse an Jugendlichen. Wie stark sich Bähnisch in die Ausbildung der Polizisten, die ebenfalls in der direkten Nachkriegszeit der Militärregierung unterlegen hatte, einbrachte, ist noch nicht bekannt. Ihren Handakten ist kein vergleichbares Interesse an der Landespolizeischule in Niedersachsen oder der ‚Polizei-Führungsakademie (bei ihrer Gründung
295 296 297 298 299
Vgl.: ebd. Riesener: Polizeidirektion, S. 243. Ebd. Ebd. Mosley, Leonard: Report from Germany, London 1945, S. 69/70, zitiert nach Riesener: Polizeidirektion, S. 207. 300 Vgl. dazu: Grotum: Thomas: Jugendliche Ordnungsstörer. Polizei und „Halbstarken“Krawalle in Niedersachsen 1956–1959, in: Fürmetz/Reinke/Weinhauer: Nachkriegspolizei, S. 277–302.
486 | The anolte Bähnisch
‚Zentral-Polizeischule‘) in Hiltrup zu entnehmen, wie sie es für die (allgemeine) Verwaltungsschule in Hahnenklee aufbrachte. Daß mit der ‚Rückgabe‘ der Polizei in die Hände deutscher Behörden im Bezirk Hannover nicht nur Traditionen wieder aufgegriffen wurden, sondern eine Tradition, die dadurch besonders augenfällig wurde, einen Bruch erfuhr, wird an folgender Meldung deutlich: „Zum ersten Mal wird in Deutschland eine Frau Polizeichef“301 verkündete das Hamburger Abendblatt am 21.03.1951. Die Tatsache zog keine vergleichbare Medienaufregung wie der Amtsantritt Theanolte Bähnischs als Regierungspräsidentin nach sich. Doch daß man an die Präsenz von Frauen in der Polizei noch nicht gewöhnt war, schlug sich insbesondere in der auch Mitte der 50er Jahre in Niedersachsen immer noch vorherrschenden Überzeugung, daß in der Polizei Frauen nur Frauen vorgesetzt sein sollten302, nieder. Theanolte Bähnisch schien als Chefin akzeptiert worden zu sein – folgt man dem Bericht des Hamburger Abendblatts. „Die Polizisten mögen sie gern. Sie kämpft für bessere Besoldungen der Männer, die ihr Leben einsetzen“303, wird ihr Schlüssel zum Erfolg beschrieben. Wenn man so will, trat die Regierungspräsidentin also in die Fußstapfen ihres Mannes und seiner Kollegen im preußischen Innenministerium, die sich ebenfalls für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Entlohnung der Polizisten einsetzten, nicht zuletzt in der Hoffnung, damit die Loyalität der Polizisten gegenüber dem Staat fördern zu können.304 Innerhalb der Polizeidirektionen war die Diskussion um weibliche Vorgesetze männlicher Beamter mit Theanolte Bähnischs Akzeptanz als Vorgesetzte jedoch nicht vom Tisch. Deshalb waren bei der niedersächsischen Polizei nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – wie bereits in den 20er Jahren – wieder ‚weibliche Kriminalpolizeien‘ eingerichtet worden. Eine Veränderung, mit der Hannover schließlich Furore machte, trat 1954 ein, als die Stadt ein innovatives Konzept zur Bekämpfung der bereits angesprochenen Halbstarken-Kralle umsetzte: Nachdem zunächst die Weibliche Kriminalpolizei für Kinder und weibliche Jugendliche und die ‚Jugendsachbearbeiter‘ für männliche Jugendliche zuständig gewesen waren, wurden 1954 beide Gruppen zu ‚Jugendschutzdienststellen‘ zusammen gefaßt305, eine Entwicklung, die Nachahmer im ganzen Bundesgebiet fand. Zur Beilegung des Konflikts, ob Frauen Männern in der Polizei vorgesetzt sein dürften, war in der entsprechenden Dienststelle eine ‚Doppelspitze‘ aus einem Mann und einer Frau eingerichtet worden. Mit der ‚Jugendschutzdienststelle‘ knüpfte die Niedersächsische Landespolizei an Entwicklungen an, die in der Weimarer Republik als innovativ galten und die auch in Theanolte Bähnischs Ausbildung eine Rolle gespielt hatten: die Prävention von Jugendkriminalität durch eine enge Zusammenarbeit zwischen der Polizei, der öffentlichen Jugendhilfe- und Fürsorge, karitativen Einrichtungen, den Schul- und Justizbehörden sowie Jugendorganisationen. Der Leitgedanke dieser Herangehensweise
301 302 303 304 305
O. V.: Frau Polizeichef, Hamburger Abendblatt, 31.03.1951. Vgl.: Grotum: Halbstarken-Krawalle, hier besonders S. 283. Wiese: Präsidentin. Siehe Kapitel 3.3.2. Grotum: Halbstarken-Krawalle, S. 278.
Regierungspräsidentin | 487
schlug sich auch darin nieder, daß bei Straftaten von Jugendlichen nicht nur der Straftatbestand an sich untersucht werden, sondern auch eine Auseinandersetzung mit dem Charakter des jeweiligen Jugendlichen selbst stattfinden sollte.306 Es steht noch aus, zu untersuchen, welchen Anteil die durch ihre Staatsexamensarbeit307 entsprechend vorgebildete Regierungspräsidentin Bähnisch an dieser Entwicklung hatte.
5.4 BILDUNG UND ‚SOZIALES‘: KERNAUFGABEN DER REGIERUNGSPRÄSIDENTIN IN DER NACHKRIEGSZEIT 5.4.1 Der Bezirk Hannover als Drehscheibe der Flüchtlingsströme Daß Theanolte Bähnischs Dienstalltag in den ersten Nachkriegsjahren vor allem von den drängenden Nachkriegsproblemen gezeichnet sein würde, hatte sie zum einen mit der Entscheidung nach Hannover zu gehen, hadern lassen, zum anderen war ihr bewußt, wie stark sie sich über jenes Amt in den Wiederaufbau einbringen konnte – was wiederum ihre Entscheidung für Hannover beförderte. Für eine Bevölkerungsgruppe, die Flüchtlinge und Vertriebenen308 – vor allem für die Jugendlichen309 und die Frauen unter ihnen – verspürte die Regierungspräsidentin ein besonderes Verantwortungsgefühl. Neben den sozialen und politischen Gründen, die Bähnisch ein besonderes Augenmerk auf jene Menschen richten ließen, könnten dafür auch persönliche Gründe eine Rolle gespielt haben. Schließlich hatte sie selbst einige Jahre in Oberschlesien gelebt und ihr Ehemann, Albrecht Bähnisch sowie ihre gute Freundin Ilse Langner hatten dort ihre Wurzeln. Viele Menschen im Bezirk Hannover mußten noch Jahre nach dem Ende des Krieges in zerstörten Häusern, in notdürftig errichteten Baracken leben, oder sie hatten gar kein Dach über dem Kopf. Noch 1950, fünf Jahre nach Kriegsende, fehlten offiziellen Schätzungen zufolge im Land Niedersachsen 730.000 Wohnungen.310 Be-
306 Vgl.: Grotum: Halbstarken-Krawalle, S. 280–287. 307 Siehe Kapitel 2.2.3.6. 308 Dies wird nicht zuletzt daran deutlich, daß bei einer Besprechung anläßlich des Besuchs von 50 ausländischen Journalistinnen in Hannover auch ein Herr Kampf aus der Flüchtlingsabteilung zugegen war. Bähnisch hatte offensichtlich ein Interesse daran, den Besucherinnen dieses Thema näher zu bringen. Vgl.: Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 261, undatierter Entwurf als Unterlage zur Tagung ausländischer Journalistinnen 1953. Für die Journalistinnen wurde außerdem eine Autobusrundfahrt veranstaltet und es wurden ihnen Photos und Schriften über die Stadt überreicht. Darunter fielen unter anderem die nicht näher bezeichneten Publikationen ‚Sieben Jahre danach‘ und ‚Vom Plan zur Wirklichkeit‘. 309 Siehe Kapitel 5.6. 310 Hauptmeyer/Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung: Niedersachsen, S. 126.
488 | Theanolte Bähnisch
sonders hart war das Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen311, die im Bezirk unterkommen mußten, obwohl schon für die einheimische Bevölkerung nicht genügend Wohnraum zur Verfügung stand. Daß zu den Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten auch noch solche aus der SBZ, beziehungsweise der DDR hinzu kamen, verschärfte die Wohnungsknappheit weiter. Und da Niedersachsen eine direkte Grenze zur SBZ/DDR hatte, die wiederum an die ehemaligen deutschen Ostgebiete angrenzte, war der Andrang von Flüchtlingen dort im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders groß. 1946 lebten ca. 1,48 Millionen, 1949 ca. 1,8 Millionen Flüchtlinge in Niedersachsen, was einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 23,4 Prozent (1946) bzw. 26,4 Prozent (1949) entspricht.312 Zum Wohnraummangel kam die Nahrungsmittelknappheit. Die täglichen Rationen waren so knapp bemessen, daß ein Teil der Bevölkerung, wie erwähnt, in der sicheren Überzeugung lebte, die Westalliierten würden die Deutschen absichtlich hungern lassen.313 Der Zorn über die Verhältnisse richtete sich jedoch auch gegen die deutsche Verwaltung: „[D]ie Bevölkerung [...] erwartete, dass der Regierungspräsident als Verkörperung der Staats- und Polizeigewalt im Regierungsbezirk sich um die Versorgung mit den notwendigen Nahrungsgütern kümmere“314, hielt der Referent Pohl vom Geschäftskreis Ernährungswirtschaft in der Bezirksregierung Düsseldorf fest. Man darf annehmen, daß im Bezirk Hannover ebenfalls ein entsprechender Anspruch gegenüber der Bezirksregierung bestand.315 Deshalb war es nur folgerich-
311 Gertrud Krallert-Sattler zählte bereits 1989 in ihrer Spezialbibliographie fast 5000 deutschsprachige Titel zur deutschen Vertreibung auf. Diese Zahl dürfte sich in den vergangen Jahren stark erhöht haben, weshalb auf die Aufführung einzelner Titel an dieser Stelle verzichtet wird. Vgl.: Krallert-Sattler, Gertrud: Kommentierte Bibliographie zum Flüchtlings- und Vertriebenenproblem in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, München 1989. Vgl. für Niedersachsen die leider nicht neu aufgelegte Bibliographie: Steinert, Johannes-Dieter: Flüchtlinge, Vertriebene und Aussiedler in Niedersachsen. Eine annotierte Bibliographie, Osnabrück 1986. Vergleichsweise aktuell sowie verbreitet sind: Aust, Stefan/Burgdorff, Stephan (Hrsg.): Die Flucht. Über die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten, Bonn 2003 sowie Urban, Thomas: Der Verlust. Die Vertreibung der Deutschen und Polen im 20. Jahrhundert, Bonn 2005 und schließlich, mehr auf das Schicksal der Vertriebenen in der ‚neuen Heimat‘ fokussierend: Kossert, Andreas: Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945, München 2008. Für Niedersachsen vgl.: Brelie-Lewien/Grebing: Flüchtlinge. 312 Vgl.: Marschalck: Bevölkerung, S. 51. 313 Diese Wahrnehmung versuchte die Militärregierung mit Positiv-Propaganda zu entkräften: NA, UK, FO 1005/1668, Fifteenth Monthly Report from Military Government Land Niedersachsen covering the period 1st November–30st November 1946, General and political, S. 1. 314 Haupstaatsarchiv Düsseldorf (HStAD) RW 143-37, Referent Pohl, Dezernat für Ernährungswirtschaft, undatiert, zitiert nach Strick: Routine, S. 73. 315 Vgl. zum entsprechenden Einsatz Bähnischs gegenüber der Militärregierung NA, UK, FO 1050/1213, Anschreiben ohne Titel, AZ MG/4815/C-in-C, 22.03.1948, als Anhang zu einem Schreiben von Mr. T. W. Garvey, PS to the Military Governor an C. M. Anderson
Regierungspräsidentin | 489
tig, daß Bähnisch – nicht nur im Rahmen ihres Amtes als Regierungspräsidentin, sondern auch in der ‚Stimme der Frau‘ – einerseits versuchte, die Militärregierung in ein gutes Licht zu rücken und der Bevölkerung plausibel zu machen, daß das Regierungspräsidium und die Militärregierung taten, was sie konnten, um die Nahrungsmittelversorgung im Bezirk zu gewährleisten316, sich andererseits im Zweifel jedoch auch als Vertreterin der Bürger im Bezirk gegenüber der Militärregierung zu präsentieren und darauf hinzuweisen, daß die Nahrungsmittelrationen „zum völligen Verhungern [...] zuviel“ waren und „gerade zum Krankwerden“317 ausreichten. Sie stand also ihrem Chef, dem Ministerpräsidenten Kopf, der sich 1948 selbst an die Spitze eines ‚Hungermarsches‘ gesetzt hatte, in nichts nach – erinnert man sich nur an ihren bereits erwähnten Auftritt mit Tablett und Kamerateam vor den alliierten Generälen.318 ‚Verteilungskämpfe‘ zwischen Einheimischen und Flüchtlingen waren im Bezirk an der Tagesordnung. Daß ‚Landesvater Kopf‘ – von dem es hieß, daß er selbst geflüchtet und gezwungen gewesen sei, „sich an einen fremden Tisch setzen zu müssen“319 – um gegenseitiges Verständnis der Gruppen füreinander bat, half nicht viel. Die im Bezirk Einheimischen befürchteten, daß die Regierung sich mehr um die Flüchtlinge als um die im Raum Hannover verwurzelten Personen kümmerte – entsprechend zahlreich waren die Beschwerden, die die Behörden erreichten.320 Die Zugezogenen fühlten sich vor jenem Hintergrund nicht willkommen – zumal das Land Niedersachsen nach Mitteln und Wegen suchte, eine Umverteilung der Flüchtlinge über ein größeres Gebiet zu erreichen, was wiederum Flüchtlingsorganisationen dazu veranlaßte, die ungewisse und unstete Situation der Menschen anzuprangern. Daß Theanolte Bähnisch anstrebte, den im Regierungsbezirk lebenden Flüchtlingen die Integration zu erleichtern, wird beispielsweise in der Anstrengung der Regierungspräsidentin deutlich, das schöpferische Potential einer potentiellen Identifikationsfigur für Ostflüchtlinge an die Region zu binden. Agnes Miegel, eine in Königsberg geborene Schriftstellerin, Dichterin und Journalistin war 1945 zunächst nach Dänemark geflüchtet, bevor sie 1946 in die britische Besatzungszone kam. Zunächst
316
317 318 319 320
Esq., PS to the Chancellor oft he Duchy of Lancaster, Foreign Office, 22.03.1948. Im Brief und im Anhang geht es um das Treffen zwischen den Generälen Clay und Robertson, sowie einer Frau Hamann und Theanolte Bähnisch in Frankfurt am 15.03.1948. O. V.: Neue Rezepte – für wen? – von wem?, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 26. Der Artikel enthält den Hinweis, daß die (Not-)Rezepte aus einem englischen Kochbuch stammten. Auch dort müßten die Frauen sparen. O. V.: Wovon Menschen leben, in:Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 2, S. 14/15, hier S. 15. Siehe Kapitel 5.2.5. Vgl.: O. V.: [‚K. W.‘]: Oberpräsident Hinrich Wilhelm Kopf. „Ich kann als Mitarbeiter nur Idealisten gebrauchen“, in: Hannoverscher Kurier, 01.10.1945. Vgl.: Bade, Klaus J./Oltmer, Jochen (Hrsg.): Normalfall Migration: Texte zur Einwandererbevölkerung und neue Zuwanderung im vereinigten Deutschland seit 1990, Bonn 2004.
490 | Theanolte Bähnisch
fand sie Aufnahme bei der Familie von Münchhausen auf Schloß Apelern. Auf der Suche nach einem ständigen Wohnsitz erhielt sie schließlich Hilfe von der Regierungspräsidentin. Bähnisch sorgte dafür, daß Miegel lebenslanges Wohnrecht in einem Gebäude im Kurort Bad Nenndorf erhielt.321 Als Ostpreußin bot Miegel mit ihrer Lyrik, die sich mit der ostpreußischen Heimat als Thema auseinandersetzte, einerseits vielen in Niedersachsen lebenden Flüchtlingen ein Stück ‚geistige Heimat‘. Andererseits konnte man in ihr, da sie sich in Niedersachsen schnell einlebte, sich mit ihrer neuen Heimat identifizierte und sich mit ihrem Schicksal aussöhnte, auch ein Beispiel für die gelungene Integration einer Frau aus Ostpreußen im Bezirk Hannover erkennen. Daß Miegel als bekannte ostpreußische Heimatdichterin auch ein Aushängeschild des NS-Regimes gewesen war, was in ihrer Aufnahme in der sogenannte ‚Gottbegnadentliste‘ 1944 mündete322, läßt ihre entschiedene Förderung durch die Regierungspräsidentin als durchaus fragwürdig erscheinen. Bähnisch schien nicht nur Miegels Weigerung, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, Akzeptanz entgegengebracht zu haben. Die beiden Frauen entwickelten ein von gegenseitiger Wertschätzung geprägtes, freundschaftliches Verhältnis. 1957 schrieb Bähnisch an Miegel, daß sie „sehr traurig“ darüber sei, die Chance eines Treffens mit Miegel verpaßt zu haben. „Wenn ich gewußt hätte, daß Sie […] dort wären, wäre ich trotz meines verletzten Knies […] herübergekommen. Denn es ist ja so selten, daß ich mich mal in Ruhe mit jemandem persönlich unterhalten kann. Ich verkörpere eine Institution, und bewundere mich oft, daß ich dabei überhaupt lebendig bleibe. Um so tiefer ist die Sehnsucht, mal mit wirklichen Menschen zusammen zu sein. Daß ich eine solch seltene Möglichkeit durch meinen dummen Unfall verpaßt habe, war für mich selbst der schwerste Verlust.“323 Zwei Jahre später teilte sie, mit ganz ähnlichen Worten und von ganz ähnlichen Gefühlen der Einsamkeit getrieben, der Dichterin mit, daß ihr der Kontakt mit ihr sehr wichtig und ein erfüllender Ausgleich zu ihrem Amt sei: „Ihr lieber Brief […] hat mir ganz besonders wohlgetan. Ohne viel Worte war […] ei-
321 O. V.: Agnes-Miegel-Gesellschaft, auf: http://www.literaturatlas.de/~lg4/gesellschaft. html, am 13.12.2013 sowie Vortrag von Dr. Anke Sawahn: Der Erinnerungskult um die Schriftstellerin Agnes Miegel und seine Problematisierung auf der Tagung: Persönlichkeiten und die Umbenennung von Straßen und Preisen als Ergebnis von erinnerungskulturellen Debatten, Arbeitskreis für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, Hannover, 16.11.2013. 322 Die 36 Seiten umfassende Liste war 1944 vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels und Adolf Hitler zusammengestellt worden. Miegel war gemeinsam mit 1040 anderen Künstlern, die dem NS-Regime besonders förderungswürdig erschienen und als eine von sechs wichtigen Schriftstellern in diese ‚Positiv-Liste‘ aufgenommen worden. Vgl.: O. V.: Ein Straßenname in der Kritik, in: Hildesheimer Allgemeine Zeitung, o. D. [Januar 2012] auf: http://www.hildesheimer-allgemeine.de/ agnesmiegel0.html?tx_comments_pi1[page]=1&cHash=6daed38a114b9c5e5f600e6ead 733fb3, am 13.12.2013. 323 DLA, A: Miegel, Briefe Dritter, 74.9236/4, Theanolte Bähnisch an Agnes Miegel, 03.09.1957.
Regierungspräsidentin | 491
gentlich von Anfang an ein so feines inneres Verstehen zwischen uns, daß wir es, glaube ich, beide als beglückend empfunden haben. Umso trauriger bin ich, daß ich infolge meiner beruflichen Belastung soviel köstliche Stunden, die ich mit Ihnen hätte verbringen können, nicht gehabt habe. Das ist ja überhaupt der schwierigste Punkt meiner ganzen Tätigkeit in Hannover gewesen, daß mir keine Zeit blieb, private Beziehungen und Freundschaften zu pflegen, die mir innerlich nahe kamen.“324 Wenn die Regierungspräsidentin in den kommenden Jahren auch stärker mit der Abwehr linker politischer Tendenzen beschäftigt sein sollte, so war ihr doch bewußt, daß die Gefahr einer politischen Instrumentalisierung von Flüchtlingen eher von rechts drohte. Vor Waldemar Kraft, dem Begründer und Leiter des ‚Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten‘325 (BHE) warnte sie die Militärregierung explizit. Auch wenn Brigadier Hume die Regierungspräsidentin gegenüber seinen Vorgesetzten als „a person of strong likes and dislikes“ charakterisierte und ihre Einschätzung Krafts als „most dangerous figure in contemporary german life“ für zu drastisch hielt, riet er seinen Kollegen doch, die Warnung Bähnischs ernst zu nehmen. „I always found her political judgment in important matters to be sound“, hielt Hume fest und konstatierte „that Kraft in particular, and to a lesser degree people like Gille and Asbach [die BHE-Abgeordneten Dr. Alfred Gille und Hans-Adolf Asbach], were from the start out to capitalize the volume of political discontent amongst the refugees for their own purposes“.326 Insbesondere der neue Name des B.H.E., ‚Gesamtdeutscher Block‘ veranlaßte Hume zu der abschließenden Äußerung, die Partei sei „closer to the direct line of succession to original National Socialism than noisy groups like the late S.R.P.“327 Die Ziele der Partei, die 1953 den Einzug in den Bundestag schaffte, gaben Bähnischs Befürchtungen recht. Sie wurden programmatisch mit dem Slogan „Lebensrecht im Westen und Heimatrecht im Osten“ umschrieben. Unter anderem strebte der GB/BHE die Wiederherstellung des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 an.328 Nicht zuletzt aufgrund des politischen Sprengstoffs, den die Unzufriedenheit von Flüchtlingen in sich barg, war es folgerichtig, daß die Situation der Flüchtlinge große
324 DLA, A: Miegel, Briefe Dritter, 72.9236/9, Theanolte Bähnisch an Agnes Miegel, 17.07.1959. 325 Der rechtsgerichtete BHE war 1950 von Waldemar Kraft in Schleswig-Holstein, dem Bundesland mit dem größten Anteil an Flüchtlingen und Vertriebenen an der Bevölkerung, gegründet worden und erreichte bei den Landtagswahlen im gleichen Jahr 23,4 Prozent der Stimmen. Im November 1952 benannte sich der BHE in ‚Gesamtdeutscher Block/BHE‘ um. 326 NA, UK, FO 371/103932. The Chancery, Office of the U. K. High Comissioner, Wahnerheide, Rheinland an Central Department, Foreign Office, London, 17.08.1953, CW 10113/118. Interessanterweise ist das Schriftstück nicht unter der causa ‚Waldemar Kraft‘, sondern unter „Brigardier Humes comments on Frau Bähnisch especially with regard to her opinion of Herr Kraft“ abgelegt. 327 Ebd. 328 Amos, Heike: Vertriebenenverbände im Fadenkreuz. Aktivitäten der DDRStaatssicherheit 1949–1989, München 2011, S. 23.
492 | Theanolte Bähnisch
Kapazitäten der Arbeitskraft im Regierungspräsidium band und Bähnisch sich nach Kräften um eine Entschärfung des Problems bemühte. Im Geschäftsplan der Regierung von 1949, der einen guten Überblick über die Aufgabenverteilung im Präsidium bietet, ist notiert, daß im ‚Dezernat Fl.‘ „besonders reger Besuchsverkehr“329 herrschte, was wohl nicht zuletzt darauf zurückzuführen war, daß viele der Personen kein festes Domizil hatten. Die Situation der Flüchtlinge war den Sachbearbeitern im Regierungspräsidium also nicht nur aus den Akten, sondern aus dem Kontakt vis-àvis mit den Hilfesuchenden bekannt. Dem Leiter des Dezernats, Dreyer, standen innerhalb des Regierungspräsidiums zwei Regierungsinspektoren und sieben Angestellte zur Bewältigung der anfallenden Aufgaben zur Seite. Drei weitere Angestellte arbeiteten, teilweise im Schichtdienst, in der am 15.02.1946 eingerichteten Flüchtlingsleitstelle, einer Außenstelle des Bezirksflüchtlingsamtes. Daß die Berichterstattung über Flüchtlingsschicksale in der Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ ab 1948 so lebensnah ausfiel, scheint mit den ‚Lage- und Erfahrungsberichten‘, die ein Regierungs-Angestellter in der Leitstelle verfaßte, zusammenzuhängen. Es erweckt den Eindruck, als habe sich die Regierungspräsidentin aus diesen Quellen bedient, um Schicksale in der von ihr herausgegeben Zeitschrift plastischer darstellen zu können.330 Dem Organisationsplan des Regierungspräsidiums zufolge war die Flüchtlingsleitstelle dafür zuständig, die Erst-Betreuung der im Land Niedersachsen eintreffenden Menschen zu gewährleisten, sie bei der Beschaffung von Zuzugs- und Aufenthaltsgenehmigungen zu unterstützen sowie Kriegsheimkehrer, insbesondere Schwerbeschädigte und Flüchtlinge, Schwangere, Mütter mit kleinen Kindern, alleinstehende Kinder, Alte und Kranke, in enger Zusammenarbeit mit dem Arbeits- und dem Ernährungsamt sowie sozialen Einrichtungen wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Caritas „alle Lebensgebiete umfassend[…]“331 zu beraten und zu unterstützen. Ein Quartier für die erste Nacht fanden die Ankommenden jeweils in einem von 19 Hannoveraner Bunkern. Der größte unter ihnen, der Bahnhofsbunker, welcher sich in der Trägerschaft der Inneren Mission befand, ging als ‚Schleuse des Elends‘ in die Erinnerung der Region ein. Laut Michael Foedrowitz war dieser Bunker die größte und bekannteste Übernachtungs- und Betreuungsstelle für Flüchtlinge in ganz Deutschland.332 Bis zu 1300 Personen pro Nacht wurden dort von 20 angestellten Fürsorgern und Fürsorgerinnen sowie von 50 ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen betreut.333 1948 sank die Zahl der ‚Übernachtungsgäste‘ im Bahnhofsbunker auf 700 bis 800. 1950, fünf Jahre nach Kriegsende, wurde die Bunkeranlage, da der Andrang immer weiter nachließ, geschlossen. Die anderen Abteilungen des Bezirksflüchtlingsamtes waren unter anderem mit der Bearbeitung der Angelegenheiten der Flüchtlingsleitstelle sowie des Durchgangs-
329 330 331 332 333
Organisationsplan der Regierung Hannover, Hannover 1949. Vgl.: Freund: Krieg, S. 113-115. Organisationsplan der Regierung Hannover, Hannover 1949, S. 39. Vgl.: Foedrowitz: Bunkerwelten, S. 143. Vgl.: ebd. Zahlen nach: O. V.: 1,5 Millionen übernachteten im Bahnhofsbunker, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 16.07.1950.
Regierungspräsidentin | 493
lagers Poggenhagen betraut. Darunter fielen Rechnungssachen, Kassenanweisungen und ein Teil der Verwaltungsangelegenheiten. Dem Flüchtlingsamt oblaglag weiterhin die allgemeine Betreuung der Hilfesuchenden, die Erteilung von Zuzugs- und Aufenthaltsgenehmigungen für den Bezirk, die Verteilung der dem Bezirk zugewiesenen Flüchtlinge, die Bearbeitung von Einsprüchen und Beschwerden nach dem Flüchtlingsbedarfsgesetz, die Beantwortung von Anträgen auf Schulbeihilfen für Flüchtlingskinder und die Beschaffung sowie Verteilung von Gebrauchsgegenständen für die Kreise und die Flüchtlingslager des Bezirks. Schließlich gehörte zu den Aufgaben des Amtes noch die ‚Bereisung‘ des Regierungs-Bezirkes nach den Weisungen des Flüchtlingsamts-Leiters und der Dezernenten des Bezirkswohnungsamtes „zur Beseitigung von Elendsquartieren u. Abstellung von Mißständen aller Art“334 und das Führen von Statistiken und die Erstellung von Lage- und Erfahrungsberichten.335 Ihre Rolle in der Bewältigung des Flüchtlingszustroms sah Bähnisch nicht zuletzt in dessen Begrenzung. In der Hannoverschen Neuen Presse ließ sie 1964 verlauten, sie habe, indem sie mit ihrer Amtsniederlegung gedroht habe, persönlich dafür gesorgt, daß Flüchtlinge nicht nur in Niedersachsen und Schleswig-Holstein untergebracht, sondern auf alle westdeutschen Bundesländer verteilt würden. „Vom nächsten Transport wurde Hannover nicht betroffen. Kurze Zeit darauf begann die Umsiedlung in andere Länder“336, faßte sie ihren Erfolg zusammen. Offenbar hatte die Regierungspräsidentin auch Photos von Flüchtlingslagern mit auf ihre Englandreise genommen, um ihre Ansprechpartner dort mit den Lebensbedingungen der Menschen zu konfrontieren. Denn in den Unterlagen, die Theanolte Bähnisch für eine Großbritannien-Reise im Winter 1946 zusammengestellt hatte, befanden sich solche Bilder, die abgemagerte Menschen mit entsprechenden Krankheitsbildern zeigen. Die Photos tragen jeweils DRK-Stempel und sind nicht im Rahmen ihrer Tätigkeit als Regierungspräsidentin im Staatsarchiv Hannover, sondern im Zusammenhang mit ihrem späteren Amt als Präsidentin des Deutschen Frauenrings überliefert.337 Auch hierin schlägt sich die Verschränkung ihrer Ämter als Regierungspräsidentin, als Leiterin einer Frauenorganisation und als Vorstandsmitglied des DRK nieder.338 5.4.2 (Zweifelhafte) Traditionen und demokratische Aspekte in der Wohlfahrtsarbeit Um die sozialen Probleme im Regierungsbezirk zu entschärfen, arbeitete Bähnisch – wie ihre Kollegen aus Politik und Verwaltung auf den neben-, über- und nachgeordneten Ebenen – mit verschiedenen privaten Organisationen zusammen. An erster
334 335 336 337
Organisationsplan der Regierung Hannover, Hannover 1949, S. 39. Ebd. Bähnisch: Entscheidung. DFR-Archiv, A 3 [Material für eine Englandreise vom 1.–15. Dezember 1946 zusammengestellt von Theanolte Bähnisch]. 338 Siehe dazu auch Kapitel 6.6.1.
494 | Theanolte Bähnisch
Stelle stand dabei das DRK, das in der Wiederaufbau-Arbeit eine tragende Rolle innehatte und den Großteil seines Budgets für die Flüchtlingsbetreuung ausgab. Der Verband war in Hannover, weil er dort neben seinem lokalen Sitz auch den Verwaltungssitz seines niedersächsischen Landesverbands eingerichtet hatte, sehr präsent. Der niedersächsische DRK-Verband war der zweitgrößte in Deutschland. Neben dem Betrieb seiner Kranken- und Entbindungshäuser, der Kinder-, Alten- und Flüchtlingsheime sowie der Versorgung von Heimkehrern, Flüchtlingen und Kindern mit warmen Mahlzeiten, gehörte auch der sehr intensiv genutzte Suchdienst des Roten Kreuzes339 zu den Leistungen der Organisation. Wie es im DRK Tradition war, wurde auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Arbeit im DRK-Kreisverband Hannover-Stadt in ‚Männerarbeit‘ und ‚Frauenarbeit‘ getrennt.340 Die Übernahme des Vermögens der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) spielte eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der Arbeit des DRK und einiger anderer Hilfsorganisationen, die ansonsten auf Spenden und Zuschüsse durch die Regierung angewiesen waren.341 Nicht selten wurde dieses finanzielle ‚Erbe‘, häufiger jedoch noch die personellen Kontinuitäten in der Wohlfahrtspflege kritisiert. Kurt Schumacher beispielsweise stand den ‚Schwestern vom Roten Kreuz‘ und den DRK-Helfern, deren Führungsspitzen sich während des Dritten Reichs mehrheitlich aus der SS rekrutiert hatten,342 äußerst kritisch gegenüber. Nicht zuletzt deshalb hatte
339 Willy Heudtlaß zufolge waren beim Landesnachforschungsdienst Niedersachsen knapp 50.000 Personen vorstellig geworden, 156.000 Briefe ein- und 192.000 Briefe ausgegangen. Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 564, Heudtlaß, Willy: „Staat und Rotes Kreuz sind Bundesgenossen.“ Feierstunde des DRK-Landesverbandes Niedersachsen am 14. Oktober 1950 in Hannover, in: N. N., Überliefert in Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 564. Vermutlich handelt es sich um ein Organ des DRK. 340 Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 562, Tätigkeitsbericht des DRK-Kreisverbandes Hannover-Stadt für das Geschäftsjahr 1949/50, 26.04.1950. Als ständige Einrichtungen des Kreisverbandes werden hier aufgeführt: Die Betreuungsstelle Bahnhofsbunker, das Übernachtungsheim Schaufelderstraße 30a, die Flüchtlingsunterkunft Bömelburg-Bunker sowie das Alters- und Heimkehrerheim Döhrbruch. Einsätze von Männern fanden unter anderem als Sanitätswache am Hauptbahnhof, solche von Frauen auf diversen Veranstaltungen und durch Fürsorgerinnen in Form von Hausbesuchen sowie der Kleiderausgabe im Lönsbunker statt. 341 NLA HA HStAH, Hann. 180 n, Nr. 13, Der Oberpräsident der Provinz Hannover an den Oberpräsidenten des Provinzialverbandes Hannover, 10.08.1945. Demnach sollten die von der NSV betriebenen Heime und sonstigen Anstalten mitsamt Inventar von Trägern übernommen werden, die den Verbänden der freien Wohlfahrt (also der Inneren Mission, dem Caritasverband, der Arbeiterwohlfahrt und dem Roten Kreuz) angehörten. 342 Von 29 Personen der DRK-Führung im Dritten Reich waren 18 auch in der SS organisiert und in die Euthanasie-Politik der Nationalsozialisten verwickelt gewesen. Birgitt Morgenbrod und Stefanie Merkenich haben im Auftrag des DRK untersucht, wie die Organisation „zu Lasten der humanitären Prinzipien“ und zum „Preis einer Ideologisierung“ eine enge Verbindung mit den NS-Eliten eingegangen war, um sich zu erhalten. O. V.: Das DRK unter der NS-Diktatur, auf: http://www.drk.de/ueber-uns/geschichte/themen/drk-
Regierungspräsidentin | 495
die SPD mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Hannover ihre eigene Wohlfahrtsorganisation wiedergegründet. Von der sozialdemokratischen Regierungspräsidentin Bähnisch ist eine kritische Auseinandersetzung mit den inhaltlichen und personellen Kontinuitäten im DRK aus dem Dritten Reich in die Nachkriegszeit nicht überliefert. 1948 gehörte sie gemeinsam mit dem Oberstadtdirektor Gustav Bratke und dem Stadtoberinspektor Hans Tiedje selbst zum Vorstand des Kreisverbands Hannover Stadt.343 Dieses Vorstandsamt brachte wiederum eine Zusammenarbeit mit den Vorsitzenden des DRK-Hauptvorstands mit sich. Den Vorsitz des DRK übernahm 1950 Gräfin Etta von Waldersee, die 1945 bereits den Vize-Vorsitz des DRK Nordrhein inne gehabt hatte. In der Weimarer Republik war von Waldersee, die von 1922 bis 1928 Vorsitzende des Verbands ‚Mütterliche Hilfe‘ war, als eine Freundin Siegmund-Schultzes und der SAG Berlin-Ost bekannt.344 Das Ehepaar Bähnisch könnte Waldersee also schon in Berlin kennengelernt haben. Waldersee hatte 1939 begonnen, für das DRK zu arbeiten. Als 1950 das fünfjährige Jubiläum des DRK in Hannover gefeiert wurde, gehörten zu den Ehrengästen die Regierungspräsidentin Bähnisch, Flüchtlingsminister Heinrich Albertz, der Ministerpräsident und Ehrenpräsident des DRK, Hinrich Wilhelm Kopf, Oberbürgermeister Weber, Oberstadtdirektor Wiechert sowie weitere namhafte Köpfe aus Verwaltung und Politik. Für den Autor Willy Heudtlaß war die Anwesenheit der Genannten „ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für die in fünf Jahren geleistete Wiederaufbauarbeit“345. Albertz hatte, so Heudtlaß, auf der Feier mit Recht die Frage gestellt „was wohl […] geschehen wäre, hätten wir nicht die freiwilligen Kräfte der Hilfe gehabt, um das zu überwinden, was der Krieg hinterlassen hatte, und was wohl die Folge gewesen wäre, wenn der leuchtende Gedanke des Roten Kreuzes, das ja aus dem Geschehen einer noch jungen Vergangenheit beschattet gewesen wäre, nicht hätte gerettet werden können“346. Der SPD-Minister und Pastor Albertz schien also nicht frei von Problembewußtsein, aber auch spürbar zufrie-
343
344 345
346
unter-der-ns-diktatur.html, am 13.12.2013 sowie Morgenbrod, Birgitt/Merkenich, Stefanie: Das Deutsche Rote Kreuz unter der NS-Diktatur 1933 bis 1945, Paderborn 2008. Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 562, Satzung des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Hannover-Stadt vom 21.04.1948. Die Satzung ist von verschiedenen Personen, unter anderem von Gustav Bratke und Theanolte Bähnisch unterschrieben. Wie lang die Regierungspräsidentin dem Vorstand angehörte, ist nicht klar. Auf einem Schreiben Bratkes, das ein Jahr später an das Sekretariat des Stadtrats Melle ging, ist Bähnisch nicht mehr als Vorstandsmitglied aufgeführt. Ebd., Gustav Bratke an Stadtrat Melle, Sekretariat, 05.04.1949, Betr.: Registrierung eines unpolitischen Vereins auf Grund der Anordnung der Militärregierung vom 29. Mai 1946, No. 722/Pol/1537/14 e. Neue Vorstandsmitglieder sind laut diesem Schreiben zufolge nicht hinzugekommen, so daß Bähnisch im Zuge der Verkleinerung des Vorstandes aus diesem ausgeschieden sein dürfte. EZA, 51/S II c 8, II, Friedrich Siegmund-Schultze an Gräfin Waldersee, 25.05.1927. Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 564, Heudtlaß, Willy: „Staat und Rotes Kreuz sind Bundesgenossen.“ Feierstunde des DRK-Landesverbandes Niedersachsen am 14. Oktober 1950 in Hannover, in: N. N. Ebd.
496 | Theanolte Bähnisch
den mit der Rolle des Roten Kreuzes im Wiederaufbau gewesen zu sein. Die im Zuge einer gemeinsamen Aktion von der Britischen Militärregierung und dem ‚National Council of Social Service‘ beziehungsweise der ‚Women’s Group on Public Welfare‘ entsandten Beobachterinnen Helena Deneke und Betty Norris hatten bereits 1947 in einem Bericht, der sich wesentlich mit der Rolle von Frauen und Frauenorganisationen in der Britischen Besatzungszone auseinandersetzt, die Entwicklung des DRK positiv eingeschätzt: „The German Red Cross may be said to have emerged from the cloud that nursing Nazi wounded cast over them and they are doing some notable relief work.“347 Angesichts der sozialen Lage in der Region dürfte es sowohl in Albertz als auch in Bähnischs Interesse gelegen haben, das Potential an Wohlfahrtsarbeit interessierter Bürger zur Entschärfung der Situation im Bezirk einzusetzen.348 Ein für Bähnisch sehr willkommener Nebeneffekt des gesellschaftlichen Engagements von Frauen im DRK lag darin, daß sich diese Frauen in einer von der Landesregierung geförderten Hilfs-Organisation engagierten und nicht etwa – das war Bähnischs größte Befürchtung349 – in einer kommunistischen Organisation. Im Jahr 1950 standen 4600 meist ehrenamtlichen männlichen Helfern im DRK 12500 Frauen gegenüber.350 Da das DRK mit anderen Verbänden des Internationalen Roten Kreuzes, vor allem dem britischen, dem schwedischen und dem Schweizer Roten Kreuz zusammen arbeitete, kamen die Mitarbeiter und Helfer des DRK auch in persönlichen Kontakt mit sozial engagierten Bürgern aus anderen westeuropäischen Ländern.351 Auch die Verteilung von Spenden aus dem Ausland war in die Verantwortung des Roten Kreuzes gelegt worden.352 Daß auch Bähnischs Vertrauter Adolf Grimme die Arbeit der Organisation unterstützte, zeigt die gemeinsame ‚Kriegsgefangenen-Weihnachtsaktion‘ des
347 Deneke, Helena/Norris, Betty (Bearb.)/National Council on Social Welfare (Hrsg.): The women of Germany, London 1947, S. 9. 348 Vgl. zu Arbeit der ‚Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände‘ in diesem Zusammenhang auch: Albertz, Heinrich: Niedersachsen und das Flüchtlingsproblem, in: Niedersächsisches Amt für Landesplanung und Statistik (Hrsg.): Flüchtlinge in Niedersachsen, Hannover 1949, S. 7–60, hier S. 25. Hier findet sich auch zeitgenössische Literatur inklusive Statistiken zum Thema. 349 Siehe Kapitel 7.1.5. 350 Vgl.: Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 564, Heudtlaß, Willy: „Staat und Rotes Kreuz sind Bundesgenossen.“ Feierstunde des DRK-Landesverbandes Niedersachsen am 14. Oktober 1950 in Hannover, in: N. N. 351 Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 562, Tätigkeitsbericht des DRK-Kreisverbandes Hannover-Stadt für das Geschäftsjahr 1949/50. Hierin wird Bezug genommen auf die Zusammenarbeit der Fürsorgerinnen des DRK mit dem Frauen-Hilfskomitee des Britischen Roten Kreuzes und der Nähstube des Schweizer Roten Kreuzes. Ebd., S. 4. 352 Deneke/Norris: Women, S. 10. Hier heißt es: “The German Red Cross, working in cooperation with the International Red Cross, undertakes the distribution of parcels of food and clothing received from abroad. They are largely responsible for the organization and running of refugee camps.”
Regierungspräsidentin | 497
DRK und des NWDR, dessen Generaldirektor Grimme seit 1948 war.353 Zusätzlich wurde der Verband von hannoverschen Firmen durch Spendenlieferungen unterstützt.354 Kurzum: Das DRK war re-etabliert und spielte eine sehr zentrale Rolle im deutschen Wiederaufbau, vor allem auch im Regierungsbezirk Hannover – und dies nicht zuletzt aufgrund der Unterstützung durch Personen wie Kopf, Albertz und Bähnisch. Einen weiteren Part in der Wiederaufbau-Arbeit übernahmen neben dem DRK und der 1946 in Hannover wiedergegründeten, ab 1949 von Heinrich Albertz selbst geleiteten Arbeiterwohlfahrt (AWO), konfessionelle karitative Organisationen wie die Caritas, die Innere Mission und verschiedene konfessionelle, aber auch nicht konfessionelle Frauen-Organisationen. Dazu gehörte auch der von Bähnisch 1946 gegründete ‚Club deutscher Frauen‘, der sich beispielsweise durch Strickabende für Kriegsgefangene, durch die Übernahme von Heimkehrer-Patenschaften und durch Beratungsangebote für die Bevölkerung in die soziale Arbeit einbrachte.355 Allem Anschein nach funktionierte die Kooperation zwischen den Frauen in verschiedenen Organisationen gut, und so hatte – zur Freude zweier Beobachterinnen der Militärregierung – über das Engagement der Bürgerinnen in einer zunächst nahezu aussichtlos scheinenden Lage ein demokratisches Element Einzug in die Wohlfahrtsarbeit gehalten: „It has arisen from the present situation“, erklären Helena Deneke und Betty Norris die Entstehung jener Allianz als eine Geburt aus der Notwendigkeit heraus. „The religious societies co-operate closely over welfare and relief work with one another and with the German Red Cross and the Arbeiterwohlfahrt, sometimes also with women members of political organizations and so women are making the discovery that it is possible for people who hold different, even opposed, views on vital questions to do a definite piece of work together for a common cause; and in some instances, they are realizing this to their mutual satisfaction.“356 Obwohl der schnelle Wiederaufbau des im Dritten Reich einflußreichen DRK und die sehr enge Zusammenarbeit der Behörden mit dieser Organisation einen fragwürdigen Charakter hatten, konnte Theanolte Bähnisch sich rühmen, mit ihren Initiativen zur Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘, der Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände357 und ihrem Vorstandsamt im DRK wesentlich zu einer Verständigung der Frauen beziehungsweise Hilfsorganisationen über die praktische Wiederaufbauarbeit beigetragen zu haben. Auf den Versammlungen, zu denen der ‚Club deutscher Frauen‘ aufgerufen hatte, sowie auf den Treffen der Frauenarbeitsgemeinschaft war nämlich jeweils Frauen aus verschiedenen Organisationen die Möglichkeit gegeben worden, trotz unterschiedlicher politischer und/oder konfessioneller Haltungen gemeinsame Ziele zu definieren und Schritte abzusprechen, mit denen man diesen Zielen näher kommen könnte.
353 354 355 356 357
Ebd. Ebd. Siehe Kapitel 6.5.5. Deneke/Norris: Women, S. 10. Siehe Kapitel 6.6.1.
498 | Theanolte Bähnisch
Da die Club-Gründung, an der verschiedene Mitarbeiterinnen der Behörde beteiligt waren, aus dem Regierungspräsidium heraus erfolgt war und die Zusammenarbeit der verschiedenen (Frauen-)Organisationen und Frauensektionen von Verbänden wie dem DRK wesentlich zur Verbesserung der sozialen Lage im Regierungsbezirk beigetragen hat, ist die Initiative Bähnischs auch im direkten Zusammenhang mit ihrem Amt als Regierungspräsidentin zu beleuchten. Denn jenes Amt ermöglichte ihr noch im ersten Jahr nach dem Ende des Krieges, gemeinsam mit anderen Eliten aus Politik und Verwaltung – von denen wiederum einige in ähnlichen Zusammenhängen wie Bähnisch sozialisiert worden waren358 – ein Netzwerk aus öffentlichen und privaten Trägern der sozialen Arbeit aufzubauen. Jenes Netzwerk trug gemeinsam mit der Militärregierung359 und mit Hilfsorganisationen aus dem Ausland wesentlich zum (Wieder-)Aufbau des Bezirks Hannover und des Landes Niedersachsen bei. Aufgrund der Vielfalt ihres Engagements konnte sie eine entsprechende Zusammenarbeit und Netzwerkbildung auch über das Land Niedersachsen hinaus ankurbeln. Letzteres ist wesentlich auf ihre Präsidentschaft im Frauenring der britischen Besatzungszone, später des Deutschen Frauenringes zurückzuführen – doch dürfte ihr die Position als Regierungspräsidentin den Kontaktaufbau und die Kontaktpflege deutlich erleichtert haben. Die Verbindung beider Ämter in einer Person setzte also positive Effekte für den Wiederaufbau frei, nicht nur was die Versorgung der Bevölkerung anging. Wie sich die Verbindung der beiden Ämter politisch und kulturell auswirkte, soll an anderer Stelle beschrieben werden. Nicht geklärt ist, wie die Zusammenarbeit der Regierungspräsidentin mit dem ‚Verband der Frauen in sozialen Berufen‘ aussah, der „von Mitgliedern, die früher den Verbänden der evangelischen und katholischen Wohlfahrtspflegerinnen oder dem Deutschen Verband der Sozialbeamtinnen angehörten“360 Zulauf erhielt. Da Dorothea Karsten, die diesen Verband leitete, gemeinsam mit Bähnisch den Club deutscher Frauen gründete und später mit Bähnischs Unterstützung vom Innenministerium als Frauenreferentin angestellt wurde, darf eine Zusammenarbeit als wahrscheinlich gelten. 5.4.3 Die Fürsorge für deutsche ‚Opfergruppen‘, das Beschweigen der Opfer des Nationalsozialismus und die Tradierung von Feindbildern Eine weitere Bevölkerungsgruppe, die sich der besonderen Unterstützung durch Theanolte Bähnisch sicher sein konnte, waren die Kriegsgefangenen und -heim-
358 Dies trifft beispielsweise auf Anna Mosolf, Katharina Petersen und Dorothea Karsten zu. 359 Die Militärregierung selbst führte in Eigenregie Schulspeisungen für Kinder durch – was für viele Bürger ein Argument dafür war, ihre Kinder überhaupt in die Schule zu schicken – und lieferte Hilfspakete. 360 Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 39, Verband ‚Frauen in sozialen Berufen‘, Dorothea Karsten an die hauptamtlich sozial-berufstätigen Frauen, Dozentinnen der sozialen Fachschulen, Praktikantinnen in sozialen Berufen sowie Schülerinnen der sozialen Fachschulen, o. D. [„im September“ 1946].
Regierungspräsidentin | 499
kehrer.361 Der niedersächsische Innenminister Richard Borowski und der niedersächsische Landesverband des DRK forderten dazu auf bei der „Zuerkennung der Heimkehrereigenschaft“ deutscher Wehrmachtssoldaten aus der Kriegsgefangenschaft „nicht engherzig zu verfahren“362, denn, so man gab sich überzeugt, „nur bei 10 bis 15 Prozent der Inhaftierten und Verurteilten“ lägen „kriminelle Anklagepunkte“ vor, in den meisten Fällen seien „die den Verurteilungen zugrundeliegenden Straftaten durch dienstliche Befehle erzwungen gewesen.“ Die Regierungspräsidentin stellte, ohne daß eine solche Anweisung erforderlich gewesen wäre, Kriegsgefangene und Spätheimkehrer als besonders unterstützungsbedürftige Personen dar und behandelte sie entsprechend. Nicht ohne Grund zur Hoffnung schrieb 1959 ein Bittsteller, der „von mehreren Kameraden“ von der „positiven Einstellung“ Bähnischs „gegenüber uns Spätheimkehrern“363 gehört haben wollte, die Regierungspräsidentin persönlich an und bat sie – erfolgreich – ihm bei der Beschaffung eines Bauplatzes behilflich zu sein. Daß das Schicksal der Kriegsgefangenen und Spätheimkehrer, das der Kriegerwitwen und -waisen, der Flüchtlinge und Vertriebenen sowie der Bombenopfer ursächlich an den von Deutschland initiierten Zweiten Weltkrieg und den Holocaust gebunden war, daß andere Länder Millionen Kriegstote zu beklagen hatten – in der Sowjetunion waren es 27 Millionen – kommt in den Verlautbarungen und Initiativen der Regierungspräsidentin nicht zum Ausdruck. Plakativer als in den Akten des Regierungspräsidiums wird dieser Sachverhalt noch in der ‚Stimme der Frau‘ greifbar.364 Daß die Regierungspräsidentin sich mit ihrer Zeitschrift an dem beteiligte, was Andreas Hilger als das „ständige Jonglieren mit den Zahlen der Gefangenen“365 bezeichnet, könnte – wie Bähnischs Engagement für Flüchtlinge – ebenfalls zumindest teilweise in ihrer eigenen Biographie begründet gewesen sein. Denn wie viele andere
361 Die Westalliierten entließen ‚ihre‘ deutschen Kriegsgefangenen fast vollständig bis 1948. Ab 1949 wurden laut Rolf-Dieter Müller noch 30.000 ehemalige Wehrmachtssoldaten in Rußland festgehalten, von denen die letzten erst 1956 nach Deutschland zurückkehrten. Vgl.: Müller, Rolf-Dieter/Ueberschär, Gerd: Hitlers Krieg im Osten 1941–1945, Darmstadt 2000, S. 389. 362 O. V., o. T., in: Deutsches Rotes Kreuz. Die Fachzeitschrift des DRK, Britische Zone, 5. Jg. (1951), Nr. 3, S. 4. 363 NLA HA HStAH, Hann. 180 H Nr. 13, Hans Bernd Backer an Frau Regierungspräsidentin Theanolte Bähnisch, 18.01.1959. Backer war laut eigener Angabe 1955 aus russischer Kriegsgefangenschaft gekommen, nachdem er als 17jähriger von der Schule aus eingezogen worden sei. Backer veröffentlichte später seine Erinnerungen an die Kriegsgefangenschaft (Backer, Hans Bernd: Büßer und Rebell, Buchholz 1978) und publizierte 1998 im Selbstverlag ein Werk mit dem Titel „Die Linke und ihre Massenmörder. Ein Buch gegen das Vergessen der linken Verbrechen“. 364 Vgl.: Freund: Krieg, S. 111–113. 365 Vgl.: Müller/Ueberschär: Krieg, S. 13/14. Vgl. zur entsprechenden Berichterstattung in der Stimme der Frau, die besonders auch das Schicksal kriegsgefangener Frauen betont: Freund: Krieg, S. 111–113.
500 | Theanolte Bähnisch
Frauen hoffte auch sie noch bis in die Mitte der 1950er Jahre auf die Rückkehr ihres Mannes aus der Sowjetunion. Zum Schicksal rassisch Verfolgter, von Zwangsarbeitern und anderen sogenannten ‚Dis-placed Persons‘ schwieg die Regierungspräsidentin. Die Verlautbarungen des ‚Club deutscher Frauen‘, Zeitungsartikel über Bähnisch, aber auch die Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ vermitteln den Anschein, als wären jene Bevölkerungsgruppen in der Region gar nicht existent gewesen. Lediglich in ihrer Ansprache zum Jubiläum des Polizeipräsidiums erwähnte Bähnisch einmal die ‚Ausländer‘ – um auf die Gefahr hinzuweisen, die von ihnen für die deutsche Bevölkerung ausgehe.366 In den öffentlichen, von Bähnisch mitgestalteten Diskursen ist, wenn es um Hilfsmaßnahmen geht, lediglich von jenen Personen die Rede, welche den gemeinhin als ‚deutsche Opfergemeinschaft‘ bezeichneten Gruppen – also den Kriegsheimkehrern und -gefangenen, den Kriegerwitwen und -waisen, den Flüchtlingen und Vertriebenen sowie den Ausgebombten – angehörten. Das Beschweigen der Existenz jener Personen, welche als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt worden waren, sowie der Juden und anderer rassisch Verfolgter, welche in Konzentrationslagern oder Verstecken überlebt hatten, stand in Zusammenhang mit der Rolle Deutschlands als jenem Land, welches in seiner jüngsten Geschichte unzählige Kriegsverbrechen und den Holocaust zu verantworten hatte. Die Tendenz, jene Ereignisse und ihre Folgen zu beschweigen, war verbreitet, Theanolte Bähnisch war also – auch in ihrer Rolle als Publizistin – keine Ausnahmeerscheinung. „[I]n der Nachkriegsliteratur über die deutsche Vertreibung ist zu spüren, daß die deutschen Betroffenen für das Schicksal der ausländischen Vertriebenen und Flüchtlinge keinen Blick hatten“367, stellt der Historiker Walter Laqueur fest. Nicht selten richtete sich der Zorn der Bevölkerung gegen das ‚kriminelle Potential‘ der ‚Ausländer‘ und – mit den Worten des CDU-Abgeordneten Riesling – gegen den Umstand, daß „der deutschen Bevölkerung durch die Lieferung an die [DP]Lager“ große „Lebensmittelverluste“ entstünden.368 Man müsse mit diesem „Staat im Staate“ ein Ende machen, soll Riesling den Hannoverschen Neuesten Nachrichten zufolge gefordert haben369 – ein Fall, der beispielhaft dafür steht, daß die nationalsozialistische Sicht auf ‚die Ausländer‘ als ‚Fremdkörper‘ und ‚Schädlinge‘ sich 1948 kaum abgeschliffen hatte. Etwas auch nur annähernd Vergleichbares wie die ‚Kriegsgefangenen Gedenkund Gebetwoche‘ – mit Gedenkläuten, Großkundgebungen, Radioansprachen und
366 NLA HA HStAH, Hann. 87, Hannover, Acc. 92/84, Nr. 18. Auszug aus der Ansprache von Frau Regierungspräsident Bähnisch aus Anlaß des 50. Geburtstages des Gebäudes der Polizeidirektion Hannover am 29.10.1953, o. D. 367 Walter Laqueur, zitiert nach Müller/Ueberschär: Krieg, S. 383. 368 Riesling, zitiert nach: [„fe“ – Eigenbericht]: „Diskussion um Ausländerlager“, in: Hannoversche Neueste Nachrichten, 09.01.1948, Auszug in: O. V.: Displaced Persons – Ein Problem der Nachkriegszeit, auf: http://www.geschichtsatlas.de/~ga2/haz2.htm, am 13.12.2013. 369 Vgl.: ebd.
Regierungspräsidentin | 501
Mahnfeuern370 – in deren Organisation und Durchführung Bähnisch als eine von vielen Behördenleitern wie selbstverständlich involviert war, oder die Sammlungen zur ‚Linderung der Not der Sowjetzonenflüchtlinge‘, die sie selbständig und ohne Aufforderung ‚von oben‘ in die Wege geleitete hatte371, wurde für die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen von Seiten der Verwaltung nicht veranstaltet. Nicht nur im Zusammenhang mit der Entnazifizierung, sondern auch im Umgang mit Kriegsheimkehrern, wirkte und präsentierte sich Theanolte Bähnisch als eine Führungspersönlichkeit, die die Bevölkerung nicht nur ökonomisch, sondern auch psychisch wieder aufzubauen und zusammenzuschweißen trachtete. In der Logik einer Wahrnehmung Hitlers als Verführer der Massen und der deutschen Bevölkerung als Büßer von Hitlers Großmachtphantasien richtete sie ihre Aufmerksamkeit weniger auf das, was sich Bürger im Bezirk Hannover zu Schulden kommen lassen hatten, sondern auf das ‚Verderben‘, welches das NS-Regime auch über die deutsche Bevölkerung gebracht hatte, und die Notlage, in der die Deutschen sich nun befanden. Die öffentlich geübte Kritik an der Praxis der Sowjetunion, Kriegsgefangene nicht freizulassen und die besondere Hervorhebung der Schicksale von Ostflüchtlingen – in Kombination mit den Entwicklungen in der SBZ – wirkten auf einen Brückenschlag hin zwischen jenen, die den Nationalsozialismus unterstützt hatten, und jenen, die sich gegen ihn gestellt hatten. Schließlich war die Politik der Sowjetunion in beiden Gruppen weitgehend geächtet. Das im Dritten Reich aufgebaute Feindbild gegen die Sowjetunion als Staat, die Slawen als ethnische Gruppe und den Kommunismus als politisches und wirtschaftliches System blieb als ideologisches Konstrukt auch in der Bundesrepublik bestehen. Auf den integrativen Charakter jener Entwicklung hat insbesondere Peter Jahn hingewiesen. 372 Seiner Darstellung nach bediente das Rußland-Feindbild373 im Nachkriegsdeutschland „ein fatales Bedürfnis nach
370 NLA HA HStAH, Nds. 120, Hannover, Acc. 83/78, Nr. 2/1, Der Niedersächsische Minister des Inneren an die Regierungskassen, Ämter, Polizeidienststellen, Abteilungen, Dezernate […], Hannover, 09.10.1952. 371 NLA HA HStAH, Nds. 120, Hannover, Acc. 83/78, Nr. 2/1, Dezernat R 131, Hannover, 06.03.1953 sowie Ebd., Der Regierungspräsident an den Regierungsvizepräsidenten, die Abteilungsleiter und Dezernate, 20.02.1953. 372 Jahn: Rußlandfeindbild, S. 225. Peter Jahn verweist auf das Vorhandensein russophober Einstellungen in der deutschen Bevölkerung schon weit vor dem Kaiserreich. Vgl.: Jahn: Kosaken. Vgl. auch: Hilger, Andreas: Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion, 1941–1956. Kriegsgefangenpolitik, Lageralltag und Erinnerung, Essen 2000. Fruchtbar für meine Analyse ist Hilgers Studie vor allem, da er sich auch mit den vorherrschenden Rußland- und antikommunistischen Feindbildern beschäftigt, welche sich für die Gefangenen teilweise bestätigten, teilweise aber auch aufgebrochen wurden. Vgl.: ebd. 373 Jahn unterscheidet ‚Feindbild‘ von Kritik insofern, als daß bei einem Feindbild auf die betreffende Gruppe vereinfachende, generalisierende, historisch unveränderbare Eigenschaften, also stereotype Vorurteile angewendet würden. Vgl.: ebd., S. 224. In der gesellschaftlichen Verständigung über eine ‚Feindgruppe‘ erhalte das Individuum dadurch Stabilität, daß die eigene, in diesem Diskurs über den Feind definierte Gruppe, innere Widersprüche verdeckten und durch Geschlossenheit auch dem sich schwach fühlenden In-
502 | Theanolte Bähnisch
Kontinuität, nach nicht gebrochener Identität in der Treue zu bestimmten Aussagen, [die] über die verschiedenen politischen Systeme hinweg erfüllt werden.“374 Theanolte Bähnisch brachte sich nicht nur über ihre Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, die dem Schicksal von Ostflüchtlingen und -vertriebenen sowie den Kriegsgefangenen und -heimkehrern gewidmet waren, in die Tradierung jenes Feindbildes ein, sondern auch – und vor allem – über die von ihr verantworteten Darstellungen in der ‚Stimme der Frau‘.375 An der Art, wie die Leiden der deutschen Bevölkerung, die mit Handlungen der SU in Verbindung stehen, thematisiert werden, fällt auf, daß oft mehrere der angesprochenen Zusammenhänge, die Deutsche als Opfer sowjetischer Politik darstellen, innerhalb eines Beitrags in der Zeitschrift aufeinandertreffen. So begegnet in einer Kurzgeschichte eine von den Russen verschleppte, enteignete Baronin, deren Mann durch sowjetische Soldaten hingerichtet worden war, einem alten Mann, der gerade aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft entlassen worden war.376 Mehrere der als Leserzuschriften deklarierten Texte berichten von vor sowjetischen Soldaten geflüchteten Frauen, deren Männer in Rußland gefallen377 oder krank aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt waren.378 Und in einem Fortsetzungsroman trifft ein männliches Opfer der russischen Demontage-Politik auf eine vor sowjetischen Soldaten geflüchtete Frau, deren Eltern sich vor dem drohenden Einmarsch der Roten Armee vergiftet hatten.379 So transportieren einzelne Beiträge gleich mehrere Negativ-Botschaften über Rußland und Russen und machen dabei auch vor rassistischen Argumenten nicht halt, was eine allgemein negative Wahrnehmung der SU, des Kommunismus und der Slaven bei den Lesern befördert beziehungsweise bestätigt haben dürfte. Ihr Amt als Regierungspräsidentin ließ Bähnisch nicht den Raum, sich so ausführlich zum Thema Sowjetunion und Antikommunismus zu verbreiten, wie sie dies in der Stimme der Frau und in anderen Medien tun konnte. Doch ihre alltägliche Arbeit, zu der Veranstaltungen und Aktionen gehörten, die den genannten Gruppen So-
374
375 376 377 378 379
dividuum das Bewußtsein von Stärke vermittelten, so Jahn. Vgl.: ebd., S. 225. Zur uferlos erscheinenden Literatur über Feindbilder sei stellvertretend genannt: Bernhard: Voraussetzungen. Jahn: Rußlandfeindbild, S. 234. Gleichzeitig habe die eigene Handlung als Soldat im NSSystem im kontinuierten Rußlandfeindbild eine Rechtfertigung erlangt, bemerkt Jahn in Bezug auf die Wehrmachtssoldaten. Vgl.: Freund: Krieg, S. 124–133. Vgl.: Helbing: Uhr. Vgl.: Zwei gesunde Arme, Leserinnenzuschrift von Anneliese Rick, Rubrik: Wir haben es geschafft, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 3, S. 22. Vgl.: Sie wurde Lehrerin, Leserinnenzuschrift von Lucy Goetz, Rubrik: Wir haben es geschafft, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 2, S. 22. Vgl.: Lang, M.: Wirbel um Angelika, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Nr. 17, S. 10–12.
Regierungspräsidentin | 503
lidarität zollten, ergänzten und bestätigten ihre entsprechende Arbeit in der ‚Stimme der Frau‘.380 5.4.4 Professionell, reformorientiert, alleinstehend: Anna Mosolf, Käthe Feuerstack und Katharina Petersen als Verbindungspersonen zwischen Kultusministerium, RP und dem Club deutscher Frauen Für zwei Bereiche, mit denen sie sich besonders identifizierte, war die Hannoveraner Regierungspräsidentin laut dem Organisationsplan der Regierung von 1949 selbst als Dezernentin zuständig. Dies betraf den ‚Geschäftskreis 22‘ der ‚Abteilung I Press[e]angelegenheiten‘, und den Geschäftskreis Nr. 26 derselben Abteilung, ‚Frauenangelegenheiten‘.381 Ein besonders fruchtbares Unterfangen sah die Regierungspräsidentin offenbar in der Kombination beider Bereiche. Auf ihre Anordnung hin werteten Mitarbeiter im Dezernat die regionale Presse (auch) unter dem Gesichtspunkt der Frauenbewegung aus382, eine Arbeit, aus der sich Bähnisch sicherlich nicht zuletzt Informationen über den von ihr geleiteten ‚Frauenring der britischen Zone‘, später ‚Deutscher Frauenring‘ (DFR) zu erlangen hoffte. Außerdem muß Bähnisch die nachgeordneten Behörden instruiert haben, in ihren Berichten ein besonderes Augenmerkt auf die Lage von Frauen, besonders in Sachen Berufstätigkeit und Gesundheit, zu richten, anders lassen sich entsprechende Schwerpunkte in den Berichten kaum erklären.383 Auch auf andere Weise betrieb Bähnisch eine besondere Frauenförderung innerhalb des Regierungspräsidiums. Aufgaben, mit denen sie sich selbst überdurchschnittlich stark identifizierte oder die sie für sehr wichtig hielt, die sie aber selbst nicht zusätzlich zu ihrer Arbeit als Behördenleiterin und Dezernentin in den beiden erwähnten Gebieten übernehmen konnte oder wollte, verteilte sie auf die Schultern dreier Frauen, denen sie besonderes Vertrauen entgegenbrachte: Anna Mosolf, Käthe Feuerstack und Anita Prejawa. Wie viele von den 429 Planstellen der Regierung mit Frauen besetzt waren, läßt sich aus dem Organisationsplan nicht ohne Weiteres ersehen, denn die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sind teilweise nur mit dem Dienstgrad und dem Nachnamen aufgeführt. Auf das Regierungspräsidium Hannover traf jedoch keinesfalls zu, was Christina Strick für das Regierungspräsidiun in Düsseldorf in der Nachkriegszeit konstatiert, nämlich daß dort Frauen nur in den unteren Positionen anzutreffen gewesen seien.384 Am Beispiel Düsseldorf wird deutlich, daß der
380 Zur Einordnung der Artikel in der ‚Stimme der Frau‘ in die (politischen) Diskurse der Nachkriegszeit vgl.: Freund: Krieg. 381 Organisationsplan der Regierung Hannover, Mai 1949, S. 3a. 382 NLA HA HStAH, Nds. 120 Hannover, Acc. 1/76, Nr 297. Der Regierungspräsident an Oberregierungsrat Dr. Paul, Rechtsanwalt Dr. Voges, Regierungsrat Westermann und Regierungsrat Dr. Gutmann, 05.05.1947. 383 NLA HA HStAH, Hann. 180, Hannover g, Nr. 169 [Lageberichte der Landkreise und der Städte Hannover und Hameln, Wirtschaftsberichte der IHK, 1947–1948]. 384 Strick: Routine, S. 32.
504 | Theanolte Bähnisch
Umstand, daß in Hannover auch höhere Ämter mit Frauen besetzt waren, nicht allein auf den Einfluß der Britischen Militärregierung zurückgeführt werden kann. Denn auch Düsseldorf stand unter britischer Besatzung. Offenbar war mit Hume ein Regional Officer in der Hanover Region eingesetzt worden, der besonderen Wert auf Frauenförderung legte. Aber auch das Netzwerk reformorientierter preußischer Verwaltungseliten, das sich nach Kriegsende in Hannover zusammengefunden hatte, war eine treibende Kraft der Förderung von Frauen in öffentlichen Ämtern. Nicht nur Theanolte Bähnisch, sondern insbesondere auch Adolf Grimme wollte mehr Frauen in wichtige Positionen bringen. Seine besondere Unterstützung für die Arbeit Bähnischs in der Frauenbewegung demonstrierte der Kultusminister durch seine Präsenz und/oder Mitarbeit bei den Frauenveranstaltungen, welche Bähnisch verantworte.385 Hinrich Wilhelm Kopf wiederum erwies sich ebenfalls als Unterstützer von Bähnischs Bestrebungen, beispielsweise indem er ihr häufig Diensturlaube gewährte, was ihr ermöglichte, in Sachen Frauenbewegung und Frauenberufstätigkeit auf Reisen zu gehen.386 Von einer ‚Durchmischung‘ der Dezernate mit Frauen und Männern auf gehobenen Posten konnte im Regierungspräsidium Hannover allerdings nicht die Rede sein. Frauen auf gut besoldeten Positionen, die ein gewisses Maß an Einfluß mit sich brachten, waren vor allem in solchen Bereichen tätig, die traditionell mit als ‘weiblich‘ assoziierten Charaktereigenschaften in Verbindung gebracht wurden: im sozialen, im medizinischen sowie im Bildungsbereich. So war Maria Prejawa387, mit der Bähnisch 1946 gemeinsam den ‚Club deutscher Frauen‘ begründete, ab 1947 als Dezernentin für den Geschäftsbereich ‚soziale Fürsorge‘ – und damit für die bereits angesprochene Zusammenarbeit des Regierungspräsidiums mit privaten und kirchlichen Organisationen wie dem DRK, der AWO und der Caritas zuständig. Prejawa erledigte auch den Löwenanteil der Verbands-Korrespondenz, während sich der ‚Club deutscher Frauen‘ zunächst zu einem zonen- und schließlich zu einem bundesweiten Verband entwickelte. Da sich der Club zum Ziel gesetzt hatte, Frauen aus verschiedenen Organisationen, auch solchen mit Schwerpunkten in der sozialen Arbeit zusammenzubringen, beziehungsweise, weil seine Nachfolgeorganisation DFR darauf abzielte, als Dachverband verschiedener Organisationen zu fungieren, überschnitten sich die Arbeitsbereiche Prejawas in ihrem Dezernat sowie als ‚rechte Hand‘ Theanolte Bähnischs im ‚Club deutscher Frauen‘/DFR sehr stark.
385 Siehe Kapitel 7.4.1. 386 Siehe Kapitel 8.1.1. 387 NLA HA HStAH, Nds. 120 Hannover, Acc., 9/90, Nr. 209 [Personalakte Prejawa] sowie Organisationsplan der Regierung Hannover, Hannover 1949, S. 37. Prejawa, die zunächst nach der Vergütungsgruppe III bezahlt wurde, schied 1957 als Oberregierungsrätin aus dem Dienst aus. Im Organisationsplan der Regierung 1949 wird sie auch als Dezernentin für ‚Hoheitssachen vermischter Art‘ genannt. Vgl.: Organisationsplan der Regierung Hannover, Hannover 1949, S. 14.
Regierungspräsidentin | 505
Käthe Feuerstack388, einer anderen Mitgründerin des Clubs, die in der Weimarer Republik Lehrerin und Volkshochschuldozentin gewesen war sowie den ‚Bund entschiedener Schulreformer‘ geleitet hatte, oblag als Regierungsdirektorin die Leitung der Abteilung ‚Kirchen und Schulwesen‘ im Regierungspräsidium.389 Als Sachbearbeiterin war sie unter anderem für die Abnahme der staatlichen Prüfungen bei Lehramtsbewerbern zuständig. Sie nahm also über diese Aufgabe, aber auch durch ihre Zuständigkeit für Personalangelegenheiten, Einfluß auf die Lehrsituation an den Schulen im Bezirk. Womöglich hatten sich Bähnisch und Feuerstack nicht erst in Hannover, sondern bereits in Berlin kennengelernt: Feuerstack, die als Dozentin an der ‚Pädagogischen Akademie‘ in Cottbus tätig war, lehrte von 1922 bis 1929 nebenberuflich an der Polizeiberufsschule in Berlin. Nachdem die engagiert gegen die Nationalsozialisten eintretende Reformpädagogin Feuerstack als Referentin im preußischen Kultusministerium unter Adolf Grimme gearbeitet und im gleichen Stadtteil wie die Bähnischs gelebt hatte390, war sie nach Hannover verzogen, wo sie von den neuen Machthabern 1932 ihres Amtes als Oberregierungs- und Schulrätin bei der Bezirksregierung Hannover, das sie zwischenzeitlich angetreten hatte, enthoben worden war. Dann war sie nach Berlin zurückgekehrt und hatte dort einen Buchladen eröffnet, den sie bis 1943 führte. Der Laden avancierte schnell zum Treffpunkt Oppositioneller. Auch mit Siegmund-Schultze stand sie in Verbindung.391 Dazu, wie sich Käthe Feuerstacks Arbeit „als Verbindungsmann“392 zwischen verschiedenen Widerstandsgruppen im Jahr 1933 äußerte, ist nichts Näheres bekannt. Feuerstack erwähnte eine solche Tätigkeit in einem Personalbogen von 1946 und nannte in diesem Atemzug jenen, 1945 nicht mehr greifbaren ‚Gewährsmann‘, auf den sich auch Theanolte
388 Vgl.: Schulz-Popken, Eva: „daß in der Erziehung des Mädchens das Ideal, ‚die Frau gehört ins Haus‘ endgültig einer überwundenen Zeit angehört.“ Das Leben der Reformpädagogin Käthe Feuerstack, in: Zeitschrift für Museum und Bildung, 63/2005, S. 40–51. Feuerstack trat 1919 in die SPD ein und übernahm 1920 die Leitung der Abteilung für Sozial- und Lehrberufe am städtischen Berufsamt in Berlin, das auf Drängen des BdF entstanden war. 1922 kehrte sie in den Lehrerinnenberuf zurück. Im ‚Bund entschiedener Schulreformer‘ engagierte sie sich für schulpolitische Neuerungen. Sie unterrichtete zusätzlich von 1922 bis 1929 an der Polizeiberufsschule und übernahm 1925 die Leitung der I. Mädchenmittelschule in Berlin-Neukölln. 1929 wurde sie im Stadtteil Magistratsschulrätin, 1930 Referentin für Lehrerbildung. Im gleichen Jahr trat sie zunächst eine Dozentinnen-Stelle an der Pädagogischen Akademie in Cottbus an, bevor sie, ebenfalls noch 1930, Professorin für Praktische Pädagogik und Psychologie wurde. Ihres Amtes als Oberregierungs- und Schulrätin in Hannover, wohin sie nach der Schließung der Akademie infolge der Wirtschaftskrise 1930 verzogen war, wurde sie 1932 enthoben. Sie kehrte daraufhin nach Berlin zurück. 389 Vgl.: Organisationsplan der Regierung Hannover, Hannover 1949, S. 1. 390 Vgl.: ebd. 391 Vgl.: EZA, 626/111, Friedrich Siegmund-Schultze an Käthe Feuerstack, 09.01.1959. 392 Vgl.: Schulz-Popken: Feuerstack, S. 48.
506 | Theanolte Bähnisch
Bähnisch wiederholt bezog, nämlich Ernst von Harnack, den Regierungspräsidenten Merseburgs und Chef Albrecht Bähnischs.393 Daß Feuerstack und Bähnisch sich bereits in Berlin kennengelernt hatten, ist auch insofern wahrscheinlich, als Feuerstack in engem Kontakt zu Katharina Petersen394 stand. Petersen, mit der Bähnisch ebenfalls in Hannover zusammen arbeitete, nachdem Adolf Grimme sie 1948 ins Kultusministerium geholt hatte, war nämlich eine Mandantin Albrecht Bähnischs – wenn nicht sogar Theanolte Bähnischs selbst, die eine Weile als Verwaltungsrechtsrätin unter dem Namen ihres Mannes korrespondiert hatte395, gewesen. Bis dato ist Katharina Petersen, in der Weimarer Republik Mitglied der DVP, die einzige Person, deren juristische Vertretung sich durch die Verwaltungsrechtsräte Bähnisch aufgrund ihrer Verfolgung durch die Nationalsozialisten belegen läßt: Am 01.07.1934 war Petersen im Rahmen des ‚Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums‘ in den Ruhestand versetzt worden. Als sie 1935 nach Holland umziehen wollte, um in Eerde eine Quäkerschule aufzubauen und zu leiten, versuchte ‚Verwaltungsrechtsrat Bähnisch‘ diese Absicht gegenüber dem ‚Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung‘ zu unterstützen und – allerdings erfolglos – einen Anspruch auf Zahlung von Ruhegeld durch den preußischen Staat durchzusetzen.396 Zwischen den Dezernaten im Regierungspräsidium, die sich mit der Schulbildung auseinandersetzten, also dem ‚Kernstab‘ Bähnischs in Sachen Frauenbildung und der entsprechenden Abteilung im Kultusministerium, welche von Petersen geleitet wurde, bestand ein enger Austausch. Petersen zählte zwar nicht zu den Mitbegründerinnen des ‚Club deutscher Frauen‘ – zu jener Zeit war sie noch nicht in Hannover – sie leitete jedoch später den DFR-Landesring Niedersachsen. Eine weitere Reformpädagogin, Anna Mosolf, war als Dezernentin für den Bereich ‚U III a‘ in der Abteilung Kirchen- und Schulwesen des Regierungspräsidiums (darunter fielen das Privatschulwesen, innere Angelegenheiten der Volksschulen, ‚technische Lehrerinnen‘, die Schulspeisung, die Förderung von Flüchtlingskindern und die Erwachsenenbildung) eingesetzt – bis sie 1955 in das Kultusministerium berufen wurde, um dort die Nachfolge Petersens anzutreten. Mosolf war ebenfalls eine Mitbegründerin des Clubs deutscher Frauen und neben Bähnisch über Jahre die zweite Mitherausgeberin der ‚Stimme der Frau‘. Ihr Schicksal glich dem Katharina Petersens: Mosolf war Schulleiterin einer großen Volksschule in Hannover gewesen, bis man sie 1934 ihres Amtes enthoben und in den einfachen Volksschullehrerinnendienst zurück versetzt hatte. Der Ärztin Dr. Elfriede Paul, einer weiteren Mitbegründerin des Clubs deutscher Frauen, die Adolf Grimme aus seiner Arbeit in der Roten Kapelle kannte, waren als
393 Vgl.: Ebd. 394 Feuerstack besuchte Petersen sogar 1937 in Holland, wo Petersen eine Quäker-Schule leitete, nachdem sie ebenfalls in Deutschland ihres Amtes enthoben worden war. Vgl.: Schulz-Popken: Feuerstack, S. 48. 395 GStA PK I. HA, Rep. 184, P Nr. 53. 396 NLA HA HStAH, Nds. 400, Acc. 27/95, Nr. 55.
Regierungspräsidentin | 507
Oberregierungsrätin diverse Zuständigkeiten im Baubereich sowie im Medizinalwesen übertragen. Die beschriebenen vier Frauen Petersen, Feuerstack, Mosolf und Prejawa – auf Elfriede Paul, die 1947 einen anderen Weg einschlug, wird später zurückzukommen sein – arbeiteten in den folgenden Jahren in der niedersächsischen Verwaltung, aber auch in der Frauenbewegung eng mit Theanolte Bähnisch zusammen und prägten damit sowohl den Wiederaufbau in der Region als auch das Bild der deutschen Bürgerlichen Frauenbewegung auf dem internationalen Parkett. So flog Katharina Petersen 1947 in Vertretung Bähnischs als Vorstandsmitglied des Frauenrings in die USA.397 Die Symbiose zwischen den Aufgaben der genannten Frauen in der Verwaltung und der thematischen Ausrichtung des von den Frauen gemeinsam gegründeten ‚Club deutscher Frauen‘ war überdeutlich. Dabei spielten die Themenfelder ‚Bildung‘ und ‚Soziales‘ – wozu auch der Bereich ‚Gesundheit‘ gehörte – eine zentrale Rolle. Der Erziehungswissenschaftler und Historiker Dühlmeier weist darauf hin, daß sowohl Petersen, die 1947 die ‚Hanover-Bristol-Society‘398 begründete, als auch Mosolf, die bald stellvertretende Vorsitzende der GEW wurde, zu jener Generation von Reformpädagoginnen zählten, welche im Kaiserreich sozialisiert worden waren, aufgrund des ‚Lehrerinnenzölibats‘ unverheiratet blieben399 und „in ihren Karrieren durch den schulpädagogischen Aufbruch in der Weimarer Republik befördert wurden“. Ihre Wirkungsmöglichkeiten seien, so Dühlmeier „jedoch radikal unterbrochen“ worden, „erst in der Nachkriegszeit und nunmehr aufgrund ihres Lebensalters“ konnten sie nur noch „wenige Jahre“ lang versuchen, „ihre reformpädagogischen Bestrebungen aus der Weimarer Republik zu realisieren“400. Käthe Feuerstack war, nachdem ihr Mann im Ersten Weltkrieg gefallen war, Witwe geworden und hatte während des Nationalsozialismus ebenfalls einen Karriereeinbruch verkraften müssen. Auch darin, daß sie ihr Leben jeweils auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren ohne Partner meisterten, ähnelten die erwähnten Frauen also der Regierungspräsidentin. Jene gemeinsame Erfahrung dürfte ihren Zusammenhalt befördert haben. Für Dühlmeier ist Anna Mosolf, die in einem Nachruf als „eine der größten Lehrerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet wurde401, neben Katharina
397 NA, UK, FO 945/283, Joy Evans an das General Department des Foreign Office, 07.07.1947. 398 Vgl. zum Selbstverständnis der Gesellschaft deren Homepage: Hannover-BristolGesellschaft, auf: http://www.hannover-bristol-gesellschaft.de/index-Dateien/Page426. htm, am 13.12.2013. 399 So schätzt es auch Wilhelm Pieper ein. Vgl.: Pieper: Schulreformen, S. 74. Pieper schreibt, daß die Entscheidung für ein solches berufliches Engagement gleichbedeutend mit dem Verzicht auf Familie war. Der Frage, ob sich die Alternative für Petersen oder Mosolf jemals stellte, widmet er sich nicht. 400 Dühlmeier: Schule, S. 52. 401 Ebd.
508 | Theanolte Bähnisch
Petersen, die zweite „Reformpädagogische Schlüsselfigur“402 für die Schule in Niedersachsen. Ob Dühlmeier seine Feststellung ausschließlich auf die Zeit Mosolfs im Kultusministerium bezog, wo Mosolf Petersen als Ministerialrätin nachfolgte, oder ob er auch ihre Arbeit im Regierungspräsidium im Blick hatte – dort war für die Volks- und Mittelschulen laut Organisationsplan von 1949 nicht Mosolf, sondern Regierungs- und Schulrat Wille zuständig – erläutert er nicht. Die Vorgaben für diese Zusammenarbeit kamen – gemäß der Stellung des Regierungspräsidiums im Verwaltungsaufbau – nicht von der Regierungspräsidentin selbst, sondern ‚von oben‘, aus dem Kultusministerium. Adolf Grimme vertraute der als resolut bekannten Katharina Petersen, die, was den Nationalsozialismus anging, unbestritten eine ‚weiße Weste‘ vorweisen konnte, erklärtermaßen „restlos“403. „Wie Grimme gehörte sie zu den wenigen, die sich nicht mit den Nationalsozialisten eingelassen hatten. Das verschaffte ihr gegenüber der großen Mehrheit belasteter Lehrer und Kultusbeamter eine besondere, auch moralisch begründete Autorität“404, erklärt Bernd Dühlmeier. Auch Mosolf und Grimme schätzten sich gegenseitig sehr. Grimme hielt Mosolf, auf ihre Integrität im Nationalsozialismus anspielend, für einen Menschen, der sich „inmitten aller Wirren und Verirrungen treu geblieben“405 war. Eine Stellungnahme aus dem Jahr 1933 läßt allerdings Zweifel an jenem Urteil Grimmes aufkommen. Denn Mosolf hatte gegenüber einer von der Regierung Hannover eingesetzten Kommission, welche ihre Loyalität gegenüber dem nationalsozialistischen Staat überprüfen sollte, immerhin erklärt, „stets die höchste Achtung vor Hitlers heiliger Überzeugung und seinem leidenschaftlichen Wollen für ein neues Deutschland gehabt“ zu haben, keine Gegnerin des Nationalsozialismus zu sein und auch nicht – wie ihr vorgeworfen wurde – mit der als oppositionell geltenden Käthe Feuerstack befreundet zu sein. „Meine positive Mitarbeit an den Idealen der neuen Staatsführung beweisen ausserdem die umfassenden Vorbereitungen, die ich in Verbindung mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut Abteilung Erblehre und Erbpflege für die
402 Vgl.: ebd., S. 46–51. Die Reformschulen waren Dühlmeier zufolge von Petersen initiiert und Mosolf begleitet worden. Vgl: ebd., S. 52. Beide Pädagoginnen waren Mitglieder des ‚Internationalen Arbeitskreises Sonnenberg‘, einem Verband, der sich für den internationalen Austausch von Pädagogen und zur gemeinschaftlichen Überwindung des Nationalsozialismus einsetzte. Mit Bähnisch verband Petersen und Mosolf bis ins hohe Alter nicht nur die Zusammenarbeit im Frauenring, sondern auch die gemeinsame Mitgliedschaft in der UNESCO und der UNICEF. 403 Adolf Grimme an Katharina Petersen, 07.12.1954, zitiert nach Hansen-Schaberg: Rückkehr, S. 330/331. 404 Dühlmeier: Schule, S. 47. 405 GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 2145, Adolf Grimme an Anna Mosolf, Hannover, 01.11.1955. In diesem Brief schreibt Grimme, es sei nun schon „über ein Menschenalter“ her, daß die beiden sich zuerst begegnet seien, „damals in jener ebenfalls aufgewühlten und doch so weit ruhigeren Zeit im alten Hannover.“ Legt man zugrunde, daß im Jahr 1955 die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern bei 65, die von Frauen bei 70 Jahren lag, müßten sich Grimme (geb 1889) und Mosolf (geb 1885) schon in Kindesoder Jugendjahren gekannt haben.
Regierungspräsidentin | 509
eugenische Durchforschung des Schulbezirks der Bürgerschulen 32/33 im kommenden Winter getroffen habe“406, schrieb Mosolf sogar in ihrer Stellungnahme. Hintergrund der Überprüfung war eine Karte Emmy Obées an die NSDAP gewesen, in der Obée die Überwachung Mosolfs empfohlen hatte, weil die Rektorin sich „nur aus praktischen Gründen umgestellt“ habe, „sich aber innerlich nicht umstellen kann“. Die Erziehung der Jugend sei „mit das Wichtigste im 3. Reich“407, weshalb Mosolf ein solches Amt, wie sie es inne habe, nicht anvertraut werden dürfe. Diese Ausführungen Obées sprechen, aus der Retrospektive betrachtet, wiederum für Mosolf. Ob es Mosolf gerade wegen dieser Äußerungen, wie sie Grimme gegenüber erklärte, mit „Stolz“ erfüllte, von ihm „im Kampf gegen den Ungeist“ als „Weggefährtin“408 angesehen zu werden? Die von der Regierung eingesetzte Kommission nahm ihr ihre Aussagen jedenfalls nicht ab, man enthob sie ihres Amtes als Direktorin, was sie später mit ihrer „Gegnerschaft geg d. Natsoz.“409 begründete. Vom Entnazifizierungsverfahren war Mosolf, die während des Dritten Reiches als Volksschullehrerin arbeitete, nicht betroffen.410 Die Überzeugung, im Nationalsozialismus ähnliche Erfahrungen gemacht und ähnliche Ziele geteilt zu haben wie Grimme, schien sich – wenn Mosolf auch nicht so geradlinig aufgetreten war, wie Grimme es dargestellt hatte – konstituierend für eine enge und von gemeinsamen Idealen geprägte Zusammenarbeit zwischen dem Kultusminister, der Schulabteilung des Ministeriums, der Regierungspräsidentin und der Schulabteilung des Regierungspräsidiums ausgewirkt zu haben. Das Kernstück jener Zusammenarbeit war die niedersächsische Schulreform. Die Reform der Schulausbildung war zugleich ein Kernstück der Re-education-Politik der Militärregierung in der britischen Besatzungszone – weshalb der Arbeit der oben Genannten die besondere Aufmerksamkeit der Briten sicher war. Beispielhaft wird an jenem Zusammenspiel deutlich, wie Grimme an seine Beziehungen aus der preußischen Verwaltung in den 20er Jahren anknüpfte: Schließlich hatte er Petersen 1945 dazu überredet, nach Hannover zu kommen – so wie er Bähnisch gemeinsam mit Kopf, Schumacher und Hume dazu gebracht hatte, Köln den Rücken zu kehren.
406 NLA HA HStAH, Nds. 400, Acc. 27/95, Nr. 51, Stellungnahme Mosolfs zu einem Schreiben des Regierungspräsidiums, betitelt ‚Des Weiteren: Zum Schreiben 345/33 vom 21.09.1933, Kommission bei der Regierung Hannover‘, 24.09.1933. 407 NLA HA HStAH, Hann. 310 I, Nr. 215, Karte Emmy Obée an NSDAP Hannover, 04.07.33. 408 GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 2145, Anna Mosolf an Adolf Grimme, 30.11.1955. Auch Mosolf spricht davon, daß man sich „schon in jungen Jahren“ begegnet sei. Ebd. 409 NLA HA HStAH, Nds. 400, Acc. 27/95, Nr. 51, Fragebogen der Militärregierung, Anna Mosolf, 1948. 410 NLA HA HStAH, Nds. 171, Hannover, Ablage Nr. 63318, Der öffentliche Kläger bei dem Entnazifizierungs-Hauptausschuß, Bescheid, 25.11.1948.
510 | Theanolte Bähnisch
5.5 DIE NIEDERSÄCHSISCHE SCHULREFORM: ANKNÜPFEN AN ‚WEIMARER‘ GEPFLOGENHEITEN IN EINEM VERTRAUTEN TEAM Die einst anwaltlich von Albrecht Bähnisch vertretene Ministerialrätin beim Niedersächsischen Kultusministerium Katharina Petersen war ohne Zweifel die ‚Vorzeigefigur‘ in dem von Grimme zusammengestellten Team, das die Schulbildung im Land reformieren sollte. Nicht nur in der Schulpolitik war sie über die Grenzen des Landes bekannt. Adolf Grimmes Statement, daß Petersen „eine der angesehensten Vertreterinnen des Deutschtums im Ausland […] und insoweit für die deutsche Kulturpolitik von besonderer Bedeutung“411 war, ist durchaus zutreffend. Sie wirkte ab 1945 entscheidend am Aufbau und an der Pflege der Kontakte zwischen der Stadt Hannover, dem Land Niedersachsen und der Bundesrepublik mit dem Ausland, darunter vor allem mit Holland und Großbritannien, mit. Für den freundschaftlichen Kontakt mit britischen Bürgern setzte sie sich beispielsweise in der von ihr gegründeten Hannover-Bristol-Society ein.412 Nicht nur von deutscher, auch von britischer Seite wurde ihr für ihr Engagement großes Lob zuteil. So erhielt sie für ihre Verständigungsarbeit den Orden des British Empire. Ab 1951 war Petersen Mitglied im Erziehungsausschuß der deutschen Sektion der UNESCO, 1966 gründete sie eine Amnesty International Gruppe in Hannover. Ihr war jedoch nicht nur an persönlichen binationalen Begegnungen gelegen, sondern sie setzte sich auch für einen theoretischen Austausch zwischen den Ländern über Pädagogik ein. Mit der regelmäßigen Übersendung der Zeitschriften ‚Die Schule‘ sowie ‚Anpacken und Vollenden‘ nach Bristol kam sie der Bitte nach, „hannoversche periodische Veröffentlichungen“413 an die Partnerstadt zu übersenden und bediente dabei das besondere Interesse der Society-Mitglieder an pädagogischen Fragen. Aktionen wie diese, vermutlich aber auch ihr an anderer Stelle ausgeführtes gemeinsames Engagement mit Theanolte Bähnisch in der Frauenbildung und der Frauenbewegung, führten dazu, daß Petersens Engagement in der „Wiederherstellung internationaler pädagogischer Beziehungen“414 heute unvergessen ist. Für die Stadt Hannover muß es eine große Genugtuung gewesen sein, daß bereits im September 1947, auf Petersens Betreiben hin, „after months of negotiation“ während der Messe eine „‚good will‘ mission, comprising several prominent Bristol citizens“ für eine Woche nach Hannover kam, „to contact representative citizens of
411 NLA HA HStAH, Nds. 400, Acc 27/95, Nr. 55, Der Niedersächsische Kultusminister an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten, Staatskanzlei, 05.12.1947. Das Schreiben ist von Grimme eigenhändig unterzeichnet und diente dem Zweck, die von ihm angestrebte Ernennung Petersens zur Regierungsdirektorin zu begründen. Petersen wurde schließlich zum 19.12.1947 als Regierungsdirektorin in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen. 412 Vgl.: Stadtarchiv Hannover, Amt für Verkehrsförderung, Nr. 1, Stadtschulrat Prof. Oppermann an Oberstadtdirektor Bratke, Hannover, 28.04.1948. 413 Vgl.: Stadtarchiv Hannover, Amt für Verkehrsförderung, Nr. 1, Stadtschulrat Prof. Oppermann an die Hahn’sche Verlagsbuchhandlung, Hannover, 14.06.1948. 414 Ebd.
Regierungspräsidentin | 511
Hanover in different fields of activity“415. Hannover erhielt so die Möglichkeit, auch auf diese Weise auf die noch immer gravierenden Probleme in der Stadt, gleichzeitig aber auf ihr kulturelles und ökonomisches Potential hinzuweisen.416 Als Theanolte Bähnisch 1948 für eine Reise in die USA zu einem Frauenkongreß, welche sie selbst nicht wahrnehmen konnte, Petersen als ihre Vertreterin vorschlug, konnte sie sich sicher sein, daß ihr Vorschlag auf offene Ohren stoßen würde. Hingegen war und ist der innovative Gehalt und die Ausrichtung des Projekts, das Grimme, Petersen und Mosolf gemeinsam angingen und – auch in Zusammenarbeit mit Theanolte Bähnisch – teilweise umsetzten, umstritten. Der Kultusminister und die Rätinnen sahen sich schon zu ihrer Zeit zwischen den Fronten: Grimme zielte mit seinem ‚Hannover-Plan‘417, Katharina Petersen mit den sogenannten ‚PetersenErlassen‘ auf eine Reform der Niedersächsischen Schulen, die sich mehr an pädagogischen Konzepten der Weimarer Republik, beziehungsweise – um mit den Worten Grimmes zu sprechen – an den „verschütteten Quellen unserer großen deutschen Pädagogik“418, als an den viel weitreichenderen Vorgaben der Alliierten orientierten. Und Anna Mosolf unterstützte diese Tendenzen als Vertraute Grimmes – aber auch als Mitarbeiterin Bähnischs im Regierungspräsidium. Die Alliierten wollten das dreigliedrige Schul-System, das „bei einer kleineren Gruppe eine überlegene Haltung und bei der Mehrzahl der Deutschen ein Minderwertigkeitsgefühl entwickelte[e], das jene Unterwürfigkeit und jenen Mangel an Selbstbestimmung möglich machte, auf denen das autoritäre Führerprinzip gedieh“419, in seinem Aufbau grundsätzlich verändert wissen. Grimmes Partei, die SPD, stand in der Schulpolitik ebenfalls nicht hinter dem Kultusminister. Denn dieser wollte das Schulsystem an sich nicht umstrukturieren, sondern durch eine Reform „von innen“ lediglich „durchlässiger“420 gestalten, indem er die Möglichkeit, zwischen Volks- und Berufsschule, Mittel- und Oberschule und dem Gymnasium zu wechseln für die fünfte und sechste Klasse durch eine Angleichung des Sprachenun-
415 Stadtarchiv Hannover, Amt für Verkehrsförderung, Nr. 1, o. V.: Hannover Mission, in: Bristol Evening Post, 25.08.1947, S. 3 und o. V.: Bristol to Hanover. Five men with a mission, in: Bristol Late Night Evening World, 25.08.1947, S. 4. 416 Vgl.: ebd., Sehenswertes für die Gäste aus Bristol, Hannover, 02.08.1947. Aus der Auflistung geht hervor, daß den Gästen der Bahnhofsbunker und andere Flüchtlingsquartiere, jedoch auch kulturelle Einrichtungen und die Export-Messe gezeigt werden sollten. 417 O. V.: Zum Neubau des Schulwesens, in: Die Schule. Monatsschrift für geistige Ordnung, 1(1946), Nr. 2/3 S. 13/14. Der im Artikel skizzierte ‚Hannover Plan‘ trug aufgrund seiner Entstehung auf einer Tagung im Landschulheim Marienau 1945, auch den Namen ‚Marienauer Pläne‘. 418 Adolf Grimme, zitiert nach Pieper: Schulreformen, S. 39, Anm. 67. 419 Bericht der Zook-Kommission aus dem Oktober 1946, zitiert nach Pieper: Schulreformen, S. 50. Die Zook-Kommission (United States Education Mission to Germany) war eine nach ihrem Leiter George F. Zook benannte Kommission, die ab 1946 dem Auftrag folgte, das deutsche Bildungssystem zu untersuchen und der US-amerikanische Regierung Empfehlungen für eine Veränderung dieses Systems zu unterbreiten. 420 Vgl.: Pieper: Schulreformen, S. 39, Anm. 65.
512 | Theanolte Bähnisch
terrichts zu vereinfachen versuchte. Die SPD forderte jedoch, ebenso wie die Militärregierung, eine Schulreform „von außen“ sowie die Entkonfessionalisierung der Schulen und der Lehrerbildung. Entsprechende Bestrebungen Grimmes, einer dieser Forderungen zu entsprechen und die Schulen zu entkonfessionalisieren, stießen jedoch wiederum auf starke Ablehnung durch die CDU und führten zu Protestmärschen von Katholiken mit bis zu 70.000 Teilnehmern im mehrheitlich protestantisch geprägten Hannover. Der Philologenverband421 und die Universitätsrektoren in der britischen Besatzungszone liefen schließlich erfolgreich Sturm gegen die von Grimme geplante Verschiebung des Beginns des Lateinunterrichtes von der fünften in die siebte Klasse. 422 So scheiterten die bildungspolitischen Ziele der SPD an ‚ihrem‘ Kultusminister, der schon in den 20er Jahren erklärt hatte, nicht „Marionette“, sondern „Exponent“423 seiner Partei sein zu wollen. Dessen Reformprogramm scheiterte wiederum am Widerstand konservativer Kräfte. Daß Grimme nicht nur mit Petersen und Mosolf, sondern auch mit Otto Hahn und später mit Günther Rönnebeck Mitarbeiter beschäftigte, die ihm schon aus seiner Berliner Zeit in der Weimarer Republik vertraut waren, ist gewiß kein Zufall: Auf der Grundlage gemeinsamer Überzeugungen ließ es sich in einer neuen Umgebung leichter an eine Vision reformorientierter Erwachsenenbildner in der Weimarer Republik anknüpfen, wie sie beispielsweise in Dreißigacker zutage getreten war. Grundlage jener Vision war die humanistisch orientierte Vorstellung der Volkshochschule als einer Schmiede der Persönlichkeit des ‚ganzen Menschen‘. Dieser sollte naturwissenschaftlich, sprachlich, musisch und ästhetisch gebildet sein, einen gesunden Geist mit einem gesunden Körper vereinen sowie durch die Rückbesinnung auf religiöse Tugenden424 und der „Verteidigung einer Welt unbedingter Werte“425 einen wertvollen Beitrag zum Aufbau der Gesellschaft leisten. Eine Abkehr von der „Unterbewertung des Geistes“426, die zur „Hitlerkatastrophe“427 geführt habe, erhob Grimme zu einem ehernen Prinzip seiner hehren wie auch elitären Pläne. Denn seine große Vision bezog er nur auf einen kleinen Prozentsatz von Schülern. Gerade einmal zehn Prozent
421 Mit Günther Rönnebeck, dem Pressesprecher des Philologenverbandes, hatte Grimme ab 1947 einen Gegner in den eigenen Reihen, der sich ebenfalls als Reformator verstand. Rönnebeck war ab 1947 19 Jahre lang als Leiter der Schulabteilung im Kultusministerium beschäftigt und damit auch Petersen, beziehungsweise ihrer Nachfolgerin Mosolf direkt vorgesetzt. 1952/53 hatte er auch die Position eines Staatsekretärs und damit eine politische Rolle inne, denn er vertrat in seiner Funktion Grimmes Nachfolger, den Kultusminister Richard Voigt. 422 Als sich diese Idee durchsetzte und Englisch als erste Unterrichtssprache flächendeckend eingeführt wurde, war Grimme nicht mehr im Amt. 423 Vgl.: Burkhardt: Biographie, S. 92. 424 „Ohne die Erweckung der religiösen Kräfte im Volke ist die Rettung der Nation undenkbar“, hatte sich Grimme geäußert. Adolf Grimme, zitiert nach Pieper: Schulreformen, S. 39. 425 O. V.: Neubau. 426 Ebd. 427 Ebd.
Regierungspräsidentin | 513
der Schüler waren seiner Meinung nach dafür geeignet, ein Gymnasium, welches jene Bildung zum ‚ganzen Menschen‘ ermöglichen sollte, zu besuchen. Dies erinnert an das Konzept der von Grimme subventionierten Heimvolkshochschule Dreißigacker, in der Josef Olbrich zufolge eine soziale und politische Elite ausgebildet werden sollte.428 Grimmes Annahmen über die „natürliche Aufteilung der Begabungen“, mit denen er die Beibehaltung des dreigliedrigen Schulsystems rechtfertigte, bezeichnet der Erziehungswissenschaftler Wilhelm Pieper rückblickend als „konservativ“429. Insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, daß es Grimmes Plänen nach verschiedene Lehrpläne für Mädchen und Jungen geben sollte, läßt sich eine inhaltliche Parallele ziehen zu ebenfalls angestaubten Annahmen über die ‚naturgegebene‘ Verschiedenheit der Geschlechter, die ‚organisch‘ für das Ganze zusammenwirken, wie sie auch Theanolte Bähnisch vertrat. Grimmes Überzeugung, eine ‚innere Einheit‘ in den Schulen herzustellen, sei konstruktiver, als eine organisatorische Einheitlichkeit zu erreichen, negierte die Idee gleicher Bildungsmöglichkeiten für alle Schüler und stützte sich auf ein im Grunde patriarchales Verständnis von Gesellschaft, wie es auch Grundlage der Arbeit von Sozialarbeitern und Pädagogen in der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Ost (SAG) gewesen war.430 Auf dem Gymnasium sollten also „organisch verbundene Bildungsgüter“431 gelehrt werden, welche im „Philosophikum“, hier gedacht als eine Zwischenstufe zwischen Schule und universitärem Fach-Studium, im Sinne eines ‚Studium Generale‘ vertieft werden sollten. Anhand dieses Lehrplans sollten die Schüler nicht nur humanistische Bildung erfahren, sondern auch zu humanistischer Gesinnung geführt und „durch die Ausbildung in einer geringen Anzahl von Fächern“ zu „Menschen“ 432 erzogen werden. So verwendet ist der Begriff ‚Mensch‘, den Bähnisch in diesem Sinn in der Korrespondenz mit Grimme gebrauchte und dabei in Abgrenzung zum Begriff ‚Leute‘ brachte, ein Schlüsselbegriff. Er steht für eine ganzheitlich gebildete Persönlichkeit in Abgrenzung zum ‚Fachspezialisten‘. Die Vision, mit einer solchen ‚inneren Schulreform‘ eine Welt zu erschaffen, die sich konzeptionell mehr an den philosophischen Strömungen des 19. als an den Notwendigkeiten des 20. Jahrhunderts orientierten433, läßt auf ein tiefes Unbehagen Grimmes in seiner Lebenswelt schließen. Als Kultusminister sah er sich vor die Herausforderung gestellt, jene nationalsozialistischen Jahre, die mit seinem Bild vom Land der Dichter und Denker nicht in Einklang zu bringen waren, als Teil der deutschen Geschichte zu akzeptieren und gleichzeitig der Abkehr vom nationalsozialistischen Gedankengut den Boden zu bereiten. Ein ‚Zurück‘ zum oben beschriebenen
428 429 430 431
Olbrich, Josef: Dreißigacker, S. 64. Siehe auch Kapitel 3.5.2.2. O. V.: Neuaufbau. Vgl.: Pieper: Schulreformen, S. 41. Das von Grimme geplante ‚Philosophikum‘ ließ sich jedoch ebenso wenig durchsetzen, wie die ‚Studientage‘ für die Oberschule, welche die Schulen näher an den Lebensalltag und die Schüler an ein selbstbestimmteres Lernen heranführen sollten. 432 Vgl.: Pieper: Schulreformen, S. 43. 433 In diesem Sinne auch Pieper: Schulreformen, S. 47.
514 | Theanolte Bähnisch
Idealbild des Menschen – der so nie existiert hatte – erschien ihm als naheliegendes politisches Ziel. „Grimme träumte […] einen idealistischen Traum von einer kleinen Gelehrtenschule und einer vor allem aus ihr herauswachsenden akademisch gebildeten Elite, deren philosophisch orientierter Humanismus, deren Geisteskraft und deren an absoluten Werten orientierte Ausstrahlungskraft Deutschlands aus seinem Elend wieder aufrichtet“434, bewertet Pieper Grimmes Modell, welches er für „insgesamt eher rückwärtsgewandt als zukunftsfähig“435 hält. Theanolte Bähnisch, die über ihren Mann Albrecht Bähnisch mit den Ideen von ‚Dreißigacker‘ konfrontiert worden sein dürfte, teilte die Überzeugung Grimmes, es müsse ein vordringliches Bildungsziel sein, Menschen zu ‚Persönlichkeiten‘ im humanistischen Sinn zu erziehen. Dies läßt sich auch in der bereits im Oktober 1947 lizensierten436, aber erst ein gutes halbes Jahr später zum ersten Mal erschienenen ‚Stimme der Frau‘ nachvollziehen. Mit Grimmes Schulpolitik, die über Mosolf ihren ‚Anker‘ im Regierungspräsidium hatte, wird sie deshalb aller Wahrscheinlichkeit zufrieden gewesen sein. Der Anspruch Piepers, Grimmes Visionen an modernen erziehungswissenschaftlichen Erkenntnissen zu messen, soll hier nicht weiter verfolgt werden. Stattdessen soll noch auf die konstruktiven Elemente der Schulpolitik in Niedersachsen verwiesen werden: Katharina Petersen stimmte mit Grimmes Auffassung überein, daß sowohl die älteren Schüler als auch die Lehrer vom Nationalsozialismus stark negativ beeinflußt seien. Sie sah deshalb ihre Aufgabe insbesondere darin, geeignete, akademisch gebildete, junge Lehrer zu finden. Ihr war, wie Grimme, bewußt, daß sich Reformen kaum ohne einen Austausch der Fachkräfte umsetzen lassen würden, deshalb beobachtete und beurteilte sie die im Land tätigen Lehrer. Zwar waren bereits reformorientierte Pädagogen, die während des Nationalsozialismus ihrer Ämter enthoben worden waren, in verantwortungsvolle Positionen zurückgekehrt, doch das Gros des Lehrpersonals war, Pieper zufolge, „wie kaum eine andere Berufsgruppe von nationalsozialistischer Ideologie durchseucht“437. Nachdem Grimme Mitarbeiter für das Kultusministerium angeworben hatte, von denen er glaubte, daß sie seine Politik unterstützten würden, tat die angeworbene Katharina Petersen es ihm gleich und setzte ebenfalls auf eine Personalpolitik, welche demokratisch orientierte Kandidaten begünstigte. Besonders in den neu eingerichteten ‚Reformschulen‘, von denen es in jedem Schulaufsichtskreis eine geben sollte, aber nach Möglichkeit auch in allen anderen Schulen, sollten jene Lehrer, von deren pädagogischen Fähigkeiten Petersen überzeugt war, ihren Unterricht auf der Basis des ‚ersten Petersen-Erlasses‘438 leisten.
434 Ebd. 435 Vgl.: ebd. 436 NA, UK, FO 1056/306, Ninth Monthly Report – Land Niedersachsen, Covering Period 1 Sept – 30 Sept. 1947, HQ Land Niedersachsen, 07.10.1947, S. 2. Demnach hatte die Zeitschrift zunächst ‚Miranda‘ heißen sollen. 437 Pieper: Schulreformen, S. 58. 438 Der Erlaß mit den ‚Anregungen zur Gestaltung des Schullebens und der unterrichtlichen Arbeit‘ vom 01.11.1946 blieb bis zur Herausgabe der Volksschulrichtlinien 1957 Grundlage des Schulunterrichts in Niedersachsen, er prägte also beinahe über die komplette
Regierungspräsidentin | 515
Dieser läßt sich mit den noch heute als pädagogisch sinnvoll erachteten Themen „Gruppenarbeit, themengebundener/problemorientierter Unterricht statt enge Orientierung am ‚Fach‘, Einüben von demokratischen Spielregeln und die Übernahme kleiner, mit Verantwortung verbundener Ämter durch die Schüler, einer fröhlichen Arbeitsatmosphäre, der Ermutigung der Kinder zur Ausbildung persönlicher Fähigkeiten, Projektarbeit, Studientage sowie Festen und Feiern als Ausdruck des gemeinsamen Schullebens“439 charakterisieren. Wilhelm Pieper unternimmt in seiner empirischen Studie jedoch den Versuch, nachzuweisen, daß dieser erste Petersen-Erlaß ebenso wie der zweite, der die Einrichtung von Reform-Schulen betraf, von den Schulen nur unzureichend umgesetzt worden sei. 1950 resümierte die Schulrätin bei der Regierung Hannover, Anna Mosolf, „dass sich die Grundzüge bis heute nicht stark verändert haben“440. In den 50er Jahren hatten sich mehr und mehr Schulen aus der Reformarbeit zurückgezogen. Andere hatten jedoch, wie Bernd Dühlmeier herausstellt, den ‚Impuls von oben‘ gar nicht mehr nötig, weil sich der Erlaß Petersens dort, wo er auf ohnehin reformgeübte und -interessierte Lehrer getroffen war, verselbständigt hatte. Meldungen der Schulen an die Verwaltung über den Stand der Reform waren zu dieser Zeit ebenso spärlich gesät, wie Versuche des Kultusministeriums und der Regierungspräsidien, sich ein Bild der Umstände zu machen. 1953 schien das Regierungspräsidium Hannover durch eine Anfrage der „Hochschule für Internationale Pädagogische Forschung“441 in Frankfurt am Main aus einer Art reformpädagogischem Winterschlaf herausgerissen worden zu sein. „Wir sind nicht in jedem Falle über die jetzt noch laufenden Schulversuche genauestens unterrichtet. Auch zur eigenen Information wäre eine Umfrage bei unseren Schulräten […] notwendig“442, notierte man im Regierungspräsidium und forderte in Folge dessen die Schulräte im Bezirk zu einer Stellungnahme auf. Die Schulräte hatten die aus dem Kultusministerium kommenden Pläne, über deren Durchführung Anna Mosolf im Regierungspräsidium Hannover wachte, zumindest in den ersten Nachkriegsjahren engagiert in die Praxis umzusetzen versucht. Sowohl Schulrat Wille als auch die Schulräte Burmester und Fricke, die ebenfalls bei der Regierung Hannover tätig waren, unterstützten den von Grimme, Petersen und Mosolf verfolgten Reformkurs: Burmester setzte sich für die Ernennung der Friedrich-Ebert-Schule in Nienburg zur Reformschule ein, Wille unterstützte reformorientierte Lehrer wie den Pädagogen Reinhold Göttling sowie neue Unterrichtsmethoden, unter anderem das Schauspiel besonders und brachte die Ernennung der Landschule Multhöpen zur Reformschule auf den Weg.443 Das Regierungspräsidium Hannover
439 440 441 442 443
Amtszeit der Regierungspräsidentin Bähnisch hinweg das Schulleben in Niedersachsen und stellte damit auch die Arbeits- und Beurteilungsgrundlage für die in der Bezirksregierung tätigen Schulräte dar. Vgl.: Dühlmeier: Schule, S. 53. Vgl.: Mosolf, Anna: Schulversuche und Reformschularbeit in Niedersachsen, in: Schulverwaltungsblatt 1/50, S. 13ff, zitiert nach Pieper: Schulreformen, S. 57. Vgl.: Dühlmeier: Schule, S. 114. Der Regierungspräsident in Hannover, zitiert nach: ebd., S. 113. Vgl.: ebd., S. 69–77.
516 | Theanolte Bähnisch
war seiner Aufgabe, an der Schulreform mitzuwirken, also zumindest in den späten 40er Jahren aktiv nachgekommen. Daß zu jener Zeit ein regelmäßiger persönlicher Austausch zwischen Bähnisch und Grimme stattgefunden hatte, daß Grimme seinem ‚verlängerten Arm‘ im Regierungspräsidium, Anna Mosolf, vertraute und daß Bähnisch mit den Schulräten weiteres geeignetes Personal zur Verfügung stand, scheint dafür wesentlich gewesen zu sein. Eine Lenkungsarbeit von ihrer Seite schien – vor allem aufgrund des direkten Drahtes von Mosolf in das Kultusministerium – weitgehend entbehrlich gewesen zu sein. Der Umstand, daß sie mit Mosolf auch in der Frauenbewegung und -bildung zusammenarbeitete, läßt auf ein großes Maß an Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitherausgeberin der Stimme der Frau, die ihre pädagogischen Fähigkeiten in die Zeitschrift einfließen ließ und ein Abrücken vom nationalsozialistischen Erziehungsideal der Härte forderte444, schließen. Es mag im Zusammenhang mit dem Weggang Grimmes gestanden haben, daß sich zu Beginn der 50er Jahre die Dinge wie beschrieben entwickelten und der Reformmotor stotterte – obwohl Bähnisch, Petersen und Mosolf auf ihren Positionen blieben. Pieper zufolge trat mit dem neuen Kultusminister Voigt (SPD) „kein entschiedener Schulreformer“, sondern eher ein „vorsichtiger Parteipolitiker“445 die Nachfolge Grimmes an. Dühlmeier allerdings macht für die Umsetzung der geplanten Reformen, die ihm insgesamt mangelhaft erscheint, auch für die 40er Jahre eine seiner Meinung nach zu stark bürokratisierte Verwaltung verantwortlich. Bessere Kommunikationsstrukturen mit einer effizienten Einbindung der Mittelinstanzen wären seiner Meinung nach von Vorteil gewesen.446 Auch das „spezifische Rollenverständnis des klassischen Schulrats“447, der in die Kommunikationsstrukturen der Schulen nicht eingebunden sei, sondern nur punktuell auftrete und stets ein verzerrtes Bild erhalte, sei von Nachteil bei der Umsetzung gewesen. Dieses Problem hatte, so Pieper, auch Petersen und Mosolf betroffen.448 Inwiefern sich die Kommunikationsstrukturen zwischen dem Kultusministerium und dem Regierungspräsidium mit dem Weggang Grimmes veränderten, bliebe zu prüfen.
444 Kessler, Hansi: Ein psychologisches Problem unserer Generation. Ein Mädchen kann nicht weinen, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 19 sowie ders.: Ein Mädchen lernt lachen und weinen!, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 2, S. 20. 445 Dühlmeier: Schule, S. 130. 446 Auch an die Regierung Hannover war ein Schreiben des Kultusministers herausgegangen, in dem zu lesen war, daß die Schulen vom „Erfolg ihrer Arbeit“ berichten sollten – offenbar auf dem Weg über das Regierungspräsidium. NLA HA HStAH, Hann. 180 Hannover II E 1, Nr. 396, Bd. 1, Der Niedersächsische Kultusminister an den Regierungspräsidenten von Hannover, 21.04.1948, nach Dühlmeier: Schule, S. 55. Anna Mosolf hatte zu diesem Zweck eine Vorlage für Berichte von Reformschulen entwickelt. Ebd., S. 63. 447 Ebd. 448 Vgl.: ebd.
Regierungspräsidentin | 517
5.6 DER SCHWERPUNKT JUGENDFÜRSORGE UND -BILDUNG IN DER WIEDERAUFBAU-ARBEIT BÄHNISCHS Das persönliche Interesse der Regierungspräsidentin am Mittel- und Volksschulwesen schien eher verhalten gewesen zu sein. Anders als Petersen, Feuerstack und Mosolf – letztere verantwortete vermutlich auch die Artikel über Kindererziehung in der ‚Stimme der Frau‘ – hatte Bähnisch keine Erfahrungen in der professionellen pädagogischen Arbeit mit Kindern gesammelt. Ihr Interesse galt stärker der sozialen Lage und der Bildung jugendlicher Heranwachsender. Diese Gruppe bedurfte ihrer Einschätzung nach besonderer Aufmerksamkeit. Bedenkt man, daß die juristische Volljährigkeit in Deutschland bis 1975 erst mit dem 21. Lebensjahr eintrat, so darf man annehmen, daß Bähnisch, wenn sie von ‚Jugendlichen‘ sprach, im Kern auf die Gruppe der 16 bis mindestens 21-jährigen anspielte. 5.6.1 Das Jugendflüchtlingslager Poggenhagen Richtete die Regierungspräsidentin ihren Blick ohnehin stark auf Flüchtlingsfragen, so war sie besonders empathisch mit jugendlichen Flüchtlingen und verspürte eine besondere Verantwortung gegenüber jener Bevölkerungsgruppe. In einer Art, wie sie auch ihre Zuständigkeit für den Wiederaufbau des Bezirks Hannover sowie für die staatsbürgerliche Frauenbildung erklärte, beschrieb sie auch ihren Entschluß, sich verstärkt um jugendliche Flüchtlinge zu kümmern, als eine schicksalhafte Eingebung und eine Notwendigkeit der Zeit, die ihr abverlangte, zu handeln: „Ich hatte nachmittags in der Zeitung gelesen, daß 30.000 Jugendliche auf Deutschlands Landstraßen herumirrten, die aus dem östlichen Deutschland kamen“ schrieb Bähnisch im Jahr 1964, dem Jahr ihrer Pensionierung, eine Erfahrung aus dem November 1946. „Mir wollte in der Nacht der Schlaf nicht kommen. Der Regen prasselte an die Scheiben und ich dachte an all die jungen Menschen auf den Landstraßen. Sie würden verwildern, wenn sich niemand ihrer annähme.“449 Ihre Aussagen, insbesondere jene von einer offenbar bevorstehenden ‚Kultur- und Sittenlosigkeit‘ jugendlicher Deutscher, muten pathetisch an. Dabei spiegelten die Einschätzungen der Regierungspräsidentin, die in zeitgenössischen Zeitungsartikeln ganz ähnlich wiedergegeben wurden, die Angst vieler Menschen wieder, die in ihrer Arbeit in der Politik und der Verwaltung, in Schulen, in Heimen und in Lagern versuchten, die scheinbar ‚verlorene Generation‘ in eine Generation zu verwandeln, auf deren Schultern sie die Zukunft der zweiten deutschen Demokratie verläßlich aufbauen und ruhen lassen konnten. Am dringlichsten erschien es Bähnisch, jugendlichen Flüchtlingen eine Grundversorgung durch Nahrung und Wohnung anbieten zu können. Gemeinsam mit Kopfs Staatskommissarin für das Flüchtlingswesen, Martha Fuchs, sowie dem Referenten
449 Bähnisch, Theanolte: Theanolte Bähnisch erzählt. Das nie vergessene Weihnachtsfest. 1946 im Flüchtlingslager/Das Glück, etwas schenken zu können, in: Hannoversche Neue Presse, 24./25.12.1964.
518 | Theanolte Bähnisch
für Jugendfragen bei der Militärregierung richtete sie deshalb in einer Scheune das Jugendflüchtlingslager ‚Poggenhagen‘ ein.450 In dieses Lager, von dem es hieß, es biete „Geborgensein, ein Dach über dem Kopf, ein Bett, eine Küche und Ruhe nach langer, ruheloser Wanderung“451, wurden Personen unter 21 Jahren, die keine Familienanbindung hatten, aus anderen Lagern überführt. Bald schon standen dem Lager neben der Scheune mehrere Baracken zur Verfügung. Eine Stellenvermittlung des Landearbeitsamtes half bei der Suche nach geeigneten Arbeitsplätzen für die jungen Menschen.452 Das Lager unterstand organisatorisch dem Flüchtlingsdezernat im Regierungspräsidium und betreute zwischen 1948 und 1950 über 30.000 Jugendliche. Zwei Delegierte der britischen Militärregierung, die sich das Lager 1951 angesehen hatten, beklagten einerseits die problematischen baulichen Zustände, unter denen die Jugendlichen lebt, beispielweise, daß der Luftaustausch in den Nissenhütten zu ungenügend sei – was Krankheiten begünstigte. Sie betonten andererseits aber das gute menschliche Klima, das im Lager herrschte. „The atmosphere there is welcoming, there can be no doubt that the venture of this camp is imaginative in its indirect plea for ‘democracy’ and the work done very [gemeint ist vermutlich ,worth‘, Anm. d. V.] while.”453 Auch die kleine Schrift ‚Jugend in Westdeutschland‘, welche die Alliierte Hohe Kommission 1951 – vielleicht in Anlehnung an den oben zitierten Bericht Helena Denekes und Margret Cornells – herausgab, widmet sich dem Lager Poggenhagen. In der Broschüre wird besonders die „Freiwilligkeit“ der Einrichtung, welche sich in besonderer Weise den „[I]llegalen“ annehme, betont und wohl kaum zufällig zu den Verhältnissen im ‚anderen Deutschland‘ in Beziehung gesetzt, aus dem „[t]agtäglich […] im Sommer 80 bis 90 Jungen und Mädchen an[kommen], die es in der Ostzone [die längst den Namen ‚DDR‘ trug] nicht mehr ausgehalten haben“454. Angst vor den „Asozialen“ habe man in Poggenhagen übrigens nicht, erklärt die Broschüre, zumal
450 Wiese: Präsidentin. Daß sie an den Vorgängen und Umständen im Lager sehr interessiert war, belegt unter anderem ein Brief an den Hannoverschen Landesbischof Lilje, in dem sie diesem für seinen Besuch im Lager dankt. Über den Leiter der Jugendlagergruppe, Dr. Fresen, hatte sie davon erfahren, daß Liljes Besuch die Jugendlichen sehr beeindruckt habe. LKA Hannover, L3 III, Nr. 544, Bähnisch an Lilje, 10.09.1951. 451 NLA HStAH, Nds. 120, Hannover, Acc. 40/78, Nr. 9/1, Zeitungsausschnitt o. T., aus: Der Pfeil. Zeitschrift der Jugend des deutschen Ostens”, Ausgabe 10, Dezember 1951. 452 Vgl.: ebd. 453 Women’s Library, Metropolitan University, London, 5 WMF/C 10, Report on the Journey in Rhineland and Westphalia, March 27th–April 24th, 1951, von M. C. Cornell und H. C. Deneke, S. 27. Den Besuch in Poggenhagen hatte – das geht aus dem Bericht hervor – Bähnisch für die beiden Frauen organisiert. Da es sich bei Helena Deneke um eine erklärte Befürworterin der Regierungspräsidentin handelte, sind Zweifel an der Neutralität ihrer Bewertung durchaus angebracht. 454 Der Broschüre zufolge hatte das Lager gemeinsam mit den Nebenlagern Kirchrode und Loccum „durchschnittlich 800 bis 1000 junge Gäste.“ Vgl.: Verlagshaus der amerikanischen Hochkommission (Hrsg.): Jugend in Westdeutschland, o. J. [1951].
Regierungspräsidentin | 519
diese sich gegen die „Soliden“, deren Prozentsatz für 1951 mit „60 bis 70“455 angegeben wird, nicht durchsetzen könnten. Was genau mit jenen Begriffen umschrieben werden sollte, erklärt die Broschüre nicht. Eine Aussage, die im gleichen Zusammenhang gemacht wird, nämlich daß es 1947 in Poggenhagen noch ganze 18 Prozent Geschlechtskranke gegeben habe, während 1951 der Anteil bei nur zwei Prozent liege456, läßt erahnen, daß die Einstufung in ‚Solide‘ und ‚Asozial‘ in der Tradition von Kategorien stand, welche in der Sittenpolizei und in der ‚Fürsorge‘ der Weimarer Republik Verwendung gefunden hatten. Hier war im Zusammenhang mit Geschlechtskranken häufig von ‚sittlicher Verrohung‘ oder gar ‚Kriminalität‘ die Rede gewesen.457 Im Nachkriegs-Hannover war es, wie in der Weimarer Republik, übrigens die ‚weibliche Polizei‘, welche in Zusammenarbeit mit der Militärregierung Razzien in Flüchtlingslagern durchführte, um geschlechtskranke Frauen und Mädchen aufzuspüren. 1947 wurden 2871 weibliche Personen von der Polizei aufgegriffen, 768 davon waren geschlechtskrank.458 Daß Bähnisch in der breitenwirksam angelegten ‚Stimme der Frau‘ einen Artikel über die ‚VD’s‘459 publizierte, kann als ein weiterer Schritt nach vorn im Zuge der Entwicklung ‚Aufklären statt Strafen‘ eingeordnet werden. Der Artikel zeigt, daß die Regierungspräsidentin sich nicht allein auf die Arbeit der Polizistinnen und Fürsorgerinnen verlassen wollte – zumal bei Weitem nicht nur Jugendliche von dem Problem betroffen waren.460 Für die Regierungspräsidentin waren Einrichtungen wie Poggenhagen prädestiniert dafür, die Bevölkerung vor der Ausbreitung ‚veneröser‘ Krankheiten zu schützen. So ließ sie 1949 in einem Interview verlauten, daß „ein Bruchteil der öffentlichen Mittel, die später nötig sind, um Geschlechtskranke zu behandeln und Verbrecher zu bekämpfen, genügt, um die verzweifelten Menschen [durch eine Anlaufstelle wie Poggenhagen] auf die rechte Bahn zu bringen“461. Bähnisch knüpfte also auch in diesem Zusammenhang an ihre und die Arbeit ihres Mannes in der Weimarer Republik an. Beide Partner hatten sich mit dem Thema Geschlechtskrankheiten – in Zusammenhang mit mangelnder ‚sittli-
455 456 457 458
Ebd. Ebd., S. 18. Siehe Kapitel 2.2.3. Vgl.: Riesener: Polizeidirektion, S. 41. Riesener bezieht sich auf Informationen aus den zeitgeschichtlichen Sammlungen des Hauptstaatsarchivs Hannover: NLA HA HStAH, ZGS 1m, Nr. 5. 459 ‚VD‘ ist im englischen die Abkürzung für ‚Veneral Deseases‘, die im deutschen Volksmund nach 1945 vor dem Hintergrund der Ansteckungen von Soldaten bei deutschen ‚Frolleins‘ auch als ‚Veronika Dankeschön‘ bezeichnet wurden. 460 Zur Thematisierung gesamtgesellschaftlicher Probleme als ‚Jugendprobleme‘ durch einen ‚Stellvertreterdiskurs‘ in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche vgl.: Jansen, Philip Jost: Jugend und Jugendbilder in der frühen Bundesrepublik. Kontexte – Diskurse – Umfragen, Dissertation, Köln 2010, S. 2, auf: http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/docu ment/44684/ssoar-hsr-trans-2010-23-janssen-Jugend_und_Jugendbilder_in_der.pdf?se quence=1, am 16.11.2017. 461 O. V.: Schubfach.
520 | Theanolte Bähnisch
cher‘ Erziehung und sozialer Notlagen, vor allem in Form von fehlendem Wohnraum – auseinandergesetzt.462 5.6.2 Der Club junger Menschen 5.6.2.1 Wie aus Hitler-Jungen Demokraten werden sollten Ebenso wie deutsche Politiker, Erwachsenenbildner und Verwaltungsfachleute – mehrfach äußerte sich auch Adolf Grimme463 – um „die Jugend“ besorgt waren, sahen auch britische Beobachter „die Erziehung der ‚lost generation‘, der 18 bis 30jährigen jungen Leute, als die schwierigste und gleichzeitig wichtigste Aufgabe der Zeit an.“464 Im Bewußtsein, daß Jugendliche im Dritten Reich der Indoktrination durch die Nationalsozialisten am stärksten ausgesetzt waren465, stellte sich Jugendarbeit ab 1945 nicht als eine rein soziale, sondern vor allem auch als eine politische Aufgabe dar. „Die enorme Stellung, die das nationalsozialistische System den Jungen zugewiesen hatte, war unausgesprochen eine wesentliche Kontrastfolie für die Behandlung von Jugend in der frühen Bundesrepublik“ 466, hält Philip Jost Jansen fest. Mit anderen Worten: Die Alliierten, in Hannover die Briten, waren darauf aus, die Köpfe der Jugendlichen von der nationalsozialistischen Ideologie zu ‚reinigen‘. Ein ‚Wertevakuum‘ anstelle nationalsozialistischer Überzeugungen galt es dabei ebenso zu verhindern wie die Adaption kommunistischer politischer Ziele. Ziel der britischen Re-education-Politik, auf die an anderer Stelle zurück zu kommen sein wird, war die Erziehung zur Demokratie. In diesem als besonders wichtig erachteten Besatzungs- und Wiederaufbau-Ziel war eine enge Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden gefragt. An diese Behörden war im Winter 1945/46 die Anordnung der Control Commission for Germany, British Element ergangen, für die Bildung von Jugend-Clubs zu sorgen.467 In Hannover schien man mit der Umsetzung dieser Aufgabe auf die Ankunft Theanolte Bähnischs gewartet zu haben. Die Regierungsvizepräsidentin gründete
462 Siehe Kapitel 2.2.3 und 3.3.4. 463 Grimme, Adolf: Jugend und Demokratie. Rede bei der Jugendkundgebung ‚Ruf an junge Menschen‘ in der Stadthalle zu Hannover am 07. Mai 1946, Hildesheim 1946. 464 Vgl.: Boll: Suche, S. 131. Boll stützt sich bei seiner Einschätzung auf ein Memorandum von Brigardier C. G. Maude, Hauptkontrolloffizier der Erziehungsabteilung der Hannoverschen Militärregierung vom 03.12.1946, NA, UK, FO 1010/57, Dok 47 B, Anlage, S. 4. 465 Die Mitgliedschaft in der Hitler-Jugend (HJ) beziehungsweise im Bund deutscher Mädel (BDM) und die Wahrnehmung von Dienstpflichten in den Organisationen war für alle Jugendlichen, die nicht aus rassistischen Beweggründen ausgeschlossen waren, in den Kriegsjahren obligatorisch. 466 Jansen: Jugend, S. 18. 467 NA, UK, FO 1050/1535, Military Government – Germany. British Zone of Control, IA&C Division Military Government Instruction N. [Nummer fehlt], Policy for the Formation of Associations of German Youth, O. D.
Regierungspräsidentin | 521
bald nach ihrem Amtsantritt im April 1946 den ‚Club junger Menschen‘.468 Oberst Hume zufolge war der Club seit Mai 1946 in der Entstehung begriffen.469 Der Club kannte – neben anders benannten, aber ähnlich arbeitenden Kreisen im ganzen Bundesgebiet – ein gleichnamiges Pendant in Hildesheim, eine Gründung, die ebenfalls vom Regierungspräsidenten des Bezirks ausgegangen war.470 Friedhelm Boll sieht in der Gründung von ‚Clubs junger Menschen‘ das Ergebnis einer Orientierung am britischen Vorbild.471 Diese Erklärung vermag vor allem dann zu überzeugen, wenn man sich vor Augen führt, daß nicht nur die Clubs in Hannover und Hildesheim, sondern auch Gründungen von Jugendclubs in anderen Regierungsbezirken unter anderen Namen die Kriterien erfüllten, welche die Militärregierung für die Etablierung politischer Jugendarbeit aufgestellt hatte, und daß sich die Clubs in ihren Zielsetzungen jeweils ähnelten. Hinreichend ist das Phänomen ‚Club junger Menschen‘ in Hannover damit jedoch noch nicht erklärt. Denn es scheint, als habe Theanolte Bähnisch mit ‚ihrem‘ ‚Club junger Menschen‘ auch an deutsche Traditionen angeknüpft – nämlich an die Jugendarbeit Friedrich Siegmund-Schultzes in der SAG-Berlin-Ost, die sie über ihren Mann kennengelernt hatte. Mit 18 Jahren und älter472 waren die Jugendlichen in Hannover jedoch älter als die in den Jungen-Clubs der SAG. Auch die SAG hatte einen regen Austausch mit dem westlichen Ausland, vor allem mit Großbritannien und den USA, gepflegt, was das Konzept, nach dem die Berliner Sozialreformer arbeiteten, beeinflußt hatte. Vor dem Hintergrund der Geschichte Albrecht Bähnischs in der SAG sind vor allem zwei Dinge besonders interessant: Zum einen, daß Theanolte Bähnisch Siegmund-Schultze persönlich – und
468 Daß die Gründung auf Bähnisch zurückgeht ist unter anderem folgendem Dokument zu entnehmen: NA, UK, FO 1056/530, Klub (!) junger Menschen (Youth Club), Inaugural meeting held on 8th August in the Beethovensaal, Hannover. 469 Ebd. 470 Vgl.: Boll: Suche, S. 27 und S. 84. So habe der Hildesheimer Regierungspräsident Joachim Raffert, der vor Ort einen informellen Gesprächskreis geleitete habe, dazu ermutigt, diesen in einen lizenzierten ‚Club junger Menschen‘ umzuwandeln, schreibt Boll. Ebd. Hierin wird ein ähnliches Prinzip deutlich, wie in der von der Militärregierung empfohlenen Festlegung von Frauenzusammenschlüssen auf das Konzept von Bähnischs ‚Club deutscher Frauen‘, beziehungsweise des ‚Frauenrings‘. 471 Vgl.: Boll: Suche, S. 61. Was für die Frauenbildung galt, kann also auch für die Jugendbildung konstatiert werden: Zu Recht weist Boll darauf hin, daß sich viel zu lange die Auffassung gehalten habe, die Besatzungspolitik in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sei konzeptlos gewesen. Richtig sei dagegen, so Boll, daß bereits vor Kriegsende vor allem bei den Briten Ausarbeitungen vorlagen, die recht genaue Vorstellungen von einem Wiederaufbau Deutschlands beinhalteten. Vgl.: Boll: Suche, S. 45. Boll verweist zur Untermauerung seiner Aussagen auf das Handbuch ‘Technical Manual on Youth Education and Church Affairs‘ aus dem Februar 1945. 472 In einer Akte des Britischen Außenministeriums ist das Alter der in Jugend-Clubs organisierten Jugendlichen mit 18 bis 30 Jahren angegeben. NA, UK, FO 1050/1209 [Office of the Educational Advisor], Education Branch Berlin, HQ CCB (B. E.) an das Büro des Educational Advisor, HQ CCB (B. E.), 19.02.1948, Anhang A.
522 | Theanolte Bähnisch
erfolgreich – darum gebeten hatte, den Club besuchen zu kommen473, zum zweiten, daß Gotthard Kronstein, der jugendliche Vorsitzende des ‚Clubs junger Menschen‘, ausgerechnet ein Projekt der Settlement-Bewegung besuchte, als er sich im Namen des Clubs auf seine Reise nach Großbritannien begab.474 Der Multiplikatoren-Effekt jener sechswöchigen Reise muß, zumal nur sehr wenigen Jugendlichen ein solcher Kontakt vergönnt war, „außergewöhnlich groß“475 gewesen sein. Wohl kaum zufällig berichtet eine deutsche Großbritannien-Besucherin im Zusammenhang mit ihrer Reise, auf der sie britische ‚Youth Clubs‘ kennenlernte, ebenfalls von Siegmund-Schultze als Initiator solcher Clubs in Deutschland.476 Da den deutschen Besuchern in Großbritannien jeweils ein ähnliches Programm geboten wurde, ist es sehr wahrscheinlich, daß nicht nur jene Besucherin, sondern auch Kronstein vor allem der ‚Youth Clubs‘ wegen ein Settlement besucht hatte. In Kronstein hatte Bähnisch einen Vertrauten gefunden, der, selbst noch ein junger Mann, in ihrem Sinn die Geschicke des am 08.08.1946 gegründeten Clubs leitete.477 Wie Bähnisch über ihre England-Reise gesprochen hatte478, so referierte auch Kronstein mehrfach über seine Reise – nicht nur in Hannover, sondern auch in ‚Nachbarclubs‘479, die in anderen Städten zu Hause waren. Das große Interesse der Jugendlichen an solchen Veranstaltungen zeigte, daß die Militärregierung auf dem richtigen Weg damit war, Verständigung zwischen deutschen und britischen Jugendlichen herzustellen. Daß Vertreter aus ihren Reihen nach Großbritannien reisen durften, hatten die Jugendlichen selbst eingefordert. Geplant war von der Militärregierung zunächst lediglich der Besuch britischer Jugendlicher in Deutschland, doch damit wollten sich die deutschen Jugendlichen nicht zufrieden geben. Überhaupt kann die Aktivität des Hannoveraner Clubs als sehr rege bezeichnet werden, was wohl ein Grund dafür war, daß Kronstein schließlich die Reise ins Ausland antreten durfte. Die Regierungspräsidentin überließ den Club jedoch nicht völlig der Leitung des 1921 geborenen Kronstein, sondern sie erschien selbst scheint hin und wieder persönlich bei den Jugendlichen vorbeigeschaut zu haben, die ihr Heim in einem Teil des Riefbunkers auf dem Grundstück der zerstörten Synagoge gefunden hatten.480
473 474 475 476 477 478 479
480
EZA, 626/75, Siegmund-Schultze an Bähnisch, 29.12.1949. Vgl.: Boll: Suche, S. 74 sowie S. 142. Ebd., S. 74. NA, UK, FO 1049/1245, Reisebericht von Frau Podlaszewski, [Berlin-]Schmargendorf, 05.12.1947. Vgl.: Mlynek, Klaus: Hannover Chronik: von den Anfängen bis zur Gegenwart: Zahlen, Daten, Fakten, Hannover 1991, S. 208. Siehe Kapitel 3.4.1.3. Vgl.: Boll: Suche, S. 74. Boll zufolge hat auch Joachim Raffert, später Bundesminister für Bildung und Wissenschaft unter Willy Brandt, als Mitglied des CdF (vermutlich im Hildesheimer Club) eine Reise nach Großbritannien unternehmen dürfen. Vgl.: ebd. Vgl.: Boll: Suche, S. 129, Abbildung aus dem Privatbesitz von Gotthard Kronstein.
Regierungspräsidentin | 523
Daß ausgerechnet im kleinen Warendorf in Westfalen eine Arbeitsbesprechung der ‚Vereinigung der Kreise junger Menschen‘ stattfand481, deutet darauf hin, daß die in Warendorf aufgewachsene Regierungspräsidentin Hannovers eine besondere Rolle in jener Vereinigung spielte. Einem bereits mehrfach zitierten Brief an Kurt Schumacher zufolge hatte Bähnisch bereits 1945 „an verschiedenen Orten angefangen, […] junge[…] Leute unter sich zusammenzubringen zu kleinen politischen Arbeitsgemeinschaften, vorläufig ohne Parteifärbung.“ Eine Arbeit im Sinne der SPD, so machte Bähnisch deutlich, sei diese Arbeit dennoch, denn die Jugendlichen sollten „über ihre eigene Erkenntnis, richtig geführt durch politische Aufklärung und gute Bücher zwangsläufig zum Sozialismus kommen und ihn aus innerer Überzeugung vertreten. Nur dann bekommen wir den Nachwuchs, der unserer Idee weitertragen kann.“482 Sie kehre auf ihren Reisen immer wieder zu ‚ihren‘ Jungens zurück, „spreche mit ihnen über die politische Entwicklung der letzten Jahrhunderte, die modernen wirtschaftlichen und sozialen Probleme und bringe sie an entsprechende Bücher heran. […] Das müsste aber viel systematischer an allen Orten gemacht werden, und zwar ohne Eintritt in die Partei zur Bedingung zu machen“, hatte sie dem SPDVorsitzenden mitgeteilt und erklärt: „Sonst werden sie gleich kopfscheu und störrisch oder man bekommt nur Konjunkturritter, die mir in der Seele zuwider sind“483. Wie stark Bähnischs Anteil an der Etablierung von Jugend-Zusammenschlüssen 1945 tatsächlich war, bliebe zu prüfen, ebenso wie die Frage, wie eng ihre Bestrebungen mit Friedrich Siegmund-Schultzes Versuchen, nach 1945 wieder an die SAG JugendClub-Arbeit anzuknüpfen, in Zusammenhang standen. Die Initiative zur Einrichtung und Pflege einer ‚Vereinigung der Kreise junger Menschen‘ war vom Hannoveraner Club – und damit ebenfalls vermutlich nicht unwesentlich von Bähnisch ausgegangen. Die Vereinigung hielt jedoch nur bis 1948 Treffen ab. 484 Überhaupt scheint 1948 ein einschneidendes Jahr im Hannoveraner Club gewesen zu sein. Mit dem Weggang Kronsteins zum Studium nach Köln ließen die Aktivitäten des Clubs stark nach. Boll zufolge existierte er nach 1948 „nur noch als geselliger Kreis“485. Jedoch wird weder für Bähnisch noch für die Militärregie-
481 Vgl.: Boll: Suche, S. 139. Friedhelm Boll zufolge hatte der Schriftsteller Paul Schallück den Warendorfer Club, der sich ‚Unabhängige Jugend-Diskussions-Gruppe‘ nannte, repräsentiert. Die Arbeitsbesprechung in Warendorf hatte am 17./18.01.1948 stattgefunden. Vgl.: AdSD, Depositum Joachim Raffert, Materialsammlung Club junger Menschen, Angabe nach Boll: Suche, S. 131, Anm. 5. Boll zufolge stammen die Unterlagen im Wesentlichen vom ehemaligen Vorstandsmitglied des Hannoveraner Clubs Hanno de Terra. Der Nachlaß Paul Schallücks ist im Stadtarchiv Köln, das zur Zeit der Abfassung dieser Dissertation aufgrund des Einsturzes nicht nutzbar war, überliefert. Über die Existenz von Korrespondenzen zwischen Schallück und Bähnisch oder anderen relevanten Unterlagen im Nachlaß Schallücks konnten daher keine Nachforschungen angestellt werden. 482 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945. Unterstreichung. i. O. 483 Ebd. 484 Vgl.: Boll: Suche, S. 139. 485 Ebd.
524 | Theanolte Bähnisch
rung hierin jedoch ein größeres Problem gelegen haben. Schließlich war bis 1948 bereits geleistet worden, was die Militärs und die Regierungspräsidentin angestrebt hatten: Ein offener, angstfreier Austausch von Jugendlichen, die verschiedenen politischen Einstellungen anhingen und der so einigen jungen Menschen überhaupt erst eine politische Positionierung ermöglichte. „Sie sind so völlig aus der Bahn gerissen, daß sie noch nicht einmal wissen, wie sie sich einen festen Standpunkt erarbeiten sollen“, wußte Bähnisch über die „jungen Leuten zwischen 20 und 30“ zu berichten. „Zugleich haben sie einen solchen Hunger nach Erkenntnis, daß sie wie Wachs in den Häden einer wirklichen Führung sind und man sie zu allem bringen kann, wenn man erst ihr Vertrauen gefunden hat“486, hatte Bähnisch 1945 an Kurt Schumacher geschrieben. 5.6.2.2 Orientierung am demokratischen Aufbau statt provokative Aufklärung über die Vergangenheit Im ‚Club junger Menschen‘ schien es den Jugendlichen möglich gewesen zu sein, ein Jahr nach Kriegsende jenen ‚Hunger nach Erkenntnis‘ zu befriedigen, von dem Bähnisch sprach und sich, wie von ihr erhofft, einen ‚festen Standpunkt‘ zu erarbeiten. „Die wichtigste Funktion, die Orientierungssuche, die zwischen Sommer 1946 und Sommer 1948 stattgefunden hatte, war offenbar abgeschlossen“, interpretiert der in der historisch-politischen Jugendbildung erfahrene Historiker Friedhelm Boll.487 Boll argumentiert, daß den mehrfach veränderten Statuten des Clubs eine zunehmende Ausrichtung auf demokratisches Denken im Lauf der Zeit zu entnehmen ist. Eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus habe dabei immerhin ansatzweise stattgefunden: Zu den erklärten Zielen des Clubs gehörten nämlich ‚Toleranz‘ und ‚Offenheit‘, was Friedhelm Boll als ein klares Abrücken vom NS-Ideal interpretiert. Immerhin eine Gruppe hatte das nahe Hannover gelegene Konzentrationslager Bergen-Belsen besucht.488 Zum Alltagsgeschäft des Clubs schien die Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust jedoch nicht gehört zu haben. Daß die Jugendlichen im ‚Club junger Menschen‘ in der Lage waren, ihren ‚festen Standpunkt‘ gegenüber der Militärregierung zu vertreten, bewiesen sie prompt: Von einer durch die Militärregierung versprochenen ‚Amnestie‘ der deutschen Jugend wollten sie nämlich nichts wissen, sondern sie forderten ‚Freispruch‘. Wo gar keine Schuld entstanden sei, sei eine Amnestie nicht von Nöten, argumentierten die Club-Mitglieder.489 Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, die Biographien aller Personen, die sich im ‚Club junger Menschen‘ zusammenfanden, zu rekonstruieren. Aussagen über individuelle Verstrickungen in das System sind deshalb nicht möglich. Allerdings waren die ältesten Club-Mitglieder um die 30 Jahre alt, was bedeutet, daß einige von ihnen durchaus aktive Rollen im System hatten spielen können. Viele der im Hannoverschen ‚Club junger Menschen‘ organisierten Jugendlichen hatten sich Offizier Hume als ehemalige Hitler-Jugend-Funktionäre vorge-
486 487 488 489
AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945. Ebd. Boll: Suche, S. 144. Ebd., S. 134.
Regierungspräsidentin | 525
stellt.490 Es ist also davon auszugehen, daß nicht nur viele Club-Mitglieder kurze Zeit zuvor noch in der HJ marschiert waren, sondern daß einige von ihnen den Organisationsalltag der HJ in der Region maßgeblich mitgestaltet hatten. Damit war es dem Club gelungen, genau jene Personen anzusprechen, die er erreichen wollte491: junge Menschen mit Multiplikatoren-Eigenschaften, die zunächst zu überzeugten Nationalsozialisten erzogen werden sollten und deren Umdenken nun andere Jugendliche beeinflussen konnte.492 Die Rechnung ging vor allem in Gotthard Kronstein auf: Er trat weit über die Grenzen des Clubs hinaus als Multiplikator auf: Mehrfach sprach er im NWDR über politische Themen wozu – wohl kaum zufällig – auch die Frauenbildung und -berufstätigkeit gehörte. Darüber hinaus war der Club mit von Kronstein verfaßten Artikeln in der Jugendzeitschrift ‚Zick-Zack‘, dem Vorläufer des ‚Stern‘, vertreten. Daß sich die Club-Mitglieder mit führenden Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben in Niedersachsen vernetzten, dafür sorgten die Militärregierung und Regierungspräsidentin. Der Club besuchte oder lud unter anderen ein: Den Kultusminister Adolf Grimme, den SPD-Parteivorsitzenden Kurt Schumacher, den Ministerpräsidenten Hinrich Wilhelm Kopf, den für Jugendpflege zuständigen persönlichen Referenten Grimmes, Hans Alfken, den Referenten für Theater, Film und bildende Kunst im Kultusministerium und späteren Intendanten des NDR-Fernsehens beim Sender Hamburg, Dr. Werner Pleister, den Wirtschaftsminister sowie Mitbegründer und späteren Aufsichtsratsvorsitzenden der Hannover Messe AG, Alfred Kubel und diverse Offiziere der Militärregierung.493 Gespräche des Clubs mit der Militärregierung hatten Friedhelm Boll zufolge vergleichsweise oft stattgefunden.494 Als besonders geeignete deutsche Ansprechpartner für die Jugendlichen schien die Militärregierung, welche die Jugend-Zusammenschlüsse in Hannover, Hildesheim, Braunschweig und Oldenburg als besonders progressiv und unterstützenswert ansah, wie-
490 Vgl.: Boll:Suche, S. 137. Boll bezieht sich auf eine Aktennotiz Humes in NA, UK, FO 1010/57. 491 Womöglich spielte nicht nur für Bähnischs Frauenarbeit, sondern auch für ihre Arbeit im Club junger Menschen der Einfluß der Women‘s International League auf die Besatzungspolitik der Briten in Deutschland eine Rolle. Ein Memorandum, das B. Duncan Harris, die Präsidentin der League am 10.05.1946 an Hynd übersandte, wirft die Frage auf, ob Frauen sich nicht speziell der ‚Nazi Civilians‘, insbesondere der HJ-Führer annehmen sollten. NA, UK, FO 938/252, The position of women in Germany, o. D., Anhang zu B. Duncan Harris an Hynd, 10.05.1946. 492 Die Clubs sollten vor allem auch ehemaligen Angehörigen der Hitler-Jugend ein Angebot zur Mitarbeit am demokratischen Wiederaufbau machen. Diese Ausrichtung des Clubs wird in den Eröffnungsreden von Hume und Bähnisch deutlich: NA, UK, FO 1056/530, Dok 12. Boll verweist auf dasselbe Dokument. Vgl.: Boll: Suche, S. 132, Anm. 10. 493 Vgl.: ebd., S. 142. 494 Vgl.: ebd., S. 139. Demnach war der Hildesheimer Club allein im ersten Halbjahr 1947 fünfmal mit der Militärregierung zusammengetroffen.
526 | The anolte Bähnisch
derholt Grimme und Kopf ins Spiel gebracht zu haben.495 Daß Bischof Lilje ebenfalls Gast im Club war, ist kein Zufall: Die britischen Vorstellungen über die Einrichtung von Jugendclubs hatten nämlich nicht nur die auf Landes-, Bezirks- und Kreisebene mit dem Bereich Erziehung betrauten, leitenden Behördenmitarbeiter erreicht, sondern auch „archbishops, bishops and ecclesiastical dignatories of equivalent status“496. Die lebensgeschichtlichen Interviews, welche Friedhelm Boll mit ehemaligen Club-Mitgliedern geführt hat, lassen den Schluß zu, daß die Einrichtung des Clubs demokratisches Denken unter seinen Teilnehmern befördert hat. Alle von Boll befragten Teilnehmer beschreiben die Jahre im Club als entscheidend für ihren weiteren, auf dem Boden der Demokratie beschrittenen Lebensweg. Das ehemalige Vorstandsmitglied des Hannoveraner Clubs, Hans Adolf de Terra, genannt ‚Hanno‘ trat später sogar in die Fußstapfen Theanolte Bähnischs: Er wurde 1966 Regierungspräsident von Hannover. 1972 bis 1980 gehörte er als Abgeordneter der CDU dem Bundestag an. Joachim Raffert, der dem Hildesheimer ‚Club junger Menschen‘ angehört hatte, wurde Journalist, 1953 Redakteur und 1964 stellvertretender Leiter des Ressorts für Politik bei der Hannoverschen Presse. 1965 bis 1972 vertrat der Vorsitzende der SPD in Hildesheim seine Partei auch im Bundestag. Mit der überparteilichen Ausrichtung des Clubs497 schien die Militärregierung im Schulterschluß mit der (Vize-)Regierungspräsidentin auf dem richtigen Weg gewesen zu sein: Die Befragten gaben an, daß sie damals vom Gedanken, sich auf eine Partei festlegen zu sollen, abgestoßen waren und die Möglichkeit, ihren persönlichen politischen Standpunkt im Club suchen zu können, genossen hatten.498 Auch wenn der Club keine „provokative Aufklärung“499 geleistet hat, so ist in seiner Einrichtung und Betreuung doch ein Erfolg Bähnischs, der Militärregierung und der Jugendlichen, die das Club-Leben gestalteten, zu sehen. „Agierten die Clubs [...] an der langen Leine der Bezirksregierungen, so dürfen sie keineswegs als deren Sprachrohr angesehen werden“500, betont Friedhelm Boll die Unabhängigkeit der Jugendlichen.
495 NA, UK, FO 1050/1209, Education Branch Berlin, HQ CCB (B. E.) an Office of the Educational Advisor, HQ CCB (B. E.), 19.02.1948, Anhang A: Übersicht von Jugendprojekten in der britischen Besatzungszone. 496 NA, UK, FO 1050/1535, Military Government – Germany. British Zone of Control, IA&C Division Military Government Instruction N. [Nummer fehlt], Policy for the Formation of Associations of German Youth, O. D. 497 Die Clubmitglieder selbst trugen ihren Teil dazu bei, eine einseitige politische Ausrichtung ihres Clubs zu verhindern. Laut Satzung durften maximal zwei von sechs Mitgliedern einer Partei angehören, wobei es bei den jeweiligen Inhabern der Posten des Vorsitzenden, des Schriftführers und des Kassierers nicht dieselbe Partei sein durfte. Vgl.: Boll: Suche, S. 139. Ob die Jungen die Satzung allein entworfen haben, ist allerdings nicht klar. 498 Vgl.: ebd. 499 Ebd., S. 144. 500 Ebd., S. 132.
Regierungspräsidentin | 527
5.6.2.3 Rekrutierung des Vorstands, Zusammensetzung und Vernetzung Die Zusammensetzung der Clubs war in sozialer wie in politischer Hinsicht bunter, als man vielleicht zunächst erwarten würde, proportional zur gesellschaftlichen Zusammensetzung war sie jedoch nicht: Wertet man, wie Friedhelm Boll es getan hat, eine Einladungsliste ehemaliger Mitglieder zu einem ‚Nachtreffen‘ aus, so zeigt sich, daß von 60 eingeladenen Personen 20 Prozent aus ‚Arbeiterhaushalten‘, 15 Prozent aus ‚kleinbürgerlichen Familien‘ und eine knappe Mehrheit von 58 Prozent aus dem ‚bürgerlichen Milieu‘ kam. Knapp die Hälfte der Eingeladenen war weiblich. Von den bereits parteipolitisch aktiven Mitgliedern war damals die Mehrzahl in der SPD oder KPD engagiert.501 Einige der eingeladenen Mädchen hatten ebenfalls aktive Rollen in der nationalsozialistischen Jugendarbeit ausgefüllt.502 Zweifelsohne handelte es sich bei den Clubmitgliedern um politisch und kulturell überdurchschnittlich interessierte junge Menschen. Darauf deutet unter anderem die Tatsache hin, daß der Club 1946 eine gemeinsame Veranstaltung zum Thema ‚Musik und Dichtung deutscher Klassik‘ in Zusammenarbeit mit der Hannoverschen Orchestervereinigung abgehalten hatte, die zugleich die erste Veranstaltung der Orchestervereinigung nach dem Krieg war.503 Die Veranstaltung hatte sich damit jenen Schwerpunkt gesetzt, der auch in der von Bähnisch herausgegebenen ‚Stimme der Frau‘ zu beobachten ist: Deutschland als Land der Dichter und Denker darzustellen und damit einhergehend das humanistische Bildungsideal des ‚wahren Menschen‘ zu beschwören. Für Theanolte Bähnisch, die hoffte, dem schlechten Bild Deutschlands, wie es sich im Dritten Reich präsentiert hatte, etwas entgegensetzen zu können und die die ‚geistige Erneuerung‘ der Deutschen anstrebte, war dies von zentraler Bedeutung im Wiederaufbau.504 Der Club unternahm diverse Anstrengungen, sich mit moderner Kunst und Musik auseinanderzusetzen und traf dabei in Hannover auf ein vergleichsweise gutes Angebot. Wie eng der Club mit dem Regierungspräsidium bzw. dem Land Niedersachsen und der Militärregierung verzahnt war, zeigt die Liste seiner Ehrenmitglieder. Neben dem ‚Hauptkontrolloffizier‘ des Regierungsbezirks Hannover, Hume, zählten in Hannover Oberstadtdirektor Bratke sowie Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf zu den prominenten Gallionsfiguren. Gotthard Kronstein war Hilfsreferent für Jugendfragen im Präsidialbüro der Regierung Hannover, Geschäftsführer des Clubs wurde Bähnischs persönlicher Referent Themeller, stellvertretender Leiter der Sohn von Werner Ellinghaus505, Wolfgang Ellinghaus506. Der Kassenwart des Clubs, ein
501 Vgl.: ebd., S. 137. 502 Vgl.: Boll: Suche, passim. 503 Vgl.: Homepage der Hannoverschen Orchestervereinigung auf: www.hannoverscheorchestervereinigung.de/pdf/hov_vita_lang.rtf, am 17.10.2011. Vgl. dazu auch Boll: Suche, S. 140. Boll zufolge hatte es im gleichen Monat eine zweite Veranstaltung ähnlichen Zuschnitts gegeben. Vgl.: ebd. 504 Vgl.: Freund: Krieg, S. 204. 505 Theanolte Bähnisch pflegte die Freundschaft mit Werner Ellinghaus bis zu seinem Tod im Jahr 1961. Vgl.: NLA HA HStAH, VVP 6, Nr. 78, Theanolte Bähnisch an Hinrich
528 | Theanolte Bähnisch
Herr Müller, war offenbar bei der Militärregierung angestellt.507 Auch der Umstand, daß die Eröffnungsveranstaltung des Clubs im August 1946 mit etwa 500 Teilnehmern im Beethovensaal stattfand,508 unterstreicht die enge Anbindung des Clubs an die Verwaltung. Die auf der Eröffnungs-Veranstaltung proklamierten Ziele lassen sich im Wesentlichen so zusammenfassen: Die Klubmitglieder wollten sich aktiv in das politische Geschehen einmischen, in ihrem Club-Leben aber parteipolitisch unabhängig bleiben. Zu ihrer politischen Vertretung beanspruchten sie Sitze in den lokalen und regionalen Parlamenten. Sie richteten sich also in ihrer Handlungslogik einerseits auf das neue politische System ein, wollten dieses jedoch nicht, wie es in demokratischen Referenzgesellschaften wie Großbritannien oder Frankreich der Fall war, ausschließlich von Parteien gestaltet wissen. Sie strebten nach Vernetzung mit anderen Jugendclubs im In- und Ausland, wollten die Chance erhalten, ihre (Aus)Bildung zu erweitern, und forderten einen Freispruch von jeglicher Schuld am Nationalsozialismus. Laut ihrer Erklärung wollten die Jugendlichen für einen langfristigen Frieden („a lasting peace“) arbeiten – eine Formulierung, die stark an ein entsprechendes Ziel des von Bähnisch gegründeten ‚Club deutscher Frauen‘ erinnert. Über ein Flugblatt verkündete der Club, sich von den „Irrlehren der Vergangenheit“ abwenden zu wollen und die „Erziehung zur Persönlichkeit“ und zum „demokratischen Staatsbürger“509 anzustreben. Inwiefern Theanolte Bähnisch Mutter des Gedankens an die Persönlichkeitswerdung war, läßt sich nicht rekonstruieren. Nicht nur für Siegmund-Schultze, sondern beispielsweise auch für Adolf Grimme, mit dem der Club ebenfalls im Austausch stand, war die ‚Persönlichkeitswerdung‘ eines der wichtigsten Politik- beziehungsweise Erziehungsziele.
506
507
508
509
Wilhelm Kopf, 10.07.1961. Im Brief berichtet sie von Ellinghaus‘ sehr schlechtem Gesundheitszustand und bietet Kopf an, beim nächsten Krankenbesuch Grüße zu übermitteln. Für Wolfgang Ellinghaus, der später als Arzt praktizierte und dann medikamentensüchtig wurde, weshalb er seine Approbation verlor, fühlte sich Theanolte Bähnisch verantwortlich. Vgl.: NLA HA HStAH, VVP 6, Nr. 78, Theanolte Bähnisch an Hinrich Wilhelm Kopf, 10.07.1961. Vgl.: Boll: Suche, S. 132. Aus dem Organisationsplan der Regierung Hannover 1949 geht jedoch hervor, daß ein Wolfgang Müller als Dolmetscher in der Abteilung „Allgemeine Angelegenheiten der Militärregierung“ angestellt war. Er war auch dafür zuständig, die Verbindung zur Militärregierung aufrecht zu halten. Vgl.: Organisationsplan der Regierung Hannover, Hannover 1949, S. 4. Vgl.: NA, UK, FO 1056/530 [Notes and minutes on meetings and conferences, PR/ISC/HE], Information Services Control Branch, Zonal Executive Offices, CCG Bunde, 62 HQ. CCG., B.A.O.R., Clara Boyle an diverse Adressen des Verteilers, 15.08.1946. AdSD, Materialsammlung Joachim Raffert, ‚An alle Interessenten‘, nicht eingesehen, zitiert nach Boll: Suche, S. 139.
Regierungspräsidentin | 529
Die Rednerin Gisela Heuer510 sprach auf der erwähnten Versammlung die besondere Situation der Frauen an. Anklänge an die Programmatik des von Bähnisch beinahe zeitgleich begründeten ‚Club deutscher Frauen‘ sowie an das Schwerpunkthema ‚Frauenberufe‘ und weibliche Berufstätigkeit in der ‚Stimme der Frau‘511 sind deutlich. Frauen hätten, so Heuer, im Dritten Reich ihren Willen nicht frei äußern dürfen, sondern ihr Leben sei völlig den Erfordernissen des Krieges unterworfen gewesen. Die jungen Mädchen hätten keine Gelegenheit gehabt, eine andere Welt, als die des Führers kennenzulernen. Nun seien sie mit der Frage konfrontiert, wie sie einen Beruf ergreifen und ihren Lebensunterhalt verdienen sollten. Gotthard Kronstein hob in seinem Rede-Beitrag darauf ab, daß die Lage für die Jugend nach dem Ersten Weltkrieg eine gänzlich andere gewesen sei. Nach dem Zweiten Weltkrieg gebe es nichts mehr, woran es sich anknüpfen ließe. „An entirely new way of life must be found“, faßte er die Lage zusammen. Auch Brigadier Hume hielt auf der Veranstaltung eine Rede. Dabei versuchte er eine Atmosphäre des Vertrauens herzustellen. Er sicherte den Jugendlichen zu, daß die Militärregierung die Interessen der Jugend nicht nur sehr ernst nehme, sondern sie auch sehr wohlmeinend behandeln werde. „I can assure you that the thoughts and aspirations […] will always be faithfully and sympathetically reported by Military Government“512, hob er auf die Verantwortung des ‚local comissioner‘, den übergeordneten Autoritäten von den Verhältnissen in der Region zu berichten, ab. Er bestärkte die jungen Männer und Frauen in ihrem Selbstvertrauen, indem er die Bedeutung der Militärregierung gegenüber der Eigeninitiative der Jugendlichen abschwächte: „We are the instruments and not the creatures of policy […]“513, hielt Hume fest und machte deutlich, daß die Zukunft Deutschlands in den Händen der Jugend liege. Diese möge ihre Stimme erheben. („youth to whom the future belongs should have its say“514). Theanolte Bähnisch hob in ihrer Rede darauf ab, daß die Jugendlichen sich nun in einem ‚No-mans-land‘ befänden und malte das Bild einer ,Tabula Rasa‘, mit der die junge Generation konfrontiert sei: „Each generation wants to start fresh in its own way; but this time there is no tradition on which to built, no base on which to start.“ Die ältere Generation sei sich ihrer Verantwortung für die Vergangenheit bewußt, auf der Basis eines gegenseitigen Vertrauens der Generationen in einander könne ein Ausweg gefunden werden. Am Ende ihrer Rede beschwor Bähnisch die Jugend für
510 Boll zufolge war Heuer die Tochter von SPD-Landtagsmitglied und Vorstandsmitglied der SPD im Bezirk Hannover, Albert Heuer. Heuer habe „Anregungen aus der sozialdemokratischen Frauenbewegung“ in den Club junger Menschen eingebracht, interpretiert Boll. Boll: Suche, S. 133. 511 Vgl.: Freund: Krieg, S. 213–233. 512 NA, UK, FO 1056/530, Klub junger Menschen (Youth Club), Inaugural meeting held on 8th August in the Beethovensaal, Hannover. 513 Ebd. 514 Ebd.
530 | Theanolte Bähnisch
einen bleibenden Frieden zu arbeiten und verlieh ihrer Hoffnung, daß sich eine „World Youth Peace Community“515 gründen würde, Ausdruck. 5.6.2.4 Die ‚Lage der Jugend‘ – (Auch) ein Stellvertreterdiskurs für die Lage der Gesellschaft „[i]ch weiß [...], daß für absehbare Zeit die deutsche Frage ein reines Jugendproblem ist“ 516, wird Theanolte Bähnisch zu ihrem jugendpolitischen Engagement 1946 in den Aachener Nachrichten zitiert. „Die Jugend muß behutsam aus den harten Schalen der Indifferenz herausgelöst werden; sie braucht Freundschaft aus richtiger Diagnose, wir geben ihr die Hand, um bis zur vollen demokratischen Mündigkeit alle Schritte gemeinsam zu gehen“, ließ die Vizeregierungspräsidentin verlauten, nicht ohne den Artikel in den Aachener Nachrichten zu einem Appell an die Aachener Bezirksregierung zu machen, es ‚Hannover‘ gleich zu tun. „Der Klub wird der jungen Generation die tragenden Fundamente schenken und ihr die ideellen Werte eines lohnenden Daseins zurückgeben“517, gab sich Bähnisch von der gesellschaftsstabilisierenden Funktion ihres Clubs überzeugt. Ein Schlüssel zum Verständnis von Bähnischs Bedürfnis, sowohl den Stellenwert ‚der Jugend‘ für den Wiederaufbau der Gesellschaft, als auch die eigene Arbeit für ‚die Jugend‘ so stark zu überhöhen, liegt in Philip Jost Jansens Überzeugung, daß der Diskurs um die Lage der deutschen Jugend in den ersten Wiederaufbaujahren im Grunde ein Stellvertreterdiskurs für die Lage der Gesellschaft an sich gewesen sei. Das Reden über Jugend, so der Diskursanalytiker Jansen, sei, besonders in Phasen großer Umbrüche, „ein chiffriertes Reden über das gesellschaftliche Selbstverständnis.“ Als „einfache Faustregel“ hält Jansen fest, daß Jugendbeobachtung – und um nichts anderes handelte es sich, wenn die Regierungspräsidentin den Alliierten im Bezirk Bericht über die ‚Lage der Jugend‘ erstattete und diese wiederum an die höheren Dienststellen entsprechend berichteten – immer dann Konjunktur habe, „wenn eine Gesellschaft als Ganzes an vorherige Wertetraditionen nur unsicher anknüpfen“518 könne. Als Theanolte Bähnisch begann, mit Jugendlichen zu arbeiten und ihre Stelle in Hannover antrat, lagen sämtliche möglichen Gründe für eine solche Werteunsicherheit vor, die Jansen erwähnt: „Äußerlich sichtbare“ Gründe [des] „Systemumbruchs, Krieg [...] oder die Folgen von Migration“ wie auch „weniger sichtbare und allmähliche Entwicklungen wie der Legitimitätsverlust alter Eliten“519. Jugend eigne sich „zur Projektionsfläche für das, was die Gesellschaft an Werten und Leitbildern definieren möchte, wie keine andere Gruppe sonst“, erklärt Jansen. Schließlich scheine, so der Mitarbeiter des Leibniz-Instituts für Sozialforschung, in ihr „im Kleinen […] bereits das vorhanden, was die Gesamtgesellschaft morgen
515 NA, UK, FO 1056/530, Klub junger Menschen (Youth Club), Inaugural meeting held on 8th August in the Beethovensaal, Hannover. 516 O. V.: Gegenwart. 517 Ebd. 518 Jansen: Jugend. 519 Ebd.
Regierungspräsidentin | 531
ausmachen wird.“520 Auch Tabu-Themen, so Jansen, würden damit gesellschaftsfähig. Man mag sich an die eine oder andere Passage der nur wenige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges von Theanolte Bähnisch verfaßte Staatsexamensarbeit über ‚Sittenpolizei und Prostitution‘ erinnert fühlen. Tatsächlich engagierte sich Bähnisch auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder gegen die ‚sittliche Verrohung‘ Jugendlicher, beispielsweise im Rahmen ihrer Gutachtertätigkeit für die ‚Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften‘. Diese ging nach Aussage ihres ersten Vorsitzenden, Robert Schilling, von einer „verbindlichen Sittlichkeit, die den ethischen Kern der abendländischen Kultur darstellt“521 aus. Die Historikerin Adelheid von Saldern vertritt allerdings – womit sie Jansens These bestätigt – die Meinung, daß es bei der Schmutz-und-Schund-Debatte „weniger um die Jugend als um Familienordnung und öffentliche Sittlichkeit und um die Einschränkung der Pressefreiheit unter dem Deckmantel des Jugendschutzes“522 gegangen sei. An ‚der Jugend‘ ließ sich kritisieren, was man ‚der Gesellschaft‘ nicht unterstellen wollte, denn erstere konnte als unfertig, irregeleitet und fehlerhaft charakterisiert werden, ohne daß ‚ihr‘ daraus einen Vorwurf zu machen. Einerseits darf es als common sense in der Gesellschaft gelten, daß Erwachsene den Heranwachsenden Hilfestellung geben und pädagogisch auf die Jugendlichen einwirken müßten, wozu auch korrigierende Maßnahmen gehörten. Andererseits sah man es ‚den Jugendlichen‘ nach, auf Irrwege zu gelangen und Fehler zu machen. Man traute ihnen zu, aus ihren Fehlern zu lernen und neue Wege einzuschlagen und damit einem Anspruch zu genügen, den demokratisch orientierte Eliten und die Besatzungsmächte an die ganze Gesellschaft richteten. Ob Angebote wie der Club junger Menschen, wie Friedhelm Boll es darstellt, Helmut Schelskys These von der ‚skeptischen Generation‘ widerlegen und damit auch die Schlußfolgerungen darauf aufbauender Arbeiten hinfällig sind, welche argumentieren, daß diese Generation „innerlich unbeteiligt an den politischen Debatten der Nachkriegszeit“ gewesen sei und sich „illusionslos, anpassungsgeschickt“ und „zupackend“ dem Wiederaufbau gewidmet habe523, ist schwer zu beantworten. Generalisierungen sind, soviel zeigt das Beispiel ‚Club junger Menschen‘ wenig zielführend. Es ist kaum von der Hand zu weisen, daß der Club nur einen kleinen Prozentsatz von Jugendlichen im Raum Hannover ansprechen konnte und vor allem bei jenen auf offene Ohren stieß, die ohnehin politisch interessiert waren.
520 Jansen: Jugend, S. 20. 521 Robert Schilling zitiert nach Jansen: Jugend, S. 183. 522 Jansen: Jugend, S. 188. Jansen zitiert sinngemäß aus Saldern, Adelheid von: Kulturdebatte und Geschichtserinnerung: Der Bundestag und das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (1952/53), in: Bollenbeck, Georg/Kaiser, Gerhard (Hrsg): Die janusköpfigen 50er Jahre, München 2000, S. 87–114. 523 Boll: Suche, S. 20 mit kritischem Verweis auf Bude, Heinz: Deutsche Karrieren. Lebenskonstruktionen sozialer Aufsteiger aus der Flakhelfer-Generation, Frankfurt a. M. 1987, S. 45. Zum Bedeutungsgehalt des Begriffs ‚skeptische Generation‘ vgl.: Schelsky, Hartmut: Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend, Düsseldorf/Köln 1957.
532 | Theanolte Bähnisch
Fakt ist, daß Theanolte Bähnisch einen Anteil an der Etablierung und Aufrechterhaltung einer auf Demokratisierung abzielenden Jugendarbeit hatte, der nicht kleingeredet werden sollte. Schließlich bot der ‚Club junger Menschen‘, wie verwandte Organisationen in anderen Städten, seinen Mitgliedern etwas, das Boll als „Lernprozeß zur politischen Teilhabe“524 charakterisiert. Vor dem Hintergrund einer offenbar tatsächlich verbreiteten Parteienphobie zu jener Zeit ist die Idee, die Zusammenschlüsse parteipolitisch offen zu halten, zu würdigen. Daß es ihr selbst neben ihrem Amt als (Vize-)Regierungspräsidentin und Präsidentin des Clubs deutscher Frauen/DFR gelang, ihre Ideen zur Jugendarbeit vergleichsweise stark zu ‚exportieren‘ wie es ihr – wie die nächsten Kapitel zeugen werden – in Bezug auf die Frauenarbeit gelingen sollte, ist, trotz der Existenz der ‚Vereinigung der Kreise junger Menschen‘ unwahrscheinlich. 5.6.2.5 Bähnischs Club-Gründungen als Trend und Gegen-Trend zugleich Mit den Gründungen ‚Club junger Menschen‘ und ‚Clubs deutscher Frauen‘, um den es im nächsten Kapitel gehen wird, leistete Theanolte Bähnisch einen Beitrag zum kulturellen und politischen Leben in der Stadt. Dieser Beitrag folgte einerseits einer geradezu inflationären Entwicklung, denn kurz nach Kriegsende waren in Hannover – zumal Parteien, wie andernorts auch, noch nicht zugelassen waren – diverse Clubs und Zirkel gegründet worden. Ein Treffpunkt wichtiger Eliten der Stadt war der ‚Club zu Hannover‘, welcher sich am 05.12.1945 konstituiert hatte.525 Einem Spiegel-Artikel zufolge wurde dem Club die „Nähe zum Kulturbund“526 nachgesagt. Ein Artikel im Hannoverschen Biographischen Lexikon charakterisiert den von Ludwig Ey mit gegründeten und von Hugo Vierthaler geleiteten Club als einen reinen „Männerclub nach britischem Vorbild“527. Frauen tauchen in den Mitglieder-Listen tatsächlich nicht auf. Mit ihren Gründungen ‚Club junger Menschen‘ und ‚Club deutscher Frauen‘ setzte Bähnisch also – ob sie einem Trend folgte – gleichzeitig auch einen Kontrapunkt zum ‚Club zu Hannover‘, denn mit ‚ihren‘ Clubs sprach sie gesellschaftliche Gruppen an, die im ‚Club zu Hannover‘ nicht vertreten waren, die aber ebenfalls ein Interesse an der Mitgestaltung des Wiederaufbaus in der Region hatten. Neben der bereits erwähnten, von Katharina Petersen gegründeten ‚HannoverBristol-Society‘ ist schließlich noch die in Hannover ebenfalls existierende ‚DeutschEnglische Gesellschaft‘ erwähnenswert, zumal auch diesem Zusammenschluß die
524 Boll: Suche, S. 24. 525 Stadtarchiv Hannover, VVP Frau, 750, Nr. 43. Statut des Clubs zu Hannover, 05.12.1945. Im Club waren unter anderem Bratke, Grimme, Ellinghaus und Lotze vertreten, aber auch Personen aus der Wirtschaft, der Wissenschaft etc. Frauen waren nicht unter den Mitgliedern. 526 O. V.: Perserteppich Deutschland. Dertinger meinte nicht, in: Der Spiegel, 26.05.1949, S. 8/9, hier S. 8. 527 Art. „Ludwig Ey“, in: Hannoversches biographisches Lexikon: von den Anfängen bis in die Gegenwart, Hannover 2002, S. 112/113.
Regierungspräsidentin | 533
Regierungspräsidentin selbst vorstand. Die Verbands-Arbeit lag wesentlich in der Hand offizieller Funktionsträger. Drei Folgetermine im April 1947 wurden nacheinander von C. K. McDowall Esq., dem Brigardier Hume und Theanolte Bähnisch gestaltet528. Der Club schien also (auch) den Zweck einer Plattform zum offiziösen Austausch zwischen deutschen Verwaltungseliten und der Militärregierung vor Ort gehabt zu haben. Die Verzahnung der Gesellschaft mit dem Regierungspräsidium muß – wie die des Clubs junger Männer‘ und des ‚Clubs deutscher Frauen‘ – sehr eng gewesen sein: Laut der Veranstaltungsankündigung bedurfte die Einladung deutscher Gäste „der Genehmigung von Frau Regierungspräsident Bähnisch und einem britischen Mitglied des Comitees“529, als dessen Adresse ‚Am Archive 3‘, die Adresse des Regierungspräsidiums, angegeben war. Im Rahmen von Versammlungen der Gesellschaft sprach die Regierungspräsidentin unter anderem zum Thema ‚Gemeinschaftserziehung‘ und berichtete von den Eindrücken, die sie auf ihrer Reise nach Großbritannien Ende 1946 gesammelt hatte. Einer Akte aus dem Stadtarchiv Hannover läßt sich entnehmen, daß eine ‚Deutsch-Englische Gesellschaft‘ in Hannover offensichtlich bereits in den dreißiger Jahren bestanden hatte und daß diese zu jener Zeit auch Beziehungen zur DeutschbBritischen Gesellschaft in Wiesbaden gepflegt hatte.530 Auf überregionaler Ebene war eine Deutsch-Englische Gesellschaft erst 1949 in Düsseldorf von Lilo Milchsack gegründet worden. Offenbar handelte es sich bei der in Hannover gegründeten Gesellschaft um einen regionalen Vorgänger dieser Gründung auf Bundesebene. Dieselbe Akte enthält die Information, daß 1949 „unter dem Patronat des Militärgouverneurs und dem Ehrenvorsitz des britischen Gebietsbeauftragten und des Niedersächsischen Ministerpräsidenten“531 ein „Deutsch-Englischer Club“ in Hannover gegründet werden sollte, um „engere Beziehungen zwischen Briten und Deutschen herzustellen“532. Unter den Gründungsmitgliedern finden sich auch Theanolte Bähnisch und Adolf Grimme.533 Ob es sich bei dem Club um einen Nachfolger der Gesellschaft handelte oder ob er unabhängig von dieser bestand, geht aus den eingesehenen Quellen nicht klar hervor.
528 Vgl.: Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 826. Deutsch-Englische Gesellschaft, Deutsches Comitee, Hannover, 12.04.1947. Veranstaltet wurden die Abende im ehemaligen YMCAHeim am Maschsee. 529 Ebd. 530 Vgl.: ebd. 531 LKA Hannover, L3 III, Staatskanzlei Dr. Walter Zechlin (Ministerialdirektor und Pressechef) an Bischof Hanns Lilje, 17.06.1949. 532 Ebd. 533 Vgl.: NLA HA HStAH, Hann. VVP 3, Nr. 1 [Nachlaß Günther Gereke]. Anlage zu einem Schreiben der Staatskanzlei (Zechlin) an Gereke, 17.06.1948, Anlage: Liste der Gründungsmitglieder.
6
Überparteilich, aber nicht unpolitisch: Genese und Arbeit, Mitglieder, Förderer und Gegenspieler von Bähnischs Club deutscher Frauen
6.1 EINFÜHRUNG UND AUSBLICK: EINTRETEN FÜR DIE MITARBEIT VON FRAUEN – DIE REGIERUNGSPRÄSIDENTIN STELLT SICH EINER (WEITEREN) GROSSEN HERAUSFORDERUNG „Ich habe es als staatspolitische Aufgabe angesehen, dass ich mich um die Frauen kümmere“1, wird Theanolte Bähnisch im Oktober 1949 im ‚Mannheimer Morgen‘ zitiert. In einem Artikel, der sie in ihrem Amt als Regierungspräsidentin porträtiert, wirkt diese Aussage in zweifacher Hinsicht irritierend. Oblag der hohen Beamtin nicht die Pflicht, ihren Arbeitsalltag zum Wohl aller Bürger des Regierungsbezirks Hannover, gleich welchen Geschlechts, auszugestalten? Und gehörte es etwa zu ihren Aufgaben als Regierungspräsidentin, ‚Staatspolitik‘ zu betreiben? Schließlich war es doch Aufgabe der Bezirksregierung zu verwalten und nicht etwa, zu regieren.2 Zieht man sich auf die Argumentation zurück, daß ihr Amt als Regierungspräsidentin eine Sache und das als Begründerin und Vorsitzende zunächst eines städtischen, bald eines niedersächsischen, dann eines zonenweiten und schließlich eines westdeutschen Frauenzusammenschlusses eine andere gewesen sei, wird man den Realitäten nicht gerecht. Denn die Arbeit Bähnischs in beiden Feldern überschnitt sich vielfach. Zudem gingen von beiden (Macht-)Positionen jeweils starke Effekte auf die jeweils andere aus. Von der selbstbewußten Juristin war dies, ebenso wie von ihren Unterstützern – allen voran war dies die britische Militärregierung – gewollt. Nur selten standen, so wird sich in späteren Kapiteln zeigen, Notwendigkeiten, die mit der einen großen Aufgabe einhergingen, Interessen im Weg, die mit der anderen verbunden waren. Dennoch muß Bähnischs Rolle als Vorsitzende jener Frauenorganisationen gesondert behandelt werden, denn was als Frauenorganisation ‚bei der
1 2
Henny-Hoffmann: Präsident. Siehe Kapitel 5.2.7.1.
536 | Theanolte Bähnisch
Regierung Hannover‘3 begann, wuchs schnell weit über die Grenzen des Regierungsbezirks hinaus. Zudem war Bähnisch zwar die wohl wichtigste Protagonistin der bürgerlichen Frauenbewegung der Nachkriegszeit, jedoch interagierte sie auf jenem Feld mit vielen anderen zentralen Personen in einer Organisation, die bis heute existiert. Ihr Bekanntheitsstatus als Präsidentin des ‚Deutschen Frauenrings‘ überstieg schließlich deutlich ihren Bekanntheitsstatus als Regierungspräsidentin Hannovers. Als Begründung dafür, daß sie sich – wesentlich in den Jahren 1946 bis 1952 – neben ihrem Amt als Regierungspräsidentin dieser zweiten großen (Lebens-)Aufgabe widmete, betonte sie den Umstand, daß zwei Drittel der deutschen Bevölkerung in der direkten Nachkriegszeit Frauen seien4 und daß diese damit auch fast zwei Drittel der Wahlbevölkerung stellten. Außerdem gingen, so Bähnisch, 80 Prozent des Nationaleinkommens durch weibliche Hände,5 was zeigt, daß die Regierungspräsidentin die Rolle von Frauen als Haushälterinnen im weiteren Sinn vor Augen hatte. Vor dem so beschriebenen Hintergrund kritisierte sie, daß die prozentuale Vertretung von Frauen im Bundestag viel zu gering sei. Sie erklärte, daß auch die gesetzliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern dringend verwirklicht werden müsse6, worin sich bereits abzeichnet, was ebenfalls in den folgenden Kapiteln deutlich werden wird: Die staatsbürgerliche Gleichstellung von Mann und Frau, wie sie in der Weimarer Verfassung festgeschrieben war, sah die Juristin als unzureichend an. Nicht nur in Politik und Beruf, sondern auch im Privatleben sollten Frauen den Männern Bähnischs Meinung nach rechtlich gleichgestellt werden. Nahezu sämtliche Artikel über die Regierungspräsidentin aus den ersten Jahren ihrer Dienstzeit vermitteln die gleiche Botschaft: Die Gesellschaft könne und dürfe auf die Unterstützung von Frauen – nicht nur, aber vor allem auch im Sinne eines ausgewogeneren gesellschaftlichen Lebens – nicht länger verzichten. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Ausbildung und ihrer herausgehobenen Stellung als Regierungspräsidentin nimmt es nicht wunder, daß Bähnisch vor allem ihr Interesse an einer stärkeren Quote von Frauen im Staatsdienst betonte. Doch ein „Blaustrumpf“7 oder gar „vermännlicht“8 sei die Regierungspräsidentin nicht, wollten sinngemäß verschiedene Journalisten, die über die Regierungspräsidentin schrieben, ihre Leser beruhigen. Die Juristin strebe gar nicht an, daß Frauen ein „Machtfaktor“ würden, sondern vielmehr, daß ihre Teilhabe ein „ordnender Faktor“9 sei. In
3
4
5 6 7 8 9
In einem Artikel von 1948 wird Bähnisch, die als Regierungspräsidentin porträtiert wird, mit den Worten zitiert, sie habe „bei uns die Frauenorganisation“ geschaffen. Sybill: Porträt. Vgl.: O. V.: Schubfach. Für einen Blick aus der Retrospektive vgl. auch: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 162. Diese Zahlen bestätigt ein Lagebericht der IHK Düsseldorf aus dem Jahr 1946. Vgl.: Böke, Karin/Liedtke, Frank/Wengeler, Martin (Hrsg.): Politische Leitvokabeln in der Ära Adenauer, Berlin/New York 1996, S. 213. Vgl.: O. V.: Schubfach. Vgl.: O. V.: Politik mit klugem Herzen, in: Die Welt, 12.10.1947. Vgl.: Wiese: Präsidentin. Henny-Hoffmann: Präsident. O. V.: Politik mit klugem Herzen, in: Die Welt, 12.10.1947.
Club deutscher Frauen | 537
diesen Zeitungsartikeln, welche die Haltung der vor allem unter Sozialdemokraten beruflich sozialisierten Theanolte Bähnisch durchaus zutreffend wiedergeben, schlägt sich derselbe befangene Umgang mit der Macht nieder, wie er, der Historikerin Petra Holz zufolge, Christdemokratinnen zu jener Zeit eigen war.10 Wie Bähnisch waren die von Holz untersuchten Politikerinnen allesamt davon überzeugt, daß gerade in der ‚Differenz‘ von Männern und Frauen11 die Notwendigkeit zur Beteiligung letzterer am ‚öffentlichen Leben‘ begründet liege. Nicht zuletzt auf das gedankliche „Konstrukt von dem stets ausgleichenden und vermittelnden Geschlechtscharakter der Frau“12, ist es zurückzuführen, daß sich jene Frauen scheuten, die Macht, nach der sie doch erkennbar verlangten, auch explizit einzufordern. Wie Bähnisch die bereits erwähnte quantitative Komponente ihrer Argumentation für eine stärkere Partizipation von Frauen am gesellschaftlichen Leben um eine qualitative Komponente erweiterte, zeigt, daß sie exakt jener, unter Christdemokratinnen, aber auch unter liberal eingestellten Frauen verbreiteten Idee vom aufbauenden und ausgleichenden Charakter von Frauen anhing. In den ‚Hessischen Nachrichten‘ beklagte sie, daß das öffentliche Leben unter einen Mangel an „weiblicher Substanz“13 leide. Schon in der Wahl jener an die aristotelische Lehre erinnernden Formulierung14 zeigt sich, daß Bähnisch den Männern ‚ihren‘ Platz nicht streitig machen wollte. In der ersten Ausgabe ihrer Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ erklärte sie, die Zukunft müsse so aussehen, „daß in der großen Familie des Volkes die aufbauenden Kräfte
10 Vgl.: Bussiek, Dagmar: Rezension zu: Holz, Petra: Zwischen Tradition und Emanzipation. Politikerinnen in der CDU in der Zeit von 1945 bis 1957, Königstein 2005, auf: H-soz-uKult, 20.01.2005, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2005-1-050, am 13. 12.2013. 11 Bussiek weist zu Recht darauf hin, daß die Debatte um ‚Gleichheit‘ und ‚Differenz‘ auch heute noch nicht abgeschlossen sei. Dies schlägt sich in verschiedenen Forschungsrichtungen nieder, die sich mit den Geschlechtern und ihrer Geschichte beschäftigen. Während die ‚Frauenforschung‘ ihre Forschungen stärker an der Idee einer gegebenen biologischen Differenz ausrichtet, welche kulturell ausgeformt, teilweise überhöht und gesellschaftlich reproduziert wird, negiert die Schule der ‚Gender Studies‘ eine gegebene Differenz und konzentriert sich ganz auf die Dekonstruktion gesellschaftlich erzeugter Differenzen. ‚Gender Mainstreaming‘ berücksichtigt Ansätze beider Denkschulen und baut darauf Analysen der Gegenwart sowie Zielvorgaben für die Zukunft auf. Vgl. für eine weitgehend dekonstruktivistisch angelegte Diskurs-Analyse der von Bähnisch herausgegebenen ‚Stimme der Frau‘: Freund: Krieg. 12 Bussiek: Rezension zu Holz: Tradition. 13 Sybill: Porträt. 14 In der aristotelischen Lehre vereinigen sich die Geschlechter, indem sich die männliche Substanz, die ‚causa formalis‘, mit der weiblichen Hülle, der ‚causa materialis‘, zu einem neuen menschlichen Wesen verbindet und so die ‚causa finalis‘ bildet. Schon in der Diskussion unter Zeitgenossen des Aristotelis erfuhr diese Lehre Kritik. Es wurde diskutiert, ob nicht auch der weibliche Beitrag zur Zeugung als substantiell verstanden werden müsse. Darauf basierend ist die aristotelische Lehre bis zur Gegenwart Gegenstand feministische Kritik geblieben. Vgl.: Butler, Judith: Körper von Gewicht, Berlin 1997.
538 | Theanolte Bähnisch
der Frau eine gute Ehe eingehen mit dem Gestaltungswillen des Mannes, dass Mann und Frau gemeinsam Einfluss nehmen auf die Dinge des öffentlichen Lebens“15. Daß die Gesellschaft in ihrer Wahrnehmung eine unvollständige, fehlerhafte sei, wenn Frauen nicht an den entscheidenden Stellen mitwirkten, machte sie deutlich, indem sie sich hinter den Helene Lange zugeschriebene Ausspruch „das Fehlen der Frau im öffentlichen Leben wirkt sich aus, wie Mutterlosigkeit in der Familie“16 stellte. In den ‚Aachener Nachrichten‘ erhob Bähnisch die Gefahr weiblicher Apathie gegenüber dem öffentlichen Leben sogar zu einer Endzeitstimmung verbreitenden Drohung. „Versagt heute die Frau, indem sie ihre Stellung nicht richtig erkennt, ist alles verloren.“17 In den Jahren 1946 bis 1952 leistete die Juristin, die ab 1948 auch als Publizistin auftrat, nicht nur die im letzten Kapitel beschriebenen Beiträge zum Wiederaufbau in der Region Hannover, sondern sie suchte sich eine zweite große Herausforderung darin, Frauen über die Grenzen Niedersachsens hinaus durch eine Förderung ihres „staatsbürgerlichen Sachverstandes“18 für die Notwendigkeit zur Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu sensibilisieren und sie inhaltlich auf diese Aufgabe vorzubereiten. Ihrer Meinung nach konnten, so argumentiert sie 1948 in der ‚Stimme der Frau‘, politisch nicht geschulte Frauen allzu leicht Opfer demagogischer Experimente werden.19 Daß das Wissen – oder auch das Nichtwissen – über geltende und erstrebenswerte zivilrechtliche Bestimmungen und Kenntnisse um staatsbürgerliche Rechte zwei Seiten derselben Medaille waren und daß das Bewußtsein darüber dem Ziel der weiblichen Emanzipation besonders zuträglich war, thematisierte Bähnisch nicht explizit. Daß sie an diesen Zusammenhang gedacht haben muß, läßt sich jedoch sowohl aus der Berichterstattung der ‚Stimme der Frau‘20 als auch aus ihren im Folgenden vorgestellten Äußerungen zwischen den Zeilen lesen. Daß sie den Zusammenhang nicht offensiv thematisierte, ist womöglich auf das bereits erwähnte Paradox zurückzuführen, daß Frauen ihrer Meinung nach zwar mehr Macht erlangen sollten, daß sie offiziell jedoch genau dies negierte. Fakt ist, daß sich die Regierungspräsidentin in den folgenden Jahren dafür einsetzte, den Einfluß von Frauen in familiären, beruflichen und politischen Zusammenhängen zu mehren und ihre Rechte in diesen Zusammenhängen zu stärken. Welche Rolle die ‚Stimme der Frau‘ hierfür spielte, wurde bereits analysiert21, weshalb in der hier vorliegenden Arbeit nur anhand einiger Beispiele auf die Zeitschrift rekurriert wird. Das Folgende soll, anknüpfend an die Einleitung dieser Arbeit erneut betont beziehungsweise den folgenden Kapiteln vorweggenommen werden: Für Bähnischs Definition einer adäquaten Stellung von Frauen in der Gesellschaft und des ‚richti-
15 Wolf: Augen. 16 Köhler, Erika-Roswitha: Eine Frau regiert mit viel Verstand und noch mehr Herz, in: Norddeutsche Zeitung, Nr. 105, 07./08.05.1955. 17 O. V.: Gegenwart. 18 Vgl.: O. V.: Schubfach. 19 Vgl.: Wolf: Augen. 20 Vgl.: Freund: Krieg. 21 Vgl.: ebd.
Club deutscher Frauen | 539
gen‘ Weges, der zu diesem Ziel führen sollte, spielten vor allem fünf wesentliche, teils interdependente Faktoren eine Rolle: 1.) Die Ausgangslage der deutschen Bevölkerung 1945/46, 2.) die Hoffnungen und Erwartungen der britischen Militärregierung, deren Verwaltungszone den Regierungsbezirk Hannover und das neu gegründete Land Niedersachsen umfaßte, 3.) die Traditionen der deutschen bürgerlichen Frauenbewegung, die sich mit dem ‚Bund deutscher Frauenvereine (BDF)‘ 1933 organisatorisch aufgelöst hatte, 4.) Bähnischs familiäre, berufliche und politische Sozialisation und 5.) Der ‚Ost-West-Konflikt‘ beziehungsweise der ‚Kalte Krieg‘.22 Bei der Analyse ihres frauenpolitischen Wirkens wird deutlich werden, wie Bähnisch mit ihren Ideen, ihren Überzeugungen und ihrer Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Eliten einen Beitrag zum Wiederaufbau von Staat und Gesellschaft leistete, der nicht nur für die Region Hannover, das Land Niedersachsen und die britische Besatzungszone, sondern für die ganze ‚Bonner Republik‘ und sogar darüber hinaus weichenstellend war. Ihre Politik beeinflußte nicht nur den Wiederaufbau der Frauenbewegung und der Frauenbildung, die Frauenberufstätigkeit, Rollen(bilder) von Frauen sowie das Zusammenleben der Geschlechter und der Familien nach 1946. Sie nahm, im Zusammenhang mit den genannten Aspekten, auch Einfluß auf den Wiederaufbau der sozialen Arbeit in Deutschland, auf die Wiederherstellung internationaler Beziehungen in der Frauenbewegung sowie auf Westdeutschlands Position im Kalten Krieg.23 Dieses Wirken war geprägt von ihren Sozialisationserfahrungen und den Kontakten, die sie, teilweise gemeinsam mit ihrem Mann, etabliert und gepflegt hatte und folgte gleichzeitig der Handlungslogik derer, die ihren Karriereweg ab 1945 unterstützten. Für ihre Arbeit im Wiederaufbau der Frauenbewegung in Deutschland galt, was auch für ihre Arbeit in der niedersächsischen Verwaltung grundlegend war: Als Teil eines Netzwerks, welches sich vor allem aus Eliten der preußischen Politik und Verwaltung sowie der (Jugend- und Erwachsenen-)Pädagogik in der Weimarer Republik rekrutierte, konnte sie sich der Unterstützung einflußreicher Personen sicher sein und innerhalb, aber auch außerhalb dieses Netzwerks ihren Einfluß geltend machen und sehr schnell neue, für ihre Ziele hilfreiche Kontakte knüpfen. Als Verwaltungsjuristin
22 Der häufig synonyme Gebrauch beider Termini ist irreführend, da die Wurzeln des ‚OstWest‘-Konflikts bis in den Krimkrieg von 1854–1856 zurückreichen. Er bestand also bereits weit vor dem Zweiten Weltkrieg. Vgl.: Stöver: Krieg, S. 8. Der ‚Kalte Krieg‘, der sein Ende offiziell mit dem Zusammenbruch des Sowjet-Imperiums 1989–1991 fand, war dagegen ein aktiv betriebener ‚Nicht-Frieden‘ (nach politologischer Definition ein ‚negativer Frieden‘), geprägt von einer Aufrüstungsspirale, Stellvertreterkriegen und exzessiv betriebener politischer Propaganda. Die meisten Historiker und Politikwissenschaftler lassen den ‚Kalten Krieg‘ nach 1945 beginnen, was unter anderem mit der geringeren weltpolitischen Bedeutung der Sowjetunion vor dem Sieg über das Dritte Reich im Zweiten Weltkrieg begründet wird. Vgl.: Körner: Gefahr, S. 12. Für Ernst Nolte beginnt der ‚Kalte Krieg‘ jedoch schon 1917 mit der bolschewistischen Oktoberrevolution. Nolte rekurriert in diesem Zusammenhang auf den amerikanischen Historiker Denna F. Flemming. Vgl.: Nolte: Deutschland, S. 31/32. 23 Zur Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ im Kalten Krieg vgl.: Freund: Krieg.
540 | Theanolte Bähnisch
war sie zudem sehr gut ausgebildet. Daß außer ihr nur sehr wenige Frauen eine entsprechende Ausbildung genossen hatten, verschaffte ihr einen singulären, aufsehenerregenden und respekteinflößenden Status. Da sie zu den jüngsten Protagonisten des erwähnten, reformorientierten Netzwerks gehörte, das seine Ideen im politischen Klima der preußischen großen Koalition entwickelt hatte, konnte sie 1945 sowohl mit einer herausragenden beruflichen Expertise, als auch mit einer bei der Militärregierung wohlgelittenen politischen Prägung und schließlich mit einer gewissen Jugendlichkeit punkten. Daß sie – auch aufgrund ihres Alters – nicht in der ersten Reihe jenes Netzwerks gestanden hatte, geriet ihr keineswegs zum Nachteil. Ihre guten Beziehungen zu deutschen Eliten, welche auf den ‚Positiv-Listen‘ der Alliierten standen, beeinflußten ihr Ansehen bei der Militärregierung positiv. Das Prestige, welches sie bei der Militärregierung und in der britischen Frauenbewegung bald genoß, ebnete ihr wiederum Kontakte zu anderen deutschen und britischen Eliten, bald sogar zu Eliten in anderen europäischen Ländern und den USA. In den beschriebenen Interaktionen kam die Zusammenarbeit der Militärregierung und der vom Militär als Berater eingesetzten Zivilisten mit Protagonistinnen der deutschen Frauenbewegung nicht etwa nur beispielhaft zum Ausdruck. Theanolte Bähnisch war – was nicht zuletzt aufgrund der britischen Frauen-Re-education Politik möglich wurde – die zentrale Persönlichkeit, welche den Wiederaufbau der deutschen Frauenbewegung ab 1946 auf deutscher Seite, vor allem in der britischen Besatzungszone, aber auch in den anderen Zonen, entscheidend beeinflussen sollte. In den Studien Denise Tscharntkes, Christl Zieglers, Pia Grundhöfers und – in geringerem Maße – John Robert Starks24, die sich mit der Frauen-Re-education-Arbeit der Westalliierten auseinandersetzen, deutet sich dies bereits an. Eine Vertiefung der von den genannten Autoren bereits begonnenen Analyse von Bähnischs Zusammenwirken mit den Briten sowie eine Verknüpfung dieses Phänomens mit dem biographischen Hintergrund Bähnischs und ihrem Wirken in anderen Zusammenhängen steht jedoch noch aus. Die von Bähnisch herausgegebene ‚Stimme der Frau‘ wurde bereits einer Analyse unterzogen, wobei ein Ergebnis war, daß die Arbeit an der Zeitschrift sowie die in der Zeitschrift transportierten Diskurse in einem engen Zusammenhang mit der von Bähnisch und den Briten gemeinsam betriebenen Frauen-Re-educationArbeit standen.25 Doch warum kam es überhaupt zu einer Zusammenarbeit zwischen der britischen Militärregierung und Vertreterinnen der deutschen Frauenbewegung? Und warum gingen von Hannover zentrale Impulse für diese Zusammenarbeit aus? Um dies erklären zu können, ist es nötig, zwei zentrale Aspekte des deutschen Wiederaufbaus sowie ihre Darstellung in der Forschungsliteratur zu skizzieren: 1.) Den Umstand, daß schon bald nach Kriegsende in einer Zeit, in der die Gründung von Parteien noch verboten war, Frauen lose Zusammenschlüsse gebildet hatten, welche versuchten, die soziale und mentale Notlage gemeinsam zu überwinden, und/oder die nach dem Ende
24 Vgl.: Tscharntke: Re-educating; Ziegler: Lernziel; Stark: Majority; Grundhöfer: Ausländerinnen. 25 Vgl: Freund: Krieg, S. 20, S. 235.
Club deutscher Frauen | 541
des Dritten Reichs die Zeit gekommen sahen, sich (wieder) gesellschaftlich und politisch zu engagieren. Beide Entwicklungen konnten, mußten aber nicht Hand in Hand gehen. 2.) Die Tatsache, daß Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der bedingungslosen Kapitulation in vier Zonen eingeteilt und von vier Staaten besetzt war, welche nach Kräften versuchten, ihren Einfluß beim Wiederaufbau von Staat und Gesellschaft geltend zu machen. Entgegen älterer Forschungsmeinungen ging gerade die Britische Militärregierung dabei überlegter vor als die anderen westalliierten Mächte26, was auch auf den Wiederaufbau der Frauenbewegung sowie auf die Geschlechterordnung in den anderen Besatzungszonen starke Auswirkungen hatte.
6.2 FRAUENZUSAMMENSCHLÜSSE IN DEUTSCHLAND AB 1945 6.2.1 „Überleben ist nicht genug“27: Hunger und Feminismus nach 1945 „Ich weiß noch, wir sind dann über diese Trümmer da hoch. Wir sahen, das Gebäude war noch ganz. Und über diese Trümmer sind wir dann hochgekrabbelt.“28 So beschreibt ‚Hedwig S.‘ ihren Weg zur ersten Versammlung des von Theanolte Bähnisch begründeten ‚Club deutscher Frauen‘ am 18.06.1946 in Hannover. Frauenpolitik zwischen den Trümmern einer deutschen Großstadt? War dafür überhaupt Zeit im „schrecklichen Friede[n]“, in dem der Hunger die Bomben ablöste29, wie Ute Frevert es formuliert? Auf den hinlänglich bekannten eklatanten Nahrungs-, Kleidungs- und Wohnraummangel der Bevölkerung soll an dieser Stelle nicht erneut eingegangen werden. Ebenfalls bekannt ist, daß sich das Leben in den großen Städten – wo sich die ersten Frauenzusammenschlüsse bildeten – besonders schwierig gestaltete, weil dort oft mehr als die Hälfte des Wohnraums zerstört war und Nahrungsmittel schwieriger zu beschaffen waren, als auf dem Land. Die Bevölkerung versuchte, den Mangel zu kompensieren, indem sie sich, soweit dies möglich war, auf schwarzen Märkten, durch ‚Hamsterfahrten‘ und durch Tauschhandel mit der Landbevölkerung versorgte. Kaffee wurde aus Eicheln, Suppe aus Löwenzahn gekocht, Wehrmachtshelme wurden zu Kochgeschirr, Uniformen zu Zivil-Bekleidung umgearbeitet – vor allem von Frauen. „Schließlich mußten sie traditionell dafür sorgen, daß die Familie ausreichend ernährt und gekleidet, die Wohnung warm, sauber
26 Siehe Kapitel 6.6.3. 27 Vgl.: Strecker, Gabriele: Überleben ist nicht genug. Frauen 1945–1950, Freiburg 1981. 28 Henicz/Hirschfeld: Club, S. 129. Henicz und Hirschfeld interviewten für ihren Aufsatz ehemalige Mitglieder des Clubs, von denen eine Person im Aufsatz ‚Hedwig S.‘ genannt wird. 29 Frevert: Frauen-Geschichte, S. 244.
542 | Theanolte Bähnisch
und behaglich eingerichtet war“30, schreibt die Historikerin Ute Frevert, die nicht zuletzt für ihre Forschung zur Frauengeschichte bekannt ist. Bereits während des Krieges hatten die meisten Frauen in Deutschland einen deutlich erweiterten Reproduktionsbereich31 zu bewältigen gehabt. Der ‚wehrhafte Haushalt‘ sollte möglichst unabhängig von Nahrungsmittelimporten aus dem Ausland sein, die Front mit Textilien versorgen und die zur Ankurbelung der Rüstungsindustrie gedrosselte industrielle Nahrungsmittelproduktion durch eigene Ernte-, Sammel- und Konservierungsaktionen kompensieren.32 Viele Frauen hatten nicht ‚nur‘ diese erweiterte Reproduktionsarbeit zu schultern, sondern zusätzlich außerhäusliche Erwerbsarbeit oder Tätigkeiten im Rahmen von Arbeitsdiensten zu leisten. Denn anders als von der nationalsozialistischen Propagandamaschinerie zunächst verbreitet, blieb die Arbeit von Frauen in den letzten Kriegsjahren nicht mehr auf Tätigkeiten im häuslichen Umfeld beschränkt, sondern sie wurden verstärkt zur Produktionsarbeit, vor allem in den Rüstungsfabriken, herangezogen.33 Der Dienst, den die Männer derweil an der Front abzuleisten hatten, forderte seine Opfer, viele Männer ‚fielen‘, kehrten ‚versehrt‘ zurück oder blieben in Kriegsgefangenschaft, so daß das Kriegsende nicht zur Wiederherstellung der gewohnten Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern führte. Viele Frauen gingen (weiterhin) einer außerhäuslichen Erwerbstätigkeit nach – was ihnen immerhin Vorteile bei der Zuteilung von Nahrungsmitteln verschaffte. Denn Frauen, die ‚nur‘ häusliche Arbeiten verrichteten, wurden von Seiten der Militärregierungen nur Lebensmittelkarten der ‚Kategorie 5‘, die auch ‚Hunger‘- oder ‚Friedhofskarten‘ genannt wurden, ausgehändigt.34 Die Wohnsituation vieler Menschen in Notunterkünften bot kaum Möglichkeiten zur Regeneration, die natürlichen Folgen der extremen Belastungen waren Erschöpfungszustände und Krankheiten. „Bei diesen Erschöpfungsproblemen handelt es sich nicht um vorübergehende Ermüdungen, sondern um einen anhaltenden Kräfteverfall. Über etwa ein Drittel der Frauen hatte ausgesagt, sie ständen vor einem körperlichen und nervlichen Zusammenbruch und hielten dem Übermaß an Arbeit nur stand durch ihr angespanntes Pflichtgefühl. Dabei muß erinnert werden, daß diese körperliche und seelische Überforderung... in vielen Fällen bis in die Kriegsjahre zurückreicht“35 beschreibt Hilde Thurnwald in einer soziologischen Untersuchung von Ber-
30 Ebd., S. 246. 31 Annette Kuhn vertritt die Position, daß kapitalistische Systeme in Krisen generell auf die Ausweitung des Reproduktionssektors setzen, welcher nach der traditionellen Rollenverteilung weitgehend von den Frauen zu bewältigen sei. Vgl.: Kuhn, Annette: Die stille Kulturrevolution der Frau. Versuch einer Deutung der Frauenöffentlichkeit (1945–1947), in: Clemens: Kulturpolitik, S. 84–101, hier S. 89. 32 Vgl. dazu: Benz, Ute (Hrsg.): Frauen im Nationalsozialismus, Dokumente und Zeugnisse, 2. Aufl., München 1997, S. 61–67. 33 Vgl.: Benz: Frauen, S. 36. 34 Vgl.: Möding: Stunde. 35 Thurnwald, Hilde: Gegenwartsprobleme Berliner Familien. Eine soziologische Untersuchung an 498 Berliner Familien, Berlin 1948, S. 85.
Club deutscher Frauen | 543
liner Familien im Jahr 1948 ihre Eindrücke von der Lage der Bevölkerung. Das Kriegsende bedeutete für viele Frauen physisch gesehen also keine Erholung. 6.2.2 Frauen in der Nachkriegszeit als Forschungsgegenstand zwischen ‚Frauenforschung‘, ‚Bielefelder Schule‘ und ‚Alltagsgeschichte‘ „Als der Krieg der Männer vorbei war, ging der Kleinkrieg der Hausfrauen und Mütter um Brot und Kohlen weiter und nahm immer schärfere und verzweifeltere Formen an, je mehr sich der Nahrungsspielraum verengte“36, spitzt Ute Frevert das Phänomen in ihrem viel zitierten, 1986 erschienenen Überblick zur Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland zu. Jene Aussage birgt einen wahren Kern, sie ist jedoch gleichzeitig Ausdruck einer in den 1980er Jahren verbreiteten und problematischen, weil stark polarisierenden Sichtweise auf die Geschlechterkonstellationen in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Zum einen wird dabei der Anteil, deutscher Frauen am expansionistischen Vernichtungskrieg des Deutschen Reiches ausgeblendet.37 Zum anderen wird die Tatsache, daß die deutsche Bevölkerung in der direkten Nachkriegszeit mehrheitlich aus Frauen bestand, überstrapaziert. Männer scheinen, folgt man Freverts Argumentation, nur in der Welt des Führerstaates, des Holocaust und des Krieges präsent gewesen zu sein, nicht aber im deutschen Wiederaufbau und dabei schon gar nicht im Familienalltag. Darstellungen wie diese sind in Werken, die sich einem ‚frauengeschichtlichen‘ Ansatz38 verpflichtet fühlen, kein Einzelfall. Studien, denen der Anspruch zugrundeliegt, das in jenen Studien als ‚heldinnenhaft‘ bewertete Alltagshandeln von Frauen in der Nachkriegszeit als Teil der kollektiven Erinnerung in der Gesellschaft zu verankern, sind zahlreich. „Nach 1945 hat es keine ‚Frauenpolitik‘ oder ‚Frauenfrage‘ in dem begrenzten Sinn gegeben, als handele es sich dabei ausschließlich um Dinge, die allein Frauen beträfen. Frauenfragen in den Nachkriegsjahren waren Lebensfragen, und zwar in der Bedeutung, daß das entscheidende politische Handeln in den unmittelbaren Notjahren nach dem Zweiten Weltkrieg darauf gerichtet war, die Überlebensbedingungen der Deutschen abzusichern, die brennenden Fragen nach Nahrung, Kleidung, Hausbrand, Wohnung zu lösen. [...] inhaltlich deckte sich die so betriebene Politik, d. h. die Arbeiten, die für Nahrung, zumutbare Wohnungen, Brennstoff für den Winter usw. sorgten, mit Tätigkeiten, die
36 Frevert: Frauen-Geschichte, S. 247. Zur Definition und Tradierung von Normen, Werten, Gesetzen und ‚Kollektivhandlungen‘ in einer Gesellschaft durch Männer und Frauen vgl.: Neissl, Julia u. a.: Einleitung: Geschlechterdimensionen und Gewaltstruktur in Alltag und Krieg, in: Dies. u. a. (Hrsg.): Männerkrieg und Frauenfrieden. Geschlechterdimensionen in kriegerischen Konflikten, Wien 2003, S. 7–12, hier S. 7. 37 Vgl.: Benz: Frauen, S. 30/32. 38 Den ersten Lehrstuhl für ‚Historische Frauenforschung‘, erhielt 1986 Annette Kuhn in Bonn. Der Ansatz der ‚Frauenforschung‘, der ‚weibliche Lebenswelten‘ sichtbar machen will, gilt, seitdem die dekonstruktivistisch arbeitenden ‚Gender Studies‘ sich etabliert haben, in der universitären Forschung weitgehend als überholt.
544 | Theanolte Bähnisch
in Bereiche traditioneller Frauenarbeit hineinreichten“39, stilisiert auch AnnaElisabeth Freier die Bewältigung des erweiterten Reproduktionsbereichs zu einem „hochpolitischen Liebesdienst“40. Diese Darstellung Freiers ist erkennbar geprägt von dem in der ‚Frauengeschichtsschreibung‘ dominierenden Movens, Frauen und ihre Leistungen in der Geschichte ‚sichtbar‘ zu machen.41 Läßt man sich auf jene Art der Argumentation ein, so bleibt es doch problematisch, daß vor dem Hintergrund der Aufwertung dieser von den Autorinnen als ‚praktisch‘ beschriebenen Art von Politik andere Formen politischen Handelns von Frauen – teilweise sogar bewußt – marginalisiert werden: „Der Prozentsatz der Frauen, die sich in Parteien und Gewerkschaften oder in der wieder entstehenden bürgerlichen Frauenbewegung, in konfessionellen und Wohlfahrtsverbänden […] mit welch unterschiedlichen, widersprüchlichen und illusorischen Zielen auch immer“42 engagierten, sei gering gewesen, so Freier. Sie beziffert ihn auf acht bis neun Prozent.43 „Das Handeln der ‚anderen Frauen‘ war politisch von größerer Relevanz, in einer Zeit, in der die Ernährung eine hochpolitische Angelegenheit war, ihre Agentinnen waren jedoch auf der politischen Bühne nicht vertreten“44, wertet Freier das praktische Handeln von Frauen auf und die Arbeit von im engeren Sinn politisch organisierten Frauen im gleichen Atemzug ab. Aus den genannten und aus ähnlichen Darstellungen von Forscherinnen, die mehrheitlich in der ‚neuen Frauenbewegung‘ der 60er und 70er Jahre sozialisiert wurden, spricht nicht zuletzt die Ablehnung der ‚bürgerlichen‘ Frauenbewegung. Denn vor allem Frauen,
39 Freier, Anna-Elisabeth: Frauenfragen sind Lebensfragen. Über die naturwüchsige Deckung von Tagespolitik und Frauenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, in: dies./Kuhn, Annette (Hrsg.): Frauen in der Geschichte V, „Das Schicksal Deutschlands liegt in der Hand seiner Frauen“ – Frauen in der deutschen Nachkriegsgeschichte, Düsseldorf 1984, S. 18–50, hier S. 18. 40 Ebd. Ähnlich argumentiert auch: Schubert, Doris: „Frauenmehrheit verpflichtet“. Überlegungen zum Zusammenhang von erweiterter Frauenarbeit und kapitalistischem Wiederaufbau in Westdeutschland, in: Freier/Kuhn: Frauen V, S. 231–265, hier S. 231. 41 Vgl. beispielsweise: Kuhn, Annette (Hrsg.): Frauen im Mittelalter, Bd. 1, Düsseldorf 1983. 42 Freier: Frauenfragen, S. 45/46. 43 Freier bezieht sich auf einen Bericht Elizabeth Holts, der für die ‚Women’s Affairs‘ abgestellten Mitarbeiterin der ‚Education and Cultural Relations-Division‘ bei der amerikanischen Militärbehörde in Bayern um 1948. Von drei Millionen Frauen in Bayern seien Holts Bericht zufolge etwa 256.000 Frauen politisch organisiert gewesen, was Frauen, die konfessionelle Arbeit leisteten, eingeschlossen habe, schreibt Freier. Vgl.: ebd. Nori Möding nennt in einem vielbeachteten Sammelband über jene Zeit dieselbe Quelle und Prozentzahl und leitet daraus ab, daß die Anzahl der Frauen, welche in der direkten Nachkriegszeit politisch oder konfessionell organisiert waren, gering gewesen sei. Vgl.: Möding: Stunde, S. 624. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, daß die Art der Zusammenschlüsse, in denen Frauen sich organisierten, nicht nur Aufschluß über die Interessen der Frauen gab, sondern, daß der Erfolg der Zusammenschlüsse – und damit die Sichtbarkeit von Interessengruppen – auch davon abhängig war, welche Organisationen von den Militärregierungen gefördert wurden. Zudem fiel das Engagement der Frauen regional unterschiedlich stark aus. 44 Freier: Frauenfragen, S. 46.
Club deutscher Frauen | 545
die sich mit den Traditionen der ‚Bürgerlichen‘ identifizierten oder wenigstens zur Kooperation mit diesen bereit waren konnten – dies wird in den folgenden Kapiteln deutlich werden – in den 1940er und 1950er Jahren auf den Wiederaufbau Deutschlands Einfluß nehmen. Ihr Handeln verstanden sie dabei – auch aus der Retrospektive betrachtet – zu Recht als ‚politisch‘. In den ‚frauengeschichtlichen‘ Arbeiten der 1980er Jahre schlug sich außerdem der – zu jener Zeit innovative – Ansatz der ‚Bielefelder Schule‘ in der Geschichtswissenschaft nieder. Diese Schule wollte die eigene Disziplin stärker als eine Gesellschafts- und Sozialwissenschaft verstanden wissen.45 Einverstanden mit der Abkehr von der ‚Geschichte der großen Männer‘, aber unzufrieden damit, daß das Individuum in der Sozialgeschichte kaum eine Rolle spielte, weil sich viele Forscher auf der Grundlage quantitativer Daten der Analyse von Strukturen widmeten, sollte die ‚Alltagsgeschichte‘ den Blick bald stärker auf die einzelnen Menschen richten. Die alltäglichen Nöte, das Handeln der ‚kleinen Leute‘ sollte dabei vor die Politik der ‚großen Männer‘ gestellt werden.46 Annette Kuhn und Anna Elisabeth-Freier47 taten das offenbar Naheliegende und stellten ihrerseits das Handeln der ‚einfachen Frauen‘ vor das der ‚großen Frauen‘. Als eine der ‚großen Frauen‘ der Nachkriegsjahre galt, solange man sich ihrer noch erinnerte, auch Theanolte Bähnisch. Daß in viele Studien für die Erforschung der direkten Nackriegszeit, in der alltägliches Handeln mehr denn je auf die Befriedigung der elementarsten Bedürfnisse ausgerichtet war, Schwerpunkte in der Analyse jenes Alltagshandelns gesetzt wurden und daß dafür auch ein entsprechender theoretischer und methodischer Zugriff gewählt wurde, entbehrt nicht einer gewissen Logik. „Hier war der Alltag eines jeden voller Ereignisse und Herausforderungen und vom Ringen ums Überleben bestimmt gewesen, demgegenüber Politiker, Denker, Unternehmer und Generäle als nahezu bedeutungslos zurück traten“48, beschreibt der Gießener Historiker Dirk van Laack den alltagsgeschichtlichen Zugriff für die Nachkriegszeit als eine naheliegende Herangehensweise. Zur Erforschung der direkten Nachkriegszeit und damit zur Verankerung der prägenden Elemente jener Zeit im Gedächtnis späterer Generationen ist die Auseinandersetzung mit den Leistungen, welche Bürger im deutschen Wiederaufbau nicht nur für ihre Familien, sondern auch für die Gesellschaft erbrachten, notwendig. Ohne Zweifel verdient auch der besondere Anteil, den Frauen am Wiederaufbau hatten, hervorgehoben zu werden. Ein Tradieren des oft bemühten „Trümmerfrau-
45 Vgl. dazu: Vgl.: Schultze, Winfried (Hrsg.): Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikrohistorie, Göttingen 1994 sowie Speitkamp, Winfried: Sozialgeschichte, in: Maurer, Michael (Hrsg.): Aufriß der historischen Wissenschaften, Bd 3: Sektoren, Stuttgart 2004, S. 72– 184. 46 Begründet hatten jene Tradition Hans-Ulrich Wehler und Jürgen Kocka. Sie stützen ihre Arbeiten zur Sozialstruktur der deutschen Gesellschaft auf Theorien von Sozialhistorikern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Zur zweiten Generation der ‚Bielefelder Schule‘ werden unter anderen Heinz-Gerhard Haupt und Ute Frevert gezählt. 47 Vgl.: Freier/Kuhn: Frauen V. 48 Laack, Dirk van: Alltagsgeschichte, in: Maurer: Aufriß, S. 14–80, hier S. 72.
546 | Theanolte Bähnisch
Mythos“49, als Teil der Konstruktion einer ‚Frauengeschichte der Nachkriegszeit‘, welche Männer entweder völlig ausblendet oder sie als ‚Kriegstreiber‘ zeichnet und sie den als friedliebend, die Trümmer ‚männlicher Politik‘ beseitigend dargestellten Frauen gegenüberstellt, erweist sich jedoch als wenig hilfreich bis kontraproduktiv auf der Suche nach Erkenntnissen über die Vergangenheit. 6.2.3 ‚Überlebenspolitik‘, ‚Frauenpolitik‘ und ‚Politik als Deutungskampf‘ – vielschichtige Zielsetzungen der Organisationen erfordern einen offenen Forschungszugang Ebenfalls vernachlässigt wurde in den angesprochenen Studien, daß die Zusammenarbeit der britischen Militärregierung und der Bürgerlichen Frauenbewegung – unter maßgeblicher Führung Theanolte Bähnischs – auch über den Kontext der Frauenemanzipation hinaus einen starken Einfluß auf die Dynamik der deutsch-deutschen Beziehungen im Kontext des Kalten Krieges und damit auf Entwicklung und Ausrichtung der zweiten deutschen Demokratie hatte. Den noch immer fortwirkenden Ansatz der ‚Historischen Frauenforschung‘ der 1980er Jahre kritisch zu reflektieren, ist für eine Einordnung von Bähnischs Wirken vor allem auch deshalb wichtig, weil zwei Aufsätze, welche die Arbeit Bähnischs zwar einer scharfen Kritik unterziehen, aber auch zentrale Informationen zur frauenpolitischen Arbeit Bähnischs enthalten, in jenem Kontext entstanden sind.50 Da die Auseinandersetzung vor allem mit der ersten Gründung Bähnischs, dem ‚Club deut-
49 Selbst im Internet-Angebot des Deutschen Historischen Museums wurde jener Mythos noch 2013 mit folgenden Worten weiter tradiert: „Krieg und Zerstörung sind zumeist fast ausschließlich das Werk von Männern. Dagegen lastete die Beseitigung der Trümmer des Zweiten Weltkrieges hauptsächlich auf den Frauen. An Stelle ihrer im Krieg gefallenen oder verkrüppelten, vermißten oder in Kriegsgefangenschaft geratenen Männer legten in vielen deutschen Städten die ,Trümmerfrauen‘ die ersten Grundsteine zum Wiederaufbau.“ O. V.: Information zu einer Skulptur von Max Lachnit in Raum 35: Besatzungszeit und Kalter Krieg, auf: http://www.dhm.de/ausstellungen/bildzeug/qtvr/DHM/n/BuZKopie/raum_35. 10.htm, am 13.12.2013. Auch das Haus der Geschichte nahm zu jener Zeit entsprechend auf Frauen Bezug, die den Wiederaufbau der Darstellung nach allein bewerkstelligt zu haben scheinen. Vgl.: o. V.: 1945–49, Ende als Anfang: Trümmerfrauen, auf: http:// www.hdg.de/lemo/html/Nachkriegsjahre/DasEndeAlsAnfang/truemmerfrauen.html, am 13. 12.2013. Eine gut recherchierte und fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema, das sich zum Ziel setzt, die Realitäten hinter dem Mythos zu rekonstruieren bietet dagegen das Hör-Feature: „Zupacken wie ein Mann… Der Mythos der Trümmerfrauen“, gesendet auf Bayern 2 am 10.05.2009, um 13:30, online abrufbar unter: http://wikimannia.org/images/ 2009_05_04_18_01_57_podcastdermythosdertrmmerfraue_a.mp3, ebenfalls bereits am 13.12.2013. 50 Henicz/Hirschfeld: Club und dies.: Frauen. Die Aufsätze folgen dem Ansatz Kuhns, aus feministischer Sicht zu historischen Phänomenen kritisch Stellung zu beziehen. Deutlich wird dieser Anspruch unter anderem in der Gegenüberstellung der Politik des Frauenrings und der Politik der neuen Frauenbewegung. Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 148.
Club deutscher Frauen | 547
scher Frauen‘, in jenen Aufsätzen pionierhaft ist, werden sie im Lauf meiner weiteren Ausführungen wiederholt herangezogen. Tatsächlich hatten, um auf die eingangs gestellte Frage nach der Vereinbarkeit von ‚Hunger‘ und ‚Frauen-Politik‘ zurückzukommen, einige Frauen nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer schwierigen Lage das Bedürfnis, sich auszutauschen und sich politisch zu artikulieren. Viele Frauen fanden den Weg in eine Frauenorganisation, weil die Zusammenschlüsse sich oft auch als ‚Notgemeinschaften‘51 verstanden und sich, anders als von Freier dargestellt, sowohl mit ‚Frauenfragen‘ in einem enger als ‚politisch‘ und/oder ‚emanzipatorisch‘ definierbaren Sinn als auch mit den von Freier skizzierten ‚Frauenfragen‘ im Sinn von ‚Überlebenspolitik‘ beschäftigten. Diesem Umstand, der auch auf den ‚Club deutscher Frauen‘ zutraf, werden die alltagsgeschichtlich ausgerichteten, dem ‚Oral History‘-Trend folgenden Arbeiten der 1980er Jahre kaum gerecht. Sie reflektieren die bürgerliche Frauenbewegung im Wesentlichen als eine Folie, vor deren Hintergrund jene Verbände ihre Ausrichtung vornahmen, und vernachlässigen den Einfluß der Militärregierung auf die Bewegung sowie die äußerst erhellenden biographischen Hintergründe ihrer zentralen Ideengeberinnen wie Theanolte Bähnisch. Daß der ‚Club deutscher Frauen‘ in Hannover entstehen konnte und daß er sich zu einem zonenweiten Verband weiterentwickelte, ist jedoch wesentlich zurückzuführen auf das in der Weimarer Republik gewachsene Netzwerk, in dem Bähnisch sich, stärker nach als vor 1945, bewegte, sowie auf die Politik der Briten, die darauf setzte, dieses Netzwerk in Zusammenarbeit mit der britischen Frauenbewegung zu reaktivieren. Studien der 90er Jahre, welche die genannten Frauenzusammenschlüsse als ‚Notgemeinschaften‘ und politische Zusammenschlüsse gleichzeitig charakterisieren, weisen darauf hin, daß die bereits im Kaiserreich virulente und sich in der Weimarer Republik fortsetzende Spaltung zwischen bürgerlicher und proletarischer Frauenbewegung nach 1945 nicht unmittelbar wieder zum Tragen gekommen sei. Sehr unterschiedliche Ziele der Zusammenschlüsse gingen Hand in Hand mit einer sehr heterogenen Mitgliederstruktur. „[E]in frauenpolitisches Spektrum bildete sich, in dem die beiden traditionellen Strömungen der Frauenbewegung – die sozialistische und die bürgerliche – eine eigentümliche Verbindung eingingen“, schreibt die Politologin und erklärte ‚Patriarchatskritikerin‘ Renate Genth52 über die Frauenzusammenschlüsse in der direkten Nachkriegszeit. „Die politischen Angelegenheiten wurden um das alltägliche, das Private und die Substanzarbeit erweitert, weil diese Bereiche neu geregelt und öffentlich erörtert werden mussten, also zum Gegenstand der Politik wurden.“53 Corinne Bouillot und Elke Schüller stützen Genths Sichtweise auf die frauenpolitischen Aktivistinnen der ersten Nachkriegsjahre, indem sie festhalten: „Zu den Gründerinnen und Trägerinnen der Frauenausschüsse gehörten […] Kommunistinnen
51 Das eingängigste Beispiel hierfür dürfte die von Else Ulich-Beil gegründete ‚Notgemeinschaft 1947‘ sein. 52 Genth ist derzeit Mitarbeiterin des ‚Forschungsinstituts für Patriarchatskritik und alternative Zivilisationen‘ in Innsbruck. 53 Genth, Renate u. a.: (Hrsg.): Frauenpolitik und politisches Wirken von Frauen im Berlin der Nachkriegszeit 1945–1949, Berlin 1996, Seite 223.
548 | Theanolte Bähnisch
und Sozialistinnen genauso wie Gewerkschafterinnen, Christdemokratinnen, Liberale, Vertreterinnen konfessioneller, berufsständischer oder karitativer Organisationen und ‚parteilose Frauen‘.“54 Die „pluralistische Kooperation von Frauen sehr unterschiedlicher Weltanschauungen, Politiken und frauenpolitischer Überzeugungen“ habe jedoch „nur sehr kurze Zeit“55 gehalten, konstatiert wiederum Ursula Nienhaus in einem Aufsatz zur Frauenbewegung in Berlin nach 1945. Doch dieser Umstand schmälert keineswegs die Relevanz solcher Zusammenschlüsse in der weichenstellenden Transformationsphase 1945 bis 1952. Vielmehr regte die vergleichsweise bunte Mitgliederstruktur der Allianzen sowie die Vielfalt ihrer Themen in jener Phase des Umbruchs zum Nachdenken darüber an, welche Rolle die Existenz solcher Zusammenschlüsse für kurz- und mittelfristig zu erreichende, im Sinne der britischen Re-education-Arbeit hochpolitische Ziele gehabt haben könnte. „Die Tatsache, daß die Ausschüsse [lokal begrenzte, als Basisbewegung entstandene Frauengruppen] in ihrer politischen Arbeit sehr konkret am unmittelbaren Alltag von Frauen ansetzten und den sozialen Belangen der Zeit gerecht wurden, trug […] dazu bei, parteipolitisch abseits stehende Frauen zu interessieren; christlich orientierte Frauen wurden durch den karitativen Aspekt der Frauenausschüsse angezogen“56, erklären Bouillot und Schüller das Phänomen. Auf diese kurzfristige Funktion von Frauenzusammenschlüssen, nämlich, Frauen über alltägliche Themen und konsensfähige Ziele zunächst einmal ‚zusammenzutrommeln‘, baute Theanolte Bähnisch gemeinsam mit der britischen Militärregierung auf. Den auf diese Weise angesprochenen Frauen sollten, in Bezug zu alltäglichen Lebensfragen gesetzt, mittelfristig eine Auseinandersetzung mit ‚Politik‘ sowie eine positive Einstellung zur Demokratie, bald auch eine ablehnende Haltung gegenüber dem Kommunismus schmackhaft gemacht werden.57 Jene Zusammenhänge sind erst mit der Erforschung der Interaktion zwischen der Re-etablierung der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland und der britischen Re-education Arbeit, von der im nächsten Unter-Kapitel die Rede sein wird, deutlicher hervorgetreten.58 Der ‚Alltag‘ der Frauen hatte sich, wie bereits erwähnt, aufgrund des ausgeweiteten Tätigkeitsbereichs weiblicher Familienoberhäupter in der Kriegs- und Nachkriegszeit gegenüber dem Alltag in der Weimarer Republik verändert. Viele Frauen trugen nun die Verantwortung in den Gewerbe-, Handwerks- oder landwirtschaftlichen Betrieben ihrer Männer, mußten selbständig wirtschaften und ihre Kinder allein erziehen. Der Ansporn, politische Bildungsarbeit für Frauen zu betreiben, war damit
54 Bouillot/Schüller: Frauenorganisation, S. 48. 55 Nienhaus, Ursula: Topographie und Generationenmobilität in der Berliner Frauenbewegung nach 1945, in: Hundt, Irina/Kischlat, Ilse (Hrsg.): Topographie und Mobilität in der deutschen Frauenbewegung. Ergebnisse des wissenschaftlichen Kolloquiums des deutschen Staatsbürgerinnenverbandes e. V. am 2. November 2002, Berlin 2003, S. 98–107, hier S. 99. 56 Bouillot/Schüller: Frauenorganisation, S. 48. 57 Vgl.: O. V.: Rückblick und Ausschau. Die Arbeit des Frauenringes in der britischen Zone, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Nr. 1, S. 25. 58 Als wichtigster Titel sei an dieser Stelle genannt: Tscharntke: Re-educating.
Club deutscher Frauen | 549
gegenüber der Weimarer Republik ebenso gewachsen, wie die Hürden, die es bei einer solchen Arbeit zu überwinden galt. Daß mit der Unterstützung des ‚Club deutscher Frauen‘ und ähnlicher Zusammenschlüsse auch ein von der Militärregierung für ungeeignet befundenes Konzept zu den Akten gelegt werden sollte und die Clubs deshalb Aufgaben übernahmen, die zuvor als Domäne der Volkshochschulen betrachtet worden waren, haben Denise Tscharntke und Christl Ziegler herausgearbeitet.59 Darauf wird an späterer Stelle60 zurückzukommen sein, wobei in einem stärkeren Maß als von den Autorinnen bereits geleistet, der Fokus auf dem Netzwerk liegen wird, welches für jene Aufgabenverlagerung verantwortlich war. Dies wiederum ermöglicht es, differenziertere Aussagen über (Eliten-)Kontinuitäten und -Brüche in der Frauenbildung zwischen der Weimarer Republik und der Bundesrepublik zu treffen. 6.2.4 Frauen-Zusammenschlüsse als landesweites Phänomen Die Städterinnen61 reagierten durchaus interessiert auf die Programme, welche die allerorten existierenden Frauenzusammenschlüsse ihnen präsentierten. Was ‚Hedwig S.‘ in Hannover engagiert über die Trümmer klettern ließ, war keinesfalls ein Unikum. In vielen deutschen Städten waren nach Kriegsende Frauenzusammenschlüsse entstanden, und in vielen deutschen Städten nahmen Frauen die Anstrengung in Kauf, die es bedeutete, sich in einer zerstörten Stadt zu einer Versammlung durchzuschlagen. „In Frankfurt wurde am 25. Januar 1946 die Öffentlichkeit durch einen Aufruf überrascht, der von 14 Frauen unterzeichnet war, die sich selbst als Frankfurter Frauenausschuß bezeichneten, der zur Gründung einer Frauenorganisation aufrief, die allen Schichten helfend und beratend zur Seite stehen wollte. [...] Gleichzeitig mit dem Frankfurter Ausschuß hatten sich in vielen anderen hessischen Gemeinden, völlig unabhängig, ohne Kenntnis voneinander zu haben, andere Frauenausschüsse gebildet auf Anregung einzelner aktiver Frauen“62, beschreibt Gabriele Strecker aus hessischer Sicht das Phänomen. Sie hält fest: „Die Geschichte des Clubs deutscher Frauen in Hannover und die des Frauenverbands Hessen [zu dem sich der Frankfurter Verband mit anderen Verbänden 1947 zusammengeschlossen hatte] ist typisch für alle in den Westzonen gebildeten Frauengruppen. Die Namen waren verschieden, etwa ‚Frauendienst‘ in Stuttgart, oder ‚Überparteilich-überkonfessionelle Frauengruppe‘ in Karlsruhe, oder ‚Heidelberger Frauenverein‘, oder ‚Süddeutscher Frauenarbeitskreis [SFAK]63‘ [...] oder einfach ‚Frauenausschuß‘ wie in Bremen und vielen Ruhrstädten. Die Ziele waren mehr oder weniger die gleichen: Verwirkli-
59 Vgl.: Ebd: Ziegler: Lernziel. 60 Siehe Kapitel 4.4 sowie 4.5.1. 61 Auf dem Land waren – ebenfalls mit Hilfe von Unterstützern aus Großbritannien – bald wieder die Landfrauenvereine führend unter den Frauenzusammenschlüssen. Vgl.: Sawahn, Anke: Die Frauenlobby vom Land. Die Landfrauenbewegung in Deutschland und ihre Funktionärinnen 1898 bis 1948, Frankfurt a. M. 2009. 62 Strecker: Frauenarbeit, S. 9/10. 63 Zum SFAK vgl.: Zepp: Redefining, S. 156–164.
550 | Theanolte Bähnisch
chung der Gleichberechtigung der Frau, höhere Wertschätzung der Frauenarbeit, Mitwirkung in der Verwaltung, gerechte Beteiligung der Frau in den Berufsvertretungen, Hinzuziehung im Rechtswesen, Hilfestellung bei unmittelbaren Nöten.“64 Nicht nur in den vier Besatzungszonen, sondern auch in der Viermächte-Stadt Berlin existierten Frauenzusammenschlüsse mit ähnlicher Zielsetzung. Agnes von Zahn-Harnack hatte dort 1946 den Wilmersdorfer Frauenbund gegründet, in dem sich als eine der ersten Frauen Nelly Friedensburg65, die ehemalige Soroptimistin und Ehefrau von Bähnischs ehemaligem Chef, Ferdinand Friedensburg, engagierte. Der Frauenbund hatte sich zum Ziel gesetzt, sowohl an der sittlichen, sozialen und wirtschaftlichen Erneuerung Deutschlands mitzuwirken als auch für die Rechte der Frauen in Familie, Beruf und Staat einzu-treten. An seinem Beispiel wird besonders deutlich, daß an den Gründungen nach 1945 jene Frauen federführend beteiligt waren, die sich bereits vor 1933 in der Frauenbewegung engagiert hatten. Schließlich war Agnes von Zahn-Harnack die letzte Vorsitzende des 1933 aufgelösten Dachverbandes ‚Bund deutscher Frauenvereine (BDF)‘ gewesen. Auch die Leiterin der ‚Sozialen Frauenschule‘ und zweite Vorsitzende des ebenfalls 1933 aufgelösten Staatsbürgerinnen-Verbandes, Else Ulich-Beil, knüpfte an ihre in der Weimarer Republik geleistete frauenpolitische Arbeit wieder an: Sie verantwortete die Gründung der ‚Notgemeinschaft 1947‘ in Berlin. Gemeinsam war den genannten Zusammenschlüssen, daß sie sich weder einer politischen Richtung noch einer Konfession oder einer Berufssparte zugehörig fühlten und entsprechend allen Frauen zur Mitarbeit offenstehen sollten. Politisch unabhängig war nominell zu Beginn seiner Existenz auch der 1947 im Berliner Admiralspalast gegründete ‚Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD)‘, auf den an anderer Stelle zurückzukommen sein wird. Nach dem Ende des Nationalsozialismus sahen vor allem in der Frauenbewegung bereits erfahrene Frauen ein politisches Engagement von Frauen als so dringlich wie nie zuvor an: „Ein Volk, das so zerschlagen ward, wie das unsre, hat nur eine Möglichkeit, seelisch und geistig Heilung und Erneuerung zu finden: durch die Heimkehr zu den Müttern“ 66, formulierte die Dichterin Ina Seidel in diesem Sinnzusammenhang in der ersten Ausgabe der Zeitschrift ‚Welt der Frau‘. Die Zeitschrift begriff sich als Nachfolgeorgan der von Gertrud Bäumer herausgegebenen Zeitschrift ‚Die Frau‘ und wollte erklärtermaßen nach 1945 „das Reich der Mütter vertreten unter deren Walten der Friede gedeiht“67.
64 Strecker: Frauenarbeit, S. 9/10. Vgl. zur Frankfurter Frauenbewegung der Nachkriegszeit auch: Schüller, Elke: „Frau sein, heißt politisch sein“. Wege der Politik von Frauen in der Nachkriegszeit am Beispiel Frankfurt am Main (1945–1956), Königstein/Taunus 2004. 65 Der Ehemann Nelly Friedensburgs, Ferdinand Friedensburg, ab 1948 kommissarisch regierender Bürgermeister von Berlin, unterstützte sowohl das Engagement seiner Frau im Verband, der sich später in ‚Berliner Frauenbund‘ umbenannte, als auch den Verband an sich. Vgl.: Keiderling, Gerhard: Um Deutschlands Einheit. Ferdinand Friedensburg und der Kalte Krieg in Berlin 1945–1952, S. 178. 66 Seidel, Ina: Zum Geleit, in: Die Welt der Frau, 1. Jg. (1946/1947), Heft 1, S. 5. 67 Ebd.
Club deutscher Frauen | 551
Die Idee, eine stärkere Stellung von Frauen im Staat könne den Aufbau eines ‚neuen Deutschland‘, das sich auf seine Tradition als Kulturnation besinnt und im Frieden mit seinen Nachbarn lebt, begünstigen, erwies sich als anschlußfähig. Sie blieb nicht Gedankengut geläuterter Funktionärinnen der bürgerlichen Frauenbewegung aus der Zeit der Weimarer Republik, sondern wurde bald Ausdruck einer – wenn auch schnell wieder vorübergehenden – weit verbreiteten Mentalität, der durchaus auch Männer anhingen.68 Die Vorstellung von der friedfertigen Frau, die ihre Dienste in den Wiederaufbau des Landes und die Verhinderung weiterer Kriege stellt, dürfte unter Frauen vor allem auch deshalb besonders populär gewesen sein, weil mit jener unterstellten Friedfertigkeit meist eine Amnestie für die Ereignisse im Krieg und im Holocaust ausgesprochen wurde. „Man muß den Frauen – da ihre Tradition in der Verwaltung noch jung ist – eine gewisse Schuldlosigkeit an der Vergangenheit ihres Volkes zubilligen“69, bot die Herausgeberin der ‚Welt der Frau‘, Annemarie Weber, den Frauen einen Ausweg aus dem „deutschen Dilemma“70 an. Neben dem ‚Frieden‘ und der Wiederauferstehung Deutschlands als ‚Volk der Dichter und Denker‘ forderten die meisten Frauen-Zusammenschlüsse mehr Rechte für Frauen und wollten dementsprechend über die bestehende Rechtslage informieren. Diverse Initiativen verlangten höhere Löhne für Frauen, denn in der Regel verdienten Frauen für die gleiche Arbeit ein Viertel bis ein Drittel weniger als Männer.71 Die meisten Zusammenschlüsse hatten sich zudem auf die Fahnen geschrieben, Hilfe bei der praktischen Wiederaufbauarbeit zu leisten.
68 Hans Thoma beispielsweise schrieb in einer späteren Ausgabe der ‚Welt der Frau‘: „Das Weib in seinem Mitleid ist berufen, Wunden zu heilen, es würde gewiß, wenn es gehört würde, alles aufwenden, um die Wunden zu verhüten, welche die wahnbetörten, haßerfüllten Völker sich schlagen.“ Thoma, Hans: Brücken des Herzens. Hans Thoma an die Frauen, in: Die Welt der Frau, 1. Jg. (1946/1947), Heft 4, S. 18. 69 Weber, Annemarie: Die Welt der Frau, in: Die Welt der Frau, 1. Jg. (1946/1947), Heft 7, S. 3–5, hier S. 5. Der Fehler der Frauen sei gewesen, so Weber, aus „Gedankenlosigkeit“ und „Passivität“ heraus dem Treiben der kriegerischen Männer nicht Einhalt geboten und die eigene Stellung in der Gesellschaft nicht behauptet zu haben. Zur noch immer vorherrschenden Annahme, daß Frauen per se friedfertig, treusorgend und empathisch, Männer dagegen kriegerisch, zerstörerisch und gewalttätig veranlagt seien, vgl.: Neissl: Männerkrieg. 70 Weber: Welt. 71 Nicht einmal der ‚Schwerstarbeiterlohn‘ für Frauen reichte an die Höhe des ‚normalen‘ Männerlohnes heran und daran änderten auch die Besatzungsmächte zunächst einmal nichts. Die Direktive Nr. 14 des Alliierten Kontrollrats vom 12.10.1945 enthielt zwar ein Verbot, Menschen aus rassistischen, religiösen oder politischen Gründen schlechter zu entlohnen, die Möglichkeit einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts spielte jedoch keine Rolle in der Direktive. Vgl.: Drohsel, Petra: Die Entlohnung der Frau nach 1945, in: Freier/Kuhn: Frauen V, S. 202–230, hier S. 203/204.
552 | The anolte Bähnisch
6.3 DER BESONDERE FOKUS AUF FRAUEN IN DER BRITISCHEN MILITÄRREGIERUNG 6.3.1 Die Umerziehungspolitik der Alliierten Das allgemein als ‚Re-education‘, bekannt gewordene Programm der Alliierten, das von Frank Schumacher zu Recht als „gewaltig“72 in seinem Ausmaß bezeichnet wird, zielte auf der Grundlage des Potsdamer Abkommens aus dem August 1945 auf eine ‚Umerziehung‘ der Deutschen weg von autoritär und obrigkeitsstaatlich geprägten Denkstrukturen, hin zu einer demokratischen Grundhaltung. Was unter ‚Demokratie‘ zu verstehen sei, legten die vier Besatzungsmächte allerdings unterschiedlich aus. Für die vier Zonen galten deshalb unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und Ausrichtungen bei der ‚Re-education‘ (ursprünglich die US-amerikanische Bezeichnung), „Reconstruction“ (britische Bezeichnung), ‚mission civilisatrice‘ (französische Bezeichnung), beziehungsweise der ‚antifaschistisch-demokratischen Umwälzung‘ (Bezeichnung der sowjetischen Militäradministration). In Ergänzung zur Demilitarisierung und zur wirtschaftspolitischen und militärischen ‚Westbindung‘ sollte die ‚Umerziehung‘ als ein auf Nachhaltigkeit angelegtes, auf die Mentalität abzielendes, kulturelles Projekt verhindern helfen, daß von deutscher Seite je wieder Angriffskrieg und Völkermord drohen könnten. Als von den Alliierten bereits während des Krieges, in der Hoffnung auf einen baldigen Sieg, Pläne zur Re-education/Re-orientation gemacht wurden, war diese zunächst vor allem als eine Aufgabe der Veränderung der Kinder- und Jugendbildung durch die Umgestaltung der Schul- und Hochschulbildung in Deutschland angesehen worden.73 Doch je mehr sich der Krieg seinem Ende näherte, desto stärker war auch die Erwachsenenbildung zu einem wichtigen Thema der angestrebten ‚Umerziehung‘ gereift. Von britischer Seite äußerte sich dies unter anderem in den Hilfestellungen, die Reform-orientierte deutsche Erwachsenenbildner, die vor den Nationalsozialisten ins britische Exil geflohen waren, für ihre Rückkehr nach Deutschland durch die Freiwilligenorganisation ‚German Educational Reconstruction‘ [GER] erhielten. Im Rahmen der Re-education behielten sich die alliierten Mächte die Lizenzierung von Vereinen und Verbänden sowie von Printmedien74 vor, sie kontrollierten Radio, Film und Theater. Sie richteten Kulturzentren (in der britischen Zone ‚Die Brücke‘, in der US-Zone ‚Amerika-Haus‘) ein, die über die politische Kultur der Herkunftsländer informierten, luden Gastredner aus ihren Heimatländern nach Deutschland ein
72 Vgl.: Schumacher: Krieg, S. 151. 73 Entsprechend schlug sich dieses Thema vergleichsweise früh und dominant in der Forschungsliteratur nieder. Vgl. dazu das vielzitierte Werk: Pakschies, Günter: Umerziehung in der britischen Zone von 1945 bis 1949. Untersuchungen zur britischen ReeducationPolitik, 2. Aufl., Köln/Wien 1984. 74 Vgl.: Koszyk: Presse. Im Aufsatz lassen sich die grundsätzlichen Voraussetzungen nachvollziehen, vor deren Hintergrund Theanolte Bähnisch ihre Lizenz für die ‚Stimme der Frau‘ beantragen und erhalten konnte. Vgl. dazu auch: Freund: Krieg.
Club deutscher Frauen | 553
und führten Studienaustauschprogramme durch.75 Jene Kulturprogramme, die sich auch in den Strukturen und Programmen von deutschen Parteien, Vereinen und Verbänden niederschlugen, sind – im Zuge des ‚Cultural Turn‘ in den Geschichtswissenschaften76, vor allem im Kreis um Anselm Döring-Manteuffel77, in diversen Studien beschrieben worden.78 Döring-Manteuffel und seine Schüler berücksichtigen im Rahmen ihres Konzepts der ‚Westernisierung‘ den Einfluß der ‚Junior Partner‘ unter den Besatzungsmächten auf den deutschen Wiederaufbau stärker, als dies in den Studien, die eine ‚Amerikanisierung‘79 Deutschlands annehmen80, der Fall ist. Insbesondere die von Hermann Graml seinerzeit aufgestellte These von der „konzeptionslosen Entschlossenheit“81 der britischen Militärregierung mußte vor dem Hintergrund der Ergebnisse jener Studien stark relativiert werden. Neueren Forschungen zufolge war die Re-education-Politik der Briten differenzierter und vorausschauender als die der US-Amerikaner. Als ein zentraler Bestandteil dieser stärkeren Ausdifferenzierung der britischen Umerziehungs-Pläne hinsichtlich ihrer Zielgruppen ist die Tatsache anzusehen, daß in Großbritannien schon 1946 Konzepte zur ‚Umerziehung‘ deutscher Frauen, von Major General Erskine als „one of the greatest of the adult educa-
75 Zur britischen Kulturpolitik in Deutschland vgl.: Clemens: Kulturpolitik. Zur USamerikanischen Kulturpolitik vgl.: Schumacher: Krieg. 76 Zum ‚Cultural Turn‘ in den Geschichtswissenschaften vgl.: Jaeger, Friedrich: Die Geschichtswissenschaft im Zeichen der kulturwissenschaftlichen Wende, in: Müller, Klaus E. (Hrsg.): Phänomen Kultur. Perspektiven und Aufgaben der Kulturwissenschaften, Bielefeld 2003, S. 221–238. Zur bereits länger währenden Diskussion über die ‚Kulturgeschichte‘ in Deutschland vgl.: Flemming: Kulturgeschichte, S. 8–23. 77 Vgl.: Doering-Manteuffel: Amerikanisierung, 1999. Vgl. auch den aktuellen Aufsatz: Doering-Manteuffel: Amerikanisierung, 2011. 78 Beispielhaft sei genannt: Angster: Konsenskapitalismus. 79 Vgl.: Jarausch/Siegrist: Amerikanisierung. 80 Vgl. dazu auch: Junker u. a.: USA. Diese Studie klammert den Kalten Krieg als Kontext weitgehend aus: Trommler, Frank/Shore, Elliott (Hrsg.): Deutsch-amerikanische Begegnungen. Konflikt und Kooperation im 19. und 20. Jahrhundert, München 2001. 81 Vgl.: Graml, Hermann: Die Alliierten in Deutschland, in: Institut für Zeitgeschichte (Hrsg.): Westdeutschlands Weg zur Bundesrepublik 1945–1949. Beiträge von Mitarbeitern des Instituts für Zeitgeschichte, München 1976, S. 25–52. Einen allgemeineren Aufsatz, in dem erstmals eine positivere Bewertung der Rolle der Briten als Besatzungsmacht in den Anfängen des Kalten Krieges erfolgt, lieferte Victor H. Rothwell 1985. Er konstatiert einen durch die Forschung zu früh angesetzten Bedeutungsverlust Großbritanniens und beschreibt den verhältnismäßig großen Handlungsspielraum der Briten in der Frühphase des Kalten Krieges überzeugend. So beweist zum Beispiel die Tatsache, daß sich Großbritannien 1944 in der Frage der Aufteilung der Besatzungszonen mit der Okkupation des industrialisierten Nordwestens Deutschlands durch Großbritannien gegenüber den USA durchsetzen konnte, für Rothwell den starken Einfluß des ‚Junior-Partners‘. Vgl.: Rothwell, Victor H.: Großbritannien und die Anfänge des Kalten Krieges, in: Foschepoth, Josef(Hrsg.): Kalter Krieg und Deutsche Frage. Deutschland im Widerstreit der Mächte. 1945–1952, Göttingen/Zürich 1985, S. 88–110.
554 | Theanolte Bähnisch
tion problems in Germany“82 bezeichnet, vorlagen.83 Ein vergleichsweise großes Interesse an der Rolle von Frauen in Deutschland zeigte zunächst nur die sowjetische Militäradministration (SMAD). Das Office of Military Government for Germany (OMGUS) hatte anfangs kein besonderes Interesse an der Thematik erkennen lassen, orientierte sich jedoch später am britischen Konzept. Die französische Militärregierung entwickelte und verfolgte während ihrer Präsenz in Deutschland kein spezielles Konzept zur Frauenbildung. 6.3.2 Die Arbeit der britischen Women’s Affairs Officers und eine Instruktion, die auch Bähnisch erreicht haben muß Bereits im Mai 1946 hatte die britische Militärregierung Offiziere eingesetzt, die sich besonders um den Bereich ‚Frauenbildung‘ kümmern sollten. Dafür war innerhalb der Erziehungsabteilung (Education Branch)84 eine ‚Civic Development Section‘ eingerichtet worden85, die 1947 in ‚Women’s Affairs Section‘ umbenannt wurde.86 Neben diesem Women’s Affairs-Büro auf zentraler Ebene wurden Women’s Affairs
82 NA, UK, FO 1049/568, Office of the Deputy Military Governor, CCG (BE) Advanced Headquarters, Berlin, B.A.O.R. an The Permanent Secretary, COGA, London, 18.04.1946. 83 Vgl. dazu die wichtigsten Werke zur Frauenpolitik der Britischen Militärregierung: Tscharntke: Re-educating sowie Ziegler: Lernziel. 84 Die britische Militärregierung bestand aus zwei Apparaten: Einen bildete das ‚German Department‘ des ‚Foreign Office‘ in London (bis 1947 war dieser Apparat als COGA – Control Office für Germany and Austria unabhängig) unter der Leitung des Duchy of Lancaster (zunächst John Burns Hynd, später Lord Pakenham), dem für Deutschland verantwortlichen Minister in Großbritannien. Der zweite Apparat war die ‚Control Commission for Germany (British Element)‘, kurz ‚CCG (BE)‘, die über diverse Einheiten in der Britischen Besatzungszone verfügte. Bis November 1949 hieß der Military Governor Sir Sholto Douglas, dann übernahm das Amt sein bisheriger Stellvertreter, General Brian Robertson. Es gab zwei Hauptsitze (Headquarters) der CCG (BE), einen in Berlin und einen in Bünde, in der Nähe Hannovers. Die Verwaltungsstruktur der CCG orientierte sich an der Struktur der deutschen Länder, Regierungsbezirke und Kreise. „CCG basically shadowed the ministries of a ,real‘ german government“ schreibt Tscharntke zum Verständnis des Apparats. Jede ,Division‘ – Manpower Division, Education Division, Political Division, Economic Division – wurde von einem ‘Advisor‘ geleitet. Die für die Women’s Affairs relevanten Branches (in der Hierarchieebene eine Stufe unter den Divisions stehend) waren zunächst die ‚Administration & Local Government Branch‘ sowie die ‚Education Branch‘. Die beiden Branches gehörten zunächst zur ‚Internal Affairs & Communications Division‘. Diese Division wurde im Sommer 1947 aufgelöst und die Education Branch wurde zu einer unabhängigen Einrichtung unter der Leitung eines Advisors aufgewertet. Im Lauf des Jahres begann 1947 sich auch die ‚Political Division‘ im Bereich der Women’s Affairs zu engagieren, 1948 spiegelte sich diese, durch faktisches Handeln geschaffene Tatsache auch in der Organisationsstruktur der CCG (BE) wieder. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 19/20. 85 Vgl. hierzu auch Ziegler: Lernziel, S. 15. 86 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 19.
Club deutscher Frauen | 555
Officers auch auf Landesebene eingesetzt.87 Als Kerndokumente aus der frühen Zeit einer vergleichsweise dichten Überlieferung geben die miteinander in Verbindung stehenden Papiere ‚Educa-tion Control Instruction No. 60‘88, und ‚Directive to S. O.‘89 Auskunft über die wichtigsten Gedanken und zentralen Elemente der FrauenRe-education. Die Dokumente zirkulierten innerhalb des Militärapparates, wurden aber in einer leicht veränderten Form90 auch an deutsche Behörden verschickt. Sie müssen auf dem Weg des üblichen Geschäftsgangs über das niedersächsische Innenministerium auch das Regierungspräsidium in Hannover erreicht haben. „Mil[iltary] Gov[ernment] considers it essential that German women should be encouraged to take an active interest in the life of their communities and in their civic responsibility and should achieve an appropriate education to that end”91, machte die Militärregierung in der für ‚German Authorities‘ maßgeblichen Anordnung ihre Überzeugung, daß Frauen künftig stärker in das gesellschaftliche Leben eingebunden werden sollten und zu diesem Zweck eine angemessene Bildung erfahren müßten, deutlich. Dies geschah offenbar nicht zuletzt, um der Möglichkeit vorzubeugen, daß Frauen-Organisationen von deutschen Behörden Steine in den Weg gelegt werden würden. Denn in solchen Organisationen hatte die Militärregierung ein geeignetes Umfeld für die angestrebte Frauen-Bildung erkannt: „Experience elsewhere has shown that for ordinary women formal education methods are rarely the most successful, and that voluntary non-political women’s organisations […] can provide the type of education required in its most palatable form“92, brachte die Instruktion die besondere Förderungswürdigkeit von Frauenorganisationen zum Ausdruck. In der Anweisung aus dem April 1946 deutete sich der Weg an, den die britische Militärregierung in den folgenden Jahren in puncto Frauenbildung und Frauenbewegung gehen würde. Beide Aspekte, Frauenbewegung und Frauenbildung wurden – ein Pro-
87 Vgl.: ebd., S. 23. 88 NA, UK, FO 1050/1299, IA & C Division Military Government Instruction No. 78 (Also known as Education Control Instruction No. 60), April 1946. 89 Für die Senior Officers in den Regional Headquarters wurde die ‚Education Control Instruction‘ durch die ‚Directive to S. O.‘ [Senior Officers] aus dem Juli 1946 ergänzt. In dieser beschrieb die A&LG Branch der IA&C Division aus dem Berliner Hauptquartier den Officers in den Regionen, wie Frauen dazu ermutigt werden könnten, ihre Rolle in der Gesellschaft wahrzunehmen. Betont wurde im Schreiben jedoch, daß die Arbeit von den Deutschen selbst erledigt werden müsse. „We are there to encourage, advise and help but not to run things ourselves. We have of course also to control.” NA, UK, FO 1050/1299, Directive to S. O. (Women’s Affairs), Regional HQ, Juli 1946. Auch die gewünschte Form der Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen der Militärregierung wurde in diesem Schreiben festgehalten. 90 NA, FO, UK, 1050/1299, Military Government – Germany, British Zone of Control, I.A.& C. Division Military Government Instruction No 78 (Also known as Education Control Instruction No. 60), Version for German Authorities, Subject: Women’s Voluntary Organisations – Adult Education, April 1946. 91 Ebd. 92 Ebd.
556 | Theanolte Bähnisch
dukt europäischer Traditionen – als miteinander eng verbunden angesehen. Daß diese Verbindung aber, insbesondere vor dem Hintergrund einer sich bald dramatisch zuspitzenden politischen Lage, zwischenzeitlich in Frage gestellt werden sollte, wird später wieder aufgegriffen werden. Das gesellschaftliche Engagement von Frauen in demokratisch organisierten Frauenverbänden wurde durch die Officers als besonders wertvoll für die Reeducation angesehen und entsprechend gefördert, da es die Einübung demokratischer Verhaltensweisen auf dem kleinsten organisatorischen Nenner und im direkten Lebensumfeld der Frauen zu ermöglichen schien. Die Offiziere beobachteten und unterstützen deshalb den (Wieder-)Aufbau von Frauenverbänden in Deutschland, indem sie an entsprechenden Veranstaltungen teilnahmen und sich mit Frauen austauschten, die sich in solchen Zusammenschlüssen engagierten oder die dafür als geeignet angesehen wurden. Sie stellten den Verbänden Material (beispielsweise Statistiken, britische Frauenzeitschriften und Informations-Broschüren, aber auch Büromaterial) zur Verfügung und planten Treffen und Konferenzen, auf denen sich Mitglieder verschiedener Organisationen austauschen konnten. Zudem arrangierten sie Besuche von prominenten Vertreterinnen der Frauenbewegung aus Großbritannien und aus anderen europäischen Ländern in Deutschland sowie Gegenbesuche deutscher Frauen in Großbritannien.93
6.4 HANNOVER IM ZENTRUM DER AUFMERKSAMKEIT: WER SOLL DIE FRAUEN BILDEN? 6.4.1 Umworbene Eliten der Frauenbildung – Die niedersächsische Volkshochschule und die Gründerinnen des ‚Club deutscher Frauen‘ Theanolte Bähnisch hatte ihr Amt als Regierungsvizepräsidentin des Bezirks Hannover im März 1946 angetreten. Die niedersächsische Volkshochschule hatte, schon bevor Bähnisch ihr Amt als Regierungsvizepräsidentin angetreten hatte und bevor die ‚Education Control Instruction No. 60‘ im April 1946 an die deutschen Behörden verschickt worden war, erste Schritte zur Etablierung von Bildungsangeboten für er-
93 Die Einladung von Protagonistinnen deutscher Frauenorganisationen diente nicht zuletzt der sogenannten ‚Projection of Britain‘: Zurück in Deutschland sollten die ausgewählten Multiplikatorinnen von ihren Erfahrungen mit Land und Leuten berichten und britische Ansätze in Frauen- und Wohlfahrtsarbeit in Deutschland populär machen. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 25. Tscharntke verweist auch auf Mayring, Eva A.: The impact of British occupation and political culture in Germany after 1945, in: Bance, Alan (Hrsg.): The cultural legacy of the British occupation in Germany. The London Symposium, Stuttgart 1997, S. 197–199. Bähnisch setzte die ,Projection of Britain‘ mustergültig auch durch die Darstellung Großbritanniens als Referenzgesellschaft in der ‚Stimme der Frau‘ um. Vgl.: Freund: Krieg, passim.
Club deutscher Frauen | 557
wachsene Frauen unternommen.94 Im Zentrum jener Anstrengungen standen Personen, die sich aus der gemeinsamen politischen und pädagogischen Arbeit in der Weimarer Republik kannten: Adolf Grimme, Heiner Lotze und Fritz Borinski. Die Anfänge ihrer speziell auf Frauen ausgerichteten Initiative im Regierungsbezirk Hannover, lassen sich aus dem Nachlaß Elfriede Pauls, einer späteren Mitbegründerin des von Bähnisch initiierten ‚Club deutscher Frauen‘ genauer rekonstruieren, als dies auf der Grundlage des von Christl Ziegler ausgewerteten Materials möglich war. Dabei wird deutlich, daß die Regierungspräsidentin ihren Club gemeinsam mit den Frauen aufbaute, welche von Seiten der Volkshochschule dazu auserkoren worden waren, eine tragende Rolle in der – VHS-internen – regionalen Frauenbildung zu übernehmen. „Die Volkshochschule Hannover möchte sich besonders stark der Frauen, und zwar der arbeitenden und der Hausfrauen annehmen. Ab Ostern wird eine größere Zahl dafür geeigneter Arbeitsgemeinschaften im Lehrplan erscheinen“95, hatte Heiner Lotze im Januar 1946 in seiner Funktion als Vorsitzender des ‚Bundes für Erwachsenenbildung, Hannover‘ und als erster Direktor der Volkshochschule Hannover nach deren Wiedereröffnung am 27.01.1946 an einen ausgewählten Kreis von Frauen geschrieben. Von diesen erhoffte er sich Hilfe bei der Verbreitung spezieller Angebote für Frauen. „Die Volkshochschule ist heute nicht mehr recht in ihrem Wesen und ihrer Aufgabe nach bekannt“96, fand Lotze eine euphemistische Beschreibung für den Umstand, daß die Volkshochschulen während des Nationalsozialismus teils geschlossen worden waren und sich teils in ihrer Ausrichtung so stark den nationalsozialistischen Zielsetzungen angepaßt hatten, daß von den Ideen der Erwachsenenbildung, wie sie in der Weimarer Republik entstanden waren, kaum mehr etwas übriggeblieben war. „Wir wollen daher die Frauen Hannovers zuerst einmal wieder vertraut mit ihr machen“, hatte Lotze, der ab 1920 an der Heimvolkshochschule Dreißigacker, später an den Volkshochschulen in Sachsensburg und Jena tätig gewesen war und schließlich die Geschäfte des Landesverbands der Thüringischen Volkshochschulen geführt hatte97, sein Anliegen eingeleitet. „Wir versprechen uns den besten Erfolg, wenn wir damit beginnen bei den Frauen in sozialen Berufen, Lehre-
94
95 96 97
Mit diesen Erwachsenenbildungs-Programmen setzt sich vor allem Christl Ziegler in ihrer erziehungswissenschaftlichen Dissertation auseinander. Vgl.: Ziegler: Lernziel. Die Erziehungswissenschaftlerin knüpft mit ihrer Arbeit an die Studien über Erwachsenenbildung in Volkhochschulen in der Nachkriegszeit von Paul Ciupke und Karen DerichsKunstmann an, die wiederum in der Tradition Bernd Faulenbachs und Franz-Josef Jelichs forschten. Vgl.: Ciupke/Derichs-Kunstmann: Emanzipation. Vgl. zu den Kontinuitäten in der Erwachsenbildung vor 1933 und nach 1945 auch: Ciupke/Jelich: Experimentiersozietas sowie dies.: Ein neuer Anfang. Politische Jugend- und Erwachsenenbildung in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, Essen 1999. BArch, NY 4229, Nr. 41, Heiner Lotze an Elfriede Paul und andere, Januar 1946. Ebd. Vgl.: Tietgens, Hans: Art. „Heiner Lotze (1900–1958)“, in: Wolgast, Günther/Knoll, Joachim (Hrsg.): Biographisches Handwörterbuch der Erwachsenenbildung, Stuttgart 1986, S. 245-246.
558 | Theanolte Bähnisch
rinnen, Ärztinnen, bei geistig regen Berufstätigen und Hausfrauen. Wir hoffen, diese werben dann für die relevanten Arbeitsgemeinschaften, jede in ihrem Kreise“.98 Seine Ansprechpartnerinnen hatte er seiner Idee entsprechend mit Bedacht ausgewählt. Unter ihnen waren Mitarbeiterinnen der Landes- und der Bezirksregierungen, wie die Schulrätin Anna Mosolf und die Professorin a. D. und Ministerialrätin beim Kultusministerium für Volks- und Mittelschulen, Katharina Petersen, die Referentin für Frauenfragen vom Landesarbeitsamt, Dr. Dorothea Karsten, eine Lehrerin, eine ‚Volkspflegerin‘ sowie die Ärztin Dr. Elfriede Paul. Sie alle sollten ihm dabei helfen, an den Volkshochschulen in der Region Angebote für Frauen zu etablieren. „Für diese erste Begegnung“ – zu der sich geeignete Multiplikatorinnen versammeln sollten – „halten wir am wirksamsten eine Reihe von Vorträgen – unter dem Gesamttitel etwa: ‚Frau und Gegenwart‘“99. Lotze bat den angeschriebenen Kreis zu einer Besprechung am 06.02.1946 in das Regierungspräsidium. Im Dienstzimmer von Oberregierungsrätin Prof. Käthe Feuerstack, der Leiterin der Abteilung für Volks- und Sonderschulen in Hannover, wollte er sich mit den angeschriebenen Frauen über geeignete Rednerinnen und Themen für die Auftaktveranstaltung unterhalten.100 Schon knapp zwei Wochen nach dem Treffen bei Feuerstack erhielt Paul einen zweiten Brief von Lotze. In diesem bat er die Ärztin, im Auftrag seines Chefs101, dem Kultusminister Adolf Grimme, gemeinsam mit der erfahrenen Erwachsenenbildnerin Franziska Lambert102 um Ostern 1946 auf einem Lehrgang für Volkshochschullehrer der Provinz Hannover zu sprechen. Die beiden Frauen sollten Vorträge zum Thema ‚Frau und Volkshochschule‘ übernehmen.103 Elfriede Paul kam nicht nur dieser Bitte nach, sondern sie brachte sich auch im Juli 1947 mit der Leitung eines Lehrgangs für Frauen an der 1945 von Lotze gegründeten ‚Heimvolkshochschule Göhrde‘ in die Frauenbildung der niedersächsischen Volkshochschule ein.104 Damit engagierte sich Paul, die von August bis zur Gründung des Landes Niedersachsen im November 1946 Ministerin des Landes Hannover für Aufbau, Arbeit und Wohlfahrt war, in ei-
98 99 100 101
BArch, NY 4229, Nr. 41, Heiner Lotze an Elfriede Paul und andere, Januar 1946. Ebd. Ebd. Heiner Lotze war Referent für Erwachsenenbildung im Niedersächsischen Kultusministerium bis zu seinem Tod am 28.12.1958. 102 Lambert war in der Weimarer Republik an der Volkshochschule Stuttgart tätig gewesen. Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 98. 103 BArch, NY 4229, Nr. 41, Heiner Lotze an Franziska Lambert und Elfriede Paul, 18.02.1946. Aus diesen Vorträgen heraus scheint die 19seitige Broschüre ‚Frau und Volkshochschule‘, die Paul und Lambert 1947 zusammen herausgeben hatten, entstanden zu sein. Am 09.12.1946 wandte sich Lotze noch einmal an Paul, mit der Bitte, sie möge gemeinsam mit Frau Dr. Junius die Leitung eines einwöchigen Lehrgangs für weibliche Lehrkräfte der Volkshochschule übernehmen. Ob Paul sich zeitnah entsprechend engagierte, ist nicht klar. Überliefert ist ein entsprechendes Engagement für den Juli 1947. NLA HA HStAH, Nds. 401, Acc. 92/85, Nr. 223, Veranstaltungsbroschüre der HeimVolkshochschule Göhrde, Ferienkurse der Volkshochschule Hannover, 1947. 104 Ebd.
Club deutscher Frauen | 559
ner Institution von Rang, die weit über die Grenzen Niedersachsens hinaus bekannt war. 6.4.2 Fritz Borinskis Konzept der ‚Mitbürgerlichen Bildung‘ und sein Einfluß auf die ‚staatsbürgerliche Frauenbildung‘ Bähnischs Das Erwachsenbildungs-Konzept, das jene Institution mit Strahlkraft bis ins Ausland verfolgte, glich stark jenem, das Theanolte Bähnisch, wenn auch nicht in vergleichsweise strukturierter Form, im Rahmen ihrer ‚staatsbürgerlichen Frauenbildungsarbeit‘ umzusetzen anstrebte. Verschiedene, miteinander verschränkte Erklärungsmöglichkeiten bieten sich dafür an: Vermutlich war Bähnisch von Beginn ihrer Arbeit in Hannover an von Personen wie Grimme, Feuerstack und Paul und/oder über die Lehrpläne der Göhrde105 – wie die Einrichtung im Volksmund genannt wurde – sowie über die Entwicklung der Erwachsenenbildung in der Region auf dem Laufenden gehalten worden. Schließlich interessierte sie sich, dies zeigten ihr Engagement im ‚Club junger Menschen‘, ihr Interesse an der SAG sowie ihre Aussage gegenüber Schumacher, daß sie ‚am liebsten ein kulturelles Propagandahaus aufziehen‘ wolle, für die (politische) Bildung Jugendlicher und (junger) Erwachsener. Vielleicht hatte sie sogar die Schriften des neuen Leiters der Göhrde zur Kenntnis genommen, zumal sich die für den Wiederaufbau in der Region maßgeblichen Empfehlungen der Militärregierung für die politische Erwachsenenbildungsarbeit mit den Ansätzen des Göhrde-Leiters Fritz Borinski deckten. Auch, daß sie über Grimme mit Borinski ins Gespräch gekommen war, ist nicht unwahrscheinlich. Schließlich ist davon auszugehen, daß Erfahrungen aus ihrem Leben mit Albrecht Bähnisch, der sich für ‚Dreißigacker‘ und die SAG eingesetzt hatte, eine Rolle dafür spielten, daß im Auftritt und in der Arbeit der von ihr geleiteten Frauenzusammenschlüsse ähnliche Strategien und ähnliche Inhalte wie in der ‚Göhrde‘ dominierten. Denn in der Göhrde kam personell wie methodisch die Theanolte Bähnisch teilweise persönlich bekannte Avantgarde der deutschen Erwachsenenbildung der Weimarer Zeit zusammen. Daß die ‚Göhrde‘ inhaltlich an die als besonders modern geltende thüringische Erwachsenenbildung der Weimarer Republik anknüpfen konnte – zu der auch „längerfristige“106 Frauenlehrgänge, wie sie in Dreißigacker stattfanden – gehört hatten, war vor allem durch ihren prominenten Leiter sichergestellt. Adolf Grimme war es gelungen, 1947 Fritz Borinski für die Leitung der Schule zu gewinnen.107 In der Anstellung dieses Karl-Mannheim-Schülers108 ist einmal mehr die bereits beschriebene
105 Vgl. neben der weiter unten genannten allgemeinen Literatur zur Volkshochschule nach 1945 speziell zur Göhrde auch die Jubiläumsschrift: Feickert, Andreas: Heimvolkshochschule Jagdschloß Göhrde 19461971, Uelzen 1971. 106 Ziegler: Lernziel, S. 109. 107 Vgl.: Faulstich, Peter/Zeuner, Christine: Erwachsenenbildung und soziales Engagement. Historisch-biografische Zugänge, Bielefeld 2001, S. 245. 108 Borinski hatte bei Mannheim, nachdem er bereits 1927 in Leipzig zum Dr. phil. promoviert worden war, eine Dissertation über Carl Schmitt und Hermann Heller zum Thema
560 | Theanolte Bähnisch
strategische Personalpolitik Grimmes zu erkennen, welche darauf abzielte, reformorientierte Eliten aus der Verwaltung und der Pädagogik in der Weimarer Republik nach Niedersachsen zu holen, um dort konzentriert den Wiederaufbau voranzutreiben. Borinski hatte die NS-Zeit im britischen Exil verbracht, wo er als Mitglied und Sekretär des 1943 gegründeten German Educational Reconstruction Committee (GER) aktiv war. Das GER war ein freiwilliges, gemeinsames Projekt eines größeren Kreises von britischen und deutschen Experten.109 Als Fachvereinigung sollte es der britischen Regierung bei der Ausarbeitung einer Re-education-Politik für Deutschland, die den Aufbau eines neuen Bildungssystems umfaßte, beratend zur Seite stehen. Zum einen konnte Fritz Borinski als leitendes Mitglied des GER weichenstellenden Einfluß auf die Erwachsenenbildungspolitik Großbritanniens im Nachkriegsdeutschland ausüben. Zum anderen schlugen sich durch Borinskis Präsenz in der Göhrde – zumal sein fachlicher Austausch mit britischen Pädagogen und Politikern anhielt – nicht nur Reform-Ansätze der Erwachsenenbildung aus der Weimarer Republik, sondernd auch Ansätze aus der modernen britischen Pädagogik, welche auf eine verstärkte Erziehung der Bürger zur Demokratie abzielten110, nieder. Mit dem Kultusminister Adolf Grimme stand der Göhrde ein Politiker und Pädagoge vor, der bereits als preußischer Kultusminister in der Weimarer Republik reformorientierte Bildungseinrichtungen engagiert gefördert hatte. Dazu zählte bekanntlich auch die Ausbildungsstätte Lotzes, das Heimvolkshochschulheim ‚Dreißigacker‘, obwohl diese Institution gar nicht in Grimmes Zuständigkeit gefallen war.111 Der 1883 geborene Leiter der Heimvolkshochschule Dreißigacker, Eduard Weitsch, schaffte es, im Gegensatz zum deutlich jüngeren, 1903 geborenen Fritz Borinski, nach 1945 nicht, in der Erwachsenenbildung wieder eine bedeutende Rolle einzunehmen.112 Weitsch, „sicherlich vor 1933 einer der wichtigsten Repräsentanten einer humanitär-demokratisch ausgerichteten Volksbildung, der großen Einfluß auf
109 110 111
112
‚Staatstheorie und Staatskrise‘ vorgelegt. Die zur Veröffentlichung in der Schweiz vorgesehene Arbeit wurde jedoch nicht publiziert, weil die deutsche Regierung Druck auf den Verlag ausgeübt hatte. Vgl.: Faulstich/Zeuner: Erwachsenenbildung, S. 242, vgl. für eine etwas abweichende Darstellung auch: Wittebur, Klemens: Die deutsche Soziologie, 1933–1945. Eine biographische Kartographie, Münster/Hamburg 1991, S. 96. Vgl.: Faulstich/Zeuner: Erwachsenenbildung, S. 14 und 243 sowie Ziegler: Lernziel, S. 12. Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 12. An dieser Stelle soll eine Kurzzusammenfassung dessen genügen, was an anderer Stelle bereits ausgeführt wurde: Das thüringische Ministerium für Volksbildung und Inneres hatte zum 22.02.1930, nachdem die Nationalsozialisten in Thüringen die Regierungsmehrheit hatten bilden können, die staatlichen Zuschüsse für Volksbildung gestrichen. Die Heimvolkshochschule Dreißigacker konnte jedoch mit Hilfe einer staatlichen Zwischenfinanzierung des Reichsinnenministeriums und des preußischen Ministers für Kunst und Wissenschaft, damals Adolf Grimme, weiterarbeiten. Fritz Borinski selbst schien dies bedauert zu haben, vgl.: Faulstich/Zeuner: Erwachsenenbildung, S. 210.
Club deutscher Frauen | 561
die Entwicklung ihrer Theorie und Praxis hatte“113, war nicht ins Exil gegangen, dies bot, den Erziehungswissenschaftlern Peter Faulstich und Christine Zeuner zufolge Raum für Spekulationen über seine politische Haltung.114 Weitsch trat ab 1947 immerhin als Mitherausgeber der Zeitschrift ‚Freie Volksbildung‘ – gemeinsam mit seinem ehemaligen Schüler Lotze – wieder in Erscheinung. Das Prinzip der unbedingten politischen Neutralität in der Bildung, auf das Weitsch seine Arbeit in der Weimarer Republik aufgebaut hatte, und damit auch der Unwille, im Sinne einer Partei bildend tätig zu sein, lebte in der zweiten Generation der Weimarer Erwachsenenbildner fort – vor allem auch durch Fritz Borinski. Dieser war in der Weimarer Republik Leiter des Volkshochschulheims für Jungarbeiter in Leipzig und – wie der zuvor in Dreißigacker beschäftigte Lotze – Lehrer an der Heimvolkshochschule Sachsenburg gewesen. Gemeinsam mit Theodor Litt hatte Borinski zudem das Seminar für freies Volksbildungswesen an der Universität Leipzig geleitet.115 Daß sich Borinski, wie Albrecht Bähnisch, in den 1920er Jahren in der SAG engagiert hatte, fand, wie im entsprechenden Zusammenhang bereits erwähnt, in den einschlägigen Studien bisher kaum Beachtung. Jene Sozialisation, von der Borinski schrieb, sie sei besonders wichtig für seinen weiteren Werdegang gewesen, liefert jedoch eine Erklärung dafür, warum Borinski, der sich politisch im rechten Flügel der Sozialdemokratie verorten läßt116, zwar in der Arbeiterbildung eine wichtige Aufgabe sah und das ‚Klassenbewußtsein‘ der Arbeiter unterstützen wollte, sich dabei jedoch nicht an der sozialdemokratischen Linie, sondern an der für die SAG-Arbeit besonders zentrale Idee der ‚Verständigung zwischen den Klassen‘ orientierte, für die eine parteipolitische Neutralität in der Bildung unabdingbar schien.117 Borinski, der das besondere Vertrauen der Briten genoß, charakterisierte die Ziele seiner Bildungsarbeit nach der Rückkehr aus Großbritannien so: „Es geht um die Freiheit in der demokratischen Bildung, um das Recht eines jeden mündigen Bürgers auf seine eigene, freie Meinungsbildung und Entscheidung, das nicht durch einseitige, die Sache verfälschende, den Menschen vergewaltigende Propaganda, nicht durch Ideologisierung
113 „Sie reichen von der Aussage, er sei in die ‚innere Emigration‘ gegangen, bis hin zu dem Vorwurf einer Affinität zum Nationalsozialismus bzw. einer unkritischen Haltung gegenüber dem NS – vor allem in Hinblick auf die Fortführung der Arbeit in Dreißigacker zwischen 1930 und 1933“, schreiben Zeuner und Faulstich weiter zu den Vorwürfen gegen Weitsch. Vgl.: ebd., S. 211. 114 Ebd. 115 Meta-Archiv-Datensatz: „Borinski, Fritz, Prof. Dr.“, in: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, auf: http://www.die-bonn.de/Weiterbildung/Archive/Meta-Archiv/personen. aspx?per_id=526, am 13.12.2013. 116 Vgl.: Graf, Rüdiger: Die Zukunft der Weimarer Republik, Krisen und Zukunftsaneignungen in Deutschland 1918–1933, München 2008, S. 273. Borinski gehörte als Mitherausgeber der Neuen Blätter für den Sozialismus zum Kreis der religiösen Sozialisten. 117 Vgl. auch: Borinski: Wechselverhältnis.
562 | Theanolte Bähnisch
und Indoktrinierung gebrochen werden darf.“118 Kaum zufällig erinnern seine Aussagen stark an das Bildungsprinzip des mit dem Leiter der SAG in engem Austausch stehenden Eduard Weitsch. Faulstich und Zeuner erklären Weitschs Position wie folgt: „Sein Ziel war es, die Lernenden erstens zur Toleranz zu erziehen, indem sie lernten, auch andere Standpunkte zu akzeptieren. Zweitens sollten sie auf diesem Weg unbeeinflußt und unabhängig eigene Ansichten entwickeln und begründen.“119 Fritz Borinski war die wohl bekannteste und einflußreichste Person im Kontext des ‚Brückenschlags‘ von der thüringischen Volkshochschulbildung in der Weimarer Republik zur Volkshochschularbeit in Niedersachsen nach 1945. In sein Konzept der ‚Mitbürgerlichen Bildung‘120 waren neben Traditionen der thüringischen und sächsischen Erwachsenenbildung auch britische und schwedische Ansätze eingeflossen.121 Den Zweck der ‚mitbürgerlichen Bildung‘ beschrieb der Vater dieses geistigen Konzepts so: „Es geht um die Bildung des Erwachsenen zum sozialen Wissen, zur sozialen Verantwortung und zur wissenden und zur verantwortlichen sozialen Aktion – und damit zugleich um die Vermenschlichung des öffentlichen Lebens. Denn die soziale Bildung des Menschen und die humane Gestaltung der Gesellschaft gehören zusammen.“122 Faulstich und Zeuner weisen darauf hin, daß dieses Konzept nicht nur in Abgrenzung, sondern sogar im Gegensatz zur Idee der ‚staatsbürgerlichen Bildung‘ der Weimarer Republik zu verstehen sei. Borinski habe diese als „einseitig statisch, formalistisch und machtpolitisch“123 wahrgenommen, weil die ‚staatsbürgerliche Bildung‘ seiner Meinung nach keine kritischen, entscheidungsfähigen Bürger erziehen, sondern über „Staatsform, Staatsgesetz und Staatsbehörden“ aufklären wolle, mit dem Zweck, „bessere[…] und bequemere Untertanen“ heranzuziehen. Deshalb stünden bei ihr die Bürgerpflichten, nicht die Bürgerrechte im Zentrum. Eine solche „politische Bildung“ diene dem Ziel der „Gehorsamkeit“, nicht der „Erziehung zur verantwortlichen Freiheit“ 124 wird Borinski zitiert. Daß Theanolte Bähnischs Vorstellungen zur ‚staatsbürgerlichen Frauenbildung‘ trotz der begrifflichen Nähe zum von Borinski geschmähten Terminus ‚staatsbürgerliche Bildung‘ eine große Nähe zu
118 Borinski, Fritz: Zum Geleit, in: Olbrich, Josef (Hrsg.): Konzeption und Methodik der Erwachsenenbildung bei Eduard Weitsch, Stuttgart 1972, zitiert nach Faulstich/Zeuner: Erwachsenenbildung, Seite 220. 119 Faulstich/Zeuner: Erwachsenenbildung, S. 219/220. 120 1954 publizierte Borinski die Kerngedanken seines Konzepts, das zunächst in Schweden als ‚Medborgarbildning‘ bekannt wurde, auch in deutscher Sprache. Vgl.: Borinski, Fritz: Der Weg zum Mitbürger. Die politische Aufgabe der freien Erwachsenenbildung in Deutschland, Düsseldorf 1954. 121 Vgl. zu den verschiedenen, im Konzept Borinskis miteinander verknüpften Einflüssen: Ziegler: Lernziel, S. 53–68. 122 Borinski: Mitbürger, zitiert nach Faulstich/Zeuner: Erwachsenenbildung, S. 251. 123 Borinski: Mitbürger, S. 55, zitiert nach Faulstich/Zeuner: Erwachsenenbildung, S. 252. 124 Ebd.
Club deutscher Frauen | 563
Borinskis Ansatz der ‚Mitbürgerlichen Bildung‘ aufwiesen125, wird an anderer Stelle aufgegriffen. Persönlichkeitsbildung sowie Bildung durch solche Persönlichkeiten, die eine „sittliche Haltung“ einnehmen, sah Borinski als zentrale Elemente der ‚Mitbürgerlichen Bildung‘ an, welche den Menschen „für den häuslichen Alltag erziehen“126 sollte. Der Pädagoge definierte die „Fähigkeit zur Selbstbestimmung und Selbstverwaltung, Fairness und Toleranz, sachliches Urteilen und sachliche und offene Diskussion, Mut zur eigenen Initiative und zum verantwortlichen Handeln“127 zu Lerninhalten, die den Schülern die aktive Gestaltung eines demokratischen Alltags erleichtern sollten. Christl Ziegler zufolge zeichnete sich das Konzept des MannheimSchülers durch einen hohen Alltagsbezug aus: Familie, Schule, Arbeitswelt, Vereinsleben, Nachbarschaft und geselliges Leben überhaupt sind darin als ‚politisch‘ definiert. Der ursprüngliche Politikbegriff erfährt in Borinskis Konzept also eine gedankliche Erweiterung um die ‚Alltagswelt‘. Auf die Prozesse dieser ‚Alltagswelt‘ sollte ein Interesse der Bürger an politisch-parlamentarischen Abläufen aufbauen.128 Daß der Erwachsenenbildner seine Schüler bei ihren Alltagskenntnissen ‚abholen‘ und darauf zwanglos politische Bildung aufbauen wollte, wird daran deutlich, daß er festhielt, es habe bei ihm zwar „keine Didaktik des Kartoffelschälens“, aber „unter Umständen ein gutes Gespräch beim Kartoffelschälen“129 gegeben. Institutionen, die nach den Empfehlungen Borinskis und des GER arbeiteten – darunter auch die Volkshochschulen – setzten Christl Ziegler zufolge in ihrer Frauenbildungsarbeit Schwerpunkte auf folgende Themen: Mitarbeit der Frau in Politik und Öffentlichkeit, Geschichte (insbesondere zeitgeschichtliche Themen, darunter auch die Geschichte der Frauenbewegung), Staat und Gesellschaft, Wirtschaft, Internationale Beziehungen, die Frage nach der deutschen Einheit sowie der europäischen Integration Deutschlands. Auch die gesellschaftliche Situation von Frauen in den europäischen Nachbarländern und den USA wurde thematisiert – mit der Absicht, ein tieferes Verständnis und eine bessere Kenntnis der Lebensbedingungen von Frauen in anderen Ländern zu erreichen.130 Jene Themen entsprachen Borinskis Ziel in jener
125 Vgl. dazu auch Ziegler: Lernziel, S. 55. Ziegler sieht offenbar ebenfalls keinen Widerspruch darin, Borinskis Abgrenzung zum Begriff der ‚staatsbürgerlichen Bildung‘ zu erklären und ihn gleichzeitig als wichtigsten Ideengeber einer ‚mitbürgerlichen Frauenbildung‘ der Nachkriegsjahre zu bezeichnen. Vgl.: ebd., S. 53/54. Daß jene Frauenbildung, die Ziegler zum Gegenstand ihrer Analyse macht, von den überparteilichen Organisationen stets als ‚staatsbürgerliche Frauenbildung‘ bezeichnet wurde, erwähnt die Autorin an dieser Stelle nicht, sie verweist jedoch an anderer Stelle darauf, daß „für dieselbe frauenspezifische Bildung“, die einer „mitbürgerlichen Konzeption“ entsprach, Begriffe wie „mitbürgerliche Bildung“, „staatsbürgerliche Bildung“ und „Frauenbildung“ in zeitgenössischen Quellen bedeutungsgleich verwendet wurden. Ebd., S. 68. 126 Borinski: Mitbürger, S. 64, zitiert nach Faulstich/Zeuner: Erwachsenenbildung, S. 253. 127 Borinski: Mitbürger, zitiert nach Faulstich/Zeuner: Erwachsenenbildung, S. 256. 128 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 53–55. 129 Borinski: Mitbürger, zitiert nach Faulstich/Zeuner: Erwachsenenbildung, S. 256. 130 Zum Themenkanon vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 65/66.
564 | Theanolte Bähnisch
„Phase des gesellschaftlichen Umbruchs“ die „westliche Demokratie zu festigen“131 und bestehende demokratische Strukturen auszubauen. Daß dabei jedoch, wie Christl Ziegler geradezu euphorisch beschreibt, einer ideologisch verfälschten, nationalsozialistischen Geschichtsschreibung nun „politische und gesellschaftliche Zusammenhänge in ihrer historischen Wirklichkeit“132 gegenübergestellt worden seien ist, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und dem damit einhergehenden ‚Kampf um Deutungsmacht‘ als fraglich zu bewerten. Vielmehr lag in der Auswahl der Themen und im pädagogischen Konzept, welches nicht nur Borinski, sondern auch die britische Militärregierung sowie Theanolte Bähnisch in den folgenden Jahren verfolgten, enormes Potential für die Annahme und Verstetigung ‚westlicher‘ Leitbilder, beziehungsweise einer ‚transatlantisch-europäischen Wirklichkeit‘.133 Schließlich erforderte, wie Ziegler selbst feststellte, der „Umbruchcharakter der unmittelbaren Nachkriegszeit mit seinem raschen Wertewandel und -zerfall […] eine Neuformulierung politischer und gesellschaftlicher Ziele und Werte“.134 Daß zu Borinskis „Ziel, die (westliche) Demokratie zu festigen“135, auch eine entschiedene Positionierung gegen den Kommunismus gehörte, arbeitete im Jahr 2000, im Zuge einer allgemein stärkeren Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Kalten Krieges auf die Kultur, der Borinski-Kenner Franz-Josef Jelich heraus.136 Fakt ist, daß von der Göhrde in den folgenden Jahren wichtige Impulse für die Erwachsenenbildung, nicht nur auf Niedersachsen, sondern auf ganz Deutschland ausgingen.137 Christl Ziegler mißt der Einrichtung auch eine besondere Rolle für die ‚mitbürgerlich-politische Bildung‘ von Frauen bei. So bot Ilse Weitsch, die Leiterin des Frauenfunks bei Radio München und Ehefrau Eduard Weitschs, im Sommer 1948 in der Göhrde Fortbildungs-Kurse für Mitarbeiterinnen von Volkshochschulen an.138 Insbesondere das Verständnis von alltagsbezogener Politik im Konzept der ‚Mitbürgerlichen Bildung‘ hatte Ziegler zufolge den Weg für die Aufnahme der täglichen, als ‚weiblich‘ definierten Lebenswelt, zwischen Familie, Kommune und Beruf in die politische Didaktik geebnet.139 Auf einer der in der Göhrde wiederholt stattfindenden wegweisenden Erwachsenenbildungs-Konferenzen, an denen oft auch die Militärregierungen beteiligt wa-
131 Vgl.: ebd., S. 61/62. 132 Ebd., S. 63. 133 Zur angebotenen Orientierung an ‚westlich‘ geprägten Referenzgesellschaften und zur Abgrenzung von kommunistischen Regimen vgl. die Analyse der ‚Stimme der Frau‘ in: Freund: Krieg. 134 Ziegler: Lernziel, S. 61. 135 Ebd. 136 Vgl.: Jelich, Franz-Josef: Der Kalte Krieg als Herausforderung mitbürgerlicher Bildung, in: ders. (Hrsg.): Borinski. 137 Vgl.: Faulstich/Zeuner: Erwachsenenbildung, S. 256. 138 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 109. 139 Vgl.: ebd., S. 74.
Club deutscher Frauen | 565
ren140, wurde – unter Beteiligung der Ärztin Dr. Elfriede Paul – 1946 über die Zukunft der Frauenbildung in der britischen Besatzungszone gesprochen. 6.4.3 Jeanne Gemmel stellt sich gegen die Volkshochschule und sucht Hilfe in der britischen Frauenbewegung Die frauenspezifischen Angebote141 der hannoverschen142 und der anderen niedersächsischen Volkshochschulen143, deren Geschäfte Kultusminister Grimme, über den Umweg des ‚Bund für Erwachsenenbildung‘, führte, wurden durchaus angenommen.144 Doch das Kurs-Angebot verfehlte einige Gruppen von Frauen, denen es zeitlich gar nicht möglich war, die Kurse zu besuchen. Dies traf vor allem auf berufstätige Frauen sowie jüngere, nicht erwerbstätige Mütter zu.145 Ausschlaggebend für die Entwicklungen der Folgezeit war, daß die Leiterin der Education Branch146 der britischen Militärregierung, Jeanne Gemmel, der Volkshochschule als Träger für Frauenbildung ablehnend gegenüberstand. Ihre Vorstellung von Frauenbildung, wie es aus den entsprechenden Akten deutlich wird, wies zwar eine große Nähe zu dem Konzept Fritz Borinskis auf, Gemmel hielt jedoch die Volkshochschule nicht für den geeigneten Ort, um Frauen für ihre Aufgaben in einer Demokratie zu schulen. Die Begründung, welche sie dafür auf einem Treffen des von
140 Vgl.: Faulstich/Zeuner: Erwachsenenbildung, S. 256. 141 Der Bund für Erwachsenenbildung hatte sich durch seinen Vorsitzenden Heiner Lotze noch einmal am 09.12.1946 an Elfriede Paul gewandt und sie gebeten, Anschriften von Frauen, die für eine Mitarbeit in der Heim-Volkshochschule Göhrde in Frage kämen, zu nennen. 142 Für einen Überblick über die Inhalte vgl.: Tietgens, Hans: Klara Meyer und Charlotte Ziegler an der Volkshochschule Hannover. Zwei der ersten Frauen in der Volkshochschularbeit nach 1945, in: Ciupke/Derichs-Kunstmann: Emanzipation, S. 227–236. 143 Auch die Heimvolkshochschulen Oldenburg und Hustedt boten entsprechende Kurse an. Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 111. 144 NA, UK, FO 1050/1210, Conference of Committee on German Women’s Education held at HQ Education Branch, IA&C Division at 11.00 hrs, Saturday, 15 June. Jeanne Gemmel zufolge waren 50 Prozent der Hörer an den Volkshochschulen Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. 145 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 106. 146 Die Alliierte Kontrollkommission/Control Comission of Germany (CCG) bestand, den vier Besatzungsmächten entsprechend, aus vier Elementen. Das ‚British Element‘ (CCG/BE), also die Britische Militärregierung, unterhielt verschiedene ‚Divisions‘, eine davon war die International Affairs and Communications Division (I.A.&C.). Dieser Division war die Education Branch untergeordnet, der schließlich im Mai 1946 die Women´s Affairs Section unterstellt wurde. 1947 wurde die I.A.&C. Division aufgelöst und die Education Branch wurde in diesem Zuge zu einer Behörde aufgewertet, die direkt der CCG (BE) unterstellt war. Damit war auch ein Aufstieg der Women´s Affairs Section in der Verwaltungshierarchie verbunden.
566 | Theanolte Bähnisch
ihr geleiteten ‚Committee of German Women’s Education‘147 ins Feld führte, war entweder sehr vage formuliert oder sehr unklar protokolliert worden, für sich allein genommen wirkt sie jedenfalls nicht überzeugend. „Miss Gemmell said she did not think that the people responsible in education in Germany had supplied these women with what they needed educationally, and though that their attendance at the Volkshochschule proved they were conscious of a need, but as things were, these women would very soon realize that they were not getting what they wanted”148, ist Gemmels Statement im Protokoll festgehalten. Was das ‚Bedürfnis‘ der Frauen sei, das Gemmels Meinung nach in der Volkshochschule nicht befriedigt werden könne, ist hier jedoch nicht ausgeführt. Möglich ist, daß ihre ablehnende Haltung damit zu tun hatte, daß eine der zentralen Persönlichkeiten der Niedersächsischen Volkshochschule, Heiner Lotze, nicht gerade als ein erklärter Unterstützer weiblicher Emanzipation galt149. Eine Äußerung Bähnischs zu diesem Umstand ist nicht überliefert. In Jugendfragen konnte sie sich eine Zusammenarbeit mit Lotze offenbar gut vorstellen, auf eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Männern im Kultusministerium – dem die Volkshochschule untergliedert war – wollte sie jedoch nicht angewiesen sein.150
147 Das Committee on German Women’s Education setzte sich aus Mitarbeiterinnen verschiedener Abteilungen der Militärregierung (Education Branch, Public Safety Branch, Public Relations and Information Service Branch (PRISC) sowie diverser britischer Hilfs- und Frauenorganisationen (unter anderem dem British Red Cross und der Young Women‘s Christian Association (YWCA) zusammen. Zu den Treffen wurden auch deutsche Gäste eingeladen, unter ihnen beispielsweise Theanolte Bähnisch und Martha Fuchs. Vgl.: NA, UK, FO 1050/1299, Jeanne Gemmel an Mrs. Freeman, NFWI [National Federation of Women’s Institutes], 15.07.1946. 148 NA, UK, FO 1050/1210, Conference of Committee on German Women’s Education held at HQ Education Branch, IA&C Division at 11.00 hrs, Saturday, 15 June at No. 3, Marktplatz, S. 3. 149 NA, UK, FO 1049/1246, Second Meeting of the Standing committee on women’s affairs held at 1000 Hrs 7th May 1948 in the Main Conference Room, Stirling House. Vgl. auch die Ausführungen von Ziegler, die auf einer anderen Quelle basieren. Ziegler: Lernziel, S. 101. Demnach hatte Heiner Lotze in seinem Tagungsprotokoll über eine Volkshochschultagung 1946 die Referate zum Thema Frauenbildung weitgehend unberücksichtigt gelassen. 150 GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Theanolte Bähnisch an Adolf Grimme, o. D., nachträglich von unbekannter Hand datiert auf „ca. Juli 1947“. Das Datum ist vermutlich falsch angesetzt, denn die enge Zusammenarbeit Bähnischs als Regierungsvizepräsidentin mit Ellinghaus als Regierungspräsidenten, auf die sie im Brief anspricht, endete im September 1946. Der Brief könnte also aus dem Juli 1946 stammen. „Gern würde ich in Jugendfragen, die mir sehr am Herzen liegen, mit Ihnen u. ihrem Referenten zusammenarbeiten“, hatte Bähnisch an Grimme geschrieben und sich damit gleichzeitig von Grimmes Vorschlag distanziert, ihn in seiner Funktion als Kultusminister zu vertreten. „Ich glaube diese Lösung ist auch für sie am besten. Ihre Herren würden sich m. E. nur schwer an mich und meine Art gewöhnen. Ich würde ihnen unbequem und unsympathisch sein. Und nun bin ich froh, daß das klargestellt ist.“ Ebd.
Club deutscher Frauen | 567
Immerhin denkbar ist auch, daß Gemmels Skepsis damit zusammenhing, daß die von Lotze geleitete Volkshochschule Hannover bereits unter der geschäftsführenden Leitung von Ada Lessing in den frühen 1930er Jahren ein stark an traditionellen Rollenvorstellungen orientiertes Bildungs-Programm für Frauen angeboten hatte.151 Ob Gemmel allerdings über diese Traditionen der hannoverschen Erwachsenenbildung informiert war, darüber läßt sich nur spekulieren. Überliefert ist immerhin, daß sie das Referat einer Frau Offenberg auf der zweiten Volkshochschultagung über das ‚Anliegen der Frau in der Erwachsenenbildung‘ aufgrund seiner Rückwärtsgewandtheit als ‚kaum erträglich‘ empfunden hatte.152 Aus dem Anhang eines von Major General Erskine an das Control Office for Germany and Austria (COGA) in London übersandten Schriftstücks, welches vermutlich im Kreis um Gemmel entstanden war, gehen weitere Gründe für die distanzierte Haltung Gemmels gegenüber den Volkshochschulen hervor: Gemmel schätzte die Ressourcen der deutschen Erwachsenenbildner an Personal, Gebäuden und Ausrüstung als zu gering ein, als sich damit eine breitenwirksame Frauenbildung, wie sie sie sich vorstellte, hätte umsetzen lassen. Schließlich ging die britische Militärregierung davon aus, Konzepte für einen extremen Frauenüberschuß in der deutschen Gesellschaft entwickeln zu müssen.153 Zudem sei die Herangehensweise der deutschen Erwachsenenbildner schlichtweg nicht besonders einfallsreich und werde deshalb vermutlich auch niemals wirklich effektiv sein, hatte der unbekannte Verfasser des Schriftstücks – vermutlich Gemmel selbst oder eine Kollegin oder Mitarbeiterin – festgehalten.154 Aus dem weiter oben zitierten Protokoll wird zwar nicht recht deutlich, warum Jeanne Gemmel negativ gegenüber der Volkshochschule eingestellt war, wohl aber, daß sie ihre Hoffnungen, was die Frauenbildung anging, in Frauenorganisationen setzte. „Miss Gemmel then went on to say, that, along with Admin. & Local Gov. every endeavour was being made to get the women’s organizations into operation, because it was felt very strongly, that this was the best method of bringing women to
151 Ada Lessing, die von 1919 bis 1933 die geschäftsführende Leitung der Volkshochschule Hannover innehatte, beteiligte sich ab 1930 auch als Dozentin. Die von Lessing geleiteten ‚Frauenarbeitsgemeinschaften‘ in der Volkshochschule hatten sich an den vier Bereichen Haushaltsführung, Eheleben, Kinder und Erziehung sowie Arbeit und Beruf orientiert – was jedoch nichts darüber aussagt, inwiefern ihnen vielleicht doch kritisches Potential innewohnte. Immerhin hatte Lessing sich für die Durchsetzung des Frauenwahlrechts engagiert und war Mitglied der SPD geworden. Vgl.: Wollenberg, Jörg: „14 Jahre Volkshochschularbeit..., das lasse ich nicht aus der Geschichte Hannovers löschen“. Ada Lessing als geschäftsführende Leiterin der Volkshochschule Hannover von 1919–1933, in: Ciupke/Derichs-Kunstmann: Emanzipation, S. 132–148. 152 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 101. 153 NA, UK, FO 1049/568, Office of the Deputy Military Governor, CCG/BE, Major General Erskine, Berlin an The Permanent Secretary, Control Office for Germany and Austria (COGA), London, 18.04.1946, Appendix B: German Women’s Voluntary Organisations. Adult Education, o. V., o. D. 154 Ebd.
568 | Theanolte Bähnisch
the proper sense of responsibility“155, heißt es in dem Protokoll. Im Aufbau von Frauenorganisationen sah Gemmel also die beste Möglichkeit, Frauen zu einem stärkeren Verantwortungsgefühl zu erziehen. Eine schlüssige Begründung, warum solche Organisationen die Aufgabe besser meistern würden als die Volkshochschule, fehlt an dieser Stelle.156 Diversen anderen Quellen aus der Überlieferung der Militärregierung ist zu entnehmen, daß Gemmel und ihre Mitstreiterinnen in lokalen Frauenzusammenschlüssen zunächst einmal eine passende Möglichkeit sahen, möglichst viele Frauen anzusprechen – was Voraussetzung dafür war, die Frauen im Sinne der Reeducation beeinflussen zu können.157 Frauenbildung, davon war Gemmel überzeugt, hatte in Deutschland nämlich vor allem dort Aussicht auf Erfolg, wo die Frauen sie gar nicht erwarteten – also außerhalb von Bildungseinrichtungen, in zwanglosen Zusammenkünften, ohne ein vorab definiertes ‚Lernziel‘. Die von Gemmel angestrebte und von Bähnisch schließlich praktizierte Form politischer Bildungsarbeit deckte sich mit dem seit den 1990er Jahren stark diskutierten, vor allem auch vom Politikdidaktiker Prof. Bernd Overwien als sinnvoll bewerteten Konzepts des ‚informellen Lernens‘.158 Sachwissen, dies wird im Folgenden deutlich werden, sollte deutschen Frauen in Frauenorganisationen durchaus, aber nicht vorrangig vermittelt werden. Die Frauen wurden vielmehr dazu angehalten, die Fähigkeit zu trainieren, Position zu beziehen, sich untereinander auszutauschen, anderslautende Meinungen zuzulassen und zu diskutieren. Davon versprach man sich, daß Kernelemente demokratischer Meinungsbildungsprozesse internalisiert werden würden. Die Frauen sollten auf diese Weise auch zu gemeinsamen Zielen finden, welche den Wiederaufbau vorantreiben könnten, diesen Zielen in der Gesellschaft Gehör verleihen und sich durch die Arbeit in Frauenorganisationen aktiv an der Gestaltung des Gemeinwesens beteiligen. Die mit der Frauenbildung betrauten Mitarbeiterinnen der Militärregierung stellten sich also vor, daß Frauenorganisationen ihre Mitglieder dazu befähigen könnten, mündige Staatsbürgerinnen zu werden, indem ihnen die Abläufe demokratischer Entscheidungsfindungsverfahren nähergebracht und sie dazu angeleitet würden, Politik und Gesellschaft durch soziale oder anderweitige, gesellschaftlich relevante Arbeit sowie durch die Verlautbarung ihrer Interessen mitzugestalten. Für informelles Lernen, persönliche Gespräche und persönlichen Meinungsaustausch – Aspekte, die Fritz Borinski für sein Konzept der ‚Mitbürgerlichen Bildung‘ als besonders wichtig erachtete159 schienen sich Frauenor-
155 NA, UK, FO 1050/1210, Conference of Committee on German Women’s Education held at HQ Education Branch, IA&C Division at 11.00 hrs, Saturday, 15 June at No. 3, Marktplatz, S. 3. 156 Ebd. 157 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 17. 158 Vgl.: Overwien, Bernd: Politische Bildung und informelles Lernen, in: Journal für Politische Bildung, Heft 3 (2011), S. 1018 sowie zur Begriffsdefinition und Vorstellung der unter dem Begriff zusammengefaßten Bandbreite von möglichen Bildungsprozessen ders.: Stichwort: Informelles Lernen, in: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Heft 3 (2005), S. 339–359. 159 Vgl.: ebd.
Club deutscher Frauen | 569
ganisationen eher anzubieten als ein Volkshochschulkurs. Bähnischs Erklärung, in einem solchen Rahmen ‚staatsbürgerliche Frauenbildung‘ betreiben zu wollen, dürfte deshalb bei Jeanne Gemmel auf offene Ohren gestoßen sein. Gemmel scheint sich dabei auch an den Entwicklungen in ihrem Heimatland orientiert zu haben: Um Mißständen in der politischen Bildung Erwachsener in Großbritannien Abhilfe zu schaffen, hatte man dort gerade erst neue Wege eingeschlagen. In der ‚Education in Citizenship‘ wurde „kooperatives Arbeiten, Eigentätigkeit und eine Verbindung von Wissen und Erfahrung“160 besonders betont. Im bereits zitierten Anhang zu Erskines Schreiben rekurrierte die unbekannte Verfasserin auf die positiven Erfahrungen, die man in Großbritannien und in anderen Ländern mit der Vermittlung der für Frauen als hilfreich erachteten Kompetenzen durch Frauenorganisationen gemacht hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach spielt diese Äußerung auf die Arbeit der ‚Women’s Group on Public Welfare‘ (WGPW) an, auf die an anderer Stelle zurückzukommen sein wird. Vor 1933 hätten in Deutschland Organisationen existiert, welche sich ähnlich der britischen entwickelt hätten, merkt die unbekannte Verfasserin – vermutlich handelte es sich um eine Frau – an. Ihre Anführerinnen, von denen namentlich Marie Elisabeth Lüders und Agnes von Zahn-Harnack im Schreiben genannt werden, seien – was als Beweis für ihre Integrität gewertet wird – 1933 gezwungen gewesen, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Nun würden einige dieser älteren Frauen wieder Organisationen gründen wollen – als „common meeting ground“161, auf dem Frauen aller politischen Überzeugungen wie auch ‚unpolitische‘ Frauen gesellschaftliche Fragen diskutieren und in einer angenehmen Atmosphäre lernen könnten, ihren Platz im gesellschaftlichen Leben auszufüllen. Leider gebe es wenige dieser erfahrenen Frauen, die nicht zu starr an den ‚alten‘ Ideen festhielten, bedauerte die unbekannte Verfasserin, den jüngeren Frauen fehle es an Erfahrung. Die ‚Women’s Group on Public Welfare‘ (WGPW) könne in näherer Zukunft durch beratende Tätigkeiten wesentliche Hilfe zur Entwicklung deutscher Frauen-Organisationen leisten, die kurzfristig unter der Kontrolle der Militärregierung zu entwickeln seien.162 Die Idee, dem Dachverband britischer Frauenorganisationen ein starkes Mitspracherecht beim Aufbau der Frauenbildung in Deutschland einzuräumen, war also bereits geboren gewesen, bevor die Militärregierung ihre Re-education-Arbeit in Form der ‚Women’s Affairs Sections‘ institutionalisierte.163 Theanolte Bähnischs Ausgangsbedingungen waren damit noch besser, als Forschungen, die sich bisher mit der
160 Ziegler: Lernziel, S. 59. 161 NA, UK, FO 1049/568, Office of the Deputy Military Governor, CCG/BE, Major General Erskine, Berlin an The Permanent Secretary, Control Office for Germany and Austria (COGA), London, 18.04.1946, Appendix B: German Women’s Voluntary Organisations. Adult Education, o. V., o. D. 162 Ebd. 163 Zum Einfluß des Modells der WGPW auf die Frauen-Politik der britischen Militärregierung in Deutschland vgl. auch: Stark: Majority, S. 214/215.
570 | Theanolte Bähnisch
Arbeit der Abteilungen für Frauensachen bei der Militärregierung auseinandergesetzt haben,164gezeigt haben. Insbesondere die Anmerkung zur WGPW im zitierten Schreiben erhärtet den Verdacht, daß das Papier tatsächlich bereits in den ersten Monaten der britischen Besatzung im Kreis um Jeanne Gemmel entstanden war. Denn diese war bereits im Februar 1946 an den Dachverband britischer Frauenorganisationen, die ‚Women’s Group on Public Welfare‘ (WGPW) herangetreten, um eine Zusammenarbeit der Britischen Militärregierung mit den drei mitgliederstärksten britischen Frauenorganisationen in die Wege zu leiten.165 Neben ihrer vergleichsweise hohen Mitgliederstärke hatten diese Organisationen – die Women’s Institutes, die Townswomen’s Guilds und die Women’s Cooperative Guilds weitere wesentliche Aspekte gemeinsam: Sie bezeichneten sich als ‚non-political‘ (womit der Verzicht auf eine parteipolitische Festlegung gemeint war) sowie ‚non-feminist‘166 und legten gesteigerten Wert darauf, ihren Mitgliedern Bildungsangebote zu unterbreiten. John Robert Stark, der seine geschichtswissenschaftliche Dissertation über Frauenorganisationen in den vier deutschen Besatzungszonen ab 1945 als praktische Handreichung für zukünftige militärische Operationen versteht, schreibt, daß die Mitarbeiter der Education Branch der CCG (BE) bereits im Dezember 1945 mit Hilfe einer Broschüre über die Arbeit der Women’s Institutes aufgeklärt worden seien.167 Als Gemmel die WGPW im Februar 1946 kontaktierte und damit zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Besatzung den Aufbau der Frauenarbeit in Deutschland in jene Richtung lenkte, tat sie dies inoffiziell168. Gemmel setzte bei ihrer Arbeit im (Wieder-)Aufbau deutscher Frauenorganisationen also auf die Vorbildfunktion gemäßigter, parteipolitisch neutraler britischer Frauenorganisationen. Alle drei Organisationen standen allen interessierten Frauen zur Mitarbeit offen, sie vertraten allerdings den Anspruch, daß sich ihre Mitglieder ihrer individuellen Verantwortung für das Gemeinwesen stellen und sich in die Gestaltung des öffentlichen Lebens einbringen sollten.169 Jene gesellschaftliche Teilhabe von Frauen sollte – der Name des Dachverbandes war also Programm – vor allem im Bereich der Wohlfahrtsarbeit stattfinden. Dabei stand die Idee der Ausweitung der als ‚weiblich‘ konnotierten Arbeit als Hausfrauen und Mütter auf eine breitere gesellschaftliche Basis im Vordergrund. Die Arbeit der WGPW basierte also auf sehr ähnlichen Vorstellungen von ‚Gesellschaft‘ wie die der bürgerlichen Frauenbewegung,
164 Darunter fallen im Wesentlichen die bereits genannten Forschungen Denise Tscharntkes und Christl Zieglers. 165 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 79. Anders als Erskine hatte Gemmel dabei bereits einige Organisationen genannt, von deren Hilfe sie glaubte, beim Wiederaufbau Deutschlands profitieren zu können. Vgl.: ebd., S. 79/80 sowie Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C7, Jeanne Gemmel an die WGPW, 05.02.1946. 166 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 79/80. 167 Vgl.: Stark: Majority, S. 214. 168 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C7, Jeanne Gemmel an die WGPW, 05.02.1946. 169 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 79/80.
Club deutscher Frauen | 571
die bis 1933 in Deutschland aktiv war.170 Es gab in Deutschland also bereits eine Tradition, an die es, in Gemmels Logik, anzuknüpfen galt. Die WGPW trug, wie im Folgenden deutlich werden wird, ab 1946 entscheidend dazu bei, Traditionen der sozialen Arbeit, welche die bürgerlichen Frauenvereine im Kaiserreich ausgebildet, in zwei Weltkriegen professionalisiert und über ihre Lobbyistinnen erfolgreich in die Sozialpolitik der Weimarer Republik eingebracht hatten zu bestätigen. Die Organisation sorgte – in Zusammenarbeit mit dem International Board des National Council on Social Services (NCSS), der britischen Militärregierung sowie mit Hilfe von Theanolte Bähnisch und ihren Mitstreiterinnen – dafür, daß diese Traditionen in der Nachkriegszeit weitergeführt wurden. Aufgrund der zentralen Bedeutung, welche die britische Dachorganisation von Frauenverbänden für den Wiederaufbau der Frauenbewegung in Deutschland unter der Federführung von Theanolte Bähnisch hatte, sollen im Folgenden die Entstehungsgeschichte und Arbeitszusammenhänge der WGPW mit der britischen Regierung skizziert werden. 6.4.4 „We are aiming at nothing less than the changing of German society“: Die Militärregierung, die WGPW und der Wiederaufbau der sozialen Arbeit in Deutschland Die WGPW hatte sich 1939 unter der Anleitung des NCSS als Ergebnis einer Tagung von Organisationen, welche sich mit der Evakuierung von Frauen und Kindern im Zweiten Weltkrieg auseinandersetzten, formiert. Entsprechend ihrer Aufgabe trug sie zunächst den Namen ‚Women's Group on Problems Arising from Evacuation‘. Bereits zu dieser Zeit hatte Margaret Bondfield, zu der nicht nur Jeanne Gemmel, sondern bald auch der stellvertretende ‚Chief of Staff‘ der CCG (BE), Major General George Erskine den Kontakt suchte171, den Vorsitz der Organisation innegehabt. Als Regierungsorgan hatte der NCSS schon seit 1919 die Arbeit von verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen betreut und die Verbindungen sowohl der Organisationen untereinander als auch zwischen den Organisationen und der Regierung gepflegt. Durch die Einbeziehung von insgesamt 46 mitgliederstarken Frauenorganisationen, die in der WGPW organisiert wurden, konnte sich die Regierung ab 1939 zusätzliche Unterstützung in der Wohlfahrtsarbeit sichern. Über das Sekretariat des NCSS als ‚Schaltstelle‘ ließen sich auch die in der WGPW zusammen gefaßten Frauenorganisationen steuern und ihre Arbeit somit an die Erfordernisse der Regierungspolitik anpassen. Die Entstehung und die erste Hochphase der Arbeit der WGPW erwuchsen also aus den Notwendigkeiten, die der Zweite Weltkrieg mit sich gebracht hatte. Damit erfüllte die WGPW eine ganz ähnliche Aufgabe wie der BDF, der sich
170 Vgl.: ebd., S. 80/81. 171 NA, UK, FO 1049/568, Office of the Deputy Military Governor, CCG (BE) Advanced Headquarters, Berlin, B.A.O.R. an The Permanent Secretary, COGA, London, 18.04.1946.
572 | Theanolte Bähnisch
während des Ersten Weltkriegs als Dachorganisation von Frauenverbänden zum unentbehrlichen Partner der deutschen Regierung entwickelt hatte.172 Die ‚Women’s Institutes‘, die ab 1939 als eine der mitgliederstärksten FrauenOrganisationen der WGPW untergliedert wurden, waren bereits im Ersten Weltkrieg gegründet worden, „when they responded to the wartime need to promote the economical use of food and preservation of surpluses and to extent the rural labour force“.173 Nach Kriegsende waren die Aufgaben der Women’s Institutes nahezu deckungsgleich mit jenen der deutschen Landfrauenvereine gewesen. Eine weitere mitgliederstarke Frauenorganisation, die der WGPW untergliedert war, die ‚Townswomen’s Guilds‘, hatten sich erst 1932 gegründet. Daß die Mitgliederzahl der Guilds in kurzer Zeit so rasant wuchs, führt Denise Tscharntke auf die finanzielle Unterstützung durch den ‚Carnegie Trust‘ zurück. Darin, daß dieser nur ‚unpolitische‘ Organisationen unterstützte, sieht Tscharntke einen wichtigen Anreiz für die Guilds, nach außen weder feministische Positionen zu vertreten noch sich zu einer politischen Richtung zu bekennen.174 Nicht nur die beiden genannten, sondern auch viele andere britische Frauenorganisationen waren im Zweiten Weltkrieg über die WGPW unter der Obhut des NCSS in „some kind of war work“175 involviert gewesen. Wie deutsche Frauenorganisationen hatten auch die britischen Zusammenschlüsse beispielsweise für ‚die Truppen‘ gestrickt und Flickarbeiten übernommen.176 Als nach dem Ende des Krieges der britische Sozialstaat neu aufgebaut wurde, stellte sich die Frage nach einer sinnvollen, geregelten Zusammenarbeit zwischen den Körperschaften des öffentlichen Rechts und den freiwilligen Organisationen. Die Kooperation der Frauenverbände in der WGPW unter dem Dach des NCSS hatte sich als effizient erwiesen und wurde deshalb fortgesetzt. Britische Expertinnen, die in diesen Zusammenhängen sozialisiert worden waren, hielten es für naheliegend, ein solches Modell auf Deutschland im Wiederaufbau zu übertragen und das Land beim Aufbau einer Zusammenarbeit staatlicher Stellen mit privaten Organisationen zu unterstützen. Dabei galt es allerdings, zu starre Strukturen und zu starren Zentralismus in der freiwilligen sozialen Arbeit zu verhindern. Im Dritten Reich hatte die NSDAP über die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) und die NS-Frauenschaft eigene, stark von den NS-Idealen geprägte Strukturen in der Wohlfahrtspflege etabliert. Beispielweise hatten die NSV und die NS-Frauenschaft gemeinsam ‚Hilfsküchen‘ betrieben. Daß ein wichtiges politisches Ziel der WGPW ab 1946 darin bestand, deutschen Frauen Wissen über die Zusammenhänge zwischen „voluntary social work […] local government and central
172 Zu diesen und den folgenden Ausführungen vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 79–84. Zur Institutionalisierung der sozialen Arbeit des BDF siehe Kapitel 6.5.3.3. 173 Ebd., S. 82. 174 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 82. 175 Tscharntke: Re-educating, S. 84. 176 Vgl.: ebd.
Club deutscher Frauen | 573
government services“177 zu vermitteln und dabei auf die Etablierung zwar geregelter, aber demokratischer Strukturen hinzuwirken, läßt sich in den Akten des Bestands ‚WGPW‘ der ‚Women’s Library‘ nachvollziehen. Nach dem Verbot der nationalsozialistischen Organisationen versprach die Orientierung an etablierten Organisationen wie dem DRK, welches in seiner Bedeutung von der NSV zwar zurückgedrängt worden war, aber mit der NSV in einer Arbeitsgemeinschaft kooperiert hatte, eine schnelle Hilfe für die deutsche Bevölkerung – und damit auch für die mit dem deutschen Wiederaufbau beschäftigten Militärregierungen. Indem sie dem DRK dazu verhalfen, innerhalb kurzer Zeit in der sozialen Arbeit wieder seinen ‚angestammten Platz‘ einzunehmen, hatten auch die Alliierten Anteil daran, daß organisationskompetente, in der Wohlfahrtsarbeit erfahrene Personen, welche während des Dritten Reiches bereits einflußreiche Ämter bekleidet hatten, in der Nachkriegszeit an ihren Führungspositionen festhalten konnten. Auf die Entstehung neuer Wohlfahrtsorganisationen mit weitgehend unbelasteten Mitgliedern ‚von unten‘ zu warten, muß den Alliierten in der akuten Notlage der Bevölkerung als ein zu großes Wagnis erschienen sein. Eine besonders wichtige Rolle spielte für die Pläne der Alliierten, Frauen zur Teilhabe am öffentlichen Leben zu motivieren, der Umstand, daß, wie bereits im Zusammenhang mit Bähnischs Rolle als Regierungspräsidentin erwähnt, vor allem weibliche Freiwillige im DRK organisiert waren. Die ‚Frauensektion‘, in der die Frauen zusammengeschlossen waren, hatte bis 1937 als – teilautonomer – ‚Vaterländischer Frauenverein beim Roten Kreuz‘ existiert. Bis zur Auflösung des BDF 1933 hatte der Vaterländische Frauenverein der Dachorganisation angehört. Daß sich die Briten im deutschen Wiederaufbau nicht stärker auf die von den Nationalsozialisten verbotene, nach 1945 wieder etablierte ‚Arbeiterwohlfahrt‘ (AWO) stützten, stand aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur mit deren geringerem Organisationsgrad, sondern auch mit der engen Bindung der Organisation an die SPD in Zusammenhang. Schließlich wollte die britische Militärregierung erklärtermaßen parteiübergreifend arbeitende Organisationen fördern.178 Für die starke Unterstützung des DRK im Raum Hannover wird auch die persönliche Sympathie, welche die wichtigste Delegierte der WGPW, Helena Deneke, für die Leiterin des DRK, Freifrau von Knigge, empfand, eine Rolle gespielt haben.179 Analysiert man britische Anstrengungen zum Wiederaufbau des sozialen Systems in Deutschland, so gewinnt man insgesamt den Eindruck, daß alle involvierten Prota-
177 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C6, WGPW an Mrs. Courtney, 30.05.1947. 178 Um die Auswirkungen jenes Zusammenhangs besser analysieren zu können, wäre eine Forschungsarbeit über die Entwicklung der AWO, die heute zu den sechs Spitzenverbänden in der freien Wohlfahrtspflege zählt, in verschiedenen Regionen nach 1945 hilfreich. 179 Deneke bezeichnet von Knigge als „outstanding […] intelligent and charming“ und betont – um ihre Eignung zur Kooperation mit britischen Frauen- und Wohlfahrtsverbänden zu unterstreichen, daß sie einen Teil ihrer Ausbildung in Großbritannien absolviert habe und Englisch spreche. Vgl.: Bodleian Library, Oxford, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 25, Textfragment eines Reiseberichts ohne Titel, beginnend mit „Hannover 14–17, Aug. 1946“.
574 | Theanolte Bähnisch
gonisten ständig zwischen zwei zentralen Säulen ihrer Wiederaufbaupläne hin- und hergerissen waren. Auf der einen Seite war die Versuchung groß, der traditionell stark in der Wohlfahrtspflege eingebundenen deutschen Frauenbewegung möglichst viel Orientierungshilfe durch das britische Modell der Zusammenarbeit zwischen der Regierung, dem NCSS und der WGPW anzubieten. Andererseits schien die Suche nach einer nachhaltigen, in Deutschland breitenwirksam akzeptierten, weil eigenständigen Lösung durch deutsche Protagonisten in Politik, Verwaltung und in ehrenamtlich tätigen Organisationen notwendig zu sein. Von Seiten des Foreign Office, von der CCG (BE) und der WGPW wurde einerseits wiederholt geäußert, daß man den Deutschen das britische soziale System nicht überstülpen wolle und daß es deshalb auch nicht sinnvoll sei, wenn sich der Aufbau von deutschen Frauen- und Wohlfahrtsorganisationen – die Teil des sozialen Systems werden sollten – eins zu eins am britischen Modell orientiere.180 „It is clear that reeducation in the social field will depend to an ever-increasing extent on the efforts of non-official organizations and it is therefore desirable that these organizations should adopt their own methods of commendation“181, hatte Basil Marsden-Smedley vom ,German General Department‘ des Foreign Office an Gertrude Williams vom ,Joint University Council of Social Studies‘ geschrieben. Von dessen Expertinnen, Mrs. Lewis und Mrs. Black, die beide Mitarbeiterinnen des Fachbereichs ‚Soziale Arbeit‘ an der Universität von Birmingham waren, ließen sich die zuständigen Offiziere beraten. Dem war die persönliche Bitte Lord Pakenhams an den Council vorausgegangen, die Militärregierung zu unterstützen.182 Anknüpfend an eine Empfehlung des Council, britischen Organisationen aus dem Bereich der sozialen Arbeit bei der Beratung sowie anderweitigen Unterstützung von Wohlfahrtsorganisationen und -schulen weitgehend freie Hand zu lassen, stellte sich Marsden-Smedley gegen eine direkte Beeinflussung des deutschen sozialen Systems durch die britische Militärregierung. Er erhob den NCSS, der wiederum auf die WGPW baute, zu seinem bevorzugten Ansprechpartner in diesem Kontext. Sein Vertrauen in den NCSS ging schließlich so weit, daß er dem Council sowohl die Organisation des Personenaustauschs zwischen deutschen und britischen sozialen Organisationen als auch die Planung und Leitung einer Konferenz zum Thema ‚soziale Arbeit‘ übertrug.183 Der NCSS und die WGPW trugen damit eine große Verantwortung für den Wiederaufbau der sozialen Arbeit im besetzten Deutschland. Dies sollte keinesfalls als ein Hinweis darauf gewertet werden, daß jenes Thema für die Spitzen der Militärregierung von untergeordneter Bedeutung war. Vielmehr zeugte das Vertrauen in die Rolle des NCSS von der Überzeugung, daß ein aufoktroyiertes Sozial-System gravierende negative Folgen für die Demokratie in Deutschland haben könnte. Welch zentrale Rolle der sozialen Arbeit für den deutschen Wie-
180 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C6, passim. 181 NA, UK, FO 371/70862, Marsden-Smedley an Gertrude Williams, Joint University Council for Social Studies, 23.11.1948. 182 NA, UK, FO 371/70862, Pakenham an Gertrude Williams, 17.03.1948. 183 NA, UK, FO 371/70862, Marsden-Smedley an Gertrude Williams, Joint University Council for Social Studies, 23.11.1948.
Club deutscher Frauen | 575
deraufbau, auch hinsichtlich politischer Besatzungsziele beigemessen wurde, verdeutlicht ein Schreiben Marsden-Smedleys aus dem britischen Außenministerium an den Militärgouverneur der britischen Besatzungszone Brian Robertson aus dem Januar 1948. „Our responsibility in these matters is inherent in our whole task of reeducating Germany. We are aiming at nothing less than the changing of German society; and the nature of German arrangements for the needy, the neglected and the mal-adjusted is of concern to us in the same way as their educational or police system. Moreover, it is very much in our interest to encourage developments which will make the Germans more impervious to communism, which thrives on mental and physical distress. We feel, therefore, that we have a very definite responsibility for seeing that the German social services develop along the lines we consider healthy and that, for example, they do not use authoritarian methods which are not approprirate [!] to a free democratic society.“184 Die Lage bedürftiger, verwahrloster und unangepaßter Bürger sollte sich also auf keinen Fall zum Einfallstor der Kommunisten entwickeln dürfen. Je stärker die Politik der Westalliierten vom sich immer weiter zuspitzenden Kalten Krieg beeinflußt wurde, desto gefährlicher schien es jedoch, die Entwicklung der sozialen Arbeit in Deutschland allein den Deutschen zu überlassen. Gleiches galt für die Frauenbildung, zumal beide Bereiche als eng miteinander verschränkt angesehen wurden. Es sollte sich zeigen, daß gerade durch den starken Einfluß, den britische NROs auf die Entwicklung der sozialen Arbeit und die Frauenbewegung nahmen, jene Abgrenzung zu ‚autoritären Methoden‘, welche Marsden-Smedley ablehnte, nicht konsequent aufrechterhalten wurde. Dies galt vor allem dann, wenn es um die Bekämpfung eines ebenfalls als ‚autoritär‘ wahrgenommenen Systems, nämlich dem Kommunismus ging. Gerade die Verschränkung der beiden Bereiche ‚Frauen-Reeducation‘ und ‚soziale Arbeit‘185, wurde von den Westalliierten – wie auch von
184 NA, UK, FO 371/70862, Marsden-Smedley, Foreign Office an Strelley-Martin [Public Health Advisor], 26.01.1948. 185 Allerdings vollzog sich mit der Professionalisierung der deutschen Sozialarbeit und der Einführung des ‚social worker‘ als Begriff bald auch in Westdeutschland eine sukzessive Abkehr vom Credo der ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘. Nach und nach verblaßte das Verständnis von sozialer Arbeit als soziale Beziehung. Mit dem ‚Sozialarbeiter‘, der eine emotionale Distanz zum ‚Klienten‘ pflegte, hielt eine aus dem britischen Kulturkreis entlehnte Methodenlehre, welche sich aus ‚social casework‘ (soziale Einzelfallhilfe), ,social groupwork‘ (soziale Gruppenarbeit) und ,social communitywork‘ (soziale Gemeinwesenarbeit) zusammensetzte, Einzug in das deutsche Sozialsystem. Karin Jäckel sieht zwar einen Ursprung der Tradition, soziale Arbeit auf der Grundlage emotionaler Distanz zu leisten, in der Alice-Salomon-Schule in Berlin, dabei scheint jedoch die Arbeitsweise der Namensgeberin unzureichend von der Prägung, welche die Schule in den 1960er Jahren, lange nach dem Tod Alice Salomons hatte, abgegrenzt zu sein. Vgl.: Jäckel, Karin: Essay über den Wandel im Selbstverständnis der Sozialarbeit als Kernfach der sozialen Dienste, auf: http://www.karin-jaeckel.de/aktuelles/Essay_Selbstverstaendnis_sozialer_Dienste. pdf, am 14.04.2014. Ivonne Schröder betont in einer Studienarbeit dagegen deutlich die Überzeugung Salomons, soziale Arbeit müsse eine emotionale Basis haben, wenn es auch
576 | Theanolte Bähnisch
Theanolte Bähnisch – als wirksames Mittel gegen eine kommunistische Infiltration angesehen. Sozialpädagogische Konzepte, die 1.) den persönlichen Beitrag Einzelner, 2.) den Austausch zwischen den in der freiwilligen sozialen Arbeit Tätigen und den ‚Bedürftigen‘186 von Angesicht zu Angesicht sowie 3.) die Idee der ‚geistigen Führung‘ jener Arbeit durch gebildete, sittliche Persönlichkeiten hervorhoben, schienen dazu geeignet zu sein, dem kommunistischen System die Stirn zu bieten. Gleichzeitig sollten sie den in der sozialen Arbeit tätigen Frauen ermöglichen, Empathiefähigkeit neu zu erlernen, nachdem die NS-Ideologie auf darwinistische Ansätze vom ‚Überleben der Stärkeren‘ gesetzt hatte. Leitende Militäroffiziere übertrugen dem NCSS und der WGPW die Verantwortung für den Wiederaufbau der sozialen (Frauen-)Arbeit, der Frauenbewegung und der Frauenbildung in Deutschland vertrauensvoll, weil sie von der Idee, soziale Arbeit vor allem als ein Feld der Frauen und der Frauenorganisationen anzusehen, überzeugt waren und hierin auch eine Möglichkeit zur politischen Frauenbildung sahen. Der Einfluß der genannten britischen Organisationen trug dazu bei, den Konnex aus Frauenbewegung, sozialer Arbeit, Pädagogik und Politik in Deutschland, wo entsprechende Traditionen ebenfalls existiert hatten187, während des Wiederaufbaus erneut zu verstetigen. Theanolte Bähnisch, die im Kreis der bürgerlichen Sozialreformer, welche traditionell auf die soziale Arbeit von Frauen, auf ein Fürsorgeprinzip auf ‚Augenhöhe‘, auf die Entwicklung der ‚Persönlichkeit‘ und auf internationalen Expertenaustausch setzten, sozialisiert war, vertrat sehr ähnliche Überzeugungen. Bähnischs Organisationen entwickelten sich, indem sie versprachen, den staatsbürgerlich bildenden Aspekt ihrer Arbeit mit Wohlfahrtsarbeit zu verbinden188, schnell zu einem
anzuraten sei, dabei eine professionelle Distanz zu wahren. „Als die beste Methode für fürsorgerisches Arbeiten hielt sie die Hilfe zur Selbsthilfe“, schreibt Schröder über Salomon. Vgl.: Schröder, Ivonne: Alice Salomon und ihre Bedeutung für die soziale Arbeit, Studienarbeit, Hochschule Neubrandenburg 2010, auf: http://books.google.de/books?id =kIwJHVw0lI4C&pg=PA21&lpg=PA21&dq=alice+salomon+emotionale+distanz&sourc e=bl&ots=7wlHxsEuE6&sig=0qU_z_Byqzo1_tqYaEoaq-cBNgI&hl=de&sa=X&ei=cv V2UPKEEqn64QSnyIDYBg&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=alice%20salomon %20emotionale%20distanz&f=false, am 13.12.2013, S. 21. 186 Aktuell spricht man in der sozialen Arbeit von ‚Klienten‘. Vgl. beispielsweise: Lutz, Ronald: Perspektiven der sozialen Arbeit, in: APUZ 12/13 (2008), auf https://www.bpb. de/apuz/31335/perspektiven-der-sozialen-arbeit?p=all, 06.03.2008, geprüft am 13.12. 2013. 187 Vgl.: Hering/Münchmeier: Geschichte, S. 134. Die beiden Autoren verweisen insbesondere auf die Gegenwehr freier Wohlfahrtsverbände gegen die Kommunalisierung der Wohlfahrtspflege und die Gründung der ‚Liga der freien Wohlfahrtspflege‘ im Jahr 1925, die heute als Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege fortexistiert. Vgl.: ebd., S. 135/135. 188 Neuer Hannoverscher Kurier, 07.06.1946, Abschrift in: Kuhn: Nachkriegszeit, Bd. 2, S. 224.
Club deutscher Frauen | 577
zentralen Hoffnungsträger der WGPW für den Wiederaufbau Deutschlands.189 Dies kam nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck, daß man Bähnisch die Orientierung am Aufbau und der Arbeit der Towns Women‘s Guilds, der mitgliederstärksten und damit wichtigsten Stütze der WGPW, nahelegte. Für den ebenfalls von der VizeRegierungspräsidentin ins Leben gerufenen Frauenarbeitskreis, der verschiedene Organisationen unter einem Dach zusammenfassen wollte, empfahl man ihr die Orientierung an den ‚Standing Conferences‘, welche die WGPW als Dachorganisation regelmäßig abhielt. Eine weitere, von Großbritannien aus unterstützte Kontinuität in der Biographie Bähnischs lag in der Art, in der die Militärregierung Einfluß auf die Auswahl und die Ausbildung des Nachwuchses in der sozialen Arbeit nahm. Die Klientel, wie sie 1945 in den Wohlfahrtspflegeschulen anzutreffen war, behagte den zuständigen Offizieren nicht. Es bestand, glaubt man den Berichten, mehrheitlich aus unbelesenen und weitgehend kritiklosen jungen Mädchen. Die zuständigen Offiziere wollten reifere, selbständigere, kritisch denkende Persönlichkeiten zu Wohlfahrtspflegerinnen ausgebildet wissen.190 Auf der Suche nach geeigneten Ausbildungs-Modellen, die ihre Wiege in Deutschland hatten und gleichzeitig den Ansprüchen der britischen Offiziere genügten, stießen die Britinnen auf die von der BDF-Funktionärin Alice Salomon gegründeten Sozialen Frauenschulen. Die 1933 aufgelösten Schulen waren 1945 von einer Vertreterin der Youth Section in der Education Branch sowohl für ihr Curriculum, als auch für ihre Zugangsmodalitäten gegenüber anderen Modellen sehr lobend hervorgehoben worden.191 Damit war der Grundstein zur Fortführung einer – mit der AliceSalomon-Hochschule noch heute existierenden192 – Tradition gelegt, welche nicht nur die Arbeitsweise der sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, sondern auch die
189 Der Staatsbürgerinnenverband erfuhr dagegen, obwohl er von Offizieren der Militärregierung ebenfalls wiederholt als positiv dargestellt wurde, keine besondere Unterstützung. Seine Kernthemen wiesen keinen Bezug zum Thema ‚soziale Arbeit‘ auf. 190 NA, UK, FO 371/70862, Visit to Soziale Frauenschulen in the British Zone, June 1947, Report from Mrs. Lewis, Lecturer and Tutor in Social Studies, University of Birmingham sowie Ebd., Report to the Joint University Council for Social Studies and Public Administration on a sponsored visit to Germany, August 9th to September 15th, 1948. Together with a discussion of recommendations and tossed at the meeting held on October 3rd. o. D., o. V. [Mrs. Black, Secretary of the joint University Council of social service, University of Birmingham, 1948]. 191 NA, UK, FO 1050/1298, Notes on Training of Social Workers (Volkspflegerinnen), Dunning, 12.10.1945 sowie ebd., Education Branch, E. S. Davies an Public Health Coordination Section, 11.10.1945. 192 Daß das Erbe Alice Salomons auch im Zeitalter der Bachelor- und Master-Studiengänge gepflegt wird, beweist das Beispiel der Alice-Salomon-Hochschule mit seiner Hochschulzeitschrift ‚Alice‘ in Berlin. Vgl.: Internetpräsentation der Schule auf: http://www. ash-berlin.eu/, am 13.12.2013. Die Hochschule begreift sich als direkte Nachfolgerin der sozialen Frauenschule Salomons, welche 1908 im Pestalozzi-Fröbel-Haus begründet worden war und feierte im Jahr 2008 ihr 100jähriges Jubiläum.
578 | Theanolte Bähnisch
Berliner Soroptimistinnen bis 1933 beeinflußt hatte. In beiden Organisationen hatten sich auffällig viele Schülerinnen Salomons wiedergefunden. Da die Schulen drei Wahlschwerpunkte „Health welfare“, „youth welfare“ sowie „economic welfare“193 angeboten hatten und jede der drei Richtungen jeweils nur mit entsprechender Erfahrung entweder als Krankenschwester, im Unterrichten oder durch eine Tätigkeit in einem Unternehmen oder in der Industrie eingeschlagen werden konnte, war eine gewisse Reife der Personen, die um Aufnahme in eine solche Schule baten, sichergestellt. Die in Deutschland traditionell enge Verbindung zwischen der bürgerlichen Frauenbewegung und den Wohlfahrtsorganisationen schrieben britische Offiziere schließlich auch dadurch fort, daß vor allem ältere Lehrerinnen, die bis 1933 in der Frauenbewegung organisiert waren, für den Unterricht in Wohlfahrtsschulen ausgewählt werden sollten. In diesem Zusammenhang wurde das Argument vorgebracht, daß jene Frauen vom Nationalsozialismus nicht so stark beeinflußt seien wie die Jüngeren, was sie als Pädagoginnen geeigneter erschienen ließ.194 Durch das Anknüpfen der Britinnen an Alice Salomon und die Sozialen Frauenschulen erfuhr der ‚Zubringer‘ der SAG, der Soroptimistinnen und des BDF mehr als ein Jahrzehnt nach ihrer Schließung eine Bestätigung und Würdigung durch die WGPW. Darin lag wiederum auch eine Bestätigung und Würdigung des Umfelds, mit dem Theanolte Bähnisch sich in der Weimarer Republik gern umgab. Die positive Einstellung der Britinnen zu Salomon und ihrem Frauenbildungskonzept dürfte einer von verschiedenen Gründen dafür gewesen sein, daß Theanolte Bähnisch im deutschen Wiederaufbau von britischer Seite stark unterstützt wurde. Auch wenn Bähnisch – vermutlich – in keinem direkten Kontakt zu Salomon gestanden hatte, geriet ihr der Umstand, daß der Name ‚Bähnisch‘ aus den weitläufigen Zusammenhängen von BDF, SAG, den Soroptimistinnen und dem Kultusministerium unter Grimme bekannt war, zum Vorteil. Gleichzeitig dürfte es der Regierungspräsidentin die praktische Zusammenarbeit mit der Militärregierung erleichtert haben, daß sie sich im Wiederaufbau Deutschlands mit Vertrautem konfrontiert sah. Die Zusammenarbeit der Militärregierung mit der WGPW im deutschen Wiederaufbau war für die Militärregierung wiederum nicht zuletzt deshalb vielversprechend, weil sich die zuständigen Mitarbeiter sicher sein konnten, daß sich die Dachorganisation, was keinesfalls selbstverständlich war, jener Herausforderung gern stellen würde. Die WGPW hatte bereits im Dezember 1945 im Rahmen ihrer internationalen Wohlfahrtsarbeit eine Lanze für die Unterstützung der Frauen und Kinder in Europa, vor allem aber in Deutschland, brechen wollen. Margaret Bondfield, die Präsidentin des Verbandes, hatte zu diesem Zweck einen appellativen Artikel mit dem Titel ‚Distress in Europe‘ verfaßt, von dem sie hoffte, daß er in der ‚Times‘ erscheinen würde.
193 NA, UK, FO 1050/1298, Notes on Training of Social Workers (Volkspflegerinnen), Dunning, 12.10.1945 sowie ebd., Education Branch, E. S. Davies an Public Health Coordination Section, 11.10.1945. 194 NA, UK, FO 1050/1298, Recommendations to Zonal Welfare Committee organized by Health Branch, CCG Main HQ IA&C Division, Education Branch, Bünde B.A.O.R. an Public Health Branch, 01.12.1945.
Club deutscher Frauen | 579
Doch der Herausgeber der bekannten und verbreiteten Zeitung hielt den Artikel vor dem Hintergrund der nach Zwei Weltkriegen allzu verständlichen Abneigung der meisten Briten gegen die Deutschen – für zu starken Sprengstoff. Daß die WGPW mit ihrem Anliegen erklärtermaßen auch ein nationales Interesse verband – nämlich als Vorbild für andere Nationen zu dienen – und damit eine gewisse Vorreiterstellung zu erlangen – half nichts, der Artikel kam, obwohl auch die britischen Soroptimistinnen und verschiedene kirchliche Gruppen ihn unterzeichnet hatten, nicht zum Abdruck.195 An ihm wird jedoch deutlich, daß Gemmel, als sie sich im Februar 1946 an den Verband wandte, bereits ahnen konnte, daß die WGPW sie beim Wiederaufbau der Frauenarbeit in Deutschland unterstützen würde. Ob sie den Kontakt zur Organisation im Februar 1946 nun ‚heimlich‘ geebnet oder zu jener Zeit bereits im Auftrag der ihr vorgesetzten Militärs gehandelt hatte, bleibt unklar. Fakt ist, daß General Major George Erskine, der stellvertretende ‚Chief of Staff‘ der CCG (BE) im April 1946 das Control Office for Germany and Austria (COGA)196 in London gebeten hatte, die WGPW zu Beratungen über das Problem der Erwachsenenbildung in Deutschland hinzuziehen zu dürfen.197 Die Liste seiner Anliegen an die Frauenorganisation war lang: Er bat sie zum einen, Namen von Frauen zu nennen, die mit der früheren deutschen Frauenbewegung in Verbindung gestanden hatten und die bei einem gesunden Wiederaufbau („sound reorganisation“198) entsprechender Organisationen behilflich sein könnten. Zum anderen sollte der Dachverband zwei Delegierte schicken, die sich über den aktuellen Stand der Frauenbewegung in Deutschland informieren und Hilfestellung für die weitere Entwicklung von Frauenorganisationen in Deutschland leisten könnten. Außerdem ver-
195 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL560, 5WFM/A22, Die WGPW an den Herausgeber der Times, 06.12.1945, Anhang: Manuskript des Artikels. Aus Box FL560, 5WFM/A14, geht hervor, daß der Artikel nicht gedruckt wurde. 196 Die Hauptzuständigkeit des bereits vor Kriegsende eingerichteten COGA lag in der Verwaltung der Control Commission for Germany, British Element (CGG, BE), während die Planung der britischen Deutschland-Politik dem Foreign Office oblag. Gleichzeitig war das COGA – um mit der Großbritannien-Kennerin Bärbel Clemens zu sprechen – eine ‚Clearing Stelle‘ zwischen dem britischen Kabinett und der Kontrollkommission. Das COGA konnte also in zonalen Fragen starken Einfluß ausüben, war aber beispielsweise nicht für die Gestaltung der Viermächte-Politik in Deutschland zuständig. Im April 1947 verlor das COGA, das Clemens aufgrund der Dominanz des Foreign Office von Beginn an als „recht einflußlos“ beschreibt, den Status als selbständige Behörde. Seine Mitarbeiter und Kompetenzen wurden als ‚German Section‘ in das Foreign Office eingegliedert. Damit verlor auch das ‚War Office‘, das zuvor seine deutschlandpolitischen Geschäfte über die COGA abwickeln mußte, seinen Einfluß auf die Besatzungspolitik. Vgl.: Clemens: Kulturpolitik, S. 82–84. Dort finden sich auch weitere Literaturangaben zum Aufbau der britischen Militärverwaltung. 197 NA, UK, FO 1049/568, Office of the Deputy Military Governor, CCG (BE) Advanced Headquarters, Berlin, B.A.O.R. an The Permanent Secretary, COGA, London, 18.04.1946. 198 Ebd.
580 | Theanolte Bähnisch
anlaßte der im gleichen Jahr wie die Juristin Bähnisch geborene Erskine die WGPW, Informationen über den demokratischen Aufbau ihrer Mitgliedsverbände, über die Ziele der einzelnen Organisationen und ihre Frauenbildungsarbeit zu liefern. Schlußendlich sollten die Organisationen geeignete Bücher ihrer Wahl als Informationsmaterial nach Deutschland schicken.199 Christl Ziegler sieht in jenem Vorgang zu Recht einen Beleg für eine Orientierung der Militärregierung an solchen Organisationen, welche „die Postulate einer frauenspezifischen politischen Bildung in einem nach demokratischen Prinzipien geführten Verband“200 erfüllten. Daneben ist das Schreiben an die WGPW aber auch Ausdruck des Bedürfnisses, mit Frauenorganisationen zusammen zu arbeiten, die fest hinter der – sich auf die Differenztheorie stützende – Idee weiblicher Wohlfahrtsarbeit standen und nicht erklärt ‚frauenrechtlerisch‘ auftraten. Es dürfte sich jedenfalls gut getroffen haben, daß Theanolte Bähnisch etwa zur gleichen Zeit, nämlich im März 1946, hatte verlauten lassen, daß das „Zeitalter der radikalen und emanzipierten Frau hinter uns“201 liege. Zusammengenommen sah – dies ist der Akten-Überlieferung aus dem Foreign Office zu entnehmen und wird im Folgenden vertieft werden – die Militärregierung die Notwendigkeit von Frauenbildung aus den folgenden Gründen als unabdingbar an: In den ersten Nachkriegsjahren waren Frauen in der deutschen Bevölkerung überproportional stark vertreten, was bedeutete, daß sie notgedrungen zukünftig eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen würden und für diese Rolle – sollte es keine rein passive oder gar destruktive sein – geschult werden müßten. Zu dieser Überzeugung waren die zuständigen Offiziere vor dem Hintergrund der Annahme gelangt, daß Frauen in Deutschland zuvor kaum Zugang zu politischer Bildung gehabt hätten und daß sie deshalb ein großes Nachholbedürfnis in dieser Hinsicht hätten. Als traditionelle Erzieherinnen der nachfolgenden Generation hatten sie zudem einen großen Einfluß auf Kinder und Jugendliche, auch in außerhäuslichen Bildungseinrichtungen, weshalb ihnen eine besondere Bedeutung für die ‚Re-education‘ der Gesellschaft zukam. Schließlich setzte die Militärregierung – in Orientierung an traditionell mit dem weiblichen Geschlecht verknüpften Fertigkeiten und Neigungen – große Hoffnungen in die Frauen, was die Bewältigung der schwierigen ökonomischen, sozialen und psychologischen Lage der Bevölkerung betraf. In diesen Zusammenhängen sollten sie Solidarität und Hilfsbereitschaft gegenüber anderen walten lassen und darüber zu einer Haltung zurückfinden, die der deutschen Gesellschaft in den Jahren des Nationalsozialismus abhanden gekommen zu sein schien. Gefördert wurden aus diesen und den bereits genannten Gründen vor allem Frauenorganisationen mit einem karitativen und/oder staatsbürgerlich bildenden Schwerpunkt in ihrer Arbeit. Daß der Club deutscher Frauen, der zu jener Zeit in der Entstehung begriffen war, erklärtermaßen beide Aspekte in seiner Arbeit vereinen wollte, dürfte seine Unterstützung maßgeblich befördert haben.
199 Ebd., Appendix A. 200 Ziegler: Lernziel, S. 23. 201 O. V. [‚Ha-Ge‘]: Frau Vizepräsident, in: Neuer hannoverscher Kurier, Nr. 25, 29.3.1946.
Club deutscher Frauen | 581
6.5 DER ‚CLUB DEUTSCHER FRAUEN‘ ETABLIERT SICH 6.5.1 Die Volkshochschule verliert ihre Hoffnungsträgerinnen für die Frauenbildung an Bähnisch Daß sich zur Gründung des ‚Club deutscher Frauen, Hannover‘ im Juni 1946, nur einen Monat, nachdem die Women’s Affairs Section in der Education Branch der I.A.&C. Division eingerichtet worden war, gerade jene Frauen zusammenfanden, welche Heiner Lotze im Januar desselben Jahres zur Zusammenarbeit in der Volkshochschularbeit hatte bewegen wollen, kann wohl kaum als Zufall gewertet werden. Es scheint, als hätten deutsche Erwachsenenbildner, wie auch die britische Militärregierung, genau diesen Personenkreis für prädestiniert dafür gehalten – zunächst einmal in der Region Hannover – ein Konzept für eine breitenwirksame Frauenbildung auf die Beine zu stellen. Kultusminister Grimme, geschäftsführender Vorstand des Bundes für Erwachsenenbildung, betrachtete den Club deutscher Frauen nicht etwa als einen Konkurrenten zur Volkshochschule im Ringen um Personal und Publikum, sondern er erwies sich als einer der stärksten Unterstützer der Organisation. Dazu hatte wohl nicht zuletzt die Education Control Instruction No. 60 der Militärregierung, die unmißverständlich erklärt hatte, auf welchem Weg Frauenbildung in der britischen Besatzungszone umzusetzen sei, beigetragen.202 Außerdem hatte Grimme im Sommer 1946 Großbritannien besucht und im Rahmen eines organisierten Studienaufenthaltes, wie es bei solchen Reisen auch für männliche Teilnehmer obligatorisch war, auch die Frauenbildungsarbeit kennengelernt, die britische Frauenorganisationen leisteten.203 Neben der Vize-Regierungspräsidentin Bähnisch gehörten, wie an anderer Stelle bereits erwähnt, zu den Gründungsmitgliedern mit Anna Mosolf und Katharina Petersen weitere Frauen, denen Grimme, wie er selbst erklärt hatte, „bedingungslos vertrau[t]e“204. Auch das Club-Mitglied Ella Ellinghaus, die Ehefrau des zur Zeit der Club-Gründung noch amtierenden Regierungspräsidenten dürfte dem Kultusminister gut bekannt gewesen sein. Die ebenfalls schon erwähnte Ärztin Elfriede Paul, die den zweiten Vorsitz im Club übernehmen sollte, war sogar, wie Grimme, in der ‚Roten Kapelle‘, jener Gemeinschaft von Gegnern den Nationalsozialismus, die sich aus verschiedenen politischen Lagern speiste, engagiert gewesen. Wie viele Gegner des Nationalsozialismus hatte Pauls Lebensgefährte Walter Küchenmeister205 seine Ar-
202 NA, UK, FO 1050/1299, I.A.&C. Division Military Government Instruction No. 78 (Also known as Education Control Instruction No. 60), April 1946. 203 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 117. 204 Siehe Kapitel 5.4.4, besonders Anm. 408. 205 Küchenmeister war am 13.05.1943 wegen ‚Vorbereitung zum Hochverrat‘ in BerlinPlötzensee enthauptet worden.
582 | Theanolte Bähnisch
beit im Widerstand mit seinem Leben bezahlt.206 Zwar teilten Grimme und Paul nicht die gleiche politische Überzeugung – Paul war Kommunistin – doch hatte der gemeinsame Kampf gegen die Nationalsozialisten und die gemeinsame Freude über das Ende des Regimes jene Unterschiede in der politischen Überzeugung vermutlich verblassen lassen und zu einem Gefühl der Solidarität geführt. Anders ist jedenfalls kaum zu erklären, daß Lotze Elfriede Paul im Auftrag Grimmes um ihre Mitarbeit in der Erwachsenenbildung der Volkshochschule gebeten hatte. Ihre Mitarbeit im ‚Club deutscher Frauen‘ dürfte er daher wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Die von Lotze angeschriebenen Frauen sowie Käthe Feuerstack, in deren Büro die Besprechung über Frauenbildung in der VHS stattgefunden hatte, steckten ihre Energien also nicht, wie es von Lotze und Grimme ursprünglich geplant war, in die Frauenbildungsarbeit der Volkshochschule, sondern, gemeinsam mit Theanolte Bähnisch, in die Arbeit des ‚Club deutscher Frauen‘. Dies galt auch für Katharina Petersen. Sie zählte zwar nicht zu den Vorstandsmitgliedern der ersten Stunde, löste aber Theanolte Bähnisch als Leiterin des ‚Club deutscher Frauen‘, beziehungsweise des Frauenring-Ortsverbandes Hannover, wie dieser später hieß, ab,207 als die Organisation größer wurde und Bähnisch als Leiterin aufstieg. Daß sie jedoch schon 1947 eine wichtige Rolle für Bähnischs Frauenarbeit gespielt haben muß, läßt sich daran ablesen, daß sie zu dieser Zeit in Vertretung Bähnischs auf Einladung und auf Kosten einer internationalen Frauenorganisation nach Philadelphia reiste.208 Gemmels erster Kontakt zu einer der Initiatorinnen des ‚Club deutscher Frauen‘ scheint auf einer VHS-Konferenz entstanden zu sein. Dies geht aus einer der beiden Einladungen hervor, die Gemmel zur Auftaktveranstaltung des Clubs erhalten hatte: Die Einladung durch Theanolte Bähnisch enthielt eine englische Übersetzung des Einladungstextes, der über die Presse publik gemacht worden war209. Die zweite, persönliche, hatte Elfriede Paul auf Deutsch an die Mitarbeiterin der Militärregierung geschrieben und sich im Text auf eine Unterhaltung bezogen, welche die beiden Frauen im Anschluß an die besagte Volkshochschultagung miteinander über die Notwendigkeit der Gründung einer Frauenorganisation geführt hatten.210 Nun wollte
206 In diesem Zusammenhang erinnert sich Paul auch an Theanolte Bähnisch, was einer der wenigen Hinweise Dritter darauf ist, daß Bähnisch der Widerstandsbewegung nah gestanden hatte. Siehe Kapitel 4.2.3.2. 207 NA, UK, FO 945/284, Notes on interview with Frau Prejava [Prejawa], Assistance to Frau Bähnisch, Mi-nistry Hamburg, 26.02.1948, A. B. Reeve. 1949 übernahm Petersen die Leitung des Landesverbandes Niedersachsen, 1952 wurde sie von der späteren FDPPolitikerin Hedi Flitz aus Wilhelmshaven abgelöst. 208 NA, UK, FO 945/283, Joy Evans an das General Department des Foreign Office, 07.07.1947. Die Gastgeberin, Lady Nunburnholme, zeigte sich von Petersen sehr beeindruckt: „It is understood that she has a good knowledge of English, and it is felt that she would be a suitable representative.“ Ebd. 209 NA, UK, FO 1049/568, Theanolte Bähnisch an „Miss Gamel“ [Jeanne Gemmel], 13.06.1946. 210 NA, UK, FO 1049/568, Elfriede Paul an Jeanne Gemmel, 07.06.1946. Aller Wahrscheinlichkeit nach war dies die ‚Erste Volkshochschul-Tagung für die britische Zone‘ gewe-
Club deutscher Frauen | 583
Paul den erfolgreichen Fortschritt in dieser Sache verkünden und bat Gemmel, nicht nur an der ersten öffentlichen Kundgebung des Clubs teilzunehmen, sondern auch schon zu einer Vorbesprechung um acht Uhr morgens desselben Tages im Büro von Regierungsvizepräsidentin Bähnisch zu erscheinen.211 Ob Gemmel den Morgen-Termin wahrgenommen hatte, läßt sich – entgegen der Darstellung Denise Tscharntkes212 – nicht sagen. Sicher ist, daß auch das fünfseitige Protokoll der Veranstaltung, welches handschriftlich auf der Rückseite der Einladung von Bähnisch entstand213, nicht von Gemmel, sondern von einer anderen Mitarbeiterin der Education Branch, Edith Davies, angefertigt worden war. Entweder hatte diese anstelle Gemmels an der Veranstaltung teilgenommen – oder aber sie war als Begleitung und Protokollantin mit zur Konferenz gekommen. Wie dem auch sei: Beide Frauen hatten von Beginn an ein wachsames Auge auf den Club deutscher Frauen geworfen. In den folgenden Monaten sollten sie entscheidenden Einfluß auf seine Entwicklung nehmen. 6.5.2 Ankündigungen und Appelle des Clubs: Menschlichkeit, das Engagement von Frauen im öffentlichen Leben und die Wiedererweckung des nationalen Stolzes Die erste Kundgebung des Clubs deutscher Frauen fand am 18.06.1946 um 19 Uhr abends in der Stadthalle statt. Daß nicht nur die eingangs erwähnte ‚Hedwig S.‘, son-
sen, die von Regierungs- und Schulrat Heiner Lotze einberufen worden war. Neben deutschen Pädagogen von 32 Volkshochschulen der britischen Besatzungszone nahmen an der Tagung auch Vertreter der Militärregierungen in den Westzonen teil, darunter Jeanne Gemmel. Auf dieser Tagung hatten Elfriede Paul und Franziska Lambert referiert, Paul zum Thema: ‚Der Anspruch der Frau an die Volkshochschule‘. Es ist also wahrscheinlich, daß es sich hierbei um die Veranstaltung handelte, für die Heiner Lotze die Redebeiträge Pauls und Lamberts eingeworben hatte. Vgl.: Ziegler: Lernziel Demokratie, S. 97. (Ziegler bezeichnet Lotze fälschlicherweise als den Oberpräsidenten der Provinz.) Referenten des Oberpräsidenten der Provinz für den Bereich Schulen und Erziehungswesen hatten sich mit Vertretern der CCG (BE) bereits im November 1945 zu einer Tagung zusammengesetzt. Vgl.: Gierke, Willi B./Loeber-Pautsch, Uta: Die pluralen Strukturen der Erwachsenenbildung: zur Geschichte der Erwachsenenbildung in Niedersachsen 1947– 1960, online Publikation 2001, auf: http://oops.uni-oldenburg.de/623/, am 14.01.2014. 211 NA, UK, FO 1049/568, Elfriede Paul an Jeanne Gemmel, 07.06.1946. 212 Tscharntke schreibt, daß die Gründung des Clubs mit Gemmel besprochen worden sei und beruft sich dabei auf die Einladung Elfriede Pauls. (Ebd.) Eine Zusage Gemmels ist jedoch nicht überliefert. Sollte sich Tscharntkes Aussage auf die von Paul erwähnte Unterredung auf der Volkshochschulkonferenz beziehen, so wäre die Aussage, es sei dort über die Einrichtung des Club deutscher Frauen gesprochen worden, als fraglich einzustufen, denn es ist unklar, wie dezidiert das Thema zwischen Paul und Gemmel erörtert worden war. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 158. 213 NA, UK, FO, 1050/1299, Theanolte Bähnisch an „Miss Gamel“ [Jeanne Gemmel], 13.06.1946.
584 | Theanolte Bähnisch
dern auch viele andere Frauen den Weg zur Veranstaltung gefunden hatten, darf wohl auf eine geglückte Werbe-Kampagne in Kombination mit einer funktionierenden Mundpropaganda zurückgeführt werden. „Your article advertising the club will be forwarded for press publication as soon as you wish it“214, hatte das Hauptquartier der britischen Militärregierung im Regierungsbezirk Hannover die Regierungsvizepräsidentin am 18.05.1946, anläßlich der erfolgreichen Lizenzierung des Clubs wissen lassen215 und ihr damit Unterstützung beim Aufbau der Vereinigung, die zunächst nur als eine lokale zugelassen wurde, signalisiert. Am 07.06.1946 war es dann soweit, die versprochene Anzeige erschien: „In Hannover wurde in diesen Tagen der Klub deutscher Frauen gegründet. Dieser Klub will unabhängig sein von Politik und Weltanschauung. Er wendet sich an die Frauen aller Bevölkerungsschichten“216, lautete der erste Abschnitt der Pressenotiz, die in verschiedenen Zeitungen der Region veröffentlicht worden war. Die Notiz war gleichsam ein Appell. Der Club, so konnte man in einer Version der Anzeige, der in Elfriede Pauls Nachlaß überliefert ist, lesen, rief die Frauen dazu auf, „1. Hüterin eines dauernden zukünftigen Friedens zu sein, 2. Die körperliche und seelische Not unserer Zeit zu lindern, im Besonderen durch Hilfeleistungen von Frau zu Frau, 3. durch stärkere Wiedereinschaltung der Frauen in das öffentliche und soziale Leben, um der Entseelung, Verflachung und Verbürokratisierung unseres Daseins entgegenzuarbeiten. 4. Für die Wiederherstellung des Familienlebens, Wiedererweckung des Gefühls für menschliche Würde, saubere moralische Haltung und einen gesunden nationalen Stolz, besonders bei den Jugendlichen beiderlei Geschlechts zu wirken“217. In der Version des Aufrufs im Hannoverschen Kurier218 wurden insgesamt sechs Ziele genannt, die mit denen, welche sich in der Club-Satzung finden219, übereinstimmen. Die Fokussierung auf Jugendliche sowie das Ziel einer ‚sauberen moralischen Haltung‘ fand sich in der Version des Kuriers nicht. Die „Linderung der körperlichen und seelischen Not“220 wurde dagegen auch im Kurier als Ziel genannt,
214 Materialsammlung Karin Ehrich zum ,Club deutscher Frauen‘, Eric W. Debney, Major, HQ Mil Gov RB Hannover OCG (HE), [CCG (BE)] an Chief of the Administration, Attention of Frau Bähnisch, 18.05.1946, beglaubigte Abschrift. Die Fehler in der Adresse des Dienstsitzes der Militärregierung deuten darauf hin, daß die verantwortliche Schreibkraft noch nicht mit der Bedeutung der Kürzel vertraut war. 215 Ebd. 216 Der Text der Pressenotiz, die am 07.06.1946 in verschiedenen Zeitungen abgedruckt worden war (vgl.: Henicz/Hirschfeld: Club, S. 128), ist – in der hier zitierten Form – überliefert in: BArch, NY 4229, Nr. 28. Eine Abschrift der Notiz in der Version Neuer Hannoverscher Kurier, 07.06.1946, S. 6, findet sich in: Kuhn: Nachkriegszeit, Bd. 2, S. 224. 217 BArch, NY 4229, Nr. 28, Notiz o. T. 218 Neuer Hannoverscher Kurier, 07.06.1946, Abschrift in: Kuhn: Nachkriegszeit, Bd. 2, S. 224. 219 Materialsammlung Karin Ehrich zum ‚Club deutscher Frauen‘, Club deutscher Frauen, Hannover, Satzung o. D. [1946]. 220 Ebd.
Club deutscher Frauen | 585
dort – wie in der Club-Satzung – fehlte jedoch der Passus, der eine besondere Hilfe von Frauen für Frauen als erstrebenswert festgeschrieben hatte. Hinzugekommen waren gegenüber der in Pauls Nachlaß überlieferten Pressenotiz als 5. Forderung die „Kameradschaftliche Zusammenarbeit von Mann und Frau unter gleicher Wertung ihrer Arbeit“ und der Punkt 6. „Gedankenaustausch und Verbindung mit den Frauen anderer Länder.“221 Ob beide Versionen veröffentlicht wurden oder ob es sich bei der Version in Pauls Nachlaß um eine Vorab-Version handelte, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Letzteres ist jedoch wahrscheinlich, zumal die Version im ‚Kurier‘ mit der für längere Zeit gültigen Club-Satzung übereinstimmt. Der Aufruf sprach vieles von dem an, was das Alltagsleben der Großstädterinnen ein knappes Jahr nach Kriegsende prägte: Sechs Jahre Krieg und zwölf Jahre nationalsozialistische Herrschaft hatten Millionen Opfer gefordert, das Ansehen Deutschlands im Ausland war diskreditiert und die Identifikation der Bevölkerung mit dem Heimatland und seinen Eliten brüchig. Zudem waren die meisten Frauen aus ihren öffentlichen Ämtern und aus den professionellen Berufen verdrängt worden.222 Jene, die den Krieg überlebt hatten, kämpften jeden Tag um ihr Dasein, was nicht selten zu erbitterten Verteilungskämpfen anstelle von gegenseitiger Anteilnahme führte. Die Bürger waren physisch und psychisch stark angegriffen. In den Familien hatten, vor allem durch lange Trennungsphasen der Partner voneinander und/oder der Kinder von den Eltern, starke Entfremdungsprozesse eingesetzt, was die ‚kameradschaftliche Zusammenarbeit von Mann und Frau‘, die der Club forderte, vermutlich als eine verheißungsvolle, aber ferne Vorstellung erscheinen ließ. Wer kaum die Kraft und den Willen aufbringen konnte, für sich und seine nächsten Angehörigen da zu sein, wer nicht einmal mehr wußte, nach welchen Regeln er seine Kinder erziehen und woraus er Zuversicht schöpfen könnte, war wohl noch weniger fähig und willens, Kraft und Hoffnung in den Wiederaufbau der Stadt, der Gesellschaft, und des Staates zu investieren. Genau an diesem Nerv sollte der Apell des ‚Club deutscher Frauen‘ die Hannoveranerinnen treffen und sie zur Zusammenarbeit im Wiederaufbau bewegen.223 Der Aufruf forderte zwar vieles, er prangerte jedoch nichts an. Er deutete auf die Zukunft hin, ohne explizit auf die Vergangenheit Bezug zu nehmen. Aufgrund seiner Forderung nach der „Wiedererweckung des Gefühls für menschliche Würde“ und durch die Kritik an der „Entseelung“ und „Verbürokratisierung“ hatte er Potential, als Anspielung auf den Massenmord, der mit Hilfe eines hochgradig bürokratisierten Apparats durchgeführt worden war, interpretiert zu werden. Dem Plädoyer zur
221 Neuer Hannoverscher Kurier, 07.06.1946, Abschrift in: Kuhn: Nachkriegszeit, Bd. 2, S. 224. 222 Vgl.: Steinbacher, Sybille: Differenz der Geschlechter. Chancen und Schranken der „Volksgenossinnen“, in: Bajohr, Frank/Wildt, Michael (Hrsg.), Frankfurt a. M. 2009, S. 94–105. 223 Daß jene Wiederaufbaurhetorik aus dem Mund regionaler Politiker und Verwaltungsleiter keine Seltenheit war zeigt unter anderem die Publikation eines Hannoveraner Kommunalpolitikers. Vgl.: Lauenroth, Heiner/Gösseln, Hans von: Anpacken und Vollenden, Hannover 1949. Vgl. auch die Broschüre des Kasseler Oberbürgermeisters, die einem ähnlichen Duktus folgt: Seidel, Willy: Kassel lebt…trotz alledem, Kassel 1948.
586 | Theanolte Bähnisch
„Verwirklichung eines dauerhaften Friedens“ konnte gedanklich die Realität der aggressiven Expansionspolitik des Dritten Reiches als Negativ-Folie entgegengesetzt werden. Doch wer in dieser Hinsicht im Aufruf nicht fündig werden wollte, der wurde es nicht. Denn die Verlautbarung enthielt kein polarisierendes Vokabular und wurde nicht konkret. Sie sprach keine bestimmte Gruppe von Frauen an und schloß keine Frau, gleich welcher politischen Überzeugung sie anhing, aus, im Gegenteil: „Der Klub ruft jede Frau auf, ihre ganze Kraft einzusetzen für die Neugestaltung Deutschlands“, wurden die Forderungen am Ende des Textes noch einmal zusammengefaßt und die Frauen dazu aufgefordert, sich schriftlich für die Aufnahme in den Club anzumelden. Als Club-Adresse war die Dienstadresse des Regierungspräsidiums „Am Archive 3“224 angegeben. Welchen Erfolg die Ankündigung erzielte, wie viele Zuschriften auf dieser Grundlage im Sekretariat eingingen, läßt sich nicht rekonstruieren. Mag der Text zentrale Sorgen und Hoffnungen der Stadtbewohnerinnen im Frühjahr 1946 angesprochen und ihr Interesse geweckt haben, so war – womöglich ganz im Sinn der Initiatorinnen – vielleicht doch nicht ganz klargeworden, was die Frauen sich unter diesem neuen ‚Club‘ vorzustellen hatten, von dem es hieß, daß er „keine Frauenpartei sein“225 wolle und vom Nutzen der Zusammenarbeit von Frauen und Männern überzeugt sei. Größere Aufmerksamkeit wird der Artikel erzielt haben, welcher die bereits erwähnte, erste Kundgebung des Clubs, zu der auch Jeanne Gemmel geladen war, ankündigte. Mit dem Slogan „RUF AN DIE FRAUEN. Wohin geht Dein Weg, deutsche Frau?“226 war die Veranstaltung beworben worden. „Frauen kommt zu dieser Kundgebung. Sie ist überparteilich und überkonfessionell. Es geht um Eure Zukunft!“227, appellierte die Einladung, laut derer man für 30 Pfennig sowohl die erst seit einigen Wochen in der Stadt weilende, neue Regierungsvizepräsidentin, als auch die in Hannover zumindest in einigen Kreisen bereits bekannte Schulrätin und Politikerin Anna Mosolf und die Allgemein-Ärztin Dr. Elfriede Paul sprechen hören konnte.228 Die prominenten Rednerinnen, die mit ihren Karrieren in der Verwaltung, im Schulwesen und in der Medizin lebende ‚Beweise‘ dafür darstellten, daß ihre Forderung nach einer stärkeren Einschaltung von Frauen in das öffentliche Leben keine Utopie bleiben müsse, waren offensichtlich gut dazu geeignet, viele Frauen auf die
224 Neuer Hannoverscher Kurier, 07.06.1946, S. 6, Abschrift in: Kuhn: Nachkriegszeit, Bd. 2, S. 224. 225 Ebd. 226 Die Einladung ist ebenfalls im Nachlaß Elfriede Pauls überliefert. BArch, NY 4229, Nr28, Wohin geht Dein Weg deutsche Frau. Ob sie in Zeitungen zum Abdruck kam, in Form eines Flugblattes verteilt, per Post verschickt oder als Plakat ausgehangen wurde, ist nicht klar. Eine Übersetzung der Einladung hatte Theanolte Bähnisch persönlich an eine Mitarbeiterin der Militärregierung geschickt. NA, UK, FO 1049/568, Theanolte Bähnisch an „Miss Gamel“ [Jeanne Gemmel], 13.06.1946. 227 BArch, NY 4229, Nr. 28, Wohin geht Dein Weg, deutsche Frau. Großbuchstaben im Original, Anm. d. V. 228 Ebd.
Club deutscher Frauen | 587
Kundgebung neugierig zu machen. Selbstbewußt waren die jeweiligen Professionen der Rednerinnen auf der Einladung ausgewiesen. Zumal ihr Amtsantritt öffentlichkeitswirksam ausgestaltet worden war, dürfte die Vize-Regierungspräsidentin bereits vor der Veranstaltung in der Bevölkerung einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Denise Tscharntke zufolge hatte dies, was eines der Ziele der Militärregierung betraf, den Nagel auf den Kopf getroffen. Für Tscharntke steht fest: Bähnisch war „a showpiece for British propaganda to help women into positions of local government and administration“229. Überzeugend dürften, was die beworbene Ausrichtung des Clubs anging, auch die unterschiedliche politische Positionierung sowie das gesellschaftliche Engagement der drei Frauen mittleren Alters230 gewirkt haben. Die zu jener Zeit 48 Jahre alte Elfriede Paul hatte im August 1945 in Burgdorf bei Hannover, wo sie bald auch die Leitung der Frauenarbeit des DRK übernahm231, eine Arztpraxis eröffnet. Sie gehörte der KPD an und hatte sich während des Nationalsozialismus von Berlin aus im Widerstand engagiert. Die in Hannover geborene Anna Mosolf, die im Dritten Reich beruflich degradiert worden war232, hatte in den Jahren der Weimarer Republik mehrfach auf der DDP-Liste für ein Mandat im preußischen Landtag kandidiert und war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in die FDP eingetreten. Daß die Regierungsvizepräsidentin – wie auch der Regierungspräsident Ellinghaus und der Oberpräsident Kopf – der SPD angehörte233, wird sich bereits herumgesprochen und dem ‚überparteilichen‘ Charakter des Clubs Glaubhaftigkeit verliehen haben. Daß es als „traurige Folge des Krieges“ in Deutschland „weit mehr Frauen als Männer gebe“234, daß die Frauen diesem Umstand Rechnung tragen müßten und „wir in Zukunft mehr als bisher auf die Mitarbeit und die berufliche Unterstützung der Frauen angewiesen sei[e]n“235, diese Überzeugung der Regierungsvizepräsidentin war bereits im März 1946, zur Zeit ihres Amtsantritts, in der Zeitung zu lesen gewesen. Ihr Statement, in dem die gefühlte Notwendigkeit zum Audruck gebracht wurde, daß die Frauen das Fehlen von Männern in der Gesellschaft kompensieren müßten war auf Ausgleich bedacht und an beide Geschlechter adressiert: „Die Frau von heute will weder gegen noch ohne den Mann arbeiten, sondern neben und mit ihm“236, machte Bähnisch ihren in vielerlei Hinsicht auf Integration abzielenden Standpunkt, auch was das Geschlechterverhältnis betraf, klar. Sie griff damit im Be-
229 230 231 232 233
Tscharntke: Re-educating, S. 158/159. Elfriede Paul war um ein Jahr jünger als Bähnisch, Mosolf war vier Jahre älter. Zur Rolle des DRK im Wiederaufbau der Wohlfahrtsarbeit siehe Kapitel 6.4.4. Siehe Kapitel 5.4.4. Im Hannoverschen Kurier wird anläßlich des Amtsantritts der Regierungsvizepräsidentin darauf hingewiesen, daß ihre Ernennung zur Regierungsreferendarin [oder „zum Regierungsreferendar“, wie es im Text heißt], „ohne Beziehungen und Parteizugehörigkeit“ erfolgt sei. O. V. [‚Ha-Ge‘].: Frau Vizepräsident, in: Neuer Hannoverscher Kurier, Nr. 25, 29.03.46. 234 Ebd. 235 Ebd. 236 Ebd.
588 | The anolte Bähnisch
zirk Hannover 1946 inhaltlich dem vor, was zwei Jahre später sinngemäß auch in der ersten Ausgabe der ‚Stimme der Frau‘ zu lesen war.237 Ob sie tatsächlich glaubte, daß Frauen als eine Art Reserveheer in Notzeiten die Plätze ausfüllen sollten, die grundsätzlich den Männern zustünden – ihre Rhetorik läßt diese Interpretation trotz ihrer eigenen, ernüchternden Erfahrungen mit den ‚Doppelverdienergesetzen‘ zu238 – oder ob sie den Männermangel nur für ein wirkmächtiges Argument hielt, um Frauen zur Berufstätigkeit zu ermuntern, läßt sich aus dem geschilderten Zusammenhang nicht klären. Wahrscheinlich ist vor dem Hintergrund ihrer eigenen Sozialisation eher Letzteres. Die Werbung für den Club schien jedenfalls gelungen zu sein – bei seiner ersten Kundgebung herrschte, wie dem Bericht von Edith Davies, einer Mitarbeiterin der britischen Militärregierung zu entnehmen ist, reges Treiben, auch einige Männer waren zur Veranstaltung gekommen.239 6.5.3 Vom überparteilichen Geist und drei Frontal-Referaten geprägt: Die erste Club-Kundgebung Von der ersten öffentlichen Veranstaltung des Clubs sind zwei Protokolle überliefert: das bereits erwähnte von der Mitarbeiterin der Militärregierung Edith Davies sowie eines von einer unbekannten Verfasserin, welches in einem Sammelband über Frauengeschichte in der deutschen Nachkriegszeit zum Abdruck gekommen ist.240 Der
237 Wolf: Augen. 238 In der ‘Stimme der Frau‘ kam auch ein gegenläufig argumentierender Artikel zum Abdruck. Über die Auswirkungen der Währungsreform schrieb Anna Haag 1948: „es ist eine traurige Erfahrung, daß Frauen immer nur als Reservoir für Arbeitskräfte betrachtet werden. In Notzeiten, d. h. wenn Männer anderweitig beschäftigt sind. Beispielsweise: wenn sie schießen müssen und Bomben werfen, dann schöpft man gierig aus dem Reservoir. In Notzeiten anderer Art jedoch stößt man das Heer der Frauen wieder zurück, schließt den Deckel fest, um den Arbeitsmarkt nicht mit diesen lästigen Konkurrentinnen zu ‚belasten‘. Wir haben heute bei Beamtengesetzen schon wieder den Begriff ‚Doppelverdiener‘ der den Anspruch der verheirateten Frau auf Arbeit als unmoralisch stempeln möchte.“ Haag, Anna: Vor neuen Sorgen?, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 2, S. 4. 239 NA, UK, FO 1050/1299, German Women’s Will to Unite, Report on the Inaugural Meeting of the „Club for German Women“ held in Hannover on 18th June 1946 von E. S. Davies, 27 July [Juni!] 1946, Bünde. An einem späteren Treffen des Clubs im Sommer 1946 sollen 300 Frauen teilgenommen haben. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 161. Zu anderen, größeren Zusammenkünften sollen laut der Interviews, die Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld mit Zeitzeuginnen geführt hatten, 50 bis 120 Frauen erschienen sein. Ob es sich dabei weitgehend um Mitglieder des Clubs handelte, oder ob viele Gäste darunter waren, ist nicht bekannt. Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Club, S. 134, Anm. 21. 240 Vgl.: Club deutscher Frauen: Protokoll der ersten Kundgebung, o. V., o. D., in: Kuhn (Hrsg.): Nachkriegszeit, Bd. 2, S. 224–226. Im Sammelband ist kein Verfasser der Quelle
Club deutscher Frauen | 589
Inhalt der Referate ist durch diese Protokolle nur teilweise und nicht wörtlich rekonstruierbar. Daß die Rhetorik des deutschen Protokolls eine starke Ähnlichkeit zu Bähnischs und Mosolfs Sprache aufweist, deutet darauf hin, daß einige Aussagen wörtlich übernommen wurden, obwohl im Protokoll Zitate nicht kenntlich gemacht wurden. Glaubt man dem Protokoll Davies‘, das auch den ‚Vorspann‘ der Veranstaltung behandelt, so war die Kundgebung alles andere als gut geplant gewesen. Schon das Chaos beim Ticket-Kauf soll einige Frauen derartig verärgert haben, daß diese noch vor Beginn der Kundgebung wieder gegangen seien. Die Veranstaltung habe schließlich erst eine halbe Stunde später als angekündigt begonnen und die Eröffnungsrednerin, die Vizeregierungspräsidentin Bähnisch, habe ihre Rede vom Blatt abgelesen, so Davies.241 Bähnischs Rede soll im Folgenden eingehend behandelt werden, zumal aus den Protokollen die Argumentationslinie Bähnischs zu einem frühen Zeitpunkt ihrer Arbeit in einer kondensierten Weise greifbar wird. Ähnlich aufschlußreich sind die Beiträge der anderen beiden Rednerinnen, denn aus ihnen läßt sich ersehen, daß sich Elfriede Pauls Haltung und Zielsetzung zumindest in einem zentralen Aspekt bereits in der Gründungsphase des Clubs deutlich von jener Bähnischs und Mosolfs unterschied. 6.5.3.1 Frauenbewegung und Berufstätigkeit als Alternative zu Partnerschaft und Familie Wer trotz der widrigen Umstände am Veranstaltungsort die nötige Konzentration aufbrachte, konnte hören, daß Bähnisch die Notwendigkeit, Frauenorganisationen zu gründen, aus dem Bedürfnis sowohl „unverheiratete[r]“ als auch „verheiratete[r]“ Frauen ableitete, sich „aus ihrer Natur heraus“, „in dieser Notzeit“242 produktiv zu betätigen, ohne sich dabei politisch binden zu müssen.243 Der Club deutscher Frauen biete insbesondere jenen Frauen, deren „weibliche[…] und mütterliche Eigenschaften, Anlagen und Fähigkeiten ungenutzt bleiben“, weil sie „keinen Lebenspartner finden und sich einen Beruf suchen müssen“, die Möglichkeit ihre „brachliegenden mütterlichen Kräfte produktiv“ zu machen. Ihre Leistungs- und Duldungsfähigkeit hätten die Frauen, so Bähnisch, bereits in den Jahren des „Bombenkrieges“ bewiesen – eine Formulierung, welche auf die Leiden der deutschen Bevölkerung fokussier-
genannt. Vermutlich stammt die Quelle aus den Privatunterlagen einer der von Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld interviewten Frauen. 241 NA, UK, FO 1050/1299, German Women’s Will to Unite, Report on the Inaugural Meeting of the „Club for German Women“ held in Hannover on 18th June 1946, Davies, 27 July [Juni!] 1946. 242 Club deutscher Frauen: Protokoll der ersten Kundgebung. 243 „Leider sei ja der Mangel an politischem Interesse bei der deutschen Frau besonders stark“, gibt die unbekannte Verfasserin des deutschen Protokolls eine Aussage Bähnisch wieder. Ebd.
590 | Theanolte Bähnisch
te.244 Nun sei es wesentlich, daß die erprobten Fähigkeiten „zu positiver Arbeit für die Gemeinschaft“245 Verwendung fänden. Bähnisch argumentierte damit in der Tradition der bürgerlichen Frauenbewegung. Aus besonderen Neigungen und Fähigkeiten, die sie allen Frauen unterstellte, leitete sie das Bedürfnis und die Pflicht aller Frauen ab, sich an der Gestaltung des Gemeinwesens zu beteiligen. Zu der zuvor bereits zitierten, wenn man so will makrosoziologisch ausgerichteten Argumentation, die Frauen müßten in der Gesellschaft die Plätze der Männer ausfüllen, die im Krieg geblieben waren, gesellte sich in ihrer Eröffnungsrede ein Argument, das die Frauen bei ihren persönlichen Ängsten zu packen versuchte: Die gesellschaftliche Schieflage, die Überzahl an Frauen, drohte dazu zu führen, daß nicht für jede Frau – die Möglichkeit eines partnerschaftlichen Zusammenlebens jenseits heterosexueller Präferenzen war ihr offenbar nicht in den Sinn gekommen – ein männlicher Partner zu haben sein würde. Dies lege den Frauen – so die Quintessenz ihrer Ausführungen zu diesem Punkt – notgedrungen die Pflicht auf, ihre Schwerpunkte anders zu setzen, um die offenbar naturgemäß vorhandenen ‚fraulichen Kräfte‘ in gesunde Bahnen zu lenken. Die Vorstellung, die hinter jener Rhetorik stand, war ganz augenscheinlich jene, daß Frauen ohne männlichen Partner und Kinder im Grunde unvollständige, irregeleitete Wesen seien, die einer Rettung durch Alternativangebote bedürfen. Hierin spiegelt sich jene Orientierung am Modell der bürgerlichen Kleinfamilie wieder, das in den 1950er Jahren nahezu sämtliche westdeutschen Frauenzeitschriften – so auch die Stimme der Frau – prägte.246 Die Regierungspräsidentin, ihre Frauenorganisation und ihre Zeitschrift arbeiteten damit einer Entwicklung zu, die 1953 in die Etablierung eines Familienministeriums unter FranzJosef Würmeling mündete. Dieser strebte, in einer Zeit in der in der DDR, wie es Irene Dölling ausdrückt, die Berufstätigkeit auch der Frau „als Ordnungshilfe und Wert an sich“, als „Sinnbild für den Aufbruch in eine neue Gesellschaft propagiert“247 wurde, die Konsolidierung der bürgerlichen Familie als „natürliche Urzelle und Kraftquelle der staatlichen Ordnung“248 in Westdeutschland an. Stärker noch in den 1950er als in den 1940er Jahren war die als erstrebenswert angesehene ‚Normalrolle‘ der Frau die der Ehefrau und Mutter, welche, finanziell abhängig vom Lohnarbeit verrichtenden Ehemann, die Sorge für den Haushalt und die Kindererziehung
244 Auch in der ‚Stimme der Frau‘ wird der Fokus auf die Leiden der deutschen Bevölkerung gerichtet, im Mittelpunkt stehen Flüchtlinge und Vertriebene, Kriegs- und Strafgefangene, versehrte Heimkehrer, ‚Ausgebombte‘ sowie Soldatenwitwen und -waisen. Vgl.: Freund: Krieg, S. 106–123. Als Verursacher jener Leiden wird, mit Ausnahme des Schicksals der ‚Ausgebombten‘, in der Zeitschrift in der Regel die Sowjetunion dargestellt. 245 Club deutscher Frauen: Protokoll der ersten Kundgebung. 246 Vgl.: Freund: Krieg, S. 213–230. 247 Dölling, Irene: Gespaltenes Bewußtsein – Frauen- und Männerbilder in der DDR, in: Helwig, Gisela/Nickel, Hildegard Maria: Frauen in Deutschland 1945–1992, Bonn 1993, S. 23–52, hier S. 28. Zur latenten Kritik der ‚Stimme der Frau‘ am Einsatz von Frauen in ‚Männerberufen‘ in der DDR vgl.: Freund: Krieg, S. 221–230. 248 Ebd., S. 268.
Club deutscher Frauen | 591
trägt.249 Zwar sollte die ‚Stimme der Frau‘ ab 1948 das Recht sogar verheirateter250 Frauen auf Berufstätigkeit einfordern und zu diesem Zweck verschiedene, auch ‚neue‘, Berufsbilder für Frauen vorstellen, jedoch suggerierte die Zeitschrift gleichzeitig, daß es sich bei der Berufstätigkeit von Frauen, die eine Familie gründen wollten, nur um eine Not- oder Übergangslösung handeln könne.251 Eine Ausnahmeerscheinung stellt allerdings korrelierend mit der positiven Darstellung von Individualismus und Selbstentfaltung in der Zeitschrift sowie mit der Biographie der Herausgeberin – die weibliche Berufstätigkeit aus einer gefühlten ‚Berufung‘ dar. Herausragende Leistungen für die Gesellschaft – beispielsweise als Kinderärztin, aber auch als Schauspielerin oder Künstlerin – rechtfertigten in der Darstellung der Zeitschrift eine längerfristige Berufstätigkeit von Frauen auch in der Ehe.252 Ein Artikel bewertet die Arbeit im Staatsdienst – wie die zu jener Zeit noch stellvertretende Behördenleiterin ihn leistete – ebenfalls als eine solche Berufung und legitimierte somit, freilich unausgesprochen, Bähnischs Berufsarbeit trotz ihrer Mutterrolle.253 Die Aussage der Juristin, daß Frauen, welche „keinen Lebenspartner finden“, sich einen „Beruf suchen müssen“254, verdeutlicht, daß sie annahm, die meisten Frauen würden, wenn sie könnten, gern auf einen solchen verzichten. Dies erscheint nicht nur widersprüchlich zur Wertschätzung, welche die Juristin aus „Leidenschaft“255 ihrem eigenen Beruf entgegen brachte, sondern auch dazu, daß sie erklärtermaßen gerade in der Zusammenarbeit mit ihrem Lebenspartner im gleichen Beruf
249 Vgl.: dazu beispielsweise Horvath, Dora: Bitte recht weiblich! Frauenleitbilder in der deutschen Zeitschrift Brigitte 1949–1982, Zürich 2000 sowie Feldmann-Neubert: Frauenleitbild. Beide Studien untersuchen die meistanalysierte deutsche Frauenzeitschrift „Das Blatt der Hausfrau/Brigitte“. Für eine allgemeinere Darstellung ohne Schwerpunkt auf Printmedien vgl.: Frevert: Frauen-Geschichte, S. 253–271. 250 Vgl.: O. V.: Wer hat in der Ehe zu sagen?, in: Stimme der Frau, 4. Jg. (1952), S. 6/7. 251 Vgl.: Freund: Krieg, S. 213–229. Vgl. insbesondere: Pelz, Gerda: Die „gute Partie“ ist nicht mehr gefragt!, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 9, S. 2. Hierin heißt es: „Eine Ehe, in der beide abends abgekämpft in eine kalte Bude kommen, entbehrt der eigentlichen fraulichen Atmosphäre des eigenen Herdes doch so fühlbar und kostet außerdem an Löhnen für Putzfrau und Waschfrau [...] auf die Dauer mehr, als die Ganztagsbeschäftigung der Ehegattin wert ist.“ Vgl. auch: O. V.: Soll die Ehefrau noch berufstätig sein?, in: Stimme der Frau, 3. Jg. (1951), Heft 11, S. 5/6. Im Artikel halten „Ursula und Annegret [...] gar nichts davon, daß ihre Mutti mitarbeitet“ und für „Frau Jäger“ steht „das bittere Muß“ hinter der Berufstätigkeit, da sie ihre Kinder und ihren kranken Mann ernähren müsse. Ebd., S. 6. 252 Ein Bericht über den Alltag einer Schauspielerin stellt diese positiv und sympathisch dar, jedoch wird berichtet, welche Zeitnot die junge Frau hat, weil sie in den Arbeitspausen die Hausarbeit erledigen müsse. Vgl.: O. V.: Die Künstlerin in ihrem Heim. Von morgen bis Mitternacht, o. V., in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 12/13. 253 Vgl.: O. V.: Frauen sind trotzdem bessere Diplomaten..., in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/59), Heft 2, S. 2/3. 254 Club deutscher Frauen: Protokoll der ersten Kundgebung. 255 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 124, Bähnisch an Schumacher, 23.12.1945.
592 | Theanolte Bähnisch
– also in der Kombination beider Lebensinhalte – ihr größtes Glück erfahren hatte.256 Sie scheint angenommen zu haben, daß die angesprochenen Frauen anders empfinden würden als sie selbst und keinen ‚Beruf aus Berufung‘ ergreifen würden, anders ist kaum zu erklären, daß sie eine ihren Überzeugungen im Grunde widersprechende Argumentation wählte, um ‚einfache‘ Frauen zu einer Berufsausbildung zu motivieren. Daß sie damit durchaus die Mehrheitsmeinung der Frauen getroffen haben dürfte, bestätigt ein Report des Büros zur Erforschung der öffentlichen Meinung, welches die Political Division der britischen Militärregierung verwaltete. In jenem Bericht von 1949 läßt sich nachvollziehen, daß das prinzipielle Wissen der Bevölkerung um die demographische Schräglage in einem eklatanten Widerspruch zu Einstellungen in Bezug auf Fragen des ehelichen Zusammenlebens, der Berufstätigkeit von Frauen und der Rollenbilder insgesamt stand.257 Demnach wollten die meisten Frauen 1946 genau das, was so schwer zu erreichen schien: einen männlichen Lebenspartner, der auch die Rolle des Ernährers übernimmt. 6.5.3.2 Eine Absage an die Parteiendemokratie? Die Idee des weiblichen Einflusses auf die ‚Gemeinschaft‘ Daß sich die Juristin vom weiblichen Engagement in der Gesellschaft eine ausgleichende Wirkung auf diese erhoffte, wird besonders an ihren Ausführungen über Parteien deutlich: Frauen welche einer Partei angehörten, so die Vize-Regierungspräsidentin, sollten auch in diesen im Sinne des Friedens und der Toleranz, also den Werten, die sich der Club auf die Fahnen geschrieben habe, wirken. „Es könnte dadurch in vielen wesentlichen Dingen eine Einigkeit unter den Parteien erreicht werden“258, wird ihr Statement im Protokoll wiedergegeben. Das der Idee der ‚Einigkeit‘ widersprechende Konkurrenzprinzip, welches grundlegend für das Selbstverständnis einer jeden Partei im Streit um politische Mehrheiten ist, schien sie mit ihrem Ansatz außer Kraft setzen und durch ein universalistisches Verständnis davon, was das Wohl der „Gemeinschaft“ sei, ersetzen zu wollen. Der Begriff ‚Gemeinschaft‘, den Bähnisch – dem Protokoll zufolge – in ihrer Rede verwendet hatte, steht, anders als der Begriff ‚Gesellschaft‘, Pate für die Vorstellung einer überbrückenden ‚Einigkeit‘ zwischen den Menschen in sich. Ob Ferdinand Tönnies, der in seinem Werk ‚Gemeinschaft und Gesellschaft‘259 unter den beiden Oberbegriffen zwei voneinander verschiedene
256 Siehe Kapitel 3.1. 257 NA, UK, FO 1049/1845, Special Report No. 287 „Germany’s surplus women“, Public Opinion Research Office, Political Division, Mai 1949. 258 Club deutscher Frauen: Protokoll der ersten Kundgebung. 259 Vgl.: Tönnies, Ferdinand: Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirische Culturformen, Darmstadt 2005 [Erstauflage 1887]. Die Ausgaben ab 1912 trugen den unverfänglicheren Untertitel: ‚Grundbegriffe der reinen Soziologie.‘ Tönnies zufolge ist ‚Gesellschaft‘ ein Kreis von Menschen, die voneinander wesentlich getrennt sind. Handlungen in einer Gesellschaft erfolgen nicht im Hinblick auf eine vorhandene Einheit oder ein Gemeinwohl, sondern entspringen dem jeweils eigennützigen Einzelwillen. ‚Gemeinschaft‘ dagegen steht für ihn für einen Kreis von Menschen, die wesentlich miteinander verbunden sind und gemeinsam nach den hö-
Club deutscher Frauen | 593
Arten kollektiven Zusammenlebens subsumierte, der Vater ihrer Wortwahl war, darüber läßt sich nur mutmaßen, unwahrscheinlich ist es nicht. Man darf davon ausgehen, daß der belesenen Juristin, die sich nach eigener Aussage für das Studium der Rechtswissenschaften entschieden hatte, weil sie sich mit den Regeln menschlichen Zusammenlebens hatte auseinandersetzen wollen, das in intellektuellen Kreisen verbreitete Werk zumindest dem Namen nach bekannt war und daß sie seine Kernthese kannte, zumal Tönnies Werk besonders stark in der Jugendbewegung rezipiert worden war.260 Dieser hatte wiederum Albrecht Bähnisch nahegestanden.261 Ihre mit sorgsam gewählten Worten verbreitete Message war zumindest bei der Presse angekommen: Daß die Hannoveranerinnen den Club deutscher Frauen als ein „Forum […], auf dem das Gemeinsame stärker bindet und das Unterschiedliche nicht trennt“ 262 verstehen sollten, wird in einem Zeitungsartikel über die erste Kundgebung des Clubs als wichtiges Ziel seiner ersten Vorsitzenden genannt. Bemerkenswert ist, daß die Vize-Regierungspräsidentin ihre Vorstellung vom parteiübergreifenden Konsens unter den Frauen nicht auf Deutschland beschränkte, sondern als ein weltweites Phänomen verstanden wissen wollte, das sich auf einen von ihr angenommenen besonderen Friedenswillen unter Frauen stützte. Frauen seien, so argumentierte Bähnisch, auf das Produkt des Krieges anspielend, „in allen Ländern in der Überzahl“ und „naturgemäß“ seien sie „in allen Ländern immer“263 diejenigen gewesen, die Kriege abgelehnt und „Friedensgedanken“ vertreten hätten. In Deutschland sei es den Frauen nur deshalb nicht möglich gewesen, den Friedensgedanken zu verteidigen, weil es dort keine oder zu wenige Frauen im „Gemeindeu[nd] Regierungswesen“ gegeben habe. Die Rednerin sprach die Frauen also von der Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg und – dies schwingt unausgesprochen mit – für den Nationalsozialismus frei. „In Kameradschaft gemeinsam mit dem Manne“ sollten die Frauen nun „die Geschicke leiten“, postulierte Bähnisch. „Beide Elemente seien nötig“, um „ein harmonisch ausgewogenes Leben zu schaffen“264, gibt die Protokollantin die Aussage der Rednerin wieder. Die Vize-Regierungspräsidentin bot ihren Zuhörerinnen also – das hatte der ‚Ruf an die Frauen‘ bereits erahnen lassen – zur ‚Neuorientierung‘ im Wesentlichen einen Rückgriff auf die Ideen der Bürgerlichen Frauenbewegung aus der Zeit vor 1933 an.
260 261 262
263 264
heren Zwecken eines Kollektivs streben. Dabei ergänzen sich die Individuen kraft ihrer Unterschiede, beispielsweise ihres Geschlechts. Die Gemeinschaftsrhetorik Tönnies‘ wirkte ab etwa 1900 stark auf die Intellektuellen des späten Kaiserreiches und der Weimarer Republik. Zur vermutlich von Ferdinand Tönnies abgeleiteten Gemeinschaftsrhetorik Bähnisch siehe auch Kapitel 8.3.8.3. Vgl.: Schröder, Peter: Die Leitbegriffe der deutschen Jugendbewegung in der Weimarer Republik. Eine ideengeschichtliche Studie, Münster 1996, S. 48 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. O. V.: Eine Friedensfront der Frauen. Erste Kundgebung des Clubs deutscher Frauen in der Stadthalle zu Hannover, in: Neuer Hannoverscher Kurier vom 21.06.1946, abgedruckt in: Henicz/Hirschfeld: Club, S. 128/129. Club deutscher Frauen: Protokoll der ersten Kundgebung. Vgl.: ebd.
594 | Theanolte Bähnisch
Die Betonung weiblicher Fähigkeiten und Charakterzüge war, in Anlehnung an die Differenzthese Rousseaus, die Schlüsselbegründung der bürgerlichen Frauenbewegung gewesen265, wenn es darum ging, einen stärkeren Einfluß von Frauen auf das gesellschaftliche Leben durchzusetzen. Daß Bähnisch an weibliche Parteimitglieder appellierte, auch in den Parteien im Sinne des Clubs zu wirken, wird plausibel, wenn man sich vor Augen führt, daß die Frauenbewegung im Kaiserreich und in der Weimarer Republik die Erfahrung gemacht hatte, daß sich die Parteien realpolitisch kaum für die Emanzipation der Frauen eingesetzt hatten. Was die kommunistische und die sozialdemokratische Partei betraf, war diese Interpretation zwar nur teilweise zutreffend, jedoch war die Juristin im Speziellen von den Sozialdemokraten enttäuscht worden, als es um ihre berufliche Stellung im Berliner Polizeipräsidium ging.266 Als eine im Kreis bürgerlicher Sozialreformer und der Großen Koalition sozialisierte Verwaltungsbeamtin war Bähnisch wiederholt mit der Überzeugung konfrontiert worden, daß ein als universell angesehenes und zum gemeinsamen ‚Staatsziel‘ definiertes ‚Wohl der Gesellschaft‘ durch überparteiliche Zusammenarbeit ‚im gleichen Geist‘ anzustreben sei. Bähnischs Hoffnung, daß über die Präsenz von Frauen in Parteien Einigkeit in wichtigen Fragen erzielt werden könne, offenbart ihren Wunsch, es möge allgemeingültige, gemeinsame Grundhaltungen und Werte in der Bevölkerung geben, eine Utopie, der auch die geistigen Väter und Mütter der SAG Berlin-Ost anhingen. Bähnischs Vorstellung von politischer Gestaltung fußte also ganz offensichtlich nicht in erster Linie auf der Idee des demokratischen Aushandlungsprozesses zwischen den Parteien als gewählte Vertreter der Bürger. Sie traute eher einem bisher in ihrer Wahrnehmung kaum zum Zuge gekommenen Geschlecht als einer gewählten Partei zu, der Gesellschaft zu geben, was sie für den Wiederaufbau brauchte. Den Beweis, daß es zu Krieg und Holocaust gar nicht erst gekommen wäre, wenn Frauen eine aktivere Rolle in der Gesellschaft gespielt hätten, mußte sie schuldig bleiben, der Glaube daran bestärkte sie jedoch einerseits selbst in ihrem Engagement für den Aufbau eines ‚besseren Deutschland‘ und erschien ihr andererseits dazu geeignet, die Zuhörerinnen dazu zu motivieren, ihre Kraft ebenfalls in den Dienst dieses ‚neuen Deutschland‘ zu stellen. Was genau Bähnisch meinte, als sie in ihrer Rede erklärte, der Club trete zunächst ‚beratend den Verwaltungen bei‘, bleibt offen. Denkbar ist, daß die Aussage im Zusammenhang mit der Funktion stand, die Frauenausschüsse zu jener Zeit in
265 Der Vollständigkeit halber sei auf die Position Elke Spitzers verwiesen, daß Einflüsse der Französischen Revolution auf die Frauenbewegung in Deutschland in der Forschung bisher weitgehend ausgeblendet worden seien. Spitzer stellt in ihrer von Heide Wunder betreuten Dissertation die gängige Praxis, den Beginn der Frauenbewegung auf das 19. Jahrhundert zu datieren, in Frage und verweist auf Geschlechterdiskurse um 1800, in denen nicht nur die Differenztheorie, sondern auch Konzepte, die sich auf die Idee der Egalität gründeten einen breiten Raum einnahmen. Vgl.: Spitzer, Elke: Emanzipationsansprüche zwischen der Querelles des Femmes und der modernen Frauenbewegung, Kassel 2002. 266 Siehe Kapitel 4.1.1.
Club deutscher Frauen | 595
Berlin hatten. In der Hauptstadt hatte der von der SMAD eingesetzte Magistrat im August 1945 die Gründung eines Frauenausschusses als Teil der Verwaltung beschlossen.267 Die Aussage von Vorstands-Mitglied Elfriede Paul, der ‚Club deutscher Frauen‘ müsse zu einer „Nebenbehörde“268 werden, die an allen maßgeblichen Stellen Anregungen gebe, war ebenfalls nebulös, in ihr deutete sich jedoch die Art an, in welcher der Frauenring später tatsächlich Einfluß auf Landes und Bundesbehörden nehmen sollte und sich einen Platz im politischen System schaffte, welcher von der Verfassung nicht vorgesehen war. Die Äußerungen beider Frauen deuten darauf hin, daß die Club-Gründerinnen planten, ihren Einfluß auszuüben, indem sie dort Präsenz zeigten, wo weichenstellende Entscheidungen für den Wiederaufbau gefällt werden würden. Dazu gehörten die bereits existierenden Behörden auf der städtischen, der Kreis- und der Bezirksebene. 6.5.3.3 ‚Mütterlichkeit‘ und ‚Friedfertigkeit‘ – Anknüpfen an Schlüsselbegriffe der bürgerlichen Frauenbewegung Bähnischs Ausführungen zum Thema ‚Mütterlichkeit‘ waren zwar der Ideologie der bürgerlichen Frauenbewegung vor 1933 verhaftet269, gleichzeitig trafen sie, vor dem Hintergrund abwesender Väter und ‚Onkelehen‘, den Nerv der zweiten deutschen Nachkriegszeit. Daß die Club-Präsidentin biologische Mutterschaft ohne einen ‚Lebenspartner‘ in ihrer Rede als nicht erstrebenswert darstellt, zeigt zum einen, daß sie am Ideal der Familie festhielt und Frauen vor den Folgen von sexueller Libertinage warnen wollte. Zum anderen aber stellte sie sich mit ihrer Wortwahl der Lebensrealität der Nachkriegsjahre, denn in der Wahl des Begriffs ‚Lebenspartner‘ schwang mit, daß dieser mit einem ‚Ehegatten‘ nicht identisch sein mußte. Unzweifelhaft ist, daß sich über den Begriff ‚Mütterlichkeit‘ alle Frauen, auch jene ohne Partner und Kinder, angesprochen fühlen sollten. Mütterlichkeit spielte in den Beiträgen aller drei Rednerinnen eine Rolle, wobei sie diese nicht – wie im Rahmen der nationalsozialistischen Propaganda weitgehend geschehen – auf die biologische Mutterschaft reduzierten. Zwar nahmen sie Festschreibungen dessen vor, was das Wesen von Frauen ausmache und welche Handlungsoptionen sich daraus für Frauen ergäben, jedoch waren diese Vorstellungen auf eine breitere Grundlage gestellt, als in der nationalsozialistischen Propaganda. Vielmehr orientierten sie sich an einem Mütterlichkeitsbegriff, der sich über Generationen in der bürgerlichen Frauenbewegung zu einem Konzept entwickelt hatte, mit dem die Berechtigung und Notwendigkeit einer Einflußnahme von Frauen auf das gesellschaftliche Zusammenleben begründet wurde: 1865 hatte die 1827 geborene Henriette Schrader-Breymann, die im Geburtsjahr Theanolte Bähnischs verstorben war, die Ideen Gustav Fröbels und Johann Heinrich Pestalozzis zum gleichermaßen christlichen wie libertären Konzept der ‚geistigen Mütterlichkeit‘ weiterentwickelt. Schrader-Breymann sorgte dafür, daß das Konzept
267 Vgl.: Nienhaus: Topographie, S. 99. Bereits im Februar 1947 waren die Frauenausschüsse in den Westsektoren wieder aufgelöst worden. Vgl.: ebd. 268 Club deutscher Frauen: Protokoll der ersten Kundgebung. 269 Siehe zum Begriff ‚Mütterlichkeit‘ in der zweiten deutschen Frauenbewegung auch Kapitel 7.7.2.3 sowie Zepp: Redefining.
596 | Theanolte Bähnisch
in der professionellen Kindererziehung, im von ihr begründeten ‚Pestalozzi-FröbelHaus‘ umgesetzt wurde. Damit war eine gesellschaftlich akzeptierte Möglichkeit für bürgerliche Frauen geboren, den Beruf der ‚Erzieherin‘ zu erlernen und auszuüben.270 Die darauffolgende Generation der Frauenbewegung arbeitete unter Federführung Helene Langes mit dem weniger theologisch, stärker fürsorgerisch ausgerichteten Konzept der ‚sozialen Mütterlichkeit‘.271 Für die frühe bürgerlichen Frauenbewegung war die ‚soziale Mütterlichkeit‘ nicht zuletzt ein wichtiges, zentrales Versatzstück der Mobilisierungsrhetorik für den ‚Dienst am Volk‘ in den Kriegsjahren 1914 bis 1918 gewesen.272 Gepaart mit nationalistischer Rhetorik hatte das Konstrukt der ‚sozialen Mütterlichkeit‘ zunächst zu einer Ausweitung der ehrenamtlich von Frauen geleisteten Krankenpflege im Ersten Weltkrieg beigetragen.273 Dieser ‚Liebesdienst am Volk‘, welcher mit einer Professionalisierung und teilweisen Verstaatlichung von sozialer Arbeit einherging, ließ sich wiederum erfolgreich für das Unterfangen der Frauenbewegung nutzen, einen größeren gesellschaftlichen Einfluß von Frauen durchzusetzen.274 Schließlich gelang mit Hilfe dieses Konstrukts und auf der Grundlage der Kriegskrankenpflege die Institutionalisierung der von der Frauenbewegung geleisteten sozialen Arbeit im Verwaltungsapparat, womit die ehrenamtliche Arbeit staatstragenden Charakter bekam. „Mit der Frauenbewegung wurde auch die entsprechende Sozialarbeit in den öffentlichen Verwaltungsapparat integriert, in der Kooperation von ‚Nationalem Frauendienst‘, kommunaler Sozialverwaltung und Frauenreferaten der Kriegsämter und Kriegsamtsstellen entwickelte sich ein integrierter Gesamtkomplex öffentlicher Dienstleistungen“, faßt der Experte für die Geschichte der sozialen Arbeit, Christoph Sachße, die Zusammenhänge zusammen. Was im Ersten Weltkrieg dazu genutzt worden war, um Frauen zur Teilhabe am ‚Nationalen Werk‘ zu motivieren, das wollten Bähnisch und ihre Mitstreiterinnen in der zweiten Nachkriegszeit dazu verwenden, um Frauen vom Sinn ihrer Mitarbeit am Wiederaufbau von Staat und Gesellschaft zu überzeugen. Denise Tscharntke verweist darauf, daß das „concept of ‚spiritual‘ or ‚extended‘ motherhood“ nicht nur von deutschen, sondern auch von großen Frauenorganisationen in Großbritannien und anderen europäischen Ländern weiter entwickelt wurde.275 Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, daß den von der britischen Militärregierung beauftragten und von der WGPW delegierten Frauen, von denen an anderer Stelle die Rede sein wird, Bäh-
270 Vgl. dazu auch die Traditionsbewußtsein verkörpernde Homepage des Pestalozzi-FröbelHauses, auf: http://www.pfh-berlin.de/pestalozzi-froebel-haus/geschichte, am 14.01.2014. 271 Vgl. zur Entwicklung und zur Unterscheidung beider Konzepte: Allen, Ann Taylor: Feminismus und Mütterlichkeit in Deutschland, 1800–1914, Weinheim 2000. Vgl. auch: Kuhn, Bärbel: Familienstand ledig. Ehelose Frauen und Männer im Bürgertum (1850– 1914), Köln/Weimar/Wien 2002, S. 75–77. 272 Vgl. zur ‚Verstaatlichung der deutschen Frauenbewegung‘ im Ersten Weltkrieg auch Sachße: Mütterlichkeit, S.148–159. 273 Vgl.: Peters, Dietlinde: Mütterlichkeit im Kaiserreich, Bielefeld 1984, S. 453–485. 274 Sachße: Mütterlichkeit, S. 158. 275 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 161. Tscharntke nimmt Bezug auf Offen, Karin: European Feminisms, 1700–1950, Stanford 2000, S. 299.
Club deutscher Frauen | 597
nischs ‚Mütterlichkeits-Rhetorik‘ nicht aufstieß, sondern ihnen Anknüpfungspunkte bot, die aus ihrer eigenen Sozialisation resultierten.276 Auch die Umstände, unter denen Theanolte Bähnisch die deutschen Frauen dazu aufrief, ihre Kraft dem Wiederaufbau einer physisch und psychisch stark in Mitleidenschaft gezogenen Gesellschaft zu widmen, erinnerten an vergangene Zeiten, in denen das Land sich in einer ähnlichen Situation befunden hatte. Die Parallelen, welche die Rhetorik Bähnischs zu den Äußerungen Marianne Webers, der Grande Dame der bürgerlichen Frauenbewegung nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, aufweist, sind augenscheinlich: „Angesichts dieser Lage ergibt sich für die kultivierte Frau, der es, weil sie außerhalb des eigentlichen Daseinskampfes steht, möglich war, auch in diesen Jahren ihr geistiges Kapital zu erhalten, die besondere Aufgabe, den Wiederaufbau der Gesittung, die Gestaltung des unmittelbaren Daseins durch Liebe und Schönheit, durch Maß und Harmonie, durch Würde und Vornehmheit bewusst in die Hand zu nehmen“277, hatte Marianne Weber 1919 konstatiert und damit alle Frauen dazu aufgerufen, ihren ‚sittlichen Einfluß‘ auf die in den Schützengräben zermürbten Kulturgewohnheiten der Männer auszuüben. Daß Bähnisch 1946 ebenfalls auf einen solchen Einfluß engagierter Frauen auf die Gesellschaft hoffte – wenn ihr ‚Aufgabenpaket‘ für die Frauen auch größer war – darauf läßt unter anderem die Äußerung, der Club erstrebe eine „saubere moralische Haltung“278 schließen. Diese Aussage war in der Pressenotiz zwar speziell auf die Lage Jugendlicher gemünzt, weshalb sich Eltern Heranwachsender in besonderer Weise angesprochen gefühlt haben dürften. Doch auch für diesen Zusammenhang muß Berücksichtigung finden, was bereits im Kontext von Bähnischs Arbeit im ‚Club junger Menschen‘ augenfällig war: TabuThemen von gesamtgesellschaftlicher Tragweite waren einfacher anzusprechen, wenn sie als besondere Probleme Jugendlicher benannt wurden und ihre ‚Behandlung‘ – in diesem Fall also das Vorleben einer ‚sauberen moralischen Haltung‘ – als Aspekt des ‚Jugendschutzes‘ angesehen werden konnte.279 Schließlich nahm die Sicht auf Frauen als besonders friedfertige Wesen in allen Redebeiträgen auf der Kundgebung einen breiten Raum ein. Der Gedanke der Friedfertigkeit von Frauen war, anders als der der Mütterlichkeit, nicht so alt wie die bürgerliche Frauenbewegung selbst. Über einen langen Zeitraum war er lediglich im radikalen Flügel der Frauenbewegung präsent gewesen, der auch die von den Frauenverbänden mitorganisierte Kriegskrankenpflege kritisiert hatte. Der BDF hatte als Dachorganisation der bürgerlichen Frauenverbände in Deutschland zwar gesteigerten Wert auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit Frauen in anderen Ländern gelegt. „Jedoch bewerteten führende Aktivistinnen des Bundes Deutscher Frauenvereine die militärischen Interessen der eigenen Nation höher als Internationalismus und
276 Siehe dazu auch Kapitel 2.2.3.5. 277 Vgl.: Weber, Marianne: Die besonderen Kulturaufgaben der Frau, in: Dies. (Hrsg.): Frauenfragen und Frauengedanken, Gesammelte Aufsätze, Tübingen 1919, S. 238–261, hier S. 251, zuerst veröffentlicht in: Die Frau. Monatsschrift für das gesamte Frauenleben unserer Zeit 26 (1918/19), S. 108 ff. Vgl. dazu auch: Flemming: Frau. 278 BArch, NY 4229, Nr. 28, Wohin geht Dein Weg deutsche Frau. 279 Siehe dazu auch Kapitel 5.6.2.4.
598 | Theanolte Bähnisch
Pazifismus“280, beschreibt Ute Kätzel das Phänomen in ihrer Studie über die Frauenfriedensbewegung von 1899 bis 1933. Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg zeigten sich führende Vertreterinnen des gemäßigten Flügels selbstkritisch in Bezug auf ihre früheren Positionen und/oder ihre Ämter – der Friedens-Gedanke gewann an Raum in der bürgerlichen Frauenbewegung. Die Frauenfriedensbewegung erhielt stärkeren Zulauf, vor allem die ‚Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit‘ (IFFF) gewann an Einfluß unter den ‚Bürgerlichen‘. Die in der Frauenbewegung zunehmend beschworene ‚Friedfertigkeit‘ der Frauen schlug sich nach dem Ende des zweiten, wiederum verlorenen Weltkrieges in der Rhetorik Bähnischs nieder, wenn sie äußerte, daß Frauen „naturgemäss“281 friedfertig seien – und sie diese Friedfertigkeit an anderen Stellen wiederum mit dem Prinzip der ‚Mütterlichkeit‘ verknüpfte. Schon im Kaiserreich hatten Pazifistinnen argumentiert, daß Frauen, wenn sie nur das Wahlrecht hätten, ihren Einfluß nutzen würden, um eine friedliche Politik in Deutschland zu gewährleisten.282 Doch die Wahlergebnisse in der ausgehenden Weimarer Republik hatten diese Überzeugung Lügen gestraft – ein Umstand der von der Vize-Regierungspräsidentin zwar nicht komplett übergangen, aber doch stark geschönt wurde. Sie argumentierte, daß die weibliche Friedfertigkeit in Deutschland bisher nur deshalb keinen günstigen Einfluß habe nehmen können, weil Frauen unzureichend in Politik und Verwaltung vertreten gewesen seien. Es ließe sich zwar argumentieren, daß Bähnisch nicht in der Wahrnehmung des aktiven, sondern des passiven Wahlrechts durch Frauen den Schlüssel zur Veränderung sah, dies wäre jedoch eine Überinterpretation von Bähnischs Einstellung. Ihr Ansinnen war es, Frauen von der Mitschuld an den nationalsozialistischen Verbrechen freizusprechen und – Davies‘ Protokoll zufolge – aus der deutschen Geschichte eine Pflicht zur aktiven Mitarbeit der Frauen abzuleiten.283 Dies läßt sich als ein gewiefter Schachzug bewerten, wenn man bedenkt, daß eine solche Rhetorik – zumindest theoretisch – die Integration aller Frauen in das Aufbauprojekt ermöglichte. Keine Frau mußte sich nach jener Logik für die Vergangenheit ‚schuldig‘ fühlen, aber alle waren dazu aufgerufen, das neue Deutschland zu einem besseren Land zu aufzubauen. „You are all to help in the rebuilding of a new
280 Kätzel, Ute: Es waren nur wenige, doch der Staat fühlte sich bedroht... Frauenfriedensbewegung von 1899 bis 1933, in: Praxis Geschichte, Heft 3/97, S. 9–13, online-Version: Berghof Foundation, 2012, auf: http://www.friedenspaedagogik.de/service/unterrichts materialien/friedensbewegung/die_frauenfriedensbewegung_1899_bis_1933 281 Club deutscher Frauen, Protokoll der ersten Kundgebung. 282 Vgl.: Suttner, Bertha von: Die Waffen nieder, Dresden 1889. 283 Sie hatte, Davies‘ Protokoll zufolge, jedoch geäußert, daß der Nationalsozialismus nicht ohne die Frauen zustanden gekommen sei. NA, UK, FO 1050/1299, German Women’s Will to Unite, Report on the Inaugural Meeting of the „Club for German Women“ held in Hannover on 18th June 1946, Davies, 27 July [Juni!] 1946. Im deutschen Protokoll wird dies nicht erwähnt.
Club deutscher Frauen | 599
Germany“284, zitiert Davies das Schlußwort der Rede Bähnischs, die der Protokollantin zufolge insgesamt nur lauwarmen Applaus erhalten habe.285 6.5.3.4 Anna Mosolfs kulturkritische Analyse der Vergangenheit Was Anna Mosolf betraf, so lag der deutschen Protokollantin daran, zu betonen, daß ihre Rede „Kraft d totalen Persönlichkeit u großer Rednergabe d Sprecherin“ den „Höhepunkt” der Veranstaltung dargestellt und den „Eindruck eines künstlerischen Erlebnisses“ hinterlassen habe. Inhaltlich schloß sich Mosolf offenbar „nur im wahrsten Sinne des Wortes ‚gedichteter‘“ weitgehend ihrer Vorrednerin an. Ihre Rede von der „Unterlassungsschuld, uns nicht genügend gegen die Gewaltsamkeit angestemmt zu haben“286 zeigte jedoch, daß Mosolf den Frauen durchaus ‚Schuld‘ am Nationalsozialismus gab – auch wenn sie diese nur aus der angeblich zu großen Passivität der Frauen ableitete. „Women must take their share of the blame“287, zitiert Davies die Schulrätin Mosolf. Die Verbrechen beim Namen nennen wollte Mosolf offenbar nicht, mit dem Terminus „Gewaltsamkeit“288 fand sie eine eher zurückhaltende Formulierung für Krieg und Holocaust. Auch die Schulrätin ließ die Vergangenheit in ihrem Vortrag schnell hinter sich und konzentrierte sich stärker auf die Zukunft. „Wir wollen das Volk Luthers, Goethes und Mozarts bleiben“, nimmt Mosolf in einer Art auf die gern erinnerte Geschichte Deutschlands als Kulturnation Bezug, wie sie in der Zeitschrift, die sie gemeinsam mit Bähnisch herausgab, ebenfalls vorkam.289 Das Hochhalten insbesondere Goethes als Sinnbild für Humanismus und abendländische Tradition stand dem Kulturhistoriker Hermann Glaser zufolge für die Suche nach dem eigentlichen, dem „inneren Deutschland“, nachdem ein Deutschland im politischen Sinne nicht mehr vorhanden war.290 In Abkehr von der politisch-ideologischen Instrumentalisierung der nationalsozialistischen Erziehung habe man dieser nach Kriegsende ein Bildungskonzept entgegengestellt, dem die formende, prägende Kraft einer humanistischen Kultur zugrunde lag, so Glaser.291 Was dieser vor allem auf Schulen in Westdeutschland bezieht, das läßt sich auch für die ‚Erziehung‘ der Frauen durch die ‚Stimme der Frau‘ sowie durch die Arbeit des ‚Club deutscher Frauen‘ nachvollziehen. „[D]ie Erziehung zum Bürger eines demokratischen und sozialen Rechtsstaates“ sollte „auf der Grundlage des christlichen, abendländischen Kulturgutes und des deutschen Bil-
284 285 286 287
288 289 290 291
Ebd. Ebd. Club deutscher Frauen: Protokoll der ersten Kundgebung. NA, UK, FO 1050/1299, German Women’s Will to Unite, Report on the Inaugural Meeting of the „Club for German Women“ held in Hannover on 18th June 1946, Davies, 27 July [Juni!] 1946. Club deutscher Frauen: Protokoll der ersten Kundgebung. Vgl.: Freund: Krieg, S. 204. Vgl.: beispielsweise den Artikel: Vgl.: Denis: Frauen. Vgl.: Glaser, Hermann: Deutsche Kultur: Ein historischer Überblick von 1945 bis zur Gegenwart, 2. Aufl., Bonn 2000, S. 107–109. Vgl.: ebd., S. 73.
600 | Theanolte Bähnisch
dungserbes“ unter Bezugnahme auf die „westeuropäische Kulturgemeinschaft“292 von statten gehen.293 Den Kern des „heutigen Übel“ leitete die Schulrätin – auch diese Argumentationslinie findet sich in der ‚Stimme der Frau‘ wieder – aus der „mißbrauchten Technik“ und der „Jagd nach immer neuen Errungenschaften“294 ab. Ein ‚ungeerdetes Fortschrittsstreben‘, so suggerierte die Zeitschrift, könne jederzeit außer Kontrolle geraten und zerstörerische Kräfte entfalten.295 Mit der Fokussierung auf die gefährlichen Aspekte von Technik hatte insbesondere die Physikerin und Politikerin Freda Wuesthoff in den direkten Nachkriegsjahren einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Auf diversen Veranstaltungen, auch solchen, die von Bähnisch (und Mosolf) initiiert wurden, hatte sie zu den Gefahren der Kernenergie referiert. Die Schriftstellerin Ricarda Huch wiederum hatte in ihrem Werk ‚Entpersönlichung‘ 1921 ein Phänomen angeprangert, das, oft bezugnehmend auf die Werke Gustave le Bons und Ortega y Gassets296, als ‚Aufgehen des Einzelnen in der Masse‘ bezeichnet wurde. „Die Welt wurde antichristlich und antipersönlich, denn das ist ein und dasselbe, als sie die Verantwortung dem Einzelnen entzog und sie auf kleinere oder größere Massen verteilte“297, beschreibt Huch das von ihr beobachtete Phänomen. Mosolf vermischte in ihrer Rede bei der Auftaktveranstaltung des ‚Club deutscher Frauen‘ Freda Wüsthoffs und Ricarda Huchs Thesen – auf die Mosolf, wie sie selbst erklärte, Bezug nahm – zu einer Melange aus Technik- und Säkularisierungskritik. Wie Ingrid Laurien mit ihrer Analyse verschiedener kulturpolitischer Zeitschriften der Nachkriegszeit nachweist, handelte es sich dabei, auch wenn die Bezugnahmen verschieden waren, um ein verbreitetes Phänomen der Zeit.298 Die Verdammung des ‚Aufstandes der Massen‘ in den ausgehenden 1940er und frühen 1950er Jahren in Deutschland ist in einem klaren Zusammenhang mit der Suche nach den Wurzeln der ‚deutschen Katastrophe‘ (Friedrich Meinecke) zu sehen. Als totalitär, egalisierend, entindividualisie-
292 293 294 295
Ebd. Freund: Krieg, S. 204/205. Club deutscher Frauen: Protokoll der ersten Kundgebung. Vgl.: Wolf: Augen, S. 3 sowie o. V.: Vom Radar-Roastbeef zum Cocktail-Auto. Dieses Mal kein Aprilscherz, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 10, S. 9. 296 Vgl. jeweils die deutschsprachige Ausgaben: Bon, Gustave le: Psychologie der Massen, [Stuttgart 1911], 15. Auflage, Stuttgart 1982; Ortega y Gasset, José: Der Aufstand der Massen, [Stuttgart 1931], Ulm 1997. Axel Schildt zufolge war der spanische Philosoph Ortega y Gasset der meistgelesene Philosoph in (West-)Deutschland zwischen 1930 und 1960. Der Höhepunkt seiner Rezeption habe in den 50er Jahren gelegen. Vgl.: Schildt: Zeiten, S. 327. 297 Ricarda Huch: Entpersönlichung, 1921, zitiert nach Roser, Traugott: Protestantismus und Soziale Marktwirtschaft. Eine Studie am Beispiel Franz Böhms, Münster 1998, S. 31. Böhm war Huchs Schwiegersohn. Er hatte Kontakt zu Ernst von Harnack und anderen Protagonisten des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. 298 Vgl.: Laurien: Zeitschriften, S. 148–168. Vgl. zum Gehalt jener Rhetorik als Kritik nicht nur am Nationalsozialismus, sondern auch am Kommunismus: Freund: Krieg, S. 187– 200.
Club deutscher Frauen | 601
rend und als Ergebnis des Irrwegs der Säkularisierung des Abendlandes299 wurde der Nationalsozialismus in vielen kulturpolitischen Zeitschriften der Nachkriegszeit charakterisiert.300 Indem die Rednerin die beschriebene Darstellung Ricarda Huchs rezipierte, fand sie eine Möglichkeit dazu, indirekt und für die Anwesenden wenig Anstoß erregend, den ‚Führerstaat‘ und sein Gefolge zu kritisieren. Denn es lag nah, den Begriff ‚Entpersönlichung‘ als eine allgemeine Entwicklung zu verstehen, der sich der Einzelne nur schwer entziehen kann – was wiederum als ein Zustand ‚verminderter Schuldfähigkeit‘ gedeutet werden konnte. Gleichzeitig legte Mosolf ihren Zuhörerinnen mit der Bezugnahme auf Huch nah, einen Gegentrend zur ‚Entpersönlichung‘ einzuleiten und sich ihrer ‚Individualverantwortung‘ bewußt zu werden. Die Brücke zu den Ausführungen ihrer Vorrednerin schlagend, beschrieb Mosolf die „elementare Aufgabe der Frau-Mutter“ aus ihrer Sicht, nämlich „Hüterin der Menschheit u d (!) Menschlichkeit, im klassischen Zeitalter, Humanität genannt, zu sein, sich schirmend und schützend vor die Menschenrechte und Lebensrechte zu stellen, sich gegen den Einfluß roher, Verderben und Zerstörung bringender Kräfte zu stemmen.“ Die Chance für Frauen, ihre bisherige ‚Nichtbeteiligung‘ an der Politik wiedergutzumachen, sah die Schulrätin also in der Orientierung an der Geschichte Deutschlands als Land humanistischer Dichter und Denker, ein Topos, der freilich auch fernab der bürgerlichen Frauenbewegung in den ersten Nachkriegsjahren häufig bemüht wurde.301 Auch die zweite Rednerin auf der Veranstaltung knüpfte also an die Vorstellung von der ‚friedlichen Frau‘ an und verknüpfte diese im gleichen Atemzug mit deren ‚Mütterlichkeit‘. Diesen Zusammenhang hatten nicht nur Protagonistinnen des radikalen Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung wie Anita Augspurg und Lida Gustava-Heynemann beschworen und mit einer Kritik am ‚Patriarchat‘ verbunden. Auch
299 Der Begriff ‚Abendland‘ wurde Axel Schildt zufolge vor Beginn des 19. Jahrhunderts für das ganze christliche Europa gegen die ‚Heiden‘ bzw. gegen den arabischen und türkischen Islam verwendet. Mit Friedrich Schlegels ‚Philosophie der Geschichte‘ habe sich die Begrifflichkeit gewendet, fortan wurde unter dem Begriff der Westen Europas, meist unter Ausschluß der slawischen Völker verstanden. Vgl.: Schildt, Axel: Zwischen Abendland und Amerika. Studien zur westdeutschen Ideenlandschaft der 50er Jahre, München 1999, S. 24. Die Beschwörung des ‚abendländischen Kulturverfalls‘ in den Feuilletons begann nicht erst mit Oswald Spenglers ‚Untergang des Abendlandes‘, wurde durch diesen jedoch erfolgreich verbreitet. Vgl.: ebd. Ingrid Laurien beschreibt die Verwendung des Begriffs ‚Abendland‘ durch die Autoren in deutschen kulturpolitischen Zeitschriften der Nachkriegszeit als geprägt durch die angenommene kulturelle Einheit des Abendlandes aus der Verschmelzung der Komponenten Antike, Christentum sowie dem germanischen und romanischen Europa. Vgl.: Laurien: Zeitschriften, S. 195. Sowohl Schildt als auch Laurien sehen die Verwendung des Begriffs im medio-politischen Diskurs der Nachkriegszeit als gegen den ‚Bolschewismus‘ gerichtet, an. Vgl.: Laurien: Zeitschriften, S. 199, sowie Schildt: Abendland, S. 34. 300 Vgl.: Laurien: Zeitschriften, S. 148–168. 301 Vgl.: Glaser: Kultur, S. 107–109.
602 | Theanolte Bähnisch
Sozialistinnen wie Clara Zetkin hatten erklärt, daß die Mutterrolle Frauen für den Kampf gegen den Krieg geradezu prädestiniere.302 Kritische Stimmen, wie die Minna Cauers und Bertha von Suttners, die sich innerhalb der Frauenbewegung pionierhaft gegen das Klischee der ‚friedfertigen Frau‘ gestellt hatten303, waren ihrerzeit weitgehend ungehört verhallt und wurden auch nach 1945 nicht breitenwirksam rezipiert. Die Schulrätin konnte deshalb auf eine breite Zustimmung zu ihren Worten hoffen, gleich welcher politischen Überzeugung die Zuhörerinnen anhingen. Bemerkenswert ist, daß sie den anwesenden Frauen schließlich die Verantwortung dafür übertrug, zur „Pflege eines gesunden nationalen Stolzes“304 beizutragen. „Germanys name must be raised from the mud“305, gibt die Protokollantin und Mitarbeiterin der britischen Militärregierung Edith Davies Mosolfs Ausführungen wieder und betont, wie zur Entschuldigung, daß Mosolf die Möglichkeit, dies zu erreichen, erklärtermaßen im Zusammenschluß mit Frauenorganisationen in anderen Ländern sehe. Mosolfs Rede, so Davies, sei insgesamt beifälliger aufgenommen worden, als die Bähnischs. Das deutsche Protokoll beinhaltet keinen derartigen Kommentar. Doch dürfte die Vorstellung, daß ihre Heimat in nicht allzu ferner Zukunft wieder ein wohlgelittener Verhandlungspartner anderer Länder sein könnte und ‚Deutschland‘ nicht für alle Zeiten ein Schimpfwort bleiben würde, verheißungsvoll auf die Zuhörerinnen gewirkt haben. Daß die Herausgeberinnen der ‚Stimme der Frau‘ mehrfach Beiträge veröffentlichten, die aufzeigen sollten, daß Deutschlands Ansehen im Ausland gestiegen sei306, unterstreicht die Wahrnehmung, daß sowohl Mosolf als auch Bähnisch eine positive Einstellung der Bürger zum eigenen Staat als einen zentralen Aspekt des Aufbauwillens werteten. 6.5.3.5 Elfriede Paul fordert die Abkehr vom Faschismus Elfriede Paul, die dritte und letzte Rednerin, fand, beiden Protokollen nach zu urteilen, „mit kühler Sachlichkeit“307 die deutlichsten Worte für die deutsche Vergangenheit und forderte dem Protokoll Davies‘ zufolge – und im Unterschied zu ihren Vorrednerinnen – explizit eine Abkehr vom „Faschismus“. Der Appell, der im deutschen Protokoll nicht erwähnt ist, war, Davies zufolge, mit Applaus honoriert wor-
302 303 304 305
Vgl.: Kätzel: Wenige. Vgl.: ebd. Club deutscher Frauen: Protokoll. NA, UK, FO 1050/1299, German Women’s Will to Unite, Report on the Inaugural Meeting of the „Club for German Women“ held in Hannover on 18th June 1946, Davies, 27 July [Juni!] 1946. 306 Vgl.: O. V.: Aus der Welt. Deutsche Literatur in Frankreich sehr gefragt, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 4, S. 29; Kaye, M.: Fünf neue Bücher, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 4, S. 24 sowie Weinschenk, Harry E.: Erna Sack sang für Deutschland, in: Stimme der Frau, 2. Jg., (1949/50), Heft 2, S. 17. 307 Club deutscher Frauen, Protokoll der ersten Kundgebung.
Club deutscher Frauen | 603
den.308 Von wem jener Applaus kam und ob die Mehrzahl oder nur wenige Frauen applaudiert hatten, schreibt Davies nicht. Auch das KPD-Mitglied Paul vertrat die Überzeugung, daß Männer und Frauen verschiedene Eigenarten hätten, auf die es aufzubauen gelte. Sie hielt – ein sehr ambitioniertes Ziel – fest, daß „überall dort, wo durch allzu grosse Verstandeseinstellung des Mannes Unglück angerichtet werden kann […] mindestens 50% Frauen in die Verwaltung des Staates gehörten.“309 Daß dies bisher nicht der Fall gewesen war, veranlaßte die bekennende Kommunistin – anders als Bähnisch und Mosolf – nicht zu einer kollektiven ‚Reinwaschung‘ aller deutschen Frauen. „She stressed the collective responsibility of German women as well as men for the war“310, notierte Davies und fügte hinzu, daß Pauls diesbezügliche Aussagen vom Publikum schweigend zur Kenntnis genommen worden seien. Die Differenzen zwischen den Geschlechtern betonte die Ärztin – dem Protokoll nach zu urteilen – sogar noch stärker als ihre Vorrednerinnen. Daß sie von der „allzu grossen Verstandeseinstellung“ der Männer sprach, läßt darauf schließen, daß sie dieser Vorstellung die Idee einer größeren Gefühlsorientierung von Frauen entgegensetzte. Damit knüpfte sie diskursiv an eine verbreitete Vorstellung an, die die ClubPräsidentin so nicht teilte. Für Bähnisch spielten ‚Verstand‘ und ‚Sachlichkeit‘ erklärtermaßen eine wichtige Rolle in politischen Entscheidungen.311 Daß sie Frauen eben nicht jene von Paul offenbar angenommene ‚Gefühlsorientierung‘ unterstellen wollte, sondern von „Menschlichkeit“312 sprach, wenn es ihr um ‚Empathiefähigkeit‘ ging, scheint politisches Kalkül gewesen zu sein. Die Interpretation, daß sich Bähnisch damit von der Signalwirkung des Begriffs ‚Gefühl‘ abgrenzen wollte, liegt nah – schließlich hatten sich Juristen auf dem vierten Richtertag 1921, mit der Begründung, Frauen seien in „weitestgehendem Maße Gefühlseinflüssen unterworfen […] welche ihre sachliche Auffassung beeinträchtigen“, dagegen ausgesprochen, Frauen zum Richteramt zuzulassen.“313 Gegen diese Interpretation spricht allerdings, wie Bähnisch selbst ihre Entscheidung gegen eine Karriere im Strafrecht und für die Verwaltungslaufbahn begründet hatte – vorausgesetzt, daß sie ihre Einsicht, einer solchen Arbeit emotional nicht standhalten zu können oder zu wollen, mit ihrem Ge-
308 NA, UK, FO 1050/1299, German Women’s Will to Unite, Report on the Inaugural Meeting of the „Club for German Women“ held in Hannover on 18th June 1946, Davies, 27 July [Juni!] 1946. 309 Club deutscher Frauen, Protokoll der ersten Kundgebung. 310 NA, UK, FO 1050/1299, German Women’s Will to Unite, Report on the Inaugural Meeting of the „Club for German Women“ held in Hannover on 18th June 1946, Davies, 27 July [Juni!] 1946. 311 Vgl. beispielsweise: O. V.: Schubfach. 312 Köhler: Frau. 313 Vgl.: Glaser, Edith/Herrmann, Ullrich: Konkurrenz und Dankbarkeit. Die ersten drei Jahrzehnte des Frauenstudiums im Spiegel von Lebenserinnerungen – am Beispiel der Universität Tübingen, in: Zeitschrift für Pädagogik, 34. Jg. (1988), Nr. 2, S. 205–226, hier S. 212.
604 | Theanolte Bähnisch
schlecht in Zusammenhang gebracht hatte. Explizit hatte sie dies nicht formuliert.314 Ihre Position, daß (auch) Frauen stets sachlich argumentieren müßten, scheint Theanolte Bähnisch erfolgreich in die Öffentlichkeit vermittelt haben, konstatierte doch Bischof Lilje anläßlich ihrer Pensionierung, sie habe „Sachlichkeit und Fraulichkeit […] glücklich verbinden können“.315 Elfriede Paul, die im Juli zur zweiten Vorsitzenden des Clubs deutscher Frauen316 und im August 1946 zur Ministerin für Aufbau, Arbeit und Wohlfahrt ernannt wurde, argumentierte also keinesfalls weniger traditionell als ihre Vorrednerinnen. Als sie am Ende ihrer Rede auf die praktischen Aspekte der Club-Arbeit zu sprechen kam, sprach die designierte Ministerin weitgehend Aspekte an, die als ‚traditionelle Frauenthemen‘ galten und sich unter die Begriffe ‚soziale Arbeit‘, ‚Erziehung‘ und ‚Gesundheit‘ subsumieren lassen. Auch im Rahmen einer Volkshochschultagung argumentierte die Ärztin mit der ‚weiblichen Eigenart‘, die Frauen für bestimmte, vor allem soziale Aufgaben, prädestiniere.317 Einem Bericht des Hannoverschen Kuriers zufolge wollte Paul im Club deutscher Frauen für die Einrichtung von Ausschüssen zu folgenden Themen sorgen: „Wohnungsfragen, Flüchtlingshilfe, Kampf gegen das Anstehen, Säuglings- und Kinderhilfe, Eheberatung im psychologischen und ärztlichen Sinne, Mutterschutz, eine neue Körpererziehung für Mädchen, Hilfe für die Frauen in den Fabriken, Arbeitsschutz, Hygiene des Arbeitsplatzes, Erziehungsfragen, Mitarbeit in Elternbeiräten, Neugestaltung der Schulen, Hinwendung der Jugend zu neuen Idealen und Wertungen, Mitarbeit in der Volkshochschule, Zusammenarbeit mit allen Friedensorganisationen, Beeinflussung der Gesetzgebung und Gründung einer Frauenzeitschrift.“318 Die Aspekte ‚Zusammenarbeit mit allen Friedensorganisationen‘, ‚Mitarbeit in der Volkshochschule‘ sowie ‚Beeinflussung der Gesetzgebung‘ und – mit Einschränkungen – auch ‚Gründung einer Frauenzeitschrift‘ waren Themen, in denen die politische Emanzipation von Frauen stärker im Vordergrund stand, als es bei den anderen angeschnittenen Themen der Fall war. Neu waren jedoch auch jene Inhalte für die bürgerliche Frauenbewegung nicht. Daß aufgrund der Mitarbeit der Kommunistin im Club deutscher Frauen also allgemein ein ‚frischer Wind‘ Einzug gehalten hätte, läßt sich nicht konstatieren. Allenfalls was den Umgang mit der jüngeren deutschen Vergangenheit betraf, positionierte sich Paul anders als ihre Vorrednerinnen. Edith Davies hielt es für erwähnenswert, daß es zur Idee der ‚Gründung einer Frauenzeitschrift‘ zustimmendes Gemurmel gegeben habe und daß das Publikum nicht applaudiert hatte, als Paul den Punkt ‚Flüchtlingshilfe‘ ansprach. Ob auch Flüchtlinge und/oder Ver-
314 Siehe Kapitel 2.2.2. 315 AddF, SP-01, Hanns Lilje an Theanolte Bähnisch, Badgastein, den 23.04.1964 (Nachlaß Theanolte Bähnisch, Kopie im Archiv der deutschen Frauenbewegung). 316 Materialsammlung Karin Ehrich zum ‚Club deutscher Frauen‘, Gründungsprotokoll, 03.07.1946. 317 Vgl.: Ziegler: Lernziel Demokratie, S. 99. 318 Eine Friedensfront der Frauen, in: Neuer Hannoverscher Kurier, 21.06.1946, abgedruckt in: Henicz/Hirschfeld: Club, S. 128/129.
Club deutscher Frauen | 605
triebene zur Veranstaltung erschienen waren, läßt sich auf der Grundlage der vorhandenen Quellen nicht nachvollziehen. Auffällig ist allerdings, zumal Paul sich später im Kreise jener bewegte, die Bähnischs Gründungen als ‚restaurativ‘ charakterisierten, daß das Wort ‚neu‘ in der Auflistung, welche Paul vorgelegt hatte, gleich dreimal vorgekommen war. Die mehrfache Verwendung dieses Begriffs kann als eine Abkehr von als falsch empfundenen Schwerpunktsetzungen, wie sie unter den Nationalsozialisten vorgenommen worden waren, interpretiert werden. 6.5.3.6 Trotz organisatorischen Desasters eine vielversprechende Veranstaltung? Die Kundgebung in der Nachlese Zusammenfassend läßt sich zu jener ersten Veranstaltung des Clubs sagen, daß sich nahezu jede Frau zumindest von einem der genannten Arbeitsschwerpunkte, vermutlich gar von mehreren angesprochen gefühlt haben dürfte. Denn die gewählten Themen waren nicht nur alltagsnah, sondern auch tagesaktuell. Daß an der Mitarbeit interessierte Frauen sich in Unterschriftenlisten eintragen sollten, war im Eifer des Gefechts allerdings untergegangen. Davies zufolge hatte Bähnisch mit dieser Bitte nur noch ein Viertel der Frauen erreichen können, weil der Großteil der Teilnehmerinnen das Gebäude bereits verlassen hatte, als sich die Regierungspräsidentin in spe an einen der Hauptzwecke der Veranstaltung, das Sammeln von Namen und Adressen interessierter Frauen, erinnerte. Die Mitarbeiterin der Militärregierung zeigte sich mit der Organisation der Veranstaltung, wie schon angedeutet, unzufrieden, zumal die Vize-Regierungspräsidentin Davies Meinung nach mit ihrer Rede die wichtigste Zielgruppe verfehlt habe. „I had the feeling, that there were very few housewives among the audience – these were probably cooking the evening meal.“319 Zudem kritisierte sie, daß es auf der Veranstaltung keinen Raum für Fragen der Teilnehmerinnen gegeben habe und daß kein Vorstand („officers of the club“320) gewählt worden war. Wenig erfreut zeigte sie sich schließlich darüber, daß Bähnisch sich in der Frage der Räumlichkeiten für Club-Versammlungen und der Bereitstellung von Papier für die angestrebte Herausgabe einer Frauenzeitschrift ganz auf die Militärregierung zu verlassen schien.321 Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Theanolte Bähnisch längst von Jeanne Gemmel oder einer anderen Mitarbeiterin der Militärregierung entsprechende Unterstützung zuge-sichert worden war – und daß Edith Davies davon schlichtweg nichts wußte. In der Pressemeldung, die Davies über die Veranstaltung aufsetzte, ist nichts von der Kritik zu lesen, die ihr Protokoll enthält. Im Zentrum der Meldung steht das positive, fast schon romantisierende und damit doch sehr überraschende Fazit der Veranstaltung. „I came away feeling distincly heartened. I had found evidence, that
319 NA, UK, FO 1050/1299, German Women’s Will to Unite, Report on the Inaugural Meeting of the „Club for German Women“ held in Hannover on 18th June 1946 von E. S. Davies, 27 July [Juni!] 1946. 320 Ebd. 321 Diesen Umstand bezeichnet Davies stichwortartig als „Reliance on Mil Gov to do the hack work“, S. 159.
606 | Theanolte Bähnisch
German women who were fitted and eager, to shoulder the tasks which lay ahead, and to take their place, side by side with the men, in the rebuilding of a new Germany“ 322, lautete die Quintessenz des Protokolls, die in die Pressemeldung übernommen wurde – so daß die Veranstaltung unter besatzungspolitischen Gesichtspunkten nach außen als ein voller Erfolg erschienen sein muß – zumal dort, wie die Meldung ebenfalls verbreitete – dem Faschismus unter lautem Beifall der Kampf angesagt worden sei.323 Die Strategie hinter diesem zunächst merkwürdig anmutenden Umstand zu deuten, fällt nicht schwer: Publik gemacht werden sollte von Seiten der Militärregierung der Umstand, daß sich etwas bewegt in Sachen Frauenpolitik und das Geschehene sollte positiv bewertet werden, damit weitere Frauen von dem Zusammenschluß angesprochen würden. Daß sich die von Bähnisch, Mosolf und Paul begonnene und von der Militärregierung werbewirksam geförderte Arbeit in Zukunft stärker an demokratischen Spielregeln orientieren würde, blieb zu hoffen. Von ‚Bildung‘ oder gar von ‚Demokratie‘ war – den Protokollen nach zu urteilen – auf der Veranstaltung des Clubs, der einen Beitrag zur ‚Frauen-Re-education‘ leisten sollte und wollte, nicht die Rede. Dabei von einer Nachlässigkeit auszugehen, wäre jedoch falsch. Schließlich glaubten weder die designierte Club-Präsidentin Bähnisch noch die Militärregierung daran, Frauen mit einem dezidiert bildungspolitischen Programm für die Arbeit im Club einnehmen zu können. Das konsequente Beschweigen der Themen ‚Bildung‘ und ‚Demokratie‘ durch die Rednerinnen darf deshalb als wohlüberlegt gelten. 6.5.4 Club-Gründung und Gründungsvorstand Im Rahmen einer Zusammenkunft im kleinen Kreis am 03.07.1946 um 16:30 Uhr im Regierungsgebäude wurde schließlich nachgeholt, was auf der Veranstaltung in der Stadthalle zwei Wochen zuvor vergessen worden war: die Wahl eines Vorstands und die damit erst möglich gewordene offizielle Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘. Laut Gründungsprotokoll hatten sich hierzu 14 Personen zusammengefunden324 und „in einer allgemeinen Aussprache“325 sechs Club-Ziele herausgestellt. Da diese Ziele bereits auf der Einladung zur ersten Kundgebung erschienen waren326, erscheint es
322 NA, UK, FO 1050/1299, Pressebericht: German Women’s Will to Unite, Report on the Inaugural Meeting of the „Club for German Women“ held in Hannover on 18th June 1946 von E. S. Davies, 27 July [Juni!] 1946. Der Report wurde mit einem Schreiben vom 27.06.1946 als Pressemeldung an die Press Section der PRISC geschickt. 323 Ebd. 324 Henicz und Hirschfeld geben, auf der Basis der Interviews, die sie mit Zeitzeugen geführt hatten, an, es seien etwa 15 Frauen zusammengekommen. Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Club, S. 129. 325 Materialsammlung Karin Ehrich zum ‚Club deutscher Frauen‘, Gründungsprotokoll, 3.7.1946. 326 Neuer Hannoverscher Kurier, 07.06.1946, Abschrift in: Kuhn: (Hrsg.) Nachkriegszeit, Bd. 2, S. 224.
Club deutscher Frauen | 607
jedoch fraglich, ob die überlieferte Version der Zielfindung den Realitäten entspricht. Denkbar ist auch, daß die Haupt-Initiatorinnen des Clubs die bereits feststehenden Ziele verkündet und die anderen anwesenden Personen akklamiert hatten. Mit der Wahl eines Namens für den Zusammenschluß mag es sich ähnlich verhalten haben. „Wir nannten uns damals Club, um die große Intimität dieses Kreises und unserer Zusammengehörigkeit zu betonen“327, schrieb Bähnisch in einem Aufsatz. Im Anschluß an die Definition der Ziele war laut Protokoll ein Vorstand gewählt worden, der sich wie folgt zusammensetzte: Erste Vorsitzende des Clubs wurde Theanolte Bähnisch, ihre Stellvertreterin die Ärztin Dr. Elfriede Paul. Ella Ellinghaus, die Ehefrau des zu dieser Zeit noch amtierenden Regierungspräsidenten Wilhelm Ellinghaus328, der wie Albrecht Bähnisch 1933 seines Amtes enthoben worden war, war zur Schriftführerin gewählt worden. Die stellvertretende Schriftführerin, Mathilde Drechsler-Hohlt, hatte sich bereits in den 1920er Jahren mit Themen der weiblichen Emanzipation auseinandergesetzt. Sie war zu dieser Zeit Mitglied der DVP, des BDF, der ‚Gemeinschaft Deutscher und Oesterreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen‘ (GEDOK), des Deutsch-Evangelischen Frauenbundes (DEF) sowie bis 1931 Vorsitzende des Staatsbürgerinnenverbandes in Hannover gewesen.329 Schatzmeisterin des Clubs wurde die Haushaltswissenschaftlerin Dr.
327 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 163. 328 Daß Ella Ellinghaus die Ehefrau von Wilhelm Ellinghaus war, ist einer Auskunft der Landeshauptstadt Hannover zu entnehmen. Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Recht und Ordnung an Nadine Freund, 01.08.2012. Über Ella Ellinghaus ist auch dort weiter nichts bekannt. Wilhelm Ellinghaus war ein Jahr vor Albrecht Bähnisch zum Landrat (SPD) ernannt worden. Sein Amt übte er in Angerburg (Ostpreußen) aus. 1930 wurde er Regierungspräsident in Gumbinen. Bis 1945 war er in Hannover als Rechtsanwalt tätig, im gleichen Jahr wurde er von der britischen Militärregierung zum Regierungspräsidenten bestellt. 1946 wurde er dann zunächst zum Generalinspekteur für Entnazifizierung, anschließend zum niedersächsischen Justizminister ernannt. Vgl.: Art. „Wilhelm Ellinghaus“, in: Internationales Biographisches Archiv 42/1961, auf: Munzinger Online/Personen: http://www.munzinger.de/document/00000004771, am 13.12.2013. 1951 wurde Ellinghaus Richter am Bundesverfassungsgericht, 1952 verzog die Familie nach Karlsruhe. Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Recht und Ordnung an Nadine Freund, 01.08.2012. 329 Vgl.: Drechsler-Hohlt, Mathilde: Betrachtungen zu einer staatsbürgerlichen Schulungswoche für Frauen, in: Die Frau, 36 Jg. (1929), S. 603–697 sowie Reagin, Nancy Ruth: A German Women’s Movement: Class and Gender in Hanover, 1880–1933, Chapel Hill, 1995, S. 242/243 und dies.: Die bürgerliche Frauenbewegung vor 1933, in: Schröder, Christiane/Sonneck, Monika (Hrsg.): Außer Haus. Frauengeschichte in Hannover, Hannover 1994, S. 137–146, insb. S. 141. Drechsler-Hohlt wurde im Staatsbürgerinnenverband, nachdem der Vorsitz längere Zeit vakant gewesen war, 1932 von der Nationalsozialistin Maya Hering-Hessel ersetzt. Diese machte Karriere in der NS-Frauenschaft. Vgl.: Reagin: Movement, S. 243. Zu Drechslers Mitgliedschaft im DeutschEvangelischen Frauenbund vgl.: Müller, Paula: Zwanzig Jahre Deutsch-Evangelischer
608 | The anolte Bähnisch
Martha Bode-Schwandt330. Vertreten wurde Bode-Schwandt in ihrem Amt durch die Pädagogin Anna Mosolf. Zu den Gründungsmitgliedern des Zusammenschlusses zählten neben den beschriebenen Vorstandsmitgliedern und der ebenfalls bereits eingeführten Käthe Feuerstack auch die Volkswirtin Dr. Dorothea Karsten331, die in Hannover vier Monate nach Kriegsende den ‚Verband der Frauen in sozialen Berufen‘ gegründet hatte.332 Diesem gehörte wiederum die Leiterin der Frauenarbeit im niedersächsischen DRK, Freifrau von Knigge an. Bis 1933 hatte Karsten als Fürsorgerin, zuletzt im Reichsarbeitsministerium als Hilfsreferentin gearbeitet. Zur Zeit der Club-Gründung war sie Frauenreferentin im niedersächsischen Landesarbeitsamt. Ab 1950 sollte sie schließlich als Ministerialrätin das Frauenreferat im Bundesinnenministerium aufbauen und dieses leiten.333 Weitere Gründungsmitglieder des Clubs waren die Regierungsrätin für Flüchtlings- und soziale Fragen im Ministerium für Arbeit und Wiederaufbau, Heidi Hof-
330
331
332
333
Frauenbund, Berlin 1919, S. 21. Demnach war Drechsler 1919 Schriftführerin des Verbands. Bode-Schwandt wird von Ruth Oldenziel und Karin Zachmann als „home economist“ bezeichnet. Oldenziel, Ruth/Zachmann, Karin: Cold War Kitchen, Americanization, Technology and European users, London 2009, S. 34. In der Literaturliste nennen Oldenziel und Zachmann folgenden Titel: Bode-Schwandt, Martha: Zeitgemässes Wohnen mit den Augen der Hausfrau gesehen, in: Hoff, August (Hrsg.): Werkbundausstellung Neues Wohnen. Deutsche Architektur seit 1945, Köln 1949. Zahlreiche Literaturtitel BodeSchwandts, die sich mit der Verwendung von Kunstoffen im Haushalt auseinandersetzen, legen nah, daß Bode-Schwandt eine Art frühe Kunststoffingenieurin gewesen war. Vgl.: Bode-Schwandt, Martha: Wunschkinder der Hausfrauen, in: Die Zeit, 18.12.1952 sowie dies.: Die Hausfrau will unterrichtet werden. Kunststoffe im Dienste der Hausfrau – Haushaltsgeräte und Gebrauchsartikel, in: Barth von Wehrenalp, Erwin/Sechtling, Hansjürgen (Hrsg.): Das Jahrhundert der Kunststoffe in Wort und Bild. Ein Bildwerk in vier Sprachen, Düsseldorf 1952, S. 71–73. Karsten war am 10.03.1902 in Gnoien (Mecklenburg) geboren, hatte Volkswirtschaft an der Universität Rostock studiert und war dort zum Dr. rer. pol. promoviert worden. Bis sie 1933 entlassen wurde, war sie als Fürsorgerin in Waren (Mecklenburg) tätig gewesen. Anschließend wurde sie Schriftleiterin der Zeitschrift ‚Soziale Praxis‘ in Berlin. In der Hauptstadt arbeitete sie in der Berufsberatung und Arbeitsverwaltung, zuletzt als Hilfsreferentin im Reichsarbeitsministerium. 1945 wurde sie Referentin für Frauenfragen im Landesarbeitsamt Niedersachsen in Hannover. Vgl.: Art. „Karsten, Dorothea“, in: Internationales Biographisches Archiv 06/1956, auf: Munzinger Online/Personen: http://www.munzinger.de/document/00000007006, am 13.12.2013. Der Verband wurde im September 1946 gegründet. Vgl.: DFR-Archiv, Freiburg, A3, Verband der Frauen in sozialen Berufen an die hauptamtlich sozial berufstätigen Frauen, Dozentinnen der sozialen Fachschulen, Praktikantinnen in sozialen Berufen und Schülerinnen der sozialen Fachschulen Hannover-Region, September 1946. Dabei vermittelte sie unter anderem den Kontakt von Frauenorganisationen zur Regierung, arbeitete Stellungnahmen zu Gesetzesvorlagen aus und hielt die Verbindung zu den Frauenreferaten in anderen Ministerien. Siehe Kapitel 8.5.2. und 8.5.4.
Club deutscher Frauen | 609
stätter, die Ärztin Dr. Ursula Schmidt, die Fürsorgerinnen Friede Rothig und Agnes Haase, die als Oberfürsorgerin beim Jugendamt der Stadt Hannover tätig war, sowie eine Lehrerin.334 Denise Tscharntke zufolge leiteten die Mitglieder des Führungs-Komitees, das neben dem Vorstand noch weitere Personen umfaßte, auch die Arbeitsausschüsse, die der Club gründete.335 Tscharntke zufolge war das Komitee nicht gewählt, sondern von Bähnisch ernannt worden.336 Das professionelle Potential, welches sich im Club versammelte, beeindruckt: Alle Gründungsmitglieder waren Akademikerinnen, vier von ihnen waren promoviert, ein Mitglied, das jedoch erst später eine wichtige Stellung in der Nachfolgeorganisation des Clubs deutscher Frauen einnehmen sollte, nämlich Katharina Petersen, war sogar Professorin. Was die soziale und berufliche Zusammensetzung anging, knüpfte Bähnisch mit dem Vorstand des Clubs deutscher Frauen an die Klientel der Soroptimistinnen an. Arbeiterinnen oder Hausfrauen waren im Club-Vorstand nicht vertreten. Interessant ist, daß nicht nur Drechsler-Hohlt, sondern auch die Fürsorgerin Rothig bereits vor 1933 zum Deutsch-Evangelischen Frauenbund (DEF) gehört hatten. Rothig war 1914 beim DEF als Pressesekretärin angestellt gewesen,337 1916 war ihr die Schriftleitung für ‚Werden und Wirken‘, das Organ der Jugendgruppen des DEF übertragen worden.338 Die Schatzmeisterin des Clubs, Bode-Schwandt, fühlte sich dem Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) verbunden.339 Wie später auf zonaler und schließlich auf bundesweiter Ebene, arbeiteten die Frauen der ‚mittleren Generation‘ – also die Führungsspitze Bähnisch, Mosolf und
334 Die Club-Mitglieder Heidi Hofstaetter und Agnes Haase gehörten laut einer Notiz Bähnischs auch dem ‚Verband der Frauen in sozialen Berufen‘ an. DFR-Archiv, A3, Notizen Theanolte Bähnischs, o. D. [1946] zum Verband der Frauen in sozialen Berufen. Andere Mitglieder des Verbands waren die Leiterin der sozialen Frauenarbeit des DRK in Niedersachsen, Sophie Louise von Knigge, die Oberinspektorin Erna Kube vom Landesarbeitsamt sowie die Oberfürsorgerin am Sozialamt der Stadt Hannover Louise Schaper. 335 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 162. 336 Vgl.: ebd. 337 Vgl.: O. V.: Chronologische Darstellung der Entwicklung des Deutsch-Evangelischen Frauenbundes, in: Hefte zur Frauenfrage, Nr. 21 (1919) S. 29–38, hier S. 35. 338 Vgl.: O. V.: Übersicht der evangelischen Jugendgruppenbewegung, in: Hefte zur Frauenfrage, 11. Jg. (1919), S. 68–70, hier S. 69. Rothig gab ‚Werden und Wirken‘, das bis 1936 erschien, bis 1919 heraus. (Angabe aus dem Katalog des AddF, Kassel zur Zeitschrift ‚Werden und Wirken‘). 339 Vgl.: AddF, K-F1/00235. Das Photo, dessen Original im Archiv des KDFB in Köln als Bild Nr. F1-00235 überliefert ist, zeigt Mitglieder des KDFB auf der 13. Generalversammlung des Verbands in Bonn 1952. Mit auf dem Bild ist auch eine als BodeSchwandt gekennzeichnete Frau. Einer Auskunft des KDFB-Archivs zufolge war BodeSchwandt vermutlich kein Mitglied des KDFB, sie arbeitete jedoch eng mit der Hausfrauenvereinigung im KDFB zusammen. KDFB-Archiv, Jutta Müther an Nadine Freund, 27.07.2012.
610 | Theanolte Bähnisch
Paul – im Club mit Frauen zusammen, die bereits auf ein längeres Engagement in der bürgerlichen und/oder konfessionellen Frauenbewegung zurückblicken konnten. Drechsler-Hohlt und Rothig waren schon so früh in die aktive Arbeit des DEF involviert gewesen, daß sie deutlich älter gewesen sein mußten, als Bähnisch. Käthe Feuerstack (geboren 1886) und Katharina Petersen (geboren 1889) bildeten eine ‚Zwischengeneration‘ zwischen Drechsler-Hohlt und Rothig auf der einen sowie den nach 1895 geborenen Frauen Mosolf, Bähnisch und Paul auf der anderen Seite. In der Zusammenarbeit mit den älteren Frauen deutete sich bereits 1946 jener von Bähnisch später beschworene ‚Brückenschlag‘ zwischen den Generationen340 und damit zu den Protagonistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung aus der Weimarer Republik an, der sich schließlich in der Gründung des DFR manifestieren sollte.341 Daß die Fürsorgerin Rothig im Club deutscher Frauen organisiert war, bedeutete eine weitere Kontinuität in Bähnischs Biographie: Als Fürsorgerin war Rothig nämlich bereits in den 1920er Jahren im Polizeiwesen engagiert gewesen. Sie hatte zu jener Zeit, als Bähnisch sich wissenschaftlich mit dem Thema ‚Frauen in der Polizei‘ auseinandersetzte, praktische Arbeit bei der weiblichen Polizei geleistet.342 1949 bis 1952 engagierte sie sich im sozialpolitischen Ausschuß des DFR, sie war also an der ‚Ausdehnung‘ des Clubs deutscher Frauen hin zum Deutschen Frauenring mit beteiligt.343 Womöglich hatte sie Bähnisch bei der Zusammenstellung der Unterlagen über Frauen im Polizeidienst unterstützt, welche die Regierungspräsidentin mit auf ihre Reise nach Großbritannien nahm.344 Für die Interessen des Clubs dürfte es sich förderlich ausgewirkt haben, daß Frauen, die, wie Drechsler-Hohlt und Rothig, in der Region heimisch waren, sich in dem Zusammenschluß mit solchen mischten, die, wie Paul und Bähnisch, erst nach Kriegsende zugezogen waren. Diese Zusammensetzung war gut dazu geeignet, den Club als etwas Neues zu präsentieren, das jedoch auch vertraute Komponenten in sich trug. Zum anderen dürfte es für die Mitglieder-Akquise sowie für das Knüpfen von Kontakten im Allgemeinen von Vorteil gewesen sein, daß einige Frauen aus dem Vorstand bereits lange in der Stadt gelebt hatten und sich entsprechend gut auskannten. Die zugezogenen Frauen verfügten wiederum über andere wertvolle Kontakte und Erfahrungen.
340 Nicht von allen Vorstands-Mitgliedern ließen sich Geburtsdaten ermitteln, doch deuten die bekannten Daten darauf hin, daß Frauen, die deutlich jünger waren als Bähnisch, Paul und Mosolf, im Vorstand fehlten. 341 Siehe vor allem Kapitel 8.3.2 und 8.3.4. 342 Vgl.: Rothig, Friede: Tagung der Fachgruppe der Fürsorgerinnen an Polizei- und Pflegeämtern des deutschen Verbandes der Sozialbeamtinnen, Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt (ZJRJW), 16. Jg. (1925), S. 262–263. 1919 hatte sich Rothig bereits zum Thema evangelische Jugendbewegung verbreitet. Vgl.: Rothig, Friede: Was heißt evangelische Jugendbewegung, Berlin 1919. 343 Vgl.: Deutscher Frauenring/Ehrlich, Eva/Borgmann, Grete (Hrsg.): Protokoll des Deutschen Frauenkongresses in Bad Pyrmont am 08. und 09. Oktober 1949, Gießen 1973. 344 DFR-Archiv, A3 [Materialien für eine Englandreise].
Club deutscher Frauen | 611
Daß viele der Club-Mitglieder in Behörden tätig waren, gewährleistete jene enge Verbindung des Clubs zur Verwaltung, die Bähnisch in ihrer Rede angesprochen hatte. Aufgrund der (leitenden) Mitgliedschaft diverser Vorstandsmitglieder in anderen Verbänden konnte ein enger Austausch mit diesen Verbänden sichergestellt werden. Die Amtsdauer des Vorstands wurde 1946 zunächst auf zwei Jahre festgelegt. Laut Satzung konnte er mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit wiedergewählt, aber auch widerrufen werden.345 Als Organe des Clubs definierte die Satzung den Vorstand, der „höchstens 19 Mitglieder“ umfassen sollte, sowie die Mitgliederversammlung. Zur Durchführung einzelner praktischer Aufgaben und zu seiner Beratung war die Bestellung von Arbeitsausschüssen und Beiräten durch den Vorstand vorgesehen. Beschlußfähigkeit war bei Anwesenheit von mindestens zwölf Vorstandsmitgliedern gegeben. Mitgliederversammlungen sollten mindestens zweimal pro Jahr stattfinden. Als Mitgliedsbeitrag wurden drei Reichsmark pro Jahr – zahlbar in monatlichen Raten zu je 0,25 RM – festgesetzt, auf Antrag konnte die Gebühr ermäßigt oder gar erlassen werden. Die Mitgliedschaft stand prinzipiell jeder Frau ab 18 Jahren, die sich zu den Zielen des Clubs bekannte, offen. Jedoch enthielt die Satzung den Zusatz, daß der Vorstand über die Aufnahme von Mitgliedern entscheide und daß er berechtigt sei, Mitglieder auszuschließen. Ausschlußgründe konnten „grober Verstoss gegen die Ziele des Clubs“ oder „unwürdiges Verhalten“346 sein. Aufgrund der für die Anfangszeit schlechten Überlieferungslage ist von einigen Frauen nicht klar, wie stark und wie lange sie sich jeweils im Club engagierten. Ella Ellinghaus verzog 1952 mit ihrem Mann nach Karlsruhe347, sie dürfte spätestens damit ihre Aktivitäten im Club niedergelegt haben. Anna Mosolf blieb nicht nur als Mitherausgeberin der ‚Stimme der Frau‘ an Bähnischs Seite, sondern sie übernahm auch immer wieder wichtige Ämter im Frauenring, der bald aus dem Club entstehen sollte. Ähnliches galt für Dorothea Karsten. Friede Rothig wurde, wie erwähnt, 1949 Leiterin des Sozialausschusses im DFR. Martha Bode-Schwandt leitete in den 50er Jahren das hauswirtschaftliche Referat im Bundeswirtschaftsministerium348 und muß zumindest insofern mit dem Frauenring zusammengearbeitet haben. Katharina Petersen übernahm 1949 die Leitung des Landesverbandes des DFR Niedersachsen. Laut Vereinsregister veränderte sich die Satzung des Clubs, der zu diesem Zeitpunkt bereits in ‚Frauenring Hannover‘ umbenannt worden war, 1952.349 Den Vorsitz
345 Materialsammlung Karin Ehrich zum ‚Club deutscher Frauen‘, Club deutscher Frauen Hannover, Satzung o. D. [1946]. 346 Ebd. 347 Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Recht und Ordnung an Nadine Freund, 01.08.2012. 348 Auskunft des KDFB-Archivs, Jutta Müther an Nadine Freund, 27.07.2012. Vgl. auch: Oesterreich, Christopher: „gute form“ im wiederaufbau. Zur Geschichte der Produktgestaltung in Westdeutschland nach 1945, Berlin 2000, S. 284, Anm. 112. 349 Materialsammlung Karin Ehrich zum ‚Club deutscher Frauen‘, Amtsgericht Hannover, Vereinsregisterauszug, Nr. 98. Wann die offizielle Umbenennung im Vereinsregister erfolgte, ist nicht klar. Für den Alltagsgebrauch wird eine Umbenennung wahrscheinlich im
612 | Theanolte Bähnisch
hatte zu jener Zeit Gerda Landsberger inne. Sie war jahrelang Vorsitzende der CDUFrauen in Hannover-Stadt gewesen und wurde noch 1968 zur Stellvertreterin der Frauenvereinigung im Landesverband der CDU gewählt.350 Als Kassenführerin des Frauenrings Hannover war 1952 Grete Brennecke gewählt worden, das Amt der Schriftführerin hatte Dr. Gertrud Jäckl übernommen. Die Popularität jener späteren Führungsspitze des ‚Club deutscher Frauen‘ beziehungsweise des ‚Frauenring Hannover‘ ist nicht mit der jener Frauen vergleichbar, die 1946 in den Vorstand gewählt worden und teilweise zwischenzeitlich ausgeschieden waren, teilweise aber auch die Geschicke des Verbands auf übergeordneten Organisationsstufen leiteten. Anna Mosolf beispielsweise war bereits im Juni 1948 stellvertretende Vorsitzende des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ geworden, so hieß der zonenweite Zusammenschluß, den Bähnisch später leitete. 6.5.5 Club-Angebote für Mitglieder und Gäste Wie die praktische Arbeit des ‚Club deutscher Frauen‘ in seinen Ausschüssen ablief, ließsich kaum rekonstruieren, weiterführend könnten gegebenenfalls persönliche Aufzeichnungen von Mitgliedern sein. Barbara Henicz und Margret Hirschfeld zufolge hat die von ihnen interviewte ‚Hedwig S.‘, die offenbarbar dem Haushaltsausschuß angehörte, die Club-Arbeit als ‚unpolitisch‘ empfunden. „Von Politik wurde da überhaupt nicht geredet“ […] Und dann haben sie Vorträge gemacht. Wie man das Essen besser einrichten kann und wie man kochen soll […] Und dann wurde auch mal vorgestellt, wie man aus zwei Tischtüchern ein Kleid macht“351, wird Hedwig S. zitiert. Eine Tendenz der Club-Arbeit in den verschiedenen Ausschüssen an der Aussage einer einzigen Frau abzuleiten, die noch dazu mit 40 Jahren Abstand zu den Geschehnissen interviewt wurde, erscheint jedoch problematisch.352 „Hat eine
Zuge der Konstituierung des Niedersächsischen Frauenrings, kurz vor der Gründung des Frauenrings der britischen Zone, also Mitte 1947 erfolgt sein. 350 Vgl.: Informationsdienst der christlich-demokratischen Union Deutschlands, 35/1968, S. 3. Landsberger scheint sich bis mindestens 1973 im DFR-Vorstand engagiert zu haben: Vgl.: O. V.: Frauen-Impulse. Informationen des Landesfrauenrats Niedersachsen, 4/2010, online auf: http://landesfrauenrat-nds.de/autodownload/FrauenImpulse/Impulse%202010 _40%20Jahre%20Landesfrauenrat.pdf, S. 51, am 13.12.2013. 351 Henicz/Hirschfeld: Club, S. 129. 352 Eine umfangreichere Auseinandersetzung mit der Problematik von Zeitzeugeninterviews als historische Quelle führt an dieser Stelle zu weit. Vgl. dazu: Geppert, Alexander: Forschungstechnik oder historische Disziplin? Methodische Probleme der Oral History, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Bd. 45 (1994), Nr. 5, S. 303–323. Es sei lediglich darauf hingewiesen, daß die beiden Forscherinnen, wie den Aufsätzen anzumerken ist, im linken politischen Milieu zu verorten sind und daß eine der beiden mit großem Abstand zu den Ereignissen interviewten Frauen, Herta Dürrbeck, nachweislich KPDMitglied war und dem von der SED gelenkten DFD zuarbeitete. Siehe Kapitel 7.6.4. Auffällig ist auch, daß über die Arbeit des DFD im Sammelband von Annette Kuhn, der die beiden sehr kritischen Artikel über Bähnischs Gründungen beinhaltet, sehr positiv berich-
Club deutscher Frauen | 613
solche Aussage möglicherweise auch Ursachen im mangelnden Interesse an den angebotenen Themen, so muß doch die Effektivität der Arbeit angezweifelt werden, wenn selbst bei langjährigen Mitgliedern der Eindruck eines unpolitischen Hausfrauenverbandes dominiert“353, schreiben Henicz und Hirschfeld zum Statement von ‚Hedwig S.‘ – ohne einen Hinweis darauf zu geben, wie lange ‚Hedwig S.‘ ClubMitglied blieb und was sie im Club gehalten hat, wenn es nicht das Interesse an seiner Arbeit war. Von der staatsbürgerlichen Arbeit, die Bähnisch mit ihrem Club erklärtermaßen leisten wollte354, habe ‚Hedwig S.‘ jedenfalls „kaum etwas gemerkt.“355 Daß der Club die von ‚Hedwig S.‘ beschriebene Beratungsarbeit in Sachen Hauswirtschaft leistete, ist nicht verwunderlich: Ratschläge zur Hausarbeit in Zeiten des Mangels lassen sich zweifelsfrei unter das Club-Ziel, praktische Hilfe im Wiederaufbau zu leisten, subsumieren. Schon eher irritiert, daß Denise Tscharntke in ihrer Studie, die sich mit der britischen Frauen-Re-education-Arbeit beschäftigt, über den Club deutscher Frauen schreibt: „Nearly nothing is reported about concrete welfare projects in the city of Hanover“356. Gesetzt den Fall, daß diese Beobachtung Tscharntkes nicht nur auf ein Überlieferungsproblem zurückzuführen ist, stellt sich die Frage, womit sich der Club – neben den erwähnten HauswirtschaftsBeratungsangeboten – eigentlich beschäftigte, wenn er weder ‚politische Arbeit‘ noch ‚Wohlfahrtsarbeit‘ geleistet haben soll. Arbeitete er überhaupt an der Umsetzung seiner übrigen, zumindest der kurzfristig zu erreichenden Ziele? Und zählte der Club ‚konkrete Wohlfahrtsprojekte‘, wie Tscharntke sie vermißte, zu seinen Aufgaben, wenn im Rahmen der Zielsetzung von „gegenseitiger Hilfe“ und „Linderung der körperlichen und seelischen Not unserer Zeit“ die Rede war? Welche Funktionen übernahm der Club also in der Stadt? Und welche Rolle spielte seine erste Vorsitzende dabei? Nachvollziehen läßt sich auf Basis von Zeitungsmeldungen und Einladungen, daß der Club „über den Kreis der Mitglieder hinaus“357 tätig war. Er verstand sich von Anfang an nicht als eine geschlossene Institution und blieb diesem Prinzip – seine Nachfolgeorganisation DFR existiert noch immer – bis heute treu.358
353 354 355 356 357 358
tet wird. Vgl.: Nödinger, Ingeborg: „Mitwissen, mitverantworten, mitbestimmen“. Zu den Anfängen des Demokratischen Frauenbundes Deutschland, in: Kuhn: Nachkriegszeit, Bd. 2, S. 122–126. Henicz/Hirschfeld: Club, S. 129. Vgl.: Wolf Augen. Hedwig S., zitiert nach Henicz/Hirschfeld: Club, S. 129. Tscharntke: Re-educating, S. 162. Henicz/Hirschfeld: Club, S. 130. Vgl.: O. V.: Deutscher Frauenring e. V., Ortsring Hannover, auf: http://www.deutscherfrauenring.de/organisation/landesverbaende-ortsringe/niedersachsen/hannover, am 24.01. 2014.
614 | Theanolte Bähnisch
Aus Pressemeldungen, aus den Beständen des Stadtarchivs Hannover359 sowie aus Akten der Militärregierung läßt sich ersehen, daß Beratungssprechstunden, Informationsveranstaltungen und Vortragsreihen das Kerngeschäft des Clubs darstellten. Einem Schreiben des ‚Headquarter Military Government Hanover‘ ist zu entnehmen, daß der Club schon im Juli 1946 ein „Marriage Advice Bureau“ eingerichtet hatte, in dem ‚eine Anwältin und erfahrene Hausfrau‘ sowie 17 andere Frauen jeweils an einem Nachmittag der Woche Ratschläge erteilen und Hilfestellung leisten wollten.360 Nimmt man an, daß die Ratschläge ähnlichen Zuschnitts waren, wie die zum gleichen Thema in der ‚Stimme der Frau‘361, so stand dieses Angebot nicht nur mit dem Club-Ziel im Einklang, die ‚kameradschaftliche Zusammenarbeit von Mann und Frau‘, im Sinne der Gleichberechtigung der Frauen in der Ehe zu fördern. Es bediente gleichzeitig auch das Ziel, ‚die seelische Not unserer Zeit‘ zu lindern. Denn zu jener Not gehörten, nicht zuletzt wegen langer Trennungsphasen und veränderter Aufgaben der Partner in der Lebensgemeinschaft, vor allem auch Ehe- und Familienprobleme. Dem gleichen Schreiben ist zu entnehmen, daß der Club jeweils ein „SubComittee“ 362 – also einen Arbeitsausschuß – für Hauswirtschaft und für Flüchtlingsfragen eingerichtet hatte. Wie die Arbeit des Flüchtlingsausschusses aussah, erfährt man aus dem Schreiben jedoch nicht. Im DFR-Archiv ist ein Schriftstück von 1946 überliefert, das den Titel ‚Bunkerbesichtigung vom Club deutscher Frauen‘ trägt.363 Dessen Verfasserin, die FDP-Politikerin Grete Sehlmeyer, war die Lebensgefährtin Anna Mosolfs. Interessant ist der Bericht vor allem aufgrund der Art, wie er die Arbeit der Verwaltung für Flüchtlinge und Heimkehrer, die in diesem Bunker eine Unterkunft fanden, als überlebensnotwendig darstellt – und damit wiederum die Brücke zu Bähnischs Arbeit im Regierungspräsidium schlägt. Denn diesem oblag die Ver-
359 Aufschlußreich ist vor allem die Überlieferung von Einladungen des Clubs deutscher Frauen im Bestand des Deutsch-Evangelischen Frauenbundes im Stadtarchiv Hannover, DEF, G 2 t I u. II. 360 NA, UK, FO 1050/1299, Controller Education & R. A., HQ Mil Gov Hannover an Education Branch, I. A.&C. Division, Zonal Executive Office, CCG (BE) Main HQ Bünde, 17.06.1946. 361 In wiederkehrenden Rechtsberatungsartikeln wird die inferiore Rolle der Frau in der Ehe in punkto Lohnarbeit, Erbrecht und Kindererziehung beschrieben und als nicht mehr zeitgemäß dargestellt. Vgl.: Freund: Krieg, S. 168/169. Vgl. insbesondere die Artikel: O. V.: Kennen Sie das BGB, das Buch mit den sieben Siegeln?, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 4, S. 19; o. V.: Was Väter alles dürfen, o. V., in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 7, S. 7 sowie Feith, L[eonore].: Darf Marianne tippen? Auch wenn der Ehemann „nein“ sagt?, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 9, S. 10. 362 NA, UK, FO 1050/1299, Controller Education & R. A., HQ Mil Gov Hannover an Education Branch, I.A.&C. Division, Zonal Executive Office, CCG (BE) Main HQ Bünde, 17.06.1946. 363 DFR-Archiv, A1, Sehlmeyer, Grete: Bunkerbesichtigung vom Club deutscher Frauen, o. D. [1946].
Club deutscher Frauen | 615
waltung der Flüchtlingsunterkünfte in Zusammenarbeit mit den freien Trägern.364 In welchem Rahmen die ‚Besichtigung‘ erfolgte, ob sie sich auch an Nicht-Mitglieder richtetete, oder, ob sie womöglich nur von einem Club-Mitglied vorgenommen und anschließend von Sehlmeyer literarisch verarbeitet worden war, ist nicht ersichtlich. Ob der Club praktische Arbeit für die Flüchtlinge, von denen viele in Bunkern untergebracht waren, leistete, ist dem Bericht ebenfalls nicht zu entnehmen. In einem Vortrag erwähnte Bähnisch, daß sich Mitglieder des Frauenrings, zu dem der Club später gehörte, im Jugendflüchtlingslager Poggenhagen „zur […] fürsorgerischen Arbeit zur Verfügung gestellt“365 hätten. Belege für diese Arbeit lassen sich zwar nicht finden, jedoch wurde von Seiten der britischen Militärregierung und von Seiten Helena Denekes wiederholt auf das Thema ‚Flüchtlinge‘ als ein wichtiges Arbeitsthema des Frauenrings re-kurriert, auf interzonalen Frauenkonferenzen, auf die Bähnisch Einfluß nahm, wurde es, oft von Rednerinnen aus Hannover, thematisiert, und auch in ihrer Arbeit als Regierungspräsidentin zeigte die Club-Vorsitzende ein besonderes Interesse an der Lage jener Bevölkerungsgruppe.366 Daß gar keine praktische Arbeit in dieser Hinsicht stattgefunden haben soll, ist deshalb eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich dagegen ist, daß sich der ‚Club deutscher Frauen‘ zumindest im Rahmen des ebenfalls von Bähnisch initiierten Arbeitskreises der Frauenverbände367 mit dem DRK sowie anderen Wohlfahrtsverbänden über die Flüchtlingsarbeit in Hannover austauschte und eventuell – als verlängerter Arm der Behörde – auch an der Koordination von Projekten beteiligt war. Aus einer Kritik Helena Denekes am Frauenring geht hervor, daß Frauenring-Mitglieder in der Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände in Hannover versucht hätten, die Koordination von Aktivitäten anderer Organisationen mit zu übernehmen.368 Dabei habe sich jeweils Protest in den Reihen des Roten Kreuzes, des Landfrauenverbandes und in konfessionellen Organisationen erhoben.369 Die ‚Sprechstunde für gesundheitliche und familienrechtliche Fragen‘, die der Club einer Pressemeldung zufolge ab Juli 1946 anbot, stand allen interessierten Frauen, also auch den Flüchtlingen offen. Vor dem Hintergrund der Verantwortung, die das Regierungspräsidium trug, ist es denkbar, daß die Club-Mitglieder sich in diesem Zusammenhang auch mit Mitarbeitern der Flüchtlingsleitstelle austauschten. Gleiches mag für die ab Januar 1947 angebotene Erziehungsberatung sowie die Unterstützung bei arbeits- und sozialrechtlichen Problemen gegolten haben.370 Aufschluß hierüber könnte eine Durchsicht der im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv überlieferten Sachakten bringen. Schließlich war in einem Zeitungsartikel zu lesen, daß
364 365 366 367 368 369 370
Siehe Kapitel 5.4.1. Bähnisch: Wiederaufbau, S. 174. Siehe Kapitel 5.6. Siehe Kapitel 6.6.1. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 186. Vgl.: ebd. O. V.: Notiz, in: Hannoversche Neueste Nachrichten, 19.07.1946, S. 2 sowie o. V.: Notiz, in: Hannoversche Presse, 03.01.1947, S. 4, jeweils in: Henicz/Hirschfeld: Club, S. 130.
616 | Theanolte Bähnisch
Bähnisch ein (kombiniertes) Frauen- und Flüchtlingsreferat gebildet habe371, um den Frauen Wege zu ersparen. Sie scheint dies auf die Person Maria Prejawas372 zu beziehen, die im Flüchtlingsdezernat tätig war, aber auch organisatorische Arbeiten und Korrespondenzen für den ‚Club deutscher‘ Frauen erledigte. Die beschriebenen Club-Angebote dürften, selbst wenn sie sich auf Beratungsangebote beschränkt haben sollten – zumal die Vorstandsmitglieder über entsprechende Kompetenzen verfügten – eine hilfreiche Unterstützung für die Bevölkerung in einer schwierigen Zeit dargestellt haben. Von Wohlfahrtsprojekten im engeren Sinn zu sprechen scheint nicht angebracht, die Club-Arbeit als ‚soziale Arbeit‘ zu bezeichnen ist jedoch sicherlich nicht falsch. Zum Wirtschaften in der Notzeit, machte der Club nicht nur die von ‚Hedwig S.‘ erwähnten, sondern weitere zahlreiche Angebote, namentlich durch Kurse in „häuslicher Diät, zeitgemäßem Kochen, für Selbstanfertigung von Spielsachen, Kinderkleidung und Handarbeit aus Resten“373 sowie durch das angeleitete Sammeln von Wildfrüchten, -gemüsen und -pilzen.374 Auch im Frühjahr 1948, knapp zwei Jahre nach der Club-Gründung, war das Thema ‚Ernährungsfragen‘ noch präsent. So startete der Club am 22.04.1948 eine neue Vortragsreihe, die mit einem Lichtbild-Vortrag zum Thema „Rationelle Auswertung unserer Nahrungsmittel in der Praxis der Hausfrau“ begann. Die Veranstaltung wurde damit beworben, daß „Sachverständige aus der Ernährungswissenschaft und der Ernährungswirtschaft“ anwesend und „zur Aussprache bereit“ seien. „Es wird eine Reihe von Fragen aufgeworfen, an deren Klärung und Beantwortung allen Hausfrauen augenblicklich und auch in der weiteren Zukunft sehr viel liegen wird“375, buhlte der Club um die Aufmerksamkeit jener großen Gruppe von Hausfrauen, die sich – glaubt man den Aussagen der Women’s Affairs Officers – anfangs von den Club-Angeboten nicht angesprochen gefühlt hatten. Ob die Veranstaltung in dieser Hinsicht ein Erfolg war, ist nicht überliefert. 6.5.5.1 Mehr als eine Gedenkveranstaltung – Der Club erweist Helene Lange die Ehre Ein Termin, mit dem der Club dezidiert an die Geschichte der bürgerlichen Frauenbewegung anknüpfte, war der 09.04.1948. An diesem Tag fand, vom Club organisiert, im großen Sitzungssaal der Regierung Hannover eine Gedächtnisfeier für Hele-
371 Vgl.: Sybill: Porträt. 372 Laut ihrer Personalakte wurde Maria Prejawa 1895 geboren, 1947 – also nach der Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘ – bei der Regierung Hannover als Dezernentin eingestellt und 1951 in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen. 1957 wurde sie, zu dieser Zeit Oberregierungsrätin, auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt. Prejawa starb 1978. NLA HA HStAH, Nds. 120 Hannover, Acc. 9/90, Nr. 209. 373 Hannoversche Neueste Nachrichten, 28.08.1946, zitiert nach Henicz/Hirschfeld: Club, S. 130. 374 Vgl.: ebd. 375 Stadtarchiv Hannover, DEF, G 2 t I u. II, Einladung des Club deutscher Frauen Hannover zur Veranstaltung am 11.05.1948, 22.04.1948.
Club deutscher Frauen | 617
ne Lange anläßlich ihres 100. Geburtstags statt.376 Kultusminister Grimme hatte zu jenem Anlaß eine Gedächtnisrede über die Gallionsfigur der Frauenbewegung verfaßt377, was sich als Beweis für seine unterstützende Haltung gegenüber dem Club und dessen Zielen interpretieren läßt. Einen weiteren Vortrag über Lange, deren Feminismus ebenfalls stark differentialistisch geprägt war und für die ‚Weiblichkeit‘ und biologische und/oder soziale ‚Mütterlichkeit‘ untrennbar zusammenhingen, hielt Anna Mosolf.378 Daß die Schulrätin über Lange sprach, war naheliegend, schließlich hatte sich Lange wesentlich für gleiche Bildungs- und Berufschancen von Mädchen und Frauen, ein Kernthema der Arbeit Mosolfs, eingesetzt. Daß der Club mit jener Feierlichkeit eine Marke zum Thema ‚Frauenbildung‘ setzte, paßte jedoch auch zur Biographie seiner Präsidentin. Denn der Lebensweg der 1848 geborenen Grande Dame der bürgerlichen Frauenbewegung wies durchaus Parallelen zur Biographie und zu den Zielen Theanolte Bähnischs auf: Lange hatte sich in jungen Jahren in Berlin über einen längeren Zeitraum hinweg in liberalen Kreisen bewegt. Dort waren ihr die Ideen der Frauenbewegung nähergebracht worden. Sie ging jedoch zunächst ihren Weg als Lehrerin, bevor sie – aus ihrem Berufszusammenhang heraus – die Relevanz der Frauenbewegung für sich entdeckte. In ihrem Berufsalltag sah sie sich mit dem Problem konfrontiert, daß bürgerliche Frauen – obwohl sie sich aufgrund ihrer finanziellen Situation oft ihren Lebensunterhalt selbst verdienen mußten – auf diese Notwendigkeit von den Schulen und den höheren Lehranstalten nicht vorbereitet, sondern nach wie vor zu ‚Ehefrauen‘ erzogen wurden.379 Helene Lange zog aus diesen Umständen die Konsequenz, sich von diesem Zeitpunkt an für eine Verbesserung der Mädchenbildung einzusetzen. Sie engagierte sich im Vorstand des BDF, leitete den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein, gründete Schulen und gab gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Gertrud Bäumer die Zeitschrift ‚Die Frau‘ heraus. 60 Jahre später sah sich die Regierungspräsidentin Bähnisch vor ein ähnliches Problem gestellt. Zwar war der Zugang für Mädchen und Frauen zu höherer Bildung, nicht zuletzt angeschoben durch Langes ‚Gelbe Broschüre‘, bereits im Kaiserreich gewährleistet und in der Weimarer Republik weiter verbessert worden. Doch während des Dritten Reichs waren die Bildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen erneut stark begrenzt worden. Eine qualifizierte Berufsausbildung für Frauen wurde 1945 nicht als selbstverständlich angesehen. Doch nachdem die ‚Ernährer‘ durch den Krieg dezimiert waren, waren viele Frauen auf sich allein gestellt. Die historische Zäsur, das Kriegsende ließ die soziale Not der Menschen in Deutschland zunächst
376 Ebd. 377 Ebd. 378 Ebd. In den Akten des DEF findet sich auch die Einladung des ‚Club deutscher Frauen‘ zum Vortrag von Luise Kipp-Kaule (Industriegewerkschaft Bielefeld) über ‚Frauenerwerbsarbeit und Gewerkschaft‘ am 20.01.1948 sowie zu einer Feierstunde zum Gedächtnis von Ricarda Huch am 06.02.1948, jeweils im großen Sitzungssaal des Regierungsgebäudes. Ebd., Einladung des Club deutscher Frauen Hannover, 08.01.1948. 379 Vgl.: Wolff, Kerstin: Helene Lange. Eine Lehrerin der bürgerlichen Frauenbewegung, auf: bpb, http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35312/helene-lange?p= all, am 08.01.2009.
618 | Theanolte Bähnisch
einmal noch größer werden. Bähnisch hatte mit ihrem Amtsantritt als Regierungspräsidentin zu jener Zeit die Aufgabe, jener Not wirksam zu begegnen. Ihr Engagement im Club deutscher Frauen beschrieb sie in der Retrospektive (auch) als eine Reaktion auf die Initiative von Bürgerinnen, die sich mit Hilfsgesuchen an sie als Regierungspräsidentin wandten. Es habe sie bedrückt, daß sie „täglich Briefe von Frauen bekam, die glaubten, daß ich als Frau in leitender Position ihnen helfen könne“, so Bähnisch. Daß die Frauen die Verwaltungsorganisation nicht durchschauten, nahm sie zum Anlaß, diese über ihre Rechte und Möglichkeiten aufzuklären – zu einer Zeit, in der sie darauf angewiesen waren, nicht nur ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, sondern auch ihre Anliegen gegenüber öffentlichen Organen selbst zu vertreten. „Es war geradezu erschreckend, von welcher Naivität und Unkenntnis diese Briefe waren“, hatte die gebildete Juristin konstatiert. Obwohl – oder eben gerade weil – vieles, was in den Briefen angesprochen wurde, nicht in ihre Zuständigkeit fiel, verspürte sie „den dringenden Wunsch“, die Frauen „wenigstens zu beraten“.380 Der Veranstaltung über Lange ist ein staatsbürgerlich bildender Impetus nicht abzusprechen, war Lange doch Parade-Beispiel dafür, wie eine Frau, durch mutiges Engagement, gepaart mit professionellem Wissen, die Gesellschaft herausforderte und sie zu verändern half. Ob Langes Ziele im Rahmen der Veranstaltung auf die zeitaktuelle Problematik – die wiederum darin bestand, Frauenbildung zu verbessern, auch um damit die Voraussetzung für einen selbständig verdienten Lebensunterhalt zu schaffen – übertragen wurde, oder ob die Zuhörerinnen jene Interpretations- und Transferleistung selbst erbringen mußten, läßt sich leider nicht rekonstruieren. Fakt ist, daß eine von Lange gewählte Interventions-Form, die ‚Eingabe‘ an die Regierung, bald auch zum beliebten Mittel des Frauenrings, Einfluß auf die Politik zu nehmen, avancierte. Als Helene Lange sich der ‚Eingabe‘ bediente, war diese noch gar nicht als Individualrecht in die Verfassung aufgenommen worden.381 Und der Frauenring machte von dieser Form der Einflußnahme Gebrauch, noch bevor diese als anerkannter Bestandteil der demokratischen Grundrechte in Art. 17 des GG festgeschrieben worden war.
380 Bähnisch: Wiederaufbau, 163. 381 Anders als fast alle Landesverfassungen des 19. Jahrhunderts, in denen dem Individuum das Recht gewährt wurde, ‚schriftliche Beschwerde zu führen‘ oder ‚seine Wünsche und Beschwerden beim Regenten unmittelbar anzubringen‘, verzichtete die Bismarck‘sche Reichsverfassung von 1871 auf einen Grundrechtskatalog und somit auch auf das Individualrecht zur Petition. Die Verfassung kannte lediglich das ‚parlamentarische Petitionsüberweisungsrecht‘, nach dem der Reichstag das Recht hatte, an ihn gerichtete Petitionen an den Bundesrat oder Reichskanzler weiterzuleiten. Erst in Art. 126 der Weimarer Reichsverfassung von 1919 wurde auf die individualrechtliche Seite des Petitionsrechts abgestellt und jedem Deutschen das Recht, sich schriftlich mit Bitten und Beschwerden an die zuständige Behörde oder an die Volksvertretung zu wenden, zugesprochen. Vgl.: O. V.: Geschichte des Petitionsrechts, auf der Homepage des Landtags Sachsen, http://www.landtag.sachsen.de/de/petition/geschichte_des_petitionsrechts/index.aspx, am 13.12.2013.
Club deutscher Frauen | 619
Mit einer Veranstaltung, in deren Rahmen die Gewerkschafterin Luise Kipp-Kaule zum Thema ‚Frauenerwerbsarbeit und Gewerkschaft‘ am 20.01.1948 sprach, zeigte der Club deutscher Frauen schließlich, daß er sich nicht auf die Traditionen der bürgerlichen Frauenbewegung allein bezog, wenn er Frauen die Themen ‚Bildung‘ und ‚Erwerbsarbeit‘ näherbringen wollte.382 6.5.5.2 Mehr Lobbyismus als Bildungsangebote: Die Club-Arbeit in der frühen Phase Die Hauptarbeit des Club bestand in den ersten beiden Jahren seiner Existenz - neben den hauswirtschaftlichen Angeboten – in Beratungs- und Bildungs-Angeboten, die sich vor allem als ‚Berufsberatung‘ sowie ‚Beratung in Fragen von Familien- und sozialrechtlicher sowie sozialethischer Hinsicht‘ charakterisieren lassen.383 Daß Bähnisch anläßlich einer frühen Rede in Düsseldorf über den Club berichtete, daß in ihm „interessierte Frauen“ von „erfahrenen Frauen“ lernen sollten, wie man sich in „einem Arbeitsgebiet anzupassen hat“, darüber spreche und zu „irgendwelchen Dingen Stellung“384 nehme, unterstreicht den Eindruck, daß der Club dem Verständnis seiner Vorsitzenden nach tatsächlich zu jener Zeit im Wesentlichen eine Bildungseinrichtung sein sollte. Seinem Ziel‚ staatsbürgerliche Bildung‘ zu leisten, scheint er – legt man eine engere Interpretation des Begriffs zugrunde – im ersten Jahr jedoch kaum nachgekommen zu sein. Als der Frauenring auf Zonenbasis gegründet worden war, gab es im ‚Club deutscher Frauen‘, der sich bald ‚Ortsgruppe Hannover des Frauenrings e. V.‘ nannte, jedoch entsprechende Angebote.385 Damit schien Bähnisch immer noch schneller gewesen zu sein als andere Erwachsenenbildnerinnen der Zeit. Christl Ziegler zufolge rückten Themen wie die Analyse von Parteiprogrammen, die Arbeit öffentlicher Medien, die kommunale Selbstverwaltung und die Funktion von Parlamenten „erst in
382 Stadtarchiv Hannover, DEF, G 2 t I u. II, Einladung des Clubs deutscher Frauen Hannover, 08.01.1948. 383 Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Club, S. 130. Hier wird eine Auswahl verschiedener Meldungen in Hannoveraner Zeitungen präsentiert. Darunter finden sich Ankündigungen für einen Vortrag Katharina Petersens über die „menschliche Verantwortung der Frau in unserer Zeit“, ein Gespräch mit Vertretern des Wirtschafts- und Ernährungsamtes, eine Diskussionsveranstaltung zum § 218 sowie eine Veranstaltung zum Thema „Frauenerwerbsarbeit und Wirtschaft“. 384 AdSD, SPD-PV (alter Bestand), Frauenbüro, 0244 A, Bähnisch: Werbung f. d. zentralen Frauenring in D’dorf [Protokoll einer Rede Bähnischs aus der Überlieferung des Frauenbüros], o. D. [1946] Es ist nicht wahrscheinlich, daß Bähnisch im Protokoll im Wortlaut wiedergegeben ist. 385 Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld „vermuten“ allerdings, daß sich „mit dem Zusammenschluß auf zonaler Ebene die Ausschußarbeit – vor allem die Behandlung rechtlicher und sozialer Fragen – immer mehr in die überregionalen Arbeitsgruppen verlagert hat.“ Henicz/Hirschfeld: Club, S. 129. Lokale Arbeitszusammenhänge und der Bezug zur Mitgliederbasis seien dabei verlorengegangen. Vgl.: ebd.
620 | Theanolte Bähnisch
den späteren Jahren didaktisch stärker in den Vordergrund“386 der Erwachsenenbildungsarbeit. Daß sich der Club vor allem auf Beratungsangebote konzentrierte, kann als eine bewußte Warm-Up-Strategie‚ die Frauen überhaupt erst einmal für die Arbeit des Clubs zu interessieren, gedeutet werden. Aussagen der britischen Militärregierung, wie der ‚richtige‘ Weg der Frauen-Re-education387 auszusehen hatte, nämlich, daß diese eher indirekt erfolgen sollte, stützen diese Interpretation. Zudem war Mitte 1946, zur Zeit der Club-Gründung, gar nicht absehbar, auf welchen Staat hin denn eine ‚staatsbürgerliche‘ Bildung überhaupt hätte betrieben werden sollen. Mit der Gründung der Bizone im Januar 1947 und der Einrichtung des Wirtschaftsrates der Bizone im Juni desselben Jahres zeichnete sich in dieser Hinsicht immerhin eine Entwicklung ab, an der sich der ‚Frauenring der britischen Zone‘, der sich etwa zum gleichen Zeitpunkt konstituierte, orientieren konnte. Mit dem Zusammenschluß der drei Westzonen zur Trizone im März 1948 traten die Konturen des noch zu gründenden, neuen Staats bereits schärfer hervor. Zudem ist zu berücksichtigen, daß in der Logik Bähnischs ein Nicht-Angebot staatsbürgerlich bildender Kurse für Mitglieder des Clubs nicht gleichbedeutend gewesen sein dürfte mit der Nicht-Erfüllung des Ziels staatsbürgerlicher Frauenbildung, das der Club sich 1946 gesetzt hatte. Die Regierungspräsidentin setzte nämlich – dem Prinzip des von ihr äußerst geschätzten Adolf von Harnack folgend388 – auf die persönliche, professionelle Kompetenz von Einzelpersonen389, im Club also vor allem auf die der Vorstandsmitglieder. Diese waren durch ihre Positionen in Behörden, Bildungseinrichtungen und anderen Zusammenhängen allesamt Multiplikatorinnen, was ihnen ermöglichte, in ihren Funktionenauch für die Ziele des Clubs einzustehen. Beispielhaft für diese Strategie steht Bähnischs Aussage, daß Club-Mitglieder, die einer Partei angehörten, in ihren Parteien im Sinne des Clubs wirken sollten. Und an der Person Anna Mosolfs läßt sich deutlich machen, wie sich die Idee Bähnischs in die Praxis umsetzen ließ: Als der Kreisverband der FDP in Hannover im Oktober
386 Ziegler: Lernziel, S. 72. Ziegler verweist auf entsprechende Quellen ab 1949. 387 „The most successful type of political indoctrination will […] be fairly indirect and must be carefully mixed with non-political interests and activities“, hatte Brian Robertson an Lord Pakenham geschrieben. NA, UK, FO 371/70711, Robertson an Pakenham, 29.04.1948. 388 Als das ‚Harnack-Prinzip‘ wird die Überzeugung Harnacks verstanden, in den KaiserWilhelm-Instituten – aus denen die Max-Planck-Institute entstanden – vor allem auf die Kompetenzen herausragender Persönlichkeiten zu setzen. Vgl.: O. V.: Der Ansatz ‚Max Planck.‘ Die Max-Planck-Gesellschaft im Deutschen Wissenschaftssystem, auf: MaxPlanck-Gesellschaft, http://www.mpg.de/101251/MPG_Einfuehrung?seite=2, am 13.12. 2013. 389 Daß sie Schumacher in einem Brief 1945 nahegelegt hatte, er müsse Personen seines Vertrauens, als „Strahlungspunkte“ über das Land verteilen (AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 23.12.1945), war in dieser Hinsicht ebenso aussagekräftig wie Bähnischs Engagement in der Europäischen Bewegung. Denn diese setzte ebenfalls – erfolgreich – darauf, daß einzelne Personen die Ideen der Bewegung in ihrem jeweiligen Umfeld populär machen würden.
Club deutscher Frauen | 621
1946 einen Vertreter „in der Angelegenheit betr. Einrichtung staatsbürgerlicher Bildungsstellen“390 benennen sollte, griff die Partei auf ihr Mitglied Anna Mosolf, die offenbar in der FPD ihre Kompetenz für dieses Thema bewiesen hatte, zurück und vertraute ihr die Vertretung der Interessen der FDP an.391 Der Ausschuß für staatsbürgerliche Aufklärung, wie die Einrichtung schließlich hieß, konstituierte sich mit Mosolf, die im Ausschuß vermutlich nicht nur die Ziele der FDP, sondern auch die des ‚Club deutscher Frauen‘ vertrat, am 21.01.1947. Da das Kultusministerium ebenfalls einen Vertreter in den Ausschuß zu entsenden hatte und dabei auf seine Mitarbeiterin Käthe Feuerstack zurückgriff, war sogar noch ein weiteres Mitglied des Clubs deutscher Frauen im Ausschuß vertreten.392 Bähnischs Organisation war also über ihre prominenten Mitglieder auch in diesem Zusammenhang präsent, was bedeutete, daß sie Bildungsarbeit auch dort mitgestaltete, wo sie nicht Organisator war. Die hing natürlich wiederum mit den Basis-Kompetenzen zusammen, die die Frauen erworben hatten, bevor sie Club-Mitglieder wurden. So erfüllte der Club seinen Anspruch, den Verwaltungen ‚beratend zur Seite zu treten‘, und setzte gleichzeitig die Idee, daß seine Mitglieder in den Parteien im Sinne des Clubs wirken, um. Die Quellen bestätigen Barbara Henicz‘ und Margrit Hirschfelds Interpretation, daß sich der „hannoversche Frauenausschuß [gemeint ist der Club deutscher Frauen], […] wie andere Frauenausschüsse auch als eine Art Nebenbehörde“ verstanden habe und daß die „im CdF [Club deutscher Frauen] maßgeblichen Frauen […] meist selbst in der Verwaltung oder in entsprechenden Positionen tätig waren, so daß eine Einflußnahme auf Behörden im Wesentlichen über diese informellen Kontakte verlief.“393 Henicz und Hirschfeld machen in ihrem Aufsatz deutlich, daß der Club damit kein Unikum in Deutschland darstellte. Auch andere von Bähnisch initiierte oder ‚betreute‘ Gründungen in der britischen Besatzungszone, wie der Club deutscher Frauen in Düsseldorf, verfolgten diese Strategie. So stellte in Düsseldorf Christine Teusch, die Kultusministerin Nordrhein-Westfalens, als Club-Vorsitzende persönlich die entscheidende Verbindung sowohl in die Verwaltung, als auch in die CDU am Ort dar.394 6.5.5.3 Die politische Bildungsarbeit nimmt zu – Schlaglichter aus den Jahren 1947 und 1949 Ab Mai 1947 veranstaltete der Hannoveraner Club eine Vortragsreihe, welche, zumindest gemessen am Thema der Auftakt-Veranstaltung, unzweifelhaft einen politisch bildenden Charakter trug. Die auf der Veranstaltung gehaltenen Vorträge hatten
390 Gemeint ist der Ausschuß für staatsbürgerliche Aufklärung, der sich am 21.01.1947 konstituierte. 391 NLA HA HStAH, Nds. 58, Acc. 2004/143, Nr. 301, FDP, Kreisverband Hannover, erster Vorsitzender, Name unleserlich [vermutlich Walter Rheinhold] an den Ministerpräsidenten, Pressestelle, 14.10.1946. 392 Ebd. 393 Henicz/Hirschfeld: Club, S. 131. 394 Über eine von Teusch geleitete Versammlung berichtet auch Helena Deneke. Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 22.
622 | Theanolte Bähnisch
die Themen ‚Bedeutung des politischen Denkens für die Frau‘ sowie ‚Die Gemeindeordnung‘ zum Inhalt.395 Zu den konkreten Inhalten der Vorträge sowie zu weiteren Themen der Vortragsreihe – wenn sie überhaupt fortgesetzt wurde – sind allerdings keine Unterlagen überliefert. Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld kritisieren in ihrem Aufsatz, daß die Nachfolgeorganisation des Clubs seine politische Bildungsarbeit auf ‚staatsbürgerliche Erziehung‘ beschränkte, und beschreiben das seiner Arbeit zugrundeliegende Politikverständnis als „unzureichend […] weil die Frage nach den komplexen Zusammenhängen von weiblicher Lebenserfahrung, gesellschaftlichem Frauenbild und politischer Haltung von Frauen in keiner Weise thematisiert“396 worden sei. Die Autorinnen wollen das Angebot der Organisationen unter Theanolte Bähnisch mit einem modernen Verständnis von politischer Bildungsarbeit analysieren, sind dabei jedoch darauf angewiesen, sich an der Zielsetzung der Zusammenschlüsse zu orientieren, weil sich die Inhalte, die sich hinter den Vortrags- und Veranstaltungsthemen verbargen, allenfalls erahnen, aber nicht rekonstruieren lassen. Eine Tendenz der Arbeit läßt sich in der ‚Stimme der Frau‘ erkennen. Da die Zeitschrift zumindest zeitweilig als Verbandsorgan des Frauenrings – also der dem ‚Club deutscher Frauen‘ ab 1947 übergeordneten Instanz – begriffen wurde397 und die beiden Herausgeberinnen gleichzeitig Führungsfiguren im Club waren, darf die Annahme, daß die Club-Vorträge von ähnlichen Inhalten geprägt waren wie die Zeitschrift, als berechtigt gelten. In der Stimme der Frau zeigt sich, daß Bähnisch zwar davon ausging, daß Frauen zunächst staatsbürgerlich geschult werden müßten, um ihre Pflichten als Staatsbürgerinnen ausüben zu können, während die „Frage nach den „‚Zugangsvoraussetzungen‘ der Männer zu politischer Arbeit“398 – ein weiterer Kritikpunkt Henicz‘ und Hirschfelds – nicht gestellt wird. Doch es war der Juristin ebenso wichtig, ihre Zielgruppe nicht nur über ihre Pflichten, sondern auch über ihre Rechte als Staatsbürgerin, Berufstätige, Ehefrau und Mutter aufzuklären. Möglichkeiten, auf
395 Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Club, S. 130. 396 Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 147. 397 Bähnisch und ihre Sekretärin Prejawa schrieben in ihrer Korrespondenz mit den Berliner Frauen in Zusammenhang mit ihrer Berichterstattung über die Arbeit des Frauenrings in der ‚Wir-Form‘ von den Verantwortlichen für die Zeitschrift. Beispielsweise: DFRArchiv, A2, Maria Prejawa an Ilse Langner, 13.05.1947. 398 Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 149. In kleineren Artikeln unter den Rubriken ‚Die Frau in der Welt‘, ‚Aus der Frauenwelt, ‚Interessant‘ und ‚Nachrichten aus der Frauenarbeit‘ wird im gesamten Untersuchungszeitraum – wenn auch mit abnehmender Tendenz – über Gesetzesvorlagen von Parteien im In- und Ausland sowie von Forderungen und/oder Eingaben von Vereinen, Verbänden, aber auch Einzelpersonen an den Bundestag beziehungsweise die Volksvertretungsorgane anderer Staaten berichtet. Auf diese Weise entsteht durch die Lektüre der Zeitschrift ein Eindruck der Funktionsweise einer Demokratie, die auf der Arbeit von Parteien und anderen Interessenvertretungen sowie dem Recht auf freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit und der Möglichkeit zur Mitwirkung am politischen Willensbildungsprozesses eines jeden Bürgers basiert. Auch von der Arbeit des Frauenrings wird wiederholt berichtet. Freund: Krieg, S. 78, S. 138, passim.
Club deutscher Frauen | 623
das gesellschaftliche Leben Einfluß zu nehmen, wurden in der Zeitschrift an unzähligen Beispielen vorgestellt, interessanterweise oft auf der letzten Seite, in Form von Kurznachrichten.399 Da die Nachrichten in dieser Form leicht konsumierbar waren, war die Wahrscheinlichkeit hoch, daß viele Leserinnen der Zeitschrift die Informationen auch zur Kenntnis nahmen. Auf einer Veranstaltung des Clubs, sieben Monate nach seiner Gründung, war Theanolte Bähnisch im Rahmen eines Vortrags persönlich ihrem Anspruch, politische Bildungsarbeit zu leisten, nachgekommen. Am 03.01.1947 berichtete sie unter dem Titel ‚Meine Eindrücke in England‘ von ihrer Reise nach Großbritannien, die sie im November 1946 angetreten hatte.400 Ein Vortragsskript dieser Rede ist nicht überliefert401, doch der ‚obligatorische‘ Reise-Bericht, den Bähnisch wie alle anderen von der Militärregierung organisatorisch und/oder finanziell unterstützten England-Reisenden eingereicht hatte,402 läßt Rückschlüsse darauf zu, was Bähnisch erzählte: Während ihres Aufenthaltes in Großbritannien hatte sie sowohl Frauenorganisationen als auch Gemeindeverwaltungen, soziale Einrichtungen, die Polizei, ein Gericht und andere Einrichtungen des öffentlichen Lebens besucht. Auf Stadtrundfahrten hatte sie zudem Gelegenheit, einen Einblick in das alltägliche Leben der britischen Bevölkerung nach dem Ende des Krieges zu bekommen und konnte sich über britische Wiederaufbau-Anstrengungen informieren. Die Würde, mit der jedem menschlichen Lebewesen in Großbritannien begegnet werde, habe sie dazu angeregt, über (Aus-)Bil-
399 In kleineren Artikeln unter den Rubriken ‚Die Frau in der Welt‘, ‚Aus der Frauenwelt‘, ‚Interessant‘ und ‚Nachrichten aus der Frauenarbeit‘ wird im gesamten Untersuchungszeitraum – wenn auch mit abnehmender Tendenz – über Gesetzesvorlagen von Parteien im In- und Ausland sowie von Forderungen und/oder Eingaben von Vereinen, Verbänden, aber auch Einzelpersonen an den Bundestag beziehungsweise die Volksvertretungsorgane anderer Staaten berichtet. Auf diese Weise entsteht durch die Lektüre der Zeitschrift ein Eindruck der Funktionsweise einer Demokratie, die auf der Arbeit von Parteien und anderen Interessenvertretungen sowie dem Recht auf freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit und der Möglichkeit zur Mitwirkung eines jeden Bürgers am politischen Willensbildungsprozesses basiert. Auch von der Arbeit des Frauenrings wird wiederholt berichtet. Freund: Krieg, S. 78, S. 138, passim. 400 Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 216, Club deutscher Frauen Hannover an den Oberstadtdirektor, 20.12.1946, weitergeleitet durch den Stadtrat an die Hauptregistratur [„zur Weiterleitung an die größeren Dienststellen“], 20.12.1946. 401 Ein über den Bestand ‚Zentralkomitee der SED‘ im Bundesarchiv überliefertes Papier, beschäftigt sich zwar laut Überschrift mit dem Bericht Bähnischs, hält aber lediglich fest „Sie erzählte dann von ihren Erlebnissen in London, was sie besucht hat usw.“ BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Die Westzonen nach dem Friedenskongress, S. 2. Das Papier ist eines von vielen, das die Überwachung der bürgerlichen Frauenbewegung in Westdeutschland durch die SED, beziehungsweise den Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD) dokumentiert. Für weitere Informationen über den DFD siehe Kapitel 7.1. 402 NA, UK, FO 1005/1668, Annexure 1 to Part 1 of Fifteenth Monthly Report by HQ Military Government Land Niedersachsen, o. D.
624 | Theanolte Bähnisch
dung und Charakter der Briten nachzudenken, schrieb Bähnisch in ihrem Bericht403 – und suggerierte damit, daß eine Orientierung am britischen Bildungssystem für Deutschland im Wiederaufbau sinnvoll sein könnte. Es war ganz im Sinn der Militärregierung, daß die Regierungspräsidentin vor möglichst vielen Personen positiv über ihre Eindrücke in Großbritannien berichtete und dabei die Brücke zwischen ihrer Expertise als Verwaltungsjuristin und als Vorstandsmitglied einer Frauenorganisation schlug, zumal es ja Ziel der britischen Frauenbildungspolitik war, den deutschen Frauen eine Orientierung am britischen (Sozial-)System, das auf eine enge Kooperation privater Verbände und öffentlicher Träger setzte, anzuempfehlen. „Von Ihnen eingeführte Gäste sind willkommen“404 hieß es, wohl nicht zuletzt in diesem Wissen, auf der Einladung, die der Club versandt hatte. Am 10.03.1947 sprach Bähnisch auch vor dem ‚Bund für Erwachsenenbildung‘405 über ihre Reise nach England. Sie zeigte in ihrer Funktion als Vorsitzende des Clubs deutscher Frauen – in der sie, der Intention der Militärregierung folgend, nach Großbritannien gereist war – demnach nicht nur Präsenz im Rahmen der vom Club selbst durchgeführten Veranstaltungen, sondern trug seine Themen sowohl in Form der an anderen Stellen genannten Zeitungsartikel als auch durch Vorträge nach außen. Die Präsenz der Vorsitzenden in ‚ihrer‘ Organisation war allgemein stark: Im August 1948 lud der Frauenring Hannover, der zu diesem Zeitpunkt bereits Teil einer zonalen Organisation war, zu einer Mitgliederversammlung ein, die auch Gästen offenstand.406 Die Regierungspräsidentin erstatte in diesem Rahmen einen ‚Bericht über eine Reise nach Berlin‘ – ein Thema, über das sich zu jener Zeit nicht reden ließ, ohne die sich ständig zuspitzende aktuelle politische Lage zu reflektieren. Welche Schwerpunkte die Rednerin setzte, läßt sich nicht nachvollziehen, aber ihr öffentlichkeitswirksames Eintreten für eine Spenden-Aktion an Berliner Bürgerinnen im Rahmen der Berlin-Blockade im Sommer 1948407 deutet darauf hin, daß Bähnisch zu diesem Thema sprach und sich vermutlich mit dieser Veranstaltung sogar eine Plattform schuf, um für ihre Spenden-Aktion zu werben. Daß aktuelle politische Themen im Club nicht zur Sprache gekommen seien, wie Henicz und Hirschfeld schreiben, scheint, wie dieses Beispiel zeigt, nicht zuzutreffen.408 Auf der derselben Veranstaltung sprach auch die SPD-Politikerin Hilde Jünemann zum tagespolitisch aktuellen Thema „Währungsreform und ihre Auswirkungen
403 Ebd. 404 Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 216, Club deutscher Frauen Hannover an den Oberstadtdirektor, 20.12.1946, weitergeleitet durch den Stadtrat an die Hauptregistratur [„zur Weiterleitung an die größeren Dienststellen“], 20.12.1946. 405 Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 216, Bund für Erwachsenenbildung Hannover an Oberstadtdirektor Bratke, 03.03.1947. 406 Stadtarchiv Hannover, DEF, G 2t I u II, Frauenring Hannover, Sekretariat an den Deutsch-Evangelischen Frauenbund, 05.08.1948. 407 Siehe Kapitel 8.3.4.1. 408 Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Club, S. 130.
Club deutscher Frauen | 625
auf die Hauswirtschaft“409. Am programmatischen Titel des Vortrags läßt sich ablesen, daß Jünemann eine Brücke zwischen der Wirtschaftspolitik im Land und den alltäglichen Sorgen von Hausfrauen schlagen wollte. Ihre Stellung als Mitglied des niedersächsischen Landtags läßt ebenso wie ihr Amt als Vorsitzende des Haushaltsrechnungsausschusses – zunächst des Hannoverschen, später des Niedersächsischen Landtags – auf fundiertes Expertinnen-Wissen in jenem Bereich schließen. Daß im Anschluß an Jünemanns Vortrag eine „freie Aussprache“410 geplant war, zeigt, daß der Club zu diesem Zeitpunkt zumindest anstrebte, die Veranstaltungen demokratischer zu gestalten, als es bei der ersten Kundgebung der Fall war. Bis sich der Frauenring als bundesweiter Verband konstituiert hatte, schien sich das Training demokratischer Willensbildungsprozesse zu einem Schwerpunkt der Arbeit im Club deutscher Frauen/Frauenring Hannover entwickelt zu haben: „Wie leitet man ne Diskussion? Kann man ja auch nicht von sich aus… Wann stimmt man ab, wann lässt man es? Alle diese Sachen kriegten wir auf ne hübsche Weise beigebogen… Das war ne ganz wichtige Sache. Und dann eben üben an Themen, die uns alle interessierten, da anzufangen, wo man sagen konnte, da haben alle ein bestimmtes Wissen und da kann jeder mitdiskutieren und braucht nicht zu denken das kann ich nicht… Man merkte deutlich, dass wir ne Menge einfach noch nicht konnten, einfach noch nicht richtig wußten“411 wird die Zeitzeugin ‚Frau Z.‘, die zuvor Arbeitsdienstführerin beim BDM gewesen sei, von Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld zitiert. Darauf, daß im Frauenring das Diskutieren geübt wurde – oder der Ring zumindest nach außen hin seine Arbeit erfolgreich so präsentierte – deutet auch die Aussage in einem zeitgenössischen Artikel hin, daß es im Frauenring ‚Debattierclubs‘ gebe.412 1951 wurden vom Frauenring Hannover laut einem Entwurf für den Geschäftsbericht in Arbeitsgemeinschaften die Themen ‚Du und der Landtag‘ und ‚Der Landtag durch die Parteibrille gesehen‘ behandelt.413 Und in der Welt der Frau hieß es 1952, daß „für die staatsbürgerliche Arbeitsgemeinschaft des Frauenringes Hannover, die an 3 Abenden in der letzten Septemberwoche durchgeführt wurde […] so viele Anmeldungen“ eingegangen seien, „daß in der folgenden Woche en Parallelkursus mit den gleichen Themen eingerichtet wurde.“ Referentinnen waren nach den Informationen der ‚Welt der Frau‘ Grete Sehlmeyer, die über „die politische Krise der Gegenwart und die deutsche Staatsbürgerin“ sprach, Friede Rothig, die über ‚Brennende sozialpolitische Probleme der Gegenwart‘ referierte, und eine Frau Schulze-
409 Stadtarchiv Hannover, DEF, G 2t I u II, Frauenring Hannover, Sekretariat an den Deutsch-Evangelischen Frauenbund, 05.08.1948. 410 Ebd. 411 Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 147 412 Sybill: Porträt. 413 DFR-Archiv, A1, Zusammenstellung von Fakten für den 1. Geschäftsbericht zur 1. Hauptversammlung 1952 durch Maria Prejawa, ehrenamtl. Geschäftsführerin, 1951.
626 | Theanolte Bähnisch
Gattermann aus Göttingen, die sich zum Thema ‚Presse und öffentliche Meinung‘ äußerte.414 6.5.5.4 Mitgliederinteressen, Einflußmöglichkeiten, (Willens-)Bildungsprozesse – eine Doppel-Strategie bestimmt das Club-Leben Wie viele Mitglieder der ‚Club deutscher Frauen‘ hatte und wie oft Treffen stattfanden läßt sich aus den wenigen Quellen, die überliefert sind, nicht rekonstruieren. Der von Henicz und Hirschfeld interviewten ‚Hedwig S.‘ zufolge waren bei größeren Veranstaltungen des Clubs jeweils 60 bis 120 Frauen, auf einer Veranstaltung, an der auch Frauen aus dem Ausland teilnahmen, sogar etwa 300 Frauen zusammengekommen. Die von ihnen interviewten Frauen hätten angegeben, so Henicz und Hirschfeld, daß etwa einmal im Monat ein Treffen des Vorstands stattgefunden hätte, auf dem die Arbeit der einzelnen Ausschüsse koordiniert und weitere Planungen besprochen worden seien.415 Auch über die soziale Zusammensetzung des Clubs und die Altersstruktur seiner Mitglieder lassen sich nur vage Aussagen machen. Mitgliederlisten sind aus dem untersuchten Zeitraum nicht überliefert. Da die politische Strategie des Clubs darin bestand, Einfluß über seine VorstandsMitglieder auszuüben, welche Positionen an wichtigen Schnittstellen bekleideten, ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß über die Ausrichtung der Club-Politik basisdemokratisch entschieden wurde. Henicz und Hirschfeld zufolge habe die Form der Einflußnahme, welche der Club über seine prominenten Mitglieder ausgeübt hätte, jene Frauen von der Mitarbeit ausgeschlossen, „die nicht über derartige Beziehungen verfügten“416, womit die Mitgliederstruktur schnell festgelegt gewesen sei. Die Möglichkeiten, sich im Club zu engagieren, seien vom Bildungs- und Berufsstand abhängig gewesen und die hieraus resultierenden Konflikte hätten bei ihren Interviewpartnerinnen zum Eindruck eines „Herausdrängens der Arbeiterinnen“417 aus dem Club geführt, so die Autorinnen. Die Mitglieder an der Basis scheinen tatsächlich nicht in die Einflußnahme auf Verwaltung und Politik, welche einen wichtigen Teil des ‚Kern-Geschäfts‘ ausmachte, aber Kenntnisse über Verwaltungsabläufe und Entscheidungsstrukturen voraussetzte, eingebunden gewesen zu sein. Bähnischs Vordstellung, daß die weniger erfahrenen Frauen im Club von den erfahreneren lernen sollten, wie man an den entsprechenden Stellen Einfluß nimmt, verdeutlicht zwar zum einen, daß der Präsidentin tatsächlich an der politischen Bildung der Club-Mitglieder gelegen war, unterstreicht jedoch gleichzeitig eine Zweiteilung der Club-Arbeit in ‚Lobbying‘ auf der einen und ‚Unterricht‘ auf der anderen Seite. Die Club-Arbeit dürfte deshalb von den Vorstands-Mitgliedern sowie anderen Akademikerinnen im Club und den ‚einfachen‘
414 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/100, Abschrift aus Welt der Frau, 6. Jg. (1952), Heft 9, S. 23. 415 Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Club, S. 129. 416 Ebd., S. 131. 417 Ebd., S. 132.
Club deutscher Frauen | 627
Mitgliedern an der Basis deshalb sehr unterschiedlich wahrgenommen worden sein. Eine gewisse, vielleicht kaum bewußte Multiplikatorinnen-Funktion werden – das erwähnen Henicz und Hirschfeld nicht – allerdings auch die Basis-Mitglieder auf der Ebene der Mund-zu-Mund-Propaganda in Betrieben oder im Freundes- und Nachbarschaftskreis übernommen haben. Dafür Belege zu finden, dürfte sich allerdings schwierig gestalten. Die Interviewpartnerin ‚Herta D.‘418 fühlte sich vom Club in ihren eigenen Interessen, vor allem was die Anhebung der Löhne für Frauen und die Möglichkeit, Kinder während der Arbeitszeit unterzubringen betraf, nicht gut vertreten. Der Club habe eher für die Interessen von gebildeten Frauen gearbeitet: „Daß zum Beispiel Akademikerinnen entsprechend ihren Fähigkeiten eingesetzt werden müssen […] Aber das war zu einer Zeit, da war noch Hunger überall“419, verlieh die Interviewpartnerin ‚Herta D.‘ ihrem Unverständnis Ausdruck. Vor dem Hintergrund von Bähnischs Sozialisation ist anzunehmen, daß ihr die Sorgen der Akademikerinnen und die Möglichkeiten, deren Interessen zu vertreten – allein schon aus ihrer Mitarbeit bei den Soroptimistinnen – sehr viel geläufiger waren. Ob und inwiefern sich die Präsidentin oder andere Vorstandsmitglieder sich dennoch für die Interessen von Nicht-Akademikerinnen eingesetzt hatten, läßt sich auf der Basis des vorhandenen Materials nicht beantworten. Daß sich der Club beispielsweise für eine gleichberechtigte Bezahlung von Arbeiterinnen mit Arbeitern eingesetzt hätte, ist nicht überliefert, damit jedoch nicht ausgeschlossen. Immerhin hatte – wie bereits erwähnt – Luise Kipp-Kaule, ein prominentes Gewerkschaftsmitglied, auf einer Club-Veranstaltung zum Thema ‚Arbeit von Frauen in Betrieben‘ gesprochen. Daß dabei auch das Thema ‚gleicher Lohn‘ zur Sprache kam, ist durchaus wahrscheinlich. Stärker als Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld reflektieren die von den Autorinnen zitierten Arbeiterinnen die Überzeugung der Club-Vorstands-Mitglieder, im Engagement professioneller Frauen in Verwaltung und Politik läge eine grundsätzlich erfolgversprechende Möglichkeit dafür, gesellschaftliche Probleme zu überwinden. Folgt man jener Logik, war es konsequent, daß die Frauen eine entsprechende Politik verfolgten und sich darauf konzentrierten, Entscheidungsstrukturen durch Eingaben und durch eine strategische Personalpolitik, die in den folgenden Jahren noch deutlicher zutage treten sollte420, in ihrem Sinn zu beeinflussen. Wie die Protagonisten der bürgerlichen Sozialreform in der SAG der Meinung waren, daß die Gesellschaft sich ändere, wenn in ihren Kreisen sozialisierte Juristen Verhandlungen
418 Aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich hierbei um Herta Dürrbeck, die als ‚Landesfrauenleiterin‘ des DFD für Niedersachsen zuständig war und den DFD im Allgemeinen über den Stand der Frauenarbeit in der Region sowie über Bähnischs Handeln im Speziellen informierte. Vgl.: BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Protokoll der Sitzung der Landesfrauenleiterinnen der britischen Zone am 03. Juli 1947 in Hannover, o. V., o. D. [Wahrscheinlich ist das Protokoll von Milli Bölke aus Berlin verfaßt worden, ihr Vorname steht handschriftlich auf dem Protokoll]. 419 Herta D., zitiert nach Henicz/Hirschfeld: Club. 420 Siehe vor allem Kapitel 8.5.2 und 8.5.3.
628 | Theanolte Bähnisch
führen und Unternehmen leiten würden, so waren Bähnisch und ihre Mitstreiterinnen – anknüpfend an die Politik der Bürgerlichen Frauenbewegung in der Weimarer Republik, die wiederum mit Projektträgern wie der SAG Berlin-Ost kooperiert hatte – der Meinung, daß die Mitarbeit gut ausgebildeter Frauen in Verwaltung und Politik die Gesellschaft verändern könne. Daß diese Überzeugung von der gleichen asymmetrischen Grundhaltung gegenüber ‚einfachen‘ Bürgern getragen wurde, wie die Arbeit der SAG, steht außer Frage. Dennoch wertet Henics und Hirschfelds Interviewpartnerin ‚Dora G.‘421 den Umstand, daß die Zusammenarbeit der sehr verschiedenen Frauen konfliktbehaftet war und daß die ‚Arbeiterinnen‘ darauf mit Rückzug reagierten nicht als alleinigen Fehler der ‚bürgerlichen Frauen‘. „Die Frauen haben selber Schuld gehabt, wenn sie nicht abgezogen wären, wenn wir erst Fuß gefaßt hätten, dann hätten wir auch die Inhalte mit bestimmen können“422, lautete die Einschätzung ‚Dora G.‘s, über deren Realitätsnähe sich allerdings nur spekulieren läßt. In der ‚Startphase‘ des ‚Club deutscher Frauen‘ schienen zwei wesentlichen Ziele Bähnischs, nämlich 1.) daß ‚interessierte Frauen‘ im Club von ‚erfahrenen Frauen‘ etwas über politische Einflußnahme lernen sollten423, und 2.) die Einflußnahme durch Vorstandsmit-glieder auf Behörden weitgehend unverbunden nebeneinander gestanden zu haben.424 Für die Regierungspräsidentin war die Schulung des „staatsbürgerlichen Sachverstandes“425 erklärtermaßen Voraussetzung für eine gesellschaftliche Einflußnahme von Frauen. Daß in dieser Hinsicht ‚ungeübte‘ Basis-Mitglieder die politische Arbeit des Clubs mitbestimmten, war nicht im Sinn seiner Präsidentin. Christl Ziegler zufolge veränderte sich dies auch in den späteren Jahren nicht. „Anders als in Bildungskonzeptionen britischer Frauenorganisationen stand hier vor einem öffentlichen Mitwirken der Erwerb theoretischer Kenntnisse“, konstatiert Zieg-
421 Hierbei muß es sich um Dora Gassmann gehandelt haben, die auch auf der Tagung von Bad Pyrmont sprach. Gassmann engagierte sich dem Sohn ihrer Freundin Herta Dürrbeck, Peter Dürrbeck, zufolge in der Frauenarbeit der KPD und war Betriebsrätin bei der Schokoladenfabrik Sprengel sowie Funktionärin bei der Gewerkschaft Nahrung-GenußGaststätten (NGG). Vgl.: Dürrbeck, Peter: Herta und Karl Dürrbeck. Aus dem Leben einer hannoverschen Arbeiterfamilie, Hannover 2010, S. 113/114. 422 Dora G., zitiert nach Henicz/Hirschfeld: Club, S. 133. 423 AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), Frauenbüro, 0244 A, Bähnisch: Werbung f. d. zentralen Frauenring in D’dorf, [Protokoll einer Rede Bähnischs aus der Überlieferung des Frauenbüros], o. D. [1946]. Bähnisch scheint im Protokoll nicht im Wortlaut wiedergegeben worden zu sein. 424 Ein über das SPD-Frauensekretariat überlieferter Bericht über den Club deutscher Frauen bestätigt diese Einschätzung: „Zur praktischen Durchführung der genannten Ziele sind Ausschüsse gebildet worden, deren Leiterinnen und ein Teil der Mitarbeiterinnen aus dem jeweiligen Arbeitsgebiet über beste Sachkenntnisse und Berufserfahrungen verfügen. Ein anderer Teil der Mitarbeiterinnen soll lernen, auf einem bestimmten Gebiet sachliche Arbeit zu leisten und selbständig Stellung zu nehmen.“ AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), Frauenbüro, 0244 A, Club deutscher Frauen Hannover, Abschrift, o. V., o. D. [Spätsommer 1946]. 425 Vgl.: O. V.: Schubfach.
Club deutscher Frauen | 629
ler im Zusammenhang mit ihrer Darstellung einer von Bähnisch im Jahr 1949 geleiteten Konferenz. „Das Prinzip des politischen Lernens durch ein praktisches öffentliches Engagement hat also keinen Eingang in die politische Bildungskonzeption des Deutschen Frauenrings gefunden“426, urteilt die Erziehungswissenschaftlerin. Ohne eine detaillierte Analyse der Verhältnisse in den regionalen Gruppen, die, angeregt durch Bähnisch, zwischen 1947 und 1949 den Status von Frauenringen annahmen, läßt sich allerdings nicht sagen, wie die beschriebene ‚politische Bildungskonzeption‘ in die Praxis umgesetzt wurde.
6.6 DER CLUB IN DER AUSEINANDERSETZUNG MIT ANDEREN POLITISCHEN UND GESELLSCHAFTLICHEN KRÄFTEN 6.6.1 Nur eine Frauenorganisation unter vielen? Der Club und die ‚Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände‘ in Hannover Ihre grundsätzliche Bereitschaft, mit Frauen unterschiedlicher politischer Überzeugungen zusammen zu arbeiten, und ihr Interesse, eine solche Zusammenarbeit zu koordinieren, bewies die Vorsitzende des ‚Club deutscher Frauen‘ auch durch ihre Vorreiterfunktion in der ‚Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände‘ in Hannover. Einem Protokoll von Dr. Martha Pfad427, der ersten Vorsitzenden des Frauenkreises der CDU428, ist zu entnehmen, daß die erste Zusammenkunft verschiedener FrauenVerbände und der Frauensektionen diverser Parteien und Verbände am 13.08.1946, also nur wenige Wochen nach der Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘ statt-
426 Ziegler: Lernziel, S. 129. 427 Martha Pfad wurde am 24.04.1897 als Martha Laureck in Schalke geboren und starb am 19.04.1974 in Garbsen bei Hannover. Sie war 1946 in der Redaktion der ‚NiedersachsenZeitung‘ tätig und verfaßte diverse Artikel zum Thema ‚Frau und Politik‘. 1940 hatte sie Dr. Bernhard Pfad, den späteren ersten niedersächsischen CDU-Vorsitzenden, geheiratet. In der Gründungsphase der CDU schien Martha Pfad sehr aktiv gewesen zu sein, Anfang der 50er Jahre zog sie sich jedoch aus der Politik zurück. Vgl.: Kulhawy, Andreas: Geschichte der Frauen-Union in Niedersachsen, Hannover 2011, S. 8/9. Die Aussage Kulhawys, daß Pfad „sehr wahrscheinlich die erste Vorsitzende der CDU-Frauenausschüsse im Land Hannover“ war, zeigt, daß in dieser Hinsicht noch Forschungsbedarf besteht. Kulhawy: Frauen-Union, S. 9. 428 Ein genaues Gründungsdatum der ‚CDU-Frauenausschüsse‘ läßt sich Kulhawy zufolge nicht feststellen. Als erstes sicheres Datum nennt er eine Tagung am 24.08.1940 in Hannover mit 40 Delegierten. Diese seien von Pfad begrüßt worden, so Kulhawy – was wiederum Rückschlüsse auf deren Stellung zuläßt. Vgl.: Kulhawy: Frauen-Union, S. 13, nach einem Bericht in der Niedersächsischen Rundschau vom 31.08.1946, S. 2.
630 | Theanolte Bähnisch
fand.429 Wie oft in den folgenden Monaten Versammlungen abgehalten wurden, ließ sich aus dem Bestand des Stadtarchivs Hannover, in dem Material über örtliche Frauenverbände und die Frauenarbeit in den Parteien überliefert ist430, nicht rekonstruieren. Dem Protokoll über die Veranstaltung vom 13.08.1946 ist jedoch zu entnehmen, daß zu diesem Zeitpunkt bereits eine Folge-Versammlung geplant war. Auf dieser sollte der Zusammenschluß der Verbände, die bisher nur einen Arbeitskreis bildeten, zu einer Arbeitsgemeinschaft vollzogen werden. Deren Funktion sollte darin bestehen, „als Vertretung aller Frauen bei besonderen Anlässen“431 aufzutreten. Ob tatsächlich alle im Arbeitskreis vertretenen Frauenverbände und -sektionen der Parteien und Verbände der Überzeugung anhingen, daß Frauen per se Sonderziele und -interessen hätten, die von jenen der Männer abwichen und entsprechend vertreten werden müßten, läßt sich den überlieferten Unterlagen nicht entnehmen. Die (politische) Bandbreite der auf der ersten Versammlung repräsentierten Verbände sowie jener, deren Einladung zur nächsten Versammlung zusätzlich vorgesehen war, beeindruckt. Laut Protokoll hatten folgende Verbände und Parteien Delegierte zur ersten Veranstaltung entsandt: Die „Internationale[…] Frauenliga für Frieden und Völkerversöhnung“432, die SPD, die KPD, die FDP, die Niedersächsische Landespartei (NLP)433, die Deutsche Rechtspartei (DRP)434, die Frauenabteilung des Kulturbunds, der Katholische und der Deutsch-Evangelische Frauenbund (KDFB und DEF), die Gewerkschaften, der Club junger Menschen und der Club deutscher Frauen. Damit war, wenn man so will, die Stimme Bähnischs im Arbeitskreis gleich doppelt vertreten. Wie viele und welche Vertreterinnen die von Bähnisch begründeten Organisationen jeweils in den Arbeitskreis entsandt hatten, ist dem Protokoll, das Martha Pfad über die Versammlung führte, allerdings nicht zu entnehmen. Auf den Vorschlag der CDU-Delegierten hin sollten zu weiteren Veranstaltungen noch der Katholische Fürsorge-Verein, der Verein Freundinnen junger Mädchen, die Evangelische Frauenhilfe, der Katholische und der Evangelische Sozialbeamtinnen-
429 Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 45 Ergebnis der Zusammenkunft verschiedener Frauenverbände am Dienstag den 13.08.46 im Clubhaus Hannover, Nienburgerstr. 1 a, 13.08.1946. 430 Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 45. 431 Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 45, Ergebnis der Zusammenkunft verschiedener Frauenverbände am Dienstag den 13.08.46 im Clubhaus Hannover, Nienburgerstr. 1 a, 13.08.1946. 432 Gemeint ist vermutlich die ‚Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit‘ (IFFF). 433 Die NLP benannte sich im November 1946 nach der Gründung des Landes Niedersachsen in ‚Deutsche Partei‘ (DP) um und konnte ihre Arbeit erfolgreich auf die angrenzenden Bundesländer ausdehnen. 434 Zur DKP-DRP (Deutsche Konservative Partei–Deutsche Rechtspartei) hatten sich im Juni 1946 die ‚Deutsche Konservative Partei‘, die ‚Deutsche Aufbaupartei‘ und die ‚Deutsche Bauern- und Landvolk Partei‘ vereinigt. Das Parteiprogramm der Deutschen Rechtspartei, die 1950 in der Deutschen Reichspartei (ebenfalls als DRP bezeichnet) aufging, stammte in weiten Teilen von Hans Zehrer, der als eine zentrale Figur der sogenannten ‚Konservativen Revolution‘ gilt.
Club deutscher Frauen | 631
Verein sowie der interkonfessionelle Sozialbeamtinnen-Verein eingeladen werden. Von „anderer Seite“435 waren laut Protokoll noch die GEDOK und die Freie Deutsche Jugend (FDJ) als Ansprechpartner genannt worden. Damit war vom weit linken (IDFF, KPD, Kulturbund) bis zum äußeren rechten Flügel (DRP) das gesamte politisch Spektrum präsent oder zur Mitarbeit im Arbeitskreis vorgesehen. Diese Verhältnisse spiegelten sich auch im vorläufigen geschäftsführenden Ausschuß: In das vierköpfige Gremium wurden am 13.08.1946 Frau Dr. Pfad von der CDU, Frau Rodemann von der Internationalen Frauenliga, Frau „Jäger“436 von der DRP und eine Frau Bosse437 vom Kulturbund gewählt. Diese potentiell explosive politische Zusammensetzung des Vorstands ist – um die Entwicklungen der folgenden Jahre wissend – bemerkenswert. Sie darf als Beweis für eine grundsätzlich weitreichende Bereitschaft zur Lager-übergreifenden Zusammenarbeit unter den Hannoveraner Frauen interpretiert werden. Umso bedeutsamer ist es, daß die Initiative zu dieser Zusammenarbeit offenbar von Theanolte Bähnisch ausgegangen war. Bereits die erste Versammlung der Frauenverbände im August 1946 hatte im Clubhaus des ‚Club deutscher Frauen‘ in der Nähe des Königsworther Platzes stattgefunden.438 Die designierte Regierungspräsidentin sorgte auch dafür, daß im Oktober 1946 alle Hannoverschen Frauenorganisationen nochmals dazu eingeladen wurden, am 18.10.1946 nachmittags um 17 Uhr,
435 Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 45, Ergebnis der Zusammenkunft verschiedener Frauenverbände am Dienstag den 13.08.46 im Clubhaus Hannover, Nienburgerstr. 1 a, 13.08.1946. 436 Dabei muß es sich um Elfriede Jaeger gehandelt haben. Die 1899 geborene Jaeger rückte 1952 als fraktionslose Abgeordnete für Fritz Rößler, alias ‚Dr. Franz Richter‘, in den Deutschen Bundestag nach, nachdem dessen tatsächliche Identität enttarnt worden war. Rößler war Gau-Hauptstellenleiter der NSDAP in Sachsen gewesen. Ursprünglich hatte Jaeger auf der Liste der DKP-DRP kandidiert, deren Bundesvorsitzender zeitweilig ihr Ehemann, Wilhelm Jaeger, war. 1953 kandidierte sie für den Dachverband der Nationalen Sammlung (DNS). Das ‚M. d. B.‘ weist Jaeger, die 1964 in Hannover starb, als Angestellte der Wehrkreisverwaltung Hannover von 1939 bis 1945 sowie als „Mitbegründerin u. Vorstand sowie Gründerin der Frauenarbeitsgemeinschaft“ der (DKP-)DRP nach. Art.: Jaeger (Hannover), Elfriede, in: Schumacher, Martin/Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien: M. d. B: Die Volksvertretung 1946–1972: Wiederaufbau und Wandel 1946–1972, online auf: http://www.kgparl.de/onlinevolksvertretung/pdf/mdb-i.pdf, am 13.12.2013, S. 553. 437 Vermutlich war dies die Gymnastiklehrerin Gertrud Bosse. Vgl.: Baumgarte, Kurt: Tanz, Kabarett und Agitprop. Erinnerungen an Gertrud Bosse, auf: http://www.hannover.vvnbda.de/hfgf.php?kapitel=29, am 13.12.2013. 438 Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 45, Ergebnis der Zusammenkunft verschiedener Frauenverbände am Dienstag den 13.08.46 im Clubhaus Hannover, Nienburgerstr. 1 a, 13.08.1946.
632 | Theanolte Bähnisch
wiederum im Clubhaus, zu einer „grundlegenden Besprechung“439 zusammen zu kommen. „In dieser Sitzung soll endgültig Klarheit geschaffen werden, über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit der Frauen aller Richtungen in der Stadt Hannover“440, stand in der Einladung. Nicht nur die Orts-, sondern auch die Landesleitungen der Verbände waren, sofern sie einen Sitz vor Ort hatten, eingeladen worden, eine Vertreterin zur Zusammenkunft zu entsenden. Wie viele Folgeveranstaltungen in einer solchen oder in einer anderen Zusammensetzung stattfanden ist in den verwendeten Quellen nicht überliefert. Einer Aktennotiz des DEF zufolge hatten sich am 30.08.1948 Vertreterinnen des DEF, des KDFB, des Landfrauenverbandes, des Vereins Frauenkultur, des DRK, der jüdischen Wohlfahrt, des Akademikerinnenverbandes, der (katholischen?) Fürsorgerinnen, der Landeskirchlichen Frauenarbeit und eine Frau von Alvensleben, die nach Auskunft eines DEF-Mitglieds sowohl zum „Freundinnenverein“441 als auch zur Bahnhofsmission gehörte, versammelt.442 Daß Bähnisch die Anstrengung, alle Frauenorganisationen und -sektionen von Parteien und Verbänden in Hannover zusammen zu trommeln, auf sich nahm, war, wie bereits angedeutet wurde und an anderer Stelle weiter ausgeführt werden wird, nicht zuletzt dem Wunsch der Britischen Militärregierung geschuldet. Diese strebte die Etablierung einer ähnlichen Dachorganisation von Frauenverbänden, wie sie die WGPW in Großbritannien darstellte, in Deutschland an. Frauenausschüsse oder arbeitskreise, in denen alle Frauen, die sich gesellschaftlich organisieren wollten, zusammenkommen konnten, waren in der Militärregierung, nicht zuletzt aufgrund der Empfehlungen der WGPW wohlgelitten. Bähnischs Handeln wird auch von der Hoffnung getragen worden sein, über den Arbeitskreis auch jene Frauen zu erreichen, die nicht Mitglieder des ‚Club deutscher Frauen‘ werden wollten, sich aber einer anderen Verbindung angeschlossen hatten. Womöglich schwebte ihr bereits zu dieser Zeit vor, in nicht allzu ferner Zukunft eine Dachorganisation von Frauenzusammenschlüssen zu leiten.443
439 Stadtarchiv Hannover, DEF, 2 G t I u II, der geschäftsführende Ausschuß, i. A. Martha Pfad und Luise Spengemann an alle Hannoverschen Frauenorganisationen, z. Hd. Frl. Haccius für den Deutsch-Evangelischen Frauenbund, 09.10.1946. 440 Ebd. 441 Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 45, Aktennotiz des DEF, Besprechung bei Frau Bänisch (!) am Montag, den 30.08.1948. 442 Ebd. 443 Darauf deutet jedenfalls der Briefverkehr mit der Militärregierung hin, in dem es um die Lizenzierung des Club deutscher Frauen ging. Materialsammlung Karin Ehrich zum ‘Club deutscher Frauen‘, Eric W Debney, Major, HQ Mil Gov RB Hannover OCG (HE) [(! – Gemeint ist CCG (BE)] an Chief of the Administration, Attention of Frau Bähnisch, 18.05.1946, beglaubigte Abschrift. Im Schreiben der Militärregierung wird Bähnisch mitgeteilt, daß der ‚Club deutscher Frauen‘ zwar vorerst auf die Region beschränkt bleiben müsse, daß jedoch eine Ausweitung bis hin zum ‚zonal level‘ möglich sei, wenn sich der Club bewähre.
Club deutscher Frauen | 633
6.6.2
Der Umgang des Clubs mit ‚seinen‘ Kommunistinnen
Barbara Henicz und Margret Hirschfeld zufolge waren im Hannoveraner Club persönliche Vorbehalte zwischen den Mitgliedern mit Differenzen aufgrund parteipolitischer Bindungen zusammengefallen. So sei die Vorsitzende Mitgliedern der KPD gegenüber sehr mißtrauisch gewesen und habe von diesen sogar die Vorab-Vorlage von Referaten, welche auf Konferenzen gehalten werden sollten, eingefordert. Der Anspruch, eine „gemeinsame überparteiliche Interessenvertretung aufzubauen“444, habe nicht funktioniert, fassen Henicz und Hirschfeld im Hinblick auf die Hürden für Frauen aus der KPD zusammen. Ob Theanolte Bähnisch jedoch jemals wirklich daran interessiert war, eine überparteiliche Interessenvertretung aufzubauen, welche Kommunistinnen einschließen sollte, ist fraglich. ‚Überparteiliche Arbeit‘ definierte sie, spätestens ab dem Winter 1946/47, als eine Zusammenarbeit von Frauen aller Parteien – mit Ausnahme von Kommunistinnen. Im Januar 1947 begann sie, wie in den nächsten Kapiteln deutlich werden wird, aktiv, den Einfluß von Kommunistinnen in der deutschen Frauenbewegung zurückzudrängen. Daß die Vize-Regierungspräsidentin Mitte 1946 den Club unter Einschluß von Kommunisten gründete und daß es zur Zusammenarbeit mit Elfriede Paul im Vorstand kam445, läßt sich aus verschiedenen Zusammenhängen heraus begründen: Zunächst einmal war die Spaltung der Alliierten, der politischen Lager in Deutschland und schließlich des Landes, wie sie sich später entwickeln sollte, Mitte 1946 nicht absehbar. Zu einer Zeit, in der noch nicht klar war, wie sich die Machtverhältnisse im Land zukünftig entwickeln würden, wäre es unklug gewesen, nicht mit der für die kommunistische Partei bedeutenden Protagonistin Paul, die zudem über Edith Davies den Kontakt zur britischen Militärregierung aufgebaut hatte, zu kooperieren. Die Zusammenarbeit mit der Ärztin und NS-Widerstandsaktivistin in der ‚Roten Kapelle‘ ergab für die Ziele der Regierungspräsidentin auch insofern Sinn, als dass sie ihr Handeln während des Nationalsozialismus in der Retrospektive ebenfalls in jenem Widerstandszirkel, in dem sich auch Adolf Grimme und Ernst von Harnack engagiert hatten, verortete. Daß die ‚Rote Kapelle‘ bald den Ruf einer kommunistischen Spionageorganisation haben würde446, daß es deshalb sogar politisch gefährlich sein konnte, mit ihr in Verbindung gebracht zu werden, zeichnete sich zu jener Zeit noch nicht ab. Jedoch ist es unwahrscheinlich, daß sich die Regierungspräsidentin nur von Kalkül leiten ließ. Auch ganz persönliche, emotionale Beweggründe dürften eine Rolle gespielt haben. Daß Bähnisch auch deshalb zu einer Zusammenarbeit mit Paul neigte,
444 Henicz/Hirschfeld: Club, S. 133. 445 Der Eintragung des Clubs im Vereinsregister vom 18.09.1946 zufolge war Elfriede Paul sogar die stellvertretende Vorsitzende des ‚Club deutscher Frauen‘. 1952 wurde Gerda Landsberger erste Vorsitzende des nun als ‚Frauenring Hannover‘ bezeichneten Clubs, eine Frau Brunnecke wurde Kassenführerin und Dr. Getrud Jäckl Schriftführerin. Materialsammlung Karin Ehrich zum ‚Club deutscher Frauen‘, Amtsgericht Hannover, Vereinsregisterauszug, Nr. 98. 446 Siehe Kapitel 4.3.2.3.
634 | Theanolte Bähnisch
weil sie sich durch die gemeinsame Ablehnung des Nationalsozialismus mit ihr verbunden fühlte und weil sie mit ihr Freunde und Bekannte wie Adolf Grimme teilte, ist durchaus wahrscheinlich. Zudem war die Anzahl der Frauen, welche 1946 öffentliche Ämter in der Region bekleideten, überschaubar. Allein schon aus diesem Grund bot sich die Kooperation der Frauen miteinander an – schließlich hatte man sich eine bessere Stellung von Frauen in der Gesellschaft als gemeinsames Ziel gesetzt. Schlußendlich mag die Zusammenarbeit der Vize-Regierungspräsidentin mit Paul und anderen Kommunistinnen im ‚Club deutscher Frauen‘ auch von der Hoffnung getragen worden sein, die Frauen würden ihren politischen Standpunkt im Gespräch mit Mitgliedern anderer Parteien womöglich verändern. Je stärker jedoch das kommunistische Feindbild gegenüber dem nationalsozialistischen an Raum gewann, je stärker sich abzeichnete, daß der Kampf der Kommunistinnen für die Emanzipation der Frauen auf ein Frauenbild und ein Geschlechterverhältnis hinarbeitete, das die ‚Bürgerlichen‘ teils überwinden, teils verhindern wollten, desto geringer wurde die Grundlage für eine Zusammenarbeit. Am Ende überwog die Angst vor den Kommunistinnen die Hoffnung, gemeinsam mit Frauen (auch) aus dieser Partei ein besseres Deutschland aufbauen zu können. Eine ‚weiße Weste‘ in Bezug auf den Nationalsozialismus forderte der Club indessen nicht, die Mitgliedschaft von ehemals bekennenden Nationalsozialistinnen war vermutlich sogar gewollt. Schließlich war die Gründung des ebenfalls von Bähnisch geleiteten ‚Club junger Menschen‘ mit der – wie sich herausstellen sollte, berechtigten – Hoffnung verbunden, daß sich vom Club-Angebot auch HJ-Funktionäre angesprochen und durch die Club-Arbeit zu anderen Überzeugungen gelangen würden. Daß auch in den ‚Club deutscher Frauen‘ entsprechende Hoffnungen gesetzt wurden, ist wahrscheinlich, zumal er von der Militärregierung als ein sehr geeigneter Rahmen zur Frauen-Re-education angesehen wurde. Folgt man jener Logik, so hätten vor allem die im Dritten Reich sozialisierten Frauen im Fokus der Club-Arbeit stehen müssen. Ob es dem Club jedoch gelingen sollte, diese Frauen anzusprechen, blieb abzuwarten. 6.6.3
Die Reaktion der ‚Abteilung Frauenkreis‘ in der CDU auf die Club-Arbeit
Theanolte Bähnisch hatte mit ihrer staatsbürgerlichen Frauenbildung beziehungsweise mit ihrer frauenpolitischen Arbeit besonders jene Frauen im Visier, die sich nicht in einer Partei engagieren wollten. Daß sie sich dabei dennoch mit ‚politischen Themen‘ auseinandersetzte und auf die Empfindlichkeiten linientreuer weiblicher Parteimitglieder wenig Rücksicht nahm, zog bald einige Kritik aus den Reihen der CDU und erbitterten Widerstand aus der SPD nach sich. Nach Kriegsende hatten sich nicht nur überparteiliche Frauenausschüsse, konfessionelle Frauen-Verbände und Frauen-Berufs- sowie Wohltätigkeitsorganisationen (wieder) gegründet. Auch die Parteien hatten ihre Frauenarbeit wiederaufgenommen beziehungsweise eine entsprechende Arbeit neu etabliert. KPD und SPD konnten bereits auf eine längere Tradition in der politischen Mobilisierung und der politischen
Club deutscher Frauen | 635
Bildung von Frauen zurückblicken.447 Wenig ausgeprägt war die organisierte Frauenarbeit dagegen in den liberalen und bürgerlichen Parteien – wenn auch prominente Einzelmitglieder herausragende Leistungen auf dem Gebiet der ‚Frauenpolitik‘ vollbracht hatten. Am Beispiel Hannover läßt sich zeigen, daß im Zuge der auch von den demokratischen Parteien angestrebten ‚Umerziehung‘ der Bevölkerung – weg vom nationalsozialistischen Gedankengut hin zur demokratischen Partizipation – ein Konkurrenzdenken innerhalb der CDU gegenüber überparteilichen Frauenzusammenschlüssen existierte. Der Frauenkreis der CDU definierte die politische Bildung von Frauen als ‚sein‘ Terrain und wollte dementsprechend der überparteilichen Organisation Bähnischs die Spielregeln diktieren. Den CDU-Frauen stieß auf, daß Bähnisch und ihre Mitstreiterinnen zum einen ‚überparteilich‘ nicht gleichbedeutend mit ‚unpolitisch‘ verstanden wissen wollten und daß sie zum anderen ihren Politik-Begriff selbst definieren wollten. Die ‚Abteilung Frauenkreis‘448 der CDU Hannover hatte dem mittlerweile von Theanolte Bähnisch geleiteten, auf zonaler Basis zugelassenen ‚Frauenring‘ – dem der ‚Club deutscher Frauen‘ zu dieser Zeit bereits als Hannoveraner Ortsverband angeschlossen war – am 06.11.1948 in Reaktion auf die Einladung zu einer Landtagswahl-Informationsveranstaltung mitgeteilt, daß er „mit dem Vorschlag einer Versammlung in dem […] vorgetragenen Sinne nicht einverstanden sein“449 könne. Die CDU-Frauen verwiesen durch die bereits im Kontext des Arbeitskreises der Frauenverbände erwähnte Dr. Martha Pfad darauf, daß es ihrer Meinung nach „nicht Sache des weltanschaulich und politisch neutral sein wollenden Frauenringes ist, sich mit so akuten Ereignissen wie z. B. den bevorstehenden Kommunalwahlen zu beschäftigen.“ Vielmehr sei es Sache der Parteien, „auch die Frauen über die hier in Frage kommenden Probleme aufzuklären“450. Daß Bähnischs Verband politische Bildungsarbeit durch die Aufklärung der Frauen in der Stadt über ihre Rechte und Pflichten als Wählerinnen leisten wollte, war bei der Abteilung Frauenkreis der CDU gar nicht willkommen. „Jede Frau hat Gelegenheit genug, sich in Versammlungen und auch durch Tageszeitungen und Schriften über die Bedeutung der Kommunalwahlen und
447 Vgl. zur SPD: Frauenmuseum Bonn/Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Hrsg.): Schwestern zur Sonne zur Gleichheit: Wegmarken der Geschichte der SPDFrauenpolitik, Bonn 2013. Vgl. zur KPD: Kontos, Silvia: Die Partei kämpft wie ein Mann. Zur Frauenpolitik der KPD in der Weimarer Republik, Frankfurt a. M./Basel 1978. 448 Die ‚Abteilung Frauenkreis‘ war Vorläufer der heute noch existierenden ‚Frauen-Union‘. Vgl.: Kulhawy: Frauen-Union. Der Facebook-Seite der Frauen-Union Niedersachsen zufolge ist das genaue Gründungs-Datum der Frauen-Union nicht feststellbar. Als Datum einer ersten größeren Versammlung wird hier, wie bei Kulhawy, der 24.08.1946 angegeben. Vgl.: Facebook-Seite der Frauen-Union Niedersachsen, auf: http://www.face book.com/FrauenUnionNiedersachsen, am 13.12.2013. 449 Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 45, Christlich Demokratische Union, Abt. Frauenkreis, Dr. Pfad an den Frauenring, 06.11.1948. 450 Ebd.
636 | Theanolte Bähnisch
die Ziele der Parteien zu orientieren“451, schrieb die 1897 geborene Pfad. Schon die von Bähnisch geplante Veranstaltung an sich war der Unions-Politikerin ganz offensichtlich ein Dorn im Auge. Vor allem aber störte sie sich daran, daß kein längerer Redebeitrag einer CDU-Kandidatin für die Veranstaltung am 19.11.1948 eingeplant war. Hilde Jünemann (SPD) und Grete Sehlmeyer452 (FDP), deren Parteizugehörigkeiten auf der Einladung zur Veranstaltung nicht vermerkt waren, sollten jeweils längere Referate zum Thema ‘Was muss die Hausfrau von Versicherungen, Steuern und Preisbildung wissen?‘ und zur Frage ‚Wie handhaben wir das neue Wahlrecht?‘ halten.453 Die Vorträge seien als „Appell an die Wahlfreudigkeit der Frauen“ gedacht, deshalb wende man sich an alle Parteien, mit dem Vorschlag, daß ihre weiblichen Kandidatinnen sich auf der Veranstaltung „mit kurzen Worten vorstellen“454, hatte Bähnisch erklärt und die Parteien dazu aufgerufen, Delegierte zur Veranstaltung zu schicken. Zu Wort kommen sollten die CDU-Frauen also durchaus. Der Frauenring handelte, so stellt es sich in der Einladung dar, nach bestem Wissen und Gewissen und hielt eine solche Veranstaltung für die „beste Form“ um „den Kontakt zwischen Wählern und Gewählten herzustellen und die Frauen für die Arbeit der Parteien im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen zu interessieren“455. Daß Sehlmeyer auf der Veranstaltung auftreten sollte, war vermutlich tatsächlich nicht ihrer Parteizugehörigkeit, sondern vielmehr dem Umstand geschuldet, daß ihre Lebensgefährtin Anna Mosolf dem Vorstand des ‚Frauenrings der britischen Besatzungszone‘ angehörte. Daß in Ergänzung zur 1891 geborenen Sehlmeyer die um 22 Jahre jüngere, 1913 geborene Hilde Obels-Jünemann456 auf der Veranstaltung sprach, war womöglich auf die Hoffnung zurückzuführen, daß die beiden Frauen unterschiedliche Generationen für die Veranstaltung interessieren konnten. Denn der ‚Frauenring‘ hatte es nicht leicht, jüngere Frauen für seine Arbeit zu interessieren. Wie sich jener Konflikt zwischen dem Frauenring und der CDU-Frauenarbeit in Hannover weiterentwickelte, ist nicht bekannt. Daß Gabriele Strecker, die 1947 den (überparteilichen) Bad Homburger Frauenverband mitgegründet hatte, maßgeblich im Frauenring mitarbeitete457, deutet darauf hin, daß die Konflikte zwischen dem überparteilichen Frauenring und den Protagonistinnen der Frauenarbeit in der CDU bald beigelegt wurden. Denn Strecker hatte parallel zu ihrem Engagement im Frauenverband und im Frauenring ab 1948 die CDU-Frauenarbeit mit aufgebaut und leitete schließlich die Frauenarbeit der Partei in Hessen von 1950 bis 1960. Martha Pfad
451 Ebd. 452 Die 1891 geborene Sehlmeyer war vom 20.04.1947 bis 05.05.1955 Mitglied des Niedersächsischen Landtages, bis 27.04.1954 als Mitglied der FDP-Fraktion. 453 Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 45, Frauenring Hannover, Theanolte Bähnisch an die Landesleitung der CDU, 25.10.1948. 454 Ebd. 455 Ebd. 456 Hilde Obels-Jünemann war bereits im August 1946 Mitglied des ernannten Hannoverschen Landtags. Von 1947 bis 1970 wurde sie in ihrem Mandat immer wieder bestätigt. 457 Vgl.: Strecker: Überleben sowie dies.: Frauenarbeit.
Club deutscher Frauen | 637
zog sich zu Beginn der 1950er Jahre aus der aktiven Politik zurück.458 Wann genau der Konflikt abebbte, beziehungsweise ob sich ein Umschwung in der CDU nachvollziehen läßt, steht noch zu klären aus. An dieser Stelle soll die Beschreibung der Hannoveraner Verhältnisse ausreichen. 6.6.4
Elisabeth Selbert (SPD) wird auf die überparteiliche Frauenarbeit aufmerksam
In den Akten der Militärregierung aus den Jahren 1947/48 wird die CDU einige Male im gleichen Kontext wie die SPD als Gegner des Frauenrings dargestellt. Gleichzeitig geht aus den Berichten hervor, daß der Unmut, mit dem die CDU in Hannover auf die politische Bildungsarbeit des Frauenrings reagierte, harmlos war, vergleicht man sie mit der Kritik, die Bähnisch bald aus ihrer eigenen Partei, der SPD, entgegenschlagen sollte.459 Bereits im März 1946 hatte Elisabeth Selbert460, die sogenannte ‚Mutter des Grundgesetzes‘, mit einem Aufsatz zum Thema ‚Überparteiliche Frauenbewegung‘ auf Pressekommentare über ‚selbständige Frauengruppen‘, die sich in Hessen sehr früh etabliert hatten, reagiert. „Nach dem Muster einer Frankfurter Gruppe, die Ende Januar ds. Js. mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit getreten ist, stellen die Gründerinnen eine Reihe von Forderungen auf, die zwar auf den ersten Blick bestechen, bei denen jedoch der politisch Geschulte in einigen Punkten das Empfinden hat, in die Zeiten vor 1918 zurückversetzt zu sein“461, hatte Selbert, damals Mitglied des SPDBezirksvorstands Hessen-Nord, über die ihr höchst suspekten Entwicklungen geschrieben. „Selbstverständliche“462 demokratische Forderungen wie die Gleichberechtigung dürften nicht als politische Programmpunkte herausgestellt werden, kritisierte Selbert die Ziele der Gruppen und knüpfte damit – ohne es auszusprechen – an die in der Sozialdemokratie vorherrschende Grundüberzeugung an, daß der Zustand einer sozialen Demokratie die Gleichberechtigung der Geschlechter unweigerlich nach sich zöge.463 „Unpolitische oder überparteiliche Frauenverbände können die
458 Vgl.: Kulhawy: Frauen-Union, S. 8/9. 459 NA, UK, FO 1050/1211, Basis for Memorandum on Policy with regard to Women’s Organisations, o. V., o. D. [1947], S. 2 sowie NA, UK, FO 1050/1211, Report on Women’s Affairs, 13.03.1947, Rita Ostermann. 460 Vgl.: Bussfeld/Hessische Landesregierung: Glücksfall. Der Band enthält auch eine ausführliche Biographie Selberts, die allerdings eher den Charakter einer Jubelschrift trägt. Vgl.: Drummer/Zwilling: Selbert. Vgl. auch: Gille, Karin/Meyer-Schoppa: Frauenrechtlerei und Sozialismus. Elisabeth Selbert und die sozialdemokratische Frauenpolitik in den westlichen Besatzungszonen, in: metis, 8. Jg. (1999), Heft 16, S. 22–41. 461 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 179 [Frauenbüro im SPD-Parteivorstand, Korrespondenz Hessen-Kassel, Hessen-Nord], Überparteiliche Frauenbewegung, 12.03.1946. 462 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 179, Überparteiliche Frauenbewegung, 12.03.1946. 463 Diese Überzeugung ist auf August Bebel zurückzuführen. Vgl.: Bebel, August: Die Frau und der Sozialismus, Neusatz der Jubiläumsausgabe 1929 [Erstauflage 1879], 3. Aufl., Bonn 1994.
638 | Theanolte Bähnisch
Politik des Staates nicht maßgeblich beeinflussen, sondern allein grosse politische Parteien, die ihre Vertreter in die Parlamente entsenden“464, betonte Selbert den politischen Gestaltungsanspruch der Parteien. Daß Frauenverbände sich anschickten, die Interessen der Frauen zu vertreten, war für sie als Parteipolitikerin nicht nachvollziehbar, schließlich waren Verbände, anders als Parteien, nicht durch Wahlen legitimiert.465 Im Interesse der „durchaus berechtigten und anerkannten Frauenforderungen“ empfehle es sich daher für die in dieser Art organisierten Frauen „dringend“, so Selbert, „ihr Arbeitsfeld in die politischen Parteien zu verlegen, um von dort aus Einfluss auf das staatliche Leben zu nehmen und dadurch die Möglichkeit der Durchsetzung ihrer Forderungen zu schaffen“466. Diese ‚Möglichkeit der Durchsetzung‘ bestand für Selbert wie für andere Parteipolitikerinnen darin, auf der Basis überzeugender Programme Wählerstimmen zu erhalten und derart legitimiert in ein Parlament einzuziehen. Daß sich die Dinge so entwickeln würden, daß sich die Arbeit der Frauenorganisationen also komplett in die Parteien verlegen würden, schien Selbert jedoch nicht wirklich geglaubt zu haben, anders läßt sich jedenfalls nicht erklären, daß sie den Frauengruppen im weiteren Verlauf ihrer Ausführungen ans Herz legte, doch die „so dringend notwendige staatsbürgerliche Schulung und Erziehung“ von Frauen zu übernehmen „und zwar ohne frauenrechtlerische Tendenzen“467. Selbert schien also – anders als Pfad – eine Funktion der überparteilichen Frauenzusammenschlüsse als ‚politische Vorfeldorganisationen‘, die allen demokratischen Parteien zuarbeiten sollten, anerkannt zu haben – zumal sie in einer solchen Arbeit einen Motor für die erklärtermaßen auch vom ‚Club deutscher Frauen‘ angestrebte Zusammenarbeit mit Frauen aus dem Ausland sah. Der Schwerpunkt der staatsbürgerlichen Schulung, so Selbert, solle in der „Anbahnung und Pflege aussenpolitischer Beziehungen liegen“, damit Deutschland „in dem Rat der Völker wieder einen ehrenvollen Platz einnehmen kann“468. Damit teilte das Mitglied des parlamentarischen Rats, das eine unmittelbare und direkte Auseinandersetzung der deutschen Bevölkerung mit dem Antisemitismus forderte469 und starke Kritik am Freispruch von Franz von Papen und Hjalmar Schacht in den Nürnberger Prozessen übte470, nicht nur ein wichtiges Ziel der Hannoveraner Regierungspräsidentin, sondern sie stand auch der von Bähnisch gewählten Rhetorik nicht fern. Die Behördenleiterin hätte zwar nie – wie die Kasslerin Selbert es tat – von der „ungeheuren Blutschuld des Dritten Reiches“ gesprochen, doch hofften beide Frauen auf eine, wie Selbert es formulierte, „weltumspannende Solidarität der Mütter“471.
464 465 466 467 468 469 470 471
AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 179, Überparteiliche Frauenbewegung, 12.03.1946. Vgl. dazu: Gille-Linne: Strategien, S. 193/194. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 179, Überparteiliche Frauenbewegung, 12.03.1946. Ebd. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 179, Überparteiliche Frauenbewegung, 12.03.1946. Vgl.: Drummer/Zwilling: Selbert, S. 71/72. Ebd., S. 83. Selbert, Elisabeth: Überparteiliche Frauenbewegung, in: Frankfurter Rundschau, 29.03.1946, zitiert nach Drummer/Zwilling: Selbert, S. 70.
Club deutscher Frauen | 639
Die Kritik, welche die Parteien beziehungsweise ihre Vertreterinnen Pfad und Selbert an Bähnischs Club und anderen überparteilich arbeitenden Frauenzusammenschlüssen vorbrachten, war also sehr unterschiedlich: Während die Christdemokratin Martha Pfad keinen Anstoß daran genommen hatte, daß der Frauenring an die Traditionen des BDF an-knüpfte und ihm – zumal sie ihn verdächtigte, sozialdemokratisch ausgerichtet zu sein – vorwarf, daß er sich in die ‚Politik‘ einmischte, kritisierte die Sozialdemokratin Selbert überparteiliche Gründungen, wie Bähnisch sie vornahm oder unterstützte, dafür, daß sie sich an überholt geglaubte ‚bürgerliche‘ Traditionen anlehnten und ‚unpolitisch‘ seien.
6.7 „THEIR FEUD HAS BECOME LEGENDARY“: DIE AUSEINANDERSETZUNG ZWISCHEN DER SPDFRAUENSEKRETÄRIN GOTTHELF UND IHRER GENOSSIN BÄHNISCH 6.7.1 Hannover wird Startpunkt und Hauptschauplatz eines landesweiten Kräftemessens Daß die überparteiliche Frauenarbeit besonders im SPD Bezirk Hessen-Nord, wo auch Elisabeth Selbert aktiv war, argwöhnisch beobachtet wurde, zeigte sich, als nach Selbert auch die Sozialdemokratin Marianne Gründer472 aktiv wurde und sich am 20.10.1946 mit einer Kritik an der Arbeit überparteilicher Frauengruppen in Hessen an das Frauenbüro des zentralen Parteivorstands der SPD in Hannover wandte.473 Darin deutete sich bereits an, daß das Zentrum der Auseinandersetzungen zwischen der SPD-Frauenarbeit und der überparteilichen Frauenbewegung in den folgenden Jahren Hannover werden würde. Die Leiterin des SPD-Frauenbüros, die Gründers Klage entgegennahm, war erst im Mai 1946 aus dem Exil in Großbritannien zurückgekehrt und hatte ihre 1933 im Zuge der Auflösung der Partei niedergelegte Arbeit wiederaufgenommen. Damit
472 Marianne Gründer, geboren 1907, war vom 05.05.1952 bis 01.03.1972 als Stadtverordnete in Kassel tätig. 1960 rückte sie als Abgeordnete in den Hessischen Landtag nach und behielt ihr Mandat bis zum Ende der Wahlperiode im November 1962. Auch in der folgenden Wahlperiode kam sie als Nachrückerin ins Parlament. Nachdem sie in der nächsten Wahlperiode erstmals direkt in den Landtag gelangt war, schied sie im November 1970 endgültig aus. 1950 war Gründer Bundesvorsitzende der Frauengilde im Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften (ZdK). Vgl.: Lengemann, Jochen/Präsident des Hessischen Landtags (Hrsg.): Das Hessen-Parlament 1946–1986. Biographisches Handbuch des Beratenden Landesausschusses, der Verfassungsberatenden Landesversammlung und des Hessischen Landtags, 1.–11. Wahlperiode, Frankfurt a. M. 1986, S. 270, passim. 473 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 179 [Frauenbüro im SPD-Parteivorstand, Korrespondenz Hessen-Kassel, Hessen-Nord], Marianne Gründer an Herta Gotthelf, 20.10.1946.
640 | Theanolte Bähnisch
stellte sich Herta Gotthelf474 einer schwierigen Aufgabe: Mit immerhin 18,3 Prozent Frauen an der Gesamtmitgliederzahl im Jahr 1947475 stand die SPD, gemessen an anderen Parteien vergleichsweise gut da. Doch die Ressentiments gegen ein stärkeres Gewicht von Frauen in der Politik waren auch in der eigenen Partei stark. Daß von 547 SPD-Abgeordneten in den Landtagen der Westzonen und in Berlin gerade einmal 65 weiblich waren, war der Frauensekretärin, wie das Amt Gotthelfs auch bezeichnet wurde, noch lange nicht genug.476 Weil sie für die Mobilisierung potentieller Wählerinnen und die Anwerbung von weiblichen Parteimitgliedern ebenso zuständig war wie für die Verbesserung der Zusammenarbeit von Männern und Frauen in der Partei, war sie zu einem ständigen Spagat bei der Amtsführung gezwungen: Eine positive Darstellung der Frauenpolitik der Partei nach außen mußte, wollte Gotthelf beiden Aufgaben gerecht werden, Hand in Hand gehen mit einer Kritik nach innen.477 Vor dem Hintergrund dieses nur schwer zu meisternden Anspruchs, den auch viele der männlichen Pateimitglieder an Gotthelf richteten, ist es nur zu verständlich, daß sie manchmal „die ganze Bagage zum Mond schicken“478 wollte. Neben der Wähler- und Mitgliederwerbung sowie den parteiinternen Reformbemühungen sah das Frauensekretariat seine Aufgabe vor allem in der Erziehung der Frauen zum Sozialismus, der von den linientreuen Mitgliedern als die einzig wahre demokratische Staatsform angesehen wurde. In diesem Sinne sollte das Frauensekretariat auch den Parlamentarierinnen zuarbeiten. Die Sozialdemokraten hofften, nachdem der Krieg zu Ende war, zum Sprachrohr der nun verstärkt in die Berufsarbeit strebenden Frauen bezüglich gleicher Entlohnung und arbeitsrechtlicher Fragen werden zu können.479 Wie die Frauen in Hessen richtete Gotthelf ihren kritischen Blick zunächst einmal auf die Dinge, die vor ihren Augen passierten. Und es ist zumindest einer Überlegung wert, ob das, was sich dort unter der Führung von Gotthelfs Parteigenossin Bähnisch im ‚Club deutscher Frauen‘ abspielte, vergleichbar viel Aufmerksamkeit erhalten hätte, wenn die SPD-Parteizentrale – und mit ihr Herta Gotthelf – ihren Sitz nicht in Hannover gehabt hätte. Über die Auseinandersetzungen zwischen Bähnisch und Gotthelf, die in einem Handbuch der britischen Militärregierung für Niedersachsen als eine ‚legendäre Fehde‘480 beschrieben wird, informierte bereits 1999 ein Aufsatz der SPD-nahen Historikerin und Böckler-Stipendiatin Karin Gille-Linne. 2011 legte dieselbe Autorin eine Monographie über Herta Gotthelf, Elisabeth Selbert und die
474 475 476 477 478
Zur Bedeutung Herta Gotthelfs für die Frauenpolitik der SPD vgl.: Gille: Gotthelf. Vgl.: Gille-Linne: Strategien, S. 180. Vgl.: ebd. Vgl. dazu: Gille-Linne: Strategien, S. 181–183. Herta Gotthelf, Arbeitsbericht und Organisationsfragen, Protokoll Wuppertal I, S. 186, zitiert nach Gille-Linne: Strategien, S. 182. 479 Zu den Aufgaben des SPD-Frauensekretariats und den frauenpolitischen Zielen der SPD vgl.: Gille-Linne: Strategien. 480 Röpcke: Saxony, S. 258. „Her [Bähnischs] greatest interest is non-political women’s organisations. In this sphere she has frequently clashed with Hertha [!] Gotthelf of the SPD zonal Committee and their feud has become legendary in Hannover.“
Club deutscher Frauen | 641
Frauenarbeit der SPD zwischen 1945 und 1949 vor.481 Da der Band Gille-Linnes während der Abfassung dieser Arbeit erschien, ist eine Darstellung der Auseinandersetzung zwischen Gotthelf und Bähnisch im ursprünglich angedachten Ausmaß, vor allem was die Quellen aus dem Archiv der sozialen Demokratie in Bonn betrifft, nicht mehr erforderlich. Es bietet sich jedoch an, einen Blick auf die von Gille-Linne nicht ausgewerteten Quellen zu werfen. Verwiesen sei zunächst auf die Vorarbeiten zum Thema: Zwar ist es richtig, wenn Gille-Linne schreibt, daß über Gotthelfs Person bis zum Zeitpunkt des Erscheinens ihrer Monographie weder größere wissenschaftliche Arbeiten vorlagen, noch, daß sie in den Biographien ihrer politischen Weggefährten besondere Erwähnung fand. Die in der Zeit zwischen 1946 bis 1951 für die Arbeit Gotthelfs zentrale Auseinandersetzung mit Theanolte Bähnisch wurde jedoch zwischenzeitlich Gegenstand zweier Aufsätze über die Regierungspräsidentin Bähnisch aus den Jahren 2008 und 2009.482 Nicht ausgewertet wurden von GilleLinne die Akten der britischen Militärregierung. Auf diese Akten wird an entsprechender Stelle, unter Berücksichtigung der Vorarbeiten Denise Tscharntkes483, zurückzukommen sein. Doch zunächst zu den Anfängen des Konflikts zwischen beiden Frauen: Im Oktober 1946 teilte Herta Gotthelf ihrem jungen Kollegen Egon Franke484, dem Mitbegründer des SPD-Stadtverbandes Hannover, mit, sie sei nicht der Meinung, „dass die beste Methode, Frauen für eine politische Partei zu gewinnen, die ist, unpolitische Frauenvereinigungen zu fördern und zu unterstützen“485. Ob sie hiermit auf ein entsprechendes Argument Bähnischs, die den Sozialdemokratinnen gern glauben machen wollte, daß der Club deutscher Frauen als politische Vorfeldorganisation für die SPD fungieren könne,486 reagierte oder ob diese Meinung von einem anderen Parteimitglied – vielleicht von Franke selbst – geäußert worden war, wird aus ihrem Brief nicht deutlich. Möglich ist, daß sich in der örtlichen SPD Gespräche über den Club entspannt hatten, zumal Maria Prejawa, eine der Mitbegründerinnen und die ‚rechte Hand‘ Bähnischs im Regierungspräsidium, aktives Mitglied der Partei war.487 Sie habe nicht den Eindruck, fuhr Gotthelf fort, daß der Club der
481 Gille-Linne: Strategien, S. 180. 482 Vgl.: Freund: Hut; dies.: Theanolte Bähnisch (1899–1973) und ihr Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands im Rahmen der Westorientierung nach 1945, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 80 (2008), S. 403–430. 483 Vgl.: Tscharntke: Re-educating. 484 Der 1913 geborene Franke hatte 1945 die SPD in der Stadt und dem damaligen Land Hannover mit gegründet. 1946/47 war er Mitglied des ernannten Landtags von Hannover, von 1947 bis 1951 Mitglied des niedersächsischen Landtags. Von 1947 bis 1952 gehörte er dem Parteivorstand an, von 1950 bis 1970 war er Bezirksvorsitzender der SPD Hannover sowie Landesvorsitzender der Partei in Niedersachsen. 485 AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), Frauenbüro, 0244 A, Herta Gotthelf an Egon Franke, 08.10.1946. 486 Ebd. 487 Ein Protokoll eines Treffens des erweiterten Bezirksvorstandes der SPD im Bezirk Hannover, bei dem auch Kurt Schumacher anwesend war, weist Prejawa als Teilnehmerin
642 | Theanolte Bähnisch
SPD bereits sehr viele Mitglieder zugeführt habe oder auch nur die Arbeit der SPD wesentlich unterstütze. „Im Gegenteil, in fast allen Orten wird unsere eigene Arbeit erschwert durch unfruchtbare Diskussionen, ob und in welchem Ausmaße wir uns an dieser Arbeit beteiligen sollen.“488 In der Hoffnung, sie könne sich so des Problems dauerhaft entledigen, noch bevor es richtig begonnen hatte, versuchte Gotthelf die Bedeutung des Clubs herunterzuspielen: „Der Club deutscher Frauen ist […] nicht die bedeutendste unpolitische und überparteiliche Frauenorganisation im Bezirk Hannover, sondern ist lediglich ein Versuch von vielen ähnlichen (FrauenStadtausschuss, Frauenliga für Frieden und Freiheit, überparteiliche Frauenausschüsse)“489, klärte sie den Kollegen, der zu dieser Zeit noch am Beginn seiner Parteikarriere stand, auf – ohne daß sie selbst einen genauen Überblick über die Verhältnisse gehabt hatte. Daß Bähnisch auch im Frauenarbeitskreis (den Gotthelf wohl meinte, als sie von ‚Frauenausschüssen‘ schrieb) ihre Finger im Spiel hatte, schien ihr nicht aufgefallen zu sein. „Der Genossin Bähnisch“ sei bereits „verschiedentlich Gelegenheit gegeben worden, mit Mitgliedern des Parteivorstandes über diese Frage zu diskutieren, und es bestand allgemein die Auffassung, dass wir als Partei unseren Frauen nicht nahe legen können, sich an dieser Arbeit zu beteiligen, dass wir aber keine Kardinalfrage daraus machen werden, wenn sie es tun“490. So brachte Gotthelf einerseits ihre Abneigung gegenüber der überparteilichen Arbeit zum Ausdruck, andererseits wollte sie dem Umstand, daß sich auch Sozialdemokratinnen in überparteilichen Frauenorganisationen engagierten, nach außen hin bloß nicht zu viel Bedeutung bemessen. „Die Genossin Bähnisch hat auch in einer Aussprache mit mir die Meinung vertreten, dass es für ihre eigene Arbeit im Gegenteil nur förderlich ist, wenn die Partei sich nicht zu nah mit ihrem Club liiert, da sie sonst in Schwierigkeiten mit ihren bürgerlichen Mitgliedern, die sie ja für die Partei gewinnen will, kommt“491, fuhr Gotthelf fort. Sie hielt es schließlich noch für wichtig, Franke darüber aufzuklären, daß die Einstellung zum ‚Club deutscher Frauen‘ „keine Privatansicht der Frauensekretärin des Parteivorstandes“ sei, sondern daß „durch Parteivorstandsbeschluss vom 21. und 22. August [1946] in Frankfurt am Main in der Entschließung zur Frauenfrage festgestellt wurde, dass die sozialdemokratischen Frauen jede Form einer Frauenpartei und so genannten unpolitischen Frauenvereinigung ablehnen“492. Tatsächlich schien die SPD im Bezirk Hannover, im Verhältnis von Männern zu Frauen, ungünstiger als in allen anderen Bezirken aufgestellt gewesen zu sein.493 Ob
488 489 490 491 492 493
nach. Vgl.: Hädrich, Dirk: SPD-Bezirksparteitag Barsinghausen 1946, Barsinghausen 2008, Dok. 7: Protokoll der Vorstandssitzung am Vorabend des Parteitages im Kaiserhof in Barsinghausen. AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), Frauenbüro, 0244 A, Herta Gotthelf an Egon Franke, 08.10.1946. Ebd. Ebd. Ebd. Ebd. Ebd.
Club deutscher Frauen | 643
dies jedoch als Beleg dafür gelesen werden kann, daß Bähnischs Club der SPD eben nicht genügend Mitglieder ‚zuführte‘, oder eher dafür, daß die Regierungspräsidentin Recht hatte mit ihrer Sorge, die Frauen würden sich von Parteien nicht angesprochen fühlen494, sei dahingestellt. Aus den im Herbst 1946 von Gotthelf verfaßten Zeilen wird jedenfalls deutlich, daß die Frauensekretärin nicht zu entscheiden wußte, ob sie sich in ihrer Arbeit vom Club bedroht fühlen sollte, oder ob sie die überparteilichen Frauenzusammenschlüsse lieber als ein Thema abhaken wollte, das der Rede gar nicht wert sei. Entsprechend widersprüchlich fiel ihre Argumentation schon zu jener Zeit, aber auch in den folgenden Jahren aus. Der Vorstand des SPD-Landesverbandes495 Braunschweig hatte den Genossen in den Kreisen durch die dort für Frauenarbeit zuständige Franziska Bennemann496 bereits am 13. September 1946 mitgeteilt, daß die „sozialdemokratischen Frauen jede Form einer Frauenpartei und so genannter unpolitischer Frauenvereinigungen“ ablehnten. „Die sozialdemokratische Partei will den Frauen eine Möglichkeit schaffen, sich Seite an Seite mit den Männern maßgeblich und verantwortlich in Staat und Gemeinde zu betätigen“497, ging auch der Landesverband auf Distanz zur Vertretung von ‚Fraueninteressen‘ durch reine Frauenorganisationen. Wie im Brief jedoch ebenfalls deutlich wird, hielten sich nicht alle „sozialdemokratischen Frauen“498 an diese von der Parteileitung verordnete Position. Die „Genossin Fuchs“499 – gemeint war die spätere SPD-Bezirksvorsitzende Braunschweigs, Martha Fuchs – habe am 05.09.1946 in Braunschweig einen „Verband deutscher Frauen“ gegründet, der „unter der Flagge der Überparteilichkeit segelt“, war dem Schreiben Bennemanns zu
494 AdSD, SPD-PV, (Alter Bestand), Frauenbüro, 0244 A, Theanolte Bähnisch an Herta Gotthelf, 29.04.1947. 495 Das Land Braunschweig wurde am 23.11.1946 mit den Ländern Hannover, Oldenburg und Schaumburg Lippe zum Land Niedersachsen vereinigt. Aus dem Land Braunschweig wurde der Bezirk Braunschweig. 496 Bennemann war 1905 geboren und arbeitete von 1947 an für die Frauengruppe ihrer Gewerkschaft in Brandenburg. Im Bezirk Braunschweig der SPD war sie – oft im Namen ihres Mannes Otto Bennemann, der Oberbürgermeister von Braunschweig war – für die Frauenarbeit im Bezirksparteivorstand zuständig. Von 1953 bis 1961 war Franziska Bennemann Mitglied des Bundestags über die Landesliste Niedersachsen. 497 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 174, [Frauenbüro im SPD-Parteivorstand, Landesverband Braunschweig], Franziska Bennemann an alle Kreise des Landesverbandes Braunschweig, 13.09.1946. 498 Ebd. 499 Martha Fuchs, geboren 1892, war 1923 in die SPD eingetreten. Während des Nationalsozialismus wurde sie politisch verfolgt und 1944 ins Konzentrationslager Ravensbrück gebracht. Nach dem Krieg kehrte sie nach Braunschweig zurück und wurde 1945 Ratsfrau, 1946 Abgeordnete des Braunschweiger Landtags und schließlich, als erste Frau in Westdeutschland, zur Ministerin (Wissenschaft und Volksbildung) ernannt. Von 1949 bis 1951 war sie Vorsitzende des SPD-Bezirks Braunschweig. Vgl.: Herrmann, Sigrid: Gedenken an Martha Fuchs, SPD-Unterbezirk Braunschweig, auf: http://www.spdbraunschweig.de/content/376698.php, am 13.12.2013.
644 | Theanolte Bähnisch
entnehmen. Fuchs habe bereits „vor mehreren Monaten von der Militärregierung eine Aufforderung erhalten, einen solchen unpolitischen Verein der Frauen zu gründen, hatte das aber bis jetzt hinausgezögert“500. Der Braunschweiger SPDLandesvorstand hoffte, diesen Verband so beeinflussen zu können, daß er sich ganz auf die Erwachsenenbildung konzentriere, denn die Arbeitskraft der Sozialdemokratinnen gehöre „in erster Linie der Partei und der Arbeiterwohlfahrt“, so Bennemann. Sie könne sich “aber auch denken“, fuhr die Landesfrauensekretärin fort, „dass vielleicht an irgendeinem Ort, wo besondere Verhältnisse herrschen, sich einzelne Frauen zu einer guten Zusammenarbeit auf überparteilicher Basis zusammenfinden. Unser gutes Beispiel und eine diplomatische Erziehungsarbeit könnte dann vielleicht manche Frauen in unsere Partei hinein führen“501, brachte Bennemann Argumente vor, an die Gotthelf nicht glauben wollte. Der hessischen Sozialdemokratin Marianne Gründer zufolge hatten sich im Oktober 1946 nicht nur die SPD-Frauen aus Stuttgart und Heidelberg, wo die Sozialdemokratin Else Reventlow 1945 den Süddeutschen Frauenarbeitskreis (SFAK) gegründet hatte502, für eine Mitarbeit der SPD an der überparteilichen Arbeit des „Frauen Ausschuss“503 (womit wohl der SFAK gemeint war) ausgesprochen. Die Kunde, daß „Frau Reg.[ierungs] Rat Bähnisch (Hannover?) sich auch für den Ausschuss aussprach“504, war bis nach Kassel durchgedrungen und schien dort als ein Argument von Gewicht interpretiert worden zu sein. Doch daß Bähnisch nun die Marke, an der es sich für Frauen in der SPD zu orientieren galt, zu setzen drohte, paßte Herta Gotthelf gar nicht. „[I]ch sehe nicht ein, warum wir uns unsere Einstellung und unsere Arbeitsmethode von diesen Leuten vorschreiben lassen sollen, selbst wenn es sich dabei um ‚Regierungspräsidenten‘ handelt“505, polterte die Frauensekretärin los. Vielmehr wollte Gotthelf, dies belegt ein anderer Briefwechsel, Bähnisch diktieren, auf welchen Kongressen sie, die ja schließlich als Sozialdemokratin in die
500 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 174, Franziska Bennemann an alle Kreise des Landesverbandes Braunschweig, 13.09.1946. 501 Ebd. 502 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 179 [Frauenbüro im SPD-Parteivorstand, Korrespondenz Hessen-Kassel, Hessen-Nord], Marianne Gründer an Herta Gotthelf, 20.10.1946. Reventlow und Bähnisch waren sich jedoch uneinig darüber, welche Ausrichtung ein überparteilicher Verband haben sollte und standen deshalb in Konkurrenz zueinander. Vgl.: Zepp: Redefining, S. 156 Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) entstand 1997 durch Fusion der IG Bergbau und Energie (IG BE) mit der IG Chemie-Papier-Keramik (IG CPK) und der Gewerkschaft Leder (GL). Sie hat ihren Sitz am Königsworther Platz in Hannover. 164. 503 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 179, Marianne Gründer an Herta Gotthelf, 20.10.1946. 504 Ebd. 505 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 175, [Frauenbüro im SPD-Parteivorstand, Korrespondenz östliches Westfalen], Herta Gotthelf an Frieda Nadig, 18.05.1948.
Club deutscher Frauen | 645
Öffentlichkeit trete, sprechen dürfe und auf welchen sie dies im Sinne der Partei unterlassen müsse.506 6.7.2 Vorurteile führender Genossinnen gegen die ‚Überparteilichen‘ und der Ruf nach harten Sanktionen Nicht alle Sozialdemokratinnen waren also gegen die Mitarbeit von SPDParteimitgliedern in überparteilichen Organisationen eingestellt. Gotthelf, die immerhin viele der SPD-Landes- beziehungsweise Bezirkssekretärinnen an ihrer Seite wußte, verwehrte sich jedoch von Monat zu Monat stärker dagegen. Dabei spielten in der Sozialdemokatie tief verwurzelte Vorbehalte gegenüber bürgerlichen Zusammenschlüssen eine wichtige Rolle. Es wird Gotthelf eine wahre Freude gewesen sein, wie die SPD-Frauensekretärin des Bezirks Niederrhein, Grete Schmalz – die damit schriftstellerisches Talent bewies – von der Gründung eines überparteilichen Frauenverbandes unter der Ägide Bähnischs in Düsseldorf berichtete: „Heute hat Gen.[ossin] Bähnisch die Düsseldorfer Frauen zur Gründung des Frauenringes eingeladen. […] In der Aula der Luisenschule, Kleine Balkone, Samtvorhänge auf der Bühne, Klappstühle, alle Zutaten des gutsituierten Bürgertums in der Schule der höheren Töchter, im von Bomben verschonten Teil des Gebäudes. Es war wie ein Symbol. Überschrift „Reminiszenzen“! Oder – sollte es wirklich der Auftakt zu etwas Neuem sein? Weißt Du, ich habe Dir doch schon mal geschrieben, dass wir – meine Geschwister und ich wegen hoffnungsloser Armut von Damen des vaterländischen Frauenvereins ‚behandelt‘ worden sind. Die Töchter dieser Damen saßen neben mir auf der Schulbank und ließen sich die Antworten vorsagen und ich mußte ihre Kleider auftragen. Seitdem habe ich Gegengefühle und saß darum von Anbeginn der Vorstellung mit gesträubten Rückenstacheln. […] Zu Beginn gab es in der gelb-blau-samtenen Atmosphäre ein langsam tropfendes Klaviersolo. […] ab und zu hörte man vernehmlich einen Magen knurren. Dann begrüßte Frau Pankok die Damen der Mil.[ilitär] Reg.[ierung], die Vertreter der Behörden und wandte sich an die Erschienenen mit der Bitte, nachher am Eingang die ausgefüllte Beitrittserklärung abzugeben […] Sie sagte […] dass diese Zusammenkunft eine Feierstunde sein sollte, keine Arbeiten, keine Diskussion. […] Danach kam eine Dame und las aus Bettina von Arnims „Gespräch über die Dämonen“. Es betrat dann das Podium Frau Reg.[ierungs] Präs.[identin] Bähnisch […], feierlich in Schwarz, breite weiße Aufschläge, ansonsten en coeur, mit großem, aufgeschlagenen Hut. Sie sah gut aus und paßte ohne Zweifel in die Umgebung. Sie sprach besser als die anderen beiden Damen und fand aufmerksame Zuhörerinnen. Alle Schläferinnen wachten auf. […] Ich verstehe […] nicht, warum eine Frau, die auf so verantwortlichem Posten steht, die Zeit aufbringt, noch solche Gründungen zu betreiben.“507
506 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 180 [Frauenbüro im SPD-Parteivorstand, Korrespondenz Hessen-Frankfurt], Herta Gotthelf an Frieda Walter, 10.05.1948. Man habe Bähnisch untersagt, auf dem Frankfurter Frauenkongreß zu sprechen, schrieb Gotthelf an Walter. 507 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 177, [Frauenbüro im SPD-Parteivorstand, Frauenbüro, Korrespondenz Niederrhein], Grete Schmalz an Herta Gotthelf, 16.05.1947.
646 | Theanolte Bähnisch
Die offenbar aus einem weniger betuchten Elternhaus stammende Schmalz wohnte also in einer Zeit des gravierenden materiellen Notstands einem aus ihrer Sicht inhaltsleeren, gehobenen Gesellschaftsspiel mit romantischer Dichtkunst, höherer Mädchenbildung, festlicher Kleidung und weitgehend weiblicher Besetzung bei. Ihre unverhohlene Kritik daran war ersichtlich zum einen gespeist aus der sowohl scham-, vielleicht auch neidbesetzten eigenen Erfahrung mit dem ‚Gegenstand‘, den sie dort zu beobachten glaubte, zum anderen sicher aber auch dem Anlaß geschuldet, dienstbeflissen einen Rapport über das Gesehene an eine Vorgesetzte abzuliefern. Deren Haltung zu derlei Veranstaltungen war hinlänglich bekannt508 – weshalb das beschriebene Déjà-vu-Erlebnis am Ende doch etwas konstruiert wirkt. Schmalz‘ Text vermag jedoch einen prägnanten Eindruck der Einstellung gegenüber überparteilichen Frauenverbänden, wie sie in Kreisen linientreuer Sozialdemokratinnen vorherrschte, zu vermitteln. Nachforschungen über einzelne Personen, die sich in der ‚überparteilichen‘ Frauenbewegung engagierten, trieben in jenen Kreisen oft Blüten, aus denen tief verwurzelte Ressentiments sprachen. So wußte Luise Albertz aus Oberhausen der Frauensekretärin als – offenbar alles erklärende – Charakterbeschreibung über eine ‚Frau Oschatz‘ mitzuteilen, daß diese „den Umgang mit Arztfrauen und sonstigen bürgerlichen Damen“509 pflege. Aus dem umfangreichen Schriftverkehr zwischen dem zentralen SPD-Frauensekretariat in Hannover und den SPD-Frauensekretariaten der Bezirke wird deutlich, wie groß die Abneigung gegen Bähnisch und die anderen „Überparteilichen“510 war, die in den Briefen als „Unpolitische“511, „Bürgerliche“512, oder auch – die gefühlte Überflüssigkeit der Zusammenschlüsse betonend – als „Pilzgewächse“513, „Pelzmantelgarde“514 und „Kaffekränzchen“515 tituliert wurden. Stärker politisch wertend war hier und da auch vom „Königin-Luise-Bund“516 und vom „Vaterländische[n] Frauenverein von ehedem“517 die Rede. Als eine Plage, mit der sich auseinanderzusetzen Zeitverschwendung zu sein schien, begriff man die Organisationen einerseits. Andererseits wird deutlich, daß
508 Ebd. Hier ist die Rede von „unserer beschlossenen Einstellung gegenüber diesen Dingen“. 509 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 177, Luise Albertz an Herta Gotthelf, 15.12.1948. 510 Ebd., Herta Gotthelf an Anny Kirschbaum-Riedel, 09.08.1947. 511 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 180 [Frauenbüro im SPD-Parteivorstand, Korrespondenz Hessen-Frankfurt], Herta Gotthelf an Margarete Starrmann, 10.03.1947. 512 AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), Frauenbüro, 0244 A, Ida Hinz an Herta Gotthelf, 19.04.1947. 513 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 177, Anny Kirschbaum-Riedel an Herta Gotthelf, 07.08.1947. 514 Ebd., Herta Gotthelf an Anny Kirschbaum-Riedel, 09.08.1947. 515 AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), Frauenbüro, 0244 A, Luise Kipp-Kaule an Gotthelf, 15.04.1947. 516 Ebd., Emmy Mayer-Laule an Gotthelf, 15.01.1947. 517 Ebd., Anni Krahnstöver an Gotthelf, 18.07.1947.
Club deutscher Frauen | 647
sich die hohe Garde der Sozialdemokratinnen um ihre Kapazitäten gebracht sah518, denn – wie bereits erwähnt – waren nicht alle führenden Genossinnen519 (die spätere SPD-Bundestagsabgeordnete Anni Krahnstöver520 sei als Beispiel genannt) und schon gar nicht alle weiblichen Mitglieder der SPD gegen Bähnisch eingestellt. Viele Frauen, nicht nur, aber vor allem auch im Ruhrgebiet521, reizte der Austausch mit Frauen aus verschiedenen Parteien und Verbänden522, zumal die ‚Überparteilichen‘ sogar Kontakte ins Ausland hatten. Andere fühlten sich – sicherlich nicht ganz zu Unrecht – von den Männern in der eigenen Partei nicht genügend unterstützt523, wenn es um ‚frauenspezifische‘ Belange ging. Sie erkannten insofern Potential in den ‚überparteilichen‘ Verbänden, vor allem auch was die Professionalisierung von gesellschaftlichen Aufgaben, die Frauen häufig übernahmen, anging.524 Die Genossin und Vorsitzende des Heidelberger Frauenvereins, Erdmuthe Falkenberg, schrieb im Hinblick auf überparteiliche Verbände im März 1947 sogar an den Parteivorsitzenden Kurt Schumacher, daß ihrer Meinung nach „eine Demokratie, besonders wenn sie im Volke so wenig verwurzelt ist wie in Deutschland, […] mit Freude jede positive politische Aktivität begrüßen“525 solle. Außerdem würden überparteiliche Organisationen – ein kaum von der Hand zu weisender Gedanke – die „so sehr fehlende Toleranz“526 fördern. „Scheuklappen“527 mußte sich Gotthelf aufgrund ihrer rigiden Haltung bald von den eigenen Genossinnen vorwerfen lassen. „Entscheidungslosigkeit“, schoß diese zurück, sei der Nährboden für diesen „überparteilichen Quatsch“528, die „Verwässerung stringenter politischer Ideen“ sei das Ergebnis der Bestrebungen dieser „Klübchen“529 der gebildeten Stände. Wie auch einige andere Bezirkssekretärinnen530 sah Gotthelf in Parteiausschlüssen eine mögliche Lösung für besonders beratungsresis-
518 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 175, Herta Gotthelf an Frieda Nadig, 18.05.1948. 519 Beispielsweise war Marie Bittorf für eine Mitarbeit in den Organisationen. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 180, Anna Bayer an Herta Gotthelf, 19.02.1947. 520 Krahnstöver wollte sich erklärtermaßen von Gotthelf nicht „auf Linie bringen“ lassen. AdSD, SPD-PV (Alter Bestand),], 0149 B [Korrespondenzen mit SPD-Mitgliedern des Bundestags], Anni Krahnstöver an Herta Gotthelf, 08.01.1951. 521 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 177, Herta Gotthelf an Runge, 07.01.1948. 522 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 180, Marie Bittorf an Herta Gotthelf, 13.06.1947. 523 Entsprechende Aussagen sind von Heli Knoll überliefert. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 180, Mary Starrmann an Herta Gotthelf, 20.06.1947. 524 Ebd., Marie Bittorf an Herta Gotthelf, 13.06.1947. 525 AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), 0244 A, Erdmuthe Falkenberg an Kurt Schumacher, 14.03.1947. 526 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 179, Marianne Gründer an Herta Gotthelf, 20.10.1946. 527 Ebd. 528 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 172 [Frauenbüro im PV, Korrespondenz Bremen Nordwest/Weser-Ems], Herta Gotthelf an Trude Reichelt, 10.11.48. 529 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 180, Herta Gotthelf an Meta Steinhäuser 23.02.1948. 530 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 172, SPD-Bezirkssekretariat Weser-Ems an Gotthelf, 12.03.1949.
648 | Theanolte Bähnisch
tente Fälle. „Ich finde, es ist Zeit, daß man sie aus der Partei herausschmeißt, denn Menschen, die so wenig Bindung mit uns haben, sollten nicht das Recht haben, sich nach außen als Sozialdemokratinnen zu tarnen“531, äußerte sich Gotthelf über eine Genossin, die sie mit ihren Äußerungen zur überparteilichen Arbeit besonders in Rage gebracht hatte. Am Mitgliederrückgang in der SPD war für Gotthelf nämlich Bähnisch schuld – und nicht etwa ihre eigene Politik.532 Bähnischs Idee, die überparteiliche Frauenbewegung als staatsbürgerliche Bildungsstätte zu begreifen, in der die Frauen fit dafür gemacht würden, „sich wirklich vollbewusst die Partei zu wählen, die ihnen die richtige erscheint“533, wollte Gotthelf nicht einleuchten. Zumindest glaubte sie eher an eine Beeinflussung durch überparteiliche Verbände im Sinne konservativer oder liberaler Parteien. Und eine andere Genossin hatte gar Angst, daß von den überparteilichen Organisationen „bei uns erarbeitete und akute Probleme, bevor sie vielleicht spruchreif sind, für Frauenvereinszwecke ausgenützt werden“534. 6.7.3 Schumacher bezieht Stellung, trifft jedoch keine Entscheidung Schumacher, der dafür bekannt war, daß er Frauen aus der ‚bürgerlichen Frauenbewegung‘ „Madames“535 nannte – zumal er in einigen Fällen ein Anknüpfen der ‚Überparteilichen‘ an den „Geist der […] Vaterländischen Frauenvereine“536 beobachtet haben wollte sollte schließlich ein Machtwort sprechen. Er sprach auf dem Frankfurter Parteitag am 02.06.1947. Doch was er sprach, konnte, das war von ihm wohl nicht unbeabsichtigt, verschieden interpretiert werden: Die Zugehörigkeit zu einer eigenständigen Frauenpartei oder einer eindeutig von der Politik einer gegnerischen Partei bestimmten Organisation ließe sich zwar mit der Mitgliedschaft in der
531 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 180, Herta Gotthelf an Frieda Walter, 10.05.1948. Gotthelfs Aussage bezog sich auf Heli Knoll, die sich in der hessischen überparteilichen Frauenarbeit engagierte. 532 Ebd., Herta Gotthelf an Käte Hoffmann, 09.08.1948. 533 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 175, Wenck an Herta Gotthelf, 30.04.1948. Wenck zitiert im Brief eine Aussage Bähnischs vom 20.03.1948. 534 AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), 0244 A, Emmy Meyer-Laule an Herta Gotthelf, 15.01.1947. 535 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 180, Herta Gotthelf an Marie Bittorf, 17.06.1947 sowie ebd., Marie Bittorf an Herta Gotthelf, 13.06.1947. Marie Bittorf war erbost über dieses Verhalten Schumachers, handele es sich doch in Frankfurt um Frauen, die im Berufsleben stünden und es gewiß nicht immer leicht gehabt hätten, so Bittorf. Ebd. Tatsächlich hatte Schumacher auch Bähnisch als „Madame“ angesprochen – noch bevor diese jedoch frauenpolitisch überhaupt in Erscheinung getreten war. AddF, SP-01, Kurt Schumacher an Theanolte Bähnisch, 16.12.1945 (Kopie aus dem AdSD). Die Angeschriebene griff seine Bezeichnung sogar – ironisierend – auf. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 23.12.1945. 536 Auszug aus der Stellungnahme Schumachers in der Parteivorstands-Sitzung zur Frauenfrage in Frankfurt/Main am 02.06.1947, zitiert nach Gille-Linne: Strategien, S. 189.
Club deutscher Frauen | 649
SPD nicht vereinbaren. Die Tätigkeit in einer anderen Sonderorganisation hinge jedoch vom freien persönlichen Entschluß der SPD-Mitglieder ab, solange daraus eine Beeinträchtigung der Arbeit in der Partei nicht resultiere. Die Kraft der Funktionärinnen solle nämlich in erster Linie der Partei zur Verfügung stehen. Es sei also nicht erwünscht, interpretierten Bähnischs Gegnerinnen in der Partei die Worte Schumachers. Es sei aber doch auch nicht verboten, entgegnen ihre Fürsprecher. Als ‚undemokratisch‘, gar ‚diktatorisch‘ nahmen viele SPD-Mitglieder die nun folgenden Versuche einiger SPD-Ortsverbände, ihre Mitglieder von der Teilnahme an überparteilichen Frauentreffen abzuhalten, wahr. Ausgerechnet in Niedersachsen ließ die Parteidisziplin schließlich so sehr zu wünschen übrig, daß weibliche Landtagsabgeordnete aller Fraktionen, auch der SPD, mit dem Vorstand des Frauenrings einen Arbeitskreis begründeten.537 ‚Lobbyismus‘, ein Phänomen, welches in etablierten Demokratien immer wieder zu Auseinandersetzungen über legitime Wege politischer Einflußnahme führt538, ermöglichte Theanolte Bähnisch in jener Phase der staatlichen Transformation also Einfluß-Spielräume, von denen Herta Gotthelf nur träumen konnte. Aus einem Artikel der Hannoverschen Neuesten Nachrichten geht hervor, wie die Lobby-Politik des Frauenrings durch den gemeinsamen Arbeitskreis mit den Parlamentarierinnen aussah. Demnach war der Arbeitskreis dazu da, „in gewissen Fragen eine vermittelnde Stellung einzunehmen zwischen Legislative und Executive“539. Wenn man so will, war seine Arbeit also darauf angelegt, die entsprechende, wohl überlegte Festlegung und Trennung beider Bereiche in der Verfassung durch eine zwischengeschaltete Instanz auszuhebeln. Die Parlamentarierinnen, welche dem Arbeitskreis angehörten, wollten in Sachen ‚Partei- und Frauenstandpunkt‘ erklärtermaßen einen Mittelweg gehen und „in der Landtagsarbeit zu einer geschlossenen und gemeinsamen Haltung der weiblichen Abgeordneten dort kommen, wo von der Sache her eine solche möglich und geboten erscheint“540. Die Verfasserin des Artikels, Maria Meyer-Sevenich, zu jener Zeit Abgeordnete der CDU im niedersächsischen Landtag, sah für ein ausgewogenes Kräftespiel in der Gesellschaft verschiedene Parteien als ebenso bedeutsam an, wie den Einfluß beider Geschlechter: „So wie die Demokratie ein gesundes, tolerant gewährtes Gleichgewicht der divergierenden Meinungen voraussetzt, ebenso muß, durchaus unter Berücksichtigung der naturgegebenen Verschiedenheiten, das Miteinander von Mann und Frau im öffentlichen Leben […] gesichert werden“ 541, versuchte Sevenich eine Brücke von der Position der bürgerlichen Frauenbewegung zu den Gesetzmäßigkeiten der parlamentarischen Demokratie zu schlagen.
537 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 172, Lisbeth Frerichs an Herta Gotthelf, 03.12.1947. 538 Vgl.: Leif, Thomas/Speth, Rudolf: Die fünfte Gewalt. Wie Lobbyisten die Prinzipien der Parlamentarischen Demokratie unterlaufen, in: Die ZEIT, 22.05.2006, auf: http://www. zeit.de/online/2006/10/lobbyismus, am 13.12.2013. Für eine ausführlichere Darstellung vgl.: Dies.: Die fünfte Gewalt, Lobbyismus in Deutschland, Wiesbaden 2006. 539 Meyer-Sevenich, Maria: Beispielhaft zu wirken, in: Hannoversche Neueste Nachrichten, 06.12.1947. 540 Ebd. 541 Ebd.
650 | Theanolte Bähnisch
Die SPD-nahe Historikerin Karin Gille-Linne interpretiert in ihrer Studie über die Frauenarbeit der SPD von 1945 bis 1949 die Erklärung Schumachers als „contra Bähnisch“542. Doch der Parteivorsitzende distanzierte sich nie offiziell von der prominenten Genossin. In der bereits erwähnten Rede hatte Schumacher, wie auch GilleLinne betont543, seine Zuhörerschaft allerdings darauf aufmerksam gemacht, daß eine Organisation „wie sie von der Genossin Thea Nolte-Bähnisch (!) beeinflußt wird“, keine „Rekrutenschule der Sozialdemokratie“ in Bömmelburgs Sinn sei, daß das „Agitationsfeld“ für Sozialdemokratinnen in solchen Organisationen deshalb beschränkt sei und man über eine „Kontaktpolitik“544 meist nicht hinauskommen werde. Mit jener letzten Äußerung mag er einigen Genossen, in Anbetracht der Tatsache, daß längst nicht alle Mitglieder der SPD den Ansatz der ‚Rekrutenschule‘ für sinnvoll erachteten, die Politik Bähnischs womöglich sogar noch schmackhafter gemacht haben. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den Flügelstreit der SPD zum Thema ‚Erwachsenenbildung‘, der bereits in der Weimarer Republik virulent war.545 Die Gegner der ‚Rekrutenschulen‘, darunter auch Vertreter des rechten Flügels der Sozialdemokratie, wollten (politische) Bildung eben nicht in den Dienst einer politischen Partei gestellt sehen. In ihrer Wahrnehmung sollte Bildung die Genese hin zu einer ‚freien Persönlichkeit‘, deren Charakterfestigkeit auf der einen und deren Toleranz auf der anderen Seite der Gesellschaft zu Gute zu kommen sollte, unterstützen. 6.7.4 Ideologischer Eklektizismus oder sozialdemokratische Überzeugung? Ein gemeinsames Ziel, aber zwei verschiedene Wege Auch dem Parteivorsitzenden dürfte bewußt gewesen sein, daß gerade dem ‚Verwaschenen‘546, das Herta Gotthelf ihrer Konkurrentin Bähnisch vorwarf, ein integratives Potential für die Gesellschaft innewohnte, welche sich in einer Phase der Neuorientierung befand. In Bähnischs Rhetorik vermischten sich verschiedene, historisch gewachsene Argumentationsstränge bezüglich der Rolle von Frauen in der Gesellschaft. In ihren Reden dominierten liberal-protestantische Ansätze zum Thema ‚Frauenrechte‘ und ‚soziale Hilfe‘, doch daneben kamen auch solche Ideen und Forderungen zum Tragen, die als ‚sozialdemokratisch‘ zu bezeichnen, nicht falsch ist. So erhob sie im ‚Manifest von Pyrmont‘, einer Mischung zwischen Arbeitsplan und Forderungskatalog des just gegründeten ‚Frauenrings der britischen Zone‘, im Juli 1947 die Forderung daß „bei gleichzeitiger Berufstätigkeit von Ehemann und Ehefrau nicht von Doppelverdienertum gesprochen werden“ dürfe, daß die „veralteten
542 543 544 545 546
Gille-Linne: Strategien, S. 186. Vgl.: Gille-Linne: Strategien, S. 186. Kurt Schumacher zitiert nach ebd. Siehe Kapitel 3.5.5.3. Gotthelf bezeichnete einer Parteigenossin gegenüber den ‚Club deutscher Frauen‘ als eine „verwaschene bürgerliche Angelegenheit“. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 178 [Frauenbüro im SPD-Parteivorstand, Korrespondenz Oberrhein], Herta Gotthelf an Hilde Esser, 30.04.1947.
Club deutscher Frauen | 651
Vorschriften über […] Verwaltung und Nutznießung des Vermögens der Ehefrau […] außer Kraft gesetzt“ werden müßten, daß der „Grundsatz: Gleicher Lohn für gleiche Leistung endlich durchgeführt wird“, daß das „Recht auf Arbeit“ in der Verfassung verankert werden müsse und daß ein „einheitlich[…] aufgebautes Schulwesen […] jedem Kinde nach seiner Begabung die bestmöglichste Ausbildung zu gewähren“547 habe. Viele von Bähnischs Mitstreiterinnen, vor allem jene der ersten Stunde, unter denen einige SPD-Mitglieder waren, verhielten sich ähnlich. Ausschlaggebend für jenes Changieren zwischen den Argumentationsstrategien der Sozialdemokratie und denen der bürgerlichen Frauenbewegung waren die Verbindungen zu erfahrenen Eliten dieser Bewegung aus der Zeit vor 1933, an die in Bähnischs Organisation engagierte Frauen angeknüpft hatten sowie Erfahrungen aus der Zeit der großen Weimarer beziehungsweise preußischen Koalition, in der vor allem (Sozial-)Liberale, Sozialdemokraten und Vertreter des Zentrum miteinander kooperiert hatten. Zudem war Bähnisch von 1933 bis 1945 in Deutschland geblieben und deshalb weitgehend frei von Illusionen, was die Demokratiefähigkeit der meisten Frauen und ihren Willen, sich einer politischen Partei anzuschließen, anging. Ihr ideologischer Eklektizismus war, indem er nicht polarisierte und Vokabeln nach vorn stellte, von denen viele Frauen sich angesprochen fühlten, dazu geeignet, Frauen mit verschiedenen (politischen) Überzeugungen anzusprechen und möglichst wenige abzuschrecken.548 Diesem Ideenpool hatte Herta Gotthelf, die sich wünschte, daß Frauen „wirklich ernsthafte politische Werbe- und Schulungsarbeit für die SPD leisteten“, anstatt sich „Vereinsspielereien“549 hinzugeben, wenig entgegenzusetzen. Sie hielt sich weitgehend im Kreis der Partei auf, hatte die nationalsozialistischen Jahre im Exil verbracht und sich dort zwar politisch mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt, aber den deutschen Alltag zu jener Zeit nicht miterlebt. Sie stellte die Parteidisziplin über das Ziel, einen von verschiedenen Anschauungen getragenen Demokratiewillen in der Bevölkerung zu etablieren, welcher auch jenen Frauen Möglichkeiten zur Mitgestaltung bot, die sich noch schwankend auf dem neuen, ungewohnten Parkett der Demokratie bewegten. Jedoch wäre es verfehlt, anzunehmen, Gotthelf sei es (lediglich) darum gegangen, ihre Prinzipien durchzusetzen. Ihre Parteidisziplin war bedingt durch eine starke politische Überzeugung, zu der es gehörte, sich den „bevorstehenden sozialen Auseinandersetzungen“ im Rahmen der Etablierung eines neuen politischen Systems im Sinne der Sozialdemokratie zu stellen. Sie wollte eben nicht an das „Gerede von der Gemeinsamkeit der Fraueninteressen“ glauben, das ihrer Meinung nach „einfach die weisse Salbe sein sollte, mit der man die wirklichen Gegensätze verkleistern will.“550 Darin kommt die Skepsis zum Tragen, die die SPD den ‚Bürgerlichen‘ traditionell in sozialen Fragen entgegen brachte. Der Einsatz für Frauenrechte war für die Frauen um Gotthelf in ein umfassenderes politisches Engagement
547 AdSD, SPD-PV, (Alter Bestand), Frauenbüro, 0244 A, Manifest von Pyrmont, zur Überarbeitung vorgesehene Version, o. V., o. D. [Eingangsstempel vom 03.07.1947]. 548 In der ‚Stimme der Frau‘ läßt sich, nicht nur, aber vor allem, was die Argumentation gegen den Kommunismus angeht, Ähnliches beobachten. Vgl.: Freund: Krieg. 549 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 175, Herta Gotthelf an Frieda Nadig, 18.05.1948. 550 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 172, Herta Gotthelf an Elisabeth Innis, 02.07.1948.
652 | Theanolte Bähnisch
eingebunden, für das die ‚Bürgerlichen‘ die Negativfolie – und nicht etwa wünschenswerte Kooperationspartner – darstellten. Der Kampf um soziale Rechte war für Gotthelf dem Kampf um Frauenrechte vorgelagert. „Die sozialdemokratische Frauenbewegung hatte ihre Anfänge nicht in einem Kampf der Geschlechter gegeneinander, wie das bei der bürgerlichen Frauenbewegung der Fall war, sondern sie entstand aus der gemeinsamen Not von Mann und Frau im kapitalistischen Staat und aus ihrem gemeinsamen Kampf zur Schaffung einer gerechten sozialen und gesellschaftlichen Ordnung“, hatte Gotthelf ihre Position in der Zeitschrift ‚Genossin‘ festgeklopft.551 Bähnisch dagegen glaubte daran, daß sich Frauen trotz verschiedener Weltanschauungen, Konfessionszugehörigkeiten und parteilicher Bindungen im „rein fraulichen“ zusammen finden müßten, um die Welt umzugestalten.552 „Es wird noch lange nicht so sein, dass die Frauen innerhalb der Parteien ihre Meinung als Frau durchsetzen können“553, weil diese sehr stark von Männern und ‚männlichem Denken‘ bestimmt seien, wird Bähnisch in einem Bericht an Gotthelf zitiert. Wenn die Position der Regierungspräsidentin in diesem Schriftstück richtig wiedergegeben ist, dann hatte sie ihren Zuhörerinnen ein Engagement innerhalb von Parteien sogar ausgeredet.554 Für sie war die Verschiedenheit der Geschlechter stärker und folgenschwerer, als die Verschiedenheit der politischen Überzeugung es je sein könne. Sie glaubte daran, daß es möglich sei, in „besonderen Frauenorganisationen“ einen gemeinsamen „Frauenwille[n] + Frauenstandpunkt“, beispielsweise zum § 218, zu entwickeln. Und sie wurde nicht müde zu betonen, daß dem „männlichen Machtstreben“555 Einhalt geboten werden müsse, indem die „ausgleichende Kraft der Frauen“ mit den „gestaltenden Kräften des Mannes“ vereint würden, um ein „neues Deutschland entstehen zu lassen“556. Gotthelf dagegen war im Exil daran beteiligt gewesen, ein anderes ‚neues Deutschland‘ – nämlich eines, das den materiellen Rechtsgedanken auf die Arbeitsund Güterordnung ausdehnt – vorzubereiten.557 Daran, daß sich jene Idee mit Hilfe Bähnischs verwirklichen ließe, glaubte sie nicht. Als beispielsweise eine Genossin der SPD-Fraktion zur Wohnungsausstellung des Frauenrings delegiert werden sollte, zeigte Gotthelf sich nach Abschluß der Ausstellung damit zufrieden, diesem Ansin-
551 Gotthelf, Herta: Fürth, in: Genossin, 10. Jg. (1947), Nr. 9/10, S. 9–11, hier S. 11, zitiert nach Gille-Linne: Strategien, S. 11. 552 AdSD, SPD-PV, (Alter Bestand), Frauenbüro, 0244 A, Ausführungen der Genossin Bähnisch, Hannover bei der Gründung des überparteilichen Frauenbundes Rendsburg, 14.04.1947. 553 Ebd. 554 Ebd. 555 AdSD, SPD-PV, (Alter Bestand), 0244 A, Bähnisch: Werbung f. d. zentralen Frauenring in D’dorf [Protokoll einer Rede Bähnischs], o. D. [1946]. 556 Ebd. 557 Vgl.: Schmidt, Manfred: Demokratietheorien. Eine Einführung, 5. Aufl., Bonn 2010, S. 225–235, vgl. auch: Huster, Ernst-Ulrich: Demokratischer Sozialismus. Theorie und Praxis sozialdemokratischer Politik, in: Neumann, Franz (Hrsg.): Handbuch Politische Theorien und Ideologien, Bd. 2, Stuttgart 1996, S. 110–160.
Club deutscher Frauen | 653
nen nicht nachgekommen zu sein, denn die Ausstellung sei „eine reine Firmenschau“ gewesen und „in keiner Weise“ seien „Hinweise für billigen Hausrat“558 gegeben worden. 6.7.5 Bähnischs Umgang mit dem Nationalsozialismus als Kritikpunkt der Sozialdemokratinnen Auch die kritische – man könnte auch sagen lapidare – Haltung Bähnischs zur Entnazifizierung war vielen Sozialdemokratinnen ein Dorn im Auge. So zeigte sich Ida Hinz aus Kiel „sehr entsetzt“ darüber, daß Bähnisch auf einer Versammlung „stürmischen Beifall“ geerntet habe, als sie ankündigte, daß „niemand einen Fragebogen ausfüllen“559 müsse, wenn er dem Club beitreten wolle. Und Clara Döhring war erregt darüber, daß der Club zur „Pflege eines gesunden nationalen Stolzes“560 aufgerufen hatte. Dies war ein Programm-Punkt, den Bähnisch bei einer späteren Rede in Rendsburg nicht mehr explizit als Ziel nannte.561 Sie wich auf die – kaum weniger unglückliche – Formulierung aus, daß das Land, „das von fremden Mächten besetzt ist“, „trotzdem seine Würde, seinen Stolz“562 behalten habe. Gotthelfs jüdische Abstammung und die Verluste in der eigenen, nahen Familie durch den Holocaust563 werden dazu beigetragen haben, daß die Frauensekretärin über solche Äußerungen Bähnischs enttäuscht war. Daß Herta Gotthelf Gertrud Bäumer negativ gegenüberstand, weil sie das BDF-Organ ‚Die Frau‘ unter dem nationalsozialistischen Regime weiterhin publiziert hatte, ist ebenfalls nachvollziehbar. Das Vorgehen der Gotthelf-Biographin Karin Gille-Linne, die überparteilichen Frauenverbände vor dem Hintergrund, daß diese sich nicht nur nicht eindeutig von Bäumer distanziert hatten, sondern viele ihrer Mitglieder der ehemaligen BDFVorsitzenden weiterhin Respekt zollten, allgemein in die „Nähe […] zum Nationalsozialismus“564 rücken, ist allerdings verfehlt. Schließlich waren Frauen wie Katharina Petersen, Marie Elisabeth-Lüders oder gar Leonore Meyer-Katz, die überparteilich frauenpolitisch arbeiteten, selbst Opfer des Regimes oder hatten sich im Widerstand engagiert. Daß prominente Personen wie Else Ulich-Beil für Bäumer Partei ergriffen565, war ohne Zweifel kein demokratisches Aushängeschild für die überparteili-
558 AdSD, SPD-PV, (Alter Bestand), Bonn, Korrespondenzen mit SPD-Bundestagsmitgliedern, 0149 B, Herta Gotthelf an Liesel Kipp-Kaule, Clara Döhring und Emmy MeyerLaule, 05.02.1951. 559 AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), Frauenbüro, 0244 A, Ida Hinz an Herta Gotthelf, 29.05.1947. 560 Ebd., Clara Döhring an Herta Gotthelf, 13.05.1947. 561 Ebd., Ausführungen der Gen. Bähnisch Hannover bei der Gründung des überparteilichen Frauenbundes Rendsburg, 14.04.1947. „nationale Stolz fällt weg“, merkt die unbekannte Protokollantin an. 562 Ebd. 563 Vgl.: Gille-Linne: Frauenrechtlerei, S. 32. 564 Gille-Linne: Strategien, S. 190. 565 Ebd.
654 | Theanolte Bähnisch
chen Verbände. Allerdings ist seit langer Zeit bekannt, daß Bäumer auch in der überparteilichen Frauenbewegung umstritten war.566 Gille-Linne folgt mit ihrer Argumentation jedoch Gotthelfs Überzeugung, daß die überparteiliche Frauenbewegung Bäumers „weiblicher Anhang“567 sei. Richtig und wichtig dagegen ist Gille-Linnes Hinweis darauf, daß (auch) in der ‚Stimme der Frau‘ zu Bäumers 75. Geburtstag ein würdigendes Portrait der Lebensgefährtin Langners erschienen war.568 Dies läßt erahnen, daß die Herausgeberin der Zeitschrift den Leistungen Bäumers in der Frauenbewegung Respekt zollte. Kritische Untertöne schwingen im Artikel nicht mit. Richtig ist auch, daß Frauen in überparteilichen Frauenverbänden bereit waren, mit Frauen, die dem Nationalsozialismus nicht erklärtermaßen ferngestanden hatten, zu kooperieren. Die nicht zuletzt von Bähnisch vertretene Sicht auf den Nationalsozialismus als ein Männerstaat, welche Frauen die Verantwortung für den Nationalsozialismus weitgehend absprach, bot hierfür eine ebenso fragwürdige wie integrative Grundlage. Eine gedankliche Umorientierung ehemaliger Nationalsozialistinnen, warum auch immer sie stattfand, wurde von Seiten überparteilicher Verbände nicht nur als legitim respektiert, sondern aktiv angestrebt. Andernfalls ergäben die Ausführungen Bähnischs über die notwendige Rückkehr zu humanistischen Prinzipien, einem entsprechenden Erziehungsstil und dergleichen mehr keinen Sinn. Dafür, daß Frauen, die sich auch nach 1945 noch offen zum Nationalsozialismus bekannten, in den Verbänden geduldet worden seien, liessen sich bisher keine Belege finden. Gille-Linne merkt zwar – zu Recht – an, daß sich in den ‚Frauenausschüssen‘ nicht nur Frauen organisiert hätten, welche sich dem Nationalsozialismus widersetzt hatten, wie dies „in der Literatur oft behauptet“569 werde, sie nennt jedoch keine Belege für diese beiden Aussagen. 6.7.6 Zur Vielschichtigkeit frauenpolitischen Engagements in der SPD Die Sozialdemokratin und Journalistin Else Reventlow aus Süddeutschland vertrat in Bezug auf den Umgang einiger überparteilicher Frauenverbände mit dem Nationalsozialismus eine ähnliche Position wie Gotthelf. Sie vergriff sich jedoch gehörig, als sie der Hannoveraner Regierungspräsidentin öffentlich zum Vorwurf machte, daß auf einer von ihr organisierten Tagung vom ‚ewigen Deutschland‘ gesprochen worden sei.570 Nach allem was bekannt ist war weder jene Formulierung gefallen, noch waren
566 Insbesondere Agnes von Zahn-Harnack und Marie Elisabeth-Lüders hatten Bäumer davon abbringen wollen, ‚Die Frau‘ im Nationalsozialismus weiter zu publizieren. Vgl.: Wiggershaus, Renate: Geschichte der Frauen und der Frauenbewegung, Wuppertal 1979, S. 91. 567 Gotthelf, Herta: Zum „Fall Bäumer“, in: Genossin, Nr. 9, November 1948, S. 175, zitiert nach Gille-Linne: Frauenrechtlerei, S. 33. 568 Gille-Linne: Strategien, S. 189. 569 Gille-Linne: Frauenrechtlerei, S. 33. 570 Vgl.: Gille-Linne: Strategien, S. 191.
Club deutscher Frauen | 655
entsprechende Bilder bemüht worden.571 Dazu, den von Bähnisch beschworenen ‚Aufbruch der Frauen von 1949‘ mit dem ‚Aufbruch von 1933‘ in Verbindung zu bringen – wie es Reventlow tat572, gehörte schon eine gehörige Portion Phantasie. „Die Sprecherin sollte nicht ‚deutsch‘ und ‚nationalsozialistisch‘ verwechseln“573, stellte Bähnisch in diesem Zusammenhang gegenüber dem Bayrischen Rundfunk, Reventlows Arbeitgeber, fest. Anders als Gotthelf hing die Sozialdemokratin Reventlow nicht nur der Überzeugung an, daß überparteiliche Frauen-Arbeit durchaus sinnvoll sei, sondern Reventlow hatte sogar selbst einen überparteilichen Frauenbund, den Süddeutschen Frauenarbeitskreis (SFAK) gegründet. 1949 schloss sich dieser auf das Betreiben von Nora Winkler von Kapp574 mit dem Bähnisch gegründeten DFR zusammen. Die leitenden Mitglieder des SFAK wahrten immer eine sehr kritische Distanz zum Umgang – oder vielmehr Nicht-Umgang der Gründungen Bähnischs mit dem Nationalsozialismus.575 Reventlow und Bähnisch arbeiteten jedoch durchaus konstruktiv zusammen, wenn es um die Besetzung von Ämtern durch Frauen in den Bundesministerien ging576. In jener Beziehung wußte Reventlow die Arbeit des DFR, vermutlich auch seinen Einfluß, zu schätzen. Daß der SFAK der SPD nicht zuarbeitete, zeigte sich 1949, als Gille-Linne zufolge die Eingabe des SFAK zum Gleichberechtigungsparagraphen dem CDU-Entwurf folgte, während sich der von Bähnisch geleitete Deutsche Frauenring dem Entwurf der SPD anschloß.577 Die frauenpolitische Landschaft in der SPD zwischen Bähnischs Gründungen auf der einen und Gotthelfs Arbeit auf der anderen Seite, war also äußert vielschichtig. Die Gründungen Bähnischs sahen sich in den Jahren 1945 bis 1952 dauerhaft mit einem doppelten Vorwurf von Seiten linientreuer Sozialdemokratinnen konfrontiert, die überparteiliche Arbeit ablehnten. Dieser doppelte Vorwurf barg einen zentralen Widerspruch in sich – und führte schließlich zu einer hoch interessanten Entwicklung. Zum einen warfen die Sozialdemokratinnen um Gotthelf den überparteilichen Verbänden vor, ‚unpolitisch‘ zu sein, zum anderen mißbilligten sie deren Einflußnahme auf die Politik – auch auf einzelne Abgeordnete – durch Vorschläge, Stellungnahmen und personalpolitische Strategien. Jener Widerspruch kulminierte schließlich, als es ‚ums Ganze‘, ging, in der Person Elisabeth Selberts: Zwei Jahre nachdem sie ihren ablehnenden Artikel gegenüber der überparteilichen Frauenarbeit verfaßt hatte, sollte Selbert im Frauenring und anderen Frauenverbänden nämlich genau jene politische Unterstützung finden, die sie von Seiten der Frauen aus anderen politischen Fraktionen im parlamentarischen Rat, teilweise aber auch von der SPD
571 AdSD, Nachlaß Reventlow, Nr. 43 [Bayerischer Rundfunk, Korrespondenz A-Z], Bähnisch an den Chefredakteur des Bayrischen Rundfunks, 24.10.1949. 572 Else Reventlow, zitiert nach Gille-Linne: Strategien, S. 191. 573 AdSD, Nachlaß Reventlow, Nr. 43, Bähnisch an den Chefredakteur des Bayrischen Rundfunks, 24.10.1949. 574 AdSD, Nachlaß Reventlow, Nr. 43, Else Reventlow an Theanolte Bähnisch, 24.02.1950. 575 Vgl.: Zepp: Redefining Germany, S. 156–164. 576 AdSD, Nachlaß Reventlow, Nr. 43, Else Reventlow an Theanolte Bähnisch, 18.10.1949. 577 Vgl.: Gille-Linne: Strategien, S. 308.
656 | Theanolte Bähnisch
selbst, vermißte.578 Karin Gille-Linne zufolge bildeten Selbert und Bähnisch 1948 ein Tandem, welches sich gemeinsam für den von der Kasseler Juristin vorgebrachten Entwurf zum Gleichberechtigungsparagraphen einsetzte. Selbert schlug also – im Gegensatz zu Gotthelf – schließlich die Brücke zur überparteilichen Arbeit.579 „Elisabeth Selbert, die anfänglich die Untätigkeit der Frauenorganisationen als Beweis für deren unpolitische Haltung geißelte, und ihnen absprach, eine demokratische Legitimation zu besitzen, berief sich im Parl[amentarischen]R[at]. auch auf deren Eingaben“580, konstatiert Gille-Linne. Daß Selbert vor dem Parlamentarischen Rat erklärte, die überparteilichen Verbände stünden hinter ihr, verurteilt die Autorin – die in ihrer Monographie für Gotthelfs Arbeit Partei ergreift –als eine „Vereinnahmung, die der politischen Abgrenzung [der SPD von den überparteilichen Verbänden] zuwiderlief“581 und womöglich den „Frauenzusammenschlüssen zu nachträglicher Legitimierung und vermeintlichem Machtzuwachs verhalf“582. Gleichzeitig macht die Historikerin an der Unterstützung, die der Frauenring Selberts Entwurf zuteilwerden ließ, ihre Erkenntnis fest, daß der Frauenring „in wichtigen politischen Fragen klar die Linie der SPD vertrat“583, was jedoch „keine Unterordnung des Vereins“584 bedeutet habe. Jene Einschätzung zu bewerten, fällt schwer, zumal nicht klar ist, welche Fragen jenseits des Gleichberechtigungsartikels für Gille-Linne ‚wichtige Fragen‘ waren. 6.7.7 „Ich habe keine Lust, ein zweites 33 zu erleben“: Gefahr durch Infiltration oder durch politische Abstinenz? Neben allem Streit um die Frage, wer berechtigt sei, die Frauen in Deutschland zu vertreten, ob ein ‚Fraueninteresse‘ über Parteigrenzen hinweg existiere und wie der richtige Umgang mit dem Nationalsozialismus aussehen sollte, ist es – auch wenn es an dieser Stelle den weiteren Entwicklungen vorgreift – wichtig zu betonen, daß die Auseinandersetzungen zwischen Gotthelf und Bähnisch vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Ziels stattfanden, das sich erst im Lauf des Jahres 1947 stärker abzeichnete: Der Abwehr des Kommunismus. So einig sich die beiden Frauen darüber
578 Vgl.: Gille-Linne: Strategien, S. 252–290. Gille-Linne möchte nachweisen, daß viele der Eingaben nicht Gotthelfs, sondern Helene Wessels Vorschlag oder den der KPD unterstützten, beziehungsweise die Verbände eigene Text-Vorschläge machten. Der ‚Frauenring der britischen Zone‘ forderte jedoch, wie Gille-Linne selbst anmerkt, „die Sicherung voller politischer und zivilrechtlicher Gleichstellung der Frau“. Frauenring der britischen Zone, zitiert nach: ebd., S. 303. Später spezifizierten Bähnisch und Mosolf die Eingabe dahingehend, daß der Frauenring Selberts Vorschlag im Wortlaut unterstützte und begründeten dies gesondert. Ebd., S. 304/305. 579 Vgl.: Gille-Linne: Strategien, S. 330. 580 Ebd., S. 392. 581 Ebd. 582 Ebd., S. 393. 583 Ebd., S. 305. 584 Ebd.
Club deutscher Frauen | 657
waren, daß der kommunistischen Ideologie wirksam begegnet werden müsse, so verschieden waren die Überzeugungen beider Frauen, wie dieses Ziel am besten erreicht werden könne. Herta Gotthelf vertrat die Überzeugung, gerade die Überparteilichkeit von Frauenorganisationen ermögliche den Kommunisten, jene Organisationen ‚unerkannt‘ zu unterwandern und sie schließlich in ihrem Sinne zu dominieren. In der Retrospektive läßt sich feststellen, daß in den meisten überparteilichen Verbänden, die organisatorisch mit dem DFR verflochten waren, Kommunistinnen keinen nennenswerten, langfristigen Einfluß ausüben konnten. Berichte die über die britische Militärregierung in den National Archives in London, Bestand der Sektion ‚Foreign Office‘ überliefert sind, zeigen jedoch, daß die Sorge Gotthelfs zumindest in wenigen Fällen und für kürzere Zeiträume585 berechtigt war. Zusätzlich beweisen in der Sammlung Parteien und Massenorganisationen (SAPMO) des Bundesarchivs in Berlin überlieferte Quellen, welche über die von der SMAD/SED kontrollierte Arbeit der kommunistischen Organisation Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD) in den Westzonen Auskunft geben, daß deren Protagonistinnen durchaus versuchten, über die Mitarbeit in überparteilichen Organisationen Frauen für die kommunistischen Parteien zu gewinnen.586 Theanolte Bähnisch sah dagegen die Gefahr, daß Frauen, welche sich von ‚Parteien‘ als solchen abgeschreckt fühlten, durch eine parteiinterne Frauenarbeit überhaupt nicht erreict würden und dementsprechend auch nicht von den Parteien über den Kommunismus aufgeklärt werden könnten. Deshalb müsse es ‚westlich‘ geprägte, überparteiliche Frauenverbände geben. Der Verzicht auf überparteiliche Frauenorganisationen im Westen vergrößerte in Bähnischs Wahrnehmung die Gefahr, daß Frauen sich, aus Mangel an nicht parteigebundenen Alternativen, von der zumindest offiziell überparteilichen Arbeit der Kommunistinnen im DFD angezogen fühlten. Die Frauen seien „politisch ahnungslos“ und deshalb den „geschickten kommunistischen Versuchen“ ausgeliefert gewesen, stellte Bähnisch in der Retrospektive fest, so daß es nur eine Möglichkeit gegeben habe, dem zu begegnen: „die deutschen Frauen wieder in eigenen Verbänden zusammenzuschließen und staatsbürgerlich aufzuklären“587. Im April 1947 machte die Regierungspräsidentin der Frauensekretärin der SPD ihre Position, die sich aus der Erfahrung des Nationalsozialismus und der Überzeugung, der Kommunismus sei nur eine andere Seite derselben Medaille speiste, unmißverständlich deutlich: „Ich habe keine Lust, ein zweites 33 zu erleben und werde all meine Kräfte einsetzen, […] um es zu verhindern“588. Gotthelf warf sie eine Scheuklappenperspektive vor: „Wenn Sie mehr Gelegenheit hätten, sich unter Frauen ausserhalb aller Parteien zu unterrichten, so würden Sie erschüttert sein und erkennen, daß sie über eine Parteipolitik nie an diese Frauen herankommen können.“
585 NA, UK, FO 371/70711, Notiz von R. S. Crawford an Ivone Kirkpatrick, 08.05.1948. „There were signs not long ago of some Communist penetration of a Frauenring in Schleswig-Holstein, but this seems to been nipped in the bud.” Ebd. 586 BArch, SAPMO DY 30 und DY 31. 587 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 162/163. 588 AdSD, SPD-PV, (Alter Bestand), Frauenbüro, 0244 A, Theanolte Bähnisch an Herta Gotthelf, Hannover, 29.04.1947.
658 | Theanolte Bähnisch
Eine „staatspolitische Erziehung“ zu „verantwortlichem Denken und Handeln“ sei „von einer Partei aus“ bei jenen Frauen „ausgeschlossen“, argumentierte Bähnisch. Schließlich stilisierte sie ihr eigenes Handeln für die ‚unpolitischen Frauen‘ zur conditio sina qua non für eine zukunftsträchtige Entwicklung des Staatswesens: „Was ich übernommen habe ist eine hochwichtige staatspolitische Aufgabe und es ist tief bedauerlich, dass sie (!) auf ihrem (!) so unendlich wichtigen Posten diese Notwendigkeit verkennen. Sie überlassen die Majorität der Frauen völlig sich selbst und das kann und will ich nicht tun.“589 Daß der ‚Club deutscher Frauen‘ und die folgenden Gründungen Bähnischs, der Frauenring der Britischen Zone und der Deutsche Frauenring (DFR), nicht nur Unterstützer unter deutschen Eliten gefunden hatten, sondern, daß auch die britische Militärregierung bei der Gründung, der Etablierung und der weiteren Genese jener Zusammenschlüsse die Finger im Spiel hatte, war Gotthelf und ihren Mitstreiterinnen bewußt. „Vom Zusammenschluß der Frauen und ihrer Arbeit ist eine Unterstützung seitens des Engländers zu erwarten und auch praktisch in Hannover erfolgt“590, berichtete dazu beispielsweise eine Besucherin der Gründung des überparteilichen Frauenbundes Rendsburg an das Frauensekretariat.
6.8 DIE ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT DER MILITÄRREGIERUNG IN SACHEN ‚FRAUENFRAGEN‘ UND DIE RETTENDE HILFE DURCH ‚VISITING EXPERTS‘ 6.8.1 Jeanne Gemmel bittet erneut die WGPW um Unterstützung Die bereits im April 1946 geäußerte Hoffnung der britischen Militärregierung, daß in Deutschland wieder Frauenorganisationen entstehen würden, hatte sich also erfüllt, zum Leidwesen vieler Sozialdemokratinnen. Doch die allerorten entstandenen Zusammenschlüsse einzuschätzen fiel den zuständigen Women’s Affairs Officers Offizieren schwer. Ihre Anzahl war groß und ihre Namen waren überall verschieden. Für die Offiziere war es schwierig, herauszufinden, ob sich hinter einer ähnlichen Bezeichnung – also ‚Frauenklub‘, ‚Frauenbund‘, ‚Frauenring‘, ‚Frauengruppe‘ oder ‚Frauenausschuß‘ – auch ein ähnliches Konzept verbarg. In ihrer bereits erwähnten ,Education-Control-Instruction No 60‘ hatte die I.A.&C.-Division der CCG (BE) die Früchte, die ein Frauenzusammenschluß hervorbringen sollte, wie folgt beschrieben: „In discussing common practical social and human problems with other women, in learning from experience and active help to the wider community, in the free exchange of ideas and information on subjects of immediate interest to them, German women may learn to practice democracy in ways
589 Ebd. 590 AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), Frauenbüro, 0244 A, Ausführungen der Gen. Bänisch, Hannover bei der Gründung des überparteilichen Frauenbundes Rendsburg, 14.04.1949.
Club deutscher Frauen | 659
which cannot fail to benefit their families and the community.“591 Ihre größten Hoffnungen setze die Division in „non-political organisations such as the Landwirtschaftliche Frauenvereine“592. Doch woher sollten die Offiziere wissen, welche Frauenorganisation über wieviel pädagogisches beziehungsweise demokratisches Potential verfügte und wie die praktische Arbeit der Zusammenschlüsse aussah, kurz: welche der Zusammenschlüsse im Sinn der Re-education positiv zu bewerten seien? An den Statuten allein, die die Gruppen der Militärregierung vorlegen mußten, ließ sich dies nicht festmachen. Gleichzeitig kam die Frage auf, ob die ‚Frauenarbeit‘ für die Jahre der Stationierung der Briten in Deutschland der Education & Religious Affairs Division, welche für den Umbau des Bildungssystems und entsprechend auch für die Arbeit der Bildungsträger593 zuständig war, unterstellt bleiben sollte. War es vielleicht sinnvoller, die Frauenarbeit organisatorisch an die Political Division, deren Zuständigkeit im Aufbau einer parlamentarischen Demokratie lag, anzugliedern? Schließlich sollten auf ihre Rolle als Bürgerinnen in einer parlamentarischen Demokratie vorbereitet werden. Die Zuständigen in der Militärregierung taten sich nicht leicht damit, abzuwägen, ob die ‚Frauenfrage‘ in Deutschland in erster Linie als eine ‚pädagogische‘ oder als eine ‚politische‘ Frage zu behandeln sei. Weil sie sich eine befriedigende Lösung dieser Probleme selbst nicht zutrauten, baten die mit der Frauenarbeit Beauftragten in der Militärregierung schließlich Expertinnen aus der britischen Frauenbewegung um Unterstützung. Dies erschien – wie im Kapitel über die Arbeit der WGPW bereits erwähnt – vor allem insofern vielversprechend, als britische Frauenorganisationen bereits vor dem Dritten Reich intensive Kontakte zur deutschen Frauenbewegung gepflegt hatten. In jenen Kreisen wußte man also nicht nur über die Arbeit deutscher Frauenverbände im Kaiserreich und in der Weimarer Republik Bescheid, sondern man kannte auch die Namen vieler deutscher Frauen, die ihr Engagement 1933 hatten aufgeben müssen und die daher als politisch unbelastet und vertrauenswürdig galten. Nachdem, wie beschrieben, die Leiterin der Education Branch, Jeanne Gemmel, im Februar 1946 bei der Dachorganisation britischer Frauenverbände WGPW ‚angeklopft‘ hatte, um ihr Interesse an einer Zusammenarbeit zu bekunden und General Erskine wenig später persönlich nachgefaßt und um Informationen über die Arbeit der in der WGPW zusammengeschlossenen Verbände gebeten hatte594, wandte sich Gemmel im Juni 1946 erneut an den Verband. Die WGPW sollte nun zwei Personen empfehlen, die möglichst schnell nach Deutschland reisen, sich ein Bild über den Stand der Frauenarbeit in der britischen Besatzungszone und in Berlin verschaffen und der Militärregierung Ratschläge zum weiteren Prozedere geben könnten. Gleichzeitig sollten diese Expertinnen im Rah-
591 NA, UK, FO 1050/22, Draft for Internal Affairs and Communications Division, Military Government Instruction No 78, Administration & Local Government Branch Bunde (!), Februar 1946. 592 Ebd. 593 Dazu gehörten traditionell in Deutschland auch die Kirchen. 594 Siehe Kapitel 6.4.3.
660 | Theanolte Bähnisch
men ihres Besuchs den deutschen Frauenorganisationen Hilfestellung dabei leisten, ihre Entwicklung in ‚gesunde‘ erfolgversprechende Bahnen zu lenken.595 Der WGPW war die Tragweite ihrer Entscheidung für den deutschen Wiederaufbau und damit auch für den Erfolg der Briten in Deutschland durchaus bewußt. Die Entscheidungsfindung verlief in mehreren Schritten: In einer Sitzung am 12.06.1946 kam das International Advisory Sub-Committee der WGPW – ein Arbeitskreis der Organisation, der sich um Fragen der Wohlfahrtsarbeit im Ausland kümmerte – zunächst überein, zwei Personen zu entsenden, die sowohl gute Kenntnisse über die Etablierung demokratischer politischer Systeme haben, als auch fließend Deutsch sprechen sollten. Zudem sollte sich eine der Delegierten mit der Arbeit ländlicher, die andere mit der Arbeit städtischer Frauenorganisationen auskennen. Das Gespräch kam schnell auf die ‚Townswomen’s Guilds‘, eine Frauenorganisation, welche in allen großen Städten Großbritanniens aktiv war und die ‚Women’s Institutes‘, eine Organisation, die den deutschen Landfrauenvereinen ähnlich war. Diese im Protokoll als ‚Mittelklasse‘-Organisationen bezeichneten Verbände wurden für besonders geeignet gehalten, jeweils eine Expertin aus ihren Reihen für die Reise nach Deutschland vorzuschlagen. Trotzdem bat die WGPW nicht nur diese beiden, sondern insgesamt acht der ihr angeschlossenen Frauenorganisationen596 darum, mögliche Delegierte zu benennen.597 Die angeschriebenen Organisationen und zusätzlich die ‚Suffrage Alliance‘598 sollten auch Namen von Frauen nennen, die vor 1933 in der deutschen Frauenbewegung aktiv gewesen waren und mit denen eine Kontakt-Aufnahme lohnenswert erschien. Ein größerer Kreis von insgesamt 22 Or-
595 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 25, Education Branch, I.A.&C. Division an die Regional Headquarters, 11.07.1946, Abschrift. „It is important that German women invited to meet Miss Deneke and Miss Norris should understand why. We suggest the following: British women’s voluntary organisations are ready to help German women to get their organizations on sound lines”, wurde das Anliegen formuliert, als die Namen der Expertinnen schon fest standen. 596 Namentlich waren dies: Die ,YWAC‘, die ,Federation of Soroptimist Clubs of Great Britain and Ireland‘, die ,British Federation of Business and Professional Women‘, die ,National Union of Townswomen’s Guilds‘, die ,National Federation of Women’s Institutes‘, die ,Women’s Social Service Clubs‘, die ,National Women Citizens Association‘ und die ,British Federation of University Women‘. 597 Darunter waren Soroptimistinnen und weitere Organisationen, welche ihr Programm eher auf sozial höherstehende Frauen zuschnitten vertreten, jedoch auch eine Organisation, deren Klientel vor allem Ehefrauen von Mineuren und anderen Arbeitern waren. 598 Die International Woman Suffrage Alliance war 1906 unter anderem von Carrie Chapman Catt gegründet worden. Der Name der Organisation wurde 1926 in ‚International Alliance of Women‘ (IAW) geändert. 1946 löste die Schwedin Hanna Rydh die seit 1923 amtierende Britin Margery Corbett Ashby als Präsidentin der Organisation ab. Rydh behielt das Amt bis 1952.
Club deutscher Frauen | 661
ganisationen wurde gebeten, Literatur, welche der Militärregierung bei ihrer Frauenarbeit hilfreich sein könnte, nach Deutschland zu schicken.599 In einer weiteren Sitzung des Komitees am 28.06.1946600 wurde ein Brief Gemmels verlesen, der einige Anregungen und Informationen zur weiteren Planung erhielt – beispielsweise, daß es in Hannover neuerdings Versuche von Frauenorganisationen gebe, mit „social problems“601 umzugehen. Die verantwortlichen Hannoveraner Frauen seien, so hatte Gemmel geschrieben, „probably ‚middle class‘ however“602, weshalb auch eine Möglichkeit für Hannoveraner Arbeiterinnen, sich in einer Frauenorganisation zusammenzufinden, vonnöten sei. Interessant ist, daß Gemmel in ihrem Schreiben ausschließlich auf Hannover explizit eingegangen zu sein scheint – obwohl doch zur britischen Zone zu Beginn der Besatzungshoheit neben der Provinz Hannover auch die Provinzen Schleswig-Holstein und Westfalen, der Norden der Rheinprovinz sowie die Länder Braunschweig, Hamburg, Lippe, Oldenburg und Schaumburg-Lippe gehörten. Der Fokus für die überparteiliche Frauenarbeit schien also schon im Frühsommer 1946 auf Hannover gerichtet worden zu sein. Schließlich einigten sich die Verantwortlichen in der WGPW darauf, Helena Deneke mit ihren 25 Jahren Erfahrung in den ‚Women’s Institutes‘ als „admirable fist choice“ und „a younger woman“603, Betty Norris, von den ‚Townswomen’s Guilds‘ für die Reise nach Deutschland vorzuschlagen. Von Norris hieß es, sie habe eine besondere Begabung, die Ideen, für die ihre Organisation einstand, sehr unterschiedlichen Menschen nahezu-bringen – eine gute Voraussetzung für die Arbeit mit Zusammenschlüssen, die ein sehr breites Spektrum von Frauen ansprechen wollten. Deneke und Norris sollten – das war der Dachorganisation wichtig zu betonen – nicht als Vertreterinnen der Townswomen’s Guilds und der Women‘s Institutes, sondern als Repräsentantinnen für alle britischen Frauenorganisationen in Deutschland auftreten.604 Lieber noch als Betty Norris hätte die WGPW Peggy Alexander von der ‚Educational Settlements Association‘, einer Freiwilligen-Organisation, deren Konzept der Erwachsenenbildung in ‚residential colleges‘ dem der deutschen Heimvolkshoch-
599 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C5. Meeting of the International Advisory Sub-Committee on Friday, 12th June, 1946, Protokoll. 600 Ebd., Meeting of the International Advisory Sub-Committee on Friday, 28th June 1946, Protokoll. o. D. 601 Ebd. 602 Ebd. 603 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C5, Meeting of International Advisory Sub-Comittee on Monday, July 22nd [1946]. 604 Ebd., Education Branch, Bunde [Bünde], Jeanne Gemmel an verschiedene Einrichtungen der britischen Militärregierung, 11.07.1946, Subj.: Advisory visit of Representatives of British Women’s Organisations, August 1946, Adult Education. Daß dies jedoch nicht immer so wahrgenommen wurde, sondern daß andere Frauenorganisationen sich durch die Entsendung von Deneke und Norris benachteiligt fühlten, zeigt sich hier: ebd., Box FL565, 5WFM/C5, Meeting of the International Advisory Committee on October 23rd [1946].
662 | Theanolte Bähnisch
schulen ähnelte, nach Deutschland geschickt. Doch diese war im geplanten Besuchszeitraum verhindert.605 Rückblickend ist dies als ein folgenschwerer Zufall zu bewerten, denn wäre Alexander anstelle von Norris gereist, hätte die britische Frauen-Re-education-Arbeit in Deutschland womöglich eine andere Gestalt angenommen. Während vor allem Helena Deneke in den folgenden Jahren fortwährend lobende Worte für Bähnischs Arbeit fand und sie entsprechend unterstützte606, kritisierte Alexander auf einer Reise, die sie später nach Deutschland unternehmen sollte, die Arbeit des Frauenringes, der unter Bähnischs Ägide entstanden war, scharf.607 Betty Norris äußerte sich nach einer späteren Reise ebenfalls etwas kritischer zum Stand der Frauenorganisationen in Deutschland608. Doch die Stimme der jungen Frau schien nicht das gleiche Gewicht gehabt zu haben wie die der erfahrenen Helena Deneke. 6.8.2 Der ‚Deneke-Norris-Report‘: Ein Kerndokument der britischen Frauen-Re-education-Politik in Deutschland Jeanne Gemmel zeigte sich zufrieden mit der Empfehlung der WGPW. Helena Deneke und Betty Norris sollten im August 1946 nach Deutschland reisen.609 Die Vorplanung jener Reise läßt sich aus Korrespondenzen über die Wahl des genauen Reisezeitraums und des Itinerars nachvollziehen, diese Quellen sind über die Akten der Militärregierung in den Beständen des Foreign Office, im Nachlaß Helena Denekes sowie als Bestandteil der Akten der WGPW überliefert. Das Kernstück der Überlieferung ist jedoch der Report, den Deneke und Norris nach ihrer Reise anfertigten. Seit Januar 1947 liegt er gedruckt und öffentlich zugänglich als Teil einer Serie mehrerer Abhandlungen vor, die sich allesamt mit dem Thema „what to do with the Germans“610 auseinandersetzen.611 Die britische Regierung ging zu diesem Zeitpunkt
605 Die WGPW schlug deshalb vor, Alexander zu einem späteren Zeitpunkt auf eine Reise nach Deutschland zu schicken. Gemmel zeigte sich daran aufgrund von Mrs. Alexanders Wissen über Erwerbslosen-Organisationen interessiert. Ebd., Box FL565, 5WFM/C5, Meeting of International Advisory Sub-Committee on Monday, July 22nd [1946]. 606 Ebd., Box FL565, 5WFM/C7, Visit paid to „Frauenringe” in the British Zone as ‘Adviser’ 29th June – 13th July, 1949, Helena C. Deneke, o. D. 607 Ebd., Box FL565, 5WFM/C10, Women’s Affairs Branch, Land Commissioner’s Office, Broome an German Education and Information Department, Foreign Office (German Section), 11.07.1950, Subject: Mrs. Alexander’s Report on Visit to Germany and Women’s Affairs. Der Fokus war auf die Arbeit des DFR in Nordrhein-Westfalen, vor allem in Düsseldorf gerichtet. Alexander konstatierte, der Frauenring dort habe zwischen 1947 und 1950 im Grunde keine nennenswerte Entwicklung genommen. 608 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C9, Betty Norris an Miss Homer, 12.08.1947. 609 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C5, A. B. Reeve, COGA an Robertson, WGPW, 17.07.1946. 610 O. V.: The german problem, in: The Glasgow Herald, 07.02.1947, auf: http://news. google.com/newspapers?nid=2507&dat=19470207&id=mlNAAAAAIBAJ&sjid=ZpEM
Club deutscher Frauen | 663
bereits offensiv damit um, daß sie keine Kosten und Mühen scheute, um Deutschland wieder aufzubauen.612 In einem Vorwort zum Deneke-Norris-Report subsumierte der Journalist, Schriftsteller und Historiker Robert Charles Kirkwood Ensor613 die Reise der beiden Frauen unter das von ihm für zielführend erachtete Konzept „humanity after victory“614 und betonte seinerseits den Umstand, daß die besondere Arbeit mit Frauen für den Wiederaufbau Deutschlands sehr wichtig sei.615 Beim Lesen seiner Ausführungen drängt sich – nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal – die Frage auf, ob die Militärregierung mit der besonderen Unterstützung von Frauen in Deutschland unter den britischen Bürgern womöglich eine größere Akzeptanz für die Wiederaufbau-Politik erzielen wollte und/oder konnte. Bis dato ließ sich dies nicht belegen, aber eine entsprechende Interpretation liegt nahe: Indem man die Frauen zum Motor des demokratischen Wiederaufbaus in Deutschland definierte und ihnen entsprechend unter die Arme griff, schien man – in der zu dieser Zeit auch in Großbritannien weit verbreiteten, differentialistischen Sichtweise auf die Geschlechter – andere Menschen mit dem Wiederaufbau der Republik zu betrauen als die, die den Nationalsozialismus zu verantworten hatten. In den Diskussionen, die sich um den Report der beiden Frauen zwischen den Einrichtungen der CCG (BE) und des Foreign Office, aber auch zwischen den Unterabteilungen beider Einrichtungen entfalteten, zeigt sich, welch großes Gewicht dem Bericht und der ‚Frauenfrage‘ in Deutschland als solcher beigemessen wurde. Denekes und Norris‘ Urteil über den Stand der Frauenbewegung und die damit verbundenen Empfehlungen sollten wegweisende Wirkung für die Arbeit der im Frühjahr 1946 etablierten ‚Women’s Affairs Sections‘ der Briten bis zum Abzug der Truppen 1952 haben – sowohl was die strukturelle Einbindung der Abteilung in den bürokratischen Apparat anging, als auch, was die Inhalte der Frauen-Re-education Arbeit be-
611
612
613
614 615
AAAAIBAJ&pg=4366,2200222, am 13.12.2013. Der Artikel des Verfassers lobt den Bericht von Deneke und Norris als den bisher eindrucksvollsten seiner Art. Deneke, Helena/Norris, Betty (Bearb.)/National Council of Social Welfare (Hrsg.): The Women of Germany, London 1947. Sofern nicht anders angegeben, wird im Folgenden aus dieser gedruckten Version zitiert. Die Genese vom ersten Entwurf der beiden Frauen über diverse Veränderungen auf Anregungen und Einwände Dritter hin bis zu seiner Publikation läßt sich in verschiedenen Akten der Militärregierung nachvollziehen. J. Mark aus dem General Department hatte Helena Deneke mitgeteilt, daß der Report ein guter Beitrag dazu sei, über die Verhältnisse, unter denen Frauenorganisationen in Deutschland arbeiteten, aufzuklären. „I think the more publicity we have, provided that it gives an accurate account of the facts, the better it will be.” NA, UK, FO 945/259, J. Mark, General Department an Helena Deneke, 05.11.1946. Zunächst war Lord Beveridge gebeten worden, das Vorwort zu schreiben, doch dieser war zur fraglichen Zeit nicht im Land. Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C5, meeting of the International Advisory Comittee on November 26th, 1946. Ensor, Robert Charles Kirkwood: Foreword, in: Deneke/Norris: The Women of Germany, S. 2. Vgl.: ebd.
664 | Theanolte Bähnisch
traf. Damit war der Report wiederum ausschlaggebend für den weiteren Erfolgsweg Theanolte Bähnischs und ihrer Frauenorganisationen. In ihrem Bericht lieferten Deneke und Norris, wie verlangt, einen Überblick über die Entwicklung der Frauenbewegung und derFrauenorganisationen in der britischen Besatzungszone, wie sie sie auf ihrer siebenwöchigen Reise wahrnahmen. Der Inhalt des Reports soll an dieser Stelle, nachdem er bereits von Christl Ziegler und Denise Tscharntke eingehend beschrieben worden ist616, nicht erneut wiedergegeben werden. Vielmehr lohnt sich es sich, einige Aspekte genauer zu beleuchten, die im Hinblick auf die Position Theanolte Bähnischs und des ‚Club deutscher Frauen‘ relevant sind. 6.8.2.1 Weichzeichnungen und Vorschuß-Loorbeeren: Deneke empfiehlt die Unterstützung des Clubs deutscher Frauen Auffällig ist vor allem, wie stark die von Deneke und Norris beobachteten Realitäten und die Entwicklungsprognosen, die die beiden Frauen über den ‚Club deutscher Frauen‘ aufstellten, auseinanderklafften. So hielten sie über den Ist-Zustand fest, daß im Club ein starker Einfluß einzelner Mitglieder vorherrsche und daß Vollversammlungen nach der bisherigen Konzeption nur zweimal im Jahr stattfinden sollten. Die Verfasserinnen sahen es jedoch als möglich an, daß Versammlungen in Zukunft öfter stattfinden würden („it may be“617) und als wahrscheinlich, daß Mitglieder mit ähnlichen Interessen bald gemeinsam Ausschüsse einrichten würden („it is anyway likely“618), beispielweise zum Betrieb eines „Citizen‘s Advice Bureaux“619, zur Widerlegung von Gerüchten620 („countering rumours“) und zur Unterstützung guten
616 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 21–26 sowie Tscharntke: Re-educating, passim. Tscharntke nimmt immer wieder, in verschiedenen Zusammenhängen, Bezug auf Denekes verschiedene Reisen nach Deutschland, während Ziegler sich vor allem auf die erste Reise Denekes konzentriert. 617 Deneke/Norris: Women, S. 13. 618 Ebd. 619 Ebd. 620 Gemeint ist die Widerlegung von Gerüchten über die Britische Militärregierung. In diversen Berichten beklagte diese ihr schlechtes Ansehen in der deutschen Bevölkerung. „It is probably fair to say, however that increasing bitterness and misery among the urban and refugee populations are placing a considerable strain on even the most confirmed optimists […] The general prestige of Military Government has unquestionally fallen. Rumours and hints of currency reform are causing nervousness […] Many people influenced by rumours and propaganda, refuse to believe that the present situation is not the result of deliberate British policy”, war in einem ,Monthly Report‘ der CCG (BE) aus dem November 1946 zu lesen. NA, UK, FO 1005/1668, Fifteenth Monthly Report from Military Government Land Niedersachsen covering the period 1st November–30st November 1946, General and political, S. 1. Im Juli 1946 konstatierte ein Report sogar: „A year ago, a large proportion of the Germans […] were welcoming their liberation. Only the genuine Nazis hated us, today the position is entirely changed, if not reversed, and many enemies of the Hitler regime hate us as much as the most fanatical Nazi.” NA, UK, FO 1005/1730, Regional Intelligence Staff Political Intelligence Report No. 7, Period 29
Club deutscher Frauen | 665
Hauswirtschaftens. „In these ways the leaders of the club have good and practical ideas. So in the housekeeping group, plans are made for advising manufacturers on what household goods are really wanted“621, beschrieben die beiden Frauen die Anstrengungen des Clubs, auch in der Wirtschaft beratend tätig zu werden. Die Expertinnen waren also gutgläubig, daß die Pläne, welche der Club-Vorstand ihnen unterbreitete, auch umgesetzt werden würden. Es schien alles nur eine Frage der Zeit und der richtigen Förderung zu sein. Und diese sollte der Club auf Empfehlung von Norris und Deneke bekommen: Aufgrund des Zustroms von Frauen verschiedener politischer Orientierungen und Konfessionen zum ‚Club deutscher Frauen‘ und aufgrund des professionellen Auftretens seiner Vorstands-Mitglieder fanden Deneke und Norris viele lobende Worte für Bähnischs Gründung. Sein Format sei es wert, anderen Zusammenschlüssen zur Nachahmung empfohlen zu werden, hielten sie fest.622 Gemeinsam mit dem von Agnes von Zahn-Harnack geleiteten Wilmersdorfer Frauenbund in Berlin stellten sie den Club deutscher Frauen als besonders förderungswürdig und die beiden Zusammenschlüsse als Organisationen heraus, an denen andere Verbände sich orientieren sollten: „We […] consider that, in developing women’s organisations, ‚uberparteiliche‘ and ‚uberkonfessionelle‘ societies on the lines of the Wilmersdorfer Frauenbund and the Hanover Frauenklub, which have an individual membership, should be given preference over any proposals to establish definitely political women’s organizations. Under present circumstances we judge that these are likely to have a disruptive rather than a constructive effect in rooting democracy.“623 Die Fürsprache für Bähnischs und Zahn-Harnacks Organisationen beinhaltete also gleichzeitig eine Ablehnung von Frauenverbänden, die sich als ‚politisch‘ im engeren Sinn verstanden. Deneke und Norris, welche sich der Frage – nach eigener Aussage – vorurteilsfrei genähert hätten, gaben sich nach ihrer Reise überzeugt davon, daß ‚die durchschnittliche deutsche Frau‘ („average German woman“) eine emotionale Distanz aufbaue, wenn man sich ihr mit einem ‚politischen‘ Ansatz („political angle“624) nähere. Solange die Stimme des Wählers („the vote“) keinen Einfluß auf die Regierung habe, sei politische Aktivität „nothing more than beating the air. Women of good sense are aware of this“625, argumentierten Deneke und Norris im Report. Zum einen behaupteten die Britinnen also eine Abneigung deutscher
621 622 623 624 625
June to 13 July 46, Part I – Public Opinion, S. 1. In einem Reisebericht aus dem Juli 1947 legte Helena Deneke der Militärregierung eine Zusammenarbeit mit Bähnisch unter anderem deshalb ans Herz, weil sie in der Arbeit der Club-Vorsitzenden eine Möglichkeit sah, den in Deutschland verbreiteten Glauben zu widerlegen, Großbritannien würde die Deutschen aus Gründen der Vergeltung verhungern lassen. Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 41, Report über eine Reise Helena Denekes nach Deutschland, Helena Deneke, 19.07. 1947, S. 30. Deneke/Norris: Women, S. 14. Vgl.: ebd., S. 15 Ebd., S. 15. Ebd., S. 22. Ebd.
666 | Theanolte Bähnisch
Frauen gegen alles ‚Politische‘, zum anderen suggerierten sie, daß jedes politische Engagement von Frauen mit der Erwartung verbunden sei, daß dieses Engagement unmittelbare Folgen für die politische Gestaltung des Landes haben müsse. Dies ist eine im Kern doch etwas widersprüchliche Argumentation, die zudem das sozialisationsbedingte, zentralistische Staatsverständnis der Verfasserinnen verriet. Zwar war zu jener Zeit noch nicht abzusehen, wann ein deutscher Staat gegründet werden würde, doch schon im Dezember 1946 sollte der erste, von der Militärregierung eingesetzte niedersächsische Landtag zusammentreten, zu dem im April 1947 die ersten Wahlen stattfanden. ‚Wählers Stimme‘ sollte also doch recht bald wieder ein Gewicht bekommen, zumal die ersten Wahlen zum Kreistag sogar schon im Oktober 1946 – also noch vor der Veröffentlichung des Reports – stattgefunden hatten. Zumindest diese Entwicklung dürfte im August 1946 bereits absehbar gewesen sein. Besonders interessant ist, daß Bähnischs Club im Report der beiden Britinnen dem von Zahn-Harnack geleiteten Wilmersdorfer Frauenklub in der Wertung gleichgestellt wurde, obwohl die Berlinerinnen in puncto demokratische Vereinskultur und politische Bildungsarbeit 1946 bereits viel größere Fortschritte aufzuweisen hatten. Sie hielten nicht nur viel häufiger, nämlich einmal im Monat, Mitglieder-Treffen ab, sie hatten auch schon Arbeitsausschüsse zur Analyse der Programme politischer Parteien, zur Entwicklung einer Verfassung für Deutschland und zur Erziehungsfrage gebildet.626 Der Club deutscher Frauen erhielt also Vorschußlorbeeren, in der Annahme, der erst wenige Wochen vor Denekes und Norris’ Besuch gegründete Verband würde sich zeitnah entsprechend dem bereits im Oktober 1945 begründeten Wilmersdorfer Frauenbund entwickeln. Daraus, daß das Club-Ziel der „Wiederherstellung eines gesunden nationalen Stolzes“, an dem sich einige Sozialdemokratinnen sehr störten, im Report nicht erwähnt wird, kann ebenfalls eine besondere Unterstützung des Clubs abgeleitet werden. Natürlich ist es möglich, daß Deneke und Norris, als sie die Club-Ziele nannten, schlichtweg vergessen hatten, auch dieses Ziel zu erwähnen. Doch es erscheint naheliegender, daß sie ein negatives Image des Clubs verhindern wollten. 6.8.2.2 Hinter den Kulissen: Die Genese des Reports und die Bewertung des Clubs in unveröffentlichten Dokumenten Was weder im Report, noch in den Akten der Militärregierung und auch nicht in den Arbeiten Christl Zieglers sowie Denise Tscharntkes deutlich wird, ist die Genese von Denekes und Norris‘ Berichterstattung über die beiden als besonders förderungswürdig dargestellten Verbände. Diese hat jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach stark dazu beigetragen, daß im Report über Hannover, den ‚Club deutscher Frauen‘ und Theanolte Bähnisch intensiver berichtet wurde als über den britischen Sektor von Berlin, Agnes von Zahn-Harnack und den Wilmersdorfer Frauenbund. Aus dem Nachlaß Denekes geht nämlich hervor, daß diese gar nicht, wie ursprünglich ge-
626 Vgl.: Deneke/Norris: Women, S. 14.
Club deutscher Frauen | 667
plant627, nach Berlin gefahren war. Betty Norris hatte jenen Teil der Reise allein bestritten, während Deneke sich zur gleichen Zeit in Hamburg und Schleswig-Holstein aufhielt. Erst in Hannover hatten sich die beiden Frauen wieder getroffen und die für dort geplanten Programmpunkte gemeinsam absolviert.628 Helena Deneke hatte die im Wilmersdorfer Verband organisierten Frauen also gar nicht kennengelernt. Daß die Erfahrung des persönlichen Austauschs mit den Club-Mitgliedern in Hannover zu einer intensiveren Berichterstattung führte als die Informationen aus zweiter Hand, die Deneke von der sehr viel jüngeren und unerfahreneren Norris über den Berliner Verband zugetragen worden waren, ist mehr als wahrscheinlich. Was ebenfalls im Report unerwähnt bleibt, ist der Umstand, daß weder die Militärregierung noch die ‚Visiting Experts‘ selbst das Programm für Hannover – wo sich beide Frauen vom 30.08. bis zum 01.09. aufhielten, um Frauen- und Wohlfahrtsorganisationen zu besuchen – aufgestellt hatten. Diese Aufgabe war Theanolte Bähnisch überlassen worden.629 Ihr Einfluß auf den Besuch der beiden ‚Visiting Experts‘ in der Region – und damit auf deren Wahrnehmung der Frauenarbeit vor Ort – ging also weit über die mit ihrem Club in direktem Zusammenhang stehenden Programmpunkte, wozu sowohl ein Treffen der Britinnen mit dem Club-Vorstand als auch ein öffentliches Zusammentreffen mit etwas mehr als 150 Club-Mitgliedern630 gehörte, hinaus. Beispielsweise dürfte die sehr positive Bewertung der Frauensektion im Deutschen Roten Kreuz (DRK)631 nicht ganz unabhängig von Bähnischs Input zustande gekommen sein. Denn Bähnisch pflegte, wie bereits erwähnt, als Vorstand des DFK-Kreisverbandes Hannover-Stadt632 gute Kontakte zum DRK und profitierte als Verwaltungschefin im Bezirk direkt von der Kooperation mit dem DRK und dessen Leistungen in der sozialen Arbeit. 6.8.2.3 Tips für die Leitung der ‚Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände‘ an Bähnisch In ihren privaten Notizen gibt Deneke außerdem an, daß sie über die beiden erwähnten Veranstaltungen mit dem ‚Club deutscher Frauen‘ hinaus „further sessions“, also weitere Treffen mit Bähnisch gehabt habe, während derer man über „constitutional problems of her Club and the Arbeitsgemeinschaft“633 gesprochen habe. Man habe der Juristin nahegelegt, ein Rotationsprinzip für den Vorstand der Arbeitsgemein-
627 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 25, Advisory Visit of Representatives of British Women’s Organisations – Itinerary for Miss Deneke and Miss Norris. [Mit handschriftlich eingefügten Korrekturen.], o. D. 628 Ebd. 629 Ebd., Suggested contacts and itinerary, Abschrift. Zahlenangabe, Ebd., Fragment ohne Titel, beginnend mit „Hannover 14.–17. Aug. 1946“, S. 2. 630 Ebd. 631 Vgl.: Deneke/Norris: Germany, S. 18/19. 632 Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 562, Satzung des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Hannover-Stadt vom 21.04.1948. 633 Ebd.
668 | Theanolte Bähnisch
schaft einzuführen,634 so Deneke, was darauf hindeutet, daß Bähnisch von den Britinnen zu Recht als wegweisende Instanz nicht nur im ‚Club deutscher Frauen‘, sondern auch in der Arbeitsgemeinschaft wahrgenommen wurde und daß diese Rolle der Regierungspräsidentin in der Arbeitsgemeinschaft auch erwünscht war. Nicht etwa dem gewählten, vierköpfigen Vorstand der Arbeitsgemeinschaft, sondern der im Vorstand gar nicht vertretenen Bähnisch empfohlen Deneke und Norris also zur Verwendung in der AG eine Arbeitsweise zur Nachahmung an, wie sie ein Arbeitskreis britischer Frauenverbände pflegte. Die Regierungspräsidentin sollte, so empfahl es Deneke, zukünftig den regelmäßig erscheinenden Brief über die ‚Standing Conferences‘ des ‚Standing Committee on German Women’s Education‘ (in dem die WGPW mit den britischen Soroptimistinnen zusammenarbeitete) erhalten. Einer jener Briefe, die zur Weiterleitung an Bähnisch bestimmt waren, enthielt sogar einen Entwurf für eine Übergangsverfassung für ‚Standing Conferences‘, welchen die britischen Soroptimistinnen ausgearbeitet hatten.635 Auch dieser sollte der Orientierung Bähnischs dienen. Vermutlich wußten weder die von der WGPW entsandten Expertinnen noch die Mitarbeiterinnen der Women’s Affairs Section von Bähnischs Vergangenheit bei den Soroptimistinnen in Berlin. Umso erstaunlicher ist es, daß sich auch hier ein Kreis in Bähnischs Biographie schließt: Eine Organisation, welche in den 1920er Jahren prägenden Einfluß auf die damals noch junge Juristin hatte, trat erneut in Erscheinung, als diese selbst eine Frauenorganisation leitete und darüber hinaus einen Beitrag zur Vernetzung anderer Frauenorganisationen leisten wollte. Ob das von Deneke vorgeschlagene Rotationsprinzip für den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft umgesetzt wurde, läßt sich in der Überlieferung des Stadtarchivs Hannover und des Foreign Office nicht nachvollziehen.636 Wohl aber, daß im Juli
634 Ebd., Fragment ohne Titel, beginnend mit „Hannover 14.–17. Aug. 1946“, S. 2. Ob Bähnisch von diesem Vorschlag Gebrauch machte, ist nicht überliefert. Einem Report von Helena Deneke über eine Reise nach Deutschland im Juni/Juli 1947 ist zu entnehmen, daß Ende Juni/Anfang Juli 1947 Anita Prejawa, die ‚rechte Hand‘ Bähnischs die Arbeitsgemeinschaft leitete und etwa 20 Frauen anwesend waren. Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 41, Report über eine Reise Helena Denekes nach Deutschland, Helena Deneke, 19.07.1947, S. 25. 635 Vgl.: ebd., Afternoon Session of Conference of Committee on German Women’s Education held on 20 Sep 46. Miss Deneke’s comments on the present and future of German women’s voluntary organisations, Jeanne J. Gemmel, o. D. [Sept. 1946], Appendix A: Standing conference of women’s organizations. Beide Verbände bildeten eine ‚Standing Conference on Women's Organisations‘, die bis 1972 andauern sollte. Vgl.: Katalogtext zum Bestand ,Women's Group on Public Welfare; 1939–1975‘ (NA 772), in: Katalog der Women’s Library, auf: http://calmarchive.londonmet.ac.uk/DServe/dserve.exe?dsqIni =Dserve.ini&dsqApp=Archive&dsqDb=Persons&dsqSearch=Code==%27NA772%27&d sqCmd=Show.tcl, am 13.12.2013. 636 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 41, Report über eine Reise Helena Denekes nach Deutschland, Helena Deneke, 19.07.1947, S. 25.
Club deutscher Frauen | 669
1947 Anita Prejawa, die auch die Geschäfte des Frauenrings besorgte, die Arbeitsgemeinschaft leitete.637 Helena Deneke und Betty Norris nahmen die Zusammenarbeit von Frauenorganisationen in Arbeitsgemeinschaften alles in allem als äußerst sinnvoll wahr, waren sie doch selbst entsprechend sozialisiert worden. Und Helena Deneke, die überdies eine überzeugte Vertreterin weiblicher Wohlfahrtsarbeit war, verknüpfte im Report wohl kaum zufällig die Entwicklungen im Bezirk Hannover mit den ihr bekannten, ihrer Meinung nach fruchtbaren Verhältnissen in Großbritannien. Allerdings gab sie in einem Gespräch mit Women’s Affairs Officers auch zu bedenken, daß bei Arbeitsgemeinschaften, wie der Frauenarbeitskreis in Hannover eine sein sollte, sowohl die Gefahr einer repräsentativen Schieflage als auch einer Abhängigkeit von der Kommune bestünde.638 Was hiermit gemeint war, erschließt sich, wenn man sich vor Augen hält, daß die Arbeitsgemeinschaften von Frauenverbänden, wie Deneke sie kannte, soziale Arbeit in enger Abstimmung mit der öffentlichen Hand koordinierten. Deshalb schien ihr einerseits die Möglichkeit der Existenz einer Arbeitsgemeinschaft, welche unbeeinflußt von einer solchen Logik funktionieren könnte, gar nicht in den Sinn gekommen zu sein. Andererseits ist denkbar, daß Bähnisch – was vor dem Hintergrund ihres Verwaltungsamtes nicht unwahrscheinlich ist – Deneke über ihre entsprechenden Pläne für die Arbeitsgemeinschaft aufgeklärt hatte. Das hieße, daß sie sich die Funktion einer Arbeitsgemeinschaft genau so, nämlich als ein der öffentlichen Hand zuarbeitendes Gremium, das soziale Arbeit in Abstimmung mit den Behörden koordinierte, vorstellte. Darauf, daß sich eine entsprechendes Vorgehen bereits etabliert hatte, deutet die Aussage Denekes und Norris‘ im Report hin, daß in der Region Hannover Frauenorganisationen in der sozialen Arbeit gut zusammen arbeiteten. 639 Eventuell ließe sich aus der Überlieferung der in der Arbeitsgemeinschaft vertretenen Verbände und der Organisationen und Parteien, die mit ihren Frauensektionen in der AG vertreten waren, mehr erfahren. Eine solche Recherche bietet sich auch deshalb an, weil sie die bisher erforschten Zusammenhänge des Wiederaufbaus in der Region mit erhellenden Informationen ergänzen könnte. Allgemein bescheinigten Deneke und Norris den deutschen Frauenorganisationen in der britischen Zone, vor allem den Frauen des Roten Kreuzes, große Couragiertheit und gute Ergebnisse bei ihrer Arbeit.640 Ob der ‚Club deutscher Frauen‘ ebenfalls eine Rolle in der Wohlfahrtsarbeit spielte, erwähnen die Frauen nicht.
637 Ebd. An einem Treffen der Arbeitsgemeinschaft am 20. oder 21.06.1947 hatten Deneke zufolge etwa 20 Personen teilgenommen. Deneke sprach auf diesem Treffen über ihre Eindrücke von der Konferenz von Pyrmont und den Zusammenschluß zum Frauenring der britischen Zone. 638 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 25, Afternoon Session of Conference of Committee on German Women’s Education held on 20 Sep 46. Miss Deneke’s comments on the present and future of German women’s voluntary organisations, Jeanne J. Gemmel, o. D. [Sept. 1946]. 639 Vgl.: Deneke/Norris: Women, S. 20/21. 640 Vgl.: ebd., S. 18/19.
670 | Theanolte Bähnisch
Die beiden ‚Visiting Experts‘ hatten also ihre Aufgabe, den deutschen Protagonistinnen der Frauenbewegung Hilfestellung zu leisten, nicht nur in Bezug auf den ‚Club deutscher Frauen‘, sondern auch in Bezug auf die Arbeitsgemeinschaft erfüllt. Ob ausschließlich mit ihr oder auch mit anderen Frauen über die Arbeitsgemeinschaft gesprochen worden war, ist dem Report nicht zu entnehmen. Daß der Regierungspräsidentin von den Expertinnen eine Relevanz in der örtlichen Frauenbewegung beigemessen wurde, die deutlich über ihre Position als ClubPräsidentin hinausging, ist auch daran zu erkennen, daß man Bähnisch Beraterqualitäten für Frauenorganisationen an anderen Orten unterstellte. In Celle und Göttingen hatten sich nämlich bereits Frauenclubs nach dem Vorbild des Hannoveraner Clubs entwickelt. Doch der Club in Celle „has not yet formed its feet and is entirely vague with regard to democratic government“, brachte Deneke ihre Kritik zum Ausdruck. „We suggested to Frau Bähnisch that a visit from her would help“641. Am Frauenclub in Göttingen dagegen, der von einer Frau Huber, „a refugee now settled in Göttingen“, geleitet wurde, hätte sich der Hannoveraner Club, wie es scheint, sogar noch ein Beispiel nehmen können: Von 300 Personen auf einer Veranstaltung am 29.08. 1946 seien etwa die Hälfte der Anwesenden Flüchtlinge gewesen, und der Vorschlag, daß der Club Verbindungen zwischen den Flüchtlingen und den „old inhabitants“642 schmieden solle, sei mit Zustimmung angenommen worden. Damit war der Göttinger Club offenbar auf einem guten Weg, eine wichtige Aufgabe gesellschaftlicher Integration umzusetzen. Was die Flüchtlingshilfe des Hannoveraner Clubs anging, konnten Deneke und Norris immerhin konstatieren, daß dieser einen Ausschuß zur Klärung von ‚Mißverständnissen‘ im Zusammenhang mit Einquartierungen eingerichtet habe.643 Überhaupt setzte Deneke große Hoffnungen in die Ausschußarbeit des Clubs. Sie hob vor allem jenen Ausschuß positiv hervor, an dem Clubmitglied ‚Hedwig S.‘ so starke Kritik geübt hatte, nämlich den Ausschuß für „household equipment“. Die Leiterin, Frau Bode-Schwandt, die Deneke als „a sensible crafts women and very knowledgible in handicrafts and food values“ beschrieb, gehörte in Denekes Wahrnehmung zu den „outstanding people in Hannover Region“644. An professioneller Kompetenz mangelte es dem Club in der Wahrnehmung Denekes also nicht, ebensowenig an hochgesteckten Zielen: „She hopes to establish a channel through which housewives can make their needs known to manufacturers so that raw materials can be used to advantage“645, beschreibt Deneke Bode-Schwandts Plan, auch in der Wirtschaft beratend tätig zu sein.
641 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 25, Fragment ohne Titel, beginnend: „Hannover 14–17 Aug. 1946”, S. 2. 642 Ebd., S. 3. Denekes Notizen zufolge hatte auch Getrud Bäumer als Gast und als Rednerin an der Versammlung teilgenommen. 643 Ebd., S. 3. 644 Ebd., S. 4. 645 Ebd., S. 2.
Club deutscher Frauen | 671
6.8.2.4 „a one man’s show“ – Ämterhäufungen unter dem Vorsitz Bähnischs Daß Theanolte Bähnisch, die ja schon durch ihr Amt als Regierungspräsidentin im Licht der Öffentlichkeit stand, in Hannover zusätzlich eine so starke Stellung in der Frauenarbeit einnahm, störte die beiden britischen Beobachterinnen nicht. Im Anschluß an ihre insgesamt sehr positive Einschätzung des Clubs deutscher Frauen („an interesting venture and likely to do good work“646) hatte Deneke in einer persönlichen Notiz sogar, ohne dies zu bewerten, festgestellt, daß der Frauenclub „at present a one man’s show“647 sei. Und obwohl unschwer zu interpretieren ist, was damit gemeint war, fügte sie in Klammern noch „Frau Bähnisch is president“648 zu ihrem Kommentar hinzu. Helena Deneke war durchaus aufgefallen, daß viele Mitglieder des Clubs auch in den anderen Organisationen, mit denen Treffen stattgefunden hatten, vertreten waren. In jener ‚Ämterhäufung‘ sah sie allerdings keine Veranlassung zur Kritik. Doch deutete sie eine Problematik an, die Barbara Henicz und Margret Hirschfeld – ohne Kenntnis der britischen Frauen-Re-education Arbeit – ebenfalls aufgezeigt hatten: „It remains to be seen how far the Club will develop so as to mean much to the ordinary member“.649 Auch die britischen Expertinnen waren also der Meinung, daß die ohnehin bereits sehr aktiven, bekannten Frauen die Club-Arbeit dominierten. Nach Denekes und Norris‘ Urteil war dies jedoch kein spezifisches Problem des ‚Club deutscher Frauen‘, sondern ein verbreitetes Phänomen in jener frühen Phase des Wiederauflebens der Frauenbewegung. Die Expertinnen sahen sich allgemein damit konfrontiert, daß ‚einfache Mitglieder‘ von Frauenzusammenschlüssen sich sehr passiv verhielten, keine Verantwortung übernehmen wollten und demokratische Verfahrensweisen nicht verstünden. Auf der anderen Seite ließe die Art der Veranstaltungen von Frauenzusammenschlüssen einzelnen Frauen aber auch zu wenig Raum, sich zu Wort zu melden und sich im Sinn der Demokratie zu üben hielten die Britinnen fest.650 6.8.2.5 Abschließende Empfehlungen, ihre Umsetzung und die Erweiterung des Einflusses der WGPW Die Empfehlungen, welche Deneke und Norris der Militärregierung gegenüber aussprachen, waren schließlich folgende: Gefördert werden sollten vor allem überparteilich-überkonfessionelle Organisationen651 nach dem Modell von Bähnischs Club und
646 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 25, Fragment ohne Titel, beginnend mit „Hannover 14–17 Aug. 1946“, S. 2. 647 Ebd. 648 Ebd. 649 Ebd. 650 Ebd. 651 Daß das Plädoyer für die überparteilichen Organisationen und gegen die Frauenarbeit bei den Parteien so stark ausfiel, dafür schien auch die WGPW verantwortlich gewesen zu sein. Die Organisation hatte einen Entwurf des Reports erhalten und entsprechend überarbeitet. NA, UK, FO 1049/568, Amendments to Report on German Women’s Organiza-
672 | Theanolte Bähnisch
dem Wilmersdorfer Frauenbund Zahn-Harnacks – womit die ‚Visiting Experts‘ sowohl die ältere als auch die jüngere Generation in der Frauenbewegung unterstützten. Weil eine Förderung politischer Frauenorganisationen nicht produktiv sei, sollten die ‚Women’s Affairs‘ im Zuständigkeitsbereich der Educational Division verbleiben.652 Außerdem waren die Expertinnen dafür, einen Personenaustausch zwischen deutschen und britischen Frauenorganisationen zu etablieren: Weitere britische Expertinnen wie Deneke und Norris sollten als ‚Visiting Experts‘ nach Deutschland reisen653 und Vertreterinnen deutscher Organisationen sollten die Gelegenheit erhalten, Frauenorganisationen in Großbritannien kennenzulernen und sich an ihrer Arbeit zu orientieren.654 Mit ihrem Lob für den ‚Club deutscher Frauen‘ sprach die spätere GermanistikProfessorin schließlich auch eine Warnung aus: Deneke war, einem Protokoll Jeanne Gemmels zufolge, der Meinung, daß der Aufbau der neu entstehenden überparteilichen und überkonfessionellen Organisationen in Deutschland nicht übereilt werden sollte. Sie hatte Sorge, daß die Zusammenschlüsse andernfalls zu ‚Quasselbuden‘ („talking shops“) verkommen könnten, anstatt praktische demokratische Arbeit zu leisten.655 Ausgerechnet dieser kritischen Ratschlag Denekes sollte für die Militärregierung jedoch alsbald nicht mehr handlungsleitend sein.656 Geduld, schrieben die Autorinnen zusammenfassend, sei der Schlüssel zum Erfolg der Demokratie in Deutschland.657 Gleichzeitig benannte der Report auch einen Umstand, der schon bald dazu führte, daß die hier beschworene Geduld der Militärregierung schnell auf-
652
653 654 655 656 657
tions submitted by Miss Deneke and Miss Norris to the Control Office, WGPW, 10.10.1946. NA, UK, FO 1049/568, Minutes of discussion with Miss Deneke and Miss Norris of the Women’s Group on Public Welfare, on the 6th of October, 1946. „The Delegation referred to the Civic Development Section of Administration & Local Government Branch, which is dealing with German Women’s Organisations and overlapping with the work of the Adult Education Section of Education Branch. The W.G.P.W. Delegates affirmed, with emphasis, that the work was essentially educational and that the women undertaking it should both be able to speak German and have a close knowledge of the German background. They stated that though they had other qualifications women doing this work in Administration & Local Government Branch had not these particular ones“, heißt es unter dem Abschnitt Responsibility for Supervision of Women’s Organisations and Recruitment of Staff.” Ebd. Eine ähnliche Argumentation findet sich in NA, UK, FO 945/259, Note on Report by Miss Deneke and Miss Norris and on Discussion with them, o. V., 14.10.1946. „The Civic Development Section of the Latter Branch [Administration & Local Government Branches] is not […] happily chosen, in that its members are politically informed but know nothing about education or conditions in Germany, and do not speak german.“ Vgl.: Deneke/Norris: Women, S. 22. Vgl.: ebd., S. 23. Ebd. Siehe Kapitel 8.2.4. Vgl.: Deneke/Norris: Women, S. 24.
Club deutscher Frauen | 673
gebraucht war: Deneke und Norris hielten es für nötig, zu erwähnen, daß einige der Frauenzusammenschlüsse, mit denen sie sich auf ihrer Reise auseinandergesetzt hatten, kommunistisch orientiert seien. Insbesondere der Hamburger Frauenring und einige Frauenausschüsse in Berlin seien entsprechend dominiert. Was die Landfrauenvereine angehe, die als eine gute Ergänzung zu den überparteilich-überkonfessionell arbeitenden Frauenzusammenschlüssen in den Städten angesehen wurden, sei es jedoch durchaus sinnvoll, auf eine schnelle Entwicklung hinzuwirken, hatte Gemmel Denekes Ausführungen interpretiert. Hierfür schien nicht zuletzt das Potential dieser Vereine, Flüchtlinge in die ländliche Gesellschaft zu integrieren, ausschlaggebend gewesen zu sein.658 „We look upon the development of Landfrauenvereine as a hopeful piece of work which may, in the course of the years, enable democracy to take root among rural women.“659 Anke Sawahns Interpretation, die Landfrauenvereine seien auf „dringenden Wunsch“ der Besatzungsbehörden „unmittelbar nach dem mental, emotional und materiell zerstörerischen Zweiten Weltkrieg […] wegen der katastrophalen Versorgungs- und Ernährungslage […] reorganisiert worden, damit sie […] mit ihren versorgungspraktischen Erfahrungen und ihrer Tatkraft zur Verbesserung der Lage beitrugen“660, ist sicher zutreffend. Auch Deneke und Norris hatten in ihrem Report darauf hingewiesen, daß sie keine Chance für eine Demokratisierung der deutschen Gesellschaft sahen, solange die Versorgungslage prekär sei. Jedoch wurde von Seiten der WGPW weder die bisherige politische Ausrichtung der Landfrauenverbände noch die Arbeit der Protagonistinnen der überparteilichen Frauenbewegung vor 1933 einseitig positiv dargestellt. An Elisabeth Boehm, der Vorsitzenden der Landfrauenvereine bis 1929, hatte Mrs. Russell von den ‚Associated Countrywomen of the World‘, in der Sitzung des International Advisory Board der WGPW kein gutes Haar gelassen.661 Deneke und Norris wiederum beschönigten die Rolle der Frauen, die sich vor 1933 in der überparteilichen Frauenbewegung in Deutschland engagiert hatten, nicht: „They admit that the present conditions of Germany are the result of her former policy“, hielten die Expertinnen fest, „but they want the chance to work for the reconstruction of their country“662. Diese Chance wollten Deneke und Norris jenen Frauen geben, zumal sie dieser Generation als Pluspunkt anrechneten, daß sie bereits die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg erfolgreich gemeistert hätten und sich damit das Vertrauen der jüngeren Generation erwerben könnten.663 Gedanklich hatten die Expertinnen also über die geplante Unterstützung von Organisationen, die dem Zuschnitt des ‚Club deutscher Frauen‘ auf der einen und den Landfrauenverbänden auf der anderen Seite folgten, ein Modell nach britischem
658 Vgl.: Sawahn, Anke: Die Frauenlobby vom Land. Die Landfrauenbewegung in Deutschland und ihre Funktionärinnen 1898 bis 1948, Frankfurt a. M. 2009, S. 285. 659 Deneke/Norris: Women, S. 19. 660 Sawahn: Frauenlobby, S. 284. 661 Vgl.: Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C5. Meeting of the International Advisory Sub-Committee on Friday, 12th June, 1946, Protokoll. 662 Deneke/Norris: Women, S. 23. 663 Vgl.: ebd., S. 24.
674 | Theanolte Bähnisch
Vorbild verfolgt, das sowohl die staatliche Bildungs- und Wohlfahrtsarbeit als auch die Anstrengungen zur Versorgung der Bevölkerung im Wiederaufbau durch die persönliche Arbeit Einzelner im Dienst der Gesellschaft unterstützen sollte. Die beiden ‚Visiting Experts‘ schienen also – anders als von Bähnisch realisiert – auf eine aktive Mitarbeit auch ‚einfacher‘ Mitglieder im ‚Club deutscher Frauen‘ zu warten. Deneke und Norris hofften, die Club-Mitglieder könnten über ihr Engagement im Club Einfluß auf ihr Umfeld ausüben und von dieser Art des Engagements würden wiederum positive Effekte auf die (Charakter-)Bildung der Frauen ausgehen. Die Militärregierung befolgte die Ratschläge Denekes und Norris‘ umgehend. Die Zuordnung der ‚Women’s Affairs‘ zur Education Branch wurde nicht verändert, Bähnischs Club deutscher Frauen erhielt die besondere Unterstützung der Militärregierung in der Region und auch darüber hinaus, vor allem, als er Anstrengungen unternahm, sich mit dem Wilmersdorfer Frauenbund und anderen Verbänden zu vernetzen sowie den Austausch von Frauenorganisationen untereinander allgemein zu fördern. Die Frauenreferate bei den Parteien erhielten, der Empfehlung der Expertinnen folgend, keine Unterstützung, die der Förderung der überparteilichen Organisationen gleichkam. Daß die Militärregierung damit einer Haltung von Vertreterinnen der britischen Frauenbewegung folgte, die der Einstellung und Hoffnung der SPDFrauensekretärin Gotthelf diametral gegenüberstand664, war den Verantwortlichen bewußt. Auch dem Vorschlag, einen Austausch zwischen deutschen und britischen Frauenorganisationen zu etablieren, kam die Militärregierung umgehend nach. Von der CCG (BE) gewollt, nahm die WGPW, auch über die ihr kooperativ angeschlossenen Organisationen Townswomen‘s Guilds und Women‘s Institutes, in den folgenden Jahren wiederholt starken Einfluß auf die Auswahl der Frauen, die nach Großbritannien eingeladen wurden, wie auch darauf, welche Frauen als ‚Visiting Experts‘ nach Deutschland geschickt wurden665. Dies verlieh der britischen Dachorganisation eine machtvolle Stellung in der britischen Politik des deutschen Wiederaufbaus. Jenen Spielraum nutzte die WGPW nicht selten zur Förderung der von Bähnisch aufgebauten Organisationen und der mit ihr eng kooperierenden Personen. 6.8.2.6 Auch ein Effekt der Hilfe Denekes: Die Regierungspräsidentin als ‚Gate-Keeper‘ zu Kontakten und Auslandsreisen Das Ansehen, das die Regierungspräsidentin in der britischen Frauenbewegung sowie bei der Militärregierung genoß, führte dazu, daß Frauen, die mit ihr zusammenarbeiteten, in den Genuß einer besonderen Förderung kommen konnten. So wurde
664 NA, UK, FO 945/259, Note on Report by Miss Deneke and Miss Norris and on Discussion with them, o. V., 14.10.1946. „Their attitude conflicts strongly with that of Miss Gotthelf, who is, of course, a paid political advisor“, ist in der Notiz über die Ratschläge Denekes und Norris’ zu lesen. Ebd. 665 Dieses Angebot hatte Gemmel der WGPW unterbreitet. Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C5, Meeting of the International Advisory Committee on November, 26th, 1946. Im Protokoll sind auch Namen von Frauen genannt, die das Komitee für eine Reise nach Deutschland empfahl.
Club deutscher Frauen | 675
auf Wunsch der Women’s Institutes, beziehungsweise Helena Denekes, Else Richter, die sowohl den Frauenring in Kiel leitete als auch an der Stimme der Frau als Chefredakteurin mitarbeitete, eingeladen. Wohnen durfte Richter sogar bei Helena Deneke persönlich.666 Betty Norris und die Townswomen‘s Guilds sorgten dafür, daß Christine Teusch667, welche ebenfalls eine verantwortliche Funktion im Frauenring inne hatte, mit Bähnisch in der Europäischen Bewegung zusammenarbeitete und als Kultusministerin des Landes Nordrhein-Westfalen ein wichtiges Verwaltungsamt bekleidete, nach Großbritannien eingeladen wurde.668 Da Else Richter besonders an Landfrauenorganisationen interessiert war, wurde für sie ein entsprechendes Programm vorbereitet, während Frauen wie Teusch, die eher mit städtischen Frauenorganisationen zusammenarbeiteten, vor allem im städtischen Umfeld herumgeführt wurden.669 Ob solche Vorteile für die professionelle Laufbahn wie Aufenthalte in Großbritannien und Kontakte zu ausländischen Frauenorganisationen für sich genommen eine besondere Motivation für andere Frauen darstellten, mit Bähnisch zusammenzuarbeiten, ist eine spannende Frage. Sie ließe sich jedoch allenfalls aus einer Analyse der Nachlässe beziehungsweise anderweitig überlieferter Äußerungen solcher Personen klären. Unwahrscheinlich ist eine Politik gegenseitiger Vorteilnahme nicht: Wer mit Bähnisch in Kontakt stand, der hatte bessere Chancen, bei der Militärregierung auf die Liste begünstigter Personen zu gelangen, Bähnisch konnte wiederum damit punkten, daß intelligente, internationaler Arbeit gegenüber aufgeschlossene Personen, die im Ausland positiv auffielen - wie Christine Teusch oder Katharina Petersen – in ihrer Organisation mitarbeiteten oder anderweitig mit ihr vernetzt waren. Das Foreign Office kam bei den Besuchen deutscher Frauen in Großbritannien – von denen natürlich nur ein Teil über den Kontakt zu Bähnisch zustande kam – jeweils für die Reisekosten, ein Taschengeld und einen Teil der Unterhaltskosten
666 Ebd., Box FL565, 5WFM/C6, Marjorie Freeman, National Federation of Women’s Institutes an Mrs. Sharp, National Council of Social Service, 16.05.1947. Allerdings war Deneke sehr daran gelegen, sich nicht ausschließlich mit Richter, sondern auch mit anderen deutschen Frauen auszutauschen: „Miss Deneke writes to say that she would very much like to have Frau Teusch and Frau Dr. Scheuner for a night during their visit.“ Ebd. Aus demselben Brief geht hervor, daß auch die frühere Kinderkrankenschwester Helga Prollius, die 1945 die Leitung des Frauenfunks beim NWDR übernahm und unter anderem für die erfolgreiche Frauenzeitschrift ‚Constanze‘ schrieb, nach Großbritannien kommen und bei Mrs. Talbot wohnen sollte. 667 Teusch war auch bei der Gründung der Frauenarbeitsgemeinschaft der CDU/CSU Deutschland in Frankfurt am 01.05.1948 anwesend. Vgl.: Süssmuth, Hans: Kleine Geschichte der CDU-Frauen-Union, Baden-Baden 1990. 668 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C6, Marjorie Freeman, National Federation of Women’s Institutes an Mrs. Sharp, National Council of Social Service, 16.05.1947. 669 Ebd., Some things the visitors have done, o. V., o. D.; The visitors themselves, o. V, o. D.
676 | Theanolte Bähnisch
auf.670 Von den britischen Frauenorganisationen erwartete das Foreign Office, die Unterbringung der Frauen zu gewährleisten, was meistens in den Privathaushalten leitender Mitglieder der Verbände geschah.671 Der Austausch war also entsprechend persönlich und führte, wie in Denekes und Bähnischs Fall, zum Entstehen freundschaftlicher Beziehungen. Daß die britischen Frauenorganisationen beziehungsweise ihre einzelnen Mitglieder einen Teil der Kosten für den Austausch übernehmen mußten bedeutete gleichzeitig, daß kleinere britische Frauenorganisationen, die oder deren Mitglieder nicht über ein entsprechendes finanzielles Polster verfügten, keinen entsprechend starken Einfluß auf deutsche Multiplikatorinnen ausüben konnten. 6.8.2.7 Herrschaft der Verbände? Deneke als Lobbyistin der Frauenbewegung Helena Deneke beriet und unterstützte den ‚Club deutscher Frauen‘ gemeinsam mit anderen ‚Visiting Experts‘ nicht nur in seiner Anfangsphase, sondern sie ließ der Regierungspräsidentin, mit der WGPW und der Militärregierung im Rücken, eine Unterstützung zukommen, die sich über die Jahre institutionalisierte. Zwischen 1946 und 1951 reiste die Germanistin insgesamt achtmal im Auftrag der WGPW/CCG (BE) nach Deutschland672, um jeweils an ihre erste Reise dieser Art anzuknüpfen und dabei besonders den von Bähnisch initiierten oder unterstützten Gründungen ‚Entwicklungshilfe‘ zukommen zu lassen. Dieser Umstand wird in den Studien, die sich der britischen Frauen-Re-education-Arbeit widmen, zwar aufgezeigt, in seiner Bedeutung für die Person Bähnischs und die Entwicklung ihrer Gründungen sowie der von ihr protegierten Organisationen jedoch nicht ausreichend betont. Deneke kam – oft in Begleitung anderer ‚Visiting Experts‘ – nicht nur häufig mit der Regierungspräsidentin zusammen, sondern sie traf sich auch mit vielen Personen, die mit Bähnisch in einem engen Austausch standen. Diese Treffen hatte diese wiederum häufig selbst arrangiert. Für David Philips, der Deneke biographisch porträtiert hat, besteht kein Zweifel, daß ihre Arbeit die Militärregierung in ihrer Entscheidung, die ‚Women’s Affairs‘ als ein wichtiges Thema auf der Agenda zu halten, bestärkt hat.673 Man kann jedoch
670 Ebd., Box FL565, 5WFM/C6, James Mark an Margaret Bondfield, 24.02.1947. Um die Frage der Finanzierung zu klären, hatte ein Vertreter des Foreign Office an einer Sitzung des International Advisory Committee der WGPW am 02.09.1947 teilgenommen. Ebd. 671 Ebd., Meeting of the International Advisory Committee, July 16th 1947 sowie ebd., Meeting of the International Advisory Committee, September 2nd, 1947. 672 Vgl.: Phillips, David: Helena Deneke and the women of Germany: A note on post-war educational reconstruction, in: German Life and Letters, 53. Jg. (2000), S. 89–105. Phillips, David: Helena Deneke and the women of Germany: A note on post-war educational reconstruction, in: German Life and Letters, 53. Jg. (2000), S. 89–105, hier S. 92. Denise Tscharntke gibt an, daß Deneke sieben Reisen nach Deutschland unternommen habe. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 17. Sie bezieht sich zwar auf dieser Seite auch auf den Aufsatz Philips‘, äußert sich jedoch nicht zur von ihm angegeben Anzahl von Reisen. 673 Vgl.: Philipps: Deneke, S. 103.
Club deutscher Frauen | 677
durchaus noch einen Schritt weiter gehen und festhalten, daß die Oxforderin auch die inhaltliche Ausrichtung jener Arbeit, die sich mit ihrer Hilfe stark auf Bähnisch konzentrierte, wesentlich beeinflußt hat, nicht nur indirekt über die Militärregierung, sondern auch direkt, im Austausch mit deutschen Frauen, die sie im Sinne Bähnisch beeinflußte. Organisatorisch und inhaltlich war Denekes Arbeit wiederum eng an die WGPW geknüpft. Die Kooperation zwischen der Dachorganisation und der Militärregierung war ein mustergültiges Beispiel dafür, wie Verbände, die als „Kinder der bürgerlichen Gesellschaft“674 geboren worden waren, als Lobbygruppen jahrzehntelang einerseits gewaltigen Einfluß auf die Politik nehmen konnten, andererseits jedoch auch den Staat dadurch entlasteten, daß sie ihm ihr Expertenpotential kostenfrei, im Tausch gegen Mitbestimmung, zur Verfügung stellten. Jenes Gefüge von Geben und Nehmen zwischen Staat und Verbänden auf die Frauenbewegung und die soziale Arbeit in Deutschland zu übertragen, war – gestützt von der WGPW – Teil der britischen Frauen-Re-education-Politik. Geht man vom ‚frühliberalen Idealbild‘ der Verbände aus, so waren ihre Existenz und ihre Teilhabe am politischen Leben der demokratischen Verfassungsrealität eines Staates, vor allem in schwierig zu meisternden Umbruchsituationen, durchaus zuträglich. Bürgerliches Engagement und individuelles Eintreten für die Rechte eines Kollektivs waren als Form der Teilhabe am politischen Willensbildungsprozeß jenseits parteipolitischer Schranken von den West-alliierten gern gesehen. Die problematische Komponente dieses Einflusses durch Verbände thematisierte, als Deutschland wieder teilsouverän war, Theodor Eschenburg, indem er die Frage nach der ‚Herrschaft der Verbände‘ stellte675 und konstatierte, daß sich einige hohe Beamte „mehr als Kommissar ihres Interessenverbandes denn als Sachwalter des Staates“ fühlten.676 Eschenburgs Formulierung regt sowohl zum Nachdenken über die Abhängigkeit der CCG (BE) von der WGPW als auch über die gleichzeitige Rolle Bähnischs als Regierungspräsidentin und Vorsitzende des ‚Club deutscher Frauen‘ beziehungsweise des ‚Frauenrings‘ an. Über die Empfehlung, auf das Potential ‚älterer Frauen‘ im Wiederaufbau der Frauenbewegung zu setzen, stießen die Women‘s Affairs Officers, die WGPW und Deneke ganz bewußt einer Fortführung der Traditionen der bürgerlichen Frauenbewegung – und damit der Politik ihres Dachverbandes BDF – die Tür auf. Denn mit der ‚älteren Generation‘ waren jene Frauen gemeint, die bis 1933 Führungspositionen in der bürgerlichen Frauenbewegung, vor allem im BDF, innehatten: Agnes von Zahn-Harnack, Else Ulich-Beil, Alice Salomon, Gertrud Bäumer und Helene Weber. Diese Frauen waren in den 1870er (Salomon, Bäumer) und 1880er Jahren (UlichBeil, Zahn-Harnack) geboren worden, sie waren 1945 also zwischen 65 und 75 Jahren alt. Die noch ältere Alice Salomon war, wie viele jüdische Frauen, emigriert, während die ebenfalls schon betagte Gertrud Bäumer, weil sie sich nicht für ihr Verhalten im Dritten Reich verantworten wollte, stark in der Kritik stand.
674 Alemann, Ulrich von: Verbändestaat oder Staatsverbände? Die Bundesrepublik auf dem Weg vom Pluralismus zum neuen Korporatismus, in: Die Zeit, Nr. 39, 19.09.1980, S. 16. 675 Vgl.: Eschenburg, Theodor: Herrschaft der Verbände, Stuttgart 1955. 676 Ebd., S. 16.
678 | Theanolte Bähnisch
Frauen im Alter von Theanolte Bähnisch, welche während der Jahre 1933 bis 1945 nicht im Einklang mit der Politik des NS-Regimes standen, hatten in ihren ‚besten Jahren‘ kaum die Möglichkeit gehabt, durch öffentliches Engagement von sich reden zu machen. Ihre Stunde war erst 1945 gekommen. Was lag also, wenn sie sich selbst noch keinen ‚Ruf‘ in der Frauenbewegung hatten erarbeiten können, für jene Frauen näher, als die Zusammenarbeit mit gestandenen Protagonistinnen der Frauenbewegung zu suchen, die bereits vor 1933 internationale Bekanntheit erlangt hatten und nicht zuletzt deshalb auf das Vertrauen der Besatzer zählen konnten? Diese auch von der Militärregierung angestrebte Zusammenarbeit mündete schließlich in der Fortführung der Traditionen des BDF 1949 durch den ‚Deutschen Frauenring‘ (DFR) unter dem Vorsitz Bähnischs. Dies führte dazu, daß wiederum drei Jahre später die internationale Frauenorganisation ‚International Council of Women‘ (ICW), – welche auch über einen innerhalb der Organisation einflußreichen britischen ‚National Council‘ verfügte – den DFR offiziell als Nachfolgeorganisation des BDF aufnahm. Damit war die deutsche Bürgerliche Frauenbewegung, wie es bis zu ihrer Auflösung 1933 der Fall gewesen war, wieder mit einem deutschen ‚National Council‘ im ICW vertreten. Auch hierzu hatten Protagonistinnen der britischen Frauenbewegung maßgebliche Vorarbeit geleistet.
6.9 DIE REISE NACH GROSSBRITANNIEN: AUFTAKT ZUR INTERNATIONALEN KOOPERATION IN DER FRAUENBEWEGUNG UND EINE CHANCE FÜR DEN REGIERUNGSBEZIRK HANNOVER Die Verbindung, welche die Briten zwischen den älteren, erfahrenen und den jüngeren in der Frauenbewegung engagierten Frauen in Deutschland stiften wollten, spiegelte sich auch in der Auswahl der Frauen, die zu Aufenthalten in Großbritannien ermuntert wurden, wider: Die ersten deutschen Frauen, die nach dem Ende des Krieges in offizieller Mission nach Großbritannien reisen durften677, waren eine ‚gestandene Persönlichkeit‘ der deutschen Frauenbewegung, Agnes von Zahn-Harnack, sowie eine, die erst in jüngster Zeit größere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, Theanolte Bähnisch. Erst wenige Tage vor ihrem Reiseantritt, am 13.11.1946, war letztere zur Regierungspräsidentin ernannt worden. Und schon jetzt galt ihr Besuch der Control Commission for Germany viel: „Since these German women are known to be outstanding and have also been re-commended by W.G.P.W. delegates to come
677 Als erste offizielle deutsche Frauendelegation nach Kriegsende im Ausland überhaupt werden in der Regel Vertreterinnen des DFD genannt, welche eine Reise nach Schweden unternahmen, um der 1945 in Paris gegründeten ‚Internationalen Demokratischen Frauenföderation‘ (IDFF) beizutreten. Vgl.: Bauer: Kulturprotestantismus, S. 335, Anm. 1356.
Club deutscher Frauen | 679
over we shall be glad to have your agreement to their visit“678, hatte ein Mitarbeiter des Londoner Standbeins der CCG (BE) an die Kollegen in Berlin geschrieben. 6.9.1 Kritik an der Mission – Die Political Branch stellt sich gegen die Reise Bähnischs Nicht alle Vertreter der Militärregierung in Deutschland waren positiv gegenüber der Reise Bähnischs nach Großbritannien eingestellt. Die ‚Political Division‘ des ‚Headquarter Berlin‘ hatte sich zu der geplanten Reise der beiden Frauen zunächst sehr zurückhaltend geäußert. Ein Besuch deutscher Frauen in Großbritannien könne nicht primär als „educational“ verstanden werden, argumentierte man dort, weshalb die Planung nicht der ‚Education Branch‘ allein überlassen werden dürfe, sondern ein Treffen zwischen einem Repräsentanten der ‚Education Branch‘ und der ‚Administration and Local Government Branch (A.&.L.G)‘ „who might more properly be considered responsible for these affairs“679 arrangiert werden müsse. Der Direktor der ‚Administration & Local Government Branch‘ (International Affairs & Communications Division) war der Meinung, daß die internationale Arbeit („international responsibility“) eher eine Sache der politischen als der lehrplanmäßigen („curricular“) Erziehung sei und entsprechend überdacht werden solle. Darüber hinaus brachte er sein Mißfallen darüber zum Ausdruck, daß die Frauen in Deutschland allgemein nicht genügend zur Teilhabe an der Politik ermuntert würden. Seiner Meinung nach werde die Bildung von „guilds and institutes“680 überbewertet – was eine deutliche Anspielung auf das Unterfangen der Townswomen’s Guilds und der Women’s Institutes war, ihresgleichen im besetzten Staat aufzubauen. Gleichzeitig verwendete der Direktor den Terminus ‚guilds and institutes‘ stellvertretend für ‚überparteiliche Frauenzusammenschlüsse‘.681 Die entschiedene Gegnerin solcher Zusammenschlüsse, Herta Gotthelf, hatte im Oktober 1946 die Political Branch der gleichnamigen Division in Berlin aufgesucht, die Förderung von „guilds […] to no particular purpose“682 kritisiert und ihre Ansprechpartner darauf aufmerksam gemacht, daß doch stärker die Teilhabe deutscher Frauen an der Politik in den Blick genommen werden solle, als dies bisher der Fall sei.683 Manch ein Mitarbeiter der ‚Political Division‘ hätte es – zumindest noch zu jenem Zeitpunkt – offenbar lieber gesehen, wenn Gotthelf an Stelle Bähnischs nach Großbritannien geflogen wäre, denn offensichtlich war es der resoluten Frauensekre-
678 NA, UK, FO 1049/568, Telegramm des COGA an die I.A.&C. Division, 25.10.1946, Subject: Visit of German Women to U.K. 679 NA, UK, FO 1049/568, Political Division, German Political Branch, Major Harcourt an Headquarters I.A.&C. Division, 14.10.1946. 680 NA, UK, FO 1049/568, Director ALG Branch, I.A.&C. Division an Director German Political Branch, Political Division, 19.10.1946. 681 Ebd. 682 NA, UK, FO 1049/568, Political Branch, Political Division to Education Branch, I.A.&C. Division, 14.10.1946. 683 Ebd.
680 | Theanolte Bähnisch
tärin gelungen, die ‚Political Division‘ auf ihre Seite zu ziehen. Mit ihrer Aufwartung in Berlin hatte sie einen Kritiker der Leitlinienpolitik, welche die Women’s Affairs Section in der Education Branch verfolgte, etabliert. Bislang war die Einbeziehung anderer Abteilungen der Militärregierung in die etablierten Entscheidungsstrukturen nicht vorgesehen gewesen, sondern das ‚Control Office for Germany and Austria (COGA)‘, die ‚Education Branch‘ und die WGPW sollten allein darüber entscheiden, wie viele und welche deutschen Frauen zu welchem Zeitpunkt nach Großbritannien reisen sollten.684 Betrachten wir jene Auseinandersetzung über die Reise Bähnischs also als einen Einblick in die Diskussionen um die richtige Leitlinie der Frauen-Re-educationPolitik innerhalb der Militärregierung und als einen Hinweis darauf, daß das letzte Wort in dieser Frage, auch nachdem Denekes Bericht vorlag, noch nicht gesprochen war. Aus der Political Division sollten in den nächsten Monaten immer wieder kritische Anmerkungen gegenüber der Politik der Education Branch fallen – und Herta Gotthelf war nicht selten der Auslöser dafür.685 6.9.2 Der International Council of Women re-etabliert seine Verbindungen nach Deutschland Die Regierungspräsidentin war, wie viele Frauen, die in den folgenden Monaten und Jahren in offizieller Mission nach Großbritannien reisten, von einer FrauenOrganisation eingeladen worden, allerdings nicht, wie zu vermuten gewesen wäre, von den ‚Women’s Institutes‘ oder den ‚Townswomen’s Guilds‘, sondern von einer dritten Organisation, die der WGPW angehörte, nämlich dem ‚British National Council des International Council of Women (ICW)‘. Dieser trat in internationalen Organisationen wie den UN als Vertreter der britischen Frauen im Ausland auf.686 Diese Einladung Bähnischs durch den ‚British Council‘ des ICW für 14 Tage ab dem 30.11.1946 stand am Anfang einer für Bähnischs Frauenorganisation sehr erfolgreichen Geschichte, die mit der bereits erwähnten Eingliederung des DFR in den ICW 1951 ihren vorläufigen Höhepunkt fand.
684 NA, UK, FO 1049/568, HQ CCG (BE), I.A.&C. Division an Deputy Military Governor, o. D. [1946]. 685 Vgl. dazu auch Tscharntke: Re-educating, S. 175–183. 686 NA, UK, FO 1049/568, Telegramm der COGA an die I.A.&C. Division, 25.10.1946, Subject: Visit of German Women to U.K. Da der ICW in Organisationen wie den Vereinten Nationen (UN) als Repräsentant der britischen Frauen im Ausland auftrat, befürchtete er Zuständigkeitsüberschneidungen mit der britischen Dachorganisation von Frauenverbänden, WGPW. Er trat deshalb 1947 aus der WGPW aus, überließ jedoch seinen lokalen Niederlassungen die Entscheidung, ob sie sich weiterhin an den Standing Conferences der WGPW beteiligen wollten.
Club deutscher Frauen | 681
1888 gegründet, war der ICW der traditionsreichste internationale Frauenverband überhaupt.687 Seine Kooperationsbereitschaft mit der Hannoveraner Regierungspräsidentin und der von ihr geleiteten Organisation demonstrierte der ICW auch dadurch, daß er neben Bähnisch und Zahn-Harnack in den folgenden Monaten weitere Frauen nach Großbritannien einlud, die mit Bähnisch eng zusammenarbeiteten.688 Dazu gehörten die Ministerialrätin im Kultusministerium Nordrhein-Westfalen, Luise Bardenhewer689 (CDU) sowie die Leiterin einer Mädchenschule in Düsseldorf, Oberstudienrätin Anne Franken690. Beide Frauen waren Mitglieder im Frauenring Düsseldorf,
687 Als Nicht-Regierungs-Organisation hält er noch heute seinen Beraterstatus bei allen UNO-Unterorganisationen und vereinigt mittlerweile 61 Mitgliedsländer unter seinem Dach. 688 Zu den eingeladenen Personen vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 91/92. 689 In den 60er Jahren leitete Bardenhewer als Nachfolgerin Aenne Brauksiepes die ‚St. Joan's International Alliance‘ in Deutschland. Die noch heute existierende Alliance ist eine internationale katholische Frauenorganisation, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen in Kirche, Staat und Gesellschaft einsetzt. Sie wurde 1911 in London gegründet. Vgl. dazu die Internetpräsentation der Alliance auf: http://stjoansinternationalalliance. org/, am 13.12.2013. Der Women’s Library zufolge hatte die Organisation in Westdeutschland nur zwischen 25 und 50 Mitgliedern, sie sei jedoch unter Bardenhewers Leitung durchaus einflußreich gewesen. Vgl.: o. V.: Datensatzbeschreibung: The Women’s Library, NA 1303, St. Joan’s International Alliance (German Section), auf: http://calm archive.londonmet.ac.uk/DServe/dserve.exe?dsqIni=Dserve.ini&dsqApp=Archive&dsq Db=Persons&dsqSearch=Code==%27NA1303%27&dsqCmd=Show.tcl., am 13.12.2013. Luise Bardenhewers Nachlaß ist im Staatsarchiv Nordrhein-Westfalen überliefert, eine Auswertung ihrer Korrespondenzen könnte im Hinblick auf eine Organisations-Geschichte des DFR und dessen Verbindungen zur regionalen Volkshochschularbeit hilfreich sein, zumal Bardenhewer an der Volkshochschule Fredeburg einen Kurs über ‚Frauenfragen‘ mit 39 Teilnehmerinnen abhielt hatte. Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 102. 690 Vgl.: Sack, Birgit: Zwischen religiöser Bindung und moderner Gesellschaft. Katholische Frauenbewegung und politische Kultur in der Weimarer Republik (1918/19–1933), Münster u. a. 1998, S. 127. Vgl. als Quelle auch: Franken, Aenne: Frauenarbeit in der Polizei, in: Soziale Berufsarbeit 5. Jg. (1926), S. 1–3. Franken wurde am 29.11.1890 in Köln geboren, war von 1919 bis 1933 Mitglied der Zentrumspartei und gehörte der staatsbürgerlichen Kommission des KDFB an. Ab 1927 war sie Direktorin der Düsseldorfer Cecilienschule, bis sie 1933 von den Nationalsozialisten degradiert wurde. 1945 bis 1956 leitete sie die Luisenschule in Düsseldorf und war 1946/47 Mitglied des ernannten Landtags von Nordrhein-Westfalen. Sie starb am 15.6.1958 in Fischbach. Vgl.: Sack: Bindung, S. 451. Aenne Franken war Bähnisch womöglich bereits in den 1920er Jahren bekannt gewesen, denn sie hatte sich beim Aufbau der weiblichen Polizei in Köln, die Bähnisch in ihrer Examensarbeit behandelte, engagiert und die von Willy Abegg sehr geschätzte Polizeifürsorgerin Josephine Erkens als ehrenamtliche Mitarbeiterin unterstützt.
682 | Theanolte Bähnisch
spielten eine prominente Rolle im DFR und gehörten gleichzeitig dem KDFB an.691 Auch Liselotte (Lilo) Milchsack, die Hauptbegründerin der deutsch-englischen Gesellschaft und Initiatorin der deutsch-englischen Gespräche, mit der Franken und Bardenhewer wiederum in engem Kontakt standen – Franken war ebenfalls an der Gründung der deutsch-englischen Gesellschaft beteiligt gewesen – durfte als Gast des British National Council des ICW nach Großbritannien reisen.692 Der Startschuß und die Grundlage, auf der sich der weitere Austausch der Gründungen Bähnischs mit anderen deutschen Frauenorganisationen aufbaute, war die gemeinsame Reise Bähnischs und Zahn-Harnacks. Diese war für die weitere Entwicklung der Frauenbewegung und -bildung in Deutschland aus verschiedenen Gründen von großer Wichtigkeit. Zum einen hatten die erste Vorsitzende des ‚Club deutscher Frauen‘ und die letzte Vorsitzende des BDF in Großbritannien Zeit, sich untereinander auszutauschen und – vermutlich taten sie dies tatsächlich schon zu jener Zeit – Pläne zum (Wieder-)Aufbau einer großen Frauenorganisation in Deutschland zu schmieden.693 Damit leisteten die beiden einen frühen, praktischen Beitrag zur Vernetzung der von Helena Deneke als besonders förderungswürdig bewerteten Organisationen und legten gleichzeitig den Grundstein einer Vernetzung dieser mit anderen Organisationen. Der Brückenschlag zwischen der älteren und der mittleren Generation in der Frauenbewegung sowie zwischen der britischen Besatzungszone und Berlin fand also zunächst über die Zusammenarbeit zwischen dem ‚Neuling‘ in der Frauenbewegung, Bähnisch, und der Person, die 1933 die Auflösung des BDF bekanntgeben mußte, Zahn-Harnack, statt. Die mittlerweile betagte Zahn-Harnack hatte sich offenbar bereits in Großbritannien an den Gedanken gewöhnt, daß die junge Frau Bähnisch ihr wohl den Rang in der deutschen Frauenbewegung ablaufen würde – oder es bereits getan hatte. Wohl kaum zufällig sicherte Zahn-Harnack, als sie eine Lizenz für die Ausdehnung des Wilmersdorfer Frauenbundes auf andere Berliner Stadtteile beantragte, der Militärregierung zu, daß ihr Verband auf die gleiche Weise wie der ‚Club deutscher Frauen‘ in Hannover arbeite.694 „Aus Gesprächen mit Frau Regierungspräsident Bähnisch habe ich ersehen, dass ihre Frauen-Clubs, die in der ganzen britischen Zone lizensiert sind, nach genau denselben Richtlinien arbeiten wie der Wilmersdorfer Frauenbund 1945. Unsere Organisationen sind überparteilich, überberuflich und überkonfessionell; sie sind in keiner Weise an die Stadt- oder Gemeindeverwaltungen gebun-
691 Vgl.: Sack: Bindung, S. 348. Die beiden Frauen gaben gemeinsam 1931 in Düsseldorf den Sammelband ‚Die katholische Frau in der Zeit‘ heraus. Bardenhewer organisierte sich sogar auf internationaler Ebene in der Katholischen Frauenbewegung. 692 Vgl.: ebd. Die Enkelin Konrad Dudens, Lilo Milchsack, leitete außerdem ein Flüchtlingslager in der Nähe von Bonn und war Mitglied eines Komitees zur Erziehungsreform. 693 Die Biographin Zahn-Harnacks, Gisa Bauer, datiert die Reise auf den Januar 1947, was jedoch nicht zutreffend zu sein scheint, bedenkt man, daß Zahn-Harnack im Dezember 1946 einen Brief an die Militärregierung schrieb, in dem sie auf die bereits vergangene Reise Bezug nahm. Vgl.: Bauer: Kulturprotestantismus, S. 334. 694 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 148. Erhalten hat Zahn-Harnack die Lizenz allerdings erst im Januar 1947. Vgl.: ebd.
Club deutscher Frauen | 683
den und sind auch finanziell ganz unabhängig“695, argumentierte Zahn-Harnack kurz nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland gegenüber der Britischen Militärregierung. In Großbritannien hatten die Frauen Gelegenheit, persönliche Kontakte zu (leitenden) Mitgliedern des ICW – Bähnisch wohnte im Haus der Vize-Präsidentin der Organisation, Lady Nunburnholme696 – und anderen Frauenorganisationen sowie zu verschiedenen öffentlichen und privaten Einrichtungen zu knüpfen und zu intensivieren. „Visitors will attend meeting of N.C.W in London and will meet leading women of different types of social work. They will also visit other parts of the country”697, wurde der Reiseplan der Frauen auf einem Telegramm zusammengefaßt und damit gleichzeitig noch einmal die scheinbar ‚urwüchsige‘ Verbindung zwischen der Frauenbewegung und der sozialen Arbeit unterstrichen. In ihrem Reisebericht sprach Bähnisch nicht nur von ihrer Gastgeberin, Miss Nunburnholme, besonders warmherzig, sondern auch von der Politikerin, Sozialarbeiterin, Schulrätin und Europaaktivistin Minna Cowan, die sie bereits im August 1946 kennengelernt hatte. Indem sie in ihrem Reisebericht an diese Begegnung erinnerte, schlug sie eine Brücke zwischen der großzügigen Gastfreundschaft, welche die Einladung nach Großbritannien bedeutete, und dem Entgegenkommen, das eine Vertreterin der britischen Frauenbewegung ihr in Hannover bewiesen hatte. 15 Jahre später beschrieb sie dieses Erlebnis so: „Mir ist die Frauenversammlung am Abend des 26. August unvergeßlich, in der Miss Cowan, als ich ihr für die Ansprache [die Cowan in Begleitung Helena Denekes gehalten hatte] dankte, mir spontan die Hand entgegenstreckte und sagte ‚Wir Frauen wollen in Zukunft zusammenarbeiten und vergessen was gewesen ist.‘ Ich glaube, daß dieses großmütige Wort einer Britin das erste Versöhnungswort überhaupt gewesen ist, das von maßgeblicher ausländischer Seite gesprochen wurde.“698 Daß die ältere Zahn-Harnack als letzte Leiterin des BDF 1933 gegenüber dem ICW dessen Auflösung und damit sein Ausscheiden aus dem ICW bekanntgeben mußte, scheint dazu geführt haben, daß die Reise nach Großbri-
695 NA, UK, FO 1050/1215, Wilmersdorfer Frauenbund 1945, Agnes von Zahn-Harnack an Mrs. Wagstaff, 30.12.1946. Neben dem deutschsprachigen Original befindet sich in der Akte auch eine englische Übersetzung des Briefs. Tatsächlich zog die Strategie ZahnHarnacks Erfolg nach sich: Die Empfängerin ihres Briefes, Mrs. Wagstaff nahm den ‚Club deutscher Frauen‘ als „very progressive movement, which is increasingly an influence for good in Hannover“ wahr und bezog sich dabei auf das Urteil der WGPW. „The report of Women’s Group on Public Welfare recommends that organisations of this type should be encouraged.“ NA, UK, FO 1050/1215, Wagstaff an ,A/SCO in charge‘, 10.01.1947. 696 Marjorie Cecilia Wilson wurde 1880 als Tochter der Marquess of Lincolnshire geboren und trug den Namen Marjorie Cecilia Wynn-Carrington. 1901 heiratete sie den 2nd Baron of Nunburnholme, Charles Wilson. Der Baron wurde 1906 zum Member of Parliament für die liberale Partei (Wahlkreis Hull-West) gewählt, war Kriegsteilnehmer in Südafrika, erhielt verschiedene hohe Auszeichnungen des Staates und starb 1928. 697 NA, UK, FO 1049/568, Telegramm der COGA an die I.A.&C. Division, 25.10.1946, Subject: visit of German Women to U.K. 698 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 163/164.
684 | Theanolte Bähnisch
tannien auf sie einen noch stärkeren emotionalen Eindruck gemacht hatte.699 „Frau Dr. von Zahn-Harnack war um so tiefer erschüttert und beeindruckt, weil sie sich nur zu gut an die Zeit nach dem ersten Weltkrieg erinnerte, wo es Jahre gedauert hatte, bis überhaupt internationale Kontakte, auch zwischen Frauen, wieder möglich waren“700, beschreibt Bähnisch die Gefühle Zahn-Harnacks, als sie an eine andere Begegnung mit britischen Frauen, die 1946 stattgefunden hatte, erinnerte. Der schrittweise, aber insgesamt gesehen sehr schnelle Wiederanschluß deutscher Frauen an den ICW in den folgenden Jahren war nicht nur für Protagonistinnen der Frauenbewegung ein unverhoffter, schneller Erfolg, sondern er war von allgemeiner politischer Bedeutung, da er am Beginn einer umfassenden Westintegration und Wiedereingliederung Deutschlands in die internationalen Beziehungen stand. Der Aufenthalt Bähnischs und Zahn-Harnacks war der Beginn eines intensiven Austauschprogramms, auf dessen Höhepunkt zwischen 1948 und Mitte 1949 allein 151 Repräsentantinnen von Frauenorganisationen, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften und Ministerien – Personen, die als Multiplikatorinnen wirkten – jeweils zu einer mehrwöchigen Studienreise nach Großbritannien aufbrachen, wo sie Anregungen für die Arbeit mit Frauen in Deutschland sammelten.701 Zusätzlich förderte die britische Militärregierung auch Kontakte deutscher Frauenorganisationen nach Frankreich, Dänemark, Schweden, Norwegen und in die Niederlande.702 Nach ihrer Rückkehr machten Bähnisch und Zahn-Harnack ihrem Auftrag, als Multiplikatorinnen aufzutreten, alle Ehre. Sie berichteten in verschiedenen Zusammenhängen von ihrem Aufenthalt703, räumten so mit Vorurteilen gegenüber Großbritannien auf und stellten das Land insgesamt sehr positiv dar. Die Reise leistete auch
699 Ausscheiden aus dem Internationalen Frauenbund. Agnes von Zahn-Harnack an die Marchioness of Aberdeeen & Temair, 24.05.1933, in: Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine, 13. Jg. (1933), Nr. 6, S. 60. 700 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 163/164. 701 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 79–101 sowie Ziegler: Lernziel, S. 113/114. 702 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 114. 703 Zahn-Harnack sprach beispielsweise im Rahmen einer Veranstaltung des Wilmersdorfer Frauenbundes am 24.01.1947 über ihre Großbritannien-Reise. NA, UK, FO 1050/1215, Wilmersdorfer Frauenbund an Mrs. Wagstaff, 07.01.1947. Einem Brief von Mrs. Wagstaff an A. B. Reeve zufolge, berichtete Zahn-Harnack bis April 1947 an verschiedenen Orten über ihre Reise. Sie sei dazu auch in die französische und in die US-Zone eingeladen worden. Außerdem habe sich die Reise der Frauen in den entsprechenden Kreisen (womit wohl die Frauenbewegung gemeint war) in der U.S.-Zone herumgesprochen, so Wagstaff. NA, FO, UK, 1050/1215, Mrs. Wagstaff, Headquarters I.A.&C. Division Berlin an Mrs. Reeve, COGA London. Bähnisch hatte unter anderem auf einer Frauenkonferenz in Aachen über ihre Reise berichtet. NA, UK, FO 945/284, Englischsprachige Übersetzung eines Artikels aus den Aachener Nachrichten vom 18.04.1947 über die Women’s Conference North Rhine Westphalia in Aachen. „Frau Dr. Baehnisch gave a comprehensive report on her experience during a visit to England. She was deeply impressed by the great assistance offered by the women of Coventry, the most destructed town in England“, war darin zu lesen. Ebd.
Club deutscher Frauen | 685
auf dieser Ebene weit über die persönliche Ebene der beiden Frauen hinaus einen Beitrag zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den Besatzern und dem besetzten Staat. Eine genaue Reiseroute der beiden Frauen ist nicht überliefert. Jedoch läßt sich dem Reisebericht, den Bähnisch für die Militärregierung verfaßte, ein grober Plan entnehmen. Demnach waren beide Frauen zusammen einige Tage lang in Birmingham Gäste von Elisabeth Carpendon, um dort unter anderem das bekannte, 1899 begründete Birmingham Settlement zu besuchen. Über das zerbombte Coventry, die nächste Etappe ihrer Reise, wußte Bähnisch, der ganz offensichtlich die gesellschaftlichen Spaltungen im eigenen Land zu schaffen machten, zu berichten, daß sie dort auf bessere Möglichkeiten zur Verständigung zwischen bombardierten Deutschen und bombardierten Engländern getroffen sei als in ihrem Heimatland zwischen bombardierten und nicht bombardierten Deutschen. In London, einem weiteren Etappenziel, hatte sie eine Verhandlung in einem Jugendgericht miterleben dürfen. Dann habe sie, vermutlich ebenfalls in London – und wahrscheinlich gemeinsam mit ZahnHarnack704 – die Heilsarmee sowie ein Altenheim besucht.705 Auch bei der Gemeindeverwaltung eines kleinen Ortes namens Harpendon waren die beiden Frauen zu Gast.706 6.9.3 Die Sorgen des Regierungsbezirks im Gepäck Daß Bähnisch eine der ersten beiden Frauen war, die in offizieller Mission nach Großbritannien fahren durften, ist bereits in mehreren Studien zur Frauen-Reeducation in Deutschland beschrieben worden.707 Jedoch wurde für die jeweiligen Analysen – da der Fokus weniger auf Theanolte Bähnisch lag – nicht die im DFRArchiv überlieferte Material-Sammlung, die die Regierungspräsidentin im Vorfeld ihrer Reise zusammengestellt hatte, herangezogen. Sie selbst betont in ihrer Rede zum zehnjährigen Jubiläum des DFR vor allem die Gastfreundlichkeit, die ihr in Großbritannien, trotz ihrer Nationalität, entgegengebracht worden sei, sowie die Bedeutung, die ihre Reise für den Wiederanschluß der deutschen Bürgerlichen Frauenbewegung an die Frauenbewegung im Ausland hatte.708 Die im DFR-Archiv überlieferte Sammlung aus Notizen und Korrespondenzen, die den Titel ‚Materialien für eine Englandreise‘709 trägt, macht jedoch deutlich, daß internationale Verständigung
704 NA, UK, FO 1005/1668, My Impressions of England by Frau Bahnisch (!), Annexure 1 to Part 1 of fifteenth monthly report by HQ Military Government Land Niedersachsen. Bähnisch spricht in ihrem Bericht von “we”, womit sie nur sich und Zahn-Harnack gemeint haben kann. 705 Ebd. 706 Ebd. 707 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 91 sowie Ziegler: Lernziel, S. 32. 708 Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 163/164. 709 Einer der Briefe beginnt beispielsweise mit den Worten: „Ich komme, mein Versprechen einzulösen. In der Anlage habe ich einiges aufgeschrieben zu den Fragen, die wir ange-
686 | Theanolte Bähnisch
und das Sammeln neuer Erfahrungen beileibe nicht die einzigen Ziele waren, die Bähnisch mit ihrer Reise verband.710 Vielmehr versuchte sie, die Reise auch für die Belange des Regierungsbezirks Hannover, also ‚ihrer‘ Verwaltungseinheit, zu nutzen. Alles deutet darauf hin, daß sie, bevor sie aufbrach, Personen mit Rang und Namen in der Verwaltung, in der Wirtschaft, in Vereinen und Verbänden, vor allem solchen aus der Frauenbewegung und/oder der Wohlfahrtspflege Gelegenheit gegeben hatte, sich zu ihrer Situation zu äußern und zu formulieren, welche Art der Hilfe dienlich sein könnte, um den Wiederaufbau im Bezirk zu meistern.711 Offenbar hatten alle Ansprechpartner Bähnischs die Reise der Regierungspräsidentin nach Großbritannien als eine, wenn nicht gar als die große Chance wahrgenommen, zukünftig mehr Unterstützung von den Briten zu erhalten. Und alles deutet darauf hin, als hätte die Behördenleiterin den Organisationen gegenüber ihre Reise auch genau so angepriesen. Der Summe der eingegangenen Berichte nach zu urteilen, muß Bähnisch entweder schon früh von ihrer Reise gewußt oder aber ihre Reisevorbereitungen mit besonderem Nachdruck durchgeführt haben. Die Gliederung auf dem Deckblatt gibt Aufschluß über den Inhalt des überlieferten Materials: „1. Weibliche Polizei, 2. Frauenarbeit Stand 1.12.1946, 3. Flüchtlingswesen […], 4. Schulwesen (Kinder-Jugend), 5. Bewirtschaftung, Ernährung, Gesundheit, 6. Gemeindewahlen, Reg. Bez. Hannover, Statistik, Bildmaterial, 7. Vortragsmaterial (Englisch)“712. Den Unterlagen und Notizen über die Entwicklung der weiblichen Polizei – mit besonderer Berücksichtigung ihrer wichtigen Rolle im Umgang mit Geschlechtskrankheiten und Prostitution713 sowie den Überlegungen zum Wiederaufbau einer weiblichen Polizei714 in der britischen Zone ist zu entnehmen, daß sich in Bähnischs Auseinandersetzung mit der ‚weiblichen Polizei‘ auch nach 1945 weiterhin die Aspekte ‚soziale Frage/Sittlichkeit‘, ‚Frauenbewegung‘ und ‚Polizei(verwaltung)‘ miteinander verknüpften. Ein Abriß, der der Sammlung beiliegt, deutet darauf hin, daß Bähnisch einem ihrer Mitarbeiter oder einer ihrer Mitarbeiterinnen den Auftrag ge-
710
711 712 713
714
schnitten haben.“ DFR-Archiv, A3, Therese [Nachname unleserlich ] an Theanolte Bähnisch, 31.10.1946. Daß die Quellen dennoch durch den DFR überliefert wurden, läßt sich zum einen über die Verschränkung der beiden großen Arbeitsfelder Bähnischs erklären. Zum anderen ist es sicherlich auch auf den Umstand zurückzuführen, daß jene frühe Reise der ersten DFRPräsidentin ins Ausland ein wichtiger Bestandteil der verbandseigenen Erinnerungskultur ist. DFR-Archiv, A3 [Material für eine Englandreise vom 1.–15. Dezember 1946, zusammengestellt von Theanolte Bähnisch]. Ebd. Teil der Sammlung ist eine Abschrift des Berichts von Höß, E.: Die Bedeutung der Polizeifürsorge und weiblichen Polizei im Kampfe gegen Geschlechtskrankheiten und Prostitution von Polizeifürsorgerin, in: Wächterruf, Nr. 10, Oktober 1935. Laut der Statistik, die der Materialsammlung beiliegt, gab es am 15.11.1946 im Regierungsbezirk Hannover bereits sieben uniformierte und drei zivil gekleidete Polizistinnen.
Club deutscher Frauen | 687
geben hatte, Ideen für die „Weibliche Polizei der Zukunft“715 zusammenzutragen. Diesen Notizen zufolge sollten die Eingangsvoraussetzungen für Frauen in die Polizei vereinfacht werden und ein Aufstieg, wenn Vorerfahrungen als Wohlfahrtspflegerinnen vorhanden seien, schneller möglich werden. Die ebenfalls den Unterlagen beiliegende ‚Anweisung Nr. 4 für den Neuaufbau der deutschen weiblichen Polizei in der britischen Zone‘ von 1946 zeigt, daß Bähnischs Bemühungen um einen Wiederaufbau der Polizei sich mit dem Interesse der Briten, die bereits in den 20er Jahren in Köln eine weibliche Polizei etabliert hatten und nun vor einer ähnlichen Herausforderung standen, deckte. „Im Augenblick existiert die weibliche Kriminalpolizei offiziell nicht und befindet sich in einem Zustand der Desorganisation. Zuerst muß ihre Zahl durch Neueinstellungen vergrößert werden, ihr Pflichtenkreis muß festgelegt und erweitert werden, damit sie dann ihren entsprechenden Platz innerhalb des neuen deutschen Polizeisystems einnehmen kann“, heißt es in der Anweisung.716 Diesem Credo entgegen beschränkten sich die in der Anweisung aufgeführten Aufgabengebiete von Polizistinnen jedoch – wie schon in der Weimarer Republik – auf die Auseinandersetzung mit Frauen, Kindern und Jugendlichen, auf Betreuungsaufgaben und auf den Zivilstreifendienst.717 Aus der Anweisung wurde sogar deutlich, daß verheiratete Frauen wohl keinen Platz in der Polizei finden würden, sondern daß die ideale Polizeibeamtin ledig oder verwitwet sein sollte.718 Theanolte Bähnisch war also ab 1945 zum zweiten Mal – wenn auch bis 1951 nur ideell – in eine Polizeiverwaltungsreform involviert, die den Alltag der Bürger ‚entpolizeilichen‘719, die Polizei demokratisieren sollte und den Einsatz von Frauen für spezielle Aufgabengebiete als zweckdienlich erachtete. Der ‚Neuaufbau‘ der weiblichen Polizei knüpfte also beinahe nahtlos an das an, was Bähnisch aus der Weimarer Republik kannte, zumal wiederum jene britischen Traditionen integriert werden sollten, die bereits 1920 in Köln zum Tragen gekommen waren. Bähnisch bewegte sich in diesem Zusammenhang also in einem ihr vertrauten Umfeld. An die Unterlagen zur weiblichen Kriminalpolizei schließt sich eine Übersicht der am 01.09.1946 existierenden Frauenzusammenschlüsse an, untergegliedert in
715 DFR-Archiv, A3, Notizen über Geschichte und Zukunft der weiblichen Polizei, o. D., unterzeichnet von ‚Wetzlaff‘. 716 DFR-Archiv, A3, Anweisung Nr. 4 für den Neuaufbau der deutschen weiblichen Polizei in der britischen Zone o. D. [22.12.1945]. 717 Ebd., S. 5. 718 „In gewissen Fällen kommen auch verheiratete Frauen in Frage, wie z. B. Frauen von Kriegsgefangenen oder Invaliden, ebenso getrennte oder geschiedene Frauen.“ Ebd., S. 4. 719 NLA HA HStAH, Nds. 100, Acc. 57/89, Nr. 11b. Die Reorganisation des deutschen Polizeisystems in der britischen Besatzungszone, 1945, Blatt 10. In der Anordnung wird als ein Ziel der Entmilitarisierung der Aufbau einer auf die „Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung“ beschränkten Polizei deutlich. Die Polizisten sollten auf die „anständige […] Anwendung der Amtsbefugnis, eine[…] hohe[…] Auffassung der polizeilichen Pflicht und Disziplin“ und die „Anwendung solcher Eigenschaften wie Höflichkeit, Feingefühl und strenge Unparteilichkeit“ achten. Ebd.
688 | Theanolte Bähnisch
‚Kirchliche Frauenarbeit‘, ‚Wohlfahrtsverbände‘, ‚Politische Frauenarbeit‘, ‚Frauenberufsorganisationen‘ und ‚Andere Frauenverbände‘.720 Neben allen Organisationen sind die Namen der Vorstände sowie deren Telefonnummern angegeben. Es scheint, als habe die Regierungspräsidentin all jene Frauen kontaktiert – oder kontaktieren lassen, denn auf einem zweiten Blatt waren die Früchte bereits erfolgter Telefonate festgehalten: hier ist vermerkt, welches Material von welchen Organisationen bereits eingegangen war oder noch nachgereicht werden würde.721 Informationsblätter von Verbänden und persönliche Notizen Bähnischs oder Maria Prejawas zu einigen Organisationen komplettieren die Sammlung. Die Regierungspräsidentin hatte sich also über die Ziele verschiedener Organisationen, ihre Vorstände und ihre Arbeitsweise informiert, bevor sie damit begann, Frauenverbände regional und überregional zu vernetzen. Ihre Materialsammlung enthält nicht nur Informationen von Frauenverbänden aus dem Regierungsbezirk Hannover, sondern greift weit darüber hinaus. Wahrscheinlich ist, daß die auf lokaler Ebene tätigen Unterorganisationen jeweils auch Material über den Gesamtverband für Bähnisch zusammengestellt hatten. In den Unterlagen über den DRK ist eine minutiöse Aufstellung der Aufbauarbeit, die die Frauen des DRK in Niedersachsen seit der Kapitulation bis zum 01.07.1946 geleistet hatten, enthalten.722 Während Unterlagen über Wohlfahrtsorganisationen keinen eigenen Ort in der Sammlung haben, sondern im Zusammenhang mit denen über Frauenorganisationen abgelegt sind, läßt sich eine abgegrenzte Sammlung zum Thema ‚Flüchtlinge‘ ausmachen, worin wiederum Berichte von Wohlfahrtsorganisationen eine zentrale Rolle spielen.723 In diesem Kontext ist Material überliefert, welches der Regierung von den Kreisen und Stadtdirektoren zugestellt worden war.724 Einige der Texte sind auf englisch verfaßt, beispielsweise ein Aufsatz mit dem appellativen Titel „We need you“725, den die Leiterin der Frauenarbeit des niedersächsischen Landesverbands im DRK eingesandt hatte. Er schließt mit den Worten „Thousands and thousands of your contemporares have nearly forgotten happiness and laughter […] Don‘t you want to help them a bit towards it?“726 Auf diesen Aufsatz folgt in der Sammlung ein
720 DFR-Archiv, A3, Frauenorganisationen in Hannover, 1.IX.46., o. V. [maschinenschriftlich, vermutlich von Theanolte Bähnisch oder einer Mitarbeiterin]. 721 DFR-Archiv, A3, maschinenschriftliche Notiz ‚Sonnabend, 23.11.1946‘ [vermutlich von Theanolte Bähnisch oder einer Mitarbeiterin]. 722 DFR-Archiv, A3, Die Frauen des Deutschen Roten Kreuzes im Landesverband Niedersachsen […], o. D., o. V. 723 So beispielsweise ein Report über DRK-Flüchtlingslager, DFR-Archiv, A3, Report about refugee-camps by the German Red Cross for Niedersachsen Hannover, o. D. 724 DFR-Archiv, A3, Kreisverwaltung des Kreises Grafschaft Schaumburg, der Oberkreisdirektor an die Regierung Hannover, Rinteln, 28.11.1946 sowie ebd., Rat der Hauptstadt Hannover, Oberstadtdirektor Bratke an den Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, 12.11.1946, Abschrift an die Regierung Hannover. 725 DFR-Archiv, A3, We need you, Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Niedersachsen, Leiterin der Frauenarbeit, o. D. 726 Ebd.
Club deutscher Frauen | 689
Bericht über Flüchtlingslager des DRK, der ebenfalls die Hilfe der Briten einfordert: „Our own power are [!] to small, we must trust on the help from outside“727, heißt es in diesem Bericht. An ihn schließt sich eine ganze Serie in englischer Sprache beschriebener Flüchtlingsschicksale, vor allem auch solcher von Kindern728, an. Photos von Flüchtlingsunterkünften, aber auch ein mit „Hungererscheinungen“729 betiteltes Bild kranker Beine, das laut Beschriftung in einer Göttinger Klinik aufgenommen wurde, unterstreichen den Hilferuf des großen Wohlfahrtsverbands bildlich. Nicht nur in der Wohlfahrtspflege, sondern auch in der Verwaltung sowie in der regionalen Wirtschaft baute man auf die Möglichkeit, über die Regierungspräsidentin im Ausland Gehör zu finden. Regierungsdirektor Haverbeck – nebenbei bemerkt, während des Dritten Reichs Wehrwirtschaftsführer, Vorstand der Deutschen Waffenund Munitionsfabriken AG in Berlin sowie diverser anderer Rüstungsbetriebe und mit seiner Biographie ein Paradebeispiel für Elitenkontinuität in der Wirtschaft – wollte Bähnischs Reise nutzen, um seinen Gedanken zum Thema „Aktuelle Wirtschaftsprobleme, die nur durch vertrauensvolle Zusammenarbeit befriedigend gelöst werden können“730 Gehör zu verschaffen. Daß die Regierungspräsidentin aktiv Wirtschaftsunternehmen um sachdienliche Informationen zur Vorbereitung ihrer Reise gebeten hatte, belegt ein Schreiben der Bahlsen Keks-Fabrik, in dem „bezugnehmend auf unsere Unterredung in der vorigen Woche“ ein Auszug aus dem Bericht „unserer Fürsorgeschwester, der Ihnen vielleicht für ihre Zwecke dienlich sein kann“ 731 gegeben wird. Auf die Einleitung folgt ein Abriß über Probleme und Erkrankungen der Fabrik-Mitarbeiter und ihrer Kinder. „Dies wird für Sie nichts Neues sein, denn so sieht es ja bei uns aus, aber vielleicht ist es doch ganz gut, wenn Sie für Ihre Englandreise viele derartige Berichte zur Hand haben, aus denen Sie das Geeignete herausnehmen können“, 732 argumentiert der Verfasser.
727 DFR-Archiv, A3, Report about refugee-camps by the German Red Cross for Niedersachsen, Hannover, Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Niedersachsen, Leiterin der Frauenarbeit, o. D. 728 DFR-Archiv, A3, Refugee – children relate, Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Niedersachsen, Leiterin der Frauenarbeit, o. D. sowie About the roads, Landesverband Niedersachsen, Leiterin der Frauenarbeit, o. D. 729 DFR-Archiv, A3, Bild mit dem Titel: Flüchtling aus dem Osten, Hungererscheinungen, aufgenommen: Klinik Göttingen. Andere Bilder zeigen ein Mädchen „vor und nach der Flucht“, ein altes Paar, eine jüngere Frau und zwei Kinder, die nebeneinander auf Stroh schlafen und ein Mädchen, das den Kopf zum Schlafen auf eine Mülltonne abgelegt hat. 730 DFR-Archiv, A3, Aktuelle Wirtschaftsprobleme, die nur durch vertrauensvolle Zusammenarbeit gelöst werden können, Reg. Dir. Edgar Haverbeck, 27.11.1946. Haverbeck kritisiert in seinem Schreiben die Reparationsbeschlüsse, insbesondere die Stillegung von Rüstungsbetrieben, welche Gebrauchsgüter anfertigen. „[W]ir hoffen, daß sich auch in England allmählich die Einsicht Bahn bricht, daß es nunmehr an der Zeit ist, zu normalen Verhältnissen zurückzukehren“, schreibt Haverbeck auf der letzten Seite. 731 DFR-Archiv, Freiburg, A 3, H. Bahlsen Keks-Fabrik KG Hannover an Frau Regierungspräsident Bähnisch, 25.11.1946. 732 Ebd.
690 | Theanolte Bähnisch
Ein Schreiben Gotthard Kronsteins, der Bähnischs ‚Club junger Menschen‘ faktisch leitete, will schließlich über die Probleme der Jugendlichen in der Region aufklären. „Hungernde und Frierende werden […] niemals gute Demokraten werden“733 hielt Kronstein in seinem Brief an die Regierungspräsidentin drohend fest. „Und so bitte ich Sie, rufen Sie es in alle Welt hinaus, sagen Sie es auf allen Konferenzen die Sie mit den Engländern haben mögen: Die jungen Deutschen wollen arbeiten, arbeiten und noch einmal arbeiten.“ Dazu müsse man ihnen aber „die geringsten Möglichkeiten“ lassen. „Die junge Generation will Frieden und Freundschaft mit allen Menschen in Europa und der ganzen Welt, aber man muß ihr auch die Möglichkeiten einen normalen Lebensstandard langsam wieder zu errichten nicht beschneiden […] wir […] appellieren […] an die Menschlichkeit und an die Vernunft der Besatzungsmächte“734 schrieb Kronstein – und äußerte sich damit unzufrieden über die bisherige britische Wiederaufbauhilfe. 6.9.4 Selbstdarstellungen und persönliche Stellungnahmen: Die Juristin will Eindruck machen Neben Schriftstücken, die von der Militärregierung selbst stammen735, liegen dem Konvolut auch Papiere bei, die sich mit Bähnischs Werdegang beschäftigen und ihre eigenen Überzeugungen im Hinblick auf den Wiederaufbau zur Sprache bringen. Ein Kurz-Aufsatz mit dem Titel ‚How I came to be a lawyer‘736, betrifft eine Episode ihres Lebens, die sie häufig thematisierte. Von ihrer schon in früher Jugend empfundenen Begeisterung, für die Gerechtigkeit einzutreten, kommt sie über ihr ‚LäuterungsErlebnis‘ im Rahmen einer Zeugenbefragung737 zu ihrem hartnäckigen Kampf um die Zulassung als Verwaltungsreferendarin im preußischen Innenministerium. „To finish with I should like to tell you that I have never regretted having gone in for administration. I love my job and feel extremely happy doing it“738, läßt sie den Text, von dem unklar ist, welchem spezielleren Zweck er diente, mit einer eindeutigen Positionierung enden. Setzt man diesen Text in Beziehung zu anderen schriftlichen Äußerungen Bähnischs über ihre Biographie, so scheint es, als solle er nicht nur ihren eigenen Berufsweg als Erfolgsgeschichte darstellen, sondern auch zeigen, daß Frauen in (hohen) Verwaltungsämtern allgemein große persönliche Zufriedenheit erlangen
733 DFR-Archiv, Freiburg, A 3, Gotthard Kronstein an „Frau Regierungspräsident“, 21.11.1946. 734 Ebd. 735 DFR-Archiv, Freiburg, A 3, No 2. Nutrition Survey Team, Report No. 6, Survey A 2, Report on Hannover City – 3–18 June 1946. Einem Schreiben vom 19.11.1946 zufolge hatte der Oberregierungs- und Medizinalrat Lilje den Public Health-Report für Oktober 1946, der den Unterlagen ebenfalls beiliegt, bei der Militärregierung angefordert. Ebd., Dr. Lilje, Administration of Hannover an Military Government, 505 L/R Det., Public Health, 19.11.1946. 736 DFR-Archiv, Freiburg, A 3, How I came to be a lawyer, o. D. [1946]. 737 Siehe Kapitel 2.2.2. 738 DFR-Archiv, Freiburg, A 3, How I came to be a lawyer, o. D. [1946].
Club deutscher Frauen | 691
könnten.739 Schließlich hatte sich Bähnisch seit den 1920er Jahren, in der Überzeugung, daß dies ein für das weibliche Geschlecht besonders geeignetes Berufsfeld sei, für die Arbeit von Frauen in der Verwaltung eingesetzt.740 Interessant ist, nebenbei bemerkt, schließlich, daß ein der Materialsammlung ebenfalls beiliegender ausführlicher Lebenslauf Bähnischs in Bezug auf das Dritte Reich in einigen Punkten von dem differiert, was Bähnisch in anderen Lebensläufen schreibt.741 Schließlich ist den Unterlagen Bähnischs eigene Sicht auf die „Lage der Nation“ in englischer Sprache beigefügt. In „How are things in Germany at the present Moment“742 beschreibt sie ihr eigenes und das Verhalten ihrer Landsleute im Wiederaufbau als besonders tapfer und zeichnet den Weg von der einst hoffnungsfrohen Wahrnehmung der Briten durch die deutsche Bevölkerung hin zu einer von Mißtrauen geprägten Haltung. Die Deutschen hätten über ihre unglückliche Lage vergessen, daß Hitler für ihr Schicksal verantwortlich gemacht werden müsse, wirbt Bähnisch um Verständnis – und stellt gleichzeitig Ansprüche an die Briten: „Hungry, freezing people do not think about the past nor the causes of their pleigt. Like a creature they live in misery and keep longing for a way out“743, stößt sie in das gleiche Horn wie Gotthard Kronstein. Setzt man die im Text enthaltene Bemerkung “Have a look at this chart and you will see how the rations have shrunk“744 in Beziehung zu der beiliegenden Liste mit Nahrungsmittelrationen, wie sie im Herbst 1946 aktuell war, deutet alles darauf hin, daß der Text die Funktion eines Vortragsmanuskripts hatte. Ihren in Großbritannien vermutlich mehrfach gehaltenen Vortrag – in einem Bericht der Militärregierung ist überliefert, daß Bähnisch in London, Oxford und Cambridge über ‚Women’s Affairs‘ sprechen sollte745 – begann sie jeweils mit einer Beschrei-
739 DFR-Archiv, Freiburg, A 3, Curriculum vitae of Frau Regierungspräsident Bähnisch, o. D. [1946]. 740 Bähnisch: Staatsverwaltung. 741 DFR-Archiv, Freiburg, A 3, Curriculum vitae of Frau Regierungspräsident Bähnisch, o. D. [1946]. Laut diesem Lebenslauf soll Carl Spiecker und nicht, wie an anderer Stelle von Bähnisch angegeben, Wilhelm Abegg, alle Beweise über Bähnischs Tätigkeit für den ‚Freiheitsverlag‘ vernichtet haben. Spiecker war unter Brüning als Sonderbeauftragter des Reichs für die Bekämpfung des Nationalsozialismus eingesetzt und hatte versucht, den Flügel um Strasser zur Abspaltung zu bewegen, um die NSDAP zu zersplittern. 1933 wurde er wegen ‚politischer Unzuverlässigkeit‘ entlassen. Er emigrierte und engagierte sich aus dem Exil gegen den Nationalsozialismus. In diesem Lebenslauf bestätigt Bähnisch auch die naheliegende Vermutung, daß Bill Drews für die Zulassung Albrecht Bähnischs zum Verwaltungsrechtsrat 1932 – obwohl Bähnisch SPD-Mitglied und von der Amtsenthebung durch die Nationalsozialisten bedroht war – verantwortlich gewesen sei. 742 DFR-Archiv, Freiburg, A 3, How are things in Germany at the present Moment?, o. V. [Bähnisch] o. D. [1946]. 743 Ebd. 744 Ebd. 745 NA, UK, FO 1005/1668, Fifteenth Monthly Report from Military Government Land Niedersachsen, covering the period 1st November to 30st November 1946, General and political, S. 5. Unter Punkt 10 – „Women’s activities in Germany“, wird über Bähnischs Er-
692 | Theanolte Bähnisch
bung der Verhältnisse in Deutschland, wie sie sie persönlich erlebte. Daß sie berichtete, wie sie gemeinsam mit ihren Kindern den Zement von den Ziegelsteinen zerstörter Gebäude geschlagen und damit einen Raum ihrer Kölner Wohnung wiederhergerichtet habe, um darin zu leben, dürfte ihr die Aufmerksamkeit und Sympathie ihrer Zuhörer gesichert haben. Über das Elend der Kinder („it is the misery of the children that hurts us most“746) versuchte sie, ihre scheinbar weitgehend weiblichen Ansprechpartnerinnen an einem empfindlichen Nerv zu treffen („you being women and mother“). Schließlich kommt in ihrem Vortrag, ähnlich wie in ihrer Examensarbeit über Sittenpolizei und Prostitution, ihr Bedürfnis nach geregelten ‚bürgerlichen‘ Verhältnissen zum Ausdruck. Wieder einmal wird deutlich, daß die Juristin soziale Notlagen stets (auch) als einen Herd für anarchische Zustände betrachtete747: Ein Familienleben, so schrieb sie, sei vor allem in Flüchtlingsfamilien gar nicht möglich, weil dazu im wahrsten Sinne des Wortes der Raum fehle. „In my opinion, we have to aim at getting, in the far future, a small kitchen and a living room for every family. Should we fail to do that, we will finish up in anarchism. The home will be merely a place to sleep in and the men and the growing children will flee from that home and all bonds of family life will break“748, malt sie ein Schreckensbild der Zukunft aus, für den Fall, daß sich die Lebensumstände nicht ändern würden. Jene Ausführungen, mit denen sie Zuhörerinnen aus britischen Frauen- und Wohlfahrtsorganisationen konfrontierte, werden ihre erwünschte Wirkung nicht verfehlt haben. Die persönliche Bilanz, welche die deutsche Besucherin aus ihrer Reise zog, war – jedenfalls mit großem zeitlichem Abstand zu den Ereignissen betrachtet – äußerst positiv. „Unvergesslich“ blieben ihr „diese Tage der Herzlichkeit und Freundschaft und der freimütigen Aussprache“749, erinnerte sie in einer Rede 1959 – wiederum publikumswirksam – an ihre Reise nach Großbritannien. Auch mit über zehn Jahren Abstand zu den Ereignissen trat Bähnisch also weiterhin als Botschafterin der Briten in Deutschland auf. Dabei spielte der persönliche Kontakt, den sie mit Lady Nunburnholme gehabt hatte, eine besondere Rolle. Bähnisch, die mittlerweile Staatssekretärin geworden war, erinnerte sich gern „an die gastliche Aufnahme in ihrem Heim […] und die guten Gespräche mit ihr, in denen sie sich bemühte uns über die Organisation des ICW und die wichtigsten Frauenpersönlichkeiten in dieser Organisation
746 747
748 749
nennung zur Regierungspräsidentin („the first woman in German history to hold this high appointment“) und ihre Reise nach Großbritannien berichtet. DFR-Archiv, Freiburg, A 3, How are things in Germany at the present Moment?, o. V. [Bähnisch] o. D. [1946]. Mit dieser Wahrnehmung war sie in Hannover nicht allein. Oberstadtdirektor Bratke hatte geradezu eine Apokalypse beschworen, als er festhielt, daß „unter dem Druck der Flüchtlingsnot auch die letzten Reste der städtischen Kultur und Zivilisation untergehen werden.“ Ebd., Rat der Hauptstadt Hannover, Oberstadtdirektor Bratke an den Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, 12.11.1946, Abschrift an die Regierung Hannover, o. D. DFR-Archiv, Feiburg, A 3, How are things in Germany at the present Moment?, o. V. [Bähnisch] o. D. [1946]. Bähnisch: Wiederaufbau, S. 164.
Club deutscher Frauen | 693
zu informieren. Ihr kluger Rat hat uns maßgeblich geführt, und eine Freundschaft fürs Leben wurde, so darf ich wohl sagen, zwischen ihr und mir begründet“750. In der Biographie Bähnischs liegt also mithin ein Beweis für den Erfolg des sektoralen, bi-nationalen Elitenaustauschs als ein erfolgreiches Instrument der Verständigung. In einer Zeit, in der Deutschland vom internationalen Reiseverkehr weitgehend abgeschnitten war, war die Reise nach Großbritannien für sie ein prägendes Erlebnis, aus dem Dankbarkeit und Achtung vor den britischen Gastgebern resultierten. Dieser Dankbarkeit verlieh die Juristin Ausdruck, indem sie anderen davon berichtete – und damit auch jenen, die nicht in den Genuß einer Auslandsreise kamen, Anlaß gab, zu hoffen, daß der internationale Wiederanschluß Deutschlands durch eine enge Kooperation mit Großbritannien in greifbare Nähe rücken würde. Als sie in der ‚Anglo-German Society‘751 über ihre Reise berichtete, betonte sie die Freundlichkeit, mit der man ihr in Großbritannien „by all classes“752 begegnet sei und wies darauf hin, daß die englischen Frauen nicht über bessere Kleidung verfügten als die deutschen und daß sie auch das Schlange stehen in England an die Verhältnisse in ihrer Heimat erinnert habe. Schließlich habe sie, so heißt es im Bericht über ihre Rede, die Planungen für ein ‚neues Coventry‘ wohlwollend hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf das ebenfalls stark zerbombte Hannover überprüft.753 Die britische Militärregierung wiederum sah im Aufenthalt Bähnischs in Großbritannien bei weitem nicht nur den Besuch irgendeiner Protagonistin der deutschen Frauenbewegung mit einer nennenswerten beruflichen Position. Im ‚Monthly Report‘ für den Dezember 1946, in dessen Anhang sich der Reisebericht der Besucherin findet, wird darauf verwiesen, daß diese ihre Eindrücke aus England weit verbreiten werde. Schließlich war sie – dem Report zufolge – von einer britischen Zeitung gar als ‚Kopf der Militärregierung in Hannover‘ bezeichnet worden. Aufgrund der Vorurteilsfreiheit ihrer Ausführungen seien diese sehr wertvoll und informativ für die deutsche Bevölkerung, so der Verfasser des Berichts.754 Der Wirkungskreis der Regierungspräsidentin wurde also bereits im Dezember 1946 weit über die Grenzen Hannovers hinausgedacht. Schließlich wertete die Reise nach Großbritannien den Status Bähnischs in Deutschland stark auf. Eine solche Unternehmung verschaffte ihr einerseits einen Wissensvorsprung vor anderen deutschen Bürgern, andererseits stärkte sie die Verbindung mit der Militärregierung – was die Zusammenarbeit mit Bähnisch wiederum für andere deutsche Eliten, auch jenseits der Frauenbewegung, interessant machte. Die Political Division hatte sich bereits im Oktober 1946 anläßlich der Pläne der Education Branch, Bähnisch nach Großbritannien zu schicken, entsprechend geäußert: „since the importance and influence of the people we send from Germany will be
750 Ebd. 751 34 deutschen Mitgliedern hätten bei dem Treffen nur zehn britische gegenübergestanden, ist im Report vermerkt. NA, UK, FO 1005/1652, Monthly Report Hannover, December 1946, Appendix B. 752 Ebd. 753 Ebd. 754 NA, UK, FO 1005/1652, Monthly Report Hannover, December 1946.
694 | Theanolte Bähnisch
considerably enhanced on their return, through the experience they have gained during their visit, we feel that they should be chosen carefully“755. Ein Plädoyer für die Reise Bähnischs war diese Äußerung jedoch nicht.
755 NA, UK, FO 1049/568, German Political Branch, Political Division, Major Harcourt an Headquarters, I.A.&C. Division, 14.10.1946.
7
„eine hochwichtige staatspolitische Aufgabe“: Vom Hannoveraner Club zur zonenweit agierenden „Organisation gegen den Demokratischen Frauenbund“
7.1 DIE FRAUENBEWEGUNG IN DER SBZ, DIE GRÜNDUNG DES DFD IM MÄRZ 1947 UND DIE REAKTIONEN IM ‚WESTEN‘ 7.1.1 Ähnliche Ziele wie der Club, aber andere Vorgaben: Der DFD als Organisation der SED Zeitgleich zur Frauen-Re-education-Arbeit der britischen Militärregierung betrieb die sowjetische Militäradministration (SMAD) in der Viermächte-Stadt Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) ihrerseits eine spezielle Politik für deutsche Frauen. Wie die CCG (BE), so legte auch die SMAD im Rahmen ihrer Wiederaufbau-Pläne für Deutschland besonderen Wert auf die Arbeit mit Frauen und Jugendlichen. Wie für die britische galten auch für die sowjetische Militärregierung diese Bevölkerungsgruppen nicht nur als besonders wichtige Zielgruppen ihrer Politik, sondern auch als strategisch relevante Partner für die Durchsetzung ihrer deutschlandpolitischen Ziele.1 Die spontan gegründeten Frauenausschüsse, die es in allen Besatzungszonen schon kurz nach Kriegsende gab2, waren in der SBZ sehr schnell von den Behörden in die kommunale Selbstverwaltung eingebunden worden. Zusätzlich forcierte die SMAD neue Gründungen ‚von oben‘, eine Strategie, die ein großes Maß an Kontrol-
1
2
„The Russians have said constantly: ‚Give us the woman and the youth, and you keep the men‘“, schreiben Sarah Southall und Pauline Newman in ihrer Arbeit über die Entwicklung der Frauenberufstätigkeit in Deutschland, die sie 1949 im Auftrag der US-Militärregierung anfertigten. Southhall, Sarah/Newman, Pauline M.: Women in German industry. Die arbeitende Frau in Deutschland, Oktober 1949, Manpower Division OMGUS (Visiting Experts Series No. 14), zitiert nach: Rupieper: Bringing, hier S. 73. Siehe Kapitel 6.2.
696 | Theanolte Bähnisch
le über die Zusammenschlüsse sowie eine effiziente Nutzung ihrer Kapazitäten für die Zwecke der Militärregierung versprach.3 Schon am 23.08.1945 war ein Zentraler Frauenausschuß (ZFA) als Organ des Magistrats von Groß-Berlin gebildet worden.4 Dem ZFA, der im Sinn der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) arbeiten sollte, oblag es, die Aktivitäten aller Berliner Frauenausschüsse zu koordinieren.5 Den Ausschüssen gehörten, wie dem ZFA selbst, auch ‚bürgerliche‘ Frauen an.6 Die ‚Gefahr‘ der Entstehung von organisierten Zusammenschlüssen, welche sich dem Einfluß der Behörden hätten entziehen können, wurde minimiert, indem per SMADBefehl vom 03.11.1945 die Schaffung von Frauenzusammenschlüssen bei den Parteien und bei anderen Organisationen in der SBZ sowie im sowjetischen Sektor von Berlin untersagt wurde.7 Kurze Zeit später beschloß das Sekretariat des Zentralkomitees (ZK) der zwischenzeitig gegründeten Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED)8 die Bildung eines vorbereitenden Komitees zur Schaffung einer Organisation, welche den Namen ‚Demokratischer Frauenbund Deutschlands‘ (DFD) tragen sollte.9 Während die Frauen-Ausschüsse in den Berliner Westsektoren am
3
4
5
6
7 8
9
Vgl.: Bouillot/Schüller: Frauenorganisation, S. 47. Vgl. auch: Weber, Gerda: Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD), in: Broszat, Martin/Weber, Hermann (Hrsg.): SBZ-Handbuch. Staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Führungskräfte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, München 1990, S. 691–713. Vgl.: ebd., S. 705. Beschlossen worden war die Gründung dieses zentralen Frauenausschusses und damit einer Organisation, die im Sinne der SED arbeiten sollte, bereits im Juli 1945. Grundlage der weiteren Arbeit des ZFA war der SMAD-Befehl Nr. 80 vom 30.10.1945 über ‚Die Organisierung der antifaschistischen Frauenausschüsse bei den Stadtverwaltungen‘. Vgl.: Weber: DFD, S. 705. Viele der Frauen, die der LDP oder der CDU angehörten, wollten ihre Arbeit im DFD, der im März 1947 gegründet wurde, fortsetzen, verließen jedoch die Organisation, als deutlich wurde, daß der DFD im Sinne der SED arbeiten sollte. Vgl.: Scheidt, Petra: Karriere im Stillstand. Der Demokratische Frauenbund Deutschlands im Spiegel seiner Kaderarbeit und der Kaderstrukturen seines hauptamtlichen Funktionärskorps, Stuttgart 2011, S. 65. Die CDU hatte der ‚Vorfeldorganisation der SED‘ im September 1947 die Zusammenarbeit aufgekündigt. Scheidt: Karriere, S. 65 sowie Suckut, Siegfried: Parteien in der SBZ/DDR 1945–1952, Bonn 2000, S. 56, jeweils nach einer Rede Jakob Kaisers auf dem 2. Parteitag der CDU in der SBZ im September 1947. Vgl.: ebd. Die Vereinigung der SPD und der KPD zur SED fand gegen den teilweisen Widerstand von SPD-Mitgliedern unter sowjetischem Druck im Rahmen einer Gründungsveranstaltung am 21. und 22.04.1946 im Berliner Admiralspalast statt. Vgl.: ebd., S. 50. Zur Entstehungsgeschichte des DFD und seiner Arbeit ‚zwischen Anspruch und Wirklichkeit‘ vgl. auch: Bühler, Grit: Mythos Gleichberechtigung in der DDR – Politische Partizipation von Frauen am Beispiel des Demokratischen Frauenbunds Deutschlands, Frankfurt a. M./New York 1997 sowie die schon früher erschienene, jedoch nur auf Microfiche verfügbare Dissertation: Mocker, Elke: Demokratischer Frauenbund
Staatspolitische Aufgabe | 697
01.04.1947 als Organe der Kommunalverwaltung aufgelöst worden waren, erfolgte per Befehl Nr. 254 der SMAD vom 11.11.1947 im Ostsektor die Zusammenlegung der dort existierenden Frauen-Ausschüsse mit dem zu dieser Zeit bereits begründeten DFD.10 Das Programm, dem die Arbeit des DFD folgen sollte, unterschied sich auf den ersten Blick kaum von jenem, das der ‚Club deutscher Frauen‘ in Hannover aufgestellt und in andere Städte wie Göttingen, Celle und Düsseldorf exportiert hatte. Auch der DFD wollte sich für einen nachhaltigen Frieden einsetzen, die schwierigen Nachkriegs-Bedingungen überwinden helfen, den Wiederaufbau unterstützen, die Basis für ein gesundes, glückliches Familienleben schaffen, den Sinn für kulturelle Werte wecken sowie Deutschlands guten Ruf in der Welt durch die Zusammenarbeit mit Frauen aller Länder wiederherstellen. Zur Lösung sozialer, rechtlicher und wirtschaftlicher Probleme von Frauen wollte der DFD durch die Festlegung gleicher
Deutschlands (1947–1989). Historisch systematische Analyse einer DDR-Massenorganisation, Diss, Berlin 1992. Für eine sehr knappe Darstellung vgl.: Weber: DFD. Die vergleichsweise frühe Erforschung des DFD als Massenorganisation durch Gerda Weber ist mit darauf zurückzuführen, daß die Ehefrau des bekannten DDR-Historikers Hermann Weber in den 1940ern und zu Beginn der 1950er Jahre eine tragende Rolle im DFD gespielt hatte, bevor sie sich gemeinsam mit ihrem Mann vom Kommunismus abwendete. Vgl. dazu die Dokumentation Gerda Webers über den DFD in Weber, Hermann (Hrsg.): Parteiensystem zwischen Demokratie und Volksdemokratie, Köln 1983. Forschungslücken in Bezug auf die Kaderarbeit des DFD will Petra Scheidt mit ihrer jüngst erschienenen Studie kompensieren. Vgl.: Scheidt: Karriere. Die Gründungsphase des DFD behandelt Scheidt leider nur sehr knapp. Dies erscheint insofern problematisch, als daß Scheidt ihre These, nämlich daß parteilose Frauen sowie Frauen, die den Blockparteien angehörten, im DFD marginalisiert wurden, durch eine andere Gewichtung hätte spezifizieren können. Bei einer Analyse der Materialen aus den frühen Jahren des DFD, die in den Beständen DY 30 (Abteilung Frauen im ZK der SED) und DY 31 (Demokratischer Frauenbund Deutschland) im Bundesarchiv (BArch) Berlin, Sammlung Parteien und Massenorganisationen (SAPMO) überliefert sind, wird Folgendes deutlich: Auch in der frühen Phase des DFD dominierten in der Organisation, beispielsweise was die Anleitung von KPD-Funktionärinnen in Westdeutschland im Sinne des DFD/der SED betraf, Frauen, die der SED angehörten. Parteilose Frauen oder Vertreterinnen der Blockparteien spielen in den entsprechenden Unterlagen – mit Ausnahme der parteilosen Anne-Marie Durand-Wever – kaum eine nennenswerte und schon gar keine handlungsrelevante Rolle. Vgl. zu Scheidt auch die folgende sehr kritische Rezension eines Rostocker Historikers und SED-Experten: Niemann, Mario: Rezension über: Scheidt, Petra: Karriere im Stillstand, in: sehepunkte 12 (2012), Nr. 10, auf: http://www.sehepunkte.de/2012/10/21768.html, am 04.09.2014. Die Erforschung der ‚Westarbeit‘ des DFD steht derzeit noch aus. Für einen Vergleich zwischen der Frauenbewegung in den beiden deutschen Nachkriegsstaaten, der, wie alle älteren Titel, noch nicht von der Öffnung der Archive in den 90er Jahren profitieren konnte: Wiggershaus: Geschichte. Ältere, in der DDR erschienene Titel nennt Gerda Weber, vgl.: Weber: DFD, S. 704. 10 Vgl.: ebd., S. 705.
698 | Theanolte Bähnisch
Rechte und Pflichten von Männern und Frauen ebenfalls beitragen. Jedoch setzte sich die Organisation auch Ziele, die nicht deckungsgleich mit denen des ‚Club deutscher Frauen‘ waren: Er wollte ‚Faschismus‘, ‚Militarismus‘ und ‚Reaktionismus‘ bekämpfen sowie der Einheit Deutschlands durch aktive Beteiligung am politischen Leben dienen.11 Ebenso wie in der häufigen Verwendung des Wortes ‚fortschrittlich‘ im Programm kommt in diesen Zielen das kommunistische Selbstverständnis der Organisation zum Ausdruck. Das Programm des DFD ist zusammen mit Schriftverkehr über die politische Ausrichtung seiner Begründerinnen12 in einer Akte der britischen Militärregierung überliefert. Aus der Sammlung wird deutlich, daß die Briten bereits die Vorplanungen zur Gründung des DFD aufmerksam und – als ein Produkt, das maßgeblich den Interessen der KPdSU/SED entsprungen war – kritisch beobachteten.13 Ein Grund für die besondere Aufmerksamkeit der Briten dürfte darin gelegen haben, daß auch die SMAD Frauenorganisationen als wichtige Träger politischer Bildung ansah und deshalb bereits im November 1945 in der Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung ein Referat für Frauenausschüsse gebildet hatte. Dem Referat, aus dem 1946 die ‚Abteilung Frauenausschüsse‘ wurde, oblag der Historikerin und Archivarin Barbara Lange zufolge „die Herstellung enger Verbindungen mit Provinzial- und Landesausschüssen [beziehungsweise den späteren Bezirksorganisationen des DFD], die Zusammenarbeit mit allen Abteilungen in den verschiedenen Zentralverwaltungen, die Berücksichtigung von Forderungen der Frauen in der Gesetzgebung und die Verstärkung des Einflusses von Frauen im öffentlichen Leben.“14
11 NA, UK, FO 1050/1212, Proclamation of the Preparatory Committee for the Formation of the Demokratischen Frauenbundes (!) Deutschland, o. D. [Februar 1947] sowie Draft for a Programme of the Demokratischen Frauenbundes (!) Deutschland, o. D. [Februar 1947], Vgl. auch: Tscharntke: Re-educating, S. 127. 12 In der Parallelüberlieferung in einer anderen Akte finden sich auch Kurzbiographien der DFD-Funktionärinnen Magda Langhans, Elli Schmidt und Wilhelmine SchirmerProescher. NA, UK, FO 1049/1847, W.C. Stanley an die Political Division, Berlin, 24.11.1949, Subject: German Delegates to IFDW Conference in Moskow. Hier ist auch vermerkt, daß Elli Schmidt eigentlich Irene Ackermann hieß, aber ihren Mädchennamen verwendete. Während sie sich von 1940 bis 1945 im Moskau aufhielt benutzte sie den Decknamen Gaertner, um sich im Widerstand gegen den NS zu engagieren. 13 NA, UK, FO 1050/1212, Democratic Women’s League, 20.02.1947. 14 Lange, Barbara: Einleitung, in: Bundesarchiv (Hrsg.): Demokratischer Frauenbund Deutschlands, DY 31. 1945–1990 (Findbuch), Berlin 1997, auf: http://www.argus.bundes archiv.de/dy31/index.htm?kid=6e1c8ca4-4ff5-44dc-9451-6145c66a8d16, am 28.01.2014. Vgl. zur Genese des DFD und zur Überlieferung seiner Unterlagen allgemein den sehr lesenswerten Einleitungstext Barbara Langes. Vgl.: ebd.
Staatspolitische Aufgabe | 699
7.1.2 Die ‚Anwältin der Frauen‘ tritt aktiv den Kommunistinnen entgegen und erntet Beifall von Officer Walker Theanolte Bähnisch hatte, einer Rede aus dem Jahr 1959 zufolge, im Winter 1946 davon gehört, daß das vorbereitende Komitee zur Schaffung des DFD versucht habe, auch eine Gründung des Verbands in Westdeutschland vorzunehmen. Von einer „Frau Pfarrer Eichholz“15 sei sie über eine für Januar 1947 in Aachen geplante Zusammenkunft aller Frauenausschüsse der westlichen Zonen16 informiert worden. Man habe die Absicht gehabt, dort „den demokratischen Frauenbund Deutschlands zu gründen, der schon in der sowjetisch besetzten Zone bestehe, um so eine echte Frauenorganisation für ganz Deutschland zu bekommen“, gibt Bähnisch die Information von Eichholz wieder. „Da bereits damals der Verdacht bestand, daß der demokratische Frauenbund eine kommunistisch getarnte Organisation sei, schien es mir wichtig, an dieser Besprechung teilzunehmen, um eine voreilige Gründung zu verhindern“, begründet die Vorsitzende des ‚Club deutscher Frauen‘, warum sie im Januar 1947 kurzentschlossen nach Aachen reiste. Daran wird, wie auch an ihrer Reise nach Großbritannien einige Wochen zuvor, deutlich, daß ihre Einflußmöglichkeiten und auch ihre Einflußnahme im Winter 1946/47 nicht (mehr) auf das Land Niedersachsen beziehungsweise den ihr ebenfalls vertrauten Raum Köln beschränkt war. In Aachen angekommen habe sie „mit großer Sorge“ zur Kenntnis genommen, „daß die Majorität der Frauen von einem einheitlichen Zusammenschluß im demokratischen Frauenbund begeistert“17 gewesen sei. Umso entschlossener setzte die Präsidentin des ‚Club deutscher Frauen‘ deshalb, ihrer Schilderung zufolge, alles daran, die Pläne der Kommunistinnen zu vereiteln. In der Logik ihrer nicht selten beschworenen Opferbereitschaft für die Nation stellt sie ihren Einsatz auf der Konferenz in NordrheinWestfalen als geradezu heldinnenhaft dar: Bei einer Besprechung im kleinen Kreis, zu der sie während der Konferenz gebeten worden sei, habe sich, auf Bähnischs Frage nach der Überparteilichkeit der Zusammenkunft herausgestellt, „daß nur Frau Pfarrer Eichholz und ich keine Kommunistinnen waren.“ Die anderen Frauen hätten daraufhin erklärt, daß dies „reiner Zufall“ sei, „sie hätten in ihren Ausschüssen sämtliche Parteien und würden sofort vor allem auch kirchlich gesinnte Frauen zu der Besprechung hinzubitten. Dies geschah. Sie hatten tatsächlich eine Menge Andersgesinnter“ stellte Bähnisch fest, „aber sie waren nicht in der Führung“18. Offenbar versuchten die Kommunistinnen am zweiten Tag der Zusammenkunft ‚Nägel mit Köpfen‘ zu machen: „Als […] gleich nach Beginn der Sitzung eine der Kommunistinnen, die ich am Abend vorher kennengelernt hatte, einen Antrag stellte, über einen Zusammenschluß abzustimmen, meldete ich mich zu Wort und bat, daß doch vorher jeder Frauenausschuß zunächst mal über seine Arbeit berichten müsse
15 Bähnisch spielt hiermit vermutlich auf die Ehefrau von Wilhelm Eichholz, später Superintendent des Kirchenkreises Aachen, an. 16 Denise Tscharntke zufolge waren Frauen aus Bochum, Duisburg, Bonn, Düsseldorf, Dortmund und Hamm anwesend. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 130. 17 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 164. 18 Ebd., S. 165.
700 | Theanolte Bähnisch
[...] Mir lag daran, Zeit zu gewinnen, weil wir telefonisch und telegraphisch vor allem einige wichtige Führerinnen herbeigerufen hatten, um zu helfen, den Zusammenschluß zu verhindern.“19 Ob es an den erschwerten Reisebedingungen lag oder ob das eigene Netzwerk zu jener Zeit noch nicht so verläßlich war, wie von Bähnisch erhofft, darüber läßt sich nur spekulieren. Die ‚wichtigen Führerinnen‘ trafen nicht rechtzeitig ein, was Bähnisch zum Anlaß nahm, das ‚Problem‘ allein zu lösen. Die zahlreichen Ansprachen und Vorträge, welche sie in den letzten Monaten seit ihrem Amtsantritt in Hannover gehalten hatte, machten sich bezahlt: Die Regierungspräsidentin war das Reden gewohnt und konnte, um Zeit zu schinden, zu einer kreativen Waffe greifen: „Ich hatte dafür gesorgt, daß ich als Letzte berichtete und ich sprach so lange, bis – [...] zur Mittagsstunde die Museumsdiener in den Türen erschienen, um [...] das Museum zu schließen. Ich atmete auf, als ich endlich meine schon sehr langatmig gewordene Rede beschließen konnte. [...] An diesem Nachmittag wurde die Gründung tatsächlich verhindert“20, beendet sie ihre Ausführungen über ihren ‚ersten Streich‘ gegen die Kommunistinnen. Als Vorsitzende einer ‚überparteilichen‘ Organisation war sie offen gegen das Bestreben der SMAD/SED eingetreten, einen Frauenverband zu gründen, der sich nicht zu seiner parteipolitischen Bindung bekannte, sondern als ‚überparteilich‘ und ‚fortschrittlich‘ auftrat. Wie die Frauen, die den DFD in den Westzonen begründen wollten, auf den Filibuster Bähnischs reagierten, ist nicht bekannt. Zwar sind Stellungnahmen von Frauen, die im DFD organisiert waren oder mit ihm zusammen arbeiteten über das Handeln der Regierungspräsidentin überliefert, sie setzen jedoch in den Akten der ‚Abteilung Frauen im ZK der SED‘21 erst im April 1946 ein. Zu dieser Zeit fand bereits eine weitere Frauen-Tagung, zu der Bähnisch ebenfalls gereist war22, in Aachen statt. Zu dieser Tagung merkte die spätere NRW-Landtagsabgeordnete und Mitbegründerin des DFD in den Westzonen, Hanna Melzer (KPD)23, an, daß das Verbindungskomitee des DFD (für die Arbeit in den Westzonen), welches nach der Gründung des Verbands in Berlin gebildet worden war, im April 1946 in Aachen nicht anerkannt worden sei, daß „aber auch Frau Bähnisch mit ihren Vorschlägen und Bestrebungen ihre Frauenorganisation als Dachorganisation aller Frauenorganisationen bezw. weiblichen Mitglieder der Parteien und anderer Organisationen zu schaffen“, auf dieser Tagung nicht „durch“ gekommen sei.24
19 20 21 22
Ebd. Ebd. BArch, SAPMO DY 30. NA, UK, FO 945/284, Englische Übersetzung eines Artikels o. V., o. T., aus einer nicht näher bezeichneten ‚Volksstimme‘ vom 21.04.1947. 23 Die Gründung des DFD in den Westzonen erfolgte schließlich erst 1950. Melzer war zu dieser Zeit Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen. 1953 erging Haftbefehl gegen Melzer wegen ihrer Tätigkeiten in der KPD und dem DFD. 1956 siedelte sie in die DDR über. 24 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Hanna [Melzer] an Emmi [Emmy Damerius-Koenen], 03.05.1947.
Staatspolitische Aufgabe | 701
Der ‚Ring‘ war also eröffnet, Melzer wußte um ihre politische Gegnerin, die Regierungspräsidentin lebte in einer Art permanentem Alarmzustand. „Frau Bähnisch ist nach der Gründung des Demokratischen Frauenbundes in Berlin sehr rührig“25 geworden, hatte Melzer das durch den Auftritt des DFD auf dem ‚Parkett‘ noch verstärkte Engagement Bähnischs in der Frauenbewegung kommentiert. Mit dieser Formulierung in ihrem Brief an eine Parteigenossin, der den Charakter eines politischen Lageberichts trägt, spielte Melzer darauf an, daß Bähnisch schon vor der Gründung des Frauenrings der britischen Zone, die im Juni 1947 erfolgen sollte, Versuche unternommen hatte, das Modell des ‚Club deutscher Frauen‘ auf Zusammenschlüsse in anderen Städten zu übertragen. Aus der Retrospektive betrachtet waren dies Vorarbeiten, die einen späteren Zusammenschluß gleichgesinnter Verbände unter ihrer Regie vereinfachen sollten. „Nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in anderen Städten wie z. B. in Bielefeld werden durch Frau Bähnisch Anstrengungen gemacht, ihren Frauenclub zu schaffen“26, zeigte sich Melzer, die zum Vorstand des KPD-Bezirks Ruhr gehörte, über Bähnischs Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen informiert. Im gleichen Atemzug wollte die als ‚Eiserne Johanna‘27 bekannt gewordene Melzer jedoch eventuell aufkommende Sorgen zerstreuen: „Nach Auffassung unserer Genossinnen bestehen wenig Aussichten, daß es Frau Bähnisch gelingen sollte, eine grosse Frauenorganisation auf die Beine zu stellen.“28 Bähnisch wurde also im Frühjahr 1946 von der KPD-Politikerin Hanna Melzer ganz ähnlich wie von der SPDFrauensekretärin Herta Gotthelf eingeschätzt: als unbequem, nicht aber als eine Bedrohung. Und wie bei Gotthelf schien hier mehr das Wunschdenken als das Wissen Vater des Gedankens gewesen zu sein. Ein Telegramm der Berlin Commission British (BERCOMB) an die Kollegen in der britischen Besatzungszone zeigt, daß Theanolte Bähnisch mit der Verhinderungstaktik, die sie in Aachen angewendet hatte, ganz im Einklang mit der britischen Militärregierung handelte. Die BERCOMB war ebenfalls daran interessiert, ein Ausgreifen des von Berlin aus gesteuerten DFD auf die Westzonen zu unterbinden, weshalb die in der Vier-Mächte-Stadt stationierten Mitarbeiter der CCG (BE) die Kollegen in der Britischen Besatzungszone anwiesen, eine Gründung des DFD gegenüber den Antragstellerinnen mit dem Hinweis auf die große Anzahl bereits bestehender Frauen-Organisationen zu verzögern.29 Ein Engagement gegen den DFD erschien den Briten vor allem in Nordrhein-Westfalen dringend geboten, denn dort hatte die ‚Eiserne Johanna‘, die zugleich Leiterin der Frauensektion der KPD war, eine große Anhängerschaft mobilisieren können.30 Miss Walker, zuständig für die Women’s Affairs bei der CCG (BE) in Nordrhein-Westfalen, lobte deshalb die Regierungspräsidentin
25 Ebd. 26 Ebd. 27 Melzer war während des Nationalsozialismus elf Jahre inhaftiert und verdankte ihren Spitznamen ihrem beharrlichen Schweigen trotz Folter während der Haftzeit. 28 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Hanna [Melzer] an Emmi [Emmy Damerius-Koenen], 03.05.1947. 29 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 130. 30 Vgl.: ebd.
702 | Theanolte Bähnisch
für ihren Einsatz in Aachen und attestierte ihr „much valuable work […] both by her speech, and by her personal interview“31 geleistet zu haben. Auch jenseits von Niedersachsen wurde Bähnisch von britischer Seite also eine wichtige Informantin und Strategin wahrgenommen. 7.1.3 Die Gründung des DFD als überregionaler Frauenverband in Berlin – unter ‚bürgerlicher‘ Beteiligung In der SBZ hatte unterdessen, unter der Hoheit und Protektion der SMAD, am 07. und 08.12.1946 eine Zusammenkunft stattgefunden, in deren Rahmen das bereits erwähnte vorbereitende Komitee zur Gründung des DFD gebildet worden war32. Bähnisch wertete diese rahmengebende Zusammenkunft als eine Reaktion auf die Verhältnisse in den Westsektoren, die sie selbst maßgeblich mitbestimmt hatte. Mit einigen Jahren Abstand zu den Ereignissen schrieb sie, daß die „kommunistischen Frauen in der sowjetisch besetzten Zone“ zu jener Zeit „erkannt“ hätten, „daß sich in den 3 übrigen Zonen eine Frauenbewegung zu bilden begann, die ihren Einflüssen nicht zugänglich war. Sie wollten uns deshalb in der Frage des deutschen Zusammenschlusses zuvorkommen“33. Die endgültige Gründung des DFD, der sich zwar zunächst auf die SBZ beschränken mußte, aber dennoch für sich beanspruchen konnte, der erste überregionale Frauenverband in Deutschland nach Kriegsende zu sein, erfolgte zu einem sehr geschickt gewählten Datum, nämlich am 08.03.1947, dem Internationalen Frauentag. Den Rahmen für die Gründung bot der ‚Deutsche Frauenkongreß für den Frieden‘, eine Großveranstaltung, welche in Berlin vom 07. bis zum 09.03.1947 stattfand. 1400 Personen nahmen an dem Ereignis teil, darunter auch Vertreterinnen der Internationalen Demokratischen Frauenföderation (IDFF) aus der Sowjetunion und deren ‚Bruderstaaten‘.34 Der überwiegende Teil der Delegierten, die von verschiedenen Frauenausschüssen entsandt worden waren, kam aus der SBZ. Daneben waren, Denise Tscharntke zufolge, 84 Delegierte aus der britischen Besatzungszone, 14 aus der amerikanischen und fünf aus der französischen Zone angereist.35 Ob die Nichtteilnahme Bähnischs darauf zurückzuführen war, daß sie selbst gar nicht zur Konferenz hatte reisen wollen36, oder darauf, daß Herta Gotthelf ihr dies untersagt hatte, läßt sich nicht rekonstruieren. „Bei den Infiltrierungsversuchen, die die Kommunisten und die S.E.D jetzt in verstärktem Umfange vornehmen und bei der sehr schwierigen politischen Situation, werden sie […] sicher der Partei keine
31 NA, UK, FO 1013/607, Report on conference of representatives of women’s organisations at Aachen 16th–18th April, Walker, 20.04.1947, zitiert nach: Tscharntke: Re-educating, S. 131. 32 Vgl.: Bouillot/Schüller: Frauenorganisation, S. 47. 33 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 166. 34 Vgl.: Pawlowski: Frauenbund, S. 75–87. Denise Tscharntke gibt die Zahl der Teilnehmer sogar mit 2000 an. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 127. 35 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 127. 36 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 166.
Staatspolitische Aufgabe | 703
Schwierigkeiten bereiten durch Ihre Anwesenheit auf diesem Kongress“37, hatte Gotthelf an die ungeliebte Genossin geschrieben. Denn sie glaubte zu wissen, daß die IDFF, also eine kommunistisch orientierte, internationale Frauenorganisation, die Veranstaltung organisiert hätte.38 Zur Vorsitzenden des neu gegründeten Dachverbandes, in den, wie bereits erwähnt, alle in der SBZ bestehenden Frauenzusammenschlüsse eingebunden wurden39, wurde die parteilose Anne-Marie Durand-Wever gewählt. Mit dieser ‚Pionierin der Sexualaufklärung und Empfängnisregelung‘40, die im Mai 1948 von Emmi Damerius-Koenen, einer überzeugten Kommunistin, abgelöst werden sollte, hatte sich der DFD zunächst eine Vorsitzende auserkoren, welche – im Gegensatz zum Großteil der Mitglieder des DFD – nicht der SED angehörte, sondern dem linken Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung zuzurechnen war. Neben Käthe Kern, die gemeinsam mit Elli Schmidt das SED-Frauensekretariat leitete, und Emmi Damerius-Koenen41 war mit Marie Elisabeth-Lüders unter den Rednerinnen auch eine sehr prominente Vertreterin des gemäßigten Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung präsent. Lüders erinnerte in ihrem Eröffnungs-Beitrag besonders an die Bedeutung internationaler Tagungen als Möglichkeiten der Verständigung42 und unterstrich damit die Bedeutung des ‚Frauenkongreß für den Frieden‘, der sich der Anwesenheit von Frauen aus verschiedenen, vor allem aber aus sozialistisch regierten Ländern, rühmen konnte. Die überzeugte Liberale, die 1926 gemeinsam mit Agnes von Zahn-Harnack und Margarete von Wrangell den Deutschen Akademikerinnenbund (DAB) gegründet und diesen ab 1930 geleitet hatte43, ermöglichte dem DFD mit ihrer Anwesenheit und ihrem Beitrag, zu demonstrieren, daß in ihm auch liberale Traditionen ihren Platz finden könnten.
37 AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), Frauenbüro, Nr. 0244 A, Herta Gotthelf an Theanolte Bähnisch, 26.02.1947, Abschrift eines Einschreibens. 38 Ebd. 39 Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 166. 40 Durand-Wever hatte sich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges insbesondere für die Abschaffung des § 218 eingesetzt. 1952 gründete sie die Organisation Pro Familia in Kassel mit. Vgl.: O. V.: 14. September 2005 – Vor 35 Jahren: Anne-Marie Durand-Wever stirbt: Für eine selbstbestimmte Sexualität, auf: http://www1.wdr.de/themen/archiv/stichtag/ stichtag1410.html, am 13.12.2013. Vgl. auch: Art. „Durand-Wever, Anne-Marie“ in: Internationales Biographisches Archiv 36/1971, auf: Munzinger Online/Personen, http://www. munzinger.de/document/00000001632, am 13.12.2013. 41 Eine andere Rednerin, Helene Beer war zuvor LDP-Politikerin gewesen und zur Zeit der Konferenz parteilos. Sie bekannte sich jedoch zum DFD und wurde dessen stellvertretende Vorsitzende. 42 BArch, SAPMO DY 31/294, o. V.: Frauen für den Frieden. Eröffnung des deutschen Frauenkongresses in Berlin, in: Pressedienst der SED, 08.03.1947. 43 Lüders, die 1949 den Akademikerinnenbund nach seiner Auflösung 1933 wieder gründete und wie Bähnisch Mitglied im Juristinnenbund war, gehörte 1953–1961 als Abgeordnete der FDP dem Bundestag an.
704 | Theanolte Bähnisch
Über die Gründe Lüders, sich so aktiv in die Konferenz einzubringen, läßt sich nur spekulieren: Vielleicht hatte die spätere FDP-Bundestagsabgeordnete, welche sich zweieinhalb Jahre später gemeinsam mit Theanolte Bähnisch im DFR offensiv gegen den DFD wenden sollte, im März 1946 in einer Zusammenarbeit mit dem DFD noch keine Kollision mit ihren eigenen politischen Zielen erkennen können. Vielleicht hatte sie durch ihre Anwesenheit aber auch einen Kontrapunkt zur kommunistisch dominierten Veranstaltung setzen wollen. Oder aber sie hatte schlichtweg ihren guten Willen demonstrieren und/oder ihrem Interesse am Austausch mit Frauen aus einem großen deutschen Verband sowie aus dem Ausland nachgeben wollen. Lüders war übrigens nicht die einzige Person aus dem ‚bürgerlichen‘ Spektrum der Frauenbewegung, die der DFD für seine Arbeit angeworben hatte. Die Dichterin Ricarda Huch wurde im November 1947 sogar zur Ehrenpräsidentin des DFD ernannt. Denise Tscharntke erkennt hierin ebenso wie in der Rede Lüders‘ eine Anleihe des DFD an die Frauenbewegung der Weimarer Republik.44 Die Historikerin konstatiert, daß sich der Verband sogar teilweise an die Rhetorik des BDF anlehnte,45 ein Eindruck den sich im vorgenommenen Vergleich der Programme des ‚Club deutscher Frauen‘ und des DFD bestätigt. Für Petra Scheidt, die die Kaderarbeit und die Kaderstrukturen im DFD analysiert hat, steht jedoch fest, daß der DFD „keineswegs in der Tradition der deutschen Frauenbewegung verankert“ war. Denn die Verbände der deutschen Frauenbewegung seien „bis zum Ende der Weimarer Republik in der Regel unabhängige Interessengemeinschaften gewesen“46. Der DFD habe seine Ziele und Aufgaben jedoch nicht selbst definiert und sein Personal habe zum größten Teil aus Funktionärinnen, welche der SED angehörten, bestanden.47 Wenn auch die Frage, wie ‚unabhängig‘ der BDF war, ein Thema für sich ist, so bestätigen die aus dem Frauensekretariat der SED überlieferten Akten fraglos Scheidts Statement zur personellen Besetzung der Führungspositionen im DFD.48 Der DFD sei, so urteilt Scheidt, weniger eine Gruppierung innerhalb der deutschen Frauenbewegung als ein „Ableger der SED“ gewesen.49 Wie andere Massenorganisationen habe der Verband im Zuge der angestrebten politisch-ideologischen Infiltration der Gesellschaft die „Kontrolle des parteifernen Raums“50 übernehmen sollen, seine Aufgabe habe darin bestanden, Bevölkerungsteile anzusprechen, die sich nicht an die Partei binden ließen. Zur Untermauerung ihrer Thesen verweist Petra Scheidt auf das Protokoll einer Sitzung der SEDLandesleitung in Sachsen im November 1946, auf der das Thema ‚Frauenarbeit‘ als
44 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 129. Tscharntke folgt in ihrer Argumentation Irene Stoehr. Vgl.: Stoehr/Schmidt-Harzbach: Friedenspolitik. 45 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 129. 46 Scheidt: Karriere, S. 36. 47 Vgl.: ebd. 48 BArch, SAPMO DY 30 sowie DY 31. 49 Scheidt: Karriere, Ebd., S. 38. 50 Ebd., S. 42.
Staatspolitische Aufgabe
|
705
ein Mittel zur Ausdehnung der kommunistischen Einflußnahme auf bürgerliche Kreise offen diskutiert wurde.51 Die Einschätzungen Tscharntkes und Scheids stehen sich nicht unvereinbar gegenüber, vielmehr deuten die Forschungsergebnisse beider Autorinnen auf das gleiche Phänomen hin: der DFD wartete zumindest anfangs durchaus mit Anleihen aus der ‚bürgerlichen‘ Kultur auf, um ein entsprechendes Publikum zu erreichen. Sein mittelfristiges Ziel bestand jedoch darin, eine ‚fortschrittliche‘ Haltung unter den Frauen zu fördern, welche mit dem Selbstverständnis und der Politik der SED52 im Einklang stand. Daß sich der DFD, wie Scheidt konstatiert, bewußt von den Traditionen der bürgerlichen Frauenbewegung abgegrenzt habe, indem er eben nicht versucht habe, deren Galionsfiguren zu integrieren53, läßt sich – denkt man an Lüders, Durand-Wever und Huch – zumindest für die Anfangsphase nicht bestätigen. Wie Kapitel 7.6 zeigen wird, waren einige Mitglieder des DFD, darunter auch Funktionärinnen, zunächst unentschlossen, was die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit den überparteilichen Frauenorganisationen in Westdeutschland anging, zumal auch innerhalb des DFD die Wahrnehmung dessen differierte, was als ‚bürgerlich‘ oder ‚fortschrittlich‘ galt. Wie Scheidt anmerkt, „gelang es der Partei [SED] nur allmählich, den Bund wirksam zu dominieren“.54 Dies war wiederum nicht zuletzt an den unterschiedlichen Resonanzen, welche die – im Vergleich zu den bereits vor 1933 aktiven Protagonistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung – noch unbeschriebene Person Bähnischs hervorrief, abzulesen. Es wird sich zeigen, daß DFDFührungsmitglieder, die an eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der SPD in den Westzonen glaubten55, in der so gar nicht linientreuen Verwaltungsjuristin zumindest zu Beginn eine interessante Kooperationspartnerin erkannten, während andere in Bähnisch allein schon aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit den ehemaligen Vorstandsmitgliedern des BDF und ihrer Retorik, die an jene Tradition anknüpfte, einen Widerpart ihrer ‚fortschrittlichen‘ Interessen sahen. Zur unterschiedlichen Einschätzung Bähnischs trug natürlich auch bei, daß sich die Präsidentin des ‚Club deutscher Frauen‘ in der Phase der Konstituierung des DFD in der Öffentlichkeit mit Äußerungen gegen Kommunistinnen zurückgehalten hatte. Weil es von der Viermächte-Stadt aus offensichtlich schwierig war, die Vorreiterschaft in Sachen Frauenbewegung jenseits der Enklave zu ‚durchblicken‘, wurde, wie in Kapitel 6 ebenfalls ausgeführt werden wird, von den meisten DFD-Funktionärinnen irrtümlicherweise nicht die britische, sondern die amerikanische Militärregierung als wichtigster Gegenspieler der SMAD in Sachen Frauenpolitik angesehen. Aus diesem Zusammenspiel von Faktoren ergab sich, aus der strategischen Position des DFD betrachtet, zunächst eine
51 Vgl.: ebd. 52 Vgl.: Malycha, Andreas/Winter, Peter Jochen: Die SED. Geschichte einer deutschen Partei, München 2009. 53 Vgl.: Scheidt: Karriere, S. 36. 54 Ebd., S. 37. 55 Gegenstand einer gesonderten Analyse könnte sein, herauszuarbeiten, inwiefern darunter Frauen waren, die über die SPD den Weg in die ‚Sozialistische Einheitspartei‘ gefunden hatten und welche Rolle sie im DFD mittelfristig spielten.
706 | Theanolte Bähnisch
Konzentration der Aufmerksamkeit von DFD-Funktionärinnen auf die ‚falschen‘ Frauen, nämlich auf jene, die in der amerikanischen Besatzungszone oder im amerikanischen Sektor Berlins aktiv waren. Daß die ‚bürgerliche Konkurrenz‘ ausgerechnet aus Hannover kommen sollte, zeichnete sich für die im DFD organisierten Frauen erst langsam ab. 7.1.4 (K)ein Gebot der ersten Stunde: Feminismus und Antikommunismus in der Selbstkonstruktion Bähnischs und in der Organisationsgeschichte des Frauenrings In der Retrospektive bewertete Theanolte Bähnisch ihr Engagement in der Frauenbewegung als eine logische Folge ihrer Sorge vor einer kommunistischen Infiltration Westdeutschlands.56 Wann dieser Beweggrund als Hauptantrieb für ihre frauenpolitische Arbeit jedoch konstitutiv wurde, läßt sich nicht genau herausarbeiten. Ihr Entschluß, sich in die Frauenbildung und -bewegung einzubringen, scheint, wie an anderer Stelle ausgeführt, nicht zuletzt von der ‚Education Control Instruction No. 60‘ der Militärregierung, in der der Kommunismus keine Rolle gespielt hatte, ausgegangen zu sein.57 Daß das Thema Kommunismus die Juristin bereits – oder, vor dem Hintegrund des bereits in der Weimarer Republik verbreiteten Antikommunismus betrachtet, noch – im Dezember 1945 beschäftigte, läßt sich aus einem ihrer Briefe an Kurt Schumacher ersehen. Demnach hielt sie die „allgemeine Auffassung […] dass für […] die nächsten Jahre durch das unmittelbare Erleben der Bolschewismus seine Suggestivkraft verloren hat“ für „gefährlich.“ Die Ergebnisse der „aktuellen Wahlen“ seien „zeitbedingte Erscheinungen an der Oberfläche der Dinge, die zu gefährlichen Trugschlüssen führen können“58. Sie glaubte nicht an ein Ende des ‚Bolschewismus‘ beziehungsweise ‚Kommunismus‘ – Begriffe, die sie bedeutungsgleich verwendete. „Die bürgerlichen Parteien haben wir auf lange Sicht m. E. nicht mehr machtmässig zu fürchten […] wohl aber die Kommunisten“, beschwor sie die größte Konkurrenz der Sozialdemokratie aus ihrer Sicht und resümierte: „Ich komme immer wieder zu dem Ergebnis, dass unsere wichtigste Aufgabe ist, den Kommunismus zu schwächen und ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen.“59 Daß die spätere Präsidentin des ‚Frauenrings‘ zu jener Zeit bereits eine starke Verbindung zwischen der Notwendigkeit, Frauen politisch zu bilden, und jener, dem Kommunismus entgegenzutreten sah, ist, den überlieferten Quellen nach zu urteilen, eher fraglich – auch wenn sie in der Retrospektive etwas anderes behaupten sollte. Zwar hatte sie an den designierten Parteivorsitzenden mit gleicher Post geschrieben, daß sie das „Problem der Frauengewinnung […] natürlich doch beschäftigt“60 habe, nachdem der Vorsitzende des SPD-Bezirks Obere Rheinprovinz und spätere Kölner
56 57 58 59 60
Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau. Siehe Kapitel 6.3.2. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 23.12.1945. Ebd. Ebd.
Staatspolitische Aufgabe
|
707
Oberbürgermeister, Robert Görlinger, versucht hatte, sie für diesen Aspekt der Parteiarbeit zu erwärmen. Doch einen Zusammenhang zwischen den beiden Themen stellte Bähnisch im Brief an Schumacher nicht her. In die parteiinterne Frauenarbeit wollte sie sich ohnehin nicht drängen lassen. „Das liegt mir […] gar nicht. Ich bin Frauen in Massen immer aus dem Weg gegangen“61, teilte sie dem Adressaten ihres Briefs mit. An dieser Einstellung hatte sich scheinbar auch nichts geändert, als sie den ‚Club deutscher Frauen‘ ins Leben rief. Der überschaubar große ‚Club‘ – das spiegelte sich schon in seinem mit Bedacht gewählten Namen wider62 – hatte nichts von einer Massenorganisation. Eine solche zu gründen beschloß Bähnisch erst, als sie keinen anderen ‚Ausweg‘ mehr sah, als dem bald schon sehr mitgliederstarken, kommunistisch dominierten DFD einen ebenfalls mitgliederstarken, ‚westlich‘ orientierten Frauenverband entgegenzusetzen. In diesem Tun erkannte sie, die 1945 erklärtermaßen neben ihrem Beruf oder mit Hilfe ihres Berufs gern an der „politischen Entwicklung der Partei“63 hatte mitarbeiten wollen, keine parteipolitische, sondern wie sie Herta Gotthelf gegenüber erklärt hatte, eine „staatspolitische Aufgabe“64. In Bähnischs Wahrnehmung war die Herausforderung, gegen die ‚Infiltration‘ Westdeutschlands durch Kommunisten zu kämpfen, mit der Gründung des DFD offenbar zu groß geworden, als daß sie mit den Möglichkeiten (nur) einer Partei zu meistern gewesen wäre – und Schumacher erinnerte sich vielleicht an Bähnischs Brief aus dem Dezember 1945, als er sie, sehr zum Ärger ‚seiner‘ Frauenreferentin Gotthelf, agieren ließ. Daß bereits die Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘, die ein dreiviertel Jahr vor der Gründung des DFD erfolgt war, wesentlich aus dem Willen zur Bekämpfung des Kommunismus resultierte, ist also unwahrscheinlich. Zwar schreibt Bähnisch 1959, sie sei „kaum 6 Wochen […] als Regierungsvizepräsidentin in Hannover“65 gewesen, als sie zu der Überzeugung gekommen sei, daß der Politik kommunistisch orientierter Frauen Einhalt geboten werden müsse – womit sie Bezug auf die Gründungsphase des ‚Club deutscher Frauen‘ im Mai/Juni 1946 nimmt. Dies vermag jedoch, aus heutiger Perspektive betrachtet, nicht zu überzeugen, zumal sich, wie bereits erwähnt, unter den Gründungsmitgliedern mit Elfriede Paul eine bekennende und aufgrund ihrer Geschichte im Widerstand gegen den Nationalsozialismus nicht unbekannte Kommunistin befunden hatte. Zu den Mitgliedern zählten auch andere Kommunistinnen, und es ist nicht wahrscheinlich, daß diese bereits in der Gründungs-Phase des Clubs von der KPDSU/SED ‚instruiert‘ worden waren, den Club zu ‚infiltrieren‘. Es scheint, als sei die Club-Gründung zu jenem Zeitpunkt ein weitgehend einvernehmliches Unterfangen seiner Mitglieder gewesen, überparteilich pro-
61 Ebd. 62 „Wir nannten uns damals Club, um die große Intimität dieses Kreises und unsere Zusammengehörigkeit zu betonen“, erklärt Bähnisch in einer Rede von 1959, die im Anschluß als Aufsatz gedruckt wurde. Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 163. 63 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 23.12.1945. 64 AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), Frauenbüro, 0244A, Theanolte Bähnisch an Herta Gotthelf, 29.04.1947. 65 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 162.
708 | Theanolte Bähnisch
duktiv zusammenzuarbeiten – zumal Elfriede Paul, auch, was die Frauenbildung betraf, eine anerkannte Kapazität war. In seiner Gründungsanzeige hatte der Club zudem – anders, als später der DFR – damit geworben, nicht nur „unabhängig […] von Politik“, sondern auch von „Weltanschauung“66 zu sein. Und als eine ‚Weltanschauung‘ beschrieb Bähnisch den Kommunismus wiederum in der ‚Stimme der Frau‘.67 Ob sich die Regierungspräsidentin bei der nicht lange währenden Zusammenarbeit mit Paul im Vorstand wohl fühlte, ist nicht überliefert, auch nicht, inwiefern strategische Gesichtspunkte sie dazu brachten, eine womöglich bestehende, distanzierte Haltung zu Paul über Bord zu werfen. Festzustellen ist, daß zu Beginn eine wie auch immer geartete ‚Bereitschaft‘ zur Zusammenarbeit mit Kommunistinnen im Club bestand. Anders, als später der DFR der ‚Freiheit‘68, sah sich der ‚Club deutscher Frauen‘ 1946 noch dem „Frieden“69 verpflichtet. In den Programmen des DFR hatte die Vokabel ‚Freiheit‘, welche als zentrale Forderung des Liberalismus bald zur Kampfformel gegen den Kommunismus avancieren sollte, den Begriff ‚Frieden‘ längst verdrängt. Der DFR war damit einem allgemeinen Trend in der Publicity westdeutscher Organisationen gefolgt. Denn Zusammenschlüsse, die mit der Vokabel ‚Frieden‘ für ihre Ziele warben, standen ab 1947 unter Generalverdacht, eine kommunistische Zielsetzung zu verfolgen. Einige Organisationen, die das Wort nicht von ihrer Fahne strichen, wurden, aufgrund des – häufig unbegründeten – Verdachts, es handle sich um ‚kommunistische Tarnorganisationen‘, tatsächlich verboten.70 Bei der Gründung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ im Juni 1947 spielte, wie im Folgenden deutlich werden wird, Bähnischs antikommunistische Haltung und mit ihr der Wille zur Abgrenzung gegenüber dem DFD, beziehungsweise zu dessen offener Bekämpfung eine tragende Rolle. In ihrer Rede zum zehnjährigen Bestehen des DFR, der sich als zonenübergreifender Verband im Oktober 1949 konstituiert hatte, betonte Bähnisch ihr Engagement in der Frauenbewegung schließlich wie folgt: „Ich beobachtete starke Versuche kommunistischer Frauen, sich diese Tatsache [daß die Mehrheit der Wähler Frauen waren] zu nutze zu machen und die Frauen in überpar-
66 Notiz o. T., in: Neuer Hannoverscher Kurier, 07.06.1946, S. 6, Abschrift in: Kuhn: Nachkriegszeit, Bd. 2, S. 224. 67 Der genaue Begriff, den sie verwendete, lautete allerdings ‚Weltbild‘. Vgl.: O. V.: Aus der Frauenwelt. Der Deutsche Frauenring für den Frieden, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 20, S. 29. 68 O. V.: Aus der Frauenwelt. Der Deutsche Frauenring für den Frieden, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 20, S. 29. Statt, wie die Überschrift vermuten läßt, den Frieden, fordert der Frauenring in seiner Resolution im Sinne der „Freiheit des Individuums“ die Wiederaufrüstung Deutschlands im Rahmen eines europäischen Bündnisses zur Verteidigung gegen den Kommunismus. 69 Notiz o. T., in: Neuer Hannoverscher Kurier, 07.06.1946, S. 6, Abschrift in: Kuhn: Nachkriegszeit, Bd. 2, S. 224. 70 Vgl.: Stoehr, Irene: Friedensklärchens Feindinnen. Klara Marie Fassbinder und das antikommunistische Frauennetzwerk, in: Paulus/Sillies/Wolff (Hrsg.): Zeitgeschichte als Geschlechtergeschichte. Neue Perspektiven auf die Bundesrepublik, Frankfurt a. M. 2012, S. 69–91.
Staatspolitische Aufgabe
| 709
teilich getarnten, aber unter kommunistischer Führung stehenden Frauengruppen zusammenzuschließen. Diese Gefahr für die deutschen Frauen war umso größer, als sie ja seit 1933 durch Hitler von jeder Tätigkeit im öffentlichen Leben ausgeschlossen waren und deshalb politisch völlig ahnungslos und ungeschult den sehr geschickten kommunistischen Versuchen ausgesetzt waren. Ich sah [...] welch große Erfolge die Kommunisten bereits zu verbuchen hatten. [...] Es gab nur eine Möglichkeit, dieser Gefahr zu begegnen: die deutschen Frauen wieder in eigenen Verbänden zusammenzuschließen und staatsbürgerlich aufzuklären. Nur so ist zu verstehen, daß ich, die ich vor 1933 nie in einer Frauenorganisation war, zusammen mit ehemaligen Mitgliedern des Bundes Deutscher Frauenvereine die Gründung einer Frauenorganisation überlegte.“71 Mit der Aussage, sie sei nie Mitglied einer Frauenorganisation gewesen und ihr Engagement in einer Frauenorganisation sei nur aus dem Wunsch heraus, deutsche Frauen vor ‚kommunistischem Gedankengut‘ zu schützen, zu verstehen, negierte die beruflich erfolgreiche Juristin ihr Engagement für die beruflichen Interessen sowie für die Gleichberechtigung von Frauen in den 1920er und den beginnenden 1930er Jahren. Ihre Arbeit bei den Soroptimistinnen sowie ihre journalistische und juristische Arbeit für die Gleichberechtigung von Kassenärztinnen in der Weimarer Republik fiel in ihren Reden vor dem DFR-Vorstand 1952 und 1959, also an entscheidender Stelle, vermutlich auf Kosten einer von ihr als stringent betrachteten Erzählung und einer gefühlten politischen Notwendigkeit unter den Tisch. Damit enthielt sie das Engagement, das sie in der Weimarer Republik für professionelle Karrieren von Frauen gezeigt hatte, einer angemessenen Würdigung vor und unterschlug gleichzeitig dessen Bedeutung als Motiv für ihre frauenpolitische Arbeit nach 1945. Schließlich spielte sie insgesamt den feministischen Aspekt ihres Beitrags zur Frauenemanzipation nach 1945 herunter. Sie suggerierte in der Retrospektive – zumindest bis zu ihrer Rede anläßlich des zehnjährigen Bestehens des DFR 1959 und deren Veröffentlichung in der Zeitschrift ‚Mädchenbildung und Frauenschaffen‘ 1960 – eine eherne Konzentration ihrer frauenpolitischen Aktivitäten auf im Grunde nur ein einziges Ziel: den Kampf gegen den Kommunismus. Die Aussage in ihrer 1959er Rede, daß auch der Wunsch zur ‚Beratung‘ von Frauen eine Rolle für ihren Entschluß gespielt habe, einen Frauenverband zu gründen72, wirkt, allein schon durch die grammatische Anordnung, nachgeschoben und somit der Bekämpfung des Kommunismus untergeordnet. Das Thema ‚Frauenberufstätigkeit‘ spielte – obwohl Bähnisch es zwischenzeitlich immer wieder aufgriff – in ihrer Version der ‚Gründungsgeschichte‘ des DFR, die sie anläßlich dessen zehnjährigen Bestehens präsentierte, gar keine Rolle. Auch die ‚Gleichberechtigung‘ von Männern und Frauen nannte sie in ihrer Rede nicht als Gründungsziel der Organisation. Ist Bähnischs Agieren in der Frauenbewegung nach 1945 trotz ihres nachweisbaren Einsatzes für die Interessen von Frauen schon in der Weimarer Republik tatsächlich
71 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 162/163. Außerdem habe sie den Wunsch gehabt, die Frauen, welche sich in Briefen an sie als Regierungspräsidentin gewandt hatten, „wenigstens zu beraten“. Ebd. 72 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 162/163.
710 | Theanolte Bähnisch
als nur einem zentralen Ziel, der Bekämpfung des Kommunismus, untergeordnet zu begreifen? Bei näherer Betrachtung ergibt sich ein widersprüchliches Bild. Ihre Verlautbarungen über ihren eigenen Beruf, über den Stellenwert eines Berufs für die weibliche Persönlichkeit und die Zukunftschancen von Frauen im Allgemeinen sowie über die Verwendung von Frauen in der Verwaltung, auch über eine grundsätzliche rechtliche und gesellschaftliche Besserstellung von Frauen, die in verschiedenen Reden und Artikeln, aber auch in ihrem Handeln deutlich werden, lassen sich nicht als ‚Augenwischerei‘ abtun. Ihre eigene Biographie, ihre Korrespondenzen vor allem mit Ilse Langner, auch die in der Weimarer Republik erschienenen Artikel über die beruflichen Nachteile von Ärztinnen gegenüber ihren männlichen Kollegen sowie über die Eignung von Frauen für die Verwaltungslaufbahn, lassen ein echtes Interesse an diesen Themen erkennen. Der Umstand, daß sie über die Soroptimistinnen sowie durch ihre Arbeit als Verwaltungsjuristin, schließlich sogar als Regierungspräsidentin Frauen zu beruflichem Erfolg verhelfen wollte, lassen darauf schließen, daß es ihr dabei nicht nur darum ging, sich selbst zu verwirklichen, sondern daß sie einen Beitrag dazu leisten wollte, daß Frauen in der Gesellschaft insgesamt eine wichtigere Rolle spielen. Sie trat also ohne Zweifel auch nach 1945 für ‚feministische‘ Ziele ein – auch wenn sie ihr Handeln mit diesem oder ähnlichen Begriffen nicht belegt wissen wollte. Viele Selbstzeugnisse beziehungsweise ‚Ego-Dokumente‘73 (Schulze) Bähnischs legen nicht nur Zeugnis ab vom Stolz, den sie auf ihre Leistungen empfand und auf ihre Zielstrebigkeit, mit der sie gegen Widerstände, vor allem solche, die sich aufgrund ihres Geschlechts auftaten vorging. Diese Selbstzeugnisse tragen gleichzeitig den Charakter einer Orientierungshilfe für Leserinnen und Leser, indem sie den
73 Der niederländische Sozial-Historiker Jaques Presser bezeichnete mit dem von ihm geprägten Begriff ‚Ego-Dokumente‘ zunächst vor allem autobiographische Zeugnisse. Der deutsche Frühneuzeit-Historiker Winfried Schulze erweiterte den Begriff um solche Quellen, deren Entstehung nicht dem direkten Einfluß des Betreffenden, über den die Quelle Auskunft gibt, unterliegt. Dies gilt beispielsweise für Personalakten oder für Protokolle. Schulze will den Begriff Ego-Dokumente jedoch auch in Bezug auf jene Quellen, die Presser im Visier hatte, anders definiert wissen: „Gemeinsames Kriterium aller Texte, die als EgoDokumente bezeichnet werden können, sollte es sein, daß Aussagen oder Aussagepartikel vorliegen, die – wenn auch in rudimentärer und verdeckter Form – über die freiwillige oder erzwungene Selbstwahrnehmung eines Menschen in seiner Familie, seiner Gemeinde, seinem Land oder seiner sozialen Schicht Auskunft geben oder sein Verhältnis zu diesen Systemen und deren Veränderungen reflektieren. Sie sollten individuell-menschliches Verhalten rechtfertigen, Ängste offenbaren, Wissensbestände darlegen, Wertvorstellungen beleuchten.“ Schulze, Winfried: Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte? Vorüberlegungen für die Tagung „Ego-Dokumente“, in: ders.: (Hrsg.): EgoDokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte, Berlin 1996. Gerade am Beispiel Bähnischs wird deutlich, daß es sinnvoll wäre, die Definition dergestalt zu verändern, daß man von ‚Aussagen über das Selbst‘ oder von ‚Darstellungen des Selbst‘ anstelle von oder in Ergänzung zu ‚Wahrnehmungen des Selbst‘ spricht. Das ‚Außengeleitete‘, von dem Schulze spricht, ließe sich auf diesem Weg sinnvoller erklären und betonen. Zu den wichtigsten Selbstzeugnissen Bähnischs siehe Kapitel 1.10.
Staatspolitische Aufgabe
|
711
schwierigen aber erfolgreichen Lebensweg einer Kloster-Schülerin bis hin zur allseits geachteten und beliebten Behördenleiterin als ein gutes, nachahmenswertes Beispiel erzählen. Dem autobiographischen Diktat, das im Privatnachlaß ihrer Tochter überliefert ist, haften sogar Züge eines Bildungsromans an: Die Hauptfigur, Bähnisch, erkennt zunächst ihr Potential, entwickelt dieses, erlebt Phasen der Förderung und der Behinderung sowie Rückschläge und Schicksalsschläge, schließlich wächst sie jedoch mit ihren Aufgaben weiter, widersteht moralisch fragwürdigem Handeln und übernimmt immer wieder auch Verantwortung für andere. Die Aufzeichnungen tragen das von dem Germanisten Rolf Selbmann beschriebene „missionarische Überlegenheitsgefühl eines sich selbst bewußten Erzählers, der seinen Bildungsvorsprung gegenüber Held und Leser geltend“74 macht, nach außen. Der von Bähnisch 1959/1960 vorgebrachten Behauptung, ihr frauenpolitisches Wirken sei nur auf die Bekämpfung des Kommunismus ausgerichtet gewesen, steht also ein starker Anspruch gegenüber, den eigenen beruflichen Lebensweg zum guten Beispiel zu machen und andere Frauen ebenfalls zur Wahrnehmung solcher Möglichkeiten zu motivieren. In ihrem Diktat von 1972 gestand sie diesem Anspruch (wieder) mehr Raum in ihrer Biographie zu als in ihrer Rede von 1959.75 Von der Gründung des Frauenrings mit dem Ziel der Bekämpfung des Kommunismus ist im Diktat nicht die Rede – was jedoch nicht heißt, daß sie ein entsprechendes Kapitel nicht geplant hatte oder daß es nicht bereits existierte und nicht überliefert wurde. Auf die praktische frauenpolitische Arbeit des DFR, der ja auf ihre Initiative hin entstand und sich weiterentwickelte, wird an anderer Stelle zurückzukommen sein. Daß die Regierungspräsidentin in ihrer Rede von 1959 die Abwehr des Kommunismus zu ihrem Haupt-Beweggrund für ihr Engagement in der Frauenbewegung erklärte, hängt wohl vor allem damit zusammen, daß sie damit ein zu jener Zeit mit dem Kalten Krieg noch immer virulentes Thema ansprach. Dieses blieb bis zu ihrem Tod 1973 – obwohl dieser in eine Phase der Entspannung des Kalten Krieges in Deutschland unter Willy Brandt fiel – von zentraler Relevanz für die deutsche Bevölkerung. Daß sie ihr Eintreten gegen den Kommunismus in den Mittelpunkt ihrer Bestrebungen stellte, sicherte ihr die Aufmerksamkeit und den Beifall einer Gesellschaft, die sich zumindest in der Ablehnung des Kommunismus weitgehend einig war.76 Mit der Pensionierung Bähnischs in den 1960er Jahren veränderte sich dies, eingeleitet durch linke Studenten- und Bürgerrechtsbewegungen, langsam. Auf der Homepage des DFR spielt unter der Überschrift ‚Blick zurück‘, mit der die Organisations-Geschichte überschrieben ist, das Thema Antikommunismus überhaupt keine Rolle. Vielmehr wird auf den Artikel 3 des Grundgesetzes als Arbeitsbasis, auf der die Mitglieder des DFR nach und nach eine Angleichung der Rechte für Frauen durchgesetzt hätten, verwiesen.77 Eine ‚richtige‘ Organisations-Geschichte gibt es nicht. Beide Überlieferungen, die durch Bähnisch im Jahr 1959 verbreitete
74 75 76 77
Selbmann, Rolf: Der deutsche Bildungsroman, Stuttgart 1984, S. 40. Bähnisch: Wiederaufbau. Siehe Kapitel 5.4.3. Vgl.: o. V: Blick zurück, auf: http://www.deutscher-frauenring.de/der-verband/blickzurueck, am 13.12.2013.
712 | Theanolte Bähnisch
und die ‚moderne‘ des DFR, können für sich in Anspruch nehmen, die ‚Wahrheit‘ zu erzählen – sie tun es jedoch jeweils nur ausschnittweise. Wendet man den Blick der Organisations-Geschichte des DFR zu, so läßt sich – wie in Kapiteln VI, VII und VIII deutlich werden wird – konstatieren, daß sich der Verband seit seiner Gründung für die Rechte von Frauen einsetzte, Frauen aufklärte und beriet sowie zu Fragen, die die Stellung von Frauen in der Gesellschaft betreffen, Stellung nahm. Doch es beeinflußte die Arbeit des Verbands durchaus, daß seine Gründungs-Präsidentin sich im Jahr 1947 anschickte, ihn zum Großverband in den Westzonen aufzubauen, weil sie die ‚Westliche Welt‘ mit ihrer auf dem christlichen Glauben basierenden Kultur vor der Bedrohung durch den Kommunismus schützen wollte. Der Einsatz gegen den Kommunismus widersprach einer Arbeit für Frauenrechte zwar nicht, beeinflußte jedoch die Argumentations- und Politikstrategie des Frauenrings stark, zumal stets vermieden werden mußte, bei der Werbung für frauenpolitische Ziele rhetorisch ins Fahrwasser des DFD zu geraten. Im Frauenring ließen sich zwar beide Missionen – der Kampf gegen den Kommunismus und für die Frauenemanzipation – vereinbaren. Schließlich sollten sich die Frauen ja nicht nur im Verband vereint, sondern auch von ihm vertreten fühlen, weshalb er mit einem mindestens ebenso attraktiven Angebot wie sein Konkurrent, der DFD, aufwarten mußte. Aus der Verknüpfung beider Missionen in der Politik des Frauenrings entsprangen jedoch Kuriositäten wie das konsequente Beschweigen emanzipatorischer Fortschritte in der SBZ/DDR in der von Bähnisch herausgegebenen Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘. Das Ziel, den Kommunismus zu bekämpfen, stand dem Ziel, den Frauen zu demonstrieren, wie emanzipatorischer Fortschritt aussehen könnte, damit – bei allem Wissen um die Instrumentalisierung der Frauenemanzipation für die politischen Ziele der SED78 – auch manchmal im Weg. Daß der Frauenring an überparteilicher Frauenarbeit interessierten Frauen eine Alternative zum nur vermeintlich überparteilich agierenden DFD bieten und sie an ‚westliche‘ Werte binden sollte, schmälert jedoch nicht die Leistung, welche seine Mitglieder für die Durchsetzung der Gleichberechtigung erbrachten. Zumal, wie Theanolte Bähnisch festhält, die Vorgeschichte des DFR „bei vielen Frauen […] die im Laufe der Jahre unsere Mitglieder geworden sind“79 überhaupt nur wenig bekannt war. Daß der DFR seit dem Beginn des Zeitalters der ‚Post-Bipolarität‘, den Antikommunismus kaum mehr werbewirksam ins Feld führen kann und er deshalb ausschließlich an andere Traditionen der Organisation anknüpft, liegt ebenfalls auf der Hand. Will man die Gründungsgeschichte des Frauenrings verstehen, ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, daß seine Gründungspräsidentin tatsächlich nicht nur eine frauenpolitische, sondern vor allem auch eine ‚staatspolitische‘ Aufgabe vor Augen hatte, als sie den ‚Frauenring der Britischen Zone‘ 1947 begründete. Dies bedeutet jedoch weder, daß die ‚frauenpolitische‘ Komponente ihres Handelns nicht spürbar gewesen wäre, noch, daß jene Komponente in der Gründungsgeschichte des DFR, die mit der Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘ 1946 begann sowie in der 1949 beginnenden
78 Vgl.: Merkel: Werkbank. 79 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 162.
Staatspolitische Aufgabe
|
713
Konsolidierungsphase, die sich zunächst bis 1952 zog, immer dominant gewesen wäre. Frauen wie Agnes von Zahn-Harnack und Marie-Elisabeth Lüders konnten auf eine längere und intensivere Auseinandersetzung mit der Frauenbewegung zurückblicken als Theanolte Bähnisch. Ihnen und ihrer Rhetorik war deshalb eine entsprechend höhere Identifikation mit deren historisch gewachsenen Zielen und Traditionen der Bewegung eigen. Dennoch entwickelte sich schließlich auch bei diesen Frauen der Kalte Krieg zu einer zentralen Motivationsgrundlage, den Aufbau einer großen Frauenorganisation voranzutreiben.80 Denn Theanolte Bähnisch war erfolgreich darin, den Frauen zu vermitteln, daß all das, worauf sich ihr Selbstverständnis gründete, durch den Kommunismus gefährdet sei. Der Kalte Krieg war eine der treibenden Kräfte dafür, daß jene ‚alte Garde‘ eine Organisation als Nachfolger des BDF akzeptierte, die dessen Erbe, wie im Folgenden deutlich werden wird, nur eingeschränkt weiter zu tragen vermochte. Daß der ‚Frauenring‘ dem Kommunismus den Kampf ansagte, trug zwar dazu bei, daß inhaltliche Traditionen des BDF wie die Argumentation über die Differenztheorie fortgeführt wurden. Gleichzeitig legte die ständige Notwendigkeit, gegen jene Form der Frauenemanzipation, wie sie sich in der SBZ/DDR entwickelte, anzugehen, dem Frauenring aber auch Fesseln an, nicht nur, was seine Argumentations- und Agitationsmethoden anging,81 sondern auch in Bezug auf die angestrebte Integration anderer Organisationen in den DFR. In der Überzeugung ihrer führenden Mitglieder mußte die Organisation wachsam sein, daß nur politisch ‚verläßliche‘ Zusammenschlüsse aufgenommen wurden.82 Die gefühlte Bedrohung durch den Kommunismus ließ die ‚Grandes Dames‘ der bürgerlichen Frauenbewegung und jüngere Expertinnen wie Theanolte Bähnisch, Christine Teusch und Gabriele Strecker an einem Strang ziehen. Eine aussichtsreichere Alternative, an ihre Traditionen anzuknüpfen, hatte für Marie Elisabeth-Lüders, Agnes von ZahnHarnack und andere ehemalige Vorstands-Mitglieder des BDF schon allein deshalb nicht bestanden, weil die CCG (BE) in Bähnisch ihre Hoffnung für die politische Frauenbildung und gegen den Kommunismus erkannt hatte. Die frühe Entscheidung, Bähnisch den Rücken zu stärken, bestätigte die Militärregierung um so mehr, desto stärker die gefühlte Bedrohung aus dem ‚Osten‘ wuchs. Daß sie sich offensiv gegen den Kommunismus stellte, öffnete Bähnisch wiederum die Tür zum Wiederanschluß der deutschen Frauen an die internationale Frauenbewegung. Und diesen wollten auch die betagten Funktionärinnen um jeden Preis. Daß die Regierungspräsidentin wiederum auf die Mitarbeit und das Wohlwollen der ehemaligen BDF-Vorsitzenden und Vorstandsmitglieder angewiesen war, um ihre frauen- und damit auch außenpolitischen Ziele zu verwirklichen, wird in späteren Kapiteln deutlich werden. Die aktive Arbeit Bähnischs, des Frauenrings und damit der ‚bürgerlichen‘ Frauenbewegung in den West-Zonen/der BRD gegen den DFD, mit der schließlich auch
80 Vgl. dazu insbesondere die bereits genannten Arbeiten Irene Stoehrs. 81 Der auf dem Gebiet der Geschichte der Frauenbewegung ausgewiesenen Stoehr zufolge setzte der Antikommunismus in der westdeutschen bürgerlichen Frauenbewegung allerdings auch modernisierende Effekte frei. Siehe Kapitel 7.7.2.3. 82 DFR-Archiv, Freiburg, A2, Nora Melle an Bähnisch, 10.10.1948.
714 | Theanolte Bähnisch
das ‚Loslassen‘ der Frauen in der SBZ/DDR verbunden war, verlief stufenweise. Sie hatte – legt man Bähnischs Ausführungen zum Thema zugrunde – im Januar 1947 mit ihrer Intervention in Aachen begonnen. Die folgenden Kapitel werden zeigen, wie sie durch ihre bald offensiv nach außen getragene, im Zuge der Zuspitzung des Kalten Krieges immer stärker werdende Konzentration auf die Bekämpfung des Kommunismus in der britischen Militärregierung mehr und mehr an Boden gewann. Dies geschah obwohl, oder manchmal auch, gerade weil ihr Handeln nicht immer jenen Regeln entsprach, die die Militärregierung 1946 in ihren Rundschreiben an die deutschen Behörden für die politische Frauenbildung in Frauenorganisationen festgelegt hatte. 7.1.5 „Im Osten geht es um eine Vergottung des Kollektivismus“ – (Nicht nur) Bähnischs inhaltliche Abgrenzung zum DFD und zum Kommunismus Führt man sich die Entschiedenheit vor Augen, mit der Bähnisch sich in den folgenden Jahren immer wieder aktiv gegen die Einflußnahme von Kommunistinnen auf die Frauen und die Frauenbewegung in den Westzonen stellte, so drängt sich die Frage auf, wie sie ihre scharfe Gegnerschaft gegen die kommunistische Lehre begründete. Dazu ist zunächst festzuhalten, daß die Regierungspräsidentin mit ihrem Bedürfnis, sich den Kommunistinnen entgegenzustellen, einem als „antitotalitären Grundkonsens“83 bekannt gewordenen sehr breiten, partei- und konfessionsübergreifenden Einverständnis in der Bonner Republik folgte und gleichzeitig selbst zur Etablierung, Vertiefung und Persistenz dieses Konsenses beitrug. Viele der verschiedenen Argumentationsstrategien und Diskursstränge gegen den Kommunismus, die sich in der frühen BRD beobachten lassen84, finden sich in der von Bähnisch herausgegebenen ‚Stimme der Frau‘, wieder, ein Umstand, der im Rahmen der Analyse der ‚Stimme
83 Geppert, Dominik: Die Ära Adenauer, Darmstadt 2002, S. 91. Sehr schön läßt sich die Wahrnehmung des ‚Kampfs der Ideologien‘ in einem Artikel, den eine Sozialdemokratin in der ‚Stimme der Frau‘ veröffentlichte, nachvollziehen: Haag, Anna: Zwischen Krieg und Frieden, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 10. „Der Individualismus und der Bolschewismus“ stünden sich, so Haag, nachdem sie einen dritten „Ismus“, den Faschismus besiegt hätten, „in gefahrvollem Mißtrauen, Gewehr bei Fuß, gegenüber.“ 84 Der Zeithistoriker Klaus Körner unterscheidet zwischen ‚Bürgerlichem Antibolschewismus‘ und ‚Sozialdemokratischem Antikommunismus‘ während die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan eine Unterscheidung zwischen ‚Antikommunismus der Sozialdemokratischen Linken‘, ‚Liberalem Antikommunismus‘, ‚Antikommunismus im weiteren Spektrum des Bürgertums‘ und ‚Nationalsozialistischem Antikommunismus‘ vornimmt. Vgl.: Körner: Gefahr, S. 21–120 sowie Schwan, Gesine: Antikommunismus und Antiamerikanismus in Deutschland. Kontinuität und Wandel nach 1945, Baden-Baden 1999, S. 35–41. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich alle von den beiden Autoren beschriebenen Diskursstränge in der Zeitschrift wiederfinden, jene Form, die Körner als ‚bürgerlichen Antibolschewismus‘ beschreibt, überwiegt.
Staatspolitische Aufgabe
|
715
der Frau‘ ausführlich beschrieben wird.85 An dieser Stelle sollen die Grundüberzeugungen und die Argumentationsmuster, denen Bähnisch und andere Protagonistinnen der bürgerlich-liberalen Frauenbewegung in ihrem Kampf gegen den Kommunismus folgten, lediglich angerissen werden. Pionierhaft hat Irene Stoehr86 über den Zusammenhang von Feminismus und (Anti-)Kommunismus gearbeitet, vor allem aber auch der Artikel Gunilla-Friederike Buddes über Bilder von ‚schicken Stenotypistinnen‘ und ‚tüchtigen Traktoristinnen‘87, welche sich auch in der von Bähnisch herausgegebenen Zeitschrift wiederfinden, vermag einen Eindruck der Gräben zu vermitteln, die sich zwischen der bürgerlichen Frauenbewegung und dem DFD auftaten. Das Handeln der in der bürgerlichen Frauenbewegung organisierten Frauen, welche verschiedenen, mehrheitlich jedoch konservativen und liberalen Parteien angehörten, war von einem grundlegend anderen Werte- und Gesellschaftsverständnis getragen, als das jener Frauen, welche sich mit den Zielen der Kommunistischen Partei identifizierten und auf die Etablierung eines kommunistischen Staats hinarbeiteten. Beide Gruppen agierten jeweils vor dem Hintergrund der Sorge, daß die Nachkriegs-Frauenbewegung und mit ihr die gesellschaftliche und politische Entwicklung des Landes inklusive der Aktionsspielräume für Frauen sich in eine jeweils als falsch bewertete Richtung entwickeln könnte, gegeneinander. Kommunistisch orientierte Frauen befürchteten die Durchsetzung einer ‚reaktionären‘ Frauenbewegung, welche mit den ‚alten Eliten‘ kooperieren, die Re-Etablierung überholt gehoffter Besitz- und Einkommensverhältnisse unterstützen und die ‚Emanzipation‘ von Frauen nicht genügend vorantreiben würde. Jene Befürchtung resultierte nicht nur aus der politischen Grundüberzeugung der Frauen, sondern auch aus der Erfahrung, daß die bürgerliche Frauenbewegung bis 1933 staatstreu war, daß kommunistisch orientierte Frauen im Nationalsozialismus verfolgt und entrechtet worden waren und daß Kooperationen einiger – wenn auch weniger – Protagonistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung wie Gertrud Bäumer mit den NS-Eliten stattgefunden hatten. Frauen, die an die Traditionen der bürgerlichen Frauenbewegung anknüpfen wollten, befürchteten, daß die von den Kommunistinnen als ‚fortschrittlich‘ bezeichnete Ausrichtung der Frauenbewegung zu einer uniformen, der Logik eines kommunistischen Staates unterworfenen Frauenpolitik führen würde, welche eine Entfaltung von Frauen im Sinne liberal-demokratischer Ideen verhindern würde – beispielsweise, was die freie Wahl der Ausbildung und des Berufs sowie die (Charakter-)Bildung auf der Grundlage humanistischer Bildungstraditionen anging. In jenen Kreisen war die Befürchtung verbreitet, daß Frauen durch eine Veränderung der Arbeitswelt und durch Pflichtdienste in ihrer ‚Weiblichkeit‘ eingeschränkt würden, daß sich säkulare Tendenzen in der Gesellschaft, denen im Bürgertum Mitschuld am Nationalsozialismus gegeben wurde, sich weiter verstärken würden, daß eine Aufhetzung der ‚Arbei-
85 Vgl.: Freund: Krieg. 86 Vgl.: Stoehr: Antikommunismus und dies.: Wiederbewaffnung. Stoehrs Studien richten den Fokus jedoch stark auf Berlin, weshalb Bähnisch nicht vorrangig behandelt wird. Vgl. dazu insbesondere: Dies.: Friedenspolitik. 87 Budde: Traktoristinnen.
716 | Theanolte Bähnisch
terschaft‘ gegen die ‚Bürgerlichen‘ provoziert werden würde und daß infolgedessen eine ‚Spaltung der Gesellschaft‘ zu befürchten sei. Diese Sorge resultierte wiederum aus der Wahrnehmung, der Kampf der Kommunisten gegen die Kooperation der ‚Bürgerlichen‘ mit den konservativen Eliten des Kaiserreichs sei ebenso radikal, wenn nicht gar gefährlicher gewesen, als die Bedrohung von ‚rechts‘. Viele liberal eingestellte, beruflich erfolgreiche Frauen hatten die Erfahrung von Beschränkungen und Verfolgungen durch Nationalsozialisten machen müssen und befürchteten ähnliches unter einer kommunistischen Führung. Die Kommunisten wurden von Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung – aber auch von Sozialdemokraten wie Kurt Schumacher, der schließlich von ‚rotlackierten Nazis‘ sprach als den Nationalsozialisten ähnlich wahrgenommen. Beide Ideologien standen für Theanolte Bähnisch und ihre Mitstreiterinnen für ein Set an radikalen, propagandistisch zu mißbrauchenden Ideen, welche notwendigerweise zu ‚Vermassung‘, ‚Entindividualisierung‘ und ‚Verrohung‘ führen müßten.88 In der ‚Stimme der Frau‘ beispielsweise wurde ein Statement des DFR, mit dem dieser die Notwendigkeit der Wiederbewaffnung Westdeutschlands zum Zweck der Abwehr des Kommunismus begründet, wie folgt veröffentlicht: „Während die Verwirklichung des östlichen Weltbildes, wie sie sich heute vollzieht, zum Untergang des Einzelnen in der Masse und damit zur Aufhebung der persönlichen Verantwortung führt, vertreten wir den Gedanken der Freiheit des Einzelnen, Verpflichtung gegenüber der sozialen Not und der Verantwortung des Individuums vor Gott.“89 Von den Linksextremen ging in der Wahrnehmung Bähnischs und ihrer Mitstreiterinnen also eine ähnliche Gefahr wie von den Rechtsextremen aus, nicht nur in Bezug auf die Selbstentfaltung von Frauen in Staat und Gesellschaft, sondern auch für die in der bürgerlichen Frauenbewegung durchaus geschätzte traditionelle Ausrichtung von Frauen auf die Kernfamilie. In den beschriebenen Ängsten spiegelte sich allerdings nicht nur die Abneigung gegen totalitäre Systeme, sondern auch eine allgemeine Kulturkritik der ‚Moderne‘ wieder90, welche sich flexibel auf verschiedene, als Gegner der ‚bürgerlichen‘ Kultur wahrgenommene Phänomene übertragen ließ. Ausdruck jener Übertragbarkeit ist auch der in der ‚Stimme der Frau‘ virulente Antiamerikanismus, der zwar in keinem Verhältnis zum durch die Zeitschrift verbrei-
88 Vgl.: Freund: Krieg, S. 187–199. Vgl. insbesondere: O. V.: Aus der Frauenwelt. Der Deutsche Frauenring für den Frieden, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 20, S. 29. 89 Ebd. 90 Vgl. dazu die Magisterarbeit Freund: Krieg, die Bähnischs Äußerungen sowie den Diskurs in der ‚Stimme der Frau‘ in der Genese der Vermassungs- und Technisierungsdebatte der 1930er Jahre verortet. Letztere basierte wiederum auf der Theorie der Massenpsychologie Gustave Le Bons. Vgl. ergänzend zu den in der Magisterarbeit genannten Titeln auch: Huizinga, Johan: Im Schatten von Morgen, Eine Diagnose des kulturellen Lebens unserer Zeit, Bern 1936. Huizingas Kritik ist insofern besonders interessant, weil sie nicht nur die faschistischen, sondern auch die demokratisch-kapitalistischen Länder in die Kulturkritik mit einschließt.
Staatspolitische Aufgabe
|
717
teten Antikommunismus steht, jedoch zumindest teilweise ähnlich begründet wird.91 Daß auch dies kein Unikum, sondern kultureller Antiamerikanismus in der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft verbreitet war, während die militärische und wirtschaftliche Überlegenheit der USA weitgehend anerkannt und die Rolle der USA als Wiederaufbauhelfer und Schutzmacht geschätzt wurde, konstatiert Axel Schildt: „Die politisch-wirtschaftliche – und bald auch militärische – Integration in den Westen unter Führung der USA [...] wurde angesichts der Gefahr im Osten als notwendig anerkannt, während die kulturell betonte Äquidistanz des europäischen Abendlandes [...] gegenüber dem gleichermaßen ‚seelenlosen Materialismus‘ von ‚Moskau‘ und ‚Detroit‘ von manchen noch lange beibehalten werden durfte.“92 Auch in der ‚Stimme der Frau‘ findet sich diese gespaltene Wahrnehmung der USA bestätigt, und über die Frauenbewegung in den USA liest man zumindest teilweise Positives. Doch allgemein wurden die USA, anders als Großbritannien und andere westeuropäische Länder, nicht zur Orientierung empfohlen. „Auslassungen zum ‚amerikanischen Charakter‘ reproduzierten im Grunde immer das gleiche Bild des optimistisch-heiteren und etwas oberflächlichen, technisch versierten und kulturell unterbelichteten Freundes, eines sympathischen Gesellen, dessen Denkungsart man aber in Europa nicht übernehmen sollte“93, beschreibt Schildt treffend das Phänomen, wie es sich auch in der Zeitschrift darstellt. Gibt sich ‚Stimme der Frau‘ – um nur ein Beispiel zu nennen – technischen Neuerungen im Haushalt gegenüber allgemein sehr aufgeschlossen, so stellt sie die ‚Amerikanisierung der Küche‘ in einem Artikel als nicht wünschenswert dar: „Sechs westdeutsche Hausfrauenvereinigungen sprachen sich gegen die Amerikanisierung der deutschen Küche aus. Sie begründeten ihre Ablehnung vor allem damit, daß ‚Konservenmahlzeiten am laufenden Band‘ nur um der Bequemlichkeit willen nicht befürwortet werden könnten.“94 Einige praktische Auswirkungen der ideologischen Gegensätze zwischen den führenden Mitgliedern der bürgerlichen Frauenbewegung und jenen im DFD lassen sich in der Überlieferung von Berichten und Korrespondenzen aus der Frühphase des DFD im Bundesarchiv Berlin95 nachvollziehen: Die Bürgerliche Frauenbewegung betonte zwar die Gleichwertigkeit der Geschlechter, beharrte jedoch auf der Überzeugung, daß die Männer und Frauen nun einmal verschieden seien, und legte deshalb auch Wert auf eine entsprechende Sozialisation. Die im DFD organisierten
91 Womöglich hatte sich Bähnisch auch bei Huizinga bedient (ebd.), denn sie kritisierte mit ganz ähnlichen Schlüsselbegriffen wie er sowohl den Kommunismus, als auch die USA. Vgl.: Freund: Krieg, S. 200–212. 92 Schildt, Axel: Der Europa-Gedanke in der westdeutschen Ideenlandschaft des ersten Nachkriegsjahrzehnts, in: Grunewald, Michael/Bock, Hans-Manfred (Hrsg.): Le discours européen dans les revues allemandes/Der Europadiskurs in den deutschen Zeitschriften (1945– 1955) Bern u. a. 2001, S. 15–30, hier S. 23. 93 Schildt: Zeiten, S. 414. Zum Antiamerikanismus und den verschiedenen Formen vgl. auch: Schwan: Antikommunismus. 94 O. V.: Aus der Frauenwelt. Gegen die Amerikanisierung der deutschen Küche, in: Stimme der Frau, 3. Jg. (1951), Heft 18, S. 21. 95 Relevant sind die Bestände DY 30 sowie DY 31.
718 | Theanolte Bähnisch
Frauen dagegen wollten von ‚Mädchenschulen‘ und ‚Hausfrauenvereinigungen‘ nichts wissen, sondern den Frauen – im Einklag mit der Partei – den Weg in die ‚Männerberufe‘ weisen.96 Sowohl die Organisationen der bürgerlichen Frauenbewegung in Westdeutschland als auch der DFD zeigten jeweils ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Anerkennung aus dem Ausland. Strebte die organisierte Frauenbewegung in der SBZ/DDR eine enge Zusammenarbeit vor allem mit der Frauenbewegung in der Sowjetunion und den kommunistischen Blockstaaten an, so wollte die bürgerliche Frauenbewegung nach dem Ende des Dritten Reiches an ihre 1933 gekappte Tradition des internationalen Austauschs mit Ländern im ‚Westen‘ anknüpfen. Veranstaltungen der jeweiligen Zusammenschlüsse waren in den folgenden Jahren nicht nur darauf ausgerichtet, das Interesse möglichst vieler deutscher Frauen zu wecken und diese in ihrer politischen Entscheidung zu beeinflussen, sondern auch darauf, Besuch ausländischer Gäste der jeweiligen Referenzgesellschaften97 zu erwirken und darüber den (Wieder-)Anschluß deutscher Frauen an die internationale Frauenbewegung zu erreichen. Theanolte Bähnisch brachte die in liberalen Kreisen verbreitete Befürchtung, die Persönlichkeit des einzelnen Menschen würde in einer Welle der ‚Vermassung‘ untergehen, was zwangsläufig zur ‚Entpersönlichung‘ führe98, in ihrer Rede von 1950 auf einen besonderen, weiblichen Nenner, der für sie bereits früher handlungsleitend gewesen sein dürfte. Ähnliche Argumente finden sich nämlich auch ab 1948 in der ‚Stimme der Frau‘. Dort sind es lediglich verschiedene kleinere Hinweise, wie eine abwertende Bemerkung über den ‚verrohenden‘ Dienst von Frauen bei der Volkspolizei in der DDR, dem in anderen Artikeln als adäquat für Frauen angesehene und entsprechend positiv konnotierte Berufsbilder entgegengesetzt werden. Die Argumentationslinie folgt dem bereits erwähnten, von Ina Merkel beobachteten diskursiven Muster der Gegenüberstellung von ‚tüchtigen Traktoristinnen‘ und ‚schicken Stenotypistinnen‘.99 Deutlicher formuliert die Regierungspräsidentin ihre Überzeugung, daß eine Hinwendung zum Kommunismus nicht nur schädlich für die westdeutsche Gesellschaft, sondern besonders fatal für die Frauen sei, in einer Rede, die sie 1950 in Köln hielt. Sie wolle „betonen, daß die Frau als Individuum ein Recht hat auf Entfaltung ihrer Fähigkeiten und deren Betätigung“100, offenbarte sich Bähnisch als Vertreterin einer in erster Linie liberalen Idee. Sich in ihrem Wunschberuf zu verwirklichen sah die Regierungspräsidentin erklärtermaßen als einen wichtigen Teil der freien Persönlichkeitsentfaltung von Frauen an. Sie ermunterte ihre Zuhörerinnen deshalb dazu, sich entsprechend gegenüber männlichen Bewerbern zu positio-
96 Vgl. zu den entsprechenden Frauenleitbildern: Merkel: Werkbank. 97 Zur Orientierung Westdeutschlands an ‚westlichen‘ Referenzgesellschaften und den Akteuren, die eine solche Orientierung beförderten, vgl.: Doering-Manteuffel: Amerikanisierung, 1999 sowie Jarausch/Siegrist: Amerikanisierung. 98 Eine Friedensfront der Frauen, in: Neuer Hannoverscher Kurier, 21.06.1946, abgedruckt in: Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 150. 99 Vgl. beispielsweise: O. V.: Interessant!, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 3, S. 2. Vgl. auch den angesprochenen Aufsatz: Merkel: Traktoristinnen. 100 Bähnisch: Himmel, S. 4/5.
Staatspolitische Aufgabe
|
719
nieren und die Sorge, durch den Kontakt mit der Frauenbewegung „ihre Heiratsaussichten zu vermindern“, ad acta zu legen. Die Juristin, die mit einem Juristen verheiratet gewesen war, argumentierte, daß „ein Mann mit derartigem Denken niemals der richtige Lebensgefährte für sie sein kann, weil er einen wichtigen Teil ihrer Persönlichkeit negiert.“ Die im Kreise der Soroptimistinnen sozialisierte Regierungspräsidentin gab sich damit zwar nicht erstmalig,101 aber doch ungewohnt kämpferisch, vielleicht, weil es um eine ‚größere Sache‘ ging: Im Anschluß an ihre Ausführungen über die Wahl des richtigen oder falschen Partners warnte sie die Frauen nämlich davor, mit dem falschen System zu kokettieren: „Wir Frauen“, sprach sie stellvertretend für das gefühlte Kollektiv, das sie noch stärker zu vereinen trachtete, „verstehen […] unter der Gleichberechtigung der Geschlechter […] keine schematische Gleichmacherei. […] wir legen den allergrößten Wert darauf, daß die Frau sich spezifisch weiblich entwickelt und eine ganz andersartige Persönlichkeit wird als der Mann.“ Frauen und Männer seien „zwei verschiedene Formen des Menschseins“, die Frauenbewegung müsse entsprechend agieren. „[N]iemals werden wir für Forderungen eintreten, die das Wesen der Frau verzerren, statt sie zu vollem Menschtum zu entwickeln. Die Freiheit der Persönlichkeit, der einmalige Wert des Individuums und der Einzelseele sind unabdingbare Voraussetzungen unserer Frauenbewegung“, beschrieb Bähnisch das pluralistische Selbstverständnis der bürgerlichen Frauenbewegung, um den Unterschied zum DFD zu betonen. „Hier besteht ein klarer und scharfer Gegensatz zum Demokratischen Frauenbund der Ostzone, der sich einem Kollektiv einordnet und sich zum politischen Instrument einer totalitären Staatsidee machen läßt.“102 Der Ost-West-Konflikt habe „seine letzte Wurzel im Religiösen“, spricht aus Bähnisch die von der Mutter zwar katholisch erzogene, aber spätestens in Berlin von der protestantischen Idee der Individualverantwortung geprägte Christin. Damit schloß sie sich – wie im Folgenden noch deutlicher werden wird – einer Argumentation an, welche vor allem die CDU unter dem Motto „Christ oder Kommunist“ verbreitete.103 Im Osten gehe es, so Bähnisch, die in ihrer Rede auf den britischen Historiker und Kulturtheoretiker Arnold Toynbee104 rekurrierte, „um eine Vergottung des Kollektivismus, um den Glauben an den Massenmenschen.“ Wie Toynbee sah auch
101 In Artikeln in der ‚Stimme der Frau‘ fallen die Forderungen – vielleicht auch weil verschiedene Autorinnen zum Thema schreiben – gemäßigter aus. Vgl.: Freund: Krieg, S. 213–233. 102 Bähnisch: Himmel. 103 Stark: Majority, S. 264/265. Stark, der als NATO-Befehlshaber in Kandahar/Afghanistan stationiert war und einen Teil seiner Ausbildung bei der Bundeswehr absolvierte, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seiner Dissertation Mitarbeiter der US-MilitärAkademie in West Point und sah seine Promotion als praktisch verwendbaren Erfahrungsbericht für Befehlshaber militärischer Operationen an. Vgl.: ebd., S. iii. Stark hat eine Professur für Militärwissenschaften an der Universität Princeton inne. 104 Zur Zeit ihrer Rede war bereits der erste Band von Toynbees Hauptwerk in deutscher Sprache erschienen. Vgl.: Toynbee, Arnold: Der Gang der Weltgeschichte, Bd. 1, Zürich 1949. Bähnisch bezieht sich in ihrem Vortrag auf eine Rede Toynbees.
720 | Theanolte Bähnisch
Bähnisch einen Grundwiderspruch zwischen dem Kommunismus und der christlichen Kultur: „Die tiefste Quelle […] der Religion des Christentums und der religiösen Auffassung des Westens überhaupt ist der Glaube an die Freiheit des Christenmenschen und die persönliche Verantwortung vor Gott.“ Da Frauen ihrer Meinung nach sowohl zur Erde als auch zum Himmel eine stärkere Verbindung hätten als Männer, leitete Bähnisch aus den allgemeinen Ausführungen Toynbees ihre eigenen Schlüsse über die besondere Verantwortung von Frauen, sich dem Kommunismus entgegenzustellen, ab. Sie müßten „ihrem innersten Wesen nach der natürlichste und schärfste Gegner jeder Art von Vermassung sein […] Denn Vermassung löst den einzelnen aus der Ordnung Gottes und kennt keine Skala der Werte.“ Die besondere Verbindung der Frauen zur ‚Erde‘ begründete Bähnisch mit dem „Muttersein“, das Körper und Geist „tiefer mit den natürlichen Kräften dieser Erde“ verbinde, sowie mit der „praktischen Erfahrung in allen Dingen des täglichen Lebens“105, die Frauen gesammelt hätten. Mit dieser Argumentation lehnte sich Bähnisch an Johann Jakob Bachofen an, womit sie gleichzeitig, bewußt oder unbewußt, im Kontext der Zeit betrachtet ihre Ausführungen in die Nähe der nationalsozialistischen Propaganda rückte. Denn diese rezipierte Bachofen ebenfalls – im Rahmen ihrer Blut- und BodenIdeologie.106 Eine besondere Verbindung der Frauen zum „Geist“ fand Bähnisch darin bestätigt, daß Frauen „durch Geburt und Tod unmittelbarer und tiefer berührt“ würden als Männer. „Wir bleiben wundergläubig; denn wir erleben das Wunder der Mutterschaft. Wir erleben aber auch die Ohnmacht des Geschöpfes und seine Abhängigkeit vom Schöpfer“, argumentierte sie und hoffte, damit auch jene Frauen überzeugen und mit ins ‚antikommunistische Boot‘ nehmen zu können, die nicht gläubig waren. Sie könne sich, fährt die Regierungspräsidentin fort, gar „nicht vorstellen, daß eine Frau nicht an Gott glaubt, auch wenn sie es behaupten sollte“107. Diese Argumentation folgt dem gleichen Schema wie der Bericht, den sie 1959 von der Zusammenkunft von Kommunistinnen lieferte, die 1946 in Aachen stattgefunden haben soll. Ausgerechnet die Frau eines Pfarrers soll sie vor den kommunistischen Umtrieben in Aachen gewarnt haben. Bähnisch bemühte die Verbindung zwischen dem christlichen Glauben und der Bekämpfung des Kommunismus (durch gläubige Frauen) also nicht nur einmal, sondern sie schien von der Hoffnung getrieben gewesen zu sein, daß deutsche Frauen den Kampf gegen den Kommunismus als eine ‚gottgewollte Aufgabe‘, vielleicht sogar als eine von Gott gegebene Bewährungspro-
105 Bähnisch: Himmel. 106 Vgl.: Bachofen, Johann Jakob: Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, Stuttgart 1861. Bachofens Werk fand in verschiedenen politischen Lagern Anerkennung. Vgl.: Laffont, Heléne: Zur Rezeption Bachofens im Nationalsozialismus, in: Heinz, Marion/Gretic, Goran (Hrsg.) Philosophie und Zeitgeist im Nationalsozialismus, Würzburg 2006, S. 143–162. Aufgrund von Bachofens Bezugnahmen auf die griechisch-römische Mythologie ist es denkbar, daß Bähnisch mit seinen Ideen eventuell über die ihr befreundete Schriftstellerin Ilse Langner, die entsprechenden Stoff bearbeitete, in Kontakt gekommen war. 107 Bähnisch: Himmel.
Staatspolitische Aufgabe
|
721
be verstehen würden, die sie nach dem Ende des Nationalsozialismus zu bestehen hätten. Daß sich Frauen „im Osten“ zum „Werkzeug einer Propaganda“ machen ließen, „die in ihrem Endeffekt zur völligen Zerstörung des eigentlichen Frauenwesens führen muß“, bezeichnete Theanolte Bähnisch als „tief bedauerlich“108. Den Kommunismus, so läßt sich aus ihren Ausführungen ableiten, wollte sie also nicht nur als ‚unweiblich‘, sondern sogar als Gefahr für die Existenz der ‚Weiblichkeit‘ an sich verstanden wissen. Ein solches Szenario dürfte auch die männlichen Zuhörer ihrer Rede aus der Reserve gelockt haben. Verknüpft man diese Ausführungen Bähnischs mit solchen aus anderen Verlautbarungen von ihrer Seite, so wird deutlich, daß nach Bähnischs Logik mit der ‚Weiblichkeit‘ nicht nur das ‚Wesen‘ der Frauen, sondern auch die Geschlechterordnung und damit wiederum Gesellschaft und Staat vom Kommunismus unmittelbar bedroht sein mußten. Denn sowohl für eine gesunde gesellschaftliche Ordnung als auch für ein funktionierendes Staatswesen war für Bähnisch das Zusammenspiel männlicher und weiblicher Komponenten Voraussetzung.109 „Wir sind uns bewußt, daß wir unser Leben und unsere Taten dereinst vor dem Herrn der Geschichte verantworten müssen“, erhob Bähnisch die Sympathie mit dem Kommunismus schließlich sogar zur Sünde. Ob bereits die Untätigkeit gegenüber der ‚kommunistischen Bedrohung‘ ein solches Vergehen darstellte, überließ sie allerdings der Interpretation ihrer Zuhörer. „Mit dieser Grundhaltung bekennen wir uns zugleich zu dem Gedankengut der westlichen Welt“, beendete Bähnisch ihre Rede und schloß damit – wie auch im weiter oben zitierten Artikel aus der ‚Stimme der Frau‘ – den Kreis zwischen dem Christentum und dem ‚Westen‘, nicht ohne noch einmal zu betonen, daß der „Konflikt West-Ost“ ein grundsätzlicher sei, und „nur der oberflächliche Betrachter der Auffassung sein könne, als ob es sich hier um soziale und wirtschaftliche Probleme handle“110. Ob Bähnisch viele ihre Partei-Genossen zu solchen ‚oberflächlichen Betrachtern‘ zählte, bleibt offen. Daß die DDR kein demokratischer Staat war, machte sie – anders als die meisten Sozialdemokraten, die vor allem die Zwangsvereinigung der SPD mit der KPD zur SED anprangerten111 – nur indirekt zum Gegenstand ihrer Kritik. Auffällig ist, daß die Regierungspräsidentin in ihrer Rede aus dem Jahr 1950 – anders als bei anderen Gelegenheiten112 – den Kommunismus nicht mit dem Nationalsozialismus gleichsetzte. Dies mag darin begründet liegen, daß der Kommunismus
108 109 110 111 112
Ebd. Vgl.: Freund: Hut. Ebd. Vgl.: Stark: Majority, S. 265. Vgl.: Wolf: Augen. Im Artikel zitiert Wolf Bähnisch zu ihrer Befürchtung, deutsche Frauen könnten „den Sirenentönen eines neuen Rattenfängers“ erliegen. Die Verwendung des Begriffs ‚neu‘ intendiert, daß Bähnisch nicht nur den Kommunismus, sondern auch den Nationalsozialismus als einen solchen Rattenfänger ansah. Ebd. An Herta Gotthelf hatte Bähnisch, ihre antikommunistische Arbeit im Frauenring begründend, geschrieben, daß sie, „kein zweites 33“ erleben wolle. AdSD, SPD-PV, (Alter Bestand), Frauenbüro, Nr. 0244 A, Theanolte Bähnisch an Herta Gotthelf, Hannover, 29.04.1947.
722 | Theanolte Bähnisch
in den Nachkriegsjahren zunehmend stärker als eine Negativfolie zur liberalen Gesellschaft diente, als der Nationalsozialismus. Der Antikommunismus war, nicht zuletzt auch als Versatzstück nationalsozialistischen Gedankenguts, in der Bevölkerung verwurzelt. Daran ließ sich im ‚Kalten Krieg‘ weitgehend bruchlos anknüpfen.113 In Auseinandersetzungen mit Politikern und anderen Eliten tendierte Bähnisch eher als in der breiten Öffentlichkeit dazu, Vergleiche zwischen dem Nationalsozialismus und dem Kommmunismus zu ziehen. Häufig zog sie diese Vergleiche jedoch nur indirekt – über eine Wortwahl, die vor allem bei belesenen Zuhörern Wiedererkennungseffekte hervorgerufen haben dürften. Bei einem Journalisten-Gespräch, das die Evangelischen Akademie in Loccum 1953 zum Thema ‚Hitler‘ veranstaltete, knüpfte sie mit der Aussage, die Nationalsozialisten hätten die fatale Fähigkeit besessen, die ‚Massen‘ für ihre Ziele zu gewinnen, an ein Bild an, das sie bereits 1948 über beide Ideologien in der ‚Stimme der Frau‘ gezeichnet hatte.114 Hitler sei‚ so erklärte die Hannoveraner Regierungspräsidentin in Loccum, „durch geschickte psychologische Behandlung der Massen zur Macht gekommen.“ Sie stellte fest, in einer „kranken Zeit“ zu leben, in der die Menschen mit „Surrogaten der Seele“ lebten, nachdem sie „die Bindung an Gott verloren haben“115. Den Kommunismus thematisierte sie in diesem Zusammenhang also nicht wörtlich, doch dürfte dies in jenem Kreis auch nicht nötig gewesen sein, um verstanden zu werden. Analysiert man Bähnischs oben zitierte Rede von 1950, so fällt auf, daß sie die Ablehnung des Kommunismus vor allem kulturell begründete und dabei besonders die ‚kulturelle Aufgabe‘ deutscher Frauen in der christlichen, westlichen Wertegemeinschaft betonte. In der ‚Stimme der Frau‘ sind die Formen der Argumentation gegen den ‚Bolschewismus‘ – was wohl nicht zuletzt der Vielzahl der Autorinnen geschuldet ist – vielfältiger und richten sich nicht nur gegen die verhaßte Ideologie, sondern auch gegen die post-zaristische (!) Sowjetunion116 sowie gegen die Slawen als Ethnie. Anleihen aus der rassisch argumentierenden nationalsozialistischen Propaganda gegen den Kommunismus117 gehören in der Zeitschrift ebenso zum Set von Abgrenzungen wie ökonomische Begründungen118. Auch die besonders in sozialde-
113 Vgl. zu den Kontinuitäten des Rußland, bzw. Kommunisten Feindbildes durch die Systeme: Jahn, Peter: Russenfurcht und Antibolschewismus. Zur Entstehung und Wirkung von Feindbildern, in: ders./Rürup, Peter (Hrsg.): Erobern und Vernichten. Der Krieg gegen die Sowjetunion 1941–1945, Berlin 1991, S. 47–64 sowie Jahn: Rußlandfeindbild. 114 Wolf: Augen. 115 Landeskirchliches Archiv, Hannover, NL Lilje, L3 III, Nr. 1104, Ev. Akademie Loccum, Gespräch für Journalisten über das Thema ‚Hitler‘, 11. –15.06.1953, Protokoll, S. 31. 116 Vgl.: Mann, Carol: Ihr Leben – ein Tanz! Die Geschichte der Anna Pawlowa, in: Stimme der Frau, 3. Jg. (1952), Heft 5, S. 22/23, hier S. 23. Im Artikel, der beschreibt, daß der Tänzerin ihr Heimatland nach der Revolution verschlossen gewesen sei, ist das zaristische Rußland gegenüber dem kommunistischen positiv konnotiert. 117 Zur rassistischen Darstellung von Slawen in der ‚Stimme der Frau‘ siehe auch Kapitel 8.1.2. 118 O. V.: Interessant! Das Baumwollkleid leicht verdient?, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 5, S. 2. Zu den von Klaus Körner und Gesine Schwan definierten ver-
Staatspolitische Aufgabe
|
723
mokratischen Kreisen wiederholt vorgenommene politiktheoretische Bewertung des Kommunismus als ein totalitäres Regime findet sich in der Zeitschrift – beispielsweise in einem Beitrag der Sozialdemokratin Anna Haag.119 Solch deutliche Worte gegen den Kommunismus wie in der ‚Stimme der Frau‘ ab Mitte 1948 und in ihrer Rede von 1950 hatte Bähnisch, als sich der DFD im März 1947 konstituiert hatte, in offiziellen Verlautbarungen noch nicht gefunden. Als die Zukunft Deutschlands noch offen schien, als die Gründung eines Staates, in dessen Selbstverständnis die Abgrenzung zum Kommunismus eine zentrale Rolle spielen sollte, noch nicht abzusehen war und als die Alliierten in Deutschland noch nicht offen gegeneinander agierten, hatte Bähnisch ihre Kraft zunächst darauf konzentriert, die Bande zu Gleichgesinnten fester zu knüpfen. Zudem hatte sie sich bemüht, die Existenz noch nicht oder kaum kommunistisch infiltrierter überparteilicher Frauenzusammenschlüsse im Inland populär zu machen und Unterstützung aus dem Ausland für ihre Arbeit zu erreichen. Die ‚Steilvorlage‘ des ‚Frauenkongresses für den Frieden‘ in Berlin mit seinen 1400 Gästen, die der Gründung des DFD beiwohnten, zu toppen, schien kaum möglich. Doch wurden in den folgenden Monaten und Jahren auch in den Westzonen verschiedene, gut besuchte Tagungen von Frauenverbänden veranstaltet, was vor allem zeigt, daß Bähnisch mit ihrem Wunsch nach Vernetzung, Austausch und einer großen Öffentlichkeitswirkung der Frauenbewegung nicht alleinstand.
7.2 EIN AUSBLICK: INTERZONALE FRAUENKONFERENZEN IN WESTDEUTSCHLAND 1947 BIS 1949: MEILENSTEINE AUF DEM WEG ZUR RE-ORGANISATION DER BÜRGERLICHEN FRAUENBEWEGUNG Im Zentrum der folgenden Ausführungen sollen jene Konferenzen stehen, welche der bürgerlichen Frauenbewegung schrittweise ermöglichten, eine (west-)deutschlandweite Frauen-Organisation aufzubauen und zu begründen. Auch eine weitere Konferenz des DFD, die den ‚Bürgerlichen‘ als Ansporn dazu diente, mit einem solchen Zusammenschluß gleichzeitig eine Konter-Organisation zum DFD zu schaffen, soll in diesem Zusammenhang thematisiert werden. An dieser Stelle erfolgt zum besseren Verständnis der Zusammenhänge, die aufgrund ihrer Komplexität im Folgenden detailliert erläutert werden sollen, eine Vorausschau der weiteren Entwicklungen. Weil an den interzonalen Frauen-Konferenzen die Militärregierungen der entsprechenden Zonen wesentlich beteiligt waren und sie auf diesem Feld miteinander konkurrierten, teilweise aber auch kooperierten, soll in an dieser Stelle auch ein Vorgriff auf die Entwicklung der von den Briten und Amerikanern jeweils betriebenen Frauenpolitik geleistet werden.
schiedenen Formen des Antikommunismus, die sich in der ‚Stimme der Frau‘ wiederfinden, siehe Anm. 84. 119 Haag: Sorgen.
724 | Theanolte Bähnisch
Die Analyse der interzonalen Frauen-Konferenzen – auch in der Vorbereitung, Beteiligung und Bewertung durch deutsche Teilnehmer und Vertreter der Besatzungsmächte – ist, wie bereits erwähnt, von wesentlicher Bedeutung, wenn man verstehen will, warum die Regierungspräsidentin neben viel Lob auch viel Kritik für ihre Arbeit beim Wiederaufbau der organisierten Frauenbewegung in Deutschland erntete, warum sie sich trotz all dieser Kritik der Unterstützung weiter Kreise sicher sein konnte und warum die Konferenzen einen wesentlichen Schlüssel für ihren und den Erfolg der von ihr geleiteteten Frauenzusammenschlüsse darstellen. Konkret wird es im Folgenden um die Konferenz von Bad Boll im Mai 1947120, um die erste interzonale Frauenkonferenz von Bad Pyrmont im Juni 1947121, um die vom DFD organisierte Frauenkonferenz im Dezember 1947122 sowie um die Frankfurter Frauenkonferenz123, die im Juni 1948 stattfand, gehen. Die zweite interzonale Konferenz von Bad Pyrmont wird Gegenstand eines Unterkapitels von Kapitel 8 werden, welches sich stärker mit der außenpolitischen und internationalen Dimension von Bähnischs Handeln auseinandersetzt sowie die Gründung und die Konsolidierungsphase des 1949 gegründeten Deutschen Frauenrings (DFR) thematisiert. Nachdem sich die Frauenzusammenschlüsse in der direkten Nachkriegszeit auf den Aufbau ihrer Organisationen auf regionaler Ebene konzentriert hatten, wurde bereits um die Jahreswende 1946/47 vielerorts das Bedürfnis organisierter Frauen spürbar, mit Frauenvereinigungen aus anderen Regionen in Kontakt zu kommen, um Hoffnungen und Befürchtungen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen. Daß, wie Marianne Zepp schreibt, ein stärkerer Austausch von Frauenzusammenschlüssen untereinander erst knapp zwei Jahre nach Kriegsende angelaufen sei124, bestätigt sich in den Korrespondenzen des ‚Club deutscher Frauen/Frauenring‘ nur für die interzonale Ebene des Austauschs. Ein Austausch zwischen Frauen-Organisationen und Organisationen mit Frauensektionen, die in der Region Hannover existierten, hatte bereits im Sommer/Herbst 1946 stattgefunden, nur wenig später hatte Bähnisch Kontakte zu anderen Frauenzusammenschlüssen aus der britischen Besatzungszone geknüpft. Vorboten für den Austausch zwischen Frauenorganisationen in verschiedenen Besatzungszonen waren Unternehmungen wie die gemeinsame Reise der Hannoveranerin Bähnisch und der Berlinerin Zahn-Harnack nach Großbritannien Ende 1946 gewesen. Gefördert von der britischen Militärregierung, weiteten sich der Aktionsrahmen der Frauenvereinigungen und ihr Bedürfnis, miteinander in Kontakt zu treten, etwa seit der Gründung der Bizone im Januar 1947 stetig aus. Dabei wurden, obwohl einige Frauenorganisationen gerade erst die Zulassung für eine Stadt oder auch nur für einen Sektor in der geteilten Hauptstadt bekommen hatten, Möglichkeiten, überregionale Organisationsformen zu etablieren, geprüft und schließlich auch umgesetzt. Der Süddeutsche Frauenarbeitskreis (SFAK) unter der Leitung Else Reventlows
120 121 122 123 124
Siehe Kapitel 7.3.3 und 7.3/4. Siehe Kapitel 7.4. Siehe Kapitel 7.7.1. Siehe Kapitel 7.7.2. Zepp: Redefining, S. 220.
Staatspolitische Aufgabe
|
725
(SPD) hatte bereits im November 1946 seine landesweite Zulassung beantragt.125 Noch bevor überhaupt ein neuer Staat gegründet war, hatten einige organisierte Frauen versucht, an die Idee einer nationalen Vertretung deutscher Frauen, wie sie der BDF für sich beansprucht hatte, anzuknüpfen.126 Nachdem die SMAD Frauen aus ‚ihrer‘ Zone Informations-Reisen ins Ausland ermöglicht hatte und der überzonale ‚Frauen-Kongreß für den Frieden‘ im März 1947 ‚gehalten‘ war, gerieten die Westmächte unter Zugzwang. Die erfolgreichen Bestrebungen der SMAD, eine Frauengesamtorganisation von Berlin aus für die SBZ aufzubauen, bezeichnet Marianne Zepp als einen „Ansporn“127 für den Westen, seinerseits, „die einzelnen regionalen Vereine zu einflußreicheren Organisationen zusammenzuführen“.128 Wann genau das Vorpreschen der SMAD im Westen nicht mehr als eine ‚sportliche Herausforderung‘ begriffen wurde, sondern zu einer tiefgreifenden Sorge mutierte, ist schwer zu sagen. Fakt ist, daß die Angst um die westdeutschen Frauen vor dem Hintergrund des sich zuspitzenden Kalten Krieges zwischen Januar und März 1948 die Spitzen der Britischen Regierung erreichte.129 Wie die mittlerweile zugängliche Aktenüberlieferung aus der ‚Abteilung Frauen im ZK der SED‘ dokumentiert130, befürchteten die Briten zu Recht ein Übergreifen des kommunistisch ausgerichteten DFD in die Westzonen – und damit eine Demontage ihrer Frauen-Reeducation-Politik, die anderen Grundsätzen folgte, als jene der SMAD. Nur ein knappes halbes Jahr, nachdem die britische Militärregierung auf Empfehlung der WGPW-Delegierten Deneke und Norris begonnen hatte, überparteiliche Frauenorganisationen aufgrund der ihnen offenbar innewohnenden Pluralität zu fördern, drohten solche Frauenorganisationen in ganz Deutschland – in der Wahrnehmung der Briten – durch kommunistisch orientierte Frauen dominiert zu werden. Wie Kapitel 7.8. zeigen wird, reagierte die CCG (BE) gleich doppelt auf diese Entwicklungen: Erstens mit einer besseren Informations-Versorgung ihrer regionalen Headquarters, zweitens mit einer intensivierten Öffentlichkeitsarbeit gegenüber der deutschen Bevölkerung. Insbesondere über den Rundfunk131 verbreitete die Militärregierung nun Informationen über ihre ‚hauseigene‘ Frauenarbeit, aber auch über die Bedrohung durch den DFD, der Denise Tscharntke zufolge bereits zehn Monate nach seiner Entstehung in der SBZ 250.000 Mitglieder zählte.132
125 126 127 128 129 130 131
Ebd., S. 157. Sein formelles Ziel erreichte der SFAK auch 1949 nicht. Siehe Kapitel 8.3.1. Zepp: Redefining, S. 157. Ebd. Siehe Kapitel 7.8. BArch, SAPMO DY 30. Vgl.: Für die Kampagne spielte Helga Prollius, die Leiterin des NWDR-Frauenfunks, eine besondere Rolle. Eine ähnliche Rolle übernahm Gabriele Strecker beim Hessischen Frauenfunk. 132 Vgl: Tscharntke: Re-educating, S. 133/134; o. V.: Die Politik des Demokratischen Frauenbundes, in: Der Tagesspiegel, 01.01.1948, in englischer Übersetzung auch überliefert in: NA, UK, FO 1049/1844. John Robert Stark spricht sogar von 280.000 Mitgliedern, die der DFD im Mai 1947 gehabt habe. Vgl.: Stark: Majority, S. 138
726 | Theanolte Bähnisch
Auf Anregung amerikanischer und deutscher Frauenorganisationen begann sich bald auch das ‚Office of the Military Government of the United States‘ (OMGUS) mit der deutschen Frauenbewegung auseinanderzusetzen.133 Ganz im Gegensatz zur CCG (BE) verfügten die Amerikaner zu dieser Zeit jedoch noch nicht einmal über BasisInformationen zum Stand der Frauenarbeit in der US-Zone – geschweige denn wußten sie, wie es um die Entwicklungen in den anderen Besatzungs-Zonen stand. Erst 1948 nahm die erste Mitarbeiterin, welche für die Arbeit mit Frauen zuständig sein sollte, ihre Arbeit beim OMGUS auf.134 Der amerikanischen Historikerin Rebecca Boehling zufolge war die Gründung der Women’s Affairs Section beim OMGUS 1948 nicht aus der Motivation, auf das Verhältnis der Geschlechter und die Rolle der Frauen in Deutschland Einfluß zu nehmen, erfolgt, sondern allein aus dem Wunsch, dem Kommunismus Paroli zu bieten.135 Den Druck, den amerikanische Frauenrechtlerinnen ausgeübt hatten, hält sie, im Gegensatz zu Hermann-Josef Rupieper, der sich bereits 1991 mit der Frauen-Re-education-Politik der USA in Deutschland auseinandersetzte und auch anders als Christl Ziegler, die auf Rupieper und Henry P. Pilgert verweist136, nicht für entscheidungsrelevant.137 „Die US-Militärregierung wollte […], daß die deutschen Frauen ihre staatsbürgerlichen Pflichten kannten und sie ausführten, daß sie sich weder autoritär noch untertänig verhielten und auch, daß sie antikommunistisch eingestellt blieben,“138 so Boehling. Das auch für die CCG (BE) unerwartete Vorpreschen vom OMGUS durch die Veranstaltung einer interzonalen Frauenkonferenz in der US-Besatzungszone noch in der ersten Jahreshälfte 1947 war Marianne Zepp zufolge wesentlich auf das Engagement deutscher Frauen zurückzuführen. Die Studienrätin Elisabeth Käser, Zepps Beurteilung nach eine „ausgewiesene Demokratin der älteren Generation“139 und „Mitglied des Frauenausschusses bei der Parteizentrale der [Bayern-]SPD“140, hatte die Initiative ergriffen und sich bereits im November 1946 – also zeitgleich zur Planung der DFD-Konferenz in Berlin – gemeinsam mit anderen Frauen an Mildred English, die stellvertretende Direktorin der ‚Education & Religious Affairs Branch‘ beim OMGUS gewandt. English hatte das Anliegen der Frauen, nämlich Unterstützung bei der Ausrichtung einer Frauenkonferenz im Frühjahr 1947 zu erhalten, an die OMGUS-Kollegen in Bayern weitergeleitet. Um Informationen über den Stand der Frauenbewegung einzuholen, um eine Gästeliste aufzusetzen und auf dieser Grundlage auf der anvisierten Konferenz „ein allumfassendes Bild des deutschen Frauenlebens“141 geben zu können, entwickelte OMGUS in Absprache mit den Frauen um
133 Vgl.: Boehling: Geschlechterpolitik, S. 71. 134 Zur Arbeit der Women’s Affairs Section beim OMGUS vgl.: Rupieper: Bringing sowie Ziegler: Lernziel. 135 Vgl.: Boehling: Geschlechterpolitik, S. 71. 136 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 46. 137 Boehling: Geschlechterpolitik, S. 71. Vgl. auch: Rupieper: Bringing. 138 Boehling: Geschlechterpolitik, S. 71. 139 Zepp: Redefining, S. 221. 140 Ebd. 141 Schreiben von E. Kaeser vom 15.02.1947, zitiert nach Zepp: Redefining, S. 222.
Staatspolitische Aufgabe
|
727
Käser einen Fragebogen, der verschiedenen Frauenorganisationen zugesandt werden sollte.142 Dem OMGUS war allerdings nicht daran gelegen, daß seine Handschrift auf der Konferenz, die schließlich in Bad Boll stattfinden sollte, erkennbar war. Von entsprechenden Gerüchten distanzierte sich die Behörde im Nachhinein.143 Man habe in ‚Bad Boll‘ keine öffentlichkeitswirksame Massenveranstaltung initiieren, sondern ein Arbeitstreffen abhalten wollen, erklärte OMGUS. Damit grenzte sich die amerikanische Militärregierung von der Einflußnahme der SMAD auf die Berliner Konferenz ab und betonte die Eigenleistung der deutschen Frauen.144 Finanzielle Hilfestellung hatte die amerikanische Militärregierung allerdings gewährt145, und daß die Anwesenheit der Frauen aus dem westlichen Ausland, die nach den Wünschen des OMGUS ausgewählt und eingeladen worden waren, keinen Einfluß auf die Inhalte der Vorträge gehabt hatten, ist mehr als unwahrscheinlich. Von britischer Seite waren derweil – in Abstimmung mit Theanolte Bähnisch – ebenfalls Überlegungen zur Planung einer überregionalen Frauen-Konferenz angestellt worden, über die in Kapitel 6.4 ausführlicher zu berichten sein wird. Sie fand im Juni 1947 in Bad Pyrmont statt. Damit kamen – die bereits beschriebene SMAD/DFD Konferenz in Berlin, die im März 1947 stattgefunden hatte, inbegriffen – innerhalb von nur vier Monaten drei Konferenzen zustande, auf denen sich überparteilich agierende Frauenorganisationen aus verschiedenen Besatzungszonen austauschen konnten. Der streng von der SMAD dirigierten ‚Frauenkonferenz für den Frieden‘ im März 1947 stellt Marianne Zepp die beiden Konferenzen in den Westzonen als „öffentliche Manifestationen liberal-demokratischer Traditionen“146 diametral gegenüber. Daß Theanolte Bähnisch auf die Konferenz von Bad Boll im Mai 1947 maßgeblichen Einfluß ausübte und jene, die in Bad Pyrmont einen Monat später stattfand, sogar leitete, beeinflußte – was Zepp allerdings kaum berücksichtigt – die politische Ausrichtung beider Westzonen-Konferenzen von 1947 wesentlich. Soviel soll an dieser Stelle noch vorweggenommen werden, um die Bedeutung der interzonalen Frauen-Konferenzen für die Geschichte der Frauenbewegung und der westalliierten Re-education Politik in Deutschland, für die Biographie Bähnischs und damit auch für diese Studie zu unterstreichen: 1948 sollte, ein Jahr nach der Konferenz von Bad Boll, erneut eine überzonale Frauen-Konferenz in der amerikanischen Besatzungszone stattfinden, diesmal in Frankfurt. Sie folgte auf eine weitere Konferenz, die der DFD im Dezember 1947 veranstaltet hatte, und ging jener geschichtssträchtigen Konferenz voraus, auf der 1949 eine westdeutschlandweite Frauenorganisation, der ‚Deutsche Frauenring (DFR)‘ unter Bähnischs Vorsitz gegründet wurde – womit die Spaltung der organisierten, als überparteilich auftretenden Frauenbewegung in zwei Verbände in ‚Ost‘ und ‚West‘ manifestiert war. Theanolte Bäh-
142 143 144 145 146
Vgl.: Zepp: Redefining, S. 221. Vgl.: Ebd, S. 224. Vgl.: ebd. Vgl.: ebd., S. 221. Zepp: Redifining, S. 220.
728 | Theanolte Bähnisch
nisch hatte damit eine für sie persönlich besonders wichtige Hürde genommen, und der ‚Bund deutscher Frauen (BDF)‘ hatte damit einen organisatorischen Nachfolger gefunden, der in verschiedenen Zusammenhängen in seine ‚Rechte‘ eintrat. Auch wenn die Konferenz von Bad Pyrmont zweifelsohne die wichtigste in der Organisationsgeschichte der Bürgerlichen Frauenbewegung nach 1945 in Deutschland war, so war der Historikerin und Mitarbeiterin des Archivs der deutschen Frauenbewegung, Kerstin Wolff, zufolge der „Rekurs auf die alte Frauenbewegung“ (auch) auf der Konferenz von Frankfurt im Mai 1948 „[b]esonders eindrücklich“147. Schließlich schloß sie sich unmittelbar an die Feierlichkeiten anläßlich des 100. Gedenkjubiläums der Revolution von 1848 an, welche in der Frankfurter Paulskirche im Mai 1948 mit einer Gedenkwoche begangen wurden. Der interzonale Frauenkongreß, der zwischen dem 22. und 24.05.1948, wiederum unter maßgeblicher Beteiligung Bähnischs, am Ende dieser Gedenkwoche abgehalten wurde, stellte durch die Beiträge seiner Rednerinnen das Engagement von Frauenzusammenschlüssen in der Nachkriegszeit in Westdeutschland mal mehr, mal weniger explizit in die Tradition der liberalen Revolution von 1848. Der vom DFD veranstalten ‚Frauenkonferenz für den Frieden‘ wurde damit, wenn man so will, eine ‚Frauenkonferenz für die Freiheit‘ entgegengesetzt. Daß sich die politische Lage in Deutschland zu diesem Zeitpunkt bereits stark verschärft hatte, wurde insbesondere daran deutlich, daß am Frankfurter Kongreß – anders als an den Konferenzen von Bad Boll und Bad Pyrmont 1947 – keine Vertreterinnen des DFD teilnahmen.148 Hatten sich die Frauen aus ‚Ost‘ und ‚West‘ also zunächst noch gegenseitig zu Konferenzen eingeladen und waren zumindest einige Frauen aus dem jeweils anderen Teil des Landes diesen Einladungen auch gefolgt, so war der Austausch zwischen den Frauenorganisationen in den Westzonen und der SBZ nach dem Tagungsfrühling von 1947 erlahmt. Die Spaltung, welche sich mit der Gründung der Bizone und schließlich der Trizone andeutete, verlief bald auch durch die Reihen der deutschen Frauenorganisationen. Diese Entwicklung sollte jedoch nicht als ein ‚Nebeneffekt‘ allgemeiner Entwicklungen bewertet werden. Vielmehr hatten die Verantwortlichen jene Spaltung nicht nur wissend in Kauf genommen, sondern sie, aus Beweggründen, die teils bereits ausgeführt wurden und teils noch zu behandeln sind, aktiv angestrebt. Zur Konferenz in Bad Pyrmont im Oktober 1949, auf der unter dem Vorsitz Bähnischs der ‚Deutsche Frauenring‘ gegründet wurde, waren Vertreterinnen des DFD erst gar nicht eingeladen worden. Der Graben, der die Frauen im Westen von jenen im Osten trennte, sei, so schreibt eine bedeutende Protagonistin des DFR, Gabriele Strecker, in ihren Erinnerungen, zu jener Zeit bereits zu tief gewesen.149 1949 führte kein Weg mehr an der Erkenntnis vorbei, daß die deutsche Frauenbewegung, wie das Land, gespalten war. Dabei hatten sich Theanolte Bähnisch und ihre Mitstreiterinnen dem Statut des ‚Club deutscher Frauen‘ zufolge, ebenso wie einige andere Zusammenschlüsse, im Frühsommer 1946 doch explizit für eine Zusammenarbeit aller Frauen beim Wiederaufbau ausgesprochen. Diese Toleranz der
147 Wolff: Traditionsbruch, S. 267. 148 Vgl.: Zepp: Redifining, S. 226. 149 Strecker: Frauenarbeit, S. 13.
Staatspolitische Aufgabe
| 729
‚ersten Stunde‘, das Bedürfnis verschiedenster Frauen, im Angesicht der Not zusammenzuarbeiten, war drei Jahre später ‚Geschichte‘. Der Weg zu diesen Entwicklungen soll im Folgenden nachgezeichnet und dabei die besondere Rolle Bähnischs in diesem Prozeß analysiert werden. Dabei soll es nicht nur um die Ziele Theanolte Bähnischs gehen, sondern auch um die Wünsche und Hoffnungen, die auf die Regierungspräsidentin als eine der zentralen Protagonistinnen der Frauenbewegung in Deutschland von verschiedenen Seiten projiziert wurden. Dazu gehört es, zu beschreiben, wie sich die Wahrnehmung Bähnischs durch die verschiedenen Gruppen im Lauf zweier ereignisreicher Jahre veränderte, welche Netzwerke und Allianzen in der Frauenbewegung und darüber hinaus – mit Hilfe Bähnischs – reaktiviert wurden, welche sich neu ausbildeten und welche – trotz (oder auch wegen) des prinzipiell einenden Gedankens der überparteilich-überkonfessionellen Arbeit – erst gar nicht zustande kamen. Es wird darum gehen, welche Rolle die Gründungspräsidentin des DFR selbst dabei spielte, welche Rolle sie sich und ihren Gründungen im Wiederaufbau der Frauenbewegung und in anderen Zusammenhängen zuwies und was zur Förderung, Akzeptanz oder Ablehnung ihrer Arbeit durch andere Protagonistinnen der Frauenbewegung führte. Es soll um die Argumente gehen, die die neue Führungsfigur der bürgerlichen Frauenbewegung lieferte und um die Handlungsstrategien, die sie anwendete. Dabei wird die Frage, ob sich Bähnisch mit ihrer Arbeit tatsächlich an alle Frauen wendete oder ob sie einige Gruppen gezielt ansprach, erörtert werden, auch die, welche Frauen sich angesprochen fühlten und welche auf Distanz blieben. Es stellt sich die Frage, ob sie Strategien entwickelte, um ihren Einflußspielraum über die von ihr geleiteten Organisationen hinaus zu vergrößern. Schließlich gilt es zu beschreiben, wie sich die Unterstützung durch die Militärregierung und durch die britische Frauenbewegung vor dem sich verändernden Hintergrund weiterentwickelte, welche Rolle der Kalte Krieg und die Lage Deutschlands für die Politik Bähnischs sowie für ihre Förderung durch die Briten und später auch die USA spielte. Weil das Handeln Bähnischs in der Frauenbewegung eng mit ihrem Wirken in anderen Zusammenhängen, vor allem in der Europabewegung, verschränkt war und einige ihrer weiteren Unternehmungen ganz offensichtlich Schwachstellen des DFR kompensieren helfen sollte, wird in den folgenden Kapiteln auch Bähnischs über den DFR hinausgehendes Engagement in die Chronologie der Analyse ihres Handelns in der Frauenbewegung eingeflochten werden. Die in den folgenden Kapiteln vorgestellten interzonalen Frauen-Konferenzen sind nicht nur ein bedeutsamer Teil der Biographie Bähnischs, sondern sie sind, auch aufgrund der jeweils langen Vorplanungen, welche ihnen vorausgingen, der großen Öffentlichkeitswirkung, die sie erreichten, und der Gelegenheiten, die sie den Frauenorganisationen untereinander boten, von zentraler Bedeutung für dem Wiederaufbau der bürgerlichen deutschen Frauenbewegung ab 1945. Sie sind ebenfalls von zentraler Relevanz für die Wiederanbahnung der Beziehungen der deutschen Frauenbewegung in das Ausland sowie für das kulturelle Gedächtnis der bürgerlichen Frau-
730 | Theanolte Bähnisch
enbewegung nach 1945 und für die Erforschung ihrer frühen Geschichte.150 Diese wiederum ist, wie die zahlreichen überlieferten Quellen zeigen, untrennbar mit dem Wirken Theanolte Bähnischs verbunden. Bis der ‚Deutsche Frauenring‘ im Oktober 1949 gegründet wurde, machte die Vor- und Nachbereitung von Frauenkonferenzen ab dem Frühjahr 1947 den Löwenanteil von Bähnischs Arbeit in der Frauenbewegung aus. Nicht zuletzt ihrer Anwesenheit auf den interzonalen Frauen-Konferenzen und dem Austausch über jene Veranstaltungen hatte Bähnisch zu verdanken, daß es zu einem anhaltenden Schulterschluß zwischen ihr und der britischen Frauenbewegung sowie der Militärregierung kam. Auch ihre vielen Auslandsreisen, ihr stetig steigender Bekanntheitsgrad, ihr Einfluß auf die ältere Generation der Frauenbewegung, aber auch die Gegnerschaft vieler, die ihre Arbeit nicht schätzten, und schließlich auch Phasen der Krankheit, der Überforderung und der Ohnmacht, allen anstehenden Aufgaben und Ansprüchen gerecht zu werden, stehen in engem Zusammenhang mit den beschriebenen Konferenzen. Was die Auseinandersetzung mit jenen Veranstaltungen ebenfalls nahelegt, ist der Umstand, daß die Überlieferungslage für die Aufbauphase des Deutschen Frauenrings, die sich jeweils wesentlich mit den genannten Interzonalen Frauenkonferenzen verdichtete, nicht nur vergleichsweise üppig, sondern auch besonders vielfältig ist und damit einen Blick auf die Genese des Rings und des Wirkens seiner Präsidentin aus verschiedenen Perspektiven ermöglicht. Insbesondere die im Archiv des ‚Deutschen Frauenrings‘ überlieferten Unterlagen wurden bisher noch nicht systematisch ausgewertet. Sie enthalten Korrespondenzen von Bähnisch und ihrer ‚rechten Hand‘, Maria Prejawa, mit Mitgliedern anderer Frauenorganisationen, daneben Protokolle von Veranstaltungen, Stellungnahmen von Teilnehmerinnen sowie Berichte aus Zeitungen und Zeitschriften über die Veranstaltungen. Korrespondenzen zwischen Personen aus der britischen Frauenbewegung, der Militärregierung, der SPD, der KPD und dem DFD, welche die Geschichte des DFR und die interzonalen Frauenkonferenzen thematisieren, sind in der Bestandsgruppe ‚Foreign Office‘ in den British National Archives beziehungsweise in den Bestandsgruppen ‚Kurt Schumacher‘ und ‚Parteivorstand alt‘ im Archiv der Sozialen Demokratie in Bonn, schließlich in der Bestandsgruppe SAPMO des Bundesarchivs in Berlin überliefert. Einige kürzere zeitgenössische Zeitungsartikel porträtieren die Regierungspräsidentin (auch) als Vorsitzende der von ihr gegründeten Organisationen und/oder geben – wie der zitierte Artikel über ihre Rede in Köln 1950 – ihre Ziele, Ideen und Überzeugungen hinsichtlich der Frauenbewegung wieder. Neben den Korrespondenzen bieten sich vor allem die Reden, die Bähnisch auf den im Folgenden vorgestellten Konferenzen hielt, sowie jene, die sie anläßlich ihres Rücktritts als Vorsitzende 1952 und aus Anlaß des zehnjährigen Jubiläums des DFR 1959 hielt, zur Analyse ihrer Überzeugungen und Ziele beziehungsweise ihrer Selbstdarstellung an. Mit der ‚Stimme der Frau‘ liegt zwar ein weiteres umfangreiches, bereits ausgewertetes151 Quellenkonvolut vor, welches Aussagen zum Thema ‚Bähnisch und die
150 Dies spiegelt sich vor allem auch in der Überlieferung der Unterlagen zu den Konferenzen von Bad Boll und Pyrmont im Archiv des DFR wieder. 151 Vgl.: Freund: Krieg.
Staatspolitische Aufgabe
|
731
Frauenbewegung‘ ermöglicht, allerdings lassen sich nur wenige Texte der Regierungspräsidentin selbst zuordnen, und nur in den ersten Ausgaben ist häufiger explizit von Bähnisch und dem ‚Frauenring‘ die Rede. Die Zeitschrift beziehungsweise die Analyse ihrer Berichterstattung soll vor diesem Hintergrund nur in Zusammenhängen, in denen auffällige Parallelen oder Diskrepanzen zwischen Bähnischs Engagement im Frauenring und in der Berichterstattung der ‚Stimme der Frau‘ bestehen, herangezogen werden.
7.3 ZWISCHEN SELBSTBEWUSSTEM AUFBRUCH UND DEM SCHWIERIGEN UMGANG MIT DER VERGANGENHEIT: DIE KONFERENZ VON BAD BOLL (20. BIS 23. MAI 1947) 7.3.1 Eine andere Besatzungszone, aber ein vertrauter Kreis – Bähnischs Friedensappell an die ‚Frauen am Scheideweg‘ Aufgrund der engen Abstimmung zwischen den deutschen Frauen um Elisabeth Käser und der amerikanischen Militärregierung konnte tatsächlich schon wenige Wochen nach der Konferenz in Berlin im März 1947 vom 20. bis 23.05.1947 eine überzonale, überparteiliche Frauenkonferenz im Kurort Bad Boll, 50 km südlich von Stuttgart, stattfinden. Der Zusammenschluß der britischen und der amerikanischen Besatzungszone zur Bizone hatte die Umsetzung der Konferenz erheblich erleichtert. Der Austausch mit den Frauen in Westberlin blieb jedoch aufgrund der Insellage der Stadt in der SBZ schwierig. Eingeladen waren zur Konferenz mit dem programmatischen Titel ‚Friedensbewegung, Völkerverständigung und Völkerversöhnung als Aufgabe der Frau‘152 insgesamt 204 Delegierte von 42 Organisationen aus allen vier Besatzungszonen. Ausländische Gäste sollen jedoch – soviel sei vorweggenommen – insgesamt eine ‚mangelnde Toleranz‘ der Frauen aus den Westzonen gegenüber ebenfalls erschienenen Repräsentantinnen des DFD beobachtet haben.153 Für die US-Amerikaner war im Zuge der Vorplanung ihrer Konferenz schnell klargeworden, wer das Sagen in der Frauenbewegung der britischen Besatzungszone hatte. Es scheint von vornherein außer Frage gestanden zu haben, daß Theanolte Bähnisch auf der Konferenz den zentralen Vortrag übernehmen würde. Das zweite von drei zentralen Referaten war der Berliner Theologin und Leiterin des Wilmersdorfer Frauenbundes, Agnes von Zahn-Harnack – einer mittlerweile guten Bekannten Bähnischs – übertragen worden. Die Patentanwältin, Physikerin und erklärte Atomkraftgegnerin Freda Wuesthoff hatte das dritte Hauptreferat übernommen. Wuesthoff lebte zu dieser Zeit in der französischen Besatzungszone und hielt dort die südbadischen überparteilichen Frauenverbände154 zusammen. Zuvor hatte sie diverse über-
152 Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 135. 153 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 157. 154 Für die nordbadischen Verbände in der amerikanischen Besatzungszone hatte sich die promovierte Juristin Erdmuthe Falkenberg, die Vorsitzende des im Juli 1946 gegründeten
732 | Theanolte Bähnisch
parteiliche Frauenzusammenschlüsse mit dem Namen ‚Frauenring‘, die nach dem Vorbild des ‚Club deutscher Frauen‘ arbeiteten, in der französischen Besatzungszone initiiert.155 Die drei Hauptrednerinnen hatten als Mitglieder von Wuesthoffs 1946 gegründetem ‚Friedenskreis‘, dem Elly Heuß-Knapp, Gertrud Bäumer, Dorothee von Velsen, Marie-Elisabeth Lüders sowie die damals erst 31 Jahre alte Leonore Mayer-Katz156 angehörten, schon vor jener Konferenz Gelegenheit gehabt, sich auszutauschen. Auch von Velsen, Lüders157 und die ebenfalls mit Wuesthoff bekannte Erwachsenenbildnerin und Ehefrau Eduard Weitschs, Ilse Weitsch158, waren anläßlich der Konferenz nach Bad Boll gereist. Nicht zuletzt aufgrund der Zusammenkunft dieses Zirkels in Bad Boll ist die Konferenz als eine Vorstufe zur Gründung des DFR einzuordnen. Erstmals war jener Kreis von Frauen der im Oktober 1949 gemeinsam den Deutschen Frauenring gründen sollte, zu einem von Wuesthoff im März 1947 in Stuttgart veranstalteten Treffen zusammengekommen. Die Friedenskreis-Mitglieder Bäumer und Heuss-Knapp sollten jedoch nicht zu den späteren Gründerinnen des DFR gehören159, während die DFR-Mitbegründerin und Leiterin des DFR ab 1952, Ulich-Beil, offenbar nicht zu Wuesthoffs Friedenskreis gehört hatte. Bereits auf einer von Wuesthoff im Juni 1948 in Stuttgart veranstalteten Konferenz war bezeichnenderweise nicht Wuesthoff selbst, sondern Theanolte Bähnisch einer anwesenden Britin als die herausragende Teilnehmerin aufgefallen „as she brought much that was too high flown firmly down to earth […] it will be chiefly due to Frau Bähnisch if they show practical results“160. Diese sei in der Lage, aufgrund ihrer Stellung als Leiterin der überparteilichen Frauenorganisationen in der britischen Zone und aufgrund ihrer engen Beziehungen zu den übrigen westlichen Zonen andere Frauenorganisationen voranzubringen und ihnen Akzeptanz zu sichern, urteilte die unbekannte Verfasserin des Berichts.161 Damit kürte sie die Regierungspräsidentin schon vor der interzonalen
155
156 157 158
159 160 161
Heidelberger Frauenvereins war, verantwortlich gezeigt. Vgl.: Guttmann, Barbara: Den weiblichen Einfluß geltend machen. Karlsruher Frauen in der Nachkriegszeit, 1945– 1955, Karlsruhe 2000, S. 131. Ebd., S. 191. Wuesthoff verantwortete die Gründungen in Baden-Baden, Tübingen (Südwürttembergischer Frauenring), in Lindau und die Gründung des Landesfrauenrings in Rheinland-Pfalz. Der erste unter den Verbänden war auf Wuesthoffs gemeinsames Betreiben mit Leonore Mayer-Katz und der Stadträtin Elisabeth von Glasenapp in BadenBaden durch die französischen Besatzungsbehörden am 22.02.1947 genehmigt worden. Vgl.: Berthold: Wuesthoff, S. 111. Zu von Velsen siehe 8.5.3, zu Mayer Katz‘ siehe Kapitel 7.3.2. Vgl.: Zepp: Redefining, S. 222. Daß Weitsch auch Freda Wuesthoff gekannt hatte, geht aus einem Nachruf der Leiterin des Frauenfunks beim Bayrischen Rundfunk auf Freda Wuesthoff hervor. Vgl.: Berthold: Wuesthoff, S. 266/267, hier S. 266. Vgl.: ebd., S. 119, S. 224. NA, UK, FO 1049/1247, Bericht über eine Konferenz in Stuttgart vom 11.-14. Juni 1948, veranstaltet vom Stuttgarter Friedenskreis, o. T., o. V., o. D. [1948]. Ebd.
Staatspolitische Aufgabe
|
733
Konferenz in Bad Pyrmont zu einem Star in der westdeutschen Frauenbewegung. Daß jedoch nicht nur die hoch im Kurs stehende Bähnisch, sondern auch Freda Wuesthoff ihren Einfluß auf die Konferenz von Bad Boll im Mai 1947 ausgeübt haben muß, war an der thematischen Ausrichtung zu erkennen: Die Veranstaltung stand nicht nur dem Titel, sondern auch den Inhalten der Referate nach ganz im Zeichen des Themas ‚Frieden‘. Die Regierungspräsidentin nutzte die Konferenz in Bad Boll, zu der etwa 200 Frauen erschienen waren, um an die Verantwortung der Frauen zu appellieren, aus dem Nationalsozialismus eine Lehre zu ziehen und sich in Zukunft stärker in das öffentliche Leben einzumischen. Dem Erfolg von Bemühungen auf nationaler Ebene setzte sie von vornherein Grenzen: „Unsere Arbeit wird Stückwerk bleiben, wenn uns nicht der Atem der Welt durchweht. Frauen müssen zusammenstehen in einer großen Weltfrauenfriedensfront“162, wird sie in einem Artikel über die Konferenz zitiert. Bezeichnend für Bähnischs herausgehobene Position ist, daß auch der Titel des zitierten Artikels Frauen am Scheideweg‘, der nicht nur über Bähnischs Vortrag, sondern über die gesamte Konferenz informieren sollte, auf Bähnischs Vortrag Bezug nahm.163 Ihre Aussage „Wir müssen uns darüber klar sein, daß wir heute am Scheideweg stehen“164 suggerierte, daß es für Frauen nun unausweichlich sei, sich politisch zu engagieren. Die Parallele dieser Metapher zu einem 1947 durch das OMGUS in Umlauf gebrachten Re-education-Poster ist überdeutlich: Unter dem Slogan „Germany is at the crossroads“ beschreibt das Poster zwei mögliche Wege für Deutschland: Einen, der über ‚Fairness‘, ‚Ehrlichkeit‘, ‚Friede‘, ‚Respekt‘ und ‚Demokratie‘ zu einer „Respected Nation“ führt, und einen zweiten, der über eine entgegengesetzte Entwicklung in Richtung einer „Outcast Nation“165 weist. Mit dem Aufruf, sich stärker in die Politik einzubringen, war also auch eine Richtungserwartung – hinsichtlich einer Kooperation mit Frauen aus dem Ausland, vor allem den Westalliierten verbunden. Auch Agnes von Zahn-Harnack wollte den Frauen den Weg aus dem ‚alten Deutschland‘ weisen. Sie forderte in ihrem Vortrag einen „neuen Nationalismus“, der sich auf ein „neues, anderes Deutschland“166 gründen müsse. Damit bediente sie, wie mit ihrem Referat zum Thema „praktische Wege zu Völkerverständigung“167 insgesamt, ähnliche Inhalte wie Anna Mosolf auf der Gründungsveranstaltung des ‚Club deutscher Frauen‘ in Hannover.168 Auch Zahn-Harnack führte den Frauen die
162 Pfeiffer, Lisbet: Frauen am Scheideweg, in: Die Welt der Frau, 1. Jg. (1947), Heft 1, S. 46 u. 31, hier S. 5. 163 Vgl.: ebd. 164 Ebd. 165 Haus der Geschichte, Bonn, EB-Nr.: 1994/04/0331, Druck 84.9 x 62.4 cm [Germany is at the Crossroads; American re-education poster. US army, American zone of occupation, ca. 1947], online auf: http://www.goethe.de/ges/pok/dun/en2770651.htm, am 13.12.2013. 166 Speicher, Rosine: Interzonale Frauenkonferenz, in: Frauenwelt Heft 12/13 (Juni/Juli 1947), zitiert nach Zepp: Redefining, S. 222. 167 Vgl: Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 136. 168 Vgl.: Zepp: Redefining, S. 222.
734 | Theanolte Bähnisch
Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit vor Augen. Für ihren Ruf nach einem „neuen Nationalismus“ erhielt sie nach der Konferenz von der CSU-Politikerin Elisabeth Meyer-Spreckels, der „reinigende Vaterlandsgefühle in durchaus passender Weise“169 angemessen erschienen, Lob. Freda Wuesthoff hatte sich in ihrem Referat über „Atomenergie und die Wirkung der Atombombe“170 mit der Frage auseinandergesetzt, welche besondere Beziehung ‚die Frau‘ mit dem Friedensgedanken verbinde171. Vor dem Hintergrund der Gefahren des atomaren Zeitalters hatte sie „die Haltung des absoluten bedingungslosen Friedens“172 gefordert. Die Interpretation, daß es der Physikerin gelungen war, Bähnisch von der Relevanz ihres Kernthemas zu überzeugen, legt insbesondere ein Artikel nah, der sich in der ‚Stimme der Frau‘ findet. Zumal dieser an die bereits an anderer Stelle angerissene Überzeugung friedensbewegter Mitglieder der Frauenbewegung anknüft, daß Frauen per se friedfertig und Männer per se aggressiv seien. „Seit Menschengedenken wird die Geschichte von Männern gemacht. Das Ergebnis ihrer Bemühungen ist erstaunlich, ein grandioser Fortschritt. Man denke nur an den stolzen Weg, der von Thermophylen nach Hiroshima führt: 300 Gefallene in einem langen Kampf – 78150 Tote in einer Sekunde! Und heute, keine drei Jahre nach jenem glorreichen Tage, an dem der Kriegsgott seine bisher erfolgreichste Waffe zum ersten Male praktisch erprobte, sind wir noch einen Schritt weiter. Wenn heute die Diplomatie versagt, brauchen die Politiker nur auf den Knopf zu drücken, um die Welt aus den Angeln zu heben. An den starken Herzen, die dazu gehören, wird es, wie die Erfahrung gezeigt hat, nicht fehlen. Noch ist es Zeit, auf die Stimme der Frau zu hören...“173 Neben dem Thema Völkerversöhnung standen Marianne Zepp zufolge die Themen ‚angewandte Volkswirtschaft‘ und ‚staatsbürgerliche Verantwortung‘ im Mittelpunkt der Tagung.174 Eine auf der Konferenz gefaßte Entschließung zur staatsbürgerlichen Erziehung von Frauen enthielt das Ziel „uneingeschränkter Mitwirkung [von Frauen] auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens“175. ‚Staatsbürgerinnenschulen‘ einzurichten wurde ebenso zur Forderung erhoben, wie eine staatsbürgerliche und wirtschaftspolitische Erziehung an den Schulen einzuführen und die ‚Geschichte der Frauenbewegung‘ als Schulfach in das Curriculum mit aufzunehmen.176 Jene Forderungen lagen ganz auf der Linie Bähnischs, die davon überzeugt war, daß die Mitarbeit von Frauen in gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen erwünscht und notwendig sei, daß aber die Kenntnisse, die die Frauen dazu befähigen würden, erst
169 Vgl.: Hauptstaatsarchiv München, OMGBY 10/49-3/1; Meyer-Spreckels, Dr. Elisabeth: Persönliche Eindrücke von der interzonalen Frauenkonferenz in Bad Boll, 20. bis 23. Mai 1947, 19.07.1947, nach Zepp: Redefining Germany, S. 224. 170 Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 135. 171 Vgl.: ebd., S. 136. 172 Pfeiffer: Scheideweg, S. 4. 173 Wolf: Augen. 174 Vgl.: ebd. 175 Zepp: Redefining, S. 222. 176 Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 36.
Staatspolitische Aufgabe
|
735
noch erworben und als Lerninhalte verstetigt werden müßten. Die Regierungspräsidentin dürfte sich auf der Konferenz also am richtigen Platz gefühlt haben – wenn sie nicht selbst steuernden Einfluß auf das Gespräch über staatsbürgerliche Bildung ausgeübt hatte, was sich der Literatur leider nicht entnehmen läßt. Weitere Forderungen, die die Frauen auf der Konferenz gegenüber den Besatzungsmächten erhoben, betrafen die Behebung der Wohnungsnot, die Verbesserung der Versorgungslage und die Jugenderziehung im Rahmen von Koedukationsschulen177. Jene Forderungen erinnern stark an die Ziele, welche sich der ‚Club deutscher Frauen‘ ein Jahr zuvor in Hannover gesetzt hatte – was den Eindruck eines starken Einflusses von Seiten der Regierungspräsidentin auf die Konferenz unterstreicht. Im Mai 1947 wurde auf der Konferenz, was Mitte 1946 noch als Ziel formuliert und den Frauen weitgehend selbst auferlegt worden war, in Form von ‚Forderungen‘ an die Westmächte gerichtet. Dies läßt sich als Ausdruck eines gewachsenen Selbstbewußtseins in der deutschen Frauenbewegung werten. Als Thema neu hinzugekommen war die Forderung nach der ‚Freilassung der Kriegsgefangenen‘178, wobei nicht klar ist, ob das Thema schon auf der Konferenz – wie es ab 1948 in der ‚Stimme der Frau‘ der Fall war179 – propagandistisch gegen die Politik der Sowjetunion, wo sich die meisten Kriegsgefangenen befanden, gewendet wurde. Eine spannende, jedoch aus der Literatur nicht zu beantwortende Frage ist, ob es überhaupt im Sinne der deutschen Initiatorin Käser war, daß die genannten Hauptrednerinnen in Bad Boll sprachen. Als es um die Aufstellung der Gästeliste ging, hatte das OMGUS der 1882 geborenen Studienrätin und Ministerialreferentin im Bayrischen Ministerium für Unterricht und Kultus, welche bereits in den 20er Jahren Abgeordnete des Bayerischen Landtags gewesen war180, nämlich das Heft aus der Hand genommen. Wäre es nach Käser gegangen, wären zur Konferenz Vertreter(innen) aus Ministerien, aus dem Erziehungswesen, aus Kirchen, Jugendgruppen und Gewerkschaften eingeladen worden. Dies widersprach, oberflächlich betrachtet, eher der Einladung Zahn-Harnacks und Wuesthoffs, als der Bähnischs. Aber daß sich die Konferenz schließlich vor allem an die Vertreterinnen überparteilicher FrauenOrganisationen richtete – für die Bähnisch wie keine andere ‚Patin‘ stand – und daß diese Personen eher ihrer Persönlichkeit181 als ihrer Funktion wegen eingeladen wurden, war von OMGUS ausgegangen. Daß die deutschen Delegierten offiziell im Namen des Stuttgarter Frauendienstes zur „Frauenkonferenz aller Zonen“ geladen worden waren, darf als ein Akt des Gehorsams gegenüber dem OMGUS interpretiert
177 Vgl.: ebd. 178 Vgl.: Zepp: Redefining, S. 222/223. 179 Vgl.: Freund: Krieg, S. 106–123. Vgl. zur propagandistischen Verwendung der Kriegsgefangenenfrage in Westdeutschland gegen die Sowjetunion auch den bereits im Zusammenhang mit der Flüchtlingsabteilung des Regierungspräsidiums erwähnten Titel: Müller/Ueberschär: Krieg, S. 374–409. 180 Vgl.: Zepp: Redefining, S. 221. 181 Vgl.: ebd., S. 222. Zepp entnahm die Information, daß Lüders persönlich eingeladen worden war, einem Brief Lüders an Theanolte Bähnisch. Sie erwähnt jedoch nicht, daß Bähnisch ebenfalls zu den persönlich eingeladenen Gästen zählte.
736 | Theanolte Bähnisch
werden.182 Die Einladung von Rednerinnen und Teilnehmerinnen aus dem westlichen Ausland, aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Großbritannien und den USA hatte OMGUS sogar komplett in Eigenregie vorgenommen183 und so der Regierungspräsidentin zu einer großen Bühne vor Frauen aus verschiedenen Nationen verholfen. 7.3.2 Ein großer Schritt für die Frauenbewegung oder ein Beitrag zur Restauration traditioneller Geschlechterrollen? Die Bewertung der Konferenz in der Forschung Die in der Frauenbewegung engagierte Historikerin und Mitarbeiterin der BöllStiftung, Marianne Zepp, schreibt in ihrer Studie über Frauenpolitik im USamerikanisch besetzten Nachkriegsdeutschland, daß in Bad Boll zum ersten Mal mit einer weiblichen Interessenlage verknüpfte sozialpolitische Forderungen erhoben worden seien und daß sich auf der Konferenz unter dem Begriff der ‚Staatsbürgerlichkeit‘ eine „Politikstrategie der Teilhabe“184 formiert habe, die Zepps Meinung nach für alle Beteiligten – also sowohl für die ‚Überparteilichen‘, als auch für die ausschließlich auf Parteiarbeit konzentrierten Politikerinnen‘ – ein gemeinsames Ziel habe darstellen können.185 Für die von deutschen Frauen geäußerten sozialpolitischen Forderungen mag dies – zumal Sozialdemokratinnen wie Lisa Albrecht die Konferenz mitgestaltet hatten, wenn sie auch weniger im Rampenlicht standen als die genannten Hauptrednerinnen – zutreffend gewesen sein. „Vor allem hätte man erwarten können, dass die Abgrenzung gegenüber dem neu gegründeten Ostverband DFD die organisatorischen Anstrengungen und den Zusammenhalt auf westlicher Seite beschleunigen würde“, spielt Zepp auf einen möglichen Zusammenschluß der auf der Konferenz repräsentierten Gruppen zu einem Großverband an. „Das war […] allerdings nicht der Fall.“186 Interessanterweise war es, darauf wird an anderer Stelle zurückzukommen sein, ausgerechnet Theanolte Bähnisch, die in Bad Boll verkündete, daß es für einen größeren Zusammenschluß von Frauenverbänden in den Westzonen noch zu früh sei, weil sich die Sache „organisch“187 entwickeln müsse. Will man den Erfolg der Konferenz einer Einschätzung unterziehen, so sollte nicht vergessen werden, daß das OMGUS und die als Gäste geladenen Vertreterinnen der amerikanischen Frauenbewegung wesentlichen Einfluß auf die Konferenz und die Themen, die in Bad Boll zur Sprache kamen, genommen hatten. Der ‚Beigeschmack‘, den die Konferenz auch aus diesem Zusammenhang heraus erhalten hatte, dürfte Käser, die SPD-Politikerin Lisa Albrecht und anderen Frauen, die zunächst ei-
182 BArch, SAPMO DY 31/1283, Einladung zur Frauenkonferenz aller Zonen in Bad Boll bei Göppingen, 25.04.1947, Abschrift. 183 Ebd. 184 Zepp: Redefining, S. 225. 185 Vgl.: ebd. 186 Ebd. 187 Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau.
Staatspolitische Aufgabe
|
737
ne andere Gästeliste – und damit auch eine andere Themengewichtung im Sinn gehabt hatten188 – in ihrem Enthusiasmus für die ‚gemeinsame Sache‘ gebremst haben. So wird der Vorschlag anwesender Amerikanerinnen, ein freiwilliges Dienstjahr für junge Mädchen in privaten Haushalten einzuführen, mit dem Argument, daß damit gleichzeitig die Not der Hausfrauen behoben und das Verantwortungsbewußtsein Jugendlicher geschult werden könne, überzeugten Sozialdemokratinnen kaum eingeleuchtet haben. Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld werten den Vorstoß der nicht näher bezeichneten ‚Amerikanerinnen‘ als eine arbeitspolitische Bemühung, die darauf abzielte, den hauswirtschaftlichen Bereich als Berufsbild für Frauen und Mädchen attraktiv zu machen. Mit diesem Vorgehen habe, so Henicz und Hirschfeld, ein „spezifisch weibliches“189 Verantwortungsgefühl geweckt werden sollen. Im Argument der Autorinnen, daß sich hieran die Orientierung der Frauenorganisationen an traditionellen Elementen ablesen lasse190, steckt, so unspezifisch es auch sein mag (zumal hier ein Einwurf von Amerikanerinnen auf die deutschen Verbände projiziert wird) doch ein wichtiger Kern: Nicht nur die britischen Frauenverbände, mit denen Bähnisch eng kooperierte, sondern auch Vertreterinnen amerikanischer Frauenverbände, die sich durch ihren Besuch für den Wiederaufbau der deutschen Frauenbewegung engagierten, trugen zum Fortbestehen von Idealen, welche die Arbeit von bürgerlichen Frauenorganisationen in Deutschland vor 1933 geprägt hatten, bei. Die nach Orientierung suchenden Protagonistinnen der deutschen überparteilichen Frauenbewegung wurden also von amerikanischer Seite191 in ihrem Festhalten an ge-
188 Informationen über die Gästeliste gehen offenbar auch aus einem von mir nicht eingesehenen, von Heniz/Hirschfeld verwendeten Dokument hervor, daß diese als ‚Siebold, Judith: Bericht über die Frauentagung vom 20.–23.05.1947 in Bad Boll, masch.-schriftl., o. O., o. J.‘ bezeichnen. Offenbar handelt es sich um ein Dokument aus dem mittlerweile im Landesarchiv Baden-Württemberg zugänglichen Privatnachlaß der Politologin Judith Siebold, geborene Spindler, die nach ihrer Scheidung wieder ihren Mädchennamen annahm. Spindler engagierte sich in der Frauenbewegung in Süddeutschland. Landesarchiv Baden-Württemberg, Q 1/44, Bü 2. Darin enthalten ist laut dem Archiv-Katalog ein Bericht von Judith Spindler über Themen und Referentinnen der Frauentagung in Bad Boll. In Q1/44 Bü 4 ist auch ein von mir ebenfalls nicht eingesehener Bericht über die Gründung des Deutschen Frauenrings in Bad Pyrmont vom 7.–10. Oktober 1949 überliefert. Vgl.: Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Findbuch/Katalogeintrag Q 1/44 Bü 1, Süddeutscher Frauenarbeitskreis München, Frauenarbeitskreis Geislingen, auf: https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=6745&klas si=&anzeigeKlassi=001, am 09.08.2014. 189 Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 136. 190 Vgl.: ebd. 191 Der DFD-Generalsekretärin Maria Rentmeister zufolge sprachen auf der Konferenz etwa 15 Amerikanerinnen, die sie jedoch nicht näher benennt. BArch, SAPMO DY 31/294, Bericht von Maria Rentmeister über die Konferenz von Bad Boll, o. D. Christl Ziegler schreibt, daß unter anderem Elizabeth Holt, die zeitweilige Leiterin der Women’s Affairs Section beim OMGUS, die Frau des Militärgouverneurs von Württemberg-Baden, Mrs. Sumner Sewall sowie die spätere Leiterin der Abteilung für Erwachsenenbildung unter
738 | Theanolte Bähnisch
schlechtsspezifischen Zuschreibungen und einer entsprechenden Agitation bestärkt. Dies trug, ebenso wie der Einfluß der britischen ‚Women’s Group on Public Welfare (WGPW)‘, zur Kontinuität traditioneller Geschlechterrollen in Deutschland nach 1945 bei.192 Ein Widerspruch zwischen der ‚Initiative Hauswirtschaft‘, die durchaus als Plädoyer für ein Festhalten an traditionellen Rollenmustern zu lesen ist, und der ebenfalls auf der Konferenz geforderten ‚staatsbürgerlichen Erziehung‘ schien sich für die Amerikanerinnen nicht aufgetan zu haben. Schließlich war nicht nur für den britischen, sondern auch für den US-amerikanischen Staat die klassische Aufgabenverteilung zwischen den Geschlechtern eine tragende Säule, vor allem im Bereich der Sozialarbeit. Die Eignung von Frauen als Hüterinnen des Haushalts, als Erzieherinnen der Kinder, als Wohlfahrtspflegerinnen und auch als Mitarbeiterinnen in den entsprechenden Verwaltungssparten wurde in beiden Nationen als ‚gegeben‘ angenommen und war entsprechend Bestandteil der nationalen (Sozial-)Politik und damit auch der Außenpolitik beider Staaten.193 Ebenso wie die Britinnen glaubten, durch die ‚Rückkehr‘ deutscher Frauen zu sozialer Arbeit ein ethisches Empfinden, das über die Zeit des Nationalsozialismus abhanden gekommen zu sein schien, wieder erwecken zu können, so sahen die auf der Konferenz anwesenden Amerikanerinnen im Einsatz junger Mädchen für überforderte Hausfrauen eine Chance zur Wiedererweckung von Gefühlen wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Verständnis für die Nöte anderer. Warum Männern vergleichbare Erfahrungen nicht zur ‚Auflage‘ gemacht wurden, ist wiederum nur nachvollziehbar über die in der bürgerlichen Frauenbewegung international verbreitete Wahrnehmung von Frauen als ‚Hüterinnen der Kultur‘. Die Argumentation war darauf ausgerichtet, vor allem in jenem Kosmos zu überzeugen, in dem sie entstanden war. Die bereits erwähnten Forscherinnen im Kreis um Annette Kuhn können – wenn auch mit Einschränkungen, auf die später zurückzukommen sein wird194 – mit ihrem Urteil überzeugen, daß in der gesellschaftlichen Neuorientierungsphase der direkten Nachkriegsjahre eine umfassende Modernisierung der Geschlechterrollen nicht stattgefunden hat.195 Bemerkenswert ist, daß Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld, die ebenfalls zu jenem Kreis zu zählen sind, ihre Überzeugung nicht zuletzt an der interzonalen Frauenkonferenz von Bad Boll festmachen.196 Die beiden Autorinnen beklagen auf der Grundlage ihrer Interpretation von ‚Bad Boll‘ und weiterer Frauenkonferenzen den ausgebliebenen Wandel als eine ‚verpaßte Chance‘ und stilisieren die sich
192 193 194 195
196
der Alliierten Hohen Kommission, Alice H. Cook, da gewesen seien. Eine Liste der ausländischen Gäste ist Ziegler zufolge im Hauptstaatsarchiv Stuttgart unter OMGUS RG 260, 12/89-2/10 überliefert. Ebd., Anm. 146. Vgl. dazu den allerdings stark subjektiv geprägten Aufsatz Boehling: Geschlechterpolitik. Vgl.: Gräser : Wohlfahrtsgesellschaft; Wendt, Wolf Rainer: Geschichte der sozialen Arbeit, 4. Aufl., Stuttgart 1995. Siehe Kapitel 8.4.3. In einem Band spricht Kuhn gar vom „Versagen der Frauenpolitik nach 45“. Kuhn, Anette: Vorwort der Herausgeberin, in: dies.(Hrsg.): Nachkriegszeit, Bd. 2, S. 9–10, hier S. 10. Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Frauen, S 135–138.
Staatspolitische Aufgabe
|
739
in dieser Zeit etablierende, neue Führungsfigur der bürgerlichen Frauenbewegung in Westdeutschland, Bähnisch, und ihre Mitstreiterinnen vor diesem Hintergrund zu Anti-Personen der ‚neuen‘ Frauenbewegung.197 Diese Sichtweise wird den komplexen Verhältnissen in der deutschen Frauenbewegung nach 1945, wie bereits ausgeführt, jedoch nicht gerecht und ist kaum hilfreich für eine historische Kontextualisierung von Bähnischs Wirken. Denn sie negiert zum einen die in an anderer Stelle näher ausgeführten, durchaus innovativen Entwicklungen jener Jahre, an die die ‚neue Frauenbewegung‘ in den 1960er und 1970er Jahren anknüpfen konnte.198 Zum anderen nimmt sie weder die Sozialisation der mit dem Wiederaufbau der Frauenbewegung beschäftigten Regierungspräsidentin noch die sehr verschiedenen Erwartungen und sonstigen Umstände, mit denen die Juristin konfrontiert war, in den Blick. Die Berücksichtigung dieser Aspekte vermag jedoch tiefergehende Erkenntnisse hinsichtlich des Handelns von Bähnisch und ihrer Mitstreiterinnen auch auf Frauenkonferenzen wie ‚Bad Boll‘ zu liefern. Weiterführend für die Verortung von Bähnischs Wirken im Wiederaufbau Deutschlands ist deshalb, was nicht oft genug betont werden kann, eine differenzierte Analyse der Interaktionen zwischen den Protagonistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung – allen voran Theanolte Bähnisch – den Vertreterinnen ausländischer Frauenorganisationen, den Militärregierungen sowie den deutschen Frauen, die sich im DFD oder in den Parteien engagierten. Auf diese Weise wird zum einen greifbar, daß ‚Bad Boll‘ mehr war als nur der Auftakt zur Restauration traditioneller Geschlechterverhältnisse. Zum anderen wird deutlich, daß viele Teilnehmer und Beobachter geglaubt hatten, daß die Konferenz noch viel mehr hätte leisten können. Daß ein Großteil dieser nicht erfüllten Erwartungen nach dem Ende der Konferenz von Bad Boll auf die nur einen Monat später tattfindende interzonale Frauenkonferenz von Bad Pyrmont umgelenkt wurde und daß damit die Hauptverantwortliche für diese Konferenz, Theanolte Bähnisch, unter noch stärkeren Erfüllungsdruck geriet als zuvor, wird im entsprechenden Zusammenhang deutlich werden. 7.3.3 Vom Umgang mit Nationalsozialistinnen und Kommunistinnen in Bad Boll – Verhinderungs-, Überwindungs- und Vermeidungsstrategien der Regierungspräsidentin Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang der unterschiedliche Umgang in Bad Boll anwesender – nicht nur deutscher – Frauen mit der deutschen Vergangenheit. Am dritten Tag der Konferenz kam es nämlich zu Auseinandersetzungen darüber, ob die Tagungsteilnehmerinnen von den Besatzungsmächten die Entlassung von Frauen fordern sollten, die in der NS-Frauenschaft eine wichtige Rolle gespielt
197 Vgl.: ebd., passim. 198 In der Arbeit des Archivs der deutschen Frauenbewegung in Kassel wird deutlich, daß in dieser Beziehung mittlerweile ein Umdenken stattgefunden hat und die Bürgerliche Frauenbewegung nach 1945 – wenn auch mit Einschränkungen – als Traditionsbildner der ‚neuen Frauenbewegung‘ anerkannt wird. Vgl. dazu beispielsweise auch Wolff: Traditionsbruch.
740 | Theanolte Bähnisch
hatten und nun in Internierungslagern festgehalten wurden. Einige der anwesenden Frauen hatten dies mit der Begründung beantragt, daß jene Frauen über Erfahrungen in der Frauenbewegung verfügten, welche für deren Wiederaufbau dienlich sein könnten. Die von Henicz und Hirschfeld wiederholt zitierte Kommunistin Herta Dürrbeck, die sich aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit mit den Opfern der Nationalsozialisten identifizierte, fühlte sich, den Autorinnen zufolge, herausgefordert „im Namen der ehemaligen [KZ-]Gefangenen“ gegen den Antrag auf Freilassung der Nationalsozialistinnen zu protestieren. Sie stellte sich gegen eine entsprechende Resolution, die „zur Abstimmung gekommen“ wäre, „wenn ich“ – so wird Dürrbeck zitiert – „nicht dazwischengebrüllt hätte“199. Die Vorsitzende des ‚Club deutscher Frauen‘ hatte eine solche oder ähnliche Auseinandersetzung womöglich bereits im Vorfeld der Konferenz befürchtet. Folgt man Dürrbeck, so hatte Bähnisch versucht, die Kommunistinnen im Club mit dem Argument, es sei „alles ausgebucht“, an der Reise nach Bad Boll zu hindern. „Frau Bähnisch hat gewissermaßen Stielaugen gemacht, als sie mich auch sah“200, wird Dürrbeck über ihren Triumph, trotzdem ein Zimmer ergattert zu haben, zitiert. Ob – und wenn ja, wie – sich die Regierungspräsidentin in der Frage der Entlassung internierter Frauen auf der Konferenz positionierte, ist nicht bekannt. In der ‚Stimme der Frau‘ wurde mehrmals die Freilassung internierter Frauen aus sowjetischen Gefängnissen und Kriegsgefangenenlagern gefordert201, was vermuten läßt, daß die Herausgeberin der Zeitschrift die in Bad Boll angestrebte Resolution als ‚hoffähig‘ wahrgenommen hatte. Allerdings geht aus den Texten in der Zeitschrift nicht hervor, daß es explizit um Mitglieder der NS-Frauenschaft gegangen wäre, und die Texte plädierten auch nicht dafür, diese Frauen für den Wiederaufbau der Frauenbewegung heranzuziehen. Die von Henicz und Hirschfeld konstatierte „Vermeidung einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit der jüngsten deutschen Vergangenheit“202, die ihrer Meinung nach im Antrag auf Freilassung der Nationalsozialistinnen und allgemein auf der Konferenz zum Ausdruck gekommen war, läßt sich in der Arbeit Bähnischs tatsächlich beobachten. Hieraus – wie die Autorinnen es tun – eine „Ignoranz gegenüber all den Frauen, die in den Konzentrationslagern umgekommen sind und jenen, die im Faschismus im Widerstand gearbeitet haben“203 abzuleiten, ist jedoch, allein schon vor dem Hintergrund von Bähnischs weitgespannten Kontakten zu Jüdinnen und zu Aktivisten des Widerstands gegen den Nationalsozialismus, verfehlt. Ihr
199 Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 137. 200 Ebd., S. 138. 201 Vgl.: o. V.: Aus der Frauenwelt. Antrag an die Sowjetunion, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 9, S. 39; o. V.: Notizen aus aller Welt, Zentralsuchstelle für vermißte deutsche Frauen, in: Stimme der Frau, 1. Jg, (1948/49), Heft 9, S. 2; o. V.: Notizen aus aller Welt, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 7, S. 2 und o. V.: Notiert aus aller Welt, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 10, S. 2 sowie Freund:Krieg, S. 111– 113. 202 Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 137. 203 Ebd.
Staatspolitische Aufgabe
|
741
Handeln war vielmehr von dem Bedürfnis geprägt, den in den Köpfen vieler noch immer virulenten Nationalsozialismus zu überwinden und zu verhindern, daß vergleichbare Verhältnisse erneut entstehen könnten. Ihr erklärtes Ziel war es, ihr Heimatland wieder zu einer friedfertigen und im Ausland geachteten Nation aufzubauen. Bähnischs Wahl der Mittel, nämlich zum einen, den Nationalsozialismus weitgehend zu beschweigen und nach vorn zu schauen, zum anderen, die deutsche Bevölkerung nahezu kollektiv zu Opfern204 des Dritten Reiches zu stilisieren, stieß den vielfach vom Regime verfolgten Kommunistinnen verständlicherweise auf. Zwar benannte die Regierungspräsidentin eine solche ‚Strategie‘ nie explizit, aber aus ihrem Verhalten und aus ihren Aussagen, aus den Diskursen der ‚Stimme der Frau‘, auch aus ihrer Zusammenarbeit mit der britischen Militärregierung und deutschen Erwachsenenbildnern läßt sich schließen, daß es ihr sinnvoller erschien, auf die Mitarbeit der Mitläufer und Sympathisanten des Nationalsozialismus beim Wiederaufbau des Landes und bei der Bekämpfung des Kommunismus zu setzen, als durch ‚aufklärende Arbeit‘ eine Spaltung zu riskieren und die zur Mitarbeit prinzipiell bereiten, nach Bähnischs Darstellung jedoch ‚unwissenden‘ und somit am Nationalsozialismus weitgehend ‚unschuldigen‘ Frauen vor den Kopf zu stoßen und damit zu verprellen. Ihr Vorgehen bestand ganz offensichtlich darin, das später von Alexander und Margarete Mitscherlich als „traumatische Entwertung des eigenen Ich-Ideals”205 beschriebene Scheitern der Allianz von Führer und Volksgemeinschaft nicht noch zu verstärken. Ob ihr in jener Zeit verbreitetes Vorgehen am Ende einen Beitrag zur ‚Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik‘ (Wolfrum; Herbert) leistete oder ob sich der ‚Lange Weg nach Westen‘ (Winkler) durch Beiträge wie den Theanolte Bähnischs noch stärker in die Länge zog, läßt sich nicht herausarbeiten, sondern wird immer eine Interpretations-Frage der Nachkriegsjahre und der folgenden Jahrzehnte bleiben. Daß ein Wiederaufbau Deutschlands ohne jene Mehrheit der Bevölkerung, die den Nationalsozialismus mitgetragen hatte, kaum möglich gewesen wäre, liegt ebenso auf der Hand wie der Umstand, daß sich Versatzstücke der nationalsozialistischen Ideologie dadurch, daß eine intensive erinnerungskulturelle Auseinandersetzung mit dem
204 Zur Problematik von Täter/Opfer-Diskursen auch in der Forschung, die sich in Begriffen wie ‚Opferlüge‘ und ‚Täterthese‘ zuspitzen, vgl. einen Artikel dem das ‚Beispiel Österreich‘ eine größere Distanz zum Thema Nationalsozialismus ermöglicht: Botz, Gerhard: Opfer/Täter-Diskurse. Zur Problematik des Opfer-Begriffs, in: Diendorfer, Gertraud u. a. (Hrsg.): Zeitgeschichte im Wandel, Innsbruck/Wien 1997, S. 223–236. Vgl. zum Einfluß des Kalten Krieges auf die frühen Begriffsprägungen auch: Schlosser, Horst Dieter: Es wird zwei Deutschlands geben. Zeitgeschichte und Sprache in Nachkriegsdeutschland 1945–1949, Frankfurt a. M. 2005 sowie für eine noch stärker abstrahierende diskursanalytische Untersuchung: Kämper, Heidrun: Der Schulddiskurs in der frühen Nachkriegszeit. Ein Beitrag zur Geschichte des sprachlichen Umbruchs nach 1945, Berlin 2005. 205 Mitscherlich, Alexander/Mitscherlich, Margarete: Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, München 1967, S. 590.
742 | The anolte Bähnisch
Nationalsozialismus in Westdeutschland erst Ende der 1970er Jahre begann206, noch lange in vielen Köpfen hielten.207 Fraglos trug Bähnisch, um noch einmal Mitscherlich/Mitscherlich zu bemühen, durch den von ihr verbreiteten „emotionelle[n] Antikommunismus” der Nachkriegszeit, in dem sich „offizielle staatsbürgerliche Gesinnung und fortbestehende ideologische Elemente des Nationalsozialismus“ amalgamierten, dazu bei, eine in der Retrospektive als sehr fragwürdig zu betrachtende Staats- und Gesellschaftsräson zu etablieren. Dem Politologen Iring Fetscher zufolge verhalf das verbreitete Verhalten, den Antitotalitarismus als Integrationsideologie zu bemühen, sogar dazu, „einen scheinbaren Konsens zwischen den ehemaligen Nazis und den Verfolgten des Naziregimes herzustellen: während die einen bei dem Wort ‚Totalitarismus‘ an den deutschen Faschismus dachten, den sie schon immer bekämpft hatten, konnten die anderen sich an ihren ehemaligen Antikommunismus erinnern.“208 Daß die Mitscherlichs mit ihrem kollektivpsychologischen Ansatz im Grunde in die gleiche Kerbe schlugen wie es die massenpsychologischen Betrachtungen aus den 20er und 30er Jahren taten, auf die Bähnisch ihre Einschätzung des Nationalsozialismus und des Kommunismus als eine „psychologische Zwangsläufigkeit“209 gründete und daß der Kommunikationsforscher Tobias Freimüller zu Recht die empirische Beweiskraft des Werks in Frage stellt210, sei nicht nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Durch Stärkung der individuellen „kritischen Ich-Leistung“211 sollte in der Einschätzung der Mitscherlichs eine Immunisierung der Gesellschaft gegen vergleichbare Entwicklungen möglich werden – die Regierungspräsidentin hätte über der Lektüre vermutlich zustimmend genickt. Hermann Lübbes Rede zum 50. Jahrestag des 30.01.1933 im Jahr 1983 konnte die Regierungspräsidentin nicht mehr hören. Der Philosoph beschrieb das „kommunikative Beschweigen“ der NS-Vergangenheit in den 1950er Jahren als notwendig zur gesellschaftlichen Integration der jungen Bundesrepublik und setzte die morali-
206 Als Auslöser der zu dieser Zeit aufkommenden Debatten fungierte der in den USA produzierte, aber auch in Deutschland ausgestrahlte Vierteiler ‚Holocaust‘, der die Geschichte der jüdischen Berliner Arztfamilie Weiss beschreibt. 207 Vgl.: Mitscherlich/Mitscherlich: Unfähigkeit sowie für eine aktuelle Einordnung des Werks: Freimüller, Tobias: Der versäumte Abschied von der Volksgemeinschaft. Psychoanalyse und „Vergangenheitsbewältigung“, in: Danyel, Jürgen/Kirsch, Jan-Holger/Sabrow, Martin (Hrsg.): 50 Klassiker der Zeitgeschichte, Göttingen 2007, S. 66–70. 208 Fetscher, Iring: Der Totalitarismus, in: Koebner, Thomas/Köpke, Wulf/Radkau, Joachim (Hrsg.): Exilforschung, Frankfurt a. M./Bern/New York, zitiert nach: Schindler, Roland W.: Geglückte Zeit, gestundete Zeit. Hannah Arendts Kritik der Moderne, Frankfurt a. M./New York 1996, S. 113. 209 Freimüller: Abschied S. 69. 210 Vgl.: ebd., S. 68. 211 Mitscherlich, Alexander: Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Ideen zur Sozialpsychologie, München 1963, S. 40. Vgl. zu einer Darstellung Mitscherlichs von pädagogischer Seite auch: Hoyer, Timo: Im Getümmel der Welt. Alexander Mitscherlich – Ein Porträt, Göttingen 2008.
Staatspolitische Aufgabe
| 743
schen und politischen Kosten, die die Unfähigkeit zum selbstkritischen Umgang mit der Vergangenheit verursachte, deren langfristig stabilisierender Wirkung entgegen.212 Bei näherer Betrachtung demontieren die Thesen Lübbes die Kernthese von Mitscherlichs Werk nicht einmal – auch wenn sie im Widerspruch dazu gedacht waren. Schließlich hielt der Umstand, daß sich der Nationalsozialismus gar nicht verdrängen ließ – eine Kernthese Lübbes – die Bürger nicht davon ab, sich in Verdrängung zu üben – ein Kernvorwurf der Mitscherlichs. Bähnisch setzte auch nach ‚Bad Boll‘ fort, was sich auf der Konferenz als eines der richtungsweisenden Prinzipien in der westdeutschen überparteilichen FrauenArbeit der nächsten Jahre herauskristallisierte: Sie widmete ihre Kraft dem Wiederaufbau des Landes und vermied gleichzeitig die (öffentliche) Auseinandersetzung mit den Ereignissen und Strukturen, die den Neuanfang unausweichlich gemacht und dafür gesorgt hatten, daß der zweite deutsche Wiederaufbau unter noch strengeren Augen der Siegermächte von Statten ging, als es in der ersten Nachkriegszeit der Fall gewesen war. Wie sich ebenfalls in ‚Bad Boll‘ zeigte, vermieden jedoch auch die Siegermächte den Konfrontationskurs weitgehend. Zwar hätten Britinnen und Amerikanerinnen mehrfach die Kriegsschuldfrage auf der Konferenz angesprochen, schreiben Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld. Die „Gesamtproblematik Faschismus“ sei dabei jedoch umgangen worden.213 „Eine Amerikanerin sprach uns aus dem Herzen als sie ihre ewige Erörterung für fruchtlos erklärte“214 zitieren die Autorinnen zur Untermauerung ihrer Ausführungen aus dem Tagungsprotokoll einer Teilnehmerin. Dieses Verhalten auf der Konferenz von Bad Boll erinnert an die Quasi-Absolution, die die Präsidentin des British National Council of Women mit den Worten „wir wollen vergessen was gewesen ist“215, bereits im August 1946 in Hannover an Bähnischs Adresse gerichtet hatte. Daß Bähnisch diese Aussage wiederholt zitierte216, läßt sich dergestalt interpretieren, daß sie sich durch die Position der Britin in ihrer Haltung bestätigt sah. Die im DFD organisierten Frauen und die Kommunistinnen, die in Westdeutschland lebten, verfolgten eine andere Strategie des Umgangs mit der Vergangenheit. Zwar teilten sie mit den Frauen, die an die Tradition des BDF wieder anknüpfen wollten, den Wunsch nach einem ‚weltweiten Frieden‘, doch vertraten sie, anders als die Frauen aus dem bürgerlichen Lager, nicht die Überzeugung, daß Frauen per se
212 Vgl.: Lübbe, Hermann: Der Nationalsozialismus im deutschen Nachkriegsbewußtsein, in: Historische Zeitschrift, 236. Jg. (1983), S. 579–599. Vgl. zur Gegenüberstellung der beiden Ansätze auch: Schildt, Axel: Zur Durchsetzung einer Apologie. Hermann Lübbes Vortrag zum 50. Jahrestag des 30. Januar 1933, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 10. Jg. (2013), Heft 1, auf: http://www. zeithistorische-forschungen.de/16126041-Schildt-1-2013, am 29.01.2014. 213 Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 137. 214 Ebd. 215 DFR-Archiv, Freiburg, A1, Bähnisch, Theanolte: Geschäftsbericht vorgelegt auf der Hauptversammlung in Berlin am 28.–29. März 1952, S. 2. 216 Ebd. Auch im Rahmen ihrer Rede anläßlich des 10jährigen Bestehens des DFR wiederholte Bähnisch Cowans Worte.
744 | Theanolte Bähnisch
friedfertig seien. Ihnen war daran gelegen, nicht nur das Fehlverhalten der Männer, sondern auch das vieler Frauen im Nationalsozialismus anzuprangern.217 Auf der Konferenz von Bad Boll hatten die im DFD organisierten Frauen dazu jedoch kaum Gelegenheit bekommen. Zwar waren zur Konferenz Vertreterinnen aus der SBZ und aus Ostberlin eingeladen worden. Jedoch hatten diese Frauen, anders als die Frauen, die aus der französischen und britischen Besatzungszone gekommen waren, keinen Einfluß auf die Gestaltung der Konferenz nehmen können. Zudem war ihnen nicht einmal annähernd soviel Redezeit eingeräumt worden, wie den anderen Teilnehmerinnen. Gabriele Strecker, später ein führendes Mitglied des DFR, berichtete über Bad Boll, ohne dies zu kritisieren, daß die „ostzonale Delegation […] sehr klein“ gewesen sei und daß ihre Mitglieder „mehr den Status von Beobachterinnen“218 gehabt hätten. Lisbet Pfeiffer kritisierte in der Zeitschrift ‚Die Welt der Frau‘, die sie gemeinsam mit einer Ikone der Frauenbewegung, Marianne Weber, herausgab, jedoch die unausgewogene Verteilung der Redebeiträge: „Da man bei anderen Frauen [...] hin und wieder bei stillschweigender Zustimmung der Hörer ein Auge zugedrückt hatte, wenn sie die vorgeschriebene Redezeit überschritten, hätte man erwarten können, daß wenigstens einer der Vertreterinnen der Ostzone Gelegenheit gegeben worden wäre, ausführlicher von der dortigen Frauenarbeit zu berichten.“219 Doch nicht einmal die Leiterin des Gesundheitswesens in der Verwaltung der SBZ habe einen ausführlichen Bericht über die Frauenarbeit im Osten erstatten dürfen. „Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, daß sie vom Osten nichts hören wollen. [...] Wir brauchen den Westen genau so, wie sie den Osten; es liegt an uns allen, ob die Grenzen sich verschärfen oder ob sie eines Tages fallen werden“220, wurde sie von Pfeiffer zitiert. Gabriele Strecker sah die Verantwortung für die Spannungen zwischen den Frauen aus den Westzonen und der SBZ jedoch nicht auf Seiten der westzonalen Verbände. Es habe sich auf der Konferenz gezeigt, so Strecker, „daß es fast unmöglich war, mit den Vertreterinnen aus der russischen Zone in ein Gespräch zu kommen“221.
217 Die Einschätzung Ingeborg Nödingers zur entsprechenden Politik des DFD, die in der Ausfsatzsammlung Anette Kuhns den Aufsätzen über den Club deutscher Frauen/Frauenring vorangestellt sind, urteilt zu einseitig (positiv): Nödinger: Mitwissen, S. 122–126. Erhellend über den unterschiedlichen Umgang mit dem Nationalsozialismus in Ost und West wirkt: Lepsius, Rainer M.: Das Erbe des Nationalsozialismus: Das Legat zweier Diktaturen für die demokratische Kultur im vereinigten Deutschland, in: Holtmann, Everhard/Sahner, Heinz (Hrsg.): Aufhebung der Bipolarität. Veränderungen im Osten, Rückwirkungen im Westen, Opladen 1995, S. 25–39. Zu einer Einschätzung der Handlungsspielräume von Frauen im Nationalsozialismus vgl.: Heinsohn, Kirsten/Vogel, Barbara/Weckel, Ulrike (Hrsg.): Zwischen Karriere und Verfolgung. Handlungsspielräume von Frauen im nationalsozialistischen Deutschland, Frankfurt a. M. 1997. 218 Strecker: Frauenarbeit, S. 11. 219 Pfeiffer: Scheideweg S. 31. 220 Ebd. 221 Strecker: Frauenarbeit, S. 12.
Staatspolitische Aufgabe
|
745
7.3.4 Die Bewertung durch zeitgenössische deutsche und ausländische Beobachter Neben den erwähnten Amerikanerinnen waren auch einige Britinnen Zeuginnen der Vorgänge in Bad Boll gewesen, unter ihnen die Mitarbeiterin der britischen Militärregierung, Rita Ostermann. Sie war von der Political Division der CCG (BE) zur Konferenz abgestellt worden, obwohl doch auf der Grundlage der Empfehlungen von Helena Deneke und Betty Norris beschlossen worden war, daß weiterhin die Education Branch für die ‚Women’s Affairs‘ zuständig sein sollte. An Ostermanns Anwesenheit auf der Konferenz war abzulesen, daß die Political Division in der Zwischenzeit ebenfalls ein Auge auf die Entwicklungen in der Frauenbewegung geworfen hatte. Neben Ostermann waren auch Women’s Affairs Officers der verschiedenen Regional Headquarters der CCG (BE) erschienen – was die überregionale Bedeutung der Konferenz unterstrich.222 Die Bewertung der Konferenz durch zeitgenössische Teilnehmer und Beobachter war so verschieden wie die Erwartungen, die in die Zusammenkunft gesetzt worden waren. Die Sozialdemokratin Lisa Albrecht, in deren Händen die Tagungsleitung lag hatte, hatte während der Veranstaltung geäußert, daß es wünschenswert sei, eine große Frauenorganisation zu gründen. Sie selbst würde für einen entsprechenden Gründungsakt jedoch nicht zur Verfügung stehen, weil ihre Partei, die SPD, die überparteiliche Frauenarbeit ablehne. Als Theanolte Bähnisch daraufhin in die Offensive ging und sich bereiterklärte, die Sache anstelle von Albrecht in die Hand zu nehmen, protestierten Frauen aus der CDU, daß sie sich – so oder so – nicht dem Diktat der SPD unterwerfen wollten. Maria Rentmeister vom DFD gab daraufhin bekannt, daß ihrer Meinung nach weder eine Frau aus München – womit Albrecht gemeint war – noch eine aus Hannover – womit sie auf Bähnisch anspielte – eine nationale Frauenorganisation leiten solle. Solch ein Amt könne nur eine Frau aus Berlin übernehmen. Da die anderen anwesenden Frauen befürchteten, daß Rentmeister damit Ost-Berlin meine, entstand wiederum Tumult im Saal.223 Zu einer Einigung kam es nicht. In der Retrospektive wurde und wird ‚Bad Boll‘, obwohl man sich dort nicht auf einen organisatorischen Zusammenschluß einigte, dennoch als Synonym für den ersten Schritt zur Bildung eines größeren Frauenzusammenschlusses der Westzonen gehandelt. Nicht nur Bähnisch und ihre Mitstreiterinnen erinnerten die Konferenz in der Gründungsgeschichte des Frauenrings entsprechend224, auch in der Forschung steht die Nennung des Kurorts stellvertretend für den ersten großen ‚Gegenschlag‘ zur Gründung des DFD.225 Insgesamt sei mit ‚Bad Boll‘, „durch die kontrapunktische Betonung zum ostzonalen DFD-Kongreß die Grundlage für das Staatsverständnis der westdeutschen Frauenorganisationen“226 geschaffen worden, schreibt Marianne Zepp
222 223 224 225 226
Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 156. Die Vorgänge sind anschaulich zusammengefaßt bei: Stark: Majority, S. 143/144. Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau; Strecker: Frauenarbeit. Vgl. dazu beispielsweise Tscharntke: Re-educating, S. 163. Ebd., S. 223.
746 | Theanolte Bähnisch
und verweist zur Untermauerung ihrer These auf eine entsprechende Wahrnehmung von Seiten amerikanischer Teilnehmerinnen.227 Führende Vertreterinnen westdeutscher Frauenorganisationen hatten sich jedoch nicht in diesem Sinn geäußert. Tatsächlich lagen der auf der Konferenz wiederholt bemühten Idee des ‚Staatsbürgertums‘ und der Forderung nach ‚staatsbürgerlicher Bildung‘ für Frauen in den Zusammenhängen, in denen die Termini bemüht wurden‚ jene Werte und Ansichten zugrunde, die Theanolte Bähnisch als ‚christlich‘ und damit als ‚westlich‘ definierte:228 Angefangen mit der Idee der ‚wesensgemäßen‘ Mitwirkung von Frauen im Staat, über die Verknüpfung der staatsbürgerlichen Verantwortung mit der christlichen Individualverantwortung bis hin zur Tatsache, daß ‚Staatsbürgerkunde‘ in Schulen für Mädchen anders gelehrt werden sollte als in Schulen für Jungen, distanzierten sich die Rednerinnen aus den westlichen Besatzungszonen von denen aus der SBZ – bewußt oder unbewußt. Daß das, was Zepp als das eigentliche Ziel von ‚Bad Boll‘ bezeichnet, nämlich ein Zusammenschluß von Frauenorganisationen im Westen, nicht erreicht wurde, bewertete der ‚Tagesspiegel‘ positiv: „No uniform organisation was formed – it will be preferable to let a variety of organisations develop by themselves in the future“229, nahm der Autor, nach dessen Meinung politische Frauenarbeit ohnehin besser den Parteien überlassen werden solle, zu der Veranstaltung Stellung. Interessanterweise beschrieb Bähnisch 1959 das Ziel von ‚Bad Boll‘ anders als Zepp, nämlich im Sinn einer engeren Kooperation eigenständiger Frauenorganisationen. „Mit dem Ziel einer engeren Zusammenarbeit fand die erste Besprechung statt zwischen den Vertreterinnen der Verbände, denen die Mitarbeit der Frau in der Öffentlichkeit ein Hauptanliegen war“230, zieht Bähnisch Bilanz der Veranstaltung. „Für die weitere Entwicklung war es wichtiger, dass zuerst ein freundschaftlicher Meinungsaustausch stattfand und eine immer engere Zusammenarbeit angebahnt wurde, als daß eine Einheitsorganisationen des Westens gegründet wurde“231, gab sie sich, gemessen an den Entwicklungen, die folgen sollten – was im Rückblick einfach war – geduldig. Sie kritisierte indirekt sogar jene, die sich mehr von der Konferenz versprochen hatten: „es ist nun einmal so, dass ein Zusammenschluss von oben und auf Kommando sehr schnell geht, aber wenn wirklich eine Organisation von unten her sich organisch entwickeln und wachsen soll, braucht es seine Zeit. Alle verantwortungsbewußten Frauen, die in Bad Boll zusammentrafen waren sich in diesem Punkte völlig einig“232, so Bähnisch.
227 Vgl.: Ebd. 228 Zur Verbindung beider Termine durch Bähnisch vgl. Bähnisch: Himmel. 229 NA, UK, FO 1050/1215, Übersetzung des Artikels: O. V.: Women’s meeting in Bad Boll, in: Der Tagesspiegel, 30.05.1947. Der Artikel bezieht allgemein sehr kritisch Stellung zur bürgerlichen Frauenbewegung. Politische Bildung solle besser den Parteien überlassen werden, so der Autor. 230 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 166. 231 Ebd. 232 Ebd.
Staatspolitische Aufgabe
|
747
Für sie bot die Tagung die Gelegenheit, sich erneut intensiv mit den ‚Grandes Dames‘ der Bürgerlichen Frauenbewegung aus den drei Westzonen auszutauschen, nachdem Wuesthoffs Stuttgarter Friedenskreis und die Konferenz von Bad Boll erste Gelegenheiten dazu geboten hatten. Mit Marie-Elisabeth Lüders hatte Bähnisch ihrem Diktat von 1972 zufolge auch in den 1920er Jahren schon einmal korrespondiert. „Frau Dr. Lüders, eine berühmte Vorkämpferin der Frauenbewegung, hatte sich […] bei mir erkundigt, ob ich auch gleichberechtigt behandelt würde und vor allem, ob ich auch das gleiche Gehalt bekäme“233, hatte Bähnisch im Zusammenhang mit ihrem Eintritt in das Berliner Polizeipräsidium berichtet. Daran, daß sie als frisch gebackene Verwaltungsjuristin in den Genuß von Lüders Patronage gekommen war, konnte sie nach 1945 anknüpfen. Daß mit Bähnisch eine hohe Beamtin anwesend war, führte schließlich mit dazu, daß die Konferenz von einer anderen Teilnehmerin als gelungen bewertet wurde. Mit Befriedigung hatte Dr. Elisabeth Meyer-Spreckels, Sozialpolitikerin der CDU in Bayern, in ihrem Bericht über ‚Bad Boll‘ an OMGUS festgehalten, daß sich unter den Delegierten „10 oder 11 Parlamentarierinnen und eine Regierungspräsidentin“ befunden hatten. Die „staatsbürgerliche Mitverantwortung“, so Meyer-Spreckels, sei damit „deutlich zum Ausdruck gekommen“234. Diese Aussage Meyer-Spreckels dürfte wiederum Bähnischs Popularität bei den Amerikanern gesteigert haben. Gabriele Strecker, mit der sich die Regierungspräsidentin offenbar im April 1947 ange-freundet hatte, schien dem Kongreß, ebensowenig wie Bähnisch mit übersteigerten Erwartungen begegnet zu sein. Sie nahm ‚Bad Boll‘ rückblickend als eine „Bestandsaufnahme der eigene Kräfte“235 wahr – womit sie das Potential der Frauenorganisationen im Westdeutschland meinte. „Die Teilnehmerinnen vergegenwärtigten sich zum ersten Mal den Umfang der […] bisher lokal entwickelten überparteilichen Frauenorganisationen,“236 so die CDU-Politikerin. „Man schied mit einer klaren Vorstellung über Zahl, Aufbau, Stand, Ziele und Arbeit der einzelnen Frauengruppen und knüpfte die Fäden fester zu den Engländerinnen und Amerikanerinnen“,237 faßte sie ‚ihr‘ Tagungsergebnis zusammen. Das Ziel der Amerikaner selbst, „to bring together women of all shades of opinion and from all four zones for a real discussion […] persuading them to lay aside their prejudices […] and overcome the tension between groups“238, war im Hinblick auf die sehr kritischen Kommentare auf der Konferenz und die geringe Beteiligung von Frauen aus der SBZ nur teilweise erfüllt worden. Eine ausländische Beobachte-
233 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Autobiographisches Diktat o. T., o. J. [1972]. 234 Hauptstaatsarchiv München, OMGBY 10/49-3/1, Meyer-Spreckels, Elisabeth: Persönliche Eindrücke von der interzonalen Frauenkonferenz in Bad Boll, 20. bis 23. Mai 1947, 19.07.1947, zitiert nach Zepp: Redefining, S. 224. 235 Strecker, Gabriele: Hundert Jahre Frauenbewegung in Deutschland, Wiesbaden 1951, S. 49. 236 Ebd. 237 Ebd. 238 Eine nicht näher benannte, amerikanische Berichterstatterin, zitiert nach Zepp: Redifining, S. 224.
748 | The anolte Bähnisch
rin berichtete von der Konferenz, daß die Deutschen wohl noch nicht gelernt hätten, Kompromisse zu schließen und anderen Meinungen Raum zu lassen.239 Ein Blick in die Akten des britischen Außenministeriums zeigt, daß den britischen Women’s Affairs Officers schon vor der Konferenz klar war, daß ein ‚revolutionäres Ziel‘ nicht erreicht werden würde. „The conference will be less interzonal in character than was originally intended“240, hatte Officer Reeve eine Woche vor der Konferenz notiert und in diesem Zusammenhang angemerkt, daß der Stand der Frauen-Organisationen in der britischen Zone vielversprechender sei als die der in der amerikanischen – was wohl heißen sollte, daß die Frauen in der britischen Zone ‚bessere‘ Arbeit geleistet hätten, wenn die Organisation der Konferenz in ihren Händen gelegen hätte. Reeve sah in der Unterstützung der Frauenbewegung zu dieser Zeit jedoch bereits eine Aufgabe, die nicht auf die britische Besatzungszone beschränkt bleiben dürfe, sondern für ganz Deutschland relevant sei. Große Hoffnungen setzte sie in Agnes von Zahn-Harnack, welche vorhatte, direkt im Anschluß an ‚Bad Boll‘ in die französische Zone zu reisen, um dort vorzutragen. Dort stand es, wie die Britin anmerkte, um die Frauenbewegung noch schlechter als in der amerikanischen Zone.241 Dort hatte der Frauenverband Hessen – Streckers Organisation – immerhin schon anläßlich seiner Gründungsveranstaltung im Januar 1947 verkündet, „eine große Massenorganisation“ sei notwendig, „um die Interessen der Frauen wirksam zu vertreten“242. Ein bemerkenswerter Kommentar Reeves, bedenkt man, daß die Frauen-Re-education-Politik der Briten auf eine politische Bildung im überschaubaren, lokalen Zusammenhang abgezielt hatte. Auch für die britische Frauenbewegung war diese Idee bereits im Frühjahr 1947 Geschichte. Lady Nunburnholme, die Vizepräsidentin des ICW, hatte den Kontakt zu Zahn-Harnack nach deren Besuch in Großbritannien aufrechterhalten und über sie von den neuen Entwicklungen in der SBZ und in Berlin erfahren. In einem Schreiben an Reeve entpuppte sich die Baroness als Verfechterin eines möglichst schnellen Zusammenschlusses von Frauenorganisationen in Westdeutschland. Auch sie hatte sich von Bad Boll mehr erhofft: „As long as a vacuum exists which has not been filled by any strong women’s society in the British, American and French zones it does leave the field free for the infiltration of Russian influence through the Women’s International Democratic Federation“243, brachte die Expertin in Sachen Internationaler Frauenpolitik ihre Sorge vor der Macht der IDFF gegenüber Reeve auf den Punkt. Was in Bad Boll mit den anwesenden Vertreterinnen des DFD hätte geschehen sollen, ob jene, die einen Zusammenschluß der Frauenorganisationen der Westzonen anstrebten, darauf gehofft hatten, die Delegierten aus dem Osten für ihre Arbeit gegen den DFD überzeugen zu können, oder ob die Gründung unter Ausschluß jener
239 240 241 242
Vgl.: ebd., S. 224. NA, UK, FO 945/283, Note for C 8/55, Reeve. Ebd. Frankfurter Frauen beraten, in: Frankfurter Rundschau, 26.04.1946, zitiert nach Zepp: Redefining, S. 167. 243 NA, UK, FO 945/283, Lady Nunburnholme an Reeve, 13.05.1947.
Staatspolitische Aufgabe
|
749
Frauen hätte stattfinden sollen, das ließ Nunburnholme, ebenso wie alle anderen Kommentatoren, die sich einen Zusammenschluß gewünscht hatten, offen. Zum einen zeichnete sich mit der Konferenz von Bad Boll also eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Frauenorganisationen aus den jeweils anderen westlichen Besatzungszonen ab – wobei für einige Frauen die Zeichen nicht nur auf ‚Zusammenarbeit‘, sondern schon auf ‚Zusammenschluß‘ standen. Zum anderen intensivierte sich die Zusammenarbeit der westdeutschen Frauenbewegung mit Frauen aus dem westlichen Ausland. Auch in dieser Hinsicht waren die Zonengrenzen durchlässiger geworden. Schließlich hatte das OMGUS Frauen aus allen Besatzungszonen zur Konferenz eingeladen. Das Interesse der Britinnen ging sogar so weit, daß britische Frauenorganisationen sich in Bad Boll bereitwillig zeigten, mit deutschen Frauenorganisationen nicht nur zu kooperieren, sondern sich, in Anknüpfung an die Verhältnisse bis 1933, für ihre organisatorische Integration in die internationale Frauenbewegung einzusetzen. Mit Lady Nunburnholme hatte der ICW in Großbritannien ein sehr einflußreiches Mitglied, da die Baronin zugleich Vizepräsidentin des Internationalen Verbands war. Diese war geneigt, die Deutschland-skeptische Präsidentin des Internationalen Verbands, Jeanne-Eder-Schwyzer, davon zu überzeugen, eine westdeutsche Frauenorganisation, die sich der Nachfolge des 1933 ausgeschiedenen BDF als würdig erweise, in den ICW aufzunehmen.244 Für Nunburnholme stand schon im Mai 1947, nach ‚Bad Boll‘, außer Frage, unter wessen Führung die Wiedereinbindung der deutschen Frauenbewegung in den ICW von statten gehen sollte. Gleich im Anschluß an die Konferenz bat Nunburnholme Mrs. Reeve, die Zustimmung der britischen Militärregierung dazu zu ersuchen, daß die Hauptrednerin der Konferenz von Bad Boll, Bähnisch, auch zur Konferenz des ICW in den USA reisen dürfe. Dort sollte die Regierungspräsidentin mit der Idee vertraut gemacht werden, daß eine von ihr geleitete, möglichst starke westdeutsche Frauenorganisation als deutscher Council in den traditionsreichen ICW eingebunden werden könnte.245
244 Ebd. 245 Ebd.
750 | Theanolte Bähnisch
7.4 DIE TAGUNG VON BAD PYRMONT (20. BIS 23. JUNI 1947) UND DIE GRÜNDUNG DES FRAUENRINGS DER BRITISCHEN ZONE DURCH DIE LEITERIN DES CLUB DEUTSCHER FRAUEN 7.4.1 Politische, pädagogische und philosophische Betrachtungen über die ‚Renaissance des Menschen‘ unter der Schirmherrschaft des Kultusministers Daß ein Zusammenschluß von Frauenverbänden auf der Tagung in Bad Boll nicht erreicht worden war, verschaffte Theanolte Bähnisch, dem Club deutscher Frauen und der britischen Militärregierung die Möglichkeit, nur knapp vier Wochen nach ‚Bad Boll‘ einen Ort in der britischen Besatzungszone in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken. Dort sollte eine weitere überparteiliche Frauenkonferenz veranstaltet werden. Das Kurbad ‚Bad Pyrmont‘ avancierte damit zu einem neuen Kristallisationspunkt von Hoffnungen und Wünschen in Bezug auf die Frauenbewegung in Deutschland. Und da klar war, wer die Konferenz leiten würde, bedeutete dies, daß alle Augen, alle Hoffnungen und Befürchtungen auf die Regierungspräsidentin Hannovers gerichtet waren. Ursprünglich hatte die Konferenz schon im April 1947, also vor jener in Bad Boll, stattfinden sollen, zumal sie offenbar insbesondere von den in der bürgerlichen Frauenbewegung engagierten Berlinerinnen sehnsüchtig erwartet worden war.246 Zur Veranstaltung, die schließlich vom 20. bis 23.06.1947 stattfand, hatte Bähnisch umtriebig eingeladen, ihr hatte die zuständige Militärregierung – anders als in Käsers Fall – nicht die Gästeliste aus der Hand genommen. Die Geschwindigkeit, mit der die Zusagen, auch von Vertreterinnen der Frauenverbände in der amerikanischen und französischen Zone, eintrafen, verdeutlicht das große Interesse der Frauen am Austausch untereinander.247 Der Umstand, daß die Vorsitzende des Clubs deutscher Frauen einige andere Frauen gebeten hatte, bereits zu einer Vorbesprechung zu erscheinen, die unmittelbar vor der eigentlichen Konferenz stattfinden sollte, steht beispielhaft für ihre häufig betriebene, informelle ‚Politik im kleinen Kreis‘. Zu den ‚VIP-Gästen‘, die zu dieser besonderen Runde geladen worden waren, zählten Hildegard Meding und Grete Rudorff248, die in Vertretung für die erkrankte Agnes von Zahn-Harnack als offizielle
246 DFR-Archiv, Freiburg, A2, Maria Prejawa an Hildegard Meding, 09.04.1947. Im Brief teilt Prejawa Meding mit, daß das „Treffen in Pyrmont“ verschoben sei. 247 Die damit zusammenhängenden Korrespondenzen, überliefert im Ordner A2 im Archiv des DFR, welches zur Zeit meiner Recherchen in Freiburg nutzbar war, sind bisher nicht Gegenstand einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung geworden. 248 „Es wäre mir lieb, wenn Sie mit Frau Rudorff [gemeint ist die Journalistin Margarete Rudorff, eine Freundin Bähnischs] schon am 19. oder wenigstens am 20. Juni früh hier sein könnten. Ich möchte gern eine kleine Vorbesprechung abhalten“, hatte Bähnisch an Meding geschrieben. DFR-Archiv, Freiburg, A2, Theanolte Bähnisch an Hildegard Meding, 05.06.1947. Die freundschaftliche Verbindung zwischen Bähnisch und Rudorff geht aus
Staatspolitische Aufgabe
|
751
Delegierte des britischen Sektors von Berlin angereist waren.249 Alles deutet darauf hin, daß es sich bei jenem Treffen um eine Strategie-Besprechung zur Gründung einer Frauenorganisation in Westdeutschland, die auf der Tagung in Pyrmont stattfinden sollte, handelte. Eine weitere Tagung voller Überraschungen und Uneinigkeiten, wie sie in Bad Boll stattgefunden hatte, wollte Bähnisch ganz offensichtlich verhindern. Der Anspruch der Regierungspräsidentin, auf der Konferenz „die gegenwärtigen und zukünftigen Probleme der deutschen Frau in wirtschaftlicher, sozialer, beruflicher und kultureller Beziehung“ zu erörtern und „eine Verbindung der bestehenden Frauenorganisationen miteinander“ herzustellen, war ambitioniert. Mit einem solch hohen wie breiten Anspruch aufgeladen, muß die Teilnahme an der Konferenz sehr reizvoll für Frauen, die sich in der Gesellschaft für die Belange ihres Geschlechts stark machen wollten, gewesen sein. 600 Gäste kamen, trotz der schwierigen Reisebedingungen zur Konferenz, 250 davon waren Delegierte von Frauenorganisationen aus der britischen Zone.250 Auch Anne-Marie Durand-Wever, die Vorsitzende des DFD, war zur Konferenz von Pyrmont eingeladen worden. „Durch diese Einladung wollten wir zeigen, daß, wenn wir auch nicht den DFD als eine gesamtdeutsche Organisation anerkannten, wir den Faden mit den deutschen Frauen der sowjetisch besetzten Zone unter keinen Umständen abreißen lassen wollten“251, erklärte Bähnisch jene Einladung in der Retrospektive. Angereist war Durand-Wever gemeinsam mit Nora Melle und Elfriede Paul, die beide ebenfalls Einladungen zur Konferenz erhalten hatten.252 Die Zusammensetzung jener kleinen Delegation aus der SBZ ist besonders interessant: Während Paul zu dieser Zeit bereits von Hannover nach Berlin umgezogen war und ihre frauenpolitischen Aktivitäten, die sie 1946 im Club deutscher Frauen aufgenommen hatte, im DFD fortsetzte, sollte Nora Melle, die zu dieser Zeit noch dem DFD angehörte253, bald den umgekehrten Weg beschreiten und nach
249 250
251 252 253
einem Brief der Mutter Rudorffs hervor. DFR-Archiv, Freiburg, A2, Salomea Schulz an Bähnisch, Juli 1948. DFR-Archiv, Freiburg, A2, Theanolte Bähnisch an Margarete Rudorff, 05.06.1947. Ziegler, Christl: Frauenkongreß in Bad Boll. Auftakt zu internationalen Frauenkongressen in den Westzonen nach 1945, in: Ciupke/Dierichs-Kunstmann: Emanzipation, S. 207–214. Hier S. 210. Den Ausführungen Bähnischs zufolge waren schließlich „über den Rahmen der offiziell geladenen Frauen zahlreiche interessierte Frauen von dieser Tagung angezogen nach Pyrmont gekommen“. Bähnisch: Wiederaufbau, S. 167. Bähnisch: Wiederaufbau, S. 167. DFR-Archiv, Freiburg, A2, Telegramm aus Berlin, in dem das Kommen der Frauen bestätigt wird, an Bähnisch, 12.06.1947. Aus einem Bericht der Intelligence Division geht hervor, daß Melle, die offenbar sogar dem Vorstand des DFD angehörte, nicht mit einer so starken Dominanz der SED im DFD gerechnet hatte und daß sie, als sie von den Entwicklungen desillusioniert war, ihre Energien in den Staatsbürgerinnenverband steckte. NA, UK, FO 1050/1213, Women‘s Organisations, Secret, O. V., o. D., Anhang zu einem Schreiben von G. Brooking, HQ Intelligence Division an die Militärregierungen der Länder, 06.05.1948.
752 | Theanolte Bähnisch
Westdeutschland übersiedeln, wo sie bald eine wichtige Rolle in der ‚gesamtdeutschen Arbeit‘ des Frauenrings spielte.254 Einen ganz besonderen Touch erhielt die Konferenz dadurch, daß der ehemalige preußische und nunmehr amtierende niedersächsische Kultusminister, Adolf Grimme, sie eröffnete.255 Mit vergleichbarer Prominenz aus Deutschland – Grimme war 1947 immerhin eine der maßgeblichen Persönlichkeiten in Bildungsfragen im Land256 – hatte ‚Bad Boll‘ nicht aufwarten können. Die persönliche, freundschaftliche Beziehung zwischen Grimme und Bähnisch machte aus seiner Rede einen symbolträchtigen Beitrag zu dem wichtigen Schritt im Leben Bähnischs, den die Konferenz von Pyrmont mit der Gründung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ bedeutete. Der als moralisch integer geltende Grimme, der in weiten Kreisen angesehen und beliebt war, stand mit seiner Person und seinem Vortrag für die Sinnhaftigkeit der Konferenz ein. „Er profitierte vor allem von dem Bedarf der deutschen Nachkriegsgesellschaft an Persönlichkeiten, die im Kern ihres Denkens und Handelns vom Nationalsozialismus nicht infiziert waren und die eine gewisse allgemeine Anerkennung genossen“257, erklärt Kai Burkhardt, der sich biographisch mit dem Kultusminister auseinandersetzt, den Erfolg Grimmes in der direkten Nachkriegszeit. Diese Aussage läßt sich so interpretieren, als daß auch Grimme aus seinem Auftritt auf der Konferenz einen Nutzen für seine Karriere ziehen konnte. Grimmes ‚Rede an die Frauen‘, welche nicht nur in der Erwachsenen-BildungsZeitschrift ‚Denkendes Volk‘258, sondern zeitnah auch in der ‚Welt der Frau‘259 zum
254 Vgl.: Stoehr: Feindinnen, S. 81. Vgl. dazu auch den Schriftverkehr Bähnischs und Prejawas mit Nora Melle in DFR-Archiv, Freiburg, A2. 255 Im Tagungs-Programm ist die Rede nicht verzeichnet, aber ein Zeitschriften-Artikel nennt Grimme als ersten Redner auf der Konferenz. Der Inhalt seiner Rede deutet ebenfalls darauf hin, daß sie zu Beginn der Konferenz gehalten wurde. Vgl.: Pfeiffer, Lisbet: Frauenschaffen. Der erste Schritt. Konstituierung des „Frauenrings der britischen Zone“, in: Die Welt der Frau, 2. Jg. (1947), Heft 2, S. 26/27, hier S. 26. 256 Das Kultusministerium arbeitete unter Grimme an einer Schulreform, welche auf Plänen aufbaute, die ihren Ursprung in der Weimarer Republik hatten und sich gleichzeitig am britischen Schulsystem orientierten. Vgl.: Burkhardt: Schweigen, S. 98. In konservativen Kreisen habe Grimme als „gefährliche Person“ gegolten, so Burkhardt. Ebd. Er selbst zeichnet Grimme als einen Opponenten, weil er ein flexibles Schulsystem mit starkem Mittelbau auf Kosten des Gymnasiums angestrebt habe. Burkhardt vernachlässigt allerdings den Umstand, daß Grimmes Bildungskonzept zwar Bekenntnisse zur Demokratie lieferte, dabei aber stark auf elitären Ideen fußte. Siehe Kapitel 5.5. 257 Burkhardt: Schweigen, S. 98. 258 Vgl.: Grimme, Adolf: Rede an die Frauen. Ansprache bei einer Tagung der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen der britischen Zone, in: Denkendes Volk, 1. Jg. (1946/47), Heft 7, S. 193–196. Das Original-Manuskript der Rede ist überliefert in Grimmes Nachlaß, GStA PK, VI. HA, NL Grimme, Nr. 444. 259 Vgl.: Grimme, Adolf: Beruf und Leben, in: Die Welt der Frau, 2. Jg. (1947), Heft 2, S. 3– 5. Der Text ist in der ‚Welt der Frau‘ zwar unter einem anderen Titel abgedruckt, der In-
Staatspolitische Aufgabe
|
753
Abdruck kam, verdeutlicht vielerlei260: an erster Stelle Grimmes nicht nur persönliche, sondern auch professionelle Unterstützung für die Arbeit Bähnischs, welche insbesondere auch darin deutlich wurde, daß er nicht allein in seiner Funktion als Kultusminister, sondern im Namen der „Staatsregierung Niedersachsens“261, also gleichsam als Gesandter Hinrich Wilhelm Kopfs und der niedersächsischen Landesregierung auf der Konferenz auftrat und Wünsche zu ihrem Gelingen überbrachte. Seine Rede verlieh der Veranstaltung damit nicht nur eine moralische Legitimation, sondern auch eine politische – durch die zu jener Zeit höchste existierende deutsche Regierungs-Instanz. Sowohl die niedersächsische Landesregierung als auch die britische Militärregierung standen hinter Grimme und hinter Bähnischs Konferenz, was den offiziellen Charakter der Veranstaltung sowie der Gründung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘, die dort stattfinden sollte, unterstrich.262 Grimmes Präsenz auf der Konferenz war gleichzeitig Ausdruck der Kontinuität politischer Geltungsmacht reformorientierter Eliten der großen Weimarer Koalition, die im Zuge der Preußischen Verwaltungsreform eng mit dem BDF kooperiert hatten, im Nachkriegsdeutschland. Somit kann sein Beitrag auf einer Tagung der überparteilichen Frauenbewegung, welche von der britischen Militärregierung gefördert wurde, auch als eine Unterstützung der Kontinuität der preußischen, geschlechtersensiblen Staatspolitik durch die britische Militärregierung gelesen werden. In der Rede des Widerstandaktivisten kommt dessen vergleichsweise progressives Denken über Frauen zum Ausdruck. Er bezeichnete die „Frauenfrage“ als eine „Menschtumsfrage“ und stellte die Gleichrangigkeit von Mann und Frau im öffentlichen Bewußtsein als gegeben dar. Die seiner Ansicht nach überholte Auffassung, der Lebenssinn von Frauen werde „im engen Umkreis der Familie voll erfüllt“, wertete er als ein „Ergebnis der historischen Entwicklung“ und somit nicht als ‚wesensgemäß‘ sondern als sozialisationsbedingt. Der Kultusminister rief Frauen und Männer dazu auf, einen kulturellen und gesellschaftlichen Wandel einzuleiten, indem sie sich den Herausforderungen der „Bipolarität“ zwischen privatem und öffentlichem Leben stellten. Der „Ausgleich zwischen Beruf und Menschtum […] zwischen dem privaten Sein und der Hingabe an die objektiven Gegebenheiten der Welt“ sei eine Aufgabe beider Geschlechter, so Grimme. Eine „Persönlichkeitsfrage“, also eine stärkere Neigung hin zur einen oder zur anderen „Welt“ in eine Geschlechterfrage „umzugröbern“263, sei nicht sinnvoll. Was Grimme hiermit im Juni 1947 bemühte, war nichts anderes als das Konzept des – christusgleichen – ‚ganzen Menschen‘, welches um 1800 aufgekommen und in der Pädagogik seinen prominentesten Vertreter in Jo-
260 261 262 263
halt weicht aber nur sehr geringfügig von der Version in der Zeitschrift ‚Denkendes Volk‘ ab. Eine Version auszugsweise findet sich auch in Ziegler: Lernziel, S. 220/221. Für eine knappe Interpretation, die Grimme jedoch zu einseitig wiedergibt vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 65. Grimme: Rede, S. 193. Entsprechend stark findet seine Rede Berücksichtigung in: Dresel, Ila: Die Frau in der Krisis der Gegenwart, in: Weser-Kurier, Nr. 51, 28.06.1947. Ebd.
754 | Theanolte Bähnisch
hann Heinrich Pestalozzi gefunden hatte.264 Sich an Pestalozzi zu orientieren, lag für Grimme auch insofern nah, als dieser sowohl den christlichen Glauben als auch die ‚Selbsttätigkeit‘ der Schüler als wichtige Elemente seiner Pädagogik beschrieb und damit zwei Grundsätze, die auch Grimme vertrat. Obwohl der Kultusminister die ‚naturgegebene Unterschiedlichkeit‘ der Geschlechter für weniger bedeutsam hielt als die Regierungspräsidentin, zeigt sich an jener Rede, daß Bähnischs und Grimmes Rhetorik doch wesentliche Ähnlichkeiten aufwiesen. Es scheint, als hätte Bähnisch Elemente ihres eigenen Argumentationsrepertoires aus der Auseinandersetzung mit dem zehn Jahre älteren Grimme gespeist – wobei es nahe liegt, daß sowohl Grimme als auch Bähnisch jeweils auf die Gedanken gemeinsamer Bekannter rekurrierten. Schließlich hatte sich nicht nur die Begründerin der sozialen Frauenschulen, Alice Salomon auf Pestalozzis Pädagogik bezogen. Siegmund-Schultze hatte – um nur ein weiteres Beispiel zu nennen – als Schüler Paul Natorps, also in zweiter Generation, Pestalozzis Erbe weitergetragen.265 Insbesondere der für Grimme so zentrale Begriff ‚Mensch‘ und dessen entfaltete ‚Persönlichkeit‘ spielte – im Sinne einer wertgebundenen, humanistischen Verantwortung für den ‚Nächsten‘ und das ‚gesellschaftliche Ganze‘ – nicht nur in Grimmes, sondern auch in Bähnischs Rhetorik eine tragende Rolle. Besonders auffällig ist in diesem Kontext, daß Bähnisch den ‚Nachholbedarf‘ für Frauen auf dem Weg zur ‚Menschwerdung‘ ganz ähnlich umriß, wie Grimme es in Bad Pyrmont tat: Da „die Frau, ob nun dem Wesen nach oder der Geschichte nach, zum mindesten noch heute im ganz Persönlichen bei sich daheim ist und die Bipolarität der Existenz noch nicht bewußt bejaht“266, müsse in erster Linie ihr Sinn für das Objektive geweckt werden, argumentierte Grimme. Männer müßten hingegen dafür sensibilisiert werden, daß es „neben den Sachwerten auch eine werthaltige private Sphäre gibt“. Damit deutete Grimme auf die in der bürgerlichen Frauenbewegung so oft beschworene und von Bähnisch sinnbildlich bemühte, ‚Kulturaufgabe der Frauen‘ hin. Dies war – ebenso wie die Forderung nach „Gleichberechtigung bei betonter Andersartigkeit“267 und der Aufruf zur Verminderung der „Scheidung des Öffentlichen und Privaten“268 – eine Anleihe bei der Rhetorik der bürgerlichen Frauenbewegung, die vermutlich aus Grimmes Kontakten zu Führungspersönlichkeiten des BDF in der Weimarer Republik resultierte. Grimme sah, wie Marianne Weber269, erklärtermaßen in den Frauen „Schrittmacherinnen auch für die Erlösung des Mannes aus seiner Sachverstricktheit“.270 Indem er „Erziehung zur Sachlichkeit und zur Menschlichkeit […]; zur
264 265 266 267
Vgl.: Reble, Albert: Geschichte der Pädagogik, 22. Aufl., Stuttgart 2009, S. 224. Vgl.: Natorp, Paul: Johann Heinrich Pestalozzi. Sein Leben und seine Ideen, 1905. Grimme: Rede. Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1800–1918, Bd. 2/1: 1866–1918 – Arbeitswelt und Bürgergeist, 2. Aufl., München 1991, S. 75, vgl.: auch: ebd., S. 86. 268 Ebd. 269 Vgl.: Weber, Marianne: Die besonderen Kulturaufgaben der Frau, in: dies.: Frauenfragen und Frauengedanken, Tübingen 1919, S. 238–361, Vgl. dazu auch: Nipperdey: Geschichte, Bd. 2/1, S. 86/87. 270 Grimme: Rede.
Staatspolitische Aufgabe
|
755
menschlichkeitsdurchströmten Sachlichkeit“ als das „nicht geschlechtsbedingte Ziel für Mädchen und für Jungen“271 festschrieb, übertrug er den Frauen, die sowohl für die charakterliche Weiterentwicklung ihres eigenen Geschlechts als auch für die der Männer Sorge tragen sollten, in der Zeit des Wiederaufbaus eine doppelte Verantwortung. Fast wie im Gegenzug befreite er, den Werteverfall in der jüngeren Vergangenheit beklagend – und damit wohl den Nationalsozialismus meinend – („der Mensch, was hat er schließlich noch gegolten“272), die Frauen zumindest partiell von Schuld an der deutschen Vergangenheit – wie Bähnisch es in ihren Reden anläßlich der Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘ in Hannover getan hatte. Im Zuge der Forderung nach einer nationale und europäische Grenzen überwindenden „Liebe“273 zitierte er schließlich Shakespeare mit den Worten „[f]ür eine Frau ist keine Grenzensperre!“274 und fügte hinzu: „Sie sieht, wen sie auch sieht, den Menschen in dem Menschen“275. Die Kulturaufgabe der Frauen wollte Grimme also als eine internationale Aufgabe verstanden wissen, und dies war wiederum anschlußfähig für jene Frauen, die hofften, an die internationale Einbindung der Frauenbewegung in der Weimarer Republik wieder anknüpfen zu können. Wie Bähnisch dies in der ‚Stimme der Frau‘ zu tun pflegte276, appellierte Grimme schließlich an „die Frau“, für die sich nicht mehr die Frage stelle, „ob sie mitarbeiten will oder nicht, sondern ausschließlich […] ob sie sich dieser Situation bewußt sei“277, Taten aus ihrer gestiegenen Verantwortung abzuleiten. Die Frauen müßten Arbeit und privates Leben vereinen, an der Entwicklung ihrer Persönlichkeit arbeiten und ihren Beitrag zur Überwindung der „Sach- und Arbeitskultur“ sowie der nationalen und europäischen Grenzen leisten. Vor allem in Verbindung miteinander weisen auch die Termini ‚Menschlichkeit‘ und ‚Sachlichkeit‘ eine wichtige Schnittmenge zwischen der Rhetorik Grimmes und Bähnischs auf. Beide Begriffe stellten für Bähnisch zentrale Kategorien menschlichen – und weiblichen – Handelns dar, womit sie gegenüber traditionellen Vorstellungen eine Neuzuschreibung von Eigenschaften an die Frauen vornahm. Wohl nicht zuletzt vor dem Hintergrund, daß Frauen die Fähigkeit zur ‚Sachlichkeit‘ oft abgesprochen worden war, kam dem Begriff in Bähnischs Ausführungen eine zentrale Rolle zu. ‚Sachlichkeit‘ sollte in ihrer Vorstellung einen Ausgleich zu den traditionell als ‚gefühlsbestimmt‘ charakterisierten Wesenszügen von Frauen bilden. ‚Menschlichkeit‘ wurde von Bähnisch dagegen als ein genuin eher weiblicher Wesenszug
271 Ebd., S. 195. 272 Ebd. 273 Die Liebe ist hier im Sinne der christlichen Nächstenliebe zu verstehen, denn Grimme zitiert als das „christlichste Wort aus vorchristlicher Zeit“ Antigone mit den Worten „Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da.“ Ebd., S. 196. 274 Ebd. 275 Ebd. 276 „Noch ist es Zeit auf die Stimme der Frau zu hören…“, wurde in der ersten Ausgabe der ‚Stimme der Frau‘ die Verpflichtung der Frauen, dem kriegerischen Treiben der Männer Einhalt zu gebieten und für eine menschlichere Politik zu sorgen, beschworen. Wolf: Augen. 277 Grimme: Rede, S. 194.
756 | Theanolte Bähnisch
zum Credo erhoben, wenn es beispielsweise um eine sinnvolle Organisation der Verwaltung ging.278 In Grimmes ‚Rede an die Frauen‘ klang argumentativ an, was der Kultusminister in anderen Ansprachen, die sich jeweils zwischen den Eckpfeilern Humanismus, Christentum und Sozialismus einordnen lassen, vertiefte. Er vertrat die Haltung, daß die „Renaissance des Menschen“279 über die Besinnung auf die „sittlichen und religiösen Werte“280 fuße und daß der „Geist, der sich den Körper baut“281, das Maß aller Dinge und damit auch der Kern der Erziehung sein müsse. Grimmes Bezugnahmen auf Deutschland als Volk der Dichter und Denker, vor allem auf Goethe, der als „der größte deutsche Geistesträger alle seine Werke mit dem einen größeren übergipfelte, mit dem der eigenen Gestalt, an der uns exemplarisch sichtbar wird, was einer tun muß, um ein Mensch zu werden“282, waren zahlreich und überdeutlich. Bähnisch, die die Überzeugung Grimmes, man sei ja nicht von selbst ein Mensch, sondern zunächst einmal ein „Lebewesen“283, teilte, wendete die – auch von ihrer Seite als als Auszeichnung verstandene – Bezeichnung ‚Mensch‘ auch auf ihren Freund Grimme selbst an.284 Damit machte sie ihm deutlich, wie sehr sie seine Person, den intellektuellen Austausch mit ihm und sogar die Kategorien, mit denen er zu argumentieren pflegte, als sinn- und haltgebend, vor allem in Krisenzeiten schätzte. Bähnisch hätte, so scheint es, ihre Überzeugungen selbst kaum treffender wiedergeben können als Grimme – weshalb seine Rede auf der Konferenz ein wahrer Glücksfall für sie gewesen sein muß. Indem der Kultusminister argumentativ dem Ideal einer zweckfreien Bildung285 folgte, welche die „Gestaltwerdung der menschlichen Person, das höchste Glück der Erdenkinder: die Persönlichkeit“ ermögliche und zu einer „Menschheit als ein […] Kollektiv von geistigen Persönlichkeiten“286 führe, folgte der Sozialdemokrat schließlich den erwachsenenbildnerischen Vorstellungen, wie sie beispielsweise Friedrich Siegmund-Schultze und Eduard Weitsch vertraten.287
278 „Es wird mein Bestreben sein, die Verwaltung so gut wie möglich, aber auch so menschlich wie möglich zu führen!“, soll Theanolte Bähnisch bei ihrem Amtsantritt gesagt haben. Vgl.: Langner: Regierungspräsident. 279 Grimme, Adolf: Erwachsenenbildung in der Renaissance des Menschen, in: Denkendes Volk, 1. Jg. (1946/47), Heft 1, S. 321–327. 280 Grimme, Adolf: Die Volkshochschule als Stätte der Besinnung, in: Denkendes Volk, 3. Jg. (1949), Heft 1, S. 1–5, hier S. 1. 281 Ebd., S. 1. 282 Ebd., S. 5. 283 Grimme: Erwachsenenbildung, S. 324. 284 AdSD, Büro Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 11.02.1946. AdSD, Büro Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 11.02.1946. 285 Vgl.: Grimme: Volkshochschule, S. 2. 286 Ebd., S. 2. 287 Vgl.: Großkopf, Steffen: Persönlichkeit als pädagogischer Begriff des 20. Jahrhunderts – eine diskursanalytische Perspektive, in: Kenklies, Karsten (Hrsg.): Person und Pädagogik. Systematische und historische Zugänge zu einem Problemfeld, Kempten 2013, S. 13–28. Großkopf zufolge kam die Idee der ‚Persönlichkeit als Ziel der Erziehung‘ in der Päda-
Staatspolitische Aufgabe
|
757
Auch in dieser Hinsicht knüpfte der „religiös-intellektuelle[…] und vor allem bürgerliche“288 Grimme, der 1922 der SPD beigetreten war, also an die Reformpolitik der Weimarer Republik an. Seine Vorstellung von zweckfreier Bildung bediente liberale, humanistische Ideale der Freiheit, der Rechtstaatlichkeit, der Toleranz und der Menschenwürde. Er rief damit zu einer Form der Bildung und des Verhaltens auf, die Bähnisch und viele ihrer Zeitgenossen als eine spezifisch ‚westliche‘ definierten, und sorgte somit dafür, daß bereits mit der Eröffnung der Tagung ein Kontrapunkt zur Tagung des DFD und zu den Entwicklungen in der SBZ gesetzt war. In seiner Partei scheiterte Grimme Kai Burkhards Interpretation zufolge mit seinem Anspruch, „in den marxistischen Reihen Verständnis für die religiösen Wurzeln des Sozialismus“289 zu wecken, obwohl er kurzzeitig dem Parteivorstand angehörte. Die Parteimehrheit wehrte sich „gegen Versuche, christliches Gedankengut in die Parteiprogrammatik zu integrieren“290. Doch mit den Absichten Bähnischs, die versucht hatte, Gespräche zwischen den Vertretern der beiden großen Konfessionen und Kurt Schumacher zu organisieren291, mit den Überzeugungen vieler anderer Frauen, die überparteilich in einer großen Frauenorganisation arbeiten und sich mehrheitlich gegen den Kommunismus abgrenzen wollten, sowie der Britischen Militärregierung, die die Konferenz Bähnischs mit initiiert hatte, standen Grimmes Ausführungen im Einklang. Dies machte ihn zu einem perfekt geeigneten Redner für die Frauenkonferenz von Pyrmont. Nach Grimmes Rede folgte am Vormittag des ersten Konferenztags unmittelbar ein Vortrag der Vorsitzenden des ‚Club deutscher Frauen‘ über „Die Frau in der Krisis der Gegenwart“292. Titel und Inhalt ihres Vortrags schienen sich zumindest lose an Gertrud Bäumers 1926 erschienener Schrift ‚Die Frau in der Krisis der Kul-
288 289 290 291 292
gogik zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf und fand sich erstmals 1914 als Lemma in Roloffs ‚Lexikon der Pädagogik‘ (Vgl.: Art.: „Persönlichkeit als Ziel der Erziehung“, in: Roloff, E. M.: Lexikon der Pädagogik, 1914, S. 1152/1153, nach Großkopf: Persönlichkeit, S. 17, hier Angabe ohne Bd.) Für Großkopf ist die Ausdehnung des Begriffs ‚Persönlichkeit‘ vom Lehrer (von dem offenbar klar war, daß er eine ‚Persönlichkeit‘ besitzt) auf den Schüler von der Vorstellung beeinflußt, der Mensch sei selbstbewußt und damit für sein Schicksal selbst verantwortlich. (Vgl.: Großkopf: Persönlichkeit, S.16.) Die Vorstellung, der Mensch könne sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit auch selbst befreien (Kant), hatte sich in der Pädagogik im 20. Jahrhundert durchgesetzt. So gesehen kann die erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts beginnende Betonung des Begriffs ‚Persönlichkeit‘ als eine späte ‚Nachwehe‘ der Aufklärung begriffen werden. Burkhard: Schweigen, S. 81. Ebd. Ebd. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 11.02.1946. DFR-Archiv, Freiburg, A1, Tagung der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen der britischen Zone vom 20. bis 23. Juni 1947, Bad Pyrmont [Programm].
758 | Theanolte Bähnisch
tur‘293 zu orientieren. Hätte sie sich von der ehemaligen BDF-Vorsitzenden distanzieren wollen, hätte sie vermutlich einen anderen Titel gewählt – denn es ist nicht davon auszugehen, daß sie die Schrift Bäumers nicht wenigstens dem Namen nach kannte. Wahrscheinlich ist also, daß sie im vollen Bewußtsein, eine entsprechende Tradition zu bemühen und auf einen entsprechenden Wiedererkennungswert hoffend, ihren Vortrags-Titel wählte. Damit knüpfte sie, ebenso wie Grimme, an die Rhetorik der bürgerlichen Frauenbewegung an und legte einen weiteren Grundstein zur Traditionsbildung des Frauenrings, der in Pyrmont gegründet werden sollte. Von der ‚Kultur-Krisis‘ war auch schon auf der ersten Kundgebung des ‚Club deutscher Frauen‘ die Rede gewesen und den Zuhörerinnen der Auftrag erteilt worden, die von Bäumer, Huch und anderen Zeitgenossen befürchtete „Entpersönlichung“294 der menschlichen Beziehungen aufzuhalten, um jener Krisis ein Ende zu bereiten.295 Das Narrativ der „Krisis“, welches schon in der Weimarer Republik im Zentrum kulturpessimistischer Ausführungen stand296, erlebte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – in Kombination mit dem Vermassungsdiskurs297 – eine Renaissance, an der also auch Theanol-
293 Bäumer, Gertrud: Die Frau in der Krisis der Kultur, Berlin 1926. In ihrer Schrift stellt Bäumer die Frau als „erschüttertes Wesen“ dar, das stärker gefährdet sei als der Mann, da sie neben sexuellen Problemen auch Probleme im Beruf und solche, die durch die „Mechanisierung“ des Lebens auftreten, bewältigen müsse. „Die Rettung aus dieser Kulturkrisis kann der Frau nur gelingen, wenn sie zu jener Bewußtheit und Selbständigkeit des persönlichen Seins kommt, die ihr erst ermöglicht, ihre Bestimmung zu begreifen“, faßt ein unbekannter Rezensent Bäumers Fazit zusammen. Vgl.: O. V.: Rezension zu: Bäumer: Frau, in: Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik, Bd. 6 (1927), S. 119. Eine Sammlung von Aufsätzen Bäumers, die in das gleiche Horn stießen und eine Krise diagnostizierten, die aus „Intellektualismus, Maschinenrhythmus und Amoralismus“ entstanden sei, war 1926 erschienen. Vgl.: O. V.: Rezension zu: Bäumer, Gertrud: Die seelische Krisis, 3. Aufl., Berlin 1926, in: Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik, Bd. 6 (1927), S. 120. 294 Im gleichnamigen Werk Ricarda Huchs schreibt die Autorin: „Die Welt wurde antichristlich und antipersönlich und das ist ein und dasselbe, als sie die Verantwortung dem Einzelnen entzog und sie auf größere und kleinere Massen verteilte.“ Zitiert nach dem Abdruck von ‚Entpersönlichung‘, in: Baum, Marie: Leuchtende Spur. Das Leben Ricarda Huchs, Tübingen/Stuttgart 1950, S. 227. 295 O. V.: Eine Friedensfront der Frauen, in: Neuer Hannoverscher Kurier, 21.06.1946, Reprint in: Jung, Martina/Scheitenberger, Martina: …den Kopf noch fest auf dem Hals. Frauen in Hannover 1945–1948, Hannover 1991, S. 143. „Der Mensch muß wieder lernen, den Menschen zu sehen und alles Lebendige über Technik und Zivilisation zu stellen“ wird Anna Mosolf hier zur „Krisis der Menschheit“ zitiert. Ebd. 296 Vgl.: Graf, Rüdiger: Either-Or: The Narrative of „Crisis“ in Weimar Germany and in Historiography, Cambridge 2010. Vgl. auch: ders.: Die Zukunft der Weimarer Republik. Krisen und Zukunftsaneignungen in Deutschland 1918–1933, München 2008. 297 Vgl. dazu beispielsweise: Raudive, Konstantin: Der Chaosmensch und seine Überwindung. Betrachtungen über die Tragik unserer Zeit, Memmingen 1951, S. 13 sowie Man,
Staatspolitische Aufgabe
|
759
te Bähnisch Anteil hatte. Da das Thema auch in der ‚Stimme der Frau‘ und entsprechend in der Analyse der Zeitschrift zum Tragen kommt298, soll es an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. An dieser Stelle anzumerken ist jedoch, daß Bähnisch mit ihrer Rede von der „Entpersönlichung“ nicht nur an Huch, sondern auch an ihren Vorredner Grimme anschloß, denn sie beschwor mit dem Begriff ‚Entpersönlichung‘ eben das, was der Mensch aufs Spiel setze, wenn er sich nicht um seine ‚Persönlichkeit‘ bemühe, sprich: etwas dazu lerne und Bereitschaft zeige, das gesellschaftliche Leben verantwortlich mitzugestalten.299 Im Anschluß an die Regierungspräsidentin referierte – was nicht nur den ‚Spiegel‘, sondern auch die ‚Welt der Frau‘ zu herber Kritik anregte – der Schriftsteller und spätere ‚Eheberater der Nation‘, Walter von Hollander300. Seinen Vortrag „Was erwarten wir Männer von den Frauen“ wertete die ‚Welt der Frau‘ als ein „geistreiches Referat – für die Friedenszeit.“301 Die Not, aus der die Frauen in Pyrmont zusammengekommen waren, habe der Redner wohl übersehen, kritisierte Lisbet Pfeiffer Hollanders Plädoyer für mehr „Grazie“ und „Schönheit“.302 7.4.2 Praktische Ansätze zur Unterstützung leidgeprüfter Bevölkerungsgruppen im Alltag „Der rote Faden der Tagung war der Friedensgedanke“303, beschrieb der ‚Spiegel‘ die philosophisch-ethische Ausrichtung der Konferenz. Diesmal fehlte zwar die Begründerin des ‚Friedenskreises‘ Freda Wuesthoff, nicht jedoch ein Referat, das sich explizit der „Friedensaufgabe der Frau“304 widmete. Zum Thema, das der Darstellung der Referentin nach in der Familie begann, sprach diesmal Anne Franken. Theanolte Bähnisch beschwor – wie als wollte sie das Fehlen der Atomphysikerin
298 299
300
301 302 303 304
Henrik de: Vermassung und Kulturverfall. Eine Diagnose unserer Zeit, Bern 1951, S. 171 und 173, schließlich die Reflexion darüber bei Schildt: Zeiten, S. 324. Vgl.: Freund: Krieg, S. 187. Der Erziehungswissenschaftler Großkopf schreibt, daß der Personalitätsbegriff in Bezug auf die Feststellungen der „Tendenzen zur Entpersönlichung“ in einem PädagogikLexikon von 1961 als die „Kraft, die menschliche Berufung zu verteidigen“ beschrieben werde. Großkopf: Persönlichkeit, S. 21. Bekannt wurde Hollander mit seiner Call-in-Sendung ‚Was wollen Sie wissen‘, aber auch mit Ratgeber-Literatur und Romanen. Vgl.: Art. „Hollander, Walther von“, in: Internationales Biographisches Archiv 50/1973, auf: Munzinger Online/Personen: http://www. munzinger.de/document/00000004433, abgerufen von Universitätsbibliothek Kassel, 16.11.2012. Pfeiffer: Frauenschaffen, S. 26. Ebd. O. V.: Gleichberechtigte Frauen. Nori Möding zufolge hatte Franken betont, „daß die deutsche Frau zunächst die eigene Familie befriedigen und eine saubere, fleißige, einwandfreie Jugendgeneration heranbilden müsse, ehe man von einer Verständigung mit anderen Völkern spreche“. Möding: Stunde, S. 642.
760 | Theanolte Bähnisch
und Kriegsgegnerin kompensieren – schließlich selbst die anwesenden Frauen, eine Lehre aus „Hiroshima“ und „Nagasaki“ zu ziehen und einen „Weltfriedensbund[…]“305 zu gründen. Noch am Nachmittag des ersten Tages sprach außerdem die Vikarin Margarethe Daasch über die „menschlich-ethische Haltung gegenüber den Flüchtlingen“306. Nicht zuletzt in der Anwesenheit Daaschs äußerte sich, nebenbei bemerkt, Bähnischs Bedürfnis, mit den Kirchen zu kooperieren. Die Konferenz von Bad Pyrmont erschöpfte sich jedoch keineswegs in philosophischen Abhandlungen über den Frieden, sondern behandelte viele alltagspraktische Themen, die nicht nur sozialpolitisch relevant waren. So sprach die Leiterin des DRK-Landesverbandes Niedersachsen, Louise-Sophie Freifrau von Knigge, geb. Komteß von Hardenberg, über ‚Praktische Lösungsversuche des Heimkehrerproblems‘307 und die – offenbar einflußreiche – Staatskommissarin für das Flüchtlingswesen, Martha Fuchs308, referierte über Gesetzesvorschläge auf dem Gebiet des Flüchtlingswesens‘. Schließlich äußerte sich Katharina Petersen zum „Besuch bei unseren Kriegsgefangenen in England“.309 Jene Themen spiegelten allesamt die Hoffnung wider, daß Frauen einen besonderen Beitrag zur Lösung sozialer Fragen und zur gesellschaftlichen (Re-)Integration verschiedener Gruppen leisten könnten. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang wird zwar nicht explizit angesprochen, aber Äußerungen und Initiativen Bähnischs über die Konferenz von Pyrmont hinaus legen nah, daß die Initiatorin der Konferenz weitergedacht hatte: Nicht nur die Wiedereingliederung von Heimkehrern in die Familien gestaltete sich aufgrund der Entfremdungsprozesse und der unterschiedlichen Erfahrungen von Familienmitgliedern während des Krieges schwierig. Die Ende der 30er Jahre eingezogenen Soldaten, die – sofern sie an der Ostfront gedient hatten – teilweise erst 1955/56 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrten, galten aufgrund ihres Lebens im Ausnahmezustand, fern
305 O. V.: Gleichberechtigte Frauen. 306 DFR-Archiv, Freiburg, A1, Tagung der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen der britischen Zone vom 20. bis 23. Juni 1947, Bad Pyrmont. [Programm]. 307 DFR-Archiv, Freiburg, A1, Tagung der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen der britischen Zone vom 20. bis 23. Juni 1947, Bad Pyrmont. [Programm]. 308 Über Fuchs heißt es, daß sie selbst zwar ihre Tätigkeit als eine „planende, anregende und beratende, niemals aber anweisende oder unmittelbar ausführende“ beschrieben, jedoch mehrfach Kabinettsentscheidungen beeinflußt sowie die Interessen Niedersachsens in der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Flüchtlingsverwaltungen und in den zonalen und bizonalen Gremien „energisch“ wahrgenommen habe. Brosius, Dieter: Zur Lage der Flüchtlinge in Niedersachsen, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Neue Folge, Bd. 55 (1983), S. 99–113, hier S. 103. 309 DFR-Archiv, Freiburg, A1, Tagung der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen der britischen Zone vom 20. bis 23. Juni 1947, Bad Pyrmont. [Programm].
Staatspolitische Aufgabe
| 761
von den neuen Verhältnissen in Deutschland, als antidemokratisches Pulverfaß.310 Sie brachte sich vermutlich nicht zuletzt deshalb über den DFR hinaus in die Integrationsarbeit des ‚Verbandes der Heimkehrer‘ (VDH), welcher sich als Bändiger der angeblich staatsgefährdenden Veteranen anbot311, ein und gestaltete gemeinsam mit dem Verband die Kriegsgefangenen-Gedenkwoche in Hannover.312 Auch die ‚Stimme der Frau‘ nahm sich der Themen Kriegsgefangenschaft und Heimkehrerprobleme an.313 Daß von Flüchtlingen in Bähnischs Wahrnehmung ebenfalls eine Gefahr für die Demokratie ausgehen konnte, wird aus der massiven Kritik deutlich, die sie an Waldemar Kraft, dem Vorsitzenden des Bundes der Heimatvertriebenen (BdH) gegenüber der britischen Militärregierung übte.314 Folgt man der Argumentation Marianne Zepps, daß die Frauen in ‚Bad Boll‘ Partizipationsansprüche angemeldet hatten, so läßt sich über ‚Pyrmont‘ feststellen, daß sie dort bereits einen Schritt weitergingen und zeigten, welche praktischen Beiträge sie selbst geleistet, welche Erfahrungen sie dabei gesammelt hatten und welches Programm sie daraus für die Zukunft ableiteten. Wenn auch die Leitung verschiedener Themen-Blöcke auf der Konferenz jeweils in den Händen von Vertreterinnen der Länder in der britischen Besatzungszone lag, so waren doch die Hannoveranerinnen, welche den ‚Club deutscher Frauen‘ gegründet hatten, sowie andere Frauen, die in der Stadt Hannover oder in ihrem Umland eine wichtige Rolle spielten, auf der Konferenz durch Redebeiträge überdurchschnittlich stark vertreten. Die Auswahl der Rednerinnen entsprach weitgehend dem Netzwerk, das Theanolte Bähnisch in Hannover und darüber hinaus bereits vor der Konferenz etabliert hatte. Es verlieh der zonalen Konferenz eine ‚niedersächsische‘ Note, zumal einige der Rednerinnen direkt oder indirekt dem niedersächsischen Kultusministerium zuarbeiteten. Zum frauenpolitischen Netzwerk, das die Regierungspräsidentin bis 1947 etabliert hatte, gehörten vor allem Politikerinnen, Juristinnen und andere Verwaltungsmitarbeiterinnen, Pädagoginnen und Theologinnen. Bähnisch umgab sich also auch nach 1945 mit Berufsgruppen, die schon den gemeinsamen Freundeskreis mit ihrem Ehemann dominiert hatten.
310 Vgl. dazu: Kimmel, Elke: Rezension über: Schwelling, Birgit: Heimkehr – Erinnerung – Integration. Der Verband der Heimkehrer, die ehemaligen Kriegsgefangenen und die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft, Paderborn 2010, auf: dradio.de, http://www.dradio. de/dlf/sendungen/andruck/1185126, am 13.12.2013. 311 Vgl.: Schwelling, Birgit: Heimkehr – Erinnerung – Integration. Der Verband der Heimkehrer, die ehemaligen Kriegsgefangenen und die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft, Paderborn 2010. 312 Siehe Kapitel 5.4.3. 313 Vgl.: Er findet sich nicht zurecht!, Leserinnenzuschrift von B. R., Stichwort: Briefkasten. Die Fragen kosten nichts, in: Stimme der Frau, 3. Jg. (1951), Heft 19, S. 17 sowie Freund: Krieg, S. 106–113 und 124–126. 314 Sie charakterisierte Kraft als „most dangerous figure in contemporary german life”. NA, UK, FO 371/103932, Views on Waldemar Kraft by Theanolte Bähnisch, Comments on Brigardier Hume, 1953.
762 | Theanolte Bähnisch
Fast alle Beiträgerinnen, die nicht aus Hannover stammten, waren Mitglieder von Verbänden, welche sich an der Organisationsform und dem Statut des Hannoveraner Clubs orientierten und – wenn man so will – in vorauseilendem Gehorsam bereits im Vorfeld der Konferenz von Pyrmont den Namen ‚Frauenring‘ angenommen hatten. Dies traf beispielsweise auf die Oberschulrätin Olga Essig315 und den ‚Frauenring Hamburg‘ zu, den Essig im April 1946 gemeinsam mit Emmy Beckmann und anderen Frauen begründet hatte.316 Essig, die an der Umsetzung von Reformen im Mädchenberufsschulwesen beteiligt war, sprach in Pyrmont über Frauen in der Verwaltung – ein Thema, das Bähnisch besonders am Herzen lag. Auch am Nachmittag des zweiten Konferenztages dominierten Vorträge, welche sich mit konkreten, praktischen Fragen zu den Themen ‚Frauen im Beruf‘, in der Verwaltung und in der Politik auseinandersetzten. Eines der Referate hatte die Schulrätin Käthe Feuerstack übernommen, ein anderes die Betriebsrätin und Gewerkschafterin Dora Gaßmann.317 Gaßmann sprach – nachdem Bähnisch dies angeblich in letzter Minute noch habe verhindern wollen318 – als einzige Arbeiterin auf der Konferenz. Offenbar hatte die Initiatorin der Konferenz das kritische Potential, das dem Auftritt der bekennenden Kommunistin innewohnte, bereits im Vorfeld erkannt und entsprechende Vorbereitungen getroffen: Eine Diskussion war in diesem Panel nicht vorgesehen. Henicz und Hirschfeld merken an, daß sich Marie-Elisabeth Lüders, als ‚Dora G.‘319 die „Kluft zwischen Akademikerin und Arbeiterin“ angesprochen hatte,
315 Essig hatte sich bereits in den 1920er Jahren für die berufliche Gleichstellung von Frauen engagiert und sich für eine Reform des Berufsschulwesens eingesetzt. 1929 wurde sie in Hamburg Oberschulrätin für das Berufsschulwesen. Nachdem sie von den Nationalsozialisten ihres Amtes enthoben worden war, wurde sie nach Kriegsende wieder in diese Position eingesetzt. Vgl.: Bake, Rita: Olga Essig, in: Frauenbiografien, auf: www.hamburg. de, http://www.hamburg.de/clp/frauenbiografien-suche/clp1/hamburgde/onepage.php?BI OID=3976&ortsteil=11, am 13.12.2013. 316 Vgl. dazu die Vereinshistorie des Frauenrings Hamburg: o. V.: Historie, auf: Hamburger Frauenring e. V., http://www.hamburger-frauenring.de/index.php/wir-ueber-uns/historie, am 13.12.2013. Ob der Zusammenschluß bereits im April 1946 ‚Frauenring‘ hieß, ist unklar. Vermutlich trug er damals, wie viele andere Zusammenschlüsse den Namen ‚Frauenausschuß‘. 317 Vgl.: Art. „Dora Gaßmann“, in: Hannoversche Frauen gegen den Faschismus 1933–1945, auf der Homepage des VVN/BdA Hannover, http://www.hannover.vvn-bda.de/hfgf.php? kapitel=20, am 13.12.2013. 318 Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 140. 319 In den 1980er Jahren stellte sich Gaßmann als kritische Zeitzeugin für den bereits mehrfach zitierten Aufsatz von Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld über den ‚Club deutscher Frauen‘ zur Verfügung. Vgl. zu Gaßmann auch: 750 Jahre Frauen und Hannover e.V. (Hrsg.): …den Kopf noch fest auf dem Hals. Frauen in Hannover 1945–1948, Hannover 1994, S. 144. Gaßmann gab an, auf den Vorschlag eines Club-Mitglieds, das gleichzeitig Mitglied der FDP war, in den Vorstand des Niedersächsischen Frauenrings gewählt worden zu sein. Vgl.: Art. „Dora Gaßmann“.
Staatspolitische Aufgabe
|
763
jedoch dazu veranlaßt gesehen habe, dazwischenzurufen, daß die bürgerlichen Frauen immer auch die sozialen Belange der Arbeiterinnen vertreten hätten.320 Abgesehen davon, daß der Beitrag Gaßmanns auf der Konferenz offenbar nicht erwünscht war, läßt sich nicht nur die Auswahl der Themen, sondern auch die Auswahl der Rednerinnen und Redner, welche im Nationalsozialismus ganz unterschiedliche Wege gegangen waren, beziehungsweise gehen mußten, als ein praktischer Schritt zur gesellschaftlichen Integration interpretieren. Während Martha Fuchs von der Gestapo verfolgt worden und 1944/45 im KZ Ravensbrück inhaftiert gewesen war, hatte Katharina Petersen sich aufgrund der von den Nationalsozialisten über sie verfügten beruflichen Einschränkungen gezwungen gesehen, nach Holland auszuwandern. Käthe Feuerstack war von den Nationalsozialisten ihres Amtes als Schulrätin enthoben worden.321 Margarethe Daasch, die als Studentin offenbar, wie Albrecht Bähnisch, in der SAG Berlin-Ost mitgearbeitet hatte322, hatte im Dritten Reich ab 1937 zunächst als Stadtvikarin und als Gefängnisseelsorgerin in Hannover gearbeitet. Ab 1941 hatte sie das Frauenwerk der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover geleitet.323 Dora Gaßmann war ihrer eigenen Aussage zufolge 1933 als erste Frau im KPD Bezirk Hannover-Braunschweig wegen der Verbreitung ‚staatsfeindlicher Geheimnisse‘ zu einer Zuchthausstrafe verurteilt worden. Nachdem sie das Gefängnis verlassen hatte, war ihr Mann mehrfach inhaftiert worden.324 Walter von Hollander hatte während des Nationalsozialismus als freier Schriftsteller und Gutsbesitzer in Niendorf gelebt. Die Mischung eher philosophischer Themen mit solchen, die eher ‚alltagspraktisch‘ waren, prägte ab 1948 auch die von Bähnisch herausgegebene ‚Stimme der Frau‘. Wie die Zeitschrift darauf ausgerichtet war, Frauen mit verschiedenen Interessen zu erreichen, so war auch die Konferenz von Pyrmont prinzipiell dazu geeignet, Frauen mit verschiedenen Erwartungen an überparteiliche Frauenvereinigungen anzusprechen. Der Anspruch, der hinter dem Konferenz-Programm stand, war vielfältig: Die Gründungspräsidentin des Frauenrings und ihre Mitstreiterinnen wollten sowohl im Sinne eines von westlich-christlichen Werten geprägten Wiederaufbaus missionieren als auch die Frauen über ihre Stellung in Familie, Beruf und Staat aufklären und sie zur Wahrnehmung und Erweiterung ihrer Rechte ermutigen. Dieses ambitionierte Ziel scheint, gemessen an den Themen der Konferenz, tatsächlich weitgehend erfüllt worden zu sein. Die Gründerinnen des ‚Club deutscher Frauen‘ sowie die anderen, teilweise ebenfalls für ihren Erfolg bekannten Rednerinnen, stellten mit ihren herausgehobenen beruflichen Positionen und ihrem Ansehen in der Gesellschaft auch
320 Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 140. 321 Zu Feuerstack siehe Kapitel 5.4.4. 322 Zumindest ist ihre Teilnahme an der Konferenz in Probstzella 1929 belegt: EZA, 51, S II b 23. 323 1945 stand sie dem Müttergenesungswerk vor, bevor sie 1952 als Sprengelvikarin und Gefängnisseelsorgerin nach Vechta ging. Zu Daasch vgl.: Blatz, Beate: Margarethe Daasch (1908–1993), in: Mager, Inge (Hrsg.): Frauenprofile des Luthertums. Lebensgeschichten im 20. Jahrhundert, Gütersloh 2005, S. 558–570. 324 Vgl.: Art. „Dora Gaßmann“.
764 | Theanolte Bähnisch
eine Avantgarde dessen dar, was, gemessen an den auf der Konferenz formulierten Zielvorstellungen, die Rolle der Frauen in der Zukunft ausmachen sollte. Ihre Lebensläufe und ihre Positionen standen beispielhaft für die Möglichkeiten, die die Teilnehmerinnen ergreifen sollten. Die Anwesenheit der Militärregierungen wiederum versprach, daß die von den Initiatorinnen aufgestellten Ziele und Forderungen auch Gehör finden würden. Die Veranstaltung bot die Möglichkeit, gegenüber den geladenen Gästen aus dem Ausland den erklärten Willen deutscher Frauen zum Frieden zu demonstrieren. Auch das Interesse, an die im westlichen Ausland durchaus geschätzten Ideen der deutschen bürgerlichen Frauenbewegung anzuknüpfen, ließ sich auf der Konferenz deutlich machen. Dazu war vor allem das Referat Marie Elisabeth Lüders‘ geeignet. Wie Christl Ziegler anmerkt, sprach Lüders auf der Konferenz über die Frauenbewegung vor 1933.325 Daß die britische Vorsitzende des ICW mit dem Placet der Militärregierung den deutschen Frauen symbolisch die Hand zur Verständigung reichte, indem sie Bähnisch in Pyrmont persönlich die Einladung zur Internationalen Frauenkonferenz nach Philadelphia überbrachte326 (und ihr damit die Aufnahme einer deutschen Frauenorganisation in den ICW in Aussicht stellte), bescherte der Veranstaltung eine besonders gute Öffentlichkeitswirkung. Das Entgegenkommen des ICW dürfte, der Erziehungswissenschaftlerin Christl Ziegler zufolge, die Veranstalterinnen und Teilnehmerinnen der Konferenz in ihrem Tun bestärkt haben: „An dieser frühen Einladung des ICW wird die Bereitschaft einer internationalen Organisation erkennbar, trotz der großen Vorbehalte vieler Länder gegenüber Deutschland und seiner nationalsozialistischen Vergangenheit, an die Beziehungen zu deutschen Frauenorganisationen vor 1933 anzuknüpfen, eine Geste, die von vielen der Kongreßteilnehmerinnen als Ermutigung und Unterstützung ihres gesellschaftlichen Engagements betrachtet wurde“327, schreibt Ziegler über das Engagement der ICW-Vositzenden Nunburnholme. Zudem dürfte Lady Nunburnholmes Verhalten auch die britische Militärregierung in der Überzeugung bestärkt haben, daß diese mit ihrer Fokussierung auf Bähnisch den richtigen Weg gegangen war, zumal, wie Denise Tscharntke anmerkt, zu jener Zeit klar wurde, daß die Besatzung Deutschlands nicht Jahrzehnte lang andauern würde. Internationale Kontakte in der Frauenbewegung versprachen, so Tscharntke, daß die deutschen Frauen auf dem richtigen Weg gehalten würden, wenn die Militärregierung nicht mehr präsent wäre.328 Die Veranstalterinnen von ‚Pyrmont‘ demonstrierten ihrerseits ein Interesse an den Verhältnissen im westlichen Ausland, indem sie am dritten und letzten Konferenztag Raum dazu gaben, über die Rechtstellung der Frau in England, Amerika und Deutschland329 berichteten.330 Theanolte Bähnisch sollte in den folgenden Jahren
325 326 327 328 329
Ziegler: Frauenkongress, S. 211. Vgl.: ebd., S. 210. Ebd., S. 211. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 167. Vgl.: PRO FO [heute NA, UK] 1013/607, Blatt 203, zitiert nach: 750 Jahre Frauen und Hannover e.V.: Kopf, S. 211.
Staatspolitische Aufgabe
| 765
immer wieder an dieses Thema anknüpfen und dafür sorgen, daß in der ‚Stimme der Frau‘ regelmäßig aktuelle Informationen zum Leben von Frauen in Großbritannien, den USA und Frankreich sowie in anderen Ländern, insbesondere in der Rubrik ‚Die Frau in der Welt‘ zu lesen waren.331 Auch dies läßt sich als ein Beitrag dazu interpretieren, die deutschen Frauen auf dem richtigen, weil ‚westlichen‘ Weg zu halten. 7.4.3 Die Konstituierung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ – Herbe Enttäuschungen und ein Traditions-Bruch Über die Konferenz von Pyrmont liegen verschiedene Berichte und Stellungnahmen vor. Im Folgenden sollen zunächst die Stellungnahmen zum Zusammenschluß mehrerer Organisationen zum Frauenring von deutscher Seite Berücksichtigung finden, bevor zwei Berichte britischer Teilnehmerinnen, die auch zu anderen Aspekten der Konferenz Auskunft geben, vorgestellt werden. Zwar thematisieren die Berichte deutscher Teilnehmerinnen auch die verschiedenen Redebeiträge, doch im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit steht jeweils die Gründung des ‚Frauenrings der britischen Besatzungszone‘. Im Tagungsprogramm war um die „Konstituierung der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen durch Erklärungen der einzelnen Ländervertreterinnen“332 nicht viel Aufhebens gemacht worden. Umrahmt von Ansprachen, Vorträgen und Diskussionen war sie geradezu unauffällig als Programmpunkt des ersten Konferenz-Tages in der Einladung plaziert worden. Nichts im Tagungsprogramm deutete darauf hin, daß es zu Differenzen irgendwelcher Art kommen könnte. Der Zusammenschluß sollte begründet werden, direkt danach sollte Fini Pfannes, die Vorsitzende des Landesverbandes der Hausfrauen in Hessen, zu Wort kommen, bevor Vertreterinnen der amerikanischen,
330 Da sich das Thema nicht im Programm findet, scheint es im Rahmen nicht näher konkretisierter Ansprachen und Kurzvorträgen zur Sprache gekommen sein. Womöglich hatte auch Käthe Feuerstack ihr Referat über ‚Praktische Fragen der Frau in Beruf und Politik‘ zum Anlaß genommen, entsprechende Vergleiche anzustellen. 331 Vgl.: Freund: Krieg, S. 134–178. Vgl.: auch: Denis, André: Mit dem Europapaß in der Hand!, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50) Heft 1, S. 4/5, sowie o. V.: Die Frau in der Welt. England, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 3, S. 24 und o. V.: Die Frau in der Welt. Australien, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 3, S. 24. Schweden nahm ebenfalls eine wichtige Rolle in der Berichterstattung der Zeitschrift ein. Vgl. dazu: Klaiber, Ingeborg: Die Schwedin von heute: Im Lande der Gastfreundschaft, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 4, S. 10/11, hier S. 10. Dazu hatte vermutlich beigetragen, daß die ‚Rechte Hand‘ Bähnischs, Anita Prejawa, im Herbst 1948 mit 31 anderen Deutschen für knapp vier Wochen nach Schweden gereist war und deshalb über entsprechende Kenntnisse und Beziehungen verfügte. DFR-Archiv, Freiburg, A1, Frauenring der britischen Zone. Bericht über die Reise nach Schweden vom 25.10.–20.11.1948 von Anita Prejawa, o. D. 332 DFR-Archiv, Freiburg, A1, Tagung der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen der britischen Zone vom 20. bis 23. Juni 1947, Bad Pyrmont [Programm].
766 | Theanolte Bähnisch
russischen und französischen Zone Ansprachen halten sollten.333 Glaubt man dem Tenor der Festrede Bähnischs aus dem Jahr 1959, so war der Zusammenschluß in Pyrmont in einer Atmosphäre voller Einigkeit und Harmonie vollzogen worden334, zumal es – wie im Programm zu lesen war – doch bereits ausgemacht zu sein schien, daß am dritten Konferenztag nicht nur Kurzreferate sowie eine Schlußansprache gehalten und Arbeitsberichte aus den verschiedenen Organisationen vorgestellt werden sollten. Laut Programm war auch die Bildung von Ausschüssen des neu gegründeten Verbandes vorgesehen, Anträge sollten in seinem Namen verfaßt werden, schließlich sollten noch ‚interne Besprechungen‘ stattfinden.335 Doch die überlieferten Konferenz-Berichte und Zeitungsartikel sprechen eine ganz andere Sprache. Diese Quellen verdeutlichen, daß mit der Konferenz, deren erklärtes Ziel die Konstituierung eines zonenweiten ‚Frauenrings‘ war, große Hoffnungen verbunden und vor diesem Hintergrund Differenzen geradezu vorprogrammiert waren. Die Organisationen waren auf den von Bähnisch veranstalteten Tagungen keineswegs so einig in ihren Zielen, wie Bähnisch es in der Retrospektive beschrieb – und sich damit wider die Realität zur Vertreterin eines ‚Common Sense‘ in Sachen Nachkriegsfrauenbewegung stilisierte. In der Darstellung von Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld war das TagungsProgramm durch die Vielzahl der Referate derart überladen, daß überhaupt keine Zeit zur Diskussion möglicher Organisationsformen und Schwerpunktsetzungen eines zonalen Verbandes vorhanden war.336 Unter den Anwesenden herrschte offensichtlich nicht einmal Einigkeit darüber, ob zukünftig überhaupt überregionale Zusammenschlüsse von Frauenorganisationen stattfinden sollten. Denn naturgemäß war davon nicht nur ein Gewinn an gemeinsamer ‚Schlagkraft‘, sondern auch einen Verlust an Autonomie für die einzelnen Zusammenschlüsse zu erwarten. Auch dazu, wie ein eventueller Zusammenschluß überhaupt aussehen könnte und wer ihn leiten sollte, gab es – auf der Konferenz von Bad Boll hatte sich dies bereits angedeutet – keine gemeinsame Position. Schließlich waren in Pyrmont einige Organisationen vertreten, die sich mit anderen Zusammenschlüssen zu einer Dachorganisation verbinden wollten und den Führungsanspruch Bähnischs und ihrer Mitstreiterinnen respektierten, denen eine organisatorische Einbindung jedoch verwehrt wurde. Ablehnung in sozialdemokratischen Kreisen Glaubt man den kritischen Berichten über die Konferenz, so war die Konstituierung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ aus heiterem Himmel und nicht – wie in der Einladung vorgesehen – „durch Erklärung der einzelnen Ländervertretungen“337 von statten gegangen. Besonders scharf beschreibt dies ein Artikel im ‚Spiegel‘. Als „Ziel
333 Ebd. 334 Bähnisch: Wiederaufbau. 335 DFR-Archiv, Freiburg, A1, Tagung der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen der britischen Zone vom 20. bis 23. Juni 1947, Bad Pyrmont [Programm]. 336 Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 139. 337 Einladung zur Tagung, in: 750 Jahre Frauen in Hannover e.V.: Kopf, S. 145.
Staatspolitische Aufgabe
|
767
der Pyrmonter Tagung“ nennt der Verfasser den „Zusammenschluß aller dem Klub Deutscher Frauen in Hannover gleichgestimmten Organisationen der britischen Zone. Dieser Zusammenschluß wurde ohne jede Abstimmung von Hannovers Theanolte Bähnisch verkündet. Die Verwunderung bei den übrigen Frauen aus der britischen Zone war groß. Denjenigen Frauenausschüssen der britischen Zone, die mit den Ansichten des überparteilichen Klubs von Frau Bähnisch nicht übereinstimmen, verwehrt sie die Mitarbeit an der Zonenorganisation“338, nahm die in Hannover ansässige SPD-nahe Zeitschrift zu den Ereignissen in Pyrmont Stellung. Das im ‚Spiegel‘ beschriebene Unterfangen schien von Pressevertretern sogar schon vor Ort hinterfragt worden zu sein. „In der Pressekonferenz äußerte die kleine Regierungspräsidentin mit den rotbraunen Locken, daß sie kein Mammutunternehmen gründen wolle und in ihrer überparteilichen Zonenorganisation darum nur die gleichgesinnten Frauenverbände zusammenschließen könne“339, berichtete der Spiegel weiter. Im ebenfalls SPD-nahen, stark antikommunistisch ausgerichteten Berliner ‚Telegraf‘ wurde die Pyrmonter Tagung von der Mitherausgeberin der Zeitung Annedore Leber als ein „willkürlich zusammengesetzter Kreis von Frauenclubs verschiedener Färbungen“340 und „als Fortsetzung der in Bad Boll umstrittenen und gescheiterten Bestrebungen einer ‚neuen Frauenbewegung‘“ bezeichnet, „der man in weiten Kreisen mit sehr viel Skepsis gegenübersteht.“ Welche ‚Kreise‘ genau hiermit gemeint waren, verrät der Artikel nicht. „Auf jeden Fall haben die Frauensekretariate der Sozialdemokratischen Partei und der Gewerkschaften eine Beteiligung abgelehnt“341, unterstrich Leber, die auch als Herausgeberin der Frauenzeitschrift ‚Mosaik‘ in Konkurrenz zu Bähnisch stand342, die Distanz der SPD zu diesen Entwicklungen. Damit stellte sie sich auf die Seite der SPD-Frauenreferentin Herta Gotthelf, die Bähnischs Arbeit in der überparteilichen Frauenbewegung als völlig kontraproduktiv zu ihren Bestrebungen ansah, welche darin bestanden, Frauen im Sinne sozialdemokratischer Ziele politisch zu bilden und gegen kommunistisches Gedankengut zu immunisieren.343 Gabriele Strecker, die dem Frauenring Hessen angehörte, verteidigte in der Retrospektive den Zusammenschluß unter Ausschluß einiger Verbände: „Wenn ein Zusammenschluß möglich werden sollte“, so Strecker, „dann war es klar, daß zunächst die überparteilichen-überkonfessionellen Verbände mit ihrem betont staatsbürgerli-
338 O. V.: Gleichberechtigte Frauen. 339 Ebd. Der Spiegel merkt auch an, daß keine der Arbeiterinnen einen Redebeitrag lieferte. 340 O. V. [Annedore Leber]: Von Bad Boll zu Bad Pyrmont, in: Der Telegraf, überliefert o. D. [Juni 1947] im DFR-Archiv, A2, als Teil eines Briefs von Prejawa an Annedore Leber, 24.06.1947. 341 Ebd. 342 Die von Leber herausgegebene Zeitschrift ‚Mosaik‘ durfte als erste und einzige Frauenzeitschrift schon 1947 auf britischem Hoheitsgebiet erscheinen und nach dem Beginn der Berlin-Blockade sogar einen Teil ihrer Auflage in der US-Besatzungszone drucken lassen. Dies wertet Sylvia Lott als Ergebnis einer engen Zusammenarbeit von britischer und amerikanischer Besatzungsmacht. Vgl.: Lott: Frauenzeitschriften, S. 317. 343 Siehe Kapitel 6.7.
768 | Theanolte Bähnisch
chen Programm zu einem Zusammenschluß berufen waren.“344 Der staatsbürgerlich bildende Aspekt der Frauenarbeit wurde also nicht nur in Bad Boll, sondern auch in Bad Pyrmont in den Vordergrund gestellt. Verbänden, die vorrangig andere Ziele verfolgten, blieb es in ‚Pyrmont‘ sowohl verwehrt, ihre Vorstellungen über einem Zusammenschluß von Frauenorganisationen in der britischen Besatzungszone einzubringen, als auch, Teil einer Dachorganisation zu werden. Gemessen an Bähnischs unverhohlenem Anspruch, nur Verbände zusammenzuschließen, welche nicht konfessionell gebunden waren, sich keiner Partei zugehörig fühlten und zudem die Erziehung von Frauen zu ‚Staatsbürgerinnen‘ zu ihrem Ziel erklärt hatten, kann aus dieser Tatsache allein – wie es in zeitgenössischen Artikeln und sogar in der Forschungs-Literatur345 geschehen ist – schlechterdings ein Vorwurf konstruiert werden. In einer Berichtigung, die sie der Sozialdemokratin Annedore Leber zu ihrem im Telegraf erschienenen Artikel übersandte, stellte die Regierungspräsidentin klar, daß zur Tagung in Pyrmont nur eingeladene Frauen erschienen waren – wozu Vertreterinnen von Parteien nicht gehört hätten, sofern sie nicht als Delegierte einer Organisation präsent gewesen wären. Es habe sich außerdem nicht um eine Tagung „sämtlicher Frauenverbände“ – wie Leber es formuliert hatte – sondern um eine „Zusammenkunft von Frauenverbänden überparteilicher Art, die aufgrund gleicher Zielsetzungen nach verwandten Satzungen arbeiten“346 gehandelt, schrieb Bähnisch. Nimmt man die Einladung, welche der ‚Club deutscher Frauen‘ verschickt hatte, ins Visier, so läßt sich konstatieren, daß Bähnischs Vorhaben im Vorfeld der Konferenz durchaus erkennbar war. Denn in der Einladung war explizit die Rede von der „Konstituierung d.[er] überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen der britischen Zone“347 gewesen. Davon, daß die Organisationen sich dem Ziel der staatsbürgerlichen Bildung verschrieben haben müßten, war jedoch nicht die Rede. Tatsächlich waren, Bähnischs Sekretärin Prejawa zufolge, in Pyrmont lediglich „die sogenannten Schwesternorganisationen“348 des ‚Club deutscher Frauen‘ zusammengeschlossen worden. Damit waren die etwa 40349 Organisationen gemeint, die sich bereits im Vorfeld der Konferenz zu einer dem Club sehr ähnlichen Organisationsform und Arbeitsweise bekannt hatten. „Keineswegs“ bestünde jedoch „die Absicht den Ring nur auf diese Organisationen zu beschränken“, teilte das Sekretariat Bähnischs auf eine Nachfrage aus Berlin mit. „Es sollte überhaupt erst einmal eine Plattform geschaffen werden, von der aus sich, wie wir hoffen, ein Gesamtzusammenschluß bilden wird, dem auch Berufsorganisationen sich anschließen sollen.“ Ferner seien
344 Strecker: Frauenarbeit, S. 12. 345 Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Frauen. 346 DFR-Archiv, A2, Maria Prejawa an Annedore Leber, 24.06.1947, Anhang: Berichtigung des Artikels ‚Von Bad Boll zu Bad Pyrmont‘. 347 DFR-Archiv, Freiburg, A1, Tagung der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen der britischen Zone vom 20. bis 23. Juni 1947, Bad Pyrmont [Programm]. 348 DFR-Archiv, Freiburg, A2, Maria Prejawa an Margarete Rudorff, 19.08.1947. 349 Angabe nach Prejawa, Ebd.
Staatspolitische Aufgabe
|
769
Arbeitsgemeinschaften mit anderen Frauenorganisationen angestrebt, „soweit sie sich zunächst noch nicht zum korporativen Anschluss entschliessen können“.350 Enttäuschung über den Traditionsbruch in der bürgerlichen Frauenbewegung Konfliktpotential barg auch der Wunsch vieler Frauen in sich, in Form eines größeren Zusammenschlusses an die Tradition des BDF, der sich 1933 aufgelöst hatte, anknüpfen zu können. Diese Hoffnung hegte beispielsweise Fini Pfannes, die zu den Gründerinnen eines Frauen-Ausschusses der ersten Stunde351 und zu den Rednerinnen des ersten Tages auf der Pyrmonter Konferenz gehört hatte.352 Die PfannesBiographinnen Elke Schüller und Kerstin Wolff haben herausgearbeitet, daß Pfannes und ihre Mitstreiterinnen im Frankfurter Frauenausschuß nicht nur die Inhalte der Arbeit des BDF in die zweite Nachkriegszeit tradierten, sondern auch die Organisationsform eines großen Frauenbundes als nationalem Dachverband, der eine große Breite von Organisationen integriert, wieder aufleben lassen wollten.353 Gemessen an diesem Anspruch konnte Bähnischs Handeln die Frankfurterin nur enttäuschen. Daß Pfannes aufgrund der rhetorischen Parallelen in den Verlautbarungen Bähnischs beziehungsweise des ‚Club deutscher Frauen‘ zur Öffentlichkeitsarbeit des BDF sowie wegen der Zusammenarbeit der Regierungspräsidentin mit bekannten Protagonistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung annahm, daß in Pyrmont ein entsprechender Zusammenschluß stattfinden würde, ist nachvollziehbar. Bähnisch und ihre Mitstreiterinnen wollten jedoch in erster Linie inhaltlich an den BDF anknüpfen. Auf eine vergleichbare Vielseitigkeit im Verband vertretener Organisationen354 war zumindest Bähnischs Politik zu dieser Zeit nicht ausgerichtet. Dies bedeutete einen markanten Bruch in der Geschichte der organisierten „bürgerlichen“ Frauenbewegung. Schließlich hatte der BDF im Jahr 1913 ganze 2.200 Vereine mit 500.000 Mitgliedern unter seinem Dach beherbergt.355 Dem standen 1947 die bereits erwähnten 40 Organisationen, die in den ‚Frauenring‘ integriert waren, gegenüber. Agnes von Zahn-Harnack
350 Ebd. 351 Der Frankfurter Frauenausschuß hatte sich bereits im Januar 1946 konstituiert und wird von daher zu Recht als „Prototyp des frauenpolitischen Aufbruchs“ bezeichnet. Schüller, Elke/Wolff, Kerstin: Fini Pfannes. Protagonistin und Paradiesvogel der Nachkriegsfrauenbewegung, Königstein/Taunus 2000, S. 100. 352 „Wir beschlossen, die Wiedererrichtung des schon vor 1933 bekannten und angesehenen Frauenverbandes in Angriff zu nehmen“, wird Pfannes in einem Interview zitiert. Im Interview berichtet Pfannes von ihrer Begegnung mit Heli Knoll, die sie aus der Zeit vor 1933 kannte. Pfannes, zitiert nach: Schüller/Wolff: Pfannes, S. 99. 353 Ebd., S. 104. 354 Die konfessionellen Verbände standen dem BDF distanziert gegenüber. Der DEF war 1908 in den BDF ein- und 1918 wieder ausgetreten, der KDFB war nie Mitglied des BDF, arbeitete jedoch mit diesem zusammen. Dauerhaft war lediglich der jüdische Frauenverband Mitglied des Dachverbands. Die proletarischen Frauenverbände hatte der Bund selbst von einer Mitarbeit im Verband ausgeschlossen. 355 Vgl.: Gerhard, Ute: Unerhört. Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung, 3. Aufl., München 1992, S. 170.
770 | Theanolte Bähnisch
sollte – dies sei den weiteren Entwicklungen vorweggenommen – mit ihrer 1933 geäußerten Ahnung Recht behalten, daß „die Form, das komplizierte, in seinen Linien sich überschneidende Gebilde des Bundes [Deutscher Frauenvereine], an dem 40 Jahre gearbeitet worden ist […] nicht wieder kommen“356 werde. Bemerkenswert ist, daß dieser Umstand der Anerkennung des ‚Frauenrings‘ durch die internationale Frauenbewegung in Form des ICW keinen Abbruch tat. Dieser hatte vielmehr schon 1947 in ‚Pyrmont‘ in Aussicht gestellt, den ‚Frauenring‘ als Nachfolger des BDF anzuerkennen. Es wäre die spannende Aufgabe einer anderen Forschungsarbeit, zu untersuchen, ob es im ICW Diskussionen zum Thema ‚Breite und Anzahl der im deutschen Council vertretenen Organisationen‘ gab. Ebenfalls noch nicht erforscht ist, wie die anderen Frauen, mit denen Bähnisch 1947 eng zusammenarbeitete, zur möglichen Integration anderer Organisationen in den Frauenring standen. Die letzte Präsidentin des BDF, Zahn-Harnack, hatte erst auf Nachfrage von Maria Prejawa erfahren, daß in ‚Pyrmont‘ nur Organisationen, die im Sinne des Frauenrings arbeiteten, zusammengeschlossen worden waren.357 Dies spielte 1947, als es noch nicht um die Begründung eines nationalen, sondern ‚nur‘ um die eines zonalen Verbands ging, zwar noch eine untergeordnete Rolle, warf aber seine Schatten auf das voraus, was kommen würde. Um das Gesagte zusammenzufassen: Gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern des ‚Frauenrings‘ schrieb sich die Regierungspräsidentin von Hannover ganz bewußt in die Tradition des großen deutschen Dachverbands der bürgerlichen Frauenbewegung – dessen internationaler Repräsentationsfunktion miteingeschlossen – ein, ohne jedoch an seine Organisations-Form anzuknüpfen. Die Leitung des Verbands beanspruchte sie, wobei sie die Leitung einer nationalen Organisation bereits vor Augen gehabt haben muß, für sich. Damit stellte sie sich offensiv in die Tradition von Frauen wie Gertrud Bäumer und Agnes von Zahn-Harnack. Für Fini Pfannes, die „unter den mehr als erschwerten Nachkriegsbedingungen kreuz und quer durch das zerstörte und in Zonen aufgeteilte Deutschland“358 zu verschiedenen Frauenkongressen gereist war, bei denen jeweils die Frage eines größeren Zusammenschlusses im Raum gestanden hatte, schien mit der Gründung des Frauenrings unter Bähnischs Leitung ‚der Zug abgefahren‘ zu sein. Dabei hatte diese viel früher als die Regierungspräsidentin, nämlich bereits im Januar 1946, verlauten lassen, daß die „Bildung einer machtvollen Frauenorganisation“359, deren Leitung in ihren Händen liegen sollte, ihr Ziel sei. Doch gelungen war ihr, die wie Bähnisch zu
356 Zahn-Harnack, Agnes von: Schlußbericht über die Arbeit des Bundes Deutscher Frauenvereine, in: Die Frau, 40. Jg. (1933), S. 551–555, hier S. 551. 357 DFR-Archiv, Freiburg, A2, Maria Prejawa an Agnes von Zahn-Harnack, 11.05.1948. 358 Schüller/Wolff: Pfannes, S. 107. 359 Schüller/Wolff: Pfannes. Im Januar 1947 war, als Schritt hin zu einem größeren Zusammenschluß, aus neun bis dato existierenden Ausschüssen in Hessen der Frauen-Verband Hessen gegründet worden. Vgl.: ebd., S. 105.
Staatspolitische Aufgabe
|
771
den neuen Führerinnen der Frauenbewegung der Westzonen gezählt wurde360, lediglich die Bildung eines Hessen-weiten Zusammenschlusses.361 Unzufriedenheit über die geringe Integrationsleistung des Frauenrings trotz der ‚historischen Chance‘ aus verschiedenen Lagern Einige in der Frauenbewegung aktive Frauen hatten darauf gehofft, daß mit dem ‚Neubeginn‘ 1945 endlich auch eine Überwindung der Trennung zwischen der bürgerlichen und der proletarischen Frauenbewegung362 möglich werde und ein Verband entstünde, der beide Traditionen integrieren würde. Dieser Hoffnung hing – das wird nicht zuletzt aus der versuchten Einflußnahme auf die SPD-Frauenreferentin Herta Gotthelf deutlich363 – auch die britische Militärregierung an. Insgesamt waren kaum Arbeiterinnen in Pyrmont vertreten. Die Konferenz war, zumindest was die Redebeiträge betraf, stark von „Akademikerinnen, […] zumeist erwerbstätig und in hohen Positionen“364 geprägt. Unstimmigkeiten zwischen kommunistischen Mitgliedern des ‚Club deutscher Frauen‘, die auf der Konferenz hatten sprechen wollen, und der Club-Vorsitzenden Bähnisch hatten sich offenbar bereits im Vorfeld der Veranstaltung herauskristallisiert. Die Zeitzeugin ‚Herta D.‘ berichtete Barbara Henicz und Margret Hirschfeld zufolge, daß sich das Mißtrauen Bähnischs gegenüber kommunistischen Club-Mitgliedern beispielsweise darin geäußert habe, daß diese von den Kommunistinnen die Vorab-Vorlage von Referaten verlangt habe, welche in Pyrmont gehalten werden sollten.365 Die Frage ‚parteiübergreifende oder parteinahe Frauenbewegung‘ hatte sich in ,Pyrmont‘ erst gar nicht gestellt, da Frauengruppen von Parteien zum einen nicht geladen worden waren, zum anderen, weil führende Frauen aus der SPD die Zusammenarbeit mit den ‚Bürgerlichen‘ ablehnten.366 Vertreterinnen der sozialdemokratischen Frauenbewegung traten als solche in Pyrmont nicht in Erscheinung. Mit der Braunschweigerin Martha Fuchs war jedoch – in überparteilicher Mission – eine Rednerin präsent, die 1947 als erste Frau die Leitung eines SPD-Parteibezirks übernahm. Alles in allem war ‚Pyrmont‘ also nicht dazu geeignet gewesen, die Verschmelzung von bürgerlicher und proletarischer Frauenbewegung anzustoßen, obwohl die Initiatorin Theanolte Bähnisch selbst der SPD angehörte. Wer mit entsprechenden Hoffnungen auf die Konferenz geblickt hatte, konnte also nur enttäuscht werden. Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld zufolge hatten vor allem ältere Frauen darauf gehofft, die
360 361 362 363 364 365
Vgl. dazu auch: Schüller/Wolff: Pfannes, S. 107 Vgl.: ebd. Vgl. dazu, weil kurz aber prägnant: Nipperdey: Geschichte, Bd. 2/1, S. 90–94. Siehe Kapitel 7.8.2. 750 Jahre Frauen und Hannover e.V.: Kopf, S. 144. Henicz/Hirschfeld: Club, S. 133. Denise Tscharntke übernimmt diese Darstellung – wie einige andere Aussagen Henicz‘ und Hirschfelds – ohne sie zu hinterfragen. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 162. 366 Siehe Kapitel 6.7.
772 | Theanolte Bähnisch
Spaltung der Frauenbewegung in zwei politische Lager überwinden zu können.367 Die Sozialdemokratinnen hielten schließlich nur eine Woche nach der Konferenz in Pyrmont eine eigene Frauen-Konferenz in Fürth ab. Auch Frauen, welche eine stärkere Zusammenarbeit von konfessionellen Organisationen mit nicht-konfessionellen Organisationen in der Frauenbewegung der Zukunft anstrebten wurden durch die Gründung des Frauenrings enttäuscht. So hatten sich Frauen aus dem ‚Heidelberger Frauenverein‘ zum Ziel gesetzt, nicht nur „die Spaltung der Alten Frauenbewegung in bürgerliche und proletarische“, sondern auch in „in evangelische, katholische und jüdische, in liberale und konservative Vereine zu durchbrechen“368. Schließlich hatte sich bereits auf der Konferenz in Bad Boll, auf der Bähnisch eine tragende Rolle gespielt hatte, abgezeichnet, daß ein Zusammenschluß von Frauenorganisationen in Deutschland perspektivisch nur für die Westzonen stattfinden würde. ‚Pyrmont‘ bestätigte diese Marschrichtung, denn auch dort war Frauen aus der SBZ oder dem sowjetischen Sektor Berlins keine Möglichkeit eingeräumt worden, die Konferenz, geschweige denn die Organisations-Gründung, mitzugestalten. Die Erwartungen der Political Division der CCG (BE) werden nur teilweise erfüllt Elke Schüller und Kerstin Wolff konstatieren, daß der „Überraschungscoup“ Bähnischs – womit die Gründung des Frauenrings gemeint ist – „in Übereinstimmung mit den britischen Besatzungsbehörden“369 stattgefunden hätte. Dies scheint jedoch nur teilweise zutreffend zu sein: Tatsächlich hatte Rita Ostermann, Women’s Affairs Officer der Political Division, die Militärregierung schon im März 1947 entsprechend beraten: „it is felt that the establishment of some form of Zonal Committee […] is most desirable“370, hatte Ostermann sich, obwohl doch die Political Division zunächst sehr skeptisch gegenüber Bähnisch und anderen überparteilich arbeitenden Frauen eingestellt gewesen war, für eine solche Gründung ausgesprochen. Zur Begründung verwies sie darauf, daß es für die deutsche Frauenbewegung positive Effekte im In- und Ausland freisetze, wenn sie in dieser Form geschlossen auftreten könnte, daß die Gründung einer solchen Organisation neue Möglichkeiten der Kooperationen mit anderen Organisationen, ebenfalls im In- und im Ausland, schaffen würde, daß sich die Gründung als eine weitere Plattform für politische Aushandlungsprozesse zwischen den Parteien eigne und daß sie schließlich Potential besaß, der KPD etwas entgegenzusetzen. Zwar hatte Ostermann durchaus an die Gründung
367 Vgl.: Henicz, Barbara/Hirschfeld, Margrit: Die ersten Frauenzusammenschlüsse, in: Kuhn: Nachkriegszeit, Bd. 2, S. 94–101, hier S. 96. 368 Guttmann: Einfluß, S. 131. Der Dozentin und Leiterin eines Historikerbüros, Barbara Guttmann, zufolge schien es sich hierbei jedoch eher um Lippenbekenntnisse gehandelt zu haben. Der Frauenverein habe jene Ziele für seine eigenen Reihen zumindest nicht umgesetzt, so Guttmann. Vgl.: ebd. 369 Schüller/Wolff: Pfannes, S. 108. 370 NA, UK, FO 1050/1211, Report on Women‘s Affairs von Rita Ostermann, 13.03.1947, Anhang zu einem Schreiben von Alan Flanders, Political Branch, Berlin an verschiedene Einrichtungen der Militärregierung und das Foreign Office (Mrs. Reeve).
Staatspolitische Aufgabe
|
773
einer solchen Organisation durch Bähnisch gedacht, jedoch hatte sie ihre Empfehlung ursprünglich in der Erwartung, daß in einem solchen Komitee alle Frauenorganisationen und politischen Parteien vertreten sein würden, ausgesprochen.371 Ungeklärt bleibt, ob die ebenfalls an der Konferenz beteiligte Helena Deneke (WGPW) direkten Einfluß auf das Gründungsprozedere, beziehungsweise den Zuschnitt der Organisation ausgeübt und womöglich auch an der Vorbesprechung im kleinen Kreis teilgenommen hatte. Sicher dagegen ist, daß sie im Anschluß an die Konferenz, mit der Zustimmung Ostermanns, eine Reise durch das Rheinland unternahm, um dort existierenden Frauenausschüssen das Statut des Frauenrings zur Orientierung anzubieten. Denise Tscharntke schreibt, sie habe dort den Boden für Bähnisch vorbereitet, die selbst im August 1947 in die Gegend reisen wollte.372 Was bereits in anderen Forschungen herausgearbeitet oder dargestellt wurde373, kann nicht oft genug betont werden: nämlich, daß der Frauenring bewußt nicht als eine Gründung gedacht war, die Frauen aus der SBZ integrieren sollte, sondern als eine solche, die der größten Frauenorganisation der SBZ, dem DFD, entgegengesetzt werden sollte374. Wenn es auch auf der ersten Konferenz in Pyrmont ‚nur‘ um die Gründung einer zonenweiten Organisation ging, so war am Veranstaltungsprogramm doch abzulesen, daß nur mit den Frauenorganisationen der westdeutschen Besatzungszonen Kooperationen mit der Aussicht auf einen späteren Zusammenschluß gepflegt werden sollten. Eine Spaltung der organisierten, als ‚überparteilich‘ auftretenden Frauenbewegung in Deutschland zeichnete sich damit nicht nur ab, sondern sie wurde von Theanolte Bähnisch – im Einklang mit der britischen Militärregierung – sogar zielstrebig verfolgt. Daß hierfür wiederum die direkte Kontrolle des DFD durch die SED ausschlaggebend war, steht außer Frage. 7.4.4 Entscheidende Statements: Unterstützung des ‚Frauenrings‘ 7.4.4.1 „trotz Frühgeburt, das Kind ist da“ – Die Akzeptanz von Bähnischs „rascher Führung“ in der deutschen bürgerlichen Frauenbewegung In der Kritik etwas milder als der ‚Spiegel‘, die Gründung als eine ‚Überrumplung‘ beschreibend, stellte Lisbet Pfeiffer den in Pyrmont erfolgten Zusammenschluß in der ‚Welt der Frau‘ dar. Sie äußerte sich zwar ambivalent, aber am Ende doch erfreut: „Besonders Mißtrauischen […] kam es verdächtig vor, daß niemand die eigentliche ‚Schuld‘ auf sich nehmen wollte: die Verantwortlichen begründeten die Konstituierung mit einem ‚starken Drängen von allen Seiten‘ zu diesem Schritt, die Verbände dagegen erwähnten etwas von ‚zu rascher Führung‘.“375 Die LandesVerbände schienen also, anders als im Tagungsprogramm vorgesehen, nicht wirklich
371 372 373 374
Ebd. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 167. Vgl.: ebd. Vgl. beispielhaft: Schüller/Wolff: Pfannes, S. 109 sowie Bouillot/Schüller: Frauenorganisation und Tscharntke: Re-educating. 375 Pfeiffer: Frauenschaffen, S. 26.
774 | Theanolte Bähnisch
zu Wort gekommen zu sein, als es um die Gründung ging. Pfeiffer verzieh den Veranstalterinnen diesen Mangel an Absprache jedoch mit dem Verweis auf die ‚gute Sache‘, für die sie einstanden. Sie verhielt sich also ganz ähnlich wie Deneke und Norris, die das Demokratie-Defizit des ‚Club deutscher Frauen‘ mit Hinweis auf seine positiven Effekte heruntergespielt hatten. „Immerhin, trotz Frühgeburt, das Kind ist da“, resümierte Pfeiffer. „Es scheint […] gesund und lebensfähig. Und – trotz Tuschelns und Schnüffelns hinter den Tagungskulissen – es konnte lediglich festgestellt werden, daß keiner dagegen, daß im Gegenteil von allen Seiten der beste Wille zu dieser Geburt und weiterem Gedeihen da war und ist. [...] Und dieser gute Wille muß zunächst als ein erstes nicht zu unterschätzendes Plus verbucht werden. So gesehen ist es auch nicht tragisch zu werten, daß dieser Zusammenschluß – vielleicht – etwas zu überstürzt erfolgte.“376 Daß ein rigider Führungsstil Bähnischs für den Ablauf der Veranstaltung verantwortlich war, daran ließ Pfeiffer allerdings keinen Zweifel: „Die Lenkung war straff und energisch – vielleicht etwas zu energisch und zu gelenkt“377, bemerkte sie. Deshalb, vielleicht aber auch aufgrund der Art, mit der man einer Vertreterin des DFD auf der Konferenz begegnet war, vermißte Pfeiffer, die selbst im Kreise der mittlerweile betagten Grandes Dames der Frauenbewegung sozialisiert worden war, in Pyrmont jene „Herzlichkeit“, welche ihr zufolge in Bad Boll zu spüren gewesen sei. Daß die Rednerin des DFD für ihre Worte „ich bin gekommen, um Verbindung und Zusammenarbeit zu suchen. Das ist der Wunsch tausender Frauen des Ostens, wir haben den Mut – bitte haben Sie das Verständnis“378, keinen Beifall erhalten hatte, war in Pfeiffers Wahrnehmung unangebracht. Was die von Pfeiffer kritisierte ‚mangelnde Herzlichkeit‘ angeht, so ist ein Brief Maria Prejawas aufschlußreich, den diese im Rahmen der Konferenz-Planungen an eine Protagonistin der Berliner Frauenbewegung, Hildegard Meding, geschrieben hatte: „Wir möchten im Gegensatz zu Bad Boll möglichst praktisch sein“379, hatte Prejawa der RIASJournalistin mitgeteilt. Daß Meding über „fliegende Baukolonnen, den „Normungsausschuß“ etc. unter dem Titel ‚Leistung als Lebensgrundsatz‘380 sprechen sollte, paßte zu diesem Unterfangen. Tatsächlich hatte sich Bähnisch im Vorfeld der Konferenz sehr darum bemüht, einen stringenten Ablauf der Tagung in ihrem Sinne zu gewährleisten, vor allem was den Zusammenschluß anging. „Du wirst […] für den britischen Sektor Berlins die offizielle Erklärung des Anschlusses an uns abgeben, unter Punkt 7) der Tagesordnung am Sonnabend“381 hatte Bähnisch, eine Widerrede kaum zulassend, im Vorfeld der Tagung an eine andere Berlinerin, Margarete Rudorff, geschrieben.
376 377 378 379 380 381
Ebd. Ebd., S. 26. Ebd. DFR-Archiv, Freiburg, A2, Theanolte Bähnisch an Hildegard Meding, 05.06.1947. Ebd. DFR-Archiv, Freiburg, A2, Theanolte Bähnisch an Margarete Rudorff, 05.06.1947.
Staatspolitische Aufgabe
|
775
7.4.4.2 ‚Pyrmont‘ und die Konferenz der Sozialdemokratinnen in Fürth in der Bewertung von Senior Women’s Oficer Ostermann Besonders interessant am Bericht der Beobachterin, welche von der Political Section der britischen Militärregierung nach Pyrmont entsandt worden war, ist, daß Rita Ostermann im gleichen Papier auch über eine zweite Konferenz, nämlich über die bereits erwähnte SPD-Frauenkonferenz in Fürth, nahe Nürnberg, berichtete. Dabei stellte sie direkte Vergleiche zwischen den Veranstaltungen an und wägte Erfolge und Mißerfolge der Konferenzen gegeneinander ab – um schließlich eine für die Frauenbewegung in Deutschland und somit für Bähnisch äußerst folgenreiche Handlungsempfehlung gegenüber ihrem Arbeitgeber, der Militärregierung, auszusprechen.382 Offenbar war es der Vorsitzenden des ‚Club deutscher Frauen‘ ein Anliegen gewesen, ihre Konferenz vor der in Fürth abzuhalten, denn sie befürchtete, daß auf der SPD-Frauenkonferenz gegen die überparteiliche Arbeit Stellung genommen werden würde. Dem Risiko, daß sich Frauen deshalb von der überparteilichen Arbeit abschrecken lassen und nicht zur Pyrmonter Konferenz erscheinen würden, wollte sie damit offenbar vorbeugen.383 Die Fürther Konferenz der SPD-Frauen fand am 26. und 27.06.1947 statt, also nur eine Woche nach der überparteilichen Konferenz in Pyrmont.384 Im Zentrum der Veranstaltung standen Referate zu den Themen „Die Stellung der Frauen in Staat und Gesellschaft“ (Louise Schroeder), „Arbeitsbericht und Organisationsfragen“ (Herta Gotthelf) sowie „Die SPD und die Frauen“ (Erich Ollenhauer). Im Tagungs-Verlauf wurden einige Resolutionen gefaßt, die sich auf die Regelung der Rentenversorgung von Kriegsopfern, die Schulreform, den Paragraphen 218 StGB, die Berufsausbildung sowie die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage bezogen. Außerdem wurde eine Friedensbotschaft an sozialistische Frauen anderer Länder, zusammen mit einer Protest-Resolution gegen die „unmenschliche Behandlung der Menschen in den deutschen Ostgebieten“385 erarbeitet. Beide Frauen-Konferenzen beschäftigten sich also mit ähnlichen Inhalten, wenn auch, trotz Bähnischs erklärtem Willen zum ‚Arbeiten‘, der ethisch-philosophische Charakter der Konferenz von Pyrmont stärker war. Vor allem durch ihre Terminierung auf den zweiten und dritten Konferenztag gerieten die Beiträge zu den praktischen Fragen in Pyrmont doch etwas in den Hintergrund gegenüber den einleitenden Vorträgen vor allem Grimmes und Bähnischs. Denise Tscharntke kommt zu einer nicht ganz zutreffenden, weil einseitigen Interpretation von Ostermanns Bericht, wenn sie ihm entnimmt, die Konferenz von
382 NA, UK, FO 1050/1230, Report on recent women’s conferences Bad Pyrmont and Fürth, 07. Juli 1947, ,Appendix B‘ zum Dokument ,Political Developments leading to the deutscher Frauenkongreß in Bad Pyrmont 1949‘. 383 NA, UK, FO 945/283, Report on visit to Germany: 7th–19th July, 1947 von A. B. Reeve. 384 Vgl.: Osterroth, Franz/Schuster, Dieter: Chronik der deutschen Sozialdemokratie, Bd. 3. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 2. Aufl., Berlin u. a. 1978, Electronic Edition, Bonn 2001, Stichtag: 26./27. Juni 1947, auf: http://library.fes.de/fulltext/bibliothek/chronik/spdc_ band3.html, am 13.12.2013. 385 Ebd.
776 | Theanolte Bähnisch
Pyrmont habe einen dilettantischen Touch gehabt, während Ostermann für die Konferenz in Fürth positiv eingenommen gewesen sei.386 Tatsächlich empfand Ostermann die Atmosphäre auf den Konferenzen als recht unterschiedlich. Sie sparte jeweils weder mit Lob noch mit Kritik: „There was a welcome lack of vague resolutions on world peace, so characteristic of above-party conferences”387, deutete sie mit ihrem Lob für die SPD-Versammlung auch eine Kritik an der überparteilichen Pyrmonter Konferenz an. Diese war wohl nicht zuletzt auf Bähnischs Vortrag und ihre Forderung nach einer ‚Frauenfriedensfront‘ gemünzt. Die Vertreterin der Militärregierung betonte, wie auffällig die Einigkeit der Frauen in Fürth gewesen sei. Das auf der Konferenz gepflegte Gedächtnis an jene, welche ihr Leben für den Sozialismus gelassen, und die Anwesenheit derer, die Zuflucht im Exil gesucht hatten, habe dieses Gefühl der Einigkeit noch erhöht. ‚Fürth‘ habe dadurch einen „drive“ erhalten, wie er bei überparteilichen Versammlungen nicht zutage trete. Daß die Definition gemeinsamer Ziele durch die verschiedenen Verbände in Pyrmont viel weniger klar ausfallen mußte, als dies auf einem Treffen von Frauen der Fall war, die alle derselben politischen Partei angehörten und die sich damit schon im Vorfeld zu einem entsprechenden Programm bekannt hatten, lag für Ostermann auf der Hand. ‚Fürth‘ habe jedoch mit seiner beeindruckenden Einstimmigkeit auch eine große Schwäche aufgewiesen, so Ostermann, nämlich: „the discussion or rather the lack of it“388. Alles in Allem war das Klima auf der SPD-Konferenz für den Geschmack der Beobachterin am Ende zu einstimmig. Tagesaktuellen Fragen, welche zu Unstimmigkeiten hätten führen können, sei man aus dem Weg gegangen, hielt sie fest und fand schließlich zu dem sehr harten Urteil, daß Toleranz unter Sozialisten, Katholiken und Kommunisten wohl ein Luxusgut sei, das man meine sich nicht leisten zu können. So sei die brennende Frage („the burning question“389) der Mitarbeit von Sozialdemokratinnen an überparteilichen Zusammenschlüssen kaum thematisiert worden, obwohl doch einige führende Frauen in der überparteilichen Bewegung Mitglieder der SPD seien. Diese Mitglieder hätten Ostermanns Meinung nach die Gelegenheit bekommen müssen, auf der Partei-Konferenz ihre Meinung, auch gegen Widerstand, zum Ausdruck zu bringen. Positiv war der Britin auf der SPD-Konferenz die große Professionalität der Redebeiträge aufgefallen, sowohl was deren zeitliche Begrenzung als auch, was die klare Präsentation von Fakten anging. Der überparteilichen Konferenz sei dieser professionelle Aspekt abgegangen. Und doch wollte Ostermann ‚Pyrmont‘ keinesfalls als ein Zusammensein von ‚enthusiastischen Amateuren‘ abtun. Verschiedene Reden hätten, wenn einige auch übermäßig lang gewesen seien, ein hohes Niveau aufgewiesen, konstatierte sie. Besonders hob die Mitarbeiterin der Political Division hervor,
386 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 165. 387 NA, UK, FO 1050/1230, Report on recent women’s conferences Bad Pyrmont and Fürth, 07.06.1947, Appendix B zum Dokument ,Political Developments leading to the deutscher Frauenkongreß in Bad Pyrmont 1949‘. 388 Ebd. 389 Ebd.
Staatspolitische Aufgabe
|
777
daß „the only women State Comissar in Germany“390 über das umstrittene Thema Flüchtlinge und deren Beziehungen zur übrigen Bevölkerung gesprochen habe. In Anlehnung an die beschriebene Tendenz der SPD-Konferenz, schwierigen Fragen aus dem Weg zu gehen und Diskussionen zu vermeiden, ist dies als eine positive Bewertung durch Ostermann zu verstehen. Die Rednerin Martha Fuchs, die immerhin ein prominentes SPD-Mitglied war, hatte auf der überparteilichen Konferenz offenbar größere Freiheiten, über politisch brisante Themen zu sprechen, als dies auf der SPD-Frauenkonferenz der Fall war – so jedenfalls lassen sich Ostermanns Ausführungen interpretieren. Ebenfalls beeindruckt zeigte sich Ostermann von einem Vortrag in Pyrmont über die Rückkehr von Kriegsgefangenen nach Deutschland. Daß die Verantwortung der Frauen „in helping an estranged husband and unwanted father back into the family circle“391 in diesem Vortrag eine zentrale Rolle gespielt hatte, hob sie lobend hervor. In Pyrmont waren in der Wahrnehmung der Berichterstatterin also gesellschaftlich virulente Themen offensiv angegangen worden. Die Konferenz behandelte – was auch die Britin feststellte – Probleme, die zum Alltag der meisten Frauen im Jahr 1947 gehörten. Sie hatte beobachtet, daß in Pyrmont sowohl die Enttäuschung junger Frauen über „what they called politics before“ als auch ein „encouraging interest“392 von Frauen spürbar gewesen sei, die bislang totale Gleichgültigkeit gezeigt hätten. Offenbar war die von Bähnisch initiierte Veranstaltung also durchaus dazu geeignet, den ‚Unmut‘ über die Vergangenheit in der Gesellschaft zu bewältigen, neue Hoffnung zu schöpfen und daraus die Bereitschaft abzuleiten, sich selbst aktiv am Wiederaufbau zu beteiligen. Dazu mag ein anderer, vermutlich in der Tat ‚unprofessioneller‘ Vortrags- und Diskussionsstil vielleicht sogar einen positiven Beitrag geleistet haben. Eine mangelnde Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus, die den ‚Überparteilichen‘ von Seiten der Sozialdemokratinnen und Kommunistinnen zum Vorwurf gemacht wurde, beklagte die Britin in ihrem Bericht über Pyrmont nicht. Ausländische Organisationen, das hatte sich durch das Verhalten von Lady Nunburnholme und Miss Cowan gegenüber Bähnisch gezeigt, hatten einen entsprechenden Vorwurf ebenfalls nicht erhoben, sondern waren mit offenen Armen auf die in Pyrmont versammelten Frauen zugegangen. Deshalb konnte Ostermann in der Quintessenz ihrer Beobachtungen den Nachteilen, welche sie einer überparteilichen Versammlung gegenüber einer parteipolitischen393 bescheinigte, einen herausragenden Vorteil („outstanding advantage“) gegenüber stellen, der vieles aufzuwiegen schien: Während der internationale Sozialismus den deutschen Sozialismus nur bis zu einem gewissen Grad unterstütze, sei der Weg für „non-political organisati-
390 391 392 393
Ebd. Ebd. Ebd. Damit konnte im Kontext ihrer Ausführungen und gemessen am Stand der parteiinternen Frauenarbeit in Deutschland nur die SPD gemeint sein.
778 | Theanolte Bähnisch
ons“394 bereits jetzt sehr viel klarer, stellte die Berichterstatterin fest. Neben den zahlreichen Einladungen, die von Frauenorganisationen aus dem Ausland an überparteilich arbeitende deutsche Organisationen ausgesprochen worden waren, erwähnte Ostermann gesondert, daß eine Frau – Bähnisch wird hier namentlich nicht genannt – sogar eingeladen worden sei, Deutschland auf der ICW-Konferenz in Philadelphia im September zu repräsentieren.395 Schon dieser Umstand rechtfertigte für sich allein genommen Ostermanns Meinung nach die Existenz überparteilicher Frauenorganisationen. Echtes Interesse an international aktuellen Themen und der lebhafte Austausch von Ideen, der auf diesem Weg möglich sei, bedeute nach 12 Jahren der Isolation für die deutschen Frauen sehr viel.396 Daß deutsche Frauen durch Bähnischs Wirken in nicht allzu ferner Zukunft wieder international eingebunden sein könnten, war für die kritische Beobachterin also ein entscheidendes Argument dafür, überparteilichen Organisationen – und damit deren Vorreiter, dem Frauenring und seiner Leiterin Bähnisch – alle erdenkliche Unterstützung zu Teil werden zu lassen. Ostermanns Fürsprache für den ‚Frauenring der britischen Zone‘ fand sich unter anderem im Dezember 1947 darin bestätigt, daß die Organisation Post vom National Council des ICW in London bekam. In jenem Schreiben sicherte der Council dem ‚Frauenring‘ nicht nur seine Unterstützung zu, sondern er teilte darüber hinaus mit, daß er auch auf andere Organisationen im Sinne einer Zusammenarbeit mit dem ‚Frauenring‘ einwirken werde.397 So profitierte Bähnischs Organisation nicht nur von der direkten Unterstützung des ICW, sondern auch von dessen MultiplikatorenFunktion, seinem Einfluß und dem Ansehen, das er in Großbritannien, aber auch in anderen Ländern genoß. Zuletzt führte die Delegierte der Political Division noch ein weiteres, gewichtiges Argument an, das für die Unterstützung der in Pyrmont gegründeten überparteilichen Organisation sprach. Im Frauenring erkannte sie, was vermutlich auch auf Vorbesprechungen, die sie mit Prejawa gehabt hatte398, zurückzuführen war, eine attraktive Alternative für deutsche Frauen zur „communist cover organisation, the Demokratischer Frauenbund Deutschlands“. In Ostermanns Einschätzung hatte der Frauenring Potential, dem DFD Mitglieder oder Intressentinnen streitig zu machen: „Women
394 NA, UK, FO 1050/1230, Report on recent women’s conferences Bad Pyrmont and Fürth, 07.07.1947, ,Appendix B‘ zum Dokument ,Political Developments leading to the deutscher Frauenkongreß‘ in Bad Pyrmont 1949. 395 Einem Brief an Margarete Rudorff zufolge hatte, wie bereits erwähnt, Bähnisch schließlich Katharina Petersen dazu bestimmt, an ihrer Stelle vom 07.–12.09.1947 zur ICWKonferenz nach Philadelphia zu reisen, da sie beruflich zu stark eingebunden und erholungsbedürftig war. DFR-Archiv, Freiburg, A2, Prejawa an Rudorff, 19.08.1947. 396 NA, UK, FO 1050/1230, Report on recent women’s conferences Bad Pyrmont and Fürth, 07.07.1947, ,Appendix B‘ zum Dokument ,Political Developments leading to the deutscher Frauenkongreß in Bad Pyrmont 1949‘. 397 DFR-Archiv, Freiburg, A2, Frauenring der britischen Zone, Sekretariat Hannover an Agnes von Zahn-Harnack, 02.12.1947. 398 Ostermann hatte sich mit Prejawa im Vorfeld der Konferenz getroffen. DFR-Archiv, Freiburg, A2, Prejawa an Hildegard Meding, 09.04.1947.
Staatspolitische Aufgabe
|
779
who would not join a political party but are looking round for some sort of activity with a wider scope, might well have joined the DFD in the sincere belief that they were members of a genuine non-party organisation.”399 Sie ging also inzwischen davon aus, daß ein Bedürfnis von Frauen, sich gesellschaftspolitisch zu betätigen, ohne einer Partei beizutreten, vorhanden sei und daß dieses abgedeckt werden müsse. Für eine Stimme aus der Political Division der CCG (BE) war dies eine geradezu revolutionäre Auffassung. Mit der grundsätzlich größeren Toleranz gegenüber Andersdenkenden, die im Frauenring vorherrschte, der internationalen Anerkennung und Einbindung, die ihm zuteilwurde, und seiner Eignung als Alternative zum DFD waren drei gewichtige Gründe dafür genannt, warum in der Folgezeit nicht nur die Education Branch, sondern auch die Political Division, jene andere Abteilung der CCG (BE), die sich maßgeblich mit ‚Women’s Affairs‘ beschäftigte, ihre Energie auf die Förderung des Frauenrings konzentrierte und damit die Arbeit der Regierungspräsidentin untersützte. „Bad Pyrmont was the answer from the British Zone to the threatened infiltration from the East and, if nothing else, it may serve as a warning that the women of the Western Zones are becoming aware that political issues are on their very doorstep”400, faßte Ostermann den Mehrwert von Bähnischs Anstrengungen und damit gleichzeitig den Boden, auf den ihre Unterstützung durch die Militärregierung in den folgenden Jahren fußen sollte, zusammen. 7.4.4.3 Helena Deneke lobt ‚Pyrmont‘ überschäumend Helena Deneke hatte als Vertreterin der WGPW und damit auch für die Education Branch, die immer wieder Denekes Rat einholte, ebenfalls an der Konferenz von Pyrmont teilgenommen und dort sogar eine Rede gehalten. Die Konferenz bewertete sie auffällig positiv.401 In ihrem Bericht, welchen sie persönlich auf dem Treffen des ‚International Advisory Committee‘ der WGPW am 02.09.1947 ablieferte, stellte sie die Vereinigung der in Pyrmont anwesenden Organisationen zu einer „zonal union“ – anders als die weiter oben zitierte deutschen Presse – als ein einhelliges Ziel dar und charakterisierte, im Gegensatz zu den kritischen Beobachterinnen, sogar die Prozedur, welche zum Zusammenschluß geführt hatte, als „very democratic“402. Von der Atmosphäre der Veranstaltung, die sie als zurückhaltend und würdevoll beschrieb, zeigte sie sich beeindruckt. Die Idee, „männliche Politik“ – in Zusammenarbeit mit den Männern – in eine „menschliche“ Politik zu verwandeln, fand die ungeteilte Zustimmung der in der Frauenbewegung engagierten Professorin. Voller Wohlwollen
399 NA, UK, FO 1050/1230, Report on recent women’s conferences Bad Pyrmont and Fürth, 07.07.1947, ,Appendix B‘ zum Dokument ,Political Developments leading to the deutscher Frauenkongreß in Bad Pyrmont 1949‘. 400 Ebd. 401 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C5, Meeting of the International Advisory Committee, Sept. 2nd, 1947. Vgl. dazu auch Tscharntke: Reeducating, S. 166. 402 Ebd.
780 | Theanolte Bähnisch
erwähnte sie, daß zu den Tagungsinhalten die „Gleichberechtigung der Frau“403, beispielsweise das Eigentum von verheirateten Frauen betreffend, gehört hatte und daß von diversen Sprecherinnen auf der Grundlage persönlicher Erfahrungen über die Arbeit, die Frauen im öffentlichen Dienst leisten sollten, gesprochen worden sei.404 Vermutlich ist es kein Zufall, daß es sich bei diesem, von Deneke besonders hervorgehobenen Thema, um ein Steckenpferd der Verwaltungsjuristin Bähnisch handelte, andererseits war es aber auch ein Thema, das der WGPW, der Deneke Bericht erstattete, besonders am Herzen lag.405 Helena Deneke erwartete also mit Spannung den Herbst des Jahres 1947, in dem sich die Frauen, welche den Zusammenschluß in Pyrmont vollzogen hatten, erneut zusammensetzen wollten. Auf diesem nächsten Treffen sollte die Verfassung, die ein „representative provisional council“406 bis dahin ausarbeiten sollte, ratifiziert werden. Der WGPW teilte Deneke mit, daß sich die Frauen-Organisationen, die sie 1946 unter die Lupe genommen hatte, in den letzten zwölf Monaten allgemein gut weiterentwickelt hätten. Da sie die offenkundig kritikwürdigen Aspekte der Konferenz von Pyrmont nicht reflektierte, drängt sich der Eindruck auf, daß die WGPW-Delegierte im September 1947 um keinen Preis mehr von dem Pferd lassen wollte, auf das sie ein gutes Jahr zuvor gesetzt hatte. Ob sie tatsächlich so hundertprozentig vom ‚Club deutscher Frauen‘ und dem aus ihm entstandenen ‚Frauenring‘ überzeugt war, oder ob sie im Willen einer bruchlosen Bestätigung ihrer 1946 verfaßten Empfehlungen negative Aspekte übersah oder kleinredete, darüber läßt sich nur spekulieren. Die persönliche Sympathie gegenüber der Regierungspräsidentin, die aus den Tagebüchern der Professorin spricht407, scheint ebenfalls eine wichtige Rolle für die Bewertung von Bähnischs Arbeit durch Deneke gespielt zu haben. Besonders interessant – vor dem Hintergrund der Kritik vieler Sozialdemokratinnen an Bähnisch – ist, daß gerade der auffällige Nicht-Gebrauch des Begriffs ‚Demokratie‘ durch Bähnisch für Deneke ausschlaggebend gewesen sein könnte, die frauenpolitische Arbeit der Regierungspräsidentin zu fördern. Eine von Denekes Quintessenzen aus ihrem Deutschland-Aufenthalt Mitte 1947 – also dem Zeitraum, in dem die Konferenz stattfand – lautete nämlich, daß das Wort ‚demokratisch‘ im Umgang mit deutschen Frauen vermieden werden müsse und daß vielmehr die ‚Idee der
403 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 41, Report über eine Reise Helena Denekes nach Deutschland, Helena Deneke, 19.07.1947, S. 30. 404 Ebd. 405 Daß Bähnisch, wie man ihr nachsagte (vgl. dazu: Sybill: Porträt), im Regierungspräsidium ein kombiniertes ‚Frauen- und Flüchtlingsreferat‘ eingerichtet hatte, läßt sich anhand der Aufstellungssystematik in den überlieferten Akten des Regierungspräsidiums nicht nachvollziehen. Vielmehr dürfte in der Person Maria Prejawas, die sowohl Büroarbeit für den Frauenring erledigte, als auch als Referentin dem Sozialdezernat zugeordnet war, der Schlüssel zum Verständnis des von der Regierungspräsidentin beschriebenen Phänomens liegen. 406 Ebd. 407 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Deneke Adds 1, Manuscript Diary of Helena Deneke, S. 35.
Staatspolitische Aufgabe
|
781
Demokratie‘ „with tact and imagination“408 kommuniziert werden solle. Der Terminus ‚Idee der Demokratie‘ ließ sich fraglos verschieden interpretieren. Deneke schien mit ihrer Überzeugung, man könne in dieser Hinsicht Frauen gegenüber gar nicht vorsichtig genug sein, jedoch nicht allein gestanden zu haben. Auch in Grimmes Pyrmonter ‚Rede an die Frauen‘ kam der Begriff ‚Demokratie‘ nicht vor – obwohl der Kultusminister ihn in anderen Reden, die sich nicht speziell an Frauen richteten, durchaus zu exponieren pflegte. Einen besonderen Dienst erwies Deneke der Regierungspräsidentin – aber auch der Militärregierung, in deren Sinn die Förderung des Frauenrings ja ebenfalls lag – dadurch, daß sie persönlich vor dem Frauenarbeitskreis in Hannover über die Konferenz von Pyrmont berichtete. Damit war sichergestellt, daß auch Frauen, die nicht im ‚Club deutscher Frauen‘ beziehungsweise im Frauenring engagiert waren, von dessen Arbeit und der Wertschätzung seiner Arbeit durch eine Vertreterin einer britischen Frauenorganisation erfuhren. Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß nach der Konferenz von Pyrmont zwischen Rita Ostermann und Helena Deneke – und somit von maßgeblicher Stelle der Political Division in der CCG (BE) und der britischen Frauenbewegung in Form der WGPW Einigkeit darin bestand, daß die überparteiliche Frauenbewegung in der britischen Zone mit Bähnisch an ihrer Spitze noch stärker zu fördern sei. Mit dem Erstarken des DFD als kommunistische Frauenorganisation auf der Linie der SMAD/SED ging die Hoffnung Ostermanns einher, daß Bähnisch dieser Organisation eine Alternative entgegensetzen könne, die dazu geeignet sei, jene Frauen anzusprechen, welche auf der Suche nach einem Betätigungsfeld waren, das man nicht in erster Linie als ‚politisch‘, sondern als ‚alltagsorientiert‘ bezeichnen würde. Der erklärte Wunsch der designierten Vorsitzenden des Frauenrings, mit ihrer Organisation einen Platz in der internationalen Frauenbewegung einzunehmen sowie die Bereitschaft von britischen und internationalen Frauenverbänden, dabei Hilfestellung zu leisten, ergänzte die überparteiliche, aber antikommunistische Ausrichtung des Frauenrings in einer Weise, wie sie für die politische Strategie der Westmächte, die unter der Führung der USA stand, optimal war: Der US-amerikanische Präsident Harry S. Truman hatte bereits im März 1947 in seiner als ‚Truman-Doktrin‘ bekannt gewordenen Ansprache verkündet, daß die Unterstützung anderer Staaten gegen kommunistische Umsturzversuche eine neue, offizielle Linie der US-Außenpolitik sei, und US-Außenminister George Kennan hatte im Juli 1947 diese ‚Containment-Strategie‘ durch eine nicht namentlich gekennzeichnete Veröffentlichung unter dem Titel „The sources of soviet conduct“ in der vom CIA finanzierten Zeitschrift ‚Foreign Affairs‘ einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ob Vertreterinnen der WGPW jenen Artikel kannten und inwiefern Rita Ostermann unter dem Einfluß der Rede Trumans stand, läßt sich nicht rekonstruieren. Fakt ist jedoch, daß die Unterstützung des DFR gegen den DFD zweifellos auf jener auch von Großbritannien maßgeblich forcierten politischen Linie der Westmächte lag. (Daß die USA sich zu einer so starken Führungsrolle im Kalten Krieg bekannten, sollte schließlich auch das Ende der
408 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 41, Report über eine Reise Helena Denekes nach Deutschland, Helena Deneke, 19.07.1947, S. 30.
782 | Theanolte Bähnisch
britischen Überlegenheit in Sachen ‚Women’s Affairs‘ in Deutschland mit sich bringen. Es handelte sich dabei jedoch um einen schleichenden Führungswechsel, der sich in jenem Bereich erst Jahre später manifestierte. Im entsprechenden Zusammenhang wird darauf zurückzukommen sein.) Daß in Pyrmont unter Frauen, die verschiedenen Meinungen anhingen, offenbar lebendigere Diskussionen entstanden waren, als dies bei parteiinternen Zusammenkünften der Fall war, verstand Ostermann als der Sache der britischen Militärregierung – dem Aufbau eines demokratischen Pluralismus in Deutschland – äußerst dienlich. Mit dem Integrationspotential des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ verhielt es sich ganz ähnlich wie mit dem des ‚Club deutscher Frauen‘: Durch seine überparteiliche Ausrichtung verlangte der Frauenring solchen Frauen, für die der Begriff ‚Partei‘ eher negativ besetzt war, kein parteipolitisches Bekenntnis ab. Durch seinen Unwillen, den Antisemitismus anzuprangern sowie seine Neigung, die Männer für den Krieg – und unausgesprochen zwischen den Zeilen auch für den Holocaust – verantwortlich zu machen, versprach er, die große Mehrheit der ‚Mitläuferinnen‘ des Nationalsozialismus nicht auszugrenzen, sondern als Teil der WiederaufbauGemeinschaft anzuerkennen, in seine Reihen zu integrieren und zu Toleranz und aktiver Arbeit für einen erst noch zu etablierenden demokratischen Staat zu erziehen. Das herausgehobene Amt Bähnischs versprach, dass das Projekt im Gespräch bleiben würde, das Medieninteresse war denkbar groß. Keine parteiinterne Frauengruppe und kein anderer überparteilicher Verband schien – nach dem, was der Militärregierung bekannt war – zu dieser Zeit ein ähnlich integratives Potential zu besitzen. Inwiefern dieses Potential auch praktisch umgesetzt wurde, stand jedoch auf einem anderen Blatt und soll an anderer Stelle ausgeführt werden. Die Ausgangsposition des Frauenrings als überparteilicher, antikommunistischer Verband, der sich auf einem guten Weg in Richtung Wiederanschluß an die internationale Frauenbewegung befand, war für Rita Ostermann im Juni 1947 bereits Grund genug dazu, auf die Organisationzu setzen – auch wenn sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzeichnete, wie die internationale Arbeit des Frauenrings genau aussehen würde. Die Inhalte, mit denen er in Sachen ‚Gleichberechtigung von Mann und Frau‘ aufwartete, schienen für Ostermann gegenüber allen anderen Argumenten, die für eine Förderung des Frauenrings sprachen, zu jener Zeit bereits stark ins Hintertreffen geraten zu sein. Ob sie sich zu einer ‚Nebensache‘ entwickeln würden, blieb abzuwarten, schließlich hatte sich der Frauenring, das läßt sich dem Protokoll der Delegiertentagung in Hannover entnehmen, auch zum Ziel gesetzt, die Rechte von Frauen zu mehren und Frauen allgemein zu einem größeren Einfluß in der Gesellschaft zu verhelfen. Helena Deneke glaubte – ihrem Bericht nach zu urteilen – jedenfalls weiterhin daran, daß Theanolte Bähnisch einen relevanten Beitrag zur rechtlichen Gleichstellung der Geschlechter, zu einer breiteren Akzeptanz von Frauenberufstätigkeit in der Gesellschaft und zu einem größeren Einfluß von Frauen auf die Gesellschaft insgesamt beitragen würde. Der Frauenring war und blieb unter jenen Voraussetzungen – seiner antikommunistischen Haltung, seinem Bekennntnis zum Pluralismus, zur Emanzipation und zur ‚staatsbürgerlichen Frauenbilung‘ sowie der Anerkennung, die ihm durch die Women’s Officers der Militärregierung zu Teil wurde – ein Partner, wie ihn sich die gemäßigte, staatsnahe britische Frauenbewegung in der internationalen Zusammenarbeit wünschen konnte.
Staatspolitische Aufgabe
|
783
7.5 QUO VADIS THEANOLTE BÄHNISCH? ERSCHÖPFUNG, ZERISSENHEIT UND DIE SUCHE NACH ALTERNATIVEN ZU DEN ETABLIERTEN ARBEITSFELDERN 7.5.1 Eine ausgebrannte Vorsitzende hegt Fluchtgedanken Daß keiner der Berichte und keines der Protokolle über ‚Pyrmont‘ darüber Auskunft gibt, mit welcher ‚Mannschaft‘ die Regierungspräsidentin den ‚Frauenring der britischen Zone‘ leiten wollte, ist kein Zufall. Denn der organisatorische Rahmen für die Arbeit des Frauenrings war, wie schon erwähnt, auf der Gründungs-Konferenz noch gar nicht abgesteckt worden. Dies erinnert an die Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘ in Hannover, die etwa ein Jahr zuvor ebenfalls ohne eine Vorstandswahl zu Ende gegangen war. Der geschäftsführende Vorstand des ‚Frauenrings‘ wurde schließlich erst ein knappes Jahr nach der Pyrmonter Konferenz und damit kurz vor der interzonalen Frauenkonferenz in Frankfurt im Mai 1948 auf einer Delegiertentagung des Frauenrings in Hannover am 01. und 02.05.1948 gewählt.409 Auch die Vereins-Satzung, die in Pyrmont nur als Entwurf vorgelegt worden war, fand erst mit diesem Treffen ihre endgültige Form. Daß zwischen dem offiziellen Gründungsakt und der Erledigung der ‚Formalitäten‘ soviel Zeit verstrich, scheint im Zusammenhang damit zu stehen, daß die Regierungspräsidentin und frisch gebackene Vorsitzende des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ nach ‚Pyrmont‘ am Ende ihrer Kräfte angelangt war und kurz davorstand, aufzugeben. Direkt im Anschluß an die Konferenz hatte sie einen zweiwöchigen Urlaub, beginnend am 01.07.1947, beantragt, doch diese Pause kam zu spät. Eine Mandelentzündung hatte sich derart festgesetzt, daß „der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen“ und bereits „Vergiftungserscheinungen“410 aufgetreten waren. Wann die starke Erschöpfung eingesetzt hatte, die sich in der zweiten Hälfte des Jahres 1947 so lähmend auf die vielbeschäftigte und engagierte Behördenleiterin auswirkte, läßt sich nicht mehr nachvollziehen. Bereits am 17.07.1947 hatte Maria Prejawa im Auftrag Bähnischs an Agnes von Zahn-Harnack geschrieben, daß ihre Chefin gerade in Folge ihrer Mandel-OP eine „sehr strenge Kur“411 halte und sich deshalb nicht persönlich melden könne. Dies war nur die halbe Wahrheit, denn ganz offensichtlich ging es Bähnisch auch psychisch schlecht. Im Anschluß an die Operation hatte die Behördenleiterin ihren ‚Krankheitsurlaub‘ bis zum 14.08.1947 verängert und anschließend, auf Anraten des Arztes, noch zwei Wochen Erholungsurlaub genommen, so daß sie insgesamt zweieinhalb Monate lang nicht im Dienst war.412 „Ich werde ihren Rat, mich gründlich zu erholen, wirklich befolgen, zumal mir mein eigenes Gefühl gesagt hat, daß ich infolge Überarbeitung seit Monaten mich in einem Stagnationsprozeß befand, der den inneren Quell der Kraft
409 DFR-Archiv, Freiburg, A2, Maria Prejawa an Agnes von Zahn-Harnack, 11.05.1948. 410 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Ärztliche Bescheinigung, Bad Pyrmont, 13.07.1947. 411 DFR-Archiv, Freiburg, A2, Prejawa an Zahn-Harnack, 17.07.1947. 412 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Blatt 25–28.
784 | Theanolte Bähnisch
und Intuition hat versiegen lassen und das war ein entsetzliches Gefühl“413, hatte sie im August 1947 aus dem Kurbad Pyrmont, wo sie sich diesmal zur Genesung aufhielt, an ihren Freund Adolf Grimme geschrieben. „Ich liege von morgens bis abends auf einem herrlichen Balkon, blicke in’s Grüne und werde dabei wieder ganz gesund“, hatte sie Grimme gezeigt, wie ernst sie seinen freundschaftlichen Rat nahm und wie wohl ihr dies tat. Im Verlauf ihres Briefes hatte sie ihrem Vertrauten mitgeteilt, daß sie „offen gestanden zur Flucht aus allen Tätigkeiten in Niedersachsen fest entschlossen“ gewesen sei. Daß sie die Einladung des ICW zur Frauenkonferenz nach Philadelphia – und damit eine sehr große Ehre – mit Hinweis auf ihre berufliche Überlastung abgelehnt hatte, „sollte der erste Schritt auf dieser Flucht sein.“ Inzwischen habe sie jedoch erkannt, hatte Bähnisch geschrieben, „daß es falsch war und ich wohl noch weiter durchhalten muß“414. Auf bereits bekannte Weise hatte sie ihre Entscheidung, durchzuhalten, zu einem Opfer für die Nation stilisiert. Sie „bilde sich ein“, hatte Bähnisch an Grimme geschrieben, daß ihre „Erkenntnisse“ sie „verpflichten, sie in Taten umzusetzen“415. Nachdem feststand, daß Katharina Petersen sie in den USA auf der ICW-Konferenz, auf der es auch um die Aufnahme des Frauenrings in den internationalen Verband gehen sollte, vertreten würde, bereute Bähnisch ihren Entschluß, wegen Überlastung abgesagt zu haben. Sie hoffe nun, daß sie durch ihr „Nichtfahren nach Amerika nicht zuviel versäume.“ Denn es „wäre die Möglichkeit gewesen, den Frauenring der britischen Zone mit einem ganz grossen Elan herauszustellen und zu unterbauen. Es wird nachher schwerer sein, aber ich muß es auch so schaffen“416, hatte sie Grimme einerseits demonstriert, daß sie ihren Enthusiasmus zwischenzeitlich zurückerlangt hatte, andererseits, daß sie den ‚Frauenring‘ vorrangig als ihr Projekt verstand, das auch nur durch ihr persönliches Engagement maximal erfolgreich sein könne. Die organisierte Frauenbewegung war im Sommer 1947 nicht das einzige Projekt, welches die Vorsitzende des ‚Frauenrings‘ stark beschäftigte und von dem sie zwischenzeitlich nicht wußte, ob ihr Einsatz sich auch lohnen würde. Zur gleichen Zeit stand ernsthaft in Frage, ob sie ihr Amt als Regierungspräsidentin weiterführen können würde.417 Die Sorge, ob ihre Stellung in der Verwaltung sicher war, schien sich mit Unsicherheit darüber zu mischen, ob sie die Position überhaupt weiterhin ausfüllen wollte, ersteres dürfte letzteres bedingt oder zumindest beeinflußt haben. In der Zeit zwischen ‚Pyrmont‘ und der Delegiertentagung des Frauenrings in Hannover 1948 ebbte die Diskussion um die Abschaffung der von den Briten als ‚undemokratisch‘ wahrgenommenen Regierungspräsidien nicht ab. Bähnisch, die der Meinung war, daß ein „Minimum an Demokratie“ und Kontrolle der Behörden durch die Ministerien genüge, hatte erklärtermaßen genug von der ihrer Meinung nach bereits
413 414 415 416 417
GStA PK, VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Bähnisch an Grimme, 12.08.1947. Ebd. Ebd. Ebd. Siehe Kapitel 5.2.7.1.
Staatspolitische Aufgabe
|
785
deutlich überzogenen „Bürokratie“418 – womit sie nicht zuletzt die parlamentarische Kontrolle von Regierungshandeln gemeint zu haben schien. Sie befürchtete einen „Erstarrungsprozeß“419 der Verwaltung, in den sie nicht involviert sein wollte. Zwischen Mitte Juli und Mitte September 1947 konzentrierte sich die Erholungsbedürftige ganz auf ihre Genesung. Im Anschluß dürfte sie wesentlich damit beschäftigt gewesen sein, wieder in ihre Kernaufgabe, die Leitung des Regierungspräsidiums, zurückzufinden. Nach ihrem Urlaub im Januar 1948 warteten dann zwei weitere große Projekte darauf, vorangebracht zu werden. Daß Bähnisch sich selbst so mit Arbeit überhäufte, scheint nicht zuletzt auch damit im Zusammenhang gestanden haben, daß sie nicht wissen konnte, ob ihr das Amt als Regierungspräsidentin als Einkommensquelle und als erfüllender Lebensinhalt erhalten bleiben würde. Andere Optionen mußten also zumindest geprüft und, für den Fall der Fälle, vorbereitet werden. 7.5.2 Die Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ Seit mindestens Mai 1947420 leistete die Juristin Vorbereitungen für die erste Ausgabe ihrer Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘. Daß sie mit dem Gedanken spiele, eine Frauenzeitschrift herauszugeben, hatte sie Kurt Schumacher bereits im Dezember 1945 mitgeteilt421, dann kam das Thema – aus dem Munde Elfriede Pauls – wieder auf die Tagesordnung, als der ‚Club deutscher Frauen‘ Mitte 1946 in Hannover seine Pläne vorstellte.422 Daß Theanolte Bähnisch im März 1848 die Lizenz für eine FrauenZeitschrift erteilt wurde423, läßt sich als weiterer Vertrauensbeweis der Militärregierung, diesmal durch die Press Relation/Information Service Center Group (PR/ISCGroup)424 und den Beratenden Presseausschuß des Landes Niedersachsen werten. Die Briten hatten als einzige Besatzungsmacht die Lizenzierungspraxis für Presseerzeugnisse an einen Presserat und vier beratende Landesausschüsse für das Pressewesen aus deutschen Verlegern, Journalisten und Vertretern von Parteien abgetreten. Diesen
418 GStA PK, Berlin, VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Theanolte Bähnisch an Adolf Grimme, 12.08.1947. 419 Ebd. 420 DFR-Archiv, A 2, Freiburg, Ilse Langer an Theanolte Bähnisch, 09.05.1947. 421 Zu dieser Zeit hatte Bähnisch allerdings an eine Zeitschrift für die „schaffende Frau“ gedacht. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 23.12.1945. 422 Eine Friedensfront der Frauen, in: Neuer Hannoverscher Kurier, 21.06.1946, abgedruckt in: Henicz/Hirschfeld: Club deutscher Frauen, S. 128/129. 423 NLA HA HStAH, Nds. 53, Nr. 637 [Der beratende Presseausschuß für Niedersachsen, Schriftverkehr mit Information Services Divison, Regional Staff Land Niedersachsen] Newspaper and periodicals licensing statement for british zone (as at 21 Oct. 1948). 424 Zur Arbeit der PR/ISC vgl.: Clemens, Gabriele: Britische Kulturpolitik in Deutschland 1945–1949. Literatur, Film, Musik und Theater, Stuttgart 1997, S. 98–101. Zu den Bedingungen in der britischen Besatzungszone unter denen Bähnisch ihre Lizenz erhielt, vgl.: Freund: Krieg, S. 74–79.
786 | Theanolte Bähnisch
einzusetzen war Aufgabe von Ministerpräsident Kopf gewesen.425 Eine Letztkontrolle der Entscheidungen behielt sich die CCG (BE) jedoch vor.426 Ein Grund dafür, daß Bähnisch trotz aller Auseinandersetzungen mit Genossen SPD-Mitglied blieb, könnte in der Lizensierungspraxis der Britischen Zone gelegen haben. Denn die Lizenzen für Zeitschriften und Zeitungen in der Zone wurden parteinah vergeben, wobei Sozialdemokraten besonders gute Chancen hatten.427 Die politische Vergangenheit und Haltung des Herausgebers waren das für eine Lizenzerteilung entscheidende Kriterium. Sogenannten ‚Altverlegern‘, die auch während des Dritten Reiches publiziert hatten, wurden zunächst nur ungern Genehmigungen erteilt. Bähnisch gab die Zeitschrift zunächst in einem Viererteam gemeinsam mit Anna Mosolf, dem Gebrauchsgraphiker Wolfgang von Duisburg428 sowie dem Theaterkritiker Gerd Schulte429 heraus. Schon im Herbst 1948 waren Bähnisch und Mosolf, wie Bähnisch in einem Brief an die designierte RIAS-Redakteurin Hildegard Meding
425 NLA HA HStAH, Nds. 53, Nr. 637, Chief PR/ISC Group an den Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, Abschrift an den Kultusminister, 22.11.1947. 426 Vgl.: Lott: Frauenzeitschriften, S. 321. 427 Vgl.: Koszyk, Kurt: The press in the British Zone of Germany, in: Pronay, Nicholas/Wilson, Keith (Hrsg.): The political re-education of Germany & her allies after World War II, London u. a. 1985, S. 107–138, hier S. 121. 428 Der 1912 geborene Wolfgang von Duisburg war sowohl Illustrator von Hildesheimer Regionalpublikationen als auch ab 1955 Herausgeber und Photograph der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung. Bei der ‚Stimme der Frau‘ war Duisburg zuständig für die Bildredaktion und die graphische Gestaltung. Von Duisburg war, wie die anderen Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer der Zeitschrift, nicht Mitglied der NSDAP gewesen und vom Entnazifizierungsverfahren nicht betroffen. Er hatte der Reichskammer für bildende Künste, dem Reichsluftschutzbund und der NSV angehört. In seinem Fragebogen hatte er angegeben, in seiner beruflichen Freiheit während des Dritten Reichs beschränkt worden zu sein. Zwischen 1943 und 1945 war er laut seinen Angaben als Zeichenlehrer und ‚Kunstbetrachter‘ tätig gewesen. 1941 hatte er eine Italienerin geheiratet. NLA HA HStAH, Nds. 171, Hildesheim, Nr. 71050. 429 Gerd Schulte war 1913 geboren und ursprünglich Buchhändler gewesen. Seine Karriere als Journalist hatte er 1933 als Schriftleiter beim Hannoverschen Kurier begonnen und dort bis 1939 als Ressortleiter des Feuilletons und des Lokalteils gearbeitet. Auch nach 1945 war er für kurze Zeit wieder beim ‚Kurier‘ tätig, bevor er 1946 zur Hannoverschen Presse wechselte. Schulte gab an, daß er im Jahr 1935 seine journalistische Arbeit für neun Monate habe unterbrechen müssen, nachdem ihm wegen einer positiven Äußerung über Gustav Stresemann gekündigt worden sei. Schulte war nicht Mitglied der NSDAP, jedoch seit 1933 Mitglied der DAF gewesen. Als Zeugen für die Richtigkeit seiner im Fragebogen gemachten Angaben verbürgten sich der Journalist Herbert Wolff, der in der ersten Ausgabe der ‚Stimme der Frau‘ einen Artikel über Theanolte Bähnisch und die Rolle von Frauen in der Gesellschaft verfaßte, sowie Maria Luisa von Duisburg, Wolfgang von Duisburgs Ehefrau. Auch Schulte war als Lizenznehmer für die ‚Stimme der Frau‘ vorgesehen gewesen. NLA HA HStAH, Nds. 171, Hannover, Nr. 12672.
Staatspolitische Aufgabe
|
787
schrieb, „den männlichen Chefredakteur“, womit von Duisburg gemeint war, „glücklich los“430. Die Arbeit an der Zeitschrift, die im Juni 1948 zum ersten Mal erschien und „ein Mittelding zwischen Zeitschrift und Zeitung“431 sein sollte, dürfte auch die Kraft der Schulrätin Mosolf sowie der ‚rechten Hand‘ Bähnischs, Maria Prejawa, weitestgehend absorbiert haben. Denn in den ersten Ausgaben war der Anspruch der (politischen) Frauenbildung spürbar stark – bevor er, trotz der angestrebten Zusammenarbeit mit Ulla Illing, der späteren Begründerin des bei Jugendlichen sehr beliebten ‚Seminars für Politik‘ in Frankfurt, bis 1951 schrittweise immer weiter nachließ und eher kurzweilige Unterhaltung an Raum gewann.432 Daß Prejawa in die Herausgabe involviert war, ist nicht nur insofern wahrscheinlich, als die ‚Stimme‘ über den Frauenring berichtete433, sondern auch, weil die für den Frauenring ehrenamtlich tätige Sekretärin auch Korrespondenzen in Angelegenheiten der Zeitschrift erledigte.434 Zwar war mit der Kielerin Else Richter eine Redakteurin des Blattes, das zunächst ‚Miranda‘435 hatte heißen sollen, benannt worden. Dies hielt Theanolte Bähnisch jedoch nicht davon ab, selbst auf die Suche nach verwertbaren Beiträgen zu gehen –
430 DFR-Archiv, A2, -Sekr.-/Bähnisch an Hildegard Meding (RIAS Berlin), 17.07.1948 Entwurf. Einem Schreiben von Duisburgs zufolge war die Zusammenarbeit einvernehmlich beendet worden. NLA HA HStAH, Nds. 53, Nr. 391 [Stimme der Frau], Wolfgang von Duisburg an die Niedersächsische Staatskanzlei, 25.09.1948. 431 DFR-Archiv, A2, -Sekr- [Bähnisch über Prejawa] an Dr. Gretel [Margarete] Rudorff, 13.05.1947. 432 Vgl.: Freund: Krieg, S. 83. Vgl. dazu Lott: Frauenzeitschriften, S. 351 und 386. Im Frühjahr 1949, mit dem Umzug nach Hamburg, habe die ‚Stimme der Frau‘ ihren Anspruch aufgegeben, „neben den üblichen Ratgeber- und Unterhaltungsthemen vor allem schwierige kulturelle, politische und juristische Themen für Laien interessant aufzuarbeiten“, konstatiert Sylvia Lott (ebd., S. 361). Einen weiteren Einschnitt in der Art der Berichterstattung sieht Lott mit dem Erscheinen von Heft 15 des Jahrgangs 1949/50. (Ebd.) Auch wenn Lott mit dieser Einschätzung in der Tendenz Recht zu geben ist, so ist die Darstellung, vor allem was den ersten von ihr gesetzten Einschnitt betrifft, doch stark vereinfacht. Auch nach 1950 äußerte sich die Zeitschrift zu den angesprochenen Themen, vor allem zu Themen der zivilrechtlichen Gleichstellung von Frauen, wenn auch in verknapptem Umfang. Über die Rechte von Frauen erschienen auch 1952 noch längere Artikel, über Literatur und Kunst, Sozialpolitik und Pädagogik wird bis Ende 1950 in einem breiteren Rahmen berichtet. Danach gibt es nur noch vereinzelt längere Artikel zu diesen Themen, so daß der zweite von Lott gesetzte Einschnitt als richtig betrachtet werden kann. In Kurzrubriken blieben Politik und Kultur allerdings weiterhin und bis zum Ende des Untersuchungszeitraums Dezember 1952 präsent. 433 Vgl.: Bähnisch, Theanolte: Die Mitarbeit der Frau ist überall!, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), S. 4/5, hier S. 5. 434 Belege dafür finden sich unter anderem in DFR-Archiv, A2. 435 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Bericht vom offiziellen Teil der Tagung der Deutschen Frauenbünde in Neumünster am 31.10.47, Lore Szeczinowski. Die Berichterstatterin fühlte sich bei diesem Namen an „schlechtes Parfum“ erinnert. Ebd.
788 | Theanolte Bähnisch
zumal sich Richter, die den Frauenring in Schleswig-Holstein leitete, vor allem auf hauswirtschaftliche Artikel konzentriert zu haben schien. Die Regierungspräsidentin akquirierte, wie die Überlieferung im DFR-Archiv zeigt, vor allem auch unter jenen Frauen, die gemeinsam mit ihr eine Dachorganisation der Frauenverbände aufbauen wollten, und nutzte deren Kontakte zu verschiedenen Journalistinnen.436 Nach dem Ausscheiden von Chefredakteur von Duisburg wollte sie mit Ulla Illing, besprechen, wie die Zeitschrift umgestaltet werden könnte. „Mir fehlt eine wirklich tüchtige Journalistin für die geistige Gestaltung der frauenpolitischen Dinge“437, erklärte sie der in der Berliner Frauenbewegung engagierten Hildegard Meding ihre Entscheidung für Illing. Meding bot von sich aus, aus der Sorge, das Interesse der Frauen in Westdeutschland an Berlin würde auf Dauer erlahmen, an, für die Zeitschrift regelmäßig einen ‚Berliner Brief‘ zu verfassen.438 Bähnischs gute Freundin Ilse Langner hatte offenbar darauf spekuliert, sich stark in die Gestaltung der Zeitschrift einbringen zu können. Doch kurz vor dem Erscheinen der ersten Ausgabe hatte die Herausgeberin der Schriftstellerin mitgeteilt, daß „Du von Berlin aus die verantwortliche Zusammenstellung des Feuilleton nicht machen kannst. Es lässt sich, wie wir hier sehen, praktisch nicht durchführen, da die Pressekonferenzen und die Chefredakteurin natürlich mit Einfluß auf die Gestaltung nehmen. Aber ich nehme an, daß das für Dich nicht so entscheidend ist. Du wirst unsere Hauptmitarbeiterin für den kulturellen Teil und auch entspr. honoriert werden.“439 Daß im DFR-Archiv auch Briefe an Langner, in denen es um die Zeitschrift geht, überliefert sind, obwohl sich Langner nicht im DFR-engagierte, deutet darauf hin, daß die Zeitschrift in der Verbandshistorie zumindest für die Anfangszeit als ‚Komplementär-Produkt‘ zum DFR bewertet wurde. Daß Ilse Langner an der Gestaltung der ‚Stimme der Frau‘ beteiligt war, mag mit dazu beigetragen haben, daß die ersten Ausgaben des Blattes im Aufbau und der Wahl der Themenschwerpunkte auffällig der in den 1920er Jahren in Berlin erschienenen Zeitschrift ‚Die schaffende Frau‘440 ähnelte, in der die Soroptimistinnen, auch Bähnisch441, regelmäßig Artikel über berufstätige Frauen veröffentlicht hatten. Viele der in der Zeitschrift abgedruckten Photos stammten aus dem Atelier der Soroptimistin Lotte Jacobi, für das Bähnisch einige Jahre lang als Vertreterin gearbeitet hatte.442
436 DFR-Archiv, A2, ‚Sekr. Bähnisch‘ [Prejawa] an Hildegard Meding, 17.07.1948, Entwurf. Gemeinsam mit Erdmuthe Falkenberg und Ulla Illing sollte Meding eine Arbeitsgemeinschaft bilden und Bähnisch Beiträge (aus Berlin) zuschicken. 437 Ebd. 438 DFR-Archiv, A2, Hildegard Meding an Theanolte Bähnisch, 31.07.1948. 439 DFR-Archiv, A2, -Sekr.- [Prejawa] an Ilse Langner, 13.05.1947. 440 Die Zeitschrift erschien mit dem Untertitel ‚Zeitschrift für modernes Frauentum‘ in Berlin. Von 1929 bis 1932 wurde sie von Margarete Kaiser herausgegeben. Bekannte Beiträger der ‚schaffenden Frau‘ waren unter anderem Helene Stöcker, Helene Weber, Theodor Plivier, Walter von Hollander und Ilse Reicke. Für weitere Informationen siehe Kap. 2, Anm. 432. 441 Bähnisch: Staatsverwaltung. 442 Siehe Kapitel 2.3.2.5.1 sowie 3.2.1.
Staatspolitische Aufgabe
|
789
Die ‚Schaffende Frau‘ ist als ein durchaus anspruchsvolles, attraktiv aufgemachtes Medium zu bewerten, was die SPD-nahe ‚Rundschau der Frau‘ 1929 dazu veranlaßte, das Medium als eine neue Zeitschrift „von hohem Niveau für alle Fragen der modernen berufstätigen Frau“ vorzustellen, „die sich bemüht, über intellektuelle Bürgerlichkeit herauszukommen“443. Es scheint, zumindest den ersten Ausgaben der ‚Stimme der Frau‘ nach zu urteilen, daß Bähnisch an beide Traditionen, die der anspruchvollen Texte und die der professionellen Illustrationen, anknüpfen, gleichzeitig aber auch ein leichter zu ‚verdauendes‘ Medium anbieten wollte. Im März 1949 verlegte der Hamburger Kurt Ganske444 die ‚Stimme‘, während Bähnisch und Mosolf Herausgeberinnen blieben.445 Aus dem ‚Stimme der Frau‘Verlag wurde der ‚Jahreszeiten‘-Verlag, in dem Ganske bald auch das Glamour-Blatt ‚Film und Frau‘ verlegte.446 Dem Ganske-Biographen Emmanuel Eckardt zufolge hatte der Verleger der Regierungspräsidentin, die mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Hinrich Wilhelm Kopf zu einem Abendessen bei Ganske erschienen sei, „aus der Patsche“447 helfen wollen. Sie habe ihm „ihr Leid“ über die „emanzipatorische Zeitschrift“, die sie „in einer Baracke“ herausgebrachte, geklagt. „Warum wollen Sie sich noch länger damit herumärgern? Geben Sie das Blatt doch an einen richtigen Verlag. Ich nehme es gern“448, soll Ganske gesagt haben. Ein gedankliches Einverständnis zwischen Ganske und Bähnisch bestand insofern, als Ganske, der ab 1939 die Taschenbuchreihe ‚Geistiges Europa‘ herausgegeben hatte449, sich sehr für die politische Entwicklung Europas interessierte.450 Er war ab 1948 auch Verleger des einstigen Sprachrohres der deutschen Verfassungsbewegung, des ‚Rheinischen Merkur‘, und hatte – seinem Sohn Thomas zufolge – dessen katholische Ausrichtung in eine ökumenische korrigiert, was ebenfalls im Sinne der überkonfessionell arbeitenden Bähnisch gewesen sein dürfte.451 Über Bähnischs Beweggründe zur Herausgabe der ‚Stimme der Frau‘ ist aus den analysierten Quellen kaum etwas zu erfahren. In der ersten Ausgabe der Zeitschrift ist zu lesen, daß diese es sich zur Aufgabe gemacht habe, die ‚Stimme der Frau‘ zu Gehör zu bringen. Dies sei eine „politische Forderung [...] über deren Berechtigung keine Zweifel mehr bestehen, deren Verwirklichung aber noch viel planmäßige Arbeit voraussetzt“452. Daraus und aus den allgemeinen Recherchen über die Arbeit Bähnischs in der Frauenbewegung sowie die Erwartungen der Militärregierung an die
443 Vgl.: O. V.: Neue Frauenzeitschriften, in: Rundschau der Frau, Nr. 4, Januar 1930. Die Rundschau wurde, wie dem Titelblatt zu entnehmen ist, „nach Bedarf“ vom Zentralverband der Angestellten (ZDA) herausgegeben. 444 Zu Ganske vgl.: Eckardt, Emmanuel: Kurt Ganske und seine Zeit, Hamburg 2005. 445 Vgl.: Lott: Frauenzeitschriften, S. 385, Anm. 4. 446 Vgl.: Eckard: Ganske, S. 115/116. 447 Ebd., S. 122. 448 Ebd. 449 Vgl.: ebd., S. 81. 450 Vgl.: ebd., S. 146. 451 Vgl.: ebd. 452 Wolf: Augen.
790 | Theanolte Bähnisch
Frauen-Re-education-Arbeit in Deutschland lassen sich folgende Zielsetzungen ableiten: 1.) wollte die Herausgeberin eine möglichst starke Verbreitung ihrer antikommunistischen, eine Orientierung an westlichen Referenzgesellschaften nahelegenden Überzeugungen auch unter jenen Frauen, die nicht im Frauenring mitarbeiteten, sicherstellen. Daß dieses Vorgehen im Sinne der CCG (BE) war, zeigte sich unter anderem darin, daß die Einfuhr sowjetischer Druckerzeugnisse im November 1948 verboten wurde453, nachdem der Niedersächsische Zeitschriftenverlegerverein bereits im April 1948 mit Sorge festgestellt hatte, daß „Niedersachsen […] in seiner ganzen Länge an die russische Zone grenzt und in besonderem Masse mit Zeitungen und Zeitschriften östlicher Prägung überschwemmt wird“454. 2.) sollte die Zeitschrift auch über die Arbeit des ‚Frauenrings‘ und über als ‚spezifisch weiblich‘ definierte Themen informieren. Die Frauenemanzipation im Sinne der bürgerlichen Frauenbewegung sollte dabei positiv dargestellt werden – zumal in absehbarer Zeit in einer verfassungsgebenden Versammlung auch über die Frage der Gleichberechtigung verhandelt werden würde und Gesetze entsprechend angepaßt werden mußten. 3.) zielte Bähnisch offensichtlich darauf ab, mit der Publikation einen Teil der Ausgaben des Frauenrings decken zu können – was zum einen den weiter zunehmenden Anteil an Werbung in der Zeitschrift erklärt und sich zum anderen darin äußerte, daß die Regierungspräsidentin, wie erwähnt, versuchte, andere Frauenzusammenschlüsse gegen Entgelt in die Distribution einzubinden. 4.) hoffte die Herausgeberin, über die Zeitschrift einen Beitrag zur Verbindung zwischen den Frauen in den westlichen Sektoren Berlins und jenen in den Westzonen erhalten zu können. Dies äußerte sich zum einen in den Korrespondenzen, die sie vor allem mit Frauen in Berlin über mögliche Beiträge zur Zeitschrift führte455, zum anderen darin, daß ‚Berlin‘ in der ‚Stimme der Frau‘ häufiger Thema war, beispielsweise während der Berlin-Blockade. 5.) war Bähnisch daran gelegen, den Wiederaufbau-Willen in der Gesellschaft zu stärken und den Leserinnen praktische sowie psychologische Hilfestellung bei der Überwindung der schwierigen Nachkriegslage anzubieten. Hauswirtschaft und Körperpflege in Zeiten des Mangels waren in der Zeitschrift deshalb ebenso Thema wie das Ansehen Deutschlands im Ausland. Am Versuch, von alltäglichen Zusammenhängen ausgehend politische Zusammenhänge zu erklären, wird, zumindest in den ersten Ausgaben, die Nähe von Bähnischs Herangehensweise zu Fritz Borinskis Konzept der ‚Mitbürgerlichen Bildung‘456 deutlich. „Wie schwindet doch das geheime Grauen vor der Politik, wenn man merkt, daß die eigene Wohnungssorge, der Kochtopf und der
453 NLA HA HStAH, Nds. 201, Nr. 726, Einfuhrverbot für sowjetische Druck-Erzeignisse, Brigardier Lingham, 06.10.1948. 454 NLA HA HStAH, Nds. 53, Nr. 637, Niedersächsischer Zeitschriftenverlegerverein an Press Chief Deneke, PR(ISC) Regional Staff, Land Niedersachsen, 29.04.1948. Ob jener Pressechef nur zufällig den gleichen Namen trug, wie ‚Visiting Expert‘ Helena Deneke von der WGPW ließ sich leider nicht klären. 455 DFR-Archiv, A2. 456 Siehe Kapitel 6.4.2.
Staatspolitische Aufgabe
|
791
Berufsweg des Kindes politische Angelegenheiten sind“457, heißt es in diesem Sinne in der ‚Stimme der Frau‘. Der Wille zur Herausgabe einer solchen Zeitschrift war also von Gründen geleitet, die einen Aufschub des Projekts nicht duldeten. Die Arbeit an der zunächst monatlich, später vierzehntägig erscheinenden ‚Stimme der Frau‘ wäre für sich genommen, zumal er auch andere (potentielle) Mitglieder des Verbands involvierte, schon Grund genug dafür gewesen, daß die Arbeit im Frauenring selbst zwischen Mai 1947 und Mai 1948 stagnierte. Die Lizenz, die Bähnisch für eine weitere Zeitschrift namens ‚Öffentliche Fragen‘ beantragt hatte, schien sie zwar zurückgegeben zu haben,458 parallel zur Vorbereitung der Frauenzeitschrift schmiedete die Herausgeberin jedoch auch noch Pläne zur Einrichtung einer Schule für staatsbürgerliche Frauenbildung. Wieviel Arbeit sie in das Konzept steckte, läßt sich schwer abschätzen, in dem Papier, das sie der Militärregierung unterbreitete, sind zumindest rudimentäre didaktische Überlegungen, grobe Lehrpläne für verschiedene Gruppen sowie eine mehr oder weniger fiktive Charakterbeschreibung der Leitungspersönlichkeit enthalten. Auf die Details wird an anderer Stelle zurückzukommen sein.459 Private Korrespondenzen Bähnischs sind aus jener Zeit kaum überliefert, was womöglich daher rührte, daß sich die Regierungspräsidentin auf die genannten Projekte konzentrierte und zur Kontaktpflege darüber hinaus kaum Zeit und Muße fand. Doch ab Mai 1948 war Theanolte Bähnisch wieder ‚sichtbar‘, auch durch die Wiederaufnahme privater Korrespondenzen. So teilte sie im Juli 1948 ihrer in die USA emigrierten Freundin und ehemaligen Geschäftspartnerin Lotte Jacobi, die sie aus dem Soroptimist-Club kannte, mit, daß sie nun Herausgeberin einer FrauenZeitschrift sei. „Müssen Sie da nicht lachen, daß ich zu alten Ambitionen zurückkehre?“460, fragte sie die ferne Freundin, die sie gleichzeitig um „Berichte aus dem Ausland“461 für ihre Zeitschrift bat. Der Soroptimistin gegenüber stellte sie also die Kontinuität ihres frauenpolitischen Engagements zwischen der Weimarer Republik und der Bundesrepublik heraus, anders, als in ihrem Bericht über die Gründungsgeschichte des ‚Frauenrings‘, in dem sie diese Kontinuität auf Kosten der Erzählung, ihr Engagement in der Frauenbewegung sei allein aufgrund der ‚kommunistischen Bedrohung‘ erfolgt, unterschlug.462
457 O. V.: [A. M., vermutlich Anna Mosolf]: Rückblick und Ausschau. Die Arbeit des Frauenringes in der britischen Zone, o. V., in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Nr. 1, S. 25. 458 NLA HA HStAH, Nds. 53, Nr. 642, Protokoll über die 7. Sitzung des beratenden Presseausschusses für Niedersachsen, 02.10.1948. „Frau Regierungspräsident ist um Nachricht zu bitten, ob sie noch an der Uebernahme der Lizenz für die ‚Oeffentlichen Fragen‘ interessiert ist“, heißt es hier. 459 Siehe Kapitel 7.7.2.4. 460 University of New Hampshire Library, Milne Special Collections, MC 58, Box 27, f7, Bähnisch an Lotte Jacobi, 20.07.1948. 461 Ebd. 462 Siehe Kapitel 7.1.4.
792 | The anolte Bähnisch
7.5.3 Organisation im Nachgang – Der ‚Ring‘ gibt sich einen Vorstand und schärft sein Profil Erst am 11.05.1948, also fast ein Jahr nach der Konferenz von Pyrmont, auf der die Gründung des Frauenrings beschlossen worden war, und kurz nachdem die erste Ausgabe der ‚Stimme der Frau‘, die über ‚Pyrmont‘ und die Ziele des Frauenrings berichtete,463 auf den Weg gebracht war, konnte Maria Prejawa Agnes von ZahnHarnack über folgende Vorstands-Zusammensetzung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ unterrichten: Bähnisch, als erste Vorsitzende des Frauenrings, wurde vertreten durch Anna Mosolf. Else Richter wurde zur ersten Schriftführerin gewählt. Das Amt der zweiten Schriftführerin übernahm Frau Dr. med. Maria Pannhoff464, die in der Bähnisch vertrauten Stadt Münster einen Frauenring begründet hatte. Die Vikarin Margarethe Daasch fungierte als Kassiererin der Organisation.465 Zwei Sozialdemokratinnen arbeiteten im Vorstand also mit einer Christdemokratin – oder, wenn man so will, auch zweien – zusammen. Denn Else Richter gehörte zwar gar keiner Partei an, wurde aber von der Militärregierung als „probably CDU“466 wahrgenommen. Mit der Vikarin und Leiterin des Frauenwerks der evangelischen Landeskirche in Hannover, Daasch, war zudem eine prominente Figur der evangelischen Frauenbewegung im Vorstand des Frauenrings vertreten. Daasch sollte ab 1952 eine Tätigkeit als Seelsorgerin im Frauengefängnis Vechta aufnehmen, wo in den 1950er Jahren auch einige der Hannoveraner Kommunistinnen, die dem DFD über die Arbeit des Frauenrings Bericht erstattet hatten, wegen verbotener Agitation einsassen. Zählt man Maria Prejawa, die viele Korrespondenzen im Vertrauen ihrer Chefin selbständig erledigte, Kontaktpflege betrieb und Informationen einholte, noch zum Vorstand hinzu, so dominierten insgesamt, allen Unkenrufen der SPDFrauensekretärin zum Trotz, Sozialdemokratinnen den geschäftsführenden Vorstand des Rings. Dem Gesamtvorstand gehörten neben den Mitgliedern des geschäftsfüh-
463 Vgl.: O. V. [‚A. M‘., vermutlich Anna Mosolf]: Rückblick und Ausschau. Die Arbeit des Frauenrings in der britischen Zone, in: Stimme der Frau, 1. Jg., (1948/49), Heft 1, S. 25/26, hier S. 26. 464 Die am 12.04.1902 in Essen geborene Maria Pannhoff war Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und hatte 1947 den ‚Westfälischen Frauenring Münster‘ begründet. Pannhoff (CDU) war Mitglied des Bundestages von 1957–1965. Wie Bähnisch zog sie sich 1952 aus der aktiven Arbeit im DFR zurück. Vgl.: O. V.: Geschichte des Deutschen Frauenrings e. V. und des Ortsrings Münster, auf: http://www.dfr-ms.de/geschichte.htm, am 13.12.2013. Laut Homepage des Frauenrings Münster war dessen Gründung auf die Anregung einer ‚britischen Frauenreferentin‘ zurückzuführen. Der Frauenring Münster hält noch heute den Kontakt zu den Townswomens Guilds in York aufrecht, eine Tradition, die während des Aufenthalts von Helena Denekes und Betty Norris in der Region begründet worden war. 465 DFR-Archiv, A2, Maria Prejawa an Agnes von Zahn-Harnack, 11.05.1948. 466 NA, UK, FO 1049/1246, Delegiertentagung des Frauenringes der britischen Zone am 1. und 2. Mai 1948 in Hannover, o. D., o. V., Abschrift.
Staatspolitische Aufgabe
|
793
renden Vorstandes zusätzlich noch die ersten Vorsitzenden der jeweiligen Landesverbände sowie jeweils eine weitere Vertreterin aus den Landesverbänden an.467 Seine genauere inhaltliche Ausrichtung, seine Kooperationsinteressen und seine Arbeitsorganisation definierte der ‚Frauenring‘ ebenfalls nicht in Pyrmont, sondern erst auf der Delegiertentagung im Mai 1948.468 Für die Organisation war es ‚höchste Zeit‘ geworden, ihre Form und Leitung zu definieren, denn die Konferenz in Frankfurt, zu der hessische Frauen ganze 100 Delegierte des ‚Frauenrings‘ eingeladen hatten, stand unmittelbar bevor. Der Vorstand des ‚Frauenrings‘ kam zu dem Entschluß, daß man mit den Frauen in der US-Zone zwar enger zusammenarbeiten wolle, daß es für einen Zusammenschluß mit Frauen aus den anderen Westzonen, den man anläßlich der Frankfurter Tagung hätte in Erwägung ziehen können, aber noch zu früh sei. Gründe, die zu diesem Entschluß führten, finden sich im überlieferten Protokoll über die Tagung in Hannover nicht. Führt man sich vor Augen, daß die Leiterin des Frauenrings weniger Vielfalt als Einigkeit in ihrem Verband anstrebte, so dürften taktische Erwägungen eine Rolle gespielt haben. Nach und nach richteten nämlich – auf sanften Druck der Militärregierung bzw. Helena Denekes – immer mehr Zusammenschlüsse in den Westzonen ihre Statuten am Beispiel des ‚Frauenrings‘ aus. Ließ man noch etwas Zeit verstreichen, so würde sich fast zwangsläufig die Zahl jener Organisationen erhöhen, die sich dazu bereiterklärten, den Zielvorgaben des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ zu folgen. Weil die Delegierten der Verbände, die sich bisher im ‚Frauenring‘ zusammengefunden hatten, in Frankfurt geschlossen auftreten sollten, mußte natürlich auch die Frage der Namensänderung auf den Tisch gebracht werden: Gegen eine Gegenstimme wurde auf der Delegiertentagung in Hannover beschlossen, daß alle zum Frauenring gehörenden Verbände fortan auch den Namen ‚Frauenring‘ tragen sollten, weil dies die „innerlich verbundene Einheit auch nach außen hin dokumentiert“ 469. Im Anschluß an die Klärung organisatorischer Fragen fand ein Austausch darüber statt, wie sich die praktische Arbeit des ‚Frauenrings‘ in Zukunft gestalten sollte. Die erste Vorsitzende schlug vor, eine zentrale Hauswirtschaftsstelle zu errichten, in die jeder Landesring Delegierte entsenden solle. Ferner sollten „alle wichtigen Gesetze und die Verfassungen“ darauf hin geprüft werden, „ob die Belange der Frauen, der Jugend- und Erziehungsfragen richtig verankert sind.“470 Es schien der Juristin demnach ernst damit gewesen zu sein, die Stellung der Frauen im Land zu verbessern und mit dieser Arbeit zu beginnen, noch bevor ein neuer deutscher Staat etabliert war. Die staatsbürgerliche Erziehung, so sprach Bähnisch, solle im Zentrum der Arbeit des Frauenrings stehen, woraufhin beschlossen wurde, daß ein Ausschuß „das gesamte Gebiet der staatsbürgerlichen Erziehung systematisch“471 durcharbeiten solle – ein zweifelsohne ambitioniertes Unterfangen, von dem noch nicht klar ist, worauf genau es sich bezog und ob und wie es schließlich umgesetzt wurde.
467 468 469 470 471
Ebd. Ebd. Ebd. Ebd. Ebd.
794 | Theanolte Bähnisch
Zwei Probleme der Mitglieder-Werbung, nämlich die Jugendgewinnung und die Gewinnung von Arbeiterinnen, sollten mit einer Klappe geschlagen werden: In den Ortsvereinen sollten, dem Protokoll zufolge, Jugendkreise eingerichtet werden, die „enge Verbindung […] mit den Frauen unserer Arbeit, die gerade für die Jugend ein besonderes Interesse haben“, halten sollten. Es bestand offenbar die Hoffnung, daß eine der bisher weitgehend verfehlten Zielgruppen die andere bei der Stange halten würde. Die Kritik, die an ‚Bad Boll‘ geübt worden war, nämlich daß Jugendliche dort kaum zu Wort und ihre besondere Problemlage zu kurz gekommen seien, war für die Planung von ‚Pyrmont‘ konstruktiv aufgegriffen worden, was darin mündete, daß in Pyrmont gleich zwei Referate von jungen Frauen gehalten wurden. Außerdem fand eine Diskussion unter Jugendlichen stattgef, und Anna Mosolf leitete ein „Rundgespräch der Jugend“. Im Jugend-Panel referierte unter anderem Hildegard Meding, die wenig später ihre Tätigkeit als Redakteurin für „berufliche und politische Frauenangelegenheiten“ beim Sender ‚RIAS‘ in Berlin472 aufnahm. 473 Die Landesringe machten im Verlauf der Delegiertentagung in Hannover Vorschläge dazu, wie der Frauenring seine praktische Arbeit mit Heimkehrern, Kriegsgefangenen und verschleppten Frauen verbessern und wie eine stärkere Präsenz von Frauen im Rundfunk aussehen könnte.474 In dieser Hinsicht mußte der Frauenring zu dieser Zeit bereits Erfolge verbucht haben, denn als die Gewerkschafterin Luise Kipp-Kaule sich auf der Suche nach entsprechender Unterstützung an die Militärregierung wandte, wurde sie von dieser an den ‚Frauenring‘ weiterverwiesen. Dieser sollte ihr mit zweckdienlichen Informationen weiterhelfen.475 Schließlich preschte auf der hannoveraner Tagung eine Vertreterin aus dem Rheinland, wo die automatische Entlassung verheirateter weiblicher Beamter abgeschafft worden war, mit dem Wunsch vor, dies auch in den anderen Ländern anzuregen476 und unterstrich damit die Funktion des Frauenrings als eine politische Organisation, die Frauen das Fortkommen im Beruf erleichtern wollte. Ein Termin mit dem Ministerpräsidenten Kopf, der am 2. Mai einige Delegierte empfing, wird auch diesem Ziel des Rings gedient haben.477
472 Meding war ab Sommer 1948 beim RIAS tätig. Vgl.: DFR-Archiv, A2, Meding an Bähnisch, 31.07.1948. 473 DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Meding, 03.06.1947. 474 Ebd. 475 NA, UK, FO 1049/1247, Rita Ostermann an Bähnisch, 17.06.1948. „Es ist vielleicht eine gute Gelegenheit die Arbeit des Frauenrings bei der Gewerkschaft bekannt zu machen“, schrieb Ostermann an Bähnisch und dankte ihr bei dieser Gelegenheit „für die schöne Fahrt neulich“ – ein Beleg dafür, daß die Frauen einige Zeit miteinander verbrachten. 476 NA, UK, FO 1049/1247, Abschrift, Delegiertentagung des Frauenringes der britischen Zone am 1. und 2. Mai 1948 in Hannover, o. D., o. V. 477 Vgl.: [A. M., vermutlich Anna Mosolf]: Rückblick und Ausschau. Die Arbeit des Frauenrings in der britischen Zone, in: Stimme der Frau, 1. Jg., (1948/49), Heft 1, S. 25/26, hier S. 26.
Staatspolitische Aufgabe
|
795
7.6 „SIE WILL DIE FRAU IM WESTEN WERDEN“ – BÄHNISCH, DER FRAUENRING UND DIE FRAUENKONFERENZEN IN DEN WESTZONEN AUS DER SICHT VON KPD-, SED- UND DFD-FUNKTIONÄRINNEN Eine Kritik, die das SED-Organ ‚Neues Deutschland‘ an der Konferenz von Bad Boll vorzubringen hatte, glich auffällig den Artikeln der SPD-nahen Presse, welche die Mißstände in ‚Pyrmont‘ angeprangert hatte478: „Einer Akademikerinnen-Tagung beizuwohnen, ist von vielen Gesichtspunkten her erfreulich, aber schließlich muß man für Fragen allgemeinen Interesses die entsprechende Vertretung fordern“, kommentierte Maria Rentmeister, SED-Parteivorstandsmitglied und Generalsekretärin des DFD, die Tagung in Bad Boll. „Es fehlten die Arbeiterinnen, Hausfrauen, Bäuerinnen und Angestellten, die nicht nur die Mehrzahl des Volkes bilden, sondern die entscheidend am Wiederaufbau Deutschlands beteiligt sind“479, rückte Rentmeister den Umstand ins Zentrum der Aufmerksamkeit, daß die Verbände der ‚Bürgerlichen‘ zwar offiziell allen Frauen zur Mitarbeit offenstanden, daß die Leitlinien der jeweiligen Verbandsarbeit jedoch von akademisch gebildeten, gut situierten Frauen definiert wurden. In der von der SMAD herausgegebenen ‚Täglichen Rundschau‘ wurde ‚Pyrmont‘ ganz ähnlich kommentiert480. Maria Prejawa konnte Margarete Rudorff, als diese im Juli um entsprechende Informationen zur Beurteilung von Pyrmont in der Presse bat, mitteilen, man könne die „Pressestimmen […] im Allgemeinen so beurteilen, dass die Presse, die der KPD oder der SED näher steht, eine nicht allzu günstige Kritik gibt“481. Im Berliner Bundesarchiv ist im Bestand DY 31 (Demokratischer Frauenbund Deutschlands) eine Sammlung von Zeitungsartikeln aus Ost- und Westdeutschland über Aktivitäten des ‚Frauenrings‘, beziehungsweise seines Vorläufers/seinem Hannoveraner Zweigverband ‚Club deutscher Frauen‘ sowie über Aktivitäten anderer westdeutscher Frauenorganisationen überliefert. Jene Artikel, die unter dem Schlagwort ‚bürgerliche Frauen‘ abgelegt wurden, bestätigen zwar im Ganzen Prejawas Aussage, zeigen aber auch, daß sich Lob und Kritik der ostdeutschen Zeitungen für die Vorgänge in Westdeutschland Mitte 1947 noch die Waage hielten, bevor sich Ende 1947 das Klima änderte und 1948 nahezu ausschließlich482 scharfe Töne ge-
478 Hauptkritikpunkte von Artikeln, die in SPD-nahen Zeitungen und Zeitschriften erschienen, waren vor allem die vergleichsweise geringe Anzahl jüngerer Teilnehmerinnen, das weitgehende Fehlen von Arbeiterinnen und von Vertreterinnen der Gewerkschaften sowie die eher akademische als praktische Ausrichtung der Konferenzen. Vgl. dazu als Beispiel: O. V.: Frauentagung in Bad Pyrmont, in: Vorwärts, 27.06.1947. 479 Rentmeister, Maria: Nur 12 Minuten Redezeit. Frauenkongreß geht an den Tagesproblemen vorbei, in: Neues Deutschland, 07.06.1947, S. 3. 480 Vgl. dazu beispielsweise: O. V.: Die Frauen der britischen Zone, in: Tägliche Rundschau, 28.06.1947. 481 DFR-Archiv, A2, Maria Prejawa an Margarete Rudorff, 07.07.1947. 482 Marianne Jahn erwähnte in einem Artikel des ‚Frauen-Pressedienst‘ allerdings noch Mitte 1948 lobend, daß Bähnisch bei der Regierung Hannover das Amt einer ‚Frauenreferentin‘
796 | Theanolte Bähnisch
genüber der Arbeit der ‚Bürgerlichen‘ fielen.483 Derselbe ‚Klimawechsel‘ bildet sich in den im Bestand ebenfalls überlieferten Berichten ab, die ‚Gesandte‘ der SED von westdeutschen Frauenkonferenzen lieferten. Den Berichten der SED-Funktionärinnen und Berichten von KPD-Politikerinnen über Frauenkonferenzen in den Westzonen, die im Bestand DY 30 (Abteilung Frauen im ZK der SED) überliefert sind, ist zu entnehmen, daß durchaus auch DFD-Funktionärinnen und KPD-Politikerinnen Hoffnungen in die Politik Bähnischs und ihre Pyrmonter Konferenz setzten. Sie glaubten daran, daß die Arbeit der Regierungspräsidentin der Sache des DFD dienlich sein könne. Die Einschätzung Bähnischs fiel also – zumindest in der frühen Zeit des frauenpolitischen Engagements der Regierungspräsidentin – auch von Seiten der Frauen, die im DFD, in der SED oder der KPD organisiert waren, viel differenzierter aus, als zu vermuten gewesen wäre. 7.6.1 Ein Mitglied des ‚Club deutscher Frauen‘ wechselt die Fronten Besonders interessant ist, daß ausgerechnet die Kommunistin Dr. Elfriede Paul, die sich 1946/46 mit Jeanne Gemmel von der britischen Militärregierung über die Möglichkeiten von Frauenbildung jenseits der Volkshochschule ausgetauscht hatte und – in dieser Konsequenz – gemeinsam mit Bähnisch 1946 den ‚Club deutscher Frauen‘ mit gegründet hatte, den offenen Bruch mit der ehemaligen Club-Schwester riskierte484, während Maria Rentmeister, die Mitbegründerin und erste Generalsekretärin des DFD, in der Regierungspräsidentin zunächst sogar die Hoffnungsträgerin für eine Zusammenarbeit zwischen der ‚Ost‘ und ‚West‘ in der Frauenbewegung erkannte. Das Interview für die Zeitschrift ‚Sie‘, in dem sich Paul sehr kritisch über den Kongreß von Pyrmont äußert, ist nicht nur in Pauls Nachlaß, sondern auch im Archiv des DFR überliefert, da Paul es der Regierungspräsidentin „mit einem Gruß über-
geschaffen habe, welches seinem Pendant in den Verwaltungen der „Ostzone“ sehr nahekäme. „Frau Bähnisch bemüht sich auch um die Schaffung einer Hausfrauenzentralstelle, die den Hausfrauen in allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite stehen soll.“ Jahn, Marianne: Wie helft ihr den Heimkehrern? Berliner Reporterin befragte westdeutsche Frauen auf dem interzonalen Frauen-Kongreß in Frankfurt am Main, in: Deutscher Frauen-Pressedienst, Nr. 7, 09.06.1948. Der Deutsche Frauen-Pressedienst erschien monatlich als Zeitschrift in der SBZ. Vgl.: Objektdatenbank des DHM München, Dg 2191 [Monatszeitschrift für Frauen ‚Deutscher Frauen-Pressedienst‘, Deutscher Frauen-Pressedienst/(1948), Nr. 10], auf: http://www.dhm.de/datenbank/dhm.php?user=uml&seite= 5&fld_0=d2b02762, am 10.09.2014. 483 BArch SAPMO DY 31/IV 2/17/99. 484 Paul lebte seit dem 01.05.1947 in Berlin und engagierte sich dort im DFD. Vgl.: O. V.: Wie ich Ministerin wurde. Elfriede Paul, in: Hannoversche Frauen gegen den Faschismus, Homepage des Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN/BdA) Hannover: auf: http://www.hannover.vvn-bda.de/hfgf.php?kapitel=50, am 13.12.2013.
Staatspolitische Aufgabe
|
797
reicht“485 hatte. Mehr noch als die ihrer Meinung nach völlig überholten Sichtweisen Walter von Hollanders kritisierte Paul, wie auch andere Kommentatorinnen aus der SBZ486, daß auf der Konferenz „keine Vertreterinnen der Landarbeiterinnen, der Hausangestellten und der vielen Tausende von Frauen in gewerblichen Berufen“487 anwesend waren und die „Arbeiterinnen fast ganz“ fehlten. Stattdessen seien dort, so Paul, die „ehemaligen Kurgäste von Pyrmont“ präsent gewesen. Besonders war der Ärztin aufgestoßen, daß während der Tagung „inoffizielle Besprechungen“ stattfanden, bei denen es um das Thema „Ost-West“ gegangen sein soll. „Aber während der Tagung war […] nicht herauszufinden, wann und wo diese Besprechung stattfinden sollte“, konstatierte Paul, die offenbar nicht hatte herausfinden können, daß die Besprechung bereits vorbei war, bevor die Tagung offiziell begann. Nicht einmal die Ergebnisse des Austauschs „in ganz kleinem privaten Kreise“488 seien den Frauen aus dem Osten mitgeteilt worden, kritisierte Paul und zürnte schließlich: „das wesentlichste Ziel der deutschen Frau muß es doch sein, sich über alle vier Zonen hinweg einig zu sein. Wie soll es möglich sein, den Weltfrieden zu sichern, wenn wir Frauen untereinander nicht zunächst den guten Willen und das aufrichtige Bestreben beweisen erst einmal in Deutschland ehrlich und unvoreingenommen zusammenarbeiten zu wollen?!“489 Mit dieser Aussage beschritt die Ärztin jenen Weg, auf dem die Kommunistinnen in der ideologischen Auseinandersetzung in den folgenden Jahren fortwährend wandeln sollten: Sie warf der Konferenzleitung – also Bähnisch – separatistische Tendenzen und Leichtfertigkeit im Umgang mit der deutschen Einheit vor. Emmi Damerius-Koenen, die 1948 das Amt der Bundesvorsitzenden im DFD übernahm, hatte bereits anläßlich der Konferenz von Bad Boll den anwesenden Frauen voller Ironie „[e]ine schöne Liebe zur deutschen Heimat, zum deutschen Volk“490 unterstellt und damit den Vorwurf erhoben, daß die Frauen im Westen an einer Aufrechterhaltung der Verbindung zu den Frauen im Osten Deutschlands nicht interessiert seien und daß die ‚deutsche Einheit‘ für sie keine Rolle spiele.491 „Unsere Da-
485 486 487 488
DFR-Archiv, A2, Interview Frau Dr. Paul, Bd. 4/707. Vgl.: O. V.: Kongress in Pyrmont, in: Sie, 29.06.1947, S. 2. DFR-Archiv, A2, Interview Frau Dr. Paul, Bd. 4/707. An diesem Treffen hätten Vertreterinnen des Wilmersdorfer Frauenverbandes „mit etwa 4–6 ziemlich reaktionär eingestellten Frauen des Westens“ teilgenommen, so Paul. BArch, NY 4229, Nr 11. Bericht über die Frauentagung der britischen Zone in Bad Pyrmont vom 20. bis 23. Juni 1947 von Elfriede Paul, 03.07. 1947. 489 Ebd. 490 BArch, SAPMO DY 31/294, Die Frauenbewegung in Deutschland, Referat von Emmy Damerius, DFD, auf der 1. Jahresversammlung des Hamburger Frauenausschusses, 18.10.1947, S. 11. 491 Ebd. Über Bad Boll sagte Damerius laut Vortragstext „Dort haben unsere Vertreterinnen […] zum ersten Mal erlebt, dass deutsche Frauen im Westen unserer Heimat deutsche Schwestern aus dem Osten derselben Heimat am liebsten in Bad Boll nicht gesehen hätten.“ Anläßlich der von Bähnisch in Pyrmont angestrebten Gründung äußerte sie die Hoffnung, daß eine große Frauenvereinigung die Umsetzung der Potsdamer Beschlüsse
798 | Theanolte Bähnisch
men wurden […] behandelt, als kämen sie aus dem Ausland, das man hasst. […] In Bad Boll ignorierte man über 17 Millionen deutsche Frauen und Männer in der Ostzone.“492. Einem Bericht über die Tagung in Pyrmont nach, der offenbar für den Vorstand des DFD bestimmt war493, sah Elfriede Paul in der Tagung nicht nur die Interessen der ostdeutschen Bürger verraten, sie bezweifelte auch den Mehrwert der Veranstaltung für die westdeutschen Frauenverbände. Die Veranstaltung beschrieb sie – offenbar nicht ganz zu Unrecht – als ein abgekartetes Spiel, das schon in der Vorplanung undemokratisch verlaufen sei. Einzelne Länderverbände hätten im Vorfeld der Konferenz noch keine Frauenzusammenschlüsse begründet gehabt und dies auf der Konferenz überstürzt nachholen müssen, damit der zonale Zusammenschluß überhaupt möglich wurde. Dies habe organisatorische Probleme für die Verbände nach sich gezogen, so Paul. Kritik übte die Ärztin auch daran, daß die praxisrelevanten Referate Dora Gaßmanns und Käthe Feuerstacks erst gehalten worden waren, als ein Großteil der Teilnehmerinnen den Saal bereits verlassen hatte. Immerhin fand Paul für Anne Frankens und Anna Mosolfs Beiträge lobende Worte.494 7.6.2 Kooperation angestrebt: Führende Kommunistinnen buhlen um Bähnischs Gunst Der neunseitige Bericht der Generalsekretärin des DFD über die Konferenz von Bad Boll war zwar allgemein negativ gehalten, hob jedoch den Vortrag Bähnischs, die Rentmeister bis dato unbekannt gewesen zu sein schien, sehr positiv hervor.495 Auf der Tagung sei „[n]ur ein praktisches Thema“ behandelt worden, so Rentmeister, „und zwar von Frau Behnisch (!) von der SPD, einer Regierungspräsidentin in Hannover, die über den neuen Weg der Frauenbewegung sprach. Sie entwickelte ein Programm, dass man hätte glauben können, man habe das Programm des DDF [ge-
492 493 494 495
forcieren würde. „Der Friede wird Deutschland nicht erhalten bleiben, wenn wir nicht die Einheit haben. Ein gespaltenes Deutschland ist der beste Boden für reaktionäre Treibereien.“ Ebd. Maria Rentmeister teilte Damerius‘ Meinung, daß die Tagung in Bad Boll einen „Anti-Ostzonencharakter“ gehabt habe. BArch, SAPMO DY 31/294, Bericht über die Tagung in Bad Boll von Maria Rentmeister, o. D. Vgl. auch: Rentmeister, Maria: Zersplitterte Frauenbewegung im Westen. Ein Stimmungsbericht von der Frauenkonferenz in Bad Boll, in: Freiheit, Ausgabe Halle, 09.06.1947. Darin heißt es: „Das Referat von Frau Bähnisch […] war der einzige konkrete Vortrag. Er stimmte in vielem durchaus mit den Zielen überein, die der Demokratische Frauenbund sich gesetzt hat.“ Ebd. Ebd. BArch, NY 4229, Nr. 11, Bericht über die Frauentagung der britischen Zone in Bad Pyrmont vom 20. bis 23. Juni 1947 von Elfriede Paul, 03.07.1947. Ebd. John Robert Stark zitiert ebenfalls aus dem Bericht Rentmeisters über Bad Boll, kommt jedoch nicht zu dem Schluß, daß Rentmeister Bähnisch positiv eingeschätzt habe. Vgl.: Stark: Majority, S. 139.
Staatspolitische Aufgabe
|
799
meint ist der DFD] vor sich.“496 Rentmeister glaubte also, ihre Verbündete im Westen gefunden zu haben, was für sich genommen schon bemerkenswert ist. Insbesondere aufgrund deren Parteizugehörigkeit hatte Rentmeister Hoffnungen in die Regierungspräsidentin gesetzt: „Ich bin nach dem Vortrag gleich zu Frau Bähnisch gegangen […] und [habe sie] gefragt ob wir sie nicht einladen können, damit wir in Berlin zu einer gemeinsamen Arbeit kämen, sie ist ja SPD-Genossin.“497 Offensichtlich war Rentmeister, die von 1945 bis 1947 Vorsitzende des Zentralen Frauenausschusses gewesen war und dann die Leitung des DDF übernommen hatte, zu jener Zeit noch vom Sinn einer Zusammenarbeit mit Sozialdemokratinnen in Westdeutschland überzeugt.498 In Bähnisch glaubte sie die progressive, sozialdemokratische Speerspitze der Frauenbewegung in den westlichen Besatzungszonen erkannt zu haben. Eine Kooperation erschien deshalb naheliegend. Daß Bähnischs Programm „in vielem“ mit den Zielen überein stimmte, die sich der DFD gesteckt habe, hatte Rentmeister auch in ihrem Artikel im Neuen Deutschland, in dem sie Bähnisch sogar als „fortschrittlich“ bezeichnete, geschrieben.499 Doch die Regierungspräsidentin hatte die in sie gesetzten Hoffnungen sofort zerschlagen: „Wir haben Beschlüsse, die sich gegen die überparteiliche Arbeit richten“500 soll die – in diesem Zusammenhang mit einem Mal überraschend linientreue – Bähnisch auf Rentmeisters Angebot geantwortet und gleichzeitig betont haben, daß sie in der SPD „überhaupt keine Rolle“501 spiele. Mit einem Mitglied des Parteivorstands der SED (Rentmeister gehörte diesem von 1946 bis 1950 an und übernahm 1949 zusätzlich die Leitung der Abteilung für kulturelle Ausklärung im Ministerium für Volksbildung502) wollte die Regierungspräsidentin ganz offensichtlich nicht zusammenarbeiten. Für sie waren die Fronten klar. Daß die Regierungspräsidentin bewußt die Nähe der Frauen aus dem BDF suchte, schien Rentmeister zu jener Zeit ebensowenig bewußt gewesen zu sein wie Bäh-
496 BArch, SAPMO, DY 31/294, Bericht über die Tagung in Bad Boll von Maria Rentmeister, o. D. [Mitte 1947]. 497 Ebd. 498 Aus einem Protokoll der Sitzung von KPD-Ländervertreterinnen wird deutlich, daß Rentmeister entsprechend eingestellte Sozialdemokratinnen auf ihrer Seite hatte. Eine namentlich nicht genannte Sozialdemokratin, die bei einer Besprechung der KPDLändervertreterinnen anwesend war, vertrat laut Protokoll die Meinung, sie könne ihre Genossinnen durch „Kleinarbeit von der Notwendigkeit der Einheit überzeugen“. BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Protokoll der Sitzung der Landesfrauenleiterinnen der britischen Zone am 3. Juli 1947 in Hannover. 499 Rentmeister, Maria: Nur 12 Minuten Redezeit. Frauenkongreß geht an den Tagesproblemen vorbei, in: Neues Deutschland, 07.06.1947, S. 3. 500 BArch, SAPMO DY 31/294, Bericht über die Tagung in Bad Boll von Maria Rentmeister, o. D. [Mitte 1947]. 501 Ebd. 502 Vgl.: Art.: „Rentmeister, Maria“, in: Müller-Enbergs, Helmut/Wielgohs, Jan/Hoffmann, Dieter (Hrsg.): Wer war wer in der DDR? Ein biographisches Lexikon, Sonderausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2000, S. 695.
800 | Theanolte Bähnisch
nischs Wille, den DFD zu bekämpfen. Allgemein bewertete Rentmeister die Konferenz von ‚Bad Boll‘, wo „alle diese Frauen aus der früheren Frauenbewegung“ gewesen seien, als „chaotisch“ und „diktatorisch“. Aus ihren Erfahrungen in Bad Boll – von denen sie glaubte, sie seien nicht auf die Regierungspräsidentin, sondern ausschließlich auf die Anwesenheit der anderen dort anwesenden Frauen zurückzuführen – hatte die Generalsekretärin des DFD die Pflicht abgeleitet, in ‚Pyrmont‘ „mit einem wirklich massiven Gewicht aufzutreten“, da „die anderen […] aus der amerikanischen und englischen Zone“ sich dort „versammeln und versuchen [werden] uns wie einen lästigen Fleck zu erdrücken“503. Sie wog sich in der Hoffnung, auf der von Bähnisch in der britischen Zone geplanten Konferenz mehr für die Interessen des DFD ausrichten zu können als auf jener in der amerikanischen Zone. Deren Charakter hatte sie grundsätzlich treffend eingeschätzt: „Selbstverständlich war der Kongress nur einberufen als Gegengewicht gegen den Kongress des DDF [DFD], weil man uns drei Schritte vorauseilen wollte mit der Bildung des gesamtdeutschen Verbandes. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass, wenn ein deutscher Frauenverband gegründet wird, das nur unter stärkster Teilnahme von uns geschehen darf. Alles andere wäre verhängnisvoll.“504 Neben Bähnisch hob die einflußreiche Rentmeister in ihrem Bericht mit Agnes von Zahn-Harnack auch eine Vertreterin der ‚alten‘ Frauenbewegung positiv hervor, und zwar weil Letztere – offenbar glaubwürdig – für eine Zusammenarbeit mit allen vier Besatzungsmächten plädiert hatte. Rentmeister glaubte, in Zahn-Harnack die „einzigste (!) Stimme für die Russen“ in Bad Boll erkannt zu haben, da die ehemalige BDF-Vorsitzende „für ihren Wilmersdorfer Bund“ (den Harnack für ganz Berlin zugelassen wissen wollte) die Zustimmung „der Sowjets“ bräuchte. „[G]egen ihre Überzeugung würde sie das nicht sagen, ein solcher Typ ist sie nicht“, gab sich Rentmeister, die offensichtlich persönliche Sympathien für die mittlerweile betagte Frau hegte, überzeugt. Die DFD-Generalsekretärin hielt, obwohl Zahn-Harnack in Bad Boll „von ihrem großen Traum, der Gründung des Bundes deutscher Frauenvereine“505 gesprochen hatte, fest: „Das Auftreten von Frau Zahn-Harnack war das wichtigste Ereignis auf der Tagung von Bad Boll.“506 Diese Bewertung Rentmeisters überrascht ebenso wie ihre Sicht auf Bähnisch, denn in den Kommentaren anderer DFD-Mitglieder konzentrierte sich die Kritik zunächst sogar stärker auf die Theologin als auf die Juristin. Erst als sich – mit der Konferenz von Pyrmont – auch für die Frauen im DFD abzeichnete, daß Bähnisch über die mächtigere Position verfügte als Zahn-Harnack, verlagerte sich auch der Schwerpunkt der Kritik.507
503 BArch, SAPMO DY 31/294, Bericht über die Tagung in Bad Boll von Maria Rentmeister, o. D. [Mitte 1947]. 504 Ebd. 505 Ebd. 506 Ebd. 507 Dazu trug offensichtlich auch bei, daß Maria Prejawa ihre Chefin als die „Gründerin der neuen Frauenbewegung“ zu bezeichnen pflegte. BArch, SAPMO DY/1283, vgl.: Bericht vom offiziellen Teil der Tagung der Deutschen Frauenbünde in Neumünster am 31.10.1047, von Lore Szeczinowski, o. D.
Staatspolitische Aufgabe
|
801
Daß von Seiten des DFD zunächst Zahn-Harnack als wichtigste Protagonistin der bürgerlichen Frauenbewegung wahrgenommen wurde, entbehrt nicht einer gewissen Logik, denn schließlich war Zahn-Harnack zum einen in Berlin, wo auch der DFD seinen Sitz hatte, präsent, zum anderen war sie die letzte Vorsitzende des Dachverbandes der bürgerlichen Frauenorganisationen gewesen. Vor allem Rentmeister hatte den Einfluß Zahn-Harnacks nach 1945 überschätzt. Sie war davon ausgegangen, daß Zahn-Harnack, Ursula von Kardorff508 und die USA in Bad Boll gemeinsam die Fäden gezogen hätten und daß Zahn-Harnack zusammen mit den USA für die Einladung der 150 Persönlichkeiten, welche in Bad Boll erschienen waren, verantwortlich gewesen sei. Die Rolle des Stuttgarter Frauendienstes und Elisabeth Käsers hatte Rentmeister scheinbar gar nicht erkannt.509. Von Bähnisch glaubte Rentmeister hingegen nicht, daß sie „von den Amerikanern unterstützt“510 würde. Zwar war der Einfluß der USA auf Bähnisch 1947 tatsächlich noch sehr viel geringer als der der Briten, jedoch schien Rentmeister auch nicht bemerkt zu haben, daß die britische Militärregierung in Sachen Frauen-Reeducation die Nase vorn hatte und damit die Weichen für die weiteren Entwicklungen stellte. Zu einer Zeit, in der die USA allgemein noch kaum eine Rolle in der Frauen-Re-education-Arbeit in Deutschland spielten, zerbrachen sich nicht nur Rentmeister, sondern auch KPD-Funktionärinnen eher den Kopf darüber, daß Fini Pfannes und Gabriele Strecker „unter amerikanischem Einfluß“511 stünden, als über die Macht, die Bähnisch durch die Unterstützung der Briten zuteilwurde. Wofür die DFD-Generalsekrtärin allerdings den richtigen Riecher bewies, waren die möglichen Konsequenzen der Verwaltungsreform, welche die Briten anstrebten. Nach Meinung der SED-Funktionärin war die Sorge Bähnischs, ihr Amt als Regierungspräsidentin zu verlieren, das ausschlaggebende Motiv für die Juristin, sich so stark in der Frauenbewegung zu engagieren: „Die Regierungspräsidien in Westdeutschland sollen nämlich verschwinden und Frau B. rechnet damit, dass sie die Frau wird, die die gesamten Frauenorganisationen in Deutschland in die Hand bekommt“512, stellte Rentmeister fest und betonte, daß sie der Hannoveranerin eine solche Arbeit durchaus zutraute: „Sie ist ausser-ordentlich ehrgeizig, hoch intelligent und hält ein ausgezeichnetes Referat vollständig aus dem Kopf.“513 Rentmeister war nicht die einzige Kommunistin, die von Bähnischs Fähigkeiten angetan war und um ihre Gunst buhlte. Ein Brief einer KPD-Funktionärin aus Han-
508 Die Journalistin von Kardoff pflegte Kontakte zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus, floh vor dem Einmarsch der Roten Armee aus Berlin und arbeitete ab 1945 für die Süddeutsche Zeitung. 509 Rentmeister: Frauenbewegung. 510 Ebd. 511 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Amerikanische Zone, Sept. 1947, Bericht von Milli Boelke, Oktober 1947. 512 BArch, SAPMO DY 31/294, Bericht über die Tagung in Bad Boll von Maria Rentmeister, o. D. [Mitte 1947]. 513 Ebd. Vgl. zu Rentmeisters Kritik über Bad Boll und die Wahrnehmung Bähnischs auch: Stark: Majority, S. 139–147.
802 | Theanolte Bähnisch
nover an zwei SED-Funktionärinnen in Berlin zeigt, daß verschiedene Frauen in der KPD wie auch in der SED Ende 1947 im Rahmen einer Tagung versuchten, Einfluß auf die Regierungspräsidentin zu gewinnen, indem sie Bähnisch „bei unseren Freunden individuell“514 unterzubringen versuchten. „Wir müssen uns hier von der besten Seite zeigen“, argumentierte eine ‚Milly‘515 in Absprache mit Herta Dürrbeck, der politischen Mitarbeiterin für Frauenpolitik und Schulungsarbeit bei der KPDBezirksleitung Hannover.516 „Die Zusammenarbeit mit diesen Organisationen ist noch schwach und wir hoffen hier, durch diese Reise eine bessere Beziehung zwischen den einzelnen Frauen erreichen zu können.“517 In der Zeit der sich langsam verschärfenden Systemkonfrontation zwischen ‚Ost‘ und ‚West‘ setzten einige Kommunistinnen also auf den persönlichen Austausch zwischen Frauen aus ‚Ost‘ und ‚West‘ – und dabei besonders auf Bähnisch, die doch den dezidierten Willen hatte, gegen den DFD zu arbeiten. Auch Annemarie Durand-Wever, die Bundesvorsitzende des DFD, fand Lob für Bähnischs Arbeit und stand einer Zusammenarbeit mit ihr aufgeschlossen gegenüber. Die Konferenz von Pyrmont, auf der sie sich, anders als in Bad Boll518, willkommen gefühlt hatte, kommentierte sie entsprechend positiv. „Ich glaube […] sagen zu können, dass […] der Kontakt mit den Frauen der Westzone (!), von denen mir viele aus früheren Jahren bekannt waren, ein sehr wesentlicher Faktor ist. Ich sehe in der Zusammenfassung der Frauen der britischen Zone die Möglichkeit, später mit uns zusammenzugehen. Wie mir Frau Baehnisch vertraulich sagte, strebt sie dies auch an.“519 Ob Durand-Wever und Bähnisch sich in diesem Moment tatsächlich einig waren, ob Bähnisch glaubte – weil Durand-Wever eben nicht der SED angehörte – mit ihr gemeinsam eine Kooperation zu Nicht-Kommunistinnen in der SBZ aufbauen
514 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Milly [vermutlich Emilie Paats] an ‚Käthe‘ und ‚Elli‘ [vermutlich Käthe Kern und Elli Schmidt], 23.02.1947. 515 Es könnte sich hierbei um Emilie Paats, genannt ‚Milly‘, handeln. Vgl.: O. V.: Und da haben sie mir meinen Erich genommen. Emilie Paats, in: Hannoversche Frauen gegen den Faschismus, Homepage des VVN/BdA Hannover, auf: http://www.hannover.vvnbda.de/hfgf.php?kapitel=47, am 13.12.2013. 516 Dürrbeck war von 1950 bis 1953 Landessekretärin des DFD in Niedersachsen und vertrat die KPD in der 2. Wahlperiode vom 22.04.1953 bis zum 05.05.1955 im Niedersächsischen Landtag. Sie wurde politische Mitarbeiterin der KPD-Landesleitung Niedersachsen sowie Mitglied des Sekretariats und der Kaderkom-mission. 517 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Milly [vermutlich Emilie Paats] an ‚Käthe‘ und ‚Elli‘ [vermutlich Käthe Kern und Elli Schmidt], 23.02.1947. 518 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Bericht über die Tagung in Bad Boll von DurandWever, o. D. Auch Rentmeister hatte an der Konferenz von Bad Boll kein gutes Haar gelassen: „Es wurde nichts Positives geschaffen, kein Programm, kein Statut, kein Ausschuß gegründet. Die Amerikaner haben den Kongreß finanziert.“ BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Sitzung Frauensekretariat 23.05.47, Maria Rentmeister berichtet wie folgt, o. D. 519 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Bericht über die Tagung in Bad Boll von DurandWever, o. D.
Staatspolitische Aufgabe
|
803
zu können, oder ob die Aussage der Bundesvorsitzenden des DFD schlichtweg nicht auf einer wahren Begebenheit beruhte, ist schwer einzuschätzen. Die Gynäkologin und Mitbegründerin von Pro Familia 1952 in Kassel war, wie Rentmeister, der Meinung, Bähnischs Programm sei in wesentlichen Punkten deckungsgleich mit dem des DFD.520 Sie hielt – vielleicht ein Stück Erfüllungspolitik gegenüber der SED betreibend – allerdings fest, daß „der Zusammenschluss der Frauen und ihre Stellung in den Westzonen in keiner Weise an das heranreicht, was wir hier in der Ostzone bereits erreicht haben.“521 Die Kosmopolitin, die in Rumänien, Bulgarien, Brasilien und den USA aufgewachsen war, zeigte sogar Verständnis dafür, daß Bähnisch zu einer geplanten Frauen-Zusammenkunft in Hannover am 20.06.1947 vom DFD nur Durand-Wever und Elfriede Paul hatte einladen wollen.522 Rentmeister, die sich zum einen wohl persönlich angegriffen fühlte und die zum anderen hatte feststellen müssen, daß ‚Pyrmont‘ am Ende doch nicht nach ihren Wünschen verlaufen war, bewertete dies als einen „unmögliche[n] Zustand“523. Auf eine Delegierte des DFD (vermutlich handelte es sich um die im gleichen Jahr wie Bähnisch geborene Nora Melle) hatte das ‚Rundgespräch der Jugend‘ in Pyrmont einen „hervorragenden Eindruck“ gemacht. Daß sich in dieser Sektion sowohl eine BDM-Führerin als auch eine „junge Halbjüdin“524 zu Wort gemeldet hatten und ihre unterschiedlichen Sorgen und ihre Vorstellungen über den Umgang mit der NS-Zeit hatten vorbringen können, erwähnte die Delegierte lobend. Sie bestätigte damit die Einschätzung von Senior Womens Affairs Officer Rita Ostermann, daß es in der überparteilichen Frauenbewegung tatsächlich Raum für brisante Diskussionen gab. Andererseits zeigte sie sich unzufrieden damit, daß die überparteilichen Organisationen mit Arbeiterinnen kaum zusammenarbeiteten und letztere auf der Konferenz fast gänzlich gefehlt hatten.525
520 DFR-Archiv, A2, Margarete Rudorff an Theanolte Bähnisch, 07.07.1947. „Frau DurandWeber (!) erklärte, sie sei von Pyrmont sehr befriedigt, ganz im Gegensatz zu Bad Boll. Für unsere etwas schwierige Situation in Berlin ist das sehr wichtig“, schrieb Rudorff an Bähnisch. Ebd. 521 Vgl.: BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Bericht über die Tagung in Bad Boll von Durand-Wever, o. D. 522 Ebd. 523 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Sitzung Frauensekretariat 23.05.47, Maria Rentmeister berichtete wie folgt, o. D. Im Anschluß an die Konferenz von Pyrmont hatten gleich mehrere Treffen überparteilicher Organisationen in Hannover stattgefunden, die unter anderem der Nachbereitung der Konferenz galten. Von einem der Treffen ist ein Protokoll überliefert. BArch, SAPMO, DY 30/IV 2/17/99, Sitzung der Landesleiterinnen der britischen Zone am 03. Juli 1947 in Hannover, o. D. 524 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Frauenarbeitstagung Bad Pyrmont am 20. bis 23. Juni 1947, von Dr. Durand-Wever und Nora Melle, o. D. Geschrieben wurde der Bericht scheinbar von Melle, denn über Durand-Wever wird im Text berichtet. 525 Ebd.
804 | Theanolte Bähnisch
7.6.3 Hilfestellung aus der KPD bei der Überwachung westdeutscher Frauenorganisationen durch die SED Daß die Frauenverbände im Westen und damit auch Bähnisch und der ‚Frauenring‘ unter kritischer Beobachtung der vom Zentralkomitee (ZK) der SED damit beauftragten Frauen standen526, läßt sich im Teilbestand ‚Abteilung Frauen im ZK der SED‘527, der im Bundesarchiv Berlin überliefert ist, nachvollziehen. Unter BArch SAPMO DY 30/IV 2/17/99 sind auch Papiere zur Frauenarbeit der britischen Militärregierung, vor allem Anweisungen an die deutschen Behörden, überliefert528. Die Papiere bilden ein Pendant zu den Dokumenten, die im Zusammenhang mit der Überwachung der kommunistischen Frauenbewegung durch die CCG (BE) den Weg in die Akten des Foreign Office gefunden haben.529 John Robert Stark weist auf den interessanten Umstand hin, daß einige Dokumente über Frauenkonferenzen in den Westzonen und über Redebeiträge der Referentinnen nur über den DFD überliefert seien.530 Tatsächlich ist die Sammlung der in den Beständen DY 30 und DY 31 überlieferten Berichte über Frauenkonferenzen, auf de-
526 Im BArch, SAPMO DY 31/1248 ist unter dem Schlagwort „Frauenorg. Westen und Süden“ sogar die Satzung des ‚Club deutscher Frauen Düsseldorf‘ überliefert. Das Schriftbild deutet darauf hin, daß die Satzung auf derselben Schreibmaschine geschrieben sein könnte wie die des ‚Club deutscher Frauen, Hannover‘, die im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv in Hannover überliefert ist. Der Text ist identisch mit dem der Satzung des Hannoveraner Clubs. Ebenfalls in DY 31 überliefert ist ein Bericht über die Gründung des Zehlendorfer Frauenbundes in Anwesenheit von Agnes von Zahn-Harnack am 31.08.1947. BArch, SAPMO DY 31/1283, Die Gründung des Zehlendorfer Frauenbundes am 31. August 1947 von ‚Jenny‘. ‚Jenny‘ war nach eigener Aussage „ohne Einladung hingegangen, um zu sehen, was sich dort tut.“ Ihr Resümee lautete, daß „die ganze Angelegenheit“, die Zahn-Harnack als „jüngere und schönere Schwester“ des Wilmersdorfer Frauenbundes bezeichnet haben soll, „ein Damen-Club“ würde. Ebd. In derselben Akte ist auch eine zusammenfassende Betrachtung über Frauenzusammenschlüsse in der amerikanischen Besatzungszone überliefert. Darin werden beschrieben: der ‚Hessische Frauenverband‘ unter der Leitung von Finni Pfannes, welche „stark unter amerikanischem Einfluß“ stünde, der ‚Heidelberger Frauenverein‘ unter der Leitung von Erna Falkenberg, der Frauen „aller Schichten und Parteien“ erfasse und „durchaus fortschrittlich“ sei, der ‚Süddeutsche Frauenring‘ [gemeint ist der Süddeutsche Frauenarbeitskreis, SFAK], geleitet von Else Reventlow (SPD) mit „95 % bürgerlichen Frauen“ sowie der ‚Würzburger Frauenbund‘, der „unter unserem Einfluß“ stünde und sich in seinem Programm an den DFD anlehne. In Dachau gebe es eine gute Zusammenarbeit von DFD-Frauen mit Sozialdemokraten, heißt es im Bericht. BArch, SAPMO, DY 31/1283, Amerikanische Zone, o. V., o. D. 527 BArch, SAPMO DY 30. 528 BArch, SAPMO DY 30 IV 2/17/99, I.A.&C. Division. Militärregierungsanweisung Nr. 78 vom 10.04.1946. 529 Vgl. beispielsweise NA, FO 1110/31. 530 Vgl.: Stark: Majority, S. 150.
Staatspolitische Aufgabe
|
805
nen Theanolte Bähnisch eine wichtige Rolle spielt, groß. Sie verdeutlicht, wie sehr der Frauenring, der in jenen Dokumenten auch als die „Bähnisch-Organisation“531 bezeichnet wird, als der wichtigste der überparteilichen Verbände und – nachdem die Machtverhältnisse klar waren – als ein Machwerk der Hannoveraner Regierungspräsidentin wahrgenommen wurde. Die Reden, die Bähnisch auf Frauenkonferenzen hielt, sind in der Überlieferung der Abteilung ‚Frauen im ZK der SED‘ so minutiös wie in keiner anderen Überlieferung ‚protokolliert‘.532 Als Quelle zur Analyse von Bähnischs Rhetorik sind diese ‚Protokolle‘ – ebenso wie einige aus der Überlieferung der SPD – jedoch mit großer Vorsicht zu genießen. Schließlich waren sie einem politischen Zweck, nämlich dem Kampf gegen die als ‚restaurativ‘ charakterisierte Arbeit der ‚Bürgerlichen‘ gewidmet. Die Äußerungen der Regierungspräsidentin werden in den Quellen nicht nur entsprechend bewertet, sondern die ‚Protokolle‘ tragen in vielen Fällen eher den Charakter einer kritischen Stellungnahme zum Gesagten als einer Mitschrift. Sie geben deshalb mindestens ebensoviel, wenn nicht gar stärker Auskunft über die Haltung der jeweiligen Protokollantin, beziehungsweise deren Auftrag, im Sinne des DFD/der SED Bericht zu erstatten, als über die Einstellung der Regierungspräsidentin selbst. Maria Weiterer533, Mitbegründerin und erste Generalsekretärin des DFD534 sowie Leiterin der Frauenabteilung des PV der SED535, versorgte zunächst die SMAD, später offenbar auch den Parteivorstand der SED mit Material über Frauenorganisationen und deren Veranstaltungen in den westlichen Besatzungszonen.536 Doch allein konnte die Berlinerin diese Arbeit nicht leisten. Sie war auf Berichte von Kommunistinnen aus den Westzonen angewiesen, die sie dann an die entsprechenden Stellen weiterleitete. Hanna Melzer, KPD-Mitglied des ersten, von der britischen Militärregierung eingesetzten Nordrhein-Westfälischen Landtags und Mitglied der Landesleitung der KPD, zeigte mehrfach, daß sie sehr viel besser über die Lage der Frauenbewegung in den Westzonen informiert war, als Maria Rentmeister und andere Funktionärinnen des DFD, die in der Viermächte-Stadt lebten. Melzer hatte Bähnisch bereits vor der
531 BArch, SAPMO DY 31/1283, Die Frauenbewegung in der britischen Zone, o. V., 30.08.1947. 532 Vgl. dazu auch Stark: Majority, S. 150. Stark schreibt sogar, der offizielle Bericht über Pyrmont, der von Bähnisch verfaßt worden sei, sei ausschließlich über den DFD überliefert. Vgl.: ebd., S. 150. Stark verweist auf das Dokument BArch, SAPMO DY 31 IV 2/17/99, Frauenarbeitstagung Bad Pyrmont, 20. bis 23. Juni 1947. 533 Vgl.: Art. „Weiterer, Maria“, in: Biographische Datenbanken, auf der Homepage der Bundesstiftung Aufarbeitung, http://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-werin-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=3755, am 01.02.2014. Weiterer war als Maria Tebbe, wie Theanolte Bähnisch, 1899 geboren worden und 1976 gestorben. 534 Wegen Konflikten mit Anne-Marie Durand-Wever hatte Weiterer ihr Amt 1947 niedergelegt. Ihre Nachfolgerin war Maria Rentmeister. 535 Weiterer leitete die Frauenabteilung gemeinsam mit Marie Hartung. Vgl.: ebd. 536 BArch, SAPMO DY 31/1283, Dokument ohne Titel über verschiedene Frauenverbände in der amerikanischen Besatzungszone, o. D.
806 | Theanolte Bähnisch
Konferenz in Bad Boll als treibende Kraft einer West-Organisation gegen den DFD identifiziert und sich gegen eine Zusammenarbeit mit ihr ausgesprochen. Anfang Mai 1947 hatte sie Emmy Damerius-Koenen, die bereits im Vorbereitungskomitee des DFD eine dominierende Rolle gespielt hatte, die auf der Gründungskonferenz im März 1947 das Hauptreferat zum Thema ‚Internationale Fragen‘ gehalten hatte und die 1948 Durand-Wever als erste Vorsitzende des DFD-Bundesvorstandes537 ablösen sollte, als Ergebnis einer Diskussion in ihrem Umfeld über die ‚causa Bähnisch‘ mitgeteilt: „Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, ob man Frau Bähnisch nicht unterstützen sollte. Da aber von vornherein ersichtlich ist, dass diese Organisation gegen den Demokratischen Frauenbund Deutschlands ausgerichtet ist, konnten wir diese Frage nicht bejahen. Bei dem bestehenden Kräfteverhältnis dürfte es auch nicht möglich sein, diese Organisation von innen heraus fortschrittlich zu gestalten.“538 Melzer sah also, anders als die DFD-Generalsekretärin und SEDFunktionärin Rentmeister und die parteilose Durand-Wever (der man die politisch wenig relevante Leitung des DFD-Bundesvorstandes übertragen hatte), keine Möglichkeit zu einer Kooperation mit Bähnisch. Sie glaubte auch nicht daran, daß eine Mitarbeit von Kommunistinnen im Frauenring den Zielen des DFD dienlich sein könne. Sie setzte stattdessen auf die Schaffung einer eigenen „demokratischen Frauenorganisation“539 im Westen und sah die ‚Arbeitsgemeinschaft der Frauenausschüsse‘ als potentielle Partner für ihren Plan an. Wo keine ‚Frauenausschüsse‘ existieren, so Melzer, solle das Verbindungskomitee [des DFD in den Westen] tätig werden.540 Die in Westdeutschland existierenden ‚Frauenausschüsse‘ waren, wie aus einem Schreiben der Intelligence Division der CCG (BE) hervorgeht541, zwar prinzipiell auf Überparteilichkeit angelegt, aber nicht selten kommunistisch dominiert. Die Briten, insbesondere die WGPW, verfolgten daher die Absicht, die noch existierenden Frauenausschüsse dazu zu bewegen, den Status von ‚Frauenringen‘ anzunehmen.542 Nachdem in Köln bereits ein DFD gegründet worden sei, habe Bähnischs Antwort nicht lange auf sich warten lassen, machte Melzer die SED-Funktionärinnen auf die schnelle Reaktion der Vorsitzenden des ‚Club deutscher Frauen‘ aufmerksam.
537 Der Bundesvorstand des DFD, der mit Frauen aus allen Parteien und parteilosen Frauen besetzt war, hatte Petra Scheidt zufolge „de facto lediglich repräsentative Befugnisse“. Die politischen Schlüsselfunktionen im Generalsekretariat des DFD waren dagegen weitgehend in die Nomenklatur der SED integriert. Vgl.: Scheidt: Karriere, S. 51. 538 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Hanna Melzer an Emmi [EmmyDamerius], 03.05.1947. 539 Ebd. 540 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Hanna Melzer an Emmi [Emmy Damerius], 03.05.1947. 541 NA, UK, FO 1050/1213, Women‘s Organisations, o. V., o. D., Anhang zu einem Schreiben von G. Brooking, HQ Intelligence Division an die Militärregierungen der Länder, 06.05.1948. 542 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 123.
Staatspolitische Aufgabe
|
807
„[G]emeinsam mit CDU Frauen, unter Unterstützung der Engländer“543 habe Bähnisch für die Schaffung eines Frauenklubs Vorkehrungen getroffen, so Melzer, die damit wahrscheinlich auf ein lokales Gegengewicht zum Kölner DFD anspielt. Auch die KPD-Politikerin Rosel Weiss hatte schon im April 1947 – vermutlich aus Aachen – nach Berlin geschrieben, daß Bähnisch eine Gegnerin des DFD sei. „Die CDU wie die SPD sträubten sich gegen die Gründung des DFB“, teilte sie, den DFD meinend, Emmy Damerius mit. „Frau Bönisch [!] nahm sogar Stellung dagegen, dass in der Ostzone der Name ‚Demokratischer Frauenbund Deutschlands‘ genannt wurde“544. In diesem Zitat deutet sich an, daß ein Kampf darum entbrannte, welcher Verband zukünftig für sich beanspruchen konnte, ‚die deutschen Frauen‘ organisatorisch zu vertreten – und welcher Verband im Ausland entsprechend wahrgenommen werden würde. In einer Sitzung im Juli 1947, also nach der Konferenz von Pyrmont, vertrat Hanna Melzer eine andere Position als noch im Mai desselben Jahres. Sie bemerkte nun, daß man „die Organisation der B.“ – was zeigt, daß man den Frauenring vor allem als Bähnischs Werk wahrnahm – bereits „in Unordnung gebracht“ habe, daß man aber „keine Kraft“ habe, „das zu zerschlagen“545. Vielmehr solle man eine paritätische Besetzung der Leitungen der Frauenringe zur Bedingung machen und darauf achten, daß diese ‚fortschrittlich‘ seien.546 Wiederum zwei Monate später, im September 1947, modifizierte Melzer ihre Position erneut. „Wir sollten überlegen, ob wir unsere Kräfte hergeben und Frau Bähnisch unterstützen, um eine Massenorganisation zu schaffen, die in fortschrittlicher Richtung arbeitet“, wird die ‚Eiserne Johanna‘ in einem Bericht Milli Boelkes zitiert. „Die Frage ist: Entweder mitarbeiten oder vorwärtsdrängen zu einer fortgeschrittenen Organisation, wie es in Schleswig-Holstein oder Solingen der Fall ist.“547 Zu jener erneut revidierten Haltung Melzers hatten die Fürsprachen anderer KPDLandesfrauenleiterinnen, die sich für den Aufbau einer einheitlichen, ‚fortschrittlichen‘ und überparteilichen Organisation ausgesprochen hatten, beigetragen. Insgesamt gesehen scheinen Berichterstatterinnen aus dem DFD und aus der KPD zu Beginn ihrer Recherchen, was die Relevanz Bähnischs betraf, ebenso unentschieden gewesen zu sein wie viele Sozialdemokratinnen. „Sie reiste im ganzen Lande herum und versuchte, auch im Lande Nordrhein-Westfalen ihre Organisation aufzuziehen“548, wird Bähnischs Unterfangen in einem Bericht aus dem Sommer 1947 be-
543 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Hanna Melzer an Emmi [Emmy Damerius], 03.05.1947. 544 BArch, SAPMO DY 31/1283, Rosel Weiss an Emmy Damerius, 25.04.1947. Unterstreichung im Original, Anm. d. V. 545 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Protokoll der Sitzung der Landesfrauenleiterinnen der britischen Zone am 3. Juli 1947 in Hannover. o. D. 546 Ebd. 547 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Amerikanische Zone, Sept. 1947, Bericht von Milli Boelke, Oktober 1947. 548 BArch, SAPMO DY 31/1283, Die Frauenbewegung in der britischen Zone, o. V., 30.08.1947.
808 | Theanolte Bähnisch
schrieben. Ihre Bemühungen werden als weitgehend erfolglos dargestellt: „Es ist ihr nicht gelungen, weil die Frauenausschüsse sich in ihren Sitzungen gegen die Organisation wandten.“549 Lediglich in Düsseldorf habe sie Erfolg gehabt und einen Verband gründen können, „allerdings nicht als Club deutscher Frauen“550. Die Berichterstatterin, die offenbar nicht wußte, daß Bähnisch bereits begonnen hatte, in Anlehnung an den von ihr im Juni begründeten ‚Frauenring der britischen Zone‘ und in Vorbereitung auf einen gesamtdeutschen Frauenring, verschiedene ‚Frauenringe‘ zu gründen, spielte auf den schließlich von der nordrheinwestfälischen Kultusministerin Teusch geleiteten Düsseldorfer Frauenring an. Sie setzte einiges daran, Bähnischs Einfluß herunterzuspielen und kam schließlich zu dem Urteil, die Organisation habe keinen Massencharakter und jenseits von Hannover keinen großen Einfluß. „Man nimmt lediglich Resolutionen an und leitet sie weiter“, konstatierte die Unbekannte. Eine andere Berichterstatterin, Luise Oliefs, die – nachdem die KPD in Westdeutschland schon lange verboten war – noch in den 80er Jahren eine Rolle bei der Gelsenkirchener MLPD spielte551, war sogar der Meinung, daß Bähnisch selbst bei den bürgerlichen Frauen „keinen Boden“552 hätte. Und eine Julia Heilemann betonte, daß eine „Frau Dr. Felsen“ 553 – womit Dorothee von Velsen, die ehemalige Leiterin des ‚Staatsbürgerinnenverbandes‘, die schon bald mit Bähnisch unter dem Dach des Frauenrings zusammenarbeitete, gemeint sein mußte – einen Zusammenschluß mit Bähnisch ebenfalls ablehne. Daß man den Einfluß der Hannoveranerin nicht recht einzuschätzen wußte, hing wohl auch damit zusammen, daß die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Organisationen in den westlichen Besatzungszonen vom DFD trotz seines Netzes an Informantinnen nicht immer richtig gedeutet wurden. So stellte eine bereits zitierte Berichterstatterin, die ebenfalls dazu neigte, Bähnisch als unwichtig abzutun, fest, daß Else Richter, welche eine Frauenorganisation „unter
549 Ebd. Diese Information stammt vermutlich ursprünglich aus dem ‚Bericht über eine Tagung des Demokratischen Frauenrings, die den Zweck hatte einen Landesvorstand von Nordrhein-Westfalen zu gründen‘. Dieser ist, offenbar in Abschrift und datiert auf den 13.06.1947 überliefert in BArch, SAPMO, DY 30/IV 2/17/99 überliefert. Demnach hatten Frau Dr. Schmücker, Dr. Hasche und Frau Dr. Gellert sowie Oberstudienrätin Franken den Zusammenschluß mit Nachdruck forciert, während Frau Bläser aus Wuppertal, Dr. Panow aus Münster, eine Vertreterin aus Essen und das KPD-Parteimitglied Scheelewald den Zusammenschluß, beziehungsweise die Annahme des Programms abgelehnt hatten. 550 BArch, SAPMO DY 31/1283, Die Frauenbewegung in der britischen Zone, o. V., 30.08.1947. 551 O. V. [‚sh‘]:»Jetzt ist Willi Dickhut für mich richtig lebendig geworden« Veranstaltung mit »Bergischer Kaffeetafel« im Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen, in: Rote Fahne. Wochenzeitung der MLPD, Nr. 43, 24.12.2002, auf: http://interaktiv.mlpd.de/rf0243/ rfart3.htm, am 03.02.2014. 552 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Protokoll der Sitzung der Landesfrauenleiterinnen der britischen Zone am 3. Juli 1947 in Hannover, o. D. 553 Ebd.
Staatspolitische Aufgabe
| 809
dem Namen Frauenbund“ in Kiel gegründet habe, „unter Einfluß der Engländer“554 stünde. Daß sie auch in enger Verbindung zu Bähnisch stand, war der Berichterstatterin nicht aufgefallen. Vielleicht sah sie es auch deshalb als eine „Aufgabe der aufgeklärten Frauen“ an, „in diesem Frauenbund zu arbeiten um die erst vorläufigen Statuten zu fortschrittlichen zu machen und so der Organisation die reaktionäre Spitze abzubrechen“555. KPD-Mitglied Lore Szezinowski nutzte die Möglichkeit, über Richter zu berichten, dazu, diese für ihr mangelndes Einfühlungsvermögen in die Lage von Arbeiterinnen sowie ihre „frech-agressive“556 Art zu kritisieren. Ihrem Amt als Vorsitzende des Frauenbundes – der zum Zeitpunkt ihres Berichtes bereits ein Frauenring gewesen sein dürfte – urteilte Szezinowski hart, sei sie nicht gewachsen.557 Eine starke Gegenposition zu den noch nicht besonders gut geschulten Beobachterinnen, die den Einfluß Bähnischs und der Frauenringe herunterspielten, nahm die erfahrende Instrukteurin für die DFD-Arbeit im Westen, Milli Boelke558 ein. Boelke mahnte zu größter Vorsicht gegenüber der Regierungspräsidentin und betonte, daß sich die Arbeit des DFD ganz wesentlich darauf konzentrieren müsse, Bähnischs Ziele zu boykottieren: „Die Baehnisch hat einen Namen. Sie will die Frau im Westen werden. Sie will im Osten mitarbeiten. Wir glauben ihr nicht. […] Wir müssen erreichen, dass die Organisation nicht so wird, wie die Baehnisch will, sondern dass die fortschrittlichen Kräfte den Sieg davontragen. […] Die Baehnisch muss mit ihren Bestrebungen allein bleiben.“559 7.6.4 Aus nächster Nähe: Empfehlungen aus dem KPD-Bezirk Hannover Die Beraterinnen aus der KPD in Hannover konnten, da sie mit Bähnisch teilweise im ‚Club deutscher Frauen‘ an einem Tisch saßen, wohl am besten einschätzen, über welches Potential die Regierungspräsidentin verfügte und ob es möglich wäre, ihren
554 BArch, SAPMO DY 31/1283, Die Frauenbewegung in der britischen Zone, o. V., 30.08.1947. 555 Ebd. 556 BArch, SAPMO DY 31/1283, Vgl.: Bericht vom offiziellen Teil der Tagung der Deutschen Frauenbünde in Neumünster am 31.10.1947, Lore Szeczinowski, o. D. Aus jenem Dokument wird die Zusammensetzung des Vorstands im Frauenring Schleswig-Holstein erkennbar: Richters Vertreterin war Emma Vaupel, erste Schriftführerin war Else Vormeyer aus Kiel und deren Vertreterin eine Frau Milerski aus Husum. Als Gäste waren auf der Veranstaltung Maria Prejawa, Mrs. Corbett-Ashby anwesend sowie die für Women’s Affairs in Schleswig-Holstein zuständige Mrs. Johnson. 557 Ebd. 558 Das ehemalige DFD-Mitglied Gerda Weber beschreibt Milli Boelke entsprechend. Vgl.: Weber, Hermann/Weber, Gerda: Leben nach dem Prinzip „links“. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten, Berlin 2008, S. 83. 559 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Amerikanische Zone, Sept. 1947, Milli Boelke, Oktober 1947.
810 | Theanolte Bähnisch
Gründungen in den Westzonen einen anderen Großverband entgegenzusetzen. Herta Dürrbeck, zu dieser Zeit Club- und KPD-Mitglied, später Leiterin des DFDLandesverbandes Niedersachsen, stellte – über andere Organisationen in Niedersachsen reflektierend – fest, sie sei „der Meinung, dass Frau Bähnisch die größere Kraft ist, dass sie auch mehr Einfluß hat durch ihre Stellung als Regierungspräsidentin. Es wird nicht möglich sein, neben den Frauenring eine andere Organisation zu stellen“560. Dürrbeck hielt es für unangebracht, kämpferisch gegen den von Bähnisch forcierten Zusammenschluß vorzugehen. „Wir müssen davon abgehen, von unserer Warte aus die Fragen zu betrachten. Die Frauen sind weniger geschult“561, warb sie beinahe um Verständnis dafür, daß den im Frauenring engagierten Frauen keine politische Bildung durch eine Partei zuteilgeworden war. Fatalismus in Bezug auf die Arbeit Bähnischs fand Dürrbeck falsch: „Wir müssen sehen, daß es nicht so negativ ist, wie wir es oft ansehen“562, schickte sie sich an, die Einstellung anderer KPDFunktionärinnen zu korrigieren. Die Hannoveranerin brach eine Lanze für ein langsames, kontrolliertes Vorgehen, wie sie es offenbar auch persönlich im ‚Club deutscher Frauen‘ verfolgte: „Man muss im Frauenring arbeiten und unsere fortschrittliche Linie hineinbringen“.563 Außerdem verlieh sie ihrer Hoffnung Ausdruck, daß die ‚Frauenarbeitsgemeinschaft Hannover‘, „die nicht dem Ring angeschlossen ist, die keine feste Organisation ist, sondern in der von jeder Organisation eine Vertreterin mit Stimmrecht vorhanden ist“, einen ausgleichenden Pol zur Arbeit Bähnischs darstellen könnte. Diese werde sich „nicht bedingungslos anschliessen“564, konstatierte Dürrbeck – was einerseits einen gewissen Interpretationsspielraum darüber zuläßt, wie gut Dürrbeck die Dominanz Bähnischs in der Frauenarbeitsgemeinschaft einschätzen konnte, andererseits aber auch die Frage aufwirft, ob Bähnisch auf die Arbeitsgemeinschaft womöglich tatsächlich weniger Einfluß ausüben konnte, als sie es sich ursprünglich erhofft hatte. Dürrbeck schien jedenfalls nicht auf eine kommunis-
560 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Protokoll der Sitzung der Landesfrauenleiterinnen der britischen Zone am 3. Juli 1947 in Hannover, o. D. 561 Ebd. 562 Ebd. In der Sitzung kam auch zur Sprache, daß Helena Deneke Bähnischs Pyrmonter Konferenz vor der Arbeitsgemeinschaft gelobt habe. Ebd., S. 2. 563 Ebd. Folgt man den stark politisch gefärbten Erinnerungen Peter Dürrbecks, so war die Mitarbeit seiner Mutter Herta Dürrbeck in der Organisation Bähnischs aufgrund deren antikommunistischer Ausrichtung für die Mutter „besonders aufreibend“. Dürrbeck, Peter: Herta und Karl Dürrbeck. Aus dem Leben einer hannoverschen Arbeiterfamilie, Hannover 2010, S. 54. Peter Dürrbeck schreibt, daß seine am 25.09.1914 als Herta Petermann geborene Mutter und Dora Gaßmann trotz der zehn Jahre Altersabstand einander freundschaftlich verbunden waren. Vgl.: ebd. Als Landtagsabgeordnete der KPD ab 1953 hatte sich Dürrbeck, ihrem Sohn Peter zufolge, vor allem für Probleme arbeitender Frauen eingesetzt. Zuvor war sie ehrenamtliches Mitglied des niedersächsischen Landesverwaltungsgerichts gewesen. Vgl.: ebd., S. 63. Dürrbeck war für den DFD tätig, bis dieser 1957 verboten wurde. Sie reiste unter anderem 1955 zum Weltfriedenskongreß nach Helsinki. 564 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Protokoll der Sitzung der Landesfrauenleiterinnen der britischen Zone am 3. Juli 1947 in Hannover, o. D.
Staatspolitische Aufgabe
|
811
tische Dominanz in der Frauenbewegung aus gewesen zu sein. Sie wollte gewährleistet sehen, daß eine Vielfalt von Stimmen, darunter auch kommunistische, in der Bewegung vertreten seien. Die Hannoveranerin Luise Gschmack vertrat in Bezug auf den Frauenring ebenfalls die Überzeugung, „dass wir in dieser Organisation mitarbeiten und ihr ein fortschrittliches Gesicht geben müssen.“ Entsprechende Anstrengungen waren von ihrer Seite bereits unternommen worden: „Wir haben in verschiedenen Ausschüssen 20 Genossinnen verankert“565, wird Gschmack zitiert. Ob diese Aussage Gschmacks der Realität entsprach, läßt sich nicht rekonstruieren. Sollte sie auch nur teilweise zutreffen, so war Herta Gotthelfs Sorge, daß Bähnischs Verband ein Einfallstor für Kommunistinnen sei, zumindest nicht völlig unbegründet. Mit Elfriede Paul hatte der DFD ein besonders wertvolles Mitglied gewonnen, das sich in Hannover auskannte und in Berlin die Stellung hielt. Eine Stippvisite Pauls in Niedersachsen schien ein naheliegendes Unterfangen zu sein, um dem DFD bei der Strategie-Planung auf die Sprünge zu helfen. Obwohl Bähnisch von dem Interview, das Paul in der Frauenzeitschrift ‚Sie‘ über die Konferenz von Pyrmont abgegeben hatte verständlicherweise wenig begeistert war566, zögerte Paul nicht, ihre ehemalige Clubschwester im September 1947 anzuschreiben, sich nach dem Stand ihrer Genesung zu erkundigen, sowie um einen aktuellen Bericht über den Fortschritt des Zonenzusammenschlusses von Frauenorganisationen zu bitten. Sie wollte auch an einer Zusammenkunft des ‚Club deutscher Frauen‘ teilnehmen, falls eine solche Anfang Oktober desselben Jahres stattfinden würde.567 „Man fühlt sich doch noch sehr verbunden mit dem Westen, wenn man so lange und in so wichtiger Zeit dort gelebt und gearbeitet hat“568, begründete Paul ihr Interesse. Doch in Anbetracht der sich zuspitzenden politischen Lage ist es wahrscheinlich, daß Paul vom DFD den Auftrag erhalten hatte, Erkundigungen über die aktuelle Arbeit des ‚Club deutscher Frauen‘ und des ‚Frauenrings‘ einzuholen, die gegen die Interessen Bähnischs verwendet werden sollten.
565 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Amerikanische Zone, Sept. 1947, Bericht von Milli Boelke, Oktober 1947. 566 Sie habe auch von anderer Seite gehört, daß sich „die Dinge […] tatsächlich so abgespielt haben und eine geheime Besprechung stattgefunden hat“. Sie finde den Ton des Interviews völlig berechtigt, schrieb Barbara von Renthe an Paul, könne aber verstehen, daß er Frau Bähnisch nicht gefiele. BArch, NY 4229, Nr. 11, Dr. v. Renthe an Frau Dr. Paul, 05.11.1947. Die parteilose Dr. med. Barbara von Renthe war im Februar 1947 als Vizepräsidentin in den Vorstand der deutschen Zentralverwaltung für das Gesundheitswesen in der SBZ berufen worden. 567 BArch, NY 4229, Nr. 11, Elfriede Paul an Theanolte Bähnisch, 03.09.1947. 568 Ebd.
812 | Theanolte Bähnisch
7.6.5 Der Frauenring: Wenig Angriffs-, aber viel Reibungsfläche für Kommunistinnen Eine detaillierte Auswertung der im Bestand ‚Abteilung Frauen im ZK der SED‘ sowie im Bestand ‚Demokratischer Frauenbund Deutschlands‘ überlieferten Unterlagen wäre sinnvoll, um Lücken in der Forschung über die Geschichte des DFR sowie über die deutsch-deutschen Beziehungen in der Frauenbewegung zu tilgen. An dieser Stelle sollten nur einige Zusammenhänge herausgearbeitet werden, die für die Kontextualisierung von Bähnischs Wirken von Relevanz sind: So fällt bei der Auseinandersetzung mit den Akten schnell auf, daß die gemeinsame Sorge Bähnischs, der britischen Militärregierung, aber auch Herta Gotthelfs, der DFD sei auf Expansionskurs in den Westen, durchaus berechtigt war. Einem Protokoll zufolge hatte das SEDParteivorstandsmitglied Elli Schmidt bereits im März 1947, im Anschluß an den DFD-Kongreß auf einer internen Sitzung, an der auch Elfriede Paul teilgenommen hatte, gegenüber KPD-Funktionärinnen aus den Westzonen verkündet: „Wir haben den Demokratischen Frauenbund ‚Demokratischer Frauenbund Deutschlands‘ genannt. Das bedeutet aber nicht, daß er schon ein Frauenbund ganz Deutschlands ist. […] Wir werden jetzt zu Euch rüberkommen. Wir haben […] viele Adressen gesammelt und unterstützen Euch mit Material. […] Man ist […] bestrebt, Euch als Kommunistinnen aus den Frauenorganisationen auszuschließen. […] Ihr müßt Euch den Verhältnissen anpassen, in jeder Stadt […] Ihr dürft […] keine Extragruppen machen, mit den anderen zusammenarbeiten.“569 Und in einem Bericht über die Konferenz in Bad Boll war zu lesen, daß „von unseren Frauen nur 5 Kommunistinnen dort“ waren, welche unter „irgendwelcher Flagge herumsegelten“570 – was heißt, daß die Frauen offiziell als Vertreterinnen anderer Organisationen gekommen waren. Auch wenn eine solche Bewertung an dieser Stelle verfrüht erscheinen mag: Bähnischs Ziel, die kommunistische Frauenbewegung in Westdeutschland zu bekämpfen, scheint am Ende aufgegangen zu sein. Ihr starker, von der britischen Militärregierung verstärkter Einfluß auf überparteiliche Frauenorganisationen nahm den Kommunistinnen nach und nach die Möglichkeiten zu jener ‚Infiltration‘ entsprechender Zusammenschlüsse, die Herta Gotthelf so sehr befürchtet hatte. Zwar waren 1946/47 einige KPD-Mitglieder in überparteilich arbeitenden Frauenzusammenschlüssen, auch im ‚Club deutscher Frauen‘, vertreten, doch wurden jene Frauen, je mehr sich der Kalte Krieg zuspitze, desto offensiver aus Organisationen, welche den Status von Frauenringen angenommen hatten herausgedrängt, oder zumindest mundtot gemacht, indem man sie als Rednerinnen nicht zuließ. In der Zusammenarbeit zwischen Bähnisch und ihren Mitstreiterinnen, Vertreterinnen britischer Frauenorganisationen und den Women‘s Affairs Officers war es durch einen intensiven Informationsaustausch gelungen, zunächst die ‚Frauenausschüsse‘ als nicht selten kommunis-
569 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, S/Ke.: Protokoll der Sitzung vom 10. März 1947 mit den Genossinnen aus der Westzone [im Anschluß an den Frauenkongress], Berlin, 11.03.1947, S. 1. Unterstreichung i. O. 570 BArch, SAPMO DY 31/294, Bericht über die Tagung in Bad Boll von Maria Rentmeister, o. D.
Staatspolitische Aufgabe
|
813
tisch dominierte Zusammenschlüsse zu ‚enttarnen‘. Im Verlauf des Kalten Krieges machten sich bald alle Zusammenschlüsse, die überparteilich arbeiteten und keine berufsständischen oder sonstigen speziellen Gruppen-Interessen verfolgten, verdächtig, wenn sie nicht den Status von ‚Frauenringen‘ annahmen. Das Ziel des DFD, Führungsgremien in Frauenringen mit ‚fortschrittlichen‘ Frauen zu besetzen, scheiterte aufgrund der intensiven Netzwerkpflege, die Bähnisch betrieb. Der Regierungspräsidentin gelang es, viele bekannte und insofern für die Meinungsbildung in Deutschland maßgebliche Frauen, deren Einstellung dezidiert antikommunistisch war, hinter sich zu bringen und ein Netz von ‚Frauenringen‘ zu spannen, in denen die ‚Führungsposten‘ mit diesen Frauen besetzt waren. Gemessen am antikommunistischen Aspekt ihrer Besatzungspolitik schienen die Briten also die richtige Strategie gewählt zu haben, indem sie auf Bähnisch als leitende Figur in der Frauenbewegung der britischen Besatzungszone setzten. Daß die Regierungspräsidentin den Kommunistinnen nicht allein, sondern in enger Zusammenarbeit mit anderen Frauen den Wind aus den Segeln nahm hatte, steht außer Frage. Aber auch Personen, die in Konkurrenz zu der Verwaltungsjuristin standen, leisteten entsprechende Arbeit. So war beispielsweise nicht nur Herta Gotthelf, sondern auch Fini Pfannes, von der die DFD-Frauen wußten, daß sie „auch den deutschen Verband leiten“571 wollte, entschieden antikommunistisch eingestellt572 und verfolgte das Ziel, den Einfluß von Kommunistinnen in Westdeutschland zurückzudrängen. Bähnischs Gründungen boten zwar aufgrund der Schnelligkeit und Entschlossenheit, auch aufgrund des teilweise wenig demokratischen Vorgehens ihrer Vorsitzenden und ihrer guten Kontakte zur britischen Frauenbewegung sowie zur britischen Militärregierung wenig Angriffsfläche für kommunistische Infiltrationsversuche. Doch all die aufgezählten Aspekte, auch die Kontakte Bähnischs zu ehemaligen BDF-Funktionärinnen verschafften dem DFD viel Raum für Projektionen. Aufgrund der Nähe, die die Regierungspräsidentin zu den ‚Bürgerlichen‘ suchte, war es für den DFD deutlich leichter, mittelfristig auch Bähnischs Politik als „restaurativ“ und „reaktionär“573 zu brandmarken und entsprechend die eigene Position in Abgrenzung dazu als ‚fortschrittlich‘ zu definieren, als dies bei einer überzeugten, entsprechend auftretenden Sozialdemokratin wie Gotthelf als Führungsfigur in der Frauenbewegung möglich gewesen wäre. Auch der Ärger über die tatsächlich wenig sensibel geführten Diskussionen bezüglich der Freilassung von Kriegsgefangenen und die Ausklammerung der Themen ‚Nationalsozialismus‘ und ‚Antisemitismus‘ ließ sich
571 BArch, SAPMO DY 30/IV2/17/99, Sitzung Frauensekretariat, 23.05.47, Maria Rentmeister berichtete wie folgt, S. 4. 572 NA, UK, FO 945/285, Englischsprachige Übersetzung eines Schreibens von Fini Pfannes an Maria Rentmeister, DFD, 30.12.1947. Der Brief von Pfannes stellte eine Antwort auf ein Schreiben Rentmeisters dar, in dem diese sich unzufrieden über Pfannes Haltung gegenüber einer Konferenz des DFD in Berlin geäußert hatte. 573 Rentmeister, Maria: Zersplitterte Frauenbewegung im Westen. Ein Stimmungsbericht von der Frauenkonferenz in Bad Boll, in: Freiheit, Ausgabe Halle, 09.06.47.
814 | Theanolte Bähnisch
von Seiten des DFD werbewirksam zum Ausdruck bringen.574 So war in der FDGBZeitschrift ‚Tribüne‘ unter dem Titel „Frauenmitleid trifft daneben“ zu lesen, daß „die Behandlung der Kriegsverbrecher […], die Entnazifizierung und die Einheit Deutschlands“575 in Bad Boll nicht „angefaßt“ worden seien, man aber mehrere Stunden über eine Resolution gestritten und die die „Freilassung […] von […] höheren BdM- und SS-Führerinnen“576 verlangt habe. Daß in weiteren Resolutionen auf der Tagung auch eine ‚Beteiligung von Frauen am Parlamentarischen Rat‘, eine stärkere Berücksichtigung von Frauen bei der Besetzung von Führungspositionen, die Aufnahme eines Rechts auf Arbeit und auf gleichen Lohn für Männer und Frauen in die neue Verfassung gefordert wurde577, erwähnten die Kritiken nicht. Für den DFD ist damit ein ähnlicher Umgang mit den ‚Realitäten‘ zu konstatieren wie für Bähnisch: Was auch immer an der jeweils ‚anderen‘ Organisation beziehungsweise am jeweils anderen System positiv war, wurde, zumindest in offiziellen Verlautbarungen, nicht erwähnt. Ein Bericht von Erika Buchmann, die Landtagsabgeordnete für die KPD in Baden-Württemberg war, zeigt, wie die teilweise positive, teilweise neutrale Darstellung Bähnischs auch durch führende Kommunistinnen in Westdeutschland spätestens 1949 einer eindeutig negativen Darstellung gewichen war. Die Vorurteile, die viele Kommunistinnen gegenüber ‚Bürgerlichen‘ Frauen pflegten, sah man nun auch durch Theanolte Bähnisch bestätigt. So schreibt Erika Buchmann über eine Rede Bähnischs auf dem zweiten) Frauenkongreß in Bad Pyrmont im Oktober 1949, daß sich die Ausführungen der Regierungspräsidentin in „unverbindlichem Gerede“ erschöpft hätten. Das „Plätschern um allgemeine Dinge“ habe „jede konkrete Aufgabenstellung vermissen“ lassen578. Nicht auf die Infiltration bestehender Gruppierungen, sondern eigene Gründungen im Westen vorzunehmen, war dem DFD, nachdem die KPD bereits verboten worden war, ab 1957 nicht mehr möglich. Mit der Begründung, er sei eine kommunistische Tarnorganisation, wurde der DFD jeweils auf der Grundlage von Erlassen
574 Vor allem Maria Rentmeister streute diese Kritik breit: Vgl.: Rentmeister, Maria: Nur 12 Minuten Redezeit, in: Neues Deutschland, 07.06.1947, S. 3 sowie dies.: Kritik an der Frauentagung in Bad Boll, in: Tägliche Rundschau, 29.05.1947 und dies: Frauenbewegung. Daß in Bad Boll „über die Wiedergutmachung an Verfolgten des nationalsozialistischen Regimes kein Wort fiel“ und stattdessen „ausgiebig über die Freilassung der im Lager Ludwigsburg internierten Nationalsozialisten“ debattiert worden sei, kritisierte auch der amerikanisch lizensierte ‚Tagesspiegel‘. „Eine solche Haltung macht das Ziel der Frauenverbände, eine größere Anteilnahme der Frau am öffentlichen Leben zu erreichen, illusorisch“, schrieb der unbekannte Verfasser, der sich als genereller Gegner von frauenpolitischem Engagement außerhalb von Parteien zu erkennen gab. O. V.: Frauentagung in Bad Boll, in: Tagesspiegel, 30.05.1947. 575 O. V.: Frauenmitleid trifft daneben, in: Tribüne, 15.06.1947. 576 Ebd. 577 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 127. 578 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Buchmann, Erika: Bericht über den Frauenkongress in Bad Pyrmont, der vom 7.–10. Oktober stattfand, 1949.
Staatspolitische Aufgabe
|
815
durch die Regierungspräsidenten verboten. In Niedersachsen wurden damit einhergehend die hauptamtlichen Funktionärinnen des DFD-Niedersachsen Emma Meyer, Lotte Düpre und Erika Krüger sowie Herta Dürrbeck wegen „Weiterführung der illegalen KPD“ angeklagt. Dürrbeck und Meyer wurden zu je einem Jahr Gefängnis sowie Verlust des aktiven und passiven Wahlrechts für drei Jahre verurteilt und im Frauengefängnis Vechta inhaftiert.579 Düpre und Krüger erhielten Bewährungsstrafen.580 Um den Einfluß interner Strukturen und der Politik des DFD für sein Scheitern in Westdeutschland zu klären, wo es ihm bis zu seinem Verbot nicht gelang, eine Großorganisation aufzubauen, wären weitere Recherchen notwendig. Petra Scheidt zufolge war der DFD, der 1950 knapp über 500.000 Mitglieder hatte und sich in den 60er Jahren bei 1,3 Millionen Mitgliedern einpendelte581, auch in der SBZ/DDR nicht besonders erfolgreich, was die Mitgliederwerbung anging. Der Verband habe, so Scheidt, in der Bevölkerung eine „fragwürdige Reputation besessen, welche von den Funktionärinnen […] zu keinem Zeitpunkt seines Bestehens völlig beseitigt werden konnte“582. Vor allem die ‚bürgerlichen‘ Frauen habe er vom Sinn einer Mitgliedschaft nicht überzeugen können, so Scheidt.583 Jedoch konnte er auch die Arbeiterinnen nicht mehr gut erreichen, nachdem er auf Weisung der SED seine Betriebsgruppenarbeit hatte beenden müssen.584
579 Vgl.: Dürrbeck, Peter: Frauen unter Anklage, in: Mitteilungen der Deutschen Kommunistischen Partei, 1957: Prozesse gegen Kommunistinnen, auf: Archiv-Parteigeschichte/ KPD, 2007, http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved =0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dkp-niedersachsen.de%2Fsystem%2Ffunk tionen%2Fhtml2pdf%2Fdkp_pdf.php%3Fmodus%3Dpdf%26med%3D501%26ausgabe% 3D89%26pfadx%3D1%26dat_id%3D285&ei=xLkJVMj4EoWJ7AbgiIGgDw&usg=AFQ jCNHO86drVxbExyxfO26shRhno--Rsg&bvm=bv.74649129,d.ZGU, am 05.09.2014. Dürrbeck betont, daß Gerda Weber neben dem ehemaligen Landessekretär Günther Hurrelmann eine „Hauptzeugin der Anklage“ war und daß an der Verurteilung der Frauen Richter mit nationalsozialistischer Vergangenheit beteiligt waren. Eine ‚Steuerung‘ des DFD durch die KPD bestreitet er. 580 Vgl.: Dürrbeck: Dürrbeck, S. 81. 581 Vgl.: Scheidt: Karriere. Lediglich in der zweiten Hälfte der 70er und in der ersten Hälfte der 80er Jahre habe er noch einmal einen „deutlichen Zuwachs“ erfahren, so Scheidt. Näher spezifiziert sie dies nicht. 582 Ebd., S. 70. Mario Niemann kritisiert in seiner Rezension über Scheidts Werk jedoch, daß das Urteil vom negativen Image des DFD in der Bevölkerung durch Scheidt nicht ausreichend belegt worden sei. Vgl.: Niemann, Mario: Rezension über: Scheidt, Petra: Karrieren im Stillstand, in: Sehepunkte, 12(2012), Nr. 10, auf: http://www.sehepunkte.de/ 2012/10/21768.html, am 04.02.2014. 583 Vgl.: Scheidt: Karriere, S. 70. 584 Vgl.: Weber: DFD, S. 702.
816 | Theanolte Bähnisch
7.6.6 „Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, daß sie vom Osten nichts hören wollen“: Der gesamtdeutsche Anspruch des DFD und die Haltung Bähnischs Lisbet Pfeiffer kommentierte in der ‚Welt der Frau‘ eine Sprecherin aus der SBZ, die auf der Konferenz von Bad Boll aufgetreten war, mit den Worten: „Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, daß sie vom Osten nichts hören wollen. [...] Wir brauchen den Westen genau so, wie sie den Osten; es liegt an uns allen, ob die Grenzen sich verschärfen oder ob sie eines Tages fallen werden.“585 Diese Ausssage gab die in der bürgerlichen Frauenbewegung sozialisierte Pfeiffer wohlmeinend wieder und stellte fest, daß Frauen im Westen größeres Entgegenkommen gegenüber den Frauen aus der SBZ zeigen müßten. Auch wenn der Vorwurf, die bürgerliche Frauenbewegung in Westdeutschland wolle die deutsche Einheit nicht erhalten, von Seiten des DFD propagandistisch verwendet wurde, scheint der ‚gesamtdeutsche Anspruch‘ des Verbands doch nicht nur Augenwischerei gewesen zu sein. Das Bemühen der Organisation, die Einheit zu erhalten und mit Frauen aus dem Westen zusammen zu arbeiten, währte länger als das der ‚Bürgerlichen‘ wie Theanolte Bähnisch und Gabriele Strecker. Unstrittig ist jedoch auch, daß die SED-Funktionärinnen im DFD die Führungsrolle für sich beanspruchten, wenn es um die Gestaltung einer Zusammenarbeit mit Frauen im Westen ging.586 Von KPD-Funktionärinnen in Westdeutschland läßt sich dies, wie das Beispiel Dürrbeck zeigt, hingegen nicht behaupten. Dürrbeck und andere Hannoveranerinnen, die der KPD angehörten, scheinen an einem ausgewogenen Verhältnis der politischen Haltungen innerhalb der (west-)deutschen Frauenbewegung interessiert gewesen zu sein. Theanolte Bähnisch sah die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit Kommunistinnen hingegen spätestens ab dem Januar 1947 als unmöglich an. Ihre Arbeit war nicht nur stärker auf eine Kooperation mit dem westlichen Ausland ausgerichtet als auf eine Zusammenarbeit mit Frauen aus Ostdeutschland. Sie nutzte die Kooperation mit den Westmächten und den Frauenverbänden aus dem westlichen Ausland auch dazu, ihre Abgrenzung zum Kommunismus und zum DFD zu unterstreichen. Dies äußerte sich unter anderem darin, daß in der ‚Stimme der Frau‘ häufig über Frauen und die Frauenbewegung in westeuropäischen Ländern und den USA berichtet, die Situation der Frauen in Ostdeutschland jedoch beschwiegen wird – bis auf wenige Ausnahmen, die ein negatives Bild des Lebens von Frauen in Ostdeutschland zeichnen.587 Über positive Aspekte des Lebens von Frauen und Familien in der SBZ/DDR
585 Ebd. 586 BArch, SAPMO, DY 30/IV 2/17/99, Vorschläge zur Entwicklung und Verbesserung der Arbeit unter den Frauen in Westdeutschland, o. V., 14.01.1950. 587 Vgl.: Freund: Krieg, S. 161/162 und S. 227/228, vgl. auch: O. V.: Interessant!, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 3, S. 2. Im Artikel geht es um den Einsatz von Frauen im Dienst an der Waffe bei der Volkspolizei in der SBZ. Ein Blick in die Broschüre vom Vorstand der SPD (Hrsg.): Von der NS-Frauenschaft zum kommunistischen DFD, Hannover o. J. [1952], zeigt, daß der Umstand, daß Frauen in der SBZ entsprechend ausge-
Staatspolitische Aufgabe
|
817
wird gar nicht Bericht erstattet. So fällt, um nur zwei Beispiele zu nennen, auf, daß im Zuge von Forderungen in der ‚Stimme der Frau‘ nach einer rechtlichen Gleichstellung unehelicher Kinder im Jahr 1952 völlig außer Acht gelassen wird, daß diese rechtliche Gleichstellung in der DDR zu jenem Zeitpunkt längst erfolgt war. Und als die ‚Stimme‘ über das sicherlich für viele Leserinnen interessante Thema ‚BabySitting‘ berichtete, wählte die Zeitschrift nicht etwa das auch räumlich naheliegende Beispiel Ostdeutschland, sondern richtete den Fokus auf die „KleinkinderWartung“588 in der Landeshauptstadt Bayerns, München, und den USA. Ein Urteil darüber zu fällen, inwiefern Bähnisch mit ihrem Kampf gegen den DFD gleichzeitig die Frauen in Ostdeutschland ‚abschrieb‘ – ein Vorwurf, der von Seiten Barbara Henicz und Margrit Hirschfelds erhoben wird589 – fällt schwer. Die Regierungspräsidentin nahm nie explizit zu diesem Thema Stellung. Texte aus der ‚Stimme der Frau‘ sowie die bereits zitierte Rede Bähnischs aus dem Jahr 1950 legen die Interpretation nah, daß sie die Frauen im ‚Ostblock‘ als ‚verloren‘ wahrnahm. In einem Artikel von Anna Haag in der ‚Stimme der Frau‘ hieß es über die Staaten im kommunistischen Machtbereich, daß sich „[e]inige Kinder Europas […] noch nicht in die mütterlichen Arme [Europas] schmiegen“ könnten, weil „[eine] gebieterische Hand […] sie in nicht unmißverständlicher Geste hinter einen Vorhang befohlen“ habe, „dem das Prädikat „eisern“ beigegeben wurde“590. Diese Erzählweise suggeriert, daß die Menschen keine Chance gehabt hätten, sich zur Wehr zu setzen. In ihrer Rede aus dem Jahr 1950 stellt die Regierungspräsidentin fest, daß sich Frauen „im Osten“ zum „Werkzeug einer Propaganda“ machen ließen, „die in ihrem Endeffekt zur völligen Zerstörung des eigentlichen Frauenwesens führen muß“591. Zwar verfügte der Frauenring nach seiner Gründung als bundesweiter Verband auch über eine Abteilung, die ‚in den Osten‘ arbeiten sollte,592 die Arbeit jener Abteilung ist jedoch noch nicht erforscht. Gleichzeitig überschätzte die Juristin im Zuge ihrer Sorge vor der ‚Vermassung‘ und dem von ihr angenommenen Ziel des DFD, die Frauen ihrer Persönlichkeit zu berauben und zu willfährigen Instrumenten der SED zu machen, die Attraktivität der Organisation und die Größe seiner Anhängerschaft. Die Annahme einer „zweigeteilten Welt: freiheitliches System im Westen und totalitäre Herrschaft im Osten“593 führte dazu, daß Bähnisch den DFD mit ‚den Frauen im Osten‘ weitgehend gleichsetzte und die Lösung für sie deshalb nur in einer vollständigen Abgrenzung liegen konnte. So konnten – in ihrer Logik – wenigstens die Frauen in Westdeutschland vor dem Schicksal bewahrt werden, das für die Frauen in Ostdeutschland schon Realität geworden zu sein schien. Daß sie die positiven frauenpolitischen Aspekte in der
588 589 590 591 592 593
bildet wurden, auch von Seiten der SPD propagandistisch gegen den DFD verwendet wurde. O. V.: Notiert aus aller Welt, o. V., in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 12, S. 2. Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 141. Haag: Krieg. Bähnisch: Himmel. Siehe Kapitel 8.4. Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 142.
818 | Theanolte Bähnisch
SBZ/DDR wie bessere Ausbildungschancen und eine hohe Aufstiegsmobilität auch für Arbeiterinnen vor allem in den ersten Jahren594 nicht thematisierte, ist zum einen vor dem Hintergrund ihres Bemühens, westdeutschen Frauen jegliches Interesse am Kommunismus zu verleiden, zum anderen aufgrund ihres weitgehenden Desinteresses an der Lage von Arbeiterinnen verständlich. Das Zitat über die Interzonen-Frauenkonferenz in Frankfurt im Mai 1948, das Henicz und Hirschfeld aus der ‚Stimme der Frau‘ bemühen, nämlich daß „es als ein deutliches Zeichen für die Einbezogenheit der Frauen in die geschichtliche Situation gelten dürfe, daß auch bei ihnen Gegensätze hervortraten“595, läßt sich tatsächlich als ein Beleg dafür werten, daß die Herausgeberin der Zeitschrift dem Thema ‚Einheit‘ als einem gestaltbaren Prozeß aus dem Weg ging. Daß es während des Frankfurter Kongresses zu gemeinsamen Resolutionen mit Frauen aus der SBZ über die Wiederherstellung der deutschen Einheit gekommen war, werten Henicz und Hirschfeld als einen „eklatanten Widerspruch“ der westdeutschen Verbände „in der Haltung zur deutschlandpolitischen Frage“596. Daß die Autorinnen als Antwort auf die Frage, inwiefern der Kompromißlosigkeit der Frauenring-Mitglieder andere Beispiele gegenüberstanden, ausgerechnet auf Elfriede Paul als ‚Integrationsfigur‘ im ‚Club deutscher Frauen‘ rekurrieren597, spricht allerdings Bände – gemessen an den späteren Verlautbarungen Pauls, die Henicz und Hirschfeld höchstwahrscheinlich nicht kannten. Auch von der Rolle der von ihnen interviewten Herta Dürrbeck als Informantin des DFD dürften sie nichts gewußt haben. Zu guter Letzt stellt sich in der Retrospektive auch das von Henicz und Hirschfeld genannte Beispiel des Hamburger Frauenrings, der auf dem Kongreß des DFD eine große Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Frauen in Ostdeutschland signalisiert hatte,598 als nicht belastbar heraus, da dieser als einziger der Frauenringe, wie die Recherchen in den Beständen des British Foreign Office belegen, zumindest zeitweilig kommunistisch dominiert war. „Gravierend für das Scheitern einer gemeinsamen Arbeit im hannoverschen Frauenclub“ sei, so Henicz und Hirschfeld, „schließlich die bestimmende Position Bähnischs“ gewesen, die „ganz auf den Schumacher Kurs ihrer Partei eingeschwenkt“ sei und „jede weitere Kooperation“599 abgelehnt habe. Zu diesem Urteil wären die Autorinnen vielleicht nicht gekommen, wenn die Unterlagen aus dem Nachlaß Elfriede Pauls aus der ‚Abteilung Frauen im ZK der SED‘ und aus dem Bestand ‚DFD‘ zur Zeit der Abfassung des Artikels bereits greifbar gewesen wären. Die auf Überwachung, Infiltration und teilweise auch auf Übernahme ausgerichtete Politik des DFD, an der auch die Ärztin und zeitweilige Ministerin Paul ihren Anteil hatte, konnte ohne die besagten
594 Vgl.: dazu den Sammelband: Budde, Gunilla-Friederike (Hrsg.): Frauen arbeiten. Weibliche Erwerbstätigkeit in Ost- und Westdeutschland nach 1945, Göttingen 1997, S. 121– 156. 595 O. V.: [‚A. M.‘, vermutlich Anna Mosolf] „Frauen tagten in Frankfurt“, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 2, S. 4. 596 Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 141. 597 Vgl.: ebd., S. 143. 598 Vgl.: ebd. 599 Ebd.
Staatspolitische Aufgabe
|
819
Unterlagen kaum erkannt werden. Henicz und Hirschfeld wollten offensichtlich mit ihrem Aufsatz einen Kontrapunkt zu den stark pro-westlich und antikommunistisch aufgeladenen Studien Hermann Webers600 und anderer DDR-Forscher über Deutschland im Kalten Krieg setzen. Dieses für jene Zeit sehr ungewöhnliche und deshalb löbliche Unterfangen wurde jedoch – so ist nach der Öffnung der Archive klar – den Realitäten nicht gerecht. Einer Zusammenarbeit der Frauen in der westdeutschen und in der ostdeutschen Frauenbewegung standen schließlich auch unterschiedliche Wünsche zur internationalen Einbindung der eigenen Arbeit entgegen. Während sich für Bähnisch seit 1946 abzeichnete, daß ein von ihr gegründeter Verband in den ICW aufgenommen werden würde – was ihr ermöglichte, in die Fußstapfen des BDF zu treten –, strebte der DFD die Aufnahme in die 1945 in Paris gegründete, kommunistisch orientierte IDFF an.601 Bereits 1948 wurde die Aufnahme vollzogen, zumal eine solche Entwicklung auf ein starkes Gegeninteresse der IDFF stieß. Wie die leitenden Mitglieder im DFD und im Frauenring jeweils auf eine internationale Anbindung des eigenen Verbandes hofften, so wurden die Allianzen der jeweils anderen Organisation argwöhnisch beobachtet. So fand der DFD im ‚British National Council for German Democracy‘ eine Organisation, die den britischen Ableger des im Frauenring so geschätzten ICW als eine „sehr reaktionäre Organisation“ beschrieb. Der ‚British National Council for German Democracy‘ teilte dem DFD mit, daß der vom ‚British National Council des ICW‘ eingefädelte Besuch Bähnischs und Zahn-Harnacks auf die „fortschrittlichen Frauen“ in Großbritannien „keinen Eindruck“ gemacht habe. Er stellte auch den zweiten großen internationalen Verbündeten des Frauenrings, die WGPW, in ein schlechtes Licht, mit der Begründung, daß diese Organisation „rechtsstehende“ Frauen nach Großbritannien eingeladen habe. Lobend erwähnt wurde dagegen der Besuch der Hamburgerin Magda Hoppstock-Huth von der IFFF im Vereinigten Königreich.602 Es steht noch aus, zu prüfen, ob und wenn ja wie – die Regierungspräsidentin Bähnisch von Seiten der organisierten internationalen kommunistischen Frau-
600 Vgl. dazu beispielsweise den dennoch lesenswerten Klassiker: Weber, Hermann: Die DDR 1945–1990, München 2006. 601 Zur Wahrnehmung beider Organisationen im Kontext des Kalten Krieges vgl.: Haan, Francisca de: Continuing Cold War Paradigms in Western Historiography of Transnational Women’s Organisations: the case of the Women’s International Democratic Federation (WIDF), in: Women’s History Review, 19. Jg. (2010), S. 547–573. 602 BArch, SAPMO, DY 30/IV 2/17/109, Abschrift eines Briefs des British Council for German Democracy, o. D. Der DFD antwortete, daß er die Reise Zahn-Harnacks und Bähnischs ebenfalls als eine „Unterstützung wenig fortschrittlicher Kreise“ betrachte. BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/109, Anne Marie Durand-Wever/Edith Hauser, im Namen des Vorbereitenden Komitees zur Schaffung des Demokratischen Frauenbundes Deutschland an den British Council for German Democracy, 19.02.1947. HoppstockHuth, die auch Funktionen in der ‚Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)‘ innehatte, in die die IFFF integriert war, gehörte der SPD an und hatte den Frauenring Hamburg mitbegründet. Sie geriet 1950 in die Kritik, weil man ihr nachsagte, kommunistisch orientiert zu sein. Die Militärregierung wußte von ihrer Bereitschaft zur Kooperation mit dem DFD. NA, UK, FO 1050/1213, Women‘s Organisations, Secret, o.
820 | Theanolte Bähnisch
enbewegung, also der IDFF, wahrgenommen worden war. Ein solches Unterfangen würde Forschungen über die Frauenbewegung auf internationaler Ebene, insbesondere, was die Rolle des Kalten Krieges in diesem Zusammenhang betrifft, bereichern.603
7.7 FRAUEN-TAGUNGEN IN BERLIN UND FRANKFURT ZWISCHEN ‚MÜNCHEN‘ UND ‚LONDON‘: ‚FRIEDEN‘ VERSUS ‚FREIHEIT‘ UND DER BRUCH ZWISCHEN ‚OST‘ UND ‚WEST‘ 7.7.1 Die DFD-Tagung im Rahmen des ersten ‚Volkskongreß für den Frieden‘ (Dezember 1947) Nachdem sowohl in der amerikanischen als auch in der britischen Besatzungszone interzonale Frauenkongresse stattgefunden hatten, sah der DFD die Zeit gekommen, Frauenorganisationen aus Westdeutschland für den Dezember 1947 zu einer ‚Konferenz der deutschen Frauen aller Zonen‘ in Berlin einzuladen. Diese Konferenz fand im Rahmen des ersten ‚Volkskongreß für Deutschlands Einheit und den gerechten Frieden‘ statt, welche vom Vorsitzenden der SED, Wilhelm Pieck, persönlich eröffnet wurde. Der Volkskongreß, der anläßlich der Londoner Außenministerkonferenz im Dezember 1947 zum ersten Mal zusammengetrat, hatte sich als deutschlandpolitisches Forum mit dem Ziel einer gesamtdeutschen Regierung etabliert. Corinne Bouillot und Elke Schüller, die sich mit der Veranstaltung des DFD im Rahmen des Kongresses auseinandersetzen, weisen darauf hin, daß der von der SED organisierte Kongreß zum Ziel gehabt habe, die Vorschläge des sowjetischen Außenministers Molotow für die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung zu unterstützen.604.Am Volkskongreß nahmen vor allem Vertreter der SED, der Massenorganisationen und der Blockparteien in der SBZ teil, auch Delegierte aus den westlichen Besatzungszonen waren in die Haupstadt gereist. Von den 2215 Mandaten zum Volkskongreß entfielen 849 auf Vertreter der SED und der KPD, 440 auf Massenorganisationen der SBZ.605 Die Veranstaltung war also deutlich von der SED dominiert, weshalb einige Organisationen aus dem Westen jenen Mitgliedern, die sie ursprünglich hatten delegieren wollen, die Anreise untersagt hatten. Die CDU in der SBZ hatte die Teilnahme ebenfalls verweigert, was zur Absetzung ihres Vorsitzenden Jakob Kaiser durch die SMAD führte. Zur DFD-Frauenkonferenz erschienen verhältnismäßig wenige Frauen aus dem Westen. Die bereits mehrfach zitierte Herausgeberin der ‚Welt der Frau‘, Lisbet
V., o. D., als Anhang zu einem Schreiben vom 06.05.1948 von G. Brooking, HQ Intelligence Division an die Militärregierungen der Länder. 603 Vgl. für einen ersten Überblick: Haan, Francisca de: Hoffnungen auf eine bessere Welt. Die frühen Jahre der Internationalen Demokratischen Frauenföderation (IDFF/WIDF) 1945–1950, in: feministische studien, 27. Jg. (2009), S. 241–258. 604 Vgl.: Bouillot/Schüller: Frauenorganisation, S. 52. 605 Vgl.: Koch, Martin: Volkskongreßbewegung und Volksrat, in: Broszat/Weber: SBZHandbuch, S. 349–354, hier S. 350.
Staatspolitische Aufgabe
|
821
Pfeiffer, reiste jedoch mit einer Delegation von 50 Frauen zur DFD-Konferenzund beklagte nach ihrer Rückkehr in der „vornehm-ruhige[n], seriöse[n]“606 Zeitschrift, die – ähnlich wie die ‚Stimme der Frau‘607 – immerhin eine Auflage von 50.000 erreichte, die Nicht-Teilnahme vieler Mitglieder der überparteilichen und überkonfessionellen Organisationen aus der britischen und amerikanischen Zone: „Warum waren die Frauen nicht gekommen? Wer nicht anwesend ist, kann sich nicht verteidigen. Die Gefahr des Nichtzuwortkommens war in Berlin nicht so groß, wie vielleicht befürchtet wurde. Wie nicht anders zu erwarten, fiel die Bemerkung – und damit leider der berechtigte Hinweis auf Boll – daß es hier keine Redebeschränkung gebe.“608 Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld schreiben, daß Mitgliedern des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ von seiner Vorsitzenden ebenfalls untersagt worden sei, auf der Berliner Tagung im Namen des Rings, der offiziell nicht an der Veranstaltung teilnahm, zu sprechen. In eigener Sache sei die Teilnahme jedoch erlaubt gewesen.609 Herta Dürrbeck, alias ‚Herta D.‘, die „mit einigen Frauen hingefahren“ sei, „weil wir hören wollten, was war“610, sei aufgrund ihrer Teilnahme an der Veranstaltung ‚auf eigene Faust‘ jedoch aus dem ‚Club deutscher Frauen‘ – und damit auch aus der Dachorganisation Frauenring – ausgeschlossen worden.611 Henicz und Hirschfeld stellen dieses Vorgehen als einen willkommenen Anlaß zu einem schon länger angestrebten Ausschluß von ‚D.‘ aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der KPD dar.612 „Denn mit der Konfrontation zwischen den überparteilichen Frauengruppen der Westzonen und dem DFD verband sich eine entsprechende Haltung gegenüber den in der KPD organisierten Frauen in den eigenen Reihen.“613 Daß Bähnisch – denn diese hatte den Ausschluß als Vorsitzende wohl maßgeblich zu verantworten – Dürrbecks ClubMitgliedschaft nicht neben der Informationsarbeit Dürrbecks für den DFD und damit für die SED dulden wollte, hatte allerdings gewichtige Gründe, die die Autorinnen
606 Kowohl, Edith: Die Frauenzeitschriften, in: Hagemann, W. (Hrsg.): Die deutsche Zeitschrift, Münster 1950, S. 197, zitiert nach Weise, Dora: Das Frauenleitbild in ausgewählten deutschen Frauenzeitschriften der Nachkriegszeit (1945–1955), Diplomarbeit, München 2009, S. 41, auf: http://books.google.de/books?id=PCbMsNkFFaoC&pg=PA40&lpg =PA40&dq=Lisbeth+Pfeiffer+welt+der+frau&source=bl&ots=_uFHUSdgeB&sig=NzD AkxsZpuV_oqx4BBo_24c93No&hl=de&sa=X&ei=OdgbUYaGPOrw4QTC7YA4&redir _esc=y#v=onepage&q=Lisbeth%20Pfeiffer%20welt%20der%20frau&f=false, am 13.12. 2013. 607 Sylvia Lott schreibt in ihrer Studie über Frauenzeitschriften der 1930er bis 1970er Jahre, die ‚Stimme der Frau‘ habe im Mai 1948 eine Auflage von 50.000 gehabt, 1949 sei die Auflage auf 74.000 gestiegen, 1950 auf 105.000. Vgl.: Lott: Frauenzeitschriften, S. 355 und S. 400. 608 Pfeiffer, Lisbet: In Berlin fiel uns auf, in: Die Welt der Frau, 3. Jg. (1948/49), Heft 5, S. 19f. 609 Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 143. 610 Ebd. 611 Vgl.: ebd. 612 Vgl.: ebd. 613 Ebd.
822 | Theanolte Bähnisch
nicht benennen, zumal ihnen entsprechende Informationen zur Zeit der Abfassung ihres Artikels nicht vorlagen. Denn Dürrbeck arbeitete der Abteilung ‚Frauen‘ des ZK der SED zu.614 Die Regierungspräsidentin befürchtete – nicht ganz zu Unrecht – daß sich die Arbeit des DFD, je mehr sich der Konflikt zwischen ‚Ost‘ und ‚West‘ verstärkte, desto stärker gegen die Arbeit ‚bürgerlicher‘ überparteilicher Organisationen in Westdeutschland richten würde. Die Mitgliedschaft Dürrbecks im ‚Club deutscher Frauen‘ dürfte Bähnisch als ein Einfallstor für die Unterwanderung und/oder Sabotage ihrer Arbeit und damit ihrer politischen Überzeugungen durch Kommunistinnen wahrgenommen haben. Daß Dürrbeck, verglichen mit anderen KPD-Funktionärinnen in Westdeutschland, zumindest 1947 noch eine vergleichsweise moderate Politik gegenüber der ‚bürgerlichen‘ Frauenbewegung vertrat, dürfte für die Club-Vorsitzende dagegen kaum ersichtlich gewesen sein. ‚Überparteilich‘ im eigentlichen Sinn waren der ‚Club deutscher Frauen‘ und der Frauenring zu jener Zeit bereits nicht mehr. Längst war klar, daß die Ansichten vieler KPD-Mitglieder in Bezug auf die Frauenbewegung teilweise konträr zu denen der Frauenring-Mitgliedern aus dem ‚bürgerlichen‘ Milieu standen. Für alle anderen mitgliederstarken Parteien läßt sich dies nicht sagen. Daß allein für Kommunistinnen im ‚überparteilichen‘ Frauenring kein Platz war, war zu jener Zeit ebenso augenfällig wie die Ausrichtung des DFD auf die Linie der SED – wobei auch dieser den Anspruch der Überparteilichkeit offiziell aufrechterhielt. Zwar konnten und sollten Frauen auch aus anderen Parteien als der SED Mitglied im DFD sein, ein Aufstieg in Führungsrollen war ihnen jedoch verwehrt.615 Der Frauenring dagegen gewährte Frauen verschiedener Parteien Zugang zu Führungspositionen, setzte dabei allerdings – mehr oder weniger ausgesprochen – ein Bekenntnis zur ‚westlichen Wertegemeinschaft‘ voraus. Nachdem die ‚Münchner Ministerpräsidentenkonferenz‘616, die mit Unterstützung Großbritanniens und der USA vom 06. bis zum 08.06.1947 stattfand, weitgehend gescheitert war, hatte sich das politische Klima in Deutschland deutlich verschärft. Die Entwicklungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Weil die französische Militärregierung die Auseinandersetzung über ‚politische Themen‘ auf der Ministerpräsidenten-Konferenz untersagt hatte, die Ministerpräsidenten aus der SBZ jedoch von der SMAD angehalten worden waren, „in den Mittelpunkt der Tagesordnung die Schaffung der wirtschaftlichen und politischen Einheit Deutschlands zu stellen“617, war das Scheitern der Gespräche vorprogrammiert gewesen. Die Ministerpräsidenten aus der SBZ waren schließlich wieder abgereist, noch bevor die Konferenz begonnen hatte.618 Vom Bayerischen Ministerpräsidenten Ehard ist überliefert, daß er diese
614 615 616 617
Siehe Kapitel 7.7.1. Siehe Kapitel 7.1.3. Zu den Vorgängen vgl.: Steininger: Geschichte, Bd. 1, S. 313–321. Ministerpräsidenten der sowjetischen Zone an den bayerischen Ministerpräsidenten Ehard, 28.5.1947, in: Bundesarchiv/Institut für Zeitgeschichte (Hrsg.): Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 2, München 1979, S. 455. 618 Die Ministerpräsidenten aus der SBZ hatten auch den Kreis der Teilnehmer erweitern und „in Anbetracht des gesamtdeutschen Interesses“ die Konferenz nach Berlin verlegen wollen. Ebd., S. 455/456.
Staatspolitische Aufgabe
|
823
Vorgänge als die „Spaltung Deutschlands“619 interpretiert habe. Tatsächlich war dieses Treffen das letzte Treffen „amtlicher deutscher Vertreter der drei westlichen Besatzungszonen und der sowjetischen Besatzungszone zu offiziellen Verhandlungen“620. Als offizielle Wiederaufnahme solcher Beziehungen wird das Treffen Willy Brandts und Willy Stophs in Erfurt 1970 gewertet. Gleichzeitig wohnte der Ministerpräsidentenkonferenz, die unter alleiniger Beteiligung der Ministerpräsidenten der Bizone und der französischen Besatzungszone fortgeführt wurde, ein bis dato – seit Kriegsende – ungekanntes Maß an deutschem Souveränitätsstreben inne. Denn die Ministerpräsidenten formierten sich in diesem Rahmen als Verhandlungspartner der westlichen Militärgouverneure – was rückblickend als ein Schritt zur (Wieder-)Erlangung nationaler Souveränität im westdeutschen Teilstaat interpretiert werden kann. Auch zwischen den Militärregierungen hatte sich die die Lage zwischenzeitlich zugespitzt. Die Außenminister der vier Besatzungsstaaten waren ab dem 25.11.1947 zum sechsten Mal, diesmal in London, zusammengekommen, um über die ‚Deutsche Frage‘ zu sprechen. Doch sowohl Frankreich als auch die Sowjetunion legten ein Veto ein, als Großbritannien und die USA ihre Ideen zur stufenweisen Schaffung einer deutschen ‚Zentralinstanz‘ mit einer parlamentarischen Vertretung vorstellten und die Umsetzung der Pläne forderten. Nachdem weder über dieses Thema noch über andere bereits mehrfach thematisierte Fragen wie vor allem die Höhe der Reparationsforderungen sowie den Verlauf der deutschen Ostgrenze eine Einigung erzielt werden konnte, war die Konferenz am 15.12.1947 vorzeitig abgebrochen worden. Das Viermächte-Treffen in London sollte das letzte seiner Art sein. Die nächste deutschlandpolitische Konferenz fand als ‚Sechsmächtekonferenz‘ unter Beteiligung der drei Westmächte plus der Benelux-Länder im Februar/März 1948 sowie von April bis Juni 1948 statt. In Reaktion auf diese Entwicklungen kam die Sowjetunion mit Albanien, Bulgarien, Jugoslawien, Polen, Rumänien, der Tschechoslowakei und Ungarn im späten Juni 1948 zu einer ‚Achtmächtekonferenz‘ in Warschau zusammen. Daß von der DFD-Frauenkonferenz in Berlin ein Appell deutscher Frauen an die Londoner Außenministerkonferenz ausgehen sollte, welcher sich gegen die Teilung Deutschlands richtete, läßt sich als ein Beweis dafür interpretieren, daß der DFD als Ausrichter der Konferenz den erklärten Willen gehabt hatte, einen Beitrag zur Entschärfung der deutlich angespannten Lage zwischen den Militärregierungen zu liefern. Im Verständnis des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ war der Appell, der auf der DFD-Konferenz verfaßt wurde und von den westdeutschen Frauen mit verabschiedet werden sollte, allerdings sehr einseitig und daher ungeeignet, zur Entspannung beizutragen. Er habe „rein demonstrative Forderungen im Sinne der russischen
619 Vorbesprechung der Ministerpräsidenten über die Tagesordnung der Münchner Ministerpräsidentenkonferenz, 05./06.06.1947, in: ebd., S. 485 ff. 620 Eschenburg, Theodor: Deutsche Einheit verfehlt? Schon damals unüberbrückbare Gegensätze, Rezension zu: Wilhard Grünewald: Die Münchner Ministerpräsidentenkonferenz 1947. Anlaß und Scheitern eines gesamtdeutschen Unternehmens, Meisenheim 1972, in: Die Zeit, Nr. 51, 22.12.1972, auf: http://www.zeit.de/1972/51/deutsche-einheitverfehlt, am 13.12.2013.
824 | Theanolte Bähnisch
Außenpolitik“621 enthalten, berichtete Gabriele Strecker in ihren Erinnerungen. Deshalb hätten die Frauenverbände der Westzonen „unter maßgeblicher Beteiligung von Theanolte Bähnisch“622 ihre Beteiligung am Vorhaben des DFD verweigert. Denise Tscharntke bewertet den darauf folgenden Alleingang des ‚Frauenring‘ als dessen erste öffentlichkeitswirksame Aktion gegen den DFD.623 Die Frauenverbände der Westzonen hatten sich nämlich nicht nur verweigert, gemeinsam mit dem DFD eine an die Außenminister gerichtete Resolution zu verfassen, sondern sie hatten unter Federführung des Frauenrings einen eigenen Appell an die britischen Frauenorganisationen gerichtet, „ihre Stimme bei der Londoner Konferenz im Sinne eines wahren Friedens und eines Friedensschlusses zu erheben, der dem deutschen Volk Einheit und Lebensmöglichkeit sichern sollte“624. Dem DFD habe man von Seiten des ‚Frauenrings‘ den gleichen Schritt empfohlen, erinnerte sich Theanolte Bähnisch 1964. Sie hielt fest, daß „die deutschen Frauen des Westens“625 – eine Formulierung, mit der sie den Frauenring und die Frauen in Westdeutschland eins werden ließ – mit diesem Vorgehen erstmalig die Initiative ergriffen hätten, zur „Lösung einer wichtigen politischen Frage einen konstruktiven Beitrag zu leisten.“626 Doch der DFD fühlte sich durch dieses Vorpreschen des ‚Frauenrings‘ und der mit ihm sympathisierenden Organisationen empfindlich getroffen. Dies teilte er jedoch nicht dem ‚Frauenring‘ direkt mit, sondern er ließ seine ablehnende Antwort auf das Schreiben, das ihn von Seiten des ‚Frauenrings‘ erreicht hatte, direkt in der „Ostpresse“627 veröffentlichen. Strecker bewertet die geschilderten Vorgänge in ihren Erinnerungen als den Todesstoß für die Zusammenarbeit deutscher Frauen in Ost- und Westdeutschland für die nächsten Jahrzehnte: „Mit diesem Schritt der Frauenverbände des Westens änderte sich auch die Haltung des Deutschen Demokratischen Frauenbundes zum Unhöflichen hin. Es wurde klar, daß eine Verständigung zweier Frauengruppen so entgegengesetzter Systeme auf die Dauer nicht möglich sein werde. Seitdem wurden die Verbindungen zum Deutschen Demokratischen Frauenbund abgebrochen. [...] Umgekehrt vertiefte diese Einsicht in die Unmöglichkeit einer Zusammenarbeit mit der östlichen Einheits-Frauenorganisation den Wunsch nach Abklärung der organisatorischen Verhältnisse im Westen.“628 Für Strecker bedeuteten die Entwicklungen im Dezember 1947 also nicht nur das Scheitern der Zusammenarbeit zwischen ost- und westdeutschen Frauenverbänden, sondern sie begründeten auch die Notwendigkeit zur Schaffung einer großen Frauenorganisation in Westdeutschland, die ohne die ostdeutschen Frauen auskommen würde. Anders lassen sich ihre Überlegungen zur „Abklärung der organisatorischen Verhältnisse im Westen“ kaum interpretieren. Jedoch fand sie erst in ihren Erinnerungen zu dieser Formu-
621 622 623 624 625 626 627 628
Strecker: Frauenarbeit, S. 13. Ebd. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 168. Strecker: Frauenarbeit, S. 13. Bähnisch: Wiederaufbau, S. 168. Ebd. Ebd. Strecker: Frauenarbeit, S. 13.
Staatspolitische Aufgabe
|
825
lierung, als die ‚Zwei-Staaten-Lösung‘ bereits Realität war. Nachdem in der Retrospektive das Scheitern der Londoner Außenministerkonferenz und der Münchner Ministerpräsidentenkonferenz einhellig als ‚Indizien‘ zur bevorstehenden Gründung eines westdeutschen Teilstaates bewertet wurden, scheint es Strecker naheliegend erschienen zu sein, die Differenzen zwischen dem DFD und dem Frauenring in diese Entwicklungen logisch einzureihen. Wie sie die Lage Ende 1947 tatsächlich einschätzte, steht auf einem anderen Blatt. Auch Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld bewerten die Londoner Außenministerkonferenz als einen wichtigen Einschnitt in die Beziehungen der ost- und westdeutschen Frauenverbände. Bemühungen, den Kontakt zueinander aufrecht zu erhalten, seien spätestens nach der Londoner Konferenz von den Verbänden in den Westzonen aufgegeben worden, so die Autorinnen. Die Aufrufe zu gemeinsamer Arbeit hätten immer mehr an Bedeutung verloren und seien schließlich zu Lippenbekenntnissen geworden, denen jeder reale Hintergrund gefehlt habe.629 7.7.2 Die interzonale Tagung der Frauenverbände in Frankfurt (Mai 1948) 7.7.2.1 Umstände und Teilnehmer An der nächsten großen interzonalen Frauen-Tagung im Westen, die in Frankfurt vom 22. bis 24.05.1948 stattfand, nahmen Vertreterinnen von Frauenverbänden aus der SBZ erst gar nicht teil. Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld führen dies, auf einen Artikel Lisbet Pfeiffers Bezug nehmend, darauf zurück, daß Frauen aus Ostdeutschland auf der Tagung als Rednerinnen nicht zugelassen worden waren630. Pfeiffer empörte sich in der ‚Welt der Frau‘ über die Frankfurterinnen, die die Veranstaltung ausgerichtet und den Anspruch auf demokratische Repräsentation gefordert, aber die Frauen aus der SBZ nicht als Rednerinnen zugelassen hatten. Sie hielt fest, daß es „bisher auf keinem Frauenkongreß im Osten oder in Berlin“ vorgekommen sei, „daß Frauen aus dem Westen nicht zu Wort gekommen wären“631. Dies scheint jedoch nicht der einzige Grund für das Fernbleiben der Frauen aus der SBZ gewesen zu sein. Marianne Zepp hat herausgearbeitet, daß das ZK der SED seine ursprünglich
629 Vgl.: Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 141. Die Autorinnen beziehen sich damit auf gemeinsam verfaßte Resolutionen zur Erhaltung der deutschen Einheit, die noch 1948 gemeinsam von Frauenverbänden in Ost- und Westdeutschland verabschiedet worden waren. 630 Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 140. 631 Pfeiffer, Lisbet: Frauen zur Demokratie, in: Die Welt der Frau, 3. Jg. (1948/49), Heft 8, S. 5.
826 | Theanolte Bähnisch
gegebene Zustimmung zur der Reise einer Delegation des DFD632 nach Frankfurt wieder zurückgezogen hatte.633 Denn die politische Lage hatte sich zwischen der Londoner Außenministerkonferenz im November/Dezember 1947 und dem Mai 1948, wie oben ausgeführt, weiter zugespitzt. Im Alliierten Kontrollrat war es im März 1948 zum Bruch gekommen, an gemeinsame Konferenzen der vier Siegermächte war nicht mehr zu denken. Ein Klima des Mißtrauens hatte sich breitgemacht, die politische Propaganda tat ihr übriges. Während sich in der Hauptstadt, die mit ihren drei Westsektoren wie eine Insel in der sowjetischen Besatzungszone lag, das ankündigte, was als ‚Berlin-Blockade‘ in die Geschichte eingehen sollte, waren in der Frankfurter Paulskirche Politik- und Verwaltungseliten zusammengekommen, um die liberale Revolution zu feiern, Einheit und Freiheit zu beschwören634 und den unbeschränkten Verkehr wirtschaftlicher Güter zu fordern.635 Der mit der Paulskirchenveranstaltung gesetzte Kontrapunkt zu den Verhälltnissen in der SBZ hätte zu einer Zeit, zu der die SMAD in Berlin Straßen blockierte und Transporte durch den sowjetischen Sektor kontrollierte, stärker kaum sein können. Die von Fini Pfannes gemeinsam mit dem ‚Frankfurter Frauenverband‘ organisierte Konferenz mit dem Titel ‚Bekenntnis der deutschen Frauen zur Demokratie‘ fügte sich mustergültig in die ideologische Ausrichtung der Feierlichkeiten zur Paulskirchenrevolution ein. Sie fand im Anschluß an die allgemeine Veranstaltung statt und wurde von Helli Knoll eröffnet. Knoll knüpfte in ihrem Vortrag an die liberalen Bewegungen des 19. Jahrhunderts an und definierte Freiheit, Gleichheit und die repräsentative Demokratie als das Erbe, das es zu pflegen gelte. Im Aufbau eines demokratischen Deutschland wollte sie „Sehnsucht und Streben der Kämpfer von 1848“636 verwirklicht sehen.637
632 Eingeladen waren Marianne Zepp zufolge Anne-Marie Durand-Wever, die designierte neue DFD-Vorsitzende Emmy Damerius, Greta Kuckhoff, die in der Roten Kapelle aktiv gewesen war sowie die spätere Justizministerin der DDR, Hilde Benjamin, die ab 1948 dem Bundesvorstand des DFD angehörte und dessen Juristinnen-Kommission leitete. Vgl.: Zepp: Redefining, S. 226. 633 Vgl.: ebd. 634 Vgl. zur Rolle der Paulskirchenversammlung in der deutschen Erinnerung allgemein und zu den Feierlichkeiten von 1948 im Speziellen: Klemm, Claudia: Erinnert-Umstrittengefeiert. Die Revolution von 1848/49 in der deutschen Gedenkkultur, Göttingen 2007. Den Frauenkongreß, der im Anschluß an die Veranstaltung stattfand, thematisiert Klemm nur in einem knappen Absatz und kommt dabei zu dem – nicht ganz richtigen Schluß – daß die Tagung „weniger auf eine Auseinandersetzung mit der 1848er Tradition abgezielt“ habe. Ebd., S. 486. Klemm bezieht sich in ihrer Argumentation auf einen Artikel in der Frankfurter Rundschau. 635 Vgl.: Zepp: Redefining, S. 227. 636 Knoll, Helli: Unser Weg zur Freiheit, Festvortrag in der Frankfurter Paulskirche zum interzonalen Frauenkongreß am 22. Mai 1948, zitiert nach Ebd., S. 227. 637 Bähnisch zufolge war es Knolls Aufgabe gewesen, auf der Tagung über die Entwicklung der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenbewegung zu sprechen. Ob die Re-
Staatspolitische Aufgabe
|
827
Insgesamt waren 650 Abgeordnete aus überparteilichen, konfessionellen und berufsständischen Frauenorganisationen aus den drei Westzonen und den Westsektoren Berlins zur Frauenkonferenz angereist, daneben Gäste aus dem Ausland, die in ihre Heimatländer vermitteln sollten, „daß in Deutschland noch gute Kräfte am Werk sind, um das der Welt zugefügte Unheil wieder gutzumachen und sich in die Reihe der friedliebenden und gutgesinnten Völker einzuordnen.“638 Jenes Credo trug deutlich die Handschrift von Pfannes, die mit den Verbrechen, die Deutschland verübt hatte, offensiver ins Gericht ging, als Bähnisch es tat. Gleichzeitig bewies Pfannes mit ihrer Idee, das ‚Unheil‘ könne – gerade einmal drei Jahre nach dem Ende des Krieges und des Holocaust – wieder gut gemacht werden, eine gewisse Naivität. Neben Pfannes und anderen bereits erwähnten Frauen hielt auch Marie Elisabeth Lüders einen Vortrag auf der Konferenz.639 Während Pfannes über Demokratie, Parteien und das Parlament sprach, zeigte Lüders den Stellenwert von Politik für den Alltag auf.640 Eine besondere, internationale Bedeutung verlieh der Konferenz die Anwesenheit von Jeanne Eder-Schwyzer, der Präsidentin des ICW, sowie die der amerikanischen Kongreßabgeordneten Chase Going Woodhouse, die zugleich die ‚League of Women Voters‘ auf der Konferenz vertrat.641 Woodhouse war für OMGUS zu jener Zeit drei Monate lang auf einer ähnlichen Mission unterwegs wie schon 1946 Helena Deneke und Betty Norris für die CCG (BE).642 Darin deutete sich einerseits an, daß die USA, was die Frauenarbeit in Deutschland anging, aus dem ‚Dornröschenschlaf‘ erwacht waren, zum anderen bedeutete die Anwesenheit solch hochrangiger Frauen aus den Vereinigten Staaten auch eine besondere Anerkennung der Arbeit der westdeutschen Frauenverbände durch amerikanische Zivilistinnen. Daß es, wie Marianne Zepp schreibt, vor der Konferenz von Frankfurt „keiner anderen Organisation oder Einzelpersonen aus Deutschland gelungen“ war, im Ausland so wie die Frauen in Frankfurt wahrgenommen zu werden643, ist allerdings als eine Fehleinschätzung der Historikerin zu bewerten. Sie beruht vermutlich auf der Konzentration Zepps auf die Geschichte der Frauenbewegung in der US-Zone. Denn vor allem Bähnisch, aber auch andere Frauen, die mit der Regierungspräsidentin in Kontakt standen, hatten eine ähnliche Anerkennung im Ausland erfahren. Schließlich war der Regierungspräsi-
638
639 640 641 642 643
gierungspräsidentin Knolls Darstellung zustimmte und ob sie ihre Arbeit von Knoll angemessen gewürdigt sah, ist nicht überliefert. Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 169. Fini Pfannes, zitiert nach Schüller, Elke/Wolff, Kerstin: „Wenn es um Frauenfragen geht, dann stehen wir Frauen geschlossen da!“ Politische Frauennetzwerke nach 1945 in Hessen, in: Berding, Helmut (Hrsg.): Hessen. 60 Jahre Demokratie. Beiträge zum Landesjubiläum, Wiesbaden 2006, S. 243–268, hier S. 274. Bähnisch zufolge hatte Lüders über den ‚Begriff der Demokratie‘ referiert. Mosolf habe über ‚Frau und Alltag‘ gesprochen. Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 169. Vgl.: Zepp: Redefining, S. 230/231. Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 158.> Vgl.: Zepp: Redefining, S. 228. Ebd., S. 229. Denise Tscharntke und Christl Ziegler hatten die internationalen Kontakte der Frauen in der britischen Besatzungszone 1946/47 bereits in ihren 2003 und 1997 erschienenen Studien beschrieben.
828 | Theanolte Bähnisch
dentin bereits die Wiederaufnahme Deutschlands in die internationale Frauenbewegung unter ihrer Federführung in Aussicht gestellt worden. Bähnischs Prominenz in der internationalen Frauenbewegung wurde auch zwischen der Konferenz von Frankfurt im Mai 1948 und der zweiten Konferenz von Pyrmont im Oktober 1949 noch einmal deutlich: Nicht etwa Pfannes oder eine andere Protagonistin der westdeutschen Frauenbewegung, sondern Theanolte Bähnisch wurde von besagter Jeanne Eder-Schwyzer zur Sitzung des Internationalen Vorstandes des ICW in Lugano eingeladen.644 Obwohl sie nur als Gast teilnahm, durfte sie im Tessin über die Situation der Flüchtlinge in Deutschland sprechen und sogar eine Resolution ‚zur Frage der Heimkehr unserer kriegsgefangenen Männer und Frauen‘ an die UN einbringen.645 Die internationale Anerkennung Gabriele Streckers, zu der Bähnisch den Kontakt in Frankfurt intensivieren konnte, war zu diesen Zeitpunkt bereits annähernd so stark wie die Bähnischs. Die Hessin hatte bereits im Oktober 1946 an einer Frauenkonferenz in South Korthright in den USA teilnehmen dürfen.646 1947 war sie zur „einer Art Nachlese des South Korthrighter Kongresses“647 nach Paris gereist. 7.7.2.2 Staatsbürgerinnen statt Parteipolitikerinnen – Bähnischs Kampfbegriff für ein neues Deutschland prägt die Konferenz Auf der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung wird der Frankfurter Kongreß von den Biographinnen Pfannes‘, Kerstin Wolff und Elke Schüller, zu Recht als einer der „wichtigsten Bausteine im Konstituierungs-Prozeß der Frauenbewegung nach 1945“648 bezeichnet. Keine geringe Rolle dafür spielte allerdings, daß Theanolte Bähnisch in Frankfurt als ‚Vertreterin der britischen Besatzungszone‘ anwesend war, während Else Reventlow die US-Zone und Freda Wuesthoff die französische Zone vertraten. Die Regierungspräsidentin hielt eines der Hauptreferate, wobei sie den Schwerpunkt auf „Staatsbürgerlichkeit“ als „ein Erziehungsprogramm, das allen Frauen den Zugang zu Wissen und damit zur politischen Teilnahme ermöglichen sollte“649, legte. Sie markierte damit erneut die ‚staatsbürgerliche Bildung‘ von Frauen in Deutschland als ihr Terrain – auch in der amerikanischen Besatzungszone. Indem sie den Begriff ‚Staatsbürger‘ auf Frauen anwendete, wurde er seiner Rolle als Kampfbegriff (Bödeker/Koselleck) besonders gerecht.650 Wenn man so will, war die offensive Verwendung des Begriffs ‚staatsbürgerliche Frauenbildung‘ also Bähnischs persönlicher Beitrag dazu, eine Brücke zwischen der historischen Paulskirchenver-
644 645 646 647 648
Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 169/170. Ebd., S. 170. Vgl.: Zepp: Redefining, S. 229. Vgl.: Strecker: Überleben, S. 60. Schüller, Elke: Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Die Frauenbewegung in der BRD, in: Dossier Frauenbewegung, 08.09.2008, Bundeszentrale für politische Bildung, auf: http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35275/neuanfang-im-westen ?type=galerie&show=image&i=61122, am 23.07.2014. 649 Zepp: Redefining, S. 227. Zepp bezieht sich dabei auf den Artikel: Frauenkongreß in Frankfurt, in: Frankfurter Rundschau, 27.05.1948. 650 Siehe dazu auch Kapitel IX, Seite 1003/1004.
Staatspolitische Aufgabe
| 829
sammlung, dem frauenpolitischen Aufbruch nach 1945 und ihrer Führungsrolle in diesem Zusammenhang zu schlagen. Auf der Frankfurter Konferenz sei – wie schon zuvor in Pyrmont – von den anwesenden Frauen die Einrichtung einer Schule zur staatsbürgerlichen Erziehung sowie staatsbürgerlicher Unterricht an den allgemeinen Schulen gefordert worden, schreibt Marianne Zepp. Sie berücksichtigt jedoch, anders als Christl Ziegler, den zentralen Part der Regierungspräsidentin an dieser Forderung nicht. Folgt man Ziegler, so war jene Forderung – und damit ein wichtiger Teil dessen, was von der Konferenz im Gedächtnis blieb und die Forschung über die Tagung prägt – in Folge von Bähnischs entsprechendem Engagement erhoben worden.651 Folgt man der ‚Stimme der Frau‘, so war es sogar die Regierungspräsidentin persönlich, die auf der Tagung die Einrichtung einer solchen Schule forderte.652 Marianne Zepp interpretiert die Bezugnahme auf die ‚Staatsbürgerschaft der Frauen‘, das Thema, das ja vor allem Bähnisch immer wieder in den Mittelpunkt der Gespräche brachte, sowohl als Botschaft an die Besatzungsmacht darüber, daß man ihr „ein verläßlicher Partner in der Frage der Demokratie“ sein wolle, als auch als den bekundeten Anspruch der westdeutschen Frauen, „das neu entstehende Staatswesen mitbestimmen zu wollen“.653 Da Bähnischs Anteil an der Vermittlung des Themas so groß war, muß jedoch unbedingt auch die für die Regierungspräsidentin zentrale Botschaft eines großen Nachholbedarfs von Frauen in Sachen politischer Bildung als Message an die deutschen Frauen selbst berücksichtigt werden. Dies gilt nicht zuletzt, weil sich die Regierungspräsidentin hiermit in der Tradition der bürgerlichen Frauenbewegung bis 1933 bewegte, welche die Teilhabe von Frauen am öffentlichen Leben nicht nur als ein Recht, sondern vor allem auch als eine Pflicht der Frauen, sich einzubringen, definiert hatte. Die Vorsitzende des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ richtete sich – was auch aus späteren Ansprachen deutlich wird – mit ihrer Botschaft, die auf eine entsprechende Erziehung der Frauen fokussierte, sowohl an die in Frankfurt anwesenden potentiellen Multiplikatorinnen wie auch an jene Frauen, die Schülerinnen des staatsbürgerlichen Erziehungspro-gramms werden sollten. Außerdem dürfte Bähnisch sich zum Ziel gesetzt haben, mit ihrer Rede dem Geschmack der auf der Konferenz ebenfalls repräsentierten Militärverwaltungen zu entsprechen – allerdings nicht nur aus den von Zepp erwähnten Gründen. Denn für ein Projekt, auf das später zurückzukommen sein wird, nämlich die Einrichtung einer ständigen Schule für staatsbürgerliche Frauenbildung, suchte sie dringend nach finanzieller Unterstützung.
651 Christl Ziegler schreibt zwar insgesamt nur drei Seiten über den Kongreß, weist jedoch darauf hin, daß die während des Kongresses erhobene Forderung nach einer eigenen Institution für die politische Bildung von Frauen, die Theanolte Bähnisch eingebracht habe, von „besonderem Interesse“ sei. Ziegler zufolge war es auch Bähnisch gewesen, die gefordert hatte, daß staatsbürgerlicher Unterricht in alle Schulformen und -stufen integriert werden müsse. Aus dem Dokument, welches Ziegler nennt, geht dies jedoch nicht hervor. Ziegler: Lernziel, S. 158/159. 652 O. V. [‚A. M.‘, vermutlich Anna Mosolf] „Frauen tagten in Frankfurt“, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 2, S. 4. 653 Vgl.: Zepp: Redefining, S. 232.
830 | Theanolte Bähnisch
Damit, daß die Regierungspräsidentin in ihren Ausführungen zum Thema ‚Staatsbürgerlichkeit‘ neben den von Zepp beschworenen ‚staatsbürgerlichen Rechten‘ auch die entsprechenden Pflichten betonte, traf sie auch noch drei Jahre nach Kriegsende den Geist der Zeit. Denn einer Umfrage des britischen ‚Public Opinion Research Office (PORO)‘ zufolge sahen es 1948 nur 62 Prozent der Frauen als ihre moralische Pflicht an, sich an Wahlen zu beteiligen.654 „Ths ideas were exactly what the CCG hoped to combat and change through its education and economic reforms in the British zone”655, schreibt der Militärexperte John Robert Stark in seiner geschichtswissenschaftlichen Dissertation über die Frauenarbeit der Militärregierungen in Deutschland. Erhellend ist, wie Marianne Zepp den Zusammenhang zwischen der ‚überparteilichen Frauenarbeit‘ als Organisationsform und der ‚staatsbürgerlichen Bildung‘ als Konzept erklärt: Daß das in Frankfurt präsente Netzwerk ‚weibliche Interessen‘ als solche über Parteigrenzen hinweg definieren und vertreten und somit der Mehrzahl der Frauen den Zugang zur Politik erleichtern wollte, war, wie Zepp andeutet, ein Argument, das dem OMGUS – insbesondere vor dem Hintergrund der Parteimüdigkeit von Frauen – stimmig erscheinen mußte.656 Die wiederholte Bezugnahme auf das Ziel der staatsbürgerlichen Bildung in jenem Netzwerk zeigte, daß das Bekenntnis zum (demokratischen) Rechtsstaat in der Wahrnehmung der überparteilich agierenden Frauenverbände nicht an das Bekenntnis zu einer Partei gebunden sein mußte, ja, nicht einmal gebunden sein sollte. Die Parteinahme für den Staat hatte für die in Frankfurt anwesenden Frauen vor der Parteinahme für ein bestimmtes politisches Konzept zu stehen. Dieser Zusammenhang vermag eine Erklärung dafür zu liefern, warum Protagonistinnen wie Bähnisch und Pfannes, die sich in vielem nicht einig waren, sich doch auf jenes, besonders von Bähnisch immer wieder strapazierte Konzept der ‚staatsbürgerlichen Bildung‘ als einen ‚common sense‘ einigen konnten. Offenbar hingen die Konkurrentinnen Pfannes und Bähnisch sowie viele andere in Frankfurt anwesende Frauen der gemeinsamen Überzeugung an, daß es nicht nur ein ‚Fraueninteresse‘, sondern auch eine ‚positive Staatsform‘ gebe, die unabhängig davon sei, welche Partei die Mehrheit im Staat habe. Dies deutet sich schon in Bähnischs Neigung, das Adjektiv ‚staatspolitisch‘657 zu verwenden an. Da sich der Begriff in einem aktuellen Lexikon nicht findet, sei ein Blick ins ‚Allgemeine Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften‘658, den ‚Ur-Brockhaus‘ getan. Darin wird der Begriff ‚Staatspolitik‘ als „pleonastisch“ bezeichnet, „da die Politik vom Staate“, griechisch ‚polis‘, ihren Namen habe und in die Nähe des Begriffs ‚Staatsklugheit‘ gerückt. „Staatsklugheit wird den Staatsmännern beigelegt, wieferne sie die allgemeinen Regeln der Klugheitslehre auf die bürgerliche Gesellschaft und deren
654 655 656 657
Vgl.: Stark: Majority, S. 253. Ebd. Vgl. dazu auch: Ziegler: Lernziel, S. 159. Henny-Hoffmann: Präsident… sowie AdSD, SPD-PV, (Alter Bestand), Frauenbüro, Nr. 0244 A, Theanolte Bähnisch an Herta Gotthelf, Hannover, 29.041947. 658 Art.: „Staatspolitik“, in: Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften, vierter Band, St–Z, Leipzig, 1829, S. 25.
Staatspolitische Aufgabe
|
831
besondre Angelegenheiten anwenden“659, heißt es im gleichen Lexikon zu diesem Begriff, der wiederum mit der ‚Staatsräson‘ in Verbindung gesetzt wird. Tatsächlich drückt der Terminus ‚Staatsraison‘ am treffendsten aus, worum es der Regierungspräsidentin gegangen sein musste, wenn man die Zusammenhänge untersucht, in denen sie den Begriff ‚staatspolitisch‘ verwendete. „Man sagt […], die Staatsräson fodre (!) etwas um des öffentlichen Wohls willen“, erläutert der entsprechende Artikel.660 Damit scheint hinreichend umrissen, was Bähnisch im Sinn gehabt hatte, wenn sie von ‚Staatspolitik‘ sprach: Eine Politik zum Wohl der bürgerlichen Gesellschaft – die sich – hier schimmert die Lehre Gustav Radbruchs durch – nicht immer streng am positiven Recht orientieren darf, sondern sich an höheren moralischen Grundsätzen messen lassen muß.661 Daß ein ‚Staat‘ als solcher überhaupt erst noch etabliert werden mußte, daß die Funktion, die Parteien und womöglich auch andere Organisationen in einem ‚neuen‘ deutschen Staat haben sollten, noch nicht in einer Verfassung festgeschrieben war, dürfte die Hoffnungen der Frauen auf Mitbestimmungsmöglichkeiten durch ein überparteiliches Frauen-Netzwerk – mit einer Lobby-Organisation als politischem Akteur – noch verstärkt haben. Denn solange es noch keine Verfassung gab, erschien es immerhin möglich, daß eine organisierte ‚Vertretung der Frauen‘ verfassungsrechtlich legitimiert werden würde. Gleichzeitig macht ein Verhalten, das auf eine solche Haltung schließen läßt – belegen läßt sie sich nicht –, die Mißbilligung überparteilich agierender Frauenorganisationen durch Parteien verständlicher. Schließlich hatten sie zu befürchten, daß in einer neuen Verfassung nicht nur Parteien, sondern auch andere Organisationen den Auftrag der politischen Bildung erhalten würden. Zepps Darstellung, die Frauen hätten sich „im Prozess der überregionalen Organisierung der Frauenorganisationen und -vereine zur Staatlichkeit“ hingewendet, trifft, vor allem vor dem Hintergrund von Bähnischs Pionierrolle auf diesem Feld ab 1946, nur teilweise zu. Der ‚Club deutscher Frauen‘ hatte sich ‚staatsbürgerliche Arbeit‘ schließlich bereits Mitte 1946, als er lediglich als regionaler Akteur auftreten durfte, als Ziel seiner Arbeit auf die Fahne geschrieben.662 Damit hatte er sich wiederum an der bürgerlichen Frauenbewegung aus der Zeit vor 1933 orientiert. Daß der
659 Art.: „Staatsklugheit“, in: ebd., S. 17. 660 Art.: „Staatsräson“, in: ebd., S. 25. 661 Nicht nur einmal schimmert in Bähnischs Argumentation die Ablehnung eines streng normativen Rechtsverständnisses durch, beispielsweise, wenn sie den Entschluß ihres Mannes, von seinem Beruf als Verwaltungsrechtsrat in die freie Wirtschaft zu wechseln, damit begründet, daß ihm die Beugung des Rechts durch die nationalsozialistischen Sondergesetze unerträglich gewesen sei, oder aber, wenn sie als Regierungspräsidentin nicht immer strikt nach dem Gesetz handelte, sondern im Sinne der ‚Menschlichkeit‘ Einzelfallentscheidungen traf. Seine ‚Formel‘ formulierteRadbruch erst 1946, als 1933 amtsenthobener Professor, SPD-Politiker und Reichsjustizminister der Weimarer Republik wird Radbruch der Juristin bereits in ihrer Berliner Zeit bekannt gewesen sein. 662 Auch der Heidelberger Frauenverein hatte schon im Herbst 1946, wie Zepp selbst anmerkt, mit dem Begriff ‚Staatsbürgerlichkeit‘ argumentiert, vgl.: Zepp: Redefining, S. 215.
832 | Theanolte Bähnisch
‚Deutsche Staatsbürgerinnenverband‘ (DStV) mit dem Begriff, auf dem sein Name basierte, bereits in den 1920er Jahren offensiv umgegangen war663 merkt auch Zepp an.664 Darauf, daß Bähnisch sich, indem sie diesen Begriff verwendete, auch in der langen Tradition des 1865 von Luise Otto Peters und Auguste Schmidt in Leipzig gegründeten ‚Allgemeinen Deutschen Frauenvereins‘ verortete, der sich 1928 in ‚Deutscher Staatsbürgerinnenverband‘ umbenannte, weist Zepp jedoch nicht hin. Beim ADF handelte es sich um den ersten deutschen Frauenverein überhaupt. Er knüpfte insofern an die 1848er Revolution an, als er unter dem Luise Otto Peters zugeschriebenen Slogan ‚Dem Reich der Freiheit werb‘ ich Bürgerinnen‘ arbeitete und die mit der Revolution von 1848 proklamierten ‚Bürgerrechte‘ auch für Frauen einforderte. Der ADF/DStV war somit der traditionsreichste Verband unter den im BDF zusammengeschlossenen Frauenverbindungen. Da Else Ulich-Beil 1947 den DStV als ‚Notgemeinschaft 1947‘ wiedergegründet hatte – erst 1949 durfte sich der Verband wieder ‚Staatsbürgerinnenverband‘ – nennen, richtete Bähnisch, wenn man so will mit ihrer Frankfurter Rede auch einen eine Gemeinschaft begründenden Gruß an die Berlinerin Ulich-Beil. Diese von Bähnisch angestrebte Gemeinschaft fand sich 1949 in der gemeinsamen Begründung des ‚Deutschen Frauenrings‘ durch Bähnisch, Ulich-Beil und andere bestätigt. Begreift man ‚Staatsbürgerlichkeit‘ als einen Begriff, in dem sich „für eine staatlich geordnete Gesellschaft Vorstellungen und Wandlungen der eigenen Identität institutionell verfestigen“665, und wertet man ihn somit als integrativ, dann läßt sich die Betonung des Begriffs auf einer Frauenkonferenz, die mit den ideellen Leitlinien der Paulskirchenfeierlichkeiten in Einklang stand und sich der Teilnahme von Vertretern der Westmächte rühmen konnte, als eine Einladung der anwesenden deutschen Frauen an alle deutschen Frauen zu einem gemeinsamen Bekenntnis lesen: Wer ‚Staatsbürgerin‘ im Frankfurter Sinn sein wollte, der wollte auch Teil einer nationalen Gemeinschaft werden, die auf Freiheit, Gerechtigkeit und internationale Einbindung abzielte. Die Begriffe ‚(west-)deutsche Nationalstaatlichkeit‘ und ‚Staatsbürgerlichkeit‘ erhielten so für die Frauen aus dem Westen Deutschlands noch vor der Gründung eines westdeutschen Staates eine entsprechende, verpflichtende inhaltliche Prägung666, die auch den Westalliierten geschmeckt haben dürfte. Irene Stoehr zufolge stimmten Frauen „transnational […] darin überein, dass westliche Staatsbürgerschaft per definitionem antitotalitär – und das hieß vor allem antikommunistisch – anzulegen sei“667. Bis in die 1950er Jahre hinein, so Stoehr, habe das Label ‚staatsbürgerlich arbeitende Frauenorganisation‘ „einerseits für eine historisch enge Verknüpfung mit
663 Vgl.: Stoehr, Irene: Emanzipation zum Staat?: Der Allgemeine Deutsche Frauenverein – Deutscher Staatsbürgerinnenverband (1893–1933), Pfaffenweiler 1990. 664 Vgl.: Zepp: Redefining, S. 215. 665 Ebd., S. 218. Zepp lehnt sich mit ihrer Argumentation an Dieter Gosewinkel an. Vgl.: Gosewinkel, Dieter: Staatsbürgerschaft und Staatsangehörigkeit, in: Geschichte und Gesellschaft, 41. Jg. (1995), S. 533–556, hier S. 532. 666 Vgl. Dazu auch Zepp: Redefining, S. 218. 667 Stoehr: Feindinnen, S. 89.
Staatspolitische Aufgabe
|
833
Re-education-Programmen, andererseits für eine Priorität antikommunistischer politischer Arbeit vor anderen Aufgaben“668 gestanden. Insbesondere für die Juristin Bähnisch dürfte die Verwendung des Begriffs ‚Staatsbürgerschaft‘ auch dazu gedient haben, nach den Jahren nationalsozialistischer Diktatur, in der eine ‚Bürgerbeteiligung‘ am gesellschaftlichen Leben im liberaldemokratischen Sinn nicht möglich gewesen war, aktiv Erinnerungen an ‚Weimar‘ zu pflegen. Denn die Weimarer Republik, wie Theanolte Bähnisch sie kennengelernt hatte, war eine Staatsform, in der parteipolitisches, aber auch bürgerliches Engagement jenseits der Wahrnehmung aktiver und passiver Wahlrechte, beispielsweise durch die Mitarbeit in Organisationen wie dem BDF, der SAG oder den Soroptimistinnen, maßgeblichen Einfluß auf die Gestaltung der politischen Kultur im Land gehabt hatte. Weil Bähnisch – mit Unterstützung der Frauen, die als gleichberechtigte Bürgerinnen in den Jahren ab 1945 endlich ‚zum Zug‘ kommen und sich als bereite, fähige Wiederaufbauhelfer zur Verfügung stellen sollten – wieder zu einer solchen gesellschaftlichen Verfaßtheit kommen wollte, ist es keinesfalls unlogisch, daß sie bereits ab 1946 erinnernd und vorausschauend mit jenem Begriff operierte.669 ‚Nationale‘, und ‚republikanische‘ Orientierung670 sowie der erklärte Wille, aus der eigenen Nation eine bessere zu machen,671 ließen sich im Begriff ‚Staatsbürgerlichkeit‘ verbinden, was offenbar überzeugend auf die Westmächte wirkte. Die Frankfurter Konferenz war, eben weil sie in die Paulskirchenfeierlichkeiten eingebunden war, dazu besonders gut geeignet und daher eine wichtige Bühne für die Regierungspräsidentin. Damit ist die Vorsitzende des ‚Frauenrings der britischen Zone‘, wenn sie auch nicht Ausrichterin der Konferenz war, mit ihrem Referat und ihrer Person doch als eine kaum zu überschätzende, tragende Säule der Veranstaltung anzusehen. Will man Bezüge zwischen der Münchner Ministerpräsidentenkonferenz und den Frauenkonferenzen in Westdeutschland herstellen, so läßt sich konstatieren, daß die in der ‚überparteilichen‘ Frauenbewegung organisierten Frauen in Deutschland zwar in ‚Ost‘ und ‚West‘ gespalten waren, jedoch auch zu einer neuen Souveränität zurückgefunden hatten. Nach den ersten Schritten in ‚Bad Boll‘ und ‚Pyrmont‘ nahmen die westdeutschen Frauen in Frankfurt noch stärker kollektiv die Mitgestaltung einer neuen ‚Nation‘ in Angriff. In den Frauen aus dem Ausland, die auf den Konferenzen präsent waren, hatten sie Partnerinnen gefunden, welche sie dazu ermutigten und sie dabei unterstützten, Traditionen zu identifizieren, an die es sich anzuknüpfen lohnte – und die es in das ‚neue‘ Deutschland, das Rednerinnen des ‚Club deutscher Frauen‘ schon 1946 herbeigesehnt hatten, zu inte-grieren galt. Augenscheinlich war, daß diese Hilfestellung auf den Frauenkonferenzen in den Westzonen ausschließlich aus dem ‚westlichen‘ Ausland kam und somit vor allem Anknüpfungspunkte im Sinne
668 Ebd. 669 Vgl. für eine allgemeinere Reflektion über die Kontinuität des Staatsbürgerschaftsbegriffs: Zepp: Redefining, S. 217. 670 Vgl.: ebd., S. 216. 671 Zur Rolle des Begriffs ‚Staatsbürgerlichkeit‘ im Nation Building-Prozeß vgl.: Gosewinkel: Staatsbürgerschaft.
834 | Theanolte Bähnisch
eines demokratischen, westlichen Werteverständnisses angeboten wurden. Auf den Frauenkonferenzen im sowjetischen Sektor von Berlin und in der SBZ reichte dagegen die Sowjetunion die Hand zum deutschen Wiederaufbau. Marianne Zepp konstatiert für die Frauenverbände in der US-Zone schließlich die „Anschlußfähigkeit an internationale Zusammenhänge“ als komplementär zur „Herausbildung eine[s] neuen nationalstaatlichen Bewußtseins, an dem man beteiligt werden wollte und für dessen demokratische Grundierung man als Garant stand“672. Im Kern trifft diese Analyse auch für die Arbeit von Frauenverbänden in der britischen Besatzungszone zu, wenn dort auch der Begriff ‚Demokratie‘ – mit dem Segen der britischen Militärregierung – nicht gerade überstrapaziert wurde. Daß Theanolte Bähnisch insgeheim bereits mit einem anderen Auftrag als andere in Frankfurt präsente Frauen angetreten war, erwähnt Zepp allerdings nicht: Denn bedeutende Protagonisten der CCG (BE) hatten, wie an anderer Stelle deutlich werden wird,673 Bähnisch längst spüren lassen, daß der Aufbau eines ‚nationalen‘ Frauenverbandes für Westdeutschland von ihr erwartet wurde. Daß die Regierungspräsidentin vor diesem Hintergrund besonders souverän auftrat, verwundert nicht. 7.7.2.3 Vorsichtige Abkehr von der Rhetorik der Bürgerlichen Frauenbewegung in Hessen – nicht jedoch in Niedersachsen Es ist Ermessenssache zu beurteilen, inwiefern nicht nur die beschworenen Kontinuitäten von 1848, sondern auch ein von Gabriele Strecker in Frankfurt geforderter Bruch mit den Traditionen der bürgerlichen Frauenbewegung vor 1933 als Abgrenzung gegen den ‚Osten‘ interpretiert werden kann: Strecker plädierte in Frankfurt, obwohl auch sie sich in der Tradition der bürgerlichen Frauenverbände verortete, für eine Absage „an einen essentialistischen Mütterlichkeits- und Weiblichkeitsbegriff“674, wie er gemeinhin in der bürgerlichen Frauenbewegung, auch durch Bähnisch, Gebrauch fand. „Wir müssen aus der Vernebelung der Schlagworte kommen, der bequemen Glorifizierung von Gattungseigenschaften wie Mütterlichkeit, Frauentum, usw. heraus in die klare Luft der Wirklichkeit“675, zitiert Zepp die Bad Homburgerin aus einem Zeitungsartikel. Die Historikerin interpretiert die offensichtlich aufsehenerregende Rede der Christdemokratin als eine „Absage an die Frauenfriedensbewegung in Westdeutschland“676. Damit wäre, wenn Zepps Interpretation richtig ist, in Frankfurt auch eine Abgrenzung gegen den ‚Osten‘ vollzogen worden, indem man der ostdeutschen Frauenbewegung den Begriff ‚Frieden‘ zum propagandistischen Alleingebrauch überließ. Was Theanolte Bähnisch betraf, so nahm diese sich mehr die
672 673 674 675
Zepp: Redefining, S. 230. Siehe Kapitel 7.8. Gabriele Strecker, zitiert nach: Zepp: Redefining, S. 227. Bekenntnis der Frauen zum Frieden. Kongress und Arbeitstagung der Westzonenverbände in Frankfurt, in Frankfurter Neue Presse, 23.05.1948, zitiert nach Zepp: Redefining, S. 227. Der Titel des Artikels steht konträr zur Interpretation, die Zepp leistet. Dafür dürfte eine entsprechende Vorprägung des Verfassers/der Verfasserin des Artikels ausschlaggebend gewesen sein. 676 Ebd., S. 228.
Staatspolitische Aufgabe
|
835
Absage an den Friedensbegriff als an den Mütterlichkeitsbegriff zu Herzen, denn in der ‚Stimme der Frau‘ fand sich für Begriffe wie ‚Mütterlichkeit‘ und ‚Weiblichkeit‘ bzw. ‚Fraulichkeit‘ oder andere Umschreibungen dessen, was die bürgerliche Frauenbewegung mit der Idee der geistigen/sozialen Mütterlichkeit verband, bis zum Ende des Untersuchungszeitraums immer ein Platz677. Von ihren Forderungen nach ‚Frieden‘ rückte Bähnisch jedoch mehr und mehr ab, bald schon sollte sie sogar die Wiederaufrüstung Westdeutschlands mit der Bedrohung durch den Kommunismus rechtfertigen.678 Doch selbst mit einer „Frauen und Frieden essentialistisch gleichsetzenden Argumentation“679 brach die Herausgeberin der Zeitschrift nicht völlig. Die ‚Stimme‘ berichtete beispielsweise positiv über die friedensbewegte Organisation ‚World Organization of Mothers of all Nations‘ (WOMAN).680 Irene Stoehr konstatiert, daß aufgrund der Abkehr von der Friedensrhetorik in der westdeutschen Frauenbewegung ein „Frauenleitbild als wesentlicher Bestandteil eines frauenpolitischen Konzepts in die Definition weiblicher Staatsbürgerschaft in der Bundesrepublik eingegangen“ sei, das „unterkühlt[…] und an männlicher Stärke und Entscheidungskraft orientiert“ gewesen sei. Diese Entwicklung, die Stoehr als ein „Element antikommunistischer Geschlechterpolitik“ bewertet, welches „auf längere Sicht modernisierend“ gewirkt habe681, liegt jedoch, wenn sie denn zutreffend beschrieben ist, sicherlich nicht im Zutun Theanolte Bähnischs begründet. 7.7.2.4 Ein Konzept für eine Schule für staatsbürgerliche Frauenbildung – und eine Bilanz des bisher in der Frauenpolitik Geleisteten Bähnischs gefühlte ‚Zuständigkeit‘ für die staatsbürgerliche Frauenbildung in Deutschland äußerte sich auch darin, daß sie der Militärregierung im Juli/August 1948, also kurz nach der Frankfurter Konferenz, ein Konzept für eine Schule zur staatsbürgerlichen Frauenbildung vorlegte. Denise Tscharntke nimmt an, daß Bähnisch die Idee für eine solche Einrichtung gemeinsam mit Elfriede Paul entwickelte. Da die Zusammenarbeit der beiden Frauen, als Bähnisch das Konzept den Briten vorlegte, bereits seit über einem Jahr beendet war, ist dies jedoch nicht besonders naheliegend.682
677 Vgl.: Freund: Krieg, S. 213–233, insbesondere S. 224. 678 O. V.: Aus der Frauenwelt, Der Deutsche Frauenring für den Frieden, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 20, S. 29. 679 Zepp: Redefining, S. 228. 680 Über Dorothy Thompson, die erste Vorsitzende der Frauenorganisation WOMAN wird beispielsweise geschrieben, sie halte die Befolgung der zehn Gebote für die beste Grundlage zur Erhaltung des Weltfriedens. Vgl.: O. V.: Ernste heitere Welt. Die beste Waffe für den Frieden, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 2, S. 26. 681 Stöhr: Feindinnen, S. 90/91. 682 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 172. Tscharntke führt ihre Annahme offenbar darauf zurück, daß Elfriede Paul gemeinsam mit Franziska Lambert ein Frauendepartement in der Volkshochschule vorgeschlagen hatte. Vgl.: ebd.
836 | Theanolte Bähnisch
Die Ministerpräsidenten der britischen Besatzungszone – also auch Bähnischs ‚Chef‘ Hinrich Wilhelm Kopf – hatten schnell ihre Zustimmung zu dem Plan zum Ausdruck gebracht. Jedoch sahen sich die Länder nicht in der Lage, eine solche Einrichtung zu finanzieren.683 Das Plädoyer, welches die Leiterin der Bezirksregierung deshalb an die Militärregierung richtete, griff ihre grundlegende Argumentation zur Notwendigkeit der staatsbürgerlichen Frauenbildung, wie sie aus ihren Reden und Publikationen bereits bekannt war, wieder auf. Sie läßt sich mit den Stichpunkten ‚Frauenmehrheit in der Bevölkerung und entsprechender Einfluß als Wählerinnen‘, ‚Nachholbedürfnis von Frauen in Sachen politischer Bildung aufgrund ihres Ausschlusses vom öffentlichen Leben in den Jahren des Nationalsozialismus‘ sowie ‚Notwendigkeit eines völlig anderen Konzeptes für die Frauen-, als für die Männerbildung‘684 umreißen.685 Auch im Konzeptpapier verwies Bähnisch wieder auf die Ehelosigkeit vieler Frauen und forderte, daß Frauen von einem Leben, welches sich nur um den Mann dreht, abkommen und zu ‚neuen Idealen‘ erzogen werden müßten. Auffällig ist, daß sie hier ähnlich stark wie in ihrer Rede über ‚Himmel und Erde‘ aus dem Jahr 1950 die ‚neue Aufgabe‘ von Frauen, nämlich die aktive Beteiligung am öffentlichen Leben, als Schlüssel zur Selbstfindung und zur Entfaltung der Persönlichkeit darstellt. Formulierungen wie „complete women“ und „complete human being“686 in ihrem Konzept erinnern an Aussagen, welche Adolf Grimme in Pyrmont und andernorts über den ‚ganzen Menschen‘ zu treffen pflegte, sowie an jene pädagogischen Konzepte, die den Begriff der ‚Persönlichkeit‘ in den Mittelpunkt stellten und auch den Kultusminister geprägt hatten. Die Begriffe transportieren gleichzeitig eine christliche Botschaft, zumindest erinnern sie an die christliche Vorstellung, daß sich das Ebenbild Gottes im ‚ganzen Menschen‘ widerspiegle.687
683 NA, UK, FO 1050/31, Proposal for a school for Education in Citizenship, Theanolte Bähnisch, o. D., Abschrift, Anhang zu einem Schreiben des Office of the Educational Advisor an den Religious Affairs Advisor, 09.08.1948. Vgl. dazu auch: Ziegler: Lernziel, S. 75–78 und Tscharntke: Re-educating, S. 172–175. 684 „Women must be introduced to politics in an entirely different way”, stellte Bähnisch in ihrem Konzept fest, ließ eine Begründung dafür an dieser Stelle jedoch vermissen. NA, UK, FO, 1050/31, Proposal for a school for Education in Citizenship, Theanolte Bähnisch, o. D., Abschrift, Anhang zu einem Schreiben des Office of the Educational Advisor an den Religious Affairs Advisor, 09.08.1948. 685 Mit der Idee, Frauen getrennt von Männern zu unterrichten, kam Bähnisch der Einstellung der meisten Frauen zur Koedukation zu jener Zeit entgegen. Vgl.: Stark: Majority, S. 253. 686 NA, UK, FO 1050/31, Proposal for a school for Education in Citizenship, Theanolte Bähnisch, o. D., Abschrift, Anhang zu einem Schreiben des Office of the Educational Advisor an den Religious Affairs Advisor, 09.08.1948. 687 Vgl. dazu: Weiss, Albert Maria: Apologie des Christenthums, Bd. 1: Erst Mensch, dann Christ und so ein ganzer Mensch, Freiburg 1880. Weiss lehnt sich mit seinem Werk an die Idee des 1873 geborenen humanistisch orientierten Theologen, Pädagogen, Politiker und Schriftsteller Nikolai Grundvigk ‚Menneske først og kristen så‘ an.
Staatspolitische Aufgabe
|
837
Daß die Vorsitzende des ‚Frauenrings‘ die Position vertrat, man könne nur im Rahmen einer „residential school“688 auf die von ihr beabsichtigte, grundlegende Weise Einfluß auf die Persönlichkeit von Frauen nehmen, läßt erahnen, daß sie sich Institutionen wie die Heimvolkshochschule Dreißigacker zum Vorbilder für ‚ihre‘ Schule nahm. Das Konzeptpapier Bähnischs ist vor allem auch deshalb interessant, weil sie darin eine Bilanz der politischen Bildungsarbeit zog, die sie bis zum August 1948 geleistet hatte. Sie habe versucht, so Bähnisch, Frauen in „great non-party women’s organisations“689 zusammenzufassen und dabei das „citizenship training“ in den Mittelpunkt gestellt. Alle Frauenringe hätten, so Bähnisch, ein „working comittee“ zu diesem Thema eingerichtet. Aufgaben dieser Komitees seien die theoretische Information von Frauen durch Vorträge über Themen wie „what does the sozialamt do“ und „women discuss their worries with the Wirtschaftsamt and Food Office“ sowie die Anleitung praktischer Übungen in Form von Debatten über einfache Themen. Es habe sich jedoch gezeigt, gibt Bähnisch einen gefühlten Mißstand der eigenen Arbeit recht offenherzig zu, daß diese Arbeit nicht ausreiche, um das Ziel, das sie als „complete women, complete human being“690 beschreibt, zu erreichen. Jene „complete woman“ sei sich ihrer Verantwortung bewußt und helfe, auf der Grundlage einer starken inneren Bindung zum Staat, das öffentliche Leben mitzugestalten. Auch in diesem Zusammenhang wird wieder Bähnischs Überzeugung, ‚ganze Menschen‘, standfeste ‚Persönlichkeiten‘ seien der Schlüssel zu einer funktionierenden Gesellschaft, deutlich. Es zeugt gleichzeitig von einem immensen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, daß sie glaubte, solche ‚Persönlichkeiten‘ durch ihre Arbeit heranbilden zu können. Nicht nur in der überparteilichen Frauenarbeit, sondern auch in der Verwaltungsfachschule Hahnenklee, einer Einrichtung, die das Ziel hatte, Verwaltungsmitarbeitern und Lokalpolitikern Kenntnisse über die Aufgaben einer Gemeindeverwaltung zu vermitteln691, habe sie – so preist sie in ihrem Konzept ihre eigene Kompetenz an – Vorerfahrungen gesammelt, die ihre besondere Kompetenz in der Frauenbildung ausmachten. Jeweils an den ersten zwei bis drei Kurs-Tagen sei sie in Hahnenklee präsent gewesen und habe in den Abendstunden mit den weiblichen Teilnehmern der gemischten Gruppen Themen besprochen, von denen sie annahm, daß Frauen sie besonders interessierten. Die Gespräche drehten sich um die Kernfrage, was Frauen von Politik und vor allem von Politikerinnen erwarteten sowie darum, ob und wie sich die Frauen selbst an der Gestaltung von Politik beteiligen sollten. Sie beschrieb die Kurse und Gespräche als sehr lebhaft und ertragreich, war aber der Meinung, daß eine solche Arbeit in Form einer ständigen Einrichtung mit Kapazitäten für die Unterbringung und Ausbildung von jeweils 50 Frauen verstetigt werden müßte. Zunächst soll-
688 Ebd. 689 Ebd. Gemeint hatte sie vermutlich nicht ‚großartig‘, sondern ‚groß‘. 690 NA, UK, FO 1050/31, Proposal for a school for Education in Citizenship, Theanolte Bähnisch, o. D., Abschrift, Anhang zu einem Schreiben des Office of the Educational Advisor an den Religious Affairs Advisor, 09.08.1948. 691 Vgl. dazu: Ziegler: Lernziel, S. 75.
838 | Theanolte Bähnisch
ten von den Angeboten Frauen profitieren, die bereits für die Idee des „public service“692 eingenommen seien, die also eine entsprechende Vorbildung besaßen. Als Schulleiterin stellte sie sich eine Frau vor, die mütterlich („motherly“) und politisch versiert („politically trained“693) zugleich sei. Ihr sollten zwei festangestellte Pädagoginnen sowie geeignete Gastredner und -rednerinnen aus der politischen Praxis, aus der Wirtschaft und aus verschiedenen Berufen, auch solche aus dem Ausland zur Seite stehen. Während Denise Tscharntke annimmt, daß Bähnisch selbst die Leitung der Schule übernehmen wollte,694 kommt Christl Ziegler, die sich ebenfalls mit dem Konzept auseinandersetzt, nicht zu diesem Schluß.695 Allein schon der Umstand, daß sich die Leiterin des Frauenrings zu jener Zeit ihrer Position als Regierungspräsidentin nicht sicher sein konnte, spricht für die Richtigkeit von Tscharntkes Interpretation. Auch die Idee Bähnischs, daß die Leiterin der Schule die Vermittlung besonders wichtiger Themen, die einen intensiven Kontakt zu den anwesenden Frauen erfordern – also Themen, welche die größte Einflußnahme auf die Frauen ermöglichten – selbst übernehmen sollte, deutet darauf hin, daß sich die Vorsitzende des Frauenrings die Position auf den Leib geschrieben hatte. Zudem wünschte sich Bähnisch erklärtermaßen eine Verschränkung der Schule mit den „Headquarters“ des Frauenrings und die Errichtung der Schule in Hannover. Dies habe den Vorteil, daß die Sekretärin des Frauenrings – also Maria Prejawa – an den Kursen teilnehmen könne „and see how the women react“696. Außerdem könnten berufstätige Frauen aus Hannover – vermutlich dachte sie nicht zuletzt an Mitarbeiterinnen des Regierungspräsidiums und der Landesregierung, mit denen sie bereits im ‚Club deutscher Frauen‘ beziehungsweise im Frauenring zusammenarbeitete – das Lehrangebot ergänzen. „In other words, she wanted financial help for establishing a school for members of her own organization that would be under her personal control”697, faßt Denise Tscharntke das Anliegen Bähnischs an die Militärregierung zusammen. Ein Bericht Denekes aus dem Jahr 1949, den Tscharntke nicht erwähnt, bestätigte diese Interpretation.698 Daß es der Regierungspräsidentin ausschließlich um die Ausbildung von Multiplikatorinnen für den Frauenring gegangen war – was ihr natürlich ihre Vision, eine große Organisation mit vielen Dependancen zu eröffnen, erleichtert hätte – ist, gemessen an ihren Ambitionen, auch Frauen jenseits des ‚Rings‘ zu beeinflussen,
692 NA, UK, FO, 1050/31, Proposal for a school for Education in Citizenship, Theanolte Bähnisch, o. D., Abschrift, Anhang zu einem Schreiben des Office of the Educational Advisor an den Religious Affairs Advisor, 09.08.1948. 693 Ebd. 694 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 175 695 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 75–78. 696 NA, UK, FO 1050/31, Proposal for a school for Education in Citizenship, Theanolte Bähnisch, o. D., Abschrift, Anhang zu einem Schreiben des Office of the Educational Advisor an den Religious Affairs Advisor, 09.08.1948. 697 Tscharntke: Re-educating, S. 175. 698 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C7, Confidential Report. Visit paid to ,Frauenringe‘ in the British Zone as ,Advisor‘ 29th June–13th July, 1949, H.C. Deneke, 18.07.1949.
Staatspolitische Aufgabe
|
839
nicht wahrscheinlich. In der Logik, die, sich aus Bähnischs Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände in Hannover ableiten läßt, hätten auch Multiplikatorinnen aus anderen Organisationen Kurse in der Schule besuchen sollen. Mittelfristig stellte sich Bähnisch für die Schule, die mit weiblichem Personal arbeiten sollte, drei verschiedene Kursprofile vor: Kurze Aufbau-Kurse für eine Woche, welche Frauen, die bereits entsprechende Arbeit leisteten, ansprechen sollten, Kurse für zwei Wochen die das Interesse noch weitgehend uninformierter Frauen für politisches Arbeiten wecken sollten, und Kurse von mindestens vier bis sechs Wochen für Frauen, die zukünftig in einer Partei oder in einer Kommune intensive politische Arbeit leisten wollten. Auch diese Idee widerspricht Tscharntkes Wahrnehmung, die Schule hätte ein Schulungszentrum allein für den Frauenring werden sollen. Zu den Themen, die Bähnisch in den Kursen auf jeden Fall behandelt wissen wollte, zählte auch das Thema ‚Pan-Europa und Weltregierung‘, was zeigt, daß sie die Frauen nicht nur zu ‚Staatsbürgerinnen‘, sondern auch zu Anhängerinnen der ‚europäischen Idee‘ erziehen wollte. Die Kurse sollten jeweils in drei Blöcke unterteilt sein: 1.) allgemeine politische Themen, 2.) das Thema lokale Verwaltung – in enger Anlehnung an die Inhalte der Kurse in Hahnenklee – und schließlich 3.) praktisches Training, also Diskussionen und Abstimmungen. Zusätzlich sollten zielgruppenspezifische Themen, je nach Berufssparte, behandelt werden. Auch dies steht mit Fritz Borinskis Auffassung, daß die Bildungsarbeit stark am Alltag der Schüler auszurichten sei, im Einklang. Daß die Juristin im Konzept besonders auf Hausfrauen einging und als hausfrauenspezifisches Thema „How do politics affect the housewive a) in the kitchen b) in the house c) in the garden“ vorschlug, kann als Eingeständnis und ‚Korrekturvorschlag‘ dafür gewertet werden, daß der Frauenring mit seiner Arbeit Hausfrauen nicht erreichte. Offenbar hoffte die Vorsitzende des Frauenrings, Multiplikatorinnen so schulen zu können, daß Hausfrauen von ihrer Arbeit angesprochen werden würden. Unterhaltung in Form von „musical performances and informal socials with quizzes, puzzles and drawing-room games“699 sollte, als Dank für die Konzentration, die die Frauen mitbrächten700, das Angebot der Schule komplettieren und den Frauen etwas Abwechslung bieten. Das Interesse der Regierungspräsidentin an politischer Bildungsarbeit für Frauen ging also über die überparteilichen Frauenorganisationen weit hinaus. Zudem scheint es, als habe sie versucht, auf anderen Wegen zu kompensieren, was sie mit dem Frauenring allein offensichtlich nicht zu leisten vermochte – oder leisten wollte. Darauf deutet neben ihrem Einsatz für die Einrichtung einer Schule für staatsbürgerliche Frauenbildung auch die im gleichen Jahr erstmals publizierte ‚Stimme der Frau‘ hin. Auch in der auf Breitenwirksamkeit ausgerichteten Zeitschrift wurden politische Themen von alltäglichen Aufgaben abgeleitet und mit unterhaltenden Elementen
699 NA, UK, FO 1050/31, Proposal for a school for Education in Citizenship, Theanolte Bähnisch, o. D., Abschrift, Anhang zu einem Schreiben des Office of the Educational Advisor an den Religious Affairs Advisor, 09.08.1948. 699 Ebd. 700 Ebd.
840 | The anolte Bähnisch
durchsetzt.701 Anhand jener Unternehmungen wird – wie durch ihre Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände in Hannover, die sie schon deutlich früher begonnen hatte – der besondere Ehrgeiz Bähnischs deutlich, Einfluß auf möglichst viele Frauen auszuüben und Multiplikatorinnen, die sie für geeignet hielt, ihr bei der Verwirklichung ihres Ziels zu helfen, besonders zu schulen. Zu gern hätte sie, die ja keine Pädagogin702, sondern Juristin war, sich als erzieherische Instanz an einer Schule, die nach dem Prinzip einer Heimvolkshochschule aufgebaut sein sollte, etabliert. Doch auch die Briten schienen sich Bähnischs Idee nicht leisten zu können – oder zu wollen. Obwohl die Women’s Affairs Officers für das Konzept eingenommen waren und versuchten, Finanzspritzen zu akquirieren, verschwand es in der Schublade.703
7.8 RÜCKBLICK AUF DEN AUSTAUSCH ZWISCHEN HANNOVER, BERLIN, LONDON UND WASHINGTON: DIE DEUTSCHE FRAUENBEWEGUNG IST CHEFSACHE IN GROSSBRITANNIEN UND THEMA IN DEN USA 7.8.1 „I am disappointed that we do not appear to have done anything“ – Britische Spitzenpolitiker zwischen Uninformiertheit und brennender Sorge Zu Beginn des Jahres 1948 war die Frauenarbeit der britischen Militärregierung zur Chefsache avanciert. Ein Schreiben von Violet Markham, Sozialreformerin und Gegnerin des Frauenstimmrechts704, hatte Lord Francis, genannt ‚Frank‘, Pakenham, der seit 1947 Foreign Secretary mit spezieller Zuständigkeit für die britische Zone Deutschlands war, wachgerüttelt. Der Lord war Sozialist und Katholik aus Überzeugung und die vielbeachtete, spätere Chefredakteurin der ‚Zeit‘, Marion Gräfin Dönhoff, sagte ihm nach, daß „jeder, der seine Sorgen vor ihm auspackte, bei dem höchst unbürokratischen Minister Gehör und eine stets wache Hilfsbereitschaft“ fand, „ob es sich um die Zustände in den Internierungslagern, um die unzureichende Ernährung oder irgendwelche abwegigen Maßnahmen der Besatzungsmacht handelte“705. So hatte Pakenham auch ein offenes Ohr, als Markham ihn über den Ausgang einer Be-
701 Vgl.: Freund: Krieg, S. 87–90. Angeboten wurden unter anderem Rätsel, Kurzgeschichten, Humorvolles und Bildberichte zu Kosmetik und Mode. 702 Folgt man der Erziehungswissenschaftlerin Christl Ziegler, so schlug sich dies auch in einem Mangel an vorgeschlagenen Methoden im Konzept nieder. Ziegler: Lernziel, S. 78. 703 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 175. 704 Vgl.: Jones, Helen: Markham, Violet Rosa (1872–1952), in: Oxford Dictionary of National Biography, Oxford 2004, online auf: http://www.oxforddnb.com/view/printable/ 34881, am 05.02.2014. 705 Dönhoff, Marion: Lord Pakenham, in: Die Zeit, Nr. 23, 07.06.1951.
Staatspolitische Aufgabe
|
841
sprechung informierte, die sie mit anderen Britinnen706 gehabt hatte, welche sich, wie sie selbst, unlängst in Deutschland aufgehalten hatten. Die Deutschland-Expertin, die sich bereits in den 1920er Jahren mit den Umständen im damals britisch besetzten Rheinland707 auseinandergesetzt hatte, war der Meinung, es sei an der Zeit, den Apparat der britischen Militärregierung in Deutschland einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen. Vor allem in der ‚Women’s Affairs Section‘ war ihrer Meinung nach eine kritische Revision angezeigt. „Its position is obscure, its budget small and its staff lacks authority“708, hatte sie ihre Wahrnehmung der Dinge zusammengefaßt und vor allem die Unterstellung der Sektion unter die Education Branch kritisch hinterfragt. Damit brachte sie ein vergessen geglaubtes Thema, die Frage, welche Abteilung der Militärregierung für die Frauenarbeit zuständig sein sollte,709 wieder auf die Tagesordnung. Schließlich gebe es, so Markham, neben solchen, die in das Feld ‚Erziehung‘ fielen, bei der Frauenarbeit doch noch andere wichtige Fragen zu bedenken. Dringend müsse man über den Platz der Frauen und damit der Bevölkerungsmehrheit im neuen industriellen und politischen Gefüge Deutschlands nachdenken und entsprechend handeln, damit die Frauen nicht zur Zielscheibe abenteuerlicher politischer Unternehmungen würden. Der Zeitpunkt sei gerade besonders kritisch, argumentierte die liberale Sozialreformerin, weil die britische Militärregierung dabei sei, nach und nach Kompetenzen in die Hände deutscher Autoritäten zurückzuverlegen. Markham rekurrierte in ihrem Schreiben auf die Ingenieurin Caroline Haslett, der zufolge die von den Nationalsozialisten demontierte Gleichberechtigung nicht über ‚Philanthropie‘ – man erinnere sich an den entsprechenden Ansatz der WGPW –, sondern nur über Arbeit, vor allem in der Industrie, zurückerlangt werden könne. „Social work covers a wholly different field from that of industry and experience in the one does not qualify for the other“710, war Markham, die selbst eine Instanz in der sozialen Arbeit war und sich in jüngerer Zeit vor allem auch mit arbeitslosen Frauen auseinandergesetzt hatte, auf der ihrer Meinung nach einseitigen Ausrichtung der Arbeit der Women’s Affairs Section herumgeritten. Sie hatte sich für ein größeres Gewicht der ‚Manpower Division‘ in der Frauenarbeit ausgesprochen und zur Beauftragung je eines Frauenoffiziers 1.) für kirchliche, 2.) für industrielle sowie 3.) für staatsbürgerliche und soziale Aktivitäten geraten. Folgt man der Argumentation des Militärhistorikers John Robert Stark, so nahm Pakenham Hasletts Brief womöglich weniger zum Anlaß, sich Sorgen um den Stand der Gleichberechtigung in Deutschland zu machen, sondern vielmehr dazu, die Notwendigkeit der Arbeit von Frauen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands schärfer ins Visier zu nehmen. Denn Berichte des britischen ‚Public Research Office‘ hatten nahgelegt, daß eine ökonomische Erho-
706 Darunter waren Margaret Bondfield, Dorothy Elliott, Caroline Haslett, Doris Blacker und eine Lady Eldon. 707 Siehe Kapitel 2.2.3. 708 NA, UK, FO 945/285, Violet Markham an Lord Pakenham, o. D., Women’s Affairs in Germany, Report of a meeting held at 35 Grosvenor Place on 14th January, 1948. 709 Siehe Kapitel 6.9.1. 710 Ebd.
842 | Theanolte Bähnisch
lung des Landes nur dann erfolgen würde, wenn Frauen viel stärker als bisher zur Erwerbsarbeit herangezogen würden.711 Pakenham schien zunächst weitere Nachforschungen über die ‚Frauenfrage‘ in Deutschland angestellt zu haben, bevor er das Thema bei Außenminister Bevin anschnitt. Er hatte dabei auch auf die Gefahr einer kommunistischen Beeinflussung von deutschen Frauen in den Blick genommen, auf die Markham in ihrem Schreiben mit der Formulierung, die Frauen könnten „the sport of some political adventurer“712 werden, ganz offensichtlichhinaus wollte.713 Ende Januar 1948 ging das Antwortschreiben des Außenministers auf den nicht überlieferten Brief Pakenhams beim Staatssekretär ein, in dem Bevin sich darüber beklagte, daß in der SBZ bereits verschiedene Frauenorganisationen, Landfrauenorganisationen und Jugendorganisationen existierten, während die Britische Militärregierung untätig geblieben sei. Bevin unterrichtete auch den Minister für Deutschland und Österreich, John Byrnes Hynd, den Leiter der deutschen Sektion im Foreign Office, Patrick Dean, und den Diplomaten Ivone Kirkpatrick, der 1950 die Nachfolge von Brian Robertson als Alliierter Hoher Kommissar von Seiten der Briten in Deutschland antreten sollte, über den von ihm gefühlten Mißstand.714 „I am dissapointed that we do not appear to have done anything“715 äußerte sich Bevin zusammenfassend gegenüber Pakenham. Der Außenminister verkannte also die Lage und die durchaus umtriebige Arbeit der Women’s Affairs Section sowie anderer Mitarbeiterinnen der Militärregierung, wie Rita Ostermann, völlig. Schließlich war die Frauen Re-education-Arbeit in der britischen Besatzungszone – wie deutlich geworden sein sollte – zu diesem Zeitpunkt nicht nur etabliert, sondern sogar auf verschiedene Schultern in der Militärregierung verteilt. „German Political Branch, Political Division, realised the potential use of these organisations [Frauenorganisationen] as instruments of political propaganda, and appointed a Women Officer in January 1947, whose special duty is to developments from this point of view“716, erklärt beispielsweise eine Vorlage für ein Memorandum die Abordnung Rita Ostermanns als Beauftragte für Frauenfragen in die Political Division, obwohl die Zuständigkeit für Frauenfragen doch zunächst in der Education Branch gelegen hatte. „The development showed itself in March when the Demokratische Frauenbund Deutschland, sponsored by one political party was set up in the Russian Zone and Sector of Berlin, and is connected with the International
711 Stark: Majority, S. 249. 712 NA, UK, FO 945/285, Violet Markham an Lord Pakenham, o. D., Women’s Affairs in Germany, Report of a meeting held at 35 Grosvenor Place on 14th January, 1948. 713 NA, UK, FO 945/285, Bevin an den Chancellor of the Duchy of Lancaster, Sir Ivone Kirkpatrick, M. Dean, P[atrick] Dean und John Burnes Hynd, 14.01.1948. Das Schreiben Pakenhams an Bevin ist nicht überliefert, daß es existierte, wird aus dem Brief Bevins an die genannten Ansprechpartner deutlich. 714 Ebd. 715 Ebd. 716 NA, UK, FO 1050/1211, Basis for Memorandum on Policy with regard to women’s organisations, o. D., o. V.
Staatspolitische Aufgabe
|
843
Democratic Federation of Women, headquarters in Paris“717, beschreibt dieselbe Vorlage, daß sich die Befürchtungen der Political Division, die zur Einsetzung Ostermanns geführt hatten, in der Entstehung des DFD bestätigt gefunden hatten. Auf der dritten Konferenz über ‚Women’s Affairs‘ am 20.01.1948 waren deshalb nicht nur Vertreterinnen der Education Branch, welcher die Women’s Affairs Section unterstellt war, anwesend, sondern unter anderem auch Rita Ostermann als Vertreterin der Political Division. John Robert Stark zufolge war dieses auffällig selbständige Vorgehen der britischen Militärregierung in Deutschland in Sachen Frauenfragen – also die Absprache verschiedener Divisionen untereinander – Ausdruck wohlüberlegten, strategischen Handelns der CCG (BE)718. Andererseits äußerte sich hierin dem historisch versierten Militärexperten zufolge aber auch die Ignoranz, welche die britische Regierung den Verhältnissen in Deutschland entgegenbrachte. Diese hatte sich Stark zufolge nicht zuletzt in der Besetzung des mittlerweile aufgelösten COGA mit dem auffällig jungen John Hynd niedergeschlagen.719 Der Informationsfluß zwischen London und Berlin in Sachen Frauenfragen in Deutschland scheint also zunächst eher schlecht gewesen zu sein. Ob es an dem in Folge der Verschärfung des Kalten Krieges häufiger glühenden Draht zwischen Berlin und London ab Januar 1948 lag, ob Rita Ostermann neue Hinweise von britischen Frauenorganisationen bekam, oder ob sie aufgrund eigener Beobachtungen – wie sie sie ja bereits im Zusammenhang mit der Konferenz in Bad Pyrmont gemacht hatte – so handelte, wie im Folgenden beschrieben, läßt sich nicht klären. Fakt ist, daß die Mitarbeiterin der Political Division etwa zur selben Zeit, zu der der Außenminister die Felle in Sachen Frauenarbeit wegschwimmen sah, bereits einige wichtige Veränderungen eingeleitet hatte: Unterstützt von der Vorsitzenden der Women’s Affairs Section in der Education Branch, Joy Evans, hatte sie die Verfasser der ‚Regional Reports‘ dazu aufgerufen, künftig auch Informationen über die kommunistische Infiltration von Frauenorganisationen in ihren Berichten über die ‚Lage der Region‘ festzuhalten.720 Der Informations-Austausch hatte sich zu jener Zeit also nicht nur zwischen der Women’s Affairs Section in Berlin und dem Foreign Office rasant verstärkt, sondern die Women‘s Affairs Section forderte auch den regionalen Stützpunkten der CCG (BE) mehr Aufmerksamkeit in ‚Frauensachen‘ ab. Auf dieser Grundlage kam schließlich ein Austausch über eine vermutete kommunistische Infiltration des Frauenrings in Schleswig-Holstein im März 1948 zustande, welcher zeigte, daß die Maschinerie, die Ostermann in Gang gesetzt hatte, auch funktionierte.721
717 Ebd. 718 Stark geht davon aus, daß das Committee on Women’s Education weder von COGA, noch von der CCG (BE) initiiert worden sei, sondern sich selbst zusammengefunden hatte. Ranghöhere Offiziere seien nur aus Höflichkeit zu den Treffen gebeten worden, sie hätten die Arbeit weder behindert noch gefördert. Vgl.: Stark: Majority, S. 218/219. 719 Vgl.: Stark: Majority, S. 192/193. 720 NA, UK, FO 945/284, Minutes of the Third Conference of Women’s Affairs held on 20th January, 1948. 721 NA, UK, FO 945/284, Foreign Office an Political Division, Berlin, 04.03.1948.
844 | Theanolte Bähnisch
Doch noch einmal zurück nach London: Pakenham, der sich zwischenzeitlich über den Stand der Frauenarbeit in der britischen Zone informiert hatte, reagierte prompt auf Bevins entrüstetes Schreiben722 und erklärte diesem die deutsche Lage aus seiner Sicht. Während die Sowjetunion sich voll und ganz auf die Förderung der Frauenarbeit der SED konzentriere und diese organisatorisch wie finanziell voll unterstütze, sei vom britischen Militärapparat bisher allen Frauenorganisationen, „whether partyones, such as promoted by the S.P.D., or above party-ones, such as that which has been formed by Frau Bähnisch in Hanover“723, dieselbe Unterstützung zu Teil geworden. Dies entsprach, bei Licht betrachtet, nicht der Wahrheit, denn aufgrund der Empfehlungen Denekes erfuhren die überparteilichen Organisationen, wie beschrieben, deutlich mehr Aufmerksamkeit als die parteiinterne Frauenarbeit. Auch Pakenhams Statement, daß die Hauptarbeit der deutschen Frauenorganisationen darin bestünde, Frauen zur Berufstätigkeit zu verhelfen, wurde den Realitäten nicht gerecht, wenn auch einige aktive Mitglieder des Frauenrings, wie an anderer Stelle deutlich werden wird, auf diesem Gebiet Einsatz zeigten und das Thema eine Herzensangelegenheit Bähnischs war. Der Foreign Secretary hatte von Bevin noch etwas mehr Geduld erbeten und geschrieben, daß er zunächst noch den Educational Advisor der CCG (BE), Robert Birley, dessen Branch die Women‘s Affairs Section unterstand, zum Thema anhören wollte. Im gleichen Brief an Bevin stelle Pakenham jedoch schon vorab Überlegungen in den Raum, ob die Frauen-Sektion nicht womöglich einen höheren Status erhalten solle und ob die Militärregierung den existierenden Frauen-Organisationen in der britischen Besatzungszone nicht wenigstens Sachmittel zur Verfügung stellen könne, um ihre Arbeit zu unterstützen. Denn bisher habe man sich weitgehend auf organisatorische Unterstützung der Zusammenschlüsse beschränkt. Insbesondere in der Knappheit an Versammlungsräumen und im Papiermangel erkannte der Staatsekretär Hemmnisse, die einer gedeihlichen Entwicklung der Arbeit von Frauenorganisationen in Deutschland im Weg stünden. Denise Tscharntke zufolge war den Frauenringen immerhin Gelegenheit gegeben worden, sich in den britischen Informationszentren namens ‚Die Brücke‘ zu versammeln, und Rita Ostermann habe sich, so Tscharntke, dafür eingesetzt, dem Frauenring auch ein Büro mit Schriftführerin, einer Telefonverbindung und einer Schreibmaschine zur Verfügung zu stellen.724 John Robert Starks Interpretation „the British simply let the few women who wished to organize continue to do so toward any non-national socialistic goal“725, kann vor dem Hintergrund der Förderung, die Bähnisch dadurch zuteil wurde, nur verwundern. Direkte finanzielle Hilfe erhielt der Frauenring von der CCG (BE) jedoch offenbar nicht.726 Darin lag ein bedeutender Unterschied zwischen der britischen und der – später einsetzenden – amerikanischen Frauenpolitik in Deutschland.727
722 723 724 725 726 727
NA, UK, FO 945/285, Pakenham an Bevin, 02.02.1948, Entwurf. Ebd. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 169. Stark: Majority, S. 212. Vgl. dazu auch: Tscharntke: Re-educating, S. 170. Vgl.: ebd., S. 171.
Staatspolitische Aufgabe
|
845
Pakenham sprach gegenüber Bevin auch den Umstand an, daß die Frauen den Männern in Deutschland zwar zahlenmäßig überlegen seien, daß sie aber dennoch in der Industrie prozentual genauso gering vertreten seien wie vor dem Krieg. Die deutschen Behörden würden in dieser Hinsicht nicht genug unternehmen und riskieren, daß rechte oder linke Kräfte die Notwendigkeit unverheirateter Frauen, einen Beruf auszuüben und ein Einkommen zu erzielen, ausnutzen könnten, hatte Pakenham gewarnt. Mit der Argumentation, die die Sorge um ehelose, auf sich selbst gestellte Frauen sollte handlungsleitend für die Frauen-Re-education-Arbeit sein, lag er ganz auf Bähnischs Linie. Die Regierungspräsidentin unternahm jedoch keine besonderen Anstrengungen, Frauen für eine Tätigkeit in der Industrie zu begeistern. Dies läßt sich darauf zurückzuführen, daß die Juristin zwar einerseits die Berufstätigkeit für Frauen als notwendig und in einigen Zusammenhängen auch als einen wichtigen Teil der weiblichen Persönlichkeit begriff, andererseits jedoch, wie in der ‚Stimme der Frau‘ deutlich wird, die Berufstätigkeit von Frauen in der Industrie nur unter besonderen Voraussetzungen als ‚wesensgemäß‘ ansah und entsprechend guthieß.728 Die Russen hätten jedenfalls bereits große Erfolge bei der Rekrutierung von Mitgliedern für den DFD erzielt, führte Pakenham weiter aus, weshalb die Briten die deutschen Frauen dringend über die Eigenschaft des DFD (als Handlanger der SED) aufklären und ihnen attraktive Alternativen in Form demokratischer Organisationen anbieten müßten.729 Damit forderte Pakenham erst im Februar 1948 etwas, was Rita Ostermann schon anläßlich der Konferenz von Pyrmont im Juni 1947 als sinnvoll herausgestellt hatte. Ihre Gedanken hatte sie damals nicht nur mit den in Deutschland stationierten Kollegen geteilt, sondern der Chef der Political Branch, für die Ostermann tätig war, hatte auch das Foreign Office in den Verteiler für den Bericht seiner Mitarbeiterin mit aufgenommen.730 Doch eine klare Ansage ‚von oben‘ war zu jener Zeit offenbar ausgeblieben. Ostermann hatte zwischenzeitlich ‚auf eigene Faust‘ den Frauenring als für deutsche Frauen eventuell attraktive, nicht-kommunistische Alternative zum DFD im Auge behalten, sich aber auch mit seinen Defiziten vertraut gemacht, die vor allem demokratischer und organisatorischer Natur waren. Sie schien, wie Visiting Expert Helena Deneke, darauf gewartet zu haben, daß diese sich auswachsen würden – und daß die überparteiliche und die SPD-interne Frauenbewegung doch noch zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit kämen, denn am ‚Klassenkampf‘ waren Ostermanns Meinung nach ebenso die ‚Bürgerlichen‘ wie die Sozialdemokraten schuld.731 Außenminister Bevin verließ sich nicht allein auf die Nachforschungen Pakenhams, sondern zapfte verschiedene Informationsquellen an. „The weeks following
728 Vgl.: Freund: Krieg, S. 213–233. 729 NA, UK, FO 945/285, Pakenham an Bevin, 02.02.1948, Entwurf. 730 NA, UK, FO 945/283, Flanders, Director German Political Branch an diverse andere Einrichtungen der Militärregierung und das Foreign Office, 04.06.1947. 731 NA, UK, FO 1050/1230, Report on recent women’s conferences Bad Pyrmont and Fürth, 07. Juli 1947, ,Appendix B‘ zum Dokument ,Political Developments leading to the deutscher Frauenkongreß in Bad Pyrmont 1949‘.
846 | Theanolte Bähnisch
the receipt of Bevin’s telegram were filled with hectic activity“732, faßt Tscharntke jene Welle zusammen, die Bevins Schreiben, in dem er schnelle Reaktionen der Militärregierung auf die Fortschritte der Russen verlangte, auslöste. Neue Berichte über die bisherige Arbeit der Womens‘ Affairs Officers wurden verfaßt, und der Informationsaustausch zum Thema Frauenarbeit stieg innerhalb der CCG (BE) sowie zwischen Berlin und London stark an. Dabei spielte die Frage, wie es um die Entwicklung des DFR stehe und welches Potential er entfalten könne, eine wichtige Rolle. Vermutlich war ein Austausch zwischen Pakenham und seiner Kollegin Reeve vom German Educational Department des Foreign Office ursächlich dafür, daß sich Reeve im Januar 1948 an die Education Branch wandte, um zu prüfen, ob Bähnisch und der Frauenring dazu geeignet waren, das ‚Problem DFD‘ zu lösen. „We should be grateful for any information regarding the development of the Frauenring Hannover as a ‘roof’ organisation“, schrieb Reeve, die auf harte Fakten aus war, nach Berlin: „If possible an indication of the number of groups affiliated to it and total membership should be given. This information is required in connection with the increased interest which is being taken in the position and influence of women in Germany“733 erklärte Reeve das ungewöhnlich starke Interesse an der Frauenarbeit, die das Foreign Office nun zeigte. Joy Evans, die Leiterin der Women‘s Affairs Section in der Education Branch leitete die Anfrage jedenfalls gleich nach Niedersachsen an ihre Kolleginnen weiter.734 Informationen über die Arbeit des Frauenrings bezog Bevin auch aus einem allgemeinen Bericht des ‚Reserch Office‘ über die Lage der Frauenbewegung in Deutschland, den das ‚Research Department‘ als Auftragsarbeit am 03.02.1948 vorlegte.735 Der Bericht handelt einleitend die sowjetische Frauen-Politik für die SBZ ab und stellt die politischen Ziele des DFD vor. Was dann folgt, zeigt, daß der Berichterstatter oder die Berichterstatterin mit dem Thema Frauenbewegung in Deutschland zuvor nicht besonders vertraut gewesen sein konnte, aber in der Lage war, schnell an Informationen zu kommen. Die britische Frauenarbeit in Deutschland scheine, so der unbekannte Verfasser/die Verfasserin, stark vom Bericht zweier Delegierter der WGPW [gemeint waren Deneke und Norris] aus dem Jahr 1946 beeinflußt worden zu sein, die der CCG (BE) empfohlen hätten, überparteiliche Organisationen zu fördern. Die SPD habe sich davon übervorteilt gefühlt und ihren Mitgliedern die Mitarbeit in solchen Organisationen verleidet. Die einflußreichste Entwicklung unter den überparteilichen Organisationen, die von den britischen Autoritäten gefördert würde, sei als „Klub deutscher Frauen“ 1946 von einer Frau „NOLTE-BAEHNISCH, Regierungspräsident of Hannover“ verantwortet worden und später im „Lower Saxony Frauenring“736 aufgegangen. Dieser habe alle überparteilichen und interkonfessio-
732 Tscharntke: Re-educating, S. 51. 733 NA, UK, FO 945/284, A. B. Reeve an die Education Branch, 30.01.1948. 734 NA, UK, FO 945/284, Joy Evans, Education Branch an Foreign Office, German Education Department, 03.02.1948. 735 NA, UK, FO 945/284, Women’s Organisations in the soviet, british and U. S. zones of Germany, Research Department, Foreign Office, 03.02.1948. 736 Ebd.
Staatspolitische Aufgabe
|
847
nellen Verbände in Niedersachsen vereinigt, bevor unter Beteiligung von Repräsentantinnen der US-Zone eine zonenweite Veranstaltung (gemeint war wohl die Konferenz von ‚Pyrmont‘) von Organisationen dieser Art stattgefunden habe. Die meisten Teilnehmerinnen auf der Veranstaltung seien über 50 gewesen, es habe kein konkretes Ziel und wenig Zeit für Diskussionen gegeben. Allerdings seien Resolutionen zu einer stärkeren Stellung der Frauen im öffentlichen Dienst, für gleiche Bezahlung und das Recht auf Berufstätigkeit, unabhängig vom Familienstand, verabschiedet worden. Ein Übergangs-Vorstand sei ernannt und ein Komitee mit der Abfassung eines Statuts beauftragt worden, „but nothing further has been heard of the organisation. As a counter-organisation to the Soviet zone DFB [gemeint war der DFD], the purpose for which it was intended by its founder, it cannot be said to have succeeded“737, urteilt der Verfasser, der keine Quellen für seine Informationen angibt. Weil der Frauenring, wie beschrieben, zwischenzeitlich von der ‚Bildfläche‘ verschwunden war, 738 ist der Schluß, den der Verfasser aus den Entwicklungen zieht, durchaus verständlich. Ob er bemerkt hatte, daß sowohl der ihm als „powerful and effective“739 bezeichnete Frauenring in Hamburg als auch der ebenfalls erwähnte in Schleswig-Holstein zu dem von Bähnisch geleiteten Dach-Verband gehörten, ist nicht klar. Schließlich setzten sich John Byrnes Hynd und Francis Pakenham im März 1948 zusammen, um über das Thema Frauen Re-education-Arbeit zu sprechen, insbesondere darüber, daß der von der SED-dominierte DFD Frauen-Organisationen der anderen Parteien und vor allem auch überparteilich arbeitende Organisationen infiltriere.740 Pakenham war der Meinung, man müsse, um Gegenmaßnahmen einzuleiten, eine verantwortliche deutsche Frau mit ausreichendem Erfahrungsschatz finden, welche einen parteipolitischen Hintergrund habe, eine Rolle in der lokalen Verwaltung spiele und unabhängig sei.741 Daß es sich um einen Zufall handelte, daß er, nachdem er sich über die Verhältnisse in Deutschland eigehend informiert hatte, Theanolte Bähnisch die Rolle der Anführerin jenes Projektes mit seinen Worten geradezu auf den Leib schrieb, ist zwar möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Daß Maria Prejawa, die ‚rechte Hand‘ Bähnischs, im Frühjahr 1948 nach Großbritannien reisen durfte742, war wohl kaum ein Zufall, sondern ist ebenfalls als eine Entscheidung in Zusammenhang mit dem gestiegenen Druck, gegen den DFD etwas ‚tun‘ zu müssen, zu sehen. Dies findet sich darin bestätigt, daß im März 1948 zu hören war, Prejawa habe vor, eine Zusammenarbeit des Frauenrings mit dem ICW anzubahnen, um durch internationale Anbindung in Sachen Attraktivität mit dem DFD
737 738 739 740
Ebd. Siehe Kapitel 7.5.3. Ebd. NA, UK, FO 945/284, Note on Discussion between Chancellor of the Duchy of Lancaster and Mr. Birley, Educational Advisor to the Commander in Chief on 15th March, Subj.: Women’s Affairs. 741 Ebd. 742 NA, UK, London, FO 945/284, Notes on Interview with Frau Prejava [Prejawa], Assistance to Frau Bähnisch, Ministry Hamburg, 26.02.1948.
848 | Theanolte Bähnisch
gleichziehen zu können, der zu diesem Zeitpunkt in die Internationale Demokratische Frauenföderation (IDFF) aufgenommen worden war.743 Mrs. Patrick Ness, die zeitgleich zu Prejawas Verhandlungen in Großbritannien eine Reise in die Schweiz unternahm, hatte diese Gelegenheit nutzen sollen, die ICW-Präsidentin Jeanne EderSchwytzer zur Zusammenarbeit mit dem DFR zu bewegen. Dazu hatte sie den Segen Reeves erhalten, die sich – nachdem sie die im Januar angeforderten Informationen über den Frauenring erhalten hatte – auf die Seite Bähnischs gestellt hatte.744 „Anything you can do […] would […] be much appreciated by Frau Bähnisch and by the Control Commission“745, bekräftigte Reeve Ness gegenüber den Gleichklang der Interessen der Militärregierung und der Regierungspräsidentin. Daß in der britischen Militärregierung Anfang 1948 auch Sir William Strang, der Spezialist für deutsch-sowjetische Fragen im Foreign Office, in den InformationsAustausch über die Frauenarbeit involviert wurde, war gewiß ebenfalls kein Zufall.746 Die Überzeugung, daß man dem kommunistischen DFD durch eine ‚Gegenmaßnahme‘ den Wind aus den Segeln nehmen könne und müsse, hatte sich in den höheren Rängen der Militärregierung und des Foreign Office durchgesetzt: das Thema Frauenarbeit stand nun weit oben auf der Tagesordnung. In den folgenden Wochen entspanntensich Gespräche darüber, welche Schwerpunktsetzungen zukünftig in der Frauenarbeit in Deutschland zu setzen seien. Dabei spielte der Einfluß der Kommunisten die tragende Rolle gespielt, doch wie man ihn eindämmen sollte, war zunächst umstritten. Richard Crawford beispielsweise sah in der Verbesserung der Lebensbedingungen für Frauen größere Chancen, dem Kommunismus wirksam zu begegnen747, als in der Förderung von Frauenorganisationen. Andere Berater hielten Frauenorganisationen zwar für sehr wichtigbefürchteten jedoch eine zu langsame Entwicklung der Organisationen und sprachen sich dafür aus, Zusammenschlüsse zu fördern, die stärker politisch mit den Frauen arbeiteten. Vor dem Hintergrund der Frage, welche Frauen-Organisationen, beziehungsweise welche Frauenarbeit stärker unterstützt werden sollte, waren die zu Beginn ebenfalls brennenden Themen ‚Berufstätigkeit‘ und ‚Ernährung‘ auf der Agenda bald auf niedrigere Ränge verwiesen worden. Doch spielten sie wiederum eine Rolle bei der Diskussion der Frage, welche demokratischen Organisationen am attraktivsten auf Frauen wirken und ihre Interessen gut vertreten könnten.748 Daß eine für Frauen interessante Organisation möglichst viele Themen auf ihrer Agenda halten müsse, die Frauen interessieren könnte, stand außer Frage.
743 744 745 746 747 748
NA, UK, London, FO 945/284, Reeve an Mrs. Patrick Ness, 22.03.1948. Ebd. Ebd. NA, UK, FO 945/285, Notiz von W. Strang, o. D. [Ende Januar/Anfang Februar 1948]. NA, UK, FO 945/285, Notiz von Crawford, 29.01.1948. NA, UK, FO 945/285, passim.
Staatspolitische Aufgabe
|
849
7.8.2 Herta Gotthelf kritisiert die Förderung des Frauenrings durch die ‚Bruderpartei‘ Was sowohl die Diskussionen in London um die Frauenpolitik in Deutschland angeheizt als auch die Entscheidungsprozesse innerhalb der Militärregierung beschleunigte hatte, war, daß nicht nur Violet Markham, sondern auch Herta Gotthelf, die Leiterin der SPD-Frauenarbeit, den direkten Kontakt zu Lord Pakenham gesucht749 und ihn im Dezember 1947 persönlich darauf aufmerksam gemacht hatte, daß die Militärregierung überparteiliche Frauenorganisationen bevorzugt behandle.750 Markhams Kritik an der Arbeit der Women’s Affairs Section war damals also auf bereits von Gotthelf vorbereiteten Boden gefallen751 und vermutlich deshalb so wirksam gewesen. Gotthelf, die bis 1933, also bis zum Verbot der Partei, das SPD-Frauenbüro geleitet hatte, war von Februar 1934 bis Mai 1946 im britischen Exil gewesen. Als sie nach ihrer Rückkehr Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der SPD, Redakteurin der SPD-Frauenzeitschrift ‚Die Gleichheit‘ und erneut Frauensekretärin der SPD wurde, hoffte sie auf die Unterstützung der ‚Bruderpartei‘, zumal die Labour-Partei in Großbritannien zu jener Zeit die Regierung stellte und entsprechend auch die Leitlinie die britische Deutschland-Politik bestimmte. Bereits auf einer Konferenz des ‚Committee on German Women’s Education‘ im September 1946, bei der es um die Etablierung eines Frauenfunks gegangen war, hatte Gotthelf, die als Repräsentantin der Gewerkschaft eingeladen war, in Anwesenheit von Vertreterinnen der Militärregierung zu Protokoll gegeben, es sei nutzlos, wenn Frauenorganisationen Funktionen übernehmen wollten, die bereits von politischen Parteien erfüllt würden.752 Was genau Gotthelf damit gemeint hatte, blieb an dieser Stelle offen (es dürfte um die Gestaltung von Sendungen für Frauen durch Frauenorganisationen gegangen sein), jedoch deutete sich mit dieser Aussage im Herbst 1946 bereits an, daß Gotthelf in ihrem Kampf gegen die ‚Überparteilichen‘ die Militärregierung als einen wichtigen Ansprechpartner ausgemacht hatte und daß sie nicht davor zurückschrecken würde, die Auseinandersetzungen um die politische Erziehung von Frauen auch auf die internationale Ebene zu tragen. Denn die Hilfestellung aus Großbritannien war nicht ansatzweise so stark, wie von Gotthelf erwartet. Eine Förderung, wie Bähnisch und der Frauenring sowie einige andere, überparteilich agierende Verbände sie erhielten, blieb der SPD-internen Frauenarbeit verwehrt. Als verantwortlich hierfür dürfen, wie beschrieben, für die Anfangszeit der britischen Frauen-Re-education-Arbeit in Deutschland vor allem die
749 NA, UK, FO 945/283, Notes on Miss Herta Gotthelf’s Interview with Lord Pakenham, 30th December, 1947. 750 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 177/178. 751 Vgl.: Zur Kritik der SPD am Frauenring gegenüber der Militärregierung auch: Tscharntke: Re-educating, S. 175–183. 752 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 25, Supplementary detailed minutes of conference of committee on german women’s education held in the Konsumverein, Bünde on Sept. 20, 1946.
850 | Theanolte Bähnisch
Empfehlungen Jeanne Gemmels und Helena Denekes gelten. Gotthelf sparte nicht mit Kritik an der britischen Politik: Die Women’s Affairs Officers, die zunächst Gemmel unterstellt waren und nach den Empfehlungen Denekes handelten, seien ja, so Gotthelf, ‚nett‘ und ‚hilfsbereit‘, von der Arbeiterklasse hätten sie jedoch, ebenso wie von gesellschaftlichen Verhältnissen jenseits ihres Heimatlandes, keine Ahnung.753 Die SPD-Frauensekretärin und ihre Mitstreiterinnen neideten Bähnisch und ‚ihrer‘ Organisation von Beginn an die ideelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung durch die Briten, schließlich auch die Papierzuteilungen für die Publikation der ‚Stimme der Frau‘, die im März 1948 beschlossen wurde, während das Schicksal der SPD-Frauenzeitschrift ‚Genossin‘ unsicher war.754 Auch der Umstand, daß der Frauenring Sendezeit im Frauenfunk der Rundfunkanstalten und Plätze in internationalen Austauschprogrammen zur Verfügung gestellt bekam, gefiel Gotthelf nicht. Ebensowenig wollte sie akzeptieren, daß immer wieder Mitglieder des Frauenrings und der mit ihm kooperierenden Wohlfahrts- und Berufsverbände für Besuchsreisen nach Großbritannien ausgewählt wurden. Die Kosten trugen, wie erwähnt, die einladenden Verbände, unterstützt von der britischen Regierung, die für ein Taschengeld und einen Teil der Reisekosten aufkam. Sozialdemokratinnen, die als solche nach Großbritannien reisen wollten, erfuhren nur selten eine entsprechende Förderung, zumal sie die geforderten englischen Sprachkenntnisse häufig nicht nachweisen konnten.755 Britische Delegierte, die nach Deutschland kamen, wurden, wie Gotthelf an ihre Mitstreiterin Trude Wolf schrieb, meist „nur in den bürgerlichen Frauenclubs präsentiert“756. Dies erschwerte den SPD-Frauen nicht nur die gewünschte internationale Anbindung, sondern auch die Möglichkeit, Ausländerinnen überhaupt erst auf die SPD-Frauenarbeit aufmerksam zu machen. Nicht alle hochrangigen Persönlichkeiten im Umkreis der Militärregierung, die sich mit der Rolle der Frauen in Deutschland auseinandersetzten, vertraten indes die Meinung, daß die überparteilichen Organisationen mehr Unterstützung erhalten sollten als die parteiinterne Frauenarbeit. In Mary Sutherland, Chief Women‘s Officer
753 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 177. Tscharntke beruft sich auf einen Brief von Herta Gotthelf an die Labour-Politikerin Barbara Ayrton-Gould vom 31.08.1946. Vgl.: ebd., Anm. 55. 754 „Ich glaube die Papierzuteilung lediglich an ‚überparteiliche Frauenzeitungen‘ (‚Constanze‘ in Hamburg und die neu herauskommende Zeitschrift von Frau Bähnisch sowie das in Aussicht genommene überparteiliche Frauenblatt in Düsseldorf) ist nicht genug ein Gegengewicht in dieser ausgesprochen politischen Auseinandersetzung.“ AdSD, SPD-Parteivorstand, alter Bestand, Nr. 0234 A, Herta Gotthelf an Lance Pope, 12.04.1948, Unterstreichung i. O. Immerhin bekam Gotthelf, so Linne, vier Tage später zwei Rollen Druckpapier von der Newspaper Supply Sub Section zugewiesen. NA, UK, FO 1049/1246, Rita Ostermann an Herta Gotthelf, 15.04.1948. 755 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 177, [Frauenbüro, Korr. Niederrhein], Trude Wolf an Herta Gotthelf, 29.08.1947. 756 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 177, Herta Gotthelf an Trude Wolf, 01.09.1947.
Staatspolitische Aufgabe
|
851
der Labour Party und britische Delegierte der UN-Kommission757, schien Gotthelf eine Unterstützerin gefunden zu haben, die auf eine stärkere Förderung der parteiinternen, ‚politischen‘ Frauenarbeit drängte. Doch es dauerte nicht lange, da distanzierte sich auch Sutherland, mit Verweis auf die rigide Haltung der Frauensekretärin, von Gotthelf.758 Anhaltende Unterstützung fand die Sozialdemokratin in einer anderen Politikerin der Labour Party: Mrs. Lucy Middleton.759 Diese wandte sich noch im Juli 1948, als Sutherland von Gotthelf bereits abgerückt war, an den Staatssekretär für ausländische Beziehungen, Lord Henderson, um ihn vor den möglichen Gefahren, die durch den Frauenring entstehen könnten, zu warnen. Dabei zog sie indirekt auch den British National Council of Women, der ein entschiedener Förderer Bähnischs war, in die Kritik: „The Over Party Women’s Organisation which is created by the C.C.G. in Germany and which is analogous to the National Council of Women in this country can become a very real danger, I think, to building up a democratic political method in Germany, in that it has the effect of side-tracking the activities of many of the most active spirits among German women and creating the impression that political views and political action are very secondary considerations.“760 In Middletons Wahrnehmung zog Bähnischs Frauenring unverdienterweise eine Aufmerksamkeit auf sich, die dem von ihr als viel wertvoller betrachteten ‚politischen‘ Handeln von Frauen in Parteien gebührte. Die Unterstützerin Gotthelfs war außerdem der Meinung, der Frauenring sei ein Kunstgebilde, das sich ohne die Unterstützung der Militärregierung nicht zu einem großen Verband entwickelt hätte und das ohne deren anhaltende Hilfe unmittelbar in sich zusammenbrechen würde.761 Dieselben Argumente brachte, wohl kaum zufällig, Herta Gotthelf gegenüber Rita Ostermann vor, als die Briten die Etablierung eines Frauenrings in Essen unterstützten: „Ich finde es doch ein bißchen unfair, daß man durch diese starke Forcierung durch die Militärregierung dem Frauenring eine Bedeutung gibt, die er von sich aus nicht haben würde.“ Es sei, so Gotthelf, „nicht richtig, wenn die Militärregierung versucht […] durch ihr Eingreifen andere Organisationen in diesen Club zu bringen. Es zeugt auch nicht gerade von der Stärke der Ideale des Frauenrings, wenn sie immer wieder auf die Hilfe der Militärregierung angewiesen sind und nicht im Stande sind, aus eigener Kraft ihre Ideen zu popularisieren, wie es ja die anderen auch tun müssen.“762 Jener Brief
757 NA, UK, FO 1049/1847, Rita Ostermann an Peter Solly-Flood, 24.11.1949. 758 NA, UK, FO 945/284, Notes on Interview with Miss Mary Sutherland, Chief Women Officer, Labour Party, 12.03.1948. „Miss Sutherland wanted to make clear that the Labour Party does not support Herta Gotthelf in her opposition to non-political organizations and regrets her rigid attitude and […] they do not wish to be officially represented at her Women’s Day meetings in Berlin, 22nd March–4th, April.“ Ebd. 759 Vgl. dazu auch Tscharntke: Re-educating, S. 180. 760 Lucy Middleton zitiert in: NA, UK, FO 1049/1247, A. B. Reeve, Foreign Office an Ostermann, 20.07.1948. „You will see from the following extract […] that your assistance will be necessary“, hatte Reeve das Zitat Middletons eingeleitet. 761 NA, UK, FO 371/70711, Meeting between Lord Henderson and Mrs Middleton MP, 21.07.1948. 762 NA, UK, FO 1049/1248, Gotthelf an Ostermann, 05.07.1948.
852 | Theanolte Bähnisch
Gotthelfs war nur einer von vielen Protestbriefen, die sie, unterstützt vor allem vom Parteigenossen Fritz Heine763, an Mitarbeiter der Militärregierung und der Regierung in London schickte. Ihrem Ärger über die britische Besatzungsmacht machte sie wiederum in Briefen an die SPD-Frauensekretärinnen in den Bezirken Luft. Lord Pakenham hatte Gotthelf bei jenem Treffen im Dezember 1947 signalisiert, daß er Frauenarbeit in politischen Parteien künftig stärker unterstützen wolle und ein Gleichgewicht zwischen überparteilicher und parteiinterner Frauenarbeit in Deutschland anstrebe.764 Es sah also für ein paar Wochen so aus, als hätte Gotthelfs Drängen an der entscheidenden Stelle Gehör gefunden und als würde Pakenham tatsächlich eine Wende einleiten. Im Januar 1948 hatte auch die in Deutschland stationierte Rita Ostermann noch zu Protokoll gegeben, die aktuelle Leitlinie der Control Commission liege darin, eine Balance765 zwischen ‚politischen‘ und nicht-parteigebundenen Organisationen aufrecht zu erhalten. Sie tradierte mit ihrer offenen Haltung die Einstellung, welche die Political Division 1946 vertreten hatte, als sie sich, anders als die Educational Division, für die Förderung aktiver Mitgliedschaften von Frauen in Parteien ausgesprochen hatte766. (Diese Haltung hatte jedoch nach der Unterstellung der Women’s Affairs Section unter die Educational Branch kaum mehr eine Rolle in der Besatzungspolitik gespielt – bis Gotthelf Ende 1947/Anfang 1948 im Foreign Office die alte Meinungsverschiedenheit wieder auf die Agenda gebracht und damit Markham den Boden dafür bereitet hatte, für Verwirrung und Zwist zwischen den Einrichtungen der CCG (BE) zu sorgen.) Gleichzeitig vertrat Ostermann Anfang 1948 schon die Meinung, Bähnisch habe womöglich mehr als irgendeine andere Person dafür getan, gebildete Frauen der Mittelschicht für aktuelle (politische) Zusammenhänge zu interessieren.767 Denise Tscharntke schreibt, daß sich Rita Ostermann, in Anbetracht des sich verschärfenden Kalten Krieges, im März 1947 dafür eingesetzt habe, daß LabourPolitikerinnen nach Berlin kämen. Die Historikerin leitet daraus eine Parteinahme Ostermanns für Gotthelf ab.768 Daß die Mitarbeiterin der Political Division jedoch im Juni 1947 in ihrem Bericht über die SPD-Frauenkonferenz in Fürth und die Konferenz der überparteilichen Verbände in Pyrmont den Frauenring insgesamt als förderungswürdiger beurteilte, bedeutet, daß sich Ostermanns Meinung entweder sehr
763 NA, UK, FO 371/70711, Fritz Heine an Duncan Wilson, 24.06.1949. 764 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 177/178. 765 Die gleiche Argumentation findet sich auch in: NA, UK, FO, 1050/1211, Basis for Memorandum on Policy with regard to women’s organisations, o. V., o. D. [1947/1948]. 766 NA, UK, FO 1050/1210, Internal Memo, Education Branch, M. M. Simmons, Assistant Director H & S, 29.10.1946. 767 NA, UK, FO 945/283, Notes on Meeting held at Norfolk House on Thursday, 8th January 1948, in order to discuss women’s affairs in Germany, A. B. Reeve, 12.01.1948. Diese ‚Leitlinie‘, aber auch die Überzeugung, daß die parteigebundenen Organisationen sich von allein entwickeln würden, findet sich auch im Bericht ‚Women’s organisations in Germany‘ von Reeve. Ebd., Women’s Organisations in Germany, A. B. Reeve, 12.01.1948. 768 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 178.
Staatspolitische Aufgabe
|
853
schnell geändert haben muß – oder aber, daß ihre Überzeugung für die parteiinterne Frauenarbeit auch zuvor schon nicht so stark war, wie von Tscharntke angenommen. Daß schließlich der für Deutschlandpolitik zuständige Sekretär im Foreign Office, Richard Crawford769, versuchte, die Verantwortung für ein größeres Gleichgewicht zwischen Bähnisch und Gotthelf ausgerechnet in die Hände Gotthelfs zu legen, ließ nichts Gutes ahnen: Crawford vertrat im Januar 1948, als aufgrund von Bevins Beschwerde und Gotthelfs Interventionspolitik eine verstärkte Diskussion über die Women’s Affairs in Deutschland stattfand, die Meinung, daß es doch im besten Dienst der Sache sei, wenn man die von Bähnisch und die von Gotthelf organisierten Gruppen dazu bewegen könne, zusammen zu arbeiten „and possibly form one movement“770. Er sah sowohl in der parteinahen als auch in der überparteilichen Frauenbewegung Potential für eine positive Entwicklung der ‚Frauenfrage‘ in Deutschland. Eine Zusammenarbeit der beiden Frauen mag aus weiter Ferne betrachtet durchaus praktikabel erschienen sein, schließlich agierten beide Organisationen von derselben Stadt aus, beide Frauen gehörten derselben Partei an, engagierten sich für die Emanzipation und wollten erklärtermaßen die kommunistische Frauenbewegung bekämpfen. Crawford war an einer Zusammenarbeit der Frauen vor allem auch deshalb gelegen, weil er fürchtete, daß aus den Kämpfen Gotthelfs und Bähnischs gegeneinander die Russen schließlich als lachende Dritte hervorgehen könnten: „Group competition and jealousies of this kind merely play into the hands of the S.E.D. and the Russians“771, konstatierte er. Doch alle Versuche, Herta Gotthelf vom Nutzen der Zusammenarbeit mit der überparteilichen Frauenbewegung zu überzeugen, sollten scheitern. Auch die Entsendung Barbara Ayrton-Goulds, einer alten Bekannten Gotthelfs von der Labour-Party, welche eigens eine Reise nach Deutschland unternahm, um Gotthelf zur Zusammenarbeit mit Bähnisch zu überreden, brachte nicht den gewünschten Erfolg.772 Was für Crawford ein Grund war, Gotthelf zu einer Zusammenarbeit mit Bähnisch zu bewegen, das war für Gotthelf einer der zentralen Gründe, sich von Bähnischs Herangehensweise abzugrenzen: Die Frauensekretärin hing ja der Überzeugung an, die Existenz überparteilicher Organisationen sei geradezu eine Einladung an
769 Crawford war zuvor ‚Assistant Secretary‘ der GI Branch im COGA gewesen. Als das COGA als eigenständige Behörde aufgelöst wurde, wurde er gemeinsam mit den anderen Mitarbeitern des COGA dem Foreign Office überstellt. 770 NA, UK, FO 945/283, Notiz von Crawford, German Educational Department an Mr. Jamieson, 30.01.1948. 771 Ebd. 772 NA, UK, FO 1049/1245, Telegramm, Foreign Office to Bercomb [Berlin Commission British Element], No. 2096, 3rd March 48, Action Copy. „She feels that she might be able to make a contribution towards making both groups working better together, as she is an old friend of Frau Gotthelf and believes she has influence with her“, wird Ayrton-Goulds Reise hier begründet. Nach ihrer Rückkehr hatte auch diese Expertin empfohlen, nicht Gotthelf, sondern die Frauenringe stark zu unterstützen. NA, UK, FO 371/70711, Notiz von Crawford über Women’s Organisations anläßlich Robertsons Brief an Birley vom 29.04.1948, 08.05.1949.
854 | Theanolte Bähnisch
die Kommunistinnen, diese zu unterwandern. Daß der bereits zitierte Bericht des Foreign Office Research Department der SPD vorwarf, genau diese Entwicklung durch ihr Verhalten zu begünstigen, entsprach wiederum der Erwartung der Briten, daß Gotthelf doch mit dem Frauenring kooperieren und Sozialdemokratinnen dazu ermuntern sollte, im Frauenring ein Gegengewicht gegen die Kommunistinnen zu bilden. „The KPD is quite determined to disrupt the Schleswig-Holstein Frauenring […] and are infiltrating as many members as possible; in the absence of support from the SPD they may well succeed“773, charakterisiert der Bericht das Problem – und findet die Schuldigen unter den linientreuen Sozialdemokratinnen. 7.8.3 Was ist Politik, was Demokratie? – Bähnisch und die CCG (BE) sind sich einig Obwohl – oder eben gerade weil sie das gemeinsame Ziel der Bekämpfung des Kommunismus vor Augen hatten –, waren die Positionen der beiden SPDPolitikerinnen unvereinbar. Dies läßt sich maßgeblich auf ein unterschiedliches Verständnis von ‚Politik‘ zurückführen: Herta Gotthelf sah (SPD-)parteilich gebundene, ideologisch eindeutig festgelegte Frauen als Garantinnen des demokratischen Neubeginns an, sie wollte die ‚Frauenfrage‘ deshalb als Teil des Aufbaus einer sozialdemokratischen Gesellschaft zwischen Parteien ausgehandelt wissen und tat Bähnischs Bemühungen als ‚gehobenes Gesellschaftsspiel‘ oder ‚Kaffeekränzchen‘ ab. Eine Arbeit, wie die Leiterin des Frauenrings sie leistete, entsprach nicht Gotthelfs Definition von politischem Handeln. Das Verständnis von ‚Politik‘, dem die Senior Women’s Affairs Officers und Bähnisch anhingen, lag dagegen bedeutend näher an dem heutigen, erweiterten Politikbegriff. Wikipedia, die Quelle der Wahl für viele informationswillige Bürger in der Gegenwart, definiert ‚Politik‘ – unter Bezugnahme auf die Politologen Frank Schimmelfennig und Thomas Bernauer so: „In der Politikwissenschaft hat sich allgemein die Überzeugung durchgesetzt, dass Politik ‚die Gesamtheit aller Interaktionen definiert, die auf die autoritative [durch eine anerkannte Gewalt allgemeinverbindliche] Verteilung von Werten [materielle wie Geld oder nicht-materielle wie Demokratie] abzielen‘. Politisches Handeln kann durch folgenden Merksatz charakterisiert werden: ‚Soziales Handeln, das auf Entscheidungen und Steuerungsmechanismen ausgerichtet ist, die allgemeinverbindlich sind und das Zusammenleben von Menschen regeln‘.“774 Das Politikverständnis der Briten beinhaltete die Überzeugung, daß sich deutsche Frauen in der Nachkriegszeit zunächst durch die Verhandlung ihrer Ideen in einem räumlich, thematisch wie personell begrenzten Rahmen im demokratischen Denken
773 NA, UK, FO 945/284, Women’s Organisations in the soviet, british and U. S. Zones of Germany, Research Department, Foreign Office, 03.02.1948. 774 Art. „Politik“, in Wikipedia, auf: http://de.wikipedia.org/wiki/Politik#cite_note-2, Datum der letzten Änderung: 02.02.2014. Wikipedia gibt folgende Quelle für das erste Zitat an: Schimmelfennig, Frank: Internationale Politik, Paderborn 2010, S. 19–21 (!). Als Quelle für das zweite Zitat wird genannt: Bernauer, Thomas u. a.: Einführung in die Politikwissenschaft. Studienkurs Politikwissenschaft, Baden-Baden 2009, S. 32.
Staatspolitische Aufgabe
|
855
und Handeln (eine Position beziehen, Diskutieren und Abstimmen) üben sollten, ohne dabei Schranken durch parteiliche Bindung oder ideologische Festlegung auferlegt zu bekommen. Persönliche Erfahrungen, Nöte und Wünsche sollten die Grundlage für ein solches Engagement darstellen.775 Daß die Briten von dieser Idee der Frauenbildung nicht abrücken würden, hätte Gotthelf im Lauf der Zeit klarwerden können, denn man hatte ihr nach einer ‚laissez faire‘-Phase recht unmißverständlich deutlich gemacht, daß die einzige Möglichkeit, ihren Einflußspielraum mit Hilfe der Besatzungsmacht zu vergrößern, über die Beteiligung an der Arbeit des Frauenringes führte. Die SPD-Frauensekretärin weigerte sich jedoch beharrlich, von ihrer Überzeugung abzuweichen, daß die beste und sicherste Lösung in Sachen Frauenpolitik für den Wiederaufbau Deutschlands der sozialdemokratische Weg sei. „Behind Miss Gotthelfs letter lies the old problem of whether encouraging democracy in Germany means encouraging the S.P.D. She clearly assumes it does and that the only way to reorganise women’s activities is through women […] with a Left Wing outlook”776, hielt J. Mark vom General Department über einen Brief Gotthelfs, in dem diese sich über die Auswahl der ‘Visiting Experts‘ durch die Militärregierung beschwert hatte, fest. Die britische Militärregierung wollte den Sozialdemokraten jedoch mitnichten das Monopol auf die Demokratie zuerkennen. Sie favorisierte unter der Maxime „agree to differ“777 die Etablierung einer pluralen Demokratie und strebte ein plurales Modell der Zusammenarbeit, vor allem auch in der politischen Bildung von Frauen, an. In Rita Ostermanns Aussage „our aims are diametrically opposed to theirs, for we want women to think for themselves and they want them to think only as […] Social Democrats“778 steckte eine Überzeugung, die in den Kreisen, in denen Bähnisch sozialisiert worden war und auch nach 1945 noch verkehrte, ebenfalls dominant war. Die SPD war in der Wahrnehmung der Briten auf eine ‚Kaderschulung‘ aus, während eine ‚staatsbürgerliche Erziehung‘, wie sie der Frauenring proklamierte, die Heranbildung von aufgeklärten, kritischen Persönlichkeiten versprach. Ein Mitarbeiter des Foreign Office ging in seiner Parteien-Kritik sogar soweit, die parteinahen Frauenorganisationen für das traditionelle Desinteresse der deutschen Frauen an Politik verantwortlich zu machen.779
775 Autoren die einem eher klassischen Verständnis von Politik verhaftet sind, beurteilen die Politik der Militärregierung eher im Sinne Gotthelfs. „[t]hey did not encourage women in politics“, schreibt John Robert Stark über die Britische Militärregierung, die seiner Meinung nach jedoch „a respectable job in helping German women tob e active in German society“ geleistet habe. Stark: Majority, S. 296 und S. 271. Wo er die Grenze zwischen gesellschaftlichem Engagement und Politik zieht, macht Stark nicht transparent. 776 NA, UK, FO 945/259 J. Mark an „G. Secretariat“ (through Mr. Churchhill), 12.09.1946. 777 AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), Frauenbüro, Nr. 0244 A, SPD-interner Bericht über die Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘, o. T., o. D. 778 NA, UK, FO 1030/94, Draft on women’s organizations, Rita Ostermann, April 1948, zitiert nach Tscharntke: Re-educating, S. 179. 779 NA, UK, FO 945/259, Notiz von Churchhill, 13.09.1946.
856 | Theanolte Bähnisch
Nicht einmal der SPD-Parteivorsitzende Schumacher stand im Januar 1948, als das Interesse der britischen Regierung an der Frauenarbeit der CCG so stark anstieg, noch überzeugt hinter der aggressiven Politik ‚seiner‘ Frauenreferentin gegenüber den ‚Überparteilichen‘. „Schumacher’s attitude to non-party organisations has, however, recently weakened. He realises that they must be accepted even if they are to be deplored. Ollenhauer is said to back up the more rigid attitude of […] Gotthelf, who is personally not on good terms with Frau Bähnisch“, ist als Statement der Mitarbeiterin des Foreign Office, Reeve vom 12.01.1948 überliefert. Denise Tscharntke weist darauf hin, daß Alan Flanders, der Chef der German Political Branch, Schumacher dahingehend beeinflußt habe, daß er in seiner Frankfurter Rede eine neutrale Position zur überparteilichen Frauenbewegung einnehme. Schumacher selbst habe dem Thema wenig Relevanz beigemessen, so Tscharntke.780 Was die Einstellung des Parteivorsitzenden zur Zeit seiner Rede in Frankfurt betrifft, mag Tscharntke richtigliegen. Sie weist nach, daß der Inhalt seiner Rede eng an der Losung für die überparteiliche Frauenarbeit, die die Labour Party 1943 herausgegeben hatte, lag. Dies spricht für eine Orientierung Schumachers an Flanders Ratschlag – und damit auch für eine gewisse Trägheit von seiner Seite, eine eigenständige Position zu definieren.781 Daß Schumacher jedoch, wie aus dem obigen, von Tscharntke nicht berücksichtigten Zitat deutlich wird, seine Haltung mit dem sich zuspitzenden Kalten Krieg änderte, zeigt, daß er nicht blind war für das Thema Frauenbildung. Er schien es, in Anbetracht der politischen Lage, für falsch gehalten zu haben, sich gegen Theanolte Bähnisch zu stellen. Hätte der Parteivorsitzende eine eindeutig ablehnende Position bezogen, wäre er damit noch stärker in Mißkredit bei den Briten geraten, als es ohnehin schon der Fall war. Außerdem war mit Adolf Grimme, der 1948 NWDRGeneraldirektor wurde, ein bekanntes, beliebtes und einflußreiches SPD-VorstandsMitglied von Bähnischs Handeln überzeugt. Zum dritten konnte der Parteivorsitzende Bähnischs Überzeugung, daß durch eine parteinahe Frauenarbeit weniger Frauen für den demokratischen Aufbau des Landes gewonnen werden könnten, angesichts der Probleme, die Gotthelf in der Rekrutierung weiblicher Partei-Mitglieder hatte, nicht von der Hand weisen. „[H]e realised the value of the appeal to the ordinary woman in working with above-party organisations“782, kommentierte ein anderes Schreiben aus den Akten der Militärregierung Schumachers Verhalten bereits nach seiner Rede im Juni 1947. Die Zurückdrängung des Kommunismus war schließlich nicht nur Bähnischs, sondern auch Schumachers erklärtes Ziel. Deshalb ließ er sie, gemeinsam mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die der überparteilichen Idee anhingen, gewähren.
780 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 179. 781 Vgl.: ebd., S. 180. Offenbarbar war die Labour-Party über diese Frage ebenso gespalten wie die SPD nach Kriegsende. 782 NA, UK, FO 1050/1211, Basis for Memorandum on policy with regard to Women’s Organisations, o. V., o. D. [1947/48].
Staatspolitische Aufgabe
|
857
7.8.4 „we should […] back the Frauenring under the leadership of Frau Bähnisch“ – General Robertson spricht ein Machtwort Offensichtlich schlossen sich an den Bericht des Research Department aus dem Februar 1948 noch einige weitere Nachforschungen und Beratungen an. General Brian Robertson, der von alledem ebenfalls in Kenntnis gesetzt worden war, zeigte sich schließlich im April 1948 im Allgemeinen mit der Arbeit der Women’s Affairs Section, wie sie sich ihm darstellte, zufrieden. Er ließ Francis Pakenham persönlich wissen, daß für ihn kein Zweifel darüber bestünde, wie in Sachen Frauenarbeit weiter zu verfahren sei. Indem er seine eigene Position deutlich gemacht hatte, hatte er die Position Bähnischs bestätigt und gefestigt: „At the risk of being misunderstood both by the Church authorities and by the S.P.D. headquarters, we should […] back the nonparty form of organisations represented by the Frauenring under the leadership of Frau Baehnisch. Such an organisation is by no means non-political. Frau Baehnisch herself is an energetic S.P.D. - Member and Regierungspräsidentin of RB [Regierungsbezirk] Hannover.“ Unterstreichend hatte er hinzu gefügt: „The most successful type of political indoctrination will be fairly indirect and must be carefully mixed with non-political interests and activities. The communists have fully recognised this fact“.783 Robertson war also, ganz im Gegensatz zu Gotthelf, offenbar der Meinung, daß die Angebote, welche der ‚Frauenring‘ seinen Mitgliedern und Gästen machte, genau die richtigen seien, um die Frauen zu erreichen und daß man lieber nicht mit der Tür ins Haus fallen sollte, wenn man deutschen Frauen politisches Denken nahebringen wolle. Aus seiner Sicht hatten die Initiativen der Organisation zur gemeinsamen Bewältigung der Nachkriegsnot, die Beratungsangebote und andere Aktivitäten einen eigenen politischen Wert, gerade weil sie, wie die Angebote des DFD, nicht direkt auf die Auseinandersetzung mit ‚Politik‘ gemünzt waren. Robertsons Aussagen darüber, ob der Frauenring nun ‚politisch‘ oder ‚unpolitisch‘ sei, waren widersprüchlich. Bezeichnete er den Frauenring im oben vorgestellten Zitat als ‚by no means unpolitical‘, so folgte er an einer anderen Stelle in demselben Schreiben zumindest teilweise der Argumentation Gotthelfs: Er sympathisiere zwar mit der Abneigung der Political Division gegen das ‚Unpolitische‘, weil es schließlich die unpolitischen Massen gewesen seien, die die Nazis willkommen geheißen hätten784. Aber weder die SPD noch die Kirchen seien unter ihrer momentanen Führung in der Lage, mit der Attraktivität überparteilicher Frauenorganisationen zu konkurrieren. Er äußerte die Meinung, daß überparteiliche Organisationen ohnehin existierten – also solle man ihnen im Kampf gegen die Kommunisten behilflich sein.785 Damit war die Zeit der defensiven, bisweilen sogar furchtsamen Haltung gegenüber der SPD, welche innerhalb der Militärregierung zwischen 1946 und dem
783 NA, UK, FO 371/70711, General Sir Brian Robertson an Rt. Hon. Lord Pakenham, 29.04.1948. 784 Vgl. dazu auch Tscharntke: Re-educating, S. 180. 785 Ebd.
858 | Theanolte Bähnisch
April 1948 ab und an zutage getreten war,786 vorbei. Auch die Political Branch, die sich zunächst zögerlich bis ablehnend verhalten hatte, stand nun ganz auf Bähnischs Seite. Nicht einmal, was die Parteinahme Else Ulich-Beils für die umstrittene Führungsfigur der bürgerlichen Frauenbewegung, Gertrud Bäumer, betraf, war Rita Ostermann zu einem Machtwort gegenüber den ‚Überparteilichen‘ zu bewegen. Denn sie hatte erkannt, daß nicht nur die Sozialdemokratinnen, sondern vor allem auch die Kommunistinnen die Beziehungen der bürgerlichen Frauenorganisationen zu Bäumer propagandistisch ausschlachten wollten. Da sie auf keinen Fall in jenes Fahrwasser geraten wollten, beschlossen die Women’s Affairs Officers, sich neutral in der Angelegenheit zu verhalten.787 Wie Robertson mit dem Umstand umging, daß der Frauenring der britischen Besatzungszone zu jener Zeit, als entsprechende Nachforschungen angestellt wurden, nicht gerade lautstark auf sich aufmerksam machte, sondern in der Wahrnehmung des vom Research Department mit der Abfassung des Berichts betrauten Mitarbeiters völlig in der Versenkung verschwunden war, wird aus den überlieferten Akten nicht deutlich. Wahrscheinlich war es Bähnisch in dem persönlichen Gespräch mit Robertson, das Mitte März 1948 stattgefunden hatte, gelungen, ihn vom Wert ihrer Arbeit zu überzeugen. Vermutlich spielte aber auch die Beratung durch Women’s Affairs Officers eine wichtige Rolle für Robertsons Entscheidung. Schließlich vesprach der Frauenring mit seiner Orientierung an der Tradition der bürgerlichen Frauenbewegung auch jenen Aspekt fortzuführen, der nicht nur den in der Frauenbewegung organisierten Britinnen, sondern auch einem in der Hierarchie der CCG gerade aufsteigenden Mitarbeiter gefiel: Die soziale Arbeit. Lord Henderson, Pakenhams Nachfolger, ging nämlich davon aus, daß die Verbesserung der sozialen Lage der beste Erzieher der deutschen Frauen sei.788 Daß die Militärregierung glaubte, diesen Umstand besser über die soziale Arbeit bürgerlicher Frauenorganisationen als über die Konzepte der sozialdemokratischen Partei lösen zu können, ist bemerkenswert. Die CCG (BE) hielt also an der Idee fest, den Frauenring als politische VorfeldOrganisation zu betrachten, der den Frauen eine Ahnung von Staatsbürgerschaft vermitteln könne, worauf dann eine weitere politische Erziehung, auch durch die Parteien, aufgebaut werden könnte.789 Die Hoffnung, daß man die SPD und auch die
786 Als eine Reise einer WGPW-Delegation in die britische Zone anläßlich der Konferenz von Pyrmont bevorstand wurde in der Political Division noch die Gefahr beschworen, man könne, vor dem Hintergrund des Streits zwischen Bähnisch und Gotthelf, durch diese Politik womöglich den Unmut der SPD auf sich ziehen. NA, FO 1050/1213, Telegramm der Political Division an das Foreign Office, German Branch, Entwurf, o. D., [Juni 1947]. 787 „I believe that women like Frau Hoppstock-Huth are […] distressed that we do not take sides in the matter, but they will all have to learn to make their own decisions and accept responsibility without expecting us to intervene.“ NA, UK, FO 1050/1213, Rita Ostermann an Ursula Lee, 14.04.1948. Vgl. dazu auch: Tscharntke: Re-educating, S. 156/157. 788 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 181. 789 Vgl.: ebd.
Staatspolitische Aufgabe
|
859
Kirchen doch noch zur Zusammenarbeit mit den überparteilichen Organisationen bewegen könne, wollte Robertson nicht kampflos aufgeben. Eine solche Zusammenarbeit sei schließlich die Grundlage für die Errichtung einer „single Women’s Organization for the Western Zones“790, beschrieb Robertson seine Vorstellung von einer Dachorganisation deutscher Frauenverbände. Er sei bereit, den Wünschen anderer Frauen-Organisationen ebenfalls entgegenzukommen, „but the crucial question is that of priority“791. Und diese wurde, noch vor der Frankfurter Konferenz, zugunsten des Frauenrings entschieden. Der General sprach sich schließlich dafür aus, auch den materiellen Nöten der überparteilichen Organisationen zu entsprechen. Die Idee Bähnischs, in jedem deutschen Land einen Fond zur Bekämpfung von Kommunisten einzurichten, „which was put into effect under the Weimarer Republik“792, erschien ihm allerdings zu stark der Gefahr des Mißbrauchs ausgesetzt. Dennoch beinhalte die Idee interessante Möglichkeiten, die nun überprüft würden, gab sich Robertson überzeugt. Was genau Bähnisch da vorgeschlagen hatte, läßt sich aus dem Brief Robertsons an Pakenham leider nicht nachvollziehen, aber daß Robertson die ‚Gefahr des Mißbrauchs‘ sah, deutet darauf hin, daß Bähnisch womöglich an Ideen anknüpfen wollte, von denen in der Weimarer Republik auch die Nationalsozialisten profitiert hatten.793 Mehr noch als Robertson schien Staatssekretär Pakenham, der in Erfahrung gebracht hatte, daß der Frauenring mittlerweile aus 60 Unterorganisationen bestehe, die Frage beschäftigt zu haben, wann ein weiterer Kongreß von Frauenorganisationen stattfinden könne. Offenbar war unstrittig, daß es einer solchen Konferenz bedürfe, um einen großen Fortschritt in der Frauenarbeit zu erzielen. Pakenhams Ausführungen waren Robertson allerdings zu vage, er konnte daraus nicht ableiten, wie man ihm aus Großbritannien zukünftig dabei helfen wolle und könne, die deutschlandpolitischen Ziele im Bereich der Frauen-Re-education umzusetzen. Er schlug deshalb vor, wiederum Visiting Experts nach Deutschland zu entsenden und Birley zu fragen, was er von dieser Idee halte.794 Birleys Antwort schlug gleich zwei Fliegen mit einer
790 NA, UK, FO 371/70711, General Sir Brian Robertson an Rt. Hon. Lord Pakenham, 29.04.1948. 791 Ebd. 792 Ebd. Offenbar hatte Bähnisch dieses Thema mit Duncan Wilson im März 1948 besprochen. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 170. Demnach hätte der Landtag über die Verwendung der Mittel entscheiden sollen. Vgl.: ebd. 793 Führende Industrielle, darunter Hugo Stinnes, hatten auf Initiative Eduard Stadlers, unterstützt von führenden Politikern wie Friedrich Naumann, 1919 einen ,AntibolschewismusFond‘ eingerichtet. Aus diesem wurden Organisationen, die sich dem Kampf gegen den Kommunismus widmeten, finanziell unterstützt. Vgl.: Kemper, Claudia: Das „Gewissen“ (1919–1925). Kommunikation und Vernetzung der Jungkonservativen, München 2011, S. 127. Die Geschichte des Fonds ist sagenumwoben, nicht nur die Nationalsozialisten, sondern auch die Sozialdemokratische Partei soll Geld aus diesem Fonds bezogen haben. 794 NA, UK, FO 371/70711, Richard Crawford an Sir Ivone Kirkpatrick, German Political Department, 8.05.1948.
860 | Theanolte Bähnisch
Klappe: „Frau Bähnisch and the other officers of the Frauen Ring are in touch with many British women; if she wishes to invite visitors to any large conference we should, of course, do all we can to help this.“795 Für Birley war im Juli 1947 also klar, daß, wenn eine große Konferenz stattfinden solle, Bähnisch die richtige Person für deren Leitung war und daß selbstverständlich auch prominente Frauen aus dem Ausland anreisen sollten. Die Konferenz von Frankfurt, welche im Mai 1948 in der US-Zone stattgefunden hatte, war also, obwohl die Zonen mehr und mehr zusammenwuchsen, nicht das, worauf Birley gewartet hatte. Vielleicht auch, um dem Frauenring die Planung einer neuen großen Konferenz zu erleichtern, teilte der Educational Advisor den unterstützungswilligen Kollegen in London mit, daß der Frauenring vor allem Büromaterial gebrauchen könne. Vor dem Hintergrund, daß Bähnischs Frauen-Organisation, nachdem sie über die Region Hannover hinausgewachsen war, nicht mehr über das Regierungspräsidium ‚abgewickelt‘ werden konnte, leuchtet diese Aufforderung Birleys ein. Den Vorschlag Bähnischs zur Einrichtung einer ‚Schule für staatsbürgerliche Bildung‘ hielt Birley ebenfalls für eine glänzende Idee, er riet dazu, sie weiter zu verfolgen. Was eine Zusammenarbeit der SPD und der Kirchen mit den überparteilichen Organisationen anging, so machte der Deutschlanderfahrene Birley dem weit von Deutschland entfernt lebenden Pakenham allerdings wenig Hoffnung. 7.8.5 Mehr Kapazitäten für Frauen-Re-education: Veränderungen im britischen Militärapparat Im Juli 1948 wurden, weil man die Arbeit Rita Ostermanns und Joy Evans prinzipiell als positiv bewertete, jedoch den aktuellen Herausforderungen in adäquater Form begegnen wollte, einige Veränderungen im Apparat der britischen Militärregierung manifest. Mit der faktischen Rolle Ostermanns in der britischen Frauenarbeit hatten sich diese bereits seit einigen Monaten angedeutet: Die Women´s Affairs Section wurde aus der Education Branch herausgelöst und direkt der Weisung des Educational Advisor unterstellt. Joy Evans behielt ihre Stellung als Senior Women’s Affairs Officer und die Aufsicht über die ‚Non-Political-Organisations‘ bei.796 Rita Ostermann, die zuvor in der Political Branch beschäftigt gewesen war, wurde ebenfalls Senior Officer in der neuen, aufgewerteten Einrichtung.797 Tscharntke interpretiert dies zu Recht als eine Betonung des politischen Aspekts der Frauenarbeit gegenüber dem pädagogischen.798 Im Zuge der Kompetenzverschiebungen wurde auch die Zahl der britischen Women´s Affairs Officers von acht auf zwölf erhöht – obwohl zu die-
795 796 797 798
NA, UK, FO 371/70711, Birley an Crawford, 12.07.1948. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 52. Vgl.: ebd., S. 51. Vgl.: ebd., S. 51/52. Tscharntke wiederspricht damit im Grunde ihrer eigenen These, die besagt, die britische Militärregierung sei zu keinem Zeitpunkt an der Emanzipation von Frauen in Deutschland interessiert gewesen, sondern hätte nur den Frieden im Land stabilisieren und die Produktion ankurbeln wollen, um die britische Wirtschaft zu entlasten. Vgl.: ebd., S. 14.
Staatspolitische Aufgabe
|
861
sem Zeitraum eine Verringerung der britischen Truppenstärke in Deutschland insgesamt vorgenommen wurde.799 In jede Region wurde zusätzlich ein Officer ersten Ranges den Women’s Affairs Sections für den – wie Tscharntke es formuliert – „political aspect of the question“800 zur Seite gestellt. Etwa in diesem Zuschnitt arbeitete die Women’s Affairs Section weiter, bis sie 1951, mit der zentralen Begründung, sie habe die Initialzündung zu etwas gegeben, was sich nun ohne Hilfe weiter entwickeln müsse, geschlossen wurde. Herta Gotthelf konnte sich, in der Hoffnung, daß die Unterstützung der überparteilichen Frauenorganisationen in Deutschland damit ein Ende gefunden hatte, die Gelegenheit nicht entgehen lassen, das Foreign Office zu diesem Entschluß zu beglückwünschen.801 Gotthelfs Politik eindeutig zu bewerten, fällt schwer. Ihre bis 1951 andauernden Weigerung, sich an der Arbeit des Frauenrings zu beteiligen, läßt sich als Standhaftigkeit im Sinne der sozialdemokratischen Idee werten, sie läßt sich jedoch auch so interpretieren, als habe Gotthelf eine Möglichkeit zur wegweisenden Mitgestaltung der Frauenpolitik im Land verstreichen lassen. In der Hoffnung, daß sich die sozialdemokratische Idee eines Tages als die bessere durchsetzen und die Militärregierung ein ‚Einsehen‘ haben würde, hatte sie das ‚Feld‘ in den überparteilichen Frauenorganisationen den Konservativen und Liberalen überlassen. Darüber, ob dies den Kernzielen der SPD im deutschen Wiederaufbau dienlich war, oder diesen sogar entgegenstand, läßt sich streiten. 7.8.6 OMGUS gründet eine Women’s Affairs Section und wirbt um Bähnisch Daß die USA zu jenem Zeitpunkt ebenfalls begannen, sich zumindest informell um die deutschen Frauen zu kümmern, wird die Spitzen der britischen Regierung gleichermaßen in ihrer Position bestärkt wie mit zusätzlichem Konkurrenzdruck erfüllt haben. Der amerikanisch lizenzierte ‚Tagesspiegel‘ tat, vermutlich auf Drängen von antikommunistisch eingestellten, überparteilich engagierten deutschen Frauen im USSektor, im Januar 1948 das, was Pakenham für so dringend erforderlich hielt. Er warnte seine deutschen Leser vor den Versuchen des DFD, die deutschen Frauen für seine Ziele einzunehmen, „in order to make politically uneducated women aware of the lurking danger.“802 Denise Tscharntke beschreibt die durch den ,Tagesspiegel‘ verbreitete Information so: „Speakers of the DFD, the reader learnt, dismissed party politics, claiming that unbiased women were in a better position to effect change than dogmatic men bound to the tradition.“803 Die Historikerin ist sich sicher, dies sei, wie sie es formuliert, „sweet music to women’s ears“804 gewesen. Auch in den USA verbreitete sich also die Sorge vor dem DFD, der seine enge politische Bindung an die
799 Vgl.: ebd., S. 52. 800 Ebd. 801 AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), Nr. 0203 A, Herta Gotthelf an den Herausgeber der Times, 05.07.1951. 802 Tscharntke: Re-educating, S. 134. 803 Ebd. 804 Ebd.
862 | Theanolte Bähnisch
SED offenbar nicht nur negierte, sondern sich von ‚Parteipolitik‘ ganz allgemein abgrenzte und die besondere ‚Unvoreingenommenheit‘ der deutschen Frauen lobte. Frauen, die mehrheitlich von ‚Parteien‘ nichts mehr wissen, aber dennoch etwas verändern wollten, so befürchtete man, könne der DFD leicht vom Sinn einer Mitgliedschaft im Verband überzeugen. Nachdem sich die Political Affairs Division (PAD) von OMGUS auf Anregung amerikanischer Frauenverbände stärker mit der Möglichkeit der politischen Bildung deutscher Frauen durch Frauenorganisationen auseinandergesetzt hatte, begann sie mit den Fortschritten der Sowjetunion zu konkurrieren: „Soviet Military Administration and its controlled organizations make strenous efforts to establish and encourage women´s groups favorable to Communism. Political Affairs believes that we should no longer overlook the support for our political principles that could be mobilized in the ranks of German women by an office within OMGUS dedicated to that purpose and completely staffed.“805 Der Umstand, daß Kräfte innerhalb der amerikanischen Militärregierung im Januar 1948 ebenfalls mit der Einrichtung einer Women’s Affairs Section liebäugelten806 stand damit, anders als die deutlich frühere Einrichtung einer solchen Sektion bei den Briten, in direktem Zusammenhang mit dem Kalten Krieg.807 Förderlich auf diese Entwicklungen beim OMGUS wirkte sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch das Treffen Bähnischs mit General Lucius D. Clay höchstpersönlich aus.808 Überliefert ist – auch durch die ‚Stimme der Frau‘809 –, daß Bähnisch den Generälen Clay und Robertson im Rahmen eines vorher abgesprochenen Empfangs ein Tablett mit der täglichen Nahrungsmittelration eines Bürgers der britischen Besatzungszone präsentierte, um ihnen vor Augen zu führen, wie klein diese sei. Aus dem in den Akten der britischen Militärregierung überlieferten Bericht über das Treffen, das Tscharntke zufolge Bähnischs privilegierte Position unterstrich810, geht hervor, daß die Regierungspräsidentin und ihre Begleiterin die Generäle auch auf die von den Kommunisten ausgehenden Gefahren durch die schlechte Ernährungssituation und die kommunistische Propaganda aufmerksam machten.811
805 National Archives Suitland‚ Akte ,Women´s Club‘, zitiert nach: Rupieper: Bringing, S. 73. 806 Christl Ziegler zufolge hatte Clay die Einrichtung einer solchen Section am 23.01.1948 in Aussicht gestellt. Am 01.03.1948 wurde sie eröffnet. Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 46. 807 Vgl.: Boehling: Geschlechterpolitik, S. 70. 808 NA, UK, FO 1049/1246, Bericht über den Empfang Bähnischs und Hamanns durch Clay und Robertson in Frankfurt am 19.03.1948, o. D., o. T., Begleitschreiben von T.W. Garvey an den Military Governor und andere Adressaten, 22.03.1948. 809 Wolf: Augen. „This meeting gave Bähnisch the unique chance to show herself as an advocate of German women and in this way to win their sympathies“, schreibt Denise Tscharntke. Tscharntke: Re-educating, S. 169. 810 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 170. 811 NA, UK, FO 1049/1246, Bericht über den Empfang Bähnischs und Hamanns durch Clay und Robertson in Frankfurt am 19.03.1948, o. D., o. T., Anhang zum Begleitschreiben von T. W. Garvey an den Military Governor und andere Adressaten, 22.03.1948. Vgl. dazu auch: Tscharntke: Re-educating, S. 169.
Staatspolitische Aufgabe
|
863
Im März 1948 erfuhr die britische Frauen-Re-education Politik dann jene Bestätigung, die größer kaum sein könnte: Zu diesem Zeitpunkt richtete OMGUS seine eigene Women’s Affairs Section ein. Auch diese organisierte fortan einen Austausch von Vertreterinnen deutscher Frauenorganisationen mit solchen in Westeuropa, aber vor allem in den USA, um die Arbeit der dort tätigen Frauenorganisationen zur Nachahmung zu empfehlen.812 Die amerikanische Section unterstützte, wie Hermann-Josef Rupieper813 herausgearbeitet und Christl Ziegler bestätigt hat, die Arbeit von Frauenorganisationen in Deutschland, auch die von den Organisationen angebotenen Programme zur politischen Bildung von Frauen und überprüfte die Arbeit der Zusammenschlüsse kritisch.814 Sie bemühte sich dabei vor allem darum, eine ‚kommunistische Infiltration‘ zu verhindern. Nicht nur die Arbeitsinhalte, sondern auch der Aufbau der amerikanischen Women‘s Affairs Section glichen im Wesentlichen jener der Briten815. Daß die Rolle der Frauen in Deutschland nun auch für die amerikanische Militärregierung ein wichtiges Thema war und sich ab 1948 eine Kooperation zwischen der britischen und der amerikanischen Militärregierung entwickelte, wird unter anderem an einem Bericht, der über OMGUS den Weg in die britischen Akten fand, deutlich. In diesem Bericht breitete die OMGUS-Mitarbeiterin Elizabeth Holt grundsätzliche Annahmen des OMGUS über Frauenpolitik und den Stand der Frauenarbeit in der US-Zone sowie in ganz Deutschland aus.816 Holt arbeitete zunächst – gemeinsam mit einer deutschen Beraterin und einer deutschen Sekretärin – Lorena B. Hahn zu, die die amerikanische Womens Affairs Section leitete. Die Leiterin war Präsidentin der seit 1919 existierenden, stark patriotischen ‚Women’s Auxiliary of the American Legion‘ – die ihre Kern-Aufgabe in der Wohlfahrtsarbeit mit Veteranen sah und sieht817 – sowie ‚State Director of Welfare‘ für den US-Bundestaat Kansas gewesen, bevor OMGUS sie als Mitarbeiterin in der Welfare Branch anstellte.818 Ihrer Arbeit wird deshalb ein ähnliches Selbstverständnis zugrunde gelegen haben,wie dem der meisten Womens Affair‘s Officers der britischen Militärregierung, die in engem Kontakt zur WGPW und zum British National Council des ICW standen. Im Oktober 1948
812 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 49. 813 Vgl.: Rupieper: Bringing sowie ders.: Die Wurzeln der westdeutschen Nachkriegsdemokratie. Der amerikanische Beitrag 1945–1952, Opladen 1993. 814 Ziegler: Lernziel, S. 49/50. 815 Vgl. dazu die Ausführungen Zieglers: Lernziel, S. 46-50. 816 NA, UK, FO 1049/1847, New Status for Women. Equality, Independence and Modernisation by Elizabeth G. Holt, OMGUS, o. D., o. S. Mordin zufolge ist der Bericht im OMGUS Bulletin vom 03.05.1949 veröffentlicht worden. Die Mitarbeiterin des Büros des Educational Advisor in Berlin, Miss Mordin, hatte den Bericht im Anhang zu einem Schreiben verschickt: NA, UK, FO 1049/1847, S. Mordin, Office of the Educational Advisor, an div. Einrichtungen der britischen Militärregierung, 18.08.1949. 817 Vgl. dazu die Internetpräsentation der Legion auf: http://www.legion.org/auxiliary, am 23.07.2014. 818 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 47.
864 | Theanolte Bähnisch
übernahm Elizabeth Holt, die der Organisation ‚League of Women Voters‘819 nah stand, selbst die Leitung der Section, bis Ruth F. Woodsmall, High-School-Lehrerin und Mitglied der ‚Young Womens Christian Association (YWCA)‘ ihr nachfolgte. Unter Woodsmalls Leitung wurde, im Zuge des Übergangs von den Militärregierungen/Control Comissions zur Alliierten Hohen Kommission, die Section im Dezember 1949 zu einer Branch aufgewertet. Im Februar 1951 übernahm schließlich Mildred B. Allport die Leitung der Branch, bis sie im Februar 1952 aufgelöst wurde.820 Von der Kooperation zwischen der CCG (BE) und dem OMGUS in Sachen Frauen-Re-education zeugen die Akten, die aus den späteren Besatzungsjahren in den Beständen des britischen Foreign Office überliefert sind. Aus ihnen läßt sich ersehen, daß nicht nur Schriftverkehr zwischen den Zonen stattfand, sondern, daß an den Konferenzen der britischen Women’s Affairs Officers stundenweise auch Vertreter der amerikanischen und französischen Militärregierung teilnahmen.821 Die französische Militärregierung spielte, zumal sie nicht auf entsprechende Strukturen im Militärapparat zurückgreifen konnte, keine besonders wichtige Rolle beim Austausch der Westalliierten über Frauen-Re-education beziehungsweise bei der Gestaltung von Frauen Re-education in Deutschland. Die Britinnen erhofften sich von der Einrichtung der Section beim OMGUS einen größeren Informationsfluß, der dem Zusammenwachsen der Zonen sowie der gefühlten Bedrohung durch den gemeinsamen Feind im Osten Rechnung trug und eine Erleichterung des Austauschs von Besucherinnen aus dem Ausland zwischen beiden Zonen.822 Außerdem sah man sich nun in die Lage versetzt, gemeinsam mit einem Verbündeten ein größeres, überfällig erscheinendes Projekt anzugehen: die Planung eines größeren Zusammenschlusses von Frauenorganisationen in Westdeutschland. Da die USA ohnehin den Großteil ihrer Informationen über die Lage der Frauenbewegung im Land von den Briten bezogen, stellten sie die Förderung Bähnischs und des Frauenrings nicht in Frage. Vielmehr unterstützten sie die Bestrebungen der Regierungspräsidentin zur Gründung einer zonenübergreifenden Organisation, indem sie sich an der Vorbereitung jener großen Frauen-Konferenz unter Bähnischs Leitung, der Birley so hoffend entgegensah, beteiligten. Die Vorsitzende des Frauenrings entwickelte sich auch für die Amerikanerinnen zu einer wichtigen Ansprechpartnerin823, zumal, wie Christl Ziegler schreibt, deutsche Organisationen, die in Kontakt mit den als maßgeblich betrachteten internationalen Organisationen ICW
819 Vgl.: Zepp: Redefining, S. 255. 820 Ebd. 821 NA, UK, FO 1050/1230, Joy Evans an verschiedene Einrichtungen der britischen Militärregierung, 07.10.1949, Subject: Seventh Conference of Women’s Affairs Officers. Die Einladung kam auf Initiative der amerikanischen und der französischen Militärregierung zustande. 822 NA, UK, FO 945/283, Entwurf eines Berichtes über ‚Women’s Affairs‘ von A. B. Reeve an Mr. Crawford, Begleitschreiben vom 24.12.1947. 823 NA, UK, FO 1050/1213, Joy Evans an Ruth Woodsmall, 20.03.1950.
Staatspolitische Aufgabe
|
865
und IAW824 sowie der Frauenvertretung bei den Vereinten Nationen standen, in der amerikanischen Women’s Affairs Section als ein „besonderes Gewicht“ wahrgenommen wurden.825 Die Prominenz, die Bähnischs mittlerweile internationale Bekanntheit ihr beim OMGUS verschafft hatte, empfanden die Britinnen, die die Kontrolle über ihr ‚Ziehkind‘ wahren wollten, jedoch nicht nur als positiv.826 Folgendes Beispiel, das einen Vorgriff auf die weiteren Entwicklungen darstellt, sei, um den inhaltlichen Zusammenhang zu wahren, an dieser Stelle gegeben: Um 1950, nachdem der Frauenring bereits als westdeutschlandweite Frauen-Organisation gegründet worden und nicht alles ‚nach Plan‘ verlaufen war, wurden die britischen Women’s Affairs Officers für Kritik, was eine zu starke Einmischung in deutsche Angelegenheiten anging, wieder empfänglicher. Da gefiel es Rita Ostermann überhaupt nicht, daß ‚der‘ Chief Women’s Affairs Officer der US-Amerikaner in Deutschland, Ruth Woodsmall, Theanolte Bähnisch auf direktem Weg kontaktiert hatte. Nachdem die von Birley ersehnte Konferenz bereits stattgefunden hatte, stand die Planung einer weiteren, tripartiten Konferenz mit ausländischen Gästen an. „This woman would very much like to be in the lime light at a conference to which international guests were invited […]. She would in fact try to use the prestige so gained to further her own organization – this impending our work by creating further resentment in other circles“827, faßte Ostermann ihre Erfahrungen mit Bähnisch aus den letzten Jahren zusammen. Das Ziel der Konferenz mit dem Thema ‚The responsibility of women in a democratic society‘ sollte nämlich die Zusammenarbeit verschiedener deutscher Organisationen untereinander fördern. Es scheint geradezu, als hätten die Britinnen damit fragwürdige Entwicklungen der letzten Jahre ausgleichen wollen. Doch die Bande, die Bähnisch mittlerweile zu den Amerikanern geknüpft hatte, erwies sich für solche Bestrebungen als nicht gerade förderlich: „Our work has been made more difficult by the fact that Frau Bähnisch, the Chairwoman of the Deutscher Frauenring, visited Miss Woodsmall in Bad Nauheim and the Conference was discussed there. These discussions were reported to Miss Williams [Women’s Affairs Officer der Briten in Niedersachsen] who asked us how it was intended to ensure co-operation with the French and British elements when plans were discussed in advance with possible German participants“828, echauffierte sich Ostermann. Die Britinnen, genauer noch Rita Ostermann, mußten schmerzlich erfahren, daß sich ihr Ziehkind um 1950 längst nicht mehr kontrollieren ließ. Und die Amerikaner, die jene Konferenz nach ihren Vorstel-
824 Zur International Alliance of Women (IAW) hatten insbesondere Mitglieder des 1945 von Agnes von Zahn-Harnack gegründeten Wilmersdorfer Frauenverbandes Kontakt. Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 85. 825 Ziegler: Lernziel, S. 51. 826 NA, UK, FO 1050/1231, The American Project of an International Women’s Conference, ‘aide Memoire’ on the informal Tripartite Meeting between the Educational Advisor and his French and United States colleagues on 16th Jan 1950 at Bad Nauheim, Auszug. 827 NA, UK, FO 1050/1231, Rita Ostermann an Professor Marshall, Office of the Educational Advisor, 20.03.1950. 828 Ebd.
866 | Theanolte Bähnisch
lungen gestalten wollten, liefen ihrem Junior-Partner in Sachen Frauen-Re-education langsam den Rang ab. Christl Ziegler geht davon aus, daß der „verzögerte institutionelle Aufbau“829 der amerikanisch Women’s Affairs Section mit dazu beigetragen hat, daß die größte Wirkung der Bildungsarbeit der amerikanischen Frauenabteilung nicht mehr unter dem OMGUS, sondern erst unter der Zivilen Hohen Kommission erzielt wurde.830 Dies läßt sich mit dem Fokus auf Bähnisch durchaus bestätigen, denn zu Beginn der 50er Jahre steuerten stärker die USA als Großbritannien den Aufbau einer (neuen) Dachorganisation für Fraueninformation und Frauenbewegung. Doch dazu an anderer Stelle mehr.
829 Ziegler: Lernziel, S. 49. 830 Ebd.
8
Bähnischs wachsende Prominenz in der Außenpolitik und die Entwicklung des Frauenrings zum ‚Deutschen Frauenring‘
8.1 BINATIONAL, INTERNATIONAL, SUPRANATIONAL, ABER VOR ALLEM EUROPÄISCH: BÄHNISCH MEHRT IHREN BEKANNTHEITSGRAD 8.1.1 Mit der Verantwortung wächst die Arbeitsbelastung Brian Robertsons Statement Ende April 1948 machte deutlich, daß die Briten nicht nur an der Unterstützung Theanolte Bähnischs festhalten, sondern, daß sie diese, in Anbetracht der politischen Lage, sogar noch verstärken wollten. Mit dem Scheitern der Münchner Ministerpräsidentenkonferenz, der Londoner Außenministerkonferenz und dem endgültigen Bruch der Beziehungen zwischen den Frauen, die in Westdeutschland überparteilich arbeiten wollten, und jenen, die in der SBZ dem DFD angehörten, hatte sich die Ausgangslage der britischen Frauen-Re-education-Politik im Vergleich zu ihrem Beginn im Jahr 1946 binnen zwei Jahren stark verändert. Die Idee, Zusammenschlüsse deutscher Frauen nur auf kleinstem regionalem und organisatorischem Nenner zuzulassen und so die Aktivitäten deutscher Frauen überschaubar zu halten, war passé. Die maßgeblichen Entscheidungsträger in der Militärregierung drängten nun auf die Entstehung einer starken westdeutschen Frauenorganisation, die deutsche Frauen zu verantwortungsbewußter Staatsbürgerschaft – oder wie es der historisch versierte Militärexperte John Robert Stark pointiert formuliert – zum „demokratischen Kapitalismus“1 – erziehen würde. Dazu war es nötig, sowohl einzelne Führungsfiguren in der Bewegung für diese Aufgabe ‚fit‘ zu machen als auch die Netzwerke zu stärken, in denen der Plan verfolgt wurde, eine große westdeutsche Frauenorganisation zu gründen. Die Effekte der letzten großen Frauenkonferenzen in Bad Boll, Pyrmont und Frankfurt hatten gezeigt, daß eine Vertiefung der Zusammenarbeit von Frauenorganisationen in Westdeutschland jeweils vor allem auf den interzonalen Zusammenkünften sowie bei deren Vor- und Nachbereitung stattgefunden hatte. Um zu einem zonenübergreifenden Zusammenschluß von Frauenorganisatio-
1
Stark: Majority, S. 196.
868 | Theanolte Bähnisch
nen in Westdeutschland zu kommen, war eine neue große Frauenkonferenz unverzichtbar. Unter wessen Leitung sie aus der Sicht der Briten stehen sollte, wer also den maßgeblichen Schritt zur Bildung eines zonenübergreifenden Zusammenschlusses leisten sollte, darin waren sich der Staatssekretär für Deutschlandfragen, Lord Pakenham, der Militärgouverneur der britischen Zone, Brian Robertson, Educational Advisor Birley sowie Chief Women’s Affairs Officer Rita Ostermann einig. Nachdem auch die USA im März 1948 eine Women’s Affairs Section etabliert hatten und die von OMGUS unterstützte Frankfurter Tagung im Mai 1948 vorbei war, schien die Gelegenheit für die Briten günstig, den nächsten ‚Streich‘ zu planen. Daß noch knapp eineinhalb Jahre verstreichen sollten, bevor es zu einer weiteren überzonalen Konferenz unter Bähnischs Leitung kommen sollte, auf der Frauen aus den westlichen Besatzungszonen sich austauschen konnten, hatten weder der Militärgouverneur der britischen Zone, Brian Robertson, noch die Leiterin der als besonders vielversprechend gehandelten Frauenorganisation, Bähnisch, erwartet. Die Regierungspräsidentin hätte eine solche Veranstaltung gern schon für den Dezember 1948 einberufen. Und die Unterstützung der Militärregierung hierfür wäre ihr sicher gewesen. Doch die Währungsreform im Juni 1948 hatte in vielen Privathaushalten zu so gewaltigen Einschnitten geführt, daß viele Frauen, die an der Gründung einer westdeutschlandweiten Frauenorganisation interessiert waren und in ihr mitarbeiten wollten, es sich schlichtweg nicht leisten konnten, zu einer Konferenz in einer anderen Besatzungszone zu reisen.2 Theanolte Bähnisch konzentrierte sich zwischenzeitlich also auf andere Projekte, die jedoch allesamt inhaltlich mit der Arbeit des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ in Einklang standen3 und ihr dabei halfen, ihre Kompetenzen zu erweitern, neue Kontakte im Inland zu knüpfen, ihren Ruf im Ausland zu mehren und dem besiegten und verfemten Staat wieder zu einer Stimme auf dem internationalen Parkett zu verhelfen. Neben den allgemeinen Verpflichtungen, die ihr Amt als Regierungspräsidentin mit sich brachte, und den zusätzlichen Projekten, wie der Herausgabe der ‚Stimme der Frau‘ ab Mai 1948 sowie die Unterstützungsarbeit für Berliner Frauen während der Berlin-Blockade von Juli bis Dezember 19484, jagte eine Veranstaltung, auf der sie im Sinne der schrittweisen Wiederaufnahme einer friedlichen Außenpolitik Deutschlands Präsenz zeigen wollte oder sollte, die nächste.
2
3
4
DFR-Archiv, A2, Sekr. [Prejawa] an Nora Melle, 20.12.1948. Denise Tscharntke schreibt, daß Theanolte Bähnisch auch im Jahr 1960 die Währungsreform als einen Grund für die Verschiebung der Konferenz auf den Oktober 1949 genannt habe, sie nennt aber keine Quelle. Vgl. Tscharntke: Re-educating, S. 171. In einem Entwurf für einen Tätigkeitsbericht des Frauenring Hannover sind die im Folgenden beschriebenen Reisen unter der Rubrik ‚Repräsentation nach außen‘ aufgeführt. DFRArchiv, A1, Zusammenstellung von Fakten für den 1. Geschäftsbericht zur 1. Hauptversammlung 1952 durch Maria Prejawa, 1951. Offenbar waren vom Frauenring in Hannover über 100 Zentner Lebensmittel gesammelt worden sowie zusätzlich 5.000 Eier. DFR-Archiv, A1, Zusammenstellung von Fakten für den 1. Geschäftsbericht zur 1. Hauptversammlung 1952 durch Maria Prejawa, ehrenamtl. Geschäftsführerin, 1951.
Wachsende Prominenz | 869
Im Gegensatz zu einigen preußischen Politik- und Verwaltungseliten sowie zu einigen führenden Mitgliedern des BDF in der Weimarer Republik, mit denen sich die Regierungspräsidentin (auch) nach 1945 umgab, war Theanolte Bähnisch bis 1945 im europäischen Ausland ein ‚Nobody‘ gewesen. Eine Serie von Terminen, die sich aus ihrer Personalakte rekonstruieren läßt, demonstriert, wie sehr ihre Prominenz im Ausland während der kurzen Zeit seit Kriegsende gewachsen war. Und anhand ihrer Auslands-Reisen wird deutlich, wie stark sich ihre internationale Reputation auf die Dienstgeschäfte in Hannover auswirkte. Daß die vielbeschäftigte Frau im Zuge ihres breiten Engagements oftmals gesundheitlich an ihre Grenzen gelangte, deutet sich im Zusammenhang mit den Aktivitäten Bähnischs im In- und Ausland bis zum Sommer 1949 bereits an. Stärker noch wird diese Entwicklung in der Auseinandersetzung mit Bähnischs Reisen und anderen Aktivitäten ab Herbst 1949, die später behandelt werden sollen, deutlich werden. Nach der Konferenz von Frankfurt kam es ähnlich wie nach der Tagung in Pyrmont im Jahr zuvor: Bereits Mitte August 1948 fühlte sich die Vorsitzende des Frauenrings stark erholungsbedürftig, nahm aber aufgrund der Vielzahl der anstehenden Termine nur einen kurzen Erholungsurlaub.5 Irgendwann in der zweiten Jahreshälfte schien jedoch eine längere Erholungspause unumgänglich geworden zu sein: Der Leiterin des Staatsbürgerinnen-Verbandes, Else Ulich-Beil, schrieb sie, daß sie sich „in erster Linie wegen Überanstrengung des Herzens und der Nerven“6 zur Kur in Bad Wörishofen aufgehalten habe. Anfang September 1948 muß sie noch im Dienst gewesen sein, denn zu dieser Zeit ließ sie sich für die Teilnahme am ‚Kongreß für moralische Aufrüstung (MRA)‘ im schweizerischen Caux dienstbefreien.7 Der US-amerikanische protestantische Pfarrer Frank Buchmann hatte den Kongreß, nach allem was bekannt ist, initiiert, um seiner metaphysisch inspierierten Suche nach einer sinnhaften Verbindung von Demokratie und Christentum eine Plattform zu schaffen.8 Ein Meldung in der ‚Stimme der Frau‘ über das Ereignis deutet an, daß der Besuch der Veranstaltung für die Herausgeberin der ‚Stimme der Frau‘ wohl eine Herzensangelegenheit gewesen war.9 „Die deutsche Öffentlichkeit kennt MRA durch Spielgruppen, die hin und wieder deutsche Städte besuchen und Theterstücke aufführen, in denen hartgesottene Ar-
5 6 7 8
9
NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Bähnisch an den niedersächsischen Ministerpräsidenten, Staatskanzlei, 10.08.1948. DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Ulich-Beil, 30.12.1948. NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Bähnisch an den niedersächsischen Ministerpräsidenten, Staatskanzlei, 01.09.1948. Arnold Sywottek stellt die Arbeit des MRA in den Zusammenhang mit der Verbreitung der Totalitarismus-Theorie. Vgl.: Sywottek: Sowjetunion, S. 317. Der Journalist Engdal Thygesen sah im MRA ein ‚Kind‘ der Oxford-Bewegung, einer Frömmigkeitsbewegung, die der Pfarrer Buchmann in den 1920er Jahren begründet hatte. Vgl.: Thydesen, Engdahl: Von Oxford bis Caux, in: Die Zeit, 26.04.1951. Vgl. auch den stark befürwortenden, älteren Artikel: Hocke, Gustav René: Ein geistiger Kreuzzug, in: Die Zeit, Nr. 35, 26.08.1948. Vgl.: O. V.: Aus der Welt. Kongreß für moralische Aufrüstung, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 5, S. 29.
870 | Theanolte Bähnisch
beitgeber und meuternde Arbeitnehmer durch Änderung ihrer persönlichen Einstellung innige Freundschaft schließen“10, frotzelte der SPD-nahe ‚Spiegel‘, ohne jedoch auf den inhaltlichen Zusammenhang zu den sozialromantischen Vorstellungen, von denen Anhänger der Sozialreformbewegung, darunter auch einige Mitarbeiter der SAG-Berlin-Ost, getrieben waren, anspielen zu wollen. Für Theanolte Bähnisch dürften Wiedererkennungseffekte, zumal beide Programme auf eine ‚moralische Umkehr‘ setzten, durchaus aufgetreten sein. Folgt man dem reißerisch aufgemachten Spiegel-Artikel, so waren auch der niedersächsische Minister Heinrich Hellwege, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Karl Arnold sowie Konrad Adenauer, mit denen Bähnisch in der Folgezeit auch in einem anderen Zusammenhang zusammenarbeiten sollte, von Frank Buchmans Arbeit überzeugt.11 Vermutlich fiel Bähnischs Kur in Wörishofen in die Zeit vom 15.11. bis zum 21.12.1948. Ab dem 22.12. des Jahres bat sie um Dienstbefreiung für eine weitere Auslandsreise, diesmal nach Großbritannien, wohin die ‚Hansard Society‘ sie eingeladen hatte. „Gleichzeitig wurde mir gesagt, daß man Wert darauf legt, daß ich dieser Einladung Folge leiste“12, unterstrich Bähnisch gegenüber Ministerpräsident Kopf die Relevanz der Mission und ihrer Person. Und ein Schreiben der Militärverwaltung des ‚Headquarter Regierungsbezirk Hanover‘ tat sein Übriges dafür, daß Kopf gar keine Wahl hatte und die Reise zur Veranstaltung jener Gesellschaft genehmigen mußte, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Idee der parlamentarischen Demokratie zu verbreiten und Bürger dazu zu motivieren, sich stärker in die Politik einzubringen: „I hope that there will be no objection on your side as Military Government certainly supports the visit“13, hatte sich Commander Jackson dem Ministerpräsidenten gegenüber unmißverständlich ausgedrückt. Schließlich blieb die prominente Mitarbeiterin von ‚Landesvater‘ Kopf sogar zwei Tage länger als geplant in Großbritannien, „da das Foreign Office den Wunsch geäußert hatte, daß ich zu Besprechungen noch zur Verfügung stehen möchte.“14 Wen genau sie im Foreign Office aufsuchte, ist dem Antrag auf Dienstbefreiung nicht zu entnehmen, was der Mission einen leicht sagenumwobenen Charakter verlieh. Vermutlich traf sich die Leiterin des Frauenrings mit Reeve, womöglich auch mit anderen, hochrangigeren Mitarbeitern des Foreign Office, die sich ein persönliches Bild jener neuen Führungspersönlichkeit der deutschen Frauenbewegung machen wollten. Besonders interessant an der Tatsache, daß Bähnisch auf Einladung der Hansard Society nach Großbritannien reiste, ist der Umstand, daß die Political Division der CCG (BE) in den Einladungen jener Gesellschaft vor allem eine Möglichkeit sah,
10 O. V.: Gesellschaft/Moralische Aufrüstung. Die Caux-Existenz, in: Der Spiegel, 13.10.1954. 11 Ebd. 12 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Bähnisch an den niedersächsischen Ministerpräsidenten, Staatskanzlei, 03.01.1949. 13 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Headquarter Regierungsbezirk Hannover, Comd. Jackson an den Ministerpräsidenten, 03.01.1949. 14 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Bähnisch an den niedersächsischen Ministerpräsidenten, Staatskanzlei, 10.02.1949.
Wachsende Prominenz | 871
Christdemokraten zum bi-nationalen Austausch zu motivieren. Damit sollte ein Ausgleich zu den Kontakten, welche zwischen der Labour Party und der SPD sowie den Gewerkschaften bestanden, geschaffen werden.15 Eingefädelt hatte die Reise, die die Juristin gemeinsam mit zwölf anderen hochrangigen Delegierten antrat, Brian Robertson persönlich.16 Ihm war mittlerweile bewußt, daß Bähnisch in einer gemischten Delegation den britischen Parlamentarismus lieber studieren würde als nur unter Sozialdemokraten und daß sie im Rahmen einer solchen Runde auch wohlgelittener sein würde als in einem Programm, das speziell auf die SPD zugeschnitten war. 8.1.2 Engagement in der ‚Europäischen Bewegung‘ Bähnischs nächste Reise in internationaler – oder, wie sich auch sagen ließe, supranationaler Mission – ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Wochen nach ihrer Reise nach London nahm sie als Delegierte an der Europa-Konferenz in Brüssel vom 25. bis zum 28.02.1949 teil – und damit an jener historisch bedeutsamen Sitzung, auf der, im Rahmen der Abschluß-Deklaration der Konferenz, die Aufnahme Westdeutschlands in den Europarat gefordert werden sollte.17 Zwischenzeitlich waren nämlich die Initiatoren der ‚Europäischen Bewegung‘18, welche als Dachorganisation verschiedener Zusammenschlüsse dienen sollte, die der Idee einer politischen Einigung Europas anhingen, auf die Regierungspräsidentin aufmerksam geworden.19
15 NA, UK, FO 1049/1845, Political Division an Marjorie Marxse, Conservative & Unionist Central Office, 03.08.1949. Marxse zufolge taten sich die britischen Konservativen schwer damit, Kontakte zur CDU zu pflegen, weil sie keine Partei unterstützen wollten, die keinen progressiven Konservativismus pflege. NA, UK, FO 1049/1845, Marjorie Marxse an Rita Ostermann, 11.08.1949. 16 O. V.: Germans to study British Methods. Political leaders visit, in: The Times, ohne Datumsangabe überliefert in NA, UK, FO 1050/1213 [Januar/Februar 1949]. 17 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Bähnisch an den niedersächsischen Ministerpräsidenten, Staatskanzlei, 22.02.1949. Ihre Teilnahme findet sich bestätigt in AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 446 [Europäische Bewegung Konferenzen], Bericht über den ersten Kongress des Internationalen Rates der Europäischen Bewegung, Brüssel, 25.–28. Februar 1949, von Eugen Kogon, o. D. 18 Der Leiter des britischen ‚United Europe Movement‘, Duncan Sandys, hatte im Mai 1948 den ‚Haager Kongreß‘ organisiert. Daran anschließend sollten Nationale Räte der Europäischen Bewegung gegründet werden, die sich dann zu einem internationalen Rat europäischer Länder zusammenschließen sollten. Eugen Kogon, der ab Mai 1949 Präsident der Europa-Union war, leistete ausschlaggebende Unterstützung zur Gründung des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung, indem er im Januar 1949 die Initiative ergriff und etwa 90 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens einlud, um ein Exekutivkomitee zu bilden. 19 Brunn: Einigung, S. 57/58. 1949 gab es in Deutschland vier Organisationen, die sich die „Teilnahme an der europäischen Einigung“ (Eugen Kogon) zum Ziel gesetzt hatten. Die ‚Europa-Union‘, der ‚Bund deutscher Föderalisten‘, die ‚Liga für Weltregierung‘ und der ‚Internationale Studentenbund für übernationale Föderation.‘ Zitat Kogon in: AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 6, Eugen Kogon: Die Organisation der Aufga-
872 | Theanolte Bähnisch
Namentlich waren es der britische Diplomat und Schwiegersohn Winston Churchhills20, Duncan Sandys (Conservative Party), der Politologe, Journalist und Autor des vielrezipierten Werkes ‚Der SS-Staat‘, Eugen Kogon sowie der ehemalige Reichstagspräsident und nunmehrige Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses der SPD, Paul Löbe, der gleichzeitig Mitherausgeber des stark antikommunistischen ‚Telegraf‘ war. Diese drei Männer hatten Theanolte Bähnisch als eine von 90 einflußreichen Persönlichkeiten aus Westdeutschland und Berlin zu ihrem ersten großen Treffen am 21.01.1949 eingeladen, auf dem ein Übergangs-Komitee gebildet werden sollte.21 Das Übergangs-Komitee sollte die Gründung eines deutschen Rats in die Hand nehmen, der dem internationalen Rat der Europäischen Bewegung – später ‚Europarat‘ – genannt, beitreten sollte. Damit war die Vorsitzende des Frauenrings von der ‚Europäischen Bewegung‘ in Deutschland als ‚Vertreterin der deutschen Frauen‘ anerkannt worden, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch keinen nationalen Verband leitete. Unter jenen Personen dürfte sich herumgesprochen haben, daß Bähnisch über die Leitung eines deutschen Councils des ICW bald in die Politik der Vereinten Nationen (UNO) involviert sein würde22. Dies machte sie zu einem besonders interessanten potentiellen Mitglied der ‚Europäischen Bewegung‘ in Deutschland, welche die Begründung eines ‚deutschen Rats‘ anvisierte, noch bevor wieder ein deutscher Staat gegründet war. Dies war insofern ein logischer Schachzug, als es der Bewegung in Deutschland nicht zuletzt auch darum ging, der Welt zu beweisen, daß die Zeit, in der Deutschland ‚über allem‘ stehen wollte, vorbei sei. „Bei uns kam noch hinzu, daß wir der Welt zeigen wollten, daß von uns nie wieder etwas zu fürchten sei, weil wir politisch wie militärisch im Vereinten Europa aufgehen und an seinem Aufbau mitarbeiten wollten“23, schrieb Theanolte Bähnisch 1971 über ihre Beweggründe, sich in der Europäischen Bewegung zu engagieren, als die Friedensaktivistin und spätere Grünen-Politikerin Petra Kelly, die zu dieser Zeit Praktikantin beim Europäischen Institut in Amsterdam war, darum gebeten hatte. Als weitere, für alle europäischen Staaten relevanten Gründe hatte die Staatssekretärin noch den Kalten Krieg, die „Angst vor Rußland“ und das Bedürfnis, weitere Kriege in Europa zu verhindern, genannt. „Ein vereinigtes Europa war die einzige politische Idee, die vor allem uns noch einmal mit etwas Hoffnung in die Zukunft blicken ließ“24, las man auf ihrem Antwortbogen zu Kellys Fragen, aber auch, daß „wir“ Deutschen „bezüglich
20
21 22 23 24
ben des Deutschen Rates in der Europäischen Bewegung, Darlegungen bei der konstituierenden Versammlung im Staatstheater zu Wiesbaden, 13.06.1949. Die Rede Churchills im September 1946 über die Neuordnung Europas, in der Churchill für eine Gemeinschaft unabhängiger Staaten eintrat, wird als Initialzündung für die Europäische Bewegung in der Nachkriegszeit angesehen. Vgl.: Niess: Idee, S. 64–67. NA, UK, FO 1049/2151 [Associations European Union], Political Advisors Office, Frankfurt to German Political Department, Foreign Office, 10.02.1949. NA, UK, FO 945/283, Lady Nunburnholme [Vizepräsidentin des ICW] an A. B. Reeve [Foreign Office] 13.05.1947. AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 41, Betr.: Einige Antworten auf den Fragebogen von Fräulein Kelly, von Theanolte Bähnisch, 24.08.1971. Ebd.
Wachsende Prominenz | 873
Europa viel zu viel Illusionen“ gehabt hätten und „alles zu schnell erreichen“25 wollten. Als eine von acht deutschen Delegierten nahm Theanolte Bähnisch also im Februar 1949 an der Sitzung des Internationalen Rats der ‚Europäischen Bewegung‘ in Brüssel teil, zu der insgesamt 75 Delegierte aus verschiedenen Nationen erschienen waren.26 Die bereits weiter oben angesprochene Erklärung, die aus der Veranstaltung resultierte, hatte folgendes ‚Nachspiel‘: Nach der am 05.05.1949 unterzeichneten Satzung des Europarats erhielt Westdeutschland, das von drei Staaten besetzt war, eine Sonderstellung: Deutschland konnte an den Beratenden Versammlungen teilnehmen, war jedoch im Ministerrat, wo die Außenminister der europäischen Staaten zusammenkamen, nicht vertreten. Diese Lösung tangierte die Rechte der Besatzungsmächte nicht, den deutschen Vertretern der europäischen Idee war jedoch gleichzeitig die Bereitschaft zur Aufnahme Deutschlands in den Rat signalisiert worden.27 Wann genau Theanolte Bähnisch für die ‚europäische Idee‘ Feuer fing, ist schwer zu sagen. In der ‚Stimme der Frau‘ wurde bereits 1948 in einem Bericht über die ‚Europäische Bewegung‘ betont, daß das zu dieser Zeit faktisch politisch entmachtete Deutschland an den Planungen zur Europäischen Union beteiligt sei und zwar „nicht wie ein Zaungast, sondern wie jedes andere Land“. 28 Es ist also durchaus möglich, daß die Herausgeberin der Zeitschrift von sich aus den Kontakt zu Protagonisten der Bewegung gesucht hatte. Die in der Zeitschrift geäußerte Hoffnung, daß „Westdeutschland, nach Möglichkeit bald ganz Deutschland […] ein integrierter Bestandteil der Europäischen Union“ werden würde, „in der jedes Volk dieselben Rechte und dieselben Pflichten haben wird“29 erfüllte sich – für Westdeutschland – am 02.05.1951 mit dem Beitritt der BRD zum Europarat, dem ersten politischen Gremium Europas. Auf der Versammlung des Internationalen Rats der Europäischen Bewegung im Februar 1949, an der Bähnisch teilgenommen hatte, hatte der Rat auch die Einrichtung eines Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte empfohlen. Dieser wurde schließlich erst zehn Jahre später auf der Grundlage der 1953 in Kraft getretenen Europäischen Konvention für Menschrechte in einer feierlichen Sitzung anläßlich des zehnjährigen Jubiläums des Europarats am 20.04.1959 gegründet.
25 Ebd. 26 Andere Teilnehmer aus Deutschland waren der Ministerpräsident Karl Arnold, der Bürgermeister von Hamburg Max Brauer, Prof. Dr. Pfeifer, Eugen Kogon, Prinz Karl zu Löwenstein, Minister Karl Spieker und die Ministerin Christine Teusch. Vgl.: Enders, Ulrich: Der Konflikt um den Beitritt der Bundesrepublik und des Saarlandes zum Europarat, in: Herbst, Ludolf/Bührer, Werner/Sowade, Hanno (Hrsg.): Vom Marshall-Plan zur EWG: die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die westliche Welt, München 1990, S. 19–46, hier S. 22, Anm. 9. 27 Vgl.: Enders: Konflikt, S. 22. 28 Vgl.: O. V.: Europäische Bewegung. Organisation und Entwicklung, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 1, S. 4. 29 Ebd.
874 | Theanolte Bähnisch
Ähnlich wie die überparteilich agierende Frauenbewegung nutzte die ‚Europäische Bewegung‘ vor allem Kongresse, um sich auszutauschen, Ziele aufzustellen, das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken und um Kampagnen zu lancieren, mit deren Hilfe man auf Regierungen Einfluß nehmen wollte30, ein Vorgehen, das Bähnisch aus der überparteilichen Frauenbewegung vertraut war. Ihr Engagement in der ‚Europäischen Bewegung‘ ermöglichte der Regierungspräsidentin nicht zuletzt deshalb, neue wichtige Kontakte im In- und Ausland zu knüpfen und alte wiederaufzufrischen. Zu den Mitgliedern der ‚Deutschen Sektion der europäischen Bewegung‘, zählten unter anderem Konrad Adenauer und Theodor Heuss. Wichtige Rollen bei der Gründung der Bewegung und in Vorstandsämtern hatten in der frühen Phase der Herausgeber der ‚Zeit‘, Ernst Friedländer, der hessische Staatssekretär Hermann Brill (SPD), Staatsrechtler und SPD-Parteivorstandsmitglied Carlo Schmidt, Fritz Erler31, der zu jener Zeit Landrat von Tuttlingen war, und Heinrich von Brentano gespielt. Mit den Mitgliedern des „Frühstückskartells“, Schmid, Erler und Wehner, das sich innerhalb der SPD schließlich mit seinen Parteireformvorstellungen durchsetzen konnte, stand Bähnisch bis in die 60er Jahre in schriftlichem Kontakt.32 Zum ‚kleineren Kreis‘ des deutschen Rates, aus dem sich später in etwa das Exekutiv-Komitee rekrutierte, gehörten – neben den bereits genannten – viele weitere Personen, die dafür bekannt waren, eher ‚verbinden‘ als polarisieren zu wollen, beispielsweise der Generalsekretär des süddeutschen Länderrats, Erich Roßmann. Dieser hatte versucht, im Vorfeld der Münchner Ministerpräsidenten-Konferenz, bei den Ministerpräsidenten in der SBZ für Vertrauen gegenüber den Ministerpräsidenten in den Westzonen zu werben.33 Ebenfalls zum kleineren Kreis gehörten der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Nordrhein-Westfalens, Walter Menzel (der eine Tochter des preußischen Ministerpräsidenten Carl Severing geheiratet hatte), der Präsident des Wirtschaftsrats der Bizone, Erich Köhler, der Landrat Walter Hummelsheim, der später die Rolle des Generalsekretärs der ‚Deutschen Sektion der Europäischen Bewegung‘ übernahm, der Landrat und spätere Ministerpräsident Niedersachsens, Heinrich Hellwege, der Präsident der ‚Europäischen Akademie‘ in Schlüchtern und Rektor der Universität Heidelberg, Prof. Karl Geiler, sowie Friedländer. Der Vorsitzende der Bayerischen FDP und spätere Bundesjustizminister Thomas Dehler, der Hessische
30 Vgl.: Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland (Hrsg.): Festschrift 60 Jahre europäische Bewegung, Berlin 2009, Online-Version auf: http://issuu.com/netzwerkebd/docs/ebdfestschrift, am 13.12.2013, passim. 31 Erler war 1950 parlamentarischer Sekretär der Deutschen Parlamentarischen Gruppe der Europäischen Bewegung. 32 Ein Brief an Erler, in dem es um die Gründung einer großen Koalition in den 60er Jahren geht, findet sich in AdSD, Nachlaß Fritz Erler, Nr. 217 A, Bähnisch an Erler, 31.08.1966. Der Verleger Kurt Ganske, der auch die von Bähnisch herausgegeben Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ verlegte, sollte diese unterstützen. Zum schriftlichen Kontakt mit Schmid siehe Kapitel 8.6.3. 33 Vgl.: Overesch, Manfred: Dokumentation. Die Reise des Generalsekretärs Erich Roßmann in die Ostzone vom 15. bis 20. Mai, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 23. Jg. (1975), Heft 4, S. 454–466.
Wachsende Prominenz | 875
Staatsekretär Hermann Brill (SPD) und der Staatsminister a. D. Dr. Josef Baumgärtner waren ebenfalls im engen Kreis vertreten.34 Im späteren Exekutiv-Komitee, wie auch in der sozialpolitischen Kommission, arbeitete auch die Bähnisch hinlänglich bekannte Leiterin der Frauenarbeit im DRK, Gräfin Waldersee mit.35 Unter anderem aus einem Brief, den der oben genannten Heinrich von Brentano an sie schrieb, wird deutlich, daß Theanolte Bähnischs Arbeit in der ‚Europäischen Bewegung‘ in zwei wichtigen Punkten derselben Logik wie ihr Wirken im Frauenring folgte: Auch in der ‚Europäischen Bewegung‘ konnte sie mit Personen zusammenarbeiten, die, wie sie, an eine konstruktive Zusammenarbeit von Persönlichkeiten über Parteigrenzen hinweg glaubten. So schrieb der CDU-Politiker und spätere Außenminister Heinrich von Brentano anläßlich von Bähnischs Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst an die scheidende Staatssekretärin: „Ich denke immer gerne an die vorzügliche Zusammenarbeit mit Ihnen, und ich hoffe, daß wir sie wenigstens im Rahmen der europäischen Bewegung fortsetzen können, wo unsere Vorstellungen, Wünsche und Ziele ja völlig übereinstimmen.“36 Für die Form des Engagements Bähnischs um 1950 lassen sich hieraus einige Anhaltspunkte ableiten, obwohl die Zielsetzung beider Protagonisten nicht bis 1964 statisch geblieben sein wird und obwohl nicht klar ist, ob Bähnisch – von der kein europapolitisches Konzept überliefert ist – jene Aussage so unterschrieben hätte. Folgt man der Einschätzung Frank-Lothar Krolls über Brentanos Europapolitik, so trat der spätere Außenminister als ein wertkonservativer Ideenpolitiker auf, der „geleitet von einem unverrückbar feststehenden Kernbestand weltanschaulicher Positionen, staatsmännisches Handeln stark an Grundsätzen und Prinzipien ausrichtete“37. Anders als Konrad Adenauer, der ebenfalls zum Gründungskreis der ‚Europäischen Bewegung‘ gehörte, billigte Brentano, Kroll zufolge, „konkreten Fragen der politischen und wirtschaftlichen, der infrastrukturellen und organisatorischen Integration“38 keine große Relevanz in seinen Reden zu. Mit seiner Betonung christlicher Traditionen und humanistischer Werte, so Kroll, sei Brentano mit den „Denkmustern
34 NA, UK, FO 1049/2151, Anhang zu einem Schreiben des Political Advisor Office, Frankfurt an das German Political Department, Foreign Office, 10.02.1949 sowie AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 447, Liste der Mitglieder des ExekutivKomitees des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung, o. D. 35 Eine Liste der Mitglieder des Exekutiv-Komitees von 1951 findet sich in: AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 447, Liste der Mitglieder des ExekutivKomitees des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung. Die Zusammensetzung der sozialpolitischen Kommission wird deutlich in: AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 27, Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Exekutiv-Komitees des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung am 11.07.1949 in Bernkastel-Kues, Landratsamt. 36 AddF, SP-01, Heinrich von Brentano an Theanolte Bähnisch, 24.04.1964. 37 Kroll, Frank-Lothar: Epochenbewusstsein, europäisches Einigungsdenken und transnationale Integrationspolitik bei Heinrich von Brentano, in: Depkat/Graglia (Hrsg.): Entscheidung, S. 189–204, hier S. 193. 38 Kroll: Brentano, S. 196.
876 | Theanolte Bähnisch
der in den 1950er Jahren verbreiteten Abendland-Ideologie“39 konformgegangen. Als deren „Versatzstücke“40 beschreibt der Neuzeithistoriker die „Rückbesinnung auf religiös-christliche Grundlagen der europäischen Kultur; eine bewusste Frontstellung gegen den Rationalismus der Aufklärung; Entgegensetzung von personal verantworteter Freiheit einerseits, kollektivistisch genormter Massenexistenz andererseits.“41 Diese Elemente hätten die Ideenlandschaft der frühen Bundesrepublik nachhaltig geprägt, schreibt Kroll.42 „Die enge Anbindung an die Wertvorgaben und Ordnungsvorstellungen des ‚Westens‘, das Arrangement mit der liberalen Demokratie angloamerikanischer Provenienz“ habe, so Kroll, den „konservativen ‚Abendland‘Apologeten als die “‚einzig verbliebene Alternative zum Bolschewismus‘“43 gegolten. In Krolls Betrachtungen über Brentano wird deutlich, daß nicht nur Bähnisch, sondern auch Brentano seiner Begeisterung für Europa das Feindbild des Kommunismus beziehungsweise des Slawen sehr bewußt gegenüberstellte. Das Bild von den „andrängenden Nomadenhorden“ des heidnischen „Ostens“44, das Brentano in verschiedenen Reden zeichnete, erinnert an das in einer Kurzgeschichte in der ‚Stimme der Frau‘ bemühte Bild vom „hochgewachsenen, dunklen“ Mann, der Gerda, eine deutsche Flüchtlingsfrau, aus „schrägliegenden Augen“ anblickte und sich ihr durch sein „wildes und begehrliches Wollen“45 getrieben, näherte.46 Insbesondere am Beispiel Brentano wird deutlich, daß sich die Vorstellung, das ‚neue Europa‘ möge aus der Wiege des ‚christlichen Abendlandes‘ emporsteigen und dem Kommunismus die Stirn bieten, diskursiv mit Bähnischs allgemeinem Bedürfnis nach einer Rechristianisierung der Gesellschaft – man erinnere sich an ihren Vortrag ‚Zwischen Himmel und Erde‘, der vor allem die Frauen an ihren ‚naturgegebenen‘ Glauben erinnern sollte – verbinden ließ.47
39 40 41 42 43 44
Ebd. Ebd. Ebd., S. 193/194. Ebd., S. 194. Ebd., S. 194. Rede von Brentano, in: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Bonn 1995, S. 1069f, zitiert nach Kroll: Brentano, S. 195. 45 Brockdorff, Gertrud von: Kann ich hier übernachten, in: Stimme der Frau, 1. Jg., (1948/49), Heft 7, S. 20–22. Die gängigen Hilfsmittel liefern keine Informationen zur Autorin. Ihren Romanen ist zu entnehmen, daß sie von 1893 bis 1961 lebte und den Titel ‚Baronin‘ trug. Sie war Schriftstellerin und veröffentlichte viele Romane, die zum Teil der Gattung ‚Kriegs- und Heimatdichtung‘ zuzuordnen sind. Die Werke tragen Titel wie ‚Der brennende Osten‘ (1921), ‚Die Deutschen von Orchowo‘ (um 1925), ‚Die letzte Zarin‘ (1930) und ‚Brennende Liebe – brennendes Land‘ (1953). 46 Vgl. zur Interpretation, auch was die propagandistische Verwendung der von Rotarmisten ausgehenden Massenvergewaltigungen gegen den ‚Osten‘ angeht: Freund: Krieg, S. 127– 130. 47 Vgl. zum christlich-katholischen Gehalt der Abendland-Formel auch Conze, Vanessa: Abendland, auf European History Online (EG0), published by the Leibniz Institute of Eu-
Wachsende Prominenz | 877
Die ohnehin schon so vielbeschäftigte Frau Bähnisch wurde schließlich mit der Aufgabe betraut, als eine der Vizepräsidentinnen48 des am 13.06.1949 gegründeten ‚Deutschen Rates der Europäischen Bewegung‘ zu fungieren und gemeinsam mit der nordrhein-westfälischen Kultusministerin Christine Teusch (CDU), die sie ja bereits aus der gemeinsamen Arbeit im DFR kannte, die Kulturkommission zu leiten.49 In dieser Funktion bereiteten Teusch und Bähnisch den Kultur-Kongreß in Lausanne vor50 und wählten ab 1950 auch die deutschen Bewerber für das Europa-Kolleg in Brügge aus. Die beiden entschieden also über die Nachwuchs-Elite, welche künftig Henry Brugmans Vision von ‚Europa‘ ausgestalten und das Netzwerk von EuropaAktivisten aus verschiedenen Ländern stärken sollte.51 Dem heute noch existierenden, angesehenen Kolleg gehörten bereits 1949 drei deutsche Studenten an.52
48
49
50 51
52
ropean History (IEG), Mainz 2012-03-09. URL: http://www.ieg-ego.eu/conzev-2012-de URN: urn:nbn:de:0159-2012030759 [YYYY-MM-DD], am 13.12.2013. NA, UK, FO 1049/2151, Political Advisors Office, Frankfurt to German Political Department, Foreign Office, 19.10.1949. Im Dokument wird als Vorsitzender des Rats Paul Löbe, als Vorsitzender des Exekutivkomitees Eugen Kogon genannt. Als Vizepräsidentin und präsidentinnen sind neben Bähnisch auch Christine Teusch, Elli Heuss-Knapp, Wolfgang Schaedla-Ruhland, Carlo Schmid und der Landesminister von Nordrhein-Westfalen (ohne Geschäftsbereich) Carl Spiecker (Zentrum) genannt. Spiecker war, wie Eugen Kogon, Mitglied der ‚Gesellschaft Imshausen‘, die zunächst nach einer Synthese zwischen ‚West‘ und ‚Ost‘ für den deutschen Wiederaufbau gesucht hatte, aber nach drei Treffen gescheitert war. Die Literatur, die sich intensiver mit der Vorgeschichte des Deutschen Rats der europäischen Bewegung auseinandersetzt, erwähnt Bähnischs Namen trotz ihrer herausgehobenen Stellung als Vizepräsidentin und Leiterin des Kulturausschuß nicht, sondern rekurriert lediglich auf jene Personen, deren Bekanntheitsgrad ohnehin bereits hoch ist. Vgl.: Netzwerk der Europäischen Bewegung (Hrsg.): 60 Jahre Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland, Berlin 2009, auf: http://www.netzwerk-ebd.de/fileadmin/files_ebd/pdfs/EBD _Festschrift_web.pdf, am 13.12.2013 sowie Conze: Europa. Der ‚Deutsche Rat der Europäischen Bewegung‘ benannte sich 1992 in ‚Netzwerk der Europäischen Bewegung‘ um. AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 27, [Kultur-Kommission], Auszug aus der Sitzung des Exekutiv-Komitees des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung am 11.07.1949 in Bernkastel-Kues, Landratsamt. AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 27, Dr. Stahl an Theanolte Bähnisch, 23.08.1949. AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 27, Dr. Stahl an Collège d’Europe, Section du Centre Européen de la Culture, Comité Local, 15.08.1949 und ebd., Dr. Stahl an Bähnisch, 12.09.1949 sowie einige andere Schreiben in der Akte. Auch ein Papier des Political Advisor Office der britischen Militärregierung, das über den Charakter und die Mitglieder der Europäischen Bewegung aufklärt, hebt den Umstand hervor, daß der Kulturausschuß jene Personen auswählt, die zukünftig „European diplomatists“ werden sollen. NA, UK, FO 1049/2151, Political Advisors Office, Frankfurt an das German Political Department, Foreign Office, 19.10.1949. Ebd. sowie AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 27, Dr. Stahl an Bähnisch, 12.09.1949.
878 | Theanolte Bähnisch
Vielen Sozialdemokraten war das überparteiliche Handeln von Parteimitgliedern in der ‚Europäischen Bewegung‘ ebenso suspekt, wie das Engagement von Genossinnen in der überparteilichen Frauenbewegung um Bähnisch.53 Kurt Schumacher schrieb 1949 an Hermann Brill, der sich ebenfalls – jedoch eher zurückhaltend54 – in der Bewegung engagierte, daß die Methoden der Auswahl von Persönlichkeiten für den Deutschen Rat der Europäischen Bewegung „nicht einer gewissen Dreistigkeit“ entbehrten und daß „Milieu und Teilnehmerliste […] regional, gesellschaftlich und politisch gesehen […] zu einem grossen Teil einfach grauenhaft“55 seien. In einem Artikel in der ‚Frankfurter Neuen Presse‘ vom 03.06.1949 war schließlich zu lesen, daß die SPD vor „gewissen Tendenzen“ im Deutschen Europarat warne und daß der außenpolitische Ausschuß der SPD fordere, „daß die deutschen Mitglieder des Europarats möglichst vom Bundesparlament bestimmt und nicht von privaten Vereinigungen entsandt werden“56. Diese Forderung sollte sich nicht erfüllen. Als sich der Deutsche Rat keine zehn Tage später konstituierte, erklärte der Generalsekretär Eugen Kogon, daß der Rat sein Dasein „aus freier demokratischer Initiative“ herleite und infolge seines „inoffiziellen Charakters […] nicht des Mittels der Wahlen […], die in einer demokratischen Gesellschaft auch nicht der einzige Weg der Willensbildung seien“57, bedurft habe. Der vorbereitende Ausschuß sei zu der Auffassung gekommen, so Kogon, daß das Präsidium „einerseits die politischen Hauptkräfte des Landes hervortreten lassen“ solle, andererseits vor allem zwei „Kräftegruppierungen des Rates“, nämlich „die Frauen und die jüngere Generation, an die sich besondere Hoffnungen der ‚Europäischen Bewegung‘ knüpfen. Denn wer wäre mehr für den Frieden als eine Frucht der Ordnung als die Frauen, und wer mehr für die Zukunft Europas als die jüngere Generation.“58 Als zu dieser Zeit bedeutendste Leiterin einer Frauenorganisation hatte Bähnisch, dieser Logik folgend, natürlich nicht außen vor bleiben können. Ihre Zugehörigkeit zur SPD schien jedenfalls nicht ausschlaggebend für ihre Wahl zur Vizepräsidentin durch den vorbereitenden Ausschuß gewesen
53 Vgl.: Weber, Petra: Guter Patriot und guter Europäer – das Europa Carlo Schmids, in: Depkat/Graglia: Entscheidung, S. 243–262, hier S. 250. Weber schreibt, daß Schmid gegen den Willen seiner Partei in der Bewegung mitgearbeitet habe, um ‚Europa‘ „nicht den Konservativen zu überlassen“. Ebd. 54 Brills distanzierte Haltung geht aus mehreren seiner Briefe an Kurt Schumacher hervor. BArch, N 1086 [Nachlaß Heinrich Brill], Nr. 379. 55 BArch, N 1086, Nr. 361, Schumacher an Brill, 26.01.1949. 56 BArch, N 1086, Nr. 370, Abschrift eines Artikels: O. V.: Besorgnis um deutschen Europarat, in: Frankfurter Neue Presse, 03.06.1949. 57 AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 6 [Konstituierende Sitzung], Eugen Kogon: Die Organisation und die Aufgaben des Deutschen Rates in der Europäischen Bewegung. Darlegungen bei der konstituierenden Versammlung im Staatstheater zu Wiesbaden, 13.06.1949, S. 6. 58 Ebd. Daß Kogon Wert darauf legte, Frauen und Jugendliche in der Bewegung angemessen zu repräsentieren, erklärt (mit) die herausgehobenen Positionen Bähnischs, Elly HeussKnapps, Christine Teuschs und Wolfgang Schaedla-Ruhlands, der in der (europäischen) Jugendbewegung aktiv war.
Wachsende Prominenz | 879
zu sein. Einem Sitzungsprotokoll des SPD-Vorstands zufolge hatte Bähnisch allerdings gemeinsam mit Otto Suhr, Max Brauer und Adolf Ludwig an einer Konferenz des ‚Mouvement Socialiste pour les États-Units d‘ Europe (MSEUE)‘ in Brüssel teilgenommen59 und damit, wenn man so will, ‚Farbe‘ bekannt. Für Beobachter aus anderen Parteien hätte also auch ein anderer Eindruck über die Funktion Bähnischs im Rat entstehen können. Daß der Deutsche Bundestag dem Beitritt Deutschlands zum Europarat auf der Grundlage jener von Kogon ins Leben gerufenen und verteidigten Vertretung am 15.06.1950 mit 218 zu 151 Gegenstimmen zustimmte, war für den SPD-Parteivorsitzenden Kurt Schumacher, der den Beitritt Deutschlands aufgrund der Sorge um die deutsche Einheit und der fehlenden Gleichberechtigung Deutschlands im Europarat ohnehin ablehnte, einer doppelten Niederlage gleich. Daß Sozialdemokraten an der ‚Aktion‘ beteiligt waren, verbesserte die Aussichten in seiner Wahrnehmung keinesfalls. Ein überzeugter Verfechter der Europa-Politik innerhalb der SPD, der sich – bis 1952 – ebenfalls im Deutschen Rat engagierte, war Carlo Schmidt. Seine Position unterschied sich insofern von der seiner Genossin Bähnisch, als er in der Nachkriegszeit von der ‚Abendland-Ideologie‘, die Bähnisch und Brentano verband, abrückte. Die Positionen Schmids und Bähnischs deckten sich aber in einem anderen zentralen Punkt, der eine Zusammenarbeit mit anderen Politikern in der Bewegung überhaupt erst ermöglichte: Schmid habe sich nicht, so schreibt die Schmid-Biographin Petra Weber, Schumachers Überzeugung zu eigen gemacht, „dass ‚der Lebensstil, die Kultur und die Wirtschaftsform‘ des europäischen Kontinents nur der “demokratische […] Sozialismus“60 sein könne. Er sei, so führt die Historikerin aus, „Realist genug“ gewesen, „um zu erkennen, daß der von ihm anvisierte europäische Bundesstaat auf Grund der zunehmenden Ost-West-Spaltung zunächst nur in Westdeutschland konstituiert werden konnte, wo in vielen Staaten die Konservativen […] an den Schalthebeln der Macht saßen“61. Folgt man dem Professor für Europäische Regionalgeschichte Gerhard Brunn, so galt dies auch für den Zusammenschluß, in dem Schmid sich bewegte. Die ‚Europäische Bewegung‘ in Deutschland sei, so Brunn, trotz einiger Bemühungen um Überparteilichkeit, „eindeutig“62 mit der Konservativen Partei
59 Vgl.: Albrecht, Willy (Hrsg.): Die SPD unter Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer 1946–1963, Sitzungsprotokolle der Spitzengremien, Bd. 2: 1948–1950, Bonn 2003, S. 123, Sitzung des Parteivorstands am 11. Und 12.03.1949 in Köln. „Mit Billigung des PV hatten an der Brüsseler Konferenz [der MSEUE] die Genossen […]an der Konferenz von Brüssel teilgenommen. Auf Grund der Berichte der Teilnehmer kam der A. A. [Auswärtiger Ausschuß] zu der Auffassung, daß die Partei zunächst eine weiter abwartende Haltung einnehmen sollte. […] Der Exekutivrat der Europabewegung in Deutschland besteht z. Zt. aus zufällig zusammengewürfelten Vertretern. der A. A. hat beschlossen, den Versuch zu unternehmen in den Rat Sozialdemokraten zu entsenden, ohne dass die Partei dabei gebunden wird.[…] Jedenfalls kann die SPD nicht schon heute einer kommenden westdeutschen Regierung durch eine außenpolitische Festlegung die Entscheidung vorwegnehmen.“ 60 Weber: Schmid, S. 249. 61 Ebd. 62 Brunn: Einigung, S. 57.
880 | Theanolte Bähnisch
verbunden gewesen. Zum ersten großen internationalen Kongreß der Bewegung in Den Haag waren, weil sie die Dominanz des konservativen Winston Churchill kritisierten, sozialdemokratische Politiker aus vielen Ländern überhaupt nicht erschienen.63 Auch Carlo Schmid hatte an diesem Kongreß nicht teilgenommen. Der Staatsrechtler wollte zwar, wie der SPD-Vorsitzende, an der Idee eines ‚Dritten Weges‘ zwischen den Blöcken festhalten, die „Freiheit für die Einheit“64 geopfert sehen, wollte er jedoch nicht, wie Weber betont. Theanolte Bähnischs Engagement in der ‚Europäischen Bewegung‘ basierte, neben den Gründen, die sie Petra Kelly gegenüber nannte, offensichtlich auch auf einer romantischen Vorstellung von ‚Europa‘. Den Artikeln in der ‚Stimme der Frau‘ ist zu entnehmen, welcher Zauber für sie von der „Idee Europa“ ausging, von der die SPDPolitikerin Anna Haag schrieb, sie steige, „als Morgenröte am Horizont empor“65. Die Leiterin des Frauenrings suchte in der Formel ‚Europa‘ nicht nur nach einem Garanten wirtschaftlicher Prosperität und Sicherheit vor dem im Osten vermuteten Aggressor. Auch kulturell sollte Europa einen ‚dritten Weg‘ zwischen „kommunistischer Dominanz“ und „amerikanischer Vereinnahmung“66 eröffnen und eine Überwindung des empfundenen Zivilisationsbruchs im ‚Land der Dichter und Denker‘ ermöglichen. In der ‚Rückbesinnung‘ auf die gemeinsame Kultur des ‚alten Europa‘ lag für Bähnisch einer der Schlüssel zur Verständigung der Nationen. In einem Artikel von André Denis in der ‚Stimme der Frau‘ kommt schließlich beides zusammen: Europa als Hort ‚abendländischer‘ Kultur und seine Rolle als Garant einer gleichberechtigten Partnerschaft der Nationalstaaten.67 Darum ging es nämlich den ‚Föderalisten‘, die, der Europa-Expertin und Journalistin Alexandra Kemmerer zufolge, die größte Gruppe unter den Europabewegten bildeten.68 Bähnisch orientierte sich, soviel verraten die Artikel in der ‚Stimme der Frau‘, an den Unionisten, die, Gerhard Brunn zufolge, „nicht im Geringsten“ daran dachten, die Nationalstaaten zu entmachten, „wie es die Föderalisten wollten“69. Das in der Zeitschrift beschriebene Bild Europas ist nie das eines Bundesstaates, wie ihn die Föderalisten anstrebten, sondern stets das eines Staatenbundes, das in der Zeitschrift einmal, frei nach Churchill, als die „Vereinigten Staaten von Europa“70 bezeichnet wird. In ihrer kulturellen Abgrenzung zur USA folgte Bähnisch jedoch spürbar der föderalistischen Mehrheit. Auf die ökonomische und militärische Stärke des transatlantischen Partners wollte sie nicht verzichten, ihre Haltung zur USA blieb, wie sich auch in der ‚Stimme der Frau‘ nachvollziehen läßt,71, gespalten. Daß Bähnisch in Reden wiederholt das Wort ‚westlich‘
63 64 65 66 67 68 69 70 71
Vgl.: ebd., S. 60. Weber: Schmid, S. 249. Haag: Krieg. Kemmerer, Alexandra: Haager Konferenz. Das Abendland will seine Erweiterung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.06.2008. Denis: Europapaß, S. 4. Vgl.: Kemmerer: Konferenz. Brunn: Einigung. Denis: Europapaß, S. 4. Siehe Kapitel 7.1.5.
Wachsende Prominenz | 881
verwendete, zeigt, daß sie – im Unterschied zu Carlo Schmid – keinesfalls der Idee einer politischen Neutralität Deutschlands oder Europas anhing. ‚Neutralism is a betrayal of democracy‘72 – diesen von den USA verbreiteten Slogan hätte wohl auch die Regierungspräsidentin unterschrieben. Weil laut den Umfragen die Wiedervereinigung um 1950 für die meisten Deutschen ein attraktiveres Ziel war73 als die europäische Integration, unternahmen ‚Europa‘-Befürworter, wozu vor allem auch die USA zählten, umfangreiche Anstrengungen, Werbung für den Zusammenschluß zu betreiben.74 Ähnlich wie in der US-Propaganda, die den Eindruck zu vermitteln versuchte, eine europäische Einigung könne helfen, das Trauma der Spaltung Deutschlands zu überwinden und durch eine gleichberechtigte Partnerschaft mit den anderen EUStaaten zu einer neuen Identität zu finden, malte auch die ‚Stimme der Frau‘ in äußerst positiven Farben aus, warum die Europäische Integration das Leben so viel besser mache: André Denis erträumt sich die „grenzenlose“ Zukunft seiner noch ungeborenen Tochter in Europa so: „Als Klein- und Schulkind soll sie natürlich in Deutschland aufwachsen. Aber vielleicht könnte sie schon einige Semester, wenn sie gescheit genug ist, an der Sorbonne studieren. Vielleicht sollte sie auch im letzten Schuljahre in Sacré coeur etwas von französischer Bildung mitnehmen, um im College zu Oxford zu studieren. Oder vielleicht kann sie in Schweden, dem Lande mit der best ausgeklügelten Sozialordnung, ihre medizinischen Studien vollenden. In jenem Land, das in Europa die schönsten Krankenhäuser besitzt.“75 Auch auf ökonomische Vorteile eines europäischen Zusammenschlusses geht der Autor ein: „Es wäre viel zu billig, zu wünschen, daß damit auch der französische Rotwein im Preise herabgedrückt werden könnte, oder die holländischen Frühgemüse nicht untergepflügt zu werden brauchten [...] Englische und deutsche Ruhrkohle in französischen und deutschen Hüttenwerken verarbeitet, gäbe den Arbeitslosen in der Eisen be- und verarbeitenden Industrie Brot und Lebensstellung. Hollands einmalige Ausnutzung der Ödländereien und seine erfolgreiche Gemüsezucht käme allen zu Gute.“76 Schließlich wendet sich der Artikel – man fühlt sich an eine politische Didaktik erinnert, welche politische Zusammenhänge vom (weiblichen) Alltag ausgehend begreifbar machen will – speziell an die deutschen Frauen: „Bis zu den Tulpen in der Vase könnte Hollands Betriebsamkeit deutsche Hausfrauen glücklich machen.“77 Resü-
72 Unter dem Slogan ‚Neutralism is a Betrayal of Democracy‘ wurden die amerikanischen Dienststellen in der BRD mit dem „Interim Plan for intensified Psychological Warfare in Germany“ angewiesen, verstärkt über die geheimen Beziehungen neutralistischer Organisationen zu DDR und UdSSR sowie zur deutschen Rechten zu berichten. Vgl.: Schumacher: Krieg, S. 228. Zum Ziel der ‚Neutralität‘ zwischen den Blöcken vgl. auch: Dohse, Rainer: Der dritte Weg. Neutralitätsbestrebungen in Westdeutschland zwischen 1945 und 1955, Hamburg 1974, S. 41–61. 73 Daten nach HICOG- und EMNID-Umfragen 1951–1955, zitiert in: Schumacher: Krieg, S. 188, Anm. 53. 74 Vgl.: ebd., S. 240–245. 75 Denis: Europapaß, S. 4. 76 Ebd. 77 Ebd.
882 | Theanolte Bähnisch
mierend heißt es „[ü]berhaupt würden die Vereinigten Staaten von Europa einen geistigen, sozialen und wirtschaftlichen Aufschwung von geradezu ungeheuerlichen Ausmaßen bringen.“78 Außerdem, so suggerierte der Artikel, würde man nie wieder eine Aggression europäischer Staaten gegeneinander zu befürchten haben: „Der Frieden […] wäre gewiß, weil die Stärke einer europäischen Einheit mehr nützen wird als Militärbündnisse und Atlantikpakte.“79 Und während die europäische Einheit beschworen wird, werden „Ost“ und „West“ einander diametral, im Sinne eines klaren Entweder-Oder-Schemas, gegenübergestellt.80 Visionär waren Bähnischs Vorstellungen zum Thema ‚Europa‘ allemal: Von heute aus betrachtet, ist es, sieht man von der romantischen Verklärtheit einmal ab, beeindruckend, welch vorausschauende Kraft sich in der Vorstellung vom ‚vereinten Europa‘, wie es in der ‚Stimme der Frau‘ beschrieben wird, ballte: Nicht nur die Öffnung der Grenzen innerhalb Europas für den Waren- und Bevölkerungsverkehr wird in einem Artikel, den vermutlich die Herausgeberin selbst zu verantworten hatte, als Zukunft angepriesen, sondern auch die Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung durch die Landeszentralbanken.81 Theanolte Bähnisch nahm im Jahr 1949 sehr regelmäßig an den Sitzungen des vorläufigen Exekutiv-Komitees teil82, danach erschien sie nicht mehr so häufig zu den Treffen. Allerdings entschied sie sich 1954, als sich der Deutsche Rat dergestalt umbildete, daß sich „nur noch‘ 60 „aktive […] Persönlichkeiten sich zu einer engeren Zusammenarbeit“83 weiterhin treffen sollten, für die Mitarbeit. Zum 70. Geburtstag Bähnischs dankten der zu dieser Zeit amtierende Generalsekretär Karlheinz Koppe sowie der Präsident Ernst Majonica der Pensionärin dafür, daß sie „einen grossen Teil“ ihres „vor allem auch an politischem Einfluß reichen Lebens der politischen
78 79 80 81 82
Ebd. Ebd. Vgl.: Bernhardt: Voraussetzungen, S. 13. Vgl.: O. V.: Bewegung. Belegt ist ihre Teilnahme an den Sitzungen des vorläufigen Exekutiv-Komitees vom 01./02.04.1949, am 02.05.1949 und 07.06.1949. AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, 18 [Sitzungen des vorläufigen Exekutiv-Komitees]. Bähnischs Beteiligung an der deutsch-europäischen Konferenz der Europäischen Bewegung in Hamburg ist belegt in: AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 6, Europäische Bewegung, Deutsch-europäische Konferenz, unter dem Vorsitz von Paul Henri Spaak, Hamburg 23.09.1951 (Drucksache mit Teilnehmerliste), Frankfurt 1952. An der Kultur-Konferenz der Europäischen Bewegung in Lausanne vom 08. bis 12.12.1949 nahm Bähnisch, trotz vorheriger Zusage, nicht teil. AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 27 [Kultur-Kommission], Mitglieder der deutschen Delegation für die Kultur-Konferenz der Europäischen Bewegung in Lausanne vom 08.–12.12.1949. 83 AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 41 [Allgemeines A–Bi], Generalsekretär Focke an Theanolte Bähnisch, 04.06.1954. Der Brief trägt den handschriftlichen Vermerk „mündl. Zusage an Dr. Friedländer“.
Wachsende Prominenz | 883
Idee gewidmet“ und „ununterbrochen“ in den „Führungsgremien“84 des Deutschen Rates mitgewirkt habe. Als Geschenk übersandte der Rat der Europäerin Bähnisch zum Jubeltag ein bedeutungsschwangeres Geschenk: Das Merian-Buch ‚Europäische Städte‘.85 Was es mit der ‚Frauensektion des Europa-Bundes‘ auf sich hatte, von der es laut einem Bericht des ‚Hamburg Intelligence Office‘ hieß, sie stünde unter dem Einfluß von Frau Bähnisch, ist bis dato unklar. Die Sektion scheint in Hamburg im Zuge der Gründung der Europäischen Bewegung lanciert worden zu sein86 und wird in einem Bericht der Intelligence Division als „allegedly non political“87 beschrieben. Ziel des ‚Europa-Bundes‘ und seiner Frauensektion sei es, so heißt es in der gleichen Akte, zur internationalen Verständigung aufzurufen. Seine Anführerinnen seien Ilse Blumenfeld, von der es hieß, sie strebe auch die Gründung einer Frauenorganisation an, welche die UNO unterstützen wolle88, und Editha Rohr. Beide Frauen seien jüdische Intellektuelle und „pleasant and attractive“.89 Der Bericht des ‚Intelligence Office‘ aus Hamburg riet dazu, die Aktivitäten der Organisation, die aufgrund ihrer Verflechtungen mit anderen Frauenorganisationen interessant seien, weiter zu verfolgen.90 Daß die KPD die Gründung als „redundant“ begriffen habe, „which suggests that they do not consider it a hopeful field for penetration“91, wertete die Verfasserin des Berichts als einen Hinweis auf Bähnischs Rolle im Verband.
84 AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 41, Generalsekretär Koppe und Präsident Majonica an Frau Staatssekretär a. D. Bähnisch, 23.04.1969. 85 Ebd., Randnotiz. 86 „The leaders are said to be under the influence of Madame Bähnisch“, ist hier notiert. NA, UK, FO 1050/1213, Special Report No. 10, Hamburg Intelligence Office, Oktober 1947, K. E. Ruttle, S. 8. 87 NA, UK, FO 1050/1213, Women‘s Organisations, Secret, o. V., o. D., als Anhang zu einem Schreiben von G. Brooking, HQ Intelligence Division an die Militärregierungen der Länder, 06.05.1948. 88 NA, UK, FO 1050/1213, Special Report No. 10, Hamburg Intelligence Office, Oktober 1947, K. E. Ruttle, S. 8. 89 NA, UK, FO 1050/1213, Women‘s Organisations, Secret, o. V., o. D., als Anhang zu einem Schreiben von G. Brooking, HQ Intelligence Division an die Militärregierungen der Länder, 06.05.1948. 90 NA, UK, FO 1050/1213, Special Report No. 10, Hamburg Intelligence Office, K. E. Ruttle, Oktober 1947, S. 8. 91 Ebd.
884 | Theanolte Bähnisch
8.2 WAS WIRD AUS DEM FRAUENRING? HOFFNUNGEN, ENTTÄUSCHUNGEN UND NEUE ENTWICKLUNGEN AUF BRITISCHER SEITE 8.2.1 Leere Kassen, eine unausgewogene Mitgliederstruktur und dennoch förderungswürdig? Erneute Lageanalyse und Entwicklungshilfe für den Ring durch Deneke Elf Tage nach der Juni-Sitzung des Exekutiv-Komitees der ‚Europäischen Bewegung‘ in Berncastel war die Regierungspräsidentin erneut verreist, diesmal wieder in ‚frauenbewegter‘ Mission – wie um zu zeigen, daß man mit ihr als Vertreterin der Frauen im Exekutiv-Komitee des ‚Deutschen Rates der Europäischen Bewegung‘ eine richtige Wahl getroffen hatte: Am 18.06.1949 fuhr sie für eine Woche nach Lugano, zur Tagung des ICW.92 Diese Reise Bähnischs ist als ein Meilenstein auf dem Weg der schrittweisen Integration des Frauenrings in den ICW zu betrachten. Denn dort durfte zum ersten Mal nach Kriegsende eine deutsche Vertreterin vor den Vorsitzenden der National Councils des ICW sprechen. Mit diesem Triumph in der Tasche schien sich die designierte Leiterin des deutschen ICW-Councils einen erneuten Besuch ihrer erklärten Unterstützerin Helena Denekes in Deutschland geradezu ‚verdient‘ zu haben. Sicherlich war die Deutschland-Expertin der WGPW neugierig auf den ‚Bericht aus Lugano‘, vielleicht auch auf die Berichte aus Brüssel und Berncastel, doch sorgte auch Deneke mit dafür, daß es während ihres Aufenthalts in Deutschland einiges mit Theanolte Bähnisch zu besprechen gab. Vom 29.06.1949 an blieb Deneke zwei Wochen lang in Deutschland und besuchte im Auftrag Bähnischs diverse Frauenringe „to stimulate newer and weaker branches and to debate on set subjects“93. Die Vorsitzende des Frauenrings hatte zum Anlaß des Besuchs aus Großbritannien diverse Versammlungen örtlicher Frauenringe mit jeweils 15 bis 36 Personen zusammengetrommelt. Handelte es sich um Zusammenschlüsse in der Gegend um Hannover, wurde Deneke von Bähnisch, einem anderen Mitglied des ‚Club deutscher Frauen‘ oder einer Mitarbeiterin des Regierungspräsidiums begleitet. Wenn die FrauenringVorsitzende nicht mit von der Partie war, konnte sie sich darauf verlassen, daß ihr die Britin einen genauen Bericht darüber erstatten würde, was sich auf den jeweiligen Treffen abgespielt hatte. „I reported in detail to Frau Bähnisch on each centre“94, bemerkte Deneke in ihrem Bericht. Die Oxford-Professorin schien es ganz selbstverständlich gefunden zu haben, daß sie von der Hannoveraner Regierungspräsidentin
92 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Bähnisch an den niedersächsischen Ministerpräsidenten, Staatskanzlei, 20.06.1949. 93 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C 7, Confidential Report. Visit paid to ‘Frauenringe’ in the British Zone as ‘Advisor’ 29th June–13th July, 1949, H. C. Deneke, 18.07.1949. 94 Ebd.
Wachsende Prominenz | 885
Aufträge erhielt95 und dieser Rapport über die Ausführung erstattete. Glaubt man dem Bericht Denekes, so dürfte sich jedesmal in etwa das Gleiche abgespielt haben: Die Germanistin sprach am Beispiel der britischen Geschichte zum Thema ‚Die Frau im Wandel der Zeit‘. Anschließend ermutigte sie die anwesenden Frauen dazu, die Stellung von Frauen und die Entwicklung der Frauenbewegung im Mittelalter und im 17. und 19. Jahrhundert in Deutschland zu rekonstruieren. Dabei sollten sich die Frauen jeweils an den Schritten orientieren, in denen Deneke die britische Geschichte nachgezeichnet hatte.96 Sie unterstützte damit die Frauenringe bei ihrer Identitätsfindung und nutzte gleichzeitig, indem sie vermittelte, daß die britische Frauenbewegung sich ganz ähnlich entwickelt hatte, die Möglichkeit, unter den deutschen Frauen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit den Britinnen zu befördern. Aufschlußreich ist, daß Deneke das Gespräch über ‚Frauen im 20. Jahrhundert‘ ganz bewußt vermied. Denn nur die ‚frühere Zeit‘, so begründete sie ihr Vorgehen, liege lang genug zurück, um keine verhaßten („odious“) Vergleiche ziehen. Die historischen Vergleiche könnten dennoch direkt in Bezug zur Verantwortung von Frauen in der Gegenwart gesetzt werden, wollte Deneke offenbar eventuell aufkommenden Bedenken der Leser ihres Berichts zerstreuen. Sie brachte auch in ihrem schriftlichen Bericht, der sich an die WGPW und die Militärregierung richtete, nur indirekt zur Sprache, worum es doch ganz offensichtlich ging: Sie wollte die Mitglieder der Frauenringe nicht mit den Rollen deutscher Frauen in den Weltkriegen und im Holocaust konfrontieren, vor allem wenn sie in diesem Zuge ‚ihre‘ Geschichte mit der der Britinnen um dieselbe Zeit hätten vergleichen müssen. Damit sollten wohl negative Erinnerungen der Frauen an das Gespräch mit Deneke sowie an Treffen von Frauenringen überhaupt vermieden werden. Ob die deutschen Frauen überhaupt ähnlich große Berührungsängste hatten wie Deneke selbst, hatte die Delegierte der WGPW scheinbar gar nicht überprüfen wollen. Sie wollte den Frauen eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Rahmen der von ihr geleiteten Zusammenkünfte nicht auferlegen – offenbar bot sie aber auch keine Auseinandersetzung mit den Themen ‚Erster und Zweiter Weltkrieg‘, ‚Drittes Reich‘ und ‚Holocaust‘ an. Ob die Frauen von sich aus das Thema ‚20. Jahrhundert‘ ansprachen, geht aus Denekes Bericht nicht hervor. Die Debatten bei den jeweiligen Treffen sollen, folgt man Denekes Bericht, lebhaft gewesen sein.97 In ihrem Report, in dem sie den Stand der Frauenringe beschrieb, kam Deneke zu dem Schluß, daß die Ringe noch nicht genügend durchorganisiert seien und die Mitgliederzahlen stark fluktuierten. In verschiedenen Zentren hätten sich intelligente, oft herausragende Frauen in Frauenringen zusammengefunden, die durch ihre Charakter-
95 Bähnisch habe ihr auferlegt („enjoined“), so Deneke, neuen und schwächeren Ringen Anreize zu bieten und mit ihnen bestimmte Themen zu besprechen. Ebd. 96 Damit ging Deneke ähnlich vor, wie Fritz Borinski es für die politische Bildungsarbeit mit Frauen angeraten hatte. Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 65/66. 97 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C7, Confidential Report. Visit paid to ‘Frauenringe’ in the British Zone as ‘Advisor’ 29th June–13th July, 1949, H. C. Deneke, 18.07.1949.
886 | Theanolte Bähnisch
stärke den emotionalen Versuchungen durch „isms“98 – also der kommunistischen und der nationalsozialistischen Ideologie – etwas entgegenzusetzen hätten, bemerkte Deneke positiv. Auch sie, die mit den Frauen, die ‚Frauenringe‘ leiteten, offenbar zufrieden war, setzte also auf den Einfluß einzelner Persönlichkeiten in den Frauenringen – ohne jedoch dabei die ‚einfachen‘ Mitglieder völlig zu vergessen. Denn auf diese sollte die Arbeit schließlich ausgerichtet sein. Die Frage, wie unter ‚einfachen‘ Frauen Mitglieder gewonnen werden könnten, bereitete Deneke Kopfzerbrechen. Sie hatte das Thema mit Bähnisch und Prejawa besprochen, schreibt aber nichts darüber, welche Vorschläge die beiden Frauen dazu gemacht hätten. Zwar hätten die leitenden Mitglieder der Frauenringe gutes Material zur Hand, merkte Deneke an, sie seien aber schlecht organisiert und wüßten sich der Hilfe der „rank and file members“99 nicht zu bedienen. Die Fixierung des Frauenrings auf seine Führungspersonen, welche wiederum offenbar nicht in der Lage waren, Aufgaben zu delegieren, wuchs sich zum Problem aus. In jenem Bericht findet sich also bestätigt, was sich im DenekeNorris-Report bereits andeutete: Das Mitglied der ‚Townswomen’s Guilds‘ erwartete, daß in den Frauenringen eine Zusammenarbeit zwischen leitenden und ‚einfachen‘ Mitgliedern im eigentlichen Sinn stattfand. Die Vorsitzende des ‚Frauenrings‘ hatte jedoch, wie an anderer Stelle ausgeführt, eine Vorstellung von ‚Zusammenarbeit‘, bei der eine ausgeprägte Hierarchie zwischen Frauen mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten im Vordergrund stand: ‚Einfache‘ Mitglieder sollten Schülerinnen ‚erfahrener‘ Frauen sein und erst nach einer Phase des Lernens in die aktive Arbeit mit Öffentlichkeitswirkung eingebunden werden. Ebenfalls sorgenvoll blickte Deneke auf die finanzielle Lage des Frauenrings. Die einzelnen Ringe taten sich offenbar schwer damit, Mitgliedsbeiträge einzutreiben.100 Zum einen, so Deneke, mangele es den Führungs-Mitgliedern an Selbstbewußtsein dafür, daß ihr Angebot es wert sei, durch einen regelmäßigen Beitrag honoriert zu werden. Zum anderen hätten die ‚einfachen‘ Mitglieder keinen Sinn für ihre persönliche Verantwortung gegenüber der Organisation. Womöglich sei, so interpretiert Deneke, eine Zurückhaltung führender Mitglieder in Hannover, die Beiträge einzutreiben, auch damit verbunden, daß die NS-Frauenschaft die Mitgliedschaft in ihrer Organisation stets mit ‚Pflichten‘ verbunden hätte und der Mitgliedsbeitrag als eine solche Pflicht wahrgenommen werden könne, was die Hannoveranerinnen unter allen Umständen vermeiden wollten.101 Daß eine möglichst große Mitgliederzahl der Ringe auch ein unausgesprochenes Argument gegenüber der Besatzungsmacht für die weitere Unterstützung des ‚Projekts‘ war und daß die Leitung des Frauenrings allein
98 Mit jener Abkürzung umschrieb sie Faschismus und Kommunismus/Bolschewismus und fokussierte dabei auf den ideologischen Gehalt beider Phänomene. 99 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C7, Confidential Report. Visit paid to ‘Frauenringe’ in the British Zone as ‘Advisor’ 29th June–13th July, 1949, H. C. Deneke, 18.07.1949. 100 Vgl. dazu auch Tscharntke: Re-educating, S. 171. 101 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C7, Confidential Report. Visit paid to ‘Frauenringe’ in the British Zone as ‘Advisor’ 29th June–13th July, 1949, H. C. Deneke, 18.07.1949.
Wachsende Prominenz | 887
schon deshalb nicht das Risiko eingehen konnte, zahlungsunwillige Mitglieder durch die Erinnerung an ihre ‚Pflichten‘ zu verprellen, schien Deneke nicht in den Sinn gekommen zu sein. Es ist naheliegend, daß die Präsidentin Bähnisch bei aller Sympathie, die sie Deneke entgegenbrachte, der Britin doch nicht alle Überlegungen, die sie intern mit leitenden Mitgliedern besprach, zugänglich machte. Ein anderes Problem bei der Mitglieder-Akquise mag wiederum der vergleichsweise finanziell gut gestellten Regierungspräsidentin nicht in den Sinn gekommen zu sein: So war es Denekes Meinung nach die schlechteste Wahl, sich – wie mancherorts bei den Frauenringen üblich – zu Versammlungen in Gaststätten zu treffen102, denn der dort herrschende Konsumzwang halte, so die Britin, viele Frauen vom Kommen ab.103 Bähnisch hatte sich bereits bei den Soroptimistinnen in den 20er Jahren daran gewöhnt, Treffen in Gaststätten abzuhalten. Ebenso wie andere leitende Mitglieder, die meist berufstätige Frauen mit vergleichsweise hohem Einkommen waren, wird sie nicht wahrgenommen haben oder wollte sie vielleicht auch nicht wahrhaben, daß viele Frauen sich den Besuch eines Lokals nicht leisten konnten oder wollten, um an einer Versammlung des Frauenrings teilzunehmen. Was Deneke ebenfalls kritisierte, war die Unbeschwertheit, mit der die Ringe zahlreiche Arbeits-Ausschüsse einrichteten. Bei ihrem ersten Besuch in Deutschland hatte sie sich für die eingerichteten und geplanten Ausschüsse durchaus begeistern können, doch nun befürchtete sie, daß in diesen Ausschüssen Energie zerstreut werden könnte, die doch besser konzentriert bleiben sollte – was bei einer größeren Anzahl von Mitgliedern ebenfalls weniger problematisch gewesen wäre. Alles in allem zeigte sich die WGPW-Delegierte aber zufrieden mit ihrem ‚Ziehkind‘. „Their work has borne fruit in these 2 1/2 years and should win through“104, bescheinigte Deneke dem Frauenring trotz leerer Kassen, einer unausgewogenen Mitgliederstruktur und mangelnder Fokussierung seiner Arbeit, Fortschritte. Sie prophezeite ihm, wie im Rahmen ihrer vergangenen Reisen, weiteren Erfolg in der Zukunft. Die im Frauenring maßgeblich tätigen Frauen seien zuversichtlich, den Status von Frauen verbessern und ein besseres Deutschland mit aufbauen zu können, so Deneke. Noch gebe es große Ungerechtigkeiten und Härten, was die rechtliche Stellung von Frauen in Deutschland betreffe, weshalb die Frauenringe nun aufmerksam nach Bonn blickten. In der Stadt am Rhein tagte seit dem 01.09.1948 der Parlamentarische Rat mit dem Auftrag, eine vorläufige Verfassung auszuarbeiten, welche der Teilung Deutschlands und einer erwarteten Wiedervereinigung Rechnung tragen sollte. Gegenstand der Erörterungen war auch die Frage, wie die Gleichberechtigung der Geschlechter in
102 Denise Tscharntke schreibt, die Treffen hätten normalerweise in Gaststätten stattgefunden, sie nennt hierfür jedoch keinen Beleg. Vgl.: ebd., S. 171. 103 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C7, Confidential Report. Visit paid to ‘Frauenringe’ in the British Zone as ‘Advisor’ 29th June–13th July, 1949, H. C. Deneke, 18.07.1949. 104 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box 565, 5WFM/C7, Confidential Report. Visit paid to ‘Frauenringe’ in the British Zone as ‘Advisor’ 29th June–13th July, 1949, H.C. Deneke, 18.07.1949.
888 | Theanolte Bähnisch
der neuen Verfassung verankert werden sollte, die 1949 als das ‚Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland‘ verabschiedet werden würde. Dies muß für Deneke ein wichtiges Thema gewesen sein, denn Christl Ziegler zufolge wurde von britischer Seite insbesondere die öffentliche Auseinandersetzung über den Gleichstellungsparagraphen als Erfolg der Arbeit der Women’s Affairs Section interpretiert.105 Bähnischs Organisation, welche sich, wie im Folgenden deutlich werden wird, aktiv für eine staats- und zivilrechtliche Gleichberechtigung von Frauen einsetzte, muß schon aus diesem Grund in einem positiven Licht gestanden haben. Auch von den anstehenden Wahlen versprach sich Deneke einen positiven Anstoß für die Frauenarbeit in Deutschland. Sie hoffte also, daß der Frauenring genau jene Arbeit leisten würde, über die sich die CDU in Hannover so lautstark beklagt hatte, nämlich, Frauen auf ihre Aufgaben als Wählerinnen vorzubereiten. Christl Ziegler weist darauf hin, daß die Aufgabe, Frauen bei der Ausübung ihres aktiven Wahlrechts zu unterstützen, auch im Rahmen des Ansatzes der ‚mitbürgerlichen Frauenbildung‘ als maßgeblich angesehen wurde106, und merkt gleichzeitig an, daß in der Bildungsarbeit von Frauenorganisationen „Informationen zum Wahlvorgang selbst, über aktives und passives Wahlrecht“107 weitgehend ausgeblieben seien. Anders als von Deneke erhofft, behandelten eher Frauengruppen der politischen Parteien diese Themen. Insbesondere die Frauenring-Vorsitzende Bähnisch scheint mit dieser Lage unzufrieden gewesen zu sein. Auf Bähnischs Idee, eine Schule für die politische Bildung von Frauen einzurichten, gründet Ziegler jedenfalls ihre Aussage, daß „die Notwendigkeit einer gezielten Vermittlung politischer und administrativer Kenntnisse als Voraussetzung einer aktiven Partizipation an (kommunal-)politischen Entscheidungen auch von maßgeblichen Persönlichkeiten überparteilicher Frauenorganisationen“108 erkannt worden sei. Denekes Empfehlungen an die Militärregierung, die sie als „Immediate Work required“109 betitelt, orientierten sich wesentlich an der starken beruflichen Belastung der Leiterinnen der Frauenringe, die jeweils in „full time jobs“ steckten. Der Staatsdienst, beziehungsweise die pädagogische Arbeit absorbierten den Großteil der Zeit von Theanolte Bähnisch, Anna Mosolf, Luise Bardenhewer110 und Anne Franken111,
105 106 107 108 109 110 111
Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 89. Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 71. Ebd., S. 90. Ziegler: Lernziel, S. 90. Ebd. Zu Luise Bardenhewer siehe Anm. 689 in Kap. 6. Die 1890 geborene Franken war bis zu ihrer Zurückstufung in den Rang einer Studienrätin durch die Nationalsozialisten Studiendirektorin an der Luisenschule in Düsseldorf und ab 1945 dort Oberstudiendirektorin. Sie war bis 1933 Mitglied der Zentrumspartei und hatte sich während des Ersten Weltkrieges für das Frauenwahlrecht engagiert. 1945/46 war sie an der Gründung der CDU im Rheinland beteiligt. 1947/47 war sie Mitglied des ernannten Landtags von Nordrhein-Westfalen. Vgl.: Detailansicht der Abgeordneten Anne Franken, auf: Landtag NRW, http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/ GB_I/I.1/Abgeordnete/Ehemalige_Abgeordnete/details.jsp?k=00371, am 20.01.2014.
Wachsende Prominenz | 889
so Deneke. Sie hatte also längst nicht mehr nur Niedersachsen, sondern auch Nordrhein-Westfalen, wo Bardenhewer und Franken lebten und unter anderem für den Frauenring wirkten, im Blick, wenn es um die Entwicklung des Frauenrings ging. Diese Frauen hätten keine Kapazitäten, die Ringe so zu organisieren, wie es jetzt nötig sei, spielte Deneke auf die sich zuspitzende politische Lage an. Daß die erwähnten Frauen jeweils die Initialzündung für die Gründung neuer Ringe setzten, reichte der Germanistik-Professorin nicht aus: „They can start new centres, they cannot nurse them.“112 Sie sei überzeugt, schrieb Deneke und setzte damit ihre Auftraggeber unter Handlungsdruck, daß eine bezahlte Kraft zukünftig die Organisations-Arbeit für die Ringe übernehmen müßte, wenn diese sich weiter im Sinne eines Bollwerks (gegen den Kommunismus) und zu einer relevanten Kraft in sozialen Angelegenheiten entwickeln sollten. Sie hielt also an der Idee fest, daß die Frauenbewegung in Deutschland, ebenso wie die in Großbritannien, einen zentralen Beitrag zur sozialen Arbeit leisten sollte. Mit den Sachmitteln, die Birley und Robertson dem Frauenring zugestanden hatten, war es ihrer Meinung nach nicht getan. Was der Frauenring brauche, sei eine Geschäftsführerin, um diese zu bezahlen fehle dem Ring jedoch das Geld. Die einzige Einkommensquelle, die der Verband derzeit habe, sei die ‚Stimme der Frau‘ mit 95.000 Abonnenten, schrieb Deneke.113 Zwar schrieben Frauen aus dem Bekanntenkreis Bähnischs offenbar umsonst für die Zeitschrift, doch viel kann es nicht gewesen sein, was dem Herausgeber-Team nach Abzug der Kosten blieb. Deneke hätte ansonsten wohl kaum die Lösung des Problems in der Zahlung eines ‚Stipendiums‘ an Bähnisch aus Mitteln des Besatzungsetats gesehen. Visiting-Expert Deneke erklärte nicht, wozu genau das ‚Stipendium‘ verwendet werden sollte, ob also Bähnisch selbst finanziell für die Leitung der Frauenringe entlohnt werden sollte, oder ob die Vorsitzende von dem Geld eine Geschäftsführerin und Koordinatorin bezahlen können sollte. Die Britin stimmte mit der Hannoveranerin darin überein, daß „Officers Schools“, also Einrichtungen, an denen Multiplikatorinnen für ihre Rolle als Leiterinnen von Frauenorganisationen weitergebildet werden könnten, gute Dienste für die inhaltliche Ausrichtung der Frauenbewegung in Deutschland leisten könnten.114 Sie spielte hiermit wohl auf den – entweder im Lauf der Zeit modifizierten oder von Deneke einseitig interpretierten – Plan Bähnischs an, eine Schule für politische Frauenbildung einzurichten. Gleichzeitig zeigt die Bemerkung Denekes, daß das Konzept, das Bähnisch im August 1948 vorgelegt hatte, im Spätsommer 1949 noch nicht umgesetzt war.115 Daß Bähnisch selbst die Leitung und Kontrolle einer solchen Schule übernehmen wollte und damit eine starke Dominanz von ihrer Seite auf die Frauenbewegung ausgegangen wäre, schien Deneke nicht aufgestoßen zu sein. Daß die Delegierte der WGPW im Rahmen ihres Besuchs in Deutschland nicht nur Frauenringe,
112 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C7, Confidential Report. Visit paid to ‘Frauenringe’ in the British Zone as ‘Advisor’ 29th June–13th July, 1949, H. C. Deneke, 18.07.1949. 113 Ebd. 114 Ebd. 115 Vgl. dazu: Ziegler: Lernziel, S. 75–78.
890 | Theanolte Bähnisch
sondern auch drei Flüchtlingscamps in der Nähe von Hannover und die Kölner Luisenschule, an der Bähnisch einst Schülerin gewesen war, besuchte, wird ebenso auf den Einfluß der Regierungspräsidentin zurückzuführen sein wie das Treffen mit der Kultusministerin und Mistreiterin Bähnischs, Christine Teusch, im NordrheinWestfälischen Landtag.116 Die WGWP-Delegierte setzte also weiterhin auf den Frauenring, weil sie hoffte, daß er gleich drei Groß-Projekte ‚stemmen‘ könnte: 1. eine wichtige Rolle in der Sozialen Arbeit spielen, 2.) die Gleichberechtigung von Frauen vorantreiben und 3.) die Kommunistinnen in die Schranken weisen. 8.2.2 Ein objektiverer Blick auf den ‚Ring‘? Stellungnahmen der Regional Women’s Affairs Officers und Vorwürfe durch andere Mitarbeiter/Ratgeber der CCG (BE) Am Beispiel verschiedener Stellungnahmen von verantwortlichen Mitarbeitern der Militärregierung zu Denekes Bericht läßt sich nachvollziehen, daß nicht alle, die innerhalb des großen Apparates ganz oder teilweise in die Frauen-Re-education involviert waren, die euphorische Haltung Denekes gegenüber dem Frauenring teilten. Es bestanden durchaus verschiedene Ansichten darüber, wie Bähnischs Arbeit zu bewerten und wie ihren Ideen und Wünschen zu begegnen sei. Dabei scheinen regionale Unterschiede in der Form und Arbeit der jeweiligen Frauenringe die Wahrnehmungen stark beeinflußt zu haben. Ebenso könnten Sympathien oder Aversionen gegenüber der Verfasserin des Berichts eine Rolle bei der Bewertung von Bähnischs Wirken gespielt haben. Senior Women’s Officer Bertha Bracey von der Militärregierung in SchleswigHolstein, wo Else Richter gemeinsam mit Emma Faupel und Else Vormeyer den Frauenring leitete117, war der Meinung, daß Deneke die Verhältnisse in der Frauenbewegung in ihrem Bericht zu sehr verallgemeinert habe. In Schleswig-Holstein sei der Frauenring nämlich nur „parus inter pares“118, also auch nicht wichtiger als andere Frauenorganisationen. Dort seien auch keine Probleme mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge in Frauenorganisationen zu beobachten.119 Von der Idee, dem
116 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C7, Confidential Report. Visit paid to ‘Frauenringe’ in the British Zone as ‘Advisor’ 29th June–13th July, 1949, H. C. Deneke, 18.07.1949. 117 NA, UK, FO, 1050/1213, Women‘s Organisations, Anhang zu einem Schreiben von G. Brooking, HQ Intelligence Division an die Militärregierungen der Länder, 06.05.1948. Die Militärregierungen der Länder wurden mit jenem Schreiben gebeten, die vorliegenden Informationen mit genaueren Angaben zur Stärke von Organisationen wie dem Frauenring in ‚ihrem‘ Land zu ergänzen. 118 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 25, Bracey, HQ CCG Kiel, an Joy Evans (in Kopie an Mrs. Ostermann), Office of the Educational Advisor, Berlin, 13.08.1949. 119 Lediglich Flüchtlingsfrauen zahlten die Beiträge nicht, weil es ihnen nicht möglich sei, schrieb Bracey. Ebd.
Wachsende Prominenz | 891
Frauenring mit einer Finanzspritze zu helfen, hielt sie nichts, ihrer Einschätzung nach würde diese Art der Bevorzugung zur berechtigten Kritik durch andere Organisationen führen. Eine solche Starthilfe sei nur dann denkbar, so schrieb sie, wenn alle Frauenorganisationen davon profitieren könnten.120 Auch die Idee, dem Frauenring zum Status eines westdeutschen Dachverbands zu verhelfen, gefiel Bracey nicht. Ihrer Einschätzung nach würde sich dies eher hinderlich auf die Kooperation der verschiedenen Organisationen untereinander auswirken. Die Welt der Frauenorganisationen im Westen, so positionierte sich Bracey, offenbar in Anlehnung an die Einheitsorganisation DFD in der SBZ, solle doch lieber bunt bleiben.121 Barbara Bliss, Women’s Affairs Officer in Hamburg, schrieb in Reaktion auf Denekes Bericht, daß der Hamburger Frauenring vor Ort gar nicht als überparteilich wahrgenommen, sondern als „shadow of the SPD“122 betrachtet würde. Damit liege ein Verdacht auf ihm, der, besonders in einem Wahljahr, schwerwiegende Auswirkungen hätte. Weil der Hamburger Frauenring seine Arbeit stärker auf die politische Bildung konzentriere als andere Frauenringe, habe er es schwerer, „free from politics“123 zu bleiben – womit Bliss scheinbar eine parteipolitische Ausrichtung in Richtung der SPD meinte. Daß der Frauenring eine bezahlte Organisations-Kraft haben sollte, hielt sie, anders als die Kollegin aus Schleswig-Holstein, für eine gute Idee. Diese müsse aber aus deutschen Mitteln bezahlt werden, hielt Bliss fest und brachte ihr Bedauern darüber zum Ausdruck, daß man in Deutschland offenbar kaum über die Möglichkeit Bescheid wisse, für gute Zwecke an das Gewissen reicher Leute zu appellieren.124 Worin für sie jener ‚gute Zweck‘ lag, ob im Kampf gegen den Kommunismus oder für Frauenrechte, ließ Bliss, die sich offenbar im Kreise vermögender deutscher Privatpersonen bewegte, offen.
120 Ebd. 121 NA, UK, FO 1049/1845, B. L. Bracey an Joy Evans, 29.07.1949. 122 Eine Erklärung, warum der Frauenring Hamburg als SPD-dominiert hatte wahrgenommen werden können, liegt darin begründet, daß die Sozialdemokratin Olga Essig ihn leitete. Andere führende Mitglieder des Frauenrings Hamburg waren eine „Frau Senator von Karpinski“ (gemeint ist die SPD-Politikerin Paula Karpinski, die von 1946 bis 1953 sowie von 1957 bis 1961 als Senatorin die Jugendbehörde leitete), die in der Frauenbewegung seit langer Zeit stark engagierte, im Akademikerinnenbund organisierte Pädagogin und Politikerin Emmy Beckmann, eine Frau Dr. Groewel (CDU) und eine Frau Dr. Wegener (SPD). Möglich ist jedoch auch, daß Bliss gar nicht die SPD, sondern die KPD gemeint hatte, denn zeitweilig scheint diese in Hamburg stark gewesen zu sein. NA, UK, FO 1050/1213, Women‘s Organisations, Secret, o. V., o. D., als Anhang zu einem Schreiben von G. Brooking, HQ Intelligence Division an die Militärregierungen der Länder, 06.05.1948. Paula von Karpinski war von dem in der ‚Europäischen Bewegung‘ organisierten Hamburger Bürgermeister 1946 als erste deutsche Frau in ein Landeskabinett berufen worden. 1897 geboren starb Karpinski 2005 mit 108 Jahren. 123 NA, UK, FO 1050/1213, Barbara Bliss, HQ Hansestadt Hamburg an Joy Evans und Rita Ostermann, 18.08.1949. 124 Ebd.
892 | Theanolte Bähnisch
Dr. Dorothy Broome, Women‘s Affairs Officer in Nordrhein-Westfalen, vertrat im Grunde die gleiche Position wie Bliss, sie verwies jedoch nicht auf die Möglichkeit deutscher Geldgeber. Von der Idee, daß eine besondere Schule für leitende Mitglieder des Frauenrings eingerichtet werden sollte, zeigte sie sich durchaus angetan.125 Veronica Williams, Women’s Affairs Officer für Niedersachsen, gefiel diese Idee Bähnischs ebenfalls gut. Sie wollte, was die Gestaltung von Veranstaltungen und die Auswahl von Kursbesucherinnen betraf, das Feld jedoch nicht der Regierungspräsidentin überlassen, sondern am liebsten selbst, gemeinsam mit Margret Cornell und Helena Deneke, Kurse für Multiplikatorinnen abhalten. Was von Bähnisch – und Deneke – als eine Schule für Leiterinnen von Frauenringen geplant worden war, wollte Williams jedoch als eine Schule für Leiterinnen verschiedener Organisationen, welche sich pädagogische und organisatorische Kenntnisse aneignen wollten und sollten, verstanden wissen. Zur Finanzierung der Arbeit des Frauenrings kam ihrer Meinung nach eine Institution wie die Rockefeller-Stiftung in Frage126. Damit orientierte sie sich womöglich am Modell der WGPW, die von der Carnegie-Stiftung, einer ebenfalls international tätigen Organisation, finanziert wurde. Mrs. Hogg, Mitarbeiterin der Education Branch in Oldenburg, gab anläßlich von Denekes Ausführungen zu bedenken, daß die Leitung des Frauenrings zur effektiveren Organisation ein Mitteilungsblatt herausgeben müsse, „which will bring the findings of these Ausschüsse down to the smallest local Frauenringe“127. Seit der Entstehung des Frauenrings habe sich die Situation verändert, so Hogg, die lokalen Gruppen warteten nun – anders als in der Zeit ihrer Unabhängigkeit – auf Anleitung durch den Verbands-Vorstand. Die „officers school“128 hielt Hogg für eine gute Idee. Indem sie vorschlug, dafür deutsche Frauen aus der ersten Frauenbewegung als Lehrkräfte zu gewinnen, knüpfte sie an die Logik der ersten Stunde in der britischen Frauen-Re-education-Politik an.129 A. B. Reeve, deren Stimme, da sie im Auftrag der German Section des Foreign Office sprach, ein größeres Gewicht als die der Regional Women’s Affairs Officers gehabt haben dürfte, sprach sich gegen die Bezahlung einer Organisations-Kraft für den Frauenring von britischer Seite aus. Auch sie hielt die Idee, wohlhabende Mäzene für diesen Zweck anzuzapfen, für naheliegend. „You could perhaps pass on to Frau Bähnisch during your next visit, Miss Bliss‘ suggestion about ,touching the rich‘ and Dr. Broome’s concerning ,fighting fund‘“130, machte Reeve Deneke
125 NA, UK, FO 1050/1213, HQ Land Nordrhein/Westfalen, Düsseldorf an Joy Evans, 24.08.1949. 126 Ebd., V. H. Williams, Education Branch, HQ Land Niedersachsen an Women’s Affairs Section, Office of the Educational Advisor, 20.09.1949. 127 Ebd., A. Hogg, Education Branch, Asst. Commissioners Office, Oldenburg an Chief Women’s Affairs Office, Education Branch, Land Commissioners Office, Hannover, 22.10.1949. 128 Ebd. 129 Ebd. 130 Ebd., Foreign Office, German Section, A. B. Reeve an Helena Deneke, 05.12.1949.
Wachsende Prominenz | 893
gegenüber deutlich, daß sie die Stimmen der Regional Women’s Affairs Officers in ihre Empfehlung mit einbezogen hatte.131 Die Stellungnahmen dazu, wie die politische Ausrichtung des Frauenrings zu bewerten sei, fielen innerhalb des britischen Militärapparates ebenfalls recht unterschiedlich aus. Besonders aufschlußreich hierfür sind die Berichte der ‚Intelligence Division‘. Während Regional Women’s Affairs Officer Barbara Bliss, wie erwähnt, den Hamburger Frauenring als Schatten-Organisation der SPD beschrieb, hielt ein bereits vor Denekes Reise entstandener Bericht der ‚Headquarter Intelligence Division‘ fest, daß der Frauenring, obwohl er sich als ‚non-political‘ bezeichne,132 das konservative Element bzw. den rechten Flügel in der Frauenarbeit verkörpere.133 „The weakness of these societies lies in the rather abstract nature of their aims, and although individual members might represent thousands of women in other organisations, they do not offer so much scope to the average women to play an active and practical part in communal affairs“134, sprach derselbe Bericht schon 1948 das 1949 von Deneke beschriebene Problem an, wonach ‘einfache’ Frauen kaum eine aktive Rolle in den Organisationen spielten – oder spielen durften. Die Organisation wurde im Bericht als „right-wing Frauenring“ bezeichnet und – im gleichen Atemzug – dem „left-wing DFD“135 gegenübergestellt. Vor dem Hintergrund, daß im Bericht nicht nur dem Frauenring, sondern auch dem DFD „abstract ideals“136 unterstellt wurden, läßt sich konstatieren, daß in der Schwäche, die dem Ring einerseits attestiert wurde, andererseits auch eine Stärke zu sehen war. Erinnert man sich an frühere Stellungnahmen der Militärregierung, so sollte der DFD ja mit seinen eigenen Mitteln geschlagen werden. Wenn seine abstrakten Ziele und seine offiziell nicht parteipolitisch ausgerichtete Haltung dazu führten, daß eine nicht geringe Zahl von Frauen
131 Zumindest für jene Zeit, in der Bähnisch als Vizepräsidentin für den ICW auf internationaler Ebene tätig war, läßt sich übrigens nachweisen, daß sie von der Idee der Britinnen, für ihre Frauenpolitik private Geldquellen anzuzapfen, Gebrauch machte. So erbat sie 1964 von dem Politiker, Industriellen und Vorsitzenden des Bundes Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA), Siegfried Balke, eine finanzielle Unterstützung für die – antikommunistische – Frauenbildungsarbeit der Internationalen Organisation. (AddF, SP-01, Theanolte Bähnisch, Vizepräsidentin des ICW an Prof. Dr. Balke [Siegfried Balke], 20.10.1964.) Wie nebenbei erwähnte sie, wohl um sich selbst als ‚gemäßigt‘ darzustellen, daß der ICW weniger „frauenrechtlerisch“ sei als die International Alliance of Women (IAW). Ebd. 132 Daß der Frauenring sich selbst als ‚non-political‘ bezeichnet haben soll, entspricht wohl kaum der Realität. Hier scheint ein Übersetzungsfehler zu einer Fehlinterpretation geführt zu haben. ‚Überparteilich‘ ist nicht mit ‚non-political‘, sondern mit ‚non-party‘ zu übersetzen. 133 NA, UK, FO 1050/1213, Women‘s Organisations, Secret, o. V., o. D., Anhang zu einem Schreiben von G. Brooking, HQ Intelligence Division an die Militärregierungen der Länder, 06.05.1948, S. 3. 134 Ebd. 135 Ebd., S.4 136 Ebd.
894 | Theanolte Bähnisch
die Nähe des DFD suchten, so war es doch auch als Trumpf des Frauenrings zu werten, daß er mit ebenso abstrakten Zielen aufwartete. In der Praxis schien die nahliegende Idee, daß eher schwammig formulierte und somit verschieden auslegbare Ziele eine hohe integrative Wirkung erzielen könnten, jedoch nicht aufgegangen zu sein. Denn an späterer Stelle hebt der Bericht auf die Schelte, welche die Konferenz von Pyrmont 1947 wegen ihrer Ausrichtung auf die „middle-class“137 women kassiert hatte, ab. Daß die ohnehin schon gering vertretenen Arbeiterfrauen dort nicht zu Wort gekommen seien, thematisiert der Bericht ebenfalls. An eine Ausrichtung des Frauenrings an der ‚Arbeiterpartei‘ SPD, wie sie dem Hamburger Frauenring von Regional Women‘s Affairs Offiver Barbara Bliss nachgesagt wurde, glaubte die Intelligence Division also nicht. Entsprechend wurde die erste große Konferenz unter Bähnischs Verantwortung bewertet: In Pyrmont habe sich der ‚rechte Flügel‘ („rally the right wing“138) der Frauenbewegung getroffen, konstatierte der Bericht der Intelligence Division. Abschließend wurde jedoch auch die besondere Problematik skizziert, mit dem der Frauenring umgehen müsse. Durch die offene Gegnerschaft der SPD und die subtilen Unterwanderungsversuche der KPD sei er nämlich Angriffen von zwei Seiten ausgesetzt. Und dieses Problem schien die Vorsitzende des Frauenrings mit britischer Unterstützung, auch in der Wahrnehmung der Intelligence Division erfolgreich zu meistern. Der Report wertete es jedenfalls als ein gemeinsames Verdienst der Britischen Militärregierung (durch die Weigerung, die SED in der britischen Zone zuzulassen) und Bähnischs (durch die Gründung des Frauenrings), eine Gründung des DFD in Hamburg vermieden zu haben.139 Einem Bericht des Hamburg Intelligence Office zufolge war es jedoch, trotz Bähnischs „anti-KPD phobia“140, über Umwege zunächst zu einer organisierten Zusammenarbeit des 300 Mitglieder starken Hamburger Frauenrings mit dem vom DFD beeinflußten Hamburger Frauenausschuß gekommen. Die Hamburger Intelligence Division schien darin jedoch kein Problem gesehen zu haben. Ihr Bericht unterstellte Bähnisch eine „exaggerated fear of Communism“ und bewertete ihre offene Ablehnung gegen den IDFF sogar als „rather too clear“141. Bähnischs Weigerung, Mitglieder der Frauenausschüsse, die unter dem Verdacht einer kommunistischen Ausrichtung standen, zu ihrer Pyrmonter Konferenz einzuladen, habe zu verständlichen Ablehnungsreaktionen in den entsprechenden Kreisen geführt, war im Bericht zu lesen.142. Die Arbeitsweise und Mitgliederstruktur des Frauenrings schätzte der Bericht der Hamburger Sektion der Intelligence Division noch kritischer ein, als es die Division in Berlin tat. Ruttles Bericht zufolge erhielten die Mitglieder der an den Ring ange-
137 138 139 140
Ebd. Ebd. Ebd. NA, UK, FO 1050/1213, Hamburg Intelligence Office, Special Political Report No. 10, Oktober 1947, von K. E. Ruttle. Der Bericht ist teilweise wortgleich mit dem der HQ Intelligence Division, wobei letzterer auf ersterem aufzubauen scheint. 141 Ebd., S. 4/5. 142 Ebd., S. 5.
Wachsende Prominenz | 895
schlossenen Berufs- oder Wohlfahrtsorganisationen nur Informationen aus zweiter Hand über die Aktivitäten des Frauenrings. Dies sei insofern problematisch, als der Frauenring selbst keine Möglichkeiten habe, Hausfrauen, „business girls“143 oder Fabrikarbeiterinnen zu erreichen. Die leitenden Mitglieder des Frauenrings, so konstatierte der Hamburger Bericht, seien durchweg ältere Frauen ohne viel „drive“ oder „personality“ und kämen aus den Reihen der CDU, dem rechten Flügel der SPD oder den „pre-Hitler Right wing parties“.144 Dies ist insofern besonders interessant, als die Persönlichkeiten, welche die Frauenringe leiteten, auf Deneke einen guten Eindruck gemacht hatten. Die Mitgliedschaft im Frauenring beschrieb Ruttle schließlich als „limited and rather exclusive“145. Jene Frauen, die damit konfrontiert waren, in Ergänzung zu einer schlecht bezahlten Fabrikarbeit auch noch einen enorm erweiterten Reproduktionsbereich zu bewältigen und die deshalb mit den schwierigen Bedingungen der Nachkriegszeit im Alltag besonders zu kämpfen hatten, neigten vermutlich stärker dazu, ihre Lebensumstände nicht der vergangenen, nationalsozialistischen, sondern der aktuellen, westalliierten Politik vorzuwerfen, als die sozial höher stehenden Frauen. Doch glaubt man den Berichten der Intelligence Division, die den Frauenring um einiges schärfer kritisierte als die Visiting Experts sowie die Women’s Affairs Officers aus der Education Branch oder der Political Division, so erreichte der Frauenring gerade diese Frauen nicht. Die von Jeanne Gemmel so sehr verschmähten Volkshochschulen gaben sich, zumindest wie ein Berliner Beispiel zeigt, damit offenbar mehr Mühe als der Frauenring. Sie kamen den Hausfrauen beispielsweise durch abweichende Kurszeiten oder Organisationsformen entgegen.146 Ob sich Gemmels Überzeugung, daß Frauen-Re-education-Arbeit in der von ihr besonders unterstützten Art viel mehr Frauen anziehen würde als eine entsprechende Bildungsarbeit in Volkshochschulen, am Ende bestätigte, darf also zumindest als fraglich gelten. Um diese Frage differenziert beantworten zu können, wären jedoch tiefergehende Analysen sowohl der Volkshochschularbeit mit Frauen als auch der Arbeit einzelner Frauenringe mit ihren Mitgliedern notwendig. Auch die jungen Frauen, welche vom Nationalsozialismus besonders geprägt waren, interessierten sich nicht für die Arbeit des Frauenrings. Dessen Führungsfigur
143 NA, UK, FO 1050/1213, Hamburg Intelligence Office, Special Political Report No. 10, Oktober 1947, von K. E. Ruttle. 144 Einzelne Buchstaben des Drucks sind schlecht zu erkennen, es könnte auch „pro-Hitler Right wing parties“ heißen. Ebd. 145 Ebd. 146 Christ Ziegler zufolge war es der Volkshochschule in Berlin Neukölln gelungen, Frauenforen zu etablieren, in denen „die von den britischen Women’s Affairs Officers mehrfach reklamierte Möglichkeit zu aktivem Mitwirken und Mitgestalten des Einzelmitglieds […] stärker gegeben“ gewesen sei. Ziegler: Lernziel Demokratie, S. 105. Aus diesem Kreis hatte Ziegler zufolge nur eine Frau studiert. Immerhin ein Drittel der Frauen war zwischen 25 und 40 Jahren alt. Doch auch der Volkshochschule sei es, so Ziegler, nicht gelungen, die für die Re-education-Arbeit bedeutenden Gruppen berufstätiger jüngerer Frauen sowie jüngerer nichterwerbstätiger Mütter anzusprechen. Vgl.: ebd., S. 104.
896 | Theanolte Bähnisch
Bähnisch war zwar deutlich jünger als die ehemaligen Führungsfiguren des BDF, aber, mit Mitte vierzig, auch deutlich älter als die wesentlich im Dritten Reich sozialisierten Mädchen und jungen Frauen.147 Dabei zählte die Regierungspräsidentin noch zu den jüngsten unter den Führungsfiguren im Frauenring. „The chairman is 78 and is deaf and other members included another elderly holding out her hearing apparatus and the former President […] is aged 88 and blind“148, wußte die selbst im Jahr 1869 geborene bekannte britische Suffragette Evelyn Sharp von einem Treffen in Nordrhein-Westfalen zu berichten. Christl Ziegler konstatiert wohl zu Recht, daß sich das für die Militärregierung so wichtige Ziel, die jungen Frauen zu erreichen, über die gewählte Form der Frauen-Re-education-Arbeit nicht in einem „befriedigendem Maß“149 hatte lösen lassen. Der Frauenring war also nicht annähernd so erfolgreich damit, verschiedene Zielgruppen zu erreichen, wie die britischen Women’s Institutes, welche dem Frauenring zur Orientierung anempfohlen worden waren.150 In einem Bericht, der mit dem Titel ‚Background policy in respect of women’s organisations‘ betitelt ist, deutet sich schließlich noch ein weiteres Problem des Frauenringes an: sein Mangel an demokratischer Kompetenz. „After a recent important meeting in Dusseldorf dealing with the establishment of the Frauenring, an organization sponsored by Frau Baenisch (!), Hannover, the preparatory committee, who had elected themselves, congratulated each other after the meeting on the fact that there was no discussion and no voting”151, beschrieb die Berichterstatterin das, was sich vor ihren Augen abgespielt hatte. Für eine Organisation, die sich der ‚staatsbürgerlichen Bildung‘ von Frauen verschrieben hatte, war ein solches Verhalten leitender Mitglieder nicht gerade ein Ausweis demokratischer Kompetenz. Wie sollten – folgt man Bähnischs Wunsch-Vorstellung der Arbeitsweise von Frauenringen – jene leitenden Mitglieder, die offenbar bereits zur Zeit des Gründungsaktes diskussionsmüde waren und das Prozedere einer Abstimmung als eine entbehrliche Anstrengung empfanden, andere Club-Mitglieder zu Demokratinnen erziehen, die eine aktive Rolle in der Gesellschaft spielen sollten? Zwar war der Düsseldorfer Frauenring einer der ersten Ringe, die gegründet worden waren, jedoch schien es sich bei dem beschriebenen Phänomen nicht um ‚Geburtswehen‘, sondern um ein anhaltendes, strukturelles Defi-
147 Vgl. dazu auch Ziegler: Lernziel, S. 94. 148 NA, UK, FO 1013/2234, Report of a visit paid to Frauenausschüsse and Arbeitsgemeinschaften in Northrhine-Westfalia and to the Verband der Soziale (!) Fürsorgerinnen in Frankfurt/Main, February 22nd–March 10th, 1951, von Mrs. Sharp. 149 Ziegler: Lernziel, S. 95. 150 „Mit den breit gestreuten inhaltlichen Angeboten an theoretischen Informationen, praktischen und kreativen Kursen bestand die Möglichkeit, Hörerinnen verschiedenen Alters und aus unterschiedlichen Schichten zusammenzuführen“, beschreibt Christl Ziegler das auf Breitenwirksamkeit angelegte Programm einer der ‚großen‘ britischen Frauenorganisationen, die Women‘s Institutes. Ob jenes Angebot auch entsprechend nachgefragt wurde, geht aus Ziegler Ausführungen jedoch nicht hervor. Ziegler: Lernziel, S. 117. 151 NA, UK, FO 1050/1210, Background Policy in respect of women’s organisations‘, o. V., o. D., [erste Jahreshälfte 1947]. Denise Tscharntke zufolge handelte es sich bei der Berichterstatterin um Rita Ostermann. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 188, Anm. 92.
Wachsende Prominenz | 897
zit gehandelt zu haben. Expertinnen, die im Auftrag der Militärregierung nach Deutschland reisten, übten auch zu späterer Zeit und an anderen Orten massive Kritik an den Treffen der Frauenringe, welche sie besuchten. Ob Helena Deneke Recht damit behalten sollte, daß sich der Frauenring in Zukunft weiter entwickeln sollte? 1951 schrieb sie, nach einem Aufenthalt in Deutschland mit Margret Cornell, daß sich die deutschen Frauenorganisationen gut „in the ‚democratic‘ direction that we wish to see“152 entwickelt hätten. Die prominenteren Mitglieder äußerten sich lebhaft zum politischen Tagesgeschäft, ihr Gewicht und ihr Einfluß seien unzweifelhaft. Sie arbeiteten nun daran, die „rank and file members“153 dazu auszubilden, Verantwortung zu übernehmen und sich ihrer Rolle als Staatsbürger bewußt zu werden. Dabei könnten die Frauen allerdings noch Hilfe gebrauchen, faßten die beiden Frauen ihre 1951er Reise durch Nordrhein-Westfalen zusammen.154 Ganz anders fiel allerdings die Einschätzung Peggy Alexanders aus, die ja ursprünglich bereits 1946 anstelle von Deneke nach Deutschland hatte reisen sollen. Der Frauenring fiel ihr auf ihrer Reise durch Nordrhein-Westfalen, die sie im Jahr 1950 übernahm, eher negativ auf. Insbesondere der Düsseldorfer Ring schien sich ihrem Bericht zufolge zwischen 1947 und 1950 nicht weiter entwickelt zu haben.155 Der Bericht Margery Sharps, die 1951 ebenfalls als ‚Visiting Expert‘ in der gleichen Region unterwegs war, fiel ebenfalls eher negativ aus. Sharp besuchte auf ihrer Reise unter anderem ein Treffen des Frauenrings in Wesel. Laut ihrem Bericht war die Vorsitzende, eine Frau Luyken, unprofessionell, die anwesenden Frauen seien sich zu oft ins Wort gefallen, und stets habe die lauteste Sprecherin die Veranstaltung beherrscht. Auf die Einhaltung begrenzter Redezeiten habe man kaum Wert gelegt, Entscheidungen seien auch kaum gefällt worden. Mit ihrer 1951 geäußerten Kritik knüpfte Sharp also an die oben beschriebene, ältere Kritik, die dem Frauenring abstrakte Ziele und eine geringe Praxisorientierung vorwarf, an.156 In Sharps Wahrnehmung hatte der Frauenring einige „definitive disadvantages“. Dazu zählte sie, daß zu viel Verantwortung in den Händen einer einzigen Frau, „i. e. Frau Bähnisch“, die bereits mit Arbeit überladen sei, liege. Auch die Frauen-Zeitschrift, welche Bähnisch seit 1948 herausgab, genügte den Ansprüchen der Schriftstellerin nicht. „As far as I could gather, there is no recognised ,Women’s Journal‘ of high repute and adequate
152 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 41, Report on the journey in Rhineland and Westphalia – M. C. Cornell, H.C. Deneke, March 27th–April 24th, 1951, S. 2. 153 Ebd. 154 Ebd. 155 Women’s Library, Metropolitan University, London, Women’s Affairs Branch, Land Commissioner’s Office, Broome an German Education and Information Department, Foreign Office (German Section), 11.07.1950, Subject: Mrs. Alexander’s Report on Visit to Germany and Women’s Affairs. 156 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C10, Report of a visit paid to Frauenausschüsse and Arbeitsgemeinschaften in Northrhine-Westfalia and to the Verband der Soziale (!) Fürsorgerinnen in Frankfurt a. M., February 22nd–March 10th, 1951, von Mrs. Sharp, S. 2.
898 | Theanolte Bähnisch
worth (,Die Stimme der Frau‘ does not entirely meet these requirements).“157 Sharp schien also bewußt gewesen zu sein, daß die ‚Stimme der Frau‘ ursprünglich vor dem Hintergrund entsprechender Erwägungen aus der Taufe gehoben worden war. Tatsächlich war die Zeitschrift 1951 längst nicht mehr das, was sie 1948 gewesen war. Den politisch und zivilrechtlich bildenden Charakter, der in den ersten Ausgaben noch deutlich spürbar gewesen war, ließen die Ausgaben von 1951 weitgehend vermissen.158 Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß die Verhältnisse im Frauenring offenbar längst nicht so gut waren, wie Helena Deneke sie wiederholt beschrieben hatte. Verschiedene Akteure der Militärregierung konstatierten gravierende Probleme des Frauenrings: Er schaffte es nicht, Hausfrauen, Arbeiterinnen und junge Frauen zur Teilnahme zu motivieren, womit er wichtige Bevölkerungsgruppen verfehlte. Die Leiterinnen der Ortsverbände gehörten zu Beginn der 1950er Jahre offenbar mehrheitlich dem politischen Mitte-Rechts-Spektrum an und waren nicht nur wirtschaftlich deutlich besser situiert, sondern auch ganz anders ausgebildet und sozialisiert als das Gros der Frauen in Deutschland. Ihr Wissen über den Alltag des Gros der Bevölkerung und ihr Verständnis für die ‚kleinen Leute‘ schien nicht zuletzt aus diesem Grund eher begrenzt gewesen zu sein. Offenbar verfolgten die führenden Mitglieder zudem eher Gruppen-Interessen als den ursprünglich gesetzten Anspruch, breitenwirksam demokratische Bildung zu vermitteln. Nach dem Ende des Krieges wollten insbesondere die führenden Mitglieder des BDF, die neben den Frauen ‚mittleren Alters‘ wie Theanolte Bähnisch im Frauenring tonabgebend waren, die Möglichkeit nutzen, in Sachen Frauen- und Sozialpolitik weitgehend dort anzuknüpfen, wo sie 1933 aufzuhören gezwungen waren. Dies bedeutete, daß sie in der Tradition eines Verbands handelten, dem vor allem berufsständische Organisationen angeschlossen waren und der deshalb auch weitgehend berufsständische Interessen überdurchschnittlich gebildeter Frauen, die zudem oft wohlhabend waren, vertrat. ‚Einfache‘ Mitglieder schienen dabei eher als Störfaktoren denn als hilfreiche Mitstreiterinnen wahrgenommen worden zu sein. Daß der Einhaltung und Einübung demokratischer Regeln im Rahmen der Club-Politik weit weniger Aufmerksamkeit beigemessen wurde als der Abwehr kommunistischer Einflüsse, war ebenfalls unschwer zu erkennen. Was Helena Deneke, Joy Evans und Rita Ostermann am Frauenring besonders schätzten, das war den Berichterstattern aus der Intelligence Division zuviel. In ihrer Wahrnehmung schoß der Frauenring über das Ziel der kommunistischen Abwehrarbeit hinaus. 8.2.3 Der Frauenring – nur eine Hoffnung unter vielen überparteilichen Organisationen? Auch Christl Ziegler konstatiert in ihrer Studie über die Frauenbildungsarbeit der britischen und der amerikanischen Militärregierung, daß britische Frauenreferentinnen „Führungsstil und Organisationsstruktur […] insbesondere jedoch die geringe Parti-
157 Ebd., S. 6. 158 Vgl.: Freund: Krieg, S. 83/84.
Wachsende Prominenz | 899
zipation von Einzelmitgliedern“159 in den überparteilichen Organisationen bemängelt hätten. Doch dies trifft, da Ziegler ihre Aussage verallgemeinert, nicht den Kern des Problems. Die Dokumente, aus denen sie ihren Schluß zieht, beziehen sich nämlich nahezu allesamt auf den Frauenring und nicht auf andere Initiativen, zumal über andere Organisationen gar nicht vergleichsweise viel berichtet beziehungsweise überliefert wurde. Es muß deshalb betont werden, daß die Hoffnung wie auch die Kritik der Women‘s Affairs Officers in den meisten Fällen speziell jenen Organisationen galt, die unter der Ägide Bähnischs standen – auch wenn einige Organisationen dabei waren, die sich ohne Zutun der Regierungspräsidentin zusammengefunden hatten und erst später unter das ‚Dach‘ des Frauenrings ‚schlüpften‘. Je weiter die Zeit der Besatzung voranschritt, desto mehr war der Frauenring – und damit vor allem Theanolte Bähnisch – gemeint, wenn es in der Militärregierung und in der britischen Frauenbewegung um die Frage der Unterstützung ‚überparteilicher Frauenorganisationen‘ ging. Diese Organisation und ihre erste Vorsitzende standen also auch am Pranger, wenn die Mißstände in der ‚überparteilichen Frauenarbeit‘ thematisiert wurden. Aus Zieglers Studie geht dieser Umstand nicht in dieser Deutlichkeit hervor. Gerade weil zwischen der Organisationsform ‚überparteiliche Frauenverbände‘ und dem konkreten Projekt ‚Frauenring‘, der Führungsfigur Bähnisch, ihren Mitstreiterinnen und deren Arbeit in den Akten der Militärregierung – ebenso wie in den Akten der SPD-Frauenreferentinnen – oft nicht klar unterschieden wird, ist es unerläßlich, den Blick noch stärker auf die Genese des Frauenrings sowie auf einzelne relevante Personen im Kontext des Gefüges zwischen deutschen Frauenorganisationen, dem Militärapparat und der britischen Frauenbewegung zu richten und ihre Rolle in der Entwicklung und Arbeit des Frauenrings zu betrachten. Insbesondere die zentrale Rolle Bähnischs kann in diesem Zusammenhang nicht stark genug betont werden. Schließlich hatten sich einige Kräfte in der einflußreichen WGPW und in der Militärregierung bereits zu einem Zeitpunkt auf Bähnisch fixiert, als in der Wahrnehmung deutscher Frauen, die sich in der Frauenbewegung engagierten, die Würfel noch nicht gefallen waren. Wie weit der ständige Aktionsradius und damit der Einfluß der in Hannover ansässigen Vorsitzenden des Frauenrings reichte, ist schwer zu sagen. An den niedersächsischen Frauenringen übten Vertreterinnen der Militärregierung und ‚Visiting Experts‘ jedenfalls deutlich weniger Kritik als an jenen im südlicheren Teil der britischen Besatzungszone. Einige Reisen von Visiting Experts waren explizit dazu gedacht, jene Ringe, die nicht im Zentrum der Hannoverschen und der britischen Aufmerksamkeit standen, kritisch unter die Lupe zu nehmen und ihnen auf den richtigen Weg zu helfen. Welchen Einfluß Bähnisch beispielweise auf den offenbar besonders ‚undemokratisch‘ organisierten Düsseldorfer Ring ausübte, ist nicht klar. Bei der Gründungszeremonie war sie, wie aus dem weiter oben zitierten Bericht einer Sozialdemokratin ersichtlich wird, vor Ort. Was Deneke zu bedenken gegeben hatte, war also offenbar nicht ganz falsch: Leitende Mitglieder brachten zwar die Zeit auf, neue Gründungen zu initiieren, um sie zu betreuen, fehlte ihnen, wie die WGWP-Delegierte geschrieben hatte, jedoch
159 Ziegler: Lernziel, S. 169.
900 | Theanolte Bähnisch
die Zeit. Bähnisch agierte, nach allem, was überliefert ist, vor allem auf der Leitungsebene des DFR und hielt sich aus der ‚Detail-Arbeit‘ weitgehend heraus. Indem Denise Tscharntke konstatiert, daß jene, die die Regierungspräsidentin mit der Detail-Arbeit betraut habe, dieser nicht gewachsen gewesen seien,160 verallgemeinert sie jedoch stark. Eine Schule für Multiplikatorinnen, wie Bähnisch sie im Sinn gehabt hatte, hätte, wenn man annimmt, daß es einigen Leiterinnen von Frauenringen an Erfahrung in der Leitung solcher Zusammenschlüsse mangelte, einem solchen Problem prinzipiell Abhilfe schaffen können. Ob in einzelnen Frauenringen im Süden der britischen Besatzungszone tatsächlich wesentliche Veränderungen eingetreten wären, wenn die Vorsitzende der Dachorganisation nur mehr Zeit für sie hätte erübrigen können, ist jedoch fraglich. Schließlich schien die nordrhein-Westfälische Kultusministerin Christine Teusch, die gemeinsam mit Luise Bardenhewer und Anne Franken in der Region Düsseldorf eine zentrale Rolle im Frauenring spielte161 und sich gemeinsam mit Bähnisch auch auf europäischer Ebene engagierte, das Vertrauen der Regierungspräsidentin genossen zu haben. Geht man davon aus, daß die Kritik von Seiten der SPD, der KPD, dem DFD, von Marianne Weber, einigen Vertretern der Militärregierung und einiger Visiting Experts zumindest teilweise berechtigt war, so war auch Bähnischs persönliches Verhalten, vor allem was die Gründung des Frauenrings der britischen Zone, die Verteilung der Redezeiten auf der Konferenz von Pyrmont sowie den Handlungsspielraum und die Mitbestimmungsrechte von Club- beziehungsweise Ring-Mitgliedern betraf, oft ‚undemokratisch‘. Vor allem im Einsatz gegen den Kommunismus heiligte für die Regierungspräsidentin der Zweck oft die Mittel – dies wird bereits in der Art deutlich, wie sie sich ihrer langwierigen Rede auf der Frauenkonferenz in Aachen rühmte, mit der sie die Gründung des DFD in Westdeutschland verhindert habe. Der Kampf gegen die ‚Rote Gefahr‘ entwickelte für sie bald eine größere Bedeutung als der Kampf für die Demokratie. Und der Propaganda gegen den Kommunismus, die sie verbreitete, standen kaum Stellungnahmen gegen die Gefahr von ‚rechts‘ gegenüber. Auch hierin lag eine auffällige Kontinuität zum Verhalten der ihr vorgesetzten preußischen Verwaltungseliten in der Weimarer Republik. 8.2.4 „the methods adopted were undemocratic“ – Die Briten unterstützen die Gründung einer größeren Organisation durch Bähnisch dennoch Das Wissen um die beschriebenen Defizite hätte der Militärgouverneur Brian Robertson dazu nutzen können, um seine Entscheidung, Theanolte Bähnisch und den Frauenring weiter zu fördern, noch einmal zu revidieren. Die zugesicherte zweite überzonale Frauen-Konferenz unter Bähnischs Leitung ließ ohnehin auf sich warten, es wäre wohl möglich gewesen, die angekündigte Unterstützung von Seiten der CCG (BE) im Sande verlaufen zu lassen. Es lag in der Hand Robertsons als Chef der Women’s Affairs Officers, seine Untergebenen anzuweisen, ihre Energien vom Frauen-
160 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 187. 161 Vgl.: ebd., S. 166.
Wachsende Prominenz | 901
ring abzuziehen, sie in andere Organisation zu investieren, welche vielleicht größeres Potential hatten, jene Zielgruppen für eine aktive Mitarbeit zu gewinnen, die der Frauenring verfehlte und die sich stärker als Vorbilder in Sachen demokratischer Meinungsbildungsprozesse hervortaten. Doch Robertson machte von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Je mehr sich der Kalte Krieg zuspitzte, desto stärker handelte auch die Militärregierung in der Logik Theanolte Bähnischs. Waren die Briten ursprünglich angetreten, um die deutschen Frauen weg vom nationalsozialistischen und hin zum demokratischen Denken zu bringen, so rückte dieses Ziel im Zuge der bald vorrangig anvisierten Abwehr des Kommunismus zunehmend in den Hintergrund. Dies betraf auch die Schwerpunktsetzung in der Bewertung von Organisationen, welche, wie die Parteien, das öffentliche Leben in Deutschland mitgestalteten. „[T]he anti-Communist attitude of an organisation became more important to the British than its potential for building democracy”162, lautet Denise Tscharntkes Schluß aus ihrer Analyse der britischen Re-educaton Politik. Die offenbar vordringliche Aufgabe der Bekämpfung des Kommunismus vor Augen, stellten Bähnisch und die Spitzen der Militärregierung dieses gemeinsame Ziel vor ihre anderen, mitunter auch differierenden Ziele und Ansprüche. Der sich verschärfende Kalte Krieg stärkte also die Zusammenarbeit der Regierungspräsidentin und der Briten und verhalf Bähnisch dazu, sich zur führenden Figur in der bürgerlichen Frauenbewegung im Nachkriegsdeutschland zu etablieren. Ohne Zweifel läßt sich argumentieren, daß sowohl die Regierungspräsidentin als auch die Militärregierung in der Abwehr des Kommunismus zu jener Zeit die wichtigste Voraussetzung für die Etablierung einer funktionierenden Demokratie sahen. Folgt man jener Logik, so war die CCG (BE) 1948/49 noch stärker mit einem Problem konfrontiert, das sich bereits zu Beginn der Besatzung aufgetan hatte: „From the beginning the British occupiers faced up to the fundamental paradox of their situation: the task was to democratise, but you cannot democratise by imposition, because to do so would demonstrate that undemocratic measures might be both acceptable and – potentially – effective as a means to an end“163, beschreibt David Philips jene große Herausforderung, die es bedeutete, eine Gesellschaft nachhaltig zu verändern, ihr dabei jedoch nichts aufzuzwingen. Doch 1948/49 hatten sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, dem Frauenring mit Mitteln, die eine deutliche, aktive Bevorteilung des Rings durch die Militärregierung gegenüber anderen Organisationen bedeuteten, zum Status einer Groß- und Dachorganisation zu verhelfen. Anders als es offensichtlich bei Helena Deneke der Fall war, war den Verantwortlichen Robertson, Pakenham und Ostermann das Problem, welches man sich mit einer noch stärkeren Förderung des Frauenrings zu einer Zeit, zu der dessen Defizite bereits offensichtlich waren, ins Haus holte, allzu bewußt. Daß die „Democratic
162 Tscharntke: Re-educating, S. 16. 163 Phillips. David: Aspects of education for democratic citizenship in post-war Germany, in: Oxford Review of Education, 38. Jg. (2012) S. 567–581.
902 | Theanolte Bähnisch
Common Front“164, mit der Pakenham und Robertson erklärtermaßen den DFD bekämpfen wollten, ausgerechnet von einer Organisation angeführt werden sollte, deren Demokratiefähigkeit zumindest als fragwürdig galt, wurde unter offener Abwägung der Vor- und Nachteile, welche eine nachdrückliche Unterstützung des Frauenrings mit sich bringen würde, beschlossen. Daß man glaubte, im Frauenring die Lösung für zwei zu jener Zeit als äußerst drängend betrachtete, im Folgenden ausgeführte Problemlagen gefunden zu haben, gab den Ausschlag für diese noch stärkere Förderung Bähnischs. Diese Förderung bestand beispielsweise darin, daß Bähnischs frauenpolitische Pläne weiterverfolgt wurden und sich der niedersächsische Regional Women‘s Affairs Officer Veronica Williams gemeinsam mit Bähnisch und einer anderen Frau, Grete Seelbach, über die endgültige Form und einen geeigneten Ort der geplanten Kurse für Leitungs-Kräfte von Frauen-Organisationen verständigen sollte. Für den Februar 1950 wurde – zur Vertiefung und Verstetigung einer für Bähnisch äußerst hilfreichen Beziehung – eine weitere Reise Denekes nach Deutschland geplant. Erneute Reisen Denekes folgten im September/Oktober 1950 und im März/April 1951.165 Im Rahmen dieser Reisen trafen sich Deneke und Bähnisch immer wieder zu informellen Gesprächen,166 welche Deneke als „helpful in giving fresh insight into the present day situation in Germany and a picture of leading questions with which leading women, engaged in public work, are pre-occupied“167 charakterisierte. Die Oxforderin reiste also 1950 längst nicht mehr nur als Beraterin Bähnischs nach Deutschland, sondern Bähnisch beriet und informierte jeweils auch Deneke, was dieser wiederum erleichtert haben dürfte, jeweils eine gute Weiterentwicklung des Frauenrings zu bescheinigen.168 Gleichzeitig setzte sich zu jener Zeit auch bei Deneke die Erkenntnis durch, daß aus Bähnischs Perspektive vor allem Aufschlüsse über die Lage jener Gruppe von Frauen, welche sich an zentraler Stelle in Politik, Verwaltung und Wohl-
164 NA, UK, FO 1050/1212, Extract from a letter from the Chancellor to the Military Governor, 2nd February, 1948, on the subject of the position of women in Germany, Copy, o. D. 165 Auf dieser Reise besuchte Deneke Ulich-Beils Staatsbürgerinnenverband und nahm an der Chiemsee-Konferenz teil. Auf der von der US-Militärregierung geplanten Konferenz hatten unter anderen Nora Melle, Katharina Petersen und Marie Elisabeth ‚Else‘ Lüders gesprochen. Bodleian Library, MSS, Deneke Papers, Box 25, Brief report on my visit to Germany 18th September, to 2nd October, 1950. 166 Beispielsweise kam Deneke an den Abenden zwischen dem 25. und dem 27.04.1951 mit Bähnisch, der Baronin von Knigge und Katharina Petersen zusammen. Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C10, Report on the Journey in Rhineland and Westphalia, March 27th–April 24th, 1951, M. C. Cornell, H. C. Deneke, S. 27. 167 Ebd. 168 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C10, Report on the Journey in Rhineland and Westphalia, March 27th–April 24th, 1951, M. C. Cornell, H. C. Deneke, S. 27.
Wachsende Prominenz | 903
fahrtsarbeit einbrachten, zu erwarten waren.169 Ob die Regierungspräsidentin im Rahmen der Gespräche jemals über das alltägliche Leben von NiedrigVerdienerinnen und Hausfrauen sprach, erwähnt Deneke nicht. Schließlich – und darin lag im Jahr 1949 die stärkste Unterstützung für den Frauenring – gab die Militärregierung, wie schon mehrfach angedeutet, dem Ring Gelegenheit zum Wachstum. Sie unterstützte Bähnisch und ihre Mitstreiterinnen bei der Planung einer weiteren großen Frauen-Konferenz, die, von beiden Partnern schon seit dem Frühjahr 1948 anvisiert, im Oktober 1949 endlich stattfinden konnte. Im Rahmen der zweiten interzonalen Konferenz in Bad Pyrmont wurde – nachdem seit Mai 1949 die Bundesrepublik existierte – der Deutsche Frauenring (DFR) gegründet. Dem ‚Demokratischen Frauenbund Deutschlands‘ (DFD), der in der ebenfalls 1949 begründeten DDR fortbestand, wurde damit ein anderer Verband, der für sich beanspruchte, die deutschen Frauen zu vertreten, entgegengesetzt. Dem Memorandum ‘Political Developments leading to the Deutscher Frauenkongreß in Bad Pyrmont 07.–09. October 1949‘170 ist ein klares Plädoyer für die nahezu bedingungslose Unterstützung des Frauenrings der Britischen Zone und der Gründung des Deutschen Frauenrings als Dachorganisation von Frauenverbänden, bei voller Gewißheit über die damit verbundenen Probleme, zu entnehmen. Es ist deshalb als ein Kern-Dokument vor allem für das Verständnis der britischen Frauen-Reeducation Politik, aber auch für die Biographie Theanolte Bähnischs in der Nachkriegszeit zu bewerten. Der Bericht beschreibt die Gründung des Deutschen Frauenrings (DFR) zwar als eine „high handed action“ der beteiligten Frauen, lobt aber auch die außergewöhnliche, vorausschauende Haltung und Entschlossenheit jener ‚Handvoll‘ Frauen und besonders Bähnischs,171 die dafür verantwortlich gemacht wird, daß der DFD nicht noch erfolgreicher sei.172 Er schien vor allem zwei Ziele verfolgt zu haben. Zum einen – das macht schon die Adressatenliste deutlich – diente er dazu, verschiedene Einrichtungen der Militärregierung über die jüngsten Entwicklungen der Frauenarbeit in Deutschland aufzuklären173, zum anderen muß er – darauf deutet sein betont defensiver Charakter hin – verfaßt worden sein, um die Unterstützung Theanolte Bähnischs, als einem höheren politischen Ziel dienend, zu rechtfertigen. „It is not disputed that the methods adopted were undemocratic according to one interpretation of the term“174, hielt Rita Ostermann als Verfasserin des Berichts fest, ohne zu beschreiben, worauf sich ihre Aussage eigentlich bezog. Doch läßt sich, gemessen an der Vorgeschichte, erahnen, daß sie damit auf die Entwicklung des
169 Ebd. 170 NA, UK, FO 1049/1847, Political Developments leading to the deutscher Frauenkongress in Bad Pyrmont, 7th–10th October, 1949, 26.10.1949. 171 Ebd., S. 2. 172 Ebd., S. 4. 173 NA, UK, FO 1049/1847, Ostermann an verschiedene Einrichtungen der Militärregierung in Deutschland und Großbritannien, 23.11.1949, Anhang: Political Developments leading to the deutscher Frauenkongress in Bad Pyrmont, 7th–10th, October 1949, 26.10.1949. 174 NA, UK, FO 1049/1847, Political Developments leading to the deutscher Frauenkongress in Bad Pyrmont, 7th–10th October, 1949, 26.10.1949.
904 | Theanolte Bähnisch
Frauenrings und die Gründung des DFR mit Unterstützung durch die Militärregierung angespielt haben muß, zumal sie, quasi die Argumentation Herta Gotthelfs aufgreifend, fortführt: „Whether this deficiency will lead to the ultimate crumbling of the Deutscher Frauenring remains to be seen but the pressure of outside circumstances sometimes does not permit a tidy and neat, or even a democratic method of procedure“175. So begründete die CCG (BE) also, warum sie entgegen ihrer ursprünglichen Überzeugung einer Frauenorganisation zu einem erheblichen Machtzuwachs gegenüber allen anderen verhalf. Die Zeit, in der man auf eine langsame, selbständige Genese des Frauenrings hin zu einer demokratischen Organisation wartete, indem man ihm zwar Schützenhilfe gewährte, sich gleichzeitig jedoch noch dem Prinzip der ‚grass-roots-democracy‘ verbunden fühlte, um anderen Organisationen alle Chancen offen zu halten, den Frauenring in Sachen Demokratiefähigkeit und Attraktivität für Mitglieder aus allen Berufen, Einkommensgruppen und Lebensaltern zu überholen, war 1949 endgültig vorbei. Ostermann erklärte in jenem Dokument, warum ausgerechnet jene Organisation, deren Demokratiefähigkeit so sehr zu wünschen übrig ließ176 und welche offenbar weder jüngere Frauen noch Arbeiterinnen noch Hausfrauen anzusprechen vermochte,177 nun noch stärker als alle andere Organisationen gefördert wurde: Die Kooperation des DFD mit der kommunistisch ausgerichteten Internationalen Frauenorganisation IDFF berge die Gefahr, so Ostermann, daß der DFD Frauen in Deutschland mit jener für deutsche Frauen so attraktiven internationalen Anbindung besonders wirksam beeinflussen könne. Außerdem sei es möglich, daß der DFD über den IDFF die alleinige Vertretung deutscher Frauen in der UNO178 für sich beanspruchen könne. Beide Gefahren hoffte man durch die Gründung des Deutschen Frauenrings (DFR) abwenden zu können. Der DFR sollte den Wiederanschluß der (west-)deutschen Frauenbewegung an internationale, ‚westlich‘ orientierte Bündnisse gewährleisten und die Vertretung deutscher Frauen im Ausland übernehmen. Auf dieser Grundlage sollte er den deutschen Frauen eine ebenfalls durch eine international agierende Organisation anerkannte Alternative zum DFD bieten und als Dachorganisation andere Zusammenschlüsse unter dem Dach der ‚democratic common front‘ vereinen. 8.2.5 Bähnisch und ihr Frauenring als Säule der westalliierten Containment-Politik Was Ostermann mit ihrem Schreiben deutlich machen wollte, war, daß sich Deutschland 1949, was die internationale Anerkennung seiner ‚nationalen‘ Frauenbewegung anging, auf einem von der Britischen Militärregierung als äußerst gefährlich wahrgenommenen Weg befand. Die ‚United Nations Comission on the Rights of Women‘,
175 176 177 178
Ebd., S. 4. Ebd., S. 3. Ebd., S. 2. Der ICW hatte damals und hat noch heute einen konsultativen Status bei der UNO und ihren ständigen Vertretungen. Aus diesem Zusammenhang heraus ist auch Bähnischs späteres Engagement in der UNESCO zu erklären.
Wachsende Prominenz | 905
die im Juni 1946 von der United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)179 etabliert worden war, strebte 1949 die Aufnahme von Vertreterinnen aus den ‚besiegten Feindstaaten‘ Deutschland und Italien in ihre Reihen an. Für Protagonisten im In- und Ausland, die das besiegte Deutschland zu einem friedfertigen, international geachteten Staat wiederaufbauen wollten, war dies eine äußerst interessante Entwicklung. Schließlich war an eine Aufnahme Deutschlands in die 1945 gegründete UNO noch lange nicht zu denken. Um so bedeutender muß für Besatzer und Besetzte die Chance erschienen sein, Deutschland wenigstens teilweise wieder in die Strukturen jenes uneingeschränkt anerkannten Völkerrechtssubjektes, das sich der Sicherung des Weltfriedens verschrieben hatte und in das zur Zeit seiner Gründung große Hoffnungen gelegt wurden, zu integrieren. Die UNESCO stützte ihre Nominierungen für die Kommission jeweils auf DatenErhebungen in den entsprechenden Ländern. Das Informationsmaterial holte sie bei den UNO-affiliierten, internationalen Organisationen ein. Daß die IDFF gerade einen Antrag auf Erhöhung ihres Status bei der UNO gestellt hatte180, machte es noch wahrscheinlicher, daß der mitgliederstarke DFD, der ja als demokratischer, überparteilicher Frauenbund für ganz Deutschland auftrat – und für den die IDFF eintrat – gebeten werden würde, eine Vertreterin in die UNESCO-Kommission für Frauenrechte zu entsenden. Schließlich war der DFD längst in die IDFF, die wiederum Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der UNO sowie bei der UNESCO und UNICEF besaß, organisatorisch eingebunden. „For a moment it seemed possible that in spring 1950 a member of the East German Parliament would attend the next Commission meeting and be allowed to speak on behalf of all German women“181, faßt Denise Tscharntke das Szenario zusammen, das sich vor Ostermanns geistigem Auge abspielte, wenn sie an die Nominierung der Vorsitzenden des DFD für die Frauenrechte-Kommission dachte.182 Daß die Generalsekretärin des DFD, Elli Schmidt, wie Ostermann zu bedenken gab, der Volkskammer angehörte, war zwar das geringere ‚Problem‘, denn Schmidt war auch Mitglied des sehr viel einflußreicheren ZK der SED. Ostermann mußte ihre Erwägungen allerdings auf die Informationen stützen, welche ihr vorlagen, und genaue Kenntnisse über die Kluft zwischen Verfassungsanspruch und -realität in der DDR, die vom uneingeschränkten Führungsanspruch der SED geprägt war, gehörten offenbar nicht dazu. Worauf Chief Women’s Affairs Officer Ostermann allerdings bauen konnte, waren ihre fundierten Kenntnisse über internationale Politik. Ihr war klar, daß die Gründung des Frauenrings als zonenübergreifender, ‚deutscher‘ Dach-Verband von Frauen-Organisationen ermöglichen würde, daß genausogut auch dessen Leiterin anstelle der Leiterin des
179 Als Vorgängerinstitution der UNESCO gilt das Institut International de Coopération Intellectuelle (IICI), das dem Völkerbund angegliedert war und im Januar 1926 in Paris seine Arbeit aufgenommen hatte. 180 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 184. 181 Ebd. 182 Diese Sorge Ostermanns ist unter anderem in einem Brief nachzuvollziehen, mit dem Ostermann sich zum wiederholten Mal gegen die Vorwürfe Gotthelfs zur Wehr setzt: NA, UK, 1049/1847, Ostermann an Peter Solly-Flood, 24.11.1949.
906 | Theanolte Bähnisch
DFD an den nächsten Sitzungen der UNESCO-Frauenrechts-Kommission teilnehmen könnte. Schließlich hatte der ICW, der wie die IDFF ebenfalls als Organisation mit B-Status183 der UNO affiliiert war, der Regierungspräsidentin bereits seine Unterstützung signalisiert. Statt Schmidt hätte also Bähnisch ‚die deutschen Frauen‘ in der UNESCO-Frauenrechtskommission repräsentieren und so auf die Gestaltung der Arbeit der UNO im Bereich Bildung, Wissenschaft und Kultur Einfluß nehmen können. Dieses Ziel wollte Ostermann unbedingt erreichen. „However there is no doubt at all that from the wider international implications the Deutscher Frauenring serves a useful and highly politic purpose“184, ist dem Dokument ‚Political developments‘ zu entnehmen. Der ‚Deutsche Frauenring‘ sollte also in Kooperation mit dem ‚westlich ausgerichteten‘ ICW dem ‚Deutschen Frauenbund‘ und der IDFF den Wind aus den Segeln nehmen und die Interessen der ‚deutschen Frauen‘, welche in der Wahrnehmung Ostermanns ‚westlicher‘ Natur zu sein hatten, auf dem internationalen Parkett vertreten. Man diskutierte in der Militärregierung also zu jener Zeit nicht mehr darüber, ob der Frauenring eine ‚politische‘ Organisation sei oder nicht, auch nicht darüber, ob er dies sein sollte oder nicht, sondern die Frage, die man sich nun stellte, war die, wie man die Organisation für die eigenen Zwecke politisch einsetzen könne. Zu Beginn hatte die Political Division der CCG (BE) dem Austausch des ‚Club deutscher Frauen‘ mit Frauen aus dem Ausland äußerst skeptisch gegenübergestanden, nun war die Anbindung des Frauenrings unter der für ihre ‚KPD-Phobie‘ bekannten Führungsfigur an die Internationale Frauenbewegung das Ziel, das Ostermann als Vertreterin der Division zu erreichen trachtete. Joy Evans trat dabei als Senior Women’s Affairs Officer aus der Education Branch gegenüber Ostermann stark in den Hintergrund. Der Erfolg jener überparteilichen Organisation, die zu Beginn unter dem Primat der Lokalität und der Offenheit für alle politischen Richtungen arbeiten sollte, wurde nur drei Jahre später über ihre internationale Rolle und über ihre Fähigkeit, als Großorganisation Frauen auf den antikommunistischen Grundkonsens einzuschwören und die Entwicklung anderer Organisationen entsprechend zu steuern, definiert. Dem Diplomaten und hochrangigen Mitarbeiter des Foreign Office, Peter Solly-Flood, gegenüber sprach Rita Ostermann sogar von einem „subject of first rate importance only at the beginning at its development“185, als sie auf die internationale politische Funktion des DFR anspielte. Mit der erhofften Aufnahme des Frauenrings in den ICW verband die Militärregierung nämlich auch die Hoffnung, daß bald andere Internationale Nicht-Regierungs-Organisationen dem Beispiel des ICW folgen und ebenfalls Verbände aus ehemaligen Feindstaaten aufnehmen würden.186
183 Diese Organisationen hatten zwar kein Recht, an Abstimmungen teilzunehmen, wurden jedoch zur Beratung herangezogen. 184 NA, UK, FO 1049/1847, Political Developments leading to the deutscher Frauenkongress in Bad Pyrmont, 7th–10th October 1949, 26.10.1949, S. 4. 185 NA, UK, FO 1050/1211, Rita Ostermann an Peter Solly-Flood, 13.11.1949. 186 NA, UK, FO 1049/1847, Political Developments leading to the deutscher Frauenkongress in Bad Pyrmont, 7th–10th October, 1949, 26.10.1949, S. 5.
Wachsende Prominenz | 907
Die Arbeit der Hannoveraner Regierungspräsidentin im Frauenring 1949 wies damit weit über das Thema Frauenbildung und Frauenbewegung hinaus. Sie hatte sich zu einer – wenn auch als tönern wahrgenommenen – Säule der allgemeinen außenpolitischen Taktik der Labour-Regierung entwickelt. Diese wiederum war Bestandteil einer gemeinsamen Politik westeuropäischer Staaten, die, unter Federführung der USA, eine Strategie der schrittweisen gemeinsamen ‚Kontrolle und Einbindung‘ ehemaliger Feindstaaten durch Konzepte wie den Marshall-Plan und Zusammenschlüsse wie die Montanunion/Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) verfolgten und umsetzten. Daß Großbritannien auf dem weiteren Weg in der europäischen Integration unter Einbeziehung Deutschlands vielfach eher bremsend als fördernd wirkte, vor allem nachdem der Konservative Churchill seine Begeisterung für ein politisches ‚Europa‘ propagiert hatte, steht auf einem anderen Blatt. Als nach der Gründung des DFR im Herbst 1949 klar war, daß er tatsächlich über den ICW187 in der UNESCO-Frauenrechtskommission repräsentiert sein würde, schien es Ostermann eine gewisse Freude bereitet zu haben, Bähnischs Widersacherin Gotthelf einen Stich versetzen zu können. Diese hatte wieder einmal einen aufgebrachten Brief geschrieben, in dem sie die Militärregierung anklagte, mit dem Frauenring eine ‚private Organisation‘ auf Kosten politischer Parteien zu fördern. Der Frauenring, so reagierte Ostermann auf dieses Schreiben, sei nach seiner Aufnahme in die UNO-Kommission jedoch gar keine private Organisation mehr, sondern eine „non-governmental agency with a political function“188. 8.2.6 Die Regierungspräsidentin als Hoffnungsträgerin in der internationalen Frauenbewegung Nicht zuletzt Dr. Eder-Schwyzers189 Zusicherung, Bähnischs Organisation sei als deutscher Council in dem von ihr geleiteten ICW willkommen, muß Auslöser für die noch stärkere Unterstützung des Frauenrings durch die britische Militärregierung
187 Die endgültige, offizielle Aufnahme des DFR als National Council in den ICW fand erst 1951 auf einer Konferenz des ICW in Athen statt. 188 NA, UK, FO 1050/1211, Rita Ostermann an Peter Solly-Flood, 13.11.1949. 189 Jeanne Eder-Schwyzer war Präsidentin des ICW seit 1947. Ihre Vorgängerin, die Belgierin Marthe Boël, hatte den Verband seit 1936 geleitet. Vgl. zur Geschichte des ICW und seiner Vorsitzenden: International Council of Women (Hrsg.): Women in a changing world. The dynamic story of the International Council of women, London 1966 sowie für einen kürzeren Überblick und Vergleich mit anderen Organisationen: Rupp, Leila, J.: Transnational Women’s Movements, in: European History online, 16.06.2011, auf: http:// www.ieg-ego.eu/en/threads/transnational-movements-and-organisations/international-so cialmovements/leila-j-rupp-transnational-womensmovements#TheInternationalCouncilof Women, am 13.12.2013. Ein Großteil der Akten des ICW ist in der Women’s Library der Metropolitan University of London überliefert. Zur Zeit meines Aufenthaltes dort waren die Unterlagen des ICW (5ICW), welche Material zur Aufnahme des DFR in den ICW auf der Konferenz von Athen 1951 (5ICW/B/14) und zur Konferenz von Philadelphia, an der Katharina Petersen teilgenommen hatte, umfassen, für Nutzer noch nicht zugänglich.
908 | Theanolte Bähnisch
gewesen sein. Hatten sich die Women’s Affairs Officers zu Beginn der Besatzungszeit vor allem an den Empfehlungen und der Kooperationsbereitschaft der britischen WGPW orientiert, so stand jetzt die Einstellung des internationalen Verbandes ICW im Fokus der Aufmerksamkeit der CCG (BE). Der Schulterschluß des DFR mit dem ICW zeigte, daß die Energien der Women’s Affairs Officers in Deutschland, was die außenpolitischen Interessen der britischen Regierung anging, zumindest teilweise erfolgreich eingesetzt worden waren. Was in Bezug auf eine breitenwirksame Frauenbildung und die britischen WunschZielgruppen des Frauenrings offenbar verspielt worden war, das wurde auf der Ebene der internationalen Einbindung durch das Festhalten am Frauenring wieder wettgemacht. Hätte Eder-Schwyzer die Aufnahme des DFR in den ICW abgelehnt, so wäre guter Rat teuer gewesen. Aus dem Stegreif eine andere, der ICW-Mitgliedschaft würdige Frauen-Organisation aufzubauen, wäre in der Schnelle kaum nicht möglich gewesen. Eine Weigerung der ICW-Vorsitzenden, mit dem DFR zu kooperieren wäre deshalb – in Bezug auf die gefühlten Erfordernisse des Kalten Krieges und die Hoffnungen, die Ostermann wie Bähnisch in die UNO und ihre Unterorganisation UNESCO setzte – einem weitgehenden Scheitern der britischen Frauenarbeit in Deutschland gleich gekommen. Jeanne Eder-Schwyzer hatte jedoch, nachdem sie einer Wiedereingliederung deutscher Frauen länger als andere Führungsmitglieder des ICW skeptisch gegenübergestanden hatte, schließlich selbst ein Interesse daran entwickelt, daß ein antikommunistischer deutscher Frauenverband aufgebaut und in den ICW integriert würde. Denn die Ausrichtung des ICW – das belegen Unterlagen Bähnischs aus ihrer Zeit als ICW-Vizepräsidentin190 – war deutlich antikommunistisch. Nachdem er in Ländern, die dem Einfluß der Sowjetunion unterlagen, seine National Councils verloren hatte, stand der Verband in Zugzwang, neue Councils, deren politische Ausrichtung zu seinen Zielen paßte, aufzunehmen.191 Denn auch auf internationaler Ebene war – mit dem IDFF als Gegner – ein Wettkampf um den Status als einflußreichste Frauen-Organisation entbrannt, in dem die neue, bipolare Weltordnung eine entscheidende Rolle spielte.192 Eine deutsche Frauenorganisation aufzunehmen, lag nicht zuletzt aufgrund der geographischen Lage des Landes im Interesse des IDFF wie des ICW. Daß schließlich beide Organisationen je eine deutsche Organisation aufnahmen, nämlich die IDFF den DFD und der ICW den DFR, spiegelte – wie die spätere Aufnahme der BRD in die NATO und die der DDR in den Warschauer Pakt – die deutsche Teilung auf internationaler Ebene. Andererseits werden auch die Traditionen, mit denen der DFR aufwarten konnte, eine Rolle für Eder-Schwytzers ‚okay‘ gespielt haben. Ob der ICW eine Organisation als deutschen Council akzeptiert hätte, die nicht auf inhaltliche und personale Kontinuitäten des bis 1933 dem ICW angeschlossenen BDF setzte, ist zumindest fraglich.
190 Bähnisch war eine von sieben gewählten Vize-Präsidentinnen des ICW ab 1963. Neben den gewählten gab es vier kooptierte Vize-Präsidentinnen. Vgl.: International Council of Women: Women in a changing world, S. 352. 191 Vgl. dazu auch: Tscharntke: Re-educating, S. 183. 192 Vgl.: ebd., S. 183/184.
Wachsende Prominenz | 909
Bei der Aufnahme des DFR in den ICW machte Eder-Schwyzer, die 1947 Marthe Boël als Präsidentin des ICW abgelöst hatte, sogar von einem in den Statuten des ICW festgehaltenen, selten genutzten Passus Gebrauch. Nach diesem war es zulässig, einen ‚Liaison Officer‘, also eine Verbindungsperson, für einen National Council schon zu benennen, bevor die entsprechende Organisation auf internationaler Ebene anerkannt worden war.193 Daß von dieser ‚Kann-Bestimmung‘ Gebrauch gemacht wurde, war offenbar eng an die Person Bähnischs, für deren Integrität sich vor allem Lady Nunburnholme, die Leiterin des British National Council, gegenüber dem Internationalen Verband verbürgt hatte, geknüpft. Einerseits war Bähnisch bei Nunburnholme zu Ansehen gelangt, weil sie mit Frauen zusammenarbeitete, die dem ICW und seinen National Councils bereits durch den BDF bekannt waren. Andererseits hatte Nunburnholme an Bähnisch gerade auch das gefallen, was ältere Protagonistinnen der Frauenbewegung wie Zahn-Harnack eben nicht bieten konnten.194 „I was very much impressed by her extraordinary virility and driving power, which are qualities not possed today by Frau von Zahn-Harnack, who lives in Berlin and in consequence has to work with great caution“195, hatte Nunburnholme im Mai 1947 ihren Eindruck von Bähnisch beschrieben. Im gleichen Brief hatte sie auf die Gefahr, welche von der kommunistischen Frauenbewegung ausgehe, hingewiesen. Dies impliziert, daß sie schon 1947 die beschriebenen Eigenschaften Bähnischs als hilfreich in dieser Hinsicht empfunden hatte. Daß der Kontakt zu Nunburnholme bereits 1946 mit der Reise Bähnischs nach Großbritannien geebnet worden war, zahlte sich am Ende also für alle beteiligten Protagonistinnen, Bähnisch, die britische Militärregierung und den ICW aus. „It is a point of minor importance – though significant – that the Federal Chancellor sent a message of goodwill to the Frauenkongress in Bad Pyrmont“196, schloß Rita Ostermann schließlich ihren Bericht über die politischen Entwicklungen, die zur Konferenz von Pyrmont führten. Sie machte damit deutlich, daß auch die neue deutsche Regierung die Gründung eines westlich ausgerichteten Frauenverbandes billigte, der sich anschickte, die deutschen Frauen im Ausland zu vertreten.
193 NA, UK, FO 1049/1847, Political Developments leading to the deutscher Frauenkongress in Bad Pyrmont, 7th–10th October, 1949, 26.10.1949, S. 4. 194 Auch A. B. Reeve schilderte nach einer Reise im Jahr 1947, daß ihr fast nur ältere Frauen begegnet seien, die sich in der Frauenbewegung engagierten. Als Ausnahmen nennt sie die beim NWDR tätige Leiterin des Frauenfunks Käthe Prollius und die ebenfalls im Frauenring aktive Else Richter. NA, UK, FO 945/283, Report on visit to Germany: 7th– 19th July, 1947 von A. B. Reeve. 195 NA, UK, FO 945/283, Nunburnholme an Reeve, 13.05.1947. 196 NA, UK, FO 1050/1230, Report on recent women’s conferences Bad Pyrmont and Fürth, 07. Juli 1947, ,Appendix B‘ zum Dokument ,Political Developments leading to the deutscher Frauenkongreß in Bad Pyrmont 1949‘, S. 5. Diese Äußerung Ostermanns ist eventuell unzutreffend, siehe Anm. 211.
910 | Theanolte Bähnisch
8.3 DER ZWEITE KONGRESS VON PYRMONT UND DIE GRÜNDUNG DES DEUTSCHEN FRAUENRINGS (DFR) ALS FRAUENVERBAND FÜR (WEST-)DEUTSCHLAND 8.3.1 „Es wird höchste Zeit, daß wir unter ein Dach kommen“ – Ungeduld und große Erwartungen Auf dem Kongreß vom 07. bis 10.10.1949 in Bad Pyrmont, zu dem verschiedenen Berichten zufolge197 über 500 Frauen zusammengekommen waren, konstituierte sich schließlich der Deutsche Frauenring (DFR). Was der damaligen Regierungs-Vizepräsidentin bereits 1946 im Zuge der Lizenzerteilung für den ‚Club deutscher Frauen‘ in Aussicht gestellt worden war, nämlich daß aus dem Club einmal ein Verband werden könnte, der zunächst über die Region Hannover und schließlich über die Grenzen der britischen Besatzungszone hinauswachsen könnte, wurde im Herbst 1949 Realität. Wie schon auf der ersten Pyrmonter Tagung im Juni 1947 waren Vertreterinnen der britischen Militärregierung aus allen Länder-Departments, Vertreterinnen des OMGUS und der französischen Militärregierung sowie interessierte Zivilistinnen, darunter viele leitende Mitglieder von Frauenorganisationen aus den USA, aus Großbritannien sowie aus anderen europäischen Ländern anwesend.198 Daß die Delegierten der US-Zone, aber auch einige Berlinerinnen199 kein Geld für die Reise nach Pyrmont hatten, war ein Grund dafür, daß die Konferenz und damit der Zusammenschluß gleichgesinnter Verbände in Deutschland zum ‚Deutschen Frauenring‘ immer wieder verschoben werden mußte.200 Aber auch der Umstand, daß es noch gar keinen deutschen Staat gab, in dessen Grenzen sich ein ‚deutscher Frauenverband‘ hätte ausdeh-
197 Diese Zahl nennt ein Manuskript von Hedwig Schmitt-Maass, das zur Veröffentlichung in einer Jugend-Zeitschrift bestimmt war, Theanolte Bähnisch nannte in ihrer Rede anläßlich ihres Rücktritts als Vorsitzende des DFR 1952 sogar die Zahl 600. DFR-Archiv, Freiburg, A 1, Schmitt-Maass, Hedwig: Jugend spricht zur älteren Generation, an „wir alle“, o. D.; ebd., DFR/Theanolte Bähnisch: Geschäftsbericht vorgelegt auf der Hauptversammlung in Berlin am 28.–29. März 1952, S. 1. Else Reventlow, die Leiterin des SFAK, die Bähnisch kritisch gegenüberstand, fand, daß diese Zahl „völlig aus der Luft gegriffen“ sei. Es seien nur ca. 80 Delegierte und 120–150 Gäste anwesend gewesen. AdSD, Nachlaß Else Reventlow, Nr. 43, Else Reventlow an Lisa Albrecht, 15.10.1949. 198 Diese hätten jedoch eher repräsentative Funktion gehabt, als daß ihre Anwesenheit im praktischen Sinne hilfreich gewesen wäre, ist im Protokoll der Women‘s Affairs Section des Landes Schleswig-Holstein über die Konferenz vermerkt. NA, UK, FO 1050/1230, Land Schleswig-Holstein, Impressions of Women’s Congress at Bad Pyrmont, October 7th to 10th, 1949. 199 DFR-Archiv, A2, Berliner Frauenbund, Agnes von Zahn-Harnack an Bähnisch, 25.01.1949. 200 DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Ulich-Beil, 30.12.1948 sowie ‚Sekr.‘ [Prejawa] an Nora Melle, 20.12.1948.
Wachsende Prominenz | 911
nen können, spielte eine Rolle für die lange Verzögerung, mit der die zweite Konferenz von Pyrmont schließlich stattfand.201 Die Vorsitzende des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ wog sich derweil in Ungeduld. Bereits im Dezember 1948 hatte Bähnisch, auf einen Zusammenschluß des Frauenrings mit anderen Organisationen anspielend, an Nora Melle, die sich im Staatsbürgerinnenverband engagierte202, geschrieben, es werde „höchste Zeit, daß wir unter ein Dach kommen.“203 Nach der Amtsenthebung ihres Mannes und seiner Abwesenheit in den Kriegsjahren mußte die aktionistisch veranlagte Theanolte Bähnisch 1948/49 eine weitere Phase der Stagnation und Unsicherheit ertragen. Wie bereits erwähnt, war zum einen ihr Amt als Regierungspräsidentin aufgrund der britischen Pläne zur Verwaltungsreform bedroht, aber zum anderen wollte es auch mit der organisierten Frauenbewegung samt der von Bähnisch angestrebten Schule zur staatsbürgerlichen Frauenbewegung in Westdeutschland nicht recht vorangehen – obwohl sich die weltpolitische Lage zunehmend verschärfte. Mit der Unzufriedenheit darüber stand sie nicht allein da. Auch die leiderprobte Agnes von Zahn-Harnack empfand im Machtzuwachs des DFD und damit des Kommunismus eine kaum ertragbare, existentielle Bedrohung. Sie war nicht nur „tief traurig“ über die Verschiebungen, sondern auch „beunruhigt, weil inzwischen der ‚Demokratische Frauenbund‘ sich weiter festigt. Demgegenüber bieten wir ein Bild der Zersplitterung, das unser Ansehen schädigt und unsere Arbeit hemmt“204, malte sie die Lage der westdeutschen organisierten Frauenbewegung in dunklen Farben aus. Ob „die Bindung an die politische Entwicklung der Westzone unumgänglich notwendig ist“205, ob man also die Staatsgründung abwarten müsse, bevor man sich endlich zu einem deutschlandweit agierenden Verband zusammenschließen könne, wollte sie nicht abschließend bewerten. Aber ihre Anmerkungen, es gebe ja auch schon wieder einen deutschen Städtetag und die Parteien seien ebenfalls nicht an die Zonen gebunden, ließen erkennen, wohin sie tendierte. Nora Melle, die sich in den folgenden Monaten zu einer zentralen Figur im Frauenring entwickeln sollte, hatte bereits im Oktober 1948 ihrem Unmut darüber Ausdruck verliehen, daß die Ausländerinnen „in großen Dingen“ nicht mit „uns“ gemeinsam arbeiten könnten, weil sie sich aufgrund der Namensungleichheit der Verbände fragen müßten, ob die Organisationen jeweils die „richtigen“ seien, oder ob sie etwa „der anderen
201 DFR-Archiv, A2, Zahn-Harnack an Bähnisch, 29.03.1949. 202 Melle war zwar an der Gründung des DFD beteiligt gewesen, hatte sich dann jedoch vom SED-nahen Verband abgewendet und sich ganz der Mitarbeit im ‚Staatsbürgerinnenverband‘ gewidmet. 203 DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Nora Melle, 30.12.1948. 204 DFR-Archiv, A2, Agnes von Zahn-Harnack an Bähnisch, 29.03.1949. Prejawa teilte Zahn-Harnack daraufhin mit, daß sie keineswegs den Eindruck hätte, daß der DFD im Westen erfolgreich sei, sondern, daß sich die Kommunistinnen wohl von der Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens überzeugt hätten. Ebd., Prejawa an Zahn-Harnack, o. D. [März oder April 1949]. 205 Ebd.
912 | Theanolte Bähnisch
Coté“206 angehören. Was Melle damit zum Ausdruck bringen wollte, war, daß sich Verbände im Ausland nicht sicher sein konnten, ob ein Verband in Deutschland ‚westlich‘ orientiert sei oder nicht, solange es keine Dachorganisation gab, die mit ihrem Namen für die politische Couleur der untergliederten, gleichnamigen Verbände bürgen könne. Daß keine Konferenz zustande kam, hieß also nicht, daß kein Austausch zwischen den verschiedenen überparteilich arbeitenden Frauenorganisationen stattgefunden hätte. Vor allem zwischen Berlin und Hannover waren Briefe hin und her gegangen, in denen sich Theanolte Bähnisch, Agnes von Zahn-Harnack, Else Ulich-Beil, Nora Melle und Hildegard Meding über das gemeinsame Ziel, eine Dachorganisation zu bilden, austauschten und sich über die jeweils geleistete Arbeit informierten.207 Die Art, in der in jenen Korrespondenzen auf die weder in Berlin noch in Hannover lebenden Frauen Freda Wuesthoff und Dorothee von Velsen Bezug genommen wurde, zeigt, daß auch diese beiden Frauen zu dem Kreis von Frauen gehörten, welche gemeinsam eine neue Groß- und Dachorganisation von Frauenverbänden aufbauen wollten.208 Hatte 1947 bei der Gründung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ der Kultusminister Adolf Grimme seine Aufwartung gemacht, so war zur zweiten FrauenKonferenz in Pyrmont der niedersächsische Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf persönlich erschienen und hatte damit seine Zustimmung zu den Entwicklungen signalisiert. Nicht zuletzt darin schlug sich nieder, daß er sich, wie auch die KopfBiographin Teresa Nentwig konstatiert209, ebensowenig der SPD gegenüber parteitreu verhielt, wie Bähnisch und Grimme dies taten. Wie eng die Beziehung zwischen dem Ministerpräsidenten und der Hannoveraner Regierungspräsidentin zu dieser Zeit war, ist schwer einzuschätzen; da die beiden bis Ende der 50er Jahre in der gleichen Stadt lebten, sind persönliche Briefe erst aus einem späteren Zeitraum überliefert. In diesen waren Bähnisch und Kopf per ‚Du‘, was in Anbetracht der Tatsache, daß Bähnisch sich selbst mit guten Freunden jahrelang siezte, durchaus auf ein engeres Verhältnis schließen läßt.210 Uneinig sind sich die Quellen darüber, welcher hochrangige Politiker auf Bundesebene eine Grußadresse zur Konferenz hatte übersenden lassen: Mal wird der Bundeskanzler, mal der Bundestagspräsident, mal der Bundesratspräsident ge-
206 207 208 209
DFR-Archiv, A2, Melle an Bähnisch, 10.10.1948. DFR-Archiv, A2. DFR-Archiv, A2, Zahn-Harnack an Bähnisch, 29.03.1949. NA, UK, FO 1005/1712, Intelligence sitrep for week ending 25th August [19]49, No. 11, Niedersachsen Intelligence Staff, 26.08.1949. Hier wird festgehalten, daß Kopf wegen seiner undogmatischen Haltung zur Parteidisziplin schon lange mißliebig sei. Die KopfBiographin Theresa Nentwig konstatiert ebenfalls eine Distanz Kopfs zu ‚seiner‘ Partei. Vgl.: Vgl.: Nentwig: Kopf, S. 490. 210 NLA HA HStAH, VVP 6, Nr. 78. In der Akte finden sich diverse Korrespondenzen zwischen Kopf und Bähnisch, in denen sie ihn ‚Hinnerk‘ und er sie ‚Thea‘ nennt.
Wachsende Prominenz | 913
nannt.211 Besatzer wie Besetzte hatten wohl noch Schwierigkeiten, die neuen Organe auseinanderzuhalten, aber die Botschaft die aus den Quellen hervorgehen sollte, ist einheitlich: Auf Bundesebene hieß man die Konferenz sowie die Existenz des Frauenrings, sein Selbstverständnis als Lobby-Organisation der westdeutschen Frauen sowie dessen Leitung durch die Regierungspräsidentin Bähnisch prinzipiell gut. Eine ehemalige Präsidentin des DFR, Grete Borgmann, sowie Eva Ehrlich haben sich 1973 dazu entschlossen, ein Konferenz-Protokoll zu veröffentlichen, welches den öffentlichen Teil der Konferenz, also den Vormittag des zweiten Konferenztags wiedergibt.212 Es ist unklar, wer das von Bähnisch und Mosolf unterzeichnete Protokoll angefertigt hat, und es läßt sich nicht ausschließen, daß nachträglich noch Änderungen eingefügt wurden. Neben diesem Protokoll aus der Überlieferung des DFR geben Aufzeichnungen aus den Akten der britischen Militärregierung sowie solche aus der Überlieferung des DFD Aufschluß über die Konferenz. Schließlich sind diverse Zeitungsartikel überliefert, die sich mit dem Ereignis beschäftigen. Dem vom DFR publizierten Protokoll zufolge wurde der Vorstand des Deutschen Frauenrings am ersten Konferenztag in einer geschlossenen Delegiertenversammlung gewählt.213 Am zweiten Tag wurde der Zusammenschluß „der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenverbände“ – man erinnere sich an die wortgleiche Formulierung im Programm zur Konferenz von Pyrmont 1947214 – „in einem Festakt mit Gästen bekräftigt“215. Diverse Ansprachen umrahmten diesen Akt: Zu Wort kamen die mitarbeitenden und die zur Kooperation bereiten Verbände, ausländische Gäste (die ICW-Präsidentin Dr. Eder-Schwyzer, die Präsidentin der International Alliance of Women (IAW), Dr. Hanna Rydh, sowie Senior Women’s Affairs Officer beim OMGUS Ruth Woodsmall, die zuvor YMCA-Präsidentin gewesen war), die deutschen Vertreterinnen der überparteilichen Frauenarbeit der drei Westzonen, respektive also der Bundesrepublik und der Niedersächsische Ministerpräsident. Theanolte Bähnisch rechnete, das verdeutlicht ein Brief an Agnes von Zahn-Harnack, sogar damit, daß schon in Bad Pyrmont die von ihr heiß ersehnte Aufnahme des DFR in
211 Im einem Bericht der Militärregierung ist notiert, es habe sich um ein Telegramm des Bundestagspräsidenten gehandelt. NA, UK, FO 1049/1847, Political Developments leading to the deutscher Frauenkongress (!) in Bad Pyrmont, 7th–10th October 1949, 26.10.1949, S. 5. Im Protokoll des Deutschen Frauenkongresses ist es der Bundesratspräsident. Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll. 212 Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll. Zwei unterschiedliche Schriftarten setzen in der publizierten Version das Protokoll von der Einleitung, einem Tagungsprogramm und einem Namens-Index, den die Herausgeberinnen hinzugefügt haben, ab. 213 Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 1. Die Vorstandsmitglieder sind im Protokoll nicht explizit aufgeführt, lediglich die Wahl Mosolfs zur Schriftführerin und die Bähnischs zur Vorsitzenden gehen daraus hervor. 214 DFR-Archiv, A1, Tagung der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen der britischen Zone vom 20. bis 23. Juni 1947, Bad Pyrmont [Programm]. 215 Ebd.
914 | Theanolte Bähnisch
den ICW stattfinden würde.216 Dies geschah jedoch, wie erwähnt, erst zwei Jahre später, auf einer Konferenz des ICW in Athen. Abgesehen davon, daß der ICW vermutlich auf die Gründung eines deutschen Staates warten und die Aufnahme auf einer seiner eigenen Konferenzen vollziehen wollte, könnte auch eine Rolle gespielt haben, daß nicht für alle auf die Gründung des DFR hinarbeitenden Frauen die internationale Anbindung als dringlichstes Problem erschien. Freda Wuesthoff zog jedenfalls in Erwägung, vor einem Beitritt zum ICW noch die „hoffentlich nahe bevorstehende Wiedervereinigung“ abzuwarten.217 Am Nachmittag des Gründungstages fanden eine Pressekonferenz sowie ein Jugendgespräch statt. Am dritten Konferenztag, der dem „inneren Zusammenschluß“218 dienen sollte, hielt Theanolte Bähnisch eine Rede zum Thema ‚Sinn und Aufgaben des Deutschen Frauenrings‘. Diese ist in einer gedruckten Version überliefert – wobei unklar ist, ob die Rede im gleichen Wortlaut vorgetragen wurde oder ob nachträglich noch Veränderungen an der Rede oder am Text vorgenommen wurden.219 Im Anschluß an die Rede der designierten Vorsitzenden des ‚Deutschen Frauenrings (DFR)‘ verständigten sich die Ausschüsse über ihre Richtlinien verständigt. Protokolle über die drei nicht-öffentlichen Konferenztage, von denen der letzte der Vorstandssitzung sowie Sitzungen der Ausschüsse vorbehalten waren, sind nicht überliefert. 8.3.2 Eine reibungsvolle Genese: Die Gründungsmitglieder und ihre Verhandlungen über den Vorstand des DFR Am 08.10.1949 präsentierte Anna Mosolf den 600 Delegierten und Gästen der Konferenz das Vorstandskomitee, das der DFR sich am Tag zuvor gegeben hatte. Dabei ordnete sie jedoch die Funktionen den Personen nur unvollständig und teilweise auch nicht genau zu. Aus dem DFR-Protokoll und anderen Überlieferungen läßt sich ein Gründungskreis des DFR herausarbeiten, der den geschäftsführenden Vorstand miteinschließt.220 Jener Kreis soll im Folgenden beschrieben und seine Genese rekonstruiert werden. Denn jene Frauen bildeten das Netzwerk, mit dem Bähnisch ihre frauenpolitischen Überzeugungen und Ziele, aber auch den Kampf gegen den Kommunismus und für die Westbindung umzusetzen versuchte, bis 1952 ein größerer
216 DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Zahn-Harnack, 08.09.1949. „Voraussichtlich […] Anschluß an den ICW“ zählte Bähnisch hierin als Punkt des Festakts auf. 217 DFR-Archiv, A1, Freda Wuesthoff an Theanolte Bähnisch, 02.03.1949. 218 NA, UK, FO 1049/1846, Bähnisch an Ostermann, 08.09.1949. 219 DFR-Archiv, Freiburg, A1, ‚Sinn und Aufgabe des Deutschen Frauenrings‘, Pyrmont 09.10.1949. 220 Ein Flyer des DFR, der sich auch online findet, nennt als Mitbegründerinnen des DFR folgende Personen: Theanolte Bähnisch, Anna Mosolf, Agnes von Zahn-Harnack, Leonore Mayer-Katz, Dorothee von Velsen, Elisabeth Mahla, Freda Wuesthoff und MarieElisabeth Lüders. Deutscher Frauenring e. V.: Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland bis heute, auf: http://www.deutscher-frauenring.de/der-verband/info-werbematerial/flyer/flyer-geschichte-der-frauenbewegung, am 14.02.2014.
Wachsende Prominenz | 915
Wechsel in der Führungsebene stattfand und der Sitz des DFR mit seiner neuen Vorsitzenden Dr. Else Ulich-Beil nach Berlin wechselte. Die im Folgenden vorgestellten Frauen221 begleiteten Bähnisch also während eines für den deutschen Wiederaufbau sehr wichtigen Abschnitts ihres Lebens und prägten mit ihr die Ausrichtung und die Inhalte der Arbeit des DFR. Gleichzeitig ist die Genese des DFR-Vorstands ein Kernstück einer bis dato so noch nicht beschriebenen, spannenden Verbandsgeschichte, die auch dazu einladen soll, diese Zusammenhänge intensiver zu erforschen.222 Viele der Frauen, aus denen sich im Oktober 1949 der Vorstand des DFR zusammensetzen sollte, waren bereits in der Weimarer Republik sehr bekannt, einige hatten schon deutlich vor 1949 mit Bähnisch zusammengearbeitet, andere waren vor der Pyrmonter Konferenz noch verhältnismäßig unbekannt. Anna Mosolf, eine Mitstreiterin Bähnischs der ersten Stunde, die nicht nur an der Gründung und Arbeit des ‚Club deutscher Frauen‘ beteiligt, sondern auch Co-Herausgeberin der ‚Stimme der Frau‘ war, wurde zur Schriftführerin des DFR gewählt. Sie repräsentierte gemeinsam mit Emma Faupel (1893–1878), Rektorin und Senatorin in Rendsburg, auf der Konferenz die britische Zone. Ihre Zonen-Zugehörigkeit zu benennen, war den Frauen offenbar sehr wichtig, stand doch die gemeinsame Konferenz für die Überwindung jener Grenzen, die in den Köpfen der Frauen verständlicherweise auch nach der Gründung der BRD noch präsent geblieben waren. Faupel blieb, wie Mosolf, bis 1952 im geschäftsführenden Vorstand des DFR, und war 1950–1952 Vorsitzende des DFRLandesverbandes Schleswig-Holstein. 1963 leitete sie den Landesfrauenrat Schleswig-Holsteins.223 Theanolte Bähnisch, zuvor Vorsitzende des ‚Frauenrings der britischen Zone‘, „diejenige Frau […] von der“ – laut Protokoll – „für unsere Frauenarbeit, jedenfalls in Norddeutschland die grössten Impulse ausgegangen“224 waren, wurde auf der Pyrmonter Konferenz im Rahmen des Gründungsaktes zur Vorsitzenden des Deutschen Frauenrings (DFR) gewählt.225 Kam diese Wahl auch wenig überraschend, so bedeutete sie dennoch eine besondere Auszeichnung für Bähnisch, die damit als Führungsfigur der überparteilichen Frauenbewegung in Westdeutschland anerkannt wurde. Sie sollte die Dachorganisation überparteilicher Frauenverbände in der verfassungsmäßig begründeten Bundesrepublik leiten und trug somit eine große Verantwortung: In ihrer Hand lag die Tradierung des historischen Erbes der bürgerlichen Frauenbewegung, und sie sollte dafür Sorge tragen, daß sich diese Bewegung im
221 Sofern die Personen bereits vorher eingeführt wurden, finden sich biographische Hinweise am entsprechenden Ort. 222 Bisher sind die Korrespondenzen zwischen den späteren Vorstands- und Führungsmitgliedern, die im Archiv des DFR überliefert sind, noch nicht systematisch ausgewertet worden. 223 Vgl.: Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 14. 224 Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 1. 225 Vgl.: Pilgert, Henry P./Waschke, Hildegard: Women in West Germany. With special reference to the Policies and Programs of the Women´s Affairs Branch, Office of Public Affairs, Office of the U. S. High Commissioner for Germany, Bad Godesberg 1952, S. 51.
916 | Theanolte Bähnisch
neuen Staatswesen bewährte, was auch Veränderungsbereitschaft erforderte. „[W]hat we do is not, cannot, and should not be a revival of what has been 14 years ago“226, hatte sich die letzte Vorsitzende des BDF, Agnes von Zahn-Harnack, überzeugt gegeben und damit demonstriert, daß auch die ‚alte Elite‘ von der neuen Anführerin erwartete, daß diese eine zeitgemäße Politik betreibe. Andererseits sollte diese jedoch den Zielen und Errungenschaften des BDF nicht widersprechen. Dazu gehörte auch die bereits mehrfach angesprochene organisatorische Einbindung der deutschen Frauenbewegung in die internationale Bewegung. Auch diese oblag nun der Regierungspräsidentin, sie sollte und wollte die (west-)deutschen Frauen auf internationaler Ebene repräsentieren. Schließlich oblag es der Vorsitzenden, für eine deutliche, inhaltliche und organisatorische Abgrenzung der bürgerlichen gegenüber der kommunistischen Frauenbewegung zu sorgen und das Gewicht ersterer im Kampf um Deutungsmacht und politischen Einfluß in Deutschland und in der Welt zu stärken. „Lassen sie mich Ihnen sagen, wie herzlich ich Ihre Wahl zur ersten Vorsitzenden […] begrüssen werde, und wie ich niemand anderen als Sie lieber als meine erste Nachfolgerin an dieser Stelle sehen würde“227, hatte Agnes von Zahn-Harnack schon im Vorfeld der Konferenz schriftlich das Zepter an Bähnisch übergeben und ihr damit eine besondere Ehre erwiesen. Zahn-Harnack, in der Bähnisch die „lebendige Verkörperung der Tradition der Frauenbewegung, die uns auch heute noch Vorbild ist“228, erkannte, konnte wegen eines gebrochenen Arms nicht zur Konferenz kommen.229 Sie zeigte sich darüber tief traurig, denn „die Tage“ in Pyrmont hatten „unsere seit 1945 geleistete Arbeit […] krönen“230 sollen. Kein Wunder, daß ZahnHarnack den DFR auch als ‚ihr‘ Projekt begriff. Schließlich hatte sie 1933 widerwillig die Auflösung des BDF und damit das Ausscheiden der deutschen Frauen aus der internationalen Frauenbewegung bekanntgeben müssen, weil die Selbstauflösung die einzige Möglichkeit darstellte, der nicht gewollten Eingliederung in die NSFrauenschaft zu entgehen. Als die Gelegenheit gekommen war, hatte Zahn-Harnack Bähnisch tatkräftig unter die Arme gegriffen, indem sie alte Kontakte zur internationalen Frauenbewegung reaktivierte. Wo, wie in der Schweizer Frauenbewegung, besonders große Skepsis gegenüber international unbekannten, jüngeren deutschen Frauen bestand, hatte sie Mut gezeigt und ein gutes Wort für den Frauenring und seine Vorsitzende eingelegt.231 Mit der Gründung des Frauenrings, dem die Aufnahme als Nachfolgeorganisation des BDF in den ICW bald sicher war, erfüllte sich für Zahn-Harnack ein seit 1933 gehegter Traum. Doch in Bezug auf den Pyrmonter
226 NA, UK, FO 945/284, Talk by Dr. Agnes von Zahn-Harnack, President Wilmersdorfer Frauenbund, The feminist Movement in Germany before Hitler and today, o. D. [1948]. 227 DFR-Archiv, A2, Zahn-Harnack an Bähnisch, 19.09.1949. 228 DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Zahn-Harnack, 19.06.1949. 229 Vgl.: Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 3. 230 DFR-Archiv, A2, Agnes von Zahn-Harnack an Theanolte Bähnisch, 19.09.1949. 231 DFR-Archiv, A2, Bericht über eine Reise in die Schweiz auf Einladung des Bundes Schweizer Frauenvereine, o. T., Agnes von Zahn-Harnack, August 1948.
Wachsende Prominenz | 917
Gründungsakt blieb der Erkrankten nur übrig, zu versichern, daß sie „mit all meinen Gedanken“232 dort sein wolle. Es war durchaus damit zu rechnen gewesen, daß die Theologin, zumal sie mit Bähnisch seit ihrer gemeinsamen Reise nach Großbritannien 1946 zusammengearbeitet hatte, eine bedeutende Position im ‚Deutschen Frauenring‘ übernehmen würde. Bähnisch hatte ihr eine stark repräsentative Position zugedacht, denn die nicht mehr ganz junge Berlinerin Zahn-Harnack könne ja, so begründete Bähnisch ihre Idee, nicht „dauernd reisen.“233 Außerdem war der Vorsitzenden an einer „echten Ausbalanciertheit der Arbeit im ganzen Bundesgebiet“234 gelegen, welche sie offenbar über die Nominierungen von Frauen aus verschiedenen Teilen Deutschlands für Vorstandsämter realisieren wollte. Doch die Grande Dame der bürgerlichen Frauenbewegung, die in der Weimarer Republik auch in der DDP aktiv gewesen war, lehnte das Amt der Ehrenvorsitzenden, das Bähnisch ihr antrug, ab. Sie wollte einen aktiven Beitrag in der neuen Organisation leisten235. Bähnisch akzeptierte diesen Wunsch – nach längeren Diskussionen – schließlich. In Abwesenheit wurde Zahn-Harnack also zur zweiten Vorsitzenden des DFR ernannt. Vielleicht hatte die Regierungspräsidentin eine zu starke Stellung Zahn-Harnacks im DFR gefürchtet, in jedem Fall aber war sie besorgt und skeptisch, was die Gesundheit der letzten Vorsitzenden des BDF und damit ihre Leistungsfähigkeit für den DFR anging. Tatsächlich schätze Bähnisch die Lage besser ein, als es die liberale Protestantin selbst tat: Die Schwester des hingerichteten NS-Widerständlers Ernst von Harnack, die nicht nur die Ermordung ihre Bruders, sondern gleich mehrerer Familienangehöriger im Dritten Reich hatte erleben müssen, starb bereits ein knappes halbes Jahr nach der Gründung des DFR, am 22.05.1950 mit 66 Jahren in ihrer Heimatstadt Berlin.236 Ob Zahn-Harnack die neue Gallionsfigur der Bürgerlichen Frauenbewegung ebenso mit Lob und Wohlwollen überschüttet hätte, wenn sie einen Brief von Bähnisch an sie, der sich mit ihrem Brief an Bähnisch überschnitt, früher erhalten hätte, darüber läßt sich nur spekulieren. Am 19.09.1949, als Zahn-Harnacks herzlicher Brief an Bähnisch Berlin gerade erst verlassen haben konnte, schrieb die Regierungspräsidentin an die Mitbegründerin des Akademikerinnen-Bundes, daß sie über ihre Funktion im Frauenring „nicht nur von ihren persönlichen Wünschen allein entscheiden“237 dürfe. Die letzte Vorsitzende des BDF müsse ihrer Meinung nach, so Bähnisch, „alles“ tun, was gegenüber der nachfolgenden Generation die Verbindung zwischen alter und junger Frauenbewegung zum Ausdruck bringen könne. „Wir
232 233 234 235
Ebd. DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Ulich-Beil, 19.09.1949. Ebd. DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Zahn-Harnack, 08.09.1949. Ebd., Hildegard Meissner an Bähnisch, 14.09.1949 sowie ebd., Ulich-Beil an Bähnisch sowie 10.09.1949, Agnes von Zahn-Harnack an Theanolte Bähnisch, 19.09.1949. 236 Die Leitung des Berliner Frauenbundes, der als Berliner Landesring des DFR fungierte, übernahm darauf hin Hildegard Meißner. 237 DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Zahn-Harnack am 19.09.1949.
918 | Theanolte Bähnisch
Menschen brauchen immer Bilder, von denen wir leben. Und ein solches Bild muss für die junge Generation in der Frauenbewegung geschaffen werden, und deshalb müssen Sie Ehrenvorsitzende sein.“238 Um Zahn-Harnack davon zu überzeugen, daß das Amt der Ehrenpräsidentin Zahn-Harnacks Alter und der Strategie des DFR angemessen wäre, hatte sie einen im Grunde geschickten Schachzug versucht: „Es scheint mir unmöglich, dass die alte Vorsitzende des Bundes deutscher Frauenvereine unter meinem Vorsitz […] arbeitet. Sie müssen über uns allen stehen.“ Doch wie sie ihre Argumentation fortführte, war etwas weniger geschickt: „auf der anderen Seite muss die praktische Leitung in der heutigen Zeit in jüngeren Händen sein, schon aus rein optischen Gründen gegenüber der jüngeren Generation.“ Davon hinge, so Bähnisch, „ganz stark die Nachwuchsfrage ab“239. Die Regierungspräsidentin schien also daran geglaubt zu haben, mit dem DFR endlich auch die jungen Frauen erreichen zu können, die der ‚Frauenring der britischen Zone‘ noch nicht für seine Arbeit hatte begeistern können. Daß sie mit deutlichen Worten nicht sparte, hieß nicht, daß Bähnisch der Schwester des ehemaligen Vorgesetzten ihres Mannes, Albrecht Bähnisch, eine geringe Wertschätzung entgegengebracht hätte. Sie möge ihr „immer offen und ungehemmt ihre Meinung und Kritik“240 sagen, forderte die allgemein im schriftlichen Kontakt sehr direkte Bähnisch – offenbar in der Annahme, daß Zahn-Harnack ebenso mit der Tür ins Haus fallen würde, wie sie selbst es tat. „Sie können versichert sein, dass ich nicht empfindlich bin, weil ich weiss, dass wir beide uns einig sind in dem Gedanken dem Deutschen Frauenring zu dienen, und dass ich noch viel zu lernen habe. Je enger Sie neben mir stehen, desto besser wird es für den Frauenring sein.“241 Daß Zahn-Harnack ‚über‘ ihr stehen sollte, wie Bähnisch zuerst geschrieben hatte, schien also doch nicht so ganz ernst gemeint gewesen zu sein. Daß die ‚neue‘ Führerin der Frauenbewegung gegenüber der ehemaligen am 8. September noch eine andere Metapher gebrauchte und Zahn-Harnack mitteilte hatte, daß der DFR „auf den Schultern der alten Frauenbewegung“242 stehen müsse, läßt darauf schließen, daß sie sich selbst noch nicht im Klaren über ihr Verhältnis zur ‚alten‘ Frauenbewegung war. Gleichzeitig verdeutlicht es, daß Bähnisch der Idee anhing, zwar einer Tradition folgen, aber dennoch etwas Neues aufbauen zu müssen. Zur Ehrenpräsidentin wurde an Zahn-Harnacks Stelle, auf Antrag von Fini Pfannes243, schließlich eine andere Mitbegründerin des Akademikerinnen-Bundes, die Juristin Dr. Marie Elisabeth Lüders ernannt. Lüders, der aufgrund ihrer Erfahrungen im Bereich der Sozialen Arbeit244 1916 die Leitung der Abteilung für Frauenarbeit im
238 239 240 241 242 243 244
Ebd. Ebd. Ebd. DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Zahn-Harnack, 25.10.1949. DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Zahn-Harnack, 08.09.1949. Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 13. Lüders hatte Erfahrungen in der Sozialen Arbeit unter anderem im Rahmen der Berliner ‚Frauen- und Mädchengruppen für soziale Hilfsarbeit‘ ab 1901 und als Geschäftsführerin beim Verein für Säuglings- und Mütterfürsorge des Kreises Düsseldorf gesammelt.
Wachsende Prominenz | 919
preußischen Kriegsamt übertragen worden war,245 galt während ihrer Zeit als Reichstagsabgeordnete von 1919 bis 1932 als eine Kontrahentin Gertrud Bäumers in derselben Partei, der DDP. Gemeinsam mit Louise Schröder (SPD) hatte sich Lüders politisch in den Bereichen ‚Soziales‘, ‚Familie‘ und ‚Gesundheit‘ engagiert. Als Mitglied in parlamentarischen Ausschüssen für Rechts-, Handels- und Wirtschaftspolitik hatte sie sich zusätzlich auf einem Terrain bewegt, auf dem die Mitarbeit von Frauen zu jener Zeit sehr unüblich war. Zudem hatte sie – ebenfalls eine Ausnahmeerscheinung – dem Präsidium des Normungssauschusses beim VDI angehört. 1932 hatte Lüders, aus Protest gegen die Zusammenarbeit der DDP mit der NSDAP, nicht mehr für den Reichstag kandidiert und 1933 sämtliche Ämter verloren.246 Nachdem sie sich bis 1945 mit verschiedenen Hilfstätigkeiten durchgeschlagen hatte, war sie 1948/49 als Stadtverordnete und ab 1949 als Stadträtin für das Berliner Sozialwesen zuständig. Gleichzeitig gehörte sie als einzige Frau von 1949 bis 1955 dem Hauptdeputationsausschuß des Deutschen Juristentages an. Anders als Zahn-Harnack stand die 1878 geborene247 Lüders, trotz ihres höheren Alters, also noch voll im Beruf, als der DFR gegründet wurde. 1953 nahm sie noch ein Bundestagsmandat der FDP an und wirkte bis 1961 maßgeblich an der sozialen und an der Gleichstellungsgesetzgebung mit.248 Mit Lüders, die verständlicherweise die besondere Aufmerksamkeit der Briten in Berlin auf sich zog,249 verfügte der DFR also über eine Ehrenpräsidentin, die in Theorie und Praxis ein Leuchtturm in gleich drei Disziplinen war: In der sozialen Arbeit, im Rechtswesen und in der Wirtschaft. Außerdem konnte über ihre Person nicht nur der Berliner Frauenbund, sondern auch der Akademikerinnen-Bund einen SpitzenPlatz im Vorstand des DFR verbuchen. Dies dürfte Bähnisch sehr recht gewesen sein. Einige der Frauen, mit denen sie in Hannover den ‚Club deutscher Frauen‘ gegründet hatte, waren ebenfalls im Akademikerinnen-Bund organisiert, und sie selbst hatte sich ja im Kreis der Soroptimistinnen für die Interessen berufstätiger, meist akademisch gebildeter Frauen eingesetzt. Neben den bereits genannten Frauen Anna Mosolf und Emma Faupel gehörten zum Kreis der Mitbegründerinnen weitere Vertreterinnen der Besatzungszonen, die nach Pyrmont gereist waren. Die Schriftstellerin Dorothee von Velsen, Vertreterin der US-Zone, war 1883 geboren und – wie Zahn-Harnack – ebenfalls Absolventin der sozialen Frauenschule Alie Salomons gewesen. Sie pflegte eine enge Freundschaft zu der prominenten, dreizehn Jahre älteren Marianne Weber, Rechtshistorike-
245 1936 veröffentlichte sie in Berlin zu diesem Thema ‚Das unbekannte Heer. Frauen kämpfen für Deutschland 1914–1918‘. Vgl. für einen autobiographischen Längsschnitt: Lüders, Marie-Elisabeth.: Fürchte Dich nicht. Persönliches und Politisches aus mehr als 80 Jahren, 1878–1962, Köln 1963. 246 1937 war Lüders kurzzeitig wegen des Verdachts der Werksspionage von der Gestapo inhaftiert worden. 247 Lüders starb am 23.03.1966 in Berlin. 248 Vgl.: Art. „Lüders, Marie-Elisabeth“ in: LEMO, auf: http://www.dhm.de/lemo/html/bio grafien/LuedersMarie/index.html, am 13.12.2013. 249 NA, UK, FO 1050/1250, Ursula Lee an Ostermann, Evans, Reeve und Ditchman (C.E.O.) am 24.09.1949, Subj.: Women’s Affairs Berlin – Monthly Report for September 1949.
920 | Theanolte Bähnisch
rin, Mitglied der DDP und Leiterin des BDF von 1919 bis 1923.250 Gemeinsam mit Marie-Elisabeth Lüders hatte von Velsen im Ersten Weltkrieg beim Nationalen Frauendienst eine Fürsorgestelle aufgebaut und das Frauenreferat im Kriegsamt Breslau geleitet. Da sich auch Zahn-Harnack im Frauendienst engagiert hatte, fand sich im DFR ein Kreis von Frauen wieder, der sich aus früherer Zusammenarbeit recht vertraut war, zumal von Velsen in der Weimarer Republik auch die Geschäftsleitung des BDF innegehabt hatte. Ab 1921 war von Velsen bis 1933 Vorsitzende des Staatsbürgerinnenverbandes gewesen, was ihr offenbar Zeit dazu ließ, ab 1925 Volkswirtschaft und Geschichte zu studieren. Zwar war es von Velsen nicht gelungen, Gertrud Bäumer davon zu überzeugen, daß es falsch sei, die Zeitschrift ‚Die Frau‘ unter den Nationalsozialisten weiterhin zu publizieren,251 doch sie brach deshalb nicht mit der ehemaligen BDF-Vorsitzenden, sondern kam mit ihr ab 1945 in Freda Wuesthoffs Stuttgarter Friedenskreis zu Gesprächen zusammen.252 Von Velsens Erfahrungen in der Frauenbewegung fanden in gleich zwei autobiographischen Werken Niederschlag.253 Aus Berlin war – neben Agnes von Zahn-Harnack – auch Else Ulich-Beil (18861965) angereist. Sie war ebenfalls eine Führungsfigur der bürgerlichen Frauenbewegung und in der Weimarer Republik besonders in der sozialen Frauenarbeit in Sachsen engagiert gewesen, unter anderem als Leiterin des Frauenreferats im Kriegsamt Leipzig, später als Regierungsrätin für Soziales im sächsischen Innenministerium. Von 1920–1929 hatte sie ein Landtagsmandat der DDP wahrgenommen. 1947 hatte sie den Staatsbürgerinnenverband, zunächst als ‚Notgemeinschaft 1947‘ wieder gegründet. Dieser sollte nach der Gründung des DFR – neben dem Berliner Frauenbund – einen zweiten Berliner Landesring des DFR bilden. 1952, als Bähnisch ihr Amt als Präsidentin niederlegte, ergriff Ulich-Beil die Gelegenheit zur Leitung des Frauenrings auf Bundesebene – zumal damit eine Verlagerung des DFR-Sitzes nach Berlin möglich wurde.254 Die Briten hatten einer solchen Entwicklung, also Berlin wieder zum Zentrum der Frauenbewegung zu machen, in der Wiederentstehungsphase der bürgerlichen Frauenbewegung nach 1945 vorbeugen wollen. Ulich-Beil blieb Vorsitzende des DFR bis 1955. Das Amt mag für sie einen Ausgleich für einen 1949 erlit-
250 Bärbel Meurer zufolge ging das freundschaftliche Verhältnis eher von Dorothee von Velsen aus und wurde von Weber mit etwas weniger Engagement erwidert. Ab 1925/26 gestaltete sich die Beziehung „zunehmend schwieriger“, bevor sie Mitte der 30er Jahre „wieder freundschaftlicher“ wurde. Meurer, Bärbel: Marianne Weber. Leben und Werk, Tübingen 2010, S. 464. 251 Vgl.: Schaser, Angelika: Gertrud Bäumer – „eine der wildesten Demokratinnen“ oder „verhinderte Nationalsozialistin“?, in: Heinsohn/Vogel/Weckel (Hrsg.): Karriere, S. 24– 43. Schaser zitiert in ihrem Aufsatz aus einem Briefwechsel zwischen den beiden Frauen. Helene Weber hingegen hatte Bäumer 1933 zum ‚weiteren Dienst‘ aufgerufen. Ebd., S. 28. 252 Vgl.: Möding: Stunde, S. 640. 253 Vgl.: Velsen, Dorothee von: Wir leben eine Spanne Zeit, Tübingen/Stuttgart 1950; dies.: Im Alter die Fülle, Tübingen/Stuttgart 1956. 254 Vgl.: Ulich-Beil: Weg, Berlin 1961, S. 219.
Wachsende Prominenz | 921
tenen Rückschlag dargestellt haben: Zu jener Zeit verzichtete sie nämlich zugunsten Zahn-Harnacks auf eine Kandidatur um einen Platz im Vorstand des DFR, da sie die Gefahr einer Spaltung der Berliner Frauenbewegung abwenden wollte.255 ZahnHarnack hatte offenbar darauf bestanden, daß man sich für Berlin auf eine Kandidatur einigen sollte. „Wie diese ‚Einigung‘ aussieht, habe ich Ihnen dargelegt“256, schrieb Ulich-Beil, die sich nicht nur persönlich um eine Chance betrogen sah, sondern Zahn-Harnack des Amtes offenbar auch nicht für würdig hielt. Denn den Kommentar, daß Zahn-Harnack 1933 „kampflos“257 den BDF aufgelöst habe, konnte sie sich nicht verkneifen. Man fühlt sich angesichts jener Äußerungen an die Vorwürfe Wilhelm Abeggs an Carl Severing erinnert, da letzterer sich nach Meinung Abeggs kampflos dem ‚Preußenschlag‘ ergeben habe.258 Die Berlinerinnen wollten insgesamt im geschäftsführenden Vorstand stärker vertreten sein, als von der Hannoveraner Regierungspräsidentin vorgesehen.259 Doch die zu jener Zeit nicht in Berlin lebenden Strateginnen von Velsen und Bähnisch wiesen darauf hin, daß eine solche Möglichkeit nur bestünde, wenn man den Vorstand vergrößere – und sieben Vorstandsmitglieder seien genug.260 Else Ulich-Beil war von Bähnisch kein Platz im geschäftsführenden Vorstand, sondern lediglich im Gesamtvorstand zugedacht worden, weil sie, so argumentierte die DFR-Vorsitzende, „aus optischen Gründen im geschäftsführenden Vorstand gern einen jüngeren Menschen sähe[…] der […] auch in der Lage wäre, die anfallende Arbeit wirklich zu leisten.“261 Bähnisch sah also von dem von der Militärregierung und der WGPW favorisierten Brückenschlag zur alten Garde der Frauenbewegung nicht nur Vorteile. Ulich-Beil gegenüber kommunizierte sie dies nicht so direkt, wie sie es gegenüber der gleichaltrigen Nora Melle getan hatte. Die Regierungspräsidentin griff auch UlichBeil gegenüber zu jener Mischung aus ‚Zuckerbrot und Peitsche‘, die sie ZahnHarnack gegenüber angewendet hatte: Sie schrieb an die Leiterin des Staatsbürgerinnenverbands, daß sie „gern, rein optisch gesehen, etwas Jugend, insbesondere auch für Berlin“262 im Vorstand hätte und daher an Nora Melle gedacht habe, während sie – ein weiteres Zeichen für die bereits angerissene Verschränkung von Bähnischs Arbeit in beiden Bewegungen – Ulich-Beil für die „sozial-politische Kommission der Europa-Bewegung“263 vorgeschlagen habe. „[B]ei ihrem Format und ihrer Fähigkeit einer grossen Gesamtschau ist mir ihre Mitarbeit in der europäischen Bewegung unentbehrlich“264, erklärte sie ihre Taktik, in der Ulich-Beil die außenpolitische Karte
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
DFR-Archiv, Ulich-Beil an Bähnisch, 10.09.1949. Ebd. Ebd. AfZ, NL Wilhelm Abegg, Nr. 59, Wilhelm Abegg an Carl Severing, 31.05.1947. DFR-Archiv, A2, Hildegard Meissner an Bähnisch, 14.09.1949, ebd., Ulich-Beil an Bähnisch, 10.09.1949. DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Nora Melle, 19.09.1949. Ebd. DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Ulich-Beil, 19.09.1949. Ebd. Ebd.
922 | Theanolte Bähnisch
spielen sollte.265 Über den Sinn dieser Taktik läßt sich allerdings streiten, schließlich war von Ulich-Beil bekannt, daß sie Gertrud Bäumer trotz ihrer teilweisen Kooperation mit den Nationalsozialisten bedingungslos die Treue hielt – was nicht gerade für positive Schlagzeilen sorgte. Daß Bähnisch ihre Favoritin Melle, die zuvor dem DFD angehört hatte und daher über wertvolle Insider-Kenntnisse verfügte, schließlich doch nicht als Vorstandmitglied durchsetzte, mag daran gelegen haben, daß die 1897 geborene Dr. Clara von Simson der zwei Jahre älteren Bähnisch ins Gewissen redete. Die Physikerin, die seit 1948 FDP-Mitglied war und für Freda Wuesthoffs Patentbüro arbeitete, kannte Bähnisch aus Wuesthoffs Friedenskreis. Sie sah in der alleinigen Nominierung Melles als Berlinerin für den Vorstand eine Verkennung der Zustände in Berlin durch die Hannoveranerin. „Ich kann mir denken, daß man das im Westen nicht verstehen kann“, leitete sie, auf die Insellage Berlins abhebend, ihre Erklärung ein. Zahn-Harnack sei für die jüngeren Frauen in Berlin nicht nur Vorbild, sondern „in sehr weitgehendem Masse selbst Träger der gesamten Arbeit“, schrieb Simson. Bei der nächsten Wahl sei man vielleicht soweit, aus der jüngeren Generation Kandidatinnen zu benennen, schrieb Simson, „heute geht es noch nicht“266. Sie legte Bähnisch nah, stärker auf die Interessen Zahn-Harnacks Rücksicht zu nehmen, und empfahl, einen langsameren Machtwechsel zwischen den Generationen zu vollziehen. Wie Bähnisch diesen Rat aufnahm, ist unklar, vermutlich jedoch zunächst mit Sorge um das Ansehen des DFR, dessen Bild nun doch, entgegen ihrem ursprünglichen Interesse, weitgehend von älteren Frauen geprägt sein würde. Schließlich sollten doch gerade auch die jüngeren Frauen, die als leichte ‚Opfer‘ der Kommunistinnen galten, auf die Seite des DFR gebracht werden. Darüber, daß der Staatsbürgerinnen-Verband schließlich gar keinen Posten im geschäftsführenden Ausschuß bekleidete, war im Dezember 1949 wiederum die vergleichsweise jugendliche Nora Melle – die 1952 die Leitung des Staatsbürgerinnenverbandes übernehmen konnte, als Ulich-Beil Bundesvorsitzende des DFR wurde – verärgert. „Die Reingefallenen sind wir, der Staatsbürgerinnenverband, ja nun letzten Endes doch. Was haben nun alle Bemühungen bis spät in die Nacht hinein in Stuttgart [gemeint ist eine dreitägige Konferenz, die im Sommer 1949 unter der Leitung von Dorothee von Velsen in Stuttgart stattgefunden hatte267] genützt, wenn nun doch Frau Dr. Lüders (Berl. Frauenbund) Ehren-Präsidentin [,] Frau Dr. ZahnHarnack (Berl. Frauenbund) im engeren Vorstand und wenn ich recht verstehe […] nun auch der Frauenbund und wir noch im erweiterten Vorstand vertreten sind, d. h., daß also der Berl. Frauenbund, obwohl er bei weitem nicht der aktivste in Berlin ist, 3 Vertreterinnen im Vorstand hat und wir, Verzeihung, nebbich, eine!!!!! So geht das
265 Ebd. 266 DFR-Archiv, A2, Dr. Clara von Simson an Bähnisch, 25.09.1949. 267 Auf dieser Konferenz hatte man sich, wie sich in Melles Brief andeutet, über die mögliche Besetzung von Ämtern im DFR ausgetauscht. Das geht aus einem Brief Bähnischs hervor. DFR-Archiv, Freiburg, A2, Bähnisch an Zahn-Harnack, 08.09.1949.
Wachsende Prominenz | 923
ja wohl auch nicht. […] Ich wundere mich nur noch, dass es uns geglückt ist, den Vorsitz hier im Ausschuß zu bekommen.“268 Vermutlich hatte Bähnisch einen Ausgleich für den Staatsbürgerinnenverband schaffen wollen, indem sie Melle, die sie ursprünglich im geschäftsführenden Vorstand hatte sehen wollen, die Position der Leitung des DFR-Ausschusses für gesamtdeutsche Arbeit übertrug. Aber Melle schien dies, zumindest zu jenem Zeitpunkt, nicht honorieren zu wollen. Auch dem Bedürfnis der Berlinerinnen, einen Platz symbolisch für den Osten unbesetzt zu lassen269, entsprach Bähnisch, die fernab der Hauptstadt lebte und die Idee wohl nicht nachvollziehen konnte, nicht. Die Führungsfiguren von damals mit den neuen Akteurinnen der Frauenbewegung unter einen Hut zu bringen und dabei noch für eine ausgewogene Verteilung der Ämter in den verschiedenen Regionen zu sorgen, war kein leichtes Unterfangen. Enttäuschungen waren vermutlich vorprogrammiert, weil die Vorsitzende es nicht allen recht machen konnte. Andererseits lernte Bähnisch in den Auseinandersetzungen jedoch auch die Grenzen ihrer Macht kennen, denn auf die Gunst der Führungsfiguren aus dem BDF zu verzichten, wäre konträr zu ihren Zielen gewesen und hätte womöglich sogar die Aufnahme des DFR in den ICW gefährdet. Auch sie mußte also notgedrungen Zugeständnisse machen. Dies galt auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem Süddeutschen Frauenarbeitskreis (SFAK). Trotz offizieller Abwesenheit (lediglich die Vertreterin einer Unterorganisation, Wanda von Baeyer, war auf der Tagung präsent, die Leiterin Else Reventlow erschien erst kurz vor Torschluß) und der skeptischen Haltung des SFAK gegenüber dem DFR, auch was dessen Anspruch anging, die deutschen Frauen zu vertreten270, wurde der SFAK in Pyrmont in den DFR aufgenommen. Reventlow hatte mehr ihre Billigung als ihre Zustimmung dazu zum Ausdruck gebracht, daß von Baeyer stellvertretend den Gründungsakt mit vollziehen sollte, und überschüttete den DFR nach Abschluß der Pyrmonter Konferenz mit Kritik. Bähnisch bewertete die Aufnahme deshalb im Nachhinein als einen Fehler. Diesen durch einen Ausschluß des SFAK zu korrigieren, wie sie es vorhatte, konnte sie nicht. Einige Vorstandmitglieder aus Berlin lehnten eine solche Reaktion ab271, die Vorsitzende des DFR mußte sich also auch in dieser Hinsicht geschlagen geben. Als Erfolg für das Zusammenwachsen der Frauenbewegung in den drei westlichen Besatzungszonen ist zu werten, daß zur Konferenz drei Delegierte der ehemaligen französischen Zone erschienen waren, die ‚interzonal‘ zuvor noch nicht soviel von sich reden gemacht hatten. Die vierte, sehr bekannte Delegierte aus der französischen Zone war die bereits mehrfach erwähnte Physikerin und Friedensaktivistin Freda Wuesthoff. Auch sie sollte bis 1952 dem geschäftsführenden Vorstand des
268 269 270 271
DFR-Archiv, A2, Melle an Bähnisch, 11.12.1949. DFR-Archiv, A2, Antrag der Notgemeinschaft 1947, 21.09.1949. Gille-Linne: Strategien, S. 194. DFR-Archiv, A2, Hildegard Meissner, Berliner Frauenbund 1947 an Deutscher Frauenring Hannover, 30.11.1949 sowie ebd., Agnes von Zahn Harnack an DFR Hannover, 26.11.1949. Für einen Ausschluß sprach sich Else Ulich-Beil aus. DFR-Archiv, A2, Notgemeinschaft 1947, Ulich-Beil an den Deutschen Frauenring Hannover, 22.12.1949.
924 | Theanolte Bähnisch
DFR angehören, bis zum Herbst 1951 als erste Beisitzerin.272 Wuesthoff war, um nur ein Beispiel für ihre Prominenz zu nennen, von Else Ulich Beil gebeten worden, anläßlich der Gründung der ‚Notgemeinschaft 1947‘ – also dem Vorläufer des Staatsbürgerinnenverbands – am 27.01.1948 das Hauptreferat zum Thema ‚Atomenergie und Frieden‘ zu halten.273 Sie stand also ebenfalls in Kontakt zu den Berlinerinnen und gehörte, wie Bähnisch, zu jener Zwischengeneration in der Bewegung, die den Brückenschlag von der älteren zur jüngeren Generation anstrebte.274 Bei den noch weniger bekannten Frauen aus der ehemaligen französischen Zone handelte es sich um Elfriede Wacker, Elisabeth Mahla und Leonore Mayer-Katz. Elfriede Wacker, 1906 geboren, war Wirtschaftslehrerin und hatte an der ‚Umwandlung‘ des ‚Stuttgarter Frauendienst e. V.‘ in den ‚Ortsring Stuttgart‘ (als Dependance des Frauenrings) Anteil gehabt. Diesen leitete sie von 1952 bis 1964, nachdem sie ihr Amt im geschäftsführenden Vorstand des DFR, das sie 1949 übernommen hatte, abgegeben hatte.275 Die 1889 geborene Kunsthistorikerin Elisabeth Mahla276 hatte sich im Ersten Weltkrieg als führendes Mitglied des Vaterländischen Frauenvereins stark in der Kriegskrankenpflege engagiert und war ab 1915 Schriftführerin der Pfälzischen Frauenvereine gewesen. Bis 1944 hatte sie die Frauenarbeits- und Handelsschule sowie die Volksküche geleitet und 1945 die Verteilung der Spenden amerikanischer Quäker für die deutsche Bevölkerung übernommen.277 1952 gründete Mahla den Frauenring in Landau. Zu dieser Zeit war sie bereits Vorsitzende des DFRLandesverbandes in Rheinland-Pfalz (gegründet 1951) und übte das Amt der Kassenführerin im Bundesvorstand bis 1962 aus. Mahla begründete insgesamt sechs DFROrtsringe.
272 Zweite Beisitzerin war damals Emma Faupel, dritte Beisitzerin Brunhilde Wacker. Vgl.: DFR-Archiv, A1, Zur Geschichte des DFR und seiner Vorstände, DFR Bundegeschäftsstelle, Januar 1983. 273 NA, UK, FO 1050/1215, E. M. Jacobs, HQ Mil Gov, Education Branch an Joy Evans, Education Branch, 31.01.1948, Subj.: Report on the first meeting of „Notgemeinschaft 1947“. 274 Weniger erfolgreich verlief die Kooperation mit der älteren Generation für Nora Melle. Diese sah in den „lieben Alten am Ruder“ des Berliner Frauenbundes eher ein Hemmnis einer gedeihlichen Zusammenarbeit. DFR-Archiv, Freiburg, A2, Melle an Bähnisch, 24.01.1949. 275 Vgl.: Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 15. 276 Denise Tscharntke übernimmt den Fehler in den Akten, in denen von einer ‚Frau Mahler‘ als Vertreterin der französischen Zone die Rede ist (vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 184). Es handelte sich bei der fraglichen Person um die 1889 in Landau geborene Elisabeth Mahla. Am 10.02.1949 wurde Mahla Vorsitzende des Frauenringes in Landau. Nach der Gründung des DFR wurde und blieb sie für mehrere Jahre dessen Schatzmeisterin. Vgl.: Art.: „Mahla, Elisabeth“, in: Carl, Victor (Hrsg.): Pfälzer Persönlichkeiten, Edenkoben 1995, abgerufen über die WBIS, DBA, 3, Fiche Nr. 0591, S. 320. 277 Vgl.: ebd.
Wachsende Prominenz | 925
Leonore Mayer-Katz, Kauffrau und Prokuristin im Familienunternehmen Katz und Klumpp AG, einem Papierwarenhersteller, war die einzige Frau mit jüdischen Wurzeln278 im Vorstand des DFR und mit 37 Jahren gleichzeitig die jüngste.279 1945 hatte sie in der Stadtverwaltung von Baden-Baden gearbeitet, gedolmetscht und geholfen, Verwaltungs- und Beschaffungsprobleme zu lösen. Auch in die Entnazifizierung war sie eingebunden gewesen.280 Wie diverse andere Frauen, die ebenfalls zum Führungskreis zu zählen sind, übernahm sie auch die Leitung eines der Arbeitsausschüsse im DFR. Nori Möding, die in ihrem Aufsatz über Frauenorganisationen des bürgerlichen Lagers nach 1945 einen Schwerpunkt auf Mayer-Katz gesetzt hat, betont, wie sehr die Aufwertung einer einst „Verfemten und Diskriminierten“ zu einer „begehrten Mitarbeiterin im sozialen Wiederaufbau“, Mayer-Katz` Erleben prägte. Denn Mayer-Katz war, so Möding, bis 1933 „integriert und […] privilegiert“ gewesen und hatte dann den Rassismus der Nationalsozialisten von ihrer Verdrängung aus dem väterlichen Betrieb als „Mischling ersten Grades“281 bis hin zur Verschleppung ihrer eigenen Mutter, Gertrud Katz, nach Theresienstadt 1944 erfahren müssen.282 Ähnlich wie bei der 1905 in Trier geborenen Gabriele Strecker, die ebenfalls eine wichtige Rolle in der Gründungs- und Verbandsgeschichte des DFR spielte283, habe „das frauenpolitische Engagement“ der jungen Mayer-Katz, die wie Strecker in der CDU engagiert war, „von außen angestoßen werden“ müssen. Bei Mayer-Katz kam jener Anstoß durch Freda Wuesthoff, die ihr offensichtlich aufgrund ihrer Fähigkeit, politische Appelle mit alltagspraktischen Aktionen zu verbinden, ein Vorbild war.284 So hatte die Kauffrau gemeinsam mit anderen Frauen den ‚Frauenring Baden-Baden‘, der 1946 seine Lizenz erhielt und auf der Basis desselben Programms wie der ‚Club
278 Gertrud Mayer-Katz, die als Getrud Ladenburg geborene Mutter von Leonore Mayer Katz, war evangelisch getauft. 279 Nori Möding zufolge hatte sich keine Frau, die vor 1915 geboren worden war, nach 1945 an prominenter Stelle engagiert. Vgl.: Möding: Stunde, S. 639. 280 Vgl.: ebd., 632. Vgl. auch: Art.: „Mayer-Katz, Leonore“, in: Koether, F. (Hrsg.): Kenner, Köpfe und Karrieren. Biographien führender Persönlichkeiten der deutschen Papierwirtschaft“, abgerufen über WBIS, DBA, 3, Fiche Nr. 0608, S. 202–206. Hier heißt es Mayer-Katz habe die Interessen der deutschen Bevölkerung gegenüber der Militärregierung vertreten. Vgl. schließlich auch den autobiographischen Bericht: Mayer-Katz, Leonore: Sie haben zwei Minuten Zeit. Nachkriegsimpulse aus Baden, Freiburg 1986 sowie Deutscher Frauenring e.V.: Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland. Von den Wurzeln bis heute, auf: http://www.deutscher-frauenring.de/der-verband/info-werbematerial/flyer/flyer-geschichte-der-frauenbewegung, am 13.12.2013. 281 Möding: Stunde, S. 632. 282 Vgl.: Möding: Stunde, S. 635/636. Möding zufolge waren auch andere Mitglieder des Frauenrings in Baden-Baden Stadträtinnen, er wies also eine ähnlich professionelle Zusammensetzung auf, wie der Club deutscher Frauen in Hannover. 283 Strecker war Vorstandsmitglied des DFR ab 1952. DFR-Archiv, A1, Zur Geschichte des DFR, Zusammensetzung der Vorstände, DFR Bundesgeschäftsstelle, Januar 1983. 284 Vgl.: ebd., S. 636. Nach anfänglichem Zögern nahm Mayer-Katz an Wuesthoffs ‚Friedenskreis‘ teil. Vgl.: ebd., S. 633.
926 | Theanolte Bähnisch
deutscher Frauen‘ arbeitete, begründet. Mayer-Katz sei, so Möding, wie Strecker, „charakteristisch für Frauen, die bereits älter als dreißig Jahre, nach 1945 erstmals den Weg in die bürgerlichen Parteien und die Frauenbewegung beschritten“285. Gabriele Strecker, die den Nationalsozialismus in „jener privaten Zurückgezogenheit“ erlebt hatte, die später „innere Emigration genannt wurde“286, wurde in Pyrmont keine besondere Rolle im Vorstand des DFR zugedacht. Sie ist dennoch zum engeren Führungskreis des DFR zu zählen.287 Strecker war von Jella Lepman, Offizierin von OMGUS und „Beraterin für Frauenfragen“288 zur Arbeit in der Frauenbewegung motiviert worden289, hatte also ähnlich wie Bähnisch zu ihrer Berufung gefunden. Anders als Bähnisch hatte Strecker jedoch für ihr Engagement in der Frauenbewegung ihren ursprünglichen Beruf – sie war Ärztin, hatte aber auch Geschichte studiert – aufgegeben. Allerdings bot sich für Strecker die Möglichkeit, ihr frauenpolitisches Engagement mit einer Festanstellung zu verknüpfen, als sie die Leitung des Frauenfunks beim Hessischen Rundfunk übernahm.290 Die Verbandsarbeit leistete sie, wie Bähnisch, ehrenamtlich. Ihre Belastung empfand sie als außergewöhnlich, oder, wie sie erklärte, als eine „dreifache“291. Zu den genannten Aufgaben und ihrer Rolle als Mutter zweier Teenager292 traten noch die Übernahme eines Landtagsmandats der CDU, der sie seit 1948 angehörte sowie der Aufbau der Frauenarbeit in der Partei hinzu. Schließlich gründete sie 1952293 den Soroptimist-Club in Frankfurt und bekannte sich offensiv zu einem Prinzip, welches sie ideell mit Personen wie Adolf Grimme, Eduard Weitsch und Theanolte Bähnisch verband: „Die Idee leuchtete mir ein, weil es endlich nicht um eine Massenmitgliedschaft, sondern um eine kleine Zahl ging. […] In den Clubs liegt der Nachdruck auf der menschlichen Begegnung und auf der beruflichen Leistung.“294 Theanolte Bähnisch trat 1956 dem in Hannover gegründeten Soroptimist-Club bei.295
285 Ebd., S. 636. 286 Ebd., S. 629. 287 Davon zeugen beispielsweise ihre autobiographischen Werke, denen eine sehr starke Identifikation mit dem DFR zu entnehmen ist. 288 Möding, Stunde, S. 629. 289 Vgl.: Ebd. 290 Vgl.: Möding: Frauen, S. 630. 291 Gabriele Strecker, zitiert nach: Dörr, Margarete: Wer die Zeit nicht miterlebt hat. Frauenerfahrungen im Zweiten Weltkrieg und danach, Bd. 3: Das Verhältnis zum Nationalsozialismus und zum Krieg, Frankfurt a. M. 1998, S. 132. 292 Ihre Kinder waren 1932 und 1935 geboren. 293 Nori Möding datiert die Gründung fälschlicherweise auf 1950. Vgl.: Möding: Frauen, S. 633. 294 Ebd. 295 AdSD, Sammlung Personalia, Nr. 480, Nachruf des Soroptimist-Clubs Hannover, Präsidentin Getrud Böker für Theanolte Bähnisch.
Wachsende Prominenz | 927
8.3.3 Vom Charakter eines überparteilichen Führungs-Komitees und seinem Unbehagen mit den ‚Massen‘ Die Sozialisation und das Verhalten vieler Frauen, die dem DFR-Gründungsvorstand sowie dem weiter gefaßten Gründungskreis angehörten, deuten darauf hin, daß das Gros der führenden Mitglieder nicht dem Wunsch angehangen hatte, eine ‚Massenorganisation‘ aufzuziehen – auch wenn dies vor dem Hintergrund der ‚kommunistischen Bedrohung‘ von als prinzipiell sinnvoll erachtet und entsprechend kommuniziert worden war. Nicht nur das Beispiel Streckers, deren „Aufgehobenheitsgefühl“296 bei den Soroptimistinnen sich laut Nori Möding auf das „alte, gebildete Vorurteil“297 gegenüber Massenorganisationen zurückführen läßt, unterstreicht diesen Eindruck. Auch die Vorsitzende des Frauenrings selbst, Bähnisch, hatte einst an den Vorsitzenden der SPD geschrieben, sie sei „Frauen in Massen immer aus dem Weg gegangen“298. Was jene führenden Mitglieder betrifft, die im DFR an ihre Arbeit im BDF wieder anknüpfen wollten, so ist es zentral, sich vor Augen zu halten, daß dem BDF, wie die ehemalige Vorsitzende Bäumer 1933 selbst betonte299, vor allem Verbände angeschlossen waren, die berufliche Interessen von Frauen vertraten. Daß Agnes von Zahn-Harnack ihrem weiter unten zitierten Brief an Bähnisch zufolge immerhin auf den Anschluß des Hausfrauenverbandes an den DFR gehofft hatte, spricht für eine gewisse Offenheit und Weitsicht dieser ehemaligen BDF-Vorsitzenden, die diesmal offensichtlich etwas anders machen wollte. Ein aktives Werben um jene Zielgruppe ist jedoch auch von ihrer Seite nicht überliefert. Bei der Lektüre von Nori Mödings Aufsatz über die bürgerliche Frauenbewegung in Westdeutschland nach 1945 wird deutlich, daß sich bei der Gründung des DFR 1949 auf einer höheren Ebene vollzog, was seine Führungsmitglieder zuvor bereits in regionalen Zusammenhängen angestrebt hatten: Eine Zusammenarbeit unter Ihresgleichen. Das Beispiel des ‚Club deutscher Frauen‘ ist bereits bekannt; doch bestand auch der Frauenring Baden-Baden, von dem Möding berichtet, zunächst aus „sieben Frauen aus dem gehobenen Bürgertum Baden-Badens“300 – unter der Leitung der Industriellen Mayer-Katz. Auch Freda Wuesthoff hatte in Stuttgart zunächst einmal nur einen sehr kleinen, erlauchten Kreis von sieben Frauen zusammengerufen, um in diesem ihre Friedensideen zu besprechen. Auch sie hatte sich damit auf einem Terrain bewegt, auf dem ein starker Widerspruch gegen die eigenen Thesen nicht zu erwarten gewesen war.
296 Strecker habe sich im Kreis der Soroptimistinnen „politisch und menschlich“ wohler gefühlt, so Möding. Ebd. Das „Aufgehobenheitsgefühl“ Streckers in diesem Club sieht Möding im „alten, gebildeten“ Vorurteil gegenüber Massenorganisationen begründet. Möding: Stunde, S. 639. 297 Ebd. 298 AdSD, Kurt Schumacher, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, Nr. 126, 23.12.1945. 299 Bäumer, Gertrud: Das Haus ist zerfallen, in: Die Frau, Bd. 40, (1932/33), S. 513/514, hier S. 513. 300 Möding: Stunde, S. 633.
928 | Theanolte Bähnisch
Ähnliches galt für die Frauen, die neben ihren Ämtern im Frauenring auch berufsständische Organisationen wie den Juristinnenbund (Hildegard Gethmann, Lüders), den Lehrerinnenverein (Beckmann) oder den Akademikerinnenbund (Else Lüders, Zahn-Harnack, Emmy Beckmann) (wieder) vertraten oder vertreten hatten. Der Staatsbürgerinnenverband, dem die zweite Vorsitzende des DFR, Zahn-Harnack, vorstand, setzte sich vor allem für die Idee gleichberechtigter Partizipation von Frauen an der Demokratie ein. Arbeiterinnen suchte man in den Vorständen solcher Verbände jeweils vergeblich, und die Sozialdemokratinnen waren in ihnen deutlich in der Minderheit gegenüber liberal oder konservativ orientierten Frauen. Die Frauen, die sich schon in der Weimarer Republik in der Frauenbewegung engagiert und einer Partei angehört hatten, waren meist in der DDP organisiert gewesen. Diese Orientierung an der bürgerlich-liberalen Tradition spiegelte sich auch im Vorstand des Frauenrings, nämlich in den Personen Lüders, Zahn-Harnack, Mosolf und Beckmann wider. Die junge Aufsteigerin im DFR, Nora Melle, war Mitglied der LDP/LDPD in der SBZ. Der von der Kaiserin Auguste Viktoria gegründete und im Kaiserreich von der Industriellen Sophie Henschel geleitete Vaterländische Frauenverein (VFV), dem das DFR-Vorstandsmitglied Mahla bis 1933 angehört hatte, war dagegen für seine konservative, kaisertreue Tradition bekannt, während Gabriele Strecker, die im Frauenring ebenfalls eine wichtige Rolle spielte, sich, wie MayerKatz, in der CDU engagierte. Lediglich Bähnisch gehörte der SPD an, tat sich jedoch, wie deutlich geworden sein dürfte, parteipolitisch nicht hervor. Die Mitglieder des Führungskomitees erweckten mit ihrer Zielsetzung, die der des ‚Club deutscher Frauen‘ sowie des Frauenrings der britischen Zone301 entsprach, den Eindruck, alle deutschen Frauen für ihre Ideen begeistern zu wollen.302 In einem Zeitungsartikel über die Konferenz in Pyrmont 1949 findet sich zudem die Aussage, alle Teilnehmerinnen seien sich darüber klar gewesen, daß die Arbeit, die in Pyrmont begonnen wurde, „erst dann Leben gewinnen“ werde, „wenn sie nicht nur das An-
301 Als Ziele des Frauenrings der britischen Zone werden in einem im DFR-Archiv überlieferten Manuskript genannt: a) „Heranbildung der Frau zur Staatsbürgerin und stärkere Einschaltung in das öffentliche und soziale leben“, b) „Verwirklichung eines dauernden Friedens“, c) „Kameradschaftliche Zusammenarbeit von Mann und Frau“ unter gleicher Wertung ihrer Arbeit“, d) „Pflege eines gesunden Familienlebens und des Gefühls für menschliche Würde“, e) „Gedankenaustausch und Verbindung mit den Frauen des Auslands“. DFR-Archiv, A1, Wohin geht Dein Weg, deutsche Frau? Aus der Frauenarbeit in der britischen Zone, o. D. [1948/49]. 302 Darauf deutet die Formulierung, man wolle „die Frau“ heranbilden, hin. Als Ziele des Deutschen Frauenrings wurden definiert: „Heranbildung der Frau als Staatsbürgerin, ihre Gewinnung zur stärkeren Teilnahme am öffentlichen Leben, Stärkung ihres Einflusses in Politik, Wirtschaft und Kultur, Förderung eines gesunden Familienlebens, Mitarbeit in allen sozialen Fragen, Verwirklichung der im Grundgesetz garantierten gleichen rechtlichen Stellung von Mann und Frau und gleicher Wertung ihrer Arbeit, Schutz der Menschenwürde, Zusammenarbeit mit den Frauen anderer Länder, Sicherung eines dauernden Friedens“. DFR-Archiv, A1, Referat/Bericht „Deutscher Frauenring“ o. D., o. V., [ca. 1951], S. 2.
Wachsende Prominenz | 929
liegen der Frauen bleibt, die an der Spitze stehen, sondern wenn sie von einer großen Zahl von Frauen aufgenommen wird“303. Davor, sich mit Frauen, die nicht ohnehin schon in Amt und Würden standen oder wenigstens einen akademischen Weg einschlugen, direkt auseinanderzusetzen, scheuten sie jedoch weitgehend zurück. Zwar schrieben sich die Frauen, die sich zur ‚überparteilichen Arbeit‘ zusammenfanden, die Überwindung der traditionellen Trennungslinien in der Frauenbewegung auf die Fahnen, doch verloren sie, wie Nori Möding es für das Beispiel Streckers treffend formuliert, „nie ein gewisses Fremdheitsgefühl in den ‚Massenorganisationen‘“304, in denen sie sich engagierten. Diese Einstellung trug dazu bei, daß diese Organisationen als Massenorganisationen weit unter ihren Möglichkeiten blieben, so daß sich die Frage stellt, ob es sich überhaupt anbietet, von Massenorganisationen zu sprechen. In der eigenen Distanz gegenüber den ‚Massen‘ und dem gleichzeitigen Anspruch, eine große, überparteiliche Frauenorganisation zu leiten, liegt also ein Grundwiderspruch zwischen Argumentation und Handeln der Gründungspräsidentin des DFR. Ihren bereits zitierten Verlautbarungen zufolge hatte sie den DFR begründet, um ‚die Frauen‘ ‚wieder‘ in eigenen Verbänden zusammenzufassen und ihnen damit eine Alternative zum DFD zu bieten. Das kleine Wörtchen ‚wieder‘ bietet sich allerdings als Schlüssel zur Interpretation ihrer Aussage an, denn das Gros der bis 1933 in Verbänden der bürgerlichen Frauenbewegung organisierten Frauen hatte eben nicht die größten Bevölkerungsgruppen repräsentiert. Um die Mitgliedschaft jener Frauen, die aufgrund ihrer sozialen Stellung und ihrer alltäglichen Nöte potentiell Interesse am DFD hätten haben können, zumal eine seiner Kernforderungen ‚gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘ lautete, bemühten sich die Vorsitzende und der engere Führungskreis kaum. Weshalb die Arbeit des DFR, der laut einer Notiz des Verbands 1951 immerhin 40.000 Mitglieder gehabt haben soll305, am Ende dennoch Vorteile für alle Frauen in Westdeutschland hatte, wird an anderer Stelle auszuführen sein. Betrachtet man die zuvor beschriebenen Ziele der Militärregierung, welche für die Unterstützung des Frauenrings zunächst eine große Rolle spielten, so erscheint die
303 O. V.: „Geschulter Geist und kluges Herz“. Die Gründung des Deutschen Frauenrings in Bad Pyrmont, Badische Zeitung, 25.10.1949. 304 Möding: Stunde, S. 632. 305 DFR-Archiv, A1, Zahlenmaterial, 1951. Demnach hatte der DFR 1951 15 Landesverbände, die sich in ca. 135 Ortsverbände aufgliederten. „Hiervon ist ein Teil, vor allem in Süddeutschland noch im Aufbau. Die Durchschnittsmitgliederzahl sind etwa 300 Frauen“, heißt es im Papier. Die Zahl 40.000 bezog sich nur auf Ortsverbände des DFR selbst, nicht auf die korporativ angeschlossenen Verbände. Mitsamt den korporativ angeschlossenen Verbänden erreichte der DFR laut der internen Aufstellung im Jahr 1951 234.000 Mitglieder, wovon jeweils 80.000 auf die mitgliederstärksten angeschlossenen Verbände, die Frauengruppe des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten und die DamenschneiderInnung entfielen. Der Verband der weiblichen Angestellten und die GEDOK, die ebenfalls dem DFR korporativ angeschlossen waren, hatten der Aufstellung zufolge jeweils 10.000 Mitglieder. Fünftstärkster Verband war der Agnes-Karll-Verband mit 7.500 Mitgliedern. Weitere 5.000 entfielen auf den Deutschen Frauenbund für alkoholfreie Kultur, 1.500 auf den Reifensteiner Verband. Ebd.
930 | Theanolte Bähnisch
Diskrepanz zwischen der Erwartung der Briten und dem, was durch die Gründung des DFR als zonenübergreifenden, nationalen Frauenverband schließlich realisiert wurde, recht groß. Nimmt man jedoch in den Blick, daß sich die Zielsetzung der Briten in der kurzen Zeit von der Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘ über die Gründung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ bis hin zur Gründung des ‚Deutscher Frauenring‘ mehrfach und dabei noch noch stärker verändert hatten als die der Regierungspräsidentin, so erscheint die Diskrepanz zwischen ‚Soll‘ und ‚Haben‘ deutlich kleiner. Schließlich setzte Senior Women’s Affairs Officer Rita Ostermann im Jahr 1949 vor allem auf die potentielle internationale Rolle des DFR in der UNO, ganz anders als ihrerzeit Jeanne Gemmel, die hoffte, die überparteiliche Frauenarbeit, wie sie von Bähnisch ausging, könne Volkshochschulkurse für Frauen ersetzen und eine breite Zielgruppe durch ‚learning by doing‘ demokratisch bilden. Was die Hoffnungen Denekes anging, so schien sich, das läßt sich aus den beiden Konferenzen von Pyrmont schließen, immerhin das Thema ‚soziale Arbeit‘ auf der Agenda des Rings erhalten zu haben. Es ist es jedenfalls, vor dem Hintergrund der teilweise offenkundig negativen Einstellung seiner Vorstandmitglieder gegenüber ‚Massenorganisationen‘, wenig verwunderlich, daß sich der DFR eben nicht zu einem Verband entwickelte, der Frauen aller Bildungsstände, sozialen Schichten und politischen Meinungen integrierte. Der Anspruch der Frauen, welche die Organisation begründeten, allen voran der Theanolte Bähnischs, Unterschiede zwischen den Frauen zu nivellieren, war halbherzig. Das hatte wohl auch mit der sich langsam durchsetzenden Erkenntnis zu tun, daß die Gesellschaft – nationalsozialistische Volksideologie hin oder her – eine differenzierte war und daß sich die Idee der ‚Verbürgerlichung‘ aller Schichten, die für die Regierungspräsidentin eine reizvolle gewesen zu sein schien, als eine Utopie erwies. Das Thema ‚Bürgertum‘ – für den Historiker Manfred Hettling schon immer ein Begriff mit „Verheißungungspotential“306, nach 1945 jedoch nunmehr ein „Wunschbegriff“307 – war eher dazu geeignet, die Festen der eigenen Überzeugungen aufrecht zu erhalten, als dafür, gesellschaftliche Spannungen (durch eine Integration größerer Bevölkerungsgruppen in den ‚bürgerlichen‘ Bildungs- und Wertekosmos) zu überwinden. Daß Theanolte Bähnisch zumindest teilweise an dieser Idee festhielt und auch in der Nachkriegszeit entsprechende Bilder308 bemühte, mag einer gefühlten Alternativ-
306 Hettling, Manfred: Bürgertum, in: Greiffenhagen, Martin/Greiffenhagen, Sylvia: Handwörterbuch zur politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl., Wiesbaden 2002, S. 63. 307 Ebd., S. 64. Hettling zielt hiermit auf den Verlust der Deutungskraft von ‚Bürgertum‘ als Gesellschaftsbild ab, nicht auf die kaum zu bestreitende Fortexistenz ‚bürgerlicher‘ Lebenswelten. Hettling beschreibt auch, wie der Begriff seit den 80er Jahren erneut an „Attraktivität als soziokulturelle[r] Leitwert“ gewinnt. Vgl.: ebd., S. 65. 308 Manfred Hettling charakterisiert die Charakteristika von Bürgertum mit den Begriffspaaren ‚Besitz und Bildung‘, ‚Eigeninteresse und Gemeinwohlorientierung‘ und ‚zweckfreie‘ Kreativität und Nützlichkeit‘ (ebd., S. 63), Bähnisch stellt die in der Bedeutung teilweise
Wachsende Prominenz | 931
losigkeit im Angesicht der ‚kommunistischen Bedrohung‘ geschuldet sein – schließlich hatte sich in ihrer Wahrnehmung die Sozialdemokratie in der ausgehenden Weimarer Republik sehr ungeschickt präsentiert. Was auch an dieser Stelle nicht vergessen werden sollte, ist, daß sie – wie viele ihrer Zeitgenossen – den Nationalsozialismus als einen Bruch mit den bürgerlichen Werten interpretierte und daß sie diese Entwicklungen mit der Vorstellung von ‚Vermassung‘ und ‚Säkularisierung‘ verband. Dieser empfundene ‚Zivilisationsbruch‘ wird auch ihre Interpretation des eigenen, ‚bürgerlichen‘ Lebensweges beeinflußt haben – und zwar in dem Sinne, daß sie glaubte, auf der ‚richtigen‘ Seite gestanden zu haben. Daß die Regierungspräsidentin stets ein Schauer überkam, wenn sie an die Zustimmung der ‚Massen‘ während des Dritten Reichs dachte, machte sie, das ist wichtig zu betonen, befangen gegenüber der ‚eigenen Sache‘, sprich dem Aufbau einer großen Frauenorganisation. Das ‚Unbehagen mit den Massen‘ allein auf den ‚elitären Habitus‘ Bähnischs und anderer Vorstandsmitglieder zurückzuführen, welche eine ähnliche Affinität zum NegativThema ‚Vermassung‘ hatten, wäre falsch. Anfang der 1950er Jahre setzte offenbar auch die Vorsitzende des Frauenrings zunehmend auf die wirtschaftliche Befriedung der Bevölkerung anstelle ihrer politischen und kulturellen Bildung. Nachdem die Zeitschrift 1948 verbreitet hatte, keine „Dame“ oder „Elegante Welt“309 sein zu wollen, da das „Mondäne“310 in der Welt keinen Platz mehr habe, bildete sie zu Beginn der 1950er Jahre wieder stärker Konsum und ‚Lifestyle‘ als Insignien des wachsenden Wohlstands ab. Gleichzeitig ließ die Zeitschrift zu dieser Zeit in der Berichterstattung über kulturelle Erzeugnisse wie Bücher, Kunst und Theater stark nach. Ob Bähnisch die Hoffnung, daß der ‚bürgerliche‘ Kultur- und Wertekosmos auch auf wirtschaftlich schlechter gestellte Bürger einen Reiz ausüben möge, damit aufgab, ist schwer zu sagen. Zumindest startete sie keine weitere Offensive dieser Art nach dem eher kurzen Versuch mit der ‚Stimme der Frau‘, die sich nur wenige Jahre nach ihrem ersten Erscheinen in eine ‚normale‘ Frauenzeitschrift mit dem üblichen Mix aus Rätseln, Geschichten, Mode- und Kosmetiktips sowie Rezepten verwandelt hatte. Der DFR war also, um wieder zum Vorstand zurückzukommen, mitnichten ein ‚Spiegel der Gesellschaft‘. Doch wäre es genauso falsch, von einer völlig homogenen Zusammensetzung des Kreises zu sprechen. Denn es waren sowohl Frauen mittleren Alters, die erst in der Nachkriegszeit stärker in die überparteiliche Frauenarbeit eingestiegen waren – wie Bähnisch, Strecker und Mayer-Katz – als auch verbandserfahrene, ältere Frauen, die bereits im BDF gewirkt hatten, im Vorstand des DFR vertreten. Frauen, die sich aktiv gegen den Nationalsozialismus engagiert hatten, und solche, deren Angehörige den Widerstand oder ihre jüdische Abstammung mit dem Leben bezahlt hatten, arbeiteten im DFR zusammen mit Frauen, die das Dritte Reich –
mit Hettlings Kategorien deckungsgleichen Begriffe ‚Persönlichkeit‘, Verantwortung‘, ‚Gemeinschaft‘, ‚Freiheit‘, ‚Gerechtigkeit‘ ‚Sittlichkeit‘, und ‚Bildung‘ nach vorn. 309 Vgl.: Schüddekopf, Jörg: Er, Sie, oder Beide? Jörg Schüddekopf an die Redaktion Stimme der Frau, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 4. Die Begriffe spielen auf zwei bekannte Frauenzeitschriften für das gehobene Publikum an. 310 Ebd.
932 | Theanolte Bähnisch
soweit sich dies von außen und in der Re-trospektive beurteilen läßt – weitgehend schadlos auf eine Art überstanden hatten, die der Schriftsteller Frank Thiess 1933 erstmals als ‚Innere Emigration‘ bezeichnet hatte. Frauen, die ins Exil gegangen waren, waren, anders als im Vorstand des ‚Club deutscher Frauen‘– und ganz anders als in der SPD-internen Frauenarbeit – im DFR-Vorstand nicht vertreten. Dies mag ein Zufall sein, könnte jedoch auch darin begründet liegen, daß sich Exilanten und jene, die während des Dritten Reichs in Deutschland geblieben waren, im Umgang miteinander häufig schwertaten. Die Unterschiede in den Mentalitäten wogen umso schwerer, als vor allem Vertreter des linken politischen Spektrums Zuflucht im Exil gesucht hatten.311 Eine Voreingenommenheit Bähnischs gegenüber Personen, die aus politischen Gründen ins Exil gegangen waren, scheint jedoch nicht bestanden zu haben. Einige ihrer Vertrauten waren jenen Weg gegangen, und aus dem Fragebogen, den Bähnisch für die Militärregierung ausgefüllt hatte, geht hervor, daß sie für sich selbst und ihren Mann ebenfalls eine entsprechende Möglichkeit geprüft haben soll.312 Der DFR-Vorstand spiegelte – wenn in ihm auch nur die gebildeteren, wohlhabenderen Frauen präsent waren – das wieder, was Strecker als die Klientel der bereits 1945/46 gegründeten Frauenausschüsse beschrieben hatte: „Überlebende, die in der Opposition gestanden hatten, Frauen, die schon in der alten Frauenbewegung tätig gewesen waren, aber auch neue, bisher unbekannte Frauen, die einfach als Menschen fühlten, daß die Zeit ihnen eine neue Chance bot und daß sie etwas tun mußten.“313 Die meisten der Frauen hingen nicht nur, wie bereits erwähnt, liberalem Gedankengut an, sondern sie hatten auch ein ausgesprochenes historisches Bewußtsein. Einige waren, wie Dorothee von Velsen, Elisabeth Mahla und Luise Bardenhewer, sogar promovierte Historikerinnen oder Kunsthistorikerinnen. Daß viele Frauen im DFR sich sowohl ihrer Stellung in der Gesellschaft als auch ihres schriftstellerischen Talents314 bewußt waren, äußerte sich unter anderem in der Entstehung diverser Autobiographien aus jenem Kreis. Das Diktat von 1972 in Bähnisch Nachlaß legt die Interpretation nah, daß auch sie eine solche Publikation anstrebte.315
311 Vgl. dazu: Krohn, Claus-Dieter: Exilforschung, Version: 1.0, in: DocupediaZeitgeschichte, 20.12.2012. Krohn weist in seinem Aufsatz auch darauf hin, daß über das Exil von Konservativen bisher kaum geforscht wurde. Vgl.: ebd. 312 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Fragebogen der Militärregierung, 05.08.1945, S. 4. Darin gibt sie an, sich nach den Möglichkeiten einer neuen Existenz für sie und ihren Mann in Amerika umgeschaut zu haben. Ihr enger Vertrauter Grimme dagegen gehörte zu jenen Personen, die das „Fortgehen der Männer, die an sichtbarer Stelle gestanden hatten“, als ein „Verhängnis“ wahrnahmen und sich selbst dafür entschieden hatten, in Deutschland zu bleiben. Adolf Grimme an Edmund Husserl, 26.11.1933, zitiert nach Burkhardt: Biographie, S. 176. 313 Strecker: Frauenbewegung, S. 34. 314 Vgl. dazu beispielsweise: Velsen: Spanne. 315 Privatnachlaß Theanolte Bähnisch, Diktat, o. D. [1972].
Wachsende Prominenz | 933
In allen Fällen ermöglichten eine gehobene gesellschaftliche Position, die meist aus der eigenen Berufsarbeit entstanden war, und entsprechende Familienverhältnisse das nicht vergütete Engagement in der Bewegung. Gabriele Strecker konnte erklärtermaßen auf ihre tüchtigen Hausangestellten, das Verständnis ihres Ehemanns sowie die Reife ihrer Kinder setzen.316 Viele ihrer Mitstreiterinnen waren, wie Bähnisch und Zahn-Harnack, Witwen, oder sie waren, wie Lüders, die einen (unehelichen) Sohn hatte, unverheiratet geblieben. 8.3.4 Die Akzeptanz Bähnischs als neue Führungsfigur (auch) in der ‚Bürgerlichen Frauenbewegung‘ – Schnittstellen und Symbiosen von Eliten-Kontinuitäten Die Kontinuität von der Vorkriegs- zur Nachkriegsfrauenbewegung sowie die Tatsache, daß sich der DFR als Nachfolgeorganisation des BDF verstand317, drückte sich unterschiedlich, am sichtbarsten aber in dem Faktum aus, daß die letzte, bis 1933 amtierende Vorsitzende des BDF, Agnes von Zahn-Harnack, 1949 zweite Vorsitzende des DFR wurde. Für sie und andere ehemalige BDF-Vorstandsmitglieder, die nun zum DFR-Vorstand gehörten, beinhaltete dieses Anknüpfen, trotz des teilweisen Generationswechsels und der Verschiebung des lokalen Machtzentrums, zunächst einmal mehr Kontinuität als Neuanfang. Eine solche Entwicklung war vier Jahre zuvor noch kaum denkbar gewesen. Doch nun zeigte sich, daß Zahn-Harnack mit ihrer Überzeugung, die Anhängerinnen der Frauenbewegung würden „auch ohne ‚Bund‘ ein Bund“318 bleiben, Recht behalten hatte. In der spürbaren Dankbarkeit für und der Erleichterung über diese Kontinuitäten, beziehungsweise dieses Wiederanknüpfen an die organisierte Vorkriegsfrauenbewegung liegt ein weiterer Schlüssel zum Verständnis einer alles in allem doch auffällig breiten Akzeptanz der Führungsrolle Bähnischs in der Frauenbewegung der Nachkriegszeit durch den ehemaligen Führungszirkel des BDF.319 Schließlich hatte die Regierungspräsidentin maßgeblichen Anteil daran, daß ein Wiederaufleben der Arbeit der Bürgerlichen Frauenbewegung und damit eine wichtige Säule innerer Zufriedenheit für die im Nationalsozialismus zur politischen Passivität verurteilten Frauen innerhalb kurzer Zeit auf interzonaler Ebene möglich geworden war. Daß ihre guten Beziehungen zu Eliten des In- und Auslands, ihre herausragende Stellung als
316 Vgl.: Strecker, Gabriele: Gesellschaftspolitische Frauenarbeit in Deutschland. 20 Jahre Deutscher Frauenring, Opladen 1970. 317 Vgl. dazu beispielsweise: Strecker: Frauenarbeit, S. 15. Die Traditionsbildung wird auch aus der Art der Ablage von Archivalien im DFR-Archiv deutlich. Im Ordner A1 leiten Archivalien welche die Auflösung des BDF thematisieren eine Materialsammlung zur Gründungsgeschichte des DFR ein. DFR-Archiv, A1. 318 Zahn-Harnack, Agnes, von: Schlußbericht über die Arbeit des Bundes Deutscher Frauenvereine, in: Die Frau, 40. Jg. (1933), S. 551–555, hier S. 555. 319 Zur Eignung Bähnischs als ‚Frontfrau‘ gegen die Kommunistinnen, die ebenfalls wesentlich zu ihrer Akzeptanz durch die leitenden Mitglieder des BDF beitrug, siehe Kapitel 7.1.5.
934 | Theanolte Bähnisch
erste Regierungspräsidentin Deutschlands, ihre Vita, beziehungsweise ihr Selbstentwurf zu einer so schnellen Wiederaufnahme Deutschlands in die internationale Frauenbewegung führte, rührte vor allem Agnes von Zahn-Harnack sehr. Bähnischs Motive für den Aufbau des DFR teilte sie; auch für die Schwester des ermordeten Regierungspräsidenten von Merseburg lag im Kalten Krieg eines der zentralen Argumente für den möglichst schnellen Wiederaufbau einer vom Geist des BDF geprägten Frauenbewegung. Theanolte Bähnisch war jedoch nicht nur aufgrund des Brückenschlags, den sie zwischen den Generationen leistete, unter den Eliten des BDF geachtet, sondern auch aufgrund ihres praktischen Handelns. Das Zusammenstehen von Frauen in der Not, welches die Gründungsvorsitzende des ‚Club deutscher Frauen‘ 1946 gefordert hatte, hatte sie zumindest an einem politisch sehr gewichtigen Beispiel selbst mustergültig umgesetzt: Als der Westsektor Berlins von der Roten Armee abgeriegelt worden war, hatte die Regierungspräsidentin von ihrem Dienstsitz aus, im Wissen, daß „das aufrichtigste Mitempfinden noch lange keinen Kochtopf füllt“320, Nahrungsmitteltransporte aus der britischen Besatzungszone nach Westberlin organisiert.321 Daneben hatte sie ideelle Unterstützung geleistet und beispielsweise im Rahmen einer Ansprache in der Viermächtestadt Berlin den anwesenden Zuhörerinnen versprochen, daß die Frauen in den Westzonen ihnen beistehen würden und daß man an Berlin als Hauptstadt festhalten werde.322 Die Vorsitzende des Frauenrings, die ihren Einfluß in dieser Hinsicht offenbar überschätzte, hatte damit im ehemaligen Zentrum des BDF Präsenz gezeigt und dafür beschwerliche Reisewege in ihre ehemalige Heimatstadt auf sich genommen. Auch in der ‚Stimme der Frau‘ hatte sie mit dem Slogan ‚Frauen des Westens helft den Berliner Müttern und Kindern‘ um Solidarität mit den Frauen in der Hauptstadt geworben.323 Die Warnung der Präsidentin des National Council of Great Britain, Mrs. Cowan, „There should not be too much Berlin in the movement“324 hatte Theanolte Bähnisch also nur teilweise befolgt, beziehungsweise vor dem Hintergrund der realen, gewach-
320 DFR-Archiv, A2, Gedanken für eine Rede in Berlin, o. D. [1948]. 321 DFR-Archiv, A2. Im Ordner ist ein großes Konvolut an Schreiben überliefert, welches Informationen zu Bähnischs Organisations-Arbeit von Hannover aus liefert. Demnach versorgte sie den Berliner Frauenbund 1947 und die Notgemeinschaft 1947 mit Lieferungen, die die Hilfsgüter dann weiter transportierten. Sie schrieb sowohl Frauenringe als auch die Kirchen um Unterstützung an, konnte bei Letzteren jedoch keine Erfolge verbuchen. 322 Ob sie eine Rede, die auf diesen Gedanken basierte, jemals gehalten hatte, ist nicht sicher, aber ein Brief Bähnischs an Nora Melle belegt, daß sie sich tatsächlich im Sommer 1948 in Berlin aufgehalten und bei Nora Melle gewohnt hatte. DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Melle, 06.08.1948. Vorab hatte sie sich mit Melle über den Aufruf zur Unterstützung der Berlinerinnen verständigt. 323 Vgl.: O. V.: Frauen des Westens helft den Berliner Müttern und Kindern, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 3, S. 3. 324 NA, UK, FO 1050/1210, Report on visit to certain parts of the British Zone, Mrs. Cowan, President of the National Council of Great Britain, 07.09.1946.
Wachsende Prominenz | 935
senen und nicht zuletzt von der CCG (BE) bestätigten Machtverhältnisse überhaupt befolgen können.325 Auch nach 1945 hielt sich eine Menge ‚Berlin‘ in der Bewegung. Auch wenn der Sitz des Frauenrings Hannover war, war der Einfluß der Berlinerinnen im Vorstand und damit auf die Politik des DFR so groß, daß man für die Nachkriegsjahre von der Existenz zweier Machtzentren der organisierten bürgerlichen Frauenbewegung nach 1945 sprechen muß. Und die Präsidentin des DFR tat gut daran, dies nicht in Frage zu stellen. Wie Theanolte Bähnisch durch das Zutun Grimmes, Kopfs und Brigadier Humes Teil der Eliten-Kontinuität aus dem Preußen der Weimarer Republik in die Bundesrepublik geworden war, so leistete sie selbst einen wesentlichen Beitrag zu einer entsprechenden Kontinuität in der bürgerlichen Frauenbewegung. Mit der Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘ hatte sie die Initialzündung zur Verlagerung des Sitzes der Bewegung nach Hannover gegeben. Dabei hatte sie vor allem von dem Personal, das Grimme nach Hannover geholt hatte, profitiert, bevor sie selbst Personen ihres Vertrauens aus anderen Landesteilen, vor allem aus Berlin, zumindest temporär nach Niedersachsen, respektive nach Bad Pyrmont, geholt hatte. Beide Formen der Eliten-Kontinuität aus der Weimarer Republik in die Bundesrepublik, jene, die Bähnischs Arbeit als Regierungspräsidentin beeinflußte, und die, die sich in ihrer Arbeit im DFR manifestierte, waren mehrfach miteinander verknüpft. Dabei kam dem früheren preußischen und späteren niedersächsischen Kultusminister Adolf Grimme eine zentrale Rolle zu: Schließlich hatte er sowohl dafür gesorgt, daß Bähnisch als Regierungspräsidentin von Hannover ins Gespräch kam, als auch dafür, daß Heiner Lotze jenen Kreis von Frauen zusammentrommelte, der sich mit dem Placet des Kultusministers bald schon stärker an Bähnisch, als an der Niedersächsischen Volkshochschule orientierte. Grimme hatte diese Entwicklungen honoriert, indem er auf der ersten interzonalen Konferenz in Pyrmont, wie auch im Kreise seiner Genossen, Partei für seine Freundin ergriff. In einer Sitzung des SPDParteivorstandes am 02.06.1947 hatten sich – mit Verweis auf die ‚Alteliten‘ des BDF im Vorstand des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ – alle Anwesenden gegen die überparteiliche Arbeit Theanolte Bähnischs gestellt, „mit Ausnahme des Genossen Grimme“326. Die Bekanntschaft mit Grimme, für die die Tätigkeit von Bähnischs Bruder Otto Nolte im Kultusministerium ursächlich gewesen zu sein scheint, hatte sich zu einer Freundschaft entwickelt327, nicht zuletzt, weil beide Personen eine sehr ähnliche Sicht auf die Gesellschaft hatten, über gemeinsame Freunde und Kollegen verbunden waren und schließlich, weil sie, aus der Sicht der Militärregierung, jeweils eine herausragende Eignung für zentrale Rollen und Positionen im deutschen Wie-
325 DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Melle, 06.08.1948. 326 Albrecht, Willy: (Hrsg.): Die SPD unter Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer 1946 bis 1963. Sitzungsprotokolle der Spitzengremien, Bd. 1: 1946 bis 1948, Bonn 1999, S. 223. 327 GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239. Ähnlich wie es lange Zeit zwischen Bähnisch und ihrer engen Freundin Ilse Langner gewesen war, sprachen auch Grimme und Bähnisch sich in Briefen mit ‚Sie‘ an. Allerdings nannte er sie „Thea“ und sich selbst ihren „alten Freund“. GStA PK VI. HA, NL Grimme, Nr. 1239, Grimme an Bähnisch, 16.12.1948.
936 | Theanolte Bähnisch
deraufbau besaßen. Daß beide mit Personen kooperierten, die gleichermaßen als reform-orientiert und erfahren galten und die sich während des Nationalsozialismus eine ‚weiße Weste‘ bewahrt hatten, gefiel den Zuständigen in der CCG (BE). Weitere Pluspunkte konnten Grimme und Bähnisch bei der Militärregierung durch die Zusammenarbeit mit dem jeweils anderen sammeln. In der SPD machte Bähnisch ähnliche Erfahrungen wie der kurzzeitig dem Parteivorstand angehörende Grimme, nämlich, daß die von Kurt Schumacher geführte Partei eine Zusammenarbeit mit den Kirchen nicht aktiv anstreben wollte und den ‚religiösen Sozialismus‘ als ideologisches Fundament der Partei ablehnte. In der Frauenbewegung dürfte sich Bähnisch in dieser Hinsicht wohler gefühlt haben, denn dort konnte sie unter anderem mit der Theologin und Tochter des bekanntesten Vertreters des Kulturprotestantismus Adolf von Zahn-Harnack, Agnes von ZahnHarnack, zusammenarbeiten. Auch in der Europabewegung versammelte sich eine größere Anzahl Gleichgesinnter, die in einer Rechristianisierung einen Schlüssel zu einer moralischen Umkehr der Gesellschaft sahen. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Idee war der Mitherausgeber der ‚Frankfurter Hefte‘ Hefte, Walter Dirks. Grimme und Bähnisch arbeiteten gemeinsam in der Europäischen Bewegung328 mit Hinrich Wilhelm Kopf, Heinrich Hellwege, Heinrich Brill, Carlo Schmid, Katharina Petersen, Christine Teusch und anderen aktuellen und ehemaligen Kollegen sowie anderen Frauen, die sich, wie Elly Heuss-Knapp und Teusch, wiederum ebenfalls in der überparteilichen bürgerlichen Frauenbewegung engagierten.329 Die Zusammenarbeit in der Europäischen Bewegung verstärkte die freundschaftliche Bande zwischen Grimme und Bähnisch noch, zumal man in der Partei nicht nur in Sachen Frauenbewegung, sondern auch in Sachen ‚Europa‘ gemeinsam auf Konfrontationskurs gegen den Mehrheitswillen ging.330 Da Grimme in der Familie Harnack hoch geachtet war, dürfte sich – neben der Beziehung, die Albrecht Bähnisch zu Ernst von Harnack gepflegt hatte – auch Grimmes Verbindung zu Bähnisch positiv auf die Wahrnehmung Bähnischs durch Zahn-Harnack ausgewirkt haben – und damit wiederum auf Bähnischs Akzeptanz unter den Alt-Eliten des BDF. Die Regierungspräsidentin knüpfte in den Jahren ab 1946 vor allem in der Zusammenarbeit mit Grimme an das Erbe der teilweise gefallenen, teilweise ermordeten, teilweise ausgewanderten und teilweise diskreditierten ersten Riege der preußischen Politik- und Verwaltungselite der Weimarer Republik an, indem sie mit dem Ziel breitenwirksam akzeptierter gesellschaftlicher Reformen überparteiliche Allianzen bildete und auf der Grundlage dieser Allianzen verantwortlich in verschiedenen
328 Daß Grimme seit 1954 korrespondierendes Mitglied des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung war, war womöglich nicht zuletzt auf das Zutun Bähnischs zurückzuführen. Belegen ließ sich dies bisher jedoch nicht. Die Mitgliedschaft Grimmes ist genannt in: Sauberzweig, Dieter (Hrsg.): Adolf Grimme. Briefe, Heidelberg 1968, S. 274. 329 Heuss-Knapp und Bähnisch kannten sich aus dem von Freda Wuesthoff initiierten ‚Stuttgarter Friedenskreis‘. 330 So geschehen bei der Sitzung des Parteivorstands am 11/12.03.1949 in Köln. Vgl.: Albrecht: SPD, Bd. 2, S. 123.
Wachsende Prominenz | 937
führenden Positionen handelte. Während sie sich in der Europabewegung und im Verwaltungsstab des Ministerpräsidenten Hinrich Wilhelm Kopf stärker funktional in Zusammenhänge einfügte und aufgrund ihres Status als Beamtin zur politischen Neutralität angehalten war, so sorgte sie im Frauenring und später auch in der ‚Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen‘ (DGVN)331 aktiv dafür, daß Personen, die ihre ‚Haltung‘ teilten, mit ihr zusammenwirkten. Vergleicht man den Kreis um Kopf, in dem Bähnisch sich bewegte, mit dem Führungsstab des DFR, so läßt sich festhalten, daß das Kabinett Kopf und sein Verwaltungsstab trotz der Offenheit Kopfs gegenüber Vertretern aus anderen Parteien stärker sozialdemokratisch, aber gleichzeitig auch stärker konservativ geprägt war als der DFR-Vorstand, in dem liberale Kräfte am stärksten vertreten waren. Die Sozialdemokratinnen im Bundes-, Landes-, und regionalen DFR-Vorstand bildeten wiederum eine Schnittmenge mit den Verwaltungseliten in Hannover und Niedersachsen, wobei auf der mittleren Ebene, also im Landesverband Niedersachsen, den Katharina Petersen (SPD) leitete und in dem sich Martha Fuchs (SPD) engagierte, die stärkste Symbiose bestand. Der Bundesvorstand war mindestens ebenso stark von Frauen aus anderen Regionen geprägt wie von solchen aus Niedersachsen, während der Landesring bei seiner Gründung im Zuge der Konstituierung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ Potential aus dem Vorstand des ‚Club deutscher Frauen‘ abgezogen und Platz für Nachrückerinnen gemacht hatte. 8.3.5 Schwammige Begriffe mit Integrationspotential Die Leitideen, auf die sich die Vorstands-Arbeit des DFR stützte, lassen sich – vor dem Hintergrund der Sozialisation und der Überzeugungen der Frauen, die ihm Leben einhauchten – als ‚bürgerlich‘ beschreiben. Gerade die ‚Unschärfe‘, die dem Begriff nachgesagt wird, ist passend, wenn es um eine Charakterisierung des DFR in den frühen Jahren geht. Für den Historiker und Bürgertumsforscher Manfred Hettling etwa bedeutet das ‚Bürgerliche‘ keinen festen Kanon, sondern ein „komplexes Set von Werten, das immer wieder neu ausgehandelt wird – einen Wertehimmel der Orientierung bietet, aber keine festen Regeln liefert“332. Dasselbe läßt sich über die Leitvokabeln, mit denen der DFR operierte, sagen. Die ‚Konzeptlosigkeit‘ und der ‚Mangel an stringenten Zielen‘, die dem DFR von Herta Gotthelf unterstellt wurden, hatten, weil die Organisation damit unter parteipolitisch nicht vorgebildeten Frauen nicht polarisierte, grundsätzlich einendes Potential – was keinesfalls im Widerspruch dazu steht, daß viele Frauen nicht in den DFR eintreten wollten. Die ‚bürgerliche‘ Frauenbewegung nach 1945 arbeitete mit eher diffusen Entwürfen von ‚Gesellschaft‘, ‚Familie‘, ‚Beruf‘ und ‚Weiblichkeit‘ sowie ‚Mütterlichkeit‘. Keine ‚etwas weiter links‘ oder ‚etwas weiter rechts‘ stehende Frau mußte sich von den Ideen, die
331 Siehe Kapitel 8.6.3. 332 Hettling, Manfred: Von Werther bis Guttenberg. „Bürgerlichkeit bietet Orientierung“, auf: ntv, 28.02.2011, http://www.n-tv.de/politik/Buergerlichkeit-bietet-Orientierung-ar ticle2719156.html, am 13.12.2013. Vgl. auch: ders./Hoffmann, Stefan Ludwig: Der bürgerliche Wertehimmel: Innenansichten des 19. Jahrhunderts, Göttingen 2000.
938 | Theanolte Bähnisch
der DFR aktiv nach außen trug, abgestoßen fühlen. Dies gilt nicht zuletzt, da die zentralen Begriffe, mit denen der DFR sich präsentierte, von jedem (potentiellen) Mitglied und jeder an der Arbeit des DFR interessierten Frau mit einem jeweils eigenen Bedeutungsgehalt gefüllt werden konnten.333 Begriffe wie ‚Mütterlichkeit‘, ‚Weiblichkeit‘, ‚Sittlichkeit‘, ‚Verantwortung‘, ‚Gleichberechtigung‘, ‚Staatsbürgerschaft‘, ‚öffentliches Leben‘, ‚Gemeinschaft‘, ‚Individuum‘, ‚Persönlichkeit‘, ‚Menschlichkeit‘, ‚Wert‘, ‚Geist‘, ‚Seele‘, ‚Religion‘, ‚Gott‘, ‚Schöpfer‘ ‚Westen‘, ‚Europa‘, ‚Völkerverständigung‘ und ‚Freiheit‘ – mit Einschränkungen auch ‚Friede‘ – waren, um nur die positiv assoziierten Begriffe zu nennen, die Leitvokabeln, mit denen führende Frauen aus dem DFR maßgeblich operierten. Wer fest auf die Linie einer Partei schwor, der kann sich hierin kaum wiedergefunden haben, dem könnte der gemeinsame Nenner, auf den sich die Frauen im DFR einigen konnten und wollten, unklar und nicht greifbar vorgekommen sein. Jene Frauen jedoch, die sich für eine neue, bessere Gesellschaft, für den Wiederaufbau und die Überwindung der Not einsetzen wollten und für sich (noch) nicht entschieden hatten, auf welchem Weg diese Ziele am besten erreicht werden könnten, konnten sich in jenem ‚parteifreien‘ Raum aufgehoben fühlen. Frauen, die vom vergangenen System enttäuscht waren, aber nur eine vage Vorstellung von einer guten Alternative hatten, sich jedoch darauf einigen konnten, daß diese ‚menschlicher‘, ‚friedlicher‘ und vielleicht auch ‚weiblicher‘ sein sollte, gab es viele. Die unterschiedliche Sozialisation, Berufszugehörigkeit und parteiliche Bindung von Vorstandsmitgliedern schaffte zusätzliche Möglichkeiten der Identifikation für Mitglieder, die sich bereits einer Partei zugehörig fühlten. Common Sense im Frauenring war immerhin die gegenseitige Akzeptanz unterschiedlicher Meinungen – in Anbetracht des politischen Systems der Jahre 1933 bis 1945 grundsätzlich eine beachtliche Idee. Daß die ‚staatsbürgerliche Bildung‘ des DFR jene Frauen, die zur Mitarbeit bereit waren, dabei unterstützen wollte, sich mittelfristig für eine ‚politische Richtung‘ auf dem Wahlzettel entscheiden zu können, war ein ebenso beachtlicher Gedanke. Seine ‚Effektivität‘ ist zwar nicht meßbar, aber jede Frau, die sich mit Hilfe jenes Ansatzes von radikalem Denken, welches der DFR ablehnte, abwandte, bedeutete einen Gewinn und eine Stütze für die junge Demokratie. Die Parteizugehörigkeit der Regierungspräsidentin und einiger anderer Vorstandsmitglieder machte außerdem deutlich, daß – anders als noch im BDF – die Identifikation mit den politischen Zielen der SPD im DFR durchaus hoffähig war.
333 An dieser Stelle sei auf die von Urs Stäheli beschriebene Funktion von Begriffen als ‚leere Signifikanten‘ verwiesen. Ein klassisches Beispiel hierfür ist der von der SPD im Wahlkampf von 1998 gebrauchte Begriff ‚Neue Mitte‘, der jedem ‚Empfänger‘ des Begriffs ermöglichte, den Begriff mit einem je eigenen Deutungsgehalt zu füllen. Vorgegeben war lediglich ein Bedeutungsgehalt der sich als ‚nicht extrem‘ und ‚innovativ‘ beschreiben ließe. Ist bei den von Bähnisch häufig verwendeten Begriffen wie ‚Mütterlichkeit‘ und ‚öffentliches Leben‘ der Rahmen möglicher Deutungen zwar enger gesteckt, so lassen die Begriffe doch eine ganze Bandbreite von Interpretationen zu. Zum Ansatz des Experten für die Theorie kultureller Integration vgl.: Stäheli, Urs: Die politische Theorie der Hegemonie: Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, in: Brodocz, André/Schaal, Gary S. (Hrsg.): Politische Theorien der Gegenwart, Opladen 1999, S. 143–166, hier S. 149.
Wachsende Prominenz | 939
Daß sich der Verband jedoch geradezu ‚fanatisch‘ gegen den Kommunismus zur Wehr setzte, ist vor dem Hintergrund der Sozialisation seiner Mitglieder nachvollziehbar. Denn dieser schien all das zu bedrohen, worauf jene ihr Selbstverständnis gründeten und was sie in den Jahren seit Kriegsende erreicht hatten. Leonore MayerKatz (CDU) brachte das Phänomen so auf den Punkt: „Wir wollten die Stimmen der Frauen aller Richtungen, auch der kommunistischen, zu Gehör bringen, aber nichts sollte uns bewegen, die Vielfältigkeit der Stimmen in unserem Kreis zum Schweigen zu bringen. Lange genug waren wir von rechts ‚gleichgeschaltet‘ worden, es sollte nicht das gleiche von links geschehen.“334 Mit den Negativ-Begriffen ‚Vermassung‘, ‚Entpersönlichung‘ ‚Entseelung‘, ‚Gleichmacherei‘ ‚Vergottung des Kollektivs‘, ‚Gleichschaltung‘, ‚östliches Weltbild‘, ‚kulturelle Krise‘, ‚Instrument‘, ‚totalitär‘, ‚Zwang‘ und ‘Schweigen‘ setzte der DFR der erklärtermaßen wünschenswerten, westlich-christlichen Welt eine offenbar gefährliche, vernichtende, schlechte Welt im ‚Osten‘ entgegen – in der Überzeugung, daß sich mit solchen Vokabeln keine Frau identifizieren können würde. Indem die oben genannten, positiv assoziierten Begriffe von Bähnisch stets gemeinsam mit dem ‚Westen‘ genannt und dem ‚Osten‘ entgegengesetzt wurden, leistete die Hannoveraner Regierungspräsidentin einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Festigung des antikommunistischen Grundkonsenses in Westdeutschland. Daß die positiven Begriffe, welche Bähnisch inflationär verwendete, nicht neu waren, sondern lediglich von ihr und ihren Mitstreiterinnen in einen – zumindest teilweise – neuen Bedeutungszusammenhang gebracht wurden, vergrößerte – folgt man dem vielfach rezipierten Pädagogen und Lerntheoretiker David Ausubel – die Wahrscheinlichkeit, daß viele ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer die ‚neue‘ Botschaft, die ‚Mütterlichkeit/Weiblichkeit ist gleich westlich‘ hieß, in Bähnischs Sinn aufnahmen. Denn Ausubel sieht Anknüpfungsmöglichkeiten an Bekanntes und Bewährtes als eine zentrale Voraussetzung für einen gelingenden Lern- und Akzeptanzprozeß an.335 Wie schnell und erfolgreich ein über Jahrhunderte etablierter Begriff in einen völlig neuen Kontext gebracht werden kann, wird an dem Begriff ‚Frieden‘ deutlich. Dieser entwickelte sich zwischen 1945 und 1947 zu einer Vokabel, hinter der man im ‚Westen‘ stets einen kommunistisch orientierten Urheber vermutete.336 An diesem Beispiel wird deutlich, wie Begriffe, wenn sie erst einmal erfolgreich im ‚Kräftefeld‘ eines Bedeutungszusammenhangs verortet werden, auch für sich genommen den mit ihm verknüpften Bedeutungsgehalt transportieren, ohne daß dieser ausgesprochen
334 Mayer-Katz: Minuten, S. 141. 335 Vgl. hierzu folgende Publikationen zur kognitivistischen Lerntheorie des bedeutungsvollen verbalen Lernens nach Ausubel: Ausubel, David P.: The Psychology of Meaningful Verbal Learning, New York 1963 sowie Thol, Norbert J.: Möglichkeiten und Grenzen der Ausubelschen Assimilationstheorie für Lern- und Behaltensleistungen. Eine Untersuchung zur Erprobung des 'advance organizer‘s' in der Sekundarstufe II eines deutschen Gymnasiums, Dissertation, Essen 1984. 336 Siehe Kapitel 7.7.2.3.
940 | Theanolte Bähnisch
werden muß.337 Gerade im Zusammenhang mit der für die vorliegende Arbeit so relevanten Neu- beziehungsweise Um- oder auch Re-orientierung einer Gesellschaft ist es – auch wenn die vorliegende Studie keine Diskursanalyse im literaturwissenschaftlichen Sinn leisten kann und soll – doch zielführend, die „Erfindung einer Identität“338 durch jene Gesellschaft mit Hilfe von durch Multiplikatorinnen wie Bähnisch gesetzten/besetzten Begriffen zu thematisieren. Denn Konstruktionen von Identität werden nicht nur in Anlehnung an Ideen, Werte und an diesen Ideen und Werten entsprechenden Referenzgesellschaften vorgenommen, sondern besonders auch in Abgrenzung zu anderen Gesellschaften. Feindbilder sind durch die Konstruktion eines „gänzlich Anderen“, „nicht Eigenen“ ein zentrales Moment der Identitätsbildung für eine Gesellschaft339, was sich nicht zuletzt an den antikommunistischen Verlautbarungen Bähnischs und anderer DFR-Mitglieder, welche diese im Zusammenhang mit einer allgemeinen Wiederaufbau-Rhetorik ‚servierten‘, nachvollziehen läßt. Diese Verlautbarungen standen im Einklang mit einer gemeinsamen Haltung des Gros der politischen Eliten Westdeutschlands zu jener Zeit: dem antikommunistischen Grundkonsens. Soviel also zur Theorie der gesellschaftlichen Integration, welche der DFR über seine Leitvokabeln hätte leisten können. In der Praxis waren es jedoch, wie bereits problematisiert, gerade die an radikales Gedankengut gewöhnten Frauen, ab dem
337 Dies betont auch der Medienforscher Stuart Hall, der sich, in der Tradition Antonio Gramscis mit hegemonialen und oppositionellen Leserarten von Botschaften auseinandersetzt. Die Voraussetzung dafür, daß der Gehalt einer Botschaft vom ‚Sender‘ zum ‚Empfänger‘ stabil bleibt, ist nach Hall, daß sich ‚Sender‘ und ‚Empfänger‘ in einem ähnlichen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld bewegen, mit anderen Worten, wenn sie mit ähnlichen Begriffs-Zusammenhängen und diskursiven Mustern konfrontiert sind. Vgl.: Hall, Stuart: Kodieren/Dekodieren, in: Bromley, Roger u. a. (Hrsg.): Cultural Studies. Grundlagentexte zur Einführung, Lüneburg 1999, S. 92–110. Halls Konzept vernachlässigt jedoch, daß stets auch Schreibende, beziehungsweise Sprechende Teil des ‚medio-politischen Diskurses‘ sind, was eine kritische Distanz zum ‚hegemonialen Diskurs‘ schier unmöglich macht. Der diskursanalytisch arbeitende Historiker Philipp Sarasin be-schreibt seine dieses Problem stärker berücksichtigende Arbeit deshalb wie folgt: „Eine diskursanalytische Untersuchung einzelner Texte, in denen Stimmen von Individuen vernehmbar sind, betrachtet den Text daher nicht als intentionale Äußerung eines Autors, eines individuellen Bewußtseins, sondern als eine ‚Oberfläche‘, als ein Gewebe von signifikanten und signifikativen Einheiten, die in ihrer Intertextualität und in ihrem vom Autor nie wirklich kontrollierten Arrangement Bedeutungseffekte haben, die immer über den einheitlichen, intendierten Sinn hinausgehen.“ Sarasin: Geschichtswissenschaft, S. 44. 338 Zum Thema ‚Identität‘ bei Sarasin vgl. auch Kapitel 1.7.2. 339 Vgl.: Laclau/Mouffe: Hegemonie, S. 176–192. „Feindbilder versprechen tief verunsicherten, sich subjektiv bedroht fühlenden Gruppen eine Wertsteigerung oder die Neukonstruktion ihrer Identität [...] die der Feindgruppe im Sinne eines negativen Gegenbildes zugewiesenen Eigenschaften ermöglichen Rückschlüsse auf das erwünschte Selbstbild.“ Bernhard: Voraussetzungen, S. 13/14.
Wachsende Prominenz | 941
Jahrgang 1920, die sich für die Arbeit des DFR nicht interessierten.340 Zu vermuten steht, daß im Nationalsozialismus sozialisierte, mit Großveranstaltungen und offensiver Propaganda konfrontierte junge Frauen für die vergleichsweise ‚leisen Töne‘ des Frauenrings kein Ohr hatten. Daß Bähnisch im DFR nicht tat, was sie Schumacher indirekt für die SPD empfohlen hatte, als sie über deren Scheitern in den 30er Jahren reflektierte, nämlich stärker auf Populismus zu setzen, ist es zumindest wert, erwähnt zu werden. Wahrscheinlich war ein solches Vorgehen für sie nicht denkbar, weil es die Kernklientel des Rings abgeschreckt und damit dem Mikro-Kosmos, in dem sich die belesene Akademikerin mit Gleichgesinnten bewegen konnte, gefährlich geworden wäre. Gleichzeitig scheint der Frauenring jungen Frauen auch inhaltlich nicht das geboten zu haben, was diese sich erhofften. Aussagen hierüber sind jedoch kaum möglich, ohne eine genauere Analyse der alltäglichen Arbeit, welche die Ortsverbände leisteten, vorzunehmen – ein Thema für ein eigenes wissenschaftliches Projekt. Eine weitere Interpretation ist naheliegend: Geht man mit Stuart Hall davon aus, daß die ‚Stabilität‘ einer Botschaft zwischen ‚Sender‘ und ‚Empfänger‘ einen ähnlichen Lebenskontext erfordert, so dürfte die Idee Bähnischs, mit den Vokabeln der bürgerlichen Frauenbewegung aus der Weimarer Republik zu ‚punkten‘ und deren Bedeutungsgehalt als mit dem Kommunismus unvereinbar zu verknüpfen, vor allem für ältere Frauen anschlußfähig gewesen sein. Eher schon scheint es der ‚Stimme der Frau‘ – das verraten die Auflagezahlen341 – gelungen zu sein, mit ihrer Mischung ausbildenden und unterhaltenden Elementen, wozu neben Kurzgeschichten, Rätseln und Hauswirtschafts-Tips bald auch Mode und Schönheitspflege gehörten, auch jüngere und wirtschaftlich schlechter situierte Frauen zu erreichen. Zum Beispiel dürften Darstellungen von Slawen, die an das von den Nationalsozialisten verbreitete, rassistisch geprägte Rußland-Feindbild anknüpften, Wiedererkennungseffekte vor allem bei jüngeren Frauen herbeigeführt haben. (Rassistisch geprägte Argumentationsmuster gegen die Slawen treten in überlieferten Reden der Regierungspräsidentin, anders als in der Zeitschrift, nicht auf). Zudem dürften besonders die Ratgeber-Artikel in der Zeitschrift die Alltags-Probleme verschiedener, jüngerer wie älterer Frauen wiedergespiegelt haben, weshalb über die Zeitschrift zumindest teilweise kompensiert werden konnte, was dem Ring nicht gelang: Eine breitere Masse von Frauen anzusprechen. Eine persönliche Auseinandersetzung mit jenen Frauen war über diesen Weg wiederum nicht möglich, aber eben auch nicht nötig. Doch Theanolte Bähnisch wirkte auch über den DFR hinaus als Multiplikatorin – und leitete andere Frauen dazu an, es ihr gleichzutun. Nicht umsonst hatte sie der Militärregierung den Plan zur Einrichtung einer staatsbürgerlichen Frauenschule unter-
340 Was zeitgenössische Artikel beklagten stützt, Nori Möding zufolge, auch eine Umfrage aus den 60er Jahren. Vgl.: Möding: Stunde, S. 639. Möding bezieht sich auf Pauls, Maria: Die deutschen Frauenorganisationen. Eine Übersicht über den Bestand, die Ursprünge und die kulturellen Aufgaben, Diss. Aachen 1966, S. 148f. 341 1950 erreichte die ‚Stimme der Frau‘ eine Auflage von 105.000 Exemplaren. Sie bewegte sich somit im Mittelfeld unter den anderen Frauenzeitschriften. Vgl.: Freund: Krieg, S. 82.
942 | Theanolte Bähnisch
breitet. Die Ideen der Vorsitzenden erreichten nicht nur die Landes- und Ortsringe des DFR, sondern auch die angeschlossenen Verbände, jene Personen, die sich in der Europäischen Bewegung engagierten, sowie die Medien. Und sie verbreiteten sich auch über jene Personen, die mit der Vorsitzenden des Frauenrings zusammenarbeiteten. Wie Bähnisch und der DFR mit ihren/seinen Politik- und Personalempfehlungen ebenfalls dazu beitrag, ihre/seine Überzeugungen zu verbreiten, soll Gegenstand späterer Kapitel sein. 8.3.6 Ein Dach ohne Haus – Der DFR erfüllt eine zentrale Erwartung nicht Nicht nur für Einzelmitglieder war der DFR weniger attraktiv, als es sich die Militärregierung erhofft hatte, auch die Attraktivität des Verbands für andere Organisationen ließ zu wünschen übrig: Nur wenige der auf der DFR-Gründungs-Konferenz anwesenden Verbände, welche grundsätzlich zur Zusammenarbeit mit anderen Frauenorganisationen bereit waren und die die DFR-Vorsitzenden gern als ihre – politisch zuverlässigen – Mitgliederverbände gesehen hätten, akzeptierten die Führungsrolle des DFR als Dachverband. Neben jenen Zusammenschlüssen, die ohnehin schon mit ihrer Arbeit auf der Linie des DFR lagen und deshalb mehrheitlich bereits den Terminus ‚Frauenring‘ im Namen trugen, wollten sich lediglich die „politisch interessierten Frauenkreisen als zu bürgerlich, gar zu zahm“342 geltende ‚Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen‘ (GEDOK), die Frauengruppe im ‚Reichsbund der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen‘ sowie der ‚Frauenbund für alkoholfreie Kultur‘ an den DFR anschließen.343 Die einflußreichen großen Organisationen wie der ‚Deutsch-Evangelische Frauenbund‘ (DEF), der ‚Landfrauenverband‘, das ‚Deutsche Rote Kreuz‘ (DRK), die ‚Deutsche Schwesterngemeinschaft, der ‚Verein Frauenkultur‘, der ‚Deutsche Akademikerinnenbund‘ und der ‚Verband weiblicher Angestellter‘ wollten ebenso unabhängig bleiben wie der ‚Christliche Akademikerinnenbund‘ und der ‚Verein Frauen in sozialen Berufen‘344 – obwohl dessen Leiterin Dorothea Karsten, wie bekannt, gemeinsam mit Bähnisch den ‚Club deutscher Frauen‘ in Hannover ins Leben gerufen hatte. Zur Konferenz gar nicht erst erschienen waren der von Finni Pfannes geleitete Hausfrauenverein sowie der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB), was die Womens Affairs Section in Niedersachsen als „not very tactful“345 kommentierte, also als mehr oder weniger offene Ablehnung des DFR durch den KDFB interpretierte. Dazu, daß der KDFB sich gegenüber dem DFR distanziert verhielt, hatte, wie es
342 Vgl.: Fleischer: Juristin, S. 119. In Hannover hatte Ida Dehmel die GEDOK-Gruppe – der offenbar auch Anna Mosolf angehörte – gegründet Vgl.: ebd. 343 NA, UK, FO 1050/1230, Land Niedersachsen, Comments on Bad Pyrmont Frauenkongress, October 1949. Vgl. dazu auch: Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll. 344 NA, UK, FO 1050/1230, Land Niedersachsen, Comments on Bad Pyrmont Frauenkongress, October 1949. 345 Ebd.
Wachsende Prominenz | 943
scheint, auch Kanzler Adenauer beigetragen. In einem Brief an die Politikerin und Pädagogin Anne Franken – von der er offenbar glaubte, sie könne entsprechenden Einfluß ausüben – hatte er die Empfehlung einer Mitbegründerin der CDU in Dortmund, Angela Zigahl, weitergegeben, welche lautete, daß man in den DFR „keinesfalls ganze Organisationen wie den KDFB eintreten lassen“346 solle. Mit dem Hausfrauenverein hatte der DFR, so erklärte Bähnisch noch sechs Wochen vor der Pyrmonter Konferenz, zumindest vorgehabt, eine vom DFR geführte Arbeitsgemeinschaft zu bilden, „damit man in wichtigen Fragen zu gemeinsamen Beschlüssen kommt“347 – ebenso wie mit den Landfrauen und den konfessionellen Verbänden. Anna Mosolf hatte zu bedenken gegeben, daß einige Verbände sich ja gar nicht anschließen könnten, weil sie, wie das DRK, das den zuvor teilautonomen ‚Vaterländischen Frauenverein‘ organisatorisch reintegriert und zur ‚Frauensektion‘ gemacht hatte, auch über männliche Mitglieder verfügten. Dies wertete die Women’s Affairs Section in Niedersachsen als einen Versuch Mosolfs, sich der Realität zu verweigern.348 Ein Erfolg, wie ihn sich die CCG (BE) vorgestellt hatte, war die Gründung des DFR also nicht – wobei man hier, wie bereits ausgeführt, zwischen den frühen Überlegungen von Mitarbeiterinnen aus der Education Branch, namentlich Jeanne Gemmels und Joy Evans, und den später dominierenden Erwartungen aus der Political Division, die Rita Ostermann gemeinsam mit dem Führungsstab im Foreign Office setzte, unterscheiden muß. Vor allem die größeren Verbände, die sich dem DFR nicht korporativ anschlossen, verwiesen zur Begründung ihrer ablehnenden Entscheidung auf ihre längere Tradition, ihre größere Mitgliederzahl und ihren höheren Organisationsgrad.349 Der ‚Staatsbürgerinnenverband‘ und der ‚Berliner Frauenbund‘ hielten, die – hier griff ohnehin schon eine Sonderregelung für Berlin – im Rahmen der Gründung des DFR beide den Status von DFR-Landesringen angenommen hatten, im Gegensatz zu allen anderen Landesringen, zumindest an ihrem Namen fest. Damit wollten deren Leiterinnen Else Ulich-Beil und Agnes von Zahn-Harnack ein gewisses Maß an eigenständiger Tradition und Selbstbewußtsein demonstrieren – was ‚Newcomer‘ Bähnisch nicht in Frage zu stellen wagte. Für ihr ‚Projekt DFR‘ bedeutete es wiederum eine Auszeichnung, solche Traditionen überhaupt integrieren zu können. Neben den Namen Ulich-Beil und Zahn-Harnack stand auch der Name ‚Staatsbürgerinnenverband‘ für eine lange Tradition der Vertretung weiblicher Interessen in der Gesellschaft. Was den DEF betrifft, so läßt sich aus verbandsinternen Korrespondenzen herauslesen, daß er dem Frauenring skeptisch gegenüberstand. Zu einer möglichen Ko-
346 Adenauer, Konrad, an Franken, Anne, 24. Mai 1947, Dokument Nr. 552, in: Morsey, Rudolf (Hrsg.): Adenauer Briefe 1947–1949, Paderborn 1984, S. 505. 347 DFR-Archiv, Freiburg, A2, Bähnisch an Zahn-Harnack, 08.09.1949. 348 NA, UK, FO 1050/1230, Land Niedersachsen, Comments on Bad Pyrmont Frauenkongress, October 1949. 349 NA, UK, FO 1050/1230, Land Niedersachsen, Comments on Bad Pyrmont Frauenkongress, October 1949.
944 | Theanolte Bähnisch
operation hatte er sich sehr verhalten geäußert350, was auch mit der Tatsache zusammengehangen haben kann, daß dem DFR eine Sozialdemokratin vorsaß. Von einem ähnlichen Motiv wird der gar nicht erst in Pyrmont erschienene KDFB geleitet worden sein. Auch der Umstand, daß Bähnisch in ihrer Arbeit eher die Nähe bekennender und bekannter Protestanten wie Hanns Lilje, Adolf Grimme, Friedrich SiegmundSchultze sowie des Ministers Albertz suchte und sich in die Arbeit der Evangelischen Akademien einbrachte, dürfte eine Rolle für die Distanz gespielt haben, die der KDFB gegenüber dem DFR wahrte. Knüpft man an die Aussage Thomas Nipperdeys an, daß Hausfrauenvereine Arbeitgeberfunktionen wahrgenommen und damit am Rande der Bewegung gestanden hätten, mit der sie „eigentlich nichts Wirkliches zu tun gehabt“351 hätten, so ließe sich auch sagen, daß mit der Nichtintegration von Fini Pfannes und ihrem Hausfrauenverband in den Frauenring aus der Sicht einiger Vorkämpferinnen der bürgerlichen Frauenbewegung ein vielleicht längst überfälliger Schluß endgültig gezogen wurde. Doch Pfannes war nach Kriegsende durchaus mit dezidierten politischen Forderungen angetreten. Zahn-Harnack, die die Flügelkämpfe im BDF kannte, fand es jedenfalls „sehr bedauerlich“, daß die Hausfrauen „nicht einfach beigetreten“ sind, „weil es den Ring zwingt, einen Teil der Aufgaben zu übernehmen, den man anderenfalls den Hausfrauen hätte überlassen können.“ Sie hoffte deshalb, daß „das letzte Wort noch nicht gesprochen“352 sei. Dies mag auch damit zusammengehangen haben, daß Pfannes in der überparteilichen Frauenbewegung in Hessen allgemein eine wichtige Rolle spielte und – obwohl die Zusammenarbeit mit ihr wohl nicht immer einfach war – das Vertrauen vieler Frauen besaß, die im ‚Hessischen Frauenverband‘ organisiert waren.353 Mit allen Verbänden, die erschienen waren, sich aber nicht korporativ anschließen wollten, wurde auf dem Kongreß jene, von Bähnisch im Brief gegenüber ZahnHarnack354 beschriebene Arbeitsgemeinschaft gegründet. Die ‚Frauensektion des DRK‘355, die Landfrauen – die diesmal nicht von der Leiterin Gräfin Leutrum, sondern von einer Frau Kühne vertreten wurden – sowie der DEF, der von Vikarin
350 Zur ersten Tagung in Pyrmont, im Jahr 1947, wollte der DEF nicht kommen, da er „als ein konfessioneller Verband nicht zu den Verbänden gehört, die nach der Einladung für den beabsichtigten Zusammenschluß in Frage kommen“. Stadtarchiv Hannover, DEF, G 2t I u II, Deutsch-Evangelischer Frauenbund an Bähnisch, 03.06.1947. Auch aus einer Notiz des DEF Hannover geht hervor, daß der Verband seine Mitglieder und Ortsvereine angewiesen habe, sich nicht der überparteilichen Frauen-Organisation anzuschließen. Stadtarchiv Hannover, DEF, G 2t I u II. 351 Nipperdey: Geschichte, Bd. 2/1, S. 89. 352 DFR-Archiv, A2, Agnes von Zahn-Harnack an Bähnisch, 03.11.1949. 353 DFR-Archiv A2, Nora Melle an Bähnisch, 04.09.1949. Pfannes zog sich aus der Arbeit des Hessischen Frauen-Verbandes schließlich zurück, konzentrierte sich ganz auf den Hausfrauenverband und überließ das Feld im ‚hessischen‘ der Vertrauten Bähnischs, Gabriele Strecker. Vgl.: Schüller/Wolff: Pfannes. 354 DFR-Archiv, A2, Bähnisch an Zahn-Harnack, 08.09.1949. 355 Für diese war anstelle von Gräfin Waldersee Frau Danehl erschienen.
Wachsende Prominenz | 945
Daasch, einer der Mitbegründerinnen des ‚Club deutscher Frauen‘, repräsentiert wurde, beteiligten sich daran.356 Die ‚Arbeitsgemeinschaft deutscher Lehrerinnen‘ begründete, da sie nur in Niedersachsen vertreten war, eine AG mit dem niedersächsischen Landesring des DFR, während sich der Verband christlicher Akademikerinnen dem niedersächsischen Landesring des DFR sogar korporativ anschloss.357 Dies wird mit der herausgehobenen Funktion Anna Mosolfs, die später die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) mitbegründen sollte, in Zusammenhang gestanden haben. Bähnisch zufolge wechselte der Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft auf Bundesebene, die ihre Organisationsform erst 1952 endgültig festlegte, jährlich.358 Was Bähnisch als ‚Club deutscher Frauen‘ bereits 1946/47 in Hannover auf regionaler Ebene in die Wege geleitete hatte, bestätigte sich also auf der zweiten Konferenz von Bad Pyrmont für die Bundes- bzw. für die Landesebene – allerdings in einem sehr viel kleineren Umfang. Schließlich waren in der Hannoveraner Arbeitsgemeinschaft sehr viele, sehr verschiedene Frauenzusammenschlüsse, auch kommunistisch orientierte, vertreten gewesen. Obwohl der DFR 1951 bereits 50.000 Mitglieder gehabt habe, sei es ihm, so Tscharntke, nicht gelungen, einen Großteil der deutschen Frauen unter seinem Dach zu vereinigen.359 Doch hinterfragen Autoren, die diesen Umstand als ‚Mißstand‘ interpretieren, nicht, inwiefern dies überhaupt das erklärte Ziel seiner Initiatorin und der Mitbegründerinnen war. In ihrem Rückblick auf die Gründung des DFR in Pyrmont zeigt Bähnisch kein Bedauern darüber, daß nicht eine größere Zahl von Frauenverbänden unter das Dach des DFR geklettert war. Erinnert man sich an ihre Presseerklärung zur ersten Konferenz von Pyrmont, auf der der ‚Frauenring der britischen Zone‘ gegründet worden war, so liegt sogar der Verdacht nah, daß die Entwicklungen auf der zweiten Konferenz von Pyrmont in ihrem Interesse waren. Schließlich hatte sie über die Gründung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ rückblickend gesagt und geschrieben, daß es ihr Ziel gewesen sei, nur die staatsbürgerlich bildenden, interkonfessionell und überparteilich arbeitenden Verbände zusammenzuschließen – was sich auch im vorab verbreiteten Tagungsprogramm abgezeichnet hatte. Für ‚Pyrmont II‘ hatte Bähnisch etwas weicher formuliert und am 08.09.1949 an ZahnHarnack wie auch an Rita Ostermann geschrieben, daß auf der zweiten Konferenz von Pyrmont ein „Zusammenschluß der in erster Linie staatsbürgerlich arbeitenden überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen zum Deutschen Frauenring“360 stattfinden solle und daß man unter Federführung des DFR eine Arbeitsgemeinschaft mit anderen Verbänden bilden wolle. Von der Gründung einer großen Dachorganisation war in diesen Briefen nicht die Rede.361 Folgt man jener
356 357 358 359 360 361
Vgl.: Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 2. Vgl.: ebd., S. 2–4. Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 176. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 185. Vgl. Ebd. NA, UK, FO 1049/1846, Bähnisch an Rita Ostermann, 08.09.1949. Ostermann hatte in ihrer Antwort an Bähnisch das von der Regierungspräsidentin geplante Vorgehen nicht in Frage gestellt. Ebd., Ostermann an Bähnisch, 24.09.1949.
946 | Theanolte Bähnisch
Logik, so stellt sich allerdings die Frage, wo der besondere, staatsbürgerlich bildende Aspekt in der Arbeit des ‚Reichsbundes der Kriegs- und Zivilgeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen‘, des ‚Deutschen Frauenverbandes für alkoholfreie Kultur‘ und der ‚GEDOK‘, die sich dem DFR korporativ angeschlossen hatten, zu sehen ist. Bähnischs Ansprache zum zweiten Kongreß von Pyrmont läßt die Interpretation zu, daß sich ihre Ziele in Bezug auf einen Zusammenschluß kurz vor der Konferenz noch einmal verändert hatten. Im Manuskript zu ihrer Rede über ‚Sinn und Aufgaben des Deutschen Frauenrings‘ benannte sie als „Zweck der Vereinigung […] die Vertretung aller Fraueninteressen und die Durchführung gemeinsamer Aufgaben.“ Man habe eine „sehr breite Plattform geschaffen für Frauen jeder Art und jeder Richtung“. Nur eines müsse den Frauen gemeinsam sein: „das tiefe Durchdrungensein von der Idee der Frauenbewegung“362. Hatte die Hauptrednerin also doch darauf gesetzt, einen größeren Zusammenschluß erreichen zu können, und dann feststellen müssen, daß die Verbände, die in Frage kamen, gar nicht dazu bereit waren, sich dem DFR anzuschließen, weshalb sie ihre schon geschriebene Rede gar nicht so wie ursprünglich geplant vortrug? Das im DFR-Archiv überlieferte Manuskript trägt das Datum des Vortrags, also den 09.09.1949. Wann es entstanden ist, läßt sich nicht klären. Möglich ist auch, daß die Ausführungen im Manuskript, vielleicht in Reaktion auf eine – allerdings nicht belegbare Antwort – Ostermanns auf Bähnischs Schreiben vom 08.09.1949 stärker von den Erwartungen der Militärregierung als von Bähnischs Überzeugungen geprägt waren. Denn 1949 sollte es nach dem Willen der Briten – was jetzt hieß Rita Ostermanns, Brian Robertsons, Lord Pakenhams und führender Mitarbeiter der ‚German Section‘ des Foreign Office – nicht mehr nur, wie noch in Pyrmont 1947, darum gehen, regionalen Organisationen, die sich die staatsbürgerliche Bildung auf die Fahne geschrieben hatten, eine zonenweite Führung und eine einheitliche Orientierung zu geben. Nachdem die Verantwortlichen in der CCG (BE) und im Foreign Office an die Eignung des DFR als ‚Erzieher‘ zur Demokratie kaum mehr glaubten, hofften sie gemeinsam mit dem ICW, daß die Organisation Bähnischs eine neue Kernaufgabe lösen würde: als eine Großorganisation sollte er, ähnlich wie der BDF in den Jahren 1894 bis 1933, also durch Masse beeindrucken und Deutschland auf internationaler Ebene als einen ‚westlichen‘ Staat repräsentieren. Dazu war es sinnvoll, so viele Verbände wie möglich zusammen zu schließen, wofür es wiederum unerläßlich war, die Vielfalt der Schwerpunktsetzungen verschiedener Verbände zu integrieren und sich eben nicht auf die staatsbürgerliche Bildung als MußKriterium zu konzentrieren. Ob der vom Unbehagen gegenüber den ‚Massen‘ geprägten Bähnisch jene Idee behagte, war für die Militärregierung, die unter starkem Handlungsdruck stand, vermutlich unerheblich und die designierte Vorsitzende wird, auch vor dem Hintergrund der Aussicht, auf dem internationalen Parkett zukünftig eine noch stärkere Rolle spielen zu können, zumindest eine theoretische Einsicht in die Notwendigkeit, eine Großorganisation zu gründen, gehabt haben.
362 DFR Archiv, Freiburg, A 1, Bähnisch, Theanolte: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, Bad Pyrmont, 09.10.1949, S. 4.
Wachsende Prominenz | 947
Bähnischs Manuskript zufolge war von Seiten des DFR keine Rede mehr von der ‚staatsbürgerlichen Frauenbildung‘ als notwendiger gemeinsamer Arbeitsgrundlage, sondern ‚alle Fraueninteressen‘ sollten im Frauenring vereinigt und vertreten werden. Ist dies nun als eine Absage der Regierungspräsidentin an die Regeln zu verstehen, nach denen 1947 auf der ersten Konferenz von Pyrmont gespielt worden war und die sie Zahn-Harnack noch im September 1949 unterbreitet hatte? Eine Absage, die zu spät kam für die Verbände, die bis dahin eine stabile Struktur und eigene Netzwerke ausgebildet hatten und den Frauenring als eine ‚breite Plattform‘, anders als dies noch 1947 der Fall gewesen wäre, nicht mehr brauchten? Zumal sie, nach den Erfahrungen von Pyrmont 1947 davon ausgegangen waren, daß die Regierungspräsidentin an einer korporativen Integration aller Verbände in den DFR gar nicht interessiert war? Theanolte Bähnisch hielt ihren Vortrag erst am Tag nach der Gründung des DFR, als bereits klar war, welche Verbände sich der Organisation korporativ anschließen würden und welche nicht. Sie hätte ihren Vortrag also noch verändern können. Ob er so gehalten wurde, wie er in jener Abschrift überliefert ist, oder nicht, bleibt eine offene Frage.363 In Gabriele Streckers Erinnerungen wird der DFR jedenfalls als ein „großer Dachverband“ bezeichnet und beschrieben, wobei die sehr ungewöhnliche Kombination aus Einzelmitgliedschaften und korporativen Anschlüssen ins Auge fällt: „Unten, an der Basis, ist es der Ortsring, die Landesverbände sind im Deutschen Frauenring zusammengeschlossen, dem wiederum ist angeschlossen etwa ein Dutzend anderer, selbständiger Verbände, ihm so den Charakter eines Dachverbandes verleihend. Das ganze ist dem Internationalen Frauenrat [ICW] und der Internationalen Frauen-Allianz [IAW] auf internationaler Ebene angegliedert.“364 Gleichzeitig beschrieb Strecker die Verflechtung des DFR „mit den inzwischen institutionalisierten, von der Bundesregierung geförderten Einrichtungen wie dem Deutschen Frauenrat, dem Zusammenschluß der wichtigsten Deutschen Frauenverbände.“365 Jene Beschreibung gibt nicht den ‚Status Quo‘ des DFR 1949 wieder, sondern zeigt – 1970 geschrieben – eine Entwicklung auf, die den DFR schließlich in seine Schranken wies. Denn der Verband mußte den von ihm nur ansatzweise erreichten Rang einer ‚Dachorganisation deutscher Frauenverbände‘ an den ‚Informationsdienst für Frauenfragen/Deutscher Frauenrat‘ abtreten, der sich erst 1951, mit starker Unterstützung der US-Amerikaner in Deutschland etablierte. Seine Arbeit war wesentlich auf die Informationsvermittlung für und zwischen verschiedenen Frauenverbänden sowie auf die Vermittlung der Arbeit dieser Verbände nach außen ausgerichtet. Ob Bähnisch vor diesem Hintergrund in ihrer Wahrnehmung mit dem DFR ‚gescheitert‘ war, ob also die Amtsniederlegung nahezu der gesamten ersten Führungsriege des DFR im Jahr 1952 auch als ein Zeichen von Resignation zu werten ist, läßt
363 Das Protokoll des öffentlichen Konferenztages liefert immerhin einen Hinweis auf die Überlieferung der Rede Bähnischs. Diese sei „unseren Landesverbänden und allen befreundeten Frauenorganisationen bereits zugegangen, sodass er hier nicht noch einmal referiert werden braucht“. Ebd., S. 7. 364 Strecker: Überleben, S. 66. 365 Ebd., S. 67.
948 | Theanolte Bähnisch
sich aus den ausgewerteten Quellen nicht beantworten. Zumindest sind diese Zusammenhänge sehr differenziert zu betrachten, denn wie im Folgenden deutlich werden wird, konnte Bähnisch auf den ‚Informationsdienst‘ einen beachtlichen Einfluß ausüben. In ihrer Rede zum zehnjährigen Bestehen des DFR sagte sie, sie sei „mit Rücksicht“366 auf ihre berufliche Arbeit zurückgetreten – was auch bedeutete, daß ihre Stellung als Regierungspräsidentin gesichert schien und sie gut daran tat, an ihr festzuhalten, nachdem aus der Arbeit in der Frauenbewegung keine vergleichsweise lukrative Tätigkeit resultiert war. Eine Reihe anderer, von Bähnisch nicht genannter Gründe dürfte ebenfalls eine Rolle gespielt haben, darauf wird jedoch an entsprechender Stelle zurückzukommen sein. Wie man den erfolgten Zusammenschluß am Ende auch wertet: in verschiedener Hinsicht manifestierte sich auf der Tagung in Pyrmont der Umstand, daß die neuen oder wiedergegründeten Frauenverbände in Deutschland in den wenigen Jahren ihrer Existenz zu einem neuen Selbstbewußtsein gefunden hatten und sich nicht ohne Weiteres den Prämissen des DFR – und damit auch nicht der britischen Militärregierung unterwerfen wollten. Partikularinteressen – als Ausdruck einer differenzierten Gesellschaft – zeichneten sich auch im vermeintlich geschlossenen, gemäßigten, bürgerlichen Lager immer stärker ab. Gleichzeitig gab die Konferenz aufgrund der Anwesenheit einflußreicher Frauen und mitgliederstarker Verbände aber auch einen Eindruck von dem Potential, mit dem sich die Regierungspräsidentin umgeben konnte. Waren nur einige Verbände bereit, unter dem Dach des DFR zu arbeiten, so waren sie doch alle auf Bähnischs Einladung hin erschienen und grundsätzlich an einer Kooperation interessiert. Den Leiterinnen der großen Frauenorganisationen war klar, daß ‚Pyrmont‘ auch 1949 wieder im Licht der Aufmerksamkeit stand und daß Bähnisch das Vertrauen der anwesenden Ausländerinnen besaß. Also nutzten sie die Bühne, die die Regierungspräsidentin ihnen in Kooperation mit den Briten geschaffen hatte, um Präsenz und guten Willen, gleichzeitig aber auch Selbständigkeit zu demonstrieren. Von einem Mißerfolg der Konferenz von Pyrmont, die schließlich weitgehend Bähnischs Werk war, zu sprechen, wäre also verfehlt. 8.3.7 Die Reaktionen ausländischer Gäste auf ‚Pyrmont II‘ Die Anwesenheit prominenter Frauen aus dem Ausland war Ausdruck der hohen Motivation Bähnischs und anderer Frauen im DFR, den (Wieder-)Anschluß an die Internationale Frauenbewegung zu finden. Gleichzeitig bewies sie den Widerhall, den diese Motivation im Ausland fand. Bähnisch hatte Einladungen in alle (westlichen) Winde verschickt und verschicken lassen, und die Eingeladenen waren erschienen. Stargast der Konferenz war die bereits mehrfach erwähnte Dr. Eder-Schwyzer, die Präsidentin des ICW. Diesem gehörten, laut Protokoll der Veranstaltung, zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Verbände in Afrika, fünf in Südamerika, sechs in Asien, zwei in Nordamerika und Kanada und zwölf in Europa an. Daß „Verbände aus den Balkanstaaten“ vorübergehend ihre Arbeit einstellen mußten, wurde im Protokoll er-
366 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 162.
Wachsende Prominenz | 949
wähnt, aber nicht näher kommentiert, zumal jeder Leser gewußt haben dürfte, daß hiermit auf kommunistische Politik als Auslöser angespielt wurde. Mit Hanna Rydh, der Präsidentin der IAW war sogar die politisch weiter linksstehende, international tätige Frauen-Organisation, die drei ihrer führenden Mitglieder als Holocaust-Opfer zu beklagen hatte367, auf der Konferenz präsent. Neben den Präsidentinnen der internationalen Organisationen waren verschiedene Vorsitzende der Nationalen Räte des ICW erschienen: Mrs. Wakefield, die neue Präsidentin des British National Council, begleitet vom Council-Mitglied Mrs. Thiselton-Folkestone368, Dr. Grete Laube369, die Vorsitzende des Bundes Österreichischer Frauenvereine (BÖF), welche laut Protokoll in Pyrmont „die grossen Fähigkeiten des deutschen Volkes“370 lobte, Dr. Renée Girod vom Bund schweizerischer Frauenvereine, Brita Juhlin-Danfelt, die Präsidentin des Schwedischen Frauenrates, Frau v. Helweg-Larsen, die Präsidentin des dänischen Rates und die noch vergleichsweise junge, 1904 geborene Pädagogin Helga Stene vom norwegischen Frauenrat, die für ihre Widerstands-Arbeit während der Besetzung Norwegens durch die Nationalsozialisten mit dem ‚Ella Victoria Dobbs-Preis‘ geehrt worden war.371 Außerdem waren anwesend: Mrs. Horton als Vertreterin der Towns Women‘s Guilds, die Journalistin und Vorsitzende der Business & Professional Women’s Clubs in Großbritannien, Phyllis Deakin, eine namentlich nicht näher bezeichnete holländische Journalistin und Mademoiselle Verkampm als Vertreterin der ‚Mouvements Mondiales des Meres‘ (MMM). Frances Woodsmall, die Senior-Frauenreferentin der Amerikaner, sowie Mme. Carrez, die Betreuerin der Frauenarbeit in der ehemaligen französischen Besatzungszone war ebenfalls vor Ort. Rita Ostermann hatte Bähnisch als Vertreterin der britischen Frauenarbeit bereits im Vorfeld der Konferenz mitgeteilt, daß Joy Evans und die zu dieser Zeit in Berlin stationierte Ursula Lee – im Andenken an die erste Konferenz und den langen Weg, den der Frauenring seit diesen frühen Tagen zurückgelegt habe – sehr froh über die Einladung zur zweiten Konferenz von Pyrmont gewesen seien.372 Senior Women’s Affairs Officer Ostermann hatte ihr übriges dazu getan, daß jenes große Aufgebot in Pyrmont zustande gekommen war. So hatte sie beispielsweise die Konferenz bei einer in Deutschland lebenden britischen Journalistin als „quite an occasion“373 beworben und sie, wohl in der Hoffnung auf gute Presse, gebeten, dort hin zu kommen.
367 Vgl.: Ulich-Beil: Weg, S. 225. 368 NA, UK, FO 1049/1847, Report on recent women’s conferences Bad Pyrmont and Fürth, Rita Ostermann, 07.07.1949, Appendix C, Representatives at Frauenring Kongress. 369 Im Protokoll wird sie fälschlicherweise als „Frau dr. von Laube“ bezeichnet. Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 11. 370 Ebd. 371 Vgl.: Art.: „Helga Stene“, in: Store Norske Leksikon, online auf: utdypning, Norsk Biografik Leksikon, Store Norske Leksikon, http://snl.no/.nbl_biografi/Helga_Stene/utdyp ning, am 13.12.2013. 372 NA, UK, FO 1049/1846, Rita Ostermann, Political Division an Bähnisch, 23.09.1949. 373 NA, UK, FO 1049/1848, Rita Ostermann, Political Division an Mrs. J. Freeman, 24.09.1949.
950 | Theanolte Bähnisch
Alle 14 ausländischen Frauen, die auf der Konferenz zu Wort kamen, begrüßten dem Protokoll nach die Gründung des DFR und den Wiederanschluß der deutschen Frauen an die internationale Frauenbewegung herzlich. Die „Spannungen“374, welche sich auf dem Weg zum DFR aufgetan hatten, wurden offenbar lediglich von der Französin Mme. Carrez thematisiert. Zu den Hoffnungen, die Jeanne Gemmel, Joy Evans und Helena Deneke in den Frauenring gesetzt hatten, läßt sich konstatieren: Das britische Modell der WGPW, das die Education Branch und Deneke Bähnisch zur Orientierung angeboten hatten, spiegelte sich mitnichten in jenem Maß, wie die Ausführungen Zieglers nahelegen, im deutschen DFR. Zum einen kann – betrachtet man die Genese des DFR – nicht von einem „demokratische[n] Aufbau von der lokalen Basis“375 aus die Rede sein. Zum anderen waren in der WGPW viele verschiedene Frauenorganisationen vertreten, wohingegen der DFR als ein ‚Dach ohne Haus‘ dazustehen drohte. Die WGPW erreichte in Großbritannien die Hausfrauen, eine Gruppe, um die sich Bähnisch Helena Deneke zufolge einfach nicht ausreichend kümmerte. Der Vorsitzenden sei es anzulasten, hatte sich Deneke einmal zu einer sonst ungekannten Deutlichkeit verstiegen, daß die Hausfrauen nicht in Bähnischs Organisation mitarbeiten wollten. „She […] was […] not interested in the actual Hausfrau herself“376, schrieb Deneke über die von ihr sonst so hochgelobte Bähnisch. „Others who preferred to lead than to be lead by Frau Bähnisch, addressed themselves especially to the Hausfrau […] they made an organisation of their own“, spielte Deneke auf Pfannes und ihren Hausfrauen-Bund an. “In this way the Club was largely cut off from the kind of membership on which it might mainly have flourished“377, hatte sie ihre Enttäuschung darüber zusammengefaßt, daß Bähnischs Organisation ihr Klientel nicht wesentlich aus dem Kreis der Hausfrauen rekrutierte. In Denekes Wahrnehmung hatte Bähnisch damit eine wichtige Gruppe, die ihrem Verband Rückhalt hätte geben können, nicht erreicht.378 Weil lediglich Mitglieder-Zahlen des DFR379, jedoch keine Statistiken zu
374 Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 12. 375 Ziegler: Lernziel, S. 96. 376 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, The Women of Germany, S. 3, zitiert nach Tscharntke: Re-educating, S. 186. 377 Ebd. 378 Denise Tscharntke schreibt, daß Deneke zu einem frühen Zeitpunkt realisiert habe, daß Bähnischs Wille zur Dominanz über andere Frauenorganisationen ein Problem sei. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 186. Doch beobachtete Deneke die Arbeit Bähnischs schon im vierten Jahr, als sie zu jener Deutung fand, weshalb von einer ‚frühen Erkenntnis‘ kaum gesprochen werden kann. Zum anderen ist den Ausführungen Denekes kaum ein kritisches Wort über jene ‚Dominanz‘ zu entnehmen, im Gegenteil: Deneke hatte Bähnisch im Lauf der Zeit zunehmend in die Hände gespielt und ihr geholfen, ihren Einflußspielraum zu vergrößern. Tscharntke zufolge hatte sich Deneke jedoch gewundert, daß Bähnisch, trotz ihrer juristischen Ausbildung, keine Sensibilität für die Einhaltung von demokratischen Regeln zur Zusammenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände in Hannover besessen hatte. Vgl.: ebd.
Wachsende Prominenz | 951
den im DFR vertretenen Berufsgruppen überliefert sind, ist es allerdings schwer nachzuvollziehen, ob Deneke mit dieser Aussage richtig lag. Die Existenz des Hausfrauen-Verbandes, der bereits vor der Konferenz von Pyrmont seinerseits eine trizonale Konferenz abgehalten hatte380, ist noch kein hinlänglicher Beweis dafür, daß dem DFR nur wenige Hausfrauen angehörten. Wahrscheinlich ist aber, daß sich die Juristin tatsächlich nicht über Gebühr bemüht hatte, Hausfrauen anzusprechen, da sie ihre Wunsch-Klientel, wie erwähnt – in der Tradition der Soroptimistinnen – eher in den berufstätigen Frauen, vor allem in den Akademikerinnen sah. Die Vertreterinnen der britischen Militärregierung, die auf der Konferenz zugegen waren, bewerteten die Konferenz sehr unterschiedlich. Als erfreulich bezeichnete die Verfasserin des Berichts der Women’s Affairs Section Hannover, daß auf der Tagung, anders als 1947 am gleichen Ort, auch viele Schülerinnen und Studentinnen vertreten waren. Dies war vermutlich auf das Engagement Mosolfs zurückzuführen, die offenbar dafür gesorgt hatte, daß eine große Gruppe Schülerinnen aus der Sekundarstufe einer Hannoveraner Schule zur Konferenz angereist war.381 Andere junge Frauen waren kaum präsent. Als unerfreulich wertete die Hannoveraner Section, daß, wie zu erwarten, auch auf der zweiten Konferenz von Pyrmont Arbeiterinnen deutlich in der Minderheit waren. Wie bei anderen von Bähnisch maßgeblich (mit)gestalteten Tagungen wurden von verschiedenen regionalen Women’s Affairs Sections auch Organisation, Ablauf und Leitung der Tagung ‚Pyrmont II‘ kritisiert.382 Das Protokoll der Section in Niedersachsen hob hervor, daß die anwesenden Delegierten von deutschen Frauenverbänden nicht von ihren örtlichen Gruppen gewählt worden waren, sondern daß es sich um „autocratically appointed representatives“ – meist die Leiterinnen der Verbände – gehandelt habe. Die Militärregierung habe es womöglich versäumt, im Vorfeld entsprechende Hinweise zu geben, räumte man ein Versäumnis von der eigenen Seite ein.383 Eher beschwichtigende Worte fand die Section des Landes Nordrhein-Westfalen. Man wies darauf hin, daß man wohl einiges an destruktiver Kritik äußern könnte, daß die aufgetretenen Probleme jedoch auf die Unerfahrenheit der verantwortlichen deutschen Frauen zurückzuführen seien. Es sei doch begrüßenswert, heißt es im Bericht,
379 Nori Möding zufolge hatte der DFR 1951 ca. 50.000 Mitglieder. Vgl.: Möding: Stunde, S. 624. 380 Vom 16. bis 18.06.1949 hatte eine trizonale Konferenz der Hausfrauen-Verbände in Eutin stattgefunden. Maria Prejawa hatte, wohl als Beobachterin, an dieser Veranstaltung teilgenommen. NA, UK, FO 1049/1846, Minutes of the Tri-Zonal Conference held by the Housewives‘ Unions at Eutin from June 16th–18th, 1949, S. 2. 381 „[N]early all the girls were from one secondary school Hanover“, merkt die Protokollantin der Womens Affairs Section in Hannover an. NA, UK, FO 1050/1230, Land Niedersachsen, Deutscher Frauenkongress, Bad Pyrmont, 7th–10th Oct. 1949. 382 NA, UK, FO 1050/1230, Land Niedersachsen, Deutscher Frauenkongress, Bad Pyrmont, 7th–10th Oct. 1949,; ebd., Land Schleswig-Holstein, Impressions of Women’s Congress at Bay Pyrmont, October 7th to 10th, 1949; ebd., Hansestadt Hamburg, The Frauenring Conference of Bad Pyrmont, 19.10.1949. 383 Ebd.
952 | Theanolte Bähnisch
daß die erfolgreiche Durchführung eines solchen Kongresses, nur einen Monat nach der Gründung der Bundesrepublik, überhaupt möglich gewesen sei. Die Regierungspräsidentin habe nicht nur den besten Vortrag geliefert, sondern sie sei überhaupt die hervorstechendste Persönlichkeit und der „moving spirit“384 dieser Entwicklungen. Sie genieße die Unterstützung von vielen wohlüberlegt handelnden, ernsthaften, hochherzigen und fähigen Frauen. Außerdem sei der Kongreß frei von Emotionshascherei („cheap emotionalism“ 385) geblieben. Auch die Section aus Schleswig-Holstein hatte insgesamt eher positive Eindrücke mit nach Hause nehmen können: „The general impression left by the conference was that there are lively, intelligent and competent women in the Women’s Movement“. Ihr Bericht betonte jedoch die große Gefahr, der in der überstürzten Entwicklung des Zusammenschlusses liege: „the whole movement suffers from the Zeitgeist – the sense that time is rushing on and does not permit a slow organic growth. Without that slow firm building of foundation in local group work […] the democratization […] of German women’s organizations will fail“386. Nicht alle Offiziere teilten also die Meinung der führenden Kräfte im Militär, daß ein schneller Zusammenschluß zu einem großen Verband ohne Rücksicht auf dessen Demokratiefähigkeit der richtige Weg sei. Allerdings standen, das zeigen die Berichte ebenfalls, 1949 auch nicht alle Mitarbeiter der Militärregierung der Demokratiefähigkeit des DFR so skeptisch gegenüber, wie dies der Bericht ‚Political Developments leading to Bad Pyrmont Conference‘ glauben macht. Im Monatsbericht der Women’s Affairs Section Berlin wurden die Fortschritte betont, die die Frauen in der Gestaltung von Tagungen gemacht hatten. „[S]peeches were shorter and to the point, and less well-known and younger persons took part than in previous years. The students‘ discussion group showed promise for the future“387, konstatierten die Berlinerinnen, die scheinbar auch 1949 noch der Hoffnung anhingen, daß sich der DFR zu einem ‘jüngeren‘ Verband entwickeln würde. Außerdem schien sich in der Berliner Women’s Affairs Section der Eindruck, daß der DFR eine gute Figur in internationalen Zusammenhängen mache, durchgesetzt zu haben: „There was obviously a better international feeling which was shown by the various nations accepting invitations“388, argumentierte Mrs. Conrad Lee. Auf der anderen Seite thematisierte sie jedoch die Enttäuschung darüber, daß in Pyrmont kein fertiges Programm beschlossen worden sei, und verwies auf die Kritik anderer Beobachterinnen, die, wie die Berlinerinnen, befürchteten, daß eine vorgehaltene Fassade über den
384 NA, UK, FO 1050/1230, Land North Rhine/Westphalia, Deutscher Frauenkongress Bad Pyrmont, 7. bis 10.10.1949. 385 Ebd. 386 NA, UK, FO 1050/1230, Land Schleswig-Holstein, Impressions of Women’s Congress at Bad Pyrmont, October 7th to 10th, 1949. 387 NA, UK, FO 1050/1215, Mrs. Conrad Lee, Women’s Affairs Berlin an Education Branch, HQ Military Government, British Troops, Berlin, 26.10.1949. 388 Ebd.
Wachsende Prominenz | 953
tatsächlichen Charakter einer im Grunde undemokratischen und überhastet zusammengewürfelten Organisation hinwegtäuschen könne.389 Die Hamburgerinnen verspürten über den ‚Zusammenschluß‘ insgesamt Enttäuschung, die sie, wenn man dem Bericht Glauben schenken darf, sogar mit der Leiterin des Hamburger Frauenrings, Frau Walner von Deuten, teilten. Die Berichterstatterin sah jedoch einen positiven Aspekt darin, daß der DFR nicht die Funktion einer ‚Joint Standing Conference‘ – wie die WGPW eine war – übernommen hatte, sondern daß er sich mehr am Aufbau des ‚National Council of Women‘, der ebenfalls sowohl individuelle Mitgliedschaften als auch korporative Anschlüsse ermöglichte, orientierte. Individuelle Mitgliedschaften waren bei einem solchen Zuschnitt ebenso wie die Aufnahme ganzer Organisationen möglich. Dies passe vielleicht am besten zu den lokalen Gegebenheiten390, konstatierte die Women‘s Affairs Section in Hamburg. Der bereits zitierte Bericht über die politischen Entwicklungen, die zum Kongreß von Pyrmont 1949 geführt hatten391, bezeichnete im Gegensatz dazu die ungeklärte Form möglicher Mitgliedschaften als einen Fehler in der Verfassung des DFR, der zu einem ernsthaften Defekt geführt habe. Die Kolleginnen aus Nordrhein-Westfalen konnten der Entwicklung des Frauenrings etwas Gutes abgewinnen, versprühten aber gleichzeitig einen Funken Resignation: „it would probably be unwise at this point to try too strongly to deflect them. Better that way than no progress at all“392. 8.3.8 ‚Sinn und Aufgaben des Deutschen Frauenrings‘ – Bähnischs Rede auf dem Gründungskongreß des DFR 8.3.8.1 Rechte, Pflichten und Chancen dreier Frauengenerationen: Von angeleiteter Sublimation über doppelte Rollen bis zur Umgestaltung der Welt Wenn man davon ausgeht, daß das Manuskript zum Vortrag ‚Sinn und Aufgaben des Frauenrings‘ mit dem von Bähnisch gehaltenen Vortrag identisch ist, so verkündete die Vorsitzende in ihrer Rede auf dem Frauenkongreß in Pyrmont, daß die ‚Idee der Frauenbewegung‘ die gemeinsame Grundlage für die Arbeit im DFR sei. Durch eine Literaturempfehlung, die sie direkt daran anschließend machte, schränkte sie die für sich genommen universalistische Aussage jedoch auf eine entscheidende Weise ein: Sie empfahl insbesondere den jungen Zuhörerinnen Agnes von Zahn-Harnacks Werk
389 Ebd. 390 NA, UK, FO 1050/1230, Hansestadt Hamburg, The Frauenring Conference of Bad Pyrmont, 19.10.1949. 391 Der Entwurf in der Akte NA, UK, FO 1050/1230 ist nicht namentlich unterzeichnet. Seine Verbreitung erfuhr er durch Rita Ostermann. Ebd, Rita Ostermann an Mr. C. E. Steel, Political Advisor und Professor T. H. Marshall, 25.10.1949. Das Schreiben enthält eine Liste mit den übrigen Adressaten, die alle relevanten Stellen in der britischen Militärregierung sowie OMGUS einschlossen. 392 NA, UK, FO 1050/1230, Land North Rhine/Westphalia, Deutscher Frauenkongress Bad Pyrmont, 7. bis 10.10.1949.
954 | Theanolte Bähnisch
‚80 Jahre Frauenbewegung 1848–1928‘ zur Lektüre und unterstrich, daß diese Tradition „in uns allen lebendig sein“ müsse, „um in der richtigen Weise unsere zukünftige Arbeit zu durchdringen und zu befruchten“. Als sie von der ‚Idee der Frauenbewegung‘ als Arbeitsgrundlage sprach, knüpfte die Sozialdemokratin Bähnisch also mitnichten an das Erbe der sozialistischen, sondern ausschließlich an das der bürgerlichen Frauenbewegung an. Auf diese Tradition bauend, wollte sie „die Arbeit der neuen Deutschen Frauenbewegung in Angriff nehmen.“ 393 Vor diesem Hintergrund erschien es nur folgerichtig, daß der ebenfalls überparteilich arbeitende Süddeutsche Frauenarbeitskreis (SFAK), dessen Leiterin Else Reventlow nicht auf die Tradition des BDF, sondern auf die kämpferischer Frauenverbände baute, erst gar nicht zur Konferenz erschienen war. Was der DFR als ‚Offenheit‘ verkaufte, das verurteilte Reventlow als Inhalts- und Ziellosigkeit. „Der Frauenring besitzt weder eine politische, noch soziale, noch weltanschauliche Konzeption“394, sollte das Urteil einer engen Mitarbeiterin Reventlows im gemeinsam verantworteten Kommentar über Pyrmont lauten. Bähnisch sollte, nicht ungeschickt, in einer Gegendarstellung klarstellen: „Wenn politisch gleich parteipolitisch, sozial gleich sozialistisch (oder kommunistisch), weltanschaulich gleich konfessionell gebunden gesetzt wird, stimmt die Behauptung.“395 Als ein Kernstück der Arbeit der neuen Deutschen Frauenbewegung begriff es Bähnisch erklärtermaßen, die Zusammenarbeit von „drei Generationen“ zu organisieren, was sie zugleich als Herausforderung wie auch als Chance ansah. „Noch nie ist die Basis ihrer Weltanschauung so unterschiedlich gewesen“, erklärte die Regierungspräsidentin – und sprach damit auf die Sozialisation der anwesenden Frauen in drei politischen Systemen: dem Kaiserreich, der Weimarer Republik und dem Dritten Reich an. „Ein um so fruchtbarerer Kompromiss wird und muss aus ihrer Zusammenarbeit möglich sein“396, entpuppte sich die Juristin einmal mehr als Vertreterin der Überzeugung, daß Frauen kraft ihres Geschlechts in besonderem Maß dazu geeignet seien, Trennendes zu überwinden. Auf der Basis des „Reichtum[s] der Erfahrungen“ der älteren Generation, erweitert um die „neue[n] Wege“, die die jüngere Generation beschreiten wolle, sollten die Generationen zusammengeführt werden. „Es wird entscheidend darauf ankommen, dass wir alle innerlich jung und elastisch genug sind, um die Aufgaben und Forderungen der neuen Zeit zu erkennen und ihnen Rechnung zu tragen“397, machte sie ihre Position deutlich. Den älteren Frauen, wie Agnes von Zahn-Harnack, schien sie diese ‚geistige Elastizität‘ jedoch nicht zuzutrauen, was folgte, deutet darauf hin, daß sie zwar den Segen der Grande Dames für ihre Arbeit als notwendig erachtete und von ihrem Wissen profitieren wollte, daß sie sie jedoch weitgehend von der aktiven Arbeit entpflichten wollte – was im Fall Zahn-
393 DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 1. 394 Feuersenger, Marianne: Zur Gründung des deutschen Frauenrings, Manuskript des Frauenfunks vom 14.10.1949, zitiert nach Zepp: Redefining, S. 163. 395 AdSD, Nachlaß Else Reventlow, Nr 43, Bähnisch an den Generaldirektor des Bayrischen Rundfunks, 24.10.1949. 396 DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des Deutschen Frauenrings, S. 1. 397 Ebd.
Wachsende Prominenz | 955
Harnack jedoch an deren Widerstand und der Unterstützung jüngerer Berlinerinnen gescheitert war. „Wir, die wir der mittleren Generation angehören, werden darauf bedacht sein müssen, der nach uns kommenden Generation den Weg zu bereiten und sie innerlich mit unserer Arbeit so zu verbinden, dass ein lebendiger und harmonischer Zusammenhang von Alt und Jung entsteht.“398 Bähnisch wollte also – in aktiver Zusammenarbeit mit Frauen ihres Alters – aufbauend auf dem Wissen der älteren Generation den jüngeren Frauen dabei helfen, sich in den neuen Gegebenheiten zurechtzufinden und zu entfalten. Folgt man der Argumentation Grete Borgmanns, Mitglied des Frauenrings Freiburg und spätere DFR-Bundesvorsitzende, bedurfte es zu jener Zeit tatsächlich jener mittleren Generation von Frauen, um zwischen den jüngeren und älteren Frauen innerhalb der Bewegung zu vermitteln, denn die älteren Frauen begegneten, Borgmann zufolge, den Jüngeren mit einer „Beherrschtheit, die sie als Ablehnung empfanden“, so daß die jungen Frauen meinten „sich einer […] fremden Verhaltenswelt gegenüberzusehen“399. Als die Gründungspräsidentin in ihrer Rede explizit den integrativen Aspekt ihrer Arbeit zum Ausdruck brachte, hob sie anders als sonst nicht auf ‚Überparteilichkeit‘ oder ‚Interkonfessionalität‘ ab. Sie fand vielmehr zu einer Vokabel aus der Öffentlichkeitsarbeit des ‚Club deutscher Frauen, Hannover‘ von 1946 zurück, als sie von der Verschiedenheit der Generationen und ihrer ‚Weltanschauungen‘ sprach. Es läßt sich darüber streiten, ob Bähnisch damit ‚nur‘ an das Selbstverständnis des BDF anknüpfen wollte, der „die deutschen Frauen jeder Partei und Weltanschauung“ vereinigen wollte, um „ihre nationale Zusammengehördigkeit zum Ausdruck zu bringen und die allen gemeinsame Idee von der Kulturaufgabe der Frau zu verwirklichen“400. Ihre Aussage läßt sich auch als einen Hinweis auf die gewollte Integration jener Frauen, die durch ihre Sozialisation zwischen 1933 und 1945 den Nationalsozialismus als prägende ‚Normalität‘ erfahren hatten, lesen. Den Prinzipien des NSSystems erteilte die DFR-Präsidentin im Verlauf ihrer Rede eine Absage. Bähnischs Haltung war vermutlich auf eine Mischung aus pragmatischen Gründen, den Reeducation-Erwartungen der West-Alliierten und die Überzeugung zurückzuführen, daß es dem Sinn der Frauenbewegung und damit dem DFR widerspreche, jene Frauen nicht zu integrieren. Eine prominente Stimme in der bürgerlichen Frauenbewegung, die sonst Bähnisch gegenüber recht kritisch eingestellte Lisbet Pfeiffer, hatte bereits anläßlich der ersten Konferenz von Pyrmont in diesem Sinne konstatiert: „Abgesehen davon, daß wir es uns wohl nicht leisten können, alle Frauen, die irgendwie einmal mit dem Nationalsozialismus in Berührung gekommen sind, beim Wiederaufbau auszuschalten, – es ist ‚vornehmstes Gebot‘ der Frau, nicht zu hassen, sondern zu lieben und zu verzeihen.“401 Jenen, die dies nicht wollten, hatte Pfeiffer in ihrem Artikel indirekt vorgeworfen, den ‚Geist echter Menschlichkeit‘ vermissen zu
398 Ebd. 399 Borgmann: Freiburg, S. 66/67. 400 Gesamtvorstandssitzung des Bundes Deutscher Frauenvereine am Montag, 15. Mai 1933, in: Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine, 13. Jg. (1933), o. S. überliefert in DFR-Archiv, A1. 401 Pfeiffer: Scheideweg, S. 31.
956 | Theanolte Bähnisch
lassen.402 Daß die proklamierte Offenheit für alle ‚Weltanschauungen‘ im Sinne einer Offenheit für den Kommunismus mißdeutet werden könnte, mußte Bähnisch nicht befürchten. Schließlich hatten sich zur Konferenz lediglich die „Frauen aus allen Ländern des westdeutschen Bundesgebietes und West-Berlins zusammengefunden“403. Daß auf dieser Veranstaltung keine Kritik über einen falschen Umgang mit dem Nationalsozialismus laut wurde, wird damit in ursächlichem Zusammenhang gestanden haben.404 Allerdings existiert ein Bericht der KPD-Politikerin Erika Buchmann über die Konferenz, in dem unter anderem dieser Umstand kritisiert wird. Zu Wort gemeldet hatte sich Buchmann offenbar nicht.405 Das besondere Interesse, das Bähnisch in ihrer Rede den ‚Generationen‘ entgegenbrachte, spiegelte sich auch im breiten Raum wieder, welcher der Ansprache der Studentin Wiltrud Wendehorst, die 1951 zum Dr. phil promoviert wurde406, auf dem Kongreß, beziehungsweise im verbandseigenen Protokoll der Veranstaltung zugemessen wurde. Dies läßt erahnen, daß es der Präsidentin mit der angestrebten Integration der ‚Jugend‘ in den DFR durchaus ernst war und sie sich den Vorwurf, ‚die Jugend‘ nicht ausreichend zu berücksichtigen, nicht länger gefallen lassen wollte. Wendehorsts Referat wird so wiedergegeben, als daß junge Frauen den grundsätzlichen Kampf um „die Erschliessung der Berufe und das Wahlrecht“407 für überholt und die Gleichberechtigung für festgeschrieben hielten. „Erst bei Beginn der Berufs-
402 Ebd. 403 DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 2. 404 Zu den kritischen Wortmeldungen von Kommunistinnen auf der Konferenz von Pyrmont 1947 siehe Kapitel 3.3.3. Zum unterschiedlichen Umgang mit der Erinnerung an den Nationalsozialismus, beziehungsweise Faschismus vgl.: Benz, Wolfgang: Zum Umgang mit nationalsozialistischer Vergangenheit in der Bundesrepublik, in: Danyel, Jürgen (Hrsg.): Die geteilte Vergangenheit. Zum Umgang mit Nationalsozialismus und Widerstand in beiden deutschen Staaten, Berlin 1995, S. 47–60. 405 BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Buchmann, Erika: Bericht über den Frauenkongress in Bad Pyrmont, der vom 7.–10. Oktober stattfand, 1949. 406 Vgl. dazu: Wendehorst, Wiltrud: Das Reichsvikariat nach der Goldenen Bulle, Dissertation, Göttingen 1951. Zudem ist ein Briefwechsel Wendehorsts mit Ludwig Bergsträsser aus demselben Jahr in dessen Nachlaß überliefert. Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, 0 21 [Nachlass Ludwig Bergsträsser], 18, 3, Findbuch, S. 63, auf: http://www.hadis.hessen. de/hadis-elink/HSTAD/O%2021/FINDBUCH.pdf, am 13.12.2013. In Rudolf Smends Nachlaß findet sich ein Brief Wendehorsts, in dem es um die Planung einer Archivreise ging. Vgl.: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (Hrsg.): Nachlass Rudolf Smend [Findbuch], Göttingen 2009, S. 151, Cod. Ms. R. Smend A 944, Acc. Mss. 2006.12 Cod. Ms., auf: http://hans.sub.uni-goettingen.de/nachlaesse/Smend.pdf, am 13.12.2013. In Zusammenhang mit der Handschriftenüberlieferung verzeichnet die Datenbank HANS der SUB Göttingen 1925 als Wendehorsts Geburtsjahr und bezeichnet sie als Historikerin und Gymnasiallehrerin. Vgl.: http://hans.sub.uni-goettingen.de/cgibin/hans/hans.pl?x=u&t_show=x&wertreg=PER&wert=wendehorst%2C+wiltrud+[1925]&reccheck=57105, am 13.12.2013. 407 Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 8.
Wachsende Prominenz | 957
ausbildung“408 oder mit Eintritt in das Studium merkten die Frauen, so wird Wendehorst zitiert, daß in der Praxis doch Männer bevorzugt würden. In der gemeinsamen Arbeit daran, die Gesetze mit Leben zu füllen, konnten ihrer Meinung nach die drei Generationen von Frauen zusammenwachsen. In der Runde der Wortmeldungen, die sich an das Referat anschlossen, wurden Stimmen deutlich, die einerseits überraschend progressiv waren, andererseits aber auch einem Phänomen der Zukunft, der weibliche Doppelrolle, klaglose Akzeptanz entgegenbrachten. „Haben Kinder nicht im Grunde mehr von einer im Leben stehenden Mutter, die sich zwar nur kürzer, aber dann auch intensiver mit ihnen beschäftigen kann?“409, wird eine junge Frau zitiert. Die im Protokoll den Jugendlichen in den Mund gelegte Aussage, „wir“ hätten heute die Aufgabe, „Familie und Beruf“ zu meistern und gleichzeitig „Seele der Familie und Berufstätige zu sein“410, erinnert zu stark an die Rhetorik Bähnischs – sowohl in einem Artikel von 1950411,als auch in der Pyrmonter Rede selbst –, als daß man von einem Zufall ausgehen sollte. Womöglich war Gesprächen zwischen den anwesenden Jugendlichen und der Vorsitzenden des DFR entsprungen, was sich als ‚Ergebnis‘ des Jugendlichen-Gesprächs herauskristallisierte, nämlich, daß sich „in diesem Miteinander“ von Beruf und Familie „erst die volle menschliche Persönlichkeit der Frau“412 entfalte. Auch Theanolte Bähnisch und der DFR, so scheint es, haben also ihren Anteil dazu beigetragen, daß sich, wie Christine Feldmann-Neubert in ihrer Längsschnitt-Analyse der Frauenzeitschrift ‚Brigitte‘ zeigt, die „Doppelrolle“ im Beruf sowie in der Kindererziehung und im Haushalt in der Bundesrepublik für Frauen zur Norm-Lebensform etablierte.413 Die Quintessenz des Austauschs der Jugendlichen durch die Protokollantin lautete schließlich: „Vor allem hat die Jugend erkannt, worauf es uns in der Frauenarbeit ankommt und dass es für sie selbst wichtig ist, an unseren Zielen mitzuarbeiten.“414 Dieser Kommentar läßt sehr fraglich erscheinen, ob im DFR, wie Bähnisch glauben machte, tatsächlich die ‚mittlere Generation‘ der jüngeren den Weg in die Zukunft ebnen wollte – oder ob nicht doch vielmehr der Anspruch an die jungen Frauen bestand, nach den Überzeugungen der älteren zu handeln. Wenn man so will, läßt es sich als eine Folge längerfristiger Sozialisations-Effekte bewerten, daß auch die Tochter Theanolte Bähnischs, Orla-Maria Fels, ihr Herz für die Frauenbewegung entdeckte. Doch mit ihrer Idee, fremde junge Frauen durch herausragende, aber kurze Ereignisse wie die Konferenz von Pyrmont für ihre Ideen einzunehmen, hatte Bähnisch einen schweren Stand. Bärbel Maul zufolge war offenbar sogar die WunschKlientel par Excellence, nämlich die angehenden Akademikerinnen, für die von älteren Frauen dominierte Frauenbewegung geradezu unerreichbar. „Die jungen Frauen vermieden [...] alles, was Distanzierung oder Isolierung von den männlichen Partnern
408 409 410 411 412 413 414
Ebd. Ebd., S. 6. Ebd., S. 7. Unterstreichung im Original. Bähnisch: Himmel, S. 4/5. Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 7. Vgl.: Feldmann-Neubert: Frauenleitbild. Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 7.
958 | The anolte Bähnisch
an den Universitäten bedeutet hätte“415, konstatiert Maul in ihrer Studie über Akademikerinnen in der Nachkriegszeit. Zwar nahm Maul besonders den Akademikerinnen-Bund als von den jungen Frauen verschmähte Interessen-Organisation in den Blick, jedoch waren die Führungsriegen des DAB und des DFR teilweise identisch, was eine Übertragbarkeit von Mauls Ergebnissen naheliegend erscheinen läßt. Maul zufolge hätten die Studentinnen allerdings nicht nur die Zusammenarbeit mit den älteren Frauen, sondern jeglichen ‚Frauenzusammenschluß‘ abgelehnt. Stärker als je zuvor appellierte Bähnisch in ihrer Pyrmonter Rede an die „Pflicht“ der Frauen, Verantwortung für „das große Ganze, d. h. die Familie des Volkes“ zu übernehmen. Schließlich habe das Grundgesetz nicht nur „Gleichberechtigung“, sondern auch „Gleichverantwortung“416 gebracht. Wie schon 1946 begründete sie ihre Ausführungen sowohl mit der zahlenmäßigen Überlegenheit der Frauen als auch mit der Unausgewogenheit, die entstünde, wenn nur Männer sich in die Gestaltung der Gesellschaft einbrächten. Um ihre These zu unterstreichen, stellte sie die Bilanz der Jahre 1945 bis 1949 als vernichtend dar. In den Jahren seit Kriegsende, so Bähnisch, hätten die Männer versucht, „den veränderten Verhältnissen nur in der alt gewohnten Weise Rechnung zu tragen und Lösungen vom rein theoretischen und rationalistischen Standpunkt her zu versuchen.“ Doch es habe sich gezeigt, daß dies nicht ausreichte, um der „neuen Situation nach 1945 Herr zu werden.“417 Sie beschrieb zwar nicht, was diese neue Situation ausmachte, klagte aber ein, daß der Bezug zu einer „lebensvollen Wirklichkeit“418 wiederhergestellt werden müsse. Im Wissen, daß der Appell an die „heilige Pflicht“419 allein als Antrieb nicht ausreichen würde, spielte sie anschließend – wie sie es in einer bereits an anderer Stelle zitierten Rede 1950 erneut tun sollte – mit den Ängsten der Frauen und argumentierte, daß das Leben ihnen womöglich nicht geben könne, worauf ihre Sozialisation abgezielt habe, nämlich ein Familien-Leben. Das Engagement in der Frauenbewegung pries sie sowohl als eine logische Erweiterung zum Familienleben als auch als eine erfüllende Alternative dazu an: Die Frauenbewegung sei immer das Werk „glücklich verheirateter Mütter“ gewesen, und „Ehe und Mutterschaft, ein glückliches Familienleben“ erfülle „das innerste Wesen der Frau am tiefsten“, doch sollten die Frauen auch für die „Familie des Volkes“420 da sein. Eine Frau „die unverheiratet bleibt“, habe durch die „Sublimierung und Transponierung der echt fraulichen Kräfte auf eine andere Ebene“ wiederum die Möglichkeit, eine „ganz neue Art von Glück“421 zu erleben. Die Frauenbewegung sollte also sowohl der Gesellschaft als Motor der Erneuerung als auch ihren Trägerinnen als Antidepressivum und Analgetikum dienen. „Denn innere Lebendigkeit und Schaffenskraft lassen keine Unzufrie-
415 416 417 418 419 420 421
Maul: Akademikerinnen, S. 95. DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 2. Ebd., S. 1. Ebd., S. 2. Ebd. Ebd., S. 3. Ebd., S. 4.
Wachsende Prominenz | 959
denheit und Bitterkeit aufkommen.“422 Niemandes Leben müsse leer bleiben, weil er – oder vielmehr sie – alleinstehend sei, lautete die Botschaft, die Bähnisch an die Frau bringen wollte. Rekapituliert man, was Bähnisch in ihrem Diktat von 1972 schrieb, so dachte sie dabei vielleicht nicht zuletzt an sich selbst. Denn während sie sich in Pyrmont aufhielt, um Geschichte zu schreiben, war das Schicksal ihres Mannes Albrecht Bähnisch weiterhin unklar. Daß sie, die aufgrund eines bezahlten, mehrerer ehrenamtlicher Ämter und ihrer Mutterrolle über Aufgabenmangel nicht gerade klagen konnte, mit ihrem zusätzlichen Engagement in der Frauenbewegung die Lücke kompensieren wollte, welche durch den Weggang Albrecht Bähnischs entstanden war, ist nicht unwahrscheinlich. Ihrer Tochter Orla-Maria Fels zufolge, wartete Theanolte Bähnisch bis in die Mitte der 50er Jahre hinein auf ein Lebenszeichen ihres Ehemannes, dessen Kriegstod nicht sicher, aber doch wahrscheinlich war.423 Andererseits wird sie als Behördenleiterin auch die Masse an Fürsorgeakten gekannt haben, die über ‚Kriegerwitwen‘ in der zweiten deutschen Nachkriegszeit zusammenkamen. Anna Schnädelbach zufolge waren die Witwen extremen körperlichen und psychischen Belastungen ausgesetzt, mit denen die Kommunen tagtäglich konfrontiert wurden.424 Der Anschluß der Frauengruppe des VDK an den DFR ist – wenn schon nicht vom staatsbürgerlichen Anspruch her, doch vor diesem Hintergrund zu verstehen. Auch wenn sie das Thema ‚Verlust‘ nicht explizit ansprach, so ist es doch unwahrscheinlich, daß Bähnisch mit ihrer Argumentation nur die Frauen angesprochen haben sollte, die noch keinen Partner gehabt hatten. Artikel wie ‚Es wartete Penelope‘ in der ‚Stimme der Frau‘ legen die Interpretation nah, daß die Regierungspräsidentin die unausgesprochene Erwartung hegte, daß Frauen, die über das Schicksal ihrer Männer noch keine Gewißheit hatten, sich in Geduld üben und ihr Leben derweil mit anderen Inhalten füllen sollten.425 Mit ihrer Argumentation schien sich Bähnisch übrigens in guter Gesellschaft befunden zu haben. Christl Ziegler zufolge wurde in den Nachkriegsjahren auch von anerkannten Erwachsenenbildnern „öffentlich-politisches Mitwirken häufig unter dem Aspekt des Ersatzes einer fehlenden Familie betrachtet“.426
422 Ebd. 423 Gespräch mit Orla-Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. 424 Vgl.: Schnädelbach, Anna: Kriegerwitwen. Lebensbewältigung zwischen Arbeit und Familie in Westdeutschland nach 1945, Frankfurt a. M./New York 2009. 425 Vgl. die Artikel: Wege, Lotte: Es wartete Penelope, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 8/9, sowie: O. V.: „Heut´ wird er kommen“. Auszüge aus den „Sonetten einer Griechin“ von Eckard Peterich, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 9. Die Darstellung von wartender Frau und heimkehrendem Mann als ‚Odysseus und Penelope‘ ist auch in der österreichischen Nachkriegsliteratur zu beobachten. Vgl. dazu: Hornung, Ela: Heimkehrer und wartende Frau. Zur Symptomatik eines Geschlechterverhältnisses nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich, in: Bandhauer-Schöffmann, Irene/Duchen, Claire (Hrsg.): Nach dem Krieg. Frauenleben und Geschlechterkonstruktionen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Herbolzheim 2000, S. 67–84. 426 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 71.
960 | Theanolte Bähnisch
„Lehren wir also die junge Frauengeneration, als sich selber zu leben“427, appellierte die Rednerin im weiteren Verlauf ihrer Rede an die reiferen Frauen, das Verantwortungsgefühl der jüngeren durch staatsbürgerliche Erziehung zu wecken und sie nicht ins ‚offene Messer‘ laufen zu lassen, das für Bähnisch in der nationalstaatlichen Isolation oder einer Hinwendung zum Kommunismus bestand. „Genau wie Unkenntnis des Gesetzes nicht vor Strafe schützt, enthebt Unkenntnis der staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten die Frau nicht ihrer Verantwortung“428, betonte die Vorsitzende einmal mehr die Pflichten der ‚Staatsbürgerin‘. Die „richtige Erziehung“ könne dazu führen, führte sie fort, daß sich „Frauenpersönlichkeiten“ entwickeln, die in der Lage seien, den „Instinkt und das Gefühl der Frau mit der Klugheit eines geschulten Geistes“ zu verbinden und „die zukünftige Gestaltung Europas entscheidend mitzubestimmen“429. Sie sprach an diesem Punkt also nur implizit an, was es zu verhindern galt, und machte explizit Werbung für die europäische Idee als erstrebenswerten Gegenentwurf. Jenes Verhalten, das die PR-Experten Dieter Schindelbeck und Volker Illgen als die Maxime ‚Persil spricht nur von Persil‘ bezeichnen, läßt sich ebenfalls in der ‚Stimme der Frau‘ nachvollziehen. Durch das Prinzip, nicht die abzulehnenden Weltentwürfe anzuprangern, sondern nur die erstrebenswerten in der Berichterstattung herauszustellen, unterscheide sich Schindelbeck und Illgen zufolge, der PR-Fachmann vom Propaganda-Aktivisten. Bähnisch, die ja erklärtermaßen am liebsten selbst ein Propaganda-Institut aufziehen wollte, hielt es allerdings nicht konsequent durch.430 Als sie die internationale Ebene des angestrebten gesellschaftlichen Engagements von Frauen ansprach, beschwor Bähnisch schließlich auch die Friedfertigkeit der Frauen. Das mittlerweile in Verruf geratene Wort ‚Frieden‘ gebrauchte sie an dieser Stelle allerdings nicht, sondern sie sprach davon, daß alle „radikalen und gewalttätigen Methoden“431 abzulehnen seien, was auch als eine Kritik am Nationalsozialismus lesbar war. Als sie an einer anderen Stelle ihrer Rede auf die internationale Arbeit, die der DFR leisten solle, abhob, rekurrierte sie auf Grimmes Rede „vor 2 Jahren hier an der gleichen Stelle“432 und sprach gleichzeitig Ministerpräsident Kopf aus dem Herzen, der den internationalen Anschluß des DFR besonders begrüßte.433 Anschließend zitierte die Rednerin – wie um die zweite Konferenz von Pyrmont in die Tradition der westdeutschen Frauenkonferenzen Bad Boll – Pyrmont I – Frankfurt einzuordnen – die auf der Frauenkonferenz in der Frankfurter Paulskirche gefaßte Resolution für die Freiheit und gegen „jeden Totalitätsanspruch“.434 Mit diesem Parforce-Ritt auf der internationalen Ebene angekommen, den anwesenden Frauen aus
427 428 429 430 431 432 433 434
DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 3. Ebd., S. 4. Ebd., S. 3. Schindelbeck, Dirk/Illgen, Volker: Haste was, biste was!, Werbung für die soziale Marktwirtschaft, Darmstadt 1999, S. 20. DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 3. Ebd., S. 12. Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 7. DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 12.
Wachsende Prominenz | 961
dem Ausland für ihre Gastfreundschaft dankend, brachte sie den „Weltfriede[n]“ nun doch explizit ins Spiel. Bähnisch bekräftigte, es nicht bei Resolutionen und Kundgebungen für diesen Frieden belassen, sondern für ihn „arbeiten“ zu wollen. Sie rief dazu auf, sich in den Dienst der „Europäischen Bewegung“ und der „Bewegung für eine gemeinsame Weltregierung“435 zu stellen. Daß sie damit mehr als nur Lippenbekenntnisse vorbrachte, zeigt ihre bereits erwähnte Arbeit als Vizepräsidentin des Exekutiv-Komitees des ‚Deutschen Rates der Europäischen Bewegung‘ und als Leiterin der Kulturkommission der organisierten Bewegung. In Bähnischs Person kulminierte, wenn man ihre vergleichsweise zentralen Funktionen in beiden Bewegungen zugrundelegt, der organisatorische und inhaltliche Zusammenhang zwischen der Frauenbewegung und der Europabewegung in Deutschland. Schließlich hatte man sie als eine von 16 ‚Vertreterinnen der Frauen‘, die zu dieser Zeit den größten Verband seiner Art leitete, in den Rat aufgenommen, in das Exekutivkomitee gewählt und ihr die Rolle einer der Vizepräsidentinnen übertragen. Zudem trug Bähnisch die Idee der Europa-Bewegung aktiv in die Frauenbewegung: Als Präsidentin des DFR hatte sie eine große Zuhörerschaft, die sie mit ihren Visionen anstecken konnte und von der sie sich wünschte, daß sie selbst entsprechend tätig werden würde. „Die Gedanken sowohl der europäischen Bewegung wie der Bewegung für Weltregierung [gemeint war wohl die Arbeit der Liga für Weltregierung436] müssen in Zukunft viel stärker in unsere Frauenkreise hineingetragen werden, durch aufklärende Vorträge und Beteiligung unserer örtlichen Vereine an allen derartigen Veranstaltungen“437, instruierte sie die anwesenden leitenden Mitglieder in diesem Sinn. Seinen Charakter als europabewegte Organisation verlor der DFR mit dem Ausscheiden Bähnischs, nebenbei bemerkt, nicht. Nachdem sie und ihr Nachfolgerin ihren Vorsitz im DFR niedergelegt hatten, blieb der Verband über Ulich-Beils Nachfolgerin Emmy Engel-Hansen438 im Vorstand des ‚Deutschen Rates der Europäischen Bewegung‘ repräsentiert. Mit dieser wirkte Bähnisch wiederum im Vorstand der ‚Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen‘ zusammen.439
435 Ebd., S. 14. 436 Die friedensbewegte ‚Liga für Weltregierung‘, eine britische Initiative, die 1948 in Köln für die gesamte britische Besatzungszone genehmigt wurde, trat für einen Zusammenschluß der Nationen als Föderalistische Union ein und orientierte sich dabei am Konzept der USA. Vgl.: O. V.: Neue Kriege zu verhindern. Natürlich nur step by step, in: Der Spiegel, 2. Jg. (1948), Heft 14, 04.04.1948, S. 6/7. Die ‚Liga‘ schloß sich der Dachorganisation ‚Europäische Bewegung‘ an, in der sich auch Bähnisch engagierte. 437 DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 14. 438 Engel-Hansen leitete den DFR von 1956 bis 1958. Vgl.: Deutscher Frauenring e. V.: Sechs Jahrzehnte Einsatz von Frauen für Frauen [Übersicht über die Präsidentinnen und die Arbeit des DFR seit 1949], auf: http://www.deutscher-frauenring.de/der-verband/infowerbe-material/plakate/6-jahrzehnte, am 13.12.2013. Vgl.: zu den verschiedenen Vorständen des DFR auch: DFR-Archiv, A1, Zur Geschichte des DFR, Zusammensetzung der Vorstände, Deutscher Frauenring, Bundesgeschäftsstelle, Januar 1983. 439 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 179.
962 | Theanolte Bähnisch
8.3.8.2 Die ‚gemeinsame Frauenhaltung‘ als Ausdruck von Solidarität im privaten und im öffentlichen Leben Die ‚staatsbürgerliche Erziehung‘ nach Bähnischs Façon sollte nicht nur zur Europabegeisterung, sondern auch zur Anerkennung des DFR als wichtigste Instanz für die Wahrnehmung von ‚Fraueninteressen‘ führen. Immer stehe „die Frau vor den gleichen Problemen als Frau“. Deshalb sollten alle Frauen „wissen, dass ihre Interessen als Frau an einheitlicher Stelle gewahrt und repräsentiert werden“440, erhob Bähnisch den DFR zum Sprachrohr der Frauen. Noch gingen viele vernünftige Gedanken und praktische Vorschläge verloren, so Bähnisch, weil sie nicht „von einer wirklich gemeinsamen Repräsentanz aufgefangen und nutzbar gemacht“ 441 würden. Bähnischs Meinung, man müsse „über alle Verschiedenheiten der Generationen, Weltanschauungen und […] politischen Überzeugungen hinaus an der Entwicklung einer gemeinsamen Frauenauffassung über die Probleme des öffentlichen Lebens“442 arbeiten, läßt unschwer erkennen, daß der DFR die Schmiede einer solchen Auffassung sein und der Verband auch als Vertreter der Frauen das Produkt einer solchen Arbeit in die Welt vermitteln sollte. Mit einer Distanz von zehn Jahren zu ihrer Pyrmonter Rede scheint Bähnisch von ihrer Überzeugung, daß Frauen über die Parteigrenzen hinweg zu einem gemeinsamen Nenner finden könnten, zumindest graduell abgewichen zu sein. Von einer ‚gemeinsamen Frauenauffassung‘ ist in ihrer Rede anläßlich des Tages „der Besinnung“ zum zehnjährigen Bestehen des DFR nicht mehr die Rede. Hier wollte die Festrednerin, die zu dieser Zeit bereits hatte erfahren müssen, daß der Gedanke der ‚gemeinsamen Frauenauffassung‘ nicht soweit trug, wie sie es sich erhofft hatte, lediglich niemals vergessen wissen, „daß wir als Frauen tätig sind und deshalb unsere Frau stehen müssen“, „wo wir auch stehen, ob in der Arbeit von Organisationen oder Parteien, in der Selbstverwaltung oder Staatsverwaltung“.443 Daß die Regierungspräsidentin keine Frauenbewegung wollte, die sich gegen die Männer stellt, hatte sie bereits an anderer Stelle betont. In Pyrmont bekräftigte sie diese Aussage und stellte auch damit den DFR in die Tradition des gemäßigten BDF, der mit seiner Arbeit auf einen ausgewogenen Einfluß der Geschlechter in der Gesellschaft abgezielt hatte: „Der tiefste Sinn der Frauenbewegung ist […] die Umgestaltung der Welt durch die Zusammenarbeit von Mann und Frau“444, ließ Bähnisch ihre Zuhörerinnen und Zuhörer wissen. Ihren Verband stellte sie als Keimzelle dieser anvisierten, weitreichenden Veränderungen dar: Im DFR sei eine Form geschaffen worden, so erklärte seine Präsidentin, „durch die die Frauenbewegung in diesem eigentlichen Sinn“445 repräsentiert werde. Diese Ausführungen Bähnischs dürften den Geschmack einer auf der Konferenz anwesenden Amerikanerin getroffen haben, die im Auftrag der US-Militärregierung als Visiting Expert nach Deutschland gereist war. „This job“ – die Frauen-Arbeit im
440 441 442 443 444 445
Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 4. Ebd. Ebd. Bähnisch: Wiederaufbau, S. 180. DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 5. Ebd.
Wachsende Prominenz | 963
Rahmen des deutschen Wiederaufbaus – „is not one for a feminist“446, hatte Chase Going Woodhouse 1948, als die US-Frauen-Re-education-Politik noch in ihren Anfängen steckte, festgestellt. Organisationen, welche im Sinne der westalliierten Reeducation-Politik Frauen staatsbürgerlich bilden sollten, mußten schließlich eine breite Masse von Frauen ansprechen, mit Männern zusammenarbeiten und einen gesamtgesellschaftlich akzeptierten Beitrag zum Wiederaufbau leisten. Radikalen Feministinnen war dies nicht zugetraut worden.447 Offensichtlich glaubte die DFR-Präsidentin jedoch nicht daran, daß alle Männer so aufgeklärt seien, wie Adolf Grimme es in seiner Pyrmonter Rede 1947 als Wunsch formuliert hatte. Die Möglichkeit einer „schlechte[n] Ehe“448 erhob Bähnisch nämlich mit zur Begründung, warum sich alle Frauen für Frauen-Rechte einsetzen müßten. Dabei maß die im reformorientierten Preußen ausgebildete Juristin den Gesetzen, die es im Zuge der Angleichung an Art 3. GG zu verändern galt, eine große Macht zu. „Es darf eine in einer […] glücklichen Ehe lebende Frau nicht, ohne in ihrem Verantwortungsgefühl getroffen zu werden, mit ansehen, wie eine andere, weniger Glückliche, durch eine unzureichende, rein männlich orientierte Gesetzgebung in einer schlechten Ehe in ihren Rechten als Frau und Mutter geschmälert wird. […] Aus diesem Solidaritätsgefühl werden dann die nötigen Reformvorschläge anstehen.“449 Sie spielte hiermit auf Regelungen an, nach denen der Ehemann das letzte Wort bei der Erziehung der Kinder450, bei der Berufstätigkeit seiner Frau und in Vermögensfragen hatte.451 Die Anpassung dieser Gesetze, vor allem des § 1354 BGB in der Fassung vor 1957, an den Art. 3 GG zählt in der verbandseigenen Retrospektive zu den Kernaufgaben des DFR.452 Seine erste Präsidentin Bähnisch setzte erklärtermaßen nicht nur auf den Sachverstand, sondern auch auf das ‚Gefühl‘ der Frauen, um Änderungen in dieser Hinsicht herbeizuführen. Jene Überzeugung kulminierte in der Äußerung Bähnischs, Frauen müßten ein „kluges Herz“453 haben. Daß es der Regierungspräsidentin am Herzen lag, Frauen über ihre Rechte in Ehe und Familie aufzu-
446 Chase Going Woodhouse, zitiert auf Basis einer Akte der amerikanischen Militärpresse von 1948 nach Rupieper: Bringing, S. 78. 447 Vgl. dazu auch: Boehling: Geschlechterpolitik, S. 71/72. 448 DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 6. 449 Ebd. 450 Vgl.: dazu: Sorge, Christoph: Das Entscheidungsrecht des Ehemannes (§ 1354 BGB), in: Projekt Frauenrechtsgeschichte der Leibniz Universität Hannover, 19. Mai 2009, auf: http://www.frauenrechtsgeschichte. uni-hannover.de/76.html?&L=1, am 13.12.2013. 451 Das Thema findet sich auch in der ‚Stimme der Frau‘ wieder. Vgl.: Freund: Krieg, S. 168/169. 452 Vgl.: Deutscher Frauenring e.V.: Sechs Jahrzehnte Einsatz von Frauen für Frauen [Übersicht über die Präsidentinnen und die Arbeit des DFR seit 1949], auf: http://www. deutscher-frauenring.de/der-verband/info-werbe-material/plakate/6-jahrzehnte, am 13.12. 2013. 453 O. V.: Geist.
964 | Theanolte Bähnisch
klären, läßt sich, wie schon erwähnt, auch in der ‚Stimme der Frau‘, in der verschiedene Artikel zu zivilrechtlichen Fragen zum Abdruck kamen, nachvollziehen. Daß ‚Bonn‘ im Sinne der Gleichstellung von Mann und Frau also ‚nicht Weimar‘ war, stieß ganz auf Bähnischs Zustimmung, was zeigt, daß die staatsnahe Verwaltungsjuristin der Weimarer Republik, in deren Verfassung Frauen nur staats-, aber nicht zivilrechtlich mit den Männern gleichgestellt waren, nicht ungebrochen positiv gegenüberstand. In Bezug auf Frauenrechte war ihr die staatliche Reformpolitik längst nicht weit genug gegangen, schließlich hatte sie selbst erleben müssen, wie sie aufgrund ihres Geschlechtes mit Hinweis auf den entsprechenden Paragraphen dazu angehalten wurde, ihr Amt als Regierungsrätin im Berliner Polizeipräsidium aufzugeben. Auch die Schicksale der Ärztinnen, die sie als Verwaltungsrechtsrätin wegen geschlechtsbedingter Diskriminierung gegenüber der Krankenkasse vertreten hatte, waren ihr ganz offensichtlich nah gegangen, weshalb es glaubhaft erscheint, daß sie anderen Frauen ähnliche Schicksale ersparen helfen wollte. Sie vertrat in Pyrmont außerdem die Meinung, daß der Gleichberechtigungsartikel der Weimarer Verfassung keinerlei Folgen in der Gesetzgebung gezeigt habe, weil der Gesetzgeber dazu „nicht gezwungen“454 gewesen sei – womit sie wiederum auf die Schieflage im BGB, vielleicht auch auf richterliche Entscheidungen, anspielte. Schließlich war der Gesetzeskatalog, der aus dem Kaiserreich stammte, nur unzureichend an die Weimarer Reichsverfassung angeglichen worden. Artikel 3 GG erkenne den Frauen nun, in Verbindung mit Artikel 117 GG, die „echte Gleichberechtigung“455 zu, weil die Art. 3 GG entgegenstehenden Bestimmungen bis 31.03.1953 aufgehoben werden müßten, so Bähnisch. Daß dies bei über 600 zur prüfenden BGB-Paragraphen eine Menge Arbeit bedeutete, wußte die Juristin nur zu gut und verwies deshalb auf die Vielzahl der betroffenen Inhalte. „Es wird noch viel Zeit und Arbeit brauchen, bis die Gleichberechtigung soweit verwirklicht ist, dass Gleichberechtigung und Gleichverantwortung sich die Waage halten.“456 Gerade hierin sah sie eine wichtige Aufgabe des DFR, auch für die Arbeit an der Basis: Entscheidend sei, daß nicht nur Vorschläge in den Fachausschüssen des DFR erarbeitet würden, sondern daß diese „bis in den kleinsten Ortsverein gründlich durchdiskutiert werden.“457 Sie kam also 1949 auf einen Schwerpunkt, den sie 1947 schon auf der ersten Pyrmonter Konferenz angesprochen hatte, zurück. Ein enger Kontakt zu den weiblichen Abgeordneten sei bei der Arbeit in diesem Bereich besonders wichtig, betonte Bähnisch, die ganz offensichtlich erwartete, daß weibliche Abgeordnete sich wie selbstverständlich für die Rechte von Frauen einsetzen – woraus sich auch ihre Idee erklärt, in Kursen an einer Schule für staatsbürgerliche Frauenbildung die Frage zu besprechen, was Frauen von Politikerinnen erwar-
454 455 456 457
DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 7. Ebd. Ebd., S. 8. Ebd.
Wachsende Prominenz | 965
ten.458 Läßt man sich auf dieses Denken ein, so muß man konstatieren, daß ihr zumindest die Erfolge interfraktioneller Frauenbündnisse in den 1920er Jahren Recht gaben. Mit Hilfe parteiübergreifender Zusammenschlüsse von Frauen waren zwischen 1922 und 1927 verschiedene Gesetze, aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte auch ‚Frauengesetze‘ genannt, durchgesetzt worden.459 Theanolte Bähnisch muß diese Gesetze gekannt und von ihrer Entstehungsgeschichte gewußt haben, denn sie waren grundlegend für das Thema, mit dem sie sich in ihrer Staatsexamensarbeit auseinandergesetzt hatte: ‚Sittenpolizei und Prostitution‘. Die Verwaltungsjuristin sah den Sinn des Frauenrings demnach auch darin, ‚beratend‘ auf die Abgeordneten einzuwirken, sowohl was die Inhalte, als auch, was die Bereitschaft betraf, mit Frauen aus anderen Parteien zu kooperieren. Damit knüpfte sie an ein Schreiben an, das der ‚Club deutscher Frauen‘ 1947 an die Landesleitungen der Parteien verschickt hatte. Der Brief appellierte daran, „das Bewußtsein der Gemeinsamkeit und Schicksalsverbundenheit über alle Gegensätzlichkeit wach zu erhalten.“ Besonders von den weiblichen Kandidatinnen erwarte der Club eine „vorbildliche Haltung“460, war den Parteien mitgeteilt worden. Ministerpräsident Kopf vertraute seiner Rede in Pyrmont zufolge darauf, daß der DFR sich für die „Gleichberechtigung der Geschlechter“ – seiner Meinung nach eine „Voraussetzung unseres heutigen Lebens“461 – mit dem nötigen Nachdruck einsetzen würde. Als hochrangiger Politiker, der wesentlich für die Einstellung Bähnischs als Regierungspräsidentin verantwortlich gewesen war und der für seinen parteiübergreifenden Kooperationswillen bekannt war, unterstrich er die Glaubwürdigkeit der ihm untergeordneten hohen politischen Beamtin. 8.3.8.3 „Wir sind alle Deutsche“: Die Aufgaben der Frauen(bewegung) in der Schicksalsund Wiederaufbaugemeinschaft Im Verlauf ihrer Ansprache brach Bähnisch – und das war der Überlieferung nach zu urteilen ein Novum – zum ersten Mal in einer ihrer öffentlichen Reden explizit eine Lanze für die Demokratie als Staatsform. Frauen seien als Staatsbürgerinnen „ganz stark“ dafür mitverantwortlich, so Bähnisch, „ob die Demokratie in unserem Volk Wurzeln schlagen wird oder nicht.“462 Sie müßten sich auflehnen gegen den „Unter-
458 NA, UK, FO 1050/31, Proposal for a school for Education in Citizenship, Theanolte Bähnisch, o. D., Abschrift, Anhang zum Schreiben: Office of the Educational Advisor an Religious Affairs Advisor, 09.08.1948. 459 Dies traf auf das Jugendwohlfahrtsgesetz (1922), das Jugendgerichtsgesetz (1923), das Gesetz über die Zulassung von Frauen zur Rechtspflege (1922) sowie auf das Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 1927 – als Abschluß eines langen Kampfes gegen die staatliche Reglementierung der Prostitution – zu. Vgl.: Gerhard, Ute: Frauenbewegung und Feminismus. Eine Geschichte seit 1789, München 2009, S. 89. 460 Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 45, Club deutscher Frauen Hannover an die Landesleitung der SPD, 29.03.1947. 461 Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 6. 462 DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 6.
966 | Theanolte Bähnisch
tanengeist“463. Dies war eine Aussage, die als klare Absage an die politischen Strukturen des Kaiserreichs, welche die 1899 Geborene selbst noch erfahren hatte, aber auch an den Nationalsozialismus gewertet werden konnte. Nachdem mit der Weimarer Reichsverfassung das Frauenwahlrecht eingeführt worden war, hatte der BDF eine Kampagne zur Wahlbeteiligung von Frauen lanciert, mit Erfolg: 1919 hatte die Gesamt-Frauenwahlquote Ute Gerhard zufolge beeindruckende 90 Prozent betragen und in den jüngeren Altersstufen sogar oberhalb der Wählerquote von Männern in den entsprechenden Jahrgängen gelegen.464 Auch wenn sich nicht rekonstruieren läßt, wie stark die Kampagne des BDF zur hohen Wahlbeteiligung von Frauen beigetragen hat: die Erinnerung an diese Zusammenhänge könnte durchaus einen Anreiz dargestellt haben, 30 Jahre später, an der Schwelle zur zweiten deutschen Demokratie, als Vorsitzende des BDF-Nachfolgers erneut an die Wahrnehmung jener zentralen staatsbürgerlichen Pflicht durch das weiblichen Geschlecht zu appellieren. Auch was die Wahrnehmung passiver Wahlrechte betraf, war die Weimarer Republik ein Beispiel, an dem es sich zu orientieren lohnte: Ein Frauen-Anteil von zehn Prozent, wie er unter den Abgeordneten der Nationalversammlung geherrscht hatte465, wurde in Deutschland erst 1983 erneut erreicht.466 Als Bähnisch in ihrer Pyrmonter Rede, festhielt, daß die ‚politische Arbeit‘ in Zukunft „nicht nur von den Frauen in den Parlamenten geleistet werden“467 müsse, hatte sie vermutlich im Hinterkopf, daß 1949 gar nicht viele Frauen in den Parlamenten saßen. Auch ein Artikel in der ‚Stimme der Frau‘ problematisiert diesen Umstand.468 Kein Wunder, daß sie die „große Frauenrepräsentanz“ also nicht im Parlament, sondern im DFR erkannte. Dieser müsse die Arbeit der Parlamente verfolgen, zu allen wichtigen Gesetzentwürfen Stellung nehmen und von sich aus Reformen vorschlagen – also Initiator und Korrektiv zugleich sein. Damit machte die DFR-Präsidentin deutlich, daß sie kaum Hoffnungen in die wenigen Parlamentarierinnen setzte. „Es wird von unserer Initiative und Zähigkeit abhängen, welchen Einfluß wir auf diese Weise gewinnen“469, stellte sie eine große Wirkung als Preis für einen hohen Einsatz in der von ihr geleiteten außerparlamentarischen Arbeit in Aussicht. Die Verwendung des Begriffs ‚Zähigkeit‘ zeigt, daß sie an einen leicht zu erringenden Erfolg nicht glaubte. Die linientreue Sozialdemokratin Annedore Leber, eine starke Verfechterin parteiinterner Arbeit für Frauenrechte, welche ebenfalls an der Konferenz teilnahm, wird sich in ihrer Abneigung gegenüber der überparteilichen Frauenarbeit bestätigt gefühlt haben, als Bähnisch ihre Rede hielt. Denn in dieser konnte man durchaus eine Infragestellung
463 Ebd. 464 Gerhard: Feminismus, S. 84. 465 Unter diesen Abgeordneten war die damalige Führungsriege des BDF vertreten: Gertrud Bäumer, Marie-Elisabeth Lüders und Marie Baum (alle DDP). Die Vorsitzende des KDFB, Hedwig Dransfeld sowie Helene Weber vertraten das Zentrum. 466 Vgl.: Gerhard: Frauenbewegung, S. 84. 467 DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 6. 468 Vgl.: O. V.: Wir sind wieder einmal schlecht dabei weggekommen!, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 5, S. 5/6. 469 DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 6.
Wachsende Prominenz | 967
der vom Grundgesetz zugewiesenen Aufgaben an die Parteien und das Parlament sehen. Einerseits hielt Bähnisch also die Frauen zur Wahrnehmung ihres Stimmrechts an, andererseits führte sie ihnen die Notwendigkeit vor Augen, sich auch auf anderen Wegen in das repräsentative System einzumischen. Daran, daß die gewählten Vertreter und Vertreterinnen des Volkes die vielbeschworenen ‚Fraueninteressen‘ wirksam vertreten würden, glaubte sie offenbar nicht. Einer der Väter dieser Gedanken könnte ein berühmter Rechtsphilosoph gewesen sein, an dem kein Student der Rechtswissenschaften vorbeikam: Georg Wilhelm Friedrich Hegel sah die ‚bürgerliche Gesellschaft‘ als eine sittliche Kategorie und einen vorstaatlichen gesellschaftlichen Ordnungsrahmen an. Eine Grundfeste des Hegel‘schen Konzepts war von der Juristin Bähnisch wiederholt beschrieben und in den Verantwortungsbereich der Frauen verwiesen worden: die Wechselwirkung zwischen der (bürgerlichen Klein-)Familie und der Gesamtgesellschaft, die sie in ihrer Rede als ‚Familie des Volkes‘ bezeichnete.470 Gleichzeitig trägt ihre Argumentation Aspekte einer sehr modernen Definition von ‚Zivilgesellschaft‘471 in sich. Nicht von ungefähr werden heute die Begriffe ‚Bürgergesellschaft‘ und ‚Zivilgesellschaft‘ häufig synonym verwendet.472 Im Konzept des Politikwissenschaftlers Christoph Gohl hat die Zivilgesellschaft eine lückenausfüllende Funktion, sie übernimmt also Aufgaben, die der Staat nicht oder nicht hinreichend erfüllt473 – was in Bähnischs Wahrnehmung auf die Ausgestaltung der Gleichberechtigung von Frauen zutraf. Nachdem sie ihre Vorstellung von Demokratie und die Rolle, die der DFR darin spielen sollte, transparent gemacht hatte, kam Bähnisch auf etwas zu sprechen, was Helena Deneke auch im Jahr 1951 noch auf Veranstaltungen des DFR vermißte474:
470 Vgl.: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Naturrecht und Staatswissenschaft, hrsg. von Helmut Reichelt, Frankfurt a. M. 1972 [Erstausgabe 1821]. 471 Die Begriffe ‚Bürgergesellschaft‘ und ‚Zivilgesellschaft‘ werden teilweise synonym verwendet, teilweise voneinander abgegrenzt. Vgl.: Klein, Ansgar: Der Diskurs der Zivilgesellschaft. Politische Kontexte und demokratietheoretische Bezüge der neueren Begriffsverwendung, Opladen 2001. 472 Der Historiker Manfred Hettling fordert seit mehr als zehn Jahren eine „neue Bürgerlichkeit“ – womit er auf die Übernahme von Verantwortung durch zivile Akteure für die Gesellschaft anspielt. Vgl.: o. V.: „Wie sollen wir leben?“ Warum nur die neue Bürgerlichkeit unsere Gesellschaft retten kann – auch wenn sie neue Ungleichheit erzeugt. Ein Interview mit dem Historiker Manfred Hettling, in: Die Zeit, Nr. 11, 9.3.2006; Hettling, Manfred: Bürgerlichkeit als politische Ordnungsidee, in: Rotary Magazin, November 2005, 36–40 sowie ders.: „Bürgerlichkeit“ und Zivilgesellschaft. Die Aktualität einer Tradition, in: Reichardt, Seven/Jessen, Ralph/Klein, Ansgar (Hrsg.): Zivilgesellschaft als Geschichte. Studien zum 19. und 20. Jahrhundert, Wiesbaden 2004, 45–63. 473 Vgl.: Gohl, Christopher: Bürgergesellschaft als politische Zielperspektive, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6-7/2001. 474 Bodleian Library, MSS, Papers of Clara Sophie Deneke, Box 41, Report on the journey in Rhineland and Westphalia – M.C. Cornell, H.C. Deneke, March 27th–April 24th, 1951, S. 2.
968 | Theanolte Bähnisch
den Wert der Toleranz für die überparteiliche Frauenbewegung. Die Voraussetzungen, die für eine konstruktive Arbeit im DFR geschaffen werden müßten, erklärte Bähnisch in Pyrmont, seien „Toleranz und sachliche Arbeit“475. Glaubhaft mahnte sie in ihrer Rede zur Umsetzung der Theorie in die Praxis: Ohne „echte Toleranz“ sei kein wirkliches „Gemeinschaftsleben“ möglich. Intoleranz sei, als Ergebnis der „Zerrüttung“ menschlicher Beziehungen, eine „mangelnde Achtung vor der Persönlichkeit des anderen“476. Daß die Präsidentin die Rolle des DFR in der Gestaltung des ‚Gemeinschaftslebens‘ sah und damit an ihre Rede anläßlich der Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘ anknüpfte, läßt sich auf Ferdinand Tönnies und auf seine Vorstellung der Orientierung des Einzelnen an einem übergeordneten Zweck, einem größeren sozialen „Ganzen“477 zurückführen. Wohl kaum zufällig verwendete Bähnisch auch diesen Begriff in ihrer Rede. In der ‚Gesellschaft‘, von der Bähnisch vermutlich bewußt nicht sprach, interagieren, der Lehre Tönnies zufolge, Personen nur, um ihre jeweils individualistischen Vorstellungen zu realisieren. Möglich ist, daß die belesene Juristin deshalb nur selten vom ‚Individuum‘, dafür aber häufig von der ‚Persönlichkeit‘ sprach. Denn im Unterschied zu dem Begriff ‚Individuum‘ war der Begriff ‚Persönlichkeit‘ in der Pädagogik nicht mit dem Odem der eigennützigen und somit gemeinschaftsfeindlichen Haltung belegt.478 Helmut Pleßners bereits 1924 verfaßte Kritik, Tönnies’ Lehre sei antimodern, da sie individuelle Persönlichkeiten auf ein Bild einzuschwören versuche, schien die Regierungspräsidentin wenig interessiert zu haben. Mit ihrer Vorstellung von einer ‚gemeinsamen Frauenauffassung‘ stand sie nämlich im grundsätzlichen Widerspruch zu Pleßners Überzeugung. Ihr wiederholtes Rekurrieren auf den Volksbegriff im weiteren Verlauf ihrer Rede macht deutlich, daß sie auch der Idee von der ‚Gemeinschaft des Blutes‘, welche Pleßner mit der von ihm ebenfalls stark kritisierten Jugendbewegung verband479, nicht ganz fernstand – wenn sie auch die pervertierten Auswüchse jener Idee im Dritten Reich scharf verurteilte. In der Verwendung des Volksbegriffs auf der einen und der Betonung der eigenen Vergangenheit als Widerstandsaktivistin auf der anderen Seite lag kein Widerspruch, zumal der Volksbegriff auch in Kreisen gebraucht wurde, denen man eine Affinität zur nationalsozialistischen Ideologie nicht unterstellen kann. Dennoch läßt sich eine interessante Tendenz an Theanolte Bähnischs Art der Selbstdarstellung feststellen: Dort, wo die Regierungspräsidentin möglichst viele motivieren wollte,
475 DFR-Archiv, Freiburg, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 7. 476 Ebd. 477 Tönnies, Ferdinand: Gemeinschaft und Gesellschaft, Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen, Berlin 1887, passim, online auf: http://www.deutschestextarchiv.de/toennies/gemeinschaft/1887/, am 13.12.2013. 478 Vgl.: Großkopf: Persönlichkeit, S. 20. 479 Vgl. dazu: Eßbach, Wolfgang: (Hrsg.): Plessners 'Grenzen der Gemeinschaft'. Eine Debatte, Frankfurt a. M. 2002. Vgl. auch: Plessner, Helmuth: Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des Sozialen Radikalismus, mit einem Nachwort von Joachim Fischer, Frankfurt a. M. 2002, [Erstausgabe 1924].
Wachsende Prominenz | 969
sich am Wiederaufbau zu beteiligen, benutzte sie besonders jene Begriffe, die sie für geeignet gehalten haben muß, ihre Adressaten zur Zusammenarbeit und zum Zusammenhalt zu motivieren. Dort, wo sie darauf angewiesen war, mit einer ‚weißen Weste‘ zu glänzen – also im Fragebogen der Britischen Militärregierung, von dessen Beantwortung ihre Zulassung zum öffentlichen Dienst abhängig war und auf ihrer Reise nach Großbritannien – hob sie auf ihre Beziehungen zum Widerstand ab. Wenn sie als DFR-Präsidentin auftrat, war vom Widerstand gegen den NS, der nach Kriegsende noch viele Jahre lang in die Nähe des Landesverrats gestellt wurde, keine Rede. Auch, daß sie im Dritten Reich in Erwägung gezogen hatte, auszuwandern, war eine Information, die ihr für die Augen der Alliierten, nicht aber für die Ohren ihrer deutschen Zuhörer geeignet erschien. Auch in dieser Hinsicht befand sie sich mit Adolf Grimme in guter Gesellschaft.480 Denn der Kultusminister erwähnte seine Rolle im Widerstand in der deutschen Öffentlichkeit nicht. Der Historiker und Grimme-Biograph Kai Burkhardt resümiert, daß „Grimmes Verhalten […] als Muster unter ehemaligen ‚Widerstandskämpfern‘ in der Bundesrepublik erstaunlich verbreitet“481 war. Besondere Vorsicht war, was Burkhardt nicht in das Zentrum seiner Argumentation stellt, für Grimme vor allem deshalb geboten, weil er durch sein Engagement in der ‚Roten Kapelle‘ – einem losen Netzwerk miteinander in Kontakt stehender verschiedener Widerstandsgruppen, das zu Unrecht jahrzehntelang als sowjetische Spionageeinrichtung gehandelt wurde482 – leicht mit kommunistischen Kreisen in Verbindung hätte gebracht werden können – was in der BRD in den Nachkriegsjahren einem politischen und damit beruflichen Todesurteil gleich gekommen wäre. Kein Wunder also, daß Bähnisch, die als Gegenpart zu den Kommunistinnen wahrgenommen werden wollte, es tunlichst unterließ, jene Karte vor größerem Publikum zu spielen. Schließlich gehörte, wie an anderer Stelle bereits erwähnt, auch der Kreis um Ernst von Harnack, mit dem sie sich politisch verbunden sah, zum Einzugsgebiet der ‚Roten Kapelle‘. Daß beide Phänomene – die ‚volksgemeinschaftsnahe‘ und ‚widerstandsorientierte‘ Frau Bähnisch – sich in ihrer Außendarstellung überlappten und daß sie vermutlich überhaupt keinen Widerspruch in ihrer Außendarstellung sah, mag darin begründet gewesen sein, daß sie ‚nach vorn‘ schauen wollte und sich für sich selbst, wie auch für die deutsche Bevölkerung, einen Neuanfang und einen raschen Wiederaufbau als einendes Projekt wünschte. Voraussetzung für ihre Beteiligung am deutschen Wiederaufbau war, daß sie sich den Alliierten gegenüber so weit wie möglich vom Nationalsozialismus distanzierte. Daß der erstrebte Neuanfang von seinem schwierigen Erbe nicht so einfach zu befreien war, bewies jedoch nicht zuletzt der Sprachgebrauch, mit dem Bähnisch – ob sie die Worte nun mehr oder weniger bewußt benutzte – die Bevölkerung auf den Wiederaufbau einschwören wollte. Die Militärregierung übte hieran keine Kritik. El-
480 Vgl.: Burkhardt: Schweigen. 481 Ebd., S. 89. Burkhardt verweist an dieser Stelle auf Scholtyseck, Joachim/Schröder, Stephen (Hrsg.): Die Überlebenden des deutschen Widerstandes und ihre Bedeutung für Nachkriegsdeutschland, Münster 2006. 482 Siehe Kapitel 4.2.3.2.
970 | Theanolte Bähnisch
se Reventlow, die Leiterin des SFAK, den Gabriele Strecker als „stärker antifaschistisch-kämpferisch“483 als den DFR beschrieb, kritisierte jedoch, wie erwähnt, die nationale Rhetorik, welche auf der Konferenz von Pyrmont herrschte, jedoch scharf, erkannte im von Bähnisch beschworenen „Aufbruch der Frauen von 1949“ sogar eine „Renaissance des Aufbruchs von 1933“484. Es ist nicht sicher, aber doch wahrscheinlich, daß Bähnisch auch die Überwindung der Gräben zwischen jenen, die für die nationalsozialistische Idee gebrannt hatten, und jenen, die ihre Gegner gewesen waren, im Auge hatte, als sie den Wert der Toleranz und die Notwendigkeit ihrer praktischen Umsetzung predigte. So gesehen hätte sie Toleranz auch gegenüber jenen erwartet, für die im Dritten Reich Intoleranz zur Gewohnheit geworden war, die jene als Bürger ‚ihres‘ Staates nicht toleriert hatten, die durch eine abweichende Religion, politische Einstellung, Lebensweise, Hautfarbe oder Abstammung aufgefallen und/oder durch gesellschaftliche Stigmatisierung, Verfolgung und Vernichtung auffällig gemacht worden waren. Für die „Gesundung des gesamten Volkslebens“485 sei es wichtig, so führte Bähnisch aus, zunächst die „Beziehung von Mensch zu Mensch wieder in Ordnung zu bringen“, was ein hohes Maß an „Selbstkritik“ und „Selbstkontrolle“486 erfordere. An dieser Stelle argumentierte die Juristin stark pädagogisch. Sie forderte konstruktive Diskussionen anstelle des Übertönens anderer Meinungen. Frauen, so bemühte sie erneut die angenommene Wesensverschiedenheit von Mann und Frau, müßten ganz besonders um Toleranz bemüht sein, denn ihnen falle es leichter, zuzuhören, mitzufühlen und Gegensätze zu überbrücken. Sie legte also die Verantwortung für die Überwindung gesellschaftlicher Spaltungsprozesse an der Schwelle zur zweiten Demokratie in die Hände der Frauen. Die Frage, ob sich nicht – wenn es Frauen ohnehin leichter fallen solle, Gegensätze zu überbücken – im Umkehrschluß vor allem Männer in Toleranz hätten üben müssen, drängt sich auf, sie bleibt aber unbeantwortet. Weder, wenn von einer ‚gemeinsamen Frauenauffassung‘, noch wenn von der ‚Gemeinschaft‘ oder von der Zusammengehörigkeit des ‚Volkes‘ oder von ‚Toleranz‘ die Rede war, berücksichtigte Bähnisch jenen Teil des ‚deutschen Volkes‘, der im Osten Deutschlands lebte. Daß die Frauen in der zu diesem Zeitpunkt bereits gegründeten DDR nicht Ansprechpartner von Bähnischs Rede waren, war allein schon daran zu ersehen, daß die DFR-Präsidentin die Genese der deutschen Frauenbewe-
483 Gabriele Strecker zitiert nach Zepp: Redefining, S. 163. 484 DFR-Archiv, A2, Notgemeinschaft 1947, Else Ulich-Beil an den Deutschen Frauenring Hannover, 22.12.1949. Else Ulich-Beil sah sich veranlaßt, diese Äußerung „eine unverschämte und üble Verdächtigung“ zu nennen. Ebd. Reventlow war offensichtlich gemeinsam mit anderen Mitarbeiterinnen des Bayerischen Rundfunks in letzter Minute zur Konferenz erschienen und mit der Begründung, daß sie im Vorfeld die Kommunikation über den geplanten Zusammenschluß verweigert habe, des Saals verwiesen worden. AdSD, Nachlaß Else Reventlow, Nr. 43, Bähnisch an den Generaldirektor des Bayrischen Rundfunks, 24.10.1949 und ebd., Bayrischer Rundfunk, Chefredaktion an Bähnisch, 14.11.1949. 485 DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 7. 486 Ebd.
Wachsende Prominenz | 971
gung nach 1945 anhand der Arbeit von „Frauenpersönlichkeiten in allen Ländern und Orten des Bundesgebiets“487 nachzeichnete – als hätte es jenseits dieses Gebiets keine Frauenbewegung gegeben. Die Frauen, die in der Rede Bähnischs nicht vorkamen, waren auch auf der Konferenz nicht sichtbar, denn DDR-Bürgerinnen waren zur Konferenz nicht erschienen.488 Anders als im Veranstaltungsprotokoll wurde in Bähnischs Rede weder der ‚Osten‘ noch der ‚Ost-West-Konflikt‘ erwähnt. Hierin wiederholt sich jene Tendenz des Beschweigens, die auch in der ‚Stimme der Frau‘ zu beobachten ist. Die Regierungspräsidentin sah also in einem Zusammenschluß von gleichzeitig empathischen, toleranten und sachlich versierten Frauen den Schlüssel zum Erfolg für die Frauenbewegung: Auf diese Weise werde es „gelingen das Vertrauen aller derer zu erlangen, die guten Willens sind […] nicht nur auf Grund unserer zahlenmäßigen Überlegenheit, sondern durch die Überzeugungskraft unserer sachlichen Arbeit und fraulich-menschlichen Behandlung der Probleme“489, machte sie den Frauen Mut und beschwor zugleich eine ‚Koalition der Willigen‘490, die im gleichen Atemzug jene als sektiererisch und illoyal brandmarkte, welche eine andere Position vertraten. Die anwesenden Frauen, größtenteils Expertinnen auf ihrem Gebiet, sei es juristisch, historisch, ökonomisch oder sozialpolitisch, teilten die Haltung Bähnischs vermutlich ohnehin. Es ist davon auszugehen, daß die Rede jedoch auch darauf gemünzt war, Wirkung über die Printmedien und den Äther zu entfalten – schließlich wollte sogar der RIAS über die zweite Konferenz von Pyrmont berichten.491 In ihren sich anschließenden Ausführungen zur Sozialpolitik sah Bähnisch nicht vorwiegend den Gegensatz „arm und reich“ als Problem, denn, so sagte sie, „den hatten wir schwächer und stärker zu allen Zeiten“, sondern „die Auswirkungen des katastrophalen Kriegsendes“, vor allem in Form einer allgemeinen Wohnungsnot, die „Familienleben“492 unmöglich mache. Hiermit sprach sie eine Sorge an, die der neue britische Educational Advisor in Deutschland, Mr. Allen, und der Verbindungsoffizier der Briten zum deutschen Parlamentarischen Rat, Roland Chaput de Saintoigne, teilten: „The Foreign Office in their memorandum acknowledges the danger of communist infiltration – what greater bulwark [!] in this menace is the influence of a good home background and in Germany as in all countries“, lautete die Essenz eines Gesprächs dieser beiden wichtigen Personen mit der WGPW. „[I]t is the wo-
487 Ebd., S. 1. 488 Immerhin war Herta Dürrbeck, die als KPD-Mitglied Beziehungen zum DFD unterhielt, laut Protokoll auf der Tagung anwesend. Vgl.: Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 8. 489 DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 7. 490 Berühmt geworden ist der Dualismus zwischen der ‚Koalition der Willigen‘ und der ‚Achse des Bösen‘ in den 1990er Jahren, als George Bush den militärischen Einsatz politisch Verbündeter gegen den Irak einforderte. 491 DFR-Archiv, A2, Hildegard Meding an Theanolte Bähnisch, 29.08.1949. 492 DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 9
972 | Theanolte Bähnisch
man who keeps the standard of the home“493, war man sich in jener Runde einig darüber, daß man dem Kommunismus wirksam begegnen könne, wenn sich die Frauen auf ihre vermeintlichen Kernkompetenzen konzentrierten. Nicht nur mit den Erfahrungen aus der ‚Verwaltung des Mangels‘ als Regierungspräsidentin, sondern auch mit der Tätigkeit ihres Mannes als Prokurist bei der ‚Einheitspreisgesellschaft‘ (EHAPE) – die im Krieg eine wichtige Rolle in der Versorg der Bevölkerung mit lebensnotwenigen Gütern eingenommen hatte – wird es zusammengehangen haben, daß Bähnisch in ihrer Rede auf die Rolle von Frauen in der Wirtschaft zu sprechen kam. Frauen, durch deren Hände 80 Prozent des Volksvermögens gingen, so Bähnisch, müßten auf die „Lenkung der einheimischen Erzeugung, bei der Bestimmung der Importe und bei der Preisgestaltung“494 Einfluß nehmen. Sie müßten im Normungsausschuß, in den Forschungsinstituten, welche sich mit Hauswirtschaft und Ernährungswirtschaft beschäftigen, sowie bei den Wohnungsbaugenossenschaften präsent sein. Überdies müsse die Rationalisierung des Haushalts ihr Ziel sein. „Der Fleiß der deutschen Hausfrau ist ein unschätzbares Volksgut, aber sie kann ihren Hausstand mit der gleichen Liebe betreuen, wenn sie durch technisches Hilfsmittel Arbeitsstunden einspart“495, griff Bähnisch mit ideologisch gefärbten Worten ein Thema auf, das auch in der ‚Stimme der Frau‘ – wie in allen Frauenzeitschriften ihrer Zeit – eine Rolle spielte. Die im Vortrag geäußerte Idee, die Hausfrauentätigkeit mit anderen Berufen gleichrangig zu stellen und sie entsprechend in die Sozialversicherung einzubinden496, läßt sich als ein Kooperationsangebot an den Hausfrauen-Bund, der sein Erscheinen in Pyrmont verweigert hatte, lesen. Den Zusammenhang des ‚katastrophalen Kriegsendes‘ mit dem Krieg als solchem wollte die Regierungspräsidentin vor ihren Zuhörern offenkundig nicht thematisieren. Und der in ihrer Rede beschworenen Solidarität mit den Flüchtlingen und Kriegsopfern in Deutschland, als deren Grundlage sie das ‚nationale‘ herausstellte, stand eine auffällige Nichterwähnung der Holocaust-Opfer, der ausländischen Zwangsarbeiter und der Kriegsgefallenen anderer Länder gegenüber497. „[S]eien wir
493 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C9, Notes for discussions at the meeting of Women’s Group delegation with Mr. Allen, Educational Advisor, and Mr. Chaput de Saintongne, at the German Section of the Foreign Office, Wednesday, October 10th, at 10.15 a. m.”, o. D. 494 DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 11. 495 Ebd., S. 12. 496 Ebd., S. 9. 497 Vgl. zu diesem, auch in der ‚Stimme der Frau‘ zu beobachtenden Ungleichgewicht die Einordnung in meiner Magisterarbeit: Freund: Krieg, S. 106–123. Vgl. als aktuellen Titel auch: Laucht, Christoph/Plowman, Andrew (Hrsg.): Divided, but not Disconnected. German Experiences of the Cold war, Oxford 2010, S. 56. Im Sammelband führt Bill Niven vor Augen, wie sich in Westdeutschland eine Erinnerungspolitik etablierte, „in which remembering Nazi victims seemed less important than scoring points against the Cold war enemy”. Dies war möglich, wenn man über Kriegsgefangene und Flüchtlinge sprach, für deren Leid meist die Sowjetunion verantwortlich gemacht werden konnte.
Wachsende Prominenz | 973
uns bewusst: uns alle hätte […] das Schicksal des Flüchtlings, der Ausgebombten, der Kriegshinterbliebenen treffen können […] wir sind alle Deutsche und haben das gemeinsam zu tragen. Niemand darf sich ausnehmen! Wer das tut, versündigt sich am Ganzen des Volkes“498, setzte die Club-Vorsitzende darauf, Solidarität und Wohlwollen zu erreichen, wo eher Konkurrenzdenken an der Tagesordnung war. Die vielbeschworene deutsche Schicksalsgemeinschaft war nicht so tragfähig, wie Bähnisch und andere hochrangige Verwaltungsbeamte es sich wünschten, die tagtäglich mit so unliebsamen Maßnahmen wie der Einquartierung von Flüchtlingen in die Häuser jener zu tun hatten, die bei den Bombenangriffen stehen geblieben waren. Immerhin fanden die ‚Displaced Persons‘, Bürger anderer Länder, die sich in Folge ihrer Verschleppung nach Deutschland nach 1945 noch immer dort aufhielten, in jenem Teil von Bähnischs Rede, der sich besonders den Flüchtlingen und dabei vor allem den Jugendlichen („Vergessen wir nicht, daß es sich um den Nachwuchs unseres Volkes handelt“499) widmete, Berücksichtigung. Doch diese Ausführungen, in denen die Vize-Präsidentin des deutschen Rates der Europäischen Bewegung, die die internationale Relevanz der Flüchtlingsfrage betonte, dienten weniger dazu, Solidarität mit den Flüchtlingen in anderen Ländern zu zeigen – und sich damit der eigenen Verantwortung zu stellen. Sie sollten vielmehr gewährleisten, daß das Leid deutscher Flüchtlinge im Ausland wahrgenommen wurde. Dies deutet sich in ihrer Aussage an, das ‚Flüchtlingsproblem‘ habe solche Ausmaße angenommen, daß es „nicht nur ein deutsches, sondern ein internationales Problem geworden ist“500. In ihrer Examensarbeit hatte die damals noch junge Dorothea Nolte den Standpunkt vertreten, daß ‚Wohnungsnot‘ – welche nach 1945 Ausgebombte, Kriegsheimkehrer und Flüchtlinge gleichermaßen traf – vor allem ein sittliches Problem sei. Auch 1949 schienen für die im Dunstkreis der SAG sozialisierte Juristin Sozialgesetze nicht vorrangig den Sinn der Nivellierung sozialer Unterschiede und der Garantie eines relativen Wohlstands für alle zu haben. Vielmehr erkannte die Regierungspräsidentin in einer Kernforderung der ‚sozialen Demokratie‘, dem sozialen Wohnungsbau, einen Schlüssel zur Entschärfung ‚unsittlicher Zustände‘ und damit zur Erhaltung einer ‚bürgerlichen Ordnung‘. „[F]ür die Schaffung der äußeren Möglichkeiten zu sorgen, überhaupt wieder ein Familienleben führen zu können“501, erklärte sie deshalb zu einer Hauptaufgabe des DFR. Entsprechend appellierte sie an ein besonderes Engagement der Frauen in den kommunalen Bau- und Wohnungsausschüssen.502 Unterstützten sich die Deutschen nicht gegenseitig, so drohte Bähnisch, „ist damit zu rechnen, daß die sozialen Spannungen sich einen gewaltsamen Ausweg su-
498 499 500 501 502
Niven, Bill: Divided Memory of the Holocaust during the Cold War, in: Laucht/Plowman: Divided, S. 49–62. DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 10. Unterstreichung im Original. Ebd., S. 10. Ebd. Ebd. S. 4. Die Vorstände der Ortsringe sollten sich zur Behandlung dieser Frage bei der Verwaltung und beim Gemeinderat vorstellen und eine Kooperation einleiten.
974 | Theanolte Bähnisch
chen und damit die Gefahr der Anarchie heraufbeschworen wird“503. Diese Befürchtung zeigte wiederum, daß „arm und reich“ im Denken Bähnischs wohl doch eine Rolle spielten. Jene Frau, die wissen wollte, „nach welchen Prinzipien Menschen ihr Leben in einer Gemeinschaft ordnen“504, hatte offenbar Angst vor dem ‚Aufstand der Elenden‘. Bereits bei ihrem Besuch in Großbritannien hatte sie die Angst vor der Anarchie dazu nutzen wollen, eine stärkere Unterstützung aus Großbritannien zu erreichen.505 Drei Jahre später griff sie das Thema, wiederum im Beisein von Gästen aus dem Ausland, erneut auf. Ihr Blick auf Hilfsbedürftige war über die Jahre also ein stark asymmetrischer geblieben. Nicht die schlechte soziale Lage der Hilfsbedürftigen war Kernthema ihrer Argumentation dafür, daß sich die Verhältnisse im Land bessern müßten, sondern die Bedrohung der ‚bürgerlichen‘ Ordnung und des gerade erst errichteten Staatsgefüges, die von solchen ‚sozialen Brandherden‘ ausging. Der Krieg hatte eine gewisse Nivellierung der Verhältnisse in Gang gesetzt, was bedeutete, daß auch ursprünglich besser gestellte Bürger Gefahr liefen, ‚abzurutschen‘, diese Einsicht schien Bähnisch, wenn es um eine Identifikation mit den Leidtragenden ging, stärker zu beschäftigen, als es die strukturelle Armut in der Gesellschaft tat. Wohl kaum zufällig beschreibt die ‚Stimme der Frau‘ nicht die Schicksale jener Frauen, die schon immer arm gewesen waren, sondern die einst wohlhabenden Frauen, die auf der Flucht alles verloren hatten und damit ihre soziale Sicherheit als vergänglich erfahren hatten.506 Jene Entwicklungen, vermutlich aber auch ihre Erfahrung, nach der Amtsenthebung ihres Ehemannes 1933 ohne ein Festgehalt eine vierköpfige Familie versorgen zu müssen, werden die Regierungspräsidentin für solche Schicksalsschläge sensibilisiert haben. Was ihren Blick auf die besondere soziale Lage Jugendlicher angeht, so ist eine in den Abschluß-Resolutionen der Konferenz durch den DFR vorgebrachte Forderung aufschlußreicher als Bähnischs Rede. Die Forderung nach einem „Bewahrungsgesetz, sowie Fürsorge- und Bewahrungsmaßnahmen“, zur „Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten und der Prostitution“507 ist nämlich vor dem Hintergrund früher Unternehmungen Theanolte Bähnischs in der Korrektur- und Besserungsanstalt Brauweiler besonders erwähnenswert. In Kombination mit der Forderung des ‚Frau-
503 504 505 506
Ebd., S. 10. Clemens: Frauen, S. 202. Siehe Kapitel 6.9.4. Vgl.: Helbing, Klaus: Die Uhr gehört Herrn Sedamore, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 6, S. 10 sowie Zwei gesunde Arme, Leserinnenzuschrift von Anneliese Rick, Rubrik: Wir haben es geschafft, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 2, S. 22 und Ein Speditionsgeschäft, Leserinnenzuschrift von Erna Schmid, Rubrik: Wir haben es geschafft. Leserinnen schreiben, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 3, S. 22. Für die Interpretation vgl.: Freund: Krieg, S. 113–115. Die Texte beschreiben jeweils den Verlust, aber auch den Neuanfang und den Wiederaufbau der Existenzen, sie sind also darauf ausgerichtet, an den Durchhaltewillen der Leserinnen und den Mut zum Neuanfang zu appellieren. Gleichzeitig bedienen sie, da die Schicksale jeweils als Folge der Handlungen von Russen dargestellt werden, das kommunistische/slawische Feindbild. 507 DFR-Archiv, A1, Referat/Bericht „Deutscher Frauenring“, o. V., o. D [ca. 1951].
Wachsende Prominenz | 975
enrings der britischen Zone‘ von 1947, die „Unterbringung arbeitsscheuer und verwahrloster Jugendlicher in Heimen“, zu ermöglichen „um sie wieder an soziale Ordnung und geregelte Lebensführung zu gewöhnen“, und zu diesem Zweck umgehend eine „Verordnung über Arbeitserziehung“508 zu erlassen, zeigt sie, daß sich die Vorsitzende des Frauenrings auch nach 1945 eine starke Hand des Staates in der „Jugenderziehung“509 wünschte. Auch hieran wird deutlich, daß Bähnisch, wenn sie an Sozial- oder Gesundheitspolitik beziehungsweise an Jugenderziehung dachte, vor allem die Gesundheit und Sicherheit der Gesamtbevölkerung im Blick hatte. Tatsächlich bewiesen, um nur ein Beispiel zu nennen, die Zustände im ‚Mädchenerziehungsheim Fuldatal‘, das im ehemaligen Zwangsarbeiterlager Breitenau untergebracht war, daß die Umstände, unter denen in den 50er und 60er Jahren die Rückführung auffälliger Jugendlicher in die Gesellschaft vorbereitet werden sollte, so verschieden von jenen in Brauweiler in den 20er Jahren gar nicht waren.510 Es wäre ein interessantes Unterfangen, herauszuarbeiten, welche Rolle der DFR und die ihm angeschlossenen Verbände beziehungsweise jene, die mit ihm zusammenarbeiteten, in solchen Zusammenhängen spielten. Ein „verstecktes Bewahrungsgesetz“511 wurde, obwohl sich die CDU-Fraktion mit Heinrich von Brentano an der Spitze schon 1949 im Bundestag dafür einsetzte, erst 1962 im Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes verabschiedet, jedoch fünf Jahre später mit Verweis auf die starken Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte für verfassungswidrig erklärt.512 8.3.9 Die Arbeits-Ausschüsse des DFR – Ein wichtiges Forschungsfeld für eine Organisations-Geschichte Die von Bähnisch proklamierten Ziele und Ideen schlugen sich in acht Arbeitsausschüssen nieder, die der DFR noch während der Pyrmonter Tagung einsetzte. In diesem Vorgehen, von dem Helena Deneke für die zonale Ebene befürchtet hatte, es könne wertvolle Energien zu stark splitten, lag nun eine Chance zur Überwindung der Diskrepanz zwischen der ursprünglichen Idee, daß sich im Frauenring nur solche Verbände, deren Ziel die staatsbürgerliche Frauenbildung war, zusammenschließen sollten, und dem neuen Anspruch, daß der DFR eine Plattform für ‚alle Fraueninteressen‘ sein sollte. So sollte im ‚Ausschuß für staatsbürgerliche Mitarbeit der Frau‘,
508 BArch, DY 30, IV 2/12/99, Frauenarbeitstagung Bad Pyrmont am (!) 20. bis 23. Juni, Nora Melle und Anne-Marie Durand-Wever, S. 10. Der Bericht scheint die OriginalResolutionen des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ zu erhalten. 509 Ebd. 510 Vgl. dazu: Grötecke, Johannes/Schattner, Thomas: Der Freiheit jüngstes Kind – 1968 in der Provinz. Spurensuche in Nordhessen, Marburg 2011, S. 103–108. 511 Ayaß, Wolfgang: Rezension über: Willing, Matthias: Das Bewahrungsgesetz. Eine rechtshistorische Studie zur Geschichte der deutschen Fürsorge, Tübingen 2003, in: HSoz-u-Kult, 26.01.2004, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2004-1-045, am 13.12.2013. 512 Ebd. Zu den Diskussionen um das Bewahrungsgesetz ab 1945 in Deutschland vgl.: Willing: Bewahrungsgesetz, S. 209 ff.
976 | Theanolte Bähnisch
dessen Leitung die erst 1911 geborene und 1938 zum Dr. phil promovierte Dr. Wanda von Baeyer(-Katte) übernahm513, jene Arbeit geleistet werden, die sich auf die staatsbürgerliche Frauenbildung konzentrierte. Entsprechend ausgerichtete Verbände sollten hier eine organisatorische Basis, auf der sie eng zusammenarbeiten konnten, finden. Mit Baeyer, Schriftstellerin und Ehefrau eines jüdisch-stämmigen Psychiaters sowie dreifache Mutter514, saß jenem Ausschuß eine Frau vor, die aktiv in kommunalpolitische Zusammenhänge eingebunden war und dem Bundeshauptausschuß der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU angehörte. Wie es scheint, war sie mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen eine passende und professionelle Besetzung für diesen Arbeitsbereich. Andere Ausschüsse sollten kooperationsbereite Verbände ansprechen, die ihre Hauptaufgabe in anderen Feldern sahen, beispielweise in der sozialen Arbeit oder im Hauswirtschaften. Die organisatorischen Ausgangsbedingungen, die in Pyrmont festgelegt wurden, waren insgesamt denkbar ungewöhnlich, und es muß einer eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit vorbehalten bleiben, zu untersuchen, wie praktikabel die angedachte Struktur in der Realität war: Die Arbeitsausschüsse sollten sich nämlich „als Schwerpunkte auf die Länder verteilen“515, womit die Arbeit der jeweiligen Landesringe auf entsprechende Inhalte festgelegt gewesen war, während der Bundesvorstand die Arbeit aller Ausschüsse untereinander zu koordinieren hatte. Im Rahmen einer Organisations-Geschichte des DFR herauszuarbeiten, wie die Ortsringe, die ja organisatorisch von den Landesringen abhingen, aber gleichzeitig zu verschiedenen Themen arbeiten sollten516, mit dieser Herausforderung umgingen, wäre ein lohnenswertes Unterfangen. Was „unter Erhaltung der Vielfalt [...] zu einer innerlich gleichgerichteten Arbeit“517 führen sollte, zog vielleicht – der Gedanke drängt sich unweigerlich auf – chaotische Verhältnisse oder zumindest undurchsichtige Strukturen nach sich. Inwiefern – und wenn ja, wie lange – diese untypische Idee tatsächlich umgesetzt worden ist, läßt sich anhand der ausgewerteten Quellen nicht nachvollziehen. Dem Protokoll nach scheint der Plan bereits im Lauf der Pyrmonter
513 Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 8 514 Vgl.: Art. „Baeyer, von, Wanda Marie“, in: Degeners Wer ist’s?, 12. Ausgabe, Berlin 1955, S. 611. Baeyer arbeitete die Nürnberger Prozesse literarisch auf und verfaßte gemeinsam mit ihrem Mann, dem Psychiater Walter Ritter von Baeyer, 1971 eine politischpsychologische Analyse des Nationalsozialismus. Vgl. dazu: Art.: „Walter Ritter von Baeyer“ (1904–1987), in: Hippies, Hans/Holdorff, Bernd/Schliack, Hans (Hrsg.): Nervenärzte, Bd. 2, Biographien, Stuttgart 2006, S. 19–28, hier S. 22. Die KPD-Politikerin Erika Buchmann betitelte von Baeyer in ihrem Bericht über die Pyrmonter Konferenz an den DFD als „sehr reaktionär, war grosse Führerin in NS-Frauenschaft“. BArch, SAPMO DY 30/IV 2/17/99, Buchmann, Erika: Bericht über den Frauenkongress in Bad Pyrmont, der vom 7.–10. Oktober stattfand, 1949, S. 21. 515 Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 2. 516 Beispielsweise muß Bähnisch in Pyrmont geäußert haben, daß in jedem Ortsverein die Gesetze, die dem Gleichberechtigungsartikel im Grundgesetz angepaßt werden mußten, diskutiert werden sollten. O. V.: Geist. 517 Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 2.
Wachsende Prominenz | 977
Konferenz zumindest teilweise aufgeweicht worden zu sein. So hatte die nationalsozialistisch vorbelastete Juristin Dr. Maya Hering-Hessel518 als Leiterin des Rechtsausschusses beantragt, daß dessen Mitglieder „in süddeutschen und norddeutschen Arbeitskreisen“ getrennt arbeiten und ihre Ergebnisse untereinander austauschen sollten.519 Unzufriedenheit schien vorprogrammiert zu sein, wenn „jeder Landesverband sich den Aufgaben widmen“ sollte, „die seine Mitglieder am stärksten interessieren“520, denn es ist unwahrscheinlich, daß die Interessen aller Mitglieder eines Landesverbandes auf einen inhaltlichen Nenner gebracht werden konnten und daß am Ende doch alle für die Arbeit des DFR als wichtig erachteten Themen einen Landesausschuß fanden, der sich tatsächlich per Mehrheits-Votum mit dem jeweiligen Thema auseinandersetzen wollte. Die Statuten des ‚Club deutscher Frauen‘ und anderer Zusammenschlüsse, die nach dessen Statuten arbeiteten, hatten die an einer Mitarbeit im Frauenring interessierten Frauen glauben lassen, daß die Organisationen, welche sich ‚Frauenringe‘ nannten, jeweils eine Vielzahl von Themen behandeln und sich verschiedenen Aufgaben widmen würden. Ob womöglich sogar Mitglieder austraten, weil sie organisatorisch an einen Landesverband gehörten, der ein Thema bearbeitete, mit dem sie sich nicht identifizieren konnten, wäre ebenfalls eine Frage für eine Organisations-Geschichte des DFR. Gabriele Strecker zufolge lag die oberste Priorität der Arbeit des DFR zunächst auf dem ‚Ausschuß für staatsbürgerliche Erziehung und Bildung‘.521 Dieser erhielt 1949 endlich die Chance, seinem erklärten Ziel gerecht zu werden, weil nun, mit der Bundesrepublik, endlich ein Staat etabliert war, an dessen Wesen sich die staatsbürgerliche Erziehungsarbeit orientieren konnte. Einen wesentlichen Teil der Vortragsund Organisations-Arbeit des Ausschusses übernahm Bähnisch zufolge Dr. Hanna Vogt, die bei der Hessischen Landeszentrale für Heimatdienst tätig war und sich später als Protagonistin deutsch-jüdischer Zusammenarbeit hervortat.522
518 Der Historikerin Nancy Reagin zufolge war Hering-Hessel, die 1932 im Anschluß an Drechsler-Hohlt kurzzeitig den Staatsbürgerinnen-Verband in Hannover geleitet hatte, nach 1933 eine erfolgreiche Karriere in der NS-Frauenschaft vergönnt. Vgl.: Reagin: A German Women’s Movement, S. 243/244. Offenbar war Hering-Hessel für die Gaufrauenschaft als Rechtsberaterin in der Wehrwirtschaft tätig. Vgl.: Rüping, Hinrich: Rechtsanwälte im Bezirk Celle während des Nationalsozialismus, 2. Aufl., Berlin 2010, S. 172. 519 Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 8. 520 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 172. 521 Vgl.: Strecker: Frauenarbeit, S. 15–19. 522 Vgl. dazu auch die Publikation: Vogt, Hanna/Büro für Frauenfragen in der Gesellschaft zur Gestaltung öffentlichen Lebens (Hrsg.): Die Fibel der Staatsbürgerin, Wiesbaden 1952. Die 1910 geborene Vogt setzte sich intensiv mit dem Nationalsozialismus auseinander (Vgl.: Vogt, Hanna: Schuld oder Verhängnis? 12 Fragen an Deutschlands jüngste Vergangenheit, Frankfurt a. M./Berlin/Bonn, 1961) und hatte zeitweilig den Vorsitz der Gesellschaft für Christlich–Jüdische Zusammenarbeit inne. Nach deren Eröffnung war sie bei der hessischen Landeszentrale für Heimatdienst tätig. Nachdem sie ursprünglich der KPD angehört hatte und in diesem Zusammenhang im KZ Moringen interniert war, trat sie nach Kriegsende in die FDP ein. 1962 wurde sie Mitglied der SPD. Vgl.: Art. „Dr.
978 | Theanolte Bähnisch
In den Jahren des Ringens um die deutsche Einheit habe, so Strecker, vor allem der ‚Ausschuß für gesamtdeutsche Fragen‘, der sich am 06.12.1949 konstituierte523, Gewicht angenommen. Seine Vorsitzende Nora Melle, die in der ersten Legislaturperiode der Stadtverordnetenversammlung von Berlin 1946-1948 Abgeordnete der LDP war, habe hinsichtlich der Tätigkeit des DFD „sehr aufklärend gewirkt“524 – also Frauen in Westdeutschland über den Charakter der SED-gesteuerten Organisation, die sich einen überparteilichen Anstrich gab, informiert. Daß Melle im Rahmen eines von den USA etablierten Besuchsprogramms auf Einladung und auf Kosten des Civil Affairs Department von OMGUS im Februar 1949 in die USA gereist war525, ist als Zeichen für das wachsende Interesse der USA an der überparteilichen Frauenarbeit in Deutschland vor dem Hintergrund des Kalten Krieges zu werten – und gleichzeitig für den Einfluß, den man Melle in jenem Bereich zuschrieb. Bähnisch, Großbritannien und die USA setzten auf die Multiplikatorinnen-Funktion Melles, die nicht nur selbst über die ‚Gefahr‘, die vom DFD ausging, informierte, sondern sich, Bähnisch zufolge, auch darum bemühte, „Frauen so zu unterrichten, daß sie selbst darüber sprechen konnten.“526 Daß Melle in der frühen Zeit selbst im DFD aktiv war, wirkte sich für ihre Arbeit im DFR praktisch aus, kannte sie doch die grundlegenden Positionen und die einflußreichen Personen im Verband. Strecker und Bähnisch zufolge waren 1952 drei Arbeitskreise des gesamtdeutschen Ausschusses gegründet worden: ‚Gesamtdeutsches Gespräch und gesamtdeutsche Wahlen‘, ‚Arbeit im Westen‘ und schließlich ‚Propaganda, Presse, Arbeit in den Osten‘527. Die von diesen drei Arbeitskreisen erarbeiteten Anregungen seien laut Strecker vom DFR auf seiner Tagung in Königswinter im Januar 1952 fast vollständig übernommen worden und hätten die Grundlage für die gesamtdeutsche Arbeit des DFR gebildet, der Melle bis zu ihrem Tod 1959 ihr Hauptinteresse gewidmet habe.528 Daß Nora Melle, die Mitbegründerin des Staatsbürgerinnenverbandes, dem gesamtdeutschen Ausschuß vorsaß529, entbehrt nicht einer gewissen Logik, denn der Staatsbürgerinnenverband arbeitete als einer von zwei Berliner Landesringen im DFR. Durch seinen Sitz in der umkämpften Stadt schien er, wie auch der Berliner Frauenbund, bestens dazu geeignet zu sein, Informationen aus Ost und West zu kanalisieren. Jene vermutete Strategie des DFR äußerte sich auch in der Wahl zunächst der Berlinerin Ulich-Beil zur ersten Vorsitzenden des DFR 1952 und Melles zur ge-
523 524 525 526 527 528 529
Hannah Vogt“, auf: KZ Gedenkstätte Moringen, Geschichte, http://www.gedenkstaettemoringen.de/geschichte/maenner/schutzhaft/schutzhaft.html, am 13.12.2013. DFR-Archiv, A2, Melle an DFR Hannover, Bähnisch, 11.12.1949. Strecker: Frauenarbeit, S. 19. NA, UK, FO 1050/1230, Rita Ostermann an V. Williams, Education Branch Hannover, Women’s Affairs, 19.02.1949. Bähnisch: Wiederaufbau, S. 175. Strecker: Frauenarbeit, S. 19. Vgl. auch: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 175. Vgl.: Strecker: Frauenarbeit, S. 19. Vgl.: Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 10.
Wachsende Prominenz | 979
schäftsführenden Vorsitzenden530 der Organisation im Jahr 1956. Neben seinem Schwerpunkt in Westdeutschland wollte der DFR verständlicherweise auch einen Schwerpunkt in Berlin bilden.531 Das Bundesinnenministerium, mit dem man im Ausschuß erklärtermaßen eng zusammenarbeiten wollte, war allerdings nicht eben um die Ecke, sondern in Bonn gelegen, und wie den „Frauen aus der Ostzone“ durch die Ausschuß-Arbeit das „Bewußtsein gegeben werden“ sollte, „dass der deutsche Frauenring sich voll für sie verantwortlich fühle“532, blieb am Konferenztag ungeklärt.533 Daß Melle an jenem Tag schon wußte, daß, finanziell gefördert vom Bundesinnenministerium, in allen Ortsringen später einmal ‚Päckchen für die Ostzone‘ gepackt werden würden534 und daß die gesamtdeutsche Fürsorge des DFR – wenn auch mit politischem Impetus – vor allem eine materielle sein würde, ist unwahrscheinlich. Darüber, wie sich im Lauf der Zeit aus der ‚Paketaktion für die Ostzone‘ die offenbar weiter gefaßte ‚Osthilfe‘ des Verbands entwickelte, könnten die Überlieferung des Staatsbürgerinnenverbands, der ja als entsprechend tätiger Landesring fungierte, sowie der Nachlaß Nora Melles Aufschlüsse bringen.535 Der Leiterin der ‚Osthilfe‘, Anneliese Dittmann, wurde für ihre Aufgabe, von der sie, Ulich-Beil zufolge, „geradezu besessen“536 gewesen sei, das Bundesverdienstkreuz verliehen. Auf der Ebene des Landesrings Niedersachsen leitete Erika Overmann die Paketaktion 27 Jahre lang.537 Aus einem Schreiben Else Ulich-Beils an den DFR Hannover geht hervor, daß im November 1949 zumindest eine Gruppe des Staatsbürgerinnenverbandes im Sinne des DFR – im Ostsektor der Stadt – arbeitete.538 Es steht zu vermuten, daß weitere Nachforschungen erhellende Erkenntnisse zutage fördern würden. Um herauszufinden, inwiefern die Mitglieder des Ausschusses für gesamtdeutsche Fragen personengleich mit den Mitgliedern des Staatsbürgerinnenverbandes, aus dessen Mitte der Ausschuß entstand, waren und blieben, bedarf es ebenfalls einer
530 Dieses Amt war nicht mit dem Amt der ersten Vorsitzenden identisch. Letzeres hatte zu dieser Zeit Else-Ulich-Beil inne. 531 Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 177. 532 Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 10 533 Zumindest liefert das Protokoll keine entsprechenden Hinweise. 534 Vgl.: Koepcke, Cordula: Frauen verändern die Welt, Opladen 1997, S. 10. Die Idee schien von Freda Wuesthoff zu stammen. DFR-Archiv, A2, Protokoll der 1. Sitzung des Ausschusses für gesamtdeutsche Fragen am Dienstag, den 6. Dezember, 11 Uhr, Nora Melle, 12.12.1949. 535 Sowohl der Nachlaß als auch die Akten des Staatsbürgerinnenverbandes (Bundesverband) sind überliefert im Archiv des Deutschen Staatsbürgerinnenverbandes in Berlin. Vgl.: http://www.staatsbuergerinnen.org/, am 13.12.2013. Bestandsbezeichnungen werden auf der Homepage nicht genannt. 536 Vgl.: Ulich-Beil: Weg, S. 223. 537 Vgl.: O. V.: Aktuelles. Frau Erika Overmann, Bankkauffrau, starb am 04.12.2013 im Alter von 99 Jahren, auf der Homepage des DFR-Niedersachsen, http://www.dfrniedersachsen.de/index.html, am 14.02.2014. 538 DFR-Archiv, A2, 23.11.1949, Notgemeinschaft 1947, Else Ulich Beil an DFR Hannover, 23.11.1949.
980 | Theanolte Bähnisch
eingehenden Sichtung der Unterlagen des Staatsbürgerinnenverbandes. Nelly Friedensburg, die sich gemeinsam mit Bähnisch bei den Soroptimistinnen engagiert hatte und dem Staatsbürgerinnenverband angehörte, war jedenfalls unter den AusschußMitgliedern, von denen neun aus Berlin und sechs aus den Westzonen stammten. Auch Else Ulich-Beil und Hildegard Meißner gehörten zum Ausschuß.539 Wegen der als notwendig erachteten Reformen des Familienrechts und der angestrebten Anpassung aller Rechte an den Gleichberechtigungsartikel kam auch dem Rechtsausschuß im DFR eine besondere Bedeutung zu.540 Die Berichterstattung über Rechte von Frauen in Ehe, Familie und Beruf in der ‚Stimme der Frau‘ zeigt, daß Theanolte Bähnisch diesem Teil der Arbeit des DFR ebenfalls eine herausragende Bedeutung beimaß. Ihr zufolge bildete der Ausschuß eine Arbeitsgemeinschaft mit dem ‚Verein der Juristinnen und Volkswirte‘ und der Gruppe der Juristinnen im Akademikerinnen-Bund. Die Idee, über die Ausschüsse andere Verbände zur Kooperation mit dem DFR zu bewegen, schien, wie dieses Beispiel zeigt, also funktioniert zu haben. Maya Hering-Hessel wurde 1951 von Dr. Erna Scheffler, Richterin am Bundesverfassungsgericht, in der Leitung des Ausschusses abgelöst.541 In Anbetracht der noch immer vorherrschenden materiellen Notlage im Land, wurde in Pyrmont auch ein ‚Ausschuß für Volks- und Heimwirtschaft‘ gegründet. Dr. Ilse Krall, die Christdemokratin und Initiatorin des Heidelberger Frauenvereins, die den Ausschuß leiten sollte, betonte, vermutlich basierend auf Informationen aus ihrem Engagement in der Heidelberger Kommunalpolitik, daß die Behörden der Beteiligung von Frauen „als Vertreterin der Verbraucherseite“542 aufgeschlossen gegenüberstünden. Leonore Mayer-Katz übernahm den Ausschuß ‚Wohnung und Siedlung‘ (später ‚Bauen und Wohnen‘), um in ihm dafür zu arbeiten, daß „nicht nur 300.000 Wohnungen pro Jahr“ gebaut würden, sondern „viel mehr“, wozu „billige Baumethoden“543 vonnöten seien. Sie leitete den Ausschuß bis 1950, dann übernahm die Leitung zunächst Else Osterloh, bis ihr 1951 Paula Schäfer nachfolgte.544 Der ‚Sozialausschuß‘ sollte vor allem Lösungen für die „Fürsorgeproblematik“ finden und sich mit Flüchtlingsfragen beschäftigen.545 Seine Leiterin, die Fürsorgerin und Mitbegründerin des ‚Club deutscher Frauen‘, Friede Rothig, empfahl sich – in
539 DFR-Archiv, A2, Mitglieder des Ausschusses für gesamtdeutsche Fragen, o. D. [ca. 1951/52] 540 Zu den Ausschüssen vgl.: Strecker: Frauenarbeit, S. 15–19 sowie Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 9. 541 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 172. Bähnisch drückt sich mißverständlich aus, es ist nicht klar, ob Scheffler nur die Arbeitsgemeinschaft oder auch den Rechtsauschuß an sich leitete. Aus einer Jubiläumsschrift geht jedoch hervor, daß Scheffler die Leitung des Ausschusses übernahm. Vgl.: Koepcke, Cordula: Frauen zeigen Flagge. Gesellschaftspolitische Arbeit in Deutschland, Wiesbaden 1985, S. 173. 542 Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 9. 543 Ebd., S. 10. 544 Vgl.: Koepcke: Flagge, S. 174. 545 Vgl.: Strecker: Frauenarbeit, S. 15–19.
Wachsende Prominenz | 981
Anknüpfung an Bähnischs Rede – mit der Aussage, daß sie „die deutsche Familie zu dem machen“ wolle, „was sie einst war: der Grundstock aller Arbeit und allen Lebens.“ Als Fürsorgerin, die einst mit der (Sitten-)Polizei zusammengearbeitet hatte, galt ihr Interesse nicht zuletzt auch der „Frage der Geschlechtskrankheiten und der Prostitution“546, womit sie bei Bähnisch auf offene Ohren gestoßen sein dürfte. Die Historikerin547 und Ministerialrätin im nordrhein-westfälischen Kultusministerium, Luise Bardenhewer betonte als Leiterin des Kulturausschusses die Breite der Aufgaben in der Schule, der Universität und der Verwaltung, in Presse, Film und Kunst,548 die sich dem Ausschuß stellten. Er wurde deshalb schließlich in drei Segmente eingeteilt: 1) Erziehung und Bildung, 2) Schrifttum, Presse und Rundfunk sowie 3) Film und Theater.549 In diesen Segmenten hatten die Initiativen des DFR zur Bekämpfung von ‚Schmutz und Schund‘550, die der Verband unternahm, ihren Ausgangspunkt. Warum der ‚Ausschuß für Frauenberufsarbeit‘, den Grete Burckhardt leiten sollte, ein ‚Unterausschuß‘ war und welchem Ausschuß er unterstand, ist dem Protokoll leider nicht zu entnehmen. Seine Ziele, Frauenarbeit gesundheitlich zu überwachen und rechtliche Sicherungen zur Frauenarbeit zu entwickeln551, waren dagegen recht eingängig. Nicht erwähnt wird von Theanolte Bähnisch in ihrem Rückblick auf die Organisations-Geschichte nach 10 Jahren, der ‚Friedensausschuß‘ – womöglich, weil dessen Aufgaben ab 1952 der geschäftsführende Ausschuß übernahm. Bis 1951 wurde der Ausschuß von Freda Wuesthoff geleitet, danach übernahm Bähnisch bis 1952 selbst die Leitung.552 Auch der Wahlausschuß, bis 1952 geleitet von Dr. Else HeinzePlorkowski, danach von Annemarie Wald, wird von Bähnisch nicht erwähnt.553 Sämtliche Ausschüsse, die erst 1952 oder später eingerichtet wurden, können an dieser Stelle keine Berücksichtigung finden. Vor dem Hintergrund der im Frauenring fortgesetzten Traditionen ist es jedoch wert, erwähnt zu werden, daß der 1952 eingerichtete Finanzausschuß des DFR ein Jahr lang von Elisabeth von Harnack, der Schwester des hingerichteten Merseburger Regierungspräsidenten Ernst von Harnack
546 Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 8. 547 Bardenhewer wurde 1914 mit einer Arbeit zum Safranhandel im Mittelalter zum Dr. phil promoviert. 548 Vgl.: Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 9. 549 Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 174. 550 DFR-Archiv, A1, Geschäftsbericht, vorgelegt auf der Hauptversammlung in Berlin am 28.–29. März 1952, Deutscher Frauenring/Theanolte Bähnisch, 28.03.1952, S. 19. Demnach hatte der DFR durch Anna Mosolf „weil ich glaubte, daß hier in erster Linie eine Pädagogin sachverständig sei“ bis 1952 zumindest Gutachten zu Schriften im Sinne des § 184 StGB (Verbreitung pornographischer Schriften) erstellt. Bähnisch führt dies als Beweis dafür an, „wie sehr unsere Bestrebungen beachtet werden.“ Ebd. 551 Vgl.: Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 9. 552 Vgl.: Koepcke: Flagge, S. 175. 553 Ebd.
982 | Theanolte Bähnisch
geleitet wurde, die sich, wie ihre Schwester Agnes von Zahn-Harnack, in jungen Jahren in der SAG Berlin-Ost engagiert hatte. Obwohl die Organisation ‚Frauenring‘ mit der Gründung auf Bundesebene noch komplexer geworden war, weil ihr mehr Landesringe, beziehungsweise Ausschüsse und zumindest einige zusätzliche Verbände angehörten, kam es nicht zur Einstellung einer bezahlten Kraft für die Organisations- und Schreibarbeit, wie Deneke es empfohlen hatte. Den Löwenanteil der Verwaltungsarbeit übernahm weiterhin Maria Prejawa.554 Die Verbindung zwischen dem Regierungspräsidium Hannover und dem Frauenring bestand also weiterhin nicht nur über Bähnisch, sondern vor allem auch über Bähnischs rechte Hand, die bei der Bezirksregierung als Sozialdezernentin tätig war und die Geschäftsführung des DFR ehrenamtlich leistete.555 Anna Mosolf gehörte zu jener Zeit ebenfalls noch zur Bezirksregierung Hannover, trat jedoch 1950 als Ministerialrätin im niedersächsischen Kultusministerium die Nachfolge Katharina Petersens an.
8.4 „NUN BEGANN DIE EIGENTLICHE ARBEIT“: DAS WIRKEN DES DFR AUF BUNDES-, LANDES- UND ORTSEBENE ANHAND AUSGEWÄHLTER BEISPIELE Wie sah nun die alltägliche Arbeit des DFR aus, die Herta Gotthelf so heftig kritisierte? Ein Einblick ist bereits mit der Beschreibung der Angebote des Clubs deutscher Frauen in Hannover gegeben worden. Denn die Inhalte, mit denen der DFR sich auseinandersetzte, waren ähnlich wie die des ‚Club deutscher Frauen‘ und des ‚Frauenrings der britischen Zone‘. Bereits die Gründung des ‚Frauenrings der britischen Zone‘ war deutlich der Logik des Kalten Krieges unterworfen gewesen. Kaum war jene Hürde genommen, hatten Bähnisch und ihre Mitstreiterinnen danach getrachtet, die nächste zu bezwingen: Die Gründung des Verbandes auf nationaler Ebene. „Nun begann die eigentliche Arbeit des Deutschen Frauenringes“556, brachte die Präsidentin des DFR den Umstand auf den Punkt, daß bis 1949 die meiste Kraft von Vorarbeiten zur Gründung des Verbands absorbiert worden und für inhaltliche Arbeit kaum Zeit geblieben war. Die Gründung der Bundesrepublik hatte nicht nur die Gründung des Frauenrings als ‚Deutscher Frauenring‘ erst ermöglicht, sie veränderte auch seine Arbeitsgrundlage. Mit der Verabschiedung des Grundgesetzes war klar, auf welcher verfassungsmäßigen Grundlage und mit welchen Organen es für den Ring zukünftig
554 Denise Tscharntke nennt keinen Beleg für ihre Aussage, daß Prejawa sich bereiterklärt habe, diese Arbeit zu übernehmen. Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 184. Doch die im DFR-Archiv überlieferten Korrespondenzen, von denen viele Prejawas Unterschrift tragen, bestätigen ebenso, daß Prejawa jene Rolle innegehabt haben muß, wie der Dank, den Bähnisch ihr anläßlich ihres Rücktritts aussprach. DFR-Archiv, A1, Geschäftsbericht, vorgelegt auf der Hauptversammlung in Berlin am 28.–29. März 1952, Deutscher Frauenring/Theanolte Bähnisch, 28.03.1952, S. 5. 555 Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 171. 556 Ebd.
Wachsende Prominenz | 983
zu streiten galt. Zudem verschaffte ihm die Gründung der BRD die Möglichkeit, noch stärker als zuvor als Vertreter der ‚deutschen‘ Frauen den Wiederanschluß an die internationale Frauenbewegung zu forcieren. In seiner Programmschrift brachte der DFR seine Basisorientierung zum Ausdruck: Die Verwirklichung der Aufgaben, so heißt es dort, liege schwerpunktmäßig in der Hand der örtlichen Verbände. Die Landesverbände und der Bundesverband hätten die Aufgabe, Koordinierungsarbeiten und die Vertretung nach außen zu leisten und die Verbindung zu den jeweiligen Behörden und Regierungen aufrecht zu erhalten. Zur fachlichen Vorbereitung bestimmter Themen waren Arbeitsausschüsse ohne eigene Beschluß- und Eingabevollmacht vorgesehen. Das Verhältnis zu den politischen Parteien wurde im Programm des DFR als neutral, das zu den kirchlichen Frauengruppen als positiv festgeschrieben. Eine Zusammenarbeit mit kulturellen, erzieherischen, beruflichen und sozialen Frauenverbänden wurde angekündigt.557 Die Landes- und Ortsringe des DFR erhielten zwar von der jeweils übergeordneten Ebene Anregungen zur Gestaltung ihrer Arbeit, doch sah die Arbeit der jeweiligen Ortsringe verschieden aus. Einen systematischen Vergleich der Entwicklung sowie der Arbeit der Landesringe oder gar der Ortsringe vorzunehmen, muß einer Organisations-Geschichte des DFR vorbehalten bleiben. Im Folgenden sollen deshalb nur einige Beispiele für Aktivitäten der Ringe auf verschiedenen Ebenen beschrieben werden, wie sie vor allem aus der Überlieferung des DFR-Archivs in Freiburg, den Akten der Militärregierung, dem Nachlaß Theanolte Bähnischs, aus ihren Reden und Veröffentlichungen, aus Publikationen leitender Mitglieder des DFR und aus Jubiläumsschriften von Landes- oder Ortsringen deutlich werden. Aus diesem Material lassen sich einige Aussagen über die Arbeit des DFR treffen, die jedoch nicht verallgemeinerbar sind. Über ein Mitteilungsblatt, dem entsprechende Informationen in strukturierter Form zu entnehmen sind, verfügte der DFR erst, nachdem Else Ulich-Beil den Vorsitz von Bähnisch übernommen hatte. Ein ‚Circular Letter‘ zum Thema Gleichberechtigung, den Bähnisch, wie Ostermann schreibt, an die Ringe verteilt habe558, ist weder im Archiv des DFR noch in den Akten der Militärregierung überliefert, weshalb fraglich ist, ob er überhaupt existierte.559 Bähnisch hatte offenbar zu Beginn des Projekts die Idee, die ‚Stimme der Frau‘ zum ‚Organ des DFR‘ zu machen und damit eine Finanzspritze für den Verband zu etablieren. Aber die Zeitschrift an entsprechende Adressaten zu bringen, war gar nicht so einfach. Andere Frauenverbände in Hannover zeigten sich jedenfalls nicht begeistert von der Idee der FrauenringVorsitzenden, daß sie mit Aussicht auf einen „Nebenverdienst bei Abnahme einer
557 Zum Programm vgl.: Deutscher Frauenring/Ehrlich/Borgmann: Protokoll, S. 17. 558 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 187. 559 Erwähnt wird ein entsprechender Vorschlag Bähnischs auch in einer Aktennotiz des DEF. Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 45, Aktennotiz des DEF, Besprechung bei Frau Bänisch am Montag, den 30.08.1948. Demnach sollte das Blatt 5 Seiten umfassen, etwa 10 bis 15 Pfennig kosten und jeder Organisation der Reihe nach die Möglichkeit bieten, einen Artikel über ihre Arbeit zu veröffentlichen.
984 | The anolte Bähnisch
festen Zahl“560 Exemplare erwerben und weiterverkaufen sollten. Lediglich das Rote Kreuz und die Landeskirchliche Frauenarbeit erklärten sich dazu bereit.561 Im Desinteresse anderer Frauenorganisationen wird ein weiterer Grund dafür gelegen haben, daß Bähnisch sich entschied, die Zeitschrift als eher ‚leichte Kost‘, in der ‚breiten Bevölkerung‘ an die Frau zu bringen und schließlich nicht mehr selbst zu verlegen, sondern die Dienste des Profis, Kurt Ganske, in Anspruch zu nehmen. Als Quelle über die Arbeit einzelner Ringe taugt die ‚Stimme der Frau‘ jedenfalls nicht. Allgemein fand, das konstatierte Bähnisch in der Retrospektive, erst unter der neuen Vorsitzenden Ulich-Beil eine „stärkere Durchorganisation“562 des Verbands statt. Diese äußerte sich auch darin, daß Ulich-Beil, die über Gertrud Bäumer zur Frauenbewegung gefunden hatte, diverse Ortsvereine besuchte und beriet sowie Tagungen und Konferenzen organisierte.563 Beil knüpfte dabei vielleicht an Wissen aus ihrer Zeit als Vorstandsmitglied des BDF an. Ob die neue Leiterin des DFR mit diesem Verhalten, wie Bähnisch behauptete, die Mitglieder „immer enger zusammen“564 schweißen konnte, wird von anderer Hand zu prüfen sein. Eine solche Arbeit, wie Beil sie leistete, hatte Deneke bei Bähnisch jedenfalls vermißt, beziehungsweise mit Respekt vor Bähnischs Amt einer bezahlten Organisations-Kraft übertragen wissen wollen. Denise Tscharntke vertritt die Meinung, daß eine bezahlte OrganisationsKraft womöglich dafür hätte sorgen können, daß die Arbeitsgrundlage der Frauenringe in den verschiedenen Regionen stärker demselben Muster gefolgt wären 565 – was nicht unwahrscheinlich ist. Ulich-Beil selbst behauptete in ihren Erinnerungen, daß sie alle Ausschüsse mit Ausnahme des Rechtsausschusses erst einmal aus ihrer „papiernen Existenz“ hätte lösen und zu „wirklichem Leben“566 bringen müssen. Die Führung des DFR567 in Bähnischs Sinn schien durch Ulrich-Beil gewährleistet. Ob sie ihr Einkommen aus der Leitung des DFR beziehen könne, darüber mußte sich Beil, anders als Bähnisch, keine Gedanken machen. Als sie den DFR übernahm war sie, 1886 geboren, gerade in die Pensionszeit eingetreten. Theanolte Bähnisch selbst war offenbar vor allem am Aufbau einer großen Frauenorganisation und erst in zweiter Instanz an ihrer Leitung interessiert. Mit der alltäg-
560 Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 45, Aktennotiz des DEF, Besprechung bei Frau Bänisch am Montag, den 30.08.1948. 561 Ebd. 562 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 176. 563 Ebd. 564 Ebd. 565 Vgl.: ebd., S. 187. 566 Ulich-Beil: Weg, S. 222. 567 Das am 28./29.03.1952 gewählte Gremium bestand aus Else Ulich-Beil als Vorsitzender, Marga Philip aus Köln als Vertreterin, Elisabeth Mahla aus Landau als Schatzmeisterin. Weitere Vorstandsmitglieder waren Maria Becker aus Hamburg, Dr. Carola Fettweis aus Freiburg, Dr. Hildegard Meissner aus Berlin, Dr. Gabriele Strecker aus Bad Homburg, Dr. Hanna Vogt aus Göttingen und Brunhilde Wacker aus Stuttgart. DFR-Archiv, A1, Zur Geschichte des DFR, Zusammensetzung der Vorstände, DFR Bundesgeschäftsstelle, Januar 1983.
Wachsende Prominenz | 985
lichen Detailarbeit schien sie kaum in Kontakt gekommen zu sein. „Bähnisch was alert and active at higher levels but could not herself undertake detailed work“568, beschreibt Denise Tscharntke das Phänomen. Der Großteil der Arbeit in den Ausschüssen, so Tscharntke, wurde durch berufstätige Expertinnen geleistet.569 8.4.1 Die Entwicklung der Landesringe bis 1952 – Schlaglichter Zur räumlichen Entwicklung des Frauenrings läßt sich – in der Zusammenschau der Akten, die über Women’s Affairs im Bestand Foreign Office in den National Archives Kew überliefert sind – sagen, daß sich der Niedersächsische Landesring am schnellsten und am stärksten entwickelte. Schon 1946 waren Gründungen von ‚Clubs deutscher Frauen‘ in Celle und Göttingen vorgenommen worden. Diese Erkenntnis über die Organisations-Strukturen in räumlicher Nähe zu Theanolte Bähnisch verwundert kaum, hatte doch in Hannover die ‚Keimzelle‘ des Verbands gelegen und Bähnischs Arbeit, die von Hannover aus immer weitere Kreise zog, von der Militärregierung Unterstützung erfahren. Der Landesring Hannover wurde von 1949 bis 1952, also zu jener Zeit, in der Bähnisch den Bundesvorsitz innehatte, von der bereits mehrfach erwähnten Katharina Petersen geleitet. Gut scheint sich der Ring, das geht ebenfalls aus der breiten Korrespondenz im Bestand sowie aus den mehrfach zitierten Reiseberichten Helena Denekes hervor, auch in Schleswig-Holstein etabliert zu haben, obwohl Dorothy Broome, die dort für die britische Women‘s Affairs Section zuständig war, dem Ring eher skeptisch gegenüberstand. Die Redakteurin der ‚Stimme der Frau‘, Else Richter, gab die Leitung des Landesrings 1950 an Emma Faupel ab, 1951 übernahm sie dann Else Vormeyer, die zuvor den Ortsring Kiel geleitete hatte. Der vergleichsweise starke Frauenring Hamburg dürfte der Präsidentin Bähnisch nicht nur Freude beschert haben, da er, wie ebenfalls an anderer Stelle bereits erwähnt, unter der sozialdemokratischen Schulrätin Olga Essig eine Zeitlang die Zusammenarbeit mit Kommunistinnen gesucht zu haben scheint. Warum Essig 1952 abtrat und die Leitung des Hamburger Rings von Rechtsanwältin Dr. Charlotte Walner von Deuten (ebenfalls SPD) übernommen wurde570, bliebe zu prüfen. Walner von Deuten setzte das besondere Engagement des Rings für die Mädchenbildung, das sich unter Essig etabliert hatte, jedoch fort. Bedenkt man auch das Engagement Mosolfs und Petersens, so hatte sich im Landesring Niedersachsen offenbar eine Tradition durchgesetzt, die Theanolte Bähnisch überhaupt erst jene berufliche und ehrenamtliche Karriere ermöglicht hatte. Daß ihrem Vater, dem Lehrer Franz Nolte, das Thema Mädchenbildung am Herzen gelegen hatte, zog nach sich, daß seine Tochter
568 Vgl.: Tscharntke: Re-educating, S. 187. 569 Vgl.: ebd. 570 Karen Hagemann und Jan Kolossa schreiben allerdings, daß Dora Hansen-Blanke Olga Essig abgelöst habe. Vgl.: Hagemann, Karen/Kolossa, Jan: Gleiche Rechte – Gleiche Pflichten? Der Frauenkampf für „staatsbürgerliche Gleichberechtigung“. Ein BilderLese-Buch zu Frauenalltag und Frauenbewegung in Hamburg, Hamburg 1990, S. 221.
986 | Theanolte Bähnisch
die Möglichkeit erhielt, entsprechenden Einfluß auch auf die Folgegenerationen auszuüben und ausüben zu lassen. In Nordrhein-Westfalen, dem südlichsten Bundesland der britischen Besatzungszone, wo die im Kultusministerium des Landes tätige Oberschulrätin Else Schmücker die Leitung übernommen hatte571, verlief die Entwicklung des Frauenrings stockend.572 Von dort wurde besonders viel Kritik an der dirigistischen Art Bähnischs, mit der sie die Organisationen zusammenschließen wollte, laut.573 Daß Helena Deneke im Auftrag der Militärregierung eine Reise durch das Rheinland unternahm, um Zusammenschlüsse davon zu überzeugen, den Statuts von ‚Frauenringen‘ anzunehmen, schien keine Wunder vollbracht zu haben. Die britische Militärregierung hatte schon vor der Gründung des DFR (also des Rings auf Bundesebene) den Frauenring als ‚primus inter pares‘ auch in Nordrhein-Westfalen verwirklicht sehen wollen. Die CCG (BE) erwartete, daß der Frauenring im Land eine Arbeitsgemeinschaft von Frauenverbänden anleitete, gleichzeitig sah sie ihn jedoch als zu schwach dafür an, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Theanolte Bähnisch wollte solche ‚Probleme‘ durch die staatliche Subventionierung schwächerer Ringe lösen.574 Doch Women’s Affairs Officer Youard, die in Düsseldorf ansässig war, hielt den Ansatz, den von der Währungsreform gebeutelten Ringen zur Bekämpfung des Kommunismus Geld zur Verfügung zu stellen, für die falsche Lösung. Ihre Berliner Kollegen setze sie davon in Kenntnis.575 „A society used for fighting communism can easily be used for fighting anything else and is not the self-governing women’s organization we hoped to see.“576 Möglich ist, daß der Ring auch deshalb in Nordrhein-Westfalen Wachstums-Probleme hatte, weil Herta Gotthelf in Lore Agnes eine starke Unterstützerin ihrer Arbeit gegen die überparteiliche Frauenbewegung vor Ort hatte.577
571 NA, UK, FO 1049/1247, Joy Evans an Rita Ostermann, 13.07.1948. Evans, Women’s Affairs Officer in Nordrhein-Westfalen, bezeichnete in ihrem Bericht den Frauenring als „strong in Niedersachsen and Schleswig, slow to develop in this land“. Ebd. 572 Es gab Frauenringe in Düsseldorf, Köln, Neuss, Hagen, Detmold und Münster, wobei Münster wohl der aktivste in der Region war. NA, UK, FO 1049/1247, Joy Evans an Rita Ostermann, 13.07.1948. 573 NA, UK, FO 945/283, Report on visit to Germany: 7th–19th July 1947 von A. B. Reeve, 24.07.1947. 574 NA, UK, FO 1050/1214, Interview with Frau Bähnisch, Hannover, 29. July 1948. 575 Ebd. sowie ebd., Youard, Women’s Affairs Department Northrhine/Westfalia an Joy Evans, Office of the Educational Advisor, Berlin, 04.08.1948. 576 NA, UK, FO 1050/1214, Youard, Women’s Affairs Department Northrhine/Westfalia an Joy Evans, Office of the Educational Advisor, Berlin, 04.08.1948. 577 NA, UK, FO 1050/1214, Information on Women’s Affairs on K.R.O.s [Kreis Resident Officers]. Die Ausführungen kamen aus Nordrhein-Westfalen, erfuhren aber durch Joy Evans weite Verbreitung in der CCG (BE). Evans an die Niederlassungen der Education Branch in den Ländern, 13.07.1948.
Wachsende Prominenz | 987
In Münster, dem Studien und -Ausbildungsort Bähnischs, lag der Ursprung des Frauenrings, wie in Hannover, im Regierungspräsidium.578 Federführend waren hier zwei Frauen um den parteilosen Regierungspräsidenten Franz Hackethal579: Hackethals Frau Elvira und eine Freundin des Regierungspräsidenten, die 1902 geborene Maria Panhoff580 (CDU), Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie. Panhoff leitete den Westfälischen Frauenring bis 1952, nachdem sie ihn gemeinsam mit Elvira Hackethal am 14.05.1947 begründet hatte. Hedwig Gründer, die Ehefrau des späteren Superintendenten des Kirchenkreises Münster, Pfarrer Georg Gründer, war stellvertretende Vorsitzende des Rings.581 Weitere Vorstandsmitglieder waren die Fürsorgerin Agnes Plaßmann und die Oberstudienrätin Margarethe Zimmermann – auch hier dominierte also eine ganz ähnliche Zusammensetzung wie in Hannover. Die Treffen des westfälischen Landesverbands fanden offenbar monatlich statt. Belegt ist als Ort der Zusammenkunft der Gasthof ‚Lindenhof‘582, was den Eindruck, daß man auf die Zahlungsnöte wirtschaftlich schlechter gestellter Frauen auch in Münster keine Rücksicht nahm, erweckt. Die Vorträge, welche im ‚Lindenhof‘ zu hören waren, schienen eher theoretischer Natur gewesen zu sein. Gisela Naunin, die den Verband ab 1953 leitete und sich mit der Geschichte des Landesrings auseinandergesetzt hat, sieht eine der wesentlichen Aufgaben von DFR-Landesringen, die als „‘Mittelinstanz‘ nicht so unmittelbar mit den Mitgliedern […] zu tun“ hätten wie ein Ortsring und auch „nicht so allgemeine bundesweite staatsbürgerliche Ansprechpartner“ wie der Bundesverband, in dem Bemühen, Ortsringe zu gründen. „Dieses habe auch ich in all den folgenden Jahren versucht“583, schreibt Naunin. Doch in Westfalen war dieser Versuch nicht so sehr von Erfolg gekrönt wie in anderen Regionen. Wo genau es ihr gelungen war, konnte auch Naunin im Rückblick nur noch teilweise rekonstruieren. Sie berichtet von Ortsringen, die „möglicherweise“ existierten, und solchen die gegründet wurden, aber „nicht lebensfähig“584 waren. Eine Trennung zwischen dem Vorsitz des Ortsrings Münster und des Landesverbands Westfalen war nach ih-
578 Vgl.: Naunin, Gisela: Der Landesverband Westfalen des Deutschen Frauenrings 1947– 1965, Münster 1984, S. 2. 579 Von Hackethal, der sich während des Dritten Reichs bis 1937 im Amt halten konnte und der von 1945 bis 1956 Regierungspräsident von Münster war, ist überliefert, daß er der Entnazifizierung sehr kritisch gegenüberstand und sich gegen die Demontage von Betrieben im Bezirk einsetzte. Auch er soll, zwar Verwaltungsfachmann, aber kein Jurist, einen eher unbürokratischen Arbeitsstil gepflegt haben, der sich sehr für die Integration von Flüchtlingen einsetzte. Vgl.: Haunfelder, Bernd: Die münsterischen Regierungspräsidenten des 20. Jahrhunderts, Münster 2006, S. 55–59. 580 Vgl.: Naunin: Landesverband. Ab 1957 gehörte Pannhoff dem Bundestag an. Vgl.: Art. „Pannhoff, Maria“, in: Vierhaus, Rudolf/Herbst, Ludolf (Hrsg.): Biographisches Handbuch der Mitglieder des Deutschen Bundestages 1949–2002, Band 2, N–Z, München 2002, S. 630. 581 Vgl.: Naunin: Landesverband, S. 2. 582 Ebd., S. 4. 583 Ebd., S. 6. 584 Ebd.
988 | Theanolte Bähnisch
rer Darstellung in den 50er Jahren aufgrund der so gering ausgeprägten Abhängigkeits-Struktur mit nur einem, beziehungsweise zwei Ortsringen zunächst entbehrlich.585 Den ersten Gründungs-Erfolg habe man, nach der Gründung in Münster, 1949 in Lemgo verbuchen können586. Doch wegen Zahlungsschwierigkeiten trat der Ortsring 1949 wieder aus dem Landesverband aus. Was Deneke schon 1947 Kopfzerbrechen bereitet hatte, schien also ein strukturelles Problem des Frauenrings, zumindest in Westfalen, geblieben zu sein. Da sich die Mitgliedsbeiträge im Westfälischen Frauenring nur schwer eintreiben ließen, lehnte es Dr. Pannhoff als seine Vorsitzende 1949 schlichtweg ab, „die von dort verlangten 30 DM pro ein Vierteljahr“587 an den Bundesvorstand zu zahlen. Wie der Bundesvorstand darauf reagierte, ist nicht überliefert, aber es steht zu vermuten, daß er die Entscheidung, in der Sorge, den Verband zu verlieren, akzeptierte. Mit allzu betuchten Mitgliedern schien man in Westfalen also nicht konfrontiert gewesen zu sein, weshalb es ebenfalls interessant wäre, mehr über die Mitgliederstruktur herauszufinden. Möglich ist, daß der Frauenring hier eine andere gesellschaftliche Schicht ansprach als in anderen Ländern, denkbar ist aber auch, daß es einfach insgesamt – beispielsweise wegen der kostspieligen Treffen in Gasthäusern – zu wenige Mitglieder gab, um den Mitgliedsbeitrag des Landesverbandes an den Bundesverband aufzutreiben. Die „materielle Unabhängigkeit“588 seiner Vorsitzenden Pannhoff, die berufstätig war, wirkte sich, Gisela Naunin zufolge, positiv für den Landesring Westfalen aus, konnte jedoch den Umstand, daß die Mitglieder aus Münster und Lemgo nicht einmal das Geld aufbringen konnten, sich zu gemeinsamen Treffen zu versammeln, nicht aufwiegen.589 Im Landesverband Rheinland, also in der Rheinprovinz, die 1946 mit Westfalen zum Land ‚Nordrhein-Westfalen‘ zusammengeschlossen wurde, war die Lage für den DFR ebenfalls nicht einfach, aber doch etwas besser als in Westfalen. Mit Luise Bardenhewer hatte der Frauenring hier eine zwar beruflich stark eingebundene, aber trotzdem sehr rege Leiterin.590 1948 bestanden immerhin schon Frauenringe in Düsseldorf, Köln, Neuss und Detmold.591 Ein Bericht der Militärregierung aus dem März 1950 nennt für Nordrhein-Westfalen schließlich folgende Ringe: Essen-Werden, Rhein-Wupper, Siegkreis, Wesel, Bonn, Lemgo und Siegen.592 Dabei könnten jedoch
585 Erst 1952 wurde Naunin Vorsitzende des Ortsringes Münster. Maria Pannhoff leitete den Westfälischen Landesring bis 1953. Vgl.: ebd., S. 7 und S. 10. 586 Dies widerspricht der Äußerung einer Mitarbeiterin der Militärregierung, nach deren Information 1948 auch ein Frauenring in Hagen existierte. Womöglich bestand der Hagener Ring nur kurz. NA, UK, FO 1049/1247, Joy Evans an Rita Ostermann, 13.07.1948. Heute besteht der DFR in Westfalen aus drei Verbänden: Münster, Castrop-Rauxel und Hagen. 587 Naunin: Landesring. 588 Ebd. 589 Ebd., S. 10. 590 Das geht aus verschiedenen monatlichen Berichten der in Düsseldorf ansässigen Chief Women’s Affairs Officer Broome aus Düsseldorf hervor. NA, UK, FO 1050/1214. 591 NA, UK, FO 1049/1247, Joy Evans an Rita Ostermann, 13.07.1948. 592 NA, UK, FO 1050/1214, Monthly Report March, Mrs. D. M. Horsfield, Women’s Affairs Branch Düsseldorf, 27.03.1950, S. 3.
Wachsende Prominenz | 989
– das legen wiederum die Ausführungen Naunins nah – (einmalige) Zusammenkünfte mit Gründungen verwechselt worden sein. 1951 etablierte sich unter Elisabeth Mahla zusätzlich ein Landesverband Rheinland-Pfalz.593 Gemessen an dem Umstand, daß das Land Hessen zur amerikanischen Besatzungszone gehörte und somit erst später in den Genuß einer entsprechenden Förderung durch britische Visiting Experts gekommen war, scheint es, den Publikationen Gabriele Streckers zufolge, schnell gelungen zu sein, einen starken Hessischen Frauenring aufzubauen. Leiterin des Hessischen Frauenrings war bis 1953 die Frankfurterin Fini Pfannes. In Bayern übernahm die Leitung des Landesverbandes bis 1955 eine der Grande Dames in der bürgerlichen Frauenbewegung, nämlich Dorothee von Velsen. Über Frauenringe in Bayern scheint allenfalls graue Literatur vorzuliegen594, weshalb an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet werden muß. Heutzutage existieren fünf bayerische Ortsringe: München, Ansbach, Augsburg, Bad Kissingen, Lauf. Schwerer fielen Gründungen in der französischen Besatzungszone, da die französische Militärregierung erst spät den Wert der politischen Frauenbildung für die Demokratisierung erkannte. Leonore Mayer-Katz mußte, wie an anderer Stelle bereits ausgeführt, ihren eigenen Ausführungen zufolge viel Überzeugungsarbeit leisten, damit sie den Ring in Südbaden begründen konnte. Der Nordbadische Verband, der 1952 mit dem Südbadischen zusammengeführt wurde, stand unter der Leitung von Dr. Ilse Krall.595 8.4.2 Die Arbeit der Ortsringe an den Beispielen Freiburg und Oldenburg Im Mai 1948, also noch bevor der DFR auf nationaler Ebene gegründet wurde, gehörten dem Frauenring laut Überlieferung in der britischen Militärregierung etwa 50 Ortsringe an.596 Zahlenmaterial über den DFR ist insgesamt rar, und so läßt sich aus der Angabe Nori Mödings, daß dem DFR 1951 etwa 50.000 Frauen angehört hätten597, nicht ableiten, ob die Anzahl der Ortsringe analog zur Ausdehnung des Frau-
593 Vgl.: Koepcke: Flagge, S. 172. Vgl. auch: Deutscher Frauenring, Landesverband Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Dokumentation des Deutschen Frauenringes, Landesverband Rheinland-Pfalz anlässlich seiner Jubiläumsveranstaltung am 17. Oktober 1981 in Zweibrücken, o. O. 1981. 594 Eine Online-Recherche in den Beständen der Luise-Büchner-Bibliothek in Darmstadt, die auf die Überlieferung von Literatur zur Geschichte der Frauenbewegung, vor allem des Frauenringes spezialisiert ist, ist derzeit nicht möglich. 595 Vgl.: Koepcke: Flagge, S. 170. 596 NA, UK, FO 1049/1246, Second Meeting of the Standing committee on women’s affairs held at 1000 hrs, third May 1948, Stirling House. 597 Vgl.: Möding: Stunde, S. 624. Der DFR selbst gab die Zahl der Mitglieder in den Ortsringen in einem Papier, das auf 1951 datiert wird, mit 50.000 an. DFR-Archiv, A1, Zahlenmaterial, 1951. Gut möglich ist, daß sich im Lauf des Jahres 1951 die Mitgliederzahl deutlich erhöht hat, was die von Möding angegebene höhere Summe erklären würde.
990 | Theanolte Bähnisch
enrings auf die anderen Besatzungszonen wuchs, zumal die Mitgliederstärke der jeweiligen Ortsringe sehr verschieden war. 1949 hatten alle dem DFR angehörenden Zusammenschlüsse, mit Ausnahme der traditionsreichen Berliner Organisationen, den Namen ‚Frauenring‘ angenommen. Die Alliierten sowie die Frauenverbände im In- und Ausland konnten sich nun sicher sein, daß sie es jeweils mit einem AblegerProjekt Bähnischs zu tun hatten, wenn ein Verband den Namen ‚Frauenring‘ trug. Einige der Zusammenschlüsse, die noch vor der Gründung des Frauenrings als zonaler Verband, beziehungsweise als überzonaler Verband gegründet worden waren, hatten bereits ab dem Zeitpunkt ihrer Gründung nach demselben Statut gearbeitet wie der ‚Club deutscher Frauen‘.598 Dies galt beispielsweise für Celle und Göttingen, aber auch für Düsseldorf. Diese Entwicklung war wesentlich auf den Einfluß Bähnischs und Helena Denekes zurückzuführen. Sie hatten Frauen, die daran interessiert waren, eine Organisation zu begründen, oder solche, die dies bereits getan hatten, besucht und ihnen eine Orientierung am ‚Club deutscher Frauen‘, beziehungsweise am ‚Frauenring‘ nah gelegt. Und doch verfolgten nicht alle Zusammenschlüsse, die den Terminus ‚Ring‘ im Namen trugen, dieselben Ziele oder hingen denselben Traditionen an. Daß das Selbstverständnis des Freiburger Frauenrings von dem des ‚Club deutscher Frauen‘, später ‚Ortsring Hannover‘, verschieden war, wird unter anderem daran deutlich, daß Grete Borgmann, die sich mit der Geschichte des Freiburger Rings auseinandersetzt, die Tradition des Freiburger Zusammenschlusses nicht wie Bähnisch und die anderen Vorstandsmitglieder aus dem BDF, sondern aus dem Freiburger Traditionszusammenschluß ‚Verein Frauenbildung – Frauenstudium‘ herleitete.599 Die lokale Tradition scheint hier – anders als beispielsweise beim Ortsring Oldenburg600 – ein viel stärkeres Identifikationspotential geboten zu haben als die na-
598 Vgl. dazu beispielsweise das Programm des Frauenrings Freiburg, der am 07.07.1947 gegründet wurde. (Das offizielle Gründungsdatum war – da man die Genehmigung der Militärregierung benötigte – der 19.04.1948.) Vgl.: Borgmann: Freiburg, S. 58 und 60. Grete Borgmann, die mit dem Abteilungsleiter beim Caritas-Verlag, Karl Borgmann verheiratet war, hatte 1973 den Frauenring Freiburg mitbegründet. Ihre Tochter Eva-Schneider Borgmann leitete den DFR-Bundesverband von 2000 bis 2006. Vgl.: Bochtler, Anja, Dauerthema Gleichberechtigung. 60 Jahre Deutscher Frauenring. Die Freiburger Vereinigung gehört zu den erfolgreichsten, in: Badische Zeitung, 21.12.2009, online auf: http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/dauerthema-gleichberechtigung--24479682. html, am 13.12.2013. Vgl. auch den publizierten Schriftwechsel des Ehepaars: Borgmann, Karl und Grete: Zum Glück hilft Dir die Sehnsucht, hrsg. vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Karlsruhe 2010. 599 Vgl.: Borgmann: Freiburg, S. 7. 600 Dieser sah die Tradition des DFR allgemein im BDF/AdF. Vgl.: Deutscher Frauenring, Ortsring Oldenburg (Hrsg.): Deutscher Frauenring, Ortsring Oldenburg e. V., Isensee 1997, S. 12 und S. 14. In der Jubiläumsschrift des Frauenrings Oldenburg wurde kritisch angemerkt, daß im Kaiserreich die Forderungen des BdF nach dem Frauenwahlrecht nicht durchgesetzt werden konnten und die Stellung der Frauen im BGB nicht wesentlich verbessert werden konnte. Ebd. Später habe der BDF wegen der Unterschiedlichkeit der
Wachsende Prominenz | 991
tionale. Dies hing wohl nicht unwesentlich damit zusammen, daß ein ehemaliges Mitglied des Vereins ‚Frauenbildung, Frauenstudium‘, Johanna Kohlund, den ‚Frauenring Freiburg‘ 1947 gegründet hatte. Grete Borgmann zufolge „mag“ Kohlund nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges „bald eingesehen haben“, daß die Frauenarbeit mit dem Ziel Frauenbildung-Frauenstudium durch eine „Frauenverbandsarbeit auf ganz breiter Basis, die alle Schichten und positiven Strömungen umfaßte“601, ersetzt werden müsse. Hieraus spricht jedoch stärker die Spekulation Borgmanns, als die vielleicht vermeintliche Überzeugung Kohlunds. Zumindest paßt die Feststellung Borgmanns nicht zur Vorstandsstruktur des Freiburger Frauenrings602, die der des ‚Club deutscher Frauen‘ ähnelte. Die Mädchenbildung war, wie im Folgenden deutlich werden wird, eines der wesentlichen Themen des Freiburger Frauenrings, was einerseits für Orientierung am Verein ‚Frauenbildung-Frauenstudium‘ spricht, andererseits aber auch dem Selbstverständnis des DFR nicht widerspricht, zumal in ihm viele Schulrätinnen engagiert waren. Kohlund hatte zwar mit der Satzung des ‚Club deutscher Frauen‘ wortgleiche Ziele für den ‚Freiburger Frauenring‘ unterzeichnet, jedoch war man sich schon im Juli 1947 – mit Freda Wuesthoff im Boot – darüber klargeworden, daß man sich für Südbaden „nicht die südwürttembergische Form eines einzigen Frauenrings mit Ortsgruppen, sondern einen Zusammenschluß selbständiger Ortsverbände und sonstiger korporativer Mitglieder wünschte“603. Die Badenerinnen wollten sich in ihren Strukturen also nicht, wie es der Vorstand des Frauenrings unter der Leitung von Bähnisch angestrebte, anpassen. Was der Freiburger Ring für sich beanspruchte, wollte er offenbar auch den anderen Ringen gewähren: Eine starke Identifikation mit dem eigenen, lokalen Potential. Zudem ersparte man sich mit dieser Regelung, die freilich weniger ‚Durchorganisation‘ ermöglichte, einen großen Verwaltungsaufwand. Inhaltlich stimmten die Badenerinnen jedoch mit Bähnischs Marschrichtung überein: eine Eingabe an die Londoner Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember 1947, wie sie von Pyrmont aus gefordert wurde, war die erste offizielle gemeinsame ‚Amtshandlung‘ der südbadischen Föderation.604 Ob sich der Status der ‚selbständigen Ortsverbände‘ in Südbaden nach der Gründung des DFR als Bundesverband noch einmal änderte, wird aus Grete Borgmanns Verbandsgeschichte nicht deutlich. Den KDFB am Ort in den Frauenring korporativ zu integrieren, gelang, trotz Fürsprache von Seiten der CDU vor Ort, auch – oder sollte man sagen: gerade auch – den Freiburgerinnen nicht.605 Denn insgesamt waren die Frauenverbände in Freiburg, wie in ganz Baden, sehr stark konfessionell aufgestellt. Auch als es im Rahmen einer Tagung 1951 um das Thema ‚Die Frau als Staatsbürgerin‘ ging, zeigte sich in der
601 602 603 604 605
zusammengeschlossenen Gruppierungen nicht geschlossen auftreten können und sich entsprechend schlechter durchsetzen können. Vgl.: ebd., S. 13. Ebd., S. 53. Vgl.: ebd., S. 61. Freda Wuesthoff an Dr. Maria Plum, 27.06.1947, zitiert nach Borgmann: Freiburg, S. 59. Vgl.: Borgmann: Freiburg, S. 59/60. Vgl.: ebd., S. 61.
992 | Theanolte Bähnisch
Rednerliste eine klare Dominanz konfessioneller Verbände.606 Doch der Freiburger Frauenring sah dadurch offenbar ‚sein‘ Aufgabenfeld nicht bedroht, sondern er schien die Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen am Ort insgesamt als sehr positiv wahrgenommen zu haben.607 Daß Arbeitsgruppen von Ortsringen mit anderen Frauenverbänden, wie sie in Hannover und Freiburg gepflegt wurden, durchaus nicht unüblich waren, zeigt auch die Geschichte des Frauenrings Oldenburg, der mit dem Allgemeinen Oldenburger Lehrerinnenverband, dem Hausfrauenverein und „alle[n] caritativen Verbände[n]“ am Ort eine Arbeitsgemeinschaft bildete und dabei seinen eigenen ArbeitsSchwerpunkt in der „staatsbürgerlichen Erziehung der Frau“608 sah. Beispielhaft sollen, ohne Anspruch auf Ausgewogenheit oder Vergleichbarkeit mit anderen Ringen, im Folgenden einige Einblicke in die Arbeit der Ortsringe in Freiburg, Oldenburg und Kiel gegeben werden. Sowohl der Oldenburger als auch der Freiburger Frauenring orientierten sich in ihrer praktischen Arbeit an den Gegenständen, die die DFR-Präsidentin und der Vorstand vorgaben: So gründete der Oldenburger Frauenring609 1948 eine Altwarenverkaufsstelle, um den Frauen bis 1952 den An- und Verkauf von Gütern in der wirtschaftlich schweren Zeit zu erleichtern.610 Hierin spiegelte sich das Ziel des Frauenrings, Hilfe zur Überwindung der Nachkriegsnot anzubieten. Daß das Rathaus hierfür zwei Räume zur Verfügung stellte, zeigt, daß auch der Oldenburger Frauenring gute Beziehungen zu den Behörden pflegte und diese gewinnbringend einsetzen konnte. Ferner initiierte der Ring eine Arbeitsgemeinschaft, die sich mit der ‚Stellung des unehelichen Kindes‘ beschäftigte611, einem Thema, das auch in der ‚Stimme der Frau‘ Berücksichtigung findet612 und mit der in Pyrmont proklamierten Orientierung des Frauenrings am ‚Familienwohl‘ in Verbindung zu bringen ist. Wohl in der Hoffnung,
606 Die Themen drehten sich um ‚Rechte und Pflichten von Frauen als Staatsbürgerinnen‘, die ‚Einwirkung der Frau auf die öffentliche Meinung‘ sowie ‚in der Wirtschaft‘, ‚Erziehung der Frau zur Verantwortung‘ und ‚Stellungnahme der Frau zu Erweiterungen im Schulwesen‘. Vgl.: ebd., S. 74/75. 607 Ebd., passim. 608 Ortsring Oldenburg: Ortsring Oldenburg, S. 18/19. 609 Gegründet wurde der Ortsring am 05.09.1947 durch zehn Frauen, darunter die Politikerin und frühere Rotkreuz-Schwester Margarete Gramberg (DVP/FDP), die in den 50er Jahren ein Landtagsmandat für die FDP innehatte. Weitere Gründungsmitglieder waren die Ehefrau des Genealogen Prof. Walter Hartung, die aus Ostpreußen stammende Marga Hilbers, die aus Schlesien stammende Frieda Rudolph, die Studienrätin Charlotte Korte und die Sozialarbeiterin Eva Mücke. Vgl.: O. V.: Anfänge und erste Entwicklung des Oldenburger Frauenringes, auf: Deutscher Frauenring, Ortsring Oldenburg, auf: http://www. dfr-oldenburg.de/index.php/wieentstand/die-anfaenge.html, am 13.12.2013. Zu Gramberg vgl.: Simon, Barbara (Bearb.)/Präsident des Niedersächsischen Landtages (Hrsg.): Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994, Hannover 1996, Seite 125. 610 Vgl.: Ortsring Oldenburg: Ortsring Oldenburg, S. 20. 611 Ebd., S. 21. 612 Vgl.: Freund: Krieg, S. 229.
Wachsende Prominenz | 993
den Zusammenhalt zwischen den Flüchtlingen und der übrigen Bevölkerung vor Ort zu stärken – ein Thema, das der Regierungspräsidentin besonders am Herzen lag – richtete der Oldenburger Ring 1950 gemeinsam mit dem BHE ein Osterfest aus und veranstaltete 1951 einen ‚Tag der Heimat‘ mit der umstrittenen Dichterin Alma Rogge als Rednerin. In Hannover fanden, unter Beteiligung der ebenfalls und aus den gleichen Gründen umstrittenen Dichterin Agnes Miegel, die über die Jahre eine Freundin Bähnischs wurde613, ähnliche Veranstaltungen statt. 1951 schickte der Oldenburger Ring dann „die ersten Liebesgabenpakete“ in die Ostzone, worin Elfriede Hartung den „ersten bescheidenen Ansatz zum ‚Packkreis‘“614 sah, der, eingebunden in den ‚Hilfsring Niedersachsen e.V.‘, 1960 in Hannover gegründet wurde.615 In jedem Fall entsprach dieses Engagement den Zielen, welche der ‚gesamtdeutsche Ausschuß‘ unter Melle im Frauenring beziehungsweise im Staatsbürgerinnenverband verfolgte. Im ‚Frauenring Freiburg‘ erklärten die Bio-Chemikerin Dr. Magda Staudinger und Hildegard Groß der weiblichen Bevölkerung, wie Hausfrauenarbeit durch eine sinnvollere Planung und Einrichtung der Wohnungen616 erleichtert werden könne, berieten Eltern zu Spiel- und Lernmöglichkeiten von Kindern in kleinen Wohnungen, entwarfen sogar Kindermöbel617 und arbeiteten schließlich dem DFR-Bundesvorstand durch die Mitarbeit an Eingaben durch den Normungsausschuß zu.618 Das Engagement des Freiburger Rings traf also ein weiteres Kernthema des DFR und Bähnischs, die (nicht nur) als Regierungspräsidentin stark in den (sozialen) Wohnungsbau im Bezirk involviert war. Soviel also zu den Inhalten der Arbeit. Offenbar wollte sich der Freiburger Frauenring jedoch so gar nicht an die Vorgabe des DFR-Vorstands halten, daß jede Ring-Ebene (nur) mit den Behörden auf der gleichen Ebene in Kontakt treten sollte. Zumindest 1957 wandte sich der Freiburger Frauenring selbständig und direkt an das Bundesministerium für Wohnungsbau.619 Auch im Rahmen einer Eingabe zum geltenden Beamtenrecht an den Badischen Landtag trat der Freiburger Ring aus dem regionalen Rahmen heraus. Sein politisches Engagement in dieser Hinsicht ergänzte der Ring mit Aufklärungsarbeit über die Rechte verheirateter Beamtinnen vor Ort, was wiederum ein Kernthema des DFR und seiner Leiterin war. Daß er schließlich eine Arbeitsvermittlungsstelle einrichtete,
613 Vgl.: O. V. [‚RMW‘]: Was bleibt, stiften die Dichter – Die Feier des achtzigsten Geburtstages von Agnes Miegel, in: Das Ostpreußenblatt, 10. Jg. (1959), Nr. 11. Im Artikel wird Bähnisch mit den Worten, Miegel sei „Mutter – Urmutter, Mutter für viele“ zitiert. 614 Ortsring Oldenburg: Ortsring Oldenburg. S. 22. 615 Vgl.: ebd. 616 Vgl.: ebd., S. 63. Vgl. dazu auch: Borgmann, Grete: So wohnt sich’s gut, Freiburg 1957. 617 Vgl.: Borgmann: Freiburg, S. 64. 618 Daß Magda Staudinger in ihrer von Bärbel Maul als ‚Gelehrtenehe‘ bezeichneten Partnerschaft mit Hermann Staudinger nach dem Ehe-Ideal Theanolte Bähnischs gelebt zu haben scheint, sei nur am Rande erwähnt. Vgl.: Maul: Akademikerinnen, S. 182. 619 Vgl.: ebd., S. 63. Vgl. dazu auch: Borgmann: So wohnt sich’s gut.
994 | Theanolte Bähnisch
war gleichermaßen Ausdruck der Unterstützung weiblicher Berufstätigkeit als auch seines sozialen Engagements.620 Die Initiative des Freiburger Rings zur Eltern-Lehrer-Verständigung, in der wohl stärker die Tradition des ‚Verein Frauenbildung – Frauenstudium‘ als die des BDF/DFR durchschlug, bezeichnet Grete Borgmann als ein ‚Wagnis‘, das Eltern wie Lehrer jedoch mit der Zeit zu schätzen lernten.621 Auch im Hinblick auf die Debatten über Koedukation spielte das Thema (Mädchen-)Erziehung, das auch eines der Kernthemen der zweiten Vorsitzenden des DFR, Anna Mosolf, war, eine zentrale Rolle im Frauenring Freiburg. Über das Thema war der Ring innerlich gespalten: Die Koedukations-Gegnerinnen waren der Meinung, daß in Mädchenklassen die Schülerinnen besser zu Persönlichkeiten im Sinne des Humanismus ausgebildet werden könnten, was einem der Ziele des DFR und Bähnischs entsprach; die Befürworterinnen waren der Meinung, Koedukation setze größere demokratische Effekte frei622, was ebenfalls ein – wenn auch weniger offensiv und schon gar nicht mit solchen Mitteln vertretenes – Ziel des DFR war. Schließlich diskutierten die Freiburgerinnen – im Austausch mit anderen Frauenverbänden – über die geplanten Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit dem Gleichberechtigungsartikel, orientierten sich also auch hier an den Vorgaben und Zielen des Bundesrings und fanden damit über die Region hinaus Gehör: Die Freiburger Juristin Dr. Plum war Grete Borgmann zufolge eine heiße Kandidatin auf die Nachfolge Bähnischs, die dann jedoch Ulich-Beil antrat. Plum hatte aufgrund einer besonders zeit- und arbeitsintensiven beruflichen Mission absagen müssen623: Sie vertrat Alexander Mitscherlich und Fred Mielke, als diese sich wegen ihrer Berichterstattung über den Nürnberger Ärzteprozeß vor Gericht verantworten mußten.624 Der Frauenring Freiburg setzte also eine Vielzahl von Anregungen, die aus dem Bundesvorstand kamen, um und brachte sich noch darüber hinaus mit eigenen Ansätzen in die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens vor Ort ein. Unter den Frauenringen im Bundesgebiet trat er als besonders rührig hervor. Dies galt, wenn man Borgmanns Ausführungen Glauben schenkt, auch für Versuche, die Stimmen von Frauen in der Gesellschaft stärker zu Gehör zu bringen. Als „abenteuerlich“ schildert sie die ersten Versuche von Freiburger Frauen, sich außerhalb der Familie zu „äußern“, also für die eigene Meinung Raum zu verlangen. Die bereits erwähnten Eltern-Lehrer-Abende hätten erste Schritte auf diesem ungewohnten Parkett erleichtert.625 Eine durchorganisierte Möglichkeit626 zum Meinungs- und Erfahrungsaus-
620 621 622 623 624
Vgl.: Borgmann: Freiburg, S. 65/66. Vgl.:ebd., S. 68. Vgl.: ebd., S. 77. Vgl.: ebd., S. 80. Vgl.: Peter, Jürgen: Der Nürnberger Ärzteprozeß im Spiegel seiner Aufarbeitung, Münster 1998, S. 160 ff. Demnach war die Rolle Professor Blüchers im Dritten Reich durch Mitscherlich und Mielke tatsächlich falsch, beziehungsweise irreführend dargestellt worden. 625 Vgl.: Borgmann: Freiburg, S. 71/72. 626 Vgl.: ebd., S. 72.
Wachsende Prominenz | 995
tausch boten, Borgmann zufolge, die monatlichen Ausspracheabende, welche vom staatsbürgerlichen Ausschuß des Ortsrings vorbereitet wurden. „Zu Beginn eines jeden monatlichen Ausspracheabends behandelte sie straff gegliederte Fragen über Stadt-, Landes, Bundes- und Weltpolitik bei möglichster Zurückhaltung der eigenen Meinung“, charakterisierte Borgmann das Vorgehen der jeweiligen, nicht näher bezeichneten Referentin. „Sie ordnete das aktuell zur Diskussion Stehende so, daß Begriffe wie Verfassungsgebende Versammlung, Lesung im Bundestag, Vollversammlung der UNO usf. einsichtig und die Zuhörerinnen angeregt wurden, ermutigt durch das nun vertrautere Vokabular, sich systematischer durch Radio und Presse zu informieren“. Staatsbürgerliche Bildungsarbeit im Freiburger Frauenring sollte also Grundlagenkenntnisse vermitteln, vor deren Hintergrund die Freiburger Frauen aktuelle Meldungen besser einordnen können sollten. Inwiefern das Konzept in der Praxis aufging, läßt Borgmann offen. Auch wie die „Ansätze zu einer tiefgreifenderen staatsbürgerlichen Bildungsarbeit, Versuche, wie man Haltungsänderung bewirken könne […] sodaß aus dem passiven Bürger der kritische, urteilsfähige, handlungsbereite Staatsbürger würde“627, in Freiburg genau aussahen, ist aus Borgmanns Organisations-Geschichte nicht zu erfahren. Immerhin ist hier die Rede von ‚Versuchen‘, woraus sich schließen läßt, daß den führenden Mitgliedern im Frauenring bewußt war, daß die ‚Umerziehungsarbeit‘ ein langwieriger Prozeß sein mußte, dessen kurzfristige Effekte kaum meßbar waren. In seiner Geschäftsstelle bot der Ring offenbar Veranstaltungen an, die sich mit Themen beschäftigten, wie „Die Mitarbeit der Frau in Politik und Gesellschaft“, „mehr Frauen in die Parlamente“ und „Warum Frauen in die Politik“. Der Ring verschrieb sich dabei jedoch nicht streng der politischen Bildungsarbeit im engeren Sinne, sondern variierte – ganz im Sinn des Konzepts von Fritz Borinski – dieses Angebot mit anderen Themen wie „Frauen wollen nicht mehr in Untermiete wohnen“ und „Eigener Herd ist Goldes wert“.628 Inwiefern jene Arbeit des Frauenrings stärker dadurch geprägt war, daß er ein ‚Anhang‘ des BundesDFR war – denn ein ‚Ableger‘ im engeren Sinn schien er ja, wenn man die Gründungsgeschichte betrachtet, nicht gewesen zu sein – oder ob gerade seine Unabhängigkeit dazu führte, daß er sich vergleichsweise stark engagierte, ist schwer zu bewerten. Eine Analyse von Korrespondenzen könnte hierüber mehr Aufschluß bringen. Vermutlich war es gerade die Kombination aus ‚Anregung von oben‘ und ‚selbstbewußter Unabhängigkeit‘ vor Ort, das den Freiburger Ring für Mitglieder aktiv machte. Inwiefern sich ‚einfache‘ Mitglieder in die aktive Arbeit des Freiburger Rings einbrachten, eine Frage, die für die Education Branch der Briten und für ‚Visiting Expert‘ Deneke so zentral war, geht aus den Ausführungen Borgmanns leider nicht klar hervor. Auf den Oldenburger Frauenring schien jener Teil der Bildungsarbeit, die sich im Ausland abspielte, besonderen Eindruck gemacht zu haben. Zwei seiner Mitglieder durfteen nach Großbritannien reisen dürfen. Elfriede Hartung erinnert diese Reise als ein „interessantes Erlebnis“, da sich Ausflugsmöglichkeiten mit den „harten Pil-
627 Ebd. 628 Frauenring Oldenburg: Frauenring Oldenburg, S. 19.
996 | Theanolte Bähnisch
len“, die die „Umerzieher“ zu „schlucken“629 gaben, mischten. Folgt man Hartungs Ausführungen, so scheuten die Briten im Heimatland nicht davor zurück, die Frauen aus Norddeutschland mit ihrer Geschichte zu konfrontieren: „Wir wurden ‚erzogen‘ in echter Demokratie und im Abhalten von Versammlungen […] wir diskutierten über politische Fragen und natürlich auch die NSDAP, die Konzentrationslager und die Hitlergreuel“.630 Welche Angebote der Oldenburger Ring seinen ‚einfachen‘ Mitgliedern machte, um deren Wissen über politische Zusammenhänge und ihre Fähigkeit zu befördern, Demokratie aktiv mit zu gestalten, erwähnt Hartung nicht. Elisabeth Vormeyer (CDU), die Vorsitzende des Frauenrings in Kiel631, die sich bereits in den 20er Jahren der staatsbürgerlichen Frauenbildung verpflichtet gesehen hatte, nahm ihre ‚staatsbürgerliche Aufgabe‘ im Frauenring, wenn man ihrem Brief an die WGPW Glauben schenken darf, als basisdemokratisch wahr. Sie stellte diesen Aspekt der Arbeit mit Frauen als zentral für die Arbeit des Ortsrings dar: „The main thing is educating our women in listening to the peoples opinions without interrupting them and in not being cross with them when they resist to being persuaded.“632 Vormeyer versuchte also den Leserinnen ihrer Ausführungen glauben zu machen, daß der Kieler Ring den vom DFR gesetzten Anspruch auf Förderung der Toleranz und Anerkennung Andersdenkender im Alltag tatsächlich einlöste. „The other day we discussed about the first meeting of the citizen with the institutes of Government: when the child enters/begins to attend a school“633, hebt Vormeyer hervor, wie der Kieler Ring in seiner Bildungsarbeit die von der britischen Militärregierung als mustergültig erachtete Ableitung ‚politischer‘ Themen aus ‚alltäglichen‘ Sorgen umgesetzt habe. „Another time four members of the two main parties, the C.D.U. and the S.P.D. spoke to the other women who were no members of any parties“634, berichtete Vormeyer an die Britinnen. Dankenswerterweise gab Vormeyer in ihrem Bericht auch einen Eindruck über die Teilnehmer der von ihr beschriebenen Veranstaltungen, aber auch dieser könnte womöglich, einer Erwartung der Britinnen entsprechend, geschönt worden sein: „At that time we had four lecturers, the widow of a dead soldier, a female student, a physician’s wife and one of those poor lonely people who are old and lost most of their money“635, charakterisiert Vormeyer die Besucher – vielleicht bewußt – als sehr verschieden. Denn den Brief hatte sie an die WGPW geschickt, nachdem sie von ihrer Reise nach Großbritannien zurückgekehrt war und den DFR in
629 Elfriede Hartung zitiert nach ebd., S. 20. 630 Ebd., S. 20/21. 631 Die 1893 geborene Vormeyer war Journalistin und Lehrerin und hatte auch den Landesfrauenring in Schleswig-Holstein mitbegründet sowie von 1952 bis 1958 geleitet. Vgl.: Schultheiß, Nicole: Geht nicht… gibt’s nicht. 24 Portraits herausragender Frauen aus der Kieler Stadtgeschichte, Kiel 2007, online auf: http://www.kiel.de/kultur/stadtgeschichte/ gehtnichtgibtsnicht/Buch_05_Portraet_Vormeyer.php, 13.12.2013. 632 Women’s Library, Metropolitan University, London, Box FL565, 5WFM/C1, Ms. Vormeyer an Ms. Homer, 19.01.1949. 633 Ebd. 634 Ebd. 635 Ebd.
Wachsende Prominenz | 997
Kiel gegründet hatte. Die Erwartungen der Britinnen, wie Frauenbildungsarbeit aussehen sollte, wird sie nach ihrem langen Aufenthalt in Großbritannien gekannt haben. Als ‚Beweis‘ für die Heterogenität der an der Arbeit des Frauenrings Kiel Interessierten eignet sich Vordermeyers Brief nur eingeschränkt. 8.4.3 Die Arbeit des Bundesvorstands, seiner Präsidentin und seiner Ausschüsse Binnen kurzer Zeit gelang es dem DFR, sich in diversen Behörden und Gremien einen Namen zu machen und sich Gehör zu verschaffen. So war er auf dem Juristentag am 15. und 16.09.1949 durch die Rechtsanwältin und das DAB-Mitglied Dr. Hildegard Gethmann vertreten, die sich – vielleicht nicht zuletzt, weil sie einmal Büropartnerin der mit Helene Lange verwandten Dorothea Frandsen gewesen war636 – dem DFR verbunden fühlte und 1952 die Leitung des Rechtsausschusses im Verband übernahm. Marie Elisabeth Lüders, ein anderes prominentes Mitglied des DFR, wurde auf diesem Juristentag als erste Frau überhaupt in den Hauptdeputationsausschuß gewählt. Auf dem Juristentag vom 14. bis 16.09.1950 konnte Theanolte Bähnisch sogar selbst den Vorsitz der bürgerlich-rechtlichen Abteilung übernehmen.637 Dr. Erna Scheffler, zu dieser Zeit Landesverwaltungsgerichtsrätin und Leiterin des Rechtsauschusses im DFR, referierte am zweiten Veranstaltungstag in dieser Abteilung.638 Zeugnis der intensiven Arbeit des DFR in Hinblick auf die Gesetzesreformen zur Stellung der Frau im BGB ist unter anderem eine sehr kritische Denkschrift zum Kabinettsentwurf des Familienrechtsgesetzes von 1952.639 Der Slogan: „Das Familienrecht beginnt, wo die Liebe aufhört“640 verdeutlich, daß der DFR sich den Lebensrealitäten, sprich den Scheidungsraten und der „geltenden patriarchalen Familienordnung“ stellte. „Der Regierungsentwurf widerspricht der Rechtsauffassung der ge-
636 Vgl.: Maul: Akademikerinnen, S. 421. Die 1903 geborene Gethmann war die Gründungsvorsitzende der ‚Vereinigung weiblicher Juristen und Volkswirte‘, der sich in der Tradition des 1914 gegründeten Juristinnenverbands sah. Gethmann war Mitglied des Bundesvorstands des DAB, Mitglied der CDU und Leiterin der CDU-Frauenvereinigung in Dortmund. Vgl.: ebd. 637 DFR-Archiv, A1, Geschäftsbericht vorgelegt auf der Hauptversammlung in Berlin am 28.-29. März 1952, Deutscher Frauenring/Theanolte Bähnisch, 28.03.1952, S. 14; Ständige Deputation des Deutschen Juristentages (Hrsg.): Verhandlungen des 38. Juristentages in Frankfurt am Main 1950, Tübingen 1951. 638 Vgl.: O. V.: Der djb von 1948 bis 2003. Das erste Jahrzehnt (1948–1948). Auszüge aus den Rundschreiben, ai-Sonderausgabe 2003, auf: http://www.djb.de/publikationen/ai_ sonderausgabe2003/ai_sonderausgabe2003_jahrzehnt1_rundschreiben/, am 13.12.2013. 639 Wolle, Waldemar/Wolle-Egenolf, Hildegard/Vorstand des Deutschen Frauenringes (Hrsg.): Denkschrift des Deutschen Frauenringes zum Kabinettsentwurf eines Gesetzes über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts und über die Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiet des Familienrechts, Berlin 23.12.1952. 640 Ebd., S. 11.
998 | Theanolte Bähnisch
samten zivilisierten Welt“ lautete die abschließende „bittere Betrachtung“641 des DFR zum geplanten Regelwerk. Denn dieses bedeute zwar gleiche Pflichten, nicht aber gleiche Rechte für Frauen.642 Letztere wurden, drei Jahre nach der Gründung des DFR, in Anbetracht nur schleichender Veränderungen, mit größerem Nachdruck eingefordert als noch 1949. Die Überzeugung einer Widersacherin Bähnischs aus der überparteilichen Frauenbewegung, Else Reventlow, daß aus der Mitte des DFR „wirklich ernst zu nehmende Vorschläge nicht erwartet werden können“643, strafte der DFR mit seiner juristischen Arbeit, die beileibe nicht nur Kritik, sondern auch konstruktive Vorschläge beinhaltete, Lügen. Daß der ‚Spiegel‘ die Position des DFR genau zwischen den revolutionären und den konservativen Meinungen zum Eherecht verortete644, war zwar eine im Prinzip zutreffende, gemessen an den Beispielen, die die Zeitschrift zur Position des DFR gegenüber dem BGB druckte, jedoch eine die Haltung des Verbands doch etwas zu sehr entschärfende Quintessenz. Schließlich sprach sich Erna Scheffler, die Vorsitzende des Rechtsausschusses, entgegen der Position der Oberlandesgerichtspräsidentin Hagemeyer sogar gegen die Regelung aus, daß im Fall einer Eheschließung automatisch der Name des Mannes Familienname werden müsse.645 Insbesondere was die Arbeit des DFR im juristischen Bereich angeht, läßt sich konstatieren, daß die von verschiedenen Autoren und Autorinnen jahrzehntelang vertretene Meinung, in den 50er Jahren habe eine völlige frauenpolitischen Flaute geherrscht646, nicht tragfähig ist.647 Die Historikerin Sylvia Heinemann, die sich mit der Arbeit liberaler Frauen außerhalb von Parlamenten beschäftigte, kommt in einer Studie aus dem Jahr 2012 zu dem Schluß, daß Politikerinnen, Juristinnen und Frauenverbände sich gemeinsam für die Umsetzung des Gleichberechtigungsartikels ein-
641 642 643 644
Ebd., S. 29 Vgl.: ebd. AdSD, Nachlaß Else Reventlow, Nr. 43, Reventlow an Lisa Albrecht, 15.10.1949. Vgl.: O. V.: Eherecht. Bettelei ums Haushaltsgeld, in: Der Spiegel 5. Jg. (1952), Nr. 1, 02.01.1952, S. 28-30, hier S. 28. 645 Vgl.: ebd. 646 Vgl.: Pitzschke: Angela: Rezension zu Heinemann, Sylvia: Frauenfragen sind Menschheitsfragen. Die Frauenpolitik der Freien Demokratinnen von 1945 bis 1963, Sulzbach/Taunus, 2012, auf: H-Soz-u-Kult, 13.11.2012, http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/rezensionen/2012-4-132, am 13.12.2013. 647 Vgl. dazu: Heinemann, Sylvia: Frauenfragen sind Menschheitsfragen. Die Frauenpolitik der Freien Demokratinnen von 1945 bis 1963, Sulzbach/Taunus, 2012. Karin Gille-Linne stellt die aufgeworfene Dichotomie zwischen dem ‚frauenpolitischen Aufbruch‘ von 1945 bis 1949 und der ‚restaurativen Phase‘ von 1949 bis 1963 ebenfalls in Frage und betont, daß Politikerinnen in der SPD auch in der späteren Phase frauenpolitisch aktiv gewesen seien. Vgl.: Gille-Linne: Strategien, S. 276. Heinemann betont dagegen die aktive Arbeit außerparlamentarischer Netzwerke, dehnt jedoch ihre Analyse auch über einen viel längeren Zeitraum, nämlich bis 1963, aus. Gille-Linne konzentriert sich weitgehend auf die Zeit bis 1949. Vgl. für eine lesenswerte Einordnung der Ergebnisse Heinemanns: Pitzschke: Rezension zu Heinemann: Frauenfragen.
Wachsende Prominenz | 999
setzten. Die Ergebnisse der zumindest ansatzweisen Rekonstruktion der Arbeit Bähnischs und des DFR in diesem Bereich stützen Heinemanns Ergebnisse, zumal sich im DFR gemeinsam mit Bähnisch vor allem liberal eingestellte Frauen engagierten, von denen viele, wie die Vorsitzende selbst, Juristinnen waren. Einige von ihnen hatten sich bereits vor dem Dritten Reich für die rechtliche Gleichstellung von Frauen eingesetzt. Heinemann stellt nämlich auch fest, daß die Formulierungen von Politikerinnen aus der SPD und der FDP, die sich für die Gleichberechtigung eingesetzt hatten, als Ergebnis einer „Interessenallianz“648 auffällige Gemeinsamkeiten auwiesen. Theanolte Bähnisch lag also mit ihrer Hoffnung, daß Politikerinnen fraktionsübergreifend zusammenarbeiten würden, zumindest was die rechtliche Gleichstellung von Frauen betraf, richtig. Dazu, daß sich Bähnischs Vision der überparteilichen Frauenarbeit im Bereich des Rechts erfüllte, trug auch die spätere Arbeit des bereits mehrfach erwähnten DFR-Führungsmitglieds Nora Melle, die Vorsitzende des 1951 gegründeten ‚Informationsdienst für Frauenfragen‘ wurde, bei sowie die Dorothea Karstens, die im gleichen Jahr Frauenreferentin im Bundesinnenministerium wurde.649 Die Entstehung des von OMGUS gefördertem ‚Informationsdienstes‘ bedeutete also, wie im entsprechenden Zusammenhang deutlich werden wird, mitnichten das Ende personeller Kontinuitäten in der bürgerlichen Frauenbewegung, wie sie die Hannoveraner Regierungspräsidentin ab 1946 wieder aufgebaut hatte. Karsten und Melle, die mit Hilfe Bähnischs an ihre Positionen gelangt waren, hatten die Aufgabe, Frauenverbände und Parlamentarierinnen beziehungsweise Parteipolitikerinnen mit Material zur ‚Frauenfrage‘ zu versorgen – was diesen die Zusammenarbeit wesentlich erleichterte. In ihrer Rezension über die Studie Sylvia Heinemanns deutet Angela Pitzschke an, daß Autorinnen früherer Studien zum Thema Emanzipation und Gleichberechtigung womöglich stark unterschätzen, welch zäher kontinuierlicher, juristischer Arbeit beispielsweise die in den 50er Jahren durchgesetzte Familienrechtsreform bedurfte.650 Bähnisch dagegen hatte, da sie als Juristin die Lage einschätzen konnte, auf beiden Pyrmonter Konferenzen vorausgesagt, daß in dieser Hinsicht eine große Menge Arbeit auf den Frauenring zukäme. Fälschlicherweise wurde insbesondere dieser langwierige Arbeits-Einsatz in der Forschung als Beweis für die behauptete frauenpolitische Flaute in den 1950er Jahren bewertet, was der Arbeit der Fürstreiterinnen nicht gerecht werde, argumentiert Pitschke.651 Sylvia Heinemann stützt sich in ihrer Argumentation vor allem auf das Wirken der im Namen des DFR tätigen Elisabeth Schwarzhaupt, wenn sie nachweist, daß auch die Arbeit des progressiven Flügels von Frauen in der CDU in Bezug auf frauenpolitische Reformen weit weniger ‚konservativ‘ war, als bisher angenommen.652
648 649 650 651 652
Heinemann: Frauenfragen, S. 2. Siehe Kapitel 8.5.2. Vgl.: Pitzschke: Rezension zu: Heinemann: Frauenfragen. Vgl.: ebd. Vgl.: ebd. Petra Holz legt ihr Augenmerk sowohl auf den Flügel um die konservativ argumentierende Helene Weber als parlamentarische Gegenspielerin Elisabeth Selberts, als
1000 | Theanolte Bähnisch
Daß der DFR und viele namhafte Politikerinnen zur gleichen Zeit, in der sie sich für die rechtliche Gleichstellung von Frauen einsetzten, die Hausfrauen-Ehe beziehungsweise das Haupternährer-Zuverdienerinnen-Modell als eine gesellschaftliche Normalität propagierten,653 läßt sich wohl nicht zuletzt auf das in den Nachkriegsjahren verbreitete Bedürfnis zurückführen, eine ‚heile Welt‘ wiederherzustellen. Daß dem Verhalten – auch wenn Bähnisch betonte, daß eine Frau zumindest die Wahl haben müsse, wie sie ihr Leben gestalten wollten – ein gewisser Widerspruch zugrundelag, läßt sich nicht von der Hand weisen. Daß Angela Pitzschke diesen Widerspruch, auf die Haltung liberaler Frauen Bezug nehmend, mit der „Realität der Mehrfachbelastung berufstätiger Mütter“654 erklärt, wird den komplexen Zusammenhängen nicht gerecht. Ein in der westdeutschen Frauenbewegung als überzogen wahrgenommener gesellschaftlicher Wandel von Frauenrollen in der DDR in Kombination mit der gefühlten Notwendigkeit, sich von der kommunistischen Frauenbewegung per se abzugrenzen, tat sein Übriges zu einer Mäßigung und abweichenden Kontextualisierung von politischen Forderungen in puncto Gleichberechtigung durch den DFR. Da ‚Gleichheit‘ das Gebot der Stunde in der kommunistischen Frauenbewegung war, blieb, wenn man so will, der bürgerlichen Frauenbewegung nur, weiterhin auf das Konzept der ‚Differenz‘ zu setzen und zu argumentieren, daß die ‚Gleichwertigkeit‘ von Männern und Frauen eben nicht ihre ‚Gleichartigkeit‘ bedeuten dürfe. Im Rahmen seiner Arbeit für Volks- und Heimwirtschaft war der DFR in diversen Gremien vertreten, die sich mit der Qualitätssicherung und Vermarktung von Lebensmitteln beschäftigten655, was zu dem Umstand führte, daß Theanolte Bähnisch, um die Zuständigkeit des DFR zu demonstrieren, 1950 die erste Deutsche FischereiMesse in Bremen eröffnete. Auch jenseits der Lebensmittelbranche versuchte die Organisation ihren Einfluß auf die Wirtschaft geltend zu machen. Im ‚ständigen Ausschuß für Selbsthilfe‘, einer Gründung christlicher Verbände, war der DFR in verschiedenen Unterausschüssen präsent. Der Verband wollte als Lobbyverband Verbrauchern gegenüber der Wirtschaft den Rücken stärken – womit er gleichzeitig dem Staat seine vermittelnde Rolle in jenem Aushandlungsprozeß streitig machte. Daß sich der DFR – und vor allem seine Präsidentin – trotz des Einsatzes für VerbraucherInnen-)Interessen eher wirtschaftsnah verhielt, schien ins Konzept des ständigen Ausschusses für Selbsthilfe zu passen, der unter Federführung des späteren, als marktliberal bekannten Bundestagspräsidenten Eugen Gerstenmaier arbeitete. Der
auch auf den um Elisabeth Schwarzhaupt. Sie gelangt deshalb zu einer sehr differenzierten Einschätzung. Vgl. dazu auch: Bussiek: Rezension zu Holz: Tradition. 653 Dies wird auch in der ‚Stimme der Frau‘ deutlich, die immer mehr von der Propagierung der Frauenberufstätigkeit als Ziel abkommt. 654 Vgl.: ebd. 655 Namentlich waren dies der Verbraucher-Ausschuß des Bundesinnenministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, der Verwaltungsrat der Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh, Fleisch und Fleischerzeugnisse, die Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, der ‚Beirat Milchwirtschaft‘, der ‚Beirat Kartoffeln‘, die ‚Deutsche Fischwerbung Bremerhaven‘ und der Verein ‚Deutsche Fischereimesse Bremerhaven‘. Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 173.
Wachsende Prominenz | 1001
„deutsche Churchill“656 machte sich wie der DFR und der Kronberger Kreis657 für die deutsche Wiederbewaffnung im Rahmen einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft stark. Bähnisch wird Gerstenmaier aus der beratenden Versammlung des Europarates, der er ebenfalls angehörte, gekannt haben658, während sie mit dem ‚Kronberger Kreis‘ vor allem über Hanns Lilje, aber auch über die Evangelischen Akademie Loccum659 und deren Leiter, Eberhard Müller, interagierte. Am Beispiel der Wirtschaft wird, wie am Beispiel des Rechtswesens deutlich, wie der DFR die Mitgliedschaft prominenter beruflich erfolgreicher Frauen nutzte, um seinen Einfluß zu erhöhen und sein Ansehen zu mehren. Mit Marie-ElisabethLüders, die auch dem Deutschen Normenausschuß sowie den Ausschüssen Bauwirtschaft und Heimtechnik angehörte, verfügte der DFR über eine Instanz auf beiden Gebieten. Weitere Beispiele zeigen, wie der DFR – zumindest seiner Präsidentin zufolge – sein Versprechen, einerseits Frauen zu mehr Geltung in der Wirtschaft zu verhelfen, andererseits die vermeintlich kollektiven Interessen von Frauen gegenüber der Wirtschaft zu vertreten, umsetzte: Der Verband war beratendes Mitglied im Fachverband Metallwaren-Industrie und hielt, wie seine Vorsitzende angab, über seinen Ausschuß für Wohnungs- und Kleinsiedlungsfragen die Verbindung „zu maßgeblichen Baubehörden, Planungs und Forschungsstellen.“660 Damit ist ein weiteres Kern-Thema der Verbands-Arbeit angesprochen: Zwar zog der Frauenring seine angestrebte Mitarbeit an der Constructa-Bauausstellung – und damit eine Möglichkeit, in der Öffentlichkeit Präsenz zu zeigen – zurück, als sich herausstellte, daß die geplante Konzeption mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Mittel nicht umgesetzt werden konnte. Doch im Anschluß an die Ausstellung machte der DFR auf sich aufmerksam, indem er starke Kritik an den auf der Bauausstellung gezeigten Kleinstwohnungen übte. Grund für die Kritik war, daß die Wohnungen auf einen Flur verzichteten, das Bad nicht von der Toilette trennten, die Küche und die Fenster zu klein und die Bettstellen zu niedrig seien. Auch das Fehlen eines entlüftbaren Speiseschranks wurde bemängelt. Die Wohnung der Version ‚Constructa‘ sollte auf 39 Quadratmetern vier Personen Platz
656 Vgl.: O. V.: Gerstenmaier. Der Traum ist aus, in: Der Spiegel, 08.12.1954, S. 9–15, hier S. 14. Gerstenmaier wird im Kreisauer Kreis verortet und zu den Unterstützern des Hitler-Attentats am 20.07.1944 gezählt. 657 Sauer, Thomas: Der Kronberger Kreis: Christlich-Konservative Positionen in der Bundesrepublik Deutschland, in: GHI Conference Papers on the Web, The American Impact on Western Europe. Americanization and Westernization in Transatlantic Perspective, Conference at the GHI Washington, March 25th–27th, 1999, auf: http://www.ghidc.org/conpotweb/westernpapers/sauer.pdf, am 13.12.2013. 658 Vgl.: O. V.: Gerstenmaier. 659 In einem Zeitungsartikel wird Bähnisch als „eifrige Besucherin der Loccumer Veranstaltungen“ bezeichnet. NLA HA HStAH, Nds. 110 F, Acc 148/90, Nr. 13, Bl. 94, Theanolte Bähnisch in Hannover gestorben. Eigener Bericht, 10.07.1948, in der Akte ohne Angabe des Erscheinungsortes überliefert. Entwurf zu o. V.: Theanolte Bähnisch in Hannover gestorben, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 11.07.1973. 660 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 173.
1002 | Theanolte Bähnisch
bieten und so Ausgebombten, Flüchtlingen und jungen Ehepaaren für 43 Mark Miete im Monat Abhilfe aus ihrer Notlage schaffen. Der Hannoveraner Baurat Hillebrecht hatte vor dem Hintergrund des Raummangels, der sich in jenem Wohnungsschnitt widerspiegelte nicht Tadel, sondern Hilfe vom DFR erwartet, nämlich bei der „Erziehung der Frauen zur Freude am Kleinmöbel“ anstelle der beliebten, Raum einnehmenden „Buffets und Kredenzen“.661 Daß der DFR nicht wie erhofft auf der Wohnungsbau-Ausstellung zum Zug gekommen war, kann mit dem zwischenzeitlichen Tod von Bundesminister Hans-Eberhard Wildermuth zusammengehangen haben, denn in ihm hatte, wie aus dem DFR-Geschäftsbeicht von 1952 hervorgeht, der DFR einen erklärten Unterstützer.662 Beim Thema ‚Schnitte und Raumabmessungen der idealen Wohnung‘ überschnitten sich die Interessen Bähnischs als Leiterin der Behörde und des Frauenverbands. Gleichzeitig scheint in Theanolte Bähnischs Arbeit zum Thema ein Stück Expertise des Landrats Albrecht Bähnisch zum Tragen gekommen sei, denn zu dessen Aufgaben hatte es gehört, den Bau von Groß-Siedlungen in seinem Landkreis zu überwachen. In ihrer Rede zum zehnjährigen Jubiläum des DFR stellte Theanolte Bähnisch ihr Engagement in Wohnungsfragen, dem Anlaß angemessen, allerdings ausschließlich in Zusammenhang mit dem DFR und dessen sozialer Arbeit.663 Ihr Verwaltungsamt wird ihr jedoch bessere Karten beschert haben, entsprechend berücksichtigt zu werden, vor allem was Veranstaltungen im Raum Hannover betraf. Eine ursächliche Trennung ihrer Eignung und Zuständigkeit als Regierungspräsidentin und/oder als Präsidentin des DFR läßt sich im Blick auf Wohnungsfragen – wie auch in einigen anderen Bereichen – nicht leisten. Dies wird auch an einer Reise Bähnischs nach Berlin vom 05. bis 08.05.1950 zur Tagung des deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung664 deutlich. Heute ist dieser Verband eine „Clearingstelle des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und den verwandten Verbänden“. Seiner Eigendarstellung zufolge bringt er seit 1946 „als überparteiliche, neutrale Plattform […] Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Rechtsprechung, Wissenschaft sowie verwandten Verbänden zu einem praxisorientierten Erfahrungsaustausch zusammen“665. Kein Wunder also, daß Bäh-
661 O. V.: Wohnungen, in: Der Spiegel, Nr. 8/1952, 20.02.1952, S. 27–29, hier S. 28. 662 DFR-Archiv, A1, Geschäftsbericht vorgelegt auf der Hauptversammlung in Berlin am 28.–29. März 1952, Deutscher Frauenring/Theanolte Bähnisch, 28.03.1952, S. 21/22. 663 Vgl.: Bähnisch: Vom Wiederaufbau, S. 174. Auch 1959 wiederholte sie in diesem Kontext noch einmal ihre Überzeugung, daß „Familienleben einfach aufhört, wenn die Familie keinen Raum mehr hat, in dem Familienleben stattfinden kann.“ Ebd. 664 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Der Regierungspräsident an den Niedersächsischen Minister des Innern, 28.06.1950. Die Tagung fand unter dem Titel ‚Deutschlands bauliche Erneuerung‘ statt. Vgl.: O. V.: Deutschlands bauliche Erneuerung. Tagung des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung, in: Neue Bauwelt, Nr. 20/1950, S. 318/319. 665 Vgl. die Rubrik ‚über uns‘ auf der Homepage des Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung: http://www.deutscher-verband.org/cms/index.php?id=10, am 13.12.2013.
Wachsende Prominenz | 1003
nisch, die sowohl Regierungspräsidentin als auch Vorsitzende der größten bürgerlichen Frauenorganisation in der Bundesrepublik war, zur Tagung eingeladen wurde. Daß diese Reise nicht nur in Verbindung mit dem Amt der Präsidentin des DFR, sondern auch mit dem der Regierungspräsidentin zu sehen ist, zeigt sich auch darin, daß Bähnisch beim niedersächsischen Innenministerium einen Reisekostenzuschuß beantragte. Denn auch in ihrer an die Region gebundenen Funktion stand sie, wie an anderer Stelle bereits erörtert, vor dem Problem anhaltender Wohnungsknappheit. Als Präsidentin des DFR wollte sie erreichen, daß Frauen viel stärker als bisher in die Wohnraumplanung einbezogen würden. Dabei folgte sie wesentlich der Argumentationslinie eines Redners auf besagter Tagung, die unter dem Titel ‚Deutschlands bauliche Erneuerung‘ abgehalten wurde: Professor Jobst hielt fest, daß die „Meinungen von Frauen als intensivste Benutzer der Wohnung […] sehr wichtig und ausschlaggebend“666 seien. Gedacht war also, daß die ‚bauliche Erneuerung‘ des Landes auch Neuerungen in Bezug auf eine geschlechtersensible Bauplanung beinhalten sollte – welche sich jedoch wesentlich an Bild von Frauen als ‚Hausfrauen‘ im wahrsten Sinne des Wortes orientierte und insofern Rollenbilder doch stärker zementierte als erneuerte. Das wohnungspolitische Engagement des DFR sei in seinen Landes- und Ortsringen zunächst uneinheitlich gewesen, hält Christopher Oesterreich, der sich mit Produktgestaltung in Westdeutschland auseinandersetzt und den DFR als Akteur auf der Verbraucherseite identifiziert, fest. Dies sei auch darauf zurückzuführen, so Oesterreich, daß eine entsprechende Sachkompetenz erst erworben bzw. angeworben hätte werden müssen667. Anzunehmen ist, daß die Bereitschaft der Bauherren, mit den Ortsringen zu kooperieren, sehr unterschiedlich ausgeprägt war, ebenso wie die Kompetenzen, über die die Ortsringe jeweils verfügten – und das eine wird wiederum das andere mit bedingt haben. Der DFR, dem Oesterreich zubilligt, einer der wenigen ‚Gestaltungsreformer‘ auf der Verbraucherseite gewesen zu sein, habe jedoch im Sommer 1953 auf Bundesebene „entscheidende konzeptionelle und politische Fortschritte“668 verbuchen können. Zu seinem Erfolg trug ganz entscheidend die Kompetenz und Durchsetzungsstärke der Architektin Wera Meyer-Waldeck, die im ‚Bauhaus‘ ihre berufliche Sozialisation erfahren hatte, bei.669 Sie leitete den Ausschuß ab 1953. Weil der Wohnungsbau eine Männerdomäne gewesen sei, war Oesterreich zufolge „von der wohnungspolitisch aktiven Frauenbewegung doppelte Arbeit zu leisten, zielte sie doch auf wohnkulturelle Reformen wie auf emanzipatorische Belange gleichermaßen“670 ab. Sein Selbstbewußtsein stellte der Verband durch die Ausweitung seiner gefühlten Zuständigkeiten unter Beweis: Die Forderungen des DFR beschränkten sich 1952 längst nicht mehr auf die von Bähnisch in Zeiten der akuten Krise nach vorn gestellten Wohnungsschnitte und Raumgrößen, sondern umfaßten
666 667 668 669 670
O. V.: Erneuerung, S. 318. Oesterreich: Form, S. 358. Ebd., S. 359. Vgl.: ebd., S. 358. Ebd., S. 359.
1004 | Theanolte Bähnisch
nun sogar die Freiraumgestaltung ganzer Siedlungen.671 Gemeinsam mit Ingeborg Jensen, der Leiterin des Frauenreferats im Bundesministerium für Wohnungsbau672, gelang es der Spezialistin des DFR, Meyer-Waldeck, sich ab 1953 zumindest im Rahmen von Tagungen Gehör zu verschaffen und DFR-Mitglieder in den Verwaltungsrat des Deutschen Bauzentrums zu entsenden. 1955 veranstaltete der DFR schließlich in Verbindung mit der Ausstellung der Werkkunstschule Krefeld die Tagung ‚Werkform 1955‘. Ihre Bedeutung für die Frau. Ihre Anwendung in Haus und Wohnung‘.673 „Konzeptionell und organisatorisch“674 stellte der DFR Oesterreich zufolge mit seinem Ausschuß Weichen. Großen praktischen Einfluß habe er über seine Ortsringe jedoch nicht nehmen können.675 Autonome Eigeninitiative – also praktische Fortschritte vor Ort – hätten die Frauen, so Oesterreich, eher auf dem Gebiet der hauswirtschaftlichen Rationalisierung, ihrer Erforschung und ihrer Propagierung im Rahmen von Verbraucherberatungen entwickelt.676 Dies wiederum ist eine Tendenz, die sich auch in der ‚Stimme der Frau‘ nachvollziehen läßt, vor allem als sich Artikel zur Rationalisierung im Haushalt mit entsprechenden Werbeartikeln zu mischen begannen.677 Daß die erste große Wohnungstagung des DFR 1953, an der Architekten, Vertreter der Genossenschaften, des zuständigen Bundesministeriums und des niedersächsischen Sozialministeriums teilnahmen, in Hannover stattfand678, hatte sicherlich etwas mit den Beziehungen Bähnischs, der das Thema besonders am Herzen lag, zur Niedersächsischen Landesregierung zu tun. Der Sitz des DFR war zu jener Zeit nämlich Berlin. Aber eine Veranstaltung in der Messe-Stadt-Hannover hatte natürlich bessere Aussichten auf Besucher aus der Bundesrepublik. Die Arbeit des Sozial-Ausschusses im DFR hing mit der Arbeit des Wohnungsausschusses zwar zusammen, umfaßte jedoch noch weitere Bereiche: Theanolte Bähnisch betonte – in Anlehnung an ihre persönlichen Interessen – vor allem die Mitwirkung des DFR an Gesetzen zur Versorgung Kriegsgeschädigter und Hinterbliebener, an Regelungen zum Mutterschutz sowie die Arbeit des Verbands mit Flüchtlingen. Sie beschrieb als eine Ausprägung praktischer sozialer Arbeit im DFR, daß sich Mitglieder im Jugendflüchtlingslager Poggenhagen „zur […] fürsorgerischen Arbeit zur Verfügung gestellt“679 hätten. Wie jene Arbeit genau aussah, ist aus ihrer Rede leider nicht zu erfahren.
671 Vgl.: ebd. 672 Zur Einrichtung von Frauenreferaten in den Bundesministerien und der Rolle des DFR dabei siehe Kapitel 8.5.2 und 8.5.4. 673 Vgl.: Oesterreich: Form, S. 361. 674 Ebd., S. 360 675 Vgl.: ebd., S. 361. 676 Vgl.: ebd., S. 364. 677 Vgl.: O. V.: Mit Radar ist das Kochen eine wahre Hexerei. Notizen aus aller Welt, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 9, S. 2. Im Artikel halten sich allerdings Faszination und Skepsis in Bezug auf die neuen Möglichkeiten die Waage. 678 Vgl.: Ulich-Beil: Weg, S. 224. 679 Bähnisch: Wiederaufbau, S. 174.
Wachsende Prominenz | 1005
Zu bedauern ist, daß Bähnisch anläßlich ihrer höchst informativen Rede, die auf zehn Jahre Arbeit des DFR zurückblickte, keine Möglichkeit sah, näher über die Arbeit des Kulturausschusses zu informieren680 – zumal sie sich doch selbst sehr für das Thema ‚Kultur‘ begeistern konnte. Ihren sehr vagen Ausführungen zufolge stellte der Kulturauschuß, wie auch der Sozialausschuß, „das rechte Bild vom Menschen“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit. An diesem Statement, das vor allem das erste Segment des Kulturausschuß, nämlich ‚Erziehung und Bildung‘ in den Blick nimmt, werden wieder die Parallelen zu den Überzeugungen Eduard Weitschs, Fritz Borinskis und Adolf Grimmes deutlich. Denn Bähnisch hielt fest, „daß in allen Bildungsanstalten die Entwicklung des freien, geistbeherrschten, selbständigen und toleranten Menschen“ gewährleistet werden müsse. Ob die Aussage, daß der „Zugang zu dieser geistigen Welt“681 allen sozialen Schichten offenstehen müsse, im sozialdemokratischen Sinn zu verstehen war oder ob für die Aussage eher die Ideen der bürgerlichen Sozialreform maßgeblich waren, ist nicht klar. Anzunehmen ist, daß Empfehlungen für Bücher, Filme und Theaterstücke sowie Künstlerinnenportraits, die in der ‚Stimme der Frau‘ abgedruckt wurden, zumindest zum Teil Nebenprodukte der Segmente ‚Schrifttum, Presse und Rundfunk‘ sowie ‚Film und Theater‘ im Kulturausschuß des DFR beziehungsweise einer ähnlichen Arbeit des ‚Club deutscher Frauen‘ oder des Frauenrings der britischen Zone waren. In solchen Empfehlungen sind wiederum Schnittmengen mit der ‚gesamtdeutschen Arbeit‘ des DFR nicht zu übersehen, denn vor allem die empfohlenen Bücher spiegeln ein ‚westliches‘ Werteverständnis wieder.682 Christl Ziegler stützt Gabriele Streckers Darstellung, wenn sie schreibt, die ‚Erziehung zur Demokratie‘ sei die maßgebliche Bildungsarbeit der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen – also vor allem auch des DFR – gewesen und habe immer auch im Zentrum der Frauen-Konferenzen gestanden.683 Einen Beleg für ihre Aussage sieht sie in der Zusammenarbeit des DFR mit den Volkshochschulen, die sich unter anderem darin äußerte, daß Mitglieder des DFR dort Vorträge hielten.684 Auch im ‚Haus Schwalbach‘ bei Wiesbaden, welches die USMilitärregierung als ‚Leadership Training Center‘ verwendete, sind Ziegler zufolge im Rahmen einer Kursreihe des Büros für Frauenfragen685 Rednerinnen des DFR aufgetreten.686 Die Kurse richteten sich vor allem an ehrenamtlich tätige Frauen, einige auch an Kommunal- und Landtagsabgeordnete.687
680 Ebd., S. 175. 681 Ebd., S. 174. 682 Vgl.: O. V.: Ein Buch für Dich, aber welches?, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 6, S. 22. 683 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 86. 684 Vgl.: ebd., S. 99. 685 Gemeint ist die Einrichtung, aus der schließlich der Informationsdienst für Frauenfragen hervorging. Dieser benannte sich wiederum später in ‚Deutscher Frauenrat‘ um. 686 Vgl.: ebd., S. 146. 687 Vgl.: ebd., S. 142.
1006 | Theanolte Bähnisch
In Schwalbach wurde unter amerikanischer Aufsicht teilweise umgesetzt, was Bähnisch, ihrem Plan zur Errichtung einer Schule für staatsbürgerliche Frauenbildung zufolge, in der Nähe Hannovers mit Hilfe der Briten hatte verwirklichen wollen. In der ‚Verwendung‘ von Rednerinnen des DFR in Schwalbach deutet sich, wie in der Entstehung des Informationsdienstes Frauenfragen zum einen der Umstand an, daß der Junior-Partner Großbritannien gegenüber dem Seniorpartner USA an Einfluß in der „Frauenfrage“ verloren hatte. Gleichzeitig ist das Engagement des DFR im Haus Schwalbach ein Beispiel dafür, daß ein einseitiger Blick auf die Mitgliederzahlen und die Mitgliederstruktur des DFR bei Weitem nicht genügt, um seinen möglichen Einfluß auf Multiplikatoren und damit auf die Gesellschaft abzuschätzen. Denn auf dem Weg über Schwalbach konnten sich die Ziele und Ideen des DFR und seiner Präsidentin – zumal sie eine Schnittmenge mit jenen des US-Militärs, beziehungsweise der zivilen hohen Kommission bildeten – bis in die Privathaushalte verbreiten.
8.5 BÄHNISCH, DER DFR UND DIE MINISTERIEN – PERSONALPOLITIK, ZUSAMMENARBEIT UND DIE INSTITUTIONALISIERUNG VON BEWEGUNGSZIELEN 8.5.1 Die ‚gesamtdeutsche Arbeit‘ des Frauenrings wird Regierungs- und Geheimsache Einen besonders wichtigen Umstand im Zusammenhang mit den führenden Persönlichkeiten im DFR, die im Haus Schwalbach verkehrten, erwähnt Christl Ziegler zwar, sie betont aber nicht dessen Bedeutung: Zu den Rednerinnen gehörten auch Nora Melle und Marie-Elisabeth Lüders, die sich beide der Aufklärung über den Charakter des DFD als ‚stalinistische Tarnorganisation‘ verschrieben hatten.688 Auch die Sozialdemokratin, Opponentin und Konkurrentin Bähnischs, Annedore Leber, die eine Zeitlang Mitherausgeberin der betont antikommunistisch ausgerichteten Zeitschrift ‚Der Telegraf‘ war, fand sich unter den Rednerinnen.689 Gemessen an der politischen Haltung Lebers, Lüders und Melles ist davon auszugehen, daß in den Vortragsreihen nicht nur ‚demokratisches Gedankengut‘ vermittelt, sondern im gleichen Zug auch ‚antikommunistische Aufklärungsarbeit‘ betrieben wurde. Denise Tscharntke deutet diesen Zusammenhang in ihrer Studie zur Frauenarbeit der Briten an verschiedenen Stellen zumindest an.690 Die niedersächsischen Volkshochschulen befürworteten eine entsprechende Ausrichtung ihrer Arbeit als Bestandteil des ‚Zonenrandprogramms‘, in dem Themen der „Wiedervereinigung“ und des „Ost-West“-Konfliktes behandelt sowie „Kontaktpersonen“ wie „Lehrer/Behördenangestellte/Beamte/Gemeinde- und Kreisräte/Betriebs-
688 Vgl. dazu: Lüders, Marie Elisabeth: Frauen sichern Stalins Sieg, Berlin 1952. Sie stellt DFD und IDFF hierin als ‚Erfüllungsgehilfen‘ zur Verwirklichung der weltumspannenden Ideologie Stalins dar. Vgl.: ebd., S. 50. 689 Vgl.: Ziegler: Lernziel, S. 146. 690 Vgl.: Tscharntke: Re-educating.
Wachsende Prominenz | 1007
räte und Gewerkschaftler/Leiter von Jugendgruppen aller Richtungen usw.“691 angesprochen werden sollten, explizit. Zu vermuten steht, daß auch die 1951 in der Volkshochschule Göhrde angebotenen Kurse „Deutschland und Europa“ sowie „Frau, Friede, Freiheit“692 eine entsprechende Ausrichtung aufwiesen. Es stellt sich also gar nicht die Frage, ob der DFR seine ‚staatsbürgerliche Arbeit‘ stärker betonte als die ‚gesamtdeutsche‘, sondern es darf als gesichert gelten, daß diese beiden Aspekte seiner Arbeit untrennbar miteinander verschränkt waren. Eine Einladung zur staatsbürgerlichen Arbeitstagung des DFR an die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes, aus der hervorgeht, daß eines von zwei Hauptreferaten ein „Bericht über die Situation der Jugend und der Frauen in der S.B.Z.“, ein anderes dem Thema „Methoden der bolschewistischen Propaganda und Möglichkeiten der Abwehr“693 behandelte, spricht Bände. Im „Vorhof der Politik“694 tätig, betrachteten es die tonangebenden Kräfte im DFR als ihre Aufgabe, diesen ‚Vorhof‘ frei von kommunistischen Einflüssen zu halten. Beispielsweise unter diesem Aspekt wiesen die Frauenbildungsarbeit der Volkshochschulen und die des DFR doch frappierende Ähnlichkeiten auf, von denen Jeanne Gemmel vermutlich nicht einmal geträumt hatte, als sie 1946 dafür sorgte, daß die CCG (BE) auf Frauenbildung in überparteilichen Organisationen setzte. Theanolte Bähnisch zufolge wurden allein im Rahmen der ‚Sonderaktion anläßlich der Wahl des Bundestages 1957‘ über 100 staatsbürgerliche Veranstaltungen vom DFR durchgeführt.695 Ob die Errichtung der Berliner Mauer 1961 zu einem Anstieg oder einem Abfall der Kurszahlen geführt hat, wäre noch herauszuarbeiten, dazu müßten jedoch Akten der einzelnen Landes- und Ortsringe konsultiert werden. Die Anzahl der Pakete, die im Namen des DFR aus den ‚Packkreisen‘ vom Westen in den Osten geschickt wurden, erhöhte sich mit dem Bau der Mauer jedenfalls drastisch.696 Die Aktion ‚Päckchenhilfe Ost‘ des DFR zog sich – ab 1961 mit prominenter Unterstützung – bis mindestens in das Jahr 1964. Unter Bertha Middelhauve, die seit 1958 Präsidentin des zu dieser Zeit 1.000.000 Mitglieder starken Verbands war, arbeitete der DFR mit dem Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen „im Rahmen des Paketversandes nach Mitteldeutschland“697 zusammen. Dem Ministerium ging es dabei nicht um „eine einmalige Hilfe […], sondern um ständige, dauerhafte
691 NLA HA HStAH, Nds. 401, Acc. 92/85, Nr. 458/2, Entwurf eines Schreibens von Heiner Lotze an den Niedersächsischen Kultusminister, betr. Zonenrandprogramm 1957. 692 NLA HA HStAH, Nds. 401, Acc. 112/83, Nr. 729. 693 DFR-Archiv, A1, Deutscher Frauenring an die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes, 21.12.1951. Die Einladung erfolgte zu einer Tagung in Königswinter am 23. und 24.01.1952. 694 Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 180. 695 Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 178. 696 Vgl.: Koepcke: Frauen verändern die Welt, S. 10 und S. 65. 697 BArch, B 137, Nr. 4775, Der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen an den Deutschen Frauenring, Bertha Middelhauve, 13.11.1964.
1008 | Theanolte Bähnisch
Verbindungen (Patenschaften)“.698 Dies erklärte ein Mitarbeiter des Ministeriums Middelhauve laut seiner Vermerk in einem persönlichen Gespräch in ihrer Privatwohnung.699 Dem Ministerialrat zufolge, sagte dieser der DFR-Präsidentin zu, Anschriften von Jugendlichen in der DDR an sie weiterzuleiten. Er betonte, daß der Verband „eine gewisse Auswahl aktiver und verantwortungsfreudiger Damen“700 bereithalte – die für die Realisierung der politischen Ziele des Ministeriums offenbar gut geeignet schienen – zumal seine Organisationsstruktur das ganze Bundesgebiet abdeckte: „Um den Gedanken der gesamtdeutschen Hilfe in den Deutschen Frauenring hineinzutragen, soll zunächst vom Büro für gesamtdeutsche Hilfe eine Tagung mit Vertreterinnen aus allen Landesverbänden veranstaltet werden.“701 Danach solle für konkrete Aktionen „über die anfallenden Organisationskosten hinaus eine Beihilfe“702 gewährt werden. Mit anderen Worten: Das Bundeministerium schulte DFRMitglieder für seine politischen Zwecke und bezahlte die Organisation für Dienste, die sie in diesem Zusammenhang leistete – immerhin ein Hinweis auf eine aktive Mitarbeit vermutlich doch auch ‚einfacher‘ Mitglieder, der ein politisch bildender Charakter nicht abging. Daß die Unterstützung des Bundesministeriums nicht öffentlich bekannt werden sollte, verdeutlicht ein Brief des Bundesministers an Middelhauve, in dem es um einen am 07.11.1964 in der Berliner Zeitung erschienen Artikel ging. Die im Kern zutreffende Formulierung der Journalistin, daß der DFR „[z]usammen mit dem Ministerium für gesamtdeutsche Fragen […] eine wirksame Osthilfe aufgebaut“ habe, „die Pakete in die Sowjetzone schickt“703, nahm der Bundesminister zum Anlaß, der Vorsitzenden des DFR mitzuteilen, daß solche Veröffentlichungen „leicht zu einer Gefährdung und Störung des Geschenkpaketversandes […] führen könnten“.704 Er bat sie deshalb ihren Einfluß geltend zu machen, „damit künftig solche Veröffentlichungen im Interesse unseres gemeinsamen Anliegens unterbleiben“.705 Mittelhauve sicherte dem Minister zu, die „Leiter der Packkreise“706 dahingehend zu unterrichten. Die ausführenden Kräfte in den Packkreisen sollten also nicht zu viel über die Interessen der prominenten Unterstützer ihrer vermutlich abendlichen Beschäftigung wissen, was den politisch bildenden Charakter jener Aktion doch fragwürdig erscheinen läßt. Daß die ‚Stimme der Frau‘ von Beginn ihres Erscheinens an die frauenpolitischen Entwicklungen in Ostdeutschland weitgehend beschwieg, mag auch daran gelegen
698 699 700 701 702 703
Ebd. BArch, B 137, Nr. 4775, Büro für gesamtdeutsche Hilfe, Aktennotiz, 27.04.1961. Ebd. Ebd. Ebd. BArch, B 137, Nr. 4775, Der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen an den Deutschen Frauenring, Bertha Middelhauve, 13.11.1964. 704 Ebd. 705 Ebd. Ein Vermerk in derselben Akte macht deutlich, daß Middelhauve sich dieser Gefahr völlig bewußt war und daß sie ebenso unzufrieden mit dem Artikel war. 706 Ebd., Vermerk [des Bundesministers nach einer Unterredung mit Middelhauve], Bonn, 20.11.1964.
Wachsende Prominenz | 1009
haben, daß der gesamtdeutsche Ausschuß als Resultat seiner Arbeit nicht nur Unerfreuliches über die Lage der Frauen in der DDR zu berichten gehabt haben kann. Erklärtermaßen wollte er nämlich zu den Gebieten Rechtswesen, Sozialwesen, Kultur, Wirtschaftspolitische Fragen, Lebensstandard und Politik jeweils Vergleiche der Realitäten in ‚Ost‘ und ‚West‘ herausarbeiten.707 Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß die Gleichberechtigung in der DDR nicht nur nominell schneller umgesetzt wurde, sondern Frauen in der DDR – wenn auch nicht vorrangigaus emanzipatorischen Gründen – eine größere berufliche und gesellschaftliche Aufstiegsmobilität beschert war als in der BRD, dürfte es dem Ausschuß schwer gefallen sein, eine einseitig negative Berichterstattung abzuliefern. Auch wenn sich dies im Rahmen einer Arbeit mit Fokus auf die Präsidentin des DFR nicht hinreichend mit Belegen unterfüttern läßt, muß im Kampf gegen den ‚Osten‘ bei gleichzeitigem Einsatz für die Emanzipation von Frauen ein gravierender Zielkonflikt gelegen haben, der sich nicht ausräumen, aber durch eine zunehmende Konzentration des Frauenrings auf ‚bürgerliche‘ Werte und eine entsprechende Korrektur seiner ohnehin moderaten Forderungen zumindest entschärfen ließ. Wurde in den ersten Ausgaben der ‚Stimme der Frau‘ die Berufstätigkeit für Frauen auch in traditionell als ‚männlich‘ klassifizierten Berufsfeldern noch forciert, so dominierte in der Berichterstattung bald schon das Bild der Ernährer-Zuverdienerinnen-Ehe, in der die Berufstätigkeit der Ehefrau das harmonische Eheleben erschwert und ein Familien-Leben schier unmöglich macht.708 8.5.2 Bähnischs personalpolitische Einflußnahme auf das Frauenreferat im Bundesinnenministerium Nachdem sie den Deutschen Frauenring als zonenübergreifenden Verband etabliert hatte, nutzte die Vorsitzende ihre Chance, personalpolitisch eine für die Zukunft der Frauen im neu gegründeten Staat als zentral erachtete Schaltstelle zu beeinflussen. Der erste Kanzler der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, hatte in seiner Regierungserklärung am 20.09.1949 verlauten lassen, daß „der Frauenüberschuß“ in der Republik ein „Problem“ sei, „das unsere besondere Beachtung“ verdiene, und daß vor diesem Hintergrund „ein einer Frau anzuvertrauendes Referat im Ministerium des Innern“709 eingerichtet werden solle. Angesichts dieser Tatsache überrascht es beinahe, daß noch ganze drei Monate vergehen sollten, bevor die Regierungspräsidentin von Hannover sich an den Innenminister Gustav Heinemann wandte, um ihren Einfluß auf die vom Kanzler angekündigten Entwicklungen geltend zu machen. Sie führte damit ein Musterbeispiel für die Umsetzung des bereits vom ‚Club deutscher Frau-
707 DFR-Archiv, Freiburg, A2, Protokoll der 1. Sitzung des Ausschusses für gesamtdeutsche Fragen am Dienstag, den 06.12.1949, 11 Uhr, von Nora Melle, 12.12.1949. 708 Vgl. dazu: Freund: Krieg, S. 218. 709 BArch, B 106, Nr. 43233, Referat IA5, Karsten an den Staatssekretär [vermutlich Ritter von Lex] über Abteilungsleiter I und Unterabteilungsleiter I A, Betr. Frauenreferat, 11.07.1951, Anlage 1, Auszug aus der Niederschrift über die 5. Sitzung des Deutschen Bundestages, Dienstag, 20.09.1949. Erklärung der Bundesregierung: Dr. Adenauer, Bundeskanzler.
1010 | Theanolte Bähnisch
en‘ proklamierten Ziels, Behörden beratend zur Seite zu stehen, vor. „Wie ich gehört habe, wird in ihrem Ministerium ein Frauenreferat eingerichtet. Ich wäre Ihnen ausserordentlich dankbar, wenn ich darüber nähere Angaben erhalten könnte. Es liegt uns so sehr an einer geeigneten Besetzung und wir wären gern bereit, Ihnen sachlich und fachlich geeignete Vorschläge zu machen, sobald wir wissen, für welche Spezialgebiete Sie Frauen einstellen wollen“710, schrieb sie im Dezember 1949 an Heinemann und betonte dabei die schon so oft beschworene Überparteilichkeit und Interkonfessionalität des DFR. Frauen, die jetzt „in leitende Stellen“ kämen, erklärte Bähnisch dem Minister, sollten „in jeder Beziehung für diese Position geeignet“ sein und die „Fähigkeit haben, die notwendigen Kontakte mit sämtlichen wichtigen Frauenorganisationen aufzunehmen.“711 In der Vorstellung der Regierungspräsidentin konnte für den zu besetzenden Posten also nur eine Frau in Frage kommen. Damit, daß für die Stelle zunächst die Bewerbungsunterlagen dreier Männer beim Bundeskanzleramt eingingen und an das Ministerium weitergeleitet wurden, hatte sie wohl nicht gerechnet.712 Aber weder einer der Männer, darunter Kurt Breull, der das Aufenthalts- und Asylrechtsreferat im BMI leitete, noch Maria S., die sich ebenfalls beworben hatte,713 schienen für die Stelle in Frage gekommen zu sein. Im Januar 1950 reichte Bähnisch dem Innenminister, nachdem dieser sie zu einer persönlichen Unterredung empfangen hatte,714 eine Vorschlagsliste mit fünf möglichen Kandidatinnen für den Posten ein. Nur zwei der Frauen kannte Bähnisch persönlich: Die Dortmunder Rechtsanwältin Hildegard Gethmann und Dr. Emmy Rebstein-Metzger715, ebenfalls eine Rechtsanwältin, die bereits in den 1930er Jahren juristische Kommentare zur Erneuerung des Familienrechts verfaßt hatte.716. Die anderen Frauen, Rechtsanwältin Edith Heitmann-Asher, Rechtsanwältin Dr. Schleifes und die Juristin Dr. Hilde Bertram, hatte Bähnisch auf Empfehlung anderer Frauen vorgeschlagen. „Da die personelle Besetzung dieses Referats von entscheidender Bedeutung für uns Frauen
710 BArch, B 106, Nr. 52024, Deutscher Frauenring, Theanolte Bähnisch an Bundesinnenminister Heinemann, 21.12.1949. 711 Ebd. 712 BArch, B 106, Nr. 52024, Zusammenstellung der an das Bundesministerium des Innern weitergeleiteten Bewerbungsunterlagen, Anlage zum Schreiben vom Bundeskanzleramt an den Bundesminister des Innern, 17.11.1949. 713 Ebd. 714 BArch, B 106, Nr. 52024, Deutscher Frauenring, Theanolte Bähnisch an den Bundesminister des Innern, 30.01.1950. 715 Rebstein-Metzger war nach Angaben von Bähnisch parteilos, hatte aber bis 1933 der „F.P.D“ [gemeint ist vermutlich die DDP] – angehört. BArch, B 106, Nr. 52024, Deutscher Frauenring, Theanolte Bähnisch an den Bundesminister des Innern, 30.01.1950. Sie war auch Mitglied des DFR. 716 Vgl.: Rebstein-Metzger, Emmi: Gutachten über die Frage: Inwiefern bedürfen die familienrechtlichen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit Rücksicht auf den die Gleichberechtigung der Geschlechter aussprechenden Art. 119 Abs. 1 Satz 2 R[eichs]verf[assung] einer Änderung?, in: Verhandlungen des 36. Deutschen Juristentages in Lübeck, Berlin/Leipzig 1932, S. 540–591.
Wachsende Prominenz | 1011
ist“, erlaubte sich Bähnisch im Namen aller deutschen Frauen zu sprechen, „bin ich Ihnen besonders dankbar, dass ich für dieses Referat Vorschläge machen darf“717. Zwischenzeitlich schien der Bundesminister auch von anderer berufener Seite Vorschläge eingeholt zu haben. Als fünf Wochen nach Bähnischs letzter schriftlicher Kontaktaufnahme noch keine Entscheidung gefallen war, aber eine Möglichkeit im Raum stand, fixierte sie sich, da sie die Felle davon schwimmen sah, ganz auf die von ihr im Januar empfohlene Hildegard Gethmann. Diese war Vorsitzende der später in ‚Juristinnenbund‘ umbenannten ‚Vereinigung weiblicher Juristen und Volkswirte‘ und „bisher durch ihre Vorträge über Rechtsfragen im Katholischen Frauenbund bekannt.“718 Von der Kandidatin erhoffte sich Bähnisch, daß sie „auch den Wünschen von Helene Weber entspricht, da sie Mitglied der CDU und positive Katholikin ist“719. Die Regierungspräsidentin hatte offenbar, von ihrer eigenen, offiziell neutralen, jedoch merklich eher dem Protestantismus zuneigenden Position ausgehend, die politische und konfessionelle Offenheit anderer im Bundesinnenministerium einflußreicher Frauen, überschätzt. „Wir hoffen, daß es Ihnen auf Grund dieses Vorschlags möglich sein wird, Frau Weber zu veranlassen, von ihrer Benennung Frau Beckmann aus München Abstand zu nehmen.“720 Weber, die bereits in der Weimarer Republik Mitglied des Zentralvorstandes des KDFB, erste Vorsitzende des ‚Vereins katholischer Sozialbeamtinnen‘ und Mitglied des Zentrums war, hatte sich 1948 als Mitbegründerin der Frauenarbeitsgemeinschaft der CDU/CSU (einer Vorläuferin der heutigen Frauenunion) hervorgetan721, leitete den ‚Bundesverband katholischer Fürsorgerinnen‘ Deutschlands und fungierte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erneut als stellvertretende Vorsitzende des KDFB. Mehrfach hatte sie – vor allem in ihrer Zeit als Mitglied des Parlamentarischen Rates – zum (geplanten) Gleichberechtigungsartikel im Bonner Grundgesetz Stellung bezogen.722 Bei ihren Parteikollegen fand sie, die seit 1949 Mitglied des Bundestages für die CDU war, entsprechend ihrer fachlichen Eignung Gehör. Das wiederum mißfiel der auf parteipolitische Unabhängigkeit setzenden Theanolte Bähnisch. „Wenn das Frauenreferat nicht mit einer Frau besetzt wird, die neben ihrer unantastbaren Persönlichkeit und fachlichen Eignung das Vertrauen der bewusst staatsbürgerlich sich verantwortlich fühlenden Frauen in Deutschland besitzt, wird nach unserer Auffassung die Frauenreferentin nicht in der Lage sein, ihre vielseitigen und schwierigen Aufgaben wirklich
717 BArch, B 106, Nr. 52024, Deutscher Frauenring, Theanolte Bähnisch an den Bundesminister des Innern, 30.01.1950. 718 Ebd. 719 BArch, B 106, Nr. 52024, Deutscher Frauenring, Bähnisch an Heinemann, 03.03.1950. 720 Ebd. 721 Vgl. dazu: Süssmuth, Hans: Kleine Geschichte der CDU-Frauen-Union, Baden-Baden 1990, S. 61–81. 1951 übernahm Helene Weber gemeinsam mit Maria Eichelbaum den Vorsitz der Frauen-Union. Vgl.: ebd., S. 211. 722 So hatte sie beispielsweise auf der Tagung der CDU-Frauenarbeitsgemeinschaft am 25./26.05.1949 in Königswinter zum Thema ‚Das Bonner Grundgesetz‘ gesprochen. Vgl.: Süssmuth: Frauen-Union, S. 71.
1012 | Theanolte Bähnisch
durchzuführen“723, ließ Bähnisch sich gegenüber Heinemann aus. Daß sie selbst eine Frau im Auge gehabt haben muß, mit der sich insbesondere der DFR identifizieren konnte, findet sich im Folgenden bestätigt: „Die bewußt staatsbürgerlich denkenden Frauen sind in ihrer überwiegenden Mehrheit im Deutschen Frauenring engagiert und ich spreche zugleich in ihrem Namen“724, betonte Bähnisch selbstbewußt ihre Stellung. Keine zwei Wochen später hakte sie nach und teilte, diesmal nicht Heinemann direkt, sondern dem Oberregierungsrat Perbandt mit, daß sie „in größter Sorge“ sei, was die Besetzung des Frauenreferats angehe. „Besser kein Frauenreferat als eine unzureichende Besetzung, zu der wir kein Vertrauen haben“, machte sie ihrer Angst, die Arbeit des Referats könne ihren Interessen – und in ihrer Wahrnehmung damit den Interessen der meisten deutschen Frauen – zuwiderlaufen, Luft. „Uns kam es ja von Anfang an in erster Linie darauf an, dass in den einzelnen Ministerien möglichst viele Frauen-Referentinnen eingestellt werden“725, stellte sie nun auch die Einrichtung des Frauen-Referats als solches in Frage. Am 01.06.1950 wandte sie sich wieder direkt an den Innenminister und teilte auch ihm, obwohl er aus „unseren wiederholten Besprechungen“726 ihre Position bereits kannte, noch einmal mit, was sie bereits an Perbandt geschrieben hatte: Daß die Lösung, in allen Ministerien geeignete Frauen-Referentinnen einzustellen, doch besser sei, als sich auf ein Frauenreferat zu konzentrieren. Zuviel Machtfülle in einer Person, das wird hier nur allzu deutlich, behagte der Präsidentin des Frauenrings nicht – jedenfalls nicht, wenn es sich nicht um eine Besetzung nach ihrem Gusto handelte. Sie wollte gesichert wissen, daß, nachdem die Einrichtung eines FrauenReferats beschlossene Sache sei, auf jeden Fall „eine Volljuristin“, eine Frau, die „ihrer ganzen Persönlichkeit nach geeignet ist, ausgleichend Verhandlungen zu führen“, und die „das Vertrauen der grossen Frauenverbände“727 habe, ausgewählt werden müsse. Um die Besetzung zu vereinfachen und in ihrem Sinne möglichst schnell festzuklopfen, ruderte sie nun, nachdem sie im März versucht hatte, das Problem durch Vorpreschen zu lösen, drei Schritte zurück und hielt fest, daß der Frauenring „mit jeder fachlich geeigneten Frau, die die drei […] Voraussetzungen erfüllt, einverstanden ist. Damit erledigt sich mein Schreiben vom 3. März d. J.“728 Bähnischs Briefen an das Innenministerium ist zu entnehmen, daß sie sich als Frauenreferentin eine Person vorstellte, die in der Lage wäre, in Zusammenarbeit mit dem DFR die erforderliche Angleichung der Gesetze an den Artikel 3 des Grundgesetzes zu leisten. Daß dies in ihrer Überzeugung am besten eine Juristin hätte leisten können, leuchtet ein. Daß sie dazu auf eine Frau setzte, die, wie sie selbst, ohne
723 BArch, B 106, Nr. 52024, Deutscher Frauenring, Bähnisch an Heinemann, 03.03.1950. 724 Ebd. 725 BArch, B 106, Nr. 52024, Theanolte Bähnisch, Regierungspräsident an Oberregierungsrat von Perbandt, Bundes-Innenministerium, 15.03.1950. 726 BArch, B 106, Nr. 52024, Deutscher Frauenring, Theanolte Bähnisch an den Bundesmister des Innern, Dr. Heinemann, 01.06.1950. 727 Ebd. 728 Ebd.
Wachsende Prominenz | 1013
Rücksicht auf parteiliche oder konfessionelle Bindungen, vermittelnd wirken konnte, war ebenfalls nicht nur im Sinne Bähnischs, sondern auch insgesamt klug gedacht, vor allem vor dem Hintergrund, daß die treibende politische Kraft in jener Hinsicht nicht in der regierenden Partei, der CDU, zu sehen war. Daß sie dabei auch den Einfluß ‚ihrer‘ Organisation sowie der Frauenverbände, die dem DFR positiv gegenüberstanden, gesichert wissen wollte, ist nur allzu nachvollziehbar. Schließlich hing sie der Überzeugung an, mit dem DFR die wichtigste Lobby-Organisation von Frauen in Deutschland überhaupt zu leiten. Daß am Ende mit Dorothea Karsten zwar keine Volljuristin, sondern eine Volkswirtin, die aber in rechtswissenschaftlichen Zusammenhängen geschult war, für den Posten ausgewählt wurde, dürfte die Regierungspräsidentin versöhnlich gestimmt haben. Schließlich hatte sie gemeinsam mit Karsten in Hannover durch die Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘ den Grundstein fürden Bundesverband DFR gelegt. Daß Bähnisch auch 1951 noch hinter Karsten stand, läßt sich daran ablesen, daß sie auch die Nominierung Karstens zur Vertreterin deutscher Frauen in der UNESCO unterstützte.729 Einer im Bestand ‚Innenministerium/‚Frauenreferat‘ überlieferten undatierten Liste zufolge war unter anderen Frauen auch Anna Mosolf für den Posten der Frauenreferentin vorgeschlagen worden.730 Bei beiden Namen, Karsten und Mosolf, die ausschließlich auf der undatierten Liste mit verschiedenen Vorschlägen für die Position der Referentin und der Hilfsreferentin auftauchen, ist jedoch unklar, wer sie ins Spiel gebracht hatte.731 Die SPD-Frauenreferentin Herta Gotthelf glaubte fest daran, daß es Bähnisch selbst gewesen sein mußte, die die Benennung Karstens durchgesetzt hatte, zumal dem Parteigenossen Meier auf seine Anfrage beim Innenministerium hin offenbar Entsprechendes zur Antwort gegeben worden war.732 Gotthelf rief den Hannoveraner Bezirksvorstand deshalb dazu auf, die Genossin, die „beim Innenministerium ihre eigene Personalpolitik macht“733, zur Rede zu stellen. „Da es sich hier nur um eine weitere, in einer Reihe von ähnlichen parteischädigenden Handlungen von Frau Bähnisch handelt, legen wir Wert darauf, dass der Bezirksvorstand die Angelegenheit untersucht und Frau Bähnisch darauf hinweist, dass auch für sie die Verpflich-
729 BArch, B 106, Nr. 47204, Allg. Frauenfragen; hier: Vollversammlung des deutschen Ausschusses der UNESCO-Beteiligung von Frauen, Vermerk, Bonn, 13.02.1951. Laut Karsten waren am 10.02.1951 der Frauenring, die Frauen-Abteilung des DGB, der „deutsch-katholische Frauenbund“ [KDFB?], die „evgl. Frauenarbeit im Reich“ [DEF?] und die WOMAN zusammengekommen, um „auf Anfordern“ zwei Vertreterinnen der gesamten deutschen Frauenorganisationen für die Vollversammlung des deutschen Ausschusses der UNESCO zu wählen. 730 BArch, B 106, Nr. 52024, Vorschläge für die Besetzung eines Frauenreferates im Bundes-Innenministerium, o. V., o. D. 731 Ebd. 732 AdSD, SPD-Parteivorstand (Alter Bestand), Nr. 0162, Herta Gotthelf an den Bezirksvorstand der SPD Hannover, 08.09.1950. 733 Ebd.
1014 | Theanolte Bähnisch
tungen, die für jeden Sozialdemokraten gelten, verpflichtend sind.“734 Im nun folgenden ‚Verhör‘ durch Hans Striefler, Bezirkssekretär der SPD Hannover, scheint die Regierungspräsidentin ihre Einflußnahme negiert zu haben.735 Doch Gotthelf wetterte, nachdem sie Karsten einmal in Bähnischs Dunstkreis verortet hatte, weiter gegen die Leiterin des Verbandes ‚Frauen in sozialen Berufen‘, die den Genossen in Hannover „wegen ihrer sozial-reaktionären- und gewerkschaftsfeindlichen Haltung bekannt“ sei.736 Als die Frauenreferentin Karsten 1951 zu einer Zusammenkunft in das Ministerium einlud, zeigte sich Gotthelf, die ganz offensichtlich darum bemüht war, an ihren Vorurteilen festzuhalten, „fest überzeugt“ davon, daß „sämtliche konfessionelle Jungfrauenverbände antreten werden.“737 8.5.3 Personalpolitik beim ‚Informationsdienst für Frauenfragen‘ Dorothea Karsten schlug ihrerseits wiederum Theanolte Bähnisch als erste unter mehreren Personen vor, als es um die personelle Besetzung des ‚Advisory Comittee‘ zur Einrichtung eines ‚Reference Service Bureau‘ ging, welches unter dem für deutsche Zungen eingängigeren Namen ‚Informationsdienst für Frauenfragen‘ im Juli 1951 eröffnet werden sollte. 1969 ging aus diesem ‚Informationsdienst‘ der heute noch unter diesem Namen existierende ‚Deutsche Frauenrat‘738 hervor. Schon 1958 hatte der ‚Informationsdienst‘ als Dachorganisation von Frauenverbänden in Deutschland fungiert. Er leistete also das, was der DFR eben nicht leisten konnte – oder wollte. Seit Ende 1951 waren in ihm – allerdings bis zum Neuzuschnitt 1958 nur über Delegierte – auch Verbände, beziehungsweise Richtungen der Frauenbewegung vertreten, die nicht unter das ‚Dach‘ des DFR gewollt hatten.739 Der DFR wurde im „Informationsdienst“ von seinem Vorstandsmitglied Dorothee von Velsen repräsentiert. 1951 hatte der ‚Informationsdienst‘ Nori Möding zufolge bereits 60.000 Mitglieder.740
734 Ebd. 735 AdSD, SPD-Parteivorstand (Alter Bestand), Nr. 0162, Hans Striefler an SPDParteivorstand, z. Hd. Herta Gotthelf, 10.10.1950. 736 Ebd. 737 AdSD, SPD Parteivorstand (Alter Bestand), Nr. 0149 B, Korrespondenzen mit SPDMitgliedern des Bundestags, Herta Gotthelf an Anni Krahnstöver, 08.01.1951. 738 Vgl. zur Geschichte des Frauenrats: Stoehr/Pawlowski: Demokratie. 739 Folgende Verbände gehörten zu den Gründungsverbänden: Arbeitsgemeinschaft der Wählerinnen, Arbeitsgemeinschaft für Mädchen und Frauenbildung, Arbeitsgemeinschaft Katholischer Frauen, Deutsche Angestellten-Gewerkschaft, Deutscher Akademikerinnenbund, Deutscher Frauenring, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Hausfrauenbund, Deutscher Landfrauenverband, Deutscher Verband Berufstätiger Frauen, Evangelische Frauenarbeit in Deutschland, Jüdischer Frauenbund, Staatsbürgerinnenverband, Verband weiblicher Angestellter. Vgl.: O. V.: Geschichte, auf: Deutscher Frauenrat, http://www. frauenrat.de/deutsch/verband/geschichte.html, am 13.12.2013. 740 Der Frauenring habe zu dieser Zeit 50.000 Mitglieder gehabt, so Möding, die ihre Informationen offenbar aus dem ‚Handbuch Deutscher Frauenorganisationen‘ bezieht, welches
Wachsende Prominenz | 1015
„Dass die Frauenvertretungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG) dabei waren, galt vielen als Versöhnung zwischen liberal-bürgerlicher und sozialistischer Frauenbewegung“741, betont der Frauenrat diese historisch bedeutsame Entwicklung heute mit einigem Stolz. Daß der Frauenrat auf seiner Homepage den ‚Neubeginn der Frauenbewegung in Deutschland‘ auf ‚Ende 1951‘ festlegt, erscheint in Anbetracht der Geschichte des DFR, aber auch anderer Frauenverbände, die sich ab 1945 (wieder) gegründet hatten, allerdings unangemessen.742 In der Einrichtung des Informationsdienstes wurde, wie an keinem anderen Beispiel, deutlich, daß die US-Militärregierung mittlerweile das Ruder in der Frauenarbeit der Westalliierten in Deutschland übernommen hatte. Denn die Initiatorin des ‚Informationsdienstes‘ war US-Senior Women’s Affairs Officer Frances Woodsmall.743 Diese hatte zu einer ersten Besprechung auch Rita Ostermann sowie Mme Carrez, also die für die Frauen-Re-education hauptsächlich zuständigen Personen aus den anderen westlichen Besatzungszonen, und die Landesfrauenreferentinnen hinzu gebeten. Als einzige Deutsche nahm Dorothea Karsten, die Leiterin des Frauenreferates im Innenministerium, teil.744 „Sie wird später den Informationsdienst von ihrer Position aus tatkräftig unterstützen und auch für seine finanzielle Förderung sorgen“745, schreibt die Expertin für die deutsche Frauenbewegung, Irene Stoehr, über Karstens Funktion im Informationsdienst. Daß Bähnischs Einfluß auf die Besetzung von Positionen, die für die Zukunft von Frauen in der Bundesrepublik eine wichtige Rolle spielten, bestehen blieb, obwohl der Informationsdienst den Frauenring in der Anzahl der ihm angeschlossenen Verbände schon mit seiner Gründung überholte746, zeigt, wie sehr sie sich bis 1951 als Expertin auf jenem Gebiet etabliert hatte.747 Daß Anna Mosolf schließlich gemeinsam mit Dorothee von Velsen und Emmy Beckmann das ‚Advisory Komitee‘ bilde-
741 742 743 744 745 746 747
der Informationsdienst 1952 herausgegeben hatte. Vgl.: Möding: Stunde, S. 624. 1951 hatten dem Informationsdienst bereits 14 Frauenverbände angehört. Was die Mitgliederstärke der beiden Verbände angeht, so ist nicht klar, wie die Zahl ‚60.000‘ für den ‚Informationsdienst‘ zustande kommt. Handelt es sich um die Mitgliederstärke, die aufgrund der angeschlossenen Verbände zustande kam, kann die Zahl kaum mit der Mitgliederstärke des DFR verglichen werden. Denn diese muß sich auf die Anzahl der Individualmitgliedschaften beziehen, die der DFR selbst um 1951 mit 40.000 angab. DFR-Archiv, A1, Zahlenmaterial, 1951. O. V.: Geschichte, auf: Deutscher Frauenrat, http://www.frauenrat.de/deutsch/verband/ geschichte.html, am 13.12.2013. Vgl.: ebd. Vgl. dazu auch: ebd., S. 15. Ebd., S. 16. Stoehr/Pawlowski: Demokratie, S. 16. In dieser Rechnung sind die Landes- und Ortsringe des DFR nicht berücksichtigt! BArch, B 106, Nr. 48585, Dorothea Karsten an Ruth F. Woodsmall, Chief Women’s Affairs Branch, Education and Cultural Relations Division, Office of the United States High Commissioner for Germany, 02.07.1951.
1016 | Theanolte Bähnisch
te748, das einen Plan für den Zuschnitt und die Aufgaben des ‚Reference Service Bureau‘ ausarbeiten sollte749, sprach für den Erfolg, auf den Bähnischs überparteiliche Strategie auch bei den Amerikanern gestoßen war.750 Gleiches läßt sich über die Tatsache sagen, daß Woodsmall als Vorsitzende des ‚Service Bureau‘ am liebsten Emmy Beckmann sehen wollte, die den Hamburger Frauenring mit gegründet hatte.751. Die Hannoveraner Regierungspräsidentin war 1951 unter den veränderten Konstellationen zwischen den Besatzungsmächten weiterhin Teil eines Netzwerks, das die Frauenarbeit in Deutschland entscheidend (mit)bestimmte. Doch durch das Zutun der Amerikaner hatte sich dieses Netzwerk verändert: Für den Rundfunk war Gabriele Strecker im ‚Advisory Committee‘ präsent, für die Printmedien die bekennende Sozialdemokratin und Kritikerin Bähnischs, Annedore Leber, welche sich Woodsmall auch als zweite Vorsitzende des Committees hatte vorstellen können. Daran wird deutlich, daß, anders als von der CCG (BE), von den USA nicht nur Frauen aus überparteilichen Frauenorganisationen, sondern auch parteinahen Protagonistinnen, die der überparteilichen Arbeit sehr kritisch gegenüberstanden, wichtige Funktionen übertragen wurden.752 Die USA schienen jenen Brückenschlag offensiv anzustreben, vor dem die Briten kapituliert – und damit Bähnisch zu starker Dominanz verholfen – hatten. Schließlich wurde doch nicht Beckmann, sondern Nora Melle zur ersten Vorstands-Vorsitzenden des Informationsdienstes gewählt. Dies mag ein später Trost dafür gewesen sein, daß ihr ein Sitz im Vorstand des DFR 1949, obwohl Bähnisch sich dafür eingesetzt hatte, verwehrt geblieben war. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch hier die Regierungspräsidentin ihre Finger im Spiel hatte. Daß die alten Eliten des BDF und damit die ältere Generation im DFR bis 1951 wieder an Einfluß verloren, nachdem sie zwischen 1946 und 1949 ihr ‚Comeback‘ erlebt hatten, war also nicht nur von Nachteil für Bähnischs politische Strategie. Denn diese bestand ja unter anderem darin, dem DFD mit jüngeren Gesichtern im Westen zu begegnen. Die Doppelfunktion Melles als Leiterin des Ausschusses für gesamtdeutsche Fragen im DFR sowie als erste Vorsitzende des ‚Informationsdienstes für Frauenfragen/Deutscher Frauenrat‘ führte dazu, daß eine enge personelle – und damit auch ideelle – Verbindung zwischen dem von Bähnisch gegründeten Verband und dem von der USMilitärregierung initiierten ‚Informationsdienst‘ entstand, die durch eine vergleichsweise junge Frau verkörpert wurde. Daß schließlich die Regierungsrätin und ehren-
748 BArch, B 106, Nr. 48585, Deutscher Frauenring, Bähnisch, an den Bundesminister zu Händen Frau Reg. Direktorin Dr. Karsten, Frauenreferat, 23.11.1951. Vgl. dazu auch: Stoehr/Pawlowski: Demokratie, S. 17. 749 Ebd. 750 Irene Stoehr und Rita Pawlowski führen den Umstand, daß Woodsmall mit von Velsen und Beckmann kooperierte auf den Umstand zurück, daß die britische Women’s Affairs Abteilung 1951 aufgelöst worden war und die Französinnen sich aus der – ohnehin nie besonders intensiven – Arbeit zurückgezogen hatten. Vgl.: Stoehr/Pawlowski: Demokratie, S. 18. 751 BArch, B 106, Nr. 48585, Vermerk von Karsten, 18.09.1951. 752 Ebd.
Wachsende Prominenz | 1017
amtliche Organisatorin des DFR, Maria Prejawa, an die Tochter des berühmten Theologen Rudolf Bultmann, Antje Lemke, schrieb und es in ihrem Brief um die Kandidatur Lemkes um den geschäftsführenden Vorsitz im Frauenrat ging753, läßt darauf schließen, daß Theanolte Bähnisch, als deren rechte Hand Prejawa auftrat, in die Genese des Informationsdienstes noch stärker involviert war, als formal ohnehin schon zu erkennen war. Irene Stoehr und Rita Pawlowski schreiben gar, daß Theanolte Bähnisch und Dorothea Karsten Nora Melle ‚gedrängt‘ hätten, der Bibliothekarin und ehemaligen Privatsekretärin Ricarda Huchs754, Antje Lemke, den Posten anzubieten, sie nennen hierfür jedoch keinen genauen Beleg.755 Daß Stoehr wiederum eine Einflußnahme der Frauenreferentin des Innenministeriums auf die Besetzung der Stelle im ‚Informationsdienst Frauenfragen‘ annahm, unterstreicht die Wahrnehmung, daß enge Zusammenhänge zwischen beiden Institutionen bestanden. Die geschäftsführende Leitung des ‚Informationsdienstes für Frauenfragen‘ übernahm schließlich, da Lemke sich nicht entsprechend binden wollte756, im Februar 1952 Annelise Glaser. Die Lektüre des Bundesarchiv überlieferten Materials bestätigt die auf OMGUS-Akten basierende Darstellung Marianne Zepps, daß sich das Informationsbüro direkt aus der Wiesbadener ‚Gesellschaft zur Gestaltung des öffentlichen Lebens‘ heraus entwickelt habe, nicht in dem von Zepp angenommenen Maß.757 Zweifelsohne ist im Wiesbadener Büro der Vorläufer des Bonner Büros zu sehen, doch scheint sich ‚Hannover‘ ebenfalls sehr stark in die Entwicklung eingebracht zu haben – was Zepp aufgrund ihrer Konzentration auf die US-Zone entgangen zu sein scheint. Berücksichtigt man den Einfluß, den Bähnisch ausübte, so war es kein Wunder, daß Herta Gotthelf, die den Informationsdienst des Büros durchaus zu schätzen wußte, mit einem anderen Gebiet, dem sich das Büro widmete, so gar nicht einverstanden war. Die „völlig[e] oder teilweise“ Finanzierung von „Konferenzen von ‚Persönlichkeiten‘, Organisationen ‚überparteilicher‘ Frauen“ – sprich: der Einfluß ihrer Rivalin Theanolte Bähnisch – müsse bei der von der Bundesrepublik geplanten Übernahme des Büros aus den Händen der Amerikaner durch die SPD „selbstverständlich“758 unterbunden werden, schrieb Gotthelf an den stellvertretenden Parteipräses Erwin Schöttle, der seit 1949 Mitglied des deutschen Bundestags war. Es war
753 BArch, B 106, Nr. 48585, „Le“ an Regierungsrätin Prejawa, persönlich, 15.11.1951. „Le“, bei der es sich – was die Ausführungen zur von Antje Lemke geleiteten „Gesellschaft zur Gestaltung des öffentlichen Lebens“ im Brief nahelegen – vermutlich um Lemke handelte, hatte im Vorfeld offenbar mit Eberhard von Radio Frankfurt gesprochen. In welchem Verhältnis Eberhard und Prejawa zueinander standen, ist nicht bekannt. 754 Vgl.: Roser, Traugott: Protestantismus und soziale Marktwirtschaft. Eine Studie am Beispiel Franz Böhms, Münster 1998, S. 101. 755 Stoehr/Pawlowski: Demokratie, S. 20. 756 BArch, B 106, Nr. 48585, „Le“ [Antje Lemke] an Regierungsrätin Prejawa, persönlich, 15.11.1951. 757 BArch, B 106, Nr. 48585, Annelise Glaser an Dorothea Karsten 13.02.1952; ebd., „Le“ [Antje Lemke] an Regierungsrätin Prejawa, persönlich, 15.11.1951. 758 AdSD, SPD-PV (Alter Bestand), Nr. 0149 B, Herta Gotthelf an Erwin Schöttle, 13.12.1951.
1018 | Theanolte Bähnisch
Teil der Re-education- wie der Containment-Strategie der USA, die Zuständigkeit für das Büro in deutsche Hände zu überführen. Und jene Hände sollten nach Gotthelfs Dafürhalten nicht die Bähnischs oder einer ihrer Mitstreiterinnen sein. 8.5.4 Das BMI-Frauenreferat zwischen Widersachern und Unterstützern Daß die frischgebackene Frauenreferentin im Bundesinnenministerium, Dorothea Karsten, kurz nach ihrem Dienstantritt erst einmal auf Großbritannien-Reise ging, verwundert, aus der Retrospektive betrachtet, nicht. Schließlich war und blieb es britische Politik, wichtige Multiplikatorinnen nach Großbritannien einzuladen. Daß diese auch auf Karsten Anwendung fand, war, gemessen an ihrer Position, aus der Sicht der Briten geradezu selbstverständlich. Die Stuttgarter Zeitung nahm Karstens Reise jedoch zum Anlaß, zu kritisieren, daß die Frauenreferentin, kaum eingestellt, schon wieder unterwegs und ihr Referat verwaist war.759 Karsten müßte dem Artikel zufolge den Posten Mitte September 1950 übernommen haben. Ihre Rückkehr aus Großbritannien war für den 06.11.1950 geplant.760 Zeit vor Ort verbrachte die Frauenreferentin noch genug: Dorothea Karsten bekleidete ihr Amt im Bundesinnenministerium bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1963. Mit der personellen war auch eine inhaltliche Kontinuität der „gesamten Frauenarbeit“ gesichert, welche Karsten zufolge „nicht die Statuierung eines besonderen ‚Frauenrechts‘“, sondern die „gemeinschaftliche Arbeit von Mann und Frau am Aufbau einer sittlichen Lebensordnung“761 zum Ziel hatte. Das Frauenreferat hatte dort seine Mitarbeit zur Verfügung zu stellen, wo es um die Förderung dieses Ziels gehe, hielt der ‚Vermerk über Aufbau, Ausbau und künftige Arbeiten des Frauenreferates im Bundesministerium des Innern‘ fest.762 Die von Karsten gewählte ZielFormulierung erinnert wohl kaum zufällig an die Erklärung des ‚Club deutscher Frauen‘ von 1946. In dieser waren die ‚kameradschaftliche Zusammenarbeit von Mann und Frau‘ sowie die ‚Gesundung des Familienlebens‘ als zwei von sechs Zielen der Club-Arbeit genannt worden. Die Aufgaben des Referats, das seine frauenpolitische Aufgabe eher defensiv definierte, standen insgesamt im Einklang mit den Zielen und Überzeugungen der Politik Bähnischs und waren eng an die im Grundgesetz erklärte Zuständigkeit des Staates für den besonderen Schutz von Ehe und Fami-
759 BArch, B 211, Nr. 22-1, Abschrift ohne Seitenangabe: O. V. [‚-kamp‘]: Frauenreferat außer Betrieb, Stuttgarter Zeitung, 31.10.1950. 760 Ebd. 761 BArch, B 106, Nr. 43233, Vermerk über Aufbau, Ausbau und künftige Arbeiten des Frauenreferates im Bundesministerium des Innern, vermutlich verfaßt von Dorothea Karsten, o. D., versendet als Anlage zu Karsten an den Staatssekretär [vermutlich Ritter von Lex] über Abteilungsleiter I und Unterabteilungsleiter I A, Betr. Frauenreferat, 11.07.1951. 762 Ebd.
Wachsende Prominenz | 1019
lie geknüpft, auf die Adenauer in seiner Antrittsrede rekurriert hatte.763 Im ‚Vermerk‘ wurden sie wie folgt definiert: „Untersuchungen über den gegenwärtigen Stand der Stellung der Frau“ sowie Mitwirkung bei • „der Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für die Gleichberechtigung im Sinne
des maßgeblich von Elisabeth Selbert forcierten Art. 3 (2) GG • „Maßnahmen zum Schutz der Ehe und Familie und der Mutter“ • „sonstigen Maßnahmen zur Förderung der Belange der Frau – insbesondere auch
• •
• •
unter dem Gesichtspunkt des Frauenüberschusses – (z. B. auf dem Gebiet der Berufspolitik, Sozialpolitik und Kulturpolitik)“ „allgemeinen gesetzgeberischen Maßnahmen aus der Sicht der Frau heraus“764 „Maßnahmen die der Sicherung gleichberechtigter Beteiligung der Frau an der Gestaltung des öffentlichen Lebens dienen“ – worunter auch die berufliche Eingliederung in die öffentliche Verwaltung und in Parlamente fallen sollte „Maßnahmen zur Förderung sachkundiger Mitarbeit der Frau als Staatsbürgerin (sog. Staatsbürgerliche Erziehung)“ „Informationen und Anregungen an die maßgeblich mit Frauenfragen befaßten öffentlichen und privaten Stellen (Bundesministerien; Abgeordneten; zentrale Frauenorganisationen, Gewerkschaften usw.)“765
Allgemeine gesellschaftspolitische Aufgaben wie die Förderung der Rolle der Familie in der Gesellschaft und ein ‚effizienter‘ Umgang mit dem ‚Frauenüberschuß‘ hielten sich also im Vermerk die Waage mit dezidiert frauenpolitischen Aufgaben wie der Verwirklichung der Gleichberechtigung, der Sicherstellung des Informationsflusses über Themen, von denen man annahm, daß sie Frauen besonders interessierten sowie der Berücksichtigung von ‚Fraueninteressen‘ in der allgemeinen Gesetzgebung. Der Wunsch Bähnischs, daß auch in anderen Ministerien relevante Posten mit Frauen besetzt werden würden, hatte sich, sicherlich jedoch nicht allein auf ihr Drängen hin, erfüllt. Das Frauenreferat im Innenministerium bekam damit, neben seiner Aufgabe als Fachreferat auch die Verantwortung übertragen, als „Querschnittsrefe-
763 BArch, B 106, Nr. 43233, Referat IA5, Karsten an den Staatssekretär [vermutlich Ritter von Lex] über Abteilungsleiter I und Unterabteilungsleiter I A, Betr. Frauenreferat, 11.07.1949, Anlage 1, Auszug aus der Niederschrift über die 5. Sitzung des Deutschen Bundestages, Dienstag, 20.09.1949: Erklärung der Bundesregierung: Dr. Adenauer, Bundeskanzler. „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung“, lautete die wortwörtliche Formulierung Adenauers. Ebd. 764 BArch, B 106, Nr. 43233, Vermerk über Aufbau, Ausbau und künftige Arbeiten des Frauenreferates im Bundesministerium des Innern, vermutlich verfaßt von Dorothea Karsten, o. D., versendet als Anlage zu Karsten an den Staatssekretär [vermutlich Ritter von Lex] über Abteilungsleiter I und Unterabteilungsleiter I A, Betr. Frauenreferat, 11.07.1951, S. 2. 765 Ebd., S. 3.
1020 | Theanolte Bähnisch
rat“766 für Frauenfragen zwischen den Frauenreferaten anderer Ministerien zu fungieren. Karsten sollte mit allen Ressorts zusammenarbeiten, „die Frauenfragen bearbeiten bzw. Fragen, bei denen die Mitwirkung aus der Sicht der Frau geboten erscheint.“ Der Aufgabenkatalog lieferte die Einsicht, daß dieser Aspekt nicht allein vom Willen Karstens abhängig war, sondern eine Gemeinschaftsleistung aller beteiligten Akteure erforderte, gleich mit: „Dies setzt voraus, dass es von allen Ressorts bei einschlägigen Arbeiten beteiligt wird.“767 In den folgenden Jahren begegnete man dem Referat allerdings nicht immer gemäß dem hier formulierten Anspruch. Beschwerden von Seiten Karstens, die oft gegen Widerstände arbeiten mußte, waren deshalb nicht selten. So beklagte sie, daß die Initiative zur Zusammenarbeit mit den anderen Referaten meist vom Frauenreferat selbst ausgehen mußte, die erwünschte Einschaltung des Frauen-Referats durch andere Referate also ausblieb. Doch die Kritik Karstens ging noch weiter: „In mehreren Fällen waren die Entwürfe nach entsprechenden Vorverhandlungen und interministeriellen Besprechungen schon soweit abgeschlossen, dass nur noch begrenzte Einwirkungsmöglichkeiten für das Referat gegeben waren.“768 Die großen Erwartungen, die Bähnisch mit der Einrichtung des Referats verbunden hatte – anders läßt sich ihr Engagement für die ‚richtige‘ Besetzung des Postens nicht erklären – wurden also enttäuscht. Die „systematische vor allem aber die rechtzeitige Beteiligung des Frauenreferats“ sei „noch nicht sicher gestellt“769, resümierte Karsten im Juli 1951. Dabei war ein nicht unbedeutender männlicher Mitarbeiter der Behörde, für den bereits in der Weimarer Republik die Verwendung von Frauen an wichtigen Schaltstellen selbstverständlich gewesen war, offenbar auf ihrer Seite. Hans Ritter von Lex, der Staatssekretär, dessen ruhmreiche militärische Vergangenheit ihm die Erhebung in den Adelsstand beschert hatte und der 1961 Präsident des DRK wurde, ließ den von Karsten verfaßten ‚Vermerk‘, mitsamt seiner Kritik und der Bitte, das Referat „bei jeder geeigneten Gelegenheit“ rechtzeitig zu beteiligen, an die Abteilungsleiter, Referenten und Hilfsreferenten verteilen.770 Ein ähnliches Schreiben, betreffend die „Rechtsstellung der Frau in Gesetzgebung und Verwaltung“771 hatte von Lex bereits im November 1950 an die obersten Bundesbehörden versendet. Daß er sich veranlaßt sah, es im eigenen Haus gleich zweimal, nämlich sowohl im April772 als auch im Juli 1951 zu verschicken, deutet darauf hin, daß doch eine gewisse Hartnäckigkeit nötig
766 767 768 769 770
Ebd. Ebd. Ebd., S. 8. Ebd., S. 9. BArch, B 106, Nr. 43233, von Lex an den Herrn Staatssekretär der Abteilung II, die Herren Abteilungsleiter und Unterabteilungsleiter, die Herren Referenten und Hilfsreferenten im Hause, 20.07.1951. 771 BArch, B 106, Nr. 43233, Der Bundesminister des Innern, i. V. von Lex, an die obersten Bundesbehörden, Betr.: Rechtsstellung der Frau in Gesetzgebung und Verwaltung, 25.11.1950. 772 BArch, B 106, Nr. 43233, Der Bundesminister des Innern, i. V. von Lex an die Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter, Referenten und Hilfsreferenten im Hause, 22.04.1951.
Wachsende Prominenz | 1021
war, um das Referat im Innenministerium zu etablieren. Der sieben Seiten umfassende Auszug aus dem Vermerk, den Karsten nach Rücksprache jeweils ‚interessierten Kreisen‘ zur Verfügung stellte, welche wissen wollten, ‚nach welchen Gesichtspunkten‘ die Arbeit des Frauenreferats erfolgt773, enthielt die von ihr erwähnte Kritik freilich nicht. In der Außendarstellung deutete alles darauf hin, daß der an das Referat gestellte Anspruch und seine Arbeitswirklichkeit auch übereinstimmten. Gegen das Frauenreferat wurde wiederum der Vorwurf erhoben, es organisiere Zusammenkünfte und den thematischen Austausch nicht aus rein fachlichen Zusammenhängen heraus, sondern kontaktiere gezielt Referentinnen und weibliche Abgeordnete aufgrund ihres Geschlechts.774 Auch die im Vermerk anvisierte „ständige enge Fühlungnahme […] durch schriftliche und persönliche Verbindung mit den maßgeblichen Vertreterinnen der Frauenorganisationen“775, die auch Theanolte Bähnisch bis kurz vor ihrer Pensionierung einen ‚Draht‘ ins Bundesinnenministerium sicherte, stieß nicht immer auf Gegenliebe. Daß – als Ausdruck der deutschen Teilsouveränität – auch die Zusammenarbeit des Referats mit den „Frauenreferentinnen der Hohen Kommissare“ (die die Militärregierungen formal abgelöst hatten) und als „Bindeglied zu den ausländischen Frauenorganisationen“776 – festgeschrieben war, ist nicht zuletzt als ein Anknüpfen an die Vorarbeiten Bähnischs von Seiten des Referats zu sehen. Denn die Regierungspräsidentin hatte einen entscheidenden Anteil daran, daß die Isolation deutscher Frauen, verglichen mit der allgemeinen Stellung Deutschlands in der Welt, nach 1945 ein recht schnelles Ende gefunden hatte. Einen interessanten Einblick in die Grenzen staatlichen Handelns liefert die Begründung für die Notwendigkeit des informellen Austauschs von Frauen untereinander, den das Referat unter Karsten ebenfalls sicherstellen sollte. Im ‚Vermerk‘ hieß es, daß durch die „enge Fühlungnahme [der Frauenreferentin] mit den Politikerinnen, den Frauenorganisationen und den Frauenreferentinnen der Hohen Kommissare“ die „erforderlichen Anregungen und Hinweise aus der Praxis“ einzuholen seien sowie „Zugang zu Material“ zu gewährleisten sei, „das sich auf amtlichem Wege nicht beschaffen läßt“777. Zu deutsch: die historische Überlieferung der Frauenbewegung und auch aktuelle Daten über ihre Arbeit befanden sich in der Hand der entsprechenden Organisationen. Jene verfügten auch über die Kontakte, um aktuelle Statistiken und Berichte aus dem In- und Ausland zu beschaffen.
773 BArch, B 106, Nr. 43233, Vermerk, betr.: Einrichtung des Frauenreferats von Dorothea Karsten, 22.12.1951. 774 BArch, B 106, Nr. 48524, Der Bundesminister für Arbeit an den Bundesminister des Inneren, 22.05.1951. 775 BArch, B 106, Nr. 43233 Vermerk über Aufbau, Ausbau und künftige Arbeiten des Frauenreferates im Bundesministerium des Innern, vermutlich verfaßt von Dorothea Karsten, o. D., versendet als Anlage zu Karsten an den Staatssekretär [vermutlich Ritter von Lex] über Abteilungsleiter I und Unterabteilungsleiter I A, Betr. Frauenreferat, 11.07.1951, S. 5. 776 Ebd. 777 Ebd., S. 6.
1022 | Theanolte Bähnisch
Staatssekretär Ritter von Lex778 war, als seine Zusammenarbeit im Innenministerium mit Karsten begann, bereits vertraut damit, daß eine Behörde, die sich die Dienste der organisierten Frauenbewegung zunutze machte, auch in eine gewisse Abhängigkeit gegenüber diesen Organisationen und ihren Führungsfiguren geriet. 1918 war er, nachdem er aus dem Krieg zurückgekehrt war, ins Kriegsministerium abkommandiert worden. Als zuständiger Staatssekretär war er höchstwahrscheinlich mit an der Formulierung des Aufgabenkatalogs für das Frauenreferat im Bundesinnenministerium beteiligt und es wäre einiger Nachforschungen wert, herauszuarbeiten, inwiefern er vielleicht führende Regierungsvertreter von der Idee überzeugte, ein solches Referat überhaupt einzurichten. Von Marie Elisabeth Lüders, die er in ihrer Funktion als Leiterin der Frauenarbeitszentrale im Kriegsministerium ab 1916 kennengelernt haben muß und die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im DFR aktiv war, hatte er sich über den Aufbau eines Frauenreferats im Bundesinnenministerium beraten lassen.779 Gemeinsam mit ihrer ehemaligen Mitarbeiterin in der Frauenarbeitszentrale, Agnes von Zahn-Harnack, ihren Partnerinnen Else Ulich-Beil (Leiterin des Frauenreferats im Kriegsamt Leipzig) und Dorothee von Velsen (Leiterin des Frauenreferats im Kriegsamt Breslau)780 stand Lüders für eine Tradition der Frauenbewegung, welche ihr Engagement in der sozialen Fürsorge und Krankenpflege im Ersten Weltkrieg intensiviert und daraus erfolgreich die Notwendigkeit und Berechtigung einer stärkeren Stellung von Frauen in Politik und Verwaltung abgeleitet hatte.781 Als Mitbegründerinnen des DFR waren Lüders, Zahn-Harnack, Ulich-Beil und von Velsen mit Bähnisch vertraut. Diese wiederum war von den Briten dazu auserkoren worden, nach dem Vorbild des englischen Modells die Brücke zwischen den Frauen(wohlfahrts-)Organisationen und den Behörden im ‚neuen Deutschland‘ zu schlagen, also ein System, das auch in Deutschland Tradition hatte, zu re-etablieren. Daß Bähnisch ihrerseits nach 1945 nicht nur den DFR aufbaute, sondern auch eine leitende Stellung im DRK einnahm, welches den Einsatz der Frauen in der Kriegskranken-
778 Von Lex war seit 1916 Kompanieführer beim königlich-bayerischen Infanterieregiment Nr. 18 gewesen. Für seine Verdienste in der Somme-Schlacht wurde er mit dem Ritterkreuz des Militär-Max-Joseph-Ordens ausgezeichnet und in den persönlichen Adelstand erhoben. Ab 1933 war er als Oberregierungsrat im Reichsministerium des Innern für Sportfragen zuständig und unter anderem mit den Vorbereitungen der olympischen Sommer- und Winterspiele 1936 betraut. 1946–1948 war er Ministerialdirektor im Bayerischen Innenministerium, von 1950 bis 1960 Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Von Lex war Mitglied der CSU. 779 BArch, B 106, Nr. 43233, Marie Elisabeth Lüders an Staatssekretär von Lex, 02.04.1951. Der Brief trägt den handschriftlichen Vermerk „Mir persönlich von Frau Dr. Lüders übergeben“. 780 Von Velsen war während des Ersten Weltkriegs zunächst in Berlin für den Nationalen Frauendienst tätig gewesen. Gemeinsam mit Marie Elisabeth-Lüders baute sie im Generalgouvernement Brüssel in der Zivilverwaltung eine Fürsorgeabteilung auf. 1917 übernahm sie in Breslau das Frauenreferat der Kriegsamtsstelle. Gegen Kriegsende wechselte sie als Referentin einer Heeresgruppe in die von deutschen Truppen besetzte Ukraine. 781 Siehe dazu auch Kapitel 6.5.3.3.
Wachsende Prominenz | 1023
pflege in zwei Weltkriegen mit verantwortet und koordiniert hatte und nach 1945 wiederum eine wichtige Stellung in der sozialen Arbeit einnahm, paßt in die Logik der geschilderten Zusammenhänge. Marie-Elisabeth Lüders bezog sich explizit auf ihre Erfahrungen im Frauenreferat des Kriegsministeriums, als sie von Lex – auf dessen Wunsch hin – ihre „Auffassung“ und „eventuellen Vorschläge für die Möglichkeiten der praktischen Durchführung“ seiner „mit dem [Frauen-]Referat verbundenen Absichten“782 unterbreitete. Die Mitgründerin des Akademikerinnen-Bundes legte von Lex ans Herz, beim Aufbau des Referats sehr geplant vorzugehen und sich „über die Konsequenzen jedes organisatorischen Schrittes vorher ganz klar zu sein“783. Offenbar beneidete sie den Kompaniechef a. D. nicht um seine Aufgabe, ein solches Referat zu Friedenszeiten und in einem zivilen Apparat aufzuziehen. Sie habe es „in dem Aufbau und der Leitung aller Frauenreferate bei allen Kriegsministerien und den Kriegsamtsstellen der Generalkommandos“ in „einem in allen Teilen rein militärischen Organismus, in dem noch nie eine Frau eingedrungen war“, leichter gehabt, da „sämtliche militärischen Mitarbeiter […] von der mir übertragenen Aufgabe nichts verstanden“784, schrieb Lüders. Sie sei „allen nachgeordneten militärischen sowie allen zivilen Dienststellen aller Grade gegenüber mit der mit der Durchführung meiner Aufgabe notwendigen militärischen Autorität“785 versehen gewesen. Dadurch habe sie überall Zutritt erhalten, alles Material anfordern und „auch die Organisationen zur Durchführung jeder getroffenen Anordnung […] verpflichten“786 können. Von Lex hingegen war weitgehend auf den Goodwill der Kooperationspartner angewiesen, weshalb es geradezu gefährlich gewesen wäre, sich die Sympathien einer grundsätzlich zu allen Kooperationen bereiten Instanz wie Bähnisch zu verspielen. „All diese großen Erleichterungen bestehen für das Frauenreferat nicht“787, faßte Lüders die ‚Härten‘ der Amtsführung, mit der von Lex konfrontiert war, zusammen. Sie empfahl, vermutlich die Idee einer besseren Durchorganisation im Hinterkopf, die Einrichtung von Zweigstellen des Referats in Berlin „und in den größten Bundesländern“788. Die Frauenreferentinnen sollten ihrer Auffassung nach je zwei Mitarbeiterinnen, ebenfalls Volljuristinnen, erhalten, in jedem Ministerium sollten eine oder mehrere Frauen als Referentinnen angestellt werden, empfahl Lüders. Letzerer Wunsch der DABVorsitzenden, die damit auch einen Stellenpool für Juristinnen schaffen wollte, war ja auch ein Wunsch Bähnischs gewesen. Er erfüllte sich immerhin teilweise. ‚Frauenreferate‘ wurden im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Referat Verbraucheraufklärung, Annelise Spieß)789, im Bundeswohnungsbauminis-
782 783 784 785 786 787 788 789
BArch, B 106, Nr. 43233, Marie Elisabeth Lüders an Staatssekretär von Lex, 02.04.1951. Ebd. Ebd. Ebd. Ebd. Ebd. Ebd. BArch, B 106, Nr. 48542, o. V.: [‚B. A. E.‘]: Frauen in Bundesministerien. Die Ernährungsweiserin, in: Bonner Rundschau, 20.06.1953, hier o. S.
1024 | Theanolte Bähnisch
terium (keine definierte Zuständigkeit, Ingeborg Jensen790) sowie im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Inga-Marie Jünemann)791 eingerichtet. Die Personalsituation im Frauenreferat des Innenministeriums blieb derweil angespannt: 1955 wagte Dorothea Karsten angesichts dieses Zustands zu fragen, ob denn das Frauenreferat als „ein optisches politisches Zugeständnis an eine Zeitströmung angesehen wird, dessen tatsächlicher Arbeit […] keine so wesentliche Bedeutung zugemessen werden brauche, wie der anderer Referate“. Ihrer Meinung nach bedürfe es „in einer Zeit sich überstürzt verändernder Strukturen […] einer staatlichen Stelle, die […] an der Klärung der Frauensituation in ihren soziologischen Zusammenhängen“ mitwirken könne. Die Frauenorganisationen könnten diese Aufgabe allein nicht mehr bewältigen. „Sie sind vielmehr nach ihrer vorübergehenden völligen Lahmlegung im Dritten Reich selber auf ständige Anregung und Förderung angewiesen.“792 Karstens Meinung nach wiesen die Frauenorganisationen also zehn Jahre nach Kriegsende noch immer strukturelle Defizite auf, die sie auf die Jahre der nationalsozialistischen Politik zurückführte. Sie argumentierte im Folgenden mit den Sorgen, die auch Adenauer 1949 dazu bewogen hatten, in Sachen Frauenpolitik auf den Zug der Militärregierung aufzuspringen, für eine bessere Ausstattung des Frauenreferats mit Personal: „Die soziologische Entwicklung, die der Frau einen für sie neuartigen Platz ausserhalb der Familie zugewiesen hat, kann den Bestand eines Volkes quantitativ und qualitativ gefährden, wenn diese Entwicklung nicht rechtzeitig in sinnvolle Bahnen gelenkt wird. Die hiermit zusammenhängende Planung ist Innenpolitik erster Ordnung.“793 Was genau Karsten damit meinte, ließ sie offen, aber alles deutet darauf hin, daß ihre Sorge der Möglichkeit des ‚sittlichen‘ Verfalls der Gesellschaft galt. Dies zeigt, daß Herta Gotthelf mit ihrer Wahrnehmung, Karsten stehe ideologisch in der Nähe der mit Katholizismus und ‚Sittlichkeit‘ assoziierten ‚Jungfrauenverbände‘, nicht ganz falsch gelegen hatte. Der von ihr formulierten Sorge setzte Karsten die Hoffnung auf eine der Gesellschaft dienende Verwendung von ‚Mütterlichkeit‘ in den Sektoren Erziehung und Bildung, Gesundheit und Soziales sowie Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit entgegen. Die Frauenreferentin zögerte nicht, auch die – von Bähnisch erfolgreich erprobte – außenpolitische Karte ins Spiel zu bringen: „Bei der starken politischen Verflechtung der Bundesrepublik mit den westlichen Nationen hat die Behandlung der Frauenfrage für sie auch übernationale Bedeutung und erfordert entsprechend enge Zusammenarbeit mit dem Ausland“794, unterstrich Karsten die außenpolitische Bedeutung des Frauenreferats. Nachdem sie noch vor dem sich anbahnenden ‚Verfall der Familie‘ durch die übergroße Belastung
790 BArch, B 106, Nr. 48542, o. V.: Die Frau soll mitplanen, in: Westdeutsches Tageblatt, 22.4.1953, hier o. S. überliefert sowie ebd., Frauen in Bonn, VIII: Dr. Ingeborg Jensen, in: Die Welt der Frau, hier o. D. [Juni 1953], o. S. Jensen war zuvor bei Land Niedersachsen angestellt und dort mit der Wohnungsbaufinanzierung befaßt gewesen. 791 Jünemann gab den ‚Informationsdienst‘ heraus und redigierte den ‚Spiegel der Frauenzeitschriften‘. Ebd., Inga-Marie Jünemann, in: Die Welt der Frau, Juni 1953, hier o. S. 792 BArch, B 106, Nr. 52024, Referat IB4 an Abteilungsleiter I, 16.06.1955. 793 Ebd. 794 Ebd.
Wachsende Prominenz | 1025
der Mütter in vaterlosen Familien gewarnt hatte, griff sie schließlich zum Kernargument Bähnischs und nannte als „brennende Frage“, mit der sich das Frauenreferat auseinandersetzen müsse, die „Abwehr der systematisch über die Frauen versuchten Infiltration mit kommunistischem Gedankengut“.795 Besonders vor diesem Hintergrund dürfte das von Karsten angestrebte „innenpolitische Ziel […] als übergeordneten Gesichtspunkt die Stellung der Frau als Mutter und Erzieherin der kommenden Generation zu sichern“796, den Lesern ihrer Ausführungen als einleuchtend erschienen sein. Bereits 1951 regte Karsten, vermutlich nicht zuletzt im Hinblick auf den gleichnamigen Ausschuß im DFR, die Einstellung einer „geeigneten Referentin“797 im Ministerium für gesamtdeutsche Fragen an. Ihren Vorschlag begründete sie gegenüber Minister Kaiser mit der „lebhaften Tätigkeit“798 der Frauenbewegung in der DDR. Offenbar befürchtete Karsten, daß der DFR seiner selbst gesetzten Aufgabe, die kommunistische Frauenbewegung zu bekämpfen, allein nicht Herr werden könne. Die Aufklärungsarbeit über den DFD war im Rahmen der gesamtdeutschen Arbeit des DFR womöglich nicht in dem von Bähnisch angestrebten Maß geleistet worden. Karsten jedenfalls sah die Notwendigkeit, hierfür eine staatliche Stelle einzurichten, an die sich interessierte Frauen wenden konnten: „Wiederholte Anfragen aus Frauenkreisen in Westdeutschland an das Frauenreferat meines Ministeriums deuten auf das dringende Bedürfnis hin, über Motive und Ziele dieser Bestrebungen hinreichend unterrichtet zu werden, zumal die Propaganda aus diesen Frauenkreisen auch in Westdeutschland zunimmt“.799 In den 50er Jahren argumentierte Karsten, wenn es um die Notwendigkeit der Arbeit des Frauenreferats im Innenministerium, beziehungsweise um die Einrichtung weiterer Frauenreferate ging, also stark mit allgemeinpolitischen – oder, um mit Bähnisch zu sprechen, mit ‚staatspolitischen‘ Zielen – und kaum aus emanzipatorischen Beweggründen heraus. Eine solche Argumentation dürfte weitgehend den Überzeugungen der Referentin entsprochen haben, jedoch ist anzunehmen, daß sie sich von dieser Art Argumentation auch eine größere Unterstützung ihrer Arbeit insgesamt, zu der ja auch die Arbeit für die Gleichberechtigung der Geschlechter gehörte, versprach. Zu bewerten, wie erfolgreich die Arbeit der Frauenreferentin Karsten und die ihrer Mitarbeiterinnen, um die sie oft kämpfen mußte800, am Ende war, kann und soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Was die ‚Stellung der Frau als Mutter und Erzieherin kommender Generationen‘ anging, so war mit der Etablierung der ‚Doppel-
795 Ebd. 796 Ebd. 797 BArch, B 106, Nr. 48542, Vermerk, betr.: Allgemeine Frauenfragen, Dorothea Karsten, 05.03.1951. 798 Ebd. 799 Ebd. 800 BArch, B 106, Nr. 52024. Karsten an den Haushaltsreferenten durch den Personalreferenten, 19.03.1951; ebd., Karsten an den Abteilungsleiter I über Herrn Unterabteilungsleiter I B, 16.06.1955.
1026 | Theanolte Bähnisch
rolle‘ mittelfristig das Schreckens-Szenario, das Karsten ausmalte, abgewendet. Den Anteil einzuschätzen, den das Frauenreferat an dieser Entwicklung hatte, muß anderen Studien vorbehalten bleiben. Die Bilanz der Arbeit des Referats in Bezug auf die Angleichung des BGB an Art. 3 des Grundgesetzes dürfte – berücksichtigt man neben den Studien, die eine frauenpolitische Flaute für die 50er Jahre konstatieren, auch die korrigierenden Annahmen Sylvia Heinemanns801 – gemischt ausfallen. Die Einschätzung Klaus-Jörg Ruhls, das Frauenreferat habe „keinen Kompetenzbereich“ gehabt und sei eingerichtet worden, um „die Aktivitäten der zahlreichen Frauenverbände unter Kontrolle zu bekommen“802, trifft nicht den Kern der Sache. Aus Ruhls Ausführungen wird deutlich, daß er die SPD als alleinigen Fürstreiter der Gleichberechtigung in den 40er und 50er Jahren identifiziert und den Erfolg des Frauenreferats entsprechend aus sozialdemokratischer Perspektive bewertet. Daß Adenauer das Thema ‚Gleichberechtigung‘ in seiner Regierungserklärung vom 20.09.1949 im Zusammenhang mit der geplanten Einrichtung eines Frauenreferats nicht erwähnte, problematisiert Ruhl zu Recht. Der Kanzler sprach, wie erwähnt, vielmehr vom „Frauenüberschuß“ als Problem und von der Notwendigkeit seiner „Beachtung“. Das Dilemma der „unverheiratet gebliebenen Frau“ stand im Zentrum seiner Ausführungen, in denen es darum ging, daß für Frauen „neue Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten“ erschlossen werden müßten und daß „auch beim Wohnungsbau darauf geachtet werden“ müsse, „dass […] den unverheiratet gebliebenen Frauen wenigstens in etwa ein Ersatz für die fehlende häusliche Behaglichkeit geboten wird.“803 Diese Aussage transportierte unzweifelhaft das Bild der Ehe eines Alleinernährers mit einer Hausfrau und Mutter an seiner Seite als erstrebenswerten Normalzustand. Auch ‚bürgerliche‘ Frauenorganisationen wie der DFR hingen diesem Ideal als Lebenskonzept für die ‚Durchschnittsfamilie‘ an – was sich wiederum im Frauenreferat niederschlug. Wie Bähnisch und andere Protagonistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung vertrat jedoch auch Karsten erkennbar die Position, daß zumindest eine Rechtsgrundlage geschaffen werden müsse, welche Frauen erlaube, sich gleichberechtigt mit Männern in Familie, Beruf und Politik zu betätigen. Deshalb brachte Karsten selbst, abweichend von Adenauers Erklärung zur Funktion des Frauenreferats, nach ihrem Amtsantritt umgehend die Frage der Gleichberechtigung als zentrales Thema für das Frauenreferat auf die Agenda.804 Auf einer Linie mit dem christdemokratischen Werteverständnis, aber doch das Recht der freien Entscheidung für eine jede Frau voraussetzend, argumentierte sie auf einer Tagung der sozialwissenschaftlichen Studiengesellschaft, daß „die Frau“, die zur „Mitarbeit im öffentli-
801 Siehe S. 958 und 959 dieser Arbeit. 802 Ruhl: Unterordnung, S. 225/226. 803 BArch, B 106, Nr. 43233, Referat IA5, Karsten an den Staatssekretär [vermutlich Ritter von Lex] über Abteilungsleiter I und Unterabteilungsleiter I A, Betr. Frauenreferat, 11.07.1951, Anlage 1, Auszug aus der Niederschrift über die 5. Sitzung des Deutschen Bundestages, Dienstag, 20.09.1949. Erklärung der Bundesregierung: Dr. Adenauer, Bundeskanzler. 804 Das erwähnt Ruhl zumindest in einer Anmerkung. Vgl.: Ruhl: Unterordnung, S. 234, Anm. 138.
Wachsende Prominenz | 1027
chen Leben“ gebracht werden müsse, nicht aus ihren Familienbindungen gerissen werden solle, „sondern es kommt darauf an, daß sie eine echte Gewissensentscheidung über Art und Ausmaß ihrer Mitarbeit [im öffentlichen Leben] trifft. Wenn sie wegen anderer Bindungen nicht im öffentlichen Verantwortungsbereich mitarbeiten will, dann muß sie dies bewußt entscheiden“.805 Karsten nahm also nicht nur Bezug auf die aktuelle Rechtslage der Frauen, sondern auch auf ihre grundsätzliche ‚sittliche Verpflichtung‘ zur Mitgestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, wie es zwar traditionell die Bürgerliche Frauenbewegung, nicht aber Adenauer tat. Daß, wie Ruhl feststellt, ausschließlich die SPD an der „Verzögerungstaktik“ Adenauers, dem es mit der Reform der Gesetzesbestimmungen nicht eilig gewesen sei806, Kritik geübt habe, führt an der Realität vorbei. Dazu genügt ein Blick in die ‚Stimme der Frau‘807 und auf die Arbeit des Rechtsausschusses des DFR. Zweifelsohne focht die SPD – oder vielmehr einige Politikerinnen in der SPD – in den folgenden Jahren deutlich stärker für die ‚Angleichung‘ des BGB an den Art. 3 GG, als andere Parteien. Doch hielt auch die Lobby um Bähnisch an diesem Ziel fest, beispielsweise durch die erwähnte Implementierung Erna Schefflers als Richterin am Bundeverfassungsgericht und den ebenfalls erwähnten aktiven Einsatz Bähnischs auf dem 38. deutschen Juristentag in der bürgerlich-rechtlichen Abteilung, in der auch die Gleichberechtigung von Frauen Gegenstand war. Um nur noch ein weiteres Beispiel zu nennen: Als 1950 das Bundesbeamtengesetz verabschiedet werden sollte, protestierte der Landesverband Rheinland-Pfalz des DFR gemeinsam mit dem Akademikerinnenbund und der ‚Vereinigung weiblicher Juristen und Volkswirte‘ gegen das Gesetz, noch bevor sein Wortlaut überhaupt veröffentlich worden war.808 Nicht nur die SPD war also der Meinung, daß ein Gesetz, das am ‚Beamtinnen-Zölibat‘ festhalten wollte, mit dem Artikel 3 GG nicht in Einklang stehen konnte.809 Auch der DFR setzte sich gegen die Verabschiedung des geplanten Gesetzes ein.810 Für dessen Vorsitzende Bähnisch war ein solches Handeln sogar Tradition, hatte sie sich doch bereits in der Weimarer Republik gegen die Entlassung beziehungsweise Nicht-Anstellung verheirateter Frauen eingesetzt811 und sich insbesondere für die Verwendung von Frauen in der Verwaltung ausgesprochen. Ohne Zweifel hatten Theanolte Bähnisch und ihre Mitstreiterinnen sowohl in der Weimarer Republik als auch in der Bundesrepublik – anders als die SPD – stärker die Rechte von Akademikerinnen als die des Großteils der weiblichen Bevölkerung im Blick. Dennoch setzte das Engagement des Verbands in Bezug
805 BArch, B 106, Nr. 43233, Sozialwissenschaftliche Studiengesellschaft, Bericht über die Herbsttagung vom 01.–03. Oktober 1952 in Springe, S. 9. 806 Vgl.: Ruhl: Unterordnung, S. 226. 807 Siehe Kapitel 6.5.5. 808 NA, UK, FO 1050/1214, Women’s Affairs Branch Düsseldorf, Monthly Report, March 1950, 27.03.1950, Mrs. D. M. Horsfield, S. 3. 809 Vgl.: NA, UK, FO 1050/1214, Monthly Report, Women’s Affairs Branch, North-Rhine Westphalia, 27.03.1950, S. 3. 810 DFR-Archiv, A2, Agnes von Zahn-Harnack an Theanolte Bähnisch, 12.12.1949. 811 Siehe Kapitel 2.3.2.5.3.
1028 | Theanolte Bähnisch
auf die zivilrechtliche Gleichstellung positive Effekte für alle in Deutschland lebenden Frauen frei. Ruhl schreibt auch, daß Frauenverbände auf dem ersten Treffen mit der Frauenreferentin in Frage gestellt hätten, ob das Frauenreferat überhaupt in der Lage sei, die Interessen der Frauen wirksam zu vertreten.812 Aus der Feststellung Ruhls wird jedoch nicht deutlich, welche Verbände sich entsprechend äußerten und worauf sich die Frage bezog. Bähnisch beispielsweise vertrat ja die Meinung, es sei sinnvoller, in verschiedenen Ministerien Volljuristinnen einzustellen, die die Gesetzeslage kennen und entsprechend Veränderungen in Gang setzen könnten. „Die Frauenverbände sollten Recht behalten, das Frauenreferat führte trotz zahlreicher Konferenzen mit Frauenverbänden ein Schattendasein“813, lautete Ruhls Quintessenz über die Arbeit des Frauenreferats. Die vorläufige Bilanz der Frauenreferentin von 1957 sah anders aus: Karsten zufolge hatte das Referat unter anderem an folgenden Gesetzen aktiv mitgewirkt: „Familienrechtsreform, Sozialreform, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Novelle zum Jugendschutzgesetz, Novelle zum Wiedergutmachungsgesetz, sowie an den Entwürfen zum Jugendarbeitsschutzgesetz und zum Gesetz über den Arbeitsschutz von Pflegepersonen in Krankenanstalten.“814 Ferner habe es sich, so Karsten, mit der Teilzeitarbeit von Frauen im öffentlichen Dienst, mit Fragen der Strafrechtsreform, der Steuerreform, mit der „Nachwuchsgewinnung für die sogenannten Frauenberufe und mit der grundsätzlichen Frage einer zeitgemäßen Mädchen- und Frauenbildung, im Hinblick auf die Doppelaufgabe der Frau in Beruf und Familie“815 auseinandergesetzt. Von Seiten des Referats schien also weder jene Doppelaufgabe in Frage gestellt worden zu sein, noch den Umstand, daß Teilzeitregelungen automatisch mit dem weiblichen Geschlecht in Verbindung gebracht wurden. Das Referat leistete vielmehr einen aktiven Beitrag zur Festschreibung des Ernährer-Zuverdienerinnen-Modells in der Gesellschaft. Der Definition von – in der Regel schlechter entlohnten – ‚Frauenberufen‘ als solcher schien Karsten zwar, was ihrer Wortwahl nach anzunehmen ist, mit einer leichten Skepsis begegnet zu sein, ein Bruch mit dem Konzept des ‚Frauenberufs‘ war von ihrer Seite jedoch nicht zu erwarten. Ihr Referat nahm also durchaus Einfluß auf die gesellschaftliche Ordnung – durch Maßnahmen, die weitgehend der Stabilisierung oder Wiederherstellung der traditionellen Ordnung dienten und, in Anlehnung an die Notwendigkeiten, die die Nachkriegsverhältnisse mit sich brachten, auf eine graduelle Ausweitung der Aufgabenbereiche von Frauen abzielten. Inwiefern diese Arbeit über den Rand über die Ministerien und die Frauenbewegung hinaus be-
812 Vgl.: Ruhl: Unterordnung, S. 226, Anm. 104. 813 Ebd., S. 226. 814 BArch, B 106, Nr. 43233, Frauenreferat, Karsten, o. D., als Anlage zu versendet zum Schreiben von Karsten an den ‚Unterabteilungsleiter IB‘, 14.10.1957. Ein Arbeitsbericht von 1955 listet tabellarisch die Gesetzesentwürfe auf, an der das Referat bis 1955 beteiligt war: BArch, B 106, Nr. 43233, R[egierungs]Rätin Dr. Schlenzka an den Unterabteilungsleiter, im Hause, 07.05.1955. 815 Ebd.
Wachsende Prominenz | 1029
kannt war oder ob sie vielmehr ‚im Verborgenen‘ geschah, was Ruhls These zumindest teilweise stützen würde, bleibt noch zu erforschen. Die Leiterin des Frauenreferats vertrat im Hause jedenfalls den Standpunkt, daß ihre Arbeit durchaus wahrgenommen werde: „Mit zunehmendem Erfolg“ habe das Referat, so schrieb Karsten, „das Interesse und den Willen zur Mitarbeit an den auf dem Frauensektor zu klärenden Problemen sowohl bei Fachkreisen als auch in der breiten Öffentlichkeit“816 wecken können. Laut einem Bericht von 1955 waren durch das Referat unter anderem auch Zuschüsse zu Tagungen von Frauenverbänden verteilt sowie Erhebungen zu Frauen in der Polizei und im Militär sowie über der Lage der Studentinnen und Dozentinnen unternommen worden.817 Ob die Politik des Frauenreferats, die ohne Zweifel auf die Beibehaltung traditioneller Familienverhältnisse ausgerichtet war, am Ende stärkere Effekte freisetzte, als die rechtlichen Veränderungen, an dessen Durchsetzung das Referat ebenfalls beteiligt war, dies zu bewerten soll nicht Aufgabe dieser Arbeit sein. Daß die Kombination beider Zielsetzungen voller Widersprüche steckte, steht, wie bereits erwähnt, außer Frage.
8.6 AUF INTERNATIONALER MISSION UND AM ENDE DER KRÄFTE: EINE ENTSCHEIDUNG STEHT AN 8.6.1 Reisen über Reisen und Krankheiten über Krankheiten Ihre ‚berufliche Überlastung‘818 als Regierungspräsidentin wäre schon für sich allein genommen Grund genug dazu gewesen, ihre zweite Mammutaufgabe, die Leitung des DFR, ad acta zu legen. Wie schon nach der ersten Konferenz der überparteilichen Frauenbewegung in Bad Pyrmont, war Theanolte Bähnisch auch im Oktober 1949, also direkt im Anschluß an die zweite Konferenz im niedersächsischen Kurort, körperlich stark angegriffen. „Wegen deutlicher Ausfallerscheinungen des Kreislaufs zur Erhaltung ihrer Arbeitsfähigkeit und völligen Wiederherstellung ihrer Gesundheit“819, nahm sie, zum wiederholten Mal, eine Kur in Bad Wörishofen in Anspruch. Kaum dort angelangt, unterbrach sie den Aufenthalt jedoch schon, um in ihrer Funktion als leitendes Mitglied des Kulturausschusses des Deutschen Rates der Europäi-
816 Ebd. 817 BArch, B 106, Nr. 43233, R[egierungs]Rätin Dr. Schlenzka an den Unterabteilungsleiter, im Hause, 07.05.1955. 818 In der Einladung zur Hauptversammlung des Deutschen Frauenrings am 28. und 29.03.1952 in Berlin gab sie bekannt, daß sie ihr Amt als Vorsitzende „wegen meiner beruflichen Belastung“ niederlege. Zur Sitzung des Gesamtvorstandes am 08./09.03.1952 bat sie, Vorschläge für die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes des DFR einzureichen. BArch, B 211, Nr. 22-1, Deutscher Frauenring, Einladung zur Hauptversammlung des Deutschen Frauenringes, Hannover, 21.02.1952. 819 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Fachärztliche Bescheinigung von Dr. med A. Deccum, Hannover, 20.10.1949.
1030 | Theanolte Bähnisch
schen Bewegung an einer Internationalen Konferenz der Europa-Bewegung820 teilzunehmen. Diese Möglichkeit wollte sie sich nicht entgehen lassen, denn im Kreis der Nonkonformisten, wie Henry Brugmans die Europa-Begeisterten einst bezeichnet hatte821, fühlte sie sich wohl. Ab 1949 waren meist Termine von internationalem Rang ausschlaggebend dafür, daß die Regierungspräsidentin um Dienstbefreiung bat. In der Regel ermöglichte ihr die Landesregierung, ihren Arbeitsplatz in Hannover zu verlassen, damit sie sich auf internationale Mission begeben konnte. Folgt man der Kopf-Biographin Nentwig, die dem Ministerpräsidenten ein „zwangloses, lockeres Verhältnis zur Macht – frei nach dem Motto ‚Ich bin dann mal weg‘“822 nachsagt, so hielt sich der ‚Landesvater‘ selbst häufig fern von seinem Dienstsitz auf. Auch der Ministerpräsident hatte Nentwig zufolge, wegen seiner Tendenz, die Grenzen seiner Belastbarkeit auszutesten, häufig mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihn an der Ausübung seiner Amtspflichten hinderten.823 Er mag auch deshalb Verständnis für ein entsprechendes Verhalten Theanolte Bähnischs gehabt haben. Als der Bundesminister für die Angelegenheiten der Vertriebenen die Hannoveraner Regierungspräsidentin für ganze zwei Monate für ein Technical Assistance Program für Vertriebenenfragen abziehen wollte824, stellte sich das Innenministerium jedoch, mit der Begründung, man brauche Bähnisch für die Abänderung der Gemeindeverfassung und des Polizeigesetzes vor Ort, quer.825 Minister Lukaschek hatte seine Bitte mit der Begründung, Frau Bähnisch erscheine „als Leiterin des Deutschen Frauenrings besonders geeignet […] zusammen mit einer entsprechenden amerikanischen Persönlichkeit die für dieses Gebiet nötigen Untersuchungen zu führen und die daraus resultierenden Vorschläge auszuarbeiten“, vorgebracht. Doch sein Betreiben war nicht von Erfolg gekrönt, obwohl er die Bedeutung, „die die Vertriebenenfrage für die soziale, wirtschaftliche und politische Entwicklung der Bundesrepublik hat“826, sogar noch einmal gesondert betont hatte. Daß sie diesmal in Hannover bleiben mußte, dürfte auch Bähnisch mißfallen haben. Denn hätte sie sich
820 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Bähnisch an den niedersächsischen Minister des Innern, 30.10.1949. 821 Kemmerer, Alexandra: Haager Konferenz. Das Abendland will seine Erweiterung, in: FAZ, 12.06.2008, auf: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/haager-konferenz-das-abend land-will-seine-erweiterung-1538651.html, am 13.12.2013. 822 Nentwig: Kopf, S. 670/671, Zitat auf S. 670. Die CDU nutzte diesen Umstand für eine Karikatur, nach deren Bildunterschrift auch Theanolte Bähnisch, gemeinsam mit anderen Lokaleliten, ihrem Chef in sein Refugium auf der Nordseeinsel Neuwerk nachgefolgt sei. Vgl.: ebd., S. 671. 823 Vgl.: ebd., S. 675–679. 824 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Der Bundesminister für Angelegenheiten der Vertriebenen an das Niedersächsische Ministerium des Innern, 11.03.1950. 825 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Staatssekretär Dr. Danehl an den Bundesminister für Angelegenheiten der Vertriebenen, 27.03.1950. 826 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Der Bundesminister für Angelegenheiten der Vertriebenen an das Niedersächsische Ministerium des Innern, 11.03.1950.
Wachsende Prominenz | 1031
nicht in besonderem Maß verantwortlich für das Schicksal Vertriebener in Deutschland gefühlt und wäre sie nicht über die Massen am Austausch mit Experten aus anderen Ländern interessiert gewesen, wäre Lukaschek wohl kaum auf die Idee gekommen, sie für diese Zwecke zu verwenden. Ob er seinen Plan mit Bähnisch abgesprochen hatte, bevor er sich an den Innenminister wandte, läßt sich leider nicht nachvollziehen.827 Obwohl für ihn als Innenminister eines Landes mit einer sehr hohen Flüchtlingsdichte das Thema ebenfalls virulent war, sah Minister Richard Borowski, vermutlich nach Rücksprache mit Kopf, im Plan Lukascheks doch eher eine Interessen-Kollision als eine effektive Ergänzung der verschiedenen Ämter Bähnischs. Im März 1951 wollte die Regierungspräsidentin schließlich an der nur alle drei Jahre stattfindenden Delegiertentagung des Internationalen Frauenrats in Athen teilnehmen. Für die Behördenleiterin, die im Grunde seit 1946 auf dieses Ziel hingearbeitet hatte, bot sich damit eine einmalige Gelegenheit. Denn drei Jahre zuvor war es Deutschland noch gar nicht erlaubt gewesen, Delegierte zu entsenden, und drei Jahre später wwar Bähnisch – was zu jenem Zeitpunkt vermutlich bereits beschlossene Sache war – nicht mehr Vorsitzende des DFR. Kein Wunder, daß sie sich sehr ins Zeug legte, um für die Athen-Reise eine Dienstbefreiung zu erreichen. Sie teilte dem niedersächsischen Innenministerium mit, daß das Bundeskanzleramt „in einem ausführlichen Schreiben […] diese Tagung als international bedeutsam bezeichnet“ und ihr deshalb auch einen Reisekostenzuschuß bewilligt habe. Auch der Generalkonsul in Athen habe ihr mitgeteilt, daß er „im Interesse der internationalen Beziehungen“ ihre Teilnahme für „sehr wünschenswert“828 halte, unterstrich sie die außenpolitische Bedeutung ihrer Reise. Neben Deutschland wurden auf der Tagung sieben weitere, neu oder wiedergegründete National Councils in den ICW aufgenommen, namentlich Österreich, Italien, die Dominikanische Republik, Ägypten, der Libanon, die Sonderverwaltungszone Chinas, Hong-Kong und Uganda. Damit fand sich Bähnisch, nachdem die Reise genehmigt worden war, inmitten eines Aktes wieder, der die internationale Aufwertung und Anerkennung von Ländern bedeutete, die im Zweiten Weltkrieg als Aggressoren aufgetreten waren.829 Die Vizepräsidentin des belgischen Senats, Madame Pol-Boël, die einst Kriegsgefangene im deutschen Siegburg gewesen war, hielt die Hauptansprache auf der Konferenz und die griechische Königin erschien mitsamt ihres diplomatischen Korps zur Veranstaltung.830 Eine weitere Reise, die Bähnisch direkt im Anschluß wahrnahm, zeigt, wie sehr die niedersächsische Regierungspräsidentin mittlerweile auf binationaler Ebene als
827 In Bähnischs Nachlaß ist nichts dergleichen überliefert und von Lukaschek selbst gibt es keinen öffentlich zugänglichen Nachlaß. Vgl.: Bundesarchiv, Kabinettsprotokolle 1949, Quellenlage, auf: http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/1000/k/k1949k/kap1_1/para 2_1.html;jsessionid=8684D598C24A7631D45FA44D61266560?highlight=true&search= Hans%20Lukaschek&stemming=false&field=all, am 20.07.2012. 828 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Theanolte Bähnisch an den Niedersächsischen Minister des Innern, 14.03.1951. 829 Vgl.: International Council of Women: Women in a changing world, S. 8. 830 Vgl.: Bähnisch: Wiederaufbau, S. 176.
1032 | Theanolte Bähnisch
Entscheidungsträgerin wahrgenommen wurde. Ihren eigenen Ausführungen zufolge war sie von der „Gesellschaft für den Austausch mit England e.V.“831 – womit die 1949 um Lilo Milchsack in Düsseldorf gegründete, 2011 in ‚deutsch-britische Gesellschaft‘ umbenannte ‚deutsch-englische Gesellschaft‘ gemeint sein dürfte – dazu eingeladen worden832, an der Königswinterer Tagung von 1951 teilzunehmen. Nachdem sich zu den ersten deutsch-englischen Gesprächen 1950 bereits „40 britische[…] und deutsche[…] im sozialen Bereich tätige[…] Menschen, die ihre Erfahrungen austauschten und ihre so verschiedenen Probleme diskutierten“833, zusammengefunden hatten, war der Teilnehmerkreis 1951 noch größer. Diskutiert wurde diesmal zum Thema ‚Die Verantwortung der Presse‘.834 Theanolte Bähnisch einzuladen, die nicht nur eine Sektion der deutsch-englischen Gesellschaft leitete835, sondern auch Herausgeberin einer Frauenzeitschrift war, die sich die staatsbürgerliche Bildung von Frauen auf die Fahne geschrieben hatte, dürfte den Verantwortlichen besonders naheliegend erschienen sein. Da Milchsack die ersten Gespräche in Königswinter gemeinsam mit dem Educational Advisor Birley organisiert hatte, könnte der Kontakt zwischen Milchsack und Bähnisch über den britischen Offizier zustande gekommen sein. Aus Großbritannien nahmen Parlamentarier, Regierungsbeamte, Geschäftsleute, Industrielle und Kulturschaffende836 an den Gesprächen teil, so daß Bähnisch das Netzwerk, das sie sich bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaut hatte, auch über diese Initiative noch weiter vergrößern konnte. Der September 1951 stand für die Regierungspräsidentin ganz im Zeichen der Europäischen Verständigung und Einigung. Gleich mehrere Veranstaltungen fanden statt, die sie allesamt, wie sie an Innenminister Borowski schrieb, nur „schwer absagen“837 konnte: Am 19.09.1951 fand die Tagung des Exekutiv-Komitees des Deutschen Rates für Europäische Bewegung statt, am Tag darauf folgte die Tagung des Deutschen Rates für Europäische Bewegung und vom 21. bis 23.09.1951 wurde schließlich eine vom Deutschen Rat veranstaltete internationale Europa-Tagung, „zu
831 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Theanolte Bähnisch an den Niedersächsischen Minister des Innern, 14.03.1951. Bähnisch war am 17.06.1948 an der Gründung eines deutsch-englischen Clubs beteiligt gewesen, der zu einer „Annäherung der beiden Nationen beitragen“ sollte. NLA HA HStAH, VVP 3, Nr. 1, Staatskanzlei, Zechlin an Günter Gereke, 17.06.1948, Anlage: Liste der Gründungsmitglieder. Ob eine Verbindung zwischen den Initiativen bestand, ist unklar. 832 Ebd. 833 Vgl.: Milchsack, Lilo: 30 Jahre deutsch-englische Gesellschaft. Gegeben in der Mitgliederversammlung am 6. November 1979 in Düsseldorf, Vortragstext auf: http:// www.debrige.de/userfiles/file/L_Milchsackzum30jaehrigenBestehenderDEG1979.pdf, am 13.12.2013, S. 2. 834 Vgl.: ebd. 835 Siehe Kapitel 5.6.3.5. 836 Vgl.: O. V.: Geschichte der deutsch-britischen Gesellschaft auf: http://www.debrige.de/ de/geschichte-der-deutsch-britischen-gesellschaft, am 13.12.2013. 837 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Der Regierungspräsident an den Niedersächsischen Minister des Innern, 10.09.1951.
Wachsende Prominenz | 1033
der 45 ausländische und 45 deutsche Teilnehmer eingeladen sind“838, veranstaltet. Bähnisch verlieh diesmal ihrer Bitte um Dienstbefreiung Nachdruck, indem sie schrieb, daß aus Niedersachsen Ministerpräsident Kopf, Bischof Hanns Lilje und sie geladen seien.839 Eine Reise, an der auch der Ministerpräsident teilnahm, konnte der Innenminister der Regierungspräsidentin wohl kaum verwehren. „Dann habe ich eine Einladung vom HICOG für ein ‚internationales Treffen junger Frauen‘ als Ehrengast in Hindelang – Bad Oberdorf/Allgäu, zu dem 200 Gäste aus Deutschland und dem Ausland erwartet werden“, berichtete die Reisefreudige im gleichen Atemzug. Die Tagung, an der sie vom 25. bis 27.09.1951 teilnehmen wolle, werde „für sehr wichtig und grundsätzlich gehalten und ich bin sehr gebeten worden, teilzunehmen“840, nutzte sie die Rolle der HICOG im teilsouveränen Staat für ihren Drang, sich auf internationalem Parkett zu bewegen. Kein Wunder, daß ihr alle Reisen, für die sie um Dienstbefreiung gebeten hatte, genehmigt wurden. Doch bereits am 17.09.1951, noch bevor die erste der vier Konferenzen begonnen hatte, zeichnete sich ab, daß die Regierungspräsidentin wiederum stark erholungsbedürftig war. Sie bat deshalb um die Genehmigung eines Sanatoriums-Aufenthalts im Schwarzwald, mit offenem Ende, ab dem 28.09., in direktem Anschluß an die vierte Tagung.841 8.6.2 Auf zu neuen Ufern: Vom Vorsitz des DFR in den Vorstand des ICW Ob Ministerpräsident Kopf ‚seine‘ Regierungspräsidentin anläßlich ihrer vielen Reisen und Repräsentationsaufgaben ins Gebet genommen hatte oder ob sie selbst bemerkt hatte, daß sie all den Belastungen nicht auf Dauer standhalten konnte, ist der schriftlichen Überlieferung nicht zu entnehmen. Aber es wird einen Zusammenhang gegeben haben zwischen den vielen Terminen im Spätsommer 1951 und dem Umstand, daß Bähnisch ihr Amt als erste Vorsitzende des DFR 1952 niederlegte. Die Auswirkungen der doppelten Belastung auf ihre Gesundheit können, nach dem, was ihrer Personalakte zu entnehmen ist, kaum zu übersehen gewesen sein. Auch ElseUlich Beil gegenüber gab sie gesundheitliche Gründe an, als sie die ehemalige BDFFunktionärin fragte, ob sie den Vorsitz des DFR übernehmen wolle.842 Andere Gründe werden ebenfalls eine Rolle für Bähnischs Rücktritt gespielt haben: Zum Zeitpunkt ihres Rücktritts schien die ‚Gefahr aus dem Osten‘, zumindest was den DFD anging, gebannt. Der Organisation war es nicht gelungen, im Westen Fuß zu fassen. Wie groß der Anteil war, den der DFR daran hatte, läßt sich nicht messen; daß er 1952, wie Bähnisch anläßlich ihres Rücktritts anführte, „festgegründet“ dastand und
838 839 840 841
Ebd. Ebd. Ebd. NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Der Regierungspräsident an den Niedersächsischen Minister des Inneren, 17.09.1951. 842 Vgl.: Ulich-Beil: Weg, S. 219.
1034 | Theanolte Bähnisch
„national wie auch international gut fundiert“843 war, dürfte das Scheitern des DFD in Westdeutschland jedoch begünstigt haben. Was der Frauenring nicht leisten konnte oder wollte, hatte, wie bereits beschrieben, zwischenzeitlich der ‚Informationsdienst für Frauenfragen‘ (später ‚Deutscher Frauenrat‘) übernommen, der unter der Leitung des von Bähnisch hoch geschätzten, führenden DFR-Mitglieds Nora Melle stand.844 Der Informationsdienst etablierte sich über die Jahre zu einer Dachorganisation für deutsche Frauenverbände845, die ideell und personell nicht zuletzt die Handschrift des DFR und seiner Gründungspräsidentin trug. Der ‚Informationsdienst‘ sorgte in den folgenden Jahren in Kooperation mit dem Frauenreferat im Innenministerium, das ebenfalls eine entscheidende Prägung durch das Zutun Bähnischs und anderer führender Mitglieder des DFR erhalten hatte, dafür, daß der Informationsaustausch zwischen den Verbänden funktionierte, aber auch dafür, daß die Bundesministerien mit den Belangen der Frauenorganisationen zumindest konfrontiert wurden. Bis zum Zeitpunkt ihres Rücktritts war es Bähnisch also gelungen, nicht nur auf direktem Weg über den DFR, sondern auch über andere Kanäle, wichtige Schaltstellen mit Lobbyistinnen zu besetzen, die in ihrem Sinn arbeiteten. Mit der Übernahme der Ehrenpräsidentschaft des DFR anstelle des Amtes der ersten Vorsitzenden quittierte Bähnisch keinesfalls ihren Einsatz für die Frauenbewegung, die ihr, wie sie anläßlich ihres Rücktritts betonte, „ein Anliegen“ ihres „Herzens und ein Teil meiner Lebensarbeit geworden“846 war. Vielmehr scheint sie den Vorsitz auch deshalb preisgegeben zu haben, um neben ihrem Amt als Regierungspräsidentin stärker ihrer internationalen Arbeit – auch in der Frauenbewegung – nachgehen zu können. Den DFR zu leiten, mag ihr gegenüber den Einfluß-Möglich keiten, die sich ihr 1952 auf der internationalen Ebene boten, sekundär erschienen sein. Auch auf der internationalen Ebene sorgte die scheidende Vorsitzende des DFR für eine Institutionalisierung ihrer bisherigen Arbeit: Seit seiner Aufnahme in den ICW in Athen 1952 war der DFR, wie Senior Women’s Affairs Officer Rita Ostermann gehofft hatte, mit beratender Stimme in der UNESCO vertreten. Die SPD-Frauenreferentin Herta Gotthelf war verärgert und äußerst mißtrauisch, als sich herausstellte, daß nicht nur über den DFR als Deutschen Rat des ICW, sondern auch von Seiten der Gewerkschaft und der SPD ausgerechnet solche Frauen in die UNESCO-Frauenrechts-Komission delegiert werden sollten, die der Mitte des DFR entstammten, nämlich Anna Mosolf, die in der ‚Gewerkschaft für
843 DFR-Archiv, A1, Geschäftsbericht vorgelegt auf der Hauptversammlung in Berlin am 28.–29. März 1952, Deutscher Frauenring/Theanolte Bähnisch, 28.03.1952, S. 24. 844 Auch dies betonte Bähnisch in ihrer Rede. Ebd., S. 23. 845 Neben dem Frauenring waren 13 weitere Verbände an der Gründung des Informationsdienstes beteiligt und über delegierte Einzelpersonen vertreten. 1958 veränderte sich das Bündnis. Mitglieder waren nun nicht mehr Delegierte, sondern Organisationen. Vgl.: O. V.: Geschichte, auf: Homepage des Deutschen Frauenrats, http://www.frauenrat.de/ deutsch/verband/geschichte.html, am 13.12.2013. Nähere Infos siehe Kapitel 8.5.3. 846 DFR-Archiv, A1, Geschäftsbericht vorgelegt auf der Hauptversammlung in Berlin am 28.–29. März 1952, Deutscher Frauenring/Theanolte Bähnisch, 28.03.1952, S. 14.
Wachsende Prominenz | 1035
Erziehung und Wissenschaft (GEW) eine tragende Rolle spielte, und Katharina Petersen, die SPD-Mitglied war. Daß diese Frauen in der Kommission im Sinne der SPD arbeiten würden, glaubte sie nicht. „[W]ahrscheinlich hat da Frau Bähnisch ziemlich gründliche Arbeit geleistet“847, schrieb Gotthelf an den stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Schöttle. Unrecht wird sie damit wohl kaum gehabt haben. Nicht nur der DFR, sondern auch die BRD befand sich mit ihrer etappenweisen Integration in den Europarat und in die UNO auf einem von der Regierungspräsidentin als zukunftsträchtig erachteten Weg.848 Diese Entwicklungen dürften für Bähnisch, die den Kampf gegen den Kommunismus zur Hauptmotivation für ihr Engagement in der Frauenbewegung erklärt hatte, Anlaß gewesen sein, mit Zufriedenheit auf das Erreichte zu schauen. Gleichzeitig schienen dem DFR als Organisation, nachdem er seine Rolle in der Mitbegründung des ‚Informationsdienstes für Frauenfragen‘ ausgeübt hatte und – noch unter Bähnischs Vorsitz – in den ICW aufgenommen worden war, in den nächsten Jahren keine bahnbrechenden Entwicklungen bevorzustehen. Anläßlich ihres Rücktritts wies die Gründungspräsidentin darauf hin, daß der DFR inzwischen „gute Verbindungen zu allen wichtigen Behördenstellen in Bonn“849 sowie „zu halbamtlichen Stellen und unabhängigen Organsiationen, Einzelhandelsverbänden, Fachverbänden usw.“850 habe. Daß der „Bundesminister des Innern […] dankenswerterweise unsere staatsbürgerliche Arbeit unterstützt“851, hatte sie gesondert betont. Auch was die Pflege der Beziehungen zu den konfessionellen Verbänden betraf, sah Bähnisch den DFR auf einem guten Weg.852 Es schien also, im Hinblick auf den DFR, die Zeit gekommen zu sein, in der die Gründungspräsidentin mit Zufriedenheit auf das Erreichte schauen und sich neuen Herausforderungen widmen konnte. Ihren Grundüberzeugungen blieb sie dabei treu. Im ICW, dem der DFR dank ihres Zutuns angehörte, engagierte sich die Regierungspräsidentin weiterhin für die Rechte von Frauen und gegen die Ausbreitung des
847 AdSD, SPD-PV (alter Bestand), Nr. 0149 B [Korrespondenzen mit SPD-Mitgliedern des Bundestags], Herta Gotthelf an Erwin Schöttle, 13.12.1951. 848 Das ‚Projekt‘ Europa sollte aufgrund französischer und britischer Vorbehalte – denn der Labour Party war das Voranpreschen des Konservativen Churchill mehr als suspekt – noch ein paar Jahre auf Eis liegen, bevor 1957 die EWG, eine Weiterentwicklung der EGKS begründet wurde. Über die WEU wurde durch eine Erweiterung des Brüsseler Paktes 1954 auch die Aufnahme Deutschlands in die NATO möglich. Eine Europäische Zollunion – wie die ‚Stimme der Frau‘ sie prognostiziert hatte – wurde 1968 erreicht. Das Schengener Abkommen, nach dem die Grenzkontrollen innerhalb Europas abgebaut werden sollten, trat 1995 in Kraft. 849 DFR-Archiv, A1, Geschäftsbericht vorgelegt auf der Hauptversammlung in Berlin am 28.–29. März 1952, Deutscher Frauenring/Theanolte Bähnisch, 28.03.1952, S. 22. 850 Ebd., S. 23 851 Ebd., S. 22. 852 Ebd., S. 23.
1036 | Theanolte Bähnisch
Kommunismus. Sie stand dabei, wie in anderen Zusammenhängen853, in Kontakt mit Annelise Glaser854, der Geschäftsführerin des ‚Informationsdienstes für Frauenfragen‘. Zwischen der Präsidentin des Verbandes, den die britische Militärregierung zum Dachverband hatte aufbauen wollen, und jenem Verband, den die USMilitärregierung deutlich später auf einen solchen Weg geschickt hatte, entwickelte sich eine Kooperation, in der der ‚Informationsdienst/Frauenrat‘ nicht zuletzt Bähnischs Kompetenz und Bekanntheit auf internationaler Ebene zu schätzen wußte. Als Jeanne Eder-Schwyzer, die Ehrenpräsidentin des ICW, 1957 starb, war es keine andere als Theanolte Bähnisch, die für den Frauenrat einen Nachruf auf die ehemals „nicht als sehr deutsch-freundlich“855 bekannte Eder-Schwyzer verfaßte. Der Frauenrat veröffentlichte den Nachruf, der geprägt ist von persönlicher Dankbarkeit und Respekt gegenüber jener Frau, die der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland die Rückkehr in die organisierte internationale Zusammenarbeit ermöglicht hatte, aus der der BDF 1933 hatte ausscheiden müssen. „In der Zusammenarbeit mit ihr ist mir so recht klar geworden, was Vertrauen auf der internationalen Ebene bedeutet“856, schrieb Bähnisch über die Verstorbene und spielte damit auf die gleichberechtigte Aufnahme Deutschlands in den ICW an. Ihren Nachruf beendete sie mit den Worten „Der International Council of Women“ hat seine Ehrenpräsidentin […] verloren – ; ich verlor einen Menschen.“857. Daß Bähnisch sich im Ausschuß für ‚Frieden und Internationale Beziehungen‘ des ICW betätigte, entsprach Gabriele Strecker zufolge, „im Tiefsten ihrer Überzeugung, daß das Zusammenleben der Menschen sowohl national wie international auf Frieden und gegenseitiger Verständigung beruhe“858. Doch spielten auch handfeste
853 BArch, B 211, Nr. 101, Annelise Glaser an Staatssekretärin Theanolte Bähnisch, 09.12.1959; Bähnisch an Annelise Glaser, Geschäftsführerin des Informationsdienstes und Aktionskreises Deutscher Frauenverbände und Frauengruppen gemischter Verbände, 16.09.1959. Hier geht es um die Bitte der IG Chemie, Papier & Keramik im Bezirk Nordmark an Bähnisch, eine Verwässerung des Lebensmittelgesetzes verhindern zu helfen. Bähnisch bat Glaser, ihren unterstützenden Standpunkt der Gewerkschaft gegenüber deutlich zu machen. 854 BArch, B 211, Nr. 101, International Council of Women, Theanolte Bähnisch an Annelise Glaser. 855 Stadtarchiv Hannover, VVP Frau 750, Nr. 45, [Absender unbekannt, offenbar ein Mitglied des DEF] an den Deutsch-Evangelischen Frauenbund zu Hd. Frau Haccius, 17.01.1949, Betr. Arbeitsbesprechung vom 30. August 1948. Im Schreiben geht es unter anderem um die Bekanntmachung Bähnischs, daß Frau Eder-Schwyzer nach Deutschland kommen solle. 856 BArch, B 211, Nr. 101, Jeanne-Eder-Schwyzer zum Gedenken, Entwurf, Theanolte Bähnisch im November 1957. 857 Ebd. Ähnlich äußerte sie sich anläßlich ihres Rücktritts über Lady Nunburnholme, die Bähnisch zu Recht als Wegbereiterin der Aufnahme des DFR in den ICW ansah. DFRArchiv, Freiburg, A1, Geschäftsbericht vorgelegt auf der Hauptversammlung in Berlin am 28.–29. März 1952, Deutscher Frauenring/Theanolte Bähnisch, 28.03.1952, S. 5. 858 Strecker: Frauenarbeit, S. 80.
Wachsende Prominenz | 1037
nationale Interessen eine Rolle für das Engagement der Juristin auf internationaler Ebene, welches sie unter anderem in die Schweiz, nach Belgien, Griechenland, Finnland und Italien, in die USA und nach Kanada führte.859 Bei ihrer Arbeit im ICW ging es, ebenso wie bei ihrer Arbeit in der ‚Europäischen Bewegung‘ und in der im nächsten Kapitel behandelten ‚Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen‘ vor allem auch darum, (West-)Deutschland als souveränen, mit anderen Ländern gleichberechtigten Staat wieder herzustellen und – auch um den Preis der Teilung und anhaltenden Spaltung des Landes – eine sowjetische Dominanz in Westdeutschland und in der Welt zu verhindern. Zudem war der Ehrenpräsidentin des DFR daran gelegen, daß der Ruf Deutschlands als einer geachteten Kulturnation in der Welt wiederhergestellt würde: Nicht als barbarischen Unrechtstaat, sondern als Land der ‚Dichter und Denker‘ sollte ihre Heimat im Ausland wahrgenommen werden. Auch ihre Freundin und Mistreiterin Ilse Langner wirkte in diesem Zusammenhang: 1966 sollte sie, das geht aus einem Brief Bähnischs an eine andere Soroptimistin, Lotte Jacobi, hervor, nach New York reisen, um dort im Auftrag des Goethe-Instituts Vorträge zu halten.860 Zu einer gleichberechtigten Stellung neben anderen Ländern in internationalen Bündnissen zählte für die Herausgeberin der ‚Stimme der Frau‘, die ihr Medium nutzte, um diesen Gedanken publik zu machen, spätestens ab 1950 auch das Recht auf ‚Selbstverteidigung‘ gegen einen Angreifer – also das Recht auf Wiederbewaffnung.861 An einen Erfolg der EVG will Bähnisch jedoch, wie sie 1971 schrieb, schon Ende der 40er Jahre nicht geglaubt haben.862 Nachdem sie 1961 das Amt der Vizepräsidentin des ICW übernommen hatte, schrieb sie an den Politiker und Chemiker Siegfried Balke, daß der ICW „die maßgebende überparteiliche und überkonfessionelle Frauenorganisation in der Welt mit jetzt 58 angeschlossenen National Councils westlicher Denkungsart“ sei. „Um harte Kerne gegen den Kommunismus zu bilden, haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Neugründungen in Asien, Afrika und Südamerika vorgenommen.“863 Die ‚politischen Einsichten‘, die den Frauen durch diese Councils vermittelt werden sollten, waren – dies schrieb Bähnisch zwar nicht explizit, aber doch im gleichen Zusammenhang, ebenso wie die Aufklärungsarbeit des DFR in der BRD – auch darauf gemünzt, gegen kommunistisches Gedankengut zu immunisieren. Die Regierungspräsi-
859 AddF, SP-01, Auslandsreisen Frau Regierungspräsident Bähnisch, o. V., o. D. sowie NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Der Regierungspräsident an den Niedersächsischen Minister des Innern, 10.04.1957. Die Reise in die USA, die auf Einladung des State Department erfolgte, nutzte Bähnisch auch, um ihre alte Freundin Lotte Jacobi zu besuchen. University of New Hampshire Library, Milne Special Collections, MC 58, Box 27, f7, Bähnisch an Jacobi, 27.03.1957. 860 Ebd., Bähnisch an Jacobi, 05.05.1965. 861 O. V.: Aus der Frauenwelt, Der Deutsche Frauenring für den Frieden, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 20, S. 29. 862 AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 41, Betr.: Einige Antworten auf den Fragebogen von Fräulein Kelly, Theanolte Bähnisch, 24.08.1971. 863 AddF, SP-01, Theanolte Bähnisch als Vizepräsidentin des ICW an Professor Dr. Balke am 20.10.1964.
1038 | Theanolte Bähnisch
dentin setzte also ab 1952 weltweit fort, was sie 1946/47 der britischen Besatzungszone begonnen hatte. 8.6.3 „bis die Sache steht“ – Bähnisch gründet eine deutsche UN-Liga 1949 hatte Theanolte Bähnisch die Gründung einer Deutschen Liga für die UNO in die Hand genommen. Dies belegen Briefe, die sie mit ihrem Parteikollegen Carlo Schmid austauschte, der sich wie sie in der Europäischen Bewegung engagierte. Aus den Korrespondenzen mit dem sogenannten ‚Vater des Godesberger Programms‘, aber auch aus Briefen im Nachlaß des FDP-Politikers Dr. Karl Georg Pfleiderer wird deutlich, daß die Regierungspräsidentin sich zu diesem Zweck mit möglichen Delegierten für eine solche Liga aus anderen Parteien austauschte. Mit ihrer Neigung zur überparteilichen Arbeit, den Erfahrungen, die sie in der Europäischen Bewegung gesammelt hatte, der Anerkennung des von ihr aufgebauten DFR durch den ICW und mit dem Respekt, den man ihr parteiübergreifend entgegenbrachte, war sie geradezu prädestiniert für eine solche Aufgabe. Auch in den Korrespondenzen, in denen es um die Gründung einer deutschen Liga für die UNO ging, machte die nonkonforme Bähnisch deutlich, daß sie auf eine ähnliche ‚Haltung‘ ihrer Adressaten, unabhängig von der Parteizugehörigkeit setzte. „Ich befürchte, daß andere Kreise, deren Interesse hieran nicht eindeutig klar ersichtlich ist, sich veranlaßt fühlen könnten, von sich aus die Liga zu gründen“864, mahnte sie, offensichtlich eine Fehlbesetzung des Gremiums verhindern wollend, den Genossen Schmid zur Eile. Das ‚Petersberger Abkommen‘ erlaubte der BRD seit dem 22.11.1949 die Aufnahme konsularischer Beziehungen in das Ausland und den Beitritt zu internationalen Organisationen – eine wesentliche Voraussetzung für die Aufnahme multilateraler Kontakte, die auch andere Interessenten zu entsprechenden Initiativen motivierte. Gleichzeitig sorgte sich Bähnisch um die Wahrnehmung Deutschlands im Ausland: „Ich befürchte, daß das Zögern Deutschlands, eine Liga für die Vereinten Nationen ins Leben zu rufen, als Mangel an Interesse für die UNO oder an demokratischem Geist ausgelegt werden könnte. Andeutungen dieser Art sind mir gegenüber schon mal gemacht worden“865, hatte sie nicht nur an Schmid, sondern, mit etwas anderen Worten, auch an den Vizekanzler und Bundesminister für Angelegenheiten des Marshall-Plans, Franz Blücher (FDP) geschrieben866. Auf welche „ausländische[n] Kreise“867 sie anspielte, machte sie nicht transparent. Sie hatte Blücher in ihrem Brief zunächst über die Funktion der UNO-Ligen aufgeklärt, nämlich in ihren jeweiligen Ländern die Bevölkerung mit der Idee der UNO vertraut zu machen, für die „Gleichberechtigung der Staaten“ einzutreten und Annäherung, Versöhnung und Vertrauen zwischen den Staaten zu fördern.
864 865 866 867
AdSD, Nachlaß Carlo Schmid, Nr. 1345, Bähnisch an Schmid, 12.09.1951. Ebd. BArch, N 1286, Nr. 18, Bähnisch an Blücher, 30.07.1951, Abschrift. Ebd.
Wachsende Prominenz | 1039
Daran anschließend hatte sie ihn gebeten, mögliche Delegierte aus der FDP zu benennen.868 Anders als Karl-Georg Pfleiderer, den die FDP schließlich delegierte, reagierten die Delegierten der DP und der CDU nicht so, wie die Initiatorin es sich vorgestellt hatte. Erst mit der Unterstützung, die Bähnisch bei Pfleiderer und Schmid eingefordert hatte869, klappte es: Am 31.10.1951 konnte sie zur Gründungversammlung, die am 17.11.1951 stattfinden sollte, einladen. Im Rahmen der Einladung ließ sie ihren Parteikollegen Schmid wissen, daß sie sich „in dieser ganzen Angelegenheit nur als Vorläufiger Manager“ betrachte, „bis die Sache steht“870. Zur Gründungsversammlung geladen waren neben Schmid und Pfleiderer (FDP) auch Heinrich Hellwege (DP), Graf von Spreti (zuerst CDP, dann CDU), ein Herr Brokmann (CDU)871, Dr. Hermann Schäfer (CDU), und Helene Wessel (Zentrum).872 Das Protokoll der ersten Sitzung schickte Schmid noch zur Korrektur an Bähnisch, bevor er es nach Straßburg weiterleitete.873 Dann verläuft sich ihre Spur. Mathias Stein, der die Geschichte Deutschlands in der UNO von ihrem Beginn an erforscht hat, erwähnt, daß Herbert Wehner (SPD)874 und der in der Europäischen Bewegung engagierte Theologe Eugen Gerstenmaier (CDU), der zu dieser Zeit auch stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag war, die erste deutsche Delegation zum UN-Generalkonsulat nach New York bildeten.875 Da Bähnisch zu beiden Personen Kontakt pflegte, ist es möglich, daß ihre ‚ManagerFunktion‘ hierüber zustande gekommen war.876 Die Motivation der Regierungspräsidentin, die Gründung einer deutschen Liga in die Hand zu nehmen, ist nicht schwer zu erklären: Aus den oben zitierten Briefen geht hervor, daß sich auch in diesem Zusammenhang ihr Verantwortungsgefühl gegenüber der Zukunft der Gesellschaft mit ihrem Bedürfnis mischte, möglichst schnell wieder zu einer vollen Souveränität
868 869 870 871 872 873 874
875
876
Ebd. BArch, N 1286, Nr. 18, Bähnisch an Pfleiderer, 12.09.1951. AdSD, Nachlaß Carlo Schmid, Nr. 1345, Bähnisch an Schmid, 31.10.1951. Vermutlich handelte es sich um den Hessischen Staatssekretär Heinz-Wilhelm Brockmann. AdSD, Nachlaß Carlo Schmid, Nr. 1345, Bähnisch an Schmid, 02.11.1951. AdSD, Nachlaß Carlo Schmid, Nr. 1345, Schmid an Bähnisch, 29.11.1951. Herbert Wehner, der ab 1966 Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen war, besprach mit Bähnisch und Fritz Erler (SPD) noch in den 60er Jahren politische Strategien, denen der beiden gemeinsame Wunsch nach einer großen Koalition zugrunde lag. AdSD, Nachlaß Fritz Erler, Nr. 217 A, Bähnisch an Erler, o. D. [Posteingangsstempel vom 20.09.1966] sowie ebd., Bähnisch an Erler, 31.08.1966. Vgl.: Stein, Mathias: Der Konflikt um Alleinvertretung und Anerkennung in der UNO. Die deutsch-deutschen Beziehungen zu den Vereinten Nationen von 1949 bis 1973, Göttingen 2001, S. 33, Anm. 145. Dafür, daß die Anregung von den beiden großen Parteien ausgegangen war, spricht auch, daß Bähnisch in ihrem Brief an Blücher geschrieben hatte, die Fraktionen von CDU/CSU sowie SPD hätten bereits Delegierte genannt, die zur Mitarbeit bereit seien. BArch, N 1286, Nr. 18, Bähnisch an Blücher, 30.07.1951.
1040 | Theanolte Bähnisch
Deutschlands zu gelangen und – nicht zuletzt zu diesem Zweck – Werbung für eine internationale Zusammenarbeit mit Deutschland zu betreiben. Für die Vorsitzende des DFR war es naheliegend, sich nach der Integration des DFR in den ICW, der ebenfalls eine der UNO affiliierte Organisation war, weiter auf überparteilicher Ebene für eine Integration Deutschlands in internationale Organisationen einzusetzen, zumal sie äußerst sensibel für entsprechende Vorstöße aus kommunistischen Kreisen war. Die Regierungserklärung Adenauers von 1951 zeigte, daß Bähnisch die Zeichen der Zeit ganz richtig deutete. In seiner Erklärung schlug Adenauer – mit Blick auf das Demokratie-Defizit in der DDR – eine Kontrolle der deutschen Wahlen durch die UNO vor – und demonstrierte damit, daß er als wichtigster politischer Funktionsträger in der BRD die internationale Organisation als Instanz in deutschlandpolitischen Fragen anerkannte.877 Die verbreitete UNO-Begeisterung hing ohne Zweifel auch mit den großen Hoffnungen zusammen, die viele Zeitgenossen in die Organisation setzten. Dass Kritiker die UNO einmal als einen ‚zahnlosen Tiger‘ bezeichnen würden, schien zu jener Zeit kaum vorstellbar.878 Der Beitritt Deutschlands zur UNO erfolgte schließlich erst im Todesjahr Bähnischs, 1973. Doch schon 1950/51 war die BRD verschiedenen UNO-Unterorganisationen, die eine Mitgliedschaft in der UNO selbst nicht voraussetzten, beigetreten. Namentlich waren dies die ‚Food and Agriculture Organization‘ (FAO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die bereits mehrfach erwähnte UNESCO. 1952 wurde die ‚Ständige Beobachtermission‘ der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen eingerichtet, und 1962 fand die erste UN-Konferenz in der Bundesrepublik statt. Die Idee der UNO schien Theanolte Bähnisch, entgegen ihrer Aussage Carlo Schmid gegenüber, ebensowenig wieder losgelassen zu haben wie die der ‚Vereinigten Staaten Europas‘ und der internationalen Frauenbewegung. Als die Schriftstellerin Ilse Langner 1957 ihre Freundin Theanolte Bähnisch in der ‚Zeit‘ porträtierte, erwähnte sie, daß Bähnisch (auch) zu dieser Zeit Vorstandsmitglied der 1952 gegründeten und noch heute existierenden Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) war.879 Nach ihrer vorübergehenden Manager-Funktion für die ‚Deutsche Liga‘ für die Vereinten Nationen, denn um nichts anderes handelte es sich bei der DGVN, schien Bähnisch ihr Engagement für die Liga tatsächlich allerdings erst einmal aufs Eis gelegt zu haben, zumal sie zu dieser Zeit noch Vorsitzende des DFR war.
877 Vgl.: ebd., S. 37. 878 Vgl.: Müter, Jochen: Nur Gerede um Syrien: auf: ntv, 03.08.2012, http://www.ntv.de/politik/politik_kommentare/UN-geben-beschaemendes-Bild-abarticle6888951.html, am 13.12.2013. Vgl. für den historischen Längsschnitt: Hankel Werner. Die UNO. Idee und Wirklichkeit, Bonn 2010. 879 Vgl.: Langner: Regierungspräsident.
Wachsende Prominenz | 1041
8.7 EPILOG An dieser Stelle Theanolte Bähnischs politisches Leben zu bilanzieren, wäre unangebracht. Denn auf die Jahre nach dem Rücktritt aus dem Vorsitz des DFR, die gleichzeitig die (Wieder-)Aufbau-Jahre des neu gegründeten Bundeslandes Niedersachens waren, folgten viele weitere Jahre, in denen die Juristin, die 1952 schließlich erst 53 Jahre alt war, ihre Kraft in die Verwaltung, die Frauenbewegung, die Europäische Bewegung und die Re-etablierung der internationalen Beziehungen Deutschlands steckte. Daß die in Oberschlesien Geborene für ihre Verdienste im (Wieder-)Aufbau Niedersachsens, in der Europäischen Bewegung und im DFR schon 1953 das große Bundesverdienstkreuz erhielt880, zeigt nicht nur, daß ihre Verdienste auf regionaler und auf nationaler Ebene von höchster Stelle gleichermaßen Würdigung erfuhren, wie ihre Arbeit auf der internationalen Ebene. Es beweist auch, daß zu dieser Zeit bereits ein neuer Abschnitt im Leben Bähnischs, wie auch in Deutschland begonnen hatte – und jener Abschnitt soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Die schwierigste Zeit des deutschen Wiederaufbaus war 1953 bereits Vergangengheit, die Bonner Republik hatte Teilsouveränität erlangt und gute Aussichten auf die Vertiefung seiner Integration in ‚westliche‘ Bündnisse. Der DFR hatte sich nicht nur als ‚Deutscher Frauenring‘, sondern auch als Deutscher Council des ICW und als Partner des ‚Informationsdienstes Frauenfragen‘ sowie des Bundesinnenministeriums etabliert. Geleitet wurde er von 1952 bis 1955 von jener langjährigen ehemaligen Vorsitzenden des BDF Else Ulich-Beil881, die sich 1933 gegen die Auflösung der Organisation durch ihre Nachfolgerin Agnes von Zahn-Harnack (1931–1933) verwehrt hatte. Theanolte Bähnisch blieb dem Bezirk Hannover als Regierungspräsidentin und der Stadt Hannover als Einwohnerin 15 Jahre lang treu, bis sie 1959, nachdem sie als Staatsekretärin mit der Wahrnehmung der Interessen des Landes Niedersachsen in Bonn betraut worden war, nach Bad Godesberg umzog. Diese neue Stellung behielt sie bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1964. Der niedersächsische Landesbischof Dr. Hanns Lilje schrieb an seine Bekannte – wohl um die Auseinandersetzungen mit Herta Gotthelf wissend – anläßlich ihres Eintritts in den Ruhestand, daß sie „Sachlichkeit und Fraulichkeit so glücklich“ habe „verbinden können“, daß ihr „was ganz selten ist – in Ihrer öffentlichen Tätigkeit so gut wie keine unzufriedene Kritik begegnet“882 sei. So sehr Bischof Lilje der Staatssekretärin a. D. mit seinem Brief auch schmeicheln wollte – ihre ‚Fraulichkeit‘ hatte für sich allein genommen wohl kaum die entscheidende Rolle für Bähnischs guten Erfolg im Umgang mit bedeutenden Eliten beiderlei Geschlechts gespielt. Zwar wiederholte Lilje in seinem Brief mit anderen Worten im Grunde das, was Bähnisch selbst einmal an Kurt Schumacher geschrieben hatte, nämlich, daß das Geheimnis ihres Erfolges darin bestehe, Verstand und Sachkenntnis auf „weibliche Art“ zu
880 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, MDI [unleserlich handschriftlich ergänzt] an Abt. II (Ref II/Ia), 16.11.1953. 881 Ulich Beil war Vorsitzende des BDF von 1921 bis 1931. 882 AddF, SP-01, Hanns Lilje an Theanolte Bähnisch, Badgastein, den 23.04.1964.
1042 | Theanolte Bähnisch
„transponieren“883. Doch tatsächlich liegt das ‚Geheimnis‘ von Bähnischs Erfolg vor allem in ihrer aktiv gelebten Überzeugung, daß die Demokratie in Westdeutschland und der (Wieder-)Anschluß des Landes an das westliche Ausland nur auf der Grundlage eines breiten Konsenses für den Weg in Richtung ‚Westen‘ zu gewinnen sei. Diese Überzeugung prägte ihr Handeln sowohl in Zusammenhängen, die mehrheitlich von Frauen dominiert waren, als auch in solchen, in denen sie als eine von wenigen Frauen in einer ‚Männerdomäne‘ auffiel. Theanolte Bähnischs Meinung nach brachten vor allem Frauen die Fähigkeit und den Willen mit, über Parteigrenzen konstruktiv zusammenzuarbeiten. Der Umstand, daß diese Überzeugung in der bürgerlichen Frauenbewegung weit verbreitet war, war für Bähnisch jedoch eher ein strategischer Vorteil als ein ausschlaggebender Grund für ihre in den Jahren ab 1945 deutlich zutage tretende Haltung. Der Grund für diese Einstellung ist vielmehr in ihrer Biographie vor 1945 zu suchen. Mit ausschlaggebend für ihren Erfolg war auch der Umstand, daß sich die Zusammenhänge, in denen sie sich bewegte, vielfach überschnitten – ideell wie personell. Daß sie 1955 zusätzlich zu ihrem Amt als Ehrenpräsidentin des DFR auch das Amt der Europareferentin der Organisation innehatte884, ist nur eines von vielen Beispielen. Daß Konrad Adenauer, wie im Nachruf der deutsch-kanadischen Gesellschaft zum Anlaß des Todes von Ehrenmitglied Bähnisch zu lesen war, die „Sozialdemokratin, Katholikin und Frau Theanolte Bähnisch eine der stärksten Persönlichkeiten unseres politischen Lebens“885 genannt haben soll, ist vor dem Hintergrund des Beschriebenen und aufgrund Adenauers Versuchs, widersprüchlich erscheinendes miteinander in Einklang zu bringen, höchst interessant. Doch aus seiner Würdigung spricht auch der Umstand, daß sich der erste Kanzler der Republik, anders als einige seiner Minister, kaum ernsthaft mit Theanolte Bähnisch auseinandergesetzt haben konnte. Denn sie selbst war weder dezidiert als Katholikin in Erscheinung getreten, noch bekannte sie sich offensiv zu ihrer Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei. Treffender war die Würdigung, die der Frauenring seiner Gründungspräsidentin in einem Nachruf zuteil werden ließ. Als Verlautbarung eines erklärt interkonfessionell und überparteilich ausgerichteten Zusammenschlusses verzichtet er darauf, Partei- und Konfessionszugehörigkeit seiner Gründungspräsidentin überhaupt zu nennen: „Frau Bähnisch hat 1949 den entscheidenden Schritt getan zur Gründung des Deutschen Frauenrings als Zusammenschluß maßgeblicher Frauenorganisationen, die den Aufbau der jungen Demokratie energisch und ideenreich mit einer Fülle von praktischen Maßnahmen zu unterstützen gewillt waren. Ihr vornehmstes Ziel war die Verbindung zur Politik [...] sowie der Zugang zu den internationalen Zusammenschlüssen, die für die deutschen Organisationen nach dem zweiten Weltkrieg beson-
883 Siehe Kapitel 1.1. 884 NLA HA HStAH, Nds. 50, Acc. 75/88, Der Regierungspräsident an den Niedersächsischen Minister des Innen, 06.07.1955. 885 AddF, SP-01, Nachruf der deutsch-kanadischen Gesellschaft für Theanolte Bähnisch, in: Washington Post, Kopie o. D.
Wachsende Prominenz | 1043
ders schwierig und diffizil zu handhaben waren.“886 An dieser Erklärung fällt wiederum auf, daß von der von Bähnisch so oft als oberstes Ziel ihrer Arbeit beschworenen ‚staatsbürgerlichen Bildung‘ gar nicht die Rede war. Der Nachruf konzentrierte sich vielmehr auf eines der Kerngeschäfte des DFR – seine Funktion als Lobbyorganisation für Frauen des gebildeten Mittelstands. Als die Gründungspräsidentin 1973 starb, fand die Vorsitzende des Deutschen Frauenrats, Annelise Glaser, Trost darin, mit der Tochter Bähnischs, Orla-Maria Fels, die Gewißheit teilen zu können, daß diese „den Weg weiter“ gehen würde, den ihre Mutter ihr „vorgezeichnet“ 887 hatte. Dem Vorschlag Glasers, einen SoroptimistClub in Stuttgart gründen, folgte Fels, deren Kinder zu jener Zeit noch klein waren, jedoch nicht. 888 Doch die Juristin Dr. Fels, die ebenfalls einen Juristen geheiratet hatte und die ihre Dissertation über Frauenbewegung und Pädagogik am Beispiel Gertrud Bäumers verfaßt hatte889, war als Redakteurin beim Frauenfunk tätig, engagierte sich im Deutschen Frauenring und übernahm in den 1980er Jahren unter der Ministerin für Arbeit, Gesundheit und Frauen, Annemarie Griesinger, schließlich die Abteilung für Frauenfragen im Baden-Württembergischen Innenministerium.
886 AddF, SP-01, Deutscher Frauenring e. V., Überparteilicher und überkonfessioneller Verband für staatsbürgerliche Bildung und Mitarbeit: Mitteilungen 2/1973. 887 BArch, B 211, Nr. 101, Deutscher Frauenrat an Orla-Maria Fels, 14.07.1973. 888 Ebd. 889 Fels, Orla-Maria: Die deutsche bürgerliche Frauenbewegung als juristisches Phänomen, dargestellt an der Erscheinung Gertrud Bäumers, Freiburg i. Br. 1959.
9
Fazit
Die Auseinandersetzung mit Theanolte Bähnischs Biographie zeigt, daß sich durchaus eine ‚übergreifende Handlungslogik‘1 ihres Wirkens konstatieren läßt: Sie bestand in dem Bedürfnis, einen breitestmöglichen gesellschaftlichen Konsens zum Aufbau und zur Wahrung eines demokratischen Rechtsstaats mit einer starken Bürgergesellschaft zu erzielen, aus deren Mitte sich Männer und Frauen gleichberechtigt, aber unter Wahrung und Nutzung ihrer (angenommenen) geschlechtsspezifischen Unterschiede in das ‚öffentliche Leben‘ einbringen. Theanolte Bähnisch war als hohe, im Kontext der preußischen Verwaltungsreform in der Weimarer Republik beruflich sozialisierte Verwaltungsbeamtin, von einer positiven Einstellung zum Staat geprägt. Sie ergriff Partei für die Demokratie, setzte ‚good leadership‘ jedoch nicht zwangsläufig in eins mit ‚demokratischer Legitimation durch Wahlen‘, sondern akzeptierte Führungsansprüche von „Persönlichkeiten, die eine starke Ausstrahlung besitzen“2 auch auf der Grundlage eines angenommenen Wissensvorsprungs und einer christlich-humanistischen3 „Haltung“4. Eine gemeinsame ‚Haltung‘ moralisch integrer, toleranter und „sachlich“5 handelnder Persönlichkeiten konnte nach ihrer Überzeugung eine verläßlichere, tragfähigere Grundlage zur Zusammenarbeit sein als die gemeinsame Identifikation vieler mit einer politischen Partei. Daß sie nicht (nur) auf Koalitionen politischer Parteien baute, sondern für die Umsetzung ihrer Überzeu-
1 2 3
4 5
Zu den Gefahren, die es mit sich bringen kann, einer entsprechenden Darstellung durch die untersuchte Person ‚aufzusitzen‘, siehe Kapitel 1.7.4.1. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945. Vgl. zum Begriff Christlicher Humanismus, den Bähnisch so allerdings selbst nicht gebrauchte: Walter, Peter: Christlicher Humanismus, in: Geschichte der CDU auf der Homepage der Konrad-Adenauer-Stiftung, http://www.kas.de/wf/de/71.9152/, am 23.12.2013 In der Pressenotiz zur Gründung des Clubs deutscher Frauen war von einer „sauberen moralischen Haltung“ als Club-Ziel die Rede. BArch, NY 4229, Nr. 28, Notiz o. T. Den Begriff ‚sachlich‘, bzw. ‚Sachlichkeit‘ verwendete Bähnisch häufig in Zusammenhang mit Appellen an die Frauen, sich in das ‚öffentliche‘ Leben einzubringen und/oder in Zusammenhängen, in denen es um eine gedeihliche Zusammenarbeit verschiedener Parteien ging. O. V.: Schubfach; LKA Hannover, NL Lilje, L3 III Nr. 544, Bähnisch an Dr. Ruppel, Kanzlei des Landesbischofs, 05.07.1947. Auch von dritten wurde dieser Begriff mit ihr in Verbindung gebracht. AddF, SP-01, Hanns Lilje an Theanolte Bähnisch, 23.04.1964.
1046 | Theanolte Bähnisch
gungen vor allem auch auf Frauenzusammenschlüsse setzte, hatte, ihren Aussagen nach zu urteilen, Methode. Denn Frauen waren Bähnischs Verlautbarungen nach besonders dazu geeignet, sich „in einen anderen Menschen hineinzuversetzen“ und „verständnisvoll zuzuhören, um dann etwa vorhandene Gegensätze zu überbrücken“.6 Jene im Familienkreis geübte Eigenschaft müsse für das „öffentliche Leben“7 fruchtbar gemacht werden, gab sich die Juristin überzeugt. Alles deutet darauf hin, daß die im katholischen Münsterland aufgewachsene Theanolte Bähnisch eine entsprechende Prägung vor allem durch ihre Arbeit und ihr Leben im politischen Klima der reform- und konsensorientierten preußischen Koalitionsregierungen in den 1920er Jahren erfuhr. In deren Geist handelten die führenden Köpfe der preußischen Verwaltung in der Weimarer Republik, mit denen das Ehepaar Bähnisch einen kollegialen bis freundschaftlichen Umgang pflegte. Der Wille zur Überwindung innergesellschaftlicher Differenzen prägte das primär christlich motivierte, aber von verschiedenen Interessen getragene Projekt der bürgerlichen Sozialreformbewegung, in das sich vor allem Albrecht, aber auch Theanolte Bähnisch einbrachte: die Soziale Arbeitsgemeinschaft (SAG) Berlin-Ost. Auch die Auseinandersetzung mit Vertretern der ‚Neuen Leipziger Richtung‘ in der Volkshochschulbewegung, einem Zirkel, der personelle und inhaltliche Schnittmengen mit der SAG, aber auch mit der preußischen Verwaltung aufwies, scheint zur beschriebenen Einstellung Bähnischs beigetragen zu haben. Schließlich wollten die bereits in der Weimarer Republik einflußreichen und sowohl vor als auch nach 1933 von Adolf Grimme protegierten Reformpädagogen in Arbeitskreisen den Austausch unterschiedlicher Positionen fördern und auf diese Weise ihren Schülern ermöglichen, sich selbst einen „festen Standpunkt“8 zu erarbeiten. Daß sie dabei tolerant gegenüber anders Denkenden bleiben und in diesem Sinne – wie der Erwachsenenbildner Eduard Weitsch es formulierte – „sauerteiglich weiterwirken“9 sollten, gehörte zu den Kernzielen der Anhänger einer ‚freien Erwachsenenbildung‘. Nicht nur, weil er aus dem protestantischen Bildungsbürgertum stammte, sondern auch, weil er seine Frau in Kontakt mit bedeutenden Personen wie dem protestantischen Theologen Friedrich SiegmundSchultze, hohen Verwaltungsbeamten und Politikern im Preußischen Innenministerium sowie in anderen Behörden brachte, muß der Einfluß Albrecht Bähnischs auf die politische Haltung und die Integration seiner Frau in die entsprechenden Kreise als groß angesehen werden. Als hoher Verwaltungsbeamter setzte er die Reformpolitik der preußischen Regierung mit um und trieb sie weiter voran; dabei widmete er sich
6 7 8
9
Bähnisch, zitiert nach: O. V.: Schubfach. Ebd. Bähnisch selbst verwendet diesen Begriff in ihrem Brief an Schumacher, als sie die Arbeit mit Jugendlichen thematisiert. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945. Zur entsprechenden Haltung der Reformpädagogen siehe Kapitel 3.5. Fritz Borinski knüpfte an jenen Gedanken insofern an, als daß er das ‚Klassenbewußtsein‘ von Arbeitern unterstützen wollte, dabei aber gleichzeitig auf Verständigung zwischen den ‚Klassen‘ setzte. Siehe Kapitel 4.4.2. Weitsch, Eduard: Zur Sozialisierung des Geistes. Grundlagen und Richtlinien für die deutschen Volkshochschulen, Jena 1919, S. 15.
Fazit | 1047
Themen, an denen auch seine Frau ein besondereres Interesse hatte. Gemeinsame, prägende Bekanntschaften machte das Ehepaar Bähnisch auch über den SoroptimistClub, dem Theanolte Bähnisch bis zu seiner Auflösung 1933 angehörte, der aber für sie über diesen Zeitraum hinaus in Form von jahrzehntelang gepflegten Freundschaften fortbestand. In diesem Service-Club versammelten sich verschiedene Stadtberühmtheiten zum intellektuellen, aber auch zum kurzweiligen Austausch. Die gegenseitige Unterstützung von Frauen aus unterschiedlichen Berufsgruppen hatte der Club zu seiner Maxime erhoben, wobei er verschiedene politische Lager und Konfessionen versammelte. Jüdinnen waren im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung überproportional stark vertreten, und die Gesamtausrichtung des Clubs war prinzipiell liberal. Praktische Ansatzmöglichkeiten zur Verwirklichung ihrer überparteilichen und interkonfessionellen Einstellung sah Theanolte Bähnisch ab 1945 – in einer Zeit, in der ein deutscher ‚Staat‘ nicht existierte – vorrangig in der Zusammenarbeit in Organisationen und Arbeitsgemeinschaften. Denn diese boten engagierten Bürgern, die keine ‚Parteipolitik‘ betreiben wollten, Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung ihres erweiterten Lebensumfelds und der Gesellschaft. Um sie für gesellschaftliche Partizipationsprozesse ‚fit‘ zu machen, wollte Bähnisch den Frauen ‚staatsbürgerliche Bildung‘ vermitteln und vermittelt wissen. Diesen Begriff füllte sie – obwohl der in Friedrich Siegmund-Schultzes SAG sozialisierte Erwachsenenbildner Fritz Borinski ihn strikt ablehnte – mit Inhalten, die stark an das Konzept der ‚Mitbürgerlichen Bildung‘ Borinskis erinnern. Die inhaltliche Nähe von Bähnischs Bildungsarbeit zu Borinskis Konzept schlug sich unter anderem in der Orientierung ihrer Bildungs-Ideen am Alltag der Bevölkerung, dem Bekenntnis zum informellen Lernen und in der Überzeugung nieder, daß Frauen anders ‚unterrichtet‘ werden müßten als Männer. Zwar betonte sie immer wieder stark die Pflichten von Frauen in der Gesellschaft – was Borinski am Konzept der ‚Staatsbürgerlichen Bildung‘ erklärtermaßen störte –, aber sie klärte Frauen auch über ihre Rechte auf und trug dafür Sorge, daß die von ihr geleiteten Organisationen entsprechende Arbeit leisteten. Durch ihre Arbeit in der Frauenbewegung, zu der auch Verlautbarungen in der Presse und die Herausgabe der ‚Stimme der Frau‘ gehörten, ermutigte sie Frauen dazu, staatliche Vorgaben in Frage zu stellen, sich für Reformen einzusetzen und für die Erweiterung ihrer Rechte zu streiten. Gerade die Erziehung zur ‚verantwortlichen Freiheit‘, welche Fritz Borinski erklärtermaßen leisten wollte, spielte auch eine zentrale Rolle in Bähnischs Äußerungen. Fritz Borinski und Theanolte Bähnisch unterschieden sich offenbar weniger in ihren Überzeugungen als vielmehr in einer unterschiedlichen Interpretation dessen, was staatsbürgerliche Bildung sei. Im ‚staatsbürgerlichen‘ Ansatz Bähnischs schlug sich nieder, was der Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE), Klaus Heuer konstatiert, nämlich daß sich an den Konzepten von Erwachsenenbildnern die von ihnen „antizipierte[...] gesellschaftliche[…] Zukunft“10 ablesen läßt. Folgt man dem Begriffshistoriker Reinhart Koselleck, so dürfte die Regierungspräsi-
10 Heuer, Klaus: Wenn Erwachsene die Schulbank drücken, in: Brogatio, Heinz Peter/Kiedel, Klaus-Peter: Forschen, Reisen, Entdecken, Lebenswelten in den Archiven der LeibnitzGemeinschaft, Halle 2011, S. 80.
1048 | Theanolte Bähnisch
dentin den Begriff ‚staatsbürgerliche Bildung‘ ganz bewußt zur Beschreibung ihrer Bildungsvisionen benutzt haben. „Staatsbürger“, so konstatiert Hans Erich Bödeker unter Bezugnahme auf Koselleck, sei ein „Kampfbegriff“11 der preußischen Reformära um 1800. Er klage „bei jeder seiner Verwendung die angestrebte politische Gleichheit gleichsam […] gegen all jene“ ein, „die ihre angestammten Privilegien verteidigen“.12 Der Begriff weise – so gibt Bödeker Kosellecks These wieder – gleichzeitig antizipatorisch voraus „auf ein Verfassungsmodell, das zu verwirklichen sei“.13 So gesehen hatte Bähnisch mit der Verwendung des Begriffs ‚staatsbürgerlichen Frauenbildung‘ das Recht der Frauen auf die Mitgestaltung des noch zu gründenden Staates proklamieren und zur Selbstverständlichkeit erheben wollen, daß den Frauen auch eine entsprechende Bildung garantiert sei. Sie argumentierte damit in der Tradition der Frauenbewegung, die Frauen-Bildung von Beginn an zu einer ihrer Kernforderungen erhoben hatte. Bähnischs starke Neigung, den Begriff ‚Staat‘ zu verwenden, erklärt sich nicht zuletzt daraus, daß sie – anders als Borinski – der juristischen Laufbahn treu geblieben war – und dementsprechend auch dem Vokabular, das ihr seit ihrem Studium vertraut war. Sie schien für sich selbst den Begriff ‚Staat‘ mit der Bedeutung des Reformstaates der Weimarer Republik besetzt zu haben, der von einer Koalition aus Sozialdemokraten, Liberalen und Zentrumspolitikern gestaltet worden war und den sie im Kreise der Verwaltungsreformer als ein System kennen- und schätzen gelernt hatte, das sich in einer stetigen Veränderung zum Positiven hin befunden hatte. In einer solchen Form von ‚Staat‘ sah sie einen willkommenden Ordnungsfaktor und in der ‚staatsbürgerlichen Bildung‘ insofern auch ein erstrebenswertes Bildungsziel. ‚Bildung‘ verstand Bähnisch indessen immer auch als ‚Unterhaltung‘ – im doppelten Sinn. Zum einen war für sie – wie für die Erwachsenenbildner der Neuen Leipziger Richtung – das ‚Gespräch‘ der Kernbestandteil eines erfolgversprechenden Bildungsansatzes, zum anderen wollte sie ‚Bildung‘ immer auch mit unterhaltenden Elementen durchsetzt wissen. Dies äußert sich in dem Raum, den die ‚Stimme der Frau‘ für Leserbriefe, Rätsel und Kurzgeschichten bot, ebenso wie in den Gedichten und musikalischen Einlagen, welche (bildende) Veranstaltungen der von ihr geleiteten Frauenzusammenschlüsse auflockern sollten. Auch in ihrem Konzeptpapier zur Einrichtung einer ‚staatsbürgerlichen Frauenschule‘ schlägt sich dieser Gedanke nieder. In ihrer konsensorientierten ‚Haltung‘, in den Kontakten, die Theanolte Bähnisch in den 1920er und 1930er Jahren vor allem in Berlin knüpfte und in ihrem Willen, Frauen durch informelles Lernen ‚fit‘ für die Demokratie zu machen, liegt auch der Schlüssel zum Verständnis ihres Erfolges ab 1945: Mit ihren Ideen zur überparteilich-interkonfessionellen Zusammenarbeit, mit ihrer Überzeugung, daß die deutschen Frauen, die 1945 zwei Drittel der deutschen Bevölkerung ausmachten, in Frauen-
11 Bödeker: Reflexionen, S. 93. Bödeker nimmt Bezug auf: Koselleck, Reinhart: Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte, in: Lutz, Christian: Soziologie und Sozialgeschichte, Aspekte und Probleme, Opladen 1992, S. 116–131, hier S. 117 ff. 12 Bödeker: Reflexionen, S. 93. 13 Koselleck: Begriffsgeschichte, S. 113, zitiert nach Bödeker: Reflexionen, S. 94.
Fazit | 1049
Zusammenschlüssen für die Aufgabe der demokratischen Partizipation dergestalt geschult werden müßten, daß sie selbstbewußt ihre Stimme erheben und damit das 'weibliche' Element in der Gesellschaft stärken könnten, überzeugte sie die für die Frauen-Re-education zuständigen Offiziere der Britischen Militärregierung beziehungsweise deren Beraterinnen aus der britischen Frauenbewegung. Gleichzeitig versprach die Regierungspräsidentin – orientiert man sich an den Appellen, welche sie über die Presse verbreiten ließ – die deutschen Frauen zu einer 'sachlichen' Haltung zu erziehen. Die Behördenleiterin und die Militärregierung teilten nämlich die Sorge, daß die vermeintlich so stark ausgeprägte emotionale Komponente des weiblichen Charakters von fanatischen Ideologen für deren Zwecke mißbraucht werden könne. Daß Bähnisch die Meinung vertrat, Frauen müßten politische Bildung in einer auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Umgebung und nach einem auf ihre Interessen und Fähigkeiten zugeschnittenen Konzept erfahren, wobei die Vermittlung von Tatsachenwissen nicht im Vordergrund stehen sollte, gefiel den ‚Women‘s Affairs Officers‘. Denn diese achteten zwar die Reform-Ansätze, welche deutsche Erwachsenenbildner in der Weimarer Republik erarbeitet und teilweise im britischen Exil weiterentwickelt hatten, waren aber der Meinung, die Institution Volkshochschule selbst könne den Interessen und Bedürfnissen der deutschen Frauen sowie den Zielen der britischen Re-education-Politik in Bezug auf Frauen nicht gerecht werden. Parteien sahen die Vertreterinnen der Education Branch der Control Commisson of Germany (CCG), British Element (BE), ebenfalls nicht als geeignet dazu an, Frauen politisch zu bilden. Viele Expertinnen vertraten zu jener Zeit – nicht ganz zu Unrecht – die Meinung, daß Frauen in Deutschland nach der Erfahrung mit der NSDAP von ‚Parteien‘ abgeschreckt seien. Sie hofften darauf, daß Frauen verschiedener politischer Überzeugungen gemeinsam einen Beitrag dazu leisten könnten, eine Gesellschaft aufzubauen, in der die mit dem weiblichen Charakter assoziierten Kategorien Frieden, Empathie und Sittlichkeit eine zentrale Rolle spielen würden. Daß Bähnisch – wie andere Protagonistinnen der Frauenbewegung – mit dem jene Kategorien umfassenden Begriff der (erweiterten) ‚Mütterlichkeit‘ operierte, wenn sie eine Beteiligung von Frauen am „öffentlichen Leben“ einforderte, lag deshalb ganz auf der Linie der ‚Women’s Affairs Officers‘, beziehungsweise ihrer Beraterinnen. Daß Theanolte Bähnisch bei der Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘, der ein Hoffnungsträger für die Militärregierung in Sachen ‚Frauenbildung‘ war, auf ‚bekannte Gesichter‘ und Personen, die ähnlich wie sie selbst sozialisiert waren, zurückgreifen konnte, ist wesentlich auf die Personalpolitik Adolf Grimmes zurückzuführen. Daß das Regierungspräsidium Hannover zur ‚Schaltzentrale‘ des Wiederaufbaus der deutschen bürgerlichen Frauenbewegung wurde, resultierte auch aus der Personalpolitik der Regierungspräsidentin. Wohl kaum zufällig waren im Regierungspräsidium und im Kultusministerium gerade jene Frauen mit leitenden Aufgaben in den – traditionell als ‚weibliche‘ Zuständigkeitsbereiche angesehenen – Sektoren ‚Soziales‘ und ‚Pädagogik‘ betraut, die gemeinsam mit der Regierungspräsidentin den Wiederaufbau der Frauenbewegung vorantrieben und die über die Angebote des ‚Club deutscher Frauen‘ dafür Sorge trugen, daß Bürgerinnen in der Region praktische Hilfe und Beratungen in Unterbringungs- und Versorgungs- sowie in Rechtsfragen in Anspruch nehmen konnten. Die Auseinandersetzung mit der Arbeit der niedersächsischen Verwaltung und des Clubs deutscher Frauen zeigt, daß Personen wie Anna Mosolf und Katharina Petersen, die heute weitgehend unbekannt sind, in Zu-
1050 | Theanolte Bähnisch
sammenarbeit mit Bähnisch auch über den pädagogischen Sektor hinaus Einfluß auf die Zukunft der Region, des Landes Niedersachsen und Deutschlands nahmen. Daß Maria Prejawa nicht nur im Regierungspräsidium für Bähnisch arbeitete, sondern ‚ehrenamtlich‘ auch die Korrespondenz des ‚Club deutscher Frauen‘ sowie seiner Nachfolgeorganisationen erledigte und daß Veranstaltungen des Clubs in den Räumen des Regierungspräsidiums stattfanden, zeigt, wie eng die Arbeit Bähnischs als Behördenleiterin und ihr Wirken in der Frauenbewegung miteinander verschränkt waren. Die Zusammenhänge verdeutlichen, mit welcher Machtfülle das Amt der Regierungspräsidentin die politisch ambitionierte Juristin in einer Zeit des Mangels ausstattete und wie stark sie von der hohen Anzahl wichtiger Kontakte, die sie in der Verwaltung und darüber hinaus im Rahmen ihres Amtes pflegte, beim Aufbau der Frauenbewegung profitieren konnte. Auch die nötige Öffentlichkeitswirkung war ihr als erster Frau in einem solchen Amt, noch dazu als eine solche, die sich anschickte, Frauen überhaupt zu mehr Selbstbewußtsein und Engagement zu ermahnen, sicher. Bähnisch nutzte diese Möglichkeit, ihre Ideen zu verbreiten und schon bald wurde sie – zumindest außerhalb von Niedersachsen – nicht mehr in erster Linie als Regierungspräsidentin, sondern als Vertreterin der deutschen Frauen wahrgenommen. Die Informationen, die ihr als Leiterin einer regionalen Behörde über die Lage und die Nöte der Bevölkerung zur Verfügung standen, konnte sie dazu nutzen, um Frauen, beispielsweise über die ‚Stimme der Frau‘ für ihre Botschaften zu interessieren. Ihre Stellung als Vorsitzende von Frauenzusammenschlüssen sowie als Leiterin einer Arbeitsgemeinschaft von Frauenzusammenschlüssen in der Region ermöglichte ihr wiederum, über einen anderen Weg als über das Regierungspräsidium steuernd auf die – von solchen Zusammenschlüssen mit verantwortete – soziale Arbeit in der Region Hannover einzuwirken. Dies dürfte wiederum zur Entlastung der Verwaltung beigetragen haben. Ihre Funktion an der Schnittstelle zwischen der Verwaltung, der Frauenbewegung und (anderen) freien Trägern von sozialer Arbeit wie dem Roten Kreuz führte – insbesondere in Kombination mit der Einflußnahme der britischen Women‘s Group on Public Welfare – mit dazu, daß auch in der zweiten deutschen Demokratie ‚soziale Arbeit‘ und ‚Weiblichkeit‘ gekoppelt blieben und daß das dualistische System der sozialen Arbeit, in dem staatliche Träger mit solchen aus der freien Wohlfahrt zusammenarbeiten, bestehen blieb. Daß Theanolte Bähnisch im Kreis jener sozialisiert worden war, die sich im Preußen der Weimarer Republik gegen staatsfeindliche Umtriebe von rechts und links eingesetzt hatten, die gesellschaftliche Reformprozesse angestoßen hatten, dabei aber mehrheitlich die Dominanz einer humanistisch-christlich geprägten 'bürgerlichen' Kultur hatten aufrecht erhalten wollen, geriet ihr ab 1945 ebenfalls zum Vorteil. Zwar war sie als eine Protagonistin aus den ‚hinteren Reihen‘ in der preußischen Verwaltung in der Weimarer Republik politisch kaum in Erscheinung getreten. Aber dadurch, daß sie in einer Zeit, in der führende Reformpolitiker wie Carl Severing und Wilhelm Abegg mehr Frauen im Staatsdienst sehen wollten, eine der ersten Verwaltungsjuristinnen überhaupt gewesen war und sie zudem einen hochgehandelten ‚Newcomer‘ in der Verwaltung geheiratet hatte, war sie beileibe auch keine Unbekannte gewesen. Zudem bescheinigten die geistigen Ziehväter, Kollegen und politischen Freunde des Ehepaars Bähnisch aus SPD, Zentrum und der DDP der gut ausgebildeten Juristin, in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus politisch auf der 'richtigen' Seite gestanden zu haben.
Fazit | 1051
Theanolte Bähnisch wußte die Chancen, die dies mit sich brachte, zu nutzen. Sie verortete sich selbst ab 1945 im aktiven Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Auch darüber hinaus stellte sie ihre Rolle im Dritten Reich – wie die ihres Mannes – als unangepaßt dar. Davon, daß Albrecht Bähnisch aufgrund seiner Zugehörigkeit zur SPD 1933 seines Amtes als Landrat enthoben worden war, konnte sie in den Nachkriegsjahren beruflich und politisch profitieren. Als sie ihr unternehmerisches Selbst an den von ihr vermuteten Nachkriegserfordernissen ausrichtete, integrierte sie die Erfahrung des Bruchs in der Biographie ihres Mannes, welchen die Amtsenthebung bedeutete, in ihre Selbstdarstellung. Damit konnte sie sich der Aufmerksamkeit jener, die ein ähnliches Schicksal erlitten hatten, sicher sein. Denn die Erfahrung der Amtsenthebung, die sich – je nach Kontext und Blickwinkel – als ein Scheitern oder auch als eine Auszeichnung interpretieren läßt, stellte eine zentrale Kategorie der Erfahrung des Nationalsozialismus auch durch andere demokratische Verwaltungseliten dar14 und wirkte somit integrativ in jenen Kreisen. Nicht zuletzt, weil sie es vermochte, jenen Marker der Biographie ihres Mannes in ihre eigene Biographie zu integrieren, vermochte sie Teil eines Erinnerungsnetzwerks15 zu werden, welches vor dem Hintergrund ähnlicher gemeinsamer Erfahrungen gestaltenden Einfluß auf die werdende Bonner Republik ausübte. In diesem Zusammenhang wird abermals deutlich, welch wichtigen Beitrag Karl Mannheim mit dem Konzept der ‚Generationsgemeinschaft‘16 zum Verständnis historischer Prozesse geleistet hat. Denn jene Politiker, deren Autobiographien der Historiker Volker Depkat analysierte17 und die mit Bähnisch nach 1945 enge Bande auf der Grundlage ähnlicher Erfahrungen knüpften, waren im Schnitt gut 15 Jahre älter als die Regierungspräsidentin. Daß Bähnisch dennoch nach deren Maximen handelte und sich deren Deutung der Vergangenheit anschloß, zeigt, daß ein Generationenkonzept, welches mit eng umgrenzten Alterskohorten arbeitet, keinen vergleichsweise erhellenden Beitrag zur Erklärung von Theanolte Bähnischs Aussagen und ihrem Erfolg nach 1945 liefern könnte. Auch im Umgang mit Zäsuren ähnelt Bähnischs Selbstdarstellung jenen, die Volker Depkat porträtierte. Interessant ist, daß die Juristin bereits in zeitgenössischen Briefen formulierte, was Depkat aus den ab 1945 entstandenen Autobiographien der von ihm untersuchten Personen herausarbeitet: Jene Personen, die die Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus einte, verarbeiteten die Zäsur 1933 jeweils als einen negativen Einschnitt, der zu einem gefühltem Stillstand im eigenen Leben geführt hatte. Demgegenüber wurde die Zäsur 1945 von allen untersuchten Personen als eine positive dargestellt, weil die neue Ausgangslage ein Anknüpfen an die eigenen Utopien in einem neuen Staat – wenn auch unter veränderten Vorzeichen – ermöglichte. Daß die Verwaltungsjuristin ähnlich dachte, wird vor allem in den Briefen an Kurt Schumacher deutlich. Daß aus ihren Aufzeichnungen keine so frühe und keine so starke Politisierung spricht wie aus
14 Vgl. dazu beispielsweise die Ausführungen Volker Depkats über die Amtsenthebungen Konrad Adenauers und Ferdinand Friedensburgs in: Depkat: Lebenswenden, S. 406/407. 15 Vgl. dazu: Schaser: Erinnerungskartelle. 16 Vgl.: Mannheim, Karl: Das Problem der Generationen, in: Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie, 7. Jg. (1928/29), S. 157–184. 17 Vgl.: Depkat: Lebenswenden.
1052 | The anolte Bähnisch
den Texten der von Depkat porträtierten Personen, läßt sich zum einen auf das Alter Bähnischs zurückführen, zum anderen auf den Umstand, daß sie, zumal sie ab 1945 sowohl in der überparteilichen Frauenbewegung, als auch in der SPD und in der von einer Vielparteien-Koalition geprägten niedersächsischen Verwaltung agierte, 1945 mit Versatzstücken aus dem Repertoire verschiedener ‚Erinnerungssilhouetten‘ argumentierte, welche Depkat beschreibt.18 Mit dem Umstand, daß ihr Ehemann während des Nationalsozialismus zu den Führungskräften eines kriegswichtigen, ‚arisierten‘ Betriebs gehörte, ging die Verwaltungsjuristin nach Kriegsende ebenso wenig hausieren, wie mit der Tatsache, daß ihr früh verstorbener Vater einer rechtskonservativen Partei angehört hatte, am Warendorfer Gymnasium durch antisemitische Übergriffe auffällig geworden zu sein schien und offenbar deshalb sowie aufgrund mangelnder pädagogischer Fähigkeiten aus dem Schuldienst entlassen worden war. Daß sie von der politischen Haltung ihres Vaters und den ihm gegenüber erhobenen Vorwürfen nichts wußte, ist zwar möglich, aber – vor dem Hintergrund ihres großen Interesses an Gesellschaft und Politik – nicht wahrscheinlich. Erklären läßt sich insbesondere ihr Schweigen zur Tätigkeit ihres Mannes beim Kaufhof, die der Familie im Dritten Reich ein gutes Auskommen bot, leicht: Erstens war eine herausgehobene Stellung in der Wirtschaft, wie Albrecht Bähnisch sie inne gehabt hatte, mit dem Odem der Kollaboration mit den nationalsozialistischen Machthabern belegt, und zweitens paßte der Umstand, daß sie in jenen Jahren vor allem von seinem Gehalt gelebt hatte, nicht zu ihrer Aussage, während jener Zeit selbständig berufstätig gewesen zu sein und als Verwaltungsjuristin für politisch und ‚rassisch‘ Verfolgte gearbeitet zu haben, zumal der Arbeitgeber ihres Mannes offenbar die Berufstätigkeit Theanolte Bähnischs unterband. Allein schon der Umstand, daß ein von der Militärregierung gelittener ehemaliger Vorgesetzter Albrecht Bähnischs beim Kaufhof 1945 für die Richtigkeit der Angaben in Theanolte Bähnischs Fragebogen verantwortlich zeichnete, zeigt, daß auch solche Kontakte mit für ihren Erfolg in der Bonner Republik verantwortlich waren. Die Tätigkeit ihres Mannes beim Kaufhof-Konzern erschloß ihr nicht nur neue Einkommensquellen in Form zahlungskräftiger Klienten direkt nach Kriegsende, sondern sie ebnete ihr auch Kontakte zu führenden Wirtschaftsvertretern, beziehungsweise ermöglichte ihr, bereits bestehende Kontakte in die Wirtschaft zu festigen. Davon profitierte auch ihr Bruder Otto Nolte, der in den 1940er bis 1960er Jahren Karriere beim Kaufhof machte. Ihre eigene Arbeit als Pressefotovertreterin in den Anfangsjahren des Dritten Reiches, welche sie in Interviews und Reden ab 1945 ebenfalls weitgehend unerwähnt ließ, versetzte sie in die Lage, in den 1940er Jahren an den mit ihrer Vertreter-Tätigkeit verbundenen Kontakt zu Lotte Jacobi anzuknüpfen und Photomaterial aus den USA, wohin die Jüdin und Soroptimistin Lotte Jacobi emigriert war, für die ‚Stimme der Frau‘ einzuholen. Nur ansatzweise appellierte Bähnisch ab 1945 an die Mitverantwortung der gleichsam vom Nationalsozialismus indoktrinierten wie enttäuschten deutschen Bevölkerung für Krieg und Holocaust. Schuld durch ‚Untätigkeit‘ war das Maximum dessen, was sie deutschen Frauen zum Vorwurf machte, (internationales) gesellschaftliches
18 Siehe Kapitel 1.7.
Fazit | 1053
Engagement in der Zukunft, vor allem im Dienst des Friedens, legte sie den Frauen – allerdings eher zwischen den Zeilen – als eine Art Buße und Möglichkeit zur ‚Wiedergutmachung‘ auf. Sie setzte insgesamt auf eine Politik der gesellschaftlichen Integration und fiel durch Aktionen, Aussagen und die Verwendung zentraler Begriffe und Bilder (Menschlichkeit, Persönlichkeit, Individualität, Verantwortung, Mütterlichkeit, Christentum, Gott, Humanismus, Freiheit, Gerechtigkeit, Ausgleich, Toleranz, Verständigung, Haltung, Gleichberechtigung, nationale Souveränität, Öffentliches Leben) auf, die in weiten Kreisen anschlußfähig waren. Von den Leiden der deutschen Bevölkerung als Vertriebene, als Opfer von Bombardierungen und als Kriegsgefangene zeigte sie sich betroffen, den Holocaust und die Kriegshandlungen deutscher Soldaten im Ausland thematisierte sie dagegen kaum. Das Medienecho, welches ihr Handeln und ihre Aussagen erfuhren, legt nahe, daß sie damit, auch mit ihrer Kritik an der Entnazifizierungspraxis der Militärregierung und ihrem Einsatz für eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln in der deutschen Gesellschaft, Punkte sammeln konnte. Ihr ‚Ignoranz‘ gegenüber den nationalsozialistischen Verbrechen vorzuwerfen – wie Barbara Henicz und Margrit Hirschfeld es tun19 – wäre allerdings verfehlt. Ihre Art des Umgangs mit der Vergangenheit schien – was einem zu jener Zeit äußerst verbreiteten Phänomen entsprach – von der Hoffnung getragen gewesen zu sein, die Gesellschaft einen und weitere Radikalisierungen vermeiden zu können. Dies spiegelt sich auch in den Aufbau-Appellen in ihren Reden wie „Wir sind alle Deutsche“20 wieder. Die Regierungspräsidentin stellte, wie so viele ihrer Zeitgenossen, ‚Persilscheine‘ aus und schreckte vor offen zur Schau gestellten Allianzen mit Persönlichkeiten, die aufgrund ihrer Rolle im Dritten Reich umstritten waren, nicht zurück. Die britische Militärregierung duldete solche Tendenzen in der bürgerlichen Frauenbewegung, wie der ‚Fall‘ Ulich-Beil zeigt. Man verwies dabei auf die Neigung von Kommunisten, ein entsprechendes Verhalten 'bürgerlicher Eliten' politisch zu instrumentalisieren – ein Vorgehen, dem die Briten keinesfalls Vorschub leisten wollten. Die Unterstützung, welche der von Bähnisch begründete, von Personen wie Friedrich SiegmundSchultze und Hans Lilje ideell begleitete 'Club junger Menschen' auch von britischer Seite erfuhr, zeigt, daß auch die Militärregierung die Integration jugendlicher 'rechter' Meinungsführer als Voraussetzung für deren Umerziehung begriff. Eine vergleichbare Haltung der CCG (BE) gegenüber deutschen Frauen läßt sich zwar nicht belegen, ist jedoch naheliegend. In Bähnischs Popularität als Regierungspräsidentin und als Führungsfigur in der Frauenbewegung scheint einer von mehreren Gründen dafür zu liegen, daß die CCG (BE) von ihren zunächst weitreichenden Plänen zur Demokratisierung der Verwaltung in Deutschland wieder abrückte und schließlich auch die Stellung der Regierungspräsidenten akzeptierte, deren Machtfülle zunächst als viel zu groß betrachtet worden war. Gerade Bähnischs Einstellung, eben nicht 'bürokratisch', sondern, orien-
19 Henicz/Hirschfeld: Frauen, S. 137. Siehe auch Kapitel 7.3.3. 20 DFR-Archiv, A1, Bähnisch: Sinn und Aufgaben des deutschen Frauenrings, S. 10.
1054 | Theanolte Bähnisch
tiert an der jeweiligen Notwendigkeit und Besonderheit des Falls, 'menschlich'21 zu verfahren, scheint auch auf einige britische Eliten überzeugend gewirkt zu haben. Dabei setzte eine solche Art der Amtsführung ein hohes Maß an persönlicher Entscheidungskompetenz bei der Auslegung von Gesetzen voraus, welche sich freilich auch als Freifahrtschein für Willkür interpretieren ließe. Daß die Hannoveraner Regierungspräsidentin die Behörde „so menschlich wie möglich“22 führen wollte, ließ hoffen, daß daraus eine positive Identifikation der Gesellschaft mit dem neuen Staat erwachsen würde. Zudem konnte ihr Amt einen Beitrag dazu leisten, die Akzeptanz von Frauen als Führungsfiguren in der Bevölkerung wachsen zu lassen, und zu guter Letzt war auch die Vorbildfunktion einer so hohen Verwaltungsbeamtin für andere Frauen ganz im Sinne der Besatzungsmacht. Ohne Wirkung scheinen Bähnischs Ideen zu den „Persönlichkeiten, die eine starke Ausstrahlung besitzen“23, zum „complete human being“24 und zu ihren ‚staatspolitischen‘ Aufgaben, die Anklänge an Macchiavellis Vorstellung einer 'guten Regierung‘ aufweisen, auch auf die Militärregierung nicht geblieben zu sein. Dazu trug sicherlich bei, daß der Politiker und Erwachsenenbildner Adolf Grimme, der bei den Briten hoch im Kurs stand, in vielen Aspekten ähnlich argumentierte wie Bähnisch und seine Freundin protegierte. Daß diese als Regierungspräsidentin eine wichtige, über die Pflichten ihres Amtes weit hinausreichende Rolle im Wiederaufbau des neu gegründeten Landes Niedersachsen und in der ‚Verwaltung des Mangels‘ spielte, ist unbestritten. Auch diese Rolle Bähnischs und der anderen Regierungspräsidenten, die in der Zeit des Wiederaufbaus, als die Mobilität stark eingeschränkt war, schlichtweg näher an der Bevölkerung waren als der Ministerpräsident, dürfte eine Rolle für die Entscheidung der Briten gespielt haben, es beim ‚Alten‘ zu belassen. Ob die Wahl-Hannoveranerin in ihrer Rolle als Regierungspräsidentin – über die direkten Zusammenhänge mit dem ‚Club deutscher Frauen‘ hinaus – anders handelte, als es ein Mann getan hätte, läßt sich schwerlich beurteilen, zumal der Versuch der Beantwortung dieser Frage zwangsläufig darauf hinauslaufen würde, fragwürdige Definitionen von ‚Weiblichkeit‘ zu reproduzieren. Will man in der Logik dessen argumentieren, was Bähnisch selbst mit ‚Weiblichkeit‘ verband und was in der Berichterstattung über ihre Amtsführung auf ihre ‚Weiblichkeit‘ zurückgeführt wurde, so läßt sich konstatieren, daß sich die erste Regierungspräsidentin Deutschlands in den Nachkriegsjahren besonders solchen Themen widmete, die traditionell als weibliche Zuständigkeitsbereiche angesehen wurden: der gesundheitlichen und sozialen Notlage der Bevölkerung, vor allem der Flüchtlinge und – wie die Einrichtung des Jugendflüchtlingslagers Poggenhagen zeigt – insbesondere der Jugendlichen, die gezwungen gewesen waren, ihre Heimat zu verlassen. Gleichzeitig waren diese Themen
21 In einem Zeitungsartikel über Bähnisch wird dieses Phänomen als „Vermenschlichung der Bürokratie“ bezeichnet. Wiese: Präsidentin. 22 Langner: Regierungspräsident. 23 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Theanolte Bähnisch an Kurt Schumacher, 23.12.1945. 24 NA, UK, FO 1050/31, Proposal for a school for Education in Citizenship, Theanolte Bähnisch, o. D., Abschrift, Anhang zu einem Schreiben des Office of the Educational Advisor an den Religious Affairs Advisor, 09.08.1948.
Fazit | 1055
zu dieser Zeit aber auch die drängendsten Probleme, weshalb sie als Arbeitsschwerpunkte im Zentrum des Schaffens der Behördenleiterin stehen mußten. Auch ein männlicher Behördenleiter hätte seine Arbeitsschwerpunkte zu jener Zeit kaum anders setzen können. Ob auch die anderen Regierungspräsidenten in der britischen Besatzungszone ihre Mitarbeiter dazu anhielten, ihnen regelmäßig über den Stand der Frauenbewegung im Bezirk zu berichten, bliebe zu prüfen. Im Hinblick auf die an alle deutschen Behörden verteilte Education Control Instruction No. 60 ist dies durchaus möglich. Daß in anderen Bezirken allerdings ähnlich viel Energie darauf verwendet wurde wie im Regierungsbezirk Hannover, ist wiederum nicht wahrscheinlich. Dies muß jedoch nicht auf eine ‚weibliche‘ Neigung, sondern kann auch auf ein inhaltliches Interesse der Behördenleiterin zurückgeführt werden. Einen allgemeinen Vergleich mit den Arbeitsschwerpunkten männlicher Regierungspräsidenten im Land Niedersachsen zu ziehen, ist für die Beantwortung der Frage, ob Bähnisch anders handelte als ihre männlichen Kollegen, nur bedingt hilfreich. Denn als Regierungspräsidentin im Bezirk Hannover war Bähnisch im sozialen Bereich stärker gefordert als ihre Kollegen. Der Flüchtlingsstrom aus dem Osten verschärfte den im Ballungsgebiet Hannover aufgrund des hohen Zerstörungsgrades der Stadt ohnehin schon gravierenden Wohnungsmangel zusätzlich und in einer Weise, der mit der Lage in ländlicheren Bezirken wie Hildesheim, Lüneburg oder gar Aurich nicht vergleichbar ist. Auch über die Frage, ob die Art der Amtsführung Bähnischs eine spezifisch ‚weibliche‘ war, läßt sich streiten. Fakt ist, daß sie versuchte, ihre Amtsführung selbst so darzustellen, daß sie zu ihren Aussagen über die (wünschenswerten) Eigenschaften von Frauen paßten. Der Umstand, daß sie eine Frau war, scheint außerdem dazu beigetragen haben, daß man ihr manches, was männlichen Kollegen als eine Zuständigkeitsüberschreitung zu Lasten gelegt worden wäre, als besonders menschliches, bürgernahes und problemorientiertes Verhalten zu Gute hielt25 – zumal in manchen Fällen, wie beispielsweise im Fall der Kleider- oder Eiersammlung für Berlin in Hannover – nicht klar war, ob Bähnisch als Regierungspräsidentin oder als Vorsitzende einer Frauenorganisation handelte. Die Fürsprache und Unterstützung der britischen Frauenbewegung, welche Theanolte Bähnisch widerfuhr, ist ein weiterer, ausschlaggebender Grund für Theanolte Bähnischs Nachkriegskarriere. Besonders betont werden muß die Rolle Helena Denekes, die als führendes Mitglied der 'Women‘s Group on Public Welfare' (WGPW) die Militärregierung in Sachen Frauenpolitik in Deutschland beriet. Der Einfluß der Germanistik-Professorin war maßgeblich dafür, daß sich die Juristin trotz der demokratischen und organisatorischen Defizite sowie der problematischen Zielgruppenorientierung und einer entsprechenden Mitgliederstruktur der von ihr geleiteten Organisationen zur Führungsfigur in der deutschen Frauenbewegung entwickelte. Auch an Politikberaterinnen wie Helena Deneke zeigt sich, welch weitreichenden Einfluß Personen, die heutzutage in Deutschland weitgehend unbekannt sind, auf den
25 In einem Artikel, der auch die Einrichtung des Jugendflüchtlingslagers Poggenhagen thematisiert, heißt es – mit lobendem Tenor: „Nach den Buchstaben war der Regierungsbezirk dafür keinesfalls zuständig, aber die Regierungspräsidentin hat sich ruhig über viele Bedenken und manche Paragraphen hinweggesetzt.“ O. V.: Schubfach.
1056 | Theanolte Bähnisch
deutschen Wiederaufbau ausübten. Am Beispiel Denekes wird deutlich, daß einige Akteure, die an den Schnittstellen verschiedener Netzwerke agierten und die ‚richtigen‘ Kontakte hatten, stärker Einfluß nehmen konnten als Personen, die nominell herausgehobene Ämter innehatten. Als ein solches Beispiel kann Herta Gotthelf dienen, die zwar als SPD-Frauensekretärin damit beauftragt war, im Namen der zweitstärksten Partei in Deutschland ‚Frauenarbeit‘ zu leisten, die jedoch weder die Militärregierung von sich überzeugen noch auf die uneingeschränkte Unterstützung des Parteivorsitzenden Schumacher zählen konnte. Neben jenen der WGPW spielten auch Vertreterinnen des ‚International Council of Women‘ (ICW) in Großbritannien und in anderen Ländern für Bähnischs Erfolg in der Frauenbewegung eine entscheidende Rolle – vor allem dafür, daß dieser Erfolg noch vor der Gründung eines deutschen Staates auch auf internationaler Ebene spürbar wurde. Indem sie die Aufnahme einer großen, von ihr selbst geleiteten deutschen Frauenorganisation in den ICW in Aussicht stellen konnte, wurde die Regierungspräsidentin zur Garantin des in der Frauenbewegung heiß ersehnten (Wieder-)Anschlusses der organisierten deutschen Frauenbewegung an die internationale Frauenbewegung. Dies sicherte der Präsidentin des Frauenrings den Respekt und die Dankbarkeit führender Protagonistinnen der deutschen Frauenbewegung wie auch die anhaltende Unterstützung durch die Britische Militärregierung. Denn als der ‚Kalte Krieg‘ an Schärfe gewann, legten die Briten andere Maßstäbe an eine Führungsfigur der deutschen Frauenbewegung an als direkt nach Kriegsende. Der ursprüngliche Auftrag, politische Bildungsarbeit auf kleinstem organisatorischen und regionalen Nenner zu leisten, hatte 1948/49 an Relevanz verloren. Vielmehr galt es nun, mit einer möglichst mitgliederstarken westdeutschen Frauen-Organisation ein Bollwerk gegen den kommunistischen DFD zu errichten. Bald schon wurde dieser FrauenOrganisation – und damit ihrer Präsidentin – auch der Auftrag übertragen, der kommunistischen Frauenbewegung auch auf internationaler Ebene Paroli zu bieten. Dies hieß vor allem, dem DFD den Rang abzulaufen, was die Repräsentation und Vertretung der deutschen Frauen in der UNO betraf, und damit auch den Einfluß der internationalen, kommunistisch orientierten Internationalen Demokratischen Frauenföderation (IDFF) zu begrenzen. Gerade die Schwerpunktverschiebungen in der britischen Deutschland-Politik sorgten also dafür, daß die Unterstützung Bähnischs durch die CCG (BE) stetig stärker wurde. Ein wichtiger Schrittgeber der Entwicklung vom regionalen Zusammenschluß ‚Club deutscher Frauen‘ über den ‚Frauenring der britischen Besatzungszone‘ bis hin zum ‚Deutschen Frauenring‘, der Landes- und Ortsringe im gesamten Bundesgebiet vorweisen konnte, waren die (interzonalen) Frauenkonferenzen. Bähnischs herausragende Rolle bei diesen Frauenkonferenzen und bei anderen Veranstaltungen der Frauenbewegung in den Westzonen zeigt, wie stark ihr (west-)deutschlandweiter Einfluß bereits vor der Gründung der Bundesrepublik und der Begründung des DFR war – und daß dieser Einfluß in der Forschung bisher nur unzureichend berücksichtigt wurde. Die Juristin wurde – nach einer Phase weitgehender Unkenntnis der Zusammenhänge in Westdeutschland – von der kommunistischen Frauenbewegung als die führende Persönlichkeit in der westdeutschen Frauenbewegung identifiziert wurde und stand im Zentrum der Auseinandersetzungen um die ‚überparteiliche‘ Frauenarbeit in der SPD stand. Dies unterstreicht den Umstand, daß in Deutschland nach 1945 nicht nur über die (erneute) Durchsetzung eines teils gelobten, teils verdamm-
Fazit | 1057
ten Konzeptes, beziehungsweise eines gesellschaftlichen Akteurs, der überparteilichen Frauenbewegung, gestritten wurde, sondern vor allem auch über die Durchsetzung einer Person. Sprach man über die Frage, ob die Existenz einer organisierten ‚überparteilichen Frauenbewegung‘ wünschenswert sei, oder nicht, so ging damit gleichzeitig die Frage einher, ob Theanolte Bähnisch eine bedeutende Rolle im Land spielen sollte oder nicht. Bähnisch war, das zeigt ihr Renommee vor allem in der britischen Frauenbewegung, nachdem sie sich erst einmal etabliert hatte, beziehungsweise etabliert worden war, kaum mehr austauschbar. Ob ein ähnlich schneller Wiederanschluß der deutschen Bürgerlichen Frauenbewegung an die internationale Frauenbewegung unter der Führung einer anderen Person vollzogen worden wäre, muß als fraglich gelten. Wichtig für Bähnischs Erfolg waren ihre Fähigkeit, sich selbst zu vermarkten, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, überzeugende Argumente zu liefern, ihre Bereitschaft, bereits Ende 1946 eine vierwöchige Reise nach Großbritannien anzutreten, auf die viele weitere Reisen ins ‚westliche‘ Ausland folgen sollten, ihr auf Kooperation ausgerichteter Kurs, natürlich auch der Umstand, daß sie zahlreiche Fürsprecher und Fürsprecherinnen hatte. Wie sehr der Aufbau der organisierten Frauenbewegung in Westdeutschland von Theanolte Bähnisch abhängig war, zeigte sich nicht zuletzt in der Stagnation des Prozesses, als die Regierungspräsidentin 1947 eine Schaffenskrise überkam. Erst nach einer Phase der Erholung und der inneren Einkehr nahm sie die Arbeit an den begonnenen Projekten wieder auf. Mit ihr ruhte in jener Zeit auch der Aufbau des Frauenrings und damit der organisierten überparteilichen Frauenbewegung. Nachdem die Regierungspräsidentin wieder zu Kräften gelangt war, wollte sie ihr Engagement in der Frauenbewegung gleich auf drei Säulen stellen, die jeweils andere Schwerpunkte setzten und jeweils andere Symbiosen ermöglichten: Den Frauenring, die ‚Stimme der Frau‘ und die ‚staatsbürgerliche Frauenschule‘. Mit Feuereifer ging sie zudem an die Planung der nächsten großen Frauenkonferenz, zumal solche Konferenzen für die Regierungspräsidentin weit mehr als ‚nur‘ eine Möglichkeit waren, den Aufbau einer Frauenorganisation organisatorisch voranzutreiben. Bähnisch nutzte – neben der ‚Stimme der Frau‘, regionalen Zeitungen und Zeitschriften und ihren Reisen ins Ausland – vor allem die Konferenzen dafür, auf sich aufmerksam zu machen und ihre Ideen zu verbreiten. Mit der Berichterstattung über die Konferenzen in der überregionalen und sogar in der ausländischen Presse (und) durch die Anwesenheit ausländischer Beobachterinnen stieg ihr Bekanntheitsgrad binnen kurzer Zeit beträchtlich. Daß ihre Führungsrolle in der bürgerlichen Frauenbewegung trotz einiger Kompetenz- und Zuständigkeitsstreitigkeiten akzeptiert wurde, hing im Wesentlichen mit den bereits genannten Aspekten zusammen: Die 'alte Garde' des BDF wünschte die Re-Organisation der deutschen Frauenbewegung in einer mitgliederstarken, weitverzweigten Organisation, die sich – auf dem Boden der Differenztheorie – für die Rechte von Frauen einsetzte und die Re-Integration einer solchen Organisation in internationale Bündnisse leistete. Daß der Präsidentin des Frauenrings auch starker Widerstand entgegenschlug, lag vor allem darin begründet, daß nicht alle gesellschaftlichen Kräfte, die sich für Frauenrechte einsetzten, Bähnischs Grundauffassung von der 'gemeinsamen Frauenüberzeugung' teilten. Für die SPD-Frauensekretärin Herta Gotthelf war vielmehr das Handeln nach den Grundsätzen sozialdemokrati-
1058 | Theanolte Bähnisch
scher Politik Voraussetzung für eine gelingende Emanzipation. Auch was eine mögliche Infiltration der Frauenbewegung durch Kommunistinnen anging, hielt die SPDFrauensekretärin den überparteilichen Weg für den falschen. Die Analyse der aus dem DFD überlieferten Unterlagen gibt Gotthelf in der Retrospektive mit dieser Befürchtung zumindest teilweise Recht. Aus gutem Grund befürchtete die SPDFrauensekretärin außerdem, daß die 'Bürgerlichen' an den 'Arbeiterinnen' wenig Interesse hätten. Allenfalls als 'Schülerinnen' der in der Frauenarbeit erfahrenen, führenden – meist akademisch gebildeten, gut situierten Mitglieder des Frauenrings – hatten sie in Theanolte Bähnischs Konzept einen Platz. Im Vorstand des ‚Club deutscher Frauen‘ und im ‚Frauenring der britischen Zone‘ waren Sozialdemokratinnen vergleichsweise stark vertreten und mit leitenden Ämtern betraut, doch ‚Arbeiterinnen‘ suchte man in den Vorständen vergeblich. Der Maxime Fritz Borinskis, Gesellschaftsschichten, die bisher an Leitungsaufgaben wenig partizipieren konnten, zur Mitbestimmung zu ermuntern, folgte Bähnisch im Hinblick auf Arbeiterinnen nicht. Dennoch hatten viele Sozialdemokratinnen Interesse an einer Zusammenarbeit mit den ‚Bürgerlichen‘, was zu erbitterten Auseinandersetzungen in der Partei führte. Auch viele Männer aus dem rechten Parteiflügel, beispielsweise jene, die sich, wie Bähnisch, in der Europabewegung engagierten, kooperierten mit der Hannoveraner Regierungspräsidentin. Noch in den 1960er Jahren war sie eine Ansprechpartnerin für namhafte SPD-Politiker wie Herbert Wehner und Fritz Erler, die breitere Wählerschichten erreichen und die Koalitionsfähigkeit der Partei stärken wollen. Theanolte Bähnisch gehörte ohne Zweifel zu jenen Personen, die den ‚Marxismus‘ als programmatisches Ziel der SPD überwinden und den Weg nach ‚Bad Godesberg‘ ebnen wollten, die also Vorreiter der ‚Partei der neuen Mitte‘ waren. Ihre Vision hinsichtlich einer Kooperation der SPD mit den Kirchen, eine Vorstellung, die sich im – auch von Adolf Grimme getragenen – Konzept des ‚christlichen Sozialismus‘26 manifestierte, erfüllte sich jedoch nicht. Weder der Parteivorstand sah eine Grundlage zur Zusammenarbeit mit den Kirchenvertretern, noch wollten diese Bähnischs Argument gelten lassen, daß die SPD den „christlichen Sozialismus im Sinne des Urchristentums“ vertrete, während die CDU den notwendigen Besitzausgleich nicht leisten könne, da sich „alle Besitzenden zu ihr geflüchtet“27 hätten. Der Dominikaner-Pater Laurentius Siemer, aber auch Laien wie der in der Europäischen Bewegung organisierte Walter Dirks und der spätere Minister für gesamtdeutsche Fragen Jakob Kaiser sahen offenbar größere Chancen darin, die CDU zum Sozialismus zu bringen, als die SPD zu einer christlichen Partei zu formen. In der Existenz der SPD, so legen es Bähnischs Ausführungen über das Thema ‚Zusammenarbeit der SPD versus Verschmelzung der Partei mit dem linken Zentrumsflügel‘28 nahe, scheint die ‚konservative Sozialdemokratin‘ einen gesellschaftlich notwendigen politischen Ausgleich ge-
26 Bähnisch sprach jedoch – vielleicht im Hinblick auf den Holocaust – vom ‚religiösen Sozialismus‘. AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher 15.12.1945. 27 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher, 11.02.1946. 28 AdSD, Kurt Schumacher, Nr. 126, Bähnisch an Schumacher 15.12.1945. Sie grenzt sich im Brief von der von ihr vermuteten Position Severings ab, der ihrer Meinung 1946 nach einer Verschmelzung der SPD mit dem linken Zentrumsflügel offen gegenüberstand.
Fazit | 1059
sehen zu haben – ganz ähnlich wie es ihr Mann Albrecht Bähnisch, seinen Äußerungen über die SAG und über das soziale System der Weimarer Republik nach zu urteilen, tat. Das Risiko einer „Verwässerung“29 der Partei durch ein Zusammengehen mit dem linken Zentrumsflügel wollte sie erklärtermaßen nicht eingehen. Nach allem, was bekannt ist, dürfte sie einen starken katholischen Flügel in der Sozialdemokratie, wie ihn die ‚Verschmelzung‘ mit dem linken Zentrumsflügel nach sich gezogen hätte, allein schon deshalb nicht befürwortet haben, weil sie dem Katholizismus skeptisch gegenüberstand und sich stärker für protestantische Ideen begeistern konnte, wie sie Adolf von Harnack und Friedrich Siegmund-Schultze vertraten. Ihr in der SPD, aber auch im DFR unerfüllt bleibendes Bedürfnis, die Brücke zwischen Kirche und Welt zu schlagen, konnte Bähnisch nicht nur in der Europabewegung, sondern auch in den Evangelischen Akademien von Bad Boll und Loccum mit Gleichgesinnten teilen. Die Akademien waren – wie die meisten Kreise, in denen sich Bähnisch bewegte – für ihr Ziel, durch eine spezielle Gesprächskultur einen Konsens zwischen verschiedenen Interessengruppen zu ermöglichen, bekannt. Das Konzept der Akademien hatte Thomas Mittmann zufolge seine Wurzeln in der Weimarer Republik, es baute auf dem Konzept der ‚Arbeitsgemeinschaften‘ auf, das im Rahmen der Volkshochschularbeit in der Weimarer Republik entstanden war. Die britische Militärregierung bestätigte – nach einigen Auseinandersetzungen zwischen der ‚Education Branch‘ und der ‚Political Section‘ sowie dem Versuch Herta Gotthelfs direkt auf die verantwortlichen Kräfte Einfluß zu nehmen – schließlich aus dem Mund von General Robertson persönlich ihren von Beginn an beschrittenen Weg, nicht die Frauenarbeit der SPD, sondern die überparteiliche Frauenarbeit Bähnischs vorrangig zu unterstützen. Denn die Briten strebten – wie die im Klima der preußischen Koalitionsregierungen sozialisierte Juristin – den Aufbau einer pluralen Demokratie in Deutschland an und sahen sich, je mehr sich der ‚Kalte Krieg‘ zuspitzte, desto stärker dazu berufen, einem breitestmöglichen demokratischen Konsens gegen die Kommunistische Partei den Boden zu bereiten. Für Theanolte Bähnisch selbst bedeutete ‚überparteiliche Arbeit‘ spätestens seit dem Winter 1946/47 nicht nur eine Arbeit unter Ausschluß von Kommunistinnen, sondern auch gegen dieses politische Lager. Sowohl Bähnischs Arbeit als Vorsitzende von Frauenzusammenschlüssen als auch ihre Rolle als Herausgeberin der 'Stimme der Frau' und ihr Engagement in der Europabewegung ermöglichten der engagierten Juristin, Einfluß auf die Gesellschaft im Wiederaufbau auszuüben. Zum einen direkt, da sie im Licht der Öffentlichkeit stand und als 'Vertreterin der Frauen' gehört wurde, zum anderen auch indirekt, über Multiplikatorinnen und Lobbyistinnen. Als sie ihr Ziel, Multiplikatorinnen auszubilden mit der 'Schule für staatsbürgerliche Frauenbildung' auf der Basis eines Konzeptes institutionalisieren wollte, das Bezüge zu den Heimvolkshochschulen aufwies, verwehrte man ihr allerdings die finanzielle Unterstützung. Mehr Erfolg hatte sie mit der Implementation von Lobbyistinnen des DFR in verschiedene deutsche Ministerien, in den 'Informationsdienst Frauenfragen' sowie in verschiedene Organisationen und Verbände. Dadurch, daß sie im Zuge der Einrichtung des Frauenreferats im
29 Ebd.
1060 | Theanolte Bähnisch
Bundesinnenministerium sowie des ‚Informationsdienstes Frauenfragen‘ ihren Einfluß geltend machen konnte, prägte sie die Arbeit der entsprechenden Einrichtungen über die Zeit ihrer aktiven Mitarbeit im DFR hinaus. Daß der DFR in der Gesellschaft durchaus als ein Sprachrohr der Frauen wahrgenommen wurde, zeigte sich beispielsweise daran, daß Journalisten ihn zu Themen, die die (von ihnen angenommenen) Interessen von Frauen betrafen, anhörten.30 Insbesondere im Zuge der Durchsetzung des Gleichberechtigungsartikel im Grundgesetz der BRD sowie der langwierigen Angleichung der Gesetze des Bürgerlichen Gesetzbuches an diesen Artikel zeigte der DFR mit seinen Stellungnahmen und Gesetzesvorschlägen Präsenz in der Öffentlichkeit. Die Gründungspräsidentin des DFR selbst übernahm 1950 auf dem Juristentag den Vorsitz der bürgerlich-rechtlichen Abteilung, diverse andere namhafte Juristinnen wie das erste weibliche Mitglied des Hauptdeputationsausschusses des Deutschen Juristentages, Marie-Elisabeth Lüders, die Vorsitzende des Juristinnenbundes, Hildegard Gethmann und die Bundesverfassungsrichterin Erna Scheffler setzten sich als führende Mitglieder des DFR dafür ein, daß sich die Rechtsstellung von Frauen in Deutschland nach und nach verbesserte. Auch in anderen Bereichen, beispielsweise im Wohnungsbau31, leisteten Frauenring-Mitglieder einen Beitrag dazu, daß die (manchmal vermeintlichen) Interessen von Frauen stärkere Berücksichtigung fanden. Mit der SPD arbeitete der DFR bei der Durchsetzung des Gleichberechtigungsgesetzes enger zusammen, als es die Partei, die die Geschichte der Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Deutschland als eine Erfolgsgeschichte der SPD darstellt32, heute erkennen lassen will. Nicht wenige Kernforderungen des DFR in jener Zeit waren deckungsgleich mit jenen der SPD. Ein besonderes Interesse, die wirtschaftliche Schlechterstellung von Arbeiterinnen gegenüber ihren männlichen Kollegen strukturell zu verändern – wie es die SPD-interne-Frauenpolitik verfolgte – ließ der DFR allerdings nicht erkennen. Sein Fokus lag stärker auf der beruflichen Verwirklichung von Akademikerinnen. In den ersten Ausgaben der ‚Stimme der Frau‘ im Jahr 1948 wird noch das Recht auf Arbeit für alle Frauen eingefordert. Diese Forderung wird jedoch in den folgenden Jahren nach und nach von der Haltung abgelöst, daß es einer Ehe nicht guttun könne, wenn beide Partner abends „abgekämpft in eine kalte Bude kommen“33. Daß in einem solchen Fall selbstverständlich die Frauen auf den Beruf verzichten sollten, wird in der Formulierung, daß ein solches Heim „der eigentlichen fraulichen Atmosphäre des eigenen Herdes doch so fühlbar“ entbehre und ein solches Leben „an Löhnen für Putzfrau und Waschfrau [...] auf die Dauer mehr“ koste, „als die Ganztagsbeschäftigung der Ehegattin wert ist“34, deutlich. Daß die Herausgeberinnen der Zeitschrift sich im DFR zu jener Zeit nach wie vor für die Anerkennung weiblicher Berufstätigkeit engagieren, zeigt einer-
30 Vgl. als Beispiel: o. V.: Eherecht, S. 28. 31 Vgl. als Beispiel: o. V.: Wohnungen. Badewanne in der Küche, in: Der Spiegel, 20.02.1952 sowie: o. V.: Kampf um den gewissen Ort. Heftige Kritik der Hausfrauen am modernen Wohnungsbau, in: Hamburger Abendblatt, Nr. 288, 10.12.1951. 32 Vgl. dazu beispielsweise folgende SPD-nahe Publikation: Gille-Linne: Strategien. 33 Pelz: Partie. 34 Ebd.
Fazit | 1061
seits, daß die Haltung Bähnischs zur Berufsarbeit von Frauen eine widersprüchliche war, andererseits schien sie einer Berufstätigkeit von Frauen, die nicht aus einem gesellschaftlichen Gestaltungsdrang resultierte – was auf viele Berufsprofile schlechter verdienender Frauen zutraf – generell weniger Verständnis, beziehungsweise Begeisterung entgegengebracht zu haben. Wenn möglich sollten – so lassen sich ihre widersprüchlichen Aussagen interpretieren – Frauen mit ‚normalen‘ Berufen ihre Energien lieber der Partnerschaft und der Familie zur Verfügung stellen. Aus der Konzentration auf die Interessen von Akademikerinnen lassen sich einige der von außen konstatierten ‚Mißerfolge‘ des DFR und damit auch Theanolte Bähnischs erklären – wobei vor dem Hintergrund der im Hauptteil beschriebenen Einstellung von DFR-Vorstandsmitgliedern in Frage gestellt worden muß, ob von Seiten dieser führenden Mit-glieder jemals ein ernsthaftes Interesse bestand, diese ‚Mißerfolge‘ zu korrigieren. Aus den Berichten Helena Denekes wird deutlich, daß viele Frauen sich die regelmäßige Teilnahme an Treffen des Frauenrings nicht leisten konnten, weil diese – wie die Treffen des Soroptimist-Clubs in der Weimarer Republik – häufig in Gaststätten stattfanden. Zumindest dieses Problem hätte sich vermutlich lösen lassen, wenn ein starkes Interesse der führenden Mitglieder an der Integration wirtschaftlich schlechter gestellter Frauen bestanden hätte. Arbeiterinnen dürften das Programm des DFR ohnehin wenig ansprechend gefunden haben, da mit den entsprechenden Berufen einhergehende Probleme auf der Agenda des Rings nur eine untergeordnete Rolle spielten oder in einer Weise thematisiert wurden, die für die Arbeiterinnen kaum ansprechend gewesen sein dürfte. Die besonders für schlechter verdienende Frauen relevanten Themen Arbeitsschutz und Vereinbarkeit von Beruf und Familie kamen in der ‚Stimme der Frau‘ und in den Verlautbarungen des DFR kaum zur Sprache. Nichtsdestotrotz stritt die Organisation, wie bereits angedeutet, für eine rechtliche Besserstellung aller Frauen in Deutschland, nicht nur im staatsrechtlichen, sondern auch im zivilrechtlichen Bereich. Dies kam auch wirtschaftlich schlechter gestellten Frauen zu Gute. Ungeklärt bleiben muß die Frage, ob sich die Schwerpunktsetzung des DFR verlagert hätte, wenn sich die SPD-Frauensekretärin Herta Gotthelf – wie es die britische Militärregierung erwartete – zu einer Kooperation mit Bähnisch bereit erklärt hätte. Ein weiteres Manko des DFR lag in dem Umstand, daß er junge Frauen nicht für seine Politik begeistern konnte. Direkt nach Kriegsende zog die Organisation allein schon aufgrund ihrer inhaltlichen Schwerpunktsetzung ein eher älteres, gebildetes Publikum an. Auch die Zeiten, zu denen die Veranstaltungen stattfanden, schienen jungen Frauen die Teilnahme erschwert zu haben. Die Frauen, welche die Landesund Ortsringe leiteten oder führend in ihnen mitarbeiteten hatten mehrheitlich Berufe mit flexiblen Arbeitszeiten. Daß der Vorstand des Rings überaltert war, sah auch Theanolte Bähnisch als ein Problem an. Ihre Versuche, dies zu verändern, um der Organisation ein ‚jugendlicheres Gesicht‘ zu geben und sie damit für jüngere Frauen attraktiver zu machen, scheiterte jedoch am Widerstand anderer einflußreicher Protagonistinnen der Bewegung. Nicht zuletzt hieran wird deutlich, daß, so sehr der DFR als ein Werk Theanolte Bähnischs zu betrachten ist, ihre Person und die Organisation doch nicht gleichgesetzt werden können. Die im DFR-Archiv überlieferten Korrespondenzen zeigen, daß Bähnischs Einfluß beim Aufbau des DFR groß, aber nicht grenzenlos war. Sie mußte Kompromisse eingehen, um den DFR leiten und somit dem DFD Paroli bieten zu
1062 | Theanolte Bähnisch
können. Ohne die Mitarbeit führender Mitglieder aus dem 1933 aufgelösten BDF wäre ihr der Aufbau des DFR kaum möglich gewesen. Schließlich legte die britische Militärregierung, auf den Rat der WGPW hin, Wert darauf, daß führende Mitglieder der deutschen Frauenbewegung aus der Zeit vor 1933, welche in Großbritannien bereits bekannt waren und als unbelastet galten, am Wiederaufbau der Frauenbewegung in Deutschland ab 1945 mittaten. Hierin mag ein Grund dafür liegen, daß Bähnisch bereits bei der Gründung des ‚Club deutscher Frauen‘ (auch) auf solche Frauen baute, die bereits vor 1933 auf regionaler Ebene in der Frauenbewegung aktiv waren. Doch nicht nur die Präsenz der ‚alten Garde‘ der bürgerlichen Frauenbewegung, sondern auch die Mitarbeit jüngerer Expertinnen im DFR war für den Erfolg der Organisation unverzichtbar. Denn diese gut ausgebildeten Juristinnen, Ingenieurinnen, Ärztinnen und Vertreterinnen anderer akademischer Berufsgruppen sorgten ebenfalls dafür, daß der DFR Gehör fand. Sie brachten ihr Fachwissen in Organisationen, Institutionen, Arbeitskreise und in die Politikberatung ein und agierten in diesem Zuge als Fürsprecherinnen des DFR. Eventuelle Konfliktkonstellationen zwischen der Gründungspräsidentin und diesen jüngeren Expertinnen zu erforschen, steht noch aus. Daß der DFR seine Gründungspräsidentin um Jahrzehnte ‚überlebte‘ und heute noch existiert, ist wiederum nicht zuletzt als ein Erfolg Theanolte Bähnischs zu werten. Schließlich hatte vor allem sie die zum Aufbau der Organisation wichtigen Kontakte gepflegt und pflegen lassen und der Organisation ihr – wenn auch umstrittenes – Profil gegeben. Zu diesem Profil gehörten ohne Zweifel starke Anleihen an den Inhalten und der Zielgruppenorientierung des BDF, das Ziel, international in die Fußstapfen des BDF zu treten und eine starke Elitenkontinuität in der bürgerlichen Frauenbewegung von der Weimarer Republik in die Bonner Republik. Gleichzeitig setzte Theanolte Bähnisch beim Aufbau der Organisation von Hannover sowohl stark auf die Mitarbeit von Sozialdemokratinnen als auch die solcher Frauen, die der konfessionellen Frauenbewegung nahestanden, oder sich bis 1933 in ihr engagiert hatten. Breiter aufgestellt als der BDF, der ein konflikthaftes Verhältnis sowohl zur Sozialdemokratie, aber auch zur konfessionellen Frauenbewegung hatte, war der DFR deshalb insgesamt gesehen jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: Mit der Gründung des Frauenrings vollzog sich auch ein Bruch in der organisierten Frauenbewegung: Seiner von der Militärregierung und von vielen Protagonistinnen der Frauenbewegung erwarteten Funktion als Dachverband wurde der DFR kaum gerecht. Nur wenige Organisationen schlossen sich ihm korporativ an. Seine Basis bestand im Wesentlichen aus den DFR-Ortsringen, die zwar regional unterschiedlich stark mit anderen Frauenorganisationen kooperierten, aber nur selten eine Funktion als Dachorganisation ausübten. Der DFR war, da seine Größe im Wesentlichen auf Individualmitgliedschaften beruhte, nicht annähernd so mitgliederstark wie der Dachverband BDF, welcher allerdings auch ein viel größeres Territorium abgedeckt hatte, als es dem DFR aufgrund der Gebietsverluste und der deutschen Teilung überhaupt möglich gewesen war. Dafür, daß der Kalte Krieg nicht nur einen starken Einfluß auf den insgesamt gesehen raschen Aufbau und die „rasche[…] Führung“35 des DFR hatte, sondern sich
35 Pfeiffer: Frauenschaffen, S. 26.
Fazit | 1063
auch auf die Inhalte seiner Politik auswirkte, liegen viele Ansatzpunkte vor: Die Einrichtung eines ‚gesamtdeutschen Ausschusses, der mit dem entsprechenden Ministerium zusammenarbeitete, der 1952 gegründete Arbeitskreis ‚Propaganda, Presse, Arbeit in den Osten‘36, die Packaktionen für die ‚Ostzone‘, welche der DFR in seinen Ortsringen durchführen ließ, die Art, wie der ‚Club deutscher Frauen‘ mit seinen kommunistischen Mitgliedern umgegangen zu sein scheint, Bähnischs Versuch, die Gründung des DFD in Westdeutschland zu verhindern und ihre Weigerung, mit der DFD-Generalsekretärin Maria Rentmeister zu kooperieren, sind nur einige Beispiele. Daß die Gründungspräsidentin und ihre Mitstreiterinnen dann und wann anders argumentiert hätten, wenn sie nicht ständig darauf hätten bedacht sein müssen, die eigene frauenpolitische Argumentation von der der Kommunistinnen abzugrenzen, läßt sich nicht belegen, aber es ist wahrscheinlich. Hätte es gar keine Schnittmenge in der frauenpolitischen Argumentation kommunistischer Politikerinnen und jener Theanolte Bähnischs gegeben, so wäre die DFD-Generalsekretärin Maria Rentmeister in der frühen Phase des Wiederaufbaus der Frauenbewegung in Deutschland wohl kaum auf die Idee gekommen, mit der Regierungspräsidentin zusammenarbeiten zu wollen. Die ehemalige Widerstandsaktivistin gegen den Nationalsozialismus, die später eine leitende Funktion im DDR-Ministerium für Volksbildung übernehmen sollte, erkannte in Bähnisch eine ‚fortschrittliche‘ Frau, die, wie Rentmeister zu Protokoll gab, ganz ähnlich wie der DFD argumentiert habe. Hinweise auf ein entsprechendes ‚Dilemma‘ der Gründungspräsidentin finden sich auch in der ‚Stimme der Frau‘. In der Zeitschrift werden naheliegende – also auf der anderen Seite der deutsch-deutschen Grenze existierende – Beispiele für eine ‚fortschrittliche‘ Frauen- oder Familienpolitik zugunsten solcher aus dem westlichen Ausland beschwiegen. Die Marschroute, die Theanolte Bähnisch den deutschen Frauen und der deutschen Gesellschaft vorgeben wolle, wies eindeutig Richtung Westen. Beispiele, die auf eine gelingende Emanzipation in Ostdeutschland hindeuteten37, waren diesem Ziel offenbar abträglich. In der Zeitschrift konzentriert sich, was sich auch aus Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln über Bähnisch, aus ihren Reden und aus ihrer Organisationspolitik herauslesen läßt: Die Warnung vor dem ‚Osten‘ als glaubensfern, totalitär, ‚vermassend‘ und unmenschlich sowie komplementär dazu die Empfehlung an die Frauen, sich am ‚Westen‘ zu orientieren. Die Argumente, welche Theanolte Bähnisch in ihren überlieferten Reden gegen den ‚Osten‘ ins Feld führte, waren weitaus weniger variantenreich als jene in der ‚Stimme der Frau‘. Dies muß einerseits damit in Zusammenhang gebracht werden, daß an der Gestaltung der Zeitschrift verschiedene Personen beteiligt waren, andererseits scheint es aber auch in dem Umstand begründet zu liegen, daß Bähnisch mit ihrer Zeitschrift ein breiteres Publikum ansprechen wollte als mit ihren Reden, die sich in erster Linie an Teilnehmerinnen interzonaler Frauenkonferenzen und/oder an Mitglieder des DFR richteten. Während in der ‚Stimme der Frau‘ auch wirtschaftliche Elemente ins Feld geführt werden, wenn es um die Ablehnung des Kommunismus geht, Slawen in rassistischer
36 Strecker: Frauenarbeit, S. 19. 37 Damit soll keinesfalls gesagt werden, daß in der DDR eine Emanzipation von Frauen im wünschenswerten Sinn stattgefunden hätte.
1064 | Theanolte Bähnisch
Manier als verschlagen, unberechenbar und böswillig dargestellt werden und sich neben ‚bürgerlichen‘ Formen des Antikommunismus auch Argumente finden, die eher dem sozialdemokratischen Lager zuzurechnen sind38, konzentrierte sich Bähnisch in ihren Reden fast ausschließlich auf die Unvereinbarkeit der kommunistischen Ideologie mit den ‚westlichen‘ Werten. Dazu zählte sie den christlichen Glauben, die körperliche und geistige Freiheit des Individuums – unter Einschluß des Rechts auf berufliche Selbstentfaltung von Frauen und der Betonung von Unterschieden zwischen den Geschlechtern – sowie die „persönliche Verantwortung vor Gott“39. „Massenmenschen“, die „Vergottung des Kollektivismus“ und eine „totalitäre[…] Staatsidee“40 waren ihr erklärtermaßen zuwider. Das von ihr angenommene Unterfangen der Kommunisten, Frauen zum „Werkzeug einer Propaganda“ machen zu wollen, mußte Bähnischs Urteil nach zur „Zerstörung des eigentlichen Frauenwesens“41 führen. Indem sie festhielt, daß Frauen sich mit einer Grundhaltung, welche den beschriebenen, christlich-humanistischen Überzeugungen folgt, „zum Gedankengut der westlichen Welt“ bekennen würden, leistete sie einen Beitrag zur Prägung entsprechender Diskurse um den ‚Osten‘ und den ‚Westen‘, um die ‚Freiheit‘, die ‚Weiblichkeit‘ und um „unsere Frauenbewegung“, die sie ebenfalls als ‚westlich‘ charakterisierte. Damit trug sie wiederum dazu bei, etablierte Feindbilder zu bestätigen, den antikommunistischen Grundkonsens in der Republik zu festigen und somit die Spaltung zwischen ‚Ost‘ und ‚West‘ zu vertiefen. Weiblichkeit sowie Emanzipation im von ihr als wünschenswert definierten Sinn auf der einen und Kommunismus auf der anderen Seite wurden von der Präsidentin der größten Frauenorganisation in der Bundesrepublik als unvereinbar dargestellt. Dies gipfelte in der Formulierung „wir Frauen […] verstehen unter der Gleichberechtigung der Geschlechter keine schematische Gleichmacherei“ und wurde unterstrichen von der Aussage, daß sie sich nicht vorstellen könne, daß „eine Frau nicht an Gott glaubt, selbst wenn sie es behauptet.“42 Mit ihrer Rhetorik bot Bähnisch in einer Zeit der gesellschaftlichen Umorientierung nicht nur einen Beitrag zur Umkonstruktion von ‚Weiblichkeit‘ an, sondern sie trug auch dazu bei, den „formal gesehen […] leere[n] Begriff“43 ‚westlich‘ mit Bedeutungsgehalt zu füllen. Der „Glaube an die Freiheit des Christenmenschen und die persönliche Verantwortung vor Gott“ sei die „religiöse Auffassung des Westens“ und „die tiefste Quelle der Religion des Christentums“44, brachte Bähnisch in ihrer Rede über ‚Himmel und Erde‘ die Zusammenhänge, wie sie sie verstanden wissen wollte, auf den Punkt. Ganz ähnlich argumentiert sie in der ‚Stimme der Frau‘, wo sie in einer Verlautbarung den Westen, den sie in diesem Fall durch das Wort „wir“
38 Zur Unterscheidung verschiedener antikommunistischer Argumentationslinien durch Gesine Schwan und Klaus Körner siehe Kapitel 7.1.5. 39 Bähnisch, Theanolte: Himmel, S. 4/5. 40 Ebd. 41 Ebd. 42 Ebd. 43 Esposito: Osten, S. 129. 44 Bähnisch: Himmel.
Fazit | 1065
ersetzte, diametral dem „östliche[n] Weltbild“45 gegenüberstellte. Das Christentum, welches den ‚Westen‘ Bähnischs Aussagen zufolge wesentlich prägte, war durch die Formel von der ‚persönlichen Verantwortung‘ des Einzelnen, von der Bähnisch sprach, protestantisch angehaucht. Erwähnenswert ist, daß Versatzstücke dessen, womit Bähnisch gemeinhin den ‚Westen‘ charakterisierte – vor allem der Liberalismus, aber auch die wirtschaftliche Prosperität, die sich in der ‚Stimme der Frau‘ als Argument für den ‚Westen‘ findet, schließlich auch die humanistische Grundeinstellung – gemeinhin auch mit dem Begriff ‚bürgerlich‘ assoziiert wurden und werden. Doch dieser Begriff war, in Anbetracht seiner propagandistischen Nutzung durch Kommunisten, nicht dazu geeignet, von Seiten des ‚Westens‘ als Antipode gegen den Kommunismus verwendet zu werden. Die Gegenüberstellung der Begriffe ‚kommunistisch‘/‚sozialistisch‘ und ‚bürgerlich‘ dürfte aus diesem Grund den Kommunisten vorbehalten geblieben sein. Daß die Begriffe ‚westlich‘ und ‚bürgerlich‘ in den 1950er Jahren ähnliches bezeichneten, wird auch aus dem Grimm’schen Wörterbuch deutlich: Es bezeugt, daß das Lemma ‚westlich‘ 1957 in der DDR-Tageszeitung ‚Neues Deutschland‘, „auf die staatengruppe mit bürgerlicher gesellschaftsordnung“ angewendet wurde46 sowie – an einem Beispiel aus der FAZ – daß der Begriff ‚bürgerlich‘ 1956 auch in Westdeutschland im Sinne von ‚westlich angehaucht‘ Verwendung fand.47 In der Verlautbarung, mit der der DFR 1949 die Wiederaufrüstung Deutschlands zur Verteidigung gegen den Osten forderte, definierte Bähnisch auch die persönliche „Verpflichtung gegenüber der sozialen Not“48 als ‚westlich‘. Theanolte Bähnisch war, obwohl sie sich mit Sozialdemokraten umgab, die einen staatlich garantierten, sozialen Ausgleich anstrebten, in Traditionen sozialisiert worden, in denen Fürsorge keine ‚automatische‘, rein staatliche Angelegenheit sein sollte. Die Juristin war mit der Idee der persönlichen Fürsorgebeziehung von Mensch zu Mensch zur Entschärfung wirtschaftlicher und ‚sittlicher‘ Not jedoch nicht erst über die SAG und durch die unter den Soroptimistinnen zahlreich vertretenen Schülerinnen von Alice Salomons sozialer Frauenschule in Kontakt gekommen, sondern auch schon im Zusammenhang mit ihren Recherchen über das Thema ‚Sittenpolizei und Prostitution‘. Nicht nur realpolitisch, sondern auch mit der – offenbar bewußten – Kopplung der Begriffe ‚Weiblichkeit‘, ‚soziale Not‘ und ‚westlich‘ leistete Bähnisch einen Beitrag dazu, daß es in Westdeutschland auch in der Nachkriegszeit weiterhin als üblich und richtig angesehen wurde, daß Frauen vor allem Aufgaben im sozialen Sektor übernahmen und daß dieser Sektor von Frauen dominiert blieb. Mit Aktionen wie dem Päckchen packen für die SBZ/DDR im DFR ermöglichte der DFR seinen Mitgliedern in den Ortsringen auch eine Art persönliche Fürsorge gegenüber Frauen in Ost-
45 Vgl.: o. V.: Aus der Frauenwelt. Der Deutsche Frauenring für den Frieden, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/59), S. 29. 46 Vgl.: Art.: „westlich(t)“, in: Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, 16 Bde. in 32 Teilbänden, Leipzig 1854–1961, online Ausgabe, auf: http://www.woerterbuch netz.de/DWB?lemma=westlicht, am 04.08.2014. 47 Ebd. 48 Ebd.
1066 | Theanolte Bähnisch
deutschland zu leisten und unterstrich damit plakativ die auch in der ‚Stimme der Frau‘ transportierte Überzeugung49, daß der Sozialismus für seine Bürger nicht sorgen könne und diese deshalb auf Hilfsaktionen von Bürgerinnen aus dem Westen angewiesen seien. Daß die Regierungspräsidentin in ihrer frauenpolitischen Arbeit stark von der britischen Frauenbewegung in Form der britischen ‚Women’s Group on Public Welfare‘ unterstützt wurde, trug dazu bei, daß traditionelle Rollenzuschreibungen, welche von Bähnisch und ihren Mitstreiterinnen mit dem ‚westlichem Kulturkreis‘ in Verbindung gebracht wurden, weitgehend aufrecht erhalten blieben. Dies bezog sich nicht nur auf die Verwendung von Frauen in der sozialen Arbeit, sondern auch auf die Rollenverteilung in Partnerschaft und Familie. In der WGPW dominierte die Überzeugung, daß die Auflösung traditioneller Rollenbilder in der Familie die Gefahr der kommunistischen Unterwanderung Westdeutschlands erhöhe. In diesem Sinne wirkte die staatsnahe Dachorganisation von Frauenorganisationen zusammen mit der britischen Militärregierung auf den Wiederaufbau Deutschlands ein.50 Auch dieser Umstand trägt dazu bei, die Widersprüche in Bähnischs Handeln ab 1945, das gleichzeitig auf die Emanzipation von Frauen und auf die Aufrechterhaltung traditioneller ‚bürgerlicher‘ Verhältnisse abzielte, erklärbar zu machen. Im Rahmen von Bähnischs Engagement in der Europäischen Bewegung sind Verlautbarungen über den Kommunismus, wie sie aus der ‚Stimme der Frau‘ und aus ihren Reden in primärem Zusammenhang mit der Frauenbewegung deutlich werden, nicht überliefert. Hier war es stärker die – in der ‚Stimme der Frau‘ und in manchen Reden ebenfalls spürbar starke – pro-europäische und pro-internationale Komponente, die ihr Handeln prägte, auch wenn die „Angst vor Rußland“51, die Bähnisch 1971 der Friedensaktivistin Petra Kelly gegenüber als Beweggrund für ihr Engagement in der Europäischen Bewegung nannte, stets mitgeschwungen haben dürfte. Wichtig zu betonen ist, daß Bähnisch mit ihrer pro-europäischen Einstellung und ihrem internationalen Engagement in der Europa- wie in der Frauenbewegung vor allem auch nationale Interessen verfolgte. Bereits 1946 schrieb sie dem ‚Club deutscher Frauen‘ auf die Fahne geschrieben, daß Deutschland wieder zu einem gesunden „nationalen Stolz“52 finden müsse und in der ‚Stimme der Frau‘ war 1949 zu lesen, daß Deutschland „nicht wie ein Zaungast“53, sondern gleichberechtigt mit allen anderen Nationen
49 O. V.: Aus der Frauenwelt. Sonderhilfsaktion für ostdeutsche Mütter und Kinder, in: Stimme der Frau, 4. Jg. (1952), Heft 11, S. 30. 50 Women’s Library, Box FL565, 5WFM/C9, Notes for discussions at the meeting of Women’s Group delegation with Mr. Allen, Educational Advisor and Mr. Chaput de Saintoigne at the German Section of the Foreign Office, Wednesday October 10th, o. J. 51 AdSD, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 41, Betr.: Einige Antworten auf den Fragebogen von Fräulein Kelly, von Theanolte Bähnisch, 24.08.1971. 52 BArch, NY 4229, Nr. 28, Notiz o. T. 53 Vgl.: O. V.: Bewegung.
Fazit | 1067
am Aufbau Europas mitarbeiten wolle. Dieser Aspekt von Bähnischs Politik dürfte in der deutschen Bevölkerung besonders populär gewesen sein.54 Im Deutschen Rat der Europäischen Bewegung, dem Bähnisch als Vizepräsidentin angehörte, konnte sie, ähnlich wie in der Frauenbewegung, ihrer Überzeugung vom Nutzen der überparteilichen Arbeit nachgehen. Das Wirken in einem inoffiziellen Gremium, besetzt mit hochrangigen Persönlichkeiten, die sich „aus freier demokratischer Initiative“55 zusammengefunden hatten, war ganz nach ihrem Geschmack. Das Problem, das die SPD mit jener Art von Politik hatte, nämlich daß sich die Zusammensetzung des Rates, in dem sich auch andere Sozialdemokraten engagierten, nicht am Parteienproporz orientierte, sah sie nicht. Vielmehr teilte sie die Überzeugung des Präsidenten des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung, Eugen Kogon, daß „Wahlen […] in einer demokratischen Gesellschaft auch nicht der einzige Weg der Willensbildung seien“56. Zumindest über den Kernzeitraum meiner Untersuchung hinweg war Theanolte Bähnisch – vermutlich auch aufgrund des langen Reiseweges – bei einigen Treffen des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung, beziehungsweise des vorbereitenden Komitees nicht präsent. Doch als Vorsitzende der Kulturkommission des Rates spielte sie eine zusätzliche, aktive Rolle im Prozeß der europäischen Einigung. Dadurch daß sie gemeinsam mit der nordrhein-westfälischen Kultusministerin Christine Teusch die Auswahl der Kandidaten für das EuropaKolleg vornahm, zeigte sie einmal mehr, daß ihr nicht nur die Zukunft Europas, sondern ‚die Jugend‘ als gesellschaftliche Gruppe sowie ihre Bildung besonders am Herzen lagen. Daß sie im Ausschuß mit Teusch zusammenarbeitete, die auch einen Landesring des DFR leitete, verdeutlicht, daß auch eine Schnittmenge ihres Netzwerkes in der Frauenbewegung und ihres Netzwerkes in der Europabewegung bestand. Welche Vorstellung Theanolte Bähnisch genau von ‚Europa‘ hatte, ist schwer zu sagen. Aus der ‚Stimme der Frau‘ läßt sich herauslesen, daß sie Frieden, freien Handel und wirtschaftliche Prosperität, ‚grenzenlose‘ Bildungsmöglichkeiten und eine vom Christentum sowie vom Humanismus geprägte Kultur damit verband. Ihre Nähe zu Politikern wie Heinrich von Brentano in der Europäischen Bewegung unterstreicht diese Wahrnehmung. Daß das Engagement Bähnischs in der Europabewegung ihr Wirken in der Frauenbewegung überdauerte, läßt sich auf verschiedene Gründe zurückführen: Zum einen waren die Weichen in Richtung ‚Westen‘ in Deutschland 1952 gestellt, der DFR war gut aufgestellt und gleichzeitig in einigen Aspekten unumkehrbar vom ‚Informationsdienst Frauenfragen‘, dem späteren ‚Deutschen Frauenrat‘ überholt worden. Das
54 Deutlich wird dies unter anderem in einem Artikel, der betont, daß durch Bähnischs Zutun Deutschland wieder gleichberechtigt sei in der „internationalen Gemeinschaft der Frauen, die bis zur UNO hinauf aktiv eingreifen in die brennenden Zeitprobleme (Kriegsgefangene, Flüchtlinge, verschleppte Kinder).“ Wiese: Präsidentin. 55 AdSD Bonn, Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 6 [Konstituierende Sitzung], Eugen Kogon: Die Organisation und die Aufgaben des Deutschen Rates in der Europäischen Bewegung. Darlegungen bei der konstituierenden Versammlung im Staatstheater zu Wiesbaden, 13.06.1949, S. 6. 56 Ebd.
1068 | Theanolte Bähnisch
Amt als Regierungspräsidentin, dessen sie sich nun weitgehend sicher sein konnte, zehrte nach wie vor an ihren Kräften, ein weiteres Mammut-Projekt, wie die Leitung des DFR es war, konnte sie auf Dauer nicht stemmen. Ihre Arbeit in der Europabewegung war weniger zeitintensiv und ermöglichte ihr zudem, ihre Netzwerke noch weiter und auch breiter – in andere gesellschaftliche Sektoren und in andere Länder – zu spannen. Wie ihr Engagement in der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) und im ICW zeigt, zog es Bähnisch immer stärker auf das internationale Parkett. Nachdem Westdeutschland als weitgehend sicher vor einer kommunistischen Infiltration gelten konnte, schwang die Gründungspräsidentin des DFR sich dazu auf, als Vizepräsidentin des ICW ihren Einfluß weltweit geltend zu machen und mit ihrer frauenpolitischen Arbeit „harte Kerne gegen den Kommunismus […] in Asien, Afrika und Südamerika“57 zu bilden. Daß die erste deutsche Regierungspräsidentin retrospektiv ihre Arbeit in der Frauenbewegung so einseitig mit dem Willen zur Abwehr des Kommunismus begründete, paßt nicht recht zu ihrer Vita und scheint, bei näherer Betrachtung, vor allem dem Bedürfnis, eine Geschichte stringent zu erzählen, geschuldet zu sein. In der Auseinandersetzung mit Bähnischs Biographie fällt auf, daß sie sich bereits in den 1920er Jahren sowohl für die Rechte von Frauen eingesetzt als auch eine stärkere Beteiligung von Frauen am öffentlichen Leben gefordert hatte. Im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten hatte sie auch Karrierenetzwerke von Frauen zu nutzen gewußt. Für ihre Staatsexamensarbeit hatte sie sich mit dem Thema ‚Sittenpolizei und Prostitution‘ ein Thema ausgesucht, das auch ein Thema der Frauenbewegung war, denn es berührte erstens Fragen von ‚Moral und Sittlichkeit‘, für die sich die Frauenbewegung zuständig fühlte, zum zweiten die Frage, inwiefern Frauen zum ‚Schutz‘ der Gesellschaft in ihren Rechten beschnitten werden durften, und zum dritten die Frage, ob und wenn ja wie Frauen als Fürsorgerinnen und/oder Polizistinnen einen Beitrag zur Lösung des ‚Problems‘ Prostitution leisten konnten und durften. Hält man sich vor Augen, daß Bähnischs geistige Ziehväter Willy Abegg und Carl Severing nicht nur den Einsatz von Frauen in der Polizei befürworteten, sondern auch sie persönlich förderten, wird deutlich, daß sich die spätere DFR-Vorsitzende bereits in den 1920er Jahren in einem Umfeld bewegte, das an einer stärkeren Mitarbeit von Frauen in der Verwaltung sehr interessiert war. Ihre eigenen Thesen über Frauen in der Verwaltung ab 1946 waren vor dem Hintergrund dieser Sozialisation weder verwunderlich, noch ist es wahrscheinlich, daß sie sich ausschließlich aufgrund der gefühlten Bedrohung durch die Kommunisten mit frauenpolitischen Themen auseinandersetzte. Ihr Eintreten für eine rechtliche Gleichstellung von Frauen und ihr Interesse an einer stärkeren Präsenz von Frauen im öffentlichen Leben durchzieht vielmehr ihre ganze Biographie. Familienpolitisch war Bähnisch vor 1945 – sieht man von ihrer Auseinandersetzung mit verheirateten Ärztinnen ab – nicht in Erscheinung getreten. Ihr Interesse an der weiblichen Emanzipation galt vor 1933 beruflichen Aspekten. Daß sie sich 1945 auch für eine zivilrechtliche Gleichstellung von Männern und Frauen einsetzte, Frauen über ihre Rechte in Ehe und Familie aufklärte und sie ermutigte, die Lage in
57 AddF, SP-01, Theanolte Bähnisch [Vizepräsidentin des ICW] an Professor Dr. Balke [wahrscheinlich Siegfried Balke], 20.10.1964.
Fazit | 1069
Frage zu stellen, dürfte nicht zuletzt auf die Auswirkungen des Krieges zurückzuführen sein, die zu veränderten Verantwortlichkeiten für Frauen in der Familie geführt hatte, welchen die Rechtslage entgegenstand. Für die Frage nach der Rollenverteilung in Partnerschaft und Familie hatte sich die spätere Fürstreiterin von Art. 3 des Grundgesetzes jedoch schon in der Weimarer Republik auseinandergesetzt. Mit ihrer Freundin Ilse Langner hatte sich Bähnisch in den 1920er und 1930er Jahren auf philosophischer Ebene über das Thema ‚Geschlechter‘ ausgetauscht und dabei Positionen vertreten, die sich selbst im Kontext der heutigen Zeit als ‚innovativ‘ bezeichnen lassen. Ihre Auseinandersetzung mit Langners Idee des ‚dritten Geschlechts‘ 193658 zeigt, daß die spätere Regierungspräsidentin ‚Männlichkeit‘ und ‚Weiblichkeit‘ in den 1920er Jahren nicht so entschieden als komplementär begriff, wie sie es ihren Äußerungen in den 1940er und 1950er Jahren nach zu urteilen nach Kriegsende tat. Dies muß nicht, es kann jedoch bedeuten, daß der Kalte Krieg sie dazu gebracht hatte, in der Nachkriegszeit ein Schema zu bemühen, welches sie – zumindest ihren philosophischen Erörterungen nach zu urteilen – in den 1920er Jahren überwinden wollte. Daß sie ihre ‚feministische Ader‘ in ihrem autobiographischen Diktat von 1972 – einer Phase der deutsch-deutschen Annäherung – wieder in einer ‚moderneren‘ Form präsentierte, als es in den 1940ern und 1950ern der Fall gewesen war, legt ebenfalls die Interpretation nah, daß ihre politische Haltung im Kalten Krieg ihre frauenpolitischen Äußerungen stärker beeinflußte, als es ohne eine Untersuchung ihrer Biographie sichtbar wird. Die aus den Briefen an Ilse Langner deutlich werdende, zumindest zeitweilige Unzufriedenheit mit ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter nach dem Umzug nach Merseburg 1930, der Umstand, daß sie die Amtsenthebung ihres Mannes 1933 auch als eine Chance begriff, selbst wieder berufstätig zu sein und die Tatsache, daß sie die weitgehende finanzielle Abhängigkeit von ihrem Ehemann und ihre eigene Arbeitslosigkeit während des Dritten Reichs nach 1945 nicht erwähnt, schließlich auch die Vehemenz, mit der sie um ihr Amt als Regierungspräsidentin kämpfte, lassen darauf schließen, daß sie für sich selbst, anders als sie es den Frauen ab 1945 nahelegen wollte, einen Beruf, beziehungsweise gesellschaftliches Engagement als Ersatz für eine fehlende Mutterrolle ansah. Sie selbst schien unter Phasen mangelnder Selbständigkeit und fehlender beruflicher Selbstentfaltung gelitten zu haben, obwohl sie Mutter zweier Kinder war. Was die ‚Stimme der Frau‘ ab 1949 suggeriert und was Bähnisch auch in ihren Reden betonte, nämlich, daß Mutterrolle und Berufstätigkeit für Frauen unvereinbar seien, das ließ sie für ihren eigenen Lebensweg nicht gelten. Sie nutzte jeweils die Chancen, die sich ihr für ihre berufliche Entfaltung boten, obwohl sie zwei Kinder hatte. Die naturgegebene Familienorientierung, die Bähnisch sowohl in der Berichterstattung der ‚Stimme der Frau‘ als auch in ihren Reden Frauen unterstellt, entpuppt sich nicht zuletzt im Blick auf ihre eigene Vita als ein im Sinne der Aufrechterhaltung einer bürgerlichen Gesellschaftsordnung überhöhtes Konstrukt. Nicht nur in der widersprüchlichen Art, in der sie ihre Entlassung 1930 in Kombination mit ihrer Entdeckung, daß sie schwanger war, darstellt, offenbart sich, daß die
58 DLA, A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34, Bähnisch an Langner, 03.09.1936.
1070 | Theanolte Bähnisch
‚Anwältin der Frauen‘ hin- und hergerissen war zwischen möglichen Lebensmodellen. Insgesamt muß festgehalten werden, daß Theanolte Bähnisch nicht eine, widerspruchslose und konstante Haltung zur ‚Weiblichkeit‘ und zur Frauenpolitik hatte und vertrat. In ihrer Hin- und Hergerissenheit über die eigene Rolle in Beruf und Familie, in ihrer mal mehr, mal weniger streitbaren Haltung zur ‚Frauenfrage‘ und in den Widersprüchen, die ihren Reden und der ‚Stimme der Frau‘ zu entnehmen sind, wird deutlich, daß auch sie – um mit Bismarck zu sprechen – „eine ganze Menge“ Seelen in ihrer Brust beherbergte, „die sich zanken“59. „[R]estlos auf[…]schließen“60 lassen sie sich nicht.
59 Bismarck zitiert nach Ullrich: Die schwierige Königsdisziplin, in: Die Zeit, 09.04.2007. 60 Ebd.
Abkürzungsverzeichnis
AddF
Archiv der deutschen Frauenbewegung
AdsD
Archiv der sozialen Demokratie
A & LG
Administration and Local Government
AWO
Arbeiterwohlfahrt
BArch
Bundesarchiv
B.A.O.R
British Army of the Rhine
BDF
Bund Deutscher Frauenvereine
BERCOMB
Berlin Commission British
BHE
Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten
BMI
Bundesministerium des Innern
BNSDJ
Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen
CCF
Congreß of Cultural Freedom
CCG (BE)
Control Commission for Germany, British Element
CIA
Central Intelligence Association
COGA
Control Office for Germany and Austria
DAB
Deutscher Angestellten-Bund
DBIS
Datenbank Informationssystem
DEF
Deutsch-Evangelischer Frauenbund
DDP
Deutsche Demokratische Partei
DFD
Demokratischer Frauenbund Deutschlands
DFR
Deutscher Frauenring
DGfE
Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft
DGVN
Deutsche Gesellschaft der Vereinten Nationen
DKP-DRP
Deutsche Konservative Partei-Deutsche Rechtspartei
DLA
Deutsches Literaturarchiv Marbach
1072 | Theanolte Bähnisch
DNVP
Deutschnationale Volkspartei
DVP
Deutsche Volkspartei
EHAPE
Einheitspreisgesellschaft
ERP
European Recovery Program
EVG
Europäische Verteidigungsgemeinschaft
EZA
Evangelisches Zentralarchiv
GB
Großbritannien
GB/BHE
Gesamtdeutscher Block/Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten
GEDOK
Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen
GER
German Education Reconstruction
GEW
Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft
GStA PK
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
I.A.&C. Division
International Affairs and Communication Division
IAF
Internationale Abolutionistische Föderation
HICOG
United States High Commissioner for Germany
IMKK
Interalliierte Militärkontrollkommission
HQ
Headquarter
H-Soz-u-Kult
Humanities – Sozial- und Kulturgeschichte
IAW
International Alliance of Women
ICW
International Council of Women
IDFF (IFFD)
Internationale Demokratische Frauenföderation
IFFF
Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit
JCS
Joint Chiefs of Staff
JGG
Jugendgerichtsgesetz
KDFB
Katholischer Deutscher Frauenbund
KPdSU
Kommunistische Partei der Sowjetunion
LBI
Leo Baeck Institute
LDP(D)
Liberal-Demokratische Partei
LHASA MER
Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg
Mil. Gov.
Military Government
Abkürzungen
|
1073
MRA
Congress of Moral Rearmement
MSPD
Mehrheits-Sozialdemokratische Partei Deutschlands
MSS
Modern Manuscript Studies
NA
National Archives
NCSS
National Council on Social Services
NCW
National Council of Women
NL
Nachlaß
NLA HStAH
Niedersächsisches Landesarchiv, Hauptstaatsarchiv Hannover
NSRB
Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund
NSV
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
OMGUS
Office of Military Government for Germany, United States
PAD
Political Affairs Division
PG
Parteigenosse
PVG
Polizeiverwaltungsgesetz
Rez.
Rezension
RJWG
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz
RSHA
Reichssicherheitshauptamt
SAG
Soziale Arbeitsgemeinschaft (Berlin-Ost)
SAPMO
Stiftung Archiv Parteien- und Massenorganisationen (der DDR)
SBZ
Sowjetische Besatzungszone
SFAK
Süddeutscher Frauenarbeitskreis
SMAD
Sowjetische Militär-Administration
S.O.
Senior Officer
TAZ
Die Tageszeitung
USPD
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands
WGPW
Women’s Group on Public Welfare
WFFB
Westfälischer Frauen Friedensbund
WBIS
World Biographical Information System
WOMAN
World of Mothers of all Nations
ZFA
Zentraler Frauenausschuß
Quellen und Literatur
QUELLENVERZEICHNIS Nicht veröffentlichte Quellen Archivalien Akademie der Künste, Archiv, Berlin Alfred Neumann Archiv DHPE, Brief von Theanolte Bähnisch an Kitty Neumann, 23.06.1953. Archiv der sozialen Demokratie (AdSD), Bonn Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Nr. 6, 18, 27, 41, 446, 447 Kurt Schumacher, Nr. 103, 109, 126, 158, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 189 Sammlung Personalia, Nr. 480 [Theanolte Bähnisch] SPD Parteivorstand (Alter Bestand), Frauenbüro, Nr. 0149 B, 0162, 01650, 0202 A, 0234 A, 0244 A Nachlaß Else Reventlow, Nr. 43 Nachlaß Fritz Erler, Nr. 217 A Nachlaß Carl Severing, Nr. 291 Archiv der deutschen Frauenbewegung (AddF), Kassel SP-01 [Sammlung Personalia, Theanolte Bähnisch] K-F1/00235 Zeitschrift ‚Stimme der Frau‘ 1948–1953 Archiv des Deutschen Frauenrings (DFR-Archiv), Wanderarchiv A1 [Geschichte des deutschen Frauenringes und seiner Vorläufer] A2 [Geschichte des deutschen Frauenringes und seiner Vorläufer, Briefwechsel] A3 [Geschichte des deutschen Frauenringes und seiner Vorläufer, Material für eine Englandreise] B1 [Hauptversammlungen] Archiv des NDR, Hamburg Stavenow, Hans: Eine bemerkenswerte Frau: Porträt der niedersächsischen Staatssekretärin Theanolte Bähnisch, Erstausstrahlung am 16.01.1963, ca. 25 Minuten.
1076 | Theanolte Bähnisch
Archiv für Zeitgeschichte (AfZ) der Eidgenössisch Technischen Hochschule (ETH) Zürich NL Wilhelm Abegg, Nr. 33, 59, 68 Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Fragen (BBF), Archivdatenbank auf: http://www.bbf.dipf.de Gutachterstelle des BIL – Preußische Volksschullehrerkartei Nachlaß Berthold Otto Personalbögen der Lehrer höherer Schulen Preußens Personaldaten von Lehrerinnen und Lehrern Preußens Bodleian Library, London, Special Collections & Western Manuscripts Papers of Clara Sophie Deneke, Box 22, Box 25, Box 41, Deneke Adds 1 Bundesarchiv (BArch) Berlin Document Center (BDC), RK [Reichskulturkammer], J 0013 B 106 [Bundesministerium des Innern], Nr. 43233, 47204, 48542, 48585, 52024, B 211 [Bundesministerium für Familie und Jugend], Nr. 22-1, 101 B 137 [Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen], Nr. 1829, Nr. 4775, Nr. 4852, Nr. 18853 N 1035 [Nachlaß Johannes Haller], Nr. 19. N 1086 [Nachlaß Heinrich Brill], Nr. 361, 370 N 1114 [Nachlaß Ferdinand Friedensburg], Nr. 26, 27 N 1146 [Nachlaß Paul Leverkuehn], Nr. 43 N 1231 [Nachlaß Alfred Hugenberg], Nr. 85 N 1286 [Nachlaß Karl-Georg Pfleiderer], Nr. 18 NS 16 [Rechtswahrerbund], Nr. 112 NY 4229 [Nachlaß Elfriede Paul], Nr. 11, 28, 41, 42 R 56 V [Reichsschrifttumskammer], Nr. 367 R 115 [Reichsprüfungsamt für den höheren und gehobenen Verwaltungsdienst], Nr. 4, Nr. 519 SAPMO DY 30 [Abteilung Frauen im ZK der SED] IV 2/17/99, IV 2/17/100, IV 2/17/109 SAPMO DY 31 [Demokratischer Frauenbund Deutschlands], Nr. 293, 294, 841, 1249, 1283 Z 35 [Deutsches Büro für Friedensfragen], Nr. 180 Center for Jewish History, Leo Baeck Institute Robert M. W. Kempner Collection, AR 3977, 891971, Nr. F 2277 [Kempner with Theanolte Baehnisch and Karl Severing, Portraits Groups (Abb.)], auf: http://access.cjh.org/query.php?term=Baehnisch&qtype=basic&stype=contains& paging=25&dtype=any&repo=all&go=#1, am 05.09.2014.
Quellen und Literatur | 1077
Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU), Zentralarchiv, Berlin MfS ZAIG, Nr. 21087 MfS HA IX/11 MfS SV 23/80 Evangelisches Zentralarchiv, (EZA), Berlin 51 [Ökumenisches Archiv] S II b 13, 19, 20, 23 51 S II c 8, II 51 S II c 8, I 51 S II c 26 51 S II f 2 51 Vh 14 626 [Nachlaß Siegmund-Schultze], Nr. 75, Nr. 111 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), Berlin I. HA, Rep 77 [Ministerium des Innern], Nr. 5176 [Landratsamt Merseburg] I. HA, Rep. 125 [Oberexaminationskommission], Nr. 267, Nr. 3527 I. HA, Rep 184 [Oberverwaltungsgericht], P Nr. 53, Nr. 54 IV. HA, NL Adolf Grimme, Nr. 1239, Nr. 1665, Nr. 2145, Nr. 2517, Nr. 3340 International Institute of Social History (IISH), Amsterdam Albert Grzesinski Papers, Nr. 48, Nr. 133, Nr. 225, Nr. 864, Nr. 1207, Nr. 1270, Nr. 1624, Nr. 2372, Nr. 1653, Nr. 2021 Kreisarchiv Warendorf Meldekarte der Familie Franz Nolte, nicht eingesehen, nach einer Information von Kreisarchiv Warendorf, Karoline Ritsch an Nadine Freund, 30.01.2007. Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart Nachlaß Mehnert, Q 1/30 Bü 34 Findbuch/Katalogeintrag Q 1/44 Bü 1, Süddeutscher Frauenarbeitskreis München, Frauenarbeitskreis Geislingen, auf: https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/ struktur.php?bestand=6745&klassi=&anzeigeKlassi=001, am 09.08.2014. Landeskirchenarchiv (LKA) Hannover NL Lilje, L3 [Kanzlei des Ladesbischofs] III, Nr. 50, Nr. 544, Nr. 1104, Nr. 1501 Literaturarchiv Marbach (DLA) A: Miegel, Briefe Dritter, 74.9236 A: Langner, Briefe an sie von Bähnisch, Theanolte, 87.5.34. A: Langner, Briefe an sie von Berlin, Soroptimist Club, 87.5.73. A: Langner, Nachtrag, 1996–1999, Briefe an sie von Grimme, Adolf & Josefine, 20.12.1956. A: Seidel, Briefe an, HS003636823 [Briefe von Agnes von Zahn-Harnack an Ina Seidel]
1078 | Theanolte Bähnisch
LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum Brauweiler Archiv des Landschaftsverbandes, Nr. 8217 Monacensia. Literaturarchiv und Bibliothek München JE B 25 The National Archives (NA), UK, London FO [Foreign Office] 371/70711, 70717, 70860, 70861, 70862, 79214, 103932, 107926 FO 924/857 FO 938/252, 380 FO 945/259, 283, 284, 285 FO 1005/1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1668, 1669, 1670, 1672, 1711, 1712, 1730, 1857, 1865, 1867, 1926 FO 1010/57, 62, 106, 278, 608 FO 1013/607 FO 1030/94, 131, 403 FO 1032/1977 FO 1033/38, 46 FO 1035/249 FO 1036/48 FO 1049/568, 1045, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1260, 1310, 1311, 1312, 1313, 1368, 1435, 1809, 1844, 1845, 1846, 1847, 1929, 2151, 2156, 2209 FO 1050/22, 31, 131,152,277, 290, 1077, 1150, 1179, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1215, 1216, 1229, 1230, 1231, 1250, 1263, 1298, 1299, 1535, 1539, 1543, 1593 FO 1051, 769 FO 1056/147, 197, 198, 237, 306, 445, 530, 537 FO 1060/808, 821 FO 1110/31 Niedersächsisches Landesarchiv, Hauptstaatsarchiv, Hannover (NLA HA HStAH) Hann. 87, Hannover, Acc. 92/84, Nr. 18 Hann. 180, H Nr. 13 Hann. 180, Hannover II E 1 Nr. 396, Bd. 1 Hann. 180, Hannover II G Nr. 205 C Hann. 180, Hannover g Nr. 169. Hann. 180, Hannover n, Nr. 13 Hann. 310 I, Nr. 215 Hann. 180 H Nr. 13. Hann. VVP 3, Nr. 1 HA ZGS 2/1, Nr. 243 HA ZGS 2/2, Nr. 72 Nds. 50, Acc. 75/88 [Personalakte Theanolte Bähnisch]. Nds. 50, Acc. 96/88, Nr. 144/2, Nr. 768 Nds. 53, Nr. 391, Nr. 633, Nr. 637, Nr. 642
Quellen und Literatur | 1079
Nds. 58, Acc. 2004/143, Nr. 301 Nds. 100, Acc. 57/89, Nr. 61, Nr. 62, Nr. 63, Nr. 64, Nr. 65, Nr. 66, Nr. 11b, Nr. 63 Nds. 100, Acc. 95/94, Nr. 44 Nds. 100, Acc. 2000/098, Nr. 29 Nds. 110 F, Acc. 148/90, Nr. 13 Nds. 120, Hannover, Acc. 1/76, Nr. 47, Nr 297, Nr. 305 Nds. 120, Hannover, Acc. 9/90, Nr. 56, Nr. 209 Nds. 120, Hannover, Acc. 18/77, Nr. 54 Nds. 120, Hannover, Acc. 40/78, Nr. 9/1 Nds. 120, Hannover, Acc. 45/77, Nr. 6 Nds. 120, Hannover, Acc. 83/78, Nr. 2/1, Nr. 3/3 Nds. 120, Hannover, Acc. 176/91, Nr. 27 Nds. 120, Lün., Acc. 30/67, Nr. 18/2, Nr. 29, Nr. 149, Nr. 215 Nds. 171, Hannover, Nr. 12672, Nr. 63318, Nr. 68692 Nds. 171, Hildesheim, Nr. 71050 Nds. 201, Nr. 726 Nds. 386, Acc 16/83, Nr. 95 Nds. 400, Acc. 27/95, Nr. 51, Nr. 55, Nr. 56 Nds. 401, Acc. 92/85, Nr. 223, Nr. 458/1, Nr. 458/2 Nds. 401, Acc. 112/83, Nr. 726, Nr. 728, Nr. 729 Nds. 725 Hann. Acc, 75 d/83, Nr. 22 VVP 3, Nr. 1 VVP 6, Nr. 78 VVP 17, Nr. 1706 VVP 37, Nr. 108 VVP 60, Acc. 38/87, Nr. 1 VVP 86, Acc. 2003/221, Nr. 51, Nr. 173 Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dependance Merseburg (LHASA MER) Rep. C 40, I b, Nr. 1084 Rep. C 48, I a II, Lit B 5 Rep. C 48 I a II, Lit. H, Nr. 25 Rep. C 48 1 b, Nr. 1084 Rep. C 50, Nr. 30 Stadtarchiv Aachen Hausbuch Eupener Straße 124 Hausbuch Eberburgweg 49
1080 | Theanolte Bähnisch
Stadtarchiv Hannover Amt für Verkehrsförderung, Nr. 1 Presse-Personen, Nr. 718, Nr. 729 DEF, G 2t I u II, DEF, F 3 DEF, Ortsverband Hannover HR 15, Nr. 81, Nr. 216, Nr. 217, Nr. 261, Nr. 427, Nr. 440, Nr. 445, Nr. 451, Nr. 562, Nr. 564, Nr. 826, Nr. 968 VVP Frau 750, Nr. 39, Nr. 43, Nr. 45, Nr. 79, Nr. 89, Nr. 90 Staatsarchiv Marburg 307 d, Nr. 283 Stadt Hannover Fachbereich Recht und Ordnung, Hausbuch Schopenhauer-Str. 9 University of New Hampshire, Durham, Special Collections MC 58 [Lotte Jacobi Collection], Box 27, f7 Women’s Library, London Box FL560, 5WFM/A, 14, 22 Box FL565, 5WFM/C, 1, 5, 6, 7, 9, 10
Quellen und Literatur | 1081
Quellen aus nicht verzeichneten Sammlungen Privatnachlaß Theanolte und Albrecht Bähnisch, im Besitz von Orla-Maria und Hans-Heino Fels, Waiblingen Quellen betr. Theanolte Bähnisch Anklageschrift des Militärgerichts gegen Theanolte Bähnisch wegen Übertretung des Curfew, 24.09.1945. Autobiographisches Diktat von Theanolte Bähnisch, maschinenschriftlich, o. D., o. J., [vermutlich 1972]. Ehrenbrief für Theanolte Bähnisch vom Bund der Opfer des Faschismus und des Krieges e. V., 08.05.1957. Gemeinnützige Berliner Ausstellungs-, Messe und Fremdenverkehrs-GmbH an Theanolte Bähnisch, 03.04.1935. Gewerbeanmeldeschein Theanolte Bähnisch, 05.02.1935. Fragebogen der Militärregierung, 20.02.1946, maschinenschriftlich. Fragebogen der Militärregierung, 05.08.1945, handschriftlich (eventuell Entwurf). Haftentlassungsschein, Theanolte Bähnisch, 25.09.1945. Notizen der Frau Regierungspräsidentin a. D., Th. Bähnisch, Verwaltungsrechtsrat (Fachanwältin für Verwaltungssachen) aus Köln am Rhein [1945]. Korrespondenzen Theanolte Bähnischs mit dem Münchner Bildbericht, verschiedene Korrespondenzpartner, 1934/35. Diverse Photos, verschiedene Jahre Quellen betr. Albrecht Bähnisch Personalbogen Albrecht Bähnisch, 1933 Diverse Photos, verschiedene Jahre Private Unterlagen von Hans-Heino und Orla-Maria Fels, Waiblingen Vorfahrentafel Georg, Hans, Margarethe, Elisabeth, Helene und Albrecht Bähnisch, zusammengestellt von Hans Jürgen Feilke, 12.05.2006 [Maschinenschriftlich]. Fels, Hans Heino: Orlas Vater. Albrecht Bähnisch, o. J. [Maschinenschriftlich]. Materialsammlung von Karin Ehrich zum ‚Club deutscher Frauen‘ [Karins Ehrichs zufolge handelt es sich bei den Materialien um Kopien aus dem Vereinsregister des Amtsgerichts Hannover, die ihr von einer ehemaligen Vereinsvorsitzenden des Club deutscher Frauen überreicht worden seien. Das Amtsgericht hat diese Aussage bestätigt.] Eric W. Debney, Major, HQ Mil Gov RB Hannover OCG (HE), [CCG (BE)] an Chief of the Administration, Attention of Frau Bähnisch, 18.05.1946, beglaubigte Abschrift durch das Regierungspräsidium. Club deutscher Frauen, Hannover, Satzung o. D. [1946]. Gründungsprotokoll [Club deutscher Frauen], 03.07.1946. Amtsgericht Hannover, Vereinsregisterauszug, Nr. 98.
1082 | Theanolte Bähnisch
Korrespondenzen Nadine Freund Archiv der sozialen Demokratie, Klaus Mertsching an Nadine Freund, 20.02.2007. Archiv des Katholischen Deutschen Frauenbundes [KDFB], Jutta Müther an Nadine Freund, 27.07.2012. Archiv der sozialen Demokratie, Sabine Kneip an Nadine Freund, 14.09.2009. Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, Bettina Irena Reimers an Nadine Freund, 29.11.2009. Biene, Daniel, Referent des Vorstandsvorsitzenden der Ganske-Verlagsgruppe, 17.08.2006. Büro für Geschichte und Biografie, Karin Ehrich an Nadine Freund, o. D. Evangelisches Zentralarchiv Berlin (EZA), Pabst, Ruth [Hoff, Henrike] an Nadine Freund, 09.09.2009. Fels, Orla-Maria an Nadine Freund, 14.09.2017 Gühne, Ekkehard an Nadine Freund, 28.05.2008. Kreisarchiv Warendorf, Karoline Ritsch an Nadine Freund, 30.01.2007. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, K. Pilger an Nadine Freund, 12.05.2009. Leo-Baeck Institute, Michael Simonson an Nadine Freund, 14.03.2014. LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum Brauweiler, Rudolf Kahlfeld an Nadine Freund, 06.04.2009. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen, Annette Hennings an Nadine Freund, 17.04.2009. Niedersächsisches Landesarchiv, Claudia Kauertz an Nadine Freund, 05.06.2008. Schneider-Borgmann, Eva, Vorsitzende des DFR an Nadine Freund, 31.08.2009. Stadt Aachen, Nicole Brillo an Nadine Freund, 28.05.2009. Stadtarchiv Dortmund, Ute Pandel an Nadine Freund, 16.08.2009. Stadtarchiv Hannover, Christel Jung-König an Nadine Freund, 25.05.2009. Stadtarchiv Krefeld, Paul Günther Schulte an Nadine Freund, 26.03.2009. Sonderarchiv Moskau, W. I. Korotajev/, N. W.Kolganova an Nadine Freund, 05.05.2009. Wolff, Mechthild, Vorsitzende des Heimatvereins Warendorf an Nadine Freund, 04.06.2008. Gespräche Gespräch mit Orla Maria Fels, Waiblingen, 11.11.2009. Gespräch mit Thomas Ganske, Vorstandsvorsitzender der Ganske-Verlagsgruppe, Herleshausen, 10.10.2006. Gespräch mit Eva Schneider-Borgmann, Freiburg, 28.09.2006. Gespräche mit verschiedenen Gesprächspartnern auf der Konferenz des Deutschen Historischen Instituts (DHI) Washington in Freiburg, 29.04.2006. Telefonat mit einer Schülerin einer Hannoveraner Schule, 2008.
Quellen und Literatur | 1083
Veröffentlichte Quellen Abegg, Wilhelm: o. T. [Vorwort], in: Hirschfeld, Hans Emil/Vetter, Karl/Preußisches Ministerium des Innern (Hrsg.): Tausend Bilder/Grosse Polizei-Ausstellung Berlin 1927. Addams, Jane: A new conscience and an ancient evil, New York 1912. Adenauer, Konrad, an Franken, Anne, 24.05.1947, in: Morsey, Rudolf (Hrsg.): Adenauer Briefe 1947–1949, Paderborn 1984, S. 505, Nr. 552. Adressbuch für die Stadt Aurich, Ostfriesland und angrenzende Gemeinden, Aurich 1951. Albertz, Heinrich: Niedersachsen und das Flüchtlingsproblem, in: Niedersächsisches Amt für Landesplanung und Statistik (Hrsg.): Flüchtlinge in Niedersachsen, Hannover 1949, S. 7–60. Albrecht, Willy (Hrsg.): Die SPD unter Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer 1946–1963, Sitzungsprotokolle der Spitzengremien, Bd. 2: 1948–1950, Bonn 2003. Ders.: (Hrsg.): Die SPD unter Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer 1946 bis 1963. Sitzungsprotokolle der Spitzengremien, Bd. 1: 1946 bis 1948, Bonn 1999. Allgemeine Verfügung des Justizministers vom Oktober 1920 über die bedingte Aussetzung der Strafvollstreckung, in Auszügen abgedruckt in: Wieking, Friedrike: Die Entwicklung der weiblichen Kriminalpolizei in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart, Lübeck 1958, S. 138–139. Art. „Dora Gaßmann“, in: Hannoversche Frauen gegen den Faschismus 1933–1945, auf der Homepage des VVN/BdA Hannover, http://www.hannover.vvnbda.de/hfgf.php?kapitel=20, am 13.12.2013. Art. „Politik“, in Wikipedia, auf: http://de.wikipedia.org/wiki/Politik#cite_note-2, Datum der letzten Änderung: 02.02.2014. Art. „Sommer, Robert“, in: Das deutsche Führerlexikon 1935/1935. Art. „Staatsklugheit“, in: ebd., S. 17. Art. „Staatspolitik“, in: Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften, Vierter Band: St–Z, Leipzig 1829, S. 25. Art. „Staatsräson“, in: ebd., S. 25. Ausführungs- und Überleitungsbestimmungen über das kassenärztliche Dienstverhältnis vom 30. Dezember 1931, in: Reichsgesetzblatt 1932 I, S. 2. Ausscheiden aus dem Internationalen Frauenbund. Agnes von Zahn-Harnack an die Marchioness of Aberdeeen & Temair, 24.05.1933, in: Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine, 13. Jg. (1933), Nr. 6, S. 60. Bachofen, Johann Jakob: Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, Stuttgart 1861. Bähnisch, Albrecht: Gesundheitspolizei, in: Drews, Wilhelm Arnold u. a. (Hrsg.): Preußisches Polizeirecht. Zweiter Band. Besonderer Teil. Ein Leitfaden für Verwaltungsbeamte, Berlin 1933, S. 199–234. Ders.: Krise der Wohlfahrtsarbeit, in: Arbeiterwohlfahrt, 8. Jg. (1933), S. 65–70. Ders.: Bedürftigkeitsprüfung in der Arbeitslosenversicherung, in: Arbeiterwohlfahrt, 7. Jg. (1932), S. 200–204.
1084 | Theanolte Bähnisch
Ders.: Medizinalpolizeirecht, in: Drews, Bill/Lassar, Gerhard (Hrsg.): W. von Brauchitsch. Verwaltungsgesetze für Preußen, Zweiter Band, Zweiter Halbband, 22., vollständig neubearbeitete Auflage, elfte Bearbeitung, Berlin 1932, S. 1–183. Ders.: Das Impfwesen, Berlin 1930. Ders.: Polizeilastenausgleich, in: Verwaltungsarchiv, Bd. 35 (1930), S. 49–104. Ders.: Konsequenz der Schweigepflicht im Geschlechtskrankheiten-Gesetz, in: Die Polizei, 26 Jg., (1929), S. 380–381. Ders.: Vernehmungen durch unbeteiligte Beamte im nichtförmlichen Dienststrafverfahren, in: Die Polizei, 26. Jg. (1929), S. 385. Ders.: Die politische Aufgabe der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, in: Neue Nachbarschaft. Akademisch-Soziale Monatsschrift, 11. Jg. (1928), Heft 7, S. 122–126. Bähnisch, Alfred: Rezension zu: Nüske, Hugo: Die Greifswalder Familiennamen, in: ZfdPh 55 (1930), S. 95–96. Ders.: Rezension zu: Reimpell, Almuth: Die Lübecker Personennamen, in: ZfdPh 55 (1930), S. 95–97. Ders.: Die deutschen Personennamen, Leipzig 1910. Ders.: Ist eine Schulbibel notwendig und wie muß sie beschaffen sein?, Glogau 1892. Ders. (Hrsg.): Sämtliche Sätze des Cornelius Nepos in vollständiger oder verkürzter Form, zusammengestellt und geordnet nach den Regeln der Grammatik von Alfred Bähnisch, Leipzig 1890. Bähnisch, Elisabeth: Die Betätigung der Landkreise in der Wohlfahrtspflege mit besonderer Berücksichtigung von Pommern, in: Jahrbuch der philosophischen Fakultät Marburg, 1922/1923, S. 113–115. Bähnisch, Theanolte: Theanolte Bähnisch erzählt. Das nie vergessene Weihnachtsfest. 1946 im Flüchtlingslager/Das Glück, etwas schenken zu können, in: Hannoversche Neue Presse, 24./25.12.1964. Dies.: Theanolte Bähnisch erzählt. Die Entscheidung für Hannover. Als die Flüchtlingszüge rollten, in: Hannoversche Presse, 23.12.1964. Dies.: Theanolte Bähnisch erzählt. Heimkehrerin nach Hannover. Der Weg in das Regierungspräsidium, in: Hannoversche Presse, 22.12.1964. Dies.: Vom Wiederaufbau der Frauenarbeit nach dem Zusammenbruch 1945. Vortrag zum 10-jährigen Bestehen des Deutschen Frauenrings, in: Mädchenbildung und Frauenschaffen, 10. Jg. (1960), Heft 4, S. 162–180. Dies: Himmel und Erde nahe (Aus einem Vortrag, gehalten zu Köln am 24. Juni 1950) in: Sattler-König, Jenny (Bearb)/Deutscher Frauenring Hildesheim (Hrsg.): Frauen sprechen zu Frauen, Hildesheim 1951, S. 4/5. Dies.: Die Mitarbeit der Frau ist überall!, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), S. 4/5. Dies.: Neue Hoffnung, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 3, S. 3. Dies.: Die Zulassung verheirateter Ärztinnen zur Kassenpraxis auf Grund der Zulassungsordnung vom 30.12.1931, in: Die Ärztin, 9. Jg. (1933), S. 75–78. Dies.: Zum § 27 der Zulassungsordnung, in: Deutsche Krankenkasse, Nr. 52, 1932, Sp. 1418–1420. Dies.: Frauen in der Staatsverwaltung, in: Die schaffende Frau, 1. Jg. (1929), Heft 1, S. 15/16. Bayer, Herbert: Ausstellungskatalog. Das Wunder des Lebens, Berlin 1935.
Quellen und Literatur | 1085
Bäumer, Gertrud: Das Haus ist zerfallen, in: Die Frau, Bd. 40 (1932/33), S. 513/514. Dies.: Die Frau in der Krisis der Kultur, Berlin 1926. Dies.: Die Frau und das geistige Leben, Leipzig 1911. Barck, Lothar: Ziele und Aufgaben der weiblichen Polizei in Deutschland, Freiburg 1928. Baumgarte, Kurt: Tanz, Kabarett und Agitprop. Erinnerungen an Gertrud Bosse, auf der Homepage des VVN/BdA, http://www.hannover.vvn-bda.de/hfgf.php?kapitel =29, am 13.12.2013. Bebel, August: Die Frau und der Sozialismus, Neusatz der Jubiläumsausgabe 1929 [Erstauflage 1879], 3. Aufl., Bonn 1994. Bode-Schwandt, Martha: Die Hausfrau will unterrichtet werden. Kunststoffe im Dienste der Hausfrau – Haushaltsgeräte und Gebrauchsartikel, in: Barth von Wehrenalp, Erwin/Sechtling, Hansjürgen (Hrsg.): Das Jahrhundert der Kunststoffe in Wort und Bild. Ein Bildwerk in vier Sprachen, Düsseldorf 1952, S. 71–73. Dies.: Wunschkinder der Hausfrauen, in: Die Zeit, 18.12.1952. Bon, Gustave le: Psychologie der Massen, [Stuttgart 1911], 15. Auflage, Stuttgart 1982. Booth, Charles: Life and labour of the people in London, 17 Bd., London 1902– 1904. Borgmann, Grete: Freiburg und die Frauenbewegung, Ettenheim/Baden 1973. Dies.: So wohnt sich’s gut, Freiburg 1957. Borgmann, Karl/Borgmann, Grete: Zum Glück hilft Dir die Sehnsucht, Karlsruhe 2010. Borinski, Fritz: Einige Gedanken über das Wechselverhältnis zwischen Settlementbewegung und Erwachsenenbildung, in: Delfs, Hermann (Hrsg.): Aktiver Friede. Gedenkschrift für Friedrich Siegmund-Schultze (1885–1969), Soest 1972, S. 255–260. Ders.: Die Bildung aktiver Minderheiten als Ziel demokratischer Erziehung. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 17. Jg. (1965), S. 528–542. Ders.: Der Weg zum Mitbürger. Die politische Aufgabe der freien Erwachsenenbildung in Deutschland, Düsseldorf 1954. Brecht, Berthold: Trommeln in der Nacht, 18. Aufl., Frankfurt a. M. 2007. Brentano, Lujo: Die Stellung der Gebildeten zur sozialen Frage, Berlin 1890. Brockdorff, Gertrud von: Kann ich hier übernachten?, in: Stimme der Frau, 1. Jg., (1948/49), Heft 7, S. 20–22. Brosius, Dieter: Zur Lage der Flüchtlinge in Niedersachsen, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Neue Folge, Bd. 55 (1983), S. 99–113. Classen, Walter: Soziales Rittertum in England, Hamburg 1901. Clauss, Hans Wolfgang/Müller-Heidelberg, Klaus (Hrsg.): Das niedersächsische Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 21.03.1951; mit den Durchführungsverordnungen und Ausführungsbestimmungen sowie sämtlichen einschlägigen Erlassen, Boorberg 1956. Club deutscher Frauen: Protokoll der ersten Kundgebung, o. O., o. J. [1946], in: Kuhn, Annette (Hrsg.): Frauen in der deutschen Nachkriegszeit, Bd. 2.: Frauenpolitik 1945–1949, Düsseldorf 1986, S. 224–226. Demokratischer Frauenbund Deutschlands-Bundessekretariat (Hrsg.): DFD, o. J. [1952 oder 1953].
1086 | Theanolte Bähnisch
Deneke, Helena/Norris, Betty (Bearb.)/National Council of Social Welfare (Hrsg.): The women of Germany, London 1947. Denis, André: Der Zustand der Frauen ist beklagenswert, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 2, S. 9. Ders.: Mit dem Europapaß in der Hand!, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50) Heft 1, S. 4/5. Deutscher Frauenring e. V.: Sechs Jahrzehnte Einsatz von Frauen für Frauen [Übersicht über die Präsidentinnen und die Arbeit des DFR seit 1949], auf: http://www. deutscher-frauenring.de/der-verband/info-werbe-material/plakate/6-jahrzehnte, am 13.12.2013. Deutscher Frauenring/Eva Ehrlich/Grete Borgmann (Hrsg.): Protokoll des Deutschen Frauenkongresses in Bad Pyrmont am 08. und 09. Oktober 1949, Gießen 1973. Deutscher Frauenring, Landesverband Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Dokumentation des Deutschen Frauenringes, Landesverband Rheinland-Pfalz anlässlich seiner Jubiläumsveranstaltung am 17. Oktober 1981 in Zweibrücken, o. O., 1981. Deutscher Frauenring, Ortsring Oldenburg (Hrsg.): Deutscher Frauenring, Ortsring Oldenburg e. V., Isensee 1997 Diels, Rudolf: Lucifer ante Portas, Zürich 1949. Die Verfassung des deutschen Reiches (Weimarer Verfassung) vom 11. August 1919, in: Hildebrandt, Horst: Die deutschen Verfassungen des 19. und 20. Jahrhunderts, Paderborn 1985, S. 69–111. Dönhoff, Marion: Lord Pakenham, in: Die Zeit, Nr. 23, 07.06.1951. Drechsler-Hohlt, Mathilde: Betrachtungen zu einer staatsbürgerlichen Schulungswoche für Frauen, in: Die Frau, 36 Jg. (1929), S. 603–697. Dresel, Ila: Die Frau in der Krisis der Gegenwart, in: Weser-Kurier, Nr. 51, 28.06.1947. Drews, Bill/Hoffmann, Franz (Hrsg.): Von Bitter. Handwörterbuch der preußischen Verwaltung, dritte, vollständig umgearbeitete Auflage, 2 Bd., Berlin/Leipzig 1928. Drews, Bill/Lassar, Gerhard (Hrsg.): W. von Brauchitsch. Verwaltungsgesetze für Preußen, Zweiter Band, Zweiter Halbband, 22., vollständig neubearbeitete Auflage, elfte Bearbeitung, Berlin 1932. Drews, Wilhelm Arnold [Bill Drews] u. a.: Preußisches Polizeirecht. Zweiter Band. Besonderer Teil. Ein Leitfaden für Verwaltungsbeamte, Berlin 1933. Dürrbeck, Peter: Frauen unter Anklage, in: Mitteilungen der Deutschen Kommunistischen Partei, 1957: Prozesse gegen Kommunistinnen, auf: ArchivParteigeschichte/KPD, 2007, http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s& source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dkpnieder sachsen.de%2Fsystem%2Ffunktionen%2Fhtml2pdf%2Fdkp_pdf.php%3Fmodus %3Dpdf%26med%3D501%26ausgabe%3D89%26pfadx%3D1%26dat_id%3D28 5&ei=xLkJVMj4EoWJ7AbgiIGgDw&usg=AFQjCNHO86drVxbExyxfO26shRh no--Rsg&bvm=bv.74649129,d.ZGU, am 05.09.2014. Ders.: Herta und Karl Dürrbeck. Aus dem Leben einer hannoverschen Arbeiterfamilie, Hannover 2010. Durieux, Tilla: Meine ersten neunzig Jahre. Erinnerungen. Die Jahre 1952–1972, nacherzählt von Werner Preuß, München/Berlin 1971, S. 317.
Quellen und Literatur | 1087
Ein Speditionsgeschäft, Leserinnenzuschrift von Erna Schmid, Rubrik: Wir haben es geschafft. Leserinnen schreiben, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 3, S. 22. Ensor, Robert Charles Kirkwood: Foreword, in: Deneke, Helena/Norris, Betty (Bearb.)/National Council of Social Welfare (Hrsg.): The women of Germany, London 1947, S. 2. Er findet sich nicht zurecht!, Leserinnenzuschrift von ‚B. R.‘, Stichwort: Briefkasten. Die Fragen kosten nichts, in: Stimme der Frau, 3. Jg. (1951), Heft 19, S. 17. Erkens, Josephine (Hrsg.): Weibliche Polizei. Ihr Wesen, ihre Ziele und Arbeitsformen als Ausdruck eines neuen Wollens auf dem Gebiete der Polizei, Lübeck 1925. Erlebte Geschichte in Warendorf von Eugenie Haunhorst, auf: http://www.heimat vereinwarendorf.de/erlebtegeschichte/erlebtegeschichte.htm, am 15.05.2014. Fechner, Frank: Leben auf dem Ulmenhof, in: Friedrich Siegmund-Schultze (1885– 1969). Ein Leben für Kirche, Wissenschaft und soziale Arbeit, Berlin 2007, S. 131–146. Feith, L.[eonore]: Darf Marianne tippen? Auch wenn der Ehemann „nein“ sagt?, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 9, S. 10. Fenske, Herbert: Saat ohne Ernte? Rückblicke eines Nachbarn, in: Foth, Heinrich (Hrsg.): Lebendige Ökumene. Festschrift für Friedrich Siegmund-Schultze zum 80. Geburtstag, Witten 1965, S. 143–151. Flaschel, Hermann: Vorwort, in ders.: Heimatkunde von Beuthen O/S, Beuthen O.S. 1903, o. S. Ders.: Beuthen in den letzten 40 Jahren, in: ders.: Heimatkunde von Beuthen O/S, Beuthen O.S. 1903, S. 29–36. Franken, Aenne: Frauenarbeit in der Polizei, in: Soziale Berufsarbeit, 5. Jg. (1926), S. 1–3. Frauen-Netze Web Datensatz „International Council of Women“, in: Frauen-InfoOnline. Die media, auf: http://www.diemedia.de/frauennetz/ausgabe.php?id=31 52&num=1&suchwort=ICW&num_total=1, am 31.01.2014. Frauen-Union Niedersachsen. Gemeinschaft & Regierung, auf: Facebook, http:// www.facebook.com/FrauenUnionNiedersachsen, am 13.12.2013. Freyer, Hans: Die Vollendbarkeit der Geschichte, in: Merkur, 9. Jg. (1955), S. 101– 114. Frick, Wilhelm: Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung ‚Das Wunder des Lebens‘; in: Der öffentliche Gesundheitsdienst, Bd. 1 (1935/36), Teilausgabe A, S. 100– 103. Friedensburg, Ferdinand: Damals in Berlin ein delikates Amt. Meine Zeit als Chef des Polizeipräsidiums, in: Der Tagesspiegel, Nr. 7353, 16.11.1969, S. 43. Fromm, Erich: Review „Sir Galahad: Mütter und Amazonen. Umriß weiblicher Reiche“, in: Zeitschrift für Sozialforschung, Bd. 1 (1932), S. 427. Gebhardt, Hertha von: Der Anfang, Nach Akten und Erinnerungen aufgezeichnet 1963, in: Soroptimist International Club Hannover: Soroptimist International Deutsche Union, Anfang und Fortgang 1930 bis 1990, Detmold o. J., S. 3–16. Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916, in: Reichsgesetzblatt 1916, S. 1333–1339, auf: LEMO [Lebendiges Virtuelles Museum Onli-
1088 | Theanolte Bähnisch
ne, Haus der deutschen Geschichte, München], http://www.dhm.de/lemo/html/ dokumente/hdg/index.html, am 05.03.2009. Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen der Rechtspflege vom 11. Juli 1922, in: Reichsgesetzblatt 1922 I, S. 573. Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, in: Reichsgesetzblatt I (1933), S. 175. Goldschmidt, James: Das Verwaltungsstrafrecht. Berlin 1902, Neudruck Aalen 1962. Gramm, Erich: Die soziale Arbeitsgemeinschaft Ost, in: Foth, Heinrich (Hrsg.): Lebendige Ökumene. Festschrift für Friedrich Siegmund-Schultze zum 80. Geburtstag, Witten 1965, S. 84–118. Ders.: Friedrich Siegmund-Schultze und die Studenten, in: Foth, Heinrich (Hrsg.): Lebendige Ökumene. Festschrift für Friedrich Siegmund-Schultze zum 80. Geburtstag, Witten 1965, S. 129–142. Ders.: Die Jugenderziehung in der Großstadtsiedlung. Die Jugendclubs, in: Soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost e.V. (Hrsg.): Nachbarschaftssiedlung in der Großstadt. Grundsätzliches aus der Arbeit der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, Berlin 1929, S. 42–49. Grimme, Adolf: Die Volkshochschule als Stätte der Besinnung, in: Denkendes Volk, 3. Jg. (1949), Heft 1, S. 1–5. Ders.: Beruf und Leben, in: Die Welt der Frau, 2. Jg. (1947), Heft 2, S. 3–5. Ders.: Rede an die Frauen. Ansprache bei der Tagung der überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisationen der britischen Zone am 21. Juni 1947, in: Denkendes Volk, 1. Jg. (1946/47), Heft 7, S. 193–196. Ders.: Erwachsenenbildung in der Renaissance des Menschen, in: Denkendes Volk, 1. Jg. (1946/47), Heft 1, S. 321–327. Ders.: Jugend und Demokratie. Rede bei der Jugendkundgebung ‚Ruf an junge Menschen‘ in der Stadthalle zu Hannover am 07. Mai 1946, Hildesheim 1946. Groneweg, Barbara: Eine Frau im öffentlichen Leben. Theanolte Bähnisch wurde 60 Jahre, in: Stuttgarter Zeitung, 28.04.1959. Haag, Anna: Vor neuen Sorgen?, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 2, S. 4. Dies.: Zwischen Krieg und Frieden, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 10. Hädrich, Dirk: SPD-Bezirksparteitag Barsinghausen 1946, Barsinghausen 2008, Dok. 7: Protokoll der Vorstandssitzung am Vorabend des Parteitages im Kaiserhof in Barsinghausen. Handbuch über den preußischen Staat, 136. Jg. (1930); 134. Jg. (1928); 133. Jg. (1927). Harnack, Agnes von: Der Mädchenklub „Fröhliche Jugend“, in: Nachrichten aus der Sozialen Arbeitsgemeinschaft, Bd. 6 (1914), S. 192–198. Harnack, Elisabeth von: „Fröhliche Jugend“ in der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost 1914–1964. Ein Brief, in: Foth, Heinrich (Hrsg.): Lebendige Ökumene. Festschrift für Friedrich Siegmund-Schultze zum 80. Geburtstag, Witten 1965, S. 151–157. Haunhorst, Eugenie: Es wehte noch der Wind der Höheren Töchterschule, in: Erlebte Geschichte in Warendorf von Eugenie Haunhorst, Heimatverein Warendorf, auf: http://www.heimatvereinwarendorf.de/erlebtegeschichte/100jahremarienschule.ht m, am 15.05.2014.
Quellen und Literatur | 1089
Heim, Harro/Nolte, Irmgard (Hrsg.): Ferdinand Freiligrath zum 150. Geburtstag, Dortmund 1960. Dies.: Französisches Geistesleben in Gegenwart und Vergangenheit, Dortmund 1959. Helbing, Klaus: Die Uhr gehört Herrn Sedamore, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 6, S. 10. Hellfaier, Karl-Alexander/Heim, Harro/Nolte, Irmgard (Hrsg.): Tabus unserer Gesellschaft, Dortmund 1964. Heuss, Theodor: Friedrich Naumann. Der Mann, das Werk, die Zeit, 2. Aufl., Stuttgart/Tübingen 1949. Hocke, Gustav René: Ein geistiger Kreuzzug, in: Die Zeit, Nr. 35/1948, 26.08.1948. Höß, E.: Die Bedeutung der Polizeifürsorge und weiblichen Polizei im Kampfe gegen Geschlechtskrankheiten und Prostitution von Polizeifürsorgerin, in: Wächterruf, Nr. 10, Oktober 1935. Hoffa, Lizzie: Der freiwillige Arbeitsdienst für Mädchen, in: Die Ärztin, 9. Jg. (1933), S. 19–35. Dies.: Moderne Clubentwicklung, in: Schmidt-Beil, Ada: Die Kultur der Frau. Eine Lebenssymphonie der Frau des XX. Jahrhunderts, Berlin 1931, S. 510–513. Dies.: Der Zauberberg von Thomas Mann, in: Nordbayerische Zeitung, 24.08.1925. Henny-Hoffmann, Johanna: Frau Präsident… Einen Augenblick bitte!, in: Mannheimer Morgen, 13.10.1949. Huch, Ricarda: ‚Entpersönlichung‘, in: Baum, Marie: Leuchtende Spur. Das Leben Ricarda Huchs, Tübingen/Stuttgart 1950, S. 227. Huizinga, Johan: Im Schatten von Morgen, Eine Diagnose des kulturellen Lebens unserer Zeit, Bern 1936. Jahn, Marianne: Wie helft ihr den Heimkehrern? Berliner Reporterin befragte westdeutsche Frauen auf dem interzonalen Frauen-Kongreß in Frankfurt am Main, in: Deutscher Frauen-Pressedienst, Nr. 7, 09.06.1948. Jentsch, Carl: Weder Kommunismus noch Kapitalismus. Ein Vorschlag zur Lösung der europäischen Frage, Leipzig 1893. Kaye, M.: Fünf neue Bücher, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 4, S. 24. Kempner, Robert: Ankläger einer Epoche. Lebenserinnerungen, Frankfurt a. M./Wien 1983. Kessler, Hansi: Ein Mädchen lernt lachen und weinen!, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 2, S. 20. Ders.: Ein psychologisches Problem unserer Generation. Ein Mädchen kann nicht weinen, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 19. Klaiber, Ingeborg: Die Schwedin von heute: Im Lande der Gastfreundschaft, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), H. 4, S. 10/11. Klausener, Erich: Zum Geleit, in: Tejessy, Fritz/Bähnisch, Albrecht (Hrsg.): Beamtenausschüsse der Schutzpolizei. Erlaß vom 15. Januar 1929 nebst Ausführungsbestimmungen, Wahlordnung und Anlagen, Berlin 1929. Knost, Friedrich August/Lösener, Bernhard: Die Nürnberger Gesetze über das Reichsbürgerrecht und den Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre nebst den Durchführungsverordnungen sowie sämtlichen einschlägigen Bestimmungen und den Gebührenvorschriften, Berlin 1936. Koch, Thilo: Feuilletonistische Ansprache eines Betroffenen über die Feuilletonisierung unserer Literatur, in: Athena, 2. Jg. (1947/48), Heft 3, S. 101–105.
1090 | Theanolte Bähnisch
Köhler, Erika-Roswitha: Eine Frau regiert mit viel Verstand und noch mehr Herz, in: Norddeutsche Zeitung Nr. 105, 7./8.05.1955. Koepcke, Cordula: Frauen verändern die Welt, Opladen 1997. Dies.: Frauen zeigen Flagge. Gesellschaftspolitische Arbeit in Deutschland, Wiesbaden 1985. Kogon, Eugen: Terror als Herrschaftssystem, in: Frankfurter Hefte, 3. Jg. (1948), Heft 11, S. 985–1001. Kracauer, Siegfried: Das Ornament der Masse. Essays, Frankfurt 1977. Ders.: Die Angestellten. Aus dem neuesten Deutschland, Frankfurt 1930. Ders.: Ein Angestelltenroman, in: Frankfurter Zeitung, 06.07.1930. Kudera, Lucian/Heim, Harro/Nolte, Irmgard (Hrsg.): Geschichte in der Auseinandersetzung unserer Zeit, Dortmund 1960. Lang, M.: Wirbel um Angelika, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Nr. 17, S. 10– 12. Langner, Ilse: Regierungspräsident Theanolte Bähnisch, in: Die Zeit, 21.02.1957. Lauenroth, Heiner/Gösseln, Hans von: Anpacken und Vollenden, Hannover 1949. Lehrerkollegium der katholischen städtischen Realschule zu Beuthen O/S (Hrsg.): Heimatkunde von Beuthen O/S, Beuthen O.S. 1903. Lehrerkollegium des Gymnasiums zu St. Magdalena zu Breslau (Hrsg.): Festschrift zur 250-jährigen Jubelfeier des Gymnasiums zu St. Maria Magdalena zu Breslau am 30. April 1893, Breslau 1893. Lindbergh, Charles A.: Das Dilemma des modernen Menschen, in: Universitas, 10. Jg. (1955), S. 113–117. Lindner, Rolf (Hrsg.): Wenzel Holek. Meine Erfahrungen in Berlin Ost, Köln 1998. Lotze, Heiner: Die ehemaligen Schüler von Dreißigacker, in: Theiß, Ilse/Lotze, Heiner: Die Heimvolkshochschule Dreißigacker, in: dies. (Hrsg.): Dreißigacker. Volkshochschule/Erwachsenenbildung, Jena 1930, S. 29–34. Lübke, Heinrich u. a.: Zum Advent, in: Die Zeit, Nr. 51, 18.12.1959. Lüders, Marie-Elisabeth.: Fürchte Dich nicht. Persönliches und Politisches aus mehr als 80 Jahren, 1878–1962, Köln 1963. Dies.: Frauen sichern Stalins Sieg, Berlin 1952. Dies.: Das unbekannte Heer. Frauen kämpfen für Deutschland 1914–1918, Berlin 1936. Dies.: Befreiung von Krankheit und Lüge, in: Die Frau, Bd. 34 (1926/27), S. 302– 305. Mayer-Katz, Leonore: Sie haben zwei Minuten Zeit. Nachkriegsimpulse aus Baden, Freiburg 1986. Man, Henrik de: Vermassung und Kulturverfall. Eine Diagnose unserer Zeit, Bern 1951. Mann, Carol: Ihr Leben – ein Tanz! Die Geschichte der Anna Pawlowa, in: Stimme der Frau, 3. Jg. (1952), Heft 5, S. 22/23. Mann, Walther: Thüringen 1930 – das Vorspiel zum Untergang der deutschen Volkshochschule, in: Aktiver Friede. Gedenkschrift für Friedrich SiegmundSchultze (1885–1969), Soest 1972, S. 287–293. Meinecke, Friedrich: Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen, Wiesbaden 1946.
Quellen und Literatur | 1091
Melchert, Monika (Hrsg.): Ilse Langner: „Von der Unverwüstlichkeit des Menschen“, Dramenzyklus, Berlin 2002. Meyer-Sevenich, Maria: Beispielhaft zu wirken, in: Hannoversche Neueste Nachrichten, 06.12.1947. Milchsack, Lilo: 30 Jahre deutsch-englische Gesellschaft. [Vortrag] Gegeben in der Mitgliederversammlung am 6. November 1979 in Düsseldorf, auf: http://www.debrige.de/userfiles/file/L_Milchsackzum30jaehrigen BestehenderDEG1979.pdf, am 13.12.2013, S. 2. Ministerpräsidenten der sowjetischen Zone an den bayerischen Ministerpräsidenten Ehard, 28. 5. 1947, in: Bundesarchiv/Institut für Zeitgeschichte (Hrsg.): Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 2, München 1979, S. 455. Mohler, Armin: Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Grundriß ihrer Weltanschauungen, Stuttgart 1950. Müller, Paula: Zwanzig Jahre Deutsch-Evangelischer Frauenbund, Berlin 1919. Nachruf auf Dorothea Bähnisch von Alfred Kubel, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 12.07.1973. Naumann, Friedrich: Bassermann und Bebel, in: Berliner Tageblatt, Nr. 503, Morgenausgabe, 04.10.1910. Naunin, Gisela: Der Landesverband Westfalen des Deutschen Frauenrings 1947– 1965, Münster 1984. Netzwerk der Europäischen Bewegung Deutschland (Hrsg.): Festschrift 60 Jahre europäische Bewegung, Berlin 2009, Online-Version auf: http://issuu.com/netz werkebd/docs/ebd-festschrift, am 13.12.2013. Nolte, Franz: Erdkundliches, in: Heimatkunde von Beuthen O/S, Beuthen O.S. 1903, S. 1–14. Oppenheimer, Hilde/Radomski, Hilde: Die Probleme der Frauenberufstätigkeit in der Übergangsgesellschaft, Mannheim/Berlin/Leipzig 1918. Ortega y Gasset, José: Der Aufstand der Massen, [Stuttgart 1931], Ulm 1997. Oswalt, August: Zur Nachbarschaftsfrage, in: Soziale Arbeitsgemeinschaft BerlinOst: Nachbarschaftssiedlung in der Großstadt. Grundsätzliches aus der Arbeit der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, Berlin 1929, S. 29–36. O. V.: 1,5 Millionen übernachteten im Bahnhofsbunker, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 16.07.1950. O. V.: 32. Europatag in Bad Pyrmont, auf: http://www.deutscher-frauenring.de/ aktuelles/nachrichten/32.-europatag-in-bad-pyrmont, am 07.04.2014. O. V.: 60 Prozent Kreisumlage. Landrat Dr. Bähnisch Staatskommissar für den Landkreis Merseburg, 08.12.1931. O. V.: Agnes-Miegel-Gesellschaft, auf: http://www.literaturatlas.de/~lg4/gesell schaft.html, am 13.12.2013. O. V.: Aktuelles. Frau Erika Overmann, Bankkauffrau, starb am 04.12.2013 im Alter von 99 Jahren, auf der Homepage des DFR-Niedersachsen, http://www.dfrniedersachsen.de/index.html, am 14.02.2014. O. V.: Anfänge und erste Entwicklung des Oldenburger Frauenringes, auf: Deutscher Frauenring, Ortsring Oldenburg, http://www.dfr-oldenburg.de/index.php/wie entstand/die-anfaenge.html, am 13.12.2013.
1092 | Theanolte Bähnisch
O. V.: Aus der Frauenwelt. Antrag an die Sowjetunion, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 9, S. 39. O. V.: Aus der Frauenwelt. Gegen die Amerikanisierung der deutschen Küche, in: Stimme der Frau, 3. Jg. (1951), Heft 18, S. 21. O. V.: Aus der Frauenwelt. Kurzer Überblick über eine große Arbeitstagung des internationalen Frauenrates, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 2, S. 35. O. V.: Aus der Frauenwelt. Sonderhilfsaktion für ostdeutsche Mütter und Kinder, in: Stimme der Frau, 4. Jg. (1952), Heft 11, S. 30. O. V.: Aus der Welt. Deutsche Literatur in Frankreich sehr gefragt, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), H.4, S. 29. O. V.: Aus der Welt. Kongreß für moralische Aufrüstung, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 5, S. 29. O. V.: Aus der Welt. Mary Wigman und Harald Kreuzberg in Zürich, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 4, S. 29. O. V.: Ausgabensperre. Landkreis Merseburg vor schweren Entscheidungen, in: Merseburger Tageblatt, 06.12.1931. O. V.: Blick zurück, auf: http://www.deutscher-frauenring.de/der-verband/blickzurueck, am 13.12.2013. O. V.: „Club deutscher Frauen in Hannover“, in: Neuer Hannoverscher Kurier vom 07.06.1946, S. 6, Abschrift in: Kuhn, Annette (Hrsg.) Frauen in der deutschen Nachkriegszeit, Bd.2, Frauenpolitik 1945–1949, Düsseldorf 1986, S. 224. O. V.: Chronologische Darstellung der Entwicklung des Deutsch-Evangelischen Frauenbundes, in: Hefte zur Frauenfrage, Nr. 21 (1919) S. 29–38. O. V.: Clubgeschichte, auf: http://www.si-club-hannover.de/index.php?option=com _content&view=category&layout=blog&id=109&Itemid=128, am 20.09.2013. O. V.: Das Große Verdienstkreuz, in: Hannoversche Rundschau, 26.05.1967. O. V.: Der djb von 1948 bis 2003. Das erste Jahrzehnt (1948–1948). Auszüge aus den Rundschreiben, ai-Sonderausgabe 2003, auf: http://www.djb.de/ publikationen/ai_sonderausgabe2003/ai_sonderausgabe2003_jahrzehnt1_rund schreiben/, am 13.12.2013. O. V.: Der Frauenring ladet ein: Theanolte Bähnisch spricht in Osnabrück, in: Osnabrücker Tageblatt, 10.02.1951. O. V.: Der neue Merseburger Landrat. Morgen offizieller Amtsantritt, in: Volksbote Zeitz, Nr. 26 vom 31.01.1930. O. V.: Der Regierungspräsident ist eine Frau, Theanolte Bähnisch, Chefin des Hauses Archivstraße 2 in Hannover – Keine Starallüren, in: Bremer Nachrichten, 27.08.1954. O. V.: Der Wintergarten des ‚Arbeiterführers‘, in: Berliner-Börsen-Zeitung, Nr. 79, 17.02.1931. O. V.: Deutscher Frauenring e. V.: Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland bis heute, auf: http://www.deutscher-frauenring.de/der-verband/info-werbematerial/flyer/flyer-geschichte-der-frauenbewegung, am 14.02.2014. O. V.: Deutscher Frauenring e. V., Ortsring Hannover, auf: http://www.deutscherfrauenring.de/organisation/landesverbaende-ortsringe/niedersachsen/hannover, am 24.01.2014. O. V., o. T., in: Deutsches Rotes Kreuz. Die Fachzeitschrift des DRK, Britische Zone, 5. Jg. (1951), Nr. 3, S. 4.
Quellen und Literatur | 1093
O. V.: Deutschlands bauliche Erneuerung. Tagung des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung, in: Neue Bauwelt, Nr. 20/1950, S. 318/319. O. V.: Die Frauen der britischen Zone, in: Tägliche Rundschau, 28.06.1947. O. V.: Die Frau in der Welt. Australien, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 3, S. 24 O. V.: Die Frau in der Welt. England, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 3, S. 24. O. V.: Die Gegenwart ruft die Frau. Der einzige weibliche Regierungspräsident zur Frauenfrage, in: Aachener Nachrichten, 16.08.1946. O. V.: Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland. Von den Wurzeln bis heute, auf: http://www.deutscher-frauenring.de/der-verband/info-werbe-material/ flyer/flyer-geschichte-der-frauenbewegung, am 07.04.2014. O. V.: Die Künstlerin in ihrem Heim. Von morgen bis Mitternacht, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 12/13. O. V.: [P. H.] Diese Frau paßt in kein Schubfach. Gespräch mit Frau Theanolte Bähnisch, Regierungspräsident von Hannover, in: Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung, 26.11.1949. O. V. [‚fe‘]: „Diskussion um Ausländerlager“, in: Hannoverschen Neuesten Nachrichten, 09.01.1948, Auszug in: Displaced Persons – Ein Problem der Nachkriegszeit, auf: http://www.geschichtsatlas.de/~ga2/haz2.htm, am 13.12.2013. O. V.: Eherecht. Bettelei ums Haushaltsgeld, in: Der Spiegel 5. Jg. (1952), Nr. 1, 02.01.1952, S. 28–30. O. V.: Ein Buch für Dich, aber welches?, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 6, S. 22. O. V.: Eine Friedensfront der Frauen, in: Neuer Hannoverscher Kurier, 21.06.1946. O. V.: Erhöhung der Kreisumlage, in: Merseburger Tageblatt, 10.12.1931. O. V.: Ernste heitere Welt. Die beste Waffe für den Frieden, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 2, S. 26. O. V.: Europäische Bewegung. Organisation und Entwicklung, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 1, S. 4. O. V.: Frauen sind trotzdem bessere Diplomaten..., in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/59), Heft 2, S. 2/3. O. V.: Frauen des Westens helft den Berliner Müttern und Kindern, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 3, S. 3. O. V.: [‚A. M.‘, vermutlich Anna Mosolf] „Frauen tagten in Frankfurt“, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 2, S. 4. O. V.: Frauentagung in Bad Boll, in: Tagesspiegel, 30.05.1947. O. V.: Frauentagung in Bad Pyrmont, in: Vorwärts, 27.06.1947. O. V.: Frau Polizeichef, Hamburger Abendblatt, 31.03.1951. O. V.: Frau Polizeichef, in: Das Abendblatt, Nr. 68, 21.03.1951, S. 1. O. V. [‚Ha-Ge‘]: Frau Vizepräsident, in: Neuer Hannoverscher Kurier, Nr. 25, 29.3.1946. O. V.: Gerstenmaier. Der Traum ist aus, in: Der Spiegel, 08.12.1954, S. 9-15. O. V.: Geschichte, auf: Deutscher Frauenrat, http://www.frauenrat.de/deutsch/ verband/geschichte.html, am 13.12.2013.
1094 | Theanolte Bähnisch
O. V.: Geschichte der deutsch-britischen Gesellschaft auf: http://www.debrige.de/ de/geschichte-der-deutsch-britischen-gesellschaft, am 13.12.2013. O. V.: Geschichte des Deutschen Frauenrings e. V. und des Ortsrings Münster, auf: http://www.dfr-ms.de/geschichte.htm, am 13.12.2013. O. V.: „Geschulter Geist und kluges Herz“. Die Gründung des Deutschen Frauenrings in Bad Pyrmont, Badische Zeitung, 25.10.1949. O. V.: Gesellschaft/Moralische Aufrüstung. Die Caux-Existenz, in: Der Spiegel, 13.10.1954. O. V.: Gleichberechtigte Frauen von 40 bis 60, in: Der Spiegel, 28.06.1947, S. 5–6. O. V.: Hannover will keine monarchische Kundgebung. Prinzenhochzeit ohne Propaganda. Theanolte Bähnisch wurde energisch, in: Remscheider GeneralAnzeiger, 24.08.1951. O. V.: „Heut´ wird er kommen“. Auszüge aus den „Sonetten einer Griechin“ von Eckard Peterich, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 9. O. V.: Historie, auf: Hamburger Frauenring e. V., http://www.hamburgerfrauenring.de/index.php/wir-ueber-uns/historie, am 13.12.2013. O. V.: Hoher Orden für Theanolte Bähnisch, in: Hannoversche Rundschau, 24.04.1964. O. V. [hjt]: Wünsche zum Geburtstag. Regierungspräsident Theanolte Bähnisch 60 Jahre, in: Hannoversche Presse, 25.04.1959. O. V.: [hwp]: Keine Angst vor Männern. Mit Herz und Verstand regierte die Präsidentin Theanolte Bähnisch, in: Die Libelle, Juni 1960. O. V.: Im Blickpunkt der Woche. Theanolte Bähnisch, in: Hannoversche Rundschau, 25./26.04.1964. O. V.: In Hannover und Bonn nicht vergessen. Niedersächsisches Verdienstkreuz für Frau Staatssekretär a. D. Bähnisch, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, Nr. 120, 26.05.1967. O. V.: Interessant!, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 3, S. 2. O. V.: Interessant! Das Baumwollkleid leicht verdient?, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 5, S. 2. O. V. [‚sh‘]:»Jetzt ist Willi Dickhut für mich richtig lebendig geworden« Veranstaltung mit »Bergischer Kaffeetafel« im Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen, in: Rote Fahne. Wochenzeitung der MLPD, Nr. 43, 24.12.2002, auf: http://interaktiv.mlpd.de/rf0243/rfart3.htm, am 03.02.2014. O. V.: [‚K.W.‘]: Oberpräsident Hinrich Wilhelm Kopf. „Ich kann als Mitarbeiter nur Idealisten gebrauchen“, in: Hannoverscher Kurier, 01.10.1945. O. V.: Kampf um den gewissen Ort. Heftige Kritik der Hausfrauen am modernen Wohnungsbau, in: Hamburger Abendblatt, Nr. 288, 10.12.1951. O. V.: Kennen Sie das BGB, das Buch mit den sieben Siegeln?, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 4, S. 19. O. V.: Kongress in Pyrmont, in: Sie, 29.06.1947, S. 2. O. V.: Kreistag am 3. Juni. Präsentation des Landtags, in: Vossische Zeitung, Nr. 109, 10.05.1930. O. V.: Kreistagswahl, in: Amtsblatt für den Landkreis Merseburg, 18.03.1933. O. V.: Korruption im Ministerium des Innern. Wann geht Regierungsdirektor Abramowitz, in: Berliner Tribüne, 26.04.1930.
Quellen und Literatur | 1095
O. V.: Kurze Mitteilungen über die Berliner Arbeit der SAG, in: Nachrichten aus der Sozialen Arbeitsgemeinschaft, Nr. 18/1925. O. V.: Mit Radar ist das Kochen eine wahre Hexerei. Notizen aus aller Welt, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 9, S. 2. O. V.: Neue Frauenzeitschriften, in: Rundschau der Frau, Nr. 4, Januar 1930. O. V.: Neue Kriege zu verhindern. Natürlich nur step by step, in: Der Spiegel, 2. Jg. (1948), Heft 14, 04.04.1948, S. 6/7. O. V.: Neue Rezepte – für wen? – von wem?, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 26. O. V.: Notiert aus aller Welt, o. V., in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 12, S. 2. O. V.: Notiert aus aller Welt, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 10, S. 2. O. V.: Notizen aus aller Welt, Zentralsuchstelle für vermißte deutsche Frauen, in: Stimme der Frau, 1. Jg, (1948/49), Heft 9, S. 2 O. V.: Notizen aus aller Welt, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 7, S. 2. O. V.: Organisationsplan der Regierung Hannover, Hannover 01.05.1949. O. V.: Perserteppich Deutschland. Dertinger meinte nicht, in: Der Spiegel, 26.05.1949, S. 8/9. O. V.: Politik mit klugem Herzen, in: Die Welt, 12.10.1947. O. V.: Rezension zu: Bäumer: Die Frau, in: Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik, Bd. 6 (1927), S. 119. O. V.: Rezension zu: Bäumer, Gertrud: Die seelische Krisis, 3. Aufl., Berlin 1926, in: Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik, Bd. 6 (1927), S. 120. O. V. [„Rsch“]: Rückblick auf den gestrigen Kreistag, in: Merseburger Korrespondent, Nr. 63, 15.03.1930. O. V.: [‚A. M.‘, vermutlich Anna Mosolf]: Rückblick und Ausschau. Die Arbeit des Frauenringes in der britischen Zone, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Nr. 1, S. 25. O. V.: „…stets Frau geblieben“. Hohe Orden für Theanolte Bähnisch und Oskar Schuster, in: Hannoversche Presse, 23.04.1964. O. V.: Soll die Ehefrau noch berufstätig sein?, in: Stimme der Frau, 3. Jg. (1951), Heft 11, S. 5/6. O. V.: Soziale Arbeitsgemeinschaft Ost. Anschriftenliste der auswärtigen Mitarbeiter der Sozialen Arbeitsgemeinschaft, Berlin 1927. O. V.: Streit um neue Straßennamen, auf: Taz.de, 05.07.2008, http://www.taz.de/ regional/nord/nord-aktuell/artikel/?dig=2008%..., am 10.07.2008. O. V.: Theanolte Bähnisch, in: Der Spiegel, 01.01.1961, S. 67. O. V.: Theanolte Bähnisch in Hannover gestorben, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 11.07.1973. O. V.: Theanolte Bähnisch, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 13.04.1964. O. V.: Theanolte Bähnisch, in: Die Welt, 10.04.1964. O. V.: Theanolte Bähnisch. Niedersachsens Bevollmächtigte beim Bund verläßt Bonn, o. V., in: SPD Pressedienst P/XIX/72, 15.04.1964, S. 3. O. V.: The german problem, in: The Glasgow Herald, 07.02.1947, auf: http://news. google.com/newspapers?nid=2507&dat=19470207&id=mlNAAAAAIBAJ&sjid =ZpEMAAAAIBAJ&pg=4366,2200222, am 13.12.2013.
1096 | Theanolte Bähnisch
O. V.: Übersicht der evangelischen Jugendgruppenbewegung, in: Hefte zur Frauenfrage, 11. Jg. (1919), S. 68–70 O. V.: Und da haben sie mir meinen Erich genommen. Emilie Paats, in: Hannoversche Frauen gegen den Faschismus, Homepage des VVN/BdA Hannover, auf: http://www.hannover.vvn-bda.de/hfgf.php?kapitel=47, am 13.12.2013. O. V.: Veranstaltungen am Ostbahnhof, in: Nachrichten aus der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Nr. 14 (1922), S. 10. O. V.: Vom Radar-Roastbeef zum Cocktail-Auto. Dieses Mal kein Aprilscherz, o. V., in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 10, S. 9. O. V.: Warenhäuser. Alles für Frau Piesecke, in: Der Spiegel, 07.01.1953. O. V. [‚RMW‘]: Was bleibt stiften die Dichter – Die Feier des achtzigsten Geburtstages von Agnes Miegel, in: Das Ostpreußenblatt, 10. Jg. (1959), Nr. 11. O. V.: Was Väter alles dürfen, o. V., in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 7, S. 7. O. V.: Wer hat in der Ehe zu sagen?, in: Stimme der Frau, 4. Jg. (1952), S. 6/7. O. V.: Wer regiert Berlins Theater? Das Regime des Fräulein Nolde, in: Berliner Herold, 22. Jg., Nr. 9, März 1927. O. V.: Wer wußte es? Deutschlands erster weiblicher Regierungspräsident stammt aus Warendorf, in: Neues Tageblatt, 26.11.1946. O. V.: Wie ich Ministerin wurde. Elfriede Paul, in: Hannoversche Frauen gegen den Faschismus, Homepage des Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN/BdA) Hannover: auf: http://www.hannover.vvnbda.de/hfgf.php?kapitel=50, am 13.12.2013. O. V.: Wir sind wieder einmal schlecht dabei weggekommen!, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 5, S. 5/6. O. V.: Wohnungen, in: Der Spiegel, Nr. 8/1952, 20.02.1952, S. 27–29. O. V.: Wovon Menschen leben, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 2, S. 14/15. O. V.: Zehn Jahre im Amt. Dienstjubiläum von Frau Regierungspräsident Bähnisch, in: Hannoversche Presse, 03.08.1956. O. V.: Zum Neubau des Schulwesens, in: Die Schule. Monatsschrift für geistige Ordnung, 1(1946), Nr. 2/3 S. 13/14. O. V. [schn.]: Zwanzig Jahre Deutscher Frauenring. „Vorhof politischer Parteien“/Theanolte Bähnisch hielt Rückschau, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 08.12.1966. Pelz, Gerda: Die „gute Partie“ ist nicht mehr gefragt!, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 9, S. 2. Pfeiffer, Lisbet: Frauen zur Demokratie, in: Die Welt der Frau, 3. Jg. (1948/49), Heft 8, S. 5. Dies.: In Berlin fiel uns auf, in: Die Welt der Frau, 3. Jg. (1948/49), Heft 5, S. 19f. Dies.: Frauenschaffen. Der erste Schritt. Konstituierung des „Frauenrings der britischen Zone“, in: Die Welt der Frau, 2. Jg. (1947), Heft 2, S. 26/27. Dies.: Frauen am Scheideweg, in: Die Welt der Frau, 1. Jg. (1947), Heft 1, S. 4–6 u. 31. Pfeifer, W. [Heinrich Zille]: Hurengespräche – gehört, geschrieben und gezeichnet von W. Pfeifer, Berlin 1921, Neuauflage [Faksimile], München 2000.
Quellen und Literatur | 1097
Pilgert, Henry P./Waschke, Hildegard: Women in West Germany. With special reference to the Policies and Programs of the Women´s Affairs Branch, Office of Public Affairs, Office of the U. S. High Commissioner for Germany, Bad Godesberg 1952. Plessner, Helmuth: Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des Sozialen Radikalismus, mit einem Nachwort von Joachim Fischer, Frankfurt 2002 [Erstausgabe 1924]. Preuß, Hugo: Volksstaat oder verkehrter Obrigkeitsstaat, in: ders. (Hrsg.): Staat, Recht und Freiheit. Aus 40 Jahren deutscher Politik und Geschichte, Tübingen 1926, S. 367. Preußisches Ministerium des Innern (Hrsg.): Große Polizei-Ausstellung Berlin 1926, 25. September–10. Oktober, Ausstellungshallen Kaiserdamm, Berlin 1926. Priess, Ingrid: Mit Hut, Charme und Diplomatie. Theanolte Bähnisch begeht heute ihren siebzigsten Geburtstag, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 26.04.1969. Raudive, Konstantin: Der Chaosmensch und seine Überwindung. Betrachtungen über die Tragik unserer Zeit, Memmingen 1951. Rebstein-Metzger, Emmi: Gutachten über die Frage: Inwiefern bedürfen die familienrechtlichen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit Rücksicht auf den die Gleichberechtigung der Geschlechter aussprechenden Art. 119 Abs. 1 Satz 2 R[eichs]verf[assung] einer Änderung?, in: Verhandlungen des 36. Deutschen Juristentages in Lübeck, Berlin/Leipzig 1932, S. 540–591. Reichelt, Helmut (Hrsg.): Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Naturrecht und Staatswissenschaft, Frankfurt a. M. 1972 [Erstausgabe 1821]. Rentmeister, Maria: Zersplitterte Frauenbewegung im Westen. Ein Stimmungsbericht von der Frauenkonferenz in Bad Boll, in: Freiheit, Ausgabe Halle, 09.06.1947. Dies.: Nur 12 Minuten Redezeit. Frauenkongreß geht an den Tagesproblemen vorbei, in: Neues Deutschland, 07.06.1947, S. 3. Dies.: Kritik an der Frauentagung in Bad Boll, in: Tägliche Rundschau, 29.05.1947. Rothig, Friede: Tagung der Fachgruppe der Fürsorgerinnen an Polizei- und Pflegeämtern des deutschen Verbandes der Sozialbeamtinnen, Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt (ZJRJW), 16. Jg. (1925), S. 262–263. Dies.: Was heißt evangelische Jugendbewegung?, Berlin 1919. Salomon, Ernst: Der Fragebogen, Hamburg 1951. Schareina, Maria-Luise: Regierungspräsident Theanolte Bähnisch 60 Jahre. Eine Frau – die ihren Mann steht, in: Die Rundschau, Nr. 96, 25./26.04.1959. Schmidt, Elke [Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Pyrmont]/Bad Pyrmont Tourismus AG (Hrsg.): Die Frauenwelt schaut(e) auf Bad Pyrmont, auf: http://www.frauenorte-niedersachsen.de/files/flyer_theanolte. pdf. am 07.04.2014. Schmidt, Josef: Drei Damen von der Hohen Kommission. Mrs. Mc Cloy, Lady Kirkpatrick und Madame Francois-Poncet am Rednerpult, in: Süddeutsche Zeitung, [als Kopie o. D., o. S. überliefert in: AdsD, Personalia 480. Schüddekopf, Jörg: Er, Sie, oder Beide? Jörg Schüddekopf an die Redaktion Stimme der Frau, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 4. Schumacher, Kurt: Der Kampf um den Staatsgedanken in der deutschen Sozialdemokratie, (Diss., Münster 1920), Stuttgart 1973.
1098 | Theanolte Bähnisch
Schulz, Günther Eberhard: Ilse Langner. Dramen II, Würzburg 1991. Seidel, Ina: Zum Geleit, in: Die Welt der Frau, 1. Jg. (1946/1947), Heft 1, S. 5. Seidel, Willy: Kassel lebt…trotz alledem, Kassel 1948. Siegmund-Schultze, Friedrich: Aus der sozialen Studentenarbeit, in: Grünberg, Wolfgang u. a. (Hrsg.): Friedrich Siegmund-Schultze: Friedenskirche, Kaffeeklappe und die ökumenische Vision, Texte 1910–1969, München 1992, S. 302– 325. Ders.: Wege zum Aufbau der neuen Volksgemeinschaft, in: Grünberg, Wolfgang u. a. (Hrsg.): Siegmund-Schultze: Friedenskirche, Kaffeeklappe und die ökumenische Vision, Texte 1910-1969, München 1992, S. 351–366. Ders.: Um ein neues Sexualethos. Bericht über die Elgersburger Konferenz zur Beratung sexualethischer Fragen vom 5.–12. Oktober 1926, Berlin 1927. Ders.: Klassenhaß, in: Evangelisch-sozial, 21. Folge der Mitteilungen des evangelisch-sozialen Kongresses, Bd. 8/9 (1912), S. 274–298. Siegmund-Schultze, Maria: Die Wohlfahrtspflege (im Rahmen der Großstadtsiedlung), in: Soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost E. V. (Hrsg.): Nachbarschaftssiedlung in der Großstadt. Grundsätzliches aus der Arbeit der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, Berlin 1929, S. 37–41. Sie wurde Lehrerin, Leserinnenzuschrift von Lucy Goetz, Rubrik: Wir haben es geschafft, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 2, S. 22. Sombart, Werner: Vom Menschen, Berlin 1938. Soroptimist International, Club Hannover: Soroptimist International Deutsche Union, Anfang und Fortgang 1930 bis 1990, Detmold o. J. Soroptimist International, Deutsche Union (Hrsg.): 50 Jahre Deutsche Union Soroptimist International, Hannover o. J. Spinner, Gerhard: Forschungs- und Ausbildungsarbeit, in: Soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost E. V. (Hrsg.): Nachbarschaftssiedlung in der Großstadt. Grundsätzliches aus der Arbeit der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, Berlin 1929, S. 62–68. Städtische katholische Realschule zu Beuthen O. S. (Hrsg.): Dritter Jahresbericht über das Schuljahr 1899, erstattet von dem Direktor Dr. Hermann Flaschel, Beuthen O.S. 1900. Ständige Deputation des Deutschen Juristentages (Hrsg.): Verhandlungen des 38. Juristentages in Frankfurt am Main 1950, Tübingen 1951. Staub, Kurt (Hrsg.): Ilse Langner. Frau Emma kämpft im Hinterland. Chronik in drei Akten, Darmstadt 1979. Strecker, Gabriele: Überleben ist nicht genug. Frauen 1945–1950, Freiburg 1981. Dies.: Gesellschaftspolitische Frauenarbeit in Deutschland. 20 Jahre Deutscher Frauenring, Opladen 1970. Dies.: Hundert Jahre Frauenbewegung in Deutschland, Wiesbaden 1951. Dies.: Frauenverbände als Spiegel der politischen Situation. Kommunistische OstOrganisationen im Kampf gegen unabhängige Gruppen Westdeutschlands, in: Neue Zeitung, 5. April 1950, o. S. Suttner, Bertha von: Die Waffen nieder, Dresden 1889. Sybill: Porträt einer Regierungspräsidentin, in: Hessische Nachrichten, 10.11.1948. Tasch, Dieter: Kontakt bis in das letzte Dorf. Theanolte Bähnisch – Regierungspräsidentin von Hannover, Hannoversche Allgemeine Zeitung, 06.02.1959.
Quellen und Literatur | 1099
Tejessy, Fritz/Bähnisch, Albrecht (Hrsg.): Beamtenausschüsse der Schutzpolizei. Erlaß vom 15. Januar 1929 nebst Ausführungsbestimmungen, Wahlordnung und Anlagen, Berlin 1929. Dies.: Vorwort, in: Dies. (Hrsg.): Beamtenausschüsse der Schutzpolizei. Erlaß vom 15. Januar 1929 nebst Ausführungsbestimmungen, Wahlordnung und Anlagen, Berlin 1929. Tergit, Gabriele: Etwas Seltenes überhaupt. Erinnerungen, Frankfurt a. M./Berlin/ Wien 1983 Dies.: Die Frauen-Tribüne, in: Die Frauen-Tribüne, 1. Jg. (1933), Heft 1/2 [Januar 1933]. Dies.: Sorores optimae, in: Berliner Tageblatt, 22.01.1930. Dies.: Freundliches Frauengespräch über die Tötung eines Mannes, in: Berliner Tageblatt, 22.2.1927. Tasch, Dieter: Schon 1902 sorgte sich der Präsident um gute Butter, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 17.04.1985. Theiß, Ilse/Lotze, Heiner: Die Heimvolkshochschule Dreißigacker, in: dies. (Hrsg.): Dreißigacker. Volkshochschule/Erwachsenenbildung, Jena 1930, S. 7–9. Thoma, Hans: Brücken des Herzens. Hans Thoma an die Frauen, in: Die Welt der Frau, 1. Jg. (1946/1947), Heft 4, S. 18. Thorwald, Jürgen: Es begann an der Weichsel, München 1950. Thurnwald, Hilde: Gegenwartsprobleme Berliner Familien. Eine soziologische Untersuchung an 498 Berliner Familien, Berlin 1948. Thydesen, Engdahl: Von Oxford bis Caux, in: Die Zeit, 26.04.1951. Tönnies, Ferdinand: Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirische Culturformen, Darmstadt 2005 [Erstauflage 1887]. Ders.: Gemeinschaft und Gesellschaft, Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen, Berlin 1887, online auf: http://www. deutschestextarchiv.de/toennies/gemeinschaft/1887/, am 13.12.2013. Toll, Hans J.: Der Chef ist eine Frau. Um das kluge Herz. Regierungspräsidentin Theanolte Bähnisch: „Lebendige Verwaltung“, in: Hannoversche Presse, 12.08.1958. Toynbee, Arnold: Der Gang der Weltgeschichte, Bd. 1, Zürich 1949. Ulich-Beil, Else: Ich ging meinen Weg, Berlin 1961. Velsen, Dorothee von: Im Alter die Fülle, Tübingen/Stuttgart 1956. Dies.: Wir leben eine Spanne Zeit, Tübingen/Stuttgart 1950. Verlustliste des Colbergschen Grenadier-Regiments Graf Gneisenau, Nr. 9, in: Onlineprojekt Gefallenendenkmäler, auf: http://www.denkmalprojekt.org/Verlust listen/vl_colbergsches_gren-reg_wk1_teil2.htm, am 14.10.2013. Verordnung zur Herabminderung der Personalausgaben des Reichs vom 27. Oktober 1923, in: Reichsgesetzblatt, 1923 I, S. 999. Vogt, Hanna (Bearb.)/Büro für Frauenfragen in der Gesellschaft zur Gestaltung öffentlichen Lebens (Hrsg.): Die Fibel der Staatsbürgerin, Wiesbaden 1952. Dies.: Schuld oder Verhängnis? 12 Fragen an Deutschlands jüngste Vergangenheit, Frankfurt a. M./Berlin/Bonn, 1961. Vorbesprechung der Ministerpräsidenten über die Tagesordnung der Münchner Ministerpräsidentenkonferenz, 5./6. 6. 1947, in: Bundesarchiv/Institut für Zeitge-
1100 | Theanolte Bähnisch
schichte (Hrsg.): Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 2, München 1979, S. 485 ff. Vorstand der SPD (Hrsg.): Von der NS-Frauenschaft zum kommunistischen DFD, Hannover o. J. [1952]. Weber, Annemarie: Die Welt der Frau, in: Die Welt der Frau, 1. Jg. (1946/1947), Heft 7, S. 3–5. Weber, Hermann/Weber, Gerda: Leben nach dem Prinzip „links“. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten, Berlin 2008. Weber, Marianne: Die besonderen Kulturaufgaben der Frau, in: dies.: Frauenfragen und Frauengedanken, Tübingen 1919, S. 238–261. Weinschenk, Harry E.: Erna Sack sang für Deutschland, in: Stimme der Frau, 2. Jg., (1949/50), Heft 2, S. 17. Wege, Lotte: Es wartete Penelope, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 8/9. Weiss, Albert Maria: Apologie des Christenthums, Bd. 1: Erst Mensch, dann Christ und so ein ganzer Mensch, Freiburg 1880. Weitsch, Eduard: Zur Sozialisierung des Geistes. Grundlagen und Richtlinien für die deutschen Volkshochschulen, Jena 1919. Westerkamp, Alix: IV. Internationale Settlement-Konferenz. Veranstaltet von der internationalen Settlement-Vereinigung vom 16. bis 20. Juli 1932 in der Siedlung Ulmenhof der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin Ost, Berlin 1932. Dies.: Geschichte der Settlementbewegung in Deutschland, in: Soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost E.V. (Hrsg.): Nachbarschaftssiedlung in der Großstadt. Grundsätzliches aus der Arbeit der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, Berlin 1929, S. 6–28. Wetekam, Robert: Wethen, Waldeck in Hessen, Arolsen 1960 (Waldeckische Ortssippenbücher, Bd. 8), Auszug auf: http://www.wethen.de/sippentw.htm, am 15.05.2014. Wiese, Eberhard von: Die Präsidentin regiert. Männer „in gelöster Haltung“, in: Hamburger Abendblatt, Nr. 109, 12./13.05.1951, S. 11. Windisch, Hans: Führer und Verführte. Totentanz und Wiedergeburt. Eine Analyse deutschen Schicksals, Seebruck 1946. Wöttke, Joachim: Leserbrief. Ein prägnanter Fall, in: Hannoversche Presse, 25.02.1961. Wolf, Herbert: Mit seinen Augen, Herbert Wolf über Theanolte Bähnisch, in: Stimme der Frau, 1. Jg. (1948/49), Heft 1, S. 3. Wolle, Waldemar/Wolle-Egenolf, Hildegard/Vorstand des Deutschen Frauenringes (Hrsg.): Denkschrift des Deutschen Frauenringes zum Kabinettsentwurf eines Gesetzes über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts und über die Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiet des Familienrechts, Berlin 23.12.1952. Wollenweber, Horst: Friedrich Siegmund-Schultze und die Volksbildungsarbeit der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, in: Delfs, Hermann (Hrsg.): Aktiver Friede. Gedenkschrift für Friedrich Siegmund-Schultze (1885–1969), Soest 1972, S. 261–274. Zahn-Harnack, Agnes von: Schlußbericht über die Arbeit des Bundes Deutscher Frauenvereine, in: Die Frau, 40. Jg. (1933), S. 551–555.
Quellen und Literatur | 1101
Dies.: Die Frauenbewegung. Geschichte, Probleme, Ziele, Berlin 1928. Zuhorn, Wilhelm: Die Gesellschaft Harmonie zu Warendorf. Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Gesellschaft am 06. Januar 1910, Warendorf 1910. Ders.: Die Gesellschaft Harmonie, in: ders.: Die Gesellschaft Harmonie, Warendorf 1910, S. 117–139. Zwei gesunde Arme, Leserinnenzuschrift von Anneliese Rick, Rubrik: Wir haben es geschafft, in: Stimme der Frau, 2. Jg. (1949/50), Heft 3, S. 22.
1102 | Theanolte Bähnisch
SEKUNDÄRLITERATUR UND HILFSMITTEL 750 Jahre Frauen und Hannover e. V. (Hrsg.): …den Kopf noch fest auf dem Hals. Frauen in Hannover 1945–1948, Hannover 1994. Albrecht, Thomas: Für eine wehrhafte Demokratie. Albert Grzesinski und die preußische Politik in der Weimarer Republik, Bonn 1999. Alemann, Ulrich von: Verbändestaat oder Staatsverbände? Die Bundesrepublik auf dem Weg vom Pluralismus zum neuen Korporatismus, in: Die Zeit, Nr. 39, 19.09.1980, S. 16. Alexander, Thomas: Carl Severing. Sozialdemokrat aus Westfalen mit preussischen Tugenden, Bielefeld 1992. Alice-Salomon-Hochschule, auf: http://www.ash-berlin.eu/, am 13.12.2013. Alkemeyer, Thomas/Budde, Gunilla/Feist, Dagmar (Hrsg.): Selbst-Bildungen: Soziale und kulturelle Praktiken der Subjektivierung, Bielefeld 2013. Allen, Ann Taylor: Feminismus und Mütterlichkeit in Deutschland, 1800-1914, Weinheim 2000. Amos, Heike: Vertriebenenverbände im Fadenkreuz. Aktivitäten der DDR-Staatssicherheit 1949–1989, München 2011. Angster, Julia: Konsenskapitalismus und Sozialdemokratie. Die Westernisierung von SPD und DGB, München 2003. Archiv für Erwachsenenbildung, Oldenburg: Informationsblatt zum Nachlaß von Dr. Paul Steinmetz, auf: http://www.ibe.uni-oldenburg.de/archiv/archivbestaende/ abstracts/nachlass_steinmetz.pdf, am 30.11.2013. Art.: „Bähnisch, Dorothea (Theanolte)“, in: Lexikon der Frau, Bd. 1, Zürich 1953. Art.:“Bähnisch, Theanolte“, in: Deutsche Biographische Enzyklopädie, Bd. 1, München 1995. Art. „Baeyer, von, Wanda Marie“, in: Degeners Wer ist’s?, 12. Ausgabe, Berlin 1955. Art. „Bürokratie“, in: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, Bd. 2, Hamburg, 1995, Sp. 405–430. Art. „Dorothea Bähnisch“ in: Internationales Biographisches Archiv, 29.07.1961, Sp. 2882. Art. „Dr. Hannah Vogt“, auf: KZ Gedenkstätte Moringen, Geschichte, http://www.gedenkstaette-moringen.de/geschichte/maenner/schutzhaft/schutz haft.html, am 13.12.2013. Art. „Durand-Wever, Anne-Marie“, in: Internationales Biographisches Archiv 36/1971, auf: Munzinger Online/Personen, http://www.munzinger.de/document/ 00000001632, am 13.12.2013. Art. „Ernst Rosenfeld“, in: Internationales Biographisches Archiv, 36/1952, auf: Munzinger Online/Personen, http://www.munzinger.de/search/portrait/Ernst+ Rosenfeld/0/3875.html, am 15.05.2014. Art. „Freda Wuesthoff“ in: Wikipedia, auf: http://de.wikipedia.org/wiki/Freda_ Wuesthoff, am 05.08.2009. Art. „Guske, Wilhelm/1880–1957“, in: Rheinland-Pfälzische Personendatenbank, auf: http://www.rlb.de/cgi-bin/wwwalleg/srchrnam.pl?db=rnam&recnums=0000 748, am 24.10.2013.
Quellen und Literatur | 1103
Art. „Godehard Ebers“, in: Rektorenporträts, Universität zu Köln, auf: http://rektorenportraits.uni-koeln.de/rektoren/godehard_ebers/, am 15.05.2014. Art. „Jacobi, Lotte“, in: The Oxford Companion to the Photograph, Oxford 2005, S. 327. Art. „Haltung, f“, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Bd. 10, Sp. 303–306. Digitalisierte Version auf: http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle =DWB&mode=Vernetzung&lemid=GH01626, am 24.10.2013. Art. „Hollander, Walther von“, in: Internationales Biographisches Archiv 50/1973, auf: Munzinger Online/Personen: http://www.munzinger.de/document/0000000 4433, am 16.11.2012. Art. „Karsten, Dorothea“, in: Internationales Biographisches Archiv 06/1956, auf: Munzinger Onli-ne/Personen: http://www.munzinger.de/document/00000007006, am 13.12.2013. Art. „Kraemer, Charlotte“, in: Degeners Wer ist’s, 10. Ausgabe, Berlin 1935. Art. „Ludwig Ey“, in: Hannoversches biographisches Lexikon: von den Anfängen bis in die Gegenwart, Hannover 2002, S. 112/113. Art. „Lüders, Marie-Elisabeth“ in: LEMO, auf: http://www.dhm.de/lemo/html/ biografien/LuedersMarie/index.html, am 13.12.2013. Art. „Mahla, Elisabeth“, in: Carl, Victor: Pfälzer Persönlichkeiten, Edenkoben 1995, abgerufen über WBIS, DBA, 3, Fiche Nr. 0591, S. 320. Art. „Mayer-Katz, Leonore“, in: Koether, F. (Hrsg.): Kenner, Köpfe und Karrieren. Biographien führender Persönlichkeiten der deutschen Papierwirtschaft“, abgerufen über WBIS, DBA, 3, Fiche Nr. 0608, S. 202–206. Art. „Mennicke, August Carl (1887–1959)“, in: Biografisch Woordenboek van Nederland:1880-2000, auf: Historici.nl, http://www.historici.nl/Onderzoek/ Projecten/BWN/lemmata/bwn5/mennicke, am 12.11.2013. Art. „Nolte, Otto“, in: Wer ist wer, Berlin 1958, S. 926. Art. „Nolte, Otto“, in: Wer ist’s, Berlin 1955, S. 860. Art. „Oppenheimer(-Bluhm), Hilde“, in: Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik online, auf: http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/0000/ adr/adrmr/kap1_3/para2_24.html, 15.05.2014. Art. „Pannhoff, Maria“, in: Vierhaus, Rudolf/Herbst, Ludolf (Hrsg.): Biographisches Handbuch der Mitglieder des Deutschen Bundestages 1949–2002, Band 2, N–Z, München 2002, S. 630. Art. „Plenge, Johann“, in: Internationales Soziologenlexikon, 2. Aufl., Bd. 1, 1980, S. 198–200. Art. „Rentmeister, Maria“, in: Müller-Enbergs, Helmut/Wielgohs, Jan/Hoffmann, Dieter (Hrsg.): Wer war wer in der DDR? Ein biographisches Lexikon, Sonderausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2000, S. 695. Art. „Sommer, Friedr. Ludw. Robert“, in: Wer ist’s? Unsere Zeitgenossen, 10. Ausg., Berlin 1935. Art.: „Theanolte Bähnisch“, in: Köpfe der Politik, Wirtschaft, Kunst u. Wissenschaft, Augsburg 1953, S. 53. Art. „Tilla Durieux“, auf: LEMO/Lebendiges virtuelles Museum online, Deutsches Historisches Museum, auf: http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/Durieux Tilla/, am 20.09.2013.
1104 | Theanolte Bähnisch
Art. "Troeger, Heinrich", in: Internationales Biographisches Archiv 01/1976, auf: Munzinger Online/Personen, http://www.munzinger.de/document/00000001532, am 21.10.2013. Art. „Walter Ritter von Baeyer (1904–1987)“, in: Hippies, Hans/Holdorff, Bernd/Schliack, Hans (Hrsg.): Nervenärzte, Bd. 2, Biographien, Stuttgart 2006, S. 19–28. Art. „Weiterer, Maria“, in: Biographische Datenbanken, auf Bundesstiftung Aufarbeitung, http://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-% 2363%3B-1424.html?ID=3755, am 01.02.2014. Art. „westlich(t)“, in: Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, 16 Bde. in 32 Teilbänden, Leipzig 1854–1961, online Ausgabe, auf: http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=westlicht, am 04.08.2014. Art. „Wilhelm Ellinghaus“, in: Internationales Biographisches Archiv 42/1961, auf: Munzinger Online/Personen: http://www.munzinger.de/document/00000004771, am 13.12.2013. Art. „Wolff, Martin“, in: Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, Bd. 2, WBIS online, Zugang über die Universitätsbibliothek Kassel/DBIS. Art. „Wuesthoff, Freda“, in: Juristinnen. Lexikon zu Leben und Werk, Baden-Baden 2005, S. 439–443. Art. „Wuesthoff, Freda“, in: Scheibmayer, Erich: Wer? Wann? Wo?. Persönlichkeiten in Münchner Friedhöfen, München 1989. Asendorf, Manfred/Müller, Achatz von/Flemming, Jens (Hrsg.): Geschichte. Lexikon der wissenschaftlichen Grundbegriffe, Hamburg 1994. Assmann, Alaida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 2009, S. 15, 27–29. Ayaß, Wolfgang: Rezension zu: Willing, Matthias: Das Bewahrungsgesetz. Eine rechtshistorische Studie zur Geschichte der deutschen Fürsorge. Tübingen 2003, in: H-Soz-u-Kult, 26.01.2004, auf: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/ rezensionen/2004-1-045. Aust, Stefan/Burgdorff, Stephan (Hrsg.): Die Flucht. Über die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten, Bonn 2003. Ausubel, David P.: The Psychology of Meaningful Verbal Learning, New York 1963. Bachmann-Medicks, Doris: Cultural Turns, Version: 1.0, in: DocupediaZeitgeschichte, 29.03.2010, auf: http://docupedia.de/zg/Cultural_Turns, am 13.12.2013. Bade, Klaus/Oltmer, Jochen (Hrsg.): Normalfall Migration: Texte zur Einwandererbevölkerung und neue Zuwanderung im vereinigten Deutschland seit 1990, Bonn 2004. Bahr, Andrea: Tagungsbericht Staatliche Mittelinstanzen in Europa nach 1945 – Machtkonstellationen und Planungskulturen, Berlin, 22.11.2013, in: H-Soz-uKult, 28.03.2014, auf: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/ id=5283. Bake, Rita: Olga Essig, in: Frauenbiografien, auf: www.hamburg.de, http://www. hamburg.de/clp/frauenbiografien-suche/clp1/hamburgde/onepage.php?BIOID= 3976&ortsteil=11, am 13.12.2013.
Quellen und Literatur | 1105
Barclay, David: Schaut auf diese Stadt. Der unbekannte Ernst Reuter, Berlin 2000. Bayrischer Rundfunk, Historisches Archiv (Hrsg.)/Lindmeyer Sebastian (Bearb.): Findbuch Hörmanuskripte, o. O., 2006. Bauer, Gisa: Kulturprotestantismus und frühe Bürgerliche Frauenbewegung. Agnes von Zahn-Harnack (1884–1950), Leipzig 2006. Becker, Nicola: Rezension zu: Depkat, Volker: Lebenswenden und Zeitenwenden. Deutsche Politiker und die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, München 2007, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 7/8, auf: http://www.sehepunkte.de/2011/07/ Beer, Mathias: Die Entwicklung der Gaswagen beim Mord an den Juden, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 35. Jg. (1987), S. 402–417. Benz, Ute (Hrsg.): Frauen im Nationalsozialismus, Dokumente und Zeugnisse, 2. Aufl., München 1997. Benz, Wolfgang: Deutschland unter alliierter Besatzung 1945–1949 (Gebhard: Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 22), 10. Aufl., Stuttgart 2009. Ders.: Zum Umgang mit nationalsozialistischer Vergangenheit in der Bundesrepublik, in: Danyel, Jürgen (Hrsg.): Die geteilte Vergangenheit. Zum Umgang mit Nationalsozialismus und Widerstand in beiden deutschen Staaten, Berlin 1995, S. 47–60. Berger, Peter/Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt a. M. 1980. Berndt, Christian: SWR2 Zeitwort, 15.06.2009, 6.45 Uhr, 15.06.1928: Der Regisseur Erwin Piscator gibt das Theater am Nollendorfplatz in Berlin auf, auf: http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/zeitwort/-/id=4833930/property= download/nid=660694/1wxkxb6/swr2-zeitwort-20090615.pdf, am 03.07.2009. Bernhard, Hans-Michael: Voraussetzungen, Struktur und Funktion von Feindbildern, in: Jahr, Christoph/Mai, Uwe/Roller, Kathrin (Hrsg.): Feindbilder in der deutschen Geschichte. Studien zur Vorurteilsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 1994, S. 9–24. Berthold, Günther: Freda Wuesthoff. Eine Faszination, Freiburg im Breisgau 1982 [2. Aufl. Stuttgart 1984]. Biedermann, Edwin: Logen, Clubs und Bruderschaften, 2. Aufl., Düsseldorf 2007. Bihler, Michael: Stadt, Zivilgesellschaft und öffentlicher Raum. Das Beispiel Berlin Mitte, Münster 2004. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon [BBKL], 34 Bd., Bd. 1–18 [1957– 2001], Herzberg, Bd. 19–34 [2001–2013] Nordhausen. Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, 3 Bd., München u. a. 1980–1993. Birke, Adolf M./Booms, Hans/Merker, Otto: Akten der britischen Militärregierung in Deutschland, Sachinventar 1945, 7 Bd., München u. a. 1993. Blair-Brysac, Sherin: Resisting Hitler: Mildred Harnack and the Red Orchestra, Oxford 2000. Blatz, Beate: Margarethe Daasch (1908–1993), in: Mager, Inge (Hrsg.): Frauenprofile des Luthertums. Lebensgeschichten im 20. Jahrhundert, Gütersloh 2005, S. 558–570. Blazek, Mathias: Von der Landdrostey zur Bezirksregierung. Die Geschichte der Bezirksregierung Hannover im Spiegel der Verwaltungsreformen, Stuttgart 2004. Bleuel, Hans-Peter: Feindbilder, oder: Wie man Kriege vorbereitet, Göttingen 1985.
1106 | Theanolte Bähnisch
Bloch, Max: Albert Südekum (1871–1944). Ein deutscher Sozialdemokrat zwischen Kaiserreich und Diktatur. Eine politische Biographie, Düsseldorf 2009. Bochtler, Anja, Dauerthema Gleichberechtigung. 60 Jahre Deutscher Frauenring. Die Freiburger Vereinigung gehört zu den erfolgreichsten, in: Badische Zeitung, 21.12.2009, online auf: http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/dauerthemagleichberechtigung--24479682.html, am 13.12.2013. Bock, Hans-Manfred: Anarchosyndikalismus in Deutschland. Eine Zwischenbilanz, in: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Heft 3/1989, S. 293–358. Bödeker, Erich (Hrsg.): Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte, Metapherngeschichte, Göttingen 2002. Ders.: Reflexionen über Begriffgeschichte als Methode, in: ders.: Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte, Metapherngeschichte, Göttingen 2002, S. 73–121. Boehling, Rebecca: Die amerikanische Kulturpolitik 1945–1949, in: Junker, Detlef u. a. (Hrsg.): Die USA und Deutschland im Zeitalter des Kalten Krieges 1945–1990, Bd. 1: 1945–1968, München 2001, S. 592–600. Dies.: Geschlechterpolitik in der US-Besatzungszone unter besonderer Berücksichtigung der Kommunalpolitik, in: Clemens, Gabriele (Hrsg.): Kulturpolitik im besetzten Deutschland 1945–1949, Stuttgart 1994, S. 69–82. Dies.: „Mütter“ in die Politik: Amerikanische Demokratisierungsbestrebungen nach 1945. Eine Antwort auf Hermann-Josef Rupieper, in: Geschichte und Gesellschaft, 19. Jg. (1993), S. 522–529. Böke, Karin/Liedtke, Frank/Wengeler, Martin (Hrsg.): Politische Leitvokabeln in der Ära Adenauer, Berlin/New York 1996. Böttcher, Dirk u. a. (Hrsg.): Hannoversches Biographisches Lexikon, Hannover 2002. Boetticher, Karl: Porträt: Werner Schulz. Engagierter Handelsherr, in: Die Zeit, 11.01.1965. Boll, Friedhelm: Auf der Suche nach Demokratie. Britische und deutsche Jugendinitiativen in Niedersachsen nach 1945, Bonn 1995. Bopf, Britta: „Arisierung“ in Köln. Die wirtschaftliche Existenzvernichtung der Juden 1933–1945, Köln 2004. Borg, Erik: Gramsci Global? Transnationale Hegemoniebildung aus der Perspektive der Internationalen Politischen Ökonomie, in: Das Argument, Nr. 239 (2001), S. 67–78. Ders.: Steinbruch Gramsci. Hegemonie im internationalen politischen System, in: Sozialistische Positionen. Beiträge zu Politik, Kultur und Gesellschaft, 10/2001, auf: http://www.sopos.org/aufsaetze/3bbdcd9ea0c9f/1.phtml, am 13.01.2014. Borgmann, Grete: Freiburg und die Frauenbewegung, Ettenheim 1973. Botz, Gerhard: Opfer/Täter-Diskurse. Zur Problematik des Opfer-Begriffs, in: Diendorfer, Gertraud u. a. (Hrsg.): Zeitgeschichte im Wandel, Innsbruck/Wien 1997, S. 223–236. die Bouillot, Corinne: „Im Osten wird stark um politische Seele der Frau gerungen“. Frauenorganisationen und parteipolitische Strategien in der SBZ und frühen DDR, in: Ariadne, 16. Jg. (2001), Heft 40, S. 46–51. Bouillot, Corinne/Schüller, Elke: „Eine machtvolle Frauenorganisation“ – oder: „Der Schwamm, der die Frauen aufsaugen soll.“ Ein deutsch-deutscher Vergleich der
Quellen und Literatur | 1107
Frauenzusammenschlüsse in der Nachkriegszeit, in: Ariadne, 10. Jg. (1995), Heft 27, S. 47–55. Bourdieu, Pierre: Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital, in: Baumgart, Franzjörg (Hrsg.): Theorien der Sozialisation, Bad Heilbrunn 1997, S. 217–231. Ders.: Die biographische Illusion, in: Bios, 1990, Heft 1, S. 75–81. BPB. Bundeszentrale für politische Bildung, auf: http://www.bpb.de/ Brandt, Willy/Löwenthal, Richard: Ernst Reuter. Ein Leben für die Freiheit. Eine politische Biographie, München 1957. Brant, Bastian: Art. „Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf“, in: Kindlers Literaturlexikon, CD-Rom, 2000. Braun, Annegret: Frauenfunk und Frauenalltag von 1945 bis 1968. Zeitgeschichte aus der Perspektive von Frauen, in: Behmer, Markus/Hasselbring, Bettina (Hrsg.): Radiotage, Fernsehjahre: Studien zur Rundfunkgeschichte nach 1945, Münster 2006, S. 163–178. Brechtken, Magnus (Hrsg.): Life Writing and Political Memoir – Lebenszeugnisse und Politische Memoiren, Göttingen 2012. Brelie-Lewien, Doris von der/Grebing, Helga: Flüchtlinge in Niedersachsen, in: Hucker, Bernd-Ulrich/Schubert, Ernst/Weisbrod (Hrsg.): Niedersächsische Geschichte, Göttingen, 1997, S. 619–634. Breuer, Stefan: Anatomie der Konservativen Revolution, Darmstadt 1993. Ders.: Die „Konservative Revolution“ – Kritik eines Mythos, in: Politische Vierteljahresschrift, 31. Jg. (1990), S. 585–607. Brinkmann, Hans: Braune Flecken trüben den Blick auf Kopf, in: Kreiszeitung.de, 17.01.12, auf: http://www.kreiszeitung.de/nachrichten/lokales/niedersachsen/ braune-flecken-trueben-blick-kopf-1564989.html, am 13.12.2013. Bröckling, Ulrich: „Die perfekte Biographie gibt es nicht!“, in: Tageszeitung (TAZ), 31.12.2009, auf: http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel /?ressort=sw&dig=2009/12/31/a0129, am 04.08.2014. Ders.: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt 2007. Brückweh, Kerstin: Mordlust. Serienmorde, Gewalt und Emotionen im 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2006. Brüning, Jens: Nachwort, in: ders.: (Hrsg.): Gabriele Tergit. Frauen und andere Ereignisse. Publizistik und Erzählungen von 1915 bis 1970, S. 213–217. Brunn, Gerhard: Die Europäische Einigung von 1945 bis heute, Bonn 2004. Bude, Heinz: Rekonstruktion von Lebenskonstruktion – eine Antwort auf die Frage, was die Biographieforschung wirklich bringt, in: Kohli, Martin/Roberts, Günter (Hrsg.): Biographie und soziale Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven, Stuttgart 1984, S. 7–28. Budde, Gunilla-Friederike: Zwischen den Stühlen. ‚Die Frau von heute‘ und ‚Für Dich‘ in den fünfziger und sechziger Jahren, in: Barck, Simone/Langermann, Martina/Lokatis, Siegfried (Hrsg.): Zwischen „Mosaik“ und „Einheit“. Zeitschriften in der DDR, Berlin 1999, S. 129–137. Dies. (Hrsg.): Frauen arbeiten. Weibliche Erwerbstätigkeit in Ost- und Westdeutschland nach 1945, Göttingen 1997. Dies.: „Tüchtige Traktoristinnen“ und „schicke Stenotypistinnen“. Frauenbilder in den deutschen Nachkriegsgesellschaften – Tendenzen der „Sowjetisierung“ und
1108 | Theanolte Bähnisch
„Amerikanisierung“?, in: Jarausch, Konrad/Siegrist, Hannes (Hrsg.): Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945–1970, Frankfurt a. M./New York 1997, S. 243–273. Buder, Johannes: Die Reorganisation der preußischen Polizei 1918–1923, Frankfurt a. M. 1986. Bühler, Grit: Mythos Gleichberechtigung in der DDR – Politische Partizipation von Frauen am Beispiel des Demokratischen Frauenbunds Deutschlands, Frankfurt/New York 1997. Büsch, Otto: Berliner Demokratie. 1919 – 1933, Berlin 1987. Bundesarchiv (Hrsg.): Findbuch Reichsschrifttumskammer, R 56 V, bearb. v. Wolfram Werner und Tim Storch, Koblenz 1987 (2006), auf: http://www. argus.bundesarchiv.de/R56V-18940/rightframe.htm?vid=R56V-18940, am 21.10. 2013. Bundesarchiv, Kabinettsprotokolle 1949, Quellenlage, auf: http://www.bundesarchiv. de/cocoon/barch/1000/k/k1949k/kap1_1/para2_1.html;jsessionid=8684D598C24 A7631D45FA44D61266560?highlight=true&search=Hans%20Lukaschek&stem ming=false&field=all, am 20.07.2012. Burkhardt, Kai: Adolf Grimme (1889–1963). Eine Biografie, Köln 2007, S. 275. Ders.: Hörbares Schweigen: Brechtken, Magnus (Hrsg.): Life Writing and Political Memoir – Lebenszeugnisse und Politische Memoiren, Göttingen 2012, S. 79– 106. Buschfort, Wolfgang: Fritz Tejessy (1895–1964). Verfassungsschützer aus demokratischer Überzeugung, in: Krüger, Dieter/Wagner, Arnim (Hrsg.): Konspiration als Beruf. Deutsche Geheimdienstchefs im Kalten Krieg, Berlin 2003, S. 111–131. Bussfeld, Barbara (Bearb.)/Hessische Landesregierung (Hrsg.): „Ein Glücksfall für die Demokratie“. Elisabeth Selbert (1896–1986). Die große Anwältin der Gleichberechtigung, Frankfurt a. M. 1999. Bussiek, Dagmar: Rezension zu: Holz, Petra: Zwischen Tradition und Emanzipation. Politikerinnen in der CDU in der Zeit von 1945 bis 1957, Königstein 2005, auf: H-soz-u-Kult, 20.01.2005, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/ 2005-1-050. Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt/New York 1990. Dies.: Körper von Gewicht, Berlin 1997. Ciupke, Paul: Friedrich Siegmund-Schultze und die Volksbildung der Weimarer Zeit, in: Tenorth, Heinz-Elmar (Hrsg.): Friedrich Siegmund-Schultze (1885–1969). Ein Leben für Kirche, Wissenschaft und soziale Arbeit, Berlin 2007, S. 85–101. Ders./Derichs-Kunstmann, Karen (Hrsg.): Zwischen Emanzipation und „besonderer Kulturaufgabe der Frau“: Frauenbildung in der Geschichte der Erwachsenenbildung, Essen 2001. Ders.: „Was gibt das Volkshochschulheim?“ Die bildungstheoretischen Grundlagen von Weitschs andragogischer Arbeit – eine Annäherung auf Nebenwegen, in: ders./Jelich, Franz-Josef (Hrsg.): Experimentiersozietas Dreißigacker, Essen 1997, S. 69–84. Ders./Jelich, Franz-Josef (Hrsg.): Ein neuer Anfang. Politische Jugend- und Erwachsenenbildung in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, Essen 1999. Dies. (Hrsg.): Experimentiersozietas Dreißigacker, Essen 1997.p
Quellen und Literatur | 1109
Clemens, Bärbel: Wir Frauen müssen ein kluges Herz haben, in: Schröder, Hiltrud: Sophie und Co. Bedeutende Frauen in Hannover, Hannover 2002, S. 201–213. Clemens, Gabriele: Britische Kulturpolitik in Deutschland 1945–1949. Literatur, Film, Musik und Theater, Stuttgart 1997. Dies. (Hrsg.): Kulturpolitik im besetzten Deutschland 1945–1949, Stuttgart 1994. Conze, Vanessa: Abendland, in: Leibniz Institute of European History (IEG) (Hrsg.): European History Online (EG0), Mainz, 03.09.2012, auf: http://www.iegego.eu/conzev-2012-de URN: urn:nbn:de:0159-2012030759 [YYYY-MM-DD], am 13.12.2013. Dies.: Das Europa der Deutschen. Ideen von Europa in Deutschland zwischen Reichstradition und Westorientierung (1920–1970), München 2005. Cox, Robert W: Labor and Hegemony, in: International Organization, Bd. 31. (1977) Heft 3, S. 385–424. Damm-Feldmann, Friderike: Die Entwicklung des Frauenanteils. Teil 1: Studierendenzahlen, Studienabschlüsse, Promotionen, in: Happ, Sabine/Jüttemann, Veronika (Hrsg.): „Laßt sie doch denken!“ 100 Jahre Studium für Frauen in Münster, Münster 2008, S. 43–52. Dams, Carsten: Staatsschutz in der Weimarer Republik. Die Überwachung und Bekämpfung der NSDAP durch die preußische politische Polizei von 1928 bis 1932, Marburg 2002. Daners, Hermann: „Ab nach Brauweiler…!“. Nutzung der Abtei Brauweiler als Arbeitsanstalt, Gestapogefängnis, Landeskrankenhaus…, Pulheim 1996. Daniela Gasteiger [Profil], M. A., Projekt [Beschreibung des Dissertationsprojekts] auf der Homepage der LMU München, http://www.promohist.geschichte.unimuenchen.de/personen/doktorandinnen/gasteiger/index.html, am 13.03.2014. Daniel, Ute: Clio unter Kulturschock. Zu den aktuellen Debatten der Geschichtswissenschaft. Teil I, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 48. Jg. (1997), S. 195–278. Danyel, Jürgen: Die Rote Kapelle innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung, in: Coppi junior, Hans/Danyel, Jürgen/Tuchel, Johannes (Hrsg.): Die Rote Kapelle im Widerstand gegen Hitler, Berlin 1992, S. 12-38. Dausien, Bettina: Biographie und Geschlecht. Zur biographischen Konstruktion sozialer Wirklichkeit in Frauenlebensgeschichten, Bremen 1996. Degeners Wer ist’s, Berlin 1935. Delfs, Hermann (Hrsg.): Aktiver Friede. Gedenkschrift für Friedrich SiegmundSchultze (1885–1969), Soest 1972. Depkat, Volker: Entwürfe politischer Bürgerlichkeit und die Krisensignatur des 20. Jahrhunderts, in: Budde, Gunilla-Friederike/Conze, Eckhardt/Rauh, Cornelia (Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter. Leitbilder und Praxis seit 1945, Göttingen 2010, S. 101–116. Ders.: Lebenswenden und Zeitenwenden. Deutsche Politiker und die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, München 2007. Ders./Graglia, Piero (Hrsg.): Entscheidung für Europa. Erfahrung, Zeitgeist und politische Heraus-forderungen am Beginn der europäischen Integration, Berlin/New York 2010. Dertinger, Antje: Marie Juchacz, in: Schneider, Dieter (Hrsg.): Sie waren die ersten. Frauen in der Arbeiterbewegung, Frankfurt a. M. 1988, S. 211–230.
1110 | Theanolte Bähnisch
Dies.: Die bessere Hälfte kämpft um ihr Recht: Der Anspruch der Frauen auf Erwerb und Selbständigkeit, Köln 1980. Detailansicht der Abgeordneten Anne Franken, auf: Landtag NRW, http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/Abgeordnete/Ehe malige_Abgeordnete/details.jsp?k=00371, am 20.01.2014. Deutsche Biographische Enzyklopädie online, Berlin/New York 2006, Zugang über DBIS der Universität Kassel. Deutscher Frauenring, Ortsring Oldenburg (Hrsg.): Deutscher Frauenring, Ortsring Oldenburg e. V., Isensee 1997. Dickmann, Fritz: Die Regierungsbildung in Thüringen als Modell der Machtergreifung. Ein Brief Hitlers aus dem Jahre 1930, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 14. Jg. (1966), S. 454–464. Dittrich, Marcus: Bündeln & Lenken. Das Regierungspräsidium Kassel zwischen Verwalten und Gestalten, Kassel 2008. Doering-Manteuffel, Anselm: Amerikanisierung und Westernisierung, Version: 1.0, in: Docupedia Zeitgeschichte, 18.01.2011, auf: http://docupedia.de/zg/ Amerikanisierung_und_Westernisierung, am 30.07.2014. Ders.: Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert, Göttingen 1999. Dölling, Irene: Gespaltenes Bewußtsein – Frauen- und Männerbilder in der DDR, in: Helwig, Gisela/Nickel, Hildegard Maria: Frauen in Deutschland 1945–1992, Bonn 1993, S. 23–52. Dörr, Margarete: Wer die Zeit nicht miterlebt hat. Frauenerfahrungen im zweiten Weltkrieg und danach, Bd. 3: Das Verhältnis zum Nationalsozialismus und zum Krieg, Frankfurt a. M. 1998. Dohse, Rainer: Der dritte Weg. Neutralitätsbestrebungen in Westdeutschland zwischen 1945 und 1955, Hamburg 1974. Dreist, Markus (Hrsg.): Die Düsseldorfer Bezirksregierung zwischen Demokratisierung, Nazifizierung und Entnazifizierung. Eine staatliche Mittelbehörde an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik, Essen 2003. Drohsel, Petra: Die Entlohnung der Frau nach 1945, in: Freier, Anna-Elisabeth/Kuhn, Annette: Frauen in der Geschichte V: „Das Schicksal Deutschlands liegt in der Hand seiner Frauen“ – Frauen in der deutschen Nachkriegsgeschichte, Düsseldorf 1984, Düsseldorf 1984, S. 202–230. Drummer, Heike/Zwilling, Jutta: Elisabeth Selbert. Eine Biographie, in: Bussfeld, Barbara (Bearb.)/Hessische Landesregierung (Hrsg.): Ein Glücksfall für die Demokratie, Elisabeth Selbert (1896–1986). Die große Anwältin der Gleichberechtigung, 2. Aufl., Frankfurt a. M. 2008, S. 9–160. Dühlmeier, Bernd: Und die Schule bewegte sich doch. Unbekannte Reformpädagogen und ihre Projekte in der Nachkriegszeit, Hannover 2001. Düring, Marten/Euman, Ulrich: Diskussionsforum Historische Netzwerkforschung, in: Geschichte und Gesellschaft, 39. Jg. (2013), S. 369–390. Ders./Keyserlingk, Linda von: Netzwerkanalyse in den Geschichtswissenschaften. Historische Netzwerkanalyse als Methode für die Erforschung von historischen Prozessen, in: Schützeichel, Rainer/Jordan, Stefan (Hrsg): Prozesse, Formen, Dynamiken, Erklärungen, Wiesbaden 2012. Eckardt, Emmanuel: Kurt Ganske und seine Zeit, Hamburg 2005.
Quellen und Literatur | 1111
Ehni, Hans Peter: Bollwerk Preußen? Preußen-Regierung, Reich-Länder-Problem und die Sozialdemokratie 1928–1932, Bonn 1975. Eifert, Christiane: Deutsche Unternehmerinnen im 20. Jahrhundert, München 2011. Erdmann, Karl Dietrich/Schulze, Hagen (Hrsg.): Selbstpreisgabe einer Demokratie. Eine Bilanz heute, Düsseldorf 1980. Erich, Karin: Die Mitarbeit der Frau ist überall! Regierungspräsidentin Theanolte Bähnisch. Netzwerkerin für die Frauen, in: Niedersachsen vorwärts, März 2011. Eschenburg, Theodor: Deutsche Einheit verfehlt? Schon damals unüberbrückbare Gegensätze, Rezension zu: Wilhard Grünewald: Die Münchner Ministerpräsidentenkonferenz 1947. Anlaß und Scheitern eines gesamtdeutschen Unternehmens, Meisenheim 1972, in: Die Zeit, Nr. 51, 22.12.1972, auf: http://www.zeit.de/1972/ 51/deutsche-einheit-verfehlt, am 13.12.2013. Ders.: Herrschaft der Verbände, Stuttgart 1955. Eskildsen, Ute: Lotte Jacobi, in: Kaetzle, Hans-Michael (Hrsg.): Das Lexikon der Fotografen. 1900 bis heute, München o. J. [2002], S. 217/218. Esposito, Elena: Westlich vom Osten. Perspektivische Begriffe und Selbstbeschreibung der Gesellschaft, in: Schäfer, Alfred/Wimmer, Michael (Hrsg.): Identifikation und Repräsentation, Wiesbaden 1999, S. 129–149. Eßbach, Wolfgang: (Hrsg.): Plessners 'Grenzen der Gemeinschaft'. Eine Debatte, Frankfurt a. M. 2002. Etzemüller, Thomas: Biographien, Frankfurt a. M. 2012. Faber, Heiko: 100 Jahre Bezirksregierung Hannover, in: Die öffentliche Verwaltung, 38. Jg. (1985), Heft 23, S. 989–997. Faulenbach, Bernd: Erwachsenenbildung in der Weimarer Republik. Zur Ambivalenz einer Beziehung, in: Ciupke, Paul/Jelich, Franz-Josef (Hrsg.): Experimentiersozietas Dreißigacker, Essen 1997, S. 11–28. Faulstich, Peter/Zeuner, Christine (Hrsg.): Erwachsenenbildung, Weinheim 2010. Dies.: Erwachsenenbildung und soziales Engagement. Historisch-biografische Zugänge, Bielefeld 2001 Fechner, Frank: Leben auf dem Ulmenhof, in: Friedrich Siegmund-Schultze (1885– 1969). Ein Leben für Kirche, Wissenschaft und soziale Arbeit, Berlin 2007, S. 131–146. Feickert, Andreas: Heimvolkshochschule Jagdschloß Göhrde 1946–1971, Uelzen 1971. Feldmann, Reinhard (Hrsg.): 175 Jahre Regierungsbezirk Arnsberg. Streiflichter aus der Geschichte, Arnsberg 1991. Feldman, Gerald/Steinisch, Irmgard: Industrie und Gewerkschaften 1918–1924. Die überforderte Zentralarbeitsgemeinschaft, Stuttgart 1985. Feldmann-Neubert, Christine: Frauenleitbild im Wandel. Von der „Familienorientierung“ zur „Doppelrolle“, Weinheim 1991. Fels, Orla-Maria: „Theanolte Bähnisch“, in: Juristinnen in Deutschland, BadenBaden 2003, S. 209–212. Dies.: Theanolte Bähnisch, in: (Hrsg.:) Deutscher Juristinnenbund. Juristinnen in Deutschland. Die Zeit von 1900 bis 1998, 3. Aufl., Baden-Baden 1998, S. 197– 200. Dies.: Die deutsche bürgerliche Frauenbewegung als juristisches Phänomen, dargestellt an der Erscheinung Gertrud Bäumers, Freiburg i. Br. 1959.
1112 | Theanolte Bähnisch
Fetz, Bernhard/Huemer, Georg (Hrsg.): Theorie der Biographie. Grundlagentexte und Kommentar, Berlin 2011. Ders. (Hrsg.): Die Biographie. Zur Grundlegung ihrer Theorie, Berlin 2009. Feustel, Jan: Spaziergänge in Friedrichshain, Berlin 1994. Fischer, Georg: Wenn nur der leidige Respekt nicht wäre – Fragen zum Ende des Projekts Dreißigacker, in: Ciupke, Paul/Jelich, Franz-Josef: Experimentiersozietas Dreißigacker, Essen 1997, S. 201–219. Fleischer, Barbara: Immer die erste – Die Juristin Theanolte Bähnisch, in: dies.: Frauen an der Leine. Stadtspaziergang auf den Spuren berühmter Hannoveranerinnen, 2. Aufl., Berlin 2009, S. 105–121. Flemming, Jens: „Neue Frau“? Bilder, Projektionen, Realitäten, in: Faulstich, Werner (Hrsg.): Die Kultur der 20er Jahre, Göttingen 2008, S. 55–70. Ders.: Kulturgeschichte als Integrations- und Leitwissenschaft? Anmerkungen zu Verlauf und Ergebnissen einer deutschen Diskussion, in: Sturma, Dieter(Hrsg.): Kultur und Kulturwissenschaft, Lüneburg 1991, S. 8–23. Ders.: Die halbierte Revolution: Deutschland 1918–1920, in: Sozialwissenschaftliche Informationen für Unterricht und Studium, 8 Jg. (1979), S. 95–101. Ders./Krohn, Claus-Dieter/Stegmann, Dirk/Witt, Peter-Christian: Die Republik von Weimar, Bd. 2: Das sozialökonomische System, Königstein/Düsseldorf 1979. Foedrowitz, Michael: Bunkerwelten: Luftschutzanlagen in Norddeutschland, Berlin 1998. Fonk, Friedrich: Der Regierungspräsident und seine Behörde. Funktionen, Zuständigkeiten, Organisation, Berlin 1967. Foucault, Michel: Archäologie des Wissens, Frankfurt a. M. 1981. Frauenmuseum Bonn/Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Hrsg.): Schwestern zur Sonne zur Gleichheit: Wegmarken der Geschichte der SPD-Frauenpolitik, Bonn 2013. Freier, Anna-Elisabeth: Frauenfragen sind Lebensfragen. Über die naturwüchsige Deckung von Tagespolitik und Frauenpolitik nach dem zweiten Weltkrieg, in: Dies./Kuhn, Annette (Hrsg.): Frauen in der Geschichte V: „Das Schicksal Deutschlands liegt in der Hand seiner Frauen“ – Frauen in der deutschen Nachkriegsgeschichte, Düsseldorf 1984, S. 18–50. Freimüller, Tobias: Der versäumte Abschied von der Volksgemeinschaft. Psychoanalyse und „Vergangenheitsbewältigung“, in: Danyel, Jürgen/Kirsch, JanHolger/Sabrow, Martin (Hrsg.): 50 Klassiker der Zeitgeschichte, Göttingen 2007, S. 66–70. Freund, Nadine: „Mit Hut, Charme und Diplomatie.“ Zum Verhältnis von Weiblichkeit und Öffentlichkeit, Integration und Partizipation in der direkten Nachkriegszeit: Die Regierungspräsidentin Theanolte Bähnisch (1899–1973), in: Bussiek, Dagmar/Göbel, Simona (Hrsg.): Kultur, Politik und Öffentlichkeit. Festschrift für Jens Flemming, Kassel 2009, S. 446–464. Dies.: Theanolte Bähnisch (1899–1973) und ihr Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands im Rahmen der Westorientierung nach 1945, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 80. Jg. (2008), S. 403–430. Dies.: Der Kalte Krieg in der ‚Stimme der Frau‘. Eine Frauenzeitschrift im Kontext der Westintegration Deutschlands, Unveröffentlichte Magisterarbeit, Universität Kassel, 2005.
Quellen und Literatur | 1113
Dies./Wolff, Kerstin: „Um harte Kerne gegen den Kommunismus zu bilden...“ Die staatsbürgerliche Arbeit von Theanolte Bähnisch in der Zeitschrift „Die Stimme der Frau“, in: Ariadne, 19. Jg. (2004), Heft 44, S. 62–69. Frevert, Ute: Frauen-Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und neuer Weiblichkeit, Frankfurt a. M. 1986. Fuchs, Peter: 100 Jahre Kaufhof Köln 1891–1991, Köln 1991. Fuchs-Heinritz, Werner: Biographische Forschung. Eine Einführung in Praxis und Methoden, 4. Aufl., Wiesbaden 2009. Führer, Carl-Christian: „Kulturkrise“ und Nationalbewusstsein. Der Niedergang des Theaters in der späten Weimarer Republik als bürgerliche Identitätskrise, in: ders./Hagemann, Karen/Kundrus, Beate (Hrsg.): Eliten im Wandel. Gesellschaftliche Führungsschichten im 19. und 20. Jahrhundert, Münster 2004, S. 155–178. Fürmetz, Gerhard/Reinke, Herbert/Weinhauer, Klaus (Hrsg.): Nachkriegspolizei. Sicherheit und Ordnung in Ost- und Westdeutschland 1945–1955, Hamburg 2001. Füßl, Wilhelm: Zwischen Mythologisierung und Dekonstruktion, in: ders./Ittner, Stefan (Hrsg.): Biographie und Technikgeschichte (BIOS. Sonderheft Nr. 11/2008), Leverkusen 1999, S. 59–69. Fuhrmann, Horst: „Fern von gebildeten Menschen“. Eine oberschlesische Kleinstadt um 1870, München 1989. Gefängnishefte. Antonio Gramsci, hrsg. vom Deutschen Gramsci-Projekt unter der wiss. Leitung von Klaus Bochmann, Bd. 1–10, Hamburg 1991ff. Geppert, Alexander: Forschungstechnik oder historische Disziplin? Methodische Probleme der Oral History, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Bd. 45 (1994), Nr. 5, S. 303–323. Geppert, Dominik: Die Ära Adenauer, Darmstadt 2002. Gerhard, Ute: Frauenbewegung und Feminismus. Eine Geschichte seit 1789, München 2009. Dies.: Frauenbewegung, in: Roth, Roland/Rucht, Dieter (Hrsg.): Die sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945. Ein Handbuch, Frankfurt a. M./New York 2008, S. 187–217. Dies.: Unerhört. Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung, 3. Aufl., München 1992. Geisthövel, Alexa/Siebert, Ute/Finkbeiner, Sonja: „Menschenfischer.“ Über die Parallelen von innerer und äußerer Mission um 1900, in: Lindner, Rolf: „Wer in den Osten geht, geht in ein anderes Land“: Die Settlementbewegung in Berlin, Berlin 2007, S. 27-47. Genth, Renate u. a.: (Hrsg.): Frauenpolitik und politisches Wirken von Frauen im Berlin der Nachkriegszeit 1945 - 1949, Berlin 1996. Gerth, Franz-Jakob: Bahnbrechendes Modell einer neuen Gesellschaft, Hamburg 1975, S. 32. Ders.: Ansätze methodisch unterbauter Sozialarbeit, in: Delfs, Hermann: Aktiver Friede. Gedenkschrift für Friedrich Siegmund-Schultze (1885–1969), Soest 1972, S. 331–340.Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland, hrsg. von Otto Brunner, Werner Conze und Reinhart Koselleck, 8 Bd., 1972–1997. Gessner, Dieter: Die Weimarer Republik, Darmstadt 2002.
1114 | Theanolte Bähnisch
Gierke, Willi B./Loeber-Pautsch, Uta: Die pluralen Strukturen der Erwachsenenbildung: zur Geschichte der Erwachsenenbildung in Niedersachsen 1947–1960, online-Publikation 2001, auf: http://oops.uni-oldenburg.de/623/, am 14.01.2014. Gille, Karin: „Kennen Sie Herta Gotthelf?“. Eine Parteifunktionärin im Schatten von Elisabeth Selbert, in: Metis : Zeitschrift für historische Frauen- und Geschlechterforschung, 10. Jg. (2003), Heft 20, S. 48–65. [Erstabdruck in: Bartmann, Sylke/Gille, Karin/Haunss, Sebastian (Hrsg.): Kollektives Handeln: politische Mobilisierung zwischen Struktur und Identität; Beiträge der wissenschaftlichen Tagung der Promotionsstipendiatinnen und Promotionsstipendiaten der HansBöckler-Stiftung vom 20. bis 23. Mai 2001 in Oer-Erkenschwick, Düsseldorf 2002, S. 221–238.] Gille-Linne, Karin: Verdeckte Strategien: Herta Gotthelf, Elisabeth Selbert und die Frauenarbeit der SPD 1945–1949, Bonn 2012. Dies.: „Frauenrechtlerei“ und Sozialismus. Elisabeth Selbert und die sozialdemokratische Frauenpolitik in den westlichen Besatzungszonen, in: metis, 8. Jg. (1999), Heft 16, S. 22–32. Glaser, Edith/Herrmann, Ullrich: Konkurrenz und Dankbarkeit. Die ersten drei Jahrzehnte desFrauenstudiums im Spiegel von Lebenserinnerungen – am Beispiel der Universität Tübingen, in: Zeitschrift für Pädagogik, 34. Jg. (1988), Heft 2, S. 205-226. Glaser, Hermann: Deutsche Kultur: Ein historischer Überblick von 1945 bis zur Gegenwart, 2. Aufl., Bonn 2000. Götz, Volkmar: Polizei und Polizeirecht, in: Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 4: Das Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus, Stuttgart 1985, S. 397–420. Gohl, Christopher: Bürgergesellschaft als politische Zielperspektive, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6-7/2001. Gosewinkel, Dieter: Staatsbürgerschaft und Staatsangehörigkeit, in: Geschichte und Gesellschaft, 41. Jg. (1995), 533–556. Gradinger, Sebastian: Service Clubs – zur Institutionalisierung von Solidarität und Sozialkapital, Diss. Universität Trier 2005, auf: http://ubt.opus.hbz-nrw.de/voll texte/2006/374/, am 26.07.2009. Ders.: Service Clubs – zur Institutionalisierung von Solidarität und Sozialkapital, Saarbrücken 2007. Graf, Christoph: Kontinuitäten und Brüche. Von der politischen Polizei der Weimarer Republik zur Geheimen Staatspolizei, in: Paul, Gerhard/Mallmann, KlausMichael (Hrsg.): Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 1995. Ders.: Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur, Berlin 1983. Graf, Rüdiger: Either-Or: The Narrative of „Crisis“ in Weimar Germany and in Historiography, Cambridge 2010. Ders.: Die Zukunft der Weimarer Republik, Krisen und Zukunftsaneignungen in Deutschland 1918–1933, München 2008. Gräser, Marcus: Wohlfahrtsgesellschaft und Wohlfahrtsstaat: Bürgerliche Sozialreform und Welfare State Building in den USA und in Deutschland 1880–1940, Göttingen 2009.
Quellen und Literatur | 1115
Graml, Hermann: Die Alliierten in Deutschland, in: Institut für Zeitgeschichte (Hrsg.): Westdeutschlands Weg zur Bundesrepublik 1945–1949. Beiträge von Mitarbeitern des Instituts für Zeitgeschichte, München 1976, S. 25–52. Gramm, Erich: Die soziale Arbeitsgemeinschaft Ost, in: Foth, Heinrich (Hrsg.): Lebendige Ökumene. Festschrift für Friedrich Siegmund-Schultze zum 80. Geburtstag, Witten 1965, S. 84–118. Grassmann, Peter: Sozialdemokraten gegen Hitler, München 1976. Grebing, Helga: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Von der Revolution 1848 bis ins 21. Jahrhundert, Berlin 2007. Grebner, Susanne: Der Telegraf. Entstehung einer SPD-nahen Lizenzzeitung in Berlin 1946 bis 1950, Münster 2002. Griebel, Regina/Coburger, Marlies/Scheel, Heinrich: Erfasst? Das Gestapo-Album zur Roten Kapelle, Halle 1992. Grötecke, Johannes/Schattner, Thomas: Der Freiheit jüngstes Kind – 1968 in der Provinz. Spurensuche in Nordhessen, Marburg 2011. Groll, Kurt: Bedingungen demokratischer Kontrolle. Lehren aus den Polizeiausschüssen der britischen Zone, in: Bürgerrechte & Polizei/CILIP 67 (3/2000), auf: http://www.cilip.de/ausgabe/67/groll.htm, am 13.12.2013. Große Kracht, Klaus: Erich Klausener (1885–1934), Preußentum und Katholische Aktion zwischen Weimarer Republik und Dritten Reich, in: Faber, Richard/ Puschner, Uwe (Hrsg.): Preußische Katholiken und katholische Preußen im 20. Jahrhundert, Würzburg 2011, S. 271–296. Großkopf, Steffen: Persönlichkeit als pädagogischer Begriff des 20. Jahrhunderts – eine diskursanalytische Perspektive, in: Kenklies, Karsten (Hrsg.): Person und Pädagogik. Systematische und historische Zugänge zu einem Problemfeld, Kempten 2013, S. 13–28. Grotkopp, Jörg: Beamtentum und Staatsformwechsel. Die Auswirkungen der Staatsformwechsel von 1918, 1933 und 1945 auf das Beamtenrecht und die personelle Zusammensetzung der deutschen Beamtenschaft, Frankfurt a. M. u. a. 1992. Grotum: Thomas: Jugendliche Ordnungsstörer. Polizei und „Halbstarken“-Krawalle in Niedersachsen 1956–1959, in: Fürmetz, Gerhard/Reinke, Herbert/Weinhauer, Klaus (Hrsg.): Nachkriegspolizei. Sicherheit und Ordnung in Ost- und Westdeutschland 1945–1969, Hamburg 2001, S. 277–302. Grüttner, Michael/Kinas, Sven: Die Vertreibung von Wissenschaftlern aus den deutschen Universitäten 1933–1945, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 55. Jg. (2007), S. 123–186. Gruhn, Klaus (Hrsg.): Gymnasium Laurentianum Warendorf. Von der Lateinschule zum Gymnasium Laurentianum Warendorf, 1329–1979, Warendorf 1979. Grunder, Hans-Ulrich/Hoffman-Ocon, Andreas/Metz, Peter (Hrsg.): Netzwerke in bildungshistorischer Perspektive, Bad Heilbrunn 2013. Grundhöfer, Pia: Ausländerinnen reichen die Hand. Britische und amerikanische Frauenpolitik in Deutschland im Rahmen der demokratischen Re-education nach 1945, Hänsel-Hohenhausen 1999, zugl. Diss. Uni Trier 1995. Gruner, Wolf: Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland, Bd. 1: Deutsches Reich, 1933–1937, München 2008.
1116 | Theanolte Bähnisch
Gühne, Ekkehard: Theanolte Bähnisch (1899-1973). Von der Marienschülerin zur Regierungspräsidentin in Hannover. Notizen zu den Warendorfer Wurzeln einer engagierten „Frauenrechtlerin“, in: Warendorfer Schriften, Bd. 40 (2010), S. 49– 54. Ders.: „Eine Schule in Bewegung“. Hundert Jahre Mariengymnasium Warendorf, in: Warendorfer Schriften Bd. 36/37 (2007), S. 129–140. Ders.: Marienschule Warendorf. Nachwort zu einem Jahrhundert Mädchenbildung in einer westfälischen Kreisstadt, Warendorf 1991. Günther, Dagmar: And for now something completely different. Prolegomena zur Autobiographie als Quelle der Geschichtswissenschaft, in: Historische Zeitschrift, 272. Jg. (2001), S. 25–61. Guttmann, Barbara: Den weiblichen Einfluß geltend machen. Karlsruher Frauen in der Nachkriegszeit, 1945–1955, Karlsruhe 2000. Haan, Francisca de: Continuing Cold War Paradigms in Western Historiography of Transnational Women’s Organisations: the case of the Women’s International Democratic Federation (WIDF), in: Women’s History Review, 19. Jg. (2010), S. 547–573. Dies.: Hoffnungen auf eine bessere Welt. Die frühen Jahre der Internationalen Demokratischen Frauenföderation (IDFF/WIDF) 1945–1950, in: feministische studien, 27. Jg. (2009), S. 241–258. Haenlein, Andreas: Zur Vereinbarkeit der Zulassungsbeschränkungen für Vertragsärzte gemäß § 101 bis 103 SGB V in der Fassung des Gesundheitsstrukturgesetzes mit höherrangigem Recht, in: Vierteljahresschrift für Sozialrecht, 31. Jg. (1993), S. 169–193. Hagemann, Karen/Schüler-Springorum, Stefanie: Home/front. The military, war and Gender in Twentieth Century Germany, Oxford/New York 2002. Dies./Kolossa, Jan: Gleiche Rechte – Gleiche Pflichten? Der Frauenkampf für „staatsbürgerliche Gleichberechtigung“. Ein Bilder-Lese-Buch zu Frauenalltag und Frauenbewegung in Hamburg, Hamburg 1990. Hagemann, Steffen: Politische Kultur, Nation und nationale Identität. Die kulturtheoretische Wende in der politischen Kulturforschung, in: Brumlik, Micha/Hagemann, Steffen (Hrsg.): Autoritäres Erbe und Demokratisierung der politischen Kultur, Berlin 2010, S. 25–44. Hall, Stuart: Kodieren/Dekodieren, in: Bromley, Roger u. a. (Hrsg.): Cultural Studies. Grundlagentexte zur Einführung, Lüneburg 1999, S. 92–110. Hankel, Werner. Die UNO. Idee und Wirklichkeit, Bonn 2010. Hannoversche Orchestervereinigung, auf: www.hannoversche-orchestervereinigung. de/pdf/hov_vita_lang.rtf, am 17.10.2011. HANS [Datenbank der SUB Göttingen], auf: http://hans.sub.uni-goettingen.de/cgibin/hans/hans.pl?x=u&t_show=x&wertreg=PER&wert=wendehorst%2C+wiltrud +[1925-]&reccheck=57105, am 13.12.2013. Hansen-Schaberg, Inge: Rückkehr und Neuanfang. Die Wirkungsmöglichkeiten der Pädagoginnen Olga Essig, Katharina Petersen, Anna Siemsen und Minna Specht im westlichen Deutschland der Nachkriegszeit, in: Jahrbuch für Historische Bildungsforschung, 1. Jg. (1993), S. 319–338. Happ, Sabine/Jüttemann, Veronika (Hrsg.): „Laßt sie doch denken!“ 100 Jahre Studium für Frauen in Münster, Münster 2008.
Quellen und Literatur | 1117
Dies.: „Laßt sie doch denken!“ 100 Jahre Studium für Frauen, in: dies. (Hrsg.): 100 Jahre Studium für Frauen in Münster, Münster 2008, S. 13–42. Hartmann, Ilya: Prostitution, Kuppelei, Zuhälterei: Reformdiskussion und Gesetzgebung seit 1870, Berlin 2006. Haunfelder, Bernd: Die Münsterischen Regierungspräsidenten des 20. Jahrhunderts, Münster 2006. Hauptmeyer, Carl-Hans: Geschichte Niedersachsens, München 2009. Ders. (Bearb.)/Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Niedersachsen. Landesgeschichte und historische Regionalentwicklung im Überblick, Hannover 2004. Hegner, Victoria: Der Knabenclub oder „Wenn wir wirklich die Führung des Lebens dieser Jungen in die Hand bekommen […] wollen, dann müssen wir unsere Vereine so organisieren, wie es die Jungen selbst tun würden“, in: Lindner, Rolf (Hrsg.): „Wer in den Osten geht, geht in ein anderes Land“. Die Settlementbewegung in Berlin zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik, Berlin 1997, S. 109–127. Heiden, Detlev/Mai, Gunther (Hrsg.): Thüringen auf dem Weg ins Dritte Reich, Erfurt 1996. Heinemann, Sylvia: Frauenfragen sind Menschheitsfragen. Die Frauenpolitik der Freien Demokratinnen von 1945 bis 1963, Sulzbach/Taunus 2012. Heinsohn, Kirsten/Vogel, Barbara/Weckel, Ulrike (Hrsg.): Zwischen Karriere und Verfolgung. Handlungsspielräume von Frauen im nationalsozialistischen Deutschland, Frankfurt a. M. 1997. Heinze, Carsten: Identität und Geschichte in autobiographischen Lebenskonstruktionen, Wiesbaden 2009. Ders./Hornung, Alfred: Medialisierungsformen des Autobiographischen, Konstanz 2013. Henicz, Barbara/Hirschfeld, Margrit: Der Club deutscher Frauen in Hannover, in: Kuhn, Annette (Hrsg.) Frauen in der deutschen Nachkriegszeit, Bd. 2: Frauenpolitik 1945–1949, Düsseldorf 1986, S. 127–134. Dies.: Die ersten Frauenzusammenschlüsse, in: Kuhn, Annette (Hrsg.): Frauen in der deutschen Nachkriegszeit, Bd. 2, Düsseldorf 1986, S. 94–101. Dies.: „wenn die Frauen wüßten, was sie könnten, wenn sie wollten“ – zur Gründungsgeschichte des deutschen Frauenrings, in: Kuhn, Annette (Hrsg.) Frauen in der deutschen Nachkriegszeit, Bd. 2: Frauenpolitik 1945–1949, Düsseldorf 1986, S. 135–156. Hennig, Eike: Nationalismus, Sozialismus und die ‚Form aus Leben‘. Hermann Hellers politische Hoffnung auf soziale Integration und staatliche Einheit, in: Müller, Christoph/Staff, Ilse (Hrsg.): Staatslehre in der Weimarer Republik. Hermann Heller zu Ehren, Frankfurt a. M., S. 100–113. Herbst, Ludolf/Bührer, Werner/Sowade, Hanno (Hrsg.): Vom Marshall-Plan zur EWG: die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die westliche Welt, München 1990. Hering, Sabine/Münchmeier, Richard: Geschichte der sozialen Arbeit. Eine Einführung. Weinheim und München 2000. Herrmann, Sigrid: Gedenken an Martha Fuchs, SPD-Unterbezirk Braunschweig, auf: http://www.spd-braunschweig.de/content/376698.php, am 13.12.2013.
1118 | Theanolte Bähnisch
Herzberg, Julia: Autobiographik als historische Quelle in ‚Ost‘ und ‚West‘, in: dies./Schmidt, Christoph (Hrsg.): Vom Wir zum Ich. Individuum und Autobiographik im Zarenreich, Köln 2007, S. 15–62. Hettling, Manfred: Bürgerlichkeit als politische Ordnungsidee, in: Rotary Magazin, November 2005, 36–40. Ders.: Von Werther bis Guttenberg. „Bürgerlichkeit bietet Orientierung“, auf: ntv, 28.02.2011, http://www.n-tv.de/politik/Buergerlichkeit-bietet-Orientierung-article 2719156.html, am 13.12.2013. Ders.: „Bürgerlichkeit“ und Zivilgesellschaft. Die Aktualität einer Tradition, in: Reichardt, Seven/Jessen, Ralph/Klein, Ansgar (Hrsg.): Zivilgesellschaft als Geschichte. Studien zum 19. und 20. Jahrhundert, Wiesbaden 2004, 45–63. Ders.: Bürgertum, in: Greiffenhagen, Martin/Greiffenhagen, Sylvia: Handwörterbuch zur politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl., Wiesbaden 2002, S. 63. Ders./Hoffmann, Stefan Ludwig: Der bürgerliche Wertehimmel: Innenansichten des 19. Jahrhunderts, Göttingen 2000. Hetscher, Elke/Steigerwald, Norbert: Die Kaffeeklappe der SAG, in: Lindner, Rolf (Hrsg.): „Wer in den Osten geht, geht in ein anderes Land“. Die Settlementbewegung in Berlin zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik, Berlin 1997, S. 179–192. Hilger, Andreas: Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion, 1941–1956. Kriegsgefangenpolitik, Lager-alltag und Erinnerung, Essen 2000. Hillmann, Gert: Der Regierungspräsident und seine Behörde. Die allgemeine staatliche Mittelinstanz in der Verwaltungsreform, Göttingen 1969. Hirdmann, Yvonne: Alva Myrdal. The passionate mind, Bloomington 2008. Hirte, Katrin: Persilschein-Netzwerke. Bruchlosigkeit in Umbruchszeiten, in: Schönhuth, Michael/Gamper, Markus/Kronenwett, Michael/Stark, Martin (Hrsg.): Visuelle Netzwerkforschung, Bielefeld 2013, S. 331–354. Hochgeschwender, Michael: Freiheit in der Offensive? Der Kongreß für kulturelle Freiheit und die Deutschen, München 1998. Hoffmann, Gabriele: Sozialdemokratie und Berufsbeamtentum. Zur Frage nach Wandel und Kontinuität im Verhältnis der Sozialdemokratie zum Berufsbeamtentum in der Weimarer Zeit, Hamburg 1972. Hoffmann, Peter: Kleine Geschichte Niedersachsens, Hannover 2006. Hoffman-Ocon, Andreas: Netzwerke in bildungshistorischer Perspektive – Versuch einer disziplintheoretischen Annäherung, in: Grunder, Hans-Ulrich/HoffmanOcon, Andreas/Metz, Peter (Hrsg.): Netzwerke in bildungshistorischer Perspektive, Bad Heilbrunn 2013, S. 23–32. Holz, Petra: Zwischen Tradition und Emanzipation. Politikerinnen in der CDU in der Zeit von 1945 bis 1957, Königstein 2004. Hopf, Caroline: Frauenbewegung und Pädagogik. Gertrud Bäumer zum Beispiel, Bad Heilbrunn 1997. Hornung, Ela: Heimkehrer und wartende Frau. Zur Symptomatik eines Geschlechterverhältnisses nach dem zweiten Weltkrieg in Österreich, in: BandhauerSchöffmann, Irene/Duchen, Claire (Hrsg.): Nach dem Krieg. Frauenleben und Geschlechterkonstruktionen in Europa nach dem zweiten Weltkrieg, Herbolzheim 2000, S. 67–84.
Quellen und Literatur | 1119
Horvath, Dora: Bitte recht weiblich! Frauenleitbilder in der deutschen Zeitschrift Brigitte 1949-1982, Zürich 2000. Hoyer, Timo: Im Getümmel der Welt. Alexander Mitscherlich – Ein Porträt, Göttingen 2008. H-soz-u-kult. Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften, auf: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/. Hubatsch, Walther (Hrsg.): Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815– 1945, Reihe A: Preußen, Bd. 4: Schlesien, Marburg 1976. Hucker, Bernd-Ulrich/Schubert, Ernst/Weisbrod, Bernd (Hrsg.): Niedersächsische Geschichte, Göttingen 1997. Huerkamp, Claudia: Bildungsbürgerinnen. Frauen im Studien und in akademischen Berufen, 1900–1945, Göttingen 1996. Hundt, Irina/Kischlat, Ilse (Hrsg.): Topographie und Mobilität in der deutschen Frauenbewegung. Ergebnisse des wissenschaftlichen Kolloquiums des Deutschen Staatsbürgerinnen-Verbandes e. V. am 2. November 2002, Berlin 2003. Huster, Ernst-Ulrich: Demokratischer Sozialismus. Theorie und Praxis sozialdemokratischer Politik, in: Neumann, Franz (Hrsg.): Handbuch Politische Theorien und Ideologien, Bd. 2, Stuttgart 1996, S. 110–160. International Council of Women (Hrsg.): Women in a changing world. The dynamic story of the International Council of women, London 1966. Jäckel, Karin: Essay über den Wandel im Selbstverständnis der Sozialarbeit als Kernfach der sozialen Dienste, auf: http://www.karin-jaeckel.de/aktuelles/Essay_ Selbstverstaendnis_sozialer_Dienste.pdf, am 14.04.2014. Jaeger, Friedrich: Die Geschichtswissenschaft im Zeichen der Kulturwissenschaftlichen Wende, in: Müller, Klaus E. (Hrsg.): Phänomen Kultur. Perspektiven und Aufgaben der Kulturwissenschaften, Bielefeld 2003, S. 221–238. Jäger, Siegfried: Kritische Diskursanalyse, 4. Aufl., Münster 2004. Jahn, Peter: Rußlandfeindbild und Antikommunismus, in: Quinkert, Babette: „Wir sind die Herren dieses Landes“. Ursachen, Verlauf und Folgen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, Hamburg 2002, S. 223–235. Ders.: Russenfurcht und Antibolschewismus. Zur Entstehung und Wirkung von Feindbildern, in: ders./Rürup, Peter (Hrsg.): Erobern und Vernichten. Der Krieg gegen die Sowjetunion 1941–1945, Berlin 1991. Ders.: „...wenn die Kosaken kommen.“ Tradition und Funktion eines deutschen Feindbildes, in: Bleuel, Hans-Peter (Hrsg.): Feindbilder, oder: Wie man Kriege vorbereitet, Göttingen 1985, S. 25–46. Jansen, Philip Jost: Jugend und Jugendbilder in der frühen Bundesrepublik. Kontexte – Diskurse – Umfragen, Dissertation, Köln 2010, S. 2, auf: http://www.ssoar.info/ ssoar/bitstream/handle/document/44684/ssoar-hsr-trans-2010-23-janssen-Jugend_ und_Jugendbilder_in_der.pdf?sequence=1, am 16.11.2017. Jarausch, Konrad Hugo/Siegrist, Hannes (Hrsg.:): Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945–1970. Frankfurt a. M. 1997. Jegelka, Norbert: Paul Natorp. Philosophie, Pädagogik, Politik, Würzburg 1992. Jelich: Franz-Josef: Der Kalte Krieg als Herausforderung mitbürgerlicher Bildung, in: ders. (Hrsg.): Fritz Borinski: zwischen Pädagogik und Politik – ein historischkritischer Rückblick, Essen 2000, S. 103113.
1120 | Theanolte Bähnisch
Ders.: Persönlichkeit und Organisationsinteresse. Milieuverbundene Institutionalisierung in der Erwachsenenbildung der 20er Jahre, in: Ciupke, Paul/Jelich, FranzJosef (Hrsg.): Experimentiersozietas Dreißigacker, Essen 1997, S. 129–139. Jeserich, Kurt/Neuhaus, Helmut (Hrsg.): Persönlichkeiten der Verwaltung. Biographien zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1648–1945, Stuttgart 1991. Ders./(Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 4: Das Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus, Stuttgart 1985. Jones, Helen: Markham, Violet Rosa (1872–1952), in: Oxford Dictionary of National Biography, Oxford 2004, online auf: http://www.oxforddnb.com/view/printable/ 34881, am 05.02.2014. Jones, Jill: Eradicating Nazism from the British Zone of Germany. Early Policy and Practice, in: German History, 8. Jg. (1990), S. 245–162. Jung, Martina/Scheitenberger, Martina: …den Kopf noch fest auf dem Hals. Frauen in Hannover 1945–1948, Hannover 1991. Junker, Detlef u. a. (Hrsg.): Die USA und Deutschland im Zeitalter des Kalten Krieges 1945–1990, Bd. 1: 1945–1968, München 2001. Kätzel, Ute: Es waren nur wenige, doch der Staat fühlte sich bedroht... Frauenfriedensbewegung von 1899 bis 1933, in: Praxis Geschichte, Heft 3/97, S. 9–13, online-Version: Berghof Foundation, 2012, auf: http://www.friedenspaedagogik.de/ service/unterrichtsmaterialien/friedensbewegung/die_frauenfriedensbewegung_ 1899_bis_1933, am 13.12.2013. Kaiser, Wolfram: Christdemokratische Netzwerke und die Genese Kerneuropas, in: Gehler, Michael/Kaiser, Wolfram/Leucht, Brigitte (Hrsg.): Netzwerke im europäischen Mehrebenensystem. Von 1945 bis zur Gegenwart, Wien/Köln/Weimar, 2009, S. 87–104. Karl, Michaela: Die Geschichte der Frauenbewegung, Stuttgart 2011. Kaufmann, Stefan: Konf.: Netzwerke – Modalitäten soziotechnischen Regierens, ETH Zürich 26.-28.09.2005, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id= 4339, 02.09.2005. Kebir, Sabine: Antonio Gramscis Zivilgesellschaft. Alltag – Ökonomie – Kultur – Politik, Hamburg 2001. Keiderling, Gerhard: Um Deutschlands Einheit. Ferdinand Friedensburg und der Kalte Krieg in Berlin 1945–1952, Köln 2009. Keller, Rainer: Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen, 4. Aufl., Wiesbaden 2011. Kemmerer, Alexandra: Haager Konferenz. Das Abendland will seine Erweiterung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.06.2008. Kemper, Claudia: Das “Gewissen” (1919–1925). Kommunikation und Vernetzung der Jungkonservativen, München 2011. Kern, Thomas: Soziale Bewegungen. Ursachen, Wirkungen, Mechanismen, Wiesbaden 2008. Kersting, Christa: Pädagogik im Nachkriegsdeutschland: Wissenschaftspolitik und Disziplinentwicklung, Kempten 2008. Kessel, Fabian/Schoneville, Holger: Soziale Arbeit und die Tafeln – von der Transformation der wohlfahrtsstaatlichen Armutsbekämpfung, in: Lorenz, Stephan (Hrsg.): TafelGesellschaft. Zum neuen Umgang mit Überfluss und Ausgrenzung, Bielefeld 2010, S. S. 35–48.
Quellen und Literatur | 1121
Kessel, Fabian/Maurer, Susanne: Soziale Arbeit, in: Kessel, Fabian/Reutlinger, Christian/Maurer, Susanne/Frey, Oliver (Hrsg.): Handbuch Sozialraum, Wiesbaden 2005, S. 11–129. Kimmel, Elke: Rezension über: Schwelling, Birgit: Heimkehr – Erinnerung – Integration. Der Verband der Heimkehrer, die ehemaligen Kriegsgefangenen und die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft, Paderborn 2010, auf: dradio.de, http://www.dradio.de/dlf/sendungen/andruck/1185126, am 13.12.2013. Klaus, Helmut: Der Dualismus Preußen versus Reich in der Weimarer Republik in Politik und Verwaltung, Mönchengladbach 2006. Klausch, Hans-Peter: Braune Wurzeln – Alte Nazis in den niedersächsischen Landtagsfraktionen von CDU, FDP und DP. Zur NS-Vergangenheit von niedersächsischen Landtagsabgeordneten in der Nachkriegszeit, o. O., o. D., S. 17/18, pdf auf: http://linksfraktion-niedersachsen.linkes-cms.de/fileadmin/linksfraktion-nieder sachsen/Texte/Broschueren_PDF/Broschuere_Nazis_internet.pdf, am 16.12.2011. Klein, Ansgar: Der Diskurs der Zivilgesellschaft. Politische Kontexte und demokratietheoretische Bezüge der neueren Begriffsverwendung, Opladen 2001. Klein, Christian (Hrsg.:) Handbuch Biographien. Methoden, Traditionen, Theorien, Stuttgart 2009. Ders.: (Hrsg.): Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens, Stuttgart 2002. Klemm, Claudia: Erinnert-Umstritten-gefeiert. Die Revolution von 1848/49 in der deutschen Gedenkkultur, Göttingen 2007. Kleßmann, Christoph: Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945– 1955, Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1991. Knudsen, Ann-Christina: Politische Unternehmer in transnationalen Netzwerken, in: Gehler, Michael/Kaiser, Wolfram/Leucht, Brigitte (Hrsg.): Netzwerke im europäischen Mehrebenensystem. Von 1945 bis zur Gegenwart, Wien/Köln/Weimar 2009, S. 105–120. Koch, Martin: Volkskongreßbewegung und Volksrat, in: Broszat, Martin/Weber, Hermann (Hrsg.): SBZ-Handbuch. Staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Führungskräfte in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, München 1990, S. 349–354. Körber, Klaus: Zwischenruf: Zurück hinter die Verwestlichung? An welche Traditionen kann die bundesrepublikanische Erwachsenenbildung anknüpfen?, in: Ciupke, Paul/Jelich, Franz-Josef: Experimentiersozietas Dreißigacker, Essen 1997, S. 191–200. Koepcke, Cordula: Frauen verändern die Welt, Opladen 1997. Dies.: Frauen zeigen Flagge. Gesellschaftspolitische Arbeit in Deutschland, Wiesbaden 1985. Körner, Klaus: „Die rote Gefahr”. Antikommunistische Propaganda in der Bundesrepublik 1950–2000, Hamburg 2003. Koldehoff, Stefan: Ein Schuß in’s Herz, in: Die Welt online, 15.01.2006, auf: http://www.welt.de/print-wams/article137281/Ein_Schuss_ins_Herz.html, am 18.09.2013. Kohli, Martin: Ruhestand und Moralökonomie, in: Heinemann, Klaus (Hrsg.): Soziologie wirtschaftlichen Handelns, Opladen 1987, S. 393–416.
1122 | Theanolte Bähnisch
Ders./Roberts, Günter (Hrsg.): Biographie und soziale Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven, Stuttgart 1984. Kompisch, Kathrin: Täterinnen. Frauen im Nationalsozialismus, Köln/Weimar/Wien 2008. Kontos, Silvia: Die Partei kämpft wie ein Mann. Zur Frauenpolitik der KPD in der Weimarer Republik, Frankfurt a. M./Basel 1978. Korfes, Gunhild: Im Kampf gegen den Eigenwillen. Ein Fall für die Kriminologie?, in: Karlizek, Kari-Maria (Hrsg.): Kriminologische Erkundungen. Wissenschaftliches Symposium aus Anlaß des 65. Geburtstages von Klaus Sessar, Münster 2004, S. 107–122. Koselleck, Reinhart: Einleitung – Zur anthropologischen und semantischen Struktur der Bildung, in: ders.: Bildungsgüter und Bildungswissen, Stuttgart 1990 (Conze, Werner/Kocka, Jürgen (Hrsg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, Bd. II), S. 11–46. Kossert, Andreas: Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945, München 2008. Koszyk, Kurt: Presse unter alliierter Besatzung, in: Wilke, Jürgen (Hrsg.): Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999, S. 31–58. Ders.: The press in the British Zone of Germany, in: Pronay, Nicholas/Wilson, Keith (Hrsg.): The political re-education of Germany & her allies after World War II, London u. a. 1985, S. 107–138. Ders.: Carl Severing, in: Westfälische Lebensbilder, Band XI, Münster 1975, S. 172– 201. Kracauer, Siegfried: Die Biographie als neubürgerliche Kunstform, in: Frankfurter Zeitung, Literaturblatt, 29.06.1930, S. 6. Krallert-Sattler, Gertrud: Kommentierte Bibliographie zum Flüchtlings- und Vertriebenenproblem in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, München 1989. Krause-Vilmar, Dietfrid: Ludwig Pappenheim (1887–1934). Vortrag in der Gedenkstätte Breitenau am 11. Juni 2002, Skript als pdf auf: https://kobra.bibliothek.unikassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-2006120416046/1/ansprache_vortrag_ pappenheim_2002.pdf, am 11.11.2013. Kreis, Georg: Alles ist Netzwerk. Überlegungen zu einer (neuen) Metapher, in: Grunder, Hans-Ulrich/Hoffman-Ocon, Andreas/Metz, Peter (Hrsg.): Netzwerke in bildungshistorischer Perspektive, Bad Heilbrunn 2013. Krenz, Detlef: Die Goldene Meile – das Exportviertel Ritterstraße, Auszug auf: http://www.postkarten-archiv.de/ross-rotophot-und-film-sterne-verlag.html, am 27.08.2014. Kress, Celina: Zwischen Bauhaus und Bürgerhaus – Die Projekte des Berliner Bauunternehmers Adolf Som-merfeld. Zur Kontinuität suburbaner Stadtproduktion und rationellen Bauens in Deutschland 1910–1970, Berlin 2008. Krohn, Claus-Dieter: Exilforschung, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 20.12.2012. Ders. u. a. (Hrsg.): Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933-1945, Darmstadt 2012.
Quellen und Literatur | 1123
Kroll, Frank-Lothar: Epochenbewusstsein, europäisches Einigungsdenken und transnationale Integrationspolitik bei Heinrich von Brentano, in: Depkat, Volker/Graglia, Piero, S. (Hrsg.): Entscheidung für Europa. Erfahrung, Zeitgeist und politische Herausforderungen am Beginn der europäischen Integration, Berlin/New York 2010, S. 189–204. Krüger, Dieter: Nationalökonomen im wilhelminischen Deutschland, Göttingen 2011. Kuhn, Annette: Die stille Kulturrevolution der Frau. Versuch einer Deutung der Frauenöffentlichkeit (1945-1947), in: Clemens, Gabriele (Hrsg.): Kulturpolitik im besetzten Deutschland 1945–1949, Stuttgart 1994, S. 84–101. Dies. (Hrsg.): Frauen in der deutschen Nachkriegszeit, Bd. 2: Frauenpolitik 1945– 1949, Düsseldorf 1986. Dies.: Vorwort der Herausgeberin, in: dies. (Hrsg.): Frauen in der deutschen Nachkriegszeit, Bd. 2, Düsseldorf 1986, S. 9–10. Kuhn, Bärbel: Familienstand ledig. Ehelose Frauen und Männer im Bürgertum (1850–1914), Köln/Weimar/Wien 2002. Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender, Berlin 1925. Kulhawy, Andreas: Geschichte der Frauen Union Niedersachsen – eine erste Chronik der Frauen Union, Hannover 2011. Kunstamt Kreuzberg/Institut für Theaterwissenschaft der Universität Köln (Hrsg.): Theater in der Weimarer Republik, Berlin 1977. Laack, Dirk van: Alltagsgeschichte, in: Maurer, Michael (Hrsg.): Aufriß der historischen Wissenschaften, Bd. 7: Neue Themen und Methoden der Geschichtswissenschaft, Stuttgart 2003, S. 14–80. Laclau, Ernesto/Mouffe, Chantal: Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus, 2. Aufl., Wien 2000. Laffont, Heléne: Zur Rezeption Bachofens im Nationalsozialismus, in: Heinz, Marion/Gretic, Goran (Hrsg.) Philosophie und Zeitgeist im Nationalsozialismus, Würzburg 2006, S. 143–162. Lange, Barbara: Einleitung, in: Bundesarchiv (Hrsg.): Demokratischer Frauenbund Deutschlands, DY 31. 1945–1990 (Findbuch), Berlin 1997, auf: http://www. argus.bundesarchiv.de/dy31/index.htm?kid=6e1c8ca4-4ff5-44dc-94516145c66a8d16, am 28.01.2014. Langewiesche, Dieter: Vom Gebildeten zum Bildungsbürger? Umrisse eines katholischen Bildungsbürgertums im wilhelminischen Deutschland, in: Lenger, Dieter (Hrsg.): Dieter Langewiesche. Liberalismus und Sozialismus. Gesellschaftsbilder – Zukunftsvisionen – Bildungskonzeptionen, Bonn 2003, S. 177–205. Ders./Tenorth, Heinz-Elmar (Hrsg.): Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Bd. 5, München 1989, S. 337/338. Laurien, Ingrid: Politisch-kulturelle Zeitschriften in den Westzonen 1945–1949. Ein Beitrag zur politischen Kultur der Nachkriegszeit, Frankfurt am Main 1991. Lehnert, Detlef/Megerle, Klaus (Hrsg.): Pluralismus als Verfassungs- und Gesellschaftsmodell. Zur politischen Kultur der Weimarer Republik, Opladen 1993. Ders.: Verfassungsdispositionen für die Politische Kultur der Weimarer Republik. Die Beiträge von Hugo Preuß im historisch-konzeptiven Vergleich, in: ders./Megerle, Klaus (Hrsg.): Pluralismus als Verfassungs- und Gesellschaftsmodell. Zur politischen Kultur der Weimarer Republik, Opladen 1993, S. 11–48.
1124 | Theanolte Bähnisch
Leif, Thomas/Speth, Rudolf: Die fünfte Gewalt. Wie Lobbyisten die Prinzipien der Parlamentarischen Demokratie unterlaufen, in: Die Zeit, 22.05.2006, auf: http://www.zeit.de/online/2006/10/lobbyismus, am 13.12.2013. Dies.: Die fünfte Gewalt, Lobbyismus in Deutschland, Wiesbaden 2006. Leifeld, Josef: Germete, in: Mürmann, Franz (Hrsg.): Die Stadt Warburg. Beiträge zur Geschichte einer Stadt, Warburg 1986, S. 454–457. Leithäuser, Joachim: Wilhelm Leuschner: Ein Leben für die Republik, Köln 1962. LEMO. Lebendiges Museum online, auf: https://www.dhm.de/lemo/ Lengemann, Jochen/Präsident des Hessischen Landtags (Hrsg.): Das HessenParlament 1946–1986. Biographisches Handbuch des Beratenden Landesausschusses, der Verfassungsberatenden Landesversammlung und des Hessischen Landtags, 1.–11. Wahlperiode, Frankfurt a. M. 1986. Leopold, Carl: Warendorfs Gymnasium und die Warendorfer Bürgerschaft im 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur bürgerlichen Kultur einer deutschen Kleinstadt, in: Gruhn, Klaus (Hrsg.): Gymnasium Laurentianum Warendorf. Von der Lateinschule zum Gymnasium Laurentianum Warendorf, 1329–1979, Warendorf 1979, S. 105–108. Lepsius, Rainer M.: Das Erbe des Nationalsozialismus: Das Legat zweier Diktaturen für die demokratische Kultur im vereinigten Deutschland, in: Holtmann, Everhard/Sahner, Heinz (Hrsg.): Aufhebung der Bipolarität. Veränderungen im Osten, Rückwirkungen im Westen, Opladen 1995, S. 25–39. Leßmann, Peter: Die preußische Schutzpolizei in der Weimarer Republik. Streifendienst und Straßenkampf, Düsseldorf 1989 Lexikon der Frau, 2 Bd., Zürich 1955. Lexikon zur Parteiengeschichte: die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutschland 1879–1945, 4. Bd., Köln 1983–1986. Liang, Hsi-Huey: Die Berliner Polizei in der Weimarer Republik, Berlin/New York 1977. Liebert, Frank: „Die Dinge müssen zur Ruhe kommen, man muß einen Strich dadurch machen“. Politische „Säuberung“ in der niedersächsischen Polizei 1945– 1951, in: Fürmetz, Gerhard/Reinke, Herbert/Weinhauer, Klaus (Hrsg.): Nachkriegspolizei. Sicherheit und Ordnung in Ost- und Westdeutschland 1945–1955, Hamburg 2001, S. 71–103. Lindenberger, Thomas (Hrsg.): Massenmedien im Kalten Krieg. Akteure, Bilder, Resonanzen, Köln 2006. Lindner, Rolf: Friedrich Siegmund Schulze – Facetten einer Persönlichkeit, in: Tenorth, Heinz-Elmar (Hrsg.): Friedrich Siegmund-Schultze (1885–1969). Ein Leben für Kirche, Wissenschaft und soziale Arbeit, Berlin 2007, S. 7–11. Ders.: Die Anfänge der Sozialen Arbeitsgemeinschaft, in: ders. (Hrsg.): Wer in den Osten geht, geht in ein anderes Land. Die Settlementbewegung in Berlin zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik, Berlin 1997, S. 81–94. Lindner, Ulrike: Gesundheitspolitik in der Nachkriegszeit. Großbritannien und die Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, Oldenburg 2004. Link, Jürgen: Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird, 2. Aufl., Opladen 1999. Loeding, Matthias: Otto Grotewohl contra Kurt Schumacher. Die Wennigser Konferenz im Oktober 1945, Hamburg 2004.
Quellen und Literatur | 1125
Lommatzsch, Erich: Hans Globke (1898–1973). Beamter im Dritten Reich und Staatssekretär Adenauers, Frankfurt a. M./New York, 2009. Loth, Wilfried: Der Weg nach Europa. Geschichte der europäischen Integration 1937–1957, Göttingen 1990. Loth, Wilfried/Graml, Hermann/Wettig, Gerhard: Die Stalin-Note vom 10. März 1952: neue Quellen und Analysen, München 2002. Lott, Sylvia: Die Frauenzeitschriften von Hans Huffzky und John Jahr. Zur Geschichte der deutschen Frauenzeitschrift zwischen 1933 und 1970, Berlin 1984. Lowenthal-Hensel, Cécile: Frauen 1930 – Frauen 1980. 50 Jahre Soroptimismus in Deutschland, 50 Jahre Soroptimist-Club Berlin, in: Soroptimist intern. Mitteilungsblatt der Deutschen Union der Soroptimist-Clubs, Nr. 22, 1980, S. 1–7. Lubos, Arno: Die schlesische Dichtung im 20. Jahrhundert, 1961 München. Lübbe, Hermann: Der Nationalsozialismus im deutschen Nachkriegsbewußtsein, in: Historische Zeitschrift, 236. Jg. (1983), S. 579–599. Lühe, Irmela von/Runge, Anita (Hrsg.): Biographisches Erzählen, Köln 2001. Lutz, Ronald: Perspektiven der sozialen Arbeit, in: APUZ 12/13 (2008), auf: https:// www.bpb.de/apuz/31335/perspektiven-der-sozialen-arbeit?p=all, 06.03.2008, geprüft am 13.12.2013. Märke, Antje: Einleitung, in: Bundesarchiv (Hrsg.): Nachlaß Heinrich Haslinde, N 1666 1926–1933, Koblenz 2008, o. S., auf: http://startext.net-build.de:8080/ barch/MidosaSEARCH/N1666-59110/index.htm?kid=titelblatt, 15.05.2014. Mager, Inge (Hrsg.): Frauenprofile des Luthertums. Lebensgeschichten im 20. Jahrhundert, Gütersloh 2005. Malycha, Andreas/Winter, Peter Jochen: Die SED. Geschichte einer deutschen Partei, München 2009. Mannheim, Karl: Das Problem der Generationen. In: Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie, 7. Jg. (1928/29), S. 157–184. Marian, Esther: Jeder Angestellte will eine Persönlichkeit sein. Zu Siegfried Kracauers Biographiekritik, in: Fetz, Bernhard/Huemer, Georg (Hrsg.): Theorie der Biographie. Grundlagentexte und Kommentar, Berlin 2011, S. 125–131. Marschalck, Peter: Bevölkerung und Wanderung im Raum Niedersachsen seit dem Zweiten Weltkrieg, in: Bade, Klaus (Hrsg.): Fremde im Land, Osnabrück 1997. Matthes, Eike: Zehn Stolpersteine für NS-Opfer der Hamburgischen Universität, in: Jura-Magazin 5/2010, auf: http://studium.jura.uni-hamburg.de/magazin/index. php?ausgabe=201005&artikel=834, am 08.08.2010. Maul, Bärbel: Akademikerinnen in der Nachkriegszeit. Ein Vergleich zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, Frankfurt a. M. 2002. Medicus, Dieter: Martin Wolff (1972–1953) ein Meister an Klarheit, in: Heinrichs, Helmut (Hrsg.): Deutsche Juristen jüdischer Herkunft, München 1993, S. 543– 554. Meier, Desiderius: Tagungsbericht: Leben verbinden. Beziehungen als Problem des Biografen, DoktorandInnen des Promotionsprogramms ‚ProMoHist‘, LudwigMaximilians-Universität München in München am 14./15.07.2011, 04.09.2011 auf: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3789, 04.09.2011, am 13.03.2014. Meissner, Kurt: Zwischen Politik und Religion. Adolf Grimme. Leben, Werk und geistige Gestalt, Berlin 1993.
1126 | Theanolte Bähnisch
Melchert, Monika: Über den Dramenzyklus, auf: http://www.trafoberlin.de/3-89626382-X.html, am 24.07.2009, S. 11. Dies.: Besprechung zu: Schulte, Birgitta: Ich möchte die Welt hinreißen... Ein Porträt: Ilse Langner 1899–1987, Rüsselsheim 1999, in: Freitag, 09.06.2000, auf: http://www.lyrikwelt.de/rezensionen/ichmoechtediewelt-r.htm, am 22.08.2009. Dies.: Die Dramatikerin Ilse Langner. „Die Frau, die erst kommen wird…“, Berlin 2002. Menz, Heinrich: Von der ‚Höheren Bürgerschule‘ zur ‚Deutschen Oberschule für Jungen‘. Zur Geschichte der ‚Gustav-Freytag-Schule‘ zu Kreuzburg OS, Festschrift zum 100. Geburtstag dieser Schule, Velen 1974. Mergel, Thomas: Zwischen Klasse und Konfession. Katholisches Bürgertum im Rheinland 1984–1914, Göttingen 1994. Merkel, Ina: Leitbilder und Lebensweisen von Frauen in der DDR, in: Kaelble, Hartmut/Kocka, Jürgen/Zwahr, Hartmut (Hrsg.): Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart 1994, S. 359–381. Dies.: ... und Du, Frau an der Werkbank. Die DDR in den 50er Jahren, Berlin 1990. Mestrup, Heinz/Gebauer, Ronald: Die thüringischen Bezirke und ihre ersten Sekretäre, in: Richter, Michael (Hrsg.): Länder, Gaue und Bezirke, Halle 2007, 191–212. Meta-Archiv-Datensatz: „Borinski, Fritz, Prof. Dr.“, in: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, http://www.die-bonn.de/Weiterbildung/Archive/Meta-Archiv/ personen.aspx?per_id=526, am 13.12.2013. Metzger, Rainer: Berlin. Die Zwanzigerjahre. Kunst und Kultur 1918–1933, München 2007. Meurer, Bärbel: Marianne Weber. Leben und Werk, Tübingen 2010. Mitscherlich, Alexander/Mitscherlich, Margarete: Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, München 1967 Ders.: Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Ideen zur Sozialpsychologie, München 1963. Mittelsdorf, Harald: Zwischen Landesgründung und Gleichschaltung. Die Regierungsbildungen in Thüringen seit 1920 und das Ende der parlamentarischen Demokratie 1932/33, Rudolstadt 2001. Mittmann, Thomas: Kirchliche Akademien in der Bundesrepublik, Göttingen 2011. Mlynek, Klaus: Theanolte Bähnisch, in: Böttcher, Dirk u. a. (Hrsg.): Hannoversches Biographisches Lexikon, Hannover 2002, S. 35. Ders./Röhrbein, Waldemar: (Hrsg.): Geschichte der Stadt Hannover, Bd. 2: Vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, Hannover 1994. Ders.: Hannover Chronik: von den Anfängen bis zur Gegenwart: Zahlen, Daten, Fakten, Hannover 1991. Mocker, Elke: Demokratischer Frauenbund Deutschlands (1947–1989). Historisch systematische Analyse einer DDR-Massenorganisation, Diss, Berlin 1992. Möding, Nori: Die Stunde der Frauen? Frauen und Frauenorganisationen des bürgerlichen Lagers, in: Broszat, Martin/Henke, Klaus-Dietmar/Woller, Hans (Hrsg.): Von Stalingrad zur Währungsreform. Zur Sozialgeschichte des Umbruchs in Deutschland, 3. Aufl., München 1990, S. 619–647. Möller, Hartmann: Das Hüffertgymnasium Warburg, in: Mürmann, Franz (Hrsg.): Die Stadt Warburg. Beiträge zur Geschichte einer Stadt, Warburg 1986, Bd. 2, S. 251–278.
Quellen und Literatur | 1127
Möller, Horst: Preußen, in: Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 4: Das Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus, Stuttgart 1985, S. 540–557. Mommsen, Hans: Die Sozialdemokratie in der Defensive: Der Immobilismus der SPD und der Aufstieg des Nationalsozialismus, in: ders. (Hrsg.): Sozialdemokratie zwischen Klassenbewegung und Volkspartei, Frankfurt a. M. 1974, S. 106133. Morgenbrod, Birgitt/Merkenich, Stefanie: Das Deutsche Rote Kreuz unter der NSDiktatur 1933 bis 1945, Paderborn 2008. Müller, Hanno: Thüringen war Testfeld für die Nazi-Regierung, in: Thüringer Allgemeine Zeitung, 31.03.2013, auf: http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/ leben/detail/-/specific/Thueringen-war-Testfeld-fuer-Nazi-Regierung-16794224 70, am 04.04.2014. Müller, Rolf-Dieter/Ueberschär, Gerd: Hitlers Krieg im Osten 1941–1945, Darmstadt 2000. Müller, Rolf-Dieter/Volkmann, Hans-Erich (Hrsg.): Die Wehrmacht. Mythos und Realität, München 1999. Müter, Jochen: Nur Gerede um Syrien, in: ntv, 03.08.2012, auf: http://www.ntv.de/politik/politik_kommentare/UN-geben-beschaemendes-Bild-ab-article688 8951.html, am 13.12.2013. Munzinger Personen online. Internationales Biographisches Archiv, Zugang über DBIS der Universität Kassel. Naas, Stefan: Die Entstehung des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes von 1931. Ein Beitrag zur Geschichte des Polizeirechts in der Weimarer Republik, Tübingen 2003. Najbarowski, Łukasz/Sadaj, Waldemar: Numery członków SS od 250 000 do 250 999.podanajest najwyższa udokumentowana ranga jaką uzyskali n/w członkowie SSwszystkie pozycje są nadal uzupełniane, auf: http://www.dws-xip.pl/reich/ biografie/numery/numer250.html, am 13.12.2013. Nalepka, Cornelia: Kalkuliertes Scheitern als biographische Maxime. Zu Wolfgang Hildesheimer: „Die Subjektivität des Biographen“, in: Fetz, Bernhard/Huemer, Georg (Hrsg.): Theorie der Biographie. Grundlagentexte und Kommentar, Berlin 2011, S. 297–301. Neissl, Julia u. a.: Einleitung: Geschlechterdimensionen und Gewaltstruktur in Alltag und Krieg, in: Dies. u. a. (Hrsg.): Männerkrieg und Frauenfrieden. Geschlechterdimensionen in kriegerischen Konflikten, Wien 2003, S. 7–12. Nelson, Anne: Die Rote Kapelle. Die Geschichte der legendären Widerstandsorganisation, München 2010. Nentwig, Teresa: Hinrich Wilhelm Kopf (1893–1961). Ein konservativer Sozialdemokrat, Hannover 2013. Netzwerk der Europäischen Bewegung Deutschland (Hrsg.): 60 Jahre Netzwerk Europäische Bewegung, Berlin 2009, auf: http://www.netzwerk-ebd.de/fileadmin/ files_ebd/pdfs/EBD_Festschrift_web.pdf, am 13.12.2013. Neumann, Franz: Handbuch politische Theorien und Ideologien, 2 Bd., 2. Aufl., Stuttgart 2000.
1128 | Theanolte Bähnisch
Ni Dhúill, Caitríona: Biographie von ‚er‘ bis ‚sie‘. Möglichkeiten und Grenzen relationaler Biographik, in: Fetz, Bernhard/Huemer, Georg (Hrsg.): Die Biographie. Zur Grundlegung ihrer Theorie, Berlin/New York 2009, S. 199-226. Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (Hrsg.): Nachlass Rudolf Smend [Findbuch], Göttingen 2009, S. 151, Cod. Ms. R. Smend A 944, Acc. Mss. 2006.12 Cod. Ms., auf: http://hans.sub.uni-goettingen.de/nachlaesse/Smend.pdf, am 13.12.2013. Niemann, Mario: Rezension über: Scheidt, Petra: Karriere im Stillstand. Der Demokratische Frauenbund Deutschlands im Spiegel seiner Kaderarbeit und der Kaderstrukturen seines hauptamtlichen Funktionärskorps, Stuttgart 2011, in: sehepunkte 12 (2012), Nr. 10, auf: http://www.sehepunkte.de/2012/10/21768.html, am 04.09.2014. Nienhaus, Ursula: Topographie und Generationenmobilität in der Berliner Frauenbewegung nach 1945, in: Hundt, Irina/Kischlat, Ilse (Hrsg.): Topographie und Mobilität in der deutschen Frauenbewegung. Ergebnisse des wissenschaftlichen Kolloquiums des deutschen Staatsbürgerinnenverbandes e. V. am 2. November 2002, Berlin 2003, S. 98–107. Dies.: Nicht für eine Führungsposition geeignet. Josefine Erkens und die Anfänge der weiblichen Polizei in Deutschland 1923–1933, Münster 1999. Dies.: Einsatz für die „Sittlichkeit“: Die Anfänge der weiblichen Polizei im Wilhelminischen Kaiserreich und in der Weimarer Republik, in: Lüdtke, Alf (Hrsg.): Polizei, Gesellschaft und Herrschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt 1992, S. 243–266. Niess, Frank: Die europäische Idee – aus dem Geist des Widerstands, Frankfurt a. M./New York 2002. Niethammer, Lutz: Deutschland danach. Postfaschistische Gesellschaft und nationales Gedächtnis, Bonn 1999. Ders.: Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizierung am Beispiel Bayerns, Bonn 1982. Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1800–1918, Bd. 2/1: 1866–1918 – Arbeitswelt und Bürgergeist, München 2008. Nödinger, Ingeborg: „Mitwissen, mitverantworten, mitbestimmen“. Zu den Anfängen des Demokratischen Frauenbundes Deutschland, in: Kuhn, Annette (Hrsg.) Frauen in der deutschen Nachkriegszeit, Bd. 2: Frauenpolitik 19451949, Düsseldorf 1986, S. 122–126. Nohlen, Dieter (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik, München 2001. Ders.: Lexikon der Politikwissenschaft, 7 Bd., München 1992–1998. Nolte, Ernst: Deutschland und der Kalte Krieg, München 1974. Notz, Gisela: Frauen in der Mannschaft. Sozialdemokratinnen im Parlamentarischen Rat und im Deutschen Bundestag 1948/49 bis 1957, Bonn 2003. Oelkers, Jürgen: Biographik – Überlegungen zu einer unschuldigen Gattung, in: Neue Politische Literatur, Bd. 19 (1974), S. 296–309. Oesterreich, Christopher: „gute form“ im wiederaufbau. Zur Geschichte der Produktgestaltung in West-deutschland nach 1945, Berlin 2000. Olbrich, Josef: Geschichte der Erwachsenenbildung in Deutschland, Opladen 2001. Ders.: Die Heimvolkshochschule Dreißigacker – Ein pädagogischer Begriff?, in: Ciupke, Paul/Jelich, Franz-Josef (Hrsg.): Experimentiersozietas Dreißigacker.
Quellen und Literatur | 1129
Historische Konturen und gegenwärtige Rezeption eines Erwachsenenbildungsprojektes der Weimarer Zeit, Essen 1997, S. 49–68. Ders.: Robert von Erdberg und das Freie Volksbildungswesen, in: Schmidt, Benno (Hrsg.): Paedagogen in Berlin. Auswahl von Biographien zwischen Aufklärung und Gegenwart, Baltmannsweiler 1991. Oldenziel, Ruth/Zachmann, Karin: Cold War Kitchen, Americanization, Technology and European users, London 2009. Ost, Peter/Bezirksregierung Münster (Hrsg.): 200 Jahre Bezirksregierung Münster. Rückblick und Perspektive, 2. Aufl., Münster 2003. Osterroth, Franz/Schuster, Dieter: Chronik der deutschen Sozialdemokratie, Bd. 3. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 2. Aufl., Berlin u. a. 1978, Electronic Edition, Bonn 2001, Stichtag: 26./27. Juni 1947, auf: http://library.fes.de/fulltext/ bibliothek/chronik/spdc_band3.html, am 13.12.2013. Ostner, Ilona: „Emanzipation durch Arbeit?“, in: Ariadne, 15. Jg. (2000), Heft 37/38, S. 72–76. O. V.: 14. September 2005 – Vor 35 Jahren: Anne-Marie Durand-Wever stirbt: Für eine selbstbestimmte Sexualität, auf: http://www1.wdr.de/themen/archiv/stichtag/ stichtag1410.html, am 13.12.2013. O. V.: 1945–49 Ende als Anfang: Trümmerfrauen, auf: http://www.hdg.de/lemo/ html/Nachkriegsjahre/DasEndeAlsAnfang/truemmerfrauen.html, am 13.12.2013. O. V.: Der Ansatz ‚Max Planck.‘ Die Max-Planck-Gesellschaft im Deutschen Wissenschaftssystem, auf: Max-Planck-Gesellschaft, http://www.mpg.de/101251/ MPG_Einfuehrung?seite=2, am 13.12.2013. O. V.: Das DRK unter der NS-Diktatur, auf: http://www.drk.de/ueber-uns/geschichte/ themen/drk-unter-der-ns-diktatur.html, am 13.12.2013. O. V.: Datensatz-Beschreibung: The Women’s Library, NA 1303, St. Joan’s International Alliance (German Section), auf: http://calmarchive.londonmet.ac.uk/ DServe/dserve.exe?dsqIni=Dserve.ini&dsqApp=Archive&dsqDb=Persons&dsq Search=Code==%27NA1303%27&dsqCmd=Show.tcl, am 13.12.2013. O. V.: Die Welt der Pflanze. Photographien von Albert Renger-Patzsch und aus dem Auriga-Verlag auf: http://www.skkultur.de/photographie/ausstellungen_info.php? id=50&goback=ausstellungen_archiv&actBtn=ausstellungen_archiv&pasBtn=au sstellungen_archiv, am 05.08.2009. O. V.: Einleitung zum Online-Findbuch der University of New Hampshire, Library, Bestand MC 58 [Jacobi, Lotte 1896–1990, Papers 1898–2000], auf: http://www.library.unh.edu/special/index.php/lotte-jacobi, am 22.08.2009. O. V.: Ein Straßenname in der Kritik, in: Hildesheimer Allgemeine Zeitung, o. D. [Januar 2012] auf: http://www.hildesheimer-allgemeine.de/agnesmiegel0.html? tx_comments_pi1[page]=1&cHash=6daed38a114b9c5e5f600e6ead733fb3, am 13.12.2013. O. V.: Frauen-Impulse. Informationen des Landesfrauenrats Niedersachsen, 4/2010, online auf: http://landesfrauenrat-nds.de/autodownload/FrauenImpulse/Impulse %202010_40%20Jahre%20Landesfrauenrat.pdf, S. 51, am 13.12.2013. O. V.: Geschichte des Petitionsrechts, auf der Homepage des Landtags Sachsen, http://www.landtag.sachsen.de/de/petition/geschichte_des_petitionsrechts/index.a spx, am 13.12.2013.
1130 | Theanolte Bähnisch
O. V.: Wider der undeutschen Geist, Homepage zur Ausstellung der HumboldtUniversität-Berlin „Wider den undeutschen Geist“, auf: http://www.buecher verbrennung33.de/schwarzelisten_4.html, am 14.10.2013. O. V.: „Wie sollen wir leben?“ Warum nur die neue Bürgerlichkeit unsere Gesellschaft retten kann – auch wenn sie neue Ungleichheit erzeugt. Ein Interview mit dem Historiker Manfred Hettling, in: Die Zeit, Nr. 11, 9.3.2006. O. V.: „Zupacken wie ein Mann… Der Mythos der Trümmerfrauen“[Hör-Feature], gesendet auf Bayern 2 am 10.05.2009, um 13:30, Text online abrufbar unter: http://wikimannia.org/images/2009_05_04_18_01_57_podcastdermythosdertrmm erfraue_a.mp3, am 13.12.2013. Overesch, Manfred: Dokumentation. Die Reise des Generalsekretärs Erich Roßmann in die Ostzone vom 15. bis 20. Mai, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 23. Jg. (1975), S. 454–466. Overwien, Bernd: Politische Bildung und informelles Lernen, in: Journal für Politische Bildung, Heft 3 (2011), S. 10–18. Ders.: Stichwort: Informelles Lernen, in: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Heft 3 (2005), S. 339–359. Owings, Chloe: Women Police. A Study of the Development and Status of Women Police Movement, with a preface by Lieutenant Mina C. van Winkle, New York 1925. Pakschies, Günter: Umerziehung in der britischen Zone von 1945 bis 1949. Untersuchungen zur britischen Reeducation-Politik, 2. Aufl., Köln/Wien 1984. Parey, Anne: „Kluge Herzen“ – Pulsschlag der Welt. Frauenkongreß in Bad Pyrmont, in: Weser-Kurier, 12.10.1949. Paschelke, Sarah: Biographie als Gegenstand von pädagogischer Forschung und Arbeit: Möglichkeiten einer konstruktiven pädagogischen Biographiearbeit, Bad Heilbrunn 2013. Paulus, Julia: Theanolte Bähnisch, geb. Nolte (1899–1973), in: Paschert-Engelke, Christa (Hrsg.): Im Garten der Rosindis. 63 Frauenporträts aus dem Kreis Warendorf, Münster 2008, S. 76/77. Pawlowski, Rita: Der demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD), in: Genth, Renate (Hrsg.): Frauenpolitik und politisches Wirken von Frauen im Berlin der Nachkriegszeit 1945–1949, Berlin 1996, S. 75–104. Perlick, Alfons: Beuthen O/S. Ein Heimatbuch des Beuthener Landes, 2. Aufl., Recklinghausen 1982. Pestalozzi-Fröbel-Schule, auf: http://www.pfh-berlin.de/pestalozzi-froebel-haus/ geschichte, am 14.01.2014. Peter, Jürgen: Der Nürnberger Ärzteprozeß im Spiegel seiner Aufarbeitung, Münster 1998. Peters, Dietlinde: Mütterlichkeit im Kaiserreich, Bielefeld 1984. Peters, Dorothea: Kunstverlage, in: Fischer, Stephan/Fischer, Ernst (Hrsg.): Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. 2: Die Weimarer Republik, 1918–1933, München 2007, S. 463–508. Pfannenstein, Dietmar: Preußen und Weimar: Eine Untersuchung über das Verhältnis von Staat und Schule am Beispiel des Gymasium Laurentianum zu Warendorf in den Jahren 1875–1927/28, in: Gruhn, Klaus (Hrsg.): Gymnasium Laurentianum
Quellen und Literatur | 1131
Warendorf. Von der Lateinschule zum Gymnasium Laurentianum Warendorf, 1329–1979, Warendorf 1979, S. 109–129. Pfeiffer, Arnold: Religiöse Sozialisten, in: Kerbs, Diethard/Reulecke, Jürgen (Hrsg.): Handbuch der deutschen Reformbewegungen, 1880–1933, Wuppertal 1998, S. 523–526. Phillips. David: Aspects of education for democratic citizenship in post-war Germany, in: Oxford Review of Education, 38. Jg. (2012) S. 567–581. Phillips, David: Helena Deneke and the women of Germany: A note on post-war educational reconstruction, in: German Life and Letters, 53. Jg. (2000), S. 89–105. Pickenaecker, Birgit Anne: Das Dilemma der Bezirksregierung in NRW zwischen Tradition und Transformation – Ansätze für eine pragmatische Modernisierungsperspektive, Dissertation, Düsseldorf 2006, online unter http://miami.unimuenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-3071/diss_pickenaecker.pdf. Pieper, Wilhelm: Niedersächsische Schulreformen im Luftflottenkommando. Von der Niedersächsischen Erziehungsstätte zur IGS Franzsches Feld, Kempten 2009. Pitzschke: Angela: Rezension über Heinemann: Frauenfragen, in: H-Soz-u-Kult, 13.11.2012, auf: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2012-4-132, am 13.12.2013. Poestges, Dieter: Die Mittelinstanz im Wandel der Zeit. Zum hundertjährigen Bestehen der Bezirksregierung Hannover, Ausstellung im Niedersächsischen Landtag, 16.4. –18.5.1985, Hannover 1985. Pokorny, Rita: Die Rationalisierungsexpertin Irene M. Witte (1894-1976). Biografie einer Grenzgängerin, Diss., TU Berlin 2003. Pollähne, Lothar: Theanolte Bähnisch, in: 150 Persönlichkeiten der hannoverschen Sozialdemokratie, auf: SPD Stadtverband Hannover, http://spd-hannoverstadt.de/content/392037.php, am 13.03.2013. Potthoff, Heinrich: Kurt Schumacher. Sozialdemokraten und Kommunisten, in: Dowe, Dieter (Hrsg.): Kurt Schumacher und der „Neubau“ der deutschen Sozialdemokratie nach 1945. Referate und Podiumsdiskussion eines Kolloquiums des Gesprächskreises Geschichte der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn am 12./13. Oktober 1995, Bonn 1996, S. 133–150. Pressemeldung der Uni Osnabrück zur Ausstellung: „Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit“ – Universitätsbibliothek Osnabrück zeigt Dokumente zu Leben und Werk von Robert Kempner, Nr. 1/1998 26.06.1998, auf: http://www.uniosnabrueck.de/en/study_programs/presseportal/pressemeldung/artikel/kempnerausstellung-ewige-wachsamkeit-ist-der-preis-der-freiheit-universitaetsbibliothekosnabr.html, am 14.10.2013. Pyta, Wolfram: Gegen Hitler und für die Republik, Die Auseinandersetzung der deutschen Sozialdemokratie mit der NSDAP in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1989. Ders./Richter, Ludwig (Hrsg.): Gestaltungskraft des Politischen. Festschrift für Eberhard Kolb, Berlin 1998. Pufendorf, Astrid von: Otto Klepper (1888–1957) deutscher Patriot und Weltbürger, München 1997. Raehlmann, Irene: Arbeitswissenschaft im Nationalsozialismus: Eine wissenschaftssoziologische Analyse, Wiesbaden 2005.
1132 | Theanolte Bähnisch
Raschke, Joachim: Soziale Bewegungen. Ein historisch-systematischer Grundriss, Frankfurt a. M. 1985. Rathkolb, Oliver: Sozialdemokratische Netzwerke in der europäischen Nahostpolitik, in: Gehler, Michael/Kaiser, Wolfram/Leucht, Brigitte (Hrsg.): Netzwerke im europäischen Mehrebenensystem. Von 1945 bis zur Gegenwart, Wien/Köln/ Weimar 2009, S. 121–137. Rauschenbach, Brigitte: Gleichheit, Differenz, Freiheit? Bewusstseinswenden im Feminismus nach 1968, gender…politik…online, August 2009, auf: http://www.fuber-in.de/sites/gpo/pol_theorie/Zeitgenoessische_ansaetze/Gleichheit__ Differenz__Freiheit/rauschenbach_august.pdf?1361541199, am 13.03.2014. Reagin, Nancy Ruth: A German Women’s Movement: Class and Gender in Hanover, 1880–1933, Chapel Hill 1995. Dies.: Die bürgerliche Frauenbewegung vor 1933, in: Schröder, Christiane/Sonneck, Monika (Hrsg.): Außer Haus. Frauengeschichte in Hannover, Hannover 1994, S. 137–146. Reble, Albert: Geschichte der Pädagogik, 22. Aufl., Stuttgart 2009. Recker, Marie-Luise: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, 3. Aufl., München 2009. Rehse, Birgit: „Dein Körper gehört Dir!“ Ärztinnen klären über Geburtenregelung auf, in: Bock, Petra/Koblitz, Katja (Hrsg.): Neue Frauen zwischen den Zeiten, Berlin 1995, S. 112–128. Reichmann, Wiebke: „O junge Mädchenherrlichkeit“. Die Gründungen der Damenverbindungen in Münster, in: Happ, Sabine/Jüttemann, Veronika (Hrsg.): „Laßt sie doch denken!“ 100 Jahre Studium für Frauen in Münster, Münster 2008, S. 81–94. Reimers, Bettina Irena: Die neue Richtung der Erwachsenenbildung in Thüringen 1919-1933, Diss. Tübingen 2000, auf: http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/ 2001/254/pdf/complete.pdf, am 30.11.2013. Dies.: Das Frauenbildungskonzept der Volkshochschule Thüringen in der Weimarer Republik, in: Ciupke, Paul/Derichs-Kunstmann (Hrsg.): Zwischen Emanzipation und ‚besonderer Kulturaufgabe der Frau‘. Frauenbildung in der Geschichte der Erwachsenenbildung, Essen 2001, S. 115–131. Reiser, Wolfgang: „Die Familie des Siegmund Cohen (1873-1938), Schicksale Warendorfer Juden im Schatten der Schoah“. Vortrag von Dr. Ekkehard Gühne am 29.11.12, auf: http://www.heimatvereinwarendorf.de/juedisches-leben/vortragguehne-cohen-29-11-12.html, am 15.05.2014. Repplinger, Roger: Zu „Tietz“ geht niemand mehr. Die Hansestadt feiert ‚100 Jahre Alsterhaus‘. Dass das Kaufhaus einmal anders hieß, wissen die wenigsten, in: Jüdische Allgemeine, 17.05.2012, auf: http://www.juedische-allgemeine.de/article/ view/id/13016, am 05.12.2013. Reulecke, Jürgen: Die Anfänge der organisierten Sozialreform in Deutschland, in: Bruch, Rüdiger vom (Hrsg.): Weder Kommunismus noch Kapitalismus. Bürgerliche Sozialreform in Deutschland vom Vormärz bis in die Ära Adenauer, München 1985, S. 21–59. Reusch, Ulrich: Deutsches Berufsbeamtentum und britische Besatzung. Planung und Politik 1943-1947, Stuttgart 1985.
Quellen und Literatur | 1133
Richter, Joeffrey S.: „Entpolizeilichung“ der öffentlichen Ordnung. Die Reform der Verwaltungspolizei in der britischen Besatzungszone 1945-1955, in: Fürmetz, Gerhard/Reinke, Herbert/Weinhauer, Klaus (Hrsg.): Nachkriegspolizei. Sicherheit und Ordnung in Ost- und Westdeutschland 1945-1955, Hamburg 2001, S. 35-50. Riesener, Dirk: Die Polizeidirektion Hannover. Gesellschaft, Industrie und Polizei vom Deutschen Reich bis zur Bundesrepublik Deutschland, Hannover 2006. Röhm, Eberhard/Thierfelder, Jörg: Juden-Christen-Deutsche, Band 1: 1933-1935: Ausgegrenzt, Stuttgart 1990, S. 316 ff. Röhrbein, Waldemar: Hannover nach 1945. Landehauptstadt und Messestadt, in: Mlynek, Klaus: (Hrsg.): Geschichte der Stadt Hannover, Bd. 2: Vom Beginn des 19. Jhd. bis in die Gegenwart, Hannover 1994, S. 579-800. Roerkohl, Anne: Der Erste Weltkrieg in Westfalen. Lebensmittelmangel und Hunger an der „Heimatfront“, Münster 1987, auf: http://www.lwl.org/westfaelischegeschichte/portal/Internet/input_felder/seite1_westf_bild.php?urlID=327, am 15.05.2014. Röpcke, Andreas: Who’s Who in Lower Saxony. Ein politisch-biographischer Leitfaden der britischen Besatzungsmacht 1948/49, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 55 (1981), S. 243–309. Röwekamp, Marion: „Ich brauchte meinen ganzen Mut.“ Das unkonventionelle Leben von Theanolte Bähnisch, in: Happ, Sabine/Jüttemann, Veronika (Hrsg.): Laßt sie doch denken!, 100 Jahre Studium für Frauen in Münster, 2. Aufl., Münster 2009, S. 262–268. Dies.: „Bähnisch, Theanolte“, in: Dies./Deutscher Juristinnenbund (Hrsg.): Juristinnen – Lexikon zu Leben und Werk, Baden Baden 2005, S. 24–27. Dies.: „Westerkamp, Alix“, in: Dies./Deutscher Juristinnenbund (Hrsg.): Juristinnen – Lexikon zu Leben und Werk, Baden Baden 2005, S. 430. Roloff, Stefan: Die Rote Kapelle, Frankfurt a. M. 2002. Roser, Traugott: Protestantismus und Soziale Marktwirtschaft. Eine Studie am Beispiel Franz Böhms, Münster 1998. Roth, Roland/Rucht, Dieter: Einleitung, in: Dies. (Hrsg.): Die sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945, Frankfurt/New York 1998, S. 9–36. Rothwell, Victor H.: Großbritannien und die Anfänge des Kalten Krieges, in: Foschepoth, Josef (Hrsg.): Kalter Krieg und Deutsche Frage. Deutschland im Widerstreit der Mächte. 1945–1952, Göttingen/Zürich 1985, S. 88–110. Rott, Joachim: Bernhard Weiß 1880 Berlin – 1951 London. Polizeivizepräsident in Berlin. Preußischer Jude – kämpferischer Demokrat, Berlin 2008. Rowell, Jay: Der erste Bezirkssekretär: Zur Scharnierfunktion der Bezirksfürsten, in: Richter, Michael (Hrsg.): Länder, Gaue und Bezirke, Halle 2007, S. 213–230. Rudzio, Wolfgang: Export englischer Demokratie. Zur Konzeption der britischen Besatzungspolitik in Deutschland, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 17. Jg. (1969), S. 219–236. Ders.: Die Neuordnung des Kommunalwesens in der Britischen Zone. Zur Demokratisierung und De-zentralisierung der politischen Struktur: eine britische Reform und ihr Ausgang, Stuttgart 1968. Rüping, Hinrich: Rechtsanwälte im Bezirk Celle während des Nationalsozialismus, 2. Aufl., Berlin 2010.
1134 | Theanolte Bähnisch
Ruhl, Klaus-Jörg: Frauen in der Nachkriegszeit 1945–1963, München 1998. Ders.: Verordnete Unterordnung. Berufstätige Frauen zwischen Wirtschaftswachstum und konservativer Ideologie in der Nachkriegszeit (1945–1963), München 1994. Runge, Anita: Geschlechterdifferenz in der literaturwissenschaftlichen Biographik. Ein Forschungsprogramm, in: Klein, Christian (Hrsg.): Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens, Stuttgart 2002, S. 113– 128. Rupieper, Hermann-Josef: Die Wurzeln der westdeutschen Nachkriegsdemokratie. Der amerikanische Beitrag 1945–1952, Opladen 1993. Ders.: Bringing democracy to the Frauleins. Frauen als Zielgruppe der amerikanischen Demokratisierungspolitik 1945–1953, in: Geschichte und Gesellschaft, 17. Jg. (1991), S. 61–91. Rupp, Leila, J.: Transnational Women’s Movements, in: European History online, 16.06.2011, auf: http://www.ieg-ego.eu/en/threads/transnational-movements-andorganisations/international-social-movements/leila-j-rupp-transnational-womensmovements#TheInternationalCouncilofWomen, am 13.12.2013. Sachse, Carola: Der Hausarbeitstag. Gerechtigkeit und Gleichberechtigung in Ost und West 1939–1994, Göttingen 2002. Sachße, Christoph: Friedrich Siegmund-Schultze, die ‚Soziale Arbeitsgemeinschaft‘ und die bürgerliche Sozialreform in Deutschland, in: Krauß, Jürgen/Möller, Michael/Münchmeier, Richard (Hrsg.): Soziale Arbeit zwischen Ökonomisierung und Selbstbestimmung, Kassel 2007, S. 231–256. Ders.: Friedrich Siegmund-Schultze, die „Soziale Arbeitsgemeinschaft“ und die bürgerliche Sozialreform in Deutschland, in: Tenorth, Heinz-Elmar (Hrsg.): Friedrich Siegmund-Schultze (1885–1969). Ein Leben für Kirche, Wissenschaft und soziale Arbeit, Berlin 2007, S. 35–50. Ders.: Mütterlichkeit als Beruf. Sozialarbeit, Sozialreform und Frauenbewegung 1871–1929, 2. Aufl., Opladen 1994. Ders./Tennstedt Florian: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, 3 Bd., Stuttgart 1980–1992. Sack, Birgit: Zwischen religiöser Bindung und moderner Gesellschaft. Katholische Frauenbewegung und politische Kultur in der Weimarer Republik (1918/19– 1933), Münster u. a. 1998. Sarasin, Philipp: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt a. M. 2003. Sauberzweig, Dieter (Hrsg.): Adolf Grimme. Briefe, Heidelberg 1968. Sauer, Thomas: Der Kronberger Kreis: Christlich-Konservative Positionen in der Bundesrepublik Deutschland, in: GHI Conference Papers on the Web, The American Impact on Western Europe. Americanization and Westernization in Transatlantic Perspective, Conference at the GHI Washington, March 25th27, 1999, auf: www.ghi-dc.org/conpotweb/westernpapers/sauer.pdf, am 13.12.2013. Sawahn, Anke: Die Frauenlobby vom Land. Die Landfrauenbewegung in Deutschland und ihre Funktionärinnen 1898 bis 1948, Frankfurt a. M. 2009. Schade, Ralf: Karl Mödersheim (1888–1952): ein erfolgreicher Kommunalpolitiker und Bürgermeister der Stadt Leuna, Leuna 2004. Schaser, Angelika (Hrsg.): Erinnerungskartelle. Zur Konstruktion von Autobiographien nach 1945, Bochum 2003.
Quellen und Literatur | 1135
Dies.: Gertrud Bäumer – „eine der wildesten Demokratinnen“ oder „verhinderte Nationalsozialistin“?, in: Heinsohn, Kirsten/Vogel, Barbara/Weckel, Ulrike (Hrsg.): Zwischen Karriere und Verfolgung. Handlungsräume von Frauen im nationalsozialistischen Deutschland, Frankfurt a. M./New York 1997, S. 24–43. Scheidt, Petra: Karriere im Stillstand? Der Demokratische Frauenbund Deutschlands im Spiegel seiner Kaderarbeit und der Kaderstrukturen seines hauptamtlichen Funktionärskorps, Stuttgart 2011. Schelsky, Hartmut: Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend, Düsseldorf/Köln 1957. Scherrer, Christoph: Globalisierung wider Willen? Die Durchsetzung liberaler Außenwirtschaftspolitik in den USA, Berlin 1999. Ders.: Neo-gramscianische Interpretationen internationaler Beziehungen. Eine Kritik, in: Hirschfeld, Uwe (Hrsg), Gramsci-Perspektiven, Hamburg 1998, S. 160–174. Ders.: Neo-gramscianische Theorie der Internationalen Beziehungen, in: Albrecht, Ulrich/Volger, Helmut (Hrsg.): Lexikon der Internationalen Politik, München 1997, S. 371–372. Schilde, Kurt: Eva-Maria Buch und die Rote Kapelle, Berlin 1992. Schildt, Axel: Die Weimarer Republik, Bd. III, online-Publikation der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung, auf: http://192.68.214.70/blz/web/100083/ 10.html, am 14.10.2013. Ders.: Zur Durchsetzung einer Apologie. Hermann Lübbes Vortrag zum 50. Jahrestag des 30. Januar 1933, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 10. Jg. (2013), Heft 1, auf: http://www. zeithistorische-forschungen.de/16126041-Schildt-1-2013, am 29.01.2014. Ders./Siegfried, Detlef: Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik – 1945 bis zur Gegenwart, Bonn 2009. Ders.: Der Europa-Gedanke in der westdeutschen Ideenlandschaft des ersten Nachkriegsjahrzehnts, in: Grunewald, Michael/Bock, Hans-Manfred (Hrsg.): Le discours européen dans les revues allemandes/Der Europadiskurs in den deutschen Zeitschriften (1945–1955) Bern u. a. 2001, S. 15–30. Ders.: Zwischen Abendland und Amerika. Studien zur westdeutschen Ideenlandschaft der 50er Jahre, München 1999. Ders.: Moderne Zeiten. Freizeit, Massenmedien und „Zeitgeist“ in der Bundesrepublik der 50er Jahre, Hamburg 1995. Ders.: Ein konservativer Prophet moderner nationaler Integration. Biographische Skizze des streitbaren Soziologen Johann Plenge (1874–1963), in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 35. Jg. (1987), S. 523–570. Schilling, Karsten: Das zerstörte Erbe. Berliner Zeitungen der Weimarer Republik im Porträt, Norderstedt 2011. Schindelbeck, Dirk/Illgen, Volker: Haste was, biste was!, Werbung für die soziale Marktwirtschaft, Darmstadt 1999, S. 20. Schindler, Roland W.: Geglückte Zeit, gestundete Zeit. Hannah Arendts Kritik der Moderne, Frankfurt a. M./New York 1996. Schlosser, Horst Dieter: Es wird zwei Deutschlands geben. Zeitgeschichte und Sprache in Nachkriegsdeutschland 1945–1949, Frankfurt a. M. 2005. Schmackpfeffer, Petra: Frauenbewegung und Prostitution: über das Verhältnis der alten und neuen deutschen Frauenbewegung zur Prostitution, Oldenburg 1989.
1136 | Theanolte Bähnisch
Schmidt, Manfred: Demokratietheorien. Eine Einführung, 5. Aufl., Bonn 2010. Schnädelbach, Anna: Kriegerwitwen. Lebensbewältigung zwischen Arbeit und Familie in Westdeutschland nach 1945, Frankfurt/New York 2009. Schnath, Georg (Hrsg.): Geschichte des Landes Niedersachsen, 6. Aufl., Freiburg 1996. Schneider, Irmela/Spangenberg, Peter (Hrsg.): Medienkultur der 50er Jahre, Wiesbaden 2002. Schneider, Karl: Der langsame Abschied vom Agrarland, in: Weisbrod, Bernd (Hrsg.): Von der Währungsreform zum Wirtschaftswunder. Wiederaufbau in Niedersachsen, Hannover 1998, S. 133–160. Schober, Kurt: Der junge Kurt Schumacher, 1895–1933, Bonn 2000. Schoen, Anke: Deutsche Banken und die Arisierung, in: Aktuell in der Zivilgesellschaft, 15.05.2012, auf: bnr.de, http://www.bnr.de/artikel/aktuell-aus-derzivilgesellschaft/deutsche-banken-und-die-arisierung, am 24.10.2013. Schöndienst, Eugen: Kulturelle Angelegenheiten – A Theater und Orchester, in: Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 4: Das Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus, S. 373–384. Schönhoven, Klaus: Reformismus und Radikalismus. Gespaltene Arbeiterbewegung im Weimarer Sozialstaat, München 1989. Schoßig, Bernhard: Eduard Weitsch und die Münchner Volkshochschule nach 1945 oder: Mutmaßungen, warum ein „rein preußischer Herr“ nicht Gründungsdirektor der Nachkriegsvolkshochschule in München wurde, in: Ciupke, Paul/Jelich, Franz-Josef: Experimentiersozietas Dreißgacker, Essen 1997, S. 243–254. Schröder, Ivonne: Alice Salomon und ihre Bedeutung für die soziale Arbeit, Studienarbeit, Hochschule Neubrandenburg 2010, auf: http://books.google.de/books?id= kIwJHVw0lI4C&pg=PA21&lpg=PA21&dq= alice+salomon+emotionale+distanz &source=bl&ots=7wlHxsEuE6&sig=0qU_z_Byqzo1_tqYaEoaq-cBNgI&hl=de& sa=X&ei=cvV2UPKEEqn64QSnyIDYBg&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q =alice%20salomon%20emotionale%20distanz&f=false, am 13.12.2013. Schröder, Peter: Die Leitbegriffe der deutschen Jugendbewegung in der Weimarer Republik. Eine ideengeschichtliche Studie, Münster 1996. Schüler, Anja: Frauenbewegung und soziale Reform. Jane Addams und Alice Salomon im transatlantischen Dialog, 1889–1933, Stuttgart 2004. Schüller, Elke: Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Die Frauenbewegung in der BRD, in: Dossier Frau-enbewegung, 08.09.2008, Bundeszentrale für politische Bildung, auf: http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35 275/neuanfang-im-westen?type=galerie&show=image&i=61122, am 23.07.2014. Dies.: Anita Augspurg, auf: Bundeszentrale für politische Bildung, http://www.bpb. de/themen/DMA2UA,1,0,Anita_Augspurg.html, am 20.05.2009. Dies.: „Frau sein, heißt politisch sein“. Wege der Politik von Frauen in der Nachkriegszeit am Beispiel Frankfurt a. M. (1945–1956), Königstein/Taunus 2004. Dies./Wolff, Kerstin: „Wenn es um Frauenfragen geht, dann stehen wir Frauen geschlossen da!“ Politische Frauennetzwerke nach 1945 in Hessen, in: Berding, Helmut (Hrsg.): Hessen. 60 Jahre Demokratie. Beiträge zum Landesjubiläum, Wiesbaden 2006, S. 243–268. Dies.: Fini Pfannes. Protagonistin und Paradiesvogel der Nachkriegsfrauenbewegung, Königstein/Taunus 2000.
Quellen und Literatur | 1137
Schüller, Liane: Vom Ernst der Zerstreuung. Schreibende Frauen am Ende der Weimarer Republik: Marieluise Fleißer, Irmgard Keun und Gabriele Tergit, Bielefeld 2005. Schrulle, Hedwig: Die Bezirksregierungen Münster und Minden/Detmold von 1930 bis 1960, Paderborn 2008. Schubert, Doris: „Frauenmehrheit verpflichtet“. Überlegungen zum Zusammenhang von erweiterter Frauenarbeit und kapitalistischem Wiederaufbau in Westdeutschland, in: Dies./Kuhn, Annette (Hrsg.): Frauen in der Geschichte V, „Das Schicksal Deutschlands liegt in der Hand seiner Frauen“ – Frauen in der deutschen Nachkriegsgeschichte, Düsseldorf 1984, S. 231–265. Schulte, Birgitta: Ich möchte die Welt hinreißen... Ein Porträt: Ilse Langner 1899– 1987, Rüsselsheim 1999. Schultheiß, Nicole: Geht nicht… gibt’s nicht. 24 Portraits herausragender Frauen aus der Kieler Stadtgeschichte, Kiel 2007, online auf: http://www.kiel.de/kultur/ stadtgeschichte/gehtnichtgibtsnicht/Buch_05_Portraet_Vormeyer.php, 13.12.2013. Schulz, Gerhard: Zwischen Demokratie und Diktatur. Verfassungspolitik und Reichsreform in der Weimarer Republik, 2. Bd., Berlin/New York 1987. Schulz, Günther: Bürgerliche Sozialreform in der Weimarer Republik, in: Bruch, Rüdiger vom (Hrsg.): Weder Kommunismus noch Kapitalismus. Bürgerliche Sozialreform in Deutschland vom Vormärz bis in die Ära Adenauer, München 1985, S. 181–217. Schulze, Hagen: Otto Braun oder Preussens demokratische Sendung. Eine Biographie, Frankfurt a. M. 1977. Schulze, Winfried: Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte? Vorüberlegungen für die Tagung „Ego-Dokumente“, in: ders.: (Hrsg.): EgoDokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte, Berlin 1996. Ders.: (Hrsg.): Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikrohistorie, Göttingen 1994. Schulz-Popken, Eva: „daß in der Erziehung des Mädchens das Ideal, ‚die Frau gehört ins Haus‘ endgültig einer überwundenen Zeit angehört.“ Das Leben der Reformpädagogin Käthe Feuerstack, in: Zeitschrift für Museum und Bildung, 63/2005, S. 40–51. Schumacher, Frank: Kalter Krieg und Propaganda. Die USA, der Kampf um die Weltmeinung und die ideelle Westbindung der Bundesrepublik Deutschland, 1945–1955, Trier 2000. Schumacher, Martin/Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien: M. d. B. (Hrsg.): Die Volksvertretung 1946–1972: Wiederaufbau und Wandel 1946–1972, online auf: http://www.kgparl.de/online-volks vertretung/pdf/mdb-i.pdf, am 13.12.2013. Schwan, Gesine: Antikommunismus und Antiamerikanismus in Deutschland. Kontinuität und Wandel nach 1945, Baden-Baden 1999. Schwegel, Andreas: Christ, Patriot und preußisches Reformer. Vor 70 Jahren wurde der Berliner Katholiken-führer Erich Klausener ermordet, in: Die Politische Meinung 419/2004, S. 84–91. Schweighöfer, Brigitte: Berufswege von Studentinnen, in: Happ, Sabine/Jüttemann, Veronika (Hrsg.): „Laßt sie doch denken!“ 100 Jahre Studium für Frauen in Münster, Münster 2008, S. 151–165.
1138 | Theanolte Bähnisch
Seidler, Eduard: Jüdische Kinderärzte 19331945: Entrechtet, geflohen, ermordet, Freiburg 2007. Seitter, Wolfang: Dreißigacker als pädagogische Experimentiersozietas. Eduard Weitschs Beitrag zur Methodendiskussion und Professionalisierung der Erwachsenenbildung in der Weimarer Republik, in: Ciupke, Paul/Jelich, Franz-Josef (Hrsg.): Experimentiersozietas Dreißigacker. Historische Konturen und gegenwärtige Rezeption eines Erwachsenenbildungsprojektes der Weimarer Zeit, Essen 1997. Seitz, Robert/Zucker, Heinz (Hrsg.): Um uns die Stadt. Eine Anthologie neuer Großstadtdichtung, Berlin 1931. Selbmann, Rolf: Der deutsche Bildungsroman, Stuttgart 1984. Sellert, Wolfgang: James Paul Goldschmidt (1874–1940), in: Heinrichs, Helmut u. a. (Hrsg.): Deutsche Juristen jüdischer Herkunft, München 1993, S. 598. Siemer, Ernst/Regierungspräsident des Bezirks Detmold (Hrsg.): 175 Jahre alt – Bezirksregierung in Ostwestfalen 1816–1991, Detmold 1991. Simon, Barbara (Bearb.)/Präsident des Niedersächsischen Landtages (Hrsg.): Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994, Hannover 1996. Sorge, Christoph: Das Entscheidungsrecht des Ehemannes (§ 1354 BGB), in: Projekt Frauenrechtsgeschichte der Leibniz Universität Hannover, 19.05.2009, auf: http: //www.frauenrechtsgeschichte.uni-hannover.de/76.html?&L=1, am 13.12.2013. Speitkamp, Winfried: Sozialgeschichte, in: Maurer, Michael (Hrsg.): Aufriß der historischen Wissenschaften, Bd. 3: Sektoren, Stuttgart 2004, S. 72–184. Spitzer, Elke: Emanzipationsansprüche zwischen der Querelles des Femmes und der modernen Frauenbewegung, Kassel 2002. Stäheli, Urs: Die politische Theorie der Hegemonie: Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, in: Brodocz, André/Schaal, Gary S. (Hrsg.): Politische Theorien der Gegenwart, Opladen 1999, S. 143–166. Stark, John Robert: The overlooked majority: German women in the four Zones of occupied Germany, 1945–1949. A comparative study, Dissertation, Ohio State University, 2003, auf: OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center, https://etd.ohiolink.edu/ap/10?0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:osu10451741 97, am 09.04.2014. Stegmann, Dirk: Angestelltenkultur in der Weimarer Republik, in: Faulstich, Werner (Hrsg.): Die Kultur der 20er Jahre, S. 21–39, Göttingen 2008. Steiger, Karsten: Kooperation, Konfrontation, Untergang. Das Weimarer Tarif- und Schlichtungswesen während der Weltwirtschaftskrise und seine Vorbedingungen, Stuttgart 1998. Steininger, Rolf: Deutsche Geschichte. Darstellung und Dokumente in vier Bänden, Bd. 1: 1945–1947, Neuausgabe, Frankfurt a. M. 2002. Stein, Ludwig: Zur Methodenlehre der Biographik. Mit besonderer Rücksicht auf die biographische Kunst im Dienste der philosophiegeschichtlichen Forschung, in: Biographische Blätter, Bd. 1 (1895), S. 22–39. Stein, Mathias: Der Konflikt um Alleinvertretung und Anerkennung in der UNO. Die deutsch-deutschen Beziehungen zu den Vereinten Nationen von 1949 bis 1973, Göttingen 2001.
Quellen und Literatur | 1139
Steinbacher, Sybille: Differenz der Geschlechter. Chancen und Schranken der „Volksgenossinnen“, in: Bajohr, Frank/Wildt, Michael (Hrsg.), Frankfurt a. M. 2009, S. 94–105. Steinborn, Norbert/Schanzenbach, Karin: Die Hamburger Polizei nach 1945 – ein Neuanfang, der keiner war, Hamburg 1990. Steinert, Johannes-Dieter: Flüchtlinge, Vertriebene und Aussiedler in Niedersachsen. Eine annotierte Bibliographie, Osnabrück 1986. Steininger, Rolf: Deutsche Geschichte. Darstellung und Dokumente in vier Bänden, Neuausgabe, Frankfurt a. M. 2002. Stekl, Hannes/Schnöller, Andrea (Hrsg.): „Höhere Töchter“ und „Söhne aus gutem Haus“. Bürgerliche Jugend in Monarchie und Republik, Wien/Köln/Weimar 1999. Steveling, Lieselotte: Juristen in Münster. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtsund Staatswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster/Westfalen, Münster 1999. Stoehr, Irene: Friedensklärchens Feindinnen. Klara Marie Fassbinder und das antikommunistische Frau-ennetzwerk, in: Paulus, Julia/Sillies, Eva-Maria/Wolff, Kerstin (Hrsg.): Zeitgeschichte als Geschlechtergeschichte. Neue Perspektiven auf die Bundesrepublik, Frankfurt a. M. 2012, S. 69–91. Dies.: Konfliktreicher Neubeginn. Zur Vorgeschichte des Deutschen Frauenrates (1951/52), in: Hundt, Irina/Kischlat, Ilse (Hrsg.): Topographie und Mobilität in der deutschen Frauenbewegung. Ergebnisse des wissenschaftlichen Kolloquiums des Deutschen Staatsbürgerinnen-Verbandes e. V. am 2. November 2002, Berlin 2003, S. 116–127. Dies.: Wiederbewaffnung und Weiblichkeit in Westdeutschland: die 50er Jahre, in: Eifler, Christine: Frauenbündnis Projekt Osnabrück (Hrsg.): Militär – Gewalt – Geschlechterverhältnis. Dokumentation der Vortragsreihe vom Frauenbündnis Osnabrück „350 Jahre Krieg und Frieden – ohne Frauen?“, Osnabrück 1999, S. 96–111. Dies.: „Feministischer Antikommunismus“ und weibliche Staatsbürgerschaft in der Gründungsdekade der Bundesrepublik, in: Feministische Studien, 16. Jg. (1998), Heft 1, S. 86–94. Dies./Pawlowski, Rita: Die unfertige Demokratie. 50 Jahre „Informationen für die Frau“, Berlin 2002. Dies./Schmidt-Harzbach, Ingrid: ‚Friedenspolitik und Kalter Krieg: Frauenverbände im Ost-West-Konflikt, in: Frauenpolitik undpolitisches Wirken von Frauen im Berlin der Nachkriegszeit 1945–1949, Berlin 1996, S. 229–238. Dies.: Emanzipation zum Staat?: Der Allgemeine Deutsche Frauenverein – Deutscher Staatsbürgerinnenverband (1893–1933), Pfaffenweiler 1990. Dies.: „Organisierte Mütterlichkeit“. Zur Politik der deutschen Frauenbewegung um 1900, in: Hausen, Karin (Hrsg.): Frauen suchen ihre Geschichte. Historische Studien zum 19. und 20. Jahrhundert, München 1983, S. 221–249. Stöver, Bernd: Die Befreiung vom Kommunismus. Amerikanische Liberation Policy im Kalten Krieg 1947–1991, Böhlau 2002. Ders.: Der Kalte Krieg, München 2002.
1140 | Theanolte Bähnisch
Ders.: Rollback: Eine offensive Strategie für den Kalten Krieg, in: Junker, Detlef u. a. (Hrsg.): Die USA und Deutschland im Zeitalter des Kalten Krieges 1945–1990, Bd. 1: 1945–1968, Stuttgart/München 2001, S. 160–168. Stolleis, Michael: Verwaltungsrechtswissenschaft und Verwaltungslehre in der Weimarer Republik, in: Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 4: Das Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus, Stuttgart 1985, S. 77–91. Strick, Christina: Jenseits der Routine? Die Bezirksregierung Düsseldorf 1945 bis 1955, Dissertation, Düsseldorf 2007, online auf: http://docserv.uni-duesseldorf. de/servlets/DocumentServlet?id=7032, am 10.12.2013. Sucher, Bernd (Hrsg.): Theater-Lexikon. Autoren, Regisseure, Schauspieler, Dramaturgen, Bühnenbildner, Kritiker, 2. überarbeitete Aufl., München 1999. Suckut, Siegfried: Parteien in der SBZ/DDR 1945–1952, Bonn 2000. Süssmuth, Hans: Kleine Geschichte der CDU-Frauen-Union, Baden-Baden 1990. Sunnus, Michael: Der NS-Rechtswahrerbund (1928–1945). Zur Geschichte der nationalsozialistischen Juristenorganisation, Frankfurt a. M. 1990. Sywottek, Arnold: Die Sowjetunion aus westdeutscher Sicht seit 1945, in: Niedhard, Gottfried (Hrsg.): Der Westen und die Sowjetunion. Einstellungen und Politik gegenüber der UdSSR in Europa und in den USA seit 1917, Paderborn 1983, S. 290–362. Tacke, Veronika: Organisationssoziologie, in: Kneer, Georg/Schroer, Markus (Hrsg.): Handbuch Spezielle Soziologie, Wiesbaden 2010, S. 341. Tennstedt, Florian: Sozialreform in Deutschland. Einige Anmerkungen zum Verhältnis von wissenschaftlichen (Vereins-)Initiativen und politischer Herrschaft seit dem 19. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Sozialreform, 32. Jg. (1986), S. 10–24. Tenorth, Heinz-Elmar: Friedrich Siegmund-Schultze – Eine erziehungswissenschaftliche Annäherung, in: ders. (Hrsg.): Friedrich Siegmund-Schultze (1885–1969). Ein Leben für Kirche, Wissenschaft und soziale Arbeit, Berlin 2007, S. 70–83. Tent, James: Mission on the Rhine. American Educational Policy in Postwar Germany, 1945–1949, in: History of Education Quarterly, 22. Jg. (1982), Nr. 3, S. 255– 276. Ders.: Vom Proleten zum Industriearbeiter. Arbeiterbewegung und Sozialpolitik in Deutschland, 1800–1914, Köln 1983. Tetzlaff, Walter: Kurzbiographien bedeutender Juden des 20. Jahrhunderts, Lindhorst 1982, auf WBIS online, Zugang über die Universitätsbibliothek Kassel/DBIS. Theiner, Peter: Sozialer Liberalismus und deutsche Weltpolitik. Friedrich Naumann im Wilhelminischen Deutschland (1860–1919), Baden-Baden 1983, S. 194–217. Thiele, Willi: Die staatliche Mittelinstanz und die parlamentarische Kontrolle, in: Deutsches Verwaltungsblatt, 82. Jg. (1967), S. 502–506. Thol, Norbert J.: Möglichkeiten und Grenzen der Ausubelschen Assimilationstheorie für Lern- und Behaltensleistungen. Eine Untersuchung zur Erprobung des 'advance organizer‘s' in der Sekundarstufe II eines deutschen Gymnasiums, Dissertation, Essen 1984. Tietgens, Hans: Klara Meyer und Charlotte Ziegler an der Volkshochschule Hannover. Zwei der ersten Frauen in der Volkshochschularbeit nach 1945, in: Ciupke, Paul/Derichs-Kunstmann, Karin (Hrsg.): Zwischen Emanzipation und ‚besonde-
Quellen und Literatur | 1141
rer Kulturaufgabe der Frau‘. Frauenbildung in der Geschichte der Erwachsenenbildung, Essen 2001, S. 227–236. Ders.: „Heiner Lotze (1900–1958)“, in: Wolgast, Günther/Knoll, Joachim (Hrsg.): Biographisches Handwörterbuch der Erwachsenenbildung, Stuttgart 1986, S. 245–246. Tscharntke, Denise: Re-educating German Women. The work of the Women´s Affairs Section of British Military Government 1946–1951, Frankfurt a. M. 2003. Tschechne, Wolfgang (Hrsg.): Heinrich Zille. Hofkonzert im Hinterhaus. Geschichten aus (manchmal) gemütlichen Jahren, Hannover 1976. Trapper, Thomas: Erziehungshilfe: Von der Disziplinierung zur Vermarktung. Entwicklungslinien der Hilfen zur Erziehung in den gesellschaftlichen Antinomien zum Ende des 20. Jahrhunderts, Rieden 2002. Trommler, Frank (Hrsg.): Amerika und die Deutschen. Bestandsaufnahme einer 300jährigen Geschichte, Opladen 1986. Ders./Shore, Elliott (Hrsg.): Deutsch-amerikanische Begegnungen. Konflikt und Kooperation im 19. und 20. Jahrhundert, München 2001. Überschär, Gerd R.: Für ein anderes Deutschland – Der deutsche Widerstand gegen den NS-Staat 1939–1945, Frankfurt a. M. 2006. Uhlendorff, Uwe: Geschichte des Jugendamtes. Entwicklungshilfen öffentlicher Jugendhilfe 1871–1929, Weinheim/Basel/Berlin 2003. Ujma, Christina: Neue Frauen, alte Männer. Gabriele Tergits „Frauen und andere Ereignisse“, in: literaturkritik.de, Nr. 2, 01.02.2002, auf; http://www.literaturkritik. de/public/rezension.php?rez_id=4585, am 15.05.2014. Ule, Carl Hermann: „Drews, Wilhelm Arnold“, in: Neue Deutsche Biographie 4 (1959), S. 117/118. Onlinefassung auf: http://www.deutsche-biographie.de/pnd 116219459.html, am 11.10.2013. Ullrich, Volker: Biografie. Die schwierige Königsdisziplin, in: Die Zeit, 09.04.2007. Ulshoefer, Helgard: Frauendachorganisationen in Westdeutschland nach 1945, in: Hundt, Irina/Kischlat, Ilse (Hrsg.): Topographie und Mobilität in der deutschen Frauenbewegung. Ergebnisse des wissenschaftlichen Kolloquiums des Deutschen Staatsbürgerinnen-Verbandes e. V. am 2. November 2002, Berlin 2003, S. 129– 137. Unseld, Melanie: Im Karussell der Gegensätze, in: Faulstich, Werner (Hrsg.): Die Kultur der 20er Jahre, München 2008, S. 151–161. Urban, Thomas: Der Verlust. Die Vertreibung der Deutschen und Polen im 20. Jahrhundert, Bonn 2005. Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung: http://www.deutscherverband.org/cms/index.php?id=10, am 13.12.2013. Vogel, Barbara: Ernst Cassirer. Philosoph und liberaler Demokrat. Ernst Cassirer und die Hamburger Universität von 1919 bis 1933, in: Frede, Dorothea/Schmücker, Reinold (Hrsg.): Ernst Cassirers Werk und Wirkung, S. 185–214. Voges, Wolfgang: Methoden der Biographie und Lebenslaufforschung, Opladen 1987. Volquarts, Elisabeth: Beamtenverbände im Nationalsozialismus. Gleichschaltung zum Zwecke der Ausschaltung aufgrund politischer oder weltanschaulicher Gegnerschaft, Kiel 2001.
1142 | Theanolte Bähnisch
Vollnhals, Clemens (Hrsg.): Entnazifizierung. Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Besatzungszonen 1945–1949, München 1991. Wallbaum, Klaus: Der Überläufer. Rudolf Diels (1900–1957) – der erste GestapoChef des Hitler-Regimes, Frankfurt a. M. 2010. Walter, Franz: „Republik das ist nicht viel“. Partei und Jugend in der Krise des Weimarer Sozialismus, Bielefeld 2011. Wartenpfuhl, Birgit: Destruktion – Konstruktion – Dekonstruktion. Perspektiven für die feministische Theo-rieentwicklung, in: Fischer, Uta Luise und andere: Kategorie: Geschlecht. Empirische Analysen und feministische Theorien, Opladen 1996, S. 191–209. Walter, Franz: Von der roten zur braunen Hochburg. Wahlanalytische Überlegungen zur Resonanz der NSDAP in den beiden thüringischen Industrielandschaften, in: Heiden, Detlev/Mai, Gunther (Hrsg.): Thüringen auf dem Weg ins Dritte Reich, Erfurt 1996, S. 119–146. WBIS (World Biographical Information System) online, auf: http://db.saur.de/WBIS/login.jsf;jsessionid=6bd2943e5da7d233fc248b1f253f, abgerufen über DBIS (Datenbank-Informationssystem der Universität Kassel. Weber, Gerda: Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD), in: Broszat, Martin/Weber, Hermann (Hrsg.): SBZ-Handbuch. Staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Führungskräfte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, München 1990, S. 691–713. Weber, Hermann: Die DDR 1945–1990, München 2006. Ders.: Gab es eine demokratische Vorgeschichte der DDR?, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 43. Jg. (1992), S. 272–280. Ders. (Hrsg.): Parteiensystem zwischen Demokratie und Volksdemokratie, Köln 1983. Weber, Petra: Guter Patriot und guter Europäer – das Europa Carlo Schmids, in: Depkat, Volker/Graglia, Piero (Hrsg.): Entscheidung für Europa. Erfahrung, Zeitgeist und politische Herausforderungen am Beginn der europäischen Integration, Berlin/New York 2010, S. 243–262. Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922. Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1914–1949, 2. Aufl., München 2003. Ders.: Zum Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Psychoanalyse, in: ders.: Geschichte und Psychoanalyse, Köln 1971. Weisbrod, Bernd (Hrsg.): Grenzland. Beiträge zur Geschichte der deutsch-deutschen Grenze, Hannover 1993. Weise, Dora: Das Frauenleitbild in ausgewählten deutschen Frauenzeitschriften der Nachkriegszeit (1945–1955), Diplomarbeit, München 2009, S. 41, auf: http://books.google.de/books?id=PCbMsNkFFaoC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=L isbeth+Pfeiffer+welt+der+frau&source=bl&ots=_uFHUSdgeB&sig=NzDAkxs ZpuV_oqx4BBo_24c93No&hl=de&sa=X&ei=OdgbUYaGPOrw4QTC7YA4&re dir_esc=y#v=onepage&q=Lisbeth%20Pfeiffer%20welt%20der%20frau&f=false, am 13.12.2013. Weickart, Eva: Der Blaustrumpf. Ein fast vergessenes Schimpfwort, in: vernetzungsstelle.de. Das Portal aus Niedersachsen für Gleichberechtigung, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, auf: http://www.vernetzungsstelle.de/index.cfm?uuid
Quellen und Literatur | 1143
=4566B782C2975CC8A429C69F0FF72C9D&and_uuid=BA20B15BC2975CC8 A9F47B1D4F74AECE, am 20.05.2015. Welsh, Helga A.: „Antifaschistisch-demokratische Umwälzung“ und politische Säuberung in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, in: Henke, KlausDietmar/Woller, Hans (Hrsg.): Politische Säuberung in Westeuropa. Die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration nach dem Zweiten Weltkrieg, München 1991. Wendt, Wolf Rainer: Geschichte der sozialen Arbeit, 4. Aufl., Stuttgart 1995. Wengst, Udo: Staatsaufbau und Verwaltungsstruktur, in: Bracher, Karl Dietrich/Funke, Manfred/Jacobsen, Hans-Adolf (Hrsg.): Die Weimarer Republik 1918–1933, 3. Aufl., Bonn 1998, S. 62–76. Wer ist wer? [ältere Auflagen: Wer ist’s], 1. bis 49. Auflage, verschiedene Verlagsorte, 1905–2010. Werner, Hans-Joachim: Politisches Bewußtsein Warendorfer Frauen 1924, in: Warendorfer Schriften, Bd. 19/20 (1989/90), S. 52–58. Wickert, Christl: Frauen gegen die Diktatur – Widerstand und Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland, Berlin 1995. Wieking, Friedrike: Die Entwicklung der weiblichen Kriminalpolizei in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart, Lübeck 1958. Wietschorke, Jens: Arbeiterfreunde. Soziale Mission im dunklen Berlin 1911–1933, Frankfurt a. M. 2013. Ders.: Friedrich Siegmund-Schultze. Ein biographisch-bibliographischer Abriß, in: Tenorth, Heinz-Elmar (Hrsg.): Friedrich Siegmund-Schultze (1885–1969). Ein Leben für Kirche, Wissenschaft und soziale Arbeit, Berlin 2007, S. 147–151. Ders.: Stadt- und Sozialforschung in der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, in: Tenorth, Heinz-Elmar (Hrsg.): Friedrich Siegmund-Schultze (1885–1969). Ein Leben für Kirche, Wissenschaft und soziale Arbeit, Berlin 2007, S. 51–67. Ders.: Soziales Settlement und ethnographisches Wissen. Zu einem Berliner Reformprojekt 1911–1933, in: Hengartner, Thomas/Moser, Johannes (Hrsg.): Grenzen & Differenzen. Zur Macht sozialer und kultureller Grenzziehungen, Dresden 2005, S. 309–316. Wiggershaus, Renate: Geschichte der Frauen und der Frauenbewegung in der Bundesrepublik Deutschland und in der deutschen Demokratischen Republik nach 1945, Wuppertal 1979. Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, auf: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia: Hauptseite. Wildt, Michael: Die Ungleichheit des Volkes. „Volksgemeinschaft“ in der politischen Kommunikation der Weimarer Republik, in: Bajohr, Frank/Wildt, Michael (Hrsg.): Volksgemeinschaft. Neue Forschungen zur Gesellschaft des Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 2009, S. 24–40. Willing, Matthias: Das Bewahrungsgesetz. Eine rechtshistorische Studie zur Geschichte der deutschen Fürsorge, Tübingen 2003. Wittebur, Klemens: Die deutsche Soziologie, 1933–1945. Eine biographische Kartographie, Münster/Hamburg 1991. Wolf, Siegbert (Hrsg.): Witkop, Milly/Barwich, Hertha/Köster, Aimée u. a.: Der syndikalistische Frauenbund, Münster 2007.
1144 | Theanolte Bähnisch
Wolff, Kerstin: Ein Traditionsbruch? Warum sich die autonome Frauenbewegung als geschichtslos erlebte, in: dies./Paulus, Julia/Silies, Eva-Maria (Hrsg.): Zeitgeschichte als Geschlechtergeschichte. Neue Perspektiven auf die Bundesrepublik. Frankfurt a. M. 2012, S. 257–275. Dies.: Helene Lange. Eine Lehrerin der bürgerlichen Frauenbewegung, auf: bpb, http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35312/helene-lange?p= all, am 08.01.2009. Wollenberg, Jörg: „14 Jahre Volkshochschularbeit..., das lasse ich nicht aus der Geschichte Hannovers löschen“. Ada Lessing als geschäftsführende Leiterin der Volkshochschule Hannover von 1919–1933, in: Ciupke, Paul/DerichsKunstmann, Karin (Hrsg.): Zwischen Emanzipation und „besonderer Kulturaufgabe der Frau“. Frauenbildung in der Geschichte der Erwachsenenbildung, Essen 2001, S. 132–148. Ders.: Vom Volkshochschulheim des Arbeitsdienstes zur Heimvolkshochschule des Wiederaufbaus. Ein anderer Blick auf die Gründungsväter von Hustedt und der Göhrde, in: Kuchta, Detlev (Hrsg.): Politische Bildung im Wandel. 50 Jahre Heivolkshochschule Jägerei Hustedt, 1948–1998, Recklinghausen 1998, S. 37–48. Women’s Auxiliary of the American Legion, auf: http://www.legion.org/auxiliary, am 23.07.2014. Wysocki, Gerd: Arbeit für den Krieg. Herrschaftsmechanismen in der Rüstungsindustrie des „Dritten Reiches“; Arbeitseinsatz, Sozialpolitik und staatspolizeiliche Repression bei den Reichswerken "Hermann Göring" im Salzgitter-Gebiet 1937/38 bis 1945, Braunschweig 1992. Zahlmann, Stefan: Rezension zu: Klein, Christian (Hrsg.): Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens, Stuttgart 2002, in: HSoz-u-Kult, 16.06.2003, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2003 -2-154, am 20.03.2014 Zeitgeschichte online, auf: http://www.zeitgeschichte-online.de Zepp, Marianne: Redefining Germany. Reeducation, Staatsbürgerschaft und Frauenpolitik im US-amerikanisch besetzten Nachkriegsdeutschland, Göttingen 2007. Zeuner, Christine: Die 'Leipziger Richtung' – Kontext erwachsenenbildnerischer Tätigkeit Fritz Borinskis vor 1933, in: Jelich, Franz-Josef (Hrsg.): Fritz Borinski: zwischen Pädagogik und Politik – ein historisch-kritischer Rückblick, Essen 2000. Ziegeler, Beate: Weibliche Ärzte und Krankenkassen. Anfänge ärztlicher Berufstätigkeit von Frauen in Berlin 1893–1935, Weinheim 1993. Ziegler, Christl: Frauenkongreß in Bad Boll. Auftakt zu internationalen Frauenkongressen in den Westzonen nach 1945, in: Ciupke, Paul/Dierichs-Kunstmann, Karin (Hrsg.): Zwischen Emanzipation und ‚besonderer Kulturaufgabe der Frau‘. Frauenbildung in der Geschichte der Erwachsenenbildung, Essen 2001, S. 207– 214. Dies.: Lernziel Demokratie. Politische Frauenbildung in der britischen und amerikanischen Besatzungszone 1945–1949, Köln/Weimar/Wien 1997. Zigan, Gisa Margarete: Die soziale Situation der Studentin: Wohnen und Studium mit Kind, in: Happ, Sabine/Jüttemann, Veronika (Hrsg.): „Laßt sie doch denken!“ 100 Jahre Studium für Frauen in Münster, Münster 2008, S. 125–150.
Quellen und Literatur | 1145
Zimmermann, Christian von: Exemplarische Lebensläufe. Zu den Grundlagen der Biographik, in: ders./Zimmermann, Nina von (Hrsg.): Frauenbiographik. Lebensbeschreibungen und Porträts, Tübingen 2005, S. 3–16. Zimmermann, Nina von: Zu den Wegen der Frauenbiographikforschung, in: dies./Zimmermann, Christian von (Hrsg.): Frauenbiographik. Lebensbeschreibungen und Porträts, Tübingen 2005, S. 17–32. Zirlewagen, Marc: Ferdinand Friedensburg, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), XXVI (2006), Sp. 313–321.
VORTRÄGE Vortrag von Dr. Anke Sawahn: Der Erinnerungskult um die Schriftstellerin Agnes Miegel und seine Problematisierung, im Rahmen der Tagung: Persönlichkeiten und die Umbenennung von Straßen und Preisen als Ergebnis von erinnerungskulturellen Debatten, Arbeitskreis für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, Hannover, 16.11.2013.
Geschichtswissenschaft Torben Fischer, Matthias N. Lorenz (Hg.)
Lexikon der »Vergangenheitsbewältigung« in Deutschland Debatten- und Diskursgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945 2015, 494 S., kart. 34,99 € (DE), 978-3-8376-2366-6 E-Book: 34,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-2366-0
Reinhard Bernbeck
Materielle Spuren des nationalsozialistischen Terrors Zu einer Archäologie der Zeitgeschichte 2017, 520 S., kart., zahlr. z.T. farb. Abb. 39,99 € (DE), 978-3-8376-3967-4 E-Book: 39,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-3967-8
Debora Gerstenberger, Joël Glasman (Hg.)
Techniken der Globalisierung Globalgeschichte meets Akteur-Netzwerk-Theorie 2016, 296 S., kart. 29,99 € (DE), 978-3-8376-3021-3 E-Book: 26,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-3021-7
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de
Geschichtswissenschaft Alban Frei, Hannes Mangold (Hg.)
Das Personal der Postmoderne Inventur einer Epoche 2015, 272 S., kart. 19,99 € (DE), 978-3-8376-3303-0 E-Book: 17,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-3303-4
Manfred E.A. Schmutzer
Die Wiedergeburt der Wissenschaften im Islam Konsens und Widerspruch (idschma wa khilaf) 2015, 544 S., Hardcover 49,99 € (DE), 978-3-8376-3196-8 E-Book: 49,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-3196-2
Pascal Eitler, Jens Elberfeld (Hg.)
Zeitgeschichte des Selbst Therapeutisierung – Politisierung – Emotionalisierung 2015, 394 S., kart. 34,99 € (DE), 978-3-8376-3084-8 E-Book: 34,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-3084-2
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de

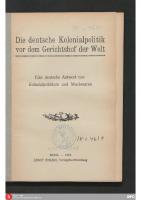

![Die Geschichte der Begrenzung von Vertragsstrafen: Eine Untersuchung zur Vorgeschichte und Wirkungsgeschichte der Regel des § 343 BGB [1 ed.]
9783428476848, 9783428076840](https://ebin.pub/img/200x200/die-geschichte-der-begrenzung-von-vertragsstrafen-eine-untersuchung-zur-vorgeschichte-und-wirkungsgeschichte-der-regel-des-343-bgb-1nbsped-9783428476848-9783428076840.jpg)





