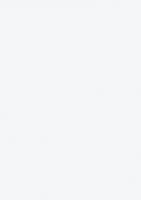Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften: Mitarbeit:Gethmann-Siefert, Annemarie;Übersetzung:Walter, Axel [3 ed.] 3534266374, 9783534266371
Der Philosoph Hacker und der Neurowissenschaftler Bennett liefern in diesem Band eine umfassende Darstellung der philoso
144 62 5MB
German Pages 565 [578] Year 2015
Front Cover
Titel
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung
Teil I: Die philosophischen Probleme in den Neurowissenschaften: Ihre historischen und begrifflichen Wurzeln
1 Die Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnis: Die Integrationstätigkeit des Nervensystems
1.1 Aristoteles, Galen und Nemesius: Die Ursprünge der Ventrikellehre
1.2 Fernel und Descartes: Der Niedergang der Ventrikellehre
1.3 Die Kortexlehre von Willis und seinen Nachfolgern
1.4 Der Reflexbegriff: Bell, Magendie und Marshall Hall
1.5 Die Lokalisierung der Funktionen im Kortex: Broca, Fritsch und Hitzig
1.6 Die Integrationstätigkeit des Nervensystems: Sherrington
2 Der Kortex und der Geist im Werk Sherringtons und seiner Protegés
2.1 Charles Sherrington: Der anhaltende cartesianische Einfluss
2.2 Edgar Adrian: Zaudernder Cartesianismus
2.3 John Eccles und das ‚Liaisongehirn‘
2.4 Wilder Penfield und der ‚höchste Gehirnmechanismus‘
3 Der mereologische Fehlschluss in den Neurowissenschaften
3.1 Die mereologischen Konfusionen in den kognitiven Neurowissenschaften
3.2 Methodologische Bedenken
3.3 Über die Gründe für die Zuschreibung psychologischer Prädikate zu einem Lebewesen
3.4 Über die Gründe für die Fehlzuschreibung psychologischer Prädikate zu einer inneren Entität
3.5 Das Innere
3.6 Introspektion
3.7 Privilegierter Zugang: Unmittelbar und mittelbar
3.8 Privatheit oder Subjektivität
3.9 Die Bedeutung von psychologischen Prädikaten und wie sie gelernt werden
3.10 Über den Geist und das, was ihn auszeichnet
Teil II: Menschliche Fähigkeiten und die Neurowissenschaften dieser Tage: Eine Analyse
Einleitende Bemerkungen
1 Der Gehirn-Körper-Dualismus
2 Das Projekt
3 Die Kategorie des Psychischen
4 Empfindung und Wahrnehmung
4.1 Empfindung
4.2 Wahrnehmung
4.2.1 Wahrnehmung als die Verursachung von Empfindungen: Primäre und sekundäre Qualitäten
4.2.2 Wahrnehmung als Hypothesenbildung: Helmholtz
4.2.3 Visuelle Bilder und das Bindungsproblem
4.2.4 Wahrnehmung als Informationsverarbeitung: Marrs Theorie des Sehens
5 Die kognitiven Vermögen
5.1 Wissen und seine Verwandtschaft mit Fähigsein
5.1.1 Fähig sein und wissen wie
5.1.2 Über Wissen verfügen und Wissen enthalten
5.2 Gedächtnis
5.2.1 Deklaratives und nichtdeklaratives Gedächtnis
5.2.2 Speicherung, Bewahrung und Gedächtnisspuren
6 Die kogitativen Vermögen
6.1 Glauben
6.2 Denken
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
6.3.1 Die logischen Merkmale des bildlichen Vorstellens
7 Emotion
7.1 Affektionen
7.2 Die Emotionen: Ein einleitender analytischer Überblick
7.2.1 Die Verwirrungen der Neurowissenschaftler
7.2.2 Analyse der Emotionen
8 Wollen und Willkürbewegung
8.1 Wollen
8.2 Libets Theorie der Willkürbewegung
8.3 Bestandsaufnahme
Teil III: Bewusstsein und die zeitgenössischen Neurowissenschaften: Eine Analyse
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
9.1 Bewusstsein und das Gehirn
9.2 Intransitives Bewusstsein
9.3 Das transitive Bewusstsein und seine Formen
9.4 Das transitive Bewusstsein: Eine unvollständige Analyse
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
10.1 Erweiterung des Bewusstseinsbegriffs
10.2 Bewusste Erfahrung und bewusste Geisteszustände
10.2.1 Verwirrungen im Hinblick auf unbewussten Glauben und unbewusste Gehirnaktivitäten
10.3 Qualia
10.3.1 ‚Wie es sich anfühlt‘ [‚How it feels‘], eine Erfahrung zu haben
10.3.2 Zum Problem des es fühlt sich an wie
10.3.3 Erfahrung als Qualität
10.3.4 Die So und die Das
10.3.5 Über die Mitteilbarkeit und Beschreibbarkeit von Qualia
11 Rätselraten um das Bewusstsein
11.1 Ein Sack voller Rätsel
11.2 Über die Vereinbarkeit von Bewusstsein oder Subjektivität mit unserer Auffassung von einer objektiven Realität
11.3 Über die Frage, wie physisch-materielle Prozesse bewusste Erfahrung hervorbringen können
11.4 Über den evolutionären Wert des Bewusstseins
11.5 Das Bewusstseins-Problem
11.6 Der Geist anderer und andere Tiere
12 Selbstbewusstsein
12.1 Selbstbewusstsein und das Selbst
12.2 Das historische Bühnenbild: Descartes, Locke, Hume und James
12.3 Gegenwärtige wissenschaftliche und neurowissenschaftliche Reflexionen zur Frage, wodurch das Selbstbewusstsein charakterisiert ist
12.4 Die ‚Selbst‘-Illusion
12.5 Der Horizont von Denken, Wille und Affektion
12.5.1 Denken und Sprache
12.6 Selbstbewusstsein
Teil IV: Methodisches
13 Reduktionismus
13.1 Ontologischer und erklärender Reduktionismus
13.2 Reduktion durch Beseitigung
13.2.1 Sind unsere psychologischen Alltagsbegriffe theoretische Begriffe?
13.2.2 Sind unsere alltäglichen psychologischen Verallgemeinerungen Gesetze einer Theorie?
13.2.3 Beseitigung alles Menschlichen
13.2.4 Den Ast absägen, auf dem man sitzt
14 Methodologische Reflexionen
14.1 Sprachbeharrung und Begriffsinnovation
14.2 Das Argument von der ‚Unzulänglichkeit des Englischen‘
14.3 Vom Unsinn zum Sinn: Die richtige Beschreibung der Resultate der Kommissurotomie
14.3.1 Der Fall des Blindsehens: Falschdarstellungen und Scheinerklärungen
14.4 Philosophie und Neurowissenschaften
14.4.1 Was die Philosophie zu leisten vermag und was nicht
14.4.2 Was die Neurowissenschaften zu leisten vermögen und was nicht
14.5 Weshalb das alles wichtig ist
Personen- und Sachregister
Back Cover
Recommend Papers
![Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften: Mitarbeit:Gethmann-Siefert, Annemarie;Übersetzung:Walter, Axel [3 ed.]
3534266374, 9783534266371](https://ebin.pub/img/200x200/die-philosophischen-grundlagen-der-neurowissenschaften-mitarbeitgethmann-siefert-annemariebersetzungwalter-axel-3nbsped-3534266374-9783534266371.jpg)
- Author / Uploaded
- Maxwell Richard Bennett
- Peter Michael Stephan Hacker
File loading please wait...
Citation preview
Maxwell R. Bennett/Peter M. S. Hacker
Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften Sonderausgabe Aus dem Englischen übersetzt von Axel Walter Mit einem Vorwort von Annemarie Gethmann-Siefert
Titel der englischen Originalausgabe: Philosophical Foundations of Neuroscience, Oxford et al. 2003: Blackwell Publishing Ltd. Die Übersetzung der Kapitel 9 und 10 basiert auf Vorarbeiten von Christoph Düchting. Gefördert durch den Wilhelm-Weischedel-Fonds der WBG
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitungdurch elektronische Systeme. Sonderausgabe 2015 © 2010 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht. Einbandgestaltung: Peter Lohse, Heppenheim Einbandabbildung: Gehirn © ktsdesign/Fotolia.com Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier Printed in Germany Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de ISBN 978-3-534-26637-1
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich: eBook (PDF): 978-3-534-73966-0 eBook (epub): 978-3-534-73967-7
Inhaltsverzeichnis Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI
Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Teil I Die philosophischen Probleme in den Neurowissenschaften: Ihre historischen und begrifflichen Wurzeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
1 Die Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnis: Die Integrationstätigkeit des Nervensystems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Aristoteles, Galen und Nemesius: Die Ursprünge der Ventrikellehre . . . 1.2 Fernel und Descartes: Der Niedergang der Ventrikellehre . . . . . . . . . . . 1.3 Die Kortexlehre von Willis und seinen Nachfolgern . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Der Reflexbegriff: Bell, Magendie und Marshall Hall . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Die Lokalisierung der Funktionen im Kortex: Broca, Fritsch und Hitzig 1.6 Die Integrationstätigkeit des Nervensystems: Sherrington . . . . . . . . . . .
13 14 29 38 43 48 52
2 Der Kortex und der Geist im Werk Sherringtons und seiner Protegés . . . . . . 2.1 Charles Sherrington: Der anhaltende cartesianische Einfluss . . . . . . . . . 2.2 Edgar Adrian: Zaudernder Cartesianismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 John Eccles und das ‚Liaisongehirn‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Wilder Penfield und der ‚höchste Gehirnmechanismus‘ . . . . . . . . . . . .
54 54 59 62 73
3 Der mereologische Fehlschluss in den Neurowissenschaften . . . . . . . . . . . . . 87 3.1 Die mereologischen Konfusionen in den kognitiven Neurowissenschaften (Crick, Edelman, Blakemore, Young, Damasio, Frisby, Gregory, Marr, Johnson-Laird) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.2 Methodologische Bedenken (Ullman, Blakemore, Zeki, Young, Milner, Squire und Kandel, Marr, Frisby, Sperry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3.3 Über die Gründe für die Zuschreibung psychologischer Prädikate zu einem Lebewesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3.4 Über die Gründe für die Fehlzuschreibung psychologischer Prädikate zu einer inneren Entität (Damasio, Edelman und Tononi, Kosslyn und Ochsner, Searle, James, Libet, Humphrey, Blakemore, Crick) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
VI
Inhaltsverzeichnis
3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10
Das Innere (Damasio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introspektion (Humphrey, Johnson-Laird, Weiskrantz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privilegierter Zugang: Unmittelbar und mittelbar (Blakemore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privatheit oder Subjektivität (Searle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Bedeutung von psychologischen Prädikaten und wie sie gelernt werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Über den Geist und das, was ihn auszeichnet (Gazzaniga, Doty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115 117 120 123 127 136
Teil II Menschliche Fähigkeiten und die Neurowissenschaften dieser Tage: Eine Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Einleitende Bemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Der Gehirn-Körper-Dualismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Das Projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Die Kategorie des Psychischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145 145 149 153
4 Empfindung und Wahrnehmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Empfindung (Searle, Libet, Geldard und Sherrick) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Wahrnehmung (Crick) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Wahrnehmung als die Verursachung von Empfindungen: Primäre und sekundäre Qualitäten (Kandel, Schwartz und Jessell, Rock) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Wahrnehmung als Hypothesenbildung: Helmholtz (Helmholtz, Gregory, Glynn, Young) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Visuelle Bilder und das Bindungsproblem (Sherrington, Damasio, Edelman, Crick, Kandel und Wurtz, Gray und Singer, Barlow) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Wahrnehmung als Informationsverarbeitung: Marrs Theorie des Sehens (Marr, Frisby, Crick, Ullman) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158 158 164
168 178
181
189
5 Die kognitiven Vermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 5.1 Wissen und seine Verwandtschaft mit Fähigsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 5.1.1 Fähig sein und wissen wie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Inhaltsverzeichnis
5.1.2 Über Wissen verfügen und Wissen enthalten (LeDoux, Young, Zeki, Blakemore, Crick, Gazzaniga) . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Gedächtnis (Milner, Squire und Kandel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Deklaratives und nichtdeklaratives Gedächtnis (Milner, Squire und Kandel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.2 Speicherung, Bewahrung und Gedächtnisspuren (LeDoux, Squire und Kandel; Gazzaniga, Mangun und Ivry; James, Köhler, Glynn; Bennett, Gibson und Robinson; Damasio) . . . . . . . . . . . . 6 Die kogitativen Vermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 Glauben (Crick) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Denken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder (Blakemore, Posner und Raichle, Shepard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Die logischen Merkmale des bildlichen Vorstellens (Galton, Richardson, Kosslyn und Ochsner, Finke, Luria, Shepard, Meudell, Betts, Marks, Shepard und Metzler, Cooper und Shepard, Posner und Raichle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Emotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 Affektionen (Rolls, Damasio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Die Emotionen: Ein einleitender analytischer Überblick . . . . . . . . . . . . 7.2.1 Die Verwirrungen der Neurowissenschaftler (LeDoux, Damasio, James) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2 Analyse der Emotionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Wollen und Willkürbewegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Wollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Libets Theorie der Willkürbewegung (Libet, Frith et al.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3 Bestandsaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII 200 203 205
209 228 228 232 240
250 266 266 271 278 291 302 302 308 313
Teil III Bewusstsein und die zeitgenössischen Neurowissenschaften: Eine Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 9 Intransitives und transitives Bewusstsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 9.1 Bewusstsein und das Gehirn (Albright, Jessell, Kandel und Posner, Edelman und Tononi; Glynn, Greenfield, Llinás, Gazzaniga, Searle, Johnson-Laird, Chalmers, Dennett, Gregory, Crick und Koch, Frisby) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
VIII 9.2 9.3 9.4
Inhaltsverzeichnis
Intransitives Bewusstsein (Searle, Dennett) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Das transitive Bewusstsein und seine Formen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Das transitive Bewusstsein: Eine unvollständige Analyse . . . . . . . . . . . . 341
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1 Erweiterung des Bewusstseinsbegriffs (Libet, Baars, Crick, Edelman, Searle, Chalmers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Bewusste Erfahrung und bewusste Geisteszustände . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2.1 Verwirrungen im Hinblick auf unbewussten Glauben und unbewusste Gehirnaktivitäten (Searle, Baars) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3 Qualia (Searle, Chalmers, Glynn, Damasio, Edelman und Tononi, Nagel, Dennett) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 ‚Wie es sich anfühlt‘, eine Erfahrung zu haben (Searle, Edelman und Tononi, Chalmers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Zum Problem des es fühlt sich an wie (Nagel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3.3 Erfahrung als Qualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3.4 Die So und die Das (Chalmers, Crick) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3.5 Über die Mitteilbarkeit und Beschreibbarkeit von Qualia (Nagel, Edelman, Glynn, Sperry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rätselraten um das Bewusstsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1 Ein Sack voller Rätsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 Über die Vereinbarkeit von Bewusstsein oder Subjektivität mit unserer Auffassung von einer objektiven Realität (Searle, Chalmers, Dennett, Penrose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3 Über die Frage, wie physisch-materielle Prozesse bewusste Erfahrung hervorbringen können (Huxley, Tyndall, Humphrey, Glynn, Edelman, Damasio) . . . . . . . . . . . . 11.4 Über den evolutionären Wert des Bewusstseins (Chalmers, Barlow, Penrose, Humphrey, Searle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5 Das Bewusstseins-Problem (Johnson-Laird, Blakemore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6 Der Geist anderer und andere Tiere (Crick, Edelman, Weiskrantz, Baars) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
352 352 355
361
366 370 374 380 381 385 396 396
397
409 416 425 428
12 Selbstbewusstsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 12.1 Selbstbewusstsein und das Selbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Inhaltsverzeichnis
12.2 12.3
Das historische Bühnenbild: Descartes, Locke, Hume und James . . . . . Gegenwärtige wissenschaftliche und neurowissenschaftliche Reflexionen zur Frage, wodurch das Selbstbewusstsein charakterisiert ist (Damasio, Edelman, Humphrey, Blakemore, Johnson-Laird) . . . . . . . . . . 12.4 Die ‚Selbst‘-Illusion (Damasio, Humphrey, Blakemore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5 Der Horizont von Denken, Wille und Affektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5.1 Denken und Sprache (Damasio, Edelman und Tononi, Galton, Penrose) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.6 Selbstbewusstsein (Edelman, Penrose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX 438
444 448 453 457 469
Teil IV Methodisches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 13 Reduktionismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.1 Ontologischer und erklärender Reduktionismus (Crick, Blakemore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Reduktion durch Beseitigung (P. M. und P. S. Churchland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.1 Sind unsere psychologischen Alltagsbegriffe theoretische Begriffe? (P. M. Churchland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.2 Sind unsere alltäglichen psychologischen Verallgemeinerungen Gesetze einer Theorie? (P. M. Churchland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.3 Beseitigung alles Menschlichen (P. M. und P. S. Churchland, Dawkins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.4 Den Ast absägen, auf dem man sitzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Methodologische Reflexionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1 Sprachbeharrung und Begriffsinnovation (P. S. Churchland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Das Argument von der ‚Unzulänglichkeit des Englischen‘ (Blakemore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3 Vom Unsinn zum Sinn: Die richtige Beschreibung der Resultate der Kommissurotomie (Crick, Sperry, Gazzaniga, Wolford, Miller und Gazzaniga, Doty) . . . . . . 14.3.1 Der Fall des Blindsehens: Falschdarstellungen und Scheinerklärungen (Weiskrantz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4 Philosophie und Neurowissenschaften (Glynn, Edelman, Edelman und Tononi, Crick, Zeki) . . . . . . . . . . . . . . . 14.4.1 Was die Philosophie zu leisten vermag und was nicht . . . . . . . . . . . . . .
481 481 496 498
502 505 510 514 516 525
527 534 537 541
X
Inhaltsverzeichnis
14.4.2 Was die Neurowissenschaften zu leisten vermögen und was nicht (Crick, Edelman, Zeki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 14.5 Weshalb das alles wichtig ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Personen- und Sachregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Vorwort Philosophie im Zeitalter der Neurowissenschaften In aller Regel wird das „Leib-Seele-Problem“, das Kernstück einer umfassenden Anthropologie, als Rätsel eingeschätzt, das schwer oder überhaupt nicht lösbar ist. Diese Einschätzung hat dazu Anlass gegeben, ausgehend von unterschiedlichen philosophischen Positionen und auf der Basis differenter ontologischer Optionen Lösungsvorschläge zu entwickeln. Das wiederum hat die Autoren der Untersuchung über die Philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften dazu herausgefordert, die Triftigkeit solcher Vorschläge kritisch zu prüfen. Interessant ist vor allem die Kooperation zwischen dem renommierten australischen Neurowissenschaftler Max R. Bennett und dem Oxforder Philosophen Peter Michael Stephen Hacker. So gelingt es, die Tradition der Philosophy of Mind nicht nur klar darzustellen, sie für die aktuelle Konfrontation mit und Kontraposition zu den Naturwissenschaften zu erschließen, sondern zugleich die philosophischen Anleihen der Neurowissenschaften und deren (zumeist fatale) Folgen aufzudecken. Das Problemfeld: Menschliches Verhalten wird hier wie dort – in der Neurowissenschaft wie der philosophischen Bestimmung des Menschen, der Philosophy of Mind oder auch der Psychologie – auf seine Bedingungen, Gründe und Ursachen bezogen und gedeutet. Daraus scheint sich der Anspruch sowohl der Neurowissenschaften als auch der Philosophie zu rechtfertigen, dass jede von ihnen eine umfassende und unstrittig gültige Erschließung des „Geheimnisses Mensch“ durch eine spezifische Analyse seiner Vermögen bzw. Funktionsbedingungen oder sogar durch eine substanzmetaphysische Letztbegründung vorlegen kann. Allerdings soll dieser Anspruch durch unvereinbare Ergebnisse der Neurowissenschaften – sofern auf ihrer Grundlage eine Anthropologie, eine Theorie des Erkennens, Wollens, Fühlens entwickelt wird – und der Philosophie, die sich den nämlichen Aufgaben widmet, eingelöst werden. Die unterschiedlichen, teilweise widersprüchlichen Resultate nötigen zur Prüfung, wie weit unbewusst und zumindest unthematisiert Vorurteile mit einfließen, die als methodische Vorentscheidungen Aufbau und Weg der Untersuchungen festlegen. Dieser Blick hinter die Kulissen der funktionierenden Neurowissenschaften zeigt, dass Ergebnisse bereits durch die Art des experimentellen Zugriffs prädestiniert sein können und in aller Regel auch weitgehend vorgefertigt sind. Die hinführenden Überlegungen der Untersuchung zu den philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften weisen eine solche Verflechtung wissenschaftlicher Experimente mit jeweils unterschiedlichen philosophischen Ansätzen nach – so zunächst
XII
Vorwort
mit der aristotelischen ganzheitlichen Bestimmung des Menschen, dann aber vor allem mit dem cartesischen Dualismus. Das cartesische Problem, wie sich die Interaktion von Körper und Geist denken lasse, wird perpetuiert. Mit den Worten Charles Sherringtons: „Dem menschlichen Verstehen bot sich die Welt hartnäckig als doppelt dar“ (S. 58)1, was schließlich zu dem durch die philosophische Konzeption Poppers beeinflussten „interaktiven Dualismus“ führt, den J. Eccles vertritt und der auch in der deutschen Debatte Raum gewinnt. Die Frage, „wie eine immaterielle Entität wie der Geist mit Neuronen interagieren könne“ (S. 66), wird hier durch abenteuerliche Zusatzannahmen – wie der eines „Liaison-Gehirns“ (i. e. der dominanten linken Hemisphäre), das mit dem „selbstbewussten Geist in unmittelbarem Zusammenhang“ (S. 69) stehen soll, beantwortet. Es ist weder sinnvoll, eine solche (noch) an Descartes orientierte Zuschreibung menschlicher Fähigkeiten wie Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Wollen an den Geist als eigene Substanz vorzunehmen, noch, wie es F. Crick oder L. Weiskrantz tun, sie kurzerhand dem Gehirn zuzurechnen. Denn beide Versuche gehen von den nämlichen ungeprüften Annahmen aus: einer ontologischen Unterstellung zweier Substanzen und somit selbständiger Entitäten und einem Verständnis des Menschen, dessen Fähigkeiten im Prinzip entweder der einen oder der anderen Entität oder beiden aufgrund nicht weiter bestimmbarer Kooperationsformen zuerkannt werden. Hier deckt die Untersuchung einen fatalen Mechanismus auf, der dann in eine ausführliche Kritik der im Wesentlichen angelsächsischen Versuche, das Leib-Seele-Problem zu lösen, mündet. Die entscheidende Kritik wird bereits gegen die Neurowissenschaften selbst vorgebracht durch den Vorwurf eines „mereologischen Fehlschlusses“ (S. 87ff. und passim). Dieser besteht im Kontext der Neurowissenschaften wie der anschließenden philosophischen Diskussion in der Zurechnung von Fähigkeiten (Vermögen) eines Lebewesens zu Teilen seines Organismus – so etwa zum Geist als der steuernden Instanz oder in den „Verfallsform[en] des Cartesianismus“ (S. 92) zum Gehirn als dem maßgeblichen materiellen Steuerungsorgan. Im Gefolge dieser Fehlzuschreibung entstehen eben die Missverständnisse sowohl der Neurowissenschaften als auch der Neurophilosophie: Psychologische Attribute werden fehlalloziert. Sie werden entweder dem Gehirn (also der wissenschaftlich erschließbaren Sphäre beobachtbarer, weil materieller Phänomene) oder der so genannten mentalen Sphäre, einem nur privat verfügund erschließbaren Inneren des Menschen zugeschrieben. Damit sind die alternativen Extrempositionen umrissen, die sich in der angelsächsischen Literatur in zahlreichen Mischformen und Differenzierungsversuchen wiederentdecken lassen. Letztlich ist durch diese Kritik auch die aktuelle Debatte im deutschen Sprachraum mit betroffen, selbst wenn hier mit den Arbeiten von G. Roth und W. Singer ein ontologischer Materialismus (selbstverständlich unter der Hand und nie explizit diskutiert) bevorzugt wird. Das Leib-Seele-Problem scheint gelöst – allerdings auf kostenträchtige 1
Die Seitenangaben beziehen sich auf die Philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften, wo die Originalfundstellen ausgewiesen sind.
Philosophie im Zeitalter der Neurowissenschaften
XIII
Weise, nämlich durch den von Bennett und Hacker plausibel kritisierten „mereologischen Fehlschluss“. Die deutsche Neurophilosophie beendet die Diskussion durch die Definition des Menschen, die lautet, er sei „sein Gehirn“. Diese Radikalisierung der Anthropologie ermöglicht natürlich eine ebenso radikale Lösung des Leib-Seele-Problems. Da sich alle Fähigkeiten des Menschen mit Gehirnaktivitäten verknüpfen lassen, ja entsprechenden Hirnsphären zugeordnet werden können, und es zudem als nachgewiesen gilt, dass sie den bewusst erfahrenen „mentalen Ereignissen“ zeitlich vorausgehen, wird diese Lösung nicht nur als plausibel, sondern als zwingend dargestellt. Gegen Kants Mahnung, nicht da Kausalität zu unterstellen, wo nur ein „post hoc“ beobachtbar ist, hat sich diese Theorie immun gemacht. Zudem wird Kausalität, kausale Verursachung, als die einzig wissenschaftlich legitime Bezugnahme unterstellt und der Mensch als Marionette seines Gehirns definiert. Die Kritik, die sich in der Abhandlung zu den philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften durchweg findet, fällt hier auf keinen fruchtbaren Boden. Es wird sowohl einem – wenn auch dem komplexesten – Teil eines Organismus das zugeschrieben, was der Organismus nur als ganzer vermag, und es wird übersehen, dass es neben einer kausalen Verursachung auch konditionale Beziehungen gibt, also Bedingungen, die vorausgesetzt werden müssen, will man bestimmte Fähigkeiten des Menschen erklären. Das Gehirn ist als materielles Steuerungsorgan eine solche Bedingung (condition), keine Ursache. Kritische Anmerkungen, dass es sowohl für die Analyse menschlichen Verhaltens als auch für die des Handelns sinnvoller sei, von Gründen anstatt von Ursachen2 auszugehen, werden in dieser Diskussion kurzerhand vom Tisch gewischt. Denn – so das von G. Roth vorgebrachte „Argument“ – es lässt sich auch für das Finden von Gründen wie für alle mentalen Ereignisse die Vorgängigkeit einer Gehirnaktivität nachweisen. Diese wird dann als ein Suchen von Gründen durch das Gehirn gedeutet. Ersichtlich verleitet ein methodischer Fehler nicht nur dazu, ausgesprochen weitreichende und begründungsbedürftige ontologische Optionen einfach vorauszusetzen, sondern führt – wie sich in der aktuellen Diskussion zeigt – auch zu Schlussfolgerungen, die das menschliche Zusammenleben insgesamt radikal verändern würden, wollte man den Begründungsanspruch und die (vermeintliche) wissenschaftliche Gewissheit der Neurophilosophie akzeptieren
2
Es gibt auch in der deutschen Diskussion durchaus Versuche, sich mit dem methodischen Ansatz dieser aktuellen (und in angelsächsischen Positionen auch vorgezeichneten) Position auseinanderzusetzen, wie sie sich beispielsweise in der Überlegung von Lutz Wingert zu den Grenzen der naturalistischen Selbstobjektivierung, aber auch in sämtlichen Beiträgen eines Bandes mit dem Titel Philosophie und Neurowissenschaften, hrsg. von D. Sturma, Frankfurt a. M. 2006, finden. Als weiteres Beispiel kann die kleine Abhandlung von Peter Janich genannt werden: Kein neues Menschenbild. Zur Sprache der Hirnforschung, Frankfurt a. M. 2009. – Hinweise auf diese und ähnliche kritische Stimmen ließen sich vermehren. Durch die Abhandlung zu den Philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften wird die bereits begonnene Diskussion durch gezielte und weiterführende Argumente gestützt.
XIV
Vorwort
und auf der Basis einer solchen praktischen Einsicht entsprechende Veränderungen vornehmen. Die Annahme, Bewusstsein, Selbstbewusstsein, die eigenen emotiven sympathischen oder antipathischen Hinwendungen und nicht zuletzt der freie Willensentschluss würden nicht von uns selbst oder den Menschen, mit denen wir interagieren, sondern von neurophysiologischen Prozessen in deren Inneren gesteuert, führt auf der einen Seite zu nicht geringfügigen Irritationen, auf der anderen Seite sogar zu weitreichenden Forderungen der Umorganisation unseres gesellschaftlichen Systems. Es zeigt sich, dass eine auf den ersten Blick beinahe kleinlich, weil eben nur philosophisch motiviert anmutende Kritik, nämlich die an mereologischen Fehlschlüssen, bei Nichtbeachtung radikale und fatale Konsequenzen zeitigen kann. Mit dieser Kritik an Teil-Ganzes-Fehlschlüssen und der konsequenten Korrektur kausaler in konditionale Voraussetzungen verknüpft Hacker seine an Wittgenstein orientierten sprachphilosophischen Überlegungen. Das wird in der vorliegenden Abhandlung durch eine minutiöse Auseinandersetzung mit den Lösungsversuchen des Leib-Seele-Problems in der anglo-amerikanischen philosophischen Debatte durchgespielt. Diese Kritik durch methodische und sprachphilosophische Überlegungen wird anhand unterschiedlicher Probleme der Neurowissenschaften unserer Tage differenziert. Im Prinzip lautet der Vorwurf auch hier, dass der Gehirn-Körper-Dualismus durch „eine Art Krypto-Cartesianismus“ und zugleich durch Spielarten des mereologischen Fehlschlusses beeinträchtigt ist. So werden zunächst die Bestimmungen von Empfindung und Wahrnehmung, dann die kognitiven und die kogitativen Vermögen des Menschen analysiert in Auseinandersetzung mit Searle, Dennett, Crick, Damasio, Blakemore, um nur die in Deutschland Bekannteren zu nennen. Es folgen Überlegungen zur Emotion und ihrer Unterscheidung von Affektionen oder Trieben. Die Bestimmungen von Wollen und Willkürbewegung lassen sich in erster Näherung durch die Kritik am Verständnis des Willens als eines (quasi personalen aktiven) Auslösers von Wollensereignissen von Missverständnissen befreien. Hinzu kommt die Forderung des Verzichts auf eine entweder material-physische oder mental-psychische Lokalisierung des Willensaktes – also wieder der Nachweis eines faktisch virulenten mereologischen Fehlschlusses. Bei dieser Kritik zeigt sich, dass beide Extreme, nämlich eine Lokalisierung dieser Fähigkeiten und Vermögen des Menschen entweder im Bereich des Mentalen oder der physischen Gehirnereignisse durch dasselbe ontologische Schema, den verdeckten Cartesianismus, ebenso wie durch die Zuschreibung der Fähigkeiten des Lebewesens Mensch zu Teilen seines Organismus geprägt sind. Bezeichnend ist das Fazit, das Hacker in Orientierung an Wittgenstein in seiner Bestandsaufnahme zieht. Die Begriffe, die hier eingeführt und differenziert werden, sind nicht die theoretischen Begriffe der Wissenschaft (vgl. S. 313). Eine Nichtbeachtung dieses Unterschiedes zwischen wissenschaftlichen Begriffen und den Charakteristika menschlichen Verhaltens, „Emotionen und Motiven, Wissen und Glauben, Denken und Vorstellen“ (S. 314), reproduziert unbewusst und contre cœur die strukturelle Beschreibungsweise des cartesischen Dualismus. Es wird lediglich dem „Gehirn eine Viel-
Philosophie im Zeitalter der Neurowissenschaften
XV
zahl psychischer Funktionen“ zugeordnet, die vorher dem Geist als der entgegengesetzten substantiellen Sphäre zugeschrieben wurden (S. 315). In der eigens vorgenommenen Analyse des Bewusstseins und seiner Bestimmung in den Neurowissenschaften im dritten Teil der Überlegungen wiederholt sich der sprachkritische Analysestil und der Nachweis verdeckter ontologischer Unterstellungen – beide dazu angetan, das Bewusstsein als „ein[en] Sack voller Rätsel“ (S. 396ff.) zu deklarieren, ohne dass – von welcher philosophischen Position auch immer – eine Lösung wenigstens einiger der Rätsel in Sicht wäre. Zu dieser Resignation tragen im Wesentlichen hausgemachte philosophische Irrtümer bei. Dazu gehört nicht zuletzt die von Wittgenstein kritisierte Sprachverhexung, die Substantiierung von Fähigkeiten. Aus „Wahrnehmen wird eine Wahrnehmung“ bzw. eine dem Menschen zugeschriebene Wahrnehmung. Diese kann dann isoliert von den Subjekten einer deskriptiven Analyse unterzogen werden. Auch die evolutionäre Theorie der Emanation des Bewusstseins aus der Natur, genauer aus der Weiterentwicklung der Gehirne der Lebewesen, führt vor ein Rätsel, hat selbst aber kaum Erklärungskraft. Denn es sind wiederum Sprachverwirrungen im Wittgenstein’schen Sinn, wenn man z. B. danach fragt, wann Lebewesen die Fähigkeit erreichen, „Bilder-im-Gehirn“ (S. 411) zu haben, so dass sie sich ihre Welt repräsentieren können. Eine ähnliche falsch gestellte Frage ist die, wie aus einem neuronalen Muster ein Vorstellungsbild wird (S. 413 Anm.). Dies sind beides Fragen, auf die sich nur schwer eine Antwort finden lässt oder die zu ausgesprochen komplizierten Antwort-Konstruktionen führen. Der Eindruck, es beim Bewusstsein „mit etwas zutiefst Rätselhaftem“ (S. 413) zu tun zu haben, entsteht offensichtlich aus sprachlichen Irrtümern, Verwirrungen, die zu unlösbaren Problemen und schon in der Fragestellung angelegten Hemmnissen führen. Aus ihnen entstehende Gewissheiten verschärfen das Problem, wenn man versucht, das Selbstbewusstsein zu charakterisieren. Dieses wird häufig als eine Art Bühnenbild aufgefasst, auf dem das Selbst (eine eigenständige Entität) sich vor sich, d. h. das Ich (als ebenfalls eigenständige Identität) bringt. Leugnet man die hier versteckte ontologische Voraussetzung, so wird das Selbstbewusstsein schlicht als eine Illusion deklariert. Auch die Erklärung weiterer, ja letztlich sämtlicher menschlicher Fähigkeiten zu erkennen, wahrzunehmen, zu fühlen, zu wollen kann nicht gelingen, sobald die Fähigkeiten als eigenständige Entitäten – besonders deutlich wird dies in der Bestimmung des Willens als des Urhebers oder Auslösers von Wollensakten – konzipiert sind. Es steht die ontologische Falle bereit: Entweder muss man diese Fähigkeit einer eigenen Realitätssphäre im Menschen zuschreiben – dem materiellen Körper oder dem immateriellen Geist bzw. der Seele – oder man verfällt auf die in den augenblicklichen Lösungsvorschlägen bevorzugte Alternative, sich wegen der Schwierigkeiten, den ganzen Bereich des Mentalen wissenschaftlich zu erschließen, auf die materiellen und mit den Mitteln naturwissenschaftlicher Erfassung erklärlichen Phänomene zu beschränken. Die Weiterungen, insbesondere für die Leib-Seele-Debatte im anglo-amerikanischen Sprachraum, führen zu einer Reihe von Mischformen, die allerdings mit guten Gründen von Bennett und Hacker jeweils als entweder verkappter
XVI
Vorwort
cartesischer Dualismus oder als ein durch diesen noch beeinflusster unschlüssiger Materialismus kritisiert werden. In einem letzten Teil der Abhandlung fassen Bennett und Hacker noch einmal die aufgedeckten methodischen Probleme zusammen. Knapp und konzise wird in den Überlegungen ein Fazit gezogen, das auch die kritischeren Geister in der deutschen Debatte bereits befruchtet und den zunächst unschlüssigen Skeptizismus mit guter Nahrung versehen hat. Hier geht es um eine abschließende Bestimmung des Leistungsvermögens sowohl der Philosophie als auch der Neurowissenschaften.3 Für den deutschen Leser mag es auf den ersten Blick verwirrend und erschwerend sein, den Zugang zu einer (in aller Regel) neuen und fremden Welt des Denkens und Thematisierens zu finden. Bei näherer Prüfung zeigt sich aber, dass hier dieselben Probleme diskutiert werden, die in der deutschen Debatte um die Hirnforschung und um das Leib-Seele-Problem – oft wesentlich an amerikanischen Philosophen orientiert – aufgegriffen werden. Wie sich an den hitzigen Debatten in den Journalen, Fernsehsendungen und Kolloquien zeigt, reizen insbesondere die reduktionistischen Positionen wegen ihrer Brisanz, und d. h. vor allen Dingen wegen der in der deutschen Forschungslandschaft geforderten Konsequenzen, zum Widerspruch. Hier geht es nicht nur um theoretisch relevante Kontroversen, sondern zugleich um lebensweltliche Konsequenzen und Lebensformvorschläge durchgreifender Art – um Probleme also, die dringend gelöst werden müssen. Daher lässt sich das Fazit des ganzen Bandes, nämlich die Frage, was eigentlich die Philosophie und was die Neurowissenschaften leisten können, auch als Menetekel für die Debatte in den eigenen Reihen anführen und hoffentlich beherzigen. Auf jeden Fall sind die Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Neurowissenschaften kulturübergreifend bedeutsam. Es gilt generell die Mahnung, sich an die eigenen philosophischen Anleihen zu erinnern bzw. philosophischerseits erinnern zu lassen (S. 537f.), die, weil sie unreflektiert, aber grundlegend in die Forschungskonzepte einfließen, zu gravierenden Verwirrungen führen können. Nur aufgrund dieser Basis-Verwandtschaft wird die Verwechslung bzw. Identifikation von neurowissenschaftlichen und philosophischen Fragestellungen und dann auch Ergebnissen vorderhand so plausibel. Umso gravierender und wirksamer sind die kritischen Vorschläge, die Bennett und Hacker in ihrem Band entwickeln. Der Anspruch, eine Erkenntnistheorie, eine Philosophie des Willens und damit des menschlichen Handelns und schließlich eine umfassende Anthropologie zu entwickeln, verdankt sich eben den (mereo-)logischen Fehlschlüssen und deren ontologischer Fundierung in der Annahme eigenständiger metaphysischer Entitäten. Ohne diese dubiosen Voraussetzungen erstreckt sich die Leistungsfähigkeit der Neurowissenschaften nicht auf eine Erklärung des Bewusstseins, Selbstbewusstseins, Wollens, ja nicht einmal der Wahrnehmung und der Emotionen. Mit Bennett und Hacker: Das „in den letzten 3
Dieser Teil der Abhandlung bildet den Auftakt in Philosophie und Neurowissenschaften (a. a. O. S. 20–42).
Philosophie im Zeitalter der Neurowissenschaften
XVII
Jahrzehnten erworbene Wissen über die Funktionsweise des Gehirns“ (S. 555) liefert keine Theorie psychischer Fähigkeiten und deren Ausübung. Unstrittig sind die Neurowissenschaften bestrebt und in der Lage, die neuralen Bedingungen für menschliche Fähigkeiten wie „Empfindung, Wahrnehmung, Gedächtnis, Affektion und Wollen“ (S. 553) zu analysieren; dies sind aber Bedingungen, nicht Ursachen der entsprechenden Fähigkeiten und Vermögen. Nimmt man Letzteres an, so erliegt man je nach der gewählten „Begriffsverwirrung“ den Schwierigkeiten, die letztlich zur These von der Unlösbarkeit des Leib-Seele-Problems geführt haben. Hier ist der Verzicht auf die unbewussten und auf keinen Fall gerechtfertigten Anleihen bei der Metaphysik des 17. Jahrhunderts (sei es beim cartesischen Dualismus, sei es bei der reduktionistischen Position eines reinen Materialismus; so z. B. S. 538) unumgänglich. Denn diese metaphysischen Versatzstücke verleiten einerseits zur Ausweitung des Konzepts wissenschaftlicher Erklärung auf die gesamte Realität, und sie erliegen andererseits der Verhexung durch die Sprache. Denn sie machen, sobald sie nicht nur auf physische, sondern auf psychische Phänomene angewandt werden, und gar da, wo sie anthropologische Erklärungen liefern, von der metaphysischen Verwirrung Gebrauch, die bereits unsere Alltagssprache verhext. Die Substantiierung von Vermögen, der Schritt von empfinden zu Empfindung, wahrnehmen zu Wahrnehmung, erinnern zu Erinnerung/Gedächtnis, wollen zu Wille öffnen dem mereologischen Fehlschluss Tür und Tor. Es bleibt die Frage, was die Philosophie in dieser Debatte zu leisten vermag. Glaubt man den Neurowissenschaftlern – und zwar durchweg den im dritten Teil des Bandes von Bennett und Hacker untersuchten zeitgenössischen Neurowissenschaften einschließlich der hier nicht eigens mitkritisierten deutschen Neurowissenschaft – so wird Philosophie überflüssig, sobald die Prozesse des Gehirns mit Hilfe einer naturwissenschaftlich-physikalischen Methode gänzlich analysiert sind. Dann kennt man psychische Prozesse, weil man ihre Ursachen beschreiben und die Zusammenhänge der physischen Ereignisse im Gehirn, der neuralen Basis, mit den mentalen Ereignissen wissenschaftlich erklären kann. Hier ist bereits der klärende Hinweis darauf, dass es sich bei Gehirnprozessen zwar um Konditionen aller bewussten Erfahrungen handelt, nicht aber um Ursachen, angetan, eine erste Skepsis gegen den Global- und Gesamtanspruch zu nähren. Das nächste Problem wird durch den Hinweis auf den neben der ontologischen Option fundamentalen „methodologischen Fehlschluss“, also einen ebenfalls ontologiebedingten Irrtum, markiert. Diese Prüfung und Klärung obliegt der Philosophie. Ihr drittes, nicht ersetzbares Arbeitsfeld ist die „Klärung unserer Darstellungsform“. Durch diese Prüfung legt die Philosophie die „Sinngrenzen: das heißt die Grenzen dessen, was auf kohärente Weise gedacht und gesagt werden kann“ (S. 541) fest. Im Blick auf die allenthalben virulenten „Überschreitungen der Sinngrenzen“ und ihre Ursachen erweist sich die sprachkritische Philosophie im Sinne und im Gefolge Wittgensteins als „destruktiv“. In der „Überprüfung und Beschreibung des Wortgebrauchs – dessen, was kompetente Sprecher, indem sie Worte richtig verwenden, sagen und nicht sagen“ (S. 543), liegt die konstruktive Aufgabe der Philosophie. Das mag sich zunächst bescheiden anhören, es
XVIII
Vorwort
liegt darin aber eine Aufgabe der Philosophie, die „kein Ende nehmen“ wird, denn jede Begriffsverwirrung, „jede einzelne Konfusion stellt einen neuen Behandlungsfall dar“ (S. 543). So gibt es keine philosophische Grund- und Gesamterklärung etwa im Sinn der Eruierung metaphysischer Letztbegründung. Es ist aber auch keine übergroße Bescheidenheit angesagt, die die Fähigkeiten der Philosophie leichtfertig verspielt. Im Gegenteil lässt sich unter Beweis stellen, was die Abhandlung zu den Philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften überzeugend geleistet hat, dass die Philosophie, die sich in diesem Sinne versteht, auch für die Wissenschaften ein unverzichtbarer Gesprächspartner wird, dessen Hinweise zwar nicht die Ergebnisse, wohl aber Ziele und methodischen Aufbau wissenschaftlicher Forschung beeinflussen. Anhand einer Reihe in der Diskussion virulenter irriger Annahmen zeigte sich nämlich, dass und wie die begriffliche Klärungsarbeit auch für die neurowissenschaftliche Forschung sinnvolle Korrektive an die Hand gibt. Das geschieht beispielsweise in der Kritik an der Konzeption der Wahrnehmung, die weder „Bildersehen oder Bilderhaben . . . [oder] die Hypothesenbildung des Gehirns ist“, daran, dass „Emotionen keine körperlichen Reaktionen auf Vorstellungsbilder sind“, dass mentale Ereignisse nicht einer Innensphäre zugehören, die sie zu unerschließbarer Privatheit verdammt, dass sie aber auch nicht auf ihre physischen, d. h. neuronalen Bedingungen verrechnet werden können, dass das Selbst des Selbstbewusstseins oder der Wille keine eigenen Entitäten sind und vieles mehr. Durch die Festlegung der Sinngrenzen gewinnt die Philosophie Begriffsklärungen, die für das Erreichen neurowissenschaftlicher Ziele „alles andere als unerheblich“ (S. 549), ja letztlich unverzichtbar sind, will man Ziel und Aufbau der Wissenschaften mit den Mitteln der Wissenschaft erreichen können. Die Untersuchung zu den Philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften weist nämlich an den faktischen Fragestellungen und der Entwicklung der Neurowissenschaften Probleme auf, die die Wissenschaft beeinträchtigen und vor allen Dingen den Erklärungsanspruch als erschlichen kenntlich machen. Nicht zuletzt werden Vorschläge entwickelt, wie man durch eine sinnvolle sprachliche Fassung auch belastbare Ergebnisse mit den Methoden der Wissenschaft erreichen kann. Die vorgeschlagenen Mittel zur Beseitigung der Irritationen sind überraschend einfach, aber auch überraschend effektiv. Man wird an jenen Helden der Menschheitsgeschichte erinnert, den man den „Großen“ nannte, weil er den gordischen Knoten, an dessen Lösung sich viele vergeblich wagten, nicht durch das Zerren und Zupfen an möglicherweise erfolgsträchtigen Schlingen und Fäden, sondern durch die Schärfe seines Schwertes löste. Auch in den Kritiken Bennetts und Hackers wird gegen die verdeckten ontologischen Optionen, ihre Verflechtung und Verfilzung zu immer subtileren Differenzierungen die typisch philosophische Variante der Problemlösung, nämlich Occham’s Razor eingesetzt: Entia non sunt multiplicanda sine neccessitatem – d. h. keinesfalls ohne wirklich einsichtige Argumente. Verzichtet man auf die den Problemlösungen nicht förderlichen, sondern eher erschwerenden metaphysischen Annahmen, so wird die Kritik an mereologischen Fehlschlüssen eo ipso triftig. Denn diese Form der Aus-
Philosophie im Zeitalter der Neurowissenschaften
XIX
stattung von Teilen bzw. Organen mit den Fähigkeiten eines lebendigen Organismus verdankt sich selbst wieder der Vorgabe, dass zunächst Realitätsbereiche verselbständigt, dann auf der Basis solcher substantiierter Bereiche (i. e. der Teile lebendiger Organismen) ihre Eigenständigkeit als jeweils deskribierbare Entität unterstellt wird. Wittgensteins Sprachkritik tut das Ihre, um zu anspruchsvolle Annahmen zu destruieren. Zwar wird behauptet, nur eine sprachkritische Reflexion zur Vorbereitung einer unbelasteten Lösung des nun nicht mehr unlösbaren Rätsels des Verhältnisses von Leib und Seele, Körper und Geist, Geist und Gehirn zu geben, aber diese dem Anspruch nach bescheiden daherkommenden Vorschläge sind triftig und durchschlagend. Des Rätsels Lösung ist die, die schon Ödipus der Sphinx, ihre mystische Aura zerstörend, entgegengeschleudert hat: „der Mensch“. Als ein Wesen mit spezifischen Fähigkeiten müssen psychologische Prädikate, die seine Vermögen umschreiben, auf ihn bezogen, ihm als Ganzem zugeschrieben werden. Eine Prüfung solcher Zuschreibungen, die bereits zum Schatz der Alltagssprache gehören, lässt die Philosophie dann nicht als eine dürre Form rein formaler Kritiken, als rein destruktives Unternehmen erscheinen. Sie bietet die Basis für den konstruktiven Versuch, den Menschen als ein sprachfähiges Wesen durch eine kritische Sichtung der Medien zu erschließen, mit deren Hilfe er sich die Welt und sich selbst zugänglich hält. In weiterführenden Arbeiten will Hacker zeigen, dass der zunächst bescheiden anmutende Ansatz sich durchaus zu einer Anthropologie erweitern lässt.4 Da die einzelnen Kapitel des Bandes – nach dem Anspruch der Autoren – so aufgebaut sind, dass sie jeweils in sich schlüssig auch gesondert zur Kenntnis genommen werden können, bieten sie nicht nur die Möglichkeit, spezifische Interessen des eigenen Studiums zu verfolgen, sondern sie sind zugleich ein reiches Schatzkästlein an Argumenten, die die unterschiedlichen Aspekte der gegenwärtigen Debatte um die Grundlegung von Psychologie und Anthropologie bereichern. In den einzelnen Kapiteln des Bandes findet daher auch der deutschsprachige Leser triftige Argumente, um sich mit den ihm bekannten Versionen des Leib-Seele-Problems auseinanderzusetzen. Die abschließenden Überlegungen des Bandes über die Leistungsfähigkeit sowohl der Neurowissenschaften als auch der Philosophie liefern Korrektive für die Auseinandersetzung mit den Ansprüchen einer neurophilologischen Anthropologie und können daher auch die heimische Debatte um das Leib-Seele-Problem einerseits vom Nimbus des Geheimnisvollen, andererseits von der das menschliche Selbstverständnis beeinträchtigenden Reduktion auf materielle Steuerung entlasten. Trotz der von Hacker wie Bennett betonten Bescheidenheit, es handele sich um Vorüberlegungen zu einer Anthropologie, die sowohl mit (neuro-)wissenschaftlichen als auch mit philosophischen Ansätzen vereinbar ist, zeigt sich hier die Tragweite einer methodisch-sprachkritischen Bereinigung. Wenige Direktiven der Argumentation reichen 4
So geschehen in dem ersten publizierten Teil einer auf drei Bände angelegten Anthropologie, der den Titel On Human Nature (Harvard 2004) trägt.
XX
Vorwort
hin, um überkomplexe Erklärungen und Deutungen überflüssig zu machen und zugleich tragfähige methodische Grundlagen für eine Anthropologie vorzugeben. Diese sollte sich auf die sprachlichen Vergewisserungen des Menschen über sich selbst beziehen; sie wird sich von Psychologie und Neurowissenschaften dadurch unterscheiden, dass sie keine Deskriptionen von Ursachenzusammenhängen, sondern unter Anerkennung gegebener physisch-biologischer Bedingungen die Besonderheit eines Lebewesens analysiert, das sich selbst sprachlich gegeben ist. Annemarie Gethmann-Siefert
Einführung Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften sind die Früchte eines Gemeinschaftsprojekts eines Neurowissenschaftlers und eines Philosophen. Die Darstellung erörtert die begrifflichen Grundlagen der kognitiven Neurowissenschaften – Grundlagen, die von den strukturellen Beziehungen zwischen den psychologischen Begriffen gebildet werden, die bei Erforschung der neuralen Verhältnisse der kognitiven, affektiven und willentlichen menschlichen Fähigkeiten Verwendung finden. Die logischen Verbindungen zwischen diesen Begriffen zu untersuchen, ist eine philosophische Aufgabe. Mit dieser Untersuchung so umzugehen, dass die Hirnforschung in ein helleres Licht gerückt wird, eine neurowissenschaftliche. Darum unser Joint Venture. Will man die neuralen Strukturen und Kräfte verstehen, die der Wahrnehmung und dem Denken, dem Gedächtnis, der Emotion und dem intentionalen Verhalten zugrunde liegen und sie ermöglichen, muss man sich über diese Begriffe und Kategorien Klarheit verschaffen. Beide Autoren, die sich der Untersuchung aus ganz verschiedenen Richtungen näherten, waren von der Anwendung der psychologischen Begriffe innerhalb der heutigen Neurowissenschaften verwirrt, mitunter sogar beunruhigt. Die Verwirrung resultierte häufig daher, dass wir uns fragten, was die Neurowissenschaftler mit ihren Behauptungen, das Gehirn und den Geist betreffend, wohl gemeint haben könnten oder weshalb ein Wissenschaftler davon ausging, seine Experimente hätten die zur Untersuchung stehende psychische Fähigkeit erklärt, oder sie wurde von den begrifflichen Vorannahmen ausgelöst, die in die aufgeworfenen Fragen eingingen. Das Unbehagen rührte von dem Verdacht her, dass die Begriffe in manchen Fällen fehlerhaft ausgelegt oder angewendet wurden oder die Grenzen ihrer definierten Anwendungsbedingungen überschritten. Und je mehr wir nachforschten, desto stärker waren wir davon überzeugt, dass trotz der beeindruckenden Fortschritte der kognitiven Neurowissenschaften mit den allgemeinen Theorieentwürfen etwas nicht stimmte. Die Neurowissenschaften haben mit den empirischen Fragen zum Nervensystem zu tun. Ihr Geschäft ist die Feststellung von Tatsachen, die mit den neuralen Strukturen und Vorgängen in Zusammenhang stehen. Die kognitiven Neurowissenschaften haben es sich zur Aufgabe gemacht, die neuralen Ermöglichungsbedingungen der kognitiven, kogitativen, affektiven, die Wahrnehmung und den Willen betreffenden Funktionen zu erklären. Solche erklärenden Theorien werden durch experimentelle Untersuchungen bestätigt oder verworfen. Dagegen sind begriffliche Fragen (die beispielsweise die Begriffe des Geistes oder des Gedächtnisses, des Denkens oder der Vorstellungskraft betreffen), die Beschreibung der logischen Beziehungen zwischen den Begriffen (wie die zwischen den Begriffen der Wahrnehmung und der Empfindung oder den Begriffen des
2
Einführung
Bewusstseins und des Selbstbewusstseins) und die Untersuchung der strukturellen Verknüpfungen zwischen den unterschiedlichen begrifflichen Bereichen (wie die zwischen dem Psychischen und dem Neuralen oder dem Geistigen und dem Verhalten) die eigentliche Domäne der Philosophie. Begriffliche Fragen gehen den Feststellungen zu Wahrheit und Falschheit voran. Bei ihnen handelt es sich um Fragen, die sich auf Darstellungsformen beziehen, aber nicht auf die Wahrheit oder Falschheit empirischer Aussagen. Diese Formen werden von den wahren (und den falschen) wissenschaftlichen Behauptungen und von den richtigen (und den falschen) wissenschaftlichen Theorien vorausgesetzt. Sie entscheiden nicht, was in empirischer Hinsicht wahr oder falsch ist, sondern vielmehr, was Sinn ergibt und was nicht. Folglich sind die begrifflichen Fragen wissenschaftlicher Untersuchung, wissenschaftlichem Experimentieren und Theoretisieren nicht zugänglich. Denn die Begriffe und begrifflichen Zusammenhänge werden von allen derartigen Untersuchungen und Theorieentwürfen vorausgesetzt. Wir befassen uns hier nicht mit Spitzfindigkeiten, sondern mit den Unterschieden, die zwischen intellektuellen Forschungsarten bestehen, die in logischer Hinsicht verschieden sind. (Diesbezügliche methodologische Einwände werden in Kapitel 14 erörtert.) Begriffliche von empirischen Fragen zu unterscheiden, ist von allerhöchster Wichtigkeit. Wenn eine begriffliche Frage mit einer wissenschaftlichen verwechselt wird, entpuppt sie sich als äußerst widerspenstig. Es scheint in solchen Fällen, als wäre die Wissenschaft in der Lage, die Wahrheit über den Untersuchungsgegenstand mit Hilfe der Theorie und des Experiments herauszufinden – und doch scheitert sie beständig dabei. Was nicht überraschend ist, denn begriffliche Fragen sind empirischen Untersuchungsmethoden ebenso wenig zugänglich, wie rein mathematische Probleme nicht mit physikalischen Methoden zu lösen sind. Darüber hinaus bringen empirische Probleme, die begrifflich nicht ausreichend geklärt wurden, zwangsläufig irrige Fragen mit sich, was wiederum die Forschung sehr wahrscheinlich auf Abwege führen wird. Denn jede Unklarheit im Hinblick auf die einschlägigen Begriffe wird sich als Unklarheit in den Fragen niederschlagen und somit auch im Design der Experimente, die Antworten liefern sollen. Und jede Inkohärenz beim Erfassen der einschlägigen begrifflichen Strukturen manifestiert sich wahrscheinlich als Inkohärenz in den Interpretationen der experimentellen Ergebnisse. Die kognitiven Neurowissenschaftler operieren über die Grenze zwischen zwei Gebieten hinweg, der Neurophysiologie und der Psychologie, deren jeweilige Begriffe sich kategorial unterscheiden. Die logischen bzw. begrifflichen Beziehungen zwischen dem Physiologischen und dem Psychologischen sind problematisch. Zahlreiche psychologische Begriffe und Begriffskategorien sind kaum bis ins Letzte zu durchschauen. Die Verknüpfungen zwischen dem Geist und dem Gehirn und zwischen dem Psychischen und dem Verhalten sind unübersichtlich. Diese Begriffe und ihre Artikulationen, die scheinbaren ‚Bereiche‘ und ihre Beziehungen untereinander haben die Neurophysiologie von Anfang an verwirrt (wir beginnen unsere Untersuchung in Kapitel 1 mit einem histori-
Einführung
3
schen Überblick über die frühe Entwicklungsphase der Neurowissenschaften). Trotz der großartigen Fortschritte innerhalb der Neurowissenschaften zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die sich in erster Linie der Arbeit Charles Sherringtons verdanken, fanden eine Reihe begrifflicher Fragen, allgemein bekannt als Körper-Geist- oder Gehirn-GeistProblem, auch weiterhin keine Antwort – belegbar an den irrigen cartesianischen Ansichten, die von Sherrington und einigen seiner Kollegen und Schützlingen wie Edgar Adrian, John Eccles und Wilder Penfield aufgegriffen wurden. So brillant ihr Werk fraglos war, tief reichende begriffliche Konfusionen blieben bestehen – wie wir in Kapitel 2 zeigen. Ob die aktuelle Generation von Neurowissenschaftlern die begrifflichen Verwirrungen der Generationen vor ihr erfolgreich überwunden oder ob sie bloß ein begriffliches Durcheinander durch ein anderes ersetzt hat, das ist die Frage, der sich die Untersuchungen in diesem Buch widmen. Ein solches Durcheinander offenbart sich in der beständigen Zuschreibung psychologischer Attribute zum Gehirn. Während Sherrington und seine Anhänger dem Geist (der als eine eigentümliche, möglicherweise immaterielle Substanz, die vom Gehirn zu unterscheiden sei, vorgestellt wurde) psychologische Attribute zuschrieben, tendieren gegenwärtige Neurowissenschaftler dahin, dasselbe Spektrum an psychologischen Attributen dem Gehirn (meist, jedoch nicht immer, als identisch mit dem Geist aufgefasst) zuzuschreiben. Der Geist, behaupten wir (3.10), ist aber weder eine vom Gehirn getrennte bzw. unabhängige Substanz noch eine mit dem Gehirn identische Substanz. Und wir zeigen auf, dass die Zuschreibung psychologischer Attribute zum Gehirn inkohärent ist (Kapitel 3). Menschen verfügen über eine große Zahl psychischer Vermögen, die in allen Lebensumständen zur Anwendung gelangen, wenn wir wahrnehmen, denken und folgern, etwas wollen, Pläne schmieden und Entscheidungen treffen. Besitz und Entfaltung solcher Vermögen machen uns zu dieser Art von Tieren, die wir sind. Wir können die neuralen Voraussetzungen und Begleiterscheinungen jener Vermögen untersuchen. Das ist die Aufgabe der Neurowissenschaften, die mehr und mehr über sie herausfindet. Ihre Entdeckungen rühren jedoch keineswegs an die begriffliche Wahrheit, dass diese Vermögen und deren Entfaltung beim Wahrnehmen, Denken und Fühlen Attribute der Menschen sind, nicht ihrer Teile – insbesondere nicht ihrer Gehirne. Ein Mensch ist eine psychophysische Einheit, ein Tier, das wahrnehmen, intentional handeln, folgernd denken und Gefühle haben kann, ein Sprache verwendendes Tier, das nicht bloß über Bewusstsein verfügt, sondern sogar über Selbstbewusstsein – kein Gehirn, das in den zum Körper gehörenden Schädel eingebettet ist. Sherrington, Eccles und Penfield betrachten die Menschen als Lebewesen, in denen der Geist, den sie als den Träger der psychologischen Attribute begreifen, mit dem Gehirn liiert ist. Man ist gegenüber dieser Fehlkonzeption keineswegs im Vorteil, wenn man davon ausgeht, dass es sich bei dem Träger der psychologischen Attribute um das Gehirn handelt. Unter den heutigen Neurowissenschaftlern gibt es viele, die vom Wahrnehmen, Denken, Mutmaßen und Glauben des Gehirns sprechen, oder davon, dass eine GehirnHemisphäre von Dingen etwas wisse, die der anderen verborgen bliebe. Verteidigt wird
4
Einführung
diese Position manchmal mit dem Hinweis, wir hätten es hier lediglich mit einer schlichten Façon de parler zu tun. Das stimmt jedoch nicht. Denn das charakteristische Erklärungsparadigma innerhalb der kognitiven Neurowissenschaften der Gegenwart besteht darin, dem Gehirn und seinen Arealen psychologische Attribute zuzuschreiben, um den Besitz psychologischer Attribute und die Entfaltung (und deren Mängel) der kognitiven Vermögen durch die Menschen zu erklären. Wenn man dem Gehirn psychologische – insbesondere kognitive und kogitative – Attribute zuschreibt, handelt man sich, wie wir zeigen werden, viele weitere Konfusionen ein. Die Neurowissenschaften sind in der Lage, die neuralen Bedingungen und Begleiterscheinungen des Erwerbs, des Besitzes und der Entfaltung des Empfindungs- und Fühlensvermögens bei Tieren zu untersuchen. Sie können die Vorbedingungen der Möglichkeit der Ausübung einzigartig menschlicher Vermögen ermitteln: des Denkund Folgerungsvermögens, der Fähigkeit, Erinnerungen und Vorstellungen artikulieren zu können, des Emotionsvermögens und der Wollensfähigkeit. Erfolge erzielen sie in diesem Feld durch das geduldige induktive Aufspüren der Wechselbeziehungen zwischen neuralen Phänomenen und dem Besitz und der Ausübung psychischer Vermögen und zwischen neuralen Schädigungen und Defiziten bei normal ausgeprägten geistigen Funktionen. Was sie nicht zu leisten vermögen, ist, die Vielzahl gewöhnlicher psychologischer Erklärungen menschlicher Aktivitäten anhand von Gründen, Intentionen, Zwecken, Zielen, Werten, Regeln und Konventionen durch neurologische Erklärungen zu ersetzen (der Reduktionismus wird in Kapitel 13 erörtert). Und sie können nicht erklären, wie ein Tier wahrnimmt oder denkt, indem sie sich auf die Wahrnehmung oder das Denken des Gehirns oder einige seiner Teile beziehen. Solche Zuschreibungen psychologischer Attribute ergeben keinen Sinn, wenn sie nicht dem Tier als Ganzem gelten. Es ist das Tier, das wahrnimmt, nicht Teile seines Gehirns, und es sind die Menschen, die denken und folgern, nicht ihre Gehirne. Das Gehirn und seine Aktivitäten ermöglichen uns – nicht ihm –, wahrzunehmen und zu denken, Gefühle zu haben, Pläne zu schmieden und sie umzusetzen. Während viele Neurowissenschaftler in einer ersten Reaktion auf den Vorwurf, sie erzeugten begriffliche Verwirrung, behaupten, dass es sich bei der Zuschreibung psychologischer Prädikate zum Gehirn um eine bloße Façon de parler handelt, reagieren sie auf die nachweisbare Tatsache, dass ihre Erklärungstheorien dem Gehirn in nichttrivialer Weise psychologische Vermögen zuschreiben, manchmal mit dem Hinweis, dieser Fehler sei wegen der Mängel der Sprache unvermeidlich. Wir treten dieser Fehlkonzeption in Kapitel 14 entgegen, wo wir zeigen, dass die großartigen Entdeckungen der Neurowissenschaften auf diese abwegige Form der Erklärung nicht angewiesen sind – alles das, was entdeckt wurde, kann ohne Weiteres in unserer Sprache, so wie sie existiert, beschrieben und erklärt werden. Wir verdeutlichen das, indem wir uns den häufig erörterten Phänomenen zuwenden, die aus der Kommissurotomie herrühren und die von Sperry, Gazzaniga und anderen beschrieben (oder, wie wir nahelegen, falsch beschrieben) wurden (14.3).
Einführung
5
In Teil II untersuchen wir die Verwendung der Begriffe der Wahrnehmung, des Gedächtnisses, des bildlichen Vorstellens, der Emotion und des Wollens in den aktuellen neurowissenschaftlichen Theorieentwürfen. Fallweise zeigen wir auf, dass begriffliche Unklarheit – das Versäumnis, den einschlägigen begrifflichen Strukturen die nötige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen – oft die Quelle für Irrtümer in der Theorie und der Grund für abwegige Schlüsse gewesen ist. Es ist ein Irrtum, ein begrifflicher Irrtum, davon auszugehen, wahrnehmen heiße, ein Bild im Geist zu erfassen (Crick, Damasio, Edelman) oder eine Hypothese zu bilden (Helmholtz, Gregory) oder eine 3-D-ModellBeschreibung hervorzubringen (Marr). Es ist verworren – eine begriffliche Verwirrung –, das Bindungsproblem als Problem der Verknüpfung von Gestalt-, Farb- und Bewegungsdaten auszugeben, aus der das Bild des wahrgenommenen Gegenstands resultiere (Crick, Kandel, Wurtz). Es ist falsch, begrifflich falsch, davon auszugehen, dass das Gedächtnis nur von der Vergangenheit handelt oder dass Erinnerungen im Gehirn in Form starker synaptischer Verbindungen gespeichert werden können (Kandel, Squire, Bennett). Und es ist verfehlt, aus begrifflichen Gründen verfehlt, die Untersuchung des Durstes, des Hungers und der Lust als Untersuchung der Emotionen aufzufassen (Rolls) oder zu denken, die Funktion der Emotionen bestünde darin, uns über unseren viszeralen und muskuloskeletalen Zustand in Kenntnis zu setzen (Damasio). Die erste Reaktion auf solche kritischen Bemerkungen mag durchaus Entrüstung und Ungläubigkeit sein. Wie können florierende Wissenschaften sich im Irrtum befinden? Wie könnte es unvermeidlich sein, dass innerhalb gut etablierter Wissenschaften begriffliche Verwirrungen auftreten? Und gewiss doch können problematische Begriffe, wenn es sie denn gibt, leicht durch andere, unproblematische ersetzt werden, die den gleichen Erklärungszwecken dienen. Solche Erwiderungen deuten auf ein mangelhaftes Verständnis für den Zusammenhang zwischen Darstellungsform und dargestellten Tatsachen hin und darauf, dass nicht erfasst wurde, womit wir es bei einem begrifflichen Irrtum zu tun haben. Zudem offenbaren sie Unkenntnis, was die Geschichte der Wissenschaften im Allgemeinen und die der Neurowissenschaften im Besonderen angeht. Die Wissenschaften sind vor begrifflichem Fehlgehen und begrifflicher Konfusion nicht besser geschützt als jede andere Form der intellektuellen Anstrengung. Die Geschichte der Wissenschaften ist voll mit Trümmern von Theorien, die nicht einfach in Bezug auf die Fakten fehlerhaft waren, sondern begriffliche Schieflagen aufwiesen. Stahls Verbrennungstheorie beispielsweise war begrifflich insofern abwegig, als sie, unter bestimmten Bedingungen, Phlogiston ein negatives Gewicht zuschrieb – eine Idee, die innerhalb ihres Rahmens, der newtonschen Physik, keinen Sinn ergab. Einsteins berühmte kritische Einwände gegenüber der Theorie des elektromagnetischen Äthers (das Medium, von dem man annahm, die Ausbreitung des Lichts beruhe auf ihm) zielten nicht nur auf die Resultate des Michelson-Morley-Experiments, das damit scheiterte, die absolute Bewegung in irgendeiner Form effektiv nachzuweisen, sondern sie richteten sich auch auf die begriffliche Konfusion, welche die relative Bewegung betraf, in Verbindung mit der Rolle, die man dem Äther im Zusammenhang mit der Erklärung
6
Einführung
elektromagnetischer Induktion zuschrieb. Die Neurowissenschaften stellten nie eine Ausnahme dar – wie wir in unserer historischen Übersicht zeigen. Es stimmt durchaus, dass sie heutzutage florieren. Das aber immunisiert sie nicht gegen begriffliches Durcheinander. Die newtonsche Kinematik war eine gedeihende Wissenschaft, was allerdings nicht verhinderte, dass Newton sich in begrifflichen Verwirrungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Fernwirkung verstrickte und dass ihn das Wesen der Kraft (ungeklärt bis zu Hertz) vor ein Rätsel stellte. So war auch Sherringtons überragende Leistung – die Erklärung der Integrationstätigkeit der Synapsen im Rückenmark, dadurch eliminierte er ein für allemal die verworrene Vorstellung von einer ‚spinalen Seele‘ – vollkommen vereinbar mit begrifflichen Konfusionen, die die ‚zerebrale Seele‘ bzw. den Geist und seine Beziehung zum Gehirn betrafen. Ebenso waren Penfields außerordentliche Verdienste um die Identifizierung der funktionalen Lokalisation im Kortex und die Entwicklung brillanter neuro-operativer Techniken vollkommen vereinbar mit beträchtlicher Konfusion hinsichtlich der Beziehung zwischen dem Geist und dem Gehirn und dem, was die ‚höchste Gehirnfunktion‘ angeht (eine von Hughlings Jackson geliehene Idee). Kurz gesagt, begriffliches Durcheinander kann mit florierender Wissenschaft koexistieren. Das mag einem seltsam vorkommen. Wenn die Wissenschaften trotz begrifflicher Konfusionen gedeihen können, warum sollten sich Wissenschaftler dann um sie kümmern? Verborgene Riffe machen die Meere nicht unschiffbar, aber sie sind gefährlich. Die Frage ist, wie sich ein Auflaufen auf den Riffen manifestiert. Begriffliche Verwirrungen können sich ganz unterschiedlich und an unterschiedlichen Stellen der Untersuchung bemerkbar machen. In manchen Fällen mag es sein, dass die begriffliche Unklarheit weder die Stichhaltigkeit der Fragen noch die Fruchtbarkeit des Experiments berührt, sondern nur das Verständnis der Resultate des Experiments und deren theoretische Implikationen. So bemühte sich beispielsweise Newton in der Optik um die Einsicht in das Wesen der Farben. Seine Forschungskraft war schier unerschöpflich darin, Beiträge für die Wissenschaft zu liefern. Sein Fazit aber: ‚Farben sind Empfindungen im Sensorium‘, ist Ausdruck seines Scheiterns beim Versuch, das ersehnte Verständnis zu erlangen. Denn was auch immer Farben sind, sie sind keine ‚Empfindungen im Sensorium‘. Und weil Newton sich so um das Verständnis seiner Forschungsresultate bemühte, hatte er mithin guten Grund, sich um die begrifflichen Konfusionen zu kümmern, die seine Arbeit durchdrangen – denn diese standen einem adäquaten Verständnis im Wege. In anderen Fällen jedoch erweist sich die begriffliche Verwirrung als nicht so unbedenklich für die empirische Forschung. Abwegige Fragen können die Forschung sehr wohl ins Abseits und also in die Bedeutungslosigkeit befördern (Beispiele hierfür werden dargelegt in Bezug auf das bildliche Vorstellen (6.3.1) und die willkürliche Bewegung (8.2)). Andererseits wiederum bringen Falschauslegungen von Begriffen und begrifflichen Strukturen mitunter eine Forschung hervor, die in keinster Weise auf Abwege gerät, was allerdings nicht das beweist, was es beweisen sollte (Beispiele werden
Einführung
7
erörtert in Bezug auf das Gedächtnis (5.2.1–5.2.2) und die Emotionen und Triebe (7.1). Gut möglich, dass die Wissenschaft in solchen Fällen nicht ganz so floriert, wie es den Anschein hat. Es bedarf einer begrifflichen Untersuchung, um die Probleme ausfindig zu machen und zu beseitigen. Sind solche begrifflichen Verwirrungen unvermeidlich? Ganz und gar nicht. Dieses Buch wurde abgefasst, um aufzuzeigen, wie sie sich verhindern lassen. Sie lassen sich freilich nicht verhindern, während man alles andere so belässt, wie es ist. Sie können vermieden werden – gelingt das, werden bestimmte Arten von Fragen nicht mehr aufgeworfen, denn man wird sie als missverständliche entlarvt haben. Wie Hertz es in der wundervollen Einführung seiner Prinzipien der Mechanik ausdrückt: „Sind diese schmerzlichen Widersprüche entfernt, [. . .], [hört] der nicht mehr gequälte Geist [. . .] auf, die für ihn unberechtigte Frage zu stellen.“ Ebenso werden bestimmte Arten von Schlüssen aus einem empirischen Forschungsgegenstand nicht mehr gezogen werden, denn man wird realisiert haben, dass sie kaum oder gar nicht mit der Sache in Zusammenhang stehen, zu deren Erhellung sie beitragen sollten, obgleich sie mit etwas anderem in Zusammenhang stehen können. Wenn es problematische Begriffe gibt, können sie dann nicht durch andere Begriffe ersetzt werden, die der nämlichen Erklärungsfunktion dienen? Ein Wissenschaftler ist stets frei, neue Begriffe einzuführen, wenn er die vorhandenen mangelhaft oder unzulänglich findet. Unser Augenmerk liegt in diesem Buch jedoch nicht auf dem Gebrauch neuer Fachbegriffe. Wir befassen uns mit dem Missbrauch der alten, nichtfachsprachlichen Begriffe – die Begriffe des Geistes und des Körpers, des Denkens und der Vorstellungskraft, der Empfindung und der Wahrnehmung, des Wissens und des Gedächtnisses, der willkürlichen Bewegung und des Bewusstseins und des Selbstbewusstseins. Was die Zwecke angeht, denen sie dienen, sind diese Begriffe nicht unzulänglich. Es gibt keinen Grund für die Annahme, sie müssten in den Zusammenhängen ersetzt werden, die für uns von Belang sind. Problematisch ist hingegen, dass Neurowissenschaftler sie falsch auslegen und so zu Missverständnissen beitragen. Diese lassen sich durch eine korrekte Darstellung des logisch-grammatischen Gepräges der relevanten Begriffe beseitigen. Und genau das ist es, worum wir uns bemüht haben. Wenn man auch zugesteht, dass die Neurowissenschaftler diese gewöhnlichen oder gebräuchlichen Begriffe nicht so verwenden, wie jedermann es tut, so stellt sich doch die Frage, mit welchem Recht die Philosophie behaupten kann, jene zu korrigieren. Wie kann die Philosophie die Klarheit und Kohärenz von Begriffen, wie sie durch kompetente Wissenschaftler Verwendung finden, mit einer derartigen Entschiedenheit beurteilen? Wie kann die Philosophie sich mit der Feststellung positionieren, dass bestimmte, von anspruchsvollen Wissenschaftlern hervorgebrachte Behauptungen keinen Sinn ergeben? Auf den folgenden Seiten werden wir derartige methodologische Bedenken zerstreuen. Allerdings könnten gewisse klarstellende Bemerkungen an dieser Stelle bereits einige von ihnen beseitigen. Was Wahrheit und Falschheit für die Wissenschaft, sind Sinn und Unsinn für die Philosophie. Empirischer und theoretischer Irrtum resul-
8
Einführung
tiert in Falschheit; begrifflicher Irrtum resultiert in einem Mangel an Sinn. Wie kann man die Grenzen des Sinns untersuchen? Nur indem man den Gebrauch der Worte untersucht. Oft entsteht Unsinn, wenn ein Ausdruck entgegen den Regeln seines Gebrauchs verwendet wird. Der fragliche Ausdruck mag ein gewöhnlicher, nichtfachsprachlicher Ausdruck sein, in welchem Fall seine Gebrauchsregeln seiner Standardverwendung und den Erklärungen seiner Bedeutung ‚entnommen‘ werden können. Oder es kann ein fachsprachlicher Kunstausdruck sein; in diesem Fall müssen die Gebrauchsregeln seiner Einführung durch den Wissenschaftler entnommen werden und den Erklärungen, die dieser bezüglich der vorgegebenen Anwendung des Ausdrucks gibt. Beide Ausdrücke können missbräuchlich verwendet werden, und wenn das geschieht, entsteht Unsinn – ein Gebilde aus Worten, das aus der Sprache ausgeschlossen ist. Denn entweder wurde nichts vereinbart, was die Bedeutung des Ausdrucks in dem irrtümlichen fraglichen Kontext angeht, oder dieses Wortgebilde ist tatsächlich durch eine Regel ausgeschlossen, die festlegt, dass es kein solches Ding gibt wie . . . (dass es z. B. so etwas wie ‚den Osten des Nordpols‘ nicht gibt), dass es sich um ein Wortgebilde handelt, für das keine Anwendung vorgesehen ist. Unsinn entsteht gemeinhin auch dann, wenn ein existierender Ausdruck einer neuen, möglicherweise fachlichen oder quasifachlichen Verwendung zugeführt wird und diese neue Verwendung sich versehentlich mit der alten überschneidet – wenn beispielsweise aus Propositionen, die den neuen Ausdruck enthalten, Schlüsse gezogen werden, die nur aus der Verwendung des alten gezogen werden dürften. Es ist die Aufgabe begrifflicher Kritik, solche Überschreitungen der Grenzen des Sinns zu identifizieren. Es ist freilich nicht damit getan zu zeigen, dass ein bestimmter Wissenschaftler den Ausdruck nicht seinem gewöhnlichen Gebrauch entsprechend verwendet – denn er könnte ihn auch in einem neuen Sinn benutzen. Der Kritiker muss nachweisen, dass der Wissenschaftler den Ausdruck im üblichen Sinn zu verwenden beabsichtigt und dass er das nicht getan hat oder dass er den Ausdruck in einem neuen Sinn zu verwenden beabsichtigt, den neuen Sinn jedoch mit dem alten gekreuzt hat. Der auf Abwege geratene Wissenschaftler sollte, wann immer möglich, mit seinen eigenen Worten widerlegt werden. Im Detail widmen wir uns methodologischen Zweifeln sowohl in Kapitel 3, Unterpunkt 3, als auch in Kapitel 14. Bei der letzten Fehlkonzeption, vor der wir warnen wollen, handelt es sich um die Vorstellung, dass unsere Reflexionen durchweg negativ seien. Alles, womit wir uns befassen, so könnte man meinen, sei die Kritik. Unsere Arbeit könnte einer oberflächlichen Betrachtung als bloßes destruktives Unternehmen scheinen, das weder Hilfe leistet noch eine neue Perspektive eröffnet. Schlimmer noch, sie könnte sogar den Anschein erwecken, sie habe es auf eine Konfrontation von Philosophie und Neurowissenschaften abgesehen. Nichts könnte der Wahrheit ferner sein. Wir haben dieses Buch in Bewunderung für die Leistungen der Neurowissenschaften des 20. Jahrhunderts geschrieben und zugleich mit dem Verlangen, ihnen beizuspringen. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie eine begriffliche Untersuchung ein empirisches Fachgebiet unterstützen kann, nämlich indem sie die (gegebenenfalls auftreten-
Einführung
9
den) begrifflichen Irrtümer identifiziert und eine Karte zur Verfügung zu stellt, welche die empirischen Forscher davon abhält, die Hoheitswege des Sinns zu verlassen. Jede unserer Untersuchungen trägt dazu zwei Aspekte bei. Einerseits haben wir versucht, begriffliche Probleme und Verwirrungen innerhalb bedeutender gegenwärtiger Theorien über Wahrnehmung, Gedächtnis, Vorstellungskraft, Emotion und Wollen ausfindig zu machen. Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass viele der aktuellen Schriften darüber, worum es sich bei Bewusstsein und Selbstbewusstsein handelt, unter begrifflichen Problemen zu leiden haben. Dieser Aspekt unserer Untersuchung ist in der Tat negativ und kritisch. Andererseits haben wir uns in jedem Fall darum bemüht, eine verständliche Darstellung des Begriffsfeldes jedes der problematischen Begriffe auszuarbeiten. Und das ist eine konstruktive Anstrengung. Wir hoffen, dieser begriffliche Überblick wird die Neurowissenschaftler bei ihren Reflexionen über die Ausgestaltung ihrer Experimente unterstützen. Es kann allerdings nicht die Aufgabe einer begrifflichen Untersuchung sein, empirische Hypothesen vorzuschlagen, die die empirischen Probleme, mit denen Wissenschaftler sich konfrontiert sehen, lösen könnten. Die Klage darüber, dass eine philosophische Untersuchung der kognitiven Neurowissenschaften keinen Beitrag für eine neue neurowissenschaftliche Theorie verfügbar mache, kommt der Beschwerde bei einem Mathematiker gleich, das neue, durch ihn bewiesene Theorem sei keine neue physikalische Theorie. Es ist unwahrscheinlich, dass viele Neurowissenschaftler eine über 550 Seiten lange begriffliche Untersuchung von Anfang bis Ende werden lesen wollen. Dementsprechend haben wir versucht, die auf ausgewählten psychologischen Begriffen beruhenden Kapitel so zu gestalten, dass sie weitestgehend unabhängig voneinander sind. Wir verbinden mit unserem Buch die Hoffnung, dass es den kognitiven Neurowissenschaftlern, die den Konturen der für ihre Forschung relevanten psychologischen Begriffe nachgehen wollen, als ein begriffliches Referenzwerk dienen wird. Was freilich bedeutete, dass Wiederholungen zwischen bestimmten Kapiteln unumgänglich waren. Wir hoffen, dass der Zweck dies rechtfertigt. Den Überschriften im Inhaltsverzeichnis sind die kursiv gesetzten Namen von Neurowissenschaftlern (und gelegentlich von Philosophen, die sich mit neurowissenschaftlichen und kognitionswissenschaftlichen Themen befassen) beigefügt, deren Theorien entweder detaillierter erörtert oder en passant im Kapitel erwähnt werden. Das wird es dem Leser hoffentlich ermöglichen, die ihn besonders interessierenden Themen und Ausführungen leicht zu entdecken.
Teil I Die philosophischen Probleme in den Neurowissenschaften: Ihre historischen und begrifflichen Wurzeln
1 Die Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnis: Die Integrationstätigkeit des Nervensystems Den Begriffsrahmen für die ersten Untersuchungen der biologischen Grundlagen der auf die Wahrnehmung, den Willen und den Geist bezogenen Fähigkeiten des Menschen legte Aristoteles in seinen Schriften über die psycheˉ fest. Das Streben nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen wurde anfangs von der Frage dominiert, wie die mit der willkürlichen Bewegung der Glieder verbundene Muskelkontraktion hervorgerufen wird. Aristoteles’ eigene rudimentäre Untersuchungen, die ihn glauben ließen, dass die Blutgefäße die Muskelkontraktion bewirken, waren allerdings ein Fehlstart. Galens viel spätere Entdeckungen hinsichtlich der vom Rückenmark ausgehenden nervlichen Innervierung der Muskeln machten schließlich deutlich, dass die Nerven diese Funktion ausüben. Galens Werk steht am Beginn einer 2000-jährigen Forschungsgeschichte zu der Frage, in welchem Zusammenhang Rückenmark und Gehirn mit den Willensbewegungen und der Reflexhaftigkeit mancher Bewegungen stehen. Ob es darum ging, die motorischen und die sensorischen Spinalnerven zu identifizieren, sich der Frage zuzuwenden, welche Rolle das Rückenmark bei Reflexbewegungen spielt oder zu erkunden, wie aus Gehirntätigkeit und Rückenmarksaktivität Willens- und Reflexbewegungen hervorgehen, stets rührten die Erkenntnisgewinne von Experimenten her. Die einschlägigen Beobachtungen der Muskeln und Glieder bezogen Läsionen in verschiedenen Teilen des Nervensystems mit ein. Auf diese Weise bildete sich eine Konzeption über den Integrationszusammenhang heraus, in dem Gehirn, Rückenmark und Nerven stehen müssen, um die finale motorische Handlung hervorzubringen. Der Begriffsrahmen, innerhalb dessen die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse anwuchsen, entstammt dem Denken Aristoteles’, später veränderte er sich allerdings im Zusammenhang mit der cartesianischen Revolution im 17. Jahrhundert. In diesem Kapitel werden wir skizzieren, wie sich die Vorstellungen, die man sich über die neuralen Grundlagen der Lebensfunktionen machte, entwickelt haben und uns zunehmend darauf konzentrieren, was Sherrington, der größte unter den Neurowissenschaftlern, ‚die Integrationstätigkeit des Nervensystems‘ nannte, und zwar im Hinblick auf die Bewegung. Dieser Abriss der Geschichte des langsamen Wissenszuwachses hinsichtlich des Nervensystems und seiner Operationen wird einige der begrifflichen Schwierigkeiten zutage treten lassen, die den Naturphilosophen, die sich mit den Fragen nach den biologischen Grundlagen der charakteristischen Vermögen lebender Wesen im Allgemeinen und von Menschen im Besonderen auseinandersetzten, im Laufe der Jahrhunderte begegneten. Es wird sich herausstellen, dass die Wurzeln der gegenwärtigen Begriffspro-
14
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
bleme der kognitiven Neurowissenschaften weit in die Vergangenheit zurückreichen. Je besser wir unser geistiges und wissenschaftliches Erbe kennen und je mehr wir es begreifen, desto schärfer treten die Begriffsprobleme der Gegenwart hervor. Und um diese werden wir uns in erster Linie kümmern. Jemand könnte die Frage aufwerfen, warum wir uns in unserem historischen Abriss der Integrationstätigkeit des Nervensystems nicht stärker auf die großartigen Sinnessysteme konzentrieren, auf das Sehen beispielsweise. Das liegt daran, dass die frühen Neurowissenschaftler sich zunächst herausgefordert fühlten, das motorische System zu verstehen, weil dieses ihnen die Durchführung von Experimenten gestattete, um ihre Vorstellungen anhand der damals zur Verfügung stehenden Verfahren zu überprüfen. Eine solche Möglichkeit bot das sensorische System nicht. Diesen Pionieren ging es darum, ihr Verständnis des sensorischen Systems in das Wissen über Muskelkontraktion und -bewegung, das sich zunehmend entfaltete, einfließen zu lassen. Und so spekulierten sie darüber, wie das Sehen und die Motorik zusammenhängen könnten. Allerdings trugen diese Überlegungen nicht viel zum Verständnis des Phänomens bei – die Frage, wie das Sehen sich vollzieht, blieb unbeantwortet und musste auf Verfahren warten, die erst im 19. und insbesondere im 20. Jahrhundert zur Verfügung standen.
1.1 Aristoteles, Galen und Nemesius: Die Ursprünge der Ventrikellehre Aristoteles’ Konzeption der psycheˉ Aristoteles ist der erste große Biologe, dessen Abhandlungen und Beobachtungsdaten Bestand hatten. Sein philosophisches Weltbild prägte das europäische Denken bis zur wissenschaftlichen Revolution des 17. Jahrhunderts und in gewisser Hinsicht auch später noch. Und obwohl er fast nichts über das Nervensystem wusste, sind seine fundamentalen, das Leben und lebendige Wesen betreffenden Konzeptionen unverzichtbar, will man das Denken früher Wissenschaftler wie Galen und Nemesius verstehen, die das Nervensystem und seinen Einfluss auf die kognitiven, kogitativen, affektiven und willentlichen Vermögen des Menschen erforschten. Darüber hinaus war seine Konzeption des Menschen, des Verhältnisses zwischen Organen und Funktionen und zwischen dem Körper und den charakteristischen Vermögen dessen, was er ‚die psycheˉ‘ nannte, tiefgründig und fundiert. Die aristotelische Konzeption der psycheˉ und die cartesianische Konzeption des Geistes, die jene im 17. Jahrhundert ablöste, konstituieren in bestimmter Hinsicht zwei fundamental unterschiedliche Möglichkeiten des Nachdenkens über die menschliche Natur, die auf die neurowissenschaftliche Reflexion über die Integrationstätigkeit des Nervensystems stets anregend gewirkt haben.
1.1 Ursprünge der Ventrikellehre
15
Die psycheˉ als Form des natürlichen Körpers Aristoteles erkannte jedem lebenden Organismus eine psycheˉ zu. Er dachte die psycheˉ als die Form eines natürlichen Körpers, der Leben hat.1 Sie wurde von ihm auch als erste Wirklichkeit [Vollendung] eines natürlichen Körpers, der Organe hat, charakterisiert (DA 412b5–6). Aristoteles’ Terminologie muss erläutert werden. Dem gewöhnlichen Verständnis nach bedeutet ‚Psyche‘ ‚Atem‘ oder ‚Lebensatem‘ (den man im Augenblick des Todes oder wenn man ohnmächtig wird ‚ausatmet‘), so wie der ältere lateinische Ausdruck ‚anima‘ auch, mit dem er übersetzt wurde und der mit der Vorstellung des Windes und vitaler Lebenskraft verknüpft ist. Die psycheˉ von solchen Assoziationen frei zu machen, war eine prä-aristotelische philosophische Innovationsleistung. Aristoteles brachte sie erstmals ausdrücklich mit allen Organismen in Verbindung, als das Lebensprinzip, das jedes lebendige Wesen durchdringt. Obwohl ‚Psyche‘ üblicherweise mit ‚Seele‘ übersetzt wird, muss man sich klarmachen, dass ‚Psyche‘ in aristotelischer Verwendung nicht die religiösen und ethischen Konnotationen unseres Terminus ‚Seele‘ aufweist. Psycheˉ ist das ‚Lebensprinzip der Geschöpfe‘ (DA 402a7–8), und zwar auch der pflanzlichen. Denn Pflanzen haben nicht weniger eine Psyche als Tiere. Es wäre gleichfalls irreführend, ‚Psyche‘ mit ‚Geist‘ zu übersetzen, denn der Geist und die Geistesvermögen sind anders als die psycheˉ nicht mit Wachstum, Ernährung und Fortpflanzung, den charakteristischen Merkmalen alles Lebendigen, verknüpft. Die Psycheˉ ist auch nicht essenziell mit dem Bewusstsein verknüpft, wie sie es in der cartesianischen Konzeption des Geistes ist. Der Terminus ‚Psyche‘, den wir in Übereinstimmung mit der Tradition im Folgenden als ‚Seele‘ übersetzen, ist ein biologischer Begriff – kein religiöser oder ethischer. Es ist wichtig, das mit Blick auf Aristoteles, aber auch hinsichtlich der neurowissenschaftlichen Debatten des 17. und 18. Jahrhunderts über die Existenz einer ‚spinalen Seele‘ zu beachten (siehe 1.4). Form und Materie werden unterschieden Um den für die Darstellung von Beständigkeit im Wandel notwendigen theoretischen Apparat zu entwickeln, unterschied Aristoteles zwischen Form und Materie. Substanzen, unabhängig davon, ob es sich um räumliche Dinge einer bestimmten Art handelt (wie ein Felsen, ein Baum, ein Beil oder ein Mensch) oder um Elemente von etwas Stofflichem einer bestimmten Art (von Wasser, Bronze, Wein oder Käse, die in Form eines Tropfens oder Klumpens, in Flaschen- oder Scheibenform in Erscheinung treten können), unterliegen dem Wandel. Dieser kann ‚akzidentell‘ oder ‚substanziell‘ (‚essenziell‘) sein. ‚Akzidenteller Wandel‘ ist der Wandel nichtessenzieller Eigenschaften (‚Akzidenzien‘) einer gegebenen Substanz. Bei ihm handelt es sich um die Aneignung eines neuen Merkmals oder den Verlust eines bereits existierenden – wie in den Fällen beispielsweise, 1
Aristoteles, De Anima 412a20. Im Text in der Folge abgekürzt als DA.
16
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
da ein Baum größer wird, ein Beil stumpfer, ein Mensch dicker oder das Wasser eines Schwimmbeckens sich erwärmt oder eine bestimmte Menge an Gold schmilzt. Der akzidentelle Wandel tastet das Wesen der Substanz, die Einheit seiner essenziellen Eigenschaften nicht an. Anders liegt die Sache beim substanziellen Wandel, hierbei verändern sich die wesentlichen Eigenschaften einer Substanz – wie in den Fällen beispielsweise, da Wein sich in Essig oder Milch sich in Käse wandelt und auch, wenn ein Lebewesen stirbt. Der substanzielle Wandel ist unvereinbar mit der fortgesetzten unveränderten Existenz der nämlichen Substanz – wenn der Wein sich in Essig wandelt, gibt es keinen Wein mehr, und wenn ein Pferd stirbt, hört es auf zu existieren, und nur seine Überreste, ein toter Körper, bleiben zurück. Aristoteles führte den Ausdruck Materie als Terminus technicus für das ein, was über die Fähigkeit zu substanziellem Wandel verfügt, und Form, um das hervorzuheben, was aus einem bestimmten materiellen Substrat die Art von Substanz macht, die es ist. Entsprechend gibt es sowohl akzidentelle Formen (z. B. die akzidentellen Formen der verschiedenen Farben, die ein Ding annehmen oder verlieren kann, während es dasselbe Ding bleibt) als auch substanzielle Formen (des Weins und Essigs beispielsweise oder einer Pflanze oder eines Menschen). Wenn eine Substanz sich akzidentell wandelt, behält sie ihre substanzielle Form bei. Form und Materie sind nicht die Teile einer Sache Man sollte sich klarmachen, dass, obwohl von irgendwie gearteten Einzeldingen gesagt wird, sie seien beides: Form und Materie, es sich bei Form und Materie nicht um die Teile einer Sache handelt. Die Materie kann ohne die Form nicht sein – ihre Form mag sich verändern, akzidentell oder substanziell, irgendeine Form muss sie haben. Gleichermaßen kann die Form ohne die Materie nicht sein – damit die Form einer X-heit existieren kann, muss es irgendeine Substanz geben, die X ist. Man könnte durchaus argumentieren, dass dieser Begriffsapparat sich besonders dafür eignet, die Transformation materieller Dinge (von Milch in Käse beispielsweise) zu erörtern oder um die Dinge und ihre konstitutiven Materialien zu untersuchen (z. B. ein Schwert und den Stahl, aus dem es gemacht ist) als auch die Dinge (unterschiedlicher Ordnungen) und ihre konstitutiven Teile (ein Haus und die Ziegelsteine, mit denen es errichtet wurde, beispielsweise). Es ist allerdings fraglich, ob es sehr angebracht ist, seine Anwendung auf die Beschreibung von Dingen und ihren Vermögen auszuweiten.2 Sei es, wie es sei, Aristoteles tat dies, indem er die Seele zugleich als die Form des lebenden Körpers und als seine erste Wirklichkeit charakterisierte.
Zur Erörterung dieser Frage siehe J. L. Ackrill, ‚Aristotle’s definition of psycheˉ, wieder abgedr. in J. Barnes, M. Schofield und R. Sorabij (Hg.), Articles on Aristotle, Bd. IV: Psychology and Aesthetics (Duckworth, London, 1979), S. 65–75. 2
1.1 Ursprünge der Ventrikellehre
17
Die psycheˉ eines Lebewesens ist aus seinen ersten Wirklichkeiten konstituiert Bei den Wirklichkeiten (entelechiai) einer Substanz handelt es sich um jene Dinge, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ist oder tut. Zu ihren Wirklichkeiten zählen (ziemlich verwirrend) ihre Vermögen (d. h. die aktiven und passiven Möglichkeiten, die sie aktuell besitzt). Solche können besessen werden, ohne zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeübt zu werden – die Sehenden erblinden nicht im Schlaf, und Menschen, diejenigen, die Englisch sprechen, hören nicht auf, diese Sprache zu beherrschen, wenn sie nichts sagen. Aristoteles bezieht sich auf die nicht ausgeübte dispositionale Kraft (hexis) eines Lebewesens als erste Wirklichkeit (z. B. sehen zu können, Englisch zu beherrschen), im Gegensatz dazu bezeichnet er die Ausübung einer dispositionalen Kraft (die momentane Aktivität des Betrachtens von etwas oder des Englischsprechens beispielsweise) als zweite Wirklichkeit (energeia). Wenn die Seele die Wirklichkeit des Körpers ist, wie nahegelegt, so ist sie das nur als erste Wirklichkeit. Denn ein lebendes Wesen hat eine Seele – das heißt, verfügt über seine unverwechselbaren definierenden Vermögen –, unabhängig davon, ob es wach ist oder schläft. Die psycheˉ oder Seele ist weder Teil eines lebenden Wesens noch eine weitere ihm zugehörige Entität Demnach bringt die Redewendung ‚eine Seele haben‘ anders als ‚ein Auto haben‘ kein Besitzverhältnis zwischen einem Subjekt und einer Entität zum Ausdruck. Ferner steht die Seele in einem anderen Verhältnis zum Körper als das Gehirn, da sie ja kein Teil des Körpers ist. Wie sollten die Zusammenhänge dann dargestellt werden? Aristoteles führt ein Analogiepaar an. Die Materie eines Beils sind Holz und Eisen, daraus wurde es gemacht. Seine Form ist seine Fähigkeit zu hacken. Die erste Wirklichkeit des Beils besteht in dem Vermögen, Holz zu hacken, und über dieses verfügt es insofern, als seine Materie entsprechend als Blatt und Stiel gestaltet wurde. Sein Hackvermögen kann nicht unabhängig von der Materie (Holz und Eisen) oder den Teilen (Stiel und Blatt), aus denen es besteht, existieren. (Selbstverständlich aber handelt es sich bei einem Beil um ein unbelebtes Artefakt, und unbelebte Dinge haben keine Seele.) Gleichermaßen kann man, behauptet Aristoteles, das Verhältnis zwischen einem Tier und seiner Seele mit dem vergleichen, das zwischen einem Auge und dem Sehvermögen besteht. Wenn das Auge ein Lebewesen wäre, dann wäre das Sehvermögen seine Seele (DA 412b18); unzweifelhaft ist das Auge jedoch kein Lebewesen, sondern Teil eines solchen – und folglich hat es keine Seele, wohl aber eine Funktion.
18
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
Die psycheˉ oder Seele als die erste Wirklichkeit eines lebenden Körpers mit Organen besteht aus seinen definierenden Funktionen Die Seele besteht aus den essenziellen, definierenden Funktionen eines Lebewesens mit Organen.3 Ein Lebewesen kann die essenziellen Funktionen nur deshalb ausüben, weil es über Organe verfügt, die ihm das ermöglichen, seiner Lebensweise entsprechend. Indem es seine Organe gebraucht, treten seine zweiten Wirklichkeiten in Erscheinung. Die nährende, die sensitive und die rationale Seele werden unterschieden Aristoteles unterschied hierarchisch drei Naturformen der Seele. Die nährende Seele ist das Fundamentalprinzip des biologischen Lebens als solchem. Es „ist das primitivste und am weitesten verbreitete Vermögen der Seele, dasjenige, aufgrund dessen das Leben allen Wesen zukommt“ (DA 415a23–26). Es setzt sich aus Wachstums-, Ernährungsund Fortpflanzungsvermögen zusammen. Pflanzen haben nur eine nährende Seele. Ihre verschiedenen Organe (Wurzeln, Blätter, Staubgefäße etc.) befähigen sie, die essenziellen Funktionen vegetativen Lebens auszuüben. Tiere haben nicht nur ein Ernährungsvermögen, sondern auch ein Wahrnehmungs-, Verlangens- und Fortbewegungsvermögen. Von ihnen wird folglich behauptet, dass sie eine sensitive Seele 4 haben. Der Besitz einer sensitiven Seele setzt den Besitz der Vermögen einer nährenden Seele voraus, was jedoch nicht umgekehrt gilt. Die Menschheit ist allerdings insofern einzigartig in der Natur, als sie nicht nur über die Vermögen einer nährenden und einer sensitiven Seele verfügt, sondern auch über das rationale Seelenvermögen. Hierbei handelt es sich um das Denken (folgerndes Denken5) und den Willen (das rationale Wollen). Die psycheˉ oder Seele ist weder ein Akteur noch eine Entität, sondern die Gesamtheit der essenziellen, definierenden Vermögen eines Lebewesens Die psycheˉ ist also kein ‚innerer Akteur‘ – nicht das Subjekt der Erfahrung und der Urheber der Handlung, das/der den Körper belebt, aber von ihm unabhängig ist. Es han3
Wir lassen hier Aristoteles’ Formulierung, ein natürlicher Körper, der der Möglichkeit nach Leben hat, außer Acht (DA 412a20). 4 [Obwohl es in deutschen Fassungen ‚wahrnehmende Seele‘ heißt, wurde der englischen Version ‚sensitive soul‘ mit der Wendung ‚sensitive Seele‘ entsprochen. Denn mit ‚sensitiv‘ ist, wie die Autoren ausführen (siehe S. 33), ‚Wahrnehmung im physiologischen Sinne und Bewegung‘ gemeint. – A.d.Ü.] 5 [‚Reasoning‘, ein zentraler Terminus im Text, meint hier nicht folgern im strengen logischen Sinn, sondern ein von Ausgangspunkten herkommendes Durch- und Weiterdenken einer Sache, die es mehr oder weniger zu Ende denkt. Ein Denken, das, obgleich ihm die Werkzeuge der Logik zur Verfügung stehen, auch fehlgehen und Irrtümern unterliegen kann. Mit ‚überlegen‘ lässt es sich auch wiedergeben. – A.d.Ü.]
1.1 Ursprünge der Ventrikellehre
19
delt sich bei ihr weder um eine Substanz noch um einen Teil einer Substanz. Sie ist, Aristoteles insistiert hier, „kein Körper, wohl aber etwas, das zum Körper gehört“ (DA 414a20–21). Generell ist die Form einer Sache keine wie auch immer geartete Entität. Sie ist aus nichts gemacht, und eine Form existiert genau insofern, als es ein Ding gibt, das in dieser Weise in eine Form gebracht [in-formed] ist. Folglich ist auch die psycheˉ als die Form lebendiger Wesen weder materiell wie Körper und Gehirn noch immateriell wie ein Gespenst. Körper und Seele ‚machen‘ ein Lebewesen ‚aus‘, allerdings nicht wie Fahrwerk und Motor ein Auto; sondern „so, wie Pupille und Sehvermögen das Auge bilden, so bilden in diesem Fall Seele und Körper das Lebewesen“ (DA 413a1–3).6 Eine Seele zu haben heißt nicht, etwas zu besitzen oder mit etwas in Beziehung zu stehen, es bedeutet, gleichsam ‚be-seelt‘ zu sein (empsychos). Die aristotelische und die cartesianische Seelenkonzeption einander gegenübergestellt Genau weil Aristoteles die Seele nicht als eine vom Körper unabhängige Entität dachte, sondern vielmehr als die Vermögen des Lebewesens, vermied er den Fehler, der Seele die Ausübung der charakteristischen Vermögen einer Kreatur, deren Seele sie ist, beizumessen. Ja, er betonte, dass „zu sagen, die Seele sei zornig, [. . .] so [ist], als würde man sagen, dass die Seele webe oder baue. Denn es ist gewiss besser, nicht zu sagen, die Seele bemitleide oder lerne oder denke, sondern der Mensch tue dies mit seiner Seele“ (DA 408b12–15).7 Diese Darstellung trennt die aristotelische Konzeption insofern entscheidend von der später ausgearbeiteten cartesianischen, als Descartes alle psychischen Funktionen dem Geist zuschrieb (siehe 1.2). Und sie markiert auch den entscheidenden Unterschied zwischen dem aristotelischen Denken und den Konzeptionen der Gegenwart, insofern als die Neurowissenschaftler der Gegenwart (und andere) eine Vielzahl psychischer Funktionen (besonders kognitive und willentliche) dem Gehirn zuschreiben (siehe 3.1). Was de facto heißt, einem Teil eines Lebewesens das zuzuschreiben, was ihm nur als Ganzem zukommen bzw. sinnvoll zugeschrieben werden kann. Aristoteles’ Konzeption unterschied sich völlig von der seines Lehrers Plato, der ja die Seele als eine vom Körper unabhängige Entität betrachtete. Im Rahmen des platonischen und, viel später, cartesianischen Dualismus besteht das drängendste – und in der Tat unlösbare – Problem darin, eine schlüssige Darstellung des Verhältnisses dieser beiden Entitäten zu liefern und gleichfalls darin, die essenzielle Einheit eines menschlichen Wesens zu erklären. Diese Fragen können im aristotelischen biologischen Denkrahmen 6
Man sollte Aristoteles’ Ansicht erwähnen, dass ein Auge ohne Sehkraft und ein gemaltes Auge sich darin gleichen, kein Auge zu sein, ebenso wie ein Leichnam und eine Statue gleichermaßen ‚leblos‘ sind. 7 Wenn Aristoteles sagt, dass wir diese Dinge mit unserer Seele tun, so ist das nicht im Sinne von: mit unseren Händen oder Augen zu verstehen, sondern vielmehr im Sinne von: mit unseren Begabungen und Fähigkeiten.
20
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
nicht aufkommen. Aristoteles erläutert weise, dass „wir [. . .] die Frage, ob die Seele und der Körper Eines sind, als unnötige ablehnen [können]: das wäre, als würden wir fragen, ob das Wachs und seine Figur Eines sind oder generell die Materie eines Dings und das, wovon sie die Materie ist“ (DA 412b6–7). Von der Seele oder psycheˉ einer Kreatur zu sprechen heißt kurz gesagt, von diesen essenziellen kreatürlichen Vermögen zu sprechen. Irgendein bestimmtes Ding wird seine Seele solange bewahren, wie es seine charakteristischen Funktionen auszuüben fähig ist. Sein Vermögen zur Entfaltung seiner essenziellen Fähigkeiten zu zerstören heißt, das Ding selbst zu zerstören.8 Aristoteles’ Sensus-communis-Konzeption In seiner Wahrnehmungsdarstellung unterscheidet Aristoteles die fünf Sinne (Sinnesfähigkeiten) und die Sinnesorgane, die (vier von) ihnen korrespondieren. Die verschiedenen Sinnesvermögen gehören freilich einem einheitlichen Einzelwesen zu, dem Tier, das mit einem einheitlichen Wahrnehmungsvermögen ausgestattet ist. Die Sinne sind, heißt es bei Aristoteles, „untrennbar, doch unterschieden in der Darstellung“ – das bedeutet, dass, was die Operationen und Mechanismen jedes der Sinne angeht, eine je besondere Darstellung vonnöten ist, dass es sich jedoch bei allen um konstitutive Elemente eines einheitlichen Wahrnehmungsvermögens handelt und dass alle Sinnesorgane Teile eines vernetzten Apparates sind, von dem Aristoteles dachte, er hätte sein Zentrum im Herz. Das Lebewesen nimmt nur dann wahr, wenn die Impulse, die durch Einwirkung auf ein Sinnesorgan oder irgendeinen Teil des für ‚Anstöße‘ empfindlichen Körpers hervorgerufen wurden, vom Blut in das zentrale Sensorium im Herz übertragen werden. Aristoteles ordnete dem Herz tatsächlich die Vereinheitlichungsfunktionen zu, die wir dem Gehirn zuerkennen.9 Er charakterisierte diesen Ort unserer Wahrnehmungsfähigkeiten als 8
Wir berücksichtigen hier nicht die komplexen Verhältnisse und Inkohärenzen, die sich im Zusammenhang mit Aristoteles’ Unterscheidung zwischen aktivem und passivem Verstand und mit der Andeutung, der aktive Verstand sei in der Lage, ohne den Körper zu existieren, ergeben (DA 429a18–29, 430a18–25). Diese Passagen waren für die spätere scholastische Synthese von aristotelischer Philosophie des Geistes und christlicher Lehre von der Unsterblichkeit der Seele von entscheidender Bedeutung. 9 Für seine Argumentation siehe De Partibus Animalium 647a22–34. In dieser Hinsicht wich er von der hippokratischen Tradition ab. In den Epilepsie-Lehrsätzen des Hippokrates heißt es: ‚Es sollte eigentlich bekannt sein, dass die Quelle unserer Freude und Heiterkeit, unseres Lachens und Vergnügens wie unserer Trauer und Angst, unseres Schmerzes und unserer Tränen nichts anderes ist als das Gehirn. Es ist insbesondere das Organ, das uns zum Denken, Sehen und Hören befähigt und dazu, zwischen dem Hässlichen und dem Schönen, dem Guten und Bösen, dem Erfreulichen und Unerfreulichen zu unterscheiden. [. . .] Das Gehirn ist auch der Sitz des Wahnsinns und des Deliriums, von Furcht und Beängstigung, die uns überfallen, oft in der Nacht, manchmal aber sogar am Tag; dort liegt auch die Ursache für die Schlaflosigkeit und das Schlafwandeln‘ (‚The sacred disease‘, 17, in G. E. R. Lloyd (Hg.), Hyppocratic Writings (Penguin Books,
1.1 Ursprünge der Ventrikellehre
21
ein „kontrollierendes Sinnesorgan“10 – fälschlicherweise jedoch, denn wir nehmen nicht so mit dem ‚Sensorium‘ wahr (egal, ob es sich um das Herz oder das Gehirn handelt), wie wir mit unseren Augen sehen und mit unseren Ohren hören, und es ist kein Sinnesorgan in dem Sinne, in dem Augen und Ohren Sinnesorgane sind. Aristoteles betonte, dass, obwohl wir unterschiedliche Sinnesfähigkeiten haben und obwohl einige Sinnesobjekte (die sogenannten dem Sinn eigentümlichen Objekte, z. B. Farbe, Klang, Geruch und Geschmack) in einzigartiger Weise durch ein bestimmtes Sinnesvermögen aufgespürt werden (z. B. die Farbe durch das Sehen und der Klang durch das Hören), andere, die sogenannten gemeinsamen Objekte (z. B. Bewegung, Formgestalt, Größe, Zahl und Einheitlichkeit), durch mehr als einen Sinn wahrgenommen werden. Letzteres ist einer von zahlreichen nicht vollständig klar werdenden Gründen dafür, dass Aristoteles ein ‚primäres Wahrnehmungsvermögen‘ oder eine ‚erste Fähigkeit zur Wahrnehmung‘ postulierte, auf die er sich gelegentlich als ‚gemeinsamer Sinn‘ (‚Gemeinsinn‘)11 bezieht (und den spätere Autoren bis ins 18. Jahrhundert hinein ‚Sensus communis‘ nennen). Der Sensus communis – ein Hauptorgan zur Vereinigung der Objekte in der Wahrnehmung Der Sensus communis wird, so scheint es, für die Erklärung benötigt, wie die Wahrnehmung gemeinsamer Objekte durch die Wahrnehmung (sinnes)eigentümlicher Objekte möglich ist (man könnte keine Form sehen, ohne nicht auch Farbe sehen zu können) und wie jene als einheitliche Attribute wahrgenommen werden können. Denn obwohl wir beispielsweise die Form durch Sehen und Ertasten zugleich wahrnehmen, sind Sehen und Ertasten je eigene Weisen, dasselbe Attribut zu erkennen: die Form nämlich (denn wir nehmen nicht sozusagen zwei verschiedene Attribute wahr, visuelle Form und taktile Form). Außerdem ist es so, dass, obwohl wir, wenn wir wahrnehmen – eine Rose beispielsweise –, mit unseren verschiedenen Sinnesorganen und ihren korrespondierenden Fähigkeiten verschiedene (sinnes)eigentümliche Merkmale wahrnehmen, diese als vereinigte Qualitäten eines einzelnen Objekts wahrnehmen.12 Dies ist laut Aristoteles ein weiterer Grund für die Vermutung, es gebe ein ‚einzelnes Sinnesvermögen‘ und ein Hauptorgan – das Herz. (Hier haben wir es wohl mit einer Vorwegnahme der Harmondsworth, 1978). Die hippokratische Einsicht ist wunderbar; die das Physiologische betreffende Argumentation ist indes nicht weniger fehlerhaft als die des Aristoteles, mit der dieser seine abweichende Hypothese zu stützen versuchte. 10 Aristoteles, De Somno 455a21. Bezieht sich auf die Übersetzung von Barnes; eine alternative Übersetzung des Satzes, in dem dieser Ausdruck erscheint, lautet: ‚Denn es existiert ein einziges Sinnes-Vermögen, und das Hauptorgan ist einzig‘. 11 Sein Ausdruck ist aisthesis koine, der nur in De Anima 425a27, De Memoria 450a10 und De ˉ ˉ Partibus Anmalium 686a27 vorkommt. 12 Aristoteles, De Sensu 499a5–11.
22
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem sogenannten Bindungsproblem zu tun, jedoch ohne die cartesianische und lockesche Konfusion, die üblicherweise mit ihr einhergeht und in der Annahme zum Ausdruck kommt, das Sensorium müsse ein inneres Bild oder eine interne Repräsentation hervorbringen.13) Im Folgenden werden andere Gründe aufgeführt, weshalb der Sensus communis als unverzichtbar erachtet wurde: (i) Wir können nicht sehen, dass wir sehen, bzw. nicht hören, dass wir hören. Nichtsdestotrotz, behauptet Aristoteles, nehmen wir wahr, dass wir sehen oder hören – und das sei eine der Funktionen des Gemeinsinns.14 (Einige Neurowissenschaftler und Neuropsychologen, die mit der Untersuchung des ‚Blindsehens‘ [Rindenblindheit] befasst sind, messen manchem Gehirnbereich die Arbeitsweise eines sich selbst kontrollierenden Apparats bei und behaupten, dass er eben diese Funktion erfüllt.15) Die Überlegung ist allerdings falsch, denn wir nehmen nicht wahr, dass wir sehen oder hören; wir können vielmehr sagen, wenn wir sehen oder hören, dass wir dies tun – aber nicht, weil wir in irgendeinem Sinn wahrnehmen würden, dass wir dies tun. Diese Form der Selbstwahrnehmung muss erläutert werden, allerdings nicht auf diesem Wege (siehe Kapitel 12). (ii) Mittels der Sehkraft unterscheiden wir Weiß von Rot, und mittels des Geschmackssinns differenzieren wir zwischen süß und sauer. Aber wir unterscheiden auch, wie Aristoteles seltsamerweise beobachtet, Weiß von süß und Rot von sauer – und das weder durch die Sehkraft noch durch den Geschmackssinn.16 Und so folgert er,
13
Siehe z. B. F. Crick, The Astonishing Hypothesis (Touchstone, London, 1995), S. 22 [dt. Was die Seele wirklich ist. Die naturwissenschaftliche Erforschung des Bewusstseins (Artemis & Winkler, München & Zürich, 1994), S. 41; A. Damasio, The Feeling of What Happens (Heinemann, London, 1999), S. 320 [dt. Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins (List, München 1999), S. 320; E. Kandel und R. Wurtz, ‚Constructing the visual image‘ in Kandel, Schwartz und Jessell (Hg.), Principles of Neural Science (Elsevier, New York, 2001), S. 492. Für eine Auseinandersetzung mit dem Bindungsproblem siehe 4.2.3. 14 Aristoteles, De Somno 455a15–20. 15 Z.B. Lawrence Weiskrantz, Blindsight: A Case Study and Implications (Oxford University Press, Oxford, 1986) und idem, ‚Varieties of residual experiences‘, Quaterly Journal of Experimental Psychology, 32 (1980), S. 365–386. Siehe unten 14.3.1. 16 Diese Ansicht ist merkwürdig, insofern nicht klar ist, in welchem Sinne er denkt, dass wir Weiß von süß unterscheiden. Selbstverständlich haben wir die Fähigkeiten, weiße Dinge zu sehen und diese von andersfarbigen Dingen zu unterscheiden oder Süßes zu schmecken und das von Sachen mit anderem Geschmack zu unterscheiden, und wir (Sprachbenutzer) verfügen auch über die Begriffe von Weiß (und anderen Farben) und von süß (und anderen Geschmacksqualitäten). Aber wir unterscheiden nicht weiße von süßen Dingen; wir brauchen auch kein Zusatzorgan, um Weiß und süß zu differenzieren (denn was sollte man sich unter ihrer Verwechselung vorstellen?).
1.1 Ursprünge der Ventrikellehre
23
dass es irgendein Hauptvermögen der Wahrnehmung geben muss, das dieser Funktion nachkommt (DA 426b). (iii) Weil sich der Schlaf auf alle Sinnesvermögen auswirkt (d. h., wir sehen, hören, schmecken, riechen oder fühlen nicht, während wir schlafen), muss es sich bei Wachsein und Schlafen um die Auswirkungen eines einzelnen einheitlichen Sinnesvermögens und kontrollierenden Sinnesorgans handeln.17 Schließlich ordnete Aristoteles dem Sensus communis die Funktionen (a) des Zeitverständnisses, (b) der Bilderzeugung durch die Vorstellungskraft oder die fantasia, (c) des Gedächtnisses (welche aus seiner Sicht sowohl (a) als auch (b) voraussetzt) und (d) des Träumens zu.18 Die Funktionen (b)–(d) setzen eine vorhergehende Wahrnehmung voraus, jedoch keinen aktuellen Gebrauch eines Wahrnehmungsorgans. Es handelt sich bei ihnen um Prozesse, die sozusagen eine ‚veraltete Wahrnehmung‘ (oder, wie man auch sagen könnte, ‚Gehirnspuren‘ oder ‚Engramme‘) einbegreifen. Sowohl in diesen frühen Reflexionen über die menschliche Vermögen und die für deren Beschreibung notwendigen Begriffsstrukturen als auch in diesen Argumenten zugunsten eines Sensus communis lassen sich die Anfänge systematischen wissenschaftlichen Nachdenkens über die Integrationstätigkeit des Nervensystems erkennen. An dieser Stelle seien noch zwei weitere Punkte abgehandelt, bevor wir Aristoteles verlassen: Die Pneumakonzeption Erstens glaubte Aristoteles genau wie Empedokles, dass es vier irdische Elemente gibt: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Diesen fügte er ein weiteres, supra-irdisches Element hinzu, ‚das erste Element‘ oder ‚der erste Körper‘, später Äther genannt, aus dem die himmlischen Körper bestehen. Die irdischen Elemente bewegen sich von Natur aus geradlinig (nach oben oder unten). Die Bewegung des ersten Elements bzw. Äthers unterscheidet sich davon: Sie ist (a) ewig und (b) kreisförmig. Mitunter findet sich die Andeutung, Aristoteles hätte dem ersten Element in seiner Biologie irgendeine irdische Funktion zuerkannt. In De Generatione Animalum heißt es: Alles Seelenvermögen scheint nun an eine andere Materie gebunden zu sein, die von höherer [göttlicher] Natur ist als die sogenannten Elemente. [. . .] Alle tragen das in ihrem Samen, was bewirkt, dass aus ihnen etwas entstehen kann; ich meine damit das, was man die Leben spendende Wärme nennt. Diese ist aber nicht Feuer oder irgendeine solche Kraft, sondern der in dem Samen und dem schaumartigen Wesen enthaltene Hauch (Pneuma) und das in diesem Hauch befindliche natürliche Prinzip, das dem Wesen der Gestirne entspricht. (736b29–737a1)
17 18
Aristoteles, De Somno 455a. Aristoteles, De Memoria 450a9–14.
24
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
Man weiß nicht recht, was hiervon zu halten ist (davon, wie das auf die Pflanzenseele zutreffen soll, ganz zu schweigen). Cicero, der einige Jahrhunderte später schrieb, als bestimmte Werke von Aristoteles bereits verloren gegangen waren, behauptete, dass [e]r denkt, es gebe eine bestimmte fünfte Natur, aus der der Geist [die Seele] gemacht ist; denn Nachdenken und Planen, Lernen und Lehren, die Entdeckung von Neuem und das ImGedächtnis-Behalten von so vielem – all das und mehr: Lieben und Hassen, Schmerz und Freude empfinden – solches und Ähnliches lässt sich, wie er annimmt, bei keinem der vier Elemente finden. Also führt er ein fünftes Element ein, das keinen Namen besitzt, und nennt die Seele selbst ‚endelecheia‘, mit einem neuen Namen, der auf eine Art von ununterbrochener und ewiger Bewegung hinweist.19
Es scheint daher, als habe Aristoteles die die Seele konstituierenden Vermögen mit einem ‚göttlichen‘, unzerstörbaren Element verbunden, bei dem es sich um eine Art Leben spendender oder vitaler, in den Samen vorhandener und für die Zeugung verantwortlicher Wärme handelt bzw. um einen ebensolchen Hauch (Pneuma). Dieses Pneuma werde im Herz in vitales Pneuma umgewandelt, das dann wiederum durch die Blutbahnen zu den Muskeln gelange, wo es eine Kontraktion hervorrufe. Dem PneumaBegriff sollte eine lange und verworrene Geschichte in der nach Klarheit strebenden Auseinandersetzung mit der Integrationstätigkeit des Nervensystems beschieden sein. Zweitens ist Aristoteles’ Beobachtung, dass „bestimmte Insekten weiterleben, wenn sie in [zwei] Teile geteilt werden“, bemerkenswert und spielte bei der Konzeption der ‚spinalen Seele‘, die die Neurowissenschaftler im 18. Jahrhundert beschäftigte (siehe 1.4), eine wichtige Rolle. Die Beobachtung zeigt, behauptete er, dass „jeder der Teile dieselbe Seele der Art nach hat, wenn auch nicht der Zahl nach; denn jeder der Teile verfügt eine Zeit lang über die Fähigkeit zur Empfindung und Ortsbewegung. Es überrascht nicht, dass dies nicht von Dauer ist, denn sie haben nicht mehr die zur Bewahrung ihres Lebens notwendigen Körperteile“ (DA 411b17ff.). Weil die zwei Insektenhälften weiterhin reizempfindlich bzw. sensitiv und bewegungsfähig sind, muss jede Hälfte, so die Überlegung, über eine eigene sensitive Seele (und eine motorische) verfügen. Aristoteles dachte nicht, und das ist wichtig (und spielt im Hinblick auf die im 18. Jahrhundert geführte Debatte über die spinale Seele eine wichtige Rolle), dass das unversehrte Insekt gleichsam aus einer einzigen ‚Hauptseele‘ und aus zwei weiteren, sich je in einer Körperhälfte befindenden Seelen besteht. Das unversehrte Insekt verfügt vielmehr über ein gewisses Vermögensspektrum, und wird es geteilt, so steht den Hälften dann jeweils ein gewisses begrenzt(er)es Vermögensspektrum zur Verfügung.
Cicero, Gespräche in Tusculum 1.10.22, zitiert von D. Furley, ‚Aristotle the philosopher of nature‘, in D. Furley (Hg.), From Aristotle to Augustine, Bd. IV der Routledge History of Philosophy (Routledge, London, 1999), S. 16. Ciceros ‚endelecheia‘ entspricht der oben erwähnten entelecheia. Anzumerken bleibt, dass Ciceros Annahme, für Aristoteles sei die Seele aus etwas gemacht, sicherlich ein Irrtum ist. 19
1.1 Ursprünge der Ventrikellehre
25
Galen: Motorische und sensorische Zentren Hierophilus (335–280 v. Chr.) entdeckte die Nerven, machte sich aber offenkundig nicht klar, dass es der Übertragung eines aktivierenden Akteurs (psychisches Pneuma) bedarf, ausgehend vom Rückenmark die Nerven entlang zu den Muskeln, um eine motorische Aktivität zu bewirken. Galen (130–200) war nun derjenige, der begriff, dass es sich bei den Nerven, die dem Gehirn und dem Rückenmark entspringen, um die notwendigen Verbindungsbahnen für die Auslösung der Muskelkontraktionen handelt. Die aristotelische Darstellung wurde entsprechend geändert. Man nahm an, dass vitales Pneuma durch die Blutgefäße zum Gehirn transportiert wird, wo es sich in psychisches Pneuma (dessen Zusammensetzung nicht klar war) wandelt, um dann von dort aus entlang der Nerven zu den Muskeln transferiert zu werden. Auf diese Weise „tragen die Nerven, die sich mithin an ihrer Verbindungsfunktion erfreuen, die Kräfte, die sie vom Gehirn wie aus einer Quelle bezogen haben, zu den Muskeln.“20 Das erlaube es den Muskeln zu kontrahieren, wahrscheinlich als Konsequenz ihrer Aufblähung, da sie sich ja mit psychischem Pneuma angefüllt haben.21 Galen grenzte die motorischen von den sensorischen Nerven ab Daraus leitete Galen die Vorstellung ab, dass die motorischen Nerven dem Rückenmark entstammen.22 Infolge seiner Beobachtungen verletzter Kampfwagenfahrer unterschied er auch die sensorischen von den motorischen Nerven. Diese Differenzierung erfolgte hinsichtlich ihrer relativen ‚Härte‘, wobei motorische Nerven als ‚hart‘ und sensorische als ‚weich‘ galten.23 Die motorischen Nerven wurden definitorisch eindeutig mit ihren Wurzeln im Rückenmark verbunden, die weichen sensorischen Nerven mit dem Gehirn.24 Galen verwendete den Terminus ‚Seele‘ in aristotelischem Sinne und vertrat die Auffassung, dass es eine ‚motorische Seele‘ und eine ‚sensorische Seele‘ gibt, die er jedoch nicht als zwei unterschiedlich Entitäten, sondern als zwei unterschiedliche Funktionen 20
C. Galen, Du movement des muscles, Abschn. I, Kap. 1, franz. Übers. von C. Daremberg, in Oeuvres anatomiques, physiologiques de Galen (Ballière, Paris, 1854–1856), Bd. II, S. 323. 21 Für weitere Details siehe M. R. Bennett, ‚The early history of the synapse: from Plato to Sherrington‘, Brain Research Bulletin, 50 (1999), S. 95–118. 22 C. Galen, Des Lieux affectés, Abschn. IV, Kap. 3, Übers. Daremberg in Œuvres, Bd. II, S. 590; C. Galen, Utilité de parties du corps, Abschn. IX, Kap. 13 und 14, Übers. Daremberg in Œuvres, Bd. I, S. 593–597; siehe auch W. H. L. Duckworth, Galen on Anatomical Procedures, hg. von M. C. Lyons und B. Towers (Cambridge University Press, Cambridge, 1962), S. 22–26. 23 C. Galen, Utilité de parties du corps, Abschn. IX, Kap. 14, Übers. Daremberg in Œuvres, Bd. I, S. 597ff. 24 C. Galen, Hippocrates librum de alimento commentarius, Abschn. III, Kap. 1, in K. G. Kühn (Hg.), Opera Omnia Claudii Galeni (Cnobloch, Leipzig, 1821–1833), Bd. XV, S. 257.
26
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
oder Prinzipien von Aktivität betrachtete.25 Gemäß dieser Konzeption und in Anbetracht des mutmaßlichen Verhältnisses zwischen der relativen Härte/Weichheit der Nerven, der Differenzierung zwischen motorisch und sensorisch und der Tatsache, dass man die härtesten Nerven eindeutig mit dem Rückenmark in Verbindung bringen konnte (kausal), ergibt sich die Vorstellung von zwei unabhängigen Seelen oder Aktivitätsprinzipien, wobei die eine mit dem Rückenmark, die andere mit dem Gehirn verbunden ist, ganz natürlich bzw. zwangsläufig (obwohl es unwahrscheinlich ist, dass Galen so dachte). Diese Konzeption sollte sich, was die Erklärung anhaltender Rückenmarksreflexe bei kortexlosen Lebewesen betraf, im 18. Jahrhundert einer größeren Beliebtheit erfreuen. Allerdings hatte sich die Konzeption der Seele bis dahin verändert und war in die des Bewusstseins eingegangen. Galen: Die funktionale Lokalisierung der rationalen Seele in den Ventrikeln Diese Verknüpfung der reinen sensorischen Nerven mit dem Gehirn und die Tatsache, dass diese Nerven sehr weich waren, erwiesen sich als äußerst folgenreich im Hinblick auf die Gehirnfunktion.26 Klar ist, dass Galen das gesamte Gehirn und nicht nur die Ventrikel mit den geistigen Fähigkeiten des Menschen verknüpfte. In seinem Werk Utilité de parties du corps führt er aus: „Meine kommentierenden Darlegungen beweisen, dass die rationale Seele dem Enkephalon [Gehirn] einwohnt; dass dieses der Teil ist, mit dem wir denken; dass eine sehr große Menge psychischen Pneumas sich dort befindet; und dass dieses Pneuma seine eigene besondere Qualität durch seine Weiterverbreitung im Enkephalon erwirbt“ (‚Enkephalon‘ ist verwandt mit ‚Enkephalos‘, was bedeutet: ‚dasjenige, das sich im Kopf befindet‘). Galen ordnete die Wahrnehmungsfunktionen, die Aristoteles dem Herz zugeordnet hatte, dem Gehirn zu. Allerdings unterschied er nicht zwischen den jeweiligen Rollen des Gehirns und der Ventrikel. Galen schrieb dem Kortex, was die höheren geistigen Vermögen wie das folgernde Denken angeht, keine spezielle Funktion zu, weil er bemerkte, dass Esel ein sehr komplex gewundenes Gehirn haben. Also nahm er an, dass die zerebralen Windungen nicht mit dem Verstand in Zusammenhang stehen können. Stattdessen identifizierte er die Ventrikel und nicht den Kortex als Quelle solcher Vermögen wie dem folgernden Denken.27 Galen genoss absolute Autorität, und das mehr als ein Jahrtausend lang. Es überrascht darum nicht, dass die Verknüpfung der Ventrikel mit den höheren geistigen Fähigkeiten in den folgenden Jahrhunderten zum Gegenstand detaillierter Ausarbeitungen wurde.
25
C. Galen, De Symptomatum Differentis, Abschn. VII, in Kühn (Hg.), Opera Omnia, Bd. VII, S. 55f. 26 C. Galen, Utilité de parties du corps, Abschn. VIII, Kap. 6, Übers. Daremberg in Œuvres, Bd. I, S. 541ff. 27 C. Galen, Des Lieux affectés, Abschn. IV, Kap. 3, Übers. Daremberg in Œuvres, Bd. II, S. 590.
1.1 Ursprünge der Ventrikellehre
27
Nemesius: Die ausdrückliche Zuordnung aller geistiger Funktionen zu den Ventrikeln Es war Nemesius (um 390), der Bischof von Emesa (heute Homs) in Syrien, der die Lehre von der ventrikulären Lokalisierung aller geistigen Funktionen, und das sind nicht nur die verstandesmäßigen, entwickelte. Anders als Galen wies er die Wahrnehmung und die Vorstellungskraft den beiden lateralen Ventrikeln (den anterioren Ventrikeln) zu, die verstandesmäßigen Fähigkeiten verortete er im Mittelventrikel, die posterioren Ventrikel waren für das Gedächtnis reserviert. Daher rührt also die Ansicht, dass Vorstellungsvermögen/Wahrnehmung, Urteilskraft und Gedächtnis den lateralen Ventrikeln bzw. dem dritten und vierten Ventrikel vorbehalten sind. Nemesius behauptete, dass diese Lokalisierung keiner Laune geschuldet sei, sondern auf einer soliden Beweisgrundlage beruhe, denn er führt das Folgende aus: Der überzeugendste Beweis ist der vom Studium der Aktivitäten der verschiedenen Gehirnabschnitte abgeleitete. Wenn die vorderen Ventrikel an irgendeiner Form von Läsion litten, so sind die Sinne beeinträchtigt, das geistige Vermögen jedoch entfaltet sich wie vorher. Wenn allerdings die Gehirnmitte von Schäden betroffen ist, so offenbart sich der Geist als gestört, die Sinne jedoch sind weiterhin im Vollbesitz ihrer natürlichen Funktion. Ist das Cerebellum [Kleinhirn] geschädigt, folgt daraus nur der Verlust des Gedächtnisses, während die Sinne und das Denken keinen Schaden nehmen. Wenn jedoch die Gehirnmitte und das Cerebellum gemeinsam geschädigt sind, zusätzlich zu den vorderen Ventrikeln, dann brechen Sensibilität, Denken und Gedächtnis zugleich zusammen, mit dem Ergebnis, dass das lebende Subjekt in Todesgefahr schwebt.28
In Bezug auf die anterioren Ventrikel bemerkt er: Das Sensibilitätsvermögen29 umfasst nun, wie Organe, zuerst die vorderen Gehirnlappen und den in diesen enthaltenen psychischen Geist, dann die Nerven, die mit psychischem Geist imprägniert sind und ihn weitertragen, und schließlich die gesamte Anlage der Sinnesorgane. Fünf Sinnesorgane gibt es, aber nur eine einzige Wahrnehmung, und sie gehört zur Seele. Mittels der Sensibilität der Sinnesorgane erfährt die Seele, was in ihnen vorgeht.30
Diese Lokalisierung der verschiedenen geistigen Funktionen in den Ventrikeln wurde als Ventrikellehre bekannt.
Nemesius, ‚The nature of man‘, in Cyril of Jerusalem and Nemesius of Emesa, übers. und hg. von William Telfer (Westminster Press, Philadelphia, 1955), S. 341f. 29 [In der angeführten englischen Nemesius-Übersetzung heißt es ‚faculty of imagination‘ (Vorstellungs- oder Einbildungskraft). Die Autoren weisen darauf hin, dass ‚imagination‘ mit Blick auf das mutmaßlich von Nemesius Gemeinte als ‚sensibility‘ aufzufassen sei. Diesem Hinweis folgend wurde hier der Ausdruck ‚Sensibilitätsvermögen‘ gewählt. – A.d.Ü.] 30 Nemesius, ‚Nature of man‘, S. 321 und 331f. 28
28
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
Die Seele als geistige Substanz aufgefasst statt als erste Wirklichkeit Es ist bemerkenswert, dass Nemesius die Seele ganz anders betrachtete als Aristoteles und seine Nachfolger. Nemesius war als Christ stärker vom Neuplatonismus als von der aristotelischen Philosophie beeinflusst (er fühlte sich zur Lehre von der Präexistenz der Seele hingezogen und auch zur Idee der Seelenwanderung). Er fasste die Seele nicht als die Form des Körpers auf, sondern als eine unabhängige, unzerstörbare geistige Substanz, die mit dem Körper eine ‚Union ohne Konfusion‘ bildet, in der jede Substanz sich gleich bleibt. Folglich schrieb er Wahrnehmung und Kognition nicht dem menschlichen Wesen (sprich dem Lebewesen als Ganzen) zu, sondern vielmehr der Seele. Wer einem ‚nachrangigen‘ Teil eines lebendigen Wesens psychologische Attribute beimisst, bewegt sich in maßgeblicher Weise von der aristotelischen Konzeption weg. Wie ein Mensch wahrnimmt, denkt und fühlt etc. anhand eines untergeordneten Teils seiner Wahrnehmung, seines Denkens und Fühlens etc. zu erklären, ist eine Gewohnheit, die sich als Krebsschaden durch die Geschichte der Neurowissenschaften zieht und bis zum heutigen Tag erhalten hat – wie sich zeigen wird. Eintausend Jahre Ventrikellehre Die Ventrikellehre von der Lokalisierung psychischer Funktionen etablierte sich in den ersten Jahrhunderten des ersten Jahrtausends und wurde noch zu Beginn des zweiten Jahrtausends von Gelehrten akzeptiert und verbreitet. So konnte Avicenna (Abu Ali alHusain ibn Abdullah ibn Sina), ein großer, von 980–1037 arbeitender Arzt und Philosoph, Folgendes schreiben: Der Sensus communis ist im vorderen Teil des vorderen Gehirnventrikels lokalisiert. Er empfängt all die Formen, die sich den fünf Sinnen eingeprägt haben und von diesen zu ihm übertragen wurden. Dann folgt die Repräsentationsfähigkeit, die im hinteren Teil des vorderen Ventrikels ihren Ort hat und die, sogar bei Abwesenheit des wahrgenommenen Objekts, bewahrt, was der Sensus communis von den fünf Sinnen empfangen hat. Dann folgt die mit der Seele des Lebewesens verknüpfte sensitive Vorstellungskraft. Dieses Vermögen ist im Mittelventrikel des Gehirns lokalisiert. Dann gibt es die Urteilsfähigkeit, die am hinteren Ende des Mittelventrikels des Gehirns lokalisiert ist. Als Nächstes folgt die Bewahrungs- und Erinnerungsfähigkeit, diese ist im hinteren Gehirnventrikel angesiedelt.31
Die Ventrikellokalisierung war während des Quattrocento in Italien eine noch immer einflussreiche Lehrmeinung. Ärzte wie Antonio Guainerio (gest. 1440) schrieben die Gedächtnisprobleme mancher Patienten einer „übermäßigen Ansammlung an Schleim [zu], sodass das ‚Gedächtnisorgan‘ in seiner Funktion beeinträchtigt war“.32 Die Lehre 31
F. Rahmann, Avicenna’s Psychology (Oxford University Press, Oxford, 1952), S. 31. A. L. Benton und R. Joynt, ‚Early descriptions of aphasia‘, Archives of Neurology, 3 (1960), S. 205–222. Siehe auch Antonio Guainerios Opera medica, (Antonio de Carcano, Pavia, 1481). 32
1.2 Niedergang der Ventrikellehre
29
wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch immer in den besten Lehrzentren vertreten, worauf Illustrationen in der Ausgabe aus dem Jahre 1494 von Aristoteles’ De Anima hindeuten. Leonardo da Vinci (1452–1519) verwandte in Anbetracht der behaupteten Wichtigkeit der Ventrikel für das geistige Leben der Menschen große Mühen darauf, die erste präzise Darstellung von ihnen bereitzustellen. Dafür injizierte er flüssiges Wachs in die ventrikulären Hohlräume von Rindergehirnen (ca. 1506). Seine Zeichnungen sind von einer unerreichten Genauigkeit, obgleich sie die Geistesvermögen noch immer den verschiedenen Ventrikeln zuordnen. In diesen Darstellungen weicht Leonardo nur einmal von Nemesius’ Lehre ab, die dieser 1100 Jahre früher verfasst hatte, und zwar insofern, als er Wahrnehmung und Sensibilität eher im Mittelventrikel als in den lateralen Ventrikeln ansiedelte; eine Veränderung, die Leonardo deswegen vornahm, weil die meisten sensorischen Nerven im Mittelgehirn konvergieren und nicht im anterioren Bereich. Andreas Vesalius (1514–1564) setzte sich mit der Dominanz der Ventrikellehre auseinander, als er 1503 an der Universität von Louvain weilte. 1543 stellte er die Ventrikel präzise und detailliert dar, und er verband diese Darstellungen in seiner Fabrica mit Beschreibungen davon, wie das psychische Pneuma in den Ventrikeln erzeugt wird und wie es sich dann auf die Nerven verteilt – auf eine Weise, die sich nicht sehr von der unterschied, die Galen vorgeschlagen hatte.33 Obgleich Vesalius der Konzeption anhing, die in den Ventrikel die Quelle des psychischen Pneumas sah, hierin Galen folgend, hegte er Zweifel an der Vorstellung, die psychischen Funktionen rührten von den Ventrikeln her. Seine einschlägigen Schriften sind insofern wichtig, als sie den Weg für Thomas Willis ebneten, der auf der Suche nach der körperlichen Grundlage der psychischen Funktionen den Schwerpunkt der Aufmerksamkeit ein Jahrhundert später endgültig verlagern sollte, weg von den Ventrikeln, hin zur Gehirnsubstanz selbst. Vesalius merkte an, dass es schwierig sei, die psychischen Funktionen wie beispielsweise das folgernde Denken, die Menschen von anderen Säugetieren abgrenzen, den Ventrikeln zuzuordnen, weil deren Form bei einer Vielzahl von Säugetieren, einschließlich des Menschen, sehr ähnlich sei.34
1.2 Fernel und Descartes: Der Niedergang der Ventrikellehre Fernel: Die Ursprünge der ‚Neurophysiologie‘ Die Begriffe der Physiologie und Neurophysiologie entstanden zur Zeit von Vesalius. Wenn auch manche Wissenschaftler die Ansicht vertraten, Aristoteles habe sich in seinen biologischen Schriften mit physiologischen Themen beschäftigt und Galens Utilité de parties du corps sei die früheste eigenständige Arbeit über die menschliche Physiolo33 34
A. Vesalius, De humani corporis fabrica (Basel, 1543), Buch VII, Kap. 1, S. 623. Wolf Singer, Vesalius on the Human Brain (Oxford University Press, Oxford, 1952), S. 40.
30
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
gie, so sollte doch der Arzt und Gelehrte des 16. Jahrhunderts Jean Fernel (1495–1558) als Verfasser der ersten ausdrücklich physiologischen Abhandlung gewürdigt werden. Fernels De naturali parte medicinae, veröffentlicht 1542 in Paris, enthält erstmalig das Wort ‚Physiologie‘. Darin findet sich die erste Physiologie-Definition: „Die Physiologie stellt fest, welche Ursachen den Aktivitäten des Körpers zugrunde liegen.“35 Fernel unterscheidet die Anatomie, die nur angibt, wo die Prozesse stattfinden, von der Physiologie, die erforscht, was die Prozesse und Funktionen der verschiedenen Organe ausmacht. Das Buch wurde umbenannt, in der Ausgabe des Jahres 1554 lautete sein Titel Physiologia, und schon bald sah man in ihm die bedeutendste Abhandlung zum Thema, eine Position, die es mehr als ein Jahrhundert lang innehatte. Thomas von Aquins Einfluss auf Fernel Sowohl Fernels empirische Beobachtungen als auch seine allgemeinen Reflexionen sind im Rahmen des spätmittelalterlichen aristotelischen Denkens, wie es von christlichen Gelehrten modifiziert wurde (im Besonderen durch Thomas von Aquins großartige Synthese), angesiedelt. Wie Aristoteles behauptet auch Fernel, dass Pflanzen und Tiere eine Seele (anima) haben bzw. ihnen ein Lebensprinzip innewohnt. Der Mensch zeichnet sich durch den Besitz einer rationalen Seele aus (sprich einer Seele, die das Verstandesvermögen und das Willensvermögen einschließt). Wie Thomas, aber anders als Aristoteles, betrachtet Fernel die rationale Seele des Menschen (die von der nährenden und der sensitiven Seele unterschieden ist) als vom Körper abtrennbar und als unsterblich.36 Es ist allerdings durchaus nicht klar, ob die aristotelische Konzeption der psycheˉ als ‚Form‘ oder ‚erste Wirklichkeit‘ des Körpers – das heißt als ein Spektrum von Vermögen und Funktionen (Vermögen zweiter Ordnung) – auf kohärente Weise mit den christlichen Unsterblichkeitslehren verbunden werden kann. Genau das war es jedoch, worum Thomas sich bemüht hatte (und im Zuge seiner Bemühungen hatte er den Verstand verdinglicht, die Form als von der Materie abtrennbar behandelt und die Unkörperlichkeit der Vermögen (bei denen es sich um Abstraktionen handelt) mit der behaupteten Unkörperlichkeit der Seele, betrachtet als einen nichtphysischen Teil eines menschlichen Wesens, durcheinandergebracht).37 Auch andere scholastische Philosophen beteiligten 35
J. Fernel, De naturali parte medicinae (Simon de Colines, Paris, 1542); siehe Physiologia, Buch II, Praefatio. 36 Thomas behauptet, indem er sich Aristoteles’ unklare Bemerkungen über den aktiven Verstand zunutze macht, dass ‚das Vernunft-Prinzip, das man Geist oder Verstand nennt, [. . .] über Selbst(per se)-Tätigkeit [verfügt], an der der Körper nicht teilhat. Es kann allerdings nichts durch sich selbst (per se) tätig werden, wenn es nicht durch sich selbst existiert, denn Aktivität kommt einem Wesen in actu zu [. . .] Folglich ist die menschliche Seele, die man Verstand oder Geist nennt, etwas unkörperlich Existierendes‘ (Summa Theologiae I, 76, 1). 37 Zur Erörterung der Philosophie der Psychologie des Thomas siehe A. J. P. Kenny, Aquinas on Mind (Routledge, London, 1993).
1.2 Niedergang der Ventrikellehre
31
sich an dem Versuch, das Christentum mit der aristotelischen Philosophie in Einklang zu bringen. Fernel war der Erbe dieser verworrenen Tradition. ‚Physiologie‘ als Erforschung der Organfunktion: Fernel Laut Fernel hat es die Physiologie mit den Prozessen zu tun, die für einen gesunden Körper und eine gesunde Seele sorgen. Er merkt an, dass „bei allen Lebewesen und insbesondere beim Menschen der Körper um der Seele willen erschaffen wurde (gratia animae). Er ist für die Seele nicht nur Behausung (diversorium), sondern ein dem Gebrauch durch die ihr innewohnenden Vermögen angepasstes Instrument.“38 Diese Sicht entsprach dem aristotelischen Ansatz. Wie dargelegt, verhalten sich gemäß Aristoteles Seele und Körper zueinander wie Sehkraft und Auge. Das Auge existiert um der Sehkraft willen (DA 412b17–24); diese ist sein Sinn und Zweck. Folglich existiert auch der Körper um der Seele willen – das heißt um der Vermögen und Funktionen willen, aus denen sie sich zusammensetzt. Ohne diese und ihre Verwirklichung im Verhalten des Lebewesens wäre die Existenz des Körpers sinnlos (DA 415b15–21; De Partibus Animalum 645b19). Die Erklärung der Aktivitäten der Teile eines Organismus muss im Hinblick auf deren Beitrag zum optimalen Funktionieren des Ganzen, von dem sie eben die Teile sind, erfolgen. Fernel betrachtete die Wahrnehmung als das Resultat der Bilderübertragung von den Sinnesorganen zum (all)gemeinen Sensorium im Gehirn, wo sie vom inneren Sinn erfasst werden. Gedächtnis und Vorstellungskraft sind zwei untergeordnete Vermögen der fühlenden Seele, und sie ermöglichen dem fühlenden Lebewesen, das zu erfassen, was angenehm oder unangenehm, was wohltuend oder schädlich ist. Das triebhafte Verlangen verursacht eine Bewegung hin zu einem angenehmen oder wohltuenden Objekt bzw. weg von einem unangenehmen oder schädlichen. Bewirkt wird eine solche Bewegung durch die Kontraktion des Gehirns, welche die ‚Lebensgeister‘ aus dem vorderen Ventrikel ins vierte (hintere) Ventrikel zwingt durcheinander gebracht und von dort nach unten ins Rückenmark und entlang der Nerven zu den Muskeln. Die Vorstellung eines Organ-(Muskel-)Reflexes All diese Annahmen gehörten zur allgemeinen Lehrmeinung. Für unsere Belange ist Fernels Beobachtung wichtig, dass manche unserer Handlungen nicht vom Eingreifen des Willens herrühren oder ungewollt geschehen oder keinem anderen Befehl des Geistes unterstehen. Er vertrat die Ansicht, dass ein solches Verhalten in bestimmten Bewegungen des Auges oder der Augenlider, des Kopfes oder der Hände während des Schlafes sowie in den mit der Atmung einhergehenden Bewegungen exemplifiziert ist. Diese Muskelbewegungen stehen laut Fernel mit keinem Willensakt in Zusammenhang und können darum als Reflexe betrachtet werden. Fernel betonte nachdrücklich, dass die 38
Fernel, Physiologia, Buch VI., Kap. 13.
32
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
Muskelbewegungen sich ereignen können, ohne dass der Wille eine Absichtshandlung initiiert; das heißt, dass es motorische Akte gibt, bei denen der Wille keine Rolle spielt.39 Diese Einsicht markiert den Beginn einer Forschungstätigkeit, die erst mit Sherringtons Arbeit im 20. Jahrhundert ihre Vollendung fand. Fernels Physiologia erlebte einige Auflagen und ihr Einfluss währte ein Jahrhundert lang. Allerdings war sie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts schon nicht mehr der maßgebliche Text im physiologischen Bereich, und zwar weil die aristotelischen Begriffe und Konzeptionen, auf denen sie beruhte, als nicht länger brauchbar galten. Vor allem die Kepler’sche physikalische Astronomie und die mechanistische Physik Galileis machten sie hinfällig. Der spektakuläre Erfolg der neuen Physik führte zum schnellen Verschwinden der aristotelischen teleologischen Wissenschaft und dazu, dass teleologische Erklärungen natürlicher Phänomene von mechanistischen Erklärungen ersetzt wurden. Das drückte sich gleichermaßen im Vordringen der biologischen und der physikalischen Wissenschaften aus. Zum einen zeigte Harvey, dass es sich beim Herz um ein mechanisches Pumpwerk handelt. Zum anderen legte Descartes überzeugend dar, dass die Aktivitäten des Körpers als des Gegenstands der Physiologie in rein mechanischer Hinsicht untersucht werden können. Descartes: Der Anfang vom Ende der Ventrikellehre Mit Descartes (1596–1650) erfolgte ein maßgeblicher Umbruch innerhalb des europäischen Denkens. Obwohl einige Aspekte seiner Philosophie noch immer in scholastischem aristotelischen Denken verwurzelt sind (und andere in augustinischem Denken), so markiert die Neuartigkeit seiner philosophischen Reflexionen doch den Beginn der modernen Philosophie. Viele Resultate seiner neurowissenschaftlichen Forschung erwiesen sich als falsch, trotzdem aber gaben seine Bemühungen den Neurowissenschaften entscheidenden Auftrieb und sorgten für deren maßgeblichen Richtungswechsel. Descartes stimmte mit den aristotelischen Scholastikern in der Auffassung überein, dass der Verstand unabhängig vom Körper operieren könne, dass die Seele bzw. der Geist unkörperlich und unsterblich und in der Lage sei, unabhängig vom Körper zu existieren. Allerdings brach er vollständig mit ihnen in den folgenden vier Punkten. Vier Gesichtspunkte cartesianischer Transformation der Geistes- bzw. Seelen-Konzeption Erstens vertrat er die Auffassung, dass der Geist die ganze Seele umfasst. Im Gegensatz dazu betrachteten die Scholastiker den Geist (als Verstand aufgefasst) bloß als einen Teil der Seele (der unsterbliche Teil, der vom Körper abtrennbar ist). Die anderen Seelenteile – die nährenden und sensitiven Funktionen nämlich – wurden von den Scholastikern nach aristotelischer Lesart als Form des Körpers betrachtet. Hier widersprach 39
Ibid., Buch IX, Kap. 8, S. 109a.
1.2 Niedergang der Ventrikellehre
33
Descartes radikal. Anders als Aristoteles betrachtete er die Seele nicht als Lebensprinzip, sondern als Denk- oder Bewusstseinsprinzip. Die aristotelischen Funktionen der nährenden Seele (Ernährung, Wachstum, Fortpflanzung) und der sensitiven Seele (Wahrnehmung im physiologischen Sinn und Bewegung) sind bei Descartes keine essenziellen Funktionen des Geistes, sondern des Körpers. Sämtliche essenzielle Funktionen der Lebewesen werden in rein mechanistischen Begriffen gefasst. Und das sollte entscheidende Auswirkungen auf die Entwicklung der Neurophysiologie haben. Zweitens zog Descartes die Grenzen des Geistigen neu. Im Kern ist der cartesianische Geist nicht die scholastisch-aristotelische rationale Seele – nur der Verstand also –, sondern vielmehr Denken oder Bewusstsein. Eine Person ist wesentlich eine Res cogitans, ein denkendes Ding – Descartes erweiterte die Begriffe des Denkens und des Gedankens derart, dass sie weit mehr umfassten, als Aristoteles und die Scholastiker der rationalen Seele zugeschrieben hätten. Die Funktionen der rationalen Seele schlossen den Scholastikern nach die reflektierend-folgernden Funktionen des Verstandes und die willentlich abwägenden Funktionen des Wollens (rationales Verlangen) ein, Empfindung und Wahrnehmung, Vorstellung und tierisches Triebverlangen (Fleischeslust) dagegen aus. Im Gegensatz dazu schloss Denken für Descartes „alles [ein], was derart in uns geschieht, dass wir uns seiner unmittelbar aus uns selbst bewusst sind. Deshalb gehört nicht bloß das Einsehen, Wollen, Vorstellen, sondern auch das Wahrnehmen hier zum Denken.“40 So wurde das Denken in revolutionärer Weise im Sinne des Bewusstseins ausgelegt – das heißt als das definiert, dessen wir uns unmittelbar in/aus uns bewusst sind. Und das Bewusstsein wurde dabei insofern dem Selbstbewusstsein einverleibt, als es, wie Descartes meinte, unmöglich ist, zu denken und Erfahrungen zu haben (Schmerz zu empfinden, wahrzunehmen glauben, Leidenschaften fühlen, wollen, vorstellen, nachdenken), ohne zugleich zu wissen oder sich bewusst zu sein, dass man dies tut. Die Identifizierung des Geistigen mit dem Bewusstsein ist uns bis zum heutigen Tag erhalten geblieben und wirft einen langen Schatten auf die neurowissenschaftliche Reflexion (wir werden die zeitgenössische Debatte über das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein in Teil III untersuchen). Drittens war er der Ansicht, dass die Vereinigung des Geistes mit dem Körper trotz ihrer ‚Intimität‘ zwei eigenständige Substanzen umfasst. Entgegen dem scholastischen Denken, für das ein menschliches Wesen eine einheitliche Substanz (ein ens per se) ist, gab Descartes zu verstehen, dass es sich beim Menschen nicht um eine solche handelt, sondern um eine zusammengesetzte Entität. Die Person (das Ich) wiederum ist eine individuelle Substanz, und sie ist mit dem Geist identisch. Und weil der menschliche Geist 40
Descartes, Die Prinzipien der Philosophie, I–9. Wieder abgedruckt in The Philosophical Writings of Descartes, Bd. I, übers. von J. Cottingham, R. Stoothoff und D. Murdoch (Cambridge University Press, Cambridge, 1985), S. 195. Diese Übersetzung wird im Text in der Folge abgekürzt als ‚CSM‘. Bezugnahmen zu den kanonischen Œuvres de Descartes, hg. von Ch. Adam und P. Tannery, überarb. Ausg. (Paris: Vrin/C. N. R. S., 1964–1976), werden auch als ‚AT‘ gekennzeichnet, gefolgt von Bandnummer und Seitenzahlen – hier AT VIII A, 7. Bei anderen Bezugnahmen wird die Paragrafennummer angeführt.
34
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
mit dem Körper vereinigt ist, hat er Wahrnehmungen (im psychologischen Sinne). Solche Wahrnehmungen jedoch werden als Denk- oder Bewusstseinsmodi aufgefasst, die aus der Geist-Körper-Vereinigung hervorgegangen sind. Und genau diese intime Vereinigung ist es, anhand derer Descartes die nichtmechanischen Wahrnehmungsqualitäten erklärt (sprich Farben, Klänge, Geschmäcke, Gerüche, Wärme etc.): Sie werden infolge psychophysischer Interaktionen als Vorstellungen im Geist hervorgebracht. Und weil er mit dem Körper vereinigt ist, ist der Geist gleichermaßen in der Lage, durch Willensakte Körperbewegungen hervorzubringen. Die Neurowissenschaften müssen folglich die Interaktionen von Geist und Gehirn, die einerseits mit Empfindungen, Wahrnehmungen und Vorstellungen (bei denen es sich um ‚verworrene‘ Denkformen handelt) und andererseits mit Willensbewegungen einhergehen, in ihren Formen untersuchen. Und viertens: So wie er davon ausging, dass der Geist eine einzelne wesentliche Eigenschaft habe – nämlich Denken –, ging er auch davon aus, dass die Materie sich durch eine einzelne wesentliche Eigenschaft auszeichne – nämlich Ausdehnung. Die Erklärungsprinzipien in den physikalischen und in den biologischen Wissenschaften betrachtete er ebenso als rein mechanische, ausgenommen den Fall der Neurophysiologie menschlicher Wesen, die in der Natur nicht ihresgleichen haben, weil sie über den Geist verfügen. Descartes trug wesentlich zu den Fortschritten in Neurophysiologie und visueller Theorie bei.41 Obwohl seine theoretischen Entwürfe sich überwiegend als falsch erwiesen, waren sie für die Suche nach dem richtigen Verständnis doch eminent wichtig. Zudem hat sich seine Überzeugung, der fundamentale biologische Erklärungsansatz werde sich auf der neurophysiologischen Ebene im Sinne von Wirkursachen entfalten, durch die Entwicklung der Neurophysiologie seit dem 17. Jahrhundert triumphal bestätigt.42 Die Ventrikel als Quelle der ‚Lebensgeister‘ aufgefasst; die Lebensgeister als ‚neurale Transmitter‘ betrachtet Descartes ersetzte die Konzeptionen Aristoteles’ und Galens, laut denen psychisches Pneuma in den Ventrikeln erzeugt wird, durch die Hypothese, dass die Ventrikel der Herstellungsort von Teilchen oder Partikeln sind, die direkt an mechanischen Phänomenen mitwirken. Bei diesen Teilchen handelt es sich um die Lebensgeister, die durch die Nerven transportiert und in die Muskelzellen übertragen werden und so eine Bewegung hervorbringen. Was den Ursprung dieser Teilchen betrifft, äußert sich Descartes wie folgt: „Die Teile des Blutes, die bis ins Gehirn vordringen, dienen nicht nur dazu, seine Substanz zu nähren und zu erhalten, sondern auch und in erster Linie, dort einen gewissen sehr feinen Wind zu erzeugen (der aus ‚sehr kleinen, sich schnell bewegenden Partikeln zusammengesetzt ist‘), oder besser eine sehr lebhafte und reine Flamme, die man 41 42
Descartes, Optics, CSM I, S. 152–175; AT VI, 81–146. Bennett, ‚Early history of the synapse‘.
1.2 Niedergang der Ventrikellehre
35
die Lebensgeister nennt.“43 Dieser Name ist insofern unglücklich gewählt, als es sich bei ihm nicht um einen angemessenen Terminus zur Beschreibung der Komponenten einer mechanischen Theorie handelt, denn das Wort ‚Geist‘ kann als ein Lebensprinzip, das dem Körper innewohnt, gedeutet werden oder als das aktive Prinzip einer als Flüssigkeit extrahierten Substanz. Descartes lässt allerdings keine Missverständnisse darüber aufkommen, dass die ‚Lebensgeister‘ materiell sind: nämlich „ein gewisser sehr feiner Wind oder sehr feine Luft“44, und dass das, was ich hier „Geister“ nenne, [. . .] bloße Körper [sind]; sie haben keine andere Eigentümlichkeit, als dass sie extrem kleine Körper sind, die sich sehr schnell bewegen, so wie die Flammenstrahlen einer Fackel. Sie bleiben nie an einer Stelle, und sobald einige von ihnen in die Hohlräume des Gehirns eindringen, verlassen andere es durch die Poren seiner Substanz. Diese Poren führen sie in die Nerven und von da in die Muskeln. Derart können die Lebensgeister den Körper in all den verschiedenen Weisen in Bewegung versetzen, gemäß denen er bewegt werden kann.45
In diesem Sinne behauptete Descartes, dass der Fluss der Lebensgeister von den Ventrikeln aus (bei motorischer Aktivität) die Öffnung spezieller Klappen in den Ventrikelwänden zur Folge hat, was wiederum das Weiterfließen der Geister in die entsprechenden motorischen Nerven und die Muskelkontraktion nach sich zieht. Im Falle eines nicht vom Willen herrührenden Verhaltens, eines durch einen Nadelstich hervorgerufenen beispielsweise, führe das zu einer Anspannung gerade derjenigen Fasern, die die entsprechenden Klappen in den Ventrikelwänden öffnen, um die Lebensgeister in die motorischen Nerven freizugeben, damit diese wiederum die Muskeln kontrahieren lassen, um den Körperteil von der Interventionsstelle wegzubewegen. Übertragung schließt inhibitorische und exzitatorische Prozesse ein Descartes verwendete das Wort ‚Reflex‘ im Zuge der Entwicklung seiner Konzeption nichtmenschlicher Lebewesen, wie beispielsweise Automaten, nur einmal, obwohl es in seinen Beschreibungen des Verhaltens der Tiere und der menschlichen nichtwillentlichen Reaktionen stets impliziert ist. Und obwohl Descartes Fernels Physiologia nie erwähnt, wird in seiner Abhandlung über den Menschen deutlich, dass die Ausarbeitung seiner Lehre vom nicht mit dem Geist verknüpften motorischen Verhalten bei Mensch und Tier ihre Grundlagen im Reflexbegriff hat, der zuerst von Fernel angeführt wurde.46 In der Abhandlung über den Menschen argumentiert er, dass solches motorisches Verhalten nicht nur einen exzitatorischen, sondern auch einen inhibitorischen Prozess voraussetzt 43
Descartes, Abhandlung über den Menschen, CSM I, S. 100; AT XI, 129. Descartes, Die Leidenschaften der Seele, I–7. 45 Ibid., I–10. 46 C. S. Sherrington, Man on his Nature, 2. Aufl. (Cambridge University Press, Cambridge, 1953), S. 151. 44
36
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
– ein spekulativer Gedanke, der später durch Sherrington experimentell bestätigt und auf der Ebene der Zellvorgänge durch seinen Studenten John Eccles analysiert wurde. Descartes vertrat zudem die Ansicht, dass es dann, wenn die exzitatorischen und inhibitorischen Prozesse zusammenwirken, möglich ist, Tiere und die Körper menschlicher Wesen (wenn sie unabhängig von geistiger Intervention funktionieren) als Automaten zu beschreiben. Diese Descartes’schen Vorstellungen über die Mechanismen, die den Reflex- bzw. den unwillkürlichen Bewegungen zugrunde liegen, welche (die Vorstellungen) die in den Ventrikeln aufgespeicherten Lebensgeister in der dargestellten Weise zum Gegenstand haben, werfen die Frage nach dem Mechanismus der Willkürbewegung auf. In diesem Zusammenhang wich Descartes fundamental von der Ventrikellehre ab. Er bestritt, dass es sich bei den Ventrikeln um den Sitz der wahrnehmungsbezogenen und rationalen Vermögen (das willentliche eingeschlossen) der Menschen handelt. Er bestritt auch, dass nichtmenschliche Lebewesen über das Wahrnehmungsvermögen in einem menschlichen Sinne verfügen, da sie nicht bei Bewusstsein sind. Und er war der Auffassung, dass der menschliche Geist bzw. die menschliche Seele mit dem Körper in der Zirbeldrüse interagiert, welche er fälschlicherweise innerhalb der Ventrikel vermutete.47 Die Zirbeldrüse als Ort des Sensus communis und der Interaktion von Geist und Körper Man sollte nicht unerwähnt lassen, weshalb Descartes (unter anderem) annahm, dass die Zirbeldrüse der Ort ist, an dem der Sensus communis sich befindet und wo die Interaktion von Geist und Körper statthat. Deshalb nämlich, weil die Zirbeldrüse zwischen den beiden Hemisphären des Gehirns angesiedelt ist und selbst keine Abzweigungen aufweist. Folglich ermögliche es die Zirbeldrüse, dass „die zwei Bilder eines Einzelgegenstands, die von den beiden Augen kommen, oder die zwei Eindrücke eines Einzelgegenstands, die durch die doppelten Organe der anderen Sinne kommen [z. B. Hände oder Ohren], sich zu einem Bild oder einem Eindruck verbinden können, bevor sie die Seele erreichen, sodass sie ihr nicht zwei anstelle von einem Bild darbieten.“48 Diese Figuren, „die sich in den Lebensgeistern auf der Oberfläche der Drüse bilden“, sind „die Formen oder Bilder, welche die mit dieser Maschine [d. h. dem Körper] vereinigte rationale Seele unmittelbar betrachtet, wenn sie sich irgendein Objekt vorstellt oder dieses durch die Sinne wahrnimmt“.49 Erwähnenswert ist, dass Descartes mahnend darauf hinwies, dass, obgleich das auf der Zirbeldrüse erzeugte Bild eine gewisse Ähnlichkeit mit seiner Ursache (die RetinaErregung als unmittelbare, der wahrgenommene Gegenstand als mittelbare Ursache) 47 48 49
Descartes, Die Leidenschaften der Seele, I–31. Ibid., I–32, Hervorhebung durch die Autoren. Descartes, Abhandlung über den Menschen, CSM I, S. 106; AT XI, 119.
1.2 Niedergang der Ventrikellehre
37
aufweist, die resultierende sensorische Wahrnehmung nicht von dieser Ähnlichkeit herrührt. Denn das würde, wie er feststellte, „noch andere Augen innerhalb unseres Gehirns [erfordern], mit denen wir sie wahrnehmen könnten.“50 Vielmehr sind es die das Bild auf der Zirbeldrüse zusammensetzenden Bewegungen, die der Seele die entsprechende Wahrnehmung ‚verschaffen‘, indem sie direkt auf sie einwirken. Descartes’ Begriffsirrtum, das Sehen der Seele anstatt der menschlichen Person zuzuordnen War die Mahnung auch angebracht, so ließ die Sorgfalt doch zu wünschen übrig. Selbstverständlich hatte Descartes Unrecht damit, die Zirbeldrüse als den Ort des Sensus communis auszuweisen, Unrecht, zu denken, ein mit dem Bild auf der Retina (und also mit dem Gesehenen) korrespondierendes Bild werde im Gehirn rekonstituiert. Wir haben es hier mit Irrtümern im Tatsachenbereich zu tun, und es ist bemerkenswert, dass sich für sie im gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Denken Entsprechungen finden lassen – im Besonderen in der verbreiteten Darstellung des sogenannten Bindungsproblems (weiter unten erörtert, 4.2.3). Descartes hatte allerdings Recht, mahnend darauf hinzuweisen, dass unser Sehen, was immer im Gehirn geschieht und uns was auch immer zu sehen ermöglicht, nicht mit der Wahrnehmung solcher Gehirnereignisse oder -konfigurationen erklärt werden kann. Denn das würde, wie er richtig bemerkte, „noch andere Augen innerhalb unseres Gehirns“ erfordern. Dennoch war er – was die Begriffe angeht – so verworren, um vorzubringen, (i) dass Bilder oder Eindrücke, die von den doppelten Organen der Sinne kommen, im Gehirn vereinigt werden müssen, um eine Einzelrepräsentation zu formen, sodass der Seele nicht zwei Gegenstände anstelle von einem dargeboten werden; (ii) dass die Seele die Formen oder Bilder im Gehirn ‚unmittelbar betrachtet‘, wenn sie einen Gegenstand wahrnimmt; und (iii) dass die Seele wahrnimmt und nicht das Lebewesen (der Mensch). Der erste Irrtum setzt genau das voraus, wovor Descartes gewarnt hatte; denn nur wenn die Bilder oder Eindrücke tatsächlich von der Seele wahrgenommen würden, gäbe es einen Grund für die Annahme, dass die ‚zwei Bilder‘ in einem doppelten Sehen bzw. einem doppelten Hören resultierten. Der zweite Irrtum offenbart sich in der Inkohärenz der Annahme, im Verlauf der Wahrnehmung werde die Seele oder der Geist etwas, was es auch sei (ob Formen oder Bilder), im Gehirn ‚betrachten‘. Und der dritte Irrtum tritt als die abwegige Annahme hervor, dass das Wahrnehmende die Seele oder der Geist ist. Wir haben bereits festgestellt, dass schon Nemesius dieser Verwirrung anheimfiel. Es handelt sich bei ihr um eine Form des mereologischen Fehlschlusses (Die Mereologie untersucht die Logik der Beziehungen zwischen den Teilen und dem Ganzen). Denn sie beruht darauf, einem Teil eines Lebewesens Attribute zuzuschreiben, die ihm in logischer Hinsicht nur als Ganzem zugeschrieben werden können. Die besondere Form, die dieser mereologische Fehlschluss bei Descartes annahm, wird darin offenkundig, dass er der Seele Attribute zuschrieb, die nur dem Lebewesen als 50
Descartes, Optics, CSM I, S. 167; AT VI, 130.
38
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
Ganzem zugeschrieben werden können. Wir werden diesen Fall im dritten Kapitel detailliert erörtern. Mitte des 17. Jahrhunderts hatte Descartes die Ventrikellehre, die die psychischen Funktionen in den Gehirnventrikeln verortete, durch seine eigentümliche interaktionistische Lehre ersetzt, die alle psychischen Funktionen in der Zirbeldrüse lokalisierte, die er als den Ort der Interaktion von Geist und Gehirn auswies. Auf diese Weise begegnete er Vesalius’ Einwand, die Vorstellung, dass die verschiedenen Ventrikel mit verschiedenen kognitiven und kogitativen Vermögen in Zusammenhang stehen, sei aufgrund der großen Ähnlichkeit, die zwischen den Ventrikeln der Menschen und denen anderer Säugetiere besteht, nur schwer zu belegen. Außerdem hatte Descartes das psychische Pneuma durch die Lebensgeister ersetzt, die als das Medium fungierten, durch welches die Zirbeldrüse ihre Wirkungen hervorruft. Dies war verbunden mit der Ersetzung des vom Pneuma abstammenden flüssigen Elements, wie Aristoteles es beschrieb, durch die mit speziellen Eigenschaften ausgestatteten mechanischen Teilchen. Allerdings sollten Descartes’ Zeitgenossen bald deutlich machen können, dass die Zirbeldrüse sich nicht innerhalb der Ventrikel befindet und dass seine Erwiderung auf Vesalius aus dem Grund unzureichend war, weil andere Säugetiere diese Drüse auch besitzen. Descartes’ wichtigster Beitrag Nichtsdestotrotz leistete Descartes einen fundamental wichtigen Beitrag, indem er alle Aktivitäten der Lebewesen für eine mechanische Analyse erschloss – aus der heraus sich die Physiologie und die Neurowissenschaften entwickelten. Indem er die psychischen Funktionen mit der Zirbeldrüse verknüpfte, war es ihm darüber hinaus gelungen, die Erörterung ihrer körperlichen Grundlagen von den Ventrikeln (nun angefüllt mit Partikeln der Lebensgeister und nicht mehr mit dem psychischen Pneuma Galens) weg- und zur Gehirnsubstanz hinzuführen – eben zur Zirbeldrüse in seinem Fall. Diese Aufmerksamkeitsverlagerung von den Ventrikeln zur Gehirnsubstanz wurde durch die Arbeit eines jungen Mannes zum Paradigma erhoben, der erst 29 Jahre alt war, als Descartes starb. Die Rede ist von Thomas Willis.
1.3 Die Kortexlehre von Willis und seinen Nachfolgern Thomas Willis: Der Kortex als die Grundlage der psychischen Funktionen Infolge seiner Beobachtungen von Patienten mit neurologischen Problemen, die schließlich starben und so obduziert werden konnten, kam der als Medizinprofessor in Oxford tätige Thomas Willis zu dem Ergebnis, dass die psychischen Eigenschaften der Menschen sich in funktioneller Hinsicht auf den Kortex und nicht auf die Ventrikel stützen. Dies erörterte er ausführlich und sehr eindringlich in seinem klassischen Werk
1.3 Die Kortexlehre
39
De anima brutorum 51 und in Cerebri anatome, cui accessit nervorum descriptio et usus 52, deren Überzeugungskraft außerordentlich von den wunderbaren Zeichnungen befördert wurde, die der junge Christopher Wren von Willis’ Skizzen anfertigte. Von Willis stammt die erste Kortex-Theorie im Hinblick auf die Muskel- und Reflexkontrolle. Dem Menschen und allen anderen Tieren (‚Getier‘ [‚brutes‘]) erkannte er ein über den ganzen Körper verteiltes Partikelsystem zu, das er die ‚Körperseele‘ nannte. „Diese Seele [. . .] entspringt zusammen mit dem Körper einer auf die richtige Weise angeordneten Materie. Sie kann von unseren Sinnen nicht wahrgenommen werden, sondern zeigt sich nur in ihren Wirkungen und Verrichtungen. Wenn der Körper oder diese Seele derart versehrt ist, dass die Seelenpartikel aus der Verschmelzung verschwinden [. . .] ist der nun seelenlose Körper der Fäulnis geweiht“ (ABN 6f.). Willis erklärt im Anschluss daran detailliert die Rolle der vitalen Geister (oder der vitalen Flüssigkeit) des in Herz und Gefäßen zirkulierenden Blutes und die Rolle der Lebensgeister (oder der Leben spendenden Flüssigkeit) von Gehirn und Nerven – den Ausdruck ‚Geister‘ in cartesianischem Sinne gebrauchend, nämlich als Destillation einer Flüssigkeit. Die Lebensgeister stammen von den vitalen Geistern ab (ABN 22f.). Die Körperseele steht mit beiden Flüssigkeiten in Verbindung. Die Lebensgeister vom Kortex aktivieren die Muskeln durch die Nerven Daran schließt sich die Darstellung der Rolle der Lebensgeister beim Zusammenspiel von kortikaler Aktivität und Muskelbewegung an: Wir haben gezeigt, dass die Lebensgeister im Gehirnkortex und im Kleinhirn entstehen, von wo aus sie absteigen und in die mittleren und markigen Teile fließen, wo sie in ausreichender Menge für die verschiedenen Zwecke der Seele vorrätig gehalten werden. Die Lebensgeister fließen von dort ins Rückenmark und dann in die Nerven und Nerventriebe und aktivieren und erweitern diese. Schließlich werden ausreichend viele Lebensgeister von den Enden der in die Muskeln, die Membranen und die inneren Organe eingelassenen Nerven destilliert und regen diese, die Sinnesorgane und die Bewegung an. (ABN 24)
51
T. Willis, De anima brutorum (Thomas Dring, London, 1683). Engl. Übers. durch S. Pordage: Two Discourses Concerning the Soul of Brutes, which is that of the Vital and Sensitive of Man (Scholars’ Facsimiles & Reprints, Gairiesville, FL, 1971). 52 T. Willis, Cerebri anatome, cui accessit nervorum descriptio et usus (Thomas Dring, London, 1681); für die Übersetzung siehe Tercentenary Facsimile Edition, The Anatomy of the Brain and Nerves, Übers. durch S. Pordage, hg. von William Feidel (McGill University Press, Montreal, 1965). Im Text in der Folge abgekürzt als ABN, gefolgt von der Angabe der Seitenzahlen.
40
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
Bei Tieren liegt der Kortex innerhalb eines Reflexbogens, der sich vom Wahrnehmungseindruck zur motorischen Handlung spannt Wodurch wird der Fluss der Lebensgeister im Kortex und vom Kortex zu den Muskeln ausgelöst? Um diese Frage zu beantworten, beschreibt Willis zunächst, wie der Fluss der Lebensgeister im Gehirn entsteht, wenn ein Wahrnehmungsorgan stimuliert wird (ABN 38). Dann verknüpft er die Wahrnehmung von etwas durch ein Lebewesen mit einer motorischen Folgehandlung. Diese Darstellung platziert den Kortex innerhalb eines vom Wahrnehmungseindruck bis zur motorischen Handlung sich erstreckenden Reflexbogens, und es wird deutlich, dass Willis dachte, in allen nichtmenschlichen Tieren seien sämtliche motorische Handlungen Reflexe, denn er erklärt, dass „Tiere oder Menschen, solange sie sich mit den Dingen noch nicht auskennen, auf das instinktive triebhafte Verlangen angewiesen sind. Solange sie also eines inneren Bewegungsprinzips ermangeln, bewegen sie sich oder ihre Glieder nur, wenn sie durch den von einem externen Objekt ausgehenden Impuls angeregt werden, und so ist die Wahrnehmung, die der Bewegung vorausgeht, in gewisser Weise ihre Ursache“ (ABN 59). Der Reflexcharakter vieler motorischer Handlungen ist in seinen Darlegungen zum Verhalten mancher Tiere, die in Teile geschnitten wurden, deutlich herausgestellt (ABN 17). Menschliche Willenshandlungen sind möglich aufgrund der kortikalen Interaktion von Seele und Körper Wie sieht es nun aber mit den vom Willen bestimmten Handlungen aus, die allein der Mensch vollbringt? An diesem Punkt führt Willis die Vorstellung von der rationalen Seele, die unsterblich ist, ins Feld (ABN 39). Um eine Willenshandlung auszuführen, muss man sich des Objekts, auf das die Handlung ausgerichtet ist, bewusst sein (ABN 58). Willis identifiziert die rationale Seele im Gehirn als das Ausführungsorgan der Wahrnehmung, welche er detailliert schildert (ABN 59). Er vertritt die Ansicht, dass die rationale Seele im Corpus callosum das Bild betrachtet.53 Seine Konzeption der Konstruktion einer internen Repräsentation auf dem Corpus callosum erinnert an Descartes’ Vorstellung, dass ein Bild dessen, was man sieht, auf der Oberfläche der Zirbeldrüse entsteht, wo es ‚der Seele dargeboten wird‘. Willis’ Annahme, dass die rationale Seele ‚das Bild eines dorthin gemalten Dings betrachtet‘, kommt dem großen Irrtum, vor dem Descartes warnte (und dann teilweise selbst erlag), zumindest nahe: zu erklären nämlich, ein menschliches Wesen könne ein Objekt sehen, weil seine Seele eine Repräsentation des Objekts im Gehirn sehe oder erfasse. Wollensakte werden demnach von der rationalen Seele, die im Corpus callosum angesiedelt ist, angestoßen, nachdem die Lebensgeister „die Bilder oder Repräsentationen aller wahrnehmbaren Dinge“ aus dem allgemeinen Sensorium übermittelt haben: 53
Willis, Two Discourses Concerning the Soul of Brutes, S. 43f.
1.3 Die Kortexlehre
41
Nichts ist wahrscheinlicher, als dass diese Teile [Corpora striata] das allgemeine Sensorium darstellen, das all die Erscheinungen und Eindrücke aufnimmt und unterscheidet und sie in zweckmäßig geordneten Arrangements ins Corpus callosum überträgt, sie der dort waltenden Einbildungskraft darbietet und die Kraft und Triebhaftigkeit jener unwillkürlichen Bewegungen, die im Gehirn ihren Anfang genommen haben, in den Nerven-Appendix zur Ausführung durch die motorischen Körperteile überträgt.54
Im Anschluss brachte Willis die Funktionen der Wahrnehmung, des Gedächtnisses und des Wollens mit dem zerebralen Kortex in Zusammenhang und insbesondere mit den Windungen des Kortex, wobei die Lebensgeister sich angeblich zwischen den Windungen hin- und herbewegen. Er ging davon aus, dass der Mensch wegen seines überlegenen Denkvermögens viel mehr Windungen aufzuweisen hat als die anderen Lebewesen (ABN 65–68). Willis bekennt sich explizit zur cartesianischen Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele bzw. des Geistes, die/der wahrnimmt und motorische Aktivitäten auslösende Willenshandlungen durchführt und mit dem Körper interagiert. Wie Descartes (und viele andere) war er der Ansicht, dass die rationale Seele, weil sie unsterblich ist, nicht in Teile zerfällt. Willis und Descartes unterscheiden sich insofern maßgeblich, als Willis die kausale Interaktion zwischen dem Geist bzw. der rationalen Seele und dem Körper in den Kortex verlegt – namentlich ins Corpus callosum – und nicht wie Descartes in die Zirbeldrüse, die dieser fälschlicherweise den Ventrikeln zuordnete. Und genau wie Descartes auf dem unlösbaren Problem ‚sitzenblieb‘, die Interaktion von Geist und Zirbeldrüse zu erklären, konnte auch Willis das Erklärungsproblem hinsichtlich der Interaktion von immaterieller rationaler Seele und materieller Körperseele im Corpus callosum nicht loswerden. So bietet er keine Erklärung dafür an, wie sich das Band zwischen der rationalen und der körperlichen Seele ausformt, das dafür sorgt, dass beide Seelen mit der Geburt durch Gott interagieren können: „So ist diese unsterbliche Seele (die rationale Seele), weil sie nicht geboren werden kann, bis bei der Menschwerdung des Kindes im Mutterleib alle Dinge zu ihrem Empfang auf die richtige Weise angeordnet sind, unmittelbar von Gott erschaffen und in den Leib eingeströmt“ (ABN 41f.). Willis’ Arbeit sollte es ermöglichen, die Aufmerksamkeit zum ersten Mal seit mehr als tausend Jahren vollständig von den Ventrikeln abzuziehen und sie sowohl auf die Forschung als auch auf das spekulative Nachdenken über den Kortex als biologische Grundlage der psychischen Eigenschaften der Menschen zu richten. Der Kortex hundert Jahre nach Willis Die durch Willis angestoßene Revolution führte dazu, dass der wissenschaftliche Fokus sich endgültig auf das Verhältnis zwischen Kortex und jenen Nervenbahnen richtete, von denen man annahm, dass sie aufs Engste mit ihm verknüpft sind. Im Jahrhundert 54
Ibid.
42
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
nach Willis waren keine Fortschritte zu verzeichnen, was die Frage der funktionalen Gehirnlokalisation betraf. 1784 ging Jiri Prochàska (1749–1820) nicht sehr weit über Willis’ Betrachtungsweise hinaus: Weil allerdings das allgemeine Sensorium durch bestimmte ihm eigene Gesetze und ohne das Bewusstsein des Geistes sensorische Eindrücke in motorische umwandelt und weil, wie wir erklärt haben, das allgemeine Sensorium Rückenmark und verlängertes Rückenmark umfasst und den allgemeinen Ausgangspunkt aller Nerven bildet, ist zu folgern, dass es sich bei Gehirn und Kleinhirn und ihren Teilen (mit Ausnahme des allgemeinen Sensoriums) um die Organe des Denkvermögens handelt.55
Mistichelli und du Petit beschreiben die pyramidale Kreuzung und identifizieren die motorische Funktion pyramidaler Fasern im Kortex Eine bemerkenswerte Leistung gab es während dieser Zeit allerdings doch, erbracht wurde sie von Domenico Mistichelli (1675–1741) und François Porfour du Petit (1664–1741). Beide beschrieben die pyramidale Kreuzung – die Kreuzung von Nerven also, die in der Pyramide genannten spinomedullären Verbindungsstelle von links nach rechts und von rechts nach links verlaufen.56 Zudem erkannten sie in ihrer beachtlichen Arbeit, dass die Ursprünge der pyramidalen Fasern im Kortex liegen, und du Petit ging noch weiter, indem er die Fasern als funktionell motorische identifizierte. Der als Militärarzt tätige du Petit beobachtete, dass eine Verwundung des zerebralen Kortex mit einer kontralateralen Lähmung verbunden ist. Aufgrund dieser Beobachtung erklärte er das Phänomen der Bewegung mit der Passage der Lebensgeister: vom Kortex durch das Striatum und die Basalganglien und dann kreuzweise durch die Pyramiden zu den Muskeln. Er entwickelte die erste explizite Darstellung (motor)kortikaler Bewegungskontrolle durch den Pyramidaltrakt. Diese vorausahnende Arbeit bietet eine bemerkenswert moderne Auffassung des Phänomens.
J. Prochàska, ‚De functionibus systemis nervosi, et observationes anatomico-pathologicae‘, in Adnotationum Academicarum (W. Gerle, Prague, 1784), Übers. T. Laycock als ‚A dissertation on the functions of the nervous system‘, in Unzer and Prochàska on the Nervous System (Sydenham Society, London, 1851), S. 141–143. 56 D. Mistichelli, ‚Trattato dell’Apoplessia‘ (Roma, A de Rossi alla Piazza di Ceri), Übers. C. D. O’Malley, in E. Clarke und C. D. O’Malley, The Human Brain and Spinal Cord (University of California Press, Berkeley, 1968), S. 282f. 55
1.4 Der Reflexbegriff
43
1.4 Der Reflexbegriff: Bell, Magendie und Marshall Hall Das Rückenmark kann unabhängig vom Enkephalon operieren Seit uralten Zeiten weiß man, dass eine Schlange sich noch Tage nach Abtrennung ihres Kopfes auf eine Berührung hin bewegt. Eine gründliche Studie der Fähigkeit des Rückenmarks, Muskelkontraktion und Bewegung ohne die Teilhabe des Gehirns anzustoßen, wurde bis zu den Untersuchungen Alexander Stuarts (1637–1742) allerdings nicht vorgelegt. In seiner Croonian Lecture für die Royal Society London von 1739 beschrieb Stuart Experimente, in denen er einem Frosch zuerst den Kopf abtrennte und dann mit einem stumpfen Instrument Druck auf das Rückenmark ausübte, was dazu führte, dass die Glieder sich bewegten. Aus diesen Experimenten folgerte er, dass der Druck die Lebensgeister aus dem Rückenmark in die zu den Muskeln führenden Nerven hineingezwungen habe.57 Stuart glaubte, auf diese Weise den Fluss der Lebensgeister vom Rückenmark zu den Muskeln experimentell nachgewiesen und sie als die für die Muskelkontraktion verantwortlichen Akteure ausgewiesen zu haben. Die Frage, wie Tiere ohne das Mitwirken des Enkephalons auf einer bestimmten Ebene weiter funktionieren können, wurde dann wieder von Robert Whytt (1714– 1766) aufgegriffen, in seinen um das Jahr 1751 herum in Edinburgh verfassten Arbeiten Essays on the Vital and Involuntary Motions of Animals und Observations on the Sensibility and Irritability of the Parts of Man and Other Animals.58 Whytt konnte den von Descartes und Willis vorgebrachten mechanischen Leitgedanken nicht akzeptieren, dass nämlich der Reflex ohne die Intervention einer ihn anstoßenden Seele zustande kommt. Er schrieb: „Die infolge einer Reizung von uns vollzogenen Bewegungen verdanken sich der ursprünglichen Konstitution unseres Körpers, auf deren Grundlage die Seele oder das Empfindungsprinzip unmittelbar und ohne vorherige Reflexion danach strebt, in jedem Fall und auf die wirksamste Weise jede unliebsame Empfindung zu vermeiden oder abzuschütteln, die sich ihr durch das, was immer dem Körper Schmerzen verursacht oder ihn quält, vermittelt.“ Es ist wichtig festzuhalten, dass diese Konzeption eher cartesianisch denn aristotelisch inspiriert ist. Denn sie postuliert ein Empfindungsprinzip (und mithin eines des Bewusstseins). Whytt nahm Sherrington hinsichtlich des Stretch-Reflexes vorweg: „Was immer die Fasern egal welchen Muskels derart dehnt, dass sie sich über ihren gewöhnlichen Umfang hinaus erweitern, regt sie zur Kontraktion an, etwa so, als wären sie durch irgendein scharfes Instrument oder eine beißende Flüssigkeit gereizt worden.“59 57
A. Stuart, Lecture III of the Croonian Lectures, Proceedings of the Royal Society, 40 (1739), S. 36. 58 R. Whytt, ‚An essay on the vital and other, involutary, motions of animals‘ (1751), wieder abgedruckt in Alexander Walker, Documents and Dates of Modern Discoveries in the Nervous System (1839), S. 112–122; Faksimile hg. von P. Cranfield (Scarerow Reprint Corp., Metuchen, NJ, 1973). 59 Ibid., S. 120.
44
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
Die Rückenmarksreflexvorstellung Die Vorstellung einer im Nervensystem operierenden ‚Seele‘ oder eines dort wirkenden Empfindungprinzips, das sich nach dem Verlust des Enkephalons erhält, wurde von Prohàska aufgegriffen. Er ließ den Gedanken eines ‚allgemeinen Sensoriums‘ wieder aufleben, welches innerhalb der Ventrikellehre mit den lateralen Ventrikeln verbunden worden war, von ihm nun aber dem Gehirn und dem Rückenmark zugeordnet wurde.60 Indem sie den Zusammenhang zwischen Rezeption und Motorik auf der Rückenmarksebene klar herausstellte, beflügelte die Arbeit Prochàskas die Entwicklung der Reflexvorstellung maßgeblich. Dieser Zusammenhang drückt sich in folgendem von ihm stammenden Kommentar aus: „Weil also die prinzipielle Funktion des allgemeinen Sensoriums in der Umwandlung sensorischer Eindrücke in motorische besteht, kann man beobachten, dass diese Umwandlung stattfindet, ob sich der Geist ihrer nun bewusst ist oder nicht.“61 Jedoch gelang es auch ihm nicht, das Problem zu lösen. Die Frage, wie Gehirn und Rückenmark an der Integrationstätigkeit des Nervensystems teilhaben, die das Verhalten begleitet, kam, wie gesagt, mit der Entdeckung der Nerven und ihrer Ursprünge in Gehirn und Rückenmark durch Galen und seine Nachfolger auf. Sie behielten den aristotelischen Gedanken bei, das vitale Pneuma werde im Herz erzeugt, waren aber aufgrund ihrer Entdeckung der Spinalnerven und wegen der Wichtigkeit der Unversehrtheit dieser Nerven für das motorische Verhalten genötigt, die aristotelischen Vorstellungen zu modifizieren. Galen behauptete, dass das vitale Pneuma, wenn es ins Gehirn eindringt, in psychisches Pneuma umgewandelt wird. Von dort wandere es sowohl über die kranialen Nerven und das Rückenmark als auch außerhalb der Spinalnerven abwärts, um die Muskeln zu aktivieren. Galen betrachtete das psychische Pneuma als eine Flüssigkeit, die entweder durch Hohlröhren in den Nerven vordringt oder das Substrat liefert für das Fließen einer Kraft – von irgendetwas, das der modernen Auffassung des Aktionspotenzials ähnelt. Descartes entwickelte Galens Konzeption wie gezeigt weiter, indem er das vitale Pneuma als Zusammensetzung feiner Blutpartikel beschrieb, die sich mit dem Erreichen des Gehirns in noch feinere verwandeln. Diese nannte er die ‚Lebensgeister‘. Die Entdeckung der Reflexe durch Willis warf die Frage auf, wie die Lebensgeister an den Integrationsleistungen des Nervensystems, die die Reflexe begleiten, teilhaben könnten. Die Schwierigkeit wurde noch von der Feststellung verschärft, dass auch kortexlose Lebewesen Reflexe zeigen können. Denn wie könnte in diesen Fällen die Herstellung der Lebensgeister, die von der Unversehrtheit des Gehirns abhängig ist, an der Hervorbringung des Reflexes durch das Rückenmark und seine angeschlossenen motorischen Nerven beteiligt sein, wenn das Gehirn fehlt? Die Lösung lieferte Luigi Galvani (1737–1798). Er zeigte, dass Nerven Elektrizität leiten können, ähnlich wie Metalldrähte voltaische Elektrizität leiten, und dass das Potenzial 60 61
Prohàska, ‚A dissertation‘, S. 123. Ibid., S. 127–129.
1.4 Der Reflexbegriff
45
zur Erzeugung dieser Elektrizität in den Nerven selbst liegt.62 Sein Schlüsselexperiment zum Nachweis nervaler Elektrizitätsleitung bestand darin, die entblößte RückenmarkSchenkel-Verbindung eines Frosches in einem verschlossenen Gefäß zu unterbrechen, und zwar mit Hilfe eines Drahts, der durch das Rückenmark und dann durch den oben am Gefäß befindlichen Verschluss geführt wurde; der induzierte Stromstoß erreichte den Boden des Gefäßes. Dann wurde ein Draht die Decke entlang gespannt, um die Ladung einer Reibungsmaschine aufzunehmen und zu dem Draht zu befördern, von dem das Rückenmark durchzogen war. Diese Apparatur zeigte eindeutig, dass immer dann, wenn die Maschine ansprang, die Schenkel zuckten. Hieraus folgerte Galvani, dass das Rückenmark und seine angeschlossenen Nerven Elektrizität leiten.63 Diese Entdeckungen machten deutlich, wie überflüssig die Annahme war, es müsse einen Gehirnspeicher für die vom psychischen Pneuma abstammenden und vom Rückenmark und seinen zugehörigen Nerven zur Kontrolle der Organe genutzten Lebensgeister geben. Sowohl das Rückenmark als auch die Nerven zeigten die Fähigkeit, die für die Auslösung von Reflexen benötigte Elektrizität gehirnunabhängig zu erzeugen. Bell und Magendie: Die Identifizierung sensorischer und motorischer Spinalnerven Wir haben die Verwirrung beschrieben, die im 18. Jahrhundert hinsichtlich der Reflexvorstellung noch immer bestand, und gezeigt, dass Whytt sich zur Erklärung der Reflexhandlungen gezwungen sah, die Rückenmarksfunktion mit einer Seelenkonzeption zu verbinden. Diese Schwierigkeit sollte bis Anfang des 19. Jahrhunderts Bestand haben, als es möglich wurde, zwischen den sensorischen und den motorischen Funktionen der posterioren und anterioren Wurzeln des Rückenmarks zu unterscheiden. Was einerseits Charles Bell (1774–1842) zu verdanken ist, der die anterioren Wurzeln als motorische identifizierte, und andererseits François Magendie (1783–1855), der die Vorstellung entwickelte, dass die posterioren Wurzeln sensorische sind. Viele Auseinandersetzungen rankten sich um die Zuschreibung dieser Entdeckungen.64 Es ist bemerkenswert, dass die Argumente für die Behauptung, die anterioren Wurzeln seien funktionell motorisch, weder auf die Seele noch auf das allgemeine Sensorium und ihre Verrichtungen irgendwie Bezug nahmen. Dass die Debatte zu diesen Fragen immer mehr auf solche Bezüge verzichtete und immer häufiger experimentelle Beobachtungen einbezog, hat eindeutige Gründe. Bells und Magendies Experimente schlossen Für eine eingehendere Darstellung siehe Bennett, ‚Early history of the synapse‘, S. 103–105. L. Galvani, ‚De viribus electricitatis in motu musculari commentarius‘, De Bononiensi Scientiarum et Atrium Instituto atque Academia commentarii, 7 (1791), S. 363–418. 64 C. Bell, ‚Idea of a new anatomy of the brain; submitted for the observations of his friends‘, wieder abgedruckt in G. Gordon-Taylor und E. W. Walls, Sir Charles Bell, His Life and Times (Livingstone, Edinburgh, 1958), S. 218–231; idem, ‚On the nerves; giving an account of some experiments on their structure and functions, which lead to a new arrangement of the system‘, Philosophical Transactions of the Royal Society, 111 (1821), S. 398. 62 63
46
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
eine Unterbrechung des Rückenmarks oder eine Aufhebung der Gehirntätigkeit aus, sodass die Fragen nach der Möglichkeit von Reflexen ohne die Mitwirkung des Gehirns nicht aufkamen. Ihre Forschung konzentrierte sich vielmehr auf die Effekte der Durchtrennung von Nerven, die von Gehirn und Rückenmark zu den peripheren Körperbereichen führen. Bell hatte sich selbst durch die Analyse bestätigt, dass die anterioren und posterioren Wurzeln in bestimmte Kolumnen des Rückenmarks übergingen, die mit dem Gehirn in Verbindung standen. So bestand kein Widerspruch zwischen der Vorstellung, die Seele sei nur im Gehirn angesiedelt (oder interagiere nur mit ihm), und der Tatsache, dass die Durchtrennung der Wurzeln die beobachteten Effekte hervorrief. Eine prägnante Passage legt die Vermutung nahe, dass Bell die integrative Kraft des Rückenmarks bei geköpften Tieren richtig verstanden hat: „Das Rückenmark hat eine große Ähnlichkeit mit dem Gehirn im Aufbau seiner grauen und medullären Substanz. Kurz gesagt, seine Struktur weist es als etwas aus, das kein bloßer Nerv ist, das unabhängig vom Gehirn über Eigenschaften verfügt.“65 In dieser Passage ist der Gedanke, dass eine Seele oder ein allgemeines Sensorium existiert, aufgegeben, und das, obgleich auch Tiere ohne Gehirne in die Betrachtung einbezogen wurden. Bell scheint nirgends auf posteriore Wurzeln, die eine sensorische Funktion erfüllen, verwiesen zu haben. Dies könnte man durch den Umstand erklären, dass ein Großteil seiner Arbeit sich an betäubten Kaninchen vollzog. Bells Zeitgenosse Magendie war der Erste, der zwischen motorischen und sensorischen Nerven unterschied, und zwar mit Blick auf die anterioren und posterioren Wurzeln. Die Französische Akademie der Wissenschaften gibt in ihren Protokollen des Jahres 1822 bekannt: „Monsieur Magendie berichtet von der ihm vor Kurzem gelungenen Entdeckung, dass, wenn man die posterioren Wurzeln der Spinalnerven durchtrennt, nur die Sensibilität dieser Nerven aufgehoben ist, und wenn die anterioren Wurzeln durchtrennt werden, nur die auf ihnen beruhenden Bewegungen unterbleiben.“66 Diese Experimente begründeten die Gewissheit, dass es sich bei den posterioren Nerven um sensorische handelt. Die Experimente von Bell und Magendie lieferten die Grundlagen für die Hypothese über die spinalen Wurzeln, die als Bell-Magendie-Hypothese bekannt geworden ist und in den folgenden Worten Magendies am prägnantesten zum Ausdruck kommt: „Es genügt mir momentan, als gesicherte Erkenntnis vorbringen zu können, dass die anterioren und posterioren Wurzeln der vom Rückenmark ausgehenden Nerven unterschiedliche Funktionen innehaben, dass die posterioren eher den Anschein erwecken, speziell C. Bell, ‚On the functions of some parts of the brain, and the relations between the brain and nerves of motion and sensation‘, Philosophical Transactions of the Royal Society, 124 (1834), S. 471–483; idem, ‚Continuation of the paper on the relations between the nerves of motion and sensation, and the brain; more particularly on the structure of the medulla oblongata and the spinal marrow‘, Philosophical Transactions of the Royal Society, 125 (1835), S. 255–262. 66 F. Magendie, ‚Expériences sur les fonctions des racines des nerfs rachidiens‘, Journal Physiologie expérimentale et de pathologie, 3 (1822), S. 276–279; wieder abgedr. mit Übers. in Walker, Documents and Dates, S. 88, 95. 65
1.4 Der Reflexbegriff
47
mit der Sensibilität verknüpft zu sein, während die anterioren besonders mit der Bewegung in Verbindung zu stehen scheinen.“67 Marshall Hall: Sensibilität ist nicht Rückenmarkssensibilität Bell und Magendie hatten es vermieden, sich in den Kontroversen um die Frage zu verfangen, ob das Rückenmark eine zur Initiation einer gehirnunabhängigen Bewegung befähigte Seele beherberge. Und zwar deshalb, weil ihre Experimente, wie wir gesehen haben, nur mit der Durchtrennung der Spinalnerven verbunden waren. Nichtsdestotrotz blieb das scheinbare Problem bestehen, wie die Sensibilität (das heißt die Fähigkeit, eine Empfindung zu haben) mit dem Rückenmark an sich in Zusammenhang gebracht werden könnte (wie sie dem Anschein nach mit ihm in Zusammenhang gebracht werden müsste). Dieses Problem wurde in den 1830er Jahren von Marshall Hall (1790– 1857) weitgehend gelöst. Er sandte der Royal Society 1833 eine umfassende Abhandlung mit dem Titel ‚On the reflex function of the medulla oblongata and medulla spinalis‘ zu, in der er zu dem Ergebnis gelangte, dass „es eine Eigenschaft des sensiblen und motorischen Nervensystems gibt, die von Empfindung und Wollen unabhängig ist; – eine Eigenschaft die, was die motorischen Nerven angeht, nicht auf übermäßiger Reizung beruht; – eine Eigenschaft, der es zu verdanken ist, dass jeder Teil eines Lebewesens mit dem korrespondierenden Teil des Gehirns und des Rückenmarks in Verbindung steht, wodurch die Teile ein Ganzes bilden.68 Was das Rückenmark eigentlich ist – ein Reflexzentrum: Hall macht die Annahme einer spinalen Seele überflüssig Im Jahr 1837 hatte Hall bereits eine Darstellung des Rückenmarks vorgelegt, nach der dieses ein Reflexzentrum beherbergt, das auf nichtsensible und nichtwillentliche Weise operiert, im Gegensatz zu den sensiblen Nerven, die zum Gehirn hinführen, und den motorischen Nerven des Wollens, die vom Gehirn wegführen. Diese Resultate waren insofern revolutionär, als sie deutlich machten, dass es sensorische Nerven gibt, die keine Empfindungen bewirken, und dass es motorische Nerven gibt, die nicht nur Wollenshandlungen anstoßen. Reflexhandlungen setzen also keinen vom Muskel zum Gehirn und dann vom Gehirn zum Muskel führenden Nervenbogen voraus, wie Charles Bell vermutet hatte. Der Reflexbogen erfordert vielmehr
67
Ibid., S. 91. M. Hall, ‚On the reflex function of the medulla oblongata and medulla spinalis‘, Philosophical Transactions of the Royal Society, 123 (1833), S. 635–665; idem, ‚These motions independent of sensation and volition‘, Proceedings of the Committee of Science, Zoological Society, 27. Nov. 1832, wieder abgedr. in Walker, Documents and Dates, S. 138. 68
48
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
1. einen Nerv, der von der Stelle oder dem Bereich der Reizung zum und ins Mark des Rückenmarks führt, 2. das Rückenmark selbst, 3. einen Nerv oder Nerven, die aus dem Rückenmark austreten bzw. von ihm wegführen; alle wesentlich aufeinander bezogen bzw. miteinander verbunden.69 Diese Arbeit legte den Grundstein für die noch im selben Jahrhundert erbrachte Leistung Sherringtons, in gewisser Weise nahm sie sie vorweg. Sie folgte Hall in der Annahme, die Vorstellungen der spinalen Seele und des spinalen allgemeinen Sensoriums seien insgesamt überflüssig. 1831 bestätigte Johannes Müller das Bell-Magendie-Gesetz experimentell. Im Jahr 1890 publizierte Michael Foster (1836–1907) die fünfte Ausgabe seines großartigen Werks A Textbook of Physiology, in dem er eine bündige Darstellung des Zusammenhangs zwischen spinalen Reflexen und dem Gehirn vorlegte. Sogar in der letzten Dekade des 19. Jahrhunderts klang die Vorstellung von der Existenz einer Rückenmarksseele noch nach und wurde von Foster in seinem Textbook als berücksichtigenswert erachtet, wie in diesen seinen Betrachtungen beispielhaft deutlich wird: Wir könnten mithin annehmen, dass, wenn der gedankenlose Frosch durch irgendeinen Impuls zu einer Reflexhandlung gereizt wird, die spinale Seele durch einen kurzzeitigen Bewusstseinsblitz belebt wird, der aus der Dunkelheit kommt und wieder in die Dunkelheit eingeht; und wir könnten vielleicht weiter annehmen, dass solch ein vorübergehendes Bewusstsein desto stärker ausgeprägt ist, je größer der Teil des in die Reflexhandlung einbegriffenen Rückenmarks ist und je komplexer die Bewegung.70
1.5 Die Lokalisierung der Funktionen im Kortex: Broca, Fritsch und Hitzig Broca: Das kortikale Areal für Sprache; Fritsch und Hitzig: Der Motorkortex Obwohl 1870 durch Fritsch und Hitzig von ersten Experimenten berichtet wurde, die auf einen auf die motorische Kontrolle spezialisierten Gehirnbereich hindeuteten, könnte man behaupten, dass die ersten Belege für die kortikale Spezialisierung 1861 von Paul Broca (1824–1880) vorgebracht wurden, und zwar hinsichtlich der Sprache. In jenem Jahr übermittelte Broca die Ergebnisse einer Kortexautopsie, vorgenommen an einem seiner Patienten, einem gewissen Herrn Leborgne, der an dem Verlust der M. Hall, ‚Synopsis of the diastaltic nervous system or the system of the spinal marrow and its reflex arcs, as the nervous agent in all the functions of ingestion and of egestion in the animal economy‘, Croonian Lectures (Mallett, London, 1850). 70 Michael Foster, A Textbook of Physiology (Macmillan, London, 1890), S. 912. Die cartesianischen Wurzeln dieser Konzeption der spinalen Seele sind hier in ihrer Verbindung mit dem Bewusstsein unverkennbar. 69
1.5 Lokalisierung der Funktionen im Kortex
49
Sprache (Aphasie) gelitten hatte. Broca entdeckte eine Läsion am linken anterioren (frontalen) Gehirnlappen, der, wie er meinte, der für die Sprache zuständige Bereich des Kortex ist. Dieser wurde in der Folgezeit als Broca-Areal bekannt.71 Zwischen dem Tod von Thomas Willis 1675 und den Experimenten von Fritsch und Hitzig um das Jahr 1870 herum gab es nur wenige Fortschritte im Hinblick auf das Verständnis der Kortexfunktion zu vermelden. Beispielsweise behauptete der führende französische Physiologe dieser Tage, Marie-Jean-Pierre Flourens (1794–1867), auf der Grundlage seiner Forschungen an Tauben (um 1824), dass der Kortex ausschließlich mit der Wahrnehmung, mit rationalen Fähigkeiten und dem Wollen zu tun hat, jedoch nicht mit der motorischen Aktivität in Zusammenhang steht.72 Im Jahr 1858 wies er nach, dass die mit der Atmung verknüpfte motorische Aktivität auf das Rückenmark eingegrenzt werden kann und das Gehirn nicht einbegreift. Außerdem können die Kortexfunktionen laut Flourens nicht verschiedenen Arealen des Kortex zugewiesen werden, weil dieser als ein Ganzes agiert. Sämtliche Empfindungen und Wahrnehmungen und alles Wollen beanspruchen seiner Ansicht nach zugleich denselben funktionellen Ort. Also folgerte er, dass es sich beim Empfindungs-, Wahrnehmungs- und Willensvermögen wesentlich um ein einziges Vermögen handelt. Die Entdeckung des Motorkortex: Fritsch und Hitzig Es dauerte bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, ehe ein Fortschritt im Hinblick auf die motorischen Kontrollfunktionen des Kortex zu verzeichnen war. 1870 veröffentlichten Gustav Fritsch (1838–1891) und Eduard Hitzig (1838–1907) ihr Monumentalwerk ‚Über die elektrische Erregbarkeit des Grosshirns‘ (1870), in dem sie die Resultate ihrer Experimente zur Stimulierung von Hundegehirnen durch galvanische Ströme vorstellten, die sie zur Vorstellung eines ‚motorischen Kortex‘ leiteten. In diesen Experimenten wurde der entblößte Kortex von Hunden an verschiedenen Stellen durch graduell abgestufte elektrische Stimulation erregt, die nur spürbar war, wenn sie auf der menschlichen Zunge zur Anwendung kam. Sie fanden auf der Kortexoberfläche Areale, die die Muskelkontraktion bewirkten, welche Gesicht und Nacken der Seite des Hundes betraf, die der stimulierten Gehirnhemisphäre gegenüberlag, sowie das Ausschreiten der Vorderbeine und die Krümmung der Vorderpfoten hervorriefen. Als sie das Vorderpfoten-Areal des Kortex einseitig entfernten, bemerkten sie, dass dies keinen Einfluss auf P. Broca, ‚Remarques sur le siège de la faculté du language articulé, suivies d’une observation d’aphémie (perte de la parole)‘, Bulletins de la Société Anatomique (Paris), 6 (1861), S. 330–357, 398–407; (übers. als ‚Remarks on the seat of the faculty of articulate language, followed by an observation of aphemia‘, in G. von Bonin, Some Papers on the Cerebral Cortex (Charles C. Thomas, Springfield, IL, 1960), S. 49–72. 72 M. J. S. Flourens, Recherches experiméntales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux dans les animaux vertèbrés (Ballière, Paris, 1823). 71
50
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
die Empfindung hatte, der Hund aber in seiner motorischen Aktivität und Körperhaltung beeinträchtigt war. Dazu bemerkten sie: Ein Theil der Convexität des grossen Gehirnes des Hundes ist motorisch (diesen Ausdruck im Sinne von Schiff gebraucht), ein anderer Theil ist nicht motorisch. Der motorische Theil liegt, allgemein ausgedrückt, mehr nach vorn, der nicht motorische nach hinten. Durch elektrische Reizung des motorischen Theiles erhält man combinirte Muskelcontractionen der gegenüberliegenden Körperhälfte. Diese Muskelcontractionen lassen sich bei Anwendung ganz schwacher Ströme auf bestimmte, eng begrenzte Muskelgruppen localisiren. [. . .] Die Möglichkeit isolirter Erregung einer begrenzten Muskelgruppe ist indessen bei Anwendung ganz schwacher Ströme auf sehr kleine Stellen, die wir der Kürze wegen Centra nennen wollen, beschränkt.73
Dies führte sie nicht nur zu der Hypothese, dass ein distinktes Kortexareal eine motorische Funktion innehabe, sondern auch zu der Verallgemeinerung, die anderen Funktionen könnten gleichfalls in spezifischen Kortexarealen lokalisiert werden. Diese Konzeption der kortikalen Lokalisation stellte den ersten wesentlichen Fortschritt in unserem Verständnis der Kortexfunktionalität seit Willis dar. Somatopische Organisation des Motorkortex: Jackson und Ferrier Der Arbeit über Hunde von Fritsch und Hitzig folgend, gelangte John Hughlings Jackson (1835–1911) hinsichtlich der Existenz eines motorischen Kortex bei Menschen zu ähnlichen Annahmen, die wiederum auf seinen Beobachtungen epileptischer Patienten basierten, von denen er 1863 berichtete: „In sehr vielen Fällen von Epilepsie und insbesondere syphilitischer Epilepsie sind die Konvulsionen auf eine Körperhälfte beschränkt; wie Autopsien von Patienten, die nach einer syphilitischen Epilepsie starben, zu belegen scheinen, steht das offensichtlich mit einer organischen Krankheit in der Hirnhälfte in Zusammenhang, die der von Krämpfen geschüttelten Körperhälfte gegenüberliegt und vielfach auf die Hemisphärenoberfläche beschränkt ist.“74 Von besonderem Interesse war das zeitliche Muster der während des an Umfang gewinnenden epileptischen Anfalls durch die Muskelgruppen verlaufenden Kontraktion. Dieses führte Hughlings Jackson zu der Vermutung, der Motorkortex müsse entlang somatopischer Linien organisiert sein, sodass Händen, Gesicht und Füßen, die über die größte Bewegungsvariabilität verfügen, das größte Areal im Motorkortex reserviert ist. Diese brillanten Vorstellungen wurden durch die von David Ferrier (1843–1928) unternommenen Arbeiten zu Primaten im Jahr 1874 bestätigt. Aufgrund der Anwendung von Wechselstrom-Reizung konnte er das KortexG. Fritsch und E. Hitzig, ‚Über die elektrische Erregbarkeit des Grosshirns‘, Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medizin, Leipzig, 37 (1870), 300–332; übers. als ‚On the electrical excitability of the cerebrum‘, in von Bonin, Some Papers on the Cerebral Cortex, S. 73–96. 74 J. H. Jackson, ‚Convulsive spasms of the right hand and arm preceeding epileptic seizures‘, Medical Times and Gazette, 2 (1863), S. 110f. 73
1.5 Lokalisierung der Funktionen im Kortex
51
areal, das für die Muskelzuckungen und auch für die in manchen Fällen Gehversuchen ähnelnden Bewegungen verantwortlich ist, präzise eingrenzen. Dadurch, dass Ferrier dem motorischen Areal des Kortex, das er ausgemacht hatte, kleinere Läsionen zufügte, konnte er nachweisen, dass diese in manchen Fällen zu einer Lähmung von Hand und Unterarm auf der gegenüberliegenden Seite führten und in einem anderen Fall zur Lähmung des Bizeps der Gegenseite. Die Tiere zeigten indes eine normal ausgeprägte Sensibilität für Berührung und schädliche Reize. Solche Beobachtungen sprachen eindeutig für die somatopische Organisation des motorischen Kortex.75 Diese Arbeit an Primaten wurde in der Folge von Victor Horsley (1857–1916) bestätigt und ausgeweitet, der im Jahr 1887 zeigte, dass der präzentrale Gyrus vornehmlich motorisch und der postzentrale sensorisch war, sodass der Motorkortex stets vor der Rolando-Furche zu finden war.76 Catons und Becks Entdeckung der elektrischen Phänomene im Kortex spricht für die Existenz eines Motorkortex Im Jahr 1875 entdeckte Richard Caton (1842–1926), dass elektrische Schwingungen durch zwei auf der Kortexoberfläche eines Affen platzierte Elektroden aufgezeichnet werden konnten und dass diese Schwingungen sich bei sensorischer Stimulation, starkem Sauerstoffmangel und Betäubung veränderten. Caton merkt an: Der Galvanometer hat bei jedem bislang untersuchten Gehirn die Existenz elektrischer Ströme in den Arealen angezeigt, die Dr. Ferrier mit der Drehbewegung des Kopfes und dem Kauen in Beziehung setzte, eine Negativschwankung des Stroms wurde immer dann beobachtet, wenn diese zwei Handlungen ausgeführt wurden. Man stellte fest, dass Sinneseindrücke die Ströme bestimmter Areale beeinflussen; beispielsweise war der Bereich des Kaninchengehirns, den Dr. Ferrier mit den Bewegungen der Augenlider in Beziehung setzte, von der Lichtreizung der gegenüberliegenden Retina markant beeinflusst.77
D. Ferrier, ‚The localization of function in the brain‘, Proceedings of the Royal Society, 22 (1873–1874), S. 228–232; idem, ‚Experiments on the brain of monkeys‘, Croonian Lecture (2. Ser.), Philosophical Transactions of the Royal Society, 165 (1876), S. 433–488; idem, The Function of the Brain (Smith Elder and Company, London, 1876). 76 C. E. Beevor und V. Horsley, ‚A minute analysis (experimental) of the various movements produced by stimulating in the monkey different regions of the cortical centre for the upper limb, as defined by Professor Ferrier‘, Philosophical Transactions of the Royal Society, 178 (1887), S. 153–167; idem, ‚A further minute analysis by electrical stimulation of the so called motor regions (facial area) of the cortex cerebri in the monkey (Macacus sinicus)‘, Philosophical Transactions of the Royal Society, 185 (1894), S. 39–81; idem, ‚A record of the results obtained by electrical excitation of the so-called motor cortex and internal capsule in an orang-outang (Simia satyrus)‘, Philosophical Transactions of the Royal Society, 181 (1890), S. 129–158. 77 R. Caton, ‚The electrical currents of the brain‘, British Medical Journal, 2 (1875), S. 278; idem, ‚Interim report on investigation of the electrical currents of the brain‘, British Medical Journal, 1 75
52
1 Anfänge neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
Die wegen der Retinareizung mit Licht aufgetretenen elektrischen Schwankungen wurden später von Adolf Beck (1863–1942) bestätigt, der zudem Catons Beobachtungen bezüglich der Lokalisation elektrischer Aktivität im Verlauf motorischer Handlungen, wie sie von Ferriers Arbeit vorhergesagt wurde, beglaubigte.78
1.6 Die Integrationstätigkeit des Nervensystems: Sherrington Wer einen experimentellen Entwurf ausfindig zu machen sucht, der über die Mechanismen des ‚eigentlichen Rückenmarks‘ Aufschluss gibt, muss sich Charles Sherrington (1857–1952) zuwenden und insbesondere die Jahrhundertwendejahre in den Blick nehmen. Sherringtons einschlägige Untersuchungen erreichten in puncto Gründlichkeit und Methodik ein neues Niveau. Sie stützten sich nicht vorrangig auf die technischen Innovationen dieser Zeit, sondern lebten in erster Linie von der Brillanz und Klarheit seines Denkens und von seiner eindrucksvollen Experimentierbegabung, die er unermüdlich entfaltete. Sherrington erkannte zuerst, dass die einen einzelnen Muskel anregenden efferenten Nerven spinalen Ursprungs sind.79 1905 förderten seine Experimente zutage, dass die Reizung der afferenten Nerven eines Einzelmuskels die Kontraktion dieses Muskels unabhängig von der Kontraktion der ‚gegenstrebigen‘ Muskeln der Verbindung zu bewirken vermag.80 Im Jahr 1910 veröffentlichte er seine großartige, fast 100 Seiten umfassende Abhandlung über ‚Flexion-reflex of the limb, crossed extensionreflex, and reflex stepping and standing‘.81 Darin beschreibt er erstmals den Beugereflex und identifiziert den Extensionsreflex [Geh- bzw. Ausschreitreflex] sowie den gekreuzten Extensionsreflex. Zusammen mit seinen früheren Abhandlungen von 1897 und 1907 begründete dieses Werk das Begriffssystem für die Analyse der Rolle des Rückenmarks beim Gehen und Stehen. Auf diese Weise vollendete Sherrington die 80 Jahre zuvor von Marshall Hall angestoßenen Forschungsprogramme mit der Konsequenz, dass der Gedanke, es gebe eine ‚spinale Seele‘, schließlich nicht weiter erörtert wurde. Obwohl Ferrier 1886 den Motorkortex erstmals als ein distinktes Areal bei Primaten lokalisiert hatte, waren es 1902 Grünbaum und Sherrington, die eine erste detaillierte (1877), Suppl. L, S. 62–65; idem, ‚Researches on electrical phenomena of cerebral grey matter, Transactions of the Ninth International Medical Congress, 3 (1887), S. 246–249. 78 A. Beck, ‚Die Bestimmung der Localisation der Gehirn- und Rückenmarkfunktionen vermittelst der elektrischen Erscheinungen‘, Zentralblatt für Physiologie, 4 (1890), S. 473–476. 79 C. S. Sherrington, ‚Notes on the arrangement of some motor fibres in the lumbo-sacral plexus‘, Journal of Physiology, 13 (1892), S. 621–772. 80 C. S. Sherrington, ‚On reciprocal innervation of antagonistic muscles: Seventh Note’, Proceedings of the Royal Society, B 76 (1905), S. 160–163; idem, ‚On reciprocal innervation of antagonistic muscles: Eighth Note’, Proceedings of the Royal Society, B 76 (1905), S. 269–297. 81 C. S. Sherrington, ‚Flexion-reflex of the limb, crossed extension-reflex, and reflex stepping and standing‘, Journal of Physiology, 40 (1910), S. 28–121.
1.6 Integrationstätigkeit des Nervensystems
53
Beschreibung der räumlichen Ausdehnung dieses Kortexareals verfügbar machten.82 Sie stellten fest, dass das ‚motorische‘ Areal sich an keiner Stelle hinter die Zentralfurche ausweitet. Damit waren Sherrington und Grünbaum die Ersten, die klar zwischen dem motorischen Areal und dem hinter der Zentralfurche befindlichen, das heute als somatosensorisches Areal bekannt ist, unterschieden.83 Ihre Methode der einpoligen Faraday’schen (Wechselstrom-)Stimulation des Kortex ermöglichte eine viel feinere Lokalisierung, als sie mit den bis dato gebräuchlichen doppelpoligen Elektroden möglich war.84 Ihre zu Beginn des 20. Jahrhunderts veröffentlichte klassische Abhandlung etablierte eine klare Konzeption des Motorkortex und mithin die ebenso klare Vorstellung, dass verschiedene Bereiche des Kortex für verschiedene Funktionen spezialisiert sind. Der Gedanke, es gebe eine ‚spinale Seele‘, war hauptsächlich durch Sherringtons detaillierte und erhellende Darlegung der spinalen Reflexe ad acta gelegt worden. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Seele und dem Kortex bzw. dem Geist und dem Gehirn plagte Sherrington allerdings noch immer, genauso wie die Neurowissenschaftler und Philosophen seit mehr als zwei Jahrtausenden. Unter seinen Protegés rief Sherrington eine ähnliche unruhige Faszination für sie hervor. Deren einschlägigen Reflexionen wollen wir uns nun zuwenden und erörtern, inwieweit ihr komplexer werdendes Wissen über die Kortexfunktionalität in dieser Frage Aufschluss brachte.
A. S. F. Grünbaum und C. S. Sherrington, ‚Observations on the physiology of the cerebral cortex of some of the higher apes (preliminary communication)‘, Proceedings of the Royal Society, 69 (1902), S. 206–209. 83 Ibid. 84 Ibid. 82
2 Der Kortex und der Geist im Werk Sherringtons und seiner Protegés 2.1 Charles Sherrington: Der anhaltende cartesianische Einfluss Über die Rolle des Geistes und seine Beziehung zum Kortex konnte Sherrington keinen Aufschluss geben Wie geschildert, ist es der brillanten Forschungstätigkeit Sherringtons zu verdanken, dass sich schließlich die wahre Natur des Rückenmarks als ein Reflexzentrum enthüllte und deutlich wurde, welche Rolle der Kortex bei der Reflexerzeugung spielt. Sherrington konnte auch die wunderbare Spezifität der Lokalisation von Funktionen des motorischen und somatosensorischen Kortex verdeutlichen. Obwohl die Vorstellung von einer ‚spinalen Seele‘ in der Neurophysiologie ausgedient hatte, blieb die Frage, ob eine ‚kortikale Seele‘ existiere, allerdings strittig. Genauer gesagt blieb die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Geist und dem Kortex die Gemüter weiterhin rätselhaft. Sherrington näherte sich dieser Frage auf seine eigene methodische Art, indem er sie zuerst innerhalb ihres geschichtlichen Rahmens verfolgte, im Werk Jean Fernels und in den ersten physiologischen und neurophysiologischen Konzeptionen. Später erörterte er das Problem in Man on his Nature, seinen Gifford Lectures von 1937/8, ausführlich.85 Sherringtons Dualismus Sherrington studierte Fernel sorgfältig, und er las ausgiebig in den Werken der Philosophen, bei Aristoteles angefangen. Sein Verständnis für philosophische Fragen und für die zwischen wissenschaftlichen und philosophischen Problemen bestehenden Unterschiede war jedoch, wie sich zeigen wird, nur schwach ausgeprägt. Trotzdem er mit 85
Wir werden Sherringtons Vorstellungen gegenüber kritisch sein, es muss jedoch daran erinnert werden, dass seine Gifford Lectures einflussreich waren und von den großen Wissenschaftlern jener Tage sehr bewundert wurden. Erwin Schrödinger bemerkte, dass ‚durch das ganze Buch [. . .] ein ehrliches Suchen nach positiven Beweisen für die Wechselwirkung zwischen Materie und Bewusstsein [geht] – Körper und Geist, wenn Sie wollen. Es ist ganz unmöglich, Ihnen die Großartigkeit von Sherringtons unsterblichem Buch durch Anführung einiger kurzer Stellen zu übermitteln: Sie müssen es schon selbst lesen‘ (zitiert von J. C. Eccles in seinen Gifford Lectures, The Human Mystery (Routledge and Kegan Paul, London, 1984), S. 4f. [dt. Das Rätsel Mensch (Piper, München 1989), S. 5]).
2.1 Charles Sherrington
55
Aristoteles’ De Anima vertraut war, erfasste er die Tiefe und Fruchtbarkeit der aristotelischen psycheˉ-Konzeption genauso wenig wie deren Bedeutung für die essenziell begrifflichen Fragen, die ihn plagten. Er vermerkte Aristoteles’ „vollumfängliche Versicherung, dass der Körper und sein Denken eben ein existierendes Eines bilden“ und dass „das ‚Einssein‘ des lebendigen Körpers und seines Geistes der gesamten [aristotelischen] Darstellung als alleiniger Bezugspunkt zu dienen scheint“.86 Sherrington untersuchte die aristotelische philosophische Lehre dennoch nicht gründlich. Stattdessen bewegte er sich auf eine cartesianische dualistische Konzeption über das Verhältnis zwischen Geist und Körper zu, und dabei stieß er, was nicht überrascht, auf dieselben unlösbaren Probleme wie Descartes. Den Terminus ‚Energie‘ verwendend, um sowohl Materie als auch Energie zu bezeichnen, vertrat Sherrington die Auffassung, dass die „Evolution sich mit uns als Zusammensetzungen aus ‚Energie‘ und ‚Psyche‘ befasst und in uns jede dieser beiden Komponenten zusammen mit der anderen bearbeitet hat. Bei diesen beiden Komponenten handelt es sich gemäß unserer Analyse um ein Energie-System und ein geistiges System, vereint in einem zweipoligen Einzelwesen“ (MN 250). ‚Energie‘ bzw. Materie und Geist sind, so dachte er, „Phänomene zweier Kategorien“ (MN 251). Sherringtons Konzeption des Geistes Aus seiner Sicht ist ‚Energie‘ wahrnehmbar, raum-zeitlich lokalisierbar und der Gegenstand von physikalischen und chemischen Gesetzen. Geist hingegen sei ‚unsichtbar‘, ‚unberührbar‘ und „von den Sinnen [sensorisch] nicht beglaubigt“ (MN 256). Mitunter erklärt Sherrington, dass der Geist ‚unausgedehnt‘ ist;87 an anderen Stellen erklärt er, ihm sei nicht einsichtig, dass der Geist, da er einen Ort hat, eines Umfangs ermangeln bzw. ausdehnungslos sein sollte. „Indem wir den endlichen Geist als etwas anerkennen, das ein ‚Wo‘ innerhalb des Gehirns hat, stellen wir fest, dass das Energie-System, mit dem wir den Geist in Beziehung setzen, selbstverständlich ausgedehnt ist und über Teile verfügt [. . .] Andere ‚Wo‘ im Gehirn stehen mit anderen geistigen Aktivitäten in Zusammenhang [. . .] Wir müssen akzeptieren, dass der endliche Geist sich im ausgedehnten Raum befindet“ (MN 249f.). Andererseits bemerkt er ‚weiser‘, als er offensichtlich selbst erfasste, dass der Geist „kein Ding“ ist (MN 256). Er sah in ihm das Agens des Denkens, die Quelle von Verlangen, Freude, Wahrheit, Liebe, Wissen, Werten – von all dem, wie er sagt, „was im Leben zählt“ (ibid.). Der Geist, schreibt er, ist „das bewusste ‚Ich‘“.88 Das ist jedoch verworren. Der Geist ist ebenso wenig im Kopf oder im Gehirn lokalisiert wie das Gehvermö86
C. S. Sherrington, Man on his Nature, 2. Aufl. (Cambridge University Press, Cambridge, 1953), S. 189. Im Text in der Folge abgekürzt als MN. 87 ‚Also hängen unsere beiden Begriffe, raum-zeitliche, spürbare [wahrnehmbare] Energie und nicht spürbarer [nicht wahrnehmbarer] Geist, auf irgendeine Weise zusammen, die Theorie aber hat auf die Frage, wie das sein könne, keine Antwort‘, zitiert von J. C. Eccles und W. C. Gibson in Sherrington – his Life and Thought (Springer Verlag, Berlin, 1979), S. 143, ohne Angaben. 88 Zitiert ibid., S. 142.
56
2 Kortex und Geist bei Sherrington
gen. Er ist weder ein ausgedehnter noch ein unausgedehnter Punkt, genauso wie die Fähigkeit, ein Tor zu erzielen, weder ein ausgedehnter noch ein unausgedehnter Punkt ist. Der Geist ist nicht „das bewusste ‚Ich‘“, weil es so etwas wie ‚ein Ich‘ genauso wenig gibt wie ‚ein Du‘ oder ‚ein Er‘ (siehe unten 12.4). Ich bin nicht mein Geist – ich habe den Geist, nicht so, wie ich ein Auto habe, oder gar so, wie ich einen Kopf oder ein Gehirn habe, sondern vielmehr so, wie ich das Sehvermögen habe oder die Fähigkeit zu denken. Sherringtons Konzeption des Geist-Körper-Zusammenhangs Wie erwartet haben wir es bei den zwischen Geist, Körper (und Gehirn) und Person bestehenden Begriffsbeziehungen mit einem tiefgründigen philosophischen Problem zu tun – dessen Lösungsmöglichkeit wir bereits angedeutet haben und weiter unten erörtern werden (siehe z. B. 3.10). Sherrington war in dieser Sache außerordentlich unklar, er bemerkte nicht in vollem Umfang, dass er es keineswegs mit einem empirischen Problem zu tun hatte, sondern mit einem rein begrifflichen. Manchmal scheint er die irrige Vorstellung zu akzeptieren, dass der Geist einen Körper habe,89 obgleich es der Mensch ist, der einen ‚Körper hat‘, und nicht der Geist.90 Dann wiederum scheint es, als scheue er nicht vor der Behauptung zurück, dass der Körper (oder jedenfalls die Teile desselben) Geist hat (bzw. haben) – ein sensitiver Teil des Körpers hat „den Geist nur geliehen, damit dieser an seiner statt empfinde“ (MN 187). Hierbei handelt es sich allerdings um eine verworrene Überlegung. Was würde ein Körper mit einem Geist anstellen? Menschen haben Geist, so wie sie wirklich Körper haben. „All das, was im Körper empfindet, hat seine Empfindungen für ihn gemacht“, und zwar mittels des Gehirns, argumentierte Sherrington und behauptete in diesem Sinne auch, dass „das Denken des Körpers offenbar für ihn vollzogen wurde, nämlich im Gehirn“ (MN 187), mutmaßlich durch den Geist. Auch hier warf er die Verhältnisse durcheinander, denn das Gehirn ‚macht‘ keine Empfindungen – es gibt nichts dergleichen wie Empfindungen ‚machen‘. Wir haben jedoch Empfindungen in verschiedenen Teilen unseres sensitiven Körpers (Teile, die schmerzen, pochen, jucken etc.) – und wir hätten keine Empfindungen, würden Gehirn und Nervensystem nicht normal funktionieren (siehe 4.1). Und der Körper ‚Ich habe erlebt, wie jemand die Frage stellte: „Warum sollte der Geist einen Körper haben?“ Die Antwort kann durchaus lauten: „Um zwischen sich und einem anderen Geist zu vermitteln.“‘ (MN 206). 90 Die Wendung ‚einen Körper haben‘ ist tatsächlich seltsam und irreführend. Wir behaupten von nicht gefühlsfähigen Dingen nicht, dass sie einen Körper haben (Bäume beispielsweise haben keinen Körper). Wir erkennen Körper nur uns selbst und manchmal höheren Tieren zu. Nur von dem, was einen Leichnam hinter- bzw. zurücklässt, wenn es stirbt, kann man sagen, dass es einen Körper hat (wir sagen z. B. von einem toten Fisch nicht, dass er die Leiche oder der Überrest eines Fisches ist – der Überrest eines Fisches wäre ein halbverspeister Fisch). Der Gebrauch der Wendung bringt keine wie auch immer geartete empirische Wahrheit zum Ausdruck, sondern eine Einstellung bestimmten gefühlsfähigen Wesen gegenüber – für gewöhnlich Menschen. 89
2.1 Charles Sherrington
57
muss auch kein Denken vollziehen – so etwas wie jemandes Körperdenken gibt es nicht. Es sind die Menschen, die denken, und ihr Denken wird nicht von ihren Gehirnen für sie vollzogen – sie müssen ihr Denken selbst vollziehen (siehe 6.2). Es gibt nichts dergleichen wie Gehirne, die irgendetwas denken – obwohl menschliche Wesen selbstverständlich nicht in der Lage wären zu denken, wenn ihre Gehirne nicht normal funktionieren würden. (Das heißt allerdings nicht, dass man mit seinem Gehirn denkt, in dem Sinne, in dem man mit seinen Beinen geht oder mit seinen Augen sieht.) Sherrington zum Geist-Gehirn-Zusammenhang: Aristoteles, missverstanden Angesichts dieses verworrenen Dualismus kommt die Frage nach dem Zusammenhang zwischen den beiden Entitäten zwangsläufig auf. Sherrington behauptete, niemand bezweifele, dass es zwischen Gehirn und Geist eine, wie er sagt, ‚Liaison‘ gibt. Jedoch ist „das ‚Wie‘ derselben, so müssen wir annehmen, [. . .] für die Wissenschaft wie für die Philosophie noch immer ein Rätsel, das gelöst sein will“ (MN 190). In all jenen Organismusarten, in denen das Physische und das Psychische koexistieren, erreichen beide ihr Ziel nur, wenn sie eine zweckmäßige Liaison miteinander eingehen. Und diese Liaison kann als der endgültige und höchste, das Individuum vervollständigende Zusammenschluss gelten. Die Frage, wie sie zustande kommt, harrt jedoch nach wie vor ihrer Beantwortung; weiter, als es Aristoteles vor mehr als zweitausend Jahren bereits war, sind wir damit nicht gekommen. Es gibt allerdings eine eigentümliche Unstimmigkeit, von der man sagen könnte, dass sie die aristotelische und viele andere psychologische Theorien kennzeichnet. Diese verorten die Seele im Körper und binden sie an den Körper, ohne darüber hinaus zu versuchen, den Grund dafür auszumachen bzw. zu ermitteln, unter welchen Bedingungen, was den Körper betrifft, eine solche (Ver-)Bindung zustande kommt. Das scheint indes die eigentliche Frage zu sein.91
Es ist merkwürdig, dass Sherrington dies schreibt, denn er wusste, dass die Frage, wie der Geist mit dem Körper interagieren könne, sich für Aristoteles nicht stellte. Innerhalb des aristotelischen Denkrahmens (siehe 1.1) ist eben diese Frage so unsinnig wie die Frage „Wie kann die Gestalt des Tisches mit dem Holz des Tisches interagieren?“ Offensichtlich ist dies keine Schwierigkeit, die uns Aristoteles mit seiner Philosophie hinterlassen hätte. Die Schwierigkeit tauchte im Rahmen von Platos dualistischer Philosophie auf, die von Aristoteles angefochten wurde, dennoch aber den Neuplatonismus anregte und durch die Vermittlung des hl. Augustinus zunehmend das christliche Denken dominierte. Thomas von Aquin übernahm allerdings die aristotelische Psychologie und eiferte mit fragwürdiger Inbrunst danach, sie der christlichen Theologie anzupassen. Der platonische Dualismus blieb jedoch die Konzeption, die dem populären Christentum am nächsten stand, und er inspirierte die Renaissance-Variante des Neuplato91
C. S. Sherrington, The Integrative Action of the Nervous System (Cambridge University Press, Cambridge, 1947), S. xxiii.
58
2 Kortex und Geist bei Sherrington
nismus. Das Verhältnis zwischen Geist und Körper stellt für jede Form des Dualismus ein außerordentliches Problem dar, und mit der Dominanz von Descartes im 17. Jahrhundert und dem gleichzeitigen Niedergang der aristotelischen Philosophie kam das Interaktionsproblem wieder auf die Tagesordnung, und dort befindet es sich noch immer. Sherrington über die Irreduzibilität des Geistigen Sherrington hat zu seiner Lösung nichts beigetragen. Er stellte fest, dass die Wissenschaft nicht imstande war, es zu lösen: Das Leben selbst [. . .] hat sich in einen Komplex materieller Faktoren aufgelöst; das ganze Leben bis auf ein Element. Vor ihm kam die Wissenschaft zum Stehen und starrte darauf wie auf einen unerwarteten Rest, der übrig blieb, nachdem ihr ‚Lösemittel‘ alles andere zersetzt und zergliedert hatte. Das seine Welt in den Blick nehmende Wissen war schmerzhaft und nicht ohne den Verlust mancher Illusion bei zwei Begriffen angelangt; der eine, der der Energie, reichte hin, um mit allem fertig zu werden, was dem Wissen bekannt war, den Geist ausgenommen. Über das „Wie“ des Gebens und Nehmens von Energie und Geist vermochte die Wissenschaft jedoch keinen Aufschluss zu geben [. . .] Dem menschlichen Verstehen bot sich die Welt hartnäckig als doppelte dar. (MN 200)
Das Leben und die Lebensprozesse waren, wie Sherrington beobachtete, durch Physik und Chemie erklärbar, aber „das Denken entwischt und verhält sich den Naturwissenschaften gegenüber weiterhin widerspenstig. Diese weisen es sogar als etwas außerhalb ihres Horizonts Liegendes ab“ (MN 229). Was natürlich nicht wahr ist. Denn die Psychologen sind in der Lage, das Denken zu erforschen, und sie tun es auch – es ist in keiner Hinsicht ‚außerhalb ihres Horizonts‘ angesiedelt. Allerdings meinte Sherrington offenkundig etwas anderes, nämlich dass Denken und Gedanken nicht auf Physik und Chemie reduzierbar sind. Er schrieb: „Das Wenige, was ich über das Wie des einen [d. h. des Gehirns] weiß, hilft mir ehrlich gesagt noch nicht einmal, um mit dem Verstehen des Wie des anderen [d. h. des Geistes] auch nur anzufangen. Was ich auch tun mag, sie bleiben hartnäckig für sich. Mir scheint, dass sie verschiedenartig sind, nicht austauschbar, dass der eine sich nicht in den anderen übersetzen lässt“ (MN 247). Was die Verneinung der Möglichkeit strenger Reduzierbarkeit angeht, hat er jedenfalls vollkommen Recht (siehe unten 13.1). Sherrington über die Geist-Körper-Interaktion Sherringtons Konzeption der Interaktion von Geist und Körper war eine cartesianische (wenn er sich auch nicht wie Descartes auf die Zirbeldrüse als Ort der Wechselwirkung festlegte). Ich würde sagen, dass wir die Verknüpfung akzeptieren und dass wir sie als Interaktion verstehen müssen; Körper Þ Geist. Makrokosmos ist ein Terminus, der möglicherweise eine zu
2.2 Edgar Adrian
59
mittelalterliche Konnotation aufweist, um hier verwendet zu werden: Ersetzen wir ihn durch ¬ Körper ® ¬ Geist. Die Sonnenenergie ist Teil des ge‚Umfeld‘, dann erhalten wir Umfeld ® schlossenen Energiekreislaufs. Welchen Einfluss kann sie auf den Geist haben? Sogar durch meine Retina und mein Gehirn vermag sie auf meinen Geist einzuwirken. Das theoretisch Unmögliche geschieht. Kurz und gut, ich behaupte, dass sie auf meinen Geist einwirkt. Andererseits denkt mein denkendes ‚Selbst‘, dass es meinen Arm zu beugen vermag. Die Physik teilt mir mit, dass mein Arm nicht gebeugt werden kann, ohne dass sich das auf die Sonne auswirkt. Mein Geist beugt meinen Arm mithin nicht. Wenn er es täte, geschähe das theoretisch Unmögliche. Lassen Sie mich doch denken, dass das theoretisch Unmögliche geschieht. Diesem zum Trotz gehe ich davon aus, dass mein Geist meinen Arm tatsächlich beugt und dass sich das auf die Sonne auswirkt. (MN 248)
Und er endete: „Reversible Interaktion zwischen dem ‚Ich‘ und dem Körper scheint mir insofern ein gültiger Schluss zu sein, als er auf Evidenz beruht“ (MN 250). Wir haben es hier mit einer schwerwiegenden Konfusion zu tun – denn nicht ‚das Ich‘ bewegt meinen Arm, wenn ich meinen Arm bewege; allerdings auch nicht mein Geist. Ich mache das – und ich bin weder mein Geist, noch bin ich ein ‚Selbst‘, ein ‚Ego‘ oder ‚ein Ich‘. Ich bin ein menschliches Wesen. Und nicht ‚mein denkendes Selbst‘ oder mein Geist denkt, es/ er könne meinen Arm beugen; vielmehr denke ich, dieses menschliche Wesen, dass ich meinen Arm beugen kann, was ich für gewöhnlich auf eine Bitte hin auch tue. Sherrington war bewundernswert aufrichtig zuzugeben, dass er sich vor ein Rätsel gestellt sah. Es ging ihm allerdings nicht auf, dass die Schwierigkeiten von einem Begriffswirrwarr herrühren – nicht von empirischer Unwissenheit. Und er übersah die Revolution in der Philosophie, die zeitgleich in Cambridge im Gange war und die ihn in die Lage versetzt hätte, aus seinen Verirrungen herauszufinden. Seine missliche Lage war der von Descartes 300 Jahre früher nicht unähnlich. Als alter Mann gestand der große Philosoph und Wissenschaftler in einem Schreiben an Prinzessin Elisabeth von Böhmen, die ihn gefragt hatte, wie eine denkende Seele die Lebensgeister in Bewegung versetzen könne, dass „ich wahrlich sagen kann, was Eure Hoheit vorbringen, scheint mir die Frage zu sein, die zu stellen die Menschen angesichts meines veröffentlichten Werks das größte Recht haben“.92
2.2 Edgar Adrian: Zaudernder Cartesianismus Adrians Leistung Edgar Douglas Adrian (1889–1977) war ein viel jüngerer Zeitgenosse Sherringtons, mit dem er sich 1932 den Nobelpreis teilte. Adrians Werk kann in gewisser Hinsicht als Ergänzung des Sherrington’schen Werks begriffen werden. Denn es liefert eine Darstellung 92
Descartes, Brief an Prinzessin Elisabeth von Böhmen, datiert vom 21. Mai 1643.
60
2 Kortex und Geist bei Sherrington
der elektrischen Aktivität in sowohl motorischen als auch sensorischen Nervenfasern, die mit den Reflexhandlungen und anderen Integrationstätigkeiten des Nervensystems einhergeht. Adrian zeigte, dass es nur eine Art des Aktionspotenzials in den Nervenfasern gibt, unabhängig davon, ob es sich bei diesen nun um motorische oder sensorische handelt. Außerdem wies er nach, dass die Kontraktionskraft und die Empfindungsintensität graduell abgestuft sind, und zwar aufgrund der unterschiedlichen Frequenzen des in den Nerven feuernden Aktionspotenzials und wegen der Veränderungen der Zahl der feuernden Nervenfasern. Später richtete er seine Aufmerksamkeit auf die Ursprünge der elektrischen Schwingungen im Gehirn und etablierte die Vorstellung, dass der Berger-Rhythmus aus dem okzipitalen Teil des Kortex stammt. Seine Abneigung gegenüber der Spekulation Die Frage, wie das Gehirn mit dem Geist zusammenhängt, bereitete Adrian nicht weniger Kopfzerbrechen als anderen. Im Gegensatz zu Sherrington widerstrebte es ihm jedoch, über die Geistesnatur zu spekulieren oder über die Frage, wie Gehirnaktivitäten sich zu geistigen Phänomenen verhalten. Darum gibt es seinerseits auch nur wenige, zudem sehr zurückhaltend formulierte Überlegungen zu solchen Fragen, die dennoch begutachtet zu werden verdienen, werfen sie doch Fragen auf, von denen sich Neurowissenschaftler noch immer in die Irre führen lassen. Obwohl sich Adrian nicht auf den cartesianischen Dualismus festlegte, haben sich cartesianische Elemente in seine verhalten formulierten und tastend voranbewegenden Darlegungen eingeschlichen, wie wir sehen werden. Die ‚Mensch-Maschine‘ und das Ego In seiner Vorlesung über Bewusstsein von 1965 führte Adrian aus, dass es Naturwissenschaftler allgemein bevorzugen, sich in solchen Fragen wie der nach dem Verhältnis zwischen Geist und Materie nicht festzulegen. Er räumte allerdings ein, dass es für Physiologen schwierig ist, eine solche geradezu olympische Zurückhaltung zu wahren. Jeder Neurowissenschaftler, der sich mit der Erforschung der Sinnesorgane und des Zentralnervensystems befasst, kommt kaum um die Probleme herum, die seit jeher treue Begleiter des Versuchs sind, physische Ereignisse und Abläufe im Körper mit geistigen Aktivitäten in Beziehung zu setzen. Das ganze Ausmaß des Problems kommt am prägnantesten in dem Gedanken zum Ausdruck, dass es laut Adrian möglich sein könnte, ein mechanisches menschliches Wesen zu konstruieren, das sich genau so verhalten würde, wie wir es tun. Denn die „universale Turingmaschine“, bemerkte er launig, könne „ihr Band zu jedem Problem hinwenden“ und eine ‚Mensch-Maschine‘ könnte so programmiert werden, dass sie alles das tut, was wir tun können. Dabei bliebe jedoch etwas auf der Strecke, nämlich „wir selbst, unser Ego, das Ich, das wahrnimmt, denkt und handelt, die Person,
2.2 Edgar Adrian
61
die sich ihrer Identität und Umgebung bewusst ist“.93 Wir sind überzeugt, bemerkte Adrian, dass wir ein unmittelbares Bewusstsein von uns selbst haben und dass das etwas ist, das eine Maschine nicht kopieren könnte. Adrians zaudernder Cartesianismus Dieser Gedanke ist selbstverständlich durch und durch cartesianisch. Nach Descartes ist es das Bewusstsein, das den Menschen vom mechanischen Lebewesen unterscheidet. Descartes ließ das Bewusstsein im Selbstbewusstsein aufgehen. Denn er war der Ansicht, dass Denken – als das wesentliche Attribut des Geistes – definiert ist als „alles, was derart in uns geschieht, dass wir uns seiner unmittelbar aus uns selbst bewusst sind“. Bekanntermaßen ging Descartes davon aus, dass die Grundlage allen Wissens das Bewusstsein einer jeden Person ist, das sie von ihren eigenen Gedanken hat, und demzufolge ihr nicht bezweifelbares Wissen darum, dass sie existiert. In dieser Hinsicht folgte Adrian Descartes, denn er stellte fest: Ich habe die Kluft zwischen Geist und Materie für einen angeborenen Glauben gehalten. Mittlerweile erkenne ich ganz bereitwillig an, dass ich sie [diese Vorstellung] in der Schule oder später erworben habe. Es fällt mit allerdings schwerer, mein Ego als etwas zu betrachten, das derart aus zweiter Hand stammt. Dass ich existiere, halte ich für sicherer, als dass Geist und Materie verschieden sind. Von den Geistesgestörten abgesehen, die ‚um den Verstand gebracht‘ sind, begegnet man niemandem, der nicht an seine Eigenständigkeit glaubt, obwohl es viele gibt, die nicht an die Trennung von Geist und Materie glauben. Der Glaube an die eigene Existenz scheint dem Einfluss des Willens kaum zu unterliegen.94
Außerdem sind, fuhr Adrian fort, „Introspektionen fast alles, was wir haben, fast alles, was uns bei der Erforschung des menschlichen Egos die Richtung vorgeben kann“. Die ‚Introspektionen‘ enthüllen uns voraussichtlich die sensorischen, wahrnehmungsbezogenen und emotionalen Bewusstseinsinhalte. Diese (Fehl-)Konzeption stimmt mit der altehrwürdigen von Descartes und den britischen Empiristen überlieferten Tradition überein (siehe 3.6). Es handelt sich bei ihr um eine allgemeine (Fehl-)Konzeption, die für einen Großteil des neurowissenschaftlichen Nachdenkens über diese Themen noch immer charakteristisch ist und besonders bei jenen Neurowissenschaftlern Zustimmung findet, die davon ausgehen, dass es sich bei ‚Qualia‘ um das Kennzeichen des bewussten Lebens handelt – ein Merkmal, das irreduzibel ‚geistig‘ zu sein scheint (für eine detaillierte Erörterung von Qualia siehe 10.3–10.3.5).
E. D. Adrian, ‚Consciousness‘, in J. C. Eccles (Hg.), Brain and Conscious Experience (Springer Verlag, Berlin und New York, 1966), S. 240. 94 Ibid., S. 241. 93
62
2 Kortex und Geist bei Sherrington
Adrians Verwirrungen, das Ego betreffend Adrian war überaus zurückhaltend, wenn es darum ging, sich auf irgendeine bestimmte Lehre festzulegen, die die Natur dessen betraf, was er ‚unser Ich‘ nannte. Er zitierte den Neurologen Francis Schiller, der 1951 behauptete, dass das Bewusstsein eine ‚logische Konstruktion‘ ist und das Ich „eine zweckdienliche Abkürzung, eine Kurzfassung der Objektmannigfaltigkeit, aus der heraus es sich entwickelt“ – das „scheint mir eine vernünftige und anstrebenswerte Position zu sein“,95 betonte er nachdrücklich. Denn seiner Ansicht nach ist „der Psychologe [. . .] nicht gezwungen, das altmodisch anmutende Bild von sich als ein mit Bewusstsein und einem eigenen Willen ausgestattetes Individuum zu verwerfen“, denn diese Position misst der introspektiven als auch der physiologischen Darstellung eine gewisse Plausibilität bei, während sie einräumt, dass beide unvereinbar sind. Das heißt Adrian zufolge, dass die beiden Darstellungs- bzw. Zugangsweisen im Laufe der Zeit in Einklang gebracht werden müssen. Aus seiner Sicht wäre es jedoch absurd anzunehmen, dass die wissenschaftliche Darstellungsform Bestand haben wird, ohne sich zu verändern. Erwähnung verdient, dass diese (im Wesentlichen russellsche) Konzeption zur cartesianischen Auffassung des Ich, die Adrian zuvor billigte, in Widerspruch steht. Man darf wohl vermuten, dass Adrian nicht klar war, was der von Russell herrührende Fachterminus ‚logische Konstruktion‘ ausdrücken soll. Denn wenn das Bewusstsein eine logische Konstruktion ist und das Ich eine zweckdienliche Abkürzung, dann ist das unmittelbare Bewusstsein vom Selbst, das Adrian bestätigt, eine ebensolche Täuschung wie die unmittelbare Bekanntschaft mit dem Durchschnittsmenschen (der Durchschnittsmensch ist unstrittig eine logische Konstruktion). Das ‚Ich‘ und das ‚Selbst‘ betreffende Konfusionen werden uns in Kapitel 12 beschäftigen.
2.3 John Eccles und das ‚Liaisongehirn‘ Eccles’ Leistung Nach dem Medizinstudium an der Melbourner Universität ging John Eccles (1903– 1997) als Student im Aufbaustudium 1925 nach Oxford, um mit Sherrington zu arbeiten, der zu dieser Zeit gemeinsam mit Liddell an der Erforschung der Charakteristika des Dehnreflexes und mit Creed zum Beugereflex arbeitete. Seine erste experimentelle Arbeit unternahm Eccles mit Creed, und zwar zu dem Thema, unter dessen Zeichen seine Forschung mehr als vierzig Jahre lang stehen sollte: dem Mechanismus inhibitorischer synaptischer Übertragung. Nach der Erlangung des Doktorgrades 1929 schloss er sich Sherringtons Forschungsgruppe an und entwickelte eine technische Neuerung des 95
Ibid., S. 246.
2.3 John Eccles
63
Torsion-Myographs im Hinblick auf eine Gemeinschaftsarbeit, die sich mit der Erforschung des Beugereflexes und seiner Hemmung befasste. Diese Experimente werden die wissenschaftliche Genialität des mittlerweile 75-jährigen Sherrington ein letztes Mal zum Erblühen bringen. Die Arbeit über den ipsilateralen spinalen Beugereflex machte Eccles mit der Technik der Nervenstimulation bekannt, die zunächst mit einem dem Schwellenwert genau entsprechenden Stromstoß einherging, dem bei späteren Durchläufen eine Test-Salve nachfolgte, um den zeitlichen Verlauf der zentralen exzitatorischen und inhibitorischen Zustände zu ermitteln. Angewandt auf die Übertragungsmechanismen im Rückenmark lieferte diese Herangehensweise sehr präzise Messergebnisse bezüglich des zeitlichen Verlaufs der zentralen exzitatorischen und inhibitorischen Zustände bzw. des, wie wir heute wissen, exzitatorischen und inhibitorischen postsynaptischen Potenzials. Dieses wurde von Eccles und seinen Kollegen ungefähr zwanzig Jahre später nachgewiesen, als ihnen die ersten intrazellulären Ableitungen des postsynaptischen Potenzials in Motoneuronen gelangen. Die folgenden, intrazelluläre Elektroden verwendenden Untersuchungen der inhibitorischen postsynaptischen Übertragung wurden von Eccles und seinen Kollegen auf sukzessiv höheren Ebenen des Zentralnervensystems durchgeführt. Sie lieferten eine funktionelle Mikroanatomie der synaptischen Verbindungen in Kleinhirn, Thalamus und Hippocampus. Auf diese Weise vervollständigte Eccles das Forschungsprogramm, das Sherrington ein halbes Jahrhundert zuvor in The Integrative Action of the Nervous System beschrieben hatte. Eccles’ Interesse für das Gehirn-Geist-Problem Eccles wendete sich den Neurowissenschaften aufgrund einer inspirierenden Erfahrung zu, die er im Alter von 18 Jahren gemacht hatte, die sein Leben veränderte und in ihm ein starkes Interesse für das Gehirn-Geist-Problem wachrief.96 Von der in den 1960er Jahren geleisteten Arbeit R. W. Sperrys und seiner Kollegen zu den Folgen der Hemisphärektomie offenkundig ermuntert, wendete er sich in den 1970er Jahren schließlich den philosophischen Fragen seiner Jugend zu, zuerst in The Self and its Brain (1977), ein gemeinsam mit Karl Popper verfasstes Buch, und danach in seinen Gifford Lectures von 1977/8, veröffentlicht 1984 in The Human Mystery. Er eröffnete seine Vorlesungen mit einer schönen Geste, indem er den vierzig Jahre früher gehaltenen Gifford Lectures Sherringtons seine Anerkennung aussprach. Eccles bemerkte, dass das zentrale Anliegen von Man on his Nature darin bestand, eine Form des Dualismus zu verteidigen – eine Konzeption, die die etablierte Philosophie in den 1970ern ablehnte. Eccles bewunderte den dualistischen Ansatz dennoch zutiefst; darüber hinaus glaubte er, dass er experimentell bestätigt worden sei, einerseits durch die Arbeit Kornhubers über das im Vorfeld einer intentionalen Handlung im zerebralen Kortex erzeugte Aktionspotenzial, an96
J. C. Eccles, in K. R. Popper und J. C. Eccles, The Self and its Brain (Springer Verlag, Berlin, 1977), S. 357 [dt. Das Ich und sein Gehirn (Piper, München, 2002), S. 430].
64
2 Kortex und Geist bei Sherrington
dererseits durch Sperrys Arbeit über Split-Brain-Patienten. Mithin zielte er in seinen eigenen Vorlesungen darauf, Sherringtons Konzeption zu verteidigen, „das Gehirn-GeistProblem genauer zu bestimmen“97 und die neuesten Ergebnisse der Neurowissenschaften bezüglich des Problems zur Sprache zu bringen. Poppers Einfluss Der allgemeine Rahmen für Eccles’ Reflexionen wurde von Poppers Wiederbelebung einer falsch konzipierten Vorstellung Gottlob Freges,98 des großartigen Vertreters der mathematischen Logik aus dem 19. Jahrhundert, vorgegeben. Frege unterschied zwischen der wahrnehmbaren ‚Außenwelt‘ der physischen Objekte, der privaten ‚Innenwelt‘ der geistigen Entitäten und einem ‚dritten Bereich‘ der Gedanken (Propositionen), die von den Sinnen nicht wahrzunehmen, der Allgemeinheit aber dennoch zugänglich sind und von ihr verwendet werden können. Popper folgte dem Beispiel und unterschied zwischen der Welt 1 der physischen Dinge, der Welt 2 der geistigen Dinge und der Welt 3 der Gedanken, Theoreme, Theorien und anderen Abstraktionen. Diese Konzeption ist verworren: Denn obwohl wir zwischen materiellen Objekten und geistigen Zuständen und beide von Propositionen oder Theoremen unterscheiden, konstituieren diese nicht kollektiv ‚Welten‘, in welchem Sinn auch immer. Außerdem sind weder Geisteszustände noch Propositionen Bewohner einer eigenen ‚Welt‘. Es gibt nur eine Welt, die durch die Beschreibung dessen, was auch immer (zufällig) der Fall ist, zur Darstellung gelangt. Wir sprechen in der Tat von den menschlichen Geisteszuständen der Heiterkeit oder Niedergeschlagenheit oder davon, dass jemand Zahnschmerzen hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Heiterkeit, die Depression oder der Zahnschmerz in einer ‚inneren Welt‘ abgetrennt existierende geistige Entitäten sind. Diese Nomen (‚Heiterkeit‘, ‚Depression‘, ‚Zahnschmerz‘) eröffnen lediglich eine umwegige Möglichkeit des Sprechens über Menschen, die heiter oder depressiv sind, und darüber, dass ihre Zähne wehtun – es werden keine neuen Entitäten eingeführt, nur neue Wege des Sprechens über existierende Entitäten beschritten (z. B. über Menschen und darüber, wie es um sie bestellt ist). Und wir sprechen ebenso von Propositionen, Theoremen und anderen Abstraktionen – aber auch dabei führen wir nur scheinbar neue Entitäten ein, in Wahrheit handelt es sich bloß um eine zweckdienliche Möglichkeit, darüber zu sprechen, was gesagt wird oder gesagt werden könnte, was behauptet oder bewiesen wird bzw. behauptet oder bewiesen werden könnte. Es besteht absolut keine Veranlassung, dem Platonismus das Feld zu überlassen und neue existierende Entitäten und Welten, die sie bewohnen können, aus dem Hut zu zaubern. Wenn man sagt, dass Ausdrücke für ‚abstrakte 97
Eccles, Human Mystery, S. 3 [dt. Das Rätsel Mensch, S. 3f.]. Im Text in der Folge abgekürzt als HM. 98 Gottlob Frege, ‚Der Gedanke. Eine logische Untersuchung‘, ‚The thought‘, in seinen Collected Papers on Mathematics, Logic and Philosophy (Blackwell, Oxford, 1984), S. 351–372.
2.3 John Eccles
65
Entitäten‘ stehen, gibt man auf irreführende Weise zu verstehen, dass Ausdrücke, die den Eindruck erwecken, als stünden sie für konkrete Entitäten, nicht für sie stehen, sondern ganz andere Funktionen erfüllen. Was selbstverständlich nicht bedeutet, dass es keine Geisteszustände gibt, keine Heiterkeit, Depression oder Angst oder dass es keine Propositionen, keine Theorien oder Theoreme gibt. Im Gegenteil, es bedeutet, dass es sie gibt – nur handelt es sich bei ihnen nicht um Entitäten, welcher Art auch immer. Poppers 3-Welten-Theorie beeindruckte Eccles und er formulierte seinen Dualismus in Bezug auf sie. Welt 1, die materielle kosmische Welt, besteht seiner Erklärung nach aus rein materiellen Dingen und aus Wesen, die in den Genuss von Geisteszuständen kommen. Auf diese, die eine Teilmenge der Entitäten in Welt 1 bilden, bezieht er sich summarisch als ‚Welt 1M‘. Diese ‚Welt‘ interagiert reziprok kausal mit Welt 2, und zwar anhand dessen, was er ‚das Liaisongehirn‘ nennt (HM 211, dt. 207). Der Einfluss von Kornhubers Forschung zum Bereitschaftspotenzial auf Eccles Die von Kornhuber und seinen Kollegen betriebene Forschungsarbeit zu Veränderungen in dem einer Willenshandlung vorhergehenden elektrischen Potenzial hatte enthüllt, dass das sogenannte Bereitschaftspotenzial bis zu 800 Millisekunden vor dem Einsetzen des Muskel-Aktionspotenzials begann und zu einem stärkeren Potenzial führte, der prämotorischen Positivierung, das 80–90 Millisekunden vor der Bewegung in Erscheinung trat. Die Muster der neuronalen Entladungen projizieren schließlich auf die entsprechenden Pyramidalzellen des Motorkortex und regen diese über die Synapsen dazu an, sich zu entladen, derart geht die Erzeugung des motorischen Potenzials (eine örtlich begrenzte negative Welle) der Entladung der motorischen Pyramidalzellen, welche die Bewegung auslöst, unmittelbar voraus. Die Frage, zu deren Beantwortung Kornhuber mit seiner Forschung beizutragen schien, lautete: „Wie kann das Wollen einer Muskelbewegung neuronale Ereignisse in Gang setzen, die zur Entladung der Pyramidalzellen des Motorkortex und somit zur Aktivierung der Nervenbahnen führen, die die Muskelkontraktion veranlassen?“ (HM 214, dt. 210). Es ist bemerkenswert, dass Eccles diese Entdeckungen als Vorboten der empirischen Bestätigung einer Form der Geist-Gehirn-Interaktion auffasste, die von Descartes ins Auge gefasst (jedoch anderswo verortet) worden war. Er argumentierte folgendermaßen: Was geschieht in meinem Gehirn zu dem Zeitpunkt, da die gewollte Handlung gerade ausgeführt wird? Man kann vermuten, dass sich während des Bereitschaftspotenzials ein spezifisches Impulsentladungsmuster in den Neuronen herausbildet, sodass schließlich die Pyramidalzellen in den entsprechenden motorischen Kortexzentren für die Hervorbringung der gewünschten Bewegung aktiviert werden. Das Bereitschaftspotenzial kann als das neuronale Korrelat der Willensabsicht aufgefasst werden. Das Erstaunliche am Bereitschaftspotenzial ist, dass es sich weit ausbreitet und langsam entwickelt. Offensichtlich übt in diesem Stadium des Wollens einer Bewegung der selbstbewusste Geist einen ausgedehnten Einfluss auf die Muster der Modulaktivität aus. Schließlich wird die gewaltige neuronale Aktivität so geformt und ge-
66
2 Kortex und Geist bei Sherrington lenkt, dass sie sich auf die Pyramidalzellen in den für die Ausführung der gewünschten Bewegung zuständigen Zonen des Motorkortex konzentriert. Die Dauer des Bereitschaftspotenzials lässt darauf schließen, dass die lange Inkubationszeit, die der selbstbewusste Geist benötigt, um Entladungen in den motorischen Pyramidalzellen hervorzurufen, die aufeinanderfolgende Aktivierung einer großen Zahl von Modulen umfasst. [. . .] Es ist charakteristisch, dass der selbstbewusste Geist nicht mit entschlossen fordernder Stärke auf das Gehirn wirkt. Er nimmt eher tastend und subtil Einfluss – sein Einfluss braucht Zeit, um Aktivitätsmuster auszuprägen, die, während sie sich entwickeln, verändert werden können. (HM 217, dt. 212f.)
Zusammenfassung der cartesianischen Probleme 1. Interaktion Eccles sah also in der, wie er sagte, „dualistisch-interaktionistischen Hypothese“ ein Hilfsmittel, um „das Erklärungsproblem der langen Dauer des einer willkürlichen Bewegung vorausgehenden Bereitschaftspotenzials lösen und neu definieren“ zu können (HM 217, dt. 213). Wie dargelegt vermutete Descartes, dass der Geist auf der Zirbeldrüse operiert, um die Kleinstbewegungen in den Lebensgeistern (das Äquivalent der neuralen Transmitter) in dem Ventrikel zu erzeugen, wo die Zirbeldrüse sich seiner Ansicht nach schwebend hielt. Das, so meinte er, ermöglicht es den Willensakten des Geistes, Einfluss auf die Bewegungen der Lebensgeister zu nehmen, die dann zu den Muskeln übertragen werden. Die Frage, wie eine immaterielle Substanz mit einem materiellen Objekt wie der Zirbeldrüse tatsächlich kausal interagieren könnte, um die entsprechenden Kleinstbewegungen hervorzubringen, blieb jedoch gänzlich unbeantwortet. Eccles ging ganz ähnlich davon aus, dass ‚der selbstbewusste Geist‘ mit den Pyramidalzellen des Motorkortex in einem kausalen Interaktionszusammenhang steht und sie schrittweise (und nicht unverzüglich) dazu bringt, sich zu entladen. Auf die Frage, wie eine immaterielle Entität wie der Geist kausal mit Neuronen interagieren könne, blieb er gleichfalls die Antwort schuldig. 2. Verdinglichung des Geistes Beide Denker irrten darin, den Geist als eine Art Entität bzw. Ding auszuweisen. Wären sie Aristoteles gefolgt, der den Geist nicht als eine Entität, sondern als ein Spektrum an Vermögen oder Potenzialen dachte, wären sie der Wahrheit nähergekommen und hätten sich nicht in die unlösbaren Probleme der Interaktion verstrickt. Denn es ergibt offenkundig keinen Sinn zu fragen, wie unsere Fähigkeiten, all die unterschiedlichen Dinge zu tun, die wir tun können, mit unserem Gehirn interagieren.
2.3 John Eccles
67
3. Den Willen betreffende Fehlkonzeptionen Beide Denker irrten darin, die willkürlichen Bewegungen als Bewegungen auszuweisen, die von vorhergehenden Willensakten herrühren bzw. verursacht werden.99 Denn obgleich es so etwas wie Willensakte [acts of will] gibt – solche nämlich, die wir unter großen Anstrengungen vollbringen, um unseren Widerwillen zu überwinden, unsere Aversion oder die Schwierigkeiten, in ungünstigen Umständen zu agieren –, gehen die allermeisten unserer gewöhnlichen Willenshandlungen [voluntary actions] offenkundig gar nicht mit ‚Willensakten‘ in diesem Sinne einher. Wir werden diese Konzeption in Kapitel 8 untersuchen. Eccles war zudem über das Objekt des angeblichen Willensaktes verwirrt, das er wechselnd als (i) eine Muskelbewegung, (ii) eine Handlung, (iii) eine Bewegung einer Extremität charakterisierte. Das Objekt des angeblichen Willensaktes betreffende Verwirrungen Selbstverständlich ist es möglich, eine Bewegung zu beabsichtigen – einen Muskel zu beugen beispielsweise; das ist jedoch etwas, das wir ziemlich selten zu tun beabsichtigen, und obgleich sämtliche unserer entschiedenen physischen Akte (im Unterschied zu den unterlassenen und den geistigen) mit Muskelbewegungen einhergehen, haben wir es bei dem, was wir beabsichtigen und was wir willentlich durchführen, mit Handlungen zu tun (wie den Arm heben, einen Brief schreiben, etwas sagen, ein Buch aufheben und eines lesen etc.) und nicht mit den konstitutiven Muskelbewegungen dieser Handlungen, derer wir uns überwiegend nicht bewusst sind. Es ist jedoch leicht einzusehen, weshalb ein dem Dualismus erliegender Neurowissenschaftler die Objekte des Willens wohl durcheinanderbringen wird. Denn laut dualistischer Konzeption muss der Geist das Gehirn kausal beeinflussen und müssen die Verursachungskräfte, die im Gehirn neurale Ereignisse hervorbringen, die Muskelkontraktion kausal bewirken. Die die willensmäßige Interaktion von Geist und Gehirn betreffenden Probleme Daraus erwächst dem Dualismus ein weiteres unlösbares Problem. Angeblich beeinflusst der ‚selbstbewusste Geist‘ die Muster der Modul-Operation, indem er sie formt und lenkt, sodass diese sich auf die Pyramidalzellen in genau den Zonen des Motorkortex konzentriert, die für die Ausführung der beabsichtigten Bewegung zuständig sind. Wie aber weiß der ‚selbstbewusste Geist‘, auf welche Pyramidalzellen er sich konzentrieren soll, und wie wählt er die richtigen Zonen des Motorkortex aus? Denn um solche Leistungen erbringen zu können, bräuchte er ein solches Wissen. Und es ist bestimmt 99
Dieser Irrtum ist unter Neurowissenschaftlern noch immer weit verbreitet und durchdringt die Forschung Benjamin Libets und seiner Kollegen; das erörtern wir weiter unten (siehe 8.1–8.2).
68
2 Kortex und Geist bei Sherrington
kein Wissen, dessen sich der selbstbewusste Geist bewusst ist. Diese Fragen kann man nicht beantworten, genauso wenig wie die innervationistischen ideomotorischen Theorien der Willkürbewegung aus dem 19. Jahrhundert, die von solch bedeutenden Wissenschaftlern wie Helmholtz und Mach (und Psychologen wie Bain und Wundt) favorisiert wurden, die Frage beantworten konnten, wie der Geist – der zudem über Bilder von kinästhetischen Empfindungen verfügen soll, mit denen die Willkürbewegung angeblich einhergeht – die Energieströme so lenkt, dass sie vom Gehirn aus ihren Weg zu den Muskeln finden. (Es muss entsprechende Gefühle der Innervation geben – des ‚Anstoßes‘ oder der ‚Wollensenergie‘, dachten sie, ansonsten könnte der Geist nicht erkennen, welcher besondere Energiestrom, ob der zu diesem Muskel oder der zu jenem, der richtige ist.) Eccles’ Konzeption der Auswirkungen von Sperrys Entdeckungen hinsichtlich der Resultate der Split-Brain-Operationen Ein zweiter empirischer Forschungsbeitrag ermutigte Eccles, seine Anwaltschaft für den interaktionistischen Dualismus fortzusetzen. Sperrys Entdeckungen, die die Fähigkeiten von Split-Brain-Patienten betrafen, waren eindrucksvoll. Er selbst bediente sich ihrer, um einer gewissen Form des Geist-Gehirn-Interaktionismus eine Rechtfertigung zu verschaffen: Bewusste Phänomene sind diesem Entwurf nach etwas, das mit den physiochemischen und physiologischen Aspekten der Gehirnprozesse interagiert und sie weitgehend beherrscht. Da dies offensichtlich auch in der entgegengesetzten Richtung geschieht, haben wir es mit einer wechselseitigen Interaktion zwischen den physiologischen und den geistigen Eigenschaften zu tun. Dennoch würden diejenigen, die aktuell über die Deutungshoheit verfügen, den Geist tendenziell in seine alten Rechte gegenüber der Materie wiedereinsetzen, in dem Sinne, dass die geistigen Phänomene als solche betrachtet werden, die die physiologischen und biochemischen Phänomene transzendieren.100
Es überrascht darum nicht, dass Eccles vermutete, Sperrys Arbeit hätte dramatische Auswirkungen. „Ich behaupte“, schrieb er, „dass sich das philosophische Geist-GehirnProblem durch die Untersuchungen der Funktionen der getrennten dominanten und untergeordneten Hemisphären bei den Split-Brain-Patienten verändert hat“ (HM 222, dt. 218). Eccles vertrat die Auffassung, die „bemerkenswerteste Entdeckung“ sei die, dass sämtliche neurale Aktivitäten der rechten Hemisphäre „dem sprechenden Subjekt unbekannt sind, das nur mit den neuronalen in der linken [dominanten] Hemisphäre in Verbindung steht“. Zwar stellt die rechte Hemisphäre „ein sehr hoch entwickeltes Gehirn“ dar, sie kann „sich [jedoch] nicht sprachlich ausdrücken und ist also nicht imstande, irgendeine Bewusstseinserfahrung mitzuteilen, die wir erkennen können“. Er ar100
Zitiert von Eccles, ohne Angaben, in Popper und Eccles, Self and its Brain, S. 374 [dt. Das Ich und sein Gehirn, S. 449].
2.3 John Eccles
69
gumentierte, dass die Dominanz der linken Hemisphäre aufgrund ihrer verbalen und geistigen Fähigkeiten und „ihrer Liaison mit dem Selbstbewusstsein (Welt 2)“ zustande kommt (HM 220, dt. 215). Denn Sperrys Arbeit zeige, „dass sich nur eine spezialisierte Zone der zerebralen Hemisphären in Liaison mit dem selbstbewussten Geist befindet. Der Terminus Liaison-Gehirn bezieht sich auf all diejenigen Bereiche des zerebralen Kortex, die potenziell mit dem selbstbewussten Geist in unmittelbarem Zusammenhang stehen können“.101 Eccles’ Konzeption des Liaison-Gehirns und Descartes’ Konzeption der Zirbeldrüse im Vergleich Descartes dachte, dass Geist und Gehirn in der Zirbeldrüse und ausschließlich in ihr in Kontakt miteinander kommen und dass der Geist erfasst, was uns vor Augen steht, kraft der von beiden Augen kommenden Bilder, die in der Zirbeldrüse vereinigt werden. Eccles dachte, dass sich der Kontakt mit dem Geist im Liaison-Gehirn herstellt, wo die von den Sinnesorganen stammenden Nervenimpulse dem Geist gewissermaßen zugänglich gemacht werden. Zwischen beiden Positionen gibt es allerdings einen gravierenden Unterschied. Descartes ging davon aus, dass die Zirbeldrüse selbst – das heißt ein Teil des Gehirns – die Aufgabe des aristotelischen und scholastischen Sensus communis erfüllt, nämlich, die Daten der einzelnen Sinne zu synthetisieren und zu vereinigen. In dieser Hinsicht war sein Denken moderner als das von Eccles, da die Neurowissenschaftler in diesen Tagen ebenfalls davon ausgehen, dass das ‚Bindungsproblem‘ vom Gehirn gelöst wird (und nicht vom Geist).102 Denn Singers Entdeckungen103 der miteinander verknüpften oszillierenden ‚Feuersalven‘ in verschiedenen Teilen des Gehirns, mit denen eine Wahrnehmungserfahrung einhergeht, legen nahe, dass die Gleichzeitigkeit dieser vielfältigen neuronalen Aktivitäten und ihre Verbindungen zu anderen Arealen des Kortex notwendige Bedingungen dafür sind, dass ein Wahrnehmender die Art einheitlicher Wahrnehmungserfahrung haben kann, die Menschen eignet. Im Gegensatz dazu verteidigte Eccles die, wie er sagt, „strenge dualistische Hypothese“, dass der selbstbewusste Geist [. . .] lebhaft damit beschäftigt ist, aus der Vielzahl der aktiven Module auf den höchsten Gehirnebenen abzulesen, nämlich in den Liaison-Bereichen, die sich 101
Ibid., S. 358. Siehe z. B. F. Crick, The Astonishing Hypothesis (Touchstone, London, 1995), S. 22, 232 [dt. Was die Seele wirklich ist (Artemis & Winkler, München & Zürich, 1994), S. 41, 285], und E. Kandel und R. Wurtz, ‚Constructing the visual image‘, in Kandel, Schwartz und Jessell (Hg.), Principles of Neural Science (Elsevier, New York, 2001), S. 492, 502. (Das Bindungsproblem wird weiter unten in 4.2.3 erörtert.) 103 A. K. Engel, S. R. Roelfsema, S. Fries, M. Brecht und W. Singer, ‚Role of the temporal domains for response selection and perceptual binding‘, Cerebral Cortex, 6 (1997), S. 571–582. 102
70
2 Kortex und Geist bei Sherrington weitgehend in der dominanten Gehirnhälfte befinden. Der selbstbewusste Geist wählt je nach Aufmerksamkeit aus diesen Modulen aus und integriert das, was er ausgewählt hat, in jedem Augenblick, um selbst der flüchtigsten Erfahrung Einheitlichkeit zu verleihen. Darüber hinaus wirkt der selbstbewusste Geist auf diese Module ein und ändert damit die dynamischen raum-zeitlichen Muster der neuronalen Geschehnisse. Auf diese Weise übt er eine höhere interpretierende und regulierende Funktion hinsichtlich der neuronalen Geschehnisse aus, und zwar sowohl innerhalb der Module als auch zwischen ihnen. Ein Kerngedanke der Hypothese besagt, dass die Einheit der bewussten Erfahrung vom selbstbewussten Geist hervorgebracht wird und nicht von der Neuronenmaschinerie der Liaison-Bereiche des zerebralen Kortex. Bisher war es nicht möglich, irgendeine neurophysiologische Theorie zu entwickeln, die erklärt, wie die vielgestaltigen Geschehnisse im Gehirn schließlich derart zusammengefasst werden, dass eine einheitliche bewusste Erfahrung entsteht. [. . .] Meine Haupthypothese betrachtet die Neuronenmaschinerie als eine Mehrfachverschaltung aussendender und empfangender Strukturen (Module). Die erfahrene Einheit rührt nicht von einer neurophysiologischen Synthese her, sondern kommt aufgrund des postulierten Integrationsvermögens des selbstbewussten Geistes zustande. Ich vermute, die Raison d’être des selbstbewussten Geistes besteht in erster Linie darin, diese Einheit des Selbst in allen seinen bewussten Erfahrungen und Aktionen zu bewirken. (HM 227f., dt. 222f.)
Wie nimmt der Geist diese synthetisierende Aktivität (oder ‚Bindungsaktivität‘) auf? Eccles legte nahe, dass der Geist das gesamte Liaison-Gehirn auf eine selektive und vereinheitlichende Art und Weise ‚durchspielt‘. Als Analogie bietet sich ein Scheinwerfer an. Eine besserer Vergleich wäre vielleicht ein gewisser multipel abtastender und sondierender Apparat, der von den unermesslichen und verschiedenartigen Aktivitätsmustern im zerebralen Kortex abliest und aus ihnen auswählt, diese ausgewählten Komponenten integriert und sie auf diese Weise so anordnet, dass sich die Einheit der bewussten Erfahrung herstellt. [. . .] So vermute ich, dass der selbstbewusste Geist die Modulaktivitäten in den Liaisonzonen des zerebralen Kortex abtastet. [. . .] In jedem einzelnen Augenblick wählt er Module entsprechend seinen Interessen (den Aufmerksamkeitsphänomenen) aus und integriert aus all dieser Vielfalt die einheitliche bewusste Erfahrung selbst. (HM 229, dt. 224)
Vier Schwachstellen der Eccles’schen Konzeption Die Metaphern sind bemerkenswert und haben in der gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Theorie ihren Nachklang gefunden.104 Trotzdem hatten Sperrys EntdeSo nannte beispielsweise Crick seine Theorie der Aufmerksamkeit ‚die Scheinwerfer-Hypothese‘, weil, wie er behauptete, der retikulare Komplex und das Pulvinar nur einen kleinen Teil der Thalamus-Vorgänge dem Kortex zugänglich machen und diese Aktivität mit einem Scheinwerfer in Verbindung gebracht werden kann, der einen Teil des Kortex erhellt. Crick behauptete, dass der thalamische retikulare Komplex und das Pulvinar mit dem Gehirnstamm und mit kortikalen Mechanismen interagieren, um eine saliente Entscheidung herbeizuführen, wozu aktive neuro104
2.3 John Eccles
71
ckungen nicht die dramatischen Auswirkungen, die Eccles ihnen beimaß. Es gibt vier Schwachstellen in Eccles’ Konzeption, auf die wir die Aufmerksamkeit lenken wollen. 1. Die aus der Hemisphärektomie resultierenden Phänomene wurden falsch beschrieben Erstens wurden die Phänomene falsch beschrieben. Es sind nicht bloß die neuralen Aktivitäten der rechten Hemisphäre, von denen das Subjekt nichts weiß – alle Aktivitäten des Gehirns sind den Subjekten unbekannt, die schließlich nicht ihre eigenen Gehirne wahrnehmen (und, selbst wenn es denkbar wäre, keine Elektronenmikroskope als Augen haben). Es ist richtig, dass die rechte Hemisphäre ‚sich sprachlich nicht ausdrücken kann‘, genauso wenig wie das rechte Bein – denn solch einen Teil eines menschlichen Wesens, der ‚sich sprachlich ausdrückt‘, gibt es nicht (siehe 3.1–3.4). Und folglich kann auch die linke Hemisphäre ‚sich sprachlich nicht auszudrücken‘. Die rechte Hemisphäre ist nicht in der Lage, ‚irgendeine bewusste Erfahrung mitzuteilen‘, die wir erkennen können, weil es keinen untergeordneten Teil einer Person, der bei Bewusstsein ist, gibt. Wie in Kapitel 3 detailliert erörtert wird, sind nur menschliche Wesen (und andere Tiere) bei Bewusstsein (oder nicht bei Bewusstsein) und sich verschiedener Dinge bewusst (oder sich ihrer nicht bewusst) – nicht ihre untergeordneten Teile. Die linke Hemisphäre entbehrt ebenso ‚jedweder bewussten Erfahrung‘. Schließlich verfügt die linke Hemisphäre nicht über ‚verbale und geistige Fähigkeiten‘, obgleich die verbalen und geistigen Fähigkeiten normal veranlagter menschlicher Wesen vom normalen Funktionieren der linken Hemisphäre abhängen.105 2. Der ‚selbstbewusste Geist‘ ist keine wie auch immer geartete Entität Zweitens handelt es sich beim sogenannten selbstbewussten Geist nicht um eine Entität welcher Art auch immer, sondern um ein Vermögen der Menschen, die eine reflexive nale Gruppen durch das Scheinwerferlicht der Aufmerksamkeit ‚ins Bewusstsein gebracht‘ werden (F. Crick, ‚Function of the thalamic reticular complex: the searchlight hypothesis‘, Proceedings of the National Academy of Science USA, 81 (1984), S. 4586–5490). In ähnlicher Weise wurde von Weiskrantz in Verbindung mit seinen Untersuchungen des ‚Blindsehens‘ die Vorstellung von einem absuchenden Apparat oder ‚Überwachungsgerät‘ im Gehirn ins Feld geführt. Seiner Ansicht nach resultiert das Bewusstsein einer ‚normalsichtigen‘ Person in Bezug darauf, ob sie etwas im Gesichtsfeld sieht und was sie darin sieht, aus der Arbeit des neuralen Überwachungssystems. Bewusste Erfahrung ist nach Weiskrantz das Produkt der Überwachungsfunktion des Gehirns (L. Weiskrantz, ‚Neuropsychology and the nature of consciousness‘, in C. Blakemore und S. Greenfield (Hg.), Mindwaves (Blackwell, Oxford, 1987), S. 307–320). Es ist bemerkenswert, dass Crick und Weiskrantz diese Metaphern auf das Gehirn anwenden, während Eccles sie auf den Geist anwendete. 105 Neurowissenschaftliche Falschdarstellungen der Fähigkeiten der Split-Brain-Patienten und deren Entfaltung werden weiter unten in 14.3 untersucht und berichtigt.
72
2 Kortex und Geist bei Sherrington
Sprache beherrschen. Darum können sie sich selbst Erfahrungen zuschreiben und über die derart zugeschriebenen Erfahrungen nachdenken (siehe 12.6). Der ‚selbstbewusste Geist‘ aber ist kein solches Ding, von dem man in verständlicher Weise sagen könnte, dass es ‚in Kontakt mit‘ dem Gehirn ist (geschweige denn mit dem sogenannten ‚Liaison-Gehirn‘). 3. Die Inkohärenz in Eccles’ Hypothese Drittens ist Eccles’ Haupthypothese unverständlich. Wenn der selbstbewusste Geist per impossible ‚lebhaft ins Ablesen‘ aus Arealen der dominanten Hemisphäre eingebunden wäre und ‚entsprechend der Aufmerksamkeit aus diesen Modulen auswählen‘ würde, dann müsste er die fraglichen neuralen Module wahrnehmen oder sich ihrer bewusst sein (wie könnte er sie sonst ‚ablesen‘?) und wissen, welche für seinen Zweck auszuwählen sind (andernfalls würden möglicherweise ständig die falschen ausgewählt). Genauer gesagt: Soll an dieser Geschichte irgendetwas dran sein, müssten die menschlichen Wesen sich der fraglichen neuralen Strukturen und Operationen bewusst sein und jeden Augenblick entscheiden, welche unmittelbar zu aktivieren sind, und selbstverständlich müssten sie das Vermögen dazu haben. Wir verfügen jedoch über kein solches Wissen und kein solches Vermögen. 4. Die richtige Vorstellung des selbstbewussten Geistes setzt die Einheit der Erfahrung voraus Schließlich ist es verworren anzunehmen, dass die Raison d’être des ‚selbstbewussten Geistes‘ darin besteht, die Einheit des Selbst hervorzurufen und, wie unsere Zeitgenossen sagen würden, ‚das Bindungsproblem zu lösen‘. Denn jede Rede davon, dass eine Person oder ein Wesen über Geist verfügt, setzt die Einheit der Erfahrung bereits voraus und kann nicht zu ihrer Erklärung angeführt werden. Eccles’ Irrtümer lassen sich nicht korrigieren, indem man seine Konzeption des ‚selbstbewussten Geistes‘ durch eine des Gehirns ersetzt Eccles’ Dualismus ist von abwegigen Annahmen durchsetzt. Die Neurowissenschaftler der Gegenwart wollen sich unbedingt von seinen Lehren distanzieren und seine Vorstellungen als unsinnige abtun. Das ist jedoch keine angemessene Reaktion. Eccles hatte den Mut, sich schwierigen Problemen zu stellen und seine Vorstellungen folgerichtig zu Ende zu denken. Dass seine Ideen in die Irre führen, ist kaum zu bestreiten, dennoch lässt sich viel von ihnen lernen. Es ist allerdings traurig, wie wenig die Neurowissenschaftler aus Eccles’ Bemühungen gelernt haben, dass sie offensichtlich glauben, man bräuchte für Eccles’ ‚selbstbewussten Geist‘ bloß das Gehirn ‚einzusetzen‘ und schon seien die Probleme gelöst, zu deren Beseitigung er seinen interaktionistischen Dualis-
2.4 Wilder Penfield
73
mus konzipierte. Die Frage, wie der Geist Bewegungen der Muskeln und Glieder durch Willensakte hervorrufen könne, ist nicht dadurch zu beantworten, dass man wie Libet annimmt, das Gehirn entscheide, welche Muskeln und Glieder in Bewegung versetzt werden. Obgleich die Annahme, der Geist sei mit der linken Hemisphäre in Liaison, in die Irre führt, ist die von Sperry, Gazzaniga und Crick vertretene Ansicht, dass die Hemisphären des Gehirns etwas wissen, glauben, denken und vermuten, hören und sehen, nicht weniger konfus. Denn hierbei handelt es sich um Funktionen von Menschen und anderen Tieren, nicht von Gehirnen oder Gehirn-Hälften (welche die Menschen in die Lage versetzen, diese Funktionen auszuüben). Und obwohl die Annahme, der Geist taste das Gehirn ab, verworren ist, wie wir angemerkt haben, ist es gleichermaßen verworren, davon auszugehen, dass das Gehirn sich selbst abtasten muss, um Bewusstsein und Selbstbewusstsein hervorzubringen – als läge es in der Natur der Sache, dass das Selbstbewusstsein notwendig mit einem selbstabtastenden Prozess einhergeht, wenn nicht des Geistes, dann des Gehirns. Kurz gesagt: Die Lektionen, die von Eccles’ Misslingen gelernt werden können, sind weitgehend noch zu lernen. Wir werden uns bemühen, das in späteren Kapiteln detaillierter nachzuweisen.
2.4 Wilder Penfield und der ‚höchste Gehirnmechanismus‘ Penfields Ausbildung Wilder Penfield (1891–1976) wurde in Spokane, Washington, geboren. Nachdem er 1913 in Princeton einen Abschluss gemacht hatte, erhielt er ein Rhodes-Stipendium für Oxford und trat der Schule der Physiologie bei, um dort unter dem inspirierenden Einfluss Sherringtons mit seinen medizinischen Studien zu beginnen. Er folgte Sherrington in seinem Interesse für Histologie und für Neurozytologie im Besonderen. Nach Erlangung seines Physiologie-Diploms in Oxford ging er an die Johns Hopkins Medical School, wo er 1918 sein Medizinstudium beendete. In seiner ersten Forschungsarbeit setzte er sich mit den Veränderungen im Golgi-Apparat der Nervenzellen nach der Durchtrennung des Axons auseinander. Im Jahre 1924 begann er mit dem Studium der Heilungsprozesse chirurgischer Wunden im Gehirn. Auf Sherringtons Ratschlag hin verbrachte er einige Zeit in Madrid, wo er mit Pio del Rio-Hortega zusammenarbeitete und die histologischen Methoden seines brillanten Lehrers Ramón y Cajal anzuwenden lernte. Zu diesem Zweck wurden Wundmalproben des Gehirns von Patienten gesammelt, die aufgrund posttraumatischer Epilepsie operiert worden waren. Penfields Leistung Penfield kannte die von Sherrington an Primaten-Gehirnen durchgeführten Studien zur kortikalen Lokalisation, die oben beschrieben wurden. 1928 ging er nach Breslau, um mit
74
2 Kortex und Geist bei Sherrington
Otfrid Foerster zusammenzuarbeiten und mit dessen Methode der sanften elektrischen Stimulation des Kortex epileptischer Patienten vertraut zu werden, die während der Entfernung des epileptogenen Wundgewebes lokal betäubt waren. Im Verlauf der Prozeduren lernte er, unter Lokal-Anästhesie zu operieren und dabei elektrisch zu stimulieren, was die Identifizierung des sensorischen und motorischen Kortex ermöglichte und dem chirurgischen Eingriff auf diese Weise die Richtung vorgab. Diese Technik sollte durch Penfield zu außergewöhnlich erfolgreicher Anwendung gelangen, und zwar in Montreal, wo er 1934 das berühmte Montreal Neurological Institute at McGill University begründete, das sich der Erforschung und chirurgischen Behandlung der fokalen Epilepsie widmete. Eine derartige Stimulation machte es möglich, die Position des sensomotorischen Kortex und des für die Sprache zuständigen Kortex exakt zu lokalisieren, sodass diese unverzichtbaren Areale während der operativen Entfernung geschont werden konnten. In einigen Fällen konnte es geschehen, dass die Stimulation den erregbareren epileptogenen Kortex aktivierte und einen Teil der üblicherweise auftretenden Anfallsmuster reproduzierte. Das erlaubte es dem Chirurgen, die Lage des physiologisch gestörten epileptischen Schwerpunkts zu ermitteln. Penfields Meisterschaft in diesen Abläufen schlug sich in der Folge in einer Reihe von Monografien über Gehirnchirurgie bei Epilepsie nieder. Im Jahre 1938 bemerkte Penfield, dass die Stimulation bestimmter Teile des temporalen Kortex bei Patienten gelegentlich eine lebhafte Erinnerung an zurückliegende Erfahrungen bewirkte. Es wurde deutlich, dass fast die Hälfte der von Epilepsie heimgesuchten Patienten Anfälle hatte, die nachweislich von dem einen oder dem anderen Temporallappen ausgingen. Diese Arbeit zur Temporallappenepilepsie führte zu sehr wichtigen Feststellungen, die den Hippocampus und die Gedächtnisfunktion betrafen als auch deren Kortexlokalisation. Bis 1951 hatte Penfield zusammen mit Milner zeigen können, dass die Entfernung eines Hippocampus im Mittelteil des Temporallappens das Gedächtnis der Patienten massiv durcheinanderbrachte, später wurde bei ihnen eine Beeinträchtigung im gegenüberliegenden Hippocampus entdeckt. Der beidseitige Funktionsverlust des Hippocampus führte bei diesen Patienten mithin dazu, dass sie vollständig unfähig waren, irgendeine post-operative Begebenheit in Erinnerung zu behalten. Dieser Gedächtnisverlust war von keinem wie auch immer gearteten Intelligenzverlust begleitet und auch nicht vom Ausfall des Aufmerksamkeitsvermögens. Penfields Analysen der elektrischen Stimulation des Kortex von 1.132 Patienten, die sich einer chirurgischen Behandlung unterzogen, haben unsere Erkenntnisse über die funktionale Lokalisation in großartiger Weise vermehrt, insbesondere was das Gedächtnis angeht und das den Menschen allein auszeichnende Vermögen, die Sprache. Penfields methodologische Einstellung Bereits in seinen Studientagen offenbarte Penfield einen „Sinn für das Staunen und eine große Neugier auf den Geist“. Als er vom Studium des Tiergehirns zu dem des menschlichen Gehirns überging, war es sein „anvisiertes Ziel“, „zum Verständnis der Mechanis-
2.4 Wilder Penfield
75
men des menschlichen Gehirns vorzudringen und herauszufinden, ob, und wenn, in welcher Weise, diese Mechanismen das ausmachen und erklären, was der Geist tut“, wie er später schrieb.106 Unter Sherrington studierend „realisierte er, dass das Gehirn ein unentdecktes Land war, in dem das Geheimnis des menschlichen Geistes eines Tages gelüftet werden könnte“. Natürlich war er sich der Sherrington’schen Ansichten zum Verhältnis von Geist und Gehirn vollauf bewusst. Im letzten Abschnitt des Vorworts zu seinem großartigen Buch The Integrative Action of the Nervous System (1906) hatte Sherrington festgehalten: „Dass unser Sein aus zwei Fundamentalelementen bestehe, ist, so vermute ich, an sich nicht unwahrscheinlicher, als dass es nur auf einem beruhe“. Penfield vertrat allerdings die Auffassung, dass die Neurowissenschaftler bestrebt sein sollten, das Verhalten der Tiere, das der Menschen inbegriffen, ausschließlich anhand neuronaler Mechanismen zu erklären. Nur wenn das misslänge, sollte man seiner Ansicht nach zu alternativen Erklärungsformen Zuflucht nehmen. Und während seiner ganzen Karriere als Neurochirurg behielt er diese methodologische Einstellung bei. Penfield über den Geist Gegen Ende eines langen, der Neurochirurgie und Neurologie gewidmeten Lebens veröffentlichte Penfield ein schmales Buch mit dem Titel The Mystery of the Mind. Dabei handelte es sich um den, wie er schrieb, „letzten Bericht über meine Erfahrung“ – eine Darlegung der Jugendziele, die er erreicht hatte. „Die Frage, was der Geist sei, ist die entscheidende Frage, und sie konfrontiert uns möglicherweise mit dem schwierigsten und wichtigsten aller Probleme“ (MM 85). Im Vorwort äußerte er sich dazu, was er am Ende seines Forscherlebens gern getan hätte, nämlich „den Stand der Dinge zu überprüfen und die Frage aufzuwerfen Machen die Gehirnmechanismen den Geist aus? Kann der Geist durch das, was augenblicklich über das Gehirn bekannt ist, erklärt werden?“ (MM xiii) Sich explizit auf die oben erwähnte Bemerkung Sherringtons beziehend, argumentierte Penfield, dass „die Zeit reif ist, den Blick auf seine beiden Hypothesen zu werfen, die zwei ‚Unwahrscheinlichkeiten‘. Entweder erklärt die Gehirntätigkeit den Geist oder wir müssen mit zwei Elementen fertig werden“ (MM 4). Trotz seiner methodologischen Einstellung fühlte Penfield sich zu einer cartesianischen Sicht hingezogen, seinem großen Lehrer nicht unähnlich. Er schrieb: Ich für meinen Teil bin nach all den Jahren der Anstrengung, eine Erklärung für den Geist ausschließlich anhand der Gehirntätigkeit zu finden, zu dem Ergebnis gekommen, dass es leichter ist (und einfacher, schlüssig zu argumentieren), wenn man sich die Hypothese zu eigen macht, dass unser Sein aus zwei Fundamentalelementen besteht. [. . .] Weil ich den sicheren Eindruck habe, dass es immer schlechthin unmöglich sein wird, den Geist anhand neuronaler Tätigkeit innerhalb des Gehirns zu erklären, und weil mir scheint, dass der Geist sich 106
W. Penfield, The Mystery of the Mind: A Critical Study of Consciousness and the Human Brain (Princeton University Press, Princeton, 1975), S. 1. Im Text in der Folge abgekürzt als MM.
76
2 Kortex und Geist bei Sherrington während des Lebens eines Individuums unabhängig entwickelt und ausreift, als ob es sich bei ihm um ein ununterbrochen existierendes Element handelte, und weil ein Computer (und ein solcher ist das Gehirn) von einer zu unabhängigem Verständnis befähigten Instanz programmiert und bedient werden muss, sehe ich mich gezwungen, den Gedanken vorzubringen, dass unser Sein anhand zweier Fundamentalelemente zu erklären ist. Das macht es meiner Ansicht nach am wahrscheinlichsten, dass wir zum endgültigen Verständnis gelangen, nach dem so viele unentwegte Wissenschaftler streben. (MM 80)
Aus welchen Gründen ließ er sich zu dieser Einschätzung hinreißen? Penfield hatte sich von zwei Merkmalen besonders beeindruckt gezeigt. Erstens war er, was in Anbetracht seiner Spezialisierung auf Epilepsiefälle nicht überrascht, vom Automatismus der Epilepsie fasziniert. Zweitens zeigte er sich von den durch die Elektrodenstimulation während des Eingriffs ausgelösten Patientenreaktionen stark beeindruckt. Penfields Interpretation des Epilepsieautomatismus Ein Patient, der einen epileptischen Anfall mit automatischem Verlauf erleidet, wird häufig damit fortfahren, die mehr oder weniger stereotypen Aufgaben zu erledigen, mit denen er beschäftigt war. Er wird allerdings in einer Fugue-Verfassung sein – das heißt, nach der Erholung wird er sich an nichts von dem, was er während des Anfalls getan hat, erinnern. Penfield deutete den Automatismus als Anzeichen dafür, dass der epileptische Anfall den Geist von dem trennte, was er, Hughlings Jackson folgend,107 „den höchsten Gehirnmechanismus“ (ein Vorgänger von Eccles’ ‚Liaison-Gehirn‘) nannte. Er nahm an, dass das Gehirn, solange der Automatismus andauert, das Verhalten eines ‚menschlichen Automaten‘ kontrolliert, und zwar gemäß der vorhergehenden ‚Programmierung‘ durch den Geist. Gerade so, wie die Programmierung eines Computers ‚von außen‘ erfolgt, wird auch die Programmierung des Gehirns, das Penfield zufolge ein biologischer Computer ist, vom Geist durch den höchsten Mechanismus des Gehirns bewerkstelligt. Der Zweck kommt dem Gehirn von außerhalb seiner eigenen Mechanismen zu. Kurzzeit-Programmierung dient offenbar einem nützlichen Zweck, da sie die automatische Fortsetzung von Routinearbeiten ermöglicht, und das tritt während solcher epileptischer Anfallsphasen klar und deutlich zutage. Dass dieser höchste, weitestgehend mit dem Geist verbundene Mechanismus eine wirkliche Funktionseinheit darstellt, wird durch die Tatsache belegt, dass die epileptische Entladung in die graue Substanz, die einen Teil seiner Verschaltungen umfasst, mit seiner selektiven Tätigkeit in Konflikt gerät. Während der epileptischen Beeinträchtigung der Funktion dieser grauen Substanz [. . .] verflüchtigt sich das Bewusstsein, und mit ihm geht die Verhaltensregie und -planung. Das heißt, der Geist hört auf, tätig zu sein und in den normalen Funktionsablauf dieses Mechanismus einzugreifen. J. H. Jackson, ‚On the anatomical, physiological and pathological investigations of epilepsies‘, West Riding Lunatic Asylum Medical Report, 3 (1873), S. 315–319. 107
2.4 Wilder Penfield
77
Der menschliche Automat, der an die Stelle des Menschen tritt, wenn der höchste Gehirnmechanismus außer Kraft gesetzt wurde, ermangelt der Fähigkeit, vollständig neue Entscheidungen zu treffen. Es ist ein der Fähigkeit, neue Gedächtnisarchive anzulegen, beraubtes Ding, das nicht mehr über jene undefinierbare Eigenschaft verfügt, den Sinn für Humor. Der Automat ist nicht in der Lage, sich von einem Sonnenuntergang ergreifen zu lassen oder Zufriedenheit, Glück, Liebe und Mitleid zu erfahren. Denn hierbei handelt es sich, wie bei allem Bewusstsein, um Funktionen des Geistes. Der Automat ist ein Ding, das Reflexe und Fertigkeiten offenbart, angeborene und erworbene, bei denen wir es mit den typischen Merkmalen eines Computers zu tun haben. (MM 47)
Obwohl Penfield keine nachprüfbare Hypothese dazu riskiert, wie diese Interaktion vonstattengeht, behauptet er, dass der höchste Gehirnmechanismus gleichsam das ausführende Organ des Geistes ist. Er empfängt vom Geist Anweisungen und leitet sie zu den verschiedenen Gehirnmechanismen weiter (MM 84). Der Geist steuert das aktive Gehirn. Er verfügt über kein eigenes Gedächtnis. Die Inhalte des Bewusstseinsstroms werden jedoch im Gehirn aufgezeichnet (das unwillkürliche Wiederfinden verloren geglaubter Inhalte während der kortikalen Stimulation des Gehirns im Laufe von Operationen scheint dies zu belegen). Wenn also der Geist einen Gedächtnisinhalt wiederfinden muss, öffnet er blitzartig die ‚Gedächtnisdateien‘ des Gehirns mit Hilfe des höchsten Gehirnmechanismus (MM 49). Penfields Interpretation der aus der kortikalen Elektrodenstimulation resultierenden Phänomene Indem er über einige Phänomene nachdachte, die während der Operationen infolge kortikaler Stimulation eintraten, kam Penfield zu ähnlichen Ergebnissen. So zeigte beispielsweise ein Patient, dessen ‚Sprach-Kortex‘ durch eine Elektrode in Mitleidenschaft gezogen wurde, Anzeichen von Verzweiflung, als er ein Bild eines Schmetterlings nicht zu identifizieren vermochte. Nach Entfernung der Elektrode sagte er: „Jetzt kann ich sprechen. Schmetterling. Ich bekam das Wort ‚Schmetterling‘ nicht zu fassen, also versuchte ich das Wort ‚Falter‘ zu erwischen!“ Interessant ist, wie Penfield diese zeitweilige Beeinträchtigung der normalen Identifizierungsfähigkeiten des Patienten auslegte und erklärte. Klar ist, dass er, während der Sprachmechanismus vorübergehend blockiert war, die Bedeutung des Schmetterlingsbildes wahrnehmen konnte. Er unternahm eine bewusste Anstrengung, das entsprechende Wort zu ‚fassen zu bekommen‘. Nicht begreifend, warum ihm das nicht gelang, wendete er sich zum zweiten Mal dem Interpretationsmechanismus zu [. . .] und entdeckte einen zweiten Begriff, von dem er annahm, dass er einem Schmetterling am nächsten komme.108 Den muss er dann dem Sprachmechanismus vorgelegt haben, was jedoch abermals nicht zum Erfolg führte. (MM 52) 108
Offensichtlich meinte Penfield, dass er die größtmögliche Annäherung an den Begriff von einem Schmetterling darstellte.
78
2 Kortex und Geist bei Sherrington
Laut Penfield werden Begriffe in dem im Gehirn befindlichen Begriffsmechanismus des Geistes gespeichert, aus dem der Geist den Begriff auswählt, den er benötigt. Dieser Begriff wird dann in den Bewusstseinsstrom ‚eingespeist‘, und wenn der Geist die Auswahl bestätigt, feuert der höchste Gehirnmechanismus diesen nonverbalen Begriff zum Sprachmechanismus, der im Falle seines normalen Funktionierens dem Geist das zum Begriff passende Wort anbieten wird (MM 53). Penfield war gleichermaßen von dem Umstand beeindruckt, dass der Patient, wenn die neurale Stimulation des Gehirns eine Handbewegung verursachte, ausnahmslos antwortete: „Ich war das nicht. Sie waren es.“ Und ebenso davon, dass der Patient, wenn die kortikale Stimulation Laute hervorbrachte, stets erwiderte: „Ich habe das Geräusch nicht hervorgebracht. Sie haben es mir entrissen.“ Offenkundig war es nicht möglich, einen Patienten in Form elektrischer Stimulation seines Kortex etwas glauben zu machen oder entscheiden zu lassen (MM 77). Es überrascht nicht, dass Penfield zu dem Schluss kam, dass es sich beim Glauben und Wollen um Funktionen des Geistes handelt. Der Geist und seine durch ‚den höchsten Gehirnmechanismus‘ vermittelte Interaktion mit dem Gehirn Penfield folgerte, dass der Mensch sein Geist ist (MM 61). Der Geist ist das, was sich des Geschehenden bewusst ist, das denkt und Entscheidungen trifft und versteht (MM 75f.). Der Mensch streift durch die Welt [sic], und dabei ist er stets von seinem ‚privaten Computer‘ abhängig, den er kontinuierlich programmiert (MM 61). Im höchsten Gehirnmechanismus kommen Geist und Gehirn miteinander in Kontakt, er bildet das psychophysische Grenzland (MM 53). Indem der Geist Entscheidungen trifft, bringt er den höchsten Gehirnmechanismus dazu, neuronale Botschaften an andere Mechanismen des Gehirns zu übermitteln, und gespeicherte Daten erhalten Zugang zum Bewusstsein. Wodurch wird die Interaktion bewirkt? Im Zusammenhang mit dieser Frage spekulierte Penfield, dass es eine zweite Energieform (eine andere Energie als die elektrische, die von der höchsten Gehirnfunktion zur Anregung des Nervensystems genutzt wird) geben muss, die dem Geist in den Stunden seines Wachseins durch die Vermittlung des höchsten Gehirnmechanismus zur Verfügung steht. Der Geist verschwindet, wenn der höchste Gehirnmechanismus infolge einer Verletzung oder wegen einer epileptischen Beeinträchtigung oder einer narkotisch wirkenden Droge zu funktionieren aufhört. Darüber hinaus verflüchtigt sich der Geist auch während des Tiefschlafes. Was geschieht, wenn der Geist verschwindet? Es gibt zwei naheliegende Antworten auf diese Frage; sie rühren von den beiden Alternativen Sherringtons her – ob das menschliche Sein anhand eines oder zweier Elemente erklärt werden soll. (MM 81)
Penfield fand es grotesk anzunehmen, dass der Geist eine bloße Gehirnfunktion ist und also zu existieren aufhört, wenn diese im Schlaf oder epileptischen Automatismus ‚ent-
2.4 Wilder Penfield
79
schwindet‘ und immer dann, wenn der höchste Gehirnmechanismus normal funktioniert, aufs Neue wiederersteht. Der Geist ist seiner Folgerung nach vielmehr ‚ein Grundelement‘, das ‚ununterbrochen da ist‘. „Man muss annehmen“, schrieb er, „dass der Geist, obgleich er stumm ist, wenn er nicht mehr über seine besondere Verbindung zum Gehirn verfügt, in den stummen Intervallen weiterexistiert und die Kontrolle übernimmt, wenn der höchste Gehirnmechanismus aktiv wird“ (MM 81). Demnach schaltet der höchste Gehirnmechanismus die den Geist energetisch antreibende Kraft immer dann ab, wenn man schlafen geht, und schaltet sie beim Erwachen wieder an. Ist diese Erklärung unwahrscheinlich, fragte Penfield. Sie ist, was den Geist angeht, nicht so unwahrscheinlich, wie es die alternative Erwartung [Erklärung] ist – dass der höchste Gehirnmechanismus selbst verstehen und denken und die Willenshandlung steuern und entscheiden würde, wohin die Aufmerksamkeit gelenkt werden soll und was der Computer lernen, aufzeichnen und bei Bedarf zutage bringen muss. (MM 82)
Penfields Neocartesianismus Penfields Neocartesianismus stellt im Vergleich zu dem von Sherrington und Eccles keinen Fortschritt dar. Wenn wir allerdings etwas aus seinen Irrtümern lernen sollen, dürfen wir sie nicht einfach als abwegige abtun und uns nach anderen Themen umschauen. Dann werden uns seine Bemühungen garantiert nichts lehren. Wir müssen fragen, was falsch lief, was einen der größten Neurochirurgen und Neurologen aller Zeiten dazu trieb, sich einer solchen Fehlkonzeption von Geist und Gehirn zu verschreiben. Geteilte Vorannahmen 1. Die cartesianische Konzeption des Geistes Es sollte festgehalten werden, dass es mindestens zwei Vorannahmen sind, die Penfield mit Sherrington und Eccles teilte. Zum einen verschrieben sich alle drei einer cartesianischen Geisteskonzeption. Wie Descartes betrachtete Penfield den Geist als eine unabhängige Substanz (oder, wie er formulierte, als ‚ein Fundamental-Element‘, das ‚ununterbrochen da ist‘). Wie Descartes sah er den Menschen als Geist an statt als Menschen. Wie Descartes fasste er den Geist als Träger der psychologischen Attribute auf109 und betrachtete die menschlichen Wesen dementsprechend als ‚nachrangige‘ Subjekte der psychologischen Prädikate. Und wie Descartes verstand er den Geist als kausalen Akteur, der durch seine Aktivitäten Veränderungen im Körper bewirken kann.
Um zu erklären, was der Geist ist, zitierte Penfield tatsächlich Webster’s Dictionary: ‚das Element [. . .] in einem Individuum, das fühlt, wahrnimmt, denkt, will und das insbesondere folgert‘ (MM 11). 109
80
2 Kortex und Geist bei Sherrington
2. Die Annahme, dass die Frage, ob Gehirnmechanismen den Geist erklären können, eine empirische ist Die zweite Vorannahme besteht darin, dass die Frage, die ihm soviel Kopfzerbrechen bereitete – nämlich, ob die Gehirnmechanismen den Geist ausmachen, ob der Geist anhand dessen, was über das Gehirn bekannt ist, erklärt werden kann –, eine empirische Frage ist. Wie Sherrington fasste Penfield die Sache als eine Entscheidung zwischen zwei unterschiedlichen empirischen Hypothesen auf. Entweder können wir alles, was der Geist tut – denken und glauben beispielsweise, folgern, wollen und Zwecke verfolgen, Absichten haben und Entscheidungen treffen, willkürlich und intentional handeln –, mit neuralen Zuständen und Ereignissen erklären oder wir müssen den Geist als unabhängige Substanz vorstellen, die sich in unmittelbarer kausaler Interaktion mit dem Gehirn, und folglich mit dem Körper, befindet. Die Wahl soll auf die Hypothese fallen, die die stärkeren ‚Evidenzen‘ auf ihrer Seite hat und die über die größere Plausibilität und Erklärungskraft verfügt. Beide Vorannahmen gehen in die Irre. Wie wir bereits deutlich gemacht haben, ist der Geist keine Substanz, gleich welcher Art. Die Rede vom Geist ist lediglich eine Façon de parler, eine Möglichkeit, um über menschliche Vermögen und ihre Ausübung reden zu können. Wir sagen von einem Wesen (in erster Linie vom Menschen), dass es Geist hat, wenn es über ein Spektrum von aktiven und passiven Verstandes- und Willensvermögen verfügt – insbesondere die Begriffsvermögen eines Sprachverwenders, die Selbstbewusstsein und Selbstreflexion ermöglichen. Die Redewendungen, die das Substantiv ‚Geist‘ einschließen, beziehen sich auf das Denken, das Gedächtnis und den Willen als ihre semantischen Brennpunkte. Und sie lassen sich ohne Weiteres in psychologischen Wendungen, in denen das Wort nicht vorkommt, umschreiben (wir werden diesen Fall in 3.10 etwas detaillierter erörtern). Ein Mensch ist nicht mit seinem Geist identisch. Geist ist etwas (jedoch kein Ding), von dem man sagt, dass ein Mensch es hat, nicht, dass er es ist. Indem es Geist hat, hat ein Lebewesen (das damit auch eine Person mit Rechten und Pflichten ist) eine Reihe charakteristischer Fähigkeiten. Und es ist offenkundig beides richtig: dass ein Lebewesen nicht mit dem Spektrum an Fähigkeiten identisch sein kann und dass ein menschliches Wesen, wenn es hinreichend viele dieser charakteristischen Fähigkeiten verliert, kein Mensch mehr sein kann (und nur noch in einem ‚vegetativen Zustand‘ existiert). Der Geist ist nicht das Subjekt der psychologischen Attribute, ebenso wenig wie das Gehirn. Das lebendige menschliche Wesen ist dieses Subjekt – das Lebewesen als Ganzes, nicht eines seiner Teile oder ein Teil seiner Vermögen. Das, was sich entschließt [makes up its mind] oder entscheidet, was sich etwas ins Gedächtnis zurückruft [calls something to mind] oder wiedererinnert und was seine Ansicht zu diesem oder jenem ändert [turns its mind] und denkt, ist nicht mein Geist [not my mind] – das bin ich, diese Person. Darum ist der Geist auch kein kausaler Akteur, der durch seine Aktivitäten Veränderungen im Körper und seinen Gliedern bewirkt. Es sind vielmehr die Menschen,
2.4 Wilder Penfield
81
die Überlegungen anstellen, sich entscheiden und Handlungen vollziehen, nicht ihr Geist. 2. Ob das Gehirn den Geist ‚ausmacht‘, ist keine empirische Frage Folglich geht Penfields zweite Vorannahme in die Irre. Ob man den Geist nur anhand des Gehirns erklären kann oder ob man den (vermeintlichen) Geistesaktivitäten (z. B. denken, folgern, wollen und Zwecke verfolgen, Absichten haben und Entscheidungen treffen, willkürlich und intentional handeln) durch Rückgriff auf den Geist selbst – verstanden als unabhängige Substanz und mithin kausaler Akteur – Rechnung tragen muss, ist keine Frage einer Entscheidung zwischen zwei empirischen Hypothesen. Wenn es empirische Hypothesen wären, könnte grundsätzlich nur eine von ihnen wahr sein; das heißt, beide würden einleuchtende Möglichkeiten darstellen, und man hätte eine empirische Untersuchung anzustrengen, um herauszufinden, welche nun wirklich die richtige ist. So verhält es sich jedoch ganz und gar nicht. Weder das Gehirn noch der Geist sind das Subjekt der psychologischen Attribute Erstens handelt es sich bei dem, was denkt und folgert, etwas will und Zwecke verfolgt, Absichten hat und Entscheidungen trifft, willkürlich oder intentional handelt, nicht um den Geist, sondern um den Menschen. Wir sagen in der Tat, dass eine Person einen klaren, strikten bzw. entschiedenen Geist habe. Damit charakterisieren wir jedoch nur individuelle Dispositionen des Denkens und Wollens. Will man verstehen, weshalb ein gewöhnlicher Mensch auf diese bestimmte Weise folgerte, das dachte, was er dachte, ganz spezielle Ziele und Zwecke verfolgt und weshalb er sich so entschied, wie er es tat, die und die Absichten und Pläne hatte und intentional handelte, wird uns keine neurologische Darstellung weiterhelfen. In diesem Punkt hatte Penfield Recht. Falsch lag er mit der Annahme, dass uns eine Erklärung fehlt, die sich auf den Geist einer Person beruft – worin dieser als ein verursachungsfähiger Akteur vorgestellt wird. Was wir jedoch wirklich brauchen und worauf wir eigentlich aus sind, ist eine Erklärung, die von den Überlegungen und Folgerungen der Person handelt und somit auch davon, was sie wusste oder glaubte und welche Ziele und Zwecke sie in all den Fällen praktischen Denkens im Auge hatte. Und wenn unsere Erklärung ihr Denken verständlich wiedergibt, kann keine Zusatzinformation über neurale Ereignisse im Gehirn dem irgendetwas hinzufügen. Eine neurale Erklärung könnte nur erklären, wodurch es der Person überhaupt möglich war, folgernd zu denken (das heißt, welche neuralen Strukturen gegeben sein müssen, um ein menschliches Wesen mit den und den verstandes- und willensmäßigen Fähigkeiten auszustatten), das Denken selbst kann sie nicht nachvollziehen, geschweige denn seine Schlüssigkeit oder Überzeugungskraft.
82
2 Kortex und Geist bei Sherrington
Weder die kausale Einwirkung des Gehirns noch die des Geistes erklären die intentionale Handlung Wenn wir von den Handlungen einer Person verwirrt sind, wenn wir erfahren wollen, wieso Person A einen Scheck über 200 Euro unterschrieb, wird uns wahrscheinlich ebenfalls keine Antwort zufriedenstellen, die auf Gehirnfunktionen zurückgreift. Wir wollen ja wissen, ob A eine Schuld beglich, etwas einkaufte, für einen wohltätigen Zweck spendete oder auf ein Pferd wettete – und wenn wir erst einmal wissen, welche dieser Möglichkeiten zutrifft, wollen wir möglicherweise auch in Erfahrung bringen, welche Gründe A hatte. Eine Beschreibung neuraler Ereignisse in A’s Gehirn könnte uns die gewünschte Erklärung wohl nicht liefern. Wenn wir wissen wollen, wieso A den Zug um 8.15 Uhr nach Paris nahm, kann eine Beschreibung neuraler Ereignisse unsere Bedürfnisse nach einer Erklärung grundsätzlich nicht befriedigen. Die Antwort jedoch, er hätte dort um 14 Uhr eine Ausschusssitzung, die über das und das Projekt, für das A verantwortlich ist, entscheiden soll, kann unsere Neugier stillen. Wenn A B ermordet hat, könnte es uns interessieren, warum. Vielleicht würde uns ein Grund genannt, der uns, weil wir mehr verstehen wollen, nicht zufriedenstellt – bei diesem ‚Mehr‘ aber handelt es sich höchstwahrscheinlich um A’s Motiv, und es hat nichts mit den neuralen Ereignissen zu tun, mit denen die Tat einherging. Wir wollen wissen, ob A B beispielsweise aus Rache oder aus Eifersucht umbrachte, und das macht eine ganz andere Darstellung erforderlich, als sie die neurowissenschaftliche Forschung je erbringen könnte. Die Erklärung einer Handlung durch (Wieder-)Beschreibung, durch Anführung von Gründen, die ein Handelnder hat, oder durch Benennung der Motive des Handelnden (und es gibt andere Erklärungsmöglichkeiten ähnlicher Art) lässt sich nicht von einer Erklärung durch neurale Gehirnereignisse ersetzen, auch nicht im Prinzip. Wir haben es hier keineswegs mit einer empirischen Angelegenheit zu tun, sondern mit einer logischen bzw. begrifflichen. Der Erklärungstyp ist ein kategorial anderer, und die auf einen Handelnden und dessen Motive, Ziele und Zwecke bezogene Erklärungen sind nicht reduzierbar auf Erklärungen im Hinblick auf Muskelkontraktionen, die von neuralen Ereignissen ausgelöst wurden (siehe Kapitel 13). ‚Lebensweltlich-alltagspraktische‘ Erklärungen handeln jedoch auch nicht vom Geist als einer unabhängigen Substanz mit einem eigenen Verursachungsvermögen. So gesehen ist Penfields Dilemma kein wirkliches Dilemma. Er lag völlig richtig mit der Annahme, dass man dem Verhalten des Menschen und seiner Erfahrung nicht allein unter Rückgriff auf das Gehirn Rechnung tragen kann, falsch lag er aber damit, dass es sich bei der Vorstellung, man könnte eine solche rein neurale Erklärung zuwege bringen, um eine sinnvolle empirische Hypothese handelt (statt um eine Begriffsverwirrung). Im Irrtum befand er sich auch mit der Annahme, die Alternative dazu bestehe darin, das Verhalten des Menschen und seine Erfahrung durch die Einwirkung des Geistes zu erklären, und indem er davon ausging, dass wir es auch in diesem Fall mit einer empirischen Hypothese zu tun haben, irrte er sich abermals. Nichts und niemand kann uns dazu zwingen, uns auf eines der beiden Hörner des Penfield’schen Dilemmas festzulegen.
2.4 Wilder Penfield
83
Die Hypothese, dass die Geist-Gehirn-Interaktion das menschliche Verhalten erklären kann, ist logisch inkohärent Hat man sich von diesen Vorannahmen erst einmal frei gemacht, sieht man besser, weshalb die Erklärung des menschlichen Verhaltens anhand der Interaktion des Geistes (verstanden als unabhängige Substanz) und des Gehirns ein Missverständnis darstellt. Es handelt sich bei ihr nicht um eine falsche empirische Hypothese, sondern um eine Begriffsverwirrung. Denn weil der Geist keine Substanz ist, und bestimmt keine irgendwie geartete Entität, ist es logisch ausgeschlossen, dass er als ein kausaler Akteur fungiert, der durch seine Handlungen Veränderungen im Gehirn bewirkt. Das wiederum ist keine empirische Entdeckung, sondern das Resultat einer Begriffsklärung. (Allerdings ist es ebenso abwegig zu vermuten, die Ersetzung des cartesianischen Geistes durch das Gehirn sei irgendwie weniger verworren. Auch durch diesen Wechsel der ‚Bezugsgrößen‘ kommt keine empirische Hypothese zustande, sondern wieder nur ein Begriffswirrwarr, das gleichfalls auf seine begriffliche Klärung wartet.) Weder der epileptische Automatismus noch die Elektrodenstimulation des Gehirns stützen den Dualismus Folglich irrte sich Penfield, indem er das, was ihn so beeindruckte – nämlich die Phänomene des epileptischen Automatismus und die unterschiedlichen Tatsachen, die die Elektrodenstimulation des Gehirns charakterisieren –, als einen empirischen Beleg für die dualistische Hypothese dachte. Der epileptische Automatismus zeigt nicht, dass der Geist sich vom ‚höchsten Gehirnmechanismus‘, mit dem er normalerweise in Kontakt steht und von dem er auf eine bislang nicht bekannte Weise mit Energie versorgt wird, abgekoppelt hat.110 Er zeigt vielmehr, dass die Person im Laufe eines epileptischen Anfalls infolge der anormalen Erregung von Teilen des Kortex einiger ihrer normalen Fähigkeiten (einschließlich des Gedächtnisses, des Vermögens, Entscheidungen zu treffen, der emotionalen Empfänglichkeit und des Sinns für Humor) beraubt ist, während andere Fähigkeiten bewahrt werden, insbesondere solche, die bei Routinehandlungen zur Anwendung gelangen. Gewiss sind die Phänomene bemerkenswert, wir haben es hier jedoch mit einer Dissoziation von normalerweise miteinander verknüpften Fähigkeiten zu tun und nicht mit einer Trennung von Substanzen, die normalerweise miteinander 110
Es ist verblüffend, Penfields Konzeption mit Descartes’ bemerkenswertem Gleichnis in seiner Abhandlung über den Menschen zu vergleichen: ‚wenn sich eine rationale Seele in der Maschine [dem Körper nämlich] befindet, wird sie ihren Hauptsitz im Gehirn haben und dort wie der Quellmeister der Wasserspiele sein, der den Verteiler, an dem alle Röhren dieser Maschine zusammenkommen, bedienen muss, wenn er in irgendeiner Weise ihre Bewegungen beschleunigen, verhindern oder ändern will‘ (AT XI, 131). Das Wasserbecken ist hier der Ventrikel, in dem die Zirbeldrüse sich angeblich schwebend hält, die Rohre sind die Nerven und das Wasser stellt die Lebensgeister dar.
84
2 Kortex und Geist bei Sherrington
verknüpft sind. Sie zeigen nicht, dass das Gehirn ein Computer oder dass der Geist sein Programmierer ist. Das Gehirn ist weder ein Computer noch eine Telefonzentrale (die früher favorisierte Analogie), und der Geist ist weder ein Computerprogrammierer noch ein Telefonist. Es ist vollkommen richtig, dass die Fähigkeit, unreflektiert mit der Ausführung von Routinearbeiten fortzufahren, nützlich ist (und der Ausdruck ‚Kurzzeitprogrammierung‘ stellt in diesem Zusammenhang eine geeignete Metapher dar). Es stimmt auch, dass die von einer Person verfolgten Zwecke nicht die des Gehirns der Person sind. Daraus folgt jedoch nicht, dass sie die Zwecke des Geistes der Person sind. Sie sind die Zwecke der Person – und die werden vor dem Hintergrund lebensweltlicher Tatsachen, gesellschaftlicher Lebensformen, zurückliegender Ereignisse, gerade herrschender Umstände, des akteurialen Glaubens- und Wertekanons etc. verständlich, nicht dadurch, dass man neurale Ereignisse und Mechanismen heranzieht. Aber es stimmt selbstverständlich auch, dass ein menschliches Wesen, wenn das Gehirn nicht normal funktionieren würde, die von uns für gewöhnlich verfolgten Zwecke nicht weiterverfolgen müsste bzw. könnte. Die verschiedenen mit der Elektrodenstimulation des Gehirns einhergehenden Phänomene wurden von Penfield in ähnlicher Weise missdeutet. Der Fall der Beeinträchtigung des ‚Sprach-Kortex‘ offenbart nicht, dass es so etwas wie einen ‚Begriffsmechanismus‘ im Gehirn gibt, der nonverbale Begriffe speichert, die vom Geist ausgewählt und dann dem Sprachmechanismus vorgelegt werden können, um mit dem Wort, das den Begriff repräsentiert, abgeglichen zu werden. Das ist pittoreske Mythologie, keine empirische Theorie. Worte sind keine Begriffsnamen, und sie stehen nicht für Begriffe, sondern drücken sie vielmehr aus. Begriffe sind Abstraktionen aus dem Wortgebrauch. Der Begriff einer Katze ist das Gemeinsame des Gebrauchs von ‚Katze‘, ‚cat‘, ‚chat‘ etc. Die gemeinsamen Merkmale des Gebrauchs dieser Worte können nicht unabhängig von dem Wort (oder Symbol), das den Begriff ausdrückt, im Gehirn oder sonst irgendwo gespeichert werden. Der von Penfield beschriebene Patient konnte nicht an das Wort ‚Schmetterling‘ denken, mit dem das Objekt in dem ihm vorgelegten Bild zu identifizieren war. Er wusste, dass das Objekt zu einer Klasse gehörte, die einer anderen Klasse von Insekten (und zwar Faltern) ähnelt, und versuchte, gleichfalls erfolglos, an das Wort für Mitglieder dieser zweiten Klasse zu denken. Es ist jedoch nicht so, wie behauptet wird, dass derjenige, den ein solches Unvermögen vorübergehend trifft, den Begriff kennt und sich nur nicht an das Wort dafür erinnern kann. Die Annahme, der Geist werde mit nonverbalen Begriffen ‚versorgt‘, aus denen er auszuwählen habe, setzt voraus, dass nonverbale Begriffe unabhängig von irgendwelchen Worten oder Symbolen, die sie ausdrücken, identifiziert und voneinander unterschieden werden können. Das aber ergibt keinen Sinn. Penfields Entdeckung, dass die Elektrodenstimulation weder einen Glauben bewirken noch eine Entscheidung auslösen konnte, ist allemal interessant. Sie zeigt jedoch nicht, dass Glauben und Entscheiden Handlungen des Geistes sind, aber genauso wenig, dass wir es dabei mit Handlungen des Gehirns zu tun haben. Es stimmt zwar, dass sie
2.4 Wilder Penfield
85
keine Handlungen des Gehirns sind – das ist jedoch keine empirische Tatsache, von der man in einem Experiment nachweisen könnte, dass sie der Fall ist. So etwas wie das Glauben oder Entscheiden des Gehirns gibt es vielmehr nicht (genauso wenig wie ein Schachmatt im Damespiel). Es stimmt aber ebenso, dass wir es bei ihnen nicht mit Handlungen des Geistes zu tun haben. Mein Geist glaubt nicht irgendwas oder zweifelt daran – das tue ich (obgleich beides selbstverständlich keine Handlung ist). Und er entscheidet auch nicht – Menschen entscheiden und handeln ihrer Entscheidung entsprechend, keine ‚Geister‘. Dass die Ausübung geistiger Vermögen eine Gehirnfunktion ist, zeigt nicht, dass Verhalten und Erfahrung neural erklärbar sind Penfield widersprach der Behauptung vehement, dass der Geist eine Gehirnfunktion ist, und vermutete, dass dieser, wenn er es wäre, während des Schlafes oder des epileptischen Automatismus aufhören würde zu existieren. Zwar ist nicht klar, wie die Auffassung zu verstehen ist, man könnte aber sicherlich sagen, dass die charakteristischen Verstandesund Willensvermögen eines über den Geist verfügenden Lebewesens Funktionen des Gehirns (und auch anderer Einflussgrößen) des Lebewesens sind. Daraus folgt nicht (während Penfield offenbar fürchtete, es würde doch folgen), dass Verhalten und Erfahrung eines solchen lebensweltlich verankerten Wesens mit neuralen Termini erklärbar sind. Es folgt aber auch nicht, dass der Geist während des Schlafes oder des epileptischen Anfalls zu existieren aufhört – genauso wenig wie das Wissen, die Überzeugungen, Absichten und Projekte von jemandem zu existieren aufhören, wenn er schläft. Penfield war zu Recht von der Tatsache beeindruckt, dass „der Geist sich während des ganzen Lebens eines Individuums unabhängig entwickelt und ausreift, als ob er ein ununterbrochen existierendes Element wäre“ (MM 80). Er ließ sich jedoch von der Annahme, der Geist sei eine Art Agens, in die Irre führen. Hätte er den Geist in eher aristotelischem Verständnis als eine Reihe von Vermögen oder Fähigkeiten gedacht, wäre er der Wahrheit nähergekommen und für Begriffstäuschungen weniger anfällig gewesen. Denn der kontinuierliche Besitz von Fähigkeiten wird nicht durch den Schlaf oder eben den epileptischen Automatismus unterbrochen, auch wenn der Akteur während des Anfalls einige seiner ihm normalerweise zur Verfügung stehenden Fähigkeiten nicht ausüben kann. Und der in der Entwicklung begriffene Geist einer Person entwickelt sich nicht wie eine vom menschlichen Wesen selbst getrennte Substanz, sondern er tritt vielmehr als ein bestimmter Charakter und eine bestimmte Persönlichkeit hervor, als ein Verstand mit bestimmten unverwechselbaren Merkmalen und als ein Wille mit einem Spektrum an Präferenzen – bei all dem haben wir es mit Eigenschaften der Person zu tun. Penfield ging davon aus, dass eine Form des cartesianischen Dualismus mit höherer Wahrscheinlichkeit richtig ist als die Alternative, die er diesem gegenüberstellte: nämlich die Zuschreibung von Verstehen und Denken, Wollen und willkürlicher Handlung als auch Entscheiden zum Gehirn selbst. Es ist äußerst verblüffend und vielsagend, dass
86
2 Kortex und Geist bei Sherrington
die aus Penfields Sicht unwahrscheinlichere der beiden Betrachtungsweisen von den Neurowissenschaftlern der dritten Generation gegenwärtig favorisiert wird, die die psychischen Funktionen dem Gehirn zuschreiben. Womit das Thema des nächsten Kapitels genannt ist.
3 Der mereologische Fehlschluss in den Neurowissenschaften 3.1 Die mereologische Konfusionen in den kognitiven Neurowissenschaften Die Zuschreibung psychologischer Attribute zum Gehirn Führende Vertreter der ersten beiden Generationen moderner Hirn- bzw. Neurowissenschaftler waren fundamental cartesianisch. Wie Descartes unterschieden sie den Geist vom Gehirn und schrieben ihm psychologische Attribute zu.111 Die Zuschreibung von entsprechenden Prädikaten zu menschlichen Wesen leitete sich folglich davon nur ab – wie in der cartesianischen Metaphysik. Die dritte Generation von Neurowissenschaftlern lehnte den Dualismus ihrer Lehrer allerdings ab. Im Zuge des Versuchs, die Tatsache zu erklären, dass Menschen über psychologische Attribute verfügen, schrieben sie diese nicht dem Geist, sondern dem Gehirn oder Teilen desselben zu. Die Neurowissenschaftler nehmen an, dass das Gehirn ein großes Spektrum an kognitiven, kogitativen, wahrnehmungs- und willensmäßigen Fähigkeiten hat. Francis Crick bringt vor: Was man sieht, ist nicht das, was wirklich da ist; es ist das, wovon Ihr Gehirn glaubt, es sei da. [. . .] Ihr Gehirn erstellt die beste Interpretation, die es mittels seiner früheren Erfahrung und der beschränkten und nicht eindeutigen Information durch die Augen erstellen kann. [. . .] das Gehirn verknüpft die von den vielen unterschiedlichen Merkmalen der visuellen Szenerie (Gestalt-, Farb-, Bewegungsaspekt etc.) gelieferte Information und entscheidet sich für die plausibelste Interpretation all dieser verschiedenen zusammen ergriffenen Anhaltspunkte. [. . .] Was das Gehirn entwickeln muss, ist eine mehrstufige Interpretation der visuellen Szenerie. [. . .]
[In der einschlägigen Literatur hat es sich in ‚Zuschreibungszusammenhängen‘ eingebürgert, von ‚psychologischen Attributen/Prädikaten‘ zu sprechen, hier sind gewissermaßen die ‚psychischen Eigenschaften‘ mitzudenken. Zudem ist zu beachten, dass das Englische die Unterscheidung zwischen psychisch und psychologisch nicht kennt. Dort, wo man im Deutschen bei ‚psychologisch‘ stutzen würde, wurde ‚psychological‘ mit ‚psychisch‘ wiedergegeben (z. B. wenn von den Bereichen des Geistigen, Physischen und Psychischen die Rede ist, wobei vorweggenommen sei, dass es sich bei diesen nur scheinbar um distinkte Bereiche handelt). Eine gewisse Uneinheitlichkeit in Bezug auf psychologisch/psychisch ließ sich mithin nicht vermeiden. – A.d.Ü.] 111
[Das Ausfüllen der Lücken] gestattet es dem Gehirn, aus unvollständiger Information ein vollständiges Bild zu erraten – eine sehr nützliche Fähigkeit.112
Demzufolge hat das Gehirn Erfahrungen, glaubt etwas, interpretiert Anhaltspunkte mittels ihm zugänglich gemachter Information und stellt Vermutungen an bzw. errät. Gerald Edelman ist der Meinung, dass die Strukturen im Gehirn „die verschiedenen, in unterschiedlich gearteten globalen Karten auftretenden Gehirnaktivitäten kategorisieren, unterscheiden und neu zusammenfügen“ und dass das Gehirn „semantische mit phonologischen Sequenzen rekursiv verknüpft und dann syntaktische Entsprechungen erzeugt, nicht nach vorgegebenen Regeln, sondern indem es die Regeln, die sich im Gedächtnis entwickeln, als Objekte betrachtet, die sich begrifflich beeinflussen lassen“.113 Demnach kategorisiert das Gehirn; und zwar „kategorisiert es seine eigenen Aktivitäten (besonders seine Wahrnehmungsklassifizierungen)“ und beeinflusst Regeln begrifflich. Colin Blakemore argumentiert, dass wir offenkundig gezwungen sind zu sagen, dass solche Neuronen [wie sie in hochgradig spezifischer Weise z. B. auf Linienanordnung ansprechen] über Wissen verfügen. Sie sind intelligent, weil sie die Wahrscheinlichkeit äußerer Ereignisse einzuschätzen vermögen – Ereignisse, die für das besagte Lebewesen wichtig sind. Und das Gehirn gewinnt sein Wissen, indem es in der von der klassischen wissenschaftlichen Methode vorgegebenen Weise induktiv schließt. Neuronen stellen dem Gehirn Argumente zur Verfügung, die auf den spezifischen Merkmalen beruhen, die sie ermitteln, Argumente, mit denen das Gehirn seine Wahrnehmungshypothese erstellt.114
Demnach weiß das Gehirn Dinge, schließt induktiv und erstellt Hypothesen anhand von Argumenten, und seine konstituierenden Neuronen sind intelligent, können Wahrscheinlichkeiten einschätzen und Argumente zur Verfügung stellen. J. Z. Young vertritt eine nahezu identische Position. Er argumentiert, dass „wir alles Sehen als eine ununterbrochene Suche nach Antworten auf vom Gehirn aufgeworfene Fragen begreifen können. Die Signale von der Retina bringen diese Antworten liefernden ‚Botschaften‘ hervor. Das Gehirn nutzt diese Information dann, um eine passende Hypothese darüber, was existiert, zu erstellen.“115 Demzufolge wirft das Gehirn Fragen auf, sucht nach Antworten und erstellt Hypothesen. Antonio Damasio behauptet, dass „unsere Gehirne oft in Sekunden oder Minuten, je nach dem zeitlichen Rahmen, der der Zielsetzung entspricht, zu ausgezeichneten Entscheidungen in der Lage [sind]. Da sie das vermögen, halten sie sich offen-
112
F. Crick, The Astonishing Hypothesis (Touchstone, London, 1995), S. 30, 32f., 57 [dt. Was die Seele wirklich ist (Artemis & Winkler, München & Zürich, 1994), S. 52, 54, 82]. 113 G. Edelman, Bright Air, Brilliant Fire – On the Malter of the Mind (Penguin, Harmondsworth, 1994), S. 109f., 130 [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer. Wie der Geist im Gehirn entsteht (Piper, München, 1995), S. 159, 188]. 114 C. Blakemore, Mechanics of the Mind (Cambridge University Press, Cambridge, 1977), S. 91. 115 J. Z. Young, Programs of the Brain (Oxford University Press, Oxford, 1978), S. 119.
3.1 Mereologische Konfusionen in kognitiven Neurowissenschaften
89
bar nicht nur an den reinen Verstand“,116 und Benjamin Libet bringt vor, dass „das Gehirn sich ‚entscheidet‘, eine Handlung zu beginnen, oder zumindest, den Beginn der Handlung vorzubereiten, bevor es irgendein mitteilbares subjektives Bewusstsein davon gibt, dass solch eine Entscheidung getroffen wurde“.117 Demnach entscheiden sich Gehirne, oder ‚entscheiden‘ sich immerhin, und leiten eine Willenshandlung ein. Der Psychologe J. P. Frisby behauptet, dass „es eine symbolische Beschreibung der Außenwelt im Gehirn geben muss, eine Beschreibung in Symbolen, die für die verschiedenen Weltaspekte, mit denen das Sehen uns vertraut macht, stehen“.118 Es gibt demzufolge Symbole im Gehirn und das Gehirn verwendet Symbole und versteht sie vermutlich. Richard Gregory betrachtet „das Sehen als die wahrscheinlich differenzierteste aller Aktivitäten des Gehirns: Es ruft dessen Datenspeicher ab; es erfordert feinste Klassifizierungen, Vergleiche und logische Entscheidungen, damit aus den sensorischen Daten eine Wahrnehmung wird“.119 Demnach sieht, klassifiziert, vergleicht und entscheidet sich das Gehirn. Und Kognitionswissenschaftler denken ähnlich. David Marr vertritt die Ansicht, dass „unsere Gehirne irgendwie imstande sein müssen, Information [. . .] zu repräsentieren [. . .]. Die Erforschung des Sehvermögens muss darum auch eine Untersuchung der Natur innerer Repräsentationen einschließen, durch die wir diese Information erfassen und zu einer Entscheidungsgrundlage für unser Denken und Handeln machen.“120 Und Philip Johnson-Laird legt nahe, dass das Gehirn „Zugang hat zu einem unvollständigen Modell seiner eigenen Fähigkeiten“ und über den „rekursiven MechaA. Damasio, Descartes’ Error – Emotion, Reason and the Human Brain (Papermac, London, 1996), S. 173. [dt. Descartes’ Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn (List, München, 1997), S. 237]. 117 B. Libet, ‚Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action‘, Behavioural and Brain Sciences, 8, (1985), S. 536. 118 J. P. Frisby, Seeing: Illusion, Brain and Mind [dt. Sehen. Optische Täuschungen, Gehirnfunktionen, Bildgedächtnis] (Oxford University Press, Oxford, 1980), S. 8f. Man sollte an dieser Stelle den bemerkenswerten Umstand erwähnen, dass die mit cartesianischen und empirischen Traditionen in Zusammenhang stehende irreführende philosophische Ausdrucksweise, nämlich die Rede von einer ‚Außenwelt‘, vom Geist auf das Gehirn übertragen wurde. Sie war aus dem Grunde irreführend, weil sie den Anschein erweckte, es gäbe eine innere ‚Bewusstseinswelt‘ und eine äußere ‚Welt der Materie‘. Was jedoch ein verworrener Gedanke ist. Wir haben es beim Geist nicht mit einem Ort zu tun, und das, was redensartlich im Geist ist, befindet sich nicht wirklich im Raum (vgl. ‚in der Geschichte‘). Somit ist die Welt (die nicht ‚bloß Materie‘, sondern auch Lebewesen umfasst), räumlich betrachtet, auch nicht ‚außerhalb‘ des Geistes angesiedelt. Der Unterschied zwischen dem, was im Gehirn, und dem, was außerhalb desselben ist, ist rein sprachlicher Natur und ganz unproblematisch. Problematisch hingegen ist die Behauptung, dass es ‚symbolische Beschreibungen‘ im Gehirn gibt. 119 R. L. Gregory, ‚The confounded eye‘, in R. L. Gregory und E. H. Gombrich (Hg.), Illusions in Nature and Art (Duckworth, London, 1973), S. 50. 120 D. Marr, Vision, a Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information (Freeman, San Francisco, 1980), S. 3, Hervorhebungen durch die Autoren. 116
90
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
nismus, Modelle in Modellen zu verankern“, verfügt; Bewusstsein, sagt er, „ist die Eigenschaft einer Klasse von Parallel-Algorithmen“.121 Es ist zu bezweifeln, dass die Zuschreibung psychologischer Attribute zum Gehirn Sinn ergibt Wer diesen weitgehenden Konsens darüber mitträgt, wie Gehirnfunktionen zu denken und wie die kausalen Vorbedingungen für Besitz und Entfaltung der natürlichen Denkund Wahrnehmungsvermögen der Menschen zu verdeutlichen seien, ist anfällig dafür, von enthusiastischen Verlautbarungen mitgerissen zu werden – über neu eroberte Erkenntnisbereiche, gerade eben gelöste Rätsel.122 Wir sollten die Dinge jedoch langsam angehen und denkend innehalten. Wir wissen, was man sich unter Menschen vorzustellen hat, die etwas erfahren, sehen, wissen oder glauben, die Entscheidungen treffen, mehrdeutige Daten interpretieren, Vermutungen anstellen und Hypothesen bilden. Wir verstehen, was induktiv schließende, Wahrscheinlichkeiten abschätzende, Argumente bereitstellende Menschen sind, die Dinge klassifizieren und kategorisieren, denen sie in ihrer Erfahrung begegnen. Wir werfen Fragen auf und suchen nach Antworten, benutzen dabei eine Symbolik – unsere Sprache nämlich –, mit der wir die Dinge beschreibend darstellen. Aber wissen wir, was man sich unter einem Gehirn vorzustellen hat, das sieht oder hört, über Erfahrungen verfügt, etwas weiß oder glaubt? Haben wir irgendeine Vorstellung davon, was ein Entscheidungen treffendes Gehirn sein soll? Begreifen wir, was ein (ob nun induktiv oder deduktiv) schließendes Gehirn darstellt (von einem Neuron ganz zu schweigen), ein Wahrscheinlichkeiten abschätzendes, Argumente zur Verfügung stellendes, Daten interpretierendes und anhand seiner Interpretationen Hypothesen erstellendes Gehirn? Wir können beobachten, ob eine Person dies oder jenes sieht – wir betrachten ihr Verhalten und stellen ihr Fragen. Was aber sollte man sich unter der Beobachtung, ob ein Gehirn etwas sieht, vorstellen – was etwas anderes ist, als das Gehirn eines Menschen, der etwas sieht, zu beobachten. Wir erkennen, wenn eine Person eine Frage stellt oder wenn eine andere ihr antwortet. Haben wir jedoch irgendeine Vorstellung davon, worum es sich bei einem Fragen stellenden oder beantwortenden Gehirn handeln würde? Bei all dem haben wir es mit Attributen menschlicher Wesen zu tun. Ist es eine neue Entdeckung, dass Gehirne auch an solchen menschlichen Aktivitäten beteiligt sind? Gehen die nämlichen Wendungen auf eine von Neurowissenschaftlern, Psychologen und Kognitionswissenschaftlern herrührende Sprachinnovation zurück, die den Alltagsgebrauch P. N. Johnson-Laird, ‚How could consciousness arise from the computations of the brain?‘, in C. Blakemore und S. Greenfield (Hg.), Mindwaves (Blackwell, Oxford, 1987), S. 257. 122 Susan Greenfield gibt, während sie ihrem Fernsehpublikum die Errungenschaften der Positronen-Emissions-Tomographie erläutert, staunend bekannt, dass es erstmalig möglich sei, Gedanken zu sehen. Semir Zeki informiert die Mitglieder der Royal Society darüber, dass das neue Jahrtausend der Neurobiologie gehöre, die unter anderem die uralten philosophischen Probleme lösen werde (siehe S. Zeki, ‚Splendours and miseries of the brain‘, Philosophical Transactions of the Royal Society, B 354, (1999), S. 2054). Wir werden diese Ansicht in 14.4.2 erörtern. 121
3.1 Mereologische Konfusionen in kognitiven Neurowissenschaften
91
dieser psychologischen Ausdrücke aus guten theoretischen Gründen erweitert? Oder haben wir es mit einer Begriffsverwirrung zu tun, was die Sache noch ominöser macht? Könnte es nicht sein, dass es so etwas wie ein denkendes oder wissendes, sehendes oder hörendes, glaubendes oder Vermutungen anstellendes Gehirn nicht gibt, nichts dergleichen wie ein über Information verfügendes und Information verwendendes und Hypothesen bildendes etc. Gehirn – das heißt, dass diese Worte keinen Sinn ergeben? Wenn es das aber nicht gibt, warum sind dann so viele glänzende Wissenschaftler davon ausgegangen, dass die fraglichen Wendungen sinnvoll sind? Ob dem Gehirn psychologische Attribute sinnvoll zugeschrieben werden können, ist eine philosophische und folglich eine begriffliche Frage und keine empirische Bei der Frage, mit der wir konfrontiert sind, handelt es sich um eine philosophische Frage, nicht um eine (natur)wissenschaftliche. Mit experimenteller Forschung ist ihr nicht beizukommen, sie will begrifflich durchdrungen und geklärt werden. Man kann nicht experimentell untersuchen, ob Gehirne denken, glauben, vermuten, folgern, Hypothesen bilden etc. oder ob sie das nicht tun, denn dazu müsste man wissen, was man sich unter einem Gehirn, dass dies tut, vorzustellen hätte – wir müssten uns also über die Bedeutung dieser Wendungen im Klaren sein und wissen, was (gegebenenfalls) als ein Vollzug dieser Dinge durch das Gehirn betrachtet wird und was dafür spräche, dem Gehirn solche Attribute zuzuschreiben. (Man kann nicht nach den Erdpolen suchen, solange man nicht weiß, was ein Pol ist – das heißt, was der Ausdruck ‚Pol‘ bedeutet und was darüber hinaus als Entdeckung eines Erdpols betrachtet wird. Ansonsten würde man vielleicht, wie Winnie Pooh, zu einer Expedition zum Ostpol aufbrechen.) Die entscheidende Frage lautet: Ergibt es Sinn, dem Gehirn solche Attribute zuzuschreiben? Gibt es ein Gehirn-Denken, -Glauben etc.? (Gibt es den Ostpol?) Die Philosophischen Untersuchungen Wittgensteins enthalten eine tiefgründige Bemerkung, die mit unserem Anliegen unmittelbar zu tun hat. „[M]an könne nur vom lebenden Menschen, und was ihm ähnlich ist (sich ähnlich benimmt), sagen, es habe Empfindungen; es sähe; sei blind; höre; sei taub; sei bei Bewusstsein, oder bewusstlos.“123 Diese Sentenz bringt die Einsicht, zu der unsere Untersuchung hinführen will, auf den Punkt. 123
L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, hrsg. von G. E. M. Anscombe und R. Rhees, Wittgenstein Werkausgabe Bd. I, § 281 (siehe auch §§ 282–284, 357–361). Den Grundgedanken zu dieser Bemerkung entwickelte A. J. S. Kenny, ‚The homunculus fallacy‘ (1971), wieder abgedr. in seinem Buch The Legacy of Wittgenstein (Blackwell, Oxford, 1984), S. 125–136. Für eine detaillierte Interpretation von Wittgensteins Feststellung siehe P. M. S. Hacker, Wittgenstein: Meaning and Mind, Volume 3 of an Analytical Commentary on the Philosophical Investigations (Blackwell, Oxford, 1990), Exegesis 281–284, 357–361, und den Essay mit dem Titel ‚Men, minds and machines‘, der einigen Implikationen der wittgensteinschen Einsicht nachgeht. Wie von Kapitel 1 her klar sein dürfte, nahm Aristoteles diese vorweg (DA 408b12–15, zitiert auf S. 19).
92
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
So bündig sie daherkommt, so sorgfältig müssen all ihre Implikationen und Konsequenzen herausgearbeitet werden. Faktische Belange spielen hier keine Rolle. Dass nur von menschlichen Wesen und jenen, die sich wie menschliche Wesen verhalten, gesagt werden kann, sie seien die Subjekte dieser psychologischen Prädikate, ist keine Tatsachenfeststellung. Wäre es eine, dann könnte es sich durchaus um eine Entdeckung handeln, die Neurowissenschaftler kürzlich machten, dass auch Gehirne sehen und hören, denken und glauben, Fragen stellen und beantworten, Hypothesen bilden und mittels Information Vermutungen anstellen. Eine solche Entdeckung würde sehr wohl zeigen, dass man nicht nur von menschlichen Wesen und jenen, die sich wie solche benehmen, so etwas sagen kann. Das würde uns in Erstaunen versetzen und unseren Wissensdurst wecken. Wir würden in Erfahrung bringen wollen, welche Belege man zugunsten dieser bemerkenswerten Entdeckung anführen könnte. Selbstverständlich aber liegen die Dinge anders. Die Zuschreibung psychologischer Attribute zum Gehirn ist durch keine neurowissenschaftliche Entdeckung gerechtfertigt, die den Nachweis erbringt, dass Gehirne, im Gegensatz zu unseren früheren Überzeugungen, tatsächlich denken und folgern, ganz so wie wir es tun. Die Neurowissenschaftler, Psychologen und Kognitionswissenschaftler, die sich dieser Form der Darstellung verschrieben haben, taten dies nicht aufgrund von Beobachtungen, die zu erkennen geben, dass Gehirne denken und folgern. Susan Savage-Rambaugh hat zur Verblüffung vieler nachweisen können, dass Bonobos in der Lage sind, wenn man sie entsprechend trainiert und lehrt, Fragen zu stellen und zu beantworten, auf sehr rudimentäre Weise zu folgern, Befehle zu geben und auszuführen etc. Dass sie das können, offenbart sich in ihrem Verhalten – in dem, was sie in ihrer Interaktion mit uns tun (und darin, wie sie Symbole benutzen). Das war wirklich eine große Überraschung. Denn niemand vermutete, dass Affen solche Fähigkeiten erwerben könnten. Es wäre jedoch absurd zu denken, dass die Zuschreibung kognitiver und kogitativer Attribute zum Gehirn sich in vergleichbarer Weise plausibel machen ließe. Absurd deshalb, weil wir noch nicht einmal wissen, worin der Nachweis, dass das Gehirn über solche Attribute verfügt, bestehen würde. Die irrige Zuschreibung psychologischer Attribute zum Gehirn ist eine Verfallsform des Cartesianismus Weshalb also wurden diese Beschreibungsform und die von ihr abhängenden Erklärungsweisen grundlos und reflexionsfrei aufgegriffen? Wir glauben die Antwort zu kennen: wegen eines gedankenlosen Festhaltens an einer Mutationsform des Cartesianismus. Ein charakteristisches Merkmal des cartesianischen Dualismus bestand darin, dem Geist psychologische Prädikate zuzuschreiben und dem menschlichen Wesen nur nachrangig. Sherrington und seine Schüler Eccles und Penfield hielten in ihren Reflexionen über den Zusammenhang zwischen ihren neurologischen Entdeckungen und den menschlichen Wahrnehmungs- und Kognitionsvermögen an einer Form des Dualismus
3.1 Mereologische Konfusionen in kognitiven Neurowissenschaften
93
fest. Ihre Nachfolger lehnten den Dualismus ab – ganz zu Recht. Die dritte Generation von Neurowissenschaftlern ordnete die Attribute, die die Dualisten dem immateriellen Geist zuschreiben, stattdessen unreflektiert dem Gehirn zu – eine scheinbar unverfängliche Konsequenz der Ablehnung des Zwei-Substanzen-Dualismus des neurowissenschaftlichen Cartesianismus. Diese Wissenschaftler wollten die menschlichen Wahrnehmungs- und Kognitionsvermögen und deren Ausübung erklären, indem sie sich auf das Gehirn und die Entfaltung seiner kognitiven und wahrnehmungsmäßigen Fähigkeiten bezogen. Die Zuschreibung psychologischer Attribute zum Gehirn ist unsinnig Wir behaupten, dass eine solche Zuschreibung psychologischer Prädikate zum Gehirn keinen Sinn ergibt. Dass Gehirne nicht denken, hypothetisieren oder entscheiden, nicht sehen und hören, keine Fragen aufwerfen und beantworten, wurde nicht als Tatsache ermittelt; vielmehr ergibt die Zuschreibung solcher Prädikate oder ihrer Verneinungen zum Gehirn keinen Sinn. Weder sieht das Gehirn, noch ist es blind – genau wie Stöcke und Steine nicht wach sind, aber auch nicht schlafen. Das Gehirn hört nicht, aber es ist nicht taub, genauso wenig wie Bäume taub sind. Das Gehirn trifft keine Entscheidungen, aber es ist auch nicht unentschlossen. Nur das, was entscheiden kann, kann unentschlossen sein. Und folglich kann das Gehirn auch nicht bei Bewusstsein sein, nur das Lebewesen, dessen Gehirn es ist, kann bei Bewusstsein sein – oder nicht bei Bewusstsein bzw. bewusstlos. Das Gehirn ist kein logisch angemessenes Subjekt für psychologische Prädikate. Nur von einem menschlichen Wesen oder einem, das sich entsprechend verhält, kann sinnvoll gesagt und wörtlich gemeint werden, dass es sieht oder blind ist, hört oder taub ist, Fragen stellt oder es unterlässt zu fragen. Wir nähern uns den Fragen also aus der Begriffsperspektive. Dem Gehirn psychologische Prädikate (oder ihre Verneinungen) zuzuschreiben, ergibt keinen Sinn, es sei denn in metaphorischer oder metonymischer Hinsicht. Die daraus resultierende Wortkombination sagt nichts Falsches, sie sagt vielmehr überhaupt nichts, weil sie keinen Sinn hat. Psychologische Prädikate sind Prädikate, die notwendigerweise auf das ganze Lebewesen zutreffen, nicht auf Teile von ihm. Nicht das Auge (geschweige denn das Gehirn) sieht, sondern wir sehen mit unseren Augen (und wir sehen nicht mit unseren Gehirnen, obgleich wir ohne ein normal funktionierendes Gehirn, was das visuelle System betrifft, nicht sehen könnten). Folglich hört auch nicht das Ohr, sondern das Lebewesen, dessen Ohr es ist. Die Körperteile eines Lebewesens gehören zu ihm als seine Teile, und psychologische Prädikate können nur dem ganzen Lebewesen zugeschrieben werden, nicht seinen konstituierenden Teilen.
94
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
Die Zuschreibung psychologischer Attribute zum Gehirn durch Neurowissenschaftler kann als ‚der mereologische Fehlschluss‘ in den Neurowissenschaften bezeichnet werden Die Mereologie ist die Logik der Teil-Ganzes-Relationen. Den Irrtum, den sich Neurowissenschaftler zuschulden kommen lassen, wenn sie den konstituierenden Teilen eines Lebewesens Attribute zuzuschreiben, die in logischer Hinsicht nur auf das ganze Lebewesen zutreffen, werden wir den ‚mereologischen Fehlschluss‘ in den Neurowissenschaften nennen.124 Das Prinzip, dass die psychologischen Prädikate, die nur auf menschliche Wesen (oder andere Tiere) als Ganze zutreffen, auf ihre Teile (wie das Gehirn) nicht sinnvoll angewendet werden können, werden wir ‚das mereologische Prinzip‘ in den Neurowissenschaften nennen.125 Von menschlichen Wesen, nicht aber von ihren Gehirnen, kann man sagen, dass sie rücksichtsvoll oder nicht rücksichtsvoll sind; von Tieren, nicht aber von ihren Gehirnen, und schon gar nicht von deren Hemisphären, kann man sagen, dass sie etwas sehen, hören, riechen und schmecken; von Menschen, nicht aber von ihren Gehirnen, kann man sagen, dass sie Entscheidungen treffen oder unentschlossen sind. Es sollte festgehalten werden, dass es viele Prädikate gibt, die sowohl auf ein gegebenes Ganzes (insbesondere einen Menschen) als auch auf dessen Teile angewendet werden können, wobei möglicherweise aus der Anwendung auf das eine auf die Anwendung auf das andere geschlossen wird. Ein Mann kann braun gebrannt sein und sein Gesicht kann braun gebrannt sein; er kann am ganzen Körper kalt sein, also werden auch seine Hände kalt sein. Ebenso weiten wir mitunter den Anwendungsbereich eines Prädikats von einem menschlichen Wesen auf die Teile des menschlichen Körpers aus; so sagen wir beispielsweise, dass ein Mann die Klinke ergriff und auch, dass seine Hand die Klinke ergriff; dass er ausrutschte und dass sein Fuß ausrutschte. Hier gibt es logisch nichts zu beanstanden. Psychologische Prädikate treffen jedoch gemeinhin auf den Menschen (oder das Tier) Kenny (‚Homunculus fallacy‘, S. 125) verwendet den Begriff ‚Homunkulus-Fehlschluss‘, um den besagten Begriffsirrtum zu benennen. Er räumt ein, dass sein Ausdruck trotz seiner Anschaulichkeit irreführend sein könnte, weil der Irrtum nicht einfach darin besteht, dass man einem imaginären Homunkulus im Kopf psychologische Prädikate zuschreibt. Wir finden den Begriff ‚mereologischer Fehlschluss‘ passender. Man darf jedoch nicht übersehen, dass der nämliche Irrtum sich nicht darauf beschränkt, einem Teil Prädikate zuzuschreiben, die nur auf ein Ganzes zutreffen, sondern dass er einen Spezialfall dieser allgemeinen Konfusion darstellt. Wie Kenny betont, handelt es sich bei der Falschanwendung eines Prädikats genau genommen nicht um einen Fehlschluss, sondern um eine unzulässige Überlegung bzw. ungerechtfertigte Argumentation, die jedoch zu Fehlschlüssen führt (ibid., S. 135f.). Allerdings ist diese mereologische Konfusion unter Psychologen und Neurowissenschaftlern weit verbreitet. 125 Ähnliche mereologische Prinzipien treffen auf unbelebte Objekte und manche ihrer Eigenschaften zu. Aus der Tatsache, dass ein Auto schnell ist, folgt nicht, dass sein Vergaser schnell ist, und aus der Tatsache, dass eine Uhr die Zeit richtig anzeigt, folgt nicht, dass ihr großes Zahnrad die Zeit richtig anzeigt. 124
3.2 Methodologische Bedenken
95
als ein Ganzes zu und nicht auf den Körper und seine Teile. Einige Ausnahmen gibt es, wie die Anwendung von Empfindungsverben wie ‚schmerzen/wehtun‘ auf Teile des Körpers – z. B. „Meine Hand schmerzt“, „Du hast meiner Hand wehgetan“.126 Die für unsere Belange relevanten psychologischen Prädikate – jene, die von Neurowissenschaftlern, Psychologen und Kognitionswissenschaftlern immer dann angeführt wurden, wenn es ihnen darum ging, die menschlichen Fähigkeiten und ihre Ausübung zu erklären – können nicht wörtlich oder buchstäblich auf die Teile des Körpers angewendet werden. Sie lassen sich insbesondere nicht sinnvoll auf das Gehirn anwenden.
3.2 Methodologische Bedenken Methodologische Einwände gegen den Vorwurf, Neurowissenschaftler hätten sich den mereologischen Fehlschluss zuschulden kommen lassen Wenn jemand einer Entität ein Prädikat zuschreibt, auf die es logisch nicht zutrifft, und er darauf aufmerksam gemacht wird, dann kann man davon ausgehen, dass er empört insistiert, er hätte ‚das so nicht gemeint‘. Schließlich sagt er vielleicht (weil es sich bei Unsinn um Worte handelt, die nichts sagen, die es ‚versäumen‘, einen möglichen Sachverhalt zu beschreiben), er habe natürlich keinen Unsinn gemeint – Unsinn kann man nicht meinen, weil es dabei gleichsam nichts zu meinen gibt. Demnach dürfen seine Worte nicht so verstanden werden, als verfügten sie über ihre gewöhnliche Bedeutung. Die problematischen Ausdrücke wurden vielleicht in einem speziellen Sinn verwendet und es handelt sich bei ihnen in Wahrheit bloß um Homonyme; oder sie erweiterten den gewöhnlichen Sprachgebrauch per Analogie, wie so oft schon in der Wissenschaft praktiziert; oder sie wurden metaphorisch bzw. bildlich verwendet. Trifft einer dieser Fälle zu, ist der Vorwurf, die Neurowissenschaftler seien dem mereologischen Fehlschluss zum Opfer gefallen, nicht aufrechtzuhalten. Obwohl sie von demselben psychologischen Wortschatz Gebrauch machen, den jedermann verwendet, verwenden sie ihn in anderer Weise. Folglich sind die Einwände gegen den Wortgebrauch der Neurowissenschaftler, die auf der Grundlage der Alltagsverwendung dieser Worte vorgebracht werden, irrelevant. So klar liegen die Dinge allerdings nicht. Natürlich beabsichtigt derjenige, der ein Prädikat in der nämlichen Weise falsch zuschreibt, nicht, sich unsinnig zu äußern. Dass 126
Wenn meine Hand wehtut, habe wohlgemerkt ich Schmerzen, nicht meine Hand. Und wenn jemand meiner Hand wehgetan hat, hat er mir wehgetan. Empfindungsverben treffen (anders als Wahrnehmungsverben) auf Teile des Körpers zu; d. h., unser Körper ist empfindsam und seine Teile können wehtun, jucken, klopfen etc. Allerdings dürfen die korrespondierenden Verb-Phrasen, die Substantive umfassen, z. B. ‚Schmerzen haben (ein Jucken, eine Klopfen spüren)‘, nur auf die Person bezogen vorgebracht bzw. geäußert werden, nicht in Bezug auf ihre Teile (in denen die Empfindung lokalisiert ist).
96
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
er jedoch keinen Unsinn äußern wollte, garantiert nicht, dass er es nicht tat. Obgleich er natürlich insistieren wird, dass er ‚es so nicht meinte‘, das fragliche Prädikat nicht seiner Alltagsbedeutung gemäß verwendet habe, stellt nicht sein Beharren die letzte Legitimationsinstanz dar, sondern sein eigenes Denken. Man muss darauf achten, was er sich unter seinen Worte vorstellt und wie er seine Überlegungen weiterdenkt, welche Schlussfolgerungen er zieht – und daran zeigt sich, ob er das Prädikat in einem neuen Sinn gebrauchte oder missbräuchlich verwendete. Wer ihn überführen will, muss das mit dessen Worten tun. Werfen wir also einen Blick auf die angeführten Fälle, die zeigen sollen, dass die Neurowissenschaftler und Kognitionswissenschaftler die Irrtümer, die wir ihnen zur Last legen, nicht begangen haben. Erster Einwand (Ullman): Die so verwendeten psychologischen Prädikate sind Homonyme der gewöhnlichen psychologischen Prädikate und haben eine andere, fachspezifische Bedeutung Erstens könnte behauptet werden, dass die Neurowissenschaftler in Wirklichkeit Homonyme verwenden, die etwas gänzlich anderes bedeuten. Daran, dass die Wissenschaftler unter dem Druck einer neuen Theorie eine neue Redensweise einführen, ist nichts Ungewöhnliches oder gar Unstatthaftes. Sollte ein unwissender Leser davon verwirrt sein, ließe sich die Verwirrung leicht beseitigen. Natürlich denken, glauben, schließen, interpretieren oder hypothetisieren Gehirne nicht im wörtlichen Sinn, sie denken*, glauben*, schließen*, interpretieren* und hypothetisieren*. Sie haben oder konstruieren keine symbolische Repräsentationen, sondern symbolische Repräsentationen*.127 Zweiter Einwand (Gregory): Die psychologischen Prädikate werden als Analogie-Erweiterungen der gewöhnlichen Ausdrücke verwendet Zweitens könnte behauptet werden, dass die Neurowissenschaftler den Alltagsgebrauch des einschlägigen Wortschatzes durch Analogiebildungen erweitern, wie das in der Geschichte der Wissenschaft häufig der Fall gewesen ist – in der analogen Erweiterung der Hydrodynamik in der Elektrizitätstheorie beispielsweise. Um die Zuschreibung psychologischer Prädikate zum Gehirn mit der Begründung zu beanstanden, dass solche Prädikate in der Alltagssprache nur auf das Lebewesen als Ganzes angewendet werden, ist es daher notwendig, eine Form semantischer Trägheit [semantic inertia; Beharrung auf den gewöhnlichen Bedeutungen] aufzuweisen.128 Siehe Simon Ullman, ‚Tacit assumptions in the computational study of vision‘, in A. Gorea (Hg.), Representations of Vision, Trends and Tacit Assumptions in Vision Research (Cambridge University Press, Cambridge, 1991), S. 314ff. zu dieser Argumentation. Er begrenzt seine Auseinandersetzung auf den Gebrauch (bzw. Missbrauch, wie wir meinen) solcher Termini wie ‚Repräsentation‘ und ‚symbolische Repräsentation‘. 128 Die Wendung geht auf Richard Gregory zurück; siehe ‚The confounded eye‘, S. 51. 127
3.2 Methodologische Bedenken
97
Dritter Einwand (Blakemore): Die Zuschreibung psychologischer Attribute zum Gehirn durch die Neurowissenschaftler ist metaphorisch bzw. bildlich, da sie ganz genau wissen, dass das Gehirn nicht denkt oder Karten verwendet Schließlich könnte behauptet werden, dass die Neurowissenschaftler nicht wirklich denken, dass das Gehirn auf die gleiche Weise folgert, argumentiert, Fragen aufwirft und beantwortet wie wir. Sie glauben nicht, dass das Gehirn wirklich Anhaltspunkte interpretiert, Vermutungen anstellt oder die Außenwelt beschreibende Symbole enthält. Und obwohl sie davon sprechen, dass das Gehirn ‚Karten‘ und ‚interne Repräsentationen‘ enthält, verwenden sie diese Ausdrücke nicht in ihrer Alltagsbedeutung. Vielmehr haben wir es hier mit metaphorischer Sprache bzw. Bildsprache zu tun – mitunter sogar mit dichterischer Freiheit.129 Die Neurowissenschaftler sind von solchen Redeweisen somit auch nicht im Mindesten verwirrt – sie wissen ganz genau, was sie sagen wollen, haben nur die Worte nicht, um es anders als metaphorisch bzw. bildlich zu sagen. Erwiderung auf den Einwand, dass Neurowissenschaftler den psychologischen Wortschatz in einem fachspezifischen Sinn verwenden Was den mit der Zuschreibung psychologischer Prädikate zum Gehirn verbundenen Wortschatz angeht, deutet alles darauf hin, dass die Neurowissenschaftler diese Termini nicht in einem spezifischen Sinn verwenden. Weit entfernt davon, neue Homonyme zu sein, werden die verwendeten psychologischen Ausdrücke in ihrem Alltagsverständnis angeführt, sonst würden die Neurowissenschaftler andere als die tatsächlich gezogenen Schlüsse aus ihnen ziehen. Wenn Crick versichert, dass das, „was man sieht, [. . .] nicht das [ist], was wirklich da ist; es ist das, wovon Ihr Gehirn glaubt, es sei da“, misst er ‚glaubt‘, und das ist wichtig, all dessen gewöhnliche Konnotationen bei – das heißt, dieser Ausdruck hat eine andere Bedeutung als irgendein neuer Terminus ‚glaubt*‘. Denn es ist Teil des Crick’schen Verständnisses, den Glauben als das Ergebnis einer Interpretation aufzufassen, die auf einer früheren Erfahrung und Information basiert (und nicht als das Ergebnis einer Interpretation*, die auf einer früheren Erfahrung* und Information* basiert). Wenn Semir Zeki anmerkt, dass der Erwerb von Wissen eine ‚primordiale Gehirnfunktion‘130 ist, meint er Wissen und nicht Wissen* – ansonsten würde er die Aufgabe zukünftiger neurowissenschaftlicher Anstrengungen nicht darin sehen, die Probleme der Epistemologie zu lösen (aber wohl nur die der Epistemologie*). Wenn Young davon spricht, dass das Gehirn Wissen und Information beinhaltet, die im Ge-
Siehe C. Blakemore, ‚Understanding images in the brain‘, in H. Barlow, C. Blakemore und M. Weston-Smith (Hg.), Images and Understanding (Cambridge University Press, Cambridge, 1990), S. 257–283. 130 S. Zeki, ‚Abstraction and idealism‘, Nature, 404 (April 2000), S. 547. 129
98
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
hirn kodiert sind, „genau wie Wissen in Büchern oder Computern aufgezeichnet werden kann“,131 meint er gleichfalls Wissen und nicht Wissen* – denn Wissen und Information können in Büchern oder Computern aufgezeichnet werden, Wissen* und Information* nicht. Wenn Milner, Squire und Kandel vom ‚deklarativen Gedächtnis‘ sprechen, erklären sie, dass diese Wendung das zum Ausdruck bringt, „was für gewöhnlich mit dem Wort ‚Gedächtnis‘ gemeint ist“,132 verkünden dann aber, dass solche Erinnerungen, und nicht Erinnerungen*, ‚im Gehirn gespeichert‘ sind. Das setzt voraus, dass es sinnvoll ist, vom Speichern der Erinnerungen (im gewöhnlichen Sinn des Wortes) im Gehirn zu sprechen (für eine detaillierte Erörterung dieser fragwürdigen Behauptung siehe unten 5.2.2). Erwiderung auf Ullman: David Marr über ‚Repräsentationen‘ Der Vorwurf, dass es sich um einen mereologischen Fehlschluss handelt, kann so leicht nicht entkräftet werden. Simon Ullman steht jedoch scheinbar auf sichererem Boden, wenn er von internen Repräsentationen und symbolischen Repräsentationen (als auch von Karten) im Gehirn spricht. Wenn ‚Repräsentation‘ nicht das bedeutet, was es üblicherweise bedeutet, wenn ‚symbolisch‘ nichts mit Symbolen zu tun hat, dann freilich kann es unverfänglich sein zu sagen, dass es interne, symbolische Repräsentationen im Gehirn gibt. (Und wenn ‚Karten‘ nichts mit Atlanten zu tun haben, sondern nur mit Kartierungen, dann kann es auch unverfänglich sein zu sagen, dass es Karten im Gehirn gibt.) Homonyme zu vermehren ist zwar eine außerordentlich schlechte Idee, birgt jedoch solange keine begriffliche Inkohärenz in sich, wie die Wissenschaftler, die diese Begriffe verwenden, nicht vergessen, dass diese nicht über ihre Alltagsbedeutung verfügen. Leider vergessen sie das für gewöhnlich, kreuzen weiterhin den alten Gebrauch mit dem neuen und erzeugen so Inkohärenz. Im Zusammenhang mit seiner Verteidigung Marrs besteht Ullman (absolut korrekt) darauf, dass bestimmte Gehirnereignisse als Repräsentationen* der (Raum-)Tiefe oder der Anordnung oder des Reflexionsgrads aufgefasst werden können;133 das heißt, dass man bestimmte neurale ‚Feuersalven‘ und Merkmale im Gesichtsfeld miteinander in Beziehung setzen kann (und jene als ‚Repräsentationen*‘ von diesen bezeichnet). Das ist jedoch augenscheinlich nicht alles, was Marr zum Ausdruck bringen wollte. Er behauptete, dass wir es bei Zahlensystemen (romanische oder arabische Zahlen, die Binärschreibweise) mit Repräsentationen zu tun haben. Solche Darstellungsformen dürfen allerdings nicht mit Kausalbeziehungen verwechselt werden, da wir es bei ihnen mit Repräsentationskonventionen zu tun haben. Er behauptete, dass „eine Gestaltrepräsentation ein Form-Schema zur Beschreibung einiger Gestalt131
Young, Programs of the Brain, S. 192. Brenda Milner, Larry R. Squire und Eric R. Kandel, ‚Cognitive neuroscience and the study of memory‘, Neuron, 20 (1998), S. 450. 133 Ullman, ‚Tacit assumptions‘, S. 314f. 132
3.2 Methodologische Bedenken
99
aspekte wäre, zusammen mit Regeln, die festlegen, wie das Schema auf jede besondere Gestalt angewendet wird“,134 dass ein Form-Schema „ein Set von Symbolen mit Regeln für ihre Zusammenstellung“135 und dass „eine Repräsentation deshalb keineswegs ein fremder Gedanke ist – wir alle verwenden die ganze Zeit über Repräsentationen. Dass man einige Aspekte der Wirklichkeit durch ihre Beschreibung mit Symbolen erfassen und dass das nützlich sein kann, scheint mir indes eine kraftvolle und faszinierende Vorstellung zu sein.“136 Der Sinn aber, in dem wir „die ganze Zeit über Repräsentationen verwenden“, in dem Repräsentationen regelgeleitete Symbole sind und in dem sie zur Beschreibung der Dinge verwendet werden, speist sich aus der konventionellen Semantik von ‚Repräsentation‘ – wir haben es also nicht mit einem Homonym zu tun, das in einem Kausalsinn aufzufassen wäre. Marr ist in seine eigene Falle gegangen.137 In Wirklichkeit vereinigte er Ullmans Repräsentationen*, die Kausalbeziehungen sind, mit Repräsentationen, die Symbole sind oder symbolische Systeme mit einer Syntax und mit einer durch Konventionen festgelegten Bedeutung. Erwiderung auf Ullman: Young über ‚Karten‘ und Frisby über ‚symbolische Repräsentationen‘ Es wäre gleichermaßen irreführend, andererseits jedoch unverfänglich, von Karten im Gehirn zu sprechen, wenn das damit Gemeinte darin bestehen würde, dass bestimmte Merkmale des Gesichtsfeldes gemäß den Feuersalven von Zellgruppen im ‚visuellen‘ Streifenkortex kartiert werden können. Dann darf man aber nicht wie Young fortfahren und sagen, dass das Gehirn von seinen Karten Gebrauch macht, indem es seine Hypothese über das Sichtbare erstellt. Unverfänglich wäre es also auch, von symbolischen Repräsentationen im Gehirn zu sprechen, solange wie ‚symbolisch‘ nichts mit der logischsemantischen Bedeutung zu tun hat, sondern lediglich eine ‚natural meaning‘ [eine ‚natürliche‘, nicht durch Konventionen festgelegte Bedeutung] meint (wie in ‚smoke means fire‘, ‚wo Rauch ist, ist auch Feuer‘). Dann darf man aber nicht wie Frisby fortfahren und sagen, dass „es eine symbolische Beschreibung der Außenwelt im Gehirn geben muss, eine Beschreibung in Symbolen, die für die verschiedenen Weltaspekte, mit denen das Sehen uns vertraut macht, stehen.“138 Denn ‚Symbol‘ wird hier offenkundig im logisch-semantischen Sinn gebraucht. Denn während dort, wo Rauch ist, auch Feuer ist, da Rauch ein Zeichen des Feuers ist (ein induktiv in Beziehung gesetztes Anzeichen), ist er kein Zeichen für Feuer. Rauch, der von einem entfernten Hang aufsteigt, ist keine Be134 135 136 137
Marr, Vision, S. 20. Ibid., S. 21. Ibid. Für weitere Kritik an Marrs computationaler Betrachtungsweise der Sehkraft siehe unten
4.2.4. 138
Frisby, Seeing, S. 8.
100
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
schreibung des Feuers in Symbolen, und das Feuern der Neuronen im ‚visuellen‘ Streifenkortex ist keine symbolische Beschreibung von Objekten im Gesichtsfeld, auch wenn ein Neurowissenschaftler aus seinem Wissen darum, welche Zellen im ‚visuellen‘ Streifenkortex feuern, darauf zu schließen vermag, was dem Lebewesen sichtbar ist. Die Feuersalven der Zellen in V1 mögen Zeichen einer Gestalt mit bestimmten Umrisslinien im Gesichtsfeld des Lebewesens sein, sie stehen jedoch nicht für irgendetwas, es handelt sich bei ihnen nicht um Symbole und sie beschreiben nichts. Erwiderung auf den zweiten Einwand (Gregory), dass Neurowissenschaftler, indem sie dem Gehirn psychologische Attribute zuschreiben, nicht dem mereologischen Fehlschluss erliegen, sondern lediglich den psychologischen Wortschatz durch Analogiebildungen erweitern Man könnte den Eindruck gewinnen, dass der Gedanke, der neurowissenschaftliche Sprachgebrauch erweitere den psychologischen Wortschatz auf innovative und begrifflich kohärente Weise, dem Vorwurf zu entgehen ermöglicht, die Beschreibungen der neurowissenschaftlichen Entdeckungen überschritten gemeinhin die Sinngrenzen. Es ist gewiss richtig, dass der wissenschaftliche Erkenntnisfortschritt sich auch Analogiebildungen verdankt. Die hydrodynamische Analogie brachte die Elektrizitätstheorie maßgeblich voran, obgleich der elektrische Strom nicht in demselben Sinn fließt wie Wasser und es sich bei einem Elektrokabel nicht um eine Wasserleitung handelt. Strittig ist, ob man die Anwendung des psychologischen Wortschatzes auf das Gehirn als analoge auffassen darf. Dafür spricht kaum etwas. Die Anwendung der psychologischen Ausdrücke auf das Gehirn ist nicht Teil einer komplexen Theorie, die mit funktionalen, mathematischen Beziehungen operiert, welche durch quantifizierbare Gesetze, wie man sie aus der Elektrizitätstheorie kennt, ausdrückbar sind. Die Sache scheint viel einfacher zu sein. So trifft es zu, dass Psychologen in Anlehnung an Freud und andere die Begriffe des Glaubens, Verlangens und der Motivation erweitert haben, um vom unbewussten Glauben, Verlangen und von unbewussten Motiven zu sprechen. Wenn diese Begriffe eine solche analoge Erweiterung erfahren, wird etwas Neues erklärungsbedürftig. Die neu erweiterten Ausdrücke lassen die alten kombinatorischen Möglichkeiten nicht mehr zu. Sie haben eine abweichende Bedeutung, die auf die alte maßgeblich bezogen ist und die erklärt werden muss. Zum Beispiel weist die Beziehung zwischen einem (bewussten) Glauben und einem unbewussten Glauben keine Ähnlichkeit mit der zwischen einem sichtbaren Stuhl und einem dem Blick verborgenen Stuhl auf – ein unbewusster Glauben ist nicht ‚genau so wie ein bewusster Glauben, nur unbewusst‘, sondern ihre Beziehung ähnelt eher der zwischen Ö1 und Ö–1. Auch wenn Neurowissenschaftler wie Sperry und Gazzaniga davon sprechen, dass die linke Hemisphäre Entscheidungen trifft, Interpretationen erzeugt, etwas weiß, beobachtet und erklärt – im Folgenden wird deutlich, dass sie diesen psychologischen Ausdrücken keine neue Bedeutung gegeben haben. Sonst hätte man nicht behauptet, dass es sich bei einer Gehirnhemisphäre „um ein bewusstes System mit eigener Daseinsberechtigung handelt, das aus eigener Kraft wahrnimmt, denkt,
3.2 Methodologische Bedenken
101
sich erinnert, folgert, will und Emotionen hat, und das jeweils auf einer typisch menschlichen Ebene“.139 Unsere Behauptung, dass Neurowissenschaftler an verschiedenen Formen begrifflicher Inkohärenz teilhaben, beruft sich nicht auf semantische Trägheit bzw. darauf, dass Bedeutungen unverändert übernommen werden. Sie gründet vielmehr in der Anerkennung der Logik psychologischer Ausdrücke. Psychologische Prädikate treffen nur auf das ganze Lebewesen zu, nicht auf seine Teile. Es gibt keine Vereinbarungen, die bestimmen würden, was mit der Zuschreibung solcher Attribute zu einem Teil eines Lebewesens, insbesondere zu seinem Gehirn, zum Ausdruck kommen soll. Folglich überschreitet die Anwendung solcher Prädikate auf das Gehirn oder die Hemisphären die Sinngrenzen. Die resultierenden Darlegungen sind nicht falsch, denn um zu sagen, dass etwas falsch ist, müssen wir irgendeine Vorstellung davon haben, worin seine Wahrheit bestünde – in diesem Fall müssten wir wissen, was ein denkendes, folgerndes, sehendes, hörendes etc. Gehirn wäre, und herausgefunden haben, dass das Gehirn so etwas in Wirklichkeit nicht tut. Aber wir haben keine solche Vorstellung, und diese Darlegungen sind nicht falsch. Die fraglichen Sätze ergeben vielmehr keinen Sinn. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie albern oder dumm sind. Es bedeutet, dass solchen Wortgebilden kein Sinn verliehen wurde und dass sie dementsprechend gar nichts sagen, obwohl es so aussieht, als sagten sie etwas. Erwiderung auf den dritten Einwand (Blakemore), dass die Zuschreibung psychologischer Attribute zum Gehirn bloß metaphorisch ist Der dritte methodologische Einwand wurde von Colin Blakemore erhoben. Im Hinblick auf Wittgensteins Bemerkung, „man könne nur vom lebenden Menschen, und was ihm ähnlich ist (sich ähnlich benimmt), sagen, es habe Empfindungen; es sähe; sei blind; höre; sei taub; sei bei Bewusstsein, oder bewusstlos“, stellt Blakemore fest, dass „sie trivial, vielleicht auch nur einfach falsch zu sein scheint“. Im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit der Anschuldigung, die von Neurowissenschaftlern vorgebrachte Rede über ‚Karten‘ im Gehirn könne falsch verstanden werden und zu Verwirrungen Anlass geben (denn sie kann nichts anderes meinen, als dass man beispielsweise Aspekte von Elementen des Gesichtsfeldes dem Feuern der Zellen im ‚visuellen‘ Streifenkortex gemäß kartieren kann), merkt Blakemore an, dass es überwältigende Belege für ‚topografische Aktivitätsmuster‘ im Gehirn gibt. Seit Hughlings Jacksons Zeit entwickelte sich die Vorstellung der funktionalen Unterteilung und topografischen Repräsentation zum sine qua non der Hirnforschung. Die Aufgabe, das Gehirn Roger Sperry, ‚Lateral specialization in the surgically seperated hemispheres‘, in F. O Schmitt und F. G. Worden (Hg.), The Neurosciences Third Study Programme (MIT Press, Cambridge, MA, 1974), S. 11, (Hervorhebungen durch die Autoren). Für eine detaillierte Überprüfung dieser Darstellungsweisen siehe unten 14.3. 139
102
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
zu kartografieren, ist keineswegs abgeschlossen, die in der Vergangenheit erreichten Fortschritte deuten jedoch darauf hin, dass wahrscheinlich jeder Teil des Gehirns (und besonders der zerebrale Kortex) räumlich angeordnet ist. Genau wie bei der Decodierung einer Chiffre, der Umsetzung von Linear B oder der Hieroglyphenforschung brauchen wir bloß eine Reihe von Regeln, um die Ordnung des Gehirns zu erkennen – Regeln, die die Nervenaktivität mit Ereignissen in der Außenwelt oder im Körper des Lebewesens miteinander in Beziehung setzen.140
Der Terminus ‚Repräsentation‘ meint hier wohl lediglich systematischen Kausalzusammenhang. Was verfänglich genug ist, aber nicht in dem Sinne verstanden werden darf, in dem man von einem Satz sagen kann, dass er den Sachverhalt, den er beschreibt, repräsentiert, oder in dem Sinne, in dem man von einer Karte oder einem Gemälde sagen kann, dass sie/es das repräsentiert, von dem sie/es eine Karte bzw. ein Gemälde ist. Eine solche Uneindeutigkeit im Gebrauch von ‚Repräsentation‘ ist allerdings riskant, weil sie voraussichtlich zu einer Verwechselung der unterschiedlichen Sinngestalten führt. Und wie verwirrend das sein kann, zeigt sich in Blakemores weiteren Darlegungen: In Anbetracht der überwältigenden Belege für topografische Aktivitätsmuster im Gehirn überrascht es kaum, dass die Neurophysiologen und Neuroanatomen dazu übergingen, vom Gehirn zu sagen, es verfüge über Karten, von denen man annimmt, dass sie bei der Repräsentation und Interpretation der Welt durch das Gehirn eine wesentliche Rolle spielen, genau wie die Karten eines Atlanten es für ihre Benutzer tun. Der Biologe J. Z. Young schreibt von dem über eine Art piktografischer Sprache verfügenden Gehirn: ‚Was im Gehirn vorgeht, muss eine genaue Repräsentation der außerhalb seiner stattfindenden Ereignisse bereitstellen, und die Organisation seiner Zellen stellt ein detailliertes Weltmodell bereit. Es übermittelt Bedeutungen anhand topografischer Analogien.‘141 Ist die metaphorische Verwendung solcher Termini wie ‚Sprache‘, ‚Grammatik‘ und ‚Karte‘, um die Gehirneigenschaften zu beschreiben, mit einem Risiko verknüpft? [. . .] Ich kann nicht glauben, dass irgendein Neurowissenschaftler glaubt, es gebe einen geisterhaften Kartografen, der den zerebralen Atlanten durchstöbert. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es sich bei der Verwendung alltäglicher Worte (wie Karte, Repräsentation, Code, Information und selbst Sprache) um einen begrifflichen Irrtum [der unterstellten Art] handelt. Eine solche metaphorische Sprache ist eine Mischung aus empirischer Beschreibung, dichterischer Freiheit und einem unzulänglichen Wortschatz.142
Die metaphorische Verwendung von Worten ist dann riskant, wenn nicht deutlich wird, dass sie rein metaphorisch ist, und wenn der Autor nicht in Erinnerung behält, dass sie nichts anderes ist als das. Ob die von Neurowissenschaftlern praktizierte Zuschreibung von Attributen, die im wörtlichen Sinn nur auf das Lebewesen als Ganzes angewendet Blakemore, ‚Understanding images in the brain‘, S. 265. Wir weisen darauf hin, dass man, um die Ordnung des Gehirns zu erkennen, nicht eine Reihe von Regeln benötigt, sondern bloß eine Reihe regelmäßiger Korrelationen. Bei einer Regel handelt es sich, anders als bei einer bloßen Regelmäßigkeit, um einen Durchführungsstandard, einen Richtigkeitsmaßstab, mit dem das Verhalten als richtig oder falsch, korrekt oder unkorrekt beurteilt werden kann. 141 Young, Programs of the Brain, S. 52. 142 Blakemore, ‚Understanding images in the brain‘, S. 265–267. 140
3.2 Methodologische Bedenken
103
werden können, tatsächlich rein metaphorisch (metonymisch oder synekdochisch) ist, kann man sehr bezweifeln. Selbstverständlich denken die Neurowissenschaftler nicht, dass es einen den zerebralen Atlanten durchstöbernden ‚geisterhaften Kartografen‘ gibt – sie denken aber, dass das Gehirn von den Karten Gebrauch macht. Laut Young bildet das Gehirn Hypothesen, und zwar anhand dieser „topografisch angeordneten Repräsentationen“.143 Die entscheidende Frage lautet: Was folgern die Neurowissenschaftler aus ihrer Behauptung, dass es im Gehirn Karten oder Repräsentationen gibt, oder aus der Annahme, dass das Gehirn Information enthält, oder aus der Rede ( J. Z. Youngs Rede) von ‚Sprachen des Gehirns‘? All diese vorgeblich metaphorischen Verwendungen sind für denjenigen, der sie in Anspruch nimmt, die reinsten Bananenschalen. Es muss nicht sein, dass er auf sie tritt und ausgleitet, er wird es aber kaum vermeiden können. Blakemores Verwirrung Wie leicht eine angeblich ganz harmlose Metapher Verwirrung stiften kann, wird in dem oben zitierten Abschnitt Blakemores deutlich. Denn während es unverfänglich sein kann, von ‚Karten‘ zu sprechen – das heißt von Kartierungen von Merkmalen des Wahrnehmungsfeldes gemäß den topografisch miteinander in Beziehung stehenden Zellgruppen, die systematisch für solche Merkmale empfänglich sind –, ist es alles andere als unverfänglich, davon zu sprechen, dass solche ‚Karten‘ „bei der Repräsentation und Interpretation der Welt durch das Gehirn eine wesentliche Rolle spielen, genau wie die Karten eines Atlanten es für ihre Benutzer tun“ (unsere Hervorhebungen). Zunächst einmal ist nicht klar, in welchem Sinn der Terminus ‚Interpretation‘ in diesem Kontext verwendet wurde. Denn es ist keineswegs evident, was man sich unter der Behauptung vorzustellen hat, dass die topografischen Beziehungen zwischen Zellgruppen, die in systematischem Zusammenhang mit Merkmalen des Wahrnehmungsfeldes stehen, eine wesentliche Rolle bei der Interpretation von etwas durch das Gehirn spielen. Interpretieren bedeutet im Wortsinn: die Bedeutung von etwas erklären oder etwas Uneindeutiges in der einen statt einer anderen Bedeutung auffassen. Es ergibt jedoch keinen Sinn anzunehmen, dass das Gehirn irgendetwas erklärt oder dass es etwas in der einen statt einer anderen Bedeutung auffasst. Wer sich J. Z. Young zuwendet, um in Erfahrung zu bringen, worum es ihm ging, wird auf die Behauptung stoßen, dass das Gehirn anhand dieser Karten ‚Hypothesen und Programme erstellt‘ – und das führt uns nur tiefer in den Schlamassel. Und was noch wichtiger ist: In welchem Sinn man Blakemores Behauptung, ‚Gehirnkarten‘ (die keine wirklichen Karten sind) spielen bei der „Repräsentation und Interpretation der Welt“ eine wesentliche Rolle, auch versteht, sie können das nicht „genauso [tun], wie die Karten eines Atlanten es für ihre Benutzer tun“. Denn eine Karte ist eine bildliche Repräsentation, die in Übereinstimmung mit den Kartografiekonventionen und 143
Young, Programs of the Brain, S. 11.
104
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
Projektionsregeln erstellt wurde. Und wer einen Atlas benutzen will, muss diese Konventionen kennen und die Merkmale des Repräsentierten aus den Karten herauslesen. Bei den ‚Karten‘ im Gehirn handelt es sich überhaupt nicht um Karten in diesem Sinn. Das Gehirn ist nicht mit dem Benutzer eines Atlanten zu verwechseln, denn man kann von ihm, dem Gehirn, nicht sagen, dass es irgendwelche Repräsentationskonventionen oder Projektionsmethoden kennt oder irgendetwas aus der einem Set an Konventionen entsprechenden topografischen Anordnung feuernder Zellen herausliest. Denn die Zellen sind überhaupt nicht Konventionen entsprechend angeordnet, und die Korrelation zwischen ihrem Feuern und den Merkmalen des Wahrnehmungsfeldes ist keine konventionelle, auf Vereinbarungen beruhende Korrelation, sondern eine kausale.144 Blakemores Andeutung, die Neurowissenschaftler würden sich wegen der Armut des Englischen und seinem Mangel an zulänglichen Begriffen einer metaphorischen oder bildlichen Sprache bedienen, werden wir später untersuchen (14.2).145
3.3 Über die Gründe für die Zuschreibung psychologischer Prädikate zu einem Lebewesen Die mit dem mereologischen Prinzip verknüpften begrifflichen Festlegungen Wir haben das mereologische Prinzip nachdrücklich zur Geltung gebracht und darauf bestanden, dass es sich bei ihm um ein logisches Prinzip handelt, das darum empirischer, experimenteller Bestätigung oder Ablehnung nicht zugänglich ist. Es stellt in Wirklichkeit eine Vereinbarung dar – eine jedoch, die festlegt, was Sinn ergibt und was nicht. Seine Anwendung – auf psychologische Begriffe beispielsweise – könnte grundsätzlich per Abmachung verändert werden, jedoch nicht, ohne sonst einen Großteil zu verändern und damit zugleich die Bedeutungen unserer Worte und die Struktur einer 144
Wie verwirrend es doch sein kann, wenn man es versäumt, eine Regel von einer Regelmäßigkeit, das Normative vom Kausalen zu unterscheiden, zeigt sich in Blakemores Kommentaren zum Diagramm des motorischen ‚Homunkulus‘ von Penfield und Rasmussen. Blakemore äußert sich darüber, ‚in welcher Weise die Mundregionen und die Hände erheblich überrepräsentiert sind‘ (‚Understanding images in the brain‘, S. 266, in der langen erklärenden Anmerkung zu Fig. 17.6); das würde jedoch nur dann Sinn ergeben, wenn wir von einer Karte sprächen, die auf einem irreführenden Projektionsverfahren basierte (in diesem Sinn sprechen wir von den jeweiligen Distorsionen der (zylindrischen) Mercator-Projektion). Weil jedoch sämtliche Bildzeichnungen nur die für bestimmte Funktionen kausal verantwortlichen Zellen repräsentieren, ist nichts ‚überrepräsentiert‘. Denn selbstverständlich meint Blakemore nicht, dass es im Gehirn mehr mit den Mundregionen und den Händen kausal zusammenhängende Zellen gibt, als es dort geben sollte! 145 Andere methodologische Einwände wurden von quineschen Wissenschaftsphilosophen ausgearbeitet. Sie sind von größerer philosophischer Tragweite und werden gesondert behandelt in 14.1. Die Leser, die unsere weiteren Erörterungen begutachten wollen, mögen dort nachschlagen.
3.3 Zuschreibung psychologischer Prädikate
105
Fülle ähnlicher Begriffe. Denn das Prinzip, dass die psychologischen Begriffe nur auf das Lebewesen als Ganzes zutreffen und nicht auf seine Teile angewendet werden können, wird von einem Geflecht aus Begriffsbeziehungen aufrechterhalten. In diesem Abschnitt werden wir die Untersuchung der begrifflichen Festlegungen, die mit der Anwendung psychologischer Prädikate verknüpft sind, weiter ausdehnen und vertiefen. Auf diese Weise sollen die begrifflichen Inkohärenzen deutlich hervortreten, die immer dann entstehen, wenn jenen Festlegungen keine Beachtung geschenkt wird, wie in einem Großteil der aktuellen neurowissenschaftlichen Debatte tatsächlich geschehen. Die Möglichkeit der Zuschreibung psychologischer Attribute zu anderen erkennen wir im Normalfall ohne zu schließen Wir schreiben einem Menschen oder einem Tier aufgrund seines Verhaltens (ihr Verbalverhalten eingeschlossen) Schmerz zu. Wenn sich eine Person verletzt und stöhnt und schreit, wenn sie ihre verletzte Gliedmaße ruhighält, humpelt oder ihre Verletzung versorgt, das Gesicht verzieht und ‚Au‘ ruft, ‚Das tut weh‘ oder ‚Ich habe Schmerzen‘, fassen wir solches Schmerz-Verhalten in dieser Situation als rechtfertigenden Grund oder rechtfertigende Evidenz dafür auf, dem Menschen Schmerz zuzuschreiben. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir normalerweise aus einer solchen Beobachtungsevidenz schließen, dass ein Mensch Schmerzen hat. Wir erkennen im Normalfall unmittelbar, dass ein Mensch sich verletzt hat, wir sehen und hören, dass er Schmerzen hat, können den Schmerz von seinem Gesicht ablesen. Es ist allerdings das Schmerz-Verhalten des Menschen, das unsere unmittelbare Schmerz-Zuschreibung rechtfertigt, und indem wir uns auf eine solche Evidenz beziehen, können wir auf die Frage ‚Aus welchen Gründen gingst du davon aus, dass er Schmerzen hat?‘ antworten. Ebenso sagen wir von Tieren und Menschen, dass sie in ihrem Wahrnehmungsfeld etwas wahrnehmen, wenn sie beispielsweise auf Sichtbares (oder Hörbares etc.) in angemessener Weise reagieren. Die Evidenz dafür, dass ein Hund eine Katze sieht, besteht folglich darin, dass er auf das ihm Sichtbare reagiert – beispielsweise der Katze mit den Augen folgt, Interesse am sichtbaren Verhalten der Katze zeigt, ihr nachjagt und auf ihre Bewegungen reagiert, indem er seine Verfolgung an den sichtbaren Drehungen und Wendungen der fliehenden Katze ausrichtet. Desgleichen schreiben wir einem Menschen einen bestimmten Glauben zu, wenn er vorbringt, dass dies und jenes der Fall ist, oder versichert, er glaube, um die Dinge stehe es so und so, oder wenn er handelt und das, was er tut, anhand der Gründe, dass es um die Dinge so und so steht, erklärt – das heißt, indem er sich auf die Dinge bezieht, von denen er weiß oder glaubt, dass es um sie so steht.146 Aus der Tat146
[‚Wie es um die Dinge steht/bestellt ist‘, ist eine alltagssprachliche Wendung: Gemeint sind damit nicht in erster Linie Einzeldinge, sondern Dinge bzw. Tatsachen in und mit ihren Zusammenhängen, also Sachverhalte oder Sachlagen, wie man sagt. An in einer Außenwelt abgetrennt existierende Dinge darf man dabei nicht denken. – A.d.Ü.]
106
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
sache, dass A versichert, dieses und jenes zu glauben, schließen wir nicht, dass er es tatsächlich glaubt, wir gehen im Normalfall davon aus, dass er das glaubt, was er zu glauben versichert; dass wir ihm diesen Glauben zuschreiben, hat seinen Grund jedoch darin, dass er das sagte, was er sagte. Die evidenzbezogenen Gründe für die Zuschreibung psychologischer Attribute zu anderen sind keine induktiven, sondern kriterielle Gründe; d. h., die Evidenz ist logisch begründete Evidenz Die wichtigsten Gründe bzw. die maßgebliche Evidenz für die Zuschreibung psychologischer Prädikate liefert das Verhalten. Es ist das Verhalten dieses Lebewesens in der entsprechenden Situation. Wir haben es hier jedoch nicht mit induktiver Evidenz zu tun. Induktive Evidenz beruht auf der Korrelation von einander begleitenden Phänomenen. Sie setzt also die nichtinduktive Identifizierung der Phänomene voraus, die als in einem Tatsachenzusammenhang stehende beobachtet werden. Schmerz und Schmerz-Verhalten stehen jedoch nicht in einem bloßen Tatsachenzusammenhang. Dass Menschen, wenn sie Schmerzen haben, stöhnen, sich die Augen ausweinen und sich um ihre Verletzung kümmern, ist keine empirische Feststellung. Zudem ist logisch ausgeschlossen, dass der Schmerz mit dem Lächeln und Lachen in einem systematischen Zusammenhang stehen könnte, im Gegensatz zu seiner Verknüpfung mit dem Weinen und Stöhnen – das heißt mit dem Schmerz-Verhalten. Es ist auch keine empirische Feststellung, dass ein Wesen, wenn es sieht, auf sichtbare Objekte reagiert, seine Augen benutzt, um ihnen zu folgen, und nicht sehen kann, wenn seine Augen geschlossen sind oder wenn es stockdunkel ist. Vielmehr ist die wichtigste Rechtfertigung für die Zuschreibung psychologischer Prädikate zu einer anderen Person oder einem Tier begrifflich mit der Bedeutung des jeweiligen Prädikats verbunden. Das Schmerzverhalten ist ein Kriterium – das heißt, es gibt logisch begründete Evidenz dafür [logically good evidence; logisch gute Gründe], dass derjenige, der sich entsprechend verhält, Schmerzen hat – und das Wahrnehmungsverhalten (in Verbindung mit dem entsprechenden Objekt und der entsprechenden Wahrnehmungsmodalität) ist ein Kriterium dafür, dass das sich entsprechend verhaltende Lebewesen wahrnimmt. Dass diese und jene Verhaltensweisen Kriterien für die Zuschreibung dieses und jenes psychologischen Prädikats sind, ist mitkonstitutiv für die Bedeutung des betreffenden Prädikats.147 147
Das heißt nicht, dass die Bedeutung der psychologischen Prädikation jener der Verhaltensbeschreibung entspricht, deren Richtigkeit jene rechtfertigt. Es ist Menschen nicht nur möglich, sondern gang und gäbe für sie, dass sie (nicht allzu schlimme) Schmerzen haben, etwas denken oder beabsichtigen, und nicht betonen, dass es so ist. Und es ist Menschen auch möglich, etwas vorzugeben oder sich zu verstellen, d. h. dieses und jenes Verhalten an den Tag zu legen, obwohl sie sich nicht in diesem und jenem psychischen Zustand befinden. Wir verteidigen keine Form des Behaviorismus; und bei dem begrifflichen Zusammenhang, auf dem wir insistieren, handelt es sich um einen a priori auf Evidenz beruhenden, aber nicht um einen reduktiven Zusammenhang.
3.3 Zuschreibung psychologischer Prädikate
107
Die kriterielle Evidenz für die Zuschreibung psychologischer Prädikate zu anderen ist durch Gegenevidenz aufhebbar Obgleich nichtinduktive, können die Verhaltenskriterien für die Zuschreibung eines solchen psychologischen Attributs zu einer anderen Person, genau wie die induktive Evidenz auch, durch Gegenevidenz nichtig gemacht bzw. aufgehoben werden. Aus der Unterstützung durch eine solche Evidenz folgt somit nicht, dass die psychische Eigenschaft, für die sie die Evidenz ist, auch besessen wird. Denn die logische Folgebeziehung – wie sie exemplifiziert ist durch: Aus der Proposition, dass A Junggeselle ist, folgt die Proposition, dass A unverheiratet ist – ist nicht aufhebbar; das heißt, die Hinzufügung weiterer Propositionen kann die Folgebeziehung nicht unterminieren. Eine Person kann jedoch (offensichtliches) Schmerzverhalten zeigen, ohne Schmerzen zu haben: Vielleicht agiert sie auf einer Bühne oder gibt in betrügerischer Absicht vor, Schmerzen zu leiden. Wenn wir über Evidenz verfügen, dass der eine oder der andere dieser Fälle zutrifft, hebt diese die vom offensichtlichen Schmerzverhalten der Person herrührende kriterielle Unterstützung auf. Eine Person mag sagen, dass sie etwas denke oder glaube, sie kann allerdings auch lügen; sie mag versichern, dass sie vorhabe, dieses oder jenes zu tun, sie kann sich allerdings auch selbst betrügen. Wenn indes die Kriterien dafür, dass die Person Schmerzen hat, etwas glaubt oder zu tun beabsichtigt, bei einer Gelegenheit erfüllt sind und in dieser Situation nicht durch Gegenevidenz aufgehoben werden, dann können wir gerechtfertigterweise davon ausgehen, dass sie Schmerzen hat, tatsächlich glaubt oder etwas beabsichtigt. Die kriteriellen Gründe für die Zuschreibung eines psychologischen Prädikats sind mitkonstitutiv für die Bedeutung dieses Prädikats Die kriteriellen Gründe dafür, einer anderen Person psychologische Prädikate zuzuschreiben, sind begrifflich mit dem betreffenden Prädikat verknüpft. Sie sind mitkonstitutiv für die Bedeutung des Prädikats. Die normale Zuschreibung psychologischer Prädikate zu anderen Personen geht also nicht mit einer induktiven Identifizierung einher. Allerdings beruht die Möglichkeit einer induktiven (nichtlogischen) Identifizierung – die Möglichkeit gewöhnlicher nichtinduktiver Identifizierungen gegeben – auf der induktiven Korrelation bestimmter psychologischer Attribute, die Subjekten eignen, mit anderen Phänomenen – z. B. neurophysiologischen Ereignissen in deren Gehirn. Jede induktive Korrelation setzt allerdings den kriteriellen Zusammenhang, der den betreffenden psychologischen Begriff mitkonstituiert, voraus. Zudem hebt, wenn solche induktive Evidenz zu den gewöhnlichen Kriterien für die Zuschreibung eines psychologischen Prädikats in Widerspruch steht, die kriterielle Evidenz die induktive Korrelation auf. Wenn also beispielsweise eine Person versichert, sie habe keine Schmerzen, obwohl PET und fMRT gegenteilige Evidenz erbringen, wird diese durch die Äußerung des Sub-
108
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
jekts aufgehoben, und die induktiven Korrelationen der PET- und fMRT-Daten mit dem (angeblichen) Schmerzleiden des Subjekts müssen nachgeprüft werden. Das Gehirn erfüllt nicht die Kriterien, die ein mögliches Subjekt psychologischer Prädikate erfüllen muss Diese sinnfälligen logischen Gesichtspunkte sollten uns innehalten lassen. Außerhalb der Neurowissenschaften und der psychologischen Forschung schreibt man dem Gehirn keinen Schmerz zu. Wenngleich neurale Phänomene mit dem Schmerz, den ein Tier oder ein Mensch hat, unverkennbar korrelieren, zeigt doch das Gehirn kein Schmerzverhalten – es klagt und stöhnt nicht, umsorgt nicht seinen gebrochenen Arm, vergießt keine Tränen und verzieht nicht das Gesicht. Zum Beispiel haben wir es bei den beobachteten neuralen Phänomenen, die Begleiterscheinungen des Schmerzleidens der Person sind, nicht mit Formen des Schmerzverhaltens zu tun. Sie werden induktiv mit dem Schmerzenhaben in Beziehung gesetzt. Bei dieser Korrelation handelt es sich um eine empirische Feststellung, die den Schmerzbegriff und seinen Zusammenhang mit der kriteriellen, nichtinduktiven Evidenz für die Anwendung des Schmerzbegriffs auf ein Lebewesen (nicht auf sein Gehirn) voraussetzt. Zudem schreibt man außerhalb der Forschung dem Gehirn weder Denken noch Glauben zu, sondern der Person, die denkt oder glaubt und sagt, was sie denkt oder glaubt, oder handelt und die gesehen werden kann, wenn sie, auf der Grundlage dieses oder jenes Denkens bzw. Glaubens, handelt. Wir betrachteten kein in Gedanken versunkenes Gehirn, Rodins Le Penseur aber versank in Gedanken. Wir sehen nicht die Leichtgläubigkeit des Gehirns, aber der Glauben (oder Unglauben) eines Menschen kann ihm ins Gesicht geschrieben stehen, wenn er dem zuhört, was ein anderer erzählt. Wir können das Denken des Subjekts mit der lokalisierten Gehirnaktivität, die durch PET und fMRT ermittelt wurde, in Zusammenhang bringen. Das ist möglich, zeigt allerdings nicht, dass das Gehirn denkt, reflektiert oder nachsinnt; es zeigt, dass die und die Teile des Kortex einer Person aktiv sind, während sie mit dem Denken, Reflektieren oder Nachsinnen beschäftigt ist. (Das, was man auf dem Scan sieht, ist nicht das Denken des Gehirns – es gibt nichts dergleichen wie ein denkendes Gehirn – noch das Denken der Person – das kann man immer dann sehen, wenn man jemanden betrachtet, der in Gedanken versunken ist, jedoch nicht, wenn man auf einen PET-Scan schaut –, sondern das computergenerierte Bild der Erregung ihrer Gehirnzellen, die sich einstellt, sobald sie denkt. Noch einmal, diese Korrelation ist eine induktive, keine kriterielle, und sie macht eine vorherige Identifizierung des Denkens und Reflektierens der Person anhand von Verhaltenskriterien erforderlich. Sie setzt den Begriff des Denkens voraus, der durch die Verhaltenskriterien, welche die Zuschreibung des Denkens zu einem Lebewesen rechtfertigen, bestimmt ist.
3.3 Zuschreibung psychologischer Prädikate
109
Ein zweiter Erklärungsansatz macht das Spektrum an cartesianischen und empiristischen Fehlkonzeptionen, dem sich viele Wissenschaftler verschrieben haben, dafür verantwortlich dass sie dazu neigen, dem Gehirn psychologische Attribute zuzuschreiben Daran scheint bei genauerem Nachdenken kein Zweifel möglich. Stellt sich die Frage, warum wir dazu neigen, die Sache anders zu sehen. Weshalb sahen es so viele Wissenschaftler (und Philosophen) anders? Woher kommt die Neigung, das Bewusstsein, Sehen, Hören, Denken und Glauben, Fühlen und Wollen etc. dem Gehirn zuzuschreiben? Eine mögliche Erklärung haben wir bereits gefunden: dass nämlich bei der Wende vom Cartesianismus zum klassischen Empirismus Wissenschaftler und Philosophen die psychologischen Attribute ohne nachzudenken vom Geist auf das Gehirn transponiert haben. Es gibt jedoch noch eine tiefschürfendere Erklärung, die Aufschluss darüber gibt, wie es geschehen konnte, dass eine solch zweifelhafte Transponierung frag- und eröterungslos und ohne dass irgendetwas dafür gesprochen hätte vorgenommen wurde. Obwohl die Zuschreibung psychologischer Attribute zu anderen Personen auf verhaltensbezogener, kriterieller Evidenz beruht (anhand dieser gerechtfertigt wird), gilt das für die Anwendung psychologischer Prädikate auf einen selbst nicht. Man sagt nicht deshalb, weil man stöhnt oder sich um seine verletzte Gliedmaße kümmert, dass man Schmerzen hat. Man drückt einen Glauben, ein Bekenntnis oder ein Geständnis, dies oder jenes zu glauben, nicht aufgrund der Evidenz des eigenen Verhaltens aus, und man wartet nicht darauf, zu hören, was man selbst sagt, wenn man herausfinden will, was man denkt. Wie kommt es also, dass wir sagen können, was wir fühlen oder wahrnehmen, was wir denken oder glauben, was wir wollen oder vorhaben? Fehlkonzeptionen in Bezug auf ‚das Innere‘ und ‚das Äußere‘; Privatbesitz von Erfahrung; privilegierter Zugang; unmittelbares (im Gegensatz zum mittelbaren) Wissen vom Inneren; Introspektion Es ist so verlockend, das Geistige und das Verhalten auf abwegige Weise voneinander abzugrenzen. Das Verhalten gehört dem öffentlichen Bereich zu und liegt für jedermann, der es entsprechend beobachten kann, offen zutage – diesen Bereich könnte man das ‚Äußere‘ nennen. Im Gegensatz dazu scheint das Geistige einem besonderen, privaten, nur seinem Subjekt zugänglichen Bereich zuzugehören, bei dem es sich, wie wir versucht sind zu sagen, um das ‚Innere‘ handelt – und wir sprechen mithin vom (geistigen) ‚Innenleben‘. Gemäß diesem Bild (und es ist schließlich doch bloß ein Bild, eine Metapher) hat jede Person Zugang zu ihrem eigenen Geist. Wir sind darüber hinaus versucht, Erfahrungen als Elemente aufzufassen, die ihrem Subjekt eigen sind bzw. von ihm besessen werden – eine Versuchung, die dadurch begünstigt wird, dass wir davon sprechen, Schmerzen, Wahrnehmungserfahrungen, Gedanken, Überzeugungen etc. zu haben. Und wir sind versucht, so etwas zu sagen wie ‚Du kannst nicht meinen Schmerz haben‘ oder ‚Nur ich kann meinen Schmerz haben‘. Indem wir so denken,
110
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
nehmen wir von Erfahrungen an, dass sie wesentlich privat und unveräußerlich sind – dass andere Menschen nicht dieselbe, sondern nur eine ähnliche Erfahrung haben können. Wenn das so ist, dann hat jede Person nicht nur Zugang zu ihrem eigenen Geist, sondern privilegierten Zugang zu ihm und zu den geistigen Ereignissen und Prozessen, die sich in ihm ereignen. Und das scheint klar auf der Hand zu liegen, denn schließlich müssen sich andere Menschen auf mein Verhalten stützen, darauf, was ich tue und sage, um zu erkennen, was ich gerade fühle oder denke. Darum hat es den Anschein, dass sie mittelbar erkennen, wie die Dinge für mich liegen. Was sie unmittelbar wahrnehmen, ist demnach bloß das äußere Verhalten. Ich jedoch habe unmittelbaren Zugang zu dem, was sich innen befindet, zu meinem eigenen Geist. Ich bin mir dessen bewusst, wie die Dinge für mich liegen. Das Vermögen, das mir einen solchen unmittelbaren Zugang zu geistigen Zuständen, Ereignissen und Prozessen erlaubt, ist die Introspektion – und weil ich nach innen sehen kann, bin ich auch in der Lage, zu sagen, wie die Dinge für mich liegen, und zwar ohne in Betracht zu ziehen, was ich tue oder sage. Dieses Überlegungsspektrum grundiert den klassischen Empirismus. Eingebettet in die Denkstruktur des cartesianischen Erbes gehört es zu der Konzeption, die bei den meisten zeitgenössischen Neurowissenschaftlern Anerkennung findet. Weil es von den cartesianischen und britischen Empiristen, die dem Geist psychologische Attribute zuschrieben, propagiert wurde, wundert es kaum, dass die Neurowissenschaftler der Gegenwart, die diese Auffassung teilen, die Konzeption des Geistes als einer immateriellen Substanz jedoch ablehnen, versucht sein würden, dem Gehirn psychologische Attribute zuzuschreiben. Laut ihrer Konzeption ist der ‚Zugang‘ zu den eigenen geistigen Zuständen und Prozessen, den die Introspektion jedermann ermöglicht, ein partieller und limitierter Zugang zu den Vorgängen, die sich im Gehirn abspielen.148
3.4 Über die Gründe für die Fehlzuschreibung psychologischer Prädikate zu einer inneren Entität Vier die Logik der Erfahrung und ihre Zuschreibung betreffende Fehlkonzeptionen Diese einflussreiche Auffassung teils cartesianischer, teils britischer Empiristen hat das Nachdenken über den Geist jahrhundertelang dominiert. Sie begünstigt eine sehr bedeutende Fehlkonzeption darüber, was die Erfahrung und ihre Zuschreibung logisch auszeichnet. Dies werden wir verdeutlichen, indem wir vier fragwürdige begriffliche FestCrick beobachtet z. B., dass „[e]s [. . .] einen allgemeinen Konsens darüber gibt, dass Menschen nicht von allen Vorgängen, die sich in ihren Köpfen abspielen, ein Bewusstsein haben [. . .] Zwar ist man sich vieler Resultate von Wahrnehmungs- und Erinnerungsvorgängen bewusst, man hat aber nur beschränkten Zugang zu den Vorgängen, die dieses Bewusstsein erzeugen“ (The Astonishing Hypothesis, S. 19f.) [dt. Was die Seele wirklich ist (Artemis & Winkler, München & Zürich, 1994), S. 38]. 148
3.4 Fehlzuschreibung psychologischer Prädikate
111
legungen dieser verführerischen Auffassung durchbuchstabieren. Diese sind unter Neurowissenschaftlern, Kognitionswissenschaftlern und Psychologen weitgehend akzeptiert und finden auch bei manchen Philosophen Unterstützung. 1. Fehlkonzeptionen über Privatheit, betrachtet als Privatbesitz von Erfahrung (1) Das Geistige ist ein privater Bereich, der vom öffentlichen Bereich des Verhaltens und physisch-materieller Phänomene abzugrenzen sei. So behauptet beispielsweise Antonio Damasio, dass das Bewusstsein ein „rein privates Phänomen [ist], das ganz auf die Perspektive der ersten Person beschränkt bleibt, auf jenen privaten Prozess der ersten Person, den wir Geist nennen.“149 Edelmann und Tononi stimmen darin überein, dass ‚Privatheit‘ „eine jener fundamentalen Aspekte der bewussten Erfahrung [ist], die allen ihren Erscheinungsformen gemeinsam ist“.150 Stephen Kosslyn und Kevin Ochsner sind der Ansicht, dass Vorstellungsbilder zu haben „ein vollkommen privates Ereignis ist“ und von daher „notorisch schwer zu erforschen“ – bei den Bildern handele es sich um „interne Repräsentationen“ des Geistes einer Person.151 Die Vorstellung gewinnt schärfere Konturen mithilfe eines Philosophen, John Searle: „Subjektive Bewusstseinszustände haben eine Erste-Person-Ontologie, weil sie nur dann existieren, wenn sie von einem Agierenden erfahren werden, der entweder ein Mensch oder ein Tier ist“; darüber hinaus ist es so, dass, selbst wenn zwei Personen dasselbe Phänomen erfahren, sagen wir ein Konzert, die Erfahrung jeder Person sich von der jeder anderen unterscheidet. Sie mögen in qualitativer Hinsicht identisch sein (so wie Ihr Penny mit meinem qualitativ identisch sein kann), numerisch unterscheiden sie sich jedoch.152 Wie der große Logiker Gottlob Frege salopp formulierte, kann er nicht meinen Schmerz haben und ich nicht sein Mitleid.153 Jede Erfahrung, jeder Bewusstseinszustand braucht jemanden, der sie hat, und jede Erfahrung oder jeder geistige bzw. mentale Zustand hat nur einen ‚Inhaber‘. Das Geistige ist privat und unveräußerliches Eigentum.
149
A. Damasio, The Feeling of What Happens (Heinemann, London, 1999), S. 12 [dt. Ich fühle, also bin ich (List, München, 1999), S. 24]. 150 G. M. Edelman und G. Tononi, Consciousness: How Matter Becomes Imagination (Allen Lane, The Penguin Press, London, 2000), S. 23 [dt. Gehirn und Geist – Wie aus Materie Bewusstsein entsteht (Beck, München, 2002), S. 39]. 151 S. M. Kosslyn und K. N. Ochsner, ‚In search of occipital activation during mental imagery‘, Trends in Neuroscience, 17 (1994), S. 290. 152 J. R. Searle, ‚Consciousness‘, Annual Reviews, 23 (2000), S. 561. 153 G. Frege, ‚Der Gedanke. Eine logische Untersuchung‘, ‚The thought‘, wieder abgedr. in Collected Papers on Mathematics, Logic and Philosophy (Blackwell, Oxford, 1984), S. 361.
112
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
2. Fehlkonzeptionen über Introspektion, betrachtet als eine Form innerer Erfahrung (2) Dieser Privatbereich kann durch Introspektion, bei der es sich um ein der Wahrnehmung ähnliches Vermögen handelt, erfasst werden. Für William James lag „klar auf der Hand, dass Introspektion heißt, Einsicht in den Geist zu nehmen und das mitzuteilen, was man dabei entdeckt. Jedermann teilt die Auffassung, dass wir dort Bewusstseinszustände entdecken.“154 Mitunter wird die Introspektion als der einzig verlässliche Indikator des InErscheinung-Tretens und der Eigenart des Inneren (als bewusste Erfahrung betrachtet) aufgefasst. Laut Benjamin Libet „kann eine Verhaltensevidenz, die nicht mit einer überzeugenden introspektiven Mitteilung einhergeht, nicht als Indikator einer subjektiven bewussten Erfahrung betrachtet werden“155 Nicholas Humphrey behauptete in ähnlicher Weise, dass „die bewusste Erfahrung sämtliche subjektiven Gefühle umfasst, die der Introspektion jederzeit zugänglich sind“;156 andernorts näherte er die Introspektion der Vorstellung von einem ‚inneren Auge‘ an, das mit anderen Sinnesorganen vergleichbar sei.157 3. Fehlkonzeptionen über privilegierten Zugang und privates Wissen (3) Der Bereich der Privaterfahrung ist nur dem Subjekt unmittelbar zugänglich; andere haben nur mittelbaren bzw. indirekten Zugang. So vertritt beispielsweise J. R. Searle die folgende Ansicht: „Mein gegenwärtiger Bewusstseinszustand ist eine Eigenschaft meines Gehirns, seine bewussten Aspekte aber sind mir in einer Weise zugänglich, wie sie Ihnen nicht zugänglich sind. Und Ihr gegenwärtiger Bewusstseinszustand ist eine Eigenschaft Ihres Gehirns, und seine bewussten Aspekte sind Ihnen in einer Weise zugänglich, wie sie mir nicht zugänglich sind.“158 Auch Libet denkt, dass eine „bewusste Erfahrung als eine Kenntnis von irgendeinem Ding oder Ereignis nur dem Individuum, das diese Erfahrung hat, unmittelbar zugänglich ist, keinem externen Beobachter“.159 Blakemore meint: „Obwohl ich davon ausgehe, dass andere menschliche Wesen weitestgehend so 154
W. James, The Principles of Psychology (Holt, New York, 1890), Bd. I, S. 185. B. Libet, ‚The neural time-factor in perception, volition and free will‘, wieder abgedr. in seiner Neurophysiology of Consciousness (Birkhäuser, Boston, 1993), S. 368. 156 N. Humphrey, Consciousness Regained (Oxford University Press, Oxford, 1984), S. 34f. 157 N. Humphrey, ‚The inner eye of consciousness‘, in Blakemore und Greenfield (Hg.), Mindwaves, S. 379. Es ist erstaunlich und bizarr, dass Humphrey hier behauptet, dass das, worüber das ‚innere Auge‘ des Bewusstseins als sein Anschauungsfeld verfügt, das Gehirn selbst ist. Einer solchen Konzeption nach dürfte die Introspektion PET und fMRT teilweise entbehrlich machen. 158 J. R. Searle, Minds, Brains and Science – the 1984 Reith Lectures (BBC, London, 1984), S. 25 [dt. Geist, Hirn und Wissenschaft (Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1992), S. 24]. Zu erwähnen ist, dass Searle schließlich darauf verzichtete, von ‚Zugang‘ zu sprechen (Siehe J. R. Searle, The Rediscovery of the Mind (MIT Press, Cambridge, MA, 1992), S. 98 [dt. Die Wiederentdeckung des Geistes (Artemis & Winkler, München, 1993), S. 117f.]). 159 Libet, ‚Neural time-factor‘, S. 368. 155
3.4 Fehlzuschreibung psychologischer Prädikate
113
denken, wie ich es tue, habe ich keine unmittelbare Evidenz von ihrem bewussten Geist“.160 Und Crick pflichtet bei, dass „[g]enaugenommen [. . .] jeder nur von sich selbst [weiß], dass er Bewusstsein hat“.161 Der geistige Bereich wird demzufolge als das ‚Innere‘ betrachtet und dem ‚Äußeren‘, dem Bereich öffentlich beobachtbaren Verhaltens, gegenübergestellt. Er wird nicht nur privat innegehabt, sondern ist auch epistemisch privat; das heißt, dass nur das Subjekt sicher weiß, was in ihm sich abspielt und in Erscheinung tritt. Und zwar deshalb, weil nur das Subjekt unmittelbaren Zugang zu diesem Bereich hat, und nur der unmittelbare Zugang darf Wissen heißen. 4. Fehlkonzeptionen über die Bedeutung psychologischer Prädikate (4) Psychologische Prädikate sind Namen von inneren Entitäten (Objekten, Zuständen, Ereignissen und Prozessen) und ihre Bedeutungen können unabhängig von jeder begrifflichen Verknüpfung mit Verhaltenskriterien erfasst werden. Diese Position wird selten vertreten, dennoch ist sie wichtig, und sie stärkt, gewollt oder ungewollt, die allgemein akzeptierte neurowissenschaftliche Konzeption des Geistigen.162 Die Annahme, dass unsere Urteile über Geisteszustände oder Bewusstseinszustände anderer Menschen induktiv sind, wird von Neurowissenschaftlern allerdings nicht selten vertreten. Edelman behauptet, dass ‚wir für uns‘ wissen, was es mit dem Bewusstsein auf sich hat, „jedoch nur induktiv schließen können, dass andere es haben“.163 Manche Wissenschaftler vertreten mit Crick die Ansicht, dass es sich bei solchen Schlüssen um Analogieschlüsse handelt.164 Sofern sich Neurowissenschaftler in irgendeiner Weise mit der Frage auseinandergesetzt haben, stimmen sie darin überein, dass das Verhalten und der Geisteszustand, dessen Evidenz es ist, nichtlogisch und nichtbegrifflich verknüpft sind. Zudem soll, wie dargelegt, jede Person privilegierten Zugang zu ihren eigenen Erfahrungen haben und in der Lage sein, ohne Rückgriff auf ihr eigenes Verhalten von ihnen zu sprechen. Sie muss offensichtlich wissen, was die Worte bedeuten, die sie verwendet, um ihrer Erfahrung Ausdruck zu verleihen. Es scheint so, als müssten sie eine Bedeutung haben, die unabhängig von dem mit ihnen verbundenen Verhaltensausdruck ist, weil eine Person diese Ausdrücke nicht aufgrund ihres Verhaltens auf sich selbst anwendet. Die 160
Blakemore, The Mind Machine, (BBC Books, London, 1988), S. 230. Crick, The Astonishing Hypothesis, S. 107 [dt. Was die Seele wirklich ist, S. 139]. 162 Damasio argumentiert: ‚In dem Satz „Ich sehe ein Auto herankommen“ steht das Wort sehe für einen bestimmten Akt der perzeptiven Inbesitznahme, der von meinem Organismus (sic) [. . .] vorgenommen wird. [. . .] Und das Wort ‚sehe‘ hat [. . .] das wortlose Geschehen zu übersetzen, das sich in meinem Geist entfaltet‘ (Damasio, Feeling of What Happens, S. 186). ‚Sehen‘ wird hier so betrachtet, als stehe es für eine innere Handlung, als sei es ihr Name. Humphrey erklärt, dass er die psychologischen Begriffe, über die er von seiner eigenen Erfahrung her verfügt, ableitet (Consciousness Regained, S. 34f.). 163 Edelman, Bright Air, Brilliant Fire, S. 111 [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer, S. 162]. 164 Crick, The Astonishing Hypothesis, S. 107 [dt. Was die Seele wirklich ist, S. 139]. 161
114
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
plausibelste Erklärung dafür, wie sich Erfahrungsnamen mit Bedeutung anreichern, scheint mithin die zu sein: Wir wissen, was sie bedeuten, weil wir sie mit unseren Erfahrungen verbinden, zu denen wir privilegierten Zugang haben. Die neurowissenschaftliche Konzeption des Geistes ist dieser Bedeutungskonzeption in der Tat verpflichtet, wenn sich viele Neurowissenschaftler darüber auch nicht im Klaren sind. Diese Verpflichtung ist kaum zu überschätzen. Wenn diese Konzeption richtig wäre, dann wäre der Gedanke abwegig, dass die psychologischen Prädikate in der dritten Person mit den Verhaltenskriterien für ihre Zuschreibung logisch verknüpft sind. Wenn sie falsch wäre, dann könnte man den Vorwurf, dass Neurowissenschaftler einen mereologischen Fehlschluss begehen, allerdings nicht anhand der Tatsache erhärten, dass nichts von dem, was das Gehirn tun kann, die Kriterien für die Zuschreibung psychologischer Attribute zu einem Lebewesen erfüllt. Denn dieser Darstellung nach wird psychologischen Ausdrücken durch ‚unmittelbare‘ Verbindung mit den Attributen, die sie zum Ausdruck bringen, Bedeutung gegeben, ohne dass Verhaltenskriterien dabei eine Rolle spielen. Jede dieser vier Thesen geht in die Irre und beinhaltet weitreichende Begriffskonfusionen: i. Es stimmt, dass es keine Erfahrungen gibt, die nicht Erfahrungen von irgendjemand sind (keine Schmerzen, wenn nicht jemand leidet, keinen Glauben ohne Glaubende). Daraus folgt jedoch nicht, dass andere Menschen nicht denselben Schmerz, denselben Glauben oder dieselbe Erfahrung haben können. ii. Bei der Introspektion handelt es sich keineswegs um ein quasi wahrnehmungsmäßiges Vermögen und auch nicht um die Quelle des Wissens über ‚das Innere‘. iii. Das Subjekt kann schon deshalb nicht über einen unmittelbaren Zugang zum Inneren verfügen, und andere nicht über einen mittelbaren, weil es überhaupt keinen Zugang zu irgendetwas Innerem hat (es hat Schmerzen, nicht Zugang zu Schmerzen), und andere, die die Manifestationen des Inneren im Verhalten beobachten, haben auf diese Weise einen so unmittelbaren Zugang wie nur irgend möglich. Deshalb kann man auch vollkommen sicher sein, und ist es oft, dass eine andere Person bei Bewusstsein ist (oder nicht), Schmerzen hat, dies oder das sieht, hört, glaubt, ärgerlich oder fröhlich ist. iv. Schließlich handelt es sich bei psychologischen Termini nicht um Namen innerer Entitäten in dem Sinn, in dem man von physikalischen Termini salopp sagen könnte, dass es sich bei ihnen um Namen äußerer Entitäten handelt. Ihre Bedeutungen lassen sich zudem nicht durch Verknüpfung mit ‚innerer‘ Erfahrung erklären. Wir werden zeigen, weshalb diese begrifflichen Positionen (1)–(4) Irrläufer sind. Will man das neurowissenschaftliche Projekt von diesen Fehlkonzeptionen befreien, ist es geboten, seinen Krypto-Cartesianismus zu beseitigen und sein empiristisches Erbe gleich mit. Nur so lässt sich angemessen würdigen und überhaupt erst richtig verstehen, was die Neurowissenschaften zur Aufklärung der empirischen Zusammenhänge zwischen dem Geistigen und dem Neuralen geleistet haben. Wir werden uns zunächst darum be-
3.5 Das Innere
115
mühen, einige Fehlkonzeptionen zu tilgen, die die gemeinhin ins Feld geführte Dichotomie von ‚innen‘ und ‚außen‘ betreffen.
3.5 Das Innere Die Konzeption der psychologischen Attribute als ‚innere‘ und als ‚geistige‘ Es ist bemerkenswert, dass ausschließlich in neurowissenschaftlichen und philosophischen Darlegungen die Rede davon ist, dass es sich beim Zahnschmerz um etwas ‚Inneres‘ handelt und dass ihn auch nur Neurowissenschaftler und Philosophen für etwas ‚Geistiges‘ halten. Der Zahnschmerz ist in einem Zahn, nicht im Geist – obgleich er natürlich weder so im Zahn ist, wie ein Loch im Zahn ist, noch so, wie eine Infektion im Zahn ist. Warum sagen wir überhaupt, dass er ‚im‘ Zahn ist? Weil es der Zahn ist, der schmerzt (nicht der Geist), und der Leidende auf den Zahn deutet, wenn er gefragt wird, wo er den Schmerz habe, seine Wange vorsichtig berührt und es unterlässt, auf den infizierten Zahn zu beißen. So etwas wie geistige Zahnschmerzen gibt es nicht, und bei dem Ausdruck ‚geistiger Zahnschmerz‘ haben wir es nicht mit einem Pleonasmus zu tun, sondern mit reinem Unsinn. Natürlich hätte man keine Zahnschmerzen, wenn die Nozizeptor-Nervenendigungen in der Zahnpulpa nicht erregt wären und dieses gesteigerte Impuls-Feuern durch den Trigeminus-Nerv nicht zum Pons (Brücke) und dann zum Gehirn übertragen würde. Das heißt jedoch nicht, dass der Zahnschmerz im Gehirn ist bzw. dass das Gehirn Zahnschmerzen hat. Diese neuralen Ereignisse stellen vielmehr die aufeinanderfolgenden Ursachen oder Begleitumstände der Zahnschmerzempfindung der Person dar. Es ist kein Zufall, dass wir von körperlichem Schmerz sprechen (weil er einen Ort im Körper hat) und ihn von geistigem Leiden unterscheiden. Das geistige Leiden ist jedoch kein brennender oder bohrender Schmerz im Geist – so etwas gibt es nicht. Es handelt sich bei ihm vielmehr um Angst oder Trauer, Demütigungsgefühle oder den Verlust des Respekts vor sich selbst etc. Die Metapher des ‚Inneren‘ und ‚Äußeren‘ Dennoch stimmt es, dass wir dazu neigen, Schmerz mit etwas ‚Innerem‘ zu vergleichen und seine Verhaltensmanifestationen mit etwas ‚Äußerem‘. Und das nicht ohne Grund, denn sagt man auch nicht aufgrund der Beobachtung des eigenen Verhaltens, man habe Zahnschmerzen, so sagt man doch von einer anderen Person, dass sie Zahnschmerzen hat, wenn man sieht, wie sie ihre geschwollene Backe hält und stöhnt. Allerdings bemerkte Wittgenstein sehr schön: „Wir müssen uns klar werden darüber, wie die Metapher des Erkennenlassens (des Äußeren und Inneren) tatsächlich von uns angewendet wird; sonst werden wir versucht sein, ein Inneres zu suchen, das noch hinter dem liegt,
116
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
was in unserer Metapher das Innere ist.“165 Dieser methodologische Hinweis ist sehr tiefgründig – bedarf aber der Klärung. Zeigen und Verbergen Jemand kann Schmerzen haben und sie verbergen, kann etwas sehen und nicht sagen, was er sieht, etwas denken und seine Gedanken nicht zum Ausdruck bringen. In diesem Sinne kann man sagen, dass das Geistige sich ‚innen‘ befindet, insofern als das, was man, in manchen Fällen, für sich behalten kann, verborgen ist und seine Manifestationen unterdrückt sind. Wenn jedoch eine Person unter Schmerzen stöhnt, sagt, was sie sieht oder ihre Meinung ausdrückt, dann hat sie das, was in unserer Metapher des ‚Inneren‘ und ‚Äußeren‘ das Innere ist, ‚erkennen lassen‘. Wenn sie vor Schmerzen aufschreit, da der Zahnarzt an ihren Zahn stößt, kann man nicht sagen „Nun gut, wir haben es hier nur mit dem Verhalten zu tun (mit etwas ‚Äußerem‘) – ihr Schmerz liegt noch im Verborgenen (er ist ‚innen‘)“. Wenn uns jemand ohne zu lügen mitteilt, was er denkt, können wir nicht sagen „Das sind nur Worte – er hat seine Gedanken für sich behalten“. Und wenn er uns darlegt, was er sieht, können auch wir sehen, was er sieht – obgleich wir nicht in etwas hineinschauen. (Was er sieht, ist nicht in seinem Gehirn, und wenn wir sein Gehirn mit dem differenziertesten PET abtasten würden, sähen wir immer noch nicht, was er sieht.) Jemand kann sich dafür schämen, was er gesagt oder getan hat, und seine Scham verbergen, wenn er jedoch vor Scham errötet, dann lässt die Schamesröte seine Scham erkennen und verbirgt sie nicht. Das ‚Innere‘ liegt nicht hinter dem Äußeren, verborgen im Gehirn oder im Geist – manchmal jedoch kann man seine Gedanken und Gefühle für sich behalten und manchmal kann man sie ganz geheim halten – ihre natürlichen Manifestationen unterdrücken, etwas vortäuschen oder lügen. Es sollte aber berücksichtigt werden, dass man seine Gedanken auch dadurch verbergen kann, dass man sein Tagebuch verschlüsselt abfasst – und daran ist nichts ‚Inneres‘. Das Innere beobachten Es ist also verworren, wie Damasio zu behaupten, dass „der Ausdruck Gefühl [. . .] für die private geistige Erfahrung einer Emotion reserviert werden [sollte] [. . .] das heißt, dass Sie bei jemand anderem kein Gefühl beobachten können, wohl aber bei sich selbst, wenn Sie als bewusstes Wesen Ihre eigenen emotionalen Zustände wahrnehmen“.166
L. Wittgenstein, ‚Notes for lectures on „private experience“ and „sense data“‘, hg. von R. Rhees, Philosophical Review, 77 (1968), S. 280 [‚Aufzeichnungen für Vorlesungen über „privates Erlebnis“ und „Sinnesdaten“‘, in Vortrag über Ethik und andere kleine Schriften, hg. Und übersetzt von J. Schulte, S. 53]. 166 Damasio, Feeling of What Happens, S. 42. 165
3.6 Introspektion
117
Angst oder Scham zu fühlen, Mitleid oder Erbarmen, Eifersucht oder Missgunst, heißt nicht, irgendetwas wahrzunehmen oder zu beobachten. Und weit entfernt davon, bei einer anderen Person unbeobachtbar zu sein, ist ein Gefühl etwas vollkommen Alltägliches und Vertrautes. Wenn jemand in gefahrvollen Umständen vor Furcht erbleicht, vor Entsetzen aufschreit, schaudert und vor der Gefahr zurückweicht – ist seine Angst manifest. Die Manifestationen der Angst einer anderen Person zu beobachten heißt selbstverständlich nicht, dieselbe Angst zu haben, die sie hat (obwohl auch das möglich ist, wenn wir genauso verängstigt sind wie sie und vor derselben Sache Angst haben). Es heißt vielmehr, zu beobachten, dass sie sich ängstigt – die Angst zu sehen, die ihr ins Gesicht geschrieben steht, sich in ihrer Haltung und ihrem Verhalten zeigt. Wenn jemand beleidigt wird und die Zornesröte ihn befällt, er seine Stimme erhebt und die Zähne zusammenbeißt, beobachten wir dann nicht, dass er zornig ist? Wir mögen nicht ebenso zornig sein oder tatsächlich durch und durch zornig, sein Zorn allerdings ist vollkommen sichtbar, und wir zittern vielleicht vor ihm. An den manifesten Emotionen anderer ist nichts ‚Inneres‘ oder Unbeobachtbares – sie sind dem allgemeinen Blick preisgegeben. Richtig ist, erstens, dass wir, wenn wir den Zorn oder die Angst eines anderen beobachten, unsererseits Zorn oder Angst für gewöhnlich nicht fühlen; und zweitens, dass eine Person manchmal zornig sein kann oder ängstlich und es nicht zeigt.
3.6 Introspektion Privilegierter Zugang und Introspektion aus der Sicht Humphreys, Johnson-Lairds und Weiskrantz’ Die obigen Bemerkungen über die Innen/Außen-Metapher scheinen trivial und irrelevant zu sein. Davon lässt sich doch niemand verwirren! Der entscheidende Punkt im Zusammenhang mit der Vorstellung von innen und außen ist sicherlich der, dass jeder von uns privilegierten Zugang zu den Inhalten seines eigenen Bewusstseins hat. Und entspricht das nicht dem, woran Wissenschaftler wie Damasio denken, wenn sie insistieren, dass jede Person nur seine eigenen Gefühle beobachten bzw. wahrnehmen kann und nicht die anderer? Denn jeder könne nur das per Introspektion beobachten, was in seinem Geist, und keiner das, was im Geist einer anderen Person ist. In der Tat behaupten manche Biologen in diesen Tagen, dass es sich bei dem Vermögen, die Bewusstseinsinhalte zu erforschen, um ein wesentliches natürliches Entwicklungsphänomen handelt. Nicholas Humphrey ist der Ansicht, dass „ein revolutionärer Fortschritt in der Evolution des Geistes eintrat, als für bestimmte soziale Lebewesen eine neue Reihe heuristischer Prinzipien ersonnen wurde, um dem drängenden Bedarf nach Gestaltung eines speziellen Realitätsbereichs nachzukommen – der durch das Verhalten verwandter bzw. ähnlicher Lebewesen gebildeten Realität. Bei dem Kunstgriff, mit dem die Natur aufwartete, handelte es sich um die Introspektion [. . .] [die] Betrachtung der Bewusst-
118
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
seinsinhalte.“167 (Wie wir zeigen werden, ist die Fähigkeit, darüber zu reflektieren, was man denkt oder fühlt, jedoch das Resultat der Fähigkeit, zu sagen, was man denkt oder fühlt; folglich ist sie kein „Kunstgriff, mit dem die Natur aufwartete“, sondern ein Begleitumstand des Besitzes einer entwickelten Sprache.) Kognitionswissenschaftler wie Johnson-Laird, die Computer- bzw. Rechen-Analoga der Geistesaktivitäten ins Auge zu fassen versuchen, legen die Introspektion im Sinne eines parallel (ver)arbeitenden Apparats bzw. Rechners aus, dessen Betriebssystem „über ein Modell seiner eigenen Operationen verfügt, das es zur Steuerung seiner Verarbeitungsprozesse verwendet. Diese ‚selbstreflektierende‘ Arbeitsweise kann das System auf seine eigenen Arbeitsergebnisse anwenden, sodass es ein Modell seiner eigenen Verwendung solcher Modelle, und so fort, auf höher werdenden Repräsentationsebenen konstruieren kann.“168 Und die Neuropsychologen folgen Weiskrantz bei der Erklärung des seltsamen Phänomens des Blind-Sehens hinsichtlich der Unterscheidung zwischen einem Überwachungssystem und den neuralen Ereignissen, die es angeblich überwacht, indem sie das hypothetisch angenommene Überwachungssystem mit dem ‚Bewusstsein‘ identifizieren, das wiederum als eine Form des privilegierten Zugangs betrachtet wird.169 Dementsprechend wird die Introspektion als die Arbeitsweise eines neuralen Überwachungsprogramms vorgestellt – ein neurales Analogon der unterstellten inneren Wahrnehmung. Introspektion ist keine Form des inneren Sehens oder inneren Sinns Die Konzeption des Bewusstsein oder der Introspektion als eine Form des inneren Sehens oder des nach innen gerichteten Beobachtens ist ein Fehlschlag. Die Analogie zwischen unserer Fähigkeit, zu sagen, was wir wahrnehmen, und unseren Wahrnehmungsfähigkeiten einerseits, und unserer Fähigkeit, zu sagen, was wir denken, fühlen, wollen etc. und der angenommenen Introspektionsfähigkeit andererseits steht auf wackligen Füßen. Sie rechtfertigt es nicht, die Introspektion als etwas dem Wahrnehmungsvermögen (einem ‚inneren Sinn‘) Ähnliches aufzufassen, oder unsere Fähigkeit zu sagen, was wir denken, fühlen oder zu tun beabsichtigen, als Ergebnis irgendeiner Form der Wahrnehmung darzustellen. Wahrnehmungsfähigkeiten sind Fähigkeiten, deren Ausübung vom Zustand des entsprechenden Wahrnehmungsorgans, den Beobachtungsbedingungen und den Beobachtungsfähigkeiten des Subjekts abhängt. Die Introspektion geht jedoch nicht mit dem Gebrauch eines Wahrnehmungsorgans einher – man gebraucht seine Augen, Ohren und irgendwelche anderen Organe nicht, um sagen zu können, was 167
Humphrey, Consciousness Regained, S. 30. Humphrey nimmt an, dass die Introspektion ein Wesen über die Inhalte seines eigenen Bewusstseins in Kenntnis setzt, das dann auf dieser Grundlage per Analogiebildung eine Theorie bzw. ein Modell des Geistes anderer ihm ähnlicher Lebewesen konstruieren kann. 168 P. N. Johnson-Laird, The Computer and the Mind (Fontana, London, 1988), S. 362. 169 L. Weiskrantz, ‚Neuropsychology and the nature of consciousness‘, in Blakemore und Greenfield (Hg.), Mindwaves, S. 319.
3.6 Introspektion
119
man denkt oder erwartet, will oder zu tun beabsichtigt. Sie ist mit keiner Beobachtung verknüpft – man beobachtet seine Gedanken nicht bzw. macht seine Lüste und Absichten nicht ausfindig. Folglich spielen auch die Beobachtungsbedingungen keine Rolle. Es gibt somit keine Entsprechung zu Sehstärke oder Sehschwäche, kein ‚mehr Licht‘ und keinen ‚zweiten Blick aus der Nähe‘. Es gibt auch keine Beobachtungsfähigkeiten, die besser oder schlechter wären und die sich durch Anwendung und Übung verfeinern ließen. Ein geistiges Auge gibt es genauso wenig wie ein geistiges Ohr, eine geistige Nase oder Zunge in einem anderen denn gänzlich metaphorischen Sinn. Und wenn wir die Metapher vom geistigen Auge gebrauchen, sprechen wir davon bzw. meinen wir, in und nicht mit unserem geistigen Auge zu sehen (siehe 6.3.1). Was Introspektion wirklich ist Zwar gibt es so etwas wie Introspektion, es handelt sich bei ihr jedoch nicht um eine Form des inneren Sehens oder der nach innen gerichteten Beobachtung. Manche Menschen verstehen sich besser darauf zu introspektieren als andere, jedoch nicht, weil sie ein besseres ‚inneres Auge‘ hätten. Die Introspektion ist einerseits eine Sache des Nachdenkens der introspektierenden Person über sich selbst und ihren Charakter, über ihre Gefühle und Motive, über ihre Haltungen und Stimmungen. In diesem Sinne haben wir es bei der Introspektion mit einer Form des reflexiven Denkens zu tun, nicht mit einer Wahrnehmungsform. Sie ist ein Weg zur Selbsterkenntnis und zum Selbstverstehen, auf dem allerdings die Gefahren des Selbstbetrugs lauern. In einem anderen Sinn ist die Introspektion eine Sache der Aufmerksamkeit für die eigenen Stimmungen und Emotionen, Empfindungen und Gefühle. So kann man sich mit dem Stärkerwerden und Nachlassen der eigenen Schmerzen im Laufe eines Tages aus medizinischen Gründen befassen oder mit den Veränderungen der eigenen Emotionen und Haltungen einem anderen gegenüber in einem gewissen Zeitraum. Sich mit den eigenen Gefühlen zu befassen heißt nicht, dass man die eigenen Gefühle wahrnimmt; es heißt vielmehr, dass man ihnen Beachtung schenkt. Ich kann in mein Tagebuch schreiben, dass der Schmerz am Morgen nicht allzu schlimm gewesen, dass er aber inzwischen so stark geworden sei, dass ich mich habe hinlegen müssen. Um das jedoch zu bemerken, nehme ich meinen Schmerz nicht wahr (es gibt nichts dergleichen wie ein Wahrnehmen des eigenen Schmerzes) – ich habe ihn und halte diese Tatsache und die Beschreibung des Schmerzes in meinem Tagebuch fest. Ich kann bemerken, dass meine leidenschaftliche Zuneigung zu Maisy schwindet und dass ich mich augenblicklich stärker zu Daisy hingezogen fühle – tue ich das, beobachte ich aber nicht meine Emotionen mit einem inneren Auge. Ich fühle meine Leidenschaft für Maisy abnehmen – das bedeutet jedoch, dass ich beispielsweise weniger häufig an sie denke, realisiere, dass ich mich nicht länger danach sehne, sie zu sehen oder mit ihr zusammen zu sein, in Gedanken weniger ihren Reizen nachhänge als bisher. Ich nehme jedoch nicht meine Ansichten, Einsichten und gedanklichen ‚Verhaftungen‘ wahr. Mein Vermögen,
120
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
meine Gefühle und Emotionen zu bemerken und mitzuteilen, hat nichts mit einem nach innen gerichteten Sehen zu tun. Dieses Vermögen ist nicht anhand eines ‚Überwachungssystems‘ zu erklären, von einem ‚neuralen Überwachungssystem‘ ganz zu schweigen, sondern anhand sprachlicher Fähigkeiten, die jedem normalen erwachsenen Sprachbenutzer mehr oder weniger eignen – wir werden dies im Folgenden darlegen.
3.7 Privilegierter Zugang: Unmittelbar und mittelbar Fehlkonzeptionen, die privilegierten Zugang und unmittelbaren/mittelbaren Zugang betreffen Vielleicht, so könnte erwidert werden, muss man aber dennoch einräumen, dass eine Person über eine Form des privilegierten Zugangs zu den Inhalten ihres eigenen Bewusstseins verfügt, die niemand sonst hat. Um herauszufinden, in Erfahrung zu bringen, ob ich Schmerzen habe, was ich denke, wie ich mich fühle etc., muss eine andere Person sich auf mein Verhalten stützen, darauf, was ich tue und sage. Demzufolge hat sie nur mittelbar Zugang zu meinen Geisteszuständen. Möglicherweise ist die im Terminus ‚Introspektion‘ verankerte Metapher insgesamt irreführend. Man kann jedoch gewiss nicht bestreiten, dass ich unmittelbar Zugang zu meinen eigenen Geisteszuständen, zu meinen Gedanken und Gefühlen habe und andere nicht. Ob es legitimerweise bestritten werden kann oder nicht, hängt davon ab, wie es zu verstehen ist. In einer Hinsicht ist es unverfänglich, in einer anderen unsinnig. Wahr ist, dass die Gründe, die es anderen erlauben, mir psychologische Attribute zuzuschreiben, Verhaltenskriterien sind, die u. a. von meinen Empfindungs-, Wahrnehmungs-, Denk-, Willens-Manifestationen und -Ausdrücken konstituiert werden, wohingegen ich selbst ganz ohne irgendwelche Kriterien bekunde oder versichere, was ich denke oder fühle. Daraus folgt jedoch nicht, dass ich unmittelbar Zugang zu irgendetwas habe oder dass andere, die aufgrund dessen, was ich tue oder sage, urteilen, dass die Dinge für mich so und so liegen, nur mittelbaren Zugang haben. Was Zugang sein könnte und warum die Fähigkeit, dem Inneren Ausdruck zu verleihen, keine Sache des Zugangs zu irgendetwas ist Schmerzen zu haben, fröhlich oder traurig zu sein, zu denken, dass dies oder jenes der Fall ist, etwas auf die eine oder die andere Weise tun zu wollen und zu beabsichtigen, dementsprechend zu handeln und es so sagen zu können, heißt nicht, zu irgendetwas Zugang zu haben. Man hat beispielsweise Zugang zu einer Bibliothek, wenn es einem gestattet ist, sie zu benutzen; man hat Zugang zu dem und dem verschlossenen Raum oder Garten, wenn man legitimerweise den Schlüssel dafür hat; und man hat Zugang zu Information im Internet, wenn man über einen Computer mit den entsprechenden tech-
3.7 Privilegierter Zugang: Unmittelbar und mittelbar
121
nischen Voraussetzungen verfügt. Es gibt jedoch nichts mit diesen Fällen Vergleichbares, das als ‚Zugang‘ zum eigenen Schmerz charakterisiert werden könnte – richtig ist, dass ich, wenn ich Schmerzen habe, das unmittelbar sagen kann, ohne evidenzbezogene Gründe. Wenn ein Baby Schmerzen hat, schreit es. Es kann noch nicht sagen ‚Ich habe Schmerzen‘ oder ‚Mein Bauch tut mir weh‘ – nicht weil ihm seine Schmerzen nicht zugänglich sind, sondern weil es noch nicht zu sprechen gelernt hat. Wenn ein kleines Kind gut gelaunt ist, springt es fröhlich umher – es hat jedoch noch nicht gelernt, seine gute Stimmung durch die Äußerung ‚Ich habe gute Laune‘ auszudrücken. Eine Person, die gelernt hat, mit der Sprache umzugehen, kann etwas behaupten. Sie kann vorbringen, dass es regnen wird oder dass die Regierung stürzen wird oder dass es nicht richtig ist, Füchse zu jagen. Für solche Behauptungen hat sie normalerweise Gründe – dass sich Regenwolken am Horizont zeigen beispielsweise, dass die Opposition genug Stimmen zusammengebracht hat, um einen Misstrauensantrag durchzusetzen, dass Grausamkeit schlimm ist. In manchen Fällen aber kann sie sich bewusst sein, dass die Gründe, die sie zur Unterstützung ihrer Äußerung anführen kann, nicht hinreichen, um die Möglichkeit auszuschließen, dass das, was sie vorbringt, falsch ist oder sich als falsch herausstellen kann. In anderen Fällen kann sie sich im Klaren darüber sein, dass das, was sie vorbringt, wesentlich Ansichtssache ist. Also wird sie ihre Behauptung mit den Worten einleiten ‚Ich glaube‘ oder ‚Ich denke‘ oder ‚Meiner Meinung nach‘. Eine solche Fähigkeit, zu sagen, dass man dieses oder jenes glaube, denke oder meine, beruht nicht darauf, dass man privilegierten Zugang zu den eigenen Gedanken, Überzeugungen oder Meinungen hätte oder zum eigenen Denken, Glauben und Meinen. In solchen Fällen (und es gibt andere, die die Sache verkomplizieren) hat man vielmehr Gründe für eine Behauptung, ist sich bewusst, dass diese Gründe nicht hinreichend sind, und kennzeichnet die eigenen Bemerkungen entsprechend. Um ihren Glauben aufrichtig vorzubringen bedarf die Person keines Zugangs zu ihrem „Geisteszustand des Glaubens“,170 sondern sie muss sich bewusst sein, dass ihre Gründe nicht hinreichend sind, keine uneingeschränkt gültige Behauptung ermöglichen, und sie muss den Gebrauch der einschränkenden Ausdrücke ‚Ich glaube‘, ‚Ich denke‘ oder ‚Meiner Meinung nach‘ beherrschen. Fehlkonzeptionen über ‚mittelbaren Zugang‘ und mittelbare Evidenz Die Vorstellung, dass andere nur mittelbar Zugang zum Schmerz(haben) des Subjekts, zu seiner Freude oder Niedergeschlagenheit haben oder nur mittelbare bzw. indirekte Evidenz dafür, dass es etwas zu trinken will oder das und das denkt, geht gleichermaßen 170
Glauben ist unter anderem kein Geisteszustand. Für die Ausarbeitung dieses Punkts siehe P. M. S. Hacker ‚Malcolm and Searle on „intentional mental states“‘, Philosophical Investigations, 15 (1992), S. 245–275. Für die Erörterung des Begriffs eines Geisteszustands siehe unten 10.2.
122
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
in die Irre. Wir können nur dort von ‚mittelbarer Evidenz‘ sprechen oder davon, etwas ‚mittelbar zu wissen‘, wo es Sinn ergibt, von unmittelbarer Evidenz zu sprechen oder davon, etwas unmittelbar zu wissen – denn um Evidenz oder Wissen als ‚mittelbar‘ zu charakterisieren, muss man einen Gegensatz bilden. Und der Gegensatz zwischen unmittelbarer und mittelbarer Evidenz dafür, dass A Schmerzen hat, ist nicht der Gegensatz zwischen dem Umstand, dass A Schmerzen hat und das auch selbst sagt, und unserer Beobachtung, dass A Schmerzen hat und das sagt. Denn Schmerzen haben ist keine Form des Wissens, aber auch keine Form der Evidenz, und die Person, die stöhnt oder sagt, sie habe Schmerzen, sagt das somit weder aufgrund von Evidenz noch von Beobachtung, denn, wie oben dargelegt, heißt Schmerzen haben nicht, etwas zu beobachten. Es gibt keine andere Möglichkeit, unmittelbar zu wissen, dass eine Person Schmerzen hat, als zu sehen, wie sie sich im Verletzungs- oder Krankheitsfall stöhnend windet. Es gibt keine andere Möglichkeit, unmittelbar zu wissen, was ein anderer sieht, als dass er einem zeigt bzw. darauf deutet, was er sieht. Und es gibt keine andere Möglichkeit, unmittelbar zu wissen, was ein anderer denkt, als es seiner aufrichtigen Äußerung zu entnehmen. Wenn man auf dem Nachtschrank einer Person eine Packung Schmerzmittel zusammen mit einem leeren Wasserglas bemerkte, würde man mittelbar wissen, dass sie Schmerzen hat. Aus Gerüchten zu erfahren, was eine andere Person denkt, könnte ebenso als ein Fall ‚mittelbaren Wissens‘ aufgefasst werden – an einer Versicherung aus erster Hand ist jedoch nichts ‚mittelbar‘. Es ist überhaupt irrig anzunehmen, dass man „‚ins Innere‘ anderer Personen ‚vordringen‘ [und] ihre bewussten Gedanken in Augenschein nehmen“171 müsste, um unmittelbar herauszufinden, was sie denken. Ein ‚Vordringen ins Innere anderer Personen‘ gibt es buchstäblich nur als Untersuchung des Inneren ihres Körpers und ihres Gehirns – denn man ‚dringt nicht in ihren Geist vor‘ (außer in einem metaphorischen Sinne). Wir haben es hier nicht mit etwas zu tun, die wir nicht tun könnten, sondern vielmehr mit etwas, das es nicht gibt. Dass es das nicht gibt, ist ebenso wenig eine Beschränkung, wie dass im Damespiel niemand matt gesetzt werden kann. Wir können also ‚ins Innere‘ des Gehirns einer anderen Person ‚gelangen‘, aber keine noch so umfangreiche Untersuchung der neuralen Prozesse einer anderen Person mittels PET wird uns in die Lage versetzen, Einsicht in ihre Überlegungen zu gewinnen oder das, was sie denkt, in Augenschein zu nehmen. Andererseits können wir die Überlegungen einer Person und den Inhalt ihres Denkens untersuchen und tun das häufig. Wir prüfen den aufrichtigen Ausdruck ihres Denkens und ihrer Argumente. Wenn wir wissen wollen, was Newton oder Kant dachten, und ihre Überlegungen und Argumente prüfen möchten, lesen wir ihre Schriften – und daran ist nichts mittelbar.172 171
Vgl. Blakemore, Mind Machine, S. 231. Ein nächster Irrtum bestünde in der Annahme, dass eine Person ihre Gedanken, Ansichten oder Meinungen beschreibt, wenn sie ihnen Ausdruck verleiht – als ob sie etwas anderen nicht Sichtbares sehen könnte, dass sie dann zu deren Nutzen beschreiben würde. Zu sagen, was man denkt, heißt nicht, seine Gedanken zu beschreiben, sondern sie auszusprechen bzw. auszudrü172
3.8 Privatheit oder Subjektivität
123
3.8 Privatheit oder Subjektivität Missverständnisse der Vorstellungen von ‚Subjektivität‘, ‚Privatheit‘, und ‚Privatbesitz‘ psychologischer Attribute Möglicherweise gesteht man zu, dass die Terminologie von ‚unmittelbar‘ und ‚mittelbar‘ zumindest irreführend ist. Die Ausdrücke ‚Zugang‘ und ‚privilegierter Zugang‘ sind vielleicht schlecht gewählt. Trotzdem ist es ganz sicher unbestreitbar, dass der Geist in einem „subjektiven Modus existiert“; dass „aufgrund seiner Subjektivität [. . .] Schmerz nicht jedem Beobachter gleichermaßen zugänglich ist. Seine Existenz [. . .] ist eine ErstePerson-Existenz.“ Jeder Schmerz „muss jemandes Schmerz sein“; „jeder Bewusstseinszustand ist immer jemandes Bewusstseinszustand“. Man könnte sagen, dass es sich bei Schmerzen um eine Art logischer Privatentität handelt. Niemand anderes kann meinen Schmerz haben, nur einen ähnlichen. Der Schmerz einer anderen Person ist ein anderer Schmerz. „Und gerade so, wie ich in einer besonderen Beziehung zu meinen Bewusstseinszuständen stehe, die nicht so ist wie meine Beziehung zu den Bewusstseinszuständen anderer Menschen, so stehen auch die anderen Menschen wiederum in einer Beziehung zu ihren Bewusstseinszuständen, die nicht so ist wie meine Beziehung zu ihren Bewusstseinszuständen.“173 Bei diesen Behauptungen versteht sich nichts von selbst. Im Gegenteil, sie stiften nur noch mehr Verwirrung. Wir müssen uns darum bemühen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Dieselben Überzeugungen oder Gedanken haben wie ein anderer Würde man auch sagen wollen, dass eine andere Person meine Überzeugungen oder Gedanken nicht haben könne? Welche Überzeugung bzw. welchen Glauben habe ich? Angenommen, ich würde glauben, dass meine Geliebte den Zug um 15.30 Uhr erreicht. Dann bestünde mein Glauben darin: dass meine Geliebte den ‚15.30er‘ erreicht. Angenommen, ich teilte Ihnen mit, weshalb ich glaube, was ich glaube, und auch Sie kämen dahin zu glauben, dass meine Geliebte den 15.30er erreicht. Jetzt hätten Sie denselben Glauben wie ich. Das mag man zugegeben, könnte jedoch immer noch einwenden, dass es sich bei Schmerzen ganz anders verhält. Schließlich können Sie nicht meinen
cken. Eine Beschreibung der eigenen Gedanken ist es, sie als brillant, konfus, einsichtsvoll oder wirr zu charakterisieren. 173 J. R. Searle, The Rediscovery of the Mind [dt. Die Wiederentdeckung des Geistes] (MIT Press, Cambridge, MA, 1992), S. 94f. Searle gebraucht nicht den Ausdruck ‚Privatheit‘, sondern favorisiert ‚Subjektivität‘. Andere Philosophen und, wie wir gesehen haben, manche Neurowissenschaftler favorisieren ‚Privatheit‘.
124
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
Schmerz empfinden! Nur ich kann meinen Schmerz empfinden – überhaupt stehe ich in einer besonderen Beziehung zu meinen Schmerzen. Denselben Schmerz haben wie ein anderer – die Identitätskriterien für Schmerzen Wenn das bloß bedeutet, dass ich, wenn Sie Kopfschmerzen haben, für gewöhnlich keine habe, dann ist es wahr. Wenn es bedeutet, dass zwei Menschen nicht denselben Schmerz haben können, dann ist es falsch. Wenn wir beide einen dumpfen, klopfenden Schmerz in der linken Schläfe haben, dann haben wir denselben Schmerz. – Aber keineswegs; es ist gerade so, dass sie sich ähneln ‚wie ein Ei dem anderen‘, nichtsdestotrotz aber zwei verschiedene Kopf-Schmerzen sind! Das stimmt nicht. Wir haben es hier mit zwei verschiedenen Menschen zu tun, die denselben Kopfschmerz haben. Denn welchen Kopfschmerz haben Sie letzten Endes? Einen dumpfen, klopfenden in den Schläfen? Das ist derselbe Kopfschmerz, den ich habe. Aber natürlich ist Ihr Kopfschmerz in ihrem Kopf und meiner ist in meinem. Wie können sie derselbe Kopfschmerz sein, wenn die Kopfschmerzen einen unterschiedlichen Ort haben? Auf diese Frage lässt sich zweierlei erwidern. Erstens: Wenn man sich über das Problem unterschiedlicher Lokalisation Gedanken macht, sollten sich die damit verbundenen Schwierigkeiten dadurch mindern lassen, dass man das Beispiel Siamesischer Zwillinge in den Blick nimmt, die einen Schmerz an der Stelle ihrer körperlichen Verbindung haben. Hier kann man nicht sagen, die Schmerzen hätten einen unterschiedlichen Ort – schließlich deuten die Zwillinge auf dieselbe Stelle. Der Umstand, dass das die Bedenken nicht mindert – dass man also immer noch zu sagen versucht ist, dass die Zwillinge unterschiedliche Schmerzen haben (obgleich diese an derselben Stelle verortet sind) –, zeigt, dass die Schwierigkeiten die Frage der Lokalisation tatsächlich gar nicht betreffen. Zweitens sollten wir beachten, dass der Begriff der Empfindungslokalisation dem der Lokalisation eines physisch-materiellen Objekts nicht entspricht. Wenn zwei Menschen einen Schmerz am gleichen Ort haben, heißt das weder, dass sie nacheinander am selben Ort sind und einen Schmerz haben, noch, dass sie Siamesische Zwillinge mit einem Schmerz am Ort ihrer Verbindung sind. Es heißt vielmehr, dass die einander entsprechenden Teile ihres Körpers in der gleichen Weise verletzt sind. Ein Schmerz ist nicht dadurch charakterisiert, dass er der Schmerz eines Subjekts ist, also spielt es im Hinblick auf die Identität des Schmerzes keine Rolle, wer ihn hat Ortsgleichheit oder -verschiedenheit ist folglich eine falsche Spur. Das mag man zugeben und dennoch weiter darauf beharren, dass unterschiedliche Menschen nicht denselben Kopfschmerz haben können. Sicherlich, möchte man einwenden, ist Ihrer Ihrer, und meiner ist meiner – wie könnten sie identisch sein? Demnach ist der Kopfschmerz einer anderen Person, wie oben angemerkt, ein anderer Kopfschmerz. Hier rühren wir an den Kern der Verwirrung. Denn meiner sein und Ihrer sein sind keine Identifizierungscha-
3.8 Privatheit oder Subjektivität
125
rakteristika des Kopfschmerzes – diese possessiven Wendungen drücken aus, wer den Kopfschmerz hat, nicht, um welchen Kopfschmerz es sich handelt. Meiner sein ist keine Identifizierungseigenschaft des Kopfschmerzes, der mich plagt, die ihn von Ihrem Kopfschmerz unterscheiden könnte, genauso wenig wie ‚die Farbe meiner Augen sein‘ eine Identifizierungseigenschaft der Farbe ist, die meine Augen haben. Wenn meine Augen braun sind und Ihre Augen braun sind, dann haben wir dieselbe Augenfarbe. (Zwei rote Kirschen haben dieselbe Farbe, weil das Rot der ersten Kirsche nicht zur ersten und das Rot der zweiten Kirsche nicht zur zweiten ‚gehört‘.) Einen Schmerz haben heißt nicht, irgendetwas zu besitzen; noch heißt es, in einer Beziehung zu einem Schmerz zu stehen Einen Schmerz haben heißt nicht, irgendetwas zu besitzen oder über irgendetwas zu verfügen – genauso wenig wie eine Aufgabe zu erledigen haben bedeutet, irgendetwas zu besitzen oder über irgendetwas zu verfügen. Einen Schmerz haben heißt nicht, in einer besonderen Beziehung zu einem Schmerz zu stehen, denn hierbei handelt es sich gar nicht um eine Beziehung – genauso wenig wie bei eine Depression haben, was einfach eine Sache des Sich-niedergeschlagen-Fühlens ist. Einen Schmerz in seinem Fuß zu haben heißt, dass der Fuß wehtut. Die Identitätskriterien eines Schmerzes bestehen in seiner Intensität, seinem Ort und seiner Empfindungsqualität, und wenn Ihr Schmerz und meiner in diesen Hinsichten übereinstimmen, dann haben wir denselben Schmerz, genau wie zwei Kissen dieselbe Farbe haben, wenn die Farbe des einen mit der des anderen in Farbton, Farbwert und Farbsättigung übereinstimmt. Wir neigen zu einer anderen Betrachtungsweise, weil wir einen Schmerz haben ungewollt nach dem Modell von einen Penny haben auslegen. Womit wir allerdings einen Irrtum begehen, denn einen Penny haben ist tatsächlich ein Fall von Eigentum oder Besitz, und wenn eine Person einen Penny hat, steht sie in einer Beziehung zu ihm – des Eigentums oder Besitzes nämlich. Wenn eine Person einen Schmerz hat, steht sie jedoch nicht in einer Beziehung zu einem Schmerz, genauso wenig wie ein rotes Kissen in einer Beziehung zur Farbe Rot steht.174 Empfindungsnomen sind von Empfindungsverben abgeleitet Einen Schmerz zu haben heißt folglich nicht, zu irgendetwas Zugang zu haben, und schon gar nicht, privilegierten Zugang zu etwas zu haben, das man unveräußerlich besitzt 174
In der Sprache der Logiker trifft die Unterscheidung zwischen qualitativer und numerischer Identität, die auf materielle Objekte zutrifft, nicht auf Eigenschaften, wie Farben beispielsweise, oder Schmerzen zu. Zwei materielle Objekte können qualitativ identisch, aber numerisch verschieden sein. Weder Farben noch Schmerzen lassen diese Unterscheidung zu (obwohl sie ansonsten kategorial ganz unterschiedlich sind).
126
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
und das in logischer Hinsicht privat ist, sodass niemand anderer es besitzen könnte (sondern nur etwas dem Ähnliches). Einen Schmerz zu haben heißt zu leiden. Heißt, dass ein Teil des Körpers wehtut. Wenn A’s linke Schläfe schmerzt, ununterbrochen pocht, und zwar derart, dass es ihn zwingt, mit dem Lesen aufzuhören, und B’s Schläfe schmerzt in der gleichen Weise, dann sagt man, dass A und B denselben Kopfschmerz haben. Unser Diskurs über Empfindungen und über Gleichheit und Unterschiedlichkeit von Empfindungen ist eine Abstraktion von der Rede von Verletzungen, juckenden und pochenden Schmerzen etc. Empfindungsnamen sind genau deshalb nützlich, weil sie uns erlauben, davon zu abstrahieren, dass A’s Kopf schmerzt und B’s Kopf wehtut, um das in den Blick nehmen zu können, was diesen beiden Missständen gemeinsam ist.175 Unterschiedliche Menschen können gewiss denselben Schmerz haben (nicht nur einen sehr ähnlichen), denn damit zwei Menschen als solche betrachtet werden, die denselben Schmerz haben, muss die Empfindung des einen mit der des anderen übereinstimmen, und zwar hinsichtlich Qualität (z. B. pochend, brennend, nagend, dumpf ), körperlicher Verortung und Intensität. Das ist es, was man ‚denselben Schmerz haben‘ nennt, und die Tatsache, dass zwei Menschen denselben Schmerz haben, kann ein bedeutsamer Diagnosehinweis darauf sein, dass sie an derselben Krankheit leiden. Natürlich ist es richtig, dass Sie, wenn ich Kopfschmerzen habe, keine haben müssen. Und es ist auch richtig, dass ich, wenn ich sage, ich habe Kopfschmerzen, das nicht aufgrund der wahrnehmenden Beobachtung meines eigenen Verhaltens tue, denn ich muss mich nicht dabei beobachten, wie ich mir den Kopf halte, um sagen zu können, dass ich Kopfschmerzen habe – denn Kopfschmerzen zu haben heißt nicht, irgendetwas wahrzunehmen. Allerdings sage ich das auch nicht aufgrund einer als ‚innere Wahrnehmung‘ betrachteten ‚introspektiven Beobachtung‘, denn es gibt nichts dergleichen. Ich sage es einfach – verleihe meinem Schmerz stimmlichen Ausdruck. Natürlich fühle/empfinde ich einen Kopfschmerz, einen Kopfschmerz zu fühlen heißt jedoch gerade, einen Kopfschmerz zu haben – das heißt, dass einem der Kopf wehtut. Einen Schmerz im eigenen Kopf zu fühlen ist keine Form taktiler Wahrnehmung, sondern eine Form der Empfindung. Es ist etwas kategorial ganz anderes, als einen Penny (mit den eigenen Fingern) in seiner Tasche zu fühlen, was eine Form taktiler Wahrnehmung ist. Um sagen zu können, dass man Kopfschmerzen hat, wenn man Migräne hat, braucht man überhaupt keinen Grund – ebenso wie man für einen Schmerzensächzer keinen braucht.
175
Denken Sie bitte über folgende Analogie nach. Stellen Sie sich vor, Farbprädikate wären ausnahmslos Verben, sodass wir von A’s röten und B’s blauen etc. sprechen würden. Dann könnten wir Farbnomen und -adjektive als Abstraktionen des Gemeinsamen von, beispielsweise, A’s grünen und B’s grünen einführen: nämlich die Farbe Grün, die sie beide haben. Auch wenn das Ereignis bzw. der Prozess von A’s Grünwerden vom Ereignis bzw. Prozess von B’s Grünwerden zu unterscheiden ist, ist die Farbe, die A und B haben – Grün nämlich –, dieselbe Farbe.
3.9 Bedeutung von psychologischen Prädikaten
127
3.9 Die Bedeutung von psychologischen Prädikaten und wie sie gelernt werden Psychologischen Ausdrücken wird Bedeutung nicht zugeschrieben, indem man sie durch Verknüpfung oder private hinweisende Definition mit Erfahrungen, Zuständen oder Prozessen verbindet Wir haben dargelegt, dass die Missverständnisse, die mit den Begriffen von innen und außen, privilegiertem Zugang und Introspektion, Subjektivität und Privatheit verbunden sind, ein vollkommen irriges Bild des Geistigen vermitteln. Dieselben Fehlkonzeptionen sind es, die zusammen eine ebenso verworrene Vorstellung von der Bedeutung psychologischer Prädikate stützen, davon, wie diese gelernt und wie sie gebraucht werden. Sie leisten insbesondere dem Gedanken Vorschub, dass jede Person weiß, was z. B. das Wort ‚Schmerz‘ bedeutet, indem sie es mit der Schmerzempfindung, zu der sie privilegierten Zugang hat, verknüpft; weiß, was die Worte ‚wollen‘, ‚glauben‘ und ‚beabsichtigen‘ bedeuten, weil sie sie mit ihren eigenen inneren Verlangensgefühlen und ihren privaten Glaubens- und Beabsichtigungserfahrungen verknüpft. Kurz gesagt, der psychologische Wortschatz wird so aufgefasst, als bestehe er aus Namen subjektiver Erfahrungen, geistiger Zustände oder Prozesse, zu denen die Person privaten, unmittelbaren und privilegierten Zugang habe. Und Worte, meint man, erhalten ihre Bedeutung, indem sie mit den Erfahrungen, Zuständen oder Prozessen verbunden werden. Die hinweisende Definition und der Gebrauch von Beispielen bei derartigen Definitionen Wittgenstein setzte sich mit dieser Fehlkonzeption ausführlich auseinander und konstituierte so die berühmteste philosophische Erörterung des 20. Jahrhunderts. ‚Das Privatsprachenargument‘, als das sie allgemein bekannt ist, ist ebenso schwierig wie berühmt (und umstritten). An dieser Stelle können wir die Wittgenstein’schen Darlegungen bloß knapp wiedergeben.176 Die Bedeutungskonzeption, die hier im Spiel ist, besagt, dass Objekten (z. B. einem Apfel) und Eigenschaften (z. B. rot, scharlachrot oder violett sein) ein Name verliehen wird, indem man auf eine entsprechende Sache zeigt und sagt ‚Dies (diese Frucht) F ist ein Apfel‘ oder ‚Das (diese Farbe) F ist Rot (Scharlachrot oder Violett)‘. Die Äußerung liefert eine Definition (der Fachterminus dafür ist ‚eine hinweisende Definition‘ [‚an ostensive definition‘], was definieren durch zeigen bedeutet) oder eine Regel für den Gebrauch eines Wortes – beispielsweise ‚Apfel‘ oder ‚rot‘ (‚schar176
Für eine detailliertere Darstellung siehe P. M. S. Hacker, Insight and Illusion: Themes in the Philosophy of Wittgenstein, überarb. Ausg. (Clarendon Press, Oxford, 1986, und Thoemmes Press, Bristol, 1997), Kap. 9–10. Für eine gründliche Analyse der Argumente Wittgensteins siehe P. M. S. Hacker, Wittgenstein: Meaning and Mind, Volume 3 of an Analytical Commentary on the Philosophical Investigations (Blackwell, Oxford, 1990).
128
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
lachrot‘ oder ‚magenta‘). Denn sie gibt zu verstehen, dass eine Frucht, die, was ihre Wahrnehmung angeht, der bezeigten entspricht, richtigerweise ‚ein Apfel‘ heißt, oder dass von irgendeinem Objekt, das offensichtlich dieselbe Farbe hat wie die bezeigte, richtigerweise gesagt wird, dass es sich um ein rotes (scharlachrotes oder magentafarbenes) handelt. Das Objekt, auf das gezeigt wird, ist ein Beispiel oder Paradigma für die Anwendung des definierten Wortes; das heißt, es fungiert als ein Standard für seine richtige Anwendung. Es kann seine Beispielfunktion erfüllen (und mitunter tut es das auch, wie z. B. in den Fällen von Scharlachrot oder Magenta), indem es als ein Vergleichsobjekt gebraucht wird, um die richtige Anwendung des definierten Ausdrucks festzulegen. Diese Art, einem Namen Bedeutung zu geben, die Bedeutung des Namens zu erklären und die Anwendung des Namens festzulegen, ist ganz gewöhnlich und alltäglich, und von ihr wird stets Gebrauch gemacht, wenn Kinder etwas gelehrt oder Erwachsenen die Bedeutung vieler geläufiger Worte unserer Sprache erklärt und wenn beispielsweise die Verwendung zahlreicher Namen von Farbschattierungen festgelegt wird. Kann psychologischen Ausdrücken durch private hinweisende Definition Bedeutung verliehen werden? Die entscheidende Frage ist, ob die Bedeutung psychologischer Ausdrücke in dieser oder in einer analogen Weise gelehrt oder erklärt werden kann. Lernt irgendjemand die Bedeutung von ‚Schmerz‘ auf diese Weise? Zwar wissen wir alle, was ‚zu sehen‘ oder ‚zu hören‘ bedeutet, haben wir aber die Beherrschung des Gebrauchs dieser Wahrnehmungsprädikate gelernt, indem wir sie in dieser Weise mit unseren Seh- und Hör-Erfahrungen verknüpften? Haben wir den Gebrauch von ‚ich denke‘ oder ‚ich beabsichtige‘ beherrschen gelernt, indem wir eine private Erfahrung oder ein privates Geschehen benannt haben? Stellen wir die Gebrauchsregeln solcher Worte wie ‚denken‘ oder ‚glauben‘ auf diese Weise bereit – wäre uns das überhaupt möglich? Gründlichem Nachdenken erschließt sich, dass wir den Gebrauch dieser Worte nicht hätten bewältigen können, indem wir Erfahrungen auf diese Weise benannten. Wir könnten eine Operationsregel für den Gebrauch dieser Worte nicht in dieser Form bereitstellen. In Wahrheit könnte eine subjektive Erfahrung nicht so als ein Standard für die richtige Verwendung eines psychologischen Ausdrucks fungieren, wie ein öffentliches Beispiel es tut. Wir werden nun zeigen, warum nicht. Wenn unseren psychologischen Ausdrücken durch private hinweisende Definition Bedeutung verliehen worden wäre, könnte niemand wissen, was andere mit ihrem psychologischen Wortschatz gemeint haben Festzuhalten ist, dass, wenn wir per impossibile den Gebrauch psychologischer Ausdrücke durch die Benennung unserer eigenen Erfahrungen in der nämlichen Weise bewältigt hätten und wenn das Geistige so beschaffen wäre, wie von Neurowissenschaftlern
3.9 Bedeutung von psychologischen Prädikaten
129
unterstellt, wir niemals wissen könnten, ob das, was andere Menschen mit ‚Schmerz‘, ‚wollen‘, ‚denken‘, ‚glauben‘, ‚beabsichtigen‘ etc. meinen, dem entspricht, was wir mit diesen Worten sagen wollen. Denn das, was eine Person beispielsweise mit dem Wort ‚Schmerz‘ meint, wird angeblich dadurch definiert, dass sie sich auf die Erfahrung, die sie hat (die nach dem favorisierten Modell eine private ist, die niemand sonst haben kann) bezieht, und sie kann prinzipiell nicht wissen, was andere Menschen haben, wenn sie sagen, dass sie Schmerzen haben (denn nach dem favorisierten Modell sind diese jedem anderen unzugänglich). Denn soviel sie weiß, können andere eine ganz andere Empfindung haben, die ganz zufällig mit dem Weinen und Stöhnen verbunden ist (denn nach dem favorisierten Modell ist das Schmerzverhalten nicht begrifflich mit dem Schmerz verbunden). Ergibt das aber einen Sinn? Haben wir irgendwelche Zweifel an dem – sollten wir welche haben –, was andere meinen, wenn sie sagen, sie hätten Schmerzen? Ist es nur eine Hypothese, dass die sich auf dem Boden windende Person, die ein gebrochenes Bein hat und die wimmert ‚Es tut so weh, es tut so weh‘, Schmerzen hat? Kann irgendjemand wirklich davon ausgehen, dass es sich bei dem, was eine Person empfindet, wenn sie ernsthaft verletzt ist und schreiend in einer Blutlache liegt, vielleicht gar nicht um einen Schmerz handelt (nicht um das, was wir mit ‚Schmerz‘ meinen), dass das, soviel wir wissen, sogar ganz angenehm sein könnte? Darüber hinaus kann man nicht begründet davon ausgehen, dass wir wissen, dass andere Schmerzen haben wie wir, weil wir wissen, dass ihre neurophysiologische Ausstattung der unseren entspricht. Denn das würde, von anderen Einwänden abgesehen, absurderweise bedeuten, dass eine skeptische Haltung, was das Wissen über die (geistige) Verfassung anderer betrifft, vor den Entdeckungen der Neurowissenschaften eine vernünftige Position darstellte. Es ist nicht möglich, einem Empfindungsausdruck anhand einer inneren, privaten HinweisDefinition Bedeutung zu verleihen Das ist jedoch noch nicht einmal die ärgste Auswirkung des favorisierten Modells. Denn wie Wittgenstein zeigte, kann es dem gründlich Nachdenkenden kaum entgehen, dass offensichtlich nicht nur eine solche imaginäre Person nicht wüsste, ob andere das mit ‚Schmerz‘ meinen, was sie gewöhnlich damit verbindet, sondern dass sie selbst den Gebrauch des Wortes ‚Schmerz‘ überhaupt nicht hätte beherrschen lernen können. Die in Erwägung gezogene Bedeutungszuschreibung zum Wort ‚Schmerz‘ z. B. ist inkohärent, und wie ein solcher psychologischer Ausdruck die Bedeutung haben soll, die er hat – auch die Konzeption ist verworren. Lassen Sie uns ergründen, warum. Farbworte durch hinweisende Definition definieren Wir definieren und erklären die Bedeutung von Farbworten wie ‚rot‘ oder ‚Wellingtonblau‘ oder ‚ultramarinblau‘, indem wir uns auf Beispiele beziehen. Wir können (und in
130
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
den beiden letzten Fällen z. B. tun wir das auch) die definierenden Beispiele als Vergleichsobjekte verwenden, um die Richtigkeit der Äußerung, ein Objekt sei Wellingtonblau oder ultramarinblau beispielsweise, zu überprüfen. Wir ziehen eine Farbtafel zu Rate und vergleichen die mit ‚Wellington-blau‘ beschriftete Farbfläche mit dem fraglichen Objekt (einem Stoffstreifen möglicherweise), und wenn das Objekt die Farbe des Beispiels hat, können wir zutreffenderweise sagen, dass es sich um Wellington-blau handelt. ‚Alles, was diese F ¢ Farbe hat‘, sagen wir, auf das Beispiel zeigend, ‚ist Wellingtonblau‘. Wenn wir jedoch versuchen sollten, das Wort ‚Schmerz‘ anhand einer Schmerzempfindung, die wir haben, zu definieren, könnten wir da ebenso verfahren? Nein – denn es kann zu diesem Vorgehen kein wirkliches Analogon geben, wenn man es mit Geistesprädikaten zu tun hat. Vier falsche Analogien zwischen der öffentlichen hinweisenden Definition und der illusionären privaten hinweisenden Definition Erstens gibt es kein Analogon zu: auf ein Beispiel zeigen. Mehr, als die eigene Aufmerksamkeit in der reproduktiven Vorstellung auf eine Schmerzempfindung oder einen im Gedächtnis behaltenen Schmerz zu richten, ist uns nicht möglich. Wer seine Aufmerksamkeit konzentriert (auf etwas richtet), zeigt jedoch nicht (auf etwas). Zweitens gibt es kein wirkliches Analogon zu einem Beispiel. Ein Beispiel ist wesentlich etwas Reproduzierbares – für den Gebrauch bei späteren Gelegenheiten bestimmt. In dem imaginären Fall jedoch, da man in der Vorstellung versucht, ein Empfindungswort wie ‚Schmerz‘ anhand einer Schmerzempfindung zu definieren, kann man höchstens eine vermeintliche Erinnerung an die Empfindung, auf die die Aufmerksamkeit ursprünglich konzentriert war, hervorrufen. Wir müssen uns daran erinnern, mit welcher Empfindung wir das Wort ‚Schmerz‘ ursprünglich verbanden. Und diese vermeintliche Gedächtnisreproduktion der ursprünglichen Empfindung soll als ein Beispiel fungieren, dessen Rolle darin besteht, einen Standard für den richtigen Gebrauch des Wortes bereitzustellen. Nun haben wir aber kein Richtigkeitskriterium, um zu bestimmen, ob es sich bei dem Vorstellungsbild bzw. der Repräsentation, das bzw. die uns in den Sinn kommt, wenn wir uns daran zu erinnern versuchen, was wir mit ‚Schmerz‘ meinen, um ein Vorstellungsbild des Schmerzes oder von etwas anderem handelt. (Es hat natürlich den Anschein, als hätten wir ein solches Kriterium, weil jeder, der den Gebrauch des Wortes ‚Schmerz‘ beherrschen gelernt hat, sich daran erinnern kann, was ein Schmerz ist, einen alten Schmerz, den er im Gedächtnis behalten hat, wachrufen kann – Erinnern setzt hier jedoch den Schmerzbegriff voraus.) Was unser Gedächtnis im Zusammenhang mit dem Wort ‚Schmerz‘ auch zutage fördern mag, nichts davon wird sich besser eignen als irgendetwas anderes, und wenn alles als richtig gilt – das heißt als das richtige Gedächtnisbeispiel –, dann gilt nichts als richtig – das heißt, dann gibt es kein Richtig oder Falsch. Wenn das aber so ist, dann hat das Wort ‚Schmerz‘ überhaupt keine richtige Anwendung und ist ganz bedeutungslos.
3.9 Bedeutung von psychologischen Prädikaten
131
Drittens kann man sowohl einer anderen Person als auch sich selbst erklären, was ein Ausdruck, der in legitimer Weise anhand einer an ein Beispiel geknüpften hinweisenden Definition definiert wurde, bedeutet. Im Falle einer vermeintlichen privaten Hinweis-Definition kann man einer anderen Person ex hypothesi nicht erklären, was der angeblich so definierte Ausdruck bedeutet. Dennoch geistert die trügerische Vorstellung durch die Köpfe, dass man sich selbst erklären kann, was er bedeutet. Man würde einfach eine mentale Repräsentation, eine Erinnerung, des definierenden Beispiels abrufen und sich darauf besinnen, dass es das ist, was der Ausdruck bedeutet. Hier täuscht man sich jedoch, weil es weder ein echtes Analogon für das Zeigen noch ein Analogon für ein echtes Beispiel gibt. Somit kann man nicht einmal sich selbst erklären, was ein vorgeblich so definierter Ausdruck bedeutet. Viertens gibt es kein wirkliches Analogon für das Vergleichen eines Beispiels mit einem Objekt, um zu bestimmen, ob das Objekt zu dem Beispiel passt, sodass von ihm gesagt werden kann, es entspreche dem anhand des Beispiels definierten Begriff. Denn nehmen wir einmal an, wir haben eine Empfindung in unserem Fuß und wir wollen überprüfen, ob sie richtigerweise als ‚Schmerz‘ bezeichnet werden kann. Wir rufen also ein Vorstellungsbild (Repräsentation) auf, das mit dem Wort ‚Schmerz‘ verknüpft ist. Wie sollen wir das Bild mit der Empfindung vergleichen? Im Falle des Farbbeispiels Wellington-blau und des Stoffstreifens halten wir das Beispiel neben den Stoff und sehen, ob sie zusammenpassen. Wie aber konfrontieren wir das vermeintliche Gedächtnisbeispiel mit der Empfindung im Fuß? Weder das eine noch das andere kann wahrgenommen werden (gesehen, gehört, geschmeckt, gerochen oder taktil erspürt). Von der Empfindung kann man sagen, dass sie gefühlt wird, wie dargelegt drückt dieser Gebrauch von ‚fühlen‘ jedoch keine Form taktiler Wahrnehmung aus – Schmerzen hat man, man nimmt sie nicht wahr. Gleichermaßen hat man das Vorstellungsbild bzw. die Repräsentation, es/sie wird nicht gesehen oder gefühlt. Und man kann das erinnerte Bild nicht neben die Empfindung stellen, um zu sehen oder zu fühlen, ob sie zusammenpassen. (Aber natürlich kann jeder, der den Gebrauch des Wortes ‚Schmerz‘ beherrschen gelernt hat, sagen, ob er Schmerzen im Fuß hat oder nicht, ohne eine solche Scharade mitzumachen.) Wie wir ein Kind die Grundlagen der Verwendung des psychologischen Wortschatzes lehren Man kann es einfacher haben. Wie lehren ein Kind den Gebrauch des Wortes ‚Schmerz‘ nicht, indem wir es dazu bringen, das Wort mit einer Empfindung, die es hat, zu verbinden und die im Gedächtnis behaltene Empfindung als einen Richtigkeitsstandard für den späteren Gebrauch des Wortes zu verwenden. Wir lehren ein Kind den Gebrauch doxastischer Verben wie ‚glauben‘ oder ‚denken‘ nicht, indem wir es dazu bringen, die Worte mit irgendeinem inneren Phänomen zu verbinden, einem besonderen Gefühl oder einer besonderen Empfindung, die es angeblich immer dann hat, wenn es etwas denkt oder glaubt. Noch lehren wir ein Kind den Gebrauch der Wendungen ‚ich beab-
132
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
sichtige‘ oder ‚ich werde‘, indem wir es dazu bringen, ein besonderes Gefühl der Absicht oder des Tendierens zu identifizieren. (Diese Tatsachen sollten uns innehalten und uns dazu übergehen lassen, die Wittgenstein’schen Argumente sorgfältig zu begutachten.) Logische Unterschiede zwischen Namensarten Es stimmt, dass psychologische Termini keine Namen psychischer Eigenschaften, Handlungen und Tätigkeiten in dem Sinne sind, in dem von ‚rot‘ gesagt werden kann, dass es der Name einer Farbeigenschaft ist, von ‚winken‘, dass es der Name einer Handlung und von ‚den Garten umgraben‘, dass es der Name einer Tätigkeit ist. Es ist zwar nicht falsch zu sagen, dass ‚Schmerz‘ ein Empfindungsname oder dass ‚Zorn‘ ein Emotionsname ist. Die Äußerung verdeckt allerdings schwerwiegende logische Unterschiede zwischen einem Farbnamen und einem Empfindungsnamen oder zwischen einem Handlungsbzw. Tätigkeitsnamen und dem Namen eines sogenannten mentalen Akts oder einer Geistestätigkeit. Dort, wo maßgebliche logische Unterschiede bestehen, suggeriert sie eine Ähnlichkeit in der Art des Ausdrucks, indem sie die ganz unterschiedlichen Verwendungen der Ausdrücke verschleiert und die unterschiedlichen Verfahren verdeckt, anhand derer sie in unserer Lebenspraxis gelehrt und erklärt werden. Sie werden keineswegs durch private hinweisende Definition bestimmt, und das Wort ‚Schmerz‘ z. B. verhält sich zur Empfindung von Schmerz nicht so wie das Wort ‚rot‘ zur Farbe Rot, genau wie das Wort ‚glauben‘ sich zu Glauben [‚believe‘/believing] nicht so verhält wie das Wort ‚laufen‘ zu Laufen [‚run‘/running]. Es handelt sich um Worte ganz unterschiedlicher logischer Kategorien, sie werden ganz unterschiedlich verwendet, und wir lehren oder erklären ihre Bedeutung auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und daran sollte es nach genauerem Überlegen keine Zweifel geben. Asymmetrien zwischen erster und dritter Person charakterisieren psychologische Verben Psychologische Prädikate werden beispielsweise Personennamen, Pronomen und Kennzeichnungen beigefügt. Es besteht eine Asymmetrie zwischen dem Gebrauch dieser Worte in der ersten Person Präsens und dem entsprechenden Gebrauch in der dritten Person. So viel wird freilich auch von der allgemein geteilten Konzeption anerkannt, denn nach dieser wenden wir solche Prädikate aufgrund von Introspektion und innerer Wahrnehmung auf uns selbst an, wohingegen wir sie auf andere aufgrund der nichtlogischen Evidenz, die deren Verhalten uns liefert, anwenden. Diese Position missversteht jedoch, worin die Asymmetrie im Wesentlichen besteht, nämlich darin, dass wir die Prädikate (einen Teil von ihnen) überhaupt ohne irgendein ‚Aufgrund‘ oder irgendwelche evidenzbezogenen Gründe auf uns selbst anwenden und aufgrund von Verhaltenskriterien auf andere – diese konstituieren logisch begründete Evidenz. Das mag verwirren: Wie können wir ein Prädikat ohne jedes Anwendungskriterium auf uns selbst anwenden? Wenden wir es beliebig an? Das wäre absurd. Wir sagen nur dann ernstlich,
3.9 Bedeutung von psychologischen Prädikaten
133
dass wir Schmerzen haben, wenn wir Schmerzen haben – mit Beliebigkeit hat das nichts zu tun. Es ist also noch nicht alles erklärt. Um die Bedeutungen jener psychologischen Prädikate zu lernen, die für unsere Erörterung von Belang sind, muss man ihren Gebrauch sowohl in der ersten als auch in der dritten Person bewältigen. Denn bei ihnen haben wir es mit unterschiedlichen Aspekten desselben Begriffs zu tun. Wir haben erläutert, dass der Gebrauch in der dritten Person mit dem Lernen der Verhaltenskriterien einhergeht, die die Anwendung des relevanten Prädikats auf eine andere Person rechtfertigen. Aber stellt uns jetzt nicht der Gebrauch in der ersten Person vor ein Rätsel? Das scheint so zu sein, allerdings nur deshalb, weil wir jetzt, da wir das Namens- und Nominatum-Modell abgelehnt haben, erkennen, dass wir uns auf offenem Meer befinden und unterzugehen drohen. Wenn wir uns aber selbst darauf besinnen, wie wir den Gebrauch dieser Worte tatsächlich lehren, wie wir ihren Gebrauch einem Lernenden erklären könnten, wie dieser dann dazu übergeht, sie zu verwenden, und was wir als richtigen oder falschen Gebrauch betrachten, werden wir Oberwasser behalten und unseren Halt finden. Ein Kind erwirbt den Schmerzbegriff als eine Erweiterung des natürlichen Schmerzverhaltens Natürlich lehren wir ein Kind den Gebrauch des Wortes ‚Schmerz‘ nicht, indem wir es dazu bringen, eine Empfindung zu identifizieren und diese dann zu benennen. Das Kind lernt, sein natürliches Wimmern und Weinen durch Schmerzäußerungen zu ersetzen. Es lernt ‚Au‘ auszurufen (oder ‚Aya‘ in manchen Ländern); später zuerst ‚Wehtut‘ und dann ‚Es tut weh‘ oder ‚Hand tut weh‘ zu sagen; und noch später ‚Ich habe Schmerzen‘. Die primitive oder elementare Schmerzäußerung wird als eine Erweiterung des natürlichen Ausdrucksverhaltens gelernt. Ein Kind schreit oder stöhnt nicht beliebig vor Schmerzen, es lernt auch nicht, seinem Schmerz beliebig verbalen Ausdruck zu verleihen. Es braucht jedoch weder Gründe, keine ‚introspektiven‘ und keine verhaltensbezogenen, um herauszuschreien ‚Es tut weh‘ oder ‚Ich habe Schmerzen‘, noch braucht es Gründe, um unter Schmerzen zu klagen. Noch später wird es lernen ‚Ich habe Schmerzen‘ als eine abgeklärte Beschreibung zu verwenden (wenn die Schmerzen nicht zu stark sind und der Arzt fragt, wie es sich fühlt). Zudem lernt das Kind, dass auch ‚Ich habe Schmerzen‘ zu sagen – genau wie das Schreien eine Möglichkeit darstellt, die Aufmerksamkeit seiner Eltern auf sich zu ziehen, seinen Schmerz zu lindern etc. – seinen Eltern (und anderen) einen Grund dafür gibt, sich um es zu kümmern, einen Grund für Wohlwollen und Mitleid. Es lernt in der Folge auch, dass immer dann, wenn seine Mutter sich verletzt und ‚Autsch‘ ausruft, ein Grund für die Äußerung besteht ‚Mama hat sich wehgetan‘. Das Kind lernt also zeitgleich die beiden komplementären Aspekte des Gebrauchs von ‚Schmerz‘, seine expressive (und später auch berichtende) Verwendung in der ersten Person und seine beschreibende Verwendung in der dritten Person, und es lernt, in welch komplexer Weise die Verwendung des Wortes in Sätzen in das natürliche und das kulturelle menschliche Verhalten einbezogen ist.
134
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
Ein Kind erwirbt den Begriff des Wollens als eine Erweiterung des primitiven Willensverhaltens Etwas Ähnliches ereignet sich im Fall von ‚wollen‘. Offensichtlich lernt ein Kind nicht, mittels Introspektion ein inneres Phänomen zu identifizieren, zu dem es ‚Zugang‘ hat und das es dann ‚wollen‘ nennt. Das Kind zeigt vielmehr Willensverhalten – es versucht, Dinge zu bekommen, an ein Spielzeug heranzukommen, das sich außerhalb des Gitterbetts befindet, oder eine verlockende Speise jenseits seiner Reichweite zu ergattern, und es weint und schreit vor lauter Frustration. Es lernt, dass das ein wirksames Mittel ist, seine Eltern dazu zu bringen, ihm das Objekt zu geben. Die Eltern heben das Objekt auf und sagen beispielsweise ‚Will Tommy den Teddy haben? Hier hast du ihn.‘ Und zu gegebener Zeit lernt das Kind zu sagen ‚will‘ und später ‚Ich will den Teddy‘ und so weiter. Der primitive oder elementare Gebrauch von ‚ich will‘ ist eine Erweiterung seines natürlichen Willensverhaltens. Indem es diese primitive Verwendung von ‚ich will‘ lernt, lernt das Kind eine neue Form des Willensverhaltens – lernt, dem, was es will, verbalen Ausdruck zu verleihen. ‚Ich will‘ ist hier ein Ausdruck des Wollens und keine Beschreibung eines inneren Prozesses oder Zustands. Das Kind muss weder einen inneren Prozess identifizieren, bevor es ‚ich will‘ sagt, noch einen inneren Prozess identifizieren, bevor es sich bemüht, an etwas heranzukommen. Auf diesem primitiven Fundament werden andere, mehr oder weniger eng damit in Beziehung stehende Gebrauchsweisen von ‚wollen‘ und anderen Willensverben etabliert. Es wäre vollkommen abwegig zu denken, dass sämtliche psychologische Begriffe derart auf das natürliche Ausdrucksverhalten aufgepfropft sind. Die Kategorie des Psychischen ist nicht nur vage und unbestimmt, was ihre Grenzen angeht; sie ist auch äußerst vielgestaltig. Zwischen ihren verschiedenen (Unter-)Kategorien bestehen grundlegende logische Unterschiede. Also werden wir ein paar Beispiele mehr anführen, um sie zu verdeutlichen. Die Hauptfunktion des doxastischen Wortschatzes und sein Anwendungsmodus Wir haben weiter oben bereits zu verstehen gegeben, dass der Gebrauch doxastischer Verben wie ‚glauben‘ oder ‚denken‘ nicht als Erweiterung des natürlichen doxastischen Verhaltens gelernt wird. Ihr Gebrauch setzt substanzielle sprachliche Fertigkeiten bereits voraus – im Besonderen die Beherrschung des Gebrauchs von Aussagesätzen, um eine Behauptung aufzustellen. Denn ‚ich denke‘ und ‚ich glaube‘ (und auch ‚ich weiß‘ und ‚ich bezweifle, dass‘) werden in Aussagesätzen als Präfixe verwendet – sie sind, wie der logische Grammatiker sagen würde, satzbildende Operatoren bei Aussagesätzen. Und wie wir angemerkt haben, besteht eine zentrale Verwendung solcher Ausdrücke darin, die Art der Gründe anzuzeigen, welche die Behauptung, der sie beigefügt sind, stützen bzw. rechtfertigen. Um diesen Gebrauch zu beherrschen, muss man also bereits etwas über evidenzbezogene Unterstützung, Gründe für das Behaupten und In-Zweifel-Zie-
3.9 Bedeutung von psychologischen Prädikaten
135
hen gelernt haben. Denn man sagt ‚ich denke . . .‘, ‚ich glaube . . .‘, ‚soweit ich weiß . . .‘ oder ‚wenn mich nicht alles täuscht . . .‘ dann, wenn man erkennt, dass seine Gründe für die folgende Behauptung unter den gegebenen Umständen nicht hinreichen, die Möglichkeit des Irrtums auszuschließen oder den Zweifel unbegründet scheinen zu lassen. Es würde zu weit führen, den ganzen (obgleich unkomplizierten) Zusammenhang hier detailliert auszubreiten. Soviel ist jedoch klar. Niemand lernt den Gebrauch von ‚ich denke‘ oder ‚ich glaube‘, indem er seinen inneren Glaubenszustand bzw. -Prozess introspektiv identifiziert. Und niemand ist dazu berechtigt, einem Satz ein ‚ich glaube‘ oder ein ‚ich denke‘ voranzustellen, weil es in ihm einen introspektierbaren Glaubensoder Denkzustand bzw. -Prozess gibt. Wie wir ein Kind den Gebrauch von Intentionsausdrücken lehren könnten Wieder anders stellt sich der Gebrauch von Intentionsausdrücken dar. Wie könnte ein Elternteil ein Kind ihre Verwendung lehren? Um es zu wiederholen, nicht, indem es das Kind dazu bringt, ein inneres Phänomen des Beabsichtigens zu identifizieren und dieses anschließend zu benennen. Ein solches inneres Phänomen gibt es nicht – es gibt keinen Phänomenbereich des Intendierens, keine ‚Intendieren‘ genannte eigenständige Erfahrung –, und ‚ich beabsichtige‘ ist weder der Name noch die Beschreibung irgendeiner ‚inneren Erfahrung‘. Wir könnten uns jedoch gewinnbringend an den primitiven oder elementaren Verwendungen der Intentionsausdrücke ausrichten, indem wir die folgenden Punkte beachten. Erstens exemplifiziert das Elternteil den Gebrauch der eine Absicht ausdrückenden Wendung ‚ich werde (jetzt) . . .‘ [‚I am going to . . .‘] für das Kind. Um diesen zu beherrschen, muss das Kind nichts ‚introspektieren‘. Es muss vielmehr erfassen, dass, wenn man sagt ‚ich werde (jetzt) . . .‘, von einem erwartet wird, dass man eine Sache in Angriff nimmt. Der Vater bzw. die Mutter sagt z. B. ‚Ich werde dich (jetzt) baden‘ und geht dann dazu über, das Kind zu baden. Das Kind muss lernen, dass ‚ich werde (jetzt) . . .‘ dazu gebraucht wird, um eine Handlung anzukündigen bzw. einzuleiten, und dass man, wenn man diese Wendung gebraucht, dazu übergehen muss, die angekündigte Sache auszuführen. Auf dieser Grundlage beruht der anspruchsvollere Gebrauch von ‚ich werde . . .‘ [‚I am going to . . .‘], bei dem sich die geplante Handlung in zeitlicher Entfernung vom Intentionsausdruck befinden kann, sowie der etwas andere Gebrauch von ‚ich beabsichtige . . .‘ [‚I intend to‘]. Die Verbindung zum ursprünglichen Fall hat jedoch Bestand. Denn in allen Fällen besteht das, was der Sprecher verstehen muss und was vom aufnehmenden Adressaten verstanden wird, darin, dass ein Intentionsausdruck dem Adressaten einen (nichtinduktiven) Grund zur Voraussage liefert. Wenn man seine Meinung ändert oder es versäumt, die ausgedrückte Absicht auszuführen, auf die der Adressat im Hinblick auf seine Pläne durchaus vertraut haben könnte, ist man mithin in gewisser Weise verpflichtet, ihn über die Planänderung zu informieren oder sich im Nachhinein dafür zu entschuldigen, legitime Erwartungen enttäuscht zu haben.
136
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
Es ist fraglos so, dass unterschiedliche psychologische Begriffe auf unterschiedliche Weisen im natürlichen und kulturellen menschlichen Verhalten verankert sind. Unterschiedliche Begriffe dienen ganz unterschiedlichen Zwecken. Und die verschiedenen Begriffe sind ganz unterschiedlich in das kommunikative und interpersonelle reaktive und interaktive Verhalten eingebettet. Jeder Begriff muss in seinem Eigenrecht präzise herausgearbeitet werden, und Verallgemeinerungen sind nicht gestattet. Wir hoffen allerdings, dass wir den Bankrott der anerkannten neocartesianischen und empiristischen Konzeption, von der das neurowissenschaftliche Nachdenken durchdrungen ist, aufzeigen und die Konzeption, von der sie ersetzt werden sollte, samt einiger ihrer Vorteile deutlich machen konnten.
3.10 Über den Geist und das, was ihn auszeichnet Die cartesianische Fehlzuschreibung psychologischer Attribute zum Geist Wenige Menschen nur sind geneigt, dem Körper psychologische Prädikate zuzuschreiben. Niemand sagt so etwas wie ‚Mein Körper hat Zahnschmerzen‘, ‚Mein Körper sieht einen Apfel‘, ‚Mein Körper will nach New York gehen‘ oder ‚Mein Körper hat vor, den Zug um 15.30 Uhr zu erreichen‘. Das ist kein Zufall, denn wir haben solchen Wortgebilden keinen Sinn verliehen. Daraus folgt aber nicht, dass es richtig wäre, sie auf den Geist ‚umzumünzen‘. Genau das tat Descartes, er schrieb eine Vielzahl psychologischer Prädikate – und zwar alle die, die er unter seiner eigenwillig gefassten Kategorie der ‚Gedanken‘ subsumierte – einer immateriellen Substanz zu, der Res cogitans, von der er annahm, dass sie in einer engen, obwohl nur kausalen Verbindung zum Körper steht. Er behauptete, dass der (auf diese Weise verkörperte) Geist Empfindungen hat, wahrnimmt (d. h. die entsprechende Erfahrung mit Beginn des Wahrnehmens eines externen Objekts hat), sich etwas vorstellt, Emotionen hat, will und entscheidet. Wir haben es hier mit einer abwegigen Auffassung zu tun, und es ist wichtig zu begreifen, wodurch sie vom Weg abkommt. Denn in unseren Tagen, wir haben es weiter oben gesehen (3.1), neigen viele Wissenschaftler dazu, ein ähnliches Spektrum an psychologischen Prädikaten dem Gehirn zuzuschreiben. Im Gefolge Chomskys und seiner Anhänger tendieren manche gar dahin, vom ‚Geist/Gehirn‘ zu sprechen, als ob der Geist und das Gehirn dieselbe Entität wären (oder so verstanden werden könnten). Diese Auffassung ist nicht weniger abwegig als ihr cartesianischer Vorgänger. Weil der Begriff des Geistes eine solch wichtige Rolle in der neurowissenschaftlichen Reflexion und Spekulation spielt, muss man die Fallen umgehen, die sich auf diesem Terrain befinden. Wir werden also versuchen, unseren gewöhnlichen oder gebräuchlichen Begriff des Geistes zu klären – dabei sparen wir für den Moment noch aus, was Philosophen und Wissenschaftler daraus gemacht haben.
3.10 Über den Geist und das, was ihn auszeichnet
137
‚The mind‘ und seine Position im Englischen Man sollte erwähnen, dass der englische Terminus ‚mind‘ etymologisch abgeleitet ist von Ausdrücken der indogermanischen Sprachen (mynd (Mittelenglisch), gimunt (Althochdeutsch), gamunds (Altteutonisch), munan (Altenglisch)), die in erster Linie mit Gedächtnis, Denken und Intention in Zusammenhang standen. Der zeitgenössische Sprachgebrauch hat sich, wie so oft, nicht von seinen Wurzeln gelöst. ‚To hold, keep [oder] to bear something in mind‘ heißt, etwas im Gedächtnis aufzubewahren; ‚to call [oder] to bring to mind‘ bedeutet, sich wiederzuerinnern bzw. sich etwas in Erinnerung zu rufen. Und ‚for something to be, go [oder] pass out of mind‘ heißt, dass man etwas vergessen hat. ‚To speak one’s mind, to let someone know one’s mind‘ heißt, jemandem zu sagen, was man denkt oder meint; ‚to turn one’s mind to something‘ heißt, damit zu beginnen, über etwas nachzudenken; ‚to have something on one’s mind‘ heißt, über etwas nachzudenken oder mit etwas gedanklich beschäftigt zu sein; und ‚to be of one mind with another‘ heißt, mit jemand anderem gleicher Meinung zu sein. ‚To be minded [oder] to have it in mind to do something‘ heißt, etwas zu tun beabsichtigen; ‚to have half a mind to do something‘ heißt, dazu zu neigen oder dahin zu tendieren, etwas zu tun; ‚to be in two minds whether to do something‘ heißt, unentschlossen zu sein; ‚to make up one’s mind‘ heißt, sich zu entscheiden; und ‚to change one’s mind‘ heißt, die eigene Entscheidung bzw. das eigene Urteil zu ändern. Freilich verzweigen sich diese englischen Wendungen in verschiedene Richtungen. Auf dem ‚allgemeinsten‘ Niveau steht ‚the mind‘ in Verbindung mit Verstandesfähigkeiten: Von einer Person wird gesagt, sie habe einen ‚powerful‘, ‚agile‘, ‚subtle‘ oder ‚devious‘ [überzeugungskräftigen, agilen, geschickten oder doppelzüngigen] ‚mind‘, wenn sie erfahren, schnell und erfinderisch beim Problemlösen ist oder wenn ihre Lösungen, Pläne und Projekte Raffiniertheit und Listigkeit verraten. Darum wird er [the mind/der Geist] auch mit entsprechenden intellektuellen Vorzügen und Mängeln verbunden: Eine Person hat einen ‚tenacious‘, ‚idle‘, ‚vigorous‘, ‚judicious‘ oder ‚indecisive‘ [beharrlichen, müßigen, energischen, umsichtigen oder unentschlossenen] ‚mind‘, je nachdem, in welcher Weise sie die Überlegung erfordernden Probleme angeht, und je nachdem, welches Ergebnis ihre Reflexionen im Normalfall haben. Eine Person ist ‚of sound mind‘ [bei Verstand], wenn sie im Vollbesitz ihrer rationalen Fähigkeiten ist, und ‚out of his mind‘ [verrückt], wenn sie Dinge denkt, vorschlägt oder tut, die irrational sind. Sie hat ‚lost his mind‘ [ihr Denkvermögen verloren], wenn ihr die rationalen Fähigkeiten abhanden gekommen sind. Andere Verwendungen gehen in unterschiedliche Richtungen auseinander: Wir sagen von Menschen, sie seien ‚broad- or narrow-minded‘ [großzügig oder engherzig], ‚small- or petty-minded‘ [kleingeistig oder kleinlich], hätten ‚a dirty mind‘ [eine schmutzige Fantasie] oder ‚a mind like a razor‘ [einen Geist, scharf wie ein Rasiermesser], zeigten ‚presence of mind‘ [Geistesgegenwart], ermangelten der ‚peace of mind‘ [Seelenruhe/des Friedens im Geiste] und so weiter.
138
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
In welchem Sinne die Rede vom Geist [the mind] eine bloße Façon de parler ist Diese sprachlichen Reminiszenzen werden in mancherlei Hinsicht sinnfällig. Erstens ist jede solche Verwendung, wie sich in den obigen Beispielen zeigt, leicht in einer Wendung paraphrasierbar, die das Wort ‚mind‘ nicht enthält, sondern nur ein auf ein menschliches Wesen zutreffendes psychologisches Prädikat. In diesem Sinn ist der Bezug zum mind/Geist eliminierbar, ohne dass ein Verlust hinsichtlich des Informationsgehalts unserer Sätze eintritt. Die Rede vom Geist ist, wie man sagen könnte, bloß eine zweckmäßige Façon de parler, eine Möglichkeit, über bestimmte menschliche Fähigkeiten und ihre Ausübung zu sprechen. Natürlich bedeutet das nicht, dass Menschen keinen eigenen Geist haben, was nur dann der Fall wäre, wenn sie pathologisch entschlussunfähig wären. Und es bedeutet auch nicht, dass Menschen geistlos sind, was nur dann der Fall wäre, wenn sie dumm wären oder nicht denken würden. Ein Wesen hat Geist, wenn es über eine charakteristische Reihe an verstandesmäßigen und willentlichen Fähigkeiten verfügt, insbesondere über die begrifflichen Fähigkeiten eines Sprachverwenders, die Selbstbewusstsein und Selbstreflexion möglich machen. Der Geist ist keine Art von Entität Zweitens ist offensichtlich, dass in diesen verschiedenen Wendungen nicht von demselben Ding die Rede ist: nämlich einer als ‚the mind‘/‚der Geist‘ bezeichneten Entität. Wenn wir sagen, dass jemand ‚changed his mind‘ [es sich anders überlegte] oder dass er ‚a dirty mind‘ [eine schmutzige Fantasie] hat oder dass er zu dieser oder jener Frage ‚turned his mind‘ [seine Ansicht änderte], implizieren wir nicht, dass es ein Ding gibt ‚the mind‘/‚den Geist‘, das sich verändert [changed] hat, schmutzig [dirty] ist bzw. verändert [turned] wurde.177 In Wirklichkeit sprechen wir nur von einem ‚Ding‘, der Person nämlich, und von Fall zu Fall (und von Wendung zu Wendung) sagen wir ganz Unterschiedliches von der Person. Wenn wir unsere gewöhnliche Rede vom Geist eine Façon de parler nennen, wollen wir nicht zum Ausdruck bringen, dass es keinen Geist gibt. Im Gegenteil, wir meinen und sagen damit in der Tat, dass es ihn gibt, dass es sich bei ihm jedoch nicht um eine Art von Ding handelt. Eine aus einem anderen Zusammenhang stammende Wendung Wittgensteins adaptierend könnte man sagen, dass der Geist nicht ein Nichts, aber auch kein Etwas ist. Warum die Frage ‚Was ist Geist?‘ [‚What is a mind?]‘ in die Irre führt Drittens stellen diese Wendungen den natürlichen ‚Lebensraum‘ des englischen Begriffs ‚mind‘ dar. Dass er abseits seiner angestammten Gefilde irgendeine sinnvolle Funktion innehat, ist nicht sicher. Gut möglich, dass insbesondere die Frage, die uns allen auf der 177
Siehe B. Rundle, Mind in Action (Clarendon Press, Oxford, 1997), S. 26.
3.10 Über den Geist und das, was ihn auszeichnet
139
Zunge liegt, nämlich ‚Was ist der Geist?‘ [‚What is the mind?‘], vollkommen irreführend ist – und zwar genau deshalb, weil der Geist keine Art von Ding ist. Wenn wir idiomatisch vom Geist sprechen, sprechen wir vielmehr von einer Reihe charakteristischer menschlicher Vermögen und ihrer Entfaltung und von einem Spektrum an menschlichen Charakterzügen. Drei Konsequenzen: Es ergibt keinen Sinn, den Geist mit dem Gehirn zu identifizieren; es ist illegitim, dem Geist psychologische Attribute zuzuschreiben anstatt dem menschlichen Wesen; die typischen Beschreibungen der Resultate der Kommissurotomie sind inkohärent Wenn das so ist und wir sagen, dass es so ist, dann ergeben sich daraus weitere Konsequenzen. Erstens ist die Frage, ob der Geist mit dem Gehirn identisch ist, entweder als abwegige Frage aufzufassen, oder sie ist als eine Frage zu verstehen, welche die Identität mancher oder aller dieser Charakterzüge, Vermögen und die Umstände ihrer Exemplifikation und Ausübung bei Zuständen, Ereignissen und Vorgängen im Gehirn betrifft. Zweitens wird deutlich, dass es ebenso illegitim ist, die meisten psychologischen Prädikate dem Geist zuzuschreiben, wie sie dem Körper oder dem Gehirn beizumessen. Man kann zwar sagen, dass A’s Geist subtil oder doppelzüngig ist – das aber bedeutet einfach, dass A in seinem Denken, Planen und Projektieren subtil oder doppelzüngig ist. Man kann sagen, dass A’s Geist scharfsinnig oder raffiniert ist – dabei aber handelt es sich schlicht um eine idiomatische Anmerkung zu A’s theoretischem und praktischem Denken. Zum anderen ist es nicht mein Geist, der sich entscheidet [makes up its mind], eine eigene Meinung hat [has a mind of its own], unentschlossen ist [is in two minds], dies oder jenes zu tun, ich bin das, ein menschliches Wesen, ein Lebewesen mit verstandesund willensmäßigen Fähigkeiten. Und folglich ist es auch nicht der Geist, der Schmerz empfindet, wahrnimmt, denkt und Verlangen bekundet, Entscheidungen trifft und Absichten hegt, sondern der Mensch, der eine psychophysische Einheit ist, keine Dualität aus zwei miteinander verbundenen Substanzen, einem Geist und einem Körper. Drittens offenbart sich eine schwerwiegende Verwirrung in der Annahme, dass die Formen der aus der Kommissurotomie herrührenden funktionalen Dissoziation aus einem Geist zwei machen, wovon der eine der linken, der andere der rechten Hemisphäre angehört. Das Gehirn hat keinen Geist und auch nicht die Hemisphären des Gehirns. (‚I’m in two minds whether to . . .‘ [Ich bin unentschlossen, ob . . .] bedeutet nicht, dass jede Hemisphäre des Gehirns einen Geist hat.) Michael Gazzanigas Beschreibungen der von Split-Brain-Operationen herrührenden experimentellen Daten, um deren Erklärung er sich bemüht, sind begrifflich inkorrekt. Die Behauptung, dass „Geist links sich mit der Welt differenzierter als Geist rechts auseinandersetze, schien das wesentliche Resultat der Forschungen dieser Ära zu sein“178, ist nicht nur nicht richtig (zu Michael S. Gazzaniga, ‚Consciousness and the cerebral hemispheres‘, in Gazzaniga (Hg.), The New Cognitive Neurosciences, 4. Ausg. (MIT Press, Cambridge, MA, 1997), S. 1392. 178
140
3 Mereologischer Fehlschluss in den Neurowissenschaften
dieser Erkenntnis gelangte Gazzaniga); sie ist inkohärent.179 Von menschlichen Wesen, nicht von ihren Gehirnen, sagt man, dass sie Geist haben, und wenn man das sagt, sagt man schlicht, dass menschliche Wesen über ein Spektrum an charakteristischen Fähigkeiten verfügen. Die Tatsache, dass manche dieser Fähigkeiten infolge der Kommissurotomie abgetrennt worden waren, zeigt nicht, dass diese Fähigkeiten zu ihren Gehirnen gehören, von deren Hemisphären gar nicht zu reden. Noch verworrener ist die Annahme, Sperrys Forschung an Patienten, die sich solchen Operationen unterzogen haben, „hat die Art, den Geist als Gehirnprodukt aufzufassen, für immer verändert; ja, zwei Gehirne, die zwei Hemisphären, jede zu menschlichem Denken und Fühlen befähigt, separierbar, im Normalfall jedoch verblüffenderweise miteinander verflochten [. . .] Die Hemisphärektomie liefert die Bestätigung für die menschliche Verfasstheit beider“.180 Was gesagt werden muss, kann klar gesagt werden Es ist wichtig, hinsichtlich der von uns ausgearbeiteten Kritik und ihrer Stoßrichtung keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Unsere kritische Erörterung nimmt den neurowissenschaftlichen Leistungen nichts von ihrem Gewicht. Wir versuchen lediglich zu zeigen, dass sich in den Beschreibungen und Überlegungen hervorragender Wissenschaftler enorme Begriffskonfusionen verbergen. Diese verleiten sie dazu, irrige Fragen aufzuwerfen und mitunter, ihre Experimente fehlerhaft zu konzipieren, wie wir zeigen werden. Was sich wiederum entstellend auf die Darlegung der Resultate und Implikationen der Experimente auswirkt. Wir sind der Ansicht, und wir werden das im Folgenden zu untermauern versuchen, dass sich solche Konfusionen vermeiden lassen, wenn man sich mit den Begriffsfragen sorgfältig auseinandersetzt. Was gesagt werden muss, kann klar gesagt werden, und sagt man es klar, schmälert man die wirklichen neurowissenschaftlichen Leistungen nicht, im Gegenteil.
179
Ebenso inkohärent ist Gazzanigas Annahme, dass seine Experimente in den folgenden Sätzen beschreibbar sind: ‚Gefragt, warum er [der Patient] diese Elemente wählte [in einem Zuordnungstest], antwortete seine linke Hemisphäre „Oh, das ist einfach [. . .].“ Hier interpretiert das linke Gehirn, die Reaktion der linken Hand beobachtend, diese Reaktion, und zwar seinem Wissen entsprechend – das keine Information über das der rechten Hemisphäre präsentierte Schneemotiv umfasst‘ (ibid., S. 1393 (unsere Hervorhebungen)). Denn nicht Hemisphären antworten auf irgendetwas, sondern Menschen tun es. Weder Gehirne noch deren linke Hälften beobachten irgendetwas, und sie interpretieren nicht, was sie sehen, weil sie weder irgendetwas sehen noch interpretieren. Dies sind Funktionen, die Menschen ausführen, und die normale Verbindung der Funktionen des Sehens, der Kognition und der Handlung ist aufgrund der Kommissurotomie leider unterbrochen. Für eine detailliertere Darstellung des Problems, wie Phänomene, die von der Kommissurotomie herrühren, richtig zu beschreiben sind, siehe unten 14.3. 180 R. W. Doty, ‚Two brains, one person‘, Brain Research Bulletin, 50 (1999), S. 423.
3.10 Über den Geist und das, was ihn auszeichnet
141
Die Ergebnisse dieses Kapitels sind für Teil II unmittelbar relevant. Darin werden wir uns bemühen, die logischen Merkmale einiger der psychologischen Kategorien, die für die kognitiven Neurowissenschaftler von Belang sind, überblickshaft darzustellen. Und zwar unter besonderer Berücksichtigung des mereologischen Prinzips und mit Augenmerk auf den neurowissenschaftlichen Falschauslegungen spezifischer psychologischer Begriffe. Wir werden argumentieren, dass es sich bei diesen Begriffsverwirrungen keineswegs um sprachliche Trivialitäten handelt. Sie affizieren und infizieren das Verständnis der neurowissenschaftlichen Arbeitsergebnisse.
Teil II Menschliche Fähigkeiten und die Neurowissenschaften dieser Tage: Eine Analyse
Einleitende Bemerkungen 1 Der Gehirn-Körper-Dualismus Die kognitiven Neurowissenschaften propagieren in diesen Tagen eine Art Krypto-Cartesianismus Wir haben argumentiert, dass die kognitiven Neurowissenschaften der Gegenwart – trotz ihrer außerordentlichen experimentell erbrachten Leistungen im 20. Jahrhundert – noch immer nicht aus Descartes’ Schatten herausgetreten sind. Denn die Generation von Neurowissenschaftlern, die Sherringtons Schüler beerbte, hat ihrer unerbittlichen Ablehnung des Cartesianismus zum Trotz den cartesianischen Dualismus von Geist und Körper in Wahrheit durch einen entsprechenden Gehirn-Körper-Dualismus ersetzt. Freilich scheint es sich bei diesem keineswegs um einen Dualismus zu handeln. Er umfasst nicht die beiden distinkten cartesianischen Substanzen, einen materiellen Körper und einen immateriellen Geist. Sowohl das Gehirn als auch der Körper sind materiell, und auf den ersten Blick scheint es, als ob wir es hier gar nicht mit einer Dualität zu tun haben, denn schließlich ist das Gehirn nur ein Teil des Körpers. Allerdings trügt der Schein, wie wir dargelegt haben. Wie der Cartesianismus begehen sie den mereologischen Fehlschluss Ein begrifflicher Kardinalfehler weiter Teile der heutigen Neurowissenschaften äußert sich darin, dem Gehirn Attribute zuzuschreiben, die nur dem Lebewesen als Ganzem sinnvoll zugeschrieben werden können. Indem sie dies tun, begehen die heutigen Neurowissenschaften den ‚mereologischen Fehlschluss‘, wie wir sagen – wobei der Irrtum darin besteht, einem Teil Attribute zuzuschreiben, die in sinnvoller Weise nur dem Ganzen, von dem der Teil ein Teil ist, zugeschrieben werden können. Es fällt auf, dass die Neurowissenschaften dem Gehirn nahezu dasselbe Eigenschaftsspektrum zuschreiben, das Cartesianer dem Geist zuschrieben. Sie operieren also mit einem Begriffssystem, das dem cartesianischen Dualismus annähernd entspricht – das heißt, nahezu die gleiche Form oder Struktur wie dieser hat –, und sie unterscheiden sich von diesem in erster Linie dadurch, dass sie den psychologischen Attributen ein anderes Subjekt ‚unterlegen‘. Sie ersetzen den immateriellen cartesianischen Geist durch das materielle Gehirn, behalten allerdings die fundamentale logische Struktur der dualistischen Psychologie bei.
146
Einleitende Bemerkungen
Wie die Cartesianer versuchen sie, die Zuschreibung psychologischer Attribute zu Menschen anhand ihrer Zuschreibung zum Gehirn verständlich zu machen Wie der Cartesianismus schreiben sie einem Teil des menschlichen Wesens psychologische Attribute zu – allerdings nicht einem vermeintlich immateriellen Teil, sondern einem materiellen. Außerdem erklären sie den Besitz psychologischer Attribute bei Menschen anhand der psychologischen Attribute, die angeblich einem Teil des menschlichen Wesens zugeschrieben werden können: dem Gehirn nämlich. Wie wir nahegelegt haben und später eingehender darlegen werden, handelt es sich hierbei nicht um eine fehlerhafte Tatsachenfeststellung [oder um einen Irrtum im Tatsachenbereich; error of fact], sondern um einen logischen bzw. begrifflichen Irrtum. Die Annahme, dass das Gehirn denkt, wahrnimmt, Emotionen hat und leidenschaftlich nach etwas verlangt, ist nicht falsch – sie ist eine Begriffsverwirrung. Denn dem Gehirn solche Attribute zuzuschreiben, ist ebenso unsinnig, wie sie einem Stein (einem unbelebten physischen Objekt) oder einer Zahl (bei der es sich gar nicht um ein raum-zeitliches Objekt handelt) zuzuschreiben – denn weder Gehirne noch Steine noch Zahlen sind Lebewesen, die sich so verhalten, dass es logisch gerechtfertigt ist, ihnen psychologische Attribute zuzuschreiben. Wie der Cartesianismus betrachten sie geistige Zustände, Ereignisse und Prozesse so, als würden diese in einem Teil der Person in Erscheinung treten, geschehen oder ablaufen Wie der Cartesianismus betrachten auch sie geistige Zustände, Ereignisse und Prozesse mithin so, als würden diese in einem Menschen in Erscheinung treten, geschehen oder ablaufen – insbesondere in seinem Gehirn –, anstatt geistige Zustände als Zustände der Person, geistige Akte oder Aktivitäten als Akte und Aktivitäten des Menschen und geistige Prozesse als Prozesse aufzufassen, die von einer Person erlebt und durchlebt wurden. Die neurowissenschaftliche Konzeption ist inkohärent, weil sie mit einem Miss(ge)brauch der Begriffe geistiger Ereignisse, Zustände und Prozesse einhergeht. Dem Gehirn Geisteszustände zuzuschreiben, ergibt ebenso wenig Sinn, wie sie den Nieren (d. h. irgendeinem anderen Teil eines Lebewesens) zuzuschreiben. Wenn man sogenannte inhaltstragende Zustände (das sind solche, die durch einen dass-Gliedsatz angeführt werden wie ‚denkt, dass . . .‘, ‚erinnert sich, dass . . .‘, ‚folgert (oder schließt), dass . . .‘), die in einschlägiger Hinsicht dem Folgern, Vermuten oder Schließen etc. entsprechen, den Subsystemen des Gehirns zuschreibt, lässt man lediglich etwas Inkohärentes hinter einer Wolke aus Fachausdrücken verschwinden. Wenn es keinen Sinn ergibt, dem Gehirn ‚inhaltstragende Zustände‘ zuzuschreiben, ergibt es gewiss ebenso wenig Sinn, sie Teilen des Gehirns zuzuschreiben. Nicht das Gehirn, sondern der Mensch befindet sich angesichts einer bevorstehenden Prüfung in einem Zustand ängstlicher Beklemmung oder ist in einem Zustand intensiver Konzentration, während er eine Examensarbeit schreibt. Es gibt nichts dergleichen wie einen Geistesprozess (das Alphabet in seiner Vorstellung auswendig aufsagen beispielsweise), der in einem Teil eines Lebewesens vor sich geht,
1 Der Gehirn-Körper-Dualismus
147
unabhängig davon, ob es sich bei diesem Teil um die Niere oder das Gehirn handelt. Und es gibt auch keinen Teil des Gehirns (die Amygdala, der Hippocampus, die präfrontalen Kortexe), der sich in einem dem ‚Zustand des Folgerns, Vermutens oder Schließens‘ entsprechenden Zustand befindet, weil weder Folgern noch Vermuten noch Schließen Zustände sind, und es gibt auch keinen Teil des Gehirns, der die Kriterien erfüllt, die es rechtfertigen würden, ihm die Attribute des Folgerns, Vermutens und Schließens oder des Denkens, Sich-Erinnerns und Entscheidens zuzuschreiben. Was im Gehirn abläuft, sind neurale Prozesse, die sich ereignen müssen, damit die Person, dessen Gehirn es ist, die entsprechenden Geistesprozesse durchleben kann. Die Person nämlich, das lebendige menschliche Wesen, durchlebt den Geistesprozess, das Alphabet oder Hamlets Selbstgespräch ‚To be or not to be‘ in ihrer Vorstellung auswendig herzusagen (diese werden als echte Geistesprozesse betrachtet); es ist die Person, die wir fragen, wie weit sie in ihrem stillen Aufsagen gekommen sei, und wenn sie erwidert, sie habe das ‚K‘ erreicht oder sei bis zu ‚it is a consummation devoutly to be wished‘ [‚Es ist ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen‘] gekommen, spricht sie nicht davon, was ihr Gehirn tut, sondern davon, was sie selbst tut. Die Person nämlich befindet sich in einem Geisteszustand der Konzentration, der Erregung oder der Angst (diese sind echte Geisteszustände), nicht ihr Gehirn oder seine Teile. Und die Menschen folgern und kommen von allgemein bekannten oder von angenommenen Prämissen aus zu Ergebnissen, nicht ihre Gehirne, und die Teile ihrer Gehirne schon gar nicht. Zudem ist logisch ausgeschlossen, dass es irgendeinen einem Teil des Gehirns zuschreibbaren Zustand gibt, der in einschlägiger Hinsicht dem Folgern, Vermuten oder Schließen entspricht, denn die Attribute, die dem Gehirn und seinen Teilen sinnvoll zugeschrieben werden können, unterscheiden sich kategorial von den den Menschen zuschreibbaren Attributen. Genauso gut könnte man Teilen des Gehirns Attribute zuschreiben, die dem Zustand des Verheiratet- oder Geschieden-Seins, des Im-Zweifel- oder Bankrott-Seins in einschlägiger Hinsicht ähnlich sind. Die Neurowissenschaftler behalten die logische Struktur der cartesianischen Psychologie hinsichtlich der Erklärung der Wahrnehmung, Willenshandlung und der Wahrnehmung von Sekundärqualitäten bei Die Schwachstellen im Begriffssystem der Neurowissenschaften der Gegenwart beschränken sind nicht auf den mereologischen Fehlschluss und die Verwirrungen, die er unmittelbar mit sich bringt. Wie angemerkt behalten die Neurowissenschaftler auch die logische Struktur der cartesianischen Psychologie bei. Descartes war der Ansicht, dass die menschliche Wahrnehmung einen ‚Gedanken‘ (in seiner eigenwilligen Verwendung dieses Terminus181) im Geist eines Menschen verursacht, und zwar durch die Wirkung des 181
Descartes betrachtete die Wahrnehmung eines Apfels nicht als Gedanken, bei dem Eindruck aber, einen Apfel wahrzunehmen, handelt es sich um einen cartesianischen Gedanken.
148
Einleitende Bemerkungen
Lichts auf die Retinas oder der Schallwellen auf die Trommelfelle etc. Und John Locke, der Gründungsvater des britischen Empirismus, vertrat die Auffassung, dass die Wahrnehmung geistige Vorstellungen und Repräsentationen hervorbringt, und zwar durch Objekte, die solchen Vorstellungen und Repräsentationen in maßgeblicher Hinsicht ähneln. Auch viele Neurowissenschaftler betrachten die Wahrnehmung mithin so, als verursache sie (visuelle, auditive etc.) Bilder im Gehirn oder im Geist. Sowohl der cartesianische als auch der lockesche Dualismus auf der einen und die aktuellen Neurowissenschaften auf der anderen Seite sehen in der Wahrnehmung eine Eigenschaft eines Teils eines menschlichen Wesens, die man diesem selbst nur mittelbar bzw. nachrangig zuschreiben könne. Sowohl der cartesianische als auch der lockesche Empirismus akzeptieren die Unterscheidung zwischen Primärqualitäten wie Extension, Gestalt/Form, Größe und Bewegung, die als objektive Eigenschaften eines Objekts aufgefasst werden, und Sekundärqualitäten wie Farbe, Klang, Geruch und Geschmack, die anders aufgefasst werden. Sekundärqualitäten, wie wir sie erfahren, wurden als bloße Geistesvorstellungen begriffen, die keine Ähnlichkeit zu irgendetwas, das sich in der Realität außerhalb des Geistes befindet, aufweisen. Obgleich ‚in den Objekten‘, handele es sich bei ihnen jedoch lediglich um Vorstellungsverursachungskräfte. Die Neurowissenschaftler dieser Tage betrachten Farben, Klänge, Gerüche und Geschmäcke im Großen und Ganzen als „mentale Konstruktionen, die im Gehirn durch sensorische Verarbeitung hervorgerufen werden. Außerhalb des Gehirns existieren sie nicht.“182 Diese Position unterscheidet sich vom Cartesianismus wiederum nur darin, dass sie den Geist durch das Gehirn ersetzt. Die Neurowissenschaftler sind nicht nur der Ansicht, dass das Gehirn wahrnimmt, fühlt und denkt, sondern auch, dass es Verlangen hat. Demnach denkt das Gehirn und die ‚unbewussten‘ Willensakte des Gehirns sind, wie die Willensakte des cartesianischen und lockeschen Geistes, die Ursachen der die Willenshandlungen konstituierenden Körperbewegungen.183 So, wie Cartesianismus und klassischer britischer Empirismus die Vorstellung nährten, menschliches Verhalten sei als kausale Interaktion zwischen Geist und Körper verständlich zu machen, wobei der Geist als das Sub182
Eric R. Kandel, James H. Schwartz und Thomas M. Jessell, Essentials of Neural Science and Behaviour (Appleton and Lange, Stamford, CT, 1995), S. 370. 183 In der Tat glauben sogar manche Neurowissenschaftler, wie beispielsweise Benjamin Libet, mittels EEG und PET zeigen zu können, dass sich der vermeintliche ‚bewusste‘ Willens- oder Entscheidungsakt, den sie als eine Konstituente der Willenshandlung betrachten, nach dem Anstoß der Bewegung, den man für die Ursache hielt, ereignet, sodass derart nachgewiesen ist, dass die Freiheit des Willens entweder eine Illusion oder dass sie darauf beschränkt ist, einen vom Gehirn angestoßenen ‚unbewussten‘ Willensprozess zu unterbinden. Wie wir in Kapitel 8 darlegen werden, handelt es sich hier um eine Begriffsverwirrung, die von Fehlkonzeptionen bezüglich der Willenshandlung und dessen, was unbewusst sein kann, herrührt und auch daher, dass der abwegigen cartesianischen Mythologie von Willensakten als Ursachen der Willensbewegung Raum gegeben wurde. Im Glauben, die cartesianische Konzeption widerlegt zu haben, verfallen solche Wissenschaftler paradoxerweise den tiefsten Irrtümern dieser Konzeption, wie wir zeigen werden.
2 Das Projekt
149
jekt der psychologischen Wollensattribute betrachtet werden soll, so unterstützen die Neurowissenschaften gegenwärtig die Vorstellung, menschliches Verhalten sei als kausale Interaktion zwischen Gehirn und Körper verständlich zu machen, wobei das Gehirn als das Subjekt der psychologischen Wollensattribute betrachtet werden soll.
2 Das Projekt Es geht uns darum, das begriffliche Diskurssystem, das die Fähigkeiten der Menschen und anderer fühlender Lebewesen betrifft, einer klärenden Analyse zu unterziehen In den folgenden fünf Kapiteln werden wir den Begriffsrahmen der Neurowissenschaften herausarbeiten, der ausschließlich Altbekanntes enthält. Er setzt sich aus dem vertrauten Begriffsspektrum zusammen, das wir alle im Laufe der Bemeisterung des Alltagsgebrauchs des psychologischen Wortschatzes von Empfindung und Wahrnehmung, Kognition und Kogitation, Vorstellung und Emotion, Wollen und Willkürhandlung erworben haben, den wir tagaus tagein verwenden. Lediglich den Neurowissenschaften ist er nicht bekannt. Denn wir werden darlegen, dass der Krypto-Cartesianismus184 der heutigen Neurowissenschaften begrifflich ebenso inkohärent ist wie der Cartesianismus, von dem er sich unbeabsichtigt herleitet. Er resultiert in inkohärenten Beschreibungen der neurowissenschaftlichen Forschungsergebnisse und führt mitunter dazu, dass sich inkohärente Forschungsprogramme herausbilden. Wenn man den Denkstil aufgibt, der sich im mereologischen Fehlschluss der Neurowissenschaften niedergeschlagen hat, und dem Gehirn somit keine psychologischen Attribute mehr zuschreibt und die Begriffe der Wahrnehmung und der Introspektion, der Vorstellungsbilder und des Willens, des Bewusstseins und des Selbstbewusstseins nicht länger falsch auslegt, macht man den Neurowissenschaftlern keine ihrer hart erarbeiteten und bemerkenswerten Leistungen abstreitig. Man trägt im Gegenteil dazu bei, dass diese besser beurteilt werden können, da sie von den Begriffskonfusionen, die derzeit nur allzu häufig und allzu schwer auf ihnen lasten, bereinigt sind. In diesem Sinn vertreten wir die Ansicht, dass der Begriffsrahmen, den wir den Neurowissenschaftlern zur Verfügung stellen – die genaue Erläuterung des alltäglichen Begriffsrahmens –, als etwas begrüßt werden sollte, das ihr wissenschaftliches Unternehmen von verschiedenen Inkohärenzen befreit und von Scheinrätseln, die auf die aktuellen Begriffskonfusionen zurückgehen. Indem wir über das Begriffssystem Aufschluss geben, das die psychologischen Begriffe festlegt, mit denen die Neurowissenschaftler gegenwärtig arbeiten und die sie ungewollt missbräuchlich verwenden, wollen wir natürlich keineswegs auf die These hinaus, dass die Einfüh-
184
Und der lockesche Empirismus, mit dem er komform geht, was die von den Neurowissenschaftlern allgemein akzeptierte Introspektionsauffassung angeht.
150
Einleitende Bemerkungen
rung neuer Fachbegriffe zu wissenschaftlichen Zwecken einen illegitimen Vorgang darstellt. Das Verhältnis zwischen den Neurowissenschaften und der empirischen Psychologie Die Hirnforschung zielt unter anderem auf die Entdeckung des neuralen Substrats im Gehirn, das Tiere im Allgemeinen und Menschen im Besonderen mit ihren charakteristischen Vermögen und Fähigkeiten ausstattet bzw. diese stiftet. Das Studium der Formen und Beschränkungen dieser Vermögen und Fähigkeiten ist in erster Linie eine Angelegenheit der Psychologie. Denn man studiert Vermögen und Fähigkeiten, indem man sich deren Ausübung widmet; und das Studium der Ausübung und der anschaulichen Beispiele menschlicher Vermögen und Fähigkeiten kommt einer Erkundung des menschlichen Verhaltens und der menschlichen Verhaltensdispositionen in den wechselnden Lebensumständen gleich. Die Erforschung des Verhaltens – seine Situationsabhängigkeit, die individuellen Unterschiede und die kulturelle Variabilität – fällt in den Bereich der experimentellen Psychologie. Die Erforschung der neuralen Bedingungen, die solchen Vermögen von Lebewesen zugrunde liegen, und der neuralen Prozesse, die sich ereignen, sobald sie beansprucht werden, ist Sache der Neurowissenschaften.185 Die neurowissenschaftliche und die psychologische Forschung sind daher eng benachbarte Unternehmen, und wenn man sich über die Leistungen der Hirnforschung Klarheit verschaffen will, muss man zunächst die Kategorien der gewöhnlichen psychologischen Beschreibungen erhellen – das heißt die Kategorien von Empfindung und Wahrnehmung, Kognition und Gedächtnis, Kogitation und Vorstellung, Emotion und Wollen. Sofern es die Neurowissenschaftler versäumen, die einschlägigen Kategorien in ihren Konturen zu erfassen, laufen sie nicht nur Gefahr, abwegige Fragen aufzuwerfen, sondern auch ihre eigenen experimentell ermittelten Resultate zu missdeuten. Diese Begriffskategorien und die spezifischeren Unterbegriffe sind gleichsam die Brille, mit der die psychologischen Phänomene betrachtet und verstanden werden. Sind die Gläser trübe oder hängt die Brille den Neurowissenschaftlern schräg auf der Nase, können sie die Phänomene nicht anders als undeutlich oder verzerrt sehen. Die Verwicklung in Begriffskonfusionen Es fällt uns heute leicht, manche Begriffskonfusion der Vergangenheit zu erkennen. Wir können ohne Weiteres aufzeigen, dass die Annahme, weil das Bild auf der Retina des Auges seitenverkehrt ist, sähen wir die Welt verkehrt herum, wenn das Gehirn das Bild nicht wieder herumdrehen würde, begrifflich verworren ist. Es ist nicht schwer, sich die 185
Viele Neurowissenschaftler hängen der einen oder anderen Form des Reduktionismus an und neigen dem Gedanken zu, dass die Psychologie mit der Zeit auf das neurowissenschaftliche Unternehmen reduziert und zu seinen Gunsten eliminiert werden wird.
2 Das Projekt
151
Tatsache klarzumachen, dass es gleichfalls verworren ist, wie Descartes anzunehmen, „die Bilder von den beiden Augen“ müssten irgendwo im Gehirn wieder vereinigt werden, um so ein Einzelbild hervorzubringen, „sodass sie [der Seele] nicht zwei anstelle von einem Bild darbieten“.186 Ein ganzes Stück schwerer ist es, unsere eigenen Begriffsverwirrungen in den Griff zu bekommen oder sich ihrer überhaupt bewusst zu werden. Es deutet jedoch rein gar nichts darauf hin, dass wir weniger anfällig dafür sind, in Begriffskonfusionen verstrickt zu werden, als unsere Vorgänger. Unsere Verwirrungen sind möglicherweise andere als ihre. Wir wissen sehr viel mehr als sie darüber, wie das Gehirn funktioniert, haben über die verschiedenen möglichen Funktionsstörungen des Gehirns viel umfangreiche Kenntnisse als sie, und folglich handelt es sich bei den von uns zur Charakterisierung unserer Arbeitsdaten verwendeten Begriffe häufig um Neuschöpfungen, in anderen Fällen um Erweiterungen früherer Begriffe. Und wenn die Begriffe sich unterscheiden, so unterscheiden sich möglicherweise auch die Begriffsverwirrungen. Zudem sind die ergiebigen Analogien, die wir in unseren Erklärungen beanspruchen, oftmals neuartige Gebilde. In bestimmter Hinsicht sind unsere Begriffe und ErklärungsAnalogien und -Modelle also reicher und verzweigter geworden. Je mehr Verzweigungen es jedoch gibt, desto größer die Gefahr, ein begriffliches Durcheinander heraufzubeschwören. Unsere Vorgänger konnten bei ihren Untersuchungen des Denkens und Folgerns keine Computeranalogien bemühen und auch nicht bei ihrer Erforschung des neuralen Netzwerks. Folglich konnten sie mit irgendwelchen Analogien, die es zwischen menschlichem Denken und maschinellem Rechnen oder zwischen neuralen Netzwerken und der Computerhardware geben mag, kein Schindluder treiben. Ansonsten aber können sich unsere Verwirrungen und die ihrigen, sieht man einmal von ihren unterschiedlichen Gewändern ab, weitgehend gleichen. Heutzutage ist kaum ein Mensch von Vorstellungen und Eindrücken im Geist verwirrt, wie es die großen Denker des 17. und 18. Jahrhunderts noch waren. Kaum jemand geht davon aus, dass das Ganze der menschlichen Erfahrung darin besteht, Vorstellungen zu empfangen, die in einfache, nicht mehr analysierbare Elemente zergliederbar sind, und kaum einer meint, dass Umfang und Grenzen des menschlichen Denkens von den Kombinationsmöglichkeiten einfacher im Experiment gewonnener Vorstellungen festgelegt werden. Unsere gegenwärtige Rede von ‚geistigen Repräsentationen‘ oder ‚Qualia‘ ist jedoch kaum mehr als die Wiederholung der Konfusionen des 17. und 18. Jahrhunderts in moderner Fachsprache, wir werden das darlegen. Kaum jemand geht davon aus, dass es sich beim Geist um eine immaterielle, irgendwie mit dem Gehirn verbundene Substanz handelt, viele aber halten ihn für eine materielle Substanz – glauben gar, dass er mit dem Gehirn identisch ist. Und diese Behauptung stellt eine ebenso bedauerliche Verwirrung dar wie die vorherigen.
186
Descartes, Die Leidenschaften der Seele, I–32.
152
Einleitende Bemerkungen
Weshalb wir uns um Klarstellung bemühen Es wäre eine Mammutaufgabe, die Struktur unserer wichtigsten psychologischen Kategorien im Detail abzubilden. Wir werden uns jedoch darum bemühen, die auffälligen Begriffsformen in groben Umrissen zu skizzieren. Das wird sich aus drei Gründen als nützlich erweisen. 1. Um uns an das zu erinnern, was wir wissen, jedoch übersehen Erstens wird es uns helfen, uns an die psychologischen Begriffe zu erinnern, mit denen wir vertraut sind und die von den Neurowissenschaftlern in ihren Untersuchungen angeführt werden. Es ist wichtig, diese Begriffe scharf im Auge zu behalten. Denn die Fragen, um deren Beantwortung es den Wissenschaftlern geht, werden umso klarer, je klarer ihnen die einschlägigen Begriffe sind und je präziser sie sie anwenden. 2. Damit wir innerhalb der Sinngrenzen bleiben und ihre Überschreitung vermeiden Zweitens wird uns die Klärung dieser psychologischen Kategorien helfen, auf der sicheren Seite zu bleiben, auf der Seite des Sinns. Der Grenzverlauf zwischen dem, was Sinn ergibt, und dem, was keinen Sinn ergibt, zwischen dem Sinnvollen und dem Unsinn – all das, was die Sinngrenzen überschreitet – wird von den Begriffen bestimmt, die wir anwenden. Denn unsere Begriffe legen die Grenzen des logisch Möglichen fest (das nicht mit dem empirisch Möglichen verwechselt werden darf ). Sie bestimmen nicht, was tatsächlich wahr ist (das wird von Experiment zu Experiment ermittelt), sondern nur das, was in sinnvoller Weise gesagt oder gedacht werden kann. Die missbräuchliche Verwendung unserer Begriffe geht mit der Überschreitung der Sinngrenzen einher. Hält man sich an die richtige Verwendung der einschlägigen Begriffe, schränkt man das Denken nicht ein, wie wir bereits dargelegt haben (3.2). Es hindert uns nicht daran, das wirklich Mögliche ins Auge zu fassen, es hindert uns daran, Unsinn zu reden. Es schließt das logisch Unmögliche aus. Bei einer logischen Unmöglichkeit handelt es sich jedoch nicht um eine unmögliche/unerreichbare Möglichkeit, wie wir betont haben – das logisch Ausgeschlossene ist ein ‚sinnfreies‘ Gebilde aus Worten, das rein gar nichts sagt, obgleich es scheinen mag, dass es etwas sagt. Das Festhalten am richtigen Gebrauch unserer Begriffe nimmt uns nichts – sieht man von der Leere des Unsinns ab. 3. Um zu verdeutlichen, wie oft die neurowissenschaftlichen Theorien die Sinngrenzen überschreiten Drittens dienen unsere skizzenhaften Ausführungen als Kontrastfolie, vor der sich einige der Konfusionen abheben sollen, denen manche Neurowissenschaftler unterliegen, wenn sie sich über die von ihnen verwendeten Begriffe nicht im Klaren sind. Wir haben
3 Die Kategorie des Psychischen
153
uns auf eine Auswahl an Darlegungen und Konzeptionen führender Neurowissenschaftler beschränkt, von denen wir demonstrieren werden, dass sie eine begriffliche Schieflage aufweisen. Diese Beispiele veranschaulichen, dass es für die neurowissenschaftliche Forschung ebenso darauf ankommt, gleichsam die Begriffshygienebestimmungen einzuhalten, wie die immense Sorgfalt aufzubringen, die sie, dieselben Neurowissenschaftler, mit solch großem Erfolg ihrer experimentellen Arbeit angedeihen lassen. Wir hoffen, dass sich die Neurowissenschaftler von unseren Ausführungen für die begriffliche Komplexität und Vielgestaltigkeit der psychologischen Attribute, deren neurale Begleiterscheinungen sie untersuchen, sensibilisieren lassen. Denn dadurch könnten sie die von uns präzise umrissenen Begriffsverwirrungen vermeiden und so eine korrekte Beschreibung der Resultate und Implikationen ihrer Experimente verfügbar machen. Bei sämtlichen von uns ausgearbeiteten psychologischen Kategorien und Begriffen handelt es sich um Attribute der Menschen (und häufig auch von anderen Tieren). Den logischen Grund für ihre Zuschreibung zum Subjekt stellt, wie gesehen (3.3), das Verhalten des Subjekts dar, des Menschen, nicht seines Gehirns. Denn nichts, das ein Gehirn tun kann, könnte unter welchen Umständen auch immer einen Grund dafür abgeben, dem Gehirn Denken, Wahrnehmung, Vorstellung oder Wollen zuzuschreiben. Vielmehr können wir neurale Ereignisse und Prozesse mit dem Denken oder Wahrnehmen, Vorstellen oder Beabsichtigen des Menschen in Beziehung setzen und herausfinden (wenn wir dazu in der Lage sind), welche neuralen Zustände, Ereignisse und Prozesse kausal notwendige Bedingungen dafür sind, dass der Mensch etwas denken oder wahrnehmen, sich etwas vorstellen oder etwas beabsichtigen kann. Unsere Schilderungen wollen keine Kontroversen vom Zaun brechen, sondern Unterschiede erläutern, die geläufig sind und beständig gebraucht werden. Obwohl wir bewusste Kreaturen sind, sind wir uns einer Sache selten bewusst, und zwar unserer Begriffsausstattung. Und auch im neurowissenschaftlichen Denken der Gegenwart werden einige der Unterschiede, die wir herausstreichen wollen, für gewöhnlich übersehen, obgleich sie aus unserer Sicht in den gewöhnlichen Verwendungen der entsprechenden Begriffe klar zutage treten.
3 Die Kategorie des Psychischen Die Dichotomie von geistig und physisch ist nicht hilfreich Es ist verlockend, den Bereich der psychologischen Alltagsbegriffe dadurch abgrenzen zu wollen, dass man sich auf den Unterschied zwischen dem Geistigen und dem Physischen beruft und das Psychische mit dem Geistigen identifiziert und ferner annimmt, das Geistige und das Physische konstituierten zwei einander vollständig ausschließende Bereiche. Hier liegt allerdings ein Missverständnis vor, und die Dichotomie ist nicht hilfreich. Es gibt eine ganze Menge, das weder physisch noch geistig ist. Gesetze geltenden Rechts,
154
Einleitende Bemerkungen
Gesetze der Physik und der Logik, Zahlen und Theoreme, Erklärungen und Gerüchte sind weder physische noch geistige Entitäten. Genauso können viele der Facetten, die uns an uns selbst interessieren, nicht ausschließlich der Kategorie des Geistigen oder der des Physischen zugewiesen werden. Unter dem Schmerz stöhnen, vor Freude lachen, sich beim Tennisspielen vergnügen, aufmerksam lesen, frei sprechen oder überstürzt schreiben, all das betrachten wir als etwas ‚Geistiges‘ und zugleich auch ‚Physisches‘. Es ist verworren, wie die Behavioristen anzunehmen, das Verhalten sei ‚bloße Körperbewegung‘ und ausschließlich unter dem Aspekt des Physisch-Körperlichen beschreibbar. Wir charakterisieren Verhalten als aufmerksames, willkürliches, intentionales, wohlüberlegtes, rücksichtsvolles oder rücksichtsloses, und diese Beschreibungen wollen nicht zum Ausdruck bringen, dass bloße Körperbewegungen von geistigen Ereignissen begleitet werden. Wir beschreiben ein Lächeln als liebenswürdig oder amüsiert, ironisch oder freundlich, liebevoll oder grausam, feixend oder verlegen, und wir könnten nicht einmal die physischen bzw. körperlichen Unterschiede zwischen diesen Lächelweisen187 beschreiben, die wir unmittelbar als Ausdrücke von Liebenswürdigkeit, Amüsiertheit, Ironie oder Freundlichkeit etc. erkennen. Und selbstverständlich meinen wir nicht, dass solche Lächelweisen von einem inneren Gefühl begleitet werden, ebenso wie eine liebenswürdige, amüsierte, ironische oder freundliche Bemerkung von keinem inneren Gefühl begleitet wird. Demnach ist die Klassifizierung der menschlichen Attribute, der menschlichen Vermögen und Veranlagungen/Dispositionen im Besonderen, in entweder ‚physische‘ oder ‚geistige‘ zu restriktiv. Die Veranlagung zum Zunehmen könnte als ‚physische‘ Veranlagung (eine Empfänglichkeit oder Anfälligkeit) aufgefasst werden, weil der Körper einer Person, die zunimmt, mehr wiegt. Über eine gute Sehkraft bzw. ein gutes Gehör zu verfügen heißt, in der Lage zu sein, die Seh- und Hörfähigkeiten optimal auszuüben, und das kann nicht als ein physisches, aber auch nicht als ein geistiges Vermögen charakterisiert werden. Jähzorn, Scheu, Rücksichtslosigkeit etc. sind Verhaltensveranlagungen – wir haben es bei ihnen allerdings mit den Eigenschaften einer Person zu tun, nicht mit denen ihres Geistes oder Körpers. Sie sind Veranlagungen, die Charakter und Temperament betreffen –, Veranlagungen eines menschlichen Wesens. Jähzornig sein heißt, tendenziell dazu zu neigen, bei der kleinsten Provokation seine Beherrschung zu verlieren; sanguinisch Veranlagte sind anfällig dafür, bestimmte Einstellungen zu übernehmen, die die Wechselfälle des Lebens betreffen; wohlwollend sein heißt, die Veranlagung zu haben, anderen gegenüber gutwillig aufzutreten. Von allen drei Beispielen gilt, dass sie weder in das Korsett von ‚physisch‘ noch in das von ‚geistig‘ wirklich passen. Sie können aber insofern als ‚psychische‘ charakterisiert werden, als es sich bei ihnen um Vermögen, Tendenzen und Veranlagungen fühlender Wesen handelt, die über eine psycheˉ – im Falle des Menschen eine rationale psycheˉ – verfügen, das heißt über Verstandes- und Willensvermögen. Unklar, wie sie ist, könnte die Kategorie des 187
Tatsächlich gibt es oftmals keine, weil diese sich aus dem Zusammenhang ergeben bzw. im Zusammenhang erschließen lassen.
3 Die Kategorie des Psychischen
155
Geistigen gewinnbringend dafür verwendet werden, eine Subkategorie des Psychischen abzugrenzen, die bestimmte Merkmale der distinkten Verstandes- und Willensvermögen eines Lebewesens umfasst. Nagels Fehlkonzeptionen über den Geist und Geistesbegriffe Thomas Nagel behauptet, „dass der Begriff des Geistes bzw. eines geistigen Ereignisses oder Prozesses keinen Platz lässt für die Möglichkeit, dass das mit ihm Gemeinte sich infolge eingehenderer wissenschaftlicher Untersuchungen als etwas Physi[kali]sches, als ein physisches Ereignis oder ein physischer Prozess entpuppt – in der Weise, in der der Begriff des Blutes offen ist für Entdeckungen, die seine Zusammensetzung betreffen. Das Problem besteht darin, dass geistige Begriffe offenbar keine Dinge oder Prozesse herausgreifen, die in der raum-zeitlich verfassten Welt Raum beanspruchen.“ Daraus schließt er fälschlicherweise: „Augenblicklich besitzen wir nicht das begriffliche Rüstzeug, um zu verstehen, wie sowohl subjektive als auch physische Merkmale wesentliche Aspekte einer einzelnen Entität oder eines einzelnen Prozesses sein könnten.“188 Wie dargelegt (3.10) bezeichnet ‚der Geist‘ [‚the mind‘] kein Ding, welcher Art auch immer. Eine Kreatur, von der man sagen kann, dass sie einen Geist hat, verfügt in Wahrheit über eine charakteristische Auswahl an aktiven und passiven Vermögen (Funktionen, Fähigkeiten, Anfälligkeiten, Empfänglichkeiten, Veranlagungen, Tendenzen und Neigungen). Selbstverständlich beanspruchen Vermögen keinen Raum, unabhängig davon, ob es sich beispielsweise um Elastizität und Zerbrechlichkeit handelt (d. h. um Vermögen rein physisch-materieller Dinge) oder um Kognition, Kogitation, Reflexion, Vorstellung, Wahrnehmung und Empfindung. Bei diesen handelt es sich um Vermögen belebter Wesen, die auch physische Dinge sind. Die Begriffe solcher Vermögen lassen freilich keinen Platz für die wissenschaftliche Entdeckung, dass eben diese Vermögen physisch verfasst sind, ebenso wie die Begriffe der Zerbrechlichkeit und Elastizität diesen Platz nicht lassen – denn Vermögen sind nicht berührbar, keine Raum okkupierenden Entitäten, sondern Attribute von Raum okkupierenden Entitäten. Vermögen sind, anders als materielle Objekte, nicht aus Stofflichem gemacht. (Das ‚Berauschungsvermögen‘ von Whisky ist nicht aus C2H5OH gemacht, sondern es rührt nur von ihm her, und die PS eines Autos [horsepower] sind nicht aus Zylindern oder aus Stahl gemacht.) Der Begriff eines Vermögens lässt allerdings Platz für wissenschaftliche Entdeckungen, die die physischen Grundlagen für den Besitz solcher Vermögen betreffen, egal, ob es sich bei diesen Vermögen um rein ‚physische‘ handelt oder um die charakteristischen Vermögen menschlicher Wesen. Und wie wir darlegen werden, verfügen die Menschen über das begriffliche Rüstzeug, um zu verstehen, wie sowohl ‚subjektive als auch physische Merkmale‘ ‚wesentliche Aspekte‘ einer Einzelentität – das heißt einer lebenden Kreatur – sein T. Nagel, ‚Conceiving the impossible and the mind-body problem‘, Philosophy, 73 (1998), S. 339, 342. 188
156
Einleitende Bemerkungen
können. Dass wir der Täuschung anheimfallen, unsere Begriffe reichten zur Erklärung der charakteristischen Fähigkeiten belebter Wesen nicht hin, rührt ausschließlich von Begriffskonfusionen her. Die gewöhnliche Kategorie des Psychischen hat keine klar bestimmten Grenzen; ihre Begriffe sind keine theoretischen Wir können die Kategorie des Psychischen nicht erklären, indem wir auf die des Geistigen zurückgreifen und auch nicht dadurch, dass wir sie einfach dem Physischen gegenüberstellen. Dennoch gibt es einen vagen Konsens darüber, bei welchen der Merkmale, die als unbestreitbar psychische gelten, es sich um Zentralfälle handelt. Dieses große Spektrum an Attributen kann menschlichen Wesen zugeschrieben werden, und viele davon können auch höheren Tieren beigemessen werden – wenn auch nicht alle, und einige von ihnen treffen auf nichtmenschliche Tiere nur in einem schwächeren Sinn zu. Obwohl sie in der psychologischen Theorie Verwendung finden, handelt es sich bei ihnen nicht um theoretische, sondern um die gewöhnlichen oder gebräuchlichen Begriffe – sie sind nicht theoretischer als unsere Alltagsbegriffe von Stuhl und Tisch, Buch und Zeitung, Stift und Papier.189 Wie alle Begriffe, theoretische wie nichttheoretische, sind sie in ein feinmaschiges Netz aus logischen Verbindungen von wechselseitigen Implikationen, Vereinbarkeiten und Unvereinbarkeiten eingezogen. Es ist nicht leicht, die psychologischen Begriffe zu untersuchen Das Netz aus psychologischen Begriffen zu untersuchen ist außerordentlich schwierig. Wir haben es mit einem dichten Geflecht zu tun, in dem jeder psychologische Ausdruck mit anderen auf mannigfaltige Weise verbunden ist und viele Termini mehrere Verwendungen haben, also mal in der einen Gestalt, mal in der anderen in Erscheinung treten. So kann beispielsweise ‚fühlen‘ [‚feeling‘] mitunter eine Empfindung (einen Schmerz fühlen) ausdrücken, mitunter eine Emotion (Wut fühlen/empfinden); es kann eine Handlungsneigung bzw. -bereitschaft ausdrücken (sich bereit fühlen . . .), es kann aber auch eine Form der Wahrnehmung bezeichnen (einen Penny in seiner Tasche fühlen); manchmal wird es gebraucht, um einen Gedanken oder eine Meinung zum Ausdruck zu bringen (fühlen, dass Gerechtigkeit üben als Pflicht betrachtet werden muss) oder eine Glaubensneigung (fühlen, dass der Angeklagte unschuldig ist); und manchmal, um ein physisches oder psychisches Allgemeinbefinden zu benennen (sich krank oder zufrieden fühlen). Ebenso kann ‚denken‘ [‚thinking‘] verwendet werden, um manchmal einen Glauben auszudrücken (denken, dass der nächste Zug um 14.30 Uhr fährt), 189
Das wird von Paul und Patricia Churchland bestritten, die behaupten, dass unser psychologischer Alltagswortschatz zu etwas gehört, das sie ‚eine alltagspsychologische Theorie‘ nennen. Für eine Analyse der in dieser Behauptung enthaltenen Fehlkonzeptionen siehe 13.2–13.2.4.
3 Die Kategorie des Psychischen
157
manchmal eine Meinung (denken, dass Gerechtigkeit wichtiger ist als Freiheit); in manchen Verwendungen bringt es etwas zum Ausdruck, das man tut oder mit dem man sich beschäftigt (eine Stunde damit zubringen, über die augenblickliche Lage der Nation nachzudenken), was möglicherweise damit einhergeht, folgernd von bestimmten Voraussetzungen aus zu einem Ergebnis zu gelangen, das diesen gerecht wird – und auch das heißt denken; in noch anderen Verwendungen drückt ‚denken‘ ein Geschehen aus (an etwas denken, ein Gedanke kommt einem in den Sinn), und in anderen benennt es etwas Gemeintes (an Henry II. von England gedacht haben, als man sagte, Henry sei ein großer König gewesen). Diese Vielfalt und diese sich verzweigenden Begriffsverbindungen machen Verallgemeinerungen riskant. Jeder Begriff und jede Begriffskategorie müssen ihrem Eigenrecht entsprechend gewürdigt werden, und ihre mannigfachen Verbindungen zu angrenzenden Begriffen müssen nachgezeichnet werden. In den folgenden Kapiteln wird es darum gehen, die wichtigsten der für unsere Belange maßgeblichen Begriffskategorien darzustellen.
4 Empfindung und Wahrnehmung 4.1 Empfindung Körperliche Gefühle unterschieden in Empfindungen und Gefühle des körperlichen Allgemeinbefindens Unter den vielfältigen Vermögen und Fähigkeiten, über die Menschen verfügen, kann man das passive Vermögen (die Empfänglichkeit oder Anfälligkeit), körperliche Gefühle zu haben, von den Wahrnehmungsvermögen der fünf Sinne unterscheiden. Die körperlichen Gefühle können grob in Empfindungen, bei denen es sich um örtlich begrenzte Gefühle wie Schmerz, Kribbeln, Kitzeln und Jucken handelt, und Gefühle des körperlichen Allgemeinbefindens wie sich gut oder krank, wach oder schläfrig, seekrank oder übel, fit oder schwach fühlen unterschieden werden. (Letztere gehen in Gefühle des psychischen Allgemeinbefindens über, wie sich ruhig fühlen, unbefriedigt oder gelangweilt, zufrieden sein oder interessiert.) Wir werden unser Augenmerk stärker auf Empfindungen richten (eng gefasst als örtlich begrenzte Gefühle) als auf Gefühle des körperlichen Allgemeinbefindens, obgleich man sich [im Englischen] auf diese irreführenderweise mitunter als ‚Empfindungen‘ bezieht (wenn man beispielsweise von einer sensation of well-being spricht190). Empfindungen (im engen Sinne aufgefasst) betreffende Unklarheiten sind für viele Verwirrungen der Wahrnehmungstheoretiker verantwortlich. Wer sich mit der Wahrnehmung auseinandersetzen will, muss sich folglich vorher um die Klärung ihres Begriffs bemühen.
190
[Im Deutschen ist das anders: Gerade in diesen Fällen (Gefühle des körperlichen Allgemeinbefindens) heißt es immer ‚fühlen‘, während z. B. bei dem, was die Autoren später als Emotionen charakterisieren, genau der von ihnen oben benannte ‚Irrtum‘ vorliegt, d. h., man sagt im Deutschen Wut, Stolz etc. empfinden (neben wütend, stolz etc. sein) und seltener Wut, Stolz etc. fühlen. Nun ist aber der von ihnen hier veranschlagte Empfindungsbegriff ein, wie sie selber sagen, eng gefasster, und es kann auch nicht darum gehen, eine Sprache mit einer anderen zu kritisieren. Ohnehin ist ein Begriff, wie die Autoren sagen, ein sprachenübergreifendes Gemeinsames des Gebrauchs von Worten (Empfindung, sensation, sensación etc.). Um dem Empfindungsbegriff der Autoren nicht ‚in die Quere‘ zu kommen, wird ‚feeling‘ stets mit fühlen wiedergegeben. Im Text wird an einigen Stellen durch Anführung beider Ausdrücke an das Problem erinnert. – A.d.Ü.]
4.1 Empfindung
159
Empfindungen unterschieden von Wahrnehmungsobjekten; Empfindungen haben und Empfindungen fühlen Eine Empfindung wie einen Schmerz, ein Kribbeln oder Jucken zu haben oder so etwas zu fühlen heißt nicht, irgendetwas wahrzunehmen. Empfindungen sind keine irgendwie gearteten Wahrnehmungsobjekte, denn diese existieren, ob man sie nun wahrnimmt oder nicht. Wie oft gesagt wurde, können Empfindungen im Gegensatz dazu nicht ‚existieren‘, wenn sie nicht gehabt bzw. gefühlt werden. Daran ist nichts merkwürdig, und wer daraus eine besondere ‚ontologische Seinsweise‘ ableitet, macht aus einem harmlosen Sprachphänomen ein metaphysisches Rätsel.191 Eigentlich bringt man damit nur undeutlich zum Ausdruck, dass eine Person, wenn sie eine Empfindung hat, eine Empfindung fühlt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen eine Empfindung haben und eine Empfindung fühlen.192 ‚Fühlen‘ bezeichnet hier also keine Form der Wahrnehmung, wie es das in den Sätzen ‚Ich fühlte einen Penny in meiner Tasche‘ oder ‚Ich fühlte den kalten Wind auf meinem Nacken‘ tut. Der Penny und der Wind existieren, ob man sie fühlt oder nicht, von Zahnschmerzen und einem Jucken im Fuß kann man aber nur insofern sagen, dass sie existieren, als sie gefühlt oder gehabt werden. Der opake und ungewöhnliche Satz ‚Eine Empfindung existiert‘ bzw. ‚Es gibt eine Empfindung‘ meint nicht mehr als ‚Jemand hat eine Empfindung‘. Bei Schmerzen, Krämpfen, Kitzeln, Jucken und Kribbeln handelt es sich um verschiedene Arten der Empfindung. Man hat immer dann Kopfschmerzen, wenn einem der Kopf wehtut; spürt immer dann ein Jucken, wenn irgendein Teil des Körpers juckt. Es überrascht also nicht, dass es Zahnschmerzen nur gibt, wenn irgendjemandes Zahn wehtut; und es ist auch nichts Bemerkenswertes daran, dass es logisch ausgeschlossen ist, dass einem der Zahn wehtut und man nichts fühlt. Denn wenn man nichts fühlt, tut einem auch kein Zahn weh. Ebenso hat man nur dann ein Jucken im Fuß, wenn einem der Fuß juckt; wenn man nichts fühlt, dann juckt einem der Fuß nicht und man hat kein Jucken im Fuß. Anders als ein wahrgenommenes Objekt ist eine Empfindung genau so, wie man sie fühlt. Und auch das ist ganz und gar nicht rätselhaft. Man hebt damit nur undeutlich auf den Umstand ab, dass wir Wendungen wie die Folgenden nicht als sinnvolle anerkennen: ‚A fühlte seine Zahnschmerzen schlimmer werden, obwohl sie nicht schlimmer wurden‘, ‚Seine Zahnschmerzen schienen immer stärker zu werden, obwohl sie tatsächlich nicht stärker wurden‘ oder ‚Der Druck in A’s Fuß ruft immer stärkere Schmerzen hervor, er selbst aber empfand keine immer stärker werdenden Schmerzen‘. Und es ist klar, weshalb wir ihnen den Sinn absprechen. 191
Siehe J. R. Searle, The Rediscovery of the Mind, (MIT Press, Cambridge, MA, 1992), Kap. 1. Für eine eigentümliche Unregelmäßigkeit indes siehe Norman Malcolms Erörterung der durch einen Schmerz verursachten Ablenkung der Aufmerksamkeit in D. M. Armstrong und N. Malcolm, Consciousness and Causality (Blackwell, Oxford, 1984), S. 15f. Diese kann als Singularität (im mathematischen Sinne) in der Grammatik von Empfindung aufgefasst werden (siehe Kap. 11, Anm. 456). 192
160
4 Empfindung und Wahrnehmung
Empfindungen und ihr Ort im Körper Die Empfindungen haben einen Ort im Körper: Es hat immer Sinn zu fragen ‚Wo tut es weh (juckt, kribbelt es etc.)?‘, und die Antwort gibt einen Teil des Körpers an. Empfindungen werden gefühlt in (dem eigenen Arm, Bein oder Kopf oder der eigenen Zehe), aber nicht gefühlt mit (einem Wahrnehmungsorgan). Es ist verworren, wie John Searle anzunehmen, dass „der Schmerz-im-Fuß [. . .] buchstäblich im physikalischen Raum des Gehirns [ist]“, dass „das Gehirn [. . .] ein Körperbild [formt], und Schmerzen [. . .] wie alle körperlichen Empfindungen zum Körperbild [gehören]“.193 Erhöht sich der Gehirndruck, entstehen Empfindungen, diese aber sind bekannt als ‚Kopfschmerzen‘; einen Schmerz im Fuß, einen Zahn- oder Bauchschmerz hat man nicht im Gehirn oder „im physikalischen Raum des Gehirns“. Zudem sind Kopfschmerzen, obwohl sie Schmerzen im Kopf sind, nicht auf die nämliche Weise im Kopf, wie es das Gehirn ist (öffnet man den Kopf, wird ein Gehirn zum Vorschein kommen, keine Schmerzen; man kann dem Schädel ein Gehirn entnehmen, aber keinen Schmerz). Die Sätze ‚Er hat Schmerzen und ein Gehirn in seinem Kopf‘ und ‚Ich habe eine Wimper und ein Jucken in meinem Auge‘ sind sylleptisch (zum Vergleich: ‚Ich habe einen Penny und ein Loch in meiner Tasche‘ – beide sind in der Tasche ‚verortet‘, der eine aber kann herausgenommen, das andere indes nur zugenäht werden). Darum handelt es sich bei ‚Was hast du in deinem Mund?‘ – ‚32 Zähne und Zahnschmerzen‘ um einen Witz. Die logische Grammatik von ‚Schmerz im Kopf‘ (Ort einer Empfindung) ist anders als die von ‚Penny in der Dose‘ (Ort eines materiellen Objekts) und anders als die von ‚Party im Garten‘ (Ort eines Ereignisses). Natürlich würde man keine Empfindungen haben, wenn das Gehirn nicht ordentlich funktionierte, das bedeutet jedoch nicht, dass sie entweder im oder durch das Gehirn gehabt werden. Das Subjekt des Schmerzes ist die Person (oder das Tier), die ihn offenbart, nicht ihr Geist oder ihr Gehirn Das Subjekt (oder der ‚Träger‘) des Schmerzes (d. h. die Entität, die den Schmerz hat) ist die Person, die in ihrer Mimik, ihrem Stöhnen und Schreien offenbart, dass sie Schmerzen hat, nicht ihr Geist oder ihr Gehirn. Das Subjekt des Juckens oder Kribbelns ist die Person, die offenbart, dass sie ein Jucken oder ein Kribbeln hat, indem sie die juckende bzw. kribbelnde Stelle kratzt oder reibt (ihr Fuß mag jucken oder kribbeln, aber ihr Fuß hat kein Jucken oder Kribbeln). Wenn einer Person der Zahn wehtut, leidet sie (nicht ihr Zahn); wenn ihr Bein schmerzt, hat sie Schmerzen (nicht ihr Bein). Man kann den Schmerz in ihrem Gesicht sehen, denn obwohl der Schmerz vielleicht in ihrem Bein ist, ist es die Person, die in ihrer Mimik, ihrem Gebaren und Stöhnen Schmerz ausdrückt. Wir kümmern uns um das Bein, aber wir trösten die Person. 193
Searle, Rediscovery of the Mind, S. 63 [dt. Die Wiederentdeckung des Geistes, S. 81].
4.1 Empfindung
161
Das Kriterium des Schmerzortes ist das Verhalten des Schmerzsubjekts; logische Unterschiede zwischen ‚Schmerz im Knie‘ und ‚Penny in der Dose‘ Wo es schmerzt, ergibt sich aus dem Verhalten des Schmerzsubjekts. Sein Schmerz ist dort, wo er sich seiner ehrlichen Äußerung nach befindet. Wenn es auf die Frage, wo es schmerze, auf sein Knie deutet, es umsorgt und darüberstreicht, dann tut ihm sein Knie weh – nicht sein Gehirn. Und wenn dem Subjekt sein Knie wehtut, dann hat es einen Schmerz in seinem Knie. Einen Schmerz in seinem Knie haben enthält ein ganz anderes ‚in‘ als einen Penny in einer Dose haben.194 Diese Verwendung der räumlichen Ortspräposition erlaubt die Ersetzung durch ‚innerhalb‘ (‚der Penny ist innerhalb der Dose‘). Einen Schmerz im Knie zu haben, bedeutet allerdings nicht, dass man einen Schmerz innerhalb seines Knies hat – die Dose enthält den Penny, das schmerzende Knie aber enthält den Schmerz nicht. Wenn der Penny in der Dose ist, muss er kleiner als die Dose sein, Schmerzen sind jedoch weder kleiner noch größer als (und haben auch nicht dieselbe Größe wie) der Teil des Körpers, der schmerzt. Der Penny, der sich innerhalb der Dose befindet, kann aus ihr auch herausgenommen werden, der Schmerz im Knie aber kann logischerweise nicht aus ihm herausgenommen werden – man kann ihn nur stoppen. Wenn die Dose nach London mitgenommen wird, dann ist der Penny in London; wenn jedoch die Person nach London reist, folgt daraus nicht, dass der Schmerz in London ist – die Person, deren Knie schmerzt, ist in London, der Schmerz jedoch hat sich nicht bewegt. Nochmals, das Argument ist klar: ‚In der Dose ist ein Penny‘ drückt eine räumliche Beziehung zwischen zwei unabhängigen Objekten aus. Die Wendung ‚In meinem Knie ist ein Schmerz‘ ist jedoch insofern irreführend, als sie keine Beziehung zwischen zwei unabhängigen Objekten, einem Schmerz und einem Knie, zum Ausdruck
Es gibt viele unterschiedliche Lokativ-Verwendungen von ‚in‘, die nichträumlich sind: z. B. ‚Es ereignete sich in der Geschichte‘, ‚Wir werden uns in diesem Jahr noch sehen‘, ‚Ich sah sie in meinen Träumen‘. Es gibt auch viele unterschiedliche Lokativ-Verwendungen von ‚in‘, die räumlich sind: z. B. ‚Penny in der Dose‘, ‚Fleck im Gewebe‘, ‚blinkende Lichter in (der linken oberen Ecke von) meinem Gesichtsfeld‘ und ‚Schmerz in meinem Bein‘. Die Ersetzungen, Implikationen, Verträglichkeiten und Unverträglichkeiten variieren von Fall zu Fall, obwohl diese Verwendungen sämtlich ortsbezogen (räumlich) sind. So hängt die logische Grammatik von ‚im Bein‘ davon ab, ob das, was im Bein sein soll, ein Schmerz oder eine Nadel ist. Ebenso hängt die logische Grammatik von ‚in meinem Jackett‘ davon ab, ob es sich bei dem, von dem man sagt, dass es in meinem Jackett ist, um eine Münze oder eine Knitterfalte handelt – denn auch hier gibt es logische Unterschiede, was die Grammatik der Verortung der fraglichen Entitäten angeht. Die Münze kann herausfallen, die Falte kann nur herausgebügelt werden; wenn das Jackett nach Paris mitgenommen wird, dann ist auch die Münze darin in Paris, von der Falte im Jackett kann man nicht sagen, dass auch sie in Paris ist (ebenso wenig wie daraus, dass ein Loch im Jackett und das Jackett in Paris ist, folgt, dass ein Loch in Paris ist). 194
162
4 Empfindung und Wahrnehmung
bringt, ebenso wie ‚Ich habe einen Schmerz‘ keine (Eigentums-)Beziehung zwischen mir und einem Schmerz ausdrückt.195 Ausstrahlende Schmerzen und Phantomschmerzen Sogenannte ausstrahlende Schmerzen (z. B. Ischiassyndrom, ausstrahlende Zahnschmerzen) sind keine Schmerzen, von denen das Subjekt irrtümlicherweise denkt, dass sie dort sind, wohin es zeigt und wo es sie zu lindern versucht, sondern Schmerzen, die an anderen Stellen als dem Ort der Verletzung, Infektion etc. gefühlt werden. Sogenannte Phantomschmerzen sind keine Schmerzen, die in der eigenen amputierten Gliedmaße zu sein scheinen – wenn die eigene Gliedmaße im ‚Entsorgungsbehälter‘ ist, zeigt man auf die Frage, wo es schmerze, nicht dorthin. Es sind vielmehr außerhalb des Körpers gefühlte Schmerzen (im ‚Phantomglied‘), da, wo die Gliedmaße noch zu sein scheint (es fühlt sich für den Patienten so an, als ob sie noch da wäre). Folglich muss der Ort der Schmerzursache vom Ort des Schmerzes selbst unterschieden werden. Nicht die Art des Schmerzes ermöglicht einem zu sagen, wo es schmerzt; das heißt, die eigene Fähigkeit zu sagen, wo es schmerzt, beruht nicht darauf, wie man den Schmerz und seine Merkmale empfindet. Wenn ich sage, dass ich einen Schmerz in meinem Fuß habe (dass mein Fuß schmerzt), dann sage ich das nicht, weil ich eine auf den Fuß hindeutende Schmerzempfindung hatte, die mich gewissermaßen über den Schmerzort in Kenntnis setzte. Unser normales Schmerzlokalisierungsvermögen ist nicht evidenzbezogen. Empfindungen können unterschiedlich intensiv, aber nicht unterschiedlich klar sein; sie sind qualitativ verfasst und mit Verhaltensneigungen verbunden Empfindungen weisen Intensitätsgrade auf – sie können entsetzlich schmerzhaft sein oder bloß zwickende und zwackende. Die Kopfhaut kann unerträglich jucken oder bloß leicht gereizt sein. Empfindungen können stärker oder schwächer sein, intensiver werden oder an Intensität verlieren. Anders als Wahrnehmungen weisen sie keine Klarheitsgrade auf – einen Schmerz hat man nicht klar und deutlich, wie man einen Schrei klar und deutlich hören kann. Empfindungen sind qualitativ verfasst, sie können beispielsweise brennen, stechen, nagen, bohren, dumpf sein oder klopfen (Schmerzen). Sie können von innen oder von außen verursacht werden. Normalerweise sind sie mit Verhaltensneigungen verbunden – zu kratzen (wenn es juckt) beispielsweise, zu lindern In dieser Hinsicht (jedoch in keiner anderen) ähneln sich ‚Ich habe einen Schmerz in meinem Knie‘ und ‚Ich habe eine Falte [have a crease] in meinem Hemd‘ grammatisch, wobei ‚Ich habe eine Falte in meinem Hemd‘ nicht bedeutet, dass ich faltig bin [I am creased] (und schon gar nicht, dass ich ‚in crease‘ bin), ‚Ich habe einen Schmerz in meinem Knie‘ bedeutet, dass ich Schmerzen habe. Gleichermaßen ist es so, dass Sie, wenn Sie meinem Bein wehtun, mir wehtun, wenn sie jedoch mein Hemd zerknittern, zerknittern Sie nicht mich. 195
4.1 Empfindung
163
(einen Schmerz), zu lachen (wenn man gekitzelt wird). Empfindungen können schnell vorbei sein wie ein stechender Schmerz oder andauern wie Geburtsschmerzen; sie bestehen jedoch während eines Bewusstseinsverlusts nicht fort – man fühlt keinen Schmerz, wenn man nicht bei Bewusstsein ist. Eine Empfindung beginnt, sobald das Subjekt etwas empfindet, und das Kriterium dafür, dass es etwas empfindet, ist sein Verhalten und das, was es sagt. Libets Annahme, das Subjekt könnte ‚die Empfindung‘ auf einen früheren Zeitpunkt als den, zu dem sie sich wirklich ereignete, ‚rückbeziehen‘, geht in die Irre.196 Empfindungen gehören der Kategorie des Lustbezogenen an Empfindungen gehören der Kategorie des Lustbezogenen an: Das heißt, sie können angenehm oder unangenehm sein. Es überrascht nicht, dass wir einen reicheren Wortschatz für Schmerzen und unangenehme Empfindungen haben als für angenehme. Sie stören unser Wohlsein und optimales Funktionieren, und ihre Charakterisierung ist für diagnostische Zwecke von großer Bedeutung. Empfindungen gehören auch zur Kategorie der Passivität. Eine Empfindung haben oder fühlen ist ein leidvolles oder mit Freude verbundenes Erleben. Natürlich kann man dafür sorgen, dass man etwas Bestimmtes empfindet, es gibt jedoch keine willkürlichen Empfindungen, nur willkürlich zugefügte bzw. herbeigeführte. Während Menschen mehr oder weniger geschickt darin sein können, bestimmte Dinge wahrzunehmen, können sie nicht mehr oder weniger geschickt darin sein, Empfindungen zu haben, nur mehr oder weniger anfällig dafür. In diesem Sinne empfindungsfähiger zu sein heißt nicht, Schmerzen oder ein Kitzeln besser empfinden zu können. Man kann nicht lernen, schärfere oder präzisere Empfindungen zu haben. Obgleich es scharfe Empfindungen gibt, handelt es sich bei diesen nicht um anspruchsvollere, und es gibt kein akkuraten oder unakkuraten, richtigen oder falschen Empfindungen. Man kann jedoch lernen, seine Empfindungen besser zu beschreiben und seinen Beschreibungswortschatz zu bereichern. Libets ‚Time-on‘-Theorie hält fest: ‚(1) Nach verzögerter Erfüllung der neuralen Bewusstseinsbedingungen vollzieht sich ein automatischer subjektiver Erfahrungsrückbezug in der Zeit (eine Erfahrungsrückdatierung), bis ungefähr zu dem Zeitpunkt der Anregung. (2) Die kortikale Anfangsreaktion (evoziertes Primärpotenzial auf dem S 1-Kortex) auf die schnelle spezifische (lemniskale) Reizprojektionsnachricht dient diesem Rückbezug als zeitlicher Orientierungspunkt. Die Erfahrung würde folglich subjektiv zurückdatiert und es würde dem Subjekt so vorkommen, als ob sie sich ohne die substanzielle neurale Verzögerung, die für ihre Hervorbringung erforderlich ist, ereignet (B. Libet, ‚Conscious subjective experience vs. unconscious mental functions: a theory of the cerebral processes involved‘, wieder abgedr. in seiner Neurophysiology of Consciousness (Birkhäuser, Boston, 1993), S. 328). Wir haben es hier mit einer irrigen Annahme zu tun, denn es kommt dem Subjekt nicht so vor, als ob die Erfahrung sich ereignet, bevor sie sich tatsächlich ereignet. Sie ereignet sich, wenn das Subjekt sie fühlt. 196
164
4 Empfindung und Wahrnehmung
Es gibt Täuschungen des Tastsinns, aber keine Empfindungstäuschungen Man muss achtgeben, dass man Täuschungen des Tastsinns, die wirklich vorkommen, nicht mit angeblichen Empfindungstäuschungen, die es nicht gibt, verwechselt. Es gibt Täuschungen des Tastsinns wie die „kutane ‚Hasen‘-Täuschung“197 Hier erliegt man der Illusion, man werde in regelmäßigen Abständen den ganzen Arm abwärts berührt, während man tatsächlich z. B. fünfmal auf dem Handgelenk, zweimal in der Nähe des Ellbogens und dreimal bei der Schulter berührt wird. Es ist jedoch keine Täuschung, dass man eine Reihe von Empfindungen hat, die gleichmäßig über die ganze Länge des Arms verteilt sind. Es kommt einem so vor, als ob man an zehn verschiedenen Stellen berührt wird. Es kommt einem jedoch nicht so vor, als ob man nacheinander zehn über den eigenen Arm verteilte Empfindungen hat – man hat solche Empfindungen tatsächlich. Einer Person, der das Bein amputiert wurde und die einen Phantomschmerz hat, kommt es gleichermaßen nicht so vor/scheint es nicht, als ob sie einen Schmerz im Fuß hat, denn man kann nicht scheinbar einen Schmerz haben. Und wie wir gesehen haben, kann man auch nicht sagen, dass sie einen Schmerz hat, der in ihrem Fuß zu sein scheint. Der Schmerz ist dort, wo (und, bei allem Respekt für Libet, dann, wann) er der aufrichtigen Angabe des Leidenden nach ist. Er hat also in Wirklichkeit dort einen Schmerz, wo sein Fuß gewesen wäre (d. h. in seiner ‚Phantomgliedmaße‘).
4.2 Wahrnehmung Worum es sich bei einem Wahrnehmungsorgan handelt Vier der fünf Sinne – nämlich Sehen, Hören, Schmecken und Riechen – sind an den Gebrauch eines spezifischen Wahrnehmungsorgans geknüpft. Man sieht mit seinen Augen, nicht mit seinem Gehirn, genauso wie man mit seinen Ohren hört, mit seiner Zunge und seinem Gaumen schmeckt und mit seiner Nase riecht. Der Ausdruck ‚mit seiner . . .‘ zeigt hier das Organ an, das zur Ausübung der nämlichen Fähigkeit verwendet wird. Um zu erfassen, wie ‚verwenden‘ hier zu verstehen ist, muss man sich klarmachen, dass man sein Auge und nicht einen anderen Teil des Körpers an ein Schlüsselloch führt, um durch es hindurchzuschauen; dass man, um besser zu hören, seine Hand hinter sein Ohr legt und dieses schräg hält oder sein Ohr näher an die Geräuschquelle heranführt; dass man, um zu riechen, schnuppert und seine Nase näher an die Geruchsquelle heranführt, um sie besser zu riechen; und dass man, um zu schmecken, an dem Objekt leckt oder ein Stück von ihm abbeißt und es in seinem Mund zerkaut. Die taktile Wahrnehmung ist allerdings nicht an ein spezielles Organ geknüpft. Die Wahrnehmung von etwas, indem F. A. Geldard und C. E. Sherrick, ‚The cutaneous „rabbit“: a perceptual illusion‘, Science, 178 (1972), S. 178f. 197
4.2 Wahrnehmung
165
man es erfühlt/ertastet, kann fast jeden Teil des Körpers beanspruchen oder sogar den Körper als Ganzen. Man kann die Form oder Größe eines Dings mit seinen Händen erfühlen, seine Stärke und Plastizität mit seinen Fingern, die Festigkeit der Tür mit seinen Schultern, die Wärme des Badetuchs mit seiner Wange. Man kann die Schlüpfrigkeit des Untergrundes erfühlen, indem man über ihn läuft, die Viskosität einer Flüssigkeit, indem man sie umrührt, die Elastizität eines Objekts, indem man es auseinanderzieht, seine Beweglichkeit oder Unbeweglichkeit, indem man es schiebt, und das Gewicht eines Objektes, indem man es anhebt oder trägt. Das Gehirn ist allerdings kein Wahrnehmungsorgan, obgleich man natürlich nichts sehen, hören, schmecken oder riechen könnte, wenn das Gehirn nicht angemessen funktionieren würde. Die Sinne sind kognitive Fähigkeiten Die Wahrnehmungsvermögen sind kognitive Fähigkeiten derart, dass wir uns durch ihre Ausübung Wissen von Objekten und ihren Qualitäten, von Ereignissen und ihren charakteristischen Merkmalen und von bedeutsamen, in unserer Umgebung vorherrschenden Sachverhalten aneignen können. Weil die Sinne kognitive Fähigkeiten sind, sind sie mit der Anstrengung, Wissen zu erwerben, verknüpft. Und weil sie keine unfehlbaren kognitiven Fähigkeiten sind, sind sie begrifflich mit Gelingen und Misslingen verbunden. Man kann versuchen wahrzunehmen und sich darum bemühen, bessere Unterscheidungen zu treffen. Man kann sich entscheiden zu sehen, zu riechen oder zu schmecken und das sorgfältig oder weniger sorgfältig tun. Anders als im Fall der Empfindung kann es Gelingen, Misslingen und Irrtum geben – das heißt, man kann wahrnehmen, es kann einem misslingen oder man kann falsch wahrnehmen. Das Ergebnis gelingender Wahrnehmungsaktivitäten wie sich umschauen, betasten, schnuppern oder schnüffeln, kosten oder probieren und lauschen ist sehen, erfühlen/ertasten, riechen, schmecken oder hören – allgemein gesagt, Perceptibilia erkennen, unterscheiden, entdecken oder voneinander abgrenzen. Verben wie ‚wahrnehmen, dass‘ werden manchmal (was ein wenig in die Irre führt) ‚Leistungsverben‘ oder ‚Erfolgsverben‘ genannt, um das Gelingen der Wahrnehmung zu signalisieren. Sachlicher betrachtet handelt es sich bei ihnen um ‚faktive Verben‘, insofern die Dinge, wenn man wahrnimmt (z. B. sieht oder hört, erkennt oder entdeckt), dass sie so sind, dann tatsächlich so sind, wie die Wahrnehmung es nahelegt. Wenn man herausfindet, dass die Dinge nicht so sind, wie sie der eigenen Wahrnehmung nach sind, dann muss man die Behauptung, man habe wahrgenommen, dass die Dinge so sind, widerrufen bzw. zurücknehmen und sich auf geeignete Äußerungen zurückziehen wie ‚Mir schien als ob . . .‘, ‚Ich dachte . . .‘ oder ‚Mir kam es förmlich vor wie . . .‘ und so weiter. Selbstverständlich müssen Wahrnehmungsverben keinen Nomen-Gliedsatz ‚dass dies und jenes‘ als Objekt aufweisen. Sie können Namen von Perceptibilia oder von Wahrnehmungsqualitäten zu ihren Objekten machen. Diese können vielen unterschiedlichen Kategorien von Dingen und ‚Nichtdingen‘ (wie Löcher oder Lücken) zugehören.
166
4 Empfindung und Wahrnehmung
Anders als Empfindungsvermögen können Wahrnehmungsfähigkeiten trainiert werden; die Wahrnehmung ist mit dem Lustbezogenen (locker) verbunden Anders als im Falle des Empfindens kann man beim Wahrnehmen mehr oder weniger geschickt sein, kann sein Wahrnehmungsleistungsvermögen bis zu einem gewissen Punkt trainieren und ein geübtes Auge oder Ohr und einen unterscheidungsfähigen oder anspruchsvollen Gaumen erwerben. So wie die Empfindungsanfälligkeit mit Lust und Schmerz verknüpft sein kann, können die Wahrnehmungsvermögen mit Freude und Verdruss verbunden sein. Oft erfreuen wir uns am Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken der Dinge, und manchmal sind wir angewidert, entsetzt oder empört von dem, was wir wahrnehmen. Ein Unterschied zwischen wahrnehmungsbezogenem Wissenserwerb und anderen Formen des Informationserwerbs ist genau darin zu sehen, dass das Wahrnehmen Freude machen oder Verdruss bereiten kann. Wahrnehmung und Willkürlichkeit Einerseits ist die Ausübung der Sinnesfähigkeiten nicht willkürlich. Man kann nicht wählen, ein lautes Geräusch in seiner Umgebung zu hören oder ein hervorstechendes Objekt in seinem Gesichtsfeld zu sehen, die Hitze in einem heißen Raum zu fühlen oder die Süße des Likörs, an dem man gerade genippt hat, zu schmecken. Man kann nur seine Ohren zuhalten, seine Augen verschließen, den Raum verlassen, um der Hitze zu entfliehen, und einen weiteren ‚Schluck‘ ablehnen. Andererseits können die Wahrnehmungsfähigkeiten vom Willen ausgeübt werden. Das Sehvermögen ist mit dem Absuchen, Betrachten, Ausschauhalten, Durchsehen, Überblicken, Beobachten und Inspizieren verknüpft, die sämtlich willkürliche Aktivitäten sein können. So ist auch das Hörvermögen mit dem willkürlichen Hören auf einen Klang oder dem Anhören einer Klangsequenz verknüpft. Man fühlt die Mittagshitze nicht willkürlich, aber man kann willkürlich nach etwas in seiner Tasche hinfühlen und seine Hand willkürlich ausstrecken, um die thermische Qualität (die Wärme) oder die stoffliche Beschaffenheit eines in seiner Reichweite befindlichen Dinges zu erfühlen. Die Wahrnehmungskriterien liegen im Verhalten; das Gehirn ist weder ein Wahrnehmungsorgan noch ein Wahrnehmungssubjekt Ob jemand über Sinnesfähigkeiten verfügt, zeigt sich im Verhalten. Sehende sind dadurch zu identifizieren, dass sie das Vermögen ausüben, sichtbare Objekte und Eigenschaften zu unterscheiden, dass sie in der Lage sind (was von der ‚Beleuchtungssituation‘ abhängt), ihren Weg zu finden, ohne sich zu stoßen oder über etwas zu stolpern, dass sie nach etwas suchen und es finden, indem sie Ausschau halten, dass sie etwas mit ihren Augen verfolgen und Kopf und Körper entsprechend ausrichten und dass sie auf visuelle Stimuli wie Lichter, Schimmerphänomene und Blitze reagieren. Im Allge-
4.2 Wahrnehmung
167
meinen bestehen die Verhaltensformen, die den Besitz einer bestimmten Wahrnehmungsfähigkeit anzeigen, in der jeweiligen Effizienz der Unterscheidung, Erkennung, Erfassung, Zielstrebigkeit und Umgebungserkundung und, was den Menschen angeht, in den entsprechenden Äußerungen. Diese in Reaktion auf sichtbare Dinge an den Tag gelegten Verhaltensweisen beispielsweise sind logische Kriterien dafür, dass ein Lebewesen etwas sieht. Neurale Ereignisse im Gehirn sind keine logischen Kriterien – bei ihnen handelt es sich um induktive Korrelationen mit dem Sehen, die die nichtinduktive Identifizierung des Sehens anhand der Verhaltenskriterien voraussetzen. Man sieht nichts in seinem Gehirn und man sucht nicht mit seinem Gehirn im Bücherschrank. Und man sieht auch nicht die Farbe von Blumen mit oder in seinem Gehirn, jedoch mit den eigenen Augen, sobald man einen Blick in den Garten wirft. Das Gehirn ist weder ein Wahrnehmungsorgan noch ein Wahrnehmungssubjekt. Die neuralen Ereignisse im Gehirn sind keine Formen des Wahrnehmungsverhaltens, und nichts, was das Gehirn tun kann, könnte als ein Kriterium dafür herangezogen werden, dass es in seiner Umgebung etwas wahrnimmt. Das Lebewesen nimmt wahr und offenbart in seinen Verhaltensreaktionen seiner Umwelt gegenüber, dass es wahrnimmt. Crick irrt darin, dem Gehirn bzw. einer dessen Hemisphären Wahrnehmung zuzuschreiben Von der rechten Hemisphäre zu sagen, wie Neurowissenschaftler es gerne tun, dass sie etwas sieht, ist folglich im besten Fall eine irreführende Façon de parler. Die folgenden Ausführungen Francis Cricks sind gleichfalls abwegig: Beim Wahrnehmen erfährt das Gehirn gewöhnlich etwas über die Außenwelt oder über andere Teile des Körpers. Deshalb scheint das, was wir sehen, sich außerhalb von uns zu befinden, obwohl die Neuronen, die das Sehen doch besorgen, sich im Kopf befinden. Vielen Menschen kommt das sehr seltsam vor. Die ‚Welt‘ befindet sich außerhalb des Körpers, und andererseits befindet sie sich (das, was man davon weiß) vollständig innerhalb des Kopfes. [. . .] Wenn wir den Schädel aufmachen und die Signale auffangen, die irgendein bestimmtes Neuron ausgesendet hat, dann können wir oftmals sagen, wo sich dieses Neuron befindet. Das Gehirn, das wir untersuchen, hat diese Information hingegen nicht. Und daraus erklärt sich, weshalb wir normalerweise nicht genau wissen, wo in unseren Köpfen sich unsere Wahrnehmungen und Gedanken abspielen.198
Diese Darstellung ist bestenfalls irreführend, denn das Gehirn lernt beim Wahrnehmen gar nichts – die Person, dessen Gehirn es ist, nimmt wahr und lernt etwas beim Wahrnehmen. Was wir sehen, scheint nicht außerhalb von uns zu sein. Was wir sehen, ist notwendigerweise außerhalb unseres Körpers lokalisiert – es sei denn, wir würden uns selbst in einem Spiegel betrachten oder unsere Gliedmaßen oder unseren Brustkorb (die weder innerhalb noch außerhalb unseres Körpers sind, sondern Teile von ihm). Die Neuronen, 198
F. Crick, The Astonishing Hypothesis (Touchstone, London, 1995), S. 104f. [dt. Was die Seele wirklich ist (Artemis & Winkler, München & Zürich, 1994), S. 137f.].
168
4 Empfindung und Wahrnehmung
ohne die wir nichts sehen würden, befinden sich in unseren Köpfen, aber diese Neuronen sehen bzw. ‚besorgen‘ das Sehen genauso wenig, wie die Zylinder eines Autos 70 km/h fahren. ‚Die Welt‘ ist in keinem Sinn innerhalb des Kopfes von irgendjemand, und es ist falsch anzunehmen, unser Wissen von der Welt befinde sich innerhalb unserer Köpfe. Wir wissen, dass die Erde kugelförmig ist, unser Wissen – nämlich, dass die Erde die Form einer Kugel hat – ist jedoch nicht in unseren Köpfen (noch sonst irgendwo). Und schließlich ist es irreführend zu sagen, wir wüssten nicht, wo in unserem Kopf sich unsere Wahrnehmungen abspielen, denn unsere Wahrnehmungen spielen sich gar nicht in unseren Köpfen ab. Lediglich Neurowissenschaftler wissen, welcher Zellbereich kausal dafür verantwortlich ist, dass wir in der Lage sind, das wahrzunehmen, was wir wahrnehmen. Unsere Wahrnehmung – unser Wahrnehmen von was auch immer – spielt sich nicht in unserem Gehirn ab, sondern stets dort, wo wir sind, wenn wir wahrnehmen, was wir wahrnehmen. Beim Wahrnehmen handelt es sich um eine Erkenntnisbeziehung zwischen einem Wahrnehmenden und einem wahrgenommenen Objekt, und weil die Objekte, die wir wahrnehmen, sich nicht in unseren Köpfen befinden, sondern in unserer Umgebung, ergibt die Annahme, dass das Wahrnehmen sich in unseren Köpfen abspielt, genauso wenig Sinn wie die Annahme, Jacks Schneller-laufen-als-Jill spiele sich in Jack ab. Die Fragen ‚Wo hast du Beethovens Neunte zuletzt gehört?‘ oder ‚Wo hast du Jack gesehen?‘ können mit ‚Im Sheldonian Theatre‘ (wenn man Jack beim Konzert gesehen hat) beantwortet werden, nicht mit ‚Zehn Zentimeter hinter meinem linken Auge‘.
4.2.1 Wahrnehmung als die Verursachung von Empfindungen: Primäre und sekundäre Qualitäten Der Gedanke, alle Wahrnehmung gehe damit einher, Empfindungen zu haben, ist abwegig Es ist wichtig, Wahrnehmung und Empfindung auseinanderzuhalten. Lange ging man in der Philosophie, aber auch in der Psychologie und den Neurowissenschaften davon aus, dass wahrnehmen charakteristischerweise damit einhergeht, Empfindungen zu haben. Die Wurzeln dieses Gedankens reichen zurück ins 17. und 18. Jahrhundert und erwachsen einer Konzeption der Wahrnehmung, worin sie als das Verursachende der Vorstellungen und Eindrücke im Geist erscheint, wobei der Einfluss der Reize auf unsere Nervenendigungen und die nachfolgende Anregung der Lebensgeister in den Nerven angeblich am Beginn des Geschehens stehen. Ein Schaden an den Nervenendigungen durch Abtrennungen oder Verbrennungen etc. verursache Schmerzvorstellungen; die Lichteinwirkung auf die Retina bzw. der Einfluss der Schallwellen auf das Trommelfell verursache Farb- und Klangvorstellungen. Schmerzvorstellungen und Farb- und Klangvorstellungen ordnete man auf der gleichen Ebene an – alle rührten von der Einwirkung der Dinge auf unsere Nervenendigungen her. Sofern die Neurowissenschaftler der Gegenwart die Wahrnehmung als eine Sache der Rezeption von Empfindungen be-
4.2 Wahrnehmung
169
greifen, stimmen sie mit einer altehrwürdigen (jedoch verworrenen) Tradition überein. Wir werden auf dieses Thema zu sprechen kommen, nachdem wir uns Aufschluss über den Ursprung der Konfusion verschafft haben. Galileis Konzeption von primären und sekundären Qualitäten Die Konzeption der Wahrnehmung als Rezeption von Vorstellungen und Eindrücken erfuhr durch den auf Galilei zurückgehenden und von Descartes, Boyle und Locke weiterentwickelten Gedanken eine Ergänzung, dass, genau wie es sich bei der Schmerzempfindung um eine auf den schädlichen Einfluss eines Objekts auf unsere Nervenendigungen beruhende subjektive Geistesmodifikation handelt und nicht um das Erfassen einer Schmerzqualität in dem Objekt, auch die Farb-, Geruchs-, Geschmacks-, Wärme- und Kälte-‚Empfindungen‘ bloß subjektive Geistesmodifikationen sind und nicht die Erfassung objektiver Qualitäten der Perceptibilia. Von den als von unserer Wahrnehmung unabhängigen Objekten nahm man an, dass sie nur über die primären Qualitäten der Ausdehnung, Form, Größe, Dichte, Bewegung oder Beharrung verfügen. Bei den sekundären Qualitäten der Farbe, des Geruchs, Geschmacks und den thermischen (als auch taktilen) Qualitäten handele es sich um bloße, wenngleich objektive, Vermögen der Objekte, in uns Vorstellungen von Farbe, Klang etc. hervorzurufen. Wenngleich wir sie erfahren, seien sie lediglich Vorstellungen oder Empfindungen in unserem Geist. Laut dieser Konzeption besteht ein dramatisch zu nennender Unterschied zwischen der Welt, wie wir sie wahrnehmen, und der Welt, wie sie an sich ist. Ein Objekt wahrzunehmen, bedeute, über ein Spektrum an zum Teil nichtrepräsentativen Vorstellungen des Objekts zu verfügen, das von der Gehirntätigkeit im eigenen Geist verursacht wurde. Wir erfassen beim Wahrnehmen nicht das Objekt selbst, sondern vielmehr die Vorstellungen, die es in uns hervorgerufen hat. Die Vorstellungen der Primärqualitäten repräsentieren objektive Qualitäten der von uns wahrgenommenen Objekte, was auf die Vorstellungen der sekundären Qualitäten nicht zutrifft. Diese Konzeption wurde zu einer der Grundannahmen der wissenschaftlichen Realitätskonzeption und der psychologischen und neurowissenschaftlichen Wahrnehmungskonzeption. Neurowissenschaftler halten noch immer an dieser Konzeption aus dem 17. Jahrhundert fest Sie ist so fest verwurzelt wie je. Kandel, Schwartz und Jessell leiten ihre Erörterung ‚der sensorischen Systeme‘ so ein: Wir empfangen elektromagnetische Wellen verschiedener Frequenzen, aber wir nehmen Farben wahr: Rot, Grün, Orange, Blau oder Gelb. Wir empfangen Druckwellen, aber wir hören Worte und Musik. Wir kommen mit unzähligen chemischen Verbindungen, die in der Luft oder im Wasser gelöst sind, in Kontakt, aber wir erfahren Gerüche und Geschmäcke.
170
4 Empfindung und Wahrnehmung
Farben, Klänge, Gerüche und Geschmäcke sind mentale Konstruktionen, die im Gehirn durch Verarbeitung sensorischer Daten entstehen. Sie existieren als solche nicht außerhalb des Gehirns. Somit können wir die traditionell von Philosophen aufgeworfene Frage stellen: Verursacht ein im Wald umfallender Baum ein Geräusch, wenn niemand nahe genug ist, es zu hören? Wir können mit Bestimmtheit sagen, dass das Umfallen, obgleich es Druckwellen in der Luft hervorruft, kein Geräusch hervorruft. Ein Geräusch entsteht nur dann, wenn die durch das Umfallen des Baums verursachten Druckwellen ein Lebewesen erreichen und dieses sie wahrnimmt. Demnach sind unsere Wahrnehmungen keine unmittelbaren Aufzeichnungen der uns umgebenden Welt, sondern sie werden intern nach angeborenen Regeln und Beschränkungen erzeugt, gemäß dem Leistungsvermögen des Nervensystems.199
Diese Fehlkonzeption trägt dazu bei, dass empirische Untersuchungen der neuralen Wahrnehmungsmechanismen systematischen Verzerrungen unterliegen. Obwohl hier nicht der Ort für eine detaillierte Erörterung der Konzeption ist, sind doch einige Bemerkungen angebracht. Wer behauptet, dass Farben, Klänge etc. essenziell subjektiv sind, formuliert keine physische Hypothese oder Theorie, sondern eine metaphysische Erstens muss hervorgehoben werden, dass wir es hier nicht mit einer empirischen Behauptung oder wissenschaftlichen Hypothese zu tun haben und schon gar nicht mit einer wissenschaftlichen Theorie, die experimentell untermauert werden kann oder untermauert wurde, sondern mit einer philosophischen oder begrifflichen Behauptung, die nur durch begriffliche Untersuchungen und apriorische Argumente bekräftigt oder entkräftet werden kann. Es gibt kein wissenschaftliches Experiment, mit dem man beweisen könnte, dass Gras, wie es an sich ist, nicht grün ist, sondern uns nur so vorkommt, dass Zucker nicht wirklich süß ist, sondern es nur zu sein scheint, oder dass Eis nicht wirklich kalt ist, sondern nur diesen Anschein in uns hervorruft etc. Alles, was eine wissenschaftliche Theorie leisten kann, besteht darin, die Prozesse zu erklären, durch die wir in der Lage sind, Farben, Klänge und thermische Qualitäten wahrzunehmen, und zu untersuchen, ob andere Tierspezies dieselben perzeptuellen Unterscheidungsvermögen haben. Es ist nicht möglich zu zeigen, dass die Dinge, die wir als farbige wahrnehmen, in Wahrheit keine Farbe haben, oder dass die Dinge, die wir als klangerzeugende wahrnehmen, nicht wirklich Klänge hervorbringen. Man kann zeigen, dass farbige Objekte Licht bestimmter Wellenlängen reflektieren, das unsere Augen und Gehirne in der und der Weise beeinflusst, was dazu führt, dass wir das sehen, was wir ‚ihre Farbe‘ nennen. Und man kann zeigen, dass ‚lärmende‘ Objekte Schallwellen verursachen, die unsere Ohren und Gehirne 199
Eric R. Kandel, James H. Schwartz und Thomas M. Jessell, Essentials of Neural Science and Behaviour (Appleton and Lange, Stamford, CT, 1995), S. 370. Wahrnehmungspsychologen wie I. Rock stimmen tendenziell damit überein: ‚Farben, Töne, Geschmäcke und Gerüche sind auf sensorische Reize zurückgehende mentale Konstruktionen. Sie existieren als solche nicht außerhalb des lebendigen Geistes‘ (Perception (Scientific American Books, New York, 1984), S. 4).
4.2 Wahrnehmung
171
auf eine Weise beeinflussen, dass unser Hörvermögen zur Entfaltung gelangt. Natürlich wird kein Geräusch gehört, wenn nicht Schallwellen die Ohren eines Hörenden erreichen – daraus folgt jedoch nicht, dass es kein Geräusch gab, das zu hören war, dass Bäume still zu Boden fallen, wenn kein Hörender dabei ist. Die wissenschaftliche Forschung zeigt keineswegs, dass Gras nicht wirklich grün ist oder dass Cellos keinen reichen und vollen Klang haben. Sie stellt nicht fest, dass es keine Farben gibt, wenn ein Beobachter ‚fehlt‘, oder dass Klänge auf der Anwesenheit eines Hörers beruhen. Will man herausfinden, ob diese These richtig ist oder nicht, muss man eine sorgfältige Begriffsanalyse der Bedeutung der Prädikate von Sekundärqualitäten anstrengen – das heißt eine Analyse davon, wie diese Ausdrücke gelehrt, gelernt und erklärt werden, wie sie angewendet werden und was logisch aus ihrer Anwendung folgt. Ob farbig sein oder eine Farbe haben eine objektive, nichtrelationale Eigenschaft von Objekten ist, ist eine Frage der Bedeutung. Welche Dinge farbig sein können – das heißt, welche einleuchtende Träger von Farbprädikaten sind –, ist eine a priori logisch-grammatische Frage. Es braucht keine Wissenschaft, uns davon in Kenntnis zu setzen, dass es unsinnig ist, den Zahlen (im Unterschied zu Zahlwörtern) Farben zuzuschreiben, oder dass das, was farbig ist, ausgedehnt sein muss. Welche der Dinge, die farbig sein können, tatsächlich farbig sind, ist eine kontingente Tatsache bzw. Sache des Zufalls und lässt sich experimentell herausfinden, allerdings nicht wissenschaftlich, sondern indem man sieht. Die sekundäre Qualitäten betreffende metaphysische Konzeption ist viel sonderbarer und hat dramatischere Implikationen, als gemeinhin bemerkt wird Zweitens darf man die Sonderbarkeit dieser historischen Konzeption nicht aus dem Blick verlieren. Wenn sie richtig ist, dann unterliegen wir Wahrnehmungstäuschungen. Die Welt, wie sie unabhängig von unserer Wahrnehmung ist, ist grundlegend anders als die Welt, wie sie uns in unserer Wahrnehmung erscheint. Wenn jedoch Farben, Klänge, Gerüche und Geschmäcke „mentale Konstruktionen [sind], die im Gehirn durch sensorische Verarbeitung entstehen“, und wenn sie „als solche nicht außerhalb des Gehirns existieren“, dann ist das, was wir wahrnehmen, wenn wir den goldenen Sonnenuntergang, das blaue Meer und die silbernen Wellen wahrnehmen, lediglich ein geistiges Konstrukt im Gehirn, und was wir beim Dinieren genießen, ist nicht der Geschmack der Speisen, die wir zu uns nehmen, sondern ein geistiges Konstrukt im Gehirn. Die Welt, wie wir sie erfahren, ist weitgehend ein Produkt unserer Vorstellungskraft (oder der ‚Fantasie‘, siehe 6.3) – das heißt unseres Bilderhervorbringungsvermögens. Die Natur, wie sie wirklich ist, unabhängig davon, wie wir sie wahrnehmen, „ist eine öde Sache, geräuschlos, geruchlos, farblos; nur die end- und bedeutungslose Bewegung der Materie“.200 Wir haben es hier
200
A. N. Whitehead, Science and the Modern World, Lowell Lectures 1925 (Mentor Books, New York, 1948), S. 56 [dt. Wissenschaft und moderne Welt (Suhrkamp, Frankfurt a.M, 1988), S. 70].
172
4 Empfindung und Wahrnehmung
mit einer metaphysischen Realitätskonzeption zu tun und nicht mit einer physi(kali) schen. Wir können die Konzeption von der Subjektivität sekundärer Qualitäten in Wirklichkeit nicht glauben und tun es auch nicht Drittens leben wir dieser metaphysischen Position nach in einer Welt der Täuschung – das kann jedoch niemand glauben, auch die Neurowissenschaftler nicht. Durch typische Täuschungen wie die Müller-Lyer- oder die Ponzo-Täuschung bzw. -Illusion, haben sich diese erst einmal als Täuschungen erwiesen, realisieren wir, dass Erscheinungen täuschen können, und wir glauben dann nicht mehr, dass die Dinge so sind, wie sie zu sein scheinen. Aber nicht einmal Neurowissenschaftler glauben wirklich, dass ihre Nasen nicht rot sind, ihr Rasen vor dem Haus nicht grün, dass der Winterschnee nicht weiß ist und Kohle nicht schwarz. Ihr Verhalten erfüllt das Kriterium des Glaubens (nicht das des Nichtglaubens), dass die sie umgebenden Objekte farbig, geräuschvoll, warm oder kalt sind, dass sie Geruch und Geschmack haben. Wie jedermann messen sie den Dingen Farben bei, entscheiden sich für Dinge wegen ihrer Farbe und lehnen andere Dinge ab, weil sie nicht die richtige Farbe haben. Und die Neurowissenschaftler denken auch nicht wirklich, dass all das, was Menschen die Farben der sie umgebenden Dinge betreffend glauben, falsch ist oder keinen Sinn ergibt. Sie haben nicht die Angewohnheit, ihren Ehepartnern oder Freunden zu widersprechen, wenn diese den Objekten Farben zuschreiben, die Farben von Dingen schätzen oder ablehnen, wohingegen sie sich zu regelrecht falschen Äußerungen über gekrümmte Stöcke im Wasser, MüllerLyer-Linien oder die Ponzo-Illusion hinreißen lassen. Weshalb die Konzeption anzuzweifeln ist Die Konzeption des 17. Jahrhunderts ist einflussreich. Nur weil sie in Wissenschaftlerkreisen große Akzeptanz gefunden hat, ist sie jedoch nicht gleich wahr; in Wirklichkeit ist sie äußerst zweifelhaft. Es handelt sich bei ihr überhaupt nicht um eine wissenschaftliche Theorie, und kein Experiment stützt oder bestätigt sie. Sie stellt eine rein philosophische bzw. begriffliche Behauptung dar, und folglich stützt sie sich nur auf apriorische Argumente. Diese Argumente aber sind fragwürdig und strittig. Wenn wir die Sache an dieser Stelle auch nicht abschließend abhandeln können, werden wir doch ein paar Einwände vorbringen – die hoffentlich stark genug sind, um Zweifel aufkommen zu lassen und die Neurowissenschaftler davon abzuhalten, in dieser metaphysischen Angelegenheit unbedacht Farbe zu bekennen.
4.2 Wahrnehmung
173
Die mit der visuellen Wahrnehmung einhergehenden Kausalprozesse zeigen nicht, dass das Wahrgenommene keine vielfarbige Welt ist Dass wir nur dann sehen können, dass ein Objekt rot ist, wenn Licht von seiner Oberfläche auf unsere Retina reflektiert wird, zeigt nicht, dass das Objekt ‚an sich und für sich‘ nicht wirklich rot ist. Es zeigt bloß, dass eine Bedingung für das Sichtbarwerden seiner Farbigkeit darin besteht, dass Licht auf es fällt. Die Tatsache, dass Photonen, die vom erhellten Objekt weg reflektiert werden, Veränderungen in den Proteinmolekülen der Retina verursachen, die ihrerseits wiederum elektrische Impulse zu den Fasern des optischen Nervs überträgt, zeigt gleichfalls nicht, dass das, was wir sehen, nicht wirklich farbig ist, und genauso wenig zeigt sie, dass wir nicht das sehen, was wir unmittelbar sehen. Was wir sehen, ist nicht die Wirkung eines Objekts auf uns. Die Wirkung eines Objekts auf uns besteht in der Anregung der Retinazellen, die Wirkung davon auf den optischen Nerv in der nachfolgenden Erregung der Zellen in den Projektionseinheiten [Hyperkolumnen] des ‚visuellen‘ Streifenkortex – aber nichts davon wird wahrgenommen, weder vom Gehirn (das nichts wahrnehmen kann) noch von der Person, deren Gehirn es ist. Dass wir sehen, ist vielmehr eine Folge der Wirkung erhellter bzw. leuchtender Objekte auf unser visuelles System, und was wir sehen, sind diese Objekte, ist Farbe und dergleichen. Was wir sehen, sehen wir folglich ‚unmittelbar‘ (möglicherweise sieht man etwas ‚mittelbar‘ bzw. nicht direkt, wenn man es durch ein Periskop oder in einem Spiegel sieht – nicht mit den eigenen Augen auf das Ding selbst bei vollem Tageslicht blickt). Es ist also auch verworren anzunehmen, dass, weil es unsinnig ist, den Lichtwellen Farben zuzuschreiben oder den Schallwellen Klänge, was wir sehen, keine Farbe hat, und was wir hören, keinen Klang – dass Farbe und Klang vielmehr in uns sind als ‚geistige, im Gehirn hervorgebrachte Konstruktionen‘. Dieser Gedanke entspringt der Vorstellung, bei dem, was wir empfangen (wie Kandel, Schwartz und Jessell sagen), was uns gegeben ist, handele es sich um elektromagnetische Wellen bestimmter Frequenzen (von denen man nicht sagen kann, dass sie Farben sind) und um Druck- und Schallwellen (die keine Farben sind). Es wird also angenommen, dass zur Wahrnehmung einer Wahrnehmungsqualität diese entweder vom wahrgenommenen Objekt zum Wahrnehmenden übertragen (die in der Antike und im Mittelalter favorisierte intromissionistische Konzeption) oder aber im Wahrnehmenden hervorgerufen werden muss (wie die Theoretiker des 17. Jahrhunderts annahmen und wovon auch unsere Zeitgenossen wie Kandel und seine Kollegen ausgehen). Das ist jedoch verworren. Wir empfangen keine elektromagnetischen Wellen oder Druckwellen – unsere Augen und Trommelfelle sind diesen ausgesetzt. Und obwohl man sagen könnte, dass sie sie ‚empfangen‘, sind diese Reize nicht in dem Sinne gegeben, wie Daten gegeben sind, sondern nur so, wie eine Erkältung gegeben ist bzw. vorliegt. Es handelt sich bei ihnen nicht um Daten, die man interpretieren kann, sondern um bloße neurale Reize. Was uns jedoch gegeben ist, was wir haben, sind Wahrnehmungen von roten, grünen oder blauen Objekten oder Wahr-
174
4 Empfindung und Wahrnehmung
nehmungen von Klängen, Sprache und Musik. Und damit ich ein rotes Objekt wahrnehmen kann, ist es genauso wenig notwendig, dass es etwas Rotes in mir gibt, wie dass etwas in mir explodiert, damit ich eine Explosion wahrnehmen kann. Das Rot der Geranie muss nicht zu mir übertragen werden, damit ich es sehe. Noch muss es in mir hervorgerufen werden. Denn das Rot, das ich sehe, wenn ich die Geranie sehe, ist weder in mir noch in der Geranie. Es ist überhaupt nicht in irgendetwas. Es ist jedoch ein Attribut [von] der Geranie, nicht [von] meiner Wahrnehmung der Geranie. Die Wahrnehmung ist nicht das letzte Glied der Verkettung der Mikromechanismen Eine nächste Verwirrung besteht in der Annahme, das Sehen der roten Geranie sei das letzte Glied einer Kausalkette, die damit beginnt, dass Licht geringer Energie (etwa 700 nm) von der Oberfläche der Blume weg reflektiert bzw. abgestrahlt wird, und die mit der Empfindung einer roten Geranie im Gehirn endet, deren Zustandekommen das Sehen ist. Diese Fehlkonzeption rührt unter anderem daher, dass in ihr die wissenschaftliche Kausalerklärung der Neurophysiologie der Wahrnehmung und die gewöhnliche Beschreibung der Objektwahrnehmung eines Lebewesens vermengt sind. Die Neurowissenschaftler erklären das Ereignis ‚A sieht eine rote Geranie‘ anhand eines Kausalgeschehens, das sich zwischen der Oberfläche der roten Blütenblätter und der Retina des Beobachters abspielt und im Anschluss daran zwischen der Retina des Beobachters und seinem optischen Nerv und so weiter bis zu den Ereignissen im ‚visuellen‘ Streifenkortex. Es verlockt, die Wahrnehmung als das letzte Glied dieser Kausalkette zu betrachten, führt aber in die Irre. Denn eine solche, auf Mikromechanismen bezogene Erklärung der Wahrnehmung von G durch A verbindet Explanandum und Explanans nicht wie die Elemente in einer mikrophysiologischen Kausalkette; und das Explanandum – das heißt A’s Wahrnehmung von G – ist nicht das letzte Glied der Kette. Vielmehr handelt es sich bei der gesamten Verkettung der mikrophysiologischen Ereignisse, die für A’s Wahrnehmung von G konstitutiv ist, um das Explanans. Etwas sehen heißt nicht, eine ‚visuelle Wahrnehmung‘ zu haben Eine nächste Inkohärenz schlägt sich in der Vorstellung nieder, dass das letzte Glied der Kausalkette nicht darin besteht, G wahrzunehmen, sondern vielmehr darin, eine Empfindung von G zu haben. Demnach heißt, G zu sehen, eine Empfindung von G zu haben, die dadurch verursacht wird, dass G Licht auf A’s Retina reflektiert etc. etc. Wer eine anders geartete bzw. verursachte Empfindung von G hat, nehme G nicht wahr, sondern halluziniere es. Aber auch das ist inkohärent. ‚A sah eine rote Geranie‘ beschreibt ein Ereignis, das A, die Geranie und das epistemische Sehverhältnis umfasst, und kein anderes Ereignis – nämlich A’s vorgebliche Empfindung von G –, das sich in A’s Geist oder Gehirn abspielt. Die neuralen Ereignisse, die für das Sehen einer roten Geranie in empirischer Hinsicht konstitutiv sind, vermitteln nicht zwischen der Geranie und einer Emp-
4.2 Wahrnehmung
175
findung im ‚visuellen‘ Streifenkortex. Wie wir weiter unten sehen werden, ist die eigentliche Vorstellung von einer ‚Empfindung‘ einer roten Geranie verworren. Ein Objekt zu sehen heißt nicht, eine wie auch immer geartete Empfindung zu haben. Die Erregung der Retina durch Photoneneinwirkung und die anschließende Erregung des ‚visuellen‘ Streifenkortex etc. sind kausal notwendige Bedingungen dafür, dass eine Person die rote Geranie sehen kann. Das Sehen des Rots der Geranie ereignet sich jedoch gar nicht im Gehirn – es ereignet sich im Garten oder im Zeichenraum; und das, was man sieht, ist eine rote Geranie, keine Rotempfindung, die weder gesehen noch gehabt wird. Neurowissenschaftler sind in Wahrheit der Ansicht verpflichtet, dass wir mit der Zuschreibung von Farben zu Objekten einen Kategorienfehler begehen Festzuhalten ist, dass Neurowissenschaftler, die die galileische/cartesianische Konzeption vertreten, sich genau genommen nicht der Behauptung verschrieben haben, dass die Dinge, die wir üblicherweise als farbige Objekte auffassen, nicht farbig sind. Denn bei den Objekten, von denen wir für gewöhnlich denken, dass sie nicht farbig sind – das heißt keine Farbe haben –, handelt es sich um farblose und durchsichtige Dinge wie beispielsweise eine Fensterscheibe; sie könnten farbig sein und werden es vielleicht. Jene Neurowissenschaftler behaupten aber nicht, dass uns bei unseren alltäglichen Farbzuschreibungen ein Tatsachenirrtum unterläuft und wir den Dingen, die eigentlich farblos sind, Farben zuschreiben. Sie behaupten in Wahrheit vielmehr, dass uns bei unseren alltäglichen Farbzuschreibungen ein offenkundiger Kategorienirrtum unterläuft. Die Objekte, die wir für gewöhnlich als farbige auffassen – beispielsweise Geranien (rot) und Rittersporn (blau) –, könnten nicht farbig sein bzw. keine Farbe haben, denn Farben sind „Empfindungen im Sensorium“ (wie Newton es ausdrückte). Jene Neurowissenschaftler sind der Annahme verpflichtet, dass es unsinnig ist, Objekten in unserer Umgebung Farben zuzuschreiben, genauso unsinnig, wie Zahlen Farben zuzuschreiben oder Propositionen Gerüche. Es ist aber sicherlich bizarr, den Satz ‚Geranien sind rot und Rittersporn ist blau‘ auf derselben Ebene anzusiedeln wie ‚Zwei ist grün und zweiundzwanzig violett‘. Denn der erste Satz ergibt Sinn, der zweite aber ist unsinnig. Rot sein kann nicht anhand von rot aussehen erklärt werden Es ist natürlich verlockend zu versuchen, das Rotsein von etwas zu erklären, indem man sich darauf bezieht, dass es für einen normalen Beobachter unter normalen Beobachtungsbedingungen rot aussieht, und rot aussehen als eine Empfindung zu denken. Ganz abgesehen davon, dass rot aussehen keine Empfindung ist, ist das jedoch abwegig. Denn bei den normalen Beobachtungsbedingungen handelt es sich um genau jene Bedingungen, unter denen farbige Dinge so aussehen, wie sie ‚in Farbe‘ tatsächlich sind, und bei normalen Beobachtern handelt es sich um jene Beobachter, für die farbige Dinge so aussehen, wie sie unter normalen Beobachtungsbedingungen ‚in Farbe‘ sind. Außerdem
176
4 Empfindung und Wahrnehmung
kann man rot sein nicht anhand von rot aussehen erklären, denn die richtige Erklärung des Rotseins von etwas besteht darin, dass es so F aussehen sollte (und hier zeigen wir auf etwas, das rot ist). Genauso wenig, wie man jemanden den Gebrauch von ‚sieht rot aus‘ vor dem Gebrauch von ‚ist rot‘ lehren kann, kann man jemanden den Gebrauch von ‚ist wahrscheinlich F‘ lehren, bevor man ihn mit dem Gebrauch von ‚ist F‘ vertraut gemacht hat. Und schließlich, wenn ‚Rot‘ der Name einer Empfindung im Gehirn wäre, müsste der Rotbegriff mittels einer privaten hinweisenden Definition erklärt werden, und so etwas gibt es, wie wir gesehen haben (3.9), nicht. Wir könnten nicht nur keinen öffentlichen, allgemein geteilten Rotbegriff haben, sondern nicht einmal einen privaten. Neurowissenschaftler brauchen sich den fragwürdigen metaphysischen Begriffen des 17. Jahrhunderts nicht verschreiben, und sie sollten es auch nicht tun Wir behaupten nicht, dass diese Betrachtungen die Apriori-Frage erledigen, ob es sich bei Farben (und anderen sekundären Qualitäten) um objektive Qualitäten der Objekte handelt oder um subjektive Modifikationen unserer Sensibilität. Die Argumentationslage ist komplex und verwickelt.201 Allerdings plädieren wir dafür, dass die kognitiven Neurowissenschaftler eine unwissenschaftliche, metaphysische Konzeption mit zweifelhafter philosophischer Abstammung nicht übernehmen sollten, die auf philosophischen Argumenten beruht, deren Wahrheitsgehalt infrage steht. Diese Empfehlung ist keineswegs trivial, denn die im 17. Jahrhundert entwickelte Konzeption von Realität, davon, was objektiv und was subjektiv ist, von der Natur der Wahrnehmung und ihrer Objekte, hat die Art, wie Gehirnwissenschaftler heutzutage ihre Untersuchungen verstehen, sehr stark beeinflusst. Wer neurowissenschaftlich kohärent argumentieren und erfolgreich forschen will, ist auf diese spezielle philosophische Konzeption nicht angewiesen, und die von Neurowissenschaftlern vorgelegten Berichte über die Resultate ihrer Forschungen würden profitieren, nicht Schaden nehmen, ließen sie diese strittige begriffliche Position beiseite. Sekundäre Qualitäten (wie wir sie wahrnehmen) sind keine Empfindungen Die von den Gründungsvätern moderner Wissenschaft und moderner Philosophie vorgelegte metaphysische Realitätskonzeption zählte Wahrnehmungsqualitäten wie Farben, Gerüche, Geschmäcke und die verschiedenen taktilen Qualitäten zu den Empfindungen. Wenn jedoch der Terminus ‚Empfindung‘ so konzipiert ist, dass er Schmerzen, Stechen, Kitzeln etc. einschließt, dann kann es sich bei diesen Wahrnehmungsqualitäten nicht um Empfindungen handeln. Denn sie gehören einer ganz anderen Kategorie an als die Empfindungen. Rosen, Mohnblumen oder Sonnenuntergänge können rot sein 201
Für eine detaillierte Ausarbeitung siehe P. M. S. Hacker, Appearance and Reality (Blackwell, Oxford, 1987), und aktueller B. Stroud, The Quest for Reality (Oxford University Press, Oxford, 2000).
4.2 Wahrnehmung
177
und also eine Farbe haben, sie haben jedoch keine Empfindungen; Trommeln und Trompeten bringen Klänge hervor, aber keine Empfindungen; und obwohl das Cello einen melodiösen Klang hat, hat es keine melodiöse Empfindung. Eine sekundäre Qualität wahrzunehmen heißt nicht, eine Empfindung dieser Qualität zu haben Schön und gut, könnte man erwidern; gemeint ist jedoch, dass eine sekundäre Qualität wahrzunehmen genau das bedeutet: eine bestimmte Empfindung von dieser Qualität zu haben. Aber auch in diesem Fall haben wir es mit einer abwegigen Auffassung zu tun. Einen roten Apfel zu sehen heißt nicht, irgendeine Empfindung zu haben noch einen Klang zu hören oder einen Geruch zu riechen. Man hat und fühlt Empfindungen in einem Teil seines Körpers, man empfindet normalerweise jedoch nichts in seinen Augen, wenn man etwas sieht, in seinen Ohren, wenn man etwas hört, in seiner Nase, wenn man etwas riecht. Empfindungen können in Wahrnehmungsorganen gehabt werden. Die eigenen Augen können jucken, die eigenen Ohren wehtun – diese Empfindungen gehen jedoch nicht auf die Ausübung des Wahrnehmungsvermögens zurück. Es kann sein, dass Empfindungen in Wahrnehmungsorganen gehabt werden und von deren Gebrauch herrühren. Wenn man in ein blendendes Licht schaut, hat man eine Blendungs-Empfindung und es tun einem manchmal die Augen weh; wenn man ein sehr lautes Geräusch hört, hat man eine Betäubungs-Empfindung. Weit entfernt davon, die Wahrnehmung hervorzurufen, handelt es sich bei diesen Empfindungen um Begleiterscheinungen der Wahrnehmung und um Hindernisse für sie. Eine Farbe ist weder eine Empfindung noch eine Eigenschaft einer Empfindung Wenn rot sehen eine Empfindung wäre und man von den gesehenen Objekten nicht sagen könnte, dass sie rot sind, dann würde sich die Frage stellen, ob das Rot eine Eigenschaft der Empfindung selbst ist. Es ergibt jedoch keinen Sinn, von roten Empfindungen zu sprechen, weil Empfindungen gefühlt und nicht gesehen und Farben gesehen und nicht gefühlt werden. Demnach muss die vermeintliche Empfindung eine Empfindung von Rot sein, nicht eine rote Empfindung. Es ist aber nicht klar, wie man den Begriff einer ‚Empfindung von Rot‘/‚Rotempfindung‘ auszulegen hat. Sollte man ihn dem Modell einer ‚Schmerzempfindung‘ gemäß verstehen? Ein absurder Gedanke, denn eine Schmerzempfindung ist ja gerade ein Schmerz, die vermeintliche Rotempfindung hingegen nicht ‚ein Rot‘. Wird die Rotempfindung gefühlt? Sicherlich nicht, denn wenn man eine Geranie sieht, fühlt man keine Rotempfindung in seinem Gehirn oder sonst irgendwo. Manifestiert sich die visuelle Rotempfindung in irgendeiner charakteristischen Weise im Verhalten, ähnlich den Verhaltensmanifestationen des Schmerzens, Kribbelns und Kitzelns? Nein, man kratzt und reibt sich seinen Kopf nicht oder umsorgt ihn sonstwie, wenn man rote Geranien sieht. Kurzum, etwas Rotes sehen (und sehen,
178
4 Empfindung und Wahrnehmung
dass es rot ist) ist eine Form der Wahrnehmung, nicht der Empfindung. Die Farbe, die man sieht, ist eine Eigenschaft des Gegenstands, den man sieht, keine des ihn Sehens.
4.2.2 Wahrnehmung als Hypothesenbildung: Helmholtz Helmholtz’ Fehlkonzeption, dass alle Wahrnehmung damit einhergeht, Empfindungen zu haben Die Vorstellung, dass Empfindungen wesentliche Konstituenten jeder Form der Wahrnehmung sind, wurde in die Grundüberlegungen moderner neurowissenschaftlicher Wahrnehmungstheorien übernommen: namentlich in das Werk von Hermann von Helmholtz. Seiner Ansicht nach werden physische Reize (die er ‚äußere Eindrücke‘ nennt) zum Gehirn übertragen, wo sie Empfindungen werden.202 Helmholtz betrachtete diese vermeintlichen Empfindungen als das Rohmaterial, aus dem der unbewusste Geist angeblich Wahrnehmungen zusammenfügt. Entsprechende Empfindungen zu haben sei die Vorbedingung dafür, wahrzunehmen. Denn die Empfindungen im Gehirn würden dort kombiniert, um Konzeptionen oder Vorstellungen oder Wahrnehmungen von Objekten zu bilden.203 Ein konfuser Gedanke. Auf Nervenendigungen geleitete physische Reize werden nicht zu Empfindungen: Man kann Photonen und Schallwellen (die physischen Reize) oder neurale Erregungen im Gehirn (die Folgen der Reizung der entsprechenden Nervenendigungen) genauso wenig in Empfindungen umwandeln, wie man Frösche in Prinzen um- bzw. verwandeln kann. Es gibt keine visuellen oder auditiven ‚Empfindungen‘ im Gehirn. Steigender Gehirndruck ruft Empfindungen hervor – und bei diesen handelt es sich um Kopfschmerzen und nicht um Farb-, Geruchs- oder Geschmacksempfindungen. So etwas wie das Kombinieren von Empfindungen, um eine Wahrnehmung zu formen, gibt es genauso wenig wie das Kombinieren von Objekten, um eine Tatsache zu formen. Den Unterschied, der zwischen einer Konzeption und einer Wahrnehmung besteht, kann man sich gar nicht groß genug vorstellen; man kann eine Konzeption von X haben, ohne X wahrzunehmen – sogar auch dann, wenn es sich bei X Hermann von Helmholtz, ‚Die neueren Fortschritte in der Theorie des Sehens‘, ‚The recent progress of the theory of vision‘, wieder abgedr. in der Übers. von R. M. Warren und R. S. Warren (Hg.), Helmholtz on Perception (Wiley, New York, 1968), S. 101. Erwähnenswert ist, dass Helmholtz zugab, unter dem Einfluss der Reflexionen der Philosophen des 17. Jahrhunderts zu schreiben. ‚In den Schriften [. . .] Lockes‘, schrieb er, ‚sind die wichtigsten Prinzipien korrekt festgehalten, auf denen die rechte Deutung der Wahrnehmungsqualitäten beruht‘ (ibid.). Er hat richtig erkannt, dass diese Konzeption das Ergebnis philosophischen Nachdenkens und nicht wissenschaftlichen Experimentierens ist. 203 Ibid., S. 82. 202
4.2 Wahrnehmung
179
nicht um eine wahrnehmbare Entität handelt –, und man kann X wahrnehmen, ohne irgendeine Konzeption davon zu haben, was man wahrnimmt. Helmholtz’ Konzeption der Wahrnehmung als das Resultat unbewussten Schließens ging also in die Irre. Er glaubte, dass wir es bei Wahrnehmungen mit den Konklusionen unbewusster Schlüsse zu tun haben, deren Prämissen unbewusste und (mehr oder weniger) unbeschreibbare Verallgemeinerungen von Verknüpfungen sind, die in der Vergangenheit zwischen Empfindungen und wahrgenommenen Objekten hergestellt wurden. Diese verworrene Vorstellung ist der Dreh-und Angelpunkt der Wahrnehmungstheorie Richard Gregorys, und sie ist unter Neurowissenschaftlern Allgemeingut.204 Wie Gregory behauptet auch Ian Glynn, dass eine Vielzahl von Täuschungen (z. B. die Ponzo-, Kaniza- und die Ames-Raum-Täuschung) im helmholtzschen Sinne erklärbar ist.205 In all diesen Fällen erklärt sich die Täuschung vorgeblich durch das Schließen des Gehirns, das es von seiner zurückliegenden Erfahrung aus vollzieht, um Hypothesen über die Objekte seiner aktuellen Erfahrung zu bilden. J. Z. Young ist der Ansicht, dass wir alles Sehen als die ununterbrochene Suche nach Antworten auf die vom Gehirn aufgeworfenen Fragen betrachten können. Die von der Retina ausgesendeten Signale stellen ‚Botschaften‘ dar, die diese Antworten in sich tragen. Das Gehirn verwendet diese Information, um eine passende Hypothese über das in der Außenwelt Existierende und ein Handlungsprogramm zur Bewältigung der Situation zu entwerfen. Wenn ein hungriger Junge sich umschaut, senden seine Augen vielleicht Signale aus, die auf einen Obstbaum schließen lassen. Die Signale gehen zu den nach Nahrung Ausschau haltenden Augen zurück, und wenn die zurückkehrenden Signale ‚Äpfel‘ anzeigen, beginnt der Junge zu klettern, um sie sich zu greifen und sie zu verspeisen.206
Und Blakemore nimmt an, wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, dass das Gehirn ‚seine Wahrnehmungshypothesen‘ aufgrund der von den Neuronen (die er metaphorisch als Argumente beschreibt) bereitgestellten Information ‚bildet‘ (siehe oben S. 88). Helmholtz’ Konzeption von Wahrnehmungen als Hypothesen des Gehirns kursiert also noch immer in der einen oder anderen Form. Es bestehen allerdings zwingende Einwände gegen sie.
204
Wir können an dieser Stelle die Behauptung, dass Helmholtz’ Konzeption der Wahrnehmung als unbewusster Schluss durch und durch verworren ist, nicht verteidigen. Für detaillierte Kritik siehe P. M. S. Hacker, ‚Helmholtz’s theory of perception‘, International Studies in the Philosophy of Science, 9 (1995), S. 199–214. Für eine Ausarbeitung der Theorie Gregorys siehe idem, ‚Experimental methods and conceptual confusions: an investigation into R. L. Gregory’s theory of perception‘, Iyyun – The Jerusalem Philosophical Quarterly, 40 (1991), S. 289–314. 205 I. Glynn, An Anatomy of Thought (Weidenfeld and Nicolson, London, 1999), S. 194f. 206 J. Z. Young, Programs of the Brain (Oxford University Press, Oxford, 1978), S. 119.
180
4 Empfindung und Wahrnehmung
Wahrnehmen heißt nicht, eine Hypothese zu bilden Erstens bildet man keine Hypothese, wenn man etwas wahrnimmt, und wenn man eine Hypothese bildet, nimmt man nicht irgendetwas wahr. Eine Hypothese ist eine unbestätigte Proposition oder Leitvorstellung, die als provisorische Grundlage für das Folgern oder die Argumentation vorgelegt wird, eine Annahme oder Vermutung zur Erklärung der relevanten Tatsachen. Bei Geranien im Garten sehen handelt es sich nicht um eine Proposition oder Vermutung. Das leicht verständliche Urteil Im Garten gibt es Geranien kann ‚ein Wahrnehmungsurteil‘ genannt werden, wenn es von perzeptuellen Gründen herrührt, in Abgrenzung zu Gerüchten oder Evidenz (z. B. Blütenblätter von Geranien auf dem Teppich). Sehen, dass es im Garten Geranien gibt, könnte man, in einem anderen Sinn, ebenso ein Wahrnehmungsurteil nennen, es handelt sich jedoch gleichfalls nicht um eine Proposition. Es hat keine Gründe, sondern setzt die erfolgreiche Ausübung einer Erkennensfähigkeit voraus (die Fähigkeit nämlich, Geranien zu erkennen). Daraus folgt nicht, dass ein Wahrnehmungsurteil (in einer dieser Sinnhinsichten) eine Hypothese oder eine Vermutung ist – was selbstverständlich auch für unsere alltäglichen Wahrnehmungsurteile gilt. (Dass Wahrnehmungsurteile in erster Linie fehlbare sind, heißt nicht, dass es sich bei ihnen um Hypothesen handelt.) Außerdem kann man etwas wahrnehmen (in Abgrenzung zum Wahrnehmen, dass etwas so und so ist), ohne irgendein Urteil abzugeben und sogar ohne zu wissen, was man wahrgenommen hat. Eine Wahrnehmung – das heißt, eine Person nimmt etwas wahr – ist keine Hypothese, sondern ein Ereignis bzw. ein Geschehen. Menschliche Wesen bilden Hypothesen, Gehirne nicht Zweitens bilden menschliche Wesen Hypothesen und ziehen Schlüsse, nicht ihre Gehirne, wir haben das mehrfach herausgestellt. Es gibt nichts dergleichen wie ein Gehirn, das eine Proposition als Folgerungs- oder Argumentationsgrundlage vorbringt oder aufgrund einer Vermutung handelt. Überdies werden Hypothesen aufgrund von Daten gebildet. Die Daten setzen sich aus Information zusammen, von denen man annimmt, dass sie die Hypothese per Evidenz stützt – das Gehirn aber verfügt nicht über eine solche Information und wäre dazu auch nicht in der Lage. Nicht, weil es nicht clever genug ist, sondern weil es kein solches Etwas ist, das über Information verfügen kann. Eine Wahrnehmung kann (in logischer Hinsicht) nicht die Konklusion eines Schlusses sein Drittens kann eine Wahrnehmung – das heißt, jemand nimmt etwas wahr – genauso wenig die Konklusion eines Schlusses sein, wie ein Rennen gewinnen oder eine Wand erklimmen die Konklusion eines Schlusses sein kann. Dass jemand etwas wahrgenommen hat, kann die Konklusion eines Schlusses sein, wenn die Prämissen beispielsweise darin bestehen, dass er im Besitz eines normal ausgeprägten Sehvermögens ist, dass er mit et-
4.2 Wahrnehmung
181
was konfrontiert wurde, das sowohl sichtbar als auch auffällig war, und dass es nichts gab, was ihn ablenkte. Aber seine Wahrnehmung dessen, was er wahrnahm, kann nicht die Konklusion eines Schlusses sein. Wenn wir wissen, dass die entsprechenden Bedingungen vorherrschen, können wir schließen, dass Jack eine Rose sieht, Jack selbst jedoch schließt nicht, dass er eine Rose sieht, wenn jene Bedingungen vorherrschen: Er sieht die Rose einfach. Schlüsse sind keine Prozesse Viertens sind Schlüsse weder bewusste noch unbewusste Geistesprozesse, denn Schlüsse sind keine Prozesse, sondern einer Regel entsprechende Umformungen von Propositionen, Ableitungen von Propositionen, die einem Ableitungsprinzip gemäß vorgenommen werden. Das Wahrnehmen von etwas geht jedoch mit keiner Umformung von Propositionen einher, weder durch den Wahrnehmenden noch durch sein Gehirn. Man darf Schlüsse (bewusste und unbewusste) nicht mit Annahmen und Vermutungen durcheinanderbringen. Aber noch einmal, das Gehirn nimmt weder irgendetwas an, noch vermutet es irgendetwas – nur Menschen tun das. Und schließlich, selbst wenn wir absurderweise annehmen würden, ein Hypothesen bildendes Gehirn sei eine sinnvolle Vorstellung, bliebe es vollkommen unklar, wie die Bildung einer Hypothese mit der Wahrnehmung von etwas in Zusammenhang stehen soll, eine Unklarheit, die auch nicht von der inkohärenten Behauptung, dass es sich bei Wahrnehmungen um die Resultate unbewusster Schlüsse handelt, aus der Welt geschafft werden könnte. Man kann über das, was man sieht, Hypothesen bilden, sehen aber heißt nicht, Hypothesen zu bilden. Man kann etwas schmecken und eine Vermutung darüber anstellen, worum es sich bei dem Geschmeckten handelt, etwas schmecken aber ist eine Sache, etwas vermuten oder ‚hypothetisieren‘ eine andere.
4.2.3 Visuelle Bilder und das Bindungsproblem Die Fehlkonzeption, dass das, was man sieht oder hört, ein Bild ist (Sherrington, Damasio, Edelman, Crick) Die klassische Auffassung von Vorstellungen und Eindrücken, die als die Resultate des Einflusses der materiellen Welt auf unsere Nervenendigungen betrachtet wurden, liegt dem Gedanken zugrunde, dass Wahrnehmen stets mit Empfindungen einhergeht, bei denen es sich laut Helmholtz’scher Theorie um die Prämissen unbewusster Schlüsse handelt. Sie ist auch der Ursprung des ebenso abwegigen und noch viel beliebteren Gedankens, dass das, was wir sehen (oder hören etc.), wenn wir etwas sehen (oder hören etc.), ein (visuelles oder auditives) Bild oder Vorstellungsbild ist. Es überrascht nicht, dass ein Cartesianer wie Sherrington vorbringt: „Wenn ich meinen Blick himmelwärts
182
4 Empfindung und Wahrnehmung
richte, sehe ich den abgeflachten Himmelsdom und die blendende Sonnenscheibe und darunter hundert andere sichtbare Dinge [. . .] Genau genommen nehme ich ein Bild der mich umgebenden Welt wahr.“207 Überraschender ist es vielleicht festzustellen, dass dieselbe repräsentationalistische Sicht von zeitgenössischen Neurowissenschaftlern verteidigt wird. So ist beispielsweise Damasio folgender Ansicht: Wenn Sie und ich ein Objekt außerhalb unserer selbst betrachten, formen wir in unseren Gehirnen vergleichbare Bilder. [. . .] Das heißt jedoch nicht, dass unser jeweiliges Bild ein Abbild des Objekts in der Außenwelt ist. Wie es tatsächlich beschaffen ist, wissen wir nicht. Das Bild, das wir sehen, beruht auf Veränderungen, die sich in unserem Organismus vollziehen [. . .], wenn die physische Struktur des Objekts mit dem Körper interagiert. [. . .] Das Objekt ist real, die Interaktionen sind real und auch die Bilder sind so real, wie sie nur sein können. Und doch sind die Struktur und die Eigenschaften des Bildes, das wir schließlich sehen, Gehirnkonstruktionen, die durch ein Objekt veranlasst werden. [. . .] Es gibt eine Reihe von Entsprechungen zwischen physischen Merkmalen des Objekts und Reaktionsweisen des Organismus, gemäß denen ein intern erzeugtes Bild konstruiert wird.208
In ähnlicher Weise behauptet Edelman, dass „es sich beim Primärbewusstsein um den Zustand handelt, in dem man sich der Dinge in der Welt geistig bewusst ist – also Vorstellungsbilder in der Gegenwart hat“, und „als menschliche Wesen erfahren wir das Primärbewusstsein als ein ‚Bild‘ oder ein ‚Vorstellungsbild‘ der ablaufenden kategorisierten Ereignisse.“209 Und Crick betont, dass wir [. . .] verstehen [können], wie die entsprechenden Teile des Gehirns das Bild (das Gesichtsfeld) auseinandernehmen, wir wissen aber noch nicht, wie das Gehirn dies alles zusammensetzt, um daraus unsere hochorganisierte Sicht der Welt zu schaffen – das heißt das, was wir sehen. Es scheint, als müsste das Gehirn gewissen Aktivitäten, die sich in verschiedenen seiner Teile abspielen, irgendeine globale Einheit auferlegen, sodass die Eigenschaften eines einzelnen Objekts – seine Gestalt, Farbe, Bewegung, sein Ort und so weiter – auf irgendeine Weise zusammengebracht werden, ohne zugleich mit den Eigenschaften anderer Objekte im Gesichtsfeld durcheinandergebracht zu werden.210
Das ist jedoch verworren. Was man durch den Gebrauch seines Wahrnehmungsorgans wahrnimmt, ist ein Objekt oder eine Reihe von Objekten, Geräuschen und Gerüchen und die Eigenschaften und Beziehungen von Gegenständen der eigenen Umgebung. Es ist ein Irrtum, zu denken, was wir wahrnehmen, sei immer oder auch nur im Allgemei207
C. S. Sherrington, Man on his Nature, zitiert in G. Edelman und G. Tononi, Consciousness: How Matter Becomes Imagination (Allen Lane, The Penguin Press, London, 2000), S. 1 [dt. Gehirn und Geist (Beck, München, 2002), S. 11]. 208 A. Damasio, The Feeling of What Happens (Heinemann, London, 1999), S. 320 [dt. Ich fühle, also bin ich (List, München, 1997), S. 385]. 209 G. Edelman, Bright Air, Brilliant Fire – On the Matter of the Mind (Penguin, Harmondsworth, 1994), S. 112 [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer (Piper, München, 1995), S. 163]. 210 Crick, The Astonishing Hypothesis, S. 22 [dt. Was die Seele wirklich ist, S. 41].
4.2 Wahrnehmung
183
nen ein Bild, oder die Wahrnehmung eines Objekts bestehe darin, ein Bild des wahrgenommenen Objekts zu haben. Man nimmt keine Bilder oder Repräsentationen von Objekten wahr, es sei denn, man nimmt Gemälde oder Fotografien von Objekten wahr. Einen roten Apfel zu sehen heißt nicht, ein Bild eines roten Apfels zu sehen, und eine Sonate zu hören, heißt nicht, das Bild oder die Repräsentation einer Sonate zu hören. Noch heißt es, ein Bild im Geist oder Gehirn zu haben, obwohl man Bilder in seinem Geist heraufbeschwören kann und einem Bilder mitunter unabhängig vom eigenen Wunsch oder Willen in den Sinn kommen. Allerdings sind die Vorstellungsbilder, die wir auf diese Weise heraufbeschwören, nicht sichtbar, weder für uns noch für andere – sie werden ‚gehabt‘, aber nicht gesehen. Und die Melodien, die man in seiner Vorstellung einstudiert, werden nicht gehört, weder von einem selbst noch von anderen. Das Gehirn nimmt weder ein Bild auseinander, noch setzt es eines zusammen Wer behauptet, dass ‚die entsprechenden Teile des Gehirns das Bild auseinandernehmen‘, stellt die Zusammenhänge nicht richtig dar. Die visuelle Szenerie ist kein Bild, obwohl sie ein Bild beinhalten kann, wenn man sich in einer Kunstgalerie befindet. Die elektrochemischen Reaktionen der Stäbchen und Zapfen der Retina auf das Licht, das sie erreicht, verursachen eine Vielzahl an Resonanzen in unterschiedlichen Bereichen des ‚visuellen‘ Kortex, was jedoch als ‚Auseinandernehmen des Bildes‘ nicht zutreffend charakterisiert ist. Und das Gehirn muss auch nicht wieder ‚alles zusammensetzen‘, um unsere Weltsicht zustande zu bringen. Denn unsere ‚Sicht der Welt‘ ist kein Bild der Welt (oder der Szenerie des Sichtbaren), und die Eigenschaften der sichtbaren Dinge vor uns müssen nicht, und können nicht, ‚zusammengebracht‘ werden. Denn Farbe, Form, Ort und Bewegung des sich in einer sanften Brise wiegenden blauen Rittersporns können nicht auseinandergenommen werden (so etwas wie ein Abtrennen dieser Eigenschaften von den Objekten, dessen Eigenschaften sie sind, gibt es nicht), und Farbe, Form, Ort und Bewegung des Rittersporns können nicht im Gehirn zusammengebracht werden, weil diese Eigenschaften nicht im Gehirn zu finden sind, nicht zusammen und nicht voneinander getrennt. Die Tatsache, dass unterschiedliche Zellen an unterschiedlichen Orten gesondert auf Farbe, Form, Ort und Bewegung reagieren, bedeutet nicht, dass diese verschiedenen Reaktionen vereinigt werden müssen, um ein Bild zu formen, denn es soll oder braucht kein Bild geformt werden, um ein sichtbares Objekt zu sehen.211 211
Wenn Neurowissenschaftler die aus dem 17. Jahrhundert stammende Konzeption von primären und sekundären Qualitäten ‚schlucken‘, werden sie allerdings zu denken versucht sein, dass die Objekte im Gesichtsfeld nicht farbig sein können. Dann aber müsste, scheint es, etwas anderes farbig sein, wenn wir eine Geranie sehen – wenn nicht die Geranie selbst, dann das Bild oder das ‚Vorstellungsbild‘ der Geranie im Geist bzw. im Gehirn! Es ist jedoch gar nicht erforderlich, diesen aus dem 17. Jahrhundert stammenden philosophischen Brocken zu schlucken, um die neurale Natur der Wahrnehmung zu untersuchen.
184
4 Empfindung und Wahrnehmung
Fehlkonzeptionen über das Bindungsproblem (Kandel, Wurtz, Crick) Genau diese Konfusion durchdringt die von Neurowissenschaftlern vorgelegte Charakterisierung des ‚Bindungsproblems‘. Eric Kandel und Robert Wurtz erklären, interessanterweise in einer Auseinandersetzung mit dem Titel ‚Constructing the visual image‘, dass ‚die Information über‘ (d. h. vermutlich, die elektrochemische Reaktionen auf ) Form, Bewegung und Farbe auf parallel verlaufenden Nervenbahnen übertragen wird. Das, so behaupten sie, ruft das Bindungsproblem hervor: Wie wird die auf voneinander unabhängigen Nervenbahnen übertragene Information zu einem kohärenten visuellen Bild zusammengefügt? Wie konstruiert das Gehirn von sensorischer Information aus eine wahrgenommene Welt und wie bringt sie diese ins Bewusstsein? [. . .] was das visuelle System eigentlich leistet, [ist], eine dreidimensionale Wahrnehmung der Welt zu erschaffen, die sich von dem auf die Retina projizierten zweidimensionalen Bild unterscheidet.212
Das ist prima facie verwirrend, weil das Gehirn keine ‚wahrgenommene Welt konstruiert‘, sondern das Lebewesen befähigt, eine sichtbare Szenerie zu sehen. Außerdem bringt das Gehirn keine ‚dreidimensionale Wahrnehmung‘ hervor, die sich vom ‚zweidimensionalen Bild‘ auf der Retina unterscheidet. Es verleiht dem Lebewesen das räumliche Sehen, die Fähigkeit aber, Raumtiefe visuell zu erfassen, unterscheidet sich weder von einer invertierten Retinaspiegelung (die für das Sehen ohnehin nur eine untergeordnete Rolle spielt), noch ist sie mit ihr identisch – sie ist etwas kategorial anderes.213 Man sollte meinen, dass diese fehlerhafte Beschreibung keinen Eingang in die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Bindungsproblem gefunden hat. Aber weit gefehlt. Kandel und Wurtz fahren nämlich fort:
E. R. Kandel und R. Wurtz, ‚Constructing the visual image‘, in Kandel, Schwartz und Jessell (Hg.), Principles of Neural Science, S. 492. 213 Man kann nicht fragen und dabei verständlich sein, ob eine Spiegelung der Fähigkeit, Raumtiefe visuell zu unterscheiden oder der Ausübung dieser visuellen Fähigkeit ähnelt. Es ist auch nicht gestattet, eine Spiegelung, im Gegensatz zur Spiegelungsoberfläche, als zweidimensional zu charakterisieren. Was in einem Spiegel zu sehen ist, ist kein Bild (Abbild oder Repräsentation) von etwas, sondern die Sache selbst – im Spiegel reflektiert. (Ein Bild in dem Sinn, in dem es sich bei einem Gemälde um ein Bild handelt, muss beleuchtet sein bzw. angestrahlt werden, damit es gesehen werden kann, um jedoch ein Objekt in einem Spiegel zu sehen, muss man das Objekt beleuchten, nicht den Spiegel.) Wenn also das, was reflektiert wird, dreidimensional ist, dann ist das, was im Spiegel zu sehen ist, auch dreidimensional. Die (Wider-)Spiegelung der Szenerie des Sichtbaren auf der Retina ist also kein zweidimensionales Bild, weil sie genau betrachtet weder ein Bild noch zweidimensional ist! Sie ist weder hier noch da, weil weder die Person noch ihr Gehirn sie sehen können, und nicht das sogenannte Retinalbild (das reflektierte Licht) ermöglicht uns zu sehen, was wir sehen, sondern das Licht, das von der Retina aufgenommen wird. 212
4.2 Wahrnehmung
185
Wie wird Information über Farbe, Bewegung, Tiefe und Form, die über voneinander unabhängige Nervenbahnen befördert werden [sic], zu kohäsiven Wahrnehmungen ausgestaltet? Wenn wir ein eckiges violettes Behältnis sehen, kombinieren wir die Eigenschaften der Farbe (violett), der Form (eckig) und der räumlichen Ausdehnung (Behältnis) zu einer Wahrnehmung. Genauso gut können wir das Violett mit einem runden Behältnis, einem Hut oder einer Jacke kombinieren. [. . .] typischerweise setzen sich visuelle Bilder aus den Inputs der parallel verlaufenden Nervenbahnen zusammen, die unterschiedliche Merkmale verarbeiten – Bewegung, Tiefe, Form und Farbe. Um die spezifische Kombination von Eigenschaften im Gesichtsfeld in jedem bestimmten Moment auszudrücken, müssen unabhängige Zellgruppen zeitweilig in eine Gemeinschaftsverbindung überführt werden. Es muss demzufolge einen Mechanismus geben, durch den das Gehirn die Information, die von unterschiedlichen Zellbeständen in unterschiedlichen kortikalen Bereichen selbständig verarbeitet wird, vorübergehend verbindet. Dieser bislang nicht eingehender herausgearbeitete Vorgang wird Bindungsmechanismus genannt.214
Solche verworrenen Darlegungen des sogenannten Bindungsproblems sind weit verbreitet. Francis Crick betont in seiner Erörterung des Bindungsproblems, dass jedes spezifische Objekt im Gesichtsfeld zu jedem gegebenen Zeitpunkt ‚repräsentiert wird von‘ (d. h. in kausaler Beziehung steht mit) dem Feuern einer Reihe von Neuronen, die in verschiedenen ‚visuellen‘ Arealen (für Form, Farbe, Bewegung etc.) verteilt sind. Wir nehmen das Objekt als eine Einheit wahr. Wenn man also wie Crick davon ausgeht, dass „[e]in auffallendes Merkmal unseres inneren Bildes der visuellen Welt [. . .] dessen gute Organisation [ist] [. . .], wir die Dinge im Raum selten durcheinanderbringen, wenn wir sie unter normalen Bedingungen sehen“,215 oder wenn man wie Kandel und Wurtz davon ausgeht, dass das, was wir wahrnehmen, visuelle Bilder sind, dann gibt es tatsächlich ein ‚Bindungsproblem‘. Denn wenn das Wahrnehmen ein inneres Bild oder ein Vorstellungsbild der äußeren Szenerie einbegreift, dann muss das Bild konstruiert und das Vorstellungsbild ‚zusammengesetzt‘ werden. Und man könnte sich durchaus fragen, wie das Gehirn solche kohärenten (Vorstellungs-)Bilder hervorbringt, die die Gestalt, Bewegung, Tiefe und Farbe des wahrgenommenen Gegenstands auf die richtige Weise verbindet und sie nicht ‚durcheinanderwürfelt‘. Die aktuelle Konzeption des Bindungsproblems ist verworren Selbstverständlich sollten die Zellen, die auf Bewegung reagieren, jene, die auf Form reagieren, und jene, die auf Farbe reagieren, besser (mehr oder weniger) gleichzeitig aktiv sein, ansonsten wird die Person oder das Tier kein farbiges, sich bewegendes Objekt der jeweiligen Form sehen (bzw. die Asynchronität spiegelt sich einfach in einer entsprechenden Wahrnehmungsverzögerung wider). Und die gleichzeitige Aktivität dieser Zellgruppen Kandel und Wurtz, ‚Constructing the visual image‘, S. 502. Crick, The Astonishing Hypothesis, S. 232, unsere Hervorhebungen [dt. Was die Seele wirklich ist, S. 285]. 214 215
186
4 Empfindung und Wahrnehmung
sollte in irgendeiner Weise mit den Zentren, die Erkennen, Bewegung und Koordinierung steuern, verbunden sein. Soviel scheint klar zu sein. Und tatsächlich bestand der erste Erfolg, was die Ermittlung der beteiligten Prozesse angeht, in der auf Wolf Singer, Charles Gray und ihre Kollegen zurückgehenden Entdeckung der 40-Hertz-Schwingungen neuronaler Entladung in unterschiedlichen Neuronen in unterschiedlichen Gehirnbereichen, die am Sehvorgang beteiligt sind.216 Dennoch ist davon auszugehen, dass die Konzeption des Bindungsproblems, der sich gegenwärtig viele Neurowissenschaftler verschrieben haben, verworren ist. Verwirrungen über Information Unabhängige Nervenbahnen tragen Information über Farbe, Form, Bewegung etc. nicht in logisch-semantischem, sondern bestenfalls in informationstheoretischem Sinne weiter. Information kann in keinem Sinn von ‚Information‘ zu ‚kohäsiven Wahrnehmungen‘ ‚ausgestaltet‘ werden. Im logisch-semantischen Sinn handelt es sich bei Information um eine Reihe wahrer Propositionen, und wahre Propositionen können nicht zu Wahrnehmungen ausgestaltet werden (d. h. zum Wahrnehmen von etwas durch eine Person). Im technischen Sinn ist ‚Information‘ ein Maß für die Wahlfreiheit bei der Übermittlung eines Signals, und die Informationsmenge wird durch den Logarithmus zur Basis 2 der Zahl der zur Verfügung stehenden Wahlmöglichkeiten ermittelt – und auch das ist nichts, was zu Wahrnehmungen ‚ausgestaltet‘ werden kann. Man kann Farbe, Form und Ausdehnung nicht zu Wahrnehmungen kombinieren bzw. in solche zusammenziehen, genau wie man Ereignisse nicht in Löcher stecken kann – das ergibt keinen Sinn. Wenn wir ein quadratisches violettes Behältnis sehen, ‚kombinieren‘ wir folglich nicht Violett, Eckigkeit und ‚Behältnishaftigkeit‘ – denn auch hierunter kann man sich nichts Sinnvolles vorstellen. Es trifft zu, dass zum Sehen eines farbigen, sich bewegenden Objekts von bestimmter Form unterschiedliche Neuronengruppen gleichzeitig aktiv sein müssen. Daraus folgt jedoch nicht, dass das Gehirn im logisch-semantischen Sinn von Information unterschiedliche Informationsbits ‚verbinden‘ muss, und es könnte auch gar nicht folgen, weil Gehirne es nicht vermögen, aufgrund von Information zu agieren oder Informationsbruchstücke zu verbinden. Ob das Gehirn in einem gewissen Sinn, der zu klären wäre, Informationen im informationstheoretischen Sinn ‚verbindet‘, ist eine andere Frage. Wenn es das tut, dann jedoch nicht, weil die Merkmale der wahrgenommenen Objekte ‚im Gehirn kombiniert‘ werden müssen, denn das ist Unsinn. C. M. Gray und W. Singer, ‚Stimulus-specific neuronal oscillations in orientation colums of cat visual cortex‘, Proceedings of the National Academy of Science, USA, 86 (1989), S. 1698–1702, und C. M. Gray, P. König, A. K. Engel und W. Singer, ‚Oscillatory responses in cat visual cortex exhibit inter-columnar synchronization which reflects global stimulus properties‘, Nature, 338 (1989), S. 334–337. 216
4.2 Wahrnehmung
187
Damit ein Lebewesen sehen kann, ist es weder nötig noch möglich, dass sein Gehirn ein visuelles oder ein inneres Bild aufbaut Ein Objekt zu sehen heißt vor allem weder, ein Bild eines Objektes zu sehen, noch, ein solches zu konstruieren. Der Grund, weshalb die verschiedenen Neuronengruppen gleichzeitig feuern müssen, wenn eine Person ein farbiges dreidimensionales Objekt in Bewegung sieht, ist nicht darin zu suchen, dass das Gehirn ein visuelles Bild zusammenzusetzen oder ein Vorstellungsbild der Objekte im Gesichtsfeld zu erzeugen hat. Damit wir einen Baum sehen können, muss das Gehirn nicht den Stamm, die Äste und Zweige oder die Farbe und die Form oder die Form und die Bewegung des Baumes verknüpfen (was es gar nicht könnte). Man kann einen Baum klar und deutlich oder unklar und undeutlich sehen, und man kann für seine Farbe und Bewegung empfänglich sein, oder man kann an der einen oder anderen Form der Farbenblindheit oder der visuellen Bewegungsagnosie leiden. Welche neuronalen Gruppen gleichzeitig aktiv sein müssen, um das optimale Sehen zu bewerkstelligen, welche Form diese Aktivität annehmen kann und wie sie mit anderen Gehirnbereichen verbunden ist, die in kausalem Zusammenhang mit der Kognition, dem Erkennen und Handeln als auch mit der Koordinierung von Sehen und Bewegung stehen – all das muss von Neurowissenschaftlern untersucht werden. Weil einen Baum sehen nicht bedeutet, ein inneres Bild eines Baumes zu sehen, muss das Gehirn keins hervorbringen. Es muss bloß normal funktionieren, sodass wir in der Lage sind, klar und deutlich zu sehen. Es muss kein Bild auseinandernehmen, weil es sich weder bei der visuellen Szenerie noch dem auf die Retina fallenden Lichtspektrum um Bilder handelt. Es muss kein Bild wieder zusammensetzen, denn das, wozu es uns verhilft, besteht darin, einen Baum (nicht ein Bild eines Baumes) im Garten (nicht im Gehirn) zu sehen. Verwirrungen über Repräsentationen (Barlow) Die Neuron-Konzeption der Wahrnehmung beförderte den Glauben, dass die Nervenbahnen, die in einer bestimmten sensorischen Konstellation aktiv sind, sich annähern und für Aktivität in einer einzelnen Zelle (einer Papst- bzw. ‚Großmutter‘-Zelle) oder in Zellgruppen (Kardinal-Zellen) sorgen, „deren Rolle darin besteht, diese Konstellation zu repräsentieren“.217 Die Vorstellung rührt zumindest zu einem Teil von dem Gedanken her, dass das Gehirn des Lebewesens, wenn dieses sehen können soll, die von der Retina herkommende Information kombinieren muss, um eine Repräsentation der visuellen Szenerie hervorzubringen. Zweifellos haben die philosophischen Vorannahmen des Repräsentationalismus Verwirrung gestiftet. Der Terminus ‚Information‘ wurde nicht eindeutig verwendet, was sicherlich auch für den Terminus ‚Repräsentation‘ zutrifft. Das Siehe Horace Barlow, ‚The neuron doctrine in perception‘, in M. S. Gazzaniga (Hg.), The New Cognitive Neurosciences, 4. Aufl. (MIT Press, Cambridge, MA, 1997), S. 421. 217
188
4 Empfindung und Wahrnehmung
zeigt sich beispielsweise in der Behauptung Horace Barlows, dass die hypothetisch angenommenen Kardinalzellen „keine arbiträren oder belanglosen Umgebungsmerkmale repräsentieren, sondern solche, die für ihre Repräsentationsfunktion nützlich sind“, und dass sie in Verbänden aktiv sein können und „derart etwas von der Beschreibungskraft von Worten haben“,218 wobei der Ausdruck ‚Repräsentationsfunktion‘ wohl „ihre Rolle als Korrelationen der Merkmale der wahrgenommenen Objekte“ meint. In diesem Kausalsinn von ‚Repräsentation‘ könnte eine Repräsentation jedoch nichts von der Beschreibungskraft der Worte haben. Denn die Erregung einer Zellgruppe repräsentiert ein bestimmtes Merkmal des Gesichtsfeldes in dem Sinne, in dem ein großer Jahresring ein Jahr mit ausgiebigen Regenfällen repräsentiert, und das hat rein gar nichts mit dem lexikalischen oder logisch-semantischen Sinn zu tun, in dem ein Satz den Sachverhalt, den er beschreibt, repräsentiert, oder mit dem ikonischen Sinn, in dem ein Gemälde das repräsentiert, was es mit malerischen Mitteln abbildet. Alles wird noch unklarer, wenn nicht nur behauptet wird, dass das Gehirn eine Repräsentation der Außenwelt liefert, sondern auch, dass wir eine Repräsentation der Welt sehen: Normalerweise wird das Verhalten analysiert, indem man das, was das Gehirn tut, in zwei Bereiche aufteilt: Sensorische Botschaften werden dazu verwendet, eine Repräsentation der Außenwelt zu erstellen, wie wir sagen, und das Gehirn verwendet diese Repräsentation dann dazu, einen Handlungsablauf zur Durchsetzung seiner Ziele zu erstellen. Das scheint sich von selbst zu verstehen, weil wir uns mit der Vorstellung narren, dass wir eine unmittelbare Repräsentation der Welt wahrnehmen und einfach nach Maßgabe dessen, was diese Repräsentation zeigt, Entscheidungen treffen, doch schon elementarste wahrnehmungspsychologische Kenntnisse verdeutlichen, dass es sich keineswegs um eine unmittelbare Repräsentation handelt. [. . .] wenn diese in Erscheinung tritt, hat das Gehirn einen Großteil seiner Mutmaßungsleistung bereits erbracht.219
Eine verworrene Vorstellung, mit der wir es hier zu tun haben. Weder im ikonischen noch im lexikalischen Sinn könnte es irgendeine Repräsentation der Außenwelt im Gehirn geben. Das Gehirn kann weder eine Entscheidung treffen noch unentschlossen sein; und es kann auch nicht mutmaßen. Wenn menschliche Wesen ihre Umgebung wahrnehmen, nehmen sie nicht Repräsentationen der Welt wahr, weder unmittelbar noch irgendwie anders, weil die Welt wahrzunehmen (oder genauer gesagt, irgendeinen Teil von ihr) nicht bedeutet, eine Repräsentation wahrzunehmen. (Eine Fotografie oder ein Gemälde wahrzunehmen bedeutet, eine Repräsentation wahrzunehmen.) Und welchen Legitimationssinn man der Annahme, dass es eine Repräsentation des Gesehenen im Gehirn gibt, auch immer verleihen mag, bei dieser Repräsentation handelt es sich nicht um das, was der Besitzer des Gehirns sieht. Der Terminus ‚Repräsentation‘ ist ein Unkraut im Garten der Neurowissenschaften, kein Werkzeug – und je eher man es samt Wurzel entfernt, desto besser. 218 219
Ibid., S. 422. Ibid., S. 429.
4.2 Wahrnehmung
189
4.2.4 Wahrnehmung als Informationsverarbeitung: Marrs Theorie des Sehens Marrs Konzeption der Wahrnehmung als Informationsverarbeitung Helmholtz’ Konzeption der Wahrnehmung als eine Angelegenheit unbewusster Hypothesenbildung ist ein abwegiger Plausibilisierungsversuch. Eine Analogie zu dieser aus dem 19. Jahrhundert herrührenden Verwirrung bildet die Computerkonzeption der Wahrnehmung aus dem späten 20. Jahrhundert. Die anspruchsvollste Version wurde von David Marr ausgearbeitet, der „sich eine Betrachtungsweise zu eigen machte, die die visuelle Wahrnehmung als ein Informationsverarbeitungsproblem auffasste.“220 In dem auf die Retina fallenden Lichtspektrum (auf das er sich als ein ‚Bild‘ bezieht) erkennt er den Informationsinput, und die Hervorbringung effizienter und nützlicher symbolischer Beschreibungen der sichtbaren Objekte fasst er als Output auf. Für David Marr ist „das Sehen [. . .] der Prozess, von Bildern ausgehend zu entdecken, was es in der Welt gibt und wo es sich befindet“.221 Es ist der Prozess der Umwandlung der in einem Bild enthaltenen Information in eine explizite Beschreibung des Gesehenen. Marrs Konzeption des Gehirns, das mit einem Symbolsystem operiert, um Beschreibungen zu erzeugen Marr fasste das Gehirn so auf, als wende es ein System von Merkmale eines Bildes repräsentierenden Symbolen an, um Beschreibungen zu erzeugen. Das Gehirn könne im letzten Stadium des visuellen Prozesses durch eine Reihe von Rechenoperationen mit diesem Symbolsystem eine Beschreibung von Objektgestalten, von deren Entfernung, Anordnung und Identität hervorbringen. Vom ‚Bild‘ aus konstruiert das Gehirn angeblich eine primäre Skizze, welche die Veränderungen der Lichtintensität in dem ‚Bild‘ darstellt, von dieser ersten Skizze aus konstruiert es dann eine 2½-D-Skizze, welche die Oberflächenanordnungsverhältnisse in einer Szenerie repräsentiert. Wir haben es hier mit einer Seher-zentrierten Beschreibung der Strukturen in der Welt zu tun. Außerdem nimmt er an, dass ein Bild-Raum-Prozessor mit der 2½-D-Skizze operiert und sie mithilfe eines abgespeicherten Katalogs von 3-D-Modell-Beschreibungen in objektzentrierte Koordinaten einer auf Achsen bezogenen strukturellen 3-D-Beschreibung umwandelt. Marrs Theorie ist, wie er selbst einräumte, eine Erweiterung der Repräsentationstheorien des Geistes, denen zufolge die Sinne hauptsächlich damit beschäftigt sind, einem mitzuteilen, was es in der Welt gibt. Die modernen Repräsentationstheorien des Geistes gehen davon aus, dass er D. Marr, ‚Visual information processing: the structure and creation of visual representations‘, Philosophical Transactions of the Royal Society, B 290 (1980), S. 203. 221 D. Marr, Vision, a Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information (W. H. Freeman, San Francisco, 1980), S. 3. 220
190
4 Empfindung und Wahrnehmung
Zugang zu den internen Repräsentationssystemen hat; um die Geisteszustände zu charakterisieren, bringt man das zur Geltung, was die internen Repräsentationen in dem nämlichen Moment repräsentieren, und um Aufschluss über die Natur der bewussten Prozesse zu geben, zeigt man auf, wie solche Repräsentationen zustande kommen und wie sie in Wechselwirkung miteinander stehen.222
Dieses Schema, folgerte er, „bietet unserer Erforschung der visuellen Wahrnehmung einen komfortablen Rahmen, und ich bin damit einverstanden, es zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen zu machen“. Wir sind der Ansicht, dass dieser Rahmen unzureichend ist und dass keine seriöse Untersuchung des Sehens von Lebewesen hier ihren Ausgang nehmen sollte. (Das schließt natürlich nicht die Möglichkeit aus, dass es neurale Analogien zu manchen Elementen gibt, die wir in Maschinen einbauen, welche dazu geschaffen wurden, visuelle Aufgaben ohne Sehen auszuführen.) Marrs Fehlkonzeption über das Sehen Zu sehen heißt nicht, irgendetwas von einem Bild oder einem auf die Retina fallenden Lichtspektrum aus zu entdecken. Denn man kann, in diesem Sinne, nichts von irgendetwas aus entdecken, das man nicht wahrnehmen kann (nicht das Lichtspektrum, das auf unsere Retina fällt, nehmen wir wahr, vielmehr das, was dieses Lichtspektrum uns wahrzunehmen ermöglicht, worum es sich dabei auch immer handeln mag). Das Lichtspektrum ist keine Informationseinheit, kein Informationsbruchstück, von dem aus man irgendetwas ableiten oder schließen könnte; und das Gehirn zieht keine Schlüsse aus Information, denn in dem Sinn, in dem Information Prämissen für Schlüsse bereitstellt, hat das Gehirn keine Information und es könnte sie ohnehin nicht verstehen. Nicht alles Sehen ist ein Entdecken (wenn man liest, was man geschrieben hat, kann man eigene Fehler entdecken, man entdeckt jedoch nicht, was man geschrieben hat; wenn man in einer Unterhaltung zu seinem Gesprächspartner aufsieht, entdeckt man nicht, dass er da ist). Und obwohl das Sehen mit neuralen Prozessen einhergeht, ist es selbst kein Prozess (genau wie das Mitteilen der Zeit selbst kein Prozess ist, obgleich die Zeitanzeige einer alten Uhr mit mechanischen Bewegungsprozessen einhergeht). Beobachten, Zuschauen, Mustern mögen Prozesse oder Aktivitäten sein, Sehen, Entdecken, Bemerken oder Erblicken sind keine. Marrs Fehlkonzeption über Repräsentation und Beschreibung Marr behauptete, dass, „wenn wir zu wissen imstande sind, was sich wo in der Welt befindet, unsere Gehirne irgendwie in der Lage sein müssen, diese Information zu reprä-
222
Ibid., S. 5.
4.2 Wahrnehmung
191
sentieren“.223 Wie bereits deutlich geworden sein sollte, gibt es jedoch nichts dergleichen wie ein Repräsentieren bzw. Darstellen von Information durch das Gehirn in der umgangssprachlichen Bedeutung dieser Worte (und es ist offenkundig, dass Marr genau die für seine Argumentation benötigt224). Darüber hinaus ist die Annahme unverständlich, dass es eine symbolische Beschreibung der visuellen Szenerie im Gehirn gibt.225 Eine 223 Ibid., S. 3. J. S. Frisby behauptet ähnlich, dass ‚es [. . .] innerhalb unserer Köpfe Symbole für die Dinge, die wir sehen, geben [muss]. [. . .] Es ist ein zwingender Schluss, dass es eine symbolische Beschreibung der Außenwelt im Gehirn geben muss, eine Beschreibung in Symbolen, die für die verschiedenen Weltaspekte, mit denen das Sehen uns vertraut macht, stehen. [. . .] Die Welt, die wir sehen [. . .] ist so unbezweifelbar „da draußen“, dass man fast einen Schock erleidet, wenn man realisiert, dass sie als Ganze irgendwie in unseren Schädeln steckt, und zwar als interne Repräsentation, die für die reale Außenwelt steht‘ (Seeing: Illusion, Brain and Mind (Oxford University Press, Oxford, 1980), S. 8f.). Ähnliche Fehlkonzeptionen werden bei Crick evident: ‚Das Gehirn muss eine symbolische Beschreibung auf einer höheren Stufe erzeugen, vermutlich auf mehreren höheren Stufen. [. . .] Was das Gehirn demnach entwickeln muss, ist eine vielstufige Interpretation der visuellen Szenerie – eine Interpretation, die normalerweise von Objekten, Ereignissen und ihrer Bedeutung für uns handelt. [. . .] Wenn etwas explizit symbolisiert worden ist, dann kann diese Information ohne Weiteres verfügbar gemacht werden, sodass sie entweder für weitere Informationsverarbeitung oder für das Handeln verwendbar ist. Neurologisch gesehen bedeutet ‚explizit‘ vermutlich, dass die Nervenzellen so feuern müssen, dass die entsprechende Information durch die Art des Feuerns nahezu direkt symbolisiert wird. Mithin ist es plausibel, dass wir eine explizite, mehrstufige symbolische Interpretation der visuellen Szenerie brauchen, um sie zu ‚sehen‘. Vielen Menschen fällt es schwer zu akzeptieren, dass das, was sie sehen, eine symbolische Interpretation der Welt ist – es wirkt doch alles so wie ‚die Sache selbst‘. Doch in Wirklichkeit haben wir keine direkte Kenntnis von den Objekten in der Welt‘ (Crick, The Astonishing Hypothesis, S. 33 [dt. Was die Seele wirklich ist, S. 54]). 224 Und zwar zeigt sich das, wie wir in 3.2 dargelegt haben, in dem, was Marr über Repräsentationen sagt, und in den Schlüssen, die er von seiner Zuschreibung von Repräsentationen zum Gehirn zieht. Marr meinte mit ‚Repräsentation‘ nicht bloß ein kausales Korrelat von etwas, denn seiner Ansicht nach handelt es sich bei symbolischen Beschreibungsarten (wie der römischen, arabischen und der Binärschreibweise in der Arithmetik) um Repräsentationen bzw. Darstellungen, wir alle verwenden stets Repräsentationen, um die Dinge zu beschreiben – und diese Behauptungen leuchten nur dann ein, wenn Marr an Repräsentationen/Darstellungen auch im logischsemantischen Sinn des Terminus denkt und diesen mit dem kausalen Sinn durcheinanderbringt. 225 Simon Ullman erklärt, dass wir, ‚wenn wir sagen, eine Sache könne als ein symbolisches System aufgefasst werden, implizieren, dass einige (aber nicht alle) Ereignisse innerhalb des Systems konsistent als solche interpretiert werden können, die in einer bestimmten Hinsicht etwas bedeuten‘. Demnach ‚können einige der Ereignisse im Gehirn hinsichtlich Tiefe, Oberflächenanordnung, Reflexionsgrad und dergleichen konsistent interpretiert werden‘ (‚Tacit assumptions in the computational study of vision, in A. Gorea (Hg.), Representations of Vision, Trends and Tacit Assumptions in Vision Research (Cambridge University Press, Cambridge, 1991), S. 314). Wenn Ullman das ‚ein symbolisches System‘ nennen möchte, wird ihn selbstredend nichts und niemand davon abhalten können. Wie Humpty Dumpty mit ‚there’s glory for you‘, womit er meint ‚there’s
192
4 Empfindung und Wahrnehmung
Beschreibung ist ein Gebilde aus Worten oder Symbolen, ein Satz, der einer Proposition, die eine Reihe von Merkmalen eines Objekts, Ereignisses oder Sachverhalts anführt, Ausdruck verleiht. Sie kann wahr oder falsch sein, genau oder ungenau, detailliert oder eher grob. Beschreibungen werden von Vorschriften, Fragen, Empfehlungen und Ausrufen unterschieden. Eine symbolische Beschreibung kann niedergeschrieben oder ausgesprochen werden; sie kann zum Zweck der Geheimhaltung oder dem der Übertragung verschlüsselt werden. So etwas wie eine Beschreibung im Gehirn gibt es jedoch nicht. Ein Muster von neuralen Entladungen, bei dem es sich um eine kausale Reaktion auf einen Reiz im Gesichtsfeld handelt, ist keine Beschreibung des Reizes oder von sonst irgendetwas. Denn Muster neuraler Entladungen sind ebenso keine Symbole, wie Jahresringe in einer Eiche oder Moleküle in einem der Kohlenstoffdatierung unterworfenen Material keine sind. Die logischen Ansprüche an Symbole Damit etwas ein Symbol (mit Bedeutung) sein kann, muss es einen regelgeleiteten Gebrauch aufweisen. Es muss eine richtige und eine missbräuchliche Weise seines Gebrauchs geben. Es muss über eine Grammatik verfügen, die seine verständlichen Möglichkeiten der Kombination mit anderen Symbolen festlegt und von Bedeutungserklärungen erhellt wird, die innerhalb einer Sprachgemeinschaft Verwendung finden und akzeptiert sind. Es kann keine Symbole im Gehirn geben, das Gehirn kann keine Symbole verwenden und kann mit einem Symbol nicht irgendetwas meinen oder sagen wollen (aber natürlich können neurale Ereignisse bestimmte andere Ereignisse ‚meinen‘ bzw. bedeuten – d. h. in kausalem Zusammenhang mit ihnen stehen –, in dem Sinn, in dem da, wo Rauch ist, auch Feuer ist). Ein Symbol wird nur dann verwendet, wenn derjenige, der es verwendet, etwas damit meint – Gehirne vermögen das allerdings nicht zu tun. Etwas mit einem Symbol sagen zu wollen heißt, die Absicht zu haben, mit dem Symbol diesen und jenen Sachverhalt auszudrücken – Gehirne können jedoch keine Absichten haben. Marrs Fehlkonzeption über den ‚Output‘ des visuellen Systems Wir werden Marrs scharfsinnige Analyse der Bedingungen für die Ableitung eines Bildes aus einem Lichtspektrum nicht untersuchen, eine Analyse, die sich für das Design a nice knock-down argument‘ [wenn das kein schlagender Beweis ist], meint Ullman mit dieser Wendung natürlich nicht das, was sie bedeutet. Wenn er sich jedoch darauf versteift, dass es das ist, was er damit meint – gut. Die entscheidende Frage ist, ob er, was seine Überlegungen angeht, in Erinnerung behält, dass es alles ist, was er meint, und keine Schlüsse zieht, die auf der Alltagsbedeutung der Wendung ‚ein symbolisches System‘ beruhen. Allerdings zieht Marr von den Repräsentationszuschreibungen aus Schlüsse, die auf der Alltagsbedeutung des Ausdrucks beruhen.
4.2 Wahrnehmung
193
von Maschinen eignet, die visuelle Aufgaben ausführen können.226 Wir befassen uns ausschließlich mit den begrifflichen Inkohärenzen der Anwendung dieses Modells auf das Sehen der Lebewesen. Laut Marr besteht der Output des Rechenprozesses in der Hervorbringung einer Beschreibung von sichtbaren Objekten, die als interne Repräsentation verkörpert ist und als eine Grundlage für Entscheidungen zugänglich gemacht wird.227 Aber auch diese Auffassung ist verworren. Der Output des neuro-visuellen Prozesses, insofern man sagen kann, er habe einen, besteht darin, dass die Kreatur sieht, was immer sie auch sieht. Etwas zu sehen heißt weder, eine Beschreibung zu erzeugen oder hervorzubringen, noch, eine Hypothese zu bilden. Es heißt tatsächlich noch nicht einmal, eine Beschreibung erzeugen zu können (nichtmenschliche Tiere können sehen, jedoch nichts beschreiben). Sehen heißt nicht beschreiben (und auch nicht hören, empfinden, riechen oder schmecken). Und die Vorstellung, dass das Gehirn eine Beschreibung oder ‚interne Repräsentation‘ hervorbringen kann, die sie dem Geist zugänglich macht, und dass dieser Vorgang das Sehen konstituiert, ist in zweifacher Hinsicht inkohärent. Die Sinne sind keine Informationsüberträger Es ist irreführend zu sagen, die Sinne seien damit befasst, ‚uns mitzuteilen, was es in der Welt gibt‘. Bei dieser Wendung handelt es sich um ein Sprachbild, das im Kontext von Marrs Theorie jedoch unangebracht ist. Denn die Sinnesorgane sind keine Informationsüberträger. Es ist nicht so, dass unsere Augen etwas sehen und dem Gehirn mitteilen, was sie sehen, und das Gehirn sagt uns nicht, was die Augen sehen. Wir verwenden unsere Sinnesorgane dazu herauszufinden, zu beobachten, zu erfassen, was sich in unserer Umgebung befindet. Unsere Sinnesvermögen befähigen uns dazu, die Dinge unserer Umgebung in ihrer Beschaffenheit zu erfassen, und zwar, indem wir unsere Sinnesorgane gebrauchen. Die Sinne sind keine Informationsüberträger, obgleich wir durch ihren Gebrauch Information erwerben. (Radio und Fernsehen sind Informationsüberträger – und auch der Stadtausrufer.) Die Sinne übertragen keine ‚internen Repräsentationen‘ zu uns, noch erzeugen sie dem Geist zugängliche bzw. verfügbare symbolische Beschreibungen. Bei der Erforschung der Wahrnehmung handelt es sich nicht um eine Untersuchung symbolischer Repräsentationen und ihrer Beziehungen zu dem, was sie repräsentieren. Das leistet die Erforschung der symbolischen Systeme, Sprachen, Beschreibungsweisen, Bilder und der anderen (gemeinhin sozialen) Artefakte, derer sich Für eine detaillierte kritische Darstellung siehe P. M. S. Hacker, ‚Seeing, representing and describing: an examination of David Marr’s computational theory of vision‘, in J. Hyman (Hg.), Investigating Psychlogy (Routledge, London, 1991), S. 119–154. 227 Diese Charakterisierung ist vom maschinellen Sehen abgeleitet, denn die ‚Identifizierung‘ des Objekts bzw. Merkmals durch den Prozessor löst die Roboter-‚Entscheidung‘ in einer vorbestimmten Weise aus. Damit sich das ereignet, braucht es allerdings kein Sehen – womit der Grund dafür genannt ist, warum wir Maschinen statt Arbeiter verwenden. 226
194
4 Empfindung und Wahrnehmung
Begriffe verwendende Wesen bedienen. Wahrnehmen heißt nicht, irgendetwas zu repräsentieren. Die Erzeugung von 3-D-Modell-Beschreibungen könnte wohl kaum eine Erklärung für das Sehen liefern Marrs Theorie kommt ohne Bilder im Gehirn oder vom Gehirn erzeugte Bilder aus. Stattdessen offeriert er uns 3-D-Modell-Beschreibungen, die im Gehirn kodiert sind. Es dürfte aber klar sein, dass diese Überlegung es gerade verabsäumt, das Sehen zu erklären. Wer sagt, der Geist habe ‚Zugang‘ zu den vom Gehirn erzeugten ‚internen Repräsentationen‘, gibt nicht weniger Rätsel auf als Descartes mit seiner Behauptung, dass der Geist Zugang zu einem Bild auf der Zirbeldrüse hat. Darüber hinaus ist es vollkommen schleierhaft, wie der zu vermeintlichen neuralen Beschreibungen Zugang habende Geist die Person zum Sehen befähigen will. Und wenn Marr (richtigerweise) insistieren würde, dass es die Person ist, die sieht, und nicht der Geist, wie sollte man dann den Übergang von der Präsenz einer im Gehirn kodierten 3-D-Modell-Beschreibung zur Erfahrung des Sehens dessen, was sich vor unseren Augen abspielt, erklären? Hierbei haben wir es jedoch nicht mit einem empirischen Problem zu tun, das mithilfe weiterer Untersuchungen zu lösen wäre, sondern mit dem Ergebnis einer Begriffskonfusion, der man mit entwirrender Begriffsarbeit begegnen muss. Denn beim Sehen von etwas handelt es sich um die Ausübung eines Vermögens, um die Anwendung der Sehkraft – nicht um die Informationsverarbeitung im logisch-semantischen Sinn oder die Hervorbringung einer Beschreibung im Gehirn. Neurowissenschaftler sollten drei Kardinalfehler vermeiden Von diesen ausgedehnten Reflexionen über den Begriff der Wahrnehmung im Allgemeinen und der visuellen Wahrnehmung im Besonderen ist manche Lektion zu lernen. Erstens müssen sich Neurowissenschaftler, wenn sie solche Termini wie ‚Information‘ und ‚Informationsverarbeitung‘ verwenden, sehr in Acht nehmen; sie sollten die Gefahren meiden, die mit den Termini ‚Repräsentation‘ und ‚interne Repräsentation‘ verbunden sind, und sich auf neurale Korrelate von Merkmalen der visuellen Szenerie weder als ‚Repräsentationen‘ noch als ‚Symbole‘ beziehen. Zweitens sollten sie sich davor hüten, bei ihren Bemühungen, den Wahrnehmungsprozess zu erklären, dem mereologischen Fehlschluss anheimzufallen. Nicht nur, dass das Gehirn nicht wahrnimmt, es ist ferner zwecklos zu versuchen, die Wahrnehmung anhand vorgeblicher kogitativer, kognitiver oder bilderzeugender Aktivitäten des Gehirns zu erklären, weil es die nicht geben kann. Drittens würden Neurowissenschaftler gut daran tun, die Frage zu umgehen, ob die sekundären Qualitäten objektiv sind oder nicht, und die abwegige Vorstellung aufzugeben, dass etwas zu sehen damit einhergeht, ein Bild dieses Dings zu haben oder zu sehen.
5 Die kognitiven Vermögen Im letzten Kapitel haben wir uns mit Empfindung und Wahrnehmung auseinandergesetzt. Es ging uns darum, die Konturen dieser wichtigen Kategorien des Psychischen nachzuzeichnen. Verschafft man sich Aufschluss über sie und klärt insbesondere den Begriff der visuellen Wahrnehmung, bleibt das nicht ohne Folgen für die neurowissenschaftliche Forschung, die größtenteils auf die empirische Natur von Empfindung und Wahrnehmung fokussiert ist. Für das Zustandekommen einer fruchtbaren und erhellenden empirischen Erforschung der neuralen Grundlagen unserer psychischen Fähigkeiten ist es unabdingbar, sich über die einschlägigen Begriffe im Klaren zu sein. Wir haben deutlich zu machen versucht, welche Relevanz der analytischen Begriffsarbeit für das wissenschaftliche Erklärungsstreben zukommt, indem wir einige Behauptungen bedeutender Neurowissenschaftler erörterten, Wissenschaftler, die unserer Ansicht nach der Aufklärung der Begriffe, mit denen sie operieren, zu wenig Aufmerksamkeit schenkten. In diesem Kapitel werden wir die kognitiven Kategorien des Wissens und des Gedächtnisses bzw. der Erinnerung untersuchen – Begriffe, die in den neurowissenschaftlichen Debatten eine ebenso bedeutende Rolle spielen.
5.1 Wissen und seine Verwandtschaft mit Fähigsein Wissen ist kein Zustand, sondern steht in verwandtschaftlicher Beziehung mit Fähigsein Die Wahrnehmung ist eine Primärquelle des Wissens, und wie bereits dargelegt, heißt wahrnehmen, dass etwas so ist, Wissen darüber zu erwerben, wie es um die Dinge, was die Objekte der eigenen möglichen Wahrnehmung betrifft, steht. Zu wissen, dass etwas so und so ist, bedeutet einfach, im Besitz von Information zu sein. Es verlockt zu denken, dass jemand, der über Information verfügt – das heißt, etwas weiß –, sich in einem bestimmten Geisteszustand befindet, von dem offenkundig Wissensleistungen ausgehen. Mit dieser Einschätzung läge man allerdings falsch. Denn wenn es so wäre, dann gäbe es zwei ganz verschiedene Kriterienreihen dafür, ob jemand etwas weiß: erstens Kriterien dafür, ob der geistige Wissenszustand vorliegt, und zweitens Kriterien, bei denen es sich um die Wissen offenbarenden Leistungen handelt. Wir haben allerdings nur die letzten Kriterien – ob eine Person etwas weiß, bestimmen wir nicht anhand irgendeiner Art von Geisteszustand, sondern indem wir uns auf ihr offenkundiges Lernen von etwas (indem ihr jemand etwas mitteilt beispielsweise) beziehen und auf jene Handlungen, die Wissen offenbaren. Information erwerben heißt nicht, von einem ‚Geisteszu-
196
5 Die kognitiven Vermögen
stand des Nichtwissens‘ in einen ‚Geisteszustand des Wissens‘ überzugehen. Zu wissen, dass etwas so und so ist, ist einer Befähigung ähnlich und darum eher einem Vermögen oder einer dispositionalen Möglichkeit verwandt als einem Zustand oder einer Realisierung. Lernen, dass etwas so ist, heißt, fähig zu werden, ein großes Spektrum an Dingen zu tun (andere in Kenntnis setzen, auf bestimmte Fragen antworten, andere korrigieren, etwas entdecken, ausfindig machen, identifizieren, erklären und so weiter). Vergessen, dass etwas so ist, heißt nicht, aus irgendeinem Zustand herauszufallen, sondern, die Befähigung zu verlieren, bestimmte Dinge zu tun. Wir fragen, weshalb jemand in einem bestimmten Zustand sei, aber woher jemand (das) wisse. Geisteszustände können unterbrochen und später wieder aufgenommen werden (wie beispielsweise, wenn die intensive Konzentration durch ein Telefongespräch unterbrochen und später wiedererlangt wird), und Geisteszustände wie große Angst oder Erregung werden vom Schlaf unterbrochen. Man kann jedoch niemanden beim Wissen von etwas unterbrechen, und man hört nicht auf zu wissen, wenn man einschläft. Die Fragen ‚Wie lange weißt du das und das schon?‘ und ‚Wie lange konzentrierst du dich schon (bist du schon aufgeregt, nervös)?‘ entsprechen einander insofern nicht, als jene eher eine Ähnlichkeit mit der Frage ‚Seit wann bist du schon in der Lage zu . . .?‘ aufweist und verwandt ist mit ‚Seit wann bist du schon fähig zu . . .?‘228 Wissen ermöglicht es einem, der gewussten Information entsprechend zu handeln Wenn wir wissen, dass es um die Dinge so und so steht, dann ist es uns möglich, aufgrund dieser Information zu handeln. Die Information, dass es um die Dinge so steht, stattet uns im Rahmen unserer Vorhaben nicht nur mit Gründen für das Handeln aus, sondern auch dafür, dies oder jenes zu denken oder zu fühlen (z. B. zufrieden zu sein oder zornig). Was eine Person weiß, kann ihr folgerndes Denken (von Wahrheiten hin zu Schlüssen, die sie möglicherweise zieht) als Prämisse anleiten. Für Sprache verwendende Wesen wie wir heißt zu wissen wo, wann, ob und wie . . . unter anderem, auf solche Fragen antworten zu können. Selbstverständlich verfügen auch andere Tiere über Wissen, nicht weniger als Menschen, obgleich sie weniger kognitive Vermögen aufweisen als wir; aus Gründen handeln können sie bestenfalls in einem schwächeren Sinne; und sie können nicht auf Fragen antworten, sondern ihr Wissen nur in ihrem nichtsprachlichen Verhalten zeigen. Fähig sein, etwas zu tun, birgt kein Wissen in sich Obgleich man sagen kann, dass Wissen mit einer Befähigung verwandt ist, bedeutet, zu einem Tun befähigt zu sein, nicht notwendigerweise, irgendetwas zu wissen. Tatsächlich 228
10.2.
Für eine weitergehende Erörterung der kategorialen Merkmale von Geisteszuständen siehe
5.1 Wissen und seine Verwandtschaft mit Fähigsein
197
bedeutet es notwendigerweise nicht einmal, zu wissen, wie irgendetwas zu tun ist. (Wie wir in 5.2 sehen werden, sind diese Abgrenzungen für die neurowissenschaftlichen Versuche, zwischen deklarativem und nichtdeklarativem Gedächtnis zu unterscheiden, von großer Relevanz.) Um diese Behauptungen zu rechtfertigen, müssen wir klären, in welcher Beziehung fähig sein, etwas zu tun, und wissen, wie man etwas tut, zueinander stehen. Im Anschluss müssen wir über die zwischen wissen, wie man etwas tut und wissen, dass etwas so ist bestehende Beziehung Aufschluss geben.
5.1.1 Fähig sein und wissen wie Angeborene und erworbene Fähigkeiten; alternativlose und Alternativ-Fähigkeiten; aktive und passive Vermögen Man kann zwischen angeborenen Fähigkeiten wie etwa denen zu atmen, wahrzunehmen, die eigenen Gliedmaßen zu bewegen und erworbenen Fähigkeiten wie etwa der Fähigkeit zu gehen oder der zu sprechen unterscheiden. Weiter kann man zwischen alternativlosen Fähigkeiten (oder Vermögen) und Alternativ-Fähigkeiten (oder Vermögen) unterscheiden. Bei sämtlichen Fähigkeiten des Unbelebten handelt es sich um alternativlose Vermögen, die aktiv oder passiv sein können. Die Fähigkeit einer Säure, ein Metall aufzulösen, ist ein alternativloses aktives Vermögen: Wenn die entsprechenden Bedingungen vorliegen, wird die Schwefelsäure das Zink auflösen. Die Säure ist der Akteur, hat jedoch gleichsam keine Wahl in der Angelegenheit – sie kann nicht Abstand davon nehmen, das Metall aufzulösen. Die Anfälligkeit bzw. Prädisposition von Zink, sich in Säure aufzulösen, ist ein alternativloses passives Vermögen. Manche der Fähigkeiten lebender Wesen sind alternativlose Fähigkeiten: die Fähigkeit zu sehen, zu hören oder Schmerz zu empfinden beispielsweise. Andere sind Alternativ-Fähigkeiten, die das Lebewesen willentlich ausüben, deren Ausübung es aber auch unterlassen kann, wenn es so entscheidet: die Fähigkeit zu gehen oder zu sprechen beispielsweise. Fähigkeiten können durch Reifung oder durch Lernen erworben werden Fähigkeiten können schlicht durch natürliche Reifungsprozesse erworben werden (die Fähigkeit von Lebewesen, den Geschlechtsakt zu vollziehen beispielsweise) oder durch Lernen (was mit Übungs- und Lehrtätigkeiten einhergehen kann, aber nicht muss). Nicht alles erfolgreiche Lernen führt zu Wissensbesitz – es kann auch zum Besitz einer Fähigkeit oder Fertigkeit führen, die kein Wissen, wie irgendetwas zu tun ist, einschließt. So muss ein Kind lernen, und tatsächlich lehrt man es entsprechend, geduldig zu sein oder still, wobei in beiden Fällen kein Wissenserwerb dazugehört. Der Erfolg solchen Lernens zeigt sich in der Fähigkeit, die entsprechenden Dinge zu tun, nicht im Wissen (und folglich In-Erinnerung-Behalten-Haben), wie man sie tut.
198
5 Die kognitiven Vermögen
Wissen wie verglichen mit fähig sein Was unterscheidet dann Wissen, wie V zu vollziehen ist, vom bloßen Fähigsein zum Vollzug von V? Man kann nur dann sagen, ein Lebewesen wisse, wie V zu vollziehen ist, wenn es sich bei seiner Fähigkeit um eine Alternativ-Fähigkeit handelt, die es ausüben kann, deren Ausübung es aber auch unterlassen kann, ganz nach seinem Belieben.229 Was noch nicht hinreicht, weil z. B. die Fähigkeit zu gehen eine erworbene Alternativ-Fähigkeit ist; obgleich wir aber zu gehen lernen müssen, besteht der Erfolg des Gehenlernens im Gehenkönnen und nicht darin zu wissen, wie man geht. Man kann das Gehvermögen durch eine Lähmung einbüßen, wie man geht, kann man jedoch nicht vergessen (d. h., in diesem Fall gibt es kein Vergessen), und man kann nicht später daran erinnert werden oder sich erinnern, wie man es macht. Wissen, wie man etwas macht, unterscheidet sich insofern von fähig sein, etwas zu machen, als wissen, wie man etwas macht, heißt, die Art und Weise des Machens zu kennen (genau wie wissen, wann oder wo etwas zu machen ist, heißt, Zeitpunkt und Ort des Machens zu kennen). Die Art und Weise zu kennen, wie man etwas macht, schließt die Kenntnis der Mittel und Wege ein (wo bzw. wann diese angemessen sind). Die Ausübung des Wissens in der Weise eines Tuns von etwas ist ein plastischer, adaptiver und von den Umständen abhängender Vorgang. Die Art und Weise zu kennen, wie man etwas macht, schließt für gewöhnlich das Wissen ein, dass es so gemacht wird, und das ‚so‘ kann von menschlichen Wesen dargelegt oder demonstriert werden. Wissen, wie man etwas macht, heißt, die Art und Weise des Machens zu kennen Man kann durch Erfahrung, Versuch und Irrtum lernen, wie man etwas macht, dadurch, dass man trainiert oder unterrichtet wird, dass einem gezeigt wird, wie man es macht, und – bei Menschen – dass einem gesagt wird, wie man es macht. Vom Wissen, wie etwas zu tun ist, kann man sinnvoll sagen, dass man es vergessen habe, im Gedächtnis behalten habe, sich an es erinnere oder an es erinnert werden könne. Es ergibt auch Sinn zu sagen, dass einem beim Versuch, etwas zu tun, von dem man weiß, wie es zu tun ist, ein Fehler unterlaufen sei, dass man realisiert habe, dass man es nicht richtig ausführte, und dass man versucht habe, es besser zu machen. Denn zu wissen, wie man etwas macht, heißt, die Art und Weise zu kennen, wie man es macht, und die Art und Weise zu kennen, wie man es macht, geht mit der Fähigkeit einher, zwischen der richtigen und der falschen Ausführung zu unterscheiden. Natürlich können nichtmenschliche Tiere nicht darlegen oder beschreiben, wie etwas zu tun ist. Weiß aber ein Tier, wie etwas zu tun ist – z. B. ein Hund, der weiß, wie er von einem bestimmten Punkt aus heimkommt –, zeigt sich das in der Plastizität seines Geschicks, auf hinderliche Um229
Eine sehr hilfreiche Erörterung von wissen wie findet sich in A. R. White, The Nature of Knowledge (Rowman and Littlefield, Totowa, NJ, 1982), S. 14–29.
5.1 Wissen und seine Verwandtschaft mit Fähigsein
199
stände zu reagieren, darin, einen Fehler zu erkennen, sobald er auftritt, und ihn umgehend zu korrigieren. Das Verhältnis zwischen wissen wie und fähig sein Man kann also fähig sein, etwas zu tun, auch wenn man nicht sagen könnte, man wisse, wie es zu tun ist, und umgekehrt kann man wissen, wie etwas zu tun ist, aber unfähig sein, es zu tun. (i) Fähig sein, etwas zu tun, impliziert in jenen Fällen nicht, zu wissen, wie man es tut, in denen der Begriff des Wissens (und folglich auch der des Sich-Erinnerns und der des Vergessens) einfach unzutreffend ist. Der Wissensbegriff kann unzutreffend sein, weil Wissen für die Art der fraglichen Fähigkeit nicht relevant ist (z. B. die Hitze des Feuers aus zwei Meter Entfernung zu spüren – eine alternativlose passive Fähigkeit – oder zu gehen oder still zu sein – Alternativ-Fähigkeiten, die kein Wissen in der Weise eines Tuns von irgendetwas einschließen). Er kann unzutreffend sein, weil Wissen für die Gattung des Besitzers der Fähigkeit nicht relevant (weil kategorial unangemessen) ist (z. B. die Fähigkeit einer Pflanze, im Schatten zu wachsen). (ii) Wissen, wie man etwas macht, impliziert nicht, fähig zu sein, es zu tun. Denn man kann wissen, wie man etwas macht, wofür man die körperliche Kraft eingebüßt hat oder die Willensstärke nicht aufbringt. Der in die Jahre gekommene Tennistrainer mag nicht mehr fähig bzw. imstande sein, Tennis zu spielen, sicherlich weiß er jedoch, wie es geht, und man kann ganz genau wissen, wie Abnehmen funktioniert, dazu aber trotzdem nicht fähig sein. Wissen wie und wissen dass: Ryles Irrtum Wir unterscheiden nicht nur zwischen fähig sein, etwas zu tun, und wissen, wie man etwas tut, sondern auch zwischen wissen, wie man etwas tut, und wissen, dass etwas so ist. Es ist jedoch unsinnig, wie Gilbert Ryle (der letztere Unterscheidung einführte und sie sehr ausführlich analysierte) davon auszugehen,230 dass wissen wie immer und wesentlich von wissen dass unterschieden ist. Bei wissen wie und wissen dass handelt es sich weniger um zwei unterschiedliche Wissensformen, als vielmehr um Wissen von zwei unterschiedlichen Arten von Dingen. Wie dargelegt heißt zu wissen, wie man etwas macht, die Art und Weise zu kennen, wie man es macht, und die Art und Weise zu kennen, wie man es macht, heißt häufig, zu wissen und es sagen oder zeigen zu können, dass es so und so gemacht wird.
230
G. Ryle, Concept of Mind (Hutchinson, London, 1949), Kap. 2 [dt. Der Begriff des Geistes]. Für eine Kritik von Ryles Unterscheidung siehe White, Nature of Knowledge, S. 14–18, 22–28, der wir verpflichtet sind.
200
5 Die kognitiven Vermögen
5.1.2 Über Wissen verfügen und Wissen enthalten Wissenserwerb Wissen kann erworben werden, zum Beispiel durch aktive oder passive Wahrnehmung oder durch folgerndes Denken. Es kann einem aber auch in Form eines autoritären Urteils oder Zeugnisses vonseiten anderer gegeben werden. Man sollte in der Tat stets berücksichtigen (Epistemologen und Psychologen vergessen das jedoch oft), dass es sich bei einem Großteil des menschlichen Wissens nicht um Wahrnehmungs-, sondern um Übermittlungswissen handelt, das aus dem geschriebenen oder gesprochenen Wort anderer durch Lernen bezogen wird. Um Übermittlungswissen zu erwerben, muss man natürlich fähig sein wahrzunehmen – das heißt zu sehen (um zu lesen) und zu hören (um dem zuzuhören, was gesagt wird) –, Gelerntes und Wahrgenommenes entsprechen sich jedoch nicht (man sieht die Worte, die man liest, aber man lernt die Information, die sie übermitteln). Wissen wird nicht nur gegeben, in Form der passiven Wahrnehmung oder der von anderen mitgeteilten Information, es kann auch durch Anstrengung erlangt werden – durch folgerndes Denken oder indem man etwas entdeckt oder ermittelt, was das Ergebnis des Sich-Bemühens, Suchens, Experimentierens sein kann oder des Versuchs, herauszufinden, wie die Dinge zusammenhängen. Überdies kann man es auch anstrengungslos und unabhängig vom Weitergeben durch andere empfangen, und zwar indem man etwas erkennt oder bemerkt, auf etwas aufmerksam oder sich ihm bewusst wird, oder indem man aufgrund bereits besessener Information realisiert, dass es um die Dinge so bestellt ist. Wie wir in Kapitel 9 sehen werden, ist die Unterscheidung zwischen dem Wissen, das durch Anstrengung erlangt oder einem durch das Wort anderer gegeben wird, und dem Wissen, das durch Bemerken, Erkennen, Innewerden/Merken oder durch Realisieren empfangen wird, für ein richtiges Verständnis der Vorstellung des Bewusstwerdens und (dann) Bewusstseins von etwas unabdingbar. Wissen und der mereologische Fehlschluss (LeDoux, Crick, Young, Zeki, Blakemore) Es muss abermals betont werden, dass es der Mensch ist, der weiß, dass es um die Dinge so und so steht, und nicht sein Gehirn, der weiß, wie man die Dinge bewerkstelligt, und die konstitutiven Fähigkeiten dafür besitzt, etwas zu wissen. Es ergibt keinen Sinn, wie LeDoux davon auszugehen, dass „es unserem Gehirn möglich ist zu wissen, ob etwas gut oder schlecht ist, bevor es genau weiß, worum es sich handelt“,231 oder wie Crick davon zu sprechen, dass das Gehirn etwas über die Außenwelt lernt, was er ja tatsächlich versichert, wovon wir uns überzeugen konnten – hierbei handelt es sich um nichts anderes als um irreführende Sprachgebilde. Es ist eine Verwirrung, wie J. Z. Young zu be231
J. LeDoux, The Emotional Brain (Phoenix, London, 1998), S. 69 [dt. Das Netz der Gefühle: wie Emotionen entstehen (Hanser, München und Wien, 1998), S. 76].
5.1 Wissen und seine Verwandtschaft mit Fähigsein
201
haupten, dass das Gehirn fragt und antwortet,232 und es ist verworren, wie Semir Zeki anzunehmen, dass der Wissenserwerb „eine primordiale Funktion des Gehirns“233 ist, denn es handelt sich beim ihm überhaupt nicht um eine Gehirnfunktion. Es ist unsinnig, wie Colin Blakemore zu schreiben, dass „das Gehirn über die Retinaeigenschaften irgendwie Bescheid weiß und die fehlende Information ergänzt“.234 Eine Person, die weiß, wo sich der Bahnhof befindet, wann der nächste Zug fährt, ob es wahrscheinlich ist, dass er pünktlich ist, wer ihn sonst noch nehmen könnte etc., kann auf die entsprechenden Fragen antworten. Es gibt jedoch nichts dergleichen wie ein Gehirn, das weiß, wann . . ., wo . . ., ob . . . etc., und auch kein auf entsprechende Fragen antwortendes Gehirn. Nicht das Gehirn, sondern die Person, deren Gehirn es ist, erwirbt Wissen durch die Wahrnehmung, durch folgerndes Denken oder das Zeugnis eines anderen. Ein Begriffe verwendendes Wesen, das in der Lage ist, etwas zu wissen, kann gut unterrichtet oder unwissend sein, gelehrt oder ungebildet, ein Experte oder ein Scharlatan, der vorgibt zu wissen. Von Gehirnen kann man jedoch nicht sagen, dass sie gut unterrichtet, unwissend, gelehrt, ungebildet, Experten oder Scharlatane sind – nur menschliche Wesen können das sein. Vom Gehirn kann man nicht sagen, es enthalte Wissen so, wie Bücher es enthalten, verfüge so über Wissen, wie Menschen darüber verfügen Es ist gleichermaßen verworren, wie Young davon zu sprechen, dass Gehirne Wissen und Information enthalten, die im Gehirn eingeschrieben bzw. kodiert sind, „genauso wie Wissen in Büchern oder Computern aufgezeichnet werden kann“.235 Von einem Buch können wir sagen, dass es das gesamte Wissen der Lebensarbeit eines Gelehrten enthält, oder von einem Aktenschrank, dass er alles verfügbare, ordnungsgemäß katalogisierte Wissen über Julius Cäsar enthält. Das heißt, dass auf den Buchseiten oder den Registerkarten im Aktenschrank Ausdrücke einer großen Zahl bekannter Wahrheiten niedergeschrieben wurden. In diesem Sinne enthält das Gehirn kein Wissen, welcher Art auch immer. Es gibt keine Symbole im Gehirn, die durch ihre Anordnung eine einzelne Proposition ausdrücken, geschweige denn eine als wahr aufgefasste Proposition.236 Selbstverständlich ent232
J. Z. Young, Programs of the Brain (Oxford University Press, Oxford, 1978), S. 119 und 126. S. Zeki, ‚Abstraction and idealism‘, Nature, 404 (April 2000), S. 547. 234 C. Blakemore, ‚The baffled brain‘, in R. L. Gregory und E. H. Gombrich (Hg.), Illusions in Nature and Art (Duckworth, London, 1973), S. 38. 235 Young, Programs of the Brain, S. 192. 236 Die Tatsache, dass ein neurales Ereignis mit einem wahrgenommenen Objekt korreliert, bedeutet nicht, dass das neurale Ereignis ein Symbol des Objekts (oder von irgendetwas anderem) ist. Es gibt nichts dergleichen wie ein Gehirn, das über lexikalische Symbole verfügt, sie verwendet oder enthält, d. h. Zeichen, die innerhalb einer Sprechergemeinschaft regelgeleitet gebraucht werden, und eine Bedeutung, die von den herkömmlichen Bedeutungserklärungen herrührt. Und ganz offensichtlich enthält oder verwendet das Gehirn auch keine ikonischen Symbole. 233
202
5 Die kognitiven Vermögen
hält auch ein menschliches Wesen in diesem Sinne kein Wissen. Über Wissen zu verfügen heißt nicht, Wissen zu enthalten. Eine Person kann beispielsweise ein oberflächliches Wissen über die Abholzungen des 17. Jahrhunderts haben, sie enthält aber keines; Hinds Geschichte früher Abholzungen enthält eine große Menge solchen Wissens, hat aber keines. Weder verfügt das Gehirn über irgendein Wissen, noch enthält es welches. Bibliotheken, Bücher, Tagebücher und Karteien enthalten Information – Information, die menschliche Wesen nachschlagen, lernen, sich einprägen und ergänzen können. Gehirne verfügen nicht über Information und enthalten keine Wie im letzten Kapitel dargelegt, treffen ähnliche Überlegungen auf die Vorstellung zu, dass das Gehirn Information enthält. Die Encyclopaedia Britannica enthält eine große Menge an Information. In diesem Sinn gibt es sie im Gehirn nicht. Von einem Schnitt durch einen Baumstamm oder von einer geologischen Probe kann eine große Menge an Information abgeleitet werden – und mithin auch von PET- und fMRT-Scans der Gehirnaktivität. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Information, die das Gehirn hat. Und sie ist auch nicht im Gehirn eingeschrieben, geschweige denn in der „Sprache des Gehirns“,237 genauso wenig wie dendrochronologische Information über die Winterstrenge der 1930er Jahre in Baumsprache im Baumstamm eingeschrieben ist. Falsche Beschreibungen der Kommissurotomie (Crick, Gazzaniga) Wenn man die in der Erörterung des mereologischen Fehlschlusses in den Neurowissenschaften gewonnenen Erkenntnisse in den Blick nimmt, dürfte unmittelbar einleuchten, dass auch die gewöhnlichen neurowissenschaftlichen Beschreibungen der Resultate der Durchtrennung von Corpus callosum und der anterioren Kommissur in die Irre gehen. Nach solchen ‚Split-Brain‘-Operationen lassen Patienten dramatische Fehlfunktionen erkennen. Das wird üblicherweise (z. B. von Crick) anhand der vorgeblichen Tatsache erklärt, dass „die eine Hälfte des Gehirns [. . .] fast überhaupt kein Wissen darüber zu besitzen [scheint], was die andere Hälfte gesehen hat.“ Wenn man den Patienten darum bittet zu erläutern, weshalb er seine linke Hand auf diese bestimmte Weise bewegte, „dann wird er Erklärungen erfinden, die darauf beruhen, was seine linke (sprechende) Hemisphäre gesehen hat, und nicht darauf, was seine rechte Hemisphäre wusste“.238 Wie dargelegt behauptet Gazzaniga, dass „das linke Gehirn, die Reaktion der linken 237
Young, Programs of the Brain, passim. Für eine detaillierte Analyse von Youngs abwegiger Analogie zwischen neuraler Aktivität und Sprachgebrauch siehe P. M. S. Hacker, ‚Languages, minds and brains‘, in C. Blakemore und S. Greenfield (Hg.), Mindwaves (Blackwell, Oxford, 1987), S. 485–505. 238 F. Crick, The Astonishing Hypothesis (Touchstone, London, 1995), S. 170 [dt. Was die Seele wirklich ist (Artemis & Winkler, München & Zürich, 1994), S. 214].
5.2 Gedächtnis
203
Hand beobachtend, diese Reaktion interpretiert, und zwar seinem Wissen entsprechend“. Wenn es jedoch unsinnig ist, dem Gehirn Wissen zuzuschreiben, im Gegensatz zur Person, ist es gleichermaßen unsinnig, einer der Hemisphären des Gehirns Wissen (oder Nichtwissen) zuzuschreiben, was erst recht auf die Annahme zutrifft, dass die andere Hemisphäre etwas sieht. Und es ist inkohärent, davon auszugehen, dass eine Gehirnhemisphäre über einen ‚Wissensbereich‘ verfügt. Man kann die von der Kommissurotomie herrührenden Formen funktionaler Dissoziation ohne Weiteres beschreiben, ohne die Sinngrenzen zu überschreiten (siehe 14.3).
5.2 Gedächtnis Das Gedächtnis ist ein kognitives Vermögen menschlicher Wesen, nicht ihres Nervensystems (Milner, Squire und Kandel) Beim Gedächtnis- bzw. Erinnerungsvermögen handelt es sich um ein kognitives Vermögen menschlicher Wesen. Noch einmal, es ist bestenfalls irreführend, wie Milner, Squire und Kandel davon zu sprechen, dass man mittlerweile besser versteht, „wie das Nervensystem lernt und in Erinnerung behält“.239 Denn nicht das Nervensystem lernt oder behält überhaupt irgendetwas in Erinnerung, sondern das Lebewesen. Und die zu Hoffnung Anlass gebenden Leistungen betreffen das Verständnis der neuralen Prozesse, die es den Lebewesen ermöglichen, das in Erinnerung zu behalten, was auch immer sie in Erinnerung behalten können. Gedächtnis ist die Fähigkeit zur Bewahrung von Wissen; was man in Erinnerung behält, muss nicht unbedingt etwas Zurückliegendes sein, jedoch etwas, das man zuvor wusste oder von dem man zuvor Kenntnis hatte Gedächtnis ist die Fähigkeit zur Bewahrung erworbenen Wissens. Das Wiedererinnern [recollecting] ist das Vergegenwärtigen bzw. In-Erinnerung-Rufen des bewahrten Wissens. Man kann logischerweise nur das in Erinnerung behalten und sich nur daran erinnern [to remember],240 was man zuvor erfahren hat oder von dem man zuvor Kenntnis hatte. Dabei muss es sich jedoch nicht um etwas handeln, das in der Vergangenheit Brenda Milner, Larry R. Squire und Eric R. Kandel, ‚Cognitive neuroscience and the study of memory‘, Neuron, 20 (1998), S. 446. 240 [Auf der nächsten Seite arbeiten die Autoren die zwei Aspekte von ‚remember‘ heraus: das In-Erinnerung-Behalten und das In-Erinnerung-Behalten-/Nicht-Vergessen-Haben. Der zweite Aspekt kann auch mit ‚sich erinnern‘ wiedergegeben werden, der erste eher nicht. Darum heißt es dort, wo der Behaltensaspekt im Vordergrund steht – beispielsweise im Zusammenhang mit der Kritik des Speicherungsgedankens –, ‚in Erinnerung behalten‘ und in den anderen Fällen ‚sich erinnern‘ – A.d.Ü.] 239
204
5 Die kognitiven Vermögen
angesiedelt ist. Denn neben vergangenen oder zurückliegenden Tatsachen lernt und behält man auch Tatsachen in Erinnerung und erinnert sich daran, die die Gegenwart betreffen (wo man seine Schlüssel hat z. B.), sich auf die Zukunft beziehen (wann der nächste Zug fährt z. B.) sowie allgemeine Tatsachen, die zu jeder Zeit Bestand haben (Naturgesetze z. B.), und mathematische oder logische Wahrheiten, die zeitlos sind. Tatsachen-, Erfahrungs- und Objektgedächtnis werden unterschieden Unter den möglichen Gedächtnisformen kann man die folgenden drei unterscheiden. Das Tatsachengedächtnis wird durch Sätze ausgedrückt, in denen das grammatische Objekt des Verbs ‚sich erinnern‘ [to remember]241 ein Dass-Satz ist: zum Beispiel ‚Ich erinnere mich, dass die Schlacht von Hastings 1066 geschlagen wurde‘. Das Erfahrungsgedächtnis wird durch Sätze ausgedrückt, in denen dem Verb ‚sich erinnern‘ die Wendung ‚wie es war, V zu vollziehen‘ (wobei V irgendein Verb ist, das etwas ausdrückt, was der Akteur tun oder erleben kann) nachfolgt: zum Beispiel ‚Ich erinnere mich, wie es war (in X) verliebt zu sein‘, oder durch Sätze der Form ‚Ich erinnere mich an (die Erfahrung) V (das Verliebtsein)‘. Ich kann mich fraglos erinnern, dass ich etwas wahrgenommen, getan oder erlebt habe, ohne mich an das Wahrnehmen, Tun bzw. Erleben zu erinnern, obgleich ich mich nicht an das Wahrnehmen, Tun bzw. Erleben erinnern kann, wenn ich mich nicht erinnere, dass ich es wahrgenommen, getan bzw. erlebt habe. Erfahrungsgedächtnis impliziert also Tatsachengedächtnis, das Umgekehrte trifft jedoch nicht zu. Das Objektgedächtnis wird manchmal durch Sätze ausgedrückt, in denen dem Verb ‚sich erinnern‘ die Präposition ‚an‘ und ein Akkusativobjekt nachfolgt, das eine wahrnehmbare Sache oder Qualität ausdrückt, zum Beispiel: ‚Ich erinnere mich (gut) an sie (ihr Lächeln, das Haus)‘, ‚Ich erinnere mich (deutlich) an den Jasminduft (die Farbe der Wand, den Geschmack der Himbeeren)‘, wobei ein Unterschied zu bloßem Tatsachengedächtnis beabsichtigt ist (Ich kann mich erinnern, dass sie ein süßes Lächeln hatte, aber nicht in der Lage sein, mich an es selbst zu erinnern; ich kann vieles in Erinnerung behalten und mich folglich an vieles erinnern, was das Haus betrifft, aber nicht in der Lage sein, es zu visualisieren). Manchmal verwenden wir solche Sätze, um unsere Fähigkeit erkennen zu lassen, Bilder (visuelle oder akustische) von etwas zuvor Wahrgenommenem heraufzubeschwören. Ein solches mnemonisches Bildheraufbeschwören bzw. bildliches Vorstellen ist, obwohl es durchaus häufig vorkommen mag, weder im Hinblick auf das Tatsachen- noch hinsichtlich des Erfahrungsgedächtnisses logisch notwendig. Ein Vorstellungsbild von etwas zuvor Wahrgenommenem zu haben reicht überdies ebenso wenig hin, um sich an das zuvor Wahrgenommene zu erinnern, 241
[Man kann, wie aus der obigen Anmerkung hervorgeht, dem Tatsachen-, Erfahrungs- und Objektgedächtnis auch in diesen Wendungen Ausdruck verleihen: ‚in Erinnerung behalten (haben), dass‘, ‚in Erinnerung behalten (haben), wie etwas war‘ und ‚O in Erinnerung behalten (haben)‘. – A.d.Ü.]
5.2 Gedächtnis
205
wie ein Foto von ihm zu besitzen dafür hinreichend ist, denn man muss sich auch daran erinnern, wovon das eigene Vorstellungsbild (oder das Foto) ein Bild ist. Das Objektoder Qualitätsgedächtnis kann mit irgendeiner der oben erwähnten Formen oder mit allen einhergehen.242 Sich erinnern wie und sich erinnern dass Parallel zu der vorher erörterten Unterscheidung zwischen wissen wie und wissen dass müssen wir zwischen sich erinnern, wie etwas zu machen ist, und sich erinnern, dass etwas so ist, unterscheiden. Und so, wie es nicht immer einen wesentlichen Unterschied zwischen wissen wie und wissen dass gibt, ist auch sich erinnern, wie etwas zu machen ist, nicht immer wesentlich unterschieden von sich erinnern, dass etwas so ist. Denn sich erinnern/in Erinnerung behalten243, wie man etwas macht, heißt, das eigene zuvor erworbene Wissen von seiner Ausführung zu bewahren. Nicht vergessen haben, wie man V vollzieht, heißt, sich zu erinnern, dass man V auf diese Weise und nicht auf jene vollzieht. In vielen Fällen ist das dasselbe wie sich zu erinnern, dass man V vollzieht, indem man dies und jenes tut (wie es offensichtlich der Fall ist, wenn man sich erinnert, wie man ein Zahlenschloss öffnet, wie man integriert, wie man den Papst anredet oder wie man ‚Edinburgh‘ buchstabiert).
5.2.1 Deklaratives und nichtdeklaratives Gedächtnis Die neurowissenschaftliche Konzeption des nichtdeklarativen Gedächtnisses Die obige Klassifikation bezieht sich auf eine Unterscheidung, die vorwiegend von Neurowissenschaftlern angeführt wird, wenn sie die neuralen Voraussetzungen des Gedächtnisses untersuchen. Die Befunde von Neal Cohen und Larry Squire „deuteten darauf hin, dass es hinsichtlich der Art, wie wir alle Information verarbeiten und speichern, einen fundamentalen Unterschied gibt“:244 einen Unterschied nämlich zwischen deklarativem und nichtdeklarativem Gedächtnis.245 Als deklaratives Gedächtnis wird das Für eine detailliertere Erörterung siehe N. Malcolm, ‚Three forms of memory‘, in Knowledge and Certainty (Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1963), S. 203–221. 243 [Genau genommen müsste es hier in Rücksicht auf das eben in den Anmerkungen Gesagte heißen: in Erinnerung behalten wie und sich erinnern dass – dann aber schiene es hier und später im Text, wenn auf den namhaft gemachten Unterschied Bezug genommen wird, als rührte er von den beiden Aspekten von ‚remember‘ her, wohingegen er sich aus dem ‚wie‘ und dem ‚dass‘ (how und that) ergibt.] 244 Milner, Squire und Kandel, ‚Cognitive neuroscience and the study of memory‘, S. 450. 245 Es ist bemerkenswert, dass Milner, Squire und Kandel nahelegen, dass, noch bevor Neurowissenschaftler diese Unterscheidung zwischen deklarativem und nichtdeklarativem Gedächtnis 242
206
5 Die kognitiven Vermögen
betrachtet, „was man für gewöhnlich mit dem Ausdruck Gedächtnis meint“; es ist ‚propositional‘, kann wahr und falsch sein und umfasst „die Abbildung der Außenwelt und die Speicherung der Repräsentationen von Tatsachen und Geschehnissen“.246 Das nichtdeklarative Gedächtnis unterliegt „den Wandlungen des gelernten Verhaltens und der Fähigkeit, durch Übung entsprechend auf Reize zu reagieren, infolge konditionierenden und habitualisierenden Lernens“. Man geht davon aus, dass es Teil des grundlegenden, sogenannten Habit-Gedächtnisses („erworbene Dispositionen oder Strebungen, die für eine Reihe von Reizen charakteristisch sind und das Verhalten leiten“) und der Pawlow’schen Konditionierung ist (sowohl die emotionale als auch die Zwinkerreflex-Konditionierung). Von all diesen unterschiedlichen Phänomenen behauptet man, dass es sich bei ihnen um Gedächtnisarten handelt, weil deren „Ausprägung sich aufgrund von Erfahrung verändert, was den Ausdruck Gedächtnis rechtfertigt“.247 Viele Formen des nichtdeklarativen Gedächtnisses wie Habituierung, Sensitivierung und klassische Konditionierung seien bereits bei Wirbellosen gut entwickelt. In Übereinstimmung damit erwies sich der (Siphon-)Kiemen-Rückzugsreflex bei Aplysia als durch Habituierung bzw. Gewöhnung, Entwöhnung, Sensitivierung, klassische und operante Konditionierung modifizierbar. Ähnliche Untersuchungen wurden zur Schwanzbewegung beim Flusskrebs, zur Ernährung bei Limax, zur Phototaxis bei Hermissenda durchgeführt. Diese zeigten den Angaben nach, dass „die nichtdeklarative Gedächtnisspeicherung nicht auf spezialisierten Gedächtnisneuronen bzw. -Neuronensystemen beruht, deren einzige Funktion darin besteht, die Information zu speichern, statt sie zu verarbeiten“.248 Ähnliche Forschungen bei Drosophila zeigten angeblich, dass sie „in Erinnerung behalten können, einen Geruch zu meiden, der mit einem Stromschlag gepaart war“, dass jedoch die Akkumulierung von cAMP „ihre Fähigkeit beeinträchtigt, neue Information zu erwerben und zu speichern“.249
trafen, ‚Philosophen und Psychologen mittels Intuition und Introspektion ähnliche Vorstellungen namhaft gemacht hatten‘ (ibid., S. 449). Bei dem von ihnen ins Feld geführten Philosophen handelt es sich tatsächlich um Ryle, und sie beziehen sich explizit auf seine Unterscheidung zwischen wissen wie und wissen dass. Allerdings unterschied Ryle weder mittels Intuition noch mittels Introspektion, sondern vielmehr aufgrund der Grammatik. Die Neurowissenschaftler scheinen sich jedoch der Mängel in Ryles scharfer Unterscheidung nicht bewusst zu sein. Wie Ryle nehmen sie an, dass wissen, wie V zu vollziehen ist, mit zu V fähig sein identisch ist. Sie unterstellen ebenso, dass wissen wie in keinem Fall mit wissen dass zusammenfällt. Die Irrtümer Ryles nicht bemerkend, wiederholen sie diese. 246 Milner, Squire und Kandel, ‚Cognitive neuroscience and the study of memory‘, S. 450. 247 Ibid. Würde das stimmen, dann hätten wir es bei einem von einer Verletzung herrührenden Hinken oder der infolge einer übermäßigen Lärmbelästigung auftretenden Hörbeeinträchtigung mit Gedächtnisformen zu tun. 248 Ibid., S. 454. 249 Ibid., S. 457.
5.2 Gedächtnis
207
Fehlkonzeptionen über das ‚deklarative Gedächtnis‘ So wertvoll diese Forschung zweifellos ist, so handelt es sich bei ihr großenteils doch nicht um Gedächtnis-Forschung, in welchem Sinn von ‚Gedächtnis‘ auch immer, und inwieweit sie sich auf das wirkliche Gedächtnis bezieht, muss erwiesen werden. Denn der Begriffsrahmen ist arg verworren. Wir werden uns weiter unten zu der Fehlkonzeption äußern, dass wir in unseren Gehirnen Information über die Welt speichern. Eine andere Fehlkonzeption – dass das Tatsachengedächtnis „die Abbildung der Außenwelt und die Speicherung von Repräsentationen der Tatsachen und Geschehnisse“ umfasst – werden wir nicht abhandeln, sondern die Neurowissenschaftler nur daran erinnern, dass Menschen nicht damit beschäftigt sind, die „Außenwelt abzubilden“, es sei denn, sie arbeiten als Bildhauer, und dass sie „Repräsentationen der Tatsachen und Geschehnisse“ vorzugsweise dann ‚speichern‘, wenn sie das Familienalbum mit Fotografien bestücken. Man sollte allerdings erwähnen, dass es irreführend ist zu sagen, beim deklarativen Gedächtnis handele es sich um das, „was für gewöhnlich mit dem Ausdruck Gedächtnis gemeint ist“. Präziser wäre es zu sagen, das deklarative Gedächtnis sei in das einbezogen, was für gewöhnlich mit dem Ausdruck ‚Gedächtnis‘ gemeint ist, denn in den Alltagsgebrauch von ‚Gedächtnis‘ beziehen wir sowohl sich erinnern dass und sich erinnern wie als auch sich erinnern, wie es war, V zu vollziehen, und sich an O erinnern (d. h. Erfahrungsund Objektgedächtnis) ein. Es wird behauptet, dass das, was man ‚bewusstes Wiedererinnern‘ [‚conscious recollecting‘] nennt, für das deklarative Gedächtnis zentral ist, für das nichtdeklarative Gedächtnis jedoch keine Rolle spielt.250 Es ist jedoch unklar, was mit ‚bewusstes Wiedererinnern‘ gemeint ist. Möglicherweise gebraucht man die Wendung, um nahezulegen, dass immer dann, wenn man sich daran erinnert, dass etwas so ist, man sich des zurückliegenden Ereignisses bewusst ist, da man das nämliche Wissen erwarb; oder sie kann bedeuten, dass immer dann, wenn man sich erinnert, man sich bewusst ist, dass man sich erinnert. Es stimmt jedoch nicht, dass immer dann, wenn man sich an ein zuvor gelerntes Informationsbruchstück erinnert – dass die Schlacht von Hastings 1066 stattfand beispielsweise oder dass F = ma ist –, man sich an das Lernereignis erinnert. Und es stimmt auch nicht, dass immer dann, wenn man sich an irgendeine Tatsache erinnert (beispielsweise daran, das Licht auszuschalten,251 oder wenn man, nachdem man zuvor mit Jack gesprochen hat, zu seiner Frau sagt, dass man ihn morgen treffen werde), man sich bewusst ist oder ein Bewusstsein davon hat, dass man sich erinnert. Es wäre gleichermaßen verworren anzunehmen, dass immer dann, wenn man sein nichtdeklaratives Gedächtnis beansprucht, kein bewusstes In-Erinnerung-Rufen be250
Ibid., S. 451. Sich daran zu erinnern, das Licht auszuschalten, heißt, das Licht auszuschalten, weil man weiß (nicht vergessen hat), dass man es tun muss. Es muss einem nichts in den Sinn kommen, wenn man es erledigt, wäre man jedoch mit der Frage konfrontiert, warum man es getan habe, würde man erklären, dass man dazu verpflichtet sei, dass man es tun müsse. 251
208
5 Die kognitiven Vermögen
teiligt ist. Denn wenn das nichtdeklarative Gedächtnis mit der Erinnerung daran, wie etwas zu tun ist, einhergeht, dann erinnert man sich sehr oft daran, wie etwas zu tun ist, indem man sich das Ereignis, da man unterwiesen wurde, es zu tun, ins Gedächtnis ruft, und man kann, wenn man sich erinnert, wie etwas zu tun ist, sich durchaus der Tatsache bewusst sein, dass man das gerade zu tun versucht. Selbstverständlich tritt weder das eine noch das andere notwendig ein. Woraus folgt, dass es sich, was das deklarative Tatsachengedächtnis angeht, ebenso verhält. Diese Begriffsverwirrungen sind leicht beseitigt. Fehlkonzeptionen über das nichtdeklarative Gedächtnis Die das nichtdeklarative Gedächtnis betreffenden Konfusionen reichen indes tiefer. Denn bei Habituation, Sensitivierung, Desensitivierung, klassischer Konditionierung etc. von Wirbellosen als auch bei den konditionierten Zwinker- und Angstreaktionen von Säugetieren handelt es sich gar nicht um Gedächtnisformen. Gewiss kann das Tier dahin gelangt sein, dass es auf bestimmte Reizarten auf bestimmte Weise reagiert, und seine Reaktionen können sich infolge einer Dauereinwirkung eines Reizes wandeln – sich z. B. beschleunigen. Man könnte also sagen, dass das Tier infolge von Erfahrung und Habituation gelernt habe, schneller zu reagieren, oder die Fähigkeit erworben habe, schneller zu reagieren. Das rechtfertigt jedoch nicht, davon zu sprechen, dass es irgendetwas in Erinnerung behält bzw. behalten hat. Denn hier ist nichts Kognitives im Spiel. Nicht alles Lernen geht mit dem Erwerb von Wissen einher, denn es schließt mitunter bloß den Erwerb nichtkognitiver Fähigkeiten ein. Im vorliegenden Fall lernte das Tier weder, dass etwas so ist, noch, wie irgendetwas zu tun ist. Bei einem beschleunigten Reflex oder einer konditionierten Reaktion handelt es sich nicht um Wissen. Gedächtnis aber ist die Bewahrung erworbenen Wissens, und wenn man sich daran erinnert, wie V zu vollziehen ist, beansprucht man bewahrtes Wissen. Sicherlich kann man Insekten und Weichtiere so konditionieren, dass sie einen bestimmten Reiz meiden, doch dies allein zeigt nicht, dass irgendein Wissen erworben oder bewahrt wurde. Man kann von diesen primitiven Tiere nicht sagen, sie wüssten nun, dass es um die Dinge so und so steht, noch, sie hätten gelernt, wie man irgendetwas tut. Dass Drosophila „in Erinnerung behalten können, einen Geruch zu meiden, der mit einem Stromschlag gepaart war“,252 ist sicherlich eine irrige Vorstellung, denn es belegt nur, dass Drosophila durch Konditionierung lernen, einen Geruch, der mit einem Stromschlag gepaart war, zu meiden (d. h. eine Meidensdisposition erwerben). Man kann sagen, dass sie eine primitive alternativlose Fähigkeit erworben haben, was allerdings kein hinreichender Nachweis irgendeiner Form von Gedächtnis ist. Sogar in dem Falle, da eine Maus konditioniert wurde, einen Stromschlag zu fürchten, wenn ein bestimmter Ton erklingt, gibt es in der Tat keinen
252
Ibid., S. 457.
5.2 Gedächtnis
209
Grund anzunehmen, dass sie irgendein Wissen erworben hat. Hier zeigt sich lediglich, dass die Konditionierung eine regelmäßige konditionierte Angstreaktion auslöst. Es kann sein, dass die neuralen Phänomene, die man als Begleiterscheinungen solcher konditionierter Reaktionen ermittelt hat, auch für das wirkliche Gedächtnis charakteristisch sind, allerdings muss nachgewiesen werden, dass dem so ist. Offenkundig betreffen diese Studien das Gedächtnis aber gar nicht. Man behauptet, die besagten Befunde veranschaulichten, dass „die nichtdeklarative Gedächtnisspeicherung nicht auf spezialisierten Gedächtnisneuronen bzw. -Neuronensystemen beruht, deren einzige Funktion darin besteht, die Information zu speichern, statt sie zu verarbeiten“.253 Hier haben wir es jedoch mit einem doppelten Irrtum zu tun. Denn erstens stehen die untersuchten Phänomene nicht mit dem Gedächtnis in Zusammenhang. Und zweitens gibt es keine Informationsspeicherung im Gehirn, wie wir weiter unten darlegen werden.
5.2.2 Speicherung, Bewahrung und Gedächtnisspuren LeDoux‘ irrige Annahme, dass Gedächtnis nur mit Zurückliegendem verknüpft ist Das Scheitern des Versuchs, auch nur die grundlegenden Konturen des Gedächtnisbegriffs zu bestimmen, ist für viele weitere Unklarheiten des neurowissenschaftlichen Nachdenkens über diese eminent wichtige Fähigkeit verantwortlich. So ist es beispielsweise verworren, wie LeDoux anzunehmen, dass „sich erinnern bedeutet, sich irgendeiner früheren Erfahrung bewusst zu sein“.254 Denn erstens muss das, woran man sich erinnert, nichts Zurückliegendes sein – es kann gegenwärtig, zukünftig oder zeitlos sein, obgleich man selbstverständlich derartige Tatsachen in der Vergangenheit gelernt haben muss. Zweitens muss das, woran man sich erinnert, keineswegs eine Erfahrung sein, und es ist keine, wenn das Erinnerte beispielsweise das Datum der Schlacht von Hastings ist. Drittens bedeutet, sich zu erinnern, wann die Schlacht von Hastings stattfand, wer Cäsars Ehefrau war oder wie man nach Hause kommt, nicht, sich des Jahres 1066, Calpurnias oder des Heimwegs bewusst zu sein. Und auch wenn die Erinnerung die Form des Erfahrungsgedächtnisses hat, bedeutet, sich daran zu erinnern, wie es war, V zu vollziehen – das heißt, sich an eine vergangene Erfahrung zu erinnern –, nicht, sich dieses vergangenen Ereignisses bewusst zu sein; noch bedeutet die Erinnerung an das Kränkeln im letzten Monat, sich des Kränkelns bewusst zu sein. Es bedeutet bloß, jetzt zu wissen, dass man damals krank war, und es zu wissen, weil man sich damals krank fühlte (und nicht weil man das Ereignis vergessen hatte und einem gesagt wurde, dass man sich ehedem krank fühlte).
253 254
Ibid., S. 454. LeDoux, Emotional Brain, S. 181 [dt. Das Netz der Gefühle, S. 194].
210
5 Die kognitiven Vermögen
Im Hinblick auf das Erinnern unterscheidet man Erfolg, Misserfolg, Irrtum und Täuschung Genau wie man wahrnehmen und mit dem Wahrzunehmungsversuch scheitern kann, falsch wahrnehmen oder Wahrnehmungstäuschungen unterliegen kann, so kann man sich auch erinnern, damit scheitern, sich falsch erinnern oder Gedächtnistäuschungen unterliegen. Wenn man herausfindet, dass es um die Dinge so steht, und das Gelernte nicht vergisst, dann ist es zutreffend zu sagen, dass man sich erinnere, dass es um die Dinge so steht. Man kann völlig unfähig sein, sich etwas in Erinnerung zu rufen, das man zuvor wusste, und ein derartiger Gedächtnisausfall kann vorübergehend sein oder andauern. Wenn man sich in seinem auf etwas zuvor Gewusstes bezogenen Glauben auf eine Weise irrt, dass dieser Irrtum korrigiert werden kann, erinnert man sich falsch. Man kann jedoch auch im Banne einer Gedächtnistäuschung stehen, die sich auf eigene zurückliegende Erfahrungen bezieht (wie es dem Prinzregenten passierte, als er sich daran zu erinnern glaubte, wie er in Waterloo kämpfte) – das Geglaubte weicht in diesem Fall derart ab, dass es sich schon nicht mehr um einen korrigierbaren Irrtum, sondern bereits um eine Form der Geistesstörung handelt. Viel häufiger kann es geschehen, dass man sich an die Erfahrung V zu erinnern meint, dann jedoch realisiert, dass man sich nur daran erinnert, dass man V erlebte – in diesem Fall verwechselt man Erfahrungs- und Tatsachengedächtnis, und zwar typischerweise deshalb, weil man die Geschichte des eigenen V-Erlebens so oft von seinen Eltern zu hören bekam. Gedächtnis ist bewahrtes, nicht gespeichertes Wissen Gedächtnis ist, wie wir hervorgehoben haben, bewahrtes Wissen (einschließlich des Wissens, dass man in der Vergangenheit dies oder jenes wahrnahm, tat oder erlebte, das die Form des Tatsachen- und des Erfahrungsgedächtnisses annehmen und mit der Ausübung des mnemonischen Visualisierungsvermögens einhergehen kann, aber nicht muss). Es ist jedoch verworren, wie Squire und Kandel255 anzunehmen, dass es sich beim Gedächtnis und seinen Inhalten um gespeichertes oder gar im Gehirn gespeichertes Wissen handelt. Es ist abwegig, wie Milner, Squire und Kandel zu behaupten, dass deklarative und nichtdeklarative Erinnerungen256 „in unterschiedlichen Arealen des Gehirns gespeichert sind“,257 denn es gibt nichts dergleichen wie im Gehirn gespeicherte Erinnerungen. Die Fähigkeit, irgendwelche unterschiedlichen Dinge im Gedächtnis zu behalten, hängt vielmehr kausal von unterschiedlichen Gehirnarealen und von synaptischen Modifikationen in diesen Arealen ab. 255
L. R. Squire und E. R. Kandel, Memory: From Mind to Molecules [dt. Gedächtnis. Die Natur des Erinnerns] (Scientific Amarican Libraray, New York, 1999), S. 211–214. 256 [Erinnerungen meint hier das, was man im Gedächtnis behält bzw. woran man sich erinnert (siehe S. 219) und ist im Sinne von Gedächtnisinhalten aufzufassen. – A.d.Ü.] 257 Milner, Squire und Kandel, ‚Cognitive neuroscience and the study of memory‘, S. 463.
5.2 Gedächtnis
211
Die Wurzeln der Vorstellungen von Gedächtnisspuren und Gedächtnisspeicherung (LeDoux) Der Speicherungsgedanke und die damit verbundene Vorstellung von Gedächtnisspuren sind viel älter als die Neurowissenschaften. Plato verwendete sie als Metaphern (die beschreibbaren Wachstafeln), und sie gehörten zu einer rudimentären spekulativen Theorie des Aristoteles, der das In-Erinnerung-Behalten als Speicherung eines Wahrnehmungseindrucks im Herz begriff, die in funktioneller Abhängigkeit von der Feuchtigkeit der Gewebe vonstattengeht. Die Auffassung des Gedächtnisses als ‚Lagerstätte für Ideen‘ durchdringt die empiristische Tradition des 17., 18. und 19. Jahrhunderts. Diese Konzeption stiftet allerdings auch weiterhin Verwirrung, indem sie die Metapher mit dem verwechselt, wofür diese bloß eine Metapher ist. So listete beispielsweise LeDoux kürzlich eine Reihe von Dingen auf, von denen man angeblich sagen könne, dass man sie gelernt und nicht vergessen hat; er warf die Frage auf, was alle diese Dinge gemeinsam hätten und antwortete: „Es handelt sich um Dinge, die ich gelernt und in meinem Gehirn gespeichert habe“.258 Man kann jedoch mit gutem Grund für logisch ausgeschlossen halten, dass die von ihm angeführten Dinge, wie beispielsweise der Geruch eines Bananenpuddings, die Bedeutung der Worte ‚friedvolle Tage‘ und die Dominoregeln, im Gehirn gespeichert werden. Man kann Gerüche in Flaschen speichern, Wortbedeutungen in Lexika niederschreiben und Spielregeln in Dokumenten festhalten, die dann gespeichert werden können – im Gehirn aber kann man weder Gerüche noch Wortbedeutungen noch Regeln speichern! Natürlich meint LeDoux, dass es sich hierbei um Dinge handelt, an die er sich erinnern kann – damit lag er nicht falsch, sondern mit der Annahme, dass er sie in seinem Gehirn (oder sonst irgendwo) speichern musste, um sich an sie erinnern zu können. Es verlockt, zu denken, dass das im Geist oder Gehirn Gespeicherte eine Repräsentation ist Es ist überaus verlockend, auf der Vorstellung zu beharren, dass es sich bei dem, was man speichert, derweil es offenkundig nicht mit dem übereinstimmt, woran man sich erinnert (z. B. Gerüche, Wortbedeutungen und Spielregeln), um eine Repräsentation des Erinnerten handelt. Man ist versucht zu denken, dass das zuvor erworbene Wissen im eigenen Geist oder Gehirn gespeichert werden muss, und zwar entweder in Form eines Bildes oder einer kodierten Beschreibung, welche(s) das Erinnerte repräsentiert. Wäre es nicht gespeichert, würde man sich, scheinbar, nicht an das erinnern können, woran man sich erinnert – das Wissen stünde einem nicht zur Verfügung. Die klassischen Empiristen neigten dem Gedanken zu, dass das Gespeicherte im Geist gespeichert ist, und zwar als ein Vorstellungsbild oder ein mentales Bild, das die Originalerfahrung repräsentiert oder ein Abbild derselben ist. Die Neurowissenschaftler denken, dass das Gespeicherte im Ge258
LeDoux, Emotional Brain, S. 179 [dt. Das Netz der Gefühle, S. 192].
212
5 Die kognitiven Vermögen
hirn gespeichert ist und dass das Speicherverfahren von einem Muster synaptischer Verbindungen mit Wirkkräften geliefert wird, die unter bestimmten Bedingungen zur Erregung bestimmter Neuronen führen, wobei die Erregung die ursprüngliche Erfahrung repräsentiert oder kodiert. Gazzaniga, Mangun und Ivry beispielsweise behaupten: Kodieren meint die Verarbeitung der zu speichernden Information. Jede Kodierungsphase verläuft über zwei Stufen: den Erwerb und die Konsolidierung. Der Erwerb ist das Erfassen des Inputs in sensorischen Zwischenspeichern und auf sensorischen Analysestufen, während die Konsolidierung mit der Zeit für stärkere Repräsentationen sorgt. Die Speicherung, als das Ergebnis von Erwerb und Konsolidierung, erzeugt eine Daueraufzeichnung und bewahrt diese. Schließlich sorgt der Abruf dafür, dass aus der gespeicherten Information eine bewusste Repräsentation wird, oder er bewirkt, dass ein gelerntes Verhalten wie eine motorische Handlung zur Ausführung gelangt.259
Wir werden diese um sich greifenden Vorstellungen gleich untersuchen. Die kaum zu übersehende Ähnlichkeit zwischen der klassischen empiristischen Konzeption und der gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Betrachtungsweise sollte uns jedoch auf der Hut sein lassen. James’ Konzeption von Gedächtnisspuren im Gehirn Es überrascht nicht, dass die merkwürdige Vorstellung von der Speicherung von Vorstellungsbildern im Geist und die Annahme, dass diese Bilder unbewusst sind, bis sie in Erinnerung gerufen werden, im Laufe der Entwicklung der Neurowissenschaften in Ungnade fiel. An ihrer Stelle gewann die Gehirnspuren-Konzeption an Popularität. Ende des 19. Jahrhunderts schrieb James: Man wird feststellen, dass die Bewahrung von n [das zuvor erfahrene Ereignis, an das man sich nun erinnert] kein rätselhaftes Aufspeichern einer ‚Idee‘ in einem unbewussten Zustand ist. Es handelt sich bei ihr (der Bewahrung) überhaupt nicht um eine geistige Tatsache. Sie ist ein rein physisches Phänomen, eine morphologische Eigenschaft, das Vorhandensein solcher ‚Pfade‘, und zwar in den feinsten Vertiefungen des Gehirngewebes. Die Wiedererinnerung oder das In-Erinnerung-Rufen ist wiederum ein psycho-physisches Phänomen, mit einer körperlichen und einer geistigen Seite. Bei ersterer handelt es sich um die funktionale Erregung der nämlichen Trakte und Pfade; die zweite manifestiert sich in der bewussten Schau des zurückliegenden Geschehens und dem Glauben, dass wir es einst erlebt haben.260
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es sich bei der Gedächtnisspur (‚Trakt‘ oder ‚Pfad‘) laut James (in diesem Abschnitt) nicht um eine Bedingung für die Bewahrung des erworbenen Wissens – das heißt eine Bedingung dafür, etwas tun zu können – han259
M. S. Gazzaniga, G. R. Mangun und R. B. Ivry, Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind (Norton, New York, 1998), S. 247f. Man beachte die Zweideutigkeit des Wortes ‚Repräsentation‘. 260 W. James, The Principles of Psychology (Holt, New York, 1890), Bd. I, S. 655.
5.2 Gedächtnis
213
delt, sondern um die Speicherung dieses Wissens selbst („Die Bewahrung [. . .] ist ein rein physisches Phänomen, eine morphologische Eigenschaft“). Wie wir sehen werden, gelingt es auf diese Weise nicht, die Bewahrung der Fähigkeiten, aus denen sich das Wissen über etwas zusammensetzt, von den neuralen Bedingungen für den Besitz dieser Fähigkeiten und von der Informationsspeicherung in kodierter oder anders gearteter Form der Aufzeichnung zu unterscheiden. Die Hintergrundvoraussetzung der James’schen Argumentation bildet die Annahme, sich erinnern heiße, eine zurückliegende Erfahrung in abgeschwächter Form ‚im Gedächtnis‘ zu wiederholen – „die bewusste Schau des zurückliegenden Geschehens“, wie er sagt. Wir haben es hier mit einer ererbten Position des Empirismus zu tun, für den Erinnern bedeutet, eine blasse Kopie (eine ‚Vorstellung‘) einer zuvor gemachten Erfahrung (einen ‚Eindruck‘) im Geist wieder aufleben zu lassen. Die Möglichkeit, ein Faksimile einer vergangenen Erfahrung zu reproduzieren, erklärt sich also dadurch, mutmaßt James, dass die Originalerfahrung einen ‚Pfad‘ oder ‚Trakt‘ – das heißt eine Gehirnspur – hinterlassen hat, der bei erneuter Reizung eine blasse Kopie der vorangegangenen Erfahrung hervorbringt, zusammen mit dem Glauben, dass man ‚sie einst erlebt‘ hat. Köhlers Konzeption von Gedächtnisspuren Die Vorstellung wurde von solchen bedeutenden Gestalt-Psychologen wie Koffka und Köhler in abgewandelter Form wiederholt und nistete sich in den Köpfen der Neurowissenschaftler ein. Das Elementarbild, das, wie wir gleich sehen werden, die neurowissenschaftliche Reflexion bis zum heutigen Tag prägt, wurde von Köhler sehr schön herausgearbeitet: Was bedeutet Wiedererkennen? Es bedeutet, dass eine gegenwärtige Tatsache, gewöhnlich aus der Wahrnehmung, mit einer entsprechenden Tatsache im Gedächtnis zusammengebracht wird, d. h. mit einer Spur; diese Verbindung verleiht der gegenwärtigen Wahrnehmung den Charakter, bekannt oder vertraut zu sein. Das Gedächtnis enthält jedoch eine ungeheure Zahl von Spuren, die alle früheren Erfahrungen repräsentieren und die durch diejenigen Prozesse entstanden sein müssen, die ihnen zugrunde lagen. Wie kommt es nun zu der erstaunlichen Leistung, dass die gegenwärtige Wahrnehmungserfahrung sich mit der richtigen früheren Erfahrung verbindet? Niemand scheint zu bezweifeln, dass die Auswahl durch die Ähnlichkeit der gegenwärtigen Wahrnehmungserfahrung mit der Erfahrung der entsprechenden früheren Tatsache zustande kommt. Da aber diese frühere Erfahrung als solche nicht gegenwärtig ist, müssen wir annehmen, dass die Spur der vergangenen Erfahrung der jetzigen Erfahrung ähnelt und dass gerade die Ähnlichkeit unserer gegenwärtigen Erfahrung (oder des entsprechenden kortikalen Prozesses) mit der Spur die Auswahl möglich macht.261
261
W. Köhler, The Task of Gestalt Psychology [dt. Die Aufgabe der Gestaltpsychologie] (Princeton University Press, Princeton, 1969), S. 122; zitiert in N. Malcolm, Memory and Mind (Cornell University Press, Ithaca, NY, 1977), S. 192.
214
5 Die kognitiven Vermögen
Und nochmals: Alle Klang-Theorien des Gedächtnisses, der Gewohnheit und so weiter müssen Hypothesen über Gedächtnisspuren als physiologische Tatsachen enthalten. Derartige Theorien müssen auch davon ausgehen, dass die charakteristischen Merkmale der Spuren den charakteristischen Merkmalen der Prozesse, durch die sie entstanden sind, mehr oder weniger ähneln. Denn sonst könnte man die Genauigkeit der Erinnerung, die in einer großen Zahl von Fällen ganz hoch ist, nicht erklären.262
Jeder, der diese Konzeption befürwortet, ist zugleich dem Gedanken verpflichtet, dass eine Originalerfahrung eine Gehirnspur erzeugt, die diese Erfahrung repräsentiert. Das Wiedererkennen sei ein Gefühl der Vertrautheit in Bezug auf ein wahrgenommenes Objekt und durch die Aktivierung einer Spur verursacht, die (die Aktivierung) wiederum durch einen dem ursprünglichen kortikalen Prozess ähnelnden Nervenreiz verursacht sei. Das Wiedererinnern komme zustande, wenn man von einer aktuellen Erfahrung an eine zurückliegende erinnert wird, die sich darin ähneln, dass sie in eine Gehirnspur münden, wobei die aktuelle Spur mit der bereits eingeschriebenen (zumindest teilweise) übereinstimme. Das Wiedererinnern bzw. In-Erinnerung-Rufen sei eine Kausalfolge der Aktivierung genau der durch die ursprüngliche Erfahrung eingeschriebenen Spur durch einen teilweise übereinstimmenden Reiz. Dieser Gedanke beeinflusst noch immer die neurowissenschaftliche Erforschung des Gedächtnisses, wir werden das sehen. Squires und Kandels Konzeption des Gedächtnisses und der Gedächtnisspuren Squire und Kandel arbeiten die James’sche Konzeption mit der Differenziertheit der Neurowissenschaften des späten 20. Jahrhunderts aus. Sie behaupten, dass das bewusste deklarative Gedächtnis „die Möglichkeit bietet, ein spezielles zurückliegendes Ereignis im Gedächtnis wiederzuerzeugen“. Den ‚Ausgangspunkt‘ dafür bildet eine Reihe kortikaler Schauplätze, die beteiligt waren, als man wahrnahm, was auch immer es gewesen sein mochte. Das nachfolgende Gedächtnis „hängt in einzigartiger Weise von der Konvergenz der Eingangssignale aus jedem dieser Kortexbereiche in die medialen Temporallappen und schließlich in den Hippocampus ab“. Die Autoren behaupten, dass diese Konvergenz „eine flexible Repräsentation herausbildet“, sodass man das wahrgenommene Objekt und den Wahrnehmungsanlass in Erinnerung behalten kann. „Die resultierenden Erinnerungen [Gedächtnisinhalte] werden als Veränderungen der Stärke vieler Synapsen innerhalb eines großen Ensembles miteinander verschalteter Neuronen gespeichert.“ Zudem „ist die gespeicherte Information in ihren spezifischen Aspekten durch den Ort der synaptischen Veränderungen bestimmt“, obwohl, wie zugestanden wird, „wir noch relativ wenig darüber wissen, wie und wo Gedächtnisspeicherung vonstattengeht“. Nichtsdestotrotz haben die Autoren keine Zweifel daran, dass das, was sie 262
W. Köhler, Gestalt Psychology [dt. Psychologische Probleme, 1932] (Liveright, New York, 1947), S. 252; zitiert in Malcolm, Memory and Mind, S. 192.
5.2 Gedächtnis
215
‚deklarative Information‘ nennen, im Gehirn gespeichert wird.263 Diese gespeicherte Information befähige einen dazu, ein vergangenes Ereignis ‚im Gedächtnis wiederzuerzeugen‘. Glynns Konzeption Ian Glynn hat einen Aspekt der gegenwärtig vertretenen Position vor Kurzem so formuliert: Weil die Ereignisse, aus denen die Erinnerungen [Gedächtnisinhalte] hervorgehen, mit einer Vielzahl von Wahrnehmungen verknüpft sind, gewinnt der Gedanke an Plausibilität, dass die Aufzeichnung solcher Erinnerungen Nervenzellen in den Assoziationsarealen und in sekundären oder höheren Kortexarealen, die mit den verschiedenen Sinnen in Beziehung stehen, einbegreift. [. . .] Es ist zudem wahrscheinlich so, dass das Wiedererinnern die Wiederherstellung des ursprünglichen (bzw. eines diesem sehr ähnlichen) Aktivitätsmusters in denselben Zellenreihen oder zumindest einigen von ihnen einschließt. [. . .] Anfänglich müssen hippocampaler und neokortikaler Bereich mithin gemeinsam agieren. Wenn die Konsolidierung abgeschlossen ist, sind die Erinnerungen schließlich in einer Weise gespeichert, dass sie ohne Beteiligung des hippocampalen Bereichs verfügbar sind, und das bedeutet, dass die Speicherung sich dann vollständig im neokortikalen Bereich vollzieht.264
Es sollte erwähnt werden, dass der Gedanke, das Wiedererinnern gehe mit der Wiedererzeugung eines Teils des ursprünglichen Musters der Nervenaktivität einher, sowohl von James als auch von Köhler herrührt. Und vermutlich ist diese Hypothese von der Hoffnung motiviert, man könne die Möglichkeit genauer Wiedererinnerung erklären, indem man davon ausgeht, dass das Wiedererinnern ein Phänomen „des Wiedererzeugens eines speziellen zurückliegenden Ereignisses im Gedächtnis“ ist (wie Squire und Kandel es sehen). Denn es wird angenommen, dass die Aktivierung der ‚Spur‘ – wie der Lauf einer Nadel entlang den Rillen einer Grammofonplatte – die Originalerfahrung ‚im Gedächtnis wiedererzeugt‘ (Gedächtnisvorstellungen werden wie von den Empiris-
263
Squire und Kandel, Memory, S. 212ff. I. Glynn, An Anatomy of Thought (Weidenfeld and Nicolson, London, 1999), S. 329. Was das Subjekt des Lernens und Erinnerns angeht, äußert sich Glynn reichlich verworren. Er schreibt, ‚klar ist, dass auf der zellulären und sub-zellulären Ebene ein Mechanismus wirkt, der nicht nur in der Lage ist, einfache logische Operationen auszuführen, sondern auch dazu, von der vorausgegangenen Erfahrung modifiziert zu werden, sodass sich sein Verhalten verändert. Genau dieser Mechanismus bildet die Grundlage der Lern- und Erinnerungsfähigkeit von Nervenzellverbänden‘ (ibid., S. 327). Selbstverständlich ist ein zellulärer Mechanismus nicht in der Lage, logische Operationen in irgendeinem wörtlichen Sinne auszuführen – Zellen können eine regelkonforme Umwandlung von Propositionen nicht leisten. Und nicht Nervenzellverbände erinnern sich an irgendetwas, sondern menschliche Wesen, die sich an das erinnern können, was sie aufgrund mutmaßlicher Veränderungen in den Zellverbänden des Gehirns im Gedächtnis bewahrt haben. 264
216
5 Die kognitiven Vermögen
ten als blasse Kopien der ursprünglichen Eindrücke, deren Vorstellungen sie sind, betrachtet). Bennetts, Gibsons und Robinsons Modell des assoziativen Gedächtnisses Aufbauend auf der Vorstellung, dass die Wiedererinnerung das ursprüngliche (bzw. ein diesem sehr ähnliches) Aktivitätsmuster wiedererzeugt, schufen Bennett, Gibson und Robinson ein Modell der Mechanismen des mutmaßlichen AssoziationsgedächtnisNetzwerks im Hippocampus. Der zentrale Gedanke ist dabei folgender: Das assoziative Gedächtnis wird als die Disposition einer Reihe von Neuronen (die zuvor nach einem bestimmten Muster feuerten als Reaktion auf einen bestimmten Input) gedeutet, das Feuermuster zu wiederholen, sobald auch nur ein Teil des Musters in sie ‚eingespeist‘ wird. Wenn es x Neuronen im Kreislauf gibt, so können diese solche Verbindungen eingehen, dass eine sehr große Zahl unterschiedlicher Inputmuster unterschiedliche sich überlappende Reihen dieser x Neuronen beanspruchen kann, wobei jede dieser Reihen zu feuern bereit ist, sobald eine Teilmenge des ursprünglichen Inputs im Kreislauf vorhanden ist. Das könne man ‚einen Gedächtniskreislauf‘ nennen. Dieses Modell wurde entwickelt, um Aufschluss über die neurale Grundlage des menschlichen Gedächtnisses zu geben. So wird behauptet: Erinnerungen sind an den periodisch auftretenden kollateralen Synapsen gespeichert, die die zweiwertige Hebb’sche Lernregel anwenden. [. . .] Das Wiedererinnern beginnt mit dem Feuern einer Reihe von CA3-Pyramidalneuronen, die mit der ins Gedächtnis zu rufenden Erinnerung verknüpft sind als auch mit der Entladung einer Reihe von Pyramidalneuronen, die mit dieser Erinnerung nicht verknüpft sind [. . .] Es zeigt sich, dass der CA3-Zellverband periodisch aktiviert wird, um unter bestimmten Spannungsbedingungen des Membranpotenzials der Pyramidalneuronen mit Hilfe inhibitorischer Interneuronen Erinnerungen abzurufen. [. . .] Wie viele davon ohne Verlust gespeichert und abgerufen werden können, hängt in erster Linie von der Zahl der im konkreten Wiedererinnerungsfall aktiven Neuronen ab und vom Vernetzungsgrad im Zellverband.265
Die Darstellung liefert ein formales Modell der von James und anderen in den Blick genommenen Gehirnspuren. Vier fragwürdige Vorstellungen Allerdings enthält diese Konzeption eine Reihe fragwürdiger Vorstellungen: 1 Es wird angenommen, dass dann, wenn wir etwas wahrnehmen und das dabei Gelernte in Erinnerung behalten, etwas gespeichert wird. M. R. Bennett, W. G. Gibson und J. Robinson, ‚Dynamics of the CA 3 pyramidal neuron auto-associative memory network in the hippocampus‘, Philosophical Transactions of the Royal Society, B 334 (1994), S. 167f. 265
5.2 Gedächtnis
217
2 Das Gespeicherte ist eine Erinnerung [ein Gedächtnisinhalt], die die ursprüngliche Wahrnehmungserfahrung repräsentiert. 3 Die Erinnerung wird in den und den Teilen des Gehirns in Form von Veränderungen der Synapsenstärke aufgezeichnet. Demnach enthalten die Neuronen eine Repräsentation der Originalerfahrung. 4 Das Wiedererinnern bzw. In-Erinnerung-Rufen geht mit der Wiederherstellung des ursprünglichen Aktivitätsmusters in den entsprechenden Neuronen einher. Das Erinnert-Werden an etwas (assoziatives Gedächtnis) insbesondere damit, dass man eine Erfahrung hat, die irgendeine Ähnlichkeit mit der zurückliegenden Erfahrung aufweist, da man die Information erwarb, an die man von der assoziativen Erfahrung erinnert wird. Denn das Wiedererinnern resultiert aus der Aktivierung der ursprünglichen Gedächtnisspur durch einen neuralen Input, der einem Teil des ursprünglichen neuralen Erregungsmusters entspricht. Diese vier Behauptungen sind strittig, und wir werden einige der Bedenken und Fragen vorbringen bzw. aufwerfen. Bewahrung und Speicherung sind zu unterscheiden (1) Der Gedanke, dass In-Erinnerung-Behalten bedeutet, etwas zu speichern, verwechselt Bewahrung mit Speicherung. In Erinnerung behalten heißt bewahren. Doch obwohl Speicherung manchmal Bewahrung implizieren kann, impliziert Bewahrung nicht Speicherung. Beim Gedächtnis als Bewahrung erworbenen Wissens handelt es sich genau dann um die Bewahrung einer Fähigkeit, wenn es sich beim Wissen selbst um eine Fähigkeit handelt – es ist jedoch nicht die Speicherung einer Fähigkeit. Man kann eine Fähigkeit erwerben und bewahren, das impliziert jedoch keine Speicherung. Denn es gibt nichts dergleichen wie ein Speichern einer Fähigkeit, obgleich es das Bewahren der neuralen Strukturen gibt, die den Besitz einer Fähigkeit kausal bedingen. Die Annahme, dass man, um sich zu erinnern, eine Repräsentation speichern musste, beruht auf der Vorstellung, dass uns besagtes Wissen nicht verfügbar wäre, gäbe es keine gespeicherte Repräsentation. Wie könnte man sich daran erinnern, wenn es nicht in kodierter Form ‚niedergeschrieben‘ ist? Wie Gazzaniga, Mangun und Ivry behaupteten (siehe S. 212), heißt kodieren, die Information in eine Form zu bringen, die gewährleistet, dass ‚eine Daueraufzeichnung‘ bewahrt wird. Das Abrufen, was mutmaßlich Erinnern bedeuten soll, ‚erzeugt eine bewusste Repräsentation‘, indem es die ‚gespeicherte Information‘ beansprucht. Neurale Speicherung semantischer Repräsentationen ergibt keinen Sinn Hierbei haben wir es jedoch mit einer Konfusion zu tun. Das Niederschreiben von etwas stellt gewiss eine Möglichkeit der Informationsspeicherung dar (solange man sich daran erinnert, wie man liest). Bilder erinnern einen daran, was man gesehen hat (solange man
218
5 Die kognitiven Vermögen
sich daran erinnert, wovon die Bilder Bilder sind). Die Vorstellung aber, dass das Erinnern eine im Gehirn gespeicherte neurale Aufzeichnung voraussetzt, ist inkohärent. Denn selbst wenn es eine solche ‚Aufzeichnung‘ gäbe, wäre sie einer Person nicht in dem Sinn verfügbar, in dem ihr ihr Tagebuch oder Fotoalbum verfügbar ist – schließlich kann eine Person nicht in ihr Gehirn schauen und Neuralesisch lesen. Außerdem setzt die Vorstellung, dass es eine gespeicherte Information geben muss, die einer Person verfügbar und eine notwendige Bedingung dafür ist, dass sie sich erinnern kann, Gedächtnis (auf zweierlei Weise) voraus und kann es nicht erklären. Denn wäre einem solch eine Aufzeichnung verfügbar, müsste man sich daran erinnern, wie man sie liest, so wie man von seinem Tagebuch nur dann Gebrauch machen kann, wenn man sich daran erinnert, wie man liest. Gleichermaßen kann man sein Fotoalbum nur dann als ein Aide-Mémoire verwenden, wenn man sich daran erinnert, wovon die Fotografien Fotografien sind. Die Vorstellung von einem Wissensspeicher ergibt nur dann Sinn, wenn einem der Speicher tatsächlich zugänglich ist und man die ‚Repräsentation‘ lesen oder erkennen kann – was offensichtlich unter der Annahme, dass die relevante Information im Gehirn ‚gespeichert‘ ist, nicht zutrifft. Die Vorstellung neuraler Speicherung von Repräsentationen (im logisch-semantischen oder ikonischen Sinn) ist inkohärent. Bei einer neuralen Repräsentation im nichtsemantischen, nichtikonischen Sinn – das heißt bei einem Kausalkorrelat – handelt es sich jedoch nicht um eine Form der Informationsspeicherung und sie geht mit keinem Kodieren einher. (Ein Baum speichert keine Information über die jährliche Niederschlagsmenge in seinem Stamm, und er kodiert nicht den Niederschlag in seinen im Wachstum befindlichen Teilen, obgleich wir aus der Untersuchung eines Stammschnitts eine solche Information ableiten können. Allerdings leiten wir keine wie auch immer geartete Information aus irgendwelchen neuralen Repräsentationen (im nichtsemantischen Sinn) ab, die sich in unseren Gehirnen befinden mögen.) In Erinnerung behalten heißt nicht, irgendetwas zu speichern; man kann in seinem Gehirn keine Information speichern Wenn man wahrnimmt oder lernt, dass es um die Dinge so und so steht, hat man herausgefunden, wie es um sie steht. Man kann in Erinnerung behalten, was man auf diese Weise gelernt hat, die Information bewahren, die man erworben hat – das heißt, über die diffusen und für das Wissen, dass es um die Dinge so steht, konstitutiven Fähigkeiten fortgesetzt verfügen. ‚Bewahren‘ bedeutet hier einfach, dass man einmal wusste und immer noch weiß; dass man z. B. die Fähigkeit erworben hat, auf die Frage ob . . . oder wo . . . oder wann . . . zu antworten und immer noch über sie verfügt; dass es einem möglich wurde, entsprechend der Information, dass es um die Dinge so steht, zu handeln und dass es einem immer noch möglich ist, so zu handeln, weil man nicht vergessen hat, dass es um die Dinge so steht. Was rein gar nichts mit Informationsspeicherung zu tun hat.266 In 266
Für eine detailliertere Auseinandersetzung siehe Malcolm, Memory and Mind, Teil 2.
5.2 Gedächtnis
219
Erinnerung behalten dass p, heißt, über die Information dass p zu verfügen, es heißt jedoch nicht, die Information dass p zu speichern oder zu enthalten. Man speichert die Information dass p beispielsweise dann, wenn man sie niederschreibt und den Eintrag in einem Aktenschrank oder Computer aufbewahrt, die ihn dann enthalten (jedoch nicht über ihn verfügen). In Wahrheit impliziert Informationsspeicherung nicht die Bewahrung dieser Information im Gedächtnis – in den Aktenschränken, Tagebüchern und Karteien ist viel gespeichert, das lange schon in Vergessenheit geraten ist. Man kann allerdings keine Information in seinem Kopf speichern, außer in einem metaphorischen Sinn, und der eigene Kopf enthält, anders als das eigene Tagebuch, keine Information. Ebenso wird man, wenn man ein Objekt, einen Ort oder eine Person M wahrnimmt und M nicht vergisst, M wiedererkennen, sobald man ihm oder ihr begegnet. Mithin kann die Erinnerung an M, neben M betreffende Tatsachen, auch eine Wiedererkennensfähigkeit einschließen. Sich gut an M zu erinnern, in der Lage zu sein, M (oder ein Bild von M) wiederzuerkennen, impliziert jedoch nicht, dass man irgendetwas gespeichert hat. Es impliziert Erwerb und Bewahrung einer Wiedererkennensfähigkeit. Welche neuralen Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, das sollte untersucht werden. Das Gespeicherte ist angeblich eine Erinnerung, die ein zurückliegendes Wahrnehmungsereignis repräsentiert (2) Wenn Neurowissenschaftler den Speicherungsgedanken anführen, gehen sie offenbar davon aus, dass es sich (a) bei dem, was gespeichert wird, wenn man etwas im Gedächtnis behält, um eine Erinnerung handelt, (b) diese gespeicherte Sache eine Repräsentation ist und (c) das Repräsentierte das ursprüngliche Wahrnehmungsereignis. Diese Darstellung versteht sich jedoch keineswegs von selbst, im Gegenteil. Eine Erinnerung ist keine Repräsentation Erstens sprechen wir von ‚einer Erinnerung‘ und davon, ‚viele glückliche (oder traurige) Erinnerungen‘ von dem und dem zu haben. So gebraucht, benennt der Ausdruck ‚eine Erinnerung‘ typischerweise das, woran man sich erinnert, wenn man sich daran erinnert, dass dies und jenes, oder an diese und jene Erfahrung selbst. Wir sagen beispielsweise ‚Meiner Erinnerung nach (steht es um die Dinge so)‘, was nahezu dasselbe bedeutet wie ‚Wie ich mich erinnere (steht es um die Dinge so)‘ oder ‚Soweit ich mich erinnern kann . . .‘. Wir sagen ‚Ich habe eine dunkle Erinnerung an . . . (Euklidische Geometrie, Toledo, meinen Großvater)‘, was nahezu dasselbe bedeutet wie ‚Ich erinnere mich . . ., aber nur dunkel‘. Eine Erinnerung/Gedächtnis ist also eine Sache der Information (bzw. angeblichen Information), dass dies und jenes, oder bezieht sich auf dieses oder jenes (oder darauf, dass man die und die Erfahrung hatte), das man zuvor erworben und nicht vergessen hat. Insofern als es das ist, was ‚eine Erinnerung‘ meint, ist offensichtlich, dass sie keine Repräsentation dessen ist, woran man sich erinnert, ebenso wie ein Glauben keine Reprä-
220
5 Die kognitiven Vermögen
sentation dessen ist, was man glaubt. Man könnte jedoch sagen, dass es sich beim verbalen Ausdruck dessen, woran man sich erinnert, um eine solche Repräsentation handelt. Was man in Erinnerung behält, kann man nicht speichern, sondern nur eine Repräsentation davon Zweitens ist eine Erinnerung – das heißt das, was man in Erinnerung behält, nämlich dass dies und jenes oder die und die Erfahrung zu haben – noch nicht einmal ein Kandidat für Speicherung. Denn es gibt nichts dergleichen wie ein Speichern, dass dies und jenes, geschweige denn ein Speichern des Erfahrens selbst; man könnte allenfalls einen Eintrag speichern, der ausdrückt, woran man sich erinnert, oder ein Bild, das repräsentiert, was erfahren wurde. Es wäre jedoch absurd anzunehmen, bei dem angeblich im Gehirn Gespeicherten handele es sich um einen englischen (oder anderssprachigen) Satz oder Eintrag bzw. um eine Reihe von Bildern (wie ein Fotoalbum).267 Was man in Erinnerung behält, muss nicht das Ereignis des Wissenserwerbs sein Drittens befindet man sich mit der Vorstellung im Irrtum, dass es sich bei dem, woran man sich erinnert, wenn man sich erinnert, notwendigerweise um ein ursprüngliches Wahrnehmungsereignis handelt. Wie dargelegt muss das In-Erinnerung-Behaltene nicht irgendetwas Zurückliegendes sein. Meistens haben wir vergessen, wie der Erwerb 267
Selbst wenn das Sich-Erinnern mit der Reproduktion von Vorstellungsbildern zuvor wahrgenommener Szenen einhergehen würde, müsste man sich immer noch daran erinnern, wovon die Bilder Bilder waren. Antonio Damasio vertritt die Ansicht, dass das Erinnern nicht mit genauen Reproduktionen verbunden ist, sondern vielmehr mit Rekonstruktionen von Bildern einhergeht, bei denen es sich um Annäherungen an ihre Originale handelt. Wenn wir uns erinnern, behauptet er, ‚[beschwören] wir vor unserem geistigen Auge oder Ohr Bilder herauf[. . .], die annähernd wiedergeben, was wir einst erfahren haben‘. Er vermutet, dass diese explizit in Erinnerung gerufenen Vorstellungsbilder ‚durch eine vorübergehende synchrone Aktivierung weitgehend der gleichen neuronalen Entladungsmuster in den frühen sensorischen Rindenfeldern entstehen, in denen einst auch die den Wahrnehmungsrepräsentationen entsprechenden Entladungsmuster auftraten‘ (Descartes’ Error – Emotion, Reason and the Human Brain (Papermac, London, 1996), S. 100f.) [dt. Descartes’ Irrtum (List, München, 1997), S. 145f.]. Selbstverständlich können diejenigen, die sich auf das Hervorbringen von Vorstellungsbildern verstehen, Objekte, Szenen und Ereignisse, an die wir uns erinnern wollen, visualisieren. Aber ein großer Teil des von uns Erinnerten ließe sich grundsätzlich nicht bildlich darstellen (z. B. dass alle X F sind oder dass kein X F ist, dass, wenn p, dann q, dass, wenn es der Fall gewesen war, dass p, dann q der Fall gewesen sein könnte, warum das und das so und so ist, A’s Grund zu denken, dass p, und so weiter und so fort in einer Unzahl von Fällen, die für die Gedächtnistheorie der Imagisten den Bankrott bedeuten), und alles das, was wir beim Erinnern visualisieren, setzt Gedächtnis voraus und kann es nicht erklären, weil wir uns daran erinnern müssen, wovon unser Vorstellungsbild ein Bild ist. Wir werden diese Themen im nächsten Kapitel detailliert erörtern.
5.2 Gedächtnis
221
des Wissens, über das wir verfügen, vonstattenging. Um uns an die unzähligen Tatsachen, die wir kennen, erinnern zu können, müssen wir uns nicht an das Ereignis erinnern, anlässlich dessen wir die besagte Information erworben haben – und für gewöhnlich tun wir das auch nicht. Wenn wir lernen, indem wir beispielsweise lesen oder etwas erzählt bekommen, behalten wir im Normalfall nicht das Lesen oder Erzähltbekommen in Erinnerung, sondern das, was wir gelesen haben bzw. was uns erzählt wurde. Die Neurowissenschaftler scheinen jedoch davon auszugehen, dass das ursprüngliche Ereignis des Wissenserwerbs in Form einer Repräsentation im Gehirn ‚verbucht‘ werden muss. Denn angeblich erklärt die Anregung einer solchen Repräsentation dreierlei. Erstens erklärt sie scheinbar die Kausalität des Erinnerns in dem Falle, da man an etwas vormals Gelerntes erinnert wird. Der gegenwärtige Reiz, der einen veranlasst, sich zu erinnern (d. h. einen an etwas denken lässt, an das man sich mithin erinnert), erzeugt ein neurales Korrelat, welches einem Teil des neuralen Musters entspricht, das durch das ursprüngliche Ereignis aufgezeichnet wurde. Darum erinnert es einen an die vorangegangene Erfahrung. Zweitens erklärt sie scheinbar das Phänomen des Erinnerns. Denn der Reiz regt dieselbe neurale Struktur an, die ‚die Erinnerung gespeichert‘ hat, und diese Anregung verhilft der Person dazu, eine Gedächtniserfahrung zu haben. Drittens erklärt sie angeblich, warum Wiederholung das Gedächtnis kräftigt bzw. stärkt. Denn mit der Wiederholung festigen sich die Kräfteverhältnisse an den Synapsen zunehmend.268 Wir werden diese Annahmen gleich untersuchen. Die Vorstellung von einer neuralen Repräsentation ist fragwürdig (3) In Anbetracht dessen, dass es sich bei dem angeblich im Gehirn ‚Gespeicherten‘ oder ‚Aufgezeichneten‘ nicht um eine verbale Mitteilung oder bildhafte Repräsentation einer zurückliegenden Erfahrung handelt (und nicht handeln könnte), müssen die Wahrnehmungen, die zu ‚Erinnerungen führen‘, dem Anschein nach in den Nervenzellen oder Synapsen kodiert werden und scheint diese neurale Repräsentation das zu sein, was gespeichert wird. Aber auch diese Vorstellung ist fragwürdig. Die Vorstellung vom Kodieren einer Wahrnehmung ist fragwürdig Erstens führt das Wahrnehmen von etwas zwar zu neuralen Veränderungen, es ist jedoch überhaupt nicht klar, was die Annahme, dass eine Wahrnehmung kodiert ist, bedeuten soll. Man kann mit Worten beschreiben, was man wahrnimmt und wie man die Wahrnehmung erlebt – und die Beschreibungen dann kodieren im Falle, dass man die Transformationsregeln kennt. So etwas wie ein Kodieren einer Wahrnehmung gibt es al268
In die Form der früher in Fachkreisen üblichen Rede von Engrammen gebracht, stellt diese Vorstellung sich so dar: Je tiefer das Engramm in das Gehirn ‚eingeprägt‘ ist, desto schneller kann die von ihm kodierte Erinnerung aufgerufen werden und desto anschaulicher gestaltet sie sich.
222
5 Die kognitiven Vermögen
lerdings nicht. Und es gibt auch nichts dergleichen wie ein Kodieren von etwas im Gehirn (jedenfalls nicht im umgangssprachlichen Sinn von ‚kodieren‘) – weil es keinen neuralen Code gibt. Denn ein Code ist ein Verfahren zur Verschlüsselung eines sprachlichen Ausdrucks (oder jeder anderen Repräsentations- bzw. Darstellungsform), das Regeln gehorcht, die auf Konventionen beruhen.269 Die Vorstellung, dass eine neurale Konfiguration eine in Erinnerung behaltene Tatsache repräsentieren kann, ist fragwürdig Zweitens ist unklar, was mit der Behauptung, dass eine neurale Konfiguration etwas in Erinnerung Behaltenes repräsentieren kann, gemeint ist. Angenommen, das in Erinnerung Behaltene besteht darin, dass einem erzählt wurde, dass die Schlacht von Hastings im Jahre 1066 stattfand. Was würde als eine neurale Repräsentation dieser in Erinnerung behaltenen Tatsache betrachtet werden? Es ist unklar, ob in der vorauszusetzenden Bedeutung von ‚Repräsentation‘ irgendetwas als eine Repräsentation betrachtet werden könnte, von den Symbolen, die Teil einer Sprache sind, abgesehen. Nichts von dem, was sich im Gehirn finden ließe, könnte eine mögliche Repräsentation der Tatsache sein, dass einem erzählt wurde, Hastings sei im Jahre 1066 geschlagen worden, in dem Sinn, in dem man von dem Satz ‚Mir wurde erzählt, dass Hastings im Jahre 1066 geschlagen wurde‘ sagen kann, dass es sich bei ihm um eine solche Repräsentation handelt. Es kann jedoch selbstverständlich so sein, dass man sich nicht an das Datum der Schlacht von Hastings erinnern könnte und sich nicht entsinnen würde, es erzählt bekommen zu haben, gäbe es bestimmte neurale Konfigurationen oder stark ausgeprägte synaptische Verbindungen nicht. Daraus folgt jedoch nicht, dass das, was man in Erinnerung behält, gleichsam im Gehirn niedergeschrieben werden oder dass es irgendeine neurale Konfiguration im Gehirn geben müsste, aus der man grundsätzlich ablesen könnte, was man in Erinnerung behalten hat. Und man kann auch nicht sagen, dass diese neurale Konfiguration eine Erinnerung ist. Man könnte indes vermuten, dass das ursprüngliche Wahrnehmungsereignis eine bestimmte neurale Konfiguration im Gehirn verursacht haben muss und dass es genau die Anregung dieses Musters ist, was es einem ermöglicht, die Wahrnehmungserfahrung zu haben, an welche Details des ursprünglichen Ereignisses man sich auch erinnern mag. Aber selbst diese relativ gemäßigte Vorstellung ist problematisch.
Wir haben uns alle an die metaphorische Verwendung des Ausdrucks ‚Code‘ in der Wendung ‚der genetische Code‘ gewöhnt – eine Metapher, die eher verdunkelt als erhellt. 269
5.2 Gedächtnis
223
Die Vorstellung, dass eine reaktivierte neurale Spur eine Gedächtniserfahrung hervorruft, basiert auf sechs fragwürdigen Annahmen (4) Die Vorstellung, dass das Gehirn, wenn man sich in einer bestimmten Situation an etwas erinnert, das Muster der neuralen Erregung reaktivieren muss, das durch die zurückliegende Wahrnehmungserfahrung angeregt wurde, in der man erfahren hat, was man sich jetzt in Erinnerung ruft – diese Vorstellung stützt sich auf eine Reihe von fragwürdigen Annahmen: i. Sich in einem gegenwärtigen Moment an etwas zu erinnern ist eine (Gedächtnis-)Erfahrung, die abwechselnd als ‚Wiedererzeugung [eines vergangenen Ereignisses] im Gedächtnis‘, ‚bewusste Version eines zurückliegenden Geschehens‘ oder ‚Erzeugung einer bewussten Repräsentation‘ beschrieben wurde. (Im Jargon des 18. Jahrhunderts heißt sich erinnern, eine aktuelle Vorstellung zu haben, die mit dem zurückliegenden Eindruck übereinstimmt.) ii. Woran man sich erinnert, ist ein zurückliegendes Ereignis oder ein gewisser Aspekt desselben. iii. Die gegenwärtige Erinnerung wird von einer Erfahrung des Erinnertwerdens ausgelöst. Diese ähnelt in bestimmter Hinsicht der zurückliegenden Erfahrung, an die man sich erinnert. Die heutige neurowissenschaftliche Spekulation fügt diesen Annahmen eine Reihe weiterer einschlägiger Vermutungen hinzu: i'. Sich in einem gegenwärtigen Moment etwas in Erinnerung zu rufen heißt, ein neurales Feuermuster wieder anzuregen. Und dieser Vorgang liefert die Kausalerklärung dafür, dass die Person die Gedächtniserfahrung hat. ii'. Die Originalerfahrung, an die man sich gegenwärtig erinnert, legte eine neurale Spur fest (eine neurale Struktur, die, wenn man sie anreizt, das Feuermuster wiederholt, welches von der originalen Erfahrung erzeugt wurde). Die Reaktivierung der Gedächtnisspur verursacht eine Gedächtniserfahrung (das ‚bewusste Gedächtnisereignis‘), die die ursprüngliche Wahrnehmungserfahrung oder einen gewissen Teil derselben ‚im Gedächtnis reproduziert‘. (Dabei handelt es sich um eine Vorstellung oder blasse Kopie des originalen Eindrucks.) iii'. Der gegenwärtige (Erinnerungs-)Auslöser [reminder] aktiviert die Gehirnspur und somit die Gedächtniserfahrung durch ein Muster neuralen Inputs, das Teil des ursprünglichen, von der zurückliegenden Wahrnehmungserfahrung erzeugten Musters ist. Dass die gegenwärtige Gedächtnis- oder Erinnerungserfahrung und die ursprüngliche Erfahrung, von der sie die Erinnerung ist, sich ähneln, wird mit der Reaktivierung der Gehirnspur bzw. des Musters neuraler Entladung erklärt, welche von der ursprünglichen Wahrnehmungserfahrung festgelegt wurde. Verführerisch sind diese Überlegungen zweifelsohne, indes, sie (ver)führen uns auf Abwege. Wir haben bereits dargelegt, dass es sich bei dem In-Erinnerung-Behaltenen nicht um etwas Zurückliegendes handeln muss. Die in der Vergangenheit erworbene Infor-
224
5 Die kognitiven Vermögen
mation muss nicht von der Vergangenheit handeln, und im Normalfall erinnert man sich nicht an den Anlass ihres Erwerbs. Ein solches Erinnern erfordert in logischer Hinsicht lediglich, dass man etwas erfahren hat und dass man es immer noch weiß (d. h. das erworbene Wissen nicht vergessen hat). Sich an etwas erinnern muss nicht mit einer reproduktiven Repräsentation einhergehen Zwei weitere Punkte müssen nun noch betont werden. Erstens muss die Erinnerung an etwas nicht mit einer reproduktiven ‚Repräsentation‘ verknüpft sein. Sich zu erinnern, dass p (z. B. dass die Schlacht von Hastings im Jahre 1066 geschlagen wurde, dass man letzte Woche dies und jenes machte, dass 252 = 625 ist), sich an das Wahrnehmen, Tun oder Erleben von etwas zu erinnern, sich an M (eine Person, ein Ort, Objekt oder Ereignis) zu erinnern oder daran, wie man etwas macht, muss nicht mit der Reproduktion einer ‚Repräsentation‘ einhergehen, weder in Form eines Vorstellungsbildes noch in Form eines laut ausgesprochenen Satzes noch damit, dass sich so etwas in der Vorstellung abspielt. So muss beispielsweise die Erinnerung an den Heimweg nicht mit dem bildlichen Vorstellen verknüpft sein, sondern lediglich mit der Ausübung der Fähigkeit, heimzufinden, ohne sich zu verlaufen. Sich daran zu erinnern, wie man Auto fährt, erfordert lediglich die Ausübung der Fähigkeit, Auto zu fahren. Sich daran zu erinnern, was jemand sagte, macht es lediglich erforderlich, aufgrund der von der Äußerung bereitgestellten Information zu handeln oder entsprechend zu reagieren. Sich an das Wahrnehmen, Tun oder Erleben von etwas zu erinnern, ist nicht essenziell eine Fähigkeit des ‚Wiedererzeugens‘ der Erfahrung in der Vorstellung. Diese wird natürlich beim Nacherzählen der Erfahrung entfaltet; sie ist jedoch nicht notwendig, um sich in einem bestimmten gegenwärtigen Moment an die Erfahrung zu erinnern. Dafür reicht es hin, wie aus den obigen Beispielen deutlich wird, dass man aus dem Grund, den man zuvor so und so wahrnahm, mitgeteilt bekam, ausführte oder erlebte, handelt (oder reagiert). (Und hier bedeutet Grund nicht Ursache, sondern Begründung, die man anführen könnte, wenn man auf die Frage, warum man getan habe, was man tat, antwortet.) Sich an etwas erinnern ist ebenso wenig eine Erfahrung wie etwas wissen Zweitens ist sich erinnern (woran wir uns bei einer bestimmten Gelegenheit erinnern) ebenso keine Erfahrung wie wissen (was wir bei einer bestimmten Gelegenheit wissen). Das dürfte nicht überraschen, weil sich zu erinnern, dass etwas so ist, bedeutet, etwas zu wissen, das man zuvor gelernt und nicht vergessen hat. Natürlich kann ich mich plötzlich an etwas erinnern, und das kann mit verschiedenen Erfahrungen einhergehen (z. B. einem Gefühl der Erleichterung oder damit, ein Vorstellungsbild zu haben). Sich bei einer Gelegenheit an etwas zu erinnern (genau wie, etwas zu wissen), hat jedoch wesentlich keine Qualität; das heißt, es ähnelt keinem Gefühl, auf das man sich mit der Frage beziehen kann ‚Wie fühlte es sich an?‘. Vielmehr kann es verschiedene Erscheinungsfor-
5.2 Gedächtnis
225
men der Tatsache geben, dass ich mich an etwas erinnere, keine davon ist das Erinnern. Wenn Sie das für diesen Abend anberaumte Treffen absagen, gibt es unendlich viel, das ich, mir in Erinnerung rufend, dass das Treffen abgesagt ist, daraufhin machen kann. Ich kann nach Hause gehen, ins Kino, irgendeinen Freund anrufen und ein gemeinsames Abendessen arrangieren, bis spät im Büro bleiben, in den Buchladen gehen, ein Buch zu kaufen, um es am Abend zu lesen, und so weiter. Alle diese Möglichkeiten sind an meine Erinnerung daran geknüpft, dass das Treffen abgesagt ist. In keinem Fall aber muss ich Ihre Absage des Abendtreffens ‚im Gedächtnis wiedererzeugen‘ oder mir auch nur sagen, dass Sie absagten. Notwendig ist allein, dass ein Grund für mein Handeln darin besteht, dass Sie das Treffen abgesagt haben – und das ist keine Erfahrung. Also schließt Erinnern nicht die Anregung einer Gehirnspur ein, um eine reproduktive Gedächtniserfahrung wiederzuerzeugen Wenn sich an etwas erinnern nicht heißt, dass man sich an ein Ereignis der Vergangenheit erinnert, anlässlich dessen die relevante Information erworben wurde, heißt es fraglos auch nicht, dass eine hypothetisch angenommene Gehirnspur oder ein mutmaßliches Muster neuraler Entladung angeregt wird, um eine Reproduktion des ursprünglichen Ereignisses ‚im Gedächtnis‘ wiederzuerzeugen. Und wenn das Erinnern keine reproduktive Gedächtniserfahrung einschließt, ist es nicht notwendig, dass die hypothetisch angenommene Gehirnspur reaktiviert wird, um die entsprechende Erfahrung zu erzeugen. Natürlich verlockt es zu denken, dass, wenn man gelernt hat, dass p (z. B. dass die Schlacht von Hastings 1066 ausgefochten wurde oder dass E = mc2), und diese Tatsache in Erinnerung behält, sie dann im Gehirn ‚aufgezeichnet‘ oder ‚kodiert‘ werden muss. Wie könnte man sie sonst wohl wiedererinnern? Allerdings wurde die Vorstellung von einem Kodieren oder Repräsentieren faktischer Information in den Neuronen und Synapsen des Gehirns kein Sinn verliehen, wie wir gesehen haben. Die neurowissenschaftliche Konzeption der Erinnerungsauslösung ist verworren Es stimmt nicht, dass immer dann, wenn man sich an etwas erinnert (z. B. an den Wochentag, den Heimweg, den letzten Geburtstag, die Eröffnungstakte von Beethovens Fünfter), dieses Erinnern von einer gegenwärtigen Erfahrung ausgelöst wird, die eine neurale Erregung verursacht, welche einem Teil der neuralen Erregung ähnelt, die vom Wahrnehmungsereignis, da man lernte, woran man sich nun erinnert, verursacht wurde. Es ist nicht wahr, dass immer dann, wenn der Grund für das eigene Tun eine zuvor gelernte Tatsache ist, man von irgendeiner gegenwärtigen Erfahrung an die Tatsache erinnert worden sein muss, geschweige denn von einer Erfahrung, die eine Ähnlichkeit mit der vergangenen Erfahrung aufweist, in der man lernte, woran man sich nun erinnert. Demzufolge benötigt man die Annahme nicht, dass die mutmaßliche Gehirnspur von einer gegenwärtigen Erfahrung, die einen Teil des ursprünglichen Musters der neu-
226
5 Die kognitiven Vermögen
ralen Erregung erzeugt, reaktiviert wird. Sie (die Annahme) wurde ausformuliert, um den Ansprüchen einer Konzeption zu genügen – einer Konzeption davon, worin das Erinnern besteht. Diese aber geht vollständig in die Irre. Die neurowissenschaftlichen Entdeckungen, die die Vorraussetzungen der Wissensbewahrung betreffen, stützen die neurowissenschaftliche Konzeption des Gedächtnisses nicht Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass eine Schädigung des Hippocampus einen der Fähigkeit beraubt, Gelerntes oder Erfahrenes länger als 30 Sekunden in Erinnerung zu behalten. Das deutet sicherlich darauf hin, dass die Bewahrung bestimmter neuraler Feuermuster und synaptischer Verbindungen eine notwendige Bedingung der Möglichkeit des Wieder-Erinnerns ist. Daraus folgt aber nicht, dass ‚die Erinnerungen an den periodisch wiederkehrenden kollateralen Synapsen gespeichert sind‘, wenn die Termini ‚Erinnerung‘ und ‚speichern‘ in ihrer Alltagsbedeutung Verwendung finden. Denn um es zu wiederholen, so etwas wie ein ‚Speichern‘ dessen, was man in Erinnerung behält – zum Beispiel dass die Schlacht von Hastings 1066 ausgefochten wurde oder den ersten Aufenthalt in Florenz –, gibt es nicht, es sei denn, es ist in Symbolform irgendwo eingetragen und der Eintrag wurde gespeichert. Es mag sein, dass die Bewahrung bestimmter synaptischer Verbindungen und die Erzeugung periodisch wiederkehrender Feuermuster dafür notwendig sind, dass man etwas in Erinnerung rufen kann – aber das ist auch schon alles. Von den entsprechenden synaptischen Verbindungen und Feuermustern kann man nicht sagen, dass sie ‚eine Erinnerung‘ oder das, woran man sich erinnert, repräsentieren. Sich an etwas erinnern heißt nicht, etwas abzurufen, das im Hippocampus gespeichert ist. Und es bedeutet auch nicht, eine besondere Art von Erfahrung zu haben – eine Gedächtniserfahrung, die irgendeine zurückliegende Erfahrung ‚im Gedächtnis‘ wiedererzeugt. Gedächtnis ist die Bewahrung zuvor erworbenen Wissens. Es ist ein Vermögen, dessen Ausübung unendlich viele Formen annehmen kann: Man kann beispielsweise sagen, woran man sich erinnert; wenn man gefragt wird, zugeben, dass man sich daran erinnert; gar nichts sagen, aber über das Erinnerte nachdenken; weder irgendetwas sagen noch denken, sondern dem in irgendeiner Weise (unter den unendlich vielen ‚Weisen‘) Erinnerten entsprechend handeln; etwas oder jemanden wiedererkennen und so weiter. Es ist sehr verlockend zu denken, dass die diversen Formen, in denen die Erinnerung an etwas sich offenbaren kann, sämtlich auf die Tatsache zurückgehen, dass das in Erinnerung Behaltene im Gehirn aufgezeichnet oder gespeichert ist. Das ist jedoch Unsinn. Woran man sich erinnert, wenn man sich erinnert, dass dieses und jenes, ist nicht irgendetwas im Gehirn Aufgezeichnetes, sondern vielmehr etwas zuvor Gelerntes oder Erfahrenes. Die Neurowissenschaftler haben sich darum zu bemühen, die neuralen Bedingungen des In-Erinnerung-Behaltens und -Rufens und ihre neuralen Begleiterscheinungen ausfindig zu machen. Kurzum, die Neurowissenschaftler, die sich dem Gedächtnis forschend widmen, sollten zwischen der Erfahrung des Informationserwerbs und der erworbenen Informa-
5.2 Gedächtnis
227
tion unterscheiden und folglich zwischen der Erinnerung an die erworbene Information und der Erinnerung an ihren Erwerb. Sie müssen sich vorsehen, nicht in den Irrtum zu verfallen, alles Erinnern sei Erinnern einer zurückliegenden Erfahrung. Wenn sie sich mit dem Erinnern einer zurückliegenden Erfahrung befassen, dürfen sie nicht voraussetzen, dass es sich beim Erinnern um eine Art vorstellungsmäßigen Reproduzierens handelt, im Unterschied zum Nacherzählen oder anderen Handlungsformen, und sie dürfen nicht voraussetzen, dass das Nacherzählen damit einhergeht, einem Vorstellungsbild Information zu entnehmen. Und sie sollten nicht glauben, dass es sich beim Erinnern an etwas um eine Art Erfahrung handelt. Demzufolge müssen sie auch das Gedächtnis – das ist das, was man in Erinnerung behält und woran man sich erinnert – von seinem Ausdruck in Worten, Symbolen oder Bildern unterscheiden und ferner einen Unterschied machen zwischen dem verbalen Gedächtnisausdruck und den vielfältigen Formen, in denen offenkundiges Erinnern sich zeigen kann. Der Gedächtnisausdruck muss unterschieden werden von den neuralen Konfigurationen, die, wie auch immer sie beschaffen sein mögen, Bedingungen dafür sind, dass eine Person sich erinnern kann, unabhängig davon, woran. Bei diesen Konfigurationen haben wir es jedoch nicht mit dem Gedächtnis zu tun; und auch nicht mit Repräsentationen, Abbildungen oder Ausdrücken dessen, was man in Erinnerung behält bzw. behalten hat.
6 Die kogitativen Vermögen Im letzten Kapitel haben wir die Hauptumrisslinien der allgemeinen Kognitionsbegriffe des Wissens und des Gedächtnisses nachgezeichnet. Nun wenden wir uns einer Gruppe verwandter Allgemeinbegriffe zu, die gleichfalls mit charakteristischen Vermögen menschlicher Wesen verknüpft sind: Glauben, Denken und Vorstellungskraft (Vorstellung). Bei einigen, obgleich nicht allen Varianten von Glauben handelt es sich um Fälle von Denken – wenn das Verb ‚glauben‘ beispielsweise dazu gebraucht wird, eine Meinung auszudrücken, also das, was man über eine bestimmte Angelegenheit denkt. Ähnlich verhält es sich beim Verb ‚vorstellen‘, das sowohl kogitativ gebraucht wird als auch dazu, die Ausübung des Vermögens, Vorstellungsbilder heraufzubeschwören, die nicht mit dem Denken in Zusammenhang stehen müssen, zum Ausdruck zu bringen. Das Verbindende der drei Begriffe rechtfertigt es dennoch, sie – zumindest für unsere Zwecke – unter der Überschrift ‚Die kogitativen Vermögen menschlicher Wesen‘ zusammenzufassen. Auch in diesem Zusammenhang muss man sich klarmachen, dass es sich bei diesen Attributen um Attribute der Menschen und nicht ihrer Gehirne handelt. Wir werden uns nicht lange beim Glauben aufhalten, weil die neurowissenschaftliche Forschung sich diesem Thema selten zugewandt hat. Allerdings werden wir Denken, Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder detailliert behandeln.
6.1 Glauben Das Verhältnis zwischen wissen und glauben Die verschiedenen Begriffe des Glaubens und der Überzeugung stehen mit dem Wissensbegriff in Zusammenhang. Glauben ‚erreicht‘ wissen nicht, denn man kann etwas glauben, ohne zu wissen, ob es um die Dinge so bestellt ist, wie man glaubt. Wissen heißt, dass es um die Dinge so bestellt ist, wie man weiß, dass sie sind, wohingegen glauben nicht bedeutet, dass es um die Dinge so bestellt ist, wie man glaubt, dass sie sind. Anders als im Falle von ‚zu wissen‘ ist ‚zu glauben‘ nicht faktiv. Man kann die Dinge im Detail, gut oder gründlich kennen, man kann sie jedoch auf keine der drei Weisen glauben. Darum gibt es Wissensgrade (seinen Umfang betreffend), jedoch keine (vergleichbaren) Glaubensgrade: Ich kann mehr über Mathematik, Physik oder Geschichte wissen als Sie, und ich kann Jack besser kennen, als Sie es tun, aber ich kann nicht mehr (über) Mathematik, Physik oder Geschichte glauben als Sie, ebenso wie ich Jack nicht besser glauben kann, als Sie es tun (obgleich ich stärker an ihn und seine Erzählung
6.1 Glauben
229
glauben bzw. diesen mehr vertrauen kann als Sie). Wir beide können glauben, dass es um die Dinge so und so steht, Sie können jedoch nicht mehr oder besser glauben, dass es um die Dinge so steht, als ich, und Ihr Glauben kann nicht größer als meiner sein. Sie können allerdings mit einer größeren Überzeugung, als ich sie habe, glauben, dass es um die Dinge so steht, weil es nämlich Überzeugungsgrade gibt – das heißt, man kann an einem Glauben mehr oder weniger nachdrücklich bzw. beharrlich festhalten. Anders als das Wissen kann der Glauben richtig oder nicht richtig, zutreffend oder unzutreffend, wahr oder falsch sein. Er ist richtig, zutreffend oder wahr, wenn das, was man glaubt – nämlich dass es um die Dinge so und so steht – richtig, zutreffend oder wahr ist; das heißt, es ist richtig bzw. zutreffend, zu glauben, oder wahr, zu sagen, dass es um die Dinge so und so steht. Der Glauben kann verbindlich oder unverbindlich, leidenschaftlich oder dogmatisch sein, was für das Wissen nicht gilt. Er ist verbindlich oder unverbindlich, wenn man verbindlich oder unverbindlich glaubt, und er ist leidenschaftlich oder dogmatisch, wenn man leidenschaftlich oder dogmatisch glaubt (aber das, was man glaubt, ist weder verbindlich oder unverbindlich noch leidenschaftlich oder dogmatisch). Es ist also wichtig, den Glauben – als das aufgefasst, was geglaubt wird –, der richtig oder nicht richtig sein kann, nicht mit dem Glauben – als Glaubensvollzug aufgefasst –, das leidenschaftlich oder dogmatisch sein kann, durcheinanderzubringen.270 Das Geglaubte kann nicht leidenschaftlich oder dogmatisch sein, und das Glauben dessen, was man glaubt, kann nicht gewiss, wahrscheinlich oder möglich sein (das Geglaubte kann so sein, wenn es gewiss, wahrscheinlich oder möglich ist, dass es um die Dinge so und so steht). Genau wie wissen ist glauben weder eine Handlung noch eine Tätigkeit, und es ist auch kein Gefühl und kein Geisteszustand. Anders als wissen ist glauben weder eine Fähigkeit, noch ähnelt es einer Fähigkeit. Wie beim Wissen, aber anders als beim Empfinden oder Wahrnehmen, hört man im Falle des Glaubens nicht auf zu glauben, was immer man glaubt, wenn man einschläft oder anderweitig das Bewusstsein verliert. Die Verknüpfungen zwischen dem Glauben und den mit ihm zusammenhängenden Attributen Glauben ist auf verschiedene Weisen mit Zweifel, Gewissheit, Überzeugung und Sicherheit verknüpft und folglich mit dem Zweifeln, Gewiss-, Überzeugt- und Sichersein. Wenn man glaubt, dass etwas so ist, dann bezweifelt man nicht, dass es so ist, und man 270
Man kann wahrheitsgemäß, richtigerweise oder zu Recht glauben, dass p, und man kann leidenschaftlich, unverbindlich oder verbindlich glauben, dass p. Im ersten Fall jedoch charakterisieren die Adverbien ‚wahrheitsgemäß‘, ‚richtigerweise‘ und ‚zu Recht‘ nicht die Art, in der man an seinem Glauben festhält, was die Adverbien ‚leidenschaftlich‘, ‚unverbindlich‘ und ‚verbindlich‘ tun. Man glaubt vielmehr wahrheitsgemäß, richtigerweise oder zu Recht, dass p, wenn es wahr, richtig oder tatsächlich so ist, dass p.
230
6 Die kogitativen Vermögen
wird das, was auch immer man als unwahrscheinlich auffasst, bezweifeln, wenn es um die Dinge so steht, wie man glaubt. Zu zweifeln oder skeptisch zu sein, ob etwas so ist, heißt, dahin zu tendieren, nicht zu glauben, dass es so ist. Man kann glauben, dass etwas so ist, ohne gewiss, sicher oder überzeugt zu sein, dass es so ist; aber man kann nicht gewiss, sicher oder überzeugt sein, dass etwas so ist, ohne zu wissen oder zu glauben, dass es so ist. Zur objektiven Gewissheit gehört, dass die Möglichkeit, dass es um die Dinge nicht so steht, wie man es glaubt oder weiß, ausgeschlossen ist. Es ist gewiss, dass es um die Dinge so und so steht, wenn aufgrund der Tatsachenlage ausgeschlossen werden kann, dass es nicht so um sie bestellt ist. Subjektive Gewissheit (gewiss oder sicher sein bzw. sich so fühlen) impliziert, dass Zweifel ausgeschlossen sind. Obgleich es keine Glaubensgrade gibt, gibt es Überzeugungsgrade, die von sicher bzw. gewiss sein oder der vollkommenen Überzeugung bis zu Unsicherheits- oder Zweifelsgefühlen reichen. Glauben ist ein Attribut von Menschen, nicht von Gehirnen (Crick) Genau wie die anderen psychologischen Attribute ist auch glauben, dass dies und jenes, einer Person beizumessen, jedoch nicht ihrem Gehirn. Darum ist Cricks Behauptung, „[w]as man sieht, ist nicht das, was wirklich da ist; es ist das, wovon Ihr Gehirn glaubt, es sei da“,271 irreführend. Es gibt skeptische Menschen und leichtgläubige, aber keine skeptischen und leichtgläubigen Gehirne. Wir alle wissen, was eine an Gott glaubende oder nicht an ihn glaubende Person ist, eine, die an die konservative Partei oder Feen, jemand anderen oder dessen Erzählung glaubt bzw. sein Wort anzweifelt und skeptisch ist, was dessen Erzählung angeht. Wir wissen allerdings nicht, worum es sich bei einem religiösen, agnostischen oder atheistischen Gehirn handeln könnte. Einem solchen Wortgebilde wurde kein Sinn zuerkannt. Es gibt nichts dergleichen wie ein Gehirn, das an Gott glaubt oder nicht an ihn glaubt, weil Gehirne nicht an etwas glauben oder nicht glauben können. Wir können diesem Wortgebilde einen Sinn zuerkennen; wir können vereinbaren, dass ein agnostisches Gehirn das Gehirn einer agnostischen Person ist – obgleich eine solche Vereinbarung keine Anwendung hat: Sie ist vollkommen überflüssig. Wir können jedoch nicht vereinbaren, dass ein agnostisches Gehirn ein Gehirn ist, das, was seinen Glauben an Gott angeht, agnostisch ist, weil Gehirne keinen Glauben haben – das heißt, es gibt nichts dergleichen wie ein (an) etwas glaubendes oder nicht glaubendes Gehirn. Es gibt gleichfalls keine konservativen oder sozialdemokratischen Gehirne, nur Menschen, die an die nämlichen Parteien glauben; und das Gehirn kann weder an Feen glauben noch an Märchen, und es kann auch nicht skeptisch sein, was ihre Existenz angeht. Ich kann meinem Freund und seiner Erzählung glauben, mein Gehirn kann jedoch nicht – kann es in logischer Hinsicht nicht – meinem Freund oder seiner Erzählung glauben. 271
F. Crick, The Astonishing Hypothesis (Touchstone, London, 1995), S. 31 [dt. Was die Seele wirklich ist (Artemis & Winkler, München & Zürich, 1994), S. 52].
6.1 Glauben
231
Warum glauben kein Gehirnzustand sein kann Man sollte beachten, dass es sich beim Glauben, dass etwas so und so ist – logisch betrachtet –, nicht um einen neuralen Gehirnzustand handeln kann (siehe auch 13.1). Denn wenn glauben das sein könnte und wenn es sich bei ‚ich glaube, dass dies und jenes‘ um eine Mitteilung über jemandes eigenen Glauben handelte, dann würde es sich um eine Mitteilung über den Zustand seines Gehirns handeln. Wäre dem so, dann würde es, weil der Zustand seines Gehirns vollkommen unabhängig davon ist, ob dies und jenes tatsächlich der Fall ist, Sinn ergeben, ihn selbst zu fragen, ob dies und jenes der Fall ist. Wenn eine Person jedoch sagte, sie glaube, dass dies und jenes, hat sie sich bereits festgelegt, dass es der Fall ist – was sie nicht getan hätte, wenn sie lediglich über ihren inneren Zustand Mitteilung gemacht hätte. Sie kann nicht sagen ‚Ich glaube, dass die Dinge so sind, auf die Frage, ob sie so sind, kann ich jedoch nicht antworten (oder, ich bin unvoreingenommen)‘. Wenn allerdings ‚Ich glaube, dass . . .‘ eine Mitteilung über den Zustand ihres Gehirns wäre, könnte sie diesen Unsinn vorbringen, und zwar verständlich. ‚Ich glaube‘ wird verwendet, um eine Behauptung auszudrücken, auf die Art der Gründe für die Behauptung hinzudeuten oder um zum Behaupteten Stellung zu nehmen ‚Ich glaube, dass . . .‘ wird normalerweise, aber nicht durchgehend verwendet, um ein Urteil, dass es um die Dinge so und so steht, zum Ausdruck zu bringen und zugleich deutlich zu machen, dass man falschliegen könnte, dass die eigenen Gründe für die Behauptung, um die Dinge sei es so und so bestellt, nicht hinreichen, die Möglichkeit auszuschließen, dass es um sie anders steht. Es handelt sich nicht um eine Mitteilung darüber, wie sich einem die Dinge im eigenen Geist oder im eigenen Gehirn darstellen. Gemeinhin hat die Wendung eine Ähnlichkeit mit ‚Soweit ich weiß, ist dies und jenes der Fall‘ oder ‚Wenn ich mich nicht sehr irre, ist dies und jenes der Fall‘ – bei denen es sich nicht einmal um Mitteilungen über den eigenen geistigen Zustand handelt, geschweige denn den neuralen.272 Leicht abweichend davon wird sie mitunter genauso verwendet wie ‚Ich gehe davon aus, dass es um die Dinge so und so steht‘, was ein Hinweis darauf ist, dass ich nicht über Wissen aus erster Hand verfüge. In anderen Zusammenhängen – wo beispielsweise Wissen aufgrund der Eigenart des Falls keine Rolle spielt – kann es jedoch verwendet werden, um eine Meinung auszudrücken und so deutlich zu machen, welche Position der Sprecher in der nämlichen Angelegenheit innehat.
272
Für eine Ausarbeitung dieses Punktes siehe A. W. Collins, The Nature of Mental Things (University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 1987).
232
6 Die kogitativen Vermögen
6.2 Denken Das Verhältnis zwischen glauben und denken Glauben und denken unterscheiden sich, mitunter aber sind sie recht nah beieinander. Zwischen zu denken, dass etwas so ist, und zu glauben, dass etwas so ist, kann eine Ähnlichkeit bestehen.273 In bestimmten Fällen gibt es keinen Unterschied zwischen denken und glauben oder sogar meinen, dass etwas so ist. Der Begriff des Denkens weicht indes auch von dem des Glaubens ab. Denn man kann ins Denken vertieft sein, aber nicht ins Glauben, daher kann man beim Denken unterbrochen werden, jedoch nicht beim Glauben. Man kann ein Problem durchdenken, aber nicht durchglauben, und an eine Lösung denken sowie sich eine ausdenken. An eine Antwort auf eine Frage zu denken heißt nicht, an eine Antwort zu glauben, noch nicht einmal, die Antwort, an die man dachte, zu glauben. Man kann laut oder leise denken, aber nicht glauben, effizient oder ineffizient, auf fruchtbare oder unfruchtbare Weise denken, aber nicht glauben. Man kann einer Person, einem Gerücht oder einer Erzählung glauben, aber nicht denken, so wie man an eine Person, einen Gott oder eine Ursache glauben [believe in] kann, aber nicht ‚think in‘. Die unterschiedlichen logischen Kategorien, zu denen denken gehören kann Denken kann etwas sein, das sich ereignet, wie in dem Fall, da einem ein Gedanke durch den Kopf geht, oder etwas, das man tut, wie in dem Fall, da man an eine Lösung denkt, sowie etwas, mit dem man befasst ist, wie in dem Fall, da man eine Stunde lang ein Problem durchdenkt, oder dem, da man einer Tätigkeit aufmerksam nachgeht, darüber nachdenkend – das heißt, sich darauf konzentrierend –, was man gerade tut. Oder es ist nichts von alledem, wie in dem Fall, da man denkt, die Meinung vertritt, dass etwas so und so ist; oder dem, da man an etwas als etwas denkt – zum Beispiel an den Epilog von Krieg und Frieden als einen Geniestreich oder an Paul Klee als den einfallsreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts –, das heißt daran, wie man die Sache oder die Person auffasst; oder dem, da man denkt – das heißt annimmt –, dass die Brücke, die man gerade überquert, sicher ist.
273
Dennoch gleichen sie sich nicht immer. Wenn mir zu Ohren kam, dass Ihr Rosengarten wunderschön ist, kann ich darum bitten, ihn zu sehen, und sagen ‚Ich glaube, er ist wunderschön‘. Habe ich ihn gesehen, würde ich Ihnen mitteilen, dass ich denke (nicht, dass ich glaube), dass er wunderschön ist. In diesem Fall bestünde die Funktion von ‚glauben‘ darin, auf ein Gerücht hinzudeuten, während die von ‚denken‘ darin besteht, meiner eigenen Meinung aus erster Hand Ausdruck zu verleihen. (Siehe B. Rundle, Mind in Action (Clarendon Press, Oxford, 1997), S. 73–80).
6.2 Denken
233
Die Varianten des Denkens Wie oben angedeutet, gibt es Varianten des Denkens. Wir alle richten unser Augenmerk nur allzu oft auf eine bestimmte Variante auf Kosten der anderen, lassen uns nur allzu leicht zu der Annahme hinreißen, indem wir uns dieser Variante widmeten, nähmen wir das Denken im Allgemeinen in den Blick. Das für gewöhnlich favorisierte Paradigma ist das Denken von Rodins Le Penseur: mit gerunzelter Stirn still dasitzen, in Gedanken versunken. Wie wir gleich sehen werden, verbirgt sich sogar hinter diesem Paradigma eine unerwartete Vielfalt des Denkens bzw. dessen, was in unserem Kontext ‚denken‘ heißt. Misst man dieser Variante des Denkens jedoch unangemessen viel Bedeutung bei, entzieht man dem Blick vieles andere, bei dem es sich auch um Denken handelt – und das kann nicht Sinn der Sache sein. Lassen Sie uns also zunächst den Fokus erweitern und solche Denkvarianten ins Spiel bringen, die weitab liegen von den kogitativen Fähigkeiten des Meditierenden. (i) Es gibt das mit nichtmeditativen Tätigkeiten einhergehende Denken – das Denken, das darin besteht, sich der vorliegenden Arbeit zuzuwenden. Man kann mit ‚stupiden‘ Verrichtungen befasst sein, ohne aufmerksam oder konzentriert zu sein. Wer mit solchen Arbeiten zu tun hat – die Möbel polieren oder die Fenster reinigen beispielsweise –, verrichtet sie gedankenlos – was nicht bedeutet, dass man während des Polierens oder Reinigens nicht denkt, denn normalerweise denkt man dabei an andere Dinge. Es bedeutet, dass die Arbeit nicht viel Aufmerksamkeit oder Sorgfalt erfordert. Je komplexer oder anspruchsvoller die Verrichtung jedoch wird – wenn man eine Uhr repariert z. B., ein raffiniertes Experiment anleitet oder eine chirurgische Operation durchführt –, desto konzentrierter müssen Aufmerksamkeit und Denken sein, was es wiederum erforderlich macht, dass man die Eventualitäten und Schwierigkeiten, die eintreten bzw. sich ergeben können, im Blick hat und sie in die Überlegungen einbezieht. Das bedeutet nicht, dass man sich mit sich selbst über diese Eventualitäten austauscht, während man die Tätigkeit ausführt. Es bedeutet, dass man wachsam ist, was diese Eventualitäten angeht, und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen trifft. Im Gegensatz dazu bedeutet, ohne Überlegung oder gedankenlos mit solchen Tätigkeiten befasst zu sein, dass man sie mechanisch ausführt, ohne die gebotene Sorgfalt oder Aufmerksamkeit. Denken als die einer Aktivität gewidmete Auffassungskraft (ii) Ähnlich, aber doch anders verhält es sich mit dem einer Aktivität gewidmeten Denken, die nicht nur sorgfältig und mit Aufmerksamkeit vollzogen wird, sondern mit Raffinesse und Scharfsinn, indem man seine Auffassungskraft rasch und auf unerwartete Weise den sich ändernden Umständen zuwendet – sodass man die Aufgabe nicht nur angemessen, sondern vielmehr überlegt und mit Geschick bewältigt –, wie es dem herausragenden Tennisspieler oder dem scharfsinnigen Schachmeister gelingt als auch dem erfahrenen Versammlungsredner während einer heftigen Auseinandersetzung. In wieder anderer
234
6 Die kogitativen Vermögen
Weise offenbaren der brillante Hamlet-Darsteller oder der die ‚Hammerklavier‘-Sonate spielende Pianist die gedankliche Tiefe ihrer Interpretation, und zwar nicht, indem sie auf die wechselnden Umstände rasch und überlegt reagieren, sondern durch die Auffassungskraft, Originalität und Empfindsamkeit ihres Vortrags. Denken als überlegtes Sprechen (iii) Es gibt das mit dem überlegten Sprechen einhergehende Denken. Bei diesem haben wir es mit etwas Heterogenem zu tun. Ohne Überlegung bzw. gedankenlos spricht man, wenn man all die Faktoren unberücksichtigt lässt, die für das, worüber man spricht, von Belang sind. Mit gedankenlosem Sprechen ist nicht gemeint, dass man ohne die Begleitung eines ‚leisen Denkens‘ spricht. Dagegen heißt, mit Überlegung zu sprechen, die nämlichen Faktoren beim Sprechen zu berücksichtigen. Während des Sprechens scharf nachzudenken heißt nicht, zwei verschiedene Sachen zu tun, sprechen und scharf nachdenken, sondern eine Sache konzentriert auszuführen. Wenn jemand, während einer öffentlichen Auseinandersetzung beispielsweise, von Prämissen aus folgernd zu einem bestimmten Ergebnis gelangt, denkt er, das Denken aber unterscheidet sich nicht vom zutage tretenden Gedankengang, der sich in seiner Behauptung zu erkennen gibt, dass b aus a folgt, b entweder c oder d impliziert, c jedoch mit a inkompatibel ist, folglich c, und so weiter. Überlegtes Sprechen kann jedoch auch bedeuten, dass man denkt, bevor man etwas sagt. Denken als Meinen, Urteilen, Annehmen, Vermuten etc. (iv) Neben den mit Aktivitäten verbundenen Denkweisen gibt es auch das Denken, dass dies und jenes. Dabei kann es sich um einen Glauben, ein Urteil, eine Annahme oder ein Voraussetzen, eine Vermutung, einen Schluss oder eine Einschätzung handeln – was davon abhängt, wie man dazu kam, zu denken, was man denkt, und welche Art von Gründen man dafür hatte. ‚Ich dachte, es sei ungefährlich (solide, robust, sicher)‘, reumütig gesagt nach einem Missgeschick, muss nicht bedeuten, dass man nachdachte und zu einem Schluss kam – es kann bedeuten, dass man keinen Gedanken an die Angelegenheit verschwendete – das heißt, nicht nachdachte –, jedoch voraussetzte, annahm, vermutete – das heißt, dachte –, es sei so. Es kann aber bedeuten, dass man die Sache aufmerksam anging und zu diesem Ergebnis gelangte – wie in dem Fall zum Beispiel, da man sagt ‚Ich wusste das und das, also dachte (schloss) ich, dass es sicher sei‘. Denken als Assoziieren oder Wiedererinnern (v) An etwas denken kann heißen, dass manche Denkobjekte einem bloß zufällig oder durch Assoziation einfallen; es kann jedoch auch einer Wiedererinnerung entsprechen, die entweder durch etwas ausgelöst wurde oder einem einfach so durch den Kopf ging.
6.2 Denken
235
Andererseits kann es sich dabei um ein Resultat handeln – das Ergebnis des Nachdenkens darüber, was (zu tun ist), wie (man von hier zur Oper gelangt), wo (man seine Schlüssel verloren hat), wer (bei der Zusammenkunft anwesend war), wann (die Schlacht von Zama ausgefochten wurde), und das, was man denkt, wenn man an etwas denkt, worum auch immer es sich dabei handeln mag, ist die mutmaßliche Antwort, zu der man gelangte. Denken als eine Angelegenheit des Auffassens (vi) Man kann an etwas als etwas denken; wie es beispielsweise der Fall ist, wenn man an eine unschöne Erfahrung, die man gerade durchlebt, als ein Übergangsritual denkt oder an ein Gemälde als eine Allegorie oder an einen musikalischen Ausdruck als ein Echo auf eine vorhergehende Passage. An etwas als etwas denken entspricht einer Betrachtungsmöglichkeit dieser Sache oder einer Art, sie aufzufassen, die aufschlussreich und nützlich oder abwegig und verworren sein kann. Denken und etwas meinen (vii) Wie oben erwähnt gibt es ein Denken, das darin besteht, mit dem Gesagten etwas oder etwas anderes zu meinen. Diese Variante kann verschiedene Formen annehmen. Der Satz „Als (nicht während) ich sagte ‚Er ist in der Stadt‘, dachte ich an Jack“ macht explizit, auf wen Bezug genommen wurde. Der Satz aber „Als (nicht während) ich sagte ‚Wir müssen besser aufpassen‘, dachte ich, dass wir den Zeitplan überprüfen und auf die Karte schauen müssen“ führt aus, was jemandem durch den Kopf ging. Sich auf jemandes Denken zu beziehen heißt hier also, sich auf einen Zeitpunkt zu beziehen – den Moment nämlich, in dem der Betreffende sagte, was er sagte –, jedoch nicht auf irgendeine Handlung oder Begebenheit, die über die zu diesem Zeitpunkt vorgebrachte Äußerung hinaus stattgefunden hat. Dass man an Jack dachte (d. h., dass man Jack meinte) oder dass man dachte, dass wir dies und jenes tun müssen (d. h., dass es das war, was man meinte), ist nichts, was damals geschah, sondern vielmehr etwas, das man gesagt oder getan hätte, wenn bestimmte Umstände eingetreten wären (wenn man z. B. gefragt worden wäre, wer oder was einem durch den Kopf ging). Denken und durchdachtes Problemlösen Lassen Sie uns an dieser Stelle auf das Modell von Le Penseurs Denken zurückzukommen: Das Paradigma dieser Art zu denken ist das stille, einer Sache auf den Grund gehende – das heißt durchdachte – Problemlösen. Das, worüber man nachdenkt, schlägt die Aufmerksamkeit in seinen Bann – daher ist man ‚in Gedanken versunken‘. Bei dieser Art des Denkens handelt es sich um ein In-Anspruch-genommen-Sein. Es kann kontinuierlich oder mit Unterbrechungen ausgeübt werden. Denken ist hier die Anstren-
236
6 Die kogitativen Vermögen
gung, die Antwort auf eine Frage oder die Lösung für ein Problem zu finden, indem man Überlegungen anstellt bzw. folgert. Das kann methodisch, effizient, schnell oder langsam vonstattengehen. Ergebnis dieses Denkens ist der Schluss, zu dem man kommt, bei dem es sich wiederum um eine Entdeckung oder eine Hervorbringung von etwas handeln kann, und der originell oder langweilig, zutreffend oder unzutreffend sein kann. Solches stilles Denken muss aber kein folgernd voranschreitendes sein – es kann auch der Versuch sein, sich zu erinnern, wo . . ., wann . . . oder was . . . (siehe (v) oben), und seine erfolgreiche Umsetzung kann darin bestehen, dass man an das denkt, was man sich in Erinnerung zu rufen versuchte. Bei diesem ‚Denken an‘ haben wir es nicht mit bloßem Assoziieren zu tun (wie bei ‚Ich dachte an meine Großtante Jemima‘), sondern vielmehr mit der Entgegnung auf ein Problem – zum Beispiel denken, dass es NN war, der . . ., oder dass es so und so war, dass . . . Denken, müßiges Nachsinnen und Sich-Ausmalen Es gibt Varianten fortgesetzten stillen Denkens, bei denen es sich weder um durchdachtes Problemlösen noch um Erinnerungsbemühungen zur Beantwortung einer Frage handelt, sondern die mehr oder weniger müßigem Nachsinnen gleichkommen: wenn man über den Urlaub des letzten Sommers nachsinnt beispielsweise oder sich Tagträumen vom nächsten Sommerurlaub hingibt. Man denkt an dies und das oder sinniert über dies und jenes, das Denken kann in diesen Fällen jedoch insofern nicht methodisch, effizient oder erfolgreich sein, als es nicht auf eine Lösung oder Antwort für bzw. auf irgendetwas zielt. Es kann sich um wahlloses Assoziieren, versonnenes Erinnern oder freudige Erwartung handeln. Es kann sich, wie wir weiter unten sehen werden, um eine Form des Sich-Ausmalens handeln – an Möglichkeiten denken und von ihnen tagträumen, daran denken, wie es wäre . . . oder was geschehen würde, wenn . . . Solches Nachsinnen kann willkürlich, unwillkürlich oder zwanghaft sein und vom Akteur, der Thematik und den Umständen abhängen. Was aus der Variantenvielfalt des Denkens für die neurowissenschaftliche Erforschung des Denkens folgt Aus zwei Gründen haben wir die Variantenvielfalt des Denkens so ausführlich dargestellt. Zum einen, weil die neurowissenschaftliche Denkforschung glaubt, mit ein oder zwei Beispielen der ganzen Vielfalt des Denkens genügen zu können. So versuchen die Experimentatoren den ‚Ort‘ des Denkens im Gehirn zu ermitteln, indem sie solche Verfahren wie PET und fMRT zur Anwendung bringen und das Subjekt, dessen Gehirn gescannt wird, darum bitten, an etwas ‚zu denken‘ (z. B. ein Wort mit einem anderen zu verknüpfen oder irgendwelche einfache Berechnungen anzustellen), und dabei vergessen sie den Variantenreichtum des Denkens und verallgemeinern die besagten Spezial-
6.2 Denken
237
fälle unberechtigterweise zu einem Gesamtbild des Denkens. Man kann jedoch nicht davon ausgehen, dass, weil es nachweisbar ist, dass bestimmte Denkvorgänge – an ein zu ‚Ehemann‘ passendes Wort (nämlich ‚Ehefrau‘) zu denken oder an eine Lösung für eine einfache Berechnung etc. – mit der Erregung von dieser und jener Gehirnregion verbunden sind, darum alle Arten des Denkens eine ähnliche neurologische Grundlage aufweisen, mithin also auch das in den Vortrag eines Falles einbegriffene Denken, das tiefsinnige Klavierspiel, die gedankenvolle Darstellung von ‚To be or not to be‘, die Reparatur einer Vorrichtung, die mit hoher Denkkraft und Konzentration verbunden ist, das Tagträumen vom nächsten Sommerurlaub, das Annehmen, Vermuten oder Voraussetzen, Meinen, Glauben und so weiter, durch das ganze Spektrum, das wir eben skizziert haben. Das dem nicht so ist, dürfte aus den folgenden Betrachtungen hervorgehen. Die polymorphe Gestalt des Denkens (a) Denken ist polymorph – das heißt, jede seiner Varianten kann viele Formen annehmen –, sodass das, was man tut, wenn man bei einem bestimmten Anlass und unter bestimmten Bedingungen etwas denkt, auch bei anderen Anlässen und Umständen getan werden kann und doch überhaupt nicht als ein Denken betrachtet wird – wie beispielsweise ‚1314‘ sagen einmal als das Denken an das Datum der Schlacht von Bannockburne betrachtet werden kann, ein anderes Mal jedoch als mechanisches Zählen oder als die an jemanden gerichtete Mitteilung, wie spät es ist oder welche Telefonnummer man selbst hat (was nicht mit denken einhergehen muss). Ebenso kann die Form, die das Denken bei einer Gelegenheit annimmt, deutlich von der Form abweichen, die das Denken derselben Sache bei einer anderen Gelegenheit annimmt – so kann man beispielsweise denken, dass man seinem Freund etwas mitteilen muss, und dieses Denken kann bei einer bestimmten Gelegenheit die Form einer an ihn gerichteten unverzüglichen Mitteilung annehmen, während es sich bei anderer Gelegenheit in Form einer Notiz in das eigene Tagebuch manifestiert und bei wieder anderer in der Form, dass man das Telefon ergreift, um ihn anzurufen. Was man als denken betrachtet – oder als einstudieren, ausführen oder üben, kämpfen, bebauen oder spielen (alles polymorphe Verben) –, hängt nicht nur davon ab, was gesagt oder getan wird, sondern vom Kontext bzw. den Umständen, in denen es gesagt oder getan wird, von der Art und Weise, in der es gesagt oder getan wird, vom Zweck, zu dem es gesagt oder getan wird, und (gegebenenfalls) von den Bewertungen, was Erfolg oder Misserfolg des Gesagten oder Getanen angeht. Dass es verschiedene Arten einer Variante des Denkens gibt, darf nicht mit der Polymorphität des Denkens verwechselt werden (b) Denken, dass dies und jenes der Fall ist, kann alle möglichen unterschiedlichen Dinge umfassen: Es kann sich bei ihm beispielsweise um ein Folgern handeln, um Annehmen,
238
6 Die kogitativen Vermögen
Voraussetzen, In-Erinnerung-Rufen, Glauben, Meinen. Diese könnten wir die ‚Arten‘ [‚species‘] des Denkens, dass etwas so ist, nennen. Ebenso kann das Denken an etwas darin bestehen, dieses Etwas mit etwas anderem zu assoziieren; es kann sich um das SichBeziehen auf dieses Etwas – das heißt das Gemeinte – handeln (‚Als ich das sagte, dachte ich an Jack‘); es kann darin bestehen, eine Antwort zu ermitteln (‚Ich habe an eine Lösung gedacht‘); es kann darin bestehen, an etwas erinnert zu werden oder von etwas ‚tagzuträumen‘. Diese könnte man die ‚Arten‘ des Denkens an etwas nennen. Diese Vielfalt ist nicht identisch mit der Polymorphität des Denkens, denn bei jedem Element (z. B. Folgern, Vermuten oder Annehmen) einer bestimmten Art (z. B. von Denken, dass) haben wir es mit der Art einer Gattung zu tun (in dem Sinn, dass es sich beim Folgern, Vermuten, Annehmen um Arten des Denkens, dass etwas so und so ist, handelt), wohingegen eine besondere Form, die Denken, dass etwas so ist, annehmen kann, keine Art einer allgemeinen Gattung darstellt und daher mit einer anderen Form, die das Denken derselben Sache annehmen kann, Gattungsmerkmale teilt. Wenn man sich über die Varianten des Denkens im Klaren ist, sollte es offensichtlich werden, dass denken kein Attribut des Gehirns ist Wir haben die Varianten des Denkens noch aus einem zweiten Grund in ihrer Mannigfaltigkeit dargestellt und ausgearbeitet: Es sollte sinnfällig werden, dass es sich beim Subjekt des Denkens nicht um das Gehirn, sondern um das menschliche Wesen handelt. Nicht das Gehirn konzentriert sich darauf, eine Operation mit der gebotenen Sorgfalt und Konzentration auszuführen, sondern der Chirurg. Nicht das Gehirn spielt eine ausgebuffte Partie Tennis oder führt die ‚Hammerklavier‘-Sonate glänzend auf, sondern der Tennisspieler bzw. der Pianist. Der erfahrene Versammlungsredner, und nicht sein Gehirn, argumentiert verständig, reagiert umgehend auf Einwände, offenbart eine herausragende Auffassungsgabe in seiner Schlagfertigkeit und ein geistreiches Denken in seiner Argumentation. Es gibt nichts dergleichen wie ein voreingenommenes und starrsinniges Gehirn, denn Gehirne vertreten keine Ansichten – das tun nur Menschen, und das Gehirn kann genauso wenig unvoreingenommen oder voreingenommen sein, wie seine Argumentationen dieses voraussetzen oder jenes annehmen können, denn Gehirne argumentieren nicht. Gehirne fassen etwas nicht als dies oder das auf, weil Gehirne gar nichts auffassen, und Gehirne können nicht darlegen, an wen sie gedacht haben, indem sie etwas sagen, oder woran sie dachten, als sie etwas sagten, weil Gehirne nichts sagen und weil sie nichts meinen können, indem sie etwas sagen. Gehirne können keine guten oder schlechten Überlegungen anstellen, obgleich die Gehirnprozesse der Menschen, die gute Überlegungen anstellen können, zweifellos charakteristische Merkmale aufweisen, die sie mit dieser Gabe ausstatten.
6.2 Denken
239
Das Gehirn ist nicht der Ort der Gedanken (Edelman und Tononi) Das Gehirn ist nicht nur nicht das Subjekt des Denkens, es ist auch nicht der Ort der Gedanken. Im Gegensatz zu dem, was von Neurowissenschaftlern oft behauptet wird (die z. B. davon sprechen, dass „im menschlichen Kopf, daran zweifeln wir keinen Moment, Gedanken gedacht werden“274), werden Gedanken nicht im Gehirn gedacht, sondern im Studium, in der Bibliothek oder wenn man die Straße hinunterläuft. Das Denkereignis (eine Person hat einen bestimmten Gedanken) hat seinen Ort dort, wo sich die Person befindet, wenn ihr dieser Gedanke durch den Kopf geht. Gedanken kann man als niedergeschriebene in Texten finden, jedoch nicht in den Gehirnen von Menschen. Gedanken können von Menschen ausgedrückt werden, jedoch nicht von Gehirnen. Denn ein Gedanke ist genau das, was durch eine Äußerung oder eine andere symbolische Repräsentation bzw. Darstellung ausgedrückt werden kann. Die Tatsache, dass Menschen etwas denken, dies aber für sich behalten können, bedeutet mithin nicht, dass das, was sie denken, in ihren Gehirnen gesagt oder dort anderweitig ausgedrückt wird. Das Gehirn ist nicht das Denkorgan; in welchen Sinnhinsichten die Annahme, man denke mit seinem Gehirn, in die Irre geht Die Behauptung, dass das Gehirn in dem Sinne das Organ des Denkens ist, in dem das Auge das des Sehens ist, hilft uns ebenso wenig weiter. Denn man sieht mit seinen Augen (nähert seine Augen dem Objekt an, das genau erforscht werden soll, um besser zu sehen), in diesem Sinn denkt man mit seinem Gehirn allerdings nicht. Und man denkt auch nicht in dem Sinn mit seinem Gehirn, in dem man mit seinen Beinen läuft oder, in einem wieder anderen Sinn, mit seinem Magen verdaut). Es gibt freilich einen Sinn, in dem man sagen kann, man denke mit seinem Gehirn – wir sagen beispielsweise ‚Benutzt eure Gehirne!‘ (was einfach ‚Denkt!‘ heißt) und wir sagen auch ‚Ich liebe sie mit/von ganzem Herzen‘ – und zwar im metaphorischen Sinn. Die Neurowissenschaftler sollten sich von Metaphern jedoch nicht in die Irre führen lassen. Es stimmt zwar, dass man ohne ganz spezielle neurale Vorgänge nicht denken könnte – ohne ganz spezielle neurale Vorgänge könnte man allerdings auch nicht gehen oder reden. Aber niemand würde sagen, dass wir mit unseren Gehirnen gehen und reden. Natürlich kann ich mir ‚das Hirn zermartern‘, aber ich bin es, der denkt, nicht mein Gehirn. Und wenn ich denke, kann ich sagen, was ich denke. Ich kann etwas überdenken, ohne bislang zu einem Ergebnis gekommen zu sein. Es wäre jedoch absurd zu sagen ‚Mein Gehirn überdenkt etwas, allerdings weiß ich noch nicht, zu welchem Ergebnis es gekommen ist‘, ganz zu schweigen 274
G. M. Edelman und G. Tononi, Consciousness: How Matter Becomes Imagination (Allen Lane, The Penguin Press, London, 2000), S. 200 [dt. Gehirn und Geist (Beck, München, 2002), S. 273].
240
6 Die kogitativen Vermögen
von ‚Warte eine Minute; wenn mein Gehirn seine Überlegungen abgeschlossen hat, wird es mir mitteilen, was es denkt, und dann werde ich dir sagen können, was ich denke‘.275
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder Die Vorstellungskraft und andere Fähigkeiten Die von ‚vorstellen‘ [‚imagine‘] und solchen Artverwandten wie ‚imaginär‘ [‚imaginary‘], ‚Bild‘ [‚image‘], ‚einfallsreich‘ [‚imaginative‘] und ‚vorstellbar‘ [‚imaginable‘] konstituierte Begriffsfamilie weist viele Verzweigungen auf.276 Sie ist durch ein oder zwei Mitglieder mit den Begriffen von Denken und Konzeption, Gedächtnis, Wahrnehmung, Täuschung, Schaffenskraft bzw. Kreativität und Erfindung verbunden. Vorstellungskraft und Schaffenskraft Das Vorstellungsvermögen [faculty of imagination] ist mit der künstlerischen und der denkerischen Schaffenskraft verknüpft, mit Originalität, gedanklichem Verständnis und der Fähigkeit, von den üblichen Problemlösungen abzuweichen. Eine leistungsstarke Vorstellungskraft manifestiert sich in der Neuartigkeit, dem Einfallsreichtum oder den Einsichten des von großen Künstlern, Wissenschaftlern und Philosophen Hervorgebrachten, also in ihren Kunstwerken, wissenschaftlichen Theorien oder philosophischen Schriften. Wir wissen durch die gründliche Auseinandersetzung mit ihrem Werk, dass sie über eine bemerkenswerte Vorstellungskraft verfügen, nicht durch einen prüfenden Blick in ihr Gehirn oder durch das Spekulieren darüber, welche geistigen Ereignisse ihre kreativen Bemühungen begleitet haben mögen. Vorstellungskraft und Wahrnehmung Die Vorstellungskraft ist mit der Wahrnehmung auf verschiedene Weise verbunden, denn man braucht die Vorstellungskraft, um bestimmte Ähnlichkeiten, Zusammenhänge oder Beziehungsmuster zwischen seh- und hörbaren Dingen sehen oder hören 275
Im 12. Kapitel werden wir weitere einschlägige Aspekte untersuchen, die das Denken und den Ausdruck von Gedanken betreffen, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der Fragen, ob man in Bildern oder in Worten denkt oder weder in Bildern noch in Worten und ob Gedanken sich aus Bildern oder aus Worten zusammensetzen oder weder aus Bildern noch aus Worten. 276 [Die englischen Ausdrücke lassen sich im Deutschen auch so wiedergeben, dass ihre Familienähnlichkeit stärker zum Tragen kommt, nämlich mit: Einbildungskraft, eingebildet, Bild, reich an Einbildungen, einbildbar (jeweils im Sinne des Vorstellens und nicht des bloßen Einbildens). – A.d.Ü.]
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
241
zu können. Man benötigt die Vorstellungskraft, um zum Beispiel ein Musikstück als Variation auf ein Thema zu hören oder ‚Zitate‘ in Gemälden zu sehen (z. B. Michelangelos Isaak in Reynolds Mrs Siddons as the Tragic Muse) oder in einem Rorschach-Klecks verschiedene Figuren ‚zu sehen‘. Die Vorstellungskraft und das Vermögen, Vorstellungsbilder zu haben Es gibt eine begriffliche Verbindung zwischen der Vorstellungskraft und dem Vermögen, visuelle oder akustische Bilder entweder im Gedächtnis oder in der Fantasie heraufzubeschwören. Wir sprechen hier vom ‚Sehen‘ oder Visualisieren bzw. Veranschaulichen der Dinge ‚in/vor unserem geistigen Auge‘, davon, dass wir ‚in unserer Vorstellung‘ zu uns selbst sprechen oder Melodien einstudieren. Die Vorstellungsbilder, denen die mit dem Erkennen befassten kognitiven Neurowissenschaftler und Psychologen viel Aufmerksamkeit schenkten, sind eine Hauptquelle der Begriffskonfusionen. Denn es ist ausgesprochen verlockend, die Vorstellungsbilder als Arten der Gattung Bild aufzufassen – das heißt als Bilder, die physisch-materiellen Bildern entsprechen, nur eben geistige physische Bilder sind. Wir werden diese Fehlkonzeption weiter unten untersuchen und argumentieren, dass diese Auffassung von Vorstellungsbildern genauso wenig erklärt wie die Annahme, Quadratwurzeln negativer Zahlen entsprächen reellen Zahlen, seien nur eben imaginäre reelle Zahlen. Vorstellungskraft und Vermutung Es gibt einen Zusammenhang zwischen vorstellen und vermuten, mutmaßen und bezweifeln. Das wird in solchen Sätzen sinnfällig wie ‚Er hat sich niemals vorgestellt, dass er besser als alle anderen sei‘, ‚Die Stadt war weiter weg, als er sich vorgestellt hatte‘ und ‚Man kann sich nicht vorstellen, dass irgendeine Kreatur in der Lage ist, den arktischen Winter zu überleben‘. Es muss allerdings festgehalten werden, dass, obgleich die Verben ‚vorstellen‘, ‚vermuten‘, ‚mutmaßen‘ und ‚bezweifeln‘ mitunter austauschbar sind, das nicht immer so ist. Und während es einen Zusammenhang zwischen den Verben gibt, existiert ein solcher zwischen den Substantiven gleicher Abstammung nicht. Es gibt das Vorstellungsvermögen, aber kein Vermutungsvermögen, und zu vermuten, dass etwas so ist, heißt nicht schlechthin, das Vorstellungsvermögen auszuüben, obwohl es sich bei den Mutmaßungen, Vermutungen und ‚Bezweiflungen‘ um das Resultat einer äußerst kreativen Vorstellungskraft handeln kann. Vorstellungskraft und Irrglauben, Fehlerinnerung oder Falschwahrnehmung Vorstellen bedeutet mitunter, irrigerweise zu glauben, sich fehlerhaft zu erinnern oder nicht richtig wahrzunehmen [sich etwas (bloß) einbilden – A.d.Ü.]. Wir können uns den Weg zu unserem Ziel halbwegs gut vorstellen, wenn wir eine Gegend notdürftig
242
6 Die kogitativen Vermögen
aus der Ferne überblickt haben; wir können denken, dass wir einen Freund im Gedränge erblickt haben, um bei genauerem Hinsehen festzustellen, dass wir uns das bloß einbildeten. Noch einmal, Irrglauben, Fehlerinnerung und Falschwahrnehmung werden nicht als Resultate der Ausübung des Vorstellungsvermögens aufgefasst. Der Grund dafür ist klar. Bei der Vorstellungskraft haben wir es nicht mit einem Wahrheit und Falschheit betreffenden kognitiven Vermögen zu tun (dessen mangelhafte Ausübung mithin in einem irrigen Glauben, fehlerhaften Erinnern oder inkorrekten Wahrnehmen resultieren könnte), jedoch mit einem kogitativen, wie wir argumentieren werden. Die Verbindung zwischen dem Begriff des Vorstellens [Einbildens] und dem Falschen stellt sich jedoch einerseits über imaginäre oder fiktive Gedanken her, Gedanken von dem, was nicht wirklich oder ‚nur in der Vorstellung‘ existiert, und andererseits über die Beziehung zwischen dem Vorstellen und dem Sich-Dinge-Ausdenken. Die Vorstellungskraft ist ein kogitatives Vermögen Die Vorstellungskraft ist ein kogitatives und kein kognitives Vermögen.277 Seine Vorstellungskraft zu betätigen heißt, einer Form des Denkens nachzugehen – an etwas als ein Mögliches zu denken oder an dessen mögliche Merkmale. Man kann sich Entitäten einer bestimmten Art vorstellen, Ereignisse, die geschehen (sein) können oder nicht, und man kann sich vorstellen, bestimmte Dinge zu tun oder dass bestimmte Menschen (man selbst oder andere) bestimmte Dinge tun. Man kann sich vorstellen, wie es wohl wäre, wenn es um die Dinge so und so stünde, wie man sich vorstellen kann, weshalb es um die Dinge so steht oder nicht so steht, wie etwas getan wurde, wird, werden wird oder eigentlich getan werden sollte, wo etwas ist oder sein könnte. Und man kann sich etwas als das und das vorstellen, sich selbst so und so vorstellen und sich vorstellen, man wäre an der Stelle von diesem und jenem. Die Vorstellungskraft ist die Fähigkeit, an Mögliches zu denken Die Vorstellungskraft ist das beim Vorstellen ausgeübte Vermögen. Es ist die Fähigkeit, an mögliche Dinge zu denken (die tatsächlich der Fall sein können oder nicht – denn um die Dinge kann es in bestimmten Fällen so bestellt sein, wie man es sich vorstellte).278 Unsere Vorstellungskraft kann stark oder schwach ausgeprägt sein, prächtig 277
Die umfangreichste philosophische Untersuchung der Vorstellungskraft stammt von A. R. White: The Language of Imagination (Blackwell, Oxford, 1990). 278 In einem ganz bestimmten, mitunter jedoch irreführenden Sinn handelt es sich bei ihr auch um die Fähigkeit, sich Unmögliches auszudenken. Lewis Carroll war brillant darin, sich unterhaltsame logische Unmöglichkeiten auszudenken, d. h. Wortkombinationen, die auf vergnügliche Weise Sinn zu ergeben scheinen, was in Wirklichkeit aber nicht der Fall ist; Escher wiederum übertraf sich selbst beim Imaginieren von logisch unmöglichen Objekten und Konstellationen, d. h. von piktoralen Darstellungen, die gegen die Perspektivregeln verstoßen.
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
243
entfaltet oder nur ein armseliges Ding sein. Wenn sie die Grenzen des Glaubwürdigen hinter sich lassen, sind unsere Vorstellungen fantastisch, unwahrscheinlich und unglaublich bzw. unglaubwürdig. Es ist nicht überraschend, dass das Vorstellungsvermögen mit Originalität, Erfindungsreichtum und Schaffenskraft verknüpft ist, der Neuartigkeit der Möglichkeiten, die man sich ausdenkt, entsprechend oder gemäß dem Einfallsreichtum, mit dem man sich vorstellt, wie es wohl wäre, wenn . . . Man gebraucht seine Vorstellungskraft sowohl zum Entdecken als auch zum Schaffen, um anhand des Vorstellens Aufschluss darüber zu geben, was wohl passieren würde, wenn . . . oder wie sich etwas ereignet haben könnte, und man verwendet sie, um sich zu überlegen, wie es aussehen oder sein würde, wenn . . . Die Vorstellungskraft kann aktiv oder passiv ausgeübt werden. Man kann sich etwas willkürlich oder unwillkürlich vorstellen, und man kann darum gebeten oder dazu aufgefordert werden, sich die Dinge vorzustellen. Aber man kann nicht verhindern, sich die Dinge so und so vorzustellen, wie eine verängstigte Mutter es nicht verhindern bzw. lassen kann, sich fürchterliche Dinge vorzustellen, die ihrer vermissten Tochter zugestoßen sein könnten. Ihre Vorstellungen gehen nicht auf den Willen zurück. Die Vorstellungskraft ist ein Vermögen, über das Menschen verfügen, nicht ihre Gehirne Es dürfte offensichtlich sein, dass nicht das Gehirn, sondern der Mensch über eine stark oder schwach ausgeprägte Vorstellungskraft verfügt, dass wir es beim Gehirn nicht mit einem möglichen Subjekt einer starken oder schwachen Vorstellungskraft zu tun haben. Nicht das Gehirn hat die Kraft, sich neue, amüsante, geistreiche und originelle Möglichkeiten auszudenken, sondern der Mensch, obgleich, und das ist ebenso offensichtlich, eine Person mit stark ausgeprägter Vorstellungskraft es zweifellos auch der Merkmalsstruktur ihres Gehirns zu verdanken hat, dass sie über eine solche verfügt. Es dürfte gleichermaßen evident sein, dass die folgende, z. B. von Blakemore vertretene Annahme in die Irre geht: Weil es verortete sensorische Areale im Gehirn gibt, „enthält das Gehirn Bilder der Außenwelt, und es ist wahrscheinlich so, dass diese Bilder von funktionalem Wert für die Bewältigung der Analyse sensorischer Signale durch das Gehirn sind“.279 Ein Ort bzw. Areal sensorischer Verarbeitung ist kein Bild von irgendetwas; es gibt keine Bilder im Gehirn, und das Gehirn hat keine Bilder. Vorstellungsbilder sind für das Vorstellen weder notwendig noch hinreichend Es ist wichtig festzuhalten, gerade weil es allzu oft vergessen wird, dass Vorstellungsbilder für die Ausübung der Vorstellungskraft weder notwendig noch hinreichend sind. C. Blakemore, ‚Understanding images in the brain‘, in H. Barlow, C. Blakemore und M. Weston-Smith (Hg.), Images and Understanding (Cambridge University Press, Cambridge, 1990), S. 282. 279
244
6 Die kogitativen Vermögen
Vorstellungsbilder können entstehen oder heraufbeschworen werden, während man sich etwas in Erinnerung ruft, antizipiert, träumt oder tagträumt, bei keinem dieser Fälle haben wir es mit dem Vorstellen zu tun oder muss es sich um dieses handeln. Obwohl einem Vorstellungsbilder durch den Kopf gehen können, wenn man sich etwas Wahrnehmbares vorstellt, müssen sie es nicht. Man kann sich die Schlacht von Borodino vorstellen, ohne Bilder heraufzubeschwören – für Tolstoi war allein notwendig, Beschreibungen heraufzubeschwören, wie sie gewesen sein könnte. Man kann sich Othellos letzte Worte vorstellen oder die Trennung von Cassius und Brutus – für Shakespeare war allein notwendig, sich auszudenken (zu erfinden), was sie gesagt oder getan haben. Ein großer Teil des Vorstellbaren ist nicht zu verbildlichen Darüber hinaus gibt es eine ganze Menge, was wir uns vorstellen können, das, geistig oder in wörtlichem Sinn, nicht in ein Bild gebracht werden könnte, wie das, was Cäsar am Vorabend der Iden des März dachte, weshalb Harold Godwinson nicht in London blieb, um die Fyrd [eine angelsächsische Miliz] aufzustellen und so weiter. Man kann sich vorstellen, dass alle Menschen, manche Menschen oder kein Mensch so und so ist bzw. sind, aber nichts in einer Verbildlichung oder einem Bild kann das einfangen, was mit ‚alle‘, ‚manche‘ und ‚kein‘ ausgedrückt ist. Man kann sich vorstellen, dass Jill sich glücklicher fühlen würde, wenn Jack klüger wäre; man kann sich vorstellen, was hätte geschehen können, wenn Harald Hardrada im Sommer 1066 nicht einmarschiert wäre oder wenn der Wind im Kanal sich nicht genau zum Zeitpunkt der norwegischen Invasion gedreht hätte. Man kann sich Schwierigkeiten vorstellen, die das eigene Projekt betreffen, als auch Einwände gegen die eigenen Argumente und so weiter. Bei einer starken Vorstellungskraft handelt es sich nicht um die Fähigkeit, lebendige Vorstellungsbilder heraufzubeschwören, sondern vielmehr um die Fähigkeit, an raffinierte, ungewöhnliche, detaillierte, bislang unbekannte Möglichkeiten zu denken. Und die Vorstellungskraft wird nicht lediglich, und nicht einmal hauptsächlich, reflektierend ausgeübt, sondern sprechend und handelnd – sie beansprucht Erfindungsgeist, Schaffenskraft, Erzähl- und Problemlösungsfähigkeiten. Das Imaginationsvermögen (Fantasie) ist mit dem kogitativen Vorstellungsvermögen nur locker verbunden Man muss also keine Vorstellungsbilder heraufbeschwören, will man seine Vorstellungskraft betätigen. In Wirklichkeit kommt die Verbindung zwischen dem kogitativen (und kreativen) Vorstellungsvermögen und der Fähigkeit, Vorstellungsbilder heraufzubeschwören, größtenteils zufällig zustande. Es könnte sich als vorteilhaft erweisen, wenn wir diese beiden als zwei unterschiedliche Vermögen betrachten würden, wobei es sich bei jenem um die Vorstellungskraft handelt (wie oben dargestellt) und bei dieser um die
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
245
Fantasie.280 Sicherlich kann man über eine bemerkenswert lebendige Fähigkeit verfügen, ‚in der Vorstellung‘ vitale Seh- und Hörbilder aufzurufen, Dinge zu visualisieren, zu sich selbst zu reden, Melodien für und in sich einzustudieren, ohne eine einfallsreiche Person zu sein. Und umgekehrt kann man über eine schöpferische und produktive kreative Vorstellungskraft verfügen, ohne sonderlich befähigt zu sein, Bilder heraufzubeschwören. Zwischen diesen beiden Vermögen scheint nur eine schwach ausgeprägte logische Verbindung zu bestehen. Anscheinend gibt es zwischen dem Gedächtnisvermögen und dem Imaginationsvermögen (Fantasie) eine stärkere Verbindung als zwischen diesem und der kogitativen Vorstellungkraft. Diejenigen, die mit einer üppigen Verbildlichungskraft ausgestattet sind, können gemeinhin lebendige Bilder des zuvor Gesehenen aufrufen, das Gesicht oder Lächeln von irgendwem in besonders anschaulichen bzw. plastischen Bildern wiedergeben, vergangene Erfahrungen in ihrer Vorstellung ‚wieder erleben‘. Was Gedächtnis und Fantasie gleichermaßen beansprucht, und zwar als die Fähigkeit, Dichtkunst wiederzugeben oder ein vertrautes Musikstück für sich selbst in der eigenen Vorstellung zu wiederholen oder sich an die Stimme von diesem und jenem zu erinnern, als er das und das sagte. Die Ursprünge des neurowissenschaftlichen Interesses an Vorstellungsbildern Der Fähigkeit, Vorstellungsbilder heraufzubeschwören, visuelle Bilder im Besonderen, haben Neurowissenschaftler große Aufmerksamkeit geschenkt. Das hat zum Teil damit zu tun, dass sie Vorstellungsbilder für mysteriöse, öffentlich nicht beobachtbare Entitäten halten, über die der Kognitionswissenschaftler einiges herausfinden kann, so wie der Physiker über Elektronen und Mesonen. Es ist sicherlich richtig, dass man über Menschen und ihre Fantasiefähigkeit etwas herausfinden kann, darüber mithin, inwieweit die Vorstellungs- und Gedächtnisfähigkeiten auf ihrer Fantasie und deren Kräften beruhen. Es ist jedoch irrig anzunehmen, dass Vorstellungsbilder eine Ähnlichkeit mit den theoretischen Entitäten in der Physik aufweisen oder dass die Untersuchung der Fantasieausübung durch PET und fMRT der Untersuchung von Elektronen in einer Nebelkammer ähnlich ist. Das einschlägige neurowissenschaftliche Interesse rührt zudem von der Annahme her, dass es sich beim Erkennen um einen Prozess handelt, bei dem 280
Für eine gewinnbringende Erörterung siehe A. J. P. Kenny, The Metaphysics of Mind (Oxford University Press, Oxford, 1989), Kap. 8. Kenny verwendete die Ausdrücke ‚kreative Vorstellungskraft‘ und ‚Fantasie‘, während wir für ‚kogitative Vorstellungskraft‘ und ‚Fantasie‘ optieren. ‚Kogitative Vorstellungskraft‘ verbindet das Vermögen, das sie ist, dezidiert mit dem Denken, das kreativ sein kann, aber nicht sein muss (wenn die verängstigte Mutter sich all die schrecklichen Dinge vorstellt, die ihrem abwesenden Kind zugestoßen sein könnten, betätigt sie ihre Vorstellungskraft, ist jedoch nicht kreativ). Uns scheint ‚Fantasie‘ [‚fantasia‘], ein Ausdruck, der nicht oft verwendet wird, vorteilhafter als der Terminus ‚Einfall‘ [‚fancy‘], der in Wendungen gebraucht wird wie ‚ich hatte den Einfall, dass . . .‘ [‚I fancied that . . .‘], welche gleichbedeutend ist mit ‚ich imaginierte [‚I imagined that‘], dass . . .‘ (jedoch nicht mit ‚ich habe ein Bild von . . .‘ [‚I have an image of‘]).
246
6 Die kogitativen Vermögen
ein Vorstellungsbild mit einer Wahrnehmung verglichen wird. Obwohl es wahr ist, dass beim maschinellen Erkennen – gemeint ist die Fähigkeit einer Maschine, ein Objekt zu erfassen, das auszuwählen (‚zu erkennen‘) sie programmiert wurde – der Input mit elektronisch gespeicherten Bildern in Übereinstimmung gebracht wird, ist es keineswegs so, dass das menschliche Erkennen ähnlich funktioniert, also ein Abgleich zwischen einer Wahrnehmung und einem Vorstellungsbild stattfindet. Posners und Raichles Hypothese über neurale Ähnlichkeiten zwischen vorstellen und wahrnehmen Indem sie auf ausgedehnte Experimente mit PET und fMRT Bezug nehmen, behaupten manche Wissenschaftler, dass das Visualisieren von etwas (d. h. das Heraufbeschwören von Vorstellungsbildern dieses Etwas) mit der Erregung der gleichen neuralen Systeme einhergeht, die die entsprechende Seherfahrung beanspruchen würde. Zudem versichern Michael Posner und Marcus Raichle, dass, „wenn wir ein Bild konstruieren, eine Reihe mentaler Abläufe denen ähnelt, die in Erscheinung treten, wenn sich die Anregung physisch vollzieht. Mit anderen Worten, es gibt grundsätzliche Ähnlichkeiten zwischen dem Wahrnehmen eines Bildes und dem Vorstellen eines Bildes.“281 Ob in die Ausübung der Fantasie dieselben neuralen Systeme einbegriffen sind wie in die entsprechende Wahrnehmungserfahrung oder nicht, ist eine nicht unwichtige empirische Frage. Bevor diese beantwortet werden kann, muss sich der experimentierende Wissenschaftler jedoch über die Begriffe im Klaren sein, die hier eine Rolle spielen. Er muss sich insbesondere mit den Unterschieden auskennen, die einerseits zwischen dem Sehen und dessen Objekten und andererseits zwischen dem Visualisieren und dessen Objekten bestehen. Viele in diesem Bereich tätige Neurowissenschaftler zollen solchen begrifflichen Fragen jedoch nicht die ihnen gebührende Aufmerksamkeit. Folglich fallen sie Verwirrungen anheim.
281
M. I. Posner und M. E. Raichle, Images of Mind (Scientific American Library, New York, 1997), S. 89. Es überrascht schon, dass die neurowissenschaftliche Forschung sich eher für das visuelle als das auditive Vorstellen interessierte. Sogar das Mit/Zu-sich-selbst-Sprechen ‚in der Vorstellung‘ ist mindestens ebenso verbreitet wie das Heraufbeschwören von Vorstellungsbildern ‚in der Vorstellung‘, wenn es nicht sogar häufiger vorkommt als dieses. Zudem erweist sich das visuelle Vorstellen als der viel stärker von Begriffsverwirrungen betroffene Bereich. So wäre beispielsweise reizvoll, die Beziehungen zwischen den neuralen Systemen zu untersuchen, die mit dem Sagen, dem Reden und dem Zu-sich-selbst-Sprechen in der Vorstellung einhergehen, oder zwischen denen, die mit dem Hören eines Musikstücks, seinem Summen und dem Einstudieren einer Melodie in der eigenen Vorstellung verknüpft sind, oder zwischen denen, die mit dem Lesen eines Gedichts, dem Hören desselben, seinem Auswendig-Aufsagen und seinem Auswendig-Aufsagen in der Vorstellung einhergehen.
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
247
Posner und Raichle gehen mit der Annahme in die Irre, dass beim Wahrnehmen und in der Ausübung der Fantasie gleichermaßen ein Bild im Geist hervorgebracht wird So nehmen beispielsweise Posner und Raichle an, dass sowohl beim Wahrnehmen als auch in der Ausübung der Fantasie „im Geist ein Bild der Szenerie hervorgebracht wird. Das von den aktuellen Seherfahrungen her gewonnene Bild wird ‚ein Perzept‘ genannt, um es von einem vorgestellten Bild abzugrenzen.“282 Hier irren sich die beiden. Wenn ich meinen Raum und die Objekte darin wahrnehme, bringe ich kein Bild meines Raumes und seiner Objekte im Gehirn hervor. Wie wir dargelegt haben (4.2.3), heißt wahrnehmen nicht, ein Bild zu haben oder eines hervorzubringen, und beim Wahrgenommenen handelt es sich nicht um ein Bild, es sei denn, man nimmt Bilder wahr. Ein Vorstellungsbild einer Szenerie hervorzubringen heißt zudem nicht, sich ein Bild dieser Szenerie vorzustellen. Das ist etwas, das ein Maler tun könnte, wenn er das Gemälde, das ihm vorschwebt, in ein Bild zu bringen versucht. Ein Vorstellungsbild einer Szenerie hervorzubringen heißt allerdings, sich diese Szenerie (kein Bild von ihr) visuell vorzustellen. Außerdem geht die Annahme, es gebe ‚grundsätzliche Ähnlichkeiten‘ zwischen dem Wahrnehmen eines Bildes und dem Vorstellen eines Bildes, über das hinaus, was sie zum Ausdruck bringen will. ‚In‘ ihr verbirgt sich die viel allgemeinere Behauptung, dass es grundsätzlich ähnlich ist, ein Objekt O wahrzunehmen und ein Bild von O zu haben, und dass es (möglicherweise) auch grundsätzlich ähnlich ist, wahrzunehmen, dass es um die Dinge so steht, sowie ein Bild zu haben von den Dingen, um die es so steht. An welche Ähnlichkeiten denken die Neurowissenschaftler? Die angebliche neurale Ähnlichkeit zwischen vorstellen und wahrnehmen (Shepard) Zum einen gehen sie davon aus, wie wir oben festgestellt haben, dass hier ähnliche neurale Systeme eine Rolle spielen. So erklärt Roger Shepard im Hinblick auf den Fall, da eine Person ein Vorstellungsbild von O heraufbeschwört: Was auch immer dabei nervlich in seinem oder in ihrem Kopf vor sich geht, es überschneidet sich hinreichend mit der Nervenaktivität, die zuvor in diesem Gehirn durch die physische Präsenz von [O] selbst oder durch ein Bild von [O] hervorgerufen wurde. Obgleich es der Kausalzusammenhang zwischen der Nervenaktivität und der verbalen Mitteilung ist, der uns davon in Kenntnis setzt, dass jemand sich etwas vorstellt, ist es mithin der Kausalzusammenhang zwischen dieser Nervenaktivität und einem externen, zuvor erlebten Objekt, der definiert, was vorgestellt wird.283
282
Ibid., S. 88. R. Shepard, ‚Postscripts on understanding mental images‘, in Barlow, Blakemore und Weston-Smith (Hg.), Images and Understanding, S. 367. 283
248
6 Die kogitativen Vermögen
Diese Behauptung hat einen begrifflichen und einen empirischen Aspekt. In begrifflicher Hinsicht ist sie verworren, in empirischer kann sie nicht richtig sein. Shepards Behauptung schränkt die Fantasie unzutreffenderweise auf das Gedächtnis ein Erstens ist die Fantasie hier ungerechtfertigterweise auf ihre Ausübung beim Erinnern beschränkt. Man kann jedoch Vorstellungsbilder zahlloser Objekte heraufbeschwören, die man nie zuvor gesehen hat. Hat man Plutarchs Leben des Cäsar gelesen, kann man Vorstellungsbilder von Cäsar haben und davon, wie er im Senat ermordet wurde. Wurde einem alles über eine bestimmte Person erzählt, mit der man sich gerade treffen will (oder über einen Ort bzw. ein Gebäude, die man gerade besuchen möchte), kann man Vorstellungsbilder von ihr haben und wenn man dann auf sie trifft, der Meinung sein, dass sie so ist (oder nicht), wie man sie sich vorgestellt hat. Überdies könnte man vieles, von dem man Vorstellungsbilder haben kann, gar nicht wahrnehmen, was beispielsweise auf fiktionale und mythologische Charaktere zutrifft (Lancelot, Pluto) oder auf entsprechende Orte (Camelot, Hades) als auch auf fiktionale und mythologische Ereignisse. Die Ausübung der kreativen Fantasie (wenn man Geschichten verfasst oder Musik komponiert oder mythologische Bilder malt) kann nicht als Wiederbelebung früherer Eindrücke charakterisiert werden. Shepards unzutreffende empirische Behauptung hinsichtlich der Kriterien für die Ausübung der Fantasie Zweitens ist es kein Kausalzusammenhang zwischen jemandes Nervenaktivität und einem Verbalausdruck von dem, was er sich vorstellt, der ‚uns davon in Kenntnis setzt‘, dass er seine Fantasie betätigt – das tut ja gerade der ehrliche Verbalausdruck. Ob jemand ein Bild in seinem Geist heraufbeschworen hat, davon setzt uns das in Kenntnis, was dieser jemand ohne zu lügen sagt. Jedwede neurale Begleiterscheinungen liefern bloß induktive und keine kriterielle Evidenz, und die induktiven Korrelationen setzen das nichtinduktive Kriterium menschlicher Äußerungen voraus, das festlegt, ob einer Person ein Bild durch den Kopf geht. Darüber hinaus ist es offenkundig nicht der Kausalzusammenhang zwischen jemandes Nervenaktivität und einem ihm zuvor begegneten Objekt, der definiert, was in ein Bild gebracht wird. Denn wovon das Vorstellungsbild, das ich habe, ein Bild ist, wird durch das festgelegt, was ich sage, und zwar aufrichtigerweise sage, wovon es ein Bild sei – nicht durch seine kausalen Vorläufer (ebenso wie, welche Person ich in meiner Äußerung ‚John ist zu Hause‘ mit ‚John‘ meinte, durch meine aufrichtige Äußerung, ich meinte den und den, festgelegt wird). Es ist richtig, dass es einen wesentlichen Zusammenhang zwischen dem Visuelle-Bilder-Haben und dem Sehen gibt (und zwischen dem Auditive-Bilder-Haben und dem Hören).284 Dieser wesentliche Zusam284
Siehe Kenny, Metaphysics of Mind, S. 119.
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
249
menhang besteht allerdings nicht darin, dass die Bilder dem neuralen Speicher entnommen sind, der während des Sehens (oder Hörens) angelegt wurde. Das Kriterium dafür, ob jemand ein Vorstellungsbild von etwas hat, besteht vielmehr darin, dass er sagt, er habe eines und sagen kann, wie er das, was er sich vorstellt, visualisiert. Dafür muss er den Gebrauch unseres Alltagswortschatzes beherrschen, der Visibilia beschreibt, einschließlich Farben und Formen. Um einen solchen Wortschatz beherrschen zu können, muss er in der Lage sein zu sehen, denn ohne das Sehen kann eine Person beispielsweise nicht den Gebrauch von Farbworten beherrschen oder visuelle Erscheinungen beschreiben (außer in abgeleiteter Form). Posners und Raichles Behauptung, dass zwischen den geistigen Operationen der Wahrnehmung und denen der Fantasie eine Ähnlichkeit besteht, geht in die Irre Zum anderen bestehen laut Posner und Raichle Ähnlichkeiten zwischen „den geistigen Operationen, die der Wahrnehmung und der Bilderzeugung zugrunde liegen“.285 Ähnlich sind ihrer Ansicht nach auch diese Vorgänge: die Buchstabe n in den Worten abzutasten, die drei Buchstabe n umfassen, und ebendies bei den entsprechenden Vorstellungsbildern zu tun.286 Hier haben wir es jedoch mit einer irrigen Annahme zu tun, denn so etwas wie ein Abtasten eines Vorstellungsbildes gibt es nicht. Ein Vorstellungsbild kann man nicht sehen – das heißt, hier gibt es kein Sehen. Ich sehe das Vorstellungsbild, das ich habe, nicht. Es gibt nichts dergleichen wie ein Ansehen, Mustern oder Betrachten eines Vorstellungsbildes und darum auch kein Abtasten eines solchen. Somit führt die daraus abgeleitete Folgerung – dass nämlich „das Bild wie ein Perzept für Worte mit drei Buchstabe n ist, jedoch nicht für längere Worte“ – ebenso auf Abwege wie die Behauptung, dass „nur einige Elemente gleichzeitig vorgestellt werden können“.287
285
Posner und Raichle, Images of Mind, S. 89. Teil des Experiments war es, die Personen darum zu bitten, ein ihnen dargebotenes Wort rückwärts zu buchstabieren und diesen Vorgang dann mit dem Vorstellungsbild eines Wortes zu wiederholen. Was Letzteres angeht, so fanden es die Versuchspersonen einfach, ‚cat‘ [Katze] rückwärts zu buchstabieren, jedoch schwieriger, das mit ‚catapult‘ [Katapult] zu wiederholen. Dass ihnen ein Vorstellungsbild vor ihrem geistigen Auge stand, war ihnen keine Hilfe; und das überrascht auch nicht, weil sie es nicht sehen konnten (genauso wenig wie sie ihre Stimme hören können, wenn sie in ihrer Vorstellung ihr Lieblingsgedicht auswendig aufsagen). Man kann sich eine Buchseite vorstellen und ein anschauliches Bild von ihr haben, aber man kann kein Bild einer Buchseite lesen (geschweige denn nicht richtig lesen). 287 Posner und Raichle, Images of Mind, S. 89f. 286
250
6 Die kogitativen Vermögen
6.3.1 Die logischen Merkmale des bildlichen Vorstellens Die logischen Unterschiede zwischen Wahrnehmung und Fantasie sind seit Galtons psychologischem Fragenkatalog unklar Die fundamentalen Forschungsmakel und die Schwächen der daraus abgeleiteten Folgerungen rühren von dem Versäumnis her, die logischen Unterschiede zu erfassen, die zwischen dem Wahrnehmen eines Objekts und dem Haben eines Bildes dieses Objekts, zwischen Objekten und Vorstellungsbildern von Objekten und zwischen Vorstellungsbildern und wirklichen Bildern bestehen. Festzuhalten ist, dass diese Verwirrungen bereits auf die Anfänge der Forschung zu Vorstellungsbildern in den 1880er-Jahren zurückgehen. Francis Galtons berühmter ‚Frühstückstisch‘-Fragenkatalog288 erkundete (a) ob die Lebhaftigkeit eines Vorstellungsbildes mit der des wirklich Geschehenden vergleichbar ist; (b) ob man „geistig mehr als drei Flächen eines Würfels oder mehr als eine Hälfte der Erdkugel gleichzeitig sehen kann“; (c) ob die eigenen Vorstellungsbilder sich „innerhalb des Kopfes, innerhalb des Erdballs, genau vor den Augen oder in einer der Wirklichkeit entsprechenden Entfernung“ zu befinden scheinen; (d) ob ein Vorstellungsbild jemals mit der Wirklichkeit verwechselt wurde; (e) ob man bewirken kann, dass die eigenen Vorstellungsbilder von Menschen sitzen, stehen oder sich langsam drehen; (f ) ob man sein Vorstellungsbild einer Person „derart deutlich sehen kann, dass man es in aller Ruhe skizzieren kann“. Die meisten dieser Fragen sind unsinnig und alle basieren sie auf der abwegigen Annahme, dass es sich bei Vorstellungsbildern um private Bilder handelt, die man mit dem geistigen Auge sieht – diese Annahme ist unter Kognitionswissenschaftlern noch immer weit verbreitet.289 Vorstellungsbilder sind jedoch, wie wir darlegen werden, keine Bilder, schon gar keine privaten, und, bei allem Respekt für Stephen Kosslyn und Kevin Ochsner, sie werden weder im noch mit dem geistigen Auge290 gesehen – bei dem es 288
F. Galton, Inquiries into Human Faculty and ist Development (Macmillan, London, 1883), S. 378–380. 289 Z. B.: ‚Vorstellungsbilder zu haben ist eine wesentlich „private“ oder „subjektive“ Erfahrung, in dem Sinn, dass wir Vorstellungsbilder anderer Menschen nicht unmittelbar betrachten können‘ ( J. T. E. Richardson, Imagery (Psychology Press, Hove, East Sussex, 1999), S. 9). Es stimmt, dass es nichts dergleichen wie ein Betrachten der Vorstellungsbilder anderer gibt; so etwas wie ein Betrachten der eigenen Vorstellungsbilder gibt es jedoch auch nicht. Die eigenen Vorstellungsbilder sind insofern privat, als man Vorstellungsbilder haben, aber anderen nicht mitteilen kann, dass man ein solches Bild hat oder wovon es ein Bild ist. Wenn man es niemandem mitteilt, dann weiß es keiner. 290 S. M. Kosslyn und K. N. Ochsner, ‚In search of occipital activation during mental imagery‘, Trends in Neuroscience, 17, Nr. 7 (1994), S. 290f. Das bildliche Vorstellen, behaupten sie, ‚ist ein
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
251
sich nicht um ein Auge handelt. Etwas im geistigen Auge zu sehen bedeutet ganz und gar nicht, dass man es sieht – es bedeutet, dass man es sich visuell vorstellt oder es sich in Erinnerung ruft. Unterschiede zwischen Wahrnehmung und Fantasie, zwischen ihren Objekten und zwischen geistigen und physisch-materiellen Bildern Wir werden eine Reihe von Unterschieden herausarbeiten, die zwischen der Wahrnehmung und der Fantasie, zwischen wahrgenommenen Objekten und Vorstellungsbildern von Objekten und zwischen physisch-materiellen Bildern und Vorstellungsbildern bestehen. Denn die Begriffe sind viel unterschiedlicher, als Psychologen und Kognitionswissenschaftler vermuten. Bei der Fantasie haben wir es keineswegs mit einer Art Privatwahrnehmung zu tun – man kann seine Vorstellungsbilder weder sehen noch hören. Ein Vorstellungsbild eines Objektes ist nicht auf dieselbe Weise mit dem verbunden, wovon es ein Vorstellungsbild ist, in der ein Bild mit dem verbunden ist, wovon es ein Bild ist. Und es stimmt nicht, dass Vorstellungsbilder „physisch-materiellen Bildern entsprechen, nur eben geistige physische Bilder sind“ – bei physischen Bildern und Vorstellungsbildern handelt es sich nicht um gleichgeordnete Arten der Gattung Bild. Wahrnehmungsobjekte und Vorstellungsbilder voneinander abgegrenzt (1) Die Wahrnehmungsobjekte existieren unabhängig davon, ob man sie wahrnimmt oder nicht, und als vom Geist unabhängige Objekte haben sie objektive und genau festgelegte Eigenschaften. Vorstellungsbilder hingegen existieren nicht unabhängig davon, ob man seine Fantasie betätigt oder nicht. Sie werden gleichsam gemacht, nicht entdeckt. Ihre Eigenschaften können unbestimmt sein, denn ein (visuelles) Vorstellungsbild eines Objektes O kann ein Bild eines O sein, das keine bestimmte Farbe oder Ausdehnung hat, auch wenn jedes O irgendeine Farbe und Ausdehnung haben muss. (Ein (visuelles) Vorstellungsbild entspricht in dieser Hinsicht (aber nicht in allen Hinsichten) eher einer Zeichnung als einem gesehenen Objekt, und das Visualisieren entspricht eher einem Verbildlichen als einem Sehen.)
vollkommen privates Ereignis‘ – wobei zu verstehen gegeben wird, dass nur das Subjekt die Bilder sehen könne. Sie schreiben von ‚internen Repräsentationen, die die Erfahrung „Sehen mit dem geistigen Auge“ konstituieren‘. Zu visualisieren oder ein Vorstellungsbild von etwas zu haben ist jedoch weder eine Sache des ‚Sehens mit dem geistigen Auge‘, noch haben Vorstellungsbilder etwas mit ‚Repräsentationen‘ zu tun – wir werden das ausführen.
252
6 Die kogitativen Vermögen
Galtons verworrene Frage Folglich ist Galtons Frage, ob man „geistig mehr als drei Flächen eines Würfels oder mehr als eine Hälfte der Erdkugel gleichzeitig sehen kann“ verworren, und verwirrte zweifellos jene, die sich zu seinem Fragenkatalog äußerten. ‚Geistig sehen‘ – das heißt, sich ein visuelles Vorstellungsbild zu vergegenwärtigen oder es heraufzubeschwören – bedeutet nicht, irgendetwas zu sehen. Korrekter formuliert handelt es sich um die Frage, ob man sich mehr als drei Flächen eines bestimmten Würfels (oder mehr als ein Auge einer im Profil imaginierten Person) gleichzeitig vorstellen kann. Und die Antwort ist, dass man es selbstverständlich kann – und besonders dann, wenn man mit den Gemälden und Zeichnungen Picassos vertraut ist. Natürlich wird man sich die nämlichen Objekte dann aber nicht so vorstellen (sie so visualisieren), wie sie einem Wahrnehmenden visuell erscheinen. Finkes verworrenes Prinzip der räumlichen Entsprechung Darum ist auch Finkes Prinzip der räumlichen Entsprechung, welches besagt, dass „die Elemente eines Vorstellungsbildes so angeordnet sind, wie die Objekte oder deren Teile bei den wirklichen Körperoberflächen oder im wirklichen physischen Raum angeordnet sind“291, bestenfalls irreführend. Das hängt davon ab, ob man über eine surrealistische oder kubistische Vorstellungskraft verfügt – und natürlich davon, was man umzusetzen versucht. Wenn man seine Versuchspersonen darum bittet, Bilder des von ihnen Gesehenen heraufzubeschwören und sie sich so vorzustellen, wie sie ihnen erschienen, dann werden sie sie sich ganz genau so vorstellen. Bittet man allerdings einen Picasso, einen Magritte, einen Escher oder einen Dalí darum, sich etwas ad libitum vorzustellen, wird das Ergebnis sich von gewöhnlichen Vorstellungen außerordentlich unterscheiden, und das Prinzip der räumlichen Entsprechung wird so wenig Gültigkeit beanspruchen können bzw. Aussagekraft haben, wie ein auf die Malerei angewandtes entsprechendes Prinzip. Der Unterschied im Hinblick auf den Gebrauch der Sinnesorgane (2) Man gebraucht seine Sinnesorgane, um wahrzunehmen. Es handelt sich bei ihnen um Teile des Körpers, die jedermann bei sich willkürlich steuern kann, und zwar so, dass seine Wahrnehmungs- und Unterscheidungsfähigkeiten davon beeinflusst werden. Man kann gute oder schlechte Augen oder Ohren haben, mehr oder weniger gut wahrnehmen, was davon abhängt, in welcher Verfassung sich die eigenen Wahrnehmungsorgane befinden. Organe der Fantasie gibt es indes nicht, man kann sein Bild von O nicht dadurch vervollkommnen, dass man es sorgfältiger beobachtet, und das Vorstellungsvermögen hängt nicht vom Zustand des Vorstellungsorgans ab, da es ein solches nicht gibt. 291
R. A. Finke, Principles of Mental Imagery (MIT Press, Cambridge, MA, 1989), S. 61.
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
253
Der Unterschied im Hinblick auf die Beobachtungsbedingungen (3) Die Beobachtungsbedingungen für die Wahrnehmung können optimal oder suboptimal sein; man kann näher an das Licht heranrücken müssen, um besser wahrzunehmen. Bei der Ausübung der Fantasie gibt es hingegen keine optimalen Beobachtungsbedingungen, denn die Fantasie geht nicht mit Beobachtung einher. Und darum gibt es auch nichts dergleichen wie ein Näher-Heranrücken an die eigenen Vorstellungsbilder, keine Möglichkeit, sie intensiver zu beleuchten, um sie klarer und deutlicher wahrzunehmen, obgleich man sich vorstellen kann, etwas aus größerer Nähe, unter guten Lichtverhältnissen zu sehen, und ein Bild eines gut beleuchteten Objekts so heraufbeschwören kann, wie es aus der Nähe wirken bzw. erscheinen würde. Um ein Objekt zu sehen, braucht man Licht, allerdings visualisiert man ein Objekt oft besser, wenn man seine Augen geschlossen hält. Während man von ‚schillernden‘ Objekten vorübergehend geblendet wird, irritiert oder blendet einen das anschauliche Vorstellungsbild des schillernden Objekts nicht, wenn man sich auch vorstellen kann, von solch einem Objekt geblendet zu werden. Der Unterschied im Hinblick auf einen möglichen Irrtum (4) Man kann richtig oder nicht richtig wahrnehmen, Fehler machen oder Merkmale dessen, was man wahrnimmt, übersehen. Man kann überprüfen, ob einem das passiert ist, indem man bei besserem Licht genauer nachsieht oder sich bei jemand anderem erkundigt. Im Gegensatz dazu kann man sich, was die eigenen Vorstellungsbilder angeht, nicht auf diese Weise irren. Deren Merkmale kann man nicht ‚übersehen‘. Sie haben keine verborgenen Eigenschaften, die man nicht ‚erkennen‘ könnte, nichts Verkapptes sozusagen. Sie sind vielmehr so, wie wir meinen, dass sie sind, und wie wir sagen, dass sie sind. Die Merkmale von Vorstellungsbildern kann man nicht so bemerken oder nicht bemerken, wie das bei Objekten, die man wahrnimmt, möglich ist. Lurias Mnemonist und seine verworrene Erklärung seines Gedächtnisfehlers Folglich ist die Erklärung eines Gedächtnisirrtums inkohärent, die von Lurias berühmtem Mnemonisten vorgebracht (und von Luria akzeptiert) wurde: dass er sich nämlich vorstellte, eine Milchflasche vor einer weißen Tür abgestellt zu haben, und dann, als er sich schließlich vorstellte, dieselbe Straße hinunterzugehen, die Milchflasche nicht bemerkte.292 Denn welches Kriterium gäbe es dafür, dass die Milchflasche ‚unbemerkt‘ dort 292
A. R. Luria, The Mind of the Mnemonist (Penguin, Harmondsworth, 1968). Der Mnemonist verdiente seinen Lebensunterhalt mit der Aufführung außergewöhnlicher Gedächtniskunststücke. Sein Publikum sollte ihm die Namen zahlreicher Gegenstände zurufen, an die er sich schließlich in der richtigen Reihenfolge zu erinnern hatte. Die von ihm genutzte heuristische Hilfe be-
254
6 Die kogitativen Vermögen
steht? Dass der Mnemonist keine Milchflasche erwähnte, ist nicht damit zu erklären, dass er sich eine vorstellte, aber nicht bemerkte, dass sie vor einer weißen Tür stand; sondern die Erklärung besteht darin, dass er es versäumte, sie in die Szene, die er neuerlich visualisierte, aufzunehmen. Kann man aus seinen Gedächtnisbildern Information gewinnen, indem man sie betrachtet? Als ähnlich inkohärent erweist sich die Annahme, dass man etwas entdecken kann, indem man von seinem Gedächtnisbild eines zuvor gesehenen Objekts visuelle oder räumliche Information über das Objekt abliest. Laut dieser Konzeption haben wir es bei einem Vorstellungsbild mit einer bildhaften Repräsentation zu tun, einer privaten Fotografie vergleichbar, aus der man mittels Betrachtung Information über das InsBild-Gesetzte gewinnen kann. So behauptete beispielsweise Shepard, dass er, um auf die Frage zu antworten, wie viele Fenster sich in seinem Haus befänden, sich das Haus aus unterschiedlichen Perspektiven oder vom Inneren verschiedener Räume her vorstellen und dann die in diesen Bildern enthaltenen Fenster zählen musste.293 P. R. Meudell legte schließlich nahe, dass es einen linearen Zusammenhang zwischen der Zeit, die es braucht, um auf die Frage zu antworten, und der Anzahl der erfassten Elemente gibt.294 Es ist unstrittig, dass man versuchen könnte, sich in Erinnerung zu rufen, wie viele Fenster es in seinem Haus gibt, indem man an jeden Raum oder jede Ansicht denkt (oder sie sich vorstellt) und sie beim Vorankommen addiert. Dann kann man sich richtig oder nicht richtig daran erinnern, wie viele Fenster darin sind. Problematisch ist allerdings die Vorstellung, man könnte die Zahl der Fenster in seinem Vorstellungsbild zählen (und könnte sich folglich dabei auch verzählen). Gesetzt den Fall, das Haus hat 15 Fenster. Man beschwört ein Vorstellungsbild der verschiedenen Ansichten herauf und kommt zu dem Ergebnis, dass es 15 Fenster gibt. Ist es ein einleuchtender Gedanke, dass es in dem eigenen Vorstellungsbild nur 14 Fenster gewesen sein könnten, bei denen man sich verzählte, sodass man auf die Frage ‚Wie viele Fenster gibt es im Haus?‘ richtig antwortet, jedoch falsch auf die Frage ‚Wie viele Fenster gibt es in Ihrem Vorstellungsbild des Hauses?‘?
stand darin, sich vorzustellen, wie er eine bekannte Straße in St. Petersburg hinuntergeht, und als die Namen fielen, stellte er sich wiederum vor, wie er sie an speziellen Stellen entlang der Straße ‚deponiert‘. Um sich an die genannten Gegenstände in der richtigen Reihenfolge zu erinnern, stellte er sich vor, wie er die Straße abermals hinuntergeht, und rief sich visuell in Erinnerung, wo er ‚sie deponiert‘ hatte. 293 R. Shepard, ‚Learning and recall as organisation and search‘, Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 5 (1966), S. 201–203. 294 P. R. Meudell, ‚Retrieval and representations in long-term memory‘, Psychonomic Science, 23 (1971), S. 295f.
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
255
Die Begriffsgrenzen im Hinblick auf das Zählen der Elemente im eigenen Vorstellungsbild Im Falle der ‚kreativen‘ (in Abgrenzung zur ‚reproduktiven‘) Vorstellungskraft wird die Sache vielleicht klarer. Angenommen, man beschwört vor seinem geistigen Auge ein vollkommen imaginäres Gebäude herauf, vielleicht das imaginäre Bild eines Wolkenkratzers mit zahlreichen Fenstern. Es gibt nichts dergleichen wie ein Zählen der Anzahl der Fenster, die in einem Vorstellungsbild vorhanden sind. Denn es ergibt keinen Sinn, dort Elemente zählen zu wollen, wo man sich ebenso wenig verzählen wie einen Rechenfehler durch neuerliches Zählen verbessern kann. Man kann nur so viele Dinge einer bestimmten Art in seinem Vorstellungsbild zählen, wie man auf einen Blick als vorhandene erfassen kann (was ‚die visuelle Anzahl‘ genannt und ‚der induktiven Anzahl‘295 gegenübergestellt werden könnte). Man kann sich ein Soldatenbataillon, das die ChampsElysées hinuntermarschiert, bildlich vorstellen, es gibt jedoch nichts dergleichen wie ein Zählen der Soldaten im Vorstellungsbild des Bataillons, weil deren Anzahl viel größer ist als jede visuelle Anzahl.296 Man kann sich ein imaginäres Gebäude bildlich vorstellen und in manchen Fällen errechnen, wie viele Fenster es in der vorgestellten Ansicht gibt – wenn beispielsweise sechs Stockwerke vorhanden sind und fünf Fenster je Stockwerk, hat das Haus also 30 Fenster. Auf diese Weise kann man zu dem Ergebnis kommen, dass man ein Haus mit 30 Fenstern auf der Vorderseite veranschaulicht hat. Man kann jedoch nicht 30 Fenster im eigenen Vorstellungsbild des Gebäudes zählen, um herauszufinden, wie viele es gibt. (Ebenso kann man die Objekte, die man veranschaulicht, nicht vermessen, sondern sich nur vorstellen, sie zu vermessen, und man kann sie nicht wiegen, sondern sich nur vorstellen, sie zu wiegen.) Man kann eine Halluzination mit einer Wahrnehmung verwechseln, aber nicht die Fantasie und ihre Objekte mit der Wahrnehmung und ihren Objekten (5) Man kann, wenn es sich um einen selbst handelt, Halluzinieren mit Wahrnehmen verwechseln. Das Heraufbeschwören eines Vorstellungsbildes von etwas kann man jedoch nicht mit dem Wahrnehmen dieser Sache verwechseln. Ebenso kann man ein Vorstellungsbild eines Objekts nicht mit dem auf diese Weise visualisierten Objekt verwechseln – obgleich man wie Macbeth die Halluzination eines Objekts für das Objekt selbst 295
Wie hoch die visuelle Anzahl ist, hängt natürlich vom Anordnungsmuster und von den beträchtlichen individuellen Unterschieden ab. 296 Selbstverständlich kann man in seiner Vorstellung ‚Schafe zählen‘, um einschlafen zu können, und tatsächlich Hunderte ‚passieren lassen‘ – in diesem Fall zählt man jedoch nicht, wie viele Schafe es in seinem Vorstellungsbild einer Schafherde gibt, sondern vielmehr, wie viele Male man sich ein Schaf vorstellt, wie es über einen Zaun springt. Und wenn man erschöpft beim tausendsten Tier anlangt, heißt das nicht, dass sich im eigenen Vorstellungsbild 999 Schafe auf der anderen Zaunseite befinden.
256
6 Die kogitativen Vermögen
halten kann – noch ein Vorstellungsbild mit einem Nachbild [after-image] oder einer Halluzination. Galtons verworrene Fragen Daher ist Galtons Frage, ob man ein Vorstellungsbild jemals mit der Wirklichkeit verwechselt habe, ebenso abwegig wie die, ob die eigenen Verpflichtungen jemals so schwer gewogen hätten wie die eigene Einkaufstasche. Es gibt nichts dergleichen wie eine Verwechselung eines Vorstellungsbildes (im Gegensatz zu einem Nachbild oder einer Halluzination) mit der Wirklichkeit. Vorstellungsbilder und das, wovon sie Bilder sind, koexistieren nicht in demselben logischen Raum (genauso wenig wie schwerwiegende Verpflichtungen und schwere Einkaufstaschen). Ebenso wenig Sinn ergibt Galtons Frage, ob Vorstellungsbilder sich „innerhalb des Kopfes, innerhalb des Erdballs, genau vor den Augen oder in einer der Wirklichkeit entsprechenden Entfernung“ zu befinden scheinen. Ein halluzinierter Dolch mag Macbeth ganz nah vorkommen; ein Nachbild kann den Anschein erwecken, ein Fleck auf einer weißen Mauer zu sein, auf die man gerade schaut. Ein Vorstellungsbild kann sich allerdings nicht irgendwo zu befinden scheinen, obgleich man sich selbstverständlich Ariadne auf Naxos oder auf Knossos vorstellen kann. Vorstellungsbilder und physisch-materielle Bilder voneinander abgegrenzt (6) Wir haben betont, dass (visuelle) Vorstellungsbilder keine privaten Bildern sind, die nur das Subjekt sehen kann. Es ist der Mühe wert, noch weitere begriffliche Unterschiede herauszuarbeiten. Wie dargelegt kann man seine Vorstellungsbilder nicht sehen, aber man sieht physisch-materielle Bilder. Ein physisches Bild eines Objekts kann über eine wahrnehmbare Ähnlichkeit mit diesem verfügen. Ein Vorstellungsbild allerdings kann keine wahrnehmbare Ähnlichkeit mit dem aufweisen, wovon es ein Bild ist – denn es ist nicht wahrnehmbar. Man kann sein Vorstellungsbild nicht mit dem vergleichen, wovon es ein Bild ist, wie man das im Falle eines physisch-materiellen Bildes tun kann. Denn man kann ein Vorstellungsbild nicht neben das stellen, wovon es ein Bild ist, und beide betrachten, Ähnlichkeiten und Unterschiede herausarbeitend. In der Tat kann man nicht zugleich etwas wahrnehmen und ein Bild von ihm haben, wie es der eigenen Wahrnehmung nach ist. Man kann sein Vorstellungsbild von etwas nicht kopieren (es gibt in diesem Zusammenhang kein Kopieren), wie man ein Bild von etwas kopieren kann. Denn erstens kann man nichts kopieren, was man nicht sehen kann. Zweitens reproduziert eine Kopie ihr Original. Sein Vorstellungsbild von X zu reproduzieren (wenn diese Wendung überhaupt irgendetwas bedeutet) bestünde allerdings darin, sich X erneut vorzustellen oder es abermals zu visualisieren.
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
257
Galtons verworrene Frage Galton fragte, ob man, wenn man ein Vorstellungsbild von einer Person hat, dieses Bild derart deutlich sehen könne, dass man in der Lage sei, es in aller Ruhe zu skizzieren. Die Frage ist verworren, da sie voraussetzt, dass es sich bei Vorstellungsbildern um private Visibilia handelt. Man könnte allerdings fragen, ob man seine Vorstellungsbilder skizzieren kann. Um auf diese merkwürdige Frage zu antworten, sollte man zuerst einmal klarstellen, was mit „seine Vorstellungsbilder zeichnen“ gemeint sein könnte. Sicherlich kann man seine Vorstellungsbilder nicht zeichnen, wie ein Künstler eine Person oder eine Landschaft zeichnet (allerdings nicht kopiert), die sich vor ihm befindet. Denn, wir haben es herausgestrichen, man kann seine Vorstellungsbilder nicht sehen, und man kann seine Skizze nicht mit seinem Vorstellungsbild auf ‚Abbildungstreue‘ hin vergleichen. Man kann das zeichnen, was man sich vorstellt, und es so zeichnen, wie man es sich vorstellt. Es wäre aber zutiefst irreführend, in solchen Fällen zu sagen, man zeichne seine Vorstellungsbilder. Man bildet das ab bzw. verbildlicht das, was man sich vorstellt, aber man stellt sich nicht seine Vorstellungsbilder vor. Man stellt sich das vor, wovon die eigenen Vorstellungsbilder Bilder sind. Folglich ähnelt eine Skizze des visuell Vorgestellten nicht dem eigenen Vorstellungsbild, weist keine überzeugende Ähnlichkeit mit ihm auf – es sieht nicht so aus wie das eigene Vorstellungsbild. Sie repräsentiert vielmehr, was man sich vorstellte oder woran man sich erinnerte und wie man es sich vorstellte oder in Erinnerung behalten hat – genau so, wie es die eigenen Worte, die eigenen Beschreibungen dessen, was man sich vorstellte, tun. Weshalb Vorstellungsbilder keine internen Repräsentationen sind (7) Die Neurowissenschaftler und Kognitionswissenschaftler charakterisieren Vorstellungsbilder als ‚interne Repräsentationen‘. Bildliches Vorstellen ist angeblich „eine Form der internen Repräsentation, bei der Information darüber verbildlicht und beeinflusst werden kann, wie physische Objekte, Ereignisse und Szenerien in Erscheinung treten“.297 Wenn es sich jedoch bei Bildern, Karten und verbalen Beschreibungen um Repräsentations- oder Darstellungsparadigmen handelt, dann handelt es sich bei Vorstellungsbildern nicht um Repräsentationen (Darstellungen) des Vorgestellten. Jedwede Repräsentation von etwas, die sinnvollerweise so heißt, hat sowohl repräsentationale als auch nichtrepräsentationale Eigenschaften.298 Bei den nichtrepräsentationalen Eigenschaften von Gemälden haben wir es mit den Eigenschaften der Farbe (der Pigmentfarben z. B.), der Leinwand oder des Tableaus, des Farbauftrags (die Stärke des Impasto z. B.) und der Farbflächen (trapezförmig oder rechteckig z. B.) zu tun. Bei den repräsentationalen Eigenschaften von Gemälden haben wir es mit den Farben, Orten und For297 298
Richardson, Imagery, S. 35. Diesen Gedanken verdanken wir John Hyman.
258
6 Die kogitativen Vermögen
men der Gegenstände im Gemälde (z. B. der gemalten Bäume, Figuren oder des gemalten Hauses) zu tun. Die nichtrepräsentationalen Eigenschaften der Schrift sind die Tintenfarben, die Handschriftsmerkmale und die Lesbarkeit. Die repräsentationalen Eigenschaften sind die semantischen Eigenschaften der Worte. Wir können die repräsentationalen Eigenschaften von Repräsentationen nur erfassen, weil wir die nichtrepräsentationalen wahrnehmen können. Wir könnten das im Radio Gesagte nicht erfassen, wenn wir die Geräusche, die dabei entstehen, nicht hören könnten. Wir könnten das Geschriebene nicht lesen und verstehen, wenn wir die ‚Einschreibung‘ nicht sehen könnten. Und wir könnten Rembrandts Porträt von Jan Six nicht bewundern, wenn wir die Farbe auf der Leinwand nicht sehen könnten. Aber genau wie die Gedanken sind die Vorstellungsbilder alle die Botschaft und nicht das Medium. Bei all ihren visuellen Eigenschaften handelt es sich um die Eigenschaften dessen, wovon sie die Bilder sind: Wenn man sich rote Mohnblumen in einem Feld vorstellt, stammt das Rot von den Mohnblumen (nicht von irgendwelchen Pigmenten), und wenn man sich einen sich behände drehenden Tänzer vorstellt, rührt das Tempo vom vorgestellten Tänzer her, nicht vom Vorstellungsbild. Demzufolge weisen Vorstellungsbilder keine nichtrepräsentationalen Eigenschaften auf. Also sind sie keine Repräsentationen. Das, was eine Person sagt, kann repräsentieren, wie sie sich etwas vorstellt, worum es sich dabei auch handeln mag. Das, was sie ins Bild setzt, wenn sie zeichnet, wie sie sich etwas vorstellte (was auch immer es gewesen sein mochte), repräsentiert das, was sie sich vorstellte. Was sie sagt und was sie zeichnet, repräsentiert allerdings nicht das, was sie sich vermöge eines Ähnlichseins mit dem bildlich Vorgestellten vorstellte – genauso wenig wie der verbale Ausdruck ihres Denkens ihrem Denken ähnelt. Was ihre Skizze zu einer guten Repräsentation dessen macht, was sie sich vorstellte und wie sie es sich vorstellte, ist nicht irgendeine Ähnlichkeit zwischen der Skizze und dem Vorstellungsbild. Man sollte nicht davon ausgehen, dass die Skizze eine überzeugende Ähnlichkeit mit dem Vorstellungsbild aufweist. Was die Skizze zu einer überzeugenden bzw. guten Repräsentation macht, ist vielmehr die aufrichtige Versicherung der Person, dass es das ist, was sie im Sinn hatte, dass es so ist, wie sie es sich vorstellte. Diese Äußerung basiert nicht auf einem ‚inneren Blick‘ auf ihr Vorstellungsbild. Bei der Skizze handelt es sich nicht um das ‚äußere Bild‘ eines ‚inneren Bildes‘. Bei dem Vorstellungsbild haben wir es keineswegs mit einer Repräsentation zu tun. Eine Repräsentation davon hervorzubringen, wie man sich etwas vorstellt, heißt, es so zu verbildlichen oder ins Bild zu setzen, wie man es sich vorstellt, oder es so zu beschreiben, wie man es sich vorstellt. Eine Repräsentation repräsentiert das, was (auch immer) sie repräsentiert, kraft Repräsentationskonventionen (semantischen, kartografischen, emblematischen), kraft beabsichtigter wahrnehmbarer Ähnlichkeiten zwischen den Elementen im Bild (die Person, das Gebäude oder die Ansicht im Bild) und den Elementen, die das Bild verbildlicht (Arthur Wellington, die Kathedrale von Salisbury, die Seine). Ein Vorstellungsbild ist nicht durch Konventionen, Ähnlichkeiten oder repräsentationale Absichten bestimmt, wie es das Bild ist. Es ist überhaupt keine Repräsentation dessen, wovon es ein Vorstellungsbild ist.
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
259
Die Lebendigkeit der Vorstellungsbilder in Abgrenzung zur Lebendigkeit anderer Dinge (8) Weil die Neurowissenschaftler und Kognitionswissenschaftler Vorstellungsbilder für eine private piktorale Repräsentation halten, gehen sie davon aus, dass ein Vorstellungsbild eines Objekts zu haben in puncto Lebendigkeit oder Lebhaftigkeit mit dem Wahrnehmen eines Objektes verglichen werden kann. Diese altehrwürdige Konzeption wurde von Hume vertreten und bekannt gemacht, der dachte, dass sich Wahrnehmen, Erinnern und Vorstellen in erster Linie nach absteigenden Lebhaftigkeitsgraden unterscheiden ließen.299 Wir sahen oben bereits, dass sich diese Konzeption auch in Galtons Fragenkatalog niederschlug, in welchem dieser fragte, ob „die Lebhaftigkeit eines Vorstellungsbildes mit der des wirklich Geschehenden vergleichbar ist“. Sie zeigt sich ebenso in Betts’ Fragenkatalog aus dem Jahre 1909, in dem dieser die Frage aufwirft, ob Vorstellungsbilder (i) völlig klar und so lebendig wie die wirkliche Erfahrung [sind]; (ii) sehr klar und in puncto Lebendigkeit vergleichbar mit der wirklichen Erfahrung; (iii) halbwegs klar und lebendig; (iv) nicht klar oder lebendig, aber erkennbar; (v) unklar und matt; (vi) so unklar und matt, dass man sie nicht erkennen kann.300 Und diese Konzeption regte auch die aktuelle Studie ‚Vividness of Visual Imagery Questionnaire‘ von D. F. Marks an.301 Die entscheidende Frage ist allerdings nicht, ob Vorstellungsbilder von Objekten so lebendig oder weniger lebendig sind wie die Wahrnehmung dieser Objekte. Wir müssen zunächst einmal untersuchen, was mit der Zuschreibung von Lebendigkeit oder Lebhaftigkeit zu Vorstellungsbildern, im Gegensatz zu ihrer Zuschreibung zur Wahrnehmung und dem Wahrgenommenen, genau gemeint ist. Schon nach kurzem Nachdenken dürfte klar sein, dass die Lebendigkeit unserer Vorstellungsbilder der Lebendigkeit einer Beschreibung stärker ähnelt als der der Farbintensität eines afrikanischen Sonnenuntergangs und dass man die Lebendigkeit eines Vorstellungsbildes mit der Lebendigkeit dessen, wovon es ein Bild ist, genauso wenig verwechseln könnte wie die Lebendigkeit einer 299
Hume, Treatise of Human Nature [dt. Ein Traktat über die menschliche Natur], I, iii, 5. Daher verspottete ihn Thomas Reid: ‚Angenommen, ein Mensch wirft seinen Kopf ‚ordentlich‘ gegen die Wand, dann hat er einen Eindruck; er verfügt nunmehr über eine Fähigkeit, die ihm ermöglicht, diesen Eindruck mit weniger Krafteinsatz zu wiederholen, sodass er von Schmerzen verschont bleibt: So muss es sein, sich zu erinnern – zumindest der Darstellung Mr. Humes nach. Jener Mensch verfügt über eine Fähigkeit, die ihn in die Lage versetzt, die Wand mit seinem Kopf nur eben zu berühren, sodass der Eindruck seine Lebendigkeit vollständing einbüßt. Hierbei handelt es sich gewiss um die Vorstellungskraft‘ (Essays on the Intellectual Powers, Essay III, Kap. 7). 300 G. H. Betts, ‚The distribution and functions of mental imagery‘, Contributions to Education, Nr. 26 (Teachers College, Columbia University, New York, 1909), S. 20f. 301 D. F. Marks, ‚Visual imagery differences in the recall of pictures‘, British Journal of Psychology, 64 (1973), S. 17–24.
260
6 Die kogitativen Vermögen
Beschreibung mit der Lebendigkeit dessen, wovon es eine Beschreibung ist. Von manchen Dingen sagt man, dass sie lebendig sind, wenn sie voller Leben, energiegeladen und dynamisch sind. In diesem Sinn kann von Menschen, materiellen Dingen und ihren Eigenschaften gesagt werden, dass sie lebendig sind (‚Er war einer der lebendigsten und auffassungsstärksten Menschen‘, ‚Die Violine ist ein lebendiges und sprunghaftes Instrument‘, ‚. . . lebendige und schauderhafte Gerüche‘). Die Gefühle der Menschen sind lebendig, wenn sie nachhaltig gefühlt werden, menschliche Äußerungen sind lebendig, wenn sie eindringlich vorgebracht oder wärmstens ans Herz gelegt werden, und menschliche Erinnerungen sind lebendig, wenn sie klar und im Detail präzise sind. Farbe und Licht sind lebendig, wenn sie strahlend, prächtig und frisch sind, und folglich sagt man von farbigen Dingen, dass sie lebendige Farben haben. Eine Beschreibung, eine Mitteilung oder eine Erzählung ist lebendig, wenn sie ihren Gegenstand in einer lebhaften, klaren, detailgenauen und eindrücklichen Weise präsentiert. Dementsprechend sagt man von einer Landschaft, dass sie im Sonnenschein lebendig daliegt, wenn die Luft rein und das Licht prächtig ist, wenn die verschiedenen Schattierungen des Grüns der Bäume und der Grasfläche ausgeprägt und leuchtend sind, wenn die roten Mohnblumen oder gelben Narzissen sich prachtvoll vom Grün des Grases abheben, wenn das Blau von Himmel und Meer intensiv ist, wenn die Schatten klar und scharf geschnitten sind. In diesem Sinn kann man nicht sagen, dass die Vorstellungsbilder lebendiger oder weniger lebendig sind als das, wovon sie Bilder sind. Sie sind überhaupt nicht in dieser Dimension von Lebendigkeit bzw. Lebhaftigkeit angesiedelt. Wenn ein Bühnenbildner zu seinem Maler sagt, er hätte sich das Rot des Hintergrunds lebendiger gewünscht, bedeutet das nicht, dass es in seiner Vorstellung leuchtender gewesen ist, genauso wenig wie eine Explosion, wenn sie nicht so laut war, wie man erwartet hatte, in der eigenen Erwartung lauter gewesen sein muss. Wenn der Bühnenbildner sagt, er habe sich vorgestellt, dass das Licht im Hintergrund stärker strahlt, bedeutet das nicht, dass es ihn blendete, als er es sich vorstellte. Man kann von seinen Vorstellungsbildern sagen, dass sie lebendig sind, wenn man das, was man sich vorstellte und wie man es sich vorstellte (oder in Erinnerung rief ), was man sich vorstellte (oder in Erinnerung rief ), klar, detailliert und anschaulich beschreiben kann, oder wenn man eine solche Beschreibung, falls eine vorgebracht wurde, als zutreffende erkennen, oder wenn man in einem Gemälde oder einer Zeichnung eine klare, detaillierte und anschauliche Darstellung dessen reproduzieren kann, was man sich vorstellte oder wie man es sich vorstellte (oder woran bzw. wie man sich erinnerte), oder wenn man anerkennen kann, dass das Gemälde von jemand anderem (z. B. von seinem Bühnenbildner) genau so gestaltet ist, wie man sich die Szenerie (oder den Szenenaufbau) vorstellte. Die Lebendigkeit eines Vorstellungsbildes einer Szenerie ist mit der Lebendigkeit der Szenerie selbst genauso wenig vergleichbar wie die Lebhaftigkeit der Beschreibung einer Party mit der der Party selbst. Demzufolge kann man die Klarheit und Lebendigkeit eines Vorstellungsbildes einer Szenerie mit der Klarheit und Lebendigkeit einer Landschaft, die nach einem Regen vom leuchtenden Abendsonnenlicht erhellt wird, ebenso wenig ver-
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
261
gleichen, wie man die Klarheit und Lebendigkeit der Beschreibung der Landschaft mit dieser vergleichen kann. Es stimmt allerdings, dass man sich eine Person klarer vorstellen kann, als man sie sehen kann (wenn das Licht schlecht ist und sie sich weit weg befindet). Das heißt, dass man sie detaillierter und mit mehr Zutrauen beschreiben kann, indem man sie sich bildlich veranschaulicht, als dadurch, dass man auf eine entfernte Gestalt in der Dunkelheit blickt. Verwirrungen bezüglich sich im geistigen Raum drehender Vorstellungsbilder (9) Häufig kann man auf das, was man wahrnimmt, einwirken (was davon abhängt, worum es sich dabei handelt). Ist es klein, kann man es oft aufheben, herumdrehen und von allen Seiten untersuchen. Einen solchen Gegenstand kann man schnell oder langsam drehen, mit konstanter oder variabler Geschwindigkeit. Wie oben angemerkt, ging Galton davon aus, dass der Gedanke, man könne ‚bewirken, dass die eigenen Vorstellungsbilder sich langsam drehen‘, Sinn ergibt. Die Frage ist, ob das einleuchtet, ob es sinnvoll ist, von der Einwirkung auf Vorstellungsbilder zu sprechen und davon, dass man diese ‚im geistigen Raum‘ langsam oder schnell dreht. Es ist durchaus möglich, dass man sich etwas langsam (oder schnell) Drehendes vorstellt und dass man ein Vorstellungsbild von etwas hat, das sich auf diese Weise dreht. Es gibt jedoch nichts dergleichen wie das Drehen eines Vorstellungsbildes eines Gegenstands, so wie es kein Drehen eines Bildes eines Gegenstands in einem Gemälde gibt. Wenn man ein gemaltes Bild der Rückseite des Gegenstands haben will, muss man sie malen; und wenn man ein Vorstellungsbild der Rückseite des Gegenstands, den man visualisiert, haben will, muss man sie sich vorstellen – das heißt, ein Vorstellungsbild von ihr hervorbringen. Man kann sein Vorstellungsbild eines Gegenstands nicht herumdrehen und es von hinten betrachten, wie es unmöglich ist es, einen von Cezannes Äpfeln in dessen Gemälden zu drehen. Was man tun kann, ist, sich den rotierenden Gegenstand vorzustellen. Sich einen rotierenden Gegenstand vorzustellen heißt jedoch nicht, einen Gegenstand irgendwelcher Art zu drehen. Galtons Verwirrung Galtons Frage, ob man bewirken könne, dass die eigenen Vorstellungsbilder von Menschen sitzen, stehen oder sich langsam drehen, führt folglich in die Irre. Sie legt fälschlicherweise nahe, dass man dazu in der Lage sein könnte, seine Vorstellungsbilder langsam zu drehen, wohingegen die einzig verständliche (und triviale bzw. alltägliche) Frage, die man in diesem Zusammenhang stellen kann, die ist, ob man Menschen visualisieren könne, die sich langsam (oder schnell) drehen. Man kann sich (bildlich) vorstellen, wie man auf eine Person einwirkt (wie man sie dreht, sie dazu bringt, sich zu setzen), auf seine Vorstellungsbilder einer Person kann man jedoch nicht einwirken. Sich einen rotierenden Gegenstand vorzustellen heißt darüber hinaus nicht, auf irgendetwas einzu-
262
6 Die kogitativen Vermögen
wirken – heißt nicht, zu bewirken, dass das eigene Vorstellungsbild sich bewegt. (Das eigene Vorstellungsbild hat weder Gewicht noch Trägheit noch Schwungkraft.) Galtons Verwirrung durchdringt die zeitgenössische psychologische Forschung zum bildlichen Vorstellen bzw. Vorstellungsbilder-Haben. Shepard und J. Metzler präsentierten ihren Testpersonen Gemälde, die perspektivische Ansichten möglicher Gegenstände zeigten, die man durch Zusammenfügung zehn identischer Würfel erhält. Gemäldepaare zeigten jeweils dasselbe Objekt aus unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen, und die Testpersonen wurden gebeten, unter einem halben Dutzend solcher Gemälde die passenden Paare zu ermitteln. Shepard und Metzler fanden heraus, dass die Zeit, die es brauchte, die zwei verschiedenen Ansichten desselben Gegenstands einander zuzuordnen, in einem proportionalen Verhältnis zum Winkel zwischen den zwei Ansichten (0°–180°) stand und dass es hierbei keinen Unterschied machte, ob die Gegenstände in der Ebene (zweidimensional) oder in der Tiefe (dreidimensional) gedreht werden mussten. Dies lief aus ihrer Sicht auf die Annahme hinaus, dass die Testpersonen ‚im Geist dreidimensionale Repräsentationen‘ von einem Gegenstand oder von zweien mit gleichbleibender Geschwindigkeit drehten, bis diese gleichgerichtet waren – an diesem Punkt konnte durch schlichten Abgleich mühelos beurteilt werden, ob sie übereinstimmten oder nicht.302 Coopers und Shepards Erkennens-Experimente; Finkes Prinzip der Transformationsäquivalenz L. A. Cooper und Shepard experimentierten mit einer komplexeren Aufgabe.303 Testpersonen wurden aufgefordert zu beurteilen, ob geläufige alphanumerische Charaktere in ihrer normalen Form präsentiert wurden oder als spiegelbildliche Umkehrungen. Die Personen wurden instruiert, sich den entsprechenden Charakter in einer von sechs unR. N. Shepard und J. Metzler, ‚Mental rotation of three-dimensional objects‘, Science, 171 (1971), S. 701–703. Es könnte interessant sein, dieses Experiment so auszuführen, dass es darauf ankäme, aus verschiedenen Blickwinkeln fotografierte menschliche Gesichter abzugleichen. Wahrscheinlich bräuchte man mehr Zeit, ein en face gesehenes Gesicht einem aus einem Viertelprofil betrachteten Gesicht zuzuordnen als einem, das aus einem Dreiviertelprofil gesehen wurde, es ist jedoch alles andere als selbstverständlich, dass sich dieser Umstand mit dem Drehen von vorgestellten Gesichtern erklären ließe. Mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit würde es mehr Zeit in Anspruch nehmen, ein junges Gesicht mit einem sehr alten in Passung zu bringen als mit einem Gesicht mittleren Alters, aber nicht deshalb, weil es länger dauert, es in der Vorstellung älter zu machen. Man sollte indes festhalten, dass es sich bei der Annahme, (Wieder-)Erkennen gehe im Allgemeinen wesentlich mit einem Abgleich einher, um einen Trugschluss handelt. ‚Wieder-erkennen‘ heißt, wieder zu wissen, und nicht, etwas Wahrgenommenes mit etwas Gespeichertem oder Aufgezeichnetem abzugleichen. 303 L. A. Cooper und R. N. Shepard, ‚Chronometric studies of the rotation of mental images‘, in W. G. Chase (Hg.), Visual Information Processing (Academic Press, New York, 1973), S. 75–176. 302
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
263
terschiedlichen Ausrichtungen vorzustellen; der Charakter wurde dann entweder in dieser Ausrichtung oder in einer der anderen fünf gezeigt und sie mussten beurteilen, ob es sich um denselben oder einen anderen handelt. Die Resultate offenbarten, dass die Reaktionszeit mit zunehmender Winkeldifferenz zwischen der vorgestellten Ausrichtung und der des gezeigten Charakters anstieg. Cooper und Shepard folgerten, dass die Personen ihre Vorstellungsbilder mit gleichbleibender Geschwindigkeit drehten, bis diese die gleiche Ausrichtung hatten wie der vorgelegte Charakter. Daraus zogen sie den Schluss, dass man auf die Vorstellungsbilder von Objekten ebenso einwirkt, wie man auf die physisch-materiellen Objekte einwirken kann. Finke formulierte diese Argumentation schließlich zum ‚Prinzip der Transformationsäquivalenz‘ aus: Vorgestellte Transformationen und wirkliche Transformationen zeigen korrespondierende dynamische Charakteristika und sind denselben Bewegungsgesetzen unterworfen.304 Posners und Raichles Erkennens-Experimente Diese Forschungsergebnisse und die Hypothesen, die sie angeregt haben, werden von solchen hervorragenden Neurowissenschaftlern wie Posner und Raichle anerkannt.305 Cooper und Shepard folgend behaupten sie, dass, wenn man einen Brief schräg gezeigt bekommt und gefragt wird, um welchen Brief es sich handele und ob er richtig oder spiegelbildlich ausgerichtet sei, die eigene Reaktionszeit mit zunehmendem Drehungswinkel annähernd linear ansteigt, weil es mehr Zeit braucht, die interne Drehung auszuführen, als mitzuteilen, um welchen Brief es sich handelt. Es kann durchaus länger dauern festzustellen, ob der Brief spiegelbildlich ausgerichtet ist oder nicht, als festzustellen, um welchen Brief es sich handelt, allerdings nicht weil es länger dauert, das Bild des Briefes im Geist zu drehen, denn es gibt nichts dergleichen wie das Drehen eines Vorstellungsbildes. Die Begriffskonfusionen, die den Erkennens-Experimenten und den Interpretation ihrer Ergebnisse zugrunde liegen Die Tatsache, dass die Reaktionszeit in all diesen Experimenten in einem proportionalen Verhältnis zum Drehungswinkel der bildlich vorgestellten Figuren steht, deutet nicht darauf hin, dass es mehr Zeit braucht, eine größere Drehbewegung mit konstanter Geschwindigkeit ‚im geistigen Raum‘ auszuführen, als eine kleinere zuwege zu bringen, denn es gibt keine Drehung eines Vorstellungsbildes mit konstanter (oder variabler) Geschwindigkeit – sondern nur die Vorstellung eines bei konstanter (oder variabler) Geschwindigkeit sich drehenden Gegenstands. In Wirklichkeit deutet die besagte Tatsache darauf hin, dass es länger dauern kann herauszufinden, wie eine bestimmte Figur zum 304 305
Finke, Principles of Metal Imagery, S. 93. Posner und Raichle, Images of Mind, S. 35.
264
6 Die kogitativen Vermögen
Vorschein kommt, wenn man sie auf diese Weise dreht, als herauszufinden, wie dieselbe oder eine andere Figur zum Vorschein kommt, wenn man sie auf andere Weise dreht. Denn man muss seine Vorstellungskraft betätigen – das heißt seine Fähigkeit, an mögliche Konstellationen zu denken, das Vermögen, herauszufinden, wo dieser Teil der Figur sich im Verhältnis zu jenem befindet, wenn die gesamte Figur um 90° gedreht wird. Man muss über die Drehung einer Figur nachdenken, keine imaginäre Figur drehen (weil es dergleichen nicht gibt). Indem man so (nach)denkt, kann man sich eine rotierende Figur vorstellen, muss es aber nicht. (Und es ist wichtig, in Erinnerung zu behalten, dass über etwas nachzudenken nicht bedeutet, irgendetwas zu sich selbst zu sagen.) Man kann sich ein rotierendes Objekt vorstellen. Sich ein sich schnell bewegendes Objekt vorzustellen heißt aber nicht, dass sich in der Vorstellung irgendetwas schnell bewegte. Ein Choreograf mag zu seinen Tänzern sagen, er habe sich einen bestimmten Pas de deux viel schneller gewünscht, als sie ihn tanzten, das heißt jedoch nicht, dass sie in seiner Vorstellung schneller tanzten. Wenn jemand insistiert, mit der Wendung ‚sie tanzten in meiner Vorstellung schneller‘ habe er nun einmal gemeint ‚ich stellte sie mir schneller tanzend vor‘, können wir das akzeptieren, sofern klar ist, dass ‚sie tanzten in meiner Vorstellung schneller‘ nicht bedeutet, dass sie schneller tanzten. Sich etwas lauter vorzustellen heißt nicht, dass es in der eigenen Vorstellung lauter war, genau wie eine Explosion lauter erwartet zu haben, als sie tatsächlich war, nicht heißt, dass sie in der eigenen Erwartung mehr Lärm gemacht hat. Die Vorstellung, dass es mehr Zeit in Anspruch nehmen muss, sich eine um 90° rotierende Figur vorzustellen, als dieselbe, die sich in einem Winkel von 45° dreht, ist ebenso abwegig wie der Gedanke, dass es länger dauern muss, eine Figur, die sich langsam bewegt, zu malen, als eine sich schnell bewegende. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, weshalb es mehr Zeit beanspruchen sollte, sich eine um 90° rotierende Figur vorzustellen, als dieselbe, die sich in einem Winkel von 45° dreht – denn es ist jedermann unbenommen, sich die erste Figur schnell rotierend und die zweite langsamer rotierend vorzustellen. Davon auszugehen, es brauche länger, eine um 90° gedrehte Figur abzugleichen als eine in einem Winkel von 45° gedrehte, weil die Figur mit konstanter Geschwindigkeit gedreht wird, fügt der Fehlkonzeption eine weitere inkohärente Hypothese hinzu. Mit gleicher Stichhaltigkeit könnte man die Hypothese vorbringen, dass die Schwerkraft auch im geistigen Raum konstant ist und dass sie 1G, der Erdanziehung, entspricht. Die kognitionswissenschaftliche Forschung, die wir erörtert haben, fußt auf der fundamental falschen Konzeption, dass es sich bei einem Vorstellungsbild um eine Art von Ding handelt, das in einem privaten geistigen Raum existiert, in den lediglich das Subjekt selbst Einsicht nehmen und die Dinge darin mit dem eigenen Willen in Bewegung versetzen kann. Diese verfehlte Konzeption setzt voraus, dass immer dann, wenn wir uns etwas sich schnell oder langsam Bewegendes vorstellen, etwas existiert, das sich in unserer Vorstellung schnell oder langsam bewegt, und sie setzt weiter voraus, dass immer dann, wenn sich in unserer Vorstellung etwas schnell bewegt, etwas existiert, das sich schnell bewegt. Wer es versäumt, die Struktur unserer Begriffe dieses Bereichs zu
6.3 Vorstellungskraft und Vorstellungsbilder
265
erfassen, der kann darangehen, die ‚Geist-Physik‘ dieser vermeintlichen ‚Geistesgegenstände‘ zu untersuchen und (mit Finke) der Ansicht sein, dass die Vorstellungsbilder ‚denselben Bewegungsgesetzen unterworfen sind‘ wie die physischen Gegenstände. Wir haben es hier mit einem Musterbeispiel dafür zu tun, was es heißt, in Sprachfesseln zu liegen, sich im Geflecht der Grammatik verfangen zu haben.
7 Emotion 7.1 Affektionen Die Emotionen sind eine Unterklasse der Affektionen Die Affektionen können grob in Emotionen, Erregungen [agitations] und Stimmungen unterteilt werden. Diese lassen sich auf der einen Seite in Einstellungen [attitudes] untergliedern, bei denen es sich nicht um Emotionen handelt, wie Zu- und Abneigung, Zustimmung und Missbilligung, und auf der anderen Seite in Charakterzüge wie Güte, Jähzorn und Rachsucht. Auf Emotionen bezieht man sich traditionell als ‚Leidenschaften‘ [‚passions‘], insofern als man sich ihnen gegenüber wesentlich in einer passiven Position befindet. Sie sind keine Handlungen oder (in den meisten Fällen) auch nur etwas, das man tut, sondern etwas, das man fühlt, das einen im Griff hat oder beherrscht, das über einen kommt und einen häufig überwältigt. Man kann eine Person anweisen, eine Handlung auszuführen; insofern aber, als man niemanden anweisen kann, etwas zu tun, das keine willkürliche Handlung ist, kann man im wörtlichen Sinn bzw. buchstäblich niemanden dazu veranlassen, zu lieben oder zu hassen. Man kann sich zum Handeln entschließen oder zu handeln beabsichtigen, man kann jedoch nicht beschließen oder beabsichtigen, zornig oder eifersüchtig zu sein. Und man kann auch nicht versuchen, Zorn, Liebe oder Mitleid zu haben, kann damit nicht vorankommen oder besser werden (nur zorniger bzw. mitfühlender werden oder mehr lieben). Andererseits sagen wir tatsächlich von einer Person, dass sie eigentlich dankbar oder eigentlich nicht eifersüchtig sein sollte, dass ihr Zorn unter diesen Umständen berechtigt sei oder dass sie einen Grund habe, empört zu sein, und wir werfen Menschen ihren exzessiven Zorn oder ihr unvernünftiges Ressentiment vor. Obwohl wir Emotionen nicht willentlich herbeiführen bzw. haben oder anordnen können, sind wir dazu in der Lage, unsere emotionalen Rückmeldungen zu kultivieren und zu verfeinern. Wir können unseren Emotionen freien Lauf lassen oder sie unter Kontrolle bringen, wir können ihnen Ausdruck verleihen oder sie unterdrücken. Das deutet darauf hin, dass die Vorstellung, unsere Emotionen seien in keiner Hinsicht willentlich zu beeinflussen, nicht richtig ist. Und tatsächlich sind wir mitunter in gewisser Weise und bis zu einem bestimmten Punkt für unsere Emotionen verantwortlich, mündig, was sie betrifft. Wir werden diesem Fall weiter unten nachgehen.
7.1 Affektionen
267
Affektionen sind Gefühle, kategorial aber von solchen Gefühlen zu unterscheiden, die Empfindungen, taktile Wahrnehmungen oder Triebe sind Affektionen sind Gefühle. Es ist üblich zu sagen, man fühle Liebe oder Hass (Emotionen), man sei/fühle sich aufgeregt oder erstaunt (Erregungen), sei/fühle sich gut aufgelegt oder niedergeschlagen (Stimmungen). Allerdings besteht ein kategorialer Unterschied zwischen den Gefühlen, bei denen es sich um Affektionen, und denen, bei denen es sich um Empfindungen handelt, die, anders als Affektionen, im Körper konkret verortet sind und uns darüber in Kenntnis setzen können, wie es um ihn bestellt ist. Sie unterscheiden sich auch von den Gefühlen, bei denen es sich um Formen taktiler Wahrnehmung handelt, die, anders als Affektionen, uns in die Lage versetzen, Merkmale unserer Umgebung aufzuspüren oder zu erfassen. Und sie unterscheiden sich von den Gefühlen, bei denen es sich um Triebe [appetites] handelt wie dem Hunger, dem Durst oder der Begierde/(Fleisches-)Lust [lust], und von den zur Sucht führenden Gefühlen wie der Gier nach Opiaten oder Alkohol, die Unterkategorien der Triebe darstellen – solche nämlich, die angereizt wurden und insofern ‚unnatürlich‘ sind. Affektionen sind auch von Gefühlen zu unterscheiden, die den Trieben in bestimmter Hinsicht ähneln wie Schwäche, Trägheit oder Müdigkeit. Diese werden gewöhnlich nicht als Triebe betrachtet, vielleicht weil Hunger, Durst und Begierde handlungsunabhängig erwachsen und zur Handlung hinführen (z. B. zur Nahrungssuche bzw. dem entsprechenden Verhalten), wohingegen die Schwäche eine Handlungsfolge ist und in Untätigkeit mündet. Es ist wichtig, Triebe von Emotionen zu unterscheiden – der Irrtum Rolls’ Es ist wichtig, den Unterschied zu beachten, der einerseits zwischen den Affektionen im Allgemeinen und den Emotionen im Besonderen und den Trieben anderseits besteht. Die jüngste Triebforschung hat die Verhältnisse nicht richtig wiedergegeben, weil sie es versäumte, ihn zu berücksichtigen. E. T. Rolls’ Buch The Brain and Emotion gibt vor, eine Untersuchung des neuralen Substrats der Emotionen zu sein. Es führt jedoch Hunger, Durst und Begierde/Lust als seine paradigmatischen Beispiele für Emotionen an und als die Objekte aller experimentellen Forschung, die es berücksichtigt. Ungeachtet der Tatsache, dass die Resultate dieser Untersuchungen durchaus interessant sind, beziehen sie sich nicht auf die Emotionen und stehen offensichtlich in keinem Zusammenhang mit ihnen, und zwar einfach deshalb, weil Hunger, Durst und Begierde keine Emotionen sind, sondern Triebe. Triebe sind Verschmelzungen von Empfindung und Verlangen Bei den Trieben handelt es sich um Verschmelzungen von Empfindung und Verlangen [desire], beides Wesensmerkmale der Tiere. Die Empfindungen, die die Triebe mit konstituieren, sind an einer bestimmten Stelle verortet. Der charakteristische Empfindungs-
268
7 Emotion
schwerpunkt des Hungers befindet sich im Bereich des Zwerchfells – man könnte kein Hungergefühl in seiner Kehle haben und auch kein Durstgefühl in seinem Zwerchfell. Die Hungergefühle, die man in seinem Bauch hat, müssen von den bloß begleitenden Empfindungen wie Benommenheit und Schwindel unterschieden werden, die auftreten können, nachdem man bereits eine Zeit lang hungrig war. Das Empfindungscharakteristikum des Durstes ist das Gefühl, eine trockene Kehle zu haben, das heißt, es ist gleichsam mit einem Trinkverlangen vermischt. Die mit den Trieben verbundenen Empfindungen sind Formen des Unbehagens, die einen zu Handlungen veranlassen, die den Trieb befriedigen. Die Intensivierung der Empfindungen wird insbesondere in den Fällen von Hunger und Durst (als auch im Fall süchtig machenden triebhaften Verlangens) zunehmend als unangenehm erlebt. Wie Beaumont und Fletcher anmerkten, ist Hunger ‚schärfer als ein Schwert‘ und es trägt ein ‚gefräßiger Gesell einen Wolf in seinem Bauch‘; Eliza Cook fiel allerdings Folgendes auf: ‚Hunger ist schmerzlich schlimm, der schlimmste aller menschlichen Schmerzen aber, der am meisten verfluchte der grausamen Skorpione Wants, ist Durst.‘ Das mit der Empfindung vermengte Verlangen ist durch sein Formalobjekt gekennzeichnet. Hunger ist ein Verlangen nach etwas Essbarem, Durst eines nach etwas zu trinken, und die Lust bzw. der Geschlechtstrieb ist ein triebhaftes Verlangen nach/eine Lust auf Geschlechtsverkehr. Die Formen des Verlangens, die die Triebe mit konstituieren, unterscheiden sich von anderen seiner Formen nicht bloß deshalb, weil sie mit typischen Empfindungen verschmelzen, sondern auch, weil die Triebe kein spezifisches Objekt aufweisen. Das Kind, das verkündet, es sei ‚not hungry for the main course, but only for the pudding‘, erzeugt versehentlich einen grammatischen Witz. Der Erwachsene, der erklärt, er sei ‚very thirsty for a gin and tonic, but not for a cup of tea‘ erzeugt einen solchen Witz absichtlich.306 Normalerweise steht die Intensität des Verlangens in einem proportionalen Verhältnis zur Intensität der Empfindung. Die Befriedigung des Triebs führt vorübergehend dazu, dass er Ruhe gibt, und somit zum Verschwinden der Empfindung. Der Nimmersatt kann natürlich weiterhin nach Essen verlangen, aber nicht, weil er noch immer Hunger hat, ebenso kann der Trinker noch einen weiteren ‚Drink‘ wollen, obwohl er keinen Durst mehr verspürt. Die Triebe machen sich nicht unausgesetzt bemerkbar, sondern treten periodisch auf. Sie werden für gewöhnlich und naturgemäß von körperlichen Bedürfnissen ausgelöst (oder im Falle der Begierde durch hormonell bedingte Schübe), beispielsweise dadurch, dass man Nahrungsmangel leidet, etwas zu trinken oder den Sexualakt entbehrt, obschon Nahrung oder ein Getränk nötig zu haben oder 306
[Der versehentliche Witz des Kindes und der absichtliche des Erwachsenen sind im Deutschen keine Witze. Denn interessanterweise ist es hier möglich zu sagen, man habe Hunger/sei hungrig auf das Hauptgericht oder habe Durst/sei durstig auf einen Gin Tonic. Aber man kann auch sagen ‚Ich habe Hunger‘ oder ‚Ich habe Durst‘, und hier sind Hunger und Durst unspezifisch, d. h. durch ein Formalobjekt charakterisiert. – A.d.Ü.]
7.1 Affektionen
269
den Drang nach der sexuellen Verbindung zu verspüren etwas anderes ist, als diese Dinge zu wollen. Unterschiede zwischen Trieben und Emotionen Darum ähneln die Triebe den Emotionen nicht. Erstens sind Emotionen nicht auf die gleiche Weise mit lokalisierten Empfindungen verbunden. Manche Emotionen sind mit Empfindungen verknüpft (Angst, Wut), andere nicht (Stolz, Reue, Neid). Man fühlt den Stolz nicht in seinem Bauch oder in seiner Kehle, und obwohl es Empfindungen gibt, die den Zorn charakterisieren, wie ein Pochen in den Schläfen und Muskelverspannungen, empfindet/fühlt man ihn nicht so in seinen Schläfen oder Bauchmuskeln, wie man den Hunger in seinem Bauch fühlt. Zweitens haben Emotionen nicht nur formale Objekte, in dem Sinne, in dem das, wovor man Angst hat, das ist, was als beängstigend oder gefährlich betrachtet wird, oder in dem das, was man bereut, ein Fehlverhalten ist, das man sich hat zuschulden kommen lassen – sie weisen spezifische Objekte auf, wie beispielsweise, wenn man vor der morgigen Prüfung Angst hat oder bereut, weil man Daisy angelogen hat. Drittens steht die Intensität der Emotionen, wie wir sehen werden, in keinem proportionalen Verhältnis zur Intensität der Empfindungen, die (welche auch immer) mit deren Manifestationen einhergehen können. Wie groß meine Höhenangst ist, kann sich darin manifestieren, welche Strecken ich zurückzulegen bereit bin, um sie zu umgehen, und wie stolz ich auf die Leistungen meiner Kinder bin, lässt sich nicht an Empfindungen ermessen. Viertens folgen die Emotionen nicht dem für die Triebe charakteristischen Erscheinungs-, Befriedigungs- und Wiederkehrsmuster, und zwar offensichtlich deshalb, weil ihre physiologische und hormonelle Basis eine andere ist als die der Triebe. Fünftens gehören die Emotionen einer anderen kognitiven Dimension an als die Triebe. Das hungrige Tier will Nahrung, das durstige will trinken, das läufige will den Geschlechtsakt vollziehen, allerdings verbindet sich mit diesen Trieben im Wesentlichen kein Spezialwissen oder Spezialglauben. Dagegen hat das sich ängstigende Tier vor etwas Angst, von dem es weiß oder glaubt, dass es gefährlich ist; eine Mutter ist insofern stolz auf ihren Nachwuchs, als sie glaubt, dass er die und die Vorzüge aufweist; ein Sünder bereut in dem Wissen, dass er falsch gehandelt hat. Und schließlich werden viele menschliche Emotionen durch charakteristische mimische Ausdrücke herausgehoben und treten in typischen ‚Zungenschlägen‘ bzw. Tonfällen zutage – wie es bei Angst, Zorn, Liebe und Zuneigung der Fall ist. Auf die Triebe trifft das nicht zu. Zu den paradigmatischen Emotionen zählen Liebe, Hass, Hoffnung, Angst, Zorn, Dankbarkeit, das Ressentiment, Verärgerung, Neid, Eifersucht, Erbarmen, Mitgefühl und Traurigkeit als auch die Emotionen der Selbstbewertung wie Stolz, Scham, Demut, Bedauern, Reue und Schuld.
270
7 Emotion
Erregungen sind von Emotionen zu unterscheiden Erregungen sind kurzzeitige affektive Beeinträchtigungen, die normalerweise von etwas Unerwartetem hervorgerufen werden. Sie umfassen solche Zustände, in denen man u. a. entweder aufgeregt, begeistert, geschockt, aufgewühlt, erstaunt, überrascht, erschrocken, entsetzt, empört, angeekelt oder entzückt ist oder sich entsprechend fühlt. Sie werden durch das verursacht, was wir wahrnehmen, lernen oder realisieren. Als von unerwarteten Störungen verursachte Beeinträchtigungen sind Erregungen keine Handlungsmotive, was die Emotionen sein können, sondern sie verhindern motivierte Handlungen vorübergehend. Jemand mag sich in bestimmter Art und Weise verhalten, weil er aufgeregt, begeistert oder geschockt ist. Es ist jedoch ausgeschlossen, dass man in dem Sinn vor Aufregung, Begeisterung oder aus dem Schreck heraus handelt, in dem man aus Liebe, Mitgefühl oder vor lauter Dankbarkeit handelt. Bei Erregungen haben wir es mit Reaktionsweisen zu tun: Man schreit vor Entsetzen oder Erstaunen auf, schreckt mit Abscheu oder Ekel zurück, biegt sich vor Lachen oder ist vor Schreck wie paralysiert. Im Gegensatz zu länger anhaltenden emotionalen Einstellungen ähneln die eine Weile gefühlten Emotionen oft den Erregungen, die sich beispielsweise in den Beeinträchtigungen der vor Wut pochenden Schläfen, des Schlotterns, Schwitzens und der Flachatmigkeit der Angst, der Tränen und Schreie der Trauer offenbaren. Stimmungen sind von Emotionen zu unterscheiden Stimmungen sind Zustände, in denen man z. B. gut gelaunt, euphorisch, zufrieden, irritiert, melancholisch oder niedergeschlagen ist bzw. sich entsprechend fühlt. Es sind Zustände oder Verfassungen des Geistes, in denen man sich befindet; so ist man beispielsweise in einem melancholischen Zustand oder in einer heiteren oder entspannten Geistesverfassung. Es kann sich bei ihnen um eine Weile lang andauernde Geisteszustände oder um längerfristige dispositionale Zustände handeln. Man kann sich einen Nachmittag lang niedergeschlagen, melancholisch, freudig erregt, entspannt, heiter, irritiert oder munter fühlen, oder man kann an einer länger andauernden Niedergeschlagenheit leiden, die sich monatelang hinzieht, so wie man über mehrere Tage heiter gestimmt sein kann. Als eine Disposition kommt eine Stimmung einer Neigung gleich, sich während des Wachseins voller Freude oder niedergeschlagen oder aufgemuntert etc. zu fühlen. Stimmungen sind weniger eng mit Objekten verknüpft als Emotionen, denn man kann sich aufgemuntert oder niedergeschlagen fühlen, ohne dass die Stimmung direkt an irgendein bestimmtes Objekt geknüpft ist, man kann hingegen nicht lieben, ohne jemanden oder etwas zu lieben, oder zornig sein, ohne auf irgendjemanden oder irgendetwas zornig zu sein. Stimmungen sind auch nicht mit bestimmten Mustern intentionalen Handelns verknüpft und schon gar nicht mit Motiven, allerdings mit Verhaltensweisen. Heiterkeit, Melancholie und Niedergeschlagenheit sind, anders als die Liebe, der Neid oder das Mitgefühl, an keine Motive gebunden, sie treten jedoch in un-
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
271
seren alltäglichen Verrichtungen, was Gebaren und Tonfall angeht, zutage. Und zwar deshalb, weil Stimmungen unsere Gedanken und Überlegungen einfärben bzw. durchdringen. Stimmungen sind keine häufig auftretenden oder andauernden emotionalen Zustände Darum ist es nicht gerechtfertigt, die Stimmungen mit Damasio als emotionale Zustände zu charakterisieren, die über lange Zeiträume hinweg häufig oder kontinuierlich vorkommen.307 Man kann den Krieg lange Zeit fürchten, das bedeutet jedoch nicht, dass man in irgendeiner besonderen Stimmung ist, obgleich jemandes Angst vor einem bevorstehenden Krieg sehr wohl zur seiner melancholischen Stimmung beitragen kann. Othellos Eifersucht bestand beharrlich und ununterbrochen fort, es handelte sich jedoch nicht um eine Stimmung, anders als bei der darauf folgenden Niedergeschlagenheit, unter der er zu leiden hatte. Man kann A seinen Erfolg jahrelang neiden, Neid aber, ob nun andauernd oder nicht, ist keine Stimmung. Und häufig kann es sich bei der Furcht vor etwas um eine von Natur aus vorhandene Furchtsamkeit handeln, die jedoch nicht mit einer Stimmung zu verwechseln ist. Die Grenzen zwischen Emotion, Erregung und Stimmung sind fließend. Emotionale Beeinträchtigungen (als die wir die typischen somatischen, ausdrucksvollen und verhaltensbezogenen Manifestationen vieler für eine Weile bestehenden Emotionen auffassen werden) weisen, wie gesagt, eine Ähnlichkeit mit Erregungen auf. Emotionen können zu Stimmungen verblassen, was beispielsweise geschieht, wenn ein abklingender Schrecken in eine Stimmung gegenstandsloser Ängstlichkeit mündet. Umgekehrt kann ein Gefühl ungerichteter Ängstlichkeit sich zu einer spezifischen Angst verfestigen. Die psychologische Kategorie der Affektionen erweist sich auf begrifflicher Ebene als komplex und vielgestaltig; die zu unterscheidenden Begriffsmuster sind uneinheitlich, und jeder Typus geht mit einer beträchtlichen Zahl an Variationen einher. Folglich müssen die meisten der im Hinblick auf die drei subkategorialen Begriffe getroffenen Verallgemeinerungen mit einem ‚zumeist‘ oder einem ‚für gewöhnlich‘ versehen werden.
7.2 Die Emotionen: Ein einleitender analytischer Überblick Emotionsbezogene Charakterzüge im Unterschied zu Emotionen als episodischen Beeinträchtigungen und zu Emotionen als Einstellungen Man muss zwischen emotionsbezogenen Charakterzügen (die keine Gefühle sind), Emotionen als episodischen Beeinträchtigungen und Emotionen als länger andauern307
A. Damasio, The Feeling of What Happens (Heinemann, London, 1999), S. 341 [dt. Ich fühle, also bin ich (List, München, 1999), S. 411].
272
7 Emotion
den Einstellungen unterscheiden (von beiden sagt man, sie seien Gefühle). Viele Emotionstermini werden gebraucht, um Charakterzüge zu benennen: Wir sagen von Menschen, sie hätten ein mitfühlendes Wesen oder ihr Wesen bestehe ganz aus Liebe, sie seien eifersüchtig oder neidisch gesinnt oder seien von Natur aus jähzornig, zaghaft oder furchtsam. Die Zuschreibung derartiger Charakterzüge bringt zum Ausdruck, dass bei ihnen eine Neigung besteht, in entsprechenden Umständen anteilnehmend oder liebevoll zu sein und zu fühlen, oder auch: eifersüchtig oder neidisch, zornig oder zaghaft; und also auch aus Mitgefühl oder Liebe, Eifersucht oder Neid, im Zorn oder mit Scheu zu handeln. Die episodische emotionale Beeinträchtigung im Unterschied zur emotionalen Einstellung – Letztere vernachlässigen die Neurowissenschaften für gewöhnlich Der Begriff einer gefühlten Emotion unterscheidet nicht zwischen einer episodischen emotionalen Beeinträchtigung und einer länger andauernden emotionalen Einstellung. Man kann von einer Woge des Mitleids für diese und jene armen Menschen übermannt werden, über jemanden erbost sein, der beleidigend agierte, stolz darüber sein, dass man die ausgelobte Trophäe verliehen bekommt – in diesen Fällen stimmt die Emotion eindeutig mit der Subkategorie der Erregungen überein. Man kann jedoch ebenso für jemanden Mitleid haben, solange er sich in einer misslichen Lage befindet, sich jahrelang über jemanden ärgern (jedoch nicht erbost über ihn sein oder ihm zürnen – beides Beeinträchtigungsformen des Zorns) und sein restliches Leben lang stolz darauf sein, eine Trophäe gewonnen zu haben.308 Wenn wir von einer Person sagen, dass sie ‚ihren Emotionen freien Lauf lässt‘, ‚ihre Emotionen im Griff hat‘ oder ‚von den Emotionen überwältigt wird‘, haben wir üblicherweise emotionale Beeinträchtigungen im Sinn. Wenn wir eine Person als ‚emotional‘ charakterisieren, meinen wir nicht, dass sie viele Menschen liebt oder hasst, zahlreiche Ängste oder Hoffnungen in sich birgt etc. Wir meinen vielmehr, dass sie für emotionale Beeinträchtigungen anfällig ist, zu GefühlsausEs ist möglicherweise verlockend anzunehmen, dass der Ausdruck ‚fühlen‘ (wie in ‚sich zornig, ängstlich, stolz fühlen‘) auf emotionale Beeinträchtigungen beschränkt ist, während ‚sein‘ (wie in ‚zornig, ängstlich, stolz sein‘) eine emotionale Einstellung ausdrückt. Damit würde man allerdings einem Irrtum erliegen. Meistens sind ‚sich ängstlich fühlen‘ und ‚ängstlich sein‘ austauschbare Wendungen. Im Großen und Ganzen gibt es, wenn überhaupt, nur einen minimalen Unterschied zwischen dem Fühlen [feeling afraid of] der Angst vor dem aufkommenden Krieg und dem Angsthaben [being afraid of] vor ihm, zwischen sich stolz fühlen, die Trophäe errungen zu haben, und stolz sein, sie errungen zu haben. Beispielsweise gehen Respekt und Bewunderung nicht mit einer Erregung einher, dennoch sagt man, dass man sie fühle/empfinde, und es scheint keinen Unterschied zu geben zwischen dem Respektieren und Bewundern von jemandem und dem Fühlen/Empfinden von Respekt und Bewunderung für ihn. Dort, wo es in diesem Zusammenhang eine Differenznuance des Gebrauchs gibt, rührt diese nicht von einem Unterschied zwischen der emotionalen Beeinträchtigung und der emotionalen Einstellung her. 308
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
273
brüchen neigt, ihrer Wut, Empörung, Liebe und ihrem Hass offen und möglicherweise bis zur Eskalation Ausdruck verleiht und dahin tendiert, ihren Emotionen zu gestatten, einen schädlichen Einfluss auf ihr Urteil auszuüben. Allerdings muss man dafür Sorge tragen, dass dieser Aspekt der Emotionen andere nicht verdeckt und dass man sich nicht der Vorstellung überlässt, dass allein die Forschung zur emotionalen Beeinträchtigung die Emotionen angemessen darstellen kann. Die neurowissenschaftlichen Arbeiten haben unter dem starken Einfluss der abwegigen James-Lange-Theorie der Emotionen die einstellungsbezogenen als auch die motivationalen, kogitativen und die Fantasie-Aspekte der Emotionen systematisch, wenn auch unwissentlich, ausgeblendet. Die länger andauernde emotionale Einstellung ist genauso ein Aspekt unseres komplexen Begriffs von einer Emotion wie die entsprechende emotionale Beeinträchtigung. Unsere Urteilskraft kann durch emotionale Bedrängnis und Erregung getrübt sein, und sie ist es beispielsweise, wenn wir von Trauer überwältigt sind, im Zorn versinken oder die Angst uns gefangen nimmt und hält. Sie kann aber ebenso von lang andauernden Ressentiments, Neidbezeigungen und Eifersüchteleien entstellt werden. Die Liebe zu einer anderen Person ist eine Emotion, die einerseits als eine emotionale Beeinträchtigung gefühlt bzw. erlebt werden kann – die Woge von Zärtlichkeit, das dahinschmelzende Herz, die zitternden Hände, das Erröten und so weiter, Dinge, die einem jungen Romeo in der Gegenwart seiner Julia gewiss nicht unbekannt sind – und andererseits als eine Dauereinstellung, wie sie in der reifen ehelichen Liebe von Pierre und Natascha im Epilog von Krieg und Frieden anschaulich zur Darstellung gelangt. Die Dauereinstellung ist keine Disposition zu den entsprechenden Episoden emotionaler Beeinträchtigung, sondern bei ihr handelt es sich um ein bleibendes sorgendes Interesse am Liebesobjekt, einen fortdauernden Antrieb, der geliebten Person Wohltaten zukommen zu lassen oder sie unter den eigenen Schutz zu stellen, um ein Wissen von und ein starkes Verlangen nach gemeinsamen Erfahrungen, und sie ist eine beständige Anstrengung, die Gedanken, Vorstellungen und Wünsche in den prächtigsten Farben zu malen. Die fortdauernde emotionale Liebeseinstellung wie die von Pierre und Natascha ist gewiss mit emotionalen Beeinträchtigungen verbunden, aber nicht mit denen eines dahinschmelzenden Herzens, freudiger Hitzewallungen, zitternder Hände und des Stammelns jugendlicher Leidenschaft. Vielmehr ist sie mit jenen Beeinträchtigungen verknüpft, die das sorgende Interesse für diejenigen, die man liebt, charakterisieren – die Sorge um ihr Wohlergehen, die Freude an dem, was sie erreicht haben, die Sehnsucht, mit ihnen wieder vereinigt zu werden nach einer langen Trennung etc. (Und man sollte nicht vergessen, dass man nicht nur Menschen lieben kann (Eltern, den Ehepartner, Kinder, Freunde), sondern auch Aktivitäten (ein Orchester dirigieren, Gartenarbeit, Kämpfe durchstehen), Gegenstände, Orte, Ansichten und Landschaften (Blumen, Bäume, das Meer, sein Zuhause, die eigene Stadt), Kunstwerke (Gemälde, Musikstücke) und Ideale (Ehre, Freiheit) – vieles davon passt zu keiner der ‚kurzatmigen‘ Liebesbeeinträchtigungen.) Noch einmal, der Hass, den Edmond Dantès seinen verräterischen ehemaligen Freunden entgegenbringt, zeigt sich viel weniger in emotionalen Ausbrüchen als in der
274
7 Emotion
eisernen Entschlossenheit seines Willens, Rache zu üben, in der Gestalt seines Denkens und seiner Fantasie und in seinen Handlungsmotiven und -gründen während all der Jahre. Der Neid, der Cousine Betty umtreibt, muss sie nicht jeden Morgen aufs Neue überwältigen, aber er ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. Liebe, Hass oder Neid sind in die Weise, in der einem das Objekt, auf das die eigene Emotion gerichtet ist, etwas bedeutet, einbegriffen, und sie durchdringen die Gründe, die für die Wichtigkeit des Objekts ausschlaggebend sind – man kann nicht gleichzeitig eine Emotion fühlen, die auf ein bestimmtes Objekt gerichtet ist, und ihm gegenüber gleichgültig sein. Daher gehört auch sie zu den Motiven, die einen zur Handlung bewegen; denn jemand, der diese Emotionen hat, wird normalerweise aus Liebe, Hass oder Neid handeln. Die eigenen Emotionen werden dann in den für einen selbst ausschlaggebenden Erwägungsgründen ersichtlich, in den Leidenschaften, die man beherbergt, und in den Gedanken, die einem im Zusammenhang mit dem Gefühlsobjekt durch den Kopf gehen. Man kann seine Emotionen nicht von seiner Fantasie und Vorstellungskraft trennen und ebenso nicht von seinen Wünschen und Sehnsüchten. So verweilt man z. B. bei seinen Hoffnungen und Ängsten, ‚fantasiert‘ über die Erfüllung seiner Wünsche im Hinblick auf die Objekte, die man liebt oder auf die man stolz ist, und sorgt sich wie besessen um die Dinge, für die man Ängste aussteht. Die Emotion lässt sich nicht einfach messen, indem man die Häufigkeit und Intensität der Beeinträchtigungen in den Blick nimmt Wie oben bereits dargelegt, kann man die Emotion einer Person nicht messen, indem man die Häufigkeit und Intensität ihrer emotionalen Beeinträchtigungen zugrunde legt. Beispielsweise kann sich die Angst eines Menschen vornehmlich in den Distanzen zeigen, die er zurückzulegen bereit ist, um Situationen aus dem Weg zu gehen, die sein Herz erschrecken könnten. Die Stärke ihrer Motivationskraft lässt sich nicht in der Weise quantifizieren wie der Anstieg von Puls- oder Atemfrequenz oder die Zunahme der Transpiration. Wie stark ihre motivierende Kraft ist, wird vielmehr danach beurteilt, inwieweit sie im Laufe der Zeit das Verhalten bestimmt und um welches Verhalten es sich dabei handelt. Obgleich die Angst zur allgemeinen Conditio der Tiere, und daher auch der Menschen, gehört, eignet sie sich schlecht als typisches Beispiel. Denn es gibt viele Emotionen, die normalerweise kaum, wenn überhaupt, mit emotionalen Beeinträchtigungen oder Störungen einhergehen; Demut beispielsweise, Respekt, Bewunderung, Zuversicht und Dankbarkeit. Nicht einmal die Angst selbst muss in allen Fällen mit ängstlichen Erregungen einhergehen, nicht, weil sie gering wäre, sondern wegen der Art ihres Objekts. Das, wovor man Angst hat, kann jede spezielle, zumindest aber jede intensive ängstliche Erregung ausschließen. Die Angst vor einer wirklich drohenden Gefahr, Verletzung oder einem ebensolchen Unglück wird im Normalfall mit einer intensiven ängstlichen Erregung verbunden sein. Das trifft nicht auf die ängstliche Befürchtung zu, dass es während der für morgen geplanten Gartenparty regnen könnte,
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
275
auch nicht auf die Angst vor einer im nächsten Monat steigenden Inflation oder die vor der Erderwärmung in den kommenden Jahren – obwohl sich aus Letzterer eine kraftvolle Motivation ergeben und die Wirkung auf die Stimmung des Akteurs lang vorhalten kann. Ebenso muss die Tiefe der Trauer einer Person nicht mit einem Syndrom an gefühlten Empfindungen und Beeinträchtigungen verknüpft sein, sondern sie kann sich vielmehr in ihren unermüdlichen Anstrengungen manifestieren, zurückliegende eigene Handlungen wieder gutzumachen und darin, die Sünden der Vergangenheit korrigierend zu überdenken. Wie stark die Liebe einer Person für jemand anderen ist, sollte nicht nur danach beurteilt werden, wie stark sie die Anwesenheit des geliebten Menschen erregt, sondern auch danach, wie sehr sie sich um sein Wohlergehen sorgt und in welchem Umfang sie bereit ist, seinetwegen Opfer zu bringen. Ist man bloß erregt und sorgt sich nicht in angemessener Weise, kann das ein Hinweis darauf sein, dass es sich in diesem Fall eher um eine Betörung und ein Verlangen als um Liebe handelt. Uneindeutigkeit von ‚Dauer einer Emotion‘ Mithin ist die Vorstellung der Dauer einer Emotion auch nicht eindeutig. Denn sie kann sich auf die Dauer der Beeinträchtigung durch ein emotionales Ereignis beziehen oder auf die Dauer eines Gedanken- oder Fantasie-Induktion einer motivierenden emotionalen Einstellung, die das Leben einer Person auf vielfältige Weise und auf lange Sicht durchdringen kann. Wegen der begrifflichen Komplexität und Vielgestaltigkeit der Emotionen gibt es keinen Begriffsprototyp Jede experimentelle Untersuchung der Emotionen muss die Komplexität des Begriffs einer Emotion und die begriffliche Vielfalt der verschiedenen Emotionen, für die sich Menschen empfänglich zeigen, in Betracht ziehen. Es gibt kein Einzelparadigma von Emotion, das gleichsam als begrifflicher Prototyp fungieren kann. Wenn sie unter den entsprechenden Umständen und im Hinblick auf ein bestimmtes Objektspektrum gefühlt werden, sind manche Emotionen eng mit bestimmten Empfindungen und mimischen Ausdrücken verknüpft, wie bei der Angst vor physischem Leid, echtem Zorn oder der wirklichen Trauer. Auf andere Emotionen wie Hoffnung, Reue oder Mitgefühl trifft das nicht zu. Manche Emotionen treten in Erregungsformen zutage, die mit einem typischen Reaktionsverhalten einhergehen, wie im Falle des Schreckens (herausschreien, zittern, bangen, kreidebleich werden) oder der Trauer (weinen und klagen). Auf andere wie Stolz, Respekt oder Mitgefühl trifft das nicht zu. Manche Emotionen sind eng mit recht spezifischen Handlungsformen oder Handlungsneigungen verknüpft, wie im Falle der Angst vor drohender Gefahr (die Neigung, auszuweichen oder die Flucht zu ergreifen) oder des Mitleids (die Neigung, Hilfe zu gewähren). Auf andere wie das Bedauern oder Hoffen trifft das nicht zu. Folglich sollte man nicht von einer einzelnen Emotion
276
7 Emotion
ausgehen wie der Angst beispielsweise (geschweige denn von Fällen konditionierter Angst), die auf ein einzelnes Objekt (z. B. den Schmerz) beschränkt ist, sie als ein Musterbeispiel auffassen und von diesem besonderen Fall aus verallgemeinern. Ratten zu konditionieren, einen Stromschlag zu fürchten (vgl. LeDoux‘ wichtige Forschung) ist eine dürftige Grundlage, um die menschliche Emotion und ihre neurobiologischen Bedingungen und Begleiterscheinungen zu verstehen. Die Unterschiede zwischen menschlicher Emotion und der von Tieren sind für die Neurowissenschaften wichtig Weil mittlerweile so viele Experimente an Tieren durchgeführt wurden, ist es wichtig, sich über die Unterschiede im Klaren zu sein, die zwischen menschlichen Emotionen und denen bestehen, die Tieren eigen sind, die keine Sprache gebrauchen. Viele Emotionen teilen wir mit anderen Tieren – z. B. Neugier, Angst und Zorn. Das Feld der möglichen Objekte menschlicher Neugier, Angst und menschlichen Zorns ist allerdings viel größer als das der rein tierischen Neugier, Angst und des bloßen Tierzorns. Die kognitiven und bewertenden Aspekte menschlicher Emotionen reichen viel weiter als die der Emotionen von Tieren. Natürlich weiß der aus Angst vor einer Schlange schreiende Affe, dass Schlangen gefährlich sind. Der Löwe, der im Zorn sein Junges anfaucht, weil es ihn belästigt, fasst es als einen ‚Quälgeist‘ auf. Die Stubenkatze, die vor Vergnügen schnurrt, wenn ihr das Futter zubereitet wird, weiß, dass die Zeit für ihre Mahlzeit gekommen ist. Allerdings sind ihre kognitiven Fähigkeiten genau dadurch beschränkt, dass sie keine Sprache beherrschen. Viele der Glaubensarten, die auf das Konto der menschlichen Emotion gehen, könnten unter keinen Umständen einem Tier zugeschrieben werden. Wie nahegelegt, können wir dank der Emotionen zeigen, was uns etwas bedeutet. Allerdings reflektieren Menschen normalerweise darüber, was ihnen etwas bedeutet, sprachunbegabte Tiere zeigen indes ausschließlich in ihrem Verhalten, wofür sie sich interessieren (ihr Territorium, die Beute, die sie getötet haben, ihre Dominanz in der Gruppe etc.). Darum ist die Antriebskraft einer Emotion bei einem sprachunbegabten Tier sowohl äußerst beschränkt als auch signifikant anders, als es die Motivationskraft der Emotionen bei Menschen ist. Denn Menschen handeln aus Gründen, Tiere hingegen sind dazu allenfalls in einem limitierten und schwächeren Sinn in der Lage. Die menschlichen Emotionen verleihen den Gedanken und Fantasien ihre Farbe, die sprachunbegabten Tiere sind jedoch nicht damit befasst, über die Objekte ihrer Emotionen nachzudenken, und sie haben keine Fantasievorstellungen, was die Erfüllung ihrer Hoffnungen und Ängste angeht – sie verfügen nicht über die begriffliche Ausstattung, die solche Gedanken und Fantasien allererst ermöglicht. Und schließlich gibt es viele Emotionen, wie Schuld-, Ehrfurchts-, Reuegefühle und solche moralischer Entrüstung, welche die sprachunbegabten Tiere, logisch betrachtet, niemals aufweisen können. Denn derartige Emotionen setzen die Beherrschung einer Sprache und den Besitz der entsprechenden Begriffe voraus. Ein Bewusstsein für die Beschränkungen, denen
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
277
die Tiere in ihrer Emotion unterworfen sind und denen auch ihre Objekte unterliegen, sollte den ungerechtfertigten Verallgemeinerungen ein Ende machen können und damit den von Tierexperimenten abgeleiteten Folgerungen, die ohne größeres Aufhebens auf Menschen ausgedehnt werden. So blendet die auf die konditionierte Angst bei Ratten fokussierte neurowissenschaftliche Forschung die allermeisten Charakteristika der menschlichen Emotion im Allgemeinen und der menschlichen Angst im Besonderen aus. Aber selbst wenn hier der richtige Ausgangspunkt gefunden ist, um mit dem Verstehen der neurologischen Fundamente der menschlichen Emotion beginnen zu können, so lassen sich doch von ihm aus überhaupt keine umfassenden Verallgemeinerungen treffen – ebenso wie es sich bei den Rufen eines wilden Tieres um eine dürftige Grundlage handelt, um verallgemeinernde Überlegungen über die menschliche Sprache anzustellen. Objekt und Ursache einer Emotion sind zu unterscheiden Emotionen haben für gewöhnlich Objekte. Wenn man Angst hat, hat man vor etwas oder jemandem Angst oder davor, dass etwas geschehen ist oder geschehen wird; wenn man Reue, Schuld oder Bedauern fühlt, dann für ein Tun; wenn man neidisch ist, empfindet man Neid auf jemanden, den das Glück begünstigt. Offenkundig wird ‚Objekt einer Emotion‘ nicht nur in einer Weise sinnfällig, und es ist wichtig, wie wir sehen werden, die unterschiedlichen Sinnhinsichten auseinanderzuhalten. Das Objekt einer Emotion muss von ihrer Ursache unterschieden werden – das, was einen eifersüchtig macht, entspricht nicht dem, worauf man eifersüchtig ist; Ihre Tirade der Entrüstung kann bei mir Schamgefühle hervorrufen, doch das, wofür ich mich schäme, ist mein eigenes Fehlverhalten; schlägt das Kriegsglück um, kann einen das hoffnungsvoll stimmen, es ist jedoch der endgültige Sieg, auf den man hofft. Emotionen in ihrer Verbindung zum Wissen und Glauben Emotionen sind auch mit dem Wissen und Glauben auf komplexe Art verknüpft. Man kann nicht neidisch sein, solange man nicht weiß oder glaubt, dass ein anderer sich eines großen Glücks erfreut, nicht eifersüchtig, solange man nicht weiß oder glaubt, dass jemand, den man liebt, jemand anderen favorisiert, und man kann nicht vor etwas Angst haben, solange man es nicht als eine Bedrohung der eigenen Belange auffasst. Emotionen gehen von daher wesentlich mit einer Einschätzung oder Bewertung ihrer Objekte durch den Akteur im Hinblick auf seine Interessen einher. Wissen und Glauben spielen in diesem Zusammenhang eine große Rolle – das heißt, aus ihnen gehen die speziellen Gründe hervor, die eine Person für das, was sie fühlt, hat.
278
7 Emotion
Körperliche Begleiterscheinungen und Verhaltensmanifestationen der Emotionen Manche Emotionen weisen typische körperliche Begleiterscheinungen, Empfindungen und Reaktionen auf, die zutage treten, wenn die Emotion – z. B. Angst, Zorn oder Trauer – als eine Beeinträchtigung erlebt wird. Manche emotionale Beeinträchtigungen gehen mit typischen Verhaltensmanifestationen einher. Bei einigen von diesen handelt es sich um expressive Reaktionen des mimischen, gestischen oder körperlichen Auftretens. Bei anderen haben wir es mit willkürlichen expressiven (in Abgrenzung zu instrumentellen) Handlungen zu tun; sie werden typischerweise nicht intentional, zweckgerichtet oder um eines Ziels willen ausgeführt, und insoweit sie das werden, sind sie nicht rein expressiv. Die expressiven Verhaltensmanifestationen emotionaler Beeinträchtigungen umfassen die Handlungsweise, sogar dann, wenn die Handlung instrumentell ist: Wenn man wütend ist, knallt man die Tür eher zu, als dass man sie leise schließt; wenn man aufgeregt ist, erreicht die eigene Stimme möglicherweise eine höhere Tonlage, und die eigenen Hände können während eines mündlichen Vortrags vor Angst zittern. Aber auch die andauernden emotionalen Einstellungen können in Mimik, Handlungsweise und Verhalten zutage treten – wie sich im ‚feinabgestimmten‘ Verhalten von Liebenden zeigt oder in der Art, wie eine Person auftritt, wenn jemand anwesend ist, den sie bewundert und respektiert oder fürchtet und hasst. Emotionen in ihrer Verbindung zum Wollen, zu Motivation, Rationalität und Fantasie Emotionen gehen üblicherweise mit einem Verlangen oder einer Abneigung einher und stehen daher mit dem Wollen und der Motivation in Zusammenhang. Emotionen sind insofern begründet oder irrational, als es Gründe für eine Emotion geben kann und die Emotionen eines Akteurs für gewöhnlich mit seinen Handlungsgründen zu tun haben. Emotionen stehen insofern mit der Vorstellungskraft oder der Fantasie in Zusammenhang, als eine Emotion und ihre Objekte die Gedanken einer Person anregen, ihre Tagträume bestimmen und sie während schlafloser Nächte in Beschlag nehmen kann.
7.2.1 Die Verwirrungen der Neurowissenschaftler LeDoux’ Fehlkonzeption Einen kleinen Teil des dicht geknüpften Begriffsgeflechts werden wir gleich untersuchen. Es dürfte jedoch bereits deutlich geworden sein, dass die von bedeutenden Neurowissenschaftlern geteilte Emotionskonzeption mangelhaft ist, was zu einem Teil auf ihren unzulänglichen Emotionsbegriff zurückzuführen ist. So fasste beispielsweise LeDoux die Ergebnisse seines Hauptwerks zum Thema in der folgenden Beobachtung zusammen:
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
279
Die emotionalen Gefühle [emotional feelings] kommen zustande, wenn wir bewusst erfassen, dass ein Emotionssystem des Gehirns aktiv ist. Jeder Organismus, der über Bewusstsein verfügt, hat Gefühle. Allerdings unterscheiden sich die Gefühle in einem Gehirn, das die Welt sprachlich klassifizieren und Erfahrungen in Worten kategorisieren kann, von denen in einem Gehirn, das dazu nicht in der Lage ist. Angst, Ängstlichkeit, Schrecken, Bangigkeit und dergleichen würden sich nicht unterscheiden, gäbe es die Sprache nicht. Zugleich hätte keines dieser Worte irgendeine Berechtigung, wenn es nicht auf die Existenz eines zugrunde liegenden Emotionssystems verweisen würde, das Gehirnzustände und körperliche Reaktionen hervorruft, auf die diese Worte zutreffen. Emotionen bildeten sich nicht als bewusste Gefühle heraus, ob diese nun sprachlich unterschieden werden oder nicht, sondern als Gehirnzustände und Körperreaktionen. Bei diesen handelt es sich um die elementaren Tatsachen einer Emotion, und die bewussten Gefühle sind Beigaben, gleichsam die Sahnehäubchen auf der Emotionstorte.309
Diese Einschätzung ist jedoch verworren und hilft dem Verständnis nicht auf die Sprünge, weder hinsichtlich der Frage, worum es sich bei all den Emotionen handelt, noch was die empirischen Bedingungen ihres Fühlens angeht. Die Kausalbedingungen für das Fühlen einer Emotion werden sowohl von der Ursache als auch dem Objekt der Emotion unterschieden (i) Eine Emotion kann gewiss aufgrund einer Ursache [cause] ‚zustande kommen‘. Das reibungslose Funktionieren des Gehirns ist fraglos eine Kausalbedingung [causal condition] für das Fühlen von Emotionen. Sind beispielsweise die ventromedialen präfrontalen Kortexe verletzt oder der somatosensorische in der rechten Hemisphäre, so ist die emotionale Sensitivität stark beeinträchtigt. Es wäre aber ein Irrtum, die Kausalbedingungen der Möglichkeit des Fühlens einer Emotion mit der Ursache einer spezifischen Emotion bei einer bestimmten Gelegenheit gleichsetzen. Die Ursache der Angst beispielsweise ist das, wodurch man Angst bekommt (z. B. der Knall eines Schusses) – nicht die Kausalbedingung des Gehirns, die Angst möglich macht. Zudem müssen Emotionsobjekt und Emotionsursache nicht identisch sein (obgleich sie mitunter ‚zusammenfallen‘ können). Wodurch man Angst bekommt/erschrickt – der Knall eines Schusses nämlich –, muss nicht mit dem übereinstimmen, wovor man Angst hat – getötet zu werden nämlich –, genau wie es sich bei dem, was Othello eifersüchtig macht ( Jagos Lügen), nicht um das handelt, worauf er eifersüchtig ist (Desdemonas angebliche Liebe zu Cassio). Eine Emotion zu fühlen heißt nicht, ‚bewusst zu erfassen, dass ein Emotionssystem des Gehirns aktiv ist‘. Denn man fühlt eine Emotion, ohne überhaupt irgendetwas über die Gehirnaktivitäten zu wissen, ebenso wie man die Ursache seiner Emotion (in Abgrenzung zu seinem Objekt) nicht kennen muss. Liebe, Eifersucht oder Neid zu fühlen und ‚bewusst zu erfassen‘, dass man so fühlt, heißt nicht, dass man sich eines Emotions309
J. LeDoux, The Emotional Brain (Phoenix, London, 1998), S. 302 [dt. Das Netz der Gefühle (Hanser, München und Wien, 1998), S. 324f.].
280
7 Emotion
systems des Gehirns bewusst ist, bei dem es sich um eine Kausalbedingung dafür handelt, eine solche Emotion haben zu können. Es heißt vielmehr, den und den zu lieben (auf den und den eifersüchtig oder neidisch zu sein) und zu realisieren, dass man liebt (eifersüchtig oder neidisch ist). Die Unterschiede zwischen menschlichen Emotionen und denen der Tiere sind nicht darauf zurückzuführen, dass unser Gehirn Dinge klassifiziert, sondern darauf, dass wir eine Sprache besitzen (ii) Wir haben bereits angemerkt, dass die von einem sprachunbegabten Tier gefühlten Emotionen viel beschränkter sind, was deren Erscheinungsformen und mögliche Objekte angeht, als die Emotionen eines menschlichen Wesens. Ich kann jetzt die Hoffnung auf ein Festessen am ersten Weihnachtsfeiertag hegen, mein Hund ist dazu nicht in der Lage; ich kann die Kriegsverwüstungen fürchten, mein Hund nicht; und während meinem Hund bange sein kann, nachdem er etwas getan hat, was er mit Bestrafung verbindet, kann er nicht bedauern oder bereuen. Diese Unterschiede zwischen menschlichen Emotionen und denen der Tiere bestehen nicht deshalb, weil unser Gehirn ‚die Welt sprachlich klassifiziert und Erfahrungen in Worten kategorisiert‘ (weil Gehirne das nicht tun können), sondern weil wir (nicht unsere Gehirne) eine Sprache beherrschen, und das hat unseren Denk- und Gefühlshorizont gleichermaßen erweitert. Weil Tiere keine Sprache beherrschen, können sie nicht über die charakteristischen menschlichen Emotionen verfügen (iii) Es ist irrig anzunehmen, dass ‚Angst, Ängstlichkeit, Schrecken, Bangigkeit und dergleichen sich nicht unterscheiden würden, gäbe es die Sprache nicht‘. Diese Gefühle hängen nicht von der Bemeisterung bzw. Beherrschung einer Sprache ab. Eine Katze kann verängstigt sein, wenn sie einen großen Hund wahrnimmt, auch wenn sie sich im Wipfel eines Baumes befindet und sicher ist; ein Hund kann Angst zeigen, wenn man ihm mit Strafe droht; und ein Hase, dem ein Fuchs nachsetzt, kann erschrecken. Es stimmt jedoch, dass viele menschliche Emotionen nichtmenschlichen Tieren verschlossen sind. Einzig ein Sprachverwender kann den Bankrott fürchten, Angst vor einer Inflation haben, sich vor Gespenstern ängstigen und ihm kann bange sein, was den Zustand des Landes angeht. Hierbei handelt es sich um Emotionen eines Typs, die nichtmenschliche Wesen haben können, die jedoch mit Objekten in Zusammenhang stehen, die jenseits ihres kognitiven Horizonts angesiedelt sind. Ebenso kann auch nur ein Sprachverwender seine Lügen und seine Heimtücke bereuen, Ehrfurcht vor dem Erhabenen oder Verachtung für die jämmerlichen Gestalten empfinden. In diesen Fällen haben wir es mit Emotionen zu tun, die nichtmenschlichen Tieren verschlossen sind.
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
281
Emotionen sind weder Gehirnzustände noch Körperreaktionen (iv) Man kann nicht sagen, dass Emotionen sich als ‚Gehirnzustände und Körperreaktionen‘ herausbildeten. Es sind vielmehr die Gehirne, die sich herausbildeten und deren Struktur es Lebewesen ermöglicht, auf Objekte ihres Interesses affektiv zu reagieren. Emotionen bildeten sich als die Reaktionen von Lebewesen auf wahrgenommene Umgebungsmerkmale heraus, die auf die eine oder die andere Weise ihr Wohl und Wehe beeinflussen. Weder Gehirnzustände (die für das Fühlen einer Emotion unverzichtbar sind) noch Körperreaktionen (die für eine emotionale Beeinträchtigung typisch sein können) sind Emotionen. Sie lassen die Intentionalität oder ‚Gerichtetheit auf ein Objekt‘ vermissen, die für die meisten Emotionen konstitutiv ist. Man kann eine Emotion nicht charakterisieren, indem man sie entweder als Gehirnzustand oder als Körperreaktion ausgibt und die Umstände ihres Erscheinens und das Wissen und den Glauben sowie das Verlangen und die Wünsche des Lebewesens unberücksichtigt lässt. Emotionen und Körperreaktionen (v) Emotionsausdrücke treffen überhaupt nicht auf Gehirnzustände zu, sondern auf Kreaturen, die Emotionen fühlen und diese in ihrem Verhalten zutage treten lassen. Emotionsausdrücke sind keine Namen von Körperreaktionen, die emotionale Beeinträchtigungen charakterisieren. Gehirnzustände sind nur in dem Sinn ‚die elementaren Tatsachen einer Emotion‘, in dem sie unentbehrliche Bedingungen dafür sind, dass das Lebewesen in der Lage ist, das zu fühlen, was es fühlt, so wie sie auch unverzichtbar dafür sind, dass das Lebewesen atmen oder sich bewegen, wahrnehmen und auf das, was es wahrnimmt, reagieren kann. Körperreaktionen sind in keinem Aufschluss gebenden Sinne ‚die elementaren Tatsachen einer Emotion‘. Meine Höhenangst kann sich darin zeigen, dass ich es vermeide, mich in irgendeiner Form in die Höhe zu begeben, jedoch nicht in dem, was ich empfinde, wenn ich irgendwo hinaufsteige – denn solche Aufstiege vermeide ich sorgfältig, weil ich Angst vor den Höhen und Abgründen habe (die irgendwann verschwinden kann). Wut auf die Ruritanische Volkspartei muss sich nicht darin zeigen, dass man rot anläuft und schreit (ein solches Verhalten ziemt sich nicht), sondern im Aufkündigen der eigenen Mitgliedschaft. Und die Ehrliebe eines fahrenden Ritters zeigte sich nicht in Form von Liebes-Beeinträchtigungen, sondern sie offenbarte sich in seinem Handlungsgrund, in den Strecken, die er zurückzulegen bereit war, um seine Ehre zu bewahren, in seiner Bewunderung für ehrenhafte Männer und deren Taten und in Form von Empörungs-Beeinträchtigungen im Hinblick auf das, bei dem es sich seiner Ansicht nach um unehrenhaftes Verhalten anderer handelte. Die Körperreaktionen der Angst vor physischem Schaden – beispielsweise eine erhöhte Pulsfrequenz, zunehmendes Transpirieren und Zittern – können sämtlich ohne die geringste Beteiligung irgendeiner Angst offenbar werden, was beispielsweise dann der Fall ist, wenn man vor Aufregung darüber ins Zittern gerät, dass man einen ‚angesagten Laden‘ betritt in Erwartung
282
7 Emotion
einer herrlichen Überraschung. Das, was diese Reaktionen zu Angstreaktionen macht, sind die Umstände, in denen sie an den Tag gelegt werden, und das Verlangen, die Überzeugungen und Gedanken des Akteurs. Bei den ‚elementaren Tatsachen einer Emotion‘ handelt es sich, was den Menschen betrifft, um sein Bewusstsein von einem zu den Umständen gehörenden Emotionsobjekt oder um seinen Glauben in Bezug auf dieses, um die Art seines Interesses für das Emotionsobjekt (warum es ihm etwas bedeutet) und die daraus resultierenden Handlungsgründe, die er haben mag, um die Motivation, die ihm durch seine einschlägige Beurteilung oder Bewertung zuwächst, um das Verhalten oder die Verhaltensdisposition, das/die auf die nämliche Weise mit dem Emotionsobjekt verknüpft ist und um die begleitenden Gedanken, Fantasien und Wünsche. Dass eine Kreatur Angst fühlt, wenn es eine Gefahr erkennt, oder Zorn, wenn es einen Übergriff auf sein Territorium bemerkt; dass ein menschliches Wesen hofft, ein Wunsch möge sich erfüllen, kindliche, eheliche oder elterliche Liebe fühlt, stolz auf die Bewältigung einer schwierigen und würdigen Aufgabe ist, eine Sünde bereut oder höchste Verlegenheit offenbart, ist nicht das ‚Sahnehäubchen auf der Emotionstorte‘, sondern das Tortenmehl. Genau in dem Sinnzusammenhang des Erkennens eines zugehörigen Emotionsobjekts, des Interesses für es, einer Verhaltensweise oder einer Neigung zu entsprechendem Verhalten diesem Objekt gegenüber (unter Berücksichtigung dessen, worauf der Akteur abzielt und was er glaubt), genau in diesem Sinnzusammenhang können die körperlichen Begleiterscheinungen, willkürlichen Handlungen und unwillkürlichen Reaktionen eines Akteurs als Erscheinungsformen dieser Emotion charakterisiert werden. LeDoux irrt sich in der Annahme, dass eine Kreatur eine Emotion haben kann, ohne sie zu fühlen (vi) Es ist ein Irrtum, zwischen eine Emotion haben und eine Emotion fühlen zu unterscheiden und davon auszugehen, dass Lebewesen, die bei Bewusstsein sind, Emotionen sowohl haben als auch fühlen können, wohingegen Lebewesen ohne Bewusstsein eine Emotion haben können – das heißt entsprechende Gehirnzustände und Körperreaktionen –, obgleich sie nicht in der Lage sind, Emotionen zu fühlen. Emotionen sind, wie dargelegt, keine Gehirnzustände oder Körperreaktionen. Es handelt sich bei ihnen weder um Wahrnehmungsobjekte noch um Empfindungen, die gefühlt werden. Sich verängstigt zu fühlen heißt ja gerade, verängstigt zu sein, ebenso wie sich zornig zu fühlen nichts anderes heißt, als zornig zu sein. Man kann nicht in einer bestimmten Situation ängstlich oder zornig sein und keine Angst oder keinen Zorn fühlen. Nimmt man an, dass es Lebewesen gibt, die Emotionen haben können, aber nicht bei Bewusstsein sind (in Abgrenzung zu Selbstbewusstsein; auf diese Differenz werden wir in Kapitel 12 zurückkommen), fügt man der ganzen Verwirrung nur noch eine weitere hinzu.
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
283
Damasio über Emotionen Eine ähnliche Verwirrung zeigt sich in den Schriften eines anderen herausragenden Neurowissenschaftlers. Antonio Damasios Forschung zu Patienten, die an einer in emotionaler Hinsicht handlungsunfähig machenden Schädigung des Gehirns leiden, genießt zu Recht hohes Ansehen, und seine beharrlich vorgebrachte Annahme, dass zwischen dem Vermögen zur rationalen Entscheidungsfindung und dem daraus resultierenden zielorientierten Handeln einerseits und der Fähigkeit, Emotionen zu fühlen, andererseits ein Zusammenhang bestehe, ist gewagt und fordert das Denken heraus. Aus unserer Sicht sind seine Mutmaßungen über die Emotionen jedoch von Begriffsverwirrungen in ihrer Qualität beeinträchtigt. James’ Einfluss auf Damasio Damasios Konzeption der Emotionen ist sehr von William James beeinflusst. Dieser vertrat die Auffassung, dass es sich bei Emotionen im Wesentlichen um Gefühle von körperlichen Beeinträchtigungen handelt, die der Wahrnehmung einer ‚erregenden Tatsache‘ nachfolgen. Eine Emotion ist laut James nicht die somatische Veränderung selbst, sondern ihre Wahrnehmung oder Erfassung durch den Akteur. Die Veränderungen seien „unendlich“ zahlreich und subtil, und der ganze Körper komme einem „Resonanzraum“ für solche Erregungen gleich. Jede dieser körperlichen Veränderungen wird angeblich gefühlt, sobald sie in Erscheinung tritt. Eliminiert man von einer Emotion „sämtliche Gefühle von ihren Körpersymptomen“, bleibt nichts als ein kalter und indifferenter Zustand verstandesmäßigen Wahrnehmens.310 Damasio behauptet, dass James, „seiner und unserer Zeit weit voraus, [. . .] den Mechanismus begriffen hat, der für das Verständnis der Emotionen und des Fühlens entscheidend ist“.311 Seiner Ansicht nach „liegt das Wesen der Emotion in zahlreichen Veränderungen der Körperzustände, die in einer Vielzahl von Funktionseinheiten durch die Nervenzellverbände hervorgerufen werden, und zwar unter der Kontrolle des zuständigen Gehirnsystems, das auf den ein bestimmtes Objekt oder Ereignis betreffenden Inhalt der Gedanken reagiert“.312 Die somatischen Veränderungen werden angeblich von den Gedanken verursacht. Damasios Konzeption der Gedanken ist in der empiristischen Tradition des 18. Jahrhunderts fest verwurzelt. Gedan310
William James, The Principles of Psychology (Molt, New York, 1890), Bd. II, S. 449–451. Für eine kurze kritische Erörterung der James’schen Verwirrungen siehe A. J. P. Kenny, Action, Emotion and the Will (Routledge and Kegan Paul, London, 1963), S. 39–41. 311 Antonio R. Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain (Papermac, London, 1996), S. 129 [dt. Descartes’ Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn (List, München, 1997), S. 181]. Er ist der Ansicht, dass nur Freud und Shakespeare es mit James und seinen Einblicken in den menschlichen Geist aufnehmen konnten. Dieses Lob hätte unserer Ansicht nach eher Williams Bruder Henry gelten sollen. 312 Ibid., S. 139 [dt. S. 192f.].
284
7 Emotion
ken, behauptet er, bestehen aus Vorstellungsbildern (die visuell oder auditiv etc. sein und sich aus Weltgegenständen oder aus Worten oder Symbolen, die solche Gegenstände benennen, zusammensetzen können).313 Die Gedanken konstituierenden Bilder lassen sich mit den Bildern vergleichen, aus denen die Wahrnehmung vorgeblich besteht, und unterscheiden sich von diesen darin, dass sie schwächer ausgeprägt oder weniger lebendig sind. In dieser Hinsicht folgt Damasio auf bewusste, aber verworrene Weise den Spuren David Humes.314 Damasio vertritt offenkundig die Ansicht, dass wir nicht in der Lage wären zu sagen, was wir denken, wenn uns das Denken nicht in Form von Bildern der Dinge und in Form von Bildern der Worte, die die Dinge benennen, verliehen wäre.315 Damasios Emotionskonzeption Anders als James (aber in Übereinstimmung mit LeDoux) unterscheidet Damasio eine Emotion – das heißt „eine Reihe von Veränderungen des Körperzustands, die mit bestimmten Vorstellungsbildern, die ein spezifisches Gehirnsystem aktiviert haben, verknüpft sind“ – vom Fühlen einer Emotion. „Das Fühlen einer Emotion ist im Wesentlichen die Erfahrung solcher Veränderungen in Juxtaposition zu den Vorstellungsbildern, die den Kreislauf in Gang gesetzt haben. Mit anderen Worten, ein Gefühl beruht auf der Juxtaposition eines Bildes vom Körper selbst zu einem Bild von etwas anderem, etwa dem visuellen Vorstellungsbild eines Gesichts oder dem akustischen Vorstellungsbild einer Melodie“.316 Demzufolge ist eine Emotion eine körperliche Reaktion auf ein Vorstellungsbild, und das Fühlen einer Emotion ist eine kognitive Reaktion auf diesen körperlichen Zu313
Ibid., S. 107f. [dt. S. 154]. Ibid., S. 108 [dt. S. 155]. Humes Darstellung findet sich in A Treatise of Human Nature, I. i. 1. 315 Er schreibt: ‚Die meisten Worte, die wir beim inneren Sprechen verwenden, bevor wir einen Satz sagen oder schreiben, existieren in unserem Bewusstsein als akustische oder visuelle Bilder. Würden sie nicht zu Vorstellungsbildern – und wenn auch nur flüchtig –, dann wären sie nichts, was wir wissen könnten‘ (Descartes’ Error, S. 106 [dt. S. 152]). Damasio sieht nicht, dass man nicht herausfinden könnte, was man denkt, indem man bloß seine Aufmerksamkeit auf Vorstellungsbilder richtet, die (welche auch immer) einem in den Sinn kommen, während man denkt. Ein Vorstellungsbild kann einen Gedanken gleichsam so illustrieren, wie ein Bild das für einen Text zu leisten vermag. Es ist allerdings der Gedanke, der aus dem Vorstellungsbild das Bild dessen macht, was es verbildlicht, ebenso wie es der Buchtext ist, der die Illustration zu einer Illustration der Geschichte macht. Ohne den Text könnte das Bild von Lancelot in voller Montur irgendeinen Rittersmann zeigen, könnte illustrieren, wie man im Sattel sitzt oder wie man nicht im Sattel sitzt, die Rüstung eines bestimmten Zeitabschnitts illustrieren oder die Art von Pferd darstellen, die Ritter in Rüstungen zu reiten pflegten und so weiter. Und das, was auf den Zusammenhang zwischen Bild und Text zutrifft, trifft auch auf den Zusammenhang zwischen Vorstellungsbild und Gedanken zu. 316 Ibid., S. 145 [dt. S. 201]. [Juxtaposition meint das Nebeneinander der Bilder, im Sinne von ‚Kombination‘ und ‚Vermischung‘, wie Damasio im Text erläutert. Was den Prozess angeht, ‚der sich bei der integrierten Erfahrung‘ in Verbindung mit diesen Bildern ‚zu vollziehen scheint‘, hält Damasio die Formulierung ‚Überlagerung‘ für angebracht. (ibid.) – A.d.Ü.] 314
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
285
stand, eine kognitive Reaktion „in Bezug auf das Objekt, das ihn angeregt hat – die Vergegenwärtigung der Verknüpfung eines Objekts mit einem emotionsbezogenen Körperzustand“.317 Das Gefühl von einer Emotion, betont Damasio, „ist genauso kognitiv wie jedes andere Wahrnehmungsbild und ebenso abhängig von zerebral-kortikaler Verarbeitung wie jedes andere Vorstellungsbild“. Allerdings beziehen sich Gefühle auf etwas anderes. Insofern, als sie sich zunächst und vor allem auf den Körper beziehen, ihn betreffen, als sie uns die Erkenntnis unseres viszeralen und muskuloskeletalen Zustands ermöglichen, während er sich unter der Einwirkung präorganisierter Vorgänge und der unter ihrem Einfluss entwickelten kognitiven Strukturen verändert. Mit Hilfe von Gefühlen vergeistigen wir den Körper [. . .]. Gefühle geben uns einen Einblick in das, was in unserem Fleisch vorgeht, als eine Momentaufnahme dieses Fleisches, während es sich in Juxtaposition zu den Vorstellungsbildern anderer Objekte und Situationen befindet; derart verändern Gefühle unsere Gesamtvorstellung von diesen anderen Objekten und Situationen. Kraft dieser Juxtaposition statten Körperbilder andere Vorstellungsbilder mit einer Qualität von Gutsein oder Schlechtsein, von Lust oder Unlust aus.318
Damasios Somatische-Marker-Hypothese In diesem Sinne bringt Damasio eine Hypothese vor, die er „die Somatische-MarkerHypothese“ nennt. Somatische Reaktionen auf ‚Bilder‘ (d. h. Wahrnehmungen und Gedanken) dienen der Hypothese zufolge dazu, die ‚Zielsicherheit‘ und Effizienz von Entscheidungsprozessen zu erhöhen, indem sie eine Reihe von Alternativen ausblenden und es dem Akteur erlauben, aus wenigen auszuwählen.319 „Wenn sich ein negativer somatischer Marker nah an einem bestimmten künftigen Ereignis befindet, wirkt diese Verbindung wie eine Alarmglocke. Befindet sich dagegen ein positiver somatischer Marker „in der Nähe“, wird er zu einem Startsignal.“320 Demnach sind die somatischen Marker, die von den somatischen Reaktionen auf Situationen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, hervorgebracht werden, den Erwägungen behilflich, indem sie einige Optionen kenntlich machen und eliminieren. Diese somatischen Reaktionen, die wir vorgeblich zur Entscheidungsfindung heranziehen, „sind wahrscheinlich [. . .] im Laufe unserer Erziehung und Sozialisation im Gehirn entstanden, indem wir bestimmte Klassen von Reizen mit bestimmten Klassen von somatischen Zuständen verknüpft haben“.321 Kulturell eingeschärfte ‚Reaktionen aus dem Bauch heraus‘ liefern die Grundlage für die rationale Entscheidungsfindung.322 Diese Einschätzung ließ Damasio ver317
Ibid., S. 132 [dt. S. 185]. Ibid., S. 159 [dt. S. 218f.]. 319 Ibid., S. 173 [dt. S. 238]. 320 Ibid., S. 174 [dt. S. 238]. 321 Ibid., S. 177 [dt. S. 243]. 322 Damasios Theorie folgt in erster Linie einem Reiz-Reaktions-Schema und operiert auf neuraler Ebene statt auf der des Verhaltens. Er schreibt: 318
286
7 Emotion
muten, dass die Entscheidungsfindungs- und Ausführungsschwierigkeiten von Patienten mit lädiertem präfrontalen Kortex damit zu erklären sind, dass die Geschädigten nicht über somatische Marker verfügen, die sie anleiten. Diese Konzeption ist unserer Meinung nach ein Ausdruck verworrener Begriffe. Damasios Verwirrungen: Eine Emotion ist keine von einem Gedanken ausgelöste somatische Veränderung. Vier Einwände (i) Eine Emotion ist kein Ensemble somatischer Veränderungen, das von einem ‚Gedanken‘ über (d. h. einem Vorstellungsbild von) ein(em) Objekt oder Ereignis herrührt. Erstens: Selbst wenn eine bestimmte emotionale Beeinträchtigung eine Reihe somatischer Veränderungen einbegreift, handelt es sich bei dem, was die Empfindungen zu Angst- im Unterschied zu Wutempfindungen macht und was das Erröten eher zu einem der Scham denn der Verlegenheit oder der Liebe macht, nicht um den ‚Gedanken‘ oder das Vorstellungsbild, wenn überhaupt, sondern um die Umstände und das Emotionsobjekt. Man könnte in der Tat argumentieren, dass das, was die Empfindungen mit den Umständen und dem Emotionsobjekt verbindet, darin besteht, dass jene nicht aufgekommen wären, wäre das Emotionsobjekt in anderer Weise aufgefasst worden, als es wurde – und vielleicht meinten das Damasio u. a. auch. Dennoch sind es weder die somatischen Veränderungen, die die Emotion konstituieren, noch die Wahrnehmung der Veränderungen. Zweitens: Selbst wenn es sich bei Emotionen wesentlich um von Gedanken (Vorstellungsbildern) hervorgerufene Ensembles somatischer Veränderungen handelte – das heißt, wenn der Ausdruck ‚Emotion‘ das bedeutet –, würde das implizieren, dass man die Bedeutung von Emotionsausdrücken lernt und mithin auch, wie man sie gebraucht, indem man die Namen komplexer körperlicher Veränderungen mit spezifischen Ursachen lernt (ähnlich dem Lernen der Bedeutung von Ausdrücken wie ‚Schwindel‘ oder ‚Seekrankheit‘). Allerdings lernen wir den Gebrauch von Emotionsausdrücken nicht, indem wir die Namen der Empfindungen oder des körperlichen Allgemeinbefindens lernen, sondern indem wir lernen, welche Objekte den einschlägigen Emotionen entsprechen – der Angst beispielsweise (was ist gefährlich oder bedrohlich), dem Zorn (was ist Somatische Marker werden also durch Erfahrung erworben. Dabei sind sie der Kontrolle eines internen Präferenzsystems unterworfen und dem Einfluss äußerer Umstände ausgesetzt, wozu nicht nur Objekte und Ereignisse gehören, mit denen der Organismus interagieren muss, sondern auch soziale Konventionen und ethische Regeln. Die neuronale Basis für das interne Präferenzsystem besteht größtenteils aus angeborenen regulatorischen Dispositionen, die dem Überleben des Organismus dienen. Die Sicherung des Überlebens deckt sich letztlich mit der Reduzierung unangenehmer Körperzustände und der Herstellung homöostatischer Zustände. Dem internen Präferenzsystem wohnt die Tendenz inne, Schmerzen zu vermeiden und potenzielle Lust zu suchen, und wahrscheinlich ist es von Natur aus dazu eingerichtet, diese Ziele in sozialen Situationen zu verfolgen‘ (Ibid., S. 179 [dt. S. 245]).
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
287
störend, beleidigend oder in gewisser Weise verkehrt), dem Stolz (Leistungen oder Besitztümer, die es wert sind, erbracht bzw. errungen zu werden), der Schuld (das eigene Fehlverhalten) etc. –, und indem wir lernen, wie man diese Worte (‚ängstlich‘, ‚zornig‘ etc.) beim Ausdrücken der eigenen Gefühle den nämlichen Objekten gegenüber verwendet und in den Beschreibungen der Gefühle (aber nicht der Empfindungen) anderer. Drittens: Wenn es sich bei Emotionen um von Vorstellungsbildern hervorgebrachte Ensembles somatischer Veränderungen handelte, dann könnte man keine guten Gründe für das Fühlen einer Emotion haben und wäre für seine Gefühle nicht in der Weise verantwortlich, wie wir es sind. Denn obgleich es möglicherweise einen Grund (d. h. eine Erklärung) dafür gibt, dass man Kopfschmerzen hat oder die eigene Atmungs- oder Herzschlagsfrequenz sich erhöht, kann man keinen Grund (d. h. keinen Beweggrund oder keine Berechtigung) dafür haben. Wenn die entsprechenden Bedingungen gegeben sind, können wir sagen, jemand sollte eigentlich stolz oder beschämt sein oder habe guten Grund dazu, aber wir können (es sei denn im rein prognostischen Sinne) nicht sagen, seine Pulsfrequenz sollte eigentlich ansteigen oder sein psychogalvanischer Reflex sollte sich eigentlich verändern. Viertens: Man kann eine Emotion E fühlen, ohne in einer für E typischen Weise beeinträchtigt zu sein. Man kann eine Person, ein Objekt (Ort, Sache, Kunstwerk) oder einen Wert lieben oder schätzen, ohne irgendwelche somatische Liebesveränderungen durchzumachen, wenn man über die Eltern, Ehefrau oder Kinder, die man liebt, nachdenkt oder über Venedig, die Kathedrale von Chartres oder Beethovens letzte Quartette, ganz zu schweigen von Freiheit, Gerechtigkeit oder Ehre. Der Gedanke, dass die Inflationsrate wahrscheinlich ansteigen wird, muss nicht mit somatischen Veränderungen einhergehen – trotzdem aber kann man durchaus Angst davor haben, dass es geschieht. Der eigene Puls muss nicht rasen, damit man hoffen kann, dass das für morgen anberaumte Picknick ein Erfolg wird. Wenn mir A in meiner Jugend einen großen Gefallen getan hat, kann ich ihm dafür mein Leben lang dankbar sein – aber ich muss nicht jedes Mal in Schweiß ausbrechen, wenn ich an A und den Gefallen, den er mir erwiesen hat, denke. Man kann für sein restliches Leben stolz darauf sein, einen Oxford Blue erworben zu haben, es gibt jedoch keine charakteristischen somatischen Veränderungen für den Stolz auf etwas – oder für viele Emotionsformen und viele andere mit bestimmten Objekten verknüpfte Emotionen. Indem wir auf diesen Feststellungen beharren, wollen wir selbstverständlich nicht bestreiten, dass es einen wesentlichen Zusammenhang gibt zwischen bestimmten Emotionen und Emotionen, die auf spezifische Objekte gerichtet sind, auf der einen Seite und Formen emotionaler Erregung, die zu somatischen Veränderungen führen, andererseits. Zumindest kann die emotionale Erregung für diese Emotion oder die mit dieser Art von Objekt verknüpfte Emotion charakteristisch sein, wenn die entsprechenden Bedingungen gegeben sind. Wir wollen also lediglich darauf beharren, dass die Emotion etwas anderes ist als die somatischen Veränderungen, die durch den Gedanken an das Objekt einer solchen Emotion verursacht werden könnten.
288
7 Emotion
Damasios Verwirrungen: Vorstellungsbilder müssen keine somatischen Veränderungen hervorrufen (ii) Wie wir bereits ausgeführt haben (4.2.3), ist es ein Irrtum anzunehmen, dass ein Objekt wahrzunehmen oder wahrzunehmen, dass es um die Dinge so und so steht, damit einhergeht, Bilder von irgendetwas zu haben. Ebenso irrig ist die Annahme, dass es, um etwas zu denken oder an etwas zu denken, entweder notwendig oder hinreichend ist, ein Bild von irgendetwas zu haben, ganz zu schweigen von einem Bild dessen, was man oder woran man denkt oder einem Bild von Worten, die, falls geäußert, ausdrücken würden, was man denkt oder sich auf das, woran man denkt, beziehen würden. Das sollte aus der schematischen Analyse des Denkens im letzten Kapitel deutlich geworden sein. Außerdem ist es irrig anzunehmen (wie wir in 12.5 darlegen werden), dass man in Bildern denkt oder dass man, um sich mit Überlegung zu äußern, zuerst sich selbst in seiner Vorstellung sagen muss, was man laut aussprechen wird. Man kann in seiner Vorstellung zu sich selbst reden (auditive Bilder spielen hier eine Rolle), ohne zu denken (was dann der Fall ist, wenn man in der Vorstellung Schafe zählt oder ein Mantra gebetsmühlenartig wiederholt, um sich selbst vom Denken abzuhalten), und man kann denken, ohne in seiner Vorstellung zu sich selbst zu reden (was dann der Fall ist, wenn man fürsorglich zu jemandem spricht, an eine Sache denkend und mit Konzentration herangeht etc.). Weil weder Denken noch Wahrnehmen mit Bildern zu tun haben müssen, müssen die somatischen Veränderungen, die zu einer bestimmten emotionalen Erregung gehören können und von einem Gedanken (in des Ausdrucks eigentlicher Bedeutung) oder einer Wahrnehmung von etwas verursacht werden können, nicht von Vorstellungsbildern verursacht werden. Damasio begeht einen Irrtum, indem er zwischen Fühlen und Eine-Emotion-Haben unterscheidet (iii) Obwohl es etwas anderes ist, eine Emotion zu fühlen (z. B. Eifersucht zu fühlen), als zu realisieren, um welche Emotion es sich handelt (z. B. dass es Eifersucht ist), gibt es, wie wir schon sagten, im Großen und Ganzen keinen signifikanten Unterschied zwischen dem Haben und dem Fühlen einer Emotion (eifersüchtig sein und Eifersucht fühlen), ebenso wie das Schmerzenhaben und das Schmerzenempfinden sich nicht unterscheiden. Da, wo es einen feinen Unterschied gibt, besteht der nicht zwischen dem Auftreten somatischer Veränderungen und der Erfassung solcher Veränderungen in Verbindung mit dem bildlichen Vorstellen. Nichts spricht für die von Damasio getroffene Unterscheidung zwischen der Emotion und dem Fühlen einer Emotion, weil es sich bei einer Emotion nicht um ein Ensemble von somatischen Veränderungen handelt und beim Fühlen einer Emotion nicht um die Erfahrung solcher Veränderungen in Juxtaposition zu den Vorstellungsbildern, die sie verursacht haben.
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
289
Eine Emotion ist keine kognitive Reaktion auf einen Körperzustand, der von Vorstellungsbildern verursacht wurde (iv) Es ist abwegig anzunehmen, dass eine Emotion fühlen eine kognitive Reaktion auf einen von Vorstellungsbildern verursachten Körperzustand ist. Wenn ich, aufgeschreckt von einem nächtlichen Geräusch, Angst bekomme, dass sich ein Dieb im Haus befindet, und mein Puls rast, handelt es sich bei meiner Angst (die ich fühle) nicht um eine Reaktion auf meinen extrem beschleunigten Puls. Das, wodurch ich Angst bekam, war das Geräusch (kein Bild eines Geräusches), das, wovor ich Angst hatte, war der Einbruch eines Diebes ins Haus (was der Fall gewesen sein kann oder nicht). Ich mag meinen rasenden Puls bemerken oder nicht – unabhängig davon, ob ich es tue, stellt meine Angst keine Reaktion auf das Pulsrasen dar. Emotionen beziehen sich nicht auf somatische Veränderungen, die mit ihnen einhergehen (v) Gefühle von Emotionen beziehen sich ganz und gar nicht auf den Körper. Das, worauf sie sich beziehen, ist das Objekt der Emotion, in dem einen oder anderen Sinn des Ausdrucks (siehe unten). Eine Person kann auf ihre Leistungen, ihre Abstammung, ihre Kinder, ihre Besitztümer etc. stolz sein – jedoch nicht auf irgendwelche somatische Veränderungen, die eintreten können, wenn sie an diese Dinge denkt. Eine Person kann in Bezug auf ihre Sünden oder Missetaten Schuld fühlen, nicht in Bezug auf irgendwelche körperliche Beeinträchtigungen, die sich einstellen können, aber nicht müssen, wenn sie über ihre Schuld nachdenkt. Eine Person kann unter Umständen auf das nervige Verhalten von jemand anderem wütend sein, auf ihre somatischen Reaktionen darauf jedoch (normalerweise) nicht. Eine emotionale Reaktion kommt unabhängig davon zustande, ob man die Ursache für die Emotion kennt (vi) Eine emotionale Reaktion muss nicht kognitiv mit der Ursache der Emotion oder der Ursache der somatischen Veränderungen, die mit einer emotionalen Beeinträchtigung einhergehen können, verbunden sein. Häufig kennen wir die Ursachen unserer emotionalen Gefühle nicht. Es mag sein, dass ich nicht weiß, was mich veranlasst hat, Maisy zu lieben, Ungerechtigkeit zu hassen, Angst vor dem Tod zu haben – was ich jedoch wissen/ kennen muss und was mit diesen Gefühlen ‚kognitiv verbunden‘ ist, das sind ihre Objekte. Wenn es sich bei der Verbindung eines Gefühls mit dem, worauf es sich bezieht – das heißt seine Objekte –, um eine Kausalverbindung handelte, dann wäre das Wissen um das, wovor man Angst hat, worauf man wütend oder stolz und wovon man beschämt ist, eine Hypothese, es sei denn, bei solchem Kausalwissen handelte es sich um nichtinduktives Wissen. Ich entdecke das Objekt meiner Gefühle jedoch nicht, indem ich die Ursachen der von mir (gegebenenfalls) gefühlten Beeinträchtigungen ausfindig mache.
290
7 Emotion
Emotionen zu haben heißt nicht, somatische Tatsachen zu entdecken, diese können einen allerdings von den eigenen Emotionen in Kenntnis setzen (vii) Wenn wir ‚Gefühlsemotionen‘ haben, wenn wir lieben oder hassen, Angst oder Hoffnung haben, stolz oder beschämt sind, finden wir nicht heraus, wie es um ‚unseren viszeralen und muskuloskeletalen Zustand‘ bestellt ist. Unsere Emotionen setzen uns sicher weder darüber in Kenntnis, in welchem Zustand sich unser Körper noch in welcher Verfassung sich die Welt um uns herum befindet. Allerdings können die emotionalen Beeinträchtigungen uns über unsere emotionalen Einstellungen in Kenntnis setzen. Eine plötzliche Eifersuchtsattacke kann darauf hindeuten, dass ich gerade dabei bin, mich in Maisy zu verlieben; ein verlegenes Erröten kann mir verdeutlichen, dass ich mich dafür schäme, gelogen zu haben; meine Kummertränen können mich erkennen lassen, wie sehr ich Daisy geliebt habe. Es ist keineswegs so, dass unsere Emotionen uns über den Zustand unseres Körpers in Kenntnis setzen, vielmehr setzt uns der Zustand unseres Körpers über unsere Emotionen in Kenntnis. Meine Trauer setzt mich nicht davon in Kenntnis, in welchem Zustand sich meine Tränendrüsen befinden, meine heißen Tränen können mich jedoch realisieren lassen, wie stark ich um den und den trauere. Meine Angst, die ich bei einer bestimmten Gelegenheit fühle, setzt mich nicht über den Zustand meines Herzens in Kenntnis, mein pochendes Herz kann mir aber offenbaren, wie groß meine Angst ist. Mein Schamgefühl setzt mich nicht davon in Kenntnis, in welchem Zustand sich meine Gesichtsarterien befinden, mein Erröten kann mir jedoch deutlich machen, dass ich beschämter bin, als ich für möglich gehalten hätte. Die Somatische-Marker-Hypothese geht in die Irre (viii) Damasios Somatische-Marker-Hypothese geht in die Irre. Emotionen sind keine somatischen Bilder, die einem mitteilen, was gut ist und was schlecht. Die Körperreaktionen sagen uns nicht ersatzweise, was wir tun sollen, und sie setzen uns nicht über das Gute und das Böse in Kenntnis. Wenn man sich über eine wahrgenommene Ungerechtigkeit empört, so besteht das, was einem sagt, dass das Objekt der Empörung böse ist, nicht darin, dass einen der Gedanke an die fragliche Handlung in Wallung bringt. Im Gegenteil, man empört sich über A’s Handlung, weil diese ungerecht ist, nicht weil man in Wallung gerät, wenn man davon hört. Und man erkennt, dass sie ungerecht ist, weil sie jemandes Rechte mit Füßen tritt, nicht weil man vor Zorn in Wallung gerät. Um eine Zornesaufwallung handelt es sich freilich bloß insofern, als man sich auf diese Weise empört. Und man wird sich nur in dem Maße empören, in dem man um den Schutz der Menschenrechte Sorge trägt (oder der Rechte dieses Menschen).
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
291
Es ist die Fähigkeit, für etwas Sorge zu tragen, die die Emotionen mit der auf Ziele ausgerichteten Rationalität verbindet Obwohl Damasio möglicherweise vollkommen zu Recht das mit dem praktischen Denken verknüpfte und auf Ziele orientierte Rationalitätsvermögen mit der Fähigkeit, Emotionen zu fühlen, verbunden hat, könnte man vermuten, dass diese Verbindung durch ein Merkmal gestiftet wird, das beiden zugrunde liegt. Weil uns die Emotionen nicht ‚den Körper vergeistigen‘ lassen und weil das Fühlen somatischer Reaktionen auf die Umstände kein Lackmustest auf gut und böse oder auf das Vorteilhafte und das Nachteilige ist, überzeugt die Annahme nicht, dass die Probleme der Patienten, die eine Schädigung im ventromedialen Bereich des präfrontalen Kortex erlitten haben, daher rühren, dass ihre somatischen Reaktionen für sie selbst nicht nachzuvollziehen sind und sie von nichts in Kenntnis setzen (hierbei hätten wir es gewissermaßen mit einer Pawlow’schen Unzulänglichkeit zu tun). Man könnte sich allerdings der Frage widmen, ob die Gehirnschädigung bei den von Damasio studierten Patienten die Fähigkeit beeinträchtigt, um etwas Sorge zu tragen oder sich beständig um Ziele und Zwecke zu kümmern. Ein derartiges Defizit würde nämlich sowohl die Emotionen der Patienten betreffen als auch ihre Fähigkeit, zielgerichtet in die Zukunft zu agieren. Man hat keine Emotionen in Bezug auf etwas, dem man gleichgültig gegenübersteht, und man verfolgt Ziele nicht effektiv, wenn man nicht aus diesem oder jenem Grund Sorge dafür trägt, sie zu erreichen. Die neurowissenschaftliche Forschung kommt also nicht umhin, sich über den Emotionsbegriff Klarheit zu verschaffen (was ebenso für die verwandten Begriffe der Stimmung und der Erregung gilt). Ist man sich über die Begriffe nicht im Klaren, so wird das aller Wahrscheinlichkeit nach zur Folge haben, dass die Experimente Kohärenz vermissen lassen und die Interpretation ihrer Resultate Verwirrung stiftet. Wir werden über die Zusammenhänge Aufschluss geben, indem wir verschiedene bereits angerissene Themen erörtern: den beziehungsreichen Begriff von einem Emotionsobjekt und die Unterscheidung zwischen Objekt und Ursache; die Verknüpfung von Emotion und Wissen, Glauben, Bewertung und Interesse oder Sorge; die somatischen Begleiterscheinungen und der Verhaltensausdruck einer Emotion; und die Verbindung zwischen Emotion und motivierter Handlung.
7.2.2 Analyse der Emotionen Unterschiedliche Sinnhinsichten von ‚Objekt‘ einer Emotion Der Begriff des Objekts einer Emotion ist erklärungsbedürftig. Denn man muss in diesem Zusammenhang zwischen verschiedenen Sinnhinsichten von ‚Objekt‘ unterscheiden. Wenn man fragt, welches Objekt jemandes Liebe, Hass oder Zorn habe, könnte man den Menschen oder den Gegenstand, den man liebt, vor dem man Angst hat oder
292
7 Emotion
auf den man zornig ist, anführen. Man würde dann darauf verweisen, dass der Lehrer selbst, und nicht sein Zorn, das Objekt der Angst ist; dass der Lotteriegewinner das Objekt des Neides ist und nicht sein Gewinn; dass der Wohltäter und nicht die Wohltat das Objekt der Dankbarkeit ist; und dass Jack, mit dem Jill flirtet, das Objekt der Eifersucht ist und nicht ihr Flirt mit ihm. Das ist eine sinnvolle Verwendungsweise des Ausdrucks ‚Objekt einer Emotion‘ (auf das man sich als Akkusativobjekt eines Emotionsverbs beziehen kann). In diesem Sinn ist das Objekt unserer Emotion das, worauf sich ein sich auf etwas beziehender Ausdruck bezieht. Wenn man eine Emotion E hat, die sich so auf ein bestimmtes Objekt bezieht, dann kann es durchaus sein, dass das Objekt nicht existiert, auf jeden Fall aber muss der Akteur glauben, dass es existiert. In diesem Sinn von ‚Objekt‘ muss nicht jede Emotion ein Objekt haben und können manche Emotionen kein Objekt haben (z. B. Hoffnung). Ebenso kann man vor einer Katastrophe Angst haben, auf einen Sieg hoffen, Stolz, Scham oder Reue für etwas fühlen, das man getan hat, oder aufgebracht oder empört darüber sein, dass A unfair agiert hat, neidisch auf B’s Erfolg sein. In dem Glauben, etwas Ungehöriges getan zu haben, kann man sich schuldig fühlen, bedauern oder bereuen, selbst dann, wenn das, was man glaubt, nicht zutrifft, so wie Othello auf Desdemonas Liebe zu Cassio eifersüchtig sein kann, obgleich sie diesen nicht liebt. In diesem Sinn von ‚Objekt der Emotion‘ wird das Objekt durch eine Akkusativnominalisierung kenntlich gemacht – das heißt durch ein abstraktes Nomen (z. B. ‚Katastrophe‘, ‚Sieg‘, ‚Desdemonas Liebe‘) oder einen Nomen-Satz (z. B. in der Form von ‚dass dies und jenes der Fall ist, war oder sein wird‘), und aus der Tatsache, dass man zu siegen hofft oder Angst hat, bezwungen zu werden, folgt nicht, dass man siegen oder bezwungen werden wird.323 Worum es sich beim Formalcharakter des Objekts einer Emotion handelt Viele Emotionen werden teilweise anhand des Formalcharakters ihrer Objekte definiert. Man kann ein Tun nicht bereuen, wenn man weiß, dass es sich bei ihm nicht um ein Fehlverhalten handelt, denn Reue ist wesentlich auf die eigenen Verstöße in der Vergangenheit gerichtet. Man kann nicht auf etwas hoffen, von dem man weiß, dass es bereits geschehen ist oder nicht geschehen kann, denn Hoffnung ist wesentlich auf eine herbei323
Eine ganze Reihe weiterer grammatischer Konstruktionen ist hier noch unberücksichtigt geblieben. Man kann Tennis lieben, Krieg hassen, Angst vor dem Sterben haben, und es versteht sich nicht von selbst, dass diese Beispiele in die Form eines dass-Satzes gebracht werden können. Tennis zu lieben heißt nicht, dass man es liebt, selbst zu spielen (man sollte sich vor schlechter Grammatik in Acht nehmen), den Krieg zu hassen ist nicht identisch mit hassen dass irgendetwas, und Angst vor dem Sterben zu haben ist etwas anderes als die Angst davor, dass man sterben wird. Diese Schwierigkeiten müssen beseitigt werden, sie bestätigen allerdings nur unsere Position: Dass nämlich der Ausdruck ‚Objekt einer Emotion‘ die logische Verschiedenartigkeit dessen verbirgt, was in den Antworten auf die Frage ‚Was (oder wen) E-en [lieben, hassen etc.] Sie?‘ oder ‚Worauf sind Sie E [neidisch, stolz etc.]?‘ angeführt werden kann.
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
293
gesehnte Möglichkeit gerichtet, deren Zustandekommen nicht gesichert ist. Über das, was man selbst getan hat oder getan zu haben glaubt, kann man nicht empört oder verstimmt sein, sondern darüber kann man nur Scham, Bedauern oder Reue fühlen/empfinden, denn Empörung und Verstimmung sind wesentlich auf die tatsächlichen oder mutmaßlichen Missetaten anderer gerichtet. Vor etwas Angst zu haben heißt, das Angstobjekt als gefährlich oder als eine Bedrohung aufzufassen und sich entsprechend verängstigt zu fühlen. Man kann jemand anderen nur beneiden, wenn man sich den oder die Betreffende vorstellt, wie er oder sie im Besitz von etwas ist, das man selbst gern besäße. Demnach muss eine Person dann, wenn sie eine bestimmte Emotion bezogen auf ein bestimmtes Objekt hat, hinsichtlich zahlreicher Emotionen annehmen, dass das Objekt ihrer Emotion die einschlägigen Formalbedingungen erfüllt, sollte es tatsächlich der Fall sein, dass sie die fragliche Emotion hat. Die Verbindung zwischen Emotion und Bewertung Widmet man sich dem Begriff des Formalobjekts einer Emotion, wird deutlich, dass Emotionen für gewöhnlich mit einer Bewertung oder Einschätzung einhergehen. Eine Emotion schließt eine Einschätzung von Menschen, Dingen und Ereignissen im Verhältnis zu jemandes Interessen ein (und seine Interessen können weit über ihr persönliches Wohl und Wehe hinausgehen). Bei Stolz, Scham, Empörung, Schuld- und Erniedrigungsgefühlen handelt es sich offensichtlich um Emotionen der Selbsteinschätzung. Mit Emotionen ist jedoch im Allgemeinen ein Bewertungselement verknüpft: Angst schließt die Bewertung einer Situation als bedrohlich oder gefährlich ein; Hoffnung geht mit der Einschätzung einer Situation als erstrebenswert einher; Zorn impliziert die Bewertung einer Handlung, eines Ereignisses oder Akteurs als (in dieser oder jener Weise) unrecht; Neid ist verbunden damit, dass man die Verhältnisse von jemand anderem als begehrenswert für einen selbst einschätzt und so weiter. Nur das, wofür man Sorge trägt (in positiver oder negativer Hinsicht), kann ein Objekt der eigenen Emotionen sein Das Objekt der eigenen Emotion (in dem einen oder dem anderen Sinn) ist etwas, das für einen selbst von Belang ist. Bei dem, was man liebt oder hasst, fürchtet oder erhofft, auf das man stolz ist oder für das man sich schämt, handelt es sich um etwas oder jemanden, das/der einem in irgendeiner Weise etwas bedeutet (in positiver oder negativer Hinsicht). Man steht Menschen und Dingen, die man liebt, alles andere als gleichgültig gegenüber. Die Dinge, von denen man weiß oder glaubt, dass sie auf die eigenen Interessen und Belange Einfluss haben, können zu Hoffnungs- oder Angstobjekten werden. Worauf man stolz ist oder wofür man sich schämt, von dem nimmt man (grob gesagt) an, dass dessen Besitz oder Ausübung den eigenen Wert steigert oder schmälert – und darauf achten wir normalerweise sehr. Was einem vollkommen gleichgültig ist, kann ebenso wenig zum
294
7 Emotion
Objekt von Zorn, Bedauern oder Empörung werden, wie man Reue oder Schuld für ein Tun fühlen kann, das einem nichts ausmacht bzw. nicht wichtig ist. Man würde sich nicht veranlasst sehen, aus Mitleid oder Mitgefühl zu handeln, wenn man nicht um das Objekt seiner Gefühle Sorge trüge, und man fühlte sich nicht gezwungen, aus Stolz oder Scham zu handeln, wenn man sich nicht um sein Ansehen oder das von anderen sorgte. Wenn einem etwas nichts mehr bedeutet, fühlt man in Bezug auf es nichts mehr. Die Emotionen sind die verschiedenen Formen, die das Sorge tragende Interesse annehmen kann. Indem wir unsere Emotionen ausdrücken, offenbaren wir, wem oder was unser Sorge tragendes Interesse gilt. Unsere Emotionsobjekte und die Intensität unserer auf sie bezogenen Gefühle lassen erkennen, wer wir sind – Emotionen und Charakterzüge stehen daher in einer nichtkontingenten Beziehung zueinander. Die Verbindung zwischen Emotion und Wissen oder Glauben Emotionen sind auf komplexe Weise mit dem verbunden, was der Akteur weiß oder glaubt. Denn insofern, als eine Emotion ein passendes Objekt haben muss, um als die Emotion kenntlich zu werden, die sie ist, muss der Akteur annehmen, dass das Objekt seiner Emotion die formalen Charakteristika erfüllt, die es zu einem angemessenen Objekt machen. Wenn er vor A oder A’s Handlung Angst hat, muss er wissen oder glauben, dass A oder A’s Handlung eine Bedrohung darstellt. Wenn jemand Mitleid oder Mitgefühl für einen anderen hat, muss er wissen oder glauben, dass dieser andere ein Unglück erlitten hat. Wenn eine Person Bedauerns-, Reue- oder Schuldgefühle hat, muss sie wissen oder glauben, dass sie etwas Bedauernswertes, Unrechtes oder Ungehöriges getan hat; und wenn sie jemanden beneidet, muss sie wissen oder glauben, dass dieser in gewisser Hinsicht besser gestellt ist als sie selbst. Außerdem muss der Akteur bei vielen Emotionen eine Reihe weiterer Dinge glauben, die das Objekt seiner Emotion (in dem einen oder dem anderen Sinn) betreffen und die es aus seiner Sicht rechtfertigen, dem Objekt die entsprechenden formalen Charakteristika zuzuerkennen. Denn die formalen Charakteristika werden von allen Objekten einer bestimmten Emotion geteilt; egal was A bedauert, es handelt sich um etwas, das er lieber nicht getan hätte oder das er hätte tun müssen, allerdings werden die Gründe, die eine Tat V bedauernswert machen, normalerweise sehr von denen abweichen, aus denen eine Tat X zu bedauern ist. Das, wovor eine Person Angst hat, ist etwas, von dem sie glaubt, es bedrohe ihre Interessen, allerdings sind ihre Befürchtungen, die das morgige Examen betreffen (zu wissen nämlich, dass sie schlecht vorbereitet ist und scheitern kann), mit ganz anderen Gründen bzw. Bedrohungsszenarien verbunden als ihre Höhenangst (zu glauben nämlich, dass sie in die Tiefe stürzen und sich schwer verletzen kann). Insoweit ihre Gründe zwingend sind, können sie auch eine Rechtfertigung für ihre Emotion liefern.324 324
Oder auch nicht: Man könnte argumentieren, dass z. B. Neid, Eifersucht und Hass von den einschlägigen Gründen her verständlich werden, dass sie jedoch nicht zu rechtfertigen sind.
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
295
Aus dieser kognitiven Komponente der Emotionen ergeben sich wichtige Folgerungen. Erstens ist ausgeschlossen, dass eine Person eine Emotion hat und nicht weiß, welches Objekt diese Emotion hat. Sie kann nicht dankbar sein und dennoch weder wissen, wem sie dankbar ist, noch, wofür; sie kann nicht beschämt sein und dennoch nicht wissen, weswegen sie beschämt ist; sie kann nicht bedauern und dennoch weder wissen, wen noch was. In Grenzfällen kann man objektlos Furcht fühlen (d. h. Angst [im Original deutsch]), eine irrationale Schuld fühlen, ohne zu wissen warum, oder sich nach etwas sehnen, ohne dass es etwas Bestimmtes gäbe, nach dem man Sehnsucht hat; hierbei haben wir es notwendigerweise jedoch mit Ausnahmen von der Regel zu tun. Der Verbindung zwischen Emotionen mit Gründen, Rechtfertigung und Angemessenheit Zweitens kann es trotz der Tatsache, dass die Emotionen zur Kategorie der Leidenschaften gehören – das heißt, sie sind keine Handlungen oder etwas, das man durchführt bzw. tut –, Gründe dafür geben, dass man fühlt, wie man fühlt, und es gibt sie für gewöhnlich auch. Wenn man vor A Angst hat, dann deshalb, weil man weiß oder glaubt, dass A eine Bedrohung für etwas ist, das einem am Herzen liegt. Normalerweise wird man Gründe dafür haben zu denken, dass sich dies so und so verhält, Gründe, die man anführen kann, um zu erklären oder zu rechtfertigen, warum man Angst hat. Wenn man über A’s Verhalten empört ist, dann deshalb, weil man glaubt, dass es eigene Interessen auf unfaire Weise verletzt hat, und normalerweise hat man Gründe dafür, etwas Derartiges zu glauben. Daher können unsere Emotionen angemessen oder unangemessen, gerechtfertigt oder ungerechtfertigt sein, von unseren Gründen abhängen und von der Emotion (ihrer Intensität und ihren Objekten), für die sie die Gründe darstellen. Trotz des Umstands, dass man eine Emotion nicht willentlich herbeiführen kann, ergibt es Sinn, von jemandem zu sagen, dass er Stolz oder Scham über sein Tun fühlen/empfinden sollte oder dass er über A nicht empört sein sollte, weil A gar nicht anders konnte, als so zu handeln. Wenn die emotionale Reaktion einer Person auf einen Umstand nicht gerechtfertigt oder angemessen ist, weder grundsätzlich noch in dem Maße, in dem sie glaubt, sie sei es, kritisieren wir sie für die Unangemessenheit ihrer emotionalen Erwiderung. Wir können sagen, es sei unangemessen, auf etwas so Unbedeutendes wie das mit Eifersucht zu reagieren; oder wir können A, während wir einräumen, dass das Verhalten seines Partners durchaus ein Eifersuchtsgrund ist, für die Intensität seiner Eifersuchtsattacke kritisieren – das heißt für seine exzessive Reaktion.325 Eine Person kann eine Emotion haben, weil sie einem Irrglauben unterlag. Auf einen solchen aufmerksam zu werden führt im Normalfall zum Verschwinden der Emotion. Wenn man herausfindet, dass das, was man glaubt und was der Eifersucht zugrunde liegt, nicht zutrifft, ist man normalerweise nicht länger eifersüchtig. Wenn der Angstgrund verschwindet, verschwindet die Angst normalerweise mit 325
Natürlich können wir eine Person auch dafür kritisieren, dass sie ihre Emotion so exzessiv zur Schau stellt, dass es ihr nicht gelang, ihr Verhalten in angemessener Weise zu kontrollieren.
296
7 Emotion
ihr. Umgekehrt können die so und so seienden Dinge einen Grund dafür abgeben, dass man eine bestimmte Emotion fühlt – und diejenigen, die herausfinden oder glauben, dass es um die Dinge so und so steht, und das wichtig nehmen, werden normalerweise so fühlen. Sie haben einen Grund dafür, so zu fühlen. Ob Emotionen begründet sind, hängt davon ab, inwiefern solche Formen der Sensibilität für Gründe zum Tragen kommen, und auch die Verantwortlichkeit einer Person für ihre Emotionen wird von daher beurteilt. Unsere Emotionen sind begründet, sofern sie auf ein Objekt gerichtet sind, das ihnen entspricht, und sofern die Intensität der Emotion in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Objekt steht.326 Die Tatsachen zu kennen, die einen Grund für diese oder jene Emotion konstituieren, heißt selbstverständlich nicht, dass sich irgendeine solche Emotion notwendig einstellt. Wenn man nicht gebührlich auf die tragischen oder freudigen Umstände reagiert, offenbart man jedoch ein Sensibilitätsdefizit und lässt erkennen, dass man nicht in der Lage ist, emotional angemessen auf die Situation zu reagieren – was wiederum deutlich macht, dass man für das, wofür man der allgemeinen Ansicht nach Sorge tragen sollte, keine Sorge trägt. Emotionen trüben tendenziell das Urteil Wie die Erregungen schließen auch manche beeinträchtigende Emotionen ein höheres Aktivierungslevel [arousal] ein – zum Beispiel Angst, Wut, Empörung. Nicht alle Arousalformen tendieren dahin, die rationale Urteils- und Handlungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Erregungen wie das Vergnügen oder die Überraschung tun dies normalerweise nicht, und Interesse, erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentration bewirken normalerweise das Gegenteil. Für gewöhnlich trüben solche Formen erhöhter emotionaler Beeinträchtigung jedoch das Urteil und führen irrationale und unvernünftige Handlungen herbei. So ist man beispielsweise schlecht beraten, ernste Entscheidungen dann zu treffen, wenn man von etwas anderem in Anspruch genommen ist, und die Beherrschung der eigenen Angst ist eine Voraussetzung dafür, in gefahrvollen Zeiten rationale Entscheidungen zu treffen, denn man ist nicht in der Lage, klar zu denken, wenn man panisch ist. Es ist aber ebenso offenkundig, dass die fortdauernden emotionalen Einstellungen die Urteilskraft beeinträchtigen können – nicht durch urteilstrübende ‚Verstörungen‘, sondern durch urteilsentstellende Verzerrungen. Überfürsorgliche Eltern beurteilen ihre Kinder 326
Bei Phobien haben wir es mit pathologischen Fällen zu tun. Es handelt sich bei ihnen um Ängste, die fortbestehen, obwohl klar ist, dass sie jeder Grundlage entbehren. In diesem Sinn sind sie vernünftigen Erwägungen nicht zugänglich. Die Höhenangst verringert sich nicht dadurch, dass man weiß, dass keine Gefahr besteht abzustürzen, und eine Spinnenphobie schwindet nicht aufgrund der Information, dass die gesichtete Spinne harmlos ist. Andere Emotionen wie der Hass (z. B. im Falle eines Rassenvorurteils) können gleichermaßen pathologisch sein. Das Pathologische tritt hier jedoch insofern anders in Erscheinung, als nicht die Emotion ungeachtet des Verschwindens der mit ihr einhergehenden Überzeugungen andauert, sondern diese selbst, trotzdem sie widerlegt sind.
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
297
im Allgemeinen falsch; man sagt, eine verliebte Person sei so geeignet, sich einen Ehepartner zu erwählen, wie es ein Blinder ist, sich ein Bild auszusuchen; und der eifersüchtige Ehegatte verliert jeden Sinn für die Fakten. Es ist demnach kein Zufall, dass, wie Aristoteles betonte, die Beherrschung der Leidenschaften eine Voraussetzung für ein tugendhaftes Leben ist und dass eine exzessiv und unkontrolliert wuchernde Sensibilität den gesunden Menschenverstand in Mitleidenschaft zieht ( Jane Austen). Die Verbindung zwischen Emotionen und Bewertungen Drittens begreifen menschliche Emotionen charakteristischerweise moralische und ideologische Überzeugungen und Bewertungen ein, wie sich aus dem letzten Punkt ergibt. Unsere Emotionen werden im Normalfall durch das Gerechte oder Ungerechte, Faire oder Unfaire, Gütige oder Grausame erregt; durch das, was man in Anbetracht des eigenen Sozialstatus oder der Stellung der anderen für einen selbst oder im Hinblick auf andere für angebracht hält. Im Allgemeinen bestimmen die Werte der Gesellschaft oder der sozialen Gruppe, welche Objekte ‚zulässige‘ Objekte von Stolz und Scham, Schuld und Reue sind, was ebenso auf zahlreiche Spielarten der Liebe und des Hasses zutrifft. Viele menschliche Emotionen rühren von moralischen, sozialen, politischen und religiösen Überzeugungen und Verpflichtungen her. Diese wiederum können vertretbar sein oder nicht, und insoweit sie das sind, sind auch die entsprechenden Emotionen angemessen. Nochmals zu Objekt und Ursache einer Emotion Wie wir gesehen haben, sollte man das Objekt einer Emotion nicht mit ihrer Ursache verwechseln. Das, aufgrund dessen man Angst hat, ist die Ursache der Angst, das, wovor man Angst hat, ist ihr Objekt. Beide können in bestimmten Fällen übereinstimmen, und sie stimmen überein, wenn man aufgrund von Blitz und Donner verängstigt ist und es sich bei diesen auch um das Wovor der Angst handelt, in anderen Fällen sind sie jedoch zu unterscheiden. Denn wenn das Objekt der Angst, Hoffnung oder Erregung in der Zukunft angesiedelt ist (und eintreten kann oder nicht) oder wenn es nicht existiert (wie beispielsweise, wenn man Angst vor Gespenstern oder vor dem Teufel hat), kann es sich bei dem, wovor man Angst hat, worauf man hofft oder worüber man erregt ist, nicht um die Ursache der Emotion handeln. Das, was eine Emotion verursacht, kann dem entsprechen, was sie auslöst, das mag ein plötzlicher Gedanke, eine beiläufige Bemerkung oder eine Erinnerung sein. Es kann allerdings ebenso mit den natürlichen Dispositionen der Person zusammenhängen. Denn wenn A Angst davor hat, dass sich das und das ereignet, und B sich Hoffnungen macht, dass alles sich zum Guten hin entwickelt, kann A’s Angst mit seiner pessimistischen Natur erklärt werden, B’s Gelassenheit hingegen mit seinem sanguinischen Temperament. Man kann eine Emotion haben, ohne die Ursache dafür zu kennen, dass man sie hat (wie im Falle des vergessenen oder verdrängten Kindheits-
298
7 Emotion
traumas). Es ist allerdings ausgeschlossen, eine Emotion zu haben und ihr Objekt nicht zu kennen, außer in den abweichenden Fällen der objektlosen Emotionen. Wenn wir von einer Person sagen, dass sie eine bestimmte Emotion hatte, weil dies und jenes, kann es also durchaus unklar sein, ob die durch den weil-Satz bereitgestellte Erklärung das Objekt der Emotion oder ihre Ursache zum Ausdruck bringt. Das lässt sich herausfinden, indem man die Frage aufwirft, ob es eine notwendige Bedingung für die Wahrheit der Äußerung ist, dass die Person wissen oder glauben müsste, dass dies und jenes. Wenn es keine notwendige Bedingung ist, dann handelte es sich bei dem Vorgebrachten um die Emotionsursache. Wenn es eine ist, dann wurde das Emotionsobjekt angeführt. Zwei Arten somatischer Begleiterscheinungen einer Emotion; drei Arten verhaltensbezogener Ausdrucksmöglichkeiten einer Emotion Die somatischen Begleiterscheinungen einer emotionalen Erregung können in zwei Kategorien unterteilt werden; in die subjektiven Empfindungen und die objektiven physiologischen Charakteristika. Bei den subjektiven somatischen Begleiterscheinungen handelt es sich um die Empfindungen, die für eine bestimmte emotionale Beeinträchtigung gemeinhin typisch sind – zum Beispiel die Empfindung des Pulshämmerns, des Herzklopfens, Spannungsempfindungen, die ‚Schmetterlinge im Bauch‘ oder ‚die trockene Kehle‘, die für Angst, Hoffnung und Aufgeregtheit gleichermaßen charakteristisch ist. Bei den objektiven somatischen Begleiterscheinungen haben wir es mit den physiologischen Veränderungen zu tun, die für die emotionale Beeinträchtigung im Normalfall charakteristisch sind: die neurale Erregung im Gehirn, viszerale Aktivitäten und Drüsenabsonderungen, der psychogalvanische Reflex etc. Die Verhaltensausdrücke einer Emotion können unterschieden werden in unwillkürliche Verhaltensformen, die keine Handlungen sind (Erröten, Schwitzen); in Verhaltensformen, die Handlungen sind, und zwar willkürliche, unwillkürliche und teilweise willkürliche327 (lächeln, finster dreinblicken, Grimassen schneiden, schreien, ächzen, stöhnen, bestimmte Körperhaltungen einnehmen, expressive Gesten vollziehen und solche Handlungen wie vor Freude oder Schreck aufspringen, sich verwirrt den Kopf kratzen oder die Faust in die Luft strecken als die Jubelpose beim Sport); und in die Verhaltensformen, die Handlungsweisen sind (Tonfall, Gestik). Das expressive Verhalten ist sogar als willkürliches charakteristischerweise nichtinstrumentelles Verhalten. Manche seiner Formen können mit einem Zweck verknüpft sein, insoweit sie das jedoch sind, haben sie ihre authentische Expressivität eingebüßt.
327
Eine Handlung ist unwillkürlich, wenn sie nicht mittels des Willens ausgeführt wird, jedoch so geartet ist, dass sie willentlich ausgeführt werden kann (unwillkürliches Lächeln im Gegensatz zu willkürlichem). Eine Handlung ist teilweise willkürlich, wenn sie nicht mittels des Willens angestoßen, aber willentlich unterdrückt werden kann (weinen). Diese Darlegung wird in Kapitel 8 fortgeführt.
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
299
Emotionen sind, anders als Damasio behauptet, im Allgemeinen wahrnehmbar Im Gegensatz zu dem, was Damasio behauptet, muss also an den Emotionen der anderen nichts ‚verborgen‘ sein. Es ist irrig zu sagen, dass ‚man bei jemand anders kein Gefühl beobachten kann‘.328 Ebenso irrig ist es, davon auszugehen, dass man ‚bei sich selbst ein Gefühl beobachten kann‘. Wir neigen dazu, die Tatsache, dass wir unsere Gefühle häufig nicht zeigen und uns mitunter sogar Mühe geben, sie zu kaschieren, mit der abwegigen Vorstellung durcheinanderzubringen, dass die Emotionen in irgendeinem tieferen Sinn ‚privat‘ und ‚verborgen‘ sind. Das stimmt aber nicht. Häufig können wir einer Person Freude und Wut vom Gesicht ablesen, Qual oder Schrecken in ihren Augen erkennen, Zufriedenheit oder Vergnügen in ihrem Lächeln sehen. Ihrer Stimme können wir Liebe und Zärtlichkeit, Trauer und Gram, Zorn und Zufriedenheit ablauschen. Wir können die Freuden- oder Gramestränen beobachten, die Schreckens- und Freudenschreie oder die Ausrufe des Erstaunens und das Erröten vor Empörung oder Scham. Eine Emotion zu haben – stolz oder beschämt zu sein beispielsweise – heißt andererseits nicht, irgendetwas zu beobachten. Somatische Begleiterscheinungen einer Emotion reichen nicht hin, um die Emotion zu identifizieren oder ihre Zuschreibung zu rechtfertigen Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass weder die subjektiven noch die objektiven Begleiterscheinungen einer Emotion an sich hinreichende Bedingungen für die Identifizierung und Zuschreibung einer bestimmten Emotion sind. Denn bei einem körperlichen Zustand, der subjektiv in Form von Empfindungen erlebt bzw. objektiv mittels physiologischer Termini bestimmt wird, handelt es sich nicht um eine Emotion. Er gehört nur dann zum Ereignissyndrom einer emotionalen Beeinträchtigung, wenn die entsprechenden Umstände vorliegen und der Akteur die entsprechenden Dinge weiß, glaubt und für sie Sorge trägt. Ähnliches trifft auf die Verhaltensreaktionen und -handlungen zu: In ihnen manifestiert sich nur dann eine Emotion, wenn der entsprechende subjektive Manifestationszusammenhang gegeben ist. Meine Hände können vor Müdigkeit zittern, ich kann schwitzen, weil es heiß ist, und ich kann eine trockene Kehle haben, weil ich durstig bin – und nicht, weil ich mich ängstige. Ich kann Tränen vergießen (weil ich Zwiebeln schäle), ich kann stöhnen (vor Schmerz) und meine Augenlider können schwer sein (vor Müdigkeit) – nicht, weil ich bekümmert bin. Ob es sich bei diesen Reaktionen um Manifestationen der einen oder anderen Emotion handelt oder ob sie nicht mit einer Emotion in Zusammenhang stehen, hängt von den Umständen ab und davon, was der Akteur von den Umständen, in denen er sich vorfindet, weiß oder glaubt, sowie davon, wofür er Sorge trägt und woran ihm liegt.
328
Damasio, Feeling of What Happens, S. 42 [dt. Ich fühle, also bin ich], zitiert oben, S. 116.
300
7 Emotion
Die Verbindung zwischen Emotion und Wollen Die Verbindung mit dem Wollen ist gleichfalls für viele (aber nicht für alle) Emotionen konstitutiv. Die Angst vor körperlichen Leiden ist unter sonst gleichen Bedingungen mit einem Verlangen verknüpft, all dem aus dem Weg zu gehen, was eine Verletzung mit sich bringen kann (und mit dem Wunsch oder der Hoffnung, dass sich nichts Gefährliches ereignen möge); der Bereuende hat ein Verlangen danach, sich zu bessern und zurückliegende Ereignisse wiedergutzumachen, der Liebende begehrt, den Geliebten zu schützen oder sein Wohl zu befördern, den Beschämten verlangt es danach, das Beschämende zu kaschieren. Allerdings sollte man sich davor hüten, ein Verlangen mit einem Motiv zu verwechseln. Aus einem Verlangen kann ein Motiv erwachsen. Ein Verlangen nach X zu haben ist jedoch kein Motiv dafür, X ‚zu gewinnen‘, obgleich es ein Motiv dafür sein kann, Y zu tun, wenn es sich bei Y um ein Mittel handelt, X zu gewinnen. Emotion und Motiv Dennoch ist es kein Zufall, dass viele Emotionstermini auch Handlungsmotive anführen, sondern für unseren Emotionsbegriff konstitutiv. Häufig handelt man aus Liebe oder Angst, aus Eifersucht oder Mitgefühl. Solche Motive heranzuziehen ist eine Möglichkeit, menschliche Handlungen zu erklären. Allerdings kommen auf diese Weise nicht die Ursachen der Handlung in den Blick, sondern die charakteristischen Muster des Handelns auf ein Ziel hin. Wenn wir aufgrund eines bestimmten Motivs handeln, veranlasst [causes] uns das Motiv nicht so zum Handeln, wie ein bewaffneter Mann uns zum Handeln veranlassen kann, indem er uns bedroht. Motive sind, ungeachtet der Etymologie des Worts, genauso wenig unsichtbare Antriebskräfte, wie Ziele unsichtbare Anziehungskräfte sind. Und bei den Emotionen, die uns motivieren, handelt es sich auch nicht um neurale oder somatische Ursachen, die uns zum Handeln veranlassen. Viele Emotionstermini benennen auch Motive, und zwar deshalb, weil Emotionen typischerweise mit Interessen und Zielen, um deretwillen eine Handlung ausgeführt werden könnte, einhergehen oder auf diese hindeuten – zum Beispiel die Beseitigung oder Vermeidung eines unerwünschten Sachverhalts, die Bewahrung oder Herbeiführung eines erwünschten Sachverhalts. Sich vor Angst zu schütteln oder aus Angst zu schreien heißt nicht, aus einem Motiv heraus zu handeln; aus Angst zu handeln und durch sie motiviert zu sein (indem man die aktuelle Situation als eine Bedrohung wahrnimmt) heißt (grob gesagt) jedoch, mit dem Ziel zu handeln, die Bedrohung zu beseitigen oder zu vermeiden. Aus Liebe zu handeln heißt (grob gesagt), das Liebesobjekt so aufzufassen, als fehle ihm etwas oder als sei es von einem Leid bedroht, und um der Beschaffung dieses Etwas oder der Abwendung der Bedrohung willen zu agieren. Aus Dankbarkeit für A zu handeln heißt, mit dem Wissen zu handeln, dass man kürzlich A’s Nutznießer war, und mit der Absicht, A profitieren zu lassen, weil man kürzlich von ihm profitierte (und wenn man auch handelt, um die eigene Dankbarkeit zu zeigen, dann beabsichtigt man
7.2 Die Emotionen: Einleitender analytischer Überblick
301
zudem, dass A (oder andere) diese Absicht erkennen). Kurzum: Viele Emotionen sind auch Handlungsmotive, aber nicht, weil sie Handlungsgründe wären, sondern weil sie eine Form des Interesses und eine Glaubensstruktur zu erkennen geben, woraus sich allgemeine Erklärungsmuster für menschliches Handeln ergeben. Erklärt man eine menschliche Handlung, indem man sagt, sie sei ausgeführt worden, weil eine Emotion (wie Angst, Liebe, Neid oder Mitleid) sie motiviert habe, zieht man keinen Einzelfaktor (wie einen Grund, eine Ursache, ein Verlangen, eine Gewohnheit oder eine Neigung) zur Erklärung heran, sondern ein Erklärungsmuster.329
329
Für eine ausführlichere Darstellung von Motiven siehe Kenny, Action, Emotion and the Will, Kap. 4, und A. R. White, The Philosophy of Mind (Random House, New York, 1967), Kap. 6.
8 Wollen und Willkürbewegung 8.1 Wollen Wollensbegriffe und Handlungserklärungen Das unter der Kategorie des Wollens [volition] subsumierte Begriffsfeld ist weit gefasst. Geprägt ist es von einer Vielzahl unterschiedlicher Begriffspfade, die es auf verwirrende Weise kreuz und quer durchziehen. Weil Wollensangelegenheiten in erster Linie mit Handlung in Zusammenhang stehen, ist jeder Begriff dieses Bereichs mehr oder weniger direkt mit Erklärungen menschlicher Handlungen verknüpft. Und es gibt vielfältige Erklärungsformen, die sich hinsichtlich ihres logischen Gepräges oftmals gravierend unterscheiden. So gibt es das umfassende Begriffsspektrum von Wollen und dem Willen: gefühlte Neigungen, gefühltes Verlangen, wollen [wanting] in all seiner verwirrenden Begriffskomplexität; Zweck, Ziel und Bestreben; Entscheidung und Handlungsgründe; Intention; und so weiter. Darum haben wir es auch mit verschiedenen Wollenskategorien des Handelns zu tun, wie dem Willkürlichen, Unwillkürlichen und Nichtwillkürlichen; dem Intentionalen, dem Nichtintentionalen, dem Besonnenen oder dem Unbesonnenen, dem Sorgfältigen und dem Sorglosen, Voreiligen oder Fahrlässigen; und so weiter. Und wir haben es mit verschiedensten Erklärungsformen menschlichen Handelns zu tun, die sich auf Gründe und Motive beziehen, auf Intentionen und Zwecke und auf Gewohnheiten, Tendenzen und Neigungen sowie auf Dispositionen und Charakterzüge. Dies alles detailliert zu untersuchen nimmt sich wahrlich wie eine Mammutaufgabe aus. Wir werden uns damit begnügen, einige Umrisslinien der Begriffe der willkürlichen und der intentionalen Handlung zu skizzieren. Ein zweites Augenmerk ist darauf gerichtet, die Neurowissenschaftler davon zu überzeugen, dass es sich bei willkürlichem menschlichen Tun nicht um Verhalten handelt, das von Willensakten, Wollenskräften, Vorhaben, Intentionen oder Entscheidungen verursacht wird. Willkürliche, unwillkürliche und nichtwillkürliche Handlungen Menschliches Tun kann unterteilt werden in Handlungen, die wir ausführen (oder nicht ausführen, z. B. unsere Unterlassungen, Enthaltungen und Zurückhaltungen), und solche Sachen, die keine Handlungen sind, wie das Ausrutschen oder Hinfallen, Einschlafen oder Schlafen. Was unsere Handlungen angeht, können wir die willkürlichen/ willentlichen von den nichtwillkürlichen/nichtwillentlichen abgrenzen. Bei nichtwillkürlichen Handlungen wiederum (oder nichtwillkürlichen unterlassenen Handlungen)
8.1 Wollen
303
kann man es mit unwillkürlichen Handlungen zu tun haben – das heißt mit solchen, die willkürlich ausgeführt werden könnten, aber nicht wurden, wie in den Fällen unwillkürlichen Lächelns oder Zwinkerns. Bei nichtwillkürlichen Handlungen kann man es auch mit Handlungen zu tun haben, die weder willkürliche noch unwillkürliche sind, wie in den Fällen unwissentlichen oder unbeabsichtigten Handelns – wenn man zum Beispiel aus Versehen das falsche Glas ergreift, unbemerkt auf ein Insekt tritt oder einen Namen falsch ausspricht. Und man kann es bei nichtwillkürlichen Handlungen mit solchen zu tun haben, die unter Zwang ausgeführt werden oder weil die Umstände einen dazu nötigen, sie auszuführen (z. B. die Landstraße nehmen, weil die Autobahn gesperrt war). Intentionale, unintentionale und nichtintentionale Handlungen Unsere willkürlichen Handlungen können intentionale, unintentionale und nichtintentionale Handlungen sein. Intentionale Handlungen sind willkürlich, es sei denn, sie werden unter Zwang ausgeführt oder weil einen die Umstände dazu nötigen. Unsere alltäglichen Handlungen und Verrichtungen wie essen, trinken, gehen und sich unterhalten sind im Normalfall willkürlich und intentional. Viele unserer Handlungen sind jedoch willkürlich, ohne notwendigerweise intentional zu sein: mit den Fingern trommeln beispielsweise, während der Arbeit pfeifen, sich mit der Hand durch die Haare fahren, lächeln, die Stirn runzeln, mürrisch dreinblicken, einschließlich der zahlreichen Ausdrucksgesten, die man mit seiner Hand ausführt, während man sich unterhält, sowie der vielen Bewegungen, die man ausführt, wenn man mit gewohnten Handlungen zu tun hat, wie sich anziehen, die Haare kämmen oder die Zähne putzen. Ebenso sind die vorausgesehenen, aber unbeabsichtigten Folgen unserer Handlungen willkürlich, ohne intentional zu sein, wie in dem Fall, da wir wissentlich die Grashalme umtreten, während wir absichtlich [intentionally] über den Rasen laufen. Die Kennzeichen willkürlicher Handlungen oder Bewegungen Willkürliche Handlungen gehen normalerweise mit der Ausführung von Körperbewegungen einher. ( Jene, auf die das nicht zutrifft, gehören zur Kategorie willkürlicher Geistesakte, wie das Kopfrechnen und, in bestimmten Fällen, Unterlassungsakte, wie das Abstandnehmen von oder das Bleibenlassen eines Tuns von etwas. Mit ihnen werden wir uns nicht weiter befassen.) Kraft welcher Merkmale ist eine menschliche Handlung oder Bewegung eine willkürliche Handlung oder Bewegung, in Abgrenzung zu einer unwillkürlichen? Zu den Kennzeichen willkürlicher Handlungen gehört sicherlich, dass man versuchen, entscheiden oder beabsichtigen kann, sie durchzuführen, sie auf Verlangen oder auf Anordnung ausführen kann; sie können mit oder ohne Sorgfalt vollzogen werden, und man kann häufig lernen, sie auszuführen (wie man das Einfädeln eines Fadens lernen kann). Wenn man eine willkürliche Handlung ausführt, weiß man,
304
8 Wollen und Willkürbewegung
was man tut, und kann es sagen, und man ist nicht überrascht von dem, was man tut. Denn wenn man willentlich agiert, übt man ein Alternativ-Vermögen aus, zu handeln oder das Handeln bleibenzulassen, und zwar im Wissen, dass einem die Wahl zwischen den Alternativen selbst obliegt. Im Gegensatz dazu können sich unsere unwillkürlichen Bewegungen ereignen, wenn wir sie nicht wollen, und sie können uns überraschen. Wodurch beweist man, dass man etwas willkürlich tun kann? Indem man es tut. Man sagt zu jemand anderem ‚Bitte mich darum, dies und jenes zu tun, und ich werde dir zeigen, dass ich es kann.‘ Und wodurch weiß man, dass man es willkürlich getan hat (und nicht zufällig oder unwillkürlich)? Nicht durch ein besonderes Gefühl, das es einem sagen würde. Es stimmt, dass das willkürliche Anheben des eigenen Arms sich anders anfühlt als das selbsttätige Aufrichten des Arms (der sich von allein erhebt, wenn man beispielsweise seinen Arm eine Minute lang gegen die Wand presst und dann zurücktritt und den Arm sich heben lässt). Dass man seinen Arm willkürlich angehoben hat, weiß man allerdings nicht aufgrund irgendeines besonderen Gefühls. Wenn uns ein besonderes Gefühl darüber in Kenntnis setzen würde, dass wir eine willkürliche Bewegung ausgeführt haben, könnte man vergessen, welches Gefühl das die Willkürlichkeit kenntlich machende war, und sich daher hinsichtlich der Frage irren, ob man willkürlich gehandelt hatte oder nicht. Von nichtpathologischen Fällen abgesehen wäre das jedoch absurd. Es gibt vielmehr kein irgendwie geartetes Wissen, wodurch; man kann sagen, die eigene Handlung oder Bewegung sei willkürlich gewesen, und das ist ein Kennzeichen der Willkürlichkeit. Eine vollkommen willkürliche Bewegung ist die Ausübung eines Alternativ-Vermögens; das Verhalten ist das, was man steuert Lässt sich dieses Durcheinander irgendwie ordnen? Eine notwendige Bedingung dafür, dass eine Bewegung willkürlich ist, besteht darin, dass sie mit der Ausübung eines Alternativ-Vermögens des Tuns oder Lassens einhergeht. Verhalten ist willkürlich, wenn man es willentlich vollziehen kann. Ein so verstandenes Verhalten kann man unmittelbar steuern – was nicht heißt, etwas anderes zu tun, das es verursacht oder beendet (folglich nicht so, wie man seinen Herzschlag steuern kann, indem man auf und ab springt, um ihn zu beschleunigen, oder sich hinlegt, um ihn zu verlangsamen). Eine vollkommen willkürliche Bewegung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie von ihrem Anbeginn an und bis zu ihrem Ende dem steuernden Einfluss des Akteurs unterliegt. Daher ist blinzeln nur teilweise willkürlich, denn man kann willentlich blinzeln, den Vorgang aber hinsichtlich ‚Verlauf‘ und Beendigung nicht steuern, und niesen ist nur teilweise willkürlich, weil man es hemmen, aber nicht unmittelbar initiieren kann.
8.1 Wollen
305
Eine willkürliche Bewegung wird weder durch ein Wollen noch durch einen Willensakt verursacht Bei einer willkürlichen Bewegung handelt es sich nicht um eine durch ein Wollen [a volition] oder einen Willensakt verursachte Bewegung, und sie rührt auch nicht von einem Wollen [a want], einer Absicht oder einer Entscheidung her, obgleich es sich bei dem, was wir tun, weil wir es tun wollen, zu tun beabsichtigen oder uns entschieden haben, es zu tun, auch um etwas handelt, was wir willkürlich tun (es sei denn, es kommt unter Zwang zustande oder ist das Resultat zwingender Umstände). Dieses Argument ist nicht leicht zu begreifen, und genau wie Descartes und die Empiristen (z. B. Hobbes, Locke, Hume und Bentham) gehen die Neurowissenschaftler häufig davon aus, dass willkürliche Handlungen von inneren Willensakten verursachte Bewegungen sind. Demnach besteht noch immer Erklärungsbedarf. Was ein Willensakt ist und was die Willenskraft Es ist irrig anzunehmen, dass wir es bei willkürlichen und intentionalen Handlungen mit Körperbewegungen zu tun haben, die von vorhergehenden und auf Bewegung zielenden Willensakten hervorgerufen werden. Willensakte gibt es durchaus. Akte nämlich, die wir unter großen Anstrengungen vollbringen, um unser Widerstreben oder unsere Handlungsschwierigkeiten zu überwinden, welche sich für gewöhnlich bei widrigen Umständen einstellen. Wir haben es bei einem Akt des Willens nicht mit einem – als ‚Wollen‘ [‚willing‘] bezeichneten – geistigen Akt zu tun, der Körperbewegungen verursacht. Willenskraft gibt es durchaus, es handelt sich dabei jedoch nicht um ein geistiges Äquivalent der Muskelkraft. Sie ist vielmehr mit der Entschlossenheit und Beharrlichkeit gleichzusetzen, seine Ziele gegen widrige Umstände durchzusetzen. Willensstärke gibt es durchaus, sie hat jedoch nichts mit kausal wirkenden geistigen Wollensakten zu tun, sondern ist vielmehr eine Sache der Hartnäckigkeit, mit der man seine Ziele verfolgt. Die inkohärenten Konsequenzen der Annahme, wollen sei ein Ereignis oder ein Akt Es scheint, dass das Wollen [willing], wenn es sich bei ihm um irgendein geistiges Geschehen handelte, das willkürlichem Tun vorhergeht und es hervorbringt, entweder ein geistiger Akt oder ein geistiges Ereignis sein müsste. Wäre es ein Akt, dann müsste dieser willkürlich sein. Denn wenn wollen ein unwillkürlicher Akt wäre, dann wäre auch das daraus resultierende Verhalten unwillkürlich. (Wenn man eine Vase unwillkürlich bzw. unabsichtlich umstößt und die Vase dabei zerbricht, dann macht man sie nicht willkürlich kaputt.) Wenn wollen hingegen willkürlich wäre, müsste es selbst wiederum von einem vorhergehenden Wollen verursacht sein, denn genau das macht dieser Auffassung nach ein irgendwie geartetes Geschehen zu einem willkürlichen. Das führt aller-
306
8 Wollen und Willkürbewegung
dings in einen unendlichen Regress. Wenn das Wollen andererseits bloß ein Ereignis wäre, das eintritt, wenn es eintritt, dann wäre das dadurch verursachte Verhalten gar kein willkürlich vollzogenes – genauso wenig wie man willkürlich niesen würde, wenn man von einem Gefühl dazu veranlasst wurde. Warum Willensakte, als die Ursachen willkürlicher Handlungen betrachtet, Erfindungen sind Wenn jeder willkürlichen Handlung ein Wollen als verursachendes Geschehen vorausginge, dann müssten wir überdies in der Lage sein festzustellen – vorausgesetzt, wir wissen, ob wir willkürlich handelten oder nicht –, wann ein solches Wollen sich ereignet (und seine Art und Dauer zu beschreiben). Und wir müssten in der Lage sein festzustellen, dass wir es bei diesen Geschehnissen mit den Ursachen des darauf folgenden Verhaltens zu tun haben. Aber: (a) Wir haben absolut keine Vorstellung davon, worum es sich bei diesen mythischen Wollensereignissen handeln könnte. Wir haben gesehen, dass sie keine inneren Akte/Handlungen sein können. Und sie können auch keine Gefühle sein, wie wir eben feststellten. Denn wäre wollen ein Gefühl, dann wäre es einfach etwas, das sich ereignet, wenn es sich ereignet, und seine kausalen Folgeerscheinungen wären keineswegs Willkürhandlungen, sondern von Gefühlen verursachte Bewegungen. (b) Wir wissen nicht, wie wir diese Willensakte identifizieren sollen. Wir müssten sie jedoch gewiss identifizieren, um sicherzugehen, dass die von uns vollzogenen Handlungen (welche auch immer) willkürliche sind. Und vermutlich könnten wir sie auch falsch identifizieren und irrtümlicherweise denken, dass wir etwas willkürlich taten, was tatsächlich nicht von irgendeinem Willensakt verursacht wurde. Jedoch auch ohne solche Identifizierungen, von Fehlidentifizierungen zu schweigen, wissen wir (d. h. können wir sagen), wann wir willkürlich und wann unwillkürlich handeln. (c) Wir haben solche inneren Akte bestimmt nicht identifiziert und gewiss keinen Kausalzusammenhang zwischen ihnen und den nachfolgenden Bewegungen hergestellt, was uns nun zuversichtlich stimmt, dass Willenshandlungen von geistigen Geschehnissen des Wollens herrühren. Wir haben vielmehr lediglich ein Bild davon, womit wir es bei einer freien Willkürhandlung zu tun haben müssen – ein Bild, das weder auf Evidenz noch auf beweiskräftigen Argumenten beruht. (d) Es wäre sicher absurd anzunehmen, dass jeder willkürlichen Handlung ein gesonderter Willensakt vorhergeht. Jedes Wort des vorigen Satzes wurde willentlich (und absichtlich) niedergeschrieben, und jeder Buchstabe jedes Wortes war dabei beabsichtigt. Es ist jedoch absurd anzunehmen, dass sich beim Schreiben jedes Buchstabe ns und jedes Wortes ein gesonderter Willensakt ereignet hat. (e) Es ist normalerweise nicht schwer, die willkürlichen und unwillkürlichen Handlungen anderer zu identifizieren und voneinander abzugrenzen. Wir grenzen diese je-
8.1 Wollen
307
doch nicht voneinander ab, indem wir herausfinden, ob die mit ihnen einhergehenden Bewegungen von geistigen Willensakten hervorgerufen wurden, die weder wir noch sie identifizieren können. Wenn wir einer anderen Person die Verantwortung für eine Handlung zuerkennen, tun wir das nicht, indem wir einen Willensakt identifizieren, den sie ausgeführt und der ihre Körperbewegung verursacht hat. Wollen, beabsichtigen und entscheiden sind keine Handlungs- oder Bewegungsursachen Selbstverständlich handeln wir im Normalfall, weil wir es tun wollen [wanting], es zu tun beabsichtigen oder uns entschieden haben, es zu tun, und zwar entweder um unsertwillen oder zur Erreichung irgendeines sonstigen Zieles. Es ist jedoch abwegig, dieses ‚weil‘ als kausales aufzufassen. Denn wäre es kausal, dann könnten wir uns rein passiv verhalten, uns zurücklehnen und der Natur freien Lauf lassen, sobald wir etwas wollen, die Absicht sich herausgebildet hat oder die Entscheidung getroffen wurde. Denn die Handlung würde sich ereignen, ohne dass wir irgendeine Initiative ergreifen müssten. Wenn ich das Licht um 18 Uhr einschalten will (mich so entschieden habe, es beabsichtige), dann müsste ich, wenn ich die Uhr sechs schlagen höre, das Licht nicht einschalten, um meine Absicht zu verwirklichen. Ich bräuchte es bloß dem Wollen [the want] (der Absicht oder Entscheidung) überlassen, meinen Arm anzuheben und das Licht einzuschalten. Ich könnte sagen ‚Und jetzt ist es 18 Uhr, schauen Sie und sehen Sie nur, wie mein Arm sich hebt!‘ – nun, genau das geschieht nicht, und genau das kann man nicht sagen. Darüber hinaus können Vorhaben [wants] und Absichten nicht die Rolle von Akten des Willens ausfüllen, denn sie sind keine Akte bzw. Handlungen, gleich welcher Art. Wollen [willing] muss, wenn es irgendetwas ist, etwas sein, das wir tun, und kein Wollen oder Verlangen, das uns befällt oder über uns kommt. Und obwohl eine Entscheidung treffen ‚ein Geistesakt‘ genannt werden kann, handelt es sich dabei nicht um eine Verhaltensursache, sondern um einen Ausdruck für einen Zustand des Schwankens. Wenn wir uns erst einmal entschieden haben, haben wir eine Absicht gebildet, und wir wissen, was wir tun werden. Dennoch müssen wir es erst noch tun – die Entscheidung kann uns nicht dazu veranlassen [cannot cause us], die Willenshandlung, zu der wir uns entschlossen haben, auszuführen. Wenn man sagt, jemand habe etwas getan, weil er es tun wollte, liefert man keine Kausalerklärung seiner Handlung anhand eines geistigen Aktes oder Ereignisses. Es kann jedoch dazu dienen, bestimmte Arten der Kausalerklärung auszuschließen; zum Beispiel, dass wir es mit einer unwillkürlichen Handlung zu tun haben – wenn jemand etwas getan hat, weil er es tun wollte, dann war es folglich keine bloße Zuckung bzw. kein unwillkürlicher Ruck. Indem man sagt, er habe es getan, weil er es tun wollte, charakterisiert man vielmehr sein Verhalten als Handlung und somit als etwas, hinsichtlich dessen die Frage nach Gründen Sinn ergibt ist (obgleich es möglich ist, dass sie grundlos ausgeführt wurde), im Gegensatz zu einer unwillkürlichen Zuckung, die man rein kausal angemessen erklären kann. Das ist selbstverständlich vollkommen vereinbar mit
308
8 Wollen und Willkürbewegung
dem Umstand, dass die Muskelkontraktionen, die mit seiner Handlung einhergehen, kausal erklärt werden. Es gibt allerdings auch noch andere Möglichkeiten. Man kann sagen ‚Ich verlasse den Raum, weil ich es will, und nicht, weil Sie es verlangt haben‘. Damit charakterisiere ich meine Handlung als willkürliche und intentionale, während ich die Art der Erklärung im Hinblick auf den angegebenen Grund ausschließe – das heißt, dass Sie von mir verlangt haben zu gehen. Nochmals sei gesagt: Wenn ich aus einer anderweitigen Absicht heraus handle, dann dienen die Wendungen ‚weil ich es so und so machen wollte‘ oder ‚weil ich das erreichen wollte‘ dazu, das angestrebte Ziel anzugeben (z. B. ‚Ich hob meinen Arm, weil ich das Buch (ergreifen) wollte‘). In diesem Zusammenhang hätte man genauso gut sagen können ‚Ich hob meinen Arm, um das Buch zu ergreifen‘. Indem ich sage, was ich wollte, gebe ich meinen Handlungsgrund an, nicht die Ursache der Bewegung meines Armes, den ich willentlich anhebe. Wenn wir wissen, was eine Person will (worauf sie abzielt) und was sie glaubt, können wir ihre Handlungen häufig vorhersagen, aber nicht, weil ihr Wollen (in Verbindung mit ihrem Glauben) die betreffenden Bewegungen verursacht. Tatsächlich können wir im Normalfall nicht vorhersagen, wie – das heißt durch welche Bewegungen – sie ihre Intentionen ausführen wird, während wir ihre Handlungen im Voraus bestimmen können. Wenn man einen Schachspieler kennt, kann man seine Züge [moves] oft vorhersagen; was einen hierzu in die Lage versetzt, ermöglicht einem jedoch nicht, seine Bewegungen [movements] im Voraus zu bestimmen.330
8.2 Libets Theorie der Willkürbewegung Libets Entdeckungen und die hieraus resultierende Theorie Bereits diese fragmentarische Skizze eines kleinen Feldbereichs der Wollensbegriffe lässt uns erkennen, was in einer renommierten neurowissenschaftlichen Theorie der Willenshandlungen nicht stimmt. Benjamin Libet behauptete, neurowissenschaftliche Forschungen würden zeigen, dass alle willkürlichen Handlungen vom Gehirn initiiert werden, und zwar unabhängig von irgendwelchen bewussten Willensakten. „Das Gehirn ‚entscheidet‘ sich, die Handlung anzustoßen, oder den Anstoß zumindest vorzuberei-
330
Siehe J. Gosling, Weakness of the Will (Routledge, London, 1990), S. 183. Für eine detailliertere Darstellung der vielfältigen Formen dieser allgemein bekannten nichtkausalen Erklärungen menschlichen Verhaltens siehe A. J. P. Kenny, Will, Freedom and Power (Blackwell, Oxford, 1975); B. Rundle, Mind in Action (Clarendon Press, Oxford, 1997); A. R. White, The Philosophy of Mind (Random House, New York, 1967), Kap. 6. Für eine Ausarbeitung von Wittgensteins einschlägigen Gedanken siehe P. M. S. Hacker, Wittgenstein: Mind and Will (Blackwell, Oxford, 1996), Essays VII und VIII.
8.2 Libets Theorie der Willkürbewegung
309
ten, bevor es irgendein mitteilbares Bewusstsein [conscious awareness331] davon gibt, dass eine solche Entscheidung getroffen wurde.“332 Libet behauptet, dass die Neuronen des supplementär-motorischen Kortex, die mit einer speziellen körperlichen Bewegung, die eine Hand ausführt, in Zusammenhang stehen, 500 ms vor dem Zeitpunkt zu feuern beginnen, da die Impulse bei den die Bewegung ausführenden Muskeln ankommen. Allerdings trat das Gefühl der Bewegungsintention, des Bewegungswillens oder Bewegungsdrangs, der von den Testpersonen mitgeteilt wurde, erst 150 ms vor Ausführung der Handlung auf. Daraus leitete er ab, (a) dass selbst die Ausführung einer freien Willenshandlung unbewusst angestoßen wird, ungefähr 350 ms bevor das Individuum bewusst zur Kenntnis nimmt, dass es sich bewegen will, aber auch (b) dass die bewusste Einflussnahme darauf, ob die Handlung tatsächlich ausgeführt wird, während der verbleibenden 150 bis 200 ms vor der Muskelaktivierung dennoch möglich ist. Das würde dem Anschein nach die Möglichkeit offen lassen, dass die bewusste Wahl- oder Willensfreiheit zumindest in einer Interventionsfunktion zum Tragen kommt.333
Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass laut Libet eine Handlung willkürlich ist – neben der Tatsache, dass sie ‚innerlich entspringt‘, ohne von außen auferlegte Beschränkungen oder Zwänge –, wenn „die Subjekte introspektiv fühlen, dass sie die Handlung auf ihre eigene Initiative hin ausführen und dass es ihrem freien Belieben überlassen ist, mit der Handlung zu beginnen oder nicht“.334 In dem Experiment sollten die Testpersonen „sich entscheiden, die Handlung in irgendeinem Moment auszuführen, da das Verlangen, der Drang, die Entscheidung und der Wille in ihnen auftauchen würden. (Sie waren also frei, jedem bemerkten Handlungsdrang oder jeder bemerkten Initialentscheidung zur Handlung nicht nachzukommen . . .).“ Die Personen wurden gebeten, ihre Hand zu bewegen, wann auch immer es ihnen beliebte, und den genauen Zeitpunkt festzuhalten, da sie einen Drang, Wunsch, ein Verlangen oder eine Absicht fühlten, sie zu bewegen – wie das Experiment zeigte, trat dieser Moment etwa 300 ms nach Beginn der neuralen Akti331
[‚Conscious awareness‘ wird hier in Anlehnung an die einschlägige deutsche (Übersetzungs-) Literatur mit Bewusstsein wiedergegeben. Genau genommen handelt es sich um ein bewusstes Erfassen oder eine bewusste Kenntnis, unbestreitbar aber um ein Bewusstseinsphänomen. Es ist nicht ratsam, hier beispielsweise mit dem Terminus ‚Gewahrsein‘ zu operieren, denn man würde damit ‚awareness‘ und dessen Stellung und Geläufigeit im Englischen nicht entsprechen und darum wohl eher Verwirrung stiften. Wessen man sich hier ‚consciously aware‘ ist, ist allerdings von den Dingen zu unterscheiden, derer man sich ‚conscious‘ sein kann (siehe all das, was die Autoren zum transitiven Bewusstsein und den entsprechenden Wendungen sagen). Der später von den Verfassern herausgearbeitete Unterschied zwischen ‚being aware of something‘ und ‚being conscious of something‘ (siehe S. 334) ist hier nicht gemeint. – A.d.Ü.] 332 B. Libet, ‚Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action‘, in Neurophysiology of Consciousness (Birkhäuser, Boston, 1993), S. 276. 333 B. Libet, ‚Epilogue: I. Some implications of „time-on theory“‘, in Neurophysiology of Consciousness, S. 389f. 334 Libet, ‚Unconscious cerebral initiative‘, S. 270.
310
8 Wollen und Willkürbewegung
vitäten der Bewegung ein. Wie Libet festhielt, basierte das Experiment auf der Grundannahme, dass dieses „subjektive Ereignis [einen Handlungsdrang oder ein Handlungsverlangen zu fühlen] nur der Person selbst introspektiv zugänglich ist“, und auf der Instruktion, dass „jede Person nach dem frühesten Erscheinen des fraglichen Bewusstseins „Ausschau halten“ und es mitteilen sollte“.335 Verworrene Vorannahmen von Libets Experiment Dieses Experiment beruht auf verworrenen Vorannahmen. Damit eine Handlung willkürlich sein kann, ist es weder notwendig noch hinreichend, dass ihr ein gefühltes Verlangen oder Wollen, eine gefühlte Absicht oder ein gefühlter Drang, sie auszuführen, vorausgeht. Wollensgefühle sind für die Willkürbewegung nicht notwendig Es ist nicht notwendig, weil man einem Akteur nicht unterstellt, und er selbst geht auch nicht davon aus, dass er sich unwillkürlich bewegt habe, wenn er eine Bewegung vollzog, ohne einen entsprechenden Drang oder ein entsprechendes Verlangen zu fühlen. Wenn man sich willkürlich bewegt – z. B. seinen Stift nimmt, um eine Mitteilung zu verfassen, oder aufsteht, um die Tür zu öffnen, wenn es läutet –, fühlt man keine Antriebe, Verlangen oder Absichten, und das ist keineswegs deshalb so, weil man sie nicht bemerkt! Selbstverständlich kann man sagen, ob man sich willkürlich oder unwillkürlich bewegt hat, aber nicht mit der Begründung, dass man kurz vor der Bewegung einen Drang, ein Verlangen oder eine Absicht fühlte. Wollensgefühle sind für die Willkürbewegung nicht hinreichend Und es ist auch nicht hinreichend dafür, dass eine Bewegung als willkürliche betrachtet wird, denn das Fühlen eines Drangs, zu niesen z. B., kurz bevor man niest, macht aus dem Niesen kein willkürliches Niesen. In Wahrheit können normal veranlagte menschliche Wesen gar nicht willentlich niesen, obgleich sie in der Lage sind, ein Niesen willentlich zu hemmen. Es ist nicht zu übersehen, dass Libets Theorie sämtliche menschliche Willenshandlungen de facto dem Status gehemmten Niesens oder dem eines Niesens, das man nicht hemmen wollte, zuschlagen würde. Denn seiner Ansicht nach werden alle menschlichen Bewegungen vom Gehirn angestoßen, noch bevor man sich irgendeines Bewegungsverlangens bewusst ist, und der willentlichen Steuerung ist nur überlassen, die Bewegung, die bereits auf den Weg gebracht ist, zu hemmen oder ihr stattzugeben.
335
Ibid., S. 274.
8.2 Libets Theorie der Willkürbewegung
311
Eine von einem gefühlten Drang verursachte Bewegung ist nicht willkürlich So etwas wie ein Fühlen eines Drangs, etwas zu tun, gibt es durchaus, und es gibt auch ein Bewusstsein eines Verlangens, etwas zu tun. Allerdings ist eine Bewegung, die von einem Drang oder gefühlten Verlangen verursacht wurde, nun gerade keine willkürliche Handlung. Wenn ein Drang zu niesen, sich zu übergeben, sich zu räuspern etc. einen dazu veranlasst, sich entsprechend zu verhalten, dann hat man unwillkürlich geniest, sich übergeben oder geräuspert. Man kann ein intensives Verlangen danach haben, zu trinken, zu essen oder seine Hand zu bewegen, und unter sonst gleichen Bedingungen wird man ‚darangehen‘ zu trinken, zu essen oder seine Hand zu bewegen. Das Verlangen ist allerdings nicht die Ursache dafür. Man trinkt vielmehr, um seinen Durst zu löschen, isst aus einem bestimmten Grund – nämlich, dass man Hunger hat – und bewegt seine Hand zu einem bestimmten Zweck, z. B. dem, sie von etwas Abstoßendem, mit dem sie in Kontakt kam, wegzubewegen. Ebenso kann man auch einen Drang fühlen, etwas zu tun, und handeln, weil man einen Drang fühlt, dieses ‚weil‘ aber ist nicht kausal. Der Drang, den man nach einem weiteren Stück Kuchen fühlt, führt die Hand ebenso wenig unwiderstehlich zum Kuchenteller, wie das Fühlen einer Neigung zu einem abendlichen Kinobesuch die Beine um 19 Uhr in Bewegung setzt. Libets Fragestellung basierte auf einer Fehlkonzeption der Willkürhandlung Wenn man seine Testpersonen auffordert, ihre Hand innerhalb der nächsten Minute willkürlich zu bewegen und darauf zu achten, den Zeitpunkt festzuhalten, da sie einen Drang, eine Absicht oder ein Verlangen fühlen, sie zu bewegen, unterwirft man sie durch die bloße Aufgaben- bzw. Fragestellung einem verlockenden (aber irrigen) philosophischen Bild davon, was eine Handlung ist und was ihr kausaler Ursprung. Eines der interessantesten (unerwartetsten) Resultate, die diese Experimente erbracht haben, besteht in der Tat darin, dass Menschen, wenn sie aufgefordert werden, solche Bizarrerien mitzuteilen wie ‚ein Gefühl der Absicht, seine Hand zu bewegen‘, etwas derartiges ausfindig machen werden, obwohl es mehr als zweifelhaft ist, ob es irgendetwas dergleichen wie ‚ein Absichtsgefühl‘ gibt. Und auf die Aufforderung hin, den Zeitpunkt festzuhalten, da sie einen Bewegungsdrang fühlen, warten sie gleichfalls mit einem derartigen Gefühl auf, obwohl eine willkürliche Handbewegung kein solches Gefühl voraussetzt und normalerweise auch nicht mit einem solchen einhergeht.336 Es ist nicht das mitgeteilte Gefühl, das ihre Bewegung zu einer willkürlichen macht, und aus ihr würde keine unwill336
Unserer Ansicht nach hat das bedeutsame methodologische Folgen für das Design solcher Experimente. Es macht unter anderem deutlich, dass die begrifflichen Konfusionen des Experimentators von den Subjekten, an denen das Experiment vollzogen wird, wahrscheinlich nicht ausgemerzt werden. Diese werden wohl denselben Konfusionen unterliegen oder vom Experimentator zumindest so eingeschüchtert sein, dass sie seinen Beschreibungen nicht widersprechen.
312
8 Wollen und Willkürbewegung
kürliche Bewegung, fühlte man nichts derartiges. Die Tatsache, dass die Neuronen im supplementär-motorischen Kortex 350 ms eher feuern, als das Gefühl angeblich erfasst wird, zeigt nicht, dass das Gehirn ‚sich unbewusst entschied‘, die Bewegung auszuführen, bevor der Akteur das tat. Es zeigt bloß, dass die neuronalen Muskelaktivierungsprozesse vor dem Zeitpunkt begangen, da der Akteur ein ‚Verlangensgefühl‘ oder ein ‚Gefühl des Dranges zur Bewegung‘ mitteilte, das sich eingestellt hat. Um es nochmals zu sagen, eine willkürliche Bewegung ist keine Bewegung, die von einem gefühlten Drang verursacht wird, genauso wenig wie das willkürliche Unterlassen einer Bewegung darin besteht, einen Drang zu fühlen, sich nicht zu bewegen, der einen davon abhält, sich zu rühren. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass über eine große Zahl von Handlungen im Vorhinein entschieden wird. Wenn wir darüber nachdenken, ob wir V diesen Abend, nächste Woche oder nächsten Monat vollziehen werden, wägen wir die Gründe ab, die für und gegen den Vollzug von V sprechen, und entscheiden uns für ihn (oder dagegen). Folglich werden wir V vollziehen, wenn die Zeit gekommen ist (vorausgesetzt, wir haben es nicht vergessen und es uns nicht anders überlegt). V auf diese Weise intentional zu vollziehen, im Einklang mit unseren zuvor gemachten Plänen und gehegten Absichten, könnte nicht voraussetzen, dass wir ‚eine Absicht fühlen‘ (es gibt nichts dergleichen wie ein Fühlen einer Absicht), und es setzt nicht voraus, dass wir ‚ein Verlangen fühlen‘. Wir handeln einfach, um unseren Plänen gerecht zu werden, und die Bewegungen, die wir dabei ausführen, sind dementsprechend willkürlich und intentional. Ein zweites Beispiel für abwegige Fragestellungen in einem Experiment Ein anderes Beispiel dafür, wie die Forschung zur Willkürbewegung aufgrund begrifflicher Verwirrungen in die Irre gehen kann, zeigt sich in einer jüngeren Arbeit von C. D. Frith und Kollegen.337 Eine ‚gewollte Handlung‘ definieren sie mit William James als „Handlung, die ausgeführt wird, wenn wir sie mit bewusster Aufmerksamkeit wählen“, und sie argumentierten, dass „eine willentliche Wahl subjektiv als gewollt erfahren wird und sich ereignet, wenn wir hinsichtlich der Handlung eine Wahl haben“. Solche „spontanen und selbst hervorgebrachten Handlungen werden nicht durch einen externen Reiz ausgelöst, sondern intern angestoßen“, im Gegensatz zu „automatischen Handlungen, bei denen die entsprechende Reaktion in vollem Umfang auf einen externen Reiz zurückgeht“. Folglich ist aus ihrer Sicht die Bewegung einer Testperson, wenn man sie auffordert, einen Finger zu bewegen, der vom Experimentator berührt wird, nicht ‚gewollt‘, sondern ein ‚Automatismus‘; bittet man die Person, einen von zwei verschiedenen Fingern zu bewegen, von denen nur der eine oder der andere berührt wird, ist die Bewegung hingegen ‚gewollt‘, insofern als die Person „hinsichtlich der Handlung eine C. D. Frith, K. Friston, P. F. Liddle und R. S. J. Frackowiak, ‚Willed action and the prefrontal cortex in man: a study with PET‘, Proceedings of the Royal Society, B 244 (1991), S. 241–246. 337
8.3 Bestandsaufnahme
313
Wahl“ hatte. Allerdings ist die ganze Rede von ‚gewollter Handlung‘ verwirrungsträchtig, und die Verwirrung wird durch James’ Fehlkonzeption der Willenshandlungen und durch seine inkohärente ideomotorische Theorie bestimmt nicht kleiner.338 Dessen ungeachtet dürfte allerdings klar sein, dass die Bewegung eines Fingers, den man bewegen sollte, keine weniger willkürliche Handlung ist als die eingeforderte Bewegung des einen oder des anderen von zwei Fingern.
8.3 Bestandsaufnahme Die Begriffe, die hier und in den letzten vier Kapiteln erörtert wurden, definieren mit, was das Menschsein ausmacht Die Begriffe, die wir in diesem und den vorigen vier Kapiteln erörtert haben, erfüllen im menschlichen Leben die vielfältigsten Funktionen und werden verwendet, um eine Vielzahl feiner Unterschiede zu machen. Sie entfalten ihre Wirkung im Innersten unserer Erfahrung, und in der Tat konstituieren und definieren sie unsere Erfahrung mit. Denn weil wir Begriffe gebrauchende Wesen sind, können wir über dieses große Erfahrungsspektrum verfügen, das uns auszeichnet und das viele Erfahrungen enthält, die anderen Lebewesen verschlossen bleiben, die nicht über diese reiche Auswahl an Begriffen verfügen, die nur Sprachverwendern, wie wir es sind, zur Verfügung stehen. Denn wir können eine Unmenge von Dingen wissen oder glauben, denken oder uns vorstellen, (be)fürchten oder (er)hoffen, wollen oder beabsichtigen, was andere Lebewesen nicht können. Es dürfte nicht überraschen festzustellen, dass das Begriffsfeld so komplex und subtil ist wie die Lebensform, die es durchdringt – unsere Lebensform. Denn die nämlichen Begriffe definieren mit, was es heißt, ein Mensch zu sein, und ihre Verwendung beim Ausdrücken und Beschreiben unserer Erfahrung ist mitkonstitutiv für das Leben von Sprache verwendenden Wesen, wie wir es sind. Sie sind keine theoretischen Begriffe Der letzte Punkt ist von höchster Wichtigkeit. Bei den Begriffen, mit denen wir uns befasst haben, handelt es sich nicht um die theoretischen Begriffe irgendeiner Wissenschaft, obgleich sie innerhalb der Psychologie und der Hirnforschung richtigerweise angeführt und verwendet werden.339 Unsere Liebes- oder Angst-, Wut- oder Bedauernsäußerungen sind keine theoretischen Darlegungen, gleich welcher Art. Cyrano, der Roxane unter 338
Für Wittgensteins detaillierte Kritik an der James’schen Darstellung des Wollens siehe P. M. S. Hacker, Wittgenstein: Mind and Will (Blackwell, Oxford, 1996), S. 565–568. 339 Es versteht sich, dass man einen theoretischen Begriff nicht als einen Begriff charakterisieren kann, der in irgendeiner theoretischen Darlegung vorkommt.
314
8 Wollen und Willkürbewegung
ihrem Balkon sein Herz ausschüttete, theoretisierte nicht über sein Verhalten, sondern verlieh seiner Liebe Ausdruck; Lear, der über die Undankbarkeit und Niedertracht der Menschheit herzog, war kein theoretisierender Laie, der mutmaßlich Emotionsausdrücke auf sich selbst anwendete, in Übereinstimmung mit einer geläufigen Theorie von der Menschennatur, sondern er machte seinem Zorn Luft. Es ist eine von den eliminativen Materialisten340 begünstigte desaströse Verwirrung, diese Begriffe als Teil einer sogenannten ‚Alltagspsychologie‘ darzustellen, die als eine mangelhafte primitive Theorie des menschlichen Verhaltens betrachtet wird. Freilich finden diese Begriffe nicht nur beim ostentativen Ausdruck von Emotionen Verwendung, sondern auch beim Beschreiben der Geistesverfassungen und Charakterzüge anderer Menschen und wenn es darum geht, das menschliche Tun zu erklären. Mit einer ebenso fatalen Verwirrung haben wir es bei der Annahme zu tun, dass Erklärung stets theoretisch ist. Die Erklärung des menschlichen Verhaltens anhand von Emotionen und Motiven, Wissen und Glauben, Denken und Vorstellen ist weder theoretisch, noch ist sie Teil einer Wissenschaft. Worauf unsere Begriffsskizzen abzielen Bei den von uns vorgelegten Beschreibungen handelt es sich lediglich um Skizzen. Die begrifflichen Zusammenhänge sind komplexer, als wir hier zeigen konnten. Eine detaillierte Abhandlung würde freilich in ein sehr umfangreiches Buch münden. Dennoch hoffen wir, dass unsere skizzenhaften Ausführungen ihrem Zweck genügen. Sie sollen die Neurowissenschaftler an die Alltagsbegriffe erinnern, die sie selbst ständig ins Feld führen, wenn sie ihre Experimente entwerfen und deren Resultate beschreiben. Die Erörterungen der mit den verschiedenen Begriffskategorien zusammenhängenden begrifflichen Artikulationen stellen einen Leitfaden zur Verfügung, der das Sinnvolle vom Unsinnigen abzugrenzen erlaubt. Wir hoffen, dass die Neurowissenschaftler diese Skizzen als hilfreich begrüßen (die unserer Ansicht nach in begrifflicher Hinsicht präziser sind als die von William James vorgebrachten). Die von uns angeführten Beispiele sollen den Blick schärfen für die zahlreichen Fallgruben, die sich auftun, wenn die begriffliche Klarheit leidet. Wie wir zu Beginn des 4. Kapitels anmerkten, ist es unser gewöhnliches System psychologischer Begriffe, das den Neurowissenschaften den Begriffsrahmen liefert. Aber obwohl uns dieses aus dem Alltag vertraut ist, ist die explizite Beschreibung seiner Formen und Strukturen alles andere als geläufig, und die meisten Neurowissenschaftler missachten die Zusammenhänge in vielen ihrer Schriften. Diese Missachtung hat jedoch zu keinem anderen Begriffssystem geführt, sondern nur zu Inkohärenzen bei ihrer Anwendung des bestehenden. Diesen Punkt werden wir in Kapitel 14 ausführlicher erörtern.
340
Hier denken wir an die von Paul und Patricia Churchland in vielen ihrer Schriften nachdrücklich unterstützte Konzeption. Diese Darstellungen untersuchen wir in Kapitel 13.
8.3 Bestandsaufnahme
315
Der Krypto-Cartesianismus der gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Reflexion Wir haben die Aufmerksamkeit immer wieder darauf gelenkt, dass und in welchem Ausmaß das neurowissenschaftliche Denken verdeckt cartesianisch ist. Selbstverständlich haben wir eingeräumt, dass die Neurowissenschaftler in diesen Tagen offen einen anticartesianischen Standpunkt vertreten und sich insofern von den ersten beiden Generationen von Neurowissenschaftlern des 20. Jahrhunderts wie Sherrington, Adrian, Eccles und Penfield unterscheiden. Ihr Anticartesianismus geht richtigerweise einher mit der Ablehnung des Zwei-Substanzen-Dualismus von Geist (verstanden als eine immaterielle Substanz) und Körper, die, wenn nicht in der Zirbeldrüse, dann im ‚Liasongehirn‘ oder ‚dem höchsten Gehirnmechanismus‘ interagieren. Wie wir deutlich zu machen versuchten, besteht ihr verdeckter Cartesianismus in erster Linie darin, dass sie dem Gehirn eine Vielzahl psychischer Funktionen zuordnen, die der Dualismus dem Geist zuordnete. Dazu gehört, dass sie den mereologischen Fehlschluss in den Neurowissenschaften begehen, mit dem wir uns im dritten Kapitel auseinandergesetzt haben. Darüber hinaus behalten sie die logischen Strukturen oder Formen der cartesianischen Erklärungen der charakteristischen psychischen Funktionen der Menschen bei. Im Anschluss werden wir diesen Punkt kurz rekapitulieren. Cartesianismus in der Art, die Wahrnehmung zu erklären Erstens akzeptieren die meisten Neurowissenschaftler im Falle der Wahrnehmung nicht nur die von Galilei, Descartes und Locke getroffene Unterscheidung zwischen primären und sekundären Qualitäten, sondern auch eine Form des Repräsentationalismus, die für den cartesianischen und gleichfalls für den lockeschen Empirismus typisch ist (siehe Kapitel 4). Denn sie entfalten den Gedanken, dass es sich bei dem, was wir wahrnehmen, um Bilder oder Repräsentationen einer ‚Außenwelt‘ handelt, die durch die Reizung der Sinnesorgane hervorgebracht werden (im Geist oder im Gehirn). Cartesianismus in der Art, das Gedächtnis zu erklären Zweitens ist die neurowissenschaftliche Erforschung des Gedächtnisses nachvollziehbarerweise der Ansicht verpflichtet, dass Erinnerungen im Gehirn gespeichert werden. Dieser Konzeption liegt die Spur-Theorie zugrunde, die bis zu Aristoteles zurückreicht. An dieser Stelle dürfte es reizvoll sein, die Ähnlichkeiten der Konzeption mit der cartesianischen Theorie herauszustellen (und das, was sie von ihr unterscheidet). Denn Descartes dachte, dass die Funktionen, die Aristoteles und die Scholastiker der ‚sensitiven Seele‘ zuschrieben, einschließlich des Gedächtnisses oder der ‚Speicherung‘ sensorischer Eindrücke oder Bilder, vollständig in rein mechanischer, materieller Hinsicht erklärt werden können. In seiner Abhandlung über den Menschen schrieb er:
316
8 Wollen und Willkürbewegung
Ich wünsche, dass man schließlich alle Funktionen, die ich dieser Maschine [dem Körper] zugeschrieben habe, aufmerksam beachte, z. B. die Verdauung der Nahrung, das Schlagen des Herzens und der Arterien, [. . .], die Aufnahme des Lichts, der Töne, der Gerüche, des Geschmacks, der Wärme und anderer solcher Qualitäten über die äußeren Sinnesorgane, den Eindruck ihrer Wahrnehmungen auf das Organ des Sensus communis und die Einbildungskraft, die Bewahrung oder Verankerung dieser Ideen im Gedächtnis [. . .]. Ich wünsche, dass man bedenke, dass die Funktionen in dieser Maschine alle von Natur aus allein aus der Disposition ihrer Organe hervorgehen, nicht mehr und nicht weniger, als die Bewegungen einer Uhr oder eines anderen Automaten von der Anordnung ihrer Gewichte und ihrer Räder abhängen. Daher ist es in keinster Weise erforderlich, hier für diese (die Maschine) eine vegetative oder sensitive Seele oder ein anderes Bewegungs- und Lebensprinzip anzunehmen als ihr Blut und ihre Lebensgeister. (AT XI, 202, unsere Hervorhebung)
Sieht man von der wunderlichen Physiologie ab, gibt es in dieser Konzeption des ‚körperlichen Gedächtnisses‘ kaum etwas, dem die zeitgenössischen Neurowissenschaftler widersprechen wollten. Dissens gäbe es jedoch hinsichtlich der Descartes’schen Konzeption des ‚intellektuellen Gedächtnisses‘, das einzig dem Menschen eignet, der über den Geist verfügt (oder über die ‚rationale Seele‘) und der demnach Begriffe im Geist speichert. Die cartesianische Konzeption des intellektuellen Gedächtnisses zurückzuweisen, weil sie dieses nicht im Körper verankere, ist eine Sache. Eine andere ist es jedoch, die Strukturmerkmale der cartesianischen Konzeption des körperlichen Gedächtnisses beizubehalten, und auch diese hat wohl eine Zurückweisung verdient. Denn, wie in Kapitel 5 dargelegt, die hier veranschlagten Konzeptionen der Gedächtnisspeicherung und der Gedächtnisspuren sind nicht kohärent. Gewiss ist das Gedächtnis eine Fähigkeit, aber keine des Reproduzierens von Kopien früherer Eindrücke, Bilder oder Vorstellungen. Cartesianismus in der Konzeption von Vorstellungsbildern als inneren Bildern Drittens wird die Konzeption von Vorstellungsbildern als privaten, inneren Bildern, die nur das Subjekt sehen könne, von den Neurowissenschaftlern allgemein akzeptiert. Vorstellungsbilder werden für gewöhnlich als Kopien früherer Eindrücke aufgefasst. Bei diesen Bildern handelt es sich angeblich um solche, die man abtasten, untersuchen und herumdrehen und deren Merkmale wie die Merkmale eines physisch-materiellen Bildes unterschieden oder übersehen werden können (siehe Kapitel 6). Es sei nochmals gesagt, dass diese Konzeption die Irrtümer wiederholt, die Descartes sich hat zuschulden kommen lassen. In seinem Gespräch mit Burman behauptet er: Wenn äußere Gegenstände auf meine Sinne einwirken, in ebendiesen ihre Idee oder besser ihre Gestalt abbilden, und dann der Geist sich diesen in der Zirbeldrüse dadurch erzeugten Bildern zuwendet, sagt man, dass er sinnlich wahrnimmt. Wenn aber jene Bilder in der Zirbeldrüse nicht von den äußeren Dingen abgebildet werden, sondern vom Geiste selbst, der bei Abwesenheit äußerer Dinge diese im Gehirn entwirft und zur Darstellung bringt, dann ist das eine Vorstellung der Einbildungskraft. Demnach besteht der Unterschied zwischen
8.3 Bestandsaufnahme
317
Einbildungskraft und Sinneswahrnehmung nur darin, dass bei dieser die Bilder von äußeren Gegenständen herrühren, die auch gegenwärtig sind, in jener aber vom Geiste, ohne äußere Dinge und gleichsam bei geschlossenen Fenstern. (AT V, 162)
Denn auch hier werden die Bilder der Einbildungs- bzw. Vorstellungskraft genau wie externe Bilder aufgefasst, als externe Bilder, die sich ‚innen‘ befinden. Wir haben es hier mit einem Teil des cartesianischen Erbes zu tun, das die Neurowissenschaften loswerden sollten, wie wir bereits darlegten. Cartesianismus in der Konzeption der Emotionen Viertens muss erwähnt werden, dass, obgleich die gegenwärtige neurowissenschaftliche Forschung zu Emotionen in erster Linie unter dem Einfluss der fehlerhaften JamesLange-Theorie steht (wie wir in Kapitel 7 gesehen haben), die James’sche Emotionskonzeption selbst cartesianischer Abstammung ist. Wie dargelegt behauptet LeDoux, dass es sich bei „den Gehirnzuständen und Körperreaktionen um die elementaren Tatsachen einer Emotion handelt“ und dass die bewussten Gefühle ‚Beigaben‘ sind (siehe 7.2.1). Damasio vertritt die Ansicht, dass eine Emotion „eine Reihe von Veränderungen des Körperzustands [ist], die mit bestimmten Vorstellungsbildern, die ein spezifisches Gehirnsystem aktiviert haben, verknüpft sind“ und dass „das Fühlen einer Emotion [. . .] im Wesentlichen die Erfahrung solcher Veränderungen in Juxtaposition zu den Vorstellungsbildern [ist], die den Kreislauf in Gang gesetzt haben“, woraus unserer Wahrnehmung oder Vorstellungskraft „die Erkenntnis unseres viszeralen und muskuloskeletalen Zustands“ erwächst. Mit dieser Konzeption wiederholen sie einige der Irrtümer der cartesianischen Konzeption der Leidenschaften der Seele „als die Wahrnehmungen, Empfindungen oder Emotionen der Seele, die ihr in besonderer Weise zugehören und die durch die Bewegung der Lebensgeister veranlasst, unterstützt und verstärkt werden.“341 Laut Descartes rühren die Leidenschaften im Allgemeinen unmittelbar von einer Erregung im Herz, im ganzen Blut und in den Lebensgeistern her,342 die ein geistiges Ereignis – die erfahrene Emotion – in der Seele hervorruft. Die unmittelbare körperliche Ursache einer Emotion kann selbst durch eine Wahrnehmung eines bestimmten (Angst machenden, anziehenden etc.) äußeren Objekts hervorgerufen werden. Genau wie Descartes versäumen es die Neurowissenschaftler der Gegenwart gemeinhin, die Ursachen einer Emotion von ihren Objekten zu unterscheiden. Cartesianismus in der Art, die Willkürhandlung zu erklären Fünftens ist die Konzeption der Willkürhandlung, die für die neurowissenschaftliche Forschung der Gegenwart typisch ist, von eben dem Bild der Willkürlichkeit inspiriert, 341 342
Descartes, Die Leidenschaften der Seele, I-27. Ibid., I-46.
318
8 Wollen und Willkürbewegung
das die cartesianische Reflexion (und die des britischen Empirismus) anregte. Bei Willensäußerungen handelt es sich laut Descartes um Handlungen der Seele. Eine Unterklasse von ihnen kommt in unseren Körpern ans Ziel, „wie wenn allein daraus, dass wir gehen wollen, folgt, dass unsere Beine sich bewegen und wir voranschreiten.“343 „Alle Tätigkeit der Seele besteht vollständig darin, dass sie allein dadurch, dass sie irgendetwas will, bewirkt, dass die kleine Hirndrüse, mit der sie eng verbunden ist, sich in der Art bewegt, wie erforderlich ist, um die Wirkung hervorzurufen, die diesem Wollen entspricht.“ Daher „bewirkt das Wollen, wenn man gehen oder seinen Körper in einer anderen Art bewegen will, dass die Hirndrüse die Lebensgeister in diejenigen Muskeln bringt, die hierzu dienlich sind.“344 Wie oben festgehalten, betrachtet Libet eine Willkürhandlung als eine Körperbewegung, die von einem Wollen verursacht wird. Angeblich fand er heraus, dass das Wollen selbst ein Akt des Gehirns ist, den es ausführt, bevor das menschliche Wesen irgendein Bewusstsein davon hat, dass es seine Gliedmaßen in Übereinstimmung mit diesem Wollen zu bewegen begehrt. An dieser Stelle schreibt er dem Gehirn die Wollensakte zu, die Descartes dem Geist zuschrieb. Das große Missverständnis, das Willkürhandlungen als von Willensakten hervorgerufene Bewegungen ausgibt, bleibt indes bestehen. Und genau dieses muss ausgemerzt werden, wie wir gesehen haben. Wir hoffen, dass wir den Krypto-Cartesianismus der gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Reflexionen über die wesentlichen psychischen Funktionen des Menschen in diesem Kapitel und in den vorherigen hinreichend verdeutlichen konnten. Allerdings hat sich dieser Krypto-Cartesianismus sogar noch tiefer in die gegenwärtigen neurowissenschaftlichen und kognitionswissenschaftlichen Reflexionen über das Bewusstsein eingewurzelt. Diesem Problem wenden wir uns im dritten Teil zu.
343 344
Ibid., I-18. Ibid., I-41, 43.
Teil III Bewusstsein und die zeitgenössischen Neurowissenschaften: Eine Analyse
9 Intransitives und transitives Bewusstsein 9.1 Bewusstsein und das Gehirn Es ist wichtig, zwischen begrifflichen und empirischen Problemen des Bewusstseins zu unterscheiden Die Probleme, die das Bewusstsein und seine Natur betreffen, stehen seit zwei Jahrzehnten im Zentrum neurowissenschaftlicher, philosophischer und kognitiver wissenschaftlicher Untersuchungen. Führende Neurowissenschaftler haben gar nahegelegt, dass „das vielleicht größte ungelöste Problem [. . .] in der gesamten Biologie darin besteht, das Bewusstsein zu analysieren“.345 Es gibt zweifellos eine Menge mit dem Bewusstsein in Zusammenhang stehende Probleme. Bei einigen handelt es sich um empirische Probleme, die der wissenschaftlichen Untersuchung zugänglich sind. Andere sind begrifflicher Art, die auch nur mit Hilfe der Begriffsanalyse angegangen werden können. Es ist sehr wichtig, diese zwei Problemarten auseinanderzuhalten, denn wenn ein begriffliches Problem mit einem empirischen verwechselt wird oder mit ihm verschmilzt, muss es einem zwangsläufig außerordentlich undurchdringlich vorkommen – und das ist es tatsächlich, denn es erweist sich den empirischen Untersuchungsmethoden gegenüber als unzugänglich. Und wenn ein empirisches Problem ohne angemessene begriffliche Klarheit untersucht wird, ergeben sich ebenso zwangsläufig abwegige Fragen und schließt sich aller Wahrscheinlichkeit nach eine auf Abwege führende Forschung an. Denn in dem Maße, in dem die Begriffe unklar sind, werden es auch die Fragen selbst sein. In der folgenden Erörterung (Kapitel 9–12) wollen wir versuchen, Aufschluss über den Begriff des Bewusstseins zu geben, und wir werden uns um den Nachweis bemühen, dass die Klärung der Begriffsstrukturen des Bewusstseinsdiskurses sich maßgeblich auf die gegenwärtige neurowissenschaftliche Debatte auswirkt. Die Zuschreibung von Bewusstsein zum Gehirn ist ein mereologischer Fehler Neurowissenschaftler neigen dazu, dem Gehirn Bewusstsein zuzuschreiben. Gerald Edelman und Guilio Tononi behaupten, dass das „Bewusstsein als ein spezieller Gehirnprozess hervortritt“; und zwar soll es sich um „eine besondere Art des physischen Geschehens [handeln], das in der Struktur und Dynamik bestimmter Gehirne seinen Ausgang T. D. Albright, T. M. Jessell, E. R. Kandel und M. I. Posner, ‚Neural science: a century of progress and the mysteries that remain‘, review supplement to Cell, 100 (2000) und Neuron, 25 (2000), S. 40. 345
322
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
nimmt“.346 Ian Glynn stimmt mit John Searle (siehe unten) in der Annahme überein, dass die geistigen Phänomene „selbst Eigenschaften des Gehirns sind“.347 Susan Greenfield behauptet, dass das Bewusstsein „eine emergente Eigenschaft nicht spezialisierter Neuronengruppen ist, die bezüglich eines Epizentrums fortlaufend variieren“.348 Rudolfo Llinás ist der Ansicht, dass es sich beim Bewusstsein (oder der ‚Geistigkeit‘ [‚mindedness‘], wie er sagt) um einen funktionalen Zustand des Gehirns handelt, um einen „von mehreren globalen physiologischen Rechenzuständen, die das Gehirn erzeugen kann“,349 und Michael Gazzaniga versichert, dass das Bewusstsein „eine Eigenschaft eines Nervennetzwerks ist“.350 Viele neurowissenschaftlich interessierte Philosophen sind einer Meinung. John Searle vertritt die Ansicht, dass „mein gegenwärtiger Bewusstseinszustand [. . .] eine Eigenschaft meines Gehirns [ist]“.351 Ähnlich behauptet John McGinn, dass „das Gehirn irgendeine Eigenschaft hat, die ihm Bewusstsein verleiht“, und fragt sich, was das Gehirn „zum alleinigen Bewusstseinsorgan“352 werden ließ. Diese Konzeption ist insofern ein besonders gutes Beispiel für den ‚mereologischen Fehlschluss in den Neurowissenschaften‘, als sie dem Gehirn – das heißt einem Teil eines Lebewesens – ein Attribut zuschreibt, das nur dem Lebewesen als Ganzem sinnvoll zugeschrieben werden kann. Neurowissenschaftler und Philosophen vertreten die Ansicht, dass wir kaum etwas darüber wissen, was das Bewusstsein ist Viele Wissenschaftler und auch Philosophen sind der Ansicht, dass wir, was das Bewusstsein angeht, momentan nahezu im Dunkeln tappen. Viel zitiert wurde Stuart Sutherlands Bemerkung, dass das „Bewusstsein ein faszinierendes, aber schwer fassbares Phänomen ist; es ist unmöglich, genau zu sagen, was es ist, was es tut oder warum es sich entwickelte“.353 Kognitionswissenschaftler wie Phillip Johnson-Laird beteuern, dass 346
G. M. Edelman und G. Tononi, Consciousness: How Matter Becomes Imagination (Allen Lane, London, 2000), S. xii und 14 [dt. Gehirn und Geist (Beck, München, 2002), S. 27]. 347 I. Glynn, An Anatomy of Thought (Weidenfeld and Nicolson, London, 1999), S. 396. 348 S. Greenfield, ‚How might the brain generate consciousness‘, in S. Rose (Hg.), From Brains to Consciousness? (Penguin Books, Harmondsworth, 1998), S. 214. 349 R. Llinás, ‚“Mindedness“ as a functional state of the brain‘, in C. Blakemore und S. Greenfield (Hg.), Mindwaves (Blackwell, Oxford, 1987), S. 339. 350 Michael S. Gazzangia, ‚Consciousness and the cerebral hemispheres‘, wieder abgedr. in Gazzangia (Hg.), The New Cognitive Neurosciences, 4. Aufl. (MIT Press, Cambridge, MA, 1997), S. 1396. 351 J. R. Searle, Minds, Brains and Science – the 1984 Reith Lectures (BBC Publications, London 1984), S. 25 [dt. Geist, Hirn und Wissenschaft – die Reith Lectures 1984 (Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1992), S. 24]. 352 C. McGinn, ‚Could a machine be conscious?‘, in Blakemore und Greenfield (Hg.), Mindwaves, S. 281, 285. 353 Stuart Sutherland, Dictionary of Psychology (Macmillan, London, 1989).
9.1 Bewusstsein und das Gehirn
323
„niemand weiß, was das Bewusstsein ist oder ob es irgendeinen Zweck erfüllt“,354 und andere Wissenschaftler wie David Chalmers verkünden unvermindert wirkungsträchtig, dass unsere Unwissenheit hinsichtlich des Bewusstseins möglicherweise „das größte unbezwungene Hindernis für ein wissenschaftliches Verständnis des Universums ist“.355 Die angebliche Unwissenheit wird im Allgemeinen durch einen abwegigen Privatheitsgedanken erklärt Wie ist diese angebliche Unwissenheit, was das Bewusstsein und seine Natur angeht, zu erklären? Daniel Dennett, ein führender Philosoph und Vertreter der Kognitionswissenschaft, legt nahe, dass die Wissenschaft, obwohl sie die Geheimnisse des Magnetismus, der Photosynthese, der Verdauung und Fortpflanzung lüften konnte, bis dato nicht in der Lage war, die Natur des Bewusstseins zu ergründen, und zwar aus folgenden Gründen: die Einzelfälle des Magnetismus oder der Photosynthese oder der Verdauung sind prinzipiell jedem Beobachter gleichermaßen zugänglich, wenn ihm die entsprechenden technischen Vorrichtungen zur Verfügung stehen, allerdings scheint jeder einzelne Bewusstseinsfall einen bevorzugten oder privilegierten Beobachter zu haben, dessen Zugang zum Phänomen ganz anders und besser ist als der jedes anderen, unabhängig davon, welche technischen Vorrichtungen sie beanspruchen. Unter anderem deshalb haben wir bisher nicht nur keine gute Bewusstseinstheorie entwickelt, sondern verfügen noch nicht einmal über eine klare und unumstrittene vor-theoretische Beschreibung des mutmaßlichen Phänomens.356
Auch Searle argumentierte, dass „mir die Bewusstseinsaspekte des Gehirns auf eine Art und Weise zugänglich sind, wie sie Ihnen nicht zugänglich sind. Und Ihr gegenwärtiger Bewusstseinszustand ist eine Eigenschaft Ihres Gehirns und seine Bewusstseinsaspekte sind Ihnen auf eine Art und Weise zugänglich, wie sie mir nicht zugänglich sind.“357 Der herausragende Psychologe Richard Gregory behauptet ganz ähnlich, dass „über das Bewusstsein kaum eine Auseinandersetzung möglich ist, weil es einzigartig privat ist: Wir verfügen also über keinerlei Analogien aus dem Bereich der von uns geteilten Weltbegriffe, die irgend angemessen wären, unsere Bewusstseinserfahrung zu beschreiben.“358 Und wir haben bereits gesehen (3.4), dass Neurowissenschaftler wie Damasio, Edelman und Tononi der Meinung sind, dass es sich beim Bewusstsein um „ein vollkommen privates Phänomen der Ich-Perspektive“ handelt und dass „Privatheit eine jener fundamentalen Aspekte der bewussten Erfahrung [ist], die all ihre Erscheinungsformen gemeinsam haben“. Nach dieser weithin akzeptierten Konzeption erklärt sich unsere angebliche Un354
P. N. Johnson-Laird, The Computer and the Mind (Fontana Press, London, 1988), S. 353. D. J. Chalmers, The Conscious Mind (Oxford University Press, Oxford, 1996), S. xi. 356 D. Dennett, ‚Consciousness‘, in R. L. Gregory (Hg.), The Oxford Companion to the Mind (Oxford University Press, Oxford, 1989), S. 160. 357 Searle, Minds, Brains and Science, S. 25 [dt. Geist, Hirn und Wissenschaft, S. 24]. 358 R. L. Gregory, Mind in Science (Penguin Books, Harmondsworth, 1984), S. 480. 355
324
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
wissenheit damit, dass jede Person privilegierten Zugang zu ihrem Bewusstsein, nicht aber zu dem anderer hat. Bewusstsein ist demnach kein öffentlich, sondern ein privat beobachtbares Phänomen und unterscheidet sich in dieser Hinsicht von den Phänomenen, die die Wissenschaften üblicherweise erforschen. Denn diese widmen sich, wie oft gesagt wird, intersubjektiv verifizierbaren Phänomenen. Manche Wissenschaftler sind der Ansicht, dass dieser vorgebliche Unterschied ein methodologisches Problem aufwirft.359 Unsere Ausführungen in Kapitel 3 dürften deutlich gemacht haben, dass diese Konzeption von Privatheit verworren ist. Sie verschmilzt die begrifflichen Wahrheiten, dass es nichts dergleichen gibt wie ein Bewusstsein, das nicht jemandes Bewusstsein ist, und dass manche Bewusstseinszustände manchmal unterdrückt oder verborgen gehalten werden können, mit den begrifflichen Konfusionen, wonach das Bewusstsein einer Person in irgendeinem tieferen Sinne privat und nur ihr zugänglich ist, sodass nur sie seine Wahrheiten unmittelbar (er)kennen kann. Neurowissenschaftler und Philosophen sind der Meinung, dass das Bewusstsein Rätsel aufgibt Unwissenheit ist eine Sache, Rätselhaftigkeit eine andere. Die Wissenschaftler und Philosophen bekennen nicht nur ihre bedauerliche Unwissenheit, sie unterstellen gemeinhin auch, dass das Bewusstsein außerordentlich rätselhaft ist. Crick und Koch bringen vor, dass es sich beim Bewusstsein um „den rätselhaftesten Aspekt“ des Gehirn-GeistProblems handelt.360 Das Bewusstsein, so Glynn, „ist bis heute ein Rätsel“.361 Psychologen pflichten bei: Das Bewusstsein, so behauptet Frisby, „bleibt trotz eines beachtlichen Wissenszuwachses über Wahrnehmungsmechanismen ein großes Rätsel“.362 Philosophen und Kognitionswissenschaftler stimmen dem zu: Dennett behauptet, dass das Bewusstsein die „rätselhafteste Eigenschaft unseres Geistes“ ist,363 und Chalmers versichert, dass „die bewusste Erfahrung die alltäglichste und zugleich die rätselhafteste Sache der Welt ist“.364 Bewusstsein hat eine ‚subjektive‘ Ontologie oder eine ‚Ontologie der ersten Person‘: J. R. Searle, ‚The future of philosophy‘, Philosophical Transactions of the Royal Society, B 354 (1999), S. 2074. 360 F. Crick und C. Koch, ‚Mind and brain‘, Scientific American, 267 (Sept. 1992), S. 111. Interessanterweise schreibt Crick an anderer Stelle von ‚unserem seltsamen Gefühl des Bei-Bewusstsein-seins‘ (Of Molecules and Men (University of Washington Press, Seattle, 1966)). Ist bei Bewusstsein sein jedoch ein Gefühl? Ist ‚sich dieser oder jener Sache bewusst zu sein‘ ein Gefühl? Und ist daran irgendetwas seltsam? Was wäre, wenn dieses ‚seltsame Gefühl‘ verschwände? Würde man das Bewusstsein verlieren, d. h. bewusstlos werden? 361 Glynn, Anatomy of Thought, S. 193. 362 J. P. Frisby, Seeing: Illusion, Brain and Mind (Oxford University Press, Oxford, 1980), S. 11. 363 Dennett, ‚Consciousness‘, S. 160. 364 Chalmers, Conscious Mind, S. 3. 359
9.1 Bewusstsein und das Gehirn
325
Was ein Rätsel ist; der Unterschied zwischen dem Rätselhaften und dem Erhabenen Vorsicht ist geboten, wenn etwas als ein unergründliches Rätsel deklariert wird. Es gibt zahlreiche Gegenstände, von denen Wissenschaftler nichts wissen, und viele empirische Fragen, auf die sie die Antworten nicht kennen. Und manchen Gegenständen begegnen sie nicht nur mit Unwissenheit, sondern haben keine klare und vielleicht nicht einmal eine vage Vorstellung davon, wie sie die Fragen, die sie umtreiben, beantworten sollen. Diese Gegenstände und Fragen können dadurch geadelt werden, dass man sie ‚Rätsel‘ nennt, obgleich man selbstverständlich dafür Sorge tragen sollte, solche ‚Rätsel‘ – das heißt Formen des Nichtwissens – nicht mit dem Wunderbaren oder Ehrfurcht gebietenden zu verwechseln. Denn viele wunderbare Dinge (die Schönheit und Fruchtbarkeit der Natur etwa oder die Pracht großer Kunstwerke) sind nicht im Geringsten rätselhaft, und die Bewunderung muss nicht mit Unwissenheit einhergehen. Und auch dem, was in unseren Herzen Ehrfurcht auslöst (wie großartiger Heroismus oder Selbstaufopferung oder erhabene Berggipfel und rasende Stürme), stehen wir normalerweise nicht unwissend gegenüber. Der Unterschied zwischen empirischen Rätseln und Begriffsverwirrungen Man muss nicht nur vermeiden, dass man die Dinge, die aufgrund von Unwissenheit verwirrend rätselhaft sind und unergründlich scheinen, mit den Wunderbaren oder Ehrfurcht gebietenden gleichsetzt, sondern hat auch darauf zu achten, dass die Rätsel, vor die uns die Natur infolge unserer Unwissenheit stellt, nicht mit den Verwirrungen durcheinandergeraten, die infolge unseres Begriffswirrwarrs entstehen. Vielleicht erklärt man die Dinge vorschnell zu ‚Rätseln‘. Denn in manchen Fällen haben wir nicht nur keine klare Vorstellung davon, wie die Wahrheit über einen bestimmten Gegenstand enthüllt werden kann, sondern durch und durch konfuse Vorstellungen. Eine solche Konfusion muss, was die widerspenstigen Phänomene betrifft, nicht mit empirischer Unwissenheit und empirischem Missverstehen oder einer inadäquaten Theorie und inadäquatem theoretischem Verständnis einhergehen, sondern es kann sich bei ihr um eine Begriffsverwirrung handeln. Zwischen einer Begriffsverwirrung [conceptual confusion] und einer fehlerhaften Tatsachenfeststellung [error of fact] besteht ein Unterschied. Diese bringt falsche Überzeugungen mit sich, jene aber Inkohärenz. Wer mit Kepler davon ausgeht, dass es nur fünf Planeten im Sonnensystem gibt, oder mit Descartes davon, dass die Zirbeldrüse ein Organ im Gehirn ist, in dem die Signale von beiden Augen oder Ohren zusammenlaufen, lässt sich eine fehlerhafte Tatsachenfeststellung zuschulden kommen. Einer Begriffsverwirrung aber erliegt, wer davon ausgeht, dass der Geist eine Art von Entität ist (entweder eine immaterielle Substanz, wie Descartes dachte, oder das Gehirn, wie viele dies heutzutage annehmen) oder dass das Gehirn denkt, wahrnimmt oder rechnet (wie viele Neurowissenschaftler glauben) oder dass es sich beim Selbstbewusstsein um das Bewusstsein eines Selbst oder eines ‚Ich‘ handelt (siehe Kapitel 12). Eine Be-
326
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
griffsverwirrung geht mit der Überschreitung der Sinngrenzen einher und die Überschreitung der Sinngrenzen resultiert in Unsinn – das heißt in einer Abfolge von Worten, die keinen Sinn ergibt. Mitunter ist es nicht zu übersehen, dass wir es mit Unsinn zu tun haben: ‚Es hat gut‘ oder ‚Die Zahl 3 verliebte sich in die Zahl 2 und sie wurden in Welt drei verheiratet‘. Der Unsinn aber, den aufzuspüren der Philosophie zukommt, liegt im Verborgenen. Insbesondere die Begriffsverwirrungen, die uns in unseren Reflexionen über den Geist und das Gehirn ‚behexen‘, scheinen uneingeschränkt Sinn zu ergeben. Es kann nur allzu leicht geschehen, dass man begriffliche Verwirrung mit empirischer Unwissenheit verwechselt. Passiert uns das, nehmen wir irrtümlicherweise an, dass uns lediglich Information fehlt und wir eine bessere Theorie brauchen, die das Phänomen erklärt, das uns in seinen Bann schlägt. Was uns allerdings fehlt und was wir brauchen, ist mehr Klarheit, und zwar nicht einmal so sehr im Hinblick auf das Phänomen als hinsichtlich der Begriffe, die wir verwenden, um unseren Mangel an Verständnis zu artikulieren. Wir sind allzu sehr geneigt, die Knoten, die wir versehentlich in unser Verständnis geknüpft haben, auf die Phänomene zu übertragen und uns vorzustellen, dass diese außerordentlich rätselhaft sind und sich dem menschlichen Verstehen widersetzen. Einige Wissenschaftler haben sogar verkündet, dass es sich beim Bewusstsein um ein Rätsel handelt, das prinzipiell jenseits des Fassungsvermögens des menschlichen Geistes angesiedelt ist. Ein schlechter Navigator in den Begriffsgewässern aber ist derjenige, der – wenn er auf See ist – verkündet, das Land sei unerreichbar. Mit dieser Art zu denken macht man aus der Verwirrung, die von unseren unzulänglichen Begriffsanstrengungen herrührt, ein in der Natur der Dinge liegendes unergründliches Geheimnis. Meist sind es Begriffsverwirrungen über das Bewusstsein, die den Eindruck erwecken, dass wir es bei ihm mit einem Rätsel zu tun haben Wir werden argumentieren, dass der weit verbreitete Eindruck, bei der Bewusstseinsnatur handele es sich um ein tiefgründiges Rätsel, viel eher von Begriffsverwirrungen denn von faktischem Unwissen herrührt. Dass es überhaupt bewusste Kreaturen gibt, ist wundervoll – und es ist gut, wenn wir uns einen Sinn für das Wunder der Existenz des Lebens im Allgemeinen und der bewussten Lebensformen im Besonderen bewahren. Zwar gibt es noch immer eine ganze Menge, was wir von den neuronalen Grundlagen des Bewusstseins in seinen unterschiedlichen Formen nicht wissen. Die zahlreichen Verlautbarungen der Neurowissenschaftler, Wissenschaftler und Philosophen machen allerdings deutlich, dass ihr Sinn für das Rätselhafte nicht allein dem faktischen Unwissen entstammt, sondern, wie wir zu zeigen versuchen werden, dem Begriffswirrwarr. Dieses lässt sich beseitigen und auflösen, indem man sich Klarheit über unsere Begriffe verschafft und der Verrätselung ein Ende macht. Dann erfassen wir einerseits, was wir im Tatsachenbereich nicht wissen, und entwickeln andererseits einen rechten Sinn für die Wunder und Zufälle der Natur.
9.1 Bewusstsein und das Gehirn
327
Das Subjekt des menschlichen Bewusstseins ist die Person, nicht das Gehirn Wir sollten uns gleich zu Beginn an einige simple begriffliche Wahrheiten erinnern, die wir in den vorherigen Darlegungen hervorgehoben haben. Nicht das Gehirn ist bei Bewusstsein oder nicht bei Bewusstsein bzw. bewusstlos, sondern die Person, um dessen Gehirn es sich handelt. Nicht das Gehirn des Dozenten ist sich einer Sache bewusst, sondern der Dozent, dem das Ticken der Uhr oder das Interesse oder die Langeweile seiner Zuhörer bewusst wird und der sich dessen bewusst ist. Das Gehirn ist nicht das Bewusstseinsorgan. Man sieht mit seinen Augen und hört mit seinen Ohren, aber man ist nicht mit seinem Gehirn bei Bewusstsein. Am Bewusstsein ist nichts einzigartig privat. Nichts ist privat oder unbeobachtbar in dem Fall, da ein Patient nach einer Operation sein Bewusstsein wiedererlangt; und es ist auch nichts privat in dem Fall, da ein Patient sich der Krankenpflegerin bewusst wird, die auf Zehenspitzen durch das Zimmer läuft – dass er sich ihrer bewusst wurde, offenbart sich in seinem erkennenden Lächeln, und wessen er sich bewusst wurde, ist für jeden Beobachter unübersehbar. Eine Person, die bei Bewusstsein ist, hat dadurch keinen Zugang zu irgendetwas, und es ist eine Verwirrung, anzunehmen, dass wir unser eigenes Bewusstsein in einzigartiger Weise beobachten können. Die Begriffe, die wir üblicherweise verwenden, wenn wir über das Bewusstsein sprechen, sind keineswegs unzureichend, obwohl es sicherlich ungewöhnliche Phänomene gibt, für die keine gewöhnlichen oder gebräuchlichen Worte zur Verfügung stehen und für die die Psychologie ein zweckdienliches Fachvokabular einführte (z. B. ‚epileptischer Automatismus‘). Und es ist keine prinzipielle Schwierigkeit damit verbunden, das ‚mutmaßliche Phänomen‘ des Bewusstseins zu beschreiben. Das Phänomen oder vielmehr die Phänomene werden keineswegs gemutmaßt – es ist keine Mutmaßung, dass es sich bei Menschen und vielen Tierarten um bewusste Lebewesen handelt, dass sie für gewöhnlich ein Bewusstsein von der Merkmalsstruktur ihrer Umgebung haben und Erfahrungssubjekte sind – das heißt, dass sie Schmerzen leiden, etwas wahrnehmen, verärgert, zufrieden oder ängstlich sind. Es ist auch keine Mutmaßung, dass Menschen anders als bloße Tiere selbstbewusste Wesen sind, in dem Sinn, dass sie die Fähigkeit haben, über ihre eigenen Geisteszustände und Gedanken, ihr Verlangen, ihre Handlungsmotive, ihre Vorlieben und Abneigungen, ihre Eigenarten und Dispositionen und ihre Lebensgeschichte nachzudenken und sich dieser bewusst zu sein. Diese Phänomene sind ohne Weiteres beschreibbar. Man muss sich jedoch darüber im Klaren sein, welche Phänomene zu Recht als ‚Bewusstseinsphänomene‘ charakterisiert werden. Und schließlich ist es nicht schwer, die Frage nach dem Wozu des Bewusstseins, insoweit diese sinnvoll ist, zu beantworten. Eine unklare Begrifflichkeit ist jedoch ein guter Nährboden für unangebrachte Verrätselungen. In diesem Kapitel geht es darum, den Alltagsbegriff des Bewusstseins zu klären. Seinem Anwendungsspektrum sind viel engere Grenzen gesetzt als demjenigen, das die Neuro- und Kognitionswissenschaftler intendieren, wenn sie vom Terminus ‚Bewusst-
328
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
sein‘ sowie von verwandten Termini Gebrauch machen. Denn sie neigen dazu, den Terminus auf das gesamte Spektrum der menschlichen Wacherfahrung (und darüber hinaus) anzuwenden. Im nächsten Kapitel werden wir einige der Gründe für diese Anwendungserweiterung der Termini ‚bewusst/bei Bewusstsein‘ und ‚Bewusstsein‘ untersuchen. Man kommt der angestrebten Klarheit einen Schritt näher, wenn man transitives und intransitives Bewusstsein voneinander abgrenzt. Bewusstsein ist transitiv, wenn es Bewusstsein von etwas oder etwas anderem ist oder Bewusstsein, dass etwas oder etwas anderes so oder anders ist. Das intransitive Bewusstsein hingegen hat kein Objekt. Es ist eine Sache des Bei-Bewusstsein-Seins oder des Wachseins, in Abgrenzung zum Nichtbei-Bewusstsein-Sein bzw. zur Bewusstlosigkeit und zum Schlafen.
9.2 Intransitives Bewusstsein Das intransitive Bewusstsein dem Schlaf und der Bewusstlosigkeit gegenübergestellt Beim intransitiven Bewusstsein handelt es sich um etwas, das eine Person oder ein Tier verlieren (durch einen Ohnmachtsanfall oder durch Narkose) und folglich auch zurückgewinnen (wenn sie oder es das Bewusstsein wiedererlangt) kann. Wenn ‚bei Bewusstsein sein‘ [‚to be conscious‘] sich von ‚wach sein‘ [‚to be awake‘] überhaupt unterscheidet, dann nur insofern, als die Zuschreibung des Wachseins zu einem Wesen impliziert, dass es zuvor schlief und nicht bewusstlos war. ‚Ist A wach?‘ ist eine Frage, die eher ins häusliche Milieu gehört, die Frage ‚Hat A sein Bewusstsein wiedererlangt?‘ hört man normalerweise in einem Krankenhaus. Die Bewusstlosigkeit unterscheidet sich vom Schlaf. Sie kann durch Fieber, Anästhetika, Alkohol etc. ausgelöst werden. Es handelt sich bei ihr um einen Zustand, in dem eine Person nicht nur nicht in der Lage ist, ihre Umgebung wahrzunehmen, sondern sich auch für Reize unempfänglich zeigt, auch wenn Teile ihres Körpers reagieren können, ohne dass sie irgendetwas fühlt. Eine schlafende Person kann im Unterschied zu jemandem, der im Koma liegt, vollkommen betrunken oder anästhesiert ist, durch Schütteln, Lärm, Licht, Hitze oder Kälte geweckt werden. Sie kann auf bestimmte Reize reagieren, ohne wach zu werden – eine schwere Decke wegstrampeln beispielsweise, weil das Bett sich erwärmt. Das Reaktionsspektrum des Schlafenden ist viel größer als das des Bewusstlosen, aber in keinem der beiden Fälle veranschlagen wir irgendein Wahrnehmungsbewusstsein – der Schlafende fühlt sich nicht heiß, wenn er die Decke wegstrampelt, und er sieht das Licht nicht, das ihn aufweckt, obwohl der Lichtreiz sein Aufwachen bewirkt.365 Der Übergang von der BewusstMan könnte freilich sagen, ihm sei ‚unterbewusst‘ heiß, er sehe Licht, höre Geräusche, oder sogar, er fühle, sehe und höre, sei sich dessen oder der Dinge, die er auf diese Weise fühlt, hört und sieht, aber nicht bewusst. Das sind jedoch lediglich unterschiedliche (mehr oder weniger ir365
9.2 Intransitives Bewusstsein
329
losigkeit zum Schlaf ist normalerweise nicht wahrnehmbar (obgleich sie in neuraler Hinsicht unterscheidbar sind), weil es sich dabei um ein Geschehen handelt, in dem ‚absente‘ Potenzialitäten Präsenz gewinnen. Grenzfälle Bewusstlos sein und schlafen, bei Bewusstsein sein und wach sein lassen Grenzfälle zu. Die Alltagssprache hält für sie zahlreiche nichtfachliche Ausdrücke parat. Man kann fast bewusstlos sein, halb bewusstlos, kaum bei Bewusstsein, benommen oder taumelig, halb schlafend oder nicht völlig wach, betäubt, empfindungslos sein etc. Es gibt abnormale Verfassungen, auf die weder ‚bei Bewusstsein‘ noch ‚bewusstlos‘ oder ‚schlafend‘ zutreffen. Manche von ihnen werden mit geläufigen Termini zum Ausdruck gebracht – beispielsweise ‚Delirium‘, ‚hypnotischer Trancezustand‘, ‚Schlafwandeln‘ –, während andere mit Hilfe von Fachausdrücken der Grenzbereichspsychologie bezeichnet werden – zum Beispiel ‚Poriomanie‘ oder ‚epileptischer Automatismus‘. Es obliegt den Neurowissenschaften und der Pharmakologie, die neuronalen Zustände und Prozesse, die mit all diesen Verfassungen einhergehen, aufzudecken und zu erklären. Die Tatsache, dass Menschen und andere tagaktive Lebewesen fast den ganzen Tag über wach oder bei Bewusstsein sind und nicht bewusstlos sind oder schlafen, ist jedoch weder erstaunlich noch rätselhaft. Die Frage ‚Wozu dient das Bewusstsein?‘ wäre schlicht und einfach töricht, zielte sie hierauf. Wenn wir uns darum bemühen, Bereiche wissenschaftlicher Unkenntnis namhaft zu machen, so ist es eher der Schlaf und seine Notwendigkeit, die Kopfzerbrechen bereiten und nach einer Erklärung verlangen, als das Bewusstsein oder Wachsein. Das Subjekt des intransitiven Bewusstseins Nur von den Lebewesen, die bei Bewusstsein sein können, kann man sinnvoll sagen, sie seien bewusstlos, ebenso wie nur von den Lebewesen sinnvoll gesagt werden kann, sie seien wach, von denen sinnvoll gesagt werden kann, sie schliefen. Nur bei einem lebenden Wesen, insbesondere einem gefühlsbegabten, kann man davon sprechen, dass es bei Bewusstsein oder bewusstlos ist. Daher ist es unsinnig, dies von einer Maschine oder einem Baum zu sagen – ein ausgeschalteter Computer ist nicht bewusstlos und er erlangt nicht das Bewusstsein wieder, wenn er erneut in Betrieb genommen wird, und bei einem Baum spricht man nur in übertragenem Sinne davon, dass er im Frühling aus seinem
reführende) Möglichkeiten zur Beschreibung eben der Phänomene, bei denen die gewöhnlichen Kriterien für das Wahrnehmen und Empfinden und auch die für das Nichtwahrnehmen und Nichtempfinden teilweise erfüllt sind.
330
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
Winterschlaf erwacht.366 Folglich sind intransitives Bewusstsein und Bewusstlosigkeit keine Eigenschaften oder Merkmale des Gehirns. Von ihnen kann man nur in Verbindung mit fühlenden Lebewesen sprechen, und wie andere psychologische Termini können sie nur auf das Lebewesen als Ganzes und nicht auf seine Teile angewendet werden. Wenn Neurowissenschaftler ausführen, dass das Gehirn und seine Teile bei Bewusstsein sind, so ergibt dies nur Sinn, sofern wir es hier mit einem synekdochischen oder metonymischen Gebrauch der Worte zu tun haben. In diesem Fall bringt die Wendung einfach einen Aktivitätszustand des Gehirns oder seiner Teile zum Ausdruck, der mit dem Bei-Bewusstsein-Sein eines Lebewesens in systematischem Zusammenhang steht und der als Bedingung der Möglichkeit, bei Bewusstsein zu sein, erkannt wurde. Wenn eine Person, die sich in Narkose befand, sich bewegt, stöhnt und die Augen öffnet, sagen wir, sie habe das Bewusstsein wiedererlangt, sie sei wach. Denn es ist nicht ihr Gehirn, das sich im Bett aufsetzt und um etwas zu trinken bittet, sich umschaut und das Bett verlässt. Die Kriterien dafür, einem Lebewesen Bewusstsein zuzuschreiben – das heißt zu sagen, dass es wach ist –, bestehen in seinen Verhaltensreaktionen auf seine Umgebung, seinen Wahrnehmungs- und Gefühlsreaktionen und seinen zielgerichteten Handlungen. In dieser vorrangig wörtlichen Verwendung ergibt die Zuschreibung des Bewusstseins zum Gehirn keinen Sinn, denn das Gehirn kann weder Gegenstände in seiner Umwelt wahrnehmen, noch kann ihm dies misslingen; nur das Lebewesen ist dazu in der Lage (obgleich es dafür notwendig ist, dass die entsprechenden Bereiche seines Gehirns normal funktionieren, und es ist möglich, dass etwaige Wahrnehmungsfehlfunktionen auf Funktionsstörungen in diesen Bereichen zurückzuführen sind). Das Gehirn kann weder erfreut noch verärgert sein über das, was es sieht, und es kann Gefühle weder mimisch, gestisch oder handelnd manifestieren noch hinter einem Pokerface verbergen.
366
Demnach ist die folgende Bemerkung Searles verworren (The Mystery of Consciousness (Granta Books, London, 1997), S. 209): ‚Ich kann nicht beweisen, dass dieser Stuhl nicht bei Bewusstsein ist. Wenn durch ein Wunder plötzlich alle Stühle Bewusstsein erlangten, so gibt es keinen Beweis, der das widerlegen könnte‘. Denn ein Stuhl kann nicht bei Bewusstsein oder nicht bei Bewusstsein/bewusstlos sein. Der Wendung ‚ein bei Bewusstsein seiender Stuhl‘ haben wir keine Bedeutung zugeschrieben und mithin auch nicht der Wendung ‚ein bewusstloser Stuhl‘. Man kann allerdings genauso wenig beweisen, dass dieser Stuhl nicht bei Bewusstsein ist, wie dass die Zahl drei nicht grün oder nicht in die Zahl zwei verliebt ist. Wenn Searle jedoch nahelegen will, dass man aus epistemologischen Gründen nicht beweisen kann, dass dieser Stuhl nicht bei Bewusstsein ist, weil man keinen Zugang zum Bewusstsein oder Nichtbewusstsein eines anderen hat, dann ist das verworren. Denn ‚Dieser Stuhl ist bei Bewusstsein‘ ist ein unsinniges Wortgebilde und beschreibt keinen Sachverhalt, der sich bewahrheiten oder widerlegen ließe. Wenn ‚durch ein Wunder‘ (hier sind die Sinngrenzen verletzt) alle Stühle Bewusstsein erlangten, wie in einem Märchen, müsste man dies zudem nicht beweisen, man würde es sehen – wie die Stühle aus ihrem Schlummer erwachten, wie sie gähnten, lächelten und miteinander zu reden begännen. In solchen Märchen aber hat der Stuhl ein Gesicht!
9.2 Intransitives Bewusstsein
331
In welchem Sinn das Gehirn die Ursache des intransitiven Bewusstseins ist Es wurde argumentiert, dass ‚das Gehirn Bewusstsein hervorbringt‘.367 Wir haben behauptet, dass nicht das Gehirn bei Bewusstsein (oder bewusstlos) ist, sondern der Mensch, um dessen Gehirn es sich handelt. Kann man sagen, das Gehirn veranlasse [causes] eine Person, bei (intransitivem) Bewusstsein zu sein? Das hängt davon ab, was damit gemeint ist. Natürlich wird eine Person bei der und der neuralen Fehlfunktion im Gehirn nicht bei Bewusstsein, sondern bewusstlos sein (bzw. an akinetischem Mutismus, epileptischer Amnesie etc. leiden). Und wenn eine Person erwacht oder ihr Bewusstsein wiedererlangt, lösen die intralaminaren Kerne eine kortikale Aktivität aus, aufgrund derer aber die Person nicht erwachen oder ihr Bewusstsein wiedererlangen würde. Die Antwort auf die Frage ‚Was ist die Ursache von A’s Erwachen?‘ lautet wiederum nicht ‚Sein Gehirn natürlich, keine Frage‘. Bei den Ereignissen im Gehirn, die von den intralaminaren Kernen angestoßen werden, handelt es sich vielmehr um die Kausalbedingungen der Möglichkeit des Erwachens und/oder Wachseins, wobei ein lautes Geräusch, das Rütteln an der Schulter etc. die ‚auslösenden Ursachen‘ sind. (Hier gibt es eine Entsprechung zu dem Umstand, dass wir den Sauerstoff in der Luft nicht als Ursache des Feuers identifizieren, obwohl es ohne ihn kein Feuer gäbe.) Nichts ist wirklich privat am intransitiven Bewusstsein Am intransitiven Bewusstsein ist im Wesentlichen nichts privat. Dass eine andere Person ihr Bewusstsein wiedererlangt hat oder aufgewacht ist, offenbart sich normalerweise in ihrem Verhalten vollständig. Man kann für gewöhnlich sehen, dass eine Person bei Bewusstsein ist (und auch, wessen sie sich bewusst ist, und häufig sogar, in welchem Bewusstseinszustand sie sich befindet – mehr dazu später). Es stimmt, dass jemand sich bewusstlos stellen und uns damit reinlegen kann – bei Bewusstsein zu sein kann allerdings niemand vortäuschen. Menschen können sich verstellen und ihre Gefühle verschleiern oder ihren gegenwärtigen Bewusstseinszustand verbergen – das heißt, in welcher geistigen Verfassung sie sind. Was auf diese Weise unterdrückt oder verborgen gehalten werden kann, das kann sich auch offenbaren oder enthüllen. Es ist möglich, dass nicht klar ist, ob jemand sich einer Sache bewusst war oder nicht, so wie es möglich ist, dass nicht klar ist, ob jemand etwas bemerkt hat. Es kann allerdings auch offensichtlich sein, dass er es bemerkte – ganz und gar offensichtlich in den Veränderungen seines Verhaltens.
367
Searle, Minds, Brains and Science, S. 18–22 [dt. Geist, Hirn und Wissenschaft, S. 19−22].
332
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
Die erste Person Dass ich bei Bewusstsein bin, wird mir selbstverständlich nicht aufgrund irgendwelcher Verhaltenskriterien deutlich. Jedoch auch nicht durch Introspektion oder privilegierten Zugang, welcher Art auch immer. Wenn es scheint, als habe „jeder einzelne Bewusstseinsfall einen bevorzugten oder privilegierten Beobachter“, dessen „Zugang zum Phänomen ganz anders und besser ist als der eines jeden anderen“,368 dann trügt der Schein. Dass man bei Bewusstsein ist, ist kein Informationsbruchstück, das einem fehlen oder das man dadurch erwerben könnte, dass man in irgendeiner Weise Zugang zu ihr hat. Ich kann mir bewusst werden und dann sein, wie jemand sein Bewusstsein wiedererlangt, ich kann mir aber nicht bewusst werden und sein, wie ich mein eigenes Bewusstsein wiedererlange. Mein eigenes (intransitives) Bewusstsein ist kein möglicher Erfahrungsgegenstand für mich, sondern eine Voraussetzung für jedwede Erfahrung.369 Die eigentümliche Verwendung von ‚Ich bin bei Bewusstsein‘ Es gibt folglich keinerlei Grund oder Evidenz für die Behauptung, dass man bei Bewusstsein ist, und es könnte keine(n) geben. Wenn ich sage ‚Ich bin bei Bewusstsein‘ [‚I am conscious‘], stelle ich keine Behauptung auf, und es kann keine Gründe dafür geben, das zu sagen. Man kann nicht irrtümlicherweise oder fälschlicherweise behaupten, dass man bei Bewusstsein ist, obgleich man hinsichtlich einer anderen Person irrtümlicherweise oder fälschlicherweise behaupten kann, dass sie bei Bewusstsein ist. Wenn jemand im Schlaf sagte ‚Ich bin bei Bewusstsein‘, würden wir ihn nicht bezichtigen, etwas Falsches behauptet zu haben, ebenso wie wir nicht ‚Er hat ganz recht‘ erwidern würden, wenn er sagte ‚Ich schlafe‘.370 Es kann einem nicht scheinen, dass man bei Bewusstsein ist. Denn man kann nicht sagen ‚Mir scheint, dass ich bei Bewusstsein bin, ich könnte aber Unrecht haben‘ oder ‚Es scheint ihm, dass er bei Bewusstsein ist, also wird er wohl Recht haben‘. Daher ist es abwegig zu behaupten: „Wenn es mir bewusstseinsmäßig so vorkommt, dass ich bei Bewusstsein bin, dann bin ich bei Bewusstsein“,371 und noch verworrener ist es zu versuchen, „jene Anlässe in meinem Leben und Dennett, ‚Consciousness‘, S. 160. Hierauf könnte entgegnet werden, dass man – da man ja träumt, wenn man schläft – Erfahrungen haben kann, obwohl man nicht bei Bewusstsein ist. Träumen heißt allerdings nicht, irgendwelche Erfahrungen zu haben, auch wenn man träumen kann, man habe welche (wenn man über sich selbst träumt und träumt, dass man verschiedene Dinge wahrnimmt, tut und durchlebt). Zu träumen, dass man einem Fußballspiel zuschaut, sich auf einer Party vergnügt etc., heißt jedoch keineswegs, dass man irgendeine Erfahrung hat – es heißt nur, dass man träumt, solche Erfahrungen zu haben. 370 L. Wittgenstein, Zettel, hg. von G. E. M. Anscombe und G. H. von Wright, Wittgensteins Werkausgabe Bd. VIII, § 396. 371 Searle, Mystery of Consciousness, S. 122. 368 369
9.3 Das transitive Bewusstsein und seine Formen
333
die Art der Vertrautheit mit ihnen [zu beschreiben], die ich als meine ‚Gründe‘ für die Behauptung anführen würde, dass ich bei Bewusstsein bin – und nicht nur zu sein scheine.“372 Es gibt eine Verwendung für den Satz ‚Ich bin bei Bewusstsein‘, die aber geht nicht damit einher, ein Element unbestreitbaren, privilegierten Wissens auszudrücken oder anderen Menschen die eigenen persönlichen Beobachtungen zu vermitteln oder über die eigene gegenwärtige Erfahrung zu berichten. Dieser Satz hat eher eine Signalfunktion. Wenn ich nach einer Narkose mein Bewusstsein wiedererlange, könnte ich zu einer Krankenpflegerin, die ich auf Zehenspitzen im Zimmer herumlaufen sehe, sagen: ‚Ich bin bei Bewusstsein‘. Ich sage dies nicht, nachdem ich ‚mein eigenes Bewusstsein beobachtet‘ habe, sondern nachdem ich beobachtet habe, dass sie denkt, ich sei noch immer bewusstlos. Genauso gut könnte ich ‚Hallo‘ sagen oder nach der Zeit fragen.373 Denn diese Äußerungen zeigen genau wie ‚Ich bin bei Bewusstsein‘, dass ich mein Bewusstsein wiedererlangt habe. Letztere bringt allerdings auch das, was sie zeigt, verbal auf den Punkt.
9.3 Das transitive Bewusstsein und seine Formen Unterscheidung von dispositionalem und sich ereignendem transitivem Bewusstsein; der Unterschied zwischen being conscious of und being aware of Transitives Bewusstsein kann dispositional sein oder sich ereignen, also da sein.374 Wenn wir von jemandem sagen, dass er sich seiner Unwissenheit oder seines Sachverstandes oder seiner über- bzw. untergeordneten sozialen Stellung bewusst ist, meinen wir normalerweise eine Disposition oder Tendenz, die er hat, sich dieser Dinge von Fall zu Fall bewusst zu sein. Wenn wir sagen, jemand sei klassenbewusst, preisbewusst oder sicherheitsbewusst, so deuten wir daher gleichfalls auf eine Tendenz hin, sich seines sozialen Hintergrunds, seiner finanziellen Erwägungen oder sicherheitsrelevanten Fragen oder denen anderer bewusst zu sein. Sich ereignendes Bewusstsein dagegen heißt, sich gegenwärtig etwas bewusst zu sein oder sich bewusst zu sein, dass etwas so und so ist.375 DieD. Dennett, ‚Towards a cognitive theory of consciousness‘, wieder abgedr. in seinen Brainstorms (Harvester Press, Brighton, 1981), S. 173. 373 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, hg. von G. E. M. Anscombe und R. Rhees, Wittgensteins Werkausgabe Bd. I, § 416. 374 Die folgende Erörterung geht maßgeblich auf A. R. White, Attention (Blackwell, Oxford, 1964), Kap. 4 zurück. 375 Nebenbei bemerkt bedeutet, sich einer Sache bewusst zu sein, nicht bloß, ‚einen sie betreffenden Gedanken zu haben oder eine Empfindung von ihr‘ (D. M. Rosenthal, ‚Thinking that one thinks‘, in M. Davies und G. W. Humphreys (Hg.), Consciousness (Blackwell, Oxford, 1993), S. 198). Bei allem Respekt gegenüber Rosenthal, aber man wird sich eines Stuhls nicht bewusst, indem man daran denkt, dass man den alten Lehnstuhl auf dem Dachboden reparieren muss, ge372
334
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
sem Verständnis nach können wir nicht von mehreren Dingen zugleich ein Bewusstsein haben, denn unsere Aufmerksamkeit kann nicht von mehreren Dingen gleichzeitig gefangen gehalten oder unser Geist nicht von mehreren verschiedenen Dingen auf einmal in Beschlag genommen sein. Und wir können uns dessen nicht bewusst bleiben, was unserer Aufmerksamkeit ‚entschlüpft‘ ist oder unsere Gedanken nicht mehr beschäftigt. In dieser Hinsicht besteht ein Unterschied zwischen being conscious of something und being aware of something. Denn während man sich einer Sache nicht mehr bewusst [conscious] ist, die die Aufmerksamkeit nicht länger beschäftigt bzw. die Gedanken nicht mehr in Beschlag nimmt, hat man von den Dingen, von denen man in Kenntnis gesetzt wurde, auch weiterhin Kenntnis [remains aware], solange man die fragliche Information nicht vergessen hat und sich halbwegs regelmäßig auf sie bezieht. Unabhängig davon, wessen man sich bewusst ist, hat man von diesem auch Kenntnis, man kann jedoch von etwas Kenntnis haben, dessen man sich nicht bewusst ist.376 Die folgende Erörterung beschäftigt sich vorrangig mit dem sich ereignenden bzw. daseienden transitiven Bewusstsein. Das intransitive Bewusstsein ist eine Voraussetzung für die verschiedenen Formen des sich ereignenden transitiven Bewusstseins – das heißt dafür, sich einer Sache zu einem bestimmten Zeitpunkt und von diesem ab eine Zeit lang bewusst zu sein. Grenzfälle intransitiven Bewusstseins ‚verschwimmen‘ mit Grenzfällen transitiven Bewusstseins. Man kann sich einer Sache vage bewusst oder halb bewusst sein, wenn man im Halbschlaf oder nicht bei vollem Bewusstsein ist. Sich einer Sache bewusst sein und sich bewusst sein, dass Sich einer Sache bewusst sein und sich bewusst sein, dass etwas so ist – die beiden Varianten fallen mitunter zusammen, ebenso wie die Wahrnehmung von etwas und die Wahrnehmung, dass etwas so ist, manchmal zusammenfallen. Sich seiner Unwissenheit bewusst zu sein heißt, sich bewusst zu sein, dass man unwissend ist, sich der Langeweile seiner Zuhörer bewusst zu sein heißt, sich bewusst zu sein, dass die Zuhörer gelangweilt nauso wenig wie man sich Cäsars bewusst werden kann, indem man über ihn nachdenkt. Und man ist sich durch die bloße Wahrnehmung eines Objektes nicht schon dessen bewusst, was man wahrnimmt – wir werden das noch erörtern. 376 [‚Be aware of something‘ kann auch durch ‚vertraut sein mit etwas‘ wiedergegeben werden, in dem Sinn, in dem ‚in Kenntnis setzen von etwas‘ auch als ‚mit etwas vertraut machen‘ verstanden und wiedergegeben werden kann. Wie aus dem Obigen hervorgeht, gibt es Hinsichten und also Verwendungen, in denen der Unterschied nicht zum Tragen kommt, mithin kann man ‚be aware of something‘ und ‚be conscious of it‘. Das heißt, ‚be aware of something‘ (Kenntnis haben von etwas) fällt mit ‚be consciously aware of something‘ (bewusste Kenntnis/Wissen von etwas haben) zusammen und folglich mit ‚be conscious of something‘ (sich einer Sache bewusst sein). Ob der Unterschied akzentuiert ist oder nicht, wird nur aus dem Zusammenhang ersichtlich. – A.d.Ü.]
9.3 Das transitive Bewusstsein und seine Formen
335
sind, und sich einer Bewegung im Gebüsch bewusst zu sein heißt, sich bewusst zu sein, dass sich etwas im Gebüsch bewegt hat. Doch obwohl sich Jacks bewusst zu sein impliziert, dass Jack anwesend ist (sonst könnte man sich seiner nicht (wahrnehmend) bewusst sein), ist, sich Jacks, der in der Ecke steht, bewusst zu sein, etwas anderes, als sich bewusst zu sein, dass Jack in der Ecke steht. Die Wendung ‚dieses und jenes bewusst‘ (wobei ‚dieses und jenes‘ der Name oder die Beschreibung eines materiellen Gegenstands oder einer Person ist) gibt an, welcher Gegenstand die Aufmerksamkeit einer Person auf sich zieht und gefangen hält. Die Wendung ‚bewusst, dass dies und jenes der Fall ist‘ betont den Sachverhalt oder die Tatsache, die ihren Geist beschäftigt und die für sie von Bedeutung ist. Man kann sich also beispielsweise Jacks bewusst werden, der in der Zimmerecke steht, wenn er die eigene Aufmerksamkeit auf sich zieht und gefangen hält. Man kann sich seiner jedoch nicht weiterhin bewusst sein, wenn er das Zimmer verlässt. Wurde man sich der Verlegenheit eines Freundes bewusst, wie es sich in seinem Verhalten offenbarte, kann man sich dagegen des Umstands, dass er verlegen war, auch dann noch bewusst sein, wenn man lange schon kein Wahrnehmungsbewusstsein mehr von seiner Verlegenheit hat (und sogar auch lange nachdem der Freund aufgehört hat, verlegen zu sein), sofern einen beispielsweise seine Verlegenheit später gedanklich noch beschäftigt. Sich etwas bewusst werden und sein; bemerken und sich etwas bewusst sein Sich einer Sache bewusst zu werden ist der Ausgangspunkt dafür, sich dieser bewusst zu sein und bewusst zu bleiben. Die Dinge, derer wir uns bewusst werden, existieren normalerweise schon, bevor wir uns ihrer bewusst werden. Bei dem, was uns bewusst ist und dann für eine gewisse Zeit bewusst bleibt, muss es sich um etwas Andauerndes oder ununterbrochen Fortbestehendes handeln. Das Vorübergehende bemerken wir vielmehr, statt dass wir uns seiner bewusst werden und bleiben. Wir können demzufolge einen Blitz oder einen Knall bemerken, uns ihrer aber nicht bewusst werden und bleiben, und wir können uns im Laufe einer Unterhaltung unserer Unwissenheit oder Zweifelsgefühle bewusst werden und sein, sie aber nicht bemerken. Das transitive Bewusstsein lässt eine Vielzahl von Objekttypen zu und kann unterschiedliche Formen annehmen. Die folgende Klassifizierung ist provisorisch, sie könnte jedoch dazu beitragen, dass ein außerordentlich vielfältiger Bereich eine ungefähre vorläufige Ordnung annimmt. Wahrnehmungsbewusstsein Man kann sich Perceptibilia bewusst werden, des Tickens einer Uhr oder des Blinkens eines Lichts beispielsweise, eines X in der Ecke oder der seltsamen Farbe eines Y. Auf diese Weise kann uns auch der Brandgeruch bewusst werden oder der Duft von Maiglöckchen, der das Zimmer durchströmt. Wir können uns des verhalten intonierten
336
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
Leitmotivs oder des periodischen Themenwechsels bewusst werden, während wir einem musikalischen Werk lauschen. Und während wir einem Freund zuhören, sind wir in der Lage zu realisieren, dass er aufgeregt oder niedergeschlagen ist, und wir werden uns so seines Gemütszustandes bewusst. Etwas wahrnehmen und sich etwas bewusst sein sind zu unterscheiden Sich solcher Dinge bewusst zu werden und zu sein ist keine Alternative zum Wahrnehmen derselben. Und wessen man sich auf diese Weise bewusst wird, ist nichts anderes als das, was man sehend, hörend, riechend etc. wahrnimmt. Sich einer Sache, die man wahrnimmt, bewusst zu sein, ist jedoch etwas anderes, als sie schlechthin wahrzunehmen, ebenso wie das Wahrnehmen von etwas sich vom Bemerken dessen, was man wahrnimmt, unterscheidet. Wir sind uns nur derjenigen Dinge bewusst, die wir wahrnehmen und als Gegenstände unserer Wahrnehmung realisieren. Nehmen wir einen Schatten im Gebüsch wahr und denken, dass es sich um eine Katze handelt, sind wir uns nicht des Schattens bewusst und a fortiori nicht der Katze. Wie wir im Folgenden noch darlegen werden, haben wir zudem nur von dem ein Wahrnehmungsbewusstsein, das unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht und gefangen hält. Somatisches Bewusstsein Man ist sich seiner Empfindungen bewusst: des Zahnschmerzes beispielsweise, des Fußkribbelns oder des Juckreizes auf dem Rücken. Obwohl es sich bei Empfindungen nicht um Gegenstände handelt, a fortiori nicht um wahrgenommene Gegenstände, ziehen sie unsere Aufmerksamkeit auf sich und halten sie gefangen. Darüber hinaus kann man sich der Zu- und Abnahme ihrer Intensität bewusst sein, sich beispielsweise des Stärkerwerdens seiner Kopfschmerzen bewusst werden oder, mit Erleichterung, des Nachlassens seines Übelkeitsgefühls. Natürlich kann man sich eines Schmerzes bewusst sein, ohne sich bewusst zu sein, dass es sich um einen Ischiasschmerz handelt. Das bedeutet nicht, dass man einen unbewussten Ischiasschmerz hat, sondern vielmehr, dass man einen Schmerz hat und sich dieses Schmerzes bewusst ist, aber nicht realisiert, dass es sich um einen Ischiasschmerz handelt. Kinästhetisches Bewusstsein Eine andere Form somatischen Bewusstseins ist das kinästhetische. Man kann sich seiner verkrampften Haltung bewusst werden, seines offen stehenden Mundes oder seiner Körperlage, wenn man realisiert, dass man verkrampft ist etc. Ebenso kann man sich der Bewegung seiner Gliedmaßen oder Finger bewusst sein. Dies kann mit kinästhetischen Empfindungen einhergehen, muss es aber nicht, und das Wissen von der Disposition oder Bewegung des Körpers oder der Gliedmaßen wird nicht aus kinästhetischen
9.3 Das transitive Bewusstsein und seine Formen
337
Empfindungen geschlossen. Es ist richtig, dass einem durch Betäubung oder Nervenverletzung einer Gliedmaße oder durch Gehirnschäden die normale Fähigkeit abhanden kommt, seine Position oder Bewegung (ohne hinzusehen) zu beschreiben. Dies zeigt jedoch nicht, dass unser Urteil, eine unserer Gliedmaßen sei auf diese Weise ausgerichtet oder bewege sich auf jene, auf der von kinästhetischen Empfindungen herrührenden Evidenz beruht oder von dieser abgeleitet wird. Der Fall ähnelt der Fähigkeit, die Richtung zu erkennen, aus der ein Geräusch kommt. Diese Fähigkeit kann durchaus darauf beruhen, dass die Schallwellen nicht beide Ohren gleichzeitig erreichen oder dass die Einwirkung auf das eine Ohr sich von der auf das andere unterscheidet. Aber man hört, fühlt oder spürt den unterschiedlichen Einfluss der Schallwellen nicht je auf einem Ohr, und also schließt man die Richtung des Geräuschs nicht aus irgendeinem wahrgenommenen Unterschied zwischen den Ohren. Es ist vielmehr so, dass das Wissen um die Richtung, aus der ein Geräusch kommt, überhaupt nicht auf Evidenz beruht. Die Fähigkeit, solche unmittelbaren, nicht auf Evidenz beruhenden Urteile zu bilden, hängt kausal davon ab, dass jedes Ohr durch die Schallwellen unterschiedlich beeinflusst wird. Unsere Fähigkeit, zu sagen, wie unsere Gliedmaßen und unser Körper disponiert sind oder wie unsere Gliedmaßen sich bewegen, hängt zweifellos gleichfalls davon ab, dass unsere Gliedmaßen nicht betäubt wurden und unsere Nerven normal funktionieren, sie wird normalerweise jedoch nicht von Evidenz abgeleitet, die von kinästhetischen Empfindungen herrührt, auch wenn es einige solcher Empfindungen geben mag. Abgesehen davon, dass man Empfindungen fühlt und seine Gliedmaßen sich bewegen fühlt, fühlt man auch sein körperliches Allgemeinbefinden, beispielsweise dann, wenn man sich schläfrig oder hellwach, erschöpft oder ausgeruht, krank oder gesund fühlt, und auch dieser ‚Befindlichkeiten‘ kann man sich bewusst werden und bewusst sein. Sie können von einer Reihe mehr oder weniger diffuser Empfindungen begleitet sein, aber das Allgemeinbefinden, dessen man sich bewusst ist, ist nicht mit den wie auch immer gearteten Empfindungen identisch, die ihn (gegebenenfalls) begleiten mögen. Affektionsbewusstsein Wir fühlen nicht nur Empfindungen und unser körperliches Allgemeinbefinden, sondern auch Emotionen und Stimmungen. Wir sind erregt oder verängstigt, entzückt oder ärgerlich, glücklich oder traurig, und wir können uns in guter Stimmung befinden, wenn wir fröhlich und zufrieden sind, oder in schlechter, wenn wir gereizt oder deprimiert sind. Auch in diesen Fällen haben wir es mit Objekten des transitiven Bewusstseins zu tun. Man kann sich seiner gegenwärtigen Gefühle bewusst werden, beispielsweise seiner zunehmenden Reizbarkeit, weil der alte Snodgrass ununterbrochen und eintönig daherredet, man kann sich seiner Eifersuchtsgefühle bewusst werden, wenn man Daisy flirten sieht, oder auch seiner wachsenden Aufgeregtheit, wenn der Zeitpunkt irgendeines sehnsüchtig erwarteten Ereignisses näherrückt. Ebenso kann
338
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
man sich seiner Stimmung und ihrer Veränderungen bewusst werden und sein, muss es aber nicht. Man kann sich seiner zunehmenden Niedergeschlagenheit bewusst werden, und man kann sich des Gefühls ungewöhnlich starker Freude bewusst werden. Man kann reizbar sein, vielleicht aber sind einige Zornausbrüche nötig, bevor man realisiert und sich bewusst wird, in welchem Gemütszustand man sich gegenwärtig befindet. Das Affektionsbewusstsein bildet sich normalerweise als eine Form des Realisierens aus und nicht als eine Form gefesselter Aufmerksamkeit. Denn beispielsweise heißt, eifersüchtig zu sein, ohne ein Bewusstsein von der Tatsache zu haben, dass man eifersüchtig ist, von Daisys Flirten mit Jack genervt zu sein, sich zu wünschen, sie möge damit aufhören, zu denken, dass sie Jack eine derartige Aufmerksamkeit zukommen lässt, sei ein illoyales Verhalten einem selbst gegenüber, etc., ohne zu realisieren, dass eine solche Art zu reagieren Eifersucht ist. Wenn wir realisieren, dass wir eifersüchtig sind, wird unsere Aufmerksamkeit nicht von unserer Eifersucht gefesselt (die kein Objekt oder Ereignis ist, das die Aufmerksamkeit fesseln kann). Vielmehr ‚dämmert‘ es uns, dass es sich bei dem, was wir fühlen, um Eifersucht handelt. Haben wir realisiert, dass wir eifersüchtig sind, können wir uns unserer Eifersucht anschließend bewusst sein, wenn die Tatsache, dass wir so fühlen, von Bedeutung für uns ist und unser Denken beschäftigt. Bewusstsein von den eigenen Motiven Die Emotionen stehen mit Motiven in Zusammenhang (7.2.2), denn in vielen (aber nicht allen) Fällen kann es sich bei dem, was wir bei einer bestimmten Emotion fühlen, auch um das handeln, was uns bildlich gesprochen zum Handeln bewegt. Demnach können wir eifersüchtig sein und aus Eifersucht handeln, rachedurstig sein und aus Rache handeln, Mitleid haben und aus Mitleid handeln. Menschen handeln häufig aus bzw. aufgrund von Motiven, ohne zu wissen, dass es sich so verhält. Man kann von Eifersucht oder Rachsucht bewegt sein, ohne zu realisieren, dass man es ist, wie man aus Mitleid oder Rache handeln kann, ohne sich selbst oder anderen einzugestehen, dass dem so ist. Das kann mit einem Mangel an Reflexion zu tun haben oder weil Selbstbetrug im Spiel ist. Man kann jedoch darüber reflektieren, warum man tut, was man tut, und man kann seine wahren Motive realisieren. Man kann sich demzufolge seiner Motivation bewusst werden. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass, wer sich seines Motivs nicht bewusst ist, kein ‚unbewusstes Motiv‘ hat, wie es im Jargon der Psychoanalytiker heißt. Reflexionsbewusstsein Das Bewusstsein, das man von seinen Handlungsmotiven hat, weist Ähnlichkeiten mit anderen Bewusstseinsformen auf, die wir ‚Reflexionsformen‘ nennen werden. Diese bilden eine bunte Mischung. Sie alle begreifen die Realisierung von Tatsachen und das Nachdenken über Dinge ein, um die es so steht, wie man realisierte, dass es um sie steht, und sie können entweder auf einen selbst oder auf andere bezogen sein oder keines von
9.3 Das transitive Bewusstsein und seine Formen
339
beidem. Anders als das somatische Bewusstsein und das Wahrnehmungsbewusstsein sowie das Bewusstsein von den eigenen Handlungen (siehe unten) ist das Reflexionsbewusstsein nicht auf die Gegenwart beschränkt. Man kann sich demzufolge einer Ehre bewusst sein, die einem vor Kurzem zuteil wurde, oder der eigenen Unbesonnenheit oder chronischen Unentschlossenheit, wenn einem solche Tatsachen gegenwärtig durch den Kopf gehen oder das, was einem durch den Kopf geht, wissentlich einfärben. Ebenso kann man sich dispositional oder tatsächlich der Umstände seiner Geburt, Heirat oder Wahl in ein Amt bewusst sein, wenn die nämlichen Tatsachen die Tendenz haben, die eigenen Gedanken in Beschlag zu nehmen, oder wenn sie es gerade tun. Und man kann sich seiner sozialen Klasse oder der eines anderen bewusst sein oder seiner (eigenen) fachlichen Qualifikationen oder Qualifikationsmängel oder denen eines anderen. Man kann sich folglich, während man sich mit einem Fachmann austauscht, der eigenen Unkenntnis (überaus schmerzlich) bewusst sein und auch ein Bewusstsein von dessen Belesenheit und einschlägigem Können haben, während man seinen Ausführungen lauscht. Was nicht nur mit dem Wissen, dass etwas so ist, einhergeht, sondern das, was man weiß, muss einem zudem auch Eindruck machen und zu denken geben. Es muss einem mithin etwas bedeuten oder für einen von Belang sein und Auswirkungen auf die eigenen Reaktionen und Handlungen haben. Man kann sich der fortgeschrittenen Stunde bewusst sein, wenn man weiß, dass es spät ist und dieser Umstand die eigenen Gedanken beschäftigt und das eigene Verhalten beeinflusst. Bewusstsein von den eigenen Handlungen Davon unterscheidet sich wiederum das Bewusstsein von den eigenen Handlungen, das zwei Formen annehmen kann. Es kann sich um akteuriales Bewusstsein handeln, wie in dem Fall, da man etwas bewusst tut – beispielsweise während einer Vorlesung einen sorgfältig geplanten Witz reißt oder bewusst das wiederholt, was man in der Vorlesung der Vorwoche gesagt hat. Hier weiß der Akteur, was er tut, und widmet sich der Sache. Er handelt intentional und sein Wissen über das, was er tut, oder über das, was er zumindest zu tun versucht, ist nicht von der Beobachtung abgeleitet, wie es das Wissen darüber, was eine andere Person tut, für gewöhnlich ist. Der Akteur führt seine Absicht handelnd aus und ist darin vertieft und davon ganz in Anspruch genommen, wie dies durch die geläufige Wendung ‚bewusst und mit Bedacht‘ hervorgehoben wird. Akteuriales Bewusstsein meint nicht, dass die Aufmerksamkeit von etwas auf sich gezogen und gefangen gehalten wird, sondern vielmehr, dass man sie auf das richtet, was man gerade absichtlich tut. Im Unterschied dazu kann man sich dessen, was man gerade tut, nicht qua Akteur, sondern qua Zuschauer bewusst sein. Wessen man sich in diesem Fall bewusst wird und bewusst ist, entspricht dem, was man für gewöhnlich ganz und gar nicht absichtlich tut. Realisiert man zur eigenen Bestürzung, dass man die Vorlesung der letzten Woche wiederholt oder seine Zuhörer langweilt, so kann einem diese Tatsache peinlich bewusst werden. Man realisiert, dass es das ist, was man gerade tut, und
340
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
die Tatsache, dass man es tut, beschäftigt die eigenen Gedanken und färbt die eigenen Reaktionen ein. Self-consciousness/Selbstbewusstsein Self-consciousness, im gewöhnlichen Sinn des Ausdrucks, kann unterschiedliche Formen annehmen. (i) In einem Sinn ist unser Bewusstsein davon gemeint, dass andere uns beobachten, was zur Folge hat, dass unser Verhalten davon beeinflusst ist – wir sind peinlich berührt oder verschüchtert etc.377 (ii) In einem anderen Sinn betrifft er das Reflektieren und Nachdenken, wie sie für gewöhnlich in kreativen Arbeitszusammenhängen zum Tragen kommen – in diesem Sinn unterscheiden wir den hochgradig reflektierten [self-conscious] und bewussten [deliberative] Künstler vom intuitiven und spontanen. (iii) Und in einem wieder anderen Sinn ist eine Neigung gemeint, über seine eigenen Motive, Haltungen und Reaktionen introspektiv zu reflektieren. In diesem Sinn sagt man, Proust sei ein hochgradig selbstreflektierter, seiner selbst bewusster [self-conscious] Mensch gewesen. Diese Verwendungen dürfen jedoch nicht mit dem philosophischen Gebrauch des Terminus‘ ‚Selbstbewusstsein‘ [‚self-consciousness‘] durcheinandergebracht werden, der ausdrückt, dass Menschen einzigartige, weil selbstbewusste Wesen sind. In diesem Sinn selbstbewusst zu sein, bedeutet nicht, sich ‚eines Selbst‘ bewusst zu sein (siehe Kapitel 12), sondern meint vielmehr die Fähigkeit eines Menschen, über seine Geisteszustände und Überzeugungen, sein Verlangen und seine Motive nachzudenken, darauf zu reflektieren, sie mitzuteilen und sich ihrer bewusst zu sein und dazu auch im Hinblick auf seine Fertigkeiten, Neigungen, Haltungen und Charakterzüge in der Lage zu sein sowie hinsichtlich seines gelebten Lebens und den damit verbundenen Erfahrungen. Mithin ist das philosophische Selbstbewusstsein in der dritten eben angeführten Form des Selbstbewusstseins exemplifiziert oder verwirklicht. Diese grobe Klassifizierung der Formen des transitiven Bewusstseins ist weder erschöpfend noch exklusiv. Sie soll in erster Linie dazu ermuntern, die Vielfältigkeit und begriffliche Heterogenität des transitiven Bewusstseins in den Blick zu nehmen.
377
[Die hier vorgebrachten Unterscheidungsformen (i) und (ii) können im Deutschen nicht mit selbstbewusst/Selbstbewusstsein wiedergegeben werden, wie die obigen Umschreibungen zeigen. ‚Nichtphilosophisches‘ self-consciousness heißt (i) Befangenheit oder (ii) Reflektiertheit. Ihren Ausführungen fügen die Autoren folgende Bemerkung an – A.d.Ü.]: Interessanterweise meint das deutsche Äquivalent Selbstbewusstsein kein peinliches Bewusstsein davon, dass andere mich beobachten, sondern Selbstvertrauen und Selbstbestimmtheit.
9.4 Das transitive Bewusstsein: Eine unvollständige Analyse
341
9.4 Das transitive Bewusstsein: Eine unvollständige Analyse Die Analyseparameter Das transitive Bewusstsein ist dort angesiedelt, wo sich die Begriffe des Wissens, des Realisierens (das ist eine besondere Form des Wissenserwerbs), des Aufnehmens (im Gegensatz zum Aneignen) sowie der von etwas auf sich gezogenen und gefangen gehaltenen oder der auf etwas gerichteten Aufmerksamkeit. Die verschiedenen Kategorien oder Arten des transitiven Bewusstseins, die wir voneinander abgegrenzt haben, sind in unterschiedlicher Weise mit diesen Begriffen verbunden. Wir werden einige der Verknüpfungen sowie einige der begrifflichen Unterschiede zwischen diesen Kategorien skizzieren. Dabei geht es uns um dreierlei. Erstens darum, die begriffliche Vielfalt innerhalb des Bereichs des transitiven Bewusstseins deutlich zu machen; zweitens darum, herauszuarbeiten, dass die verschiedenen Kategorien nicht auf irgendeine simple Weise miteinander verknüpft sind. Sie gehören nicht einer allgemeinen, durch spezifische Unterscheidungsmerkmale differenzierten Gattung an. Es ist sicherlich aufschlussgebender, sie als Variationszentren aufzufassen. Drittens darum, ungerechtfertigten Verallgemeinerungen zuvorzukommen. Zunächst müssen einige begriffliche Verknüpfungen und Einteilungen vorgenommen werden. Erstens ist ‚sich etwas bewusst werden (oder sein) (oder sich bewusst werden, dass)‘ polymorph. Zweitens sind ‚sich etwas bewusst werden (und bewusst sein) (oder sich bewusst werden und sein, dass)‘ – je nachdem, wie man sie zum Satz ergänzt – entweder faktive oder Existenz-implizierende Verben – man kann sich des So-und-soSeins einer Sache nicht bewusst sein, wenn sie nicht de facto so ist, und man kann sich X nicht bewusst sein, wenn X nicht existiert. Beim transitiven Bewusstsein handelt es sich um eine Form des Wissens. Drittens ist das Wissen, das mit dem Bewusstwerden von etwas einhergeht, empfangenes Wissen, im Gegensatz zum angeeigneten oder errungenen Wissen. Es gibt Mittel und Wege der Wissensaneignung, jedoch keine dafür, sich einer Sache bewusst zu werden (oder etwas zu bemerken, zu realisieren oder innezuwerden). Beim Bewusstwerden von etwas handelt es sich genau wie beim Merken, Realisieren und Bemerken im Wesentlichen um eine Form des Aufnehmens.378 Viertens stehen einige Formen des transitiven Bewusstseins in Bezug zur Aufmerksamkeit – das heißt, die Aufmerksamkeit wird von etwas, das so und so ist, auf sich gezogen und gefangen gehalten. In anderen Fällen des aufmerksamkeitsbezogenen transitiven Bewusstseins (z. B. beim akteurialen Bewusstsein von seinen Handlungen) richtet man die Aufmerksamkeit auf das, was man tut. Andere Formen des transitiven Bewusstseins sind weniger durch den Bezug zur Aufmerksamkeit charakterisiert, als vielmehr dadurch, dass ein Wissen gegenwärtig die Gedanken und Gefühle einer Person beschäftigt und/oder für ihre Überle-
378
Siehe White, Attention, Kap. 4.
342
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
gungen und Handlungen von Bedeutung ist oder ihre Gedanken, Gefühle und Reaktionen merklich einfärbt. Transitives Bewusstsein ist polymorph ‚Sich etwas bewusst werden‘ und ‚sich etwas bewusst sein‘ sind polymorphe Verben. In dieser Hinsicht sind sie wie ‚arbeiten‘, ‚einen Befehl ausführen‘, ‚üben‘, ‚einstudieren‘, ‚kämpfen‘ und, wie wir zuvor dargelegt haben, ‚denken‘. Was beispielsweise als Arbeiten oder Einstudieren betrachtet wird, ist von Kontext zu Kontext und von Ereignis zu Ereignis verschieden, und was man bei der einer Gelegenheit tut, kann auch bei anderer Gelegenheit getan werden und dann dennoch keineswegs als Arbeiten oder Einstudieren betrachtet werden. Bei den verschiedenen Fällen einer polymorphen Aktivität mögen wir es mit den Formen zu tun haben, die das Polymorphe anzunehmen vermag, es handelt sich bei ihnen jedoch nicht um die Arten einer Gattung. Was als Bewusstwerden oder Bewusstsein von X betrachtet wird, hängt demzufolge davon ab, worum es sich bei X handelt. Wenn einem gesagt wird, jemand sei sich etwas bewusst, erfährt man ebenso nicht, welche Form dessen Bewusstsein annimmt, wie man, wenn einem gesagt wird, jemand übe, nicht erfährt, ob er deklamiert, singt, Klavier spielt oder Golfbälle schlägt. Sich des Tickens einer Uhr bewusst zu werden oder zu sein, nimmt eine ganz andere Form an (nämlich Hören), als sich Daisys Augenfarbe bewusst zu werden oder zu sein (nämlich Sehen), so wie das Einstudieren eines Tanzes eine ganz andere Form annimmt (nämlich Tanzen) als das Einstudieren eines Liedes (nämlich Singen). Was man tut, wenn einem X bewusst wird, kann auch bei anderer Gelegenheit getan werden, ohne dass gesagt werden kann, man sei sich X bewusst (oder nicht bewusst) geworden, so wie das, was man beim Einstudieren eines Liedes tut, auch bei anderer Gelegenheit ohne das Einstudieren getan werden kann – nämlich wenn man mit dem Lied wirklich auftritt. So kann ich beispielsweise zu Daisy hinübergehen, um sie zu begrüßen, nachdem ich mir ihrer, die sich in einer Ecke des Zimmers aufhält, bewusst geworden bin; ich kann aber auch in dem Moment, da ich sie sehe, also unmittelbar nach meinem Eintritt in den Raum, zu ihr hinübergehen, um sie zu begrüßen – und in diesem Fall bin ich mir ihrer nicht bewusst geworden. Wenn man sich vertrauten Personen unmittelbar konfrontiert sieht, wird man sich ihrer weder bewusst, noch erkennt man sie, obgleich es allerdings nicht so ist, dass man sie nicht erkennt, und man ist sich ihrer Gegenwart weder bewusst noch nicht bewusst.379 379
Es wäre absurd zu sagen, man erkenne seine Frau beim allmorgendlichen Frühstück, oder noch absurder, man erkenne sie jedes Mal aufs Neue, wenn man den Kopf hebt und sie ansieht. Was selbstverständlich nicht bedeutet, dass man sie nicht erkennt. Es bedeutet, dass ein besonderer Kontext notwendig ist, um sinnvoll sagen zu können, man habe etwas Vertrautes erkannt. Ebenso kann man nicht sagen, man sei sich seiner Frau bewusst oder nicht bewusst, während man ihr gegenübersitzt und sich mit ihr unterhält, denn, um es zu wiederholen, es bedarf eines besonde-
9.4 Das transitive Bewusstsein: Eine unvollständige Analyse
343
Die verschiedenen Formen des transitiven Bewusstseins Das transitive Bewusstsein nimmt folglich verschiedene Formen an. Das Wahrnehmungsbewusstsein kann die Form des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens oder die des taktilen Fühlens von etwas annehmen. Wessen man sich wahrnehmend bewusst ist, schwebt nicht über den Dingen, die man wahrnimmt. Das somatische Bewusstsein nimmt die Form des Fühlens an (ein Sensorieren und kein taktiles Fühlen), und wessen man sich somatisch bewusst ist, unterscheidet sich nicht von dem, was man (nichttaktil) fühlt oder hat. Und auch das, dessen man sich fühlend bewusst ist, unterscheidet sich nicht von der gegenwärtigen Emotion und Stimmung, die man fühlt (obgleich anzumerken ist, dass das Fühlen von Fröhlichkeit, Ärger, Niedergeschlagenheit oder Aufgeregtheit sich logisch vom Fühlen eines Schmerzes oder eines Juckreizes unterscheidet). Sich einer Sache reflektierend bewusst zu werden – seiner Unwissenheit beispielsweise oder der Belesenheit eines anderen oder der fortgeschrittenen Stunde oder der eigenen chronischen Unentschlossenheit –, nimmt normalerweise die Form eines Wissens an, das aus einer Realisierung hervorgeht. Sich etwas reflektierend bewusst zu sein ist keineswegs eine Sache der gefesselten Aufmerksamkeit. Wessen sich jemand gegenwärtig auf diese Weise bewusst ist, beschäftigt seine Gedanken, ist für ihn von Bedeutung und/ oder färbt seine Überlegungen, Reaktionen und Handlungen wissentlich ein. Es gibt kein besonderes Vermögen oder Organ des transitiven Bewusstseins Demnach gibt es erstens kein besonderes Vermögen des transitiven Bewusstseins, obwohl die eigenen Wahrnehmungsvermögen immer dann beteiligt sind, wenn man sich etwas wahrnehmend bewusst wird. Es gibt auch kein Organ des transitiven Bewusstseins. Manchmal begreift Bewusstwerdung und Bewusstsein von etwas den Gebrauch eines Organs ein, wie im Fall des Wahrnehmungsbewusstseins. Manchmal aber auch nicht, wie in den Fällen des somatischen Bewusstseins, des Affektions- sowie des Reflexionsbewusstseins. Natürlich kann man sich etwas nicht transitiv bewusst sein, wenn das Gehirn nicht normal funktioniert, was die relevanten Prozesse angeht. Es gibt nicht die eine Sache, die von den Neurowissenschaften des transitiven Bewusstseins untersucht werden muss Zweitens gibt es nicht die eine Sache, die die Neurowissenschaftler untersuchen können, wenn sie am transitiven Bewusstsein interessiert sind, denn dieses nimmt viele verschiedene Formen an. Was untersucht werden müsste, sind die neuralen Korrelate der verschiedenen Formen der Wahrnehmung, Empfindung, der Gefühle und der Stimmung ren Kontextes, damit diese Ausdrücke ins Spiel gebracht werden können – wie wir weiter unten darlegen werden.
344
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
als auch der Reflexion – freilich nicht in all ihren Aspekten, sondern nur in jenen, die mit dem so oder so ausgeprägten Bewusstsein von etwas in Zusammenhang stehen. Die entscheidende Frage lautet: Wodurch zeichnet sich das transitive Bewusstsein aus? Was unterscheidet das Wahrnehmungsbewusstsein von der Wahrnehmung im Allgemeinen? Was ist das somatische Bewusstsein über die Empfindung hinaus? Welche Kennzeichen haben das affektive und das Reflexionsbewusstsein, in Abgrenzung zu den allgemeinen Phänomenen der Emotionen und der Stimmungen oder des Nachdenkens über dieses und jenes? Wir müssen noch besser verstehen, was das transitive Bewusstsein in logischer Hinsicht charakterisiert. Die Verbindung zwischen transitivem Bewusstsein und Wissen Die Grammatiker klassifizieren solche Verben wie ‚wissen‘, ‚sich erinnern‘, ‚realisieren‘, ‚wahrnehmen‘ als faktive Verben (siehe 4.2). Treten sie in Form von ‚A weiß, dass dies und jenes der Fall ist‘ oder ‚A erinnert sich daran, wie das und das war‘ in Erscheinung, impliziert das die Wahrheit der Proposition, die durch die (Satz-)Ergänzung ausgedrückt oder zu verstehen gegeben wird. Wenn A weiß, sich daran erinnert, realisiert oder wahrnimmt, dass es um die Dinge so und so steht, dann ist es tatsächlich der Fall, dass es um sie so steht. Manche faktive Verben (aber nicht alle) können auch mit einem direkten Objekt statt einer Satzergänzung auftreten: zum Beispiel ‚A kennt B (nimmt B wahr)‘. Wird der Satz in dieser Weise verwendet, impliziert er die Existenz des Verbobjekts. Wenn A B kennt oder wahrnimmt, dann muss B existieren. Die Faktivität des transitiven Bewusstseins ‚Sich etwas bewusst werden (oder sich bewusst werden, dass)‘ und ‚sich etwas bewusst sein (oder sich bewusst sein, dass)‘ sind faktiv oder implizieren die Existenz – das heißt, es ist logisch ausgeschlossen, dass man sich etwas bewusst werden oder sein kann, das nicht der Fall ist oder das es nicht gibt. Man kann sich der so und so seienden Dinge (oder dass die Dinge so und so sind) nicht bewusst werden und dann bewusst sein, wenn sie nicht so und so sind. Niemand kann sich der ihm zuteil gewordenen Ehre, der Abneigung des Publikums, des Zunehmens seiner Rückenschmerzen oder der Absurdität seiner Gedanken bewusst sein, wenn er nicht geehrt wird, das Publikum keine Abneigung hegt, seine Rückenschmerzen nicht schlimmer werden und seine Gedanken nicht absurd sind. Wird man sich eines Kaninchens im Innenhof bewusst und ist sich dieses dann bewusst, so muss auch ein Kaninchen im Innenhof sein. Gibt es dort keins, dann dachte man, man habe ein Kaninchen erspäht oder bemerkt, und man hat sich geirrt – es war ein Hase oder bloß ein Schatten. Also war man sich nicht eines Kaninchens bewusst, da es kein Kaninchen gab, dessen man sich hätte bewusst sein können. Wenn man sich eines bewusst ist, dann weiß man auch, dass es da ist.
9.4 Das transitive Bewusstsein: Eine unvollständige Analyse
345
Bewusstsein und Wissen Die Faktivität des transitiven Bewusstseins ist in Anbetracht der etymologischen Verbindung von ‚bewusst‘ [conscious] mit Kognitionsverben wenig überraschend, denn bei diesen handelt es sich um Paradigmen der faktiven Verben. ‚To be conscious of‘ (‚bei Bewusstsein sein‘) ist von scio (‚ich weiß‘) abgeleitet und mit cum (‚mit‘) zusammengesetzt, was conscio ergibt, das ‚ich weiß zusammen mit‘ oder ‚ich teile (mit jemandem) das Wissen, dass‘ bedeuten kann; oder es kann ‚ich weiß sehr wohl‘ oder ‚ich weiß bestimmt‚ bedeuten, wenn das Präfix cum lediglich als Intensivierer fungiert.380 Das transitive Bewusstsein ist wesentlich mit Wissen verknüpft. Ist man sich einer Bewegung im Gebüsch bewusst, weiß man demnach, dass sich im Gebüsch etwas bewegt; ist man sich seiner Unwissenheit bewusst, weiß man, dass man nichts weiß, und wenn man sich der Torheit seiner Gedanken bewusst wird, realisiert man und gelangt so zu der Erkenntnis, dass die eigenen Gedanken töricht sind. Ebenso weiß man, wenn man sich Jacks, der in
380 ‚Conscious‘ [bewusst] und ‚conscious of‘ [etwas bewusst] und das Nomen ‚consciousness‘ [Bewusstsein] tauchten erst im 17. Jahrhundert auf. Das Nomen ‚conscientia‘ und das Adjektiv ‚conscius‘ sind mit dem Verb ‚conscio‘ verwandt. Sie sind ebenso wenig eindeutig wie das Verb. Denn ‚conscientia‘ kann sowohl das Teilen von Wissen oder Wissen zum Ausdruck bringen, als auch Bewusstsein [awareness] oder Erfassen [apprehension] als solches und sogar einfach Geist [mind] oder Denken [thought]. Als es im Sinne von eingeweiht sein in das, was ein anderer weiß verwendet wurde, entfaltete es ‚aus sich heraus‘ einen reflexiven Gebrauch: ‚conscious to oneself‘ [einem selbst bewusst], d. h. ein Wissen von etwas, das einem an sich selbst verborgen war. Während ‚conscience‘ die spezifischere Bedeutung eines innerlichen Zeugen gewann, und dann später die eines innerlichen Gesetzgebers, entwickelte sich ‚conscious‘ in eine andere Richtung. Seine offensichtlich reflexive Form ‚to oneself‘ und seine notwendige Verbindung zu Mitwisserschaft verschwindet, obgleich ein Bedeutungsschatten des Letzteren noch greifbar ist, wenn man sagt, eine Person sei sich ihrer Empfindungen und Gefühle bewusst. Consciousness of something [Bewusstsein von etwas] erlangte einen weitaus größeren Anwendungsbereich, in dem der Sinn von Geheimnis oder privilegiertem Wissen keine Rolle mehr spielte. Ich kann mir etwas bewusst sein, z. B. des Tickens einer Uhr, des Rosendufts oder der späten Stunde, dessen sich auch andere bewusst sind. Die Bewusstseinsobjekte sind nicht länger auf geheime Wissenselemente beschränkt, und schon gar nicht auf die eigenen guten oder schlechten Taten, sondern sie umfassen ein weit gefasstes (wenn auch nicht allumfassendes) Spektrum an Dingen, die jemanden geistig beschäftigen können. Im 18. Jahrhundert trat being self-conscious in Erscheinung, im Sinne von ‚beschäftigt mit‘, sich selbst und seinen Eigenschaften ‚übermäßig viel Aufmerksamkeit zukommen lassen‘ oder, anders ausgedrückt, ‚zum Glauben oder zu der Vorstellung neigen, man selbst sei das Objekt der Beobachtung durch andere‘. Being conscious [bei Bewusstsein sein] – im Unterschied zu unconscious or insenate [bewusstlos oder besinnungslos sein] – taucht erst im 19. Jahrhundert auf. Und being ‚class-‚, ‚money-‚ oder ‚colour‘-conscious [‚klassen-‚‘ ‚finanz-‚ oder ‚farbbewusst‘] sind Wortschatzergänzungen aus dem 20. Jahrhundert. Siehe C. S. Lewis, Studies in Words (Cambridge University Press, Cambridge, 1960), Kap. 8.
346
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
der Ecke des Zimmers steht, bewusst ist, dass Jack anwesend ist, und wenn man sich eines Geräuschs bewusst ist, weiß man, dass es ein Geräusch gab. Natürlich wissen wir auch vieles, dessen wir uns nicht bewusst sind. Des Großteils der unzähligen Tatsachen, die wir gelernt oder erfahren haben, sind wir uns nicht bewusst. Wir wissen vieles, an das wir jedoch möglicherweise erinnert werden müssen, an die Dinge aber, derer wir uns bereits bewusst sind, müssen wir nicht erinnert werden. Was auch immer man gelernt oder erfahren und nicht unwiederbringlich vergessen hat, weiß man, man ist sich jedoch jener Objekte des transitiven Bewusstseins bewusst, die den eigenen Geist beschäftigen. Es gibt eine ganze Menge von Dingen, die man lernen oder erfahren kann, indem man in Kenntnis gesetzt wird, entdeckt oder herausfindet, dass es um sie so steht. Man kann sich jedoch nicht einer Sache bewusst werden, indem man davon in Kenntnis gesetzt wird, dass es um sie so steht – nur damit vertraut gemacht werden [made aware], dass es so um sie steht. (Und damit vertraut zu sein, dass es um die Dinge so steht, heißt nicht, sich bewusst zu sein, dass es so um sie steht. Dinge, die mir bereits vertraut sind, müssen Sie mir nicht mitteilen, obgleich Sie mich möglicherweise an sie erinnern müssen; Sie müssen mich jedoch nicht an das erinnern, dessen ich mir bereits bewusst bin.) Man kann gut darin sein, bestimmte Sachen zu lernen, zu entdecken, aufzudecken oder herauszufinden, es ist jedoch nicht möglich, sich Sachen gut bewusst zu werden oder bewusst zu sein. Dieser logische Gesichtspunkt erweist sich als zutreffend, insofern als die Frage ‚Woher wissen Sie das?‘ allgemein akzeptiert ist‘ wohingegen ‚Woher sind Sie sich der F-heit von X bewusst?‘ als unverständliche Frage aufgefasst wird, im Gegensatz zu ‚Was brachte Ihnen die F-heit von X zu Bewusstsein?‘ oder ‚Wie wurden Sie sich der F-heit von X bewusst?‘. Bewusstwerdung von etwas ist eine Form des Wissensempfangs Wodurch unterscheidet sich nun das Wissen, das man erwirbt, indem einem etwas bewusst wird, von anderen Formen des Wissenserwerbs? Das Bewusstwerden von etwas ist ein Geschehen – ebenso wie das Merken, das Bemerken und Realisieren von etwas. Anders als beim Lernen, Herausfinden oder Entdecken handelt es sich beim Bewusstwerden, Innewerden etc. nicht um etwas, das wir tun, geschweige denn um Handlungen, die wir ausführen. Man kann sich nicht willkürlich, intentional, vorsätzlich oder mit Absicht eines blinkenden Lichtes bewusst werden, X bemerken oder realisieren, dass man es bei X eigentlich mit Y zu tun hat. Folglich kann man nicht beschließen, ablehnen oder versuchen, sich etwas bewusst zu werden oder es zu bemerken oder zu realisieren und sich entsprechend auch nicht geschickt oder ungeschickt dabei anstellen. Man kann nicht nach dem Grund einer Person fragen, aus dem ihr etwas bewusst wurde oder sie etwas bemerkte oder realisierte. Vielmehr fragt man möglicherweise danach, was es ihr bewusst machte.
9.4 Das transitive Bewusstsein: Eine unvollständige Analyse
347
Die Familie der Verben des Wissensempfangs Normalerweise folgt das Bewusstsein von etwas der Bewusstwerdung dieses Etwas nach. ‚Sich etwas bewusst werden‘ gehört neben ‚merken‘ [to become aware of], ‚realisieren‘ und ‚bemerken‘ zu einer Kleinfamilie kognitiver Verben. Ebenso wie die Mitglieder der anderen Familie von Kognitionsverben, zu der ‚aufdecken‘, ‚entdecken‘, ‚aufklären‘, ‚ermitteln‘, ‚herausfinden‘ und ‚feststellen‘ gehören, drücken sie den Erwerb von Wissen aus. Was nun die erste Familie von der zweiten unterscheidet, ist der Umstand, dass ihre Mitglieder mit dem Wissensempfang in Zusammenhang stehen, im Gegensatz zur Wissensaneignung. Man kann anhand verschiedener Mittel und Methoden versuchen, etwas herauszufinden, aufzudecken, zu entdecken, und falls einem dies gelingt, eignet man sich Wissen an. Aber man versucht nicht, sich etwas bewusst zu werden oder etwas zu merken, zu bemerken oder zu realisieren – es ist in diesen Fällen vielmehr so, dass sich einem Wissen gleichsam aufdrängt. In die Mittel und Methoden des Wissenserwerbs kann man sich einarbeiten, geübter und geschickter werden, was sie angeht, hinsichtlich der Mittel und Methoden des Bewusstwerdens von etwas ist dies nicht möglich, da es dergleichen nicht gibt. Aufmerksamkeit, Reflexion, Erwägung und das Objekt des Bewusstseins Manche Formen des transitiven Bewusstseins sind dadurch charakterisiert, dass unsere Aufmerksamkeit von dem auf sich gezogen und gefangen gehalten wird, dessen wir uns bewusst sind. Eine andere Art des mit der Aufmerksamkeit zusammenhängenden Bewusstseins ist das akteuriale Handlungsbewusstsein, wenn die Aufmerksamkeit des Akteurs voll und ganz darauf gerichtet ist, was er gerade ‚bewusst und mit Bedacht‘ tut. Wie wir bei den anderen Formen des transitiven Bewusstseins gesehen haben, beschäftigen die Dinge, derer jemand sich bewusst ist, seinen Geist und können für seine Erwägungen von Bedeutung sein und/oder sein Verhalten und seine Reaktionen wissentlich einfärben. (Der Begriff des transitiven Bewusstseins ist mithin uneinheitlich, und man kann sagen, dass es sich bei den bisher getroffenen Unterscheidungen um ‚Variationszentren‘ innerhalb dieses Begriffsfeldes handelt.) Nicht alles, was wir wahrnehmen, ist ein Objekt unseres transitiven Bewusstseins Offenkundig handelt es sich bei jedwedem Wahrnehmungsbewussten um etwas Wahrgenommenes. Allerdings ist nicht jedes Wahrgenommene etwas Bewusstes. Erstens kann es sein, dass wir eine ganze Menge von dem, was wir wahrnehmen, nicht einmal bemerken, geschweige denn, dass wir uns diesen Sachen widmen – man kann also nicht sagen, wir seien uns ihrer bewusst. Zweitens: Wenn wir ein X wahrnehmen (z. B. eine Katze im Gebüsch), aber nicht realisieren, dass es sich um ein X handelt und es mit einem Y (z. B. einem Schatten) ver-
348
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
wechseln, kann man nicht sagen, wir seien uns eines X (z. B. einer Katze) bewusst, denn wir wissen nicht, dass sich eine Katze im Gebüsch befindet. Drittens: Selbst wenn wir etwas flüchtig bemerken, folgt daraus nicht, dass wir uns dieses Etwas bewusst sind, denn damit wir uns etwas wahrnehmend bewusst sein können, muss dieses Etwas unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und gefangen halten. Demnach kann man die leuchtenden Farben der Rosen bemerken, wenn man an ihnen vorübereilt, um den Bus zu erwischen, man braucht sich dabei jedoch nicht ihrer Farbe bewusst werden oder bleiben. Viertens: Wenn wir unsere Aufmerksamkeit intentional auf etwas und seine Eigenschaften richten wie in dem Fall, da wir ein Gemälde einer genauen Prüfung unterziehen oder uns mit jemandem unterhalten, kann man nicht sagen, wir seien uns dessen, was unsere Aufmerksamkeit auf diese Weise beschäftigt, bewusst (oder nicht bewusst), es sei denn, unsere Aufmerksamkeit wird von dieser Sache gefesselt. Denn wir können uns nur dessen bewusst werden oder sein, was unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht dessen, dem wir uns intentional zuwenden. An diesem Punkt besteht weiterer Erklärungsbedarf. Intentionale Aufmerksamkeit schließt Wahrnehmungsbewusstsein und seine Negation aus Wenn ich die Oberfläche eines Gemäldes sorgfältig prüfe und nach Abnutzungs- bzw. Wertminderungserscheinungen suche, kann ich mir eines feinen Risses in der Rahmenleiste bewusst werden, aber nicht auf der Oberfläche des Gemäldes, die ich untersuche. Wenn ich mich aufmerksam mit Daisy unterhalte, kann ich mir ihres fehlenden Interesses bewusst werden und dann bewusst sein, aber nicht ihrer selbst, obgleich ich sie wahrnehme und wahrnehme, dass sie da ist. Natürlich wäre es ebenso abwegig zu sagen, man sei sich der Oberfläche des Gemäldes oder Daisys nicht bewusst. Denn dies würde fälschlicherweise nahelegen, dass ich, was das Objekt meines Interesses angeht, unaufmerksam oder unwissend bin. In solchen Fällen (sorgfältigen Prüfens und aufmerksamen Unterhaltens) können wir uns dessen bewusst werden und dann sein, was unsere Aufmerksamkeit unterbricht, zeitweilig stört oder ablenkt (das Ticken einer Uhr im Hintergrund beispielsweise oder der von der Küche herüberziehende Essensgeruch). In anderen Fällen handelt es sich bei dem, dessen wir uns bewusst werden und dann sein können, um Merkmale des Objekts unserer Aufmerksamkeit, denen wir uns nicht widmeten, die aber dennoch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und gefangen halten: Daisys Augenfarbe beispielsweise oder ihr Gelangweiltsein, der feine Riss in der Rahmenleiste oder das kleine Wurmloch in dessen Ecke. Die Gründe dafür sind offensichtlich: (a) Wenn unsere Aufmerksamkeit intentional auf etwas gerichtet ist, so ist das, worauf wir achten und dem wir uns widmen, nichts passiv Empfangenes. (b) Jener Merkmale eines Objekts, auf die wir unsere Aufmerksamkeit intentional richten, werden wir uns nicht bewusst; man kann vielmehr von jenen Merkmalen, die für
9.4 Das transitive Bewusstsein: Eine unvollständige Analyse
349
eine Verlagerung in unserer Aufmerksamkeit sorgen, sagen, dass wir uns ihrer bewusst werden und dann sind. (c) Was sich uns von selbst aufdrängt, sich uns unabhängig von unserem Wünschen und Wollen einprägt, ist häufig genau das, womit wir gar nicht zielstrebig beschäftigt sind: ablenkende Merkmale nämlich, die unsere Aufmerksamkeit fordern, wie z. B. das Ticken einer Uhr oder der Essensgeruch. Bei vielem, von dem wir ein Wahrnehmungsbewusstsein erlangen und dann haben, handelt es sich um Objekte der peripheren Wahrnehmung, die unsere Aufmerksamkeit in der einen oder anderen Weise auf sich ziehen und gefangen halten. In den Fällen jedoch, in denen die Aufmerksamkeit einer Person von etwas gefesselt wird – und zwar für gewöhnlich, aber nicht ausschließlich, von etwas, dem sie mit intensiver Konzentration nachgeht –, sagen wir, dass ‚sie sich nichts anderem bewusst war als . . .‘, um so die Ausschließlichkeit ihres Aufmerksamkeitsfokus kenntlich zu machen. Hier verlagert sich der Schwerpunkt von der durch etwas auf sich gezogenen Aufmerksamkeit zur unwiderstehlich gefangen gehaltenen und somit vom Wissensempfang zur Aufmerksamkeitsfesselung (bei der es sich um das Resultat intentionaler Konzentration handeln kann). Somatisches Bewusstsein und Aufmerksamkeit Auch das somatische Bewusstsein von Empfindungen ist ein Fall, bei dem jemandes Aufmerksamkeit von etwas auf sich gezogen und gefangen gehalten wird. Weil es sich beim Schmerzenhaben nicht um eine Form der Wahrnehmung handelt, ist das Schmerzbewusstsein kein Fall des Wahrnehmungsbewusstseins. Meistens besteht kein Unterschied zwischen Schmerzen haben und sich Schmerzen bewusst sein. Wenn eine Empfindung intensiv ist, wird sie die Aufmerksamkeit unweigerlich auf sich ziehen. Je intensiver sie ist, desto mehr drängt sie sich unserer Aufmerksamkeit auf. Wenn sie wie ein stechender Schmerz vorübergeht, kann man nicht umhin, von ihr Kenntnis zu haben [being aware of]. Wenn sie andauert, kann man nicht umhin, sich ihrer bewusst zu sein [being conscious of]. Je intensiver die Empfindung, desto schwerer ist es, sich mit irgendetwas anderem zu befassen oder auch nur an irgendetwas anderes zu denken. Es ist kein Zufall, dass wir davon sprechen, dass uns der Schmerz ‚im Griff‘ hat. Je geringer die Intensität der Empfindung ist, desto leichter für uns, unsere Aufmerksamkeit von ihr ablenken zu lassen oder sie zu vergessen. (Anzumerken ist, dass es sich beim Vergessen der Schmerzen (oder Sorgen), da ein Besucher uns an unserem Krankenbett zerstreuen konnte, nicht um einen Gedächtnisausfall handelt, sondern um eine Ablenkung der Aufmerksamkeit.)
350
9 Intransitives und transitives Bewusstsein
Affektionsbewusstsein und Realisierung Das Affektionsbewusstsein hat, wie oben festgestellt, ebenso mit Gefühlen zu tun, allerdings in einem anderen Sinn des Wortes. Zu seinen Objekten zählen Emotionen wie Zorn, Erbarmen, Mitgefühl, Angst, Stolz oder Scham sowie die entsprechenden Motive; Erregungen wie erschrocken, geschockt oder verwundert sein; Stimmungen wie reizbar, fröhlich, niedergeschlagen, gelangweilt, ängstlich oder glücklich sein; sowie Haltungen wie zufrieden, aufgeschlossen oder gleichgültig sein. Auch solcher Gefühle kann man sich bewusst werden und sich bewusst sein, sie zu haben, und man kann seine Motive realisieren und sich ihrer bewusst werden. Einige dieser Fälle gehen mit Empfindungen einher, die man nicht fühlen kann, ohne von ihnen Kenntnis zu haben oder sich ihrer bewusst zu sein. In manchen Fällen kann man ein bestimmtes Muster an Empfindungen haben, ohne zu realisieren, dass sie dem und dem umfassenderen Gefühlssyndrom gleichkommen oder zu diesem gehören. Sobald man es realisiert, kann man sich bewusst werden, dass man sich gelangweilt fühlt, eifersüchtig ist oder Angst hat. In vielen Fällen sind jedoch keine deutlich ausgeprägten Empfindungen beteiligt oder sogar überhaupt keine. Man kann sich seiner Langeweile bewusst werden, wenn man merkt, dass die eigene Aufmerksamkeit abschweift. Man kann sich des Gelangweiltseins anschließend bewusst bleiben, wenn einen das Gefühl der Langeweile beschäftigt. Man kann sich seiner Verlegenheit bewusst werden, wenn man erfasst, dass andere den eigenen Ausrutscher bemerkt haben, und wenn der Gedanke einen entsprechend verunsichert und man diese Tatsache realisiert und sie einem gegenwärtig bleibt. Man kann sich bewusst werden, dass man aus Eifersucht handelt, wenn man sich selbst prüft, über seine Gründe nachdenkt und realisiert, dass sie unter das und das Muster fallen. Reflexionsbewusstsein Das Reflexionsbewusstsein haben wir namhaft gemacht, um jene Fälle in die Betrachtung einzubeziehen, da man sich einer Reihe von Dingen bewusst ist, bei denen es sich weder um Objekte der gegenwärtigen Wahrnehmung oder Empfindung noch um aktuell gefühlte Emotionen, Erregungen oder Stimmungen handelt. Zu dieser ziemlich heterogenen Sammlung von Elementen gehören das Nachdenken über und die Realisierung von Tatsachen, die einen selbst oder andere oder weder einen selbst noch andere betreffen und sich sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft beziehen können. Das Wissen, um das es uns hier geht, ist ein Wissen, das die Gedanken eines Menschen beschäftigt, für seine Überlegungen von Bedeutung ist, seine Reaktionen einfärbt und seine Handlungen beeinflusst. Bin ich mir Ihres vor Kurzem eingetretenen Trauerfalls bewusst, äußere ich mich zu diesem und jenem so, dass kein weiteres Leid entsteht; bin ich mir meiner Unwissenheit bewusst, wähle ich meine Worte mit besonderer Vorsicht und gebe mich bescheiden; bin ich mir der vorgerückten Stunde bewusst, schaue ich unruhig auf die Uhr und frage mich, ob ich den letzten Bus wohl noch bekommen
9.4 Das transitive Bewusstsein: Eine unvollständige Analyse
351
kann und so weiter. Im Allgemeinen ist das Bewusstsein von Tatsachen wie diesen – wie auch solche Fälle, da man sich einer zuteil gewordenen Ehre, des Stellenwerts einer Gelegenheit oder des Ernstes einer Lage bewusst ist – eine Sache des Berücksichtigens des Wissens, über das man verfügt, und geht damit einher, dass einen dieses Wissen auf unterschiedliche Art beeinflusst. Das Bewusstsein eines Akteurs von seinen Handlungen ist ebenso wie das Wahrnehmungsbewusstsein an die Aufmerksamkeit gebunden. Während jedoch sich etwas wahrnehmend bewusst zu werden und dann zu sein dadurch charakterisiert ist, dass die Aufmerksamkeit von etwas auf sich gezogen und gefangen gehalten wird (und nicht intentional verliehen), begreift eine ‚bewusst und mit Bedacht‘ ausgeführte Handlung die intentionale Hinwendung der Aufmerksamkeit zur Handlung oder Aktivität ein. Die begriffliche Komplexität und Heterogenität des transitiven Bewusstseins sowie sein polymorpher Charakter deuten darauf hin, dass a priori nichts für die Annahme spricht, es könne mit irgendeiner einzelnen neuronalen Ereigniskette oder Prozessfolge korrelieren, und dass der Gedanke, es sei unwahrscheinlich, dass es irgendeine solche uniforme Korrelation gibt, über einige Plausibilität verfügt.
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia 10.1 Erweiterung des Bewusstseinsbegriffs Die Verwirrung hinsichtlich des Bewusstseins betrifft nicht speziell das transitive Bewusstsein Wir hoffen, dass die bisherigen Untersuchungen das schwierige Begriffsterrain etwas erhellen konnten. Unsere skizzenhaften Erörterungen sind unvollständig, sie genügen allerdings, um sich ein Bild von der begrifflichen Vielfalt der Formen des transitiven Bewusstseins zu machen. Viele Neurowissenschaftler (und Philosophen) werden jedoch zu Recht entgegnen, dass es nicht dieser Sinn von ‚Bewusstsein‘ war, der ihre Aufmerksamkeit fesselte. Die Unterscheidung zwischen transitivem und intransitivem Bewusstsein ist hinreichend deutlich geworden, und die Differenzierung der Formen des transitiven Bewusstseins hilft möglicherweise weiter. Wer jedoch ‚das Bewusstseinsproblem‘ als das Hauptproblem der Neurowissenschaften betrachtet, zerbricht sich nicht den Kopf über die verschiedenen Formen des transitiven Bewusstseins. Die Verwirrung entsteht durch die bloße Vorstellung der Erfahrung oder ‚des Bewusstseinsbereichs‘ Die Verwirrung entsteht durch den Gedanken, dass eine ausschließlich physikalische Beschreibung der Welt die Erfahrung ausspart. Was wohl auch das Verhalten lebender Körper betreffen würde. Bei Erfahrungen handele es sich allerdings nicht um Verhalten, sondern um etwas, das dem Verhalten zugrunde liegt, etwas wesentlich Subjektives. Demnach ist das Verhalten, das Kummer, Hoffnung, Freude, Angst, Zuneigung etc. ausdrückt, lediglich die äußere Schale der inneren psychischen Realität, mit der jedes Subjekt aufs Intimste vertraut ist. Und genau dieser ‚Bewusstseinsbereich‘ sei rätselhaft – und er umfasse viel mehr, als die Formen des transitiven Bewusstseins, die im vorigen Kapitel dargestellt wurden. Die gegenwärtige Ausdehnung des Bewusstseins auf ‚Erfahrung‘ ist krypto-cartesianisch Diese Erweiterung des Bewusstseinsbegriffs auf das gesamte Spektrum all dessen, was seine Verfechter ‚Erfahrung‘ nennen, findet ihre Entsprechung in der cartesianischen Identifizierung der ‚Gedanken‘ mit Bewusstsein, denn Descartes vertrat die Ansicht, dass Empfindung, Wahrnehmungserfahrung, Vorstellung, Kogitation, Affektion und
10.1 Erweiterung des Bewusstseinsbegriffs
353
Wollen den Bewusstseinsbereich bilden.381 Bei dieser Entsprechung haben wir es mit einer weiteren krypto-cartesianischen Facette zu tun, die die gegenwärtigen Neurowissenschaften und die Kognitionswissenschaften als auch manche Bereiche der Philosophie des Geistes charakterisiert. Wir werden untersuchen, wodurch diese Erweiterung des alltäglichen Bewusstseinsbegriffs motiviert ist und wie ‚Erfahrung‘ ge- bzw. missdeutet wird. Die Verwirrung darüber, wie physische (neurale) Ereignisse Bewusstsein hervorbringen können, ist wesentlich cartesianisch Weshalb sollte die Tatsache, dass menschliche Wesen (und andere Kreaturen auch) in den Genuss mannigfaltiger Erfahrungen kommen, rätselhaft sein? Weshalb sollte darin das Zentralproblem der Neurowissenschaften bestehen? Es ist kaum zu übersehen (und sollte vielleicht beunruhigen), dass das Hauptargument ein philosophisches ist, freilich ein cartesianisches. Aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet mag es einem äußerst rätselhaft und geheimnisvoll vorkommen, wie die Kausalvorgänge in der materiellen Welt zu irgendsoetwas wie Erfahrung führen können, die sich von der Materie kategorial unterscheidet. Wie kann die Wirkung der Strahlung auf die Zapfen und Stäbchen der Netzhaut die Erfahrung des (bewussten) Sehens von etwas hervorbringen? Wie können die Geschehnisse im Kortex bewirken, dass bewusste Geisteszustände ‚in Erscheinung treten‘? Natürlich ist hier vom cartesianischen Blickwinkel die Rede, dem zufolge sich die Welt aus zwei kategorial distinkten Bereichen zusammensetzt, dem materiellen Bereich (wesentlich durch den Ausdehnungsbegriff charakterisiert) und dem geistigen Bereich (wesentlich durch den Bewusstseinsbegriff charakterisiert). Es dürfte nun allerdings klar sein, dass dieser Blickwinkel weder nötig ist (die aristotelische Konzeption kam ohne ihn aus (siehe 1.1)) noch unproblematisch (siehe 1.2 und die einleitenden Bemerkungen zu Teil II). Diese cartesianischen Probleme bringen andere scheinbare Rätsel mit sich. Weshalb sollte der Einfluss einer bestimmten Strahlungsart gerade die Erfahrung hervorrufen, die sie hervorruft? Weshalb sollte Licht einer bestimmten Wellenlänge bewirken, dass wir die Erfahrung haben, Rot zu sehen und nicht Blau oder Grün, oder gar eine qualitativ völlig andere Erfahrung zur Folge haben wie einen Klang zu hören beispielsweise? Wenn die bewusste Erfahrung das Ergebnis einer solchen neuralen Erregung ist, welchem Zweck dient sie? Weshalb könnte es nicht Lebewesen geben, deren Nervensystem Siehe Descartes, Die Prinzipien der Philosophie, I–9: ‚Unter dem Wort Denken [Gedanke] verstehe ich alles, was auf bewusste Weise in uns geschieht (nobis consciis), das wir also erkennen, insofern es zu unserem Bewusstsein gehört‘ (siehe auch Erwiderung auf den zweiten Einwand (AT VII, 161) und Brief an Mersenne, 27. April 1637 (AT I, 366)). Zur weiteren Erörterung siehe: A. J. P. Kenny, ‚Cartesian privacy‘, in The Anatomy of the Soul (Blackwell, Oxford, 1973), S. 113– 128. 381
354
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
wie das unsrige reagiert und die sich so verhalten, wie wir es tun, allerdings keine (so aufgefassten) bewussten Erfahrungen haben? Genau solche Fragen sind es, in denen das Rätselhafte und Geheimnisvolle zur Sprache kommt – zumindest ist das die weit verbreitete Ansicht. Wir werden darauf im 11. Kapitel zurückkommen. Neurowissenschaftler und Philosophen erweitern den Bewusstseinsbereich Was die Neurowissenschaftler bei ihren Reflexionen über die Bewusstseinsnatur interessiert, sind also die bewussten Geisteszustände oder die bewusste Erfahrung. Benjamin Libet charakterisiert das Bewusstsein in der Encyclopaedia of Neuroscience als „subjektive Kenntnis [awareness] und subjektive Erfahrung, seien es sensorische Erfahrungen von unserer Innen- und Außenwelt oder die subjektive Erfahrung von unseren Gefühlen und Gedanken oder sei es schlechthin die Kenntnis von unserem existierenden Selbst und unserem Dasein in der Welt. Nur unser eigenes subjektives Innenleben, einschließlich der sensorischen Erfahrungen, Gefühle, Gedanken, Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen, ist für uns als Menschen wirklich von Bedeutung.“382 Auch B. J. Baars beobachtet: „Wenn wir Menschen am Morgen das Bewusstsein wiedererlangen, teilen wir eine ganze Reihe reichhaltiger, verschiedenartiger Erfahrungen mit: Farben und Geräusche, Gefühle und Gerüche, Bilder und Träume, das prächtige Schauspiel unserer alltäglichen Wirklichkeit. [. . .] Unsere Gehirne beginnen von Neuem zu funktionieren. In diesem umfassenden Sinn ist das Bewusstsein ganz ohne Zweifel von zentraler Bedeutung.“383 Im Rahmen seiner Überlegungen zur Frage, wie man das Bewusstsein ‚wissenschaftlich‘ angehen könne, beschloss Crick, sich auf das ‚visuelle Bewusstsein‘ [visual awareness] zu konzentrieren, womit er offensichtlich die visuelle Erfahrung des Sehens von etwas meinte.384 Edelman charakterisierte ‚Primärbewusstsein‘ [primary consciousness] ebenso als „den Zustand, in dem man die Dinge in der Welt geistig erfasst“.385 Kurz gesagt, das Interesse gilt den Formen des subjektiven Erlebens im Allgemeinen und insbesondere der Wahrnehmungserfahrung (und hier wiederum ihrer visuellen Form) – nicht speziell dem intransitiven Bewusstsein oder den verschiedenen Formen des transitiven Bewusstseins. Die Philosophen erweitern den Bewusstseinsbegriff gleichfalls, auf dass er die Wahrnehmungserfahrung insgesamt und mehr noch abzudecken vermag. So identifiziert beispielsweise Searle das Bewusstsein mit „unseren alltäglichen subjektiven Erlebens- und B. Libet, ‚Consciousness: conscious, subjective experience‘, in Encyclopaedia of Neuroscience, Bd. I, hg. von George Adelman (Birkhäuser, Boston, 1987), S. 271f. 383 B. J. Baars, In the Theater of Consciousness (Oxford University Press, New York, 1997), S. 14 (siehe auch S. 3). 384 F. Crick, The Astonishing Hypothesis (Touchstone, London, 1995), S. 21 [dt. Was die Seele wirklich ist (Artemis & Winkler, München & Zürich, 1994), S. 40]. 385 G. Edelman, Bright Air, Brilliant Fire – On the Matter of the Mind (Penguin, Harmondsworth, 1994), S. 112 [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer (Piper, München, 1995), S. 163]. 382
10.2 Bewusste Erfahrung und bewusste Geisteszustände
355
Bewusstseinszuständen, während wir wach sind, sowie mit unseren Traumzuständen, während wir schlafen“, wobei er alle „inneren, qualitativen subjektiven Zustände wie unsere Schmerzen und Freuden, Erinnerungen und Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle, Stimmungen, all die Fälle der Reue und alle Hungeranwandlungen“ einbezieht.386 Und Chalmers behauptet: „Was das Bewusstsein angeht, ist einzig die Erfahrung von zentraler Bedeutung“. Diese reicht von „lebhaften Farbeindrücken bis zu den Erfahrungen feinster Hintergrundaromen; von heftigen Schmerzen bis zur flüchtigen Erfahrung von Gedanken, die einem auf der Zunge liegen; von profanen Geräuschen und Gerüchen bis zur umgreifenden Größe musikalischer Erfahrung; von der Alltäglichkeit eines lästigen Juckens bis zum Lasten einer tiefen existenziellen Angst“.387 Die Vorstellung, dass immer dann, wenn wir etwas wahrnehmen, wir uns dieses Etwas auch bewusst sind, ist nicht zu rechtfertigen, wie wir dargelegt haben. Das transitive Bewusstsein ist polymorph und umfasst zugleich weniger (in einer Hinsicht) als auch mehr (in anderer Hinsicht), als das Spektrum der Wahrnehmungserfahrungen. Die Annahme, man müsse sich immer dann, wenn man sich in einem bestimmten Geisteszustand befindet, dessen (d. h., dass man es ist) auch transitiv bewusst sein, ist gleichermaßen abwegig. Man kann eifersüchtig sein, ohne es zu realisieren, und man kann reizbar sein, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die Neurowissenschaftler, Kognitionswissenschaftler und Philosophen neigen jedoch im Allgemeinen dazu, Bewusstsein mit Erleben gleichzusetzen oder es gar drastisch zu erweitern, und zwar nahezu auf das gesamte Spektrum des Geistigen. Zunächst müssen wir diese Erweiterung untersuchen. Anschließend werden wir einer ihrer Wurzeln nachspüren: der Qualiakonzeption nämlich, die sich viele Neurowissenschaftler und Philosophen in diesen Tagen zu eigen gemacht haben.
10.2 Bewusste Erfahrung und bewusste Geisteszustände Die Uneindeutigkeit von ‚bewusste Erfahrungen‘ und ‚bewusste Zustände‘ Die Erweiterung des Bewusstseinsbegriffs schließt den Gebrauch der Wendungen ‚bewusste Erfahrungen‘ und ‚bewusste Zustände‘ ein. Diese Wendungen bringen einerseits Erfahrungen und Zustände zum Ausdruck, derer man sich bewusst ist. Nach diesem Verständnis haben sie mit einer Subkategorie des transitiven Bewusstseins zu tun (oder dürften damit zu tun haben). Denn es ist zweifellos so, dass man sich verschiedener Erfahrungen, die man durchlebt, oder verschiedener Zustände, in denen man sich befindet, bewusst sein kann, wenn die Aufmerksamkeit von ihnen auf sich gezogen und gefangen gehalten wird (z. B. vom Schmerz) oder wenn man realisiert, dass es so um einen 386 387
J. R. Searle, The Mystery of Consciousness (Granta Books, London, 1997), S. xii–xiii. D. J. Chalmers, The Conscious Mind (Oxford University Press, Oxford, 1996), S. 3f.
356
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
steht (dass man z. B. eifersüchtig ist), und die Tatsache, dass es so um einen steht, den Geist beschäftigt und die Gedanken, Reaktionen und Handlungen wissentlich beeinflusst. So wird die Sache im Allgemeinen jedoch nicht aufgefasst. Man könnte die Termini ‚bewusste Erfahrung‘ und ‚bewusste Zustände‘ wiederum auch so verstehen, als drückten sie Erfahrungen aus, die man gehabt, derer man sich erfreut oder die man durchlebt hat, sowie Geisteszustände, in denen man sich befindet, während man bei Bewusstsein ist. Eine bewusste Erfahrung ist keine Erfahrung, die bewusst ist Unabhängig davon, ob wir den Ausdruck ‚bewusste Erfahrung‘ so oder so verstehen, dürfen wir nicht den Fehler machen anzunehmen, dass eine bewusste Erfahrung eine Erfahrung ist, die die Eigenschaft hat, bewusst zu sein.388 Die Person, die die Erfahrung hat, ist bewusst/bei Bewusstsein und kann sich einer bestimmten Erfahrung bewusst sein – z. B. ihres stärker werdenden Zorns oder der Eifersuchtsgefühle. Wenn ich realisiere, dass ich meine Beherrschung verliere, und mir mithin meines stärker werdenden Zorns bewusst werde, so ist es ebenso wenig mein Zorn, der zu Bewusstsein kam, wie es die Uhr oder ihr Ticken ist, die bzw. das zu Bewusstsein kam, wenn ich mir des Tickens der Uhr bewusst werde. Wessen man sich bewusst wird, ist ein Objekt, kein Subjekt, des Bewusstseins. Und eine Erfahrung, die man hat, während man bei Bewusstsein ist, besitzt nicht die Eigenschaft, bewusst zu sein, und es muss sich bei ihr auch nicht um eine Erfahrung handeln, derer man sich transitiv bewusst ist – und man ist sich ihrer nicht bewusst, wenn sie weder die eigene Aufmerksamkeit auf sich zieht und gefangen nimmt noch die eigenen Gedanken beschäftigt oder für die eigenen Überlegungen wissentlich von Bedeutung ist. Dies bedeutet natürlich nicht, dass es sich um eine ‚unbewusste Erfahrung‘ handelt; und es bedeutet auch nicht, dass man nicht sagen kann, man mache die und die Erfahrung. Man muss nicht von der Tatsache, dass man sich in einem freudigen oder ängstlichen Geisteszustand befindet, in Beschlag genommen sein, um sagen zu können, man sei voller Freude oder habe Angst; und man muss auch nicht über die Tatsache, dass man etwas oder etwas anderes anschaut, betrachtet oder beobachtet, nachdenken, um sagen zu können, man tue das.
Wie beispielsweise Rosenthal behauptet: ‚Wir erklären die Eigenschaft eines Geisteszustands, bewusst zu sein, im Sinne unseres Bewusstseins von diesem Zustand‘ (D. M. Rosenthal, ‚Thinking that one thinks‘, in M. Davies und G. W. Humphreys (Hg.), Consciousness (Blackwell, Oxford, 1993), S. 198f., unsere Hervorhebung). Ein bewusster Geisteszustand ist jedoch ebenso wenig ein Geisteszustand, der die Eigenschaft hat, bewusst zu sein, wie ein leidenschaftlicher Glaube ein Glaube ist, der die Eigenschaft hat, leidenschaftlich zu sein. Was Rosenthal offensichtlich meinte, war, dass wir die Wendung ‚bewusster Geisteszustand‘ im Sinne unseres Bewusstseins von dem entsprechenden Zustand erklären. 388
10.2 Bewusste Erfahrung und bewusste Geisteszustände
357
Von Träumen abgesehen werden alle Erfahrungen gehabt, während man bei Bewusstsein ist; Schwierigkeiten mit der Erweiterung der ‚Erfahrung‘ Wenn wir die strittige Frage zurückstellen, ob träumen ‚eine Erfahrung‘ genannt werden soll, ist die Wendung ‚bewusste Erfahrung‘ – verstanden als eine Erfahrung, die man hat, während man bei Bewusstsein ist – normalerweise ein Pleonasmus. Denn wird träumen als eine Erfahrung missverstanden, dann erfreut man sich oder erlebt man im Normalfall sämtliche Erfahrungen, während man bei Bewusstsein ist. Es ist allerdings fraglich, was mit dem unklaren Terminus ‚Erfahrung‘ genau gemeint ist.389 Wahrnehmen kann in all seinen verschiedenen Ausprägungen und zahlreichen Formen sicherlich als ‚Erfahrung‘ charakterisiert werden; was auch auf die Empfindungen oder die Gefühle des körperlichen Allgemeinbefindens zutrifft, auf gegenwärtig gefühlte Stimmungen und Emotionen sowie zweifellos auf vieles andere, was jemand haben, erleben oder sich seiner erfreuen kann, einschließlich der Aktivitäten und abenteuerlichen Unternehmungen. Es ist dennoch offensichtlich, dass ‚Erfahrung‘ nicht den gesamten Bereich des Psychischen umfasst. Ist denken eine Erfahrung? Wenn ich denke, dass es ungefähr 14.30 Uhr ist, ist das eine Erfahrung? Wie lange dauerte sie? So lange, wie es brauchte, ‚Ich denke, es ist 14.30 Uhr‘ zu sagen? Wenn ich denke (der Meinung bin), dass Freiheit wichtiger ist als Gerechtigkeit (oder umgekehrt), ist das eine Erfahrung? Und wenn zwei Menschen das Gleiche denken, folgt dann daraus, dass sie die gleichen Erfahrungen hatten? Wenn ich glaube, dass die Schlacht von Agincourt im Jahre 1416 geschlagen wurde, ist das eine Erfahrung? Und wenn Sie mich korrigieren und ich nun glaube, dass die Schlacht 1415 stattfand, ist die Änderung meines Glaubens eine Erfahrung? Und ist Ihre Erinnerung an das Datum eine Erfahrung? Wenn ich beabsichtige, um 12.30 Uhr Mittag zu essen, ist dieses mein Beabsichtigen eine Erfahrung? Ist wissen, dass um 12.30 Uhr Mittag gegessen wird, eine Erfahrung? Und wenn ich mich entscheide, das Mittagessen ausfallen zu lassen, hatte ich dann eine Erfahrung? Wenn ich etwas sage und meine, was ich sage, ist dieses Meinen, was ich sage, eine Erfahrung, die ich durchlebte? Wenn ich sage ‚Napoleon war ein Narr‘ und meine damit Napoleon III., ist das Ihn-Meinen eine Erfahrung, die ich hatte? Wir müssen darauf achten, dass wir den Ausdruck ‚Erfahrung‘ nicht noch über seine ohnehin großzügigen und ausgesprochen vagen Grenzen hinaus ausdehnen. Es gibt offensichtlich eine ganze Reihe psychologischer Zu beachten ist, dass in der Alltagsrede ‚eine Erfahrung‘ üblicherweise etwas Bemerkenswertes ausdrückt, das man getan oder erlebt hat, zum Beispiel dass man gestern eine wundervolle Erfahrung hatte – es wurde eine Überraschungsparty von allen Freunden ausgerichtet, oder zum Beispiel eine höchst unangenehme Erfahrung – man musste einem Freund mitteilen, dass seine Frau gestorben ist. In einem davon abweichenden Sinne sagen wir von einer Person auch, dass sie ganz allgemein im Leben oder in der Politik oder in irgendeinem anderen Praxis- oder Forschungsbereich umfangreiche oder eingehende Erfahrungen hatte. Diese Verwendungen oder Verwendungsapekte sind für unser Anliegen unerheblich und werden von uns nicht berücksichtigt. 389
358
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
Prädikate, die nicht als ‚Erfahrungsprädikate‘ klassifiziert werden können, und also auch eine ganze Reihe psychologischer Attribute, bei denen es sich nicht um Erfahrungen handelt. Bewusstsein und Wahrnehmungserfahrung Man könnte den Terminus ‚Bewusstsein‘ plausibel auf das Spektrum der Wahrnehmungserfahrung ausdehnen, indem man argumentiert – wie es einige Philosophen bereits getan haben –, dass es sich bei den verschiedenen Wahrnehmungsmodi um Formen des Objektbewusstseins handelt. Demnach ist Sehen visuelles Bewusstsein oder Bewusstsein von Visibilia, Hören auditives Bewusstsein oder Bewusstsein von Audibilia und so weiter. Es ist selbstverständlich unstrittig, dass das transitive Wahrnehmungsbewusstsein die verschiedenen Formen der Wahrnehmungsmodi annimmt. Wie bereits dargelegt (9.4) sind wir uns allerdings nicht jedes Objekts bewusst, das wir sehen oder hören, denn nicht alles, was wir sehen oder hören, zieht die Aufmerksamkeit auf sich und hält sie gefangen. Manchen Dingen, die wir sehen oder hören, wenden wir unsere Aufmerksamkeit intentional zu, und unter sonst gleichen Bedingungen kann man von diesen nicht sagen, dass wir uns ihrer entweder bewusst oder nicht bewusst sind. Manchmal sehen oder hören wir etwas – einen Schatten im Gebüsch beispielsweise oder ein Auto mit Fehlzündungen – und halten es für etwas anderes – für eine Katze im Gebüsch beispielsweise oder für einen Gewehrschuss –, und folglich kann man nicht sagen, wir seien uns dessen, was wir sehen oder hören, bewusst, denn wir wissen nicht, was dort ist – ein Schatten im Gebüsch oder ein in der Nähe befindliches Auto mit Fehlzündungen –, da wir irrtümlicherweise annehmen, eine Katze gesehen oder einen Gewehrschuss gehört zu haben. Man kann a fortiori nicht sagen, wir seien uns bewusst, dass sich eine Katze im Gebüsch bewegte (oder hätten ein Bewusstsein von der Bewegung einer Katze im Gebüsch) oder seien uns bewusst, dass ein Schuss aus einem Gewehr abgefeuert wurde (oder hätten ein Bewusstsein von einem Gewehrschuss). Obgleich vollkommen nachvollziehbar, verdeckt die Ausweitung des Bewusstseinsbegriffs auf das gesamte Spektrum der Wahrnehmungserfahrung somit die feinen Unterschiede, die wir mit Hilfe unseres Alltagsbegriffs des transitiven Wahrnehmungsbewusstseins herausgearbeitet haben. Für manche Zwecke spielt das möglicherweise keine Rolle, und in einigen Zusammenhängen ist es unbedenklich. Für andere Zwecke und in anderen Zusammenhängen spielt es jedoch eine Rolle. Insbesondere dann, wenn man den Bewusstseinsbegriff, auf den wir in unserer vorliegenden Erörterung zurückgreifen, präzise fassen will, wäre man schlecht beraten, ihn in dieser Weise auszuweiten. Denn indem man dies tut, schließt man das aus der Betrachtung aus, was für den Begriff (und somit auch die Phänomene) des transitiven Bewusstseins charakteristisch ist.
10.2 Bewusste Erfahrung und bewusste Geisteszustände
359
Bewusstsein und Geisteszustände Das trifft annähernd auch auf den Ausdruck ‚bewusster Geisteszustand‘ zu. Wie so viele andere kategoriale Termini im Bereich des Psychischen (beispielsweise ‚Geistesprozess‘, ‚Geistesaktivität‘, ‚geistiges Ereignis‘) ist auch der Terminus ‚Geisteszustand‘ unbestimmt. Zunächst müssen wir zwischen dispositionalem und sich ereignendem Geisteszustand unterscheiden. Wenn wir sagen, eine Person befinde sich in einem anhaltenden Zustand der Niedergeschlagenheit oder der neurotischen Ängstlichkeit, der Wochen oder Monate fortdauern kann, sprechen wir von ihrer Disposition, im Wachzustand niedergeschlagen oder ängstlich zu sein. Natürlich kann sich eine Person der Tatsache bewusst werden und dann sein, dass sie sich in einem anhaltenden Zustand der Niedergeschlagenheit befindet, so wie sie sich jeder anderen stimmungsmäßigen oder charakterlichen Disposition bewusst werden und dann sein kann, wenn sie realisiert, dass sie sich in einem solchen dispositionalen Zustand befindet und diese Tatsache immer wieder für gewisse Zeit ihr Denken beschäftigt oder für ihre Überlegungen von Bedeutung ist. Im Gegensatz dazu meinen wir sich ereignende Geisteszustände, wenn wir davon sprechen, dass wir jemanden in einem Zustand akuter Ängstlichkeit vorfinden, wenn wir sagen, dass uns die guten Nachrichten für den Rest des Tages froh machten oder dass wir aufgrund einer Beleidigung verärgert waren und vor Wut kochten, bis man sich bei uns entschuldigt hat. Solche Zustände treten während unseres ‚Wachlebens‘ auf und können als ‚bewusste Geisteszustände‘ bezeichnet werden. Dies bedeutet nicht, dass man sich ihrer notwendigerweise (transitiv) bewusst ist – man kann eine Zeit lang eifersüchtig sein, wenn man beobachtet, wie Daisy flirtet, ohne zu realisieren, dass man eifersüchtig ist, so wie man sich auch eine Zeit lang in gelangweilter oder reizbarer Stimmung befinden kann, ohne sich dessen bewusst zu sein. Es bedeutet vielmehr, dass es sich bei solchen Zuständen um Geisteszustände handelt, an denen man teilhat, während man bei Bewusstsein ist, und mithin auch, dass es Zustände sind, derer man sich bewusst werden kann, wenn man realisiert, dass man sich in einem solchen Zustand befindet, und wenn die Tatsache, dass man darin ist, die eigenen Gedanken beschäftigt und so weiter. Klarstellungen, den Begriff eines Geisteszustands betreffend Geisteszustände sind diesem Verständnis nach für gewöhnlich Zustände, in denen man sich befindet und die eine gewisse Zeit andauern. Während sie bestehen, ist es jederzeit möglich, sozusagen ‚stichprobenhaft‘ zu kontrollieren, ob sie noch bestehen, und man kann bestimmen – mal präzise, mal nur grob –, wann sie begannen und wann sie endeten. Sie können durch Ablenkung oder Aufmerksamkeitsverlagerung unterbrochen und später wieder aufgenommen werden. Sie weisen Intensitätsgrade auf und sind schwankend in ihrem Bestand. Während der Schlafphasen oder bei Bewusstseinsverlust dauern sie nicht an. Ich kann mich also in einem Zustand intensiver Konzentration befinden,
360
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
der seinen Anfang nahm, als ich zu schreiben begann, und endete, als ich damit aufhörte. Dieser kann durch einen Telefonanruf unterbrochen und später wieder aufgenommen worden sein, mit einer möglicherweise geringeren Intensität. Ich kann mich den ganzen Tag über in einem ängstlichen oder freudigen Geisteszustand befinden und mich dabei besorgt oder beschwingt fühlen. Ich fahre jedoch nicht damit fort, entweder ängstlich oder freudig erregt zu sein, wenn ich schlafe, und Schlafen ist keine Unterbrechung eines solchen bewussten Geisteszustands. Obgleich wir nicht davon sprechen, ‚in einem Schmerz-Zustand zu sein‘, ist es begründet, das Schmerzen(haben) als einen Geisteszustand aufzufassen. Anders als ein stechender Schmerz hat das Schmerzen bzw. Wehtun echte Dauer,390 Intensitätsgrade, die wechseln können, und die Aufmerksamkeit kann vom Schmerz ‚abgezogen‘ werden, sofern dieser nicht zu massiv ist. Man kann jederzeit stichprobenhaft prüfen, ob er noch ‚da‘ ist. Es ist eine Gnade der Natur, dass man keinen Schmerz fühlt, wenn man schläft oder bewusstlos ist; und wir sprechen davon, ‚Schmerzen zu haben‘ [being in pain],391 wie wir davon sprechen, in einem Angst- oder einem freudigen Gemütszustand zu sein. Man kann sagen ‚Ich war niedergeschlagen, als ich zu Bett ging, und ich war niedergeschlagen, als ich aufwachte‘, aber nicht ‚Und auch während ich schlief, war ich die ganze Zeit niedergeschlagen‘. Jenseits dieser unbestimmten Grenzen verliert der Begriff eines (bewussten) Geisteszustands allmählich seine ‚Passung‘; es ist unklar, ob anschauen, hinsehen, beobachten, mustern als Geisteszustände zu charakterisieren sind, denn im Unterschied zu Geisteszuständen ähneln sie Tätigkeiten. Und dennoch sind sie keine. Es ist ganz klar, dass es sich bei erspähen, erblicken, ausfindig machen, entdecken nicht um Geisteszustände handelt, ebenso wenig wie bei bemerken oder realisieren – ihnen fehlt es an der notwendigen Dauer. Denn Zustände müssen eine Zeit lang Bestand haben, und man kann nicht fragen, wie lange jemand etwas erspähte, ausfindig machte oder bemerkte, und man kann auch jemandes Realisieren oder Erblicken von etwas nicht unterbrechen. Einige psychologische Ausdrücke werden in zweifacher Hinsicht gebraucht, manchmal drücken sie einen Geisteszustand aus und manchmal nicht. Wir können uns also beispielsweise in einem Zustand erregter Erwartung befinden, wenn wir gespannt auf ein ungeduldig herbeigesehntes Ereignis warten. Zu erwarten, dass die Inflationsrate im nächsten Jahr fällt, heißt jedoch nicht, sich in irgendeinem Geisteszustand zu befinden, weder in einem sich ereignenden noch in einem dispositionalen; es heißt bloß, etwas die Zukunft Betreffen‚Echte Dauer‘ ist ein künstlicher Terminus, der von Wittgenstein eingeführt wurde, um die Art der Dauer, die sich ereignende Geisteszustände auszeichnet, hervorzuheben und von der Dauer der Dispositionen und Fähigkeiten oder der Potentialitäten zu unterscheiden (siehe Zettel, hg. von G. E. M. Anscombe und G. H. von Wright, Wittgensteins Werkausgabe Bd. VIII, §§ 46f., 82, 281 und Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, Bd. II, hg. von G. H. von Wright und H. Nyman, Wittgensteins Werkausgabe Bd. VII, § 45. 391 [Im Deutschen ist mitunter in poetischen oder theologischen Texten die Rede davon ‚in Schmerzen zu sein/zu leben‘; eine vergleichbare Wendung aus ‚Schmerzzusammenhängen‘ ist diese: ‚in den Wehen liegen‘ – A.d.Ü.] 390
10.2 Bewusste Erfahrung und bewusste Geisteszustände
361
des zu glauben. Und es ist offensichtlich, dass wissen oder denken, dass etwas so ist, meinen, glauben, sich erinnern oder beabsichtigen, etwas zu tun, keine Geisteszustände sind. Sie dauern, haben aber keine ‚echte Dauer‘. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, sich in einem Zustand des Wissens oder Glaubens, dass etwas so ist, zu befinden. Man kann nicht dabei unterbrochen werden, etwas zu wissen oder etwas zu glauben, und man hört nicht auf, etwas zu wissen oder zu glauben, wenn man einschläft, wie man aufhört, sich fröhlich, ängstlich oder niedergeschlagen zu fühlen, wenn man schläft. Der erweiterte Bewusstseinsbegriff hat einen größeren Umfang als der Begriff bewusster Geisteszustände Wenn man den Begriff des Bewusstseins so erweitert, dass er sämtliche sich ereignende Geisteszustände umfasst, derer man sich erfreut oder die man erleidet, während man bei Bewusstsein ist, derer man sich aber nicht transitiv bewusst sein muss, hat man ihn nicht auf das gesamte Spektrum des Psychischen ausgedehnt, denn die flüchtigen Geschehnisse, bei denen es sich nicht um Zustände handelt (z. B. ein stechender Schmerz, ein Gedankenblitz, der einem durch den Kopf schießt, das Bemerken oder Realisieren von etwas, das Erspähen oder Erblicken von etwas), sind ebenso nicht erfasst wie das Wissen, Glauben, Annehmen, Sich-Erinnern (d. h. Nicht-vergessen-haben), die eine größere Ähnlichkeit mit Vermögen und Fähigkeiten aufweisen als mit Geisteszuständen. Und auch das Beabsichtigen, Entscheiden und Meinen von etwas sind nicht erfasst. Und gleichfalls nicht die vielen Dispositionen und Tendenzen des Geistes, der Affektion und des Willens, die menschliche Wesen charakterisieren. Denn auch diese sind keine Geisteszustände, die ‚echte Dauer‘ auszeichnet. Außerdem wird, wie im Fall der ‚bewussten Erfahrung‘, das ausgeblendet, was das transitive Bewusstsein in all seinen facettenreichen Formen ausmacht. Diese Erweiterungen des Bewusstseinsbegriffs schließen nicht all das ein, was als ‚geistig‘ oder ‚psychisch‘ betrachtet wird, und es wird nicht deutlich, weshalb der so ausgelegte Bewusstseinsbegriff hochgradig problematisch sein sollte. Wir müssen also noch eingehendere Untersuchungen anstellen, und das werden wir in 10.3.1 auch tun. Zunächst aber müssen wir einer Verwirrung entgegenwirken, die ‚unbewusste Gehirnaktivitäten‘ betrifft.
10.2.1 Verwirrungen im Hinblick auf unbewussten Glauben und unbewusste Gehirnaktivitäten Der scheinbare Unterschied zwischen bewussten und unbewussten Geisteszuständen Man könnte behaupten, dass die von uns getroffene Unterscheidung zwischen sich ereignenden und dispositionalen Geisteszuständen und die Unterscheidung zwischen
362
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
Geisteszuständen (wie beschwingt, erregt, fröhlich, chronisch niedergeschlagen oder ängstlich sein) und Elementen, bei denen es sich weder um sich ereignende noch um dispositionale Geisteszustände handelt (wie wissen, glauben, meinen, beabsichtigten) eine Verwirrung ist. Es sei vielmehr nötig, könnte man vorbringen, bewusste von unbewussten Geisteszuständen abzugrenzen. So behauptet beispielsweise Searle, dass „der Glauben, der Eiffelturm stehe in Paris, ein echter Geisteszustand ist, auch wenn er zufälligerweise ein Geisteszustand ist, der dem Bewusstsein meistens nicht gegenwärtig ist.“392 Ein bewusster Glaubenszustand manifestiert sich also, wenn dieser dem ‚Bewusstsein gegenwärtig ist‘. Demnach sind nahezu alle unsere Glaubenszustände normalerweise unbewusst, unabhängig davon, ob wir wach sind oder schlafen. Sie sind uns nur bewusst, wenn wir beispielsweise gegenwärtig daran denken oder ‚in diesem Moment glauben‘, dass der Eiffelturm in Paris steht. Demzufolge befindet man sich buchstäblich zu jedem festgelegten Zeitpunkt in vielen unterschiedlichen unbewussten Geisteszuständen, und zwar in unzählig vielen, da man eine Unzahl von Dingen glaubt (unzählige Erinnerungen, Absichten, Wissensbruchstücke hat).393 Hier haben wir es allerdings mit einer abwegigen Annahme zu tun, nicht nur, weil glauben kein irgendwie gearteter Geisteszustand ist, sondern auch, weil der Begriff des unbewussten Glaubens falsch ausgelegt ist. Die Uneindeutigkeit von ‚Glauben‘ Wir müssen zwischen dem Glauben und dem, was geglaubt wird, unterscheiden, wobei beides verwirrenderweise ‚Glauben‘ genannt wird (6.1). Hat eine Person einen leidenschaftlichen oder vorbehaltlichen Glauben, dass p, dann glaubt sie leidenschaftlich oder unter Vorbehalt, dass p, das aber, was sie glaubt (auch das wird ‚ein Glauben‘ genannt), nämlich dass p, ist weder leidenschaftlich noch unter Vorbehalt. Ist ihr Glauben wiederum gewiss, vorbehaltlich, wahrscheinlich oder möglich, dann ist es gewiss, ‚mit einem Fragezeichen versehen‘, wahrscheinlich oder möglich, dass p, das aber, was sie glaubt, muss weder gewiss oder unter Vorbehalt noch wahrscheinlich oder möglich sein. Wir müssen darauf achten, dass wir die Zuschreibung von Prädikaten zum Glauben einer Person nicht mit der Zuschreibung von Prädikaten zu dem, was sie glaubt, durcheinanderbringen. 392
J. R. Searle, The Rediscovery of the Mind, (MIT Press, Cambridge, MA, 1992), S. 154 [dt. Die Wiederentdeckung des Geistes (Artemis & Winkler, München, 1993), S. 175]. 393 Unzählbar viele nicht nur deshalb, weil es praktisch kaum möglich ist zu zählen, was eine Person alles glaubt, sondern weil es keine eindeutigen Prinzipien der Zählbarkeit gibt. Wenn ich glaube, dass die Rosen in ihrem Garten rot sind, glaube ich dann eine Sache oder mehrere? Denn glaube ich nicht auch, dass die Rosen in ihrem Garten nicht grün, nicht blau, nicht gelb oder orange etc. sind? Und wenn ich glaube, dass der Teppich vier Meter lang ist, glaube ich dann nicht auch, dass er nicht 10 oder 11 und nicht 13 oder 14 etc. ad infinitum Meter lang ist?
10.2 Bewusste Erfahrung und bewusste Geisteszustände
363
Unbewusster Glauben falsch ausgelegt Was soll vor dem Hintergrund dieser Unterscheidung als ein Geisteszustand betrachtet werden? Eindeutig das Glauben und nicht das, was geglaubt wird, weil der Glauben, dass der Eiffelturm in Paris steht, offensichtlich kein Geisteszustand ist, obgleich das Glauben (fälschlicherweise) als solcher aufgefasst werden könnte. Was soll nun aber ‚dem Bewusstsein gegenwärtig‘ sein, wenn ein Glauben bewusst ist, und unbewusst – das heißt ‚dem Bewusstsein nicht gegenwärtig‘ –, wenn er es nicht ist? Das Glauben offenkundig nicht, denn dann würde das, dessen man sich bewusst wäre, darin bestehen, dass man glaubt, was immer man auch glaubt, und nicht darin, was man glaubt – dass der Eiffelturm in Paris steht beispielsweise. Laut Searle aber ist der Glauben, dass p, dann bewusst, wenn einem der Gedanke, dass p, durch den Kopf geht oder wenn man daran denkt, dass p. Obgleich es in diesem Zusammenhang einen wichtigen Unterschied gibt, besteht dieser nicht zwischen einem bewussten und einem unbewussten Glauben, sondern zwischen dem Denken an oder dem Nachdenken über etwas, von dem man glaubt, es sei so und so, und dem Nicht-daran-Denken oder dem Nicht-Nachdenken über es. Ich glaube, dass Hannibal Rom hätte belagern sollen, nachdem er Cannae belagert hatte, dass kein Dichter sowohl die Ilias als auch die Odyssee verfasst hat und noch unzählige andere Dinge. Über die meisten Dinge, die ich glaube, denke ich selten nach, das macht aus ihnen jedoch keine unbewussten Dinge, ebenso wie mein Wissen, dass die Schlacht von Bannockburn 1314 ausgefochten wurde und die von Agincourt 1415, und auch mein Wissen von einer Unzahl anderer Dinge kein unbewusstes Wissen ist. Unbewusster Glauben richtig ausgelegt Richtig ausgelegt ist ein unbewusster Glauben etwas, das ich glaube, ein Glauben, das meine emotionalen Reaktionen einfärbt und meine Handlungen anregt, das ich aber vor mir selbst oder vor anderen nur unwillig als etwas anerkenne, was ich glaube. Dennoch erklärt die Tatsache, dass ich das glaube, mein anomales Verhalten (meine Neurosen) – nimmt man zumindest an. Nur unter besonderen Umständen – im Verlauf einer Psychotherapie beispielsweise – erkenne ich (langsam), dass ich dies und das über mich oder meine Kindheit oder meine Eltern unbewusst geglaubt habe. Und meine in einem psychoanalytischen Rahmen zustande gekommene Erkenntnis, dass ich das glaubte, wird als Bestätigung der Erklärungshypothese aufgefasst. Das ist es, was man ‚einen unbewussten Glauben‘ nennt. Es ist jedoch nichts unbewusst an meinen unzähligen ‚Glauben‘ (d. h. an dem, was ich glaube), über die ich nicht nachdenke. Und bei keinem der unzähligen Dinge, die ich weiß – dass die Schlacht von Hastings 1066 geschlagen wurde beispielsweise –, handelt es sich um ‚unbewusstes Wissen‘, nur weil ich gerade nicht darüber nachdenke, genauso wenig wie meine Absicht, meinen diesjährigen Sommerurlaub in Neapel zu verbringen, eine unbewusste Absicht ist, nur weil ich nicht ununterbrochen darüber nachdenke, was ich im Sommerurlaub zu tun beabsichtige.
364
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
Eine Verwirrung über ‚sich ereignendes Glauben‘ Außerdem wäre es irreführend, obgleich ich gerade glauben kann, dass p, und später nicht mehr, von meinem sich ereignenden [occurently] Glauben von etwas zu sprechen, in Abgrenzung zu meinem gegenwärtigen [currently] Glauben von etwas. Zu glauben ist keine Handlung oder Tätigkeit, mit der man beschäftigt sein kann, und auf die Frage ‚Was machst du gerade?‘ kann man unmöglich antworten ‚Ich bin gerade im Begriff zu glauben, dass p.‘ Und die Frage ‚Was bist du gerade im Begriff zu glauben?‘ [‚What are you now believing?‘] ist keine gut formulierte Frage (im Gegensatz zu ‚Was glaubst du gerade?‘ [‚What do you now believe?‘]). Die Tatsache, dass ich gerade über Hannibals Invasion in Italien nachdenke und der Meinung bin, dass er Rom hätte belagern sollen, nachdem er Cannae belagert hatte, impliziert nicht, dass ich gerade ‚im Begriff bin, bewusst zu glauben‘, dass er dies hätte tun sollen, obgleich ich mich normalerweise in einem unbewussten Glaubenszustand (in dem ich das glaube) befinde. Über etwas nachzudenken, das man glaubt, heißt nicht, dieses Etwas ‚bewusst‘ zu glauben, und schon gar nicht, ‚im Begriff zu sein‘, es ‚bewusst zu glauben‘ [‚be believing‘ it ‚consciously‘]; und nicht über etwas nachzudenken, das man glaubt, heißt nicht, es ‚unbewusst zu glauben‘ oder ‚im Begriff zu sein‘, es ‚unbewusst zu glauben‘. Missbräuchliche Verwendung des Ausdrucks ‚Geisteszustand‘ Und schließlich gibt es keinen Grund, auch wenn der Begriff eines Geisteszustands in der Tat unbestimmt und dehnbar ist, ihn so weit auszudehnen, dass es legitim wird zu sagen, man befinde sich zugleich in Zehntausenden von (unbewussten) Geisteszuständen. Man gewinnt nichts, wenn man diese neuartige Redeweise übernimmt, und unser Alltagsbegriff eines Geisteszustands verliert dadurch sinnloserweise an Schärfe und Kraft. Der zulässige Gebrauch dieses Ausdrucks sieht die Möglichkeit, sich zugleich in unendlich vielen Geisteszuständen zu befinden, sie zu erleiden oder sich ihrer zu erfreuen, ebenso wenig vor, wie man sich Zehntausender Dinge gleichzeitig widmen oder mit Zehntausenden Dingen gleichzeitig beschäftigt sein kann. Gehirnaktivitäten sind weder bewusst noch unbewusst Wir müssen noch auf eine andere missbräuchliche Verwendung des Ausdrucks ‚unbewusst‘ hinweisen, die unter Psychologen und Neurowissenschaftlern verbreitet ist. Sie neigen zu der Annahme, Gehirnaktivitäten seien ‚unbewusst‘. So spricht man beispielsweise davon, dass „das Gehirn einen großen Teil seiner Arbeit unbewusst verrichtet, mit Hilfe unzähliger kleiner Abschnitte spezialisierten Hirngewebes“, und dass „der Großteil dieses Gewebes unbewusst ist“; und dass wir uns, wenn wir die Wendung ‚visueller Fokus‘ lesen, nicht bewusst sind, dass das darin enthaltene Wort ‚Fokus‘ ein Nomen ist, die
10.2 Bewusste Erfahrung und bewusste Geisteszustände
365
Wendung jedoch unverständlich wäre, wenn das Gehirn „‚Fokus‘ nicht unbewusst als ein Nomen ausweisen würde“.394 Diese Auffassung ist allerdings verworren. Das Gehirngewebe, wie auch das Gehirn selbst, ist weder bewusst noch unbewusst, weder wach, noch schläft es. Die vom Gehirn verrichtete ‚Arbeit‘ wird nicht bewusst und mit Bedacht verrichtet, aber auch nicht unbewusst und ohne sie zu bedenken. Denn das Gehirn kann nichts bewusst oder unbewusst tun, da es keine bewusste Kreatur ist mit der Fähigkeit, bei Bewusstsein zu sein oder sich irgendetwas bewusst zu sein, ganz zu schweigen von der Fähigkeit, irgendetwas mit oder ohne Bedacht und Aufmerksamkeit zu tun. Wenn wir keinem bildgebenden Abtastverfahren in einem Labor ausgesetzt sind, können vielmehr wir die Aktivitäten unseres Gehirns ebenso wenig wahrnehmen wie unseren Hinterkopf oder die Rückseite des Mondes. Und weil wir unsere Gehirnaktivitäten normalerweise nicht wahrnehmen können, können wir uns ihrer auch nicht bewusst werden und dann sein; das bedeutet jedoch nicht, dass es sich bei ihnen um unbewusste Aktivitäten handelt, die entweder uns selbst oder unseren Gehirnen unbewusst sind. Die Tatsache, dass wir uns unserer Gehirnaktivitäten nicht bewusst sind, impliziert nicht, dass wir unbewusst mit ihnen beschäftigt sind; es impliziert aber auch nicht, dass das Gehirn unbewusst mit diesen Aktivitäten beschäftigt ist. Denn nur von einem Lebewesen, das etwas bewusst tun kann, kann man auch sagen, dass es in der Lage ist, etwas unbewusst zu tun. Es stimmt, dass wir, wenn wir die Wendung ‚visueller Fokus‘ lesen, nicht darüber nachdenken, dass es sich um ein Nomen handelt – wir setzen voraus, dass es so ist, und lesen es als ein Nomen. Dies bedeutet nicht, dass unser Gehirn ‚Fokus‘ unbewusst als ein Nomen ausweist, denn das Gehirn weist nicht irgendetwas aus, weder als ein Nomen noch als irgendetwas anderes. Wir wissen, dass ‚Fokus‘ in diesem Fall ein Nomen ist [Es könnte sich im Englischen auch um ein Verb handeln: to focus – A.d.Ü.]; wissen ist jedoch keine Aktivität oder Tätigkeit, mit der wir befasst sind. Wir müssen die Wendung keiner grammatischen Analyse unterziehen, um sie zu verstehen. Das heißt allerdings nicht, dass wir sie ‚unbewusst‘ so analysieren. Ganz allgemein kann man sagen, dass wir viele unserer Fertigkeiten ohne nachzudenken ausüben können, was wiederum nicht bedeutet, dass die Überlegungen, die ein Anfänger notwendigerweise anstellen müsste, nun ‚unbewusst‘ angestellt werden; es bedeutet, dass sie überhaupt nicht mehr angestellt werden. Sie müssen nicht mehr angestellt werden, gerade weil wir die entsprechende Fertigkeit bereits erworben haben. ( Jemand, der gelernt hat, blind zu schreiben, muss nicht mehr auf die Tastatur schauen, das bedeutet aber nicht, dass er unbewusst auf sie schaut oder dass er unbewusst herausfinden muss, wo sich die Tasten befinden.) Ein kleines Kind kann gezwungen sein, jedes Wort zu buchstabieren, weil ihm das Lesen schwerfällt, ein Erwachsener kann einen ganzen Satz auf einmal übersehen. Der Erwachsene hat eine Fähigkeit, die dem Kind fehlt: nämlich, einen Satz als Ganzen zu erfassen. Er müsste vermutlich ohne diese Fähigkeit auskommen, wenn nicht bestimmte 394
Baars, Theater of Consciousness, S. 4, 6, 17.
366
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
synaptische Verbindungen in seinem Gehirn vorhanden wären und wenn nicht bestimmte Gehirnereignisse stattfinden würden, während diese Fähigkeit ausgeübt wird. Das bedeutet allerdings nicht, dass er selbst oder sein Gehirn jedes Wort unbewusst buchstabiert.
10.3 Qualia Qualia als das betrachtet, was Erfahrung qualitativ ausmacht – eine von Philosophen entwickelte Konzeption Die Versuchung, den Bewusstseinsbegriff so weit auszudehnen, dass er den gesamten Bereich der ‚Erfahrung‘ abdeckt, wurde durch die Einführung des abwegigen Qualiabegriffs seitens der Philosophen nachhaltig gefördert. Die Neurowissenschaftler haben diese irrige Vorstellung und die damit verbundenen Fehlkonzeptionen bedauerlicherweise aufgegriffen. Der Terminus ‚Qualia‘ wurde geprägt, um der mutmaßlichen Tatsache Ausdruck zu verleihen, dass Erfahrung ‚qualitativ beschaffen‘ ist. Es wird behauptet, dass jede Erfahrung eine unverwechselbare Wesensqualität hat. Qualia, erklärt Ned Block, „sind all die ‚Anfühlungsweisen‘: wie es sich anfühlt zu sehen, zu hören, zu schmecken, wie es sich anfühlt, Schmerzen zu haben; allgemeiner ausgedrückt, wie es sich anfühlt, Geisteszustände zu haben. Qualia sind die Erfahrungsmerkmale der Empfindungen, Gefühle, Wahrnehmungen und [. . .] Gedanken sowie des Verlangens“.395 Searle behauptet ganz ähnlich, dass „jeder Bewusstseinszustand eine bestimmte Gefühlsqualität aufweist, was sich durch Beispiele illustrieren lässt. Es ist etwas ganz anderes, Bier zu schmecken, als Beethovens Neunte Symphonie zu hören, und beide sind in qualitativer Hinsicht wiederum anders beschaffen als das Riechen an einer Rose oder die Betrachtung eines Sonnenuntergangs. Diese Beispiele verdeutlichen die unterschiedlichen qualitativen Eigentümlichkeiten bewusster Erfahrungen.“396 Searle vertritt wie Block die Auffassung, dass Denken eine besondere Gefühlsqualität aufweist: „Denken, dass zwei plus zwei gleich vier ist, fühlt sich auf bestimmte Weise an. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu beschreiben, man kann nur sagen, dass es sich dabei um die Eigentümlichkeit handelt, ‚zwei plus zwei ist gleich vier‘ bewusst zu denken“.397 Chalmers glaubt, dass der Untersuchungsgegenstand Bewusstsein ‚am besten als ‚die subjektive Erfahrungsqualität‘ charakterisiert werden sollte‘. Er behauptet, dass ein Geisteszustand bewusst ist, „wenn er eine Gefühlsqualität hat – eine begleitende Erfahrungsqualität. Diese Gefühlsqualitäten sind auch als phänomenale Qualitäten bekannt oder kurz als Ned Block, ‚Qualia‘, in S. Guttenplan (Hg.), Blackwell Companion to the Philosophy of Mind (Blackwell, Oxford, 1994), S. 514. 396 J. R. Searle, ‚Consciousness‘, Annual Reviews, 23 (2000), S. 560. 397 Ibid., S. 561. 395
10.3 Qualia
367
Qualia. Die Schwierigkeit, sie zu erklären, ist nun genau die Schwierigkeit, Bewusstsein zu erklären.“398 Er ist zudem der Ansicht, dass denken eine Erfahrung mit einem qualitativen Gehalt ist: „Denke ich beispielsweise an einen Löwen, scheint es, als präge mein Denken eine gewisse löwenartige Qualität aus: An einen Löwen zu denken fühlt sich auf subtile Weise und fast unmerklich anders an, als an den Eiffelturm zu denken.“399 Neurowissenschaftler folgen den Philosophen Die Neurowissenschaftler haben sich mit der Qualiavorstellung einverstanden erklärt. Ian Glynn stellt folgende Behauptung auf: „Obwohl Qualia höchst offensichtlich Empfindungen und Wahrnehmungen begleiten, findet man sie auch bei anderen Geisteszuständen wie denen des Glaubens, Verlangens, der Hoffnung und der Angst, und zwar während der bewussten Abschnitte dieser Zustände.“400 Damasio erklärt, dass „Qualia [. . .] die einfachen sensorischen Qualitäten sind, die durch das Blau des Himmels oder den Klang eines Cellos hervorgerufen werden. Die Grundelemente der Vorstellungen oder Bilder [aus denen sich die Wahrnehmung vermeintlich zusammensetzt] werden also von Qualia gebildet.“401 Edelman und Tononi sind der Ansicht, dass „jede unterscheidbare bewusste Erfahrung ein anderes subjektives Quale verkörpert, unabhängig davon, ob es sich nun in erster Linie um eine Empfindung, ein Bild, einen Gedanken oder auch um eine Stimmung handelt“, und sie fahren fort und behaupten, dass „das Qualiaproblem das vielleicht einschüchterndste Problem im Zusammenhang mit dem Bewusstsein“ ist.402 Die Erklärung der Qualität der Erfahrung anhand des Gedankens, sie zu haben, fühle sich auf bestimmte Weise an Das subjektive oder qualitative Gefühl einer bewussten Erfahrung wird wiederum so charakterisiert, dass es sich für einen Organismus auf bestimmte Weise anfühlt, die Erfahrung zu haben. Wie es sich anfühlt, ist die subjektive Eigentümlichkeit der Erfahrung. „Eine Erfahrung oder eine andere Geistesausprägung geht genau dann mit einem ‚phänomenalen Bewusstsein‘ einher, wenn es für einen auf bestimmte Weise ist, sie zu 398
Chalmers, Conscious Mind, S. 4. Ibid., S. 10. 400 I. Glynn, An Anatomy of Thought (Weidenfeld and Nicolson, London, 1999), S. 392. 401 A. Damasio, The Feeling of What Happens (Heinemann, London, 1999), S. 9 [dt. Ich fühle, also bin ich (List, München, 1999), S. 21]. Es sei angemerkt, dass es sich dabei um eine hier nicht angefochtene Annahme handelt, dass Farbe und Klang keine Eigenschaften von Objekten sind, sondern von Sinneseindrücken. 402 G. M. Edelman und G. Tononi, Consciousness: How Matter Becomes Imagination (Allen Lane, The Penguin Press, London, 2000), S. 157 [dt. Gehirn und Geist (Beck, München, 2002), S. 215]. 399
368
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
haben“, teilt uns die Routledge Encyclopaedia of Philosophy mit.403 „Bewusstseinszustände sind in dem Sinne Qualitäten“, erklärt Searle, „als jeder Bewusstseinszustand [. . .] dadurch ausgezeichnet ist, dass in ihm zu sein mit einer bestimmten Anfühlungsqualität einhergeht.“404 Die Vorstellung und die hypnotisierende Redewendung ‚es gibt ein Wiees-ist/ein Anfühlungswie‘ [‚there is something which it is like‘] entstammen einer Arbeit des Philosophen Thomas Nagel mit dem Titel ‚Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein?‘. Nagel vertritt die Auffassung, dass „die Tatsache, dass ein Organismus überhaupt bewusste Erlebnisse hat, [. . .] auf der elementarsten Ebene [impliziert], dass es sich irgendwie anfühlt, dieser Organismus zu sein. [. . .] Grundsätzlich hat ein Organismus dann und nur dann bewusste innere Zustände, wenn es irgendwie ist, dieser Organismus zu sein – wenn es da etwas gibt, das sich für ihn so und so anfühlt“.405 Dies – das heißt, wie es sich für den Organismus anfühlt – ist die subjektive Eigentümlichkeit oder Qualität der Erfahrung. Nagels Erklärung des Bewusstseins im Sinne eines Anfühlungswie Einmal angenommen, wir verstehen, was mit der Wendung ‚es gibt ein Wie-es-ist/ein Anfühlungswie‘ gemeint ist, dann hat es den Anschein, als erlaube uns Nagels Vorstellung, den Begriff eines bewussten Wesens und den einer bewussten Erfahrung abzuhandeln: (1) Ein Wesen ist dann und nur dann bei Bewusstsein oder hat dann und nur dann bewusste Erfahrungen, wenn es sich für es auf bestimmte Weise anfühlt, das Wesen, das es ist, zu sein. (2) Eine Erfahrung ist dann und nur dann eine bewusste Erfahrung, wenn es für das Subjekt der Erfahrung auf bestimmte Weise ist, sie zu haben. Demnach fühlt es sich für eine Fledermaus auf bestimmte Weise an, eine Fledermaus zu sein (obwohl Nagel behauptet, dass wir uns nicht vorstellen können, wie es sich anfühlt), und für uns fühlt es sich auf bestimmte Weise an, menschliche Wesen zu sein (und wir alle wissen, behauptet er, wie es sich anfühlt, wir zu sein). Es ist wichtig zu betonen, dass die Wendung ‚für ein Subjekt gibt es ein Wie-es-ist (ein Wie-es-sich-anfühlt), Erfahrung E zu haben‘ [‚there is something which it is like for a subject to have experience E‘] keinen Vergleich zum Ausdruck bringt. Nagel behauptet nicht, dass eine bestimmte bewusste Erfahrung zu haben etwas anderem ähnelt (z. B. irgendeiner anderen Erfahrung), sondern vielmehr, dass es sich für das Subjekt auf bestimmte E. Lomand, ‚Consciousness‘, in Routledge Encyclopaedia of Philosophy (Routgedge, London, 1998), Bd. II, S. 581. 404 Searle, Mystery of Consciousness, S. xiv. 405 T. Nagel, ‚What is it like to be a bat?‘ [dt. ‚Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein?‘], wieder abgedr. in seinen Mortal Questions (Cambridge University Press, Cambridge, 1979), S. 166 [dt. Letzte Fragen (Philo, Bodenheim, 1996), S. 231]. 403
10.3 Qualia
369
Weise anfühlt, sie zu haben; das heißt, ‚wie es sich anfühlt‘ soll bedeuten, ‚wie es sich für das Subjekt selbst anfühlt‘.406 Auffallend ist allerdings, dass Nagel uns an keiner Stelle mitteilt oder auch nur ein Beispiel dafür vorbringt, wie es sich für irgendjemanden anfühlt, sie zu haben. Er behauptet, dass die Erfahrungsqualitäten anderer Spezies möglicherweise jenseits unseres Vorstellungsvermögens angesiedelt sind. Und das kann sogar auf die Erfahrungen anderer Menschen zutreffen. „Die subjektive Dimension der Erlebnisse eines beispielsweise von Geburt an blinden und tauben Menschen ist mir nicht zugänglich, und ich gehe davon aus, dass ihm die meiner Erlebnisse ebenso unzugänglich sein dürfte“. Wir wissen allerdings, wie es ist, wir zu sein, „und auch wenn wir nicht über den Wortschatz verfügen, es hinreichend zu beschreiben, [wissen wir doch], dass es hochgradig subjektiv ist und zu seiner detaillierten Beschreibung Begriffe erfordert, die allein von Lebewesen verstanden werden könnten, die uns ähnlich sind.“407 Philosophen und Neurowissenschaftler stimmen überein Philosophen und Neurowissenschaftler haben sich dieser Vorstellung angeschlossen. Sie glauben begriffen zu haben, was bewusste Wesen und die bewusste Erfahrung wesentlich ausmacht. So behaupten Davies und Humphreys: „Obgleich es nichts gibt, was das ‚Sein‘ eines Backsteins oder eines Tintenstrahldruckers, zu einem irgendwie anfühlbaren Sein macht, fühlt es sich wahrscheinlich auf bestimmte Weise an, eine Fledermaus oder ein Delfin zu sein, und ganz sicher fühlt es sich auf bestimmte Weise an, ein menschliches Wesen zu sein. Ein System – sei es ein Wesen oder ein Artefakt – ist genau dann bei Bewusstsein, wenn es sich auf bestimmte Weise anfühlt, dieses System zu sein.“408 Edelman und Tononi stimmen darin überein, dass „[w]ir wissen, wie es sich anfühlt, wir selbst zu sein, aber wir würden gerne erklären, warum wir überhaupt ein Bewusstsein haben, warum es sich überhaupt irgendwie anfühlt, wir selbst zu sein – erklären, wie subjektive Erlebnisqualitäten entstehen.“409 Und Glynn vertritt die Ansicht, dass wir, was unsere Erfahrungen betrifft – frisch gemahlenen Kaffee zu riechen beispielsweise oder eine Oboe spielen zu hören oder das Himmelsblau zu sehen –, „nur dadurch wissen, wie es sich anfühlt, sie zu haben, dass wir sie haben oder hatten [. . .] Und genau wie das Riechen frisch gemahlenen Kaffees sich auf bestimmte Weise anfühlt, kann glauben, dass . . . oder begehren, dass . . . oder fürchten, dass . . . sich (zumindest zeitweise) auf bestimmte Weise anfühlen.“410 Qualia werden demnach als qualitative Charakteristika von ‚Geisteszuständen‘ oder von ‚Erfahrungen‘ aufgefasst, wobei die beiden Kategorien diesem Verständnis nach 406 407 408 409 410
Ibid., S. 170 Anm. [dt. S. 235 Anm.]. Ibid., S. 170. [dt. S. 236]. Davies und Humphreys (Hg.), Consciousness, S. 9. Edelman und Tononi, Consciousness, S. 11 [dt. Gehirn und Geist, S. 23]. Glynn, Anatomy of Thought, S. 392.
370
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
nicht nur die Wahrnehmung, Empfindung und Affektion, sondern auch das Verlangen, Denken und den Glauben einbegreifen. Jede ‚bewusste Erfahrung‘ oder jeden ‚bewussten Geisteszustand‘ charakterisiert ein Anfühlungswie, sodass sie zu haben bzw. in ihm zu sein für das Subjekt so und so ist. Bei diesem Anfühlungssoundso handelt es sich um ein Quale – ‚eine Gefühlsqualität‘. „Die Schwierigkeit, diese Phänomenqualitäten zu erklären, ist“, wie Chalmers verkündet, „genau die Schwierigkeit, das Bewusstsein zu erklären.“411
10.3.1 ‚Wie es sich anfühlt‘ [‚How it feels‘], eine Erfahrung zu haben Der Hauptgrund für die Erweiterung des Alltagsbegriffs des Bewusstseins Der Bewusstseinsbegriff wurde hauptsächlich aus dem Grund über seine legitimen konservativen Grenzen hinaus erweitert, weil, wie es heißt, das Charakteristische, Bemerkenswerte und in der Tat Rätselhafte an Erfahrungen ist, dass es sich irgendwie anfühlt, sie zu haben. Eine Erfahrung, so wird behauptet, ist genau dann eine bewusste Erfahrung, wenn es sich für das Subjekt der Erfahrung irgendwie anfühlt, sie zu haben. Das so aufgefasste Bewusstsein wird mittels der Gefühlsqualität der Erfahrung definiert. Es ist je etwas Besonderes und Eigenes, zu sehen, zu hören und zu riechen, einen Schmerz zu haben oder gar ‚Geisteszustände zu haben‘ (Block); jeder bewusste Zustand weist eine bestimmte Gefühlsqualität auf (Searle) und jede unterscheidbare bewusste Erfahrung verkörpert ein anderes Quale (Edelman und Tononi). Diese für jede unterscheidbare Erfahrung einmalige Gefühlsqualität entspricht dem, wie es für das Subjekt der Erfahrung ist, die Erfahrung zu haben. Zumindest wird diese Position vertreten. Wir sollten diesen sonderbaren Formulierungen misstrauen, die sich auf etwas berufen, das uns allen angeblich vollkommen vertraut ist. Zunächst werden wir ‚Anfühlungsweisen‘ untersuchen und im Anschluss daran das Problem des ‚es fühlt sich an wie‘. Fühlt es sich immer auf eine Weise an, eine ‚bewusste Erfahrung‘ zu haben? Gibt es wirklich eine spezifische Anfühlungsweise des Sehens, Hörens oder Riechens? Zwar könnte man jemanden, dessen Sehkraft, Hörvermögen oder Geruchssinn wiederhergestellt wurde, fragen ‚Wie fühlt es sich an, wieder zu sehen (zu hören, zu riechen)?‘ [‚How does it feel to . . . again?‘] Und eine mögliche Antwort könnte lauten: ‚Einfach wunderbar‘ oder vielleicht ‚Es fühlt sich sehr seltsam an‘. Die Frage bezieht sich auf die Haltung der Person im Hinblick auf den Gebrauch ihrer wiederhergestellten Wahrnehmungsfähigkeit – sie findet es mithin wunderbar, wieder sehen zu können, oder seltsam, nach so vielen Jahren der Taubheit wieder hören zu können. In diesen Fällen fühlt es 411
Chalmers, Conscious Mind, S. 4.
10.3 Qualia
371
sich wirklich auf eine Weise an, wieder zu sehen oder zu hören: nämlich wunderbar oder seltsam. Fragten wir jedoch einen normalen Menschen danach, wie es sich anfühlt, einen Tisch, Stuhl, Pult, Teppich etc. zu sehen, würde ihm wohl nicht klar sein, worauf wir hinauswollen. Es ist nichts Besonderes dabei, diese banalen Gegenstände zu sehen. Einen Tisch zu sehen ist natürlich etwas anderes, als einen Stuhl, Pult, Teppich etc. zu sehen, aber der Unterschied hat nichts damit zu tun, dass es sich anders anfühlt, ein Pult zu sehen, als einen Stuhl zu sehen. Der Anblick eines einfachen Tisches oder Stuhls zieht unter normalen Umständen keine wie auch immer geartete emotionale Reaktion oder Haltung nach sich. Die Erfahrungen unterscheiden sich nur in ihren Objekten, in nichts sonst. Man könnte es unbeholfen formulieren und sagen, es gibt eine Anfühlungsweise des Schmerzenhabens. Damit bringt man jedoch nur kompliziert zum Ausdruck, dass es eine Antwort auf die (ziemlich alberne) Frage gibt ‚Wie fühlt es sich an, Schmerzen zu haben?‘ – beispielsweise, dass es sehr unangenehm ist oder in manchen Fällen fürchterlich. Man kann folglich sagen, dass es sich auf eine Weise anfühlt, eine Migräne zu haben: nämlich sehr unangenehm. Dies ist unverfänglich, verleiht aber der allgemeinen Behauptung, dass sich jede unterscheidbare Erfahrung auf spezifische Weise bzw. besonders anfühlt, keinen Nachdruck. Schmerzen bilden eine Ausnahme, da sie per definitionem eine negative affektive Färbung haben. Schmerzen sind Empfindungen, die an sich unangenehm sind. Wahrnehmen hat allerdings nichts mit empfinden zu tun. Und mit ihren verschiedenen Modalitäten und unendlich vielen möglichen Objekten kann die Wahrnehmung häufig das Subjekt irgendwelcher Gefühls- oder Einstellungsqualitäten (z. B. angenehm, lustvoll, schrecklich) sein, was sie für gewöhnlich jedoch nicht ist, geschweige denn ein für jedes Objekt in jeder Wahrnehmungsmodalität besonderes Subjekt. Und auf enorm viele Dinge, die ‚Erfahrungen‘ genannt werden können, trifft es nicht zu, dass es sich ‚auf eine Weise anfühlt‘, sie zu haben; das heißt, hier gibt es keine Antwort auf die Frage ‚Wie fühlt es sich an zu . . .?‘ Man kann Searle nur zustimmen, dass die Biergeschmackserfahrung etwas ganz anderes ist als das Hörerlebnis von Beethovens Neunter und dass sich beide vom Riechen an einer Rose unterscheiden oder davon, einen Sonnenuntergang zu betrachten, denn Wahrnehmungserfahrungen werden im Wesentlichen durch ihre Modalität – das heißt Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und taktile Wahrnehmung – identifiziert und spezifiziert und durch ihre Objekte – das heißt durch das, wovon sie Erfahrungen sind. Es ist jedoch etwas anderes und noch dazu fragwürdiger zu behaupteten, dass mit den verschiedenen Erfahrungen ein je einzigartiges, charakteristisches Gefühl einhergeht. Fragwürdiger insofern, als ganz und gar nicht klar ist, wie es gemeint ist. Selbstverständlich sind alle vier von Searle angeführten Erfahrungen normalerweise für viele Menschen angenehm. Und es ist vollkommen richtig, dass die Identität des Vergnügens (oder Genusses) auf dem Objekt des Vergnügens beruht. Man kann nicht das Vergnügen des Biertrinkens aus dem Hören von Beethovens Neunter ableiten oder das Vergnügen beim Betrachten eines Sonnenuntergangs aus dem Riechen an einer Rose. Dies ist eine
372
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
logische, keine empirische Wahrheit; das heißt, es ist nicht so, dass die für die Betrachtung eines Sonnenuntergangs charakteristische ‚Gefühls‘-Qualität sich tatsächlich [as a matter of fact] von der unterscheidet, die für das Riechen an einer Rose charakteristisch ist – schließlich können beide angenehm sein. Es ist vielmehr so, dass das Vergnügen, das man beim Betrachten eines Sonnenuntergangs hat, sich logisch [as a matter of logic] von dem unterscheidet, das man beim Riechen an einer Rose verspürt, denn das Vergnügen wird durch das identifiziert, was Vergnügen bereitet. Daraus folgt nicht, dass jede Erfahrung eine andere Gefühlsqualität hat – das heißt, dass mit jeder Erfahrung ein besonderes ‚Gefühl‘ verbunden ist. Denn erstens haben die meisten Erfahrungen überhaupt keine Gefühlsqualität in diesem Sinn – sie sind weder angenehm noch unangenehm, weder schön noch unschön. Gehen wir eine Straße entlang, können wir Dutzende verschiedener Objekte sehen. Einen Laternenpfahl zu sehen ist eine andere Erfahrung als die, einen Briefkasten zu sehen – war damit ein anderes ‚Gefühl‘ verknüpft? Nein; und es war auch nicht das gleiche ‚Gefühl‘, denn das Sehen der beiden Objekte rief keine Reaktion hervor – keine wie auch immer geartete ‚Gefühlsqualität‘ war mit ihrem Sehen verknüpft. Zweitens können unterschiedliche Erfahrungen, die wirklich mit einer ‚Gefühls‘-Qualität einhergehen – das heißt solche, die beispielsweise als lustvolle charakterisiert werden können –, mit dem gleichen Gefühl verknüpft sein. Was sie unterscheidet, ist keine Anfühlungsweise, kein Anfühlungswie, insofern als die Frage ‚Wie fühlte es sich an, V zu haben?‘ (wobei ‚V‘ für irgendeine in diesen Zusammenhang gehörende Erfahrung steht) zur selben Antwort führen kann – denn die unterschiedlichen Erfahrungen können genauso angenehm oder unangenehm, interessant oder langweilig sein. Die Gefühlsqualität von Erfahrungen richtig ausgelegt Sowohl das Schmerzenhaben als auch das Wahrnehmen von etwas, was immer es sei, kann ‚Erfahrung‘ heißen. In einem bestimmten emotionalen Zustand zu sein, gleichfalls. Und natürlich auch: mit einer Aktivität oder Tätigkeit, von denen es unzählige Varianten gibt, beschäftigt zu sein. Wir können sagen, dass Erfahrungen mögliche Subjekte von Prädikaten sind, die sich auf Einstellungen beziehen; das heißt, sie können angenehm oder unangenehm, interessant oder langweilig, wundervoll oder fürchterlich sein. Was man ‚die Erfahrungsqualitäten‘ nennen könnte, sind solche Attribute, nicht die Erfahrungen selbst. Demzufolge kann man nicht sagen, Rot zu sehen oder Guernica zu sehen, ein Geräusch zu hören oder Tosca zu hören, seien ‚Qualia‘. Wenn Damasio vom Himmelsblau als einem Quale spricht, verändert er somit den Sinn des Terminus ‚Quale‘ – denn wenn die Farbe eines Objekts ein Quale ist, dann sind Qualia keineswegs die Qualitäten der Erfahrung, sondern die Qualitäten der Objekte der Erfahrung (oder wenn man Farben nicht als Qualitäten der Objekte auffasst, dann die konstituierenden Inhalte der Wahrnehmungserfahrungen). Wenn Edelman und Tononi behaupten, dass jede unterscheidbare bewusste Erfahrung – sei es eine Empfindung, ein Bild, eine Stimmung
10.3 Qualia
373
oder ein Gedanke – ein anderes Quale verkörpert, so verändern auch sie den Sinn des Terminus ‚Quale‘. Denn er meint offensichtlich nicht ‚die Gefühlsqualität einer Erfahrung‘ in dem dargelegten Sinn. Was er tatsächlich meint, oder meinen soll, werden wir in Kürze untersuchen (10.3.4). Es sollte darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der Rede von Erfahrungen als Subjekten einstellungsbezogener Qualitäten um eine potenziell irreführende Façon de parler handelt. Denn indem man sagt, dass eine Erfahrung (z. B. sehen, betrachten, erblicken, hören, schmecken von diesem oder jenem, aber auch gehen, sprechen, tanzen, das Spielespielen, Bergebesteigen, Schlachtenschlagen, Bildermalen) eine bestimmte Gefühlsqualität hat (dass sie beispielsweise angenehm, entzückend, reizend, unangenehm, abscheulich, ekelhaft war), sagt man einfach, dass das Subjekt der Erfahrung – das heißt die Person, die sah, hörte, schmeckte, ging, redete, tanzte etc. – sie angenehm, entzückend, reizend etc. fand. Demnach haben wir es bei der Gefühlsqualität einer Erfahrung E – das heißt, wie es sich anfühlt, diese Erfahrung zu haben – mit der affektiven Einstellung des Subjekts zum E-Erfahren zu tun (wie es für dieses war). Um an dieser Stelle nicht in Verwirrung zu geraten, müssen wir die folgenden vier Punkte beachten: (1) Vielen Erfahrungen wird im Wesentlichen durch Bestimmung dessen, wovon sie Erfahrungen sind, ein Profil verliehen, d. h., sie werden derart aus der Fülle der Erfahrungen herausgehoben. (2) Jede Erfahrung ist ein mögliches Subjekt von positiven und negativen einstellungsbezogenen Prädikaten: zum Beispiel von Vergnügens-, Interessens- oder Attraktionsprädikaten. Daraus folgt nicht, und es ist nicht wahr, dass es sich bei jeder Erfahrung wirklich um ein Subjekt eines positiven oder negativen einstellungsbezogenen Prädikats handelt. (3) Distinkte Erfahrungen, die jeweils das Subjekt eines einstellungsbezogenen Attributs sind, sind nicht dadurch unterscheidbar, dass man sich darauf bezieht, wie es sich für die Person anfühlt [how it feels], sie zu haben. Rosen riechen anders als Flieder. Rosen zu riechen ist eine andere Erfahrung als die, Flieder zu riechen. Man kann das Vergnügen am Duft von Rosen nicht dadurch erlangen, dass man den Umweg über den Fliederduft nimmt. Dennoch können die Erfahrungen gleichermaßen angenehm sein. Wenn man also gefragt wird, wie es sich anfühle, Rosen zu riechen, und wie es sei, Flieder zu riechen, kann die Antwort durchaus identisch ausfallen und lauten: ‚Entzückend‘. Wenn diese Antwort festlegt, wie es sich anfühlte, dann ist es offensichtlich nicht wahr, dass jeder distinkten Erfahrung durch ihre unverwechselbare qualitative Eigentümlichkeit oder ihr Quale ein einzigartiges Profil verliehen werden kann. Wir dürfen die qualitative Eigentümlichkeit der Erfahrung nicht mit der qualitativen Eigentümlichkeit des Objekts der Erfahrung verwechseln. Diese gibt der Erfahrung ein Profil, nicht jene. (4) Selbst wenn wir den Erfahrungsbegriff so weit ausdehnen, dass er denken, dass etwas so ist, oder denken an etwas umfasst, so besteht das, was das Denken einer Sa-
374
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
che vom Denken einer anderen unterscheidet, nicht darin, wie es ist oder wie es sich anfühlt zu denken, was immer man denkt. Zu denken, dass 2 + 2 = 4 ist, unterscheidet sich davon zu denken, dass 25 × 25 = 625 ist, und beides unterscheidet sich davon zu denken, dass die Demokraten bei der nächsten Wahl gewinnen werden.412 Sie unterscheiden sich insofern, als sie im Wesentlichen durch ihre Objekte bestimmt oder profiliert werden. Man kann denken, dass etwas so und so ist, oder an etwas oder etwas anderes denken, ohne irgendeine affektive Einstellung dabei zu haben – es muss also folglich keine ‚Anfühlungsweise‘ solchen Denkens geben. Eine löwenartige Anmutung mag das Denken an Löwen, an Richard Löwenherz oder an das Lyons Corner House begleiten, im Gegensatz zu dem, was Chalmers sagt, ist die Bestimmung der begleitenden Anmutung jedoch nicht die Charakterisierung des Wie-es-sich-anfühlt, an solche Gegenstände zu denken, geschweige denn, dass sie dem Denken ein einzigartiges Profil verleiht. Dass man das Denken an eines dieser Dinge mit etwas löwenartig Anmutendem verbindet, ist keine Antwort auf die (seltsame) Frage ‚Wie fühlt es sich an, an Löwen (Richard Löwenherz, Lyons Corner House) zu denken?‘ und es grenzt sicherlich nicht jemandes Denken an Löwen vom Denken an Lyons Corner House oder Richard I. ab.
10.3.2 Zum Problem des es fühlt sich an wie Die Klärung der Frage ‚Wie fühlt es sich an, V zu haben?‘ Wir wenden uns nun dem vertrackteren (Streit-)Fall zu, dass, eine bestimmte Erfahrung zu haben, ist wie, sich für das Subjekt der Erfahrung anfühlt wie. Wir können eine Person A fragen ‚Wie fühlt es sich (für Sie) an, V zu haben?‘, wobei V ein Verb ist, das eine Erfahrung benennt. ‚Wie fühlt es sich an?‘ ist hier eine Nachfrage, die nicht auf einen Vergleich abzielt, sondern auf eine Charakterisierung (d. h., es geht nicht darum, in Erfahrung zu bringen, was dem V-Haben ähnelt, sondern, welche Gefühlsqualität es hat). Wenn A antwortet ‚Es ist ganz angenehm (unangenehm, schön, unschön, reizend, widerwärtig, entzückend, ekelerregend, faszinierend, langweilig), V zu haben‘, dann können wir (ziemlich umständlich) sagen: ‚Es gibt etwas, das es für A ist, V zu haben.‘
Denn offensichtlich ist V haben ganz angenehm; das heißt, A findet es ganz angenehm, V zu haben. Was wir nicht sagen können, ist: (1) ‚V zu haben ist wie‘
412
Vgl. Searle, Mystery of Consciousness, S. 201.
10.3 Qualia
375
Ganz zu schweigen von: (2) ‚V zu haben ist für A wie‘413
(1) eignet sich nur für Vergleiche. Wenn V zu haben in bestimmter Hinsicht so ist wie W zu haben, dann gibt es tatsächlich etwas, das so ist wie V zu haben, nämlich W zu haben. (Man sollte allerdings berücksichtigen, dass die weniger umständliche Version lauten würde: ‚V zu haben ist wie W zu haben; es gibt also etwas, das so ist wie der Vollzug von V, nämlich der Vollzug von W‘.) (2) vermischt indes ein Ähnlichkeitsurteil mit einer Nachfrage nach einer affektiven einstellungsbezogenen Charakterisierung einer Erfahrung.414 Denn wenn A auf die Frage ‚Wie war es für Sie, V zu haben?‘ antwortet: ‚Es war wunderbar (ehrfurchtgebietend, aufregend, faszinierend)‘, kann man daraufhin nicht einfach sagen: ‚V zu haben ist für A wie . . .‘ und dann die qualitative Beschaffenheit oder die subjektive affektive Färbung von A’s V-Haben angeben, denn das wäre (a) ungrammatisches Gestammel und (b) würde es, sprachlich korrekt zusammengezogen, nicht angeben, dass V zu haben für A wie etwas war, sondern vielmehr, dass es etwas war (nämlich wunderbar etc.).415 413 [Die Wendungen sind keine Sätze, verdeutlichen aber das Gemeinte (sie sind nicht deshalb unkorrekt, weil sie keine Sätze sind). Eigentlich, aber kompliziert müsste es heißen: (1) ‚Es gibt ein Es-ist-wie, V zu haben.‘ [‚There is something which it is like to V‘.] (2) ‚Es gibt für A ein Es-ist-wie, V zu haben.‘ [‚There is something it is like for A to V‘.] Die Wendung ‚There is something which it is like to V/to have experience E‘ wurde bislang mit ‚es gibt ein Wie-es-sich-anfühlt/Wie-es-ist, V/Erfahrung E zu haben‘ oder ‚es fühlt sich auf bestimmte Weise/irgendwie/so und so an, V zu haben‘ übersetzt und mithin im Sinne der Versicherung Nagels, dass solche Wendungen keinen (like-/wie-)Vergleich indizieren, sondern zum Ausdruck bringen sollen, dass es sich für das Subjekt auf bestimmte Weise/irgendwie/so und so anfühlt, V/eine Erfahrung E zu haben. Die Autoren wenden gegen derartige Formulierungen grammatisch ein, dass sie nur in Vergleichszusammenhängen sinnvoll gebraucht werden können bzw. dass es nicht möglich ist, eine Erfahrung mittels einer like-/wie-Formulierung (nichtvergleichend) zu charakterisieren. Um dieser Argumentation Rechnung zu tragen, wurde hier ‚Es-istwie‘ bzw. ‚es fühlt sich an wie‘ übersetzt (auch um im Deutschen sozusagen eine ‚Entsprechung im Falschen‘ für die von den Autoren kritisierten englischen Formen zu haben). – A.d.Ü.] 414 Fachterminologisch ausgedrückt heißt das: Die Existenzverallgemeinerung eines Ähnlichkeits- bzw. Vergleichsurteils (‚V zu haben ist wie W zu haben‘ oder ‚V-Haben ist wie W-Haben‘) behält den Ausdruck ‚wie‘ [‚like‘] bei (‚Es gibt ein Es-ist-wie, V zu haben‘ oder ‚Was das V-Haben angeht, gibt es ein Es-ist-wie‘). Im Gegensatz dazu ist dies bei der Existenzverallgemeinerung einer Antwort auf die Frage ‚Wie war es für Sie, V zu haben?‘ nicht der Fall (‚Was das V-Haben angeht, so gab es etwas, das es für mich war‘ [‚There was something that it was for me to V.‘]). Und es ist auch ersichtlich, warum nicht: Die Antwort auf die Frage lautet ‚V zu haben, war für mich . . .‘, nicht ‚V zu haben, war für mich wie . . .‘ [‚For me to V was . . .‘, nicht ‚For me to V was like . . .‘]. 415 [Fehlform (a) könnte also lauten: V zu haben ist für A wie ehrfurchtgebietend. Und (b): V zu haben ist für A ehrfurchtgebietend. – A.d.Ü.]
376
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
Warum man bewusste Erfahrung nicht mit ‚sie zu haben fühlt sich an wie‘ umschreiben kann Es ist demzufolge irrig anzunehmen, dass man bewusste Erfahrung mit ‚sie zu haben fühlt sich für ein Subjekt an wie‘ umschreiben oder gar definieren kann. Es spielt keine Rolle, ob ‚bewusste Erfahrung‘ als ‚Erfahrung, die man hat, während man bei Bewusstsein ist‘, aufgefasst wird oder als ‚Erfahrung, derer man sich bewusst ist‘. Genau der Ausdruck ‚Sie zu haben, ist für eine Person wie‘ ist falsch konstruiert. Abgeleitet ist er von der Frage ‚Wie ist (oder war) es für Sie (oder A), V zu haben?‘, die in vollkommen legitimer Weise nach der affektiven Einstellung zu dem Zeitpunkt fragt, als die Erfahrung gemacht wurde, danach‘ ‚wie es für jemanden ist (oder war)‘. Wenn es eine Antwort gibt, dann gibt es etwas, das es für Sie (oder A) ist (oder war), V zu haben – nämlich . . . (und an dieser Stelle wird das einstellungsbezogene Attribut angeführt). Einem Großteil der Erfahrungen gegenüber ist man jedoch überhaupt nicht affektiv eingestellt. Und selbst hinsichtlich des begrenzten Bereichs des transitiven Bewusstseins von etwas oder etwas anderem wäre es falsch anzunehmen, dass es stets oder auch nur üblicherweise eine Antwort auf die Frage gibt ‚Wie fühlte es sich für Sie an, sich . . . bewusst zu sein?‘. Die bescheidene Wahrheit Die schlichte und tatsächlich einzige Wahrheit dieser ganzen Verwirrung ist, dass nur bewusste, zum Fühlen befähigte Wesen Subjekte von Erfahrung sind und affektive Einstellungen ihren Erfahrungen gegenüber einnehmen können, die sie angenehm oder unangenehm, interessant oder langweilig etc. finden können. Erfahrung E aber als F aufzufassen (als angenehm, unangenehm etc.) ist jedoch kein Kennzeichen von Erfahrungen schlechthin oder von jenen Erfahrungen, die man hatte, während man bei Bewusstsein war, oder von Erfahrungen, derer man sich bewusst ist, und schon gar nicht vom transitiven Bewusstsein im Allgemeinen (das viel mehr umfasst als Erfahrungen). Man kann ein bewusstes Wesen nicht charakterisieren, indem man sagt, ein solches zu sein, sei/fühle sich an wie Ebenso abwegig ist die Annahme, man könne, was es heißt, ein bewusstes Wesen zu sein, anhand der Formel charakterisieren ‚es zu sein, ist wie‘, fühlt sich für den Organismus an wie. Selbstverständlich können wir fragen ‚Wie fühlt es sich an, ein X zu sein?‘, wobei der Ausdruck ‚X‘ ein Rollenname ist (z. B. ‚Soldat‘, ‚Matrose‘, ‚Kesselflicker‘, ‚Schneider‘), oder ‚Wie fühlt es sich an, ein V‘er zu sein?‘, wobei der Ausdruck ‚V‘er‘ ein Wort ist, das aus einem Verb geformt wurde (z. B. ‚Gewinner‘, ‚Mörder‘, ‚Fahrer‘), oder eine Nominalphrase (‚betagter Ruheständler‘). Auf solche Fragen antwortet man, indem man Merkmale der Rolle anführt, dessen, was man tun und auf sich nehmen muss, und indem man Vor- und Nachteile oder Standardmerkmale der Erfahrungen eines V’ers
10.3 Qualia
377
angibt. Es ist eine ins Auge springende und distinkte Eigenschaft solcher Fragen, dass sie eine Angabe der qualitativen Eigentümlichkeit des X-Seins erfordern – insbesondere der damit einhergehenden Vor- und Nachteile. In der Tat wurden genau deshalb zur Erklärung der eigentümlichen Bewusstseinsnatur solche Wortgebilde gewählt. Es ist normalerweise nicht nötig, die Subjektklasse der allgemeinen Frage ‚Wie fühlt es sich an, ein X zu sein (oder F zu sein)?‘ anzugeben. Denn diese wird üblicherweise im jeweiligen Zusammenhang ersichtlich. ‚Wie ist es, ein Arzt zu sein?‘ ist eine auf Erwachsene beschränkte Frage; ‚Wie ist es, schwanger zu sein?‘ fragt man nur Frauen. Mitunter aber betrifft die Frage eine Unterklasse der Klasse möglicher X, wie bei ‚Wie ist es für eine Frau (im Gegensatz zu einem Mann), Soldat zu sein?‘ oder ‚Wie ist es für einen Teenager (im Gegensatz zu jemand Älterem), der Wimbledon-Sieger zu sein?‘. Und mitunter handelt es sich um eine persönliche Frage, wie bei ‚Wie war es für dich, Soldat im Zweiten Weltkrieg zu sein?‘. Diese Frage erfordert normalerweise, dass man seine Eindrücke wiedergibt, die Schwierigkeiten benennt, denen man ausgesetzt war, dass man beschreibt, welche guten und schlechten Erlebnisse man hatte etc. Sofern die Antwort nicht aus dem vorgegebenen Rahmen fällt, kann man daraufhin sagen ‚Es gibt etwas, das es ist, ein X (oder ein V’er) zu sein, nämlich (sagen wir) sehr aufregend, aber gefährlich‘ [‚There is something which it is to be an X (or a V’er), namely . . .‘]; ‚Es gibt etwas, das es für ein Y ist, ein X zu sein, nämlich . . .‘; und ‚Es gab etwas, das es für mich war, ein V’er zu sein, nämlich . . .‘. Wie im zuvor untersuchten Fall des ‚Wie ist es, V zu haben?‘ entfällt auch hier das ‚Wie‘/‚like‘ in der Antwort, und daher ebenso in der verallgemeinerten Form ‚Es gibt etwas, das es ist, ein X zu sein‘ (‚Es gibt ein So-und-so des XSeins‘). Logische Beschränkungen von ‚Wie fühlt es sich für . . . an, . . . zu sein?‘ Solche Fragen sind jedoch nicht mit der Frage gleichzusetzen, wie es sich für einen Menschen anfühlt, ein Mensch zu sein (oder für eine Fledermaus, eine Fledermaus zu sein), oder für mich, ich selbst zu sein. Denn diese hat die Form ‚Wie ist es für ein X, ein X zu sein?‘und nicht die ‚Wie ist es für ein Y, ein X zu sein?‘. Macht diese Differenz einen Unterschied? Denkt man über diese zweifellos zulässigen Frageformen nach, so fallen einem drei Merkmale ins Auge. Erstens unterscheidet sich der Subjektterminus ‚Y‘ vom Objektterminus ‚X‘. Zweitens kommt dort, wo die Subjektklasse durch die Formulierung ‚für ein Y‘ angegeben wird, ein Gegensatzprinzip zur Geltung. Wir fragen, wie es für ein Y ist, ein X zu sein, wenn das X-Sein der Y sich vom X-Sein irgendeiner anderen Klasse unterscheidet. Wir wollen wissen, wie es für ein Y ist, im Gegensatz zu einem Z, ein X zu sein. So kann man fragen, wie es sich für eine Frau anfühlt, Soldat zu sein. Wir könnten herausfinden wollen, was für eine Frauenkarriere in der Armee charakteristisch ist, im Gegensatz zur männlichen Variante. Und wenn wir die persönliche Frage stellen ‚Wie ist es für Sie, ein X zu sein?‘, fragen wir gleichermaßen nach Ihren besonderen und vielleicht idiosynkratischen Eindrücken vom X-Sein, im Gegensatz zu den Ein-
378
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
drücken von jemand anderem. Drittens begreift die Frage ‚Wie ist es für ein Y, ein X zu sein?‘ ein zweites Gegensatzprinzip ein, X betreffend. Denn wir wollen wissen, wie es ist bzw. wie es für Y ist, ein X zu sein, im Gegensatz zu etwas anderem, das Y sein oder gewesen sein könnte. Die problematischen Fälle, mit denen wir uns befassen, die Fälle, die angeblich Aufschluss darüber geben, was das Bewusstsein ausmacht, sind anders geartet. Sie wiederholen den Subjektterminus in der Objektposition. Die Frage aber ‚Wie ist es für einen Soldaten, ein Soldat zu sein?‘ weist ganz gewiss eine Schieflage auf. Sie hat keine Ähnlichkeit mit ‚Wie ist es für einen Soldaten, ein Matrose zu sein?‘ oder ‚Wie ist es für eine Frau, ein Arzt zu sein?‘, Fragen, bei denen offensichtlich Gegensatzprinzipien eine Rolle spielen. Man kann nicht fragen ‚Wie ist es für einen Arzt, ein Arzt zu sein, im Gegensatz zu jemand anderem, der kein Arzt ist, ein Arzt zu sein?‘, denn dies ergibt keinen Sinn. ( Jemand, der kein Arzt ist, kann nicht auch Arzt sein, obgleich er einer werden kann). Die eingefügte Wendung ‚für einen Arzt‘ ist hier nicht zulässig und fügt der Frage ‚Wie ist es, ein Arzt zu sein?‘ nichts hinzu. Eine solche Frage zielt, wie dargelegt, auf eine Beschreibung der Rolle, der Rechte und Pflichten, der Beschwernisse und Befriedigungen, der typischen Episoden und Erfahrungen einer Person, die ein X ist. Ist der Adressat ein X, dann kann diese Frage natürlich als eine eher persönliche aufgefasst werden, die der Frage ‚Wie ist es für Sie, ein X zu sein?‘ nahekommt – das heißt, persönliche Eindrücke und Einstellungen abfragt. Schwierigkeiten mit der Frage ‚Wie fühlt es sich für einen Menschen an, ein Mensch zu sein?‘ Die Frage ‚Wie fühlt es sich für einen Menschen an, ein Mensch zu sein?‘ (oder gar ‚Wie fühlt es sich für eine Fledermaus an, eine Fledermaus zu sein?‘) gerät mit dem gleichen Einwand, dass wir es hier mit einer unzulässigen Wiederholung zu tun haben, in Konflikt. Die eingefügte Wendung ‚für einen Menschen‘ kann nicht die Funktion innehaben, die eine Wendung in dieser Position innehaben sollte. Möglicherweise gibt es aber noch ein weiteres Problem. Im Gegensatz zu Proteus, virtuellen Gestalten und Göttern kann ein Mensch (anders als ein Soldat oder ein Matrose, die ihren Beruf aufgeben können) nicht aufhören, ein Mensch zu sein, ohne dass er zu existieren aufhört. Und es kann auch nur ein menschliches Wesen und kein anderes ein menschliches Wesen sein. Somit ist keines der beiden Gegensatzprinzipien erfüllt. Man kann nicht fragen ‚Wie ist es für einen Menschen, im Gegensatz zu einem anderen Wesen, ein Mensch zu sein?‘, denn außerhalb der Mythologie kann nur ein Mensch ein Mensch sein. Und man kann auch nicht fragen ‚Wie fühlt es sich für einen Menschen an, ein menschliches Wesen zu sein, im Gegensatz dazu, ein anderes zu sein?‘, denn der Mensch könnte kein anderes Wesen sein. (Ebenso könnte auch nur eine Fledermaus und kein anderes Wesen eine Fledermaus sein, und eine Fledermaus könnte nur eine Fledermaus sein und keine andere Kreatur.) Der Frage ‚Wie fühlt es sich für einen Menschen an, ein Mensch zu sein?‘ ist folglich nur dann Sinn abzugewinnen, wenn sie mit der Frage zusammenfällt ‚Wie
10.3 Qualia
379
fühlt es sich an, ein Mensch zu sein?‘. Und diese wiederum ist sonderbar. Man könnte sie folgendermaßen verstehen: ‚Wie ist das menschliche Leben, wie fühlt es sich an? [‚What is human life like?‘]‘. Eine fürwahr nebulöse Frage. Man könnte Verschiedenes darauf antworten, beispielsweise: ‚Scheußlich, brutal und kurz‘ oder ‚Es ist voll von Hoffnung und von Angst‘. Und auch die Frage ‚Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein?‘ kann, wenn sich überhaupt irgendein Sinn mit ihr verbinden lässt, nicht mehr sein als ein Wunsch nach einer vergleichbaren Bestimmung des Lebens einer Fledermaus. Und eine solche scheint prinzipiell möglich zu sein, es spricht jedoch nichts für die Annahme, dass wir dadurch irgendetwas darüber erfahren, was das Bewusstsein ist. Dennoch ist es unstrittig, dass die Frage nur im Hinblick auf bewusste Wesen gestellt werden kann, die Vergnügen aus bestimmten Dingen ziehen, andere Dinge fürchten, Interesse für etwas aufbringen und so weiter. Ähnliche Argumente treffen auf die Behauptung zu, dass wir (oder ich) zu sein sich für uns (oder für mich) auf bestimmte Weise anfühlt und dass wir alle wissen, wie es sich anfühlt. Es ergibt keinen Sinn zu fragen, wie es sich für mich anfühlt, ich zu sein, denn niemand sonst könnte ich sein und ich könnte niemand anderer sein als ich. Abgesehen davon, dass ‚Ich bin (m)ich‘ [‚I am me‘; wenn schon, müsste es lauten ‚I am I‘ – A.d.Ü.] gegen die Grammatik verstößt, sagt es auch nichts (worauf könnte es abzielen – darauf, ein affirmierendes Beispiel für die Identität einer Sache mit sich selbst zu geben?).416 Folglich sagt ‚Ich selbst zu sein fühlt sich für mich auf bestimmte Weise an‘ ebenfalls nichts. Nicht nur, dass ich nicht weiß, wie es sich für mich anfühlt, ich selbst zu sein, es gibt da nichts zu wissen. Die Behauptung, ein Mensch zu sein, fühle sich für mich auf bestimmte Weise an, ist ebenso anfechtbar. Denn die Frage ‚Wie fühlt es sich für Sie an, ein Mensch zu sein?‘ setzt voraus, dass ich etwas anderes sein oder gewesen sein könnte als ein Mensch, etwas, das meinem Menschsein gegenübergestellt werden könnte – und so etwas gibt es nicht. Machen wir also eine Bestandsaufnahme: Inkohärenzen, die sich ergeben (i) Die Sätze ‚Ein Mensch zu sein fühlt sich an wie‘, ‚Eine Fledermaus zu sein ist wie‘ und ‚Ich selbst zu sein ist durch ein Es-ist-wie charakterisiert‘ weisen in der hier vorgebrachten Form alle miteinander eine Schieflage auf. (ii) Die Frage ‚Wie fühlt es sich für ein X an, ein X zu sein‘ ist wegen der TerminusWiederholung nicht zulässig, und sie ist in einer weiteren Hinsicht unstatthaft, wenn ‚X‘ der Name einer Lebewesenart ist (wie ‚Mensch‘ oder ‚Fledermaus‘). Man kann sie höchstens als ein Äquivalent zu ‚Wie fühlt es sich an, ein X zu sein?‘ auffassen und diese Frage wiederum als eine verstehen, die nach den charakteristiAls Shakespeares Richard III. erleichtert murmelt ‚Richard ist nun wieder er selbst‘, meint er nicht, dass er zuvor nicht mit sich selbst identisch war, es aber jetzt glücklicherweise wieder ist! 416
380
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
schen einstellungsbezogenen Merkmalen des Lebens von X fragt. Auf solche Fragen kann man Antworten finden, und man muss kein X sein oder keinem X ähnlich, um auf sie zu antworten. Man muss nur gut über die Leben der X Bescheid wissen. (iii) Die Fragen ‚Wie fühlt es sich für mich an, ich zu sein?‘ und ‚Wie fühlt es sich für mich an, ein menschliches Wesen zu sein?‘ sind gleichermaßen unzulässig. Wenn dies richtig ist, dann liegt Nagel falsch mit der Annahme, dass ‚wir wissen, wie es sich [für uns] anfühlt, wir zu sein‘, dass wir selbst zu sein sich [für uns] auf ganz bestimmte Weise anfühlt‘ und dass, ‚auch wenn wir nicht über den Wortschatz verfügen, es hinreichend zu beschreiben, [wir doch wissen], dass es hochgradig subjektiv ist‘. Edelman und Tononi sind mit ihrer Beteuerung im Irrtum, dass ‚wir alle wissen, wie es sich anfühlt, wir selbst zu sein‘, und ihre Annahme, ‚wir selbst zu sein sei durch ein Anfühlungswie charakterisiert‘, ist verworren. Und das gilt auch für Searles Ansicht, dass jeder Bewusstseinszustand dadurch ausgezeichnet ist, ‚dass in ihm zu sein mit einer bestimmten Anfühlungsqualität einhergeht‘.
10.3.3 Erfahrung als Qualität Erfahrungen werden durch das bestimmt, wovon sie Erfahrungen sind, aber nicht dadurch, wie sie sich anfühlen Der Versuch, die Wesensart des Bewusstseins oder dessen, was es heißt, ein bewusstes Wesen zu sein, anhand des Gedankens zu erfassen, es fühle sich auf bestimmte Weise an, diese oder jene Erfahrung zu haben oder das Wesen zu sein, das man ist – dieser Versuch ist fehlgeschlagen. Der Gedanke, dass jede bewusste Erfahrung mit einem besonderen ‚Gefühl‘ verbunden ist – das heißt, dass jede Erfahrung, die eine Person hat, für sie mit einer unverwechselbaren Anfühlungsqualität einhergeht –, hat sich ebenfalls als abwegig erwiesen. Trotzdem lässt sich durchaus die Ansicht vertreten, dass all jenen, die sich darum bemühen, Erfahrung als Qualität bzw. als qualitativ beschaffene zu charakterisieren, Unrecht getan wurde. Wir haben argumentiert, dass es zulässig ist zu fragen, wie es sich anfühlt [how it feels], eine bestimmte Erfahrung zu haben, oder wie es ist [what is it like], die und die Erfahrung zu haben, und dass es sich hierbei in Wirklichkeit um Fragen handelt, die die gegenwärtige einstellungsbezogene Reaktion eines Subjekts auf eine Erfahrung betreffen, die es durchlebt. Darauf könnte nun allerdings erwidert werden, dass dies nicht im Mindesten dem Gemeinten entspricht. Was also war mit der Einführung der Qualia gemeint? Und ist sie kohärent? Qualia und die Eigentümlichkeit jeder Erfahrung Man wird bemerkt haben, dass der künstliche Terminus ‚Quale‘ nicht eindeutig verwendet wird. Die Qualevorstellung schwankt hinsichtlich dessen, was sie zum Aus-
10.3 Qualia
381
druck bringen soll, zwischen dem Wie-(auch-immer)-es-sich-anfühlt für eine Person, eine Erfahrung E zu haben, und der Erfahrung E selbst. In Anbetracht unserer vorherigen Analyse verzichten wir auf die schlecht konzipierten Wendungen ‚es gibt ein Esist-wie‘ und ‚es gibt ein Anfühlungswie‘. Wenn wir der Sache mit den Qualia auf den Grund gehen wollen, müssen wir die Vorstellung in den Blick nehmen, dass jede Erfahrung einzigartig und unverwechselbar ist. Rot zu sehen unterscheidet sich davon, Blau zu sehen, und Farbensehen ist etwas anderes als Geräuschehören oder Schmecken. Zornig sein unterscheidet sich mithin von eifersüchtig sein und beide unterscheiden sich von lieben oder Zuneigung empfinden. Wir haben bereits erwähnt, dass manche Autoren versuchen, die Qualiavorstellung auf das Denken von Gedanken auszudehnen, wobei sie (vollkommen zu Recht) der Ansicht sind, dass 2 + 2 = 4 zu denken sich davon unterscheidet, 25 × 25 = 625 zu denken, und diesen Unterschied (ganz zu Unrecht) als einen Unterschied hinsichtlich der Qualität der Denk-‚Erfahrung‘ auffassen. Auf solche Unterschiede zielen die Theoretiker ab, wenn sie irrtümlicherweise darauf bestehen, dass bewusste Erfahrungen in qualitativer Hinsicht unverwechselbar sind. Dies ist einerseits richtig und unverfänglich. Natürlich unterscheidet sich das Sehen von Rot vom Sehen von Blau, und lieben ist etwas anderes als hassen. 2 + 2 = 4 zu denken unterscheidet sich natürlich davon, 25 × 25 = 625 zu denken. Andererseits ist es verworren. Denn der Unterschied zwischen Rotsehen und Blausehen hat nichts damit zu tun, wie es sich für eine Person anfühlt oder wie es für sie ist, diese beiden Farben zu sehen. Dennoch unterscheiden sich diese Erfahrungen wirklich, und jeder normal veranlagte Mensch, der eine solche Erfahrung hat, weiß sehr genau, dass die Erfahrung des Rotsehens sich von der des Blausehens unterscheidet und wird sie wahrscheinlich nicht verwechseln. Und ob es nun richtig ist, Denken als eine Erfahrung aufzufassen oder nicht: Jemand, dem der Gedanke, dass 2 + 2 = 4, durch den Kopf geht, wird diesen kaum mit dem verwechseln, dass 25 × 25 = 625. Muss sich also der Unterschied zwischen den Erfahrungen bzw. zwischen dem Denken der verschiedenen Gedanken nicht auch in irgendeiner Qualität der Erfahrungen widerspiegeln? Und worum auch immer es sich bei einer solchen Qualität handeln mag, sie muss etwas sein, das vom Subjekt erfasst wird, denn es ist dieses subjektive Erfassen, das erklärt, wie das Subjekt die Erfahrungen, die es hat, unterscheiden kann. Zumindest scheint es so zu sein.
10.3.4 Die So und die Das Indexikalischer Bezug auf das Eigentümliche einer jeden Erfahrung Wir haben oben festgestellt, dass, obgleich viele Philosophen und Neurowissenschaftler von der Qualiavorstellung eingenommen sind und dementsprechend insistieren, dass jede Erfahrung von einzigartiger Qualität ist, uns in Wahrheit keiner von ihnen auch
382
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
nur von einer Erfahrung sagt, worin ihre Besonderheit besteht. Es ist jedoch offenkundig ganz selbstverständlich zu versuchen, sich auf die besondere Qualität einer gegebenen Erfahrung mittels eines indexikalischen Ausdrucks wie ‚so‘ oder ‚derart‘ zu beziehen. So fragt David Chalmers ‚Warum sind bewusste Erfahrungen je besonders beschaffen?‘ und speziell ‚Warum ist Rot sehen so [like this] und nicht so [like that]?‘.417 Und es scheint offensichtlich, dass das ‚So‘ [‚the like this‘] und das ‚So‘ [‚the like that‘] auf die besonderen Qualitäten verweisen sollen, die Erfahrungen angeblich haben. Die logischen Beschränkungen, denen solche indexikalische Bezüge unterliegen Menschen mit normal ausgeprägten visuellen Fähigkeiten können also rote (grüne, blaue etc.) Objekte in ihrer Umwelt sehen. Das Sehen eines roten Objektes ist, so sagt man uns, mit einem besonderen ‚subjektiven Gefühl‘ verknüpft. Worum handelt es sich bei diesem ‚subjektiven Gefühl‘? Nun, Rot sehen ist so, Grün sehen ist so, Blau sehen ist so – das heißt, dies ist die Weise, auf die ich Rot sehe, dies ist, wie ich Rot sehe. Interessant und verblüffend ist es, dass Wittgenstein diese Verwirrung vor mehr als fünfzig Jahren vorwegnahm. Er schrieb: Der Inhalt der Erlebnisse. Man möchte sagen ‚So sehe ich Rot‘, ‚So höre ich den Ton, den du anschlägst‘, ‚So fühle ich Vergnügen‘, ‚So empfinde ich Trauer‘ oder auch ‚Das empfindet man, wenn man traurig ist, das, wenn man sich freut‘ etc. Man möchte eine Welt analog der physikalischen mit diesen So und Das bevölkern. Das hat aber nur dort Sinn, wo es ein Bild des Erlebten gibt, worauf man bei diesen Aussagen zeigen kann.418
Sein Argument ist einfach: Es ergibt keinen Sinn zu sagen ‚So sehe ich Rot‘, wenn man dann nicht sagen kann, wie man Rot sieht. Wir unterliegen der Täuschung, dass wir, wenn wir einen roten Apfel sehen, gleichsam unser Sehen in den Blick nehmen und zu uns selbst sagen können ‚So sehe ich die rote Farbe des Apfels‘, und dass wir, indem wir das sagen, etwas (zumindest uns) Einleuchtendes zum Ausdruck bringen. Indem wir ‚so‘ oder ‚das‘ sagen, sagen wir jedoch nichts Sinnvolles, weder zu uns selbst noch zu anderen, es sei denn, es gibt ein So oder ein Das, auf das wir zeigen können – das heißt, es sei denn, es gibt ein So oder ein Das, anhand dessen wir den Satz ‚Das ist es, wie ich Rot sehe‘ oder ‚So sehe ich Rot‘ einlösen können. Es ist vollkommen sinnvoll zu sagen ‚Ich sehe die Farbe des Apfels so F ¢ ‘ und dabei auf ein Beispiel von Rot zu zeigen. Das Beispiel entspricht hier dem, was Wittgenstein in der zitierten Passage mit ‚ein Bild‘ meint – das heißt einem Etwas, das für einen selbst und für andere darstellen kann, wie man die Farbe des Apfels sieht. Es ist allerdings eine Illusion anzunehmen, man könne gleichsam innerlich (und nur für sich allein) auf die Erfahrung zeigen, die man gerade erlebt, und sagen ‚So sehe ich Rot‘ und damit irgendetwas Sinnvolles ausdrücken – 417
Chalmers, Conscious Mind, S. 5. Wittgenstein, Bemerkungen zur Philosophie der Psychologie, Bd. I, Wittgensteins Werkausgabe Bd. VII, § 896. 418
10.3 Qualia
383
dann könnte man genauso gut sagen ‚Das ist das‘ (siehe 3.9). Es ist „wie wenn ich in einem Auto unterwegs bin und mir die Zeit im Nacken sitzt, sodass ich instinktiv gegen etwas drücke, das sich vor mir befindet, als ob ich damit das Auto von innen her schieben könnte“.419 Inkohärenzen, die sich ergeben, wenn man die logischen Beschränkungen missachtet Wenn man Wahrnehmungserfahrungen als Varianten von dies und so versteht, ist man wie Chalmers versucht weiterzufragen: „Warum sind bewusste Erfahrungen je besonders beschaffen?“ – speziell: „Warum ist Rotsehen so und nicht so? [. . .] Warum [. . .] haben wir genau die Empfindung der Röte, die wir haben, und nicht irgendeine vollkommen andere Art der Empfindung, wie einen Trompetenklang beispielsweise?“420 Es dürfte nun aber einleuchten, dass die Frage ‚Warum ist Rot sehen wie das F ¢ [auf ein Rotbeispiel zeigen] sehen?‘ unsinnig ist. Erstens ähnelt das Rotsehen nicht dem Sehen dieser F ¢ Farbe, es ist das Sehen dieser Farbe. Zweitens besteht die einzig stichhaltige Antwort auf die verworrene Frage ‚Warum ist Rot sehen wie dies sehen?‘ darin, dass diese F ¢ Farbe sehen Rot sehen ist, da es diese Farbe ist, die wir ‚Rot‘ nennen. Und genauso verworren ist die Frage ‚Warum hat man, wenn man rote Rosen betrachtet, nicht die Erfahrung, Blau zu sehen?‘. Denn die einzig mögliche Antwort (ein normal ausgeprägtes Sehvermögen und gewöhnliche Beobachtungsbedingungen vorausgesetzt) ist trivial, nämlich ‚Weil sie rot sind und nicht blau.‘ Was würde eine Person mit normal ausgeprägtem Sehvermögen sonst zu sehen erwarten, wenn sie bei Tageslicht rote Rosen betrachtet? Der Begriff einer Person mit normal ausgeprägtem Sehvermögen wird mit von ihrer Fähigkeit definiert, farbige Objekte zu unterscheiden. Das menschliche Sehsystem stattet eine Person mit der Fähigkeit aus, zwischen verschiedenen Farben zu unterscheiden, und normal veranlagte Menschen können zwischen roten und blauen Objekten unterscheiden. Wir können erforschen, welche Gehirnmerkmale uns diese Fähigkeit verleihen und welche neuralen Schädigungen die Farbenblinden der ihren berauben, und genau das erforschen die Neurowissenschaftler, die sich dem Farbsehen widmen. Mehr gibt es dazu, dass man ein rotes Objekt sieht, wenn man bei normalen Lichtverhältnissen ein rotes Objekt betrachtet, nicht zu fragen. Ein sogar noch größeres Missverständnis liegt der Frage zugrunde „Warum haben wir dann die Empfindung der Röte und nicht die eines Trompetenklangs?“421 Das Auge und der Rest des visuellen, lichtempfindlichen Systems statten das Lebewesen mit dem visuellen Unterscheidungsvermögen aus. Es ist nicht möglich, Geräusche mit den Augen 419
Wittgenstein, The Blue and Brown Books (Blackwell, Oxford, 1958), S. 71. Chalmers, Conscious Mind, S. 5. 421 Mit dem Ausdruck ‚Empfindung‘ bezieht sich Chalmers hier eher auf Wahrnehmungen als auf Empfindungen. Rotsehen beinhaltet streng genommen keine wie auch immer gearteten Empfindungen. 420
384
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
zu sehen. Wir brauchen uns folglich nicht zu fragen, warum wir keinen Trompetenklang sehen, wenn wir eine rote Rose betrachten. Und es braucht uns auch nicht zu wundern, dass wir nicht zugleich einen Trompetenklang hören, wenn wir eine rote Rose betrachten – vorausgesetzt, dass niemand auf einer Trompete spielte und daher keine Trompete zu hören war. Cricks Verwirrung In diesen Morast geraten auch Neurowissenschaftler. Crick beispielsweise verbindet mit den Qualia die Schwierigkeit „die Röte des Rots und die Schmerzhaftigkeit des Schmerzes zu erklären“ und stellt fest, dass „dies eine sehr mühselige Sache“ ist, da sich die Röte des von mir wahrgenommenen Rots keinem anderen Menschen präzise mitteilen lässt, zumindest normalerweise nicht.422 Es ist jedoch keineswegs klar, was mit „die Röte des Rots erklären“ gemeint ist. Stellt uns die Frage, weshalb rote Dinge rot sind, vor ein Rätsel? Man kann fragen, warum Briefkästen in Großbritannien rot sind – sie sind es, damit sie nicht übersehen werden. Man kann fragen, warum Blut rot ist – das Eisen enthaltende Hämoglobin macht es rot. Wir haben es hier nicht mit Rätseln zu tun, und das meinte Crick sicherlich auch nicht. Es ist jedoch überhaupt nicht klar, was er wirklich meint oder ob überhaupt eine verständliche Frage aufgeworfen wurde. Cricks ‚hineingeheimnissende‘ Verwirrung scheint von zwei abwegigen Vorstellungen herzurühren. Erstens denkt er offenbar, dass das, was man wahrnimmt, keiner anderen Person mitgeteilt werden kann. Zweitens denkt er offenbar, dass es sich bei Farben nicht um Eigenschaften farbiger Gegenstände handelt, sondern um Affektionen des Geistes (somit ist die Röte, die ich wahrnehme, keine Eigenschaft der Mohnblumen, die ich betrachte, sondern vielmehr die Wirkung jener Mohnblumen auf meine Sinne – die nicht mit ihren Wirkungen auf die Sinne einer anderen Person verglichen werden kann). Wir werden auf diese Fehlkonzeptionen im nächsten Abschnitt zurückkommen. Was die Qualität einer Erfahrung sein könnte Was also bleibt von der ‚Gefühlsqualität der Erfahrung‘? Wir müssen unterscheiden. Jede Erfahrung erlaubt die Frage, was sie ausmachte. Die Antwort wird festlegen, worin ihre Eigenart bestand – ob man beispielsweise ein Stechen oder ein Kribbeln gefühlt hat, eine rote Rose gesehen oder den Klang von Musik gehört hat, mit A zornig oder auf B eifersüchtig war, Kricket spielte oder in die Oper ging. Wir können im Hinblick auf eine Erfahrung auch fragen, wie es war, sie zu durchleben, und sofern es eine Antwort gibt, wird diese festlegen, ob man es angenehm oder unangenehm fand, interessant oder langweilig, beängstigend oder aufregend etc. Daran ist nichts rätselhaft, überraschend oder verwirrend. 422
Crick, Astonishing Hypothesis, S. 9f. [dt. Was die Seele wirklich ist, S. 24].
10.3 Qualia
385
Der Gedanke, dass die ‚Gefühlsqualitäten der Erfahrungen‘ nicht oder nur unzureichend mitgeteilt werden können, dass sie nicht oder nur anhand anderer Erfahrungen beschreibbar sind, verrätselt die Zusammenhänge jedoch unnötig. Und bringt eine Verwirrung mit sich, der wir uns nun zuwenden wollen.
10.3.5 Über die Mitteilbarkeit und Beschreibbarkeit von Qualia Die Unbeschreibbarkeits- und die Nichtmitteilbarkeitsthese Ob die Eigenart unserer Erfahrung mitteilbar ist und, wenn ja, in welchem Umfang, ist umstritten. Wir haben bereits dargelegt, dass Nagel die Ansicht vertritt, wir besäßen nicht den Wortschatz, um die eigentümliche Qualität der Erfahrung, wie er sie versteht, angemessen zu beschreiben. Sie ist, behauptet er, nur in gewisser Hinsicht beschreibbar, und eine solche Beschreibung kann auch nur von Wesen, wie wir es sind, verstanden werden. Edelman bringt vor, dass „Qualia [. . .] die Menge persönlicher oder subjektiver Erfahrungen, Gefühle und Empfindungen darstellen, die mit dem Bewusstsein einhergehen. Es handelt sich bei ihnen um Erfahrungszustände [. . .] Beispielsweise ist die ‚Röte‘ eines roten Objekts ein solches Quale. Qualia werden, wie er sagt‘ „von jedem Individuum unmittelbar erlebt“ und daraus erwächst ein methodologisches Problem. Denn: „Was ein Individuum unmittelbar als Qualia erfährt, kann ein anderes beobachtendes Individuum vielleicht nicht in gleicher Weise nachvollziehen.“ Diese Schwierigkeit kann jedoch überwunden werden, wenn wir seinem Vorschlag gemäß „annehmen, dass es in anderen bewussten Menschen genau wie in uns Qualia gibt.“423 Glynn argumentiert: Wenn wir frisch gemahlenen Kaffee riechen oder eine Oboe spielen hören oder das intensive Blau eines mediterranen Himmels sehen oder Zahnschmerzen haben, so haben wir Erfahrungen, die nicht zu beschreiben sind, es sei denn, wir verweisen auf ähnliche Erfahrungen, die wir bei anderen Gelegenheiten gemacht haben. Wir können uns nur dann vorstellen, wie diese Erfahrungen sich anfühlen, wenn wir sie haben oder hatten. Man kann uns alles Mögliche andere über sie berichten – worin ihre Ursachen in der Außenwelt liegen; welche Rückschlüsse die Tatsache zulässt, dass wir sie haben, und zwar im Hinblick auf uns und die Außenwelt; welche Auswirkungen sie auf unser Verhalten haben oder wahrscheinlich haben werden; was in unserem Gehirn vor sich geht, während wir sie haben – all das sagt uns jedoch nichts über ihre subjektive Qualität; wie es für uns ist, sie zu haben.424
Menschen mit normal ausgeprägtem Farbsehvermögen sehen rote (grüne, blaue etc.) Dinge in ihrer Umgebung. Bei guten Lichtverhältnissen können sie rote Dinge von andersfarbigen unterscheiden. Leiden sie an einer der verschiedenen Formen der Farben423 424
Edelman, Bright Air, Brilliant Fire, S. 114f. [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer, S. 166f.]. Glynn, Anatomy of Thought, S. 392.
386
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
blindheit, dann haben ihre Unterscheidungsfähigkeiten gelitten. Es gibt allerdings standardisierte Tests für Farbenblindheit. Wir können also relativ genau bestimmen, ob eine Person rote, grüne oder blaue Objekte so sieht, wie normalsichtige Menschen sie sehen. Wie also kommt die Täuschung zustande, dass die sogenannten Qualia nicht oder nur unzureichend mitteilbar sind? Eine Quelle der Nichtmitteilbarkeitsthese Die Täuschung rührt zum einen von dem Gedanken her, dass ich Ihnen nicht mein Sehen zeigen kann. Was soll das aber heißen? Sicherlich können Sie sehen, dass ich etwas sehe. – Ja, könnte man darauf erwidern, allerdings können Sie nicht sehen, was ich sehe. Das stimmt aber nicht, zumindest dann nicht, wenn wir beide über eine einigermaßen gute Sehkraft verfügen und denselben Gegenstand unter optimalen Bedingungen beobachten, denn dann kann ich genau das sehen, was Sie sehen. Einverstanden, könnte man nun erwidern, auf jeden Fall aber können Sie nicht für mich sehen! Was aber heißt das? Ich kann mit Sicherheit etwas an ihrer Stelle sehen oder betrachten und Ihnen berichten, was ich sehe. Ja, aber dennoch können Sie mein Sehen nicht ausführen [do]. Das ist nun allerdings ein verworrener Gedanke. Denn auch Sie können Ihr Sehen nicht ausführen. Sehen ist nichts, was man tut. Sie können etwas sehen, und ich kann oder kann nicht sehen, was Sie sehen. Es ist (a) richtig, dass aus der Tatsache, dass Sie das und das sehen, nicht folgt, dass auch ich das und das sehe. Folglich (b), dass ihr Sehereignis von dem und dem sich von meinem Sehereignis von dem und dem unterscheidet, selbst wenn ich das sehe, was Sie sehen. Und (c), dass die Tatsache, dass Sie es auf bestimmte Weise sehen, nicht impliziert, dass ich dies auch tue, denn was Sie klar und deutlich sehen, sehe ich möglicherweise verschwommen, und was Ihnen bedrohlich vorkommt, kann auf mich völlig harmlos wirken. Dennoch ist daran nichts rätselhaft oder nicht mitteilbar. Eine zweite Quelle der Nichtmitteilbarkeitsthese Zum anderen rührt die Täuschung von etwas her, über das wir uns bereits Klarheit zu verschaffen versuchten (3.6–3.9). Es handelt sich um den Gedanken, dass Erfahrungen privat besessen werden und privat zugänglich sind. Entspräche das der Wahrheit, dann wäre es tatsächlich so, dass eine Person nicht oder nicht sicher wissen könnte, ob eine andere Person eine Erfahrung gemacht hat, und wenn ja, welche. Denn bei derartigen Erfahrungen oder Qualia hätten wir es wirklich mit seltsamen ätherischen (geistigen) Objekten zu tun, die kein anderer wahrnehmen kann, wie Käfer in einer Schachtel, in die bloß ich hineinsehen darf – nur ist die Schachtel in diesem Fall der Geist und die Käfer sind die Qualia. Wie wir bereits dargelegt haben, ist es jedoch ein Irrtum, davon auszugehen, dass Erfahrungen in diesem Sinne privat sind. Meine Erfahrungen gehören mir nicht, ich besitze sie nicht. Ich habe Erfahrungen – das heißt, ich sehe und höre et-
10.3 Qualia
387
was, bin frohgemut oder niedergeschlagen etc. –, und jemand anderes kann ebensolche Erfahrungen haben. Ich nehme meine Erfahrungen nicht wahr, obgleich ich mir manchmal dessen bewusst sein kann, eine spezielle Erfahrung zu haben, wenn ich ihre Eigenart erfasse, und der Gedanke, dass ich sie habe, meinen Geist beschäftigt. Und bei einer Erfahrung handelt es sich nicht um eine Art von Objekt. Sehe ich einen roten Apfel, so ist das einzige Objekt, das hier eine Rolle spielt, ein roter Apfel, nicht meine Erfahrung, einen roten Apfel zu sehen; und was ich sehe, ist der Apfel, nicht mein Sehen desselben. Es kann gut sein, dass Sie ein Rembrandt-Gemälde, das ich genieße, ausdruckslos und langweilig finden. In diesem Sinn kann meine Erfahrung in qualitativer Hinsicht von der Ihren abweichen, auch wenn sie sich auf dasselbe Objekt beziehen und gleichermaßen klar erlebt werden. Es ist aber auch möglich, dass Sie es genauso interessant und schön finden. Die Vorstellung, dass sich die Eigentümlichkeit der Erfahrung nicht beschreiben lässt, stellt die dritte Quelle der Nichtmitteilbarkeitsthese dar Es gibt noch eine dritte Quelle der Konfusion, nämlich die Vorstellung, dass sich die Eigenart der Erfahrung nicht beschreiben lässt. Für diese Konfusion sind wiederum verschiedene Dinge ausschlaggebend. Erstens müssen wir zwischen der Beschreibung der relevanten Erfahrung und der Beschreibung des Objekts der Erfahrung unterscheiden. Zweitens müssen wir zwischen der Beschreibung des Objekts der Erfahrung und der Beschreibung der Eigenschaften oder Qualitäten des Objekts der Erfahrung unterscheiden. Daher müssen wir drittens auch zwischen der Beschreibung der Erfahrung und der Beschreibung der Qualitäten der Erfahrung unterscheiden. Beschreibung einer Wahrnehmungserfahrung Frisch gemahlenen Kaffee zu riechen, dem Spiel einer Oboe zu lauschen oder den mediterranen Sommerhimmel zu sehen sind Beispiele für Erfahrungen, die ohne Schwierigkeiten beschrieben werden können. Die erste Erfahrung ist ziemlich angenehm, zumindest für die meisten Kaffeetrinker; die zweite kann absolut wunderbar sein, wenn es sich um einen erstklassigen Spieler handelt und das Stück vollendet ist, kann aber unerträglich sein, wenn der Spieler ein Anfänger ist oder das Stück kein Niveau hat, und die dritte Erfahrung kann eine berauschende Wirkung haben und begeistern (wenn man gleichsam van Gogh in Arles ist) oder etwas gänzlich Unspektakuläres sein (wenn man ein ganz normaler Küstenbewohner der mediterranen Region ist). Bei solchen Eigenschaften von Erfahrungen, oder zumindest den uns interessierenden, haben wir es im Wesentlichen mit ihren Lust- oder Unlustmerkmalen zu tun. Das ist unproblematisch, und es entspricht offensichtlich nicht dem, was diejenigen meinen, die Qualia als unbeschreibbar charakterisieren.
388
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
Beschreibung der Objekte solcher Erfahrungen Und es gibt auch keine prinzipiellen Schwierigkeiten dabei, die Objekte der Erfahrungen zu beschreiben, wenn diese so begriffen werden wie der Kaffee, den man riecht, das Oboenspiel, das man hört, oder der mediterrane Himmel, den man sieht. Wie Glynn sagt, ist der Kaffee frisch gemahlen, hat das Aroma frischer Röstung, ist dunkelbraun oder mokkafarben, fein oder grob gemahlen. Das Oboenspiel kann gekonnt sein, die Triller können mit Verve ausgeführt, die Modulation kann subtil und elegant sein etc. Und der mediterrane Himmel ist tiefblau, das Licht klar und strahlend. Auch das ist unproblematisch, und es entspricht ebenso nicht dem Gemeinten. Die Vorstellung, dass die Qualitäten der Erfahrungsobjekte unbeschreibbar sind Was also ist gemeint? Es könnte gemeint sein, dass man die Qualitäten der Erfahrungsobjekte nicht beschreiben kann, das besondere Kaffeearoma, die lieblichen Oboenklänge und die blaue Farbe des mediterranen Himmels. Hier gibt es Schwierigkeiten; diese lassen sich jedoch auf Begriffsverwirrungen zurückführen. Wir sind tatsächlich versucht zu sagen, dass das Kaffeearoma, der Oboenklang oder das Blau des mediterranen Himmels unbeschreibbar sind. Wir glauben zu wissen, wie sie sind, und gehen davon aus, dass unser Wortschatz zu ihrer Beschreibung nicht hinreicht. Was sicherlich verworren ist, denn wenn unser Wortschatz nicht hinreicht, steht es uns frei, ihn zu verfeinern. Und wir müssen eine gewisse Konzeption von einer Beschreibung haben, die uns eine ausgefeiltere Sprache an die Hand gäbe – das heißt, wir müssen annehmen, dass das Aroma prinzipiell beschreibbar ist, nur eben nicht mit unserer unzulänglichen Sprache. Es ist jedoch nicht klar, dass es das ist, was die Vertreter der ‚Unaussprechlichkeits‘-These meinen. Lassen sie uns die Sache also langsam angehen. Beschreibung des Kaffeearomas Erstens: Ist es denn überhaupt richtig, dass wir das Kaffeearoma nicht beschreiben können? Schließlich können wir ja sagen, dass es frisch, reich und köstlich ist, dass es das Aroma frisch gemahlenen Kaffees ist. Ist das keine Beschreibung des Kaffeearomas? Selbstverständlich ist es eine. Und sie kommt darüber hinaus nicht zustande, indem man ‚auf ähnliche Erfahrungen‘ des Kaffeearomariechens bei anderen Gelegenheiten ‚zeigt‘ oder ‚verweist‘. Die Verfechter der Unaussprechlichkeitsthese werden zweifellos erwidern, dass dies nicht gemeint war, dass diese Worte das Wesentliche nicht beschreiben – das nicht in Worte gefasst werden kann.
10.3 Qualia
389
Der Anschein der Unbeschreibbarkeit von Qualitäten kommt aufgrund einer Abweichung vom Paradigma für die Beschreibung von Substanzen zustande Diese Einschätzung hat nichts mit der Armut unserer Sprache zu tun, sondern ist dem Umstand geschuldet, dass solche Aromabeschreibungen ein Beschreibungsparadigma nicht erfüllen. Die Behauptung, dass das Kaffeearoma unbeschreibbar ist, läuft auf die Behauptung hinaus, dass eine Beschreibungsform auf diesen Fall nicht angewendet werden kann, und führt zur Ablehnung der Beschreibungsform, die auf ihn anwendbar ist. Wenn also jemand insistiert, dass das Kaffeearoma unbeschreibbar ist, lehnt er es ab, das am Kaffeearoma Beschreibbare – das heißt das, was sinnvoll ‚eine Beschreibung des Aromas’ genannt werden kann – als eine Beschreibung in Betracht zu ziehen bzw. als eine, die seinen Vorstellungen entspricht. Die Beschreibungsform, an die er denkt, ist jedoch zur Charakterisierung von Objektqualitäten (ihren Gerüchen, Farben und Geschmäcken beispielsweise) prinzipiell ungeeignet. Dieses Argument ist nicht ohne Weiteres nachzuvollziehen und verlangt eine sorgfältige Erklärung. Welches von der Unaussprechlichkeitsthese vorausgesetzte Paradigma verleitet einen dazu, die Aromabeschreibungen, die formuliert werden können, als unzulängliche zurückzuweisen? Es ist die Beschreibung eines materiellen Objekts durch die Angabe seiner Eigenschaften oder Qualitäten. Wir beschreiben einen Tisch als rund, aus Mahagoni bestehend, im Querschnitt einen Meter messend etc., ebenso wie wir eine Tasse Kaffee als schwarz, heiß und bitter beschreiben. Ein materielles Objekt zu beschreiben bedeutet, seine Eigenschaften oder Qualitäten anzugeben. Wird aber nach den Eigenschaften oder Qualitäten gefragt statt nach dem Objekt, das diese Eigenschaften hat oder sich durch diese Qualitäten auszeichnet, ist dieses Beschreibungsparadigma nicht anwendbar. Die entscheidende Frage lautet: Was nennen wir ‚die Beschreibung einer Eigenschaft oder Qualität‘? Wir könnten die Beschreibung der Tasse Kaffee als schwarz, heiß und bitter mit der Beschreibung des Aromas des Kaffees, aus dem sie ‚besteht‘, als vollmundig, reich und röstfrisch vergleichen, wie wir die Beschreibung einer Rose als wohlgestaltet, süßlich duftend und rot mit der Beschreibung ihrer roten Farbe als dunkel und matt vergleichen könnten. Dies ist ein vollkommen akzeptabler Vergleich, aber eben nur ein Vergleich bzw. eine Analogie. Denn dunkel und matt sein verhält sich zu rot sein nicht wie rot sein zu einer Rose. Denn mattrot sein oder dunkelrot sein können auch als zwei unterschiedliche komplexe Eigenschaften oder Qualitäten, die farbige Dinge haben können, aufgefasst werden – und wenn man diese Auffassung teilt, neigt man möglicherweise auch zu dem Gedanken, dass zu sagen, die rote Farbe sei dunkel und matt, nicht bedeutet, sie zu beschreiben. Denn die besagte rote Farbe ist weder ein Objekt noch eine Substanz mit den Eigenschaften, matt und dunkel zu sein, wobei diese sich ändern können, ohne dass das Objekt zu existieren aufhört – es ist einfach ein dunkles mattes Rot. Ebenso kann ein reiches, röstfrisches Aroma haben als eine komplexe Qualität des Kaffees aufgefasst werden – und wenn man dies gern so ausdrücken
390
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
würde, neigt man möglicherweise auch zu dem Gedanken, dass zu sagen, das Aroma sei reich und frisch, nicht bedeutet, es zu beschreiben. Die angebliche Unbeschreibbarkeit läuft nur auf einen Einwand gegen eine Konvention hinaus Sicherlich kann man niemandem eine Analogie aufzwingen, der sich gegen sie sträubt. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Behauptung, das Kaffeearoma, der Oboenklang oder die Farbe des mediterranen Himmels seien unbeschreibbar, lediglich bedeutet, dass man Eigenschaften oder Qualitäten nicht nach Art eines bevorzugten Paradigmas beschreiben kann: nämlich des Paradigmas der Beschreibung eines materiellen Objektes durch die Angabe seiner Eigenschaften. Selbst wenn wir solche Einwände berücksichtigen, ist unverkennbar, dass die ‚Unbeschreibbarkeit‘ weder ein Rätsel ist noch auf die Grenzen der Sprache hindeutet, sondern mit einer Konvention zu tun hat hinsichtlich dessen, was man ‚eine Beschreibung‘ einer Qualität nennt. Insistiert jemand, dass man Qualitäten nicht beschreiben kann, können wir einräumen, dass es nicht möglich ist, eine Qualität so zu beschreiben, wie man ein Objekt beschreibt, nämlich durch die Angabe seiner Qualitäten. Wir müssen uns jedoch klarmachen, dass eine derart insistierende Person keine rätselhafte Begrenzung unseres Beschreibungsvermögens enthüllt hat. Sie wendet sich lediglich gegen eine Konvention. Die angebliche Unbeschreibbarkeit der subjektiven Qualitäten einer Erfahrung Man könnte dafürhalten, dass all diese Überlegungen am Kern der Sache vorbeigehen. Bei dem, was als unbeschreibbar oder als nur durch Verweis auf ähnliche Erfahrungen beschreibbar betrachtet wird, handelt es sich weder um das Erfahrungsobjekt noch um die Qualitäten des Erfahrungsobjekts, sondern um die subjektiven Qualitäten der Erfahrung selbst. Was jedoch offenkundig so nicht stimmt. Denn man kann die Erfahrung des Riechens des Kaffeearomas oder des Gestanks fauler Eier beschreiben – die erste ist angenehm, Letztere abscheulich. Man kann die Erfahrung des Betrachtens des mediterranen Sommerhimmels beschreiben oder die, Mozarts Oboenkonzert zu lauschen; die erste kann wunderbar friedlich sein, man möchte das tiefe Blau gleichsam einsaugen, es beruhigt die Seele und vertreibt die Sorgen, die einen umtreiben; und Letztere kann einen fesseln, zu Tränen des Glücks und der Lebensfreude rühren. Aber auch das, so wird man sagen, trifft das Gemeinte nicht. Es fühlt sich auf bestimmte Weise an, frisch gemahlenen Kaffee zu riechen, ein Oboenspiel zu hören, und daher, so versichert Glynn, fühlt es sich auch auf bestimmte Weise an, etwas zu glauben oder ein Verlangen nach etwas zu haben – wie, das lässt sich nicht beschreiben. Das aber ist ein verworrener Gedanke, wie wir bereits gesehen haben.
10.3 Qualia
391
Eine Beschreibung ist kein Ersatz für eine Erfahrung; der Beschreibungseindruck unterscheidet sich vom Erfahrungseindruck Und hierauf könnte nun wiederum erwidert werden: Was man mit der Äußerung, eine Beschreibung könne nicht erfassen, wie es sich anfühlt, die und die Erfahrung zu haben, jedoch wirklich meint, ist, dass eine Beschreibung kein Ersatz für eine Erfahrung darstellt. Sagen wir schließlich nicht auch, dass man Liebe oder Leid erfahren muss, um zu wissen, wie sie wirklich sind? Man muss Beethovens Neunte hören und Michelangelos Sixtinische Kapelle sehen, um zu wissen, wie sie wirklich sind. Ja, solche Sätze sagen wir durchaus. Entscheidend ist, was wir damit sagen wollen. Selbstverständlich ersetzt eine Beschreibung das Beschriebene nicht. Die Beschreibung einer einfachen Tasse Kaffee oder eines Stuhls ist kein Ersatz für eine Tasse Kaffee oder einen Stuhl – was jedoch nicht heißt, dass man sie nicht beschreiben kann. Eine Beschreibung kann einem vermitteln, wie das Erfahrungsobjekt beschaffen ist – das heißt, welche Eigenschaften es hat, die uns beispielsweise in die Lage versetzen werden, es zu erkennen (das ist es, was Beschreibungen leisten). Allerdings ist der von einer Beschreibung hervorgerufene Eindruck ein ganz anderer als der vom Beschriebenen hervorgerufene, und das kann man auch zugestehen. Eine Beschreibung der Sixtinischen Kapelle, wie ausgefeilt auch immer, wird uns nicht ebenso stark beeindrucken, wie der Anblick der Sixtinischen Kapelle selbst es vermag – nichts anderes sollte man erwarten. Das ist allerdings ebenso trivial wie die Feststellung, dass eine Beschreibung kein Ersatz für die Erfahrung ist, Michelangelos großartiges Fresko zu sehen. Eine Beschreibung von Liebe oder Leid wird uns nicht so betroffen machen, wie ihr Erleben selbst es vermag – auch die genaueste und raffinierteste nicht, ob nun von Tolstoi, Proust oder Henry James verfasst. Das bedeutet jedoch nicht, dass unser Beschreibungsvermögen oder das, was Beschreibungen vermitteln können, irgendeiner Beschränkung unterliegt. Die Fehlkonzeption von sekundären Qualitäten stiftet zusätzlich Verwirrung Die Gefahr ist hier groß, noch weiteren Verwirrungen anheimzufallen. Man kann wie viele Wissenschaftler davon ausgehen, dass das Kaffeearoma, der Oboenklang oder die Farbe des mediterranen Himmels im Geist sind. Von Galilei, Descartes, Locke und Boyle beeindruckt, kann man zu der Ansicht gelangen, dass Gehirne „über einen besonderen Trick verfügen, der sie in die Lage versetzt, das kosmische System der Dinge zu ergänzen durch: Farbe, Klang, Schmerz, Vergnügen und all die anderen Facetten geistiger Erfahrung“.425 Wenn man diese Ansicht teilt, dann findet man sich in der Tat mit tief reichenden Problemen konfrontiert. Denn dann gibt es freilich kein Aroma im Kaffeeladen, keine lieblichen Oboenklänge im Konzertsaal, und die zahllosen Gegenstände, die man wahrnimmt, sind nicht farbig. Gerüche, Geräusche und Farben werden dann als essen425
Roger Sperry, zitiert von Baars, Theater of Consciousness, S. 11.
392
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
ziell geistige aufgefasst – als ‚Vorstellungen‘ oder ‚Eindrücke‘ im Geist. Dann werden ihre Beschreibung und Mitteilung zu höchst problematischen Vorgängen. Denn die Bedeutung der Farbworte, der Geräusche- und Gerüchenamen könnte nicht anhand öffentlicher Beispiele erklärt werden, die für jeden, der über die entsprechenden Fähigkeiten verfügt, wahrnehmbar sind. Sie müssten anhand privater geistiger Beispiele erklärt werden – und das ist nicht möglich. Es gibt jedoch keinen guten Grund dafür, so zu denken bzw. die Verwirrungen der Metaphysik des 17. Jahrhunderts zu wiederholen (siehe 4.2.1). Die verworrene Vorstellung, dass man nicht wissen kann, wie es ist, eine Erfahrung gegebener Art zu haben, wenn man sie nicht gehabt hat In engem Zusammenhang damit steht der verworrene Gedanke, dass man nicht wissen kann, wie es sich anfühlt, eine Erfahrung gegebener Art zu haben, wenn man sie nicht selbst gehabt hat. Wer ihn vertritt, verwechselt die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Person über den Begriff der und der Erfahrung verfügen kann, mit dem Wissen darüber, wie es sich anfühlt, sich einer Erfahrung gegebener Art zu erfreuen oder sie zu erleiden. Es ist offensichtlich nicht so, dass man, um beispielsweise den Begriff der Eifersucht, den des Neides oder den der Rache zu erfassen, Eifersucht, Neid oder Rache gefühlt haben muss. Jeder Proust-Leser wird Eifersucht bis ins kleinste Detail beschrieben finden und keine Schwierigkeit haben zu verstehen, was Eifersucht ist oder wie es sich anfühlt, eifersüchtig zu sein. Und jeder, der Balzacs La Cousine Bette gelesen hat, wird eine Menge darüber wissen, was Rache und Rachsucht ausmacht und wie es ist, einer solchen Leidenschaft zu erliegen. Man muss derartige Leidenschaften nicht selbst erfahren haben, um die entsprechenden Begriffe zu erfassen, und wenn man solche Romane gelesen hat, wird man auch beschreiben können, wie es ist, von solchen Leidenschaften getrieben zu sein (welches die augenfälligen Charakteristika sind und nicht, was dem Getriebensein ähnelt). Die verworrene Vorstellung, die Beherrschung von Farbbegriffen schließe ein, dass man sie anhand von Erfahrungen definiert Ein Blinder ist dagegen nicht in der Lage, Farbbegriffe zu erfassen oder vollständig zu erfassen, ebenso wie ein Tauber Klangbegriffe nicht oder nicht vollständig erfassen kann. Was sich jedoch nicht so erklärt, dass eine Person farbige Dinge sehen oder die Noten der Oktave hören muss und dann, da sie (angeblich) weiß, wie sich die visuelle oder auditive Erfahrung anfühlt, die Farb- oder Klangbegriffe anhand ihrer Erfahrung definiert. Das würde bedeuten, dass die Begriffe der Wahrnehmungsqualitäten anhand ‚privater Erfahrungen‘ hinweisend definiert werden. Und dies würde wiederum bedeuten, dass Worte wie ‚rot‘ oder ‚grün‘ etc. und ‚Fis‘ oder ‚B‘ etc. anhand privater Beispiele von Far-
10.3 Qualia
393
ben oder Noten definiert werden. Es würde bedeuten, dass das Wort ‚rot‘, wie ich es verwende und verstehe, anhand eines So, über das nur ich verfüge, definiert wird – das heißt anhand eines geistigen Beispiels, das keinem anderen gezeigt werden kann. Die richtige Vorstellung, dass Farbbegriffe anhand öffentlicher Beispiele definiert werden Wie wir bereits in Kapitel 3 dargelegt haben, ergibt dies jedoch keinen Sinn. Denn es gibt nichts dergleichen wie ein privates Beispiel, anhand dessen ein Ausdruck in einer Sprache definiert wird und das als Standard für den richtigen Gebrauch eines Wortes fungiert – und es kann ein solches auch nicht geben. Nicht nur könnten andere Sprachverwender nicht wissen, was das vom Sprecher so gebrauchte Wort bedeutet; auch dieser selbst könnte nicht wissen, welche Bedeutung er mit ihm verbindet. Und es würde in der Tat gar nichts bedeuten. Begriffe der Wahrnehmungsqualitäten wie Farb-, Geräusch-, Geruchs- und Geschmacksbegriffe werden vielmehr anhand öffentlicher Beispiele definiert. ‚Rot‘ (oder ‚Scharlachrot‘, ‚Kastanienbraun‘, ‚Magenta‘ etc.), kann man jemandem erklären, der nicht weiß, was diese Farbnamen bedeuten, ist diese F ¢ Farbe (hier zeigt man auf ein öffentliches Farbbeispiel). Und das Beispiel kann dann als ein Standard für den richtigen Gebrauch des hinweisend bestimmten Wortes verwendet werden. Denn von allem, was diese F ¢ Farbe hat, kann man richtigerweise sagen, dass es sich um Rot handelt (oder Scharlachrot, Kastanienbraun, Magenta etc.). Das definierende Beispiel ist ein öffentliches Beispiel, keine Privaterfahrung. Aber nur eine Person mit normal ausgeprägter Farbsichtigkeit kann das Beispiel sehen und unterscheiden und es somit als Standard für den richtigen Gebrauch des so definierten Farbnamens verwenden. Sie muss nicht ‚wissen, wie es sich anfühlt‘, Rot oder Scharlachrot oder Kastanienbraun zu sehen – sie muss in der Lage sein, rote, scharlachrote oder kastanienbraune Dinge zu sehen und zu unterscheiden. Sie muss in der Lage sein, das Beispiel, auf das gezeigt wird, zu sehen und muss es wirklich sehen, und sie muss es als Standard für den richtigen Gebrauch des definierten Farbwortes verwenden können. Sie muss in der Lage sein, etwas zu tun, was nur Menschen mit normal ausgeprägtem Farbsehen tun können. Muss sie auch wissen, wie Rot sehen ist? An dieser Stelle fragt man sich, worauf die Frage hinauswill. Sicherlich muss die Person wissen, was Rot sehen ist – das heißt wissen, was diese Wendung ausdrückt: nämlich, dass Rot sehen heißt, diese F ¢ Farbe zu sehen (und an dieser Stelle muss sie auf das öffentliche Beispiel zeigen). Ob es angenehm oder indifferent ist, spielt keine Rolle. Und ob es wie etwas anderes ist, ist gleichermaßen unerheblich. Nur jemand, der Farben sehen kann, kann Farbbegriffe beherrschen, diese werden jedoch nicht anhand seiner Erfahrung definiert, sondern anhand ihres Objekts Man darf also die Wahrheit, dass nur eine Person, die Farben sehen kann, den Gebrauch von Farbworten vollständig beherrschen kann, nicht mit der Unwahrheit verwechseln,
394
10 Bewusste Erfahrung, Geisteszustände und Qualia
dass Farbworte anhand privater und nichtmitteilbarer Erfahrungen definiert werden. Darüber hinaus darf man von den Begriffen der Wahrnehmungsqualitäten, die durch öffentliche hinweisende Definitionen definiert werden, nicht auf die Empfindungsbegriffe schließen. Denn Empfindungsworte wie ‚Schmerz‘ werden, wie wir gesehen haben (3.9), weder anhand öffentlicher noch anhand privater Beispiele definiert. Denn sie werden überhaupt nicht hinweisend definiert. Sie werden vielmehr als Erweiterungen des natürlichen Verhaltens gelernt – das heißt des natürlichen Verhaltens als Reaktion auf Schmerz (Kitzeln, Jucken etc.) – und diese Begriffe sind janusköpfig, wie wir bereits erläutert haben. Sie werden nämlich in der ersten Person ohne irgendwelche Kriterien und in der dritten Person aufgrund öffentlicher Verhaltenskriterien verwendet. Logisch betrachtet sind sie also ganz anders als die Begriffe der Wahrnehmungsqualitäten. Aber genau wie diese und wie tatsächlich alle anderen Begriffe werden sie nicht anhand privater Erfahrungen oder Qualia definiert. Und man sollte auch nicht annehmen, dass die Emotions- und Stimmungsbegriffe oder epistemische Begriffe wie wissen oder glauben anhand von Beispielen definiert werden – denn eine solche Annahme würde uns auf Abwege führen. Man muss nicht ‚wissen, wie es ist‘, etwas zu wissen oder zu glauben, um den Gebrauch der Verben ‚wissen‘ und ‚glauben‘ zu beherrschen (und es ist ja noch nicht einmal klar, was dieses ‚wissen, wie es ist‘, zu wissen oder zu glauben, heißen soll). Die neurowissenschaftliche Theoriebildung kann das philosophische Problem nicht umgehen Ein letzter Punkt: Bei dem Gedanken, Erfahrung sei nur unzureichend mitteilbar, die Neurowissenschaften aber könnten feststellen, dass verschiedene Menschen Rot tatsächlich „auf die gleiche Weise“ (Crick) sehen, handelt es sich um einen Irrtum. Und zwar nicht nur deshalb, weil wir auch ohne die Hilfe der neurowissenschaftlichen Forschung feststellen können, ob verschiedene Menschen dasselbe sehen, sondern auch, weil wir, wenn wir das nicht könnten, mit neurowissenschaftlicher Hilfe ebenso wenig dazu in der Lage wären. Denn um die erforderlichen neurowissenschaftlichen Korrelationen zwischen den Wahrnehmungserfahrungen und den neuralen Ereignissen und Prozessen zu ermitteln, müssen wir bereits ermittelt haben, was Menschen wahrnehmen, a fortiori ob verschiedene Menschen dasselbe Ding auf die gleiche Weise wahrnehmen. Unterscheiden sich die neuralen Vorgänge, zeigt das schlicht, dass derselbe Reiz bei verschiedenen Menschen zu anderen neuralen Reaktionen führt. Es zeigt nicht, dass sie die Dinge anders sehen. Einmal angenommen, wir könnten feststellen und stellen tatsächlich fest, dass verschiedene Menschen sich derselben Erfahrung erfreuen oder dieselbe erleiden, so würden irgendwelche Unterschiede in den zugrunde liegenden neuralen Prozessen zudem nicht zeigen, dass sie, ungeachtet ihrer aufrichtigen gegenteiligen Versicherung, in Wirklichkeit nicht dieselbe Erfahrung haben. Andernfalls müsste man davon ausgehen, dass jemand aufrichtig Schmerzen bekunden, stöhnen und schreien könnte, dass ein Gehirnscan aber gleichwohl zeigen könnte, dass die Person gar keine Schmerzen
10.3 Qualia
395
hatte. Absurd. Gezeigt werden könnte derart nur, dass eine neurowissenschaftliche Theorie, die von neuraler Uniformität bei unterschiedlichen Individuen ausgeht, falsch ist. Denn die kriterielle (logisch begründete) Evidenz für das Schmerzenhaben, die für die nichtinduktive Identifizierung des Schmerzes anderer erforderlich ist, wird von der induktiven Evidenz vorausgesetzt, die den Schmerz mit neuralen Zuständen und Ereignissen in Beziehung setzt, und folglich geht sie ihr vorher. Wir haben nicht alle begrifflichen Ungereimtheiten und Verwirrungen problematisiert, die die Qualiavorstellung umgeben – sie alle zu erörtern war auch gar nicht unser Ziel. Allerdings haben wir einige der Fälle entwirrt, die Neurowissenschaftler (und andere) täuschen und verwirren, und wir haben dargelegt, dass der bloße Begriff eines Quale ein missratener Abkömmling begrifflicher Konfusion ist. Wir meinen, dass die im Zusammenhang mit den sogenannten Qualia auftretenden Schwierigkeiten und Ungereimtheiten die Neurowissenschaften selbst nicht zu beschäftigen brauchen, sondern getrost den Philosophen überlassen werden können. Die sind in der Lage, die Verwirrungen zu beseitigen (und sie sollten es tun); allerdings können sie sich auch im Geflecht der Sprache verfangen (und viele stecken bereits darin fest). Die Neurowissenschaftler wiederum sollten in der Lage sein, diesen Ungereimtheiten und Verwirrungen einfach aus dem Weg zu gehen – es sei denn, sie fallen den nämlichen Täuschungen zum Opfer: ‚Privatbesitz‘ von oder ‚privilegierter Zugang‘ zu Erfahrung, nichtmitteilbare oder nur unzureichend mitteilbare ‚Gefühlsqualität‘ von Erfahrung oder dem Gedanken, jede gehabte Erfahrung sei durch ein Anfühlungswie charakterisiert.
11 Rätselraten um das Bewusstsein 11.1 Ein Sack voller Rätsel Über die Frage, wie neurale Ereignisse die ‚Bewusstseinswelt‘ hervorrufen können Wir haben im vorangehenden Kapitel aufgezeigt, dass die Unterschiede zwischen dem intransitiven und dem transitiven Bewusstsein und die zwischen den verschiedenen Formen des transitiven Bewusstseins (sie alle sind in unserer Sprache verankert) von den heutigen Neurowissenschaftlern und Philosophen, die mit der Erforschung des Bewusstseins befasst sind, umgangen werden. In erster Linie von der philosophischen Frage nach der Beziehung zwischen neuralen Ereignissen und kogitativen, kognitiven, affektiven sowie willentlichen Phänomenen und Funktionen verwirrt, neigen sie dazu, den Bewusstseinsbegriff weit über die Grenzen seines Alltagsgebrauchs hinaus auszudehnen. Bewusstsein wird insbesondere mit Erfahrung im Allgemeinen gleichgesetzt. Diesen unscharfen Ausdruck selbst dehnt man gleichfalls weit über sein normales Anwendungsspektrum hinaus aus. Neurowissenschaftler und Philosophen sind vorrangig mit dem ‚Bewusstseinsbereich‘ befasst, der mit dem Verhalten lebender Körper in Verbindung gebracht wird. Bloßes Verhalten wird der physischen Welt zugerechnet. Bewusste Erfahrung und bewusste Geisteszustände scheinen sich davon jedoch kategorial vollständig zu unterscheiden. Wie können dann Ereignisse in der physischen Welt – das heißt neurale Ereignisse – die ‚Bewusstseinswelt‘ hervorbringen? Die ‚Bewusstseinswelt‘ wurde anhand von Qualia charakterisiert Den Philosophen und Neurowissenschaftlern, denen die Auseinandersetzung mit derartigen Fragen obliegt, kam es ganz natürlich vor, die Bewusstseinsphänomene auf diese Weise zu umschreiben. Wir haben erwähnt, dass viele von ihnen in diesem Zusammenhang die Vorstellung von der ‚Qualität der Erfahrung‘ heraufbeschworen, die selbst wiederum von dem Gedanken herrührt, dass Erfahrungen sämtlich eine eigene ‚Gefühlsqualität‘ haben, und auf die Vorstellung zurückgeht, dass eine bestimmte Erfahrung zu haben durch ‚ein Anfühlungswie‘ charakterisiert ist. Wir haben dargelegt, dass man hinsichtlich einer Erfahrung von bestimmter Art zwar fragen kann, wie es sich angefühlt habe, sie zu erleben, oder wie es gewesen sei, sie zu haben, dass es jedoch nicht immer eine Antwort auf eine solche Frage gibt. Außerdem ist die nämliche Konzeption, dass es sich auf die und die Weise anfühlt, eine bestimmte Erfahrung zu haben, das Resultat einer Verwirrung. Bei zahlreichen psychologischen Attributen, wie wissen, glauben, an-
11.2 Bewusstsein oder Subjektivität und objektive Realität
397
nehmen und denken (bei manchen Varianten des Denkens), handelt es sich überhaupt nicht um Erfahrungsformen. Und schließlich haben wir die Vorstellung untersucht, dass jedes Erfahrungssubjekt mit seinen eigenen Erfahrungen unmittelbar vertraut ist, auf die es sich selbst hinweisen kann durch ein Dies oder ein So, bei dem es sich um einen Hinweis auf die qualitative Verfasstheit der Erfahrung handelt, auch wenn das Subjekt das, was es erfährt, nur unzureichend oder vielleicht gar nicht mitteilen kann. Aber auch diese Argumentation erwies sich als abwegig. Indem man die Qualiavorstellung unterläuft, beseitigt man nicht die cartesianische Verwirrung Es reicht allerdings nicht, die Qualiavorstellung zu unterlaufen, um die Probleme zu lösen, von denen Neurowissenschaftler und andere umgetrieben werden. Die wahrgenommene Schwierigkeit, Subjektivitätstatsachen mit unserer Konzeption einer objektiven physisch-materiellen Welt zu vereinbaren, die von der Wissenschaft erforscht wird, muss noch angegangen werden. Die cartesianische Rätselfrage, wie physisch-materielle, neurale Ereignisse Bewusstseinsphänomene hervorbringen können, hat nichts von ihrer Dringlichkeit eingebüßt. Auch wenn Qualia zum Verständnis des Bewusstseins nichts beitragen, muss die vonseiten der Wissenschaftler wiederholt zum Ausdruck gebrachte Verwirrung über das Wozu des Bewusstseins genauer geprüft werden. In diesem Kapitel werden wir uns diesem Thema zuwenden und anderen Fragen, die sich uns, wie wir bereits dargelegt haben, durch Fehlkonzeptionen unterschiedlicher Art aufgedrängt haben. Sind diese erst einmal beseitigt, löst sich die Verwirrung in Luft auf. Entweder verschwinden die Fragen oder sie haben geläufige und manchmal triviale Antworten.
11.2 Über die Vereinbarkeit von Bewusstsein oder Subjektivität mit unserer Auffassung von einer objektiven Realität Verwirrung darüber, wie es Bewusstsein in einer physisch-materiellen Welt geben kann Philosophen und Kognitionswissenschaftler bringen für gewöhnlich ihre Verblüffung über die bloße Existenz des Bewusstseins zum Ausdruck. Searle beobachtet, dass „es [. . .] halt eine simple Tatsache [ist], dass die Welt bewusste geistige Zustände und Ereignisse enthält; es ist allerdings schwer zu begreifen, wie rein materielle Systeme Bewusstsein haben könnten. Wie könnte so etwas möglich sein? Wie könnte beispielsweise dieser graue und weiße Glibber in meinem Schädel bei Bewusstsein sein?“426 An anderer Stelle suggeriert er dann auch: „In Anbetracht unseres Begriffes davon, wie die Realität J. R. Searle, Minds, Brains and Science – the 1984 Reith Lectures (BBC, London, 1984), S. 15 [dt. Geist, Hirn und Wissenschaft (Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1992), S. 14]. 426
398
11 Rätselraten um das Bewusstsein
sein müsse, und unter Berücksichtigung des Rahmens, in dem wir all unsere Anstrengungen, etwas über sie herauszufinden, ansiedeln, scheint es uns unvorstellbar, dass es irgendetwas irreduzibel Subjektives im Universum geben könnte. Trotzdem wissen wir alle, dass Subjektivität existiert.“427 Chalmers behauptet, dass Bewusstsein, während es „für eine subjektive Betrachtungsweise im Zentrum steht, [. . .] für einen objektiven Standpunkt vollkommen unerwartet ist.“ Der ‚objektive Standpunkt‘ ist der der Physik – und er liefert eine Darstellung der Welt unter dem Aspekt der Interaktion von Teilchen, Feldern und Wellen im raumzeitlichen Gesamtzusammenhang. Von diesem Standpunkt aus ist Bewusstsein ‚vollkommen unerwartet‘; geradezu „überraschend. Wenn all unser Wissen physikalisches Wissen wäre und sogar die Tatsachen des Spiels der Kräfte und der Informationsverarbeitung in komplexen Systemen einbegreifen würde, gäbe es dennoch keinen zwingenden Grund, die Existenz bewusster Erfahrung zu postulieren. Würde die Ich-Perspektive uns diese nicht unmittelbar vor Augen führen, schiene die Hypothese unvertretbar – vielleicht sogar mystisch. Wir wissen jedoch unmittelbar, dass es bewusste Erfahrung gibt. Die Frage ist, wie wir dies mit all dem, was wir darüber hinaus wissen, in Einklang bringen.“428 Fehlkonzeptionen hinsichtlich des Bewusstseinsbegriffs sind für die Verwirrung verantwortlich Wie dargelegt, ist es abwegig zu denken, dass Erfahrungen vom Erfahrungssubjekt besessen werden, oder davon auszugehen, dass zwei Menschen nicht dieselbe Erfahrung haben können (3.8). Die Annahme, das Erfahrungssubjekt habe Zugang oder privilegierten Zugang zu seiner eigenen Erfahrung, führt gleichfalls in die Irre (3.7). An der Erfahrung ist, wie gesagt, nichts eigentlich privat. Es mag zwar sein, dass ich nichts von dem preisgebe, was ich erfahre – ich muss nicht zeigen, dass ich einen leichten Schmerz verspüre, nicht kundtun, dass ich das und das sehe, nicht zugeben, dass ich dies oder jenes zufällig gehört habe, und ich kann meinen Zorn oder meine Traurigkeit unterdrücken. Aber dadurch werden diese Erfahrungen nicht zu schlechthin privaten. Und wenn ich meinen Schmerz und meine Emotionen verdeutliche, wenn ich zeige, was ich sehe oder höre, dann können andere ganz genau wissen, welcher Erfahrungen ich mich erfreute oder welche ich durchlebte. Diese Bemerkungen sollen uns an die vorherigen Ausführungen erinnern. Sie sind nötig, um das Bild des Bewusstseins und der sogenannten bewussten Erfahrung, der bewussten Geisteszustände oder Qualia zu bekämpfen, das dem mit dem neoklassischen Empirismus vermengten Neo-Cartesianismus inhärent ist, den sich viele zeitgenössische Neurowissenschaftler und Kognitionswissenschaftler sowie Philosophen unwis427
J. R. Searle, The Rediscovery of the Mind (MIT Press, Cambridge, MA, 1992), S. 99 [dt. Die Wiederentdeckung des Geistes (Artemsi & Winkler, München, 1993), S. 119]. 428 D. J. Chalmers, The Conscious Mind (Oxford University Press, Oxford, 1996), S. 4f.
11.2 Bewusstsein oder Subjektivität und objektive Realität
399
sentlich zu eigen gemacht haben. Denn die gegensätzlichen Annahmen unterstützen ein prinzipiell in die Irre führendes Bild. Nach diesem Bild ist das Bewusstsein oder die bewusste Erfahrung ein besonderer Phänomenbereich. Dieser ist ganz anders als der physisch-materielle Bereich, obgleich er sonderbarerweise von ihm abhängt. Der wiederum ist von öffentlichen physisch-materiellen Objekten bevölkert, die physi(kali)sche Eigenschaften haben (besonders die Primärqualitäten, die von Galileo, Descartes, Boyle und Locke hervorgehoben wurden, aber auch modernere wie die elektrische Ladung oder das Magnetfeld). Allen kompetenten Wahrnehmenden ist er gleichermaßen zugänglich. Es handelt sich bei ihm um den Bereich des Objektiven. Der Bewusstseinsbereich dagegen ist jedem Erfahrungssubjekt essenziell privat zugänglich. Bei ihm handelt es sich demnach um den Bereich des Subjektiven.429 Und es gibt ebenso viele solche ‚Bereiche‘, wie es Erfahrungssubjekte gibt. Jeder dieser ‚Bereiche‘ ist von Qualia bevölkert – die sich von physischen Objekten vollständig unterscheiden. Jedes Erfahrungssubjekt besitzt seine Qualia unveräußerlich und hat nur zu seinen Qualia Zugang. Es kann sie keinem anderen zeigen, und es kann nicht wissen, ob die Qualia eines anderen den seinen ähneln. Falschauslegungen des Subjektivitätsgedankens Die Vorstellung eines so gedeuteten Subjektivitätsbereichs verlangt eine genauere Prüfung. Denn obgleich es ein richtiger und unverfänglicher Gedanke ist, dass sich jedes Erfahrungssubjekt Erfahrungen erfreut oder sie durchlebt, Emotionen fühlt und Gedanken denkt, etwas glaubt und weiß, das es für sich behalten kann, und somit als ein Wesen beschrieben werden kann, dem ein – wie wir mitunter sagen – ‚Innenleben‘ eignet, ist die Annahme, dass uns diese Binsenweisheit zur Vorstellung eines Subjektivitätsbereichs hinführt, alles andere als einleuchtend. Searle charakterisiert die ‚Subjektivität‘, indem er sich auf die Tatsache bezieht, dass jeder bewusste Zustand oder jede bewusste Erfahrung stets jemandes Zustand oder Erfahrung ist (sie ‚gehört‘ zu einem Erfahrungssubjekt), dass jede Person in einer besonderen Beziehung zu ihren eigenen Bewusstseinszuständen steht, dass das Bewusstsein einer Person davon, wie es um die Dinge in der Welt bestellt ist, immer von ihrem eigenen Standpunkt aus erwächst und für sie mit einer subjektiven Gefühlsqualität einhergeht. Die ‚Subjektivität‘ einer anderen Person ist, behauptet er, nicht beobachtbar, denn wir können nur ihr Verhalten beobachten. Und er konstatiert, dass Subjektivität insofern ein Problem darstellt, als es schwierig ist, sie in unsere Gesamtkonzeption der Realität einzufügen, die auf der Vorstellung von einer objektiven Welt beruht. Man kann sicherlich einräumen, dass es so etwas wie eine Erfahrung, die nicht jemandes Erfahrung ist (ein Schmerz, der nicht jemandes Schmerz ist etc.), nicht gibt. Das muss einen aber nicht befremden oder einem seltsam vorkommen. Tänze werden 429
Searle, Rediscovery of the Mind, S. 93–100 [dt. Die Wiederentdeckung des Geistes, S. 113−119].
400
11 Rätselraten um das Bewusstsein
nicht ohne Tänzer getanzt, Lieder nicht ohne Sänger gesungen. Dennoch bereitet es uns keine Schwierigkeiten und stellt uns vor kein Problem, Tänze oder Lieder in unsere Konzeption von einer objektiven Welt einzufügen. So gibt es auch weder Wahrnehmen noch Wahrnehmungen ohne Wahrnehmende – und es ist leicht einzusehen, warum das so ist. Denn bei den Nominalphrasen ‚ein Wahrnehmen‘ oder ‚eine Wahrnehmung‘ haben wir es schlicht mit zweckmäßigen Ableitungen vom Verb ‚wahrnehmen‘ zu tun. Nimmt A ein Objekt O wahr, dann hat ein Wahrnehmen stattgefunden, und zwar von O durch A, und A hatte eine Wahrnehmung von O. Diese Nominalphrasen aber bringen keine anderen Entitäten ins Spiel als die, die bereits durch den einfacheren Satz ‚A nimmt O wahr‘ namhaft gemacht wurden; sie führen keine neuen Entitäten ein, sondern lediglich zweckmäßige Façons de parler, Abstraktionen aus den geläufigen Phänomenen. Das bedeutet nicht, dass es in Wirklichkeit keine Wahrnehmungen gibt (oder dass Schmerzen, Kitzeln oder Stechen nicht wirklich existieren oder dass es keine Hoffnungen oder Ängste gibt). Es bedeutet, dass es sie gibt, dass es sich bei ihnen allerdings nicht um ‚Entitäten‘ oder irgendwie geartete Dinge handelt. Wenn A mit B zürnt oder Zorn auf diesen empfindet, so ist es zweckmäßig bzw. praktisch, von A’s Zorn zu sprechen. Natürlich gibt es keinen Zorn, der nicht jemandes Zorn ist. Aber daran ist nichts Seltsames oder Rätselhaftes, das eine Verwirrung darüber hervorrufen könnte, wie denn solche ‚Subjektivitätstatsachen‘ in einer Realitätskonzeption von einer objektiven Welt unterzubringen seien. Es gibt kein Lächeln, das nicht jemandes Lächeln ist, kein Niesen, das nicht jemandes Niesen ist. Dennoch ist an lächeln und niesen nichts Subjektives, außer in dem unverfänglichen Sinne, dass jemand lächeln oder niesen muss, damit ein Lächeln oder ein Niesen in die Welt kommt. Eine Erfahrung zu haben heißt nicht, mit einer Erfahrung ‚in Beziehung zu stehen‘ Sicherlich ist die Vorstellung nicht aufrechtzuhalten, dass eine bestimmte Erfahrung zu haben – einen Schmerz zu haben beispielsweise oder einen roten Apfel zu sehen (‚eine visuelle Erfahrung eines roten Apfels haben‘) – heißt, in einer speziellen Beziehung zu einer Erfahrung zu stehen, da ‚haben‘ hier keine Beziehung ausdrückt und die Erfahrung, die eine Person hat, kein Relatum ist (3.8). Schmerz ist eine Empfindung, aber Empfindungen sind keine Objekte, zu denen man in einer bestimmten Beziehung stehen kann. Kopfschmerzen zu haben bedeutet nicht, in einer Beziehung zu Objekten irgendwelcher Art zu stehen – es ist nicht mehr, als dass einem der Kopf wehtut. ‚Einen Apfel sehen‘ kann auch umständlich mit ‚die visuelle Erfahrung eines Apfels haben‘ formuliert werden. Einen Apfel zu sehen kann bedeuten, in einer bestimmten Beziehung zu einem Apfel zu stehen, es bedeutet jedoch nicht, in irgendeiner Art von Beziehung zum Sehen eines Apfels zu stehen. Die visuelle Erfahrung eines Apfels zu haben bedeutet gleichermaßen nicht, in einer Beziehung zu einer visuellen Erfahrung zu stehen. Demnach ist es gleichfalls abwegig, wie Searle davon auszugehen, dass jede Person in einer speziellen Beziehung zu ihren eigenen Bewusstseinszuständen steht.
11.2 Bewusstsein oder Subjektivität und objektive Realität
401
Falschauslegungen des ‚Standpunkt‘-Gedankens Man kann einräumen, dass eine Person, wenn sie etwas sieht, dies immer von einem speziellen Punkt oder einer speziellen Position im Raum aus tut. Daraus folgt jedoch gewiss nicht, dass sie, was immer sie auch sieht oder – allgemeiner ausgedrückt – erfährt, von ihrem einzigartigen Standpunkt [point of view] aus sieht oder erfährt. Denn zum einen kann jeder andere das, was diese Person sieht, von derselben räumlichen Position aus sehen, wenn die Person diese freigibt. Und andere Menschen können dieselben Geräusche hören oder dieselben Gerüche riechen, wenn sie direkt neben der Person stehen. Und zum anderen haben wir es hier mit einem falschen Gebrauch des Terminus ‚Standpunkt‘ zu tun. Ich empfinde Schmerz nicht von meinem oder überhaupt von irgendeinem Standpunkt aus, und ich nehme nicht von meinem Standpunkt aus wahr, was ich wahrnehme, sondern von einer Position im Raum aus. Ich kann von einem politischen, ökonomischen oder moralischen Standpunkt aus ein Urteil fällen oder eine Meinung äußern oder das von meinem Standpunkt aus tun – das heißt vom Standpunkt meiner Interessen, Präferenzen und Belange aus. Ein Urteil, das vom ‚Standpunkt‘ meiner Präferenzen aus getroffen wurde, kann richtigerweise als subjektiv bezeichnet werden; was unter Umständen auch auf ein vom ‚Standpunkt‘ meiner Interessen aus abgegebenes Urteil zutrifft. An einem Urteil, das von einem politischen, ökonomischen oder moralischen Standpunkt aus abgegeben wurde, ist jedoch nichts subjektiv. Außerdem werden zahlreiche Urteile – zum Beispiel, dass der Zweite Weltkrieg im September 1939 ausbrach, dass Kraft das Produkt aus Masse und Beschleunigung ist, dass Löwen Fleischfresser sind – nicht von irgendeinem speziellen Standpunkt aus getroffen. Fehlkonzeptionen hinsichtlich der Beobachtbarkeit der Erfahrungen anderer Die Vorstellung, dass wir die ‚Subjektivität‘ einer anderen Person nicht beobachten können, sondern nur ihr Verhalten, ist ein Irrtum (3.5). Denn wir können beobachten, wie andere Menschen etwas wahrnehmen, und wir tun dies auch, wir beobachten ihre Emotionen und Stimmungen und beobachten, dass sie Schmerzen haben. Natürlich ist es richtig, dass man, wenn man beobachtet, dass ein anderer Schmerzen hat, diese nicht selbst hat; seine Freude oder seinen Zorn zu beobachten – das heißt, zu beobachten, dass er sich freut oder zornig ist –, bedeutet nicht, sich selbst zu freuen oder selbst zornig zu sein; und man kann einen anderen dabei beobachten, wie er etwas wahrnimmt, ohne wahrzunehmen, was er wahrnimmt. Es verlockt zu erwidern, dass wir dennoch nicht seine Wahrnehmung wahrnehmen oder sein Gefühl fühlen können. Das ist jedoch ein verworrener Gedanke. Denn in einem bestimmten Sinn können wir dies: Wir können ihn wahrnehmen, wie er wahrnimmt, was er wahrnimmt und häufig genau das wahrnehmen, was er wahrnimmt; wir können denselben Schmerz empfinden, den er empfindet, und in derselben Stimmung sein, in der er sich befindet. In einem anderen (Un-)Sinn neigen wir dazu zu sagen, wir könnten nicht ‚seinen Schmerz empfinden‘
402
11 Rätselraten um das Bewusstsein
oder ‚seine Wahrnehmungen wahrnehmen‘. Aber wenn ‚seinen Schmerz empfinden‘ nicht bedeutet, ‚denselben Schmerz empfinden, den er empfindet‘, dann bedeutet es nichts. Und wenn ‚seine Wahrnehmungen wahrnehmen‘ nicht entweder ‚wahrnehmen, dass er wahrnimmt‘ oder ‚wahrnehmen, was er wahrnimmt‘ bedeutet, bedeutet es ebenfalls nichts. Im Übrigen ist es nicht so, dass er seine Wahrnehmungen wahrnimmt und wir nicht – er nimmt sie ebenfalls nicht wahr, er hat Wahrnehmungen; und wenn wir ebenso klar und deutlich wahrnehmen, was er wahrnimmt, haben wir dieselben Wahrnehmungen. Diese Fehlkonzeptionen erzeugen die Verwirrung über den Ort des Bewusstseins in einer physisch-materiellen Welt Begreift man ‚bewusste Erfahrung‘ oder ‚bewusste Geisteszustände‘ als einen Subjektivitätsbereich, der sich aus Qualia zusammensetzt, wesentlich privat und nur dem Subjekt zugänglich ist, durch Introspektion unmittelbar erfasst wird, nicht oder nur unzureichend mitteilbar ist, dann scheint uns die Tatsache, dass es so etwas wie bewusste Erfahrung gibt, wirklich in verwirrende Erklärungsnot zu bringen (siehe 9.1). Die so verstandene Erfahrung scheint das zu sein, was bewusste Wesen charakterisiert – sie ist ‚der Bewusstseinsbereich‘. Denn wenn wir so denken, wollen wir wissen, wie etwas derart Bizarres wie Qualia in der physisch-materiellen Welt überhaupt existieren kann. Und wir werden gewiss die Frage aufwerfen „Wie können Körper aus Materie in einer Welt aus Materie ein Phänomen wie das Bewusstsein in sich bergen?“430 Qualia, das heißt Erfahrungen mit ihrer ganz eigenen Qualität, scheinen aus physisch-materiellen Ereignissen zu emergieren, scheinen durch die Erregung von Neuronen hervorgebracht zu werden. Wie aber kann die Neuronenerregung einen solchen Bewusstseinbereich hervorbringen? Und man könnte sich fragen, ob „das Bewusstsein nur einepassive Begleiterscheinung des Besitzes eines hinlänglich hoch entwickelten Kontrollsystems ist und für sich genommen eigentlich überhaupt nichts ‚tut‘“.431 Wenn man von solch schlecht konzipierten Annahmen aus seine Überlegungen anstellt, dann ist es fraglos so, dass die wirklich tief reichenden Probleme hier angesiedelt sind. Diese Probleme rühren jedoch von Begriffsverwirrungen her; und sie sollten durch die Entflechtung der Knoten, die wir versehentlich in unser Verständnis geknüpft haben, gelöst werden – das heißt durch entwirrende Begriffsarbeit.
D. Dennett, ‚Consciousness‘, in R. L. Gregory (Hg.), The Oxford Companion to the Mind (Oxford University Press, Oxford, 1989), S. 160. 431 R. Penrose, The Emperor’s New Mind, überarb. Aufl. (Oxford University Press, Oxford 1999), S. 523f. [dt. Computerdenken (Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg, 1992), S. 395]. 430
11.2 Bewusstsein oder Subjektivität und objektive Realität
403
Es ist irreführend zu behaupten, dass die Welt bewusste Zustände oder Ereignisse ‚enthält‘ Es ist irreführend zu behaupten, dass es eine schlichte Tatsache ist, dass die Welt ‚bewusste Zustände und Ereignisse enthält‘. Man kann sagen, dass die Welt fühlende Wesen ‚enthält‘, einschließlich der Menschen, die bei Bewusstsein (oder bewusstlos) sind, und die, wenn sie bei Bewusstsein sind, in den Genuss eines breit gefächerten Erfahrungsspektrums kommen, sich in verschiedenen Geisteszuständen befinden können und sich verschiedener Dinge bewusst sind. Das ist ganz sicher eine schlichte Tatsache. Natürlich wollen wir wissen, wie es dazu kam. Das ist eine auf die Ursprünge des Lebens zielende wissenschaftliche Frage – auf die wir mittlerweile vielversprechende Antworten haben – und eine evolutionsbiologische Frage, welche die Evolution derjenigen Lebensformen betrifft, die solche wahrnehmungsbezogenen, affektiven, kognitiven und andere Fähigkeiten besitzen, die es rechtfertigen, diesen Lebensformen im Allgemeinen Erfahrungen beizumessen sowie intransitives und transitives Bewusstsein – auch auf diese Frage haben wir recht gute Antworten. Es ist jedoch verworren zu fragen, wie Körper aus Materie in einer Welt aus Materie Bewusstsein in sich bergen können oder wie rein materielle Systeme Bewusstsein haben könnten. Fühlende Wesen ‚enthalten‘ kein Bewusstsein Denn erstens enthalten fühlende Wesen, bei denen es sich um bewusste Wesen handelt, kein Bewusstsein, sie sind bei Bewusstsein (oder bewusstlos) und sind sich verschiedener Dinge bewusst [conscious of ]. Sie empfinden Schmerz, nehmen Objekte ihrer Umgebung wahr, haben Angst oder sind zornig, finden an verschiedenen Aktivitäten und Situationen Gefallen, haben Verlangen nach etwas und verfolgen ihre Ziele. Sie weisen verschiedene aktive und passive Vermögen auf, einschließlich des passiven Vermögens, ihre Aufmerksamkeit von etwas, das sie wahrnehmen, auf sich ziehen und gefangen nehmen zu lassen: das heißt das Vermögen, sich einer Sache, die sie wahrnehmen, bewusst zu werden und dann bewusst zu sein. Wenn es sich um sprachbegabte, selbstbewusste Wesen handelt, eignet ihnen das Vermögen, zu realisieren oder zu erkennen, wie es um die Dinge bestellt ist, und dieses Wie im Gedächtnis zu bewahren, damit in Gänze beschäftigt zu sein – das heißt, sich bewusst zu sein, dass es um die Dinge so und so bestellt ist. Fühlende Wesen sind keine ‚rein materiellen Systeme‘ Zweitens sind fühlende Wesen keine rein materiellen (oder physikalischen) Systeme. Von der Atmosphäre (Wettersystem) kann man als einem ‚rein materiellen System‘ sprechen, ein Vulkan kann als ein rein materielles System bezeichnet werden und auch einen Taschenrechner oder einen Computer kann man so nennen. Bei Tieren und Menschen handelt es sich jedoch nicht um solche Systeme, sondern um lebende, fühlende
404
11 Rätselraten um das Bewusstsein
‚Systeme‘. Fühlende Wesen verstehen wir als den genauen Gegensatz zu rein materiellen Systemen. Und es ist klar, warum wir so denken, denn sie haben Fähigkeiten, die rein materielle Systeme nicht haben, Fähigkeiten, Wissen über ihre Umwelt zu erlangen, indem sie ihre Sinnesorgane gebrauchen, Vergnügen und Schmerz zu empfinden, sich Ziele zu setzen und diese ihrem Wissen entsprechend zu verfolgen. Die Frage, wie das Gehirn bei Bewusstsein sein könne, ist falsch gestellt Drittens ist die Frage, wie das Gehirn (‚dieser graue und weiße Glibber in meinem Schädel‘) bei Bewusstsein sein könne, abwegig. Denn das kann es nicht, wie wir bereits erörtert haben. Von dem Lebewesen, dessen Gehirn es ist, kann man sagen, dass es bei Bewusstsein oder bewusstlos ist. Die Frage, wie rein materielle Systeme bei Bewusstsein sein könnten, ist falsch gestellt Es ist mithin nicht schwer zu begreifen, „wie rein materielle Systeme bei Bewusstsein sein könnten“; es ist logisch ganz und gar unmöglich. Denn gerade hinsichtlich eines „rein materiellen Systems“ ergibt es keinen Sinn zu sagen, „es ist bei Bewusstsein oder bewusstlos“.432 Und die Frage „Wie können Lebewesen bei Bewusstsein oder bewusstlos sein?“ ist vermutlich nur eine ziemlich vage und dürftig formulierte Frage der Biologie, die die Entwicklung fühlender Lebensformen von hinreichender Komplexität betrifft, die dadurch charakterisiert sind, dass sie über wahrnehmungsbezogene, kognitive, affektive und willensmäßige Fähigkeiten verfügen. Es gibt in diesem Zusammenhang nicht nur eine Frage zu stellen, sondern viele, wobei wir auf die meisten von ihnen zwar unvollständige, aber recht gute Antworten haben. Die Frage, ob Bewusstsein physisch-materiell ist, führt in die Irre Die Frage, ob Bewusstsein ‚physisch-materiell‘ ist oder ‚nur eine Begleiterscheinung materieller Systeme‘, ist gleichfalls irreführend. Diese Frage wurde auch schon von Wittgenstein aufgeworfen: Es scheint uns paradox, dass wir in einem Bericht Körper- und Bewusstseinszustände kunterbunt durcheinander mischen: ‚Er litt große Qualen und warf sich unruhig umher‘. Das ist ganz gewöhnlich; warum scheint es uns also paradox? Weil wir sagen wollen, der Satz handle
432
Die Spekulation über Androiden können wir einfach den Autoren der Science-Fiction-Literatur überlassen. Unsere Begriffe sind für die Auseinandersetzung mit solchen erfundenen Fällen nicht geeignet, und es gibt keinen Grund für die Annahme, dass das Nachdenken über solche Fantasien etwas zur Erhellung unserer gegenwärtigen Begriffe beiträgt, ebenso wie unser Begriff von einer Maus nicht von Reflexionen über Micky Maus profitiert.
11.2 Bewusstsein oder Subjektivität und objektive Realität
405
von Greifbarem und Ungreifbarem. – Aber findest du etwas dabei, wenn ich sage: ‚Diese drei Stützen geben dem Bau Festigkeit‘? Sind drei und Festigkeit greifbar?433
Wenn wir uns das ‚Physische‘ als einen Bereich materieller Dinge vorstellen, der sich im Raum erstreckt, öffentlich zugänglich und greifbar ist, und das Geistige als einen Subjektivitätsbereich denken, der mit Qualia identisch ist oder sich aus ihnen zusammensetzt, wobei Qualia privat und nur ihrem Subjekt oder ‚Besitzer‘ zugänglich sind, ungreifbar, sowie mit einem nicht oder nur teilweise mitteilbaren subjektiven ‚Gefühl‘ einhergehen, dann sind wir zwangsläufig verwirrt. Denn wir haben es scheinbar mit zwei unterschiedlichen ‚Seinsordnungen‘ zu tun. Hält uns dieses Bild gefangen, scheinen unzählige Alltagssätze plötzlich paradox zu sein, da sie zwei unterschiedliche ‚ontologische Bereiche‘ miteinander vermischen. Dann scheint es verwirrend, dass das, was sich hin- und herbewegt – das heißt etwas ‚Physisches‘ –, dasselbe Ding sein kann, das Qualen leidet. Denn ist das Qualenleiden etwas Physisches oder nur eine Begleiterscheinung eines ‚materiellen Systems‘? Sprechen wir aber von drei Stützen, die einem Gebäude Festigkeit verleihen, scheint uns daran nichts paradox, obwohl Festigkeit und drei ebenso wenig ‚greifbar‘ sind wie das Qualenleiden. Mit wirklichen Paradoxa haben wir es in keinem der nämlichen Fälle zu tun, denn der jeweilige Anschein rührt von einem unsinnigen Bild her, das unser Nachdenken beherrscht. Es ist fraglos so, dass bei Bewusstsein sein (in Abgrenzung zu bewusstlos sein), sich etwas bewusst sein und in einem bestimmten Bewusstseinszustand sein (ein Geisteszustand, dessen man sich erfreut oder den man erleidet, während man bei Bewusstsein ist) ebenso ungreifbar sind wie solche Eigenschaften wie die Formgestalt, Größe, Rauheit oder Glätte, Wärme oder Kälte mittelgroßer Gegenstände. Und es handelt sich bei ihnen auch nicht um ‚bloße Begleiterscheinungen materieller Systeme‘, denn es ist vollkommen abwegig, sich auf fühlende bzw. empfindungsfähige Wesen als ‚materielle Systeme‘ zu beziehen. Fühlende Wesen sind auch, nicht nur, materielle Systeme Obgleich fühlende Wesen auch ‚materielle Systeme‘ sind, sind sie nicht nur ‚materielle Systeme‘, sondern ‚biologische Systeme‘ – oder, genauer gesagt, Lebewesen mit Gefühls-, Wahrzunehmungs-, Kognitions-, Affektions- und Verlangens- und vor allem Handlungsvermögen. Es sind selbsttätige Wesen mit eigenen Zielen und Zwecken, die sie ihrem Wissen und ihren Wahrnehmungen entsprechend verfolgen. Ihr Bewusstsein, intransitives und transitives, ihre Bewusstseinszustände und -erfahrungen sind keine Begleiterscheinungen ihrer Körper. ‚Ist Bewusstsein physisch-materiell oder bloß eine Begleiterscheinung materieller Systeme?‘ ist folglich eine abwegige Frage, die zwei Scheinalternativen anbietet, die beide abgelehnt werden sollten. In der Auseinandersetzung mit 433
L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, hg. von G. E. M. Anscombe und R. Rhees, Wittgensteins Werkausgabe Bd. I, § 421.
406
11 Rätselraten um das Bewusstsein
diesen leidigen Fragen müssen wir stets beachten, dass man nur von den Lebewesen sagen kann, dass sie bei Bewusstsein sind, sich etwas bewusst sind und sich in einem bestimmten Bewusstseinszustand befinden, die bestimmte unterscheidbare und lebensweltlich verankerte Verhaltensweisen an den Tag legen. Diese rechtfertigen es, ihnen (den Wesen) die mannigfaltigen Attribute zuzuschreiben, die für gefühlsbegabte Lebensformen charakteristisch sind. Die ‚Unvorstellbarkeit‘ irreduzibler Subjektivität basiert auf Fehlkonzeptionen Scheint es in Anbetracht unserer Realitätskonzeption wirklich unvorstellbar, dass es im Universum ‚irgendetwas irreduzibel Subjektives‘ gibt? Nur, wenn wir eine verzerrte Vorstellung davon haben, was Realität heißen soll, und eine gleichermaßen verzerrte Vorstellung von sogenannter Subjektivität. Wenn wir unter ‚Subjektivität‘ Bewusstsein verstehen, dass mit Qualia identisch ist oder sich aus ihnen zusammensetzt, dann scheint es nicht nur unvorstellbar, sondern dann ist es das. Denn diese Konzeption von Bewusstsein, Erfahrung und Qualia ist inkohärent, wie wir bereits erörtert haben. Es gibt nichts dergleichen und kann es nicht geben. Denn so aufgefasste Qualia sind nichts weiter als modern gewandete empiristische Vermutungen und Vorstellungen, wittgensteinianische ‚Privatobjekte‘, deren Konzeption keinen Sinn ergibt. Die Täuschung, Bewusstsein und Physik seien unvereinbar, basiert auf Fehlkonzeptionen Wenn unsere ‚Realitäts‘-Konzeption verzerrt ist, kann es gleichfalls unvorstellbar scheinen, dass es irgendsoetwas wie Bewusstsein gibt – das heißt bewusste Wesen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Physik ultimativ entscheidet, was existiert, und dass die Physik nichts anderes als physikalische Partikel, Felder und Wellen als existierend gelten lässt, dann verwirrt uns zweifellos sowohl die Physik als auch das, was sie enthüllt. Und versuchen wir aus dieser Verwirrung heraus weiterzudenken, werden wir uns auch nicht vorstellen können, dass es irgendsoetwas wie gotische Kathedralen oder barocke Paläste, florierende Ökonomien in der westlichen Welt und kollabierende in der afrikanischen, demokratische und nichtdemokratische Institutionen und Gesellschaften, Rechtssysteme und Gerichtshöfe gibt – oder gar Gesetze, die gerecht oder ungerecht sein können. Dann wird es unvorstellbar sein, dass es Zahlen und mathematische Theoreme gibt, Symphonien und Sonaten sowie deren Aufführungen oder Romane, Gedichte und Gemälde. Und dann wird es sicherlich auch unvorstellbar sein, dass fühlende Wesen und Menschen existieren. Finden wir es wirklich oder nur scheinbar unvorstellbar, dass solche Dinge existieren? Behaupten denn die Physiker, dass es solche Dinge nicht gibt oder nicht geben kann? Behaupten die Physiker, dass es solche Dinge nicht gibt oder dass ihre Existenz den Tatsachen entgegensteht, die sie über die physisch-materielle Konstitution der Realität herausgefunden haben?
11.2 Bewusstsein oder Subjektivität und objektive Realität
407
Die Physik untersucht die physikalischen Eigenschaften physisch-materieller Phänomene. Sie setzt sich nicht mit den nichtphysikalischen Eigenschaften physisch-materieller Phänomene auseinander und braucht dies auch nicht zu tun, obgleich das Verständnis der physischen Grundlage, die den Besitz solcher Eigenschaften ermöglicht, davon profitieren kann. Sie kann a fortiori nur wenig, wenn überhaupt irgendetwas, zum Verständnis der nichtphysikalischen Eigenschaften nichtphysischer Phänomene beitragen. Sie befasst sich demzufolge nicht mit den biologischen Eigenschaften von Lebensformen, die von der Biologie studiert werden (die kein Zweig der Physik ist) oder mit den psychischen Eigenschaften gefühlsbegabter Lebensformen, die von der Psychologie studiert werden (die ebenfalls kein Zweig der Physik ist). Und es ist ihr nicht möglich, etwas zum Verständnis der sozialen Eigenschaften von sozialen Wesen in ihren sozialen Organisationen beizutragen oder der logischen, mathematischen und ästhetischen Eigenschaften der intellektuellen oder ästhetischen Schöpfungen der Menschheit, einschließlich der Zahlen, Theoreme, Propositionen und Kunstwerke. Die Physik behauptet jedoch nicht, dass solche Dinge und ihre Eigenschaften nicht wirklich sind oder dass es dergleichen in Wirklichkeit nicht gibt. Und sie behauptet auch nicht, noch deutet sie an, dass deren Existenz überraschend ist.434 Natürlich sind zum Fühlen befähigte Wesen einschließlich der Menschen auch physische Wesen – sie sind raum-okkupierende physische Dinge, und sie bestehen aus Materie. Ihre Eigenschaften und Fähigkeiten hängen letztlich von den physikalischen und mikrophysikalischen Prozessen ab, die ihre physische Konstitution charakterisieren, sind jedoch nicht auf sie reduzierbar (siehe 13.1). Mit ihren biologischen, psychischen, sozialen und kulturellen Eigenschaften hat die Physik jedoch gar nichts zu schaffen. Diese Eigenschaften hängen zudem auch von Faktoren ab, bei denen es sich überhaupt nicht um Untersuchungsgegenstände der Physik oder um Elemente physikalischer Erklärungen handelt. Die Vorstellung, dass das Bewusstsein – von einem ‚objektiven‘ Standpunkt aus betrachtet – unerwartet ist, ist aus drei Gründen verworren Ist das Bewusstsein mithin überraschend? Ist es unerwartet? Oder vielmehr ‚vom objektiven Standpunkt‘ der Physik aus überraschend und unerwartet, wie Chalmers beteuert? Wenn wir nur die von der Physik ermittelten Tatsachen kennen würden, wäre es dann überraschend und unerwartet, eine nicht gerechtfertigte Hypothese, vielleicht geradezu mystisch? Diese Fragen sind Ausdruck begrifflicher Verwirrung. Erstens sind die Propositionen oder Theorien der Physik nicht objektiver als die anderer Wissenschaften und auch nicht objektiver als jede andere wahre Proposition oder Theorie – unabhängig davon, ob es sich um wahre Propositionen der Biologie, Psychologie, Soziologie, Ökonomie oder der Geschichte oder um irgendeine wahre Proposition 434
Für eine alte, aber sehr lesenswerte und überaus relevante Erörterung dieser Verwirrungen siehe G. Ryle, Dilemmas (Cambridge University Press, Cambridge, 1954), Kap. 5.
408
11 Rätselraten um das Bewusstsein
handelt. Selbstverständlich erörtert die Physik nicht die Themen der Psychologie oder der sozialen und kulturellen Wissenschaften oder Disziplinen. Das verleiht ihren Wahrheiten allerdings keine größere Objektivität als denen anderer Wissensgebiete. Zweitens ist folglich der ‚Standpunkt‘ der Physik für den ‚Standpunkt‘ der Psychologie oder der Geschichte oder der Rechtswissenschaft oder Wirtschaftswissenschaft irrelevant. Ist der Anstieg der Inflationsrate in Großbritannien in den 70er-Jahren vom Standpunkt der Physik aus überraschend? Ist die Existenz des bürgerlichen Rechts im britischen Rechtssystem aus der Perspektive der Physik eine unerwartete? Ist Hannibals Scheitern beim Versuch, Rom einzunehmen, vom Standpunkt der Physik aus unerwartet? Diese Fragen sind nahezu ohne Sinn. Drittens ist die Frage ‚Wenn wir nur die von der Physik ermittelten Tatsachen kennen würden, gäbe es dann irgendeinen Grund, die Existenz bewusster Erfahrung zu postulieren?‘ irreführend. Wenn wer nur die von der Physik ermittelten Tatsachen kennen würde? Könnte irgendein Wesen nur diese kennen – und nicht Tatsachen, die mit der Wahrnehmung und ihren Objekten zu tun haben, mit Wissen und seinen evidenzbezogenen Gründen, die Frage, wie Experimente durchgeführt und Maschinen konstruiert werden, die Frage, wie man misst und berechnet, ganz abgesehen von den Tatsachen, die die Lebewesen selbst betreffen, ihre Familie und Bekannten, die Tatsachen der sozialen Welt, die sie bewohnen, ihrer Autobiografien und der Biografien anderer? Dass man Bewusstsein nicht auf Physik und die von ihr ermittelten Tatsachen reduzieren kann, heißt nicht, dass es überraschend ist Das kann nicht gemeint sein. Was also ist gemeint? Vielleicht, dass die Tatsachen, die das ‚Bewusstsein‘ betreffen – das heißt die fühlenden Wesen, ihre Erfahrungen und Geisteszustände –, sich nicht aus den von der Physik ermittelten Tatsachen ableiten lassen? Ist vielleicht gemeint, dass die Darlegungen über Lebewesen und ihre Lebensweisen, über ihre Erfahrungen, Gedanken, Überzeugungen, Emotionen und Handlungen, nicht auf die von der Physik ermittelten Tatsachen reduzierbar sind? Das ist ganz bestimmt wahr – das Programm zur logischen Reduktion aller empirischen Feststellungen auf Feststellungen der Physik (ein kurzer Traum der Mitglieder des Wiener Kreises aus den 30er Jahren) scheiterte schon vor Jahrzehnten (für eine Erörterung des Reduktionismus siehe Kapitel 13 unten). Und der Umstand, dass die das Bewusstsein voraussetzenden oder sich auf es beziehenden Darlegungen der Psychologie weder auf Darlegungen der Physik reduzierbar sind noch von ihnen abgeleitet werden können, ist überhaupt kein Grund, die unzähligen Bewusstseinstatsachen überraschend oder unerwartet zu finden. (Erinnern wir uns: Es stimmt nicht, dass wir von ‚der Existenz des Bewusstseins‘ kraft ‚unmittelbarer Evidenz der Ich-Perspektive‘ wissen. Dafür, dass ich bei Bewusstsein bin, wann immer ich es bin, habe ich weder irgendwelche Evidenz, noch brauche ich dergleichen.) Wenn wir die Dinge ins rechte Licht rücken und sie von der schweren Bürde begrifflicher Verwirrungen befreien, die auf den Bewusstseinsdebatten lastet, verschwindet
11.3 Psychisch-materielle Prozesse und bewusste Erfahrung
409
folglich das Problem, wie die ‚Subjektivität‘ oder die ‚bewusste Erfahrung‘, richtig verstanden, zu vereinbaren sei mit der Physik oder mit der (hoffentlich nun wieder richtiggestellten) Konzeption davon, ‚wie die Realität sein müsse‘, ganz zu schweigen von ‚all dem, was wir darüber hinaus wissen‘.
11.3 Über die Frage, wie physisch-materielle Prozesse bewusste Erfahrung hervorbringen können Verblüffte Wissenschaftler: Huxley und Tyndall, Glynn und Humphrey Diese Verblüffung angesichts der bloßen Existenz des Bewusstseins und die angebliche Schwierigkeit, ‚Subjektivitäts‘-Tatsachen mit unserer Konzeption von objektiver Realität in Einklang zu bringen, erfahren noch eine Steigerung durch die altehrwürdige Verwirrung, die die Wissenschaftler im Zusammenhang mit der Frage befiel, wie physische, neurale Prozesse bewusste Erfahrung ‚hervorbringen‘ könnten. Aus dem 19. Jahrhundert stammt T. H. Huxleys berühmte Feststellung: „Wie es sein kann, dass etwas so Bemerkenswertes wie ein Bewusstseinszustand infolge der Stimulation von Nervengewebe zustande kommt, ist ebenso unerklärlich, wie dass Aladin der Dschinn erschien, als er die Lampe rieb.“435 John Tyndall merkte erstaunt an, dass „der Übergang vom physischen Geschehen im Gehirn zu den korrespondierenden Bewusstseinstatsachen unvorstellbar ist. Angenommen, ein klar abgegrenzter Gedanke und ein klar abgegrenzter molekularer Vorgang im Gehirn geschähen gleichzeitig, [es nützte nichts, denn] wir besitzen weder das intellektuelle Vermögen noch augenscheinlich auch nur einen Ansatz eines solchen, der uns in die Lage versetzen würde, denkend von einem zum anderen zu gelangen.“436 Bis auf den heutigen Tag sind Wissenschaftler von dieser Vorstellung fasziniert: Humphrey stellt fest, dass „die Kluft zwischen Gehirnzuständen, wie sie von Physiologen beschrieben werden, und Geisteszuständen, wie sie von bewussten menschlichen Wesen beschrieben werden, praktisch – und einige würden meinen, logisch – unüberbrückbar ist.“437 Und Glynn vertritt im Zusammenhang mit der oben zitierten Passage die Ansicht, dass „wir uns kaum besser vorstellen können‘ weshalb das Bewusstsein aus den Ereignissen im Gehirn hervorgehen [emerge] sollte, als Thomas Henry Huxley dies konnte“.438
435
T. H. Huxley, Lessons in Elementary Psychology (1866), S. 210. J. Tyndall, Fragments of Science, 5. Aufl., S. 420, zit. nach W. James, The Principles of Psychology (Holt, New York, 1890), Bd. I, S. 147. 437 N. Humphrey, ‚The inner eye of consciousness‘, in C. Blakemore und S. Greenfield (Hg.), Mindwaves (Blackwell, Oxford, 1987), S. 379. 438 I. Glynn, An Anatomy of Thought (Weidenfeld and Nicolson, London, 1999), S. 396. 436
410
11 Rätselraten um das Bewusstsein
Fehlkonzeptionen hinsichtlich des Bewusstseins machen aus seiner evolutionären Entstehung ein Rätsel Stellt man sich das Bewusstsein als einen Privatbereich von Qualia und bewussten qualitativen Erfahrungen vor, so bereitet einem die evolutionäre Entstehung des Bewusstseins notgedrungen Kopfschmerzen. Denn wenn wir das Bewusstsein so auffassen, dann scheinen wir es mit einem ‚Alles oder Nichts‘-Fall zu tun zu haben. Entweder ein Wesen hat Qualia oder nicht. Das bewusste Leben mancher einfacherer Wesen mag uns vergleichsweise dürftig vorkommen, das Spektrum ihrer ‚Subjektivität‘ umfasst möglicherweise kaum etwas, aber entweder haben sie einige Qualia oder nicht. Geht man davon aus, bewusste Erfahrungen zu haben, bedeute, ‚Bilder von Objekten im Gehirn‘ zu haben (in der einen oder anderen Sinnesmodalität) oder einen ‚Film im Gehirn‘, wie Damasio es formuliert, dann hat ein Wesen entweder Bilder im Gehirn oder nicht. Dann kann es den Anschein haben, dass „sich das Bewusstsein zu einem gewissen Zeitpunkt der Evolution der Arten als eine phänotypische Eigenschaft herausgebildet [hat]. Davor existierte es nicht. Sein Erwerb brachte den Individuen der Art also entweder unmittelbar evolutionäre Fitness, oder es lieferte die Grundlage für andere Merkmale, die fitter machten.“439 Die Verwirrung rührt von dem Bild her Stellen wir derartige Überlegungen an, sind wir von einem Bild gefesselt. Wir werden selbstverständlich sagen wollen, dass das Bewusstsein, die Erfahrung, nur dann hervortritt, wenn die Phänomene in der physisch-materiellen Welt einen bestimmten Komplexitätsgrad erreicht haben. Denn wir schreiben Pflanzen kein Bewusstsein oder Amöben keine Erfahrung zu. Ein sehr komplexes biologisches Fundament, ein hoch entwickeltes Nervensystem, ist für bewusste Wesen charakteristisch. Unser Bild vom Bewusstsein als einem Subjektivitätsbereich, der von Qualia bevölkert wird, führt uns allerdings in die Irre. Denn nun kann einem das evolutionäre Hervortreten des Bewusstseins plötzlich vollkommen rätselhaft und verwirrend vorkommen. Wie vermag etwas, dass so ganz anders als reine Materie und ihre Eigenschaften ist, aus einer lediglich komplexeren Anordnung materieller Partikel hervorzutreten? Wie konnte ‚Subjektivität‘ nur dadurch entstehen, dass die Komplexität des Nervensystems zunahm? Wie konnte der ‚Bewusstseinsbereich‘ geschaffen werden? Wer so fragt und nachdenkt, ist auf dem Holzweg. Wir müssen uns des Bildes entledigen.
G. Edelman, Bright Air, Brilliant Fire – On the Matter of the Mind (Penguin, Harmondsworth, 1994), S. 113 [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer (Piper, München, 1995), S. 165]. 439
11.3 Psychisch-materielle Prozesse und bewusste Erfahrung
411
Gründe für die Zuschreibung von Bewusstsein Wir schreiben einem Wesen aufgrund seines lebensweltlichen Verhaltens Bewusstsein zu, nicht weil es private Qualia hat oder Filme im Gehirn. Dabei haben wir entweder das intransitive Bewusstsein im Blick oder das transitive in einer seiner vielen Formen. Das Verhalten, das die Zuschreibung einer Form von Bewusstsein rechtfertigt, unterscheidet sich von dem, das die Zuschreibung einer anderen rechtfertigt, obgleich allerdings jede Zuschreibung transitiven Bewusstseins voraussetzt, dass das Wesen in gewissem Maße intransitiv bewusst [‚bei intransitivem Bewusstsein‘] ist. Bei der Zuschreibung von Bewusstsein zu einem Wesen kann es sich vorrangig darum handeln, ihm die Fähigkeit beizumessen, innerhalb eines bestimmten Spektrums Erfahrungen zu haben: Empfindungen, Wahrnehmungen, Verlangen und Emotionen beispielsweise. Die Verwirklichung derartiger Fähigkeiten offenbart sich im Verhalten des Lebewesens, und die Kriterien für die Zuschreibung von Empfindungen, der Wahrnehmung dieses oder jenes Umgebungsmerkmals, von Emotionen oder Verlangen zu ihm sind seine Verhaltensreaktionen auf die Umstände, in denen es sich befindet. Das evolutionäre Hervortreten des Bewusstseins Allerdings ‚tritt‘ das Bewusstsein nicht wie ein ätherischer Lichthof oder ein Astralkörper aus unbelebter Materie oder tatsächlich belebter Materie ‚hervor‘. Es kann Lebewesen zugeschrieben werden. Es gibt in der Natur jedoch keine scharfe Trennlinie zwischen Wesen, denen man sinnvollerweise Bewusstsein oder Erfahrung in irgendeiner der vielen Formen zuzuschreiben kann, und Wesen, bei denen das nicht der Fall ist. Weil die biologische Konstitution der Lebewesen komplexer wird, weil ihre Nervensysteme, Wahrnehmungsorgane und Gehirne sich weiterentwickeln, sollte man wohl davon ausgehen, dass sich immer mehr Möglichkeiten herausbilden werden, die Umwelt zu erfassen und auf sie anzusprechen und zu reagieren. Die neuralen Strukturen, deren Erforschung den Neurowissenschaftlern obliegt, ermöglichen es einem Wesen, höhere Formen des Erlebens und des zweckgerichteten Handelns zu entfalten. Es gibt auf dem ‚Zeitstrahl der Evolution‘ keinen Punkt, an dem Bilder-im-Gehirn, Filme-im-Kopf oder Subjektivität emergieren – denn das sind Fiktionen. Und es gibt auch keinen Punkt auf diesem Strahl, in Bezug auf den sich sagen ließe, dass jetzt der und der Genotyp Bewusstsein hervorbringt. Es handelt sich vielmehr um eine graduell voranschreitende Evolution immer komplexer werdender Vermögen, sensitiv auf die Umgebung zu reagieren. Wenn uns nicht gerade philosophische Fehlkonstruktionen in ihren Bann schlagen, zögern wir keinen Augenblick, den höheren Tieren Empfindung, Wahrnehmung, Emotion, Verlangen und Zweckverfolgung (verschiedener Intensitäten und Formen) zuzuschreiben, ganz gleich, ob es sich um Fische, Reptilien, Vögel oder Säugetiere handelt. Bei niederen Lebensformen sieht die Sache anders aus: Hier greifen die zahlreichen verschieden Erfahrungsbegriffe immer weniger. Was weder auf unsere Unwissenheit zu-
412
11 Rätselraten um das Bewusstsein
rückzuführen ist noch auf einen Defekt in unserer Begrifflichkeit hindeutet. Es hat vielmehr damit zu tun, dass es zwischen den sehr primitiven Empfindungsformen, die Weichtiere und Garnelen etc. aufweisen, und den entwickelteren Formen, die Fische und Reptilien offenbaren, keine klare Trennungslinie gibt. Aber auch hier ist nichts Geheimnisvolles im Spiel und auch kein tiefgründiges Rätsel – selbst wenn wir vieles noch nicht wissen. Es ist keineswegs rätselhaft, dass physische Ereignisse Bewusstsein mit sich bringen, und wer es rätselhaft findet, unterliegt einer Täuschung Ist es nicht trotzdem rätselhaft, wie bloße physisch-materielle Prozesse bewusste Erfahrungen hervorbringen können? Ist es nicht rätselhaft, dass Bewusstseinszustände aus der bloßen Reizung des Nervengewebes herrühren? Ist der Übergang vom ‚physischen Geschehen im Gehirn zu den korrespondierenden Bewusstseinstatsachen‘ nicht undenkbar? Nochmals: Unserer Ansicht nach hat es deshalb den Anschein, dass wir es mit etwas Rätselhaftem zu tun haben, weil die Phänomene nicht richtig aufgefasst werden. Die Vorstellung von einer ‚unüberbrückbaren Kluft‘ zwischen Bewusstsein und Gehirnprozessen ist eine Täuschung, die infolge von Begriffsverwirrungen zustande kommt – Begriffsverwirrungen, die das philosophische Nachdenken prägen, unabhängig davon, ob es von Philosophen oder von Neurowissenschaftlern praktiziert wird. Wenn man uns erzählt, dass jemand eine Flasche Whisky getrunken und das Bewusstsein verloren hat, kommt es uns nicht so vor, als sei etwas Rätselhaftes oder Unbegreifliches geschehen. Es kommt uns nicht in den Sinn, dass die Wirkung des Alkohols mit der Überwindung einer unüberbrückbaren Kluft einhergeht. Und wenn ein Neurowissenschaftler nahelegt, dass der durch Intoxikation verursachte Bewusstseinsverlust mit den und den Veränderungen in der Aktivität des präfrontalen Kortex verknüpft ist, haben wir etwas Interessantes dazugelernt, wir denken aber nicht, dass etwas zutiefst Rätselhaftes erklärt wurde. Und wir haben auch nicht das Gefühl, dass etwas unerklärlich Geheimnisvolles stattgefunden hat, wenn wir während einer Gehirnoperation, nachdem der primäre visuelle Kortex an einer Stelle stimuliert wurde, ein hell aufleuchtendes Licht im oberen linken Bereich unseres Gesichtsfeldes sehen. In diesem Fall sollten wir freilich sagen, dass dieser Eindruck, einen Lichtblitz zu sehen, von der Gehirnstimulation hervorgerufen wird. Auch wenn es uns merkwürdig vorkommen mag, weil unser Gehirn normalerweise nicht auf diese Weise stimuliert wird, sollten wir uns dennoch des Gefühls erwehren, wir hätten etwas Unbegreifliches oder Rätselhaftes erlebt.440 Und man täuscht sich ebenso, und gleichfalls aufgrund begrifflicher Konfusionen, wenn man es unheimlich findet, dass Bewusstseinszustände das ‚Ergebnis einer Stimulation von Nervengewebe‘ sein sollten. Es ist nicht rätselhaft, dass wir einen roten Apfel sehen, wenn das von einem roten Apfel reflektierte Licht in unsere Augen fällt. Es kann 440
Siehe Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 412.
11.3 Psychisch-materielle Prozesse und bewusste Erfahrung
413
jedoch verwirrend oder sogar rätselhaft scheinen, wenn wir dieses Phänomen neu beschreiben. Denn wir sagen – zu Recht –, dass sich dann, wenn Licht der und der Wellenlänge von einem Apfel reflektiert wird und auf unsere Augen fällt, sodass die Stäbchen und Zapfen der Netzhaut gereizt und folglich Impulse entlang des optischen Nervs zum Thalamus und von da aus zum Kortex geleitet werden, eine Erfahrung ereignet, und zwar die, einen roten Apfel zu sehen. Wie können neurale Ereignisse abrupt in eine Erfahrung umgewandelt werden, die eine ‚Gefühlsqualität‘ aufweist und einzig und allein ihrem Subjekt ‚zugänglich‘ ist? Wie könnte so etwas vor sich gehen? Ist dieser ‚Übergang vom physischen Geschehen im Gehirn zu den korrespondierenden Bewusstseinstatsachen‘ denn nicht undenkbar? Der Eindruck, wir seien mit etwas zutiefst Rätselhaftem konfrontiert, rührt von unserer Verwirrung her. Denn wenn man sagt, dass Photonen die lichtempfindlichen Zellen der Netzhaut reizen, beschreibt man das mit einem Lichteinfall in unsere Augen verbundene Geschehen in physikalischer und neuraler Hinsicht (neu), und nichts ist rätselhaft an der Vorstellung, dass Licht zum Sehen notwendig ist und dass Licht des gesehenen Objekts unsere Augen erreichen muss. Die neurowissenschaftliche Beschreibung der darauf folgenden neuralen Ereignisse in der Netzhaut und dem optischem Nerv sowie der Übertragung der Impulse zum primären ‚visuellen‘ Kortex ist ein gutes Beispiel, um zu verdeutlichen, was die Neurowissenschaften in den letzten Jahrzehnten geleistet haben. Die Komplexität der Mechanismen ist erstaunlich und die Organisation der Zellen des primären ‚visuellen‘ Kortex bemerkenswert – bis dahin jedoch keineswegs rätselhaft. Eine Quelle der Verwirrung Die Neurowissenschaftler hatten nicht erwartet, dass man Merkmale des Gesichtsfeldes – die Lage und Richtung der Linien und Kanten eines sichtbaren Objektes – der Erregung spezieller Zellen des Streifenkortex gemäß kartieren kann. Das ist tatsächlich eine Überraschung. Der Eindruck, etwas Rätselhaftes gehe vor sich, wird allerdings durch die Vorstellung hervorgerufen, dass auf einer gewissen Stufe, nach der Stimulation der Zellen des primären ‚visuellen‘ Kortex, im Gehirn ein vollkommen neues Phänomen in Erscheinung tritt: nämlich eine visuelle Erfahrung, ein Quale oder ein visuelles Bild.441 Wie, so könnten wir nun fragen, können solche neuralen Ereignisse etwas hervorrufen, dass sich so grundlegend von Nervenerregungen unterscheidet wie ein Quale oder ein Bild im Gehirn. Wo, so könnten wir weiterfragen, tritt das Quale oder das visuelle Bild in Erscheinung? Und wenn es irgendwo im Gehirn erscheint, wie kommt es dann, dass Damasio bemerkt dazu: ‚Die Frage, wie Vorstellungsbilder aus neuronalen Mustern entstehen, stellt uns indes vor ein Rätsel. Wie ein neuronales Muster zu einem Vorstellungsbild wird, ist eine Frage, die die Neurobiologie noch nicht beantwortet hat‘ (The Feeling of What Happens (Heinemann, London, 1999), S. 322 [dt. Ich fühle, also bin ich (List, München, 1999), S. 387]). Es wäre tatsächlich ein Rätsel; und wahrscheinlich keines, dass die Neurobiologie jemals lösen könnte. 441
414
11 Rätselraten um das Bewusstsein
wir es sehen? Aber natürlich tritt so etwas gar nicht in Erscheinung. Sieht man einen roten Apfel vor sich auf dem Tisch, sieht man kein Bild eines roten Apfels; und es ist auch nicht Sache des Gehirns, einen roten Apfel zu sehen. Wenn man einen roten Apfel sieht, ist kein Bild des roten Apfels im Gehirn oder sonst irgendwo. Man sieht ein Bild eines roten Apfels auf einem Tisch, wenn man ein Stillleben von Cézanne betrachtet. Man hat ein Bild eines roten Apfels, wenn man sich lebhaft einen roten Apfel vorstellt, man sieht jedoch nicht das Bild, das man hat. Und das Gehirn sieht nicht nur nichts, es hat auch keine Bilder von irgendetwas. Wird unter normalen Bedingungen Licht von einem roten Apfel auf die Retina eines normal veranlagten Menschen reflektiert, so sieht er einen Apfel vor sich. Die außerordentlich komplexe Abfolge neuraler Ereignisse resultiert nicht in einem wundergleich hervorspringenden Bild oder Quale – weder im Gehirn noch an anderer Stelle. Es ist vielmehr so, dass die Person den Apfel sieht. Denn die neurowissenschaftliche Beschreibung betrifft die neuralen Ereignisse, die es einem Menschen ermöglichen, ein Objekt im Raum zu sehen, und diese müssen (kausal) wirklich stattfinden, soll er sehen, was er sieht. Eine weitere Quelle der Verwirrung Wenn wir das wollen, können wir sagen, dass neurale Ereignisse in einer visuellen Erfahrung eines roten Apfels resultieren. Wir dürfen uns von unserer eigenen Beschreibung jedoch nicht durcheinanderbringen lassen. Sonst könnte es scheinen, dass wir eine außergewöhnliche Umwandlung von Materie in Geist, von physisch-materiellen in geistige Ereignisse beschrieben haben – und wie könnte etwas derart Physisches wie das Feuern der Neuronen in etwas umgewandelt werden, dass sich kategorial davon so grundlegend unterscheidet wie eine visuelle Erfahrung (und natürlich leistet man einer Verrätselung Vorschub, wenn man eine visuelle Erfahrung als ein Quale auffasst). Mit der Äußerung, aus den und den neuralen Ereignissen resultiere eine visuelle Erfahrung, bringt man jedoch in Wahrheit auf potenziell verwirrende Weise zum Ausdruck, dass das Ergebnis dieser neuralen Ereignisse im Gehirn eines normal veranlagten Menschen darin besteht, dass er das Objekt sieht, das Licht auf seine Netzhäute reflektierte. Weder ist eine neue Entität entsprungen, noch wurde eine unüberbrückbare Kluft zwischen Gehirnprozessen und Bewusstsein geheimnisvollerweise überwunden. Ein Objekt sehen ist keine Art von Objekt – kein Quale, das die Person sieht oder zu dem es Zugang hat. Die Neurowissenschaftler haben vielmehr die neuralen Prozesse zum Teil erklärt, die im Gehirn eines Menschen ablaufen, wenn er etwas sieht. Diese Erklärung ist ganz sicher eine bemerkenswerte wissenschaftliche Leistung, mit ihr wurde jedoch nichts Rätselhaftes enthüllt oder ergründet. Rätselhaft wäre es, wenn ein Lebewesen nicht auf neurale Prozesse angewiesen wäre, um zu sehen, was es sieht. Es würde uns stutzig machen, wenn wir – Descartes’ Vermutung entsprechend – irgendwo im Gehirn ein optisches Bild des Sichtbaren gefunden hätten, denn dann würden wir uns fragen,
11.3 Psychisch-materielle Prozesse und bewusste Erfahrung
415
wie dieses Bild die Person befähigte, zu sehen, was sie sieht, da sie offenkundig ebenso wenig ein kleines Bild in ihrem Kopf sehen kann wie ein invertiertes reflektiertes Bild auf ihren Netzhäuten. Verblüffend wäre es, wenn Neurowissenschaftler per impossibile entdeckt hätten, dass die von ihnen erforschten neuralen Ereignisse darauf hindeuteten, dass das Gehirn ein Bild sieht. Denn dann würden wir uns fragen, wie etwas, das keine Augen hat und auf das Gesehene nicht mit entsprechendem Verhalten reagieren kann, ein Bild sehen könnte oder soll sehen können. Und wenn Neurowissenschaftler per impossibile entdeckt hätten, dass das Gehirn ein Bild hat, würden wir immer noch nichts darüber wissen, wie der Mensch sieht, was immer er sieht. All diese absurden Annahmen rühren jedoch von begrifflichen Verstrickungen und nicht etwa von wissenschaftlichen Entdeckungen her. Die wirklich beeindruckenden Entdeckungen in der Theorie des Sehens erklären die neuralen Prozesse, die nötig sind, damit ein Tier, und nicht ein Gehirn, sehen kann. Und diese Erklärungen überbrücken auch keine Kluft zwischen Gehirnprozessen und Bewusstsein und geben auch nicht vor, dies zu tun, denn dass es eine Kluft gibt, ist eine Täuschung. Tyndalls Verwirrung Ist der Übergang vom ‚physischen Geschehen im Gehirn‘ zu den korrespondierenden ‚Bewusstseinstatsachen‘ wirklich undenkbar, wie Tyndall beteuert? Keineswegs. Die Neurowissenschaften fanden überzeugende induktive Korrelationen zwischen solchen ‚Bewusstseinstatsachen‘ wie dem Sehen verschiedener Merkmale im Gesichtsfeld und solchen Gehirntatsachen wie dem Feuern von Zellen in den Hyperkolumnen des ‚visuellen‘ Streifenkortex. Diese induktiven Korrelationen sind nunmehr in einer (bisher unvollständigen) Theorie verankert, welche die neuralen Prozesse betrifft, die das Sehen ermöglichen. Aufgrund dieser Theorie können wir nun aus dem Umstand, dass die und die neuralen Ereignisse im Gehirn eines normal veranlagten Wesens mit durchschnittlichen visuellen Fähigkeiten stattfinden, schließen, dass es die und die Merkmale in seinem Gesichtsfeld sieht. Dieser ‚Übergang‘ vom ‚physischen Gehirngeschehen‘ zu den ‚Bewusstseinstatsachen‘ ist nicht undenkbar; er ist ein einfacher induktiver Schluss. Wenn Tyndall meinte, dass wir, wenn wir die im Streifenkortex stattfindenden neuralen Ereignistatsachen gekannt hätten, ohne sie mit den Elementen im Gesichtsfeld (Linienverläufe, Kanten etc.) korreliert zu haben, nicht in der Lage gewesen wären, aus jenen auf diese zu schließen, dann lag er damit natürlich vollkommen richtig, brachte jedoch keineswegs etwas Rätselhaftes zum Ausdruck. Weil wir es hier mit induktivem Schließen zu tun haben, das induktive Korrelationen voraussetzt, überrascht es kaum, dass wir derartige Schlüsse nicht ziehen können, bevor wir nicht die entsprechenden Korrelationen ermittelt haben.
416
11 Rätselraten um das Bewusstsein
11.4 Über den evolutionären Wert des Bewusstseins Verwirrung über das Wozu des Bewusstseins Das Rätselraten darüber, wie es in einer physisch-materiellen Welt so etwas wie bewusste Erfahrung geben kann, wie physische Ereignisse Bewusstsein ‚hervorbringen‘ könnten und weshalb Bewusstsein aus dem Gehirn ‚emergieren‘ sollte, bringt weitere verworrene Verrätselungen im Hinblick auf das Wozu des Bewusstseins mit sich. So wirft Chalmers die Frage auf: „Warum gibt es bewusste Erfahrung?“442 Diese teleologische Frage beschäftigt auch die Wissenschaftler. Horace Barlow beispielsweise fragt: „Welcher selektive Vorteil wird der Menschheit oder irgendeiner anderen Gattung durch das Bewusstsein zuteil? Ist es nur eine Begleiterscheinung unseres Gehirnmechanismus – das Aufheulen unseres neuralen Getriebes, das Klicken unserer neuralen Verschaltung? Oder spielt es für das Überleben und die Zukunft unserer Gattung eine bedeutendere Rolle?“443 Und Roger Penrose stellt dieselbe Frage, betont aber, sie setze voraus, dass das Bewusstsein „wirklich ‚etwas tut‘ – und dass seine Tätigkeit dem damit ausgestatteten Lebewesen überdies nützt, sodass ein bewusstseinsloses, aber ansonsten identisches Lebewesen sich weniger effektiv verhalten würde.“ Andererseits könne Bewusstsein auch als bloßes Epiphänomen aufgefasst werden, eine passive Begleiterscheinung des Besitzes eines hinlänglich hoch entwickelten Kontrollsystems.444 Barlows Antwort auf die Frage ‚Wozu dient das Bewusstsein?‘ Es wurden verschiedene Antwortversuche unternommen. Barlow erläutert, dass das „Bewusstsein das Individuum mit der Gemeinschaft, in der es lebt, verbindet, eine Verbindung, die für das Menschsein von entscheidender Bedeutung ist. Das normale Wahrnehmen, Lernen und Erinnern werden als wichtige Elemente aufgefasst [. . .], dass aber das Individuum Bewusstsein benötigt und ohne soziale Erfahrung nicht sein kann, bedeutet, dass das Bewusstsein selbst das Individuum dazu bringt, mit der Gemeinschaft zu interagieren.“445 Dies erklärt er wie folgt: Lassen Sie uns annehmen, dass das Bewusstsein beim Kind durch den ersten gemeinsamen kommunikativen Akt mit einer anderen Person wachgerufen wird – vielleicht durch das erste erwiderte Lächeln [. . .] Um diese Erfahrung auszubauen und sie teilweise unter seine Kon442
Chalmers, Conscious Mind, S. 5. Es ist keineswegs klar, ob er die teleologische Frage im Sinn hat oder nur die bereits namhaft gemachte Frage, wie es für Lebewesen physisch (neurologisch betrachtet) möglich ist, in den Genuss ‚bewusster Erfahrung‘ zu kommen. 443 H. Barlow, ‚The biological role of consciousness‘, in Blakemore und Greenfield (Hg.), Mindwaves, S. 361. 444 Penrose, Emperor’s New Mind, S. 523f. [dt. Comupterdenken, S. 395]. 445 Barlow, ‚Biological role of consciousness‘, S. 361.
11.4 Über den evolutionären Wert des Bewusstseins
417
trolle zu bringen, muss das kindliche Gehirn ein Modell von demjenigen konstruieren, mit dem es interagiert, das heißt ein Modell der Mutter und ihres Gehirns, welches das Kind erkennen lässt, wann ein Lächeln erwidert wird und wann andere Reaktionen und Interaktionen sich ereignen [. . .] So kann die Introspektion durch immer neue richtige Einsichten erweitert werden, jedoch einzig durch soziale Erfahrung, die zur Verinnerlichung der Denkmodelle anderer Menschen führt. Aus dieser Sicht besteht das entscheidende Merkmal des Bewusstseins darin, dass seine Introspektionen die Erinnerung an einen Gegenüber erfordern: Bewusstsein wird durch Interaktionen mit anderen Denkmodellen vermittelt, wachgerufen und aufrechterhalten, und seine Charakteristika beruhen bei jedem Individuum in gewissem Umfang auf diesen anderen Denkmodellen.446
Humphreys Antwort auf die Frage ‚Wozu dient das Bewusstsein?‘ In ähnlicher Weise legt Humphrey nahe, dass das Bewusstsein sich als eine biologische Adaption zur Ausübung introspektiver Psychologie entwickelte. „Bei Bewusstsein zu sein verschafft einem Tier den Vorteil, dass es bewusste Erfahrung ausschließlich privat als ein Mittel zur Entwicklung eines Begriffsrahmens benutzt, der ihm dabei behilflich ist, das Verhalten anderer Tiere zu modellieren.“447 Dies, so erklärt er, legt den Schluss nahe, dass „irgendwann im Laufe der Evolution, die von den Fischen zu Schimpansen führte, eine Veränderung im Nervensystem eintrat, die ein Tier, das sich einfach nur ‚verhielt‘, in ein solches verwandelte, das zugleich seinen Geist über seine Handlungsgründe in Kenntnis setzte. Meiner Einschätzung nach ging diese Veränderung mit der Evolution eines neuen Gehirns einher – eines ‚bewussten Gehirns‘, parallel zum älteren ‚Ausführungsgehirn‘.“448 Das „innere Auge des Bewusstseins“, wie Humphrey es nennt, „stattet uns mit einem außerordentlich effektiven Werkzeug zum analogen Verstehen des Geistes anderer Individuen aus, die so sind wie wir.“449 Penroses Entgegnung Dagegen behauptet Penrose, dass der selektive Vorteil des Bewusstseins darin besteht, seinen Besitzer in die Lage zu versetzen, eine Art nicht-algorithmisches Urteil darüber zu bilden, wie man sich in einer bestimmten Situation verhält. Vielleicht könnte man sich auf solche Urteile als ‚inspirierte Vermutungen‘ beziehen; es lohnt sich, einige herausragende Beispiele für inspirierte Einfälle zu begutachten, wie sie beispielsweise von Poincaré und Mozart festgehalten wurden. Hier sind die Inspirationen anscheinend durch den unbewussten Geist heraufbefördert worden, will man jedoch den Wert der Einfälle selbst ermessen, braucht man bewusste Urteile. Diese sind von bemerkens446 447 448 449
Ibid., S. 373. N. Humphrey, Consciousness Regained (Oxford University Press, Oxford, 1984), S. 35. Ibid., S. 37. Humphrey, ‚Inner eye of consciousness‘, S. 380f.
418
11 Rätselraten um das Bewusstsein
werter Allgemeinheit; einen großen Teil scheint man im Nu überblicken zu können – ein rein mathematisches Thema etwa oder eine Symphonie. Große Bereiche unseres bewussten Denkens auf einer (scheinbar) viel alltäglicheren Ebene sind von ebenso allgemeiner Art, die Entscheidung, was man zu Abend isst, beispielsweise oder die Erfassung einer visuellen Szenerie.450
Penrose behauptet also, dass „Bewusstsein nötig [ist], um Situationen zu bewältigen, in denen wir neue Urteile bilden müssen und bei denen die Regeln nicht zuvor festgelegt worden sind. [. . .] Die Urteile selbst sind [. . .] Ausdruck der Tätigkeit des Bewusst450 R. Penrose, ‚Précis of The Emperor’s New Mind: concerning computers, minds and the laws of physics‘, Behavioural and Brain Sciences, 13 (1990), S. 653. Der Mozartbezug, der in Penroses Emperor’s New Mind, S. 547 [dt. Computerdenken, S. 434], näher ausgeführt wird, soll einem berüchtigten Brief aus dem Jahr 1789 an einen gewissen Baron von P. entstammen, in dem Mozart seine Kompositionsmethoden darlegt und beschreibt, dass sein Geist die ganze Komposition so erfasst, ‚wie ein Blick meines Auges ein schönes Bild oder ein hübsches Mädchen‘ erfasst. ‚Sie fällt mir nicht hintereinander ein, in verschiedenen genau ausgearbeiteten Teilen – das geschieht erst später –, sondern in ihrer Gesamtheit, wie ich sie in meiner Vorstellung hören kann.‘ Penrose zitiert den Brief aus J. Hadamards Psychology of Invention in the Mathematical Field (Princeton University Press, Princeton, 1945), S. 16. Bei dem Brief handelt es sich jedoch offenkundig um eine Fälschung (siehe E. Anderson, Letters of Mozart (Macmillian, London, 1966), S. xvii). Das ist in diesem Zusammenhang jedoch unwichtig. Wichtig ist, was Menschen meinen, wenn sie bezogen auf eine hochkomplexe Problemlösung ganz zu Recht sagen ‚Ich habe die Antwort blitzartig erfasst‘. Denn selbst wenn Mozart gesagt hätte, dass ihm die gesamte Komposition blitzartig zufiel, meinte er sicherlich nicht, dass er das gesamte Stück in seiner Vorstellung blitzartig hörte. Es gibt also keinen Grund für die Annahme, dass die Lösung des Rätsels, wie er blitzartig so viel und etwas zeitlich Ausgedehntes erfassen konnte, durch Manipulation der Zeit gemäß einer vermeintlichen Theorie ‚genauer Quantengravitation‘ zustande gekommen ist, wie Penrose dies nahelegt. Eine Lösung für ein komplexes Problem musikalischer Komposition oder für jedes andere Problem irgendeines Bereichs ‚blitzartig‘ zu erfassen, ist nicht rätselhafter (obgleich nicht weniger bemerkenswert), als einen komplexen Gedanken bewahren zu können, indem man rasch einige Worte oder ein Schema notiert, die die gedankliche Essenz darstellen. Zur Essenz des Gedankens wird die Notiz durch den Gebrauch, den der Verfasser anschließend von ihr macht. Die plötzliche Inspiration ist das Auftauchen einer Fähigkeit und nicht die rasend schnelle Artikulation eines Gedankens. Sie ist einer unvermittelten Befähigung zu einem Tun ähnlicher als dem unvermittelten Tun selbst. Die Lösung, die man blitzartig vor sich sieht, ist eher ein Fingerzeig als ein fertiges Produkt. Es handelt sich hierbei um eine Form des Wissens, dass man etwas tun kann, nicht um eine rätselhafte Form eines Tuns von etwas mit unmöglicher Hochgeschwindigkeit. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob es wirklich so ist, dass man ‚die Lösung hat‘, d. h., dass man weiß, wie das Theorem zu beweisen oder die Symphonie zu vollenden ist. Denn mitunter denken wir, wir hätten die Lösung blitzartig erfasst, und bemerken beim Versuch, sie genauer herauszuarbeiten, dass wir uns geirrt haben. Es versteht sich von selbst, dass wir nur die Gelegenheiten erinnern und aufbewahren, bei denen wir die Lösung tatsächlich blitzartig erfasst haben; die Gelegenheiten, bei denen wir uns irrten, vergessen wir einfach.
11.4 Über den evolutionären Wert des Bewusstseins
419
seins.“451 Und „das Wesensmerkmal des Bewusstseins ist ein nicht-algorithmisches Bilden von Urteilen“.452 All die Antworten beruhen auf Fehlkonzeptionen über die Bewusstseinsnatur Es sollte nun klar sein, dass all diese Antworten, die die Aufmerksamkeit auf wesentliche Fähigkeiten von Wesen wie uns richten, dennoch verworren sind. Denn sie sagen uns nicht – entgegen den Auskünften ihrer Verfasser –, wozu das Bewusstsein dient oder welchen evolutionären Vorteil es verschafft. Es gelingt ihnen nicht, weil sie missverstehen, worum es sich beim Bewusstsein handelt; das heißt, sie legen den Bewusstseinsbegriff falsch aus, unabhängig davon, ob sie ihn auf das intransitive und das transitive Bewusstsein einengen oder weiter fassen als ‚bewusste Erfahrung‘ oder ‚bewusste Geisteszustände‘. Bei richtiger Auslegung sind die Antworten offensichtlich, wie wir darlegen werden – und viel profaner als diese von herausragenden Wissenschaftlern stammenden Vorschläge. Die Fehlkonzeptionen offenbaren sich in dem Gedanken, dass das Bewusstsein ein Epiphänomen sein könnte und dass ‚Zombies‘ logisch möglich sind Das Missverständnis schlägt sich bereits in den Fragen nieder, ob das Bewusstsein nicht „einfach ein Epiphänomen unseres Gehirnmechanismus, das Aufheulen unseres neuralen Getriebes“ sein könnte und ob „ein bewusstseinsloses, aber ansonsten identisches Lebewesen“ sich weniger effektiv verhalten würde als ein bewusstes Wesen wie der Mensch. Mitunter wird dem Gedanken Sinn abgewonnen, dass es Wesen geben könnte, die sich ganz genauso verhalten wie wir, die jedoch nicht bei Bewusstsein, sich nichts bewusst sind und die keine Wahrnehmungserfahrung, ja sogar überhaupt keine Form von Erfahrung aufweisen. Ihre Lebensführung entspricht genau der unsrigen; sie reagieren ebenso auf Visibilia und Audibilia wie normale Menschen, sie handeln (scheinbar) zielgerichtet, bekunden ihre (scheinbare) Entschlossenheit, Absicht und Zielsetzung, sprechen und unterhalten sich so, wie wir es tun. Dennoch, so nimmt man an, mangelt es ihnen an ‚Subjektivität‘ – dort, wo ‚Licht‘ oder ‚Leben‘ oder ‚Erfahrung‘ sein sollte, gibt es gleichsam nur Dunkelheit. Sie sind eben ‚Zombies‘.453 451
Penrose, Emperor’s New Mind, S. 531 [dt. Computerdenken, S. 401]. Ibid., S. 533 [dt. S. 402]. 453 Siehe Searle, Rediscovery of the Mind [dt. Die Wiederentdeckung des Geistes], Kap. 3, und idem, The Mystery of Consciousness (Granta Books, London, 1997), S. 106ff., 146ff. Unserer ‚landläufigen‘ Vorstellung nach handelt es sich bei bewussten Wesen um Kreaturen, aus deren Kopf eine Blase heraustritt, die mit Bildern gefüllt ist (wie in Comics); und Zombies stellen wir uns als identische Wesen vor: Auch aus ihrem Kopf tritt eine Blase heraus, diese jedoch ist innen gleichmäßig schwarz. An diesen Vorstellungen ist nichts falsch – es sind bildhafte Vorstellungen eines bewussten und eines nichtbewussten Wesens –, so wie an der bildhaften Vorstellung von Liebe 452
420
11 Rätselraten um das Bewusstsein
Bestünde Bewusstsein nur darin, Qualia zu haben, dann könnte es tatsächlich epiphänomenal sein Wenn man davon ausgeht, bei Bewusstsein zu sein, bedeute, Qualia zu haben – das heißt private Geistesobjekte bzw. mentale Gegenstände, die nur ihrem Besitzer zugänglich sind etc. –, dann muss man zwangsläufig die Ansicht vertreten, dass das Bewusstsein epiphänomenal ist, und die Frage, ob es einen evolutionären Wert besitzt, ist nicht mehr abzuweisen. Es gibt jedoch nichts dergleichen wie so aufgefasste Qualia. Und es ist ausgeschlossen, dass ein Lebewesen wahrnehmungsbezogene, kognitive, affektive und willentliche Vermögen offenbart und nicht bei Bewusstsein ist. Denn diese unendlich reichen lebensweltlichen Verhaltens- und Sprechweisen sind die logischen Kriterien dafür, dass ein Wesen bei Bewusstsein ist (in Abgrenzung zu bewusstlos sein oder schlafen), dass es sich vieler verschiedener Dinge in seiner unmittelbaren Umgebung bewusst ist [conscious of], dass es wahrnimmt, Emotionen hat, etwas will und intentional handelt, um es zu bekommen. Verhält sich ein Wesen fortwährend so, wie wir es in unserem lebensweltlichen Alltag tun, dann ist es bei Bewusstsein, genau wie wir es sind. Wären ‚Zombies‘ logisch möglich, würde die Frage aufkommen, ob andere Menschen Zombies oder bewusste Wesen sind Folgendes sollte man sich klarmachen: Wenn wir davon ausgehen, dass es Zombies geben könnte, die sich genauso verhalten wie wir, denen es nur an Bewusstsein mangelt, dann müssten wir uns fragen, ob alle unsere Mitmenschen nicht solche Wesen sein können. Argumentieren wir nun, dass wir ja wissen, dass sie keine Zombies sind, da sie biologisch so wie wir ausgestattet sind und über ebensolche Gehirne verfügen, wie wir sie haben, und dass „wir wissen, dass die Gehirnstruktur und sein Funktionieren kausal hinreichen, um Bewusstsein hervorzubringen“,454 so sagen wir damit inter alia, dass vor den neurophysiologischen Entdeckungen zu Rolle und Funktion des Gehirns niemand sicher sein konnte, dass es sich bei anderen Menschen (von anderen Tieren gar nicht zu reden) um bewusste Wesen handelt. Und das ist sicherlich absurd. Es ist keine Hypothese, dass andere Menschen bei Bewusstsein sind; es ist kein Schluss, der auf dem ‚Wissen um das eigene Bewusstsein‘ basiert, geschweige denn auf dem ‚Bewusstsein vom Bewusstsein‘. Wir sehen andere das Bewusstsein verlieren und wiedererlangen; wir sehen, wie sie sich dieses oder jenes bewusst werden und bemerken, dass sie sich der und der Sache bewusst sind. Wir sehen sie ihre Umgebung wahrnehmen, beobachten, wie sie einer Unterhaltung oder Musik zuhören oder auf Geräusche hören. „Schau ins Gesicht und Tod nichts falsch ist, die eine Putte mit Pfeil und Bogen zeigt, welche von einem alten Mann mit einer Sense begleitet wird. Die Frage ist nur, was man mit der bildhaften Vorstellung macht – wie man sie interpretiert. 454 Searle, Mystery of Consciousness, S. 147.
11.4 Über den evolutionären Wert des Bewusstseins
421
des Andern und sieh das Bewusstsein in ihm und einen bestimmten Bewusstseinston. Du siehst auf ihm, in ihm, Freude, Gleichgültigkeit, Interesse, Rührung, Dumpfheit usf. Das Licht im Gesicht des Andern. Schaust du in dich, um den Grimm in seinem Gesicht zu erkennen? Er ist dort so deutlich wie in deiner eigenen Brust.“455 ‚Welchen evolutionären Vorteil verschafft das Bewusstsein?‘: Verschiedene Fragen sind zu unterscheiden Welchen evolutionären Vorteil verschafft das Bewusstsein also? In diesem Zusammenhang müssen verschiedene Fragen auseinandergehalten werden. Man kann den evolutionären Vorteil einer winzigen primitiven Veränderung in einem Organismus untersuchen, der auf dem Wege der natürlichen Selektion zur Entstehung einer Fähigkeit oder eines Merkmals führte, das die entfernten Nachfahren in einer höher entwickelten Form aufweisen. Hier haben wir es mit evolutionsbiologischen Fragen zu tun. Die Evolution der ursprünglichen licht-, schall- oder geruchsempfindlichen Organe primitiver Wesen ist offenbar geklärt. Auf den frühen Entwicklungsstufen gab es fraglos kein Bewusstsein, nur variierende primitive Licht-, Schall- und Geruchsempfindlichkeit. Allerdings entwickelten sich aus diesen ursprünglichen Formen Augen, Ohren und Nasen. Die mit diesen primitiven Sinnesorganen ausgestatteten Wesen, die also bereits über primitive Sinneswahrnehmungsfähigkeiten verfügten, machten die ersten Schritte auf dem Weg hin zur Evolution solcher Wesen, von denen man sagen kann, dass sie bei Bewusstsein (oder bewusstlos) sind und die Fähigkeiten für das somatische und das wahrnehmungsbezogene transitive Bewusstsein haben. Solche evolutionsbiologischen Fragen bringen keine begrifflichen Verwirrungen oder Rätsel mit sich, und die Vorteile, die Licht-, Schall- und Geruchsempfindlichkeit einem Organismus verschaffen, sind offensichtlich. Die Vorteile des transitiven Bewusstseins für ein entwickeltes Wesen sind offensichtlich Die Neurowissenschaftler, die die Frage nach dem evolutionären Vorteil des Bewusstseins aufwerfen, kümmern sich natürlich nicht um diese Fragen. Vielleicht sollten sie das tun, da ihre Verwirrung möglicherweise nicht aufgekommen wäre, hätten sie sich ihnen gewidmet. Wie dem auch sei, ihre Frage betrifft offenkundig die Vorteile, die das Bewusstsein einem entwickelten Wesen verschafft. Welche Funktionen erfüllt das Bewusstsein im Leben eines Wesens, wie der Mensch eines ist? Zielte diese Frage auf das intransitive Bewusstsein, wäre sie albern, wie wir bereits anmerkten. Richtet sie sich auf das transitive Wahrnehmungsbewusstsein, ist die Antwort offensichtlich. Ein großer Teil des transitiven Wahrnehmungsbewusstseins betrifft die periphere Wahrnehmung – 455
L. Wittgenstein, Zettel, hg. von G. E. M. Anscombe und G. H. von Wright, Wittgensteins Werkausgabe Bd. VIII, § 220.
422
11 Rätselraten um das Bewusstsein
das heißt das passive Vermögen, unsere Aufmerksamkeit von Dingen und Ereignissen am Rande unseres Wahrnehmungsfeldes erregen zu lassen. Sein evolutionärer Vorteil ist offensichtlich – ein Urwaldtier würde ohne dieses Vermögen nicht lange überleben. Was das somatische Bewusstsein angeht, so unterscheidet sich die Frage nach dem evolutionären Wert des Schmerzbewusstseins zweifellos nicht von der Frage nach dem evolutionären Wert des Schmerzes. Denn es gibt unter sonst gleichen Bedingungen keinen Unterschied zwischen einen Schmerz haben und sich eines Schmerzes bewusst sein. Gerade die Schmerzempfindung ist etwas, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht und gefangen nimmt.456 Und die Antwort auf die Frage nach dem evolutionären Wert des Schmerzes im Allgemeinen liegt auf der Hand. Was die anderen Formen des transitiven Bewusstseins wie Affektions- oder Reflexionsbewusstsein angeht, so setzen sie die Beherrschung einer Sprache voraus. Denn um zu realisieren und sich bewusst zu werden, dass man zornig oder niedergeschlagen, aufgeregt oder fröhlich ist, muss man über die Begriffe des Zorns, der Niedergeschlagenheit, Aufgeregtheit oder Fröhlichkeit verfügen. Insofern es Sinn ergibt, von einem evolutionären Wert solcher Formen transitiven Bewusstseins zu sprechen, ist dieser mithin nur ein Aspekt des offensichtlichen evolutionären Wertes der Fähigkeit, eine Sprache zu erwerben und zu beherrschen. (Natürlich brauchen wir nicht davon ausgehen, dass jede Form des transitiven Bewusstseins einen evolutionären Vorteil haben muss, genauso wenig, wie wir voraussetzen sollten, dass jede Art von Schmerz einen evolutionären Vorteil verschafft.) Die Frage nach dem evolutionären Vorteil ‚bewusster Erfahrung‘ ist entweder naiv oder verworren Offenkundig ist damit aber nicht das getroffen, worauf jene abzielen, die die Frage nach dem evolutionären Vorteil aufwerfen. Manche von ihnen beziehen sich auf die ‚bewusste Erfahrung‘. Das ist jedoch entweder naiv oder verworren. Naiv ist es, wenn man fragt: ‚Welches ist der evolutionäre Vorteil davon, Erfahrungen zu haben, während man bei Bewusstsein ist?‘, denn das läuft auf die Frage hinaus, welcher Vorteil dem Organismus durch die Sensibilität entstand – das heißt dadurch, Augen und Ohren, Nase, Gaumen und einen sensitiven Körper zu haben, und somit durch das Seh-, Hör-, Geruchsund Geschmacksvermögen sowie die Fähigkeit, zu fühlen. Die Antwort ist zu offensichtNatürlich kann unsere Aufmerksamkeit manchmal abgelenkt werden – und dann tritt in unserem Schmerzbegriff etwas Singuläres zutage. Denn wir wollen nicht sagen, dass der Schmerz unempfunden andauerte, da ein nicht empfundener Schmerz soviel ist wie kein Schmerz. Wir wollen jedoch auch nicht sagen, dass der Schmerz aufhörte – da wir uns keines Erlöschens des Schmerzes bewusst sind (wären wir es gewesen, würden wir das so sagen, aber dann handelte es sich nicht mehr um einen Fall bloßer Aufmerksamkeitsablenkung). So sagen wir ex post facto, dass unsere Aufmerksamkeit vom Schmerz weg- bzw. abgelenkt wurde und lassen die Sache auf sich beruhen. Wir haben es hier sozusagen mit einer Singularität (im mathematischen Wortsinn) zu tun, einer jedoch, mit der wir gut leben können. 456
11.4 Über den evolutionären Wert des Bewusstseins
423
lich, als dass sie aufgeführt werden müsste. Und die Frage scheint nur deshalb so seriös, weil wir der cartesianischen Täuschung unterliegen, dass ein Tier dasselbe visuelle, auditive, geschmacksbezogene etc. Reaktionsrepertoire an Verhaltensweisen aufweisen könnte, über das wir und andere höher entwickelte Lebewesen verfügen, ohne jedoch überhaupt bei Bewusstsein zu sein (und Descartes vertrat tatsächlich die Ansicht, dass alles ‚bloße Getier‘ nicht bei Bewusstsein ist). Fassen wir bewusste Erfahrung als eine Sache des Besitzes von Qualia auf, dann fällt es leicht, der Annahme Sinn abzugewinnen, dass ein Tier auf Visibilia und Audibilia, Gerüche, Geschmäcke und taktile Qualitäten so reagieren könnte, wie es empfindungsfähige Wesen tun, ohne allerdings irgendwelche Qualia zu haben. Was uns hier als Bild in seinen Bann schlägt, ist jedoch inkohärent, wir sagten es bereits, und wir müssen uns von ihm abwenden. Betrachten wir die Dinge richtig, verflüchtigt sich das Problem. Erwiderung auf Barlow Die oben aufgeführten wissenschaftlichen Vermutungen akzentuieren wichtige menschliche Vermögen (einige von ihnen werden mehr oder minder von anderen Tieren geteilt). Sie alle setzen Bewusstsein (im engeren wie im weiteren Sinne) voraus, können jedoch nicht als sinnvolle Erklärungen der ‚evolutionären Vorteile des Bewusstseins‘ angeführt werden. Die Vorstellung, dass das Bewusstsein gebraucht wird, damit die Gehirne Neugeborener in die Lage versetzt würden, ein Modell der Mutter und ihres Gehirns zu entwerfen und die Denkmodelle anderer Menschen zu verinnerlichen, ist inkohärent. Sie fasst nicht nur das Bewusstsein falsch auf, sie schreibt dem Gehirn auch Vermögen zu, die ihm nicht sinnvoll zugeschrieben werden können. Denn nur menschliche Wesen – nicht Gehirne (oder Wesen ohne Sprachbegabung) – können Modelle jeder beliebigen Sache konstruieren und Modelle dafür verwenden, um Ereignisse vorauszusagen. Es ist zudem nicht die Angelegenheit menschlicher Babys, Modelle irgendwelcher Art zu konstruieren – dafür müssen sie zunächst eine Sprache beherrschen und sich dann ausgiebig mit Wissenschaft auseinandersetzen. Dass ein menschliches Baby, oder auch ein junges Kätzchen, ein Welpe, ein Küken, mit bestimmten gewöhnlichen Verhaltensweisen auf seine Eltern reagiert, Verhaltensweisen, die binnen Stunden nach seiner Geburt durch verschiedene Prägungsprozesse festgelegt werden, ist eine angeborene Tendenz, deren evolutionärer Wert sehr leicht einzusehen ist. Es gibt jedoch keinen Grund für die Annahme, dass das Neugeborene, geschweige denn sein Gehirn, von irgendetwas in Anspruch genommen ist, das mit dem Ausdruck ‚Modellbildung‘ gewürdigt werden kann. Die angeborenen neuralen Tendenzen (über die wir praktisch nichts wissen) sind das Ergebnis von Evolution und natürlicher Selektion, haben jedoch nichts mit der Konstruktion eines Modells der Mutter und ihres Gehirns zu tun, von der Modellierung des Geistes von anderen Menschen (oder von Katzen, Hunden oder Vögeln) gar nicht zu reden. Diese Tendenzen sind gewiss wunderbar. Ein junger Pinguin, ein Flamingo oder ein neugeborener Seehund kann die Rufe seiner Mutter im Lärm Tausender ähnlicher Rufe
424
11 Rätselraten um das Bewusstsein
identifizieren – und das ist in der Tat bemerkenswert. Es hat jedoch nichts mit Modellbildung durch das Neugeborene oder sein Gehirn zu tun. Sind wir anderer Meinung, müssen wir weiter darüber nachdenken, was mit ‚ein Modell‘ gemeint ist und mit der Vorstellung, dass wir es verwenden, um Voraussagen zu treffen. Erwiderung auf Humphrey Ebenso inkohärent ist die Vorstellung, dass sich das Bewusstsein herausgebildet hat, um Tieren die Entwicklung eines Begriffsrahmens zu ermöglichen, der ihnen hilft, das Verhalten eines anderen Tieres zu modellieren. Nur Sprache gebrauchende Wesen besitzen etwas, das den Ausdruck ‚Begriffsrahmen‘ verdient. Denn ein ‚Begriffsrahmen‘ ist ein System von logisch miteinander verknüpften Begriffen, deren Gebrauch Regeln unterliegt, die wiederum von Bedeutungserklärungen geliefert werden. Und dies setzt eine Sprache und hochkomplexe sprachliche Fähigkeiten voraus.457 Gleichfalls unsinnig ist der Gedanke, dass die Evolution des Bewusstseins mit einer Veränderung im Gehirn einherging, die ein Tier, das sich ‚bloß verhielt‘, in ein solches verwandelte, das zugleich seinen Geist von seinen Verhaltensgründen in Kenntnis setzte. Denn erstens sind die einzigen Wesen, die sich ‚bloß verhalten‘ und nicht sehen oder hören, riechen oder schmecken, ziemlich niedere Lebensformen. Bewusste, fühlende Wesen mit kognitiven, affektiven und Willensvermögen erschienen auf der evolutionären Bildfläche lange bevor irgendein Wesen ‚seinen Geist von seinen Verhaltensgründen‘ in Kenntnis setzen konnte. Zweitens ist unklar, was damit gemeint ist, dass ein Wesen ‚seinen Geist [von irgendetwas] in Kenntnis setzt‘ (wenn dieser Gedanke überhaupt Sinn ergibt). Und drittens ist das einzige Wesen, das aus Gründen handeln und sich der Motive seiner Handlungen bewusst sein kann, der Mensch. Wie wir im nächsten Kapitel ausführen werden, beruht diese Fähigkeit wesentlich darauf, eine Sprache zu beherrschen. Es gibt keinen Zweifel daran, dass nur Lebewesen mit komplexen Gehirnen und Nervensystemen, die Wahrnehmungsvermögen und einigermaßen gut entwickelte affektive Fähigkeiten ausgeprägt haben, komplexe Bindungsformen und mithin auch die sozialen Beziehungsformen, die für höher entwickelte Lebewesen charakteristisch sind, entfalten können. Empfindungsfähiges Leben ist sicherlich viel älter als soziales Leben 457
Manche Philosophen verstehen unter Begriffsbeherrschung eine sprachliche Fähigkeit, d. h. das Vermögen, Worte verständlich und ihrer Bedeutung entsprechend zu gebrauchen, und Begriffe fassen sie als Abstraktionen aus dem Wortgebrauch auf. So gesehen ergibt es keinen Sinn, bloßen Tieren die Beherrschung von Begriffen zuzuerkennen. Andere Philosophen knüpfen die Vorstellung der Begriffsbeherrschung in ihren primitivsten Formen an die Beherrschung reiner Erkennungsfähigkeiten und schreiben jenen Tieren, die entsprechende Fähigkeiten in ihrem Verhalten offenbaren, primitive Begriffsbeherrschungsformen zu. Wir müssen uns in dieser Sache hier nicht entscheiden, da es in keinem der beiden Fälle Sinn hat, einem Tier ohne Sprachfähigkeit die Beherrschung eines Begriffssystems zuzuerkennen. Wir werden auf diese Angelegenheit im folgenden Kapitel zurückkommen.
11.5 Das Bewusstseins-Problem
425
oder gar solches, das auf der Bindung zwischen Eltern und Neugeborenem beruht. Es spricht nichts für, jedoch viel gegen die Annahme, dass die Formen des in vollem Umfang empfindungsfähigen Meereslebens, geschweige denn Dinosaurier, mit der Modellierung ihrer Mutter und deren Gehirns befasst waren, um so die soziale Interaktion (die nicht stattfand) voranzutreiben, oder mit der Entwicklung eines Begriffsrahmens (den sie wohl kaum haben konnten), um das Verhalten eines anderen Wesens zu modellieren und ihren Geist (der ihnen fehlte) von den Gründen ihres Verhaltens (das nicht auf Gründen basierte) in Kenntnis zu setzen. Erwiderung auf Penrose Und schließlich ist Penroses Behauptung, dass der durch den Besitz des Bewusstseins erwachsende evolutionäre Vorteil die nicht-algorithmische Urteilsbildung betrifft, aus unserer Sicht eine massive Überinterpretation. Es scheint uns sehr unklar, welche der zahllosen von Menschen gefällten Urteile korrekterweise als algorithmisch und welche als nicht-algorithmisch zu beschreiben sind. Zweifellos fällen nichtbewusste Wesen keine wie auch immer gearteten Urteile – weder algorithmische noch nicht-algorithmische. Allerdings kann die Vorstellung, dass das Wesensmerkmal des Bewusstseins die nicht-algorithmische Urteilsbildung ist, nicht zutreffend sein. Denn sowohl das intransitive als auch das transitive Bewusstsein sowie Empfindung, Wahrnehmung, Affektion und Verlangen entstanden im Laufe der evolutionären Entwicklung lange bevor irgendein Wesen in der Lage war, Urteile gleich welcher Art zu fällen.
11.5 Das Bewusstseins-Problem ‚Das Bewusstseins-Problem‘ aus der Sicht Johnson-Lairds und Blakemores Ein Problem, das unter den Neuro- und Kognitionswissenschaftlern Verwirrung gestiftet hat, wird mitunter als ‚das Bewusstseins-Problem‘ [‚problem of awareness‘] bezeichnet: Dabei geht es um die Frage, wie wir der Unterscheidung zwischen dem, dessen wir uns bewusst sein können, und dem, dessen wir uns nicht bewusst sein können, Rechnung tragen. Johnson-Laird merkt an: „Manche Dinge dringen leicht ins Bewusstsein, anderen hingegen gelingt das offenkundig nicht. Sie können sich der Inhalte Ihrer Wahrnehmung bewusst sein, zum Beispiel, dass Sie gerade Worte auf dieser Seite lesen, Sie können sich jedoch nicht des Wahrnehmungsprozesses bewusst sein – der verwickelten Ereigniskette, die das Netzhautbild in eine informative Repräsentation der Welt umwandelt.“458 Auch Blakemore fragt: P. N. Johnson-Laird, ‚How could consciousness arise from computations of the brain?‘, in C. Blakemore und S. Greenfield (Hg.), Mindwaves (Blackwell, Oxford, 1987), S. 248. Es sei hier an458
426
11 Rätselraten um das Bewusstsein
Warum sieht das innere Auge so wenig? Es gewährt uns nur einen winzigen und noch dazu verzerrten Einblick in die innere Welt. Ein Großteil dessen, was unser Gehirn tut, ist dem Bewusstsein vollkommen verborgen. Wenn man einen Freund erkennt, macht man sich nicht im Mindesten klar, dass Milliarden von Nervenzellen die Signale unserer Augen verarbeitet und daraus die Weisheit der Wahrnehmung gewonnen haben [. . .] Die meisten Aktivitäten des menschlichen Geistes finden dort statt, wo der starre Blick des inneren Bewusstseinsauges nicht hinreicht.459
Nimmt man das für bare Münze, könnte man gewiss denken, dass „es für diesen Umstand viele gute evolutionäre Gründe geben mag: Wenn man einen Tiger sieht, ist es das Beste, ihm aus dem Wege zu gehen, ohne über den Wahrnehmungsprozess nachzudenken. Wäre dieser Prozess introspektierbar, so ginge er ganz offensichtlich langsamer vonstatten, weil er sich nicht auf parallel ablaufende Geschehnisse stützen könnte und weil man selbst in der Lage wäre innezuhalten, um zu überprüfen, ob der Tiger bloß eine Täuschung ist.“460 Das Problem ist nur ein scheinbares und die angebotene Lösung abwegig Wir haben es hier mit einem Scheinproblem zu tun, dessen Lösung abwegig ist. Die neuralen Ereignisse und Prozesse selbst, die während des Wahrnehmens stattfinden und bei denen es sich um die Kausalbedingungen des Wahrnehmens handelt, können vom Wahrnehmenden nicht wahrgenommen werden. Dass er sich ihrer nicht bewusst sein kann, ist ebenso wenig rätselhaft, wie dass er sich in diesem Augenblick des gestrigen Sonnenuntergangs oder der Merkmale der Mondrückseite nicht wahrnehmend bewusst sein kann. Es ist eine logische Wahrheit und keine kausale, dass man von etwas, das man nicht wahrnehmen kann, kein Wahrnehmungsbewusstsein erlangen kann. Die neuralen Prozesse, die der Wahrnehmung zugrunde liegen, sind nicht ‚der Wahrnehmungsprozess‘. Daisy auf der Straße oder im Zimmer zu sehen, zu erblicken, zu entdecken, zu erkennen oder zu bemerken, ist kein Prozess – denn sobald man Daisy sieht, hat man sie gesehen, und sobald man sie erblickt, entdeckt, erkennt oder bemerkt, hat man dies getan. Prozesse können weitergehen, unterbrochen werden, bevor sie beendet sind, und die Frage, wie weit man im Prozess vorangekommen sei, ergibt Sinn. Keinen Sinn ergibt es hingegen zu sagen, man habe den auf einen anderen gerichteten Erkennensprozess zur Hälfte durchlaufen oder sei schon beinahe am Ende des auf ihn oder sie gerichteten Erblickensprozesses (sei schon fast damit fertig, ihn oder sie zu erbligemerkt, dass es keine Ereigniskette gibt, die das Netzhautbild in eine informative Repräsentation der Welt umwandelt. Ein Objekt zu sehen heißt nicht, eine Repräsentation von irgendetwas zu haben. 459 C. Blakemore, The Mind Machine (BBC Publications, London, 1988), S. 14. Siehe auch Penrose: ‚nicht jede Gehirnaktivität ist dem Bewusstsein unmittelbar zugänglich‘ (Emperor’s New Mind, S. 527). 460 Johnson-Laird, ‚How could consciousness arise‘, S. 248.
11.5 Das Bewusstseins-Problem
427
cken). Zwar kann man die neuralen Prozesse unterbrechen, die sich ereignen müssen, um dieses oder jenes zu entdecken, zu erblicken, zu erkennen oder zu bemerken; wenn das geschieht, dann wird die Person oder das Tier jedoch nicht das entdeckt, erblickt, erkannt oder bemerkt haben, was sie ansonsten vielleicht entdeckt etc. hätte. Da es sich bei diesen Wahrnehmungsleistungen nicht um Prozesse handelt, kann man sich ihrer logischerweise auch nicht als Prozesse bewusst werden und dann sein. Andererseits sind Hinschauen, Mustern und Anstarren, da man von ihnen als Prozessen sprechen kann, eben solche, derer man sich tatsächlich (als solche, in die man verwickelt ist) bewusst werden und dann sein kann, wenn man realisiert oder einem schlagartig aufgeht, dass man dies gerade tut. Wird man sich der Tatsache bewusst, dass man Daisy gerade anstarrt, erlangt man jedoch selbstverständlich kein Bewusstsein von einem neuralen Prozess, obgleich in diesem Moment neurale Prozesse stattfinden, ohne die man Daisy nicht anstarren könnte. Einen introspektierbaren neuralen Prozess, den die Evolution ausschließen könnte, gibt es nicht „Wenn man einen Tiger sieht“, ist es gewiss „das Beste, ihm schleunigst aus dem Weg zu gehen“ – aber nicht aus evolutionären Gründen, die mit einem neuralen Parallelverarbeitungsprozess zu tun haben. Denn es ist irrig anzunehmen, dass der Prozess, „wäre er introspektierbar, ganz offensichtlich langsamer vonstattenginge, weil er sich nicht auf parallel ablaufende Geschehnisse stützen könnte und weil man in der Lage wäre innezuhalten, um zu überprüfen, ob der Tiger bloß eine Täuschung ist“. Es gibt nichts dergleichen wie „einen introspektierbaren (innerlich wahrnehmbaren) neuralen Prozess“. Denn Introspektion ist, wie wir bereits dargelegt haben (3.6), keine Form der Wahrnehmung (keine ‚innere Wahrnehmung‘), sondern eine Form des Nachdenkens über die eigenen Gefühle, Motive, Gründe etc. Es ist bei passender Gelegenheit sehr wohl möglich zu überprüfen, ob das, was man zu sehen scheint (der scheinbar gekrümmte Stock im Wasser oder Macbeths Dolch), täuscht oder eine Halluzination ist. Und die eigenen neuralen Prozesse sind keine möglichen Wahrnehmungsobjekte, wenn man sich nicht gerade einem Gehirnscanning unterzieht und einen Blick auf die Apparatur werfen kann. Gehirnaktivitäten sind notwendigerweise, nicht aufgrund der biologischen Ausstattung ‚vom Bewusstsein ausgeschlossen‘ Und schließlich ist es nicht richtig, dass viele Gehirnvorgänge ‚dem Bewusstsein verborgen‘ sind, denn von neurologischen Experimenten abgesehen (bei denen der Neurowissenschaftler, der ein Scanning prüfend begleitet, sich der neuralen Ereignisse wahrnehmend bewusst werden kann) sind alle Gehirnvorgänge ‚dem Bewusstsein verborgen‘. Denn unsere Gehirnzustände und -ereignisse befinden sich nicht in unserem Wahrneh-
428
11 Rätselraten um das Bewusstsein
mungsfeld, und anders als Empfindungen, Stimmungen und Emotionen können sie die Aufmerksamkeit nicht auf sich ziehen und gefangen halten oder unsere Gedanken beschäftigen. Es ist gleichfalls verworren anzunehmen, dass ‚die meisten Aktivitäten des menschlichen Geistes‘ nicht im Bereich der möglichen Bewusstseinsobjekte angesiedelt sind. Es stimmt natürlich, dass viele unserer Gefühle, Stimmungen, Emotionen etc. die Aufmerksamkeit nicht auf sich ziehen und unseren Geist beim Nachdenken nicht beschäftigen können. Und es stimmt auch, dass es unbewusste Gefühle und Leidenschaften gibt. Was nicht bewusst ist, kann jedoch bewusst werden, und das, was unsere Aufmerksamkeit nicht auf sich zieht oder unsere Gedanken nicht beschäftigt, genau das könnte in solchen Fällen ein Bewusstseinsobjekt werden.
11.6 Der Geist anderer und andere Tiere Die neurowissenschaftliche Konzeption des Wissens über den Geist anderer Menschen Das letzte Problem, das wir behandeln werden, wird von Neurowissenschaftlern nicht als etwas aufgefasst, das Rätsel aufgibt. Im Gegenteil, es herrscht weitgehend Übereinstimmung. Die Wissenschaftler sind sich im Wesentlichen einig, dass man absolut sicher (mit absoluter Gewissheit) weiß, dass man bei Bewusstsein ist und welchen Bewusstseinszustands man sich erfreut. Die Sache wird indes problematischer, wenn es um unser Wissen über die Bewusstseinszustände oder die bewussten Erfahrungen anderer Menschen geht. Und was andere Tiere betrifft und die Frage, ob sie bewusste oder nichtbewusste Wesen sind, scheint man sich noch mehr Zurückhaltung aufzuerlegen. Crick meint dazu: Genau genommen weiß jeder nur von sich selbst mit Gewissheit, dass er Bewusstsein hat. Ich beispielsweise weiß, dass ich Bewusstsein habe. Es scheint mir, dass Ihr Auftreten und Ihr Verhalten dem meinen sehr ähnlich sind; deshalb – und weil Sie mir ja insbesondere auch versichern, dass Sie wirklich Bewusstsein haben – folgere ich mit einem hohen Grad an Sicherheit, dass auch Sie Bewusstsein haben.461
Edelman bringt gleichfalls vor, dass Qualia „von jedem Individuum unmittelbar erlebt werden“ und vertritt die Ansicht, dass angesichts dieser Tatsache eine methodologische Schwierigkeit zutage tritt. Denn: „Was das Individuum unmittelbar als Qualia erfährt, wird möglicherweise von einem anderen Individuum nicht ebenso aufgefasst.“ Er legt nahe, dass diese Schwierigkeit jedoch überwunden werden kann, wenn wir „annehmen, dass es in anderen bewussten Menschen genau wie in uns Qualia gibt.“462 Inkonsisten461
F. Crick, The Astonishing Hypothesis (Touchstone, London, 1995), S. 107 [dt. Was die Seele wirklich ist (Artemis & Winkler, München & Zürich, 1994), S. 139]. 462 Edelman, Bright Air, Brilliant Fire, S. 114f. [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer (Piper, München, 1995), S. 166].
11.6 Der Geist anderer und andere Tiere
429
terweise behauptet er zudem, dass wir „für uns selbst“ wissen, was das Bewusstsein ist, „seine Existenz in anderen jedoch nur induktiv schließen können.“463 Man geht also davon aus, dass das Wissen über ‚das Bewusstsein‘ anderer weniger sicher ist als das Wissen über ‚unserer eigenes Bewusstsein‘ und dass jenes entweder eine Annahme ist oder auf einem Analogieschluss oder einem induktiven Schluss beruht. Die wissenschaftliche Konzeption von der Wahrscheinlichkeit des Tierbewusstseins Wissenschaftler neigen dazu, sich in Bezug auf andere Tiere mehr Zurückhaltung aufzuerlegen. Crick merkt an: „Zwar bin ich weniger sicher, dass ein Affe Bewusstsein hat, als dass Sie Bewusstsein haben, ich kann aber begründeterweise annehmen, dass ein Affe kein totaler Automat ist“.464 Eine ganz ähnliche Position vertritt Weiskrantz: „Weil wir mit Tieren nicht in einen verbalen Austausch treten können und über kein Beurteilungskriterium verfügen, sind wir auf verschiedene tief eingewurzelte Intuitionen und auf Argumente, die von Analogien mit uns herrühren, zurückgeworfen.“465 Und Baars erklärt, dass „Tiere sehr wahrscheinlich Bewusstsein haben“, obgleich er, wie er schreibt, den Eindruck habe, „dass die wissenschaftliche Gemeinschaft sich nun eindeutig zu einer Version durchgerungen hat [d. h. dazu, Tieren Bewusstsein zuzuerkennen]“.466 Es ist also nur wahrscheinlich, dass auch Tiere bewusste Lebewesen sind, und das Urteil, dass sie es sind, ist mithin entweder eine Annahme oder basiert auf einem Analogieschluss oder auf Intuition. Diese Vorstellung ist cartesianisch Der Gedanke, dass ich mit absoluter Sicherheit weiß, dass ich Bewusstsein habe/bei Bewusstsein bin, dass ich mit einem geringeren Grad an Sicherheit schließe, dass Sie Bewusstsein haben (weil Sie sich so ähnlich verhalten wie ich und vor allem, weil Sie mir mitteilen, dass Sie es haben), und dass ich unsicher bin, ob Affen Bewusstsein haben, obwohl ich begründeterweise annehmen kann, dass sie es haben, ist nahezu Cartesianismus ‚in Reinkultur‘. Von diesem unterscheidet er sich nur durch die Annahme, dass nichtmenschliche Tiere Bewusstsein haben; denn Descartes dachte, wir könnten sicher sein, dass sie keines haben, nicht bei Bewusstsein sind.467 Damit befand er sich jedoch im Irrtum. 463
Ibid., S. 111 [dt. S. 162]. Crick, Astonishing Hypothesis, S. 109 [dt. Was die Seele wirklich ist, S. 141]. 465 L. Weiskrantz, Consciousness Lost and Found (Oxford University Press, Oxford, 1997), S. 77f. 466 B. J. Baars, In the Theater of Consciousness (Oxford University Press, New York, 1997), S. 32f. 467 Er dachte nicht, dass man beweisen könnte, dass Tiere keine bewussten Wesen sind, ging aber davon aus, dass die Vermutung, sie hätten kein Bewusstsein, die besseren Gründe auf ihrer Seite hätte als die Bewusstseinannahme. In einem Brief an Henry More (5. Februar 1649) schrieb er: ‚Obwohl es aus meiner Sicht keinen Zweifel daran gibt, dass wir nicht beweisen können, dass 464
430
11 Rätselraten um das Bewusstsein
Diese wissenschaftlichen Konzeptionen wurzeln in Falschauslegungen der Begriffe des Verhaltens und des Bewusstseins Solche Ansichten wurzeln in den abwegigen Konzeptionen des Verhaltens einerseits und des Bewusstseins andererseits, die unter Neurowissenschaftlern (und Philosophen, von denen sie ‚Rückendeckung bekommen‘) weit verbreitet sind. Fassen wir ‚bewusste Erfahrung‘ als etwas Privates auf, das nur dem Subjekt zugänglich ist, nur durch Introspektion unmittelbar erfahren werden kann sowie durch Qualia bestimmt ist etc., und stellen uns zudem das Verhalten als bloße Körperbewegung vor, die von neuralen Ereignissen herrührt, können wir gar nicht anders, als die bewussten Erfahrungen anderer Menschen und anderer Tiere ebenso zu verstehen. Es ist jedoch offensichtlich, dass wir die Zusammenhänge anders auffassen sollten. Dass Menschen bewusste Wesen sind, ist eine begriffliche Wahrheit Es ist eine kontingente Wahrheit, dass Menschen und andere höher entwickelte Tiere existieren. Dass Menschen und andere höher entwickelte Tiere bewusste Wesen sind, ist jedoch keine kontingente, sondern eine begriffliche Wahrheit – so wie es eine begriffliche Wahrheit ist, dass materielle Objekte im dreidimensionalen Raum existieren und aus Materie der einen oder anderen Art bestehen. Dass ich hier und jetzt bei Bewusstsein bin, ist sicherlich eine kontingente empirische Wahrheit, denn ich hätte auch schlafen oder bewusstlos sein können (wenn ich z. B. vor zehn Minuten eingeschlafen oder betäubt worden und noch nicht wieder aufgewacht wäre). Es ist jedoch abwegig, diese einfache Tatsache als ein unbezweifelbares Wissenselement darzustellen oder als etwas, dass ich aufgrund von Introspektion weiß, kraft der Beobachtung meines eigenen Bewusstseins oder kraft des Umstands, mir meines Bewusstseins bewusst zu sein.
Tiere in irgendeiner Form denken, gehe ich nicht davon aus, dass damit bewiesen ist, dass sie es nicht tun, denn der menschliche Verstand reicht nicht in ihre Herzen.‘ Interessanterweise vertritt Crick die Meinung, wir wüssten hauptsächlich deshalb, dass andere menschliche Wesen Bewusstsein haben, weil sie uns mitteilen, dass sie es haben, d. h. Sprache benutzen können (und uns so von etwas in Kenntnis setzen, das sie mit Sicherheit wissen), und Weiskrantz meint, das Fehlen eines ‚verbalen Austauschs‘ mit Tieren werfe uns zur Stützung der Annahme, dass es sich bei ihnen um bewusste Wesen handelt, auf Analogieargumente und tief eingewurzelte Intuitionen zurück. Descartes erklärte More gegenüber, der Hauptgrund für die Vermutung, dass Tiere nicht über Denken oder Bewusstsein verfügen, sei der, dass ‚noch nie beobachtet wurde, dass irgendein bloßes Tier die Sprachverwendungsschwelle erreicht hat, d. h. in der Lage ist, durch das Wort oder Zeichen etwas auszudrücken, wie es echtem Denken entspricht und nicht einer natürlichen Anwandlung. Eine solche Sprache ist das einzig sichere Zeichen dafür, dass Denken in einem Körper verborgen ist.‘
11.6 Der Geist anderer und andere Tiere
431
Die epistemologischen und logischen Eigentümlichkeiten von ‚Ich bin bei Bewusstsein‘ Denn wie wir bereits dargelegt haben (9.2), kann man sein Bewusstsein weder beobachten noch wahrnehmen, und man kann sich dessen auch nicht bewusst sein. Für die Behauptung, man sei bei Bewusstsein, gibt es weder irgendeinen Grund noch irgendwelche Evidenz, und es kann keine(n) geben. Man kann in der Tat nicht behaupten, bei Bewusstsein zu sein. Man kann nicht sagen ‚Er behauptet, bei Bewusstsein zu sein, er täuscht sich jedoch‘; und wenn man der Krankenschwester, die auf Zehenspitzen im Zimmer umhergeht, sagt ‚Ich bin bei Bewusstsein‘ [‚I am conscious‘], behauptet man nichts. Es kann einem auch nicht scheinen, dass man bei Bewusstsein ist, denn ‚Ihm scheint, dass er bei Bewusstsein ist, er täuscht sich jedoch‘, ist Unsinn. ‚Ich bin bei Bewusstsein‘ ähnelt einer empirischen Behauptung und soll eine sein. Es ist jedoch nicht möglich, den Satz auf verständliche Weise so zu negieren, dass die Negation wiederum als Behauptung vorgebracht werden könnte (‚Ich bin nicht bei Bewusstsein‘). Zwar lässt er keinen Zweifel zu, genau darum jedoch kann man von ihm nicht sagen, er sei gewiss. Denn eine empirische Proposition gilt dann als gewiss, wenn jeder mögliche Zweifel ausgeschlossen ist, wenn jedoch aus logischen Gründen nicht gezweifelt werden kann, lässt sich nichts mit Gewissheit ausschließen. ‚Ich bin bei Bewusstsein‘ drückt nichts aus, das man nicht wissen könnte, bringt aus demselben Grund jedoch auch nichts zum Ausdruck, von dem man sagen kann, man wisse es – denn schreibt man jemandem Wissen zu, schließt man dessen mögliches Nichtwissen aus, und in diesem Fall lässt sich kein mögliches Nichtwissen ausschließen. Würde jemand auf cartesianische Weise ins Feld führen, dass der Satz ein Element absolut sicheren Wissens ausdrückt, könnte man erwidern, dass es sich bei ihm gar nicht um eine Proposition oder eine degenerierte Proposition handelt (in dem Sinne, in dem ein Punkt ein degenerierter Fall eines konischen Abschnitts ist). Natürlich hat der Satz, wie wir gesehen haben, eine seriöse Anwendung – die nicht darin besteht, ein Element unbezweifelbaren Wissens auszudrücken oder eine Behauptung vorzubringen, sondern beispielsweise jemandem (u. U. der Krankenschwester) zu signalisieren, dass man nach einer Operation sein Bewusstsein wiedererlangt hat. Selbstverständlich kann ich jemand anderem mitteilen, dass ich mir dieser oder jener Sache bewusst bin [conscious of] – der Feindseligkeit meiner Zuhörer beispielsweise oder der fortgeschrittenen Stunde. Was, wie dargelegt, nicht nur informativ, sondern auch eine implizite Wissensbehauptung ist. Denn wenn die Zuhörerschaft freundlich und nicht feindselig gesinnt ist, dann war ich mir nicht ihrer Feindseligkeit bewusst – denn ist man sich etwas auf diese Weise bewusst, weiß man, wie wir gesehen haben, dass die Dinge so sind, wie man sich ihrer als seiende bewusst ist. Das Wissen, in dem das transitive Wahrnehmungsbewusstsein besteht, ist Wissen, das man erwarb, indem die eigene Aufmerksamkeit von etwas, das man wahrnimmt, auf sich gezogen und gefangen genommen wurde. Man ist sich nicht ‚seines Bewusstseins bewusst‘, sondern so
432
11 Rätselraten um das Bewusstsein
und so seiender Dinge. Und man weiß, dass sie so und so sind, weil man sie als so seiende wahrnimmt (9.4). Das Wissen, dass andere bei Bewusstsein sind, ist normalerweise ein unmittelbares, kein geschlossenes Der Gedanke, dass ich induktiv oder analog schließe, dass andere Menschen um mich herum bei Bewusstsein sind, dass ich aufgrund ihrer bloßen Körperbewegungen auf ihr Bewusstsein schließe oder dass ich annehme, dass sie bei Bewusstsein sind, weil sie sich so verhalten, wie ich es tue, wenn ich bei Bewusstsein bin, ist gleichermaßen abwegig. Ich kann sehen, ohne irgendwie zu schließen, dass sie bei Bewusstsein sind. Ich kann sehen, dass sie sich dieses anschauen, dass sie sich jenem zuwenden, dass sie Schmerzen haben oder sich amüsieren. Ich kann ihnen ihr Vergnügen oder ihr Leid vom Gesicht ablesen, ihre Erregung oder Langeweile, ihre Freude oder ihren Zorn. Natürlich würde ich meine Behauptung, dass jemand Schmerzen hat oder sich amüsiert, vergnügt ist oder leidet, dadurch rechtfertigen, dass ich mich auf sein Verhalten beziehe. Fragte man mich, wie ich wisse, dass er Schmerzen hat, würde ich erwidern ‚Ich sah, wie er sich unter Schmerzen krümmte‘, und fragte man mich, woher ich wisse, dass er sich amüsiert, würde ich sagen ‚Ich sah, wie er sich enthusiastisch an dem Spaß beteiligte‘. Erstens zeigt jedoch die Tatsache, dass ich mein Urteil auf diese Weise rechtfertigen würde, nicht, dass ich es aus der rechtfertigenden Evidenz geschlossen habe. Denn ich schließe nicht: ‚Er blutet und stöhnt, hat einen schrecklichen Gesichtsausdruck; daher hat er aller Wahrscheinlichkeit nach Schmerzen.‘ Ich gelange auch nicht durch einen ‚unbewussten Schluss‘ zu meinem Urteil. Ich erkenne vielmehr unmittelbar und ohne irgendeinen Schluss, dass der Mann Höllenqualen leidet. Das Verhalten, das Urteile über die Geisteszustände anderer rechtfertigt, ist keine ‚bloße Körperbewegung‘ Zweitens besteht das Verhalten, auf das man sich zur Rechtfertigung solcher Urteile beziehen würde, nicht aus ‚bloßen Körperbewegungen‘, wie die Behavioristen nahelegten, sondern aus Schmerzensächzern, Vergnügensglucksern und Kummertränen. Wir beschreiben dieses Verhalten mittels des reichen psychologischen Wortschatzes, und wir hätten Probleme, es unter dem Aspekt bloßer Bewegungen zu beschreiben. (Versuchen Sie einmal, den Unterschied zwischen einem verächtlichen, amüsierten, peinlichen, grausamen oder einem freundlichen Lächeln etc. unter dem Aspekt muskulärer Bewegungen zu beschreiben. Niemand von uns hat jedoch irgendwelche Schwierigkeiten, diese verschiedenen Arten des Lächelns im Kontext zu erkennen.) Daran ist nichts Seltsames oder Ungewöhnliches. Wir haben die Fähigkeit, ein Verhaltensmuster in bestimmten Umständen in psychologischer Hinsicht zu erkennen, das heißt als ein Stöhnen vor Schmerzen, ein Freudengelächter oder einen Seufzer der Erleichterung. Dieses Kön-
11.6 Der Geist anderer und andere Tiere
433
nen ist nicht ungewöhnlicher als unsere allgemeine Fähigkeit, Gesichter unmittelbar und nicht schließend zu erkennen. Und unsere Fähigkeit, Verhalten als Schmerzverhalten oder als Freude- oder Affektionsverhalten zu erkennen, steht mit unserem allgemeinen Vermögen, Gesichter zu erkennen, in engem Zusammenhang. Denn man benötigt dazu unter anderem ein gewisses Feingefühl für Gesichtsausdrücke und die Fähigkeit, diese zu erkennen. Beides zahlt sich in evolutionärer Hinsicht offensichtlich aus. Urteile über die Geisteszustände anderer beruhen nicht auf induktivem oder analogem Schließen Drittens können unsere Urteile über andere nicht auf induktivem Schließen beruhen. Denn dieses setzt die nichtinduktive Identifizierung von Bezugsgrößen voraus, die zuvor als systematisch miteinander in Beziehung stehende erkannt wurden. Wenn sich herausgestellt hat, dass Phänomen A und Phänomen B stets korrelieren, dann ist man berechtigt, vom Auftreten eines Falles A auf das Auftreten eines Falles B zu schließen. Offensichtlich aber kann ich den Schmerz oder die Freude eines anderen Menschen, seine Angst oder gute Laune nicht unabhängig von seinem Verhalten identifizieren und feststellen, dass dieses und jenes Verhalten mit seinem Schmerz oder seiner Freude etc. in enger Beziehung steht. Stattdessen soll ich bemerkt haben, dass ich, wenn ich Schmerzen habe (etc.), mich stets auf die und die Weise verhalte, und daraus dann angeblich folgern, dass andere sehr wahrscheinlich auch Schmerzen haben (etc.), wenn sie sich im Verletzungsfalle ganz ähnlich verhalten. Das setzt jedoch voraus, dass ich (i) meinen Schmerz identifiziere und dann mit meinem Verhalten in Beziehung setze und dass ich (ii) von meinem eigenen Fall auf andere schließe. Dies ist allerdings inkohärent. Die Bekundung und Mitteilung meines eigenen Schmerzes geht weder mit Identifizierung noch mit der Anwendung von Identitätskriterien einher Denn erstens identifiziere ich meinen Schmerz nicht (würde ich das tun, könnte ich ihn auch falsch identifizieren – und das ergibt keinen Sinn). Ich wende keine Identitätskriterien an, wenn ich meinen Schmerz offen bekunde – es schmerzt einfach und ich sage das. Meine Fähigkeit jedoch, ohne irgendein Identitätskriterium zu bekunden, dass ich Schmerzen habe, setzt die Beherrschung des alltäglichen, öffentlichen Schmerzbegriffs voraus und die Kenntnis der (nichtinduktiven) Verhaltenskriterien, die es rechtfertigen, anderen Schmerz zuzuschreiben. Wie wir bereits dargelegt haben, sind diese Fähigkeiten zwei Seiten derselben Medaille, desselben begrifflichen Zusammenhangs. Demzufolge ziehe ich von meinem eigenen Fall aus nicht nur keine Schlüsse, wenn ich anderen Schmerz beimesse, sondern es ist vielmehr so, dass es ‚meinen eigenen Fall‘ überhaupt erst gibt (d. h., dass ich in der Lage bin, den Begriff des Schmerzes zu verwenden, indem ich sage, ich habe Schmerzen, oder denke, dass ich besser eine Aspirin genommen hätte, weil ich Schmerzen habe), wenn ich über den Begriff des Schmerzes verfüge. Und um
434
11 Rätselraten um das Bewusstsein
über ihn zu verfügen, muss ich bereits wissen, unter welchen Umständen ich dazu berechtigt bin, anderen Schmerz zuzuschreiben – das heißt, ich muss die Kriterien für die Schmerzzuschreibung zu anderen kennen, nämlich ihr Schmerzverhalten in den entsprechenden Umständen. Diese Verhaltenskriterien liefern jedoch keine induktive Evidenz, sondern logisch begründete Evidenz [logically good evidence] – die den Begriff des Schmerzes mit konstituiert. Um anderen Schmerz beimessen zu können, brauche ich also keine induktive Evidenz. Und wenn ich sie bräuchte, könnte ich sie nicht haben, weil ich den Schmerzbegriff nicht besäße und nicht einmal in der Lage wäre zu sagen, ich habe Schmerzen, wann immer ich welche habe. Ein Analogieschluss würde in meinem eigenen Fall Identifizierung voraussetzen Zweitens: Würde man mir abverlangen, von meinem eigenen Fall aus zu schließen, wodurch könnte ein solcher unmöglicher Schluss von einem Einzelfall aus zu rechtfertigen sein? Es kann sich bei dem mutmaßlichen Schluss also nicht um einen induktiven handeln. Könnte es sich auch nicht um einen Analogieschluss handeln? Schließe ich aus dem Verhalten anderer, dass sie eine bestimmte Erfahrung haben, indem ich meinen Fall als Analogie heranziehe? Dies würde solche angeblichen Schlüsse natürlich viel schwächer machen als induktive. Aber auch hier haben wir es mit einer inkohärenten Annahme zu tun. Denn genau wie im Falle des mutmaßlichen induktiven Schlusses setzt auch die Annahme eines Analogieschlusses voraus, dass ich in meinem eigenen Fall meinen Schmerz (oder meine Freude, Niedergeschlagenheit, Erregung etc.) identifiziere, indem ich den Begriff des Schmerzes (der Freude, Niedergeschlagenheit, Erregung etc.) unabhängig von seiner Verknüpfung mit den öffentlichen Kriterien verwende, die seine Zuschreibung zu anderen rechtfertigen. Das bedeutet jedoch, dass ich ein Identitätskriterium bräuchte, um dessen Anwendung auf mich selbst zu rechtfertigen. Ich habe allerdings keins. Und ich könnte nur dann eines haben, wenn ich ein privates geistiges Beispiel des Schmerzes (der Freude, Niedergeschlagenheit, Erregung etc.) hätte, an dem ich die Anwendung des Begriffs auf mich überprüfen könnte. Das aber ist, wie wir bereits erörtert haben, vollkommen inkohärent, weil es nichts dergleichen geben kann wie ein privates geistiges Beispiel, das als Standard für die richtige Anwendung eines Wortes fungiert. Es ist keine Annahme, dass andere Menschen bei Bewusstsein sind Ist es mithin eine Annahme, dass andere Menschen bewusste Wesen sind, dass sie Erfahrungen haben so wie ich selbst? Nein, auch das ergibt keinen Sinn. Wäre es eine Annahme, dass sie bei Bewusstsein sind, dann könnte sie sich als irrig erweisen (wie man annehmen und sich damit irren könnte, dass ein Patient bei Bewusstsein ist, wenn er sich nach einer Narkose regt und etwas vor sich hin murmelt). Aber könnte irgendetwas als ein Nachweis betrachtet werden, dass wir unseren Mitmenschen, die sich ganz ge-
11.6 Der Geist anderer und andere Tiere
435
wöhnlich verhalten, irrigerweise Bewusstsein zuschreiben? Wenn wir einen schwer verwundeten Menschen sehen, der vor Schmerzen schreit, nehmen wir dann an, dass er Schmerzen hat? Stellen wir in einem solchen Fall eine Hypothese auf? Was wollten wir noch, und was könnten wir noch haben, um diese angebliche Vermutung oder Hypothese zu bestätigen? Mehr Schmerzensschreie? Der Gedanke, dass wir aufgrund eines induktiven oder analogen Schlusses oder aufgrund einer Annahme wissen, dass andere Menschen bei Bewusstsein sind und dass sie ‚bewusste Erfahrung‘ haben und sich ‚in bewussten Geisteszuständen‘ befinden, offenbart das ganze Ausmaß, in dem wir von einem abwegigen Bild hypnotisiert sind, und macht deutlich, wie wir uns im Geflecht der Begriffe verfangen können, deren Verwendung uns im Alltag vor keinerlei Probleme stellt. Reaktion und Erwiderung auf andere geht dem Denken voraus Wir sollten uns an einige Binsenweisheiten erinnern. Wir reagieren auf die offenkundigen ‚Erfahrungen‘ anderer, auf ihren offen zutage tretenden Zorn und ihre augenscheinliche Trauer, ihren Schmerz und ihre Freude, ihr Vergnügen und ihre Erregung instinktiv – lange bevor wir in der Lage sind, aus ihrem Verhalten zu schließen, Analogieschlüsse aus unserem eigenen Fall zu ziehen oder anspruchsvolle Annahmen zu machen. Ein kleines Kind reagiert auf den elterlichen Zorn ängstlich, erwidert das liebevolle Lächeln oder das zärtliche Lachen seiner Mutter, indem es selbst freudig lächelt, offenbart sofortige unüberlegte Ängstlichkeit, wenn die Mutter weint. Auf diesen natürlichen, instinktiven Reaktionen beruht der sukzessive Erwerb psychologischer Begriffe. Und die Beherrschung dieser Begriffe in der ersten Person (die keine Evidenz und keine Identitätskriterien einbegreift) lässt sich nicht von der Beherrschung ihres Gebrauchs in der dritten Person trennen (die mit dem Erkennen der Verhaltenskriterien einhergeht, die logisch begründete Evidenz für ihre Zuschreibung zu anderen konstituieren). Die Vorstellung, dass das Neugeborene oder sein Gehirn ein Modell seiner Mutter oder ihres Geistes (oder Gehirns) ‚konstruieren‘ muss, um die Reaktionen und das Verhalten von ihr ‘voraussagen‘ zu können, ist eine Absurdität, die wesentlicher Bestandteil einer offenkundigen Überinterpretation menschlichen Verhaltens, empathischer und instinktiver menschlicher Reaktionen und der Sprachwurzeln ist. Es ist weder eine Annahme noch eine Hypothese, dass andere Tiere bewusste Wesen sind Was auf die Zuschreibung von Bewusstsein und bewusster Erfahrung zu anderen Menschen zutrifft, trifft nicht weniger auf die entsprechenden Zuschreibungen zu höher entwickelten Tieren zu. Es ist nicht nur ‚eine begründete Annahme‘ oder bloß ‚sehr wahrscheinlich‘, dass Affen, die sich wie wache Affen verhalten, bei Bewusstsein sind. Schließlich schlafen sie nicht und sind auch nicht bewusstlos. Ist es nicht unübersehbar, dass sie Dinge sehen? Sind sie nicht verspielt oder verärgert? Ist es nicht so, dass sie et-
436
11 Rätselraten um das Bewusstsein
was haben wollen und es zu bekommen versuchen? Sind sie sich denn nicht Dingen in ihrer unmittelbaren Umgebung bewusst (des Futters, das man ihnen zur Fütterungszeit bringt) und anderer Dinge nicht bewusst (eines anderen Affen, der sich in ihrem Rücken anschleicht, um ihre Banane zu ergattern)? Das ist keine Annahme und nichts daran ist ungewiss. Wir brauchen auch nicht die wissenschaftliche Gemeinschaft, um uns zugunsten irgendeiner solchen Annahme zu entscheiden, damit wir ganz sicher wissen, dass es sich bei solchen Tieren um bewusste Wesen handelt – wir wissen es bereits. Wir können das Vergnügen sehen, das ein Hund hat, wenn sein Herrchen mit ihm Bringden-Stock spielt, so wie wir seine Freude sehen können, wenn er zu ihm zurückeilt, mit seinem Schwanz wedelt und vor Aufregung bellt. Wir wissen mithin auch ganz genau, dass die schnurrende Katze ihr Gestreicheltwerden genießt, und es ist nicht weniger offensichtlich, dass sie verärgert ist und droht, wenn sie faucht und ihre Haare aufstellt. Das Wissen, dass andere Tiere bei Bewusstsein sind, ist kein Analogiewissen Unser Wissen, dass höher entwickelte Tiere bewusste Wesen sind, basiert nicht auf einer Analogie mit uns, ebenso wenig wie unser Wissen, dass menschliche Babys bewusste Wesen sind, Schmerzen empfinden, wahrnehmen, über dieses und jenes verärgert oder erfreut sind, in Wirklichkeit nur ein bloßer Glauben ist, der auf einem heiklen Analogieargument von unserem eigenen Fall her beruht. Menschliche Babys und Tiere erfüllen gleichermaßen die Verhaltenskriterien für das Empfinden, für sehen und hören und für zornig sein, Angst haben und sich elend fühlen. Es ist zu sehen, dass sie bei Bewusstsein sind und dass sie sich Wahrnehmungs- und Affektionserfahrungen erfreuen oder sie erleiden. Wir sehen, dass es so ist und können unsere Zuschreibungen solcher Erfahrungen zu ihnen rechtfertigen, indem wir uns auf die Verhaltenskriterien beziehen, die sie exemplifizieren – nicht aufgrund einer Analogie mit unserem eigenen Fall.
12 Selbstbewusstsein 12.1 Selbstbewusstsein und das Selbst Selbstbewusstsein im philosophischen Sinne Wir haben viele Begriffsmerkmale des unterschiedlich aufgefassten Bewusstseins untersucht. Mit einer Untersuchung der Selbstbewusstseinsvorstellung haben wir jedoch noch gewartet. Dieses schwierige Thema beschäftigt Psychologen, Kognitions- und Neurowissenschaftler schon über ein Jahrhundert lang. Sein philosophischer Stammbaum reicht sogar noch weiter zurück. Die Rede ist von dem, was wir zuvor das philosophische ‚Selbstbewusstsein‘ genannt haben, da es sich von der gewöhnlichen oder gebräuchlichen Auffassung [von self-consciousness] abhebt, die [im Englischen] Peinlichkeit ausdrückt, und von dem Verständnis, in dem wir [im Englischen] von einem Künstler oder Autor sagen, dass er ein hochgradig self-conscious/bewusster, reflektierter Schöpfer ist. Es ist verwandt mit dem Sinn von ‚Selbstbewusstsein‘, in dem wir einer introspektiven Person Selbstbewusstsein bzw. Selbstreflektiertheit zuschreiben – das heißt einer Person, die dazu neigt, über ihre Motive oder Gründe, Vorlieben oder Abneigungen, über ihre Charakterzüge und ihre Beziehungen zu anderen nachzudenken. Eine solche Person tendiert zur häufigen Ausübung eines Vermögens, über das normal veranlagte Sprecher einer entwickelten Sprache notwendigerweise verfügen, aber relativ selten ausüben. Die Äußerung, dass Menschen selbstbewusste Wesen sind, soll nicht suggerieren, dass uns allen die introspektive Konstitution eines Proust eignet. Vielmehr soll damit zum Ausdruck kommen, dass wir die Fähigkeit zu solchem Nachdenken haben (in einem meist viel geringeren Ausmaß und mit weitaus weniger Geschick und Raffinesse verbunden als bei Proust) und zudem die verbreitetere Fähigkeit (von der die eben genannte ein Spezialfall ist), beim Denken und Handeln Tatsachen in Betracht zu ziehen, die uns selbst betreffen, unsere vergangenen und gegenwärtigen Erfahrungen sowie unsere Charakterzüge und Dispositionen. Denn im Gegensatz zu anderen Tieren können wir uns der Tatsache bewusst sein, dass wir fröhlich oder niedergeschlagen sind, dass wir über ein bestimmtes Thema gut Bescheid wissen oder schlecht informiert sind, dass wir an gewisse Dinge glauben oder an ihnen zweifeln, dass wir bestimmte Charakterzüge und Veranlagungen haben, dass wir in der Vergangenheit verschiedene Dinge getan und erlebt haben. Solche uns betreffenden Tatsachen, von denen wir Kenntnis haben, können für unsere Überlegungen von Bedeutung sein und uns beim Nachdenken beschäftigen; sie können unsere Gründe dafür sein, hier und jetzt auf die und die Weise zu handeln, zu fühlen oder zu denken. Sie können unser folgerndes Denken als Prämissen anleiten und
438
12 Selbstbewusstsein
die Rechtfertigungen für unsere Handlungen und Reaktionen abgeben – und das ist für unser Sein als selbstbewusste Kreaturen mitkonstitutiv. Selbstbewusstsein und ‚das Selbst‘ Die Debatte über die Natur des Selbstbewusstseins ist von tief reichenden Begriffskonfusionen belastet. Denn sowohl Philosophen als auch Nichtphilosophen neigen dazu, das Selbstbewusstsein als Bewusstsein von einem Etwas auszulegen, das sie als ‚Selbst‘, ‚Ich‘ oder ‚Ego‘ bezeichnen. Dieses Ding besitzt angeblich jeder, von dem man sagen kann, dass er ein Selbst hat – ich habe mein Selbst und Sie haben Ihr Selbst. Mein Selbst wird als etwas aufgefasst, das ‚in mir‘ ist, von dem ich Kenntnis oder ein Bewusstsein erlangen kann oder mit dem ich angeblich stets vertraut bin. Als aber die Philosophen und Psychologen sich anschickten, dieses seltsamen Dinges habhaft zu werden, stellten sie fest, dass es außerordentlich schwer zu fassen ist. Und jüngere von Neurowissenschaftlern unternommene Anstrengungen, die Aufschluss bringen sollten, waren gleichermaßen erfolglos – so werden wir zumindest einwenden. Das ist keine Überraschung, denn wie wir noch zeigen werden, ist das ‚Selbst‘ oder das ‚Ich‘ (so aufgefasst) eine auf Begriffskonfusionen zurückgehende Fiktion. Gewiss gibt es so etwas wie Selbstbewusstsein im philosophischen Sinne des Ausdrucks, dabei handelt es sich jedoch nicht um ein Bewusstsein von einem ‚Selbst‘, sondern um eine den Menschen allein auszeichnende Fähigkeit zu reflexivem Denken und Wissen, die mit dem Sprachbesitz steht und fällt. Bevor wir neuere wissenschaftliche Reflexionen zu diesem heiklen Thema untersuchen, ist ein kurzer Überblick über die Ursprünge dieser philosophischen Tradition angebracht. Denn viele der Verwirrungen, denen Neurowissenschaftler, Kognitionswissenschaftler und Psychologen anheimfallen, wiederholen die Irrtümer früherer Philosophen.
12.2 Das historische Bühnenbild: Descartes, Locke, Hume und James Das cartesianische Ego ist eine immaterielle Substanz Von Descartes an haben sich die Philosophen sehr darum bemüht, Aufschluss über das Subjekt der Erfahrung zu geben. Descartes argumentierte zutreffend, dass ein Gedanke nicht ohne ein denkendes Ding existieren kann – eine Substanz (eine Entität, die Dauer hat und der Träger von Attributen ist), der er innewohnt. Er behauptete, dass das Bewusstsein von den eigenen Gedanken den Beweis für die Existenz des Denkenden als eine Substanz liefert, die mit dem Wort ‚ich‘ benannt oder ausgedrückt wird. Was dieses ‚Ich‘ jedoch ist, müsse untersucht werden, denn „ich muss mich hüten, dass ich nicht etwa unvorsichtigerweise etwas anderes für mich selbst ansehe und auf diese Weise sogar in der Erkenntnis abirre, von der ich behaupte, sie sei die gewisseste und einleuch-
12.2 Descartes, Locke, Hume und James
439
tendste von allen.“468 Denn während er glaubte, an der Existenz der materiellen Welt zweifeln zu können und folglich auch daran, dass sein Körper existiert, „kann ich nicht bezweifeln, dass ich bin‘, denn um zweifeln zu können, muss es ein Zweifelndes geben. Und er folgerte, dass „dieses ‚Ich‘, d. h. die Seele, durch die ich das bin, was ich bin, völlig verschieden ist vom Körper“.469 Es handelt sich, so hielt er fest, um eine immaterielle denkende Substanz, die eng mit dem Körper verbunden, aber von ihm unterschieden ist. Eine grammatische Fehlform: „Das ‚Ich‘“ Wir sollten an dieser Stelle gleich darauf hinweisen, dass die Wendung „dieses ‚Ich‘“ grammatisch ebenso inkorrekt ist wie „dieses ‚Er‘ (dieses ‚Sie‘ oder ‚Es‘)“ oder „dieses ‚Jetzt‘ (dieses ‚Hier‘ oder ‚Dort‘)“. Eine ähnliche grammatische Abirrung kommt zustande, wenn man (wie es so viele tun) von „dem ‚Ich‘“ spricht (vergleiche „das ‚Er‘“, „das ‚Du‘“, „das ‚Sie‘“ oder „das ‚Es‘“). Und das Ganze wird nicht wirklich besser, wenn man sich mit dem Lateinischen zu behelfen versucht und von „dem ‚Ego‘“ spricht. Drei Schwierigkeiten für die cartesianische Doktrin Die Vorstellung, dass „das ‚Ich‘“ eine immaterielle Substanz ist, führt zu unüberwindlichen Problemen. Drei ins Auge springende werden wir kurz erörtern. Das Erste-Person-Pronomen ist nicht referenziell uneindeutig Erstens suggeriert sie unplausiblerweise, dass das Erste-Person-Pronomen im alltäglichen Gebrauch systematisch nicht eindeutig verwendet wird, insofern als es sich manchmal ‚richtigerweise‘ auf die immaterielle Substanz, die ich angeblich bin, bezieht (z. B. in dem Satz ‚Ich denke gerade an Daisy‘) und manchmal verwirrenderweise auf meinen Körper (z. B. in ‚Ich bin 1,90m groß‘, was dieser Ansicht nach genauer oder deutlicher mit ‚Mein Körper ist 1,90m groß‘ wiederzugeben ist). Daher müssen solche umgangssprachlichen Sätze wie ‚Ich lege mich absichtlich hin‘ einen Doppelbezug implizieren, der eine vereindeutigende Begriffserklärung erforderlich macht: nämlich, dass die geistige Substanz (das ‚Ich‘) beabsichtigte, dass sein Körper sich hinlegt, und dass sich daraufhin die materielle Substanz, sprich sein Körper, hinlegt. Einer ganz ähnlichen und gleichermaßen unplausiblen Überlegung nach muss es sich bei sämtlichen auf MenDescartes, ‚Second Meditation‘, in Meditations on First Philosophy, AT VII, 175f. [dt. ‚Zweite Meditation‘ in Meditationen über die Grundlagen der Philosophie (Meiner, Hamburg, 1993), S. 22]. 469 Descartes, Discourse on Method, AT VI, 33 [dt. Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung (Meiner, Hamburg, 1990), S. 55]. 468
440
12 Selbstbewusstsein
schen anwendbaren Verben entweder um solche handeln, die auf rein materielle Körper anwendbar sind (z. B. Verben der Bewegung), oder um solche, die nur auf den Geist anwendbar sind, oder sie müssen einer der beiden Gruppen zugeordnet werden können. Der Interaktionsgedanke ist fragwürdig Zweitens ergaben sich durch den Gedanken der Interaktion zwischen der immateriellen Substanz und dem Körper, mit dem sie verbunden ist, unlösbare Schwierigkeiten (einige von ihnen machte Aristoteles in seiner Kritik des platonischen Dualismus namhaft). Denn Descartes konnte keine Rechenschaft darüber geben, wie eine immaterielle denkende Substanz kausal mit dem materiellen Körper interagieren und wie sie insbesondere Bewegung in ihm erzeugen und steuern könnte. Er vertrat die Ansicht, dass die Verbindungsstelle zwischen den beiden Substanzen die Zirbeldrüse im Gehirn ist, von der er – wie wir angemerkt haben (1.2) – fälschlicherweise vermutete, dass sie sich in den Lebensgeistern im vorderen Ventrikel schwebend halte. Der Gedanke von der kausalen Interaktion zwischen einer immateriellen Substanz und dem materiellen Körper gewinnt nicht dadurch an Plausibilität und Nachvollziehbarkeit, dass man erklärt, die immaterielle Substanz interagiere nur mit einem Teil des materiellen Körpers. Es gibt keine adäquaten Identitätskriterien für immaterielle Substanzen Drittens lieferte Descartes weder Kriterien für die Identifizierung einer besonderen geistigen Substanz und ihre Unterscheidung von anderen geistigen Substanzen der gleichen allgemeinen Art noch für ihre Re-Identifizierung als dieselbe bei einer späteren Gelegenheit. Es war also nicht möglich zu begründen, dass es ‚in mir‘ – in Abgrenzung zu tausend anderen Wesen, die alle dieselben Gedanken denken – eine geistige Substanz gibt; oder dass es ‚in mir‘ eine ununterbrochen existierende geistige Substanz gibt, in Abgrenzung zu einer anders gearteten geistigen Substanz, der allmorgendlich die vorhergehende ihre sämtlichen Erinnerungen weitergegeben hatte (wie eine Billardkugel ihren Impuls auf die nächste Kugel, auf die sie prallt, weitergibt). Der cartesianische Weg zum Ego war ein epistemologischer Der cartesianische Weg zum ‚Ich‘ oder ‚Ego‘ war epistemologisch – das heißt an Betrachtungen geknüpft, die Wissen, Zweifel und Gewissheit betreffen. Denn der Beweis der Existenz des ‚Ich‘ beruhte auf der Unterscheidung zwischen dem, was bezweifelt, und dem, was nicht bezweifelt werden kann, und der Beweis, dass ich wesentlich ein denkendes Ding bin, eine Res cogitans, beruhte auf der Vorstellung, dass ich sicher wissen kann, dass ich denke, jedoch nicht sicher wissen kann, dass ich einen Körper habe.
12.2 Descartes, Locke, Hume und James
441
Der Locke’sche Weg zum ‚Selbst‘ war ein psychologischer Eine Generation später schlug John Locke eine andere Richtung ein, was eine ebenso fundamentale Fehlkonzeption über die Natur des Erfahrungssubjekts mit sich brachte. Lockes Weg zum ‚Selbst‘ war psychologisch und nicht epistemologisch. Denn seine Konzeption des Selbst geht nicht auf Reflexionen darüber zurück, wovon man unbezweifelbares Wissen erlangen kann (nämlich von den eigenen Gedanken und der eigenen Existenz als ein denkendes Ding), sondern erwuchs aus dem Nachdenken über die Introspektion, die er als eine Form der Wahrnehmung missverstand. Er behauptete, dass „jemand unmöglich wahrnehmen kann, ohne wahrzunehmen, dass er es tut. Wenn wir etwas sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, überlegen oder wollen, so wissen wir, dass wir das tun, [. . .] jeder wird dadurch für sich selbst zu dem, was er sein Selbst [self] nennt.“470 Es ist das Bewusstsein von den eigenen Erfahrungen, dass „jeden zu dem macht, was er sein Selbst nennt und wodurch er sich von allen anderen denkenden Wesen unterscheidet“.471 Es ist in der Tat „durch sein Bewusstsein von seinen gegenwärtigen Gedanken und Handlungen, [dass er] für sich sein eigenes Selbst [ist]. Er bleibt dasselbe Selbst, soweit sich dasselbe Bewusstsein auf vergangene oder künftige Handlungen erstrecken kann.“472 Man sollte nicht unerwähnt lassen, dass es sich bei diesem Gebrauch von ‚Selbst‘ als ein Nomen, das scheinbar eine irgendwie geartete fortdauernde Entität benennt, um eine philosophische Innovation handelte, und um eine Abirrung, wie wir weiter unten noch darlegen werden. Anders als Descartes ging Locke nicht davon aus, dass ein ‚Selbst‘ eine denkende Substanz sei, sondern davon, dass es einer (materiellen oder immateriellen) Substanz, die sich verändern kann, ohne dass das ‚Selbst‘ sich verändert, lediglich ‚angehängt‘ ist. Denn wenn mein Bewusstsein davon, dass ich dies und jenes in der Vergangenheit gemacht habe, mit dem Bewusstsein davon identisch ist, dass ich gerade schreibe, wenn ich also ‚dasselbe Bewusstsein‘ habe, könnte ich dann gar nicht daran zweifeln, dass ich [. . .] dasselbe Selbst bin. Dabei ist es gleichgültig, aus welcher Substanz es besteht. Ja, an der eben erwähnten Tatsache könnte ich ebenso wenig zweifeln wie daran, dass ich, der ich dieses schreibe, während solcher Tätigkeit derselbe bin, der ich gestern war, einerlei, ob ich nun rein aus einer materiellen oder einer immateriellen Substanz bestehe oder nicht. Denn für die Identität des Selbst kommt es nicht darauf an, ob das gegenwärtige Selbst aus derselben Substanz oder aus verschiedenen Substanzen besteht.473
470
Locke, An Essay Concerning Human Understanding [dt. Versuch über den menschlichen Verstand], II. xxvii. 9. 471 Ibid. 472 Ibid., II. xxvii. 10. 473 Ibid., II. xxvii. 16.
442
12 Selbstbewusstsein
Die Hume’sche Infragestellung Hume stellte Lockes Vorstellung infrage, dass man sich eines ‚Selbst‘ introspektiv bewusst ist. In einer der berühmtesten Passagen der gesamten Philosophie schrieb er: Ich meines Teils kann, wenn ich mir das, was ich als mich [myself] bezeichne, so unmittelbar als irgend möglich vergegenwärtige, nicht umhin, jedes Mal über die eine oder andere Wahrnehmung zu stolpern, die Wahrnehmung der Wärme oder Kälte, des Lichtes oder Schattens, der Liebe oder des Hasses, der Lust oder Unlust. Niemals treffe ich mich ohne eine Wahrnehmung an und niemals kann ich etwas anderes beobachten als eine Wahrnehmung. [. . .] Wenn jemand nach ernstlichem und vorurteilslosem Nachdenken eine andere Vorstellung von sich selbst [himself] zu haben meint, so bekenne ich, dass ich mit ihm nicht länger zu streiten weiß. [. . .] Er nimmt vielleicht etwas Einfaches und Dauerndes in sich wahr, was er sich selbst nennt; darum bin ich doch gewiss, dass sich in mir kein derartiges Moment findet.474
Man sollte nicht unerwähnt lassen, dass Humes Suche nach einem ‚Selbst‘ in sich ein ebenso schimärenhaftes Unterfangen ist wie eine Suche nach dem Ostpol. Denn man kann nur dann nach etwas suchen, wenn man eine Vorstellung davon hat, was als sein Ausfindigmachen zu betrachten sei (selbst wenn die Suche erfolglos bleibt). Man kann nach Eldorado suchen, wo die Straßen mit Gold gepflastert sind, aber weder nach dem Ostpol noch, kraft dessen, was man als Introspektion (miss)versteht, nach einem ‚Selbst‘. Denn wir wissen absolut nicht, was wir uns unter einer solchen Begegnung mit einem Selbst vorstellen sollten. James über ‚das Selbst‘ Descartes’ Konzeption des Selbst als einer immateriellen Substanz wird heutzutage von den meisten Philosophen zu Recht verworfen und findet auch bei den meisten Wissenschaftlern wenig Anklang. Seine verfehlte Rede von „dem ‚Ich‘“ hat jedoch noch keine Zurückweisung erfahren. Lockes psychologischer, introspektiver Weg zum ‚Selbst‘ und seine verworrene Rede vom ‚Selbst‘ blieben ungeachtet der Kritik Humes populär und sind es noch immer. So behauptete beispielsweise William James Ende des 19. Jahrhunderts (obgleich er die scharfe Kritik Humes kannte), dass wir dann, wenn wir reflektierend „an Subjektivität als solche denken, [. . .] an uns selbst als Denkende denken“, im Bewusstseinsstrom auf einen bestimmten abgesonderten Bereich [stoßen], der darum als etwas ganz Besonderes erkannt und von allen Menschen als eine Art innere Zitadelle im Kreislauf alles subjektiven Lebens angesehen wird, als eine Art heiliger Raum innerhalb der Zitadelle. Verglichen mit diesem Element des Stroms sind die anderen Teile, selbst die des subjektiven Lebens, dem Anschein nach vergänglicher, äußerlicher Besitz, der sämtlich abgestoßen werden kann, während dasjenige, was abstößt, fortbesteht.475 474 475
Hume, Treatise of Human Nature [dt. Ein Traktat über die menschliche Natur], I. iv. 6. W. James, The Principles of Psychology (Holt, New York, 1890), Bd. I, S. 297.
12.2 Descartes, Locke, Hume und James
443
Dieses nannte er „das Selbst all der anderen Selbste“ und versuchte herauszufinden, worin es besteht. Er behauptete, es handele sich um „das aktive Element im Bewusstsein“; „es herrscht über die Wahrnehmung der Empfindungen und indem es seine Zustimmung erteilt oder verweigert, beeinflusst es die Bewegungen, die diesen für gewöhnlich nachfolgen“, „es ist die Quelle von Anstrengung und Aufmerksamkeit und es ist der Ort, von dem die Befehle des Willens auszugehen scheinen“. Dieses Zentrums-Selbst wird seiner Ansicht nach gefühlt. „Es ist etwas, das wir fühlend unmittelbar erfassen und das in jedem Bewusstseinsmoment, in dem es präsent ist, vollkommen präsent ist, solange solche Momente dauern. [. . .] es zu entdecken, heißt, es zu fühlen.“ Was also ist dieses Selbst-Gefühl? James’ introspektive Nachforschung mündete in die Feststellung, dass „sich das ‚Selbst der Selbste‘ sorgfältiger Untersuchung in der Hauptsache als die Menge der [. . .] eigentümlichen Bewegungen im Kopf oder zwischen dem Kopf und der Kehle offenbarte“.476 Diese Einschätzung hätte man als Reductio ad absurdum der ‚inneren‘ Suche nach einem ‚Selbst‘ auffassen sollen, was jedoch nicht geschah – und so suchen die Neurowissenschaftler noch immer.477 476 Ibid., S. 301. Interessanterweise gelangt Wundt, den James zitiert (S. 303 Anm.), in seiner Physiologischen Psychologie zu ganz ähnlichen Folgerungen. Seiner Meinung nach ‚unterscheiden sich die Bilder von Gefühlen, die wir von unserem eigenen Körper erhalten, sowie die Repräsentationen unserer eigenen Bewegungen von allen anderen dadurch, dass sie eine fortdauernde Gruppe bilden . . . Überdies hat dieses Fortwährende die Besonderheit, dass wir uns unserer Fähigkeit bewusst sind, in jedem Moment willkürlich irgendeines seiner Bestandteile hervorzurufen . . . Daher nehmen wir diese fortwährende Anhäufung von Gefühlen als etwas wahr, das unmittelbar oder entfernt unserem Willen unterworfen ist und nennen dies das Bewusstsein unseres Selbst. Dieses Selbstbewusstsein ist von vornherein ganz und gar empfindungsbezogen . . . erst nach und nach gewinnt dessen Unterwerfung unter unseren Willen die Oberhand . . . Dieses Bewusstsein, verengt auf den Prozess der Apperzeption, nennen wir unser Ego.‘ 477 Es ist beunruhigend, wenn ein so herausragender Kognitions- und Neurowissenschaftler wie Baars behauptet: ‚James’ Denken ist von ungebrochener Aktualität; es ist beschämend, aber wahr, dass er der Gemeinschaft der Wissenschaftler meist immer noch voraus ist‘ (B. J. Baars, In the Theater of Consciousness (Oxford University Press, New York, 1997), S. 16). Edelman stellt ebenso anerkennend fest, dass James’ ‚Gedanken zum Bewusstsein – dass es ein Prozess und keine Substanz ist; dass es personal ist und Intentionalität aufweist – unsere moderne Betrachtungsweise dieses Gegenstands beeinflussen‘ (G. Edelman, Bright Air, Brilliant Fire – on the Matter of the Mind (Penguin, Harmondsworth, 1994), S. 16 [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer (Piper, München, 1995), S. 23]). Auch wir sind der Meinung, dass es beschämend, aber wahr ist, dass James’ Fehlkonzeptionen die moderne neurowissenschaftliche Sicht auf das Bewusstsein so stark beeinflussen. Interessanterweise sind James’ Schriften aus Wittgensteins Perspektive voller philosophischer Verwirrungen über die Psychologie (MS 124, S. 291; MS-Nummer im Katalog von Wrights: G. H. von Wright, Wittgenstein (Blackwell, Oxford, 1982). James behauptete, schrieb Wittgenstein in sein Notizbuch, dass die Psychologie eine Wissenschaft ist, obschon sie kaum wissenschaftliche Fragen erörtert. All seine Bemühungen sind Versuche, sich aus dem Spinnennetz der Metaphysik zu befreien, in dem er sich verfangen hat. ‚Er ist überhaupt nicht imstande zu lau-
444
12 Selbstbewusstsein
Die Verwirrungen überleben in den Reflexionen der Neurowissenschaftler Dass diese Jahrhunderte währende Debatte mit schweren Verwirrungen einherging, bräuchte lediglich die Historiker zu interessieren, die sich mit Ideen und Philosophen auseinandersetzen, wären die heutigen Reflexionen zur Natur des Bewusstseins seitens der Neurowissenschaftler und anderer, die sich mit den Bewusstseinsproblemen befassen, nicht von ähnlichen Verwirrungen geprägt.
12.3 Gegenwärtige wissenschaftliche und neurowissenschaftliche Reflexionen zur Frage, wodurch das Selbstbewusstsein charakterisiert ist Andere Tiere sind bewusste, Menschen aber selbstbewusste Wesen Wissenschaftler und Neurowissenschaftler, die derzeit untersuchen, was es mit dem Bewusstsein auf sich hat und welche neuralen Bedingungen ihm zugrunde liegen, müssen zwangsläufig auch das Selbstbewusstsein und seine Charakteristika in ihre Betrachtungen einbeziehen. Denn trotz gelegentlich vorgebrachter Einwände kann es keinen triftigen Grund für die Annahme geben, dass es sich bei Tieren nicht um bewusste Wesen handelt oder dass sie sich keiner Bewusstseinszustände erfreuen oder dass sie sich nicht irgendetwas transitiv bewusst sein können. Sie haben Empfindungen, können durstig und hungrig sein und haben Wahrnehmungs- und Gefühlserfahrungen. Der größte Teil der experimentellen Arbeiten zu den neuralen Erscheinungsformen der Wahrnehmungserfahrungen wird an Tieren und nicht an Menschen vollzogen; demnach geht vieles von dem, was wir über die neurale Wahrnehmungsgrundlage und über das Bewusstsein ganz allgemein verstanden haben, auf Tierexperimente zurück. Das macht die Ansicht vieler Wissenschaftler, dass es lediglich wahrscheinlich ist, dass Tiere Bewusstsein haben, nur umso paradoxer. Denn wenn sie tatsächlich keines haben, dann ist es auch nur wahrscheinlich, dass die neuralen Grundlagen des Bewusstseins so sind, wie diese Wissenschaftler glauben, herausgefunden zu haben – indem sie an Tieren forschten. Trotzdem neigen die meisten Menschen, Wissenschaftler eingeschlossen, mit Recht dem Gedanken zu, dass es etwas gibt, das die menschliche Erfahrung einzigartig macht. Bloße Tiere sind bewusste Wesen, Menschen aber sind selbstbewusste Wesen. Sie sehen und hören nicht nur, fühlen nicht nur Freude und Schmerz, sind nicht nur gut gelaunt fen oder zu fliegen‘, bemerkte Wittgenstein, ‚er windet sich nur‘ (MS 165, S. 150f.). Wir haben es hier nicht mit einer Übertreibung zu tun, für die sich sonst keine Beispiele finden ließen: für weitere Einzelheiten der vernichtenden Kritik an James’ Konzeptionen siehe P. M. S. Hacker, Wittgenstein: Meaning and Mind (Blackwell, Oxford, 1990) und idem, Wittgenstein: Mind and Will (Blackwell, Oxford, 1996), im Index jeweils unter ‚James’.
12.3 Gegenwärtige Reflexionen zur Charakterisierung des Bewusstseins
445
oder niedergeschlagen, können nicht nur an dieses oder jenes denken, sondern sie sind oder können sich auch bewusst sein, dass sie das tun bzw. dass es ihnen so ergeht. Sie können über die Tatsache nachdenken, dass sie sich an etwas erfreuen, können über ihre Gefühle und Veranlagungen nachdenken, können sich der Tatsache bewusst sein, dass sie aus diesem oder jenem Vergnügen ziehen und darüber nachdenken. So unterscheiden die Neurowissenschaftler zwischen ‚Kern-Bewusstsein‘ und ‚erweitertem Bewusstsein‘478 (Letzteres ist das, was „einem Organismus einen höheren Selbst-Sinn vermittelt“) oder zwischen ‚Primärbewusstsein‘ und ‚Bewusstsein höherer Ordnung‘479 (Letzteres ist das, was einen Menschen in die Lage versetzt, „eine im gesellschaftlichen Zusammenhang gründende ‚Selbstheit‘ zu konstruieren, ein Modell der Welt in Bezug auf Vergangenheit und Zukunft zu entwerfen“). Damasios Konzeption des Selbstbewusstseins Damasio vertritt die Auffassung, dass die Neurobiologie des Bewusstseins sich mit zwei fundamentalen Allgemeinproblemen konfrontiert sieht: „der Frage, wie der Film-imGehirn erzeugt wird, und der Frage, wie das Gehirn das Gefühl erzeugt, dass es einen Besitzer und Beobachter für diesen Film gibt“.480 Das erweiterte Bewusstsein, wie er es nennt, „vermittelt dem Organismus einen höheren Selbst-Sinn“. Ähnlich wie Locke glaubt Damasio, dass es außer den „Bildern dessen, was wir in der Außenwelt wahrnehmen“, auch noch „diese andere Präsenz [gibt], die Sie als Beobachter der vorgestellten Dinge ausweist, als potenziellen Urheber der Handlungen, die an den vorgestellten Dingen vorgenommen werden können. Es gibt eine Präsenz Ihrer selbst in einer bestimmten Beziehung zu einem Objekt. Wenn es eine solche Präsenz nicht gäbe, wie könnten Ihre Gedanken dann Ihnen gehören?“ Und wie James ist er der Ansicht, dass das Selbst ein Gefühl ist: „die einfachste Form einer solchen Präsenz ist ebenfalls ein (Vorstellungs-) Bild, und zwar die Art von Bild, die ein Gefühl konstituiert. So gesehen ist Ihre Präsenz das Fühlen dessen, was geschieht [the feeling of what happens], wenn ihr Sein durch die Wahrnehmungsakte verändert wird. Die Präsenz dauert vom Augenblick des Erwachens bis zu dem Moment, da der Schlaf eintritt. Es muss diese Präsenz geben oder es gibt Sie nicht.“481
478
A. Damasio, The Feeling of What Happens (Heinemann, London, 1999), S. 16 [dt. Ich fühle, also bin ich (List, München, 1999), S. 28f.]. 479 Edelman, Bright Air, Brilliant Fire, S. 124 [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer (Piper, München, 1995), S. 180]. 480 Damasio, Feeling of What Happens, S. 11 [dt. Ich fühle, also bin ich, S. 23]. 481 Ibid., S. 10 [dt. S. 22].
446
12 Selbstbewusstsein
Humphreys Konzeption des Selbstbewusstseins Eine weniger jamessche und vielleicht eher lockesche Sichtweise vertritt Humphrey. Im Hinblick auf sein eigenes Verhalten stellt er folgende Überlegung an: Ich werde mir nicht nur der äußeren Umstände meiner Handlungen bewusst, sondern auch einer bewussten Präsenz, eines bewussten ‚Ich‘, das jene Handlungen ‚will‘. Dieses ‚Ich‘ hat Gründe für das, was es will. Bei den Gründen handelt es sich um Arten des ‚Fühlens‘ – um ‚Empfindungen‘, ‚Emotionen‘, ‚Erinnerungen‘, ‚Verlangen‘. ‚Ich‘ will essen, weil ‚ich‘ hungrig bin, ‚ich‘ habe vor, ins Bett zu gehen, weil ‚ich‘ müde bin [. . .] wenn ich vor der Aufgabe stehe, auf das Verhalten eines anderen Menschen Einfluss zu nehmen, gehe ich natürlich davon aus, dass er nach denselben Prinzipien handelt wie ich. Ich gehe davon aus, dass es auch in ihm ein bewusstes ‚Ich‘ gibt und dass sein ‚Ich‘ Gefühle hat.482
Blakemores Konzeption des ‚Ichs‘ in ihm Eine davon stark abweichende Sichtweise wird von anderen Wissenschaftlern vertreten. Blakemore geht davon aus, dass das Gehirn eine Maschine ist, die Modelle bildet, dass aber der größte Teil dieser Modellbildung ohne unser Wissen vonstattengeht. Allerdings kommt ein Modell häufig ins Blickfeld des bewussten Geistes, und zwar das Modell des Geistes selbst. Der eigentliche Bewusstseins- und insbesondere der Selbstbewusstseinsakt lässt darauf schließen, dass das Gehirn die Fähigkeit besitzt, ein Modell der Person zu entwerfen, der dieses Gehirn gehört, und diese Geistespuppe im Theater des Geistes agieren zu lassen – eine Welt von anderen Menschen, die über dieselbe Denk- und Wollensstruktur verfügen. [. . .] [Das ist] [. . .] der Bereich des Selbstbewusstseins [self-awareness].483
Den Cartesianismus zurückweisend glaubt Blakemore, „dass das ‚Ich‘ in mir die Leistung eines Geistes ist, der selbst wiederum die eines Gehirns ist, und dass es einzig und allein von Genen und Umwelt hervorgebracht wird. Ich finde diese Vorstellung ebenso wundervoll und in vielerlei Hinsicht befriedigender als die leere Illusion eines spirituellen Selbst.“484 Blakemores Konzeption des Selbstbewusstseins Es ist unklar, was Blakemore mit der Behauptung, der Geist besitze ein Modell von sich selbst oder habe es öfter in seinem Blickfeld, zum Ausdruck bringen will. Ebenso unklar ist, was er mit der davon abweichenden Behauptung des nächsten Satzes meint, dass das Gehirn ein Modell (nicht des Geistes, sondern) der Person entwirft, der dieses Gehirn gehört, und ‚diese Geistespuppe im Theater des Geistes agieren lässt‘. Glaubt er wie Des482 483 484
N. Humphrey, Consciousness Regained (Oxford University Press, Oxford, 1984), S. 33. C. Blakemore, The Mind Machine (BBC Publications, London, 1988), S. 249. Ibid., S. 272.
12.3 Gegenwärtige Reflexionen zur Charakterisierung des Bewusstseins
447
cartes, dass eine Person ihr Geist ist? Blakemore ist allerdings unverkennbar davon überzeugt, dass die mit dem Selbstbewusstsein einhergehende Reflexivität impliziert, dass der Akteur ein Modell seiner selbst im Sinn hat (oder ‚in seinem Geist‘). Es wird nicht klar, was hier mit ‚ein Modell‘ gemeint ist, es scheint jedoch evident zu sein, dass man keine Geistespuppen in Theatern des Geistes braucht, um denken zu können ‚Ich bin zu faul, ich muss härter arbeiten‘, ‚Ich war sonst toleranter‘, ‚Ich neige zu vorschnellem Aufgeben‘ oder ‚Meine Gedanken sind verworren‘. Dafür muss man nur das Erste-PersonPronomen gebrauchen können und andere sprachliche Wendungen beherrschen, die als Prädikatszuschreibungen zu einem selbst fungieren (von Gedanken und Erfahrungen beispielsweise (sowohl gegenwärtigen als auch zurückliegenden), von Charakterzügen und Fähigkeiten, Motiven, Einstellungen und Veranlagungen). Johnson-Lairds Konzeption des Selbstbewusstseins Die Vorstellung, dass der Geist oder das Gehirn (bzw. ‚Geist/Gehirn‘) Modelle oder Repräsentationen hervorbringt, ist seit den Schriften des Cambridge-Psychologen Kenneth Craik und des großen Mathematikers Alan Turing Mitte des letzten Jahrhunderts bekannt. Von dieser Tradition her erklärt Johnson-Laird, dass „die Selbstreflexion den Zugang zu einer besonderen geistigen Repräsentation erfordert – einer Repräsentation, die gewissermaßen ein Verarbeitungssystem des Selbstverstehens aktiviert“. Auf der unklaren Annahme basierend, dass der Geist ein ‚Verarbeitungssystem‘ ist, „beruht [. . .] unsere Selbstreflexion [. . .] auf einem geistigen Modell [. . .] Ein Modell wird dadurch zu einem Modell, dass es von einem Interpretationssystem verwendet werden kann.“ Versucht man diese Darstellung computertechnisch zu rekonstruieren, bekommt das Ganze, wie er zugesteht, einen „paradoxen Anstrich“, denn eine Option des Betriebssystems besteht darin, sein Modell von sich zum Problemlösen zu verwenden, und diese Option muss wiederum auch Teil des Modells sein. Diese Bedingung eröffnet keinen Circulus vitiosus, sondern sie führt zu einem speziellen Verarbeitungsmodus, der für Selbstreflexion und Selbstbewusstsein ausschlaggebend ist. Er besteht darin, dass das Betriebssystem die Konstruktion eines Modells seiner eigenen Operationen in die Wege leitet, das es zur Steuerung seiner Verarbeitungsprozesse verwendet. Diese ‚selbstreflektierende‘ Arbeitsweise kann das System auf seine eigenen Arbeitsergebnisse [output] anwenden, sodass es ein Modell seiner Verwendung solcher Modelle und so fort auf höher werdenden Repräsentationsebenen konstruieren kann.485
Wir haben es hier jedoch mit abstrakten Spekulationen und nicht mit den wirklichen Verhältnissen zu tun – mit einem weitgefassten, der Informatik entlehnten Bild, dessen Übertragung auf die menschliche Psyche total unverständlich ist. Johnson-Laird argumentiert jedoch, dass diese Ansicht von Beobachtungen bewusster Erfahrungen als eine Hypothese über die Natur des menschlichen Selbstbewusstseins untermauert wird. 485
P. N. Johnson-Laird, The Computer and the Mind (Fontana, London, 1988), S. 361.
448
12 Selbstbewusstsein
„Wir haben wirklich die Fähigkeit, über das nachzudenken, was wir gerade tun – auf einer höheren Ebene als der des Tätigkeitsvollzugs –, und sind infolge dieses Nachdenkens dazu in der Lage, unser eigenes Tun zu verändern.“486 Zweifel an der Vermutung, dass das Gehirn Selbstreflexion ermöglichende Modelle konstruiert Auch wir sagen, dass jeder normal veranlagte Mensch das kann. Wir bestreiten jedoch, dass dies in irgendeiner Weise die Hypothese stützt, wonach der Geist oder das Gehirn ein die Selbstreflexion ermöglichendes Modell seiner eigenen Operationen entwirft. Damit eine Person, ein lebendes menschliches Wesen, über ihre eigenen Gedanken oder ihren eigenen Geisteszustand nachdenken kann, bedarf sie keines ‚Modells‘ ihres Geistes, sondern nur der normalen Sprachbeherrschung und normaler menschlicher Fähigkeiten. Reflexives Denken erfordert die Beherrschung sprachlicher Wendungen der Prädikatszuschreibung in der Ich-Form, jedoch keine Modelle, die für die Verwendung durch ein ‚Interpretationssystem‘ entworfen wurden.
12.4 Die ‚Selbst‘-Illusion Das Selbst als etwas, das mit mir identisch ist, das ich habe und das sich in mir befindet In der von Descartes und Locke begründeten philosophischen Tradition und auch von manchen zeitgenössischen Neurowissenschaftlern wird das ‚Selbst‘ als das beständige Subjekt sukzessiver Bewusstseinszustände und bewusster Erfahrungen aufgefasst. Gäbe es kein Selbst, wie könnten dann, fragt Damasio, meine Gedanken und bewussten Erfahrungen mir gehören? Allerdings geht man nicht davon aus, dass das Selbst, das ich bin, mit dem Menschen aus Fleisch und Blut identisch ist, mit dem alle meine Freunde auf vertrautem Fuß stehen. Stattdessen soll es sich um eine Entität handeln, mit der nur ich unmittelbar vertraut bin, eine Entität, welcher ich introspektiv bewusst bin. Man behauptet, dass ich mit meinem Selbst identisch bin; solange mein Selbst existiert, solange existiere auch ich, und sollte mein Selbst zu existieren aufhören, so höre auch ich zu existieren auf. Wenn es keine solche ‚Präsenz‘, kein Selbst gäbe, dann gäbe es auch mich nicht, behauptet Damasio. Das Selbst wird indes auch als etwas verstanden, das ich habe. Denn solche Autoren sprechen von meinem Selbst [my self], Ihrem Selbst [your self] und von den Selbsten anderer Menschen [the selves of other people]. Es ist jedoch unklar, wie ich mit etwas identisch sein kann, das ich habe. Denn wenn ich es habe, wer ist dann der Besitzer dieses Selbst? Und in welcher Beziehung stehen das Selbst und sein Besitzer? Andererseits soll das Selbst wiederum etwas in mir sein. Denn 486
Ibid., S. 362.
12.4 Die ‚Selbst‘-Illusion
449
das Selbst ist, wie Humphrey meint, eine bewusste Präsenz in mir, und er nimmt an, dass es auch ‚in‘ anderen Menschen ein bewusstes ‚Ich‘ gibt. Und Blakemore vertritt die Auffassung, dass es in ihm ein ‚Ich‘ gibt. Es ist jedoch gleichermaßen unklar, wie ich mit etwas identisch sein kann, das in mir ist, denn das würde bedeuten, dass ein Ganzes mit bestimmten konstituierenden Teilen seiner selbst identisch ist. Denn weil das Pronomen ‚mir‘ nichts anderes ist als eine Form des Pronomens ‚ich‘, behauptet, wer vorbringt, dass ich mit etwas identisch bin, das in mir ist, letztlich, dass ich nicht mit mir selbst, sondern mit einem bestimmten Teil meiner selbst identisch bin. Die Inkohärenz der ‚Selbst‘-Vorstellung Die Vorstellung, es gebe ein ‚Selbst‘, geht komplett in die Irre. Es gibt nichts dergleichen wie ein solches ‚Selbst‘ und der unterstellte Begriff eines so ausgelegten ‚Selbst‘ ist inkohärent. Die Verwirrung entsteht u. a. dadurch, dass man die Reflexivpronomen ‚myself‘ [ich selbst]‘ ‚yourself‘ [du/Sie selbst], ‚ourselves‘ [wir selbst] trennt und damit einen Zwischenraum eröffnet, wodurch man die abwegigen Ausdrücke ‚my self‘, ‚your self‘ und ‚our selves‘ [mein, Ihr/dein und unser Selbst] erhält. Haben wir diese unstatthafte Lücke erst einmal aufgetan, fallen wir in sie hinein bzw. auf sie herein. Denn nun scheint es, als hätten wir einen rätselhaften Gegenstand entdeckt, ein Selbst, dessen Eigentümlichkeit erforscht werden müsste. Und wir fragen uns also, worum es sich bei diesem Selbst handelt. Die Frage ‚Welchen ontologischen Status hat ein Selbst?‘ ergibt jedoch keinen Sinn. Es ist, als würden wir, wenn wir festgestellt haben, dass man Jack oder Jill zuliebe [for Jack’s sake] etwas machen kann und andere darum bitten kann, etwas uns zuliebe zu tun, fragen ‚Was ist ein Zuliebe? [What is a sake?]‘. Das ist offenkundig absurd, obgleich der Zwischenraum zwischen dem Possessivum [Jack’s etc.] und dem Wort ‚sake‘ legitim ist. Noch weniger verzeihlich ist dies im Fall von ‚myself‘ oder ‚yourself‘, bei denen die englische Rechtschreibung einen Zwischenraum ausschließt. Spreche ich von mir (selbst) [myself], spreche ich nicht von einem Selbst, das ich habe, sondern einfach von dem Menschen, der ich bin. Wenn ich sage, dass ich an mich selbst [myself] dachte, sage ich nicht, dass ich an mein Selbst dachte, sondern dass ich an mich [me] dachte, diesen Menschen, der allen Freunden vertraut ist. Das Erste-Person-Pronomen bezieht sich nicht auf ein Selbst oder Ego Ebenso abwegig ist es, davon auszugehen, dass das Erste-Person-Pronomen der Name einer bestimmten in mir befindlichen oder von mir besessenen Entität ist, mit der ich unmittelbar und eng vertraut bin. Wer so denkt, wird – wie so viele – dazu neigen, von dieser Entität als „einem ‚Ich‘“ zu sprechen und zu behaupten, dass jede Person im Besitz eines solchen ist. Es sollte zu denken geben, dass jene, die solchen Versuchungen erliegen, das Pronomen in Anführungszeichen setzen – wobei sie sich kaum darüber im Klaren sind, dass hier etwas nicht stimmt. Die An- und Abführung ist der stille Tribut,
450
12 Selbstbewusstsein
den die falsche Grammatik der richtigen zollt. Wie wir oben bereits angemerkt haben, scheint es nur so, als sei die Rede vom ‚Ego‘ in grammatischer Hinsicht korrekter als die vom ‚Ich‘. Das Pronomen ‚ich‘ ist jedoch kein Name von etwas, ebenso wenig wie ‚er‘ oder ‚es‘. Es ist ein Pronomen, und das Nomen, das es vertritt, ist beispielsweise ein Eigenname (zum Beispiel ‚Jack‘), der Eigenname eines menschlichen Wesens, nicht irgendeiner rätselhaften Entität innerhalb eines Menschen. Wenn ich mich mit den Worten ‚Ich bin Jack‘ vorstelle, beziehe ich mich nicht auf mein Ego und sage, dass mein Ego Jack ist. Das Erste-Person-Pronomen bezieht sich nicht auf ein Selbst oder Ego, darin besteht seine Funktion nicht. Wenn ich ankündige, dass ich nach London gehe, stelle ich keine Beobachtungen über eine rätselhafte innere Entität an, die sich auf den Weg nach London machen will, und wenn ich sage, dass ich Kopfschmerzen habe, sage ich nicht, dass mein Ego Kopfschmerzen hat, sondern dass ich sie habe. Und wenn ich, Jack, das so sage, sind andere wiederum in der Lage zu sagen, dass Jack nach London geht oder Kopfschmerzen hat, nicht, dass Jacks Ego oder Selbst nach London geht oder Kopfschmerzen hat. Wenn ich sage ‚Ich war gestern in London‘, spreche ich zwar von mir selbst [of myself], aber nicht von meinem Selbst [of my self].487 Die Täuschung über die Existenz einer inneren Entität Haben wir erst einmal eine Pseudo-Entität heraufbeschworen, werden wir hernach versucht sein, uns um deren Identifizierung und Charakterisierung zu bemühen. Und weil wir irrtümlicherweise davon ausgehen, dass sie in uns ist, nehmen wir auch leichthin an, dass sich das, was sie ausmacht, durch Introspektion (als eine Form ‚innerer Wahrnehmung‘ aufgefasst) erfassen lässt. Demnach könnten wir wie James, Wundt und Damasio davon ausgehen, dass es sich bei diesem ‚Ich‘ oder ‚Selbst‘ um ein besonderes Gefühl handelt, mit dem jede Person unmittelbar vertraut ist, um eine bewusste ‚Präsenz‘, wie sowohl Damasio als auch Humphrey annehmen, oder um eine ‚Leistung des Geistes‘, die selbst eine ‚Leistung des Gehirns‘ ist, wie Blakemore es sieht. Hierbei täuscht man sich jedoch, und die Täuschung geht inter alia auf grammatische Konfusion zurück. Das Erfahrungssubjekt ist richtig verstanden keine Entität mit dem Namen „das ‚Ich‘“ oder „das Selbst“, sondern der lebende Mensch.
487
Würde dennoch jemand insistieren, dass es neben der Alltagssprache auch noch eine Sprache der Gelehrsamkeit gibt und dass unser gewöhnlichen (Ver-)Wendungen lediglich verworrene Abkürzungen für die Rede von einem wirklichen Selbst ‚im Inneren‘ sind, dann sollten wir ihn kritisch hinterfragen, wie wir Descartes kritisch hinterfragen. Wir müssten ihn um die Erklärung bitten, worum es sich bei einem ‚Selbst‘ handelt, mithilfe welcher Kriterien man ein bestimmtes Selbst identifiziert und von anderen solchen Objekten unterscheidet, und ebenso, mithilfe welcher Kriterien man die Re-Identifizierung eines dieser Objekte als dasselbe bei einem späteren Zusammentreffen vollbringt und so weiter (siehe oben 12.2).
12.4 Die ‚Selbst‘-Illusion
451
Das Erfahrungssubjekt ist kein Besitzer von Erfahrung oder eines ‚Selbst‘, sondern ein menschliches Wesen Es ist vollkommen korrekt zu behaupten, dass es ohne ein Subjekt keine Erfahrung geben kann, dass es keine Gedanken gibt, die nicht jemandes Gedanken sind, und keine Schmerzen, ohne dass jemand sie empfindet. Erstens aber ist das Subjekt des Denkens und der Erfahrung nicht ihr Besitzer. Und zweitens ist das Subjekt des Denkens und der Erfahrung der Mensch, das lebende Wesen – kein ‚Selbst‘ oder ‚Ich‘. Wir neigen dazu, das anders aufzufassen: Denn um zu versichern, dass wir einen bestimmten Gedanken denken oder eine bestimmte Erfahrung haben, müssen wir zuvor keine Überprüfung anstrengen, um herauszufinden, wer den Gedanken denkt oder die Erfahrung hat – und wir müssen nicht beobachten, was wir sagen, bevor wir herausfinden können, was wir denken, oder wir müssen nicht unser Verhalten in Augenschein nehmen, um herauszufinden, dass wir Schmerzen haben. Das ist vollkommen richtig, es zeigt jedoch nicht, dass das Subjekt des Denkens und der Erfahrung irgendetwas anderes ist als der Mensch, der ihnen Ausdruck verleiht oder Ausdruck verleihen würde, wenn er das wollte. Vielmehr zeigt es, wie bereits erwähnt, dass wir es hier mit einer wichtigen Asymmetrie zwischen den Äußerungen oder Bekundungen des Denkens und der Erfahrung in der ersten Person und denen in der dritten zu tun haben. Die von einer Person vorgebrachten Bekundungen und Versicherungen des Denkens und der Erfahrung sind kriterienlos, wir haben das dargelegt (3.3 und 3.9). Was allerdings nur insofern möglich ist, als der Sprecher die nämlichen Begriffe des Denkens und der Erfahrung beherrscht und infolgedessen auch ihre Zuschreibung zu anderen. Er muss die kriteriellen Gründe verstehen, die ihre Zuschreibung zu anderen rechtfertigen, und muss normalerweise in der Lage sein, solche Gründe als Rechtfertigung seiner Zuschreibung anzuführen, wenn er gefragt wird, woher er wisse, dass eine andere Person das und das dachte oder eine bestimmte Erfahrung hatte. Woraus die Täuschung entspringt Diese Asymmetrie ist der Ursprung zahlreicher Verwirrungen. Wenn man nämlich nicht genau überlegt, kann es scheinen, als ob ich auf eine Weise ‚Zugang‘ zu meinen Gedanken und Erfahrungen habe, wie sie kein anderer hat. Denn andere müssen mich und mein Verhalten beobachten, ich aber muss nicht beobachten, was ich tue und sage. Und wenn wir die bewusste Erfahrung mit Qualia gleichsetzen oder denken, dass sie aus diesen besteht (10.3), dann wird es auch den Anschein haben, dass die bewusste Erfahrung, zu der ich privilegierten Zugang habe, ein privater Bereich mit essenziell privaten Objekten ist. An diesem Punkt jedoch wird die Annahme absurd scheinen, dass das Subjekt, das Zugang zu einem solchen ‚Erfahrungsbereich‘ hat, der Mensch aus Fleisch und Blut ist. Es wird einem so vorkommen, als ob es sich beim Subjekt der Erfahrung um eine schwer fassbare Entität im Inneren eines jeden Menschen handelt, um eine En-
452
12 Selbstbewusstsein
tität mit einem ‚inneren Auge‘, das beobachtet, was innerhalb dieses Privatbereichs vor sich geht, und mit einem ‚inneren Ohr‘, das die in Erscheinung tretenden auditiven Bilder hört. Wie gesehen haben wir es hier mit einer auf Begriffsverwirrungen beruhenden Fiktion oder einem Fiktionszusammenhang zu tun (3.4–3.9). Um zu sagen, dass ich Schmerzen habe, ist es nicht notwendig, sie wahrzunehmen – ich könnte sie ja gar nicht wahrnehmen. Ich muss nur Schmerzen haben, den Begriff des Schmerzes verstehen und der Tatsache, dass ich Schmerzen habe, kraft der Erweiterung des natürlichen Schmerzverhaltens durch die Äußerung ‚Ich habe Schmerzen‘ Ausdruck verleihen. Ebenso muss ich nicht meine Gedanken wahrnehmen, um sagen zu können, ich denke, dass dies und jenes der Fall ist. In Wahrheit gibt es nichts dergleichen wie ein Wahrnehmen meiner Gedanken. Ich muss vielmehr denken, dass dies und jenes der Fall ist, und ausdrücken können, was ich denke – nicht irgendetwas wahrnehmen. Ich muss zudem gelernt haben, einem Satz der Form ‚dies und jenes ist der Fall‘ ein ‚Ich denke, dass‘ voranzustellen, um beispielsweise eine unverblümte Bemerkung zu relativieren, um zu verstehen zu geben, dass es sich bei dem, was auf ‚Ich denke, dass‘ folgt, um eine Meinung handelt oder um ein Urteil, das auf Anhaltspunkten beruht, die nicht hinreichen, um gegenteilige Urteile auszuschließen. Zudem ist das Erste-Person-Pronomen in solchen Erste-Person-Äußerungen nicht der Name eines schwer fassbaren inneren Denkund Erfahrungssubjekts und bezieht sich auch nicht auf ein solches. Seriöse Verwendungen von ‚Selbst‘ Man darf allerdings nicht vergessen, dass es, obgleich die philosophische Konzeption des ‚Selbst‘ verworren ist, ganz seriöse Verwendungen des Ausdrucks ‚Selbst‘ gibt. Wir sprechen in vollkommen unverfänglicher Weise von ‚meinem früheren Selbst‘ [of ‚my former self‘] – das heißt, von mir [of myself], wie ich [I] früher war – und auch von ‚meinem besseren Selbst‘ – das heißt von den vorteilhafteren Aspekten meines Wesens – und von ‚meinem wahren Selbst‘ – das heißt von meinen grundlegendsten und beständigsten Wesenszügen. Ebenso sagen wir von einer Person, dass sie ‚wieder ganz ihr altes Selbst‘ sei, wenn sie von einer Krankheit genesen ist oder nach einer vorübergehenden charakterlichen Verirrung wieder zu sich selbst gefunden hat. Und es ist auch nicht verfehlt, wenn man von einer großzügigen und altruistischen Person sagt, dass sie selbstlos oder dass ‚ihr Selbst kleiner‘ [‚less of self in him‘] ist als das der meisten anderen Leute. Alle Einwände gegen die Rede vom ‚Selbst‘ richten sich ausschließlich auf die philosophische Konzeption ‚eines Selbst‘, wie es als ‚inneres Subjekt‘ und ‚Besitzer‘ von Erfahrung in der cartesianischen und lockeschen Tradition aufgefasst wird, die das neurowissenschaftliche, kognitionswissenschaftliche und psychologische Nachdenken noch immer total durcheinanderbringt.
12.5 Der Horizont von Denken, Wille und Affektion
453
12.5 Der Horizont von Denken, Wille und Affektion Selbstbewusstsein und Sprachbeherrschung Selbstbewusstsein ist also kein Bewusstsein von einem Selbst. Wie sollen wir das verstehen? Wir werden in 12.6 darlegen, dass es sich beim Selbstbewusstsein um ein Vermögen handelt, über das nur Wesen mit umfassenden sprachlichen Fähigkeiten verfügen. Solche mit einem anspruchsvollen Sprachvermögen ausgestattete Wesen können Eigennamen und Pronomen sowie psychologische Prädikate und solche mit Handlungsbezug sowohl in der ersten als auch der dritten Person und in verschiedenen Zeitformen verwenden und verfügen also über die entsprechenden Begriffe, die normalerweise auf einen selbst ohne irgendwelche Kriterien und auf andere anhand von Verhaltenskriterien angewendet werden. Ein Sprache verwendendes Wesen, das diese sprachlichen Techniken beherrscht, ist ein selbstbewusstes Wesen mit der Fähigkeit, sich seiner Geisteszustände und geistigen Verfassung transitiv bewusst zu sein, ein Wesen, das denken und darüber nachdenken kann, wie es um die Dinge bestellt ist, das nicht nur handeln, sondern sich auch als so handelndes Wesen bewusst werden und sein kann. Und es wird zudem die Fähigkeit haben, über seine Vergangenheit, seine Charakterzüge und Veranlagungen, seine Handlungspräferenzen, Handlungsmotive und Handlungsgründe nachzudenken. Um dies jedoch zu verdeutlichen, müssen wir zunächst einige der komplexen Verknüpfungen zwischen Denken und Sprache eingehender erkunden. Denn so mancher Wissenschaftler kann sich nicht vorstellen, dass es sich beim Selbstbewusstsein essenziell um ein Sprachvermögen handelt, und dieser Mangel an Vorstellungskraft beruht auf Missverständnissen hinsichtlich der komplizierten Begriffsbeziehungen zwischen Denken und Sprache. Psychologische Attribute, die die Beherrschung einer Sprache voraussetzen Wir haben dargelegt, dass intransitives Bewusstsein und transitives Wahrnehmungsbewusstsein nicht nur den Menschen eignen. Dies gilt auch für einige Formen der sogenannten bewussten Erfahrung und der bewussten Geisteszustände, sofern diese zu Recht als Erfahrungen begriffen werden, die man hat, und als Geisteszustände, in denen man sich befindet, während man bei Bewusstsein ist. Ein nichtmenschliches Tier kann Objekte in seiner Umgebung, Schmerzen und einen Juckreiz nicht weniger gut wahrnehmen bzw. empfinden, als wir dies tun. Es ergibt fraglos Sinn, von einem Hund zu sagen, dass er das eine oder andere denkt, sofern mit denken etwas gemeint ist, das sich in seinem Verhaltensrepertoire niederschlagen kann. Ein Hund mag in diesem Moment denken, dass er gleich zu einem Spaziergang mitgenommen wird – wenn er hört, wie die Leine vom Haken genommen wird, läuft er aufgeregt zur Tür, wedelt mit dem Schwanz und bellt aufgeregt. Er kann jedoch nicht in diesem Moment denken, dass er
454
12 Selbstbewusstsein
nächsten Mittwoch zu einem Spaziergang mitgenommen wird. Ein Hund mag in diesem Moment sein Herrchen erwarten, wenn er dessen Schritte hört und erkennt, er kann jedoch nicht in diesem Moment erwarten, dass sein Herrchen am nächsten Sonntag heimkommt. Er mag sich daran erinnern, wo er seinen Knochen vergraben hat, insofern als er dort hinlaufen und ihn ausgraben kann, es ergibt allerdings keinen Sinn, einem Hund eine Erinnerung daran zuzuschreiben, wann (an welchem Wochentag, an welchem Tag im Monat) er seinen Knochen vergraben hat, wo auch immer er es tat. Er mag ärgerlich oder verängstigt sein, aber er kann nicht über seinen Ärger oder seine Angst oder über die Gründe für seine Verärgerung oder Angst nachdenken. Denn solche Fähigkeiten setzen die Beherrschung einer Sprache voraus. Die Grenzen des Denkens und Wissens Die Grenzen des Denkens und Wissens sind die Grenzen des möglichen Ausdrucks des Denkens und Wissens. Einem Wesen kann nur das an Wissen, Gedächtnis, Denken oder Glauben sinnvoll zugeschrieben werden, was es prinzipiell in seinem Verhalten ausdrücken kann. Denn das Verhalten eines Wesens konstituiert das Kriterium für solche Zuschreibungen. Folglich wird der Horizont möglicher kognitiver Leistungen eines Wesens durch die Grenzen seines Verhaltensrepertoires bestimmt. Im Verhaltensrepertoire eines Hundes gibt es jedoch nichts, das Kriterien konstituieren könnte, um ihm Glauben und Wissen, die mit einem genauen Zeitbezug einhergehen, zuzuschreiben. Es ist das mit dem Gebrauch von Wendungen und grammatischen Strukturen für die zeitliche Bezugnahme verknüpfe Sprachverhalten, das die grundlegenden Kriterien für die Zuschreibung von derart auf die Vergangenheit und Zukunft bezogenem Wissen, Gedächtnis, Denken und Glauben zu einem Wesen konstituiert.488 Im Verhaltensrepertoire eines Hundes gibt es gleichfalls nichts, das Kriterien konstituieren könnte, um ihm Stolz auf sein mutiges Verhalten oder Scham wegen seiner Feigheit zuzuschreiben, denn um auf seinen Mut stolz zu sein oder sich wegen seiner Feigheit zu schämen, muss man die Begriffe solcher Tugenden und Untugenden beherrschen. Die Möglichkeit solcher sprachlicher Wendungen des Wissens, Gedächtnisses, Denkens und Glaubens macht die Zuschreibung dieser kognitiven Leistungen und reflexiven Einstellungen selbst dann einleuchtend, wenn sie nicht gezeigt werden. Natürlich kann ein Tier die primitiven Ansätze solcher Emotionen der Selbstbewertung wie Stolz oder Scham in seinem Verhalten zeigen – es kann in seinem Sieg Freude, in seiner Niederlage Verzweiflung offenbaren oder Unbehagen darüber, dass es bei seinem Versagen beobachtet wird. Natürlich verfügen sowohl Tiere als auch Menschen über ‚biologische Uhren‘ und reagieren entsprechend auf das Verstreichen der Zeit. Im Gegensatz zu anderen Tieren können wir uns aber in diesem Moment an das erinnern, was wir letzten Mittwoch getan haben, können denken, dass, weil gestern Dienstag war, heute Mittwoch sein muss, können in diesem Moment erwarten, dass Jack vor Jill eintrifft, in diesem Moment Rom im Jahre 2010 besuchen wollen und so fort. 488
12.5 Der Horizont von Denken, Wille und Affektion
455
Sprachbesitz erweitert den Verstand Der Besitz einer Sprache erweitert den Verstand und ermöglicht nicht nur, zu denken, dass es um die Dinge hier und jetzt so und so steht, sondern auch, dass es um unzählig viele verschiedenartige Dinge zu unzählig vielen Zeitpunkten und an unzählig vielen Orten einzeln so und so bestellt ist. Stehen einem Wesen die sprachlichen Verallgemeinerungsinstrumente zur Verfügung, ist es einleuchtend, ihm Wissen, Glauben oder Vermutung allgemeiner Art zuzuschreiben: dass alle Menschen sterblich sind beispielsweise, dass kein Mensch ewig lebt, dass jeder eine gewisse Zeit lang getäuscht werden kann. Mit der Beherrschung von allgemeinen Begriffsausdrücken, Zahlworten, Nomen für feste Mengen und Ziffern steht einem Wesen ein Denken offen, das über bloßes Erkennen hinausgeht, und ein Wissen, in Abgrenzung zum bloßen Erkennen, von Zahlenund Mengenverhältnissen. Und wenn ihm in seinem Sprachrepertoire die Mittel der Logik zur Verfügung stehen, die Negation (‚nicht‘), Konjunktion (‚und‘), Disjunktion (‚oder‘) und Implikation (‚wenn . . . dann . . .‘) ausdrücken, kann es logische Überlegungen anstellen, was es einleuchtend macht, ihm dieses Vermögen zuzuschreiben, das die meisten elementaren Denkleistungen übertrifft. Die Grenzen des Tierdenkens Selbstverständlich können wir den höher entwickelten Tieren elementare Denkformen beimessen. Manch einer ist vielleicht sogar bereit, das Verhalten eines Tieres zu erklären, indem er diesem einen Grund dafür zuerkennt, warum es so denkt, wie es denkt (er könnte sagen, dass der Grund dafür, dass der Hund denkt, er werde zu einem Spaziergang ausgeführt, das Rasseln seiner Leine war, das er gehört hat). Auf diesem Weg kommt man jedoch nicht allzu weit. Denn selbst wenn man bereit ist zu sagen, dass das Tier einen Grund dafür hatte, das und das zu denken, kommt ein Großteil der Denkund Glaubensgründe bei den Kreaturen, die keine Sprache verwenden, nicht in seinen wesentlichen Funktionsaspekten zum Tragen. Denn ein nichtmenschliches Wesen kann Gedanken nicht als Prämissen in einem begründeten Schluss verwenden, kann sein Denken nicht anhand eines Grundes rechtfertigen, kann im Gegensatz zu uns weder sich noch anderen seine Irrtümer erklären, indem es sich auf die Gründe bezieht, die es zu haben dachte, denn es kann nicht gedacht haben, dass es Gründe hatte; und es kann nicht aus einem Gedanken einen anderen folgern – selbst wenn man sich nicht davon abbringen lässt zu sagen, dass es für sein Tun einen Grund hatte. Sprachbesitz erweitert den Willen Der Besitz einer Sprache erweitert den Willen nicht weniger als den Verstand. Genau wie wir wollen Tiere etwas und richten ihr Handeln an den Objekten ihres Verlangens aus. Ihr Verlangens-Horizont ist jedoch ebenso begrenzt wie der ihrer kognitiven Vermögen.
456
12 Selbstbewusstsein
Unsere Katze mag gerade ihr Futter haben wollen, sie kann aber nicht in diesem Moment kommenden Sonntag Fisch haben wollen. Unser Hund mag gerade ausgeführt werden wollen, er kann aber nicht in diesem Moment am nächsten Weihnachtstag ausgeführt werden wollen. Tiere haben Absichten, verfolgen Ziele und wählen zwischen verschiedenen Möglichkeiten, ihre Ziele zu erreichen. Die Bahn ihres Verlangens reicht jedoch nicht hinter die Ausdrucksgrenze ihres Verhaltensrepertoires, und der Kreis ihrer möglichen Verlangensobjekte ist durch ihre limitierten, nichtsprachlichen Erkennensfähigkeiten in seinem Umfang eingeschränkt. Sie können zwischen offenkundigen Alternativen wählen, jedoch nicht darüber mit sich zu Rate gehen. Es gibt Gründe, weshalb ein Tier handelt, wie es handelt; wir können (wie dargelegt) jedoch nur im schwächsten Sinne davon sprechen, dass sie Handlungsgründe haben, wie wir sie haben, und es ist fraglich, ob es Sinn ergibt, einem Tier (im Gegensatz zu uns selbst) Gründe dafür zuzuschreiben, dass es etwas nicht getan hat. Nur ein Sprache gebrauchendes Wesen kann Überlegungen anstellen und Erwägungen vorantreiben, kann die ihm bekannten widersprüchlichen Tatsachenbehauptungen im Licht seines Verlangens, seiner Ziele und Werte gegeneinander abwägen und in Rücksicht auf Gründe zu einer Entscheidung finden. Man kann insofern davon sprechen, dass Tiere sich entscheiden, als ihre Entscheidungen weder einen Überlegensprozess beschließen noch einen Abwägungsvorgang zu den Vor- und Nachteilen eines Handlungsverlaufs beenden und auch keinen Prozess begründeten Schließens. Sie setzen lediglich einem Zustand des Zögerns oder Schwankens ein Ende. Sprachbesitz erweitert die Affektionen Was auf den Willen zutrifft, trifft gleichfalls auf Einstellungen und Affektionen zu. Nichtmenschliche Tiere können etwas mögen oder nicht mögen, sie können sich an ihm erfreuen, an bestimmten Aktivitäten Gefallen finden, Angst haben oder zornig sein. Allerdings liegt ein großer Bereich der Emotionen, die maßgeblich mit Denken und Kognition im Zusammenhang stehen, jenseits der Vermögensgrenze solcher Wesen. Im Gegensatz zu anderen Tieren können wir eine moralische Verpflichtung fühlen. Wir können bereuen, Tiere nicht; denn um bereuen zu können, muss man über die Begriffe von gut und böse verfügen, muss erkennen können, dass man moralisch falsch gehandelt hat, fähig sein, seine Taten zu bedauern, sich zu wünschen, dass man es nicht getan hätte, und Wiedergutmachung anzustreben. Im Gegensatz zu anderen Tieren können wir in Erwartung der nächste Woche stattfindenden Jagdfeier aufgeregt sein, wegen einer Kränkung, die uns letzte Woche zugefügt wurde, verärgert sein und uns darüber freuen, dass alle unsere Nachkommen bei guter Gesundheit sind. Der Sprachbesitz erweitert das Spektrum möglicher emotionaler Reaktionen ebenso sehr wie den Denk- und Willenshorizont. Er gibt uns nicht nur die Möglichkeit, die uns umgebende Welt nachdenkend in den Blick zu nehmen, sondern auch unsere kognitiven und affektiven Reaktionen auf das, was wir auf diese Weise herausfinden.
12.5 Der Horizont von Denken, Wille und Affektion
457
12.5.1 Denken und Sprache Damasio, Edelman und Tononi zum Vorrang des Denkens vor der Sprache Das Bewusstsein der Tiere setzt im Gegensatz zu dem unsrigen offenkundig keinen Sprachbesitz voraus. Und zur Ausübung der elementaren Denkformen, die den höher entwickelten Tieren zugeschrieben werden können, ist die Beherrschung einer Sprache nicht notwendig. Bei den für Menschen charakteristischen Formen von Denken, Wille und Affektion ist dies anders. Die einschlägigen wissenschaftlichen Studien sind jedoch außerordentlich unklar. Damasio stellt fest: „die Vorstellung, dass das Selbst und das Bewusstsein nach der Sprache entstanden und unmittelbar aus ihr hervorgegangen sein könnten, ist wohl kaum richtig. Die Sprache gibt uns Namen für die Dinge. Wenn Selbst und Bewusstsein de novo aus der Sprache hervorgehen würden, wären sie das einzige Beispiel für Worte ohne einen zugrunde liegenden Begriff.“489 Diese Vorstellung wird durch die Behauptung gestützt, dass Sprache – das heißt Worte und Sätze – [. . .] eine Übersetzung von etwas anderem [ist], eine Umwandlung nichtsprachlicher Bilder, die für Objekte, Ereignisse, Beziehungen und Schlüsse stehen. Wenn die Sprache für das Selbst und für das Bewusstsein das Gleiche leistet wie für alles andere, das heißt, wenn sie in Worten und Sätzen symbolisiert, was zunächst in nichtsprachlicher Form vorhanden war, dann muss es ein nichtsprachliches Selbst und ein nichtsprachliches Wissen geben, für welche die Worte ‚ich‘ oder ‚mich‘ oder die Wendung ‚ich weiß‘ die angemessenen Übersetzungen sind.490
Eine ähnliche Konzeption des Vorrangs von Begriffen vor ihrem sprachlichen Ausdruck wird von Edelman und Tononi vorgebracht, die behaupten, dass „Begriffe nicht in erster Linie syntaktisch befrachtet sind. Das heißt, Begriffe sind nicht die Propositionen in einer Sprache (wie es die gebräuchliche Verwendung dieses Ausdrucks [Begriff] nahelegt); sie sind vielmehr Konstrukte, die das Gehirn entwickelt, indem es seine eigenen Reaktionen vorsprachlich kartiert. [. . .] Unserer Ansicht nach gehen Begriffe der Sprache voraus, diese entwickelt sich erst vermittels epigenetischer Mechanismen zur Optimierung unseres begrifflichen und emotionalen Austauschs.“491 Penroses Konzeption der Entbehrlichkeit von Sprache für das Denken Die Zusammenhänge werden durch Penroses Vorstellung, dass die gewöhnliche menschliche Sprache für das charakteristische menschliche Denken oder Bewusstsein 489
Damasio, Feeling of What Happens, S. 108 [dt. Ich fühle, also bin ich, S. 134]. Ibid., S. 107 [dt. S. 133f.]. 491 G. M. Edelman und G. Tononi, Consciousness: How Matter Becomes Imagination (Allen Lane, The Penguin Press, London 2000), S. 215f. [dt. Gehirn und Geist (Beck, München, 2002), S. 295f.]. 490
458
12 Selbstbewusstsein
nicht notwendig ist, sogar noch undurchsichtiger. Um diesen Standpunkt zu untermauern, zitiert Penrose Bemerkungen herausragender Wissenschaftler wie Einstein, Galton und Hadamard ausführlich. Einstein schrieb, dass „die Worte bzw. die Sprache, ob in schriftlicher oder gesprochener Form, [. . .] in meinem Denkmechanismus keine Rolle zu spielen [scheinen]. Die psychischen Komplexe, die anscheinend als Elemente des Denkens dienen, sind bestimmte Zeichen und mehr oder weniger deutliche Bilder, die sich „willkürlich“ reproduzieren und kombinieren lassen.“ Galton hielt Folgendes fest: Es ist für mich ein ernstes Hindernis beim Schreiben und noch mehr bei mündlichen Erklärungen, dass ich in Worten nicht so leicht denke wie sonst. Nachdem ich angestrengt gearbeitet und für mich selbst völlig klare und zufriedenstellende Resultate erzielt habe, gewinne ich, wenn ich sie sprachlich auszudrücken suche, oft den Eindruck, dass ich mich zunächst einmal auf eine ganz andere intellektuelle Ebene versetzen muss. Ich muss meine Gedanken in eine Sprache übersetzen, die sich ihnen nicht gut anpasst. Darum verschwende ich ungeheuer viel Zeit auf die Suche nach passenden Worten und Ausdrücken.
Und Hadamard „besteh[t] darauf, dass Worte in meinem Geist überhaupt nicht vorhanden sind, wenn ich wirklich denke“. Penrose fügt diesen Beobachtungen hinzu: Fast all mein mathematisches Denken geschieht visuell und in Form nichtverbaler Begriffe, obwohl die Gedanken sehr oft von albernen und fast nutzlosen verbalen Kommentaren begleitet sind [. . .] die Schwierigkeit, die diese Denker mit der Übersetzung ihrer Gedanken in Worte gehabt haben, erfahre ich häufig selbst. Oft besteht der Grund darin, dass einfach die Worte nicht verfügbar sind, um die erforderlichen Begriffe auszudrücken. In der Tat benutze ich bei meinen Rechnungen oft speziell konstruierte Diagramme als Kurzschrift für bestimmte Typen algebraischer Ausdrücke [. . .] Das soll nicht heißen, dass ich nicht manchmal in Worten denke, sondern nur, dass nach meinen Erfahrungen Worte fast nutzlos für das mathematische Denken sind.492
Diese Konzeptionen enthalten zahlreiche Verwirrungen Wir haben argumentiert, dass das Bewusstsein bestimmt nicht ‚nach der Sprache auftaucht‘. ‚Das Selbst‘ hingegen taucht wirklich ‚nach der Sprache‘ auf, jedoch nur in der Hinsicht, dass die Begriffsverwirrung, die dem Mythos von einem ‚Selbst‘ Auftrieb gibt, in den Missverständnissen unserer Sprache und ihrer Begriffsstrukturen verwurzelt ist. Bei der Annahme, dass Sprache eine Übersetzung nichtsprachlichen Denkens ist, haben wir es allerdings mit einem fatalen Irrtum zu tun, wie wir zeigen werden.493 Ebenso ab492
R. Penrose, The Emperor’s New Mind, überarb. Aufl. (Oxford University Press, Oxford, 1999) S. 548f. [dt. Computerdenken (Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg, 1991), S. 413f.]. 493 Mit einer ehrwürdigen Abstammung: ‚Allgemein wird die Sprache dazu gebraucht, unser sich im Geiste abspielendes Denken in wörtlich geäußertes oder die Folge unserer Gedanken in eine Folge von Worten zu übertragen‘ (Hobbes, Leviathan, Kap. IV).
12.5 Der Horizont von Denken, Wille und Affektion
459
wegig ist es, davon auszugehen, dass Worte ganz allgemein für Vorstellungen oder Bilder im Geist stehen oder Namen derselben sind (wie die Empiristen sich einbildeten494) oder für Begriffe stehen. Natürlich sind Begriffe nicht die Propositionen in einer Sprache – eine Fehlkonzeption, die nichts mit der gebräuchlichen Verwendung dieses Ausdrucks zu tun hat: Wir sprechen vom Begriff eines Pferdes, aber nicht vom Begriff (sondern nur von der Proposition), dass sich Ihr Pferd ausrittbereit im Stall befindet. Sie sind jedoch auch keine Konstrukte, die das Gehirn entwickelt, indem es seine eigenen Reaktionen vorsprachlich kartiert. Wir sind an diesem Punkt mit zahlreichen Verwirrungen konfrontiert. Zu wissen, was ein Wort bedeutet, hat nichts damit zu tun, ein Vorstellungsbild zu haben Erstens: Zu wissen, was ein Wort bedeutet, heißt, in der Lage zu sein, es richtig zu verwenden. Die Kriterien dafür, dass eine Person weiß, was ein Wort bedeutet, bestehen nicht darin, dass ihr das richtige Vorstellungsbild immer dann in den Sinn kommt, wenn sie es verwendet oder hört, wie jemand es verwendet. Wenn dies so wäre, dann wüssten wir nie, ob eine andere Person die Worte versteht, die wir gebrauchen, ohne sie zu fragen, welche Vorstellungsbilder sie beim Hören dieser Worte habe. Darüber hinaus ist es so, dass sie, wenn wir sie fragen müssten, welche Vorstellungsbilder sie mit ‚W‘ assoziiere, und wenn ihre Antwort sowohl eindeutig als auch verständlich ausfallen soll, unsere Frage so verstehen muss, wie wir es tun, und wir ihre Antwort so verstehen müssen, wie sie es tut. Wäre verstehen jedoch immer eine Sache der Bildassoziation, könnte dies nie festgestellt werden – was absurd ist. Bildassoziierung ist für das Verstehen irrelevant Wenn zweitens jemand ein anderes Vorstellungsbild als wir mit dem Wort ‚W‘ assoziiert, würde daraus nach imagistischer Theorie folgen, dass er es nicht versteht oder dass er es anders versteht. Wenn einem beim Hören des Wortes ‚umherlaufen‘ das Bild eines ‚Kinderwagens‘ in den Sinn kommt, folgt daraus nicht, das man das Wort nicht verstanden hat oder nicht weiß, was es bedeutet. Sofern man es richtig verwendet, das heißt im Sinne von ‚gehen‘, und sofern man auf die Frage nach seiner Bedeutung erwidert ‚Es bedeutet zu gehen‘, weiß man, was es bedeutet, unabhängig davon, welche Bilder man – gegebenenfalls – mit ihm verknüpft. Wenn überdies das Bild, das einem im Zusammenhang mit dem Wort einfällt, das eines gehenden Mannes ist, woher würde man wissen, ob ‚umherlaufen‘ ‚gehen‘ oder ‚Mann‘ oder ‚gehender Mann‘ oder ‚schnell (oder langsam) gehender Mann‘ bedeutet? Eine ebenso ehrwürdige Verwirrung: ‚Die Worte vertreten also ihrer ursprünglichen oder unmittelbaren Bedeutung nach nur die Vorstellungen im Geiste dessen, der sie benutzt‘ (Locke, An Essay Concerning Human Understanding, III. ii. 2). 494
460
12 Selbstbewusstsein
Die imagistische Konzeption liefert kein Kriterium, das die Richtigkeit des Verstehens durch ein Vorstellungsbild sicherstellt Schließlich ist somit überhaupt unklar, welches das ‚richtige‘ Vorstellungsbild ist, das mit irgendeinem gegebenen Wort assoziiert werden soll. Wenn ich nicht sicher bin, was ein Wort bedeutet, beschwöre ich nicht Bilder in meinem Geist herauf, sondern schlage es im Wörterbuch nach. Das Wörterbuch verdeutlicht die Wortbedeutung nicht, indem es die zu assoziierenden Bilder auflistet, sondern indem es andere, äquivalente Worte oder Wendungen anführt – es gibt uns eine Regel für den Gebrauch des Wortes. So kann das Verb ‚umherlaufen‘ anstelle des Verbs ‚gehen‘ verwendet werden, und es wird mutatis mutandis immer dann richtig verwendet, wenn ‚gehen‘ richtig verwendet wird. Man benötigt kein Bild einer gehenden Person als Orientierung oder Standard für den richtigen Gebrauch des Verbs ‚gehen‘. Kurzum, Vorstellungsbilder sind für die Wortbedeutung irrelevant und gleichermaßen für die Frage, ob ein Sprecher die Worte versteht, die er verwendet oder hört. Begriffsbesitz ist die Beherrschung des Gebrauchs eines Ausdrucks Die Vorstellung, dass Worte darunterliegende Begriffe vertreten, die zunächst in nichtsprachlicher Form existieren, dass Begriffe der Sprache also vorangehen, ist ebenfalls ein Irrläufer. Begriffe sind keine Vorstellungsbilder. Über einen Begriff zu verfügen bedeutet nicht, ein Vorstellungsbild oder eine Disposition für den Besitz eines solchen zu haben. Begriffe sind auch keine Konstrukte, die das Gehirn entwickelt, indem es seine eigenen Reaktionen kartiert. Ein Begriff ist eine Abstraktion aus dem Wortgebrauch. Die Worte ‚snow‘, ‚neige‘ und ‚Schnee‘ unterscheiden sich, werden jedoch in maßgeblicher Hinsicht in der gleichen Weise verwendet. Im Geflecht der Worte halten sie den gleichen Platz besetzt, sie erlauben (in maßgeblicher Hinsicht) die gleichen Kombinationsmöglichkeiten und weisen die gleichen logischen Kennzeichen auf (Implikationen, Vereinbarkeiten und Unvereinbarkeiten). Unterschiedliche Worte in unterschiedlichen Sprachen drücken also denselben Begriff aus. Menschen, die des Englischen, Französischen oder Deutschen mächtig sind und den Gebrauch des Wortes für Schnee in ihrer Sprache beherrschen, teilen einen gemeinsamen Schneebegriff. Über einen Begriff zu verfügen, bedeutet, den Gebrauch eines Wortes (oder einer Wendung) zu beherrschen. Begriffsbesitz ist mithin eine komplexe Fähigkeit oder ein Spektrum miteinander verbundener Fähigkeiten. Was die anderen Befähigungen angeht, so kann man einen bestimmten Begriff mehr oder weniger gut erfassen, seinen Gebrauch teilweise, aber eben nur unvollständig beherrschen. Verfügt jemand über einen bestimmten Begriff, hat er die Fähigkeit, ihn richtig zu verwenden, und er kann ihn gelegentlich falsch verwenden. Er kann, wenn es sich ergibt, einen Begriff durch einen anderen, verwandten ersetzen oder einen Begriff gegen einen ‚zutreffenderen‘ tauschen. Mitunter kann er einen Begriff über dessen gewöhnliche Grenzen hinaus erweitern. Denn für bestimmte Arten von Begriffen (jedoch
12.5 Der Horizont von Denken, Wille und Affektion
461
nicht alle) gilt, dass derjenige, der über einen Begriff C verfügt, die unter C subsumierbaren Fälle erkennen, die Dinge, die C sind, von denen, die es nicht sind, unterscheiden kann. Wenn C zu sein impliziert, D zu sein, aber nicht E, dann besteht ein Kriterium für die fehlende Beherrschung des Begriffs C darin, ihn einem Objekt zuzuschreiben, während man bestreitet, dass das Objekt D ist, oder versichert, dass es E ist. Also kann von jemandem, der versichert, dass ein Objekt rot ist, jedoch bestreitet, dass es farbig ist, und der versichert, dass es sich um ein nichtausgedehntes handelt, unter sonst gleichen Bedingungen gesagt werden, dass er den Begriff von rot sein nicht verstanden hat oder nicht beherrscht. Kurz gesagt schließt die vollständige Beherrschung eines Begriffs das Verstehen seiner logischen Implikationen, Vereinbarkeiten und Unvereinbarkeiten ein. Worte sind keine Sätze (obwohl es Einwort-Sätze gibt wie ‚Spring!‘) und Begriffe sind keine Propositionen. (Contra Edelman und Tononi gehört es nicht zur ‚gebräuchlichen Verwendung‘ des Ausdrucks ‚Begriff‘, dass Begriffe ‚Propositionen in einer Sprache‘ sind.) Worte werden zur Bildung von Sätzen verwendet, mittels derer Sprechakte ausgeführt werden; Sätze stellen die kleinste Einheit der verbalen Kommunikation dar. Es ist nicht möglich, irgendetwas zu sagen, außer mittels eines Satzes. So wie die Funktion der Worte darin besteht, zur Bedeutung der von uns verwendeten Aussage-, Imperativ- oder Fragesätze beizutragen, ist es auch die Funktion der von ihnen ausgedrückten Begriffe, zu den Aussagen (Propositionen), Aufforderungen oder Fragen etc. beizutragen, die mittels der verwendeten Sätzen getroffen, vorgebracht oder gestellt werden. Für den Begriffsbesitz ist eine bloße Erkennensfähigkeit nicht hinreichend Ein geläufiger Einwand kritisiert an dieser Auslegung des Begriffsbesitzes, im Falle nichtmenschlicher Tiere sei impliziert, dass sie über keine Begriffe verfügen. Wenn man jedoch – so wird entgegnet – über einen Begriff C verfügt, bedeutet dies, dass man die Fähigkeit hat, die Dinge, die C sind, zu erkennen oder sie von anderen, die nicht C sind, zu unterscheiden. Und Tieren eignet gewiss Erkennungs- und Unterscheidungsvermögen. Darauf kann man erwidern, dass eine bloße Erkennungs- und Unterscheidungsfähigkeit für den Begriffsbesitz nicht hinreicht. Um beispielsweise den Begriff von Rot zu beherrschen, muss man nicht nur rote Dinge erkennen und sie von nichtroten unterscheiden können; man muss auch die logische Form des Begriffs erfasst haben – das heißt seine möglichen und unmöglichen Kombinationen, seine Vereinbarkeiten und Unvereinbarkeiten mit anderen Begriffen. Ein normaler Mensch, der den Rotbegriff beherrscht, muss wissen, dass Rot eine Farbe ist (d. h., dass dann, wenn irgendetwas rot ist, es farbig ist), dass es Sinn ergibt, die Eigenschaft des Rotseins ausgedehnten Objekten zuzuschreiben, nicht aber Klängen, Gerüchen oder Geschmäcken. Er muss wissen, dass dann, wenn etwas ganz rot ist, es nicht zugleich grün (oder blau oder gelb etc.) sein kann. Er muss wissen, dass Rot dunkler als Rosa ist (das heißt, dass dann, wenn ein Objekt A rot und ein anderes Objekt B rosa ist, A dunkler als B ist) und dass es Orange ähnlicher ist als Gelb (wenn also A rot, B orange und C gelb ist, dann ist A B
462
12 Selbstbewusstsein
farblich ähnlicher als C). Und so fort. Denn genau in dem Maße, in dem er diese begrifflichen Verknüpfungen nicht erfasst, beherrscht er den Begriff unzureichend. Er muss, kurz gesagt, die logischen Zusammenhänge des Begriffs verstehen. Was nichts anderes heißt, als dass er den regelgeleiteten Gebrauch des Wortes, das den Begriff zum Ausdruck bringt, beherrschen muss. Nach diesem Verständnis verfügen sprachunbegabte Tiere nicht über Begriffe, obgleich sie offensichtlich eine ganze Reihe von Erkennensfähigkeiten haben. Begriffsbesitz ist selbstverständlich eine komplexe Fähigkeit oder ein Bündel miteinander verbundener Fähigkeiten, und bei manchen Begriffen ist ein Erkennungsvermögen eine Komponente davon. Reicht das, an sich, für die Zuschreibung eines Begriffs zu einer Kreatur nicht schon hin? Wir haben es hier mit einer Frage zu tun, die nach einer Entscheidung verlangt und nicht nach einer (wissenschaftlichen) Entdeckung. Wenn wir wollen, können wir den Begriff des Begriffsbesitzes so ausdünnen, dass der Besitz entsprechender Erkennensfähigkeiten für die Zuschreibung des Besitzes des einschlägigen Begriffs hinreicht. Es spricht allerdings kaum etwas für eine solche Begriffsabschwächung. Sie geht damit einher, dass man den Begriff des Begriffsbesitzes vom großen Spektrum miteinander verbundener Fähigkeiten abtrennt, die zur Beherrschung des Gebrauchs eines Worts gehören. Dazu kommt noch, dass der Begriff eines Begriffs von seinen Verbindungen mit den Begriffen der Anwendung und Falschanwendung, des Ge- und Missbrauchs, der Ausdehnung, Ersetzung und Substitution losgelöst wird. Für ein solches Vorgehen gibt es keinen triftigen Grund, wenn man berücksichtigt, dass wir schon alles, was wir über die entsprechenden Tiervermögen sagen möchten, durch den Gebrauch des Terminus ‚Erkennensfähigkeit‘ ausdrücken können. Worte ‚stehen nicht für‘ Begriffe und ‚bezeichnen‘ sie nicht Begriffe wandeln sich und können ausgefeilter werden (oder an Feinheit verlieren), insofern als sich die Wortverwendungen wandeln, ausgefeilter werden (oder an Feinheit verlieren). Neue Begriffe werden durch die Erklärung der Bedeutungen neuer Ausdrücke (oder der Zuschreibungen oder Verfeinerungen der Bedeutungen älterer Ausdrücke) eingeführt oder erläutert, wobei die Bedeutungserklärungen als Regeln für den korrekten Gebrauch der so erläuterten Ausdrücke fungieren. Und natürlich werden die Bedeutungserklärungen der neuen Ausdrücke anhand der altvertrauten Begriffe formuliert. Die Behauptung, dass Worte für Begriffe stehen, ist bestenfalls irreführend, und sie hilft uns überhaupt nicht auf die Sprünge. Es ist durch und durch verworren anzunehmen, dass Worte Bezeichnungen für zugrunde liegende Begriffe sind, die zunächst in nichtsprachlicher Form existieren müssen.
12.5 Der Horizont von Denken, Wille und Affektion
463
Sprechen heißt nicht, wortlose Gedanken in Sprache zu übersetzen Wenn Sprechen hieße, wortlose Gedanken zu übersetzen, dann müsste es einem möglich sein, seine wortlosen Gedanken zu überprüfen, um sicherzustellen, dass man ihn richtig übersetzt hat, so wie man einen französischen Satz überprüfen kann, um sicherzustellen, dass man ihn richtig übersetzt hat. Kann es jedoch so etwas geben wie ein Überprüfen wortloser Gedanken, um sicherzugehen, dass seine Bestandteile von den Worten erfasst wurden, mit denen er übersetzt wurde? Haben Gedanken Bestandteile? Den einzigen Sinn, den man dieser Annahme abgewinnen könnte, liegt darin, dass die ‚Bestandteile‘ eines Gedankens ein Schatten der Bestandteile des verbalen Ausdrucks des Gedankens (eine Abstraktion aus ihnen) sind. Wenn die Bestandteile eines Gedankens Bilder wären, stünde uns dann ein Verfahren zur Verfügung, Bilder in Worte zu übersetzen, in Abgrenzung zur Beschreibung und Anführung von Bildern? Und wenn man die Bilder, die einem (gegebenenfalls) durch den Kopf gehen, während man denkt, dass dies und jenes der Fall ist, beschreiben oder angeben sollte, hätte man dadurch dem Gedanken, das dies und jenes der Fall ist, Ausdruck verliehen? Man kann ebenso wenig ‚wortlose Gedanken‘ in Worte übersetzen, wie man die Zimmermöbel in Worte übersetzen kann.495 Wir neigen dazu, die Sache anders aufzufassen, weil wir durch die Vorstellung genarrt werden, dass wir in einem Medium denken, so wie wir in der einen oder der anderen Sprache sprechen, wenn nicht in Englisch, dann in Deutsch, und wenn nicht in Deutsch, dann in Französisch. Und natürlich sagen wir solche Sätze wie ‚Mein Deutsch ist nun so gut, dass ich sogar in Deutsch denke‘. Daher scheint es so, dass wir stets in etwas denken. Und wenn wir nicht in einer Sprache denken, müssen wir in etwas anderem denken – in Bildern zum Beispiel. Das ist allerdings eine konfuse Vorstellung. Wir müssen die eigentlichen Fragen untersuchen: ‚Denken wir in einer Sprache?‘ und ‚Ist Sprache für das Denken notwendig, braucht man sie, um zu denken?‘. Was heißt es, ‚in einer Sprache‘ zu denken? Wir wissen, was es heißt, in der einen oder der anderen Sprache zu sprechen. Was heißt es, in einer Sprache zu denken? Wenn ich mit Überlegung [with thought] in Englisch spreche, denke ich dann in Englisch zusätzlich zum Sprechen? Offensichtlich nicht. Mit Überlegung zu sprechen bedeutet nicht, zu sprechen und die eigene Rede durch eine andere, verborgene Aktivität zu begleiten, ebenso wie mit Ausdruck zu singen nicht bedeutet, das eigene Singen mit einer zweiten Aktivität zu begleiten, dem Ausdrücken. Es bedeutet, ausdrucksvoll zu singen; und mit Überlegung zu sprechen bedeutet, mit Verständnis, durchdacht, reflektiert zu sprechen, gute Gründe für das zu haben, was man sagt (und Gründe für das zu haben, was man sagt, bedeutet nicht, die eigenen Äußerun495
[‚Translate‘ bedeutet auch ‚verschieben‘, darauf beruht hier das Wortspiel – A.d.Ü.]
464
12 Selbstbewusstsein
gen mit irgendeiner gleichzeitigen Aktivität zu begleiten). Mit Überlegung – das heißt nichtmechanisch – zu sprechen bedeutet nicht, zu sprechen und auch etwas anderes zu tun. Man kann sich Menschen vorstellen, die nur laut denken können (so wie es Menschen gibt, die nur laut lesen können), niemand aber würde sich vorstellen, dass diese Menschen alles zweimal sagen, wenn sie mit Überlegung sprechen! Was Mit-Überlegung-Sprechen ist Etwas mit Überlegung zu sagen bedeutet im Gegensatz zum einfachen Nachplappern, es mit (mindestens etwas) Verständnis zu sagen – das Verständnis, mit dem man dann etwas sagt, ist jedoch nicht etwas Denkbegleitendes, sondern die Fähigkeit, das Gesagte zu erklären. Wohlüberlegt zu versichern, dass es um die Dinge so und so steht, bedeutet, aufgrund aller relevanten Erwägungen (unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren) zu versichern, dass es um die Dinge so und so steht, oder es bedeutet, die wohlüberlegte Versicherung als ein Argument in der eigenen Argumentation vorzubringen (z. B. als einen Grund für einen nachfolgenden Schluss). Das Sprechen ohne Überlegung – das heißt das mechanische, unbedachte, gedanken- und verständnislose etc. Sprechen (jeweils etwas anderes) – ist nicht dadurch charakterisiert, dass es von nichts begleitet wird. Mitunter (obwohl nicht immer) liefert gerade eine Begleiterscheinung die Erklärung dafür, dass es einem an Überlegung mangelt – ein heftiger Kopfschmerz beispielsweise oder die Ablenkung der Aufmerksamkeit (‚Es tut mir leid, ich habe nicht nachgedacht, als ich das sagte, ich hatte nur die Musik im Sinn‘). Gedankenlosigkeit beim Sprechen kann sich einerseits durch die mechanische, monotone Sprechweise und den Mangel an stimmlicher und mimischer Ausdruckskraft zeigen; in anderer Hinsicht ist sie durch die Unangemessenheit oder Unbeholfenheit des Gesagten gekennzeichnet. In beiden Fällen hat die Gedankenlosigkeit nichts mit dem Fehlen eines inneren Prozesses zu tun, der nur einem selbst zugänglich ist. Gedankenlosigkeit ist beispielsweise durch die Unfähigkeit charakterisiert, das Gesagte zu erklären oder zu rechtfertigen, durch die Grundlosigkeit des Gesagten (vorausgesetzt, dass es Gründe braucht), durch den Unwillen, bei der eigenen Versicherung zu bleiben, oder durch die Taktlosigkeit und Unsensibilität des Gesagten. Man kann also überlegt oder unüberlegt bzw. gedankenlos sprechen; mit Überlegung zu sprechen bedeutet jedoch nicht, die Rede mit einem bestimmten anderen, verborgenen Prozess zu begleiten, und ohne Überlegung zu sprechen bedeutet nicht, dass ein Begleitendes fehlt. Natürlich kann man auch ohne zu sprechen denken. Heißt das, man tut genau das, was man tut, wenn man mit Überlegung spricht, nur ohne zu sprechen? Offensichtlich nicht. Würde man gebeten, zunächst etwas mit Überlegung zu sagen, und daraufhin dann, das zu tun, was man tat, als man es mit Überlegung sagte, dabei jedoch auf das Sprechen zu verzichten, wüsste man nicht, was man tun sollte. Es wäre so, als läse man etwas mit Verständnis und würde dann gebeten, das zu tun, was man beim verständigen Lesen des Abschnitts getan hat – nur ohne irgendetwas zu lesen. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, das ‚Mit-Überlegung-Sprechen‘ adverbial auf-
12.5 Der Horizont von Denken, Wille und Affektion
465
zufassen – das heißt, ähnlich wie eiliges Laufen oder eifriges Wandern –, folglich nicht als ein Paar von Aktivitäten, mit denen man gleichzeitig befasst ist. Der Begriff des Denkens-ohne-zu-sprechen macht also eine gesonderte Prüfung erforderlich. Denkt man nicht in einem Medium? Denkt man nicht entweder in Englisch oder in irgendeiner anderen Sprache? Oder wenn nicht in einer Sprache, dann in Bildern oder Diagrammen oder Formeln? In der Vorstellung zu sich selbst zu sprechen ist für das Denken weder notwendig noch hinreichend Man kann in seiner Vorstellung zu sich selbst in Englisch oder in Deutsch sprechen. Erstens jedoch muss das ‚innere‘ Sprechen nicht mit denken einhergehen. Wenn man das Einmaleins in der Vorstellung aufsagt oder seine Rede nochmals durchgeht, um sicherzugehen, dass man sie auswendig beherrscht, oder wenn man ‚Schafe zählt‘, um sein Denken zum Stillstand zu bringen und einschlafen zu können, denkt man nicht. Zweitens kann man denken, ohne irgendwie in der Vorstellung zu sich zu sprechen. Man kann aufgrund der Evidenz e zu dem Schluss kommen, dass p, oder begreifen, dass c aus a und b folgt, ohne irgendetwas zu sich selbst zu sagen; notwendig ist allein, dass man von da an gewillt ist, unter sonst gleichen Bedingungen zu versichern, dass p aufgrund von e oder dass c aus dem Grund, dass a und b, oder willens ist zu handeln aus dem Grund, dass p, und in der Lage ist, die Tatsache, dass p, als den Grund für das eigene Handeln anzuführen. Zur Verwendung von ‚fähig zu sein, in . . . zu denken‘ Wir neigen unter Umständen dazu, dies anders zu sehen, weil wir zu sehr oder fälschlicherweise von der Tatsache beeindruckt sind, dass wir so etwas sagen wie ‚Ich kann in Deutsch sprechen, aber nicht in Deutsch denken‘. Mit einer solchen Äußerung bringt man zum Ausdruck, dass man, bevor man etwas in/auf Deutsch sagen kann, überhaupt erst einmal entscheiden muss, was man sagen will (und fähig sein muss, es in Englisch zu sagen), und dann darum kämpfen muss, die richtigen deutschen Worte zu finden. Daraus folgt nicht, dass es Sinn ergibt, von einem englischen Muttersprachler zu sagen, dass er in Englisch denkt, es sei denn, dies bedeutet lediglich, dass er, wenn er in seiner Vorstellung zu sich selbst spricht, das, was er dabei sagt, in Englisch sagt. Man kann natürlich auch von einem Engländer sagen, er spreche so gut Deutsch, dass er sogar in Deutsch denkt. Das bedeutet jedoch lediglich – sofern es nicht bedeutet, dass er in seiner Vorstellung zu sich selbst in Deutsch spricht –, dass er nicht zuerst daran denkt, was er sagen will, und dann innehält, um zu versuchen, an die deutschen Worte zu denken.
466
12 Selbstbewusstsein
Nach dem richtigen Wort jagen – eine irreführende Analogie Getäuscht werden wir zweifellos auch durch die Analogie zwischen einem englischen Sprecher, der nach dem richtigen deutschen Wort sucht, um das und das zu sagen, und einem englischen Sprecher, der nach dem richtigen englischen Wort sucht, um seinen Gedanken auszudrücken. Die Analogie ist jedoch abwegig. Denn im ersten Fall kann er in Englisch sagen, was er denkt; im zweiten Fall aber kann er das nicht. Was nicht daran liegt, dass er in Bildern gedacht und nicht die richtige Übersetzung gefunden hat, dass er also quasi weiß, was er denkt, und nun nach den richtigen Worten sucht, um seinen (subjektiv) vollkommen klaren Gedanken auszudrücken. ‚Das Wort liegt mir auf der Zunge‘ hat nahezu dieselbe Bedeutung wie ‚Mir ist das richtige Wort momentan entfallen, es wird mir aber hoffentlich gleich wieder einfallen‘. Und so ist auch die Äußerung ‚Ich weiß genau, was ich sagen will, mir fallen aber nicht die richtigen Worte ein‘ entweder Unsinn oder sie bedeutet lediglich ‚Gib mir noch einen Moment, damit sich der Gedanke herauskristallisieren kann, und dann werde ich dir sagen, was ich denke‘. Wenn auch jemand anderes die richtigen Worte findet – die Worte, nach denen ich gesucht habe, um meinen Gedanken auszudrücken –, besteht die Richtigkeit seiner Worte nicht darin, dass sie meinen Gedanken korrekt übersetzen oder dass sie mit meinem wortlosen Gedanken übereinstimmen. Sie besteht vielmehr darin, dass sie mit dem Phänomen, das der Gegenstand des Gedankens ist, in einer Weise übereinstimmen, die mich überzeugt und die ich selbst zu finden versucht habe. Über das sogenannte nichtsprachliche Denken – Einstein, Galton, Hadamard und Penrose Was hat es dann mit den Beobachtungen von Einstein, Galton, Hadamard und Penrose auf sich? Nicht nur, dass sie nicht insistieren, in Sprache zu denken, sie bestehen darauf, dass sie es nicht tun. Einstein betonte mit großem Nachdruck, dass die Elemente seines Denkens ‚gewisse Zeichen und mehr oder weniger deutliche Bilder‘ sind; Penrose versichert, dass er ‚visuell‘ denkt, mittels ‚speziell konstruierter Diagramme‘, die eine Kurzschrift algebraischer Ausdrücke sind. Galton konstatierte, dass er seine Gedanken in Sprache übersetzen musste. Zeigt das nicht, dass man in Bildern denkt und seine Gedanken dann in Sprache übersetzt? Das tut es nicht. Es zeigt, dass die Beschreibung dessen, was einem beim Denken durch den Kopf geht, normalerweise weder eine Beschreibung seines Denkens ist noch dessen, was man denkt. Was man denkt, ist nicht das, was einem während des Denkens in der Vorstellung präsent ist, von Fällen abgesehen, in denen das, was man zu sich selbst sagt, das ist, was man denkt. Und eine Beschreibung dessen, was einem während des Denkens durch den Kopf geht, ist keine Beschreibung des eigenen Denkens.
12.5 Der Horizont von Denken, Wille und Affektion
467
Vorstellungsbilder können heuristische Hilfsmittel sein, sie sind jedoch keine Gedanken oder Gedankenausdrücke Natürlich können manche Menschen Vorstellungsbilder als heuristische Hilfsmittel für ihr Denken heraufbeschwören, so wie andere Diagramme oder fragmentarische Symbole auf ein Blatt Papier kritzeln können. Weder beim Zustandekommen der Bilder noch bei dem der Kritzeleien haben wir es mit dem Denken zu tun. Die Bilder oder Kritzeleien sind auch keine Denk- bzw. Gedankenausdrücke. Das Vorstellungsbild, das man heraufbeschwört, mag ein Vorstellungsbild dessen sein, worüber man nachdenkt, es kann sich bei ihm jedoch nicht um das handeln, was man denkt (nämlich dass p). Vorstellungsbilder können das Denken unterstützen, häufig sogar wesentlich – eine Beschreibung der Abfolge dieser Bilder, einschließlich der Bilder von Diagrammen und/ oder algebraischen Symbolen, wäre jedoch weder eine Beschreibung des Denkens der Person (das als schnell, aufschlussreich und imponierend oder als langsam, schwerfällig und ineffektiv beschrieben werden kann) noch eine Darstellung dessen, was sie dachte. Und es gibt nichts dergleichen wie ein Übersetzen dieser Bilder in Sprache. Nicht ‚in Worten‘ zu denken ist nichts Rätselhaftes, es ist jedoch verworren anzunehmen, dass unser Denken eine ‚Übersetzung‘ in Worte nötig hat An Galtons Insistieren, er denke nicht in Worten, ist nichts auszusetzen und überrascht nichts. Er will damit sagen, dass er beim Durchdenken eines Problems in seiner Vorstellung nicht mit sich spricht. Wenn er zu einem Ergebnis gelangte, wusste er, dass er sein Problem gelöst hatte, und wusste, dass er seine Lösung klar darlegen könnte, obgleich er es bislang noch nicht getan hatte. Das ist genauso wenig rätselhaft, wie zu wissen, was man sagen wird, bevor man es sagt, was der Normalfall ist – wirklich rätselhaft wäre es, wenn man nie wüsste, was man sagen würde, bevor man es sagte! Wissen, was man sagen wird, bedeutet nicht, es sich selbst zu sagen, bevor man es laut ausspricht. Es impliziert auch nicht, dass man in einem nichtsprachlichen Gedankenmedium denkt, was man sagen wird. Galton irrt vollständig, wenn er versichert, dass er seine ‚wortlosen Gedanken‘ in Sprache übersetzen muss. Denn die Lösung eines Problems kennen und sagen, um welche es sich handelt, bedeutet nicht, irgendetwas zu übersetzen. Es bedeutet, eine Fähigkeit zu verwirklichen – die nämlich, das Problem der richtigen Lösung zuzuführen. Wort- und Begriffsverwirrungen Auch Penrose irrt nicht in der Annahme, dass er nicht ‚in Worten‘ denkt, sondern damit, zu behaupten, dass ‚die Worte nicht verfügbar sind, um die erforderlichen Begriffe auszudrücken‘. Denn mathematische Symbole drücken Begriffe aus, unterliegen nicht weniger als Worte einem regelgeleiteten Gebrauch. Die Worte ‚cat‘, ‚chat‘ und ‚Katze‘
468
12 Selbstbewusstsein
sind Symbole in drei verschiedenen Sprachen, die alle denselben Begriff ausdrücken; bei den arithmetischen Symbolen ‚+‘, ‚=‘ und ‚i‘ handelt es sich um allgemein anerkannte Symbole in der ‚Sprache der Arithmetik‘, die die Begriffe der Additionsfunktion, der Gleichheit und der Quadratwurzel von −1 ausdrücken. Es gibt Worte, die mathematische Begriffe ausdrücken. Allerdings wäre es äußerst umständlich, anstelle der mathematischen Symbole Worte zu verwenden, und völlig unmöglich, komplexe Berechnungen ohne diese Symbole durchzuführen. Wenn Penrose eine mathematische Lösung für ein Problem findet, spielen Worte bei dem, was in seinem Kopf vor sich geht, zweifellos keine signifikante Rolle. Mathematische Symbole und vorgestellte Diagramme können eine heuristische Rolle spielen. Wenn er ein mathematisches Problem gelöst hat, kann er die Lösung jedoch in mathematischen Symbolen aufschreiben, und diese drücken Begriffe aus, mathematische Begriffe, nicht weniger als die Worte der natürlichen Sprache dies tun. Neuformulierung der Frage Ist Sprache zum Denken also notwendig? Diese Frage ist zu allgemein und muss in eine Reihe von Fragen aufgegliedert werden. Können nichtmenschliche Tiere denken? Erstens: Können Kreaturen, die keine Sprache beherrschen, denken? Wir haben diese Frage bereits beantwortet. Nichtmenschlichen Tieren kann rudimentäres Denken zuerkannt werden, allerdings nur in dem Maße, wie sich das, was als ihr Denken betrachtet wird, in ihrem Verhaltensrepertoire niederschlägt. Die Frage, ob man ‚in‘ Sprache denken müsse, ist irreführend Zweitens: Muss man, um denken zu können, in Sprache denken? Wir haben nahegelegt, dass diese Frage irreführend ist. Ob man in seiner Vorstellung mit sich selbst spricht, während man denkt, oder nicht, ob man seine Gedanken in einem inneren Monolog still einstudiert oder nicht: Mit sich selbst in der Vorstellung sprechen ist nicht dasselbe wie denken, und es muss nicht mit dem Denken einhergehen. Und wenn man nicht zu sich selbst in der Vorstellung sagt, was man denkt, wenn man denkt, folgt daraus nicht, dass man in irgendeinem nichtsprachlichen Medium, wie etwa Bilder, denken muss. Die bloße Wendung ‚in Sprache denken‘ führt uns auf Abwege, denn sie eignet sich dazu, nach dem Modell von ‚in Englisch sprechen‘ oder ‚in Deutsch sprechen‘ aufgefasst zu werden. Man muss nicht (in diesem Sinn) in irgendetwas denken, denn man muss nicht zu sich selbst sprechen, wenn man denkt, und selbst wenn man während des Denkens zu sich selbst spricht, ist das, was man zu sich selbst sagt, vielleicht gar nicht das, was man denkt (wie Penrose korrekterweise herausstreicht).
12.6 Selbstbewusstsein
469
Die Frage, ob man in Bildern denken könne, ist irreführend Drittens: Kann man in Bildern denken? Auch diese Frage ist irreführend. Obgleich einem während des Denkens Bilder durch den Kopf gehen mögen und obgleich man Bilder heuristisch verwenden kann, handelt es sich weder bei den Bildern noch ihren Beschreibungen um Ausdrücke des Denkens. Zudem ist der Prozess, bei dem einem Bilder durch den Kopf gehen, ebenso wenig der Denkprozess, wie es sich bei der Reihe heuristischer Kritzeleien auf einem Stück Papier um den Denkprozess handelt. Insofern, als man vom Denken (folgernden Denken) als einem Prozess sprechen kann, ist es ein Prozess, bei dem man (eben) folgernd von den und den Prämissen zu einer bestimmten Konklusion gelangt. Der Gedankengang wird in der expliziten Darlegung der Schlüsse offenbar, nicht in der Beschreibung von Bildern, Symbolen oder Diagrammen, die einem während des Denkens durch den Kopf gingen oder die man als heuristische Instrumente verwendete, um sich denkend zur Lösung vorzutasten. Ein Bild von X im Kopf zu haben heißt nicht, in Bildern zu denken, in dem Sinne, in dem man in Englisch spricht. Die Worte, die wir beim Sprechen äußern, sind der Ausdruck unseres Denkens. Die Bilder, die wir während des Denkens heraufbeschwören, sind nicht der Ausdruck unseres Denkens, sondern sie unterstützen das Denken oder begleiten es. Die Grenzen des möglichen Denkens sind die Grenzen des möglichen Ausdrucks des Denkens Und schließlich: Muss man eine Sprache beherrschen, um jenseits des rudimentären Denkens eines Tieres irgendetwas denken zu können? Davon gehen wir in der Tat aus. Denn um es zu wiederholen, die Grenzen des möglichen Denkens sind die Grenzen des möglichen Ausdrucks des Denkens. Ein Denker kann nur das denken, was er ausdrücken kann (aber nicht muss) (oder was er hätte ausdrücken können, hätte er nicht die Sprachfähigkeit eingebüßt, über die er vorher verfügte). Ein Einstein muss nicht zu sich selbst sprechen, während er denkt. Und das muss auch sonst niemand. Man kann jedoch nur denken, was man ausdrücken kann (oder als Ausgedrücktes erkennen kann) – sei es in Worten, Symbolen, Diagrammen oder Formeln.
12.6 Selbstbewusstsein Bewusstsein und Selbstbewusstsein einander gegenübergestellt Ein nichtmenschliches Tier kann Empfindungen haben und etwas wahrnehmen, kann fühlen, etwas wollen und das Gewollte handelnd verfolgen. Es kann eine ganze Menge wissen und, in einem elementaren Sinne, Verschiedenes denken oder glauben. Wie wir ist es entweder bei Bewusstsein oder nicht; es erfreut sich Wahrnehmungs-, Gefühlsund Willens-Erfahrungen; und es kann sich insofern verschiedener Dinge bewusst wer-
470
12 Selbstbewusstsein
den und sein, als seine Aufmerksamkeit von Gegenständen, die es wahrnimmt, auf sich gezogen und gefangen genommen werden kann. Dennoch ist es kein selbstbewusstes Wesen. Es kann wahrnehmen, es kann jedoch nicht über die Tatsache nachdenken oder reflektieren, dass es, was auch immer, wahrnimmt. Es kann zornig, verängstigt, eifersüchtig, liebenswürdig, aufgeregt sein; es hat Vorlieben und Abneigungen und kann aus einer ganzen Reihe von Aktivitäten Vergnügen ziehen. Es kann jedoch nicht realisieren und sich auf diese Weise der Tatsache bewusst werden, dass es verängstigt oder eifersüchtig ist oder dass es aufgeregt ist oder Vergnügen aus seinen Aktivitäten zieht. Daher kann die Tatsache, dass es ängstlich oder erschrocken ist, es auch nicht beschäftigen oder für sein Nachdenken und intentionales Handeln von Bedeutung sein, auch wenn seine Handlungen von dem, was es fühlt, beeinflusst werden. Noch offensichtlicher ist, dass es sich der Tatsache, dass es eine Veranlagung zu Jähzorn oder Güte hat, nicht bewusst werden und dann sein kann. Es kann auch nicht über seine zurückliegenden Erfahrungen nachdenken, obwohl diese Einfluss auf sein gegenwärtiges Verhalten und seine gegenwärtigen Reaktionen haben können. Selbstbewusstsein ist kein Bewusstsein von einem Selbst; es setzt begriffliche Fertigkeiten voraus Dass ein Tier kein selbstbewusstes Wesen ist, lässt sich nicht durch den Gedanken erklären, dass ihm ‚ein Selbst‘ fehlt oder dass es ‚ein Selbst‘ hat, sich dessen aber nicht bewusst ist. Denn, wie wir bereits ausgeführt haben, gibt es nichts dergleichen wie ‚ein Selbst‘, das als innerer Besitzer von Erfahrung aufzufassen ist, und die Tatsache, dass wir selbstbewusste Wesen sind, besteht nicht darin, dass wir ‚ein Selbst‘ haben oder uns ‚eines Selbst‘ bewusst sind. Woran es einem Tier mangelt und worüber wir verfügen, ist eine Sprache bzw. ihre Beherrschung. Wir stimmen also annähernd mit Edelman überein, der insistiert, dass das, was er in Abgrenzung zum ‚Primärbewusstsein‘ das ‚Bewusstsein höherer Ordnung‘ nennt, eine Sprache voraussetzt. Das ist jedoch nicht darauf zurückzuführen, dass eine Sprache nötig ist, um „ein begriffliches Modell der Selbstheit [selfhood] und auch ein Modell der Vergangenheit“ zu bilden.496 Noch darauf, dass „Lebewesen, die nur über Primärbewusstsein verfügen, auch Qualia haben, diese [aber] weder einem menschlichen Beobachter noch sich selbst explizit mitteilen können, da ihnen ein Begriff vom Selbst fehlt“.497 Es rührt vielmehr daher, dass man, damit einem deutlich werden kann, dass man sich einer bestimmten Art von Erfahrung erfreut, damit man fähig ist, über sie nachzudenken und damit sie für die eigenen Überlegungen von Bedeutung sein kann, über den Begriff der entsprechenden Erfahrung verfügen muss. Um zu realisieren und sich so der Tatsache bewusst zu werden, dass man eifersüchtig, zornig oder ängstlich ist, und damit diese Tatsache die eigenen Gedanken beschäftigen und einem 496 497
Edelman, Bright Air, Brilliant Fire, S. 131 [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer, S. 190]. Ibid., S. 135 [dt. S. 195].
12.6 Selbstbewusstsein
471
selbst einen Grund dafür liefern kann, dies oder das zu tun oder zu denken, muss man über die Begriffe der Eifersucht, des Zorns oder der Ängstlichkeit verfügen. Ebenso muss man, um sich seiner Unwissenheit oder Belesenheit, seiner Eitelkeit oder seines Stolzes bewusst zu sein, über die Begriffe dieser Charakteristika verfügen. Und damit unsere Vergangenheit für unsere Reflexionen von Bedeutung sein kann, muss man fähig sein, über sie nachzudenken – und das setzt Sprachbeherrschung voraus. Menschliche Wesen haben eine Autobiografie, andere Lebewesen jedoch nicht. Und menschliche Wesen können im Gegensatz zu anderen Lebewesen einen Sinn für Geschichte haben, können sich ihrer selbst als historische Wesen, die einer Gesellschaft oder sozialen Gruppe mit einer bestimmten Geschichte angehören, bewusst sein und sind es für gewöhnlich auch. Selbstbewusstsein macht die Beherrschung von Personalpronomen erforderlich Selbstbewusstsein geht mit keinem Bewusstsein von einem Selbst einher, wir sagten das bereits. Es geht einher mit der Beherrschung des Gebrauchs von Personalpronomen im Allgemeinen und des Gebrauchs des Erste-Person-Pronomens im Besonderen. Um den Gebrauch von ‚ich‘ zu beherrschen, muss man kein inneres Objekt bemerken, das man bislang nicht bemerkt hatte, dem das Pronomen ‚ich‘ den Namen verleiht. Denn es gibt kein inneres Objekt, „das ‚Ich‘“ oder „das ‚Ego‘“ genannt, und das Erste-Person-Pronomen ist kein Name. Um den Gebrauch des Erste-Person-Pronomens zu lernen, muss man nicht lernen, ein Objekt irgendeiner Art zu identifizieren, weder ein inneres noch ein äußeres. Der charakteristische Gebrauch von ‚ich‘ lässt keine Fehlidentifizierung oder Falscherkennung zu.498 Was jedoch nicht deshalb so ist, weil er stets mit einer eindeutigen Identifizierung und Erkennung von einem selbst (geschweige denn des eigenen Selbst) einhergeht. Sondern vielmehr deshalb, weil überhaupt keine Identifizierung oder Erkennung mit ihm verknüpft ist. Die Beherrschung des Erste-Person-Pronomens durch ein Kind im Laufe einer normalen menschlichen Entwicklung geht jedoch mit der Beherrschung anderer Personalpronomen und personenbezogener Ausdrücke einher und Hand in Hand mit ihr. Wie weiter oben dargelegt ist der Übergang von den anfänglichen Schmerzensschreien zu ‚Tut weh!‘, ‚Es tut weh!‘ und dann ‚Ich habe Schmerzen‘ an das Verständnis der Frage ‚Tut es weh?‘ geknüpft und damit auch an das Lernen des Gebrauchs des Fragesatzes ‚Hat Mami Schmerzen?‘ und somit an die Beherrschung des Aussagesatzes ‚Sie hat Schmerzen‘. Denn wenn das Kind lernt, seinem eigenen Schmerz verbal Ausdruck zu verleihen, lernt es zudem, andere als solche zu beschreiben, die Schmerz leiden – denn die Schmerzäußerungen in der ersten und dritten Per498
In ganz speziellen Einzelfällen besteht die Möglichkeit einer Fehlidentifizierung: Wenn man z. B. eine alte Fotografie betrachtet, kann man auf jemanden zeigen und sagen ‚Ich war ein ziemlich hübsches Baby‘, und man kann damit insofern falschliegen, als es sich nicht um ein Foto von einem selbst handelt. Das ist ein Fall von Fehlidentifizierung – allerdings hat er keinen Einfluss auf die obige Erörterung.
472
12 Selbstbewusstsein
son sind zwei Seiten derselben Sprachmünze. Man kann nicht sagen, jemand verfüge über den Begriff des Schmerzes, solange er nicht sowohl dessen kriterienlosen Gebrauch in der ersten Person als auch dessen auf Kriterien beruhenden Gebrauch bei Schmerzzuschreibungen in der dritten Person gelernt hat (siehe 3.9). Ebenso kann man nicht sagen, jemand beherrsche den Gebrauch von ‚ich . . .‘, solange er nicht erfasst hat, dass ‚Ich bin . . .‘ zu sagen für andere ein Grund ist, von mir zu sagen ‚Du bist . . .‘ oder ‚Er ist . . .‘. Das Erste-Person-Pronomen ist eine Figur in einem komplexen Spiel, in dem die anderen Personalpronomen und personenbezogenen Ausdrücke andere unentbehrliche Figuren sind. Wie der König beim Schach ist es die Schlüsselfigur für jeden Spieler; aber ohne die anderen Figuren kann das Spiel nicht gespielt werden. Die Beherrschung von Wahrnehmungsprädikaten Das Muster, das wir zur Erklärung der Beherrschung des Erste-Person-Pronomens heranziehen, kann gleichermaßen auf wahrnehmungsbezogene Äußerungen in der ersten Person wie ‚Ich sehe . . .‘ oder ‚Ich höre . . .‘ etc. angewendet werden. Das lernende Kind muss zunächst den Gebrauch der entsprechenden Beschreibungstermini bewältigt haben, um beschreiben zu können, was es wahrnimmt – ‚Teddy ist auf dem Boden‘ beispielsweise, ‚Rover bellt‘ und so weiter. Zu lernen, solchen Beschreibungen ein ‚Ich sehe . . .‘ oder ein ‚Ich höre . . .‘ voranzustellen, heißt abermals nicht, dass man lernt, ein anderes, ‚Ich‘ genanntes Objekt zu identifizieren. Vielmehr muss das Kind gelernt haben, dass sehen als eine Möglichkeit, herauszufinden, dass es um die Dinge so und so bestellt ist, ins Spiel gebracht werden kann (z. B., dass der Teddy auf dem Boden liegt, der Ball rot und die Sonne rund ist), wie hören als eine Möglichkeit, andere Dinge herauszufinden, ins Spiel gebracht werden kann. Und das wird es sicherlich lernen, wenn seine Eltern es fragen ‚Kannst du sehen, wo der Teddy ist?‘, ‚Kannst du Rover bellen hören?‘ und so weiter. Die Voraussetzungen, die das vom Kind zu erlernende Voranstellen eines ‚Ich sehe . . .‘ oder eines ‚Ich höre . . .‘ rechtfertigen, unterscheiden sich nicht von den Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um vorbringen zu können, was man sieht oder hört, indem man seine Augen oder Ohren gebraucht. Das Präfix lässt jemand anderes erkennen, wodurch man das, was (dem Präfix) nachfolgt, vorbringen kann oder konnte: das heißt, wodurch man weiß (oder zu wissen meint), dass die Dinge so sind, wie man sie als seiend beschreibt. Mit zunehmender Beherrschung des Erste-Person-Pronomens in solchen Zusammenhängen muss das Kind – und das lehrt man es zwangsläufig – aber auch den Gebrauch der Zweite- und Dritte-Person-Pronomen in diesen Zusammenhängen beherrschen. Es wird zu fragen lernen ‚Siehst du?‘ und ‚Hast du gehört?‘ und mitzuteilen ‚Mama hat es nicht gesehen‘ und ‚Papa hat es nicht gehört‘, wenn es herausfindet, dass seine Mutter etwas nicht bemerkte oder dass sein Vater nicht zugehört hat. Die Möglichkeit der verschiedenen Formen des Selbstbewusstseins wird also zusammen mit und nicht vor der Beherrschung des sprachlichen Rüstzeugs zur Beschreibung der
12.6 Selbstbewusstsein
473
Erfahrungen anderer erworben. Darum ist es vollkommen abwegig, davon auszugehen, dass das Kind zunächst lernt, sich selbst Erfahrungen zuzuschreiben, und erst dann, anderen Erfahrung zuzuschreiben, indem es eine Analogie mit seinem Fall bildet oder eine Theorie über ‚die Denkmodelle‘ oder ‚den Geist anderer‘ aufstellt. Selbstbewusstsein ist an die Sozialisation geknüpft, jedoch nicht an Modellbildung Es ist irreführend, solche Prozesse der Bewältigung sprachlicher Techniken, die vom Selbstbewusstsein vorausgesetzt werden, als „Konstruktion eines begrifflichen Modells der Selbstheit“ oder „Konstruktion einer auf Gemeinschaft gründenden Selbstheit“ zu charakterisieren, wie Edelman vorschlägt. Offensichtlich ist aber, dass die Möglichkeit des Selbstbewusstseins an die zahlreichen komplexen Formen der Sozialisation des Kindes geknüpft ist. Das kleine Kind antwortet instinktiv auf die elterlichen Emotionen; es reagiert ohne nachzudenken oder zu schließen auf die zärtliche Umsorgung vonseiten der Eltern, auf ihren Zorn, auf ihre Zustimmung und Missbilligung, auf ihr Lächeln und ihre Tränen. Die Vorstellung, dass das Kind (oder sein Gehirn), um das zu tun, ‚ein Modell‘ des Geistes seiner Eltern ‚konstruieren‘ muss, welches es dann in die Lage versetzt, deren Verhalten vorherzusagen, ist sicherlich ebenso grotesk wie die Vorstellung, dass das Küken, das Kätzchen oder der Welpe ein Modell des Geistes seiner Eltern konstruiert. Modellbildung ist eine anspruchsvolle, begriffliche Fähigkeiten voraussetzende Tätigkeit, und wir können sie nicht anführen, um deren Erwerb zu erklären. Darüber hinaus ist ihre Zuschreibung zum Gehirn buchstäblich unfassbar, wenn ‚Modellbildung‘ im Kontext solcher Beschreibungen seine normale Bedeutung aufweist. Selbstbewusstsein ist kein irgendwie geartetes ‚Konstrukt‘, sondern eine Fähigkeit. Es ist nicht ersichtlich, worum es sich bei einer ‚Selbstheit‘ handeln soll. Wenn man hier jedoch das Hervortreten der Vorstellung des Kindes von sich selbst im Sinn hat und seine Fähigkeit, an sich selbst als ein Kind zu denken, als der Sohn der und der Eltern, als (kurz gesagt) das Subjekt der und der Prädikate, dann allerdings tritt die ‚Selbstheit‘ des Kindes oder besser gesagt der Sinn des Kindes für sich als ein Kind, auf das dies und jenes zutrifft, mit seiner Sozialisation und seinen zunehmenden sprachlichen Fähigkeiten hervor. Sein Selbstbewusstsein ist nicht abzulösen von seiner Beherrschung des Erste-Person-Pronomens und anderer Personalpronomen, seiner Bewältigung des kriterienlosen Gebrauchs psychologischer Prädikate in der ersten Person und deren an Kriterien gebundenen Gebrauchs in der dritten, und es ist nicht zu trennen von dem sehr breit gefächerten Spektrum an anderen sprachlichen Fähigkeiten, die das Kind bereits beherrschen muss, bevor es das Stadium der Sprachreife erreicht.
474
12 Selbstbewusstsein
Die Selbstbewusstseinsfähigkeiten Ein Wesen, das auf diese Weise eine Sprache beherrschen gelernt hat, ist ein selbstbewusstes Wesen. Es hat nicht nur ‚bewusste Erfahrung‘ (und ist bei Bewusstsein oder nicht und kann sich dieser oder jener Sache bewusst sein), sondern es hat auch die Fähigkeit, seinen Gedanken und Erfahrungen artikulierten Ausdruck zu verleihen. Es kann nicht nur wahrnehmen, es kann auch sagen, dass es wahrnimmt; nicht nur fühlen, sondern auch sagen, was es fühlt. Es kann denken und nicht sagen, was es denkt, gerade weil es sagen kann, was es denkt. Darüber hinaus kann es nicht nur denken und seinen Gedanken und Erfahrungen artikulierten Ausdruck verleihen; es kann an sich selbst als jemand denken, der jene Gedanken und Erfahrungen hat. Gerade weil es seinen Gedanken und Erfahrungen als seinen Gedanken und Erfahrungen in Worten artikulierten Ausdruck verleihen kann, ist es auch in der Lage, über seine Gedanken zu reflektieren und über die Tatsache, dass es die und die Gedanken hat. Es kann über seine Erfahrungen und über die Tatsache, dass es die und die Erfahrungen hat, nachdenken – auch wenn es seine kontemplativen Gedanken und Grübeleien vielleicht nicht offen artikuliert zum Ausdruck bringt. Kurz gesagt, wir fühlen, wollen, denken und nehmen nicht nur wahr, was immer wir fühlen etc.; sondern wir können auch sagen, dass wir das tun. Und weil wir sagen können, was wir so sagen können, können wir auch über unsere Verfassung und über uns selbst als Menschen nachdenken, die sich in dieser Verfassung befinden, ohne irgendetwas zu sagen. Diese Fähigkeit ist für das Selbstbewusstsein konstitutiv, und sie ist ein Privileg der Sprache verwendenden Wesen. Der Umfang der Selbstbewusstseinsvermögen Es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass die Selbstbewusstseinsvermögen, was ihre Objekte angeht, auf die gegenwärtigen Gedanken, Geisteszustände und Erfahrungen begrenzt sind. Ein selbstbewusstes Wesen wie der Mensch kann sich seiner eigenen Motive bewusst sein, und dass es aus den und den Motiven heraus handelt, kann seine Gedanken beschäftigen und ihm wichtig sein. Häufig wird man sich seiner Motive handelnd bewusst, indem man realisiert, dass einen die und die Gründe bewegen und dass diese Gründe einem bestimmten Motivmuster entsprechen – Barmherzigkeit beispielsweise, Liebe, Eifersucht, Ehrgeiz, Rache oder Angst. Wie wir bereits gesehen haben (7.2.2), besteht das Muster, dem wir üblicherweise einen Motiv-Namen geben, aus einem rückwärts gerichteten Handlungsgrund – zum Beispiel einem vergangenen oder gegenwärtigen Sachverhalt, der in bestimmter Hinsicht unerwünscht ist – und einem nach vorn gerichteten Handlungsgrund, der auf einen zukünftigen und den unerwünschten Sachverhalt irgendwie beseitigenden oder aufhebenden Sachverhalt verweist. Aus Mutterliebe zu handeln, bedeutet (in etwa), das Befinden der Mutter als sich verschlechterndes zu begreifen, einen zukünftigen Sachverhalt ins Auge zu fassen, der durch eine bestimmte Handlung herbeigeführt werden kann und der Mutter eine Wohltat ist, und
12.6 Selbstbewusstsein
475
diese Handlung in der Absicht auszuführen, die Mutter um ihrer selbst willen zu begünstigen. Aus Rache zu handeln, bedeutet (in etwa), zu glauben, dass beispielsweise Jack ein legitimes Interesse unsererseits schädigte, eine bestimmte Handlung ins Auge zu fassen, die Jack Schaden zufügt, und diese Handlung in der Absicht ausführen, Jack zu schaden, weil er eines unserer Interessen verletzt hat. Offensichtlich kann man aus einem bestimmten Motiv heraus handeln, ohne über einen Begriff dieses Motivs zu verfügen. Man kann jedoch nicht seine Handlungsmotive realisieren und sich ihrer auf diese Weise bewusst werden, wenn man nicht über einen Begriff des nämlichen Motivs verfügt. Hat man seine Motive realisiert, kann man sich freudig oder beschämt der Tatsache bewusst werden, dass man aus einem solchen Motiv heraus handelt. Man kann sich bezüglich seiner wahren Handlungsmotive demnach auch im Unklaren befinden, und diese fehlende Klarheit kann für einen von Bedeutung sein und die eigenen Gedanken beschäftigen – und auch das ist nur einem selbstbewussten Wesen möglich. Selbsterkenntnis Selbsterkenntnis geht mit dem Wissen um die eigenen Charakterzüge, Dispositionen und Befähigungen (oder den Mangel an eigenen Befähigungen) einher. Welche das sind, kann man auf unterschiedlichen Wegen erfahren: Indem einem andere etwas über die Charakterzüge etc. mitteilen beispielsweise oder indem man realisiert, dass das eigene Verhalten in der Vergangenheit als ängstlich, faul, rachsüchtig, verwöhnt oder rüpelhaft aufzufassen ist. Man erfährt seine Charakterzüge oder Dispositionen allerdings nicht, indem man sich ihrer wahrnehmend oder ‚introspektiv‘ bewusst ist. Denn Charakterzüge, Dispositionen und Befähigungen sind keine Objekte, die man wahrnehmen kann, geschweige denn ‚introspektieren‘ (missdeutet als Wahrnehmung durch einen ‚inneren Sinn‘), oder derer man sich bewusst werden kann. Weiß man jedoch, dass man sie hat, kann man sich ihrer bewusst sein – das heißt der Tatsache, dass man so und so ist. Und ist man sich ihrer bewusst, beschäftigen sie den eigenen Geist und sind für die eigenen Überlegungen von Bedeutung. Auch das ist nur einem Sprache verwendenden, selbstbewussten Wesen möglich. Denn um mir meiner Unwissenheit oder Belesenheit, meines Könnens oder meiner Inkompetenz, meiner Eitelkeit oder meines Ehrgeizes, meiner Vergesslichkeit oder Willensschwäche bewusst zu sein, muss ich über die Begriffe der entsprechenden Charakteristika verfügen, deren Selbst-Zuschreibung [ihre Zuschreibung zu mir durch mich] Teil meines Bewusstseins von mir [my being conscious of myself] als jemand ist, der über sie verfügt. Eine Autobiografie und einen Identitätssinn haben Selbstbewusste Wesen wie wir kennen nicht nur ihre gegenwärtigen Gedanken und Erfahrungen, Motive und Charakterzüge etc. und können sich ihrer bewusst sein, sondern auch ihre(r) Lebensgeschichte. Wie zuvor erwähnt haben Menschen im Gegensatz zu
476
12 Selbstbewusstsein
Tieren eine Autobiografie (und ein mehr oder weniger ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein). Von dem, was ein Mensch mit Blick auf seine Vergangenheit (und die seiner Gesellschaft, sozialen Gruppe oder Familie) weiß oder glaubt, hat er mithin ein dispositionales Bewusstsein und kann sich solcher Tatsachen oder vermeintlichen Tatsachen wirklich bewusst werden (siehe 9.3), wenn sie ihn beim Denken, bei seinen Überlegungen oder in der Fantasie in Beschlag nehmen. Solche Tatsachen oder Überzeugungen machen einen Großteil seines Selbstverständnisses bzw. Selbstsinns aus (aber nicht des Sinns von seinem Selbst). Denn sie sind für den Identitätssinn einer Person als einer Person der und der Art mit den und den Loyalitäten, Bindungen, Verpflichtungen und Rechten mitkonstitutiv. Selbstbewusstsein lässt sich nicht anhand selbstabtastender Einheiten im Gehirn erklären Es dürfte nun nicht mehr zu übersehen sein, auf welche Abwege die Vorstellung führt, dass das Selbstbewusstsein eine neurale Selbstabtastungs- oder Selbstüberwachungseinheit im Gehirn ist oder mit einer solchen einhergehen muss. Ob die Nervennetzwerke des Gehirns irgendetwas enthalten, das auch nur entfernt einer Selbstabtastungseinheit ähnelt, die in einen Computer eingebaut werden könnte, wissen wir nicht, und das weiß auch sonst niemand. Aber selbst wenn sie so etwas enthielten, warum sollten wir annehmen, dass damit geklärt wäre, worum es sich beim Selbstbewusstsein handelt? Offensichtlich gründet die Annahme, es wäre alles klar, auf einer Konzeption des Selbstbewusstseins als einer Form introspektiven Abtastens/Scannens der Geistesinhalte. Stimmt man mit dieser Konzeption überein, dann könnte man auch davon ausgehen, dass das Selbstbewusstsein von einer entsprechenden Selbstabtastungseinheit im Gehirn ermöglicht wird.499 Wir haben es hier allerdings mit einer doppelt irrigen Vorstellung zu tun. Erstens hat das Selbstbewusstsein, wie wir dargelegt haben, nichts mit einem Abtasten von irgendwas durch einen ‚inneren Sinn‘ (das heißt durch eine falsch verstandene Introspektion (siehe 3.6)) zu tun. Zweitens, selbst wenn (per impossibile) es mit einem solchen in Zusammenhang stünde, wäre nicht klar, wie eine neurale Selbstabtastungseinheit irgendeinen Beitrag zur Ermöglichung des Selbstbewusstseins leisten könnte. Eine neurale Selbstabtastungsstruktur im Gehirn wäre sich ebenso wenig der Gehirnvorgänge bewusst, wie ein Computerprogramm, das als ein Unterprogramm eine ‚Beschreibung‘ eines anderen Programms einschließt, sich dieses anderen Programms bewusst ist. Eine selbstreferenzielle Komponente in einem Programm kann einem Computer kein Bewusstsein von irgendwas verleihen, geschweige denn von sich selbst. Richtet man eine Videokamera auf einen Spiegel, wird sie sich nicht ihrer selbst bewusst, wie Penrose anmerkte.500 Selbst wenn also das Gehirn tatsächlich irgendetwas enthält, das 499
Eine Position, die in Weiskrantz’ Erklärungen des Blindsehens ganz offensichtlich ist, siehe unten 14.3.1. 500 Penrose, Emperor’s New Mind, S. 530 [dt. Computerdenken, S. 400].
12.6 Selbstbewusstsein
477
einer Selbstabtastungseinheit ähnelt, könnte es sich bei den Resultaten seiner ‚Selbstabtastung‘ nicht um etwas handeln, das es der Person, deren Gehirn es ist, mitteilen kann. Und wenn es das könnte, wäre die nämliche Person nicht in der Lage, die Mitteilung zu verstehen, es sei denn, wir hätten es mit einem ‚Über-Neurowissenschaftler‘ zu tun. Denn eine neurale Selbstabtastungseinheit könnte im Höchstfall komplexe neurale Strukturen zu erkennen geben. Es mag sein, dass eine Person so manches, zu dem sie normalerweise befähigt ist, nicht tun und die verschiedenen Formen des Selbstbewusstseins nicht ausprägen könnte, würden nicht komplexe selbstabtastende Nervennetzwerke am Werk sein und ihre Wirkung entfalten. Was jedoch, wenn dem so ist, nicht deshalb so ist, weil das selbstbewusste reflexive Denken mit dem Abtasten von irgendwas einhergeht. Es spricht kein spezieller Grund für die Annahme, dass die Fähigkeit einer Person, über sich selbst nachzudenken, über ihre jetzigen oder früheren Wahrnehmungserfahrungen, über ihre jetzigen oder früheren Emotionen oder Handlungsmotive, über ihre Charakterzüge und Veranlagungen, von einer neuralen Selbstabtastungseinheit abhängt, die scannt, wessen sich die Person bewusst ist oder was mit diesem in systematischem Zusammenhang steht. Sprachliche Fertigkeiten sind der Schlüssel zum Verständnis des Selbstbewusstseins Dass es überhaupt selbstbewusste Wesen gibt, ist gewiss keine Selbstverständlichkeit. Wir wären sicherlich nicht die Wesen, die wir sind, wenn wir kein Selbstbewusstsein hätten. Menschsein ist Selbstbewusstsein – das heißt, ganz Mensch ist, wer über die Fähigkeit verfügt, die vielfältigen Formen reflexiven Denkens und Reflektierens auszuüben. Das vollumfängliche Menschsein schließt somit auch die Fähigkeit ein, unsere Glaubens- und Wissenstatsachen, Erfahrungen und Veranlagungen, Emotionen und Motive, zurückliegenden Ereignisse und sozialen Beziehungen als Gründe dafür heranzuziehen, das und das zu denken, dies und jenes zu fühlen (einschließlich moralische Erfüllung oder Reue oder Schuld) oder aufgrund der und der Motive zu handeln. Der Schlüssel zum Verständnis des Selbstbewusstseins, dessen, was es ausmacht und ermöglicht, liegt nicht in neuralen Selbstabtastungsmechanismen im Gehirn, sondern in der normalen menschlichen Sprachbeherrschung. Und der Schlüssel zum Verständnis seiner neuralen Grundlagen liegt im Begreifen der neuralen Bedingungen des Besitzes und der Ausübung sprachlicher Fähigkeiten und der neuralen Bedingungen der Möglichkeit der Denkformen, die eine Folge der Möglichkeit des Sprechens sind. Diese mögen mit neuralen Selbstabtastungseinheiten verknüpft sein oder nicht.
Teil IV Methodisches
13 Reduktionismus 13.1 Ontologischer und erklärender Reduktionismus Ontologischer und erklärender Reduktionismus unterschieden: Crick Viele Neurowissenschaftler glauben vorbehaltlos an den Reduktionismus. Wenige nur versuchen zu verdeutlichen, was genau sie mit diesem künstlichen Terminus meinen. Die luzideste Darstellung der innerhalb der Neurowissenschaften allgemein akzeptierten Reduktionismuskonzeption, die wir gefunden haben, liefert Francis Crick in seinem Buch The Astonishing Hypothesis. Die titelgebende „Erstaunliche Hypothese“, die Crick verteidigt, ist in der Tat reduktionistisch; bei ihm heißt es: „‚Sie‘, Ihre Freuden und Leiden, Ihre Erinnerungen, Ihre Ziele, Ihr Sinn für ihre eigene Identität und Willensfreiheit – bei alledem handelt es in Wirklichkeit nur um das Verhalten einer riesigen Ansammlung von Nervenzellen und dazugehörigen Molekülen.“501 Crick meint, es falle „nicht leicht zu glauben, dass ich das differenzierte Verhalten einer Menge von Nervenzellen bin“, tatsächlich aber sei es so. Bei dieser Konzeption haben wir es dem Anschein nach mit einer Form des ontologischen Reduktionismus zu tun, da mit ihr die Ansicht vertreten wird, dass eine Entitätsart, mag es auch anders scheinen, in Wirklichkeit nur ein Gefüge aus anderen Entitätsarten ist. Im Schulterschluss mit dem ontologischen Reduktionismus verteidigt Crick auch eine Form des erklärenden Reduktionismus: „Die wissenschaftliche Überzeugung besteht darin, dass unser Geist – das Verhalten unseres Gehirns – sich durch die Wechselwirkungen von Nervenzellen (sowie anderen Zellen) und den dazugehörigen Molekülen erklären lässt.“ Der reduktionistische Ansatz besteht Crick zufolge darin, dass ein komplexes System durch das Verhalten seiner Teile und ihrer Wechselwirkungen untereinander erklärt werden kann. Bei einem System mit vielen Aktivitätsebenen muss dieser Vorgang vielleicht mehr als einmal wiederholt werden – d. h., es kann sein, dass das Verhalten eines bestimmten Teils wiederum durch das Verhalten seiner Teile und deren Wechselwirkun501
F. Crick, The Astonishing Hypothesis (Touchstone, London, 1995), S. 3 [dt. Was die Seele wirklich ist (Artemis & Winkler, München & Zürich, 1994), S. 17]. Es verwundert schon, dass Crick seine materialistische Hypothese ‚erstaunlich‘ findet, weil sie bereits im ersten vorchristlichen Jahrhundert in epikuräisch-atomistischer Form vorgelegt wurde, und zwar von Lukrez in seinem großartigen Gedicht De rerum natura. In etwas abgewandelten Ausprägungen wurde sie im 17. Jahrhundert von Gassendi und Hobbes und im 18. von La Mettrie, Diderot und d’Holbach vertreten. Wenn sie erstaunlich ist, dann sicher nicht aufgrund ihrer Neuartigkeit.
482
13 Reduktionismus
gen erklärt werden muss. Um beispielsweise das Gehirn zu verstehen, kann es nötig sein, die vielen Wechselwirkungen der Nervenzellen untereinander zu kennen; es kann zudem erforderlich sein, das Verhalten jeder einzelnen Nervenzelle mit Rückgriff auf die Ionen und Moleküle zu erklären, aus denen sie sich zusammensetzt.502
Laut Crick ist der Reduktionismus die „wichtigste theoretische Methode, von der die Entwicklung der Physik, der Chemie und der Molekularbiologie angetrieben worden ist. Er ist weitgehend verantwortlich für die spektakulären Entwicklungen der modernen Wissenschaft. Er ist die einzig vernünftige Vorgehensweise, solange keine starken experimentellen Beweise es nötig machen, dass wir unsere Einstellung ändern.“503 Was daraus mitunter gefolgert wird: Blakemore Colin Blakemore legte in seinen BBC-Vorlesungen The Mind Machine eine ähnliche reduktionistische Version mit eher epiphänomenalistischem Akzent vor. Alle unsere Handlungen werden von unseren Gehirnen hervorgebracht [. . .] Wir fühlen für gewöhnlich, dass wir die Kontrolle über unsere Handlungen ausüben, dieses Gefühl selbst aber ist ein Produkt des Gehirns, dessen Mechanismus wegen seiner Nützlichkeit auf dem Wege der natürlichen Selektion entwickelt wurde. Wir sind Maschinen, so wunderbar ausgeklügelte Maschinen jedoch, dass niemand verletzt sein sollte, wenn man von ihm sagt, er sei eine solche Maschine. [. . .] Das Gefühl des Wollens ist eine Erfindung des Gehirns. Wie so vieles, was das Gehirn tut, ist das Gefühl, eine Wahl zu haben, ein mentales Modell – eine einleuchtende Darstellung davon, wie wir handeln, die uns genauso wenig mitteilt, wie Entscheidungen im Gehirn tatsächlich getroffen werden, wie unsere Wahrnehmung der Welt uns über die Rechenleistungen aufklärt, die mit ihrer Ableitung verknüpft sind.504 502
Ibid., S. 7 [dt. S. 22]. Ibid., S. 8 [dt. S. 23f.]. 504 C. Blakemore, The Mind Machine (BBC Publications, London, 1988), S. 272ff. In dem Sinn, in dem all unsere Handlungen von unseren Gehirnen herrühren, geht selbstverständlich auch unser Wissen auf sie zurück (einschließlich unseres neurowissenschaftlichen Wissens). Und genauso wie die Tatsache, dass das normale Funktionieren des Gehirns eine notwendige Bedingung des Wissens von irgendetwas ist, nicht zeigt, dass wir nichts wissen, so zeigt auch die Tatsache, dass das normale Funktionieren des Gehirns eine notwendige Bedingung des Handelns ist, nicht, dass wir nicht handeln. Normalerweise fühlen, d. h. denken wir, dass wir die Kontrolle über unsere Handlungen ausüben, und wir kontrollieren sie tatsächlich – die Tatsache, dass dieses Gefühl ‚ein Gehirnprodukt‘ ist, zeigt nicht, das es trügt. Das ‚Gefühl des Wollens‘ ist keine Erfindung des Gehirns, weil Gehirne nichts erfinden, und das Gefühl, eine Wahl zu haben, ist kein ‚mentales Modell‘, weil es kein Modell ist. Dass wir häufig handeln, weil wir uns entschieden haben, so zu handeln, ist keine ‚einleuchtende Darstellung davon, wie wir handeln‘, weil es überhaupt keine Darstellung davon ist, wie wir handeln. Wie im dritten Kapitel erörtert, werden im Gehirn keine Entscheidungen getroffen und sind unsere Wahrnehmungen der Welt nicht von irgendwelchen Rechenleistungen, die das Gehirn vollbringt, abgeleitet. Denn Wahrnehmungen werden nicht 503
13.1 Ontologischer und erklärender Reduktionismus
483
Derartige Annahmen – nämlich, dass Menschen Maschinen sind oder dass menschliches Verhalten nicht mehr ist als das Verhalten ihrer Nervenzellen oder dass Entscheidungen im und (scheinbar) durch das Gehirn getroffen werden – haben nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern sind Metaphysik. Es ist fraglich, ob solche ehrwürdigen metaphysischen Bilder durch die moderne Wissenschaft irgendwie überzeugender werden, als sie es vor mehr als 2.000 Jahren in der Antike durch Demokrits, Epikurs oder Lukrez’ Vermittlung waren. Genau weil wir es bei den verschiedenen Formen des ontologischen und erklärenden Reduktionismus mit metaphysischen Thesen zu tun haben, die die Logik von Existenzzuschreibungen und die logische Erklärungsstruktur betreffen, verschließen sie sich wissenschaftlicher Bestätigung oder Widerlegung. Sollen sie bestätigt oder widerlegt werden, dann hat das durch analytische Beweismittel zu geschehen. Klassischer Reduktionismus und Einheitswissenschaft Um solche reduktionistischen Behauptungen zu bewerten, muss zunächst geklärt werden, was der Reduktionismus ist und welche Formen er annehmen kann. Im weitesten Sinne ist er das Bekenntnis zu und die Suche nach einer einzelnen einheitstiftenden Erklärung eines Phänomens von bestimmter Art. In diesem Sinne verficht der Marxismus eine reduktive Erklärung der Geschichte und verteidigt die Psychoanalyse eine reduktive Erklärung des menschlichen Verhaltens. Genauer betrachtet bemüht sich der Wissenschafts-Reduktionismus um die vollständige Erklärung der Natur und des Verhaltens von Entitäten einer bestimmten Art vermittels der Erklärung der Natur und des Verhaltens von deren Bestandteilen. Das Ideal der ‚Einheitswissenschaft‘, für das die Positivisten des Wiener Kreises505 in den 1920er und 1930er Jahren plädierten und das von den logischen Empiristen in den 1950er Jahren wieder aufgegriffen wurde, war dem sogenannten ‚klassischen Reduktionismus‘ verpflichtet.506 Diese Konzeption hielt fest, dass die Gegenstände, aus denen die Welt besteht, auf eine Weise hierarchisch klassifiziert werden können, dass die Gegenstände aller Klassifizierungsebenen aus Gegenständen von irgendetwas abgeleitet, und das Gehirn (be)rechnet nichts. Sind wir Maschinen? Nur dann, wenn es Maschinen gibt, die Schmerz empfinden und an ihren Aktivitäten Gefallen finden können, die ein eigenes Verlangen aufweisen und eigene Zwecke haben, die fähig sind zu denken und zu handeln, die über Handlungsabläufe nachdenken und entscheiden können, was sie gründehalber tun werden, und die für ihr Tun verantwortlich sind. 505 Siehe des Manifests des Kreises aus dem Jahr 1929: ‚Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis‘ in Wiener Kreis. Texte zur wissenschaftlichen Weltauffassung (Meiner, Hamburg, 2006), II. Rudolf Carnaps Handschrift ist unverkennbar in der Charakterisierung des ins Auge gefassten reduktiven ‚Formelsystems‘ (siehe besonders S. 11f.). 506 Die Terminologie nimmt Anleihen bei John Dupré, The Disorder of Things: The Metaphysical Foundations of the Disunity of Science (Harvard University Press, Boston, MA, 1993), dessen Auseinandersetzung mit dem Reduktionismus in den Kapiteln 4–7 wir viel verdanken.
484
13 Reduktionismus
einer tieferen Ebene zusammengesetzt sind. Auf der tiefsten Ebene sind angeblich die Elementarteilchen angesiedelt, denen sich die Grundlagenphysik widmet. Oberhalb werden die aufeinanderfolgenden Ebenen von Atomen, Molekülen, Zellen, mehrzelligen Organismen und sozialen Gruppen gebildet. Diese Ebenen zu untersuchen obliegt einer bestimmten Wissenschaft (oder bestimmten Wissenschaften), die ihren Zweck in der Entdeckung der Gesetze findet, die das Verhalten der Entitäten der fraglichen Art beschreiben. Der Reduktionismus ist ‚programmiert‘, die Gesetze jeder bestehenden Ebene von den differierenden Gesetzen abzuleiten, die das Verhalten der Entitäten auf der niedrigeren Ebene beschreiben. Der so verstandene ableitende Reduktionismus braucht neben den Gesetzen der reduzierten und der reduzierenden Ebenen auch Brückenprinzipien, welche die Gegenstände auf der reduzierten Ebene mit spezifischen Strukturen der die reduzierende Ebene bildenden Gegenstände identifizieren.507 Wissenschaftlicher Reduktionismus und metaphysischer Materialismus Der klassische Reduktionismus war eine gewagte und beeindruckende und eine in erster Linie philosophische These über die Ontologie und über die logische Besonderheit des wissenschaftlichen Erklärungsansatzes, die auf zwei Grundannahmen beruhte. Bei der ersten handelte es sich um die in einigen Wissenschaftsbereichen offenbar erfolgreich vollzogene Reduzierung von Fragmenten einer Wissenschaft auf Elemente einer anderen. So wurden beispielsweise die Wechselwirkungen zwischen verschiedenartigen Materialien durch die Atom- und Valenztheorie der Chemie erfolgreich erklärt. Die zweite Annahme war dem metaphysischen Materialismus verpflichtet, einer ontologischen Doktrin, die üblicherweise gegen den cartesianischen Dualismus ins Feld geführt wird. In seiner einfachsten und gerechtfertigten Form läuft er auf eine Ablehnung des Gedankens hinaus, dass es mentale oder geistige Substanzen gibt. In seiner einfachsten und krudesten bzw. am wenigsten ausgereiften Form geht er mit der Behauptung einher, dass alles Existierende materiell ist. In dieser Version behauptet er, dass der Geist das Gehirn ist (daher der rasante, mit Noam Chomsky verbundene Aufstieg der abwegigen Wendung ‚Geist/Gehirn‘ in den letzten Jahren). In differenzierterer und ausgreifterer Form geht er mit der Behauptung einher, dass wir es bei geistigen Zuständen, Ereignissen und Prozessen in Wirklichkeit mit neuralen Zuständen, Ereignissen und Prozessen zu tun haben, dass geistige Eigenschaften in Wirklichkeit mit neuralen zusammenfallen.
507
Die klassische Fassung eines solchen klassischen Reduktionismus liefern P. Oppenheim und H. Putnam in ihrer Abhandlung ‚The unity of science as a working hypothesis‘, in H. Feigl et al. (Hg.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Bd. II (University of Minnesota Press, Minneapolis, 1958). Die Schwachstellen dieser Konzeption werden von Dupré gut herausgearbeitet.
13.1 Ontologischer und erklärender Reduktionismus
485
Ontologischer Materialismus Zugunsten des ontologischen Materialismus lässt sich kaum etwas vorbringen. Die Bestreitung der Existenz mentaler oder geistiger Substanzen impliziert nicht, dass die einzigen existierenden Dinge materielle Objekte (und materiell Stoffliches) sind. Denn bei Gesetzen und Rechtsordnungen, Zahlen und Theoremen, Spielen und Bühnenstücken handelt es sich offenkundig weder um materielle Objekte noch um materiell Stoffliches. Die Farben, Größen und Gewichte von materiellen Objekten, ganz zu schweigen von ihren Funktionen und Dispositionen, sind mit Sicherheit keine materiellen Objekte, obgleich es zweifellos Sinn hat zu sagen, dass es solche Eigenschaften wie Farben, Größen und Gewichte und solche Dispositionen wie Löslichkeit und Elastizität gibt. Zudem handelt es sich bei Kriegen, Revolutionen und Kulturen, Theateraufführungen, Geburtstagsfeiern und Beerdigungen nicht um materiellen Objekte – solche Dinge gibt es jedoch, sie kommen vor, ereignen sich oder existieren zu einer Zeit oder für eine gewisse Zeit. Wandelte man die Behauptung ab, ließe sich vorbringen, dass alles, was es gibt, aus Materie gemacht ist oder aus ihr besteht. Diese Formulierung ist allerdings nicht besser, denn Gesetze und Rechtsordnungen, Zahlen und Theoreme, Spiele und Bühnenstücke, politische Parteien, eine Gesellschaft und ihre Kultur, Inflation und Wirtschaftswachstum sind nicht aus Materie gemacht und bestehen nicht aus Materie. Die Bestreitung der Existenz immaterieller Substanzen impliziert überdies nicht, dass für die Erklärung der Eigenschaften und/oder des Verhaltens der existierenden Dinge – ja auch nur der existierenden materiellen Objekte – lediglich die Materie relevant ist, aus der sie gemacht sind. Hilfsmittel und Artefakte werden in erster Linie anhand ihrer Funktion, nicht einfach nur anhand ihrer materiellen Zusammensetzung erklärt. Das Verhalten fühlender Wesen im Allgemeinen wird teilweise im Hinblick auf ihre Ziele erklärt und das von menschlichen Wesen im Besonderen auch hinsichtlich ihrer Gründe und Motive, nicht im Hinblick auf die Materie, aus der sie bestehen. Noch offensichtlicher ist, dass die Erklärung von Ereignissen und Prozessen wie Hannibals Sieg bei Cannae oder das Aufkommen der Romantik nichts mit der Materie zu tun hat, aus der die Explananda gemacht sind, denn sie sind aus nichts gemacht. Der Materialist könnte nun mit einer viel bescheideneren Behauptung aufwarten: Alles, was aus irgendetwas gemacht ist, ist aus Materie gemacht. Sicherlich dürften wir einräumen, dass der Geist nicht aus einer immateriellen Substanz gemacht ist508 – dann aber, wenn die Argumentation von 3.10 zutrifft, ist der Geist aus nichts gemacht, und alle Rede vom Geist ist eine bloße Façon de parler, um von den besonderen menschlichen Denk-, Gedächtnis und Willensfähigkeiten und von deren Ausübung zu reden.509 508
Selbstverständlich behauptete Descartes das nie. Er vertrat die Auffassung, dass der Geist eine immaterielle Substanz ist, nicht, dass er aus ‚immateriellem Stoff‘ gemacht ist. 509 Wenn das aber zutrifft, ist Cricks Behauptung, dass unser Geist ‚das Verhalten unserer Gehirne‘ ist, ebenso inkohärent wie die Vorstellung, dass die uns geltenden Zuliebe das Verhalten
486
13 Reduktionismus
Rechtsordnungen bestehen aus Gesetzen und nicht aus Materie; Gedichte bestehen aus Strophen, nicht aus Tinte; und Revolutionen bestehen aus menschlichen Handlungen und Ereignissen. Der Materialist könnte einräumen, dies sei das, woraus Gesetze und Gedichte und Revolutionen bestehen, zugleich aber bestreiten, dass diese aus irgendetwas gemacht sind. Auch das können wir einräumen. Aber selbst wenn es so ist, dass alles, was aus irgendetwas gemacht ist, aus Materie gemacht ist, stützt diese These in keiner Weise irgendeine Form der ontologischen Reduktion, nach der alle ‚Entitäten‘ auf Materie reduziert werden können. Sie stützt auch keine Form der erklärenden Reduktion, nach der die Eigenschaften und das Verhalten alles Existierenden durch die Eigenschaften und das Verhalten von dessen materielleren Bestandteilen zu erklären sind. Menschliche Wesen sind nicht ontologisch auf ihr Nervensystem reduzierbar Dass alles, was aus irgendetwas gemacht ist, aus Materie gemacht ist, zeigt nicht, dass menschliche Wesen ontologisch auf ihr Nervensystem reduzierbar sind und schon gar nicht, dass ihr Geist ihr Gehirn ist. Menschen sind aus verschiedenen Teilen – ihren Körperteilen – zusammengesetzt und sie sind aus bestimmten Mengen chemischer Elemente gemacht; sie sind jedoch nicht identisch mit dem, woraus sie gemacht sind, oder mit einem besonderen Körperteil jener (Körperteile), aus denen sie sich zusammensetzen – dem Gehirn nämlich. Wir sind Menschen, und wir leben nicht in unseren Schädeln, sondern in unseren Wohnungen. Die Eigenschaften, die wir haben (z. B. unsere physischen Eigenschaften – Körpergröße, Gewicht, Aussehen – und unsere persönlichen Beziehungen, unsere gesellschaftliche Stellung, unsere ökonomische Position, unsere Lebensgeschichte), sind keine Eigenschaften des Gehirns, genauso wenig, wie die Eigenschaften des Gehirns unsere Eigenschaften sind. Es ist schlichtweg falsch, dass wir „nur das Verhalten einer riesigen Ansammlung von Nervenzellen (und anderer Zellen) und den dazugehörigen Molekülen“ sind. Tautologisch wahr ist, dass wir nicht aus noch mehr Zellen bestehen, als der riesigen Ansammlung von Nervenzellen und anderen Zellen, aus denen wir – lebende menschliche Wesen – tatsächlich bestehen. Wir sind allerdings genauso wenig eine bloße Ansammlung von Zellen (Nervenzellen und anderen), wie ein Gemälde ein bloße Ansammlung von Pigmenten und Pinselstrichen ist, ein Roman eine bloße Ansammlung von Worten oder eine Gesellschaft eine bloße Ansammlung von Menschen – obgleich das, was ein Gemälde über Pigmente hinaus ist, kein Mehr an Pigmenten ist, was ein Roman über Worte hinaus, was eine Gesellschaft über Menschen hinaus ist, kein Mehr an Worten bzw. Menschen ist. unserer Freunde sind, die uns zuliebe bestimmte Sachen machen. Und, zurückhaltender formuliert, bei meinem Entschluss, meinem Sinneswandel oder meinem Zögern in Bezug auf V handelt es sich auch nicht um das Verhalten meines Gehirns, obgleich ich mich nur entschließen, meine Ansicht ändern und zögern kann (zu und ob V), wenn mein Gehirn in entscheidender Hinsicht normal funktioniert.
13.1 Ontologischer und erklärender Reduktionismus
487
Dies könnte von einem neurowissenschaftlichen Reduktionisten eingeräumt werden. Mit Crick könnte er argumentieren, dass ein großer Teil des Gehirnverhaltens ‚emergent‘ ist – d. h., derartiges Verhalten existiert nicht in den separaten Teilen des Gehirns wie z. B. den einzelnen Neuronen [. . .] Nur durch das verwickelte Zusammenwirken vieler Neuronen können diese fantastischen Leistungen zustande gebracht werden. [. . .] emergentes Verhalten eines Systems ist zwar nicht unbedingt die einfache Summe des Verhaltens der Teile, es kann aber zumindest im Prinzip unter dem Aspekt der Beschaffenheit und des Verhaltens der Teile und vermöge des Wissens um die Interaktionsweisen all dieser Teile verstanden werden.510
Das ist allerdings verworren. Zwar kann ein großer Teil des Verhaltens des Gehirns emergent sein und anhand der Interaktionen seiner Teile erklärt werden, das Verhalten eines menschlichen Wesens ist jedoch keine emergente oder supervenierende Eigenschaft seines Gehirns. Emergente oder supervenierende Eigenschaften sind Eigenschaften eines komplexen Systems, die so geartet sind, dass eine vollständige Kenntnis der Beziehungen der Systemelemente untereinander (die wir nicht erlangen können) hinreichend ist (für einen Gott gleichsam), um sie insgesamt abzuleiten. Möglicherweise reicht es in irgendeinem Sinn aus, die neuralen Ereignisse zu kennen, um eine Beschreibung der Bewegungen ‚des Systems‘ insgesamt abzuleiten (vorausgesetzt, es handelt sich bei ‚dem System‘ um den Menschen und nicht bloß um sein Gehirn) – die Bewegungen der Hand der Person beispielsweise (in der Annahme, dass sie keine fremde Macht bewegt oder zur Bewegung veranlasst). Es ist die Frage, ob neurales Wissen zwischen dem Ereignis einer Handbewegung durch eine Person und der Ausführung der Handbewegung durch sie differenzieren und so zwischen der Supervenienz eines Ereignisses (die Bewegung der Hand) und der einer Handlung (die Ausführung der Handbewegung durch die Person) unterscheiden kann. Aber selbst wenn das möglich wäre, würde kein noch so umfangreiches neurales Wissen hinreichen, um zu unterscheiden zwischen dem Niederschreiben des eigenen Namens, dessen Nachahmung, dem Einstudieren der eigenen Unterschrift, der Namensfälschung, dem Autogrammschreiben, dem Unterschreiben eines Schecks, einer Testamentsbeglaubigung, der Unterzeichnung eines Hinrichtungsbefehls und so weiter. Denn die hier bestehenden Unterschiede sind von den Umständen abhängende Funktionen nicht nur der Intentionen des Individuums, sondern auch der sozialen und rechtlichen Konventionen, die Bestand haben müssen, soll man solche Intentionen haben und sie handelnd ausführen können. Crick hat ganz Recht, wenn er sagt, dass „es nicht leichtfällt zu glauben, dass ich das differenzierte Verhalten einer Menge von Nervenzellen bin“ – und das ist auch gut so. Ich bin nicht das Verhalten der Nervenzellen und anderer Zellen, aus denen ich bestehe, weil ich nicht das Verhalten von irgendwas bin – nicht einmal das meinige. Ich bin ein Mensch, ein Tier einer bestimmten Art mit ganz charakteristischen Fähigkeiten. Meine Geschichte ist mein Verhalten in meinem sozio-historischen Lebenszusammenhang, das, 510
Crick, Astonishing Hypothesis, S. 11 [dt. Was die Seele wirklich ist, S. 27].
488
13 Reduktionismus
was ich im Laufe der Zeit getan habe (und auch das, was mir widerfuhr); ob aber meine Geschichte auf die Geschichte meiner Nervenzellen und anderen Zellen reduzierbar ist, ist eine andere Frage, der wir uns nun zuwenden müssen. Drei Einwände gegen die Identifizierung psychologischer Attribute mit neuralen Zuständen Eine Variante des erklärenden Reduktionismus im Bereich des Geistigen ist die von Crick vertretene These, nach der alles Verhalten und alle geistigen Zustände (Ereignisse, Prozesse, Vermögen) mit neuralen Prozessen vollständig erklärt werden können. Die Behauptung, alles menschliche Verhalten sei ‚letztlich‘ oder ‚theoretisch‘ mit neuralen Prozessen erklärbar, sieht sich mit einer Reihe von Einwänden konfrontiert. Das erste Einwandsspektrum betrifft insbesondere die Frage, ob es einleuchtend ist, psychologische Attribute mit neuralen Zuständen oder Ereignissen zu identifizieren. (i) Es ist eine Sache, davon auszugehen, dass eine Person nicht glauben, hoffen, fürchten, denken, wollen etc. würde, was immer sie glaubt etc., wenn ihr Gehirn in den entscheidenden Hinsichten nicht normal funktionierte. Etwas ganz anderes ist es, allgemeine Brückenprinzipien zu veranschlagen, die das Glauben einer Person von was auch immer etc. mit einer speziellen Art von neuralem Zustand oder neuraler Verfassung identifizieren. Bei der ersten Position handelt es sich um eine wichtige Binsenweisheit. Bei der zweiten handelt es sich um einen Irrtum. Denn es gibt keinen Grund anzunehmen, dass zwei Menschen nicht beispielsweise dasselbe glauben können, trotzdem die entsprechenden neuralen Strukturen (bislang unbekannt) in ihren Gehirnen anders ausgeprägt sind. Die Identitätskriterien für geistige Zustände, Ereignisse und Prozesse unterscheiden sich von den Identitätskriterien für neurale Zustände, Ereignisse und Prozesse.511 Das sollte aus der folgenden Überlegung hervorgehen. Von Zustand X mag gesagt werden, dass er nur dann mit Zustand Y identisch ist, wenn A jedes Mal, wenn es in Zustand X ist, auch in Zustand Y ist. Dann allerdings kann das Glauben von etwas prinzipiell nicht mit einem neuralen Zustand identisch sein, denn das Subjekt des Glaubens ist die Person A und das Subjekt eines entsprechenden neuralen Zustands ist A’s Gehirn, und A ist nicht identisch mit seinem Gehirn. Siehe A. J. P. Kenny, ‚Language and mind‘, wieder abgedr. in The Legacy of Wittgenstein (Blackwell, Oxford, 1984), S. 142. Wie Kenny ausführt, steht dieser Unterschied im Zusammenhang mit einem vergleichbaren Unterschied in Computern: Es gibt keine Eins-zu-eins-Entsprechung zwischen Softwarestrukturen und Hardwarestrukturen. Die elektronischen Ereignisse, die sich in einem Computer oder Taschenrechner vollziehen, der die Quadratwurzel aus 123456789 berechnet, müssen keine Ähnlichkeit mit den Ereignissen in einem anderen Computer oder Taschenrechner aufweisen, der sich mit der gleichen Aufgabe befasst. Wenn man die Hardware von Tastatur und Bildschirm abtrennt, dann würde es sich bei den elektronischen Ereignissen, unabhängig davon, welche sich in ihr abspielen, gleichermaßen nicht um die Berechnung der Quadratwurzel aus 123456789 handeln. 511
13.1 Ontologischer und erklärender Reduktionismus
489
(ii) Wenn glauben, hoffen, wollen etc. mit bestimmten neuralen Zuständen identisch wären, dann wäre der Ort des Geisteszustands M oder des Geistesereignisses E, der/das im M-/E-Werden des Akteurs besteht, der Ort der entsprechenden neuralen Zustände oder Ereignisse (um welche es sich auch immer handeln mag). Allerdings beantwortet man die Frage ‚Wo glauben Sie, dass es regnen wird?‘, indem man den Ort angibt, wo es vermeintlich regnen wird, nicht, indem man auf eine Stelle im eigenen Schädel hindeutet, und die Frage ‚Wo glauben Sie, dass E = mc2 ist‘ ist ohne Sinn. Ebenso kann ‚Wo haben Sie den Glauben, dass p, erworben?‘ mit ‚In der Bibliothek‘ oder ‚Als ich mit Jack durch die Heidelandschaft wanderte‘ beantwortet werden, jedoch nicht mit ‚In meinem Gehirn natürlich‘. (iii) Wie wir in 6.1 erörtert haben, ist es im Hinblick auf viele Attribute unsinnig anzunehmen, dass sie mit neuralen Zuständen oder Verfassungen identisch sind, insofern als ein neuraler Zustand oder eine neurale Verfassung unmöglich die logischen Konsequenzen solcher Attribute haben könnte. Wenn also beispielsweise glauben, dass p mit irgendwelchen (bis jetzt unbekannten) Neuronen-Konfigurationen im Gehirn identisch wäre, dann würde eine Person, wenn sie bekundet oder vorbringt, sie glaube, dass p, sich in Wirklichkeit (ohne es selbst zu wissen) zum Zustand ihres Gehirns äußern (so wie eine Person, die sich zu Hesperus äußert, sich auch zu Phosphorus äußert, weil sie derselbe Himmelskörper sind, ob sie es weiß oder nicht). Wenn das allerdings so wäre, dann würde es Sinn ergeben, wenn eine Person sagte ‚Ich glaube, dass p, ob es jedoch so ist, dass p, ist, was mich betrifft, eine offene Frage (oder: ist etwas, zu dem ich keine Stellung nehme)‘. Sie könnte in der Tat kohärent vorbringen ‚Ich glaube, dass Jack in der Stadt ist [d. h., mein Gehirn befindet sich in dem neuralen Zustand, der mit meinem entsprechenden Glauben identisch ist], er ist jedoch nicht in der Stadt‘ – denn es besteht selbstverständlich kein Widerspruch zwischen der Versicherung, dass eine bestimmte neurale Konfiguration in meinem Gehirn vorherrscht, und der Leugnung von Jacks Anwesenheit in der Stadt. Es ist allerdings inkohärent zu behaupten ‚Ich glaube, dass Jack in der Stadt ist, er ist jedoch nicht in der Stadt‘ und zu sagen, dass glauben, dies und jenes sei der Fall, heißt, dazu Stellung zu nehmen, ob es der Fall ist, was es nicht hieße, wenn eine Glaubensversicherung eine Äußerung über eine neurale Konfiguration im eigenen Gehirn wäre. Zu sagen ‚Ich glaube, dass p‘ ist normalerweise eine abgesicherte Behauptung, dass p, keine Bezugnahme auf und schon gar keine Beschreibung eine(r) neurale(n) Konfiguration im eigenen Gehirn. Und man keine abgesicherte Behauptung, dass p, aufstellen und zugleich leugnen, dass p. Ebenso kann ein neurales Muster im Gehirn nicht die logischen Konsequenzen haben wie etwas glauben: nämlich, entweder Recht oder Unrecht mit dem zu haben, was man glaubt. Denn so etwas wie eine neurale Konfiguration, die, was die Wahrheit einer Proposition angeht, Recht oder Unrecht hat, gibt es nicht.512 512
Siehe Arthur Collins, The Nature of Mental Things (University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 1987), Kap. 2, und idem, ‚Could our beliefs be representations in our brains?‘, Journal of Philosophy, 76 (1979), S. 225–243.
490
13 Reduktionismus
Wenn glauben eine neurale Konfiguration wäre, würde es gleichfalls Sinn ergeben zu sagen ‚Ich befinde mich in einem Zustand des Glaubens, dass es regnen wird, der in Wirklichkeit ein Zustand meines Gehirns ist, und mein Zustand ist verlässlich, also verlasse ich mich auf ihn‘ oder ‚Ich glaube, dass es regnen wird, und weil meine Gehirnzustände verlässlich sind, wird es wohl so sein‘.513 Aber auch das ergibt keinen Sinn. Wenn sich also kein Sinn damit verbinden lässt, neurale Zustände und Konfigurationen buchstäblich mit psychologischen Attributen zu identifizieren, kann es keine allgemeinen Brückenprinzipien geben, die die reduzierenden Entitäten (neurale Konfigurationen) mit den Entitäten, die reduziert werden sollen (psychologische Attribute), verknüpft. Wenn es aber keine Brückenprinzipien geben kann, dann besteht keinerlei Hoffnung für all die Formen der Reduktion, die es uns erlauben sollen, die Gesetze, die die Phänomene auf der höheren Ebene des Psychischen beherrschen, von denen abzuleiten, der die Phänomene auf der neuralen Ebene unterliegen. Also haben wir es bei dieser Form des ableitenden Reduktionismus mit einer Schimäre zu tun. Es gibt keine psychologischen Gesetze menschlichen Handelns, die auf neurale Gesetze zu reduzieren sind Es gibt nicht nur keine Brückenprinzipien, die irgendeine Form der ontologischen Reduktion psychologischer Attribute auf neurale Konfigurationen erlauben, sondern es ist auch sehr zu bezweifeln, dass es irgendetwas gibt, dem man den Ehrentitel psychologische Gesetze menschlichen Handelns verleihen kann, die auf neurologische Gesetze reduziert und mithin durch sie erklärt werden könnten, welche auch immer dereinst entdeckt werden. Denn es ist unverkennbar, dass es sich bei den Erklärungen dafür, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln, oder weshalb ein bestimmter Mensch so handelte, wie er handelte, obgleich sie sehr zahlreich und unterschiedlich sind, nicht um nomologische Erklärungen handelt (d. h., sie sind keine Erklärungen, die auf ein Naturgesetz menschlichen Verhaltens verweisen). Es gibt allerdings Erklärungen der Handlung einer Person, die sie (die Handlung) erklären, indem sie sie als ein Beispiel eines allgemeinen Musters identifizieren. Weshalb A V vollzieht, können wir also anhand der Tatsache erklären, dass es sich dabei um eine Angewohnheit handelt oder dass A in derartigen Augenblicken eine Neigung zu V hat oder dass es in A’s Umgebung so Usus und A ein konventioneller Mensch ist oder dass sich A in der und der Zwangslage befindet und Leute mit A’s Persönlichkeitsmerkmalen in solchen Umständen zu V neigen. Diese Erklärungen führen jedoch nichts an, was als ein strenges Gesetz erachtet werden könnte; sie erklären das Verhalten auch nicht, indem sie es von einem Gesetz und einer Reihe von Ausgangsbedingungen herleiten. Stattdessen identifizieren sie es als ein Beispiel der einen oder anderen ‚ungefähren‘ Re513
L. Wittgenstein, Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, Bd. I, hg. von G. E. M. Anscombe und G. H. von Wright, Wittgensteins Werkausgabe Bd. VII, §§ 481–483.
13.1 Ontologischer und erklärender Reduktionismus
491
gelmäßigkeit im Verhalten der Person, die mit vielen Ausnahmen verbunden sein kann. Weshalb A V ausführte, können wir anhand der zahlreichen unterschiedlichen Einflussfaktoren nach Maßgabe unterschiedlicher Erklärungsschemata erklären. Selbstverständlich können manche Handlungen anhand von Kausalfaktoren erklärt werden. Es ist indes wichtig anzumerken, dass es sich auch bei dieser Erklärungsform nicht um eine nomologische handeln muss – es gibt nichts offenkundig Nomologisches an der Erklärung, dass A aufschrie, weil ihn das plötzliche Geräusch erschreckte. Die typischeren Erklärungen, auf die wir zurückgreifen, bestehen jedoch darin, den Grund anzuführen, den der Handelnde für seine Handlung hatte, oder sein Motiv zu benennen, und bei ihnen handelt es sich weder um kausale noch um nomologische Erklärungen menschlichen Verhaltens.514 Handlungserklärung durch (Wieder-)Beschreibung Wir fragen beständig danach, weshalb jemand etwas tat oder tut, und wir finden normalerweise befriedigende Antworten. Wir wollen wissen, warum A seinen Arm hob – und man sagt uns vielleicht, er habe B gewunken oder ein Taxi angehalten, oder er habe versucht, ein Buch zu greifen, oder habe seinen Arm gestreckt, weil dieser sich steif anfühlte. Wir wollen wissen, weshalb A Klavier spielt, und man sagt uns vielleicht, er übe oder habe einen Auftritt oder stimme das Instrument. Wir fragen, wieso A B eine Münze aushändigte, und man sagt uns vielleicht, bei der Münze habe es sich um ein Geburtstagsgeschenk gehandelt oder A habe B bestechen wollen oder habe ihm etwas geliehen oder eine Schuld beglichen oder B ein altertümliches Geldstück gezeigt. Solche Erklärungen erklären, indem sie eine rätselhafte Handlung in unterschiedlichen Hinsichten charakterisieren, wodurch das Rätselhafte im Zusammenhang vollständig verschwinden kann. Wurde die Erklärung formuliert, weiß man nun, was A bei oder mit der Ausführung von V tat – und das kann uns genügen. Für unsere Belange ist die Tatsache von Bedeutung, dass es sich bei solchen Erklärungen um nichtreduktive handelt. Sie beziehen sich auf verschiedene Faktoren und setzen die Kenntnis von sozialen Praktiken und Konventionen voraus. Es wäre jedoch absurd anzunehmen, dass sie sich durch irgendeine Form reduktiver neuraler Erklärung zeitgleich stattfindender Gehirnereignisse verbessern ließen oder dass ein solcher Zusatz unsere verstehende Einsicht darein, was A tat und wieso er es tat, tatsächlich vertiefen würde. Um zu verstehen, was vor sich geht, wenn A B eine kleine runde Metallscheibe aushändigt, müssen wir wissen, 514
Die logische Analyse der aus Gründen ausgeführten Handlung und der von Motiven herrührenden Handlung ist umstritten. Für Argumente, die leugnen, dass es sich bei diesen Erklärungsformen um kausale handelt, siehe A. J. P. Kenny, Will, Freedom and Power (Blackwell, Oxford, 1975), Kap. 6; G. H. von Wright, ‚Of human freedom‘, wieder abgedr. in In the Shadow of Descartes (Kluwer, Dordrecht, 1998); B. Rundle, Mind in Action (Clarendon Press, Oxford, 1997), Kap. 7 u. 8; A. R. White, The Philosophy of Mind (Random House, New York, 1967), Kap. 6.
492
13 Reduktionismus
was Geld ist und weshalb es verwendet wird; und wenn A B bestochen hat (oder bei ihm eine Schuld beglich oder ihm etwas lieh), müssen wir eine ganze Menge von sozio-ökonomischen Vereinbarungen in menschlichen Gesellschaften wissen. Die neurowissenschaftliche Reduktion hat zu solchen Erklärungsformen nichts beizutragen. Handlungserklärung anhand von Gründen des Handelnden Haben wir A’s Münzübergabehandlung als Bestechung, Ausleihe, Schuldbegleichung, Schenkung oder Vorzeigen eines Sammlerstücks charakterisiert, werden wir indes noch wissen wollen, weshalb A etwas dergleichen tut. Will man anhand personaler Gründe erklären, weshalb jemand tut, was er tut, oder welche Motive er dafür hatte zu tun, was er tut, ist ein solches Wissen normalerweise notwendig. Motiverklärungen können wir in diesem Zusammenhang vernachlässigen; es kann sich als fruchtbar erweisen, an Gründe als an Tatsachen zu denken, die in einer praktischen Überlegung angeführt werden können und darum in einer Erklärung oder Rechtfertigung dessen, was man tut. So kann A’s Grund dafür, B eine Münze auszuhändigen, darin bestehen, dass A vergangene Woche eine entsprechende Geldsumme von B geliehen und versprochen hat, sie heute zurückzugeben. Oder A’s Grund dafür, B die Münze zu geben, könnte darin bestehen, dass B unter der Bedingung zustimmte, V auszuführen, dass ihm diese Summe ausbezahlt würde (und A wollte, dass B V ausführt). Oder A’s Grund dafür, B die Münze zu geben, könnte darin bestehen, dass B um ein Darlehen bat oder darin, dass der junge B ein Neffe A’s ist und A B das Geld gibt, damit dieser sich ein Geschenk kaufen kann oder darin, dass B ein Kellner ist und A ihm ein Trinkgeld zukommen lässt. Und so weiter. Die in diesen Erklärungen angeführten Faktoren nehmen wiederum Bezug auf eine Vielzahl geläufiger, aber komplexer moralischer, sozialer und rechtlicher Konventionen. Diese Erklärungen funktionieren nicht dadurch, dass sie das Verhalten eines Ganzen anhand der Eigenschaften und des Verhaltens seiner Teile erklären. Sie funktionieren vielmehr, indem sie das Verhalten menschlicher Wesen aus dem Zusammenhang heraus erklären und bezogen auf die Begründung, die diese vorbringen oder vorbringen würden, wenn man sie fragte, warum sie taten, was sie taten. Die Anführung von Gründen kann mit all den menschlichen Werten in Zusammenhang stehen, die Handlungsziele konstituieren als auch gesellschaftliche Normvorgaben, die verschiedene Formen menschlichen Verhaltens gestatten, verbieten oder ermöglichen. Wir sollten freilich festhalten, dass manche Erklärungsweisen dafür, weshalb jemand nicht in der Lage war, etwas zu tun (und vielleicht auch dafür, weshalb jemand anderes dazu in der Lage war), sich auf gesetzliche Vorgaben beziehen, die Menschen zum Handeln ermächtigen oder die bestimmten Menschen das Recht absprechen, das zu tun, was andere tun können. (Kein neurowissenschaftlicher Beitrag kann erklären, weshalb Henry VIII. sich nicht ohne päpstliche Erlaubnis von Katharina von Aragon scheiden lassen oder weshalb Edward VIII. die bürgerliche Mrs. Simpson nicht ehelichen konnte, ohne abzutreten.)
13.1 Ontologischer und erklärender Reduktionismus
493
Dass man begründete Handlungen auf neurowissenschaftliche Erklärungen reduzieren kann, ist eine Täuschung Wenn die ontologische Reduktion ein ‚Rohrkrepierer‘ ist und wenn es keine ernst zu nehmenden psychologischen Gesetze menschlichen Handelns gibt, das auf Gründen basiert, dann bestehen keine nennenswerten Aussichten darauf, die anerkannten Erklärungen menschlichen Verhaltens auf neurowissenschaftliche Erklärungen reduzieren zu können. Denn es gibt weder Brückenprinzipien, kraft derer man Elemente der psychologischen Erklärungsebene (nämlich Überzeugungen, Hoffnungen, Ängste, Absichten, Gründe, Motive) mit existierenden Größen der neurologischen Erklärungsebene identifiziert, noch Gesetze der psychologischen Erklärungsebene, die von fundamentaleren Gesetzen der neurologischen Ebene abgeleitet werden könnten. Das sollte uns jedoch nicht im Mindesten überraschen. Es ist vollkommen einleuchtend, dass sich unser Wissen über die meisten beobachtbaren Reaktionen des Wassers auf verschiedene Chemikalien dadurch vertieft, dass wir seine atomare und subatomare Beschaffenheit (und die anderer chemischer Stoffe) verstehen – dieses Wissen wird diejenigen Aspekte des Wasserverhaltens erklären, die wir beobachten können, aber die wir nicht begreifen. Ist es jedoch wirklich einleuchtend anzunehmen, dass die Neurowissenschaften das von den menschlichen Individuen in ihren Lebenswelten an den Tag gelegte Verhalten stets nachvollziehbarer machen? Wir wenden uns an Jack, weil wir herausfinden wollen, wo er sich aufhält. Wir fragen, wo er sei, und erhalten zur Antwort, er habe sich in die Stadt begeben. Warum, wollen wir wissen, und er teilt uns mit, dass heute der Geburtstag seiner Frau ist, dass er vor Wochen Tosca-Karten gekauft und dass er sie in ihre Lieblingsoper mitgenommen hat. Würde eine neurowissenschaftliche Betrachtung unser Verständnis von Situation und Ereignissen vertiefen? In welcher Hinsicht bedarf es einer Vertiefung? Bleibt irgendetwas zu fragen übrig, nachdem die Dinge auf die alltägliche Weise erklärt wurden? Könnten die Neurowissenschaften erklären, weshalb Geburtstage gefeiert werden, wieso Tosca einen Besuch lohnt und warum ein Ehemann es als angemessen empfindet, Opernkarten aufzutreiben, um seiner Frau ein Geburtstagsvergnügen zu ermöglichen? Die Neurowissenschaften können die neuralen Ermöglichungsbedingungen des Besitzes und der Ausübung menschlicher Fähigkeiten erklären Neurowissenschaftliche Erklärungen können gemeinhin erklären, wie es Wesen mit dem und dem Gehirn möglich ist, das zu tun, was sie tun. Sie können erklären, welche neuralen Bedingungen vorherrschen und welche neuralen Aktivitäten stattfinden müssen, damit es Lebewesen möglich ist, die Vermögen zu besitzen und auszuüben, die sie von Natur her besitzen. Handelt es sich insbesondere um Menschen, können sich die Neurowissenschaften darum bemühen, Aufschluss über die neuralen Bedingungen der Möglichkeit der Beherrschung einer Sprache zu geben, deren Besitz selbst wiederum
494
13 Reduktionismus
eine Bedingung der Möglichkeit von Rationalität im Denken und im Handeln ist. Die Neurowissenschaften können allerdings nicht die Erklärungskraft der guten Gründe, die wir für unser Verhalten offen anführen, ersetzen oder unterminieren oder die Rechtfertigungen annullieren, die wir hinsichtlich unseres rationalen Verhaltens vorbringen. Die Rationalität des von guten Gründen herrührenden Verhaltens wird nicht dadurch näher erklärt, dass die neuralen Tatsachen angeführt werden, die es Wesen wie uns ermöglichen, aus diesen Gründen heraus zu handeln. Wenn wir die Anständigkeit, Angemessenheit oder Tugendhaftigkeit der Handlungsgründe einer Person erfassen, dann verstehen wir vollkommen, weshalb sie tat, was sie tat. Die Neurowissenschaften können einen Beitrag zur Erklärung irrationalen Handelns leisten Die Neurowissenschaften können jedoch einen Beitrag zur Erklärung irrationalen oder teilweise irrationalen Handelns leisten. Sie können erklären, weshalb eine Person für bestimmte Geisteszustände anfälliger ist als ein normal veranlagter Mensch – für eine Depression beispielsweise, die dafür sorgt, dass sie stärker dazu neigt, aus einer bestimmten Art von Grund heraus zu handeln, als jemand, der nicht derart depressiv ist. Das kann eine große Rolle spielen für die Erklärung menschlichen Verhaltens in bestimmten Umständen. Man sollte jedoch keineswegs unerwähnt lassen, dass eine solche Erklärung nicht zwangsläufig an die Stelle der Gründe tritt, die beispielsweise die depressive Person dafür hat, Selbstmord zu begehen. Dass sie depressiv ist, gar pathologisch depressiv möglicherweise, impliziert nicht, dass es sich bei ihren Gründen dafür, sich selbst zu töten, um bloße Rationalisierungen handelt, die keine Rolle spielen, wenn es darum geht, ihr Verhalten als nachvollziehbares zu erfassen. Die neurowissenschaftliche Erklärung kann die auf Gründen fußende Erklärung des Akteurs ergänzen, und zwar ohne diese Gründe als irrelevant zu begreifen. Die Neurowissenschaften können Formen von Unfähigkeit erklären Darüber hinaus können die Neurowissenschaften erklären – darauf sind sie in der Tat spezialisiert –, wie schwerwiegende pathologische Defizite bei der Ausübung alltäglicher menschlicher Fähigkeiten aus Gehirnschäden resultieren. Sie mögen somit ausgezeichnete Erklärungen dafür liefern, weshalb Patienten sich nicht so verhalten können, wie es normal veranlagte Menschen auf mannigfaltige Weise können. Sie mögen insbesondere in der Lage sein zu erklären, weshalb solche Patienten in der einen oder anderen Form unfähig sind, in bestimmter Hinsicht rational zu handeln. Die Neurowissenschaften können das normale menschliche Verhalten nicht erklären Die bemerkenswerten neurowissenschaftlichen Erklärungserfolge im Hinblick auf bestimmte Formen psychologischer Neigungen und stimmungsmäßiger Anfälligkeiten so-
13.1 Ontologischer und erklärender Reduktionismus
495
wie hinsichtlich pathologischen Verhaltens und entsprechender Unzulänglichkeiten zeigen nicht, dass die Neurowissenschaften jetzt oder für die Zukunft darauf hoffen können, das normale menschliche Verhalten zu erklären (im Gegensatz zur Erklärung der neuralen Bedingungen seiner Möglichkeit). Die Neurowissenschaften sind in der Lage zu erklären, wie es normal veranlagten Menschen möglich ist, rational zu denken. Sie vermögen jedoch nicht, die Ratio menschlichen Handelns im Einzelfall zu erklären oder Aufschluss darüber zu geben, was einen bestimmten Grund zu einem guten Grund macht. Sie können die zur Ausübung menschlicher Fähigkeiten notwendigen Bedingungen ermitteln. Daraus folgt jedoch nicht, dass sie in der Lage sind oder jemals sein werden, eine Reihe neuraler Bedingungen anzugeben, die für das charakteristische lebensweltliche Handeln der Menschen hinreichend sind. Um menschentypisches Verhalten zu erklären, muss man auf der höheren, irreduziblen Ebene der gewöhnlichen Beschreibungen menschlicher Handlungen und ihrer verschiedenen Formen der Erklärung und Rechtfertigung in Begriffen von Gründen und Motiven (als auch Ursachen) operieren. Diese Beschreibungen werden zahlreiche Faktoren ins Feld führen: zurückliegende und zukünftige Ereignisse, die in bestimmten Umständen die Handlungsgründe des Akteurs konstituieren können; sein Verlangen, seine Intentionen, Ziele und Zwecksetzungen; seine Neigungen, Gepflogenheiten und Angewohnheiten; und die moralischen und gesellschaftlichen Normen, denen er zustimmt. Unsere gewöhnlichen oder gebräuchlichen Erklärungen menschlichen Verhaltens richten sich darauf, was menschliche Wesen tun – das normalerweise unter Handlungsund nicht unter Bewegungsgesichtspunkten identifiziert wird (wie in 8.1 angemerkt, wollen wir die ‚Spielzüge‘ [moves] einer Person verstehen, nicht ihre Bewegungen [movements]). Solche Identifizierungen sind hochgradig kontext- und situationsabhängig. Hat man klären können, was eine Person in einer bestimmten Situation getan hat oder womit sie beschäftigt war, könnte es dennoch unklar sein, weshalb sie so handelte, wie sie es tat. Das wiederum könnte man erklären, indem man sich auf ihre Intentionen, Ziele und Zwecksetzungen bezieht, auf ihre Beweggründe und Motive, ihre Gepflogenheiten, Angewohnheiten und Vorlieben – im Kontext des gesellschaftlichen, moralischen und rechtlichen menschlichen Lebens. Die neurowissenschaftliche Betrachtungsweise steht mit diesen Erklärungsformen nicht im Wettbewerb (geschweige denn im Konflikt); sie reduziert sie jedoch auch nicht auf neurowissenschaftliche Erklärungsformen.
496
13 Reduktionismus
13.2 Reduktion durch Beseitigung Beseitigungsreduktionismus Der ableitende bzw. Ableitungsreduktionismus ist für sich genommen nicht verheißungsvoll.515 In den letzten zwanzig Jahren hat sich allerdings eine radikalere Position herausgebildet. Indem sie unsere gewöhnlichen oder gebräuchlichen Erklärungen menschlichen Verhaltens als Teil dessen begreifen, auf das sie sich verächtlich als ‚Alltagspsychologie‘ [‚folk psychology‘ – man könnte vielleicht auch ‚Vorurteilspsychologie‘ sagen, A.d.Ü.] beziehen, suggerieren einige amerikanische Wissenschaftler, vor allem Steven Stitch und Paul und Patricia Churchland, dass diese ‚Theorie‘ menschlichen Verhaltens dazu bestimmt ist, von einer zukünftigen neurowissenschaftlichen Theorie beseitigt bzw. abgelöst zu werden. Sie plädieren also tatsächlich für die Reduktion der psychologischen Erklärung menschlichen Verhaltens durch ihre Beseitigung vonseiten einer zukünftigen neurowissenschaftlichen Theorie, die menschliches Verhalten wird vollkommen erklären können. Sie akzeptieren die Tatsache, dass die ‚Entitäten‘, die in psychologischen Erklärungen einbegriffen sind (Gründe, Motive, Überzeugungen, Verlangensformen), nicht auf neurowissenschaftliche Strukturen reduziert werden können. Was jedoch, wie sie betonen, darauf zurückzuführen ist, dass es sich bei diesen ‚Entitäten‘ um bloße Fiktionen handelt. Die psychologische Erklärungsebene, die zwischen dem Verhalten und der neurowissenschaftlichen Theorie angesiedelt ist, sei ein Schwindel und müsse beseitigt werden. Die Neurowissenschaften werden in der Lage sein, menschliches Verhalten in Gänze zu erklären, und zwar ohne dass auf die primitiven psychologischen Termini zurückgegriffen werden müsste – nicht auf die volkstümlichalltäglichen und nicht auf die experimentellen. Was ‚Alltagspsychologie‘ angeblich ist Die Alltagspsychologie, behaupten die Beseitigungsbefürworter oder Eliministen, umfasse den alltäglichen Begriffsrahmen, den wir alle verwenden, „um das Verhalten von Menschen nachzuvollziehen, vorherzusagen, zu erklären und zu beeinflussen.“ Dieser Rahmen „schließt Begriffe ein wie Glauben, Verlangen, Schmerz, Vergnügen, Liebe, Hass, Freude, Misstrauen, Gedächtnis, Erkennen, Zorn, Mitgefühl, Intention und so weiter“. Demnach konstituiert er unsere Konzeption davon, was eine Person ist. Die Eliministen vertreten allerdings die Auffassung, dass die Alltagspsychologie viel mehr ist als ein bloßes Begriffsspektrum. Sie sei auch eine Theorie über das menschliche Verhalten. Denn „der entsprechende Rahmen ist spekulativ, systematisch und für Korrekturen offen, Der folgende Abschnitt ist eine stark gekürzte Version von P. M. S. Hacker, ‚Eliminative materialism‘, in S. Schroeder (Hg.), Wittgenstein and Contemporary Philosophy of Mind (Routledge, London, 2001), S. 60–84. 515
13.2 Reduktion durch Beseitigung
497
[. . .] er enthält verallgemeinerte Information und [. . .] er gestattet Erklärungen und Voraussagen wie jeder theoretische Rahmen“.516 Als eine Theorie bringt er kausale Erklärungsgesetze vor (zum Beispiel: Eine Person, die körperlich ernstlich Schaden nimmt, wird Schmerzen leiden; eine Person, die Schmerzen leidet, wird zusammenzucken; eine Person, die längere Zeit kein Essen zu sich nahm, wird Hunger haben) und rechtfertigt Vorhersagen (zum Beispiel: Menschen, die danach verlangen, dass p, und glauben, dass der Vollzug von V es mit sich bringt, dass p, und die keine übergeordneten anderen Verlangen und präferierten Strategien haben, werden gemeinhin versuchen, V zu vollziehen). Drei angebliche Schwächen der ‚Alltagspsychologie‘ Von einer so aufgefassten ‚Alltagspsychologie‘ wird gesagt, dass es sich bei ihr um eine Theorie handelt, die mit der ‚Alltagsastronomie‘, ‚Alltagsphysik‘, ‚Alltagsthermodynamik‘, ‚Alltagsbiologie‘ und so weiter zusammengehört. Diese betrachtet man als rudimentäre oder unausgegorene Theorien, die während der letzten vier Jahrhunderte von ernst zu nehmenden wissenschaftlichen Theorien ersetzt worden sind. Die Alltagspsychologie gehe einem ähnlichen Schicksal entgegen. Denn sie steht aus drei Gründen am Pranger. (i) Erklärungs-, Voraussage- und Einflussnahme-Irrtümern wegen: Die Alltagspsychologie erklärt nicht, was Schlaf ist und warum wir ihn brauchen, wie Lernen aus Kindern gebildete Erwachsene macht, kann die Gründe von Intelligenz nicht bestimmen, kann nicht erläutern, wie das Gedächtnis arbeitet, was Geisteskrankheit ist oder wie deren Heilung erreicht werden kann. (ii) Sie hat in den letzten 2.500 Jahren keine nennenswerten Fortschritte gemacht, hat nicht die Verbesserungs- und Entwicklungsfähigkeit an den Tag gelegt, die man von einer erfolgreichen Theorie erwarten kann. (iii) Sie kann nicht reibungslos in die sich abzeichnende Synthese von physikalischen, chemischen, biologischen und neuro-computationalen Wissenschaften integriert werden. Es wird moniert, dass insbesondere wenig Aussicht auf eine unproblematische theoretische Reduktion der Begriffe, Entitäten und Gesetze der Alltagspsychologie auf die grundlegenderen Begriffe, Entitäten und Gesetze der avancierteren Wissenschaften Neurobiologie, Chemie und Physik besteht.517 Die angebliche Begriffsleere der Alltagspsychologie spricht für ihre Beseitigung Die ersten beiden Punkte legen nahe, dass die Alltagspsychologie von der Wissenschaft der experimentellen Psychologie ersetzt werden sollte, genauso, wie – aus Sicht der Beseitigungsbefürworter – die physikalische Astronomie die Alltagsastronomie, die TherP. M. Churchland, ‚Folk psychology‘, in S. Guttenplan (Hg.), A Companion to the Philosophy of Mind (Blackwell, Oxford, 1994), S. 308. 517 Ibid., S. 310f. 516
498
13 Reduktionismus
modynamik die Alltagsthermodynamik und die Biologie die Alltagsbiologie ersetzt hat. Die Beseitigungbefürworter/Eliministen wollen jedoch auf etwas anderes hinaus. Ihrer Ansicht nach sind die alltagspsychologischen Begriffe nichtssagend bzw. leer – ganz ähnlich den Begriffen von Phlogiston, kalorischer Substanz, kristallinen Himmelssphären und Elan vital. Die Alltagspsychologie muss folglich beseitigt werden. Denn „wenn die Alltagspsychologie erst einmal auf Distanz gebracht ist und man sich mit der gebotenen wissenschaftlichen Strenge mit ihr wie mit jeder anderen Theorie auseinandergesetzt hat, wird sie in ihrer Gewöhnlichkeit als umso unqualifizierteres, schwächeres und begrenzteres Phänomen hervortreten“.518 Ihre Begriffe sind so leer wie Phlogiston, kalorische Substanz, Hexe und wie andere nichtssagende Begriffe, die mit dem wissenschaftlichen Fortschritt ausrangiert wurden. Demnach wird auch die empirische Psychologie, die ein nahezu identisches Spektrum an leeren Begriffen verwendet, vom Voranschreiten der Wissenschaft beseitigt werden. Die unausgegorenen Gesetze der Alltagspsychologie und die vermeintlichen Gesetze der experimentellen Psychologie werden von präzisen Gesetzen einer zukünftigen neurowissenschaftlichen Psychologie verdrängt werden.
13.2.1 Sind unsere psychologischen Alltagsbegriffe theoretische Begriffe? Weshalb man davon ausgeht, dass unsere psychologischen Alltagsbegriffe theoretische Begriffe sind Unsere gewöhnlichen Erklärungen menschlichen Verhaltens führen ein umfangreiches Spektrum an psychologischen Begriffen ins Feld. Warum sollte man jedoch annehmen, dass sie mit irgendeiner Theorie menschlichen Verhaltens einhergehen? Unter anderem weil, wie man sagt, jedes Urteil die Anwendung von Begriffen einschließt, jeder Begriff ein Knoten in einem Geflecht aus unterschiedlichen Begriffen ist und die Bedeutung eines Begriffs von seiner Position im Geflecht herrührt. Ein Begriffsgeflecht aber sei eine spekulative Annahme oder Theorie, zumindest eine Theorie hinsichtlich der Klassen, in die die Natur sich aufgliedert, und der zwischen ihnen bestehenden Beziehungen.519 Die psychologischen Alltagsbegriffe zu lernen, bedeute, die entsprechenden Verallgemeinerungen zu lernen, die die Bedingungen richtiger Anwendung festlegen. Die psychologischen Ausdrücke würden durch solche Verallgemeinerungen implizit definiert und seien Teil der alltagspsychologischen Theorie. Und unsere gewöhnlichen psychologischen Erklärungen des menschlichen Verhaltens gingen mit Verallgemeinerungen einher, was ein charakteristisches Merkmal einer Theorie sei. 518
P. S. Churchland, Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind/Brain (MIT Press, Cambridge, MA, 1986), S. 395. 519 P. M. Churchland, Matter and Consciousness, überarb. Aufl. (MIT Press, Cambridge, MA, 1988), S. 80.
13.2 Reduktion durch Beseitigung
499
Logische Beziehungen implizieren keine Theoriehaftigkeit Wir haben es hier jedoch mit einer Fehlkonzeption zu tun. Es stimmt, dass Begriffe untereinander in Implikations-, Vereinbarkeits- und Unvereinbarkeitsverhältnissen stehen. Das impliziert aber nicht, dass alle Begriffe theoretische Begriffe sind. Dass etwas vollständig rot ist, impliziert, dass es nicht vollständig blau, grün, gelb etc. ist, dass es dunkler als alle pinken Objekte ist und farblich eher einem orangen Objekt als einem gelben ähnelt. Bei diesen Propostitionen handelt es sich nicht um theoretische, sondern um begriffliche oder grammatische Wahrheiten, die die Bedeutung des Wortes ‚rot‘ mit konstituieren. Dass es sich bei einer Schachfigur um den König handelt, impliziert, dass dieser Figur Schach geboten werden kann, dass sie ein Feld weiterzieht, dass sie die Rochade ausführen kann etc. Diese Propositionen implizieren nicht, dass ‚Schachkönig‘ ein theoretischer Begriff ist, obgleich sie selbstverständlich mitdefinieren, was ein Schachkönig ist. Sprache als holistisches Phänomen impliziert keine Theoriehaftigkeit Gewiss ist jeder Begriff in ein feinfasriges Begriffsgeflecht eingewoben. In diesem Umstand offenbart sich keine Theoriehaftigkeit, sondern das normative und holistische Gepräge der Sprache. Er macht deutlich, dass ein Ausdruck gemäß den Regeln, die seine Bedeutung festlegen, zu verwenden ist. Und er zeigt, dass ein Ausdruck eine Bedeutung nur als Sprachausdruck hat, und zwar in Koordination mit einer Menge weiterer Ausdrücke, mit denen er begrifflich oder grammatisch durch Regeln verbunden ist, die Vereinbarkeiten, Unvereinbarkeiten und Implikationen festsetzen. Es wäre jedoch absurd zu behaupten, dass alle Begriffe theoretische Begriffe sind. Denn das würde der Behauptung den Sinn rauben, dass ein gegebener Begriff – der eines Mesons beispielsweise oder der eines Quarks – ein theoretischer Begriff ist, im Gegensatz zu, sagen wir, den Begriffen von einem Baum, einem Cricketspiel oder einem Tisch. Ein Begriffsgeflecht impliziert keine Theoriehaftigkeit Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass ein Begriffsgeflecht „eine spekulative Annahme oder Theorie“ ist, geschweige denn eine Theorie bezüglich der Klassen, in die die Natur sich aufgliedert. Die Natur ‚gliedert sich‘ in nichts ‚auf‘. Unsere Begriffe dienen verschiedenen Zwecken. Insofern als der Zweck einer Reihe von Begriffen in der wissenschaftlich und theoretisch fruchtbaren Klassifizierung natürlicher Phänomene besteht, können die von uns eingeführten Begriffe bezogen auf diesen Zweck mehr oder weniger nützlich sein. Allerdings sind wir es, die die Dinge auf diese Weise klassifizieren, nicht die Natur. Und wie wir sie klassifizieren, hängt nicht von der Natur, sondern von unseren theoretischen Interessen ab. Selbst die wissenschaftliche Klassifizierung bringt keine absoluten, präzisen, zweckunabhängigen Kategorien hervor, die von der natürlichen
500
13 Reduktionismus
Ordnung der Dinge festgelegt sind. In der Biologie liegen oftmals morphologische mit evolutionären Kriterien überkreuz, und weder die einen noch die anderen liefern durchweg eindeutige Antworten – beispielsweise ist die Zuordnung von Organismen zu Arten nicht weniger an Zwecken orientiert, veränderlich und zum Teil beliebig, als gewöhnliche oder gebräuchliche Klassifizierungen. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Resultate der Evolutionsprozesse zu klassifizieren, und ob die eine oder die andere fruchtbarer ist, hängt von den besonderen Zwecken ab, die wir verfolgen, und von den Eigentümlichkeiten der fraglichen Organismen. Nicht jede Klassifizierung ist an Theorie-Zwecke geknüpft Die Klassifizierung zum Zwecke wissenschaftlicher Theoriebildung ist allerdings nur ein möglicher Klassifizierungszweck. Unsere verschiedenen Klassifizierungen von Artefakten (Werkzeuge und Waffen, Kleidung und Gebäude, Gemälde und Skulpturen), ihrer Vorzüge und Schwachstellen und der Fertigkeiten, die man zu ihrer Herstellung benötigt, stehen weitgehend überhaupt nicht mit wissenschaftlichen Zwecken in Zusammenhang. Aber selbst natürliche, in Abgrenzung zu ‚artefaktischen‘, Objekte können zu anderen als wissenschaftlichen Zwecken klassifiziert werden. Sie können bezogen auf die unterschiedlichen Zwecke und Interessen, die wir mit ihnen verbinden, klassifiziert werden. (Der Begriff von einem Baum findet in systematischen botanischen Klassifizierungen keinen Platz, ist jedoch für eine Vielzahl anderer menschlicher Zwecksetzungen äußerst dienlich.) Ein Wortschatz ist keine Theorie Schließlich ist ein Wortschatz keine Theorie. Die ‚Fachwortschätze‘ der Kunst und des Handwerks unserer Kultur, der Spiele und Rituale, des Eigentums und Besitzes, der Moral und des Gesetzes sind keine Theorien über irgendetwas. Das Englische beinhaltet keine Theorie, obgleich es inzwischen eine Menge theoretischer Termini enthält, die in den letzten Jahrhunderten hinzukamen, während die theoretischen Wissenschaften sich herausbildeten. Eine Sprache ist keine Theorie von irgendetwas, obgleich sie uns die Mittel für die Artikulation unendlich vieler Theorien an die Hand geben kann, einschließlich der miteinander nicht zu vereinbarenden. Die von Ptolemäus, Kopernikus und Kepler stammenden Theorien des Sonnensystems sind in Englisch formulierbar und miteinander unvereinbar, was jedoch aus dem Englischen keine inkonsistente Sprache macht. Dass Beobachtung begriffshaltig ist, impliziert nicht, dass sie theoriehaltig ist Zweifellos geht jedes verständliche Urteil mit der Anwendung von Begriffen einher. Eine verständlich vorgebrachte Beobachtung ist begriffshaltig. Daraus folgt jedoch nicht, dass
13.2 Reduktion durch Beseitigung
501
sie darum theoriehaltig ist. Das, was theoretisch ist, und das, was es nicht ist, müssen, wenn der Terminus ‚theoretisch‘ irgendwie gehaltvoll sein soll, einander ausschließen. Die von einem Wissenschaftler angeführte Beschreibung des Teilchenzerfalls in einer Nebelkammer ist theoriehaltig, sie schließt den Gebrauch von theoretischen Termini ein, die nicht durch Beobachtung gewonnen wurden. Die Beschreibung eines Gartens als gepflegt, mit blühenden Narzissen und Tulpen darin, hat allerdings nichts mit einer Theorie zu tun. Genauso wenig wie die Beschreibung einer Person als eine, die sich fragt, ob sie heute Abend ins Theater gehen soll, die denkt, dass das ein Vergnügen wäre, und sich entschließt, Karten zu erwerben. Begriffserwerb ist etwas anderes als das Lernen einer Theorie In den Kapiteln 4–8 erörterten wir eine Reihe psychologischer Grundbegriffe. In vielen Fällen erwähnten wir die unterschiedlichen Möglichkeiten, sie zu erwerben. Manche, so legten wir nahe, sind dem vorsprachlichen natürlichen Ausdrucksverhalten aufgepfropft bzw. angegliedert (z. B. ‚tut weh‘, ‚will‘), andere (z. B. ‚wissen‘, ‚glauben‘) dem bereits existierenden Sprachverhalten. Es sollte klar sein, dass ein Kind mit dem Erwerb solcher Begriffe keine Theorie von irgendwas lernt; es lernt Formen menschlichen Verhaltens. Indem es lernt, seine Schmerzensschreie durch ‚Es tut weh‘ oder ‚Ich habe Schmerzen‘ zu ersetzen, indem es lernt, sein Klagegeschrei über misslungene Ergatterungsversuche durch ein ‚Ich will‘ zu ersetzen, indem es lernt, eine Handlung durch ein ‚Ich werde . . .‘ anzukündigen, lernt das Kind keine Alltagstheorie menschlichen Verhaltens; es lernt menschliches Verhalten, lernt, seinem Schmerz Ausdruck zu verleihen und sein Verlangen und seine Intentionen auszudrücken. Es lernt den janusköpfigen Gebrauch psychologischer Termini – ihre expressive (und später mitteilende) Verwendung in der ersten Person Präsens und ihre beschreibende Verwendung in der dritten Person. Und indem es den elementaren Gebrauch von ‚ich weiß‘, ‚ich glaube‘ und ‚ich denke‘ lernt, lernt das Kind keine Theorie über seine inneren Zustände, sondern ein Sprachspiel, das es nur ‚spielen‘ kann, wenn es den Unterschied bereits begriffen hat, der zwischen einer gut begründeten Behauptung und einer unzureichend begründeten besteht oder zwischen dem Ausdruck eines eigenen Urteils und dem eines abgeleiteten. Die von einem Kind gelernten Verwendungen psychologischer Prädikate sind keine theoretischen Die Verwendungen psychologischer Prädikate, die das Kind lernt, haben mit theoretischen Belangen rein gar nichts zu schaffen. Bei Erste-Person-Ausdrücken der Empfindung, des Verlangens, der Intention etc. handelt es sich nicht um Hypothesen über die eigenen Geisteszustände. Die Zuschreibungen von psychologischen Attributen zu anderen Menschen sind keine Hypothesen über die Existenz innerer Zustände gemäß einer Common-Sense-Theorie. Denn beim Denken, Glauben, Hoffen und Sich-Ängstigen,
502
13 Reduktionismus
dass p haben wir es nicht mit inneren Zuständen einer Person zu tun, die hinter ihrem Verhalten verborgen sind. Ihr Verhalten, einschließlich ihrer Denk-, Glaubens-, Hoffnungs- und Angstbekundungen, ist keine induktive Evidenz, geschweige denn Evidenz dafür, die Existenz unbeobachteter Entitäten zu postulieren. Es ist keine Theorie, dass eine Äußerung der Form ‚Ich V, dass p‘ (wobei ‚V‘ ein Verb ist wie beispielsweise ‚denken‘, ‚glauben‘, ‚Angst haben‘ etc.) ein Kriterium für den Vollzug von V durch den Sprecher ist. Es ist vielmehr eine Regel für den Gebrauch des Verbs, die dessen Bedeutung mit konstituiert, wie wir in 3.3 gesehen haben. Psychologische Begriffe sind keine Begriffe theoretischer Entitäten Psychologische Begriffe sind keine Begriffe von nichtwahrnehmbaren Entitäten (wie Genen oder Viren) oder von theoretischen Entitäten (wie Menonen oder Quarks). Es handelt sich bei ihnen gar nicht um Begriffe von ‚Entitäten‘. Unsere Begriffe von Gedanken, Überzeugungen, Hoffnungen, Ängsten, Erwartungen etc. sind keine Begriffe von irgendwie gearteten Dingen, sondern Abstraktionen aus der Verwendung der Worte denken, glauben, hoffen, sich ängstigen und erwarten. In einem Sinne ist das, was zahlreiche solcher Verben ausdrücken, der Beobachtung voll und ganz zugänglich. Denn es ist eine Begriffsverwirrung, anzunehmen, jemandes Freude oder Trauer, Denken oder Glauben, Angst- oder Hoffnunghaben offenbare sich in ‚rein körperlichem Verhalten‘ oder bloßen Körperbewegungen. Im Gegenteil, normalerweise können wir die Wut eines anderen sehen (wenn er wütend ist), die Trauer oder Pein, die ihm ins Gesicht geschrieben steht oder sich in seinem Auftreten offenbart (wenn er trauert oder Qualen leidet). Man kann die Gedanken eines Menschen hören, wenn er sie einem mitteilt, und sie lesen, wenn er sie aufschreibt. Man braucht keine Theorie, alltäglich-volkstümlich oder anders geartet, um die zum Ausdruck gebrachten Gedanken eines anderen zu hören oder zu lesen. Die Tatsache, dass wir unsere Gedanken nicht enthüllen müssen, dass wir mitunter jede Gefühlsregung unterdrücken können und dass wir manchmal in der Lage sind zu heucheln, zu lügen und hinters Licht zu führen, macht aus psychologischen Prädikaten keine theoretischen.
13.2.2 Sind unsere alltäglichen psychologischen Verallgemeinerungen Gesetze einer Theorie? Die angeblichen theoretischen Doktrinen der ‚Alltagspsychologie‘ Beseitigungsbefürworter behaupten, dass die Alltagspsychologie nicht nur ein umfangreiches Spektrum an theoretischen Begriffen einschließt, sondern auch eine große Zahl theoretischer Doktrinen. Sie vertreten die Ansicht, dass die rudimentären, vorgeblich kausalen Gesetze der Alltagspsychologie verwendet werden, um das normale mensch-
13.2 Reduktion durch Beseitigung
503
liche Verhalten in der üblichen Weise gesetzmäßig zu erklären und vorherzusagen. Das aber ist ein verworrener Gedanke. Drei Verallgemeinerungstypen Wir müssen hier verschiede Arten von Propositionen unterscheiden. Erstens handelt es sich bei Propositionen wie zum Beispiel (1) ‚Menschen, die einen starken Schmerz verspüren, neigen zum Zusammenzucken‘ oder (2) ‚Zornige Menschen neigen zum Ungeduldigwerden‘ nicht um Kausalgesetze. Zusammenzucken ist ein logisches Kriterium dafür, Schmerzen zu haben – es ist eine Form des Schmerzverhaltens. Dass Menschen für gewöhnlich zusammenzucken, wenn sie Schmerzen haben, ist keine Entdeckung, die daher rührt, dass man die Zuckungen der Menschen und ihr Schmerzleiden miteinander in Beziehung setzte, denn wir identifizieren das Schmerzleiden der Menschen (unter anderem) anhand ihrer Zuckungen. Und obgleich es so ist, dass zornige Menschen zum Ungeduldigwerden neigen, handelt es sich auch bei dieser Verallgemeinerung nicht um ein Kausalgesetz, sondern um eine Charakterisierung einer möglichen Form von Zorn. Der Zorn ist keine Ursache der Ungeduld; er manifestiert sich vielmehr in Ungeduld. Erklärt man A’s Ungeduld, indem man sich auf seinen Zorn bezieht, gibt man überdies ebenso wenig eine nomologische Erklärung ab, wie in dem Fall, da man jemandes Weinen erklärt, indem man sich auf dessen Trauer bezieht. Das ist etwas anderes, als jemandes Weißhaarigkeit zu erklären, indem man sich auf dessen Alter bezieht. Zweitens sind die folgenden Propositionen ebenfalls keine einfachen Kausalverallgemeinerungen: (3) ‚Menschen, die wollen, dass p, und die glauben, dass der Vollzug von V es mit sich bringt, dass p, und die keinen übergeordneten Grund haben, V nicht zu vollziehen, werden gemeinhin V vollziehen oder es zu tun versuchen‘ und (4) ‚Menschen, die glauben, dass p, zweifeln alles das an, was ihrer Auffassung nach mit p nicht vereinbar ist‘. Es handelt sich bei ihnen vielmehr um Verallgemeinerungen, die auf Begriffsbeziehungen beruhen und die Bedeutungen ihrer einzelnen Termini mit konstituieren. Wenn jemand behauptet, herbeiführen zu wollen, dass p, glaubt, dass der Vollzug von V es mit sich bringt, dass p, und keinen Grund dafür hat, V nicht zu vollziehen, und V dennoch nicht vollzieht, dann gibt es einen Grund für die Annahme, dass er nicht wirklich herbeiführen will, dass p. Wenn man weiß oder glaubt, dass es dann, wenn es wahr ist, dass q, falsch ist, dass p, und wenn man weiß, dass p, dann wird man natürlich im Normalfall nicht glauben, dass q. Wir haben es hier jedoch nicht mit einer empirischen Verallgemeinerung zu tun. Denn nicht zu bezweifeln, dass q, wäre in diesem Fall ein logisches Kriterium dafür, dass man nicht weiß, dass p, oder dafür, dass man nicht weiß, dass, wenn q, dann nicht p, oder dafür, dass man die Schlussregel nicht erfasst hat, und darum dafür, dass man die Implikation nicht verstanden hat. Solche Wahrheiten wie (3) und (4) zu begreifen heißt nicht, irgendwelche psychologischen Gesetze oder empirischen Verallgemeinerungen zu kennen oder zu glauben, sondern vielmehr, die Begriffe des Wissens, Glaubens, Zweifelns und Wollens begriffen zu haben.
504
13 Reduktionismus
Drittens sind Propositionen wie beispielsweise (5) ‚Eine Person, die längere Zeit kein Essen zu sich nahm, wird Hunger haben‘ oder (6) ‚Eine Verletzung verursacht normalerweise Schmerzen‘ gleichermaßen fragwürdige Kandidaten für Kausalgesetze, die angeblich durch die scheinbare ‚Alltagstheorie‘ der menschlichen Psychologie entdeckt wurden. Denn die Verletzung bzw. Versehrung ist ein Umstand, bei dem das Schmerzverhalten ein Schmerzkriterium ist, und die Nahrungsentbehrung ist ein Umstand, bei dem das Nahrungsverlangen eine Erscheinungsform des Hungers ist (und nicht des Heißhungers beispielsweise). Verletzung ist nicht bloß kausal, sondern auch begrifflich mit Schmerz verbunden, wie Nahrungsentbehrung nicht nur kausal, sondern auch begrifflich mit Hunger verbunden ist. Echte Beispiele für ‚Alltagspsychologie‘ Und schließlich kann man sicherlich Beispiele für etwas anführen, dass als ‚Alltagspsychologie‘ betrachtet werden könnte. Als da wären (7) ‚Wer mit der Rute spart, verzieht das Kind‘ oder (8) ‚Gebranntes Kind scheut das Feuer‘. Diese können kaum mit theoretischen Äußerungen verwechselt werden, und welche psychologischen Termini in derartigen Äußerungen auch immer vorkommen, sie werden nicht von solchen Verallgemeinerungen implizit definiert. Psychologisches Erklären und Voraussagen stimmen nicht mit dem ‚Covering-Law‘-Modell wissenschaftlicher Erklärung überein Es ist natürlich richtig, dass wir das Verhalten der Menschen erklären und vorhersagen, indem wir uns auf ihre Gedanken, Überzeugungen, Wünsche, Intentionen, Vorlieben und Abneigungen beziehen. Es ist jedoch abwegig anzunehmen, dass solche Erklärungen und Vorhersagen im Allgemeinen oder auch nur typischerweise mit dem klassifizierungstheoretischen Modell wissenschaftlicher Erklärung übereinstimmen. Sie beruhen im Gegenteil auf Prinzipien des praktischen folgernden Denkens. Dass Menschen für gewöhnlich das tun, für dessen Tun sie gute Gründe zu haben meinen, dass sie ihre Intentionen umzusetzen versuchen, dass sie dazu neigen, das von ihnen als begehrenswert Erachtete zu verfolgen, sind keine Kausalverallgemeinerungen. Und auch wenn die entsprechenden Verallgemeinerungen und Vorhersagen mit dem ‚Covering-Law‘-Modell der Wissenschaften übereinstimmen, handelt es sich bei ihnen in keiner Hinsicht um proto-wissenschaftliche Gesetze. ‚Er hat seit Stunden nichts gegessen, er wird also hungrig sein‘ ist ebenso wenig theoretisch oder proto-wissenschaftlich wie ‚Es fängt zu regnen an, die Wäsche wird also nass werden‘. Wir müssen offenkundig einräumen, dass unsere gewöhnlichen oder gebräuchlichen Erklärungen mitunter nicht zutreffen. Wir können uns selbst unvollkommen verstehen, und manchmal führen wir uns selbst hinters Licht, darum können die Erklärungen, die wir im Hinblick auf unser Verhalten vorbringen, falsch sein. Sie können von
13.2 Reduktion durch Beseitigung
505
anderen korrigiert werden. Das deutet jedoch nicht darauf hin, dass unsere psychologischen Alltagsbegriffe obsolet sind und beseitigt werden müssen; es macht nur deutlich, was offensichtlich sein sollte: Dass man nämlich selbst nicht immer die letzte Autorität ist, wenn es um die eigenen Emotionen und Motive geht. Ebenso offensichtlich ist, dass wir mit unseren Erklärungen des Verhaltens anderer falschliegen können, und manchmal kann deren Verhalten und Motivation ganz und gar undurchsichtig sein. Das deutet jedoch nicht auf ein Theoriedefizit hin, geschweige denn darauf, dass die Postulierung unbeobachtbarer Entitäten wie Überzeugungen und Verlangen ungerechtfertigt oder vergebens ist.520 Denn wenn man anderen Wissen, Glauben, Verlangen oder Intention zuschreibt, postuliert man nichts, und Wissen, Glauben, Verlangen und Intention sind keine theoretischen Entitäten irgendwelcher Art. Vielmehr deutet es darauf hin, dass die logischen Kriterien für die Zuschreibung psychologischer Prädikate zu anderen aufgehoben werden können, wie wir in 3.3 dargelegt haben. Es macht deutlich, dass menschliche Wesen nicht unfehlbar sind, und ebenso, dass das Geistige durch eine gewisse Unbestimmbarkeit charakterisiert ist (was z. B. die Motivlage oder die emotionale Authentizität angeht). Viele Aspekte des menschlichen Verhaltens können zweifellos von der empirischen psychologischen Forschung geklärt werden. Davon profitiert unser Verständnis, unsere gewöhnlichen Verhaltenserklärungen erfahren so eine Ergänzung, aber sie werden nicht ersetzt. Und das trifft auch auf die neurowissenschaftlichen Einsichten in die Ursachen einer Vielzahl von Verhaltensdefiziten zu.
13.2.3 Beseitigung alles Menschlichen Widerlegung der drei Beseitigungsargumente Wie oben (13.2) dargelegt, führen die Eliministen drei Gründe für die beseitigende Reduktion der Alltagspsychologie zugunsten zukünftiger Neurowissenschaften an. Der erste bestand in ihren Erklärungs- und Vorhersageirrtümern, darin, dass sie nicht erklären könne, was Schlaf ist, wie Lernen sich vollzieht, welches die Ursachen von Intelligenz sind oder was Geisteskrankheit ist und wie sie zu heilen sei. Weil jedoch unser normaler psychologischer Wortschatz nichts mit Theorie zu tun hat und unsere normalen Beobachtungen, Erklärungen und Verallgemeinerungen keine Gesetze einer irgendwie gearteten Theorie sind, geht der Einwand fehl. Die empirische Psychologie sollte Theorien und Erklärungen dafür bereitstellen (und das tut sie auch), weshalb wir schlafen müssen, was zu den unterschiedlichen Intelligenzquotienten führt, welche verschiedenen Geisteskrankheiten es gibt und wie diese geheilt werden können. Es ist jedoch ab-
520
Vgl. P. M. Churchland, Scientific Realism and the Plasticity of the Mind (Cambridge University Press, Cambridge, 1979), S. 91.
506
13 Reduktionismus
surd, unseren alltäglichen Begriffsrahmen dafür zu geißeln, dass er nicht mit entsprechenden Antworten aufwarten kann, ebenso absurd, wie unserem gewöhnlichen oder gebräuchlichen Wortschatz von Stöcken und Steinen, Stühlen und Tischen (und den dazugehörigen alltäglichen Verallgemeinerungen) zur Last zu legen, dass er es versäumt, Materietheorien und mechanische Gesetze zur Verfügung zu stellen. Der zweite Grund war der, dass die sogenannte Alltagspsychologie in den letzten 2.500 Jahren keine Fortschritte zu verzeichnen hatte. Gewiss könnte man der Wissenschaft attestieren, dass sie sich im Medium des Fortschritts vollzieht. Weil es sich jedoch bei unserer psychologischen Sprache nicht um eine theoretische Wissenschaftssprache handelt, geht der Schuldspruch, sie verzeichne ‚keine Fortschritte‘, ins Leere. Denn es ist gar nicht klar, was mit ‚Fortschritte‘ in diesem Zusammenhang gemeint sein könnte. Man kann durchaus die Ansicht vertreten, dass die empirische Psychologie vorangekommen ist – dass eine Menge Wissen angesammelt wurde und dass alte Theorien widerlegt und von geeigneteren ersetzt worden sind. Das ist jedoch ohne Einfluss auf unseren Alltagswortschatz, denn, wie wir dargelegt haben, stellen ein Wortschatz und das Geflecht der logischen Verbindungen zwischen seinen Bestandteilen keine Theorie dar, und die Erklärungen, die wir hinsichtlich unseres Verhaltens und des Verhaltens anderer liefern, sind keine theoretischen. Man könnte sicherlich die Ansicht vertreten, dass der psychologische Wortschatz des Englischen (wie auch sein ästhetischer) im Laufe der letzten tausend Jahre reicher geworden ist, diesen Umstand als wissenschaftlichen Fortschritt zu verbuchen, wäre jedoch unsinnig. Der dritte Grund bestand darin, dass die normalen Verhaltenserklärungen nicht in „die sich abzeichnende Synthese von physikalischen, chemischen, biologischen und neuro-computationalen Wissenschaften“521 integriert werden können. Weil es keine Brückenprizipien geben kann, die eine Verbindung zwischen psychologischen und neurowissenschaftlichen Erklärungen stiften, und weil es keine strengen psychologischen Gesetze gibt, kann die Frage nach der Ableitungsreduktion normaler psychologischer Erklärungen auf neurowissenschaftliche nicht aufkommen. Was indes kein Argument zugunsten der Beseitigungsreduktion liefert. Es macht vielmehr die Absurdität jeglicher Reduktion des Psychologischen deutlich, sei sie nun an Ableitungen oder an Beseitigungen interessiert. Dass alles Wissen und wirkliche Verstehen der Wissenschaft zu verdanken sei, ist ein primitiver moderner Glauben Unter Berufung auf diese drei Erwägungen glaubt man in unseren Tagen primitiverund charakteristischerweise, dass alles Wissen und alles wirkliche Verstehen von der Wissenschaft herrühre. Richard Dawkins formuliert es prägnant: „Die Wissenschaft ist
521
P. M. Churchland, ‚Folk psychology‘, S. 311.
13.2 Reduktion durch Beseitigung
507
die einzige uns bekannte Möglichkeit, die wirkliche Welt zu verstehen.“522 Wissenschaft meint in solchen Glaubens- bzw. quasireligiösen Verlautbarungen eine Wissenschaft des Physisch-Materiellen – insbesondere Mikrobiologie, Chemie und, letztendlich, Physik. Denn, so wird argumentiert, „was die Weltbeschreibung und -erklärung betrifft, ist die Wissenschaft das Maß aller Dinge, der seienden, dass sie sind, der nichtseienden, dass sie nicht sind“.523 Es gibt nichts dergleichen wie ein ‚die Welt Erklären‘ Erstens gibt es jedoch so etwas wie ‚Welterklärung‘ nicht, nur unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Weltphänomene zu erklären. Die Theorien der verschiedenen Naturwissenschaften beschreiben und erklären nicht alles Beschreib- und Erklärbare, und sie wollen auch nicht den Anschein erwecken, als leisteten sie das. Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Soziologie beschreiben und erklären juristische, ökonomische und soziologische Phänomene, ebenso wie die Physik physikalische Phänomene beschreibt und erklärt und die Chemie chemische. Innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche sind die Sozialwissenschaften ein ebensolches Maß des Seienden und Nichtseienden. Und die Geschichte, die weder eine Natur- noch eine Sozialwissenschaft ist, ist ein Maß des Gewesenen, dass es war, und des Nichtgewesenen, dass es nicht war. Es gibt überdies keinen Fortschritt, wie auch immer diese juristischen, ökonomischen, soziologischen und geschichtlichen Phänomene durch irgendeine Naturwissenschaft oder biologische Wissenschaft erklärt werden mögen, von deren Reduktion ganz zu schweigen. Es ist grotesk zu behaupten, dass all diese Gegenstände pseudowissenschaftlich sind oder bloße Erfindungen, weil sie sich im Geflecht eines nichtssagenden und obsoleten Wortschatzes verfangen haben. Soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich bei unseren Vorstellungen davon, wie der Untergang des Römischen Reiches, der Aufstieg des Protestantismus, der Ausbruch der Französischen Revolution und der des Ersten Weltkrieges zu erklären sind, um Fiktionen handelt? Die Wissenschaft ist nicht das Maß aller Dinge Zweitens ist es absurd anzunehmen, dass die Wissenschaft, handele es sich nun um den natur- oder den sozialwissenschaftlichen Bereich, das wichtigste Maß des Existierenden und des Nichtexistierenden abgibt. Man braucht keine Wissenschaft, um zu entdecken oder herauszufinden, dass im Garten ein Baum steht oder dass es in meinem Zimmer keine Bäume gibt. Und man braucht auch keine Wissenschaft, um zu erklären, dass R. Dawkins, ‚Thoughts for the millennium: Richard Dawkins‘, in Microsoft Encarta Encyclopaedia 2000 (Microsoft Corporation, 1993–1999). 523 W. Sellars, ‚Empiricism and philosophy of mind‘, in seinem Buch Science, Perception and Reality (Routledge and Kegan Paul, London, 1963), S. 173. 522
508
13 Reduktionismus
man nach Paris ging, weil man es einem Freund versprochen hat. Nicht alles Wissbare kann durch reine Beobachtung gewonnen werden, ohne reine Beobachtung könnte jedoch rein gar nichts gewusst werden – und die Fähigkeit, etwas über die uns umgebende Welt zu lernen, ist ein Privileg des Menschen, die der Wissenschaft und dem Erwerb wissenschaftlicher Erkenntnisse vorhergeht. Die Behauptung, alle Beobachtung sei theoriehaltig, ist schlichtweg falsch. Es gibt Formen des Erklärens und Verstehens, die weder wissenschaftlich noch theoretisch sind Drittens ist es abwegig anzunehmen, dass die einzigen Verstehensformen solche der Wissenschaft und dass die einzig seriösen Erklärungsformen empirischer Phänomene solche der Theorie sind. Es ist abwegig anzunehmen, dass das philosophische Verstehen und Erklären von begrifflichen Irrtümern und Verwirrungen den auf die natürlichen Phänomene gerichteten wissenschaftlichen Verstehensmodi nachgebildet ist. Auch nicht triftiger ist die Annahme, dass es sich beim historischen Verstehen um eine Nachbildung des für die Physik, die Chemie oder die Neurowissenschaften charakteristischen Verstehens handelt. Nur dogmatisches Beharren kann einen zu der Ansicht verleiten, dass ästhetische Phänomene – Werke der Literatur, Musik, Malerei, Bildhauerkunst und Architektur – entweder nicht verstanden werden können oder dass wir es bei jedem Versuch in dieser Richtung mit einer Imitation des von den Wissenschaftlern angestrebten Verständnisses der physikalischen oder chemischen Phänomene zu tun haben. Sind wir denn nicht alle dem Verständnis der menschlichen Natur verpflichtet, das in den Werken solcher einfachen Leute wie Tolstoi, Dostojewski, Proust und Henry James aufscheint? Aufgegebene Theorien und fallengelassene Begriffe Wissenschaftliche Theorien werden im Laufe des wissenschaftlichen Fortschreitens ersetzt – die ptolemäische Astronomie von der newtonschen Physik und diese wiederum von der Relativitätstheorie; die Kalorische Theorie von der Thermodynamik. Manchmal werden Begriffe als leere über Bord geworfen (z. B. Phlogiston, kalorische Substanz, Elan vital) und von fruchtbareren ersetzt. Die fundamentalen Veränderungen in der Astronomie führten allerdings nicht dazu, dass die Begriffe von Sonne, Mond und Sternen aufgegeben wurden, ebenso wie die Veränderungen in der chemischen Theorie nicht zur Aufgabe der Begriffe des Brennens und Rostens oder der Hitze und Kälte führten oder die Veränderungen in den Lebenswissenschaften nicht zur Preisgabe der Begriffe eines lebenden Wesens, eines toten Wesens und eines unbelebten Dings. Wie gesehen legten die Beseitigungsbefürworter unsere psychologischen Begriffe als protowissenschaftliche aus, die auf der gleichen Ebene angesiedelt seien wie Phlogiston, kalorische Substanz oder Elan vital. Das ist jedoch ein Irrtum. Im Gegensatz zu solchen Be-
13.2 Reduktion durch Beseitigung
509
griffen handelt es sich bei unseren psychologischen Alltagsbegriffen nicht um Postulate irgendeiner Theorie, sondern um konstitutive Elemente der menschlichen Lebensform. Phlogiston wurde postuliert, um die Verbrennung, die kalorische Substanz, um die Wärmeübertragung, und der Elan vital, um das Leben zu erklären. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass es nichts dergleichen gibt – dass die Begriffe leer und die Erklärungen Irrläufer sind. Ganz anders verhält sich die Sache bei unseren psychologischen Begriffen, wie wir dargelegt haben. Unsere psychologischen Alltagsbegriffe sind weder theoretisch noch leer Unsere psychologischen Begriffe sind keine für wissenschaftliche Zwecke entwickelten Begriffe, obgleich es stimmt, dass die psychologischen und neuropsychologischen Wissenschaften sie verwenden, so wie die Chemie die Begriffe des Wassers und des Eisens verwendet und die Biologie solche Begriffe wie Katze und Hund. Sie werden unter anderem verwendet, um die Phänomene zu beschreiben, mit denen es die empirische Psychologie zu tun hat (sie werden jedoch auch verwendet, um diese Phänomene herauszustellen oder zu manifestieren, um ihnen zu artikuliertem Ausdruck zu verhelfen). Es kann durchaus sein, dass die empirische Psychologie der Gegenwart mit Fachtermini operiert, die von der zukünftigen Psychologie ersetzt werden. Das zeigt allerdings nicht, dass es keine Gedanken und Überzeugungen, Wahrnehmungen und Empfindungen, kein Verlangen und keine Intentionen gibt. Den Begriffen von Phlogiston, kalorischer Substanz und Elan vital entspricht nichts. Man kann allerdings nicht sagen, dass unseren psychologischen Alltagsbegriffen nichts entspricht. Für die Anwendung dieser Termini gibt es Kriterien, und diese Kriterien werden tagtäglich, unzählige Male im Leben jedes normal veranlagten Menschens erfüllt. Und nur, wenn die Logik dieser Ausdrücke falsch ausgelegt wird, wie es im Falle der Beseitigungsbefürworter geschehen ist, und diese fälschlicherweise zur Bezeichnung theoretischer, unbeobachtbarer Entitäten herangezogen werden, kann es den verwirrenden Anschein haben, als könne es sein, dass diesen Begriffen nichts entspricht. Zur Falschauslegung der Rolle unseres psychologischen Wortschatzes Beseitigungsbefürworter suggerieren, unser psychologischer Alltagswortschatz werde verwendet, „um das Verhalten von Menschen begreifend nachzuvollziehen, vorherzusagen, zu erklären und zu beeinflussen“. Es ist wahr, dass wir uns selbst in und mit diesen Termini verstehen. Wir prognostizieren menschliches Verhalten anhand des Verlangens, der Intentionen, Zweck- und Zielsetzungen. Wie erklären, weshalb Menschen Dinge tun, die sie aufgrund von Motiven, Charakterzügen, Überzeugungen und Verpflichtungen tun. Und manchmal beeinflussen/manipulieren wir andere (mitunter auf unmoralische Weise), indem wir von unserer Kenntnis ihrer Überzeugungen, Vorlieben und Abneigungen, Hoffnungen und Ängste Gebrauch machen (obwohl empfehlen, über-
510
13 Reduktionismus
reden oder nahelegen nicht mit manipulieren zu verwechseln ist). Das bedeutet jedoch erstens nicht, dass unser psychologischer Wortschatz eine Theorie von irgendwas ist. Und zweitens wäre es absurd zu versuchen, die Funktion oder die Funktionen unseres psychologischen Wortschatzes anzugeben. Dieser hat ebenso viele Funktionen wie die menschliche Sprache und ist ebenso vielgestaltig wie die Phänomene des menschlichen Lebens selbst. Das dürfte nicht überraschen, weil diese Ausdrücke in der Mannigfaltigkeit sowohl ihrer Verwendung als auch ihrer Bedeutung das menschliche Leben mit konstituieren. Dieser ‚Begriffsrahmen‘ konstituiert nicht bloß ‚unseren Begriff davon, was ein Mensch ist‘ – er macht uns auch zu der Art von Wesen, die wir sind. Unsere psychologische Sprache ist mitkonstitutiv für die psych(olog)ischen Phänomene Ohne Sprache sind wir jedoch bloße Affen. Ohne die Sprache der psychologischen Ausdrücke sind wir keine selbstbewussten Wesen. Ohne Selbstbewusstsein sind wir keine moralischen Wesen. Denn das Menschsein erwächst uns aus dem Sprachbesitz. Und unsere psychologische Sprache ist nicht lediglich ein Beschreibungsinstrument zur Charakterisierung dessen, was wir um uns her beobachten. Sie ist mitkonstitutiv für die Phänomene, zu deren Beschreibung sie auch verwendet wird, genau weil die Verwendung psychologischer Verben in der ersten Person Präsens im Normalfall ein Kriterium für andere ist zu sagen ‚Er glaubt (will, beabsichtigt etc.)‘. Solche Wendungen werden in der ersten Person Präsens charakteristischerweise dazu gebraucht, einen Glauben, ein Wollen oder eine Absicht etc. auszudrücken. Die paradigmatischen Ausdrücke unverkennbar menschlicher Absichten und Verlangensbekundungen, Gedanken und Überzeugungen, Liebes- und Hassäußerungen sind sprachliche. Es handelt sich bei ihnen nicht um Beschreibungen des Inneren, sondern um dessen Manifestationen. Und das, was bei einem großen Spektrum an psychologischen Attributen und deren Objekten manifest wird, ist etwas, das nur einem Wesen eignen kann, das den psychologischen Wortschatz in all seiner Vielfalt und Unterschiedlichkeit zu gebrauchen gelernt hat – dieser Gebrauch konstituiert mit, was es heißt, Mensch zu sein.
13.2.4 Den Ast absägen, auf dem man sitzt Annahme, Behauptung und Konklusion der Beseitigungsbefürworter sind abwegig Die Fundamentalannahme der Beseitigungsbefürworter – dass nämlich unser psychologischer Alltagswortschatz ein theoretischer ist – ist falsch. Was ebenso auf deren Behauptung zutrifft, dass unsere gewöhnlichen Erklärungen menschlichen Verhaltens theoretischer Art sind. Und ihre Schlussfolgerung, dass es sich bei unseren an uns und an andere gerichteten gewöhnlichen Beschreibungs- und Erklärungsmodi um obsolete Wissenschaft handelt, die dazu bestimmt ist, von den Neuro- und computationalen Wissen-
13.2 Reduktion durch Beseitigung
511
schaften des neuen Jahrtausends ersetzt zu werden, ist verworren. Die Verwirrungen reichen indes noch tiefer. Die Anschuldigung, die ‚Alltagspsychogie‘ versäume es, die psychischen Phänomene zu erklären, ist verworren Erstens: Zu den Gründen, aus denen sie an der vorgeblichen ‚Alltagspsychologie‘ etwas auszusetzen haben, zählen die Anschuldigungen, sie habe nicht erklärt, wie Lernen sich vollzieht (d. h. der Erwerb von Wissen, gut begründeten Überzeugungen und fundierten Meinungen), sie habe nicht erläutert, wie das Gedächtnis arbeitet oder worin die Geisteskrankheiten bestehen (z. B. manische Depression, Angstneurose, Paranoia) oder wie sie geheilt werden könnten. Wenn die Beseitigungsbefürworter jedoch Recht haben, gibt es solche Krankheiten nicht. Denn es gibt kein chronisches Depressivsein oder irrationales Außersichsein, kein Angsthaben oder Sich-Fürchten, und niemand glaubt jemals, dass andere unterwegs sind, um ihm Schaden zuzufügen. Gedächtnis muss ebenso wenig erklärt werden wie das Walten der kalorischen Substanz – weil beide Begriffe gleichermaßen leer sind. Und es kann auch keine Lerntheorie geben, weil es nichts dergleichen gibt wie wissen, glauben oder meinen. Aus dieser Sicht der Dinge gibt es also nichts, was unser gewöhnliches Begriffssystem zu leisten versäumt hätte, das laut Beseitigungsbefürwortern noch zu leisten wäre. Die Erklärungskonzeption der Beseitigungsbefürworter ist per se inkohärent Zweitens halten die Beseitigungsbefürworter Ausschau nach den Vorteilen von Neuround Computerwissenschaften, um die verschieden Phänomene zu erklären, einschließlich jener, die das Gedächtnis, Lernen, Bewusstsein etc. betreffen. Erklärung ist jedoch per se, begrifflich, mit verstehen verknüpft sowie mit herausfinden, mit begründetem Glauben und fundierter Meinung. All diese Termini stehen jedoch auf dem Index der Beseitigungsbefürworter. Darum ist es vollkommen unklar, was sie mit ‚erklären‘ meinen können, wenn der Begriff der Erklärung seiner Verknüpfungen mit diesen epistemischen Begriffen der sogenannten Alltagspsychologie beraubt ist. Wenn ihre Begriffe leer sind, bleibt der Psychologie nichts zu erklären übrig Drittens sind die Beseitigungsbefürworter mit den vorgeblichen Irrtümern der ProtoPsychologie befasst. Sie bringen nicht nur vor, dass die ‚Alltagspsychologie‘ nicht erklären kann, was sie ihrer Ansicht nach erklären sollte, sondern monieren zudem, dass deren Charakterisierung der mutmaßlichen Explananda vollständig in die Irre geht. Denn die von ihr angewendeten Begriffe seien leer. Was eine wissenschaftliche Psychologie, die diesen Namen verdient, brauche, sei ein neuer, den Neuro- und Computerwissenschaften entlehnter Wortschatz. Wissenschaftspsychologie ist allerdings unmöglich, wenn es
512
13 Reduktionismus
keine mit Geist begabten Wesen gibt – mit verstandesmäßigen Fähigkeiten für das Wissen, Glauben, Denken und Meinen sowie Willensfähigkeiten, um aus Gründen und nach Motiven zu handeln, und affektiven Fähigkeiten, um Emotionen zu haben, Schmerz zu empfinden und sich an Dingen zu erfreuen. Wenn die Begriffe unseres abwegigerweise als ‚Alltagspsychologie‘ aufgefassten psychologischen Wortschatzes leer sind, dann hat die genuine Psychologie keinen Gegenstand – ebenso wie eine wissenschaftliche Erforschung der Hexenkunst oder von Geistern gegenstandslos ist, wenn es keine Hexen bzw. Geister gibt. Der Beseitigungsbefürworter sägt de facto den Ast ab, auf dem er sitzt Schließlich setzt die eigentliche Annahme ‚hinter‘ den Behauptungen der Beseitigungsbefürworter den sinnvollen Gebrauch von Begriffen voraus, die ihrer Auffassung nach jedoch leer sind und nichtssagend. Denn der bloße, auf das Geltendmachen bzw. Behaupten und das Fragenaufwerfen eingeschränkte Sprachgebrauch setzt die Anwendung solcher Begriffe voraus wie Intention, etwas meinen mit dem, was man sagt, Wissen und Glauben, Gründe haben und in der Lage sein, Gründe anzuführen, verstehen und erklären. Glaubt der Beseitigungsbefürworter, was er sagt – oder glaubt er nicht, was er sagt, wie das Erkalten des Wassers in einem Krug nicht mit dem Transport einer kalorischen Substanz einhergeht? Oder glaubt er weder, noch glaubt er nicht? Beabsichtigt er, seine Leser von der Wahrheit seiner Worte zu überzeugen? Oder beabsichtigt er das nicht, wie die Eisenoxidation nicht mit irgendeinem Phlogiston in Verbindung steht? Ist seine Äußerung intentional? Oder unintentional? Wenn sie nicht intentional ist, aber auch nicht unintentional, weder zufällig noch ungewollt, ist sie dann überhaupt eine Äußerung? Wenn er weder meint, was er sagt, noch irgendetwas damit meint, hat er dann überhaupt irgendetwas gesagt? Erwartet er, dass uns seine Argumente überzeugen? Hat er Gründe für das, was er sagt, oder äußert er sich grundlos? Hat er Gründe für das, was er sagt, oder handelt es sich bei seinen Einlassungen um unbegründeten Dogmatismus? Offenkundig ist er der Meinung, viele unterschiedliche Gründe für seine seltsame Theorie mitzuliefern. Aber kann ein Wesen Gründe für bestimmte Behauptungen haben und dennoch weder glauben noch nicht glauben, dass diese Gründe sie stützen? Und so weiter. Der Beseitigungsverfechter sägt den Ast ab, auf dem er hockt. Denn wenn das, was er behauptet, wahr wäre, könnten seine Äußerungen nicht als Versicherungen oder Behauptungen aufgefasst werden und seine Stützargumente nicht als Gründe dafür, dass er glaubt, was er sagt. Der Beseitigungsmaterialismus ist keine ernst zu nehmende Option, weil es keine ernst zu nehmende Möglichkeit für die Erforschung von Natur und Verhalten des Menschen ist, sich der Begriffe zu entledigen, die ihre Thematik definieren und deren diskursiver Gebrauch ihre Gegenstände mit konstituiert. Die Erforscher der menschlichen Natur könnten die Begriffe nicht nur nicht aufgeben und dennoch mit ihren Erklärungsbemühungen fortfahren, sondern es wäre überdies so, dass man, könnte man zei-
13.2 Reduktion durch Beseitigung
513
gen, dass die Begriffe auf eine bestimmte Kreatur nicht zutreffen, dadurch nachgewiesen hätte, dass es sich bei ihr nicht um eine Person handelte, noch überhaupt um einen Menschen.
14 Methodologische Reflexionen Methodenpraktizierung geht vor methodologischer Auseinandersetzung Bislang haben wir auf detaillierte methodologische Reflexionen verzichtet. Solche Diskussionen werden häufig leidenschaftlich geführt und tendieren, wenn methodologische Gebrauchsbeispiele für die Methodik und die Ergebnisse ihrer Anwendung fehlen, zwangsläufig zur Unbestimmtheit und dazu, nicht überzeugen zu können, sieht man von besser aufbereiteten Reflexionen ab. Die Philosophie ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts uneins, was die Eigenart, die Methoden und Grenzen des Gegenstands angeht. Wir haben uns in diesem Buch nicht darum bemüht, unseren methodologischen Ansatz gegenüber anderen Zugangsweisen zur Philosophie der Psychologie zu verteidigen. Vielmehr haben wir die analytische Philosophie des Geistes auf eine Weise praktiziert, wie sie von Wittgenstein auf den Weg gebracht und von vielen anderen analytischen Philosophen weiterentwickelt wurde. Im Glauben, dass Methoden sich von ihren Resultaten her rechtfertigen, haben wir es vorgezogen, die Methoden der verbindenden Analyse524 auf die Begriffsfragen anzuwenden, die für die Neurowissenschaften an der Schnittstelle zur Psychologie charakteristisch sind. Nachdem wir zeigen konnten, was mit solchen Begriffserklärungmethoden zu erreichen ist, können wir uns an dieser Stelle methodologischen Fragen und Einwänden zuwenden. Erster Einwand: Der angebliche Irrtum ist vielmehr eine von der gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Theorie gerechtfertigte Innovation Die erste Sache, die wir angehen werden, wurde bereits erörtert. In 3.2 haben wir uns kurz drei methodologischen Bedenken zugewendet. Jetzt werden wir einen grundlegenderen methodologischen Einwand untersuchen. Denn gemeinhin geht man davon aus, dass es sich bei den von uns in den neurowissenschaftlichen Schriften aufgespürten Irrtümern lediglich um sprachliche Innovationen handelt, die durch die avancierte Theorie gerechtfertigt sind. Man behauptet, dass die Philosophie nichts zur Kritik an den Sprachinnovationen der Wissenschaftler ermächtigt, deren Theorien festlegen, ob es Sinn ergibt, ‚Verbindende Analyse‘ [‚connective analysis‘] (oder ‚verbindende Erklärung‘ [‚connective elucidation‘]) ist ein künstlicher Terminus, der von P. F. Strawson eingeführt wurde in Analysis and Metaphysics (Oxford University Press, Oxford, 1992), Kap. 2. Er eignet sich zur Bezugnahme auf die Methoden der Begriffsuntersuchung, die von Wittgenstein und vielen anderen analytischen Philosophen um die Mitte des 20. Jahrhunderts herum entwickelt und weiterentwickelt wurden. 524
13.2 Reduktion durch Beseitigung
515
dem Gehirn psychologische Attribute zuzuschreiben, oder nicht. Bei der in diesem Buch praktizierten Art der Begriffsanalyse handele es sich bloß um eine Form von ruinösem Begriffskonservatismus, der einer kreativen Wissenschaft im Wege steht. Zweiter Einwand: Die angeblichen Irrtümer sind bloß bildliche Sprachverwendungen der Neurowissenschaftler, die den Unzulänglichkeiten des Englischen geschuldet sind Eine sich davon recht deutlich abhebende Kritik, die bescheidener und weniger überbordend selbstsicher in Erscheinung tritt, muss ebenfalls zurückgewiesen werden. Gemeint ist die Blakemore’sche Behauptung, dass es sich bei den Ausführungen zahlreicher Wissenschaftler, die aus unserer Sicht Verletzungen des mereologischen Prinzips darstellen, lediglich um bildliche oder metaphorische Sprachverwendungen handelt oder gar um dichterische Freiheit. Denn, so sagt man, die normale Sprache statte den Neurowissenschaftler nicht mit dem geeigneten Wortschatz aus, der es ihm ermöglichen würde, seine Vorstellungen adäquat zum Ausdruck zu bringen. Er wisse ganz genau, was er denke, nur stünden ihm nicht die sprachlichen Mittel zur Verfügung, um das Gemeinte anders als auf diese Weise zu sagen. Worum es in der folgenden Erörterung gehen wird Wir werden im Anschluss einige Beispiele aus den Schriften angesehener Neurowissenschaftler anführen, denen jene Irrtümer unterlaufen, gegen die wir angeschrieben haben, und erstens deutlich machen, dass es sich bei ihren missbräuchlichen Verwendungen von Ausdrücken (wie mittlerweile klar sein dürfte) keineswegs um bloße Façons de parler handelt, sondern um Begriffsverwirrungen, auf denen die favorisierten Erklärungen wesentlich beruhen; und wir werden zweitens zeigen, dass es überhaupt nicht schwer ist, sämtliche Entdeckungen logisch fehlerlos darzulegen und ohne die metaphorische oder poetische Freiheit beanspruchen zu müssen. Kein Verlust ist, was man dabei verliert, nämlich eine inkohärente theoretische Erklärung. Für die Entstellungen und Inkohärenzen, die in den Schriften so vieler kognitiver Neurowissenschaftler vorkommen, sind nicht Unzulänglichkeiten des Englischen verantwortlich zu machen – sondern vielmehr Verstehensunzulänglichkeiten; das mangelhafte Erfassen der Begriffe und begrifflichen Zusammenhänge also, das den Rahmen bildet, in dem jene Neurowissenschaftler ihre Entdeckungen beschreiben und deren Auswirkungen auf das Verständnis der menschlichen Psychologie zu erklären versuchen. In Anbetracht der unter Neurowissenschaftlern weit verbreiteten Missverständnisse im Hinblick darauf, was die Philosophie zu leisten oder nicht zu leisten hätte, werden wir am Ende zu klären versuchen, in welcher Form die Neurowissenschaften von der Philosophie profitieren können.
516
14 Methodologische Reflexionen
14.1 Sprachbeharrung und Begriffsinnovation Zusammenfassung In unserer Untersuchung haben wir uns stets mit Nachdruck darauf konzentriert, wie psychologische Ausdrücke verwendet werden. Und wir haben fallweise aufgezeigt, wie bestimmte Neurowissenschaftler (sowie Psychologen und Kognitionswissenschaftler) unseren psychologischen Alltagswortschatz missbräuchlich verwenden, indem sie die Bedeutung zahlreicher psychologischer Ausdrücke falsch auslegen. Wir haben von Beginn unserer analytischen Erörterung an nachdrücklich betont, dass es ein Irrtum ist, dem Gehirn Attribute zuzuschreiben, die man nur Menschen (und manchen Tieren) als Ganzen sinnvoll zuschreiben kann. Diesen Irrtum haben wir ‚den mereologischen Fehlschluss in den Neurowissenschaften‘ genannt, und wir sind darauf aufmerksam geworden, wie weit verbreitet er unter Neurowissenschaftlern ist, die dem Gehirn psychologische Prädikate zuschreiben, um die psychologischen Attribute von Menschen zu erklären. Wir argumentierten, dass solche Prädikatszuweisungen keinen Sinn ergeben, dass es nichts dergleichen gibt wie ein denkendes oder folgerndes, Schmerz empfindendes oder etwas wahrnehmendes, vorstellendes oder wollendes Gehirn. Die von uns gewählte Herangehensweise ist nicht neu. Vorbehaltlich einiger Einschränkungen kann man sagen, dass sie bis zu Sokrates’ Wortwahl und Aristoteles’ häufiger Bezugnahme auf ta legomena (‚das, was gesagt wird‘) zurückreicht. Im 20. Jahrhundert wurde sie von jenen, die den von Wittgenstein angestoßenen ‚Linguistic Turn‘ mitvollzogen, glänzend entfaltet und von zahlreichen analytischen Philosophen weiterentwickelt, ob diese nun Anhänger Wittgensteins waren oder nicht. Die Anhänger und Mitvollzieher des Linguistic Turn einte der Glauben, dass, wie Paul Grice es formulierte, „philosophisches Denken eine sorgfältige Untersuchung der Einzelmerkmale der Alltagssprache erfordert“.525 Diese Herangehensweise mit ihrem Beharren darauf, dass die Untersuchung der Sprachverwendungsweisen eine sine qua non der Begriffserläuterung ist und darum unverzichtbar zur Lösung, Aufhebung oder Beseitigung begrifflicher Probleme, wurde von Kognitionswissenschaftlern und durch Quine beeinflusste Philosophen kritisiert.526 Ihre Bedenken lassen sich in der Kritik Patricia Churchlands gut nachH. P. Grice, ‚Reply to Richards‘, in R. E. Grandy und R. Warner (Hg.), Philosophical Grounds of Rationality (Clarendon Press, Oxford, 1986), S. 51. Er ging sogar so weit, ‚es als meinen Glauben zu proklamieren, dass die sprachliche Urbarmachung für eine philosophische Untersuchung auf einem bestimmten Niveau unverzichtbar und dass es bedauerlich ist, dass man das vergessen oder sich nie klargemacht hat‘ (ibid., S. 57). 526 Quine und seine Anhänger gehen davon aus, dass alle ‚Begriffsbildung‘ [‚conceptualization‘] theoriehaltig ist. Sobald Sprache verwendet wird, ist also Theorie im Spiel. (Entsprechend ist ‚Mama, ich will ein Glas Wasser‘ Teil der ‚Welttheorie‘ des Kindes, und die Erwiderung ‚Sei still, mein Liebling, es ist Zeit schlafen zu gehen‘ ist Teil der ‚Welttheorie‘ der Mutter.) Sie sind der Auffassung, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Begriffswahrheiten (dass Rot eine Farbe ist z. B. 525
14.1 Sprachbeharrung und Begriffsinnovation
517
vollziehen, die sich dagegen ausspricht, zur Klärung dessen, was Sinn ergibt und was nicht, den Gebrauch zu untersuchen. Wir haben dargelegt, dass der Gedanke, bestimmte Geisteszustände könnten mit Gehirnzuständen identisch sein, inkohärent ist – dass es beispielsweise keinen Sinn ergibt, einen Bauchschmerz mit einem Gehirnzustand, oder glauben, dass es regnen wird, mit einem neuralen Zustand zu identifizieren. Churchland wendet jedoch ein, „dass es von jemandes Hintergrundüberzeugungen und -annahmen abhängt, ob eine Hypothese für ihn Sinn ergibt. So kann das, was für einen Dualisten keinen Sinn ergibt, für einen Physikalisten sehr wohl Sinn ergeben.“527 Zweitens fügt sie hinzu, dass unser Glaubenshorizont oder unser Vorstellungsvermögen maßgeblich dafür ist, ob uns etwas begreiflich oder vorstellbar ist. Für Galilei war es einfach, die Erde als einen von mehreren Planeten auf einer Sonnenumlaufbahn zu begreifen, seine Kritiker fanden es jedoch unerhört und unbegreiflich. [. . .] Ob es Teil des Begriffs von Geisteszuständen ist, dass kein physischer Zustand die Wesensart der betreffenden Geisteseigenschaft charakterisieren könnte, wird gleichermaßen davon abhängen, ob man die Möglichkeit, dass Geisteszustände Gehirnzustände sind, glaubhaft findet. Für Menschen, in deren Glaubensrahmen das möglich ist, gilt: Ihre Begriffe von Geisteszuständen und Geisteseigenschaften und ihre Anschauungen werden ganz andere sein [als die von anderen]. Das heißt, dass die Anschauungen, die mit bestimmten Begriffen verknüpft sind, nicht über die wirkliche empirische Beschaffenheit dessen befinden können, worauf jene Begriffe, wie man glaubt, zutreffen.528
Drittens konfrontiert Churchland die Anschuldigung, der mereologische Fehlschluss sei unter Neurowissenschaftlern weit verbreitet, mit folgender Überlegung:
oder dass kein Ding ganz und gar rot und grün sein kann oder dass Rot Orange stärker ähnelt, als es Gelb ähnelt) und empirischen Wahrheiten (dass dieser Teppich rot ist z. B. oder dass dieser Teppich eher einem afghanischen als einem shirazschen Teppich ähnelt) – und folglich keinen zwischen Darstellungsnormen (bei den meisten Begriffswahrheiten handelt es sich um solche) und Tatsachenfeststellungen. Darum gehen sie auch davon aus, dass die Philosophie in die Wissenschaft übergeht und ein Teil desselben Unternehmens ist wie diese (bzw. dessen, was sie der Wissenschaft beimessen): nämlich Theorien über ‚die Welt‘ zu bilden. Unserer Ansicht nach könnte man der Wahrheit nicht ferner stehen. Hier ist nicht der Ort, sich dieses Themas anzunehmen. Allerdings gehen wir davon aus, dass die in diesem Buch von uns vorgelegten Analysen der Begriffsstrukturen unsere Herangehensweise rechtfertigen. Für einen detaillierten Vergleich der konfligierenden Ansichten Quines und Wittgensteins und für eine Kritik an Quines Konzeption der Philosophie und ihrer Methoden siehe P. M. S. Hacker, Wittgenstein’s Place in TwentiethCentury Analytic Philosophy (Blackwell, Oxford, 1996), Kap. 7 [dt. Wittgenstein im Kontext der analytischen Philosophie]. Für eine umfassendere Quine-Kritik siehe H.-J. Glock, Quine and Davidson on Language, Thought and Reality (Cambridge University Press, Cambridge, 2003). 527 P. S. Churchland, Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind/Brain (MIT Press, Cambridge, MA, 1986), S. 272. 528 Ibid., S. 273.
518
14 Methodologische Reflexionen
[D]ie Annahme, dass das Gehirn sich erinnert oder über Wissen verfügt oder sprachliche Symbole verwendet, ist mitunter als ein schierer Begriffsirrtum angeprangert worden, der darin besteht, Kategorien eines Bereichs auf einen anderen Bereich zu übertragen, auf den diese Kategorien nicht zutreffen. Was für den einen ein Kategorienfehler ist, stellt für den anderen eine grundlegende Theorie über die Natur des Universums dar. [. . .] Um der Wahrheit über Gehirne näher zu kommen, ist es nicht wichtig, ob die Menschen auf der Straße für gewöhnlich sagen, dass Personen sich erinnern, aber nicht, dass Gehirne dies tun; von entscheidender Bedeutung ist vielmehr die Frage, ob wir sagen sollten, dass Gehirne sich erinnern – ob es in Anbetracht der empirischen Tatsachen eine überzeugende Hypothese ist, dass Gehirne sich erinnern.529
Schließlich vertritt sie die Auffassung, dass der neue neurowissenschaftliche Sprachgebrauch eine Form sprachlicher Beharrung aufweist, die völlig ungerechtfertigt ist: Weil im normalen Verlauf des wissenschaftlichen Fortschritts die Wortbedeutungen sich infolge des Wandels in der Theorie verändern, so wäre der Bedeutungswandel innerhalb einer weiterentwickelten Hypothese an sich kein Einwand gegen die Hypothese. [. . .] Daher kann das, was für die am Altvertrauten geschulten Ohren befremdlich klingt, vollkommen gewöhnlich und richtig scheinen. Das liegt daran, dass altgediente Theorien diese Ohren schulten. [. . .] [. . .] Die Annahme, dass die Angemessenheit einer neuen Theorie gefährdet ist, wenn ihre Termini die bedeutungsmäßige Übereinstimmung mit den Termini der alten Theorie nicht aufrechterhalten können, ist auf abträgliche Weise konservativ. Denn sie impliziert, dass die Bewahrung des Status quo über oder vor Erwägungen geht, die unter empirischem Gesichtspunkt als angemessen aufgefasst werden.530
Vielen Neurowissenschaftlern mögen diese Einwände zusagen. Die Beschäftigung mit ‚bloßen Worten‘ kommt ihnen im Hinblick auf das unablässige Voranschreiten der Wissenschaft vielleicht albern und irrelevant vor. Sollten sie diesen Eindruck tatsächlich haben, täuschen sie sich allerdings. Wir sind, was wir sind, weil wir eine reiche, hoch entwickelte Sprache beherrschen. Wir haben erreicht, was wir erreicht haben, weil wir die ‚bloßen Worte‘ haben, um uns und die Welt zu verstehen – denn wir haben keine anderen Denk-Werkzeuge. Es gehört sich so, dass wir unsere Werkzeuge kennen und sicherstellen, dass sie einwandfrei funktionieren und keines fehlt. Ob eine Hypothese Sinn ergibt, hängt davon ab, ob ihre Einzeltermini richtig verwendet werden Auf Churchlands Einwand antworten wir wie folgt: Ob eine mutmaßliche Hypothese Sinn ergibt, hängt erstens von den Bedeutungen – das heißt den richtigen Verwendungen – der Worte ab, aus denen sie sich zusammensetzt. Die Bedeutungen der Worte werden 529 530
Ibid., S. 273f. Ibid., S. 274.
14.1 Sprachbeharrung und Begriffsinnovation
519
durch deren regelgeleiteten Gebrauch festgelegt, und sie werden von den durch die Sprechergemeinschaft als richtig anerkannten Bedeutungserklärungen bereitgestellt. Denn die Bedeutungserklärungen fungieren als Regeln oder Standards für den richtigen Gebrauch der betreffenden Ausdrücke. Der Alltagsgebrauch eines Ausdrucks ist ebenso wenig der Alltagsgebrauch des ‚Mannes auf der Straße‘, wie es der Alltagsgebrauch des Professors auf seinem Fachgebiet oder der des Neurowissenschaftlers in seinem Labor ist. Er ist die Standardverwendung, die von den bildlichen oder metaphorischen oder sekundären Verwendungen abgegrenzt werden kann. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es sich bei den Termini, mit denen wir uns in dieser Studie auseinandergesetzt haben, und jenen, mit denen Neurowissenschaftler in ihren Untersuchungen zu den neuralen Grundlagen von Empfindung, Wahrnehmung, Denken, Vorstellung, Gedächtnis, willkürlicher Bewegung etc. auf problematische Weise umgehen, nicht um Fachtermini handelt. (Natürlich werden sie von einer Menge fachsprachlicher und quasifachsprachlicher Termini ergänzt, der Streit dreht sich jedoch nicht um diese.) Der Alltagsgebrauch fachsprachlicher und nichtfachsprachlicher Termini Der Alltagsgebrauch eines nichtfachsprachlichen Ausdrucks (z. B. ‚Geist‘, ‚Körper‘, ‚wahrnehmen‘, ‚denken‘, ‚sich erinnern‘) kann vom Alltagsgebrauch fachsprachlicher Termini (z. B. ‚Hippocampus‘, ‚Amygdala‘, ‚präfrontaler Kortex‘, ‚epileptischer Automatismus‘) abgegrenzt werden. Fachtermini wiederum können theoretische oder nichttheoretische Termini sein. Die meisten Fachtermini der Neuroanatomie sind keine theoretischen, im Gegensatz zu vielen von den Neurophysiologen ins Feld geführten Fachtermini (obgleich es sich natürlich bei manchen von ihnen um theoretische Termini anderer Wissenschaften handelt wie der Physik und der physikalischen Chemie). Sowohl theoretische als auch nichttheoretische Fachtermini finden bei der Formulierung wissenschaftlicher Hypothesen Verwendung. Ob eine Hypothese Sinn ergibt, muss jedoch geklärt werden, bevor man ihre Wahrheit oder beweisrelevanten Aspekte bestimmt. Andernfalls wüssten wir nicht, worum es sich bei dem handelt, das wir als Tatsache ausweisen sollen, wofür wir bestätigende Belege beibringen müssen. Ob ein bestimmter Satz eine einleuchtende Hypothese formuliert, wird selbstverständlich von seinen einzelnen fachsprachlichen und nichtfachsprachlichen Ausdrücken und ihrer Kombinationsweise in dem Satz abhängen. Die Bedeutungen dieser Ausdrücke, seien diese nun fachsprachliche oder nichtfachsprachliche, hängen nicht von den Überzeugungen des Hypothesenbildners ab. Churchlands erster Einwand entkräftet: Sinnfragen gehen vor Wahrheitsfragen Um auf Churchlands erste ‚Sorge‘ zurückzukommen: Die Vorstellung, dass „das, was für einen Dualisten keinen Sinn ergibt, für einen Physikalisten sehr wohl Sinn ergeben kann“, geht in zweifacher Hinsicht in die Irre. Dualismus und Physikalismus sind keine irgendwie gearteten wissenschaftlichen Theorien. Kein Experiment kann festlegen, ob
520
14 Methodologische Reflexionen
der Geist eine immaterielle Substanz ist oder nicht, und Descartes’ Argumente für seine Form des Dualismus haben keinen experimentellen Beweis erbracht, der seine Behauptungen stützt. Ebenso kann kein Experimentum Crucis beweisen, dass glauben, dass es morgen regnen wird, ein Zustand des Gehirns des Glaubenden ist oder dass nach Neapel gehen wollen mit einem bestimmten Gehirnzustand identisch ist. Dualismus und Physikalismus sind philosophische, metaphysische Konzeptionen. Sie bemühen den Alltagswortschatz des Geistigen. Dessen Ausdrücke – zum Beispiel ‚hoffen‘, ‚sich ängstigen‘, ‚wissen‘, ‚sich erinnern‘, ‚glauben‘, ‚denken‘, ‚wahrnehmen‘, ‚Zahnweh haben‘ – sind keine theoretischen Termini irgendeiner Wissenschaft. Welche Bedeutung sie haben, wird nicht durch metaphysische Konzeptionen festgelegt, sondern durch ihren Alltagsgebrauch. Die Frage ist nicht, ob diese Ausdrücke aus Sicht eines Dualisten oder eines Physikalisten Sinn ergeben, sondern vielmehr, ob diese gewöhnlichen oder gebräuchlichen Ausdrücke von diesem oder von jenem so verwendet werden, dass ihr Gebrauch Sinn ergibt. Es geht nicht darum, ob eine bestimmte von einem Dualisten oder einem Physikalisten vorgebrachte Konzeption – dass der Geist eine immaterielle Substanz ist beispielsweise oder dass er mit dem Gehirn identisch ist – aus seiner Sicht Sinn ergibt, entscheidend ist, ob sie überhaupt Sinn ergibt. Denn die Frage, ob eine Konzeption aus Sicht einer Person Sinn ergibt, entspricht ungefähr der Frage, ob sie ihm plausibel scheint. Ob eine Behauptung oder scheinbare Hypothese Sinn ergibt, ist keine personenbezogene Frage und keine, die auf scheinbare Plausibilität abzielt. Es handelt sich bei ihr um eine Frage, die die Bedeutung und Wohlgeformtheit eines Satzes oder von Sätzen betrifft, eine Frage, die Wahrheit und Falschheit vorhergeht. Und damit eine solche vorgebliche empirische Hypothese wie die, dass das Gehirn denkt oder schließt (oder dass das Gehirn möglicherweise mit dem Geist identisch ist), entweder wahr oder falsch sein kann, muss sie Sinn ergeben – es muss möglich sein anzugeben, was als ihr Wahrsein betrachtet würde, und auch, was als ihre Bestätigung oder Widerlegung zu betrachten wäre. Churchlands zweiter Einwand entkräftet: Begreiflichkeit und Vorstellbarkeit sind keine Kriterien für das Sinnergeben Churchlands zweiter Einwand lautete, dass das Begreifliche oder das Vorstellbare von den eigenen Überzeugungen, der eigenen Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, und den eigenen Anschauungen abhängt. Ob es zum Begriff eines Geisteszustands gehört, dass er ausschließt, dass ein Geisteszustand mit einem Gehirnzustand identisch ist, hängt, wie sie ausführt, davon ab, ob man innerhalb eines ‚Rahmens‘ denkt und glaubt, in dem das möglich ist, oder nicht. Hier irrt sie jedoch gleich aus mehreren Gründen. Weder Begreiflichkeit noch Vorstellbarkeit sind Kriterien dafür, ob ein Gebilde aus Worten Sinn ergibt oder unsinnig ist, und die zwischen Sinn und Unsinn verlaufenden Grenzen werden nicht von Begreiflichkeit oder Vorstellbarkeit festgesetzt. Es ist richtig, dass es Galilei leichtfiel, die Erde ‚als einen von mehreren Planeten auf einer Sonnenumlaufbahn‘ zu begreifen und dass seine Kritiker es unerhört und unbegreiflich fanden.
14.1 Sprachbeharrung und Begriffsinnovation
521
Was sie jedoch unerhört fanden, war, dass Galilei vorbrachte, was er vorbrachte – das der damaligen Lehrmeinung und dem religiösen Dogma entgegenstand –, und was sie ‚unbegreiflich‘ fanden, war, dass Gott den Wohnsitz der Menschheit nicht ins Zentrum des Kosmos gestellt haben könnte. Sie fanden nicht die Vorstellung, dass die Erde ein die Sonne umkreisender Planet ist, buchstäblich unbegreiflich – das konnten sie problemlos begreifen. Sie verstanden genau, worauf Galilei hinauswollte. Sie hatten nicht den Eindruck, dass es sich um eine bedeutungslose Aneinanderreihung von Worten handelte; im Gegenteil, sie fanden es schlichtweg falsch. Sie wandten nicht ein, dass die Erde sich bewege, sei ein ebenso unsinniger Gedanke wie der, dass die Zahl drei grün werde vor Neid. Sie wandten vielmehr ein, wie es sein könne, dass, wenn die Erde sich bewegt, kein Wind geht oder dass senkrecht nach oben geworfene Gegenstände nicht Hunderte Meter entfernt landen oder dass keine Sternparallaxe zu beobachten war.531 Wir haben es hier mit empirischen, nicht mit semantischen Einwänden zu tun. (Die einschlägige Kritik an den kognitiven Neurowissenschaften lässt hingegen Zweifel am Sinn bestimmter kognitiver neurowissenschaftlicher Behauptungen aufkommen, nicht an deren Wahrheit.) Was logisch möglich ist und was ausgeschlossen, hat zudem nichts mit irgendjemandes ‚Anschauungen‘ (Vermutungen, Mutmaßungen oder Annahmen) über Begriffe zu tun, sondern nur mit dem richtigen Gebrauch der Worte, mit den Regeln für deren Verwendung und mit den Erklärungen ihrer Bedeutungen. Natürlich befinden Begriffe nicht über die empirische Beschaffenheit dessen, was sie zum Ausdruck bringen – diese Ermittlungs- und Festlegungsleistung muss im Experiment erbracht werden. Was Sinn ergibt und was Unsinn ist, hängt von den Sprachregeln ab, einschließlich der Bedeutungserklärungen, die die Standards für den richtigen Wortgebrauch zur Verfügung stellen. Was wahr ist oder falsch, hängt von der Welt ab. Sich einen neuen Rahmen anzueignen, bedeutet, die Regeln und damit die Bedeutungen zu verändern Wenn es jedoch die Sprachregeln sind, die festlegen, was Sinn ergibt und was Unsinn ist, dann können wir doch sicherlich die Regeln ändern, wie es uns beliebt? So mag es scheinen, dass wir uns einen ‚Rahmen aneignen‘ können, in dem es Sinn hat zu sagen, glauben sei ein Gehirnzustand oder das Gehirn denke und ziehe Schlüsse. Das ist jedoch ein Irrtum. So etwas wie ein ‚Aneignen eines Rahmens‘, in dem Unsinn Sinn hat, gibt es nicht – ohne die Spielregeln zu verändern. Es ergibt keinen Sinn zu sagen, es sei fünf Uhr auf der Sonne oder etwas sei gleichzeitig vollständig rot und grün – denn wir haben diesen Wortgebilden keine Bedeutung gegeben. Wir können ihnen eine Bedeutung geben und uns ‚einen neuen Rahmen aneignen‘, in dem es sinnvoll ist, so zu reden – wenn wir kohärente neue Regeln für den Gebrauch dieser Ausdrücke festschreiben. Dann 531
Eine Sternparallaxe wäre im 18. Jahrhundert auch dann nicht zu beobachten gewesen, wenn es viel stärkere Teleskope gegeben hätte als das, mit dem Galilei operierte.
522
14 Methodologische Reflexionen
aber werden die Worte nicht das bedeuten, was sie jetzt bedeuten, und wir werden ‚fünf Uhr‘ oder ‚auf der Sonne‘ oder ‚rot‘ oder ‚grün‘ oder ‚vollständig‘ oder ‚gleichzeitig‘ eine neue Bedeutung gegeben haben. Würden wir das tun, dann stünde das von uns Gesagte natürlich nicht mit irgendjemandes früheren Glaubensannahmen in Widerspruch – denn wir würden von etwas anderem sprechen. Neurowissenschaftler bemühen sich nicht darum, anstelle des existierenden psychologischen Wortschatzes neue Begriffe einzuführen Unsere Kritik am mereologischen Fehlschluss in den Neurowissenschaften hält die Neurowissenschaftler nicht davon ab, die Verben ‚denken‘, ‚glauben‘, ‚wahrnehmen‘, ‚sich erinnern‘ auf neue Weise und gemäß neuen Gebrauchsbedingungen zu verwenden, die sich von den althergebrachten unterscheiden, solange sie erklären können, was mit diesen neuen Verwendungen gemeint ist. Sie können bei Bedarf ‚denken‘, ‚glauben‘, ‚wahrnehmen‘, ‚sich erinnern‘ neu definieren und den Wendungen ‚Mein Gehirn dachte, es sei besser, nichts zu sagen‘, ‚Ihr Gehirn glaubt, dass morgen Dienstag ist‘, ‚Sein Gehirn nahm wahr, dass sie lächelte‘, ‚Ihr Gehirn erinnerte sich daran, heimzugehen‘ eine neue Bedeutung geben. Uns war wichtig zu betonen, dass sie das nicht getan haben. Es deutet auch nichts darauf hin, dass sie es tun wollen, denn sie versuchen, die neurale Grundlage für das Denken, Glauben, Wahrnehmen und Erinnern aufzuspüren – und nicht die für etwas anderes. Wenn sie jedoch solchen Wendungen eine Bedeutung geben wollten, würde das mehr erfordern, als einen existierenden Ausdruck bloß mit einem Sternchen zu versehen (z. B. ‚Repräsentation*‘ (siehe 3.2)) und lediglich festzuhalten, dass das Gehirn etwas zum Ausdruck bringt. Neue Bildungsregeln müssten vereinbart werden, die Bedingungen für die richtige Anwendung dieser innovativen Wendungen wären festzulegen und die logischen Implikationen ihrer Anwendung müssten ausbuchstabiert werden. Wäre das geleistet worden, hätten die einzelnen Worte dieser Wendungen natürlich nicht mehr ihre alte Bedeutung. Folglich würden die Neurowissenschaftler gar nicht die neuralen Bedingungen des Denkens, Glaubens, Wahrnehmens und Erinnerns untersuchen, sondern vielmehr die von etwas anderem, das bislang nicht definiert wurde und unbestimmt ist. Das aber ist es offenkundig nicht, worauf sie aus sind. Churchland tritt der Anschuldigung, sie begehe den von uns so genannten mereologischen Fehlschluss, mit der Behauptung entgegen, dass das, „was für den einen ein Kategorienfehler ist, für den anderen eine grundlegende Theorie über die Natur des Universums darstellt“. Aus ihrer Sicht ist nicht wichtig, ob die Menschen sagen, dass Gehirne sich erinnern, sondern ob wir sagen sollten, dass sie es tun – „ob es eine überzeugende Hypothese ist, dass Gehirne sich erinnern“. Das ist jedoch verworren. Denn wenn ein Satz ‚s‘ im Idiolekt einer Person einen Kategorienfehler enthält und in dem Idiolekt einer anderen eine grundlegende Theorie zum Ausdruck bringt, dann hat ‚s‘ eine völlig andere Bedeutung in den beiden Fällen. Und ob es eine überzeugende Hypothese ist, dass Gehirne sich erinnern, kann nur ermittelt werden, wenn klar ist, was ‚das
14.1 Sprachbeharrung und Begriffsinnovation
523
Sich-Erinnern des Gehirns‘ genannt werden soll. Wenn das unbestimmt ist, dann gibt es gar keine in Betracht zu ziehende Hypothese, so wie es sich bei ‚es ist jetzt fünf Uhr auf der Sonne‘ nicht um eine Hypothese handelt. Denn über den Sinn einer Hypothese muss befunden werden, bevor ermittelt wird, ob sie wahr ist oder falsch, überzeugend oder nicht überzeugend. Wenn eine Hypothese Sinn ergibt, dann können wir uns den Tatsachen zuwenden, um herauszufinden, ob sie überzeugend ist oder nicht – wir können uns solchen Tatsachen jedoch nicht zuwenden, um herauszufinden, ob ein Satz Sinn ergibt, wie wir uns ihnen nicht zuwenden können, um herauszufinden, ob es sich bei einer mathematischen Proposition um ein Theorem handelt. Empirische Tatsachen können nicht über die Wahrheit eines mathematischen Theorems entscheiden, und Tatsachen, die das Gehirn betreffen, können auch nicht entscheiden, ob ein Wortgebilde wie beispielsweise ‚das Gehirn erinnert sich‘ Sinn ergibt. Churchlands vierter, die Veränderungen der Wortbedeutung in den neuen Theorien betreffender Einwand entkräftet Churchlands vierter Einwand lautete, dass die Wortbedeutungen sich mit dem Theoriewandel verändern können und dass dies nicht gegen die neue Theorie spricht. Das in der neuen Theorie Gesagte mag jenen seltsam anmuten, die mit dem neuen Gebrauch nicht vertraut sind, es ist aber dennoch völlig richtig (oder kann es sein). Dem stimmen wir zu. Wenn Neurowissenschaftler die Termini ‚wahrnehmen‘, ‚denken‘, ‚vorstellen‘, ‚sich erinnern‘ etc. auf kohärente Weise neu definieren würden und wenn die derart neu definierten Termini theoretische Termini innerhalb einer komplexen Theorie wären, dann könnten Fehlschlussvorwürfe hinfällig sein. Wir sollten mithin versuchen herauszufinden, was die Neurowissenschaftler mit diesen Homonymen sagen wollen, und zu begreifen, was mit der Behauptung gemeint ist, dass Gehirne wahrnehmen, denken, glauben oder sich erinnern. Um es nochmals zu sagen, die Neurowissenschaftler haben nichts neu definiert. Sie sind damit befasst, die neuralen Grundlagen unserer Fähigkeit zum Wahrnehmen, Denken, Vorstellen und Erinnern zu erklären, und bei diesen Ausdrücken haben wir es nicht mit theoretischen Termini einer avancierten Wissenschaft zu tun, sondern mit den gewöhnlichen oder gebräuchlichen Termini des Alltagsdiskurses über uns selbst. Weshalb man nicht sagen kann, Neurowissenschaftler veränderten unbewusst die Bedeutungen der Termini Man könnte argumentieren, dass die Neurowissenschaftler die Bedeutungen unseres psychologischen Wortschatzes nicht bewusst, ostentativ, verändern, sondern dass sie dabei sind, diese Termini unbeabsichtigt oder gar unbewusst neu zu definieren, indem sie deren Bedeutungen graduell und unwahrnehmbar verändern. Obgleich es keinen Sinn ergibt, vom Wahrnehmen, Denken, Vorstellen und Sich-Erinnern des Gehirns zu sprechen, wenn diese Ausdrücke ihrer alten Bedeutung verhaftet sind, sei dies gleichwohl in
524
14 Methodologische Reflexionen
dem Maße sinnvoll, in dem sie eine neue Bedeutung angenommen haben. Aber auch dieser Gedanke ist verworren. Worum es sich bei gradueller Bedeutungsveränderung handelt Erstens: Obwohl sich die Bedeutung psychologischer Ausdrücke graduell verändern kann, besteht der graduelle Wandel nicht in winzigen und nicht zu bemerkenden Bedeutungsveränderungen, die sich im Laufe der Zeit aufsummieren. Er besteht vielmehr darin, dass manche Sprecher einen bestimmten psychologischen Terminus auf eine Weise verwenden, die sich in maßgeblicher Hinsicht von der althergebrachten Verwendung unterscheidet, und dass sie das, was sie mit ihm in einem bestimmten Satz meinen, auf neue Weise erklären. Graduell ist der Anstieg der Zahl der Menschen, die sich den neuen Gebrauch aneignen, nicht die Anreicherung einer neuen Bedeutung. An der Veränderung der Bedeutung eines psychologischen Wortes ‚W‘ ist jedoch nichts ‚graduell‘, wenn es einer neuen Verwendung zugeführt wird. Wie sollte das auch möglich sein? Schließlich erlaubt die neue Verwendung syntaktische Kombinationsmöglichkeiten, die die alte als unsinnige ausgeschlossen hat – beispielsweise Verben wie ‚denken‘, ‚schließen‘, ‚vermuten‘ am Subjekt-Terminus ‚das Gehirn‘ festzumachen. Es kann allerdings keinen ‚graduellen Wandel‘ geben, der sich von der Nichtzuschreibung eines dieser Verben zum Gehirn bis zu dessen Zuschreibung zu ihm ‚erstreckt‘, so wie es keinen graduellen Wandel von der Rede von Ö1 zur Rede von Ö−1 geben kann. Zwei Quellen von Begriffsverwirrungen unter Neurowissenschaftlern: Die cartesianische Tradition und AI Zweitens: Wenn solche Veränderungen im Gange sind, dann sollte man die neue Verwendung, die sich immer mehr Neurowissenschaftler nach und nach und unbemerkt zu eigen machen, erklären können. Es muss den Neurowissenschaftlern, die den neuen Gebrauch übernehmen, möglich sein zu sagen, was sie damit meinen. Es ist jedoch keine solche graduelle Veränderung in den Neurowissenschaften im Gange. Die große Mehrheit der Neurowissenschaftler spricht und schreibt bereits so, und keiner von ihnen hat irgendwie erklärt, was mit der Zuschreibung psychologischer Attribute zum Gehirn gemeint ist. Die anerkannten Formen der kognitiven neurowissenschaftlichen Beschreibungsmodi gehen mit Begriffsverwirrungen einher. Diese speisen sich aus mindestens zwei Hauptquellen. (i) Sie beerben die cartesianische Tradition und schreiben dem Gehirn dieselben Attribute zu, die Descartes dem Geist zuschrieb. (ii) Es handelt sich bei ihnen um Ableitungen vom Computerdiskurs, in dem psychologische Prädikate (fälschlicherweise) auf Maschinen angewendet werden und die Rede von ‚Informationsverarbeitung‘ an der Tagesordnung ist.532 Die der zweiten Quelle entstammenden Ver532
Wir werden an dieser Stelle nicht die Ansicht verteidigen, dass die Anwendung von Kognitionsprädikaten auf Maschinen entweder bildlich oder abwegig ist. Für eine detaillierte Erörte-
14.2 Das Argument von der ‚Unzulänglichkeit des Englischen‘
525
wirrungen sind Teil der Hinterlassenschaft der sogenannten kognitiven (computationalistischen) Revolution, die der Psychologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Rang ablief, bedauerlicherweise, wie Jerome Bruner zugesteht.533
14.2 Das Argument von der ‚Unzulänglichkeit des Englischen‘ Blakemores Einwand gegen das mereologische Prinzip entkräftet In 3.2 erwähnten wir Colin Blakemores Hinweis, Wittgensteins Darlegung des, wie wir sagen, ‚mereologischen Prinzips‘ scheine trivial oder vielleicht auch nur einfach falsch zu sein. Blakemore behauptete, dass es sich bei den Verwirrungen, gegen die wir angeschrieben haben, um reine Metaphern handelt, die das Resultat poetischer Freiheit und der Unzulänglichkeit des Wortschatzes geschuldet sind. Aus seiner Sicht fallen die Neurowissenschaftler keinem ‚begrifflichen Schnitzer‘ der von uns dargelegten Art zum Opfer. Wir haben allerdings gezeigt, dass Blakemore sich im Kern seiner Ausführung genau den Schnitzer erlaubt bzw. zuschulden kommen lässt, den wir meinen. Denn er vertrat die Ansicht, dass die metaphorischen (oder bildlichen) ‚Karten‘ im Gehirn – das heißt die Kartierungen von Merkmalen im Gesichtsfeld gemäß dem Feuern der Kortexzellen – ‚bei der Repräsentation und Interpretation der Welt durch das Gehirn eine wesentliche Rolle spielen, genau wie die Karten eines Atlanten es für ihre Benutzer tun‘. Denn wie wir herausstellten, kann man vom Gehirn nicht einleuchtend sagen, dass es die Welt (oder irgendetwas in ihr) interpretiert, und die Beziehung zwischen dem Gehirn und den Kartierungen von Merkmalen des Gesichtsfeldes eines Lebewesens in den verschiedenen Kortexarealen ist eben genau nicht analog zu der Beziehung zwischen einem Benutzer und einem Atlanten. Die Anwendung psychologischer Prädikate auf das Gehirn vonseiten der Neurowissenschaftler kann nicht mit der Unzulänglichkeit des Englischen gerechtfertigt werden Insofern als die Neurowissenschaftler psychologische Prädikate in metaphorischer oder bildlicher Weise auf das Gehirn anzuwenden begannen, haben sie sich ganz offenkundig in ihren eigenen Metaphern verfangen. Indes behauptete Blakemore weiter, dass die vorgebliche neurowissenschaftliche Inanspruchnahme der Metaphern- und Bild-Sprache, rung siehe P. M. S. Hacker, Wittgenstein: Meaning and Mind (Blackwell, Oxford, 1990) und darin den Aufsatz ‚Men, minds and machines‘. 533 Am verblüffendsten ist, dass Bruner, einer der Initiatoren der zur Mitte des 20. Jahrhunderts in Erscheinung getretenen kognitiven Revolution, diese schließlich darum verwerfen sollte, ‚weil sie die „Sinnproduktion“ als ihr zentrales Anliegen vernachlässigte und stattdessen zugunsten von „Informationsverabeitung“ und Computerberechnung optierte‘ ( J. Bruner, Acts of Meaning (Harvard University Press, Cambridge, MA, 1990), S. 137).
526
14 Methodologische Reflexionen
der ‚dichterischen Freiheit‘ gar, daher rührt, dass den Neurowissenschaftlern keine zulängliche Sprache zur Verfügung steht, mittels derer sie auf nichtmetaphorische Weise ihre Entdeckungen artikulieren und ihren Gedanken Ausdruck verleihen könnten, die das Verhältnis zwischen Gehirn und psychologischen Attributen menschlicher Wesen betreffen. Wir werden uns nicht zu der Annahme äußern, wonach die neurowissenschaftliche Zuordnung psychologischer Attribute zum Gehirn schlichtweg ein Ausdruck dichterischer Freiheit ist. Die Behauptung aber, dass der Wortschatz des Englischen (oder gar jeder anderen entwickelten natürlichen Sprache) den neurowissenschaftlichen Intentionen nicht genügt, verdient eine Erläuterung. Der Wissenschaft, so Blakemore, ‚gehen die Worte aus‘. Einer der besonders rätselhaft anmutenden Aspekte der Wissenschaft zeigt sich darin, dass sie häufig die Alltagssprache [everyday language] verwenden muss, um die Fragen und Begriffe auszuarbeiten, die sich auf eine Welt jenseits der Alltagserfahrung beziehen. Es stimmt, dass in einigen Bereichen des intellektuellen Strebens (wie der Mathematik, Logik, Musik) neue Darstellungssysteme entstanden sind, weil die Alltagssprache sich in diesen Disziplinen als ein unzulängliches Medium für den Austausch von Fragen und Vorstellungen erwiesen hat. In den meisten Wissenschaftsbereichen begeht man jedoch den Fehler, die Alltagssprache zu benutzen, um neue Begriffe aus ihr zu schöpfen [‚bootstrap‘]. Nirgendwo ist das Sprachproblem dringlicher als in der Hirnforschung, die Schwierigkeit besteht allerdings nicht so sehr in einer grundsätzlichen Sprachverwirrung als in der Unzulänglichkeit des Wortschatzes und der Darstellungsweise.534
Es überrascht nicht sonderlich, dass man den Dingen nachforscht, die mit dem bloßen Auge nicht zu beobachten sind. Wenn es das ist, was ‚eine Welt jenseits der Alltagserfahrung‘ ausdrückt, dann sind weder solche Nachforschungen besonders rätselhaft noch die Tatsache, dass man zur Beschreibung des Entdeckten die natürliche Sprache verwendet, wenn auch manche dieser Dinge in der Tat rätselhaft sind. Es gibt keinen Grund, weshalb die Wissenschaft, indem sie diesen Dingen nachforscht, sich auf den Wortschatz der ‚Alltagsprache‘ beschränken sollte, wenn ‚Alltagssprache‘ den Wortschatz meint, der sich auf die alltägliche Erfahrung normaler menschlicher Wesen bezieht. Die Physik wurde von den Grenzen der Alltagssprache nicht im Mindesten daran gehindert, Mikro- und Makrokosmos zu erforschen – sie hat mit großem Erfolg einen reichen Fachwortschatz verfügbar gemacht. Was gleichermaßen auf die Chemie und die Biologie zutrifft. Und auf die Neurowissenschaften selbstverständlich auch. Man kann wohl kaum behaupten, dass solche Termini wie ‚parahippocampale und perirhinale Kortizes‘, ‚Gyrus dentat‘, ‚cAMP-PKA-MAPK-CREB-Pfad‘ oder ‚Vesikel-Exocytose‘ dem entnommen sind, was Blakemore ‚Alltagssprache‘ nennt, oder zur Beschreibung der Alltagserfahrung herangezogen werden. C. Blakemore, ‚Understanding images in the brain‘, in H. Barlow, C. Blakemore und M. Weston-Smith (Hg.), Images and Understanding (Cambridge University Press, Cambridge, 1990), S. 283. 534
14.3 Richtige Beschreibung der Resultate der Kommissurotomie
527
Es gibt kein ‚Sprachproblem‘ in der Hirnforschung, nur Begriffsverwirrungen Wenn man Fachterminologie benötigt, so kann man sie leicht erfinden und durch entsprechende Erklärungen einführen. Es gibt keinen wie auch immer gearteten Grund für die Annahme, dass das ‚Sprachproblem‘ in der Hirnforschung am größten ist – es spricht wahrlich nichts dafür, dass es irgendein ‚Sprachproblem‘ in der Hirnforschung gibt. Es besteht kein Grund anzunehmen, dass der Wortschatz der Neurowissenschaftler wegen der Grenzen des Englischen irgendwie unzulänglich ist – und wenn er das wäre, spräche nichts gegen die Einführung irgendwelcher neuer Termini, die benötigt werden, wodurch das Englische reicher würde. Blakemore fragt rhetorisch, „ob es wirklich eine größere Begriffsverwirrung ist, wenn Hirnforscher die Aktivitätsverteilung im visuellen Kortex eine ‚Karte‘ nennen, als wenn man einen Kniestuhl ‚einen Stuhl‘ nennt“. Selbstverständlich nicht. Eine Begriffsverwirrung ist es aber zu behaupten, dass die ‚Karte‘ „bei der Repräsentation und Interpretation der Welt durch das Gehirn eine wesentliche Rolle [spielt], genau wie die Karten eines Atlanten es für ihre Benutzer tun“ (unsere Hervorhebungen). Es ist keine Sprachverwirrung, die tiefer gelegenen Bereiche eines Berges seinen ‚Fuß‘ zu nennen – es wäre allerdings eine, wenn man losginge, um nach seinem Schuh zu suchen. Bei den Schwierigkeiten, auf die wir uns in diesem Buch konzentriert haben, handelt es sich gewiss um Begriffsverwirrungen. Zu ihrer Beseitigung braucht man indes keinen neuen Wortschatz, sondern Klarheit, was den Gebrauch des existierenden und völlig hinreichenden Wortschatzes angeht. Im nächsten Abschnitt werden wir einige Beispiele aus den Schriften von Neurowissenschaftlern anführen, die schwerwiegende begriffliche Inkohärenzen enthalten, und wir werden zeigen, dass sämtliche Entdeckungen ohne Weiteres kohärent beschrieben werden können. Das Englische ist nicht zu arm oder unzulänglich – das ist nicht das Problem, problematisch sind vielmehr die fehlerhaften Ausführungen und falschen Auffassungen, die von jenen Neurowissenschaftlern vorgebracht bzw. vertreten werden.
14.3 Vom Unsinn zum Sinn: Die richtige Beschreibung der Resultate der Kommissurotomie Die von Neurowissenschaftlern formulierten Beschreibungen Es ist in den Neurowissenschaften mittlerweile Usus, die von der Kommissurotomie herrührenden Schädigungen terminologisch auf eine Weise zu erörtern, dass jede Gehirnhemisphäre als ein mögliches Subjekt psychologischer Attribute in Erscheinung tritt. Die faszinierende Arbeit zu diesem Thema wurde größtenteils von Roger Sperry, Michael Gazzaniga und ihren jeweiligen Kollegen bewerkstelligt. Francis Crick erklärt einige der Forschungsergebnisse wie folgt:
528
14 Methodologische Reflexionen
Bei den meisten rechtshändigen Menschen kann sich nur die linke Hemisphäre mündlich oder schriftlich mitteilen. Sie beherbergt außerdem einen Großteil des Vermögens, Sprache zu verstehen, auch wenn die rechte Hemisphäre gesprochene Worte in einem beschränkteren Ausmaß verstehen kann und sich vermutlich um Betonung und Satzmelodie kümmert. Wenn das Callosum durchtrennt ist, sieht die linke Hemisphäre nur die rechte Hälfte des Gesichtsfeldes und die rechte die linke. Jede Hand wird hauptsächlich von der gegenüberliegenden Hemisphäre gesteuert, obwohl die andere Gehirnhälfte ein paar weniger differenzierte Handund Armbewegungen auszulösen vermag. Beide Hemisphären können, von besonderen Umständen abgesehen, hören, was gesagt wird. [. . .] Man bittet den Patienten, seinen Blick fest auf einen Bildschirm zu richten, auf dem ein Bild auf der einen oder der anderen Seite seines Blickfixationspunkts erscheint. Damit ist sichergestellt, dass die visuelle Information nur die eine der beiden Hemisphären erreicht [. . .] Wenn der linken (sprechenden) Hemisphäre des Patienten ein Bild dargeboten wird, dann kann er es beschreiben wie ein normal veranlagter Mensch. Diese Fähigkeit ist nicht auf das Sprechen beschränkt. Der Patient kann auf eine Bitte hin mit seiner rechten (weitgehend von seiner linken Hemisphäre gesteuerten) Hand auf Objekte hindeuten, ohne dabei zu sprechen. Seine rechte Hand kann auch durch Tasten Objekte identifizieren, selbst wenn der Patient sie nicht sehen kann. Wird jedoch der rechten (nichtsprechenden) Hemisphäre ein Bild dargeboten, kommen ganz andere Ergebnisse zustande. Die linke Hand, die weitgehend von der rechten, nichtsprechenden Hemisphäre gesteuert wird, kann zwar – wie zuvor die rechte Hand auch – auf Objekte hindeuten und sie durch Tasten identifizieren, auch wenn sie nicht gesehen werden. Aber wenn man den Patienten fragt, weshalb sich seine linke Hand in dieser besonderen Weise verhält, dann wird er Erklärungen erfinden, die darauf beruhen, was seine linke (sprechende) Hemisphäre gesehen hat, und nicht darauf, was seine rechte Hemisphäre wusste. Der Experimentator kann erkennen, dass diese Erklärungen falsch sind, weil er ja weiß, was der nichtsprechenden Hemisphäre in Wirklichkeit dargeboten worden war, um das Verhalten hervorzurufen. Das ist ein gutes Beispiel für sogenanntes ‚Konfabulieren‘. Kurz gesagt, die eine Hälfte des Gehirns scheint fast gar nicht zu wissen, was die andere Hälfte gesehen hat.535
Laut Cricks Beschreibung kann sich die linke Hemisphäre des Gehirns mündlich oder schriftlich mitteilen; nach der Durchtrennung des Callosums kann sie nur die rechte Seite des Gesichtsfeldes sehen. Sie kann hören, was gesagt wird. Sie kann etwas lernen, wissen oder nicht wissen. Die rechte Hemisphäre kann Worte nur in einem beschränkten Ausmaß verstehen. Nach der Durchtrennung des Callosums kann sie nur die linke Seite des Gesichtsfeldes sehen. Sie kann hören, was gesagt wird, und sie kann etwas lernen, wissen oder nicht wissen. Bei einem normal ausgestatteten Menschen „kann das detaillierte visuelle Bewusstsein in der rechten Hemisphäre ohne Weiteres der linken übermittelt werden, sodass er es sprachlich beschreiben kann. Wenn das Corpus callo535
F. Crick, The Astonishing Hypothesis (Touchstone, London, 1995), S. 169f. [dt. Was die Seele wirklich ist (Artemis & Winkler, München & Zürich, 1994), S. 213f.].
14.3 Richtige Beschreibung der Resultate der Kommissurotomie
529
sum vollständig durchtrennt ist, kann diese Information nicht zur sprechenden Hemisphäre hinübergelangen.“536 Die fehlerhafte Beschreibung der Kommissurotomie ist nicht auf populärwissenschaftliche Abhandlungen beschränkt Man könnte denken, dass die fehlerhafte Beschreibung des Phänomens sich auf populärwissenschaftliche Abhandlungen beschränkt, die ein Laienpublikum erreichen sollen, das die fachspezifischeren Fragen, die von Neurowissenschaftlern ohne Weiteres verstanden werden, nicht verstehen kann. So ist es jedoch nicht. Roger Sperry, der die Forschung zu Split-Brain-Patienten auf den Weg brachte und die Standardtests zur Bestimmung der hemisphärenbezogenen Funktionenverteilung entwickelte, behauptete von der rechten (nichtdominanten) Hemisphäre, es handele sich bei ihr um „ein eigenständiges bewusstes System, das wahrnimmt, denkt, sich erinnert, folgert, will, Emotionen hat, und das auf einer charakteristisch menschlichen Ebene. Und sowohl die linke als auch die rechte Hemisphäre können in unterschiedlichen, sogar in einander widersprechenden geistigen Erfahrungen, die sich parallel vollziehen, zugleich bei Bewusstsein sein“.537 George Wolford, Michael Miller und Michael Gazzaniga hängen den nämlichen Falschdarstellungen an, entsprechend schreiben sie im Journal of Neuroscience: Gazzaniga und Metcalfe et al. haben hypothetisch die Existenz eines Interpreten behauptet, dessen Funktion in dem Versuch besteht, die Information, mit der er sich konfrontiert findet, zu verstehen, mit anderen Worten, Kausalhypothesen zu bilden. In der Auseinandersetzung mit Split-Brain-Patienten konnte Gazzaniga (1995)538 den Nachweis erbringen, dass dieser In536
Ibid., S. 171 [dt. S. 217]. Roger Sperry, ‚Lateral specialization in the surgically separated hemispheres‘, in F. O. Schmitt und F. G. Worden (Hg.), The Neurosciences Third Study Programme (MIT Press, Cambridge, MA, 1974), S. 11. 538 Gemeint ist hier: Michael Gazzaniga, ‚Principles of human brain organization derived from split-brain studies‘, Neuron, 14 (1995), S. 217–228. Auch darin läuft der mereologische Fehlschluss in den Neurowissenschaften Amok. ‚Rechte Hemisphären‘, schreibt Gazzaniga, ‚die Sprachfähigkeiten offenbaren, können Grammatikalitätsurteile bilden. Sie können folglich erkennen – obgleich sie nicht in der Lage sind, Syntax zur Unterscheidung von Reizen oder zur Bildung von Verstehensurteilen zu verwenden –, dass eine Reihe von Äußerungen den Regeln der Grammatik folgt, eine andere wiederum nicht‘ (S. 225). Und auch hier ist es so, dass ‚das linke Gehirn, die Reaktion der linken Hand beobachtend, diese im Rahmen dessen interpretiert, was es weiß/ kennt [. . .] Die linke Hemisphäre [. . .] mit ihrem Schlussfolgerungs- und Interpretationsvermögen war stärker von Handlungserwartungen beeinflusst, die für gewöhnlich mit einer Szenerie verbunden werden, und ordnete Bilder fälschlicherweise der beobachteten Szenerie zu [. . .] Sie verfügt ebenso über ein einzigartig menschliches Vermögen, nämlich Verhalten zu interpretieren und Theorien über die Beziehungen zwischen wahrgenommenen Ereignissen und Gefühlen zu 537
530
14 Methodologische Reflexionen
terpret bei den meisten Individuen in der linken Hemisphäre angesiedelt ist. Der simultane Begriffstest exemplifiziert die Funktion des Interpreten. Im Rahmen dieses Tests werden einem Split-Brain-Patienten zwei Bilder gezeigt, und zwar eines exklusiv der linken Hemisphäre (z. B. das eines Huhnes) und ein anderes Bild exklusiv der rechten (z. B. ein Schneemotiv). Im Anschluss wird dem Patienten ein Bilderspektrum dargeboten und er wird gebeten, auf ein mit den präsentierten Bildern verknüpftes Bild hinzudeuten. In dem obigen Beispiel wählte die linke Hemisphäre eine Hühnerkralle und die rechte eine Schaufel. Als er darum gebeten wurde, seine Entscheidungen zu erklären, erwiderte der Patient ‚Oh, das ist leicht. Die Hühnerkralle passt zum Huhn, und man benötigt eine Schaufel, um den Hühnerstall auszumisten.‘ Die rechte Hemisphäre ist zur Sprachproduktion nicht fähig, sie kann ihre Wahl also nicht erklären. Die linke Hemisphäre kennt die Bilder nicht, auf die die rechte reagiert (z. B. das des Schneemotivs), sie muss also ihre eigene Interpretation hervorbringen, weshalb die linke Hand auf eine Schaufel hindeutete. Die Aktionen von linker Hand und rechtem Gehirn beobachtend, interpretiert die linke Hemisphäre diese im Rahmen dessen, was sie weiß/ kennt (d. h. eine Hühnerkralle) und bringt eine Erklärung für die Schaufel hervor, die im Einklang mit ihrem Wissen steht.539
Man könnte dafürhalten, dass die in dieser Darlegung enthaltenen Begriffsirrtümer wohl nur den Leserlaien verwirren werden, dass die Neurowissenschaftler sich absolut im Klaren darüber sind, was sie meinen, auch wenn sie sich wegen der ‚Unzulänglichkeit‘ des Englischen nicht besonders gut ausdrücken. Dass dem so ist, kommt uns jedoch allein aufgrund textimmanenter Anzeichen äußerst unwahrscheinlich vor. Aber selbst wenn Sperry, Gazzaniga, Crick und ihre Kollegen nicht verwirrt sind, ist es sicherlich so, dass sie andere Neurowissenschaftler außerordentlich verwirren. So schreibt Robert Doty, um nur ein Beispiel zu nennen, auf das wir uns schon bezogen haben (3.10), im Brain Research Bulletin: Angeleitet von der Genialität Sperrys hat die Forschung zu diesen Patienten die Art, den Geist als Gehirnprodukt aufzufassen, für immer verändert; ja, zwei Gehirne, die zwei Hemisphären, jede zu menschlichem Denken und Fühlen befähigt, separierbar, im Normalfall jedoch verblüffenderweise miteinander verflochten durch das dichte Geflecht kallosaler Fasern, die die Unterhändler des Zusammenspiels der Hälften sind. Die Hemisphärektomie liefert die Bestätigung für die menschliche Verfasstheit beider. [. . .] Die Anerkennung der Tatsache, dass die beiden menschlichen Hemisphären potenziell zwei separierbare Geistesentitäten sind, wird sich in den kommenden Jahrhunderten auf allen gesellschaftlichen Ebenen auswirken und zur Neubestimmung der Natur des Menschseins und des Zusammenhangs zwischen Menschsein und Natur führen.540
entwerfen‘ (S. 225ff.). Es ist offensichtlich, dass die Autoren weder hier noch in den obigen Zitaten eine bloße Façon de parler zur Anwendung bringen. 539 George Wolford, Michael B. Miller und Michael Gazzaniga, ‚The left hemisphere’s role in hypothesis formation‘, Journal of Neuroscience, 20 (2000), RC 64 (1–4), S. 2. 540 R. W. Doty, ‚Two brains, one person‘, Brain Research Bulletin, 50 (1999), S. 423.
14.3 Richtige Beschreibung der Resultate der Kommissurotomie
531
Es dürfte klar sein, dass die Gehirnhemisphären weder sehen noch hören können. Sie können nicht sprechen oder schreiben, geschweige denn irgendetwas interpretieren oder aus Information Schlüsse ziehen. Man kann von ihnen nicht sagen, dass sie sich entweder irgendetwas bewusst oder nicht bewusst sind; man kann von ihnen nicht einleuchtend sagen, dass sie irgendetwas erkennen oder nicht erkennen. Sie fällen keine Entscheidungen oder Grammatikalitätsurteile, und weder wissen sie etwas, noch wissen sie nichts. Sie sind selbstverständlich weder ‚Geistesentitäten‘ noch menschlich verfasst. Und rein gar nichts spricht dafür, sich derart verworren zu äußern. Die von den Kommissurotomien abgeleiteten Feststellungen richtig charakterisiert Bei dem, was mit Hilfe der Experimente an Split-Brain-Patienten festgestellt wurde, handelt es sich um eine sehr merkwürdige Dissoziation von Funktionen, die normalerweise aufs Engste miteinander verwoben sind, und um eine daraus resultierende und mit Konfabulationen einhergehende Verwirrung, die sich hauptsächlich (aber nicht exklusiv) unter Experimentierbedingungen offenbaren, wenn der visuelle Reiz der Kontrolle durch den Experimentator unterliegt. Wenn ein Patient seinen Blick fest auf einen Bildschirm richtet und ein Bild links vom Blickfixationspunkt erscheint, sodass der Lichtreiz nur seine rechte Hemisphäre affiziert, dann kann der Patient, infolge der Kommissurotomie und anders als eine Normalperson, nicht sagen, was ihm auf diese Weise visuell dargeboten wird. Er kann jedoch mit seiner linken Hand auf Objekte hindeuten, die den Bildern auf dem Schirm entsprechen. Wenn der Patient im Anschluss gefragt wird, weshalb er mit seiner linken Hand auf ein bestimmtes Objekt hindeutete, wird er allerdings eine Rationalisierungsversion anbieten, die sich auf das rechtsseitige Objekt bezieht, obgleich sinnfällig ist, dass er auf jenes aufgrund dessen hindeutete, was ihm auf der linken Bildschirmseite visuell dargeboten wurde. Dennoch macht keines dieser Phänomene die Verletzung des mereologischen Prinzips erforderlich. Der – richtig beschriebene – simultane Begriffstest geht nicht mit der Notwendigkeit einher, das Phänomen im Sinne einer Spracherzeugungsunfähigkeit der rechten Hemisphäre zu erklären und ihres daraus resultierenden Unvermögens, die eigene Wahl verständlich zu machen, und seine korrekte Darstellung ist auch nicht notwendig mit der Annahme verknüpft, die linke Hemisphäre kenne das Bild nicht, auf das die rechte reagiert, und bringe also ihre eigene Interpretation hervor, weshalb die linke Hand auf die Schaufel hindeutete. Wie sollten die Zusammenhänge dann beschrieben werden? Die Dissoziation von Funktionen folgt auf die Kommissurotomie Einem Patienten wird ein Bild eines Huhns gezeigt, das per Lichtreflexion nur dessen linke Hemisphäre affiziert, und ein Schneebild, das per Lichtreflexion nur dessen rechte Hemisphäre affiziert. Er wird gebeten, mit seiner rechten Hand auf ein Bild hinzudeuten, das dem entspricht, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, und er zeigt auf eine Hüh-
532
14 Methodologische Reflexionen
nerkralle. Bittet man ihn jedoch, mit seiner linken Hand auf etwas hinzudeuten, zeigt er auf eine Schaufel. Auf die Frage, weshalb er diese beiden Objekte mit dem assozierte, was auf dem Schirm zu sehen ist, antwortet er, dass die Kralle zum Huhn gehört und die Schaufel zum Ausmisten des Hühnerstalls benötigt wird, offenbar ohne auch nur ansatzweise zu bemerken, dass sich in seinem Gesichtsfeld auch ein Schneebild befand und dass er de facto dieses mit der Schaufel in Verbindung brachte. Diese funktionale Dissoziation und das damit verbundene Konfabulieren werden anhand der Tatsache erklärt, dass der vom Schneebild ausgehende Lichtreiz die rechte Hemisphäre affizierte, deren Abtrennung von der linken den Patienten der Fähigkeit beraubte, das zu beschreiben oder sich dessen visuell bewusst zu sein, was ihm auf der linken Seite seines Gesichtsfeldes dargeboten wurde, obgleich er dieses (das Schneebild nämlich) bemerkenswerterweise richtig mit einer Schaufel in Verbindung bringen konnte, indem er auf sie hindeutete. Dennoch wusste er nicht, weshalb er diese Verbindung herstellte (ohne Kenntnis von dem ihm dargebotenen Schneebild), und reimte sich eine Geschichte zusammen (konfabulierte), um zu erklären, weshalb er das getan hatte (etwas Vergleichbares geschieht in den Fällen, da Subjekte ihr an sie herangetragenes Hypnoseverhalten nachträglich mit einer Geschichte bzw. konfabulierend zu erklären suchen). Das wiederum wird (plump) mit der Tatsache erklärt, dass die visuelle Reizung der rechten Hemisphäre abgekoppelt von der linken stattfindet, sodass der Patient seiner normalen kognitiven Fähigkeit beraubt ist, sich des ihm Dargebotenen visuell bewusst zu sein und ihm auf diese Weise präsentierte vertraute Objekte zu erkennen und zu beschreiben. Erhalten bleibt ihm indes die Fähigkeit, das ihm visuell auf dem Bildschirm Dargebotene mit einem entsprechenden Objekt (einer Schaufel nämlich) in Verbindung zu bringen – jedoch ohne zu wissen, weshalb er das tut.541 Gehirnhemisphären sind nicht die Träger psychologischer Attribute Keine der Hemisphären trifft irgendeine Wahl – es ist der Mensch, der etwas auswählt. Keine der beiden Hemisphären ist sich entweder einer Sache bewusst oder nicht bewusst; noch weiß bzw. kennt eine der beiden irgendetwas – nur von Lebewesen kann man sagen, dass sie etwas wissen oder sich etwas bewusst sind, und Gehirne sind keine Lebewesen. Also bringt auch keine der beiden Interpretationen von irgendetwas hervor oder erklärt irgendetwas. Menschen interpretieren oder erklären etwas. Es ergibt keinen Sinn, davon zu sprechen, dass die rechte Hemisphäre beobachtet, was die linke Hand 541
Anzumerken ist, dass die beiden normalerweise gleichrangigen Kriterien, die Gründe liefern für die Äußerung, eine Person sehe etwas, nämlich: was sie sagt, und was sie tut, hier miteinander in Konflikt stehen. Man kann also weder sagen, sie habe das Schneebild gesehen, noch, sie habe es nicht gesehen. Hier zeigt sich eine auffallende Ähnlichkeit mit den Fällen des sogenannten Blindsehens (siehe J. Hyman, ‚Visual experience and blindsight‘, in J. Hyman, Investigating Psychology: Sciences of the Mind after Wittgenstein (Routledge, London, 1991), S. 166–200). Siehe 14.3.1 unten.
14.3 Richtige Beschreibung der Resultate der Kommissurotomie
533
tut, denn keine der Hemisphären kann überhaupt irgendetwas beobachten oder versäumen, das zu tun – denn Gehirnhemisphären sind keine Beobachter, sie sind nicht in der Lage, Dinge zu mustern, zu betrachten oder anzublicken, ihre Augen ans Schlüsselloch zu heften, die Brille aufzusetzen oder ein Fernglas zu benutzen, um besser zu sehen. Sie können ganz bestimmt nicht die Aktionen/Handlungen der linken Hand beobachten, denn die linke Hand führt keine durch. Die linke Hand kann sich bewegen oder kann bewegt werden, aber nur die Person, zu der die Hand gehört, führt Handlungen durch bzw. handelt. Die Erklärung der merkwürdigen Dissoziation von Funktionen, die normalerweise aufs Engste miteinander verwoben sind, besteht nicht darin, dass die eine Hemisphäre nicht sehen kann, was die andere sieht; und auch nicht darin, dass eine Hemisphäre nicht weiß, was die andere weiß, denn keine der Hemisphären sieht oder weiß irgendetwas. Und die Erklärung besteht auch nicht darin, dass es einer Hemisphäre möglich ist, beobachtete Handlungen zu interpretieren, und dass die andere kein Interpretationsvermögen aufweist. Wie von den Entdeckungen Sperrys, Gazzanigas und ihrer Kollegen her evident ist, besteht die allgemeine Form der Erklärung vielmehr darin, dass die Durchtrennung des Corpus callosum die Menschen der Fähigkeit beraubt, normalerweise aufeinander abgestimmte Funktionen zu entfalten. Und das wiederum ist mit der Trennung von Nervenverbänden zu erklären, die kausal in die Entfaltung der entsprechenden Fähigkeiten eingebunden sind. Es ist natürlich nicht so, dass das visuelle Bewusstsein nicht zur linken Hemisphäre übertragen werden kann, um von der Person mit Worten beschrieben zu werden – denn beim ‚visuellen Bewusstsein‘ handelt es sich nicht um etwas, das man in einer Hemisphäre auffinden, geschweige denn zu einer anderen übertragen kann. Und es ist auch nicht der Fall, dass „die Information nicht zur sprechenden Hemisphäre hinübergelangen kann“, denn es gibt keine Information in einer Gehirnhemisphäre (noch nicht einmal in dem schwachen Sinne, in dem man davon sprechen könnte, dass sich in einem Telefonkabel Information befindet, während jemand spricht), und Information könnte in keiner Weise von einer Hemisphäre auf die andere überwechseln (das Corpus callosum ist kein Telefonkabel, und die Hemisphären sind, bei allem Respekt für Doty, keine Sprecher). Vielmehr wurde durch die Kommissurotomie die Übertragung neuraler Signale über das Corpus callosum – die eine notwendige Bedingung dafür ist, dass die Person das ihr visuell Dargebotene kennen/wissen und mitteilen kann – verhindert. Diese ist nichtsdestotrotz noch immer in der Lage, auf das ihr visuell Dargebotene zu reagieren, indem sie auf entsprechende Objekte hindeutet, auch wenn sie nicht weiß, weshalb sie das tut, und sich eine Geschichte zusammenreimt, um es zu erklären. Kurz gesagt kann man alle auf das Konto von Sperry und Gazzaniga und ihren Kollegen gehenden Entdeckungen beschreiben, ohne gegen das mereologische Prinzip zu verstoßen und ohne auf die metaphorische oder bildliche Sprache zurückzugreifen, von dichterischer Freiheit gar nicht zu reden. Es gibt keinen Grund, dem Englischen vorzuwerfen, dass es zur Beschreibung der Phänomene nicht hinreicht.
534
14 Methodologische Reflexionen
14.3.1 Der Fall des Blindsehens: Falschdarstellungen und Scheinerklärungen Das Phänomen des Blindsehens hat die Aufmerksamkeit kognitiver Neurowissenschaftler und Psychologen auf sich gezogen. Lawrence Weiskrantz prägte den Namen für die eigentümlichen Fähigkeiten eines Subjekts, dessen rechter Okzipitallappen chirurgisch entfernt worden war. Mit Hilfe gewöhnlicher klinischer Tests fand man heraus, dass es fast in der gesamten linken Hälfte seines Gesichtsfeldes nichts sehen konnte. Gebeten, den Blick fest auf die Mitte einer Hälfte zu richten, in der kleine Lichtpunkte aufleuchteten, versicherte die Person, dass sie innerhalb des Skotoms (der blinde Bereich im Gesichtsfeld) nichts sehen könne. Als sie mit Signalen im Skotom konfrontiert wurde und sagen sollte, ob sie diese erkennen könne, landete sie in 90% der Fälle einen Treffer. Anschließende Untersuchungen zeigten, dass manche Blindsehenspatienten unter ähnlichen Bedingungen Linienverläufe, einfache Muster und Anfang oder Ende einer Bewegung unterscheiden konnten. Die Patienten dachten, sie würden bloß Mutmaßungen anstellen, und waren überrascht zu erfahren, dass sie die Treffer landen konnten, trotzdem sie sich keines einzigen Skotomsignals bewusst waren. Einerseits hatte es den Anschein, dass die Patienten innerhalb eines Teils ihres Gesichtsfeldes offenbar blind waren, und andererseits, dass sie darin offenbar etwas sehen konnten (obgleich sie das nicht wussten). Daher der paradoxe Name ‚Blindsehen‘.542 Das Phänomen, von Weiskrantz erschöpfend erforscht, schien tief im Verborgenen liegende Merkmale unserer visuellen Fähigkeiten und der ‚bewussten Erfahrung‘ zutage zu bringen. Denn hier lag ein Fall vor, bei dem man, wie es schien, von einer Dissoziation von Funktionsstörungen viel lernen konnte: nämlich zwischen der visuellen Unterscheidung und der ‚Bezugnahme‘ des Subjekts auf seine Unterscheidung. Im einfachsten Menschen-Fall besteht die ‚Bezugnahme‘ darin zu sagen, ob man irgendetwas sehen kann. Weil jedoch Blindsehen auch unter sprachunbegabten Tieren aufzutreten schien, wird der Begriff der Bezugnahme weiter gefasst und mit Überwachung [monitoring] gleichgesetzt (siehe unten). Was verrät uns das Blindsehen, und wie soll es erklärt werden? Weiskrantz war der Ansicht, dass es eine Unterscheidung bestätigt, die von Luciani vor mehr als 100 Jahren unter Berücksichtigung der Resultate experimenteller Extirpation des visuellen Kortex bei Affen getroffen wurde. Luciani behauptete, dass diese Affen der ‚visuellen Wahrnehmung‘ beraubt wurden, die ‚visuelle Empfindung‘ jedoch bewahrten.543 Das, schrieb Die folgende Erörterung ist maßgeblich beeinflusst von Hyman, ‚Visual experience and blindsight‘. 543 L. Luciani, ‚On the sensorical localisations in the cortex cerebri‘, Brain, 7 (1884), S. 145–160. Anders als Weiskrantz brachte Luciani die visuellen Empfindungen mit dem schlechthinnigen Sehen in Verbindung, und visuelle Wahrnehmungen ordnete er nicht der Überwachung der auftretenden visuellen Empfindungen zu, sondern dem Wahrnehmungsurteil. Aus seiner Sicht gewinnen die Affen nach der Extirpation ihr Sehvermögen wieder, lassen jedoch Unterscheidungsund Urteilsvermögen vermissen. 542
14.3 Richtige Beschreibung der Resultate der Kommissurotomie
535
Weiskrantz, „muss stimmen“.544 Die Entdeckung des Blindsehens bei Menschen schien zu belegen, dass Lucianis Unterscheidung „zwischen geistiger und sensorischer Verarbeitung“ entgegen der herrschenden Meinung auch auf Menschen zutraf. Weiskrantz argumentierte, Blindsehen erkläre sich damit, dass das normal ausgeprägte Sehvermögen sowohl die Reaktion auf visuelle Reize als auch die ‚Überwachung‘ des sensorischen Prozesses oder die ‚Kenntnis‘ von ihm einbegreift. Die Überwachung, behauptete er, ist „eine Form des privilegierten Zugangs“,545 eine Kenntnis von privaten visuellen Empfindungen. Und ihr Resultat ist die visuelle Wahrnehmung – bei der es sich um eine Form der ‚bewussten Erfahrung‘ handelt. Das Überwachungssystem „konstituiert das Bewusstsein“ und bringt die ‚bewusste Erfahrung‘ hervor.546 Im Falle des Blindsehens hat der Patient visuelle Empfindungen, weil jedoch das Überwachungssystem abgetrennt ist, hat er keine visuellen Wahrnehmungen oder bewusste visuelle Erfahrungen. Das schien zu belegen, dass es ein solches Überwachungssystem ist, was den Normalsichtigen befähigt, ‚bewusst‘ zu sehen, oder allgemein gesagt, sich irgendeiner Erfahrung bewusst zu sein, um welche es sich dabei auch immer handeln mag. Akribische experimentelle Arbeit ist etwas Beeindruckendes. Der von Weiskrantz zur Phänomenbeschreibung beanspruchte Begriffsapparat ist jedoch mangelhaft. Mithin sind die gewagte Erklärung und die gezogenen Schlüsse aus rein begrifflichen Gründen fragwürdig. Wie im Falle der Kommissurotomie kann man die Phänomene beschreiben, ohne begrifflichen Konfusionen anheimzufallen. Wie aus unserer Erörterung von Empfindung und Wahrnehmung (4.1 und 4.2) hervorgegangen sein sollte, ist Lucianis Unterscheidung zwischen visueller Empfindung und visueller Wahrnehmung inkohärent. Es gibt nichts dergleichen wie eine visuelle Empfindung (bis auf eine in den Augen gefühlte Blendungs-Empfindung vielleicht, die das Sehen eher unterbricht als hervorbringt). Denn Empfindungen werden gefühlt, nicht gesehen; so etwas wie eine nicht gefühlte Empfindung gibt es nicht; Empfindungen sind im Körper verortet, weisen Intensitätsgrade auf und haben phänomenale Qualitäten. Es ergibt jedoch keinen Sinn zu fragen, wo eine Person eine visuelle Empfindung von einem roten Apfel habe oder wie sie sich anfühle. Die von blindsichtigen Patienten bewahrte Fähigkeit kann folglich nicht beschrieben werden, indem man sagt, sie hätten visuelle Empfindungen, allerdings keine visuellen Wahrnehmungen.547 L. Weiskrantz, ‚Varieties of residual experience‘, Quarterly Journal of Experimental Psychology, 32 (1980), S. 369. 545 L. Weiskrantz, Blindsight (Oxford University Press, Oxford, 1986), S. 169. 546 L. Weiskrantz, ‚Neuropsychology and the nature of consciousness‘, in C. Blakmore und S. Greenfield (Hg.), Mindwaves (Blackwell, Oxford, 1987), S. 317. 547 Wie Hyman bemerkte (‚Visual experience and blindsight‘, S. 191), bestanden Lucianis Gründe dafür, Affen eine mangelhafte visuelle Wahrnehmung zu attestieren, zudem in deren agnosischem Verhalten und hatten nichts mit irgendeiner Dissoziation von Unterscheidungsfähigkeit und sogenanntem Sehbewusstsein zu tun. 544
536
14 Methodologische Reflexionen
Die Vorstellung von einem ‚Überwachungssytem‘ variiert die Konzeption der als eine Fähigkeit eines ‚inneren Sinns‘ aufgefassten Introspektion – als eine Form innerer Wahrnehmung oder Erfassung von privaten Objekten, zu denen das Subjekt ‚privilegierten Zugang‘ hat und derer es sich ‚unmittelbar bewusst‘ ist. Wie wir argumentiert haben, ist diese Konzeption inkohärent (3.6–3.7). Die Introspektion ist eine Fähigkeit zum Nachdenken über sich selbst, die eigene Geschichte und die eigenen Erfahrungen, Einstellungen und Motive und keine zum Wahrnehmen von Ereignissen auf einem Privatschauplatz. Das Sehen (‚die visuelle Erfahrung‘) ist kein nur dem Subjekt zugängliches Privatereignis, und wer sagt, er sehe, berichtet nicht von einer Privaterfahrung. Die Funktion von ‚ich kann . . . sehen‘ ist es, eine Mitteilung über öffentlich sichtbare Dinge vorzubringen, die das Subjekt unterscheidet, oder eine solche Mitteilung zu rechtfertigen, indem die ausgeübte kognitive Fähigkeit angeführt wird, oder nach Maßgabe von Klarheit und Deutlichkeit vom Wahrgenommenen zu berichten. Weiskrantz denkt ein Überwachungssystem mitunter als (i) ein psychisches Phänomen des Bewusstseins von einem Privatprozess, von dem er annimmt, dass es sich bei ihm um eine Bedingung der Möglichkeit handelt, sich auf die eigene visuelle Erfahrung zu beziehen, und mitunter als (ii) ein neurales Programm zur Überwachung eines neuralen Prozesses, dessen Abtrennung Blindsehen erklären könnte. Einerseits wird das Überwachungssystem so aufgefasst, als konstituiere es das transitive Bewusstsein von einer visuellen Empfindung (und die subjektive Erfahrung), und seine Abtrennung sei das für das Blindsehen charakteristische klinische Dissoziationssyndrom. Andererseits ist die Überwachung „kein Glied der durchlaufenden Informationsverarbeitungskette selbst“; sie richtet sich vielmehr auf das, „was geschieht“ – womit „die Art neuraler Organisation [gefunden ist], nach der wir suchen, um das Bewusstsein zu erklären“.548 Man nimmt jedoch nur aus einem einzigen Grund an, dass eine solche Organisationsform existiert, und zwar weil es sich bei ihr um ein neurales Korrelat (einen neuralen Abtastmechanismus) zu handeln scheint, homolog zur inkohärenten Konzeption der Introspektion (als einer psychischen Abtastleistung). Verantwortlich für das verwirrende Durcheinander sind die irrigen Annahmen, dass Erfahrung privat ist, dass das Subjekt dem Experimentator verbal von ihr Bericht erstatten kann kraft seines privilegierten Zugangs zu ihr, wobei dieser als eine psychische Fähigkeit begriffen wird, auf der alle ‚bewusste Erfahrung‘ beruht. Hat man sich dieser Annahmen entledigt, muss man sich auch von der Beschreibung der Blindsehenspatienten als Menschen verabschieden, die sensorische Erfahrungen haben von sichtbaren Objekten innerhalb des Skotoms, aber nicht wahrnehmen können, dass es sich so verhält. Und darum müssen wir auch die Auffassung als unbegründet zurückweisen, beim Blindsehensphänomen handele es sich um die Abspaltung eines neuralen Überwachungsprogramms, dessen normale Abtastleistung Tiere in die Lage versetzt, sich ihrer Erfahrungen bewusst zu sein und visuell wahrzunehmen als auch visuelle Empfindungen zu 548
Weiskrantz, ‚Neuropsychology and the nature of consciousness‘, S. 316.
14.4 Philosophie und Neurowissenschaften
537
haben. Das ‚neurale Überwachungsprogramm‘ ist nichts weiter als eine der Fantasie entsprungene Hilfskonstruktion, die entworfen wurde, um das Paradox des Blindsehens wegzuerklären. Wie jedoch Hyman argumentierte, sind niemals die Phänomene paradox, sondern ihre Beschreibung. Der blindsichtige Patient benimmt sich nicht auf absurde oder widersprüchliche Weise. Indem wir sein Verhalten beschreiben, nehmen wir jedoch Zuflucht zu paradoxen Beschreibungen wie ‚Blindsehen‘ oder ‚unbewusstes Bewusstsein‘ [‚unconscious awareness‘]. Aus Hymans Sicht neigen wir aus dem Grund zu solchen paradoxen Formulierungen, weil wir nach Antworten auf die Frage suchen, ob der Blindsichtige innerhalb des Skotoms Elemente sehen kann oder nicht. Aber genau diese Frage lässt sich nicht beantworten. Denn die übliche Konvergenz der ‚Seh-Indizien‘ – nämlich: angemessene affektive Rückmeldung, Verhaltensreaktion, neu abgestimmte Bewegung, verbale Beschreibung, Antworten auf entsprechende Fragen etc. – ist auf subtile Weise aufgelöst. Solche Konvergenzen konstituieren jedoch den Rahmen, in dem Sehensverben gelehrt und gebraucht werden und in dem ihr Gebrauch infrage gestellt und bestätigt oder abgelehnt wird. Sie konstituieren einen Teil der Hintergrundvoraussetzungen für die Verwendung und Verwendbarkeit dieser Ausdrücke. Die Auflösung dieses Zusammentreffens ist für das Blindsehen typisch und bringt die nämlichen paradoxen Beschreibungen mit sich. Denn unter den ganz besonderen Experimentierbedingungen (der Blindsichtige kann bei normaler Augenbewegung hinreichend gut sehen) sind manche Kriterien für das Sehen erfüllt (Treffer bei den Entscheidungsurteilen, ob man etwas sehe oder nicht) und manche Kriterien dafür, dass kein Sehen statthat (die Versicherung des Patienten, er könne nichts sehen). Infolge dieses Kriterienkonflikts kann man weder sagen, dass der Patient Objekte innerhalb seines Skotoms sieht, noch, dass er es nicht tut. Das ist nicht paradox – es lässt bloß erkennen, dass ein Begriff in einem besonderen Fall nicht angewendet werden kann bzw. nicht zutrifft. Die Beschreibung des Phänomens bereitet keinerlei Schwierigkeiten. Es ist jedoch nicht gestattet, auf Lucianis Unterscheidung zwischen visueller Empfindung und visueller Wahrnehmung zurückzugreifen oder zu versuchen, eine begriffliche Singularität zu erklären, indem man einen neuralen Überwachungsmechanismus postuliert, in Entsprechung zu einer abwegigen Konzeption von Introspektion und privilegiertem Zugang.
14.4 Philosophie und Neurowissenschaften Unklarheiten über das Verhältnis zwischen den Neurowissenschaften und der Philosophie Vielen Neurowissenschaftlern ist nicht klar, in welcher Beziehung die kognitiven Neurowissenschaften und die Philosophie zueinander stehen. Sie geißeln die Philosophie ihrer angeblichen Fehler wegen und sind sich offenbar nicht im Klaren darüber, dass es sich bei ihrem Denkrahmen, innerhalb dessen sie arbeiten und den sie triumphal proklamie-
538
14 Methodologische Reflexionen
ren, zu großen Teilen um das (fragwürdige) Vermächtnis der Metaphysik des 17. Jahrhunderts handelt. Wie wir gesehen haben, nehmen manche von ihnen auf einen führenden Philosophen – William James nämlich – als eine Autorität Bezug, scheinen aber die gravierenden Mängel, die das James’sche Werk aufweist, nicht zu bemerken. Einerseits wissen die Neurowissenschaftler darum, dass die Probleme, um deren Lösung sie sich bemühen, mit Reflexionen zur Natur des Geistes und geistiger Phänomene im Zusammenhang stehen, die vonseiten der Philosophen angestellt wurden. Andererseits sind sie ungehalten, dass die Philosophie über die Funktionsweise des Gehirns nichts herausgefunden hat. Den berechtigten Stolz auf die bemerkenswerten neurowissenschaftlichen Leistungen der letzten hundert Jahre verbinden sie mit der Zuversicht, dass sie die Probleme, mit denen sich Philosophen jahrhundertelang herumgeschlagen haben, in den Griff bekommen werden. Wenn es darum geht zu bestimmen, was den Geist ausmacht, wie er sich zum Gehirn verhält, welchen Zusammenhang es zwischen Geist und Gehirn einerseits und dem menschlichem Verhalten andererseits gibt, so hat die Philosophie aus Sicht vieler von ihnen beiseitezutreten und der Wissenschaft den Vortritt zu lassen. Vier von Neurowissenschaftlern gegen die Philosophie erhobene Anschuldigungen In Anbetracht solcher vorgefasster Meinungen überrascht es kaum, dass viele Neurowissenschaftler sich der Philosophie gegenüber herablassend geben. Sie beschweren sich auf mancherlei Art. Erstens wird mitunter nahegelegt, dass die Philosophie für die neurowissenschaftlichen Belange schlicht irrelevant ist. Ian Glynn schreibt: „Die meisten meiner wissenschaftlichen oder medizinischen Kollegen zeigen sich eher uninteressiert an der Philosophie. Ihre Haltung widerspiegelt freilich eine realistische Einschätzung, was die mutmaßliche Relevanz der Philosophie für ihre unmittelbaren Anliegen betrifft.“549 Zweitens werden die philosophischen Methoden von Neurowissenschaftlern gemeinhin beklagt. Edelman ist der Ansicht, dass die apriorischen Methoden der Philosophie ihre auf den Geist und seine Natur gerichteten Untersuchungen wertlos machen: „Eine der Versuchungen, in die wir geraten, weil wir über den Geist verfügen, besteht darin, das Geheimnis seiner Natur ausschließlich durch ihn selbst lösen zu wollen. Darum bemühen sich die Philosophen seit unvordenklichen Zeiten. [. . .] Als ein allgemeines Verfahren zur Erforschung des Stoffes, aus dem der Geist ist, wird es jedoch nicht von Erfolg gekrönt sein.“550 Drittens gehen die kognitiven Neurowissenschaftler davon aus, dass sie sich mit denselben Problemen befassen, mit denen es auch die Geistesphilosophen zu tun haben. Edelman und Tononi behaupten, „dass das Bewusstsein als ein wissenschaftlicher Ge549
I. Glynn, An Anatomy of Thought (Weidenfeld and Nicolson, London, 1999), S. 367. G. Edelman, Bright Air, Brilliant Fire – On the Matter of the Mind (Penguin, Harmondsworth, 1994), S. 31 [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer (Piper, München, 1995), S. 57]. 550
14.4 Philosophie und Neurowissenschaften
539
genstand aufgefasst werden kann und dass es nicht die alleinige Domäne der Philosophie ist“.551 Crick insistiert ebenso, alle spitzfindigen Unterscheidungen hinter sich zu lassen: „Die Erforschung des Bewusstseins ist ein wissenschaftliches Problem. Zwischen der Wissenschaft und dem Bewusstsein gibt es keine unüberwindliche Barriere. Wenn man aus diesem Buch irgendeine Lehre ziehen kann, dann diese: Es ist jetzt erkennbar, wie man dieses Problem experimentell angehen kann. Die Ansicht, nur Philosophen könnten es behandeln, ist völlig haltlos.“552 Wegen ihrer Unzufriedenheit mit den philosophischen Methoden neigen viele Neurowissenschaftler allerdings dem Gedanken zu, die Philosophie komme gänzlich von ihrem Weg ab und verliere ihr angestammtes Ziel aus den Augen. Crick glaubt, dass „es hoffnungslos [ist], die mit dem Bewusstsein in Verbindung stehenden Probleme mit Hilfe allgemeiner philosophischer Argumente lösen zu wollen; benötigt werden Anregungen für neue Experimente, die Aufschluss über diese Probleme geben könnten“.553 Und Edelman beobachtet, dass es „endlos viele Hypothesen über das Bewusstsein [gibt], besonders von Philosophen. Die meisten sind jedoch nicht das, was wir eine systematische wissenschaftliche Theorie nennen könnten, die auf Beobachtungstatsachen beruht und auf die Funktionen des Gehirns und des Körpers bezogen ist.“554 Viertens zeigt man sich bisweilen enttäuscht über die Leistungen der Philosophie. Crick merkt an, dass „die philosophische Bilanz der letzten 2.000 Jahre derart armselig [ist], dass den Philosophen eine gewisse Bescheidenheit besser anstünde als die hochtrabende Überheblichkeit, die sie für gewöhnlich an den Tag legen“.555 Edelman bläst in das gleiche Horn: „In Anbetracht der Geschichte der Philosophie des Geistes und der Psychologie wird unser Verständnis für die Entstehung und Wirkung des menschlichen Geistes vermutlich nicht wachsen, solange wir die biologischen Grundlagen dieses Zusammenhangs außer Acht lassen“.556 Was aus den angeblichen Fehlern der Philosophie folgt: Ihre Juniorpartnerschaft Daraus folgt, dass sich die Philosophen diesem großartigen Unternehmen anschließen können, jedoch nur als reine Juniorpartner. „Ich hoffe“, sagt Crick, „dass mehr Philosophen soviel über das Gehirn lernen werden, dass auch sie einschlägige Ideen beisteuern können. Sie müssen jedoch lernen, dass man seine Lieblingsideen aufgeben muss, wenn 551
G. M. Edelman und G. Tononi, Consciousness: How Matter Becomes Imagination (Allen Lane, The Penguin Press, London, 2000), S. 3 [dt. Gehirn und Geist (Beck, München, 2002), S. 13]. 552 Crick, Astonishing Hypothesis, S. 258 [dt. Was die Seele wirklich ist, S. 316]. 553 Ibid., S. 19 [dt. S. 37f.]. 554 Edelman, Bright Air, Brilliant Fire, S. 112 [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer, S. 164]. 555 Crick, Astonishing Hypothesis, S. 258 [dt. Was die Seele wirklich ist, S. 316]. Diese Bemerkung entstammt seiner Erörterung der Bewusstseinsforschung. 556 Edelman, Bright Air, Brilliant Fire, S. 41 [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer, S. 68].
540
14 Methodologische Reflexionen
die wissenschaftlichen Belege dagegen sprechen; andernfalls werden sie sich nur lächerlich machen“.557 Machen sie sich diese Einschätzung zu eigen, dann könnte es Edelmans Ansicht nach so sein, dass „eine neue wissenschaftliche, auf der Biologie beruhende Theorie des Geistes der Philosophie eine neue Daseinsberechtigung gibt. [. . .] Man kommt um die Frage nicht herum, ob eine biologisch begründete Theorie des Geistes diese Gedanken neu beleben und vielleicht sogar der Philosophie eine neue Richtung geben könnte.“558 Mitunter scheuen die Neurowissenschaftler nicht davor zurück, der Philosophie die Zukunft zu verordnen. „Hat man sich klargemacht, wie Information und Bewusstsein in der Natur entstanden sind, sollte man einen Schritt weitergehen und fordern, dass die Epistemologie sich auf die Biologie gründen solle, und insbesondere auf die Neurowissenschaften.“559 Was daraus noch folgt: Ihre Überflüssigkeit Mindestens ein bedeutender Philosoph glaubt wirklich, dass die Philosophie selbst obsolet bzw. überflüssig ist und dass die großen philosophischen Probleme von den Neurowissenschaften gelöst werden. Semir Zeki lamentiert über „die Armseligkeit der Ergebnisse“, welche die herrschaftliche Art der Philosophie erbracht hat, Probleme zu formulieren, die „das Verstehen unserer Gehirne und ihre geistige Verfassung“ betreffen.560 Die Erforschung „der Fähigkeit des Gehirns, Wissen zu erwerben, zu abstrahieren und Ideale hervorzubringen“, ist „eine philosophische Last, die die Neurobiologie zu schultern hat“.561 Zu den „prominentesten Problemen“, die, wie Zeki hofft, die Neurobiologie in Angriff nehmen wird, zählen „die Natur des Wissens selbst und das Verhältnis zwischen Wissen und Glauben, in Anbetracht der herausragenden menschlichen Fähigkeit zum Wissenserwerb“. Aus seiner Sicht entsprechen die in der Zukunft auf die Neurobiologie wartenden Probleme „den bleibenden Wahrheiten und ultimativen Werten, denen die Philosophie sich in der Vergangenheit so erfolglos zugewandt hat“.562 Zeki versichert, dass es sich bei den abstrakten Begriffen der Ehre und der Gerechtigkeit „um Schwierigkeiten handelt, denen sich die Neurobiologie noch nicht zugewandt hat, wenn es auch überraschen würde, ginge sie diese im kommenden Jahrhundert nicht an“. Seiner Behauptung nach hat die Neurobiologie einige Antworten auf solche philosophischen Fragen gegeben wie „Gibt es in der materiellen Welt Farben?“ und „Können Farben als Objekteigenschaften aufgefasst werden?“. Sie hat nachgewiesen, dass „Körper keine Farbe haben“ und dass Farbe „eine Gehirneigenschaft ist“ oder (alternativ) dass 557
Crick, Astonishing Hypothesis, S. 258 [dt. Was die Seele wirklich ist, S. 316]. Edelman, Bright Air, Brilliant Fire, S. 159 [dt. Göttliche Luft, vernichtendes Feuer, S. 227]. 559 Edelman und Tononi, Consciousness, S. 207 [dt. Gehirn und Geist, S. 283]. 560 S. Zeki, ‚Splendours and miseries of the brain‘, Philosophical Transactions of the Royal Society B 354 (1999), S. 2053–2065. 561 Mit ‚Idealen‘ meint Zeki offenbar Vorstellungen und Begriffe. 562 Ibid., S. 2054. 558
14.4 Philosophie und Neurowissenschaften
541
Farbe „in Wirklichkeit die Interpretation ist, die das Gehirn hinsichtlich dieser physikalischen Eigenschaft der Objekte anstellt (ihren Reflexionsgrad), eine Interpretation, die den zügigen Erwerb von Wissen über den Reflexionsgrad erlaubt“.563 Diese bedauerlichen Anmerkungen rühren, wie wir dargelegt haben, von mangelndem Verständnis für die Eigentümlichkeit philosophischer Probleme her, von Unkenntnis, was die Methoden ihrer Lösung, Klärung oder Beseitigung angeht, sowie von Fehlkonzeptionen im Hinblick auf die neurowissenschaftlichen Domäne und ihre Grenzen.
14.4.1 Wozu die Philosophie in der Lage ist und wozu nicht Eine Aufgabe der analytischen Philosophie: Sinngrenzenüberschreitungen identifizieren Die analytische Philosophie ist zuallererst eine Begriffsuntersuchung. Ihr konstruktives Hauptaugenmerk liegt auf der Klärung unserer Darstellungsform [our form of representation] und mithin darauf, philosophische Probleme zu lösen und Begriffsverwirrungen zu beseitigen.564 Sie kümmert sich folglich nicht um Tatsachen, sondern hat es mit Fragen der Bedeutung zu tun. Ihre Domäne ist nicht der Bereich der empirischen Wahrheit oder Falschheit, sondern der von Sinn und Unsinn. Sie untersucht und beschreibt die Sinngrenzen: das heißt die Grenzen dessen, was auf kohärente Weise gedacht und gesagt werden kann. Destruktiv ist ihr Tun insofern, als sie die Überschreitungen der Sinngrenzen kritisiert. Diese können in Problemformulierungen oder in Lösungsvorschlägen für Probleme zutage treten. Bei den formulierten Problemen kann es sich um philosophische, die apriorische Natur der Dinge betreffende Probleme handeln oder um wissenschaftliche, die auf die empirischen Charakteristika der Dinge abzielen. Bei den vorgeschlagenen Lösungen kann es sich zum einen um philosophische 563
Ibid., S. 2056. Natürlich wurden auch viele andere Unternehmungen unter dem altehrwürdigen Namen ‚Philosophie‘ subsumiert. Unsere Ausführungen beziehen sich auf jene Art von Philosophie und von philosophischen Methoden, die in diesem Buch erörtert wurden. Wir glauben, dass das Untersuchungsfeld von diesen beherrscht wird. Die obige Charakterisierung der analytischen Philosophie müsste im Hinblick auf den Bereich der Werte modifiziert werden, mit dem es die Moral-, Rechts- und die politische Philosophie zu tun haben. Wir sind uns im Klaren darüber, dass viele Denker, die sich selbst als analytische Philosophen verstehen, die von uns vertretenen und praktizierten Methoden der verbindenden Analyse ablehnen. Wir wollen keineswegs in die Auseinandersetzung darüber eingreifen, was zu Recht ‚analytische Philosophie‘ heißen darf und was nicht. Methoden sollten von ihren Resultate her beurteilt werden – die unseren vom Erkenntnisgewinn her, den sie, was die untersuchten Begriffe und Begriffsstrukturen angeht, erbracht haben, und von dem Umfang her, in dem sie die Identifizierung von Sinngrenzenüberschreitungen, abwegigen Fragen und unzulässigen, von Falschdarstellungen herrührenden Schlüssen erlauben. 564
542
14 Methodologische Reflexionen
Erläuterungen oder zum anderen um empirische Feststellungen und wissenschaftliche Theorien handeln. Die Problemformulierungen und Lösungsvorschläge können die Sinngrenzen versehentlich verletzen. Was in der einen oder anderen Weise in Unsinn mündet – das heißt in Wortgebilde, die jedes Sinns entbehren. Diese erwecken typischerweise den Anschein, Sinn zu ergeben – und es ist nicht leicht, die verschlungenen Missverständnis-Fäden zu entwirren. In manchen Fällen braucht es Jahrhunderte angestrengten Bemühens. Philosophische Klärung Wir verleihen unseren Gedanken und unserem Wissen über die Welt durch Sätze unserer Sprache artikulierten Ausdruck. Die zur Beschreibung unserer Erfahrung und ihrer Erfahrungsobjekte verwendeten Sätze bestehen aus Worten, die in regelgeleiteter Weise miteinander verbunden sind. Wir gebrauchen solche Sätze für Äußerungen, die unsere Erfahrung und ihre Objekte betreffen, und solche Äußerungen stehen zueinander im Verhältnis der Implikation, der Vereinbarkeit und der Unvereinbarkeit. Zur philosophischen Arbeit gehört es, die Formen der zulässigen Verbindung von Ausdrücken klärend herauszuarbeiten, die kaum merklich bzw. subtil die Regeln verletzenden Verbindungsformen zu entdecken, die Implikationen, Vereinbarkeiten und Unvereinbarkeiten der aus wohlgeformten, verständlichen Sätzen gebildeten Äußerungen zu beschreiben. Solche Klärungsbemühungen richten sich im Normalfall auf ein bestimmtes Spektrum der in Betracht kommenden begrifflichen Probleme, Ungereimtheiten und Verwirrungen. Die Klarstellungen dieses Buches beispielsweise sind auf die Begriffsprobleme zugeschnitten, die für die kognitiven Neurowissenschaften am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts charakteristisch sind. Obwohl es sich dabei zum Teil um dieselben Probleme handelt, die man am Ende des 19. Jahrhunderts hätte erörtern müssen, um beispielsweise die beträchtlichen Begriffsverwirrungen bei William James auszumerzen, unterscheiden sie sich auch von ihnen. Selbst wenn die Erklärungsmethoden sich nicht unterscheiden würden, bestünden hinsichtlich der Anordnung des Stoffes doch Unterschiede. Wenn es auch Ähnlichkeiten zwischen den aufeinander folgenden Konfusionen geben mag, weist doch jede Generation eine andere Verwirrung auf, die den vorgefassten Meinungen, den dominierenden Gedanken und manchmal den technischen Verfahrensweisen dieser Zeit entsprechend ausgeformt ist.565 Die philosophische Klärungsarbeit hat mithin kein Ende, da die Begriffsverwirrungen, denen Menschen erliegen 565
Eine Hauptquelle der gegenwärtigen Begriffsverwirrung innerhalb all jener Wissenschaften, die sich direkt oder indirekt mit den Kognitionsvermögen des Menschen befassen, sind die irreführenden Analogien zwischen den Vorgängen im Geist und denen im Computer und zwischen den Vorgängen im Gehirn und der Informationsverarbeitung durch den Computer. Das frühere Leitbild, das einer Telefonzentrale, war an eine weniger einnehmende und faszinierende Analogie geknüpft und richtete entsprechend weniger Schaden an.
14.4 Philosophie und Neurowissenschaften
543
können, kein Ende nehmen, und jede einzelne Konfusion stellt einen neuen Behandlungsfall dar. Die verbindende Analyse in der Philosophie Eine grundlegende Methode zur Beseitigung von Begriffsverwirrungen ist die sorgsame Überprüfung und Beschreibung des Wortgebrauchs – dessen, was kompetente Sprecher, indem sie Worte richtig verwenden, sagen und nicht sagen. Denn auf diese Weise kann man Aufschluss über die problematischen Begriffe gewinnen, die eine Ursache des ganzen Ärgers sind. Sie werden mit Hilfe der verbindenden Analyse erläutert, die den Verästelungen des logisch-grammatischen Geflechts der Verbindungen zwischen den problematischen Begriffen und den angrenzenden nachspürt, soweit das für die Klärungsbemühungen und die Lösung oder Beseitigung der Probleme und Fragen nötig ist. Darum haben wir uns in den Kapiteln 4–8 bemüht, wo wir unter Berücksichtigung einer kleinen Auswahl zentraler psychologischer Kategorien – und zwar Empfindung, Wahrnehmung, Wissen, Glauben, Gedächtnis, Denken, Vorstellungskraft und Vorstellen, Emotion, Stimmung und Wollen – einen Teil der komplexen Muster miteinander verschränkter Begriffe umrissen haben. Unsere skizzenhaften Darlegungen erläuterten diese Begriffe, indem sie den Gebrauch der entsprechenden Worte untersuchten und beschrieben, obgleich wir an diesen nicht lexikografisch, sondern begrifflich interessiert waren. Unsere logisch-grammatischen Untersuchungen rührten von einem Interesse für das logische Gepräge der Begriffe her, die man durch die Worte ausdrückt, deren Gebrauch untersucht wurde. Denn das Begriffsgeflecht tritt im Geflecht der Worte zutage. Die verbindungsanalytische Übung der Kapitel 4–8 sollte einige der grundlegenden Unterschiede veranschaulicht haben, die zwischen der philosophischen und der wissenschaftlichen Forschung bestehen. Es gibt keine Theorien und Hypothesen in der Philosophie, denn es kann keine Theorien über logische Möglichkeiten geben In dem Sinn, in dem es in der Wissenschaft Theorien und Hypothesen gibt, kann es sie in der Philosophie nicht geben. Denn die Wissenschaften bringen Theorien hervor, um zu erklären, und formulieren Hypothesen, um Phänomene vorherzusagen. Wissenschaftliche Theorien müssen im Experiment nachzuprüfen sein. Sie können wahr sein (oder falsch); möglicherweise aber nähern sie sich der Wahrheit auch nur an. Die Philosophie dagegen trennt Sinn von Unsinn. Sinnbestimmungen gehen der Erfahrung voraus und werden sowohl von wahren als auch von falschen Urteilen vorausgesetzt. Es kann in der Philosophie keine Theorien geben, von denen man Hypothesen über Ereignisse ableiten oder anhand derer man erklären kann, weshalb die Dinge sich so abspielen, wie sie es tun. Das ist nicht die Aufgabe des Fachs – in ihm geht es, wie man sagen könnte, um logische Möglichkeiten, nicht um empirische Wirklichkeiten. Und es ist
544
14 Methodologische Reflexionen
nicht die Funktion der Philosophie, logische Möglichkeiten mittels nachprüfbarer Hypothesen zu erklären – denn so etwas kann es gar nicht geben. Sie besteht vielmehr darin, das Sinnvolle zu beschreiben oder anzuführen (denn dieses ist mit dem logisch Möglichen identisch), im Hinblick auf jedes vorliegende problematische Sprachfragment zu erläutern, welche Wortkombinationen Sinn ergeben und innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft gebraucht werden können, um etwas Wahres oder Falsches zu sagen. Bei ihren Ergebnissen kann es sich nicht um Annäherungen handeln, in dem Sinn, in dem es sich bei wissenschaftlichen Hypothesen um Annäherungen an die Wahrheit handeln kann, denn eine bloße Sinnannäherung ist so oder so Unsinn. Zu ihrer kritischen und destruktiven Arbeit gehört es, häufig gebrauchte Wortgebilde, die Sinn zu ergeben scheinen, sich bei eingehenderer Überprüfung jedoch als unsinnige erweisen, zu beschreiben oder anzuführen. So wird der Nachweis erbracht, dass die ins Feld geführten Begriffe falsch ausgelegt sind und dass die begrifflichen Vereinbarkeits- und Unvereinbarkeitsverhältnisse nicht richtig verstanden werden. Zu dieser kritischen Arbeit gehört es, die Quellen der begrifflichen Falschauslegungen und Missverständnisse und die Gründe für die Begriffsverwirrungen und Inkohärenzen en detail zu erklären. Über die Torheit, die Erforschung ‚bloßer Worte‘ geringzuschätzen Es ist natürlich verlockend, ‚bloßen Worten‘ gegenüber eine geringschätzige Haltung an den Tag zu legen und der scheinbaren Belanglosigkeit einer Sorge um bloße Worte die Wichtigkeit der Tatsachenarbeit entgegenzusetzen. Das ist allerdings töricht. Denn wie wollte man Tatsachen darlegen, ohne Worte zu gebrauchen? Wissenschaftliches Denken ist nur möglich, weil Worte zur Verfügung stehen, ihm Ausdruck zu verleihen. Die ‚bloßen Worte‘ und deren regelgeleitete Verbindungen konstituieren unsere Darstellungsform bzw. unser Begriffssystem. Die Untersuchung der Struktur und der Grenzen unseres Begriffssystems ist nicht weniger wichtig, obgleich etwas ganz anderes, als die Tatsachen und Theorien, zu deren Formulierung wir dieses System verwenden. Es wäre absurd, die Brillengläser, durch die wir die Welt betrachten, mit der Begründung geringzuschätzen, sie seien lediglich aus Glas und ausschließlich für Linsenschleifer von Interesse (als ob sich nur Lexikografen für bloße Worte interessieren sollten). Noch absurder wäre es, fehlerhafte Stellen in den Gläsern als unwichtig abzutun, weil man sich nicht für Brillengläser und ihre Defekte interessiert, sondern nur dafür, was man sehen kann. Über die Nichttrivialität von Begriffsproblemen Begriffsprobleme sind alles andere als trivial oder belanglos. Es sind Probleme, die daraus resultieren, dass unsere Sprachformen falsch interpretiert, Worte auf nur scheinbar sinnvolle Weise verwendet werden. Der Anschein von Sinn kann so überzeugend sein wie eine Wahrnehmungstäuschung (z. B. die Müller-Lyer-Linien), und sich von ihm zu
14.4 Philosophie und Neurowissenschaften
545
lösen, kann so viel Mühe kosten, wie sich klarzumachen, dass ein bestimmter Wahrnehmungseindruck eine Täuschung ist. Sehr häufig sind wir von abwegigen Wortgebilden förmlich angezogen (es ist offenkundig anziehend, von „dem ‚Ich‘“ zu sprechen (oder ‚dem Ego‘) – obgleich niemand je von „dem ‚Du‘“566 (oder „dem ‚tu‘“) spricht). Es kann uns in der Tat außerordentlich schwerfallen, ein irreführendes Wortgebilde aufzugeben (z. B. ‚das Gehirn schließt‘, ‚das Gehirn glaubt‘, ‚das Gehirn speichert Information‘), wenn es ihm erst einmal gelungen ist, unser Denken zu dominieren. Die Wurzeln der begrifflichen Täuschung reichen tief, so tief wie die Formen unseres Denkens. Denn begriffliche Täuschungen sind darauf zurückzuführen, dass wir uns in den Formen unseres Denkens verfangen haben. Über die Bedeutung der Philosophie für die Neurowissenschaften Folglich sollte eine realistische Bewertung der mutmaßlichen Bedeutung der Philosophie für die Kernfragen der wissenschaftlichen Kollegen Ian Glynns keineswegs von Geringschätzung geprägt sein. Die kognitiven Neurowissenschaften werden von allen möglichen Begriffsverwirrungen heimgesucht, von denen wir einige im Laufe unserer Darlegung aufzuzeigen versuchten. Die Klärung der Begriffe ist sowohl für die Identifizierung und unmissverständliche Formulierung von Problemen als auch für die Beschreibung der wissenschaftlichen Entdeckungen und die realistische Bewertung ihrer Stichhaltigkeit erforderlich. Die kognitiven Neurowissenschaften operieren über eine kategoriale ‚Trennlinie‘ zwischen dem Psychischen und dem Neuralen (das ein Sonderfall des Physischen ist) hinweg. An dieser ‚Trennlinie‘ ist nichts geheimnisvoll oder rätselhaft. Es gibt sie aufgrund der logisch-grammatischen Unterschiede zwischen den charakteristischen Begriffen der Neurowissenschaften und den Begriffen der Psychologie einerseits und ihren jeweiligen begrifflichen Verbindungen und Artikulationen andererseits. Wie wir in diesem Buch zeigen konnten, haben wir es mit tief reichenden und weit verzweigten Unterschieden und mit subtilen und komplexen Begriffsverbindungen zu tun. Weil die kognitiven Neurowissenschaften dauernd gezwungen sind, diese logische Trennlinie zu überschreiten und sich von Beschreibungen der Strukturen und Prozesse neuraler Phänomene weg- und auf Beschreibungen psychischer Phänomene hinzubewegen, geraten sie unweigerlich in Schwierigkeiten – in begriffliche Schwierigkeiten, nicht in empirische. Diese lassen sich nicht durch wissenschaftliche Experimente beseitigen, sondern nur durch apriorische Begriffsuntersuchungen und philosophische Argumente.
[Das mag auf das englische ‚you‘ zutreffen, im Hinblick auf das Deutsche sei zumindest an Martin Buber erinnert und solche Sätze wie: ‚Das Du begegnet mir von Gnaden, durch Suchen wird es nicht gefunden.‘ – A.d.Ü.] 566
546
14 Methodologische Reflexionen
Über die Verwirrung, die apriorischen Methoden der Philosophie zu beklagen Wenn Neurowissenschaftler wie Edelman sich beklagen, die philosophischen Methoden seien hoffnungslos apriorisch, gehen sie ebenso in die Irre, wie das Physikern passieren würde, die sich über die Apriorizität mathematischer Methoden beschwerten. Mathematik ist Begriffsbildung mittels apriorischer Beweise – denn ein mathematischer Beweis stellt eine neue Begriffsverbindung her, die durch das bewiesene Theorem zum Ausdruck kommt. Philosophie ist Begriffserläuterung mittels Beschreibung des regelgeleiteten Wortgebrauchs. Solche Beschreibungen gehen der Erfahrung voraus, und jede wahre oder falsche empirische Behauptung, zu deren Formulierung die einschlägigen Worte herangezogen werden, setzt sie voraus. Die Klarstellungen der Begriffe der Wahrnehmung oder des Gedächtnisses oder des Vorstellens und der Vorstellungskraft gehen allen empirischen Theorien über die neuralen Grundlagen dieser Fähigkeiten voraus. Denn die Begriffe sind in den Theorieentwürfen immer schon enthalten. Die Verwirrungen der Neurowissenschaftler sind zum Teil dem Versäumnis geschuldet, apriorische, begriffliche Fragen von solchen empirischer, wissenschaftlicher Couleur abzugrenzen. Die philosophische Untersuchung der Natur des Geistes beschränkt sich zwangsläufig auf die Klärung des Begriffs des Geistes und der weit verzweigten logisch-grammatischen Verbindungen zu verwandten Begriffen. Die Philosophie kann mithin Aufschluss geben über die Beziehungen, die zwischen dem Begriff des Geistes und den Begriffen der Person, der fühlenden Kreatur, des Körpers oder des Gehirns bestehen. Das ist es, was die Philosophie zu leisten vermag. Die neurowissenschaftliche Untersuchung der Natur des Geistes beschränkt sich zwangsläufig auf die Ermittlung der neuralen Grundlagen unserer psychischen und verhaltensbezogenen Fähigkeiten und deren Ausübung. Die philosophischen und neurowissenschaftlichen Unternehmungen unterscheiden sich grundlegend. Ja mehr noch, diese setzen jene voraus, insofern als ein unklarer und verworrener Begriff des Geistes und unklare und verworrene verwandte Begriffe die Beschreibung und das Verständnis der neurowissenschaftlichen Problemstellungen und Lösungsvorschläge ‚verderben‘. Das neurowissenschaftliche Projekt unterscheidet sich maßgeblich vom philosophischen Man sollte sich unbedingt klarmachen, dass es Neurowissenschaftler, anders als Edelman, Tononi und Crick versichern, nicht mit denselben Problemen zu tun haben wie die Philosophen, die sich dem Geist widmen. Entgegen den Beteuerungen mancher Philosophen unterscheiden sich das philosophische und das neurowissenschaftliche Unternehmen. Die philosophischen und neurowissenschaftlichen Untersuchungen des Bewusstseins beispielsweise ergänzen sich, sind aber nicht identisch. Es stimmt, dass das Bewusstsein auch wissenschaftliche Fragen aufwirft, dass sich Philosophie und Neurowissenschaften gleichermaßen für die Natur des Bewusstseins interessieren. Die Bedeutung von ‚die Natur des Bewusstseins‘ unterscheidet sich jedoch in diesen beiden Fällen.
14.4 Philosophie und Neurowissenschaften
547
Die Philosophie versucht, Aufschluss über die definierenden Merkmale des Bewusstseins (seine apriorische Natur) zu geben. Zu ihren Obliegenheiten gehört die Klärung des Begriffs des Bewusstseins und seiner Verbindungen mit angrenzenden Begriffen – mit Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, Denken und gedanklicher Auseinandersetzung. Sie hat sich zudem der Aufgabe verschrieben, das Bewusstsein betreffende Begriffsverwirrungen zu beseitigen – konfuse Gedanken über Qualia, über die unbeschreibliche und nicht mitteilbare ‚Röte des Rots‘, über die Annahme, bei Bewusstsein zu sein, fühle sich auf bestimmte Weise an und so weiter. Den Begriff des Bewusstseins als gegeben voraussetzend, machen es sich die Neurowissenschaften zur Aufgabe, die empirische Natur des Bewusstseins zu untersuchen, insbesondere die neuralen Bedingungen des intransitiven und transitiven Bewusstseins zu entdecken. Die Philosophie kann zu den wissenschaftlichen Theorien über die neuralen Grundlagen des Bewusstseins in all seinen Formen ebenso wenig beitragen wie die Neurowissenschaften zur Klärung des Bewusstseinsbegriffs. Kein experimentelles Problem kann durch philosophische Argumente gelöst werden. Die von Crick in den Blick genommenen ‚neuen Experimente, die über Bewusstseinsfragen Aufschluss geben könnten‘, vermögen es wiederum nicht, in irgendeiner Form Aufschluss über den Begriff des Bewusstseins zu geben. Die beiden Herangehensweisen ergänzen sich, oder sollten sich ergänzen – sie konkurrieren nicht miteinander und schließen einander nicht aus. Wenn, wie Edelman nahelegt, Philosophen ‚Hypothesen über das Bewusstsein‘ vorbringen, überspannen sie den Bogen. Denn es ist nicht Sache der Philosophie, Hypothesen über irgendetwas vorzubringen – ihre Aufgabe ist es, die Sinngrenzen zu beschreiben, und das kann unmöglich etwas mit Hypothesenbildung zu tun haben. Bei den philosophischen Analysen des Begriffs des Sich-etwas-bewusstseins und der Familie eng verwandter Begriffe (z. B. Kenntnis haben von etwas, etwas bemerken, erkennen oder realisieren) handelt es sich nicht um Hypothesen und gewiss nicht um ‚systematische wissenschaftliche Theorien, die auf Beobachtungstatsachen beruhen‘ – so wie es sich bei mathematischen Theoremen nicht um systematische wissenschaftliche Theorien handelt, die auf Beobachtungstatsachen beruhen. Es ist nicht die Aufgabe der Philosophie, den Neurowissenschaftlern Theorien vorzuschlagen Folglich reizt Cricks Hoffnung, Philosophen könnten so viel über das Gehirn lernen, dass auch sie einschlägige Ideen beisteuern können, zum Lachen (und vielleicht soll sie das auch). Philosophen sind keine verhinderten Neurowissenschaftler, und dass Philosophen (was ihr fachliches Vermögen angeht) die Arbeitsweise des Gehirns betreffende Ideen werden beisteuern können, ist so wahrscheinlich, wie dass Mathematiker die Gesetze der Physik betreffende Ideen werden vorbringen können.567 Und ebenso lachhaft 567
Das heißt nicht, dass es einzelnen Philosophen nicht möglich ist, neurowissenschaftliche Sachkenntnis zu erwerben und zu den Fortschritten dieses Fachgebiets beizutragen. Zweifellos gab es eine Reihe großer Philosophen, Descartes eingeschlossen, die die empirische Wissenschaft
548
14 Methodologische Reflexionen
ist wiederum die Annahme, dass ein wissenschaftlicher Beweis im Widerspruch zu einer philosophischen Begriffsanalyse stehen könnte. Philosophen irren sich sehr häufig in ihren Darstellungen eines bestimmten Begriffsbereichs – ein solcher Irrtum ist allerdings (wie ein rein mathematischer Irrtum) ein apriorischer, der erfahrungs- und experimentunabhängig identifiziert werden kann. Philosophen sollten ihre Lieblingstheorien über die Natur des Bewusstseins angesichts wissenschaftlicher Belege nicht aufgeben müssen. Sie sollten keine Lieblingstheorien haben, denn es ist nicht ihre Sache, empirische Theorien aufzustellen, die in erster Linie Gegenstand empirischer Bestätigung und Verwerfung sind. Sie haben es mit Begriffen zu tun, nicht mit empirischen Urteilen; mit Formen des Denkens, nicht mit seinem Inhalt; mit dem logisch Möglichen, nicht mit dem empirisch Wirklichen; mit Sinn und Unsinn, nicht mit Wahrem und Falschem. Über das Besondere des philosophischen Fortschritts im Vergleich zum wissenschaftlichen Die Enttäuschung (Cricks, Edelmans und Zekis beispielsweise) über die philosophischen Leistungen der letzten 2.000 Jahre beruht auf Missverständnissen, die mit der Besonderheit des Fachbereichs zu tun haben. Die Philosophie hat zweifellos keine Fortschritte dabei gemacht, zu unserem Wissen über die Welt beizutragen – aber das sollte sie auch gar nicht. Ihre Aufgabe besteht darin, klärenden Aufschluss über das Begriffssystem zu geben, das unserer Wissensartikulation zugrunde liegt. Ihre Leistungen tragen dazu bei, dass wir die logische Struktur unseres Denkens und Weltwissens verstehen. Zum dem das Gehirn betreffende Wissen kann sie nichts beisteuern, und das sollte man von ihr auch nicht erwarten. Philosophen sind keine verkappten Wissenschaftler und ihre Methoden sind nicht zur Entdeckung neuer empirischer Wahrheiten da. Aber stimmt es denn, dass es während der letzten 2.000 Jahre keinen philosophischen Fortschritt zu verzeichnen gab? Dies kommt nur dem so vor, der sich unbegründete Hoffnungen macht, weil er die Philosophie als eine Wissenschaft missversteht und nicht versteht, worum es sich beim philosophischen Fortschritt handelt. Dann kann er philosophische Theorien herbeisehnen, die wie wissenschaftliche konzipiert sind, und verworrene Hoffnungen auf bessere und ambitioniertere Theorien nähren (und es ist nicht zu leugnen, dass manche Philosophen sich derart selbst hinters Licht geführt haben). Der wissenschaftliche Fortschritt besteht in der Entwicklung und Bestätigung immer noch stärkerer Theorien. Wie wir dargelegt haben, gibt es in der Philosophie allerdings keine Theorien in dem Sinn, in dem es sie in der Wissenschaft gibt, und die Philosophie sollte keine empirischen Theorien aufstellen, wie es die Wissenschaft tut. Daraus folgt nicht, dass es in der Philosophie keinen Fortschritt gibt, sofern man den Fortschrittsbegriff in diesem Bereich richtig auffasst. Man unterscheidet Formen des folgernden Denkens (z. B. wird das deduktive vom induktiven, das theoretische vom prakvorangebracht haben (es ist allerdings viel schwieriger, irgendeinen Wissenschaftler namhaft zu machen, der Großes für die Philosophie geleistet hat).
14.4 Philosophie und Neurowissenschaften
549
tischen folgernden Denken unterschieden), und die für sie konstitutiven logischen Prinzipien werden expliziert und mitunter reglementiert und festgeschrieben (wie im Fall der deduktiven Logik). Kategoriale Begriffe, die einen bestimmten Denkbereich charakterisieren, werden geklärt. Den Strängen in unserem Begriffsgeflecht wird nachgegangen, Begriffsverbindungen werden herausgearbeitet, Begriffsaffinitäten und -unterschiede namhaft gemacht. Verwirrungen und Fehlkonzeptionen werden als das enthüllt, was sie sind. Manche von ihnen entschwinden daraufhin dem Blick, und ihre Ausmerzung wird ganz einfach vergessen. Andere erscheinen in jeder neuen Generation in neuem Gewand – denn die Versuchung, bestimmte Merkmale unseres Begriffssystems falsch auszulegen, nimmt kein Ende (Qualia sind Wittgensteins ‚private Objekte‘ modern gewandet, und interne Repräsentationen sind die direkten Abkömmlinge der Ideen und Sinneseindrücke). Doch wenn man es erreicht, eine Generation von einer Erkrankung des Verstehensvermögens zu kurieren, so ist das eine ehrenwerte und beachtliche Leistung, auch wenn abzusehen ist, dass das Übel in einer Mutationsform wieder ausbrechen und eine Nachfolgegeneration befallen wird. Was die Philosophie zum neurowissenschaftlichen Unternehmen beitragen kann Die Philosophie kann also etwas zum neurowissenschaftlichen Unternehmen beisteuern, indem sie die begriffliche Klärungsarbeit vorantreibt. Wir haben in diesem Buch aufzuzeigen versucht, wie das bewerkstelligt werden kann. Die Philosophie kann die Verletzungen der Sinngrenzen kenntlich machen – so wie wir es im Hinblick auf den mereologischen Fehlschluss in den Neurowissenschaften getan haben. Sie kann die Verzerrungen oder Entstellungen des Begriffsrahmens, von dem sich die neurowissenschaftliche Forschung leiten lässt, verdeutlichen. Sie kann also klären – wie wir es getan haben –, was an dem Gedanken nicht stimmt, dass die Wahrnehmung mit Bildersehen oder Bilderhaben einhergeht oder dass die Wahrnehmung die Hypothesenbildung des Gehirns ist. Sie kann vor der irrigen Annahme warnen – wie wir es versucht haben –, dass Gedächtnis die Neuauflage vergangener Erfahrungen oder dass es stets auf die Vergangenheit bezogen ist. Sie kann darüber Aufschluss geben, weshalb es sich bei konditionierten Reaktionen nicht um Gedächtnisformen handelt und warum es abwegig ist anzunehmen, dass Erinnerungen im Gehirn gespeichert werden können. Sie kann zeigen – wie wir gezeigt haben –, weshalb die Erforschung emotionaler Beeinträchtigungen nicht mit der Erforschung von Emotionen verwechselt werden darf, weshalb Emotionen keine körperlichen Reaktionen auf Vorstellungsbilder sind und weshalb das Fühlen von Emotionen nicht das Bewusstsein körperlicher Veränderungen ist, die uns über unseren viszeralen und muskuloskeletalen Zustand in Kenntnis setzen. Sie kann erklären – wie wir erklärt haben –, warum Vorstellungsbilder keine ätherischen Bilder sind und warum sie nicht in der Vorstellung gedreht werden können. Und so weiter. Die philosophisch-analytischen Begriffsklärungen sind für die neurowissenschaftlichen Ziele alles andere als unerheblich – sie sind unverzichtbar, sollen diese Ziele angegangen und erreicht werden.
550
14 Methodologische Reflexionen
14.4.2 Was die Neurowissenschaften zu leisten vermögen und was nicht Weshalb die Neurowissenschaften nichts zur Lösung philosophischer Probleme beisteuern können Crick hat ganz Recht mit seiner Annahme, dass es hoffnungslos ist, empirische Probleme, die die Natur des Bewusstseins betreffen, mit Hilfe allgemeiner philosophischer Argumente lösen zu wollen. Begriffliche Probleme mit empirischen Methoden lösen zu wollen, ist jedoch ein ebenso hoffnungsloses Unterfangen. PET und fMRT können Gehirne abtasten, Begriffe und deren Artikulationen allerdings nicht. Die Neurowissenschaften können synaptische Verbindungen untersuchen, jedoch keine begrifflichen. Es ist keineswegs klar, was Edelman mit „einer auf der Biologie beruhenden Theorie des Geistes“ meint. Sollten Neurowissenschaftler jedoch etwas hervorbringen, das so genannt werden kann, ist nicht zu erwarten, dass es der Philosophie ‚eine neue Daseinsberechtigung‘ liefert. Denn erstens hat die Philosophie ihre alte Daseinsberechtigung nicht verloren, die voraussichtlich so lange Bestand haben wird, wie die Menschheit fortfährt zu denken und die Menschen, Wissenschaftler eingeschlossen, weiterhin aus rein begrifflichen Gründen irren. Und zweitens vermag eine neue wissenschaftliche Theorie von irgendwas der Philosophie keine neue Daseinsberechtigung oder Richtung zu verschaffen, sondern lediglich ein neues Spektrum an begrifflichen Ungereimtheiten oder Verknotungen, die zu beseitigen bzw. aufzulösen sind. Neurowissenschaftliche Entdeckungen (das Blindsehen z. B.) können neue Begriffsprobleme aufwerfen – sie können Mahlgut für die philosophischen Mühlen liefern, Lösungen für philosophische Probleme allerdings nicht. Weshalb die Epistemologie nicht auf den Neurowissenschaften gründen könnte Wer propagiert, dass die Epistemologie durch die Neurowissenschaften zu grundieren sei, der kann unmöglich über eine angemessene Vorstellung von ihr verfügen. Schließlich handelt es sich bei ihr nicht um den Versuch, empirisch zu erkunden, wie, in Verbindung mit welchen Tatsachen, menschliche Wesen ihre jeweilige Sprache erwerben können und wirklich erwerben – das leistet die Lerntheorie, die ein Zweig der Psychologie ist. Die Epistemologie erkundet vielmehr das Geflecht epistemischer Begriffe, das gebildet wird aus den Verbindungen, Vereinbarkeiten und Unvereinbarkeiten zwischen den Begriffen von Wissen, Glauben, Überzeugung, Verdacht, Annahme, Mutmaßung, Zweifel, Gewissheit, Gedächtnis, Evidenz und Offensichtlichkeit, Wahrheit und Falschheit, Wahrscheinlichkeit, Gründen und folgerndem Denken etc. Die nämlichen Verbindungen sind logischer oder begrifflicher Art – und die neurowissenschaftlichen Untersuchungen können keinen Aufschluss über die normativen Verbindungen der Logik geben (‚Logik‘ im weiteren Sinn). Die Epistemologie hat es auch mit dem logischen Gepräge der Rechtfertigungen von Wissensbehauptungen zu tun, mit dem der Bestätigungen und
14.4 Philosophie und Neurowissenschaften
551
Widerlegungen, der Unterschiede zwischen deduktiver und induktiver Untermauerung, dessen, was als evident betrachtet wird und dessen, was der Evidenz bedarf und so weiter. Auch hierbei handelt es sich nicht um empirische Untersuchungen. Die Entdeckung irgendwelcher mit dem Gehirn zusammenhängender Tatsachen kann solche epistemologischen Überlegungen nicht befruchten. Weshalb die Neurowissenschaften die Begriffsnatur des Wissens nicht erforschen können: Zekis Verwirrung Die Neurowissenschaften könnten es sich nicht zur Aufgabe machen, die Begriffsnatur des Wissens und seine Beziehung zum Glauben zu erforschen. Sollten sie ‚diese Last schultern‘, wie es Zeki verlangt, müssten sie erforschen, weshalb man wissen kann wie, jedoch nicht glauben kann wie; weshalb man fragen kann ‚Woher weißt du das?‘ und ‚Warum glaubst du das?‘, aber nicht ‚Warum weißt du das?‘ und ‚Woher glaubst du das?; weshalb man wissen kann ob oder besser wissen kann, aber nicht glauben kann ob oder besser glauben kann; warum wissen, dass p, und glauben, dass p, nicht so miteinander in Beziehung stehen wie NN wissen und NN glauben; weshalb ‚Er glaubt, dass p, es stimmt jedoch nicht, dass p‘ ein einwandfreier Satz, aber ‚Ich glaube, dass p, es stimmt jedoch nicht, dass p‘ Unsinn ist und so weiter. Ist es vorstellbar, dass uns die Kenntnis der Funktionsweise des Gehirns Aufschluss über diese logisch-grammatischen Fragen gibt? Zeki scheint zu glauben, dass diese Probleme wegen „des außerordentlichen Vermögens des menschlichen Gehirns [. . .], Wissen zu erwerben“, zum neurowissenschaftlichen Hoheitsgebiet gehören. Wie jedoch mittlerweile klar sein sollte, verfügt das Gehirn gar nicht über ein Vermögen zum Wissenserwerb – es sind die Menschen, denen dieses Vermögen eignet. Es ist selbstverständlich richtig, dass wir kein solches Vermögen unser eigen nennen könnten, wenn wir nicht das Gehirn hätten, das wir haben. Und es ist auch richtig, dass die Neurowissenschaften das Gehirn erforschen sollen und dass sie guter Dinge sind, seine Struktur und Funktionsweise, die uns mit diesem Vermögen ausstatten, zukünftig verstehen zu können. Daraus folgt jedoch nicht, dass die Neurowissenschaften Begriffsfragen beantworten können, die den Zusammenhang zwischen Wissen und Glauben betreffen. Die Neurowissenschaften können auch den Status sekundärer Qualitäten nicht klären Ebenso verworren ist es anzunehmen, dass die Neurowissenschaften Antworten auf solche philosophische Fragen bereithalten wie ‚Gibt es in der Welt der Materie Farben?‘ und ‚Können Farben als Objekteigenschaften aufgefasst werden?‘. Die Antworten, von denen Zeki annimmt, dass die Neurowissenschaften sie zur Verfügung stellten, wurden im Wesentlichen bereits von Galilei, Descartes, Boyle und Locke geliefert. Die Zekis Ansicht nach von den Neurowissenschaften bereitgestellten Antworten sind ebenso frag-
552
14 Methodologische Reflexionen
würdig wie die metaphysischen Positionen des 17. Jahrhunderts, bei denen es sich um Vorwegnahmen der neurowissenschaftlichen Positionen handelt. Zekis Verwirrungen Die Behauptung, die Neurowissenschaften konnten zeigen, dass Objekte keine Farben haben, ist offenkundig verworren, wenn man sie wörtlich nimmt zumindest. Denn sie würde im buchstäblichen Sinn zum Ausdruck bringen, dass alle Objekte farblos sind – wie durchsichtige, farblose Fensterscheiben. Gemeint ist, oder dürfte es sein, dass es sinnlos ist, materiellen Objekten Farben zuzuschreiben – dass materielle Objekte nicht farbig sein könnten. Wie könnten die Neurowissenschaften jedoch zeigen, dass etwas logisch ausgeschlossen ist? Wie sollte es ihnen insbesondere möglich sein zu zeigen, dass kein ausgedehntes, im Raum angesiedeltes Objekt eine Farbe haben könnte? Die Vermutung, dass Farben Gehirneigenschaften sind, ist offenkundig verworren, denn Zeki meinte natürlich nicht, dass das Gehirn farblich zwischen Grau und Weiß changiert und dass alles andere gar keine Farbe hat. Er muss darauf hinauswollen, dass die Tatsache, dass die meisten materiellen Objekte eine Farbe zu haben scheinen, mit der Arbeitsweise unserer Gehirne in Zusammenhang steht. Die Neurowissenschaften können jedoch nicht mehr tun, als die Mechanismen aufzuspüren, die uns dazu befähigen, die Farben von Dingen wahrzunehmen – und das zeigt keineswegs, dass die Dinge nicht farbig sind, und schon gar nicht, dass es logisch ausgeschlossen ist, dass sie eine Farbe haben. Zekis andere Behauptung – Farbe sei „die Interpretation, die das Gehirn in Bezug auf diese physikalische Eigenschaft der Objekte (ihren Reflexionsgrad) anstellt, eine Interpretation, die den zügigen Erwerb von Wissen über den Reflexionsgrad erlaubt“ – ist gleichfalls verworren. Denn das Gehirn kann weder etwas interpretieren noch Wissen von etwas erwerben – a fortiori nicht von den Reflexionseigenschaften der Dinge. Die Person, deren Gehirn es ist, kann infolge der Prozesse in ihrem Gehirn Wissen über die Farben der Dinge, die sie sieht, erwerben, daraus folgt aber nicht, dass sie irgendwelches Wissen über die Reflexionseigenschaften dieser Dinge erwirbt. Denn wenn sie von Physik nichts versteht, wird sie über Reflexionseigenschaften und Wellenlängen des Lichts wahrscheinlich nichts wissen. Das zeigt aber nicht, dass die Farben, die sie zu sehen vermeint, nicht wirklich die Farben der Gegenstände sind. Wenn es so wäre – das heißt, wenn Farben keine objektiven Eigenschaften der Gegenstände wären –, dann könnte sie im Grunde genommen nichts in ihrer Umgebung sehen, weil das, was keine Farbe hat (a fortiori keine Farbe haben kann), nicht sichtbar ist. Galilei, Descartes, Boyle und Locke behaupteten natürlich genau das: dass Farben keine objektiven Eigenschaften der Gegenstände sind. Laut ihrer repräsentationalistischen Metaphysik handelt es sich bei dem, was wir visuell wirklich wahrnehmen, um nichts anderes als um bloße Vorstellungen in unserem Geist, aus denen wir mit Zweifeln behaftete Schlüsse über die nicht wahrnehmbare Welt ziehen, in der wir zu leben meinen. Besteht der Beitrag der Neurowissenschaf-
14.5 Weshalb das alles wichtig ist
553
ten des 21. Jahrhunderts zur Philosophie jedoch darin? Solche metaphysischen Doktrinen gehörten der Philosophie 350 Jahre lang an, und ob man sie nun verfechten kann oder nicht, so dürfte zumindest so viel klar sein, dass sie nicht als empirische Fragen aufzufassen sind, die von neurowissenschaftlichen Untersuchungen erledigt werden könnten. Keine Tatsachenentdeckung kann eine Begriffsfrage klären Keine neurowissenschaftliche Entdeckung oder Feststellung vermag irgendeines der Begriffsprobleme zu lösen, die in den Zuständigkeitsbereich der Philosophie fallen, genauso wenig wie die empirischen Entdeckungen von Physikern ein mathematisches Theorem beweisen können. Denn jede Beschreibung des von den kognitiven Neurowissenschaften Entdeckten setzt die einschlägigen psychologischen Begriffe voraus.568 Tatsachenentdeckungen können nicht entscheiden, was Sinn ergibt. Sie entscheiden, was wahr ist – und das Wahre setzt das Sinnvolle voraus. Auf die Neurowissenschaften warten eine Menge gewaltiger Aufgaben. Sie sind bestrebt, die neuralen Bedingungen zu begreifen, die uns mit den spezifisch menschlichen Fähigkeiten ausstatten, die wir haben. Ihre Forschungen zu Empfindung, Wahrnehmung, Gedächtnis, Affektion und Wollen geben über diese Themen bereits Aufschluss. Die Leistungen der kognitiven Neurowissenschaften tragen dazu bei, dass wir immer besser verstehen, weshalb wir so sind, wie wir sind, warum wir die Vermögen haben, die wir haben, was deren empirische Grenzen bestimmt und was in unseren Gehirnen während ihrer Ausübung vor sich geht. Neurowissenschaftliche Fortschritte halten auch die Hoffnung aufrecht, dass es uns schließlich gelingen mag, unsere Lage zu verbessern und furchtbare Leiden, die bislang jenseits unserer Behandlungsmöglichkeiten lagen, zu heilen.
14.5 Weshalb das alles wichtig ist Zur Frage, wie es sich auf das nächste Experiment auswirken wird Wir können uns einen Wissenschaftler vorstellen, der unsere analytische Erörterung liest und einigermaßen verblüfft ist. Er könnte ein gewisses Interesse für manche unserer verbindenden Analysen haben und sich dennoch von den scheinbar endlosen logischen Abwägungen verunsichert fühlen. ‚Ist all das wirklich wichtig?‘, könnte er sich fragen, wenn er unsere eingangs formulierten Darlegungen zur Kenntnis genommen hat. ‚Wie wird sich das denn auf das nächste Experiment auswirken?‘, könnte er weiterfragen. Wir hoffen, dass keiner der Leser, die uns bis hierher gefolgt sind, diese Frage in 568
Was freilich nicht heißt, dass einzelne Neurowissenschaftler kein philosophisch-analytisches Fachwissen erwerben könnten und zur Begriffklärung nichts beizutragen hätten.
554
14 Methodologische Reflexionen
sich aufkommen fühlt. Denn das würde nicht gerade darauf hindeuten, dass unser Anliegen richtig erfasst wurde. Wir beschäftigen uns nicht damit, ob sich unsere analytischen Überlegungen auf das nächste Experiment auswirken werden oder nicht. Mag sein, mag nicht sein – ob sie sich auswirken, hängt von der Art des in Erwägung gezogenen Experiments und den Vorannahmen der Neurowissenschaftler ab. Unsere Darlegungen sollten klargemacht haben, dass, wenn unsere Argumente zwingend sind, auf einige Experimente am besten verzichtet werden sollte (siehe z. B. unsere Erörterung der Willkürbewegungen in 8.2). Andere bräuchten ein neues Design (siehe z. B. unsere Erörterung des bildlichen Vorstellens in 6.3.1). Auf die meisten wird es keinen Einfluss haben, obgleich die aufgeworfenen Fragen möglicherweise umgeschrieben und die Resultate anders als bislang beschrieben werden müssten (siehe z. B. 14.3). Uns geht es darum, das letzte Experiment zu verstehen Uns ging es nicht um das Design des nächsten Experiments, sondern vielmehr darum, das letzte zu verstehen. Allgemeiner gesagt tragen Begriffsuntersuchungen in erster Linie zum Verständnis des Bekannten bei und dazu, die auf das noch Unbekannte bezogenen Fragen klar zu formulieren. Es würde rein gar nichts ausmachen, wenn sich unsere Überlegungen nicht auf das nächste Experiment auswirkten. Sie wirken sich allerdings beträchtlich auf die Interpretation der Resultate früherer Experimente aus. Und sie haben ganz gewiss etwas beizutragen, wenn es darum geht, Fragen aufzuwerfen, sie zu formulieren und zwischen sinnvollen und verworrenen Fragen zu unterscheiden. (Wenn wir Recht haben, dann rühren die Erwägungen zum ‚Bindungsproblem‘, verstanden als die Frage danach, wie das Gehirn Bilder hervorbringt, zumeist von Verwirrungen her (siehe 4.2.3) und geht ein großer Teil der Debatte über das bildliche Vorstellen in die Irre (siehe 6.3 und 6.3.1).) Ist all das wichtig? Wenn Verstehen wichtig ist, dann ja Ist all dies offenkundig logische Abwägen, dieses detaillierte Erörtern von Worten und ihren Verwendungen wichtig? Brauchen die Neurowissenschaften das wirklich? Wenn hinter dem neurowissenschaftlichen Projekt der leidenschaftliche Wunsch steckt, neurale Phänomene und ihren Zusammenhang mit psychischen Fähigkeiten und deren Ausübung zu verstehen, dann ist es überaus wichtig. Denn unabhängig davon, wie brillant die neurowissenschaftlichen Experimente ausgetüftelt und wie verfeinert ihre technischen Verfahren auch sind – die Wissenschaftler werden das, was sie verstehen wollten, nicht verstanden haben, wenn ihre Fragestellungen begriffliche Unklarheiten aufweisen oder in den Beschreibungen ihrer Resultate begriffliche Irrtümer stecken. Die meisten im Bereich der kognitiven Neurowissenschaften arbeitenden zeitgenössischen Neurowissenschaftler stimmen darin überein, dass Sir John Eccles’ Befürwor-
14.5 Weshalb das alles wichtig ist
555
tung einer Form des Dualismus (siehe 2.3) ein Fehler war – und was die Eccles’sche Position zu einem Irrtum macht, ist eine Begriffsverwirrung. Wir haben anhand einer Reihe von Theorien hervorragender zeitgenössischer Neurowissenschaftler nachzuweisen versucht, dass das begriffliche Fehlgehen eine weit verbreitete Erscheinung ist und durch eine vordergründige Ablehnung des cartesianischen Dualismus keineswegs aus der Welt geschafft wurde. Es beeinflusst und beeinträchtigt die Überzeugungskraft der aufgeworfenen Fragen, den Aufbau der zu ihrer Beantwortung ersonnenen Experimente, die Verständlichkeit der Beschreibungen ihrer Resultate und die Kohärenz all dessen, was daraus gefolgert wurde. Und das ist sicherlich wichtig: sowohl für das Verständnis des von den zeitgenössischen Neurowissenschaftlern bereits Geleisteten als auch für den weiteren Fortschritt der kognitiven Neurowissenschaften. Weshalb es für die interessierte Allgemeinheit wichtig ist Auch im Hinblick auf die interessierte Allgemeinheit ist es außerordentlich wichtig. Denn unabhängig davon, ob bestimmte Neurowissenschaftler verwirrt sind, ist es fraglos so, dass die von ihnen verwendeten Beschreibungsformen die interessierten Laien in Verwirrung stürzen. Die Neurowissenschaftler haben verständlicherweise ein Interesse daran, das von ihnen in den letzten Jahrzehnten erworbene Wissen über die Funktionsweise des Gehirns weiterzugeben und die Allgemeinheit an der Erregung teilhaben zu lassen, die ihnen in der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand zuteil wird. Die Flut von Büchern, verfasst von zahlreichen hervorragenden Vertretern des Metiers, macht das deutlich. Indem sie jedoch davon sprechen, dass das Gehirn denkt und folgert, dass eine Hemisphäre etwas weiß und die andere davon nicht in Kenntnis setzt, dass das Gehirn ohne das Wissen der Person Entscheidungen trifft, dass Vorstellungsbilder im geistigen Raum bzw. in der Vorstellung gedreht werden und so weiter, leisten diese Neurowissenschaftler Mystifizierungstendenzen Vorschub und kultivieren eine Neuromythologie, was sehr zu bedauern ist. Denn das hat erstens zur Folge, dass das Verständnis des Laienpublikums leidet, statt wie avisiert zu profitieren. Zweitens werden die Laien bei den Neurowissenschaften nach Antworten suchen, nach Antworten auf Pseudo-Fragen, die gar nicht hätten aufgeworfen werden sollen und die von den Neurowissenschaften nicht beantwortet werden können. Ist die Allgemeinheit erst einmal all ihrer trügerischen Hoffnungen beraubt, wird es die echten, wirklichen Fragen, die die Neurowissenschaften aufwerfen und auch beantworten können, übergehen. Und das ist alles andere als unwichtig. Zur Notwendigkeit begrifflicher Klarheit Wir haben in diesem Buch nachzuweisen versucht, dass es für die Neurowissenschaften ebenso wichtig ist, die Begriffsstrukturen zu klären wie sich Klarheit über die experimentellen Methoden zu verschaffen. Was Neurowissenschaftler für unser Verständnis
556
14 Methodologische Reflexionen
der biologischen Wurzeln menschlicher Fähigkeiten und ihrer Ausübung Großes geleistet haben, wird von solcher Klärungsarbeit nicht heruntergespielt, sondern in seiner Tragweite erhellt. Denn erst wenn die langen Schatten, die von den Begriffsverwirrungen geworfen werden, verscheucht sind, können die neurowissenschaftlichen Leistungen angemessen gewürdigt werden.
Personen- und Sachregister Ackrill, J. L. 16 Anm. Adrian, E. D. 59–62, 315 Affektionen 266f., 271 Akt, Wollens- siehe Willen, Akt des -s Albright, T. D. 321 Alltagspsychologie 314, 496–498, 502, 504–506, 511f. Analogie, hydrodynamische 96, 100 Analyse, verbindende 514, 541 Anm., 543 Aristoteles 13–24, 28–31, 33f., 38, 54f., 66, 91 Anm., 211, 279, 315, 440, 516 Attribute/Prädikate, psychologische 87–115, 127–136, 145–157, 314, 496–502, 508–510 Aufhebbarkeit 107 Aufmerksamkeit 119, 334f., 341, 347–349 Ablenkung der 159 Anm., 422 Anm. Augustinus 57 ‚Außenwelt‘ 89 Anm. Automatismus, epileptischer 76, 78, 83, 85, 327, 329, 519 Avicenna 28 Baars, B. J. 354, 429, 443 Anm. Bain, A. 68 Barlow, H. 187f., 416, 423 Beck, A. 51f. Bedeutung 459 Wandel der 521, 523f. psychologischer Worte 127–136 Beeinträchtigungen, emotionale 270–275, 278, 296 Begreiflichkeit 520 Begriffe 6–9, 78, 84, 392f., 457–462, 467f., 498–502 psychologische siehe Attribute/Prädikate, psychologische theoretische 498–502, 509f. verfügen über 424 Anm., 460–462, 470
Behaviorismus 106 Anm., 154 Bei-Bewusstsein-Sein, Gefühl des -s 324 Anm. Beispiele 128–130, 392f. Bell, C. 43, 45–48 Bemerken 253, 335f., 341 Bennett, M. R. 5, 25, 34, 45, 216 Bentham, J. 305 Benton, A. L. 28 Anm. Beschreibung 122 Anm., 189–193, 221, 385, 387–392 von Qualitäten 388f. Beschreibung im Gehirn, symbolische 89, 98f., 191 Anm. Betts, G. H. 259 Bewegung unwillkürliche 36, 41, 304 willkürliche 66f., 303–305, 308–313 Bewusstlosigkeit 328–330 Bewusstsein 33, 49, 61f., 112f., 321–366, 396–436, 441, 453f., 457, 538f., 546f. Affektions- 337f., 343, 350 cartesianische Konzeption des -s 352 Etymologie des -s 345 Anm. evolutionärer Wert des -s 416–425 evolutionäres Erscheinen des -s 410–412 Handlungs- 339f., 351 intransitives 328–333 kinästhetisches 336f. Problem des -s [problem of awareness] 425–428 rätselhaftes/geheimnisvolles 324f., 327f., 412f. Reflexions- 338f., 343, 350f. somatisches 336, 343, 349, 422 transitives 333–351, 355, 431f., 453f. Wahrnehmungs- 335f., 343, 358, 421f. der Tiere siehe Tiere, Bewusstsein der -szustände 331
558
Personen- und Sachregister
und Erfahrung 352–358, 535 und objektive Wirklichkeit 397–409 und physische Prozesse 402–406, 409–415 und Wissen 341, 345–349, 428f. von Motiven 338 Bild, mentales siehe Vorstellungsbild Bild, visuelles siehe auch Vorstellungsbild 181– 188, 413 Blakemore, C. 88, 97, 101–104, 112, 179, 200f., 243, 425, 446f., 449f., 482, 515, 525–527 Blindsehen 22, 72 Anm., 534–537 Block, N. 366, 370 Boyle, R. 169, 391, 399, 551f. Broca, P. 48f. Bruner, J. 525 Cajal, R. y 73 Carnap, R. 483 Anm. Carroll, L. 242 Anm. Cartesianismus 32–38, 41, 54f., 58–62, 66, 75, 79, 85, 87, 92f., 109f., 136, 145–149, 315–318, 353, 397, 423, 429, 431, 438–440, 446, 524 und die Neurowissenschaften der Gegenwart siehe Neurowissenschaften, Krypto-Cartesianismus der Caton, R. 51 Chalmers, D. 323f., 355, 366, 370, 374, 382f., 398, 407, 416 Charakterzüge, emotionale/emotionsbezogene 271f. Chomsky, N. 136, 484 Churchland, P. M. 156 Anm., 314 Anm., 496 Churchland, P. S. 156 Anm., 314 Anm., 496, 516–520, 522f. Cicero 24 Code 102, 222 Cohen, N. 205 Collins, A. W. 231 Anm. Computer 76–79, 84, 98, 118, 151, 189, 201, 219, 476 Cooper, L. A. 262f. Craik, K. 447 Crick, F. 5, 70 Anm., 73, 87, 97, 110 Anm., 113, 167, 181f., 184f., 191 Anm., 200, 202, 230,
324, 354, 384, 394, 428f., 430 Anm., 481f., 485, 487f., 527f., 530, 539, 546–548, 550 Damasio, A. 5, 88, 111, 113 Anm., 117, 181f., 220 Anm., 271, 283–291, 317, 323, 367, 373, 410, 413 Anm., 445, 448, 450, 457 Dauer, echte 360 Davies, M. 369 da Vinci, L. 29 Dawkins, R. 506 Definition hinweisende 127–131, 392–394 private hinweisende 128–131, 175f., 392f. Demokrit 483 Denken [thinking] 33, 56f., 108, 121, 156f., 232–240, 381, 438f., 451, 463–469 Erwerb des Begriffs des -s 134f. in Bildern 288, 463, 465–469 in Sprache 463, 465–467 Denken [thought] 33, 466f. Grenzen des -s 454, 469 Ort des -s 239 und Sprache 456–469 von Tieren siehe Tiere, Denken der Dennett, D. 323f. Descartes, R. 19, 29, 32–38, 40f., 43f., 55, 58f., 61, 65f., 69, 79, 83 Anm., 87, 136, 145, 147, 151, 169, 194, 305, 315f., 318, 325, 352, 391, 399, 414, 423, 429, 430 Anm., 438, 440–442, 448, 450 Anm., 485 Anm., 520, 524, 547 Anm., 551f. Diderot, D. 481 Anm. Disposition/Veranlagung 81, 154, 206, 297, 302, 316, 327, 333, 354, 361, 437, 475 Dissoziation funktionale 139, 531 von Fähigkeiten 531 von Funktionsstörungen 534 Doty, R. W. 530, 533 du Petit, F. P. 42 Dualismus 19, 54, 57f., 60, 63, 65, 67f., 72, 83, 85, 87, 92f., 145, 148, 315, 440, 484, 519f., 555 platonischer 57f., 440 Dupré, J. 483 Anm.
Personen- und Sachregister Eccles, J. 3, 36, 62–73, 76, 79, 92, 315, 554f. Edelman, G. 5, 88, 111, 113, 172, 182, 239, 321, 323, 354, 367, 369f., 373, 380, 385, 428, 443 Anm., 457, 461, 470, 473, 538–540, 546–548, 550 Ego, das 59–62, 438–440, 443 Anm., 449f., 471, 545 Eigenschaften emergente 487 repräsentationale/nichtrepräsentationale 257f. Einstein, A. 5, 458, 466, 469 Einstellung 373–376 Einstellungen, emotionale 271–274, 290 Elisabeth von Böhmen 59 Emotion 266–301, 317, 456 Dauer der 275 Gründe für 297f. Lernen der 286 Objekte der 277, 279, 291–294 somatische Begleiterscheinungen der 281f., 286, 288, 299 Ursachen der 297f. Wahrnehmbarkeit der 299 der Tiere siehe Tiere, Emotionen der und Motive 273f., 300f. Empfindung 56, 95 Anm., 125f., 131, 158–164, 168f. Fühlen einer 126, 158 kinästhetische 336f. Ort der 160 visuelle 534–537 ‚- im Sensorium‘ 6, 175 Englische (das), angebliche Unzulänglichkeit des -n 515, 525f. Engramm siehe Gedächtnisspur Entitäten, abstrakte 64f. Epilepsie, Penfields Arbeit zur 73f. Epiphänomenalismus 419 Erfahrung 113f., 356–358, 370–385, 391–394 Beschreibung der 385–388 bewusste 355–361, 368–374, 376, 380–395, 402, 410, 451, 535
559
Einheit der 69f., 72 epistemische Privatheit von 111, 250 Anm., 323, 327, 331, 386, 398 Inhalt der 382 Namen der 132 ‚Privatbesitz‘ von 109, 111, 123–126, 324, 387, 399, 536 subjektive Verfasstheit der siehe Qualia Unbeschreibbarkeit der 387–395 Erinnern; sich erinnern, wie/sich erinnern, dass 205, 207f. Erkennen 213f., 219, 246, 262–265, 342 Anm. Erkennensfähigkeiten 433, 461f. Erregungen 270, 297f. Erste-Person-Pronomen 439, 447, 449f., 452, 471–474 Escher, M. 242 Anm. Evidenz, unmittelbare/mittelbare 121f. Façon de parler 4, 80, 138, 167, 373, 400, 485, 515, 530 Anm. Fähigkeit siehe auch Vermögen 197–199, 208, 217, 361 Auftauchen/Erwachen einer 418 Anm. Faktivität 344 Fantasie 244–253, 255, 273–276, 278, 282 Farbe 6, 126 Anm., 130, 169–178, 382–384, 386, 389, 392f., 540f., 551f. Fernel, J. 29–32, 35, 54 Ferrier, D. 50–52 Finke, R. A. 252, 263, 265 Fledermaus 368f., 377f. Flourens, M.-J.-P. 49 Foerster, O. 74 Form/Materie-Unterscheidung 15f., 19 Fortschritt 497f., 506f., 548 Foster, M. 48 Frege, G. 64, 111 Freud, S. 100 Frisby, J. P. 89, 99, 191 Anm., 324 Frith, C. D. 312 Fritsch, G. 48–50 Fühlen 116f., 156, 266f., 272, 279, 281–283, 288f., 291, 309, 337f., 369, 380
560
Personen- und Sachregister
Galen 13f., 25–27, 29, 34, 38, 44 Galilei, G. 32, 169, 175, 315, 391, 517, 520f., 551f. Galton, F. 250, 252, 256f., 259, 261f., 458, 466f. Galvani, L. 44f. Gassendi, G. 481 Anm. Gazzaniga, M. 4, 73, 100, 139f., 187, 202, 212, 217, 322, 527, 529f., 533 Gebrauch, Alltags-/gewöhnlicher 517–519, 521–524 Gedächtnis 77, 98, 203–227, 315f. deklaratives 98, 205–208 Erfahrungs- 204f., 207, 209 Habit- 206 nichtdeklaratives 205, 207–209 Objekt- 204f., 207 Objekte des -ses 204f., 209, 219f., 226 Tatsachen- 204f., 209 Gedächtnisbilder (mnemonisches Bilderheraufbeschwören) 204f., 220 Anm., 224 Gedächtniserfahrung (mnemonische Erfahrung) 225f. Gedächtniskreislauf (mnemonischer Kreislauf ) 216 Gedächtnisspeicherung 207, 209–227 Gedächtnisspur 211–217, 223, 225 Gehirn 3, 26–30, 36, 41–44, 48–53, 65f., 69f., 74–79, 87–90, 93f., 97, 101f., 108, 145f., 160, 184–188, 192, 201f., 210, 215–218, 221–224, 364–366, 482f., 487, 489f. Gehirn-Körper-Dualismus 145–149 Geist 2, 24, 66, 71f., 80–85, 136–140, 155, 485 Descartes’ Konzeption des -es 32–34, 136 Penfields Konzeption des -es 75–86 Sherringtons Konzeption des -es 55–59 über – verfügen 80f., 155 Geist anderer (Menschen), Wissen vom 112f., 121f., 128f., 420f., 428–436 Geist-Gehirn-Beziehung/Identität 3, 60–62, 65f., 68f., 71f., 75–78, 82, 139, 230f., 484, 488–491, 517 Geist-Körper-Interaktion 33f., 36f., 54–59, 148f., 440 Geisteszustände/mentale Zustände 121 Anm., 146, 361–366, 488f., 517
bewusste 354, 356–361, 370, 402 Ort der 489 Geräusch/Klang 170f., 337 Gesetze, psychologische 490f., 493 Gewissheit 229, 428f., 431 Gibson, W. G. 216 Glauben 84, 97, 105f., 121, 123f., 228–232, 241f., 277, 294, 362 Anm., 488 Erwerb des Begriffs des -s 134f. unbewusster 100, 363f. Glock, H.-J. 517 Glynn, I. 179, 215, 322, 324, 367, 369, 385, 388, 390, 409, 438, 545 Gosling, J. 308 Anm. Gray, C. 186 Greenfield, S. 90 Anm., 322 Gregory, R. 5, 89, 96, 179, 323 Grice, H. P. 516 Grünbaum, A. S. F. 52f. Gründe 196, 225f., 307f. für das Handeln 196, 424, 491f. Guainerio, A. 28 Hacker, P. M. S. 91 Anm., 122 Anm., 127 Anm., 176 Anm., 179 Anm., 193 Anm., 202 Anm., 308 Anm., 313 Anm., 444 Anm., 496 Anm., 517 Anm., 524 Anm. Hadamard, J. 418 Anm., 458, 466 Hall, M. 47, 52 Handlung Erklärung der 82, 307f., 311, 314, 487, 490–495, 504f., 509f. unwillkürliche 298 Anm., 302f., 310 willkürliche/willentliche 40, 67f., 298 Anm., 302f., 310f. Harvey, W. 32 Helmholtz, H. von 68, 178–181 Hemisphärektomie siehe Kommissurotomie Hemisphären des Gehirns, als Subjekte psychologischer Attribute 100f., 139f., 527–533 Hertz, H. 6 Hitzig, E. 48–50 Hobbes, T. 305, 458 Anm., 481 Anm. ‚höchster Gehirnmechanismus‘ 6, 77–79, 83
Personen- und Sachregister Hören 170f., 181, 337, 370f. Holbach, P.-H. T. d‘ 481 Anm. Homunkulus-Fehlschluss siehe auch mereologischer Fehlschluss 94 Anm. Horsley, V. 51 Hume, D. 259, 284, 305, 442 Humphrey, N. 112, 113 Anm., 117f., 409, 417, 424f., 446, 449f. Huxley, T. H. 409 Hyman, J. 257 Anm., 532 Anm., 534 Anm., 537 Hypothese 517–519 ‚Ich‘, das 55f., 59, 62, 438f., 443, 446, 449f., 471f. Identität, numerische/qualitative 111, 124f., 125 Anm. ‚in‘, unterschiedliche Lokativ-Verwendungen von 160f. Information 97f., 184–186, 190f., 193–196 Speicherung von 201f., 217–219 Überträger von 193f. innen/außen 109f., 115–117 Intention/beabsichtigen 67, 135, 363f. Intentionalität 281 Interpretation 102f. Introspektion 61, 109f., 112, 114, 117–120, 427, 437, 441f., 476, 536 Ivry, R. B. 212, 217 Jackson, J. H. 6, 50, 76, 101f. James, H. 283 Anm. James, W. 112, 212–214, 216, 283, 312f., 442f., 445, 450, 538, 542 James-Lange-Theorie der Emotionen 273, 283, 317 Jessell, T. M. 148, 169f., 173, 321 Johnson-Laird, P. N. 89, 118, 322f., 425, 447f. Joynt, R. 28 Anm. Kandel, E. R. 5, 98, 148, 169f., 173, 184f., 203, 205, 210, 214f., 321 Karten im Gehirn 97f., 101–104, 527 Kenny, A. J. P. 30 Anm., 91 Anm., 94 Anm., 245 Anm., 248 Anm., 283 Anm., 301 Anm., 308 Anm., 353 Anm., 488 Anm., 491 Anm.
561
Kind, Erwerb psychologischer Begriffe durch das 131, 133–135, 471–473, 501f. Klassifizierung 499f. Koch, C. 324 Kodieren 212, 217f., 221f., 225 Köhler, W. 213f. Kommissurotomie 63, 68f., 71 Fehlbeschreibung der Resultate der 100f., 139f., 202f., 527–533 Konfabulieren 528, 531 Kortex, motorischer 49f., 52f. Kortexlehre 38f. Kosslyn, S. M. 111, 250f. Kriterien 104–108, 195, 248f., 330, 451, 453f., 472, 488, 509f. La Mettrie, J. O. de 481 Anm. Lebensgeister siehe auch psychisches pneuma 34f., 38f., 59 Lebhaftigkeit/Lebendigkeit 259–261 LeDoux, J. 200, 209, 211, 278–282, 284, 317 Lewis, C. S. 345 Anm. Liaison-Gehirn 62, 65, 69f., 72, 76 Libet, B. 67, 73, 89, 112f., 148 Anm., 308–313, 318, 354 Llinás, R. 322 Locke, J. 148, 169, 178 Anm., 305, 315, 391, 399, 441f., 445, 448, 459 Anm., 551f. Lokalisierung, funktionale 6, 20, 26–28, 38f., 42, 48–53, 73f. Lomand, E. 368 Luciani, L. 534f., 537 Lukrez 483 Luria, A. R. 253f. Mach, E. 68 Magendie, F. 45–47 Malcolm, N. 192, 205 Anm., 218 Anm. Mangun, G. R. 212, 217 Marks, D. F. 259 Marr, D. 5, 89, 98f., 189–194 Materialismus eliminativer/Beseitigungs- 496–510 metaphysischer 481 Anm., 484 ontologischer 485f.
562
Personen- und Sachregister
Mathematik, der Philosophie gegenübergestellt 546f. McGinn, C. 322 Mensch/Person 3, 20, 33, 37f., 56f., 78, 80f., 90–92, 109, 146, 160, 180, 378–380, 430, 447, 450f., 475f., 483, 487f., 491f. Mereologie 94 mereologischer Fehlschluss 37, 87–110, 145f., 149, 190f., 215 Anm., 516–523, 525–527 bei Descartes 37f. bei Sherrington 56f. das Bewusstsein und die Bewusstlosigkeit betreffend 112f., 321–324, 330, 364–366, 403 das Denken betreffend 238f. das Gedächtnis betreffend 203 das Wissen betreffend 200–202 das Wollen betreffend 308–313 den Glauben betreffend 87f., 230f. die Kommissurotomie betreffend 100f., 139f., 202f., 527–533 die Vorstellungskraft betreffend 243 die Wahrnehmung betreffend 167f., 190f. Metapher 102f., 119, 515, 525f. Methodologie 95–104, 514–556 Metzler, J. 262 Meudell, P. R. 254 Miller, M. 529f. Milner, B. 98, 203, 205f., 210 Mistichelli, D. 42 Modell, geistiges 446–448, 482 Modellbildung 423–425, 446f., 473 Möglichkeit, logische 152, 521, 543f. More, H. 429 Anm. Motiv 270, 274, 300f., 338, 474f. unbewusstes 100f. Mozart, W. A. 417f. Müller, J. 48 Nagel, T. 155, 368f., 380, 385 Nemesius 12, 27f., 37 Neurowissenschaften (kognitive) 1–9, 145– 153, 537–556 Geschichte der 13–53
Krypto-Cartesianismus der 110–115, 145– 149, 315–318, 353f., 398f. Zuständigkeitsbereich der 1, 4, 493f., 497f., 550–556 und Epistemologie 540f., 550–553 und Handlungserklärung 4, 487f., 493–495 und Philosophie 537–556 und Psychologie 150 Newton, I. 6, 175 Objektive (das), Bereich des -n 399 Ochsner, K. N. 111, 250f. Oppenheim, P. 484 Anm. Penfield, W. 3, 6, 73–86, 92, 315 Penrose, R. 402, 416–419, 425, 426 Anm., 457f., 466–468, 476 Philosophie 514f., 541–549 apriorische Methoden der 538, 546 Fortschritt in der 548f. linguistic turn in der 516 Zuständigkeitsbereich der 2, 7, 545 und kognitive Neurowissenschaften 537–556 und Theorie 543f. Phobien 296 Anm. Physik 406–408, 484, 526 Standpunkt der 398, 407f. ‚Physiologia‘ 30 Physische (das), der Bereich des -n 404f. Platon 19, 57, 211 Platonismus 64f. pneuma 23f. psychisches 25f., 29, 34, 38 vitales 24f. Poincaré, H. 417 Polymorphität 237f. Popper, K. 63–65 Posner, M. I. 246f., 249, 263, 321 Privatheit siehe Erfahrung, epistemische Privatheit von und Erfahrung, Privatbesitz von Privatsprachenargument 127–136 Prochàska, J. 42, 44
Personen- und Sachregister Propositionen 64f. Prozess, physischer und bewusste Erfahrung siehe Bewusstsein und physische Prozesse psycheˉ 13–22, 26f., 30f., 32f., 54f. Psychologie, Alltags- siehe Alltagspsychologie Putnam, H. 484 Anm. Qualia 151, 366–370, 372, 380–395, 398f., 402, 406, 413f., 451, 549 Nichtmitteilbarkeit von 385–387, 428–430 Qualitäten Beschreibung von siehe Beschreibung von Qualitäten primäre und sekundäre 147f., 168–178, 183 Anm., 391f. Quine, W. V. O. 516 Rahman, F. 28 Raichle, M. E. 246f., 249, 263 Rätsel(haftigkeit)/Geheimnis 325f., 414f. Realisierung 336, 341, 346f. Reduktionismus 58f., 408f., 481–513 ableitender 484, 487, 490 eliminativer/Beseitigungs- 496–513 epiphänomenaler 482f. erklärender 81, 482–484, 486f., 493f. klassischer 483f. ontologischer 481–483, 486 Reflexe 31f., 35f., 40, 43f., 62f. in kortexlosen Tieren 43–45 Reflexion (Spiegelbild) 184 Anm. Reid, T. 259 Anm. Repräsentation/Darstellung 37, 98f., 103f., 187f., 211, 217–224, 259 interne 40, 98, 111, 191 Anm., 193f., 257f., 447 Repräsentationalismus 182f., 187f., 190f. Repräsentationen, geistige/mentale 152, 223f. Retinabild 36f., 150, 184, 414, 425 Richardson, J. T. E. 250 Anm. Rio-Hortega, P. del 73 Robinson, J. 216 Rock, I. 170 Anm. Rolls, E. T. 5, 267
563
Rosenthal, D. M. 333, 356 Rückenmark, anteriore und posteriore Wurzeln des -s 45–47 Rückenmarksseele 6, 24, 44–47, 52 Rundle, B. 138, 232 Anm., 491 Anm. Russell, B. 62 Ryle, G. 199, 205 Anm., 407 Anm. Savage-Rumbaugh, S. 92 Scheinwerfer-Hypothese 70 Anm. Schiller, Francis 62 Schlaf 328f. Schluss, unbewusster 179–181 Schmerz 105–108, 115f., 119, 121–126, 129– 132, 158–164, 371, 394f., 422, 432–434, 452, 471f. Ausdruck des -es 105f. ‚Besitz‘ des -es 124f. Erwerb des Begriffs des -es 131–133 Identitätskriterien des -es 123–126 Ort des -es 124, 160f. Phantom-/ausstrahlender 162 Subjekt des -es 123f., 160 -verhalten 105–108, 432 Schrödinger, E. 54 Anm. Schwartz, J. H. 148, 169f., 173 Searle, J. 111f., 123, 159f., 322–324, 330 Anm., 332, 354f., 362f., 366, 368, 370f., 374, 397f., 419f. Seele 25f., 28, 30, 32f., 40f. aristotelische Konzeption der siehe psycheˉ Interaktion der – mit dem Körper 32f., 36, 40 Unsterblichkeit der 28, 30, 40 Sehen 37, 105f., 173–179, 182f., 187, 189–194, 370f., 382f., 385f., 400, 413–415, 534–537 Selbst, das 59, 437–444, 452, 457f. Identitätskriterien für das 440, 450 Anm. Täuschung über das 448–452 ‚Selbst der Selbste‘ 443 Selbstbewusstsein 33, 69f., 327, 340, 437–452, 469–477 Grenzen des -s 474f. und Selbstabtastungsmechanismus 476f. und Sprachfähigkeit 453–566, 474
564
Personen- und Sachregister
Selbsterkenntnis 475 Sellars, W. 507 Sensorium communis siehe Sensus communis Sensus communis 20–23, 28, 31, 36, 40–42, 44, 69 Shepard, R. 247f., 254, 262f. Sherrington, C. 3, 6, 13, 32, 43, 48, 52–59, 62f., 73, 75, 78f., 92, 181f., 315 Singer, W. 29 Anm., 69, 186 Sinn, Grenzen des -s 8, 152, 541–544 Sinn/Unsinn 8, 520f., 541f., 544, 553 Sinne/Sinnesvermögen 20–23, 165, 193f. Sinnesobjekte, eigentümliche/gemeinsame 21 Sinnesorgan 20, 193, 252 Somatische-Marker-Hypothese 285f., 290 Sorge tragen für etwas 291, 293f. Speicherung 211f., 217–219, 226 Sperry, R. W. 4, 63f., 68–71, 73, 100f., 140, 527–533 Split-Brain, Beschreibung der Resultate des siehe Kommissurotomie Sprachbeharrung 518, 522–524 Sprache, Alltags-/gewöhnliche 516–519, 521–524, 526, 542–545 Sprachverwender 276, 280, 313, 424f., 453–477, 510 Sprechen, mit Überlegung 463–465 Squire, L. R. 5, 98, 203, 205f., 210, 214f. Standpunkt/Betrachtungsweise der Physik siehe Physik, Standpunkt der Standpunkt, objektiver 398, 407f. Stimmungen 270f. Stitch, S. 496 Strawson, P. F. 514 Anm. Stroud, B. 176 Anm. Stuart, A. 43 Subjektive (das), Bereich des -n 399f., 402 Subjektivität 123–126, 397–409 Substanz 15f., 33f., 439 immaterielle 19f., 32–34, 58f., 68–73, 78–86, 438–440, 485 Sutherland, S. 322 Symbol 98f., 192, 201 Anm. Systeme, physikalische/materielle 402–406
Theorie/theoretische Termini 498–505, 507–510, 516 Anm., 518f., 523, 543, 548 Theorie der Handlung, ideomotorische 68, 313 Thomas von Aquin 30, 57 Tiere 198f., 421–425, 453–456 Bewusstsein der 422–425, 429, 435f., 444f., 454f., 469f. Denken der 455, 468 Emotionen der 276f., 280–282, 469–471 Verlangen der 455f. und Begriffsbesitz 461f. ‚Time-on‘-Theorie 163f. Tononi, G. 111, 239, 321–323, 367, 369f., 373, 380, 457, 461, 538f., 546 Tradition, hippokratische 20 Anm. Traum 332 Anm., 357 Triebe 267–269 Turing, A. 447 Tyndall, J. 409, 415 Überwachen 535–537 neurales 70 Anm., 118 Ullman, S. 96, 98–100, 191 Anm. Unsinn 95, 101, 175, 325f. Ventrikel 26–29, 31, 34–36 -lehre 27–29, 35, 38 Veranlagung siehe Disposition Vergessen 196, 207, 209 Vergnügen/Genuss 371f. Verlangen 267f., 300, 311 unbewusstes 100 Vermögen 17, 150, 155, 166, 197, 304, 361 Verstand, aktiver 20 Anm. Verstehen 460, 508f. blitzartiges 418 Verwendung, Alltags-/gewöhnliche siehe Gebrauch Vesalius, A. 29, 38 Vorstellbarkeit 520f. Vorstellungsbild 211f., 220 Anm., 224, 241–265, 283f., 288, 316f., 457, 459, 467 Abtasten des -es 249 Drehung des -es 261–265
Personen- und Sachregister Lebendigkeit des -es 259–261, 284 und Denken 458–460, 463, 466–469 und Wahrnehmung 36, 181–188, 250–261 Vorstellungskraft 240–265 Vortäuschung/etwas vorgeben 331 Wahrnehmung 20–23, 31, 34, 40, 118, 164– 194, 221f., 240f., 247, 253, 256, 335f., 358, 371, 400, 426f. Kausalauffassung der 173–177 Neuron-Konzeption der 187 Objekte der 169f., 182f. Organ der 164f. periphere 349, 421f. Verhaltenskriterien für 166f. visuelle 534–537 als Hypothesenbildung 178–181 als Informationsverarbeitung 189–194 -sprozesse 427 und Empfindung 165, 168f., 174f. und Kognition 165, 347f. und Willkürlichkeit 166 Wandel 15f. Weiskrantz, L. 70 Anm., 118, 429, 476 Anm., 534–537 White, A. R. 198 Anm., 199 Anm., 242 Anm., 301 Anm., 308 Anm., 333 Anm., 341 Anm., 491 Anm. Whitehead, A. N. 171 Whytt, R. 43, 45 Willen, Akt des -s 65–68, 148, 405–407 Willis, T. 29, 38–41, 43 Wissen 195–203, 208, 228f., 277, 294f., 341, 363, 551
565
Bewahrung des -s 203f., 208–211, 217–219, 226 das Enthalten von 201f. Empfang/Aufnehmen von 341, 347–349 Erwerb von 97, 200, 220f. Grenzen des -s 454 Speicherung des -s 209f. unmittelbares/mittelbares 121f. über – verfügen 201f. der Wortbedeutung (diese kennen) 459 und Fähigkeit 195–197 und Zustand 195f. Wissen, dass 197, 205 Anm. Wissen, wie, und fähig sein 197–199 Wissenschaft 2, 5f., 506–509, 543, 548 Wittgenstein, L. 91, 101, 115f., 127–136, 138, 308 Anm., 313 Anm., 332f., 360 Anm., 382f., 404f., 412, 420f., 443 Anm., 490, 514, 525 Wolford, G. 529f. Wollen 302–308, 317f. Wren, C. 39 Wright, G. H. von 491 Anm. Wundt, W. 68, 443 Anm., 450 Wurtz, R. 5, 184 Young, J. Z. 88, 97–99, 102f., 179, 200–202 Zeki, S. 90 Anm., 97, 201, 540, 548, 551f. Zirbeldrüse 36–38, 41, 66, 69, 440 Zombies 419 Zugang, privilegierter 109f., 112–114, 120– 122, 125, 327, 332, 398, 451, 535f. unmittelbarer/mittelbarer 120–122
![Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften: Mitarbeit:Gethmann-Siefert, Annemarie;Übersetzung:Walter, Axel [3 ed.]
3534266374, 9783534266371](https://ebin.pub/img/200x200/die-philosophischen-grundlagen-der-neurowissenschaften-mitarbeitgethmann-siefert-annemariebersetzungwalter-axel-3nbsped-3534266374-9783534266371-k-3103352.jpg)

![Die Gravitation und die philosophischen Grundlagen der Physik [1 ed.]
9783428415410, 9783428015412](https://ebin.pub/img/200x200/die-gravitation-und-die-philosophischen-grundlagen-der-physik-1nbsped-9783428415410-9783428015412.jpg)
![Die ontologische Distanz. Eine Untersuchung zur Krisis der philosophischen Grundlagen der Neuzeit [1. ed.]
9783518587881](https://ebin.pub/img/200x200/die-ontologische-distanz-eine-untersuchung-zur-krisis-der-philosophischen-grundlagen-der-neuzeit-1nbsped-9783518587881.jpg)
![Die wissenschaftlichen und philosophischen Grundlagen der Tiefenpsychologie und der modernen Psychotherapie [1 ed.]
9783428446520, 9783428046522](https://ebin.pub/img/200x200/die-wissenschaftlichen-und-philosophischen-grundlagen-der-tiefenpsychologie-und-der-modernen-psychotherapie-1nbsped-9783428446520-9783428046522.jpg)

![System der philosophischen Ethik und Pädagogik: Vorlesungen über die Grundlagen der Ethik. Zweiter Band [3 ed.]
9783787338443, 9783787338351](https://ebin.pub/img/200x200/system-der-philosophischen-ethik-und-pdagogik-vorlesungen-ber-die-grundlagen-der-ethik-zweiter-band-3nbsped-9783787338443-9783787338351.jpg)