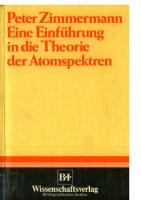Bildnerisches Denken: Eine Theorie der Bilderfahrung 9783839433317
How do we experience images? To answer this question it is necessary to know what images are: they only develop through
258 23 11MB
German Pages 328 [332] Year 2016
INHALT
VORWORT
1 EINLEITUNG
2 BILDER ERFAHREN
.1 Bild als »Picture« und »Image«
.1 »Picture« und »Image« in verschiedenen Bildtheorien
.2 Picture und Image in der Bilderfahrung
.3 Image als notwendige Bedingung
.2 Image in verschiedenen Bildtheorien
.1 Gegenständlichkeit des Image
.2 Sprachabhängigkeit des Image
.3 Alternativen
.1 Ungegenständliches im Image
.2 Sprachloses im Image
.4 Konsequenzen
.3 Bilderfahrung im Modell des Bildnerischen Denkens
.1 Entwicklung des Modells
.2 Abgrenzung des Modells
3 DENKEN
.1 Kriterien des Denkens: Abstraktion und Konkretion
.1 Traditionelle Kriterien: Begrifflichkeit und Abstraktion
.1 Begrifflichkeit des Denkens
.2 Abstraktion als Voraussetzung für Begrifflichkeit
.3 Begrifflichkeit und Abstraktion in der klassischen Abstraktionstheorie
.4 Begrifflichkeit und Abstraktion in der modernen Abstraktionstheorie
.5 Abstraktion und Denken
.2 Herleitung des alternativen Kriteriums: Konkretion
.1 Das Begriffspaar »abstrakt« und »konkret«
.2 Voraussetzungen für Abstraktion
.3 Voraussetzungen in der klassischen Abstraktionstheorie
.4 Voraussetzungen in der modernen Abstraktionstheorie
.3 Konkretion als Denkleistung
.1 Konkretion als Aufmerksamkeit auf Verschiedenartiges
.2 Konkretion in verschiedenen Theorien des Denkens
.4 Abstraktion und Konkretion als komplementäre Kriterien
.2 Faktoren des Denkens: Vollzug und Gegenstandsbezug
.1 »Abstrakt« und »konkret« im absoluten und relativen Sinn
.1 Abstrahierender und konkretisierender Vollzug des Denkens
.2 Abstrakter und konkreter Gegenstandsbezug des Denkens
.3 Gliederung der Welt durch das Denken
.2 Absolut und relativ »abstrakt« und »konkret« in anderen Theorien
.1 Moderne Abstraktionstheorie
.2 Immanuel Kant
.3 Absolute »Dichte« und relative »Fülle« bei Nelson Goodman
.1 Absolut »dicht« versus absolut »konkret«
.2 Relativ »voll« versus relativ »konkret«
.3 »Dichte« und »Fülle« im Bildnerischen Denken
.3 Konkretisierender Vollzug in alternativen Theorien des Denkens
.1 John Dewey
.1 Deweys Konzept der ästhetischen Erfahrung
.2 Konkretisierender Vollzug des Denkens bei Dewey
.2 Wolfgang Welsch
.1 Welschs Konzept von Vernunft und Rationalität
.2 Konkretisierender Vollzug des Denkens bei Welsch
.3 Konkretisierendes Denken bei Dewey und Welsch
.4 Abstrahierendes und konkretisierendes Denken
.1 Faktoren des Denkens im Überblick
.1 Gegenstand des Denkens
.2 Vollzug des Denkens
.2 Das Bild als Gegenstand des konkretisierenden Denkens
.1 Bilder und visuelle Medien
.2 Bilder und Schemata
3 Kombinationen von abstrahierendem und konkretisierendem Denken
4 DAS BILDNERISCHE
.1 Bilder betrachten
.1 Das Betrachtete
.1 Bild und Bildwerk
.2 Visuelle und plastische Wahrnehmung
.2 Der Betrachter
.3 Das Betrachten
.1 Wahrnehmen
.2 Zusammensetzen
.3 Verbinden
.4 Die drei Funktionen als Bedingungen der Bildbetrachtung
.5 Die Bildrelation
.6 Der enge Bildbegriff: materielle Bilder
.2 Bilder gestalten
.1 Notwendige Bedingungen
.1 Wahrnehmen
.2 Zusammensetzen
.3 Verbinden
.4 Funktionen 1-3 als notwendige Bedingungen
.2 Funktion 4 als hinreichende Bedingung
.1 Erfinden als Vorstellen
.2 Erfinden beim Bildgestalten
.3 Die vier Funktionen als Bedingungen der Bildgestaltung
.4 Der weite Bildbegriff: mentale Bilder
5 BILDNERISCHES DENKEN
.1 Begriffsgeschichte
.1 »Bildnerisches Denken« in der Philosophie
.2 »Bildnerisches Denken« in der Kunstpädagogik
.3 Abgrenzung zum Modell des Bildnerischen Denkens
.2 Konkretisieren in den vier Funktionen
.1 Funktion Wahrnehmen
.1 Bildnerisches Wahrnehmen
.2 Nicht-Bildnerisches Wahrnehmen
.2 Funktion Zusammensetzen
.1 Bildnerisches Zusammensetzen
.2 Nicht-Bildnerisches Zusammensetzen
.3 Funktion Verbinden
.1 Bildnerisches Verbinden
.2 Nicht-Bildnerisches Verbinden
.4 Funktion Erfinden
.5 Bildnerisches Denken als Konkretisieren in den vier Funktionen
.3 Kategorisierung von »abstrakten« und »konkreten« Bildern
1 »Abstrakter« und »konkreter« Gegenstand des Bildnerischen Denkens
.1 Gegenstand des Wahrnehmens
.2 Gegenstand des Zusammensetzens
.3 Gegenstand des Verbindens
.4 Gegenstand des Erfindens
5 »Abstrakte« und »konkrete« Bilder im Modell des Bildnerischen Denkens
.2 »Abstrakte« und »konkrete« Bilder bei anderen Autoren
.3 Die Kategorisierungen im Modell des Bildnerischen Denkens
6 BILDERFAHRUNG ALS BILDNERISCHES DENKEN
VERZEICHNISSE
Literatur
Abbildungen
Tabellen
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Goda Plaum
File loading please wait...
Citation preview
Goda Plaum Bildnerisches Denken
Image | Band 88
Goda Plaum (Dr. phil.), geb. 1977, hat in Nürnberg und Erlangen Bildende Kunst und Philosophie studiert und beides mit dem Zweiten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien abgeschlossen. Neben ihrer Lehrtätigkeit am Institut für Kunsterziehung der Universität Regensburg sowie an einem Nürnberger Gymnasium promovierte sie im Fach Philosophie an der Universität Erlangen-Nürnberg mit ihrer Arbeit »Bildnerisches Denken«.
Goda Plaum
BILDNERISCHES DENKEN Eine Theorie der Bilderfahrung
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften in Ingelheim am Rhein.
Der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg unter dem Titel »Bildnerisches Denken« zur Erlangung des Doktorgrades Dr. phil. vorgelegt von Goda Plaum aus Konstanz. Gutachter: PD Dr. Peter Bernhard, Universität Erlangen-Nürnberg und Prof. Dr. Klaus Sachs-Hombach, Universität Tübingen. Als Dissertation genehmigt von der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg. Tag der mündlichen Prüfung: 23.Januar 2015; Vorsitzende des Promotionsorgans: Prof. Dr. Christine Lubkoll.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2016 transcript Verlag, Bielefeld Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. Umschlaggestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld Umschlagabbildung: Goda Plaum: [o. T.], Ausschnitt, 30 x 30 cm, Öl auf Leinwand, 2004 Printed in Germany Print-ISBN 978-3-8376-3331-3 PDF-ISBN 978-3-8394-3331-7 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Besuchen Sie uns im Internet: http://www.transcript-verlag.de Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter:
[email protected]
Für meine Eltern
INHALT
VORWORT
XIII
1
EINLEITUNG
1
2
BILDER ERFAHREN
5
Bild als »Picture« und »Image«
7
.1
»Picture« und »Image« in verschiedenen Bildtheorien
9
.2
Picture und Image in der Bilderfahrung
14
.3
Image als notwendige Bedingung
17
Image in verschiedenen Bildtheorien
18
.1
Gegenständlichkeit des Image
19
.2
Sprachabhängigkeit des Image
26
.3
Alternativen
28
.1
.2
.1 Ungegenständliches im Image
29
.2 Sprachloses im Image
34
Konsequenzen
42
Bilderfahrung im Modell des Bildnerischen Denkens
44
.1
Entwicklung des Modells
45
.2
Abgrenzung des Modells
48
.4 .3
VIII | Bildnerisches Denken
3 .1 .1
DENKEN
51
Kriterien des Denkens: Abstraktion und Konkretion
52
Traditionelle Kriterien: Begrifflichkeit und Abstraktion
52
.1 Begrifflichkeit des Denkens
52
.2 Abstraktion als Voraussetzung für Begrifflichkeit
56
.3 Begrifflichkeit und Abstraktion in der klassischen
61
Abstraktionstheorie .4 Begrifflichkeit und Abstraktion in der modernen
67
Abstraktionstheorie .5 Abstraktion und Denken .2
Herleitung des alternativen Kriteriums: Konkretion
77 78
.1 Das Begriffspaar »abstrakt« und »konkret«
78
.2 Voraussetzungen für Abstraktion
87
.3 Voraussetzungen in der klassischen
90
Abstraktionstheorie .4 Voraussetzungen in der modernen Abstraktionstheorie .3
Konkretion als Denkleistung
97 105
.1 Konkretion als Aufmerksamkeit auf Verschiedenartiges 105 .2 Konkretion in verschiedenen Theorien des Denkens .4 .2 .1
111
Abstraktion und Konkretion als komplementäre Kriterien
119
Faktoren des Denkens: Vollzug und Gegenstandsbezug
121
»Abstrakt« und »konkret« im absoluten und relativen Sinn
121
.1 Abstrahierender und konkretisierender Vollzug des
122
Denkens .2 Abstrakter und konkreter Gegenstandsbezug des
126
Denkens .3 Gliederung der Welt durch das Denken .2
Absolut und relativ »abstrakt« und »konkret« in anderen Theorien
128 131
.1 Moderne Abstraktionstheorie
131
.2 Immanuel Kant
132
Inhalt |
.3
.3
.1
.2
.3 .4 .1
.2
.3
4 .1 .1
.2
Absolute »Dichte« und relative »Fülle« bei Nelson Goodman
IX
144
.1 Absolut »dicht« versus absolut »konkret«
145
.2 Relativ »voll« versus relativ »konkret«
147
.3 »Dichte« und »Fülle« im Bildnerischen Denken
149
Konkretisierender Vollzug in alternativen Theorien des Denkens
151
John Dewey
154
.1 Deweys Konzept der ästhetischen Erfahrung
155
.2 Konkretisierender Vollzug des Denkens bei Dewey
158
Wolfgang Welsch
161
.1 Welschs Konzept von Vernunft und Rationalität
161
.2 Konkretisierender Vollzug des Denkens bei Welsch
162
Konkretisierendes Denken bei Dewey und Welsch
164
Abstrahierendes und konkretisierendes Denken
167
Faktoren des Denkens im Überblick
168
.1 Gegenstand des Denkens
168
.2 Vollzug des Denkens
169
Das Bild als Gegenstand des konkretisierenden Denkens
170
.1 Bilder und visuelle Medien
170
.2 Bilder und Schemata
178
Kombinationen von abstrahierendem und konkretisierendem Denken
187
DAS BILDNERISCHE
191
Bilder betrachten
191
Das Betrachtete
194
.1 Bild und Bildwerk
196
.2 Visuelle und plastische Wahrnehmung
197
Der Betrachter
198
X
| Bildnerisches Denken .3
Das Betrachten
200
.1 Wahrnehmen
201
.2 Zusammensetzen
202
.3 Verbinden
205
.4
Die drei Funktionen als Bedingungen der Bildbetrachtung
210
.5
Die Bildrelation
212
.6
Der enge Bildbegriff: materielle Bilder
215
Bilder gestalten
217
Notwendige Bedingungen
218
.2 .1
.2
.1 Wahrnehmen
218
.2 Zusammensetzen
220
.3 Verbinden
222
.4 Funktionen 1-3 als notwendige Bedingungen
223
Funktion 4 als hinreichende Bedingung
225
.1 Erfinden als Vorstellen
226
.2 Erfinden beim Bildgestalten
230
.3
Die vier Funktionen als Bedingungen der Bildgestaltung
231
.4
Der weite Bildbegriff: mentale Bilder
233
BILDNERISCHES DENKEN
237
Begriffsgeschichte
238
.1
»Bildnerisches Denken« in der Philosophie
238
.2
»Bildnerisches Denken« in der Kunstpädagogik
244
.3
Abgrenzung zum Modell des Bildnerischen Denkens
252
Konkretisieren in den vier Funktionen
254
Funktion Wahrnehmen
255
5 .1
.2 .1
.1 Bildnerisches Wahrnehmen
255
.2 Nicht-Bildnerisches Wahrnehmen
258
Inhalt |
Funktion Zusammensetzen
.2
XI
258
.1 Bildnerisches Zusammensetzen
259
.2 Nicht-Bildnerisches Zusammensetzen
261
Funktion Verbinden
.3
262
.1 Bildnerisches Verbinden
263
.2 Nicht-Bildnerisches Verbinden
265
.4
Funktion Erfinden
268
.5
Bildnerisches Denken als Konkretisieren in den vier Funktionen
269
Kategorisierung von »abstrakten« und »konkreten« Bildern
270
.3
»Abstrakter« und »konkreter« Gegenstand des Bildnerischen 272 Denkens
.1
.1 Gegenstand des Wahrnehmens
274
.2 Gegenstand des Zusammensetzens
274
.3 Gegenstand des Verbindens
276
.4 Gegenstand des Erfindens
277
.5 »Abstrakte« und »konkrete« Bilder im Modell des
277
Bildnerischen Denkens .2
»Abstrakte« und »konkrete« Bilder bei anderen Autoren
277
.3
Die Kategorisierungen im Modell des Bildnerischen Denkens
281
BILDERFAHRUNG ALS BILDNERISCHES DENKEN
285
6
VERZEICHNISSE
289
Literatur
289
Abbildungen
308
Tabellen
312
VORWORT
Dieses Buch wäre ohne die Unterstützung nicht zustande gekommen, die ich durch mehrere Personen erhalten habe. Mein Dank gilt zunächst meinen beiden Betreuern. Peter Bernhard hat durch seine konstruktive Kritik entscheidend an meinem Denkfortschritt mitgewirkt, dessen Richtung ich dennoch immer selbst bestimmen konnte. Gleiches gilt für Klaus SachsHombach, auch wenn seine Betreuung erst später begonnen hat. Mein Dank gilt außerdem Christian Thiel, von dem ich in der Abschlussphase meiner Promotion zusätzlich entscheidende Unterstützung erhielt. Sebastian Zimlich ist ein weiterer Austauschpartner, dem ich viel verdanke. Er machte sich während vieler Stunden die Mühe, sich in meine Gedanken hineinzudenken und sie mitzudenken. Ebenso taten dies Silke Herzog und mein Vater, die für mich mehrere Tage zum Korrekturlesen opferten, wofür ich ebenfalls sehr dankbar bin. Meiner Familie und meinen Freunden möchte ich dafür danken, dass sie den Nährboden für die Reifung dieser Gedanken durch ihr Verständnis und ihren Beistand stets fruchtbar gehalten haben. Die Arbeit an diesem Buch wurde zwei Jahre lang von der StaedtlerStiftung durch ein Stipendium unterstützt. Goda Plaum Nürnberg im Frühjahr 2016
1 EINLEITUNG
Der Titel dieser Arbeit nennt das Thema, um das es geht: Es wird ein Modell des Bildnerischen Denkens1 entworfen, indem erklärt wird, was unter dem Bildnerischen Denken zu verstehen ist, was es leistet und was es nicht leistet. Außerdem wird gezeigt, warum es überhaupt nötig ist, ein Denken speziell als bildnerisch zu charakterisieren, und wie sich dieses Denken von anderem Denken unterscheidet. Der Entwurf des Modells ist dabei zweifach motiviert. Das Hauptanliegen besteht darin zu erklären, wie wir Bilder erfahren, genauer, wodurch eine Erfahrung zu einer Bilderfahrung wird. Da wir Erfahrungen mit Bildern nicht nur haben, wenn wir sie betrachten, sondern auch, wenn wir sie herstellen, müssen diese beiden Prozesse in den Blick genommen werden, um das Phänomen der Bilderfahrung vollständig zu erfassen. Eine Untersuchung des Prozesses der Bildproduktion kann zudem dazu beitragen, das Rezipieren von Bildern besser zu verstehen, da die bildspezifischen Denkprozesse viel offensichtlicher in der Bildgestaltung zu Tage treten als bei der Bildbetrachtung. Auch für die Bestimmung dessen, was Bilder sind, ist es ratsam, den Blick nicht nur auf die Rezeption von Bildern, sondern auch auf deren Produktion zu richten. Wenn man beispielsweise erfahren will, was Tango ist, bzw. den Tango als Tanz verstehen möchte, wendet man sich nicht an solche Personen, die sich nur gelegentlich Tango-Shows ansehen oder gerade an einem Anfängerkurs teilnehmen. Stattdessen sucht man sich als Ansprechpartner einen »Profi«, d. h. jemanden, der seit vielen Jahren selbst Tango tanzt oder diesen Tanz unterrichtet. Entsprechend verhält es sich, wenn man eine Sprache oder ein Musikinstrument verstehen
1
Um diese Neubegründung des Begriffs »Bildnerisches Denken« als Terminus technicus hervorzuheben, wird er im Folgenden großgeschrieben.
2
| Bildnerisches Denken
oder erlernen möchte. Daher scheint die Frage berechtigt zu sein, mit welcher Begründung bei der Untersuchung des Phänomens Bild der Prozess der Bildgestaltung meistens ausgeblendet wird. Im Gegensatz dazu legt dieses Buch den inneren Zusammenhang zwischen dem rezeptiven und dem produktiven Umgang mit Bildern offen. Beide Prozesse stellen den Betrachter bzw. Gestalter vor spezifisch bildnerische Probleme, die er bewältigen muss – und zwar durch Bildnerisches Denken. Ein Nebenanliegen, das die Kunstpädagogik als Fachgebiet betrifft, verfolgt dieses Buch nur indirekt, da es nicht als kunstpädagogische, sondern als philosophische Arbeit verfasst wurde. Für die Kunstpädagogik relevant ist dennoch die hier gelieferte Begründung einer bildspezifischen Denkart. Sie zeigt auf, dass unserem Umgang mit Bildern Denkprozesse zugrunde liegen, und dass dieses Denken nicht hierarchisch unterhalb des begrifflichen Denkens steht, sondern diesem gleichrangig ist. Eine solche Begründung liefert ein Argument gegen die Geringschätzung, die in unserem Bildungssystem der bildnerisch-praktischen Arbeit immer wieder droht: So wird der Wert des Schulfaches Kunst oft nur in Abhängigkeit zu den anderen Schulfächern anerkannt – beispielsweise als Ausgleichsfach oder als Fach, das die kognitiven Leistungen in den anderen Fächern unterstützen kann. Die vorliegende Arbeit bleibt der Kunstpädagogik allerdings die didaktische Aufbereitung des hier entwickelten Denkmodells schuldig. Sie könnte nur durch eine empirisch ausgerichtete Anschlussforschung geleistet werden. Der vorliegende Text ist – abgesehen von der EINLEITUNG (Teil 1) – in 5 Abschnitte gegliedert (Teile 2 bis 6). Teil 2 – BILDER ERFAHREN – entwickelt die zentrale Frage, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden soll. Außerdem wird die Argumentationsstruktur der folgenden Teile dargelegt, in denen das Modell des Bildnerischen Denkens entworfen wird. Teil 3 – DENKEN – behandelt dabei die übergeordnete Gattung, zu der das Bildnerische Denken gehört, während Teil 4 – DAS BILDNERISCHE – die spezifische Differenz dieses Denkens ausführt. Beide Teile werden schließlich in Teil 5 – BILDNERISCHES DENKEN – zusammengeführt. Teil 6 – BILDERFAHRUNG ALS BILDNERISCHES DENKEN – spannt den Bogen zu Teil 2 und fasst die in der Arbeit entwickelte Antwort auf die anfangs aufgeworfene Frage zusammen. Für Leser, die sich lediglich für das entworfene Modell des Bildnerischen Denkens ohne dessen Herleitung interessieren, genügt es, Teil 5 und eventuell die Zusammenfassung von Teil 3 (Kapitel 3.4) zu lesen. Wer darüber hinaus etwas über den Bezug des Modells zur Bildtheorie erfahren möchte, sollte sich mit den Teilen 2 und 4 beschäftigen. Diejenigen Leser, die sich
1 Einleitung |
3
hingegen nur für die Anbindung an die Theorie des Denkens interessieren, können sich auf Teil 3 beschränken. Allerdings soll keineswegs davon abgeraten werden, das gesamte Buch zu lesen.
2 BILDER ERFAHREN
Die Frage, die mit diesem Buch beantwortet werden soll, lautet: »Was ist eine Bilderfahrung?«. Sie fragt nach der spezifischen Differenz, die eine Erfahrung zu einer Bilderfahrung macht. Die Antwort auf diese Frage erklärt, wie wir Bilder erfahren. Dabei muss grundsätzlich zwischen zwei Prozessen unterschieden werden, in denen eine Bilderfahrung stattfinden kann: der Rezeption und der Produktion eines Bildes. Während die Sprachtheorie dem Produzieren von Sprache – also dem Bilden von Begriffen, dem Anwenden von Prädikaten oder dem Formulieren von Sätzen – ähnlich viel Aufmerksamkeit widmet, wie dem Rezipieren von Sprache, liegt hier in der Bildtheorie ein Ungleichgewicht vor. Die meisten philosophischen Bildtheorien thematisieren die Bilderfahrung ausschließlich als Erfahrung der Bildrezeption. In dieser Arbeit werden hingegen beide Arten berücksichtigt. Die Bilderfahrung in der Produktion eines Bildes wird im Folgenden »Bildgestaltung« genannt. Hingegen wird die Bilderfahrung beim Rezipieren eines Bildes als »Bildbetrachtung« bezeichnet. Beides sind Prozesse des Bildnerischen Denkens. Mit dieser Begrifflichkeit setzt sich das Modell des Bildnerischen Denkens von solchen Theorien ab, die die Bilderfahrung in der Rezeption als »Bildwahrnehmung« bezeichnen.1 Aus zwei Gründen wird diese Begrifflichkeit hier nicht übernommen. Erstens wird »Bildwahrnehmung« häufig als bestimmte – bildspezifische – Art der Wahrnehmung aufgefasst, die hauptsächlich im Identifizieren von dargestellten Gegenständen im Bild besteht. Die Bildwahrnehmung wird abgeleitet von unserer alltäglichen Wahrnehmung, für die das Erkennen von Gegenständen wesentlich ist. Implizit wird in solchen Theorien also das Bild als gegenständliches Bild aufgefasst, wie in Kapitel 2.2 genauer gezeigt wird. Zweitens wird der Begriff der Wahrnehmung auch im Zusammenhang mit Bildern meist als passiver
1
Vgl. z. B. Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 92.
6
| Bildnerisches Denken
Vorgang verstanden, so etwa bei Eva Schürmann: »Wer etwas wahrnimmt, realisiert in der Regel nicht, dass er wahrnimmt. Der Akt der Wahrnehmung ›verschwindet‹ zumeist hinter dem Wahrgenommenen«2. Im Gegensatz dazu zeigt das Modell des Bildnerischen Denkens die aktiven Denkprozesse auf, die nicht nur für die Bildgestaltung, sondern auch für die Bildbetrachtung nötig sind. Die zentrale Frage dieses Buches kann also in zwei Teilfragen aufgespalten werden: »Was heißt es, ein Bild zu betrachten?« und »Was heißt es, ein Bild zu gestalten?«. So formuliert legen die beiden Teilfragen allerdings nahe, dass nur die beiden Tätigkeiten des Betrachtens und Gestaltens erklärt werden müssten, während die Frage, was ein Bild ist, bereits beantwortet sei. Tatsächlich kann aber die Frage nach dem Bild nicht unabhängig von den beiden Teilfragen beantwortet werden. Denn Bilder sind keine Gegenstände, die sich anhand empirischer Kriterien in der Welt auffinden lassen. Ebenso wenig sind das Betrachten und Gestalten von Bildern empirisch beschreibbare physikalische Vorgänge. Etwas wird dadurch zum Bild, dass Menschen es als Bild behandeln. Was ein Bild ist, zeigt sich dadurch, dass es als solches betrachtet oder gestaltet wird. Das Verhältnis der beiden Teilfragen zur Frage nach dem Bild ist also umgekehrt: Eine bestimmte Art des Umgangs mit Etwas führt dazu, dass wir dieses Etwas als Bild bezeichnen. Demzufolge kann die vorgestellte Untersuchung nicht empirisch vorgehen. Stattdessen wird durch eine philosophische Begriffsanalyse geklärt, was wir meinen, wenn wir etwas als Bild bezeichnen und wenn wir davon sprechen, dass jemand etwas als Bild betrachtet oder gestaltet. Daher werden die beiden Teilfragen folgendermaßen umformuliert: »Was heißt es, etwas als Bild zu betrachten?« und »Was heißt es, etwas als Bild zu gestalten?«. Diese Begriffsanalyse ist dabei eine philosophische Bemühung im Sinne Sachs-Hombachs, unser Verständnis des Phänomens Bild zu verbessern: »Wie für alle unsere Begriffe gilt auch für den Bildbegriff, daß wir ihn weder als ein für allemal gesichert voraussetzen dürfen, noch daß Grund zur Hoffnung besteht, überhaupt eine für alle Bildphänomene gleicherweise gültige Definition finden oder formulieren zu können. Das philosophische Nachdenken wird sich deshalb damit begnügen müssen, sich der jeweils verschiedenen Bedeutungsaspekte relativ zu ihren Verwendungskontexten reflektierend zu versichern. Entsprechend besteht das primäre Ziel der philosophischen Bemühungen aus unserer Sicht ganz allgemein in der Verbesserung eines kohärenten Selbstverständnisses, indem rational nachvollziehbare Vorschläge angeboten
2
Schürmann, Eva: »Bildwahrnehmung«, in: Schirra, Jörg R. J. u. a. (Hg.): Glossar der Bildphiloso-
phie, 2013, Online-Ausgabe, Zugriff am 09.04.2015, [ohne Seitenangabe].
2 Bilder erfahren |
7
werden, wie die jeweils relevanten Begriffsfelder sinnvollerweise intern strukturiert und zueinander in Beziehung gesetzt werden könnten.«3
Um die zentrale Frage bzw. ihre beiden Teilfragen sinnvoll beantworten zu können, wird zunächst dargelegt, wie sie von anderen Autoren beantwortet wird. Das erste Kapitel stellt anhand mehrerer Bildtheorien exemplarisch die Unterscheidung zwischen zwei Bildaspekten vor, die der Charakterisierung von Bilderfahrung dient (2.1.). Die Autoren sind sich zumindest darin einig, dass einer der beiden Aspekte – nämlich der »Image-Aspekt« – notwendig für die Bilderfahrung ist. Daher legt das zweite Kapitel den Fokus auf diesen Aspekt. Es wird gezeigt, wie der Image-Aspekt von verschiedenen Autoren charakterisiert wird und welche Probleme sich daraus ergeben (2.2). Zur Lösung dieser Probleme ist es notwendig, Bilderfahrung als Bildnerisches Denken neu zu fassen. Kapitel 2.3 erläutert den Gang der Argumentation, durch die das Modell des Bildnerischen Denkens hergeleitet und die zentrale Frage beantwortet wird.
2. 1
B ILD ALS »P ICTURE « UND »I MAGE «
Zur Charakterisierung der Bilderfahrung wird in vielen Bildtheorien zwischen zwei Aspekten von Bildern unterschieden. Im Englischen kommt dies in den beiden Übersetzungsmöglichkeiten für »Bild« zum Ausdruck: »image« und »picture«. Da im Deutschen keine entsprechenden Begriffe zur Verfügung stehen, werden im Folgenden die Ausdrücke »Image-Aspekt« und »Picture-Aspekt« verwendet. Eine sehr knappe Beschreibung beider Aspekte, die vorläufig übernommen werden kann, liefert Gerhard Schweppenhäuser: »Ob man nun semiotisch oder wahrnehmungstheoretisch beschreibt, was Bilder sind, oder, präziser formuliert: aufgrund wovon wir einen Gegenstand als Bild bezeichnen – in jedem Fall ist für ein Bild die ›ikonische Differenz‹ (Gottfried Boehm) zwischen dem empirischen Träger des Bildes und seinem imaginären Inhalt konstitutiv. Ernst H. Gombrich hat dargelegt, dass wir Bilder stets unter zwei Aspekten betrachten können. Der eine Aspekt betrifft das Bild als Bildträger, als dinghaftes Objekt, also als gegenständliches Objekt unserer Wahrnehmung; der andere die im Bild dargestellten Phänomene. Im Kern hat Edmund Husserl diese Unterscheidung bereits […] formuliert. […] Wollheim hat dies
3
Sachs-Hombach, Klaus; Schirra, Jörg R. J.: »Medientheorie, visuelle Kultur und Bildanthropologie«, in: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bildtheorien, Frankfurt a. M., 2009, S. 400.
8
| Bildnerisches Denken
›twofoldness‹ genannt: Wir sehen etwas in etwas, ›nämlich das Dargestellte in der Darstellung‹ (Sachs-Hombach/Schürmann 2005: 116).«4
Hier wird bereits deutlich, dass die Unterscheidung zwischen beiden Aspekten in sehr verschiedenen bildtheoretischen Traditionen zentral ist. Robert Hopkins erläutert den Unterschied in seinem Artikel »depiction« in der Routledge Encyclopedia folgendermaßen: »How do pictures work? How are they able to represent what they do? A picture of a goat, for example, is a flat surface covered with marks, depicting a goat chewing straw while standing on a hillock. The puzzle of depiction is to understand how the flat marks can do this.«5 Im Folgenden wird gezeigt, wie in exemplarisch ausgewählten Bildtheorien die beiden Aspekte unterschieden werden. Die Auswahl der Autoren richtet sich danach, wie explizit sie die beiden Aspekte und ihr Verhältnis zueinander thematisieren: Von W. J. T. Mitchell stammt die Unterscheidung mit Hilfe der Begriffe »picture« und »image«. Richard Wollheim beschreibt beide Aspekte in seinem Konzept der Twofoldness als konstitutiv für die Bilderfahrung. Er antwortet damit auf Ernst Gombrich, für den der PictureAspekt die Bilderfahrung geradezu zerstört. Klaus Sachs-Hombach beruft sich in seiner Bildtheorie auf Wollheims Analyse. In der phänomenologischen Tradition hat sich die Bezeichnung ikonische Differenz für die Unterscheidung zwischen den beiden Bild-Aspekten durchgesetzt. Gottfried Boehm prägte diesen Begriff, Bernhard Waldenfels und Lambert Wiesing greifen ihn auf. Letzterer nimmt außerdem eine weitere Differenzierung des Image-Aspektes vor. Anhand der Bildtheorien dieser Autoren wird erklärt, was unter den beiden Aspekten zu verstehen ist (2.1.1). Die Autoren sind sich uneinig dahingehend, welche Rolle die beiden Aspekte in der Bilderfahrung spielen (2.1.2). Ihre Theorien können in zwei Gruppen zusammengefasst werden (2.1.3): Den Theorien der ersten Gruppe zufolge sind beide Aspekte gleichermaßen wichtig für das Zustandekommen einer Bilderfahrung. Entsprechend der Theorien der zweiten Gruppe spielt für die Bilderfahrung nur der Image-Aspekt eine Rolle.
4
Schweppenhäuser, Gerhard: Ästhetik, Frankfurt a. M, 2007, S. 259–260, Hervorh. i. O. Schweppenhäuser zitiert Klaus Sachs-Hombach und Eva Schürmann aus folgendem Artikel: »Philosophie«, in: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bildwissenschaft, Frankfurt a. M., 2005, S. 116.
5
Hopkins, Robert: »Depiction«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 2011, Online-Ausgabe, Zugriff am Zugriff am 26.08.2013, [ohne Seitenangabe].
2 Bilder erfahren |
9
2.1.1 »Picture« und »Image« in verschiedenen Bildtheorien Die Unterscheidung zwischen den beiden Bildaspekten und ihre Identifikation mit den Begriffen »picture« und »image« wurde am deutlichsten von W. J. T. Mitchell formuliert: »The picture is a material object, a thing you can burn or break. An image is what appears in a picture, and what survives its destruction – in memory, in narrative, and in copies and traces in other media. […] The picture, then, is the image as it appears in a material support or a specific place.«6 Ernst Gombrich trifft dieselbe Unterscheidung – allerdings verwendet er die Begriffe »picture« und »image« nicht so konsequent wie Mitchell. Im Index seines Werkes Art and Illusion wird ein ähnliches Begriffsverständnis wie das von Mitchell nahegelegt. Zur Bezeichnung der materiellen Bildoberfläche scheint Gombrich den Begriff »picture« für passend zu halten. Zumindest weist darauf ein Querverweis von »picture plane« auf den Indexeintrag »flat surface« hin.7 Das »image« hingegen scheint für Gombrich eher immaterieller Natur zu sein, wie in folgender Ausführung zum Impressionismus deutlich wird: »[I]mpressionism demanded more than a reading of brushstrokes. It demanded, if one may so put it, a reading across brushstrokes. […] The image, it might be said, has no firm anchorage left on the canvas – it is only ›conjured up‹ in our minds.«8 Im Widerspruch dazu verwendet er den Begriff »picture« auch zur Kennzeichnung mentaler Bilder.9 Trotz dieser begrifflichen Unschärfe thematisiert er den Unterschied zwischen beiden Bildaspekten an anderer Stelle sehr deutlich – anhand eines Mosaiks, auf dem eine Schlacht dargestellt ist: »The bold foreshortening of the foreground figures, the frightened horse, the fallen Persian whose face is reflected in his shield, all draw us into the scene. We are forced to sort out the puzzling shapes to build up the image of events in our mind […]. Once we are ›set‹ for this kind of appeal to our imagination, we will try to look through the picture into the imagined space and the imagined minds behind its surface.«10
6
Mitchell, W. J. T.: »Four Fundamental Concepts of Image Science«, in: Elkins, James (Hg.):
7
Visual Literacy, New York, 2008, S. 16. Vgl. Gombrich, Ernst: Art and Illusion, New York, 1960, S. 451 und S. 459.
8
Ebenda, S. 202.
9
Vgl. ebenda, S. 66.
10 Ebenda, S. 137.
10 | Bildnerisches Denken
Mit explizitem Bezug zu Gombrich prägt Richard Wollheim den Begriff der »Twofoldness« zur Beschreibung der beiden Bildaspekte: »Originally concerned to define my position in opposition to Gombrich’s account, which postulates two alternating perceptions, Now canvas, Now nature, […] I identified twofoldness with two simultaneous perceptions: one of the pictorial surface, the other of what it represents.«11 Das, was das Bild repräsentiert, nennt Wollheim in Übereinstimmung mit Mitchell »image«.12 Für den zweiten Bildaspekt verwendet Wollheim eher den Begriff »surface« als »picture«. Allerdings ist nicht ganz klar, was er mit »surface« genau bezeichnen will. Folgende Textstelle legt die Interpretation nahe, dass Wollheim diesen Begriff auf die Bildoberfläche als Materie bezieht: »The surface of any picture can contain elements that, though individually visible, make no contribution to what the picture represents. […] Consider, for instance, […] the dabs of complementary color, red, say, in a field of green, that Monet used to enhance vivacity.«13 Wollheims bereits zitierte Beschreibung von »pictorial surface« als »canvas« (siehe S. 10) spricht ebenfalls für diese Interpretation. Sie deckt sich auch mit den Ausführungen zu Wollheims Bildtheorie, die John Kulvicki liefert: »Wollheim famously said that we see the contents of pictures in them. Seeing-in is a perceptual state in which one is simultaneously visually aware of two objects, the canvas and the content.«14 Andere Formulierungen Wollheims lassen aber ebenso die Interpretation zu, dass er unter »surface« auch die rein formale – d. h. immaterielle – Anordnung von Farben und Formen versteht. Dies wird deutlich, wenn er die Mittel aufzählt, die die Aufmerksamkeit auf die Oberfläche (»surface«) richten. Darunter finden sich neben dem materiell wahrnehmbaren Pinselstrich auch die Wirkung der Luftperspektive und der Unsichtbarkeit des Pinselstrichs – beides immaterielle Bildaspekte.15
11 Wollheim, Richard: »On Pictorial Representation«, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1998, S. 221. 12 Vgl. Wollheim, Richard: Painting as an Art, Princeton, 1987, S. 21. 13 Wollheim, Richard: »On Pictorial Representation«, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1998, S. 222. 14 Kulvicki, John: »Twofoldness and Visual Awareness«, in: Sachs-Hombach, Klaus; Trotzke, Rainer (Hg.): Bilder – Sehen – Denken, Köln, 2011, S. 74. 15 Vgl. Wollheim, Richard: Painting as an Art, Princeton, 1987, S. 75.
2 Bilder erfahren | 11
Dazu passend kennzeichnet er den Bildaspekt der Oberfläche an anderer Stelle als »configurational«16 – ein Begriff der ebenfalls nicht an die Materialität der Bildoberfläche, sondern an ihre formale, immaterielle Konfiguration denken lässt. Klaus Sachs-Hombach beruft sich in seiner Analyse der Bildwahrnehmung auf Wollheims Twofoldness.17 Seine Interpretation deckt sich mit der Deutung von »surface« als materielle Bildoberfläche: »Die Bildwahrnehmung zeichnet sich nach Wollheim dadurch aus, dass wir etwas in etwas sehen. Sie enthält deshalb notwendig zwei Komponenten: Die Wahrnehmung des als Bild geltenden Gegenstandes als Oberfläche und die Wahrnehmung eines weiteren Gegenstandes oder Sachverhaltes in dieser Oberfläche.«18
Sachs-Hombach erörtert außerdem das Verhältnis, in dem Wollheims Analyse der Bildwahrnehmung zur Symboltheorie von Nelson Goodman steht: »Legt man […] Wollheims Charakterisierung der Bildwahrnehmung zugrunde, dann bleibt beim derzeitigen Stand der Überlegungen offen, ob sie mit Goodmans Theorie in Konflikt steht. Denn Goodman bestreitet nicht generell die Relevanz von Wahrnehmungsaspekten für die Bildrezeption, sondern lediglich die ähnlichkeitstheoretische Variante der perzeptuellen Bildtheorie.«19
In Übereinstimmung dazu unterscheidet Goodman in Bezug auf das Bild zwar zwischen der Bildoberfläche (»face«) und dem, was das Bild repräsentiert. Diese Unterscheidung spielt aber im weiteren Verlauf seiner Argumentation keine Rolle, wie er selbst andeutet.20 Gottfried Boehm knüpft in seiner Theorie des Zeigens explizit an Wollheim an:
16 Wollheim, Richard: »On Pictorial Representation«, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1998, S. 221. 17 Vgl. Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 50. 18 Ebenda, S. 92. 19 Ebenda, S. 93. 20 Vgl. Goodman, Nelson: Languages of Art, Indianapolis, Cambridge, 1976, S. 41–42.
12 | Bildnerisches Denken
»Genauer gesprochen geht es um die zur These verfestigte Vermutung, dass Bilder ihrer eigenen Natur nach auf einem doppelten Zeigen beruhen, nämlich etwas zu zeigen und sich zu zeigen.«21 »Schon Richard Wollheim hatte, im Anschluss an Wittgenstein, die Generierung bildlichen Sinns auf ein Sehen ›als‹ bzw. ein Sehen ›in‹ zurückgeführt.«22
An anderer Stelle nimmt er Bezug auf Mitchells Unterscheidung und erklärt die Übereinstimmung der beiden Bildaspekte mit dem, was er als »äußere« (=materielle) und »innere« (= immaterielle) Bilder bezeichnet: »Zwar ist ›Bild‹ schon ein sehr altes deutsches Wort, das im übrigen, abweichend von anderen europäischen Sprachen, insbesondere dem Englischen, zugleich innere und äussere Bilder, das heisst images und pictures, unter einem einzigen Allgemeinbegriff zusammenfasst.«23 Diese Unterscheidung ist nach Boehm das, »was wir die ›ikonische Differenz‹ nennen […], welche die Eigenart des Bildes kennzeichnet, […] das in Materie eingeschrieben ist, darin aber einen Sinn aufscheinen läßt«24. Bernhard Waldenfels schließt an Boehms Begriff der Differenz an: »Das Bild unterliegt nun seinerseits einer ikonischen Differenz, einer Differenz zwischen dem, was bildhaft sichtbar wird, und dem Medium, worin es sichtbar wird. […] Im Falle malerischer Bildnisse materialisiert sich diese Differenz zu einer pikturalen Differenz«.25 Diese Differenzen sind nach Waldenfels bereits in der Bildwahrnehmung gegeben: »Noch das künstlerische Spiel mit den Extremen von Bild-Dingen und Ding-Bildern kreist um eine ikonische Differenz, die schon in der Wahrnehmung am Werk ist und die sich in der pikturalen Differenz fortsetzt.«26 Ergänzend zu diesem Satz macht er in einer Fußnote sein Anknüpfen an Boehm deutlich: »Ich verstehe die besagten Differenzen in dem Sinne, wie sie von Gottfried Boehm und mir einge-
21 Boehm, Gottfried: »Die Hintergründe des Zeigens. Deiktische Wurzeln des Bildes«, in: ders.: Wie
Bilder Sinn erzeugen, Berlin, 2007, S. 19. 22 Boehm, Gottfried: »Unbestimmtheit. Zur Logik des Bildes«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen, Berlin, 2007, S. 211. 23 Boehm, Gottfried: »Einführung«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen, Berlin, 2007, S. 11, Hervorh. i. O. 24 Boehm, Gottfried: »Die Wiederkehr der Bilder«, in: ders.(Hg.): Was ist ein Bild?, München, 1995, S. 11-38, S. 30. 25 Waldenfels, Bernhard: »Spiegel, Spur und Blick. Zur Genese des Bildes«, in: Boehm, Gottfried (Hg.): Homo Pictor, München, Leipzig, 2001, S. 15, Hervorh. i. O. 26 Waldenfels, Bernhard: Phänomenologie der Aufmerksamkeit, Frankfurt a. M., 2004, S. 213.
2 Bilder erfahren | 13
führt wurden.«27 In einer späteren Veröffentlichung distanziert er sich allerdings teilweise von Boehm, dessen Konzept der »ikonischen Differenz« ihm zu wenig präzise formuliert scheint: »Diese grundlegende pikturale Differenz deckt sich nur teilweise mit dem überkomplexen Sachverhalt, den Gottfried Boehm […] als ikonische Differenz […] bezeichnet […] und der so heterogene Paarungen wie Materie/Sinn, Figur/Grund, Sache/Ansicht oder Präsenz/Absenz umfaßt.«28 Die von ihm gezogene Unterscheidung zwischen ikonischer und pikturaler Differenz erläutert Waldenfels dabei wie folgt: »Ich selbst werde von ›ikonischer Differenz‹ sprechen, wenn es allgemein um Bilder und Bildlichkeit, von ›pikturaler Differenz‹, wenn es speziell um Bildnisse, Gemälde oder gemäldenahe Gebilde geht.«29 Lambert Wiesing unterscheidet in Anschluss an Husserl zwischen dem »Bildträger«, der dem Picture-Aspekt entspricht, und dem »Bildobjekt«, das mit dem Image-Aspekt gleichgesetzt werden kann: »Der Bildträger und das Bildobjekt sind die beiden Aspekte eines Bildes (hier im Sinne von Einheit). Es sind die zwei Aspekte des Bildes, die man sich zwar nicht in gleicher Weise, aber doch gleichermaßen anschauen kann.«30 »Sowohl das Bildobjekt (also die sichtbar werdende Darstellung) als auch der Bildträger (also das sichtbar machende Bildmaterial) werden […] oft kurz als ›Bild‹ angesprochen.«31 »Die Funktion des Bildträgers besteht also darin, ein geistiges Bild (der Begriff ist ein Synonym für Bildobjekt) zu wecken.«32
An anderer Stelle führt Wiesing allerdings eine weitere Differenzierung ein. So nimmt er begrifflich eine deutliche Trennung zwischen »Bildmaterial« und »Bildoberfläche« vor: »Die Sichtbarkeit der Bildoberfläche widerspricht der Sichtbarkeit der anwesenden Sache. Jedes Bild muß seine Oberfläche zu einem eigenständigen Phänomen erheben, das heißt eine Differenz zwischen der Bildoberfläche und dem Bildmaterial aufbauen.«33 Die immaterielle Bildoberfläche scheint also ebenso zum Image-Aspekt zu gehören wie das Bildobjekt.
27 Ebenda. 28 Waldenfels, Bernhard: Sinne und Künste im Wechselspiel, Frankfurt a. M., 2005, S. 44, Fußnote 5. 29 Ebenda. 30 Wiesing, Lambert: Artifizielle Präsenz, Frankfurt a. M., 2005, S. 46. 31 Ebenda. 32 Ebenda, S. 53. 33 Wiesing, Lambert: Die Sichtbarkeit des Bildes, 2008, S. 161.
14 | Bildnerisches Denken
Wie sich gezeigt hat, spielt die Unterscheidung zwischen dem PictureAspekt und dem Image-Aspekt eines Bildes in vielen Bildtheorien eine große Rolle bei der Bestimmung der Bilderfahrung. Der Picture-Aspekt wird dabei beschrieben als materieller Träger oder Medium (Mitchell), Bildoberfläche (Gombrich, Wollheim, Goodman, Sachs-Hombach), Leinwand (Kulvicki), das Worin des Bildes, (Waldenfels), das äußere Bild (Boehm) oder der Bildträger (Wiesing). Unter dem Image-Aspekt verstehen die Autoren das Immaterielle des Bildes (Mitchell), das Repräsentierte (Wollheim, Goodman), das Bild im Geist (Gombrich), den Inhalt (Kulvicki), den in der Bildoberfläche wahrgenommene Gegenstand oder Sachverhalt (Wollheim, SachsHombach), das Was des Bildes (Waldenfels), das innere Bild (Boehm) oder das Bildobjekt bzw. die Bildoberfläche (Wiesing). Außerdem wurde bei Wollheim und Wiesing deutlich, dass in dieser Zweiteilung der Bildaspekte unklar bleibt, welchen Platz die formalen, immateriellen Bildeigenschaften einnehmen. Zur Beantwortung der Frage »Was ist eine Bilderfahrung?« ist es daher nötig, das Phänomen Bild unter mehr als nur diesen beiden Aspekten zu betrachten. 2.1.2 Picture und Image in der Bilderfahrung Nachdem zunächst ein Überblick über die beiden Bildaspekte in verschiedenen Bildtheorien geliefert wurde, soll nun der Frage nachgegangen werden, wie die verschiedenen Autoren das Verhältnis der beiden Aspekte zueinander näher beschreiben. Grundsätzlich kann hier zwischen zwei Ansätzen unterschieden werden. Der erste Ansatz vertritt die Position, dass beide Aspekte gleichermaßen wesentlich für das Spezifische der Bilderfahrung sind. Der zweite Ansatz hält es hingegen für notwendig, den materiellen Bildträger zu übersehen, um zum Image durchdringen zu können und eine Bilderfahrung zu machen. Nicht alle Autoren lassen sich eindeutig einem der beiden Ansätze zuordnen. Im Folgenden werden von den bereits vorgestellten Autoren nur die Theorien näher erläutert, die eindeutig jeweils eine der beiden Positionen vertreten. Ernst Gombrich und Richard Wollheim sind nicht nur zwei prominente Kontrahenten in dieser Diskussion, sie sind zugleich ihre Begründer. Auch in der gegenwärtigen Bildphilosophie werden beide Positionen nach wie vor vertreten. Dies wird anhand der Positionen von Klaus Sachs-Hombach und Lambert Wiesing dargelegt. Ernst Gombrich hat mit seiner Analyse der Bildwahrnehmung den ersten Anstoß für die anschließende Diskussion um die beiden Bildaspekte gegeben, wie Klaus Sachs-Hombach erläutert:
2 Bilder erfahren | 15
»Gombrich hatte in Art and Illusion die Bildwahrnehmung in Zusammenhang mit dem Aspektsehen erläutert […] und gefolgert, dass der Bildbetrachter entweder nur die Oberflächenstruktur oder aber diese als etwas anderes wahrnimmt (wie wir beim Hasen-Enten-Bild entweder nur den Hasen oder nur die Ente sehen). Gegen diese Ansicht richtet sich berechtigterweise Wollheims Twofoldness-
Bedingung«.34
Gombrich vertritt also die These, dass ein Bildbetrachter immer nur einen der beiden Bildaspekte, niemals aber beide zugleich beachten kann. Er erläutert diese These anhand des Bildes einer Schlacht: »But is it possible to ›see‹ both the plane surface and the battle horse at the same time? If we have been right so far, the demand is for the impossible. To understand the battle horse is for a moment to disregard the plane surface. We cannot have it both ways.«35 Gombrich ist dabei nicht der Ansicht, dass wir, wenn wir den Picture-Aspekt in der Bildbetrachtung vergessen, einer Illusion erliegen und das im Bild Dargestellte für real halten: »A fine landscape or seascape by one of the Dutch masters certainly does not give me the illusion that the museum wall opens into parts of Holland. But I would claim that in getting absorbed in such a painting my search for meaning between and behind its brushstrokes weaves on its surface a rich fabric of uncontradicted [sic] sensations. Following the artist's suggestion I begin to forget the textured surface. I see the horizon curving and the sky arching over the earth, not a mediated perception so much as a mediated phantom.«36
Das Vergessen des Picture-Aspektes ist nach Gombrich notwendig für das Zustandekommen der Bilderfahrung – und zwar von Bildern jeder Art. Auch die impressionistische Malerei, in der die flache Leinwand offensichtlich durch den einheitlichen und deutlich sichtbaren Pinselduktus betont ist, interpretiert Gombrich in dieser Weise. Er unterstellt dem impressionistischen Maler, dass auch er vom Betrachter erwartet, den Picture-Aspekt zu übersehen: »In doing so, however, he [the impressionist painter, Anm. d. A.] expects, and rightly expects, that the resulting painting would not be seen as a canvas covered with dabs and strokes, but that the under-
34 Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 93, Hervorh. i. O. 35 Gombrich, Ernst: Art and Illusion, New York, 1960, S. 279. 36 Gombrich, Ernst: »›The Sky is the Limit‹: The Vault of Heaven and Pictorial Vision«, in: ders.: The
Image and the Eye, Oxford, 1982, S. 171.
16 | Bildnerisches Denken
standing beholder would want to step back from the picture to eliminate these interfering messages from the picture surface and experience the sensations of light and flicker that the artist wished to arouse in him as an equivalent of his own reaction to his motif.«37
Gemälde, die dieses Vergessen unmöglich machen oder sogar bewusst unterlaufen, wie beispielsweise Werke des Kubismus, scheinen für Gombrich keine Bilder zu sein. Dieses Bildverständnis formuliert er zwar nicht ausdrücklich, es wird aber implizit in seinem Wortgebrauch deutlich, wie in Kapitel 2.2 näher erläutert wird. Richard Wollheim grenzt sich explizit von Gombrichs Analyse der Bildwahrnehmung ab. Nach ihm ist es geradezu das Charakteristikum der Bilderfahrung, beide Bildaspekte zugleich wahrzunehmen: »This special kind of experience […] [is] marked by this strange duality – of seeing the marked surface, and of seeing something in the surface – which I call twofoldness«.38 Das, was der Betrachter im Bild sehen kann, der Image-Aspekt, wird von Wollheim größtenteils als ein Erkennen von Gegenständen beschrieben. Aber dennoch sieht er die Bedingung der Twofoldness auch bei einigen abstrakten Gemälden erfüllt, wie in Kapitel 2.2 genauer ausgeführt wird. Klaus Sachs-Hombach beruft sich, wie bereits erwähnt, auf Wollheims Analyse der Bildwahrnehmung. Entsprechend thematisiert er beide Bildaspekte als relevant für die Bilderfahrung: »Um ein Bild zu verstehen, muss zunächst der als Bildträger dienende Gegenstand angemessen wahrgenommen werden.«39 »Für das Bildverstehen ist zudem eine spezielle Wahrnehmungskompetenz erforderlich, die es uns nicht nur erlaubt, einen Gegenstand als diesen zu sehen (beispielsweise dunkle Flecken am Himmel als Wolken), sondern zudem etwas anderes in ihm zu sehen als er selber ist (beispielsweise eine Landschaft in der Wolkenstruktur).«40 »Sind die genannten Bedingungen erfüllt, verstehen wir, dass es sich bei einem Gegenstand um ein Bild handelt, mit dem etwas anschaulich zur Darstellung kommt.«41
Die Analyse der Bilderfahrung von Lambert Wiesing steht in deutlichem Widerspruch zu der Traditionslinie von Wollheim und Sachs-Hombach.
37 Gombrich, Ernst: »Mirror and Map: Theories of Pictorial Representation«, in: ders.: The Image
and the Eye, Oxford, 1982, S. 181. 38 Wollheim, Richard: Painting as an Art, Princeton, 1987, S. 21, Hervorh. i. O. 39 Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 288. 40 Ebenda, S. 289. 41 Ebenda, S. 290.
2 Bilder erfahren | 17
Wiesing ist wie Gombrich der Ansicht, dass das Vergessen des PictureAspektes notwendig für die Bilderfahrung ist: »Doch diese Sichtbarkeit des Bildmaterials, das selbstverständlich auch gerochen und getastet werden kann, muß durch den bildnerischen Prozeß überwunden werden, weshalb man als ein Prinzip der Bildlichkeit festhalten kann: Die reine Sichtbarkeit entsteht nur dann, wenn das Bild in der Lage ist, den materiellen Stoff, aus dem es besteht, zur Unsichtbarkeit zu bringen.«42 »Erst wenn ein Gegenstand als eine Darstellung von etwas betrachtet wird, geht man sicher, daß eine Bildoberfläche betrachtet oder, genauer gesagt: daß die Bildoberfläche durchschaut und in ihrer Materialität übersehen wird«.43
2.1.3 Image als notwendige Bedingung Es wurde gezeigt, dass die verschiedenen Autoren das Verhältnis der beiden Bildaspekte sowie deren Relevanz für die Bilderfahrung unterschiedlich beurteilen. Einige Autoren bestehen darauf, dass in der Bilderfahrung zugleich die (materielle) Bildoberfläche wie auch das im Bild Dargestellte beachtet werden müssen. Andere vertreten hingegen die Ansicht, dass in der Bilderfahrung notwendigerweise die Flachheit und Materialität des Bildes vergessen werden muss. Konsens besteht hingegen bei allen Autoren darin, dass Bilderfahrung ohne den Image-Aspekt nicht möglich ist. Dieser Bildaspekt kann daher in Übereinstimmung mit allen vorgestellten Theorien als notwendige Bedingung für Bilderfahrung gelten. Der Image-Aspekt ist der kleinste gemeinsame Nenner aller Beschreibungen der Bilderfahrung. Wie im Folgenden gezeigt wird, weisen jedoch alle Charakterisierungen des Image-Aspektes Defizite auf.
42 Wiesing, Lambert: Die Sichtbarkeit des Bildes, 2008, S. 164. 43 Ebenda, S. 214–215.
18 | Bildnerisches Denken
2.2
I MAGE IN VERSCHIEDENEN B ILDTHEORIEN Dieses Kapitel zeigt, was die genannten Autoren unter dem Image-Aspekt verstehen. Einige der Auffassungen hierzu sind dabei in zweifacher Weise problematisch: sie reduzieren den Image-Aspekt 1. auf das Erkennen von sichtbaren Gegenständen und 2. auf das durch die Verbalsprache Beschreibbare. Unter »sichtbare Gegenstände« sollen im Folgenden der Einfachheit halber auch sichtbare Personen und Situationen verstanden werden. Ebenso können fiktive Gegenstände in diesem Sinn als sichtbar gelten, sofern sie sichtbar wären, wenn es sie geben würde. Die beiden angeführten problematischen Merkmale sind nicht in allen angeführten Bildtheorien gleichermaßen zu finden. Boehm und Waldenfels wenden sich explizit gegen diese beiden Reduktionen des Image-Aspektes. Ihre Ausführungen sind jedoch wenig systematisch ausgearbeitet. Sie beschreiben den Image-Aspekt z. T. nur mithilfe von Metaphern. Bei den anderen Autoren scheint es einen Zusammenhang zwischen den beiden Reduktionen zu geben. Es ist auffällig, dass viele Bildtheorien, die das Image hauptsächlich als Erkennen von sichtbaren Gegenständen beschreiben, auch davon ausgehen, dass Bilderfahrung in irgendeiner Weise von der Verbalsprache abhängt. So werden in der Beschreibung der Bilderfahrung häufig diejenigen Elemente in das Zentrum der Bildtheorie gerückt, die sehr leicht sprachlich wiedergegeben werden können. Das sind die in einem Bild erkannten sichtbaren Gegenstände. Doch auch andere Elemente der Bilderfahrung, die nicht einfach als das Erkennen sichtbarer Gegenstände beschrieben werden können, werden oft in einer solchen Abhängigkeit gesehen. So wird auch das Erkennen eines bestimmten Ausdrucks in einem Bild von vielen Theoretikern als Leistung beschrieben, die erst durch Sprache ermöglicht wird. Die Kennzeichnung des Image-Aspektes weist bei der Mehrheit der Autoren diese beiden Merkmale auf: die Konzentration auf das Erkennen sichtbarer Gegenstände und die Sprachabhängigkeit. Dennoch sind auch in diesen Theorien Ansätze erkennbar, eine solche eingeengte Sicht auf die Bilderfahrung aufzubrechen. Allerdings zeigen sie sich zum Teil nur in Randbemerkungen oder sie sind – wie auch die Theorien von Boehm und Waldenfels – nicht systematisch ausgearbeitet. Dieses Defizit der aktuellen Diskussion um die Bilderfahrung wird im Folgenden behandelt. Zunächst wird gezeigt, inwiefern die Mehrheit der genannten Autoren den Kern des ImageAspektes als Erkennen von sichtbaren Gegenständen im oben erläuterten Sinn versteht (2.2.1). Das anschließende Kapitel zeigt auf, welche Autoren in welchem Sinn die Bilderfahrung als sprachabhängig beschreiben (2.2.2). Der
2 Bilder erfahren | 19
dritte Abschnitt beschäftigt sich mit den Ansätzen alternativer Kennzeichnungen des Image-Aspektes (2.2.3). Schließlich wird zusammenfassend dargelegt, dass die bisherigen Charakterisierungen des Image-Aspektes zu problematischen Konsequenzen führen und daher keine befriedigende Beschreibung der Bilderfahrung liefern (2.2.4). 2.2.1 Gegenständlichkeit des Image Die überwiegende Zahl der hier vorgestellten Autoren ist der Ansicht, dass das Erkennen von sichtbaren Gegenständen paradigmatisch für den ImageAspekt der Bilderfahrung ist. In diesen Theorien ist aber die Bilderfahrung von abstrakten bzw. ungegenständlichen Bildern schwer zu erklären ist. Einige Autoren lösen dieses Problem, indem sie solche Bilder als Randphänomene, Sonderformen oder Ausnahmen beschreiben. Andere hingegen lehnen es ab, für sie den Begriff »Bild« zu verwenden. Eine solche Kategorisierung der abstrakten bzw. ungegenständlichen Bilder erfolgt in den verschiedenen Theorien nicht gleichermaßen explizit. Zudem unterscheiden die meisten Autoren nicht scharf zwischen abstrakten und ungegenständlichen Bildern. Im Folgenden werden in Zusammenhängen, in denen diese Unterscheidung nicht relevant ist, beide Bildarten als »abstrakt« bezeichnet, da auch die meisten Autoren diesen Ausdruck verwenden. Er beschreibt dann Bilder, auf denen kaum oder gar keine sichtbaren Gegenstände erkennbar sind. Unter den bisher vorgestellten Theoretikern sind drei Autoren hervorzuheben, weil sie unter dem Image-Aspekt ausdrücklich sehr viel mehr als das Erkennen von sichtbaren Gegenständen verstehen. Es handelt sich um Autoren, deren Theorien in der Tradition der Phänomenologie stehen: Gottfried Boehm, Bernhard Waldenfels und Lambert Wiesing. Ihr alternativer Ansatz wird in Kapitel 2.2.3 behandelt. Im Folgenden werden daher nur die Ansätze von Mitchell, Gombrich, Wollheim und Sachs-Hombach vorgestellt. W. J. T. Mitchell wendet in einer frühen Veröffentlichung den Begriff »image« auch auf ungegenständliche Bilder an, wie in Kapitel 2.2.3.1 näher ausgeführt wird.44 In einer seiner neueren Veröffentlichungen liefert er allerdings eine Explikation dieses Begriffs, die den Image-Aspekt als Erkennen von sichtbaren Gegenständen beschreibt: »The image is thus the perception of a relationship of likeness or resemblance or analogous form – what C. S. Peirce defined as the ›iconic sign,‹ a sign whose intrinsic sensuous quali-
44 Vgl. Mitchell, W. J. T.: »What Is an Image?«, in: New Literary History, 1984, S. 528.
20 | Bildnerisches Denken
ties remind us of some other object.«45 Folgerichtig fallen abstrakte Gemälde – entsprechend seiner neueren Ansicht – nicht unter den Begriff »image«: »Abstract and ornamental forms are thus a kind of ›degree zero‹ of the image, and are identifiable by very schematic descriptions such as arabesques or geometrical figures.«46 Mitchells Verständnis von »image« scheint sich also verengt zu haben. Ernst Gombrich ist in seiner Charakterisierung des Image-Aspektes von Bildern nicht ganz so deutlich wie Mitchell. Dennoch weist seine Verwendung des Begriffs »image« darauf hin, dass er wie Mitchell unter dem damit bezeichneten Bildaspekt das Erkennen von sichtbaren Gegenständen versteht. So beschreibt er zwei komplementäre Pole in der Kunst: die Repräsentation und das reine Design. Während sich sein Buch Art and Illusion mit dem ersten Pol beschäftigt, geht es in The Sense of Order um den zweiten Pol.47 Nur für den ersten verwendet Gombrich den Begriff »image«. Eine dritte Kategorie von Dingen, die keine sichtbaren Gegenstände repräsentieren, aber dennoch mehr als Design sind, kommt für Gombrich nicht in Betracht. Zumindest bewegen sich seine Überlegungen weitgehend zwischen diesen beiden Polen. Er macht an mehreren Stellen deutlich, dass ein Ding, sobald es nichts mehr repräsentiert, seinen Status als »image« verliert. Bestenfalls kann es dann noch als Ornament der Dekoration dienen: »We easily succeed in ›making sense‹ of some of the lines and accept others for what they are – mere flourishes. But the more intently we look the more we may also find that the image ›dissolves‹ and recomposes itself according to various possible readings.[…] The instability of these acts of projection naturally presents a problem to the interpreter of decorative styles – for how can he be sure that what he reads as a face was intended to represent one?«48
In Übereinstimmung damit scheint er auf solche Gemälde, die kaum noch einen oder gar keinen Bezug zur sichtbaren Welt aufweisen, den Begriff »image« nicht anwenden zu wollen. Stattdessen bezeichnet er diese Art von Kunst als Formenarrangement: »Since art has begun to cut itself loose from anchorage in the visible world, the question how to suggest one reading rather than another of any arrangement of forms has become of crucial im-
45 Mitchell, W. J. T.: »Four Fundamental Concepts of Image Science«, in: Elkins, James (Hg.):
Visual Literacy, New York, 2008, S. 18. 46 Ebenda. 47 Vgl. Gombrich, Ernst: The Sense of Order, Oxford, 1980, S. ix. 48 Ebenda, S. 264–265. Vgl. auch S. 101 und S. 222.
2 Bilder erfahren | 21
portance.«49 Auch in seinen Ausführungen zum Kubismus vermeidet er den Begriff »image« und spricht stattdessen von »picture« oder »painting«.50 Passend dazu sieht er das Hauptanliegen des Kubismus darin, den Illusionismus des Bildes zu zerstören und das »picture« als farbige, flache Leinwand zu interpretieren: »Cubism, I believe, is the most radical attempt to stamp out ambiguity and to enforce one reading of the picture – that of a man-made construction, a colored canvas. If illusion is due to the interaction of clues and the absence of contradictory evidence, the only way to fight its transforming influence is to make the clues contradict each other and to prevent a coherent image of reality from destroying the pattern in the plane.«51
Dass mit dieser Begriffsverwendung implizit auch eine Wertung verbunden ist, wird an seinen Ausführungen zur völlig gegenstandslosen Malerei deutlich. Kubistische Gemälde kann er aufgrund ihrer bewusst mehrdeutigen Darstellung von Gegenständen wertschätzen. Denn diese Mehrdeutigkeit steht immer noch in Abhängigkeit zur illusionistischen Malerei. Völlig ungegenständlichen Gemälden fehlt dieser Bezug, weswegen sie nach Gombrichs Ansicht spannungslos sind. Dies bezeichnet er als »intrinsisches Problem abstrakter Kunst«: »In cubism even coherent forms are made to play hide-and-seek in the elusive tangle of unresolved ambiguities. It is important to distinguish these contradictions from nonfigurative art. […] There are various other readings, all of which fit, and still the picture lacks that tension which the cubists achieved by similar means. We now see why. There is no possible test by which we can decide which reading to adopt. The example reminds us of one of the intrinsic problems of abstract art that are too rarely discussed: its overt ambiguity.«52
Zu dieser negativen Einschätzung passen auch seine Ausführungen, in denen er die Etablierung abstrakter Kunst als Symptom der Angst begreift.53 Dass die Entwicklung zur ungegenständlichen Kunst auch Auswirkung auf unser Bildverständnis hat, reflektiert Gombrich sehr deutlich:
49 Gombrich, Ernst: Art and Illusion, New York, 1960, S. 263. 50 Vgl. ebenda, S. 284. 51 Ebenda, S. 281. 52 Ebenda, S. 285–286. 53 Vgl. Gombrich, Ernst: The Sense of Order, Oxford, 1980, S. 46.
22 | Bildnerisches Denken
»Claude Lorrain, to remind you of Constable's fine formulation, ›was legitimately connected with the chain of art‹, these painters [die Maler des 20. Jhds., Anm. d. A.] cannot be, for there no longer is such a chain. It broke into disconnected links when the consensus broke down about the aims and functions of image making in our culture.«54
Daher ist es nur konsequent, dass Gombrich keine Explikation seines Verständnisses von »image« liefert. Für ihn ist es selbstverständlich, dass es hierüber keinen Konsens mehr gibt. Dennoch wehrt er sich gegen den Vorwurf, er würde Kunst mit illusionistischer Malerei gleichsetzen. Doch in seiner Antwort wird, wie oben schon ausgeführt, deutlich, dass er neben die gegenständliche Malerei keineswegs ungegenständliche »Bilder« als Alternative stellen möchte, sondern »reines Design«: »My previous book Art and Illusion (1960) dealt with the emergence and perfection of representational skills in the history of painting and sculpture. It was perhaps inevitable that this interest was sometimes identified with a championship of figurative as against nonobjective art, all the more as I have criticized certain theories advanced in favour of these 20th-century experiments. I do not want to deny that I was needled by the assumption that I wished to equate ›art‹ with ›illusion‹ though my critics could not possibly know that in point of fact my interest in problems of pure design goes back much further in my life than my interest in the psychology of illusion.«55
Richard Wollheim fasst in seinem Konzept der »Twofoldness« den ImageAspekt eindeutig als Erkennen von sichtbaren Gegenständen auf. Dies wird in folgendem Zitat deutlich, in dem er – in Anlehnung an Alberti – Repräsentation und Malerei als Wiedergabe des Sichtbaren interpretiert: »What is the scope of representation? The answer falls into two parts. The first part is ontological […]. The second part consists in an overarching constraint, and this is imposed by the limits of visibility. As Alberti put it, ›The painter is concerned solely with representing what can be seen.‹«56 Im Gegensatz zu Gombrich führt Wollheim näher aus, wo seiner Ansicht nach die Grenze des Sichtbaren und damit auch des bildlich Repräsentierbaren verläuft. Er unterscheidet dabei zwischen dem, was man »von Angesicht zu Angesicht« sehen
54 Gombrich, Ernst: »Experiment and Experience in the Arts«, in: ders.: The Image and the Eye, Oxford, 1982, S. 239. 55 Gombrich, Ernst: The Sense of Order, Oxford, 1980, S. vii. 56 Wollheim, Richard: »On Pictorial Representation«, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1998, S. 223.
2 Bilder erfahren | 23
kann, und dem im Bild Sichtbaren. Der letztere Bereich ist größer als der erste, wie er an einem Beispiel erläutert: »Representation does not have to limit itself to what can be seen face-to-face: what it has to limit itself to is what can be seen in a marked surface. […] For we can see in pictures things merely of a particular kind, and these we cannot see face-to-face. We cannot see face-to face women and battles of which we may not ask, Which [sic] woman? Which battle?«57
Zudem erweitert Wollheim ein gängiges Verständnis von Repräsentation durch seine Differenzierung zwischen Repräsentation und Figuration. Letztere sieht er als Unterart der Repräsentation an. In seinem Verständnis gibt es daher einerseits Bilder, die repräsentieren und figurativ sind, und andererseits solche, die zwar repräsentieren, aber nicht figurativ sondern abstrakt sind.58 Wollheim formuliert eine Minimalbedingung, die erfüllt sein muss, damit man auch von einem abstrakten Gemälde sagen kann, dass es repräsentiert. Man muss in irgendeiner Weise Tiefe darin sehen können. Viele, aber nicht alle abstrakten Gemälde sind demnach repräsentational.59 Wollheim unterscheidet also zwischen abstrakten Gemälden, die repräsentieren und ein »image« darstellen und solchen, die dies nicht tun und daher keine Bilder sind bzw. keine Bilderfahrung ermöglichen. Da sein Konzept von Bilderfahrung als »Twofoldness« aber zwei Bedingungen enthält, können einem Gemälde die Voraussetzungen für Bilderfahrung in zwei Hinsichten fehlen. Die erste Bedingung, die besagt, dass man Tiefe in dem Bild sehen können muss, wird von bestimmten abstrakten Gemälden nicht erfüllt. Die zweite Bedingung, dass man die Oberfläche als solche wahrnimmt, wird hingegen von bestimmten illusionistischen Bildern nicht erfüllt – genauer von Trompe l'Œils. Damit bestimmt er die nicht-repräsentierenden Gemälde auf der einen und die Trompe l'Œils auf der anderen Seite als zwei Pole, zwischen denen der Bereich der Bilder liegt: »It is however worth noting that, if there are certain abstract paintings that are non-representational for the reason that they do not call for awareness of depth, there are also paintings that are nonrepresentational for the complementary reason, or because they do not invoke, indeed they repel, attention to the marked surface. Trompe l'oeil paintings […] are surely in this category. They incite our
57 Ebenda. 58 Vgl. Wollheim, Richard: Painting as an Art, Princeton, 1987, S.62. 59 Vgl. ebenda.
24 | Bildnerisches Denken
awareness of depth, but do so in a way designed to baffle our attention to the marks upon the surface.«60
Nach Wollheim fallen also weder abstrakte, nicht-repräsentationale Gemälde noch Trompe l'Œils unter die Kategorie Bild. Diese Explikation des Bildbegriffs ist von mehreren Seiten scharf kritisiert worden, u. a. von Oliver Scholz: »Eine einflussreiche Bildtheorie – Wollheims Sehen-in-Theorie – behauptet geradezu, dass diese Doppelseitigkeit (›twofoldness‹) das Wesensmerkmal der Bilderfahrung sei. […] Dass Wollheim eine gute phänomenologische Beobachtung überzieht, sieht man u.a. daran, dass er Trompe-l’oeilGemälde nun gar nicht mehr unter die Bilder rechnet. Dies ist freilich kaum weniger absurd, als sie zum Paradigma des Bildes zu erheben.«61
Elisa Caldarola kritisiert das Sehen von Tiefe als Bedingung für die Bilderfahrung. Sie betont, dass auch zweidimensionale Aspekte eines Gegenstandes bildlich dargestellt werden können und dass daher auch solche Darstellungen, die keinerlei Tiefenillusion hervorrufen, eine Bilderfahrung ermöglichen können.62 Ein weiterer Aspekt in Wollheims Theorie der Bilderfahrung muss als problematisch beurteilt werden: In seinem Verständnis des Image-Aspektes sind alle Bildmerkmale, die nichts zu der Minimalbedingung des Sehens von Tiefe bzw. zum Erkennen des dargestellten Gegenstandes beitragen, für die Bedeutung eines Bildes irrelevant: »The surface of any picture can contain elements that, though individually visible, make no contribution to what the picture represents. In Budd's phrase, they lack ›pictorial significance.‹ Consider, for instance, […] the dabs of complementary color, red, say, in a field of green, that Monet used to enhance vivacity.«63
Wollheim unterstellt eine klare Unterscheidbarkeit von Bildelementen, die repräsentieren, die also der Bedingung des Sehens-in entsprechen, und
60 Ebenda, Hervorh. i. O. 61 Scholz, Oliver: Bild, Darstellung, Zeichen, Frankfurt a. M., 2009, S. 66, Fußnote 82. 62 Vgl. Caldarola, Elisa: »Representation without background?«, in: Aisthesis, 2012, [ohne Seitenangaben], Hervorh. i. O. 63 Wollheim, Richard: »On Pictorial Representation«, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1998, S. 222.
2 Bilder erfahren | 25
solchen, die das nicht tun. Für Letztere ist allerdings fraglich, ob und in welcher Weise sie bei der Interpretation eines Bildes eine Rolle spielen können. Da diese Elemente für das Sehen-in irrelevant sind, müssen sie offensichtlich zum Sehen der Bildoberfläche gehören, also zum Picture-Aspekt. Hier zeigt sich aber das Problem, dass Wollheim nicht erklärt, ob und wenn ja in welcher Weise zwischen diesen beiden Bildaspekten eine Verbindung hergestellt werden kann. An Wollheims Beispiel ausgeführt heißt das Folgendes: Er erläutert zwar, dass die »lebhafte« Wirkung der grünen Fläche durch die roten Punkte »gesteigert« wird. Aber seinen Ausführungen zufolge hat diese Wirkung nichts mit der repräsentierten Wiese zu tun. Das würde bedeuten, dass wir nicht die dargestellte Wiese als »lebhaft« empfinden, sondern nur die grüne Fläche, die die Wiese repräsentiert. Eine solche Deutung widerspricht allerdings unserer Erfahrung mit Monets Bildern. Weiterhin verdeutlicht dieses Beispiel abermals Wollheims Unklarheit darüber, welchen Platz die formalen, aber immateriellen Eigenschaften eines Bildes in seiner Analyse der Bilderfahrung einnehmen. Klaus Sachs-Hombach geht in seiner Bildtheorie davon aus, dass die Bildwahrnehmung von grundsätzlichen Wahrnehmungskompetenzen abhängt, die wir ähnlich auch bei der alltäglichen Gegenstandswahrnehmung benötigen.64 Er fasst den Image-Aspekt der Bilderfahrung, zumindest in seiner klassischen Ausprägung, als Erkennen von sichtbaren Gegenständen auf. Dieses funktioniert seinen Ausführungen zufolge nach den gleichen Mechanismen wie das Gegenstandserkennen im Alltag oder das Sehen von Gegenständen z. B. in Wolkenformationen.65 Sachs-Hombach erläutert diesen Prozess wie folgt: »Für das Bildverstehen ist […] eine spezielle Wahrnehmungskompetenz erforderlich, die es uns nicht nur erlaubt, einen Gegenstand als diesen zu sehen […], sondern zudem etwas anderes in ihm zu sehen als er selber ist […]; die zugrunde liegenden Mechanismen […] beruhen auf kognitiven Vergleichsprozessen, die ich im nächsten Abschnitt im Rahmen einer Erörterung des Prototypenbegriffs genauer vorstellen werde. Der visuelle Prototyp umfasst hierbei die jeweils relevanten Eigenschaften, die ein Gegenstand in der Wahrnehmung aufweisen muss, um einer bestimmten Gegenstandsklasse zugeordnet werden zu können. Sehen wir einen Gegenstand nicht nur als diesen Gegenstand, son-
64 Vgl. Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 262 und Sachs-Hombach, Klaus; Schirra, Jörg R. J.: »Medientheorie, visuelle Kultur und Bildanthropologie«, in: Sachs-Hombach, Klaus: (Hg.): Bildtheorien, Frankfurt a. M., 2009, S. 412–413. 65 Vgl. Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 289.
26 | Bildnerisches Denken
dern in ihm zudem etwas anderes, sind unterschiedliche visuelle Prototypen am Klassifikationsprozess beteiligt.«66
Nach dieser Beschreibung besteht das Erkennen eines Bildinhaltes, d. h. der Image-Aspekt, ganz wesentlich darin, dass die im Bild erkennbaren Gegenstände klassifiziert werden. Im nächsten Kapitel wird deutlich, wie nicht nur bei Sachs-Hombach, sondern auch bei anderen Autoren solche Klassifikationsprozesse als zentral für die Bilderfahrung angesehen werden. Das Mittel zur Klassifikation ist hierbei stets die Verbalsprache. 2.2.2 Sprachabhängigkeit des Image Im Folgenden wird gezeigt, in welchem Sinne die verschiedenen Autoren den Image-Aspekt als sprachabhängig ansehen. Dabei nehmen wiederum drei Autoren eine Gegenposition ein. Sowohl Boehm als auch Waldenfels und Wollheim betonen die Unabhängigkeit der Bilderfahrung von der Verbalsprache. Bei Wiesing ist diese Gegenposition nicht ganz so deutlich: Er hält eine Leistung für bildspezifisch, die er als »vorbegrifflich« beschreibt und die daher nicht völlig sprachunabhängig ist. Seine wie auch die Positionen der anderen drei Autoren werden näher in Kapitel 2.2.3 erläutert. Hingegen vertreten Mitchell, Gombrich und Sachs-Hombach die Ansicht, dass das Subsumieren des im Bild Erkannten unter Prädikate ein zentrales Element der Bilderfahrung ist, wie im Folgenden gezeigt wird. W. J. T. Mitchell ist der Ansicht, dass das Verstehen von Bildern stark abhängig ist von Sprache, wie in älteren und neueren Veröffentlichungen von ihm deutlich wird. So können wir seiner Ansicht nach die im Bild repräsentierten Gegenstände sowie deren Ausdruck nur mit Hilne vob Sprache erfassen.67 Diese Ansicht vertritt er noch deutlicher in einem späteren Text. Demzufolge besteht der Image-Aspekt einer Bilderfahrung im Zuschreiben von Prädikaten: »The image, then, is a highly abstract and rather minimal entity that can be evoked with a single word. It is enough to name an image to bring it to mind – that is, to bring it into consciousness in a perceiving or remembering body. Panofsky's notion of the ›motif‹ is relevant here, as the element in a picture that elicits cognition and especially recognition; the awareness that ›this is that‹; the perception of the nameable, identifiable object that appears as a virtual presence; […] that is fundamental
66 Ebenda. 67 Vgl. Mitchell, W.J.T.: »What Is an Image?«, in: New Literary History, 1984, S. 528.
2 Bilder erfahren | 27
to all representational entities.«68 »[W]e might say that images are what allow us to identify the genre of a picture, sometimes very specifically (the Churchill picture) or quite generally (the portrait).«69
Diese Sprachabhängigkeit betrifft nach Mitchell auch abstrakte Bilder, die seiner Ansicht nach ebenfalls nur durch die Verbalsprache erschlossen werden können: »But abstract expressionist painting is, to use Tom Wolfe's phrase […], a ›painted word,‹ a pictorial code requiring a verbal apologetics as elaborate as any traditional mode of painting«.70 Diesen Zusammenhang erklärt er in einem späteren Text etwas deutlicher, in dem er die Entwicklung der Abstraktion als Versuch interpretiert, das Sprachliche aus der Malerei zu eliminieren. Dieser Versuch ist seiner Meinung nach allerdings gescheitert: Zwar mag es gelungen sein, das Erzählerische aus der Malerei zu verbannen. Dieser Sieg wurde ihm zufolge aber mit einer Niederlage an anderer Front erkauft. Die abstrakte Malerei ist laut Mitchell stark abhängig von einem theoretischen Diskurs, ohne den sie unverständlich bleibt.71 Ernst Gombrich behandelt die Abhängigkeit der Bilderfahrung von der Verbalsprache weniger deutlich als Mitchell. So beschreibt er zwar den Image-Aspekt nicht explizit als sprachabhängig, wohl aber unsere Wahrnehmung insgesamt: »Perception always stands in need of universals. We could not perceive and recognize our fellow creatures if we could not pick out the essential and separate it from the accidental – in whatever language we may want to formulate this distinction.«72 Wenn jede Wahrnehmung in dieser Weise abhängig ist von Sprache, dann trifft dies auch auf den ImageAspekt der Bilderfahrung zu. Klaus Sachs-Hombach führt detaillierter aus, inwiefern der Image-Aspekt in der Bilderfahrung sprachabhängig ist. Erstens sieht er eine Analogie zwischen einer elementaren Bildverwendung und einer Prädikation,73 die er folgendermaßen erklärt:
68 Mitchell, W. J. T. »Four Fundamental Concepts of Image Science«, in: Elkins, James (Hg.): Visual
Literacy, New York, 2008, S. 17, Hervorh. i. O. 69 Ebenda, S. 18. 70 Mitchell, W.J.T.: »What Is an Image?«, in: New Literary History, 1984, S. 528. 71 Vgl. Mitchell, W.J.T.: Picture Theory, Chicago, London, 1995, S. 220. 72 Gombrich, Ernst: »The Mask and the Face: The Perception of Physiognomic Likeness in Life and in Art«, in: ders.: The Image and the Eye, Oxford, 1982, S. 106. 73 Vgl. Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 158.
28 | Bildnerisches Denken
»Auf elementarer Ebene veranschaulicht ein Bild lediglich Eigenschaften. Hierbei werden, genauer betrachtet, zunächst nur die als wesentlich erachteten Merkmale eines Begriffs ins Spiel gebracht: Wie man sich etwa den Begriff des Parallelogramms durch vier entsprechend gezeichnete Linien veranschaulichen kann.«74
Zweitens beschreibt er in Übereinstimmung mit Mitchell die Bestimmung des Bildinhaltes als Klassifikation. Mit Gombrich ist er sich einig, dass eine solche jeder Wahrnehmung zugrunde liegt: »Die These, dass die illokutionäre Funktion von Bildern in elementarer Verwendung in der Veranschaulichung von Begriffen besteht, ist im Grunde genommen eine Konsequenz der wahrnehmungstheoretischen Voraussetzungen des entwickelten Bildbegriffs, denn sie besagt nichts anderes, als dass die Bestimmung des Bildinhalts eine auf Bilder angewandte klassifikatorische Wahrnehmungsleistung voraussetzt. Bilder können dann (in Umkehrung dieser Verhältnisse) als Vergegenständlichung der Klassifikationsleistung verstanden werden, da sie uns die verschiedenen Möglichkeiten zeigen, einen Gegenstand anhand bestimmter visueller Eigenschaften zu klassifizieren.«75
Mitchell, Gombrich und Sachs-Hombach verstehen den Image-Aspekt der Bilderfahrung als sprachabhängig. Gombrich und Sachs-Hombach leiten dies von der Sprachabhängigkeit der Wahrnehmung im Allgemeinen ab. Den Image-Aspekt der Bilderfahrung verstehen sie als eine besondere Form dieser Wahrnehmung. 2.2.3 Alternativen In allen bisher vorgestellten Theorien finden sich Ansätze, diese eingeengte Beschreibung des Image-Aspektes aufzubrechen. Allerdings beschränken sich diese Ansätze z. T. auf Nebenbemerkungen oder sie sind kaum systematisch und überzeugend ausgeführt, wie im Folgenden gezeigt wird. Die Schilderung alternativer Ansätze zur Beschreibung des Image-Aspektes folgt derselben Systematik wie die bisherigen Ausführungen: Im ersten Unterkapitel wird erläutert, welche der bisher vorgestellten Autoren auch die Darstellung von Ungegenständlichem in einem Bild für möglich halten (2.2.3.1). Wie bereits ausgeführt, vertritt Wollheim hier die strengste Position. Seiner Ansicht nach muss man in einer Farb- und Formanordnung immer etwas Gegenständliches erkennen können, um von einem Bild sprechen zu kön-
74 Sachs-Hombach, Klaus; Schirra, Jörg R. J.: »Medientheorie, visuelle Kultur und Bildanthropologie«, in: Sachs-Hombach, Klaus: (Hg.): Bildtheorien, Frankfurt a. M., 2009, S. 414. 75 Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 185.
2 Bilder erfahren | 29
nen. Der Eindruck räumlicher Tiefe ist hier die Minimalbedingung für Gegenständlichkeit. Im zweiten Unterkapitel wird untersucht, inwiefern die Autoren die Möglichkeit reflektieren, Nicht-Verbalisierbares in einem Bild zu erkennen (2.2.3.2). Nur Gombrich zieht diese Möglichkeit nicht in Betracht. 2.2.3.1 Ungegenständliches im Image Es wurde schon deutlich, dass die Beschreibung des Image-Aspektes in einer Theorie direkten Einfluss auf das vertretene Bildverständnis hat. Die Reduktion auf das Erkennen sichtbarer Gegenstände führt zu einem Bildverständnis, bei dem abstrakte bzw. ungegenständliche Bilder als Randphänomen oder Sonderfall interpretiert werden. Folgende Ausführungen verdeutlichen, welchen Stellenwert die verschiedenen Autoren dem Ungegenständlichen im Image-Aspekt zuerkennen. W. J. T. Mitchell konzentriert sich in seiner Analyse der Bilderfahrung zwar sehr stark auf das Erkennen von sichtbaren Gegenständen. Dennoch scheint er es zumindest früher für möglich gehalten zu halten, dass ein Bild etwas nicht Sichtbares zum Ausdruck bringt und insofern ganz abstrakt ist: »The expressive aspect of imagery may, of course, become such a predominant presence that the image becomes totally abstract and ornamental, representing neither figures nor space but simply presenting its own material and formal elements.«76 Entsprechend deutet er hier – wie viele andere Autoren – abstrakte Bilder als reflexiv bzw. selbstreferenziell. Aber dieses breitere Verständnis von »image« scheint er, wie bereits erläutert, später verworfen zu haben. Ernst Gombrich verwendet, wie oben ausgeführt, den Begriff »image« in der Regel nur für gegenständliche Bilder. Doch gibt es eine Bildart, die er – trotz ihrer völligen Abstraktheit – dennoch zu den »images« rechnet, das sind Bilder der Op Art.77 Dieses breite Verständnis ist allerdings eine deutliche Ausnahme. Es steht nicht nur im Gegensatz zu seiner oben erläuterten Verwendung des Begriffs »image« für gegenständliche Bilder, sondern auch zu seiner an mehreren Stellen erwähnten Polarisierung von Illusion auf der einen Seite und reinem Ornament bzw. Design auf der anderen. Für Klaus Sachs-Hombach fallen auch abstrakte Gemälde unter den Begriff »Bild«, wie er deutlich betont: »[I]ch habe also keinen Zweifel daran, dass auch fiktionale und ungegenständliche Bilder als vollwertige Bilder
76 Mitchell, W.J.T.: »What Is an Image?«, in: New Literary History, 1984, S. 528. 77 Vgl. Gombrich, Ernst: The Sense of Order, Oxford, 1980, S. 136.
30 | Bildnerisches Denken
angesehen werden sollten.«78 Wie viele andere Autoren versteht er ungegenständliche Bilder als reflexiv,79 weil sie nicht auf etwas außer sich, sondern auf sich selbst, genauer auf bestimmte Merkmale von sich verweisen. Nicht nur die gegenständlichen sondern auch die ungegenständlichen Bilder bezeichnet er als wahrnehmungsnahe Zeichen.80 Ihre Wahrnehmungsnähe ist im Gegensatz zu den gegenständlichen Bildern reflexiv: »Bei ihnen tritt ein figürlicher Bildinhalt zwar zugunsten einer Charakterisierung der Bildmittel zurück; dies ist aber nur möglich, da sie sich auf eine differenzierte Tradition gegenständlicher Bilder beziehen, deren Produktions- und Rezeptionsformen sie veranschaulichend thematisieren.«81 Deutlich wird hier, dass SachHombach die ungegenständlichen bzw. abstrakten Gemälde zwar auch in die Kategorie »Bild« einordnet. Sie stellen ihm zu Folge aber insofern einen Sonderfall dar, als sie nur als Metabilder mit Bezug zu gegenständlichen Bildern verstanden werden können. Gottfried Boehm gesteht zwar zu, dass das gegenständliche Bild die Bildart ist, die am meisten verbreitet ist. Dennoch handelt es sich seiner Ansicht nach hierbei um die »schwächsten« Bilder: »Die historisch erfolgreichste und die verbreitetste Bildpraxis ist zugleich auch die schwächste: sie nimmt das Bild als Abbild in Gebrauch.«82 Bilder, die nicht nur sichtbare Gegenstände abbilden, scheint Boehm für »stärkere« Bilder zu halten. In Übereinstimmung damit kritisiert er die Deutung abstrakter Bilder als reflexiv, wie sie u. a. von Mitchell und Sachs-Hombach vertreten wird. Nach Boehms Ansicht stellt diese Deutung eine Verkürzung dar, weil sich abstrakte Bilder nicht nur auf sich selbst beziehen, sondern ebenso wie gegenständliche Bilder auf die Welt. Der Unterschied besteht lediglich darin, wie die Welt durch das Bild gegliedert wird. Im gegenständlichen Bild wird die Welt in einzelne sichtbare Gegenstände (im oben erläuterten Sinn) gegliedert. Ein abstraktes Bild hingegen kann laut Boehm für das Ganze der Wirklichkeit stehen und in diesem Sinne etwas Unsichtbares zeigen: »Kandinsky hat sich nicht zufällig von Monet inspirieren lassen. In diesen abstrakten Werken scheint gewiss die Welt auf, als blosse [sic] selbstreferentielle Übungen in Farbe und Form wären sie miss-
78 Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 151. 79 Vgl. ebenda, S. 15–16. 80 Vgl. ebenda, S. 208. 81 Ebenda, S. 153. 82 Boehm, Gottfried: »Jenseits der Sprache?«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen, Berlin, 2007, S. 43.
2 Bilder erfahren | 31
verstanden. Aber es ist eine ganz andere Welt, deren Beschaffenheit sich keiner prästabilierten Analogie verdankt […] Mit dem abstrakten Bild verschwindet die ganze Gliederung der Wirklichkeit nach Geschichte, Individuum, Körper, Natur und Ding. Jetzt ist jedes einzelne Bild Metapher der Wirklichkeit schlechthin«.83
Für Boehm scheint gerade in der Darstellung von Unsichtbarem die Stärke des Bildlichen zu liegen. Damit bezieht er zwar deutlich Stellung für eine nicht auf das gegenständliche Erkennen reduzierte Kennzeichnung des Image-Aspektes. Allerdings liefert er keine nähere Erklärung dazu, inwiefern das Bild diese Darstellung leisten kann. Stattdessen stellt er einfach nur fest, dass eine solche Darstellung zweifellos möglich und nachvollziehbar sei: »Jetzt ist jedes einzelne Bild Metapher der Wirklichkeit schlechthin, repräsentiert eine Totalität, wie unbestimmt sie begrifflich auch sein mag. An ihrer visuellen Artikulation und Nachvollziehbarkeit dagegen gibt es keinen Zweifel. Mit dem abstrakten Bild eröffnet die Kunst der Moderne eine neue Direktheit: le tableau und le monde konfrontieren sich in einer unvergleichlichen Konstellation.«84
Auch den Begriff der »starken Bilder« erklärt er nicht präzise, sondern durch Metaphern: »Starke Bilder sind solche, die Stoffwechsel mit der Wirklichkeit betreiben. Sie bilden nicht ab, sie setzen aber auch nicht nur dagegen, sondern bringen eine dichte, ›nicht unterscheidbare‹ Einheit zustande.«85 Ähnlich wie Boehm betont auch Bernhard Waldenfels, dass Bilder mehr als ausschließlich Sichtbares darstellen können. Allerdings wird in seinen Ausführungen nicht ganz deutlich, was er genau unter dem Unsichtbaren im Image-Aspekt versteht. Er verwendet den Begriff der »Sichtbarkeit« offenbar mit unterschiedlichen Bedeutungen, die er aber nicht erläutert: »Welche Formen diese Arbeit am Referenten auch annehmen mag, sie stützt sich jedenfalls auf keinen vorhandenen Referenten. Vielmehr erprobt sie Möglichkeiten der Referenz, indem sie die Welt in den Blickwinkel einer ›Vorwelt‹ rückt. Sie ringt dem wiedersehenden Sehen ein Sehen ab, das sichtbar macht, was nicht sichtbar ist und doch selbst als bestimmtes Unsichtbares einem begrenzten Feld der Sichtbarkeit zugehört. Sie hat es mit einer Sichtbarkeit zu tun, die nicht mehr in einem einzigen Reich der Sichtbarkeit Platz findet und ebenso verstreut ist wie die Bemühungen, diese Sichtbarkeit sichtbar zu machen. […] Das Sichtbarwerden des Sichtbaren kommt nur zum Vorschein,
83 Boehm, Gottfried: »Das bildnerische Kontinuum«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen, Berlin, 2007, S. 170–171. 84 Ebenda, S. 171, Hervorh. i. O. 85 Boehm, Gottfried: »Zuwachs an Sein«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen, Berlin, 2007, S. 252.
32 | Bildnerisches Denken
wenn die Materialität des Bildes etwas von einem Rohmaterial oder besser gesagt: von einem Element behält, und dies mit allen Zeichen des Schöpferischen und des Bedrohlichen.«86
Ähnlich unklar ist seine Position in Bezug zu abstrakten Bildern. Während an einigen Stellen deutlich wird, dass völlig gegenstandslose Gemälde für ihn keine Bilder sind, scheint er an anderen Stellen für den Bildstatus abstrakter Bilder zu argumentieren. So betont er zwar, dass der Begriff des Bildes nicht nur auf reine Abbilder von sichtbaren Gegenständen reduziert werden dürfe. Aber reine »Urbilder«, also solche Gemälde, die sich gar nicht auf sichtbare Gegenstände beziehen, kommen für ihn ebenso wenig als Bilder in Betracht: »Ein pures Urbild, dessen Einmaligkeit durch kein Nocheinmal angekratzt wäre, ist ein ebensolcher Grenzfall wie das pure Abbild, das gar nichts Eigenes hinzuzusetzen hätte. Erfahrung oszilliert zwischen den Extremen eines reinen Neusehens und eines reinen Wiedersehens, bei denen es entweder kein Bild oder nur noch Bilder gäbe.«87
In Übereinstimmung damit bezeichnet er die abstrakte Malerei durchaus mit negativer Konnotation als »Nullpunkt der Malerei«: »Es fragt sich […], ob der ›Nullpunkt der Malerei‹, den diese seit langem umkreist, als Endpunkt zu verstehen ist, als zunehmende Ausradierung aller Tafeln, wo am Ende alles und nichts mehr geht, – oder als Neueinsatz. […] Vieles, was in der modernen, hyper- oder postmodernen Kunst geschieht, kann verstanden werden als der Versuch, in Extremen und Exzessen bis an die Grenzen der herkömmlichen Kunst zu gehen, bis an den Punkt, wo Absturz oder Auflösung drohen – und nicht selten auch erfolgen.«88
Dennoch scheint Waldenfels an anderer Stelle die Ansicht zu vertreten, dass auch ungegenständliche Gemälde als Bilder zu verstehen sind.89 Im Unterschied zu Boehm hält Waldenfels die Interpretation abstrakter Bilder als reflexiv bzw. selbstreferenziell für plausibel.90
86 Waldenfels, Bernhard: »Das Rätsel des Sichtbaren«, in: ders.: Der Stachel des Fremden, Frankfurt a. M., 1990, S. 224, Hervorh. i. O. 87 Ebenda, S. 210, Hervorh. i. O. 88 Ebenda, S. 218. 89 Vgl. Ebenda, S. 219, Hervorh. i. O. 90 Vgl. Ebenda, S. 220.
2 Bilder erfahren | 33
Lambert Wiesing erläutert ausdrücklich, dass das Erkennen von sichtbaren Gegenständen keineswegs zentral für die Bilderfahrung ist.91 Er geht noch einen Schritt weiter, indem er betont, dass gerade das Übersehen der dargestellten Gegenstände die richtige Art der Bildbetrachtung sein kann: »Ein bewußtes Übersehen des abgebildeten Gegenstandes ist in diesem Fall kein Mißbrauch des Bildes, weil dieses selbst eine solche Nutzung nahelegt. Ein Bild von Turner ist sinnvoll betrachtet, wenn man sich nicht Schiffe, sondern eine Ordnung des Sichtbaren zeigen läßt.«92 Seine Deutung abstrakter Bilder schließt an diese Überlegung an. Sie ermöglichen dem Betrachter auf natürliche Weise eine rein formale Betrachtung, die bei gegenständlichen Bildern nur durch das künstliche Übersehen der Gegenständlichkeit möglich ist: »Faßt man den phänomenologischen Gedankengang zusammen, so kann man festhalten: Das Besondere eines abstrakten Bildes besteht darin, daß es in der natürlichen Einstellung so betrachtet werden kann wie ein gegenständliches Bild aus der Epoché heraus. Die Notwendigkeit zur Einklammerung des Gegenstandsbezugs und der damit einhergehende widernatürliche Zug der formalen Betrachtung entfällt bei einem abstrakten Bild. Das abstrakte Bild zeigt dem normal eingestellten Betrachter das, was ein gegenständliches Bild aus einer künstlichen Haltung zeigen kann.«93»Aus der Sicht der Phänomenologie wird das abstrakte Bild als die Verabsolutierung eines Teilaspekts des gegenständlichen Bildes gedeutet.«94
Wiesings Erklärung abstrakter Bilder verdeutlicht, dass jedes gegenständliche Bild abstrakte Komponenten enthält, wie auch von ihm mit einem Zitat Roman Ingardens ausgeführt wird: »›Es kommt mir lediglich darauf an, uns zum Bewußtsein zu bringen, daß in den Aufbau eines jeden darstellenden Bildes ein sozusagen nichtdarstellendes Bild als sein unentbehrlicher Bestandteil eingeht.‹«95 Dennoch ist auch Wiesing wie Sachs-Hombach der Ansicht, dass man abstrakte Bilder nicht ohne ihren Bezug zu gegenständlichen Bildern verste-
91 Vgl. Wiesing, Lambert: Die Sichtbarkeit des Bildes, Frankfurt a. M., 2008, S. 13. 92 Ebenda, S. 20. 93 Ebenda, S. 233. 94 Ebenda. 95 Ebenda, S. 234. Wiesing zitiert aus: Ingarden, Roman: »Das Bild«, in: ders.: Untersuchungen zur
Ontologie der Kunst, Tübingen, 1962, S. 225, und verweist auf: Ingarden, Roman: »Über die sogenannte ›abstrakte‹ Malerei«, in: ders.: Erlebnis, Kunstwerk und Wert, Tübingen, 1969.
34 | Bildnerisches Denken
hen kann.96 Damit teilt Wiesing auch die Annahme Sachs-Hombachs, abstrakte Bilder seien Bilder über Bilder bzw. Metabilder: »Das abstrakte Bild ist […] ein Zeichen für ein anderes Zeichen, ein Bild darüber, wie ein gegenständliches Bild strukturiert sein könnte. Anstelle wirklicher Fische wird nur das Netz gemalt, mit dem mögliche Fische gefangen werden können. Anstatt eine gegenständliche Wirklichkeit zu beschreiben, die auch fiktiv sein kann, aber dennoch eine Wirklichkeit ist, beschreibt das abstrakte Bild Möglichkeiten, wie die Wirklichkeit dargestellt und erfahren werden kann.«97
2.2.3.2 Sprachloses im Image Es gibt in fast allen bisher erörterten Bildtheorien Ansätze, auch die Darstellung von Etwas, das nicht verbalisiert werden kann, als Image zu bezeichnen. Diese werden im Folgenden erläutert, wobei auch ihre Defizite deutlich werden. Ernst Gombrich ist unter den genannten Autoren die einzige Ausnahme. Für ihn scheinen Bilder in allen Fällen nur Verbalisierbares darstellen zu können. W. J. T. Mitchell betont einerseits in einem älteren Text, dass die Ausdrucksmöglichkeiten eines Bildes nicht durch die Prädikate eingeschränkt sind, die wir den erkennbaren Gegenständen im wörtlichen Sinn zuschreiben können.98 Andererseits ist seiner Ansicht nach die sprachliche Beschreibung des Ausdruckscharakters unverzichtbar für sein Verstehen: »Twain and Lessing's skepticism about pictorial expression is useful insofar as it reveals the necessarily verbal character of imaging the invisible. It is misleading in that it condemns this verbal supplementation of the image as improper or unnatural.«99 Hier formuliert er deutlich die Abhängigkeit des Image-Aspektes von der Sprache. Allerdings räumt er ein, dass die sprachliche Erfassung eines bildlichen Ausdrucks durchaus poetischen Charakter annehmen kann: »[T]he setting, compositional arrangement, and color scheme may all carry expressive charge, so that we can speak of moods and emotional atmospheres whose appropriate verbal counterpart may be something on the order of a lyric poem.«100 Anders als Mitchell betont Richard Wollheim die völlige Unabhängigkeit des bildlichen Ausdrucks von der Verbalsprache:
96 Vgl. ebenda, S. 233. 97 Ebenda, S. 234. 98 Vgl. Mitchell, W.J.T.: »What Is an Image?«, in: New Literary History, 1984, S. 528. 99 Ebenda. 100 Ebenda.
2 Bilder erfahren | 35
»But note that melancholy, turbulence, serenity, are textbook objects of expression, and they are deeply misleading if they suggest that, whenever a picture is expressively perceived, it is perceived as expressing something as simple as these examples. […] It is unwarranted to think that, as has often been thought, a painting cannot express an emotion or feeling unless that emotion or feeling can also be caught in language. Why should something, if it can be expressed once, have to be expressible twice – and, if it has to be, why stop there?«101
Auch das, was ein Bild repräsentiert, muss nach Wollheim nicht unbedingt verbalsprachlich beschreibbar sein, wie beispielsweise bei abstrakten Bildern: »[A]bstract paintings reveal themselves to be representational, and it is at this point irrelevant that we can seldom put into adequate words just what they represent.«102 Damit zieht Wollheim die Möglichkeit in Betracht, dass Bilder etwas zum Ausdruck bringen, was nicht sprachlich beschreibbar ist. Er rechtfertigt diese Möglichkeit, indem er die Annahme anzweifelt, alles, was im Bild ausgedrückt ist, müsse zusätzlich in einer anderen Sprache ausdrückbar sein. Allerdings liefert er keine Systematisierung, die das Verhältnis von Sprache und Bild näher erklären würde. Obwohl Klaus Sachs-Hombach das Bild in Analogie zur Prädikation beschreibt, geht er nicht davon aus, dass Bilder nur sprachlich Beschreibbares darstellen können.103 Die Aspekte des Bildes, die über die Veranschaulichung eines Begriffes hinausgehen, sind nach Sachs-Hombach verantwortlich für den ästhetischen Wert eines Bildes: »[E]ine visuelle Darstellung kann natürlich aus prinzipiellen Gründen niemals eine adäquate Darstellung eines bestimmten Begriffs sein. […] Sowohl die zur Darstellung eines Begriffs redundanten bzw. kontingenten Bildeigenschaften als auch die gleichzeitig nötige Beschränkung auf bestimmte (dann als markant erscheinende) Eigenschaften bewirkt einige der besonderen ästhetischen Möglichkeiten des Bildeinsatzes. Weil nicht alle inhaltlichen Bestimmungen eines Bildes im veranschaulichten Begriff aufgehen, lässt sich das Bild einerseits, wie es heißt, auch nicht auf den Begriff bringen. Da zudem immer einige Eigenschaften zur Charakterisierung des Begriffs in besonderer Weise herausgestellt werden, trägt es andererseits zur Akzentuierung eines Begriffs bei. Der ästhetische Wert vieler Kunstwerke verdankt sich mitunter einem dieser beiden Verfahren.«104
101 Wollheim, Richard: Painting as an Art, Princeton, 1987, S.80. 102 Ebenda, S.62. 103 Vgl. Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 185. 104 Ebenda, S. 172.
36 | Bildnerisches Denken
Auch wenn hier die völlige Sprachabhängigkeit von Bildern verneint wird, werden die nicht sprachlich erfassbaren Bildeigenschaften doch nur unter eben diesem Aspekt berücksichtigt, dass sie nicht sprachlich erfassbar sind. Negativ ausgedrückt sind es die Eigenschaften eines Bildes, die für die reine Veranschaulichung eines Begriffs überflüssig sind. Positiv formuliert handelt es sich um die Eigenschaften, die den »ästhetischen Wert« eines Bildes ausmachen. Beide Charakterisierungen dieser Bildeigenschaften verdeutlichen, dass die Verbalsprache als dominanter Maßstab für die Analyse des Phänomens Bild wirksam bleibt: Alle Bildeigenschaften werden hinsichtlich der Frage untersucht, ob sie der Veranschaulichung eines Begriffes dienen können. Diejenigen Bildeigenschaften, die diese Funktion nicht erfüllen, sind bezogen auf sie wertlos. Zwar wird ihnen ein anderer positiver, nämlich »ästhetischer«, Wert zugesprochen. Aber es bleibt hier unklar, was damit genau gemeint ist. Bei der Analyse abstrakter Bilder entfernt sich Sachs-Hombach von diesem Maßstab. Hier erläutert er, dass es Bilder gibt, bei deren Wahrnehmung die verbalsprachlichen Klassifikationsprozesse nicht mehr vorausgesetzt werden: »Denn insofern diese Bilder – etwa von Mark Rothko oder von Cy Twombly – eine Entkoppelung der Wahrnehmungsprozesse von den ihnen üblicherweise inhärenten Klassifikationsprozessen erzwingen, laufen die (mit der Wahrnehmung automatisch aktivierten) begrifflichen Tendenzen des Betrachters zur Identifizierung und Strukturierung gleichsam ins Leere und lenken den Wahrnehmungsprozess so auf sich selbst zurück. Die Erfahrung des Unbestimmten und klassifikatorisch nicht Einholbaren scheint die von den Künstlern der Minimal Art intendierte Erfahrung zu sein, die sie oft mit den Metaphern des Mystischen oder auch mit buddhistischen Theoremen erläutern.«105
Sachs-Hombach deutet zumindest bestimmte abstrakte Bilder als solche reflexiven Bilder, die den Wahrnehmungsprozess vom Klassifikationsprozess entkoppeln und in diesem Sinn etwas Nicht-Sprachliches zur Darstellung bringen. Diese Bilder ermöglichen dem Betrachter kein sprachliches Klassifizieren von Gegenständen, sondern erfordern eine von dieser begrifflichen Tendenz losgelöste Betrachtung. Im Unterschied zu Sachs-Hombach betont Gottfried Boehm gerade den nicht-prädikativen Charakter von allen Bildern: »Bildsinn ist nicht-prädikativ […]. Der sinngenerierende Akt vollzieht sich nicht nach dem Muster der Prädikation (S ist P), sondern nach dem anderen einer qualitativen Wahr-
105 Ebenda, S. 212.
2 Bilder erfahren | 37
nehmung dessen, was sich in der ikonischen Differenz zeigt.«106 Die Bilder von Cy Twombly, die Sachs-Hombach eher als Ausnahme kennzeichnet, sind für Boehm paradigmatisch für Bilder schlechthin: »Die Kunst des Zeigens entfaltet Twombly gleichwohl zu außerordentlichen Möglichkeiten. […] Twomblys Criticism […] bietet eine vor dem Nennen liegende Matrix dar. Was sie enthüllt, wird niemals gesagt werden können. Gleichwohl mangelt es an nichts, denn es zeigt sich, was es ist.«107 Boehm schließt dabei nicht aus, dass manche Teile oder Aspekte des Dargestellten verbal beschreibbar sind. Der Sinn des gesamten Bildes lässt sich seiner Meinung nach durch solche Verbalisierungen aber nicht erschließen. Er ist in jedem Fall nichtsprachlich: »Natürlich lässt sich das inhaltliche Repertoire des Dargestellten in vielen Fällen identifizieren und nachbuchstabieren: dies könnte das sein. Gewiss ein wichtiger, erster Schritt der Analyse. Der Sinn aber, den diese unterschiedlichen Zeichen generieren, ist mit der Ikonographie nicht identisch. Aus einem ganz einfachen Grund: das Bild bietet uns an, alles auf einmal zu sehen, und lädt uns deshalb ein, was es zeigt, auf eine freie Weise zu lesen, es so oder so miteinander zu verbinden. Diese möglichen Verbindungen begründen, was man den Sinn nennt. Und dieser Sinn folgt nicht der Linearität der Sprache und der Logik des Satzes. Er aktualisiert sich ganz anders.«108
Boehm formuliert also ein deutliches Plädoyer für die Nicht-Sprachlichkeit des Bildsinns. Allerdings liefert er keine weitere Erklärung, auf welche Art sich der Bildsinn »aktualisiert«. Stattdessen gibt er folgende stark metaphorische Beschreibung für das Entstehen des Bildsinns: »Bevor das Bild etwas sagt, das man auch in Worte fassen könnte, ist es ein Akt des Zeigens, der visuellen Entfaltung. In ihm verbinden sich die unterschiedlichsten Elemente der äusseren [sic] oder inneren Welt, bilden sich Interferenzen, Schichtungen, Kollisionen aus. Was sich da ereignet, ist das Spiel einer offenen Verbindung, in dem sich Begriffe, Wortfetzen, Zeichen, Gesichter, Organe, Geräte, Farben, Gesten etc. aufeinander beziehen.«109
106 Boehm, Gottfried: »Unbestimmtheit«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen, Berlin, 2007, S. 211, Hervorh. i. O. 107 Boehm, Gottfried: »Das Zeigen der Bilder«, in: Boehm, Gottfried u. a. (Hg.): Zeigen, München, 2010, S. 29, Hervorh. i. O. 108 Boehm, Gottfried: »Die Kraft der Bilder«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen, Berlin, 2007, S. 239, Hervorh. i. O. 109 Ebenda, S. 240, Hervorh. i. O.
38 | Bildnerisches Denken
Bernhard Waldenfels geht ebenso wie Boehm davon aus, dass der Bildsinn sprachlich nicht erfassbar ist: »Der gemeinte Bildsinn realisiert sich in der Bildstruktur auf eine Weise, daß das Gemeinte auf neue Weise gesehen wird; damit geht die ›Leistung ikonischer Sinndichte‹ über die Sprache hinaus «.110 Waldenfels nimmt eine eigene bildliche Ordnungsstruktur an, die unabhängig von der Verbalsprache einem eigenen »ästhetischen Logos« folgt: »Wenn im folgenden von Ordnungen des Sichtbaren die Rede ist, so wird einmal vorausgesetzt, daß es einen autochthonen ›Logos der ästhetischen Welt‹ gibt, daß also die sinnliche Erfahrung als solche bereits strukturiert, artikuliert, gestaltet und organisiert ist; die Ästhetik bleibt damit zurückgebunden an die genuine Aisthesis.«111
Das Verstehen dieses sinnlichen Logos wird durch die Verbalsprache eher gefährdet als unterstützt: »Museen sind auch Orte, wo das Gesehene zur Sprache gebracht wird […]. Wie sehr die Gefahr besteht, daß das Sehen durch Reden überdeckt oder gar verhindert wird, weiß jeder Besucher, der sich durch Wortschwaden hindurchkämpft.«112 Die nähere Beschreibung dieser Ordnung des Sichtbaren fällt auch bei Waldenfels recht allgemein und zum Teil metaphorisch aus: »Die unverbrüchliche Ordnung des Sichtbaren wirft ihre Schatten, wie schon angedeutet, auf die Ordnung des Bildhaften.«113 »Die Ordnung in den Dingen, die sich in der Bildordnung spiegelt, bezieht sich auf verschiedene Aspekte. Sie betrifft die innere Anordnung des Sichtbaren, die dazu führt, daß Eidos und Morphe als Wesensgestalt alles Beiläufige und Zufällige von sich abstreifen. Hinzu kommt die Einordnung in ein Ganzes, innerhalb dessen etwas sich als es selbst entfalten kann. Schließlich kommt es zu einer Über- und Unterordnung, die dazu führt, daß etwas mehr oder weniger sehensund bildwürdig ist und daß das Sehbegehren gezügelt wird durch eine Hierarchie des Sichtbaren.«114
110 Waldenfels, Bernhard: »Ordnungen des Sichtbaren«, in: ders.: Sinnesschwellen, Frankfurt a. M.,1999, S. 104. 111 Ebenda, S. 102. 112 Waldenfels, Bernhard: »Der herausgeforderte Blick«, in: ders.: Der Stachel des Fremden, Frankfurt a. M., 1990, S. 236. 113 Waldenfels, Bernhard: »Ordnungen des Sichtbaren«, in: ders.: Sinnesschwellen, Frankfurt a. M.,1999, S. 108. 114 Ebenda, S. 109, Hervorh. i. O.
2 Bilder erfahren | 39
Lambert Wiesing analysiert in seiner Bildtheorie am ausführlichsten die Möglichkeiten des Bildes, Nicht-Sprachliches darzustellen. Dabei schließt er an die Tradition der formalen Ästhetik an. Diese – so Wiesing – beschäftigt sich nicht mit der semantischen Dimension eines Bildes, sondern mit seiner formalen Struktur: »[D]ie formale Ästhetik behandelt das Bild – weil sie die semantische Dimension nicht übergeht, sondern einklammert – wie eine leere syntaktische Struktur, wie eine mathematische Formel. Sie weiß, daß das, was sie beschreibt, ein Aspekt eines Bildes ist, daß die Oberfläche nicht nur dekorative Eigenschaften besitzt, sondern eine Bildsprache manifestiert, die geeignet ist, einen abwesenden Gegenstand sichtbar werden zu lassen. Deshalb erzeugt sie mittels der Epoché einen künstlichen Blick auf das Bild, der den schmalen Weg zwischen einer materialistischen – allein auf das physische Werk gerichtete – und einer idealistischen – allein auf den Gehalt gerichtete – Werkbeschreibung eröffnet«115
Hier wird außerdem nochmals deutlich, dass Wiesing im Gegensatz zu den meisten anderen Theoretikern nicht nur zwischen zwei Bildaspekten unterscheidet – dem Picture- und dem Image-Aspekt –, sondern zwischen drei möglichen Perspektiven auf das Bild: der materialistischen, der idealistischen und der formalen. Das nicht-sprachliche Potential von Bildern besteht laut Wiesing in einer vorbegrifflichen Leistung. Anhand von zwei Bildbeispielen erläutert er jeweils eine solche vorbegriffliche Ordnungsleistung, und zwar: 1. das Sichtbarmachen von Gleichem im Ungleichen und 2. das Sichtbarmachen von Ungleichem im Gleichen. Zur Veranschaulichung wählt er zwei sehr unterschiedliche Schiffdarstellungen: eine von William Turner und eine von Hergé aus der Comicserie Tintin.116 Beide Bilder nehmen nach Wiesing eine Ordnungsleistung vor, indem sie etwas differenzieren und etwas Anderes gleichsetzen bzw. zusammenfassen: »[B]ei Turner sind der Qualm und der Rumpf des Schiffs eine sichtbare Einheit.«117 »Doch die Lichtunterschiede des Himmels […] [werden von] Turner wiederum fein differenziert«118. Im Gegensatz dazu sind »das Schiff und der Hintergrund […] bei Hergé als zwei
115 Wiesing, Lambert: Die Sichtbarkeit des Bildes, Frankfurt a. M., 2008, S. 217. 116 J. M. William Turner: »Staffa, Fingal’s Cave«, 1832 und Georges Prosper Remi alias Hergé: »Bild der Sirius« aus der Comicserie Tintin, 1943. 117 Wiesing, Lambert: Die Sichtbarkeit des Bildes, Frankfurt a. M., 2008, S. 78, Hervorh. i. O. 118 Ebenda.
40 | Bildnerisches Denken
Dinge sichtbar unterschieden.«119 »Doch die Lichtunterschiede des Himmels, […] werden bei Hergé mit einem Farbton gleichgesetzt.«120 Turner setzt also die verschiedenen Gegenstände gleich (Qualm und Rumpf), differenziert aber die Lichtunterschiede im Himmel), während Hergé genau das Gegenteil macht. Er differenziert die unterschiedlichen Gegenstände, setzt hingegen die Lichtunterschiede im Himmel gleich. Wiesing bezeichnet Turner als Vertreter eines malerischen Stils, während Hergé einen linearen Stil verfolgt: »Malerische Formen fassen unterschiedliche Dinge zur Einheit zusammen; […] [l]ineare Formen differenzieren hingegen«.121 In dieser unterschiedlichen Ordnungsleistung des Sichtbaren sieht Wiesing eine vorbegriffliche bzw. begriffsanaloge Leistung: »Bilder bereiten ein begriffliches Gleichsetzen von Nichtgleichem durch Sichtbarmachung von Gleichem im Ungleichen und umgekehrt durch Sichtbarmachung von Ungleichem im Gleichen vor. Sie zeigen, was gleich und was unterschiedlich sein kann, und bringen insofern eine vorbegriffliche Leistung zur Sichtbarkeit.«122
Die unterschiedlichen Stile von Abbildern entsprechen dabei unterschiedlichem Denken, das die jeweilige Ordnungsleistung vollzieht.123 Diese unterschiedlichen Denkarten entsprechen laut Wiesing unterschiedlicher begrifflicher Rationalität: »Unterschiedlichen Stilen ist unterschiedliches Denken eigentümlich, und zwar durchaus ein Denken, welches mit entsprechender begrifflicher Rationalität parallelisiert werden kann. […] Der Umfang der Elemente, die unter einen wissenschaftlichen Begriff fallen, ist linear begrenzt, während in anderen Kontexten angemessen und erfolgreich mit offenen, ›malerisch‹ begrenzten Begriffen gearbeitet wird. Hieran sieht man, daß das Typensystem Riegls von den sichtbaren immanenten Relationen zwischen Bildteilen auf die unsichtbaren Relationen zwischen Begriffen übertragen werden kann, um das wissenschaftliche Denken als ein haptisches Denken zu typisieren.«124
Wiesing erkennt also eine Analogie zwischen den Ordnungsleistungen durch Begriffe und durch Bilder. Mit Hilfe von beidem kann man die Welt
119 Ebenda, Hervorh. i. O. 120 Ebenda. 121 Ebenda. 122 Ebenda. 123 Vgl. ebenda. 124 Ebenda, S. 79.
2 Bilder erfahren | 41
ordnen und beides kann in unterschiedlichen Stilen erfolgen. Diese Stile entsprechen dann verschiedenen Denkarten. Beide Ordnungsleistungen sind seiner Ansicht nach Denkleistungen. Die Gleichsetzungen und Differenzierungen im Bild (z. B. von Rumpf und Qualm) entsprechen dabei den Gleichsetzungen und Differenzierungen, die durch die Sprache vorgenommen werden können. Die so beschriebene Ordnungsleistung ist allerdings nicht völlig sprachunabhängig. Wie viele andere Autoren bestimmt auch Wiesing die Leistung des Bildes dadurch näher, dass er sie mit der Leistung der Verbalsprache vergleicht. Zudem verdeutlichen die Beispiele, dass die so beschriebene Leistung im Bild eher als nachbegrifflich bezeichnet werden müsste. Denn damit die malerischen Formen unterschiedliche Dinge (z. B. Rumpf und Qualm) zur Einheit zusammenfassen können, muss zunächst die Unterschiedlichkeit der Dinge erkannt sein. Diese Unterschiedlichkeit wird auch nach Wiesing mit Hilfe von Begriffen erkannt und beschrieben: das eine Ding ist der »Rumpf«, das andere der »Qualm«. Ohne diese begrifflich getroffene Unterscheidung erkennt man als Betrachter sowohl der Wirklichkeit wie auch des Bildes eventuell nur eine einzige, unterschiedslose weiße Fläche – eben genau so, wie sie von Turner gemalt wurde. Dann kann man aber nicht mehr davon sprechen, dass der Maler eine Gleichsetzung oder Zusammenfassung geleistet hat, weil die Dinge in seiner Wahrnehmung gar nicht unterschieden waren. Die Auffassung des Bildes als begriffsanalog führt außerdem dazu, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen Bildern und Sprache nicht hervorgehoben wird: Bilder oder auch Bildteile dienen, wenn sie als Bilder ernst genommen werden, gerade nicht dazu, Dinge unter sich zu subsumieren, wie das Begriffe tun. Dies lässt sich an den Bildbeispielen Wiesings gut verdeutlichen: Durch die Differenzierung und Zusammenfassung unterschiedlicher Dinge (Rumpf und Qualm) oder der Farbunterschiede im Himmel entstehen gerade keine Einheiten (analog zu Begriffen), unter die man weitere Dinge subsumieren könnte. Die weiße Fläche in Turners Bild dient nicht der Klassifizierung einer bestimmten Art von Dingen in der Welt. Stattdessen handelt es sich um eine einmalige Farb- und Formanordnung, deren Stärke gerade in ihrer Einzigartigkeit liegt. Das Klassifizieren von Dingen in der Welt funktioniert mit Begriffen viel besser als mit Bildern oder Bildteilen. Werden Bilder an dieser Funktion gemessen, erscheinen sie immer als defizitär gegenüber der Sprache. Bilder ordnen die Welt nach einem gänzlich anderen Prinzip.
42 | Bildnerisches Denken
2.2.4 Konsequenzen In diesem Kapitel wurde dargelegt, wie in verschiedenen Bildtheorien der Image-Aspekt der Bilderfahrung beschrieben wird. Dabei hat sich gezeigt, dass die meisten dieser Theorien mindestens eines der beiden problematischen Merkmale aufweisen: Der Image-Aspekt wird zumindest in seiner typischen Ausprägung als Erkennen von sichtbaren Gegenständen und als abhängig von der Verbalsprache beschrieben. Das erste Merkmal hat zur Folge, dass gegenständliche Bilder als paradigmatisch gelten, abstrakte bzw. ungegenständliche Bilder hingegen als Sonderfälle oder gar nicht mehr als Bilder. Dadurch entsteht der Eindruck, als wäre die Bilderfahrung eines gegenständlichen Bildes grundsätzlich zu unterscheiden von der Bilderfahrung abstrakter Bilder. Tatsächlich ist die Grenze zwischen beiden Bildarten und ihrer Erfahrung fließend. Zudem kann die allmähliche, schrittweise Entwicklung der Arbeit eines Künstlers von der gegenständlichen Malerei zur Abstraktion bei diesem Bildverständnis nicht als fließender Übergang beschrieben werden. Weiterhin bleibt völlig unberücksichtigt, dass auch in jedem gegenständlichen Bild abstrakte Komponenten vorhanden sind und eine wichtige Rolle spielen können. Genau aus diesem Grund üben sich professionelle Bildgestalter und Bildbetrachter darin, auch gegenständliche Bilder unter einem rein abstrakten – das heißt hier rein formalen – Blickwinkel zu betrachten. Denn die formale Gestaltung eines Bildes beeinflusst immer auch, welche Gegenstände wir in einem Bild erkennen. Die Form eines Bildes trägt wesentlich zu seinem Inhalt bei – auch bei gegenständlichen Bildern. Bildtheorien, die diese Verzahnung nicht berücksichtigen, verfehlen den Kern des Bildhaften. Das zweite Merkmal führt dazu, dass das, was man im Bild erkennen kann, davon bestimmt wird, was verbal beschreibbar ist. Der Image-Aspekt in der Bilderfahrung wird aufgefasst als das Anwenden von Prädikaten auf das Bild. Dadurch werden von vorneherein solche Aspekte der Bilderfahrung ausgeschlossen, die sich der Verbalisierung entziehen. Zudem erscheint das Bild gemessen an den Funktionen, die die Sprache erfüllt, defizitär und erfährt so automatisch eine Abwertung. In allen hier aufgeführten Theorien wurden Ansätze einer alternativen Kennzeichnung des Image-Aspektes gefunden. Keiner dieser Ansätze ist dabei befriedigend ausgearbeitet. Entweder wird das Ungegenständliche und Sprachlose im Bild nur als Randphänomen, als Ausnahme oder doch in Abhängigkeit zum Gegenständlichen und zur Sprache gesehen. Oder es wird, wenn es eine größere Rolle im Rahmen der jeweiligen Bildtheorie spielt, nicht ausreichend systematisch erläutert, sondern nur metaphorisch
2 Bilder erfahren | 43
umschrieben. Bei Wollheim und Wiesing zeigte sich zudem, dass in der Zweiteilung von Picture- und Image-Aspekt die formalen, aber immateriellen Eigenschaften eines Bildes nicht oder nur unzureichend berücksichtigt sind.
44 | Bildnerisches Denken
2.3
B ILDERFAHRUNG IM M ODELL DES B ILDNERISCHEN D ENKENS In der Analyse verschiedener Beschreibungen des Image-Aspektes wurden zwei Merkmale als problematisch erkannt: die Reduktion des ImageAspektes 1. auf das Erkennen von sichtbaren Gegenständen und 2. auf das durch die Verbalsprache Beschreibbare. Diese Merkmale sind in jedem Fall problematisch – unabhängig davon, ob der Image-Aspekt allein als notwendig für die Bilderfahrung angesehen wird oder nur zusammen mit dem Picture-Aspekt. Zudem hat sich herausgestellt, dass bei der Beschreibung des Phänomens Bild als »Picture« und »Image« die formalen immateriellen Eigenschaften eines Bildes nicht systematisch erfasst sind. In den meisten Beschreibungen des Image-Aspektes sind sie nicht mitberücksichtigt, da diese sich auf das Erkennen sichtbarer Gegenstände konzentrieren. Den meisten Theorien zufolge scheinen sie auch nicht zum Picture-Aspekt zu gehören, da dieser in der Regel als Materialität des Bildes aufgefasst wird. Die aufgezeigten Probleme lassen sich lösen, wenn das Spezifische der Bilderfahrung durch das Modell des Bildnerischen Denkens erklärt wird. Aus der Analyse der Bildtheorien ergeben sich zwei Forderungen für den Modellentwurf des Bildnerischen Denkens. Aus dem zweiten Merkmal folgt: Das Modell muss erklären, worin die spezifische Differenz der Bilderfahrung im Vergleich zu anderen Erfahrungen liegt. Genauer muss es erklären, welche geistigen Tätigkeiten ein Bild erfordert – besonders im Unterschied zur Sprache. Dabei dürfen diese bildspezifischen Tätigkeiten nicht in Abhängigkeit zur Sprache beschrieben werden. Das erste Merkmal führt zur zweiten Forderung: Das Modell des Bildnerischen Denkens muss in gleicher Weise die Bilderfahrung gegenständlicher wie ungegenständlicher Bilder erklären. Weder darf eine der beiden Bildarten als Sonderfall oder Ausnahme gelten, noch darf das Modell von einer strikten Trennung beider Bildarten ausgehen. Das Modell des Bildnerischen Denkens liefert eine Systematisierung von Bilderfahrung, die das Phänomen Bild in seiner ganzen Fülle berücksichtigt – als etwas, das aus Materie bestehen kann, das formale Eigenschaften besitzt und mit dem wir einen Inhalt verbinden. Damit wird die Zweiteilung der Bildaspekte durch eine differenziertere Systematik ersetzt. Im Folgenden wird zunächst die Systematik erörtert, nach welcher das Modell des Bildnerischen Denkens entwickelt wird (2.3.1). Um den Leser vor enttäuschten Erwartungen zu bewahren und um Missverständnisse zu vermeiden, folgt darauf ein kurzer Überblick über zentrale Themen der Bildwissenschaft, die zwar an das Modell des Bildnerischen Denkens angrenzen, aber dennoch nicht in ihm erfasst sind (2.3.2).
2 Bilder erfahren | 45
2.3.1 Entwicklung des Modells Die Frage »Was ist eine Bilderfahrung?« wurde in zwei Teilfragen aufgespalten: »Was heißt es, etwas als Bild zu betrachten?« und »Was heißt es, etwas als Bild zu gestalten?« Tabelle 1 zeigt, wie diese Fragen im Laufe der vorliegenden Arbeit durch die Begründung zweier Thesen beantwortet werden. In dieser Argumentationsstruktur werden außerdem die beiden oben formulierten Forderungen an das Modell des Bildnerischen Denkens systematisch berücksichtigt. Dabei ist das Denken – genauer das konkretisierende Denken – die Gattung der bildspezifischen Tätigkeit. Das Bildnerische ist ihre spezifische Differenz. Daher werden erst das »Denken« und dann das »Bildnerische« im »Bildnerischen Denken« begründet. Entsprechend sind die beiden Thesen formuliert: These 1 beschreibt die Gattung des Bildnerischen Denkens. These 2 spezifiziert diese Gattung. Entsprechend der beiden Arten von Bilderfahrung kann diese These in zwei Teilthesen (2a und 2b) aufgespalten werden:
These 1: »Bilderfahrung ist eine Form des konkretisierenden Denkens.« These 2: »Bilderfahrung ist Konkretisieren in Form von Bildnerischem Denken.« These 2a: »Bilderfahrung in der Bildbetrachtung ist das Ausüben der Funktionen 1–3 des Bildnerischen Denkens.« These 2b: »Bilderfahrung in der Bildgestaltung ist das Ausüben der Funktionen 1–3 oder der Funktion 4 des Bildnerischen Denkens.« In Teil 3 – DENKEN – wird zunächst folgende Antwort auf die zentrale Frage gegeben: Etwas als Bild zu betrachten und zu gestalten heißt, konkretisierend zu denken. Es wird These 1 begründet. Dieser Teil entwirft eine Theorie des Denkens, die zwischen zwei komplementären Denkarten unterscheidet, dem abstrahierenden und dem konkretisierenden Denken. Beide Denkarten können sich im Medium der Sprache ausdrücken, allerdings ist das abstrahierende Denken viel sprachaffiner als das konkretisierende. Das Kriterium zur Unterscheidung verschiedener Denkarten ist somit unabhängig von der Unterscheidung verschiedener Medienarten, wie z. B. sprachlicher oder visueller Medien. Damit wird zunächst die erste Forderung an das Modell des Bildnerischen Denkens erfüllt: Das Spezifische der Bilderfahrung wird durch eine eigene Denkart erklärt, die nicht in Abhängigkeit zur Sprache oder zum begrifflichen Denken steht.
46 | Bildnerisches Denken
Teil 1
2
ARGUMENTATION EINLEITUNG
BILDER ERFAHREN Frage
Was ist Bilderfahrung? Was heißt es, etwas als Bild zu betrachten und zu gestalten?
3
4
DENKEN These 1
Bilderfahrung ist eine Form des konkretisierenden Denkens.
Antwort 1
Es heißt, konkretisierend zu denken.
DAS BILDNERISCHE These 2
Bilderfahrung ist Konkretisieren in Form von Bildnerischem Denken.
These 2a
Bilderfahrung in der Bildbetrachtung ist das Ausüben der Funktionen 1–3 des Bildnerischen Denkens. enger Bildbegriff
These 2b
Bilderfahrung in der Bildgestaltung ist das Ausüben der Funktionen 1– 3 oder der Funktion 4 des Bildnerischen Denkens. weiter Bildbegriff
Antwort 2
5
Es heißt, die Funktionen des Bildnerischen Denkens auszuüben.
BILDNERISCHES DENKEN These 1 & 2
Bilderfahrung ist Konkretisieren im Ausüben der Funktionen des Bildnerischen Denkens. Kategorisierung von Bildern
6
BILDERFAHRUNG ALS BILDNERISCHES DENKEN Antwort 3
Es heißt, bildnerisch zu denken.
Tabelle 1: Argumentationsstruktur
2 Bilder erfahren | 47
In Teil 4 – DAS BILDNERISCHE – wird auf die zentrale Frage eine genauere Antwort gegeben: Etwas als Bild zu betrachten und zu gestalten heißt, bildnerisch zu denken. Es wird These 2 begründet. Das Bildnerische Denken wird dabei durch eine Analyse seiner vier Funktionen näher spezifiziert. Mit Hilfe dieser Funktionen können die beiden Arten von Bilderfahrung – die Bildbetrachtung und die Bildgestaltung – näher bestimmt werden. These 2a wird belegt, indem gezeigt wird, dass für das Betrachten von Bildern lediglich die ersten drei Funktionen konstitutiv sind. Das Gestalten von Bildern kann ebenfalls durch die ersten drei Funktionen, aber auch nur durch die vierte Funktion konstituiert werden, welche die ersten drei in modifizierter Form enthält. Damit wird die These 2b begründet. Durch die Begründung der Thesen 2a und 2b wird deutlich, worin der Zusammenhang der beiden Arten von Bilderfahrung besteht. Die Funktionen des Bildnerischen Denkens konstituieren die Bilderfahrung in beiden Varianten. Anders ausgedrückt sind sie das, was eine Erfahrung zu einer Bilderfahrung macht. Das bedeutet aber auch, dass sie begründen, wodurch etwas zu einem Bild wird. Daher lassen sich aus dieser Analyse zwei Bildbegriffe ableiten – ein enger und ein weiter: Durch die Begründung der These 2a wird ein enger Bildbegriff begründet, durch These 2b hingegen ein weiter. Der weite Bildbegriff unterscheidet sich vom engen darin, dass er auch mentale Bilder mit einschließt. Beide Bildbegriffe sind so weit, dass sie gegenständliche, abstrakte und auch natürliche Bilder einbeziehen. Damit wird das Modell des Bildnerischen Denkens auch der zweiten Forderung gerecht, die oben formuliert wurde. Teil 5 – BILDNERISCHES DENKEN – verbindet die Ergebnisse aus den beiden vorangegangenen Teilen 3 und 4. Er setzt die Theorie vom konkretisierenden Denken in Beziehung zur Erklärung des Bildnerischen. Damit werden die beiden Thesen 1 und 2 zusammengeführt: Bilderfahrung ist Konkretisieren im Ausüben der Funktionen des Bildnerischen Denkens. In diesem Teil wird anhand von Beispielen genau erläutert, inwiefern die einzelnen Funktionen des Bildnerischen Denkens eine Art des konkretisierenden Denkens darstellen. Außerdem werden diese Funktionen von anderen Denkprozessen abgegrenzt, die im Zusammenhang mit Bildern stattfinden können, aber nicht bildspezifisch sind. Am Ende dieses Teils wird gezeigt, wie das Modell des Bildnerischen Denkens ein System zur Kategorisierung von Bildern bereitstellt. Anhand von Bildbeispielen wird dargelegt, was es heißt, ein Bild als »abstrakt« oder »konkret« zu bezeichnen. Diese Klassifizierung wird anschließend verglichen mit Kategorisierungen anderer Autoren, die sich zum Teil gegenseitig widersprechen. Dabei zeigt sich, dass
48 | Bildnerisches Denken
durch das System des Bildnerischen Denkens diese Widersprüche verständlich werden und aufgelöst werden können. In Teil 6 – BILDERFAHRUNG ALS BILDNERISCHES DENKEN – wird schließlich ein systematischer Überblick über die verschiedenen Arten von Bilderfahrung gegeben. Dieser Teil behandelt außerdem die anfangs aufgeworfene Frage zur Rolle von Picture- und Image-Aspekt in der Bilderfahrung. Es wird gezeigt, welche Antwort das Modell des Bildnerischen Denkens auf diese Frage gibt, und wie sich in dieser Antwort die gängige Dichotomie zwischen zwei Bildaspekten auflöst. 2.3.2 Abgrenzung des Modells Oliver Scholz stellt in seinem Buch Bild, Darstellung, Zeichen fest, dass die zentrale Leitfrage der Bildwissenschaft »Was ist ein Bild?« »vage und potentiell irreführend«125 sei. Er schlägt vor, diese durch eine Liste von mindestens 10 Fragen zu ersetzen, deren Antworten Aufschluss über das Phänomen Bild liefern sollen. Einige dieser Fragen lauten beispielsweise: »(Q 5) Wie unterscheiden sich Bilder von anderen Phänomenen? […] (Q 6) Wodurch ist der Inhalt eines Bildes festgelegt? (Q 7) Wodurch ist der Gegenstandsbezug eines Bildes festgelegt? (Q 8) Was kann man mit Bildern tun?«126 Die Relevanz all dieser Fragen für die Bildwissenschaft macht er unmissverständlich klar: »Umfassende Bildtheorien müssen zu allen diesen Fragen erhellende Antworten liefern.«127 Vor diesem Hintergrund muss betont werden, dass das hier vorgestellte Modell des Bildnerischen Denkens keine »umfassende Bildtheorie« darstellt. Es werden zwar einige der von Scholz formulierten Themen in der vorliegenden Arbeit erörtert. Aber erstens werden nur ein paar der Fragen, und diese zweitens nicht gleichermaßen detailliert behandelt. Um Missverständnissen vorzubeugen, wird daher im Folgenden erläutert, welche Fragen der Bildwissenschaft in dieser Arbeit nicht beantwortet werden bzw. welche Aspekte von Bilderfahrung durch das Modell des Bildnerischen Denkens keine Erklärung finden. Zunächst muss klargestellt werden, dass das Modell des Bildnerischen Denkens nicht sämtliche Denkprozesse erklärt, die im Zusammenhang mit Bildern stattfinden können, sondern nur diejenigen, die bildspezifisch sind, also eine Erfahrung zur Bilderfahrung machen. Es gibt viele Denkprozesse
125 Scholz, Oliver: Bild, Darstellung, Zeichen, Frankfurt a. M., 2009, S. 14. 126 Ebenda, S. 15. 127 Ebenda.
2 Bilder erfahren | 49
beim Betrachten von Bildern, die genauso auch beim Rezipieren von literarischen Texten vorkommen, wie beispielsweise alle durch kulturelle Traditionen geregelten Zuordnungen von symbolischen Bedeutungen. Wenn man die Darstellung einer Taube auf einem Bild erkannt hat, oder die Beschreibung einer Taube in einem Text verstanden hat, dann ist der Vorgang, durch den man diese Taube als Symbol für Frieden interpretiert, in beiden Fällen derselbe. An diesem Beispiel kann ein weiterer Aspekt von Bilderfahrung aufgezeigt werden, der nicht durch das Modell des Bildnerischen Denkens erklärt wird. Auch das Erkennen einer Farb- und Formzusammenstellung als Taube ist nicht bildspezifisch. In unserem Alltag sind wir ständig gefordert, unter ganz unterschiedlichen Bedingungen Gegenstände in Farb- und Formzusammenstellungen zu erkennen: So identifizieren wir beispielsweise auch Gegenstände in der Dämmerung, wenn nahezu jede Farbinformation fehlt; bei Nebel, wenn die Sättigung der Farben sehr gering ist und die Formen verschwimmen; durch eine Scheibe mit Regentropfen, durch welche die Formen stark verzerrt werden; einäugig, so dass die räumliche Wahrnehmung eingeschränkt ist, oder ohne Brille, und damit ohne scharf zu sehen, etc. Einige dieser Bedingungen erschweren das Erkennen von Gegenständen erheblich, manche machen es sogar unmöglich. Die Grenze zwischen Bedingungen, die das Erkennen noch ermöglichen, und solchen, die es unmöglich machen, ist nicht bei allen Menschen gleich. An manche Bedingungen kann man sich gewöhnen. Dass ein Gegenstand mit Hilfe von Farben und Formen auf einer flachen Leinwand abgebildet ist, stellt nur eine dieser möglichen Bedingungen dar. Auch hier sind manche Abbildungen so, dass sie das Erkennen der Gegenstände stark erschweren oder fast unmöglich machen, und auch hier gibt es individuelle Unterschiede in der Fähigkeit, Gegenstände zu erkennen. Wie Sachs-Hombach erläutert, weisen auch empirische Studien darauf hin, dass es keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Erkennen von Gegenständen in der Wirklichkeit und auf Bildern gibt: »Bereits einer frühen Studie von Hochberg & Brooks zufolge sind Bildwahrnehmung und Gegenstandswahrnehmung in etlichen Hinsichten aufeinander bezogen, so daß die Bildwahrnehmung zumindest im Hinblick auf das Erkennen einfacher Objekte keine zusätzlichen Lernprozesse benötigt.«128 Das Modell des Bildnerischen Denkens liefert daher keine Erklärung
128 Sachs-Hombach, Klaus; Schirra, Jörg R. J.: »Medientheorie, visuelle Kultur und Bildanthropologie«, in: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bildtheorien, Frankfurt a. M., 2009, S. 396. Sachs-
50 | Bildnerisches Denken
dafür, wie und unter welchen Bedingungen es uns möglich ist, Gegenstände überhaupt oder auf einem Bild zu erkennen. Zwei weitere Aspekte von Bilderfahrung werden hier nicht behandelt. So spielen alle bildpragmatischen Fragen oder – wie es Scholz ausdrückt – die Frage: »Was kann man mit Bildern tun?«129 in diesem Buch keine Rolle. Auch folgende Frage wird durch das Modell des Bildnerischen Denkens nicht beantwortet: »Wie unterscheiden sich Bildmedien von anderen Medien, z. B. von Sprachmedien?« Sie wird hier deshalb nicht berücksichtigt, weil die der Frage zugrunde liegende These nicht geteilt wird, nämlich dass Bilder Medien seien. Denn nicht alle Darstellungen in visuellen Medien sind Bilder, wie näher in Kapitel 3.4.2 erläutert wird. Stattdessen wird ein Bildbegriff entwickelt, der nicht an einen Medienbegriff gekoppelt ist. Bilder sind keine Medien, sondern sie entstehen durch eine bestimmte Betrachtereinstellung, nämlich durch die des Bildnerischen Denkens. In einem weiten Bildverständnis ist dazu noch nicht einmal ein visuelles Medium vonnöten.
Hombach verweist hier auf folgende Studie: Hochberg Julian; Brooks, Virginia: »Pictorial Recognition as an Unlearned Ability«, in: American Journal of Psychology, 1962. 129 Scholz, Oliver: Bild, Darstellung, Zeichen, Frankfurt a. M., 2009, S. 15.
3 DENKEN
Teil 3 dient dazu, die Bilderfahrung als eigenständigen, sprachunabhängigen Denkprozess zu erklären. Dies geschieht durch die Unterscheidung zwischen zwei Denkarten: dem abstrahierenden und dem konkretisierenden Denken. Es wird gezeigt, dass diese nicht hierarchisch miteinander in Beziehung stehen, sondern stattdessen komplementär zueinander sind, weil beide dieselbe grundlegende Operation voraussetzen und weiterführen. Konstitutiv für die Bilderfahrung ist das konkretisierende Denken. Damit wird These 1 begründet: Bilderfahrung ist eine Form des konkretisierenden Denkens. Außerdem ist damit eine erste Antwort auf die Frage gegeben: »Was ist eine Bilderfahrung?«. Im Rahmen der Herleitung des Modells des Bildnerischen Denkens erklärt Teil 3 die Gattung des Bildnerischen Denkens. Das heißt es wird gezeigt, warum die entsprechenden Prozesse als Denkleistungen angesehen werden können. Dieser Teil gliedert sich in vier Abschnitte. In Kapitel 3.1 werden zwei Kriterien des Denkens erörtert: die Abstraktion als traditionelles Kriterium und die Konkretion als Alternative dazu. Die bildspezifischen Prozesse in einer Bilderfahrung erfüllen das alternative Kriterium und können daher als Denkleistung gelten. Das Kapitel 3.2 unterscheidet zwischen zwei Faktoren des Denkens, dem Vollzug und dem Gegenstandsbezug. Diese Unterscheidung führt zu einer weiteren Differenzierung der beiden Kriterien des Denkens. In Kapitel 3.3 wird das so erarbeitete Modell vom konkretisierenden Denken in Beziehung gesetzt zu alternativen Theorien des Denkens zweier anderer Autoren: John Dewey und Wolfgang Welsch. Abschließend wird in Kapitel 3.4 eine systematische Übersicht der erarbeiteten Unterscheidung zwischen den beiden Denkarten des Abstrahierens und des Konkretisierens gegeben.
52 | Bildnerisches Denken
3.1
K RITERIEN DES D ENKENS : A BSTRAKTION UND K ONKRETION Dieses Kapitel diskutiert zwei Kriterien des Denkens: Der traditionellen Vorstellung vom Denken zufolge ist das Denken immer begrifflich und daher ohne Abstraktion nicht möglich (3.1.1). Als Alternative dazu kann ein anderes Kriterium hergeleitet werden: die Konkretion (3.1.2). Sie kann berechtigterweise ebenso als Denkleistung bezeichnet werden (3.1.3). Die beiden Kriterien sind zueinander komplementär, weil sie beide dieselbe Grundoperation voraussetzen und weiterführen (3.1.4). 3.1.1 Traditionelle Kriterien: Begrifflichkeit und Abstraktion Traditionelle Theorien des Denkens gehen davon aus, dass das Denken immer begrifflich oder sprachlich ist. Nicht-begriffliches oder nichtsprachliches Denken gibt es nach dieser Vorstellung nicht. Kriterium für eine Denkleistung ist in diesen Theorien die Abstraktion, die als Voraussetzung für den Umgang mit Begriffen und Sprache angesehen wird. Die bildspezifischen Prozesse einer Bilderfahrung können gemäß diesen traditionellen Theorien nicht als Denkleistung bezeichnet werden, weil sie das Kriterium der Abstraktion nicht erfüllen. Im Folgenden wird zunächst diese Vorstellung von Begrifflichkeit bzw. Sprachlichkeit des Denkens anhand exemplarisch ausgewählter Autoren vorgestellt (3.1.1.1). Die anschließende Erläuterung zeigt auf, inwiefern die Abstraktion eine Voraussetzung für die Bildung und den Gebrauch von Begriffen ist (3.1.1.2). In der Unterscheidung zwischen der klassischen (3.1.1.3) und in der modernen Abstraktionstheorie (3.1.1.4) wird dargelegt, was die entsprechenden Autoren jeweils unter Abstraktion verstehen und worin sie den Zusammenhang zur Bildung und zum Gebrauch von Begriffen sehen. Schließlich liefert eine Zusammenfassung einen Überblick über die Theorien zur Abstraktion als Kriterium des Denkens (3.1.1.5). 3.1.1.1 Begrifflichkeit des Denkens Laut Mittelstraß und Lorenz ist Immanuel Kant ein exemplarischer Vertreter einer begriffszentrierten Theorie des Denkens: »Seit Immanuel Kant (Logik, Einleitung, V), der Denken begrifflich scharf vom Erkennen unterscheidet, weil es dazu auch der Anschauung bedarf, wird Denken auf der obersten sprachlichen Stufe an die methodische Schrittfolge der Begriffsbildung, des
3 Denken | 53
Urteils und des Schlusses gebunden.«1 Diese traditionelle Vorstellung vom Denken ist keineswegs eine historische Position, sondern wird auch im 21. Jahrhundert vertreten. Ganz in der kantischen Tradition schlägt Reinhard Brandt vor, das Wort »Denken« so zu verwenden, »dass das jeweilige Denken auch zu Urteilsakten befähigt sein soll.«2 Denken in diesem Sinne kann daher nicht mit oder in Bildern stattfinden, wie er deutlich betont: »Der Urakt des Denkens entzieht sich also jeder Verbildlichung und ist in keinem Bildmedium präsent, weder vor dem iconic oder pictorial turn noch nach ihm.«3 Sichtbar wird die Aktualität dieser Position auch in einem Vergleich des oben zitierten Enzyklopädie-Artikels mit dessen Vorgänger-Artikel der alten Auflage: In der ersten Auflage schreibt Mittelstraß, dass das »Denken, am deutlichsten seit Immanuel Kant (Logik, Einleitung, V), an die methodische Schrittfolge der Begriffsbildung, des Urteils und des Schlusses gebunden ist.«4 Erst in der zweiten Auflage von 2005 wird – vielleicht vom neuen Koautor Kuno Lorenz – nur noch das Denken »auf der obersten sprachlichen Stufe« als begrifflich bezeichnet. Auch mit dieser Einschränkung behält das begriffliche Denken allerdings seinen Status als oberste Stufe. In Übereinstimmung damit gehen viele englischsprachige Autoren davon aus, dass das Denken erst durch Begriffe (»concepts«) ermöglicht wird. Die von Georges Rey formulierte Ansicht: »A concept is supposed to be a constituent of a thought«5 wird auch von Eric Margolis und Stephen Laurence als unstrittig bezeichnet: »Concepts are the constituents of thoughts. […] This much is relatively uncontroversial.«6. Für Kant sind die Begriffe das grundlegende Instrumentarium des Denkens, ohne das kein Denken möglich ist: »Denken ist das Erkenntnis durch
1
Mittelstraß, Jürgen; Lorenz, Kuno: »Denken«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philoso-
2
Brandt, Reinhard: »Das Denken und die Bilder«, in: Nortmann, Ulrich; Wagner, Christoph (Hg.):
3
Ebenda, S. 40, Hervorh. i. O.
4
Mittelstraß, Jürgen: »Denken«, in: ders. (Hg.): Enzyklopädie Philosophie Wissenschaftstheorie,
5
Rey, Georges: »Concepts«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy,
phie Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005, S. 155, Hervorh. i. O. In Bildern denken?, München, 2010, S. 38.
Stuttgart, Weimar, 2004, S. 449, Hervorh. i. O. London, 1998, Online-Ausgabe, Zugriff am 05.08.2014, [ohne Seitenangabe]. 6
Margolis, Eric; Laurence, Stephen: »Concepts«, in: Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy, Frühjahr 2014, Online-Ausgabe, Zugriff am 05.08.2014, [ohne Seitenangabe].
54 | Bildnerisches Denken
Begriffe.«7 Diese können aufeinander bezogen und so zu Urteilen zusammengesetzt werden. Folgerichtig gelten für Kant auch die durch die Begriffe gebildeten Urteile und Schlüsse als Denken: »Wir können aber alle Handlungen des Verstandes auf Urteile zurückführen, so daß der Verstand überhaupt als ein Vermögen zu urteilen vorgestellt werden kann. Denn er ist nach obigen ein Vermögen zu denken.«8 Damit ist nach Kant alles bestimmt, was gerechtfertigterweise als Denken bezeichnet werden kann, wie auch in der Jäsche-Logik betont wird: »Sie selbst [die Logik, Anm. d. A.] beschäftiget sich bloß mit den Regeln des Denkens bei Begriffen, Urteilen und Schlüssen, als wodurch alles Denken geschieht.«9 Zwar sieht Kant, dass wahre Erkenntnis nicht ohne Sinnlichkeit möglich ist, doch bildet alles sinnlich Wahrgenommene nur das Material für das eigentliche Denken. »Daher ist es eben so notwendig, seine Begriffe sinnlich zu machen […] als seine Anschauungen sich verständlich zu machen (d. i. sie unter Begriffe zu bringen). Beide Vermögen, oder Fähigkeiten, können auch ihre Funktionen nicht vertauschen. Der Verstand vermag nichts anzuschauen, und die Sinne nichts zu denken.«10 Begriffsfreies Denken gibt es nach Kant nicht. Eine Interessensverlagerung der Logik im 19. Jahrhundert führte auch zu einem veränderten Blick auf das Denken. Vor allem John Stuart Mill hat dafür argumentiert, die Theorie der Begriffe durch eine Theorie der sprachlichen Zeichen zu ersetzen.11 So schreibt Mill: »To say, therefore, that we think by means of concepts, is only a circuitous and obscure way of saying that we think by means of general or class names.«12 »For these and other reasons, I consider it nothing less than a misfortune, that the words Concept, General Notion, or any other phrase to express the supposed mental modification corresponding to a class name, should ever have been invented.«13
7
Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, B 94, A 69.
8
Ebenda, Hervorh. i. O.
9
Jäsche, Gottlob Benjamin (Hg.): »Immanuel Kants Logik«, in: Akademie-Ausgabe, Band 9, S. 33.
10 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, B 75, A 51. 11 Vgl. Haller, Rudolf; Mittelstraß, Jürgen: »Begriff«, in: Ritter, Joachim u. a. (Hg.): Historisches
Wörterbuch der Philosophie, Basel, Darmstadt, 1971, S. 784. 12 Mill, John Stuart: »An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy«, in: Robson, John M. (Hg.): Collected Works of John Stuart Mill, Band 9, Toronto, London, 1979, S. 316. 13 Ebenda, S. 317.
3 Denken | 55
So wird auch gegenwärtig sowohl von Rey als auch von Margolis und Laurence darauf hingewiesen, dass große Unklarheit über »the nature of concepts«14 besteht, bzw. darüber, »what exactly a concept is.«15 Im Zuge der modernen sprachphilosophischen Bemühungen wird daher »in vielen Kontexten der Philosophie und anderer wissenschaftlicher Disziplinen […] der Begriff des (vernünftigen) Denkens durch den Begriff des (vernünftigen) Redens ersetzt«16. Entsprechend gilt in der modernen Fortführung der traditionellen Denktheorie nicht mehr die Begrifflichkeit als notwendig für das Denken, sondern die (gesprochene) Sprache, wie z. B. bei Wittgenstein: »Denken ist kein unkörperlicher Vorgang, der dem Reden Leben und Sinn verleiht, und den man vom Reden ablösen könnte.«17 Ähnlich wenden sich auch Kamlah und Lorenzen gegen die Ansicht, man könne Denken vom Sprechen unterscheiden: »Reden oder auch Denken im Sinne von innerem Reden ist stets aktuelle sprachliche Handlung.«18 Laut Nelson Goodman ist diese sprachgebundene Theorie des Denkens weit verbreitet: »Many psychologists and analytic philosophers look upon thinking as entirely verbal, upon thoughts as always in words. This tendency has been strengthened by recent focusing of attention upon linguistics«.19 Tatsächlich wird dieses Verständnis vom Denken in verschiedenen Diskussionen vertreten. So ist es beispielsweise ein Kerngedanke der »Language of Thought Hypothesis«. Sie wurde in der Debatte um mentale Repräsentationen formuliert. An ihr beteiligen sich nicht nur Philosophen, sondern auch Psychologen und Neurowissenschaftler. Der Unterschied zur rein philosophischen Frage nach dem Denken besteht darin, dass hier darüber diskutiert wird, wie das Denken im Gehirn verankert sein könnte. Murat Aydede erklärt die dabei vertretene Hypothese wie folgt:
14 Margolis, Eric; Laurence, Stephen: »Concepts«, in: Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford
Encyclopedia of Philosophy, Frühjahr 2014, Online-Ausgabe, Zugriff am 05.08.2014, [ohne Seitenangabe]. 15 Rey, Georges: »Concepts«, in: Routledge Encyclopedia of Philosoph, London, 1998, OnlineAusgabe, Zugriff am 05.08.2014, [ohne Seitenangabe]. 16 Mittelstraß, Jürgen; Lorenz, Kuno: »Denken«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philoso-
phie Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005, S. 155. 17 Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen, Frankfurt, 1971, § 339, S. 137. 18 Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich, 1990, S. 61. 19 Goodman, Nelson: Of Mind and Other Matters, Cambridge, London, 1984, S. 21.
56 | Bildnerisches Denken
»The Language of Thought Hypothesis (LOTH) postulates that thought and thinking take place in a mental language. This language consists of a system of representations that is physically realized in the brain of thinkers […]. According to LOTH, thought is, roughly, the tokening of a representation that has a syntactic (constituent) structure with an appropriate semantics. Thinking thus consists in syntactic operations defined over such representations.«20
Die These von der Sprachabhängigkeit des Denkens wird im Zusammenhang einer weiteren Debatte vertreten. In der Diskussion um die Frage, ob man von Tieren sagen kann, dass sie denken oder sprechen, wird unter dem Schlagwort »human exceptionalism« die These vertreten, dass Denken und Sprache ausschließlich dem Menschen vorbehalten sind, wie Dale Jamieson erläutert: »The question of animal language and thought has been debated since ancient times. Some have held that humans are exceptional in these respects«.21 Jamieson führt mehrere Autoren an, die diese These vertreten haben, so z. B. Noam Chomsky, Willard Van Orman Quine und Donald Davidson.22 Ihrer Argumentation ist laut Jamieson gemeinsam, dass sie Sprache als Voraussetzung für Denken ansehen: »All of the arguments that we have reviewed suppose that having language is a necessary condition for having thoughts […]. Moreover, some of these philosophers […] think that having language is sufficient for having thoughts.«23 Wenn im Folgenden von einer traditionellen Theorie des Denkens gesprochen wird, soll darunter nicht nur die klassische begriffszentrierte Theorie sondern auch ihre moderne sprachzentrierte Variante verstanden werden. 3.1.1.2 Abstraktion als Voraussetzung für Begrifflichkeit Den traditionellen Theorien des Denkens zufolge liegt unserem Umgang mit Begriffen und Sprache eine Leistung zugrunde, die das Kriterium des Denkens darstellt. Voraussetzung für unser Begriffs- und Sprachvermögen ist demnach die Abstraktionsleistung. Dieser Zusammenhang wird u. a. von
20 Aydede, Murat: »The Language of Thought Hypothesis«, in: Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford
Encyclopedia of Philosophy, Herbst 2010, Online-Ausgabe, Zugriff am 05.08.2014, [ohne Seitenangabe]. 21 Jamieson, Dale: »Animal language and thought«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclope-
dia of Philosophy, London, 1998, Online-Ausgabe, Zugriff am 10.08.2014, [ohne Seitenangabe]. 22 Vgl. ebenda. 23 Ebenda.
3 Denken | 57
der klassischen und der modernen Abstraktionstheorie thematisiert. In beiden Ansätzen wird davon ausgegangen, dass Begriffe durch Abstraktion gebildet werden. Sie werden im Folgenden erläutert, um zu zeigen, was unter dem Kriterium der Abstraktion zu verstehen ist. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der klassischen und der modernen Abstraktionstheorie besteht in den unterschiedlichen Begriffs- bzw. Sprachtheorien, die ihnen zugrunde liegen. Für den Zusammenhang hier sind besonders die darin enthaltenen Vorstellungen zur Bildung und zum Gebrauch von Begriffen sowie zu verschiedenen Stufen von Begriffen wichtig. Für die folgende Erläuterung werden diese Vorstellungen in eine Ordnung gebracht. Die Übersichten in Tabelle 2 und Tabelle 3 konzentrieren sich dabei auf zwei Aspekte: 1. Die Unterteilung der Begriffe in verschiedene Stufen und das Verhältnis dieser Stufen zueinander. 2. Die Trennung zwischen der Bildung und dem Gebrauch von Begriffen bzw. das Verhältnis zwischen beidem. Die Systematik ist stark vereinfachend und kann nicht dazu dienen, Positionen einzelner Autoren umfassend darzustellen. Aber sie ermöglicht einen Einblick in zwei Aspekte der Thematik und in ihre historische Entwicklung. So wird deutlich, welche Auswirkung die Entwicklung beider Aspekte auf das Verständnis von Abstraktion hat. KLASSISCHE ABSTRAKTIONSTHEORIE Bildung = Abstraktion
Gebrauch = Prädikation = Abstraktion
Wahrnehmung Begriffe 1. Stufe Begriffe 2. Stufe
Tabelle 2: Die klassische Abstraktionstheorie Zwei Merkmale der klassischen Abstraktionstheorie sind hier relevant. Sie betreffen die zugrunde liegende Begriffstheorie: Zum einen wird noch nicht klar zwischen Begriffen verschiedener Stufen unterschieden wie später von
58 | Bildnerisches Denken
Frege; nur Ansätze einer solchen Unterscheidung sind bei Kant zu finden.24 Zum anderen wird die Bildung von Begriffen relativ unabhängig von ihrem Gebrauch thematisiert. Als Folge des ersten Merkmals wird in der klassischen Abstraktionstheorie nicht zwischen einem Übergang innerhalb der Begriffe 1. Stufe und einem Übergang von Begriffen 1. Stufe zu Begriffen 2. Stufe unterschieden. Der Übergang der ersten Art, der gleichbedeutend mit der Verallgemeinerung ist, wird ebenso als Abstraktionsleistung verstanden, wie die zweite Übergangsart. Die Frage nach der Bildung von Begriffen wird für beide Stufen in gleicher Weise gestellt. Auch das zweite Merkmal verdeutlicht das breite Verständnis von Abstraktion in der klassischen Abstraktionstheorie: Zwar wird zwischen der Bildung von Begriffen und ihrem Gebrauch unterschieden. Der Begriffsgebrauch, d. h. die Prädikation, wird aber auch als Abstraktionsleistung angesehen. In der klassischen Abstraktionstheorie werden demnach bei weitem mehr Phänomene als Abstraktion bezeichnet als in der modernen Abstraktionstheorie. Die Begriffstheorie, die der modernen Abstraktionstheorie zugrunde liegt, unterscheidet sich in beiden Aspekten von der Begriffstheorie der klassischen Abstraktionstheorie. Wie bereits angedeutet, wird in der modernen Abstraktionstheorie im Anschluss an Frege zwischen den Begriffen 1. und 2. Stufe unterschieden.25 Hingegen wird in Anlehnung an die späte Sprachtheorie von Wittgenstein die Unterscheidung zwischen Begriffsbildung und Begriffsgebrauch aufgehoben. Begründet wird dies folgendermaßen: Begriffe treten unabhängig von ihrer sprachlichen Realisierung (und damit ihrem Gebrauch) nicht in Erscheinung und können daher nur in ihrem Gebrauch thematisiert werden. Stattdessen wird innerhalb des Gebrauchs von Begriffen eine weitere Unterscheidung eingeführt. Prädikationen werden von for-
24 Vgl. Weidemann, Hermann: »Prädikation« (Teil I), in: Ritter, Joachim u. a. (Hg.): Historisches
Wörterbuch der Philosophie, Basel, Darmstadt, 1971–2007, S. 1206. 25 Ebenda, S. 1206–1207. Diese Unterscheidung wird in der Stanford Encyclopedia of Philosophy nicht thematisiert, weder von Eric Margolis und Stephen Laurence in ihrem Artikel »Concepts«, in: Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy, Frühjahr 2014, OnlineAusgabe, Zugriff am 05.08.2014, noch unter den Stichworten »Abstraction« oder »Predication«, da keine Artikel mit diesen Titeln vorhanden sind. Auch in der Routledge Encyclopedia of Philo-
sophy wird auf diesen Unterschied nicht eingegangen, weder in Georges Reys Artikel: »Concepts«, noch von Kevin Mulligan in seinem Artikel »Predication«, beide in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 1998, Online-Ausgabe, Zugriff am 05.08.2014. Zum Stichwort »Abstraction« existiert ebenfalls kein Artikel.
3 Denken | 59
mulierten Regeln unterschieden, d. h. von Anweisungen zum korrekten Gebrauch von Wörtern. MODERNE ABSTRAKTIONSTHEORIE Bildung bzw. Gebrauch… … in einer Prädikation
… in einer formulierten Regel (≠ Prädikation)
= Prädikatoren = Abstraktoren
Begriffe 2. Stufe
Begriffe 1. Stufe
Wahrnehmung ▼ [1]
≠ Abstraktion
Begriff
»Dies ist eine Heidelerche.«
Einzelnes
Unterbegriff
▼ [2]
___
»Dieser Tango ist schön.«
=/≠ Abstraktion
=/≠ Abstraktion
»Die Heidelerche überwintert
»Heidelerchen sind Lerchen.«
im Mittelmeerraum.«
»Tango ist ein Tanz.«
»Tango ist schwierig.«
= Prädikatorenregel
▼ [3]
= Abstraktion
= Abstraktion
Metabegriff
»Die Zahl 1 ist ungerade.«
»1 ist eine Zahl.«
»Das Prädikat ›Tanz‹ kann nicht
»›Tanz‹ ist ein Prädikat.«
als Adjektiv gebraucht werden.«
= Abstraktorenregel
Schema
Oberbegriff
Tabelle 3: Die moderne Abstraktionstheorie Unter die Begriffe der 1. Stufe können einerseits Gegenstände, andererseits aber auch andere Begriffe fallen. Die Ordnung von Unterbegriffen und Oberbegriffen (wie beispielsweise die Ordnung des Tierreiches in Gattungen und Familien) ist daher eine Ordnung von Begriffen innerhalb der 1. Stufe. Auch Begriffe von einzelnen Aktualisierungen (z. B. einzelne Handlungen) und von deren Schemata (z. B. Handlungsschemata) gehören zu den Begriffen der 1. Stufe. Die Begriffe der 2. Stufe können als Metabegriffe in Bezug zu den Begriffen 1. Stufe gesehen werden. Sowohl Begriffe der 1. Stufe als auch der 2. Stufe können in Prädikationen auftreten. Als Prädikatoren können aber nur Begriffe der 1. Stufe verwendet werden. Begriffe der 2. Stufe kommen in Sätzen nur als Abstraktoren vor, und diese sind keine Prädikatoren.
60 | Bildnerisches Denken
Ein Beispiel für eine Prädikation auf der 1. Begriffsebene wäre der Satz 1) »Dieser Tango ist schön.«. Der Satz 2) »Tango ist ein Tanz.« ist zwar ebenfalls ein Satz der 1. Begriffsebene. Er ist aber keine Prädikation, sondern nur die Formulierung einer Prädikatorenregel.26 Das bedeutet, dass dieser Satz nur angibt, wie andere Sätze über den Tango (beispielsweise Satz 1) verstanden werden sollen, indem er den Prädikator »Tanz« erklärt. Ein Beispiel für eine Prädikation auf der 2. Begriffsebene ist der Satz 3) »Die Zahl 1 ist ungerade.«. Der Ausdruck »Zahl« ist dabei kein Prädikator, sondern ein Abstraktor, d. h. ein Begriff 2. Stufe. Auch Satz 4) »1 ist eine Zahl.« ist ein Satz der 2. Begriffsebene. Aber analog zur 1. Begriffsebene handelt es sich nicht um eine Prädikation, sondern um die Formulierung einer Abstraktorenregel. Das heißt, dass dieser Satz sagt, wie ein Abstraktor, z. B. »Zahl«, verwendet werden soll.27 Satz 3) ist die Art von Prädikation, »auf deren Ermöglichung es uns bei der Abstraktion ankommt.«28 Satz 4) hingegen stellt keine Prädikation dar, sondern kann als Ausdruck genau dieser Abstraktionsleistung gesehen werden, die Satz 3) ermöglicht. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass in der modernen Abstraktionstheorie Prädikationen in der Regel nicht als Abstraktionen interpretiert werden, sondern die Abstraktion als eine Operation – genauer als Übergang – verstanden wird, die eine bestimmte Art von Prädikation ermöglicht. Dabei muss zwischen drei in Frage kommenden Übergängen unterschieden werden, die in der Tabelle 3 mit den Ziffern [1], [2] und [3] markiert sind. Alle Autoren der modernen Abstraktionstheorie sind sich darüber einig, dass der Übergang [3] von Begriffen 1. Stufe zu den Begriffen 2. Stufe eine Abstraktionsleistung darstellt. Uneinigkeit besteht in der Frage, ob die Abstraktion auch auf der 1. Begriffsebene eine Rolle spielt. In Frage kommen hier zwei Übergänge. Der Übergang [1] von der Wahrnehmung zur Sprache, der in elementaren Prädikationen29 zum Ausdruck kommt, wird in der Regel nicht als Abstraktion verstanden. Uneinigkeit besteht darin, ob der Übergang [2] von Unterbegriffen zu Oberbegriffen bzw. von der Rede über Einzelnes zur Rede über das entsprechende Schema als Abstraktion gelten kann.
26 Vgl. Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich, 1990, S. 101. 27 Vgl. ebenda, S. 102. 28 Ebenda. 29 Vgl. ebenda, Kapitel I und II, S. 23–70.
3 Denken | 61
Innerhalb der modernen Abstraktionstheorie kann man weiter zwischen verschiedenen Interpretationen der Abstraktion unterscheiden. Einige Autoren verstehen das Verfahren lediglich als Redeverkürzung. Andere hingegen sehen darin die Konstruktion neuer Gegenstände oder zumindest neuer (Rede-) handlungsmöglichkeiten. Trotz solcher Interpretationsunterschiede kann als Gemeinsamkeit der modernen Abstraktionstheorie festgehalten werden, dass ihr Verständnis von Abstraktion deutlich eingeschränkter ist als das der klassischen Theorie. Ignacio Angelelli kritisiert daher das moderne Verständnis von Abstraktion, weil es seiner Ansicht nach lediglich eine Pseudo-Abstraktion beschreibt: »Aside from neo-scholasticism, only a few individual authors carried the torch of genuine abstraction in our century; for example: Husserl and Piaget; within modern logic: Weyl, and especially Lorenzen. […] The void was filled by a proliferation of pseudo-uses of the terms ›abstraction‹ and ›abstract‹: the
usurpers«.30
Die Interpretation des Begriffs »Abstraktion« hat also einen starken Wandel durchlaufen, der im Folgenden an exemplarischen Positionen in seinen Grundzügen nachgezeichnet wird. 3.1.1.3 Begrifflichkeit und Abstraktion in der klassischen Abstraktionstheorie Die Geschichte der klassischen Abstraktionstheorie beginnt laut Schneider31 und Angelelli32 in der Scholastik und greift auf Gedanken von Aristoteles zurück. Um den Unterschied zur modernen Abstraktionstheorie zu erläutern, genügt es allerdings, exemplarisch solche Positionen vorzustellen, die am Übergang von der klassischen zur modernen Abstraktionstheorie stehen. Immanuel Kant, John Stuart Mill und Ernst Mach vertreten ein klassisches Verständnis von Abstraktion. Ihre Begriffstheorien enthalten aber in unterschiedlichem Grad Züge einer modernen Vorstellung vom Begriff, die auch Teil der modernen Abstraktionstheorie ist. Diese drei Autoren eignen sich
30 Angelelli, Ignacio: »Adventures of Abstraction«, in: Coniglione, Francesco u. a. (Hg.): Idealiza-
tion XI, Amsterdam, New York, 2004, S. 11, Hervorh. i. O. 31 Vgl. Schneider, Hans J.: »Abstraktion«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie
und Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005, S. 21–22. 32 Vgl. Angelelli, Ignacio: »Adventures of Abstraction«, in: Coniglione, Francesco u. a. (Hg.): Ideali-
zation XI, Amsterdam, New York, 2004, S. 25.
62 | Bildnerisches Denken
daher gut, um den Übergang von der klassischen zur modernen Abstraktionstheorie aufzuzeigen. Der klassischen Abstraktionstheorie liegt eine klassische Auffassung vom Begriff zugrunde. Darin wird nach Jürgen Mittelstraß ein »Begriff […] als ›einfacher Denkakt‹, ›Denkinhalt‹, ›Vorstellung‹, ›Idee‹ […] aufgefaßt; im Gegensatz zur ›sinnlichen‹ oder empirischen Anschauung, in der Gegenstände anschaulich gegeben sind, [ist der Begriff, Amn. d. A.] Ergebnis einer Abstraktion.«33 In dieser Begriffstheorie ist keine deutliche Trennung zwischen Begriffen verschiedener Stufen erkennbar. Die Begriffe werden den sinnlichen Anschauungen gegenübergestellt, aus denen sie durch Abstraktion gewonnen werden. Abstraktion wird somit als ein Absehen von den einzelnen Merkmalen sinnlich wahrnehmbarer Dinge aufgefasst. Immanuel Kant Für Immanuel Kant, der an diese klassische Begriffstheorie anschließt,34 spielt die Abstraktion sowohl bei der Bildung von Begriffen als auch bei ihrem Gebrauch eine Rolle. Er versteht unter dem Begriffsvermögen das Vermögen, sich etwas im Allgemeinen vorzustellen: »Etwas sich durch Begriffe d. i. im Allgemeinen vorstellen, heißt denken […].«35. Die Abstraktion ist dabei nach Kant wesentliche Voraussetzung für die Bildung von Begriffen: »Der Ursprung der Begriffe der bloßen Form nach ist logisch und beruht auf der abstraction von dem Unterschiede der Dinge, die durch eine gewisse Vorstellung bezeichnet sind«.36 Daher sind nach Kant alle Begriffe abstrakt, weil sie durch eine Abstraktionsleistung entstanden sind. Etwas »in abstracto« zu betrachten ist gleichbedeutet mit »durch Begriffe«: »[S]o kann man die Verhältnisse der Dinge in abstracto, wenn man es mit bloßen Begriffen anfängt, […] denken«37. Die »philosophische Erkenntnis […] muß […] das Allgemeine jederzeit in abstracto (durch Begriffe) betrachten […].«38
33 Mittelstraß, Jürgen: »Begriff«, in: ders. (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheo-
rie, Stuttgart, Weimar, 2005, S. 384. 34 Vgl. ebenda. 35 Kant, Immanuel: »Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik«, in: Akademie-Ausgabe, Band 20, S. 325, Hervorh. i. O. 36 Kant, Immanuel: Reflexion 2859, in: Akademie-Ausgabe, Band 16, S. 549. 37 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, B 341–342, A 285. 38 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, B 762–763, A 734– 735.
3 Denken | 63
Durch das Absehen von den Unterschieden der Dinge werden die Dinge im Allgemeinen vorgestellt. Diese Fähigkeit, zu verallgemeinern bzw. zu abstrahieren, ist Voraussetzung dafür, dass wir Begriffe bilden können und damit Voraussetzung für jede Denkleistung. Mit dieser Ansicht teilt Kant eine traditionelle Auffassung zur Begriffsbildung, die u. a. auch Georg Friedrich Meier vertritt – der Verfasser einer Schrift zur Logik, die Kant als Grundlage für seine Vorlesung zur formalen Logik verwendet hat. Meier schreibt: »Wir machen einen Begriff durch die logische Absonderung (conceptus per abstractionem logicam formatus), wenn wir übereinstimmende Begriffe von verschiedenen Dingen gegen einander halten, und die Merkmale, die sie miteinander gemein haben, allein uns deutlich vorstellen.«39 Auch bei Meier spielt die Abstraktion eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Begriffen. Für Kant ist die Abstraktion nicht nur Voraussetzung für die Bildung von Begriffen, sie ist auch zentral bei der Anwendung der Begriffe, allerdings nicht in jedem Fall. Kant unterscheidet hier einen graduell abstrakteren von einem graduell konkreteren Gebrauch von Begriffen. Mit dieser Unterscheidung argumentiert er gegen einen »Mißbrauch[, der] gleich selbst durch die neueren Logiker authorisiret«40 wurde. Kant betont, dass es nicht die Begriffe selbst sind, die abstrakt oder konkret sind, sondern nur deren Gebrauch, weil alle Begriffe als solche abstrakt sind: »Man […] abstrahirt in dem Gebrauche eines Begriffs von der Verschiedenheit desjenigen, was unter ihm enthalten ist. […] Die Unterschiede von abstract und concret gehen nur den Gebrauch der Begriffe, nicht die Begriffe selbst an«41. Die Abstraktion ist daher für den Gebrauch von Begriffen graduell unterschiedlich relevant. Was jeweils über den Grad von Abstraktion entscheidet, wird in der Jäsche-Logik erklärt: »Und dieser Gebrauch kann hin wiederum verschiedene Grade haben; — je nach dem man einen Begriff bald mehr bald weniger abstract oder concret behandelt, d. h. bald mehr bald weniger Bestimmungen entweder wegläßt oder hinzusetzt.«42 Der Gebrauch eines Begriffes wird also dadurch
39 Meier, Georg Friedrich: Auszug aus der Vernunftlehre, in: Akademie-Ausgabe, Band 16, S. 549– 550. 40 Kant, Immanuel: »Über eine Entdeckung«, in: Akademie-Ausgabe, Band 8, S. 199, Anmerkung 1. 41 Ebenda. 42 Jäsche, Gottlob Benjamin (Hg.): »Immanuel Kants Logik«, in: Akademie-Ausgabe, Band 9, S. 99.
64 | Bildnerisches Denken
abstrakter, dass weniger Bestimmungen des betrachteten Gegenstandes berücksichtigt werden. Die kantische Unterscheidung zwischen einer absoluten und einer relativen Bedeutung der Termini »abstrakt« und »konkret« wird in einem der nachfolgenden Kapitel (3.2.2.2) ausführlich behandelt. Unabhängig von diesem graduellen Unterschied im Gebrauch ist bei Kant ein erster Ansatz einer Unterscheidung zwischen Begriffen verschiedener Stufen zu finden. Er kennzeichnet die Begriffe als diejenigen Vorstellungen, die nur mittelbar, nämlich über eine Anschauung, auf Gegenstände bezogen werden können. Dabei macht er aber auf die Möglichkeit aufmerksam, dass Begriffe selbst nur auf Begriffe bezogen sein können: »Da keine Vorstellung unmittelbar auf den Gegenstand geht, als bloß die Anschauung, so wird ein Begriff niemals auf einen Gegenstand unmittelbar, sondern auf irgend eine andre Vorstellung von demselben (sei sie Anschauung oder selbst schon Begriff) bezogen.«43 Damit ist eine Unterscheidung zwischen Begriffen, die direkt auf Anschauungen bezogen sind und solchen, die nur auf Begriffe bezogen sind, im Ansatz gegeben. John Stuart Mill John Stuart Mill kann in Bezug auf seine Begriffstheorie als Vorreiter einer modernen Vorstellung vom Begriff gelten.44 Wie bereits erläutert (vgl. Kapitel 3.1.1.1), hält er es für missverständlich, vom Denken in Begriffen zu sprechen, und geht stattdessen davon aus, dass unser Denken sprachlich ist. Modern an seiner Begriffstheorie ist außerdem, dass er die tatsächlich gegebene Verschränkung von Begriffsbildung und -gebrauch explizit thematisiert. Dennoch muss er in Bezug auf seine Abstraktionstheorie als Vertreter der klassischen Tradition angesehen werden, der zufolge das Absehen von Merkmalen von Dingen in der Welt die erste Stufe der Abstraktion darstellt. In folgendem Zitat werden beide Aspekte – der Ausgang der Abstraktion von der Wahrnehmung von Dingen und die Verschränkung von Bildung und Gebrauch von Begriffen – deutlich: »It is not a law of our intellect, that in comparing things with each other and taking note of their agreement we merely recognise as realized in the outward world something that we already had in our minds. The conception originally found its way to us as the result of such a comparison. It was
43 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, B 93, A 68. 44 Vgl. Haller, Rudolf; Mittelstraß, Jürgen: »Begriff«, in: Ritter, Joachim u. a. (Hg.): Historisches
Wörterbuch der Philosophie, Basel, Darmstadt, 1971–2007, S. 784.
3 Denken | 65
obtained (in metaphysical phrase) by abstraction from individual things. These things may be things which we perceived or thought of on former occasions, but they may also be the things which we are perceiving or thinking of on the very occasion.«45 »If we had never seen any white object or had never seen any cloven-footed animal before, we should at the same time and by the same mental act acquire the idea, and employ it for the colligation of the observed phenomena.«46
Ernst Mach Noch stärker als Mill sieht Ernst Mach die Verknüpfung von Begriffsbildung und -gebrauch. Dies wird daran deutlich, dass in seiner Begriffstheorie das reagierende Verhalten eine entscheidende Rolle spielt. Ein Begriff ist nach seiner Meinung nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern ein Impuls zu einer Tätigkeit: »Ein Begriff ist überhaupt nicht eine fertige Vorstellung. Gebrauche ich ein Wort zur Bezeichnung eines Begriffs, so liegt in demselben ein einfacher Impuls zu einer geläufigen sinnlichen Tätigkeit«47. Einen Begriff kennt und versteht man daher erst dann, wenn man die ihm entsprechende Tätigkeit selbst aus- und eingeübt hat: »Jeder Beruf hat seine eigenen Begriffe. Der Musiker liest seine Partitur, so wie der Jurist seine Gesetze, der Apotheker seine Rezepte, der Koch sein Kochbuch, der Mathematiker oder Physiker seine Abhandlung liest. Was für den Berufsfremden ein leeres Wort oder Zeichen ist, hat für den Fachmann einen ganz bestimmten Sinn, enthält für ihn die Anweisung zu genau begrenzten psychischen oder physischen Tätigkeiten, welche ein psychisches oder physisches Objekt von ebenso umschriebener Reaktion in der Vorstellung zu erzeugen oder vor die Sinne zu stellen vermag, wenn er die betreffenden Tätigkeiten wirklich ausführt. Hierzu ist es aber unerläßlich, daß er die genannten Tätigkeiten
wirklich geübt, und sich in denselben die nötige Geläufigkeit erworben, daß er in dem Beruf mit gelebt hat.«48
Steht Mach mit dieser Vorstellung vom Begriff den modernen Begriffstheorien nahe, so muss er dennoch wie Mill in Bezug auf seine Theorie der Abstraktion zu den Vertretern der klassischen Theorie gezählt werden. Abstraktion besteht nach Mach in einer Teilung der Aufmerksamkeit in Bezug auf
45 Mill, John Stuart: »A System of Logic«, in: Robson, John M. (Hg.): Collected Works of John Stuart
Mill, Band 8, Toronto, London 1981, S. 650–651, Hervorh. i. O. 46 Ebenda, S. 651, Hervorh. i. O. 47 Mach, Ernst: »Einfluß der vorausgehenden Untersuchungen auf die Auffassung der Physik«, in:
Die Analyse der Empfindungen, Jena, 1922, S. 263, Hervorh. i. O. 48 Mach, Ernst: »Der Begriff«, in: Erkenntnis und Irrtum, Leipzig, 1906, S. 130, Hervorh. i. O.
66 | Bildnerisches Denken
bestimmte Aspekte sinnlich wahrgenommener Objekte, die zu einer bestimmten Reaktion führen: »Betrachten wir nun noch etwas genauer den Prozeß der Abstraktion, durch welchen Begriffe zustande kommen. Die Dinge (Körper) sind für uns verhältnismäßig stabile Komplexe von aneinander gebundenen, von einander abhängigen Sinnesempfindungen. Nicht alle Elemente dieses Komplexes sind aber von gleicher biologischer Wichtigkeit.«49 »[B]iologisch wichtigen[n] Empfindungen […] [wird] die Aufmerksamkeit zugewendet, dagegen von anderen Elementen des Komplexes […] abgewendet. In dieser Teilung der Aufmerksamkeit besteht nun wesentlich der Prozeß der Abstraktion.«50 »Jedes Wort dient […] zur Bezeichnung einer Klasse von Objekten (Sachen oder Vorgängen) be-
stimmter Reaktion.«51 »In dem Wort besitzt er [der Mensch, Anm. d. A.] eine sinnlich allgemein faßbare Etikette des Begriffes«.52
In der Abstraktion wird die Aufmerksamkeit auf die Gleichartigkeit der Reaktion gelegt. Aus dieser Gleichartigkeit der Reaktion in unterschiedlichen Situationen kann dann ein Begriff gebildet werden. Mit diesem Begriff bzw. dem entsprechenden Wort wird der Auslöser der Reaktion bezeichnet. In diesem Sinne besitzen auch Tiere rudimentäre Ansätze zu Abstraktionsfähigkeit. Da dieser Abstraktionsprozess graduell gesteigert werden kann, so wird auch Begriffsfähigkeit allmählich erworben. Anfänge von Begriffsfähigkeit erkennt Mach daher bereits bei höheren Tieren.53 Er steht damit in der Tradition der heute verbreiteten Ansicht, dass manche Tiere über sprachlose Denkfähigkeit verfügen.54 Bei dieser breiten Konzeption vom Begriff ist die Bindung an die Sprache nicht zwingend nötig, weshalb Mach der Sprache nur eine unterstützende Funktion bei der Begriffsbildung zuerkennt: »Der Mensch bildet seine Begriffe in derselben Weise wie das Tier, wird aber durch die Sprache und durch den Verkehr mit den Genossen, welche beiden Mittel dem Tier nur geringe Hilfe leisten, mächtig unterstützt.«55
49 Ebenda, S. 132, Hervorh. i. O. 50 Ebenda, Hervorh. i. O. 51 Ebenda, S. 128, Hervorh. i. O. 52 Ebenda, Hervorh. i. O. 53 Vgl. ebenda, S. 127–128. 54 Vgl. Jamieson, Dale: »Animal Language and thought«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Ency-
clopedia of Philosophy, London, 1998, Online-Ausgabe, Zugriff am 22.07.2014, [ohne Seitenangabe]. 55 Mach, Ernst: »Der Begriff«, in: Erkenntnis und Irrtum, Leipzig, 1906, S. 128.
3 Denken | 67
Zusammenfassung Zusammenfassend lässt sich sagen: Für Kant, als Vertreter einer klassischen Abstraktions- und Begriffstheorie, ist die Abstraktion Voraussetzung für die Bildung und den Gebrauch von Begriffen. Der Unterschied zwischen Begriffen 1. und 2. Stufe ist im Zusammenhang mit der Bildung von Begriffen bei ihm jedoch noch nicht deutlich reflektiert. Lediglich im Gebrauch der Begriffe, der klar unterschieden wird von ihrer Bildung, ist eine entsprechende Unterscheidung zwischen Begriffen verschiedener Stufen angedeutet. Diese muss von den verschiedenen Graden von Abstraktion im Gebrauch der Begriffe unterschieden werden. Diese graduelle Differenz ist abhängig von der jeweiligen Verwendungssituation eines Begriffs. Bei Mill und Mach deutet sich bereits ein modernes Verständnis von Begriffen an, das die Bildung und den Gebrauch von Begriffen stärker verschränkt betrachtet. In Bezug auf ihr Verständnis von Abstraktion vertreten sie beide die klassische Position, der zufolge Abstraktion im Absehen von Merkmalen von Dingen in der Welt besteht. 3.1.1.4 Begrifflichkeit und Abstraktion in der modernen Abstraktionstheorie Die moderne Abstraktionstheorie hat sich ursprünglich entwickelt, um in der Mathematik das Verständnis von Abstrakta wie beispielsweise Zahlen – im Unterschied zu Ziffern – zu erklären. In ihrer Weiterentwicklung wurde »dem eigenen Anspruch nach die ursprünglich vorhandene enge Bindung an mathematische Kontexte aufgegeben […] zugunsten der Einordnung in das explizit ausformulierte Programm eines auf den gesamten Bereich der Wissenschaften und der Philosophie bezogenen methodischen Sprachaufbaus aus der vorwissenschaftlichen Lebenspraxis.«56
Erst in diesem Entwicklungsstadium der modernen Abstraktionstheorie kann man sinnvoll danach fragen, welche Bedeutung die Abstraktion für Begriffe hat. Wie bereits anhand von Tabelle 2 und Tabelle 3 (S. 57–59) erläutert, wird nicht mehr streng zwischen der Bildung und dem Gebrauch von Begriffen unterschieden. Im Folgenden wird zunächst erklärt, wie in den Begriffstheorien, die der modernen Abstraktionstheorie zugrunde liegen, das Verhältnis von Begriffsbildung und -gebrauch gesehen wird. Anschließend wird erläutert, welche Rolle das Abstraktionsverfahren bei Begriffen der 2.
56 Prätor, Klaus: »Wer hat Angst vor ›dem‹ Nashorn?«, in: ders. (Hg.): Aspekte der Abstraktionsthe-
orie, Aachen, 1988, S. 64.
68 | Bildnerisches Denken
Stufe und der 1. Stufe spielt. Zum Schluss wird der Frage nachgegangen, was genau unter dem Prozess der Abstraktion verstanden wird, der in allen Varianten der modernen Abstraktionstheorie als »Übergang« beschrieben wird. Hier werden Positionen vorgestellt, die z. T. gegensätzliche Ansichten darüber vertreten, um welche Art von Übergang es sich bei der Abstraktion handelt. Die Auswahl der Autoren orientiert sich an entsprechenden Einträgen in mehreren Nachschlagewerken. Dabei überwiegen die deutschsprachigen Autoren, da die englischsprachige Diskussion weniger die Abstraktion als Prozess, sondern vielmehr den Status abstrakter Gegenstände in ihren Fokus stellt. Dies zeigt sich an den Stichworten, zu denen in den entsprechenden Nachschlagewerken Einträge vorhanden sind. So existieren weder in der Stanford Encyclopedia of Philosophy noch in der Routledge Encyclopedia of Philosophy Artikel zum Stichwort »abstraction«.57 Beide Nachschlagewerke enthalten aber Einträge zum Begriff »abstract objects«.58 In der Enzyklopädie Philosophie Wissenschaftstheorie und dem Historischen Wörterbuch der Philosophie ist es genau umgekehrt. In beiden gibt es zwar Einträge zu »Abstraktion«59, aber keinen zu abstrakten Gegenständen oder abstrakten Objekten.60 Unterscheidung zwischen Bildung und Gebrauch von Begriffen Wittgensteins späte Sprachphilosophie hat maßgeblich dazu beigetragen, die Unterscheidung zwischen Begriffsbildung und -gebrauch aufzuheben. Seine Formulierung »Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Spra-
57 Vgl. Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy, Frühjahr 2014, OnlineAusgabe, Zugriff am 05.08.2014, und Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philoso-
phy, London, 1998, Online-Ausgabe, Zugriff am 05.08.2014. 58 Rosen, Gideon: »Abstract Objects«, in: Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philos-
ophy, Frühjahr 2012, Online-Ausgabe, Zugriff am 05.08.2014, und: Hale, Bob: »Abstract objects«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 1998, OnlineAusgabe, Zugriff am 05.08.2014. 59 Aubenque, Pierre u. a.: »Abstraktion«, in: Ritter, Joachim u. a. (Hg.): Historisches Wörterbuch
der Philosophie, Basel, Darmstadt, 1971, und: Schneider, Hans J.: »Abstraktion«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005. 60 Vgl. Ritter, Joachim u. a. (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel, Darmstadt, 1971.
3 Denken | 69
che«61 war einflussreich für die moderne Begriffstheorie: Die Bedeutung eines Begriffs kann nach Wittgenstein nur in Abhängigkeit zur konkreten Gebrauchssituation beschrieben werden. Damit ist es auch unmöglich, den Prozess der Begriffsbildung losgelöst vom Begriffsgebrauch zu untersuchen. Das bedeutet, dass auch der Prozess der Bildung von Begriffen nur eingebettet in konkrete Sprechsituationen beschrieben werden kann: »Aber haben wir denn nicht einen Begriff davon, was ein Satz ist, was wir unter ›Satz‹ verstehen? – Doch; sofern wir auch einen Begriff davon haben, was wir unter ›Spiel‹ verstehen. Gefragt, was ein Satz ist […] werden wir Beispiele angeben […]; nun, auf diese Weise haben wir einen Begriff vom Satz.«62
Kamlah und Lorenzen unterscheiden zwar zwischen mehreren Stufen, die bei der Einführung von Begriffen durchlaufen werden müssen – von Prädikatoren über Termini zu Begriffen.63 Im Anschluss an Wittgenstein beschreiben sie aber jede dieser Stufen als eingebettet in eine konkrete Sprechsituation. Eine Analyse der Bildung von Begriffen unabhängig von konkreten Sprechhandlungen kommt für die Autoren nicht in Betracht. Entsprechend betonen sie: Es kann »nicht oft genug gegen das traditionelle Vorurteil Einspruch erhoben werden«, »demgemäß Denken als ›primärer Bewußtseinsakt‹ vom Sprechen als der hernachfolgenden ›sprachlichen Äußerung‹ zu unterscheiden sei.«64 Klaus Prätor sieht den Zusammenhang von Begriffsbildung und deren Gebrauch noch enger als Kamlah und Lorenzen. Er kritisiert Letztere, weil sie Begriffsbildung als Prozess beschreiben, in dem die Begriffe erst nach der Bildung und dem Gebrauch von Wörtern erworben werden können: »Die Rede von Begriffen wird erworben, indem im jeweiligen Gebrauchszusammenhang gelernt wird, daß es für diesen nicht darauf ankommt, ob ein Wort durch ein gleichgebrauchtes, synonymes ersetzt wird.«65 »Das hier vorgeschlagene Vorgehen konstituiert Begriffe als nicht den Wörtern nachgeordne-
61 Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen, Frankfurt, 1971, § 43, S. 35. 62 Ebenda, § 135, S. 72, Hervorh. i. O. 63 Vgl. Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich, 1990, S. 28 und S. 86–87. 64 Ebenda, S. 61. 65 Prätor, Klaus: »Wer hat Angst vor ›dem‹ Nashorn?«, in: ders. (Hg.): Aspekte der Abstraktionsthe-
orie, Aachen, 1988, S. 79.
70 | Bildnerisches Denken
te, sondern ihnen grundsätzlich semantisch gleichgestellte, nur in anderen Gebrauchszusammenhängen stehende Referenzobjekte. […] Diese Konzeption vermeidet […] eine […] weithin als künstlich empfundene Nachträglichkeit der konstruktivistischen Abstraktionstheorie, die die Begriffe als erst in der Rede über Wörter konstituiert erscheinen läßt, während diese Leistung in Wahrheit bereits auf der Stufe ihres Gebrauchs erfolgt.«66
Auch für Harald Wohlrapp ist der Prozess der Begriffsbildung durch Abstraktion nicht abzulösen von lebenspraktischen Bezügen, wie er am Begriff der »Arbeit« erläutert: »Insofern diese Gleichgültigkeit, welche die praktische Grundlage der ›Abstraktion‹ ist, sich herausgebildet hat und in den sozialen Beziehungen wirkt, ist der abstrakte Gegenstand ›Arbeit‹ existent; oder, anders ausgedrückt, die Abstraktion ist nicht bloß eine theoretische Konstruktion, sondern ist ›praktisch-wahr‹.«67 Es lässt sich also eine relativ große Einigkeit darüber feststellen, dass die Bildung von Begriffen immer nur eingebettet in einen Gebrauchszusammenhang geschieht. Wenn im Folgenden daher vom Prozess der Begriffsbildung die Rede ist, dann ist damit immer mitgedacht, dass sich dieser Prozess nur in konkreten Sprechsituationen zeigt und nicht unabhängig von diesen untersucht werden kann. Begriffe 2. Stufe In den verschiedenen Ansätzen der modernen Abstraktionstheorie herrscht Einigkeit darüber, dass die Abstraktion nicht nur bei der Konstruktion von Zahlen, sondern auch bei der Bildung von Begriffen eine zentrale Rolle spielt. Die Parallele zu den Zahlen in der Mathematik macht allerdings deutlich, dass hier zunächst nur Begriffe 2. Stufe gemeint sind, wie Kamlah und Lorenzen erläutern: »Obwohl die Ziffern sich von den Prädikatoren dadurch unterscheiden, daß sie erst konstruiert werden müssen, ist also die Handlung der Abstraktion, aus der die Zahlen hervorgehen, derjenigen ähnlich, aus der Begriffe entstehen.«68 Die Abstraktion wird ganz allgemein verstanden als »Übergang von einer Redeweise zu einer anderen, der durch eine Übergangsregel […] reguliert wird. […] Aussagen über einen Begriff sind demgemäß nichts anderes als Aussagen über ein Prädikat, die bezüglich der
66 Ebenda, S. 80. 67 Wohlrapp, Harald: »Abstraktion in Marxens Wissenschaftsauffassung«, in: Prätor, Klaus (Hg.):
Aspekte der Abstraktionstheorie, Aachen, 1988, S. 104. 68 Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich, 1990, S. 94.
3 Denken | 71
Äquivalenzrelation Synonymie invariant sind.«69 Uneinig ist man sich darin, wie die durch das Abstraktionsverfahren konstruierten »abstrakten Gegenstände« bzw. »abstract objects« zu interpretieren sind. Eine Deutung, die auch als reduktionistische Lesart bezeichnet wird, fasst »die Rede von abstrakten Gegenständen als eine faҫon de parler, als ein[en] Kunstgriff zur Bereicherung der Redemöglichkeiten«70 auf. »Die im Abstraktionsverfahren vollzogene Konstruktion erschließt nach dieser Deutung nicht etwas Neues; sie spart nur Zeit und Schreibraum und schafft so eine bessere Übersichtlichkeit.«71 Sie wird von den sogenannten Nominalisten vertreten: »Nominalists have commonly adopted a programme of reductive paraphrase, aimed at eliminating all apparent reference to and quantification over abstract objects.«72 Eine offene Frage dieser Deutung besteht darin, ob und wie sinnvoll zwischen Abstrakta und Konkreta unterschieden werden kann bzw. muss.73 Die nicht-reduktionistische Lesart interpretiert das Abstraktionsverfahren so, dass dadurch zwar keine realen abstrakten Gegenstände konstruiert werden, wohl aber eine neue Sichtweise bzw. Handlungsweise im Sinne einer Sprechhandlung erschlossen wird. Sie wird beispielsweise von Hans Schneider vertreten: »Der Zuwachs, die Ausweitung von Kenntnissen, die wir hier betrachten, betrifft also primär die Ebene des Handelns: […] Der neue Umgang bedeutet eine neue Sehweise, und diese artikuliert sich in einer neuen Redeweise: in der Benutzung von neuen, abstrakten Prädikatoren und von Abstraktoren.«74 »Ich möchte also behaupten, daß die abstrakte Redeweise tatsächlich eine neue sprachliche Handlungsmöglichkeit darstellt, die sich auf konkrete Redeweisen nicht reduzieren läßt.«75
69 Künne, Wolfgang: »Abstrakte Gegenstände via Abstraktion?«, in: Prätor, Klaus (Hg.): Aspekte
der Abstraktionstheorie, Aachen, 1988, S. 19. 70 Lorenzen, Paul: »Logik und Grammatik«, in: ders.: Methodisches Denken, Frankfurt a. M., 1974, S. 75. 71 Schneider, Hans Julius: »Der Konstruktivismus ist kein Reduktionismus!«, in: Prätor, Klaus (Hg.): Aspekte der Abstraktionstheorie, Aachen, 1988, 2. 164. 72 Hale, Bob: »Abstract objects«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 1998, Online-Ausgabe, Zugriff am 29.04.2013, [ohne Seitenangabe]. 73 Vgl. hierzu die Diskussion zwischen Geo Siegwart, Christian Thiel und Dirk Hartmann in der
Zeitschrift für philosophische Forschung, 1993. 74 Schneider, Hans Julius: »Der Konstruktivismus ist kein Reduktionismus!«, in: Prätor, Klaus (Hg.): Aspekte der Abstraktionstheorie, Aachen, 1988, S. 167. 75 Ebenda, S. 168, Hervorh. i. O.
72 | Bildnerisches Denken
Ähnlich deutet Ignacio Angelelli das Abstraktionsverfahren, der ebenfalls davon ausgeht, dass Abstraktion nicht einfach nur als Redeverkürzung aufgefasst werden kann.76 Angelelli gibt allerdings zu, dass eine zu diesem Nominalismus alternative Interpretation der Abstrakta nicht leicht zu finden ist, weswegen er auch keine solche anbietet: »There is also the other side of the coin: it is easy to complain about nominalism but difficult to build something better, i.e. to produce a good answer to the ultimate question: What is the output of abstraction? Here the phenomena – the abstracta – are hard to describe.«77
Begriffe 1. Stufe Wie oben angedeutet, herrscht in der modernen Abstraktionstheorie Uneinigkeit darüber, ob bei der Bildung und dem Gebrauch von Begriffen 1. Stufe die Abstraktion eine Rolle spielt. In der Regel werden auf dieser Stufe zumindest die elementaren Prädikationen nicht als Abstraktionsleistung bezeichnet. In diesen elementaren Prädikationen wird die Brücke zwischen der Wahrnehmung der Welt und der Sprache geschlagen. Es handelt sich dabei um den Übergang [1] in Tabelle 3 (S. 59). Abstraktion im modernen Sinne bezieht sich nicht auf Wahrnehmungsinhalte, sondern auf sprachliche Einheiten. Aus diesem Grund wird von vielen Autoren betont, dass es sich bei der Abstraktion nicht um eine bestimmte Lenkung der Aufmerksamkeit handelt,78 und dass sie daher auch nicht als psychischer Prozess verstanden werden kann. So betont Lorenzen: »Die Abstraktion, die von den Termini zu Begriffen führt, ist aber keine psychische Operation, sondern eine logische Operation.«79 Ignacio Angelelli hingegen ist der Meinung, dass die von vielen Autoren als logische Operation beschriebene Abstraktion im modernen Sinne gar keine Abstraktion ist:
76 Vgl. Angelelli, Ignacio: »Adventures of Abstraction«, in: Coniglione, Francesco u. a. (Hg.): Ideali-
zation XI, Amsterdam, New York, 2004, S. 11, S. 29, Hervorh. i. O. 77 Ebenda, Hervorh. i. O. 78 Vgl. Prätor, Klaus: »Wer hat Angst vor ›dem‹ Nashorn?«, in: ders. (Hg.): Aspekte der Abstrakti-
onstheorie, Aachen, 1988, S. 65. 79 Lorenzen, Paul: »Logik und Grammatik«, in: ders.: Methodisches Denken, Frankfurt a. M., 1974, S. 76.
3 Denken | 73
»Frege’s ›logical method‹ – so much praised by Dummett – is […] a frivolous procedure that cannot be referred to as ›logical abstraction‹ or as abstraction of any sort simply because there is no abstraction in it […]. The method is not really interested in any of the infinitely many, different particular types of objects […] all that matters is their common suitability, i.e. the compatibility of the chosen objects with the previously established condition«.80
Übereinstimmend mit den anderen Autoren der modernen Abstraktionstheorie versteht er Prädikationen – zumindest elementare – nicht als Abstraktion, den Abstraktion bezieht sich immer auf Sätze, nicht auf Wahrnehmungsinhalte.81 Prätor dagegen betont eine deutliche Verwandtschaft der beiden Operationen – der Prädikation und der Abstraktion: »Wie die mit Abstraktoren gebildete Rede gibt auch die Rede von Individuen zu verstehen, welche Art von Ununterschiedenheit im jeweiligen Zusammenhang unterstellt wird. Sie steht damit neben den Möglichkeiten, synonyme Wörter, tauschgleiche Produkte oder zählgleiche Ziffern ununterschieden zu behandeln und so von Begriffen, Warenwerten oder Zahlen zu reden. In gleicher Weise läßt sich auch die typisierende Rede über Gattungen […] verstehen als die hinsichtlich der Prädikationsgleichheit, der gemeinsamen Möglichkeit des berechtigten Zusprechens des gleichen Prädikators, ununterschiedene Behandlung von Individuen beziehungsweise von deren Vorkommnissen. Nach dem gleichen Muster läßt sich auch der Übergang von Wortäußerungen zu Wörtern verstehen, wenn die Artikulations- und Verwendungsgleichheit eigen- und fremderzeugter Wortäußerungen zur Grundlage gemacht wird. So wird auch die Verwandtschaft der Leistungen von Abstraktion und Prädikation erklärlich, ohne diese einander gleichzusetzen.«82
Dies deutet darauf hin, dass die Abgrenzung beider Prozesse stark davon abhängt, was genau unter dem Übergang verstanden wird, den die Operation der Abstraktion leistet. Je nachdem, wie man diesen Übergang interpretiert, erfolgt auch eine entsprechende Antwort auf die Frage, ob bei der Bildung der Begriffe 1. Stufe die Abstraktion eine Rolle spielt.
80 Angelelli, Ignacio: »Adventures of Abstraction«, in: Coniglione, Francesco u. a. (Hg.): Idealiza-
tion XI, Amsterdam, New York, 2004, S. 24. 81 Vgl. ebenda, S. 12. 82 Prätor, Klaus: »Wer hat Angst vor ›dem‹ Nashorn?«, in: ders. (Hg.): Aspekte der Abstraktionsthe-
orie, Aachen, 1988, S. 77–78.
74 | Bildnerisches Denken
Der Übergang Die nähere Beschreibung des »Übergangs«, der durch die Abstraktion geleistet wird, fällt bei verschiedenen Autoren sehr unterschiedlich aus. Wie bereits erläutert, besteht große Einigkeit darüber, dass der Übergang von der sprachlichen Ebene, d. h. den Begriffen 1. Stufe, zur Metasprache, d. h. den Begriffen 2. Stufe, eine Abstraktionsleistung darstellt. Hingegen gibt es gegensätzliche Ansichten darüber, ob dies auch für den Übergang innerhalb der Begriffe 1. Stufe gilt. Der Übergang in der Begriffshierarchie von Begriffen zu ihren Oberbegriffen, wie beispielsweise von einer Gattung zur Familie, wird nur von manchen Autoren als Abstraktion gesehen. Weiterhin wird von manchen Autoren auch der Übergang von der Rede über eine aktuelle Handlung zur Rede über ihr Handlungsschema als Abstraktion bezeichnet. Als eine Variante dieser Interpretation kann der Übergang von einem aktuell gesprochenen Wort zum Wortschema verstanden werden. Nachfolgend werden einige dieser Positionen exemplarisch vorgestellt. Für Hans Schneider ist der Übergang von einer Ebene der Begriffshierarchie zu einer anderen ein Beispiel zur Erläuterung der klassischen Abstraktionstheorie. Ihm zufolge bezeichnet »Abstraktion« in der ursprünglichen, also klassischen Bedeutung eine »Operation, vermittels derer man in der Erkenntnis zu den dann Abstrakta, Abstraktionen oder abstrakte Gegenstände genannten Genera und Spezies […] gelangt.«83 Für Kuno Lorenz hingegen scheint in diesem Punkt kein Unterschied zwischen der klassischen und einer von ihm vertretenen modernen Abstraktionstheorie zu bestehen. Solche Übergänge sind seinen Ausführungen zufolge Paradebeispiele für Abstraktion im modernen Sinne, wie etwa der Übergang von der Art Ammomanes deserti (Steinlerche) über die Gattung Ammomanes zur Familie Alaudidae (Lerche).84 Ähnlicher Ansicht sind Kamlah und Lorenzen. Am Beispiel des Tangotanzens erläutern sie, inwiefern auch beim Reden über Handlungen ein sprachlicher Übergang im Sinne einer Abstraktion stattfinden kann. »Wenn wir z. B. sagen ›der Tango ist schwer‹ (im Sinne von ›schwieriger auszuführen als andere Tänze‹), dann sprechen wir über ›den Tango als Tango‹, d. h. über den Tango als Handlungsschema. […] Der ›Übergang‹ von einer aktuel-
83 Schneider, Hans J.: »Abstraktion«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und
Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005, S. 21. 84 Vgl. Lorenz, Kuno: »Abstraktum«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und
Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005, S. 25, Hervorh. i. O.
3 Denken | 75
len Handlung zu ihrem Schema ist also auch wieder eine Abstraktion«.85 Versteht man auch das Sprechen als Handlung, dann kann das aktuell gesprochene Wort in Analogie zum Tango als aktuelle Handlung gesehen werden, so dass der Übergang von diesem gesprochenen Wort zum Begriff eine zweistufige Abstraktion darstellt: »Wir unterscheiden also Abstraktionen der ersten und der zweiten Stufe. Auf der ersten Stufe gehen wir vom konkreten, aktuell gesprochenen Wort oder Satz zum Wort als Schema oder zum Satzschema über. Ist das Wort ein Terminus oder ist der Satz eine Aussage, so können wir auf der zweiten Stufe abstrahierend zum Begriff oder zum Sachverhalt weitergehen«.86
Für Prätor hingegen ist der Abstraktionsbegriff sowohl von Kamlah und Lorenzen als auch von Lorenz zu weit gefasst. Mit Bezug zu Kamlah und Lorenzen macht er darauf aufmerksam, dass es bei deren Verständnis von Abstraktion schwierig ist, die Abgrenzung zur Prädikation eindeutig aufrecht zu erhalten.87 Vom Einbezug der Verallgemeinerung in die Abstraktion, die Lorenz vorschlägt, distanziert er sich in aller Deutlichkeit: »Mit den Abstraktoren sind Wörter dritter Art eingeführt worden […]. Das macht deutlich, daß die Abstraktion nach diesem Modell scharf zu unterscheiden ist von der Verallgemeinerung. Bei dieser, beispielsweise im Übergang von einer Tierart zu einer Tierfamilie oder -gattung, wird auf allen Stufen auf die gleichen konkreten Gegenstände, nämlich auf Tierindividuen, Bezug genommen. […] Während für den Übergang von ›Eule‹ zu ›Nachtraubvogel‹ lediglich die Anzahl der zugelassenen Beispielexemplare sinngemäß erweitert werden muß, ist dies für den Übergang von Wörtern zu Begriffen nicht möglich.«88
Diese Ansicht teilt auch Wohlrapp. Er ordnet ähnlich wie Schneider das Verständnis von Abstraktion als Verallgemeinerung der veralteten klassischen Abstraktionstheorie zu, die seiner Ansicht nach zirkulär ist:
85 Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich, 1990, S. 100, Hervorh. i. O. 86 Ebenda, S. 102–103. 87 Vgl. Prätor, Klaus: »Wer hat Angst vor ›dem‹ Nashorn?«, in: ders. (Hg.): Aspekte der Abstrakti-
onstheorie, Aachen, 1988, S. 70. 88 Ebenda, S. 67.
76 | Bildnerisches Denken
»Mit ›klassischer Abstraktionslehre‹ meine ich die Beschreibung des Übergangs z. B. von Pflaumen, Äpfeln, Quitten usw. zu Obst. Die Beschreibung sieht bekanntlich so aus, daß wir dabei von Verschiedenem absehen und das Gleiche behalten. […] Es ist oft genug darauf hingewiesen worden, daß diese Beschreibung zirkulär ist.«89
Die generelle Schwierigkeit bei der Präzisierung der Abstraktionsleistung liegt meiner Ansicht nach darin, dass der Übergang von der aktuellen Wahrnehmung einer einmaligen Erscheinung bis hin zur abstraktesten metasprachlichen Äußerung schrittweise in zueinander ähnlichen, aber nicht gleichen Operationen erfolgt. So ist es letztlich eine Sache der Entscheidung, ab welcher Operation man den Begriff der Abstraktion verwenden möchte. Diesen schrittweisen Übergang hat Lorenzen treffend beschrieben. Die Schritte in seiner Beschreibung entsprechen dabei genau den drei Arten von Übergängen in Tabelle 3 (Seite 59). Schritt [1] »Mit jedem Prädikat der Sprache wird eine Unterscheidung getroffen: Das Einzelne, dem das Prädikat zugesprochen wird, wird unterschieden von dem Einzelnen, dem das Prädikat abgesprochen wird. […] Die exemplarisch eingeführten Prädikate liefern ein System von Unterscheidungen, das jetzt als eine Basis für das weitere dienen kann.«90 »Prädikate [werden] durch die Wahl von Regeln zu einem System verbunden […], immer bekommt jedes Prädikat dadurch außer seiner exemplarischen Einführung zusätzlich einen Stellenwert im System.«91
Schritt [2] »In einem System ist es aufgrund der Regeln möglich, sogenannte Ableitungen durchzuführen; z. B. ist in dem oben angedeuteten System aus der Aussage ›dies ist ein Rabe‹ die Aussage ›dies ist ein Lebenwesen‹ ableitbar.«92
Schritt [3] »In komplizierteren Systemen kann es vorkommen, daß Q sich als ableitbar aus P ergibt und auch umgekehrt P als ableitbar aus Q. P und Q heißen dann im System gleichwertig. Wir sagen dann auch,
89 Wohlrapp, Harald: »Abstraktion in Marxens Wissenschaftsauffassung«, in: Prätor, Klaus (Hg.):
Aspekte der Abstraktionstheorie, Aachen, 1988, S. 109. 90 Lorenzen, Paul: »Methodisches Denken«, in: ders.: Methodisches Denken, Frankfurt a. M., 1974, S. 31. 91 Ebenda, S. 34–35, Hervorh. i. O. 92 Ebenda, S. 35.
3 Denken | 77
daß die Prädikate P und Q ›denselben Begriff darstellen‹. Dadurch wird die Rede von Begriffen methodisch eingeführt.«93
Die Schwierigkeit zu entscheiden, ab welchem Schritt man sinnvoll von einer Abstraktionsleistung sprechen kann, hat auch Geo Siegwart gesehen: »Konkreta sind die in der Gleichheit Stehenden, die Startentitäten für den Abstraktionsprozeß, Abstrakta die Zielentitäten. Dabei kann man durch Abfolgen […] von Abstraktions- und gegebenenfalls Konkretionsschritten ganze Abstraktions- und gegebenenfalls Konkretionstrassen legen. Sollte dereinst oder demnächst eine kunstgerechte Abstraktionsprozedur bereitstehen, dann ist damit alleine noch nicht fixiert, wo die Anfänge zu nehmen und wohin die weiteren Schritte zu lenken sind.«94
Diese Unklarheit der »Startentität« des Abstraktionsprozesses wird auch in Erläuterungen zum Gegenbegriff des »Abstraktums« deutlich – dem »Konkretum«. Kuno Lorenz liefert hier eine zweideutige Erklärung: Ihm zufolge kann »Konkretum« sowohl als Bezeichnung für »einen konkreten sinnlich gegebenen Gegenstand« als auch für »einen Prädikator für einen konkreten Gegenstandsbereich« verstanden werden.95 3.1.1.5 Abstraktion und Denken Bei allen Unterschieden einzelner Theorien zueinander lässt sich doch zusammenfassend sagen, dass in traditionellen Theorien des Denkens die Operation der Abstraktion eine entscheidende Rolle spielt. In den modernen Varianten der Abstraktionstheorie ist sie zumindest bei der Herausbildung einer Metasprache, d. h. der Begriffe 2. Stufe, entscheidend (Schritt [3]) und, je nach Autor, auch für die Übergänge innerhalb der Begriffe 1. Stufe (Schritt [2]). In der klassischen Variante beginnt die Abstraktion mit dem Zuschreiben von Prädikaten (Schritt [1]). Auch wenn sich die verschiedenen Theorien dadurch unterscheiden, ab welchem Schritt von Abstraktion gesprochen wird, gemeinsam ist ihnen eine bestimmte Vorstellung davon, nach welchem Prinzip unser Denken funktio-
93 Ebenda. 94 Siegwart, Geo: »›Die fundamentale Methode der Abstraktion‹«, in: Zeitschrift für philosophische
Forschung, 1993, S. 612, Hervorh. i. O. 95 Vgl. Lorenz, Kuno: »Konkretum«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und
Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2010, S. 299.
78 | Bildnerisches Denken
niert. Das Bildnerische Denken hingegen unterscheidet sich nicht nur von allen drei Schritten und somit von allen drei möglichen Varianten der Abstraktion. Darüber hinaus ist dieser Unterschied zum Bildnerischen Denken gleichzeitig eine Gemeinsamkeit der drei Abstraktions-Schritte. Um diesen grundlegenden Unterschied zum Bildnerischen Denken zu charakterisieren, wird im Folgenden gezeigt, dass alle drei Übergänge ein und dieselbe Grundoperation voraussetzen. 3.1.2 Herleitung des alternativen Kriteriums: Konkretion Das folgende Kapitel führt die Konkretion als alternatives Kriterium für Denken ein. Diesem wird das Bildnerische Denken gerecht. Die Herleitung erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst werden in einem kurzen historischen Überblick mehrere Autoren vorgestellt, die mit dem Begriffspaar »abstrakt« und »konkret« verwandte oder gegenläufige geistige Prozesse bezeichnen (3.1.2.1). Das hier verfolgte Anliegen, die beiden Kriterien als komplementär zu beschreiben, knüpft an diese Verwendungen an. Die Komplementarität lässt sich daraus begründen, dass sowohl die Abstraktion als auch die Konkretion dieselbe Grundoperation weiterführen: das grundlegende Unterscheiden zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem. Sie unterscheiden sich darin, wie sie diese Operation weiterführen, genauer, worauf sich das Denken in der Weiterführung konzentriert. Abstraktion wird in allen erläuterten Varianten verstanden als Konzentration auf das Gleichartige. Dies wird in Bezug auf die vorgestellten Abstraktionstheorien nachgewiesen (3.1.2.2). Manche Theorien reflektieren dabei, dass diese Grundoperation auch anderweitig fortgeführt werden könnte, wie abschließend gezeigt wird (3.1.2.3). 3.1.2.1 Das Begriffspaar »abstrakt« und »konkret« Die Gegenüberstellung der beiden Begriffe »abstrakt« und »konkret« hat eine lange Tradition. In vielen Zusammenhängen dienen sie der Kennzeichnung verwandter oder gegenläufiger geistiger Prozesse. Manche Autoren verwenden die beiden Begriffe dabei in einem absoluten Sinne, also ohne fließende Grenzen. Andere Autoren fassen die Begriffe relativ auf, d. h. sie beschreiben einen graduellen Übergang zwischen dem »Abstrakten« und dem »Konkreten«. Auffällig ist, dass der Operation der Abstraktion bei weitem mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als der Konkretion. So gibt es zwar eine klassische und moderne Abstraktionstheorie, und in der letzteren wird die Konkretion als zur Abstraktion gegenläufige Operation beschrieben. Dennoch kann man hier nicht von einer ausgearbeiteten Konkretionstheorie
3 Denken | 79
sprechen. Im Folgenden werden exemplarisch einige Gegenüberstellungen von »abstrakt« und »konkret« in ihrem jeweiligen Theorierahmen erläutert. Kriterium für diese exemplarische Auswahl bilden die Ausführungen zu den beiden Begriffen in mehreren Lexika. In den meisten Nachschlagewerken zu philosophischen Begriffen erhält die Abstraktion deutlich mehr Aufmerksamkeit als die Konkretion. Dies zeigt sich im Vorhandensein und in der Länge entsprechender Artikel. In den beiden englischsprachigen Werken Stanford Encyclopedia of Philosophy und Routledge Encyclopedia of Philosophy gibt es weder Artikel zum Begriff »concrete« noch zu »concretion« oder »concretization«. Die Artikel »Abstract Objects«96 in beiden Werken behandeln die Diskussion der modernen Abstraktionstheorie um den Status der abstrakten Gegenstände. In diesem Zusammenhang erläutert Bob Hale die Frage, wie abstrakte Objekte von konkreten Objekten unterschieden werden können. Implizit geht er dabei davon aus, dass diese Unterscheidung absolut ist und diskutiert verschiedene mögliche Unterscheidungskriterien, wie beispielsweise die sinnliche Wahrnehmbarkeit.97 Auch Gideon Rosen konzentriert sich in seinen Ausführungen auf ein Kriterium, mit dessen Hilfe abstrakte und konkrete Objekte ohne fließenden Übergang unterschieden werden können: »It should be stressed there need not be one single ›correct‹ way of explaining the abstract/concrete distinction. Any plausible account […] will draw a clear and philosophically significant line in the domain of objects.«98 In der Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie ist ein ähnlicher Schwerpunkt gelegt. Auch hier wird der »moderne Universalienstreit«99 um die abstrakten Gegenstände, der sich aus der Philosophie der Mathematik entwickelt hat, ausführlich erläutert. Aber im Gegensatz zu den anderen Nachschlagewerken enthält die Enzyklopädie sowohl einen Artikel zum Stichwort »konkret« als auch zu »Konkretion« und »Konkretum«. Die Begriffe Abstraktion und
96 Rosen, Gideon: »Abstract Objects«, in: Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philo-
sophy, Frühjahr 2012, Online-Ausgabe, Zugriff am 29.04.2013 und Hale, Bob: »Abstract objects«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 1998, OnlineAusgabe, Zugriff am 29.04.2013, [ohne Seitenangabe]. 97 Vgl. Hale, Bob: »Abstract objects«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philoso-
phy, London, 1998, Online-Ausgabe, Zugriff am 29.04.2013, [ohne Seitenangabe]. 98 Rosen, Gideon: »Abstract Objects«, in: Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy, Frühjahr 2012, Online-Ausgabe, Zugriff am 29.04.2013, [ohne Seitenangabe]. 99 Prätor, Klaus: »Einleitung«, in: ders. (Hg.): Aspekte der Abstraktionstheorie, Aachen, 1988, S. 4.
80 | Bildnerisches Denken
Konkretion werden als zueinander »duale Operationen«100 bezeichnet, d. h. als Operationen, die in bestimmter Hinsicht symmetrisch zueinander sind.101 Interessant sind zudem die Bearbeitungen einiger Artikel für die derzeit erscheinende zweite Auflage dieses Werkes. Kuno Lorenz und Hans Schneider haben die Artikel »abstrakt«102 und »Abstraktion«103 im Vergleich zu den entsprechenden Artikeln der ersten Auflage von Siegfried Blasche stark überarbeitet und erweitert. Die Überarbeitung der Artikel »konkret«104 und »Konkretion«105 durch Lorenz fiel zwar nicht so massiv aus, enthält aber dennoch einige interessante Neuerungen. In den Artikeln zu »abstrakt« und »konkret« ist der Hinweis neu eingefügt, dass beide Begriffe sowohl in einem absoluten wie auch in einem relativen Sinn gebraucht werden können – eine Unterscheidung, die bereits Kant vorgenommen hat und die an späterer Stelle (3.2.2.1) genauer erläutert wird. Eine weitere Neuerung in der zweiten Auflage ist ein Literaturhinweis: Der Artikel »Konkretion«, der in der ersten Auflage keine Literaturhinweise enthält, ist nun ergänzt durch einen Verweis
100 Lorenz, Kuno: »Konkretion«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissen-
schaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2010, S. 298, in der ersten Auflage wurde das Verhältnis beider Operationen als »konvers« statt »dual« bezeichnet: vgl. Lorenz, Kuno: »Konkretion«, Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2004, S. 438. 101 Vgl. Lorenz, Kuno: »dual/Dualität«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und
Wissenschaftstheorie, Weimar, 2005, S. 249. 102 Vgl. Lorenz, Kuno: »abstrakt«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wis-
senschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005. Und: Blasche, Siegfried: »abstrakt«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2004. 103 Vgl. Schneider, Hans J.: »Abstraktion«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005. (Eine ausführlichere Behandlung des Begriffs der »Abstraktion« liefert derselbe Autor in folgender Monographie: ders.: Historische und systematische Untersuchungen zur Abstraktion, Inaugural-Dissertation der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg, 1970). Und: Blasche, Siegfried: »Abstraktion«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2004. 104 Vgl. Lorenz, Kuno: »konkret«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wis-
senschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2010. Und: ders.: »konkret«, Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2004. 105 Vgl. Lorenz, Kuno: »Konkretion«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2010. Und: ders.: »Konkretion«, Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2004.
3 Denken | 81
auf einen Artikel in einem Handbuch zur Sprachphilosophie.106 Dieser Artikel von Joëlle Proust (in französischer Sprache) ist einer der wenigen Texte, der die beiden Begriffe gemeinsam behandeln. Darin wird eine Brücke geschlagen zwischen der ursprünglich in der Philosophie der Mathematik geführten Diskussion um die Abstrakta und der erkenntnistheoretischen Debatte um die Frage, wie unser Wissen von der Welt aufgebaut ist. Im Zusammenhang der Konstitutionssysteme von Rudolf Carnap und Nelson Goodman wird die Frage erörtert, ob es sich bei Abstraktion und Konkretion (im Französischen: concrétisation) um parallele Prozesse handelt. Die wesentlichen Aspekte dieser Frage werden im Folgenden knapp erläutert. Laut Geoffrey Hellman sind die Begriffe des Abstrakten und Konkreten zentral für die Konstitutionssysteme von Carnap und Goodman. Goodman kritisiert in seinem Werk The Structure of Appearance107 (von Hellman mit SA abgekürzt) das System Carnaps, das dieser in Der logische Aufbau der Welt108 formuliert hat (von Hellman mit Aufbau abgekürzt). »Thus, both, the system of the Aufbau, critiqued in Chapter 5 of SA and the SA system itself, are concerned with the relationship between the realms of abstract and concrete.«109 Goodman bemängelt an Carnaps System das Verhältnis dieser beiden Bereiche: »Thus, Goodman develops a realist system covering roughly the same territory as the first stages of the Aufbau […]; this is motivated […] because the relation between abstract and concrete is unsatisfactorily treated in Carnap’s system, and the realist alternative promises a better solution to this problem.«110 Den Übergang von einem Bereich in den jeweils anderen bezeichnet Goodman als »abstraction« bzw. »concretion«. Proust räumt einerseits ein, dass gewisse Parallelen zwischen beiden Prozessen vorhanden seien. Die Konstruktion der konkreten Partikularen durch Konkretion sei exakt das Gegenteil zur Konstruktion abstrakter Universalen durch Abstraktion. Sie betont andererseits, dass diese Parallele ihre Grenzen hat und dass Goodmans Argumente stichhaltig sind, die er für eine Grundlegung des Konstitutionssystems durch Abstraktion anführt: So bietet die Abstraktion
106 Proust, Joëlle: »Abstraction et concrétisation«, in: Dascal, Marcelo u. a. (Hg.):
Sprachphilosophie, Berlin, New York 1996. 107 Goodman, Nelson: The Structure of Appearance, Havard, 1951. 108 Carnap, Rudolf: Der logische Aufbau der Welt, Leipzig, 1928. 109 Geoffrey Hellman: »Introduction«, in: Structure of Appearance, Dordrecht, Holland, Boston, USA, 1977, S. XXIV, Hervorh. i. O. 110 Ebenda, S. XXV, Hervorh. i. O.
82 | Bildnerisches Denken
zwar kein Instrumentarium, um die Bildung natürlicher Begriffe zu erklären. Aber sie eignet sich besser zur Rekonstruktion bestimmter Begriffssysteme.111 In einer Tradition, die mit Aristoteles beginnt und bis in die Gegenwart reicht,112 wird die Unterscheidung zwischen »abstrakt« und »konkret« ontologisch bzw. erkenntnistheoretisch aufgefasst. So versteht auch Gideon Rosen die Diskussion um abstrakte Gegenstände, die in der modernen Abstraktionstheorie geführt wird, als ontologisch bzw. metaphysisch: »The abstract/concrete distinction is supposed to be a metaphysical distinction; abstract objects are supposed to differ from other objects in some important ontological respect.«113 Die Autoren des Artikels »Abstrakt/konkret«114 im Historischen Wörterbuch der Philosophie behandeln die beiden Begriffe ebenfalls im Rahmen ontologischer bzw. metaphysischer Fragen. Außer diesem Artikel gibt es im Historischen Wörterbuch der Philosophie keinen Eintrag zu den Begriffen »Konkretion« oder »Konkretisation«, wohl aber zu »Abstraktion«115. Darin zeigt sich, wie auch bei den englischsprachigen Werken, die einseitig auf Abstraktion bezogene Theoriebildung. In diesen beiden Artikeln des Historischen Wörterbuchs werden zwei Aspekte erläutert, welche für die hier verhandelte Thematik relevant sind: Zum einen hat die moderne Unterscheidung zwischen verschiedenen Stufen der Abstraktion mehrere mittelalterliche Vorläufer. So unterscheiden z. B. auch Avicenna und Albertus Magnus zwischen verschiedenen Arten bzw. Graden der Abstraktion.116 Zum anderen wird die bereits oben erwähnte Unterscheidung von Kant in Verbindung mit Baumgarten gebracht: Kant betont, dass alle Begriffe abstrakt sind, aber mehr oder weniger konkret verwendet werden können.
111 Vgl. Proust, Joëlle: »Abstraction et concrétisation«, in: Dascal, Marcelo u. a. (Hg.): Sprachphilo-
sophie, Berlin, New York, 1996, S. 1210, Hervorh. i. O. 112 Vgl. Acham, Karl: »Abstraktion« (Teil IV), in: Ritter, Joachim u. a. (Hg.): Historisches Wörterbuch
der Philosophie, Basel, Darmstadt, Band 1, 1971, S. 59. 113 Rosen, Gideon: »Abstract Objects«, in: Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philo-
sophy, Frühjahr 2012, Online-Ausgabe, Zugriff am 29.04.2013, [ohne Seitenangabe]. 114 Aubenque, Pierre; Oeing-Hanhoff, Ludger: »Abstrakt/konkret«, in: Ritter, Joachim u. a. (Hg.):
Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel, Darmstadt, 1971. 115 Aubenque, Pierre u. a.: »Abstraktion«, in: Ritter, Joachim u. a. (Hg.): Historisches Wörterbuch
der Philosophie, Basel, Darmstadt, 1971. 116 Vgl. Oeing-Hanhoff, Ludger: »Abstraktion« (Teil III), in: Ritter, Joachim u. a. (Hg.): Historisches
Wörterbuch der Philosophie, Basel, Darmstadt, 1971, S. 47–48.
3 Denken | 83
Dabei grenzt er sich deutlich von der langen Tradition ab, die zwischen abstrakten und konkreten Namen bzw. Begriffen unterscheidet. Im Historischen Wörterbuch ist dazu folgendes zu lesen: »A. G. Baumgarten gibt als Übersetzung von ›abstrakt‹ und ›konkret‹ ›abgesondert‹ und ›unabgesondert‹ an und nennt das ›in mehrerer Bestimmung betrachtete‹ ens universale ein ›concretum‹, ein ›abstractum‹ hingegen, sofern es nicht bestimmter und im einzelnen betrachtet wird [12]. Von hier aus ist dann Kants Lehre zu verstehen: ›Die Ausdrücke des Abstracten und Concreten beziehen sich also nicht sowohl auf die Begriffe an sich selbst, denn jeder Begriff ist ein abstracter Begriff, als vielmehr nur auf ihren Gebrauch. Und dieser Gebrauch kann hinwiederum verschiedene Grade haben; je nachdem man einen Begriff bald mehr, bald weniger abstract oder concret behandelt, d.h. bald mehr, bald weniger Bestimmungen entweder wegläßt oder hinzusetzt‹ [13].«117.
Dem Historischen Wörterbuch zufolge wurde diese kantische Differenzierung in einen konkreteren und abstrakteren Gebrauch von Begriffen von nachfolgenden Autoren nicht übernommen.118 Die moderne Abstraktionstheorie greift lediglich das relative Verständnis der beiden Begriffe »abstrakt« und »konkret« sowie ihren damit verbundenen graduellen Unterschied auf, wie in Kapitel 3.1.2 näher erläutert wird. Einen ähnlichen graduellen Unterschied zwischen »abstrakt« und »konkret« hat Hegel formuliert. Dieser betrifft allerdings nicht den Gebrauch von Begriffen, sondern das Denken selbst. So unterscheidet er zwischen abstraktem und konkretem Denken, wie Barbara Ränsch-Trill feststellt: »Der Philosoph denkt konkret, die Mehrzahl der Menschen denkt abstrakt. So knapp lässt sich eine wesentliche Einsicht Hegels formulieren. Diese Einsicht zieht sich wie ein Leitmotiv durch sein Werk: in immer neuen Zusammenhängen stellt Hegel die Frage nach der Möglichkeit des konkreten Denkens.«119
117 Aubenque, Pierre; Oeing-Hanhoff, Ludger: »Abstrakt/konkret«, in: Ritter, Joachim u. a. (Hg.):
Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel, Darmstadt, 1971, S. 39, Hervorh. i. O. Quellennachweise für die Zitate: [12]: Baumgarten, Alexander Gottlieb: Metaphysica – Metaphysik, Stuttgart, 2011, S. 108. Hervorh. i. O. [13]: Jäsche, Gottlob Benjamin (Hg.): »Immanuel Kants Logik«, in: Akademie-Ausgabe, Band 9, S. 99. 118 Vgl. Aubenque, Pierre; Oeing-Hanhoff, Ludger: »Abstrakt/konkret«, in: Ritter, Joachim u. a. (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel, Darmstadt, 1971, S. 39 ff. 119 Ränsch-Trill, Barbara: »Vom abstrakten Denken des gemeinen Verstandes«, in: Zeitschrift für
philosophische Forschung, 1980, S. 96.
84 | Bildnerisches Denken
Ganz ähnlich zu Kants gradueller Unterscheidung kennzeichnet auch Hegel das abstrakte Denken dadurch, dass es eine Sache nur unter Berücksichtigung weniger Merkmale betrachtet: »Dies heißt abstrakt gedacht, in dem Mörder nichts als dies Abstrakte, daß er ein Mörder ist, zu sehen, und durch diese einfache Qualität alles übrige menschliche Wesen an ihm zu vertilgen.«120 Hegel bewertet diese Abstraktion negativ. Daher fordert er, laut Ränsch-Trill, vom Philosophen das konkrete Denken, das solchen unrechtmäßigen Reduktionen entgegentritt: »Allerdings vermag die philosophische Vernunft den Verführungen des Denkens durch die Abstraktionen des gemeinen Verstandes Widerstand zu bieten. Philosophische Vernunft möge hier im Sinne Hegels als das Vermögen betrachtet werden, die Einseitigkeit der Bestimmungen, welche in der Begegnung mit dem ›Konkreten‹ durch Abstraktionsleistungen des Denkens allemal zustande kommen, aufzuheben oder mindestens zu relativieren.«121
Dass dieser Unterschied zwischen abstraktem und konkretem Denken graduell ist, wird an der komparativen Verwendung der Begriffe bei Hegel deutlich: »Der gemeine Mensch denkt wieder abstrakter, er tut vornehm gegen den Bedienten und verhält sich zu diesem nur als zu einem Bedienten;«122 Bei August Seiffert und Maurice Blondel spielt das Begriffspaar »abstrakt« und »konkret« eine ganz entscheidende Rolle. Beide Autoren stehen dem Existentialismus und der Lebensphilosophie nahe. August Seiffert, der sich selbst dem Existenzialismus verpflichtet sieht,123 verfolgt mit seinem Werk Concretum das Ziel einer »Untersuchung des Wesens der Konkretität«124. Seine Untersuchung gliedert er in zwei Teile. Der erste Teil liefert eine deskriptive Analyse unterschiedlicher Bedeutungen des Begriffs »konkret« in verschiedenen theoretischen Zusammenhängen. Der zweite Teil unternimmt den Versuch einer normativen Berichtigung dieser Verwendungswei-
120 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: »Wer denkt abstrakt?«, in: ders.: Werke, Band 17, Berlin, 1835, S. 403. 121 Ränsch-Trill, Barbara: »Vom abstrakten Denken des gemeinen Verstandes«, in: Zeitschrift für
philosophische Forschung, 1980, S. 105. 122 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: »Wer denkt abstrakt?«, in: ders.: Werke, Band 17, Berlin, 1835, S. 405. 123 Vgl. Seiffert, August: Concretum. Gegebenheit – Rechtmäßigkeit – Berichtigung, Meisenheim am Glan, 1961, S. 137. 124 Ebenda, S. 1.
3 Denken | 85
sen.125 Dabei identifiziert Seiffert um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert das Phänomen des »Konkretismus«. Darunter versteht er eine philosophische Hinwendung zum Konkreten. Besonders die Theorien von Ernst Mach deutet Seiffert als Ausdruck dieses Konkretismus. Ihm zufolge beginnt das Ringen mit der Konkretitätsidee im Empiriokritizismus, genauer mit dem Erscheinen von Ernst Machs Analyse der Empfindungen126, und wird fortgesetzt u. a. im modernen Existenzialismus.127 Allerdings ist der Kern seiner deskriptiven wie normativen Begriffsanalyse schwer verständlich, wie exemplarisch an folgendem Zitat ersichtlich wird. Darin liefert Seiffert »Erklärungen über die Begriffsunterschiede zwischen der Sphäre des Konkreten und des Abstrakten«128: »Das Gegebene kann auftreten 1. als Abstrahiertes, d. h. zunächst fiktiv durch kunstlogische Verallgemeinerung probeweise gewonnen; 2. als Abstraktum, d. h. als ontisch Gesichertes, durch die Festigkeit seines Habitus gewissermaßen überraschend und evident;« 3. als Konkretisiertes, d. h. alle Spuren des Operativen und Fiktiven, aber eben deswegen nur Vorläufigen an sich tragend, u. U. auch passiv getönt: Tagestraum, Halluzination; 4. als Konkretes, d. h. als relativ stabil-Beharrendes [sic], ›Reales‹; sein Sein ist gemessen am Sein der Abstrakta ungleich ungesicherter und labiler; man könnte von einem Sein zweiten Ranges sprechen.«129
Wie in diesem Zitat bereits anklingt, setzt sich Seiffert »für die ontologisch begründete und gegen die rein begriffsformalistisch gegründete Auffassung«130 des Konkreten ein. Ziel seiner Untersuchung ist eine ontologische bzw. metaphysische Bestimmung des Konkreten. Das ist für ihn auch der Grund dafür, eine relative Bestimmung der Begriffe »abstrakt« und »konkret«, wie sie Kant vornimmt, abzulehnen:
125 Vgl. ebenda, S. 3. 126 Vgl. ebenda, S. 46. 127 Ebenda, S. 26, Fußnote 35, Hervorh. i. O. 128 Ebenda, S. 132. 129 Ebenda, S. 131–132. 130 Vgl. ebenda, S. 331.
86 | Bildnerisches Denken
»Den Sinn von ›konkret‹ und ›abstrakt‹ letztlich auf standpunktliche Relativität hinauslaufen zu lassen, solche – wie wir schon hervorhoben – überaus merkwürdige ›Aspectitis‹ bedeutet unstreitig das Ende aller besonnenen Ontologie und Metaphysik;«131 »Eine Ernst machende Relativierung macht Unternehmungen von der Art der unsrigen bedeutungslos. Sie uniformiert natürlich alles zum sich gegenseitig relativierenden Spiel! […] Sie vernichtet die eigenen Denkprinzipien oder ignoriert deren Ansprüche.« 132
Maurice Blondel wird mit einem seiner Hauptwerke Das Denken (französisch: La Pensée) ebenfalls dem Existentialismus und der Lebensphilosophie zugeordnet.133 In dieser Schrift unterscheidet er zwischen zwei Arten des Denkens – dem »noetischen« Denken, das er später »abstrakt« nennt, und dem »pneumatischen« Denken, das er später als »konkret« bezeichnet.134 Ähnlich wie bei Seiffert ist auch den Schriften Blondels das Unterscheidungskriterium zwischen den beiden Denkarten nur vage zu entnehmen. Folgendermaßen kennzeichnet er den Unterschied: »1. Das abstrakte Denken neigt dazu, verdinglichte Aspekte in Zeichen zu isolieren; es liefert eine vereinfachende und darstellende Dublette des Konkreten, einen vom Wirklichen formell unterschiedenen Ersatz. Je präziser diese Herausarbeitung ist, desto mehr entfernen wir uns von einzeln Daseienden, um Schemata zu bilden, die an die Stelle der Dinge treten, die gleichwohl unserem Zugriff die Kräfte der Natur erschließen. 1’. Das konkrete Denken neigt dazu, sich die Wirklichkeit zu vergegenwärtigen, sie zu assimilieren und sie mit seiner Ursprünglichkeit zu zeichnen. Es geht somit aus dem wechselseitigen Wirken des Universalen und des Einzelnen hervor, ohne aufzuhören in all seinen Phasen sub specie totius et unius zu stehen. Es betrachtet so das Komplexe, insofern es verbunden und unzerlegbar ist, als etwas Einfaches, dessen relative Einheit etwas anderes darstellt als eine Ordnungsnummer – das Einfache und Eine nämlich, die um so reicher an inneren Bestimmungen sind als sie eine organische Zusammenfassung von Universalität und Singularität bieten.«135
Beide Denkarten sind dabei nicht gleichrangig. Robert Scherer, der Übersetzer von La Pensée, macht deutlich, dass Blondel dem konkreten Denken die
131 Vgl. ebenda, S. 105. 132 Vgl. ebenda, S. 106. 133 Vgl. Bormann, Claus von u. a.: »Denken«, in: Ritter, Joachim u. a. (Hg.): Historisches Wörterbuch
der Philosophie, Basel, Darmstadt, 1972, S. 96. 134 Vgl. ebenda. 135 Blondel, Maurice: Das Denken, Band 2, Freiburg, München, 1956, S. 37, Hervorh. i. O.
3 Denken | 87
größere Bedeutung zuerkennt: »Diese Zweigesichtigkeit im einen Denken allein garantiert, […] daß die Abstraktion nicht um ihrer selbst willen vollzogen wird, sondern im Dienste der […] Konkretion.«136 Ähnlich wie bei Seiffert besteht das Anliegen Blondels in einer ontologischen bzw. metaphysischen Fundierung des Abstrakten und Konkreten und damit auch der entsprechenden Denkarten: »Unsere ganze Untersuchung des Denkens mündet somit darin aus, die Probleme des Seienden und des Tuns in ihrer Beziehung zu dem des denkenden und gedachten Geistes schärfer zu stellen, nicht mehr insofern wir das Denken als Mittelpunkt der Betrachtung für eine Ontologie und eine Deontologie nehmen, sondern umgekehrt, indem wir im Seienden und im Tun das Spezifische, Ursprüngliche, Erleuchtende und den zufallenden Anteil für eine vollständigere und normativere Wissenschaft des Denkens suchen.« 137
Es wurde gezeigt, wie die Begriffe »abstrakt«/»Abstraktion« und »konkret«/»Konkretion« in verschiedenen Traditionen zueinander in Beziehung gesetzt werden und zur Kennzeichnung verwandter oder gegenläufiger Prozesse dienen. Dabei ist auffällig, dass dem Prozess der Konkretion im Rahmen der meisten ausgearbeiteten Theorien weit weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird als der Abstraktion. Dieses Ungleichgewicht soll im Folgenden behoben werden. Inwiefern sich das Verständnis von Konkretion, das in dieser Arbeit entwickelt wird, mit der Auffassung anderer Autoren deckt, wird in Kapitel 3.1.3.2 diskutiert. In Kapitel 3.2.2 wird die Frage behandelt, ob und in welchem Maße die hier getroffene Unterscheidung zwischen einem absoluten und einem relativen Verständnis von »abstrakt« und »konkret« mit entsprechenden Theorien anderer Autoren übereinstimmt. 3.1.2.2 Voraussetzungen für Abstraktion Dieses Kapitel weist nach, dass alle Versionen von Abstraktion auf einer Operation basieren, die der eigentlichen Abstraktion vorausgehen muss: die grundlegende Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem. Sie ist daher eine Voraussetzung von Abstraktion – sowohl im klassischen wie auch im modernen Sinne.
136 Scherer, Robert: »Einführung«, in: Blondel, Maurice: Das Denken, Band 2, Freiburg, München, 1956, S. XXII. 137 Blondel, Maurice: Das Denken, Band 2, Freiburg, München, 1956, S. 322.
88 | Bildnerisches Denken
Diese Grundoperation enthält dabei zwei voneinander abhängige Aspekte: den Vergleich und die Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem. Eine Unterscheidung kann man nur treffen, wenn es mindestens zwei Dinge gibt, die man voneinander unterscheiden kann. Um einen Unterschied zwischen beiden Dingen feststellen zu können, muss man sie zuvor miteinander verglichen haben. Das Vergleichen kann daher als Voraussetzung für die Unterscheidung angesehen werden. Umgekehrt ist allerdings auch der Unterschied eine Voraussetzung für den Vergleich. Wenn man nicht mindestens zwischen zwei Dingen irgendeine Art von Unterschied feststellen kann, gibt es nichts, was man miteinander vergleichen kann, weil dann alles ein unterschiedsloses Ganzes ist. Zudem muss für einen sinnvollen Vergleich bereits eine passende Auswahl an sinnvoll vergleichbaren Einheiten vorhanden sein. Passend ist die Auswahl, wenn die zu vergleichenden Einheiten nicht identisch aber auch nicht zu verschieden sind. So wird es beispielsweise schwer sein, aus dem Vergleich eines PollockGemäldes mit dem Rezept für einen Gugelhupf durch das Verfahren der Abstraktion einen Begriff zu bilden. Hingegen wäre ein Gemälde von Bob Ross als Vergleichsgegenstand für das Pollock-Gemälde sehr vielversprechend. Ob eine Auswahl passend ist, kann allerdings nur durch einen Vergleich entschieden werden. Vergleich und Unterscheidung bedingen sich daher wechselseitig und bilden zusammen nicht zwei Voraussetzungen, sondern nur eine. Diese wird als grundlegende Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem bezeichnet. Das, was als gleichartig oder verschiedenartig betrachtet wird, variiert je nach Abstraktionsverständnis. In der klassischen Abstraktionstheorie handelt es sich hierbei um gemeinsame Merkmale von Dingen in der Welt, die entweder direkt wahrgenommen und/oder erinnert werden. Die Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem wird also in der Welt getroffen. Die strenge Version der modernen Abstraktionstheorie setzt hingegen eine Gleichartigkeit im Sinne der Bedeutungsgleichheit von Prädikaten voraus. Sie wird in einer entsprechenden Äquivalenzrelation formuliert. Die Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem betrifft dann sprachliche Einheiten, genauer Prädikate. Indirekt spielt aber auch hier die Einteilung der Welt in Gleichartiges und Verschiedenartiges eine Rolle. Denn auch die modern verstandene Abstraktion ist nicht möglich ohne diese Grundoperation, die in den elementaren Prädikationen zum Ausdruck kommt. Die Bedeutungsgleichheit von Prädikaten kann nur dann
3 Denken | 89
festgestellt werden, wenn verschiedene Prädikate bereits eingeführt sind. Und dies geschieht durch exemplarische Prädikationen,138 unter denen auch elementare Prädikationen sind. Sowohl in der klassischen als auch in der modernen Abstraktionstheorie ist daher die genannte Grundoperation direkte oder indirekte Voraussetzung. Eine solche Grundoperation wird von vielen Autoren beschrieben. Die Frage, nach welchen Kriterien die grundlegende Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem geschieht, wird dabei unterschiedlich beantwortet. Einige Autoren sehen hierin eine Operation des Menschen, die von bestimmten Zwecken abhängt. Andere sind der Ansicht, dass diese Unterscheidungsleistung so grundlegend ist, dass sie erkenntnistheoretisch nicht weiter hinterfragt und aufgeklärt werden kann. Nicht alle Autoren behandeln die beiden Aspekte der Grundoperation gleich ausführlich. In manchen Theorien wird der Aspekt des Vergleichs stärker betont, in anderen der Aspekt der Unterscheidung. Im Folgenden wird erläutert, wie die bereits vorgestellten klassischen und modernen Abstraktionstheorien die genannte Operation als Voraussetzung reflektieren. Anhand von Tabelle 4 wird die Reihenfolge dieser Erläuterung dargelegt. Bei der Analyse der Voraussetzung für den Prozess der Abstraktion muss nicht zwischen Begriffsbildung und -gebrauch unterschieden werden, und zwar weder bei der klassischen noch bei der modernen Abstraktionstheorie. In der klassischen Theorie ist die Bildung von Begriffen selbst Voraussetzung des Gebrauchs. Daher genügt es, nur die Voraussetzung der Bildung von Begriffen zu untersuchen. Da hier nicht zwischen verschiedenen Begriffsebenen unterschieden wird, muss nur die Voraussetzung für die elementare Prädikation (= Übergang [1]) untersucht werden. In der modernen Abstraktionstheorie werden die Prozesse von Begriffsbildung und -gebrauch nicht mehr unabhängig voneinander untersucht. Entsprechendes gilt daher auch für ihre Voraussetzungen. Stattdessen wird zwischen verschiedenen Begriffsebenen unterschieden. Die erste Begriffsebene ist hellgrau markiert, die zweite mit einem mittleren Grau. Die Abstraktion, die zu den Begriffen der 2. Stufe führt (Übergang [3]), muss unterschieden werden von der Abstraktion, die auf der 1. Ebene zu den Oberbegriffen bzw. Schemata führt (Übergang [2]). Von beiden muss weiterhin die elementare Prädikation unterschieden werden, die nicht als Abstraktion verstanden wird (Übergang [1]).
138 Vgl. Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich, 1990, S. 29.
90 | Bildnerisches Denken
Auf der 2. Begriffsebene ermöglichen die durch Abstraktion gewonnenen Metabegriffe (wie z. B. »Zahl«) die Prädikationen (wie z. B. »Die Zahl 1 ist ungerade«). Das heißt, dass auf der 2. Begriffsebene die Abstraktion eine Voraussetzung für Prädikation ist. Daher müssen die Voraussetzungen dieser Prädikation nicht gesondert betrachtet werden. Auf der 1. Begriffsebene sind dagegen umgekehrt die elementaren Prädikationen Voraussetzung jeder Abstraktion. Daher werden solche Prädikationen gesondert berücksichtigt. Sie stellen indirekte Voraussetzungen der Abstraktion im modernen Sinne dar. Da manche Autoren auch die Verallgemeinerung als Abstraktion ansehen, muss auch deren Voraussetzung untersucht werden. KLASSISCHE ABSTRAKTIONSTHEORIE Übergang [1] Wahrnehmung Sprache
= Abstraktion MODERNE ABSTRAKTIONSTHEORIE Übergang [1]
Übergang [2]
Übergang [3]
Prädikationen
Wahrnehmung Sprache
Einzelnes Schema
Sprache Meta-
mit
Unterbegriff Oberbegriff = Elementare Prädikation
sprache
Abstraktoren
= Verallgemeinerung
= Abstraktion ???
= Abstraktion
Tabelle 4: Voraussetzungen von Abstraktion in verschiedenen Theorien Damit ergibt sich folgende Reihenfolge: Zunächst wird die klassische Abstraktionstheorie untersucht. Es wird gezeigt, wie die Grundoperation der Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem als Voraussetzung für Begriffsbildung (= Übergang [1]) reflektiert wird (3.1.2.3). Bei der Untersuchung der modernen Abstraktionstheorie wird zwischen den drei Übergängen unterschieden. Es wird erläutert, wie die verschiedenen Autoren die Grundoperation als Voraussetzung der Übergänge [3], [2] und [1] thematisieren (3.1.2.4). Außerdem wird gezeigt, dass in allen Varianten die Abstraktion als Konzentration auf das Gleichartige beschrieben wird. 3.1.2.3 Voraussetzungen in der klassischen Abstraktionstheorie Die klassische Abstraktionstheorie beschreibt den Prozess der Begriffsbildung auf jeder Begriffsstufe als Abstraktion. Schneider zufolge besagt diese
3 Denken | 91
Theorie, »daß das […] Allgemeine […] durch Absehen (lat. abstrahere, fortziehen, abziehen) von den jeweils unwesentlichen Merkmalen bei gleichzeitigem Herausheben und gesondertem Betrachten der wesentlichen Merkmale […] erkannt werde.«139 Abstraktion ist daher auch notwendig bei der Herausbildung elementarer Prädikate. Ganz ähnlich beschreibt Gideon Rosen das klassische – aber seiner Ansicht nach veraltete – Verständnis von Abstraktion: »According to a longstanding tradition in philosophical psychology, abstraction is a distinctive mental process in which new ideas or conceptions are formed by considering several objects or ideas and omitting the features that distinguish them. One is given a range of white things of varying shapes and sizes; one ignores or ›abstracts from‹ the respects in which they differ, and thereby attains the abstract idea of whiteness. […] So conceived, the Way of Abstraction is wedded to an outmoded philosophy of mind.«140
Im Folgenden wird erörtert, inwiefern die Autoren der klassischen Abstraktionstheorie das grundlegende Unterscheiden zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem als Voraussetzung für diese Art von Abstraktion anerkennen. Immanuel Kant Es wurde schon erläutert, dass nach Kant die Abstraktion eine Voraussetzung dafür ist, Begriffe zu bilden. Er beschreibt sie als ein Absehen vom Unterschied: »Der Ursprung der Begriffe der bloßen Form nach ist logisch und beruht auf der abstraction von dem Unterschiede der Dinge, die durch eine gewisse Vorstellung bezeichnet sind«.141 Die Abstraktion nach dieser Beschreibung setzt zwei Schritte voraus. Erstens muss vorher eine Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem erfolgt sein, denn nur dann kann »von dem Unterschiede der Dinge« abgesehen werden. Zweitens ist damit implizit gesagt, dass die Abstraktion die Aufmerksamkeit auf das Gleichartige legt. Diese Fokussierung des Gleichartigen geschieht nach Kant nicht automatisch, sondern dadurch, dass die Aufmerksamkeit
139 Schneider, Hans J.: »Abstraktion«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und
Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005, S. 22. 140 Rosen, Gideon: »Abstract Objects«, in: Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philo-
sophy, Frühjahr 2012, Online-Ausgabe, Zugriff am 29.04.2013, [ohne Seitenangabe]. 141 Kant, Immanuel: Reflexion 2859, in: Akademie-Ausgabe, Band 16, S. 549.
92 | Bildnerisches Denken
entsprechend gerichtet wird. Daher bezeichnet er die Abstraktion auch als ein »Hülfsmittel der Aufmerksamkeit«142. Kant beschreibt den Schritt des Unterscheidens zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem also nicht explizit. Dass dieser dennoch eine Voraussetzung für Abstraktion darstellt, wird nur implizit klar. Deutlich thematisiert Kant den Aspekt des Vergleichens im Zusammenhang mit der Abstraktion. Der Vergleich stellt eine der drei Verstandeshandlungen dar, durch die Begriffe hervorgebracht werden. Die bisherige Erläuterung der kantischen Theorie ist daher etwas ungenau. Nach Kant werden Begriffe nicht allein durch Abstraktion gebildet. Er unterscheidet innerhalb des Prozesses der Begriffsbildung zwischen der Materie der Begriffe und ihrer logischen Form. Nur bei letzterer ist die Abstraktion beteiligt. In diesem Punkt widerspricht er der Meierschen Logik-Schrift, in der es heißt: »§. 259. Wir machen einen Begriff durch die logische Absonderung (conceptus per abstractionem logicam formatus), wenn wir übereinstimmende Begriffe von verschiedenen Dingen gegeneinander halten, und die Merkmale, die sie mit einander gemein haben, allein uns deutlich vorstellen.«143 Kant kommentiert diesen Absatz mit folgender Anmerkung: »Durch abstraction werden keine Begriffe, sondern durch reflexion […]. Die comparation und abstraction bringt keine Begriffe hervor, sondern nur die logische form derselben.«144 Aufgabe der Logik kann es aber nach Kant nur sein, zu klären, wie Begriffe ihrer logischen Form nach entstehen: »Die logische Frage ist nicht: wie wir zu Begriffen gelangen, sondern: welche Handlungen des Verstandes einen Begrif [sic] ausmachen, er mag nun etwas enthalten, als von der Erfahrung hergenommen ist, oder auch etwas erdichtetes oder von der Natur des Verstandes entlehntes.«145 Seine Antwort auf diese Frage besteht in der Auflistung der drei Verstandeshandlungen: »Logischer Ursprung der Begriffe: 1. durch comparation: […] wie sie sich zu einander in einem Bewußtseyn verhalten. […] 2. durch reflexion [wie sie sich gegen einander in einem Bewußtseyn
142 Kant, Immanuel: Reflexion 2888, in: Akademie-Ausgabe, Band 16, S. 562. 143 Meier, Georg Friedrich: Auszug aus der Vernunftlehre, in: Akademie-Ausgabe, Band 16, S. 549– 550, Hervorh. i. O. 144 Kant, Immanuel: Reflexion 2865, in: Akademie-Ausgabe, Band 16, S. 552. 145 Kant, Immanuel: Reflexion 2856, in: Akademie-Ausgabe, Band 16, S. 548.
3 Denken | 93
verhalten als identisch oder nicht]: […] wie verschiedene in einem Bewußtseyn begriffen seyn können. […] 3. durch abstraction: […] da man das weglaßt, worin sie sich unterscheiden.«146
Bei diesem Zitat handelt es sich um eine kurze Notiz aus dem handschriftlichen Nachlass von Kant. Weitere Erläuterungen zu den für die Begriffsbildung notwendigen Verstandeshandlungen fehlen. Hinzu kommt, dass Kant keine eigene Schrift zur formalen Logik veröffentlicht hat, auf die man zurückgreifen könnte. Daher ist eine Deutung dessen, was er unter den Handlungen des Vergleichs, der Reflexion und der Abstraktion genau versteht, schwierig und umstritten – wie auch Mittelstraß feststellt.147 Es sei aber auf die umfassende Diskussion und Deutung dieser und anderer Textstellen verwiesen, die Bernd Prien zu diesem Thema geliefert hat.148 Er kommt in seiner Interpretation zu dem Ergebnis, dass für Kant die Reflexion der zentrale Akt der Begriffsbildung ist. Die anderen beiden Verstandestätigkeiten sind in ihm bereits enthalten: »Der zentrale logische Akt, der eine gegebene Vorstellung allgemein macht, ist die Reflexion, d. h. das Verwenden einer Vorstellung als Erkenntnisgrund. Von der Reflexion kann man sagen, dass sie die Komparation und die Abstraktion schon in sich enthält, denn wenn man eine Vorstellung als Erkenntnisgrund verwendet, sieht man sie dadurch als verschiedenen Dingen gemeinsam an (Komparation), sieht aber gleichzeitig auch von den Unterschieden zwischen diesen Dingen ab (Abstraktion).«149
Folgt man der Interpretation Priens wird deutlich, dass die Abstraktion nicht ohne die Komparation möglich ist, auch wenn der Vergleich nicht als Voraussetzung der Abstraktion bezeichnet wird. Von beiden Aspekten der Grundoperation diskutiert Kant also das Vergleichen explizit, das Unterscheiden hingegen nur implizit. Der Vergleich ist wie die Abstraktion direkt bei der Begriffsbildung beteiligt, allerdings bleibt etwas unklar, in welchem Verhältnis Vergleich und Abstraktion dabei zueinander stehen. Sehr deutlich weist Kant darauf hin, dass die Abstraktion in einer bestimmten Fokussie-
146 Kant, Immanuel: Reflexion 2876, in: Akademie-Ausgabe, Band 16, S. 555. Der Halbsatz in eckigen Klammern ist keine Einfügung der Autorin, sondern im Original ein von Kant durchgestrichener Textteil. 147 Vgl. Mittelstraß, Jürgen: »Begriff«, in: ders. (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschafts-
theorie, Stuttgart, Weimar, 2005, S. 384 148 Vgl. Prien, Bernd: Kants Logik der Begriffe, Berlin, 2006, besonders S. 56–72. 149 Ebenda, S. 69.
94 | Bildnerisches Denken
rung der Aufmerksamkeit besteht und dass diese ein aktives Tun erfordert. »Eine jede Abstraktion ist nichts anderes als eine Aufhebung gewisser klarer Vorstellungen, welche man gemeiniglich darum anstellt, damit dasjenige, was übrig ist, desto klarer vorgestellt werde. Jedermann weiß aber, wieviel Tätigkeit hierzu erfordert wird, und so kann man die Abstraktion eine negative Aufmerksamkeit nennen, das ist, ein wahrhaftes Tun und Handeln«150. Die aktive Konzentration der Abstraktion auf das Gleichartige ist damit von Kant sehr deutlich formuliert. John Stuart Mill Abstraktion ist eine grundlegende Operation für wissenschaftliche Forschung, wie John Stuart Mill in seiner Schrift A System of Logic 151 betont. Sein Konzept von Abstraktion ist dabei so breit, dass es auch die Klassifizierung der Gegenstände in der Welt nach ihrer Gleichartigkeit miteinschließt. Damit gehört er, wie erläutert, zu den Vertretern der klassischen Abstraktionstheorie: »If we find a second object which presents a remarkable agreement with the first, inducing us to class them together, the question instantly arises, in what particular circumstances do they agree? and [sic] to take notice of these circumstances is already a first stage of abstraction, giving rise to a general conception.«152
Mill greift auf die Analyse der Abstraktion von Sir William Hamilton zurück: Dieser beschreibt die Abstraktion als grundlegende Operation für alles Denken. Sie besteht darin, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf ein einzelnes Objekt konzentrieren oder auf ein einzelnes Merkmal eines Objektes, und sie von allem anderen abziehen.153 Mill betont außerdem, dass der Vergleich eine große Rolle bei Begriffsbildung und -gebrauch spielt:
150 Kant, Immanuel: »Versuch den Begriff der negativen Grössen in die Weltweisheit einzuführen«, in: Akademie-Ausgabe, Band 2, S. 190, Hervorh. i. O. 151 Mill, John Stuart: »A System of Logic«, in: Robson, John M. (Hg.): Collected Works of John Stuart
Mill, Band 8, Toronto, London, 1981. 152 Ebenda, S. 654. 153 Vgl. Mill, John Stuart: »An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy«, in: Robson, John M. (Hg.): Collected Works of John Stuart Mill, Band 9, Toronto, London, 1979, S. 302.
3 Denken | 95
»What really takes place, is, I conceive, more philosophically expressed by the common word Comparison, than by the phrases ›to connect‹ or ›to superinduce.‹ For, as the general conception is itself obtained by a comparison of particular phenomena, so, when obtained, the mode in which we apply it to other phenomena is again by comparison.«154
Die in solchen Vergleichen getroffene Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem hat Hamilton so klar formuliert, dass Mill ihn wörtlich zitiert: »[W]hen, comparing a number of objects, we seize on their resemblances; when we concentrate our attention on these points of similarity, thus abstracting the mind from a consideration of their differences«.155 Zudem wird die Abstraktion hier deutlich als Konzentration auf das Gleichartige beschrieben. Diese passiert Mill zufolge keinesfalls automatisch, sondern wird durch den Einsatz der Willenskraft geleistet.156 Mill sieht also sehr klar, welche Grundoperation die Abstraktion voraussetzt. Er erläutert dabei die zentrale Rolle beider Aspekte – des Vergleichens und des Unterscheidens. Sein Hinweis darauf, dass es eine Sache der Willenskraft ist, worauf wir bei dieser Unterscheidung den Fokus legen, stützt die Argumentation für die Konkretion. Wenn die Konzentration auf das Gleichartige durch die Willenskraft zustande kommt, dann muss es auch möglich sein, die Konzentration auf das Verschiedenartige zu legen, wie dies in der Konkretion geschieht. Ernst Mach Ähnlich wie Mill sieht Mach in der Abstraktion eine grundlegende Operation für jede wissenschaftliche Forschung.157 Die große Bedeutung, die Mach dem Vergleichen in den Wissenschaften zuerkennt, wird nicht nur daran deutlich, dass er einen Aufsatz mit dem Titel »Über das Princip der Verglei-
154 Mill, John Stuart: »A System of Logic«, in: Robson, John M. (Hg.): Collected Works of John Stuart
Mill, Band 8, Toronto, London 1981, S. 654. 155 Hamilton, Sir William: »Lecture 34«, in: ders.: Lectures on Methaphysics and Logic in four
Volumes, Band 2, Edinburgh, London, 1870, S. 288, zitiert in: Mill, John Stuart: »An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy«, in: Robson, John M. (Hg.): Collected Works of John Stuart Mill, Band 9, Toronto, London, 1979, S. 303. 156 Vgl. Mill, John Stuart: »A System of Logic«, in: Robson, John M. (Hg.): Collected Works of John Stuart Mill, Band 8, Toronto, London 1981, S. 650. 157 Vgl. Mach, Ernst: »Der Begriff«, in: Erkenntnis und Irrtum, Leipzig, 1906, S. 137.
96 | Bildnerisches Denken
chung in der Physik«158 geschrieben hat. Mit Bezugnahme auf Mill thematisiert auch Mach die zentrale Rolle des Vergleichs bei der Operation der Abstraktion: »Wenn wir die Baconschen Tafeln der für oder gegen eine Annahme sprechenden ›Instanzen‹, oder die Millschen Schemata der Übereinstimmung und Differenz betrachten, so sehen wir, daß die
Vergleichung uns auf einen bisher unbeachteten Zusammenhang aufmerksam machen kann, auch wenn derselbe nicht auffallend genug ist, um sofort den Blick auf sich zu ziehen. Ist die Aufmerksamkeit auf die voneinander abhängigen Merkmale konzentriert, von den minder wichtigen abgelenkt, so nennen wir dies Abstraktion.«159
Auch den Bezug von Vergleich und Abstraktion zur Begriffsbildung erläutert Mach: »Durch die häufige Anwendung solcher Vergleichungen unter mannigfaltigen Umständen haben sich aber den übereinstimmenden Merkmalen gegenüber die wechselnden so verwischt, dass erstere eine selbständige von jedem Objekt, jeder Verbindung unabhängige, wie man sagt, abstrakte oder begriff-
liche Bedeutung gewonnen haben.«160
Wie Kant und Mill sieht auch Mach in der Abstraktion eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das Gleichartige: »Ist die Aufmerksamkeit auf die voneinander abhängigen Merkmale konzentriert, von den minder wichtigen abgelenkt, so nennen wir dies Abstraktion.«161 Aber im Unterschied zu Kant betont er, dass die Abstraktion nicht nur ein Absehen von etwas ist, sondern dadurch auch automatisch ein Hinsehen zu etwas anderem. Damit kritisiert er die kantische rein negative Bestimmung der Abstraktion:
158 Mach, Ernst: »Über das Princip der Vergleichung in der Physik«, in: Populär-wissenschaftliche
Vorlesungen, Leipzig, 1903. Und Ernst Mach: »Die Vergleichung als wissenschaftliches Princip«, in: Prinzipien der Wärmelehre, Leipzig, 1900, beide Texte stimmen nur zum Teil überein. 159 Mach, Ernst: »Deduktion und Induktion in psychologischer Hinsicht«, in: Erkenntnis und Irrtum, Leipzig, 1906, S. 313, Hervorh. i. O. 160 Ernst Mach: »Die Vergleichung als wissenschaftliches Princip«, in: Prinzipien der Wärmelehre, Leipzig, 1900, S. 397–398, Hervorh. i. O. 161 Mach, Ernst: »Deduktion und Induktion in psychologischer Hinsicht«, in: Erkenntnis und Irrtum, Leipzig, 1906, S. 313, Hervorh. i. O.
3 Denken | 97
»Nach dem Dargelegten ist das Wesen der Abstraktion nicht erschöpft, wenn man sie (mit Kant) als
negative Aufmerksamkeit bezeichnet. Zwar wendet sich beim Abstrahieren von vielen sinnlichen Elementen die Aufmerksamkeit ab, dafür aber andern neuen sinnlichen Elementen zu, und das letztere ist gerade wesentlich. Jede Abstraktion gründet sich auf das Hervortreten bestimmter sinnlicher Elemente.«162
Mach beschreibt also deutlich, wie die Abstraktion an die Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem anschließt. Noch stärker als Mill reflektiert Mach die Frage, nach welchem Kriterium diese Unterscheidung zustande kommt. Während Mill bei dieser Frage nur betont, dass es Sache der Willenskraft ist, worauf die Aufmerksamkeit gelegt wird, fragt Mach direkt nach der Berechtigung dieser Unterscheidung: »Wer garantiert uns, daß wir bei unseren Abstraktionen die richtigen Umstände beachten, und gerade die gleichgültigen unbeachtet lassen? Der geniale Intellekt unterscheidet sich von dem normalen eben durch die rasche und sichere Voraussicht des Erfolges einer intellektuellen Maßregel. In diesem Zuge gleichen sich große Forscher, Künstler, Erfinder, Organisatoren u. s. w.«163
Es ist fraglich, ob der Verweis auf das Genie hier als Antwort befriedigen kann. Im Folgenden wird sich allerdings zeigen, dass auch die moderne Abstraktionstheorie auf die Frage des Unterscheidungskriteriums keine klare Antwort liefert. 3.1.2.4 Voraussetzungen in der modernen Abstraktionstheorie Wie erläutert unterscheidet die moderne Abstraktionstheorie zwischen drei Arten von Übergängen (siehe Tabelle 4, Seite 90): Übergang zu Metabegriffen, d. h. zur 2. Begriffsebene = Übergang [3] Übergang zu Oberbegriffen und Schemata innerhalb der 1. Begriffsebene = Übergang [2] Übergang von der Betrachtung der Welt zur Sprache, d. h. die elementare Prädikation = Übergang [1]
162 Mach, Ernst: »Einfluß der vorausgehenden Untersuchungen auf die Auffassung der Physik«, in:
Die Analyse der Empfindungen, Jena, 1922, S. 266, Hervorh. i. O. 163 Mach, Ernst: »Der Begriff«, in: Erkenntnis und Irrtum, Leipzig, 1906, S. 140–141, Hervorh. i. O.
98 | Bildnerisches Denken
Nicht alle drei dieser Operationen werden als Abstraktion angesehen, aber wenn nicht, dann gelten sie als Voraussetzung für Abstraktion. Übergang [3] wird unstrittig, Übergang [2] umstritten und Übergang [1] gar nicht als Abstraktion bezeichnet. Alle drei Übergänge setzen eine grundlegenden Unterscheidung von Gleichartigem und Verschiedenartigem voraus, wie im Folgenden erläutert wird. Übergang [3] zur 2. Begriffsebene Der Übergang zur Metasprache, der von allen Autoren als Abstraktion bezeichnet wird, beruht auf einer Bedeutungsgleichheit von Prädikaten. In der Logik wird diese Gleichheit als Äquivalenzrelation aufgefasst. Solche Äquivalenzrelationen kommen auch in anderen Bereichen vor, z. B. in der Mathematik, so dass auch dort Abstraktionsprozesse möglich sind. Die Operation der Abstraktion kann man nur leisten, wenn man die entsprechende Äquivalenzrelation versteht, wie Kamlah und Lorenzen erläutern: »Sowohl die intensionale wie auch die extensionale Gleichheit von Prädikatoren sind Relationen, genauer: Äquivalenzrelationen. Es gibt in der Mathematik weitere Äquivalenzen, daraufhin weitere Abstraktionen, und dem Verständnis des Terminus ›Abstraktion‹ kann es dienlich sein, wenn man an einer Mehrzahl von Beispielen sieht, welchen Handlungen des methodischen Denkens er zukommt.«164 Das Erkennen einer Äquivalenzrelation ist gleichbedeutend mit der grundlegenden Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem. Um die Äquivalenz von Prädikaten zu erkennen, müssen diese miteinander verglichen werden. Dabei muss einerseits erkannt werden, dass es sich um unterschiedliche Prädikate handelt, anderseits, dass sie dieselbe Bedeutung haben. Die Abstraktionsleistung besteht dann darin, dass in der Rede über diese Prädikate nur auf deren Gleichartigkeit Bezug genommen wird, d. h. auf ihre gemeinsame Bedeutung. Schneider hat darauf hingewiesen, dass das Erkennen einer solchen Äquivalenz kein rein theoretischer Vorgang ist, sondern sich auch in konkreten Reaktionshandlungen zeigen kann. Er erläutert dies am Beispiel von Kindern, die den Abstraktor ›Symbol‹ verstehen lernen: »Worin besteht demgegenüber die besondere Sehweise, die der Abstraktor ›Symbol‹ in einer Aussage wie ›dieses Symbol bedeutet ›Erste Hilfe‹‹ signalisiert? Was müssen die Kinder dazulernen, um sich diese Sehweise anzueignen? […] Sie müssen lernen, bestimmte Prägungen trotz ihrer Größen-, Farb-
164 Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich, 1990, S. 93.
3 Denken | 99
und sonstigen Unterschiede als im fraglichen Kontext gleichwertig zu behandeln und beliebige, nie gesehene konkrete Blechtafeln aufgrund der jeweiligen bekannten Prägung als Wegweiser zur Auffindung eines bestimmten Ortes zu benutzen. Was erworben wird, ist also die Kenntnis eines wiederholbaren Handlungszusammenhangs, in dem numerisch verschiedene konkrete Dinge jeweils dieselbe Rolle spielen.«165
Auch in dieser handlungsbezogenen Deutung der Abstraktion ist die grundlegende Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem als Voraussetzung für Abstraktion beschrieben. Die Kinder müssen die verschiedenen Schilder vergleichen und bestimmte Unterschiede als irrelevant ansehen. Damit richten sie ihre Aufmerksamkeit auf das als gleichartig Erkannte. In dem Beispiel geschieht dies nicht in einer Sprechhandlung, sondern einer Gleichbehandlung der verschiedenen Schilder. Übergang [2] innerhalb der 1. Begriffsebene Christian Stetter betrachtet die Bildung von Begriffen 1. Stufe bereits als Abstraktionsleistung. Sie besteht zum Beispiel in einem Übergang von einer konkreten Wortäußerung zu einem Wortschema. Dabei muss von verschiedenen individuellen Merkmalen konkreter, wahrgenommener Wortzeichen abgesehen werden: »Im Verstehen einer Äußerung schematisieren wir; wir identifizieren die sie konstituierenden Einheiten, indem wir im Vergleich der geäußerten Kette mit den Einheiten unseres Sprachsystems von individuellen Merkmalen wie Färbung, Lautstärke etc. absehen […]. Verstehen impliziert so die Identifikation von Zeichengestalten. Der signifiant ist Resultat von Abstraktionen und somit selbst eine real existierende Abstraktion.«166
Nach Stetter ist die Bedeutung des Vergleichs für die Operation der Abstraktion nicht auf das Sprachverstehen eingeschränkt: »[J]ede generalisierende Abstraktion impliziert eine Operation des Vergleichs. Wenn x als Resultat einer Abstraktion aus y und z aufgefaßt wird, müssen y und z als in irgend-
165 Schneider, Hans Julius: »Der Konstruktivismus ist kein Reduktionismus!«, in: Prätor, Klaus (Hg.): Aspekte der Abstraktionstheorie, Aachen, 1988, S. 165. 166 Stetter, Christian: »Zum Problem der Abstraktion in der Linguistik«, in: Prätor, Klaus (Hg.):
Aspekte der Abstraktionstheorie, Aachen, 1988, S. 50.
100 | Bildnerisches Denken
welchen Hinsichten identisch betrachtet werden können, wobei x eine dieser Hinsichten ist, die als solche identifiziert werden muß.«167 Einen ganz ähnlichen Übergang zu einem Schema erläutern Kamlah und Lorenzen am Beispiel des Tangos: »Einer aktuellen Handlung, die in einer konkreten Situation ausgeführt wurde, möge der Prädikator ›Tango‹ zukommen. Zugleich möge diese Handlung ›linkisch‹ ausgefallen sein. Wir unterscheiden nämlich individuelle Eigenschaften einer Handlung als ›zufällige‹ von anderen Eigenschaften, die der Handlung ›als solcher‹ eigentümlich sind. Wenn wir z. B. sagen ›der Tango ist schwer‹ (im Sinne von ›schwieriger auszuführen als andere Tänze‹), dann sprechen wir über ›den Tango als Tango‹, d. h. über den Tango als Handlungsschema.«168
Auch hier muss also zwischen den individuellen Merkmalen eines konkret ausgeführten Tangos und denjenigen Merkmalen unterschieden werden, die dem Tango als Handlungsschema zukommen. In der Rede über das Handlungsschema wird von den Merkmalen der aktuellen Tanzhandlung abgesehen. Die Bedeutung der grundlegenden Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem beim Übergang zu Oberbegriffen erläutert Lorenz am Beispiel der Vogelgattungen und -familien: »[B]ei einer Abstraktion wird von allen Unterschieden zwischen diesen Instanzen bis auf die für die Abstraktion maßgebende Eigenschaft abgesehen. Z. B. gewinnt man […] durch das Abstrahieren von allen Unterschieden bis auf die für die Zugehörigkeit zur Familie der Lerchen maßgebende(n) Eigenschaft(en) die abstrakte Familie der Lerchen (Alaudidae);«169
Voraussetzung für die Abstraktion ist hier, wie im Text erwähnt, eine Unterscheidung zwischen den maßgebenden und nicht-maßgebenden Eigenschaften der einzelnen Vögel. Welche Eigenschaften in diesem Fall maßgebend sind, wird durch die Familienbezeichnung »Lerche« vorgegeben. Analog kann der Übergang zur Vogelfamilie »Lerche« auch von den verschiedenen Lerchengattungen aus geschehen. »Eine Vogelfamilie ist hier also sowohl aus einzelnen Vögeln als auch aus einzelnen Gattungen von Vögeln abstra-
167 Ebenda, S. 53. 168 Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich, 1990, S. 100. 169 Lorenz, Kuno: »Abstraktum«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wis-
senschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005, S. 25.
3 Denken | 101
hiert und daher in doppeltem Sinne ein Abstraktum.«170 In beiden Fällen muss als Voraussetzung für die Operation der Abstraktion bereits entschieden sein, welche Eigenschaften im betreffenden Fall maßgebend sind. Das bedeutet, dass eine Unterscheidung von Gleichartigem und Verschiedenartigem stattgefunden haben muss. Wohlrapp weist darauf hin, dass es einer gesonderten Erklärung bedarf, wie die notwendige Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem vor sich geht. Er bemerkt, dass eine solche auch in der modernen Abstraktionstheorie noch nicht gegeben wurde: »Am Beispiel gesagt, ist kein derartiger Übergang von den Pflaumen, Äpfeln, Birnen usw., die in der Obstschale liegen, auf das Obst mehr möglich, wenn jemand das Schlüsselbund dazugelegt hat. Das eigentliche Geheimnis besteht also darin, wie wir es hingekriegt haben, lauter ›Obst‹ auf die Schale zu legen; anders gesagt: es besteht darin zu wissen, worauf es ankommt, wenn wir auf ›Gleiches‹ achten und von ›Verschiedenem‹ absehen. Die Lösung des Abstraktionsrätsels, die wir in Gestalt der zeitgenössischen (z. B. der konstruktiven) Abstraktionstheorie vor uns haben, gibt nun gerade auf diese Frage auch keine Antwort.«171
Dieses Problem der modernen Abstraktionstheorie sieht auch Ignacio Angelelli. Seiner Ansicht nach ist die Äquivalenzrelation, von der die Abstraktion im modernen Sinne ausgeht, selbst nur durch eine Abstraktionsleistung zu verstehen. Ihm zufolge hat Lorenzen als einer der wenigen dieses Manko erkannt: »Lorenzen’s main merit, with regard to abstraction, is that he was the first to dare to overhaul the circumspection method […], turning it upside down, bringing out, and subjecting to a rigorous analysis, the abstraction that obscurely underlies the ›equivalence‹«.172
Übergang [1] von der Betrachtung der Welt zur Sprache (elementare Prädikation) Wie erwähnt wird in der modernen Abstraktionstheorie die Operation der elementaren Prädikation nicht als Abstraktionsleistung angesehen. Da solche Prädikationen aber in jedem Fall Voraussetzung für Abstraktion sind,
170 Ebenda. 171 Wohlrapp, Harald: »Abstraktion in Marxens Wissenschaftsauffassung«, in: Prätor, Klaus (Hg.):
Aspekte der Abstraktionstheorie, Aachen, 1988, S. 109–110. 172 Angelelli, Ignacio: »Adventures of Abstraction«, in: Coniglione, Francesco u. a. (Hg.): Idealiza-
tion XI, Amsterdam, New York, 2004, S. 25.
102 | Bildnerisches Denken
wie auch Prätor betont,173 werden sie von einigen Autoren dennoch im Rahmen ihrer Abstraktionstheorie behandelt. Die elementaren Prädikationen können nämlich als sprachlicher Ausdruck der grundlegenden Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem verstanden werden, wie bei einigen Autoren deutlich wird. Es werden dabei unterschiedliche Antworten darauf gegeben, inwieweit diese Grundoperation hinterfragt und erklärt werden kann. Prätor vertritt die These, dass diese Grundleistung nicht weiter philosophisch reflektiert werden kann: »Die Prädikation wird als eine elementare Leistung betrachtet. Die dabei erfolgende Gleichbehandlung verschiedener Gegenstände kann auf dieser Stufe nur praktisch vollzogen, aber nicht als ein Absehen von Unterschieden erkenntnistheoretisch thematisiert werden.«174 Auch Kamlah und Lorenzen beschreiben die elementare Prädikation als grundlegend und nicht zu hinterfragen: »Mit jedem Prädikat der Sprache wird eine Unterscheidung getroffen: Das Einzelne, dem das Prädikat zugesprochen wird, wird unterschieden von dem Einzelnen, dem das Prädikat abgesprochen wird.«175 »Die Sprache mit ihren Eigennamen und Prädikatoren ist es also, die uns unsere Welt ›immer schon‹ erschließt, immer schon bekannt und vertraut macht.«176
Klar formuliert ist hier der Aspekt des Unterscheidens, mit dem wir die Welt gliedern. Mit dem Ausdruck »immer schon« weisen die Autoren darauf hin, dass wir keinen Zugang zur Welt vor einer so getroffenen Unterscheidung haben. Das bedeutet, dass wir diese Unterscheidungsleistung selbst nicht reflektieren können, weil wir den Zustand nach der geleisteten Unterscheidung nicht mit einem Zustand vor dieser Unterscheidung vergleichen können. Daher sehen die Autoren diese Leistung als Ausdruck einer grundlegenden Fähigkeit, die wir mit allen Lebewesen gemeinsam haben. Beim Menschen ist diese Unterscheidungsfähigkeit nur insofern gesteigert, als sie in einer Prädikation zum Ausdruck gebracht werden kann: »Die allen Lebe-
173 Vgl. Prätor, Klaus: »Wer hat Angst vor ›dem‹ Nashorn?«, in: ders. (Hg.): Aspekte der Abstrakti-
onstheorie, Aachen, 1988, S. 65–66. 174 Ebenda, S. 65. 175 Lorenzen, Paul: »Methodisches Denken«, in: ders.: Methodisches Denken, Frankfurt a. M., 1974, S. 31. 176 Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich, 1990, S. 46.
3 Denken | 103
wesen eigene Fähigkeit, ›unbewußt‹ im Verschiedenen das Gleiche wiederzuerkennen, wird im Menschen gesteigert zur Fähigkeit, im Gebrauch von Prädikatoren verschiedene Gegenstände als dasselbe zusammenzufassen und als solches wiederum von anderem zu unterscheiden.«177 Kamlah und Lorenzen weisen auch darauf hin, dass viele dieser Unterscheidungen von einem bestimmten Standpunkt aus willkürlich sind, weil sie auch anders getroffen werden könnten.178 Auch in der Wissenschaft ist dieser Spielraum gegeben, der zu bewusst getroffenen Entscheidungen nötigt: »Die Wissenschaft vollends bemüht sich um eine Sprache von optimaler Angemessenheit an die Welt. Doch auch sie kann nicht vermeiden, daß sich ihr die Dinge nicht überall von sich her als verschieden anbieten, daß sie vielmehr […] entscheiden muß, was sie als gleichartig und was sie als
verschiedenartig ansehen und demgemäß ansprechen will.«179
Kamlah und Lorenzen behandeln die Lenkung der Aufmerksamkeit nicht explizit. Höchstens indirekt wird deutlich, dass sich die Prädikation auf das Gleichartige konzentriert: Die Autoren erläutern, dass in der Sprache das Neue als das wiederkehrende Gleiche betrachtet wird. Das bedeutet, dass man mit der Sprache überhaupt nur Gleichartiges erfassen kann und dass damit automatisch die Konzentration darauf gelegt wird: »Innerhalb des Sprechens aber wiederholen sich Wörter und Wendungen in einer Weise, die der Einbettung des immer Neuen in das immer Gleiche gleichsam in genialer Anpassung entspricht. (›Gleich‹ und ›gleichartig‹ unterscheiden wir hier nicht, und ›gleichartig‹ sind Gegenstände eben dann, wenn ihnen dieselben Prädikatoren zukommen, einer oder mehrere.)«180
Auch Mittelstraß thematisiert die grundlegende Unterscheidungsleistung und betont ähnlich wie die anderen Autoren, dass man diese Fähigkeit des Menschen unter erkenntnistheoretischen Aspekten nicht weiter hinterfragen kann: »Die Weitergabe von Unterscheidungen und deren wiederholte Anwendung auch über die zunächst als Beispiele und Gegenbeispiele benutzten Gegenstände hinaus wird man dabei nur als eine freie
177 Ebenda, S. 51–52. 178 Vgl. ebenda, S. 46–47, Hervorh. i. O. 179 Ebenda, S. 49, Hervorh. i. O. 180 Ebenda, S. 51.
104 | Bildnerisches Denken
Leistung des Menschen bezeichnen können. Jeder Versuch, an dieser Stelle hinter ein solches offenkundiges Können zurückzufragen […], müßte von theoretischen Hilfsmitteln Gebrauch machen […], die hier, wo es zunächst nur um die sprachlich fundamentale Handlung der Prädikation geht, noch gar nicht zur Verfügung stehen.«181
Zwar kann nach Mittelstraß die grundlegende Unterscheidungsfähigkeit nicht weiter reflektiert werden. Aber man kann die einzelnen Unterscheidungen prüfen und nach ihrer Begründung fragen. Viele Unterscheidungen können dadurch begründet werden, dass sie bestimmten Bedürfnissen entsprechen: »Auch diese Unterscheidungen aber, die hier ›erste‹ Unterscheidungen heißen mögen, stehen einer kritischen Überprüfung jederzeit offen; und sie sind es auch in erster Linie, die einer Begründung bedürfen.«182 »Worauf es hier vielmehr ankommt, sind die Absichten und Bedürfnisse, die hinter einer solchen ›ersten‹ Unterscheidung stehen. […] Was also in Wahrheit im Falle solcher ›ersten‹ Unterscheidungen gerechtfertigt werden muß, sind genau jene motivierenden Bedürfnisse und Absichten.«183
Zusammenfassung Sowohl in der klassischen als auch in der modernen Abstraktionstheorie wird die Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem als menschliche Grundleistung angenommen und beschrieben. In einigen Theorien wird sie selbst als Abstraktionsleistung angesehen, in anderen als direkte oder indirekte Voraussetzung. Einige Theorien erläutern auch, dass in der Abstraktion die Aufmerksamkeit auf das Gleichartige gelegt wird. Die Gleichartigkeit kann sich dabei, je nach Abstraktionsbegriff, auf gleichartige Wahrnehmungseindrücke, gleiche Merkmale von Individuen oder einzelnen Handlungen sowie auf die Bedeutungsgleichheit von Prädikaten beziehen. Im folgenden Kapitel wird gezeigt, dass man bei der grundlegenden Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem ebenso die Aufmerksamkeit auf das Verschiedenartige richten kann, was als Konkretion bezeichnet werden soll.
181 Mittelstraß, Jürgen: »Die Prädikation und die Wiederkehr des Gleichen«, in: ders.: Die Möglich-
keit von Wissenschaft, Frankfurt a. M., 1974, S. 150. 182 Ebenda, S. 154. 183 Ebenda, S. 155.
3 Denken | 105
3.1.3 Konkretion als Denkleistung Im diesem Kapitel wird die Konkretion als alternatives Kriterium für das Denken eingeführt. Zunächst wird anhand von Bildbeispielen die Konkretion im Prozess der Bildrezeption vorgeführt. Dabei wird gezeigt, dass sie auf derselben Grundoperation wie die Abstraktion basiert, der Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem. Deshalb kann sie als komplementär zur Abstraktion angesehen werden (3.1.3.1). Nach der exemplarischen Einführung wird untersucht, ob die Möglichkeit zur Konkretion in den bisher behandelten Theorien des Denkens und der Abstraktion thematisiert wird (3.1.3.2). 3.1.3.1 Konkretion als Aufmerksamkeit auf Verschiedenartiges Dieses Kapitel erklärt anhand eines Beispiels den grundsätzlichen Unterschied zwischen Abstraktion und Konkretion. Es wird gezeigt, dass Bildbetrachtung nur durch Konkretion möglich ist, weil die Bildrezeption durch Abstraktion den Kern des Bildes, d. h. dessen Bildhaftigkeit, verfehlt. Für die Abgrenzung zur Konkretion wird hier »Abstraktion« in einem weiten Sinne verstanden. Unter diesem Begriff werden alle Operationen zusammengefasst, bei denen ausgehend von einer Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem die Aufmerksamkeit auf das Gleichartige gerichtet wird. Im Unterschied dazu gilt als »Konkretion« eine Operation, in der sich die Aufmerksamkeit auf das Verschiedenartige richtet. Der Prozess der Bildrezeption wird anhand eines Bildes veranschaulicht, das mit mehreren anderen Bildern verglichen wird. Die Rezeption durch Abstraktion besteht dabei in einem Prozess der Klassifikation, der schrittweise immer genauer wird. Sie muss dennoch scheitern, da sie die wesentlichen bildlichen Merkmale eines konkreten Bildes nicht erfassen kann. Der Grad der Genauigkeit in der Abstraktion ist niemals ausreichend, um dem Bild als Bild gerecht zu werden. Der Grund dafür liegt darin, dass die Abstraktion auch bei der Beschreibung von Unterschieden immer auf eine Gemeinsamkeit verweisen muss, die das Bild mit anderen Bildern hat. Dadurch kann sie der Einmaligkeit eines konkreten Bildes nicht gerecht werden, wie im Folgenden gezeigt wird. Das Gemälde von Bob Ross (Abb. 1) kann man problemlos auf den ersten Blick als gegenständliches Bild klassifizieren. Besonders leicht ist dies im Unterschied zum Gemälde von Jackson Pollock (Abb. 2) bei dem es sich um ein ungegenständliches Gemälde handelt. Damit ist in einem ersten Schritt zwar ein Unterschied zwischen beiden Gemälden festgestellt, allerdings durch Abstraktion und nicht durch Konkretion. Es wird auf das Merkmal der
106 | Bildnerisches Denken
Gegenständlichkeit verwiesen, welche das Gemälde von Bob Ross mit vielen anderen Gemälden aus vielen Epochen gemeinsam hat. Ebenso teilt das Gemälde von Jackson Pollock die Eigenschaft der Ungegenständlichkeit mit vielen anderen Malereien des 20. Jahrhunderts. Die Abstraktion erfasst den Unterschied zwischen beiden Werken durch den Verweis auf eine Gemeinsamkeit, die sie jeweils mit anderen Gemälden haben. Die obige Klassifizierung des Gemäldes von Bob Ross kann schrittweise weiter verfeinert werden. Es kann beispielsweise als »Landschaftsdarstellung« bezeichnet werden oder als »Darstellung einer Berglandschaft mit Fluss oder See« bis hin zu folgender Beschreibung: »In der linken Hälfte des Hintergrundes sind mehrere Berge zu sehen. Hinter den Bergen erstreckt sich ein blauer, leicht bewölkter Himmel. Aus der Richtung der Berge schlängelt sich ein See oder ein Fluss in den Vordergrund bis zum unteren Bildrand. Das Wasser ist auf beiden Seiten von Bäumen gesäumt. An der rechten Uferseite stehen mehrere Bäume. Einer der Bäume, der dem Ufer am nächsten steht, ist kleiner als die anderen und zeigt eine leichte Neigung zum Wasser.« Zwar mag diese Beschreibung auf den ersten Blick bereits recht genau erscheinen. Wie ungenau sie aber dennoch ist, wird deutlich, wenn man ein weiteres Gemälde zum Vergleich heranzieht, auf das dieselbe Beschreibung ebenso exakt zutrifft (Abb. 2). Das Motiv beider Werke ist zwar sehr ähnlich und kann durch die Abstraktion sehr gut erfasst werden. Nicht erfasst wird die Wirkung der Bilder, die völlig unterschiedlich ist. Sie ist aber nicht nur eine nebensächliche Randerscheinung der Gemälde, sondern der Kern ihrer Bildhaftigkeit. Bei einer Bildrezeption durch Konkretion hingegen kommen die Unterschiede zwischen beiden Bildern in Betracht. Dabei wird die Andersartigkeit ihrer Wirkung nicht einfach nur erfasst. Vielmehr kann sie auch auf die Unterschiede in der Farb- und Formgestaltung der Bilder zurückgeführt werden. Um dies zu verdeutlichen, sollen die bereits beschriebenen Bäume als Detail herausgegriffen und verglichen werden (Abb. 5 und Abb. 6). Bildrezeption durch Konkretion bedeutet, in diesem Vergleich die Differenzen zwischen den Farben und Formen, zwischen den Zusammensetzungen von Farben und Formen und zwischen der Wirkung dieser Farb- und Formzusammensetzungen so genau wie möglich zu beobachten.
3 Denken | 107
Abb. 1: Bob Ross: »Gebirgsspiegelung«, [ohne Jahresangabe], Öl auf Leinwand, 45,7 × 60,9 cm
Abb. 2: Jackson Pollock: »Black and White N°15«, 1951, Kunstharzlack auf Leinwand, 142,2 × 167,7 cm
Abb. 3: See vor dem Berg, Acryl auf Papier, 30 × 40 cm, aus: Archiv der Autorin
Abb. 4: Josef Anton Koch: »Das Wetterhorn von der Rosenlaui aus«, 1824, Öl auf Leinwand, 94 × 83 cm
Die verbale Beschreibung einer solchen Beobachtung könnte wie folgt lauten: »Insgesamt wirkt der Baum mit seiner Umgebung auf Abb. 5 eher freundlich, heiter und warm. Auf Abb. 6 hingegen herrscht im Vergleich dazu eine unangenehme, kühle und fast unheimliche Stimmung. Diese Wirkungen werden verursacht durch folgende Farb- und Formanordnungen:
108 | Bildnerisches Denken
Abb. 5: Bob Ross: »Gebirgsspiegelung«, Ausschnitt, [ohne Jahresangabe], Öl auf Leinwand, 5,7 × 60,9 cm
Abb. 6: See vor dem Berg, Ausschnitt, Acryl auf Papier, 30 × 40 cm,, aus: Archiv der Autorin
Auf beiden Abbildungen ist der Grundton der Nadelbäume etwa gleich. Auf Abb. 5 ist dieser aber an einigen Stellen am rechten Rand der Bäume aufgehellt. Man deutet diese Aufhellung als Lichteinfall. Diese Deutung wird dadurch gestützt, dass eine ähnliche Aufhellung in den Sträuchern vor dem Nadelbaum sowie im Hintergrund links neben dem Baum zu erkennen ist. Auf Abb. 6 ist im Nadelwerk keine Aufhellung zu finden. Auch im Hintergrund kann man höchstens ein sehr schwaches Streiflicht in den Spitzen der Bäume oder der Sträucher entdecken. Nur die Wiese links vom Nadelbaum ist leicht aufgehellt, als schiene die Sonne darauf. Allerdings ist der Farbton dieser Aufhellung wesentlich kühler. Auf Abb. 5 ist der Farbton der Lichter mehr gelb- und rothaltig. Dadurch wirkt die Szene auf Abb. 5 nicht nur stärker beleuchtet, sondern auch von einem wärmeren Licht durchdrungen. Diese Wirkung wird auch durch die unterschiedlichen Blautöne des Himmels unterstützt. Auf Abb. 5 ist das Blau mehr rothaltig, während es auf Abb. 6 viel Cyan enthält – die kälteste Farbe auf dem Farbkreis. Auf Abb. 6 ist nicht nur das Licht kühler, es ist auch weniger Licht vorhanden. Den Nadelbäumen auf der rechten Seite fehlen nicht nur die Aufhellungen in der Krone. Sie sind auch nicht, wie die Bäume auf Abb. 5, umgeben von beleuchteten, aufgelockerten Sträuchern. Durch das Fehlen der Sträucher und des
3 Denken | 109
Lichtes entsteht auf der rechten Seite vor den Nadelbäumen eine dunkle, unstrukturierte Fläche. Durch die fehlende Struktur und die Dunkelheit kann der Betrachter diesen Teil der Darstellung nicht richtig einordnen. Die so entstehende Unsicherheit trägt entscheidend zu der etwas düsteren und unheimlichen Stimmung bei. Auf Abb. 5 wurde eine solche Wirkung an dieser Stelle nicht nur durch die Farbe, sondern auch durch die Formgebung des Busches vermieden. Der helle warme Farbton sowie das aufgelockerte Blattwerk brechen die dunkle Fläche. Die Farbverteilung, die z. T. als Lichtverteilung interpretiert wird, sowie die Anordnung und Formgebung der umgebenden Sträucher führen so auf beiden Bildern zu der beschriebenen unterschiedlichen Wirkung.« Diese Beschreibung der beobachtbaren Unterschiede, die fast eine DIN A4 Seite füllt, ist – selbst bezogen auf diesen kleinen Bildausschnitt – immer noch unvollständig. Bezogen auf die beiden kompletten Werke würde eine solche Beschreibung vermutlich mehrere Seiten füllen und trotzdem nicht alle unterschiedlichen Aspekte berücksichtigen können. Die Denkleistung der Konkretion kann mit dem Medium der Sprache nur sehr unzureichend wiedergegeben werden. Unsere Wahrnehmung ist immer um ein Vielfaches reicher, als es in der Sprache zum Ausdruck kommen kann. Das liegt auch daran, dass der Umgang mit Sprache Abstraktion erfordert: In jeder noch so elementaren Prädikation wird auf eine Gleichartigkeit verwiesen, wie bereits erläutert wurde. Durch die Verwendung von Metaphern in solchen Beschreibungen kann der Mangel an wörtlichem Vokabular nur abgemildert werden. Das Medium, mit dem die beobachteten Unterschiede am genauesten wiedergegeben werden können, ist nicht sprachlich, sondern visuell. Die Charakterisierung der Unterschiede zwischen beiden Bäumen gelingt am besten durch Zeichnung oder Malerei oder andere visuelle Medien. Damit kann man die Konturen, die Anordnung der Bildteile und die Farbunterschiede am genauesten wiedergeben. Aus diesem Grund werden in professionellen Werkanalysen in der Regel auch immer visuelle Medien verwendet, um wesentliche Charakteristika des analysierten Bildes zu verdeutlichen. Eine Kompositionsskizze ist ein Beispiel für eine solche Analyse mit Hilfe visueller Medien. In einer solchen Skizze kann die Denkleistung der Konkretion zum Ausdruck kommen. Die verbale Beschreibung der Konkretion ist zwar unzureichend und nur näherungsweise möglich, aber sie ist nicht völlig verfehlt, wie am Beispiel deutlich wurde. Das heißt, dass der Unterschied zwischen Konkretion und Abstraktion kein medialer ist. Es ist ein Unterschied in der Blickrichtung. Während die Abstraktion auf Gemeinsamkeiten achtet, um die Welt zu ord-
110 | Bildnerisches Denken
nen, richtet die Konkretion ihre Aufmerksamkeit auf die Unterschiede. Aus rein praktischen Gründen eignet sich das Medium der Sprache eher zum Ausdruck von Prozessen der Abstraktion als von Prozessen der Konkretion. Das Verhältnis von Denkarten zu Medienarten wird in Kapitel 3.4.2 näher ausgeführt. Anhand eines letzten Bildvergleichs soll abschließend dargelegt werden, wie wichtig die Blickrichtung der Konkretion für unseren Umgang mit Bildern und unser Verständnis von Bildern ist. Die in der Abstraktion vorgenommene Klassifikation des Gemäldes von Bob Ross (S. 107) trifft auch auf das Bild auf Abb. 4 zu. Sie sei hier nochmals wiederholt: »In der linken Hälfte des Hintergrundes sind mehrere Berge zu sehen. Hinter den Bergen erstreckt sich ein blauer, leicht bewölkter Himmel. Aus der Richtung der Berge schlängelt sich ein See oder ein Fluss in den Vordergrund bis zum unteren Bildrand. Das Wasser ist auf beiden Seiten von Bäumen gesäumt. An der rechten Uferseite stehen mehrere Bäume. Einer der Bäume, der dem Ufer am nächsten steht, ist kleiner als die anderen und zeigt eine leichte Neigung zum Wasser.« Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Gemälden besteht darin, dass das Werk von Josef Anton Koch auf Abb. 4 ein allgemein anerkanntes Kunstwerk ist. Hingegen werden die Malereien von Bob Ross eher nicht als Kunstwerke angesehen. Diese unterschiedliche Einordnung der beiden Werke ist zwar selbst nicht sichtbar, aber die Konkretion kann sichtbare Unterschiede aufdecken, die sie begründen. Der sichtbare Hauptunterschied zwischen beiden Bildern besteht darin, dass Koch die Farben und Formen bei weitem mehr differenziert, als Bob Ross dies tut. Ross verwendet zwei klar voneinander unterschiedene Farbtöne für die Pflanzen: ein sehr helles Gelbgrün und ein dunkles Tannengrün. Innerhalb dieser Töne gibt es zwar leichte Variationen, doch der Hauptkontrast zwischen diesen beiden Farben bleibt bestehen. Koch hingegen verwendet eine ungleich reichere Palette für die Pflanzen. Es kommen nicht nur verschiedenste Grüntöne vor, sondern auch Mischungen zu Grau oder Braun. Koch verändert zudem die Farben der Pflanzen, die weiter im Hintergrund stehen, indem er sie aufhellt und ihnen einen leichten Blaustich gibt. Damit erzeugt er eine Luftperspektive, d. h. die Illusion eines Tiefenraumes, die im Bild von Ross völlig fehlt. Diesen Unterschied in der Differenziertheit kann man auch bei den Farben der Berge und des Wassers feststellen sowie bei den Formen. Ross deutet die Pflanzen mit zwei Formentypen an, die nur wenig variieren: Eine längliche Form für die Nadelbäume und eine rundliche Form für Laubbäume und -sträucher. Koch hingegen gibt dem Blattwerk der verschiedenen Baumarten und der verschiede-
3 Denken | 111
nen Bäume einer Baumart ganz unterschiedliche Formen. An manchen Stellen sind außerdem Zweige und Äste zwischen den Blättern zu sehen. Zusätzlich sind die Pflanzen auch unterschiedlich detailliert gemalt. Vorne sind die Pflanzen detaillierter ausgearbeitet, während die Details nach hinten abnehmen. Damit wird nochmals die räumliche Illusion gesteigert. Dieselbe Differenziertheit der Formen findet man bei Koch auch in den Formen der Berge, der Wasserwellen und der Wolken. Zusammenfassend kann man daher sagen, dass das Gemälde von Koch wesentlich differenzierter ist. Es scheint so, dass Koch zu einer stärkeren Differenzierung fähig war als Ross. Wenn dem nicht so war, dann hat Ross beim Malen seines Bildes von seiner Differenzierungsfähigkeit zumindest weniger Gebrauch gemacht als Koch. Weil man das den beiden Bildern ansieht, wird ihre Qualität unterschiedlich bewertet. Im Allgemeinen werden die Gemälde von Koch als qualitätsvoller eingeschätzt als die Bilder von Ross. Diesen Qualitätsunterschied kann ein Bildrezipient nur dann bemerken, wenn er geübt ist im bildnerischen Konkretisieren, d. h. im Bildnerischen Denken. Eine Bildrezeption, die diese Unterschiede nicht beachtet, wird keiner der drei Berglandschaften (Abb. 1, Abb. 3 und Abb. 4) gerecht. Eine Bildtheorie, die diese Art von Unterschieden zwischen Bildern nicht systematisch erfasst, ist als Theorie des Bildes nicht überzeugend. Die Konkretion ist daher ein notwendiges Element einer überzeugenden Theorie zur Rezeption und Produktion von Bildern. Da sowohl die Konkretion wie auch die Abstraktion dieselbe Grundoperation voraussetzen und weiterführen, können sie als komplementäre, aber gleichwertige Leistungen angesehen werden. Hier soll dafür argumentiert werden, dass bereits diese vorausgesetzte Grundoperation der Anfangspunkt der geistigen Leistung darstellt, die man Denken nennt. Daher können beide Operationen – die der Abstraktion genauso wie die der Konkretion – berechtigtermaßen als Denken bezeichnet werden. 3.1.3.2 Konkretion in verschiedenen Theorien des Denkens Nach dieser am Beispiel erläuterten Unterscheidung zwischen Abstraktion und Konkretion wird gezeigt, wie die Konkretion in verschiedenen Theorien thematisiert wird. Von den Autoren Kant, Baumgarten, Mill, Mach, James, Goodman, Lorenz, Kamlah und Lorenzen thematisieren alle mit Ausnahme von Mill, Kamlah und Lorenzen eine zur Abstraktion gegenläufige Operation, wie im Folgenden gezeigt wird. Vielfach wird diese Operation allerdings nicht als »Konkretion« oder »konkret« bezeichnet. Und nicht immer deckt sich diese gegenläufige Operation mit der hier entworfenen Konkretion.
112 | Bildnerisches Denken
Immanuel Kant & Alexander Gottlieb Baumgarten Bei Kant – bzw. genauer in der Jäsche-Logik – ist ein Hinweis auf zwei Denkoperationen zu finden, die in entgegengesetzte Richtungen laufen. Die zur Abstraktion gegenläufige Operation, die »logische Determination« genannt wird, entspricht allerdings nicht der Konkretion. In der Jäsche-Logik heißt es: »Durch fortgesetzte logische Abstraktion entstehen immer höhere, so wie dagegen durch fortgesetzte logische Determination immer niedrigere Begriffe. — Die größte mögliche Abstraction giebt den höchsten oder abstractesten Begriff — den, von dem sich keine Bestimmung weiter wegdenken läßt. Die höchste vollendete Determination würde einen durchgängig bestimmten Begriff (conceptum omnimode determinatum), d. i. einen solchen geben, zu dem sich keine weitere Bestimmung mehr hinzu denken ließe. Anmerk. Da nur einzelne Dinge oder Individuen durchgängig bestimmt sind: so kann es auch nur durchgängig bestimmte Erkenntnisse als Anschauungen, nicht aber als Begriffe, geben; in Ansehung der letztern kann die logische Bestimmung nie als vollendet angesehen werden«.184
Eine Gemeinsamkeit von Determination und Konkretion besteht darin, dass beide konsequent fortgeführt zur Anschauung, d. h. zum Bildlichen, tendieren. Dennoch überschreitet die Determination niemals die Grenze zur Anschauung, da sie als logische Bestimmung immer im Begrifflichen bleibt. Die logische Determination ist eine Form der Abstraktion. Zwar wird sie beschrieben als eine schrittweise Annäherung an eine immer detailliertere Charakterisierung eines Individuums. Diese Annäherung geschieht aber nicht durch eine qualitative Veränderung der Aufmerksamkeit hin zu den Unterschieden. Es findet nur eine quantitative Veränderung des Blicks statt. Es werden schrittweise mehr Bestimmungen berücksichtigt. Daher ist zwar die Richtung von Abstraktion und Determination unterschiedlich, die Art der Charakterisierung hingegen gleich. Die Charakterisierungen durch Abstraktion unterscheiden sich von denen durch Determination nur graduell. Hingegen ist der Unterschied sowohl zwischen den Operationen Abstraktion und Konkretion als auch zwischen ihren Charakterisierungen grundsätzlicher Natur. Auch bei Baumgarten findet man eine Beschreibung zweier Denkprozesse, die sich durch die Quantität der berücksichtigten Bestimmungen vonei-
184 Jäsche, Gottlob Benjamin (Hg.): »Immanuel Kants Logik«, in: Akademie-Ausgabe, Band 9, S. 99, Hervorh. i. O.
3 Denken | 113
nander unterscheiden. Kants Unterscheidung geht möglicherweise auf diesen Gedankengang Baumgartens zurück. Im Unterschied zu Kant setzt Baumgarten die Denkform, die relativ viele Bestimmungen berücksichtigt, mit dem »Schönen Denken« gleich: »Es möge also derjenige, der schön denken will, sich entweder einen bestimmteren Stoff aussuchen, einen aus den niedrigeren Gattungen oder überhaupt aus den Arten; oder, wenn es ihm beliebt, zu höheren Gattungen aufzusteigen, möge er dennoch gehalten sein, dieselben mit vielen Merkmalen und charakteristischen Eigentümlichkeiten zu bekleiden, welche die reinere Wissenschaft ausläßt; oder er möge sich schließlich einzelne Themen auswählen, in denen die materiale Vollkommenheit der Wahrheit vorherrschen mag. Diese sollen mit einer ungemeinen Menge von Merkmalen umgeben werden.«185
John Stuart Mill In Mills Ausführungen wird sehr deutlich, dass eine zur Abstraktion gegenläufige Denkoperation für ihn nicht in Betracht kommt. Denn seiner Ansicht nach ist jede Beschreibung einer Beobachtung klassifizierend – und damit Abstraktion: »We cannot describe a fact, without implying more than the fact. The perception is only of one individual thing; but to describe it is to affirm a connexion between it and every other thing which is either denoted or connoted by any of the terms used. To begin with an example, than which none can be conceived more elementary: I have a sensation of sight, and I endeavour to describe it by saying that I see something white. In saying this, I do not solely affirm my sensation; I also class it. I assert a resemblance between the thing I see, and all things which I and others are accustomed to call white. I assert that it resembles them in the circumstance in which they all resemble one another, in that which is the ground of their being called by the name. This is not merely one way of describing an observation, but the only way.«186
Ernst Mach Im Gegensatz dazu vertritt Ernst Mach eine Theorie des Denkens, die verschiedene Denkarten zulässt. Anhand eines Beispiels erläutert er, dass es einen zur Abstraktion gegenläufigen Erkenntnisprozess gibt. Er zeichnet
185 Baumgarten, Alexander Gottlieb: Ästhetik, Hamburg, 2007, S. 543. 186 Mill, John Stuart: »A System of Logic«, in: Robson, John M. (Hg.): Collected Works of John Stuart
Mill, Band 8, Toronto, London 1981, S. 643.
114 | Bildnerisches Denken
sich dadurch aus, dass in ihm Unterschiede in den Blick kommen, die bei der Abstraktion missachtet werden: »Um mit unseren Beispielen nicht bloß auf dem Gebiete der Mechanik zu bleiben, betrachten wir
Newtons Entdeckung der Dispersion des Lichtes. Neben der feineren Unterscheidung von Lichtern verschiedener Farbe und ungleicher Brechungsexponenten im weißen Licht, hat Newton das Licht auch zuerst als aus verschiedenen voneinander unabhängigen Strahlungen bestehend erkannt. Der zweite Teil der Entdeckung scheint durch Abstraktion, der erste durch den entgegengesetzten Prozeß gewonnen zu sein; allein beide beruhen auf der Fähigkeit und Freiheit, die Umstände nach Belieben und Zweckmäßigkeit zu beachten oder außer acht zu lassen.«187
Mach bezeichnet die erste Unterscheidung als »feiner«. Sie sucht innerhalb der fließenden Übergänge von einer Lichtfarbe zu einer anderen nach immer feineren Differenzen. Die Lichtfarben werden also nicht bloß in Farbgruppen klassifiziert. Es findet auch innerhalb der Farbgruppen eine Differenzierung statt. Diese wird allerdings mit dem Brechungsexponenten im weißen Licht in Verbindung gebracht, der die Gleichartigkeit der verschiedenen Lichtfarben bestimmt. Damit entspricht diese Operation eher der kantischen Determination als der Konkretion. An anderer Stelle beschreibt er die zur Abstraktion gegenläufige Operation als eine »Vertiefung ins Einzelne«. Es bleibt unklar, ob Mach an dieser Stelle eine Operation meint, die sich von der kantischen Determination unterscheidet: »Der Mensch hat vorzugsweise die Fähigkeit, sich seinen Standpunkt willkürlich und bewusst zu bestimmen. Er kann jetzt von den imposantesten Einzelheiten absehen und sofort wieder die geringste Kleinigkeit beachten, jetzt die stationäre Strömung ohne Rücksicht auf den Inhalt (ob Wärme, Elektrizität oder Flüssigkeit) betrachten, und dann die Breite einer Fraunhoferschen Linie im Spektrum schätzen: er kann nach Gutdünken zu den allgemeinsten Abstraktionen sich erheben, oder ins einzelne sich vertiefen.«188
Sehr deutlich wendet sich Mach gegen eine Theorien des Denkens, die allein das Operieren mit Begriffen als Denkakt ansieht:
187 Mach, Ernst: »Der Begriff«, in: Erkenntnis und Irrtum, Leipzig, 1906, S. 141, Hervorh. i. O. 188 Mach, Ernst: »Einfluß der vorausgehenden Untersuchungen auf die Auffassung der Physik«, in:
Die Analyse der Empfindungen, Jena, 1922, S. 5–6, Hervorh. i. O.
3 Denken | 115
»Die noch immer auftauchende Ansicht, dass die Sprache für jedes Denken unerlässlich sei, muss ich für eine Uebertreibung halten. Schon Locke hat dies erkannt, und auch dargelegt, dass die Sprache, indem sie die Gedanken fast niemals genau deckt, dem Denken sogar auch nachtheilig werden kann. Das anschauliche Denken, welches sich ausschliesslich in Association und Vergleichung der anschaulichen Vorstellungen, Erkenntniss der Übereinstimmung oder des Unterschiedes desselben bewegt, kann ohne Hülfe der Sprache vorgehen.«189
An späterer Stelle erklärt er allerdings, dass sprachliche Erläuterungen das anschauliche Denken klären. »Geleugnet soll nicht werden, dass auch anschauliche Vorstellungen durch sprachliche Beschreibung und die damit verbundene Zerlegung in Einfacheres und Bekanntes an Klarheit gewinnen.«190 Hier zeigt sich, dass Mach zwar die Einengung auf die Abstraktion kritisch beurteilt. Dennoch hat er keine ausgearbeitete Theorie der Konkretion entwickelt. William James Ein Autor, der bisher nicht erwähnt wurde, der aber deutlich gegen eine Dominanz der Abstraktion Stellung bezogen hat, ist William James. Seine Kritik am »Abstraktionismus« beschreibt prägnant, dass ein Denken, das sich allein auf Abstraktion stützt, der Wirklichkeit nicht gerecht wird. Seiner Meinung nach ist die Reduktion des Denkens auf die Abstraktion eine der größten Sünden des Rationalismus: »[R]educing the originally rich phenomenon to the naked suggestions of that name abstractly taken, treating it as a case of ›nothing but‹ that concept, and acting as if all the other characters from out of which the concept is abstracted were expunged.[…] Abstraction, functioning in this way, becomes a means of arrest far more than a means of advance in thought. […] The viciously privative employment of abstract characters and class names is, I am persuaded, one of the great original sins of the rationalistic mind.«191
Nelson Goodman Obwohl die Bedenken gegen eine Dominanz der Abstraktion im Denken immer wieder formuliert wurden, ist bis heute keine umfassende Theorie
189 Mach, Ernst: »Die Sprache«, in: Prinzipien der Wärmelehre, Leipzig, 1900, S. 412–413, Hervorh. i. O. 190 Mach, Ernst: »Die Sprache«, in: Prinzipien der Wärmelehre, Leipzig,1900, S. 413. 191 James, William: The Meaning of Truth, London, 1909, S. 249–250.
116 | Bildnerisches Denken
der Konkretion entwickelt worden. Wie erläutert gehört Nelson Goodman zu den wenigen Autoren, die sich explizit mit der Konkretion befasst haben. Sein erklärtes Ziel war dabei allerdings weniger, eine Theorie des Denkens zu entwerfen, sondern verschiedene Konstitutionssysteme – d. h. Systeme, die den Zusammenhang unserer Begriffe erklären und begründen – zu kategorisieren und gegeneinander abzuwägen.192 Dazu unterscheidet er grundsätzlich zwischen zwei Arten von Systemen – solche, die unser Begriffssystem durch Abstraktion und solche, die es durch Konkretion konstruieren. Goodman kennzeichnet die beiden Operationen der Abstraktion und Konkretion wie folgt: »The problem of interpreting qualitative terms in a particularistic system, of constructing repeatable ›universal‹ ›abstract‹ qualities from concrete particulars, I call the problem of abstraction. The problem of defining predicates pertaining to concrete individuals in a typical realistic system, of constructing unrepeatable concrete particulars from qualities, I call the problem of concretion. The two problems are so closely parallel that to explain one is to explain a good deal about the other.«193
Abstraktion ist also die Konstruktion wiederholbarer, abstrakter Qualitäten aus konkreten Partikularen. Konkretion ist die Konstruktion unwiederholbarer, konkreter Partikularen aus abstrakten Qualitäten. Diese allgemeine Erklärung ist sehr ähnlich zur hier getroffenen Unterscheidung zwischen Abstraktion und Konkretion. Letztere zielt im Sinne Goodmans ebenso auf die Charakterisierung eines Gegenstandes als einzigartig und »unwiederholbar« ab. In seinem Buch Structure of Appearance ist sein Bemühen allerdings sehr stark auf unser begriffliches Denken fokussiert, wie auch Hellman betont.194 Hingegen verdeutlicht Goodman an anderer Stelle, dass wir nicht nur durch begriffliche Systeme, sondern durch eine Vielzahl von Systemen die Welt ordnen und dadurch Welten konstruieren können: »And a variety of systems can be constructed. The mistake comes in thinking of such systems as devices for representing an antecedent reality. […] There are then many
192 Vgl. Proust, Joëlle: »Abstraction et concrétisation«, in: Dascal, Marcelo u. a. (Hg.):
Sprachphilosophie, Berlin, New York, 1996, S. 1205. 193 Goodman, Nelson: Structure of Appearance, Dordrecht, Holland, Boston, USA, 1977, S. 106, Hervorh. i. O. 194 Vgl. Geoffrey Hellman: »Introduction«, in: Structure of Appearance, Dordrecht, Holland, Boston, USA, 1977, S. XXIV.
3 Denken | 117
worlds if any«195, »a world is an artifact«.196 Er reflektiert ebenfalls, dass die Unterscheidung in Gleichartiges und Verschiedenartiges von dem jeweiligen System abhängt und keinesfalls durch die Welt vorgegeben ist: »Symbol systems are artefacts. Their syntactic and semantic features are not dictated by the domain, but result from decisions we make about how the domain is to be organized. And the systems we construct determine the similarities and differences we can recognize, the levels of precision we can produce, the degrees of determinateness we can achieve.«197
Aber offensichtlich scheint er eine Ordnung der Welt, die ohne allgemeine Kategorien und damit ohne Abstraktion auskommt, nicht in Betracht zu ziehen. Zumindest legt dies seine Beschreibung der dafür in Frage kommenden Systeme nahe. Sie können anscheinend nur entweder sprachlich oder in anderer Hinsicht kategorisierend sein.198 Daher ist es fraglich, ob Goodman Konkretion im hier erläuterten Sinn in Betracht gezogen hat. Kuno Lorenz Auch in der modernen Abstraktionstheorie sind bisher nur Ansätze einer Theorie zur Konkretion geliefert worden – u. a. von Kuno Lorenz. Die entsprechenden Artikel in der Enzyklopädie Philosophie Wissenschaftstheorie lassen zwar eine deutlich intensivere Beschäftigung mit der Abstraktion erkennen. Aber zumindest existiert im Gegensatz zu vielen anderen Lexika ein Artikel zur »Konkretion«, auch wenn dieser nur etwa ein Fünftel so lang ist wie der Artikel zur Abstraktion. Die »Konkretion« wird dabei – ähnlich wie schon von Goodman – als »die zur […] Abstraktion […] duale […] Operation«199 bezeichnet. »Dual« bedeutet, wie bereits erläutert, dass die Operationen in bestimmter Hinsicht symmetrisch zueinander sind.200 Entsprechend wird die Konkretion erklärt als eine »Überführung« eines Bereichs von Ge-
195 Goodman, Nelson; Catherine Z. Elgin: Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Scienc-
es, Indianapolis, 1988, S. 51. 196 Ebenda, S. 53. 197 Ebenda, S. 11. 198 Vgl. ebenda, S. 6–7. 199 Lorenz, Kuno: »Konkretion«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissen-
schaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2010, S. 298. 200 Vgl. Lorenz, Kuno: »dual/Dualität«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und
Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005, S. 249.
118 | Bildnerisches Denken
genständen in einen anderen Bereich von Gegenständen, »derart, daß erstere zu Typen und letztere zu Instanzen dieser Typen werden«201, also zu Einzelfällen. Als Beispiel wird der Übergang von Zahlen zu den Ziffern genannt, z. B. der Übergang von »der Zahl Drei« zu den Ziffern »3« oder »III«. Zwar werden hier die grundlegende Unterscheidung von Gleichartigem und Verschiedenartigem sowie die Fokussierung auf das Verschiedenartige nicht erwähnt. Das Beispiel verdeutlicht aber, dass hier im Unterschied zur kantischen Determination nicht einfach nur mehr Bestimmungen berücksichtigt werden. Der Übergang von den Zahlen zu den Ziffern ist kein gradueller, sondern ein grundsätzlicher. Dennoch ist das Verständnis von »Konkretion« in der Enzyklopädie sehr eng gefasst und bezieht sich anscheinend nur auf begriffliches oder mathematisches Denken – zumindest legen das die angeführten Beispiele nahe. Daher ist es hier ebenso fraglich, ob der für das Bildnerische Denken entwickelte Begriff von Konkretion mit dem Verständnis von Lorenz in Übereinstimmung gebracht werden könnte. Kamlah und Lorenzen Während Kuno Lorenz die Konkretion als gegenläufige Operation zur Abstraktion beschreibt, sucht man bei Kamlah und Lorenzen vergeblich nach einer Thematisierung der Konkretion. Für beide Autoren kommt eine zur Abstraktion alternative Weiterführung der Unterscheidung zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem nicht in Betracht. Die Gliederung der Welt ist für sie automatisch eine sprachliche Gliederung. Und diese kann nicht anders, als die Aufmerksamkeit auf das Gleichartige zu legen: »Die Sprache mit ihren Eigennamen und Prädikatoren ist es also, die uns unsere Welt ›immer schon‹ erschließt, immer schon bekannt und vertraut macht.«202 »In unserer sprachlich schon immer erschlossenen Welt erfassen wir das Einzelding auch als ein solches in der Regel zugleich schon als Exemplar von ….«203 Die Fokussierung auf das Gleichartige durch die Sprache scheint für Kamlah und Lorenzen sogar einem natürlichen Gesetz zu folgen. So betonen sie, dass die Sprache nur die natürlichen Eigenschaften der Welt wiedergibt: »Daß es aber überhaupt eine uns schon vertraute Welt gibt, in der das im-
201 Lorenz, Kuno: »Konkretion«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissen-
schaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2010, S. 298. 202 Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich, 1990, S. 46, Hervorh. i. O. 203 Ebenda, S. 49.
3 Denken | 119
mer neue Einzelne doch zumindest als Fall des schon bekannten Allgemeinen begegnet, erklärt sich nicht aus der Sprache, sondern daraus, daß in der Welt selbst die Wiederkehr von Gleichem stattfindet, zumal in der ›Natur‹.«204 3.1.4 Abstraktion und Konkretion als komplementäre Kriterien In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass Konkretion und Abstraktion als komplementäre Operationen aufgefasst werden können, weil beide dieselbe Grundoperation voraussetzen und weiterführen – das grundlegende Unterscheiden zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem. Diese gemeinsame Basis rechtfertigt es, nicht nur die Abstraktion, sondern auch die Konkretion als Denkleistung anzusehen. Beide Operationen haben zudem das Ziel, eine Sache näher zu charakterisieren. In der Abstraktion geschieht dies durch die Gemeinsamkeiten, die die entsprechende Sache mit anderen Sachen hat, in der Konkretion hingegen durch die Betonung der Aspekte, durch die sie sich von anderen unterscheidet. Die Grundoperation des Unterscheidens ist dabei eine notwendige Bedingung sowohl für das Abstrahieren wie auch für das Konkretisieren. Dennoch muss auf diese grundlegende Unterscheidung nicht zwingend eine der beiden Operationen folgen. In unserem Alltag erleben wir oft Situationen, in denen wir zwar einen Unterschied bemerken, aber nicht genau festmachen können, worin dieser Unterschied besteht und uns auch gar nicht weiter Gedanken darüber machen. Manchmal begegnen wir z. B. einer uns bekannten Person und stellen fest, dass sie irgendwie anders aussieht, als früher. Wir sind in einem solchen Fall nicht gezwungen, uns weiter zu überlegen, in welcher Hinsicht sie anders aussieht. Wir sind also in der Lage, Unterscheidungen in der Welt zu treffen, ohne über Kriterien dieser Unterscheidung zu verfügen. Falls wir dennoch nach einem Unterscheidungskriterium suchen, stellen wir möglicherweise überrascht fest, dass die Person eine andere Frisur hat oder nun eine Brille trägt. Erst jetzt haben wir Kriterien des Unterscheidens. Die Art der Kriterien, die wir entwickeln, richtet sich danach, ob wir die grundlegende Unterscheidung abstrahierend oder konkretisierend weiterführen. Wir können uns also zwischen den beiden Denkarten entscheiden. Die Frage nach dem Kriterium für diese Entscheidung kann in Anlehnung an einen Gedankengang von Mittelstraß beantwortet werden. Dieser argumentiert dafür, dass die »ersten Unterscheidungen«, die in den elementaren
204 Ebenda, S. 51.
120 | Bildnerisches Denken
Prädikationen zum Ausdruck kommen, durch Bedürfnisse bestimmt sind. Die Unterscheidungen werden so getroffen, dass sie möglichst praktikabel für die Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses sind.205 Die Entscheidung für eine der beiden Denkarten wird durch ähnliche Faktoren bestimmt. Für manche Zwecke eignet sich die Charakterisierung durch Abstraktion besser, für andere hingegen die durch Konkretion. Liegt es beispielsweise in unserem Interesse, eine uns bekannte Person trotz veränderter Kleidung oder Frisur als dieselbe zu identifizieren, ist es ratsam, sich auf das zu konzentrieren, was bei allen unseren Begegnungen mit dieser Person gleichartig bleibt. Entsprechende Kriterien entwickeln wir dann beim abstrahierenden Betrachten der Person. Bittet uns die Person hingegen in der Frage um Rat, für welches Brillengestell sie sich entscheiden soll, ist es nötig, konkretisierend auf die kleinen Unterschiede in der Wirkung des Gesichts zu achten, die durch die unterschiedlichen Brillenformen verursacht werden. Ähnliches spielt sich häufig beim Betrachten eines Portraits ab. Kennt der Betrachter die portraitierte Person, dann ist er in der Regel sehr gut in der Lage festzustellen, ob das Portrait der Person ähnlich sieht oder nicht. Das bedeutet, er bemerkt einen Unterschied im Aussehen der Person auf dem Bild zur portraitierten Person. Das heißt aber nicht automatisch, dass er auch genau angeben kann, worin – genauer hinsichtlich welcher Kriterien – dieser Unterschied besteht. Wäre dem so, dann müsste er in der Lage sein, das Portrait entsprechend zu ändern. Er müsste also ein guter Porträtist sein. Die Fähigkeit, ein Portrait mit seinem Modell zu vergleichen und einen Unterschied zu bemerken, tritt aber nicht immer gemeinsam mit der Fähigkeit auf, ein gutes Portrait selbst anzufertigen. Für letzteres muss man im Konkretisieren sehr genaue Kriterien des Unterscheidens entwickeln, für ersteres nicht. Das bloße Wiedererkennen der Person, beispielsweise anhand besonders markanter Merkmale wie eine Frisur oder eine bestimmte Brille, ist Sache des Abstrahierens. Um die entsprechende Frisur oder das Brillengestell aber mit malerischen Mitteln genau in Farbe und Form wiederzugeben, ist konkretisierendes Denken nötig. Es gibt auch Fälle, in denen beide Denkformen ineinander greifen, z. B. bei der professionellen Analyse eines Kunstwerkes. Solche Fälle werden im Kapitel 3.4.3 näher erörtert. Dabei wird deutlich, dass trotz ihres Ineinandergreifens beide Prozesse klar voneinander unterschieden werden können.
205 Vgl. Mittelstraß, Jürgen: »Die Prädikation und die Wiederkehr des Gleichen«, in: ders.: Die
Möglichkeit von Wissenschaft, Frankfurt a. M.,1974, S. 154–155.
3 Denken | 121
3.2
F AKTOREN DES D ENKENS : V OLLZUG UND G EGENSTANDSBEZUG Bisher wurden die beiden Kriterien der Abstraktion und Konkretion auf das Denken insgesamt bezogen. In diesem Kapitel wird nun zwischen zwei Faktoren des Denkens unterschieden: dem Vollzug und dem Gegenstandsbezug. Abstraktion und Konkretion im bisher beschriebenen Sinne sind nähere Bestimmungen des Vollzugs des Denkens. Der Unterschied zwischen ihnen ist deutlich und ohne fließenden Übergang. Im Gegensatz dazu wird eine neue Verwendung von »abstrakt« und »konkret« eingeführt. In einem relativen Sinne dienen beide Begriffe der näheren Bestimmung des Gegenstandsbezuges. Dieser kann graduell abstrakter oder konkreter sein. Die Grenze zwischen beidem ist fließend. Die Differenzierung des Denkens in die beiden Faktoren ermöglicht den Aufbau einer Systematik, mit der man die umgangssprachliche bzw. kunstwissenschaftliche Charakterisierung von Bildern als »konkret« oder »abstrakt« begründen kann, wie im Kapitel 5.3 gezeigt wird. Die hier getroffene Unterscheidung zwischen einer absoluten und einer relativen Verwendung der Begriffe »abstrakt« und »konkret« hat Vorläufer in der Philosophiegeschichte. Sowohl Kant als auch einige Autoren der modernen Abstraktionstheorie nehmen eine solche Unterscheidung vor. Nachfolgend wird zunächst die Unterscheidung zwischen der absoluten und der relativen Bedeutung von »abstrakt« und »konkret« so erläutert, wie sie hier verstanden wird. Es wird dargelegt, wie mithilfe dieser Differenzierung die beiden Faktoren des Denkens näher bestimmt werden können (3.2.1). In einem anschließenden Vergleich mit ähnlichen Differenzierungen anderer Autoren klären sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede (3.2.2). Der abschließende Vergleich mit dem Vokabular von Nelson Goodman zeigt große Übereinstimmungen zur hier getroffenen Unterscheidung, obwohl Goodman ganz andere Begriffe verwendet (3.2.3). 3.2.1 »Abstrakt« und »konkret« im absoluten und relativen Sinn Im Modell des Bildnerischen Denkens bezieht sich die absolute Verwendung von »abstrakt« und »konkret« immer auf den Vollzug des Denkens. Die bisherige Unterscheidung zwischen Abstraktion und Konkretion kann daher wie folgt präzisiert werden: Entspricht der Vollzug des Denkens der Abstraktion, kann das Denken »abstrahierend« genannt werden. Beim »konkretisierenden« Denken hingegen vollzieht sich das Denken durch Konkretion. Der Unterschied zwischen beiden Denkarten ist nicht graduell, sondern grundsätzlich. Relativ »konkret« oder »abstrakt« hingegen kennzeichnet den Gegenstandsbezug des Denkens näher. Aus dieser graduellen Unterscheidung
122 | Bildnerisches Denken
ergibt sich ein ebenfalls gradueller Unterschied zwischen abstrakteren oder konkreteren Gegenständen des Denkens. In der Differenzierung des Denkens in zwei Faktoren spiegelt sich also die Unterscheidung zwischen der absoluten und der relativen Bedeutung von »abstrakt« und »konkret«. Im Folgenden wird am Beispiel einer Bildproduktion gezeigt, was unter einem »abstrahierenden« oder »konkretisierenden« Vollzug des Denkens zu verstehen ist (3.2.1.1) und wodurch sich ein abstrakterer von einem konkreteren Gegenstandsbezug des Denkens unterscheidet (3.2.1.2). 3.2.1.1 Abstrahierender und konkretisierender Vollzug des Denkens Wie bereits am Prozess der Bildrezeption gezeigt (siehe Kapitel 3.1.2.3), kann nur das konkretisierende Denken die spezifischen Probleme lösen, die Bildhaftigkeit ausmachen, d. h. die bildnerisch sind. Während es in der Bildrezeption darum ging, die Bildhaftigkeit zu erkennen, zielt die Bildproduktion darauf ab, diese herzustellen. Ein Produzent, der rein abstrahierend denkt, stellt daher eigentlich kein Bild her, auch wenn sein Produkt später von einem Rezipienten als Bild betrachtet werden kann. Oft liegt genau darin der Unterschied zwischen einem laienhaften und einem professionellen Bildgestalter: Während viele Laien bei der Herstellung eines Bildes abstrahierend denken, geht der Professionelle konkretisierend vor. Hierbei wird erneut deutlich, dass die Unterscheidung zwischen den Denkarten sich nicht mit der Unterscheidung zwischen sprachlichen und visuellen Medien deckt. Beide Denkarten können in beiden Medienarten zum Ausdruck kommen. Wie oben ausgeführt, bestimmt das abstrahierende Denken eine Sache dadurch, dass es auf die Gleichartigkeit der entsprechenden Sache mit anderem verweist. Das konkretisierende Denken hingegen legt die Aufmerksamkeit auf die Unterschiede zu anderem. Angewendet auf das Produzieren eines Portraits, führen beide Denkarten zu unterschiedlichen Vorgehensweisen, die in Tabelle 5 dargestellt sind. Im Abstrahieren wird eine Person dadurch charakterisiert, dass auf die Gemeinsamkeiten Bezug genommen wird, die sie mit anderen Personen hat. Diese bestehen u. a. darin, dass die Person zwei Augen, eine Nase und einen Mund besitzt. Diese Gesichtsteile werden beim Abstrahieren nicht als individuelle, einmalige Form- und Farbzusammensetzungen wahrgenommen, sondern als Schemata. Daher ist es sinnvoll, Schemata von Bildern, die konkretisierendes Denken erfordern, zu unterscheiden, wie an anderer Stelle (Kapitel 3.4.2.2) näher ausgeführt wird. In der Psychologie werden Schemata beschrieben als »Modelle eines Teils unserer Umwelt und unserer Erfahrungen. Sie sind mentale Repräsentationen, zum Beispiel […] einer Klasse
3 Denken | 123
von Objekten«.206 Die Schemata für »Auge«, »Nase« oder »Mund« sehen in etwa so aus wie auf den Ausschnitten aus Abb. 7. Solche oder ähnliche Formen erkennen wir als »Auge«, »Nase« und »Mund«, obwohl ihre Ähnlichkeit mit dem Wahrnehmungseindruck, den wir von echten Nasen, Augen und Mündern haben, zumindest fraglich ist. VOLLZUG UND GEGENSTANDSBEZUG DES DENKENS am Beispiel: Portraitieren einer Person
GEGENSTANDSBEZUG
KONKRETISIEREND
d. h. erkennen
d. h. erkennen
von typischen Gesichtsteilen
von Farben & Formen
mithilfe von Schemata
ohne Schemata
Augen
Nase
Mund
▼
▼
▼
Ausschnitte aus Abb. 7
Ausschnitte aus Abb. 9 und Abb. 10
ABSTRAKTER KONKRETER
ABSTRAKTER KONKRETER
d.h. beachten von mehr oder weniger
d.h. beachten von mehr oder weniger
Bestimmungen des Gegenstandes
Bestimmungen des Gegenstandes
Gegenstand des Denkens
VOLLZUG
ABSTRAHIEREND
Abb. 7
Abb. 8
Abb. 7: Zeichnung eines Gesichts Abb. 8: Farbiges Portrait
Abb. 9
Abb. 10
Abb. 9: Dürer: »Portrait der Mutter« Abb. 10: Dürer: »Porträt der Barbara Dürer«
Tabelle 5: Vollzug und Gegenstandsbezug des abstrahierenden und konkretisierenden Denkens am Beispiel Jemand, der abstrahierend vorgeht, erstellt sein Portrait also mit Hilfe dieser visuellen Schemata. Sie lassen ihn in seiner Beobachtung das Gesicht als Gesicht erkennen. Dabei werden nur solche Merkmale des Gesichtes beo206 Becker-Carus, Christian: Allgemeine Psychologie, München, 2004, S. 415, Hervorh. i. O.
124 | Bildnerisches Denken
bachtet, die für das jeweilige visuelle Schema relevant sind. Die visuellen Schemata können aber nicht nur bei der Wahrnehmung, sondern auch bei der Reproduktion des Wahrgenommenen aktiviert sein.207 Dann vollzieht sich auch das Herstellen des Portraits abstrahierend, genauer schematisierend. Die visuellen Schemata für die Gesichtsteile werden so angeordnet, dass man darin das Gesichtsschema erkennt. Das abstrahierende Denken arbeitet sowohl bei der Rezeption als auch bei der Produktion eines Portraits schematisierend. Die visuellen Schemata funktionieren hier wie »gezeichnete Wörter« – ganz ähnlich den geschriebenen Wörtern »Auge«, »Nase« und »Mund«. Sie dienen dazu, Gegebenheiten in der Welt zu klassifizieren, das heißt, sie als gleichartig zu anderen Gegebenheiten zu charakterisieren. Das Ergebnis dieses abstrahierenden Vorgehens könnte wie Abb. 7 oder Abb. 8 aussehen. Die Merkmale, die das Gesicht im Unterschied zu allen anderen Gesichtern auszeichnet, sind weitgehend irrelevant. Im konkretisierenden Verfahren entsteht das Portrait ganz anders. Zur Charakterisierung einer Person untersucht der Maler die Merkmale, die das Gesicht der Person von allen anderen unterscheidet. Dies ist nur möglich, wenn er sich gerade nicht auf die geläufigen visuellen Schemata für ein Gesicht oder für Gesichtsteile stützt. Stattdessen versucht er, die einmaligen Farb- und Formkonstellationen so genau wie möglich zu beobachten und wiederzugeben (vgl. Ausschnitte aus Abb. 9 und Abb. 10). Das Portrait wird nicht aus benennbaren Schemata zusammengesetzt, sondern aus Farb- und Formzusammensetzungen, die meistens nicht benennbar sind. In der Regel gibt es in der Sprache keine Prädikate für sie, weil sie so nur in diesem einen Portrait vorkommen. Eine Orientierung an den (benennbaren) Schemata ist beim Konkretisieren sogar hinderlich, da die Schemata die Aufmerksamkeit von den Unterschieden weglenken, wie Thomas Städtler bestätigt: »Einmal aktivierte Schemata lösen Erwartungen aus, die dazu führen, dass gezielt nach Informationen gesucht wird, die die dazu eröffneten Leerstellen ausfüllen. Die schemabezogene Information erhält dadurch mehr Aufmerksamkeit«208 Das Ergebnis des konkretisierenden Vorgehens könnte wie die Zeichnung oder das Gemälde von Albrecht Dürer aussehen (Abb. 9 und Abb. 10), die beide seine Mutter zeigen. Sie wird in beiden Portraits durch einmalige Farb- und Formzusammensetzungen charakterisiert, z. B. durch die einmalige Form ihrer Nase, die durch den Begriff »Nase« oder durch das visuelle Schema »Nase« gerade nicht erfasst werden kann.
207 Vgl. ebenda, S. 417. 208 Städtler, Thomas: »Schema«, in: ders.: Lexikon der Psychologie, Stuttgart, 2003, S. 952.
3 Denken | 125
Die hier erfolgte Zuordnung der Abbildungen (Abb. 7 – Abb. 10) zu einer der beiden Denkarten ist allerdings nicht eindeutig möglich und wurde daher lediglich im Konjunktiv vorgenommen. Nur aufgrund des Ergebnisses kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob der Produzent beim Herstellen eines Bildes abstrahiert oder konkretisiert hat. Jede einzelne Form in den Gesichtern auf Abb. 7 oder Abb. 8 kann auch ein Ergebnis des konkretisierenden Denkens sein. In diesem Fall müsste man die Darstellungen so deuten, dass jede kleinste Abweichung vom visuellen Schema ein bewusst gesetzter Unterschied wäre. Dies würde beispielsweise bei Abb. 7 die verschobene Position des linken Auges betreffen, den leicht schielenden Blick oder die unsymmetrische Nase. Zudem wäre der Gegenstand, den das Bild zeigt, nicht die äußere Erscheinung einer Person, da beobachtbare Gesichter nicht so aussehen, wie das Gesicht, das auf dem Bild zu sehen ist. Stattdessen könnte es sich beispielsweise um die Darstellung einer Geistererscheinung handeln. Wenn aber der Bildproduzent von Abb. 7 mit seinem Bild ein beobachtbares Gesicht zeigen möchte, dann ist ihm sein Vorhaben misslungen, anders ausgedrückt: dann sind seine Fähigkeiten im Konkretisieren – oder genauer: im Bildnerischen Denken – sehr gering. Es ist jedoch auch möglich, dass einem Bildproduzenten das Konkretisieren in manchen Aspekten besser gelingt als in anderen. Als Vorgriff auf Kapitel 3.4.3 soll hier erwähnt werden, dass konkretisierendes und abstrahierendes Denken auch ineinander greifen können. Ein solches Ineinandergreifen kann man bei der Entstehung des Bildes auf Abb. 8 vermuten. Während die Formen der Augen, der Nase und des Mundes stark schematisch sind, scheint die Hautfarbe genauer beobachtet worden zu sein. Dies sieht man daran, dass der Hautton keinem fertig gemischten Ton im Farbkasten entspricht. Außerdem variiert der Farbton innerhalb des Gesichtes. Die Wangen, die Nase sowie der Hals zeigen unterschiedliche Farbnuancen. Auch die Tatsache, dass die Lippen nicht rot sind, wie es dem visuellen Schema entsprechen würde, sondern in einem leicht rötlichen Hautton gemalt sind, spricht dafür. Diese Beobachtungen legen die Vermutung nahe, dass der Bildproduzent hinsichtlich der Hautfarbe konkretisierend vorgegangen ist, während die Gesichtsformen schematisch sind, d. h. abstrahierend hergestellt wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Unterschied zwischen dem abstrahierenden und dem konkretisierenden Vollzug des Denkens qualitativ ist und daher übergangslos. Das Unterscheidungskriterium besteht darin, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet wird – auf das Gleichartige oder das
126 | Bildnerisches Denken
Verschiedenartige. Beide Denkarten können sich auf graduell abstraktere oder konkretere Gegenstände richten, wie im Folgenden erläutert wird. 3.2.1.2 Abstrakter und konkreter Gegenstandsbezug des Denkens Der relative Unterschied zwischen »abstrakt« und »konkret« betrifft den Gegenstandsbezug des Denkens. Dieser Bezug entspricht der Relation, in die wir uns stellen, wenn wir über etwas nachdenken. Der Begriff »Gegenstand« soll hier ähnlich wie von Carnap in einem sehr weiten Sinn verstanden werden: »Der Ausdruck ›Gegenstand‹ wird hier stets im weitesten Sinne gebraucht, nämlich für alles das, worüber eine Aussage gemacht werden kann. Danach zählen wir zu den Gegenständen nicht nur Dinge, sondern auch Eigenschaften und Beziehungen, Klassen und Relationen, Zustände und Vorgänge, ferner Wirkliches und Unwirkliches.«209
In Analogie zu Carnap soll unter »Gegenstand des Denkens« alles verstanden werden, worüber wir nachdenken bzw. worauf wir uns im Denken beziehen. Der Gegenstand des Denkens ist nicht unabhängig vom Denken und damit von einem bestimmten Vollzug des Denkens zugänglich. Das bedeutet, dass es keinen objektiven Standpunkt gibt, von dem aus man beispielsweise beurteilen könnte, welche der beiden Denkarten einen Gegenstand besser erfasst. Der Gegenstand des konkretisierenden Denkens ist ein anderer als der Gegenstand des abstrahierenden Denkens, selbst wenn sich das Denken in beiden Vollzügen anscheinend auf denselben Teil der Welt bezieht. Das, was von diesem Teil der Welt für die beiden Denkarten in Betracht gezogen wird, ist nicht dasselbe. Gegenstand des Bildnerischen Denkens kann alles sein, worüber wir uns – im wörtlichen Sinn – ein Bild machen können. In den Prozessen der Bildrezeption und -produktion ist dies der Bildgegenstand. Beim Herstellen eines Portraits ist der Bildgegenstand die portraitierte Person. Das heißt, dass die Person im Prozess der Bildproduktion für den Produzenten nur bezogen auf dieses Portrait in Betracht kommt. Im Malen des Portraits entsteht der Bildgegenstand, und das Bild zeigt, wie der Maler die Person betrachtet. Die Person wird durch diese Betrachtung zu einem Teil der Welt des Malers. Die Person als solche ist unabhängig von dieser bildnerischen Betrachtung oder einer anderen Art der Betrachtung nicht zugänglich. Es ist also nicht möglich, das Portrait mit der Person als solcher zu vergleichen.
209 Carnap, Rudolf: Der logische Aufbau der Welt, Hamburg, 1966, S. 1.
3 Denken | 127
Alles, was miteinander verglichen werden kann, sind Charakterisierungen der Person durch unterschiedliche Betrachtungsarten. Das bedeutet aber nicht, dass bei einem Portrait nicht darüber gesprochen werden kann, ob es dem Portraitierten ähnlich sieht oder nicht. Zwar hat ein Betrachter zum Portraitierten nur Zugang, insofern der Portraitierte Teil der Welt dieses Betrachters ist. Und jeder Betrachter hat seine eigene Welt. Aber wir teilen große Bereiche unserer Welten miteinander. Wir können diese Bereiche einander mitteilen und uns damit dem anderen mitteilen. Das liegt u. a. daran, dass unsere Körper ähnlich aufgebaut sind und wir daher ähnliche Erfahrungen in der Welt machen. Wir teilen mit vielen Menschen dieselbe Umwelt, dieselbe Sprache, dieselbe Kultur, dieselben Wahrnehmungsbedingungen etc. Daher ist es uns möglich, auch unsere Wahrnehmungseindrücke miteinander zu teilen und zu besprechen, und in der Regel sind wir uns in vielen unserer Wahrnehmungsurteile einig. Ein Betrachter kann seinen Wahrnehmungseindruck von der portraitierten Person mit dem Wahrnehmungseindruck des Bildes vergleichen und das Ergebnis seines Vergleichs mit einem anderen Betrachter besprechen. Je nachdem, welche Denkart sie dabei vollziehen, werden sie ähnliche oder unterschiedliche Ansichten über das Betrachtete haben. Wenn sie beide bildnerisch denken, werden ihre Ansichten ähnlicher sein, als wenn der eine bildnerisch, der andere hingegen abstrahierend denkt. Für die Beispiele in Tabelle 5 heißt das, dass der Bildgegenstand der beiden Portraits von Dürers Mutter (Abb. 9 und Abb. 10) vom konkretisierenden Standpunkt aus gesehen nicht derselbe ist. Der Bildgegenstand der Zeichnung ist im Vergleich zum Gemälde weniger bestimmt. Der Bezug des Denkens zum Bildgegenstand, d. h. zur portraitierten Person, kann daher als »relativ abstrakt« bezeichnet werden. Der relative Unterschied zwischen einem abstrakteren und einem konkreteren Gegenstandsbezug betrifft also die Menge der Bestimmungen, durch die der Bildgegenstand charakterisiert wird. Beispielsweise beschränkt sich der Zeichner auf Umrisslinien und lässt alle farbigen Bestimmungen außer Acht. Da der Bildgegenstand durch diese relativ abstrakte Bezugnahme des Denkens überhaupt erst konstituiert wird, kann auch der Gegenstand des Denkens selbst als relativ abstrakt bezeichnet werden. Für den Zeichner ist der Gegenstand seines Denkens bzw. der Bildgegenstand farblos und damit abstrakter als der Bildgegenstand des Gemäldes, das die portraitierte Person nicht nur durch gezeichnete Formen, sondern auch mit Hilfe farbiger Bestimmungen charakterisiert. Beim abstrahierenden Denken gibt es denselben graduellen Unterschied zwischen einem abstrakteren und einem konkreteren Gegenstand des Denkens. So ist
128 | Bildnerisches Denken
auch der Gegenstand der Zeichnung in Abb. 7 abstrakter bestimmt als der Gegenstand in Abb. 8. Für einen abstrahierenden Produzenten oder Rezipienten können die beiden Darstellungen auf Abb. 7 und Abb. 8 aber auch denselben Gegenstand zeigen. Dies ist dann der Fall, wenn der Betrachter so von den Unterschieden beider Bilder abstrahiert, dass er nur noch ihre Gemeinsamkeiten beachtet, z. B. das schematische Gesicht. Die Unterschiede in den Formen der visuellen Schemata sowie die unterschiedliche Farbgebung kommen dann für ihn nicht in Betracht. Der Gegenstand dieses abstrahierenden Denkens könnte hier auch sehr gut sprachlich erfasst werden, z. B. mit dem Prädikat »Gesicht« oder auch »Mensch«. Die Menge der Bestimmungen, die im Bezug des Denkens zum Gegenstand beachtet werden, entspricht also der Menge der Bestimmungen, mit denen der Gegenstand charakterisiert wird. Daher muss nicht unbedingt zwischen dem Gegenstandsbezug und dem Gegenstand des Denkens unterschieden werden. In einer vereinfachten Redeweise kann unterschiedslos vom Gegenstandsbezug wie auch vom Gegenstand des Denkens gesprochen werden. Vergleichsweise konkreter sind der Gegenstandsbezug und der Gegenstand des Denkens dann, wenn die Menge der beachteten Bestimmungen vergleichsweise groß ist. Das Kriterium zur Unterscheidung zwischen einem abstrakten und einem konkreten Gegenstandsbezug bzw. Gegenstand ist daher quantitativ. Die Grenze zwischen beidem ist nicht scharf, sondern besteht in einem fließenden Übergang. 3.2.1.3 Gliederung der Welt durch das Denken Der Gegenstand des Bildnerischen Denkens ist identisch mit dem Bildgegenstand. Das bedeutet, dass durch das Bildnerische Denken bzw. durch das Bild ein Teil der Welt überhaupt erst als Gegenstand des Denkens in Betracht kommt. In Bezug auf das sprachliche Denken haben Kamlah und Lorenzen das Verhältnis von »Welt« und »Gegenstand« folgendermaßen beschrieben: »Ähnlich wie ›Gegenstand‹ nur scheinbar ein Prädikator ist, so ist ›die Welt‹ nur scheinbar ein Eigenname (oder gar ein ›Begriff‹, ein Prädikator). Nur in der Welt können wir Gegenstände ausgrenzen, so daß die Welt nicht selbst ein von anderem abgrenzbarer Gegenstand ist.«210 »Somit ist die Welt in gar keinem Sinne die bloße Summe oder die Menge der Gegenstände (was ja oft behauptet wird). Sie ist aber auch nicht selbst ein Gegenstand (da nur ›in der Welt‹ Gegenstände durch Prädikatoren ausgegrenzt werden), was ferner heißt: ›Die Welt‹ ist kein Eigenname, obwohl sich dieses Wort ›so anhört‹
210 Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich, 1990, S. 52.
3 Denken | 129
(ähnlich nämlich wie ›die Erde‹, ›die Sonne‹), sondern – ähnlich wie ›Gegenstand‹ – ein Wort sui generis, dessen Gebrauch wir ›synsemantisch‹ einüben«.211
Analog dazu kann man das Verhältnis von Bildgegenstand und Welt beschreiben: Der Gegenstand des Bildnerischen Denkens bzw. der Bildgegenstand wird in der Welt durch das Bildnerische Denken bzw. durch das Bild »ausgegrenzt«. Das Bild zeigt den Bildgegenstand und damit den Gegenstand des Denkens. Es existieren also nicht einerseits ein Bildgegenstand und andererseits ein Gegenstand des Denkens in der Welt, auf den der Bildgegenstand verweist. Der Teil der Welt, der durch das Bild als Gegenstand des Denkens eingegrenzt wird, ist unabhängig von dem Bild überhaupt nicht zugänglich. Durch das Herstellen der Verbindung vom Bild zur Welt wird ein Teil der Welt vom Rest der Welt abgegrenzt. So wird die Welt durch das Bild gegliedert und muss nicht schon gegliedert sein. Ähnlich beschreibt Lambert Wiesing das Verhältnis von Bildgegenstand und Wirklichkeit: »Zeigt ein Bild einen Gegenstand, so fällt die Sichtbarkeit mit der ganzen Wirklichkeit zusammen, denn die Sichtbarkeit ist im Bild alles, was von einem Gegenstand gegeben ist; Gegenstand und Sichtbarkeit sind in der Darstellung – und zwar nur in der bildlichen Darstellung – identisch: Die Gegenstände des Bildes haben keine Substanz, sie sind Phantome. […] Zur Wirklichkeit des Bildes gibt es nur einen Zugang: hinsehen.«212
Wie wir die Welt durch die Sprache und ihre Prädikate – d. h. durch sprachliches bzw. begriffliches Denken – gliedern, können wir sie auch durch Bilder – genauer durch Bildnerisches Denken – ordnen. Die Frage, wie diese Welt beschaffen ist, bevor wir sie mit Hilfe von Sprache oder Bildern gliedern, ist unsinnig, wie Mittelstraß treffen erklärt hat: »Die ›immer schon‹ gegliederte Welt, das ist jetzt die Welt derer, die vor uns waren, deren Unterscheidungen wir lernen, und die ›immer wieder‹ vollzogene sprachliche Gliederung der Welt ist das, was wir dann in unseren eigenen Unterscheidungen […] tun. Damit wird aber zugleich erneut deutlich, daß der Versuch, von einer gegliederten Welt zu sprechen, die unseren sprachlichen Gliederungen noch vorausginge, über tautologische Aussagen nicht hinwegkäme.«213 »Was unseren Gliederungen, sprich Unterscheidungen, vorausgeht, sind eben andere Unterscheidungen, übernommene, verworfene
211 Ebenda, S. 49. 212 Wiesing, Lambert: Die Sichtbarkeit des Bildes, Frankfurt a. M., 2008, S. 162, Hervorh. i. O. 213 Mittelstraß, Jürgen: »Die Prädikation und die Wiederkehr des Gleichen«, in: ders.: Die Möglich-
keit von Wissenschaft, Frankfurt a. M., 1974, S. 155.
130 | Bildnerisches Denken
oder präzisierte; und alles, was sich darüber hinaus noch sagen läßt, ist lediglich, daß diese Unterscheidungen ›in der Welt‹ getroffen werden. In ›welcher‹ Welt, das läßt sich dann wiederum nur über schon erfolgte Unterscheidungen erfahren.«214 »Der triviale, fast ein wenig paradox klingende Satz, daß sich ohne (sprachliche) Unterscheidungen über die Welt nicht sprechen läßt, bewahrheitet sich so aufs neue.«215
Mittelstraß zufolge ist es unsinnig, danach zu fragen, welche Unterscheidung wir mit einem Prädikat in der Welt vornehmen, ohne das Prädikat selbst zu verwenden oder es durch ein Synonym zu ersetzen. Das Prädikat bezeichnet eben genau das, was es bezeichnet und unser genauester Zugriff auf dieses Etwas ist die Verwendung dieses Prädikates. Ebenso verhält es sich mit Bildern. Auch mit Bildern bzw. durch Bildnerisches Denken nehmen wir eine Unterscheidung in der Welt vor, die am exaktesten durch das Bild selbst gezeigt wird. Durch Prädikate wird die Welt gegliedert. Was die Prädikate meinen, kann man nur dadurch verstehen, dass man sie richtig verwenden lernt. Analog dazu verhält es sich bei Bildern: Durch Bilder wird die Welt gegliedert. Was Bilder meinen, kann man nur dadurch verstehen, dass man sie richtig verwenden lernt, d. h. dass man lernt, bildnerisch zu denken. Auch Gottfried Boehm zufolge können Bilder »entscheiden, […] was die Welt ›ist‹. Wer sie anders anzuschauen vermag, ist ihr gewiss so nahe wie derjenige, der seine Begriffe verändert.«216. Dieser Bezug zur Welt besteht nach Boehm auch bei abstrakten Gemälden. Sie sind nicht einfach nur selbstreferenziell, sondern können ebenso wie gegenständliche Gemälde auf die Welt bezogen werden: »Abstrakte Kompositionen von Kandinsky, Mondrian oder Malewitsch begründen auf sehr unterschiedliche Weise eine Metaphorik von ›Welt‹ bzw. ihrer Zustände.«217 Der »triviale« Satz von Mittelstraß kann daher folgendermaßen für Bilder ergänzt werden: »Ohne (sprachliche) Unterscheidungen lässt sich über die Welt nicht sprechen. Ohne (bildnerische) Unterscheidungen lässt sich über die Welt kein Bild machen.« Sowenig die Unterscheidungen, die für das Sprechen über die Welt nötig sind, bildnerisch sein müssen, sowenig müssen die Unterscheidungen, die für das Bildermachen über die Welt nötig sind, sprachlich sein.
214 Ebenda, S. 155–156. 215 Ebenda, S. 157. 216 Boehm, Gottfried: »Einführung«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen, Berlin, 2007, S. 14. 217 Ebenda, S. 12.
3 Denken | 131
3.2.2 Absolut und relativ »abstrakt« und »konkret« in anderen Theorien Eine Differenzierung zwischen der absoluten und der relativen Bedeutung der beiden Begriffe »abstrakt« und »konkret« ist sowohl in der modernen Abstraktionstheorie als auch bei Immanuel Kant zu finden. Im Folgenden wird ein Vergleich mit diesen Vorläufern vorgenommen. Die hier getroffene Unterscheidung steht dabei der kantischen näher, weil Kant nicht nur von der relativen, sondern auch von der absoluten Bedeutung Gebrauch macht. In der modernen Abstraktionstheorie werden dagegen die Begriffe »abstrakt« und »konkret« in der Regel nur in ihrem relativen Unterschied verwendet, da ihre absolute Unterscheidung als veraltet angesehen wird und der klassischen Abstraktionstheorie zugeordnet wird. Im Folgenden wird zunächst der Ansatz der modernen Abstraktionstheorie erläutert (3.2.2.1). Im Anschluss daran wird die kantische Unterscheidung erörtert und mit der hier getroffenen Differenzierung verglichen (3.2.2.2). 3.2.2.1 Moderne Abstraktionstheorie Die explizite Reflexion einer absoluten und einer relativen Bedeutung von »abstrakt« und »konkret« ist verhältnismäßig neu in der modernen Abstraktionstheorie. Bob Hale thematisiert in der Routledge Encyclopedia of Philosophy diesen Unterschied nicht, sondern geht von der absoluten Bedeutung aus: »Abstract objects can be neither seen nor heard, nor can they be tasted, felt or smelled.«218 Gideon Rosen hingegen spricht in der Stanford Encyclopedia of Philosophy zumindest an, dass es noch kein klares Kriterium für die Unterscheidung von abstrakt und konkret gibt: »We may know how to classify things as abstract or concrete by appeal to intuition. But in the absence of theoretical articulation, it will be hard to know what (if anything) hangs on the classification.«219 Eine Bemerkung Siegwarts lässt ebenfalls darauf schließen, dass zumindest bis vor einigen Jahren noch nicht abschließend geklärt war, ob der Gegensatz zwischen abstrakt und konkret ein absoluter oder ein relativer ist: »Um Mißverständnisse […] zu vermeiden, möchte ich […] eigens ›verraten‹, daß ich […] das Begriffspaar ›abstrakt‹/›konkret‹ ausschließlich im relativen Sinn verwende«.220
218 Hale, Bob: »Abstract objects«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 1998, [ohne Seitenangabe]. 219 Rosen, Gideon: »Abstract Objects«, in: Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philo-
sophy, Frühjahr 2012, [ohne Seitenangabe]. 220 Siegwart, Geo: »›Die fundamentale Methode der Abstraktion‹«, in: Zeitschrift für philosophische
Forschung, 1993, S. 612.
132 | Bildnerisches Denken
In der Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie wird erst in der aktuell erscheinenden zweiten Auflage das absolute und das relative Verständnis der beiden Begriffe thematisiert. In allen Artikeln, die Kuno Lorenz zu dem Themenkreis Abstraktion und Konkretion verfasst hat,221 wird explizit oder implizit – durch entsprechende Verweise – zwischen der relativen und der absoluten Bedeutung unterschieden. Lorenz beschreibt die relative Bedeutung als diejenige, »bei der von einem (partikularen) Gegenstand nur unter Bezug auf einen Bereich konkreter (partikularer) Gegenstände, aus denen er durch die Operation der Abstraktion hervorgegangen ist, ›abstrakt‹ ausgesagt werden kann«222. Die absolute Bedeutung kennzeichnet »Gegenstände[, die] nur dem Denken, nicht aber der (sinnlichen) Wahrnehmung zugänglich sind.«223 Laut Lorenz werden die Begriffe »abstrakt« und »konkret« in der modernen Abstraktionstheorie nur in ihrer relativen Bedeutung verwendet.224 Lorenz’ Beschreibung des absoluten Unterschieds stimmt mit dem hier getroffenen nur insoweit überein, als beide Differenzierungen durch ein qualitatives Kriterium entstehen: die sinnliche Wahrnehmbarkeit auf der einen und die Charakterisierung durch Verweis auf Gleichartiges oder Verschiedenartiges auf der anderen Seite. Weitere Gemeinsamkeiten gibt es nicht. Aus zwei weiteren Gründen ist Lorenz’ Beschreibung der beiden Verwendungsweisen von »abstrakt« und »konkret« für die hier getroffene Unterscheidung wenig hilfreich. Erstens wendet er das Begriffspaar in beiden Bedeutungen immer nur auf Gegenstände an, nicht auf den Vollzug des Denkens. Zweitens werden in der modernen Abstraktionstheorie beide Bedeutungen nicht systematisch zueinander in Beziehung gesetzt. Die absolute Verwendung gilt als veraltet und von der relativen abgelöst. 3.2.2.2 Immanuel Kant Die von Kant getroffene Unterscheidung zwischen relativem und absolutem Gebrauch der Begriffe »abstrakt« und »konkret« ist der hier vorgenomme-
221 Vgl. die Artikel »abstrakt« und »Abstraktum« von Kuno Lorenz in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.):
Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005, sowie die Artikel »konkret«, »Konkretion« und »Konkretum« desselben Autors in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyk-
lopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2010. 222 Lorenz, Kuno: »abstrakt«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005, S. 20. 223 Ebenda. 224 Vgl. ebenda.
3 Denken | 133
nen Unterscheidung sehr ähnlich. Mit der absoluten Bedeutung kennzeichnet er die beiden Vorstellungsarten Anschauung und Begriff, mit der relativen Bedeutung hingegen unterschiedliche Arten des Gebrauchs der Vorstellungen. Für beide Verwendungsweisen benutzt Kant die Ausdrücke »in abstracto« bzw. »in concreto«. Dieses Kapitel erläutert sie näher und geht dabei auch auf mögliche Bezüge zu Vorläufern ein. Die Unterschiede zur Theorie von Georg Friedrich Meier, dessen Schrift zur Logik Kant als Grundlage für seine Logik-Vorlesung verwendet hat, werden in direktem Anschluss an die entsprechenden Aspekte der kantischen Theorie behandelt. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Theorie von Alexander Gottlieb Baumgarten, der Kants Denken ebenfalls nachweislich beeinflusst hat,225 werden anschließend dargelegt. Zum Schluss erfolgt ein Vergleich der hier getroffenen Unterscheidung zwischen konkretisierendem und abstrahierendem Denkens mit der kantischen Systematik. Absolut »abstrakte« und »konkrete« Begriffe und Anschauungen In Kants Lehre der zwei Vorstellungsarten »Anschauung« und »Begriff« spiegelt sich sein Verständnis von »abstrakt« und »konkret« im absoluten Sinne wider. Er bestimmt alle Begriffe als abstrakt, weil sie ihrer logischen Form nach durch Abstraktion gewonnen sind, wie bereits ausführlich in Kapitel 3.1.1.3 erläutert wurde. Alle Anschauungen hingegen sind konkret. Dementsprechend charakterisiert er die philosophische Erkenntnis als diejenige, die »das Allgemeine jederzeit in abstracto (durch Begriffe) betrachten muß, indessen […] Mathematik das Allgemeine in concreto (in der einzelnen Anschauung) […] erwägen kann«.226 »Jene [die philosophische Betrachtung, Anm. d. A.] hält sich bloß an allgemeinen Begriffen, diese [die mathematische Betrachtung, Anm. d. A.] kann mit dem bloßen Begriffe nichts ausrichten, sondern eilt sogleich zur Anschauung, in welcher sie den Begriff in concreto betrachtet.«227 Dass es sich hierbei um einen grundsätzlichen Unterschied zwischen »abstrakt« und »konkret« handelt, wird daran deutlich, dass Kant mit ihm den Unterschied zwischen zwei Arten von Vernunfterkenntnis identifiziert:
225 Vgl. Mohr, Georg; Willaschek, Marcus: »Einleitung«, in: dies. (Hg.): Immanuel Kant. Kritik der
reinen Vernunft, Berlin, 1998, S. 10. 226 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, B 762–763, A 734– 735. 227 Ebenda, B743, A715.
134 | Bildnerisches Denken
»Die philosophische Erkenntnis betrachtet also das Besondere nur im Allgemeinen, die mathematische das Allgemeine im Besonderen, ja gar im Einzelnen […], so daß […] der Gegenstand des Begriffs, dem dieses Einzelne nur als sein Schema korrespondiert, allgemein bestimmt gedacht werden muß. In dieser Form besteht also der wesentliche Unterschied dieser beiden Arten der Vernunfterkenntnis, und beruhet nicht auf dem Unterschiede ihrer Materie, oder Gegenstände.«228
Da es keinen fließenden Übergang zwischen Anschauungen und Begriffen gibt, ist auch die Abgrenzung von »abstrakt« und »konkret« übergangslos. In Übereinstimmung damit werden in der Jäsche-Logik beide Vorstellungsarten als zueinander entgegengesetzt beschrieben: »Der Begriff ist der Anschauung entgegengesetzt; denn er ist eine allgemeine Vorstellung oder eine Vorstellung dessen, was mehreren Objecten gemein ist, also eine Vorstellung, sofern sie in verschiedenen enthalten sein kann.«229 Mit dieser Unterscheidung zwischen zwei Vorstellungsarten grenzt sich Kant ausdrücklich von Meiers Systematik ab, für den alle Vorstellungen Begriffe sind. So schreibt Meier: »Ein Begriff (conceptus) ist eine Vorstellung einer Sache in einem Dinge, welches das Vermögen zu denken besitzt. Es sind demnach alle unsere Vorstellungen Begriffe.«230 Kant kommentiert diesen Satz mit der Bemerkung: »nicht alle«231, da seiner Ansicht nach auch Anschauungen Vorstellungen sind. Kants absolute Unterscheidung zwischen abstrakt und konkret kann demnach nicht von Meier übernommen sein. Relativ »abstrakte« und »konkrete« Begriffe Kant erläutert den relativen Unterschied zwischen einem abstrakteren und konkreteren Gebrauch von Begriffen sehr deutlich. Folgender Satz aus Kants handschriftlichem Nachlass mag zunächst widersprüchlich zu der oben gegebenen Erläuterung erscheinen, dass alle Begriffe abstrakt sind: »Ich denke durch den Begrif [sic] einen Gegenstand in abstracto oder concreto.«232 Kant verwendet hier die Ausdrücke »in abstracto« bzw. »in concreto« im Sinne der relativen Unterscheidung – im Gegensatz zu oben. Die Ausdrücke kennzeichnen in diesem Satz nicht den Begriff näher, son-
228 Ebenda, B 742, A 714. 229 Jäsche, Gottlob Benjamin (Hg.): »Immanuel Kants Logik«, in: Akademie-Ausgabe, Band 9, S. 91. 230 Meier, Georg Friedrich: Auszug aus der Vernunftlehre, in: Akademie-Ausgabe, Band 16, S. 533, Hervor. i. O. 231 Kant, Immanuel: Reflexion 2829, in: Akademie-Ausgabe, Band 16, S. 533. 232 Kant, Immanuel: Reflexion 2873, in: Akademie-Ausgabe, Band 16, S. 554.
3 Denken | 135
dern den Gegenstand. Dies wird deutlich wenn man den Kontext dieses Zitates berücksichtigt. Kant korrigiert hier die Systematik von Meier. Während Meier innerhalb der Begriffe zwischen abstrakteren und weniger abstrakten Begriffen unterscheidet, lehnt Kant diese Unterscheidung ab. So schreibt Meier: »Je abstrakter und höher also ein Begriff ist, das ist: je öfter die logische Absonderung bei ihm wiederholt ist, desto größer ist sein Umfang.«233 Deutlich geht Meier von einem graduellen Unterschied zwischen abstrakt und konkret aus, aber nicht in Bezug auf den Gebrauch der Begriffe, sondern innerhalb der Begriffe selbst. Kant kommentiert diesen Absatz wie folgt: »Der conceptus inferior ist immer der conceptus communis in concreto betrachtet;«234 Der Zusatz »in concreto« bei Kant bezieht sich somit an dieser Stelle nicht auf die Begriffe selbst, sondern auf die Art, wie die Begriffe betrachtet, d. h. angewendet werden. Wird ein Begriff abstrakter gebraucht, dann wird dadurch auch der Gegenstand, der durch den Begriff gedacht wird, abstrakter. In Übereinstimmung damit heißt es in der JäscheLogik: »Ein jeder Begriff kann allgemein und besonders (in abstracto und in concreto) gebraucht werden. – In abstracto wird der niedere Begriff in Ansehung seines höhern; in concreto der höhere Begriff in Ansehung seines niederen gebraucht. Anmerk. 1. Die Ausdrücke des Abstrakten und Concreten beziehen sich also nicht so wohl auf die Begriffe an sich selbst – denn jeder Begriff ist ein abstrakter Begriff – als vielmehr nur auf ihren Gebrauch. Und dieser Gebrauch kann hin wiederum verschiedene Grade haben; – je nach dem man einen Begriff bald mehr bald weniger abstract oder concret behandelt, d. h. bald mehr bald weniger Bestimmungen entweder wegläßt oder hinzusetzt. – Durch den abstrakten Gebrauch kommt ein Begriff der höchsten Gattung, durch den konkreten Gebrauch dagegen dem Individuum, näher. Welcher Gebrauch der Begriffe der abstracte oder der concrete, hat vor dem andern einen Vorzug? – hierüber lässt sich nichts entscheiden. Der Werth des einen ist nicht geringer zu schätzen, als der Wert des anderen. – Durch sehr abstracte Begriffe erkennen wir an vielen Dingen wenig; durch sehr concrete Begriffe erkennen wir an wenigen Dingen viel;«235
Ein Beispiel zur Erläuterung dessen, was Kant mit dem graduellen Unterschied im Gebrauch meint, liefert er selbst. In der Schrift Über eine Entde-
ckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll, mit der er sich gegen die kritischen Einwände
233 Meier, Georg Friedrich: Auszug aus der Vernunftlehre, in: Akademie-Ausgabe, Band 16, S. 560. 234 Kant, Immanuel: Reflexion 2904, in: Akademie-Ausgabe, Band 16, S. 567. 235 Jäsche, Gottlob Benjamin (Hg.): »Immanuel Kants Logik«, in: Akademie-Ausgabe, Band 9, S. 99.
136 | Bildnerisches Denken
von Johann August Eberhard zur Kritik der reinen Vernunft wehrte, ist zu lesen: »Der Ausdruck einer abstracten Zeit […] im Gegensatz des hier vorkommenden, der concreten Zeit, ist ganz unrichtig, und muß billig niemals, vornehmlich wo es auf die größte logische Pünktlichkeit ankommt, zugelassen werden, wenn dieser Mißbrauch gleich selbst durch die neueren Logiker authorisiret worden. Man abstrahirt nicht einen Begriff als gemeinsames Merkmal, sondern man abstrahirt in dem Gebrauche eines Begriffs von der Verschiedenheit desjenigen, was unter ihm enthalten ist. […] Wer Erziehungsregeln entwerfen will, kann es thun so, daß er entweder blos den Begriff eines Kindes in abstracto oder eines bürgerlichen Kindes (in concreto) zum Grunde legt, ohne von dem Unterschiede des abstracten und concreten Kindes zu reden. Die Unterschiede von abstract und concret gehen nur den Gebrauch der Begriffe, nicht die Begriffe selbst an.«236
Kant lehnt die Rede vom »konkreten« oder »abstrakten« Kind ab. Stattdessen stellt er den Begriff »eines Kindes in abstracto« dem Begriff »eines bürgerlichen Kindes in concreto« gegenüber. Hier wird deutlich, was Kant mit der Beachtung von mehr oder weniger Bestimmungen im Gebrauch eines Begriffes meint. Der Begriff »eines bürgerlichen Kindes« ist deshalb konkreter gebraucht, weil dem bloßen Begriff »Kind« die nähere Bestimmung des »bürgerlichen« hinzugefügt wurde. Die Bestimmungen, die den Gebrauch eines Begriffes konkreter werden lassen, sind also im Kontext des Begriffes mitgegeben. Betrachtet man nur den Begriff »Kind« unabhängig von seinem Kontext, so ist der Begriff weder abstrakt noch konkret bzw. im absoluten Sinne abstrakt, weil alle Begriffe abstrakt sind. An diesem Beispiel wird sehr gut deutlich, wie ein abstrakter oder konkreter Gebrauch eines Begriffs den dadurch bezeichneten Gegenstand als abstrakter oder konkreter bestimmt. Denn der konkretere Gebrauch des Begriffs »Kind« führt auch zu einer konkreteren Bestimmung des Gegenstandes des Denkens. Das bürgerliche Kind ist ein konkreterer Gegenstand des Denkens als das Kind als solches. Der relative Unterschied zwischen »abstrakt« und »konkret« betrifft daher – ebenso wie beim konkretisierenden Denken bzw. beim obigen Beispiel des Portraits – nicht nur den Gegenstandsbezug des Denkens, sondern dadurch auch den Gegenstand des Denkens selbst.
236 Kant, Immanuel: »Über eine Entdeckung«, in: Akademie-Ausgabe, Band 8, S. 199, Anmerkung 1, Hervorh. i. O.
3 Denken | 137
Relativ »abstrakte« und »konkrete« Anschauungen Die Unterscheidung zwischen einem relativ abstrakten oder konkreten Gebrauch trifft Kant nicht nur in Bezug auf Begriffe. Auch Anschauungen können abstrakter oder konkreter gebraucht werden. Dies erläutert er beispielhaft anhand einer Zeichnung eines Dreiecks: »So konstruiere ich einen Triangel, indem ich den diesem Begriffe entsprechenden Gegenstand, entweder durch bloße Einbildung […] oder […] auf dem Papier […] darstelle. Die einzelne hingezeichnete Figur ist empirisch, und dient gleichwohl den Begriff, unbeschadet seiner Allgemeinheit, auszudrücken, weil bei dieser empirischen Anschauung immer nur auf die Handlung der Konstruktion des Begriffs, welchem viele Bestimmungen, z. E. der Größe, der Seiten und der Winkel, ganz gleichgültig sind, gesehen, und also von diesen Verschiedenheiten, die den Begriff des Triangels nicht verändern, abstrahiert wird.«237
Zwar beschreibt Kant in diesem Beispiel nur den relativ abstrakten Gebrauch der Anschauung – in diesem Fall einer Zeichnung – und nicht auch einen relativ konkreten Gebrauch. Dennoch kann das Beispiel ganz analog zum Beispiel des Kindes für den abstrakteren oder konkreteren Gebrauch von Begriffen interpretiert werden. Auch bei der Anschauung wird der Gebrauch dadurch abstrakter, dass relativ wenig Bestimmungen des Gegenstandes berücksichtig werden. Die Bestimmungen des gezeichneten Dreiecks, die im abstrakten Gebrauch der Zeichnung nicht beachtet werden, sind seine Größe, seine Seiten und seine Winkel. Dadurch ist auch der Gegenstand des Denkens, in diesem Fall der Begriff des Dreiecks, relativ abstrakt bestimmt. Auch wenn Kant nicht explizit darauf hinweist, ist doch deutlich, dass dieselbe Zeichnung ebenso relativ konkret gebraucht werden kann, wie der Begriff »Kind«. Das wäre der Fall, wenn der Gegenstand des Denkens durch die Zeichnung mehr bestimmt wäre. Beispielsweise könnten im konkreteren Gebrauch der Zeichnung die Winkel, in denen die Seiten aufeinandertreffen, auch zu den Bestimmungen des Gegenstandes gehören. Der Gegenstand des Denkens wäre dann nicht das Dreieck als solches, sondern beispielsweise ein gleichschenkliges Dreieck. Der Aspekt der Gleichschenkligkeit in der Zeichnung hätte hier dieselbe Funktion wie der Zusatz »bürgerlich« beim konkreteren Gebrauch des Begriffes »Kind«.
237 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, A 713–714.
138 | Bildnerisches Denken
Vergleich der kantischen Systematik mit der Verwendung von »abstrakt« und »konkret« bei Baumgarten Im Gegensatz zu den Ausführungen von Meier sind in den Texten von Baumgarten Hinweise sowohl zu einer absoluten wie auch zu einer relativen Bedeutung der Begriffe »abstrakt« und »konkret« zu finden. So ist es möglich, dass Kant hieraus einige Anregungen für seine Unterscheidung gezogen hat. Allerdings sind sowohl die Begrifflichkeit der Unterscheidung sowie ihre Erläuterung etwas unklar. Es wird nicht ganz klar, worauf sich die entsprechende Unterscheidung bezieht und worin das Unterscheidungskriterium besteht. In folgendem Zitat scheint Baumgarten zunächst eine absolute Unterscheidung zwischen zwei Betrachtungsarten vorzunehmen, die der Unterscheidung zwischen dem abstrahierenden und dem konkretisierenden Denken sehr nahe kommt. Baumgarten verwendet hier wie Kant die Ausdrücke »in concreto« und »in abstracto«: »Das Allgemeine, in seinem Unteren betrachtet, und das Einzelne, im Hinblick auch auf seine anderen Prädikate außer einem bestimmten Allgemeinen betrachtet, werden in concreto betrachtet und heißen dann konkret. Das Allgemeine, das zwar betrachtet wird, aber nicht in seinem Unteren, und das Einzelne, in dem aber nur sein gewisses Obere betrachtet wird, werden in abstracto betrachtet und heißen dann abstrakt. Das Allgemeine in concreto ist das physikalisch Allgemeine (in vielen, in dem Ding), das Allgemeine in abstracto ist das logisch Allgemeine (nach vielen, nach dem Ding). Das Allgemeine, das nur in Individuen in concreto vorstellbar ist, d. h. das nur Individuen unter sich hat, ist die Spezies; dasjenige Allgemeine, das auch in Allgemeinem in concreto vorstellbar ist, m.a.W. das ebenfalls Allgemeines unter sich hat, ist das Genus«.238
Diese Unterscheidung klingt auf den ersten Blick ganz ähnlich wie die hier gegebene absolute Unterscheidung zwischen dem abstrahierenden und dem konkretisierenden Denken. Baumgarten unterscheidet zwischen zwei Betrachtungsarten. Die eine wendet in der Betrachtung des Einzelnen ihren Blick auf die »anderen Prädikate außer einem bestimmten Allgemeinen«. Die andere Betrachtungsweise beachtet bei dem Einzelnen »nur sein gewisses Obere«. Die erste nennt Baumgarten »in concreto betrachten«, die zweite »in abstracto betrachten«. In der zweiten Betrachtungsweise wird das Einzelne in seinen allgemeinen Bestimmungen, d. h. den Bestimmungen, die es mit anderen Dingen gemeinsam hat, betrachtet – wie im abstrahierenden Denken. Die erste Betrachtungsweise beachtet hingegen auch andere Be-
238 Baumgarten, Alexander Gottlieb: Metaphysica – Metaphysik, Stuttgart, 2011, S. 109.
3 Denken | 139
stimmungen, d. h. Bestimmungen, die das Einzelne im Unterschied zu anderen Dingen ausweist – ähnlich wie im konkretisierenden Denken. Bei diesen Bestimmungen handelt es sich aber dennoch um Prädikate, d. h. um Merkmale, die das Einzelne doch auch mit anderen Dingen teilen muss. Somit ist nicht entscheidbar, ob sich Baumgartens Unterscheidung mit der hier getroffenen Unterscheidung zwischen konkretisierendem und abstrahierendem Denken deckt. Ein wesentlicher Unterschied zur kantischen absoluten Unterscheidung von abstrakt und konkret besteht darin, dass Baumgarten seine beiden Betrachtungsweisen nicht mit den Vorstellungsarten Anschauung und Begriff in Verbindung bringt. Stattdessen nimmt er zur Erläuterung seiner Unterscheidung nur Bezug auf Begriffe, nämlich auf die begriffshierarchische Gliederung in Genus und Spezies. Das legt die Vermutung nahe, es handele sich um eine Unterscheidung auf rein begrifflicher Ebene. Dagegen spricht die Position dieses Paragraphen in der Gliederung der Metaphysik. Der Paragraph gehört zum ersten Teil der Metaphysik, der mit »Ontologie« betitelt ist. Daher bleibt unklar, ob es sich bei dieser Unterscheidung Baumgartens um eine Unterscheidung von Dingen in der Welt, von Begriffen oder von Verwendungsweisen von Begriffen handelt. An anderer Stelle charakterisiert Baumgarten zwei Denkarten, deren Unterscheidungskriterium nicht eindeutig als absolut oder relativ zu interpretieren ist. Auch die Kennzeichnung durch die Begriffe »abstrakt« und »konkret« ist nicht klar als absolut oder relativ zu deuten. Dennoch mag Kant hierin eine Anregung für seine Unterscheidung zwischen zwei Erkenntnisarten gefunden haben. So schreibt Baumgarten: »Wenn die logische und wissenschaftliche Denkungsart ihre vornehmlichen Gegenstände – sogar nicht einmal Individuen ausgeschlossen, wenn die übrigen Umstände die gleichen sind – lieber abgesondert [im Original für abgesondert: ›in abstracto‹, Anm. d. A.], nur in gewisser Bestimmung, erwägt: So betrachtet derjenige, der schön denken will, mit dem Analogon der Vernunft seine vornehmlichen Stoffe am liebsten nicht allein unabgesondert [im Original für unabgesondert: ›in concreto‹, Anm. d. A.], in mehrerer Bestimmung, sondern auch in den allerbestimmtesten [im Original: ›in determinatissmimis‹] Gegenständen, in denen dies möglich ist, also in Einzeldingen, in für sich bestehenden Dingen, in Personen und Ereignissen, sooft dies gegeben ist.«239
Baumgarten unterscheidet zwischen einer logischen bzw. wissenschaftlichen Denkungsart einerseits und dem schönen Denken andererseits. Er betont, dass der Unterschied zwischen beiden nicht nur in der Anzahl der beachte-
239 Baumgarten, Alexander Gottlieb: Ästhetik, Hamburg, 2007, S. 755.
140 | Bildnerisches Denken
ten Bestimmungen besteht – das wäre ein gradueller Unterschied, der der relativen Bedeutung von »abstrakt« und »konkret« entsprechen würde. Er gibt ein zusätzliches Kriterium an, das sich eher nach einer absoluten Unterscheidung anhört. Das schöne Denken betrachtet die Dinge als maximal bestimmte Einzeldinge. Ob diese maximale Bestimmtheit allerdings nur der Endpunkt einer Skala der Menge der beachteten Bestimmungen darstellt, oder ob es sich um eine grundsätzliche Unterscheidung handelt, bleibt unklar. Es bleibt offen, ob sich Kant bei seiner Unterscheidung zwischen einer relativen und einer absoluten Bedeutung von »abstrakt« und »konkret« an Unterscheidungen von Baumgarten orientiert hat. Kants Differenzierung scheint klarer und der hier getroffenen Unterscheidung sehr verwandt. Um dennoch auch die Unterschiede zur kantischen Systematik zu verdeutlichen, wird in folgendem Abschnitt ein vergleichender Überblick gegeben. Vergleich der kantischen Systematik mit der Unterscheidung zwischen abstrahierendem und konkretisierendem Denken In Tabelle 6 ist die kantische Unterscheidung zwischen der absoluten und der relativen Bedeutung von »abstrakt« und »konkret« zusammengefasst. In ihrer absoluten Bedeutung kennzeichnen die beiden Begriffe die beiden Vorstellungsarten Anschauung und Begriff. Alle Begriffe sind abstrakt, während alle Anschauungen konkret sind. Das Kriterium der Unterscheidung ist qualitativ. Eine Vorstellung durch Begriffe ist von grundsätzlich anderer Natur als eine anschauliche Vorstellung. Mit modernem Vokabular kann man den Unterschied als medial bezeichnen. In ihrer relativen Bedeutung beziehen sich »abstrakt« und »konkret« auf den Gebrauch von Begriffen oder Anschauungen. Der Unterschied zwischen einem relativ abstrakten und einem relativ konkreten Gebrauch ist quantitativ. Das Unterscheidungskriterium ist die Menge der Bestimmungen des betrachteten Gegenstandes. Aus dem graduellen Unterschied im Gebrauch von Begriffen und Anschauungen kann ein gradueller Unterschied zwischen abstrakteren und konkreteren Gegenständen des Denkens abgeleitet werden. In Abgrenzung zur kantischen Systematik wird im Folgenden eine andere Unterscheidung als grundsätzlich betrachtet (vgl. Tabelle 7). Nicht der Unterschied zwischen verschiedenen Medien, in denen sich das Denken äußert, ist grundlegend, sondern der Unterschied im Vollzug des Denkens. Das Denken kann abstrahierend und konkretisierend vollzogen werden, und zwar unabhängig vom Medium des Denkens. Der Vorteil dieses Kriteriums im Vergleich zum kantischen Kriterium besteht darin, dass in dieser Syste-
3 Denken | 141
matik ein grundsätzlich unterschiedlicher Umgang mit visuellen Medien, wie z. B. Zeichnungen oder Gemälden, erklärt und transparent gemacht werden kann. Wie bei Kant ist der Unterschied zwischen »abstrakt« und »konkret« im absoluten Sinne qualitativ, während der graduelle Unterschied quantitativ bestimmt wird. Je mehr Bestimmungen bei der Charakterisierung eines Gegenstandes berücksichtigt werden, desto konkreter ist der Gegenstand des Denkens. Kants Unterscheidung zwischen den beiden Vorstellungsarten bleibt innerhalb des abstrahierenden Denkens erhalten – hier modern formuliert als medialer Unterschied. Alle seine Beispiele können in diese neue Systematik übertragen werden. Sie werden ergänzt durch Beispiele für konkretisierendes Denken.
…DES BESONDEREN
…DES ALLGEMEINEN
Gegenstand des Denkens
BETRACHTUNG…
= relativ konkret
= relativ abstrakt
= qualitativ: Vorstellungsart [= Medium]
= absolut konkret
Mathematik/Geometrie: Konstruktion eines gleichschenkligen Dreiecks
Dreiecks
Pädagogik: Erziehungsregeln für das = absolut abstrakt
Vorstellungsart
…IM ALLGEMEINEN = durch Begriffe
…IM BESONDEREN = in der Anschauung
Kriterium = quantitativ Menge der berücksichtigten Bestimmungen im Gegenstandsbezug
»bürgerliche Kind«
»Kind«
Philosophie: Analyse des Begriffs »gleichschenkliges Dreieck«
»Dreieck«
Tabelle 6: Kants Unterscheidung zwischen Anschauungen und Begriffen
142 | Bildnerisches Denken
…DES BESONDEREN
Gegenstand des Denkens
BETRACHTUNG…
= relativ konkret
= quantitativ Menge der berücksichtigten Bestimmungen im Gegenstandsbezug
visuelle Medien
Portrait einer konkreten Person
Ausdruck von Harmonie
leicht verständliche Darstellung der Konstruktion eines Dreiecks
visuelle Medien
Literarisches Gestalten: Gedicht als Portrait einer konkreten Frau
Schilderung der Frau schlechthin
Mathematik/Geometrie: Konstruktion eines gleichschenkligen Dreiecks
Dreiecks
Pädagogik: Erziehungsregeln für das sprachliche Medien
= absolut abstrakt
= relativ abstrakt
Bildnerisches Gestalten: Bild als
sprachliche Medien
= qualitativ: Denkart = absolut konkret Vollzug des Denkens
…DURCH KONKRETISIEREN
Kriterium
…DURCH ABSTRAHIEREN
…DES ALLGEMEINEN
»bürgerliche Kind«
»Kind«
Philosophie: Analyse des Begriffs »gleichschenkliges Dreieck«
»Dreieck«
Tabelle 7: Unterscheidung zwischen Konkretisieren und Abstrahieren in Abgrenzung zu Kant
3 Denken | 143
Die Zeichnung des Dreiecks dient laut Kant nur dazu, den Begriff »Dreieck« bzw. dessen Schema zu veranschaulichen. Die Zeichnung ist daher – ähnlich wie die schematischen Gesichtszeichnungen auf Abb. 7 und Abb. 8 in Tabelle 5 (S. 123) – ein gezeichneter Begriff und damit Ausdruck des abstrahierenden Denkens. Dies ist auch daran zu erkennen, dass man eine unendliche Menge an solchen unterschiedlichen Zeichnungen erstellen könnte, die aber dennoch alle denselben Begriff veranschaulichen könnten. Für die Darstellung des Begriffs sind nicht nur sehr wenige Aspekte dieser Zeichnungen relevant. Die Aspekte sind auch vollständig verbal beschreibbar, wie z. B. in der kantischen Anweisung zur Erstellung der Dreieckskonstruktion.240 Werden diese wenigen Aspekte berücksichtigt, ist der Begriff bzw. sein Schema korrekt dargestellt. Grundlegend anders hingegen müsste man eine Konstruktionszeichnung eines Dreiecks erstellen, die möglichst leicht verständlich das Verfahren der Konstruktion in einem Lehrbuch veranschaulichen soll. Bei dieser Zeichnung sind nicht nur mehr Aspekte als bei der ersten relevant. Es handelt sich auch um ganz andere Aspekte. Sie betreffen die Merkmale, die den Unterschied dieser einen Zeichnung im Vergleich zu allen anderen Zeichnungen ausmachen, die ebenso gleichwertige Darstellungen des Konstruktionsschemas sind. Solche Aspekte sind beispielsweise die Art der Hilfslinien (gestrichelt oder durchgezogen), die Farbe der Linien (einheitlich schwarz oder mehrfarbig) oder die Farbe des Hintergrundes. Der Unterschied kann hier nicht rein quantitativ erklärt werden, sondern es handelt sich um einen qualitativen Unterschied in der Betrachtungsweise. Die Abbildung in dem Lehrbuch wird nicht nur unter konstruktiven – oder allgemeiner: schematischen – Gesichtspunkten geprüft, sondern auch unter bildnerischen. Ein solcher qualitativer Unterschied der Betrachtungsweise innerhalb des Mediums Zeichnung kann in der kantischen Systematik nicht erklärt werden. Weitere Beispiele für konkretisierendes Denken, das sich in visuellen Medien äußert, sind das Portrait einer konkreten Frau oder ein Gemälde als Ausdruck von Harmonie. In sprachlichen Medien hingegen kann das konkretisierende Denken beispielsweise in Gedichten zum Ausdruck kommen. Das Verhältnis der beiden Denkarten zu verschiedenen Medien wird ausführlicher in Kapitel 3.4.2 erläutert.
240 Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, B 744–745, A 716–717.
144 | Bildnerisches Denken
3.2.3 Absolute »Dichte« und relative »Fülle« bei Nelson Goodman In Nelson Goodmans Theorie des Bildes spielen die Begriffe »abstrakt« und »konkret« keine Rolle. Dennoch lohnt sich ein Vergleich mit dem Modell des Bildnerischen Denkens. Er macht in seiner Bildtheorie von einem absoluten und einem relativen Unterscheidungsmerkmal Gebrauch, die dem hier erläuterten absoluten und relativen Verständnis von »abstrakt« und »konkret« sehr ähnlich sind. Goodman verwendet dabei aber ein völlig anderes Vokabular, um seine Theorie des Bildes zu entwickeln. Er unternimmt den Versuch, die Besonderheiten des Phänomens Bild mit den Mitteln der Zeichentheorie zu erklären. In seiner Systematik unterscheiden sich bildliche von nicht-bildlichen Zeichen durch zwei Merkmale: das eine Merkmal führt zu einem absoluten Unterschied, das andere hingegen zu einem relativen. Im Folgenden wird die Unterscheidung zwischen dem (abstrahierenden oder konkretisierenden) Vollzug des Denkens und dem (abstrakteren oder konkreteren) Gegenstand des Denkens mit zwei Merkmalen verglichen, die laut Goodman zu repräsentationalen (»representational«) Zeichensystemen gehören. Diese Systeme zeichnen sich erstens durch ihre Dichte (»density«) aus und unterscheiden sich von nicht dichten Systemen übergangslos. Deshalb muss man im Umgang mit ihnen konkretisierend denken – wie man Goodman ergänzen könnte. Im Gegensatz dazu ist der Umgang mit artikulierten Systemen (»articulate«) abstrahierend. Zweitens unterscheidet Goodman innerhalb der repräsentationalen Systeme zwischen graduell volleren und weniger vollen Schemata241. Relativ volle (»replete«) Schemata nennt Goodman bildlich (»pictorial«). Wieder kann man ergänzen: Mit diesen Zeichenschemata lassen sich die Gegenstände des Denkens relativ konkret ausdrücken. Die weniger vollen Schemata bezeichnet er als diagrammatisch (»diagrammatic«). Sie bestimmen die Gegenstände des Denkens verhältnismäßig abstrakt – was abermals hinzugefügt werden kann. Goodman fasst die beiden Merkmale der Dichte und der Fülle anhand von Beispielen wie folgt zusammen: »A simple graphic diagram and a full-blown portrait differ from each other in degree but contrast sharply with a description«.242 Ein wesentlicher Unterschied zwischen der hier getroffenen Differenzierung der Denkarten auf der einen und der Systematik von Goodman auf der
241 In Goodmans Zeichentheorie ist ein Schema »a linear or more complex array of labels«, d. h. es betrifft die syntaktische Ordnung eines Zeichensystems. Siehe Goodman, Nelson: Languages of Art, Indianapolis, Cambridge, 1976, S. 73. Es ist daher nicht zu verwechseln mit dem, was hier als »visuelles Schema« bezeichnet wurde. 242 Goodman, Nelson: Languages of Art, Indianapolis, Cambridge, 1976, S. 231.
3 Denken | 145
anderen Seite besteht darin, dass Goodman alle Kategorisierungen anhand der näheren Charakterisierung von Zeichensystemen vornimmt. Der hier verfolgte Ansatz hingegen liefert die Beschreibung von grundlegend unterschiedlichen Tätigkeiten, die nicht nur unseren Umgang mit Zeichensystemen betreffen. Beide Ansätze stehen nicht in explizitem Widerspruch zueinander, denn auch Goodman betont, dass Zeichensysteme nur dadurch konstituiert werden, dass wir bestimmte Dinge als Zeichen behandeln. Allerdings ist der Ansatz Goodmans enger, weil er nur die Zeichensysteme, nicht aber die zugrunde liegenden Tätigkeiten oder Denkprozesse thematisiert. Das Modell des Bildnerischen Denkens hingegen beschreibt eine Art unseres Umgangs mit unserer Umwelt, die sich nicht auf den Umgang mit Zeichensystemen reduzieren lässt. So kann dieses Denken auch unabhängig von materiellen Bildern aktiv sein. Weiterhin können auch einzelne Funktionen des Bildnerischen Denkens, die näher in Teil 4 hergeleitet werden, ganz unabhängig von Zeichensystemen in verschiedenen alltäglichen Zusammenhängen wirksam sein. Im Folgenden werden zunächst Dichte und Fülle als Merkmale von Zeichensystemen einzeln erläutert und mit dem entsprechenden Aspekt der hier getroffenen Unterscheidung verglichen (3.2.3.1 und 3.2.3.2). Im Anschluss daran werden beide Systematiken in einem zusammenfassenden Vergleich einander gegenübergestellt und ihre Vor- und Nachteile für eine Theorie des Bildes erörtert (3.2.3.3). 3.2.3.1 Absolut »dicht« versus absolut »konkret« Die Dichte eines Zeichensystems stellt nach Goodman das Kriterium dar, das es zu einem repräsentationalen Zeichensystem macht. Damit sind Repräsentationen eindeutig und scharf von Beschreibungen unterschieden: »A system is representational only insofar as it is dense; and a symbol is a representation only if it belongs to a system dense throughout or to a dense part of a partially dense system.«243 Was Goodman mit Dichte meint, erklärt er wie folgt: »A scheme is syntactically dense if it provides for infinitely many characters so ordered that between each two there is a third.«244 »In such a dense scheme […] no mark can be determined to belong to one rather than to many other characters.«245 Eine Marke in einem dichten System, also beispielsweise ein konkretes Gemälde, kann keinem Charakter bzw. Bildtyp
243 Ebenda, S. 226. 244 Ebenda, S. 136. 245 Ebenda, S. 137.
146 | Bildnerisches Denken
eindeutig zugeordnet werden. Diese Betrachtungsweise auf ein Gemälde entspricht genau dem konkretisierenden Denken. Auch dieses unternimmt gerade nicht den Versuch, ein Gemälde als Bild eines bestimmten Typs zu klassifizieren. Es konzentriert sich auf die Unterschiede zu anderen Gemälden, die gerade verhindern, dass das Gemälde als gleichartig zu anderen angesehen werden kann. Zwar hat Goodman das Unterscheidungskriterium der Dichte in dem obigen Zitat als ein Merkmal des Zeichenschemas, d. h. als syntaktisches Merkmal, erläutert. Dennoch weist er an anderer Stelle darauf hin, dass das Kriterium für eine Repräsentation auch die semantische Dimension betrifft: »[R]epresentation thus depends upon certain syntactic and semantic relationships among symbols«246. Allerdings scheint Goodman in der Frage, ob und inwiefern das Merkmal der Dichte auch semantisch aufzufassen ist, keinen völlig eindeutigen Standpunkt zu haben. Dies ist folgender vorsichtiger Anmerkung aus seinem Vorwort zur zweiten Auflage zu entnehmen: »The property of being representational […] is now defined for symbol systems rather than symbol schemes.«247 In dem Beispiel, anhand dessen Goodman das Merkmal der Dichte erläutert, wird die Auswirkung auf die semantische Ebene dennoch deutlich: »Consider, for example, some pictures in the traditional Western system of representation: the first is of a man standing erect at a given distance; the second, to the same scale, is of a shorter man at the same distance. The second image will be shorter than the first. A third image in this series may be of intermediate height; a fourth, intermediate between the third and second; and so on. According to the representational system, any difference in height among these images constitutes a difference in height of man represented.«248
Die unterschiedliche Größe des Mannes in der Darstellung bedeutet demnach eine unterschiedliche Größe des repräsentierten Mannes. Die Dichte kann dabei auch mehrere Aspekte eines Bildes betreffen: »Furthermore, while I have for simplicity considered only one dimension in this example, every difference in every pictorial respect makes a difference under our familiar system of representation.«249
246 Ebenda, S. VI. 247 Ebenda. 248 Ebenda, S. 226. 249 Ebenda, S. 227.
3 Denken | 147
Die beiden Ansätze – des konkretisierenden Denkens und der Kennzeichnung repräsentationaler Zeichensysteme als dicht – teilen eine gemeinsame Annahme über ein wesentliches Merkmal von Bildern: Sie zu verstehen besteht nicht primär darin, sie bestimmten Bildtypen zuzuordnen. Stattdessen ist es notwendig für das Bildverstehen, auf die Unterschiede zu achten, die ein einzelnes Bild gegenüber anderen Bildern auszeichnet. Zumindest in der überarbeiteten Version von Languages of Art betrifft dieses Merkmal sowohl die syntaktische als auch die semantische Dimension von Bildzeichen. In Übereinstimmung damit ist das Konkretisieren, also das Beachten von Unterschieden, für alle vier Funktionen des Bildnerischen Denkens wesentlich, wie in Kapitel 5.2 erläutert wird. Im Vergleich zur Systematik Goodmans ist das Modell des Bildnerischen Denkens genauer, weil die Tätigkeit des bildnerischen Unterscheidens auf drei bzw. vier verschiedenen, aufeinander aufbauenden Ebenen – den vier Funktionen – detailliert erklärt wird. Zudem zeigt dieses Modell nicht nur Beziehungen zu unserem Umgang mit anderen Zeichen auf, sondern auch zu alltäglichen Tätigkeiten, die völlig unabhängig von Zeichensystem sind, wie ebenfalls in Kapitel 5.2 gezeigt wird. Solche Beziehungen bestehen dadurch, dass einzelne Funktionen des Bildnerischen Denkens auch in anderen Zusammenhängen als der Produktion oder Rezeption von Bildern relevant sein können. Dadurch wird das Bildverstehen, obwohl es als spezifische Tätigkeit mit bestimmten notwendigen und hinreichenden Bedingungen beschrieben wird, auch zu anderen alltäglichen Tätigkeiten und Prozessen in Beziehung gesetzt. 3.2.3.2 Relativ »voll« versus relativ »konkret« Innerhalb der repräsentationalen und damit dichten Zeichensysteme unterscheidet Goodman zwischen volleren und weniger vollen Schemata. Damit erfasst er den graduellen Unterschied zwischen bildlichen und diagrammatischen Zeichensystemen: »[T]he symbols in the pictorial scheme are relatively replete. While there is an at least theoretically sharp line between dense and articulate schemes, among dense schemes the difference between the representational and the diagrammatic is a matter of degree. We cannot say that no aspects of a representational painting, for example, are contingent«.250
Das Merkmal der Fülle betrifft die Menge der in einem Bild relevanten Aspekte. In einem volleren Schema sind mehr Aspekte relevant als in einem
250 Ebenda, S. 230, Hervor. i. O.
148 | Bildnerisches Denken
weniger vollen. Da dieser Unterschied nach Goodman nur das Schema und nicht das ganze Symbolsystem betrifft, handelt es sich um ein rein syntaktisches Merkmal von Zeichensystemen. Er erläutert das Merkmal der Fülle anhand von zwei Beispielen – dem Ausdruck von einem Elektrokardiogramm und der Zeichnung eines Berges: »Compare a momentary electrocardiogram with a Hokusai drawing of Mt. Fujiyama. The black wiggly lines on white backgrounds may be exactly the same in the two cases. […] What makes the difference? […] The difference is syntactic: the constitutive aspects of the diagrammatic as compared with the pictorial character are expressly and narrowly restricted. The only relevant features of the diagram are the ordinate and abscissa of each of the points the center of the line passes through. The thickness of the line, its color and intensity, the absolute size of the diagram, etc., do not matter; whether a purported duplicate of the symbol belongs to the same character of the diagrammatic scheme depends not at all upon such features. For the sketch, this is not true. Any thickening or thinning of the line, its color, its contrast with the background, its size, even the qualities of the paper-none of these is ruled out, none can be ignored.«251
Das relative Unterscheidungsmerkmal der Fülle trifft denselben Aspekt, den auch der relative Unterschied zwischen einem abstrakteren und einem konkreteren Gegenstand des (bildnerischen) Denkens kennzeichnet. Das hier vertretene Modell unterscheidet sich vom Modell Goodmans allerdings darin, dass dieser graduelle Unterschied gerade nicht nur die syntaktische Ebene betrifft. Während Goodman betont, dass es sich um einen rein syntaktischen Unterschied handelt, betrifft die Unterscheidung zwischen abstrakterem oder konkreterem Gegenstand des Denkens alle Funktionen des Bilderischen Denkens. Jede Funktion hat ihren eigenen Gegenstand des Denkens, so dass auf jeder Ebene die Menge der relevanten Bestimmungen analysiert werden kann, wie in Kapitel 5.3 gezeigt wird. Diese Differenzierung der goodmanschen Fülle in mehrere Ebenen hat zwei Vorteile. Erstens ist sie genauer, weil sie berücksichtigt, dass manche Bilder beispielsweise mit sehr wenigen Farben arbeiten, dafür aber jeder kleinste Aspekt der Komposition relevant ist. Goodmans System hingegen enthält keinen Mechanismus, mit dem man berücksichtigen könnte, dass ein Bild bezogen auf die Farben zu einem wenig vollen, kompositorisch aber zu einem vollen Schema gehört. Zweitens wird es durch die Differenzierung des Bildnerischen Denkens in einzelne Funktionen möglich, kunstwissenschaftliche Kategorien wie »abs-
251 Ebenda, S. 229.
3 Denken | 149
trakte Bilder« oder »konkrete Kunst« zu verstehen und zu erklären. Beide Vorteile werden im Kapitel 5.3 anhand von Beispielen ausgeführt. 3.2.3.3 »Dichte« und »Fülle« im Bildnerischen Denken Da die hier entwickelte Systematik ausführlicher ist als die Theorie Goodmans, können die goodmanschen Merkmale der »Dichte« und »Fülle« in das Vokabular des Bildnerischen Denkens übersetzt werden. Das konkretisierende Denken, das sich auf die Unterschiede konzentriert, ist für den Umgang mit allen repräsentationalen Zeichensystemen aufgrund ihrer Dichte erforderlich. Nicht-dichte Systeme sind im Gegensatz dazu in der Regel artikuliert und werden durch abstrahierendes Denken erfasst und angewendet. Die Grenze zwischen dichten und nicht-dichten Systemen ist übergangslos. Innerhalb der repräsentationalen Systeme kann man zwischen graduell volleren und weniger vollen Schemata unterscheiden. Relativ volle Schemata nennt Goodman bildlich. In ihnen sind die Gegenstände des Denkens relativ konkret. Die weniger vollen Schemata, die die Gegenstände des Denkens als verhältnismäßig abstrakt beschreiben, bezeichnet er als diagrammatisch. Dem hier vertretenen und dem zeichentheoretischen Ansatz Goodmans ist gemeinsam, dass beide den medialen Unterschied zwischen Bild und Sprache nicht als letztes Unterscheidungskriterium akzeptieren. Sie suchen beide nach einem fundamentaleren Kriterium, mithilfe dessen sich der Unterschied zwischen Bild und Sprache erklären lässt. Ein solcher Ansatz hat den Vorteil, dass er eine intuitiv erlebte Nähe bestimmter Bildphänomene zur Sprache erklären kann, wie auch Goodman schon festgestellt hat: »Our analysis of types of symbol schemes and systems thus enables us to deal with some stubborn problems concerning representation and description. At the same time, it unearths some unexpected affinities between pictures and seismograms and pointer-positions on ungraduated dials on the one hand, and between pictographs and circuit plans and words on the other.«252
Wie schon erwähnt ist ein Vorteil des hier vorgestellten Modells, dass darin unser Umgang mit der Dichte und Fülle von Bildphänomenen viel detaillierter erklärt wird. Das Denken erschließt sich sowohl die Dichte wie auch die Fülle von Bildern in mehreren Ebenen, d. h. durch die aufeinander aufbauenden bildnerischen Funktionen. In seinem Spätwerk Of Mind and other matters betont Goodman, wie wichtig es ist, die Denkprozesse im Zusam-
252 Ebenda, S. 232.
150 | Bildnerisches Denken
menhang mit unserem Umgang mit Zeichen genauer zu untersuchen. Das weist darauf hin, dass er darin eine Forschungslücke seines Werkes sah. Denn er erklärt, dass er eine solche genaue Analyse der Denkprozesse für ein nötiges und lohnendes Forschungsvorhaben hält: »What I do urge is that the study of laws of form must include – and will find an intriguing field of exploration in – the study of how the processes and states involved in thought are related, dynamically and statically, to each other, of how they affect and are affected by the symbols to be produced or perceived or judged, and of how the forms of the symbol systems we think in and employ in our worldversions determine the forms of the worlds we think about and live in.«253
Goodman beschreibt dabei drei Hinsichten, in denen man von der »Form des Denkens« sprechen kann. Er unterscheidet zwischen der Form dessen, woran wir denken, der Form dessen, worin wir denken, und der Form des Denkens selbst.254 Diese Dreiteilung entspricht der hier vorgenommenen Unterscheidung zwischen dem Gegenstand des Denkens (= das, woran wir denken), dem Medium des Denkens (= das, worin wir denken) und dem Vollzug des Denkens (= das Denken selbst). Die hier vorliegende Arbeit setzt alle drei Aspekte des Denkens zueinander in Beziehung und unternimmt eine genauere Analyse der Form des Denkens selbst. Damit kann diese Arbeit als Versuch angesehen werden, einen Teil der von Goodman identifizierten Forschungslücke zu schließen. In Kapitel 3.4 wird eine Zusammenfassung der bisher erarbeiteten Systematik des abstrahierenden und konkretisierenden Denkens gegeben, in der die drei Aspekte des Vollzugs, des Mediums und des Gegenstands des Denkens erläutert und ihr Bezug zueinander erklärt werden.
253 Goodman, Nelson: Of mind and other matters, Cambridge, 1984, S. 28. 254 Vgl. ebenda, S. 27, Hervorh. i. O.
3 Denken | 151
3.3
K ONKRETISIERENDER V OLLZUG IN ALTERNATIVEN T HEORIEN DES D ENKENS
Dieses Kapitel stellt alternative Theorien des Denkens vor, die neben dem begrifflichen auch ein nicht-begriffliches bzw. nicht-sprachliches Denken beschreiben. In der Literatur werden verschiedene Begriffe zur Kennzeichnung einer solchen alternativen Denkart verwendet. Beispielsweise ist in der Psychologie der Ausdruck »bildhaftes« im Gegensatz zum »propositionalen« Denken üblich.255 Hingegen versucht die philosophische »Debatte über die logische Struktur des Bildlichen, […] gegenwärtig das Verhältnis von Logik und Bild mit Begriffen wie bildliches Denken, ikonisches Denken, visuelles Denken oder bildnerisches Denken zu begründen«.256 Ein Ausdruck, der in dieser Aufzählung fehlt, ist das »anschauliche Denken«. Auch wenn sich diese Begriffe ähnlich anhören, unterscheiden sich die Konzepte, die dahinter stehen, doch zum Teil ganz erheblich voneinander. In all diesen Versuchen, eine alternative Denktheorie zu formulieren, kann vereinfachend zwischen zwei Lagern unterschieden werden. Die eine Richtung versucht, eine Theorie zu entwickeln, die das Denken insgesamt – das heißt auch das begriffliche Denken – als visuell konstituiert beschreibt. Denken und Wahrnehmen werden nicht als getrennte Vermögen betrachtet, sondern als stark miteinander verknüpft oder sogar als ein zusammenhängendes Erkenntnisvermögen. Entsprechend untersuchen solche Theorien eher das »visuelle Denken« – oder genauer: die »Visualität des Denkens«. Die andere Richtung verfolgt das Ziel, neben dem begrifflichen, sprachlichen oder diskursiven Denken eine andere Denkart zu begründen. Fließend ist der Übergang zwischen beiden theoretischen Lagern dann, wenn die verschiedenen Denkarten nicht als gleichwertig betrachtet werden, sondern als hierarchisch geordnet, so dass das nicht-begriffliche Denken als »vorbegrifflich« beschrieben wird. Zur ersten Richtung gehört Arnheims Werk Anschauliches Denken257, wie bereits am englischen Originaltitel des Buches zur erkennen ist: Visual Thinking258. Arnheim verfolgt mit seinem Buch einen bescheidenen Anspruch. Er betont, dass er darin keine »theoretische Grundlage, die das weite Gebiet des anschaulichen Denkens zusammenfassen und unterbauen wür-
255 Vgl. Becker-Carus, Christian: Allgemeine Psychologie, München, 2004, S. 284, Hervorh. i. O. 256 Engel, Franz u. a.: »Einleitung«, in: dies. (Hg.): Das bildnerische Denken: Charles S. Peirce, Berlin, 2012, S. 49–50. 257 Arnheim, Rudolf: Anschauliches Denken, Köln, 2001. 258 Arnheim, Rudolf: Visual Thinking, Berkeley, Los Angeles, 1969.
152 | Bildnerisches Denken
de«259, liefert. Entsprechend findet man in dem Buch keine systematische Erklärung, was unter dem anschaulichen Denken zu verstehen ist. Dennoch wird deutlich, dass es ihm um das Denken schlechthin geht. So vertritt Arnheim im Gegensatz zur traditionellen Theorie des Denkens die These, dass das Denken gerade nicht in Worten geschieht.260 Stattdessen ist seiner Ansicht nach die Sinnlichkeit das Medium des Denkens: »[D]as menschliche Denken kann nicht über die Formen hinausgehen, die ihm die Sinne liefern. Die Sprache ist also ein beredter Zeuge dafür, daß sich das Denken im Sinnlichen abspielt.«261 Alle Wahrnehmung ist daher eine vorbegriffliche Leistung: »Die Formwahrnehmung enthält die Anfänge der Begriffsbildung.«262 Ebenso ist auch das anschauliche Denken vorbegrifflich und kann daher nur durch Begriffe rekonstruiert werden: »Wenn man anschauliches Denken in Bilddarstellungen nachweisen will, so muß man sich nach Formen und Formbeziehungen umsehen, die in einfacher Entsprechung Begriffe und Begriffsbeziehungen widerspiegeln.«263 Wahrnehmen und Denken gehören so zu einem einheitlichen Erkenntnisprozess, der ganz wesentlich im Abstrahieren besteht: »Die Wahrnehmung besteht, wie oben gezeigt, in dem Erfassen wesentlicher Allgemeineigenschaften; und umgekehrt braucht das Denken als seinen Gegenstand Vorstellungen von der Erfahrungswelt. Die gedankliche Qualität der Wahrnehmung und die Wahrnehmungsqualität des Denkens ergänzen einander; und dies macht die menschliche Erkenntnis zu einem einheitlichen Prozeß, der bruchlos vom Erwerb der elementarsten Sinnesgegebenheiten zu den allgemeinsten Ideen führt. Das Hauptmerkmal dieses einheitlichen Erkenntnisprozesses besteht darin, daß er auf jeder Stufe Abstraktionen verwendet. Was unter Abstraktion zu verstehen sei, muß also sorgfältig betrachtet werden.«264
Arnheims Konzept des anschaulichen Denkens steht in klarem Kontrast zum hier vorgestellten Modell des Bildnerischen Denkens. Zwei wesentliche Unterschiede wurden deutlich: Erstens zielt Arnheim auf eine Charakterisierung des Denkens im Allgemeinen als anschaulich ab. Zweitens kennzeichnet er dieses Denken als Abstrahieren.
259 Arnheim, Rudolf: Anschauliches Denken, Köln, 2001, S. 9. 260 Vgl. ebenda, S. 103. 261 Ebenda, S. 220. 262 Ebenda, S. 37. 263 Ebenda, S. 239. 264 Ebenda, S. 150.
3 Denken | 153
Auch der Band Das bildnerische Denken: Charles Sanders Peirce265 ist dieser Richtung zuzuordnen. Der Band über Peirce verfolgt ein ganz ähnliches Ziel wie Arnheim, auch wenn der Buchtitel und der Titel des Aufsatzes von Helmut Pape suggerieren, es ginge um das »Bildnerische Denken«. Pape stellt in seinem Text »Was ist Peirce’ bildnerisches Denken?« deutlich das Ziel des Buches heraus: Es wird die These vertreten, »dass Visualität das gesamte Peirce’sche Denken bestimmt«266. Weiterhin soll der Band zeigen, dass »Peirce’ These von der rahmenden Funktion visueller Qualitäten und Wahrnehmungsweisen […] auf der Annahme [basiert], dass visuelle Formung von nicht verkörperten Qualitäten und ein visueller Denkstil den Weltzugang moderner Wissenschaften erst ermöglichten.«267 In beiden Werken geht es also darum, Visualität des Denkens schlechthin zu begründen. Die bisher angeführten Untersuchungen haben mit dem Modell des Bildnerischen Denkens nicht direkt etwas zu tun, weil sie sich nicht mit verschiedenen Denkarten beschäftigen. Einen fließenden Übergang zum zweiten Lager der alternativen Denktheorien stellen solche Ansätze dar, die diese alternative Denkart in Abhängigkeit zum begrifflichen Denken beschreiben. Damit verbunden ist oft die Vorstellung einer Hierarchie der Denkarten bzw. von »verschiedene[n] Stufen des Denken«268, so dass das alternative Denken z. B. als »vernunftanalog«269 – wie bei Baumgarten – oder als »vorbegrifflich«270 – wie bei Wiesing – bezeichnet wird. Baumgartens Theorie des Denkens wurde in Kapitel 3.1.3.2, Wiesings Ansatz in Kapitel 2.2.3.2 vorgestellt. Ein Autor des zweiten Lagers, der die Alternative zum wissenschaftlichen Denken diesem gleichrangig gegenübergestellt, ist Konrad Fiedler. Allerdings bezeichnet er diese alternative Tätigkeit zwar als »geistig«, aber nicht
265 Engel, Franz u. a. (Hg.): Das bildnerische Denken: Charles S. Peirce, Berlin, 2012. 266 Pape, Helmut: »Was ist Peirce’ bildnerisches Denken?«, in: Engel, Franz u. a. (Hg.): Das bildne-
rische Denken: Charles S. Peirce, Berlin, 2012, S. 74. 267 Ebenda, S. 76. 268 Mittelstraß, Jürgen; Lorenz, Kuno: »Denken«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philoso-
phie Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005, S. 154. 269 Baumgarten, Alexander Gottlieb: »Aesthetica § 1«, in: ders: Texte zur Grundlegung der Ästhetik, Hamburg, 1983, S. 78. Vgl. hierzu auch: Jäger, Michael: Kommentierende Einführung in Baumgartens »Aesthetica«, Hildesheim, New York, S. 31. 270 Vgl. z. B. Wiesing, Lambert: Phänomene im Bild, München, 2007, S. 35.
154 | Bildnerisches Denken
als »Denken«.271 Gottfried Boehm ist einer der prägnantesten Vertreter des zweiten Lagers. Er beschreibt zwei ganz unterschiedliche Weltzugänge, die er aber eher mit dem Begriff des Logos als mit dem des Denkens kennzeichnet. So prägt er für die alternative Denkart, die sich in Bildern ausdrückt, den Begriff des »ikonischen Logos«: »Das Ikonische repräsentiert einen Logos, d. h. Bilder generieren auf ihre nichtsprachliche Weise einen Sinn und eröffnen damit unersetzliche Zugänge zur Welt und deren Erkenntnis.«272 »Die Pointe dieses Logos [des ikonischen Logos, Anm. d. A.] besteht vielmehr darin, andere, reichere Zugänge zur Welt zu gewinnen, unser Erkenntnisspektrum zu erweitern und seine Subtilität zu präzisieren.«273 Aber Boehm bemerkt auch Anfang des 21. Jahrhunderts noch, dass eine zufriedenstellende Untersuchung dieser alternativen Denkform noch aussteht: »Allerdings und eklatant mangelt es an unserer Fähigkeit, hinreichend zu verstehen, was da in den Bildern geschehen ist und geschieht. Unter ikonischen Vorzeichen steht eine Revision dessen an, was Logos bedeutet.«274 Zu beiden Lagern könnten weitere Autoren angeführt werden, die ähnliche Gedanken formuliert haben, so etwa auch die Autoren des Sammelbandes Logik des Bildlichen. Zur Kritik der ikonischen Vernunft.275 Eine Ideengeschichte ist weder für das allgemeinere – visuelle – Denken noch für das speziellere – Bildnerische – Denken geschrieben. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich daher exemplarisch auf zwei Autoren des zweiten Lagers. Sie wurden ausgewählt, weil sie die alternative Denkart deutlich als konkretisierenden Denkvollzug kennzeichnen und ihr einen herausragenden Platz im Rahmen ihrer Theorie einräumen. Wolfgang Welsch hat explizit eine Theorie des Denkens entworfen, John Dewey hingegen nur implizit. 3.3.1 John Dewey Dewey entwickelt in seinem Buch Art as experience276 eine Kunsttheorie, die den Begriff der Erfahrung (engl. experience) ins Zentrum rückt. Ausgehend von einer allgemeinen Erklärung dieses Phänomens erläutert er die spezifi-
271 Vgl. Fiedler, Konrad: »Der Ursprung der künstlerischen Tätigkeit«, in: ders: Schriften über Kunst, Köln, 1996, S. 200. 272 Boehm, Gottfried: »Das Bild und die hermeneutische Reflexion«, in: Figal, Günter; Gander, Hans-Helmut (Hg.): Dimensionen des Hermeneutischen, Frankfurt a. M., 2005, S. 23. 273 Ebenda, S. 34. 274 Ebenda, S. 35. 275 Heßler, Martina; Mersch, Dieter (Hg.): Logik des Bildlichen, Bielefeld, 2009. 276 Dewey, John: Art as experience, New York, 1980.
3 Denken | 155
schen Merkmale einer ästhetischen Erfahrung, die seiner Ansicht nach jedem Kunstwerk zugrunde liegt. Dabei unterscheidet er zunächst zwischen gewöhnlichen Erfahrungen und »eine Erfahrung machen«. Eine Theorie des Denkens ist darin insofern enthalten, als eine bestimmte Denkleistung hierfür das Unterscheidungskriterium liefert. Diese Denkleistung ist auch in der ästhetischen Erfahrung gegeben, die nach Dewey eine besondere Stellung einnimmt, weil sie paradigmatisch für alle anderen Fälle von Erfahrungen ist. Demnach ist auch die Denkleistung in der ästhetischen Erfahrung nicht nur eine Denkleistung unter Vielen. Vielmehr ist sie paradigmatisch für das Denken, das Erfahrungen schlechthin konstituiert. Es ist im Kern ein Denken, das an das Sinnliche gebunden ist und sich im Sinnlichen zeigt. 3.3.1.1 Deweys Konzept der ästhetischen Erfahrung Zunächst nimmt Dewey eine Unterscheidung vor zwischen Erfahrungen machen und »eine Erfahrung« machen. Das Kriterium, das uns berechtigt, von »einer Erfahrung« zu sprechen, beschreibt er wie folgt: »Experience occurs continuously, because the interaction of live creature and environing conditions is involved in the very process of living. […] Oftentimes, however, the experience had is inchoate. Things are experienced but not in such a way that they are composed into an experience. […] In contrast with such experience, we have an experience when the material experienced runs its course to fulfillment. Then and then only is it integrated within and demarcated in the general stream of experience from other experiences.«277
An der Wortwahl Deweys – »fulfillment« – erkennt man, dass mit dem Kriterium für »eine Erfahrung« nicht nur eine bestimmte Art von äußerlich beschreibbarem Vorgang gemeint ist. Dies wird auch an den Beispielen für »eine Erfahrung machen« deutlich, die er anführt: »A piece of work is finished in a way that is satisfactory; a problem receives its solution; a game is played through; a situation, whether that of eating a meal, playing a game of chess, carrying in a conversation, writing a book, or taking part in a political campaign, is so rounded out that its close is a consummation and not a cessation. Such an experience is a whole and carries with it its own individualizing quality and self-sufficiency. It is an experience.«278
277 Ebenda, S. 35, Hervorh. i. O. 278 Ebenda, Hervorh. i. O.
156 | Bildnerisches Denken
Ob man »eine Erfahrung« macht, hängt auch wesentlich von der Innenperspektive des jeweiligen Subjektes ab, um dessen Erfahrung es geht. Doch geht es dabei nicht um eine passive Sicht des Subjektes auf das Erlebte. Stattdessen entsteht eine Erfahrung aus der Relation aktiver und passiver Elemente, aus Handeln und Hinnehmen. Beide Elemente in eine sinnvolle Beziehung zueinander zu setzen, ist die Aufgabe des Subjektes. Erst wenn dies gelingt, entsteht aus dem bloßen Strom von Erfahrungen »eine Erfahrung«: »An experience has pattern and structure, because it is not just doing and undergoing in alternation, but consists of them in relationship. To put one’s hand in the fire that consumes it is not necessarily to have an experience. The action and its consequence must be joined in perception.«279 In der Herstellung dieser Relation zwischen aktivem Handeln und passivem Erleben sieht Dewey die wesentliche Denkarbeit, die das Subjekt leisten muss: »This relationship is what gives meaning; to grasp it is the objective of all intelligence. The scope and content of the relations measure the significant content of an experience.«280 Der Unterschied zwischen »einer Erfahrung« und »einer ästhetischen Erfahrung« ist kein grundsätzlicher, sondern ein gradueller. Dewey betont, dass jede Erfahrung ästhetische Züge trägt, bei einer ästhetischen Erfahrung sind diese Züge nur besonders deutlich.281 Die ästhetische Erfahrung ist paradigmatisch für eine Erfahrung schlechthin: »[N]o experience of whatever sort is a unity unless it has esthetic quality.«282 »In short, art, in its form, unites the very same relation of doing and undergoing, outgoing and incoming energy, that makes an experience to be an experience.«283 Für die ästhetische Erfahrung wiederum ist der Schaffensprozess eines Künstlers paradigmatisch. Denn dort ist die Beziehung zwischen aktivem Tun und passivem Erleben am engsten und am direktesten vorhanden. Ein Künstler nimmt sofort die Wirkung seines Pinselstrichs wahr und kann sein weiteres Handeln nach dieser Wirkung ausrichten. Handeln und Erleben verschmelzen in eins. »Man whittles, carves, sings, dances, gestures, molds, draws and paints. The doing or making is artistic when the perceived result is of such a nature that its qualities as perceived have controlled the
279 Ebenda, S. 44. 280 Ebenda. 281 Vgl. ebenda, S. 46. 282 Ebenda, S. 40. 283 Ebenda, S. 48.
3 Denken | 157
question of production. […] The artist embodies in himself the attitude of the perceiver while he works.«284 »What is done and what is undergone are thus reciprocally, cumulatively, and continuously instrumental to each other.«285
Aber auch jeder Prozess der Rezeption von Kunst kann zu einer ästhetischen Erfahrung werden, da auch in der Rezeption aktive Tätigkeit nötig ist.286 Dewey unterscheidet hier zwischen »perception« und »recognition«, um den Unterschied zwischen aktivem und passivem Betrachten deutlich zu machen: »The difference between the two is immense. […] In recognition there is a beginning of an act of perception. But this beginning is not allowed to serve the development of a full perception of the thing recognized. It is arrested at the point where it will serve some other purpose, as we recognize a man on the street in order to greet or to avoid him, not so as to see him for the sake of seeing what is there.«287
Dewey beschreibt hier den bereits angedeuteten Unterschied zwischen der alltäglichen Wahrnehmung zum Zweck der Gegenstandserkennung und der bildnerischen Wahrnehmung. Diese Differenz wird in den Kapiteln 3.4.2 und 5.2 näher ausgeführt. Nicht-ästhetische Erfahrungen unterscheiden sich laut Dewey von den ästhetischen dadurch, dass ihre Entwicklung nicht alleine von der Relation von Handeln und Erleben bestimmt wird. Es treten weitere Ziele und Interessen hinzu, so dass der Aspekt des Ästhetischen, der die Erfahrung zu einer Erfahrung werden lässt, nur einer von mehreren Bestimmungsfaktoren darstellt.288 Deweys Theorie des Denkens ist ein Teil seiner Theorie der Erfahrung, da in jeder Erfahrung eine bestimmte Denkleistung nötig ist, um die Erfahrung erst zu »einer Erfahrung« werden zu lassen. Diese Denkleistung besteht darin, Relationen herzustellen zwischen dem eigenen aktiven Tun und dem passiven Erleben. Durch das Herstellen solcher Relationen werden die Einzelaspekte einer Erfahrung zu einer Ganzheit integriert und verursachen dadurch die Erfahrung der Erfüllung oder Vollendung. Im Produktionsprozess von Kunst ist die Relation von aktivem Tun und dem passi-
284 Ebenda, Hervorh. i. O. 285 Ebenda, S. 50. 286 Vgl. ebenda, S. 52. 287 Ebenda, Hervorh. i. O. 288 Vgl. ebenda, S. 55.
158 | Bildnerisches Denken
ven Erleben nicht nur so eng, wie sie überhaupt nur sein kann, sie ist auch das eigentliche Ziel dieses Prozesses. Daher stellt die ästhetische Erfahrung beim künstlerischen Gestalten das paradigmatische Beispiel nicht nur für alle ästhetischen Erfahrungen, sondern für Erfahrungen schlechthin dar. Insofern kann auch die spezifische Denkleistung in der ästhetischen Erfahrung – die man auch als »ästhetisches Denken« bezeichnen könnte – als paradigmatisch für die Denkleistung in allen Erfahrungen angesehen werden. Eine vollständige Theorie des Denkens, die das Denken schlechthin systematisiert, liefert Dewey damit natürlich nicht. Dennoch entwirft er die Theorie einer Denkart, die in ihrem Vollzug einen konkretisierenden Charakter aufweist, wie im Folgenden gezeigt wird. 3.3.1.2 Konkretisierender Vollzug des Denkens bei Dewey Nach Dewey besteht die spezifische Denkleistung der ästhetischen Erfahrung darin, innerhalb dieser Erfahrung eine Relation herzustellen zwischen dem aktiven Tun und dem passiven Erleben. Dadurch, so Dewey, kann überhaupt erst eine Erfahrung als abgeschlossenes Ganzes erlebt werden. Der künstlerische Produktionsprozess ist hierbei paradigmatisch für eine Erfahrung schlechthin. Denn für Dewey ist es selbstverständlich, dass ein Künstler, z. B. ein Maler, während seiner Arbeit Denkprozesse durchläuft, und diese sich in seinen Pinselstrichen äußern: »The artist has his problems and thinks as he works. But his thought is more immediately embodied in the object. Because of the comparative remoteness of his end, the scientific worker operates with symbols, words and mathematical signs. The artist does his thinking in the very qualitative media he works in, and the terms lie so close to the object that he is producing that they merge directly into it.«289
Diese von Dewey beschriebene Art des Denkens ist nicht vom Medium der Sprache abhängig. Stattdessen, so Dewey, denkt der Maler in Verhältnissen von Qualitäten: »Any idea that ignores the necessary rôle [sic!] of intelligence in production of works of art is based upon identification of thinking with use of one special kind of material, verbal signs and words. To think effectively in terms of relations of qualities is as severe a demand upon thought as to think in terms of symbols, verbal and mathematical. […] [T]he production of a work of genuine art probably
289 Ebenda, S. 16.
3 Denken | 159
demands more intelligence than does most of the so-called thinking that goes on among those who pride themselves on being ›intellectuals.‹«290
In Übereinstimmung mit den in Kapitel 3.1.2 erläuterten Theorien sieht Dewey einen wesentlichen Grundzug des Denkens im Vergleichen. Nur durch Vergleiche können Qualitäten miteinander in Beziehung gesetzt werden. Zudem erkennt auch Dewey in der Denkleistung des Malers eine Denkart, die komplementär zur begrifflichen ist: »Logicians for certain purposes regard qualities like red, sweet, beautiful, etc., as universals. As formal logicians, they are not concerned with existential matters which are precisely what artists are concerned with. A painter knows, therefore, that there are no two reds in a picture exactly like each other, each being affected by the infinite detail of its context in the individual whole in which it appears.«291
Was Dewey hier beschreibt, ist die oben erläuterte Denkleistung des Konkretisierens. Der Logiker sucht laut Dewey das allen Rottönen Gemeinsame im Begriff »Rot«, während dem Maler klar ist, dass es in einem Bild niemals zweimal dasselbe Rot gibt, weil die Wirkung jedes Farbtons immer auch von den direkt benachbarten Farbtönen beeinflusst wird. In dieser wie auch in der weiteren Beschreibung der für den Maler relevanten Relationen kann man die Unterscheidung der vier Funktionen des Bildnerischen Denkens wiedererkennen – natürlich ohne dass Dewey sie selbst so benennt. Sie werden zwar erst ausführlich in Teil 4 hergeleitet. Im Vorgriff darauf sollen hier dennoch die Erläuterungen zum Denkprozess des Künstlers, die Dewey gibt, den vier Funktionen des Bildnerischen Denkens gegenübergestellt werden. So entsprechen das Differenzieren verschiedener Rottöne und das Wahrnehmen einzelner Pinselstriche der ersten Funktion des Bildnerischen Denkens – dem Wahrnehmen: »A painter must consciously undergo the effect of his every brush stroke or he will not be aware of what he is doing and where his work is going.«292 Passend zur zweiten Funktion, dem Zusammensetzen von Farben und Formen in Relation zum Bildganzen, schreibt Dewey folgendes: »Moreover, he has to see each particular connection of doing and undergoing in relation to the whole that he desires to produce. To apprehend such relations is to think, and is one of the
290 Ebenda, S. 46. 291 Ebenda, S. 215, Hervorh. i. O. 292 Ebenda, S. 45.
160 | Bildnerisches Denken
most exacting modes of thought.«293 Auch die dritte Funktion, das Verbinden, wird bei Dewey angesprochen. Bilder – wie auch Musik – haben nach Dewey einen Sinn (englisch meaning), auch wenn dieser meist nicht in Verbalsprache übersetzt werden kann: »Thinking directly in terms of colors, tones, images, is a different operation technically from thinking in words. But only superstition will hold that, because the meaning of paintings and symphonies cannot be translated into words, or that of poetry into prose, therefore thought is monopolized by the latter. If all meanings could be adequately expressed by words, the arts of painting and music would not exist. There are values and meanings that can be expressed only by immediately visible and audible qualities, and to ask what they mean in the sense of something that can be put into words is to deny their distinctive existence.«294
Das Erfinden als vierte Funktion des Bildnerischen Denkens ist ebenfalls in Deweys Reflexion enthalten. So beschreibt auch er eine Denkleistung, die darin besteht, die anderen bisher beschriebenen Funktionen in die Vorstellung (englisch in imagination) zu verlagern: »An incredible amount of observation and of the kind of intelligence that is exercised in perception of qualitative relations characterizes creative work in art. The relations must be noted not only with respect to one another, two by two, but in connection with the whole under construction; they are exercised in imagination as well as in observation.«295
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Deweys Konzept der ästhetischen Erfahrung eine Theorie einer alternativen Denkform enthalten ist, die sehr große Ähnlichkeit zum Modell des Bildnerischen Denkens aufweist. Das Denken in der ästhetischen Erfahrung ist komplementär zum abstrahierenden Denken. Sein charakteristischer Denkvollzug ist das Konkretisieren. Zudem identifiziert Dewey sowohl im Produktions- wie auch im Rezeptionsprozess von Bildern wesentliche Denkleistungen, die den vier Funktionen des Bildnerischen Denkens entsprechen. Dass dieses Denken seiner Ansicht nach gleichwertig zum wissenschaftlichen Denken ist, macht er unmissverständlich klar:
293 Ebenda. 294 Ebenda, 73–74. 295 Ebenda, S. 50–51.
3 Denken | 161
»Because perception of relationship between what is done and what is undergone constitutes the work of intelligence, and because the artist is controlled in the process of his work by his grasp of the connection between what he has already done and what he is to do next, the idea that the artist does not think as intently and penetratingly as a scientific inquirer is absurd.«296
3.3.2 Wolfgang Welsch Wolfgang Welsch hat sich expliziter als Dewey mit den Begriffen »Vernunft«, »Rationalität« und »Denken« auseinandergesetzt. In seinem Werk mit dem Titel Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft297 entwirft er in systematischer Weise ein allgemeines Konzept von Vernunft und Rationalität. Der ästhetischen Rationalität kommt in diesem Konzept eine herausragende Rolle zu. Ähnlich wie bei Dewey ist sie paradigmatisch – bei Welsch für Vernunft schlechthin. Was er näher unter diesem Rationalitätstyp versteht, erläutert er – nun weniger systematisch – in dem Band Ästhetisches Denken298, in welchem mehrere Aufsätze zu diesem Thema zusammengefasst wurden. 3.3.2.1 Welschs Konzept von Vernunft und Rationalität Wolfgang Welsch unterscheidet in seiner Theorie des Denkens zwischen den verschiedenen Typen von Rationalität einerseits und der einen Vernunft andererseits, die sich auf diese Rationalitätstypen beziehen kann. Mit dieser Unterscheidung sollen aber keineswegs zwei verschiedene Vermögen beschrieben werden. Stattdessen handelt es sich nach Welsch um dasselbe Vermögen, das uns in zwei unterschiedlichen Ausprägungen begegnen kann: einmal zeigt es sich als eine Rationalität (unter mehreren möglichen), die z. B. durch bestimmte Paradigmen und Gegenstandsbereiche gekennzeichnet ist. Zum anderen tritt es als Vernunft in unserer Fähigkeit zu Tage, unabhängig von einem der vielen Rationalitätstypen über die Relationen der verschiedenen Rationalitäten zu reflektieren: »Vernunft ist in ihrer Tätigkeit stets auf Rationalität bezogen. Seit Kant obliegt es ihr, für das korrekte Verhältnis der diversen Rationalitätsformen zu sorgen.«299 Diese beiden Erscheinungsweisen desselben Vermögens sind dabei nicht unabhängig voneinander, weil bereits in der Innenperspektive einer Rationalität Reflexionen zum Verhältnis zu anderen Rationalitäten enthalten sind – und sei es nur in
296 Ebenda, S. 45. 297 Welsch, Wolfgang: Vernunft, Frankfurt a. M., 1996. 298 Welsch, Wolfgang: Ästhetisches Denken, Stuttgart, 2010. 299 Welsch, Wolfgang: Vernunft, Frankfurt a. M., 1996, S. 437.
162 | Bildnerisches Denken
Form einer Abgrenzung oder Ablehnung. »Rationalitäten sind […] von vorneherein durch Bezugnahmen aufeinander geprägt und durch interne Verflechtungen bestimmt.«300 Sowohl Vernunft als auch Rationalität im Sinne Welschs weisen dabei Züge eines konkretisierenden Denkvollzugs auf, wie im Folgenden gezeigt wird. 3.3.2.2 Konkretisierender Vollzug des Denkens bei in Welsch In seinem Band Ästhetisches Denken entwirft Welsch ein Plädoyer für einen bestimmten Rationalitätstypus, den Typus des ästhetischen Denkens. Ästhetisch im Sinne von sinnlich ist laut Welsch dieses Denken in zweifacher Hinsicht: Einmal in Bezug auf den Gegenstandsbereich und zum anderen in Bezug auf die Vollzugsart des Denkens: »Ästhetisches muß, damit von ›ästhetischem Denken‹ gesprochen werden kann, nicht bloß Gegenstand der Reflexion sein, sondern den Kern des Denkens selbst betreffen. […] Ästhetisches Denken ist eines, für das Wahrnehmungen ausschlaggebend sind. Und zwar sowohl als Inspirationsquelle wie als Leit- und Vollzugsmedium.«301
Das ästhetische Denken nimmt dabei ähnlich wie bei Dewey eine zum begrifflichen Denken ergänzende Position ein: »Begriffliches Denken reicht […] nicht aus, eigentlich kompetent ist – diagnostisch wie orientierend – ästhetisches Denken.«302 In Übereinstimmung mit Dewey sieht auch Welsch die Kernkompetenz des ästhetischen Denkens im Erkennen von Unterschieden und damit im Konkretisieren: »Es [das ästhetische Denken, Anm. d. A.] sensibilisiert für Differenzen und für die Irreduzibilität und Inkommensurabilität von Lebensformen.«303 Wie oben erläutert führt diese Aufmerksamkeit auf die Unterschiede automatisch zur Begriffsferne dieses Denkens, ohne dass es dadurch seinen Status als Denkleistung verlieren würde: »Daher bedeutet das Votum für ein ›ästhetisches Denken‹ keineswegs ein simples Plädoyer für Empfindung, Gefühl, Affekt und dergleichen – jedenfalls so lange nicht, wie man diese Phänomene noch traditionell als im Schema einer Gegenüberstellung zu Reflexion, Gedanke, Begriff denkt. […] Man kann diese neuartige Akzentuierung zusammen mit ihrer behutsamen Begrenzung auch so
300 Ebenda, S. 443. 301 Welsch, Wolfgang: »Zur Aktualität ästhetischen Denkens«, in: ders.: Ästhetisches Denken, Stuttgart, 2010, S. 46. 302 Ebenda, S. 57. 303 Ebenda, S. 75.
3 Denken | 163
ausdrücken: Die entscheidenden Gehalte sind von Grund auf ästhetisch signiert und bleiben es; vor allem können sie durch Reflexion nicht substituiert werden.«304
Ähnlich wie Dewey beschreibt auch Welsch die Kunsterfahrung als besonders geeignetes Feld, um ästhetisches Denken einzuüben, da in der Kunst der Pluralismus wie kaum in einem anderen Bereich ausgeprägt ist. Ein Denken, das sich nicht darauf konzentriert, Phänomene unter einen einheitlichen Begriff zu subsumieren, sondern das jeweils Eigentümliche der Phänomene zu erkennen, ist besonders geeignet, mit dem Pluralismus nicht nur in der zeitgenössischen Kunst, sondern auch in der Gesellschaft fertig zu werden.305 Aus diesem Grund schreibt Welsch dem ästhetischen Denken eine Bedeutung zu, die weit über den Kunstbereich hinausgeht: »Meine These lautet, dass ästhetisches Denken gegenwärtig das eigentlich realistische ist.«306 Dieses realistische Potential des ästhetischen Denkens ist nach Welsch vor allem durch die pluralistische Entwicklung unserer Gesellschaft verursacht. Ästhetisches Denken ist ein Denken, das besonders gut mit diesem Pluralismus zurechtkommt, weil das Erkennen von Unterschieden – bzw. das Konkretisieren – zu seiner Kernkompetenz gehört: »Die gegenwärtige Gesellschaft ist keine einheitliche Truppe, sondern gleicht einem losen Netz heterogener Formen. […] Ästhetisches Denken gibt hierfür das Nötige an die Hand«307. Aus demselben Grund sieht Welsch das ästhetische Denken auch als paradigmatisch für Vernunft schlechthin an – zumindest für die Art von Vernunft, die in der Lage ist, sich in den verschiedenen sich teilweise widersprechenden Formen von Rationalität zurecht zu finden. Welsch nennt diese Form von Vernunft »transversal«. Seiner Beschreibung nach trägt diese Vernunft nicht nur ästhetische Züge, sondern zeichnet sich durch einen konkretisierenden Denkvollzug aus: »Transversale Vernunft nimmt […] auch Züge ästhetischer Vernünftigkeit an. Sensibilität wird zu einer Elementarbedingung in einer Welt der Pluralität.«308 »Inmitten der neuartigen Pluralität von Rationalitätsformen und Paradigmen – in der es einen alleinseligmachenden Maßstab nicht mehr gibt – zeichnet sich Vernunft gerade durch Sinn für das Spezifische einer Situation aus. […] Sie hat ein
304 Ebenda, S. 55. 305 Vgl. ebenda, S. 71 und S. 75. 306 Ebenda, S. 57. 307 Ebenda, S. 75. 308 Welsch, Wolfgang: Vernunft, Frankfurt a. M., 1996, S. 796.
164 | Bildnerisches Denken
Richtiges zu treffen, das nicht das unter allen, sondern unter den jeweiligen Umständen Richtige ist. In gewissem Maß nimmt Vernunft darin sinnenartige Züge an.«309 »Auf die Grundleistungen [der Vernunft, Anm. d. A.] des Gespürs für Unterschiede, des Gewahrwerdens von Eigentümlichkeiten, des Urteilens ohne Regelbesitz wurde schon hingewiesen. […] Inmitten der Pluralität benötigt Vernunft Sinn für Differenz.«310
Konsequenterweise sieht Welsch auch in der transversalen Vernunft den Aspekt der Begriffsferne: »Vernünftigkeit schließt in all diesen Funktionen ein begrifflich inexplikables Moment ein. Sie stellt ein Können dar, dessen Trefflichkeit letztlich nicht ausschreibbar, lehrbar und begründbar, sondern allenfalls demonstrierbar und erlernbar ist.«311 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Welschs Theorie des ästhetischen Denkens und der transversalen Vernunft viele Aspekte wiederzufinden sind, die der Charakteristik des Bildnerischen Denkens entsprechen. Er entwirft das Modell einer Denkform, deren zentrale Denkoperation nicht im Abstrahieren, sondern im Erkennen von Unterschieden liegt, d. h. im Konkretisieren. Begriffliches und ästhetisches Denken sieht er in Übereinstimmung mit Dewey als zwei Denkarten an, die sich gegenseitig ergänzen – ganz ähnlich der beiden Denkarten des Abstrahierens und Konkretisierens. 3.3.3 Konkretisierendes Denken bei Dewey und Welsch Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte zusammengefasst, in denen sich die Theorien Deweys und Welschs gleichen und unterscheiden. Anhand einer tabellarischen Auflistung wird gezeigt, welche Funktion das ästhetische Denken in ihren jeweiligen Konzepten erfüllt. Zudem wird deutlich, welche Bedeutung dieses Denken den beiden Autoren zufolge für unser Leben insgesamt hat. In Tabelle 8 sind die wesentlichen Aspekte der beiden Konzepte zum Vergleich zusammengefasst. Der augenfälligste Unterschied beider Theorien liegt in ihrer Zielrichtung. Dewey entwirft eine Theorie der ästhetischen Erfahrung als Kunsttheorie, während es Welsch bei seinem Konzept des ästhetischen Denkens um eine Theorie der Rationalität bzw. der Vernunft geht. Dennoch gibt es große Gemeinsamkeiten.
309 Ebenda, S. 621. 310 Ebenda, S. 801. 311 Ebenda.
3 Denken | 165
AUTOREN
Ziel = ästhetisches Denken = Funktion des ästhetischen Denkens =
DEWEY WELSCH Theorie der ästhetischen Theorie des ästhetischen Erfahrung Denkens Theorie der Kunst Vernunft & der Rationalität begriffsfern, konkretisierend im Vollzug und kunstaffin innerhalb der Kunst Verstehenden von Herstellen einer Pluralismus, Sinnlichkeit & ästhetischen Erfahrung, Einzigartigkeit d. h. der Relationen zwischen aktivem Tun & passiven Erleben außerhalb der Kunst Verstehenden von Herstellen einer Erfahrung Pluralismus & Einzigartigund dadurch eines erfüllten keit in der Gesellschaft Lebens Ästhetische Ästhetisches Erfahrung Denken = paradigmatisch für = paradigmatisch für transversale Vernunft Erfahrungen schlechthin schlechthin
Tabelle 8: Vergleich der alternativen Theorien des Denkens von Dewey und Welsch In beiden Konzepten wird die Theorie einer Denkart entwickelt, die sehr ähnlich charakterisiert wird. Sowohl bei Dewey als auch bei Welsch wird diese Denkart als Alternative zum begrifflichen, d. h. abstrahierenden Denken angesehen. Beide Autoren betonen außerdem eine besondere Aufmerksamkeit dieses Denkens für Unterschiede. Das Konkretisieren ist also ein wesentliches Element dieses Denkens. Zudem beschreiben beide diese Denkarten als besonders relevant für Kunsterfahrungen bzw. ästhetische Erfahrungen. Dennoch halten sie dieses Denken auch außerhalb der Kunst für höchst bedeutsam bzw. paradigmatisch. Während Dewey das ästhetische Denken als wesentlich für Erfahrungen schlechthin ansieht, geht Welsch davon aus, dass dieses Denken ein wesentliches Moment von Vernunft überhaupt darstellt. Gemeinsam ist beiden Autoren, dass sie einen engen Zusammenhang sehen zwischen dem ästhetischen Denken und unserem
166 | Bildnerisches Denken
normalen Alltag. Für Dewey ist das ästhetische Denken Bedingung für das Erleben von Sinn, das in Erfahrungen stattfindet. Daher könnte man auch sagen, dass es Voraussetzung für ein glückliches oder sinnerfülltes Leben ist. Bei Welsch erhält das ästhetische Denken eine ähnlich bedeutsame Rolle, auch wenn er mit seinem Konzept auf etwas Anderes abzielt. Welsch konzentriert seinen Blick auf ein Manko traditioneller Vernunftkonzepte, die angesichts unserer pluralistischen Gesellschaft nicht mehr in der Lage sind, Orientierung zu bieten. Im ästhetischen Denken glaubt er eine Art von Rationalität zu erkennen, die uns dabei behilflich sein kann, uns in unserer pluralistischen Welt zurechtzufinden. In diesem Sinne kann auch nach Welsch das ästhetische Denken zum Glück und Wohlbefinden des Menschen beitragen.
3 Denken | 167
3.4
A BSTRAHIERENDES UND KONKRETISIERENDES D ENKEN Die vorherigen Kapitel haben das Konkretisieren als eine zum Abstrahieren komplementäre Denkart hergeleitet und mit anderen Theorien, insbesondere von Dewey und Welsch, verglichen. Es wurde gezeigt, dass nur das konkretisierende Denken in der Lage ist, das Phänomen des Bildlichen zu erfassen – und zwar sowohl in der Rezeption als auch in der Produktion von Bildern. Bilderfahrung ist daher eine Form des konkretisierenden Denkens. Somit ist These 1 begründet und die Gattung des Bildnerischen Denkens – das Denken – eingeführt.
Tabelle 9: Übersicht abstrahierendes und konkretisierendes Denken Als Abschluss dieses Teils werden die getroffenen Unterscheidungen nochmals zusammengefasst und die sich daraus ergebenden Konsequenzen
168 | Bildnerisches Denken
erläutert. Dazu wird zunächst ein Überblick über die Faktoren der beiden Denkarten gegeben (3.4.1). Anschließend wird das Bild als Gegenstand des konkretisierenden Denkens eingeführt und – zunächst negativ – in Abgrenzung zu Medien und Schemata bestimmt (3.4.2). Zum Abschluss wird erläutert, inwiefern abstrahierendes und konkretisierendes Denken aufeinander bezogen sein können, ohne dass ihre scharfe Trennung aufgehoben wird (3.4.3). 3.4.1 Faktoren des Denkens im Überblick Tabelle 9 gibt einen Überblick über das bisher Erarbeitete. Abstrahierendes und konkretisierendes Denken unterscheiden sich grundsätzlich hinsichtlich ihres Vollzugs. Dieser Unterschied ist absolut, d. h. es gibt keinen fließenden Übergang. Er kann unabhängig von der Frage beschrieben werden, in welchen Medien das Denken zum Ausdruck kommt. Durch beide Denkarten können die Gegenstände des Denkens graduell abstrakter oder konkreter bestimmt werden. 3.4.1.1 Gegenstand des Denkens Der Gegenstand des Denkens ist als solcher unzugänglich. Das bedeutet, er kann nicht unabhängig von einer der beiden Denkarten betrachtet werden, sondern wird erst durch den abstrahierenden oder konkretisierenden Denkvollzug erschlossen. In diesem Denkvollzug wird der Gegenstand des Denkens charakterisiert – z. B. als »Mensch«, als »Frau mittleren Alters«, durch ein Piktogramm, das für »Frau« steht, durch ein Gedicht, durch eine Zeichnung oder ein Gemälde. Der Gegenstand des Denkens ist der Mensch, die Frau mittleren Alters oder das, was in dem Piktogramm, dem Gedicht, der Zeichnung und dem Gemälde zum Ausdruck kommt. Daher ist es nicht möglich, den Gegenstand sozusagen in Reinform mit dem Gegenstand des abstrahierenden oder konkretisierenden Denkens zu vergleichen. Der Gegenstand des Denkens ist bei der Produktion einer Charakterisierung – also z. B. beim Anfertigen einer Zeichnung – prinzipiell derselbe wie bei der Rezeption dieser Charakterisierung – also beim Betrachten der Zeichnung. Es ist der Gegenstand der Charakterisierung – also z. B. der Bildgegenstand der Zeichnung. Sowohl im konkretisierenden als auch im abstrahierenden Denken kann der Gegenstand des Denkens graduell abstrakter oder konkreter bestimmt sein. Je mehr Bestimmungen die Charakterisierung enthält, desto konkreter ist der Gegenstand. Je weniger Bestimmungen zur Kennzeichnung des Gegenstandes herangezogen werden, desto abstrakter ist er. Im abstrahierenden Denken ist die Kennzeichnung des
3 Denken | 169
Gegenstandes als »Mensch« daher abstrakter als die Bestimmung als »Frau mittleren Alters«, denn durch Letztere wird eine bestimmte Art von Menschen charakterisiert. Die Bestimmung als Mensch ist in ihr enthalten. Das Piktogramm steht für Frau und kennzeichnet den Gegenstand des Denkens daher konkreter als das Wort »Mensch«, aber abstrakter als die Beschreibung »Frau mittleren Alters«. Natürlich spielen bei all diesen Kennzeichnungen Kenntnisse über kulturelle Konventionen eine Rolle. Versteht man das Piktogramm nicht als Zeichen für »Frau«, sondern für »Frau mittleren Alters, die einen Rock trägt«, dann handelt es sich hierbei um eine sehr viel konkretere Kennzeichnung. Die Kenntnis von Konventionen ist aber nicht nur für das Verständnis visueller, sondern auch sprachlicher Charakterisierungen nötig. In gleicher Weise unterscheidet sich beim konkretisierenden Denken ein abstrakterer von einem konkreteren Gegenstand des Denkens: Das Gemälde kennzeichnet den Gegenstand des Denkens konkreter als die Zeichnung, weil in der Zeichnung alle farbigen Bestimmungen außer Acht gelassen wurden. Das Gedicht charakterisiert den Gegenstand des Denkens gerade als etwas, das nicht zu schildern ist, und beschreibt ihn daher am abstraktesten. Auch hier spielen kulturelle Konventionen eine Rolle. Fasst man die Zeichnung als ein Bild eines Gespenstes auf, das farblos ist und nur aus Umrisslinien besteht, handelt es sich dabei um eine mindestens ebenso konkrete Charakterisierung wie bei dem Gemälde. In der Regel interpretieren wir aber Zeichnungen als Darstellungen von farbigen Gegenständen, in denen die Farbe weggelassen wurde. So verstanden ist die Zeichnung abstrakter als das Gemälde. 3.4.1.2 Vollzug des Denkens Im abstrahierenden Denken wird der Gegenstand des Denkens dadurch charakterisiert, dass auf seine Gemeinsamkeiten mit anderen Gegenständen verwiesen wird. Das konkretisierende Denken beschreibt den Gegenstand des Denkens hingegen durch die Unterschiede, die er im Vergleich zu anderen Gegenständen aufweist. Die Frage, welche der beiden Denkarten den Gegenstand des Denkens »besser« oder »richtiger« kennzeichnet, ist dabei unsinnig, denn der Gegenstand als solches ist nicht zugänglich. Nur ein Vergleich zwischen dem Gegenstand des konkretisierenden Denkens und dem Gegenstand des abstrahierenden Denkens ist möglich. So kann man z. B. den Gegenstand, der durch das Wort »Frau« oder durch das entsprechende Piktogramm gekennzeichnet wird, vergleichen mit dem Gegenstand, den das Gemälde zeigt. Dabei wird man feststellen, dass die Kennzeichnungen
170 | Bildnerisches Denken
durch das Wort und durch das Piktogramm ebenso auf den Gegenstand des Gemäldes zutreffen. Auch die Beschreibung »Frau mittleren Alters« passt auf diesen Bildgegenstand. Auf den Gegenstand der Zeichnung hingegen trifft diese Beschreibung nicht zu, da dieses Bild offenbar eine alte Frau darstellt. 3.4.2 Das Bild als Gegenstand des konkretisierenden Denkens Wie die Beispiele verdeutlichen, deckt sich der Unterschied zwischen dem abstrahierenden und dem konkretisierenden Denken nicht mit der Differenzierung, die üblicherweise zwischen Bild und Sprache vorgenommen wird. Stattdessen zeigt die Tabelle, dass beide Denkarten sowohl visuell als auch verbal zum Ausdruck kommen können. Das abstrahierende Denken kann sich in der verbalen Kennzeichnung »Frau mittleren Alters« genauso äußern wie in der visuellen Charakterisierung durch das Piktogramm. Auf der anderen Seite kann das konkretisierende Denken verbal in einem Gedicht oder visuell in einer Zeichnung bzw. einem Gemälde zum Ausdruck kommen. Da das Bild hier als Gegenstand des konkretisierenden Denkens – genauer des Bildnerischen Denkens – beschrieben wird, kann der Begriff »Bild« nicht gleichzeitig als Bezeichnung für eine bestimmte Art von Medien verwendet werden. Zudem gibt es Charakterisierungen von Gegenständen, die zwar mit Hilfe visueller Medien ausgedrückt werden, aber dennoch nicht unter die Kategorie Bild fallen, wie beispielsweise das Piktogramm. Daher wird hier vorgeschlagen, statt der medialen Differenzierung von Bild und Sprache zwischen visuellen und verbalen Medien zu unterscheiden. Damit wird ein erster Hinweis darauf gegeben, was im Modell des Bildnerischen Denkens unter »Bild« verstanden wird. Die folgenden beiden Kapitel enthalten dabei aber – abgesehen von der allgemeinen Bestimmung des Bildes als Gegenstand des Bildnerischen Denkens – nur eine negative Kennzeichnung: Bilder sind keine Medien (3.4.2.1) und unterscheiden sich von Schemata (3.4.2.2). Eine positive Explikation des hier vorgeschlagenen Bildverständnisses erfolgt in Teil 4 (Kapitel 4.1.6 und 4.2.4). 3.4.2.1 Bilder und visuelle Medien Exemplarisch für alle Theorien, die das Bild als Medium begreifen, kann der Ansatz von Klaus Sachs-Hombach vorgestellt werden. Schon im Titel eines Buches von ihm – Das Bild als kommunikatives Medium312 – wird dieses Bildverständnis offensichtlich. Darin verdeutlicht er anhand eines tabellari-
312 Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006.
3 Denken | 171
schen Überblicks, dass er das Bild als Medium den Medien der Schriftsprache und der Lautsprache gegenüberstellt.313 In Übereinstimmung damit geht Sachs-Hombach davon aus, dass es zwei mediale Fähigkeiten gibt – das Sprachvermögen und das Bildvermögen.314 Das Phänomen des Piktogramms legt allerdings offen, dass diese zweipolige Differenzierung nicht ausreicht. So erläutert auch Sachs-Hombach, dass das Piktogramm weder ganz zum Bild noch ganz zur Sprache gehört, sondern eine Zwischenposition einnimmt: »Piktogramme liefern Beispiele für bildhafte Darstellungen, die mitunter so sehr konventionalisiert sind, dass sie mit einigem Recht als eine eigene Zeichenklasse zwischen Bildern und Wörtern behandelt werden können.«315 Er weist darauf hin, dass sie eigentlich wie Wörter funktionieren. 316
DENKEN
DENKARTEN UND MEDIENARTEN MEDIEN räumlich linear 231dimensional dimensional dimensional visuell plastisch verbal (akustisch/literal) z. B. Malerei, z. B. Steinskulp- z. B. Lautsprache, Beamertur, Tonplastik Schriftsprache projektion Abstrahierend Konkretisierend
Piktogramm für »Frau« Selbstportrait von Rembrandt
zeitlich 4dimensional auditiv z. B. Musik
Pausengong Morsezeichen BrandenburgiDavid von (konkrete) Poesie sche Konzerte Michelangelo Wegweiser
Wissenschaftlicher Text
Tabelle 10: Denkarten und Medienarten am Beispiel Dieser Unterschied kann treffender mit Bezug zu verschiedenen Denkarten beschrieben werden. Anstatt eine dritte Zeichenklasse einzuführen, wird hier daher vorgeschlagen, einerseits zwischen dem abstrahierenden und konkretisierenden Denken zu unterscheiden. Andererseits können verschie-
313 Vgl. Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 96. 314 Vgl. Sachs-Hombach, Klaus; Schirra, Jörg R. J.: »Medientheorie, visuelle Kultur und Bildanthropologie«, in: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bildtheorien, Frankfurt a. M., 2009, S. 419. 315 Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 154. 316 Vgl. Ebenda, S. 201 und S. 199.
172 | Bildnerisches Denken
dene Medienarten differenziert werden. Beide Denkarten können sich in allen Medien ausdrücken. Tabelle 10 veranschaulicht eine Möglichkeit, innerhalb der Medien eine Unterteilung vorzunehmen. Das Kriterium dieser Unterteilung ist die Art der Ordnung, die für das jeweilige Medium konstitutiv ist. So können die Elemente eines Mediums linear, räumlich oder zeitlich geordnet sein. Diese drei Ordnungsprinzipien entsprechen einer Ordnung hinsichtlich der vier Dimensionen – sofern man die Zeit als vierte Dimension anerkennen möchte. Die lineare Ordnung ist eindimensional, die räumliche kann zwei- oder dreidimensional sein, und die zeitliche ist vierdimensional. Bilder können in den beiden räumlichen Medien – genauer in visuell-plastischen Medien – zum Ausdruck kommen, wie in Teil 4 genauer erläutert wird. Die Begriffe zur näheren Kennzeichnung für die Medienarten entsprechen zum Teil bestimmten Sinnesmodalitäten, decken sich aber nicht ganz mit diesen: die plastischen Medien werden auch visuell wahrgenommen, aber nicht nur. Die Wahrnehmung von Dreidimensionalität wird durch ein Zusammenspiel vieler Sinne geleistet, daher könnte man sie als »plastische Wahrnehmung« bezeichnen. Die verbalen Medien werden als Schriftsprache (= verballiterales Medium) visuell und als Lautsprache (= verbal-akustisches Medium) auditiv wahrgenommen. Weitere Medienarten könnten durch Kombination mehrerer Ordnungsprinzipien kategorisiert werden, so zum Beispiel die audio-visuellen Medien durch die Kombination von räumlichen und zeitlichen Ordnungen. Diese Differenzierung der Medienarten soll hier aber höchstens als vage Ideenskizze ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit verstanden werden. Eine systematische Ausarbeitung des Medienbegriffs ist Aufgabe der Medienwissenschaft und wird dort laut Sachs-Hombach seit einigen Jahren vorangetrieben.317 Ebenso erfährt der Begriff der Bildmedien bisher noch keine allgemein anerkannte einheitliche Verwendung.318 Im Rahmen dieser Arbeit wird lediglich die Unterteilung der räumlichen Medien in visuelle und plastische Medien näher diskutiert (Kapitel 4.1.1).
317 Vgl. Ebenda, S. 96. 318 Vgl. Schirra, Joerg R. J.; Liebsch, Dimitri: »Bildmedien«, in: Schirra, Jörg R. J. u. a. (Hg.): Glossar
der Bildphilosophie, 2013, Online-Ausgabe, Zugriff am 11.07.2014, [ohne Seitenangabe].
3 Denken | 173
ABSTRAHIERENDES DENKEN
Abb. 11: Piktogramm 1 Abb. 12: Piktogramm 2
KONKRETISIERNDES DENKEN
Abb. 13: Dürer: »Porträt der Barbara Dürer«
Abb. 14: Dürer: »Portrait der Mutter«
= Charakterisierung… …desselben Gegenstandes ▼
…mehrerer unterschiedlicher Gegenstände ▼
Ein Gegenstand des Denkens: Frau
Zwei Gegenstände des Denkens: junge und alte Mutter Dürers
Tabelle 11: Abstrahierendes und konkretisierendes Denken am Beispiel 1
ABSTRAHIERENDES DENKEN
Abb. 13
Abb. 14
KONKRETISIERENDES DENKEN
Abb. 11
Abb. 12
= Charakterisierung… …desselben Gegenstandes ▼
…mehrerer unterschiedlicher Gegenstände ▼
Ein Gegenstand des Denkens: Frau
Zwei Gegenstände des Denkens: eine kräftige und eine schlanke Frau
Tabelle 12: Abstrahierendes und konkretisierendes Denken am Beispiel 2
174 | Bildnerisches Denken
Entscheidend für den Zusammenhang hier ist die Tatsache, dass in allen diesen Medien das konkretisierende Denken ebenso zum Ausdruck kommen kann wie das abstrahierende. Da man aber, wie bereits erläutert, einem konkreten medialen Gegenstand nicht ansehen kann, ob er konkretisierend oder abstrahierend produziert bzw. rezipiert wird, kann er auch nicht in einem absoluten Sinne einer der beiden Denkarten zugeordnet werden. Die Zuordnung ist somit immer relativ zum jeweiligen Rezipienten oder Produzenten. Das bedeutet, dass ein Gegenstand als Bild, d. h. konkretisierend, hergestellt, aber dann abstrahierend rezipiert werden kann und umgekehrt, wie in Tabelle 11 dargestellt. So wird ein Frauenpiktogramm, wie in Abb. 11 zu sehen, in der Regel abstrahierend rezipiert, d. h. als Äquivalent für das Wort »Frau«. Dabei wird nur auf die Merkmale des charakterisierten Gegenstandes geachtet, die er mit anderen Gegenständen teilt. Aus dieser Perspektive ist das Piktogramm gleichartig zu allen anderen Frauenpiktogrammen, z. B. auch zu dem in Abb. 12, genauso wie jede Frau in Hinsicht auf ihr Frausein gleichartig zu allen anderen Frauen ist. Beide Piktogramme charakterisieren also denselben Gegenstand. Diese Tatsache ist beispielsweise dann wichtig, wenn wir in einem Restaurant oder an einem Flughafen die Toilette suchen. In einem solchen Fall betrachten wir die verschiedenen Darstellungen als gleichartig, ihre Unterschiede sind uns egal, solange sie uns den Weg zur entsprechenden Toilette weisen. Das Gemälde und die Zeichnung von Albrecht Dürer betrachten wir hingegen in der Regel konkretisierend. Auch wenn sie beide seine Mutter darstellen, würden wir doch nicht sagen, dass sie denselben Bildgegenstand haben. Das Gemälde zeigt seine Mutter in jungen Jahren, während sie auf der Zeichnung im fortgeschrittenen Alter zu sehen ist. Hier achten wir gerade auf die Unterschiede der Darstellungen, durch die zwei verschiedene Gegenstände des Denkens charakterisiert werden. Dennoch ist diese Betrachtungsweise nicht zwingend, wie in Tabelle 12 gezeigt wird. In vielen Restaurants oder Kneipen werden zur Kennzeichnung der Toilettentüren bewusst keine Piktogramme verwendet, sondern beispielsweise Fotos von Filmstars oder berühmte Gemälde. In einem entsprechenden Kontext können daher auch die beiden Darstellungen von Dürers Mutter (Abb. 13 und Abb. 14) wie ein Piktogramm funktionieren. In einem solchen Fall ist es notwendig, dass wir das Gemälde bzw. die Zeichnung abstrahierend betrachten und nur auf die Gemeinsamkeit achten, die sie mit normalen Frauenpiktogrammen haben, nämlich dass eine Frau dargestellt ist. Würden wir das Gemälde oder die Zeichnung in diesem Fall konkretisierend betrachten, wäre es uns nicht möglich, die richtige Toilettentür zu fin-
3 Denken | 175
den. Auf der anderen Seite können auch Piktogramme konkretisierend betrachtet werden. So könnte man die beiden Frauenpiktogramme (Abb. 11 und Abb. 12) beispielsweise als Darstellungen unterschiedlicher Frauentypen betrachten, etwa einer kräftigen und einer schlanken Frau. Otl Aicher, der die Piktogramme für die Olympischen Spiele 1972 entworfen hat, hatte sicher ebenfalls eine konkretisierende – genauer bildnerische – Perspektive auf die Piktogramme. Er hat bei der Gestaltung auf die Unterschiede der verschiedenen Entwürfe geachtet, um diejenige Formvereinfachung zu wählen, die sich am besten für die spätere Funktion des Piktogramms eignet. Ebenso rezipiert und produziert der Künstler Lars Arrhenius die Piktogramme konkretisierend, wenn er in seiner Arbeit »Men without Qualities« das Privatleben von Aichers Piktogrammen verbildlicht. Die reduzierte Darstellung des Menschen durch ein Piktogramm wird von Arrhenius als Verbildlichung der Eigenschaftslosigkeit interpretiert. Das Verhältnis von Bildern und visuellen Medien ist also kein Identitätsverhältnis: Bilder sind keine Medien. In einem medialen Bildbegriff werden mehrere Aspekte des Phänomens Bild miteinander vermischt, die besser getrennt betrachtet werden, wie die Denkweise, die Materialität und die Medialität. Unter der Voraussetzung, dass visuelle Medien konkretisierend rezipiert oder produziert werden, können sie als »Bildmedien« oder verkürzt als »Bilder« bezeichnet werden. In diesem Sinne sind »Bilder« zwar nicht identisch mit visuellen Medien, aber dennoch von ihnen abhängig. Bilder begegnen uns in visuellen Medien. Auf diesen engen Bildbegriff wird näher in Kapitel 4.1.6 eingegangen. Das weite Verständnis von »Bild« beschreibt dieses als medienunabhängig, wie in Kapitel 4.2.4 erläutert wird. Auch dieser Bildbegriff spiegelt sich in bestimmten alltäglichen Verwendungsweisen wider. Der Zusammenhang zwischen beiden Bildbegriffen besteht im Bildnerischen Denken, das sowohl bezogen auf das enge wie auch auf das weite Bildverständnis verantwortlich für die Bilderfahrung ist. Das hier vorgeschlagene Bildverständnis schließt an eine Reihe von Theorien an, die, wie hier, den Begriff »Bild« nicht als Charakterisierung einer bestimmten Medienart verstehen wollen. So macht W. J. T. Mitchell deutlich, dass zumindest das Bild im Sinne von »image« unabhängig von bestimmten Medien zu sehen ist: »The picture is a material object, a thing you can burn or break. An image is what appears in a picture, and what survives its destruction – in memory, in narrative, and in copies and traces in other media. The golden calf may be smashed and melted down, but it lives on as an image in stories and innumerable depictions. The picture, then, is the image as it appears in a material support or a specific
176 | Bildnerisches Denken
place. […] The image never appears except in some medium or other, but it is also what transcends media, what can be transferred from one medium to another. The golden calf appears first as sculpture, but it reappears as an object of description in a verbal narrative, and as an image in painting. It is what can be copied from the painting in another medium, in a photograph or a slide projection or a digital file.«319
Entsprechend seiner Unterscheidung zwischen dem image und dem Medium, hält er es sogar für möglich, dass das image auch in einem verbalen Medium, z. B. in einer Beschreibung, zum Ausdruck kommt. Er verdeutlicht dies am »Bild« des goldenen Kalbs, das in der Bibel verbal beschrieben wird, aber auch vielfach visuell dargestellt ist. In der hier vorgeschlagenen Systematik wäre dieser Sachverhalt treffender folgendermaßen zu beschreiben: Das goldene Kalb ist der Gegenstand des Denkens, der durch konkretisierenden Denkvollzug in einem Bild oder in einem literarischen Text zum Ausdruck kommen kann. Für einen abstrahierend denkenden Rezipienten des Bildes und des literarischen Textes kann es sich dabei um denselben Gegenstand des Denkens handeln, der als »das goldene Kalb« gekennzeichnet werden kann. Ein konkretisierender Rezipient hingegen wird gerade nach den Aspekten suchen, die im Bild enthalten sind, aber nicht im Text und umgekehrt. Gottfried Boehm erläutert sehr deutlich, dass in seinem Verständnis der Begriff »Bild« keinesfalls eine bestimmte Medienart kennzeichnet: »[I]n kunsthistorischen Debatten [sind] auch Institutionen wie Radierung, Kupferstich, Lithographie, Ölmalerei, Fresko, Skulptur, Plastik etc. ›Gattungen‹ genannt worden. […] [B]ei den genannten Institutionen handelt es sich in Wahrheit um Medien, das heisst um Technologien, deren Gebrauch allererst zu Bildern führt. Man kann es nicht genug betonen: Medien sind keine Bilder. Sie sind vielmehr die notwendigen Prämissen und Koordinaten, die Material- und Verfahrensgrundlagen, welche die Bildproduktion ermöglichen. Das Medium, zum Beispiel die Photographie, determiniert den jeweiligen Gestaltungsrahmen, das Bild dagegen basiert auf Interventionen und Erfindungen, auf Sichtweisen eines Gestalters, die nicht eben selten auch gegen die mediale Disposition vorgenommen werden.«320
319 Mitchell, W. J. T. »Four Fundamental Concepts of Image Science«, in: Elkins, James (Hg.): Visual
Literacy, New York, 2008, S. 16. 320 Boehm, Gottfried: »Das bildnerische Kontinuum«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen, Berlin, 2007, S. 169–170, Hervorh. i. O.
3 Denken | 177
Damit wird auch deutlich, dass ein Vergleich oder eine Abgrenzung zwischen Bildern und Sprache, d. h. verbalen Medien, nicht sinnvoll ist, weil man dadurch zwei Dinge miteinander vergleicht, die nicht derselben Kategorie angehören. Stattdessen wäre zu fragen, in welchem Verhältnis das abstrahierende und konkretisierende Denken jeweils zu den visuellen, verbalen oder auch anderen Medien stehen. Wie bereits erläutert, können prinzipiell beide Denkarten in allen Medien zum Ausdruck kommen. Dennoch kann man eine Unterscheidung dahingehend treffen, welches Medium welcher Denkart besonders gut entspricht. Es ist offensichtlich, dass sich die visuellen Medien viel besser dafür eignen, Gegenstände des konkretisierenden Denkens auszudrücken, als die verbalen Medien. Das liegt daran, dass Letztere nur eine begrenzte Anzahl an Wörtern zur Verfügung stellen, wodurch die Beschreibung eines Gegenstandes in seiner Einmaligkeit wesentlich erschwert wird. Darum wurden in der Poesie verschiedene Strategien zur Erweiterung dieser begrenzten Ausdrucksmöglichkeit entwickelt. So spielt es bei einem Gedicht eine viel größere Rolle, welches Wort aus einer Reihe von Synonymen gewählt wird, wie die Satzstellung ist, welche Wörter nebeneinander gesetzt werden und so Assoziationsketten hervorrufen können, welche Wörter sich reimen, wann eine neue Zeile begonnen wird etc. In einem wissenschaftlichen Text hingegen spielen all diese Aspekte keine Rolle – zumindest, wenn er rein abstrahierend geschrieben und gelesen wird. Aber wie beim Beispiel des Piktogramms kann man auch einen wissenschaftlichen Satz konkretisierend lesen und auf feine Unterschiede zu anderen Sätzen achten. So kommt es auf die Denkart an, ob man der Ansicht ist, dass in den Sätzen A und B derselbe Gegenstand zum Ausdruck kommt oder nicht:
Satz A: Aber wie beim Beispiel des Piktogramms kann man auch einen Satz aus einem wissenschaftlichen Text konkretisierend lesen und auf feine Unterschiede zu anderen Sätzen achten. Satz B: Es ist aber auch möglich, einen Satz aus einem wissenschaftlichen Text konkretisierend zu lesen und dabei auf das zu achten, was ihn von anderen Sätzen unterscheidet – wie beim Beispiel des Piktogramms. Abstrahierendes Denken wird eher in verbalen Medien ausgedrückt, während konkretisierendes Denken häufiger in visuell-plastischen Medien zum Ausdruck kommt. Diese Zuordnung ist aber nicht zwingend, sondern in den meisten Fällen praktisch oder ökonomisch. Diese eingeschränkte Möglich-
178 | Bildnerisches Denken
keit der Verbalsprache, Einmaliges zum Ausdruck zu bringen, wurde von vielen Theoretikern reflektiert. So schreiben Kamlah und Lorenzen: »In unserer sprachlich schon immer erschlossenen Welt erfassen wir das Einzelding auch als ein solches in der Regel zugleich schon als Exemplar«321, wie beispielsweise »›der Blick aus dem Westfenster des Rathausturms‹. Was ein solcher Blick aus einem bestimmten Fenster zu einer bestimmten Zeit ausgrenzt und zusammenfaßt, ist freilich kein willkürlicher Weltausschnitt mehr, sondern kann für denjenigen, der ihn ›hat‹, sehr bedeutsam sein. Wollte er ihn als Ganzes nicht allein durch einen Prädikator erfassen, sondern durch eine Folge von Prädikationen ›in allen Einzelheiten‹ beschreiben, so käme er an kein Ende: individuum est ineffabile.«322
Dabei reflektieren beide, dass die Erfassung von Einmaligkeit, dennoch sehr wichtig für den Menschen sein kann: »Situationen, in denen wir uns jeweils befinden, die ›Schicksale‹, die uns widerfahren, setzen der sprachlichen Bewältigung unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Wer zum Beispiel eine Krankheit erleidet, dem ist dieses Einzelne nicht schon dadurch hinreichend bekannt, daß er den medizinischen Prädikator weiß, der dieser Krankheit zukommt […]. Wir können die Welt samt ihrer Geschichte als ›unsere Welt‹ kraft der Sprache mit andern teilen, und zugleich ist doch jeder Einzelne, von der Einmaligkeit seines Schicksals betroffen und bedrängt, in seine Einsamkeit eingeschlossen, als lebe er in einer Welt, die nur seine ist derart, daß er seinem Sterben als dem Untergang der Welt entgegengeht.«323
Was das abstrahierende Denken nicht leisten kann, ist dem konkretisierenden Denken möglich, und zwar auch in verbalen Medien, nämlich dann, wenn die Sprache nicht als Wissenschaftssprache – als Anwendung medizinischer Prädikatoren –, sondern literarisch oder poetisch verstanden wird. Die Ergänzung des abstrahierenden Denkens durch das konkretisierende Denken ist daher womöglich notwendig für den Menschen, um mit seiner Welt, seinem Leben und seinem Sterben fertig zu werden. 3.4.2.2 Bilder und Schemata Die im vorangegangenen Kapitel getroffene Unterscheidung zwischen Bild und visuellen Medien erklärt, dass nicht alle Charakterisierungen in visuellen Medien Bilder sind. Deutlich wurde dies bereits am Beispiel des Piktog-
321 Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich, 1990, S. 49. 322 Ebenda, Hervorh. i. O. 323 Ebenda, S. 174–175.
3 Denken | 179
ramms. Im Folgenden wird der systematische Unterschied zwischen Bildern und anderen Darstellungen in visuell-plastischen Medien erläutert. Dabei wird das Bild vom Schema unterschieden. Zur Vereinfachung werden als Beispiele hier nur Darstellungen in visuellen Medien, d. h. Visualisierungen, gewählt, obwohl in Teil 4 ein Bildverständnis eingeführt wird, das auch plastische Bildwerke miteinschließt. Die Beispiele können aber analog auf plastische Medien übertragen werden. Im Anschluss an Kant wird dargelegt, dass ein Schema eine Leistung des abstrahierenden Denkens ist, mit deren Hilfe man einen Begriff visualisieren kann. Die Visualisierung eines Begriffs ist aber kein Bild. Sie kann zum Bild werden, wenn sie als solches betrachtet wird. Umgekehrt kann auch etwas, das ursprünglich als Bild gestaltet wurde, zur Visualisierung eines Begriffs werden, wenn es als Schema rezipiert wird. Dies wird im Folgenden anhand der Tabelle 13 erläutert. VISUELLE DARSTELLUNGEN
Abb. 15: Drei Dreiecke
= produzierbar /rezipierbar… …als Schema d. h. abstrahierend DARSTELLUNG
= produzierbar /rezipierbar… ...als Bild d. h. konkretisierend DARSTELLUNG
= schematische Visualisierung/ visualisiertes Schema z. B. visualisierter Begriff: »Dreieck«
= bildliche Visualisierung/ visualisiertes Bild z. B. visualisiertes Einzelnes: »Diese einmalige Dreiecksform auf diesem Mantel« = Charakterisierung des Gegenstandes… im Unterschied zu Anderem als Einmaliges Bildnerisches Denken = konkretisierendes Denken in visuell-plastischen Medien
= Charakterisierung des Gegenstandes… in seinen Gemeinsamkeiten mit Anderem als Exemplar einer Klasse von Dingen Schematisierendes Denken = abstrahierendes Denken in visuell-plastischen Medien
Tabelle 13: Abstrahierende und konkretisierende Visualisierung
180 | Bildnerisches Denken
Kant unterscheidet klar zwischen Bild und Schema: »[S]o ist das Schema doch vom Bilde zu unterscheiden.«324 Unter einem Schema versteht er »mehr die Vorstellung einer Methode, einem gewissen Begriffe gemäß […] [etwas, Anm. d. A.] in einem Bilde vorzustellen, als dieses Bild selbst.«325 Dabei müssen nach Kant auch empirische Begriffe, wie beispielsweise der des »Hundes«, schematisiert werden, um anschaulich zu sein.326 Das Schema ist nach Kant keine eigenständige Entität, sondern die Vorstellung einer Methode oder eines Verfahrens: »Diese Vorstellung nun von einem allgemeinen Verfahren der Einbildungskraft, einem Begriff sein Bild zu verschaffen, nenne ich das Schema zu diesem Begriff.«327 Dieses Verständnis des kantischen Schematismus erläutert auch Thomas Khurana in Anschluss an Heidegger: »Es gilt also weniger eine Klasse von Schemata aufzulisten als vielmehr Schematisierung zu verstehen als die allgemeine Form der Kooperation von Begriff und Anschauung. Das ›Schema‹ – als ›Vorstellung einer Methode‹ oder eines ›Verfahrens‹ – ist dann nichts anderes als ein Niederschlag dieser Kooperation, dieses Artikulationsprozesses.«328
Am Beispiel in Tabelle 13 ausgeführt heißt dies: Die drei Darstellungen von Dreiecken (Abb. 15) sind nicht selbst Schemata, können aber als solche betrachtet oder gestaltet werden, bzw. als Visualisierungen eines Begriffs. Diese Betrachtungsweise ist abstrahierend, weil sie nur auf die Gemeinsamkeiten achtet, die der Gegenstand der Zeichnung mit anderen Gegenständen hat. Das abstrahierende Denken charakterisiert seinen Gegenstand durch die Zeichnung in seinen Gemeinsamkeiten mit Anderem, z. B. als »Dreieck«. Alle drei Dreiecks-Zeichnungen sind damit äquivalent zu allen anderen Visualisierungen, deren Gegenstände ebenfalls als »Dreieck« bezeichnet werden. Sie sind austauschbar. Jede der drei abgebildeten Zeichnungen kann als Visualisierung des Begriffs »Dreieck« betrachtet werden, bzw. als Visualisierung des entsprechenden Schemas. Denn nicht nur der Begriff selbst, sondern auch die Methode seiner Veranschaulichung hat in der Darstellung ihren Niederschlag gefunden. Unter dieser Betrachtung können alle
324 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, B 179, A 140. 325 Ebenda, B 179, A 140. 326 Vgl. ebenda, B 180, A 141. 327 Ebenda, B 179–180, A 140. 328 Khurana, Thomas: »Schema und Bild«, in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissen-
schaft, 2013, S. 210–211.
3 Denken | 181
abgebildeten Zeichnungen auch als »schematische Visualisierungen« oder »visualisierte Schemata« bezeichnet werden. Alle drei Zeichnungen können dem abstrahierenden Denken dazu dienen, die Winkelsumme im Dreieck von 180° zu beweisen. 329 Zwar ist dieser Beweis – wie Kant sagt – nicht möglich bei bloßer Betrachtung des Begriffs des Dreiecks, bzw. seiner Definition.330 Der konstruktive Beweis kann nur mit Hilfe der Anschauung geschehen, d. h. durch Konstruktion (siehe Abb. 16), und diese Anschauung ist »als Anschauung, ein einzelnes Objekt«331. Dennoch muss sie »als die Konstruktion eines Begriffs (einer allgemeinen Vorstellung), Allgemeingültigkeit für alle mögliche Anschauungen, die unter denselben Begriff gehören, in der Vorstellung ausdrücken«332. Dies geschieht »so daß, wie dieses Einzelne unter gewissen allgemeinen Bedingungen der Konstruktion bestimmt ist, eben so der Gegenstand des Begriffs, dem dieses Einzelne nur als sein Schema korrespondiert, allgemein bestimmt gedacht werden muß.«333 Es kommt also nicht darauf an, wie die Dreieckszeichnung genau aussieht, an der die Winkelsumme konstruktiv bewiesen wird. Alle in Tabelle 13 abgebildeten Zeichnungen eignen sich dafür, sofern sie als Schema betrachtet werden. Man kann dieselben drei Darstellungen aber auch konkretisierend produzieren und rezipieren. Dann werden sie nicht als Schema, sondern als Bild betrachtet und werden so zu »bildlichen Visualisierungen« oder »visualisierten Bildern«. Aus dieser Perspektive visualisieren die Zeichnungen keinen Begriff, sondern Einzelnes oder Einzigartiges, z. B. die Form einer
329 Kant beschreibt den konstruktiven Beweis der Winkelsumme im Dreieck wie folgt: »Allein der Geometer nehme diese Frage vor. Er fängt sofort davon an, einen Triangel zu konstruieren. Weil er weiß, daß zwei rechte Winkel zusammen gerade so viel austragen, als alle berührende Winkel, die aus einem Punkte auf einer geraden Linie gezogen werden können, zusammen, so verlängert er eine Seite seines Triangels, und bekommt zwei berührende Winkel, die zweien rechten zusammen gleich sind. Nun teilet er den äußeren von diesen Winkeln, indem er eine Linie mit der gegenüberstehenden Seite des Triangels parallel zieht, und sieht, daß hier ein äußerer berührender Winkel entspringe, der einem inneren gleich ist, u.s.w. Er gelangt auf solche Weise durch eine Kette von Schlüssen, immer von der Anschauung geleitet, zur völlig einleuchtenden und zugleich allgemeinen Auflösung der Frage.« Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, B 744–745, A 716–717. 330 Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, B 744 und A 716. 331 Ebenda, B 741, A 713, Hervorh. i. O. 332 Ebenda. 333 Ebenda, B 742, A 714.
182 | Bildnerisches Denken
dreiecksförmigen Naht auf einem Mantel. Die drei abgebildeten Zeichnungen sind nicht äquivalent und nicht austauschbar. Sie charakterisieren den Gegenstand des Denkens durch die Beachtung der Unterschiede, die der Gegenstand zu anderen Dingen aufweist. In dieser Betrachtung sind beispielsweise die Unterschiede in den Seitenlängen, den Innenwinkeln und der Orientierung des Dreiecks auf der Bildfläche relevant.
Abb. 16: Konstruktiver Beweis der Winkelsumme im Dreieck Das hier vorgeschlagene Bildverständnis deckt sich nicht mit der kantischen Begriffsverwendung. Der Begriff »Bild« wird von Kant – wie auch von einigen anderen Autoren (siehe Kapitel 3.4.2.1) – allgemein als Bezeichnung für alle Darstellungen in visuellen Medien verwendet. Sofern sie einen Begriff visualisieren, werden sie erst durch das Schema möglich: »So viel können wir nur sagen: das Bild ist ein Produkt des empirischen Vermögens der produktiven Einbildungskraft, das Schema sinnlicher Begriffe (als der Figuren im Raume) ein Produkt und gleichsam ein Monogramm der reinen Einbildungskraft a priori, wodurch und wonach die Bilder allererst möglich werden, die aber mit dem Begriffe nur immer vermittelst des Schema, welches sie bezeichnen, verknüpft werden müssen, und an sich demselben nicht völlig kongruieren.«334
Das kantische Verständnis von »Schema« und »Bild« entspricht damit genau der hier getroffenen Unterscheidung zwischen »Schema« und »schematischer Visualisierung« (siehe Tabelle 13). Kants Erläuterungen haben für die hier getroffene Differenzierung daher volle Gültigkeit, sofern man den Be334 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, B 181, A 141–142, Hervorh. i. O.
3 Denken | 183
griff »Bild« bei Kant entsprechend austauscht. Laut Khurana trifft auch Heidegger in seiner Kant-Interpretation dieselbe Unterscheidung, allerdings mit Hilfe der Begriffe »Schema« und »Schema-Bild«: »Um dies zu verdeutlichen, spricht Heidegger im Weiteren von Schema und Schema-Bild. Der Begriff oder die Regel, die hier versinnlicht wird, kann dies nur als schematisierter Begriff; das Bild kann hier nur versinnlichen, sofern es ein Schema-Bild ist.«335 »Der schematisierte Begriff schlägt sich im Schema-Bild nieder, wird aber nicht wie ein Gegenstand abgebildet; es wird gerade nur unter der Bedingung wirklich versinnlicht, dass er nicht abgebildet wird, sondern im Wie der Regelung des Abbildens zum Ausdruck kommt.«336
Ersetzt man den Begriff »Schema-Bild« durch »schematische Visualisierung«, entspricht auch diese Unterscheidung der hier in Tabelle 13 erläuterten Differenzierung. Ob eine Darstellung als Schema oder als Bild betrachtet wird, hängt also davon ab, wie sie rezipiert wird bzw. worauf sich der Rezipient konzentriert. Auch Khurana unterscheidet im Anschluss an Heidegger zwischen zwei möglichen Betrachtungsweisen, die er am Beispiel der Betrachtung eines Hauses erläutert: »Wenn wir etwa ein bestimmtes wahrgenommenes Haus nehmen, so können wir in der Wahrnehmung ›dieses‹ Hauses auch darauf achthaben, wie ein Haus ›überhaupt‹ aussieht. In einem bestimmten Anblick verzeichnet sich nicht nur dieses Seiende, sondern ein ›Wie des empirischen Aussehenkönnens‹: Wir sehen nicht nur ›dieses Haus‹, sondern auch: ›ein Haus könnte so aussehen‹.«337
Dieser Unterschied in der Betrachtungsweise ist laut Khurana – genau wie der Unterschied zwischen abstrahierendem und konkretisierendem Denken – Sache der Aufmerksamkeit und kann auf das Betrachten von Visualisierungen übertragen werden:
335 Khurana, Thomas: »Schema und Bild«, in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissen-
schaft, 2013, S. 215. 336 Ebenda. 337 Ebenda, S. 213–214. Im zweiten Satz zitiert Khurana aus: Heidegger, Martin: Kant und das
Problem der Metaphysik, Frankfurt a. M., 1991, S. 95, die Hervorhebungen stammen von Khurana.
184 | Bildnerisches Denken
»Heidegger meint also, dass wir, indem wir in einer konkreten Anschauung auf das Angeschaute als Möglichkeit der Manifestation eines Begriffes achten, den Blick auf die Regel selbst richten, die den Umkreis des Aussehenkönnens regelt. Er will dabei nicht einfach sagen, dass wir auf diese Regel schließen, sie folgern, sie hypothetisch postulieren, sondern dass wir sie in einer bestimmten Weise des Bildbetrachtens gewissermaßen ›sehen‹«.338 »Statt uns also an eine abstrakte Vorstellung des Begriffes zu halten, müssen wir bei einer Anschauung gewissermaßen über ihre konkrete Anschauung ein Stück weit hinwegsehen, um das mögliche Aussehenkönnen und die Weise seines begrifflichen Geregeltseins mitsehen zu können.«339
Dieses Hinwegsehen über die konkrete Anschauung und das Mitsehen des begrifflichen Geregeltseins entspricht genau dem, was hier als Abstrahieren bezeichnet wird. In Übereinstimmung damit identifiziert auch Khurana diese von Heidegger beschriebene Leistung als Abstraktion: »Man kann das von Heidegger hier Geforderte mithin als einen bestimmten besonderen Typ der Abstraktion – des Absehens oder Wegsehens von – bestimmen«.340 Auch nach Kant ist die schematisierende Betrachtung eine gedankliche Leistung, da er das Schema als eine gedankliche Vorstellung beschreibt: »Das Schema des Triangels kann niemals anderswo als in Gedanken existieren, und bedeutet eine Regel der Synthesis der Einbildungskraft, in Ansehung reiner Gestalten im Raume.«341 Das Schema, das Kant als Vorstellung einer Methode bzw. eines Verfahrens in Gedanken beschreibt, kann daher mit einer bestimmten Art zu denken identifiziert werden: dem schematisierenden Denken als eine Art des abstrahierenden Denkens. Die Visualisierung, also z. B. eine Zeichnung wie in Tabelle 13, ist nicht ein Schema, genauso wenig wie sie ein Bild ist. Stattdessen kann eine Zeichnung als Bild, d. i. konkretisierend, oder als Schema, d. i. abstrahierend, betrachtet werden. Wenn man eine Zeichnung als Schema produziert, vollzieht man – in Kants Worten – »das allgemeine Verfahren, einem Begriff sein Bild zu verschaffen«342. Bei der Rezeption einer Zeichnung als Schema muss nun im Prinzip die gleiche gedankliche Leistung erbracht werden, nur in die andere Richtung: von der Visualisierung über das Schema zum Begriff. In beiden Fällen muss man schematisierend denken. Analog verhält es
338 Khurana, Thomas: »Schema und Bild«, in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissen-
schaft, 2013, S. 214. 339 Ebenda, S. 214–215. 340 Ebenda, S. 215. 341 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, B 180, A 141. 342 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Band 3, B 179–180, A 140.
3 Denken | 185
sich, wenn man eine Zeichnung als Bild betrachtet oder gestaltet. In beiden Fällen muss man bildnerisch denken, d. h. die Funktionen des Bildnerischen Denkens ausüben. Ob eine Zeichnung als schematische oder bildliche Visualisierung gilt, hängt von der Art der Betrachtung ab. Abstrahierend rezipiert, wird sie als Schema betrachtet. In konkretisierender Sicht gilt sie als Bild. Beispielsweise sind Piktogramme Darstellungen, die in der Regel schematisierend rezipiert werden. Derjenige, der sie gestaltet, betrachtet sie aber als Bild. Das bedeutet, dass die beiden Begriffe »Schema« und »Bild« keine materiellen Gegenstände bezeichnen, sondern die Art ihrer Betrachtungsweise. Nur in einer verkürzten Redeweise kann man eine Zeichnung als »Bild« oder als »Schema« bezeichnen. Das abstrahierende Denken, das sich in visuell-plastischen Medien ausdrückt, kann also als schematisierendes Denken bezeichnet werden. Hingegen ist das konkretisierende Denken, das in visuell-plastischen Medien zum Ausdruck kommt, das Bildnerische Denken. Damit ist das schematisierende eine Unterart des abstrahierenden Denkens und das bildnerische eine Unterart des konkretisierenden Denkens. Das hier vorgeschlagene Verständnis von »Schema« entspricht demselben Begriff, der bei der Beschreibung von Kinderzeichnungen verwendet wird. So bezeichnet man eine Phase in der Entwicklung der Kinderzeichnung als Schemaphase.343 Sie wird folgendermaßen beschrieben: »Vom 4. Lebensjahr ab stellen die meisten Kinder den Menschen nach dem Prinzip des sogenannten Primitivschemas dar.«344 »Ein Schema ist eine Darstellungsform, die ein gewisses Maß von Ähnlichkeit mit einem darzustellenden Gegenstand anstrebt.«345 Diese Darstellungsform übernimmt dabei die Funktion von Prädikaten: »Kinder benutzen diese einfachen Darstellungsformen immer wieder, um die gleichen Objekte zu kennzeichnen.«346 Aus diesem Grund findet bei der Schematisierung eine Reduktion auf geometrische Grundformen statt. Diese sind gut einzuprägen und können leicht wiederholt werden:
343 Vgl. z. B. Kirchner, Constanze: Kunstpädagogik für die Grundschule, Bad Heilbrunn, 2009, S. 67. 344 Eid, Klaus u. a.: Grundlagen des Kunstunterrichts, Paderborn, 2002, S. 131. 345 Vgl. Aissen-Crewett, Maike: Kunstunterricht in der Grundschule, Braunschweig, 2007, S. 50, Hervorh. i. O. 346 Vgl. ebenda, S. 50.
186 | Bildnerisches Denken
»Charakteristisch für die Schemabildung sind die annähernd geometrischen Formen. […] Die Ursachen der Bevorzugung eines geometrisierenden Formvokabulars liegen in dem Verlangen des Kindes nach Ordnung gegenüber der Vielfalt optischer Wirklichkeit und in der Eignung dieser Formen für wiederholte Darstellungen des gleichen Objekts.«347
Die Schemabildung in der kindlichen Entwicklung erfolgt also ebenso nach dem Prinzip des abstrahierenden Denkens. Mit Hilfe der Schemata kennzeichnet das Kind einen Gegenstand dadurch, dass es auf seine Gemeinsamkeiten mit anderen Gegenständen verweist. Das Kind denkt schematisierend. SCHEMATISIERENDES DENKEN = Abstrahierendes Denken in visuell-plastischen Medien
Abb. 13
Abb. 14
BILDNERISCHES DENKEN = Konkretisierendes Denken in visuell-plastischen Medien
Abb. 11
Abb. 12
Ein Gegenstand des Denkens: Frau
Mehrere Gegenstände des Denkens: Junge und alte Mutter Dürers, eine kräftige und eine schlanke Frau
= dasselbe Schema
= vier unterschiedliche Bilder
Tabelle 14: Schematisierendes und Bildnerisches Denken Abschließend soll die getroffene Unterscheidung auf die vier Bildbeispiele übertragen werden (vgl. Tabelle 14). Für das schematisierende Denken können die beiden Piktogramme und die Darstellungen Dürers denselben Gegenstand charakterisieren: Frau. In diesem Sinne handelt es sich jeweils um unterschiedliche Visualisierungen desselben Schemas. Für das Bildnerische Denken charakterisieren nicht nur die beiden Darstellungen Dürers, son-
347 Eid, Klaus u. a.: Grundlagen des Kunstunterrichts, Paderborn, 2002, S. 131.
3 Denken | 187
dern auch die beiden Piktogramme unterschiedliche Gegenstände. In diesem Sinne handelt es sich um vier unterschiedliche Bilder. 3.4.3 Kombinationen von abstrahierendem und konkretisierendem Denken Die Unterscheidung zwischen abstrahierendem und konkretisierendem Denken ist scharf und übergangslos. Das bedeutet aber nicht, dass bei der Rezeption und Produktion einer visuell-plastischen Darstellung immer nur eine der beiden Denkarten beteiligt sein kann. Im Gegenteil: Oft spielen in diesen Prozessen beide Denkarten eine Rolle. Aber nur das Bildnerische Denken ist dafür verantwortlich, dass die Darstellung zum Bild wird. Nur dieses berücksichtigt dessen Einmaligkeit. Alle anderen Denkprozesse beziehen sich nicht auf die einmalige Farb- und Formkombination einer Darstellung. Im Folgenden soll anhand eines Beispiels gezeigt werden, wie abstrahierendes und konkretisierendes Denken gleichzeitig auftreten können, ohne dass die scharfe Unterscheidbarkeit zwischen ihnen aufgehoben wird. Bei einer kunstwissenschaftlichen Analyse eines Gemäldes sind in der Regel beide Denkarten beteiligt. Sowohl das Identifizieren der dargestellten Gegenstände, als auch das Erkennen des dargestellten Motivs oder des ikonographischen Bezugs erfordern abstrahierendes Denken. Keiner dieser Vorgänge ist dabei bildspezifisch. Auch in unserer alltäglichen Wahrnehmung müssen wir ständig Gegenstände identifizieren und es ist davon auszugehen, dass zumindest kein prinzipieller Unterschied zwischen dem Erkennen eines Gegenstands in der Wirklichkeit und in einer visuellen oder plastischen Darstellung besteht. Das Erkennen eines bestimmten Motivs, z. B. einer Kreuzigungsdarstellung, ist ebenfalls nicht bildspezifisch, weil sie genauso in der Literatur vorkommen kann. Weiß man, welche Elemente zum Motiv der Kreuzigung gehören, kann man diese auch in einer verbal beschriebenen Szene erkennen. Ebenso kann man die ikonographische Bedeutung einer Taube – als Symbol für den heiligen Geist – auch dann erkennen, wenn die Taube nicht in einem Gemälde dargestellt ist, sondern in einem Roman beschrieben wird. In allen diesen Denkprozessen wird etwas Einzelnes – die Darstellung eines Gegenstandes oder einer Szene – so rezipiert, dass es als Exemplar eines bestimmten Typs klassifiziert wird. Das heißt, dass alle diese Denkprozesse abstrahierend sind. Bildnerisch ist das Denken bei einer Werkanalyse nur, insofern auf die Unterschiede zu Anderem verwiesen wird. Bezogen auf die Beispiele heißt das: Das Denken ist dann bildnerisch, wenn darauf geachtet wird, worin sich eine einmalige Darstellung eines Gegenstandes, eine einmalige Kreuzigungsdarstellung oder eine einmalige Taubendarstellung von allen anderen vergleichbaren
188 | Bildnerisches Denken
Darstellungen unterscheidet. Auch bei der Produktion eines Bildes, das keine ikonografischen Bezüge enthält, können sich schematisierendes und Bildnerisches Denken gegenseitig ergänzen, wie beispielsweise beim Zeichnen eines Portraits. So kann man in einer bestimmten Phase des Zeichnens ein gängiges Proportionsschema für den menschlichen Kopf zur Kontrolle heranziehen und z. B. überprüfen, ob die Augen etwa auf der horizontalen Mittelachse des Kopfes liegen. Zum Bild und damit auch zum Portrait wird die Zeichnung aber erst durch die bildnerischen Abweichungen von diesem Schema und die bildnerischen Elemente, die durch kein Schema vorgegeben werden. Für das Verhältnis der beiden Denkarten bedeutet dies, dass sie sich gegenseitig ergänzen können, ohne sich miteinander zu vermischen. Der jeweils eine Denkvollzug kann die Ergebnisse des jeweils anderen aufgreifen, ohne dass hierdurch die klare Unterscheidung zwischen beiden Denkvollzügen verloren geht. Das Modell des Bildnerischen Denken beschreibt also nicht alle Denkprozesse, die bei der Betrachtung von Darstellungen in visuell-plastischen Medien beteiligt sind und damit auch nicht alle Denkprozesse einer kunstwissenschaftlichen Werkanalyse. Durch das Modell werden nur die Denkprozesse beschrieben, die bildspezifisch sind bzw. die eine Darstellung in einem visuell-plastischen Medium zum Bild werden lassen.
Abb. 17: Logo Rezeption & Produktion 1
Abb. 18: Logo Rezeption & Produktion 2
Dieses gegenseitige Ergänzen der beiden Denkarten ist auch bei der Rezeption und Produktion von Verbalisierungen, z. B. von Schrift, möglich. Abstrahierend wird die Schrift rezipiert, wenn die einzelnen Wörter identifiziert werden. Das Bildnerische Denken kann hingegen einen Schriftzug als Bild betrachten. Der Rezipient konzentriert sich dann auf das Schriftbild und beurteilt beispielsweise die Formatierung. Das bedeutet aber nicht, dass bei einer solchen Betrachtung die Wörter nicht mehr als Wörter erkannt bzw. verstanden werden. Die bildnerische Betrachtung kann durch die abstrahierende ergänzt werden. So muss beispielsweise ein Grafiker, der die Aufgabe
3 Denken | 189
hat, ein Logo aus den beiden Wörtern »Rezeption« und »Produktion« zu bilden, die Bedeutung dieser Wörter nicht vergessen, um verschiedene LogoVarianten (siehe Abb. 17 und Abb. 18) bildnerisch beurteilen zu können. Der Grafiker kann durch Bildnerisches Denken feststellen, dass beim Logo 1 (Abb. 17) die beiden Wortteile REZEP und PRODUK kompositorisch ungünstig angeordnet sind, da sie unterschiedlich lang sind und an der linken Seite nicht bündig abschließen. Beim Logo 2 (Abb. 18) hingegen ergeben alle Schriftteile zusammen gesehen einen rechteckigen Block. Durch abstrahierendes Denken kann der Grafiker aber gleichzeitig zu der Überzeugung kommen, dass die Anordnung der Wortteile beim Logo 1 bezogen auf die Bedeutung der Wörter passender ist, da der Prozess der Produktion in vielen Fällen – zum Beispiel bei Bildern – den Prozess der Rezeption beinhaltet und daher die Rezeption als erstes genannt werden sollte. Die Leistung des Grafikers besteht nun gerade darin, durch die wechselseitige Ergänzung des abstrahierenden und konkretisierenden Denkens zu einer gestalterischen Lösung zu kommen, die sowohl der Bedeutung der Wörter, als auch dem bildnerischen Anspruch eines Logos gerecht wird. Eine ähnliche Verzahnung der beiden Denkarten spielt beim Betrachten vieler kubistischer Gemälde eine Rolle, dann nämlich, wenn im synthetischen Kubismus Schriftelemente im Bild integriert sind. Obwohl bei diesen Beispielen das abstrahierende und konkretisierende Denken stark ineinander greifen, wäre es doch verfehlt, wenn man die Denkleistung des Grafikers oder des Betrachters kubistischer Gemälde als einen fließenden Übergang zwischen zwei Denkarten beschreiben würde. Das Identifizieren und Verstehen der geschriebenen Wörter geht nicht fließend in das Beurteilen des Layouts oder das Betrachten der Bildmerkmale über. Beide Denkvollzüge – der abstrahierende und der konkretisierende – sind klar voneinander unterscheidbar. Damit wurde gezeigt, wie abstrahierendes und konkretisierendes Denken ineinander greifen können, ohne ihre klare Unterscheidbarkeit zu verlieren.
4 DAS BILDNERISCHE
Teil 4 dient der Begründung von These 2: Bilderfahrung ist Konkretisieren in Form von Bildnerischem Denken. Sie erfolgt dadurch, dass die beiden in der zentralen Frage enthaltenen Teilfragen beantwortet werden. Kapitel 4.1 gibt eine Antwort auf die erste Teilfrage: »Was heißt es, etwas als Bild zu betrachten?«. Sie begründet These 2a: Bilderfahrung in der Bildbetrachtung ist das Ausüben der Funktionen 1–3 des Bildnerischen Denkens. Daraus leitet sich ein enger Bildbegriff ab. Kapitel 4.2 behandelt die zweite Teilfrage: »Was heißt es, etwas als Bild zu gestalten?«. Ihre Beantwortung führt zur Begründung der These 2b: Bilderfahrung in der Bildgestaltung ist das Aus-
üben der Funktionen 1–3 oder der Funktion 4 des Bildnerischen Denkens. Hieraus wird ein weiter Bildbegriff abgeleitet. Die ersten drei Funktionen sind damit sowohl für die Rezeption als auch für die Produktion von Bildern konstitutiv und begründen die Verwandtschaft dieser Prozesse. Insofern ist es gerechtfertigt, beide als »bildnerisch« zu bezeichnen. Mit der Herleitung der vier Funktionen wird damit das »Bildnerische« des Bildnerischen Denkens als dessen spezifische Differenz begründet.
4.1
B ILDER BETRACHTEN In der ersten Teilfrage wird danach gefragt, wann man davon sprechen kann, dass jemand etwas als Bild betrachtet. Gefragt ist nicht, wann jemand ein Bild richtig versteht. Etwas als Bild betrachten und ein Bild richtig verstehen sind zwei Prozesse, die nicht immer gemeinsam auftreten. Der erste kann auch ohne den zweiten stattfinden. Auch bei der Sprache kann man nicht davon ausgehen, dass jemand, der ein Blatt mit kleinen Kritzeleien als Text betrachtet, diesen Text automatisch versteht. Selbst wenn er die Sprache versteht, in der der Text geschrieben ist, kann es immer noch sein, dass er einzelne Wörter oder den geschilderten Sachverhalt nicht begreift, weil ihm das nötige Hintergrundwissen (z. B. einer wissenschaftlichen Disziplin)
192 | Bildnerisches Denken
fehlt. Genauso ist es bei Bildern. Man muss unterscheiden zwischen einem Kriterium für »etwas als Bild betrachten« und »ein Bild richtig verstehen«. Nur für Letzteres sind bei manchen Bildern auch abstrahierende Denkprozesse nötig. Im Modell des Bildnerischen Denkens geht es nur um das erste Kriterium. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Modell von solchen Theorien, die das stufenweise Verstehen von Bildern erklären – wie beispielsweise die »Stufen des Bildverstehens« von Oliver Scholz1, die »Ebenen der Bildkompetenz« Roland Posners2 oder die »Dimensionen der Bildkompetenz« bei Rolf Niehoff3. Während diese Autoren den Versuch unternehmen, alle Denkprozesse in einer Bildrezeption als stufenweise aufeinander aufbauend zu beschreiben, beschränkt sich das Modell des Bildnerischen Denkens auf die Prozesse, die Etwas zu einem Bild werden lassen. Dies sind ausnahmslos Prozesse des Konkretisierens. Im Gegensatz dazu beschreiben die genannten Autoren überwiegend abstrahierende Denkprozesse, durch die das Phänomen des Bildlichen nicht erfasst wird, wie im Folgenden kurz dargelegt wird. So beschreibt Oliver Scholz die Stufe »Verstehen des Bildinhalts« wie folgt: »Wer diese Stufe des Verstehens erreicht hat, hat etwas darüber erfasst, mit welcher Art von Bild er es zu tun hat; er beherrscht bestimmte Weisen, das Bild zu klassifizieren«.4 Solches Klassifizieren ist ein Prozess des abstrahierenden Denkens, den wir in unserem Alltag ständig durchführen und der deshalb keineswegs bildspezifisch ist. Zudem sind für ein solches Einordnen die einmaligen Merkmale eines konkreten Bildes völlig irrelevant. Durch Klassifizierung erschließt sich das Phänomen des Bildlichen nicht, wie bereits in Kapitel 3.1.3.1 ausführlich demonstriert wurde. Die »piktorale Kompetenz«5 innerhalb des Bildkompetenzmodells von Roland Posner erklärt dieser als Erkennen von »Gegenstandstypen«6, auf die das Bild verweist. Hier wird unser alltägliches Gegenstandserkennen, das ebenfalls nicht bildspezifisch ist, auf Bilder angewendet. Auch dieser Prozess geschieht durch abs-
1
Scholz, Oliver: Bild, Darstellung, Zeichen, Frankfurt a. M., 2009, S. 169.
2
Posner, Roland: »Ebenen der Bildkompetenz«, in: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Was ist Bild-
3
Niehoff, Rolf: »Bildung – Bild(er) – Bildkompetenz(en)«, in: Bering, Kunibert; Niehoff, Rolf (Hg.):
4
Bildkompetenz(en), Oberhausen, 2009. Scholz, Oliver: Bild, Darstellung, Zeichen, Frankfurt a. M., 2009, S. 175.
5
Posner, Roland: »Ebenen der Bildkompetenz«, in: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Was ist Bild-
6
Ebenda.
kompetenz?, Wiesbaden, 2003.
kompetenz?, Wiesbaden, 2003, S. 21.
4 Das Bildnerische | 193
trahierendes Denken, das die dargestellten Gegenstände klassifiziert. Die Zuordnung einzelner Gegenstände im Bild zu Gegenstandsklassen bezieht sich dabei genauso wenig auf die Einmaligkeit eines Bildes wie die Klassifizierung des ganzen Werkes. Auf solche Weise wird das Phänomen des Bildlichen ebenfalls nicht erfasst – auch das wurde in Kapitel 3.1.3.1 gezeigt. Welche Funktion die »Biografische Dimension«7 in seinem Kompetenzmodell einnimmt, erklärt Rolf Niehoff wie folgt: »Das kompetente Umgehen mit Bildern schließt […] das Wissen um ihre jeweilige subjektiv-biografische Determiniertheit mit ein.«8 Ein solches Wissen ist genauso für das Verstehen eines literarischen Textes relevant. Die spezifisch bildlichen Merkmale eines Werkes werden durch solches Wissen nicht erschlossen. Im Gegensatz zu diesen vorgestellten Ansätzen beschreibt das hier entworfene Modell dasjenige Denken, das ausschließlich auf Bildlichkeit bezogen ist und daher Etwas zum Bild werden lässt. Es systematisiert die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für Bilderfahrung. In der ersten Teilfrage »Was heißt es, etwas als Bild zu betrachten?« ist bereits ein Hinweis zu ihrer Beantwortung enthalten. Die Frage behauptet einen Zusammenhang zwischen der Betrachtungsweise eines Rezipienten und dem Zuschreiben des Prädikates »Bild«. Er kommt in der Formulierung »etwas als etwas betrachten« zum Ausdruck. »Betrachten« kann einerseits im wörtlichen Sinn heißen, etwas visuell zu rezipieren. Im übertragenen Sinn kann der Begriff als Synonym für »bezeichnen« verwendet werden und sich so auf das Zuschreiben eines Prädikates beziehen. Etwas im wörtlichen Sinn als Bild Betrachtetes wird auch im übertragenen Sinn als Bild betrachtet. Das Modell des Bildnerischen Denkens teilt damit die grundlegende Annahme vieler Bildtheorien9, dass ein Gegenstand nicht aufgrund einer besonderen Eigenschaft zum Bild wird, sondern durch einen bestimmten Umgang mit ihm – nämlich durch eine bestimmte Art der Betrachtung, der Bildbetrachtung. Die erste Teilfrage wird beantwortet, indem erklärt wird, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit man etwas als »Bildbetrachtung« bezeichnen kann. Dabei werden zunächst die Bedingungen in Bezug auf das Betrachtete (4.1.1), den Betrachter (4.1.2) und das Betrachten (4.1.3) näher bestimmt. Die einzeln notwendigen und zusammen hinreichenden
7
Niehoff, Rolf: »Bildung – Bild(er) – Bildkompetenz(en)«, in: Bering, Kunibert; Niehoff, Rolf (Hg.):
8
Ebenda.
Bildkompetenz(en), Oberhausen, 2009, S. 25. 9
Vgl. Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 161, und Scholz, Oliver: Bild, Darstellung, Zeichen, Frankfurt a. M., 2009, S. 137–139.
194 | Bildnerisches Denken
Bedingungen für das Betrachten eines Bildes werden anschließend zusammengefasst (4.1.4). Sind alle diese Bedingungen erfüllt, kann man auch zugleich davon sprechen, dass eine Bildrelation besteht (4.1.5). Die Bedingungen für die Bildbetrachtung bzw. für die Bildrelation sind zugleich die Bedingungen dafür, das etwas ein Bild ist – zumindest bezogen auf den engen Bildbegriff, der dadurch hergeleitet werden kann (4.1.6). 4.1.1 Das Betrachtete Zwei Bedingungen muss das Betrachtete erfüllen, damit es als Bild betrachtet werden kann. Erstens muss es nicht nur im übertragenen Sinne sondern auch im wörtlichen Sinne betrachtet werden können, d. h. es muss sinnlich wahrnehmbar sein. »Wahrnehmung« soll hier verstanden werden als »Bezeichnung […] für das Geschehen eines Vorgangs, in dessen Verlauf strukturierte Inhalte der sinnlichen Erfahrung zugänglich werden.«10 Die Art der Wahrnehmbarkeit kann weiter eingeschränkt werden: Das Betrachtete muss visuell wahrnehmbar sein oder – da hier auch plastische Gegenstände als Bilder gelten sollen – durch vielsinnliche Raumwahrnehmung. Als zweite Bedingung muss das Betrachtete als solches von anderen Dingen unterschieden werden können. Das bedeutet, es muss wahrnehmbar räumlich eingegrenzt sein. Dazu ist nicht erforderlich, dass diese Grenze selbst in irgendeiner Form markiert sein muss, etwa durch einen Rahmen oder eine gezogene Linie. Das Betrachtete muss auch nicht künstlich hergestellt oder als Bild hergestellt worden sein. Gefordert ist lediglich, dass der Betrachter eine Unterscheidung treffen können muss zwischen dem Betrachteten und dem, was außerhalb des Betrachteten liegt. Er muss beide Seiten der Grenze wahrnehmen können – das Innere und das Äußere. Die Grenze des Gesichtsfeldes beispielsweise erfüllt dieses Kriterium nicht. Man registriert zwar, dass das Gesichtsfeld begrenzt ist, aber man kann nur das Innere dieser Begrenzung tatsächlich wahrnehmen. Eine Grenze zwischen zwei gleichwertigen Teilen, etwa zwischen links und rechts, reicht ebenfalls nicht aus. Die Grenze muss so gezogen sein, dass sie die Welt in ein Innen und ein Außen einteilt. Der Teil der wahrnehmbaren Welt, der sich innen befindet, ist das Bild, während das Äußere der Rest der Welt ist. Der Begriff »Welt« soll hier im bereits erläuterten Sinne von Kamlah und Lorenzen verstanden werden (siehe Kapitel 3.2.3). In dieser Welt können wir
10 Uhlemann, Brigitte; Ganslandt, Herbert, R.: »Wahrnehmung«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.):
Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2004, S. 601.
4 Das Bildnerische | 195
Gegenstände eingrenzen bzw. dadurch von der Welt ausgrenzen.11 Ein Bild stellt in diesem Sinne einen in der Welt ausgegrenzten Gegenstand dar. Der Unterschied zur Sprache besteht darin, dass die Ausgrenzung nicht durch einen Prädikator, sondern durch die wahrnehmbare räumliche Grenze geschieht. Es ist ein spezifisches Charakteristikum von Bildern, dass ihre wahrnehmbare Grenze räumlich, und zwar nur räumlich, nicht jedoch zeitlich ist. Ein Teil der Welt liegt räumlich innerhalb der Grenze, während ein anderer räumlich außerhalb liegt. Ein Bild hat einen räumlichen Anfang und ein räumliches Ende, aber keinen zeitlichen Anfang und kein zeitliches Ende. Zwar ist jedes Bild wie die ganze Welt einem Verfallsprozess ausgesetzt, aber diese zeitliche Begrenzung ist nicht identisch mit der Grenze oder dem Rahmen des Bildes. Es gibt keinen zeitlichen Anfang, keine zeitliche Mitte und kein zeitliches Ende des Bildes, wie beispielsweise bei einem Musikstück. Anfang, Mitte und Ende des Bildes sind räumlich definiert und auch die Bildelemente sind räumlich zueinander geordnet, anders als bei einem Musikstück, bei dem die einzelnen Musikelemente zeitlich geordnet sind. Zwar benötigt auch ein Bildbetrachter Zeit für die Wahrnehmung des Bildes, wie auch ein Musikhörer Raum benötigt. Hier würde aber niemand davon sprechen, dass der zeitliche Anfang der Bildbetrachtung dem zeitlichen Anfang des Bildes entspricht. Hingegen muss das Hören spätestens mit dem zeitlichen Anfang des Musikstückes beginnen. Die konventionellste Form einer »wahrnehmbaren räumlichen Eingrenzung« ist ein rechteckiger Rahmen. Es ist aber nicht notwendig, dass die Eingrenzung in irgendeiner Form materialisiert ist. Sie kann beispielsweise nur durch Farbunterschiede oder als Begrenzung einer Beamer-Projektion sichtbar sein. Die Eingrenzung kann außerdem sehr offensichtlich sein, wie z. B. die Begrenzung eines Bildschirms. Sie kann aber auch weniger offensichtlich oder mehrdeutig sein. Bei einem Gemälde mit einem sehr breiten und schmuckvollen Rahmen kann es sinnvoll sein, den Rahmen als Teil des Bildes zu betrachten. Das Innere des Bildes kann Anhaltspunkte liefern, die diese Interpretation nahelegen, beispielsweise wenn im Bild eine dem Rahmen ähnlich Form oder Farbe vorkommt. Die Eingrenzung muss nicht rechtwinklig sein. Jede mögliche wahrnehmbare Form kann zur Bildgrenze werden. Welche wahrnehmbare Form im Einzelfall als räumliche Eingrenzung eines Bildes wahrgenommen wird, hängt vom Betrachter ab, wie in den folgenden beiden Kapiteln näher erläutert wird. Alle Gegenstände, die diesen
11 Vgl. Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich,1990, S. 52.
196 | Bildnerisches Denken
notwendigen Bedingungen des Betrachteten entsprechen, können daher zum Bild werden. Sie sind es aber erst, wenn sie von einem Rezipienten als Bild betrachtet werden. 4.1.1.1 Bild und Bildwerk Die räumliche Eingrenzung des Betrachteten kann auf zwei Arten erfolgen: flächig und plastisch. Flächige Bilder werden visuell durch das Auge wahrgenommen, plastische Bilder im Zusammenwirken mehrerer Sinneswahrnehmungen, u. a. durch das Innenohr, durch die Haut sowie durch die Sehnen, Muskeln und Gelenke.12 Diese vielsinnliche Raumwahrnehmung, die für die Wahrnehmung plastischer Bilder notwendig ist, soll hier als »plastische Wahrnehmung« bezeichnet werden. Die beiden Arten von Wahrnehmung bzw. von räumlicher Eingrenzung führen zu einer Differenzierung des Bildbegriffs. Alles, was räumlich eingegrenzt ist, wird als »Bild« bezeichnet. »Bildfläche« hingingen trifft nur auf die Bilder zu, die flächig eingegrenzt sind bzw. nur visuell wahrgenommen werden. »Bildwerk« bezieht sich dagegen auf die plastischen Bilder, d. h. Skulpturen, Plastiken, Objektkunst etc. Dieses Verständnis von »Bild« greift dessen etymologischen Ursprung auf, in dem der Begriff nicht – wie heute vielfach üblich – auf die flächigen Bilder beschränkt war, sondern in einem umfassenderen Sinne auch Plastiken und Skulpturen mit einbezog.13 Reste dieser Verwendung des Begriffs »Bild« finden sich noch heute in manchen Ausdrücken, wie zum Beispiel in dem Wort »Bildhauer«.14 Es ergibt sich also folgender begrifflicher Zusammenhang, wie in Tabelle 15 dargestellt:
BILD = sinnlich wahrnehmbar räumlich eingegrenzt Bildfläche Bildwerk = flächig eingegrenzt = plastisch eingegrenzt = nur visuell wahrgenommen = vielsinnlich, d.h. plastisch wahrgenommen
Tabelle 15: Bild, Bildfläche und Bildwerk
12 Vgl. May, Mark: »Raumwahrnehmung«, in: Funke, Joachim; Frensch, Peter, A. (Hg.): Handbuch
der Allgemeinen Psychologie – Kognition, Göttingen, 2006, S. 173. 13 Vgl. [ohne Autor]: »Bildnerei«, in: Olbrich, Harald (Hg.): Lexikon der Kunst, Leipzig, 1987. 14 Vgl. hierzu auch: Scholz, Oliver: Bild, Darstellung, Zeichen, Frankfurt a. M., 2009, S. 6.
4 Das Bildnerische | 197
In dieser Unterscheidung spiegelt sich die Differenzierung zwischen visuellen und plastischen Medien, die in Kapitel 3.4.2.1 erläutert wurde. Visuelle Medien betrachtet man in der Regel als Bildflächen, während plastische Medien als Bildwerke rezipiert werden. 4.1.1.2 Visuelle und plastische Wahrnehmung Die Einschränkung der Wahrnehmung von Bildflächen auf das rein Visuelle ist künstlich und entspricht nicht der alltäglichen Funktionsweise unserer Sinne. Strenggenommen sind wir nicht in der Lage, nur visuell wahrzunehmen, da wir unsere anderen Sinne nicht »ausschalten« können. Die Unterscheidung zwischen der rein visuellen Wahrnehmung und einer vielsinnlichen Raumwahrnehmung bzw. der plastischen Wahrnehmung entsteht daher nur durch einen Unterschied in der Aufmerksamkeit des Betrachters. Je nachdem, auf welche Art der Eingrenzung sich der Betrachter konzentriert – auf eine flächige oder auf eine plastische – nimmt er etwas als Bildfläche oder als Bildwerk wahr. Das bedeutet, dass prinzipiell jeder sinnlich wahrnehmbare und räumlich eingegrenzte Bereich sowohl als Bildfläche wie auch als Bildwerk betrachtet werden kann. Genau wie bei der Frage, ob etwas ein Bild ist, hängt auch die Frage, ob etwas Bildfläche oder Bildwerk ist, von der Perspektive des Betrachters ab. Ein Ölgemälde beispielsweise kann als Bildfläche aber auch als Bildwerk betrachtet werden: Lenkt der Betrachter seine Aufmerksamkeit auf das Relief, das durch den dicken Farbauftrag entstanden ist und das er erst durch die Bewegung seines Kopfes oder seines Körpers erkennt, nimmt er dasselbe Gemälde als Bildwerk wahr. Umgekehrt kann auch eine Skulptur nicht nur als Bildwerk, sondern auch als Bildfläche wahrgenommen werden. Der Betrachter kann entscheiden, sie nur aus einer Perspektive zu betrachten und sich nur auf die rein visuell wahrgenommenen Farben und Formen zu konzentrieren. Dass beide Perspektiven immer möglich sind, bedeutet nicht, dass in jedem Fall willkürlich zwischen ihnen gewählt werden könnte. Viele Bilder besitzen deutliche Merkmale, die für die eine oder die andere Perspektive sprechen. Doch es gibt auch weniger klare Fälle. Auf den ersten Blick schwer einzuordnen ist beispielsweise ein Gemälde, das aus einer Leinwand besteht, die zwei Meter hoch und einen Kilometer lang ist. Zwar kann man die Malerei auf dem Gemälde rein visuell wahrnehmen, was für eine Einordnung als Bildfläche spricht. Um jedoch das ganze Bild zu betrachten, wäre der Einsatz des gesamten Körpers und damit auch der Raumwahrnehmung nötig, in Form eines einen Kilometer langen Spaziergangs. Daher mag es berechtigt erscheinen, das Gemälde als Bildwerk zu betrachten. Gegen diese Einord-
198 | Bildnerisches Denken
nung spricht aber, dass die räumliche Eingrenzung des Gemäldes eher flächig und nicht plastisch ist, auch wenn man sie nicht insgesamt, sondern nur stückweise wahrnehmen kann. Die plastische Begrenzung des Gemäldes – z. B. die Stärke der Leinwand oder das Farbrelief – sind hier von untergeordneter Bedeutung. Die einzelnen Abschnitte der flächigen Eingrenzung können jeweils rein visuell wahrgenommen werden und müssen nur aneinander gereiht werden. Folgende Beschreibung der Bildwahrnehmung des Gemäldes scheint daher treffend: Auf dem Spaziergang werden mehrere Bildflächen betrachtet, die alle aneinander hängen. Ein anderer, etwas komplizierterer Fall stellt ein begehbares Panorama dar: Der Betrachter steht in der Mitte eines Rings, der so bemalt ist, dass er die Illusion einer rings um den Betrachter liegenden Landschaft erzeugt. Die Wahrnehmung des gesamten Panoramas mit seiner räumlichen Eingrenzung ist hier nur vielsinnlich möglich, da der Betrachter die Ringform des Panoramas erkennen muss. Für diesen Betrachter ist das Panorama daher ein Bildwerk, das allerdings aus lauter Bildflächen besteht: der Betrachter kann seine Aufmerksamkeit auf einzelne, abgegrenzte Bildteile lenken und diese isoliert von ihrer Einbettung in das Gesamtbild betrachten. Das bedeutet, dass ein Bildwerk Bildflächen enthalten kann, wie auch umgekehrt jede Bildfläche in Teilen oder auch in der Gesamtheit als Bildwerk betrachtet werden kann. Wie an diesen Beispielen deutlich wurde, gibt es kein allgemeines Kriterium für die richtige Einordnung eines Bildes als Bildfläche oder als Bildwerk. Stattdessen ist dies eher eine Frage der Angemessenheit. Ob der Betrachter mit der jeweils von ihm gewählten Perspektive dem betrachteten Gegenstand gerecht wird, kann dabei nur im Einzelfall entschieden werden. Für die Fragestellung dieser Arbeit ist die Differenz zwischen Bildfläche und Bildwerk weitgehend irrelevant, weshalb im Folgenden nur noch vom Bild die Rede sein wird. Eventuell fließende Übergänge oder nicht entscheidbare Einzelfälle zwischen beiden Bildarten müssen daher ebenfalls nicht weiter thematisiert werden. 4.1.2 Der Betrachter Die erste Bedingung, die der Betrachter erfüllen muss, ergibt sich aus den Bedingungen des Betrachteten. Er muss mit Sinnesorganen zur visuellen Wahrnehmung und zur plastischen Wahrnehmung ausgestattet sein. Neben diese abgeleitete Voraussetzung tritt eine zweite Bedingung. Der Betrachter muss in der Lage sein, diejenige Relation zwischen sich und dem Betrachteten herzustellen, welche aus dem Betrachteten ein Bild werden lässt. Dafür ist es nicht hinreichend, dass der Betrachter das Betrachtete gedankenlos
4 Das Bildnerische | 199
anblickt. Er muss sich der Beziehung, die zwischen ihm und dem Betrachteten besteht, bewusst sein, d. h. er muss wissen, dass er ein Bild betrachtet. Demnach ist er nicht nur für den Status des »Bildseins« des Betrachteten verantwortlich, sondern auch für seinen eigenen Status als Betrachter. Etwas als Bild »zu betrachten« (im wörtlichen Sinne) heißt, sich selbst als Betrachter »zu betrachten« (im übertragenen Sinne). Dieser Vorgang, der sowohl das Bild als auch den Betrachter in seinen entsprechenden Status setzt, kann treffend mit dem Begriff »Rezeption« bezeichnet werden. Das lateinische Wort »recipere« ist zusammengesetzt aus der Vorsilbe »re« und dem Verb »capere«. Die Silbe »re« kann unter anderem bedeuten: »Bringen in den gehörigen Stand«15 oder »Hinbringen an die richtige Stelle«16. Die Zusammensetzung »recipere« wird u. a. übersetzt mit: »entgegennehmen, hin- und annehmen, in sich aufnehmen« und »(in einen Stand oder in ein Verhältnis) aufnehmen«17. Die etymologische Wurzel des Begriffs »Rezeption« enthält also bereits einerseits das aktive »In-sich-Aufnehmen«, z. B. einer Sinneswahrnehmung, was mehr ist als gedankenloses Blicken, und andererseits das Herstellen eines bestimmten Verhältnisses. Der Betrachter nimmt das Betrachtete in sich auf und setzt dadurch das Betrachtete und sich selbst in eine Relation – die Bildrelation, die näher in Kapitel 4.1.5 erläutert wird. Der Rezipient macht das Bild zum Bild, indem er sich selbst zum Bildrezipienten macht. Die Bedingung, die der Betrachter erfüllen muss, ist also, dass er rezeptionsfähig sein muss. Voraussetzung dafür ist, dass er ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein besitzt, welches es ihm ermöglicht, sich in dieses bestimmte Verhältnis zum Betrachteten zu setzen. Die Frage, welche Lebewesen ab welcher Entwicklungsstufe über ein ausreichendes Maß an Selbstbewusstsein verfügen und damit die Fähigkeit zur Bildrezeption haben, kann nur empirisch beantwortet werden. Das hier vertretene Bildverständnis legt dabei nicht fest, ob der Erwerb dieser Fähigkeit in Stufen oder kontinuierlich vor sich geht, wie manche empirische Studien nahelegen18.
15 Menge, Hermann; Güthling, Otto: Enzyklopädisches Wörterbuch der lateinischen und deutschen
Sprache, Berlin, 1954. 16 Ebenda. 17 Ebenda. 18 Vgl. z. B.: Rajala, Abilgail Z. u. a.: »Rhesus Monkeys (Macaca mulatta) Do Recognize Themselves in the Mirror «, in: PLoS ONE, 2010, [ohne Seitenangaben].
200 | Bildnerisches Denken
4.1.3 Das Betrachten Das Betrachtete und der Betrachter stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander – dem der Bildbetrachtung. Die Wahrnehmbarkeit und Begrenztheit des Betrachteten sowie die Rezeptionsfähigkeit des Betrachters wurden als notwendige Bedingungen dieser Beziehung beschrieben. Für das Zustandekommen der Bildbetrachtung treten weitere Bedingungen hinzu, welche die eigentliche Relation betreffen, d. h. den Bezug zwischen Betrachter und Betrachtetem. Diese Relation wird durch bestimmte Tätigkeiten hergestellt, die sich auf die bereits erörterten Merkmale der beiden Relata beziehen – dem Betrachteten und dem Betrachter. Es handelt sich bei diesen Tätigkeiten um die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens, die vom Betrachter ausgeübt werden müssen: das bildnerische Wahrnehmen, Zusammensetzen und Verbinden. Anders ausgedrückt sind es die Denkprozesse, durch welche die spezifisch bildnerischen Probleme der Betrachtung bewältigt werden. Bildbetrachtung ist daher mehr, als das »Wahrnehmen« eines Bildes. Zwar ist eine bestimmte Art der Wahrnehmung – das bildnerische Wahrnehmen – eine Funktion des Bildnerischen Denkens. Aber diese unterscheidet sich grundlegend von der Art der Wahrnehmung, mit der wir in unserem Alltag Gegenstände identifizieren, wie in Kapitel 5.2 gezeigt wird. Alle drei Tätigkeiten bestehen im Konkretisieren, d. h. im Charakterisieren durch Unterschiede. Voraussetzung für das Konkretisieren ist die Grundoperation des Unterscheidens zwischen Gleichartigem und Verschiedenartigem. Für das Charakterisieren durch Verweis auf Unterschiede ist die Fähigkeit, möglichst viele und feine Unterschiede zu erkennen, viel wichtiger als für das Abstrahieren. Die Leistungsfähigkeit in den Funktionen des Bildnerischen Denkens ist daher abhängig von der Fähigkeit zu differenzieren. Jemand, der in der Lage ist, mehr oder feinere Unterschiede festzustellen, beherrscht diese Tätigkeiten besser als ein anderer. Die Frage, welche Faktoren die Differenzierungsfähigkeit in den drei Tätigkeiten beeinflussen, ist empirisch zu beantworten.19 Die drei Tätigkeiten bauen aufeinander auf. Das bedeutet zum einen, dass die dritte Tätigkeit nicht möglich ist ohne die ersten beiden. Zum anderen führt es dazu, dass beispielsweise eine geringe Differenzierungsfähigkeit in der ersten Tätigkeit negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit in
19 Wahrscheinlich spielen hier neben angeborenen Faktoren Lernprozesse eine entscheidende Rolle. Eine genaue Untersuchung dieser Faktoren der Lernerfahrung wäre von großer Bedeutung für jede Art von Kunstunterricht.
4 Das Bildnerische | 201
den beiden folgenden Tätigkeiten hat. Eine geringe Differenzierungsfähigkeit bei einer der drei Tätigkeiten muss unterschieden werden von dem Fall, dass eine Person generell zu der entsprechenden Tätigkeit nicht in der Lage ist, z. B. aufgrund einer organischen Einschränkung. Im Folgenden werden die drei Tätigkeiten aus den bisher erörterten notwendigen Bedingungen des Betrachteten und des Betrachters abgeleitet. Jede der drei Tätigkeiten bezieht sich auf eine der Bedingungen. Die bisher beschriebenen Bedingungen der Wahrnehmbarkeit und Begrenztheit des Betrachteten sowie der Rezeptionsfähigkeit des Betrachters sind also Voraussetzungen für die im Folgenden beschriebenen Tätigkeiten des Betrachters. Daher können die notwendigen Bedingungen für die Bildbetrachtung auf die notwendigen Bedingungen des Betrachtens, d. h. auf die drei oben genannten Tätigkeiten, reduziert werden. 4.1.3.1 Wahrnehmen Die Tätigkeit, mit der sich der Betrachter auf das Merkmal der Wahrnehmbarkeit des Betrachteten bezieht, ist das Wahrnehmen. Durch die Bedingung der räumlichen Begrenztheit des Betrachteten wird auch die Art der Wahrnehmung näher eingeschränkt. Die flächige Eingrenzung ist visuell wahrnehmbar, während die plastische Eingrenzung plastisch wahrgenommen wird. Visuell wahrgenommen werden Farben und flächige Formen. In der plastischen Wahrnehmung treten zu den flächigen Formen die plastischen hinzu. Diese Unterscheidung der flächigen und plastischen Formen spiegelt die Differenzierung zwischen Bildfläche und Bildwerk. Da die Beschreibung der Tätigkeiten des Betrachtens für Bilder im Allgemeinen gelten soll, kann auch in Bezug auf die Wahrnehmung die Unterscheidung zwischen dem visuellen und der plastischen Wahrnehmen vernachlässigt werden. Wenn im Folgenden von Wahrnehmung die Rede ist, dann sind damit beide Arten der Wahrnehmung gemeint, ebenso wie unter Formen immer sowohl flächige wie auch plastische Formen verstanden werden. Die unterschiedliche Leistungsfähigkeit verschiedener Personen im bildnerischen Wahrnehmen kann durch Unterschiede in der entsprechenden Differenzierungsfähigkeit erklärt werden, wie bereits allgemein erläutert. Jemand, der die Funktion des bildnerischen Wahrnehmens besser beherrscht als ein anderer, ist in der Lage, mehr oder feinere Unterschiede von Farben und Formen zu erkennen. Solche Unterschiede in der Differenzierungsfähigkeit können sich z. B. bei der Betrachtung eines Portraits zeigen. Ein wenig differenzierender Betrachter nimmt den Unterschied der Gesichtsfarben auf Abb. 19 und Abb. 20 nicht wahr, sondern hat vielleicht nur
202 | Bildnerisches Denken
ein diffuses Gefühl für die unterschiedliche Wirkung beider Portraits. Einem stark differenzierenden Betrachter fällt auf, dass durch die leichte Rotfärbung der Nase auf Abb. 19 die Person nicht mehr so seriös und vergeistigt wirkt, wie auf Abb. 20, weil sie an das Aussehen eines Alkoholikers erinnern mag. Die Fälle unterschiedlicher Differenzierungsfähigkeit müssen unterschieden werden von solchen, in denen die Wahrnehmungsfähigkeit stark eingeschränkt ist. In solchen Fällen kann das bildnerische Wahrnehmen eventuell gar nicht ausgeübt werden, so dass auch keine Bildrezeption stattfindet. Ein völlig farbenblinder Rezipient kann bei einem Gemälde nur die flächigen Formen erkennen, nicht aber die unterschiedlichen Farbwerte. Ähnlich verhält es sich bei einem völlig blinden Rezipienten, der eine Skulptur lediglich ertasten kann. Ob man in diesen Grenzfällen noch davon sprechen kann, dass der Blinde die Skulptur als Bildwerk wahrnehmen kann bzw. der Farbenblinde das Gemälde als Bildfläche, hängt vom jeweiligen Bild ab: wenn es sich um eine Skulptur handelt, deren tastbare Qualitäten, wie z. B. die Oberflächenstruktur, entscheidend sind, würde man den blinden Rezipienten eventuell als »Bildbetrachter« akzeptieren. Hingegen würde man ihn wohl kaum als Bildbetrachter einer Skulptur bezeichnen können, bei der die Farbgebung zentral ist. Analog liegt der Fall bei dem Gemälde und dem farbenblinden Betrachter: Wenn bei dem Gemälde nur die Formsetzung von Bedeutung ist, kann man eventuell davon sprechen, dass der Farbenblinde das Gemälde zumindest in Aspekten »als Bild betrachten« kann. Bei einem monochromen Gemälde hingegen, bei dem es allein auf die Wirkung der Farbe ankommt, wird man dem Farbenblinden eher absprechen, das Bild als solches wahrnehmen zu können. Unabhängig von diesen organischen Einschränkungen kann bei beiden Rezipienten die Differenzierungsfähigkeit im Bereich ihrer jeweils intakten Sinneswahrnehmung besser oder schlechter sein. Der eine Farbenblinde kann Helligkeitswerte eventuell besser unterscheiden als ein anderer. Ebenso können manche Blinde Dinge besser ertasten als andere. Die erste für die Bildbetrachtung notwendige Tätigkeit des Betrachters besteht also im bildnerischen Wahrnehmen. Es kann näher als ein Erkennen von Farben und Formen sowie deren Differenzen beschrieben werden. 4.1.3.2 Zusammensetzen Die Tätigkeit, mit der sich der Betrachter auf die Bedingung der wahrnehmbaren räumlichen Eingrenzung des Betrachteten bezieht, ist das Zusammensetzen bzw. Komponieren.
4 Das Bildnerische | 203
Abb. 19: Digitale Bearbeitung von: El Greco: »Christus am Kreuz mit zwei Stiftern«, Ausschnitt 1, vgl. Abb. 20
Abb. 20: El Greco: »Christus am Kreuz mit zwei Stiftern«, Ausschnitt 1, um 1580, Öl auf Leinwand 47 × 71 cm
Abb. 22: Mathis Gothart Grünewald: »Tauberbischofsheimer Altar«, Szene: »Die Kreuzigung Christi«, 1523–1524, Öl auf Holz, 151 × 193 cm
Abb. 21: El Greco: »Christus am Kreuz mit zwei Stiftern«, Ausschnitt 2, um 1580, Öl auf Leinwand, 47 × 71 cm
Abb. 23: El Greco: »Christus am Kreuz mit zwei Stiftern«, um 1580, Öl auf Leinwand, 47 × 71 cm
204 | Bildnerisches Denken
Wie oben bereits angedeutet, wird eine wahrnehmbare räumliche Eingrenzung erst dadurch zur Bildgrenze, dass der Betrachter sie als solche wahrnimmt. Die Entscheidung des Betrachters, wo die Bildgrenze liegt, ist dabei nicht völlig willkürlich. Der Betrachter kann, zumindest auf dieser Stufe, nur dort eine Bildgrenze setzen, wo er eine eingrenzende Form tatsächlich wahrnimmt. Erst in Verbindung mit einer weiteren bildnerischen Tätigkeit, dem Erfinden, kann sich die Tätigkeit des Zusammensetzens von der aktuellen sinnlichen Wahrnehmung lösen, wie näher in Kapitel 4.2 erläutert wird. Unter verschiedenen wahrnehmbaren eingrenzenden Formen wählt der Betrachter eine aus, die er als Bildgrenze sehen möchte. Die Auswahl geschieht dadurch, dass er zwischen Innen und Außen unterscheidet. Die Farben und Formen, die innerhalb der Eingrenzung liegen, nimmt er als innenliegend wahr und setzt sie damit in Bezug zur Grenze. Jede Farbe bzw. jede Form erhält dadurch eine räumliche Position oder Stelle innerhalb des Bildes. Die Eingrenzung ist der Bezugsrahmen der verschiedenen Bildstellen. Dadurch, dass jeder Bildteil eine räumliche Stelle in Bezug zur Eingrenzung hat, ist jeder Bildteil auch zu jedem anderen in Position gesetzt. Anders ausgedrückt werden durch die Eingrenzung die innenliegenden wahrgenommenen Farben und Formen zum Ganzen des Bildes zusammengesetzt. Das bedeutet, dass die Farben und Formen nicht mehr isoliert voneinander wahrgenommen werden, sondern in ihren wechselseitigen Bezügen. Das bildnerische Zusammensetzen ist ein Erkennen dieser Wechselwirkungen der Farben und Formen miteinander und in Bezug zum Bildganzen. Insofern baut die Tätigkeit des bildnerischen Zusammensetzens auf dem bildnerischen Wahrnehmen auf. Durch die Unterscheidung zwischen Innen und Außen findet zugleich eine Fokussierung der Aufmerksamkeit statt. Nur die innenliegenden Farben und Formen werden in Beziehung zueinander und zur Eingrenzung gesetzt. Alle wahrnehmbaren Farben und Formen außerhalb der Eingrenzung rücken damit aus dem Fokus der Aufmerksamkeit. Wie beim bildnerischen Wahrnehmen wird die Leistungsfähigkeit einer Person auch beim Zusammensetzen durch ihre Differenzierungsfähigkeit bestimmt. Je besser jemand das bildnerische Zusammensetzen beherrscht, desto mehr bzw. feinere Differenzen wird er zwischen verschiedenen Zusammensetzungen von Farben und Formen erkennen. Am Beispiel erläutert bedeutet dies: Jemand, der »gut« ist im Zusammensetzen bzw. Komponieren, erkennt den Unterschied zwischen Abb. 20 und Abb. 21 in der Anordnung der Bildteile. In Abb. 20 ist der Kopf im Verhältnis zum Bildrand stärker nach vorne geneigt, während die Haltung der Person in Abb. 21 aufrechter ist. Ein Betrachter hingegen, der nur wenig Differenzen zwischen ver-
4 Das Bildnerische | 205
schiedenen Kompositionen erkennt, nimmt zwar eventuell die unterschiedliche Wirkung der beiden Portraits wahr, kann aber vielleicht nicht erkennen, dass ihre Ursache in der unterschiedlichen Komposition der beiden Bilder liegt. Die zweite für die Bildbetrachtung notwendige Tätigkeit des Betrachters besteht also im bildnerischen Zusammensetzen. Es kann näher als ein Erkennen der Wechselwirkungen von Farben und Formen sowie ihrer Differenzen innerhalb der Bildgrenze und in Bezug zur dieser beschrieben werden. 4.1.3.3 Verbinden Mit der dritten für die Bildbetrachtung notwendigen Tätigkeit, dem bildnerischen Verbinden, bezieht sich der Betrachter auf seine eigene Rezeptionsfähigkeit. Er verwirklicht sie, indem er etwas als Bild rezipiert und so zwischen sich und diesem Etwas eine Beziehung herstellt. Dabei setzt er sich zum Bild in eine Relation, die nicht nur in eine Richtung – nämlich von sich selbst zum Bild – sondern auch in die andere Richtung verläuft – also vom Bild zurück zum Betrachter. Der Betrachter bezieht sich auf das Bild, indem er es betrachtet, d. h. seine Wahrnehmung auf die Farben und Formen konzentriert und durch die Eingrenzung von seiner Umgebung unterscheidet. Er bezieht das Bild aber auch auf sich, indem er sich bewusst als Rezipient dem Bild gegenüber stellt. Er nimmt die Farben und Formen und ihre Zusammensetzungen nicht nur als bezugslose Wahrnehmungsphänomene wahr, sondern setzt sie in Beziehung zu sich selbst, indem er sich die Frage stellt: »Was sind diese Farb- und Formzusammensetzungen für mich?«. Dieses Verständnis von »Verbinden« kommt auch in Redewendungen wie »Ich verbinde etwas damit« zum Ausdruck. Mit diesem Satz erklärt jemand, dass er einer Sache in irgendeiner Form eine Bedeutung zuerkennt und diese versteht. Wie bereits erläutert, setzt die Rezeptionsfähigkeit des Betrachters ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein voraus. Selbstbewusstsein heißt hier, dass der Betrachter sich selbst und seiner Stellung in der Welt bewusst ist. So wie er das Bild in der Welt vom Rest der Welt abgrenzt, kann er auch sich selbst vom Rest der Welt unterscheiden.20 Zu ihm gehören alle Erlebnisse, Gedanken, Erinnerungen, Erkenntnisse etc. oder anders ausgedrückt: seine Welt. Damit ist die Verbindung, die der Betrachter vom Bild zu sich herstellt, gleichzeitig eine Verbindung zur Welt, wenn auch nur zu seiner eigenen.
20 Vgl. zum Begriff »Welt« Kapitel 3.2.1.3.
206 | Bildnerisches Denken
Aber da die meisten Menschen und damit auch die meisten Bildbetrachter in Gemeinschaften leben, gibt es zwischen den Welten der verschiedenen Menschen große Überschneidungen. Daher muss die Verbindung, die ein Bildbetrachter zur Welt herstellt, nicht rein subjektiv bleiben, sondern kann in einer Gemeinschaft geteilt und diskutiert werden. Prinzipiell kann zu jedem Teil der Welt eine Verbindung hergestellt werden. Damit ist noch nichts über die Art dieser Verbindung gesagt. Sie kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Ein Faktor, der die Art der Verbindung bestimmt, ist die Beschaffenheit des Teils der Welt, zu dem die Verbindung hergestellt wird. Dieser entspricht dem Gegenstand des Bildes, wie in Kapitel 3.2 erläutert. Häufig wird zwischen zwei Arten von Verbindungen des Bildes zur Welt unterschieden, die mit den Begriffen »Bildinhalt« einerseits und »Sachbezug« oder »Referenz« andererseits gekennzeichnet werden, z. B. von Oliver Scholz: »Besonders grundlegend ist die Unterscheidung zwischen Bildinhalt und Sachbezug. […] Mir ist es um eine Unterscheidung zu tun, der wohl in jedem Ansatz in irgendeiner Form Rechnung getragen werden muss.«21 Zusätzlich kann man weitere Bedeutungsebenen oder – im hier verwendeten Vokabular ausgedrückt – weitere Verbindungsarten voneinander unterscheiden. So fügt beispielsweise Sachs-Hombach dem Bildinhalt und der Bildreferenz das Sinnbild und den kommunikativen Bildgehalt hinzu.22 Auch Nelson Goodman hat in Languages of Art23 mit Hilfe eines zeichentheoretischen Vokabulars verschiedene Arten von Verbindungen zwischen Bild und Welt beschrieben. Er unterscheidet u. a. zwischen Denotation, Repräsentation, Exemplifikation und Ausdruck. Entscheidend für den Zusammenhang hier ist, dass alle diese Arten von Verbindungen nicht möglich sind, ohne dass das Subjekt seine Aufmerksamkeit vom Bild weg auf sich selbst und die ihm zur Verfügung stehende Welt richtet. Verbinden mit der Welt heißt insbesondere bei gegenständlichen Bildern auch: Verstehen, dass das Dargestellte nicht Teil der realen Welt ist. Wer das Bild mit der Welt verbinden kann, lässt sich nicht durch die Illusion des Bildes täuschen. Nur dann, wenn der Betrachter das Bild von der Welt ausgegrenzt hat und verstanden hat, dass das Dargestellte nicht Teil der Welt, sondern des Bildes ist, stehen ihm zwei »Punkte« zur Verfügung – das Bild und die Welt – die er miteinander verbinden kann. Diese Trennung zwischen Bild und Welt besteht dabei nur in Bezug auf die Bildbetrachtung,
21 Scholz, Oliver: Bild, Darstellung, Zeichen, Frankfurt a. M., 2009, S. 174. 22 Vgl. Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium, Köln, 2006, S. 173. 23 Vgl. Goodman, Nelson: Languages of Art, Indianapolis, Cambridge, 1976.
4 Das Bildnerische | 207
denn nur in dieser wird das Bild von der Welt ausgegrenzt und anschließend mit ihr verbunden. Unabhängig von der Bildbetrachtung ist das Bild, genauer der Gegenstand, der als Bild betrachtet werden kann, ebenso Teil der Welt wie jeder andere Gegenstand auch. Ob eine konkrete Verbindung, die ein Betrachter eines Bildes zu einem Teil der Welt herstellt, passend ist, hängt dabei von zahlreichen Faktoren ab. Zunächst muss gefragt werden: »passend für wen?«. Wenn die Verbindung nur für den Betrachter selbst passend sein muss, dann ist alleine er für das Kriterium der Passung zuständig. Wenn es sich aber um einen Bildrezeptionsprozess handelt, der innerhalb eines bestimmten Systems stattfindet, z. B. in der Schule, an der Universität oder im Museum, dann gibt es in diesem System meistens Regeln, die über die Passung einer Verbindung entscheiden. Hierzu gehören beispielsweise tradierte Regelwerke, wie die Ikonographie. Andere Regeln beschreiben bestimmte Darstellungskonventionen (z. B. die Regeln der Perspektive), die kulturell, physiologisch oder physikalisch bedingt sein können. Es kann sich auch um Regeln handeln, die von den Bedingungen der menschlichen Psyche bestimmt sind, wenn beispielsweise bestimmte Farben mit bestimmten Emotionen verknüpft sind. Einige dieser Regelsysteme können von den Naturwissenschaften empirisch untersucht werden, andere sind durch unsere Kulturgeschichte geprägt und werden in den Geisteswissenschaften untersucht. Manche Regeln existieren in einem Kulturkreis bereits seit einigen hundert Jahren, andere entwickeln sich neu und lösen alte Regelsysteme ab – wie beispielsweise die Konvention der parallelperspektivischen Darstellung von der zentralperspektivischen ersetzt wurde. Ein Betrachter kann aber auch Verbindungen herstellen, die nicht durch mehr oder weniger allgemeine Regeln zustande kommen, sondern aufgrund von ganz persönlichen Verknüpfungen. Alle diese Regeln oder sonstigen Ursachen für die Verknüpfungen gehören zur Welt des Betrachters. Auch Regeln, die zum Allgemeingut einer bestimmten Kultur gezählt werden, wie beispielsweise die Ikonographie, können bei der Tätigkeit des Verbindens nur soweit wirksam werden, wie sie zur Welt des jeweiligen Betrachters gehören. Anders ausgedrückt: Ein Betrachter kann ikonographische Bezüge eines Bildes nur verstehen, wenn er mit der Ikonographie vertraut ist. Ein Betrachter eines Bildes kann das Bild nur mit Gegenständen verbinden, die aus seiner Welt stammen. Eine andere Welt steht ihm nicht zur Verfügung. Das Herstellen einer Verbindung beim Bildbetrachten wird in manchen Systemen »Interpretieren« oder »Deuten« genannt. Je nach Kontext des Bildes werden solche Interpretationen explizit oder weniger explizit themati-
208 | Bildnerisches Denken
siert. Im Kunstkontext, besonders in den Kunstwissenschaften, kommt der schriftlichen Bildinterpretation eine große Bedeutung zu. Ein Betrachter ist dann besonders gut im Herstellen der Verbindungen, wenn er in den wahrgenommenen Differenzen von Farben, und Formen und ihren Wechselwirkungen mögliche Differenzen in der Interpretation erkennt. Das bedeutet beispielsweise, dass er die Unterschiede der beiden Kreuzigungsszenen Abb. 22 und Abb. 23) erkennt und sie entsprechend unterschiedlich interpretiert: Das Bild auf Abb. 22 konzentriert sich auf die Leiden des Gekreuzigten und zielt darauf ab, mit der Dramatik der Darstellung den Betrachter aufzurütteln und ihm das unfassbare Ausmaß der Aufopferung des Gottessohnes für die Menschen prägnant vor Augen zu führen. Durch die drastische Verbildlichung seines Leidens erscheint Jesus umso menschlicher und seine Aufopferung umso erschütternder. Das Gemälde auf Abb. 23 hingegen zeigt einen quasi übermenschlichen Jesus, dem die Schmerzen der Kreuzigung anscheinend kaum etwas anhaben können. Durch diesen Ausdruck wird eher der Aspekt der Hoffnung betont, die durch die Menschwerdung Jesu nach christlichem Glauben den Menschen gegeben wird. Auch bei diesen Beispielen wird deutlich, dass das bildnerische Verbinden auf den beiden anderen Funktionen des Wahrnehmens und des Zusammensetzens aufbaut und ohne diese nicht möglich ist. Denn eine gründliche Bildinterpretation führt den soeben beschriebenen unterschiedlichen Ausdruck der beiden Bilder auf wahrnehmbare Farben und Formen und deren Zusammensetzungen zurück, wie im Folgenden demonstriert wird: Die Körperform und Körperhaltung des Gekreuzigten in Abb. 22 lässt deutliche Spuren des irdischen, körperlichen Leidens erkennen. So zeigen die verschiedenen Formen eine Verkrampfung der Finger, einen gesenkten Kopf, einen Oberkörper, der an den Armen zu hängen scheint, leicht nach innen gedrehte Knie und unnatürlich übereinander genagelte Füße. Die Farbgebung verdeutlicht, dass die Haut an einigen Stellen aufgeschürft und zum Teil blutig ist. Die Kontur des Körpers und der Gliedmaßen weist Unregelmäßigkeiten auf. Ähnlich wirkt auch die Oberfläche des Körpers durch die Verteilung unterschiedlicher Helligkeitswerte uneben. Das um die Lenden gewickelte Tuch ist zerrissen und löchrig und unterstreicht den Eindruck der Verletzung des Körpers. Unterstützt wird diese Wirkung durch die warmen erdigen Farbtöne des Körpers, welche den Farben des umgebenden Erdbodens gleichen. Der gekreuzigte Körper wird so durch die Farbgebung dem Erdboden angeglichen. Er erscheint fast aus demselben Material. Auch kompositorisch ist der Gekreuzigte relativ eng mit dem Erdboden verbun-
4 Das Bildnerische | 209
den. Man sieht deutlich die Stelle, an der das Kreuz im Boden verankert ist; der Gekreuzigte überragt die beiden neben ihm auf dem Erdboden stehenden Personen nur um eine halbe Körperlänge. Ihre Köpfe reichen ihm bis zur Hüfte. Ganz gegensätzlich sind die Farben und Formen in Abb. 23 zusammengesetzt. Die Körperform und -haltung des Gekreuzigten wie auch seine Oberfläche weisen keinerlei Spuren des Leidens auf. Die Form der gekreuzigten Hände erweckt den Anschein von Entspannung, der Kopf ist erhoben, der Körper scheint nicht an den Armen zu hängen, da sie entspannt ausgestreckt sind. Der Rumpf mit den Beinen weist einen fast grazilen Schwung auf, die Kontur des Körpers und der Gliedmaßen ist ebenmäßig, die Verteilung der Helligkeitswerte auf dem Körper lässt diesen sehr jugendlich, glatt und gespannt erscheinen. Sogar das Tuch um die Hüften wirkt dekorativ drapiert. Die Grenze zwischen Licht und Schaffen auf dem Körper bildet eine ebenmäßige, durchgehende, geschwungene Linie. Durch die Form dieser Linie wird der Eindruck der Ebenmäßigkeit des Körpers weiter unterstrichen. Der gekreuzigte Jesus wirkt wie eine völlig vergeistigte, fast körperlose Erscheinung und nicht wie ein schmerzerfüllter, irdischer Körper. Diese Wirkung wird durch die Farbgebung unterstützt. Der Körper ist, ähnlich wie der hinter dem Kreuz zu sehende Himmel, in kühlen Grau- und Blautönen gehalten. Dadurch scheint der Körper auch materiell eher eine Verbindung zum materielosen Himmel zu haben. Kompositorisch wird diese Wirkung dadurch gestützt, dass das Kreuz vor einem bewegten Himmel zu schweben scheint, da man keinen Erdboden sehen kann. Die beiden nebenstehenden Personen reichen – anders als in Abb. 22 – gerade bis zu den Füßen des Gekreuzigten, wodurch dieser noch stärker in den Himmel gezogen erscheint. Durch diese Ausführungen wurde deutlich, wie ein differenzierendes Verbinden auf den Differenzierungen in den beiden ersten Tätigkeiten des Wahrnehmens und Zusammensetzens aufbaut.24 Nur ein Betrachter, der sich auf die eben genannten Unterschiede in den Farb- und Formzusammensetzungen beider Bilder konzentriert und diese bei den Verbindungen, die er zur Welt herstellt, berücksichtigt, nimmt die Gemälde als Bilder wahr. Ein Betrachter, der sie lediglich als »Kreuzigungsdarstellungen« kategori-
24 Max Imdahl hat in seinem Buch zu Giottos Arenafresken eine ähnlich differenzierende Bildanalyse geliefert. Auch er betont, wie wichtig die Berücksichtigung der einmaligen Farb- und Formkonstellation eines Gemäldes für dessen Interpretation sind. Vgl. Imdahl, Max: »Ikonographie – Ikonologie – Ikonik«, in: ders.: Giotto Arenafresken, München, 1988.
210 | Bildnerisches Denken
siert, denkt nicht bildnerisch, sondern abstrahierend. Er wendet nur seine Fähigkeit zur Objekterkennung auf die Gemälde an. Er hat die beiden Gemälde als Bilder etwa so wenig verstanden wie jemand zwei Texte versteht, von denen er lediglich feststellt, dass beide in deutscher Sprache geschrieben sind. Die dritte für die Bildbetrachtung notwendige Tätigkeit des Betrachters besteht also im bildnerischen Verbinden. Es kann näher als ein Erkennen der Verbindungen von Farb- und Formzusammensetzungen zur Welt sowie deren Differenzen beschrieben werden. 4.1.4 Die drei Funktionen als Bedingungen der Bildbetrachtung Alle Bedingungen der Bildbetrachtung sind in Tabelle 16 zusammenfassend dargestellt. Die Bildbetrachtung wird bestimmt durch mehrere Bedingungen, die die Beschaffenheit A) des Betrachteten, B) des Betrachters und C) des Betrachtens betreffen. Das Betrachtete muss zwei Bedingungen erfüllen, um überhaupt als Bild in Betracht zu kommen. Es muss wahrnehmbar sein und es muss eine wahrnehmbare räumliche Eingrenzung besitzen, die das Innere des Bildes vom Äußeren trennt. Der Betrachter muss nur eine Bedingung erfüllen. Ihm muss Rezeptionsfähigkeit zukommen, was bedeutet, dass er in der Lage sein muss, sich als Betrachter in Beziehung zum Bild zu setzen. An den Vorgang des Betrachtens selbst werden drei Bedingungen gestellt, die jeweils auf den drei bisher beschriebenen Bedingungen aufbauen. Es handelt sich dabei um Tätigkeiten des Betrachters, von denen die erste das Wahrnehmen ist. Der Betrachter muss die Farben und Formen und ihre Differenzen erkennen. Die zweite Tätigkeit besteht im Zusammensetzen, d. h. im Erkennen der Wechselwirkungen von Farben und Formen sowie ihrer Differenzen innerhalb der Bildgrenze und in Bezug zur dieser. Das Verbinden ist die dritte geforderte Tätigkeit. Dadurch, dass der Betrachter nicht nur das Betrachtete als Bild, sondern auch sich selbst als Rezipienten betrachtet, ermöglicht er eine Interpretation des Bildes und kann die Verbindungen der Farb- und Formzusammensetzungen zur Welt und ihre Differenzen erkennen. Diese drei Tätigkeiten des Betrachters entsprechen den ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens, die in Kapitel 5.2 näher erläutert werden. Sie bauen aufeinander auf, d. h. die dritte Funktion ist nicht möglich ohne die ersten beiden.
4 Das Bildnerische | 211
BEDINGUNGEN DER BILDBETRACHTUNG A) DES BETRACHTETEN
C) DES BETRACHTENS
1. Wahrnehmbarkeit
1. Wahrnehmen = Erkennen der Farben & Formen in der Welt sowie deren Differenzen
flächig: visuell
plastisch: vielsinnlich
B) DES BETRACHTERS
Welt 2. Wahrnehmbare räumliche Eingrenzung flächig: visuell
plastisch: vielsinnlich
Bildfläche
Bildwerk
2. Zusammensetzen = Erkennen der Wechselwirkungen von Farben & Formen sowie deren Differenzen innerhalb der Bildgrenze und in Bezug zu ihr
Bild Welt 3. Verbinden = Erkennen der Verbindungen von Bild & Welt sowie deren Differenzen
Bild Welt = einzeln notwenige & zusammen hinreichende BEDINGUNGEN = aufeinander aufbauende Funktionen 1–3 des Bildnerischen Denkens
Tabelle 16: Bedingungen der Bildbetrachtung
3. Fähigkeit zur Bildrezeption Fähigkeit zur Betrachtung des Teils der Welt als Bild und seiner selbst als Rezipient
212 | Bildnerisches Denken
Da sie die Bedingungen des Betrachteten und des Betrachters voraussetzen, reicht es aus, die ersten drei Funktionen des Bildernischen Denkens als Bedingungen für die Bildbetrachtung anzugeben. Sie sind einzeln notwendig und zusammen hinreichend. Die erste Teilfrage »Was heißt es, etwas als Bild zu betrachten?« kann damit folgendermaßen beantwortet werden: »Es heißt, die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens auszuüben.« Damit ist die These 2a begründet: Bilderfahrung in der Bildbetrachtung ist
das Ausüben der Funktionen 1 –3 des Bildnerischen Denkens. Ob und wie man in einer konkreten Situation allerdings erkennen kann, dass ein Betrachter tatsächlich im oben erläuterten Sinne bildnerisch wahrnimmt, zusammensetzt und verbindet, ist damit noch nicht geklärt. Diese Frage wird in Kapitel 4.2 diskutiert. Sie ist auch für die Praxis des Kunstunterrichtes ganz entscheidend, da das Betrachten von Bildern einen zentralen Bestandteil der Lehrpläne für das Fach Kunst in allen Schularten darstellt. Der Kunstlehrer hat dabei nicht nur die Aufgabe, die Schüler bei genau diesen Tätigkeiten der Bildbetrachtung anzuleiten. Er muss den Erfolg seiner Bemühungen auch überprüfen und die Leistungen im Bildnerischen Denken qualitativ bewerten können. Auch bei der Beantwortung dieser pragmatischen Frage wird die Untersuchung dessen, was es heißt, ein Bild zu gestalten, hilfreich sein. 4.1.5 Die Bildrelation Im Folgenden wird erläutert, inwiefern man die Bildbetrachtung auch als Bildrelation bezeichnen kann. Die Bedingungen für die Bildbetrachtung entsprechen dabei den Kriterien für das Bestehen der Bildrelation. Sie kann als zweistellige Relation aufgefasst werden, die zwischen dem Bild und dem Betrachter mit seiner Welt besteht. Der Bezug zwischen den Relata wird dabei nicht durch eine sprachliche Formulierung hergestellt, wie beispielsweise in dem Ausdruck »Martin ist größer als Stefan«. Hier besteht die Verbindung zwischen Martin und Stefan in der Relation »größer als« und kommt auch erst durch ihre sprachliche Formulierung zustande. Die Bildrelation hingegen entsteht nicht dadurch, dass jemand – der Betrachter oder eine andere Person – das Verhältnis zwischen dem Bild und dem Betrachter als Bildrelation beschreibt, etwa durch den Satz: »Der Betrachter betrachtet X als Bild«. Vielmehr kommt sie durch bestimmte Tätigkeiten zustande, und zwar unabhängig davon, ob diese von jemandem sprachlich beschrieben werden. Diese sollen daher als Tätigkeits-Relationen bezeichnet werden. Es handelt sich dabei um zwei einstellige und eine zweistellige TätigkeitsRelation, aus denen die Bildrelation zusammengesetzt ist. In allen drei Rela-
4 Das Bildnerische | 213
tionen ist der Betrachter das Subjekt der Tätigkeit. Nur in der letzten Relation ist er zugleich Objekt, daher wird diese Relation als zweistellig beschrieben. Bei den drei Tätigkeiten handelt es sich um die im vorherigen Kapitel hergeleiteten ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens – das bildnerische Wahrnehmen, Zusammensetzen und Verbinden. Mit Hilfe der Tabelle 17 sollen die in der Bildrelation enthaltenen Tätigkeits-Relationen genauer erklärt werden. Die erste Tätigkeits-Relation kommt durch das Wahrnehmen zustande. Bei dieser Tätigkeit ist der Betrachter Subjekt und das Bild das Objekt. Die Tätigkeits-Relation selbst ist mit einem Pfeil dargestellt, der nur in eine Richtung verläuft – vom Subjekt zum Bild. Diese Pfeilrichtung entspricht dem Zeigegestus, der die Tätigkeit der Wahrnehmung begleiten kann. Das Subjekt zeigt auf das Bild oder einen Teil des Bildes, den es wahrnimmt. Die sprachliche Beschreibung der Relation des Wahrnehmens darf nicht verwechselt werden mit der Tätigkeits-Relation des Wahrnehmens selbst. Der Satz »Der Betrachter nimmt das Bild wahr.« kann so aufgefasst werden als gäbe es zwei Relata, den Betrachter und das Bild, und zwischen beiden bestünde die Relation des Wahrnehmens. So würde man bereits das Wahrnehmen als zweistellige Relation ansehen. Durch diese Interpretation, welche die sprachliche Beschreibung des Wahrnehmens durchaus nahegelegt, geht aber ein Aspekt verloren: In der Tätigkeit des Wahrnehmens ist die Aufmerksamkeit allein auf das Objekt gerichtet – wie der Fingerzeig im Zeigegestus und der Pfeil in der Tabelle. Im Wahrnehmen vergisst sich das Subjekt, d. h. es stellt keinen Selbstbezug her. Daher ist es hier sinnvoll, nicht von einer zweistelligen, sondern von einer einstelligen TätigkeitsRelation zu sprechen. Sie verdeutlicht die Richtung der Aufmerksamkeit der entsprechenden Tätigkeit. Wie die erste Tätigkeits-Relation ist auch die zweite einstellig: das Zusammensetzen. Auch hier ist der Betrachter nur Subjekt der Tätigkeit, seine Aufmerksamkeit bzw. der Fingerzeig, der die Tätigkeit begleiten kann, ist ebenfalls nur auf das Bild hin gerichtet. Auch hier muss zwischen der sprachlichen Beschreibung der Relation des Zusammensetzens und der Tätigkeits-Relation selbst unterschieden werden. Wie bei der Tätigkeit des Wahrnehmens wird durch die Formulierung »Der Betrachter setzt die Farben und Formen des Bildes zusammen.« eine zweistellige Relation beschrieben, obwohl die Aufmerksamkeit des Betrachters auch hier nur zum Bild gerichtet ist. Die Tätigkeits-Relation des Zusammensetzens muss außerdem unterschieden werden von den Formulierungen des Ergebnisses dieser Tätigkeit. Sie bestehen oft aus mehrstelligen Relationen, wie z. B.
214 | Bildnerisches Denken
»Der rote Kreis liegt zwischen dem gelben Dreieck und dem blauen Quadrat.« In der Tätigkeit des Zusammensetzens richtet der Betrachter seine Aufmerksamkeit zwar auf Relationen, aber diese bilden innerhalb der Bildrelation nur das Relatum der Tätigkeits-Relation des Zusammensetzens. Dass die meisten Bilder – genauer ihre Kompositionen – als mehrstellige Relationen beschreibbar sind, ist zwar für die Tätigkeit des Zusammensetzens relevant, nicht aber für die Bildrelation. Die Aufmerksamkeit (bildlich gesprochen: der Fingerzeig) ist nur auf das Bild gerichtet, auch wenn sich der Fokus der Aufmerksamkeit (bildlich gesprochen: die Fingerkuppe) vergrößert hat, weil er auf Zusammensetzungen von Farben und Formen gerichtet ist.
BESTANDTEILE DER BILDRELATION BETRACHTETES
BETRACHTEN
BETRACHTER
Relatum: Bild
BILDRELATION bestehend aus 3 Tätigkeits-Relationen
RELATUM / Objekt der Tätigkeit
RELATION / TÄTIGKEIT
Relatum: Betrachter mit seiner Welt
RELATUM / Objekt der Tätigkeit
1. Relation des Wahrnehmens [Betrachter ist nur Subjekt der Tätigkeit] 2. Relation des Zusammensetzens [Betrachter ist nur Subjekt der Tätigkeit] 3. Relation des Verbindens
Tabelle 17: Die Bildrelation
4 Das Bildnerische | 215
Erst bei der dritten Relation findet eine grundlegende Veränderung der Aufmerksamkeit statt. In der Tätigkeit des Verbindens richtet das Subjekt seinen Blick nicht mehr nur auf das Bild, sondern auch zugleich auf sich selbst bzw. auf alles, was zu seiner Welt gehört. Im Verbinden muss die Aufmerksamkeit (oder der Fingerzeig) ständig hin und her wandern zwischen dem Bild und dem Subjekt mit seiner Welt. Das Subjekt bzw. seine Welt wird selbst zum Objekt der Tätigkeit. Erst durch diesen Wechsel der Aufmerksamkeit wird das Subjekt eigenständiges Relatum, die Relation zweistellig und das Bild zum Bild. Die dritte Tätigkeitsrelation gibt dem Bild einen Sinn bzw. einen Bildgegenstand. Das bedeutet nicht, dass der Bildgegenstand oder der Teil der Welt, zu dem die Verbindung hergestellt wird, vor dem Verbinden in irgendeiner Weise existieren muss. Durch das Herstellen der Verbindung vom Bild zur Welt wird ein Teil der Welt vom Rest der Welt abgegrenzt. So wird die Welt durch das Bild gegliedert und muss nicht zuvor schon gegliedert sein, wie bereits in Kapitel 3.2.1.3 erläutert wurde. 4.1.6 Der enge Bildbegriff: materielle Bilder Die Antwort auf die erste Teilfrage ermöglicht zugleich eine erste Explikation des Begriffs »Bild«, wie er hier im engen Sinn verwendet wird. Um ein Ding in der Welt als Bild zu identifizieren, reicht es nicht, bestimmte Merkmale des Dings zu beschreiben. Wie das Phänomen der Sprache kann man auch das Phänomen des Bildes nicht erklären, ohne seine Einbettung in menschliches Verhalten zu berücksichtigen. Es lässt sich nicht sinnvoll davon sprechen, dass eine Sprache »existiert«, ohne auch davon auszugehen, dass es Wesen gibt, die diese Sprache sprechen. Ebenso kann man nicht sinnvoll über Bilder sprechen, ohne diejenigen zu berücksichtigen, die mit diesen Bildern umgehen. Die Art dieses Umgangs wird durch die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens beschrieben. Sie erklären das Bildspezifische in der betrachtenden Bilderfahrung. Dennoch ist ein Bild nicht nur ein Phänomen des menschlichen Umgangs. Wir wenden den Begriff Bild in der Regel auf materielle Gegenstände an: Ein Gemälde besteht beispielsweise aus Farbpigmenten, dem Bindemittel zur Fixierung der Pigmente und dem Bildträger, auf dem die Pigmente aufgebracht werden. Auch Lichtprojektionen oder digitale Bilder haben materielle Bestandteile. Bei der Projektion ist es die Projektionsfläche, bei einem digitalen Bild ist es der Bildschirm, durch den das Bild betrachtet werden kann. Selbst ein Regenbogen besitzt eine materielle Grundlage, nämlich die Wassertropfen in der Luft, die das Licht brechen. Das Bild ist aber dennoch nicht identisch mit dem Material, aus dem es besteht. Um diese Unterscheidung sprachlich zu verdeutlichen, wird
216 | Bildnerisches Denken
der Begriff »Bildkörper« eingeführt. Er bezeichnet die materielle Grundlage eines Bildes, während »Bild« das bezeichnet, was der Betrachter im bildnerischen Wahrnehmen, Zusammensetzen und Verbinden betrachtet. Die Bezeichnung »Bildträger«, die einige Autoren für den Bildkörper verwenden,25 führt leicht zu Missverständnissen: In nicht-bildwissenschaftlichen Zusammenhängen versteht man unter »Bildträger« alles, auf das man Farbpigmente auftragen kann, aber nicht die Pigmente selbst, die aber zur materiellen Grundlage eines Bildes gehören, also zum Bildkörper. Die beiden Begriffe »Bild« und »Bildkörper« kennzeichnen zwei Aspekte desselben Gegenstandes: »Bild« bezeichnet den Gegenstand, insofern er von einem Betrachter bildnerisch rezipiert wird. Bildnerisch rezipiert wird etwas, wenn die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens ausgeübt werden. »Bildkörper« bezeichnet denselben Gegenstand, insofern er materielle Eigenschaften besitzt. Das »Bild« entspricht damit dem »Image-Aspekt«, der »Bildkörper« hingegen dem »Picture-Aspekt«. »Bild« umfasst in diesem Sinne alle materiellen Gegenstände, auf welche die ersten drei Funktionen angewendet werden. Dieses Verständnis ist verhältnismäßig offen, weil es abstrakte und natürliche Bilder miteinschließt, die in manchen Bildtheorien ausgeschlossen werden. Als eng wird dieses Bildverständnis hier dennoch bezeichnet, weil etwas in diesem Sinne nur dann ein Bild ist, wenn es gleichzeitig ein materieller Gegenstand ist. Daher können diese Bilder auch als »materielle Bilder« bezeichnet werden. Ein weiter Bildbegriff, der auch die sogenannten »mentalen Bilder« mit einschließt, wird im folgenden Kapitel hergeleitet. Entsprechend der hergeleiteten ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens kann der Begriff »Bild« im engen Sinne folgendermaßen bestimmt werden:
»Ein Bild ist etwas, das von einem Betrachter bildnerisch rezipiert wird, das heißt, dass der Betrachter am Betrachteten 1. Farben & Formen sowie deren Differenzen erkennt, 2. Wechselwirkungen von Farben & Formen sowie deren Differenzen innerhalb der räumlichen Eingrenzung und in Bezug zu ihr erkennt, 3. Verbindungen dieser räumlich eingegrenzten Farb- & Formkombinationen zur Welt sowie deren Differenzen erkennt.«
25 Vgl. z. B. Jonas, Hans: »Homo Pictor und die Differentia des Menschen« in: Zeitschrift für philo-
sophische Forschung, 1961, S. 167, und Sachs-Hombach, Klaus; Schirra, Jörg R. J.: »Medientheorie, visuelle Kultur und Bildanthropologie«, in: Sachs-Hombach, Klaus: (Hg.): Bildtheorien, Frankfurt a. M., 2009, S. 412 ff.
4 Das Bildnerische | 217
4.2
B ILDER GESTALTEN Die Beantwortung der zweiten Teilfrage »Was heißt es, etwas als Bild zu gestalten?« begründet die Bilderfahrung im Gestaltungsprozess. Sie ist abhängig von der Antwort auf die erste Teilfrage, denn in jedem Prozess der Bildgestaltung ist die Bildbetrachtung enthalten. Jeder, der etwas als Bild gestaltet, betrachtet das, was er gestaltet, auch gleichzeitig als Bild. Dennoch lohnt es sich aus mehreren Gründen, den Prozess der Bildgestaltung gesondert in den Blick zu nehmen. Erstens stellt die Bildgestaltung ein Instrumentarium dar, mit dessen Hilfe die Denkvorgänge der ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens anschaulich gemacht werden können. Wenn ein Bildbetrachter beispielsweise aufgefordert wird, einen bestimmten wahrgenommenen Farbwert selbst anzumischen, die Komposition eines Bildes in einer Skizze festzuhalten oder den traurigen Gesichtsausdruck eines Portraits in einen zornigen zu verwandeln, kann man den Ergebnissen dieser praktischen Arbeit ansehen, wie stark die Differenzierungsfähigkeit in den einzelnen Funktionen bei diesem Bildbetrachter ausgeprägt ist. Denn man kann beim Gestalten nur solche Differenzen herstellen, die man in der Betrachtung erkennen kann. Natürlich mag die Fähigkeit zu differenzieren ausgeprägter sein, als in der Gestaltung sichtbar wird, z. B. weil der Bildgestalter zu bequem ist oder weil er mit dem Pinsel nicht richtig umgehen kann. Die Differenzierungsfähigkeit kann aber beim Betrachten nicht kleiner sein als beim Gestalten. Das, was jemand differenziert gestaltet, kann er auch differenziert betrachten. Damit ist eine Möglichkeit gegeben, zumindest näherungsweise festzustellen, ob und wie gut jemand tatsächlich bildnerisch wahrnimmt, zusammensetzt und verbindet. Zweitens ist Bildgestalten mehr als Bildbetrachten. Dies kann systematisch durch die vierte Funktion des Bildnerischen Denkens erklärt werden. Diese Funktion ist zwar keine notwendige, aber eine hinreichende Bedingung für manche Arten von Bilderfahrung. Sie erklärt die Bildlichkeit dieser Art von Erfahrung. Erst die Berücksichtigung der Bildgestaltung vervollständigt die Untersuchung von Bilderfahrung und komplettiert das Modell des Bildnerischen Denkens. Dieses erfasst nicht nur alle Arten von Bilderfahrung, sondern gibt auch eine systematische Erklärung für ihren Zusammenhang. Drittens kann erst mit diesem vollständigen Modell des Bildnerischen Denkens ein weites Verständnis von »Bild« hergeleitet werden, dem viele alltäglichen Verwendungen des Begriffs entsprechen und die der enge Bildbegriff nicht erklären kann.
218 | Bildnerisches Denken
Im Folgenden wird daher zunächst erläutert, inwiefern die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens auch notwendig für die Bilderfahrung in der Bildgestaltung sind (4.2.1). Anschließend wird die vierte Funktion des Bildnerischen Denkens als hinreichende Bedingung für die Bildgestaltung hergeleitet (4.2.2). Eine Zusammenfassung dieser notwendigen und hinreichenden Bedingungen verdeutlicht, worin der Zusammenhang zwischen den Prozessen der Bildrezeption und -produktion besteht (4.2.3). Schließlich wird aus der vierten Funktion das weite Verständnis von »Bild« hergeleitet (4.2.4). 4.2.1 Notwendige Bedingungen Jeder Bildgestaltungsprozess enthält den Prozess der Bildbetrachtung und damit die Bildrelation. Das bedeutet aber nicht, dass jedes produzierte Objekt, welches später als Bild rezipiert wird, bereits im Produktionsprozess als Bild gelten kann. Entscheidend ist, ob bei der Produktion die notwendigen Bedingungen der Bildbetrachtung gegeben sind. Man kann nur dann davon sprechen, dass eine Person ein Bild gestaltet, wenn sie während der Herstellung und in Bezug auf das Hergestellte die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens ausübt. Das Herstellen selbst ist dabei keine eigenständige Funktion des Bildnerischen Denkens, sondern ist als Potential in den jeweiligen Funktionen bereits enthalten. Jede Funktion kann sich rezeptiv oder produktiv zeigen. 4.2.1.1 Wahrnehmen Der Begriff des »Wahrnehmens« wird zwar in vielen Fällen zur Bezeichnung rezeptiver Vorgänge verwendet, dennoch kann er in bestimmten Zusammenhängen auch eine produktive Bedeutung haben. Grimms Wörterbuch führt hierzu unter anderem folgende Bedeutungsaspekte an: »für etwas sorge tragen, sich einer sache annehmen«26, »verwalten, ausüben, ausführen«27 »sich bedienen, gebrauch machen von etwas«28 und etwas »ausnutzen, nicht unbenutzt verstreichen lassen«29. Redewendungen, die diesen aktiven Aspekt des Wortes »wahrnehmen« aufgreifen, sind beispielsweise: ein Angebot, eine Gelegenheit oder einen Termin wahrnehmen. Ebenso
26 Grimm, Jacob und Wilhelm: »Wahrnehmen«, in: dies.: Deutsches Wörterbuch, Leipzig, 1854– 1961 und 1971, Online- Ausgabe, Zugriff am 01.08.2014, Sp. 949. 27 Ebenda, Sp. 952. 28 Ebenda, Sp. 953. 29 Ebenda, Sp. 954.
4 Das Bildnerische | 219
betont Dewey den produktiven Charakter des Wahrnehmens (»to perceive«): »But receptivity is not passivity.«30 »For to perceive a beholder must create his own experience. And his creation must include relations comparable to those which the original producer underwent.«31 Auch in der Psychologie wird das Wahrnehmen als aktiver Vorgang beschrieben.32 Bildnerisches Wahrnehmen in diesem produktiven Sinn meint also nicht nur Erkennen von Farben und Formen. Es kann auch beinhalten, dass man von den Farben und Formen Gebrauch macht und sich ihrer bedient. Im Rahmen eines Bildproduktionsprozesses bedeutet dies, Farben und Formen zu erkennen und entsprechend herzustellen. Um einen Gegenstand zu produzieren, der als Bild betrachtet werden kann, muss z. B. ein Maler Farben und Formen verwenden. Um diesen Gegenstand als Bild zu gestalten, darf er sie nicht blindlings oder willkürlich auf die Leinwand auftragen. Er muss sie während der Produktion erkennen und entsprechend herstellen, indem er z. B. farbige Pasten auf einer Palette so miteinander mischt, dass die Mischung genau den Farbton ergibt, den er in einer bestimmten Form auf die Bildfläche auftragen möchte. Ein digitaler Bildgestalter tut dasselbe mit den verschiedenen Werkzeugen zur Farb- und Formmanipulation entsprechender Programme. Und auch ein Fotograf kann durch gezielte Wahl des Standpunktes oder durch Manipulationen des Motivs und des Lichteinfalls die Farben und Formen nach seinen Vorstellungen beeinflussen. Ebenso wie im Prozess der Bildrezeption zeigt sich auch bei der Bildproduktion die Leistungsfähigkeit einer Person im bildnerischen Wahrnehmen in ihrer Differenzierungsfähigkeit. Ein Maler beherrscht das produktive, bildnerische Wahrnehmen der Farben und Formen dann besonders gut, wenn er z. B. in der Lage ist, sehr viele Farbnuancen zwischen den Farbtönen Rot und Gelb zu erkennen und entsprechend herzustellen (vgl. Abb. 24). Für einen sehr ungeübten Maler hingegen wäre womöglich mit Abb. 25 schon eine ausreichende Abstufung zwischen Rot und Gelb erreicht. Die Funktion des Wahrnehmens zeigt sich in der Bildproduktion im Erkennen und Herstellen der Farben und Formen sowie ihrer Differenzen. Das Wahrnehmen in diesem Sinne ist notwendige Bedingung für das Gestalten eines Bildes.
30 Dewey, John: Art as experience, New York, 1980. S. 52. 31 Ebenda, S. 54, Hervorh. i. O. 32 Vgl. Flade, Antje: »Wahrnehmung«, in: Asanger, Roland; Wenninger, Gerd (Hg.): Handwörter-
buch Psychologie, Weinheim, 1999, S. 833–834.
220 | Bildnerisches Denken
4.2.1.2 Zusammensetzen Im Begriff »Zusammensetzen« ist eine sehr deutliche produktive Komponente enthalten. Mit der lateinischen Version dieses Begriffs (abgeleitet von »componere«) verbinden wir nicht nur eine produktive, sondern auch eine gestalterische Tätigkeit. So sprechen wir davon, dass jemand ein Musikstück oder ein Gemälde »komponiert«. Bildnerisches Komponieren ist das Zusammensetzen von Farben und Formen zu einem Bildganzen. Hierzu gehört bereits die Wahl des Bildformates, die dem Setzen der Grenze zwischen dem Inneren und dem Äußeren des Bildes entspricht. Jede Farb- und Formanordnung innerhalb des Bildes steht so automatisch in einer bestimmten Beziehung zur Bildgrenze und zum Bildganzen. Angewendet auf die drei beispielhaften Bildgestalter heißt das Folgendes: Um einen Gegenstand zu produzieren, der als Bild betrachtet werden kann, muss ein Maler auf einer eingegrenzten Fläche Farben und Formen anordnen. Damit man davon sprechen kann, dass er dieses Objekt als Bild gestaltet, muss er die Wechselwirkungen der Farben und Formen untereinander und in Bezug zur Bildgrenze während der Produktion erkennen und entsprechend herstellen. Dazu fertigen viele Maler Kompositionsskizzen an, in denen sie die Anordnung der Farben und Formen genauestens planen. Ein digitaler Bildgestalter komponiert sein Bild, indem er beispielsweise das Format eines Bildes beschneidet oder bestimmte Bildteile proportional vergrößert oder verkleinert. Ebenso legt auch der Fotograf mit Hilfe des Suchers den Bildausschnitt, d. h. die Bildgrenze, fest und kann durch Veränderung seines Standpunktes oder des Motivs die Komposition des Fotos manipulieren. Die Fähigkeit zu differenzieren zeigt sich bei einem Bildgestalter nicht nur darin, dass er beispielsweise erkennt, dass die Anordnung der Farben und Formen auf Abb. 26 deutlich mehr an Bäume erinnert, als auf Abb. 27. Als versierter Gestalter ist er darüber hinaus in der Lage, aus Abb. 27 durch Veränderung der Dicke des Stammes, der Dicke der Äste sowie ihrer Winkel und Richtungen eine realistischere Darstellung eines Baumes herzustellen, wie auf Abb. 28 zu sehen. Die Funktion des Zusammensetzens zeigt sich also bei der Bildproduktion im Erkennen und Herstellen der Wechselwirkungen von Farben und Formen sowie ihrer Differenzen innerhalb der Bildgrenze und in Bezug zu ihr. Das Zusammensetzen in diesem Sinne ist notwendige Bedingung für das Gestalten eines Bildes.
4 Das Bildnerische | 221
Abb. 24: Caspar David Friedrich: »Frau vor untergehender Sonne«, Ausschnitt 1, um 1818, Öl auf Leinwand, 22 × 30 cm
Abb. 25: Himmel
Abb. 26: Caspar David Friedrich: »Frau vor untergehender Sonne«, Ausschnitt 2, um 1818, Öl auf Leinwand, 22 × 30 cm
Abb. 27: Baum 1
Abb. 28: Baum 2
Abb. 29: Baum 3
222 | Bildnerisches Denken
4.2.1.3 Verbinden Ebenso wie der Begriff des »Zusammensetzens« enthält auch das »Verbinden« einen starken produktiven bzw. aktiven Aspekt. Bereits in der Rezeption muss die Verbindung der Farb- und Formzusammensetzungen vom Bild zur Welt durch den Betrachter aktiv hergestellt werden. Dazu ist es nötig zu erkennen, welche Assoziationen, Bedeutungszuschreibungen, Ähnlichkeitseindrücke etc. die Farb- und Formzusammensetzungen bei einem Betrachter auslösen können, beziehungsweise entsprechende Zusammenstellungen herzustellen. Wenn ein Maler beispielsweise mit einer sehr wässrigen Farbe den Hintergrund eines Portraits bemalt hat und anschließend feststellt, dass einer der Farbflecken wie ein Gesicht aussieht, muss er die Funktion des bildnerischen Verbindens ausüben, um mit diesem Zufallsprodukt professionell umgehen zu können. Er muss nun entscheiden, ob er diesen Fleck so stehen lässt, wie er ist und bewusst den Betrachter im Unklaren lässt, ob der Fleck so geplant war oder nicht. Der Maler kann sich aber auch entscheiden, den Fleck zu übermalen, damit er nicht vom eigentlichen Portrait ablenkt. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Gesichtszüge durch leichte Kontrastanhebung noch etwas zu verstärken, damit der Betrachter die gesichtsartige Form im Hintergrund deutlich wahrnimmt und nicht übersehen kann. Der Betrachter kommt dann nicht umhin, die Beziehung zwischen dem Portraitierten und der zweiten Person im Hintergrund irgendwie zu deuten. Anhaltspunkt für diese Deutung wäre dann das kompositorische Verhältnis, in dem die beiden Personen auf der Bildfläche zueinander stehen. Eine derartige Deutung dieser Beziehung würde wesentlich zur Charakterisierung der portraitierten Person beitragen. Diese wie auch die anderen beiden Umgangsweisen des Malers mit dem zufällig entstandenen Fleck verändern die Verbindung zur Welt, die der Betrachter und – vor ihm – der Maler herstellt. Das technische Medium der Bildproduktion ist dabei nicht entscheidend. Das Erkennen und Herstellen von Verbindungen bei der Bildgestaltung mit Hilfe des Computers oder des Fotoapparates erfordert dieselbe Denkoperation. Die Frage, ob es für das Herstellen dieser Verbindungen Regeln gibt, und wenn ja welche, deckt sich mit der Frage nach solchen Regeln im Prozess der Bildbetrachtung und wurde bereits in Kapitel 4.1.3.3 erörtert. Ein Gestalter besitzt dann besonders große Fähigkeiten im Herstellen von bildnerischen Verbindungen, wenn er auch feine Veränderungen von Farb- und Formzusammensetzungen als bedeutungsrelevant erkennt. Ein ungeübter Gestalter mag die beiden Darstellungen auf Abb. 28 und Abb. 29 gleichermaßen mit einem Baum verbinden. Hingegen kann der erfahrene Bildgestalter die Farben und Formen so anordnen, dass man mit ihnen
4 Das Bildnerische | 223
mehr als nur einen Baum verbindet. So wird in der Form der Äste auf Abb. 28 die Richtung des Windes sichtbar. Die Zusammensetzung der Äste und des Stammes auf Abb. 29 mögen hingegen beim Betrachter die Assoziation eines Kreuzes auslösen, so dass sich das Bild zu einer Darstellung des Todes wandelt. Die Funktion des Verbindens zeigt sich also bei der Bildproduktion im Erkennen und Herstellen von Verbindungen der Farb- und Formzusammensetzungen zur Welt sowie ihrer Differenzen. Das Verbinden in diesem Sinne ist notwendige Bedingung für das Gestalten eines Bildes. 4.2.1.4 Funktionen 1–3 als notwendige Bedingungen Wie gezeigt wurde, enthalten alle drei Funktionen neben einem rezipierenden Aspekt auch den Aspekt der Produktion. Daher kann die zweite Teilfrage »Was heißt es, etwas als Bild zu gestalten?« mit derselben Formulierung wie die erste Teilfrage beantwortet werden: »Es heißt, die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens auszuüben.« Der Unterschied zwischen Bildbetrachtung und Bildgestaltung besteht darin, ob und worin sich die Funktion zeigt: Sie kann sich entweder gar nicht oder in einer sprachlichen Äußerung oder einem gestalterischen Handeln zeigen. Die Funktionen als solche bleiben dabei stets dieselben. NOTWENDIGE BEDINGUNGEN DER BILDGESTALTUNG 1. WAHRNEHMEN Erkennen & Herstellen
2. ZUSAMMENSETZEN Erkennen & Herstellen
3. VERBINDEN Erkennen & Herstellen
der Farben & Formen in der Welt sowie deren Differenzen
der Wechselwirkungen von Farben & Formen sowie deren Differenzen innerhalb der Bildgrenze und in Bezug zu ihr
der Verbindungen von Bild & Welt sowie deren Differenzen
Bild Welt
Welt
= Funktionen 1–3 des Bildnerischen Denkens
Tabelle 18: Notwendige Bedingungen der Bildgestaltung
Bild Welt
224 | Bildnerisches Denken
In Tabelle 18 sind die drei Funktionen zusammengefasst und grafisch veranschaulicht. Entsprechend der obigen Erläuterungen wurde die Erklärung der einzelnen Funktionen durch den Zusatz »herstellen« ergänzt. Wie im Prozess der Bildbetrachtung bauen auch bei der Gestaltung eines Bildes alle drei Funktionen aufeinander auf. Das Verbinden ist nicht möglich ohne das Zusammensetzen und Wahrnehmen. Damit man von einem Bildgestaltungsprozess sprechen kann, müssen alle drei Funktionen gegeben sein. Diese hierarchische Ordnung darf aber nicht so verstanden werden, dass es sich dabei um eine empirisch beobachtbare Abfolge von Vorgängen handelt. Bei einem konkreten Betrachtungs- oder Gestaltungsprozess greifen alle drei Funktionen wechselseitig ineinander. So ist möglicherweise das erste, was einem Betrachter bei einem Bild auffällt, dessen unheimliche Wirkung, und er verbindet das Bild assoziativ mit einem Gruselfilm. Erst im Nachhinein mag er eine solche Verbindung auf die einmalige Farb- und Formanordnung zurückführen. Ebenso kann bereits der erste Strich auf einem Papier, den ein Zeichner vornimmt, einen Bedeutungsgehalt haben, der eventuell durch den Rahmen der Zeichnung, den der Künstler anschließend definiert, noch gesteigert wird. Die Systematik der drei Funktionen beinhaltet ebenso wenig eine Aussage darüber, wie geradlinig ein Betrachtungs- oder Gestaltungsprozess sein kann oder soll. Was ein Bildgestalter mit dem Bild, das er gerade herstellt, verbindet, mag sich im Prozess der Gestaltung beliebig oft verändern. Nichts besagt, dass das bildnerische Verbinden nur dann vorliegt, wenn der Gestalter bereits zu Beginn des Gestaltungsprozesses genau festgelegt hat, welche Verbindungen des Bildes zur Welt er erzeugen möchte. Ebenso verhält es sich mit den anderen Funktionen. Auch die kompositorischen Entscheidungen oder die Farb- und Formwahl können in jedem Moment der Gestaltung revidiert werden, ohne dass der Prozess aufhört, Bildgestaltung zu sein. Wie am Beispiel gezeigt wurde, kann auch das bewusste Spiel mit Zufallsergebnissen Teil eines Gestaltungsprozesses sein, solange der Umgang mit diesem Zufallsergebnis durch die drei Funktionen bestimmt wird. Wie bereits erläutert, liefern die Ergebnisse einer Bildproduktion keinen eindeutigen Hinweis dafür, welche Leistungsfähigkeit ihr Produzent in den entsprechenden Funktionen des Bildnerischen Denkens tatsächlich besitzt. Nur weil in einem Bild z. B. sehr wenige Farbtöne vorkommen, heißt das nicht unbedingt, dass der Produzent nur wenig zwischen verschiedenen Farbtönen differenzieren kann. Auf einigen Bildern von Piet Mondrian beispielsweise sind sehr wenige Farbtöne zu sehen, dennoch kann man, auch mit Blick auf sein malerisches Frühwerk, davon ausgehen, dass er über ein
4 Das Bildnerische | 225
sehr großes Differenzierungsvermögen in Bezug auf Farben verfügte. Er hat sich in seinem Spätwerk bewusst auf die Verwendung weniger Farben und Formen beschränkt. Hier zeigt sich, dass man bei der isolierten Betrachtung eines Bildes das angestrebte Ziel des Bildgestalters nicht mit Sicherheit rekonstruieren kann. Die Differenzierungsfähigkeit einer bestimmten Person in Bezug auf die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens kann daher höchstens an einem Gestaltungsergebnis abgelesen werden, wenn die Zielsetzung der Gestaltung genau bekannt ist. Im Kunstunterricht kann dies dadurch erreicht werden, dass den Schülern eine Aufgabe gestellt wird, die von ihnen eine entsprechende Differenzierung verlangt. Solche Aufgaben können sich auch nur auf einzelne Funktionen beziehen. So kann man beispielsweise die Betrachtung eines Gemäldes durch die praktische Aufgabe ergänzen, alle vom Maler verwendeten Farben nachzumischen. Da die Schüler nur die Farben bzw. Farbdifferenzen nachmischen können, die sie auch wahrnehmen, kann hier die Differenzierungsfähigkeit in der ersten Funktion des Bildnerischen Denkens sichtbar und überprüfbar gemacht werden. 4.2.2 Funktion 4 als hinreichende Bedingung Neben dem Verweis auf die einzeln notwendigen und zusammen hinreichenden Bedingungen für das Gestalten von Bildern gibt es noch eine weitere Möglichkeit, zu erklären, was es heißt, ein Bild zu gestalten. Es kann eine weitere Bedingung für das Gestalten von Bildern angeführt werden, die zwar nicht notwendig, aber hinreichend ist. Diese Bedingung, die als bildnerisches »Erfinden« bezeichnet wird, entspricht zugleich der vierten Funktion des Bildnerischen Denkens. Wenn sie beim Herstellen von Etwas mit gegeben ist, dann entspricht dieser Herstellungsprozess dem Gestalten eines Bildes. Ist dies der Fall, kann auf die anderen notwendigen Bedingungen (die ersten drei Funktionen) als Kriterium verzichtet werden, da diese in der Funktion des Erfindens bereits enthalten sind. Das Erfinden ist eine Tätigkeit, bei der die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens vom konkreten, sinnlichen Reiz losgelöst sind und in die Vorstellung verlagert werden. Wie bei den ersten drei Funktionen, kann auch hier die Leistungsfähigkeit größer oder kleiner sein. Es gibt große individuelle Unterschiede dahingehend, wie gut sich jemand Farben oder Formen vorstellen und entsprechend der Vorstellung herstellen kann. Wenn beim Herstellen von Etwas das Erfinden von Farben und Formen, von ihren Wechselwirkungen und von Verbindungen zur Welt beteiligt ist, dann kann man ebenso davon sprechen, dass hier »etwas als Bild gestaltet wird«. Im Folgenden wird zunächst erläutert, wie die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens
226 | Bildnerisches Denken
vom konkreten, sinnlichen Reiz losgelöst und in die Vorstellung verlagert werden können (4.2.2.1). Im Anschluss daran wird erklärt, welche Rolle dieser Tätigkeit im Rahmen einer Bildgestaltung zukommen kann (4.2.2.2). 4.2.2.1 Erfinden als Vorstellen Die vierte Funktion des Bildnerischen Denkens, das Erfinden, besteht im Vorstellen der ersten drei Funktionen. Jemand übt das bildnerische Erfinden aus, wenn er sich vorstellt, dass er Farben und Formen wahrnimmt, zusammensetzt und mit der Welt verbindet. Die Vorstellung dieser Denktätigkeiten umfasst auch die des Denkgegenstandes selbst – also der Farben und Formen, der Farb- und Formzusammensetzungen sowie der Verbindungen zur Welt. Diese Vorstellungsfähigkeit ist bereits in jeder einzelnen Funktion angelegt. Die ersten drei Funktionen wurden als konkretisierender Denkvollzug charakterisiert. Der Gegenstand des Denkens, d. h. der Bildgegenstand, wird dadurch charakterisiert, dass auf die Unterschiede verwiesen wird, die dieser Gegenstand im Vergleich zu anderen Gegenständen aufweist. Man achtet dabei auf die Unterschiede in Farbe und Form, in der Zusammensetzung von Farbe und Form sowie in den Verbindungen der Farb- und Formzusammensetzungen zur Welt. Jede einzelne Funktion erfordert also einen Vergleich mit der bildnerischen Charakterisierung anderer Gegenstände. Das Konkretisieren setzt das Vergleichen voraus, wie bereits in Kapitel 3.1.2 gezeigt wurde. Beispielsweise kann die Besonderheit eines Blautons nur erkannt werden im Vergleich zu möglichen anderen Blautönen. Diese sind allerdings nicht immer sinnlich gegeben, sondern müssen oft vorgestellt werden. Soll also beim Betrachten oder Gestalten eines Portraits die Augenfarbe bildnerisch wahrgenommen werden, so muss sie mit anderen Augenfarben verglichen werden. In vielen Fällen sind hierbei nicht genügend oder gar keine anderen Augen als Vergleichsobjekte verfügbar und müssen vorgestellt bzw. in Erinnerung gerufen werden. Ebenso verhält es sich mit den anderen beiden Funktionen. Daher ist das Erfinden als Vorstellen der ersten drei Funktionen bereits in jeder Funktion angelegt. Zur eigenständigen Denktätigkeit – d. h. zur vierten Funktion – wird das Erfinden allerdings erst dann, wenn alle drei Funktionen völlig unabhängig von einem konkreten, sinnlichen Reiz vorgestellt werden. Dann kann man davon sprechen, dass jemand »ein Bild erfindet«. Auch in alltäglichen Zusammenhängen bedient man sich der Funktion des bildnerischen Erfindens, wenn man beispielsweise versucht, sich das Bild von etwas ins Gedächtnis zu rufen, das man in der Vergangenheit gesehen hat. Erfinden kann also auch heißen, dass die vorgestellten Farben, Formen und deren Kombinatio-
4 Das Bildnerische | 227
nen in der Vergangenheit tatsächlich einmal wahrgenommen, zusammengesetzt und verbunden worden sind. Im Erfinden ruft man sich dieses Erleben ins Gedächtnis, indem man es sich vorstellt. Man stellt sich dann vor, die Farben, Formen und deren Kombinationen erneut wahrzunehmen, zusammenzusetzen und zu verbinden. Man übt die ersten drei Funktionen in der Vorstellung aus. Die Funktion des Erfindens trägt außerdem der Tatsache Rechnung, dass eine Person, die sehr geübt ist im Betrachten und Gestalten von Bildern – die also sehr häufig Farb- und Formdifferenzen, Farbund Formzusammensetzungen sowie Verbindungen dieser Zusammensetzungen zur Welt erkennt und herstellt –, diese Differenzierungsfähigkeiten nicht nur trainiert, sondern auch zunehmend vom konkreten sinnlichen Reiz ablösen und in die Vorstellung verlagern kann.
Abb. 30: Caspar David Friedrich: »Frau vor untergehender Sonne«, um 1818, Öl auf Leinwand, 22 × 30 cm Beispielsweise kann sich ein ungeübter Bildbetrachter oder -gestalter möglicherweise nicht vorstellen, welche Wirkung das Bild von Caspar David Friedrich (vgl. Abb. 30) hat, wenn die warmen Orange- und Gelbtöne durch wesentlich dunklere Blau- , Grau- und Grüntöne ersetzt werden und die Figur der Frau so verkleinert wird, dass ihr Kopf nur knapp über den Horizont reicht. Ein geübter Bildbetrachter bzw. -gestalter hingegen vermag sich nicht
228 | Bildnerisches Denken
nur diese Veränderung der Farb- und Formzusammensetzung vorzustellen (vgl. Abb. 31), sondern auch die dadurch erreichte Veränderung der Wirkung des Bildes, d. h. die Veränderung der Verbindung der Farb- und Formzusammensetzungen zur Welt: Er kann sich vorstellen, dieselbe Vielfalt der Farbnuancen des Himmels in einem dunkleren Blau-/Grau/Grün-Bereich wahrzunehmen. Er kann in seiner Vorstellung die Bildteile derart zusammensetzen, dass die Frau sehr viel kleiner ist und nur mit dem Hals zum Horizont reicht. Er kann sich die dadurch veränderte Verbindung zur Welt vorstellen, die nicht mehr im Ausdruck von harmonischem Eingebundensein des Menschen in die Natur liegt, sondern im Ausdruck von Einsamkeit oder Bedrohung durch die Natur. Der ungeübte Bildbetrachter hingegen muss die Veränderung der Farb- und Formzusammensetzungen und ihrer Verbindung zur Welt erst tatsächlich durchführen, um die veränderte Wirkung zu erkennen. Er kann sie nicht oder nicht ausreichend in der Vorstellung vorwegnehmen.
Abb. 31: Digitale Bearbeitung von: Caspar David Friedrich: »Frau vor untergehender Sonne«, vgl. Abb. 30 Das Erfinden kann sich auch völlig vom Prozess der Bildgestaltung lösen. Dieses Phänomen lässt sich bei geübten Bildbetrachtern oder -gestaltern beobachten, die in der Lage sind, in allen möglichen Wahrnehmungskonstel-
4 Das Bildnerische | 229
lationen Bilder zu erkennen. Beispielsweise entdeckt wahrscheinlich nur jemand, der geübt ist in den Funktionen des Bildnerischen Denkens, in der Spiegelung einer Fensterfront interessante Farb- und Formkorrespondenzen zwischen den Dingen, die hinter der Glasscheibe sichtbar sind und denen, die von der Glasscheibe gespiegelt werden. So kann man in Abb. 32 zwei solche Korrespondenzen erkennen – zum einen zwischen dem orangenfarbenen Sofa und der Jacke einer Frau in derselben Farbe sowie zum anderen zwischen der senkrechte Säule neben dem Sofa links und der senkrechten Stütze des Vordaches rechts. So gesehen betrachtet man den Teil der Welt, der durch die Rahmung der Fensterfront räumlich eingegrenzt ist, als Bild.
Abb. 32: Foto einer Spiegelung Eine weitere Steigerung der Funktion des Erfindens ist dann gegeben, wenn sie sich sowohl von gegebenen oder vergangenen, sinnlichen Reizen als auch von konkreten Gestaltungsprozessen loslöst. Damit beschreibt die vierte Funktion das, was wir umgangssprachlich als »Erfinden von Bildern« beschreiben würden. Jemand, der sehr geübt ist in der vierten Funktion, kann in seiner Vorstellung Bilder erfinden, indem er die ersten drei Funktionen in der Vorstellung ausübt. Diese vorgestellten Bilder können anschließend auch hergestellt werden, aber sie müssen es nicht. Damit liefert die vierte Funktion des Bildnerischen Denkens ein begriffliches Instrumentarium, um einen weiten Bildbegriff zu entwickeln, der mentale Bilder einschließt, wie im Kapitel 4.2.4 näher ausgeführt wird. Wie bei den ersten drei Funktionen gibt es auch bei der vierten einen graduellen Unterschied der Leistungsfähigkeit verschiedener Personen,
230 | Bildnerisches Denken
welcher auf der jeweiligen Differenzierungsfähigkeit beruht. Je mehr bzw. feinere Differenzen in den Farben und Formen, in den Farb- und Formzusammensetzungen sowie in den Verbindungen zur Welt sich jemand vorstellen kann, desto besser beherrscht er das bildnerische Erfinden. Die Leistungsfähigkeit im bildnerischen Erfinden hängt somit von der Leistungsfähigkeit der ersten drei Funktionen ab. Auch Nelson Goodman thematisiert die graduell unterschiedliche Fähigkeit im Erfinden von Bildern. Sich ein früher einmal gesehenes Bild völlig ohne aktuellen, sinnlichen Reiz in Erinnerung zu rufen und entsprechend herzustellen, sei schwerer, als ein aktuell vorhandenes Bild mit der Erinnerung in der Vorstellung zu vergleichen und entsprechend zu korrigieren.33 Im Vokabular des Bildnerischen Denkens ausgedrückt heißt dies: das Erfinden ist umso schwerer auszuüben, je stärker es von konkreten, sinnlichen Reizen gelöst wird. Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass der innere Zusammenhang der Wahrnehmung sinnlicher Reize und deren Vorstellung sich auch in empirischen Befunden widerspiegelt, wie in einem Lehrbuch zur Allgemeinen Psychologie betont wird: »Wie bereits aus unseren Darlegungen zum bildhaften Denken zu vermuten war, handelt es sich offenbar im Gehirn um dieselben Strukturen (Areale), die sowohl für das bildhafte Vorstellen als auch für die bildliche Wahrnehmung verantwortlich sind.«34 Auch Verena Gottschling weist in ihrem Band zur Mental-Imagery-Debatte auf diese Befunde hin: »Deutlich geworden ist [durch die Einbeziehung neurophysiologischer und neuropsychologischer Daten] […], wie eng verbunden die Fähigkeiten visuelle Wahrnehmung und bildhaftes Vorstellen im menschlichen Gehirn sind. Entsprechend eng verknüpft sind auch die Diskussionen um die zugrunde liegenden Repräsentationsformate. Das bildhafte Vorstellen ist […] unzweifelhaft eine kognitive Fähigkeit«.35
4.2.2.2 Erfinden beim Bildgestalten Da die Funktion des Erfindens die anderen voraussetzt und in abgewandelter Form in sich enthält, nämlich in die Vorstellung verlagert, kann es diese als Bedingung für das Bestehen der Bildrelation im Gestaltungsprozess ersetzen. Wenn jemand einen Gegenstand entsprechend seiner bildnerischen Erfindung herstellt, dann besteht in diesem Herstellungsprozess, bezogen
33 Vgl. Goodman, Nelson: Of Mind and Other Matters, Cambridge, London, 1984, S. 24. 34 Becker-Carus, Christian: Allgemeine Psychologie, München, 2004, S. 292. 35 Gottschling, Verena: Bilder im Geiste, Paderborn, 2003, S. 154–155.
4 Das Bildnerische | 231
auf den Gegenstand, der gerade hergestellt wird, eine Bildrelation. In diesem Fall kann man davon sprechen, dass dieser Gegenstand »als Bild gestaltet« wird. Das bildnerische Erfinden ist damit eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung für das Gestalten eines Bildes. Die Differenzierung zwischen den ersten drei Funktionen als einzeln notwendige und zusammen hinreichende Bedingungen für das Gestalten eines Bildes auf der einen Seite und der vierten Funktion als bloß hinreichendes Kriterium auf der anderen Seite entspricht dem Unterschied zwischen einem unerfahrenen und einem erfahrenen Bildgestalter. Während der unerfahrene Bildgestalter Farben und Formen und deren Zusammensetzungen vor sich sehen muss, um etwas mit ihnen zu verbinden, kann der erfahrene Bildgestalter diese Tätigkeiten in der Vorstellung vorwegnehmen. Er kann somit umgekehrt vorgehen und die Farb- und Formzusammensetzungen mit ihren Verbindungen entsprechend seiner Vorstellung herstellen. Die vierte Funktion ermöglicht so die Unterscheidung zwischen einem geübten Bildgestalter, der seine Bildmotive eigenständig erfindet und umsetzt und einem Gestalter, der ohne erfinderische Zugabe und möglicherweise stur nach Anweisungen ein aktuell wahrgenommenes Motiv ins Bild setzt. Beide können zwar als Bildgestalter bezeichnet werden, jedoch auf einem unterschiedlichen Niveau. 4.2.3 Die vier Funktionen als Bedingungen der Bildgestaltung In Tabelle 19 sind alle vier Funktionen des Bildnerischen Denkens als Bedingungen für das Gestalten eines Bildes aufgelistet. Die ersten drei Funktionen sind einzeln notwendig und zusammen hinreichend dafür, dass man die Herstellung eines Gegenstandes als Prozess der Bildgestaltung bezeichnen kann. Die vierte Funktion ist eine nicht notwendige, aber hinreichende Bedingung für das Gestalten eines Bildes. Das Erfinden kann die ersten drei Funktionen als notwendige Bedingungen deshalb ersetzen, weil sie im Erfinden enthalten sind. Nach dieser Herleitung kann nun die bisher gegebene Antwort auf die zweite Teilfrage erweitert werden. Die Frage heißt: »Was heißt es, etwas als Bild zu gestalten?«. Die vollständige Antwort lautet nun: »Es heißt, die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens oder die vierte Funktion des Bildnerischen Denkens auszuüben.« Damit ist die These 2b begründet:
Bilderfahrung in der Bildgestaltung ist das Ausüben der Funktionen 1–3 oder der Funktion 4 des Bildnerischen Denkens. Zusammen mit der Begründung von These 2a ist somit das »Bildnerische« als spezifische Differenz eingeführt. Zugleich ist damit erklärt, was eine Erfahrung zu einer Bilderfahrung macht.
232 | Bildnerisches Denken
BEDINGUNGEN DER BILDGESTALTUNG einzeln notwendige & zusammen hinreichende Bedingungen 1. 2. 3. WAHRNEHMEN ZUSAMMENSETZEN VERBINDEN Erkennen & Erkennen & Erkennen & Herstellen Herstellen Herstellen
der Farben & Formen in der Welt sowie deren Differenzen
der Wechselwirkungen von Farben & Formen sowie deren Differenzen innerhalb der Bildgrenze und in Bezug zu ihr Bild
Welt
Welt
der Verbindungen von Bild & Welt sowie deren Differenzen
Bild Welt
hinreichende Bedingung 4. ERFINDEN Vorstellen & Herstellen
von Farben & Formen, von Wechselwirkungen, von Verbindungen zur Welt sowie deren Differenzen Bild Bild
Bild Welt
= Funktionen 1–4 des Bildnerischen Denkens
Tabelle 19: Notwendige und hinreichende Bedingungen der Bildgestaltung Die Antworten auf die erste und die zweite Teilfrage liefern außerdem die Erklärung für den Zusammenhang der beiden Prozesse: Bildbetrachten und Bildgestalten. Sie sind miteinander verwandt, weil für beide dieselben Denkfunktionen notwendig sind – nämlich die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens. In beiden Prozessen finden also prinzipiell dieselben Denkleistungen statt. Das bedeutet aber keineswegs, dass nicht neben den Funktionen des Bildnerischen Denkens weitere Denkprozesse eine Rolle spielen können. So mögen im Prozess der Bildrezeption Überlegungen zur historischen Einordnung des Bildes oder zu einem beworbenen Produkt hinzutreten. Genauso können im Prozess der Bildproduktion Überlegungen zur Trocknungszeit der Farbe oder zu den zur Verfügung stehenden Werkzeugen in einem Computerprogramm von Bedeutung sein. Dennoch berühren diese zusätzlichen Überlegungen nicht den gemeinsamen Kern der Funktionen des Bildnerischen Denkens. In Bezug auf dieses Denken besteht der einzige Unterschied zwischen Bildbetrachtung und -gestaltung darin, in welche Tätigkeit diese Denkleistungen münden. Die Denkleistungen der Bildbetrachtung werden in vielen Fällen im Medium der Sprache festgehal-
4 Das Bildnerische | 233
ten. Beim Gestalten eines Bildes finden sie hingegen ihren Ausdruck in visuellen oder plastischen Medien. Doch auch das Betrachten eines Bildes kann in visuellen Medien zum Ausdruck kommen, beispielsweise in Form einer Kompositionsskizze, in der die Zusammensetzung von Farben und Formen eines Bildes genau analysiert wird. Ebenso können die Überlegungen beim Gestalten eines Bildes verbal geäußert werden, wie beispielsweise bei Besprechungen von praktischen Arbeiten im schulischen, universitären oder akademischen Gestaltungsunterricht. Durch die Analyse des Prozesses der Bildgestaltung – genauer des Erfindens als seiner hinreichenden Bedingung – wird deutlich, dass der Begriff der Bilderfahrung neben dem Betrachten und Gestalten von Bildern auf eine dritte Art von Erfahrung ausgeweitet werden kann, die völlig unabhängig von sinnlich wahrnehmbaren Bildkörpern ist. Sie ist systematisch durch die Funktion des Erfindens erfasst und führt zu einer Erweiterung des bisher eingeführten Bildbegriffs, wie im folgenden Kapitel gezeigt wird. 4.2.4 Der weite Bildbegriff: mentale Bilder Die Funktion des Erfindens verdeutlicht eine Eigenart des Phänomens Bild, die in dem bisher explizierten engen Bildbegriff lediglich angedeutet wurde. Entsprechend der Herleitung der ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens gehört es zu den notwendigen Bedingungen für das Bestehen der Bildrelation, dass eine wahrnehmbare räumliche Eingrenzung besteht, die das Innere des Bildes bzw. das Bild als Ganzes vom Äußeren und damit vom »Nicht-Bild« unterscheidet. In Kapitel 4.1.3.3 wurde bereits angedeutet, dass eine solche Einteilung in »Bild« und »Nicht-Bild« bzw. »Welt« insofern künstlich ist, als jedes Bild auch immer Teil der Welt ist. Das Erfinden trägt dieser Tatsache dadurch Rechnung, dass es diese künstliche Trennung wieder aufhebt, weil es in der Lage ist, überall in der Welt Bilder zu erkennen. Durch die Funktion des Erfindens können wir in der gesamten Welt Bilder finden – und zwar nicht nur in der sinnlich wahrnehmbaren, äußeren Welt, sondern auch in unserer inneren Welt. Wir finden bzw. erfinden mentale Bilder oder – wie man auch sagt – »wir machen uns ein Bild von der Welt«. Diese Erfahrung kann man, neben dem Betrachten und Gestalten, als eine dritte Art von Bilderfahrung beschreiben, die völlig unabhängig von konkreten Betrachtungs- oder Gestaltungsprozessen ist. Sie führt zu einem erweiterten Bildbegriff, der mentale Bilder mit einschließt. Für diese Art von Bilderfahrung ist die Funktion des Erfindens nicht nur hinreichende, sondern notwendige Bedingung.
234 | Bildnerisches Denken
Ein mentales Bild ist das, was durch die Ausübung der Funktion des Erfindens entsteht, also durch die Verlagerung der ersten drei Funktionen in die Vorstellung. Das mentale Bild ist zwar nicht etwas, das »als Bild« und auch »als etwas anderes betrachtet werden kann«. Daher handelt es sich hier um eine Erweiterung der ursprünglichen Explikation des Begriffs »Bild«. Dennoch besteht ein Zusammenhang beider Bildbegriffe, der »materiellen Bilder« und der »mentalen Bilder«. Für beide Bildarten sind die Funktionen des Bildnerischen Denkens konstitutiv. Für die materiellen Bilder sind es die ersten drei Funktionen, für die mentalen Bilder sind es die ersten drei Funktionen in die Vorstellung verlagert bzw. die vierte Funktion. Mit dieser Beschreibung der »mentalen Bilder« wird dabei keinesfalls eine problematische Entität postuliert. Der erweiterte Bildbegriff gibt lediglich eine Erklärung für unsere subjektive Erfahrung, dass wir bildhafte Vorstellungen haben. Er leistet dies, indem er die Gemeinsamkeiten aufzeigt, die solche Erfahrungen mit der Erfahrung materieller Bilder haben. Dass wir solche bildhaften Vorstellungen haben, wird laut Gottschling auch in der Imagery-Debatte nicht angezweifelt: »Die Erfahrung bildhaften Vorstellens ist unzweifelhaft wahrnehmungsähnlich und wir haben subjektiv den Eindruck, Bilder vor uns zu sehen, darum aber geht es den Teilnehmern der Debatte nicht«.36 Beide Bildarten, die materiellen wie die mentalen, sind keine Entitäten, die in irgendeiner Weise unabhängig von der Ausübung der Funktionen des Bildnerischen Denkens existieren. Sie entstehen beide in der Ausübung der jeweiligen Funktionen. Die kritischen Einwände, die in der Imagery-Debatte gegen die Beschreibung mentaler Bilder als mentale Repräsentationen angeführt werden,37 treffen daher auf die hier vorgenommene, systematische Erfassung mentaler Bilder durch das Modell des Bildnerischen Denkens nicht zu. Auch Nelson Goodman beurteilt die Rede von mentalen Bildern als unproblematisch oder zumindest als ebenso problematisch wie die Rede von mentalen Worten oder von verbalem Denken: »Pictures in the mind and thoughts in pictures are no more and no less mythical than words in the mind and thoughts in words – a conclusion likely to shock those who pride themselves on the scientific probity of insisting that all thought is verbal.«38 Entsprechend der hergeleiteten vierten Funktionen des Bildnerischen Denkens kann damit die Erweiterung des Begriffs »Bild« folgendermaßen bestimmt werden:
36 Ebenda, S. 104, Hervorh. i. O. 37 Vgl. ebenda, S. 49–51. 38 Goodman, Nelson: Of Mind and Other Matters, Cambridge, London, 1984, S. 23.
4 Das Bildnerische | 235
»Ein mentales Bild ist etwas, das von einem Betrachter bildnerisch erfunden wird, das heißt, dass sich der Betrachter 1. Farben & Formen sowie deren Differenzen vorstellt, 2. Wechselwirkungen von Farben & Formen sowie deren Differenzen innerhalb der räumlichen Eingrenzung und in Bezug zu ihr vorstellt, 3. Verbindungen dieser räumlich eingegrenzten Farb- & Formkombinationen zur Welt sowie deren Differenzen vorstellt.«
5 BILDNERISCHES DENKEN
In den letzten beiden Teilen (3 und 4) wurden die übergeordnete Gattung – Denken – und die spezifische Differenz – das Bildnerische – des Bildnerischen Denkens erläutert. In Teil 3 wurde gezeigt, dass Bilderfahrung eine Form des Konkretisierens ist, im Unterschied zum abstrahierenden Denken (These 1). Während beim Abstrahieren eine Sache dadurch charakterisiert wird, dass auf die Gemeinsamkeiten verwiesen wird, die diese Sache mit anderen Sachen hat, bezieht sich das konkretisierende Denken gerade auf die Unterschiede zu Anderem. Das Abstrahieren klassifiziert einen Gegenstand somit als Exemplar einer Gegenstandsklasse, während das Konkretisieren einen Gegenstand in seiner Einmaligkeit erfasst. Teil 4 hat das konkretisierende Denken in der Bilderfahrung näher als bildnerisch ausgezeichnet und damit den Zusammenhang von Bilderfahrung im Betrachten und im Gestalten eines Bildes erklärt. Er besteht darin, dass für beide Prozesse die Funktionen des Bildernischen Denkens notwendig sind (These 2). Teil 5 leistet nun eine Zusammenführung der beiden Teile 3 und 4, die auch als Zusammenführung der beiden Thesen 1 und 2 formuliert werden kann:
Bilderfahrung ist Konkretisieren im Ausüben der Funktionen des Bildnerischen Denkens. Um das damit hergeleitete Modell des Bildnerischen Denkens vollständig zu entfalten, wird zunächst ein Überblick über die Begriffsgeschichte des Ausdrucks »Bildnerisches Denken« gegeben (5.1). Anschließend wird für alle vier bildnerischen Funktionen gezeigt, dass sie im Konkretisieren bestehen und worin sie sich von nicht-bildnerischen Denkleistungen unterscheiden (5.2). Damit liefert das Modell des Bildnerischen Denkens nicht nur eine genaue Analyse der bildspezifischen Denkprozesse. Mit Hilfe der Unterscheidung zwischen Vollzug und Gegenstandsbezug des Bildnerischen Denkens wird es zudem möglich, gängige und z. T. widersprüchliche Kategorisierungen von »abstrakten« und »konkreten« Bildern
238 | Bildnerisches Denken
systematisch zu erklären und damit deren scheinbare Widersprüchlichkeit aufzulösen (5.3).
5.1
B EGRIFFSGESCHICHTE Im Folgenden werden verschiedene Verwendungsweisen des Begriffs »Bildnerisches Denken« in philosophischen und kunstpädagogischen Zusammenhängen vorgestellt. Dabei handelt es sich ausschließlich um Konzepte deutschsprachiger Autoren, da der Begriff »Bildnerisches Denken« nicht adäquat ins Englische übersetzt werden kann. In Übereinstimmung mit dem hier vorgeschlagenen Verständnis vom Bildnerischen Denken ist allen diesen Konzepten gemeinsam, dass sie diese Art des Denkens sowohl bei der Rezeption als auch bei der Produktion von bildnerischen Werken beteiligt sehen. Eine weitere Gemeinsamkeit der Konzepte besteht darin, dass sie sich alle implizit oder explizit an das sogenannte »Bildnerische Denken« von Paul Klee anlehnen, auf das im Kapitel zur Kunstpädagogik näher eingegangen wird. 5.1.1 »Bildnerisches Denken« in der Philosophie Der Begriff des »Bildnerischen Denkens« wird in den einschlägigen deutschen Wörterbüchern der Philosophie1 nicht verhandelt. Auch die Begriffe »anschauliches«, »visuelles« oder »analoges« Denken sind nicht berücksichtigt – abgesehen von einer Nebenbemerkung zum »anschaulichen Denken«, die Mittelstraß und Lorenz in der Neuauflage der Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie eingefügt haben.2 Ein englisches Äquivalent für den Begriff »bildnerisch« gibt es nicht. In den englischen Nachschlagewerken3 findet man zu den möglichen Übersetzungen »Visual Thinking«4 oder
1
Vgl. Barck, Karlheinz u. a. (Hg.): Ästhetische Grundbegriffe, Stuttgart, Weimar, 2000–2005; Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005ff; Sandkühler, Hans-Jörg (Hg.): Enzyklopädie Philosophie, Hamburg, 1999; Ritter, Joachim u. a. (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel, Darmstadt, 1971–2007.
3
Vgl. Mittelstraß, Jürgen; Lorenz, Kuno: »Denken«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar, 2005, S. 154. Vgl. Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 1998, OnlineAusgabe, Zugriff am 22.04.2014; Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy, Online-Ausgabe, Zugriff am 22.04.2014; Kelly, Michael (Hg.): Encyclopedia of Aesthetics, Ox-
4
Englischer Originaltitel von: Arnheim, Rudolf: Anschauliches Denken, Köln, 2001: ders: Visual
2
ford, 1998.
Thinking, Berkeley, Los Angeles, 1969.
5 Bildnerisches Denken | 239
»The thinking eye«5 keine Einträge, genauso wenig wie zu den Übersetzungsversuchen »aesthetic/ analogue/ analogous/ artistic/ iconic/ imaginal/ pictorial« »thinking/ reason/ mind«. Dabei bedauert John Dewey bereits 1934 in seinem Buch Art as Experience das Fehlen eines solchen Begriffes im Englischen: »We have no word in the English language that unambiguously includes what is signified by the two words ›artistic‹ and ›esthetic‹. Since ›artistic‹ refers primarily to the act of production and ›esthetic‹ to that of perception and enjoyment, the absence of a term designating the two processes taken together is unfortunate.«6
Im Deutschen haben wir mit dem Begriff »bildnerisch« zumindest bezogen auf Bilder ein solches Wort, das die Prozesse der Rezeption und Produktion zusammenfasst – auch wenn das »Bildnerische Denken« nicht als terminus technicus in der Philosophie etabliert ist. Dennoch wird dieser Begriff von einigen Autoren verwendet, allerdings meistens ohne systematische Einführung dieser Denkart, wie im Folgenden gezeigt wird. So ist beispielsweise die bereits erwähnte Veröffentlichung, die sich der philosophischen Untersuchung des zeichnerischen Werks von Charles Sanders Peirce widmet, betitelt mit: Das bildnerische Denken: Charles Sanders Peirce.7 Der Bezug zu Paul Klee wird in diesem Sammelband ausdrücklich erwähnt.8 In dem darin enthaltenen Aufsatz mit dem Titel »Was ist Peirce’ bildnerisches Denken?«9 sucht man aber vergebens nach einer systematischen Analyse dieser Denkart, obwohl der Titel des Textes den Anspruch erhebt, zu klären, was das Bildnerische Denken von Peirce sei. Dazu passend wird der Begriff »Bildnerisches Denken« im Text kaum verwendet. Anders als der Titel verspricht, handelt der Aufsatz nicht vom bildnerischen, sondern vom visuellen Denken, wie bereits in Kapitel 3.3 erläutert.
5
Titel der englischen Ausgabe von: Klee, Paul: Das Bildnerische Denken, Basel, Stuttgart, 1956:
6
Dewey, John: Art as Experience, 1980, S. 46.
7
Engel, Franz; Queisner, Moritz, Tullio, Viola (Hg.): Das bildnerische Denken: Charles S. Peirce,
ders.: The Thinking Eye, London, New York, 1961.
Berlin, 2012. 8
Vgl. Engel, Franz u. a.: »Einleitung«, in: (dies.) (Hg.): Das bildnerische Denken: Charles S.
9
Pape, Helmut: »Was ist Peirce’ bildnerisches Denken?«, in: Engel, Franz u. a. (Hg.): Das bildne-
Peirce, Berlin, 2012, S. 39. rische Denken: Charles S. Peirce, Berlin, 2012.
240 | Bildnerisches Denken
Ein ähnliches Missverhältnis von Textüberschrift und Inhalt ist in dem Aufsatz »›Bildnerisches Denken‹. Martin Heidegger und die bildende Kunst«10 von Toni Hildebrandt festzustellen. Der Autor wählt den Begriff des »Bildnerischen Denkens« ebenfalls in Anlehnung an Paul Klee, wie durch die erste Unterüberschrift und das erste Zitat deutlich wird.11 Abgesehen vom Titel des Aufsatzes verwendet er den Begriff allerdings nur noch ein einziges Mal, und das auch ohne Erklärung, was darunter zu verstehen ist.12 Ebenfalls in Anlehnung an Paul Klee wird der Begriff von manchen Autoren in einem sehr weiten Verständnis als Synonym für Künstlertheorien, für das Denken von Künstlern oder für visuelles Denken verwendet, wie z. B. von Thomas Lange. Während sich der Titel seines Buches Das bildnerische Denken Philipp Otto Runges13 auf das Denken eines Künstlers und dessen Künstlertheorie bezieht, wird im Vorwort deutlich, dass Lange mit dem Begriff »Bildnerisches Denken« das Denken von Künstlern überhaupt oder – noch allgemeiner – das visuelle Denken bezeichnet: »Runge bezieht sich auf ein dem Künstler eigenes Denken, das dann im 20. Jahrhundert, wohl auf Paul Klee zurückgehend, das ›bildnerische Denken‹ genannt werden sollte. Und das ist, wie Runge richtig bemerkte, allen Künstlern […] zu eigen gewesen.«14 »Die Frage nach Runges bildnerischem Denken konnte nur dadurch einer Beantwortung zugeführt werden, daß die bildnerischen Innovationen ihrem systematischen Ort entsprechend analysiert wurden: als spezifisch visuelles Denken«15.
Ein noch weiteres Verständnis vom »Bildnerischen Denken« hat Matthias Bunge, das er wie folgt erläutert: »Die Begriffe: Künstlerästhetik, Künstlertheorie, Künstlerreflexion, Künstlerbekenntnis, künstlerische Selbstäußerung, künstlerische Selbstinterpretation und Bildnerisches Denken werden weitgehend synonym gebraucht. Wenn hier allgemein von dem ›Bildnerischen Denken‹ geredet wird, ist immer das Denken von Klee, Kandinsky und Beuys gemeint.«16
10 Hildebrandt, Toni: »›Bildnerisches Denken‹«, in: Espinet, David; Keiling, Tobias (Hg.): Heideg-
gers Ursprung des Kunstwerks, Frankfurt a. M., 2011. 11 Vgl. ebenda, S. 219. 12 Vgl. ebenda, S. 226. 13 Lange, Thomas: Das bildnerische Denken Philipp Otto Runges, Berlin, München, 2010. 14 Ebenda, S. 9. 15 Ebenda, S. 11. 16 Matthias Bunge: Zwischen Intuition und Ratio, Stuttgart, 1996, S. 14, Fußnote 8, Hervorh. i. O.
5 Bildnerisches Denken | 241
Von dieser sehr weiten und daher unscharfen Begriffsbestimmung Bunges grenzt sich das hier vorgeschlagene Verständnis vom »Bildnerischen Denken« deutlich ab. Darin besteht eine Übereinstimmung mit Stephan Schmidt, der ebenfalls betont: »Anders jedoch als Bunge würde ich Künstlertheorie und bildnerisches Denken nicht synonym verwenden.«17 Stephan Schmidt stellt unter den bisher genannten Autoren eine Ausnahme dar, weil er sein Verständnis vom »Bildnerischen Denken« sehr klar erläutert. Daher lohnt es sich, dieses etwas ausführlicher darzustellen. Auch Schmidt entwickelt sein Konzept vom Bildnerischen Denken im Anschluss an Paul Klee, wie im Titel seines Aufsatzes deutlich wird.18 Einige Aspekte seines Konzeptes stimmen mit dem hier vorgestellten Modell überein. So betont er, dass beispielsweise die kompositorische Beurteilung eines Bildes während des Produktionsprozesses Teil dieses Denkens ist: »Die in Worte gefassten theoretischen Überlegungen der Künstler (Texte, Interviews, Kommentare etc.) sind nur die Verbalisierung von Denkprozessen, die zeitgleich mit der bildnerischen Praxis auftreten, die aber während der Produktion nicht immer eigens ins Bewusstsein treten. Die Beurteilung, ob bestimmte Elemente passen, ist ein Denkprozess.«19
Dabei geht er ebenfalls davon aus, dass es einen engen Zusammenhang dieser Denkprozesse in der Produktion und in der Rezeption gibt: »Diese Bildrationalität ist nicht nur für die Gestaltung eines Bildes entscheidend, sie ermöglicht auch einen interpretativen Zugang zum Bild, indem sie Ansatzpunkte und Einstiegsmöglichkeiten für eine Interpretation aufzeigt.«20 Dies erläutert er anhand von zwei Bildbeispielen, »so dass erkennbar wird, dass bildnerisches Denken sich sowohl im Produktions- als auch im Rezeptionsgeschehen von Kunstwerken wiederfindet.«21
17 Schmidt, Stephan: »›Eine kleine Reise in das Land der besseren Erkenntnis‹: Paul Klee und der Begriff des ›bildnerischen Denkens‹«, in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissen-
schaft, 2011, S. 287. 18 Schmidt, Stephan: »›Eine kleine Reise in das Land der besseren Erkenntnis‹: Paul Klee und der Begriff des ›bildnerischen Denkens‹«, in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissen-
schaft, 2011. 19 Ebenda, S. 286. 20 Ebenda, S. 287. 21 Ebenda, S. 276.
242 | Bildnerisches Denken
Im Unterschied zum hier vorgestellten Modell vertritt Schmidt die These, dass auch das Bildnerische Denken – wie alles Denken – ein begriffliches Moment enthält: »Ziel […] soll es sein, zu zeigen, dass Sinnlichkeit und Verstand bzw. Anschauung und Begriff im Konzept des bildnerischen Denkens notwendig zusammengehören. Es beinhaltet immer ein sinnliches und ein begriffliches Moment – und dies gilt nicht allein für das Werk Klees.«22
Schmidt ist der Ansicht, dass jede künstlerische Tätigkeit notwendigerweise von begrifflichen Kategorien geleitet sein muss: »Das bildnerische Denken hingegen ist die mediale Tätigkeit des Künstlers, passiv erkennend und aktiv gestaltend. Es ist die bildnerische Praxis des Künstlers unter Anleitung bestimmter Begriffe, eben der künstlerischen Kategorien, ohne die der Künstler nicht zu gestalten vermag.«23
Mehr noch ist Schmidt der Meinung, dass auch Klee dieser Ansicht war: »Klee deckt in seinen theoretischen Texten diese Begriffe in einem gewissen Sinne sogar systematisch auf«.24 »Zu nennen wären insbesondere: Genesis, Raum-Zeit (in Klees Vorstellung sind beide nicht voneinander zu trennen), Gestaltung und Bewegung. Diese Begriffe sind in jedem Fall konstitutiv für die Werke Klees, sie sollen aber, dem Anspruch Klees gemäß, auch konstituierend für moderne Kunst überhaupt sein.«25
Dieses Konzept des Bildnerischen Denkens fußt auf der hier in Teil 3 als »traditionell« bezeichneten Theorie des Denkens, nach der es begriffsloses Denken nicht gibt. Diese Ansicht vertritt auch Schmidt, wie er deutlich formuliert: »Denken ist immer eine Operation mit Begriffen, das gilt auch für das intuitive Denken, insofern es überhaupt noch Denken sein soll. Entscheidend scheint hier vielmehr die Art des Gebrauchs zu sein. Ähnlich wie wir nach Kant uns der Kategorien ›bedienen‹, um Gegenstände zu konstituieren, so bedient sich der Künstler intuitiv bestimmter Begriffe, die ihn in seiner bildnerisch-tätigen Praxis anleiten.«26
22 Ebenda, S. 285–286, Hervorh. i. O. 23 Ebenda, S. 287. 24 Ebenda, S. 286. 25 Ebenda, S. 287. 26 Ebenda, S. 286.
5 Bildnerisches Denken | 243
Um diese Ansicht zu untermauern, erläutert er anhand von zwei Bildern Klees, wie » sich die begrifflichen Elemente, die Klee im Naturstudium entdeckt, auch sinnlich erfassbar im Kunstwerk niederschlagen.«27 In zwei detaillierten, formalen Analysen zeigt er auf, wie in den Bildern Bewegung sichtbar wird. Er meint, damit nachgewiesen zu haben, dass der Begriff »Bewegung« für diese Bilder konstitutiv ist, bzw. dass dieser Begriff den Künstler in seiner praktischen Tätigkeit geleitet hat. Unbestreitbar erzeugen die beiden ausgewählten Bilder den Eindruck von Bewegung. Allerdings ist höchst fraglich, ob sich Klee beim Malen der Bilder vom »Begriff der Bewegung« leiten ließ bzw. ist unklar, was dies überhaupt heißen soll. Schmidt gibt keine nähere Erklärung dazu, welche Funktion die Begriffe im Prozess einer Bildgestaltung genau haben sollen. Allein aus der Tatsache, dass man mit einer gewissen Plausibilität einen bestimmten Begriff auf ein Bild anwenden kann, kann man nicht schließen, dass dieser Begriff den Gestaltungsprozess geleitet hat. Zudem wird in seiner eigenen Bildanalyse deutlich, wie wenig der allgemeine Begriff der »Bewegung« die konkrete Wirkung der beiden Farb- und Formkombinationen beschreiben kann. Schmidt verwendet zur Beschreibung dieser Wirkung Wortzusammensetzungen wie »Farbbewegung«28, »Beobachterbewegung«29, »Wachstumsbewegung«30 und »Vervollkommnungsbewegung«31. Was unter diesen Begriffen zu verstehen ist, kann einzig am konkreten Werk erklärt werden. Losgelöst von diesen sind sie zumindest unklar, wenn nicht völlig unverständlich. Daher scheint der Zusammenhang zwischen diesen Begriffen bzw. dem allgemeinen Begriff der »Bewegung« und den beiden Bildern eher umgekehrt zu sein, als Schmidt zu zeigen versucht. Nicht die Bilder werden nach den Begriffen gestaltet, sondern die Begriffe werden passend zu den Bildern gebildet, und zwar im Nachhinein, um die auf den Bildern beobachtbaren Wirkungen zumindest näherungsweise beschreiben zu können. Die These vom begrifflichen Moment im Bildnerischen Denken ist daher von Schmidt nicht überzeugend begründet. Abschließend lässt sich sagen, dass der Begriff »Bildnerisches Denken« in der Philosophie bisher keine überzeugende Ausarbeitung erfahren hat.
27 Ebenda, S. 291. 28 Ebenda, S. 292 und S. 295. 29 Ebenda, S. 293. 30 Ebenda. 31 Ebenda.
244 | Bildnerisches Denken
5.1.2 »Bildnerisches Denken« in der Kunstpädagogik Wie schon erwähnt, berufen sich die meisten Autoren, die den Begriff des »Bildnerischen Denkens« verwenden, auf Paul Klee. Genauer beziehen sie sich auf das 1956 von Jürg Spiller unter dem Titel Das bildnerische Denken32 herausgegebene Werk, das Klees Aufzeichnungen zu seiner Lehre enthält. Auch Rainer Wick sieht den Ursprung dieses Begriffs in Spillers Veröffentlichung.33 Wick stellt aber auch fest: »Ob Klee tatsächlich den Begriff ›bildnerisches Denken‹ geprägt hat, ist bis heute umstritten.«34 Paul Klee nannte seine Lehre am Bauhaus zwischen 1921 und 1931 »Bildnerische Gestaltungslehre«35. Die Manuskripte hierzu, die einerseits aus dem Buch Beiträge zur bildnerischen Formenlehre sowie andererseits aus fast 4000 Seiten mit Unterrichtsnotizen bestehen, enthalten keine Anmerkung zum Begriff »Bildnerisches Denken« – wie man seit kurzem in der Online-Datenbank des Zentrums Paul Klee überprüfen kann.36 Für alle weiteren Bestände des Zentrums, die nicht in der Online-Datenbank erfasst sind, steht eine entsprechende Überprüfung noch aus. Woher Jürg Spiller den Titel der Veröffentlichung genommen hat, ist also unklar. Er selbst gibt in seiner Einführung keine Erklärung für die Wahl dieses Titels.37 Möglicherweise hat er ihn von Werner Haftmann übernommen, der 6 Jahre vor Spillers Veröffentlichung ein kleines Bändchen über Klee mit dem Titel Paul Klee. Wege bildnerischen Denkens 38 geschrieben hat. Haftmann hat Klee nicht persönlich gekannt, wie er selbst bemerkt,39 daher kann er den Begriff des »Bildnerischen Denkens« nicht aus einer mündlichen Äußerung Klees übernommen haben. Stattdessen scheint er ihn selbst geprägt zu haben, wovon auch
32 Klee, Paul: Form- und Gestaltungslehre, Band 1: Das Bildnerische Denken, Basel, Stuttgart, 1956. 33 Vgl. Wick, Rainer: »Vorwort«, in: Jenny, Peter: Bildkonzepte, Mainz, Zürich, 2000, S. 13, Fußnote 9. 34 Ebenda. 35 Vgl. Zentrum Paul Klee in Bern (Hg.): »Einleitung« zur Online-Datenbank zu: Paul Klee – Bildneri-
sche Form- und Gestaltungslehre, Zugriff am 22.04.2014, [ohne Seitenangabe]. 36 Vgl. Zentrum Paul Klee in Bern (Hg.): Paul Klee – Bildnerische Form- und Gestaltungslehre, Online-Datenbank, Zugriff am 22.04.2014. 37 Vgl. Spiller, Jürg: »Einführung«, in: Klee, Paul: Form- und Gestaltungslehre, Band 1: Das Bildne-
rische Denken, Basel, Stuttgart, 1956. 38 Haftmann, Werner: Paul Klee, München, 1950. 39 Vgl. ebenda, S. 7.
5 Bildnerisches Denken | 245
Baumgärtel ausgeht.40 Haftmann selbst gibt folgende Erläuterung des Begriffs: »Das wäre dann dieser Punkt des Werdens, von dem aus eine Menschlichkeit ans Handeln gerät und schöpferisch wird durch den Einsatz einer besonderen Intelligenz, die ich das bildnerische Denken nennen möchte. Auch dieses bildnerische Denken ist ein Aneignungs-, Ordnungs-, Verwirklichungsund Ausdrucksverfahren des ins Ganze der Welt gestellten menschlichen Geistes. Es bedient sich besonderer Sprachmittel, im Falle der Malerei der farbigen Formen, und es hat seine genaue Logik. Die Wege, die dieses bildnerische Denken nimmt, schreiten recht eigentlich die geistige Monographie eines Menschen aus, wenn er nun einmal als Maler in diese Welt trat und sie von diesem Standpunkt aus arbeitend erfuhr und, sofern er begnadet genug war, bewältigte. Auch als Betrachter muß man sich erst einmal in der Richtung dieser Wege in Bewegung bringen, erst dann wird man die innere Notwendigkeit des Wachstumsprozesses eines künstlerischen Werkes erfahren können. Das Weltanschauliche mag sich dann als Schlußergebnis der fragenden Arbeit einstellen. Man kann nicht bei ihm anfangen. Die Wege, die Paul Klees bildnerisches Denken einschlug, habe ich mich zu beschreiben bemüht.«41
Mit diesem Textabschnitt erschöpfen sich die allgemeinen Erläuterungen zum Bildnerischen Denken in diesem Band. Obwohl der Ursprung dieses Begriffs also immer noch unklar ist, wurde er in der Kunstpädagogik dennoch recht bald populär. Wie auch Wick bemerkt,42 leistete Reinhard Pfennig einen wesentlichen Beitrag hierzu mit seinem Buch Gegenwart der Bildenden Kunst. Erziehung zum Bildnerischen Denken43. Das Buch erschien erstmals 1959 unter dem Titel Bildende Kunst der Gegenwart: Analyse und Methode 44 und wurde für die zweite, neu betitelte Fassung erweitert. Im kunstpädagogischen Konzept des »Kunstunterrichts«45, dessen Hauptvertreter Reinhard Pfennig und Gunter Otto sind, wurde der Begriff des »Bildnerischen Denkens« so zum »Schlüs-
40 Vgl. Baumgärtel, Gerhard: »Denk-Kunst und Bildnerisches Denken«, in: Kunstforum Internatio-
nal, 1974/75, S. 88. 41 Haftmann, Werner: Paul Klee, München, 1950, S. 8. 42 Vgl. Wick, Rainer: »Vorwort«, in: Jenny, Peter: Bildkonzepte, Mainz, Zürich, 2000, S. 13, Fußnote 9. 43 Pfennig, Reinhard: Gegenwart der Bildenden Kunst, Oldenburg, 1974. 44 Pfennig, Reinhard: Bildenden Kunst der Gegenwart, Oldenburg, 1959. 45 Vgl. Eid, Klaus u. a.: Grundlagen des Kunstunterrichts, Paderborn, 2002, S. 113.
246 | Bildnerisches Denken
selbegriff«46 für eine Neuorientierung der schulischen Kunstpädagogik: »Aus der Analyse der bildenden Kunst der Gegenwart ergibt sich eine Neuorientierung für den Kunstunterricht, sein Ziel heißt: Erziehung zum bildnerischen Denken.«47 Dieses Konzept des Bildnerischen Denkens unterscheidet sich in zwei wesentlichen Aspekten von dem hier vorgestellten Modell. Einerseits ist es weniger systematisch, andererseits weist es eine starke formalistische Tendenz auf – also eine Tendenz zur Reduktion des Bildnerischen Denkens auf Denkprozesse, die die Anordnung von Farben und Formen betreffen. Das hier vertretene Modell wird damit um die Funktion des Verbindens beschnitten, die alle inhaltlichen Aspekte eines Bildes betrifft und das Bild erst zum Bild werden lässt. Diese Tendenz zum Formalismus wurde zum größten Kritikpunkt der nachfolgenden Generation von Kunstpädagogen. Wie die Autoren aus dem Bereich der Philosophie knüpft auch Pfennig an Klee an.48 Für Pfennig ist Bildnerischen Denken »in Bildern oder Zeichen denken und sich durch Bilder mitteilen«49. »In jedem Falle ist Sichtbarmachen sowohl Weg wie Ziel des bildnerischen Denkvorganges.«50 Das, was Pfennig weiterhin die Beschreibung der »Eigenschaften des bildnerischen Denkens«51 nennt, ist allerdings weniger eine systematische Analyse einer bestimmten Denkart, sondern eher eine assoziative Aneinanderreihung verschiedener Tätigkeiten, die er unter diese Denkart fassen möchte: »Der bildnerische Denkvorgang geschieht im Wechsel zwischen Machen – Sehen – Einfühlen – Finden
– Reflektieren – Reagieren – Machen.«52 »Das bildnerische Denken ist gebunden an Material, an den sinnlichen Stoff.«53 »Die bildnerischen Denkvorgänge, die hierbei ausgelöst werden, heißen Finden, Auswählen, Verwenden, Verformen, Verwandeln. Die Analyse der bildenden Kunst unserer Gegenwart hat aufgezeigt, daß auch der Zufall zum Material werden kann; die ›befreienden Verfahren‹ provozie-
46 Otto, Gunter: »Nachwort über Kommunikation«, in: Breyer, Herber u. a. (Hg.): Kunstunterricht, Düsseldorf, 1973, S. 169. 47 Pfennig, Reinhard: Gegenwart der Bildenden Kunst, Oldenburg, 1974, S. 120, Hervorh. i. O. 48 Vgl. ebenda, S. 117. 49 Ebenda, Anhang Begriffserklärungen, S. 331. 50 Ebenda, S. 117, Hervorh. i. O. 51 Ebenda, S. 123. 52 Ebenda, S. 117, Hervorh. i. O. 53 Ebenda, S. 118, Hervorh. i. O.
5 Bildnerisches Denken | 247
ren geradezu den Zufall. Dieses Material löst Entdecken, Enthüllen und Ordnen als bildnerische Denkvorgänge aus.«54
Der Schwerpunkt von Pfennigs Konzept des Kunstunterrichts liegt auf abstrakten Bildgestaltungen, was durch die Orientierung an der damals zeitgenössischen Kunst erklärt werden kann. Dies wird nicht nur an den gewählten Bildbeispielen aus der Kunst deutlich,55 sondern auch an den abgebildeten Schülerlösungen von Aufgabenstellungen,56 die mustergültig »Wege aufzeigen, die für fundamentale Einsichten in bildnerische Probleme geeignet sind«57. In seinen weiteren Erläuterungen zu diesen bildnerischen Problemen zeigt sich, dass hiermit weitgehend oder gänzlich formale Probleme gemeint sind, wie am Beispiel folgender Aufgabenstellung deutlich wird: »Die schwarze Form ist so schwer, wir wollen sie einmal ganz leicht machen.«58 Die bildnerischen Probleme, die Pfennig bei dieser Aufgabe als zentral herausstellt, sind rein formaler Natur, inhaltliche Aspekte der Bilder spielen keine Rolle: »In dieser Aufgabe sind verschiedene Probleme enthalten und sehr verschiedene Lösungen möglich. Zu bestimmen ist der Ort der Form im Bildraum, die Formgestalt dieser schweren schwarzen Form, das Verhältnis des Schwarz zu einem anderen oder zu den umgebenden Farben, und wie kann man es leichtmachen?«59
Bildnerisches Denken scheint er als das Denken zu begreifen, das solche formalen Probleme löst, denn er schreibt in Bezug auf die genannte beispielhafte Aufgabe: »Daraus folgt unter anderem eine notwendige Neubesinnung auf das, was der Schüler unbedingt lernen müßte, auf die unbedingt notwendigen Aufgaben, an denen der Schüler bildnerisches Denken und Verhalten erlernen kann.«60 Noch deutlicher drückt er sich an anderer Stelle aus, indem er betont, dass das Thema oder das Motiv eines Bildes für den Kunstunterricht eine untergeordnete Rolle spielt:
54 Ebenda. 55 Vgl. ebenda, Abbildungsverzeichnis, S. 338. 56 Vgl. ebenda, S. 165 und v. a. ab. S. 201. 57 Ebenda, S. 201, Hervorh. i. O. 58 Ebenda, S. 165. 59 Ebenda. 60 Ebenda.
248 | Bildnerisches Denken
»Nicht das Motiv, nicht das Thema, nicht der zu malende Gegenstand, sondern das Malen, das Zeichnen, das Formen oder Bauen, also die jeweilige bildnerische Realisation interessiert den Schüler. […] Wir haben bisher immer angenommen, daß zu jeder Aufgabe ein ›Motiv‹ oder ein ›Thema‹ (wie es allgemein in der Kunsterziehung genannt wird) gehören müßten. Motivation aber besagt, daß es sich nicht um das Motiv, sondern um die Begründung einer bildnerischen Aufgabe handelt. […] Nehmen wir also das Thema nicht wichtiger als das Bild, das Thema sei Motiv, es bewege und sei nur Anlaß zum Bilden.«61
Pfennig entwirft hier ein Konzept von Kunstunterricht, welches das Verhältnis von Form und Motiv bzw. Thema – oder anders ausgedrückt: von Form und Inhalt – umkehrt.62 Entsprechend plädiert er dafür, dass die Form, d. h. die » bildnerischen Probleme als Inhalte begriffen werden.«63 Ganz ähnliche Ansichten vertritt Günter Wienecke in einem Band, den er u. a. zusammen mit Gunter Otto geschrieben und herausgegeben hat.64 Wienecke bezieht sich in seiner Erklärung des Begriffs »Bildnerisches Denken« explizit auf Pfennig, und über diesen auch auf Klee und Haftmann.65 In Übereinstimmung mit dem hier vertretenen Modell geht auch Wienecke davon aus, dass das Bildnerische Denken vom begrifflichen Denken zu unterscheiden ist: »Die Auffassung herrscht vor, daß bildnerisches Denken bei der Schaffung graphischer, malerischer oder plastischer Gebilde auftritt. Es wird herausgestellt, daß bildnerisches Denken eine andere Art zu denken bedeutet als das Denken in Begriffen. Nach V. Zuckerkandl ist es eben ausschließlich ein
Denken zu Bildern, sind es Denkakte, die als Resultat Bilder zeitigen.«66
Auch in den Erläuterungen Wieneckes ist eine deutliche Tendenz zur formalistischen Reduktion des Bildnerischen Denkens festzustellen. Wie bei Pfennig wird es als das Lösen bildnerischer Probleme aufgefasst: »Zusammenfassend läßt sich sagen, daß bildnerisches Denken als Reflexion über bildnerische Probleme aufzufassen ist.«67 Diese bildnerischen Probleme werden
61 Ebenda, S. 162–163. 62 Vgl. ebenda, S. 163. 63 Ebenda, S. 210, Hervorh. i. O. 64 Breyer, Herber u. a. (Hg.): Kunstunterricht, Düsseldorf, 1973. 65 Vgl. Wienecke, Günter: »Bildnerisches Denken als Inhalt«, in: Breyer, Herber u. a. (Hg.): Kunstunterricht, Düsseldorf, 1973, S. 77. 66 Ebenda, Hervorh. i. O. 67 Ebenda, S. 93, Hervorh. i. O.
5 Bildnerisches Denken | 249
weitgehend als formale Probleme bestimmt, aber nicht durchgängig, woran die mangelnde systematische Ausarbeitung des Konzeptes sichtbar wird. So listet Wienecke z. B. einen »Katalog bildnerischer Probleme«68 auf, der neben den Kategorien »Bildelemente« und »Syntax« auch eine Kategorie »Semantik« enthält,69 was einer rein formalen Auffassung bildnerischer Probleme widerspricht. An anderer Stelle wird eine »Klassifikation« der bildnerischen Probleme vorgestellt, die nur formale Aspekte enthält: »Am Ende des vorgestellten Unterrichtsverlaufs steht als Ergebnis die Formulierung von Gesichtspunkten zur Klassifikation bildnerischer Probleme, nämlich solche des Farb- und Formeinsatzes sowie des Bildaufbaus.«70 Diese beiden Klassen von bildnerischen Problemen entsprechen den Problemen, für die die ersten beiden Funktionen des Bildnerischen Denkens (im hier vorgestellten Modell) zuständig sind. Wie bei Pfennig ist das Verbinden – und damit der Bezug zur Welt bzw. der Inhalt eines Bildes – unberücksichtigt. Kritisiert wurde das Konzept des »Kunstunterrichts« und des darin formulierten »Bildnerischen Denkens« vor allem deshalb, weil es mit dem Anspruch vertreten wurde, sämtliche Inhalte der schulischen Kunstpädagogik umfassend zu beschreiben: »Zu den kognitiven Komponenten im Lehrprozeß zählt […] das Verständnis des Lehrers für die Struktur des Stoffgebietes. Für den Kunstpädagogen versteht es sich als Einsicht in die Struktur der Sachverhalte, die Gegenstand des bildnerischen Denkens sind.«71 Einer der schärfsten Kritiker dieser Reduktion der Kunstpädagogik ist Hermann Ehmer: »Bisher ging es in der Kunstpädagogik fast ausschließlich um das Phänomen der Gestaltung, also um syntaktische Aspekte«72. Sehr deutlich formuliert er seine Ablehnung dieser Reduktion: »In der Theorie des Kunstunterrichts, besonders dann in ihrer ›reinsten‹ Ausformulierung bei Reinhard Pfennig, ist aber die konkrete Wirklichkeit kein eigentliches Problem der Kunsterziehung mehr.«73 »Man muß schon fragen, welche Identität sich Kunstunterricht, der sich so definierte, zugelegt hatte.
68 Wienecke, Günter: »Bildnerisches Denken als Methode«, in: Breyer, Herber u. a. (Hg.): Kunstun-
terricht, Düsseldorf, 1973, S. 118. 69 Vgl. ebenda. 70 Ebenda, S. 107, Hervorh. i. O. 71 Ebenda, S. 101, Hervorh. i. O. 72 Ehmer, Hermann K.: »Vorwort«, in: ders. (Hg.): Kunst/Visuelle Kommunikation, Steinbach (Giessen), 1974, S. 7. 73 Ehmer, Hermann K.: »Krise und Identität«, in: Hartwig, Helmut (Hg.): Sehen lernen, Köln, 1976, S. 28.
250 | Bildnerisches Denken
Ein Fach, unter dem Anspruch angetreten, das Sehen zu lehren, leugnet die Bedeutung der gesamten sichtbaren Welt für das erkennende Subjekt«.74 »Daß […] das Nichtmeinen des Gegenstands im bildnerischen Denken erst ›die Freiheit des Denkens‹ gewährleisten soll, ist heute nicht mehr nachvollziehbar.«75
Seine Kritik geht aber noch weiter, denn er sieht im Konzept des Bildnerischen Denkens eine gesellschaftskonforme Ausbildung der Schüler und fordert stattdessen eine Erziehung zum »kritischen Denken«: »Statt den Schüler […] über bewußte Rezeption zu kritischer Rezeption zu befähigen, verband man mit ihrer Vermittlung den Zweck, ›über die Einsicht in bildnerische Denkstrukturen der Erwachsenen, d. h. ihre Kunst‹ …›das Kind in die Ordnung der Gesellschaft hineinzuführen‹ (Pfennig). Statt den Schüler an kritisches Denken zu gewöhnen, hielt man ihn im bildnerischen Denken befangen. Bildnerisches Denken – was immer das sein mag – definiert sich wenigstens annäherungsweise dadurch, daß es sich der rationalen Ergründung und Ableitung seiner Konstituenten verschließt; Erziehung zum bildnerischen Denken bedeutet immer auch Vorenthaltung von Rationalität.«76
Auch Hans Giffhorn äußert scharfe Kritik am Konzept des Bildnerischen Denkens – zumindest in seiner formalistischen Reduktion. So führt er an, dass das Bildnerische Denken nur für spezielle Berufszweige von Nutzen sei und daher an allgemeinbildenden Schulen überflüssig: »Ein Denken, das in der Auseinandersetzung mit bildnerischen Mitteln und Problemen und mit irgendwelchen Gestaltungslehren geschult wird, mag höchstens für den Menschen sinnvoll sein, der Sachverhalte visuell kommunizieren will (der zum Beispiel als Grafiker oder als Maler arbeitet). Die allgemeinbildende Schule hat jedoch nicht die Aufgabe, zum Beispiel Werbegrafiker auszubilden – sie muß zu einem Denken erziehen, das die Orientierung in der Umwelt und dadurch sinnvolle Entscheidungen ermöglicht. Bildnerisches Denken hat mit diesem Denken ebenso wenig zu tun, wie zum Beispiel das zusammenhanglose Wissen um die Farb-, Form- und Hell-Dunkelbeziehungen, die optischen Strukturen eines Gegenstandes mit dem Wissen um die Bedeutung z. B. des Gebrauchswertes und des Tauschwertes dieses Gegenstandes für uns.«77
74 Ebenda. 75 Ebenda, S. 29. 76 Ehmer, Hermann K.: »Vorwort«, in: ders. (Hg.): Kunst/Visuelle Kommunikation, Steinbach (Giessen), 1974, S. 8. 77 Giffhorn, Hans: Kritik der Kunstpädagogik, Köln, 1972, S. 98–99, Hervorh. i. O.
5 Bildnerisches Denken | 251
Gegenwärtig gibt es vor allem einen Gestaltungslehrer, der den Begriff des »Bildnerischen Denkens« zur Beschreibung seiner Lehre verwendet. Peter Jenny versteht seinen Unterricht in den Grundlagen bildnerischen Gestaltens als Schule des Bildnerischen Denkens.78 Dabei knüpft er nur lose an die Tradition des Bauhauses an.79 Eine systematische Erklärung oder Begründung dieses Denkens liefert er allerdings nicht, obwohl er selbst das Fehlen einer systematischen Lehre des Bildnerischen Denkens bemängelt.80 Seine Veröffentlichungen legen stattdessen den Schwerpunkt auf eine reich bebilderte Dokumentation seiner Lehre an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. In einem Aufsatz mit dem Titel »Bildnerisches Denken« schreibt er: »Es wird an dieser Stelle kaum möglich sein, die Totalität der Zusammenhänge beschreibend zu erfassen, die das komplexe Feld des bildnerischen Denkens und des bildnerischen Gestaltens ausmachen.«81 Dabei hält Jenny das Bildnerische Denken für wesentlich – und zwar nicht nur als Grundlage für alle gestalterischen Tätigkeiten, sondern für alle Menschen, als wesentliches Element ihres Menschseins: »Denn bildnerisches Denken gehört zu den Grundbedürfnissen, auch wenn sich diese Erkenntnis nirgends in den Stundenplänen niederschlägt. [...] Denn wer mittels der eigenen und der verfügbaren Bilder zu denken lernt, gewinnt dadurch ein Stück Lebensqualität in Form von Vorstellungsvermögen und auch einen Weg, über die Schule hinaus lernfähig zu bleiben.«82
Auf die oben erläuterte kunstpädagogische Diskussion der 60er/70er Jahre um den Begriff des Bildnerischen Denkens lässt sich Jenny nicht ein. Möglicherweise ist diese Kontroverse nicht bis in die Schweiz vorgedrungen, wo Jenny am Department Architektur der ETH Zürich unterrichtet hat, denn anscheinend wird der Begriff dort in mehreren Zusammenhängen völlig ohne Vorbehalte verwendet. So hat beispielsweise die »Arbeitsgruppe der Schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung«, in der Dozenten aller Pädagogischer Hochschulen der deutschen Schweiz und der Romandie sowie der Hochschulen der Künste zusammenarbeiten, in einem Dokument das »Bildnerische Denken und Handeln von Kindern und Jugendlichen« als
78 Vgl. Wick, Rainer: »Vorwort«, in: Jenny, Peter: Bildkonzepte, Mainz, Zürich, 2000, S. 9. 79 Vgl. ebenda, S. 7. 80 Vgl. Jenny, Peter: »Warum Bilder nicht allein den Spezialisten überlassen werden dürfen«, in: ders.: Das Wort, das Spiel, das Bild, Zürich, 1996, S. 232. 81 Jenny, Peter: »Bildnerisches Denken«, in: Die Zukunft beginnt im Kopf, Zürich, 1994, S. 126. 82 Ebenda, S. 128–129.
252 | Bildnerisches Denken
einen von acht zentralen Bereichen für das Schulfach »Bildnerische Gestaltung und Kunst« ausgezeichnet.83 In jüngster Zeit hat Jochen Krautz in einem kurzen Text84 einen Versuch unternommen, den Begriff des Bildnerischen Denkens zu rehabilitieren. Dabei zeigt er einerseits Verständnis für den damaligen Vorwurf des Formalismus, den er zum Teil für berechtigt hält.85 Andererseits schließt er Überlegungen darüber an, in welchem Sinne der Vorwurf überzogen war. So weist er darauf hin, »dass auch die Form Ausdrucks- und damit Aussagequalität besitzt«86. Eine strenge Trennung zwischen Form und Inhalt wäre also gar nicht möglich. Daher hält er es für ein lohnendes Unternehmen, »offene Fragen an eine schulische Didaktik des Bildnerischen Denkens«87 zu beantworten. 5.1.3 Abgrenzung zum Modell des Bildnerischen Denkens Die hier vorgestellten Konzepte des Bildnerischen Denkens aus Philosophie und Kunstpädagogik weisen mehrere Gemeinsamkeiten auf: Erstaunlicherweise beziehen sich alle Autoren implizit oder explizit auf Paul Klee, obwohl völlig unklar ist, ob er diesen Begriff jemals verwendet hat. Zudem wird der Begriff sowohl in philosophischen wie auch in kunstpädagogischen Zusammenhängen weitgehend gar nicht oder nur unzureichend systematisch begründet. Deutliche Ausnahme ist hier das Konzept von Stephan Schmidt. Sein Versuch, das Element des Begrifflichen im Bildnerischen Denken nachzuweisen, kann dennoch nicht überzeugen. Die Systematisierung des Bildnerischen Denkens, die im Konzept des »Kunstunterrichts« vorgenommen wird, ist zum Teil widersprüchlich. Insgesamt überwiegt jedoch der Eindruck, dass sie eine formalistische Verkürzung des hier vorgeschlagenen Modells darstellt. Das Bildnerische Denken wird im Folgenden als konkretisierendes Denken beschrieben, das als solches unabhängig von Begriffen ist. Zudem wird es als nicht formalistisch ausgezeichnet, weil zu ihm nicht nur das Wahrnehmen von Farben und Formen und ihr Zusammensetzen gehört, sondern
83 Vgl. Glaser-Henzer, Edith: »Einblicke in die Entwicklung der Fachdidaktik Bildnerisches Gestalten in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung«, in: Beiträge zur Lehrerbildung, 2013. 84 Vgl. Krautz, Jochen: »Bildnerisches Denken lehren und lernen«, in: Cron, Béatrice; Tobias, Karen Betty: Faszination Komposition, Frankfurt a. M., 2014. 85 Vgl. ebenda, S. 8. 86 Ebenda, S. 9. 87 Ebenda, S. 11.
5 Bildnerisches Denken | 253
auch das Herstellen von Verbindungen zur Welt sowie das Erfinden von Bildern. Damit wird das Bildnerische Denken als das Denken ausgezeichnet, das Bilderfahrung im Allgemeinen überhaupt erst möglich macht. Dennoch beschreibt das Modell des Bildnerischen Denkens nicht alle Denkprozesse, die im Zusammenhang mit Bildern auftreten können, sondern nur diejenigen, die konstitutiv für die Bilderfahrung sind. Noch viel weniger beschreibt es alles, was im schulischen Kunstunterricht gelehrt und gelernt werden sollte.
254 | Bildnerisches Denken
5.2
K ONKRETISIEREN IN DEN VIER F UNKTIONEN In diesem Kapitel werden die Funktionen des Bildnerischen Denkens abgegrenzt von anderen Denkprozessen, die im Zusammenhang mit Bildern auftreten können. Denn Bildbetrachtung ist zwar immer Bildnerisches Denken, aber Bildrezeption ist meist mehr als Bildnerisches Denken. Für das Verständnis eines Bildes kann in vielen Fällen auf das abstrahierende Denken nicht verzichtet werden – auch wenn es nicht bildspezifisch ist, weil es nicht dafür verantwortlich ist, dass aus einer Erfahrung eine Bilderfahrung wird. Konkretisierendes visuell-plastisches Denken ist bildspezifisch, d. h. bildnerisch. Zwar gibt es Fälle, in denen das Bildnerische Denken nicht vollständig vollzogen wird, sondern beispielsweise nur die Funktionen des Wahrnehmens oder des Zusammensetzens. In diesen Fällen kann nicht davon gesprochen werden, dass etwas als Bild betrachtet wird. Insofern können zumindest Teile des Bildnerischen Denkens – also einzelne Funktionen – auch in Zusammenhängen auftreten, die man nicht als Bilderfahrung bezeichnen kann. Sobald aber die dritte Funktion vollzogen wird, ist das Bildnerische Denken vollständig und macht aus einer Erfahrung eine Bilderfahrung. Die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens sind also zusammen genommen bildspezifisch und treten nur in einer Bilderfahrung auf. Viele Denkprozesse, die im Rahmen einer Bildrezeption vollzogen werden, können beispielsweise in gleicher Weise auch bei einer Textrezeption vonstattengehen. Wie bereits in Kapitel 3.4.3 erläutert, können abstrahierende und konkretisierende Denkprozesse aufeinander bezogen sein, ohne dabei ihre klare Unterscheidbarkeit zu verlieren. DENKVOLLZÜGE BEI DER REZEPTION UND PRODUKTION VON BILDERN bildnerisch nicht-bildnerisch = konkretisierend & = abstrahierend visuell-plastisch visuell-plastisch nicht-visuell-plastisch = schematisierend
Tabelle 20: Denken im Zusammenhang mit Bildern Dies soll im Folgenden für jede der vier Funktionen des Bildnerischen Denkens gezeigt werden. Diese Erläuterung geschieht dabei entsprechend der in Tabelle 20 dargestellten Systematik. Zunächst werden in einem ersten Schritt die Denkprozesse der jeweiligen bildnerischen Funktion erläutert,
5 Bildnerisches Denken | 255
und es wird gezeigt, inwiefern es sich hierbei um konkretisierendes Denken handelt. Dass dieses Denken zugleich visuell-plastisch ist, muss nicht für jede Funktion neu begründet werden, da die Funktionen 2–4 auf dem bildnerischen Wahrnehmen von Farben und Formen aufbauen und nicht ohne dieses möglich sind. Zusätzlich wird dargelegt, ob und inwiefern die jeweilige bildnerische Funktion außerhalb einer Bilderfahrung auftreten kann. In einem zweiten Schritt wird das Bildnerische Denken in jeder einzelnen Funktion von solchen nicht-bildnerischen Denkvollzügen abgegrenzt, die ebenfalls in einer Bildrezeption oder -produktion eine Rolle spielen können. Innerhalb der nicht-bildnerischen Denkvollzüge kann weiter zwischen dem visuell-plastischen (= schematisierenden) Denken und dem nicht-visuellplastischen Denken unterschieden werden. Von beidem werden die Funktionen des Bildnerischen Denkens abgegrenzt. Die Beschreibung der bildnerischen Denkprozesse in Abgrenzung einerseits zum schematisierenden und andererseits zum nicht-visuell-plastischen Denken wird anhand des Gemäldes »Der Mechaniker« von Fernand Léger (Abb. 33) beispielhaft dargelegt. 5.2.1 Funktion Wahrnehmen Die Gegenstände, auf die sich das bildnerische Wahrnehmen bezieht, sind Farben und Formen. Diese werden dann konkretisierend, d. h. bildnerisch wahrgenommen, wenn darauf geachtet wird, was sie von anderen vergleichbaren Farben und Formen unterscheidet. Das schematisierende Wahrnehmen besteht dagegen im Identifizieren klassifizierbarer Formen und Farben. Nicht-visuell-plastisches Wahrnehmen – also das Wahrnehmen durch andere Sinne – spielt in den Prozessen der Bildrezeption oder -produktion naturgemäß keine Rolle. 5.2.1.1 Bildnerisches Wahrnehmen Bei der Rezeption oder Produktion des Bildes von Fernand Léger (Abb. 33) besteht das bildnerische Wahrnehmen unter anderem im Erkennen bzw. Herstellen der annähernden Kreisformen in verschiedenen Bildteilen: im Kopf, in der Schulter und im Hintergrund. Jede dieser Form muss dabei in ihrer jeweiligen Größe sowie mit ihrer Abweichung vom mathematisch exakten Kreis wahrgenommen werden. Auch die anderen, vorwiegend rechtwinkligen Formen im Hintergrund sowie die genauen Farbwerte der farbigen Flächen, die z. T. Farbverläufe enthalten, werden im bildnerischen Wahrnehmen in ihrem Unterschied zu vergleichbaren Farben und Formen betrachtet bzw. gestaltet. Eine exemplarische Auswahl der wahrnehmbaren Farben und Formen aus dem Gemälde von Léger ist in Abb. 34 zu sehen.
256 | Bildnerisches Denken
Abb. 33: Fernand Léger: »Le mécanicien« (Der Mechaniker), 1920, Öl auf Leinwand, 116 × 88,8 cm
Abb. 35: Digitale Bearbeitung 2 von: Fernand Léger: »Le mécanicien« (Der Mechaniker), vgl. Abb. 33
Abb. 34: Digitale Bearbeitung 1 von: Fernand Léger: »Le mécanicien« (Der Mechaniker), vgl. Abb. 33
Abb. 36: Kompositionsanalyse zu: Fernand Léger: »Le mécanicien« (Der Mechaniker), vgl. Abb. 33
5 Bildnerisches Denken | 257
Dieses Erkennen von Differenzen ist dabei keinesfalls trivial. Zwar meint wohl jeder zu wissen, wie beispielsweise der Hautton eines hellhäutigen Menschen aussieht. Stellt man aber ungeübten Malern die Aufgabe, diesen Hautton zu mischen, werden viele von ihnen an ihre Grenzen stoßen. Und dies ist nicht dadurch begründet, dass sie den Pinsel nicht richtig führen oder die Farben nicht ineinander mischen können. Stattdessen liegt es daran, dass sie nicht wirklich sehen, wie der Hautton aussieht. Zunächst ist vielen wahrscheinlich nicht einmal so genau klar, dass es den einen Hautton gar nicht gibt, sondern dass neben den individuellen Unterschieden auch innerhalb einer Hautpartie unterschiedliche Tönungen auftreten können. Die Konkretisierungsleistung im bildnerischen Wahrnehmen liegt darin, diese Differenzen genau zu analysieren, d. h. zu erkennen, welche der Tönungen leicht ins Grünliche, welche ins Rötliche oder Bläuliche geht. Genauso verhält es sich mit dem Wahrnehmen von Formen. Jeder weiß im Prinzip, wie ein menschlicher Kopf im Profil aussieht. Die meisten Menschen können auch ganz ohne Probleme Personen, die ihnen bekannt sind, im Profil wiedererkennen. Stellt man ihnen aber die Aufgabe, ein solches Profil oder sogar das Profil eines bestimmten Menschen zu zeichnen, werden die meisten Laien daran scheitern, und dies ebenso nicht deswegen, weil sie den Stift nicht halten oder keine Linien zeichnen können. Sie sind nicht in der Lage, den Winkel der Nase, seine Veränderung hin zur Nasenspitze, die Dicke der Nasenspitze, den Winkel des Kinns etc. genau zu sehen. Diese Fähigkeit ist nicht nur für die Produktion eines Portraits, sondern ebenso für die Rezeption von entscheidender Bedeutung, zumindest wenn diese Rezeption über das bloße Wiedererkennen der dargestellten Gegenstände hinausgehen und zu einer Bildbetrachtung werden soll. Wir können uns des bildnerischen Wahrnehmens in unserem Alltag auch außerhalb einer Bilderfahrung bedienen. Dies tun wir beispielsweise, wenn wir für eine Zimmereinrichtung einen Vorhang auswählen wollen, der exakt denselben Rotton hat wie das Sofa. Dieses Ziel erreicht man umso besser, je genauer man hierbei die verschiedenen Rotnuancen beachtet, die eventuell auch durch den unterschiedlichen Glanz oder die unterschiedliche Webart des Stoffes beeinflusst werden. Ein anderes Beispiel für bildnerisches Wahrnehmen, dessen sich jemand unabhängig von einer Bilderfahrung bedient, ist die differenzierende Wahrnehmung eines Kriminologen, wie sie z. B. von Sir Arthur Conan Doyle dem fiktiven Detektiven Sherlock Holmes zugeschrieben wird. Wenn Holmes beispielsweise aus der Form eines Blutflecks an der Wand den Tathergang und die Mordwaffe erschließt, ist ihm das nur möglich, weil er die Form des Flecks im Unterschied zur
258 | Bildnerisches Denken
Form möglicher anderer Blutflecke wahrnimmt. Dennoch handelt es sich nicht um Bildnerisches Denken, da die Funktionen des bildnerischen Zusammensetzens und Verbindens fehlen. Holmes fügt den Fleck nicht in eine räumlich wahrnehmbare Eingrenzung ein, auf die er die Form des Flecks dann beziehen würde. Er stellt zwar Verbindungen zwischen der Form des Flecks und der Welt her, aber nicht zwischen der Anordnung des Flecks innerhalb der räumlichen Eingrenzung und der Welt. Wenn der Blutfleck fotografiert wird, ist es für Holmes’ Analyse völlig irrelevant, in welchem Verhältnis der Fleck zum Rand des Fotos steht. Daher kann man hier nicht davon sprechen, dass Holmes eine Bilderfahrung hat oder bildnerisch denkt. Er nimmt nur bildnerisch wahr. 5.2.1.2 Nicht-Bildnerisches Wahrnehmen Das schematisierende Wahrnehmen versucht, klassifizierbare Farben und Formen zu erkennen bzw. herzustellen. Bei der Auswahl des Vorhangs übersieht es die feinen Farbnuancen und gibt sich stattdessen mit einem Farbton zufrieden, der in die gleiche Kategorie passt, z. B. »Weinrot«. Beim Gemälde von Léger identifiziert es beim Wahrnehmen oder Herstellen beispielsweise nur die Formen als »Kreise« und »Streifen« und die Farben als »Rot«, »Gelb«, »Schwarz« oder »Weiß«, ohne die Abweichungen und genauen Größenverhältnisse der Formen oder die genauen Farbnuancen zu registrieren. Sobald das, worauf die Konzentration fällt, selbst nicht mehr wahrnehmbar ist, handelt es sich um abstrahierendes, d. h. schematisierendes Wahrnehmen. So ist ein »Kreis« schlechthin nicht wahrnehmbar. Jeder wahrnehmbare Kreis hat immer eine bestimmte Größe. Wird von dieser Größe abgesehen, kann es sich nicht mehr um Bildnerisches Denken handeln. Die einmalig wahrgenommenen Formen werden so unter eine Kategorie subsumiert. Ziel einer solchen Subsumierung könnte beispielsweise sein, die Vorliebe des Malers für Kreisformen zu belegen. In einem solchen Fall wird die Einmaligkeit des Bildes außer Acht gelassen und die Form stattdessen nur als ein Fall von vielen, d. h. in ihrer Gemeinsamkeit mit anderen Formen, betrachtet. Im Rahmen einer kunstwissenschaftlichen Bildrezeption kann eine solche abstrahierende Denkleistung durchaus angebracht und aufschlussreich sein. 5.2.2 Funktion Zusammensetzen Gegenstand des bildnerischen Zusammensetzens sind Kombinationen von Farben und Formen sowie deren Wechselwirkungen untereinander und in Bezug zum Ganzen. Dies wird auch als »Komposition« eines Bildes be-
5 Bildnerisches Denken | 259
zeichnet. Sie wird dann konkretisierend, d. h. bildnerisch zusammengesetzt, wenn darauf geachtet wird, was sie von anderen vergleichbaren Kompositionen unterscheidet. Das Zusammensetzen kann in vielen Lebensbereichen unabhängig vom Umgang mit Bildern eine Rolle spielen. Das schematisierende Zusammensetzen besteht hingegen im Identifizieren klassifizierbarer Zusammensetzungen. Auch nicht-visuell-plastisches Zusammensetzen kann in den Prozessen der Bildrezeption oder -produktion relevant sein, wie im Folgenden gezeigt wird. 5.2.2.1 Bildnerisches Zusammensetzen Das Gemälde von Léger wird bildnerisch dadurch zusammengesetzt, dass die genaue Anordnung der Kreis- & Rechtecksformen, der anderen Formen sowie der verschiedenen Farben erkannt bzw. hergestellt wird (siehe Abb. 35 und Abb. 36). Auffällig ist der starke Kontrast zwischen den abgerundeten Formen in der Figur und den weitgehend rechtwinkligen Formen im Hintergrund. Dennoch werden diese beiden Bildebenen kompositorisch stark aufeinander bezogen und zu einer Einheit zusammengefügt. Dies geschieht durch die ausgeglichene, stark symmetrisch aufgebaute Komposition. Sie wird gestützt durch die zentral angeordnete Figur sowie durch die Streifen, welche die Figur links und rechts flankieren und die Horizontale und Vertikale betonen. Zudem korrespondieren die Kreisformen des Kopfes und der Schultern mit zwei Kreisformen links und rechts von der Figur im Hintergrund. Selbst im Rauch der Zigarette wird die Kreisform nochmals aufgegriffen. Auch wenn hier mehrere Formen im Bild als Kreisformen beschrieben werden, handelt es sich dennoch nicht um abstrahierendes Wahrnehmen oder Zusammensetzen. Denn hier geht es immer noch um ganz konkrete Kreisformen, deren kompositorischer Bezug zueinander von mehr als nur ihrer abstrakten Kreisform abhängt. Abgesehen davon, dass keine der Formen einen vollständigen Kreis darstellt, ist ihre jeweils einmalige Größe und Position innerhalb des Bildes entscheidend für den Bezug zwischen ihnen (vgl. Abb. 36). Dieses einmalige Kompositionsgefüge zu erkennen bzw. herzustellen, ist eine Leistung des bildnerischen Zusammensetzens. Ähnlich wie das bildnerische Wahrnehmen kann das bildnerische Zusammensetzen z. T. recht schwer sein und viel Übung verlangen, wie man gut am Beispiel eines Portraits erklären kann. Sowohl in der Bildproduktion als auch in der Rezeption eines Portraits ergeben sich im bildnerischen Zusammensetzen sehr komplexe Aufgaben. Ein Maler oder Zeichner muss in der Lage sein, in seinem Bild die einzelnen Teile des Gesichts richtig zu-
260 | Bildnerisches Denken
sammenzusetzen, d. h. er muss sehr gut darin sein, Proportionen zu erkennen und umzusetzen. Bei einem Portrait, das dem Portraitierten ähnlich sehen soll, ist das besonders schwierig. Der Grund hierfür liegt darin, dass wir als Gemeinschaftswesen stark darauf angewiesen sind, individuelle Gesichter zu erkennen. Diese Fähigkeit benötigen wir für unser Gemeinschaftsleben, da wir z. B. unsere Familienmitglieder wiedererkennen müssen. Bereits die kleinste Proportionsveränderung im Gesicht würde dazu führen, dass wir die Person nicht mehr als sie selbst erkennen würden. Das Schwierige ist aber nicht, zu erkennen, dass die Proportionen in einem gemalten Portrait nicht stimmen. Schwierig ist vielmehr, genau zu erkennen, was nicht stimmt bzw. was geändert werden muss, damit es stimmt. Aus diesem Grund ist es für die meisten Menschen sehr schwer, ein Portrait von einer Person herzustellen, das der Person ähnlich sieht. Dies liegt, wie auch schon beim bildnerischen Wahrnehmen, nicht daran, dass die meisten Menschen mit dem Stift nicht umgehen können, sondern dass sie im Konkretisieren in Bezug auf Farb- und Formzusammensetzungen nicht geübt sind. Sie sind nicht in der Lage, genau zu sehen, worin sich die Formzusammensetzungen des einen Gesichts (d. h. die Proportionen) im Vergleich zu einem anderen Gesicht unterscheiden. Dieselbe Schwierigkeit kann uns beim Betrachten eines Portraits begegnen, wenn uns beispielsweise ein Maler ein Portrait unserer Mutter präsentiert, das ihr zwar ähnlich sieht, auf dem sie aber einen völlig untypischen Gesichtsausdruck hat. Hier können wir mit dem Maler in einen Streit darüber geraten, ob der Gegenstand des Bildes tatsächlich unsere Mutter ist oder nur eine Frau, die ihr ähnlich sieht. Je größer unsere Differenzierungsfähigkeit im bildnerischen Wahrnehmen und Zusammensetzen sind, desto bessere Argumente besitzen wir, dem Maler darzulegen, warum wir das Bild nicht kaufen möchten. Proportionen eines konkreten Gesichtes sind dabei nur ein Beispiel für die Probleme des Zusammensetzens. Anders als bei der Funktion des bildnerischen Wahrnehmens gibt es in Bezug auf die zweite Funktion des Bildnerischen Denkens verschiedenste Ansätze, allgemeine Regeln zu formulieren, nach denen das Zusammensetzen der Farben und Formen in einem Bild erfolgt oder erfolgen soll. Hierbei wird bestimmten Zusammensetzungen eine bestimmte Wirkung zugeschrieben, d. h. eine bestimmte Verbindung zur Welt. Die Rolle solcher Regeln im Bildnerischen Denken wird daher in einem der nächsten Kapitel (5.2.3.1) näher erläutert. In unserem Alltag greifen wir auch losgelöst von Bilderfahrungen auf das bildnerische Zusammensetzen zurück. Wenn wir beispielsweise mehrere
5 Bildnerisches Denken | 261
Regalbretter an eine Wand anbringen möchten, müssen wir uns für eine Anordnung der Bretter an der Wand im Bezug zur restlichen Einrichtung entscheiden. Auch hier spielt das differenzierende Erkennen von Farb- und Formzusammensetzungen eine große Rolle. 5.2.2.2 Nicht-Bildnerisches Zusammensetzen Schematisierend ist das Zusammensetzen von solchen Formen, die in der dritten Funktion als Gegenstände identifiziert und wiedererkannt werden. Es fügt beim Gemälde Légers die einzelnen Fingerformen zur Handform und die einzelnen Körperteile zur Figur zusammen. Auch das Zusammensetzen der Komposition aus Vordergrund und Hintergrund ist schematisierend, solange nicht die Unterschiede zu vergleichbaren Anordnungen von Vorderund Hintergrund berücksichtigt werden. Die aufgezählten Farb- und Formzusammensetzungen (»Fingerform«, »Handform«, »Körperteil«, »Figur«) charakterisieren das Bild von Legér nicht in seiner Einmaligkeit, sondern kommen so in vielen anderen Bildern vor. Solche Körperschemata können aber auch in bildnerischen Denkprozessen eine Rolle spielen. Genauer gesagt können abstrahierendes und konkretisierendes Denken in direktem Austausch miteinander stehen. Beispielsweise gibt es für das Zeichnen von Portraits eine Reihe von Proportionsschemata, die behilflich sein können, um grobe Proportionsfehler zu vermeiden. Eine solche schematische Regel lautet: Die Augen liegen etwa auf der horizontalen Mitte des Kopfes. Diese Regel kann als Ergebnis eines abstrahierenden Denkprozesses aufgefasst werden. Sie ist allgemein formuliert und subsumiert alle (normal gebauten) Köpfe unter sich. Mit dieser Regel kann man einen beliebigen Kopf zeichnen, der keinen Bezug zu einer realen Person hat. Folgt man beim Zeichnen einzig dieser Regel, stellt man die Visualisierung eines Schemas her, kein Bild. Es ist allerdings auch hilfreich, diese Regel zu beachten, wenn man ein Bild einer konkreten Person zeichnen möchte. In einem solchen Zeichenprozess kann nun ein ständiger Wechsel zwischen dem abstrahierenden und konkretisierenden Zusammensetzen stattfinden: Abstrahierend ist das Zusammensetzen, sofern es die angefertigte Zeichnung darauf hin kontrolliert, ob sie der allgemeinen Regel entspricht. Für diese Kontrolle ist es nicht notwendig, die konkrete Person vor Augen zu haben. Konkretisierend ist das Denken in zweierlei Hinsicht: Einmal, wenn alle anderen Merkmale beobachtet werden, die nicht durch das Schema erfasst werden. Zum anderen kann es aber auch notwendig sein, vom Schema abzuweichen, weil die konkrete Person z. B. ein auffällig langes Kinn und eine besonders kurze Stirn hat, so dass die Augen nicht mehr
262 | Bildnerisches Denken
richtig in der Mitte des Kopfes liegen. Solche Proportionsschemata können daher nur als Faustregeln gelten, deren Anwendung in jedem Fall durch das konkretisierende Denken kontrolliert werden muss. Das Schwierige beim Herstellen eines Portraits ist dieses »Switchen« zwischen den Denkarten, der abstrahierenden und der konkretisierenden. Nicht-visuell-plastisches Zusammensetzen kann bei Bildern dann eine Rolle spielen, wenn in ihnen Schriftelemente enthalten sind. Hier findet dann dasselbe Wechselspiel von abstrahierendem und konkretisierendem Denken statt, das bereits in Kapitel 3.4.3 beschrieben wurde. Das Zusammensetzen der einzelnen Buchstaben zu Wörtern und jener wiederum zu Sätzen erfolgt weder konkretisierend noch plastisch-visuell. Zwar werden die Formen der Buchstaben visuell wahrgenommen, der Gebrauch des Sehsinns ist aber in diesem Fall kontingent. Buchstaben und Wörter können genauso auditiv wahrgenommen werden. Ebenso muss das Zusammensetzen von Buchstaben zu Wörtern und von Wörtern zu Sätzen nicht notwendig visuell erfolgen. Für dieses Zusammensetzen ist zudem die genaue Form der einzelnen Buchstaben irrelevant, solange das Buchstaben-Schema erkennbar ist. Wenn hingegen die Buchstaben als bildnerische Formen wahrgenommen und bildnerisch in die Komposition eingefügt werden, kann dies nur visuell-plastisch erfolgen. Hierbei sind die genaue Form sowie die Anordnung der Buchstaben von entscheidender Bedeutung. Um ein einmaliges Gefüge aus Farben und Formen zu erfassen bzw. herzustellen, muss auf jeden feinen Unterschied zu anderen vergleichbaren Gefügen geachtet werden. Das bedeutet, dass die Buchstaben und Wörter, die in einem Bild eingefügt sind, zugleich abstrahierend und konkretisierend wahrgenommen und zusammengesetzt werden müssen. 5.2.3 Funktion Verbinden Die Gegenstände, auf die sich das bildnerische Verbinden bezieht, sind Verbindungen der Farb- und Formzusammensetzungen zur Welt. Im Unterschied zu den ersten beiden Funktionen kann die Funktion des bildnerischen Verbindens nicht unabhängig von einer Bilderfahrung auftreten. Da das bildnerische Verbinden nur ausgehend von den anderen beiden bildnerischen Funktionen möglich ist, sind mit ihm immer die ersten beiden Funktionen des Bildnerischen Denkens gegeben. Dadurch erfüllt jede Situation, in der eine Person solche bildnerischen Verbindungen herstellt, automatisch die notwendigen Bedingungen für das Bestehen einer Bildrelation. Eine Farb- und Formzusammenstellung, die bildnerisch mit der Welt verbunden wird, ist ein Bild. Da das Verbinden auf die Konkretionsleistung der beiden
5 Bildnerisches Denken | 263
anderen Funktionen aufbaut, spielen die dort gewonnenen Erkenntnisse über die relevanten Differenzen im Verbinden eine Rolle. Im bildnerischen Verbinden werden die im Wahrnehmen und Zusammensetzen beachteten Bestimmungen in Verbindung gesetzt mit Bestimmungen in der Welt (des Betrachters). Wie bereits erläutert, gibt es verschiedene Arten dieser Verbindungen und noch mehr theoretische Konzepte, diese zu kategorisieren. Entscheidend ist, dass das bildnerische Verbinden nach den Differenzen der einzelnen, einmaligen Verbindungen im Vergleich zu möglichen anderen Verbindungen sucht. Neben diesem bildnerischen Verbinden spielen in den Prozessen von Bildrezeption und -produktion oft auch schematisierendes sowie abstrahierendes nicht-visuell-plastisches Verbinden eine Rolle. 5.2.3.1 Bildnerisches Verbinden Das Gemälde von Léger wird bildnerisch dadurch mit der Welt verbunden, dass von den einzelnen Farb- und Formzusammensetzungen in ihrer Einmaligkeit Verbindungen zu Teilen der Welt erkannt bzw. hergestellt werden. So kann man beispielsweise mit dem Formkontrast zwischen den runden Formen der Figur und den rechtwinkligen Formen im Hintergrund den Unterschied zwischen Mensch und Maschine bzw. Technik verbinden. Dieser Kontrast wird aber nicht als konfliktreich dargestellt. Stattdessen ergeben die unterschiedlichen Formen ein sich gegenseitig harmonisch ergänzendes Ganzes. Daher wird auch das Verhältnis Mensch und Maschine durch das Bild als harmonisch und ausgewogen charakterisiert. Der symmetrische und statische Bildaufbau sowie die vereinfachten, wenig detailreichen Formen verhindern den Eindruck einer Momentaufnahme. Die starke Dominanz der rechten Winkel sowie der horizontalen und vertikalen Streifen im Hintergrund stützen die statische Wirkung der Komposition. Auch in der Haltung der Figur wird das Gestaltungsprinzip der Rechtwinkligkeit aufgegriffen. Während der Oberkörper frontal zum Betrachter gewandt ist – und damit parallel zur Bildfläche –, wird uns der Kopf im Profil präsentiert – also in einer 90°-Drehung im Verhältnis zum Oberkörper. Die Haltung der Figur ist so zwar sehr unnatürlich, fügt sich aber dadurch harmonisch in das statische Kompositionsgefüge des Hintergrundes ein. Das Dargestellte bzw. der Bildgegenstand ist damit nicht ein zufälliger Moment einer kurzen Zigarettenpause eines individuellen Mechanikers, der in einer natürlichen Haltung seine Zigarette raucht. Gegenstand des Bildes bzw. des Bildnerischen Denkens ist der Mechaniker schlechthin, der in seiner Tätigkeit aufgeht und eins wird mit seiner Maschine. Durch diese Beschreibung wird deutlich, wie durch die einmalige Farb- und Formanordnung des Gemäldes von Legér der
264 | Bildnerisches Denken
Bildgegenstand bestimmt wird bzw. eine einmalige Verbindung zur Welt hergestellt wird. Auch beim Betrachten oder Gestalten des Portraits einer konkreten Person als Bild spielt das bildnerische Verbinden als Konkretisieren eine entscheidende Rolle. So geht es dem bildnerischen Verbinden nicht darum, einen einfachen Verweis des Bildes auf die Person herzustellen. Eine solche verweisende Verbindung besteht beispielsweise auch zwischen der Person und ihrem Passfoto oder ihrem Namenszug. Das bildnerische Verbinden sucht bei einem Portrait danach, worin sich die Verbindung des Portraits von der des Passfotos unterscheidet. Zur Beantwortung dieser Frage muss das Verbinden auf die erkannten Differenzen aus den anderen beiden Funktionen zurückgreifen. So kann der Betrachter eine Verbindung herstellen zwischen einerseits den Bestimmungen des Portraits (z. B. der Blickwinkel auf die Person, die Position des Kopfes im Bezug zum Rahmen, die Dicke der Augenkontur, die Form der Schatten unter den Augen etc.) und andererseits den Bestimmungen der Person (z. B. ihre Charaktereigenschaften, ihr Temperament oder ihre derzeitige Lebenssituation). Dadurch, dass diese Fülle von einzelnen Bestimmungen beachtet wird, kann die Einmaligkeit, die dieses eine Portrait von allen anderen Portraits derselben Person unterscheidet, deutlich werden. Der Vollzug des Verbindens ist in diesem Sinne konkretisierend. Wie bereits in Kapitel 4.1.3.3 angedeutet, gibt es verschiedene Ansätze, Regeln des bildnerischen Zusammensetzens und Verbindens zu formulieren. Solche Regeln schreiben beispielsweise bestimmten Farb- oder Formzusammensetzungen eine bestimmte psychologische Wirkung zu. Kandinskys Punkt und Linie zu Fläche88 ist eines der prominentesten Beispiele für ein solches Regelwerk aus dem Bereich der Kunst. Die Gestaltpsychologie hat ihren Beitrag zu diesem Thema in den Gestaltgesetzen formuliert. Sicherlich sind einige dieser Regelwerke nicht interkulturell gültig. Regeln, die die Unterschiede in der Wirkung der rechten und linken Bildhälfte beschreiben, wie beispielsweise von Kandinsky formuliert,89 können wohl nur innerhalb eines solchen Kulturkreises Geltung beanspruchen, in dem eine einheitliche Leserichtung herrscht, z. B. die von links nach rechts. Andere Regeln, die z. B. das Verhältnis von oberer und unterer Bildhälfte thematisieren, mögen evtl. grundlegender und daher kulturübergreifend sein, weil sie auf die menschliche Grunderfahrung der Schwerkraft zurückführbar sind. Auch
88 Kandinsky, Wassily: Punkt und Linie zu Fläche, Bern, 2009. 89 Vgl. ebenda, S. 144–145.
5 Bildnerisches Denken | 265
mag es Regeln geben, die eine gewisse Zeit lang als Mode in einem bestimmten Bereich gelten, ähnlich wie auch die Vorstellungen von Schönheit den Veränderungen der Mode ausgeliefert sind. Doch all das sind nur Vermutungen, die einer empirischen Erforschung bedürften, und die das hier analysierte Grundvermögen des bildnerischen Zusammensetzens und Verbindens nicht betreffen. Denn keines dieser Regelwerke ist so formuliert, dass man rein abstrahierend vorgehen kann und die Komposition eines Bildes nur anhand der entsprechenden Regeln verstehen bzw. herstellen könnte. Es gibt im Unterschied zur Syntax der Sprache bis heute kein vollständiges Regelwerk für das Zusammensetzen und Verbinden eines Bildes, das auch nur annähernd Allgemeingültigkeit beanspruchen könnte. Die Quellen solcher Regelwerke scheinen nicht nur unendlich, sondern auch unerschöpflich zu sein, so dass nicht nur verschiedene Regeln für verschiedene Bereiche existieren, sondern auch immer wieder neue Regeln entstehen, die die alten ablösen. Der Hauptgrund, warum man aber davon ausgehen kann, dass es eine beschreibbare Bildsyntax vergleichbar zur Syntax der Sprache niemals geben wird, liegt wohl darin, dass die Menge aller möglichen Kombinationen von Farbe und Form unendlich ist. Aus diesem Grund sind die Funktionen des Bildnerischen Denkens im Kern Tätigkeiten des Konkretisierens. Die Frage, inwieweit für ein konkretes Bild allgemeine Kompositions- und Verbindungsregeln relevant sind, kann immer nur am Einzelfall entschieden werden. Die Probleme des Bildnerischen lernt man nicht dadurch besser zu lösen, dass man Einzelfälle von Bildern unter Kategorien von Bildern subsumiert und dann bestimmte Regeln auf sie anwendet. Stattdessen lernt man das bildnerische Wahrnehmen, Zusammensetzen und Verbinden nur durch genaue Analyse von Einzelfällen, durch das Erkennen der Faktoren, die die Einzigartigkeit dieses jeweiligen Bildes ausmachen oder – anders ausgedrückt – durch das Erkennen der Eigengesetzlichkeit des Bildes. 5.2.3.2 Nicht-Bildnerisches Verbinden Eine rein auf allgemeine Regeln gestützte Bildproduktion und -rezeption ist nicht bildnerisch bzw. konkretisierend, sondern abstrahierend. Im Folgenden wird gezeigt, inwiefern abstrahierendes Verbinden bei einer Bildproduktion oder -rezeption dennoch eine Rolle spielen kann. Wie erläutert können diese abstrahierenden Operationen nochmal unterschieden werden in visuell-plastische, d. h. schematisierende, und nicht-visuell-plastische. Generell vollzieht sich das Erkennen von dargestellten Gegenständen auf Bildern schematisierend und daher nicht-bildnerisch. Wir ordnen die wahrgenom-
266 | Bildnerisches Denken
menen Farb- und Formzusammensetzungen in bestimmte Gegenstandsklassen ein, die wir häufig mit Begriffen benennen. Diese Klassifizierung läuft dabei prinzipiell genauso ab, wie das Gegenstandserkennen in unserem Alltag.90 Auch beim Einordnen eines Gemäldes in eine bestimmte »Bildart« stellen wir eine schematische Verbindung zu anderen Gemälden her. Wenn wir beispielsweise ein Bild als »Kreuzigungsdarstellung« klassifizieren, verweisen wir auf die Gemeinsamkeit, die dieses Bild mit anderen Bildern hat – nämlich dass eine Szene dargestellt ist, die wir als »Kreuzigung« klassifizieren. Bezogen auf das Gemälde von Léger könnte das schematisierende Verbinden beispielsweise einen Teil des Bildes als »Gesichtsschema«, einen anderen Teil hingegen als »Mann-Schema« klassifizieren. Wie wenig mit dieser Klassifikation für das Verständnis eines Bildes gewonnen ist, wird deutlich, wenn man sie mit der oben gegebenen bildnerischen Interpretation des Gemäldes vergleicht.
Abb. 37: Hyacinthe Rigaud: »Portrait des französischen Königs Ludwig der XIV«, 1701, Öl auf Leinwand, 279 × 190 cm Am Beispiel eines Herrscherportraits (siehe Abb. 37) kann gezeigt werden, inwiefern bei einer Bildrezeption auch nicht-visuell-plastische Verbindungen relevant sein können. So werden einige der dargestellten Gegenstände als Symbole verstanden und mit bestimmten Eigenschaften eines Herrschers in Verbindung gebracht. In der christlich-abendländischen Tradition verbinden 90 Vgl. Mallot, Hanspeter A.: »Visuelle Wahrnehmung«, in: Funke, Joachim; Frensch, Peter A. (Hg.):
Handbuch der Allgemeinen Psychologie – Kognition, Göttingen, 2006, S. 132.
5 Bildnerisches Denken | 267
wir die Säule mit Eigenschaften wie Tragkraft, Stärke und Beständigkeit91 eines Herrschers. Andere dargestellte Gegenstände, wie die goldene Lilie auf dem blauen Mantel oder die Krone, verknüpfen wir nicht nur als Darstellung, sondern auch in der Wirklichkeit mit dem französischen König als Machtinstitution. Diese Verbindungen können prinzipiell gezogen werden, ohne das Bild zu betrachten, d. h. ohne die ersten beiden Funktionen des Bildnerischen Denkens auszuüben. Wenn die Identifikation der Gegenstände einmal geleistet ist, kann die Verbindung zu solchen symbolischen Bedeutungen ohne Bildbezug geschehen. Daher sind es nicht-visuell-plastische Verbindungen. Solche Verbindungen können sich auch auf historische Hintergründe zur Entstehungszeit des Gemäldes beziehen. So ist es beispielsweise für das Verständnis des Gemäldes von Léger wichtig, dessen Entstehungszeit zu berücksichtigen. In den 20er Jahren waren die massiven Veränderungen der industriellen Revolution noch deutlich zu spüren und es herrschte zum Teil eine euphorische Technikbegeisterung. Weiterhin war zu dieser Zeit die gesundheitsschädliche Wirkung des Rauchens noch nicht allgemein bekannt. Aus diesem historischen Hintergrundwissen kann man schließen, dass die durch die Komposition erreichte Verschmelzung von Mensch und Maschine hier nicht negativ konnotiert ist, ebenso wenig wie das Rauchen des Mechanikers. Diese Überlegungen sind für die Rezeption des Gemäldes zwar wichtig, sie sind aber nicht bildspezifisch, weil sie bei einem Roman aus derselben Zeit, in dem ein rauchender Mechaniker beschrieben wird, ebenso relevant wären. Am Beispiel eines Logo-Entwurfes wurde bereits in Kapitel 3.4.3 gezeigt, wie abstrahierendes und konkretisierendes Denken im Allgemeinen aufeinander bezogen sein können. Für die Funktion des Verbindens kann dies an einem ähnlichen Beispiel nochmals dargelegt werden – an einem Bild, in dem Buchstaben und Wörter eingebaut sind. Beide Betrachtungsweisen ergänzen sich dabei. So kann die Bedeutung eines Wortes die Wirkung der jeweiligen Farb- und Formgebung des Wortes ergänzen oder ihr zuwiderlaufen. Ist beispielsweise in einem Bild die Darstellung eines Liebespaares mit dem Schriftzug »Liebe« zusammengesetzt, kann die Farbe und die Form des Schriftzuges den Ausdruck des Liebespaares entscheidend bestimmen. Wählt man etwa für die Buchstaben eher weiche, runde Formen und einen warmen Farbton, kann das Wort den harmonischen und liebevollen Eindruck, den das Paar z. B. durch seine Haltung macht, unterstützen. Sind die
91 Vgl. Biedermann, Hans: »Säulen«, in: ders.: Knaurs Lexikon der Symbole, München, 1998, S. 376.
268 | Bildnerisches Denken
Buchstaben hingegen mit harten Kanten und kühlen Farben gesetzt, wirkt die Haltung des Liebespaares vielleicht eher wie eine Karikatur oder wie der krampfhafte Versuch, eine bereits gescheiterte Liebesbeziehung aufrecht zu erhalten. So wird durch das Wechselspiel der beiden Denkarten der Sinn dieser einmaligen Kombination von Text und Bild konstituiert. Dennoch sind beide Rezeptionsweisen klar voneinander unterscheidbar. Die abstrahierende Denkoperation in dieser Rezeption – das Verstehen des Textes – ist nicht bildspezifisch und ist daher im Modell des Bildnerischen Denkens nicht berücksichtigt. Nur die konkretisierenden Denkoperationen – das Wahrnehmen, Zusammensetzen und Verbinden von Farben und Formen – sind verantwortlich dafür, dass eine solche Rezeption zu einer Bildrezeption wird bzw. zu einer Bilderfahrung. 5.2.4 Funktion Erfinden Die Gegenstände, auf die sich das bildnerische Erfinden bezieht, sind die vorgestellten Farben und Formen, ihre Zusammensetzungen sowie ihre Verbindungen zur Welt. Wie beim bildnerischen Verbinden ist auch das bildnerische Erfinden immer bezogen auf Bilder – wenn auch eventuell nur auf mentale. Nur in Teilen – als vorgestelltes bildnerisches Wahrnehmen oder Zusammensetzen – kann es unabhängig von materiellen oder mentalen Bildern auftreten, ist aber dann in diesem Sinne unvollständig. So bedienen wir uns des bildnerischen Wahrnehmens oder Zusammensetzens in der Vorstellung z. B., wenn wir uns für eine neue Wohnung eine bestimmte Farbkombination für den Vorhang und das Sofa vorstellen. Die vierte Funktion – das bildnerische Erfinden – ist immer konkretisierend, weil es auf den ersten drei Funktionen aufbaut, deren konkretisierender Vollzug bereits erläutert wurde. Im bildnerischen Erfinden wird der Unterschied zwischen Rezeption und Produktion aufgehoben, da das Vorstellen mentaler Bilder weder selbst als Rezeption oder Produktion bezeichnet werden kann, noch zwingend in eine Rezeption oder Produktion münden muss. Das bildnerische Erfinden kann klar vom schematisierenden Erfinden, sowie vom nicht-visuell-plastischen Erfinden unterschieden werden. Ein Beispiel für rein schematisierendes Erfinden ist die von Kant erläuterte Konstruktion eines Dreiecks in der reinen Anschauung. Wie in Kapitel 3.4.2.2 dargelegt, ist diese Konstruktion deshalb schematisch, weil in ihr das vorgestellte, konkrete Dreieck nur als Exemplar der Gegenstandsklasse, die mit dem Begriff »Dreieck« bezeichnet wird, in Betracht kommt. Wie bei den ersten drei Funktionen kann auch das bildnerische Erfinden auf schematisierendes Erfinden bezogen sein und mit diesem in Wechsel-
5 Bildnerisches Denken | 269
wirkung treten. Dies ist der Fall, wenn man z. B. ein Bild erfinden möchte, das einem bestimmten Kompositionsschema entspricht. So könnte man sich die Aufgabe stellen, ein Bild zu erfinden, das eine ganz ähnliche Komposition wie das Gemälde von Léger aufweist, auf dem aber eine völlig andere Szene dargestellt ist. Das schematisierende Denken hat dann die Aufgabe, auf die Gemeinsamkeiten beider Kompositionen zu achten – der Kompositionen des Gemäldes von Léger und der des vorgestellten mentalen Bildes. Das Bildnerische Denken hingegen ist dafür zuständig, aus dem vorgegebenen Schema eine in sich stimmige Komposition zu entwickeln und in Einklang mit dem Bildgegenstand zu bringen. Obwohl hier beide Denkarten stark aufeinander bezogen sind, findet doch keine Vermischung statt. Die Aufgabenbereiche sind klar verteilt. Visuell-plastisches Erfinden – egal ob konkretisierend oder abstrahierend – unterscheidet sich außerdem vom nicht-visuell-plastischen Erfinden. So entwickeln Menschen in allen möglichen Medien Erfindungen, beispielsweise auch im Medium der Sprache. Das Erfinden von Geschichten erfordert dabei möglicherweise genauso ein Wechselspiel zwischen abstrahierendem und konkretisierendem sprachlichen Denken. 5.2.5 Bildnerisches Denken als Konkretisieren in den vier Funktionen In Kapitel 5.2 wurden die beiden Teile 2 (DAS DENKEN) und 3 (DAS BILDNERISCHE) zusammengeführt. Es wurde gezeigt, in welchem Sinne das Bildnerische Denken visuell-plastisches Konkretisieren ist. Dieser Nachweis erfolgte bezogen auf jede der vier Funktionen des Bildnerischen Denkens. Daher können die Funktionen selbst als bildnerisch bezeichnet werden. So können das bildnerische Wahrnehmen und das nicht-bildnerischen Wahrnehmen voneinander unterschieden werden und analog dazu alle anderen bildnerischen Funktionen. Der Denkvollzug ist bei allen vier Funktionen gleich, ihr Unterschied besteht in ihrem jeweiligen Gegenstand des Denkens. Alle vier bildnerischen Funktionen wurden abgegrenzt von abstrahierenden Denkoperationen, die z. T. visuell-plastisch sein können, z. T. aber auch auf andere Medien bezogen sind. Es wurde erklärt, wie dabei in den einzelnen Funktionen konkretisierende und abstrahierende Denkoperationen aufeinander bezogen sein können, ohne dass ihre klare Unterscheidbarkeit verloren ginge. Damit ist das Bildnerische Denken als eigenständige Denkart vollständig hergeleitet.
270 | Bildnerisches Denken
5.3
K ATEGORISIERUNG VON » ABSTRAKTEN « UND » KONKRETEN « B ILDERN
Das Modell des Bildnerischen Denkens ermöglicht es, Bilder als graduell »abstrakter« und »konkreter« zu charakterisieren. Dazu muss – entsprechend der Unterscheidung zwischen den Faktoren des Denkens (siehe Kapitel 3.2) – die absolute Bedeutung von »abstrakt« und »konkret« von ihrer relativen unterschieden werden. Im absoluten Sinne sind alle Bilder konkret, weil sie aus einem konkretisierenden Denkvollzug hervorgehen. In diesem absoluten Sinne sind Piktogramme und alle anderen schematischen Visualisierungen abstrakt. Im relativen Sinne, der sich auf den Gegenstand des Denkens bezieht, können sowohl Bilder als auch Schemata graduell abstrakter oder konkreter genannt werden. Da hier nur die Kategorisierung von Bildern, nicht von Schemata diskutiert werden soll, ist für das Folgende der Unterschied zwischen abstrahierendem und konkretisierendem Denkvollzug irrelevant. Der Denkvollzug ist bei allen Bildern konkretisierend. Der Gegenstand des Bildnerischen Denkens, d. h. der Bildgegenstand kann abstrakter oder konkreter sein. In diesem relativen Sinne kann ein Bild dann als abstrakter oder konkreter bezeichnet werden. Der graduelle Unterschied zwischen einem abstrakteren und einem konkreteren Bildgegenstand wird dabei durch den Unterschied zwischen abstrakteren und konkreteren Gegenständen des Denkens in den einzelnen Funktionen verursacht – genauer in den ersten drei Funktionen: im Wahrnehmen, Zusammensetzen und Verbinden. Der Denkvollzug ist bei allen drei Funktionen gleich, aber ihre Gegenstände des Denkens unterscheiden sich: Beim Wahrnehmen sind es die Farben und Formen, beim Zusammensetzen die Farb- und Formkombinationen und beim Verbinden die Verbindungen zur Welt. Da das konkretisierende Denken auf die Unterschiede achtet, sind auch diese Differenzen jeweils Gegenstand des Denkens. Ausführlich formuliert sind daher die Gegenstände des bildnerischen Wahrnehmens: Farben und Formen sowie deren Differenzen, des bildnerischen Zusammensetzens: Farb- und Formzusammensetzungen sowie deren Differenzen, des bildnerischen Verbindens: Verbindungen der Farb- und Formzusammensetzungen zur Welt sowie deren Differenzen. Der Gegenstand des Bildnerischen Denkens als Ganzes – also der Bildgegenstand – wird durch diese Gegenstände des Denkens der einzelnen Funktionen bestimmt, also durch Farben, Formen, deren Zusammensetzungen und deren Verbindungen zur Welt. Der Gegenstand eines Bildes ist relativ
5 Bildnerisches Denken | 271
abstrakt, wenn ihn das Bild durch relativ wenige Bestimmungen charakterisiert. Relativ konkret ist der Bildgegenstand – und damit auch das Bild – dagegen dann, wenn er durch relativ viele Bestimmungen gekennzeichnet wird. Ob der Gegenstand des Bildes und damit das Bild selbst graduell abstrakter oder konkreter ist, hängt also davon ab, wie viele Bestimmungen aus den drei Funktionen den Bildgegenstand charakterisieren. Genauer ist ein Bildgegenstand relativ abstrakt, wenn er durch relativ wenig Farben, Formen und deren Unterschiede, Farb- und Formkombinationen und deren Unterschiede sowie Verbindungen der Farb- und Formkombinationen zur Welt und deren Unterschiede bestimmt wird. Relativ konkret ist der Bildgegenstand, wenn er durch relativ viele Farben, Formen und deren Unterschiede, Farb- und Formkombinationen und deren Unterschiede sowie Verbindungen der Farb- und Formkombinationen zur Welt und deren Unterschiede charakterisiert wird. Die Unterschiede der Gegenstände des Denkens in den einzelnen Funktionen können dabei tatsächlich im Bild gegeben sein. Sie können aber auch zwischen einem Bild und einem möglichen anderen Bild bestehen. Beispielsweise kann innerhalb eines Bildes der Unterschied zwischen zwei Rotnuancen für die Charakterisierung des Bildgegenstandes relevant sein. Wenn das Bild aber nur einen Rotton enthält, kann der Unterschied dieses einen Rottons zu möglichen anderen Rottönen relevant sein, selbst wenn in diesem Bild keine anderen Rottöne vorkommen. Hingegen können bei einem Bild, das sehr viele Rotnuancen enthält, diese für die Bestimmung des Bildgegenstandes irrelevant sein. Entscheidend ist also nicht, wie viele unterschiedliche Farben oder Formen auf einem Bild zu sehen sind, sondern wie viele dieser Farben und Formen, Zusammensetzungen und Verbindungen – im Unterschied zu anderen Farben und Formen, Zusammensetzungen und Verbindungen – den Bildgegenstand bestimmen. Die Kriterien, nach denen ein Bildbetrachter oder -gestalter entscheidet, welche Bestimmungen in der einzelnen Funktion für den Bildgegenstand relevant sind, können sehr vielfältig sein. So kann die Relevanz von Bestimmungen durch Konventionen, durch Wahrnehmungsgesetze, oder durch Zusatzinformationen wie den Titel des Bildes oder den Bildkontext geregelt sein. Der graduelle Unterschied zwischen abstrakten und konkreten Bildern ergibt sich also aus den Gegenständen der einzelnen Funktionen bzw. aus der Menge der Bestimmungen der einzelnen Funktionen. In diesem Sinne kann man auch den Gegenstand des Denkens jeder einzelnen Funktion als abstrakter – d. h. weniger bestimmt – oder konkreter – d. h. mehr bestimmt – bezeichnen. Innerhalb einer Funktion ist der Gegenstand des Denkens
272 | Bildnerisches Denken
abstrakter, wenn relativ wenige Bestimmungen dieser Funktion relevant sind für die Bestimmung des Bildgegenstandes. Konkreter wird der Gegenstand des Denkens einer Funktion dadurch, dass in dieser Funktion mehr Bestimmungen für die Charakterisierung des Bildgegenstandes berücksichtigt werden müssen. Je konkreter oder abstrakter die Gegenstände des Denkens in den einzelnen Funktionen des Bildnerischen Denkens sind, desto konkreter oder abstrakter ist der Bildgegenstand und damit das Bild selbst. Im ersten Kapitel wird anhand von zwei Bildern gezeigt, wie durch die relevanten Bestimmungen in den einzelnen Funktionen der Gegenstand der Bilder abstrakter oder konkreter charakterisiert wird und wie dadurch die Bilder selbst abstrakter oder konkreter genannt werden können (5.3.1). Das folgende Kapitel greift eines der beiden Bilder heraus und legt dar, wie es von anderen Autoren zum Teil gegensätzlich klassifiziert wird (5.3.2). Die hier erarbeitete Kategorisierung kann nicht nur diese Widersprüche aufheben, sondern führt auch zu einem tieferen Verständnis des betreffenden Bildes (5.3.3). 5.3.1 »Abstrakter« und »konkreter« Gegenstand des Bildnerischen Denkens Im Folgenden wird anhand von zwei Bildbeispielen (Abb. 38 und Abb. 39) gezeigt, wie das Bildnerische Denken den Gegenstand des Bildes graduell abstrakter und konkreter bestimmt. Tabelle 21 zeigt, wie sich die Einstufung eines Bildes als abstrakter oder konkreter aus den entsprechenden Einstufungen in den einzelnen Funktionen ergibt. Das Gemälde von Piet Mondrian (Abb. 38) ist abstrakter als das Portrait von Albrecht Dürer (Abb. 39), weil beim Portrait der Gegenstand des Bildes in allen drei Funktionen durch mehr Bestimmungen charakterisiert ist. Dies wird im Folgenden für jede der drei Funktionen dargelegt (Kapitel 5.3.1.1 bis Kapitel 5.3.1.3). Daraufhin wird erklärt, wie auch der Gegenstand der vierten Funktion abstrakter oder konkreter sein kann, so dass auch ein mentales Bild abstrakter oder konkreter genannt werden kann (5.3.1.4). Abschließend wird die Kategorisierung der beiden Bilder durch das Modell des Bildnerischen Denkens zusammengefasst (5.3.1.5).
5 Bildnerisches Denken | 273
Abb. 38: Piet Mondrian: »Tableau I«, 1921, Öl auf Leinwand, 103 × 100 cm Abb. 39: Albrecht Dürer: »Portrait der Barbara Dürer« (große Ansicht), um 1490–93, Öl auf Tannenholz, 47 × 38 cm
KATEGORISIERUNG VON BILDERN GEGENSTAND DES DENKENS = relativ abstrakt, d. h….
= relativ konkret, d. h….
charakterisiert durch relativ... VOLLZUG DES DENKENS 1. Wahrnehmen
2. Zusammensetzen
3. Verbinden
in Rezeption & Produktion
wenig…
viel… Bestimmungen, d. h.
…Farben und Formen & deren Differenzen
…Farb- und Formkombinationen & deren Differenzen
…Verbindungen der Farb- und Formkombinat. zur Welt & deren Differenzen
= relativ abstrakt
= relativ konkret
Tabelle 21: Kategorisierung von »abstrakten« und »konkreten« Bildern
274 | Bildnerisches Denken
5.3.1.1 Gegenstand des Wahrnehmens In der Funktion des bildnerischen Wahrnehmens besteht der Gegenstand des Denkens in den Farben und Formen sowie deren Differenzen. Dieser Gegenstand ist relativ konkret, wenn relativ viele Farben und Formen bzw. Farb- und Formunterschiede für die Bestimmung des Bildgegenstandes relevant sind. Wenn hingegen relativ wenig Farben und Formen sowie deren Unterschiede bei der Bestimmung des Bildgegenstandes berücksichtigt werden, ist der Gegenstand des bildnerischen Wahrnehmens relativ abstrakt. Bei der ersten Funktion ist dieser relative Unterschied zwischen Abb. 38 und Abb. 39 sehr deutlich. Das Gemälde von Mondrian besteht aus einer abzählbaren Anzahl von Farben und Formen: die Farben Blau, Rot und Gelb, Schwarz, Weiß und Grau sowie rechteckige Formen. Für das bildnerische Wahrnehmen sind mögliche Unebenheiten im Farbauftrag, die zu feinsten Farbunterschieden beispielsweise innerhalb der blauen Fläche führen, nicht relevant zur Bestimmung des Bildgegenstandes. Alle Flächen sollen als geschlossene, einfarbige Flächen wahrgenommen werden. Auch feine Formunterschiede, die sich beispielsweise daraus ergeben könnten, dass eine der schwarzen Linien etwas unsauber gezogen ist, spielen für den Bildgegenstand keine Rolle. Die Farben und Formen des Gemäldes von Dürer hingegen sind nicht nur so zahlreich, dass sie nicht annähernd verbal beschrieben werden können. Für die Bestimmung des Bildgegenstandes sind wesentlich mehr Bestimmungen der Farbe und Form sowie deren Differenzen relevant, als bei dem Gemälde Mondrians. So sind die feinen Farbunterschiede im Hautton sowie im grünen Hintergrund relevant. In Bezug auf die Form ist die feine Biegung der Gürtellinie sowie jede einzelne Faltenform relevant für die Bestimmung des Bildgegenstandes. Wären die Falten anders, wäre der Bildgegenstand ein anderer. Hinsichtlich der Funktion des bildnerischen Wahrnehmens ist das Bild von Mondrian also wesentlich abstrakter als das Gemälde von Dürer. 5.3.1.2 Gegenstand des Zusammensetzens In der zweiten Funktion richtet sich das Denken auf die Kombinationen der Farben und Formen sowie deren Differenzen. Konkreter ist der Gegenstand des Denkens in dieser Funktion dann, wenn relativ viele Farb- und Formkombinationen sowie deren Unterschiede relevant für die Bestimmung des Bildgegenstandes sind. Mondrian hat die Farben und Formen so kombiniert, dass sich ein komplexes Netz aus verschiedensten Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bildteilen ergibt. Die Wirkung der Komposition ist zentral für den Gegenstand des ganzen Bildes. Sie kann in etwa wie folgt
5 Bildnerisches Denken | 275
beschrieben werden: Blickfang des Bildes ist die relativ dunkle, blaue Fläche im linken unteren Bildteil, der als Pendant vor allem die kleine, schwarze Flächen rechts oben gegenübergestellt wird. Diese diagonale Kompositionslinie wird ausgeglichen durch eine Entsprechung zwischen der gelben und der roten Fläche. Eine weitere diagonale Beziehung wird durch die feinen, unterschiedlichen Abstufungen der Grautöne hergestellt. Da die grauen Flächen oberhalb und rechts der blauen Fläche etwas heller und etwas gelbstichiger sind als die anderen grauen Flächen, entsteht auch hier eine diagonale Korrespondenz. Die sich kreuzenden diagonalen Bezüge unterstützen zusammengenommen den Eindruck der Ausgewogenheit. Manipuliert man ein einzelnes Element der Komposition, beispielsweise die Größe oder den Farbton einer Fläche, verändert sich die Wirkung des gesamten Gefüges und damit auch der Bildgegenstand.
Abb. 40: Komposition 1
Abb. 41: Komposition 2
Dies wird dann besonders deutlich, wenn man versucht, selbst eine solche Komposition herzustellen. So kann man beim Betrachten der Bilder auf Abb. 40 und Abb. 41 feststellen, dass die beiden Zusammensetzungen nicht gleich harmonisch wirken. Die unterschiedlichen Wirkungen können beschrieben und begründet werden. So wirkt die Komposition auf Abb. 41 deswegen weniger harmonisch als die Komposition auf Abb. 40, weil die eher dunklen Farben Rot und Blau am unteren Bildrand im Verhältnis zum hellen Gelb am oberen Bildrand ein Übergewicht darstellen. Aus diesen Vergleichen wird ersichtlich, dass jeder kleinster Unterschied in der Komposition für die Bilder Mondrians entscheidend ist. Für den Bildgegenstand des Gemäldes von Mondrian sind also relativ viele Farb- und Formkombinatio-
276 | Bildnerisches Denken
nen sowie deren Differenzen relevant, daher kann das Bild in Bezug auf die Funktion des Zusammensetzens als relativ konkret bezeichnet werden – wenn auch nicht so konkret wie das Gemälde von Dürer. Das Portrait besteht allein aufgrund der Vielzahl an Farben und Formen aus sehr vielen Farb- und Formkombinationen, die – ähnlich wie beim Gemälde Mondrians – ein Netz aus kompositorischen Wechselwirkungen bilden. Allein die kompositionsbestimmenden Schrägen, die durch den Faltenwurf der Kleidung und der Kopfbedeckung entstehen, bilden eine komplexe Struktur. Noch viel deutlicher wird die Relevanz feiner Kompositionsunterschiede in Bezug auf das Gesicht. Kleinste Verschiebungen in der Anordnung von Nase, Mund und Augen würden den Bildgegenstand komplett verändern. Das Gemälde Dürers ist daher bezogen auf die zweite Funktion ähnlich konkret bestimmt wie das Bild von Mondrian. 5.3.1.3 Gegenstand des Verbindens Gegenstand des Denkens der dritten Funktion sind die Verbindungen, die zwischen dem Bild und der Welt hergestellt werden. Konkreter ist das Bild, wenn relativ viele Verbindungen bzw. deren Unterschiede relevant sind für die Bestimmung des Bildgegenstandes. Das Gemälde Dürers zeigt eine ganz bestimmte Frau, Barbara Dürer, die Mutter des Malers. Nahezu jeder Bildteil kann hier mit einem Teil der Welt verbunden werden: alle Teile des Gesichtes, des Körpers, der Kleidung genauso wie der grüne Hintergrund. Alle diese Verbindungen sind relevant für den Bildgegenstand, jede kleinste Änderung einer dieser Verbindungen wirkt sich auf die Bestimmung des Bildgegenstandes aus. Ebenso sind die Unterschiede zwischen den möglichen Verbindungen relevant. Der Bildgegenstand ist beispielsweise ein anderer, wenn das weiße Tuch auf dem Kopf der Frau nicht als übliche Kopfbedeckung, sondern als Handtuch gedeutet wird. Der Gegenstand des Bildes ist also durch eine Vielzahl an Verbindungen zur Welt bestimmt und daher relativ konkret. Anders verhält es sich hingegen beim Gemälde Mondrians. Hier kann man keine Verbindung zwischen einzelnen Bildteilen – etwa dem blauen oder gelben Rechteck – und der Welt herstellen. Nur die Komposition als Ganzes kann mit der Welt verbunden werden, wenn sie als Ausdruck für ein kosmisches Harmonieprinzip interpretiert wird. Die Harmonie kommt hier im Gleichgewicht dieser einmaligen Farb- und Formkombination zum Ausdruck. In seiner Verbindung zur Welt ist das Bild daher sehr abstrakt.
5 Bildnerisches Denken | 277
5.3.1.4 Gegenstand des Erfindens Den Gegenstand des Denkens bilden in der vierten Funktion die vorgestellten Farb- und Formzusammensetzungen mit ihren Verbindungen zur Welt. Ihre relative Konkretheit und Abstraktheit wird genauso wie bei den ersten drei Funktionen bestimmt, auch wenn diese beim Erfinden nur in der Vorstellung ausgeübt werden. Daher kann auch ein mentales Bild hinsichtlich der ersten drei Funktionen als graduell abstrakter oder konkreter beschrieben werden. Die vorgestellten Gemälde von Dürer und Mondrian sind daher im gleichen Grad konkret bzw. abstrakt wie die betrachteten Gemälde. 5.3.1.5 »Abstrakte« und »konkrete« Bilder im Modell des Bildnerischen Denkens Betrachtet man die Bestimmung des Bildgegenstandes in allen drei Funktionen zusammen, lässt sich feststellen, dass der Gegenstand des Gemäldes von Dürer eindeutig konkreter charakterisiert ist als der des Bildes von Mondrian. Daher ist das Bild von Dürer insgesamt wesentlich konkreter als das Gemälde Mondrians. Die hier vorgeschlagene Kategorisierung von abstrakten und konkreten Bildern mit Hilfe des Modells des Bildnerischen Denkens entspricht damit der Einordnung beider Bilder, wie sie von vielen intuitiv vorgenommen wird. 5.3.2 »Abstrakte« und »konkrete« Bilder bei anderen Autoren Das hier erläuterte Verständnis von »abstrakt« und »konkret« zur Kategorisierung von Bildern muss sich nicht nur am alltäglichen Gebrauch dieser beiden Begriffe messen, sondern auch an der entsprechenden kunstwissenschaftlichen Diskussion, die im Folgenden dargelegt wird. Dabei zeigt sich, dass die Kunstwissenschaft keineswegs über einen Konsens der Begriffsverwendung verfügt. Stattdessen gibt es eine rege Diskussion darüber, ob der Begriff der »abstrakten Kunst« als Oberbegriff für jede Kunst verwendet werden soll, die sich vom Abbilden der sichtbaren Welt entfernt.92 Dieses Verständnis wird beispielsweise in der Routledge Encyclopedia of Philosophy93 und im Lexikon der Kunst94 vertreten. Andere Autoren wollen zwi-
92 Vgl. hierzu z. B. Fassmann, Kurt: »Abstrakte Malerei«, in: ders. (Hg.): Kindlers Malereilexikon, Zürich, 1971. 93 Vgl. Brown, John H.: »Art, abstract«, in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 2011, Online-Ausgabe, Zugriff am 26.05.2013. 94 Vgl. [Ohne Autor:] »Abstrakte Kunst«, in: Olbrich, Harald (Hg.): Lexikon der Kunst, Leipzig, 1987, S. 18.
278 | Bildnerisches Denken
schen »abstrakter« und »abstrahierter« Kunst unterscheiden95 oder den Begriff der »abstrakten Kunst« durch den der »konkreten Kunst« ersetzen. Solche widersprüchlichen Kategorisierungen werden im Folgenden bezogen auf das Gemälde »Tableau I« von Piet Mondrian exemplarisch vorgestellt. Während das Bild von einigen Autoren als »abstrakt« bezeichnet wird, halten es andere für ein Paradebeispiel »konkreter« Malerei bzw. Kunst. In einem weiten Verständnis werden die Begriffe »abstrakte Kunst« bzw. »abstrakte Malerei« als Oberbegriffe aufgefasst, wie im Lexikon der Kunst erläutert wird: »Das abstrakte Kunstwerk verzichtet ganz oder weitgehend auf die gegenstandsbezogenen Assoziationen, auf die Spannung zwischen Natur- und Kunstform als mögliche Elemente der Wirkung auf den Betrachter. Es reduziert sich auf elementare, psycho-physische und damit z.T. auch historischerfahrungsmäßig bedingte Ausdrucks-, Stimmungs-, Symbol-, Schmuckwirkungen und Sinneseindrücke, wie sie Formen und Farben samt deren wechselseitigen Beziehungen eigentümlich sein können.«96
Hier wird unterschieden zwischen Kunstwerken, die weitgehend auf das Abbilden von Gegenständen verzichten, und solchen, die das ganz tun. Ähnlich formuliert John Brown dieses breite Verständnis von »abstrakt«: »The widespread use of the term ›abstract« for a category of visual art dates from the second decade of the twentieth century […]. Two subcategories may be distinguished: first, varieties of figurative representation that strongly schematize, and second, completely nonfigurative or nonobjective modes of design (in the widest sense of that term).«97
Aus dieser Perspektive ist das Gemälde Mondrians (siehe Abb. 38) eindeutig abstrakt. Auch er selbst bezeichnet seine Bilder der Neuen Gestaltung als »abstrakt«:
95 Vgl. Brion, Marcel: Geschichte der abstrakten Kunst, Stuttgart, Hamburg, 1962, S. 11. 96 [Ohne Autor:] »Abstrakte Kunst«, in: Olbrich, Harald (Hg.): Lexikon der Kunst, Leipzig, 1987, S. 18. 97 Brown, John H.: »Art, abstract«, in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 2011, Online-Ausgabe, Zugriff am 26.05.2013, [ohne Seitenangabe].
5 Bildnerisches Denken | 279
»Die neue Gestaltung […] könnte ebensogut die Malerei der realen Abstraktion heißen […]. Sie ist eine Komposition farbiger Rechtecke, welche die tiefste Realität ausdrücken. Dahin kommt sie durch den gestalteten Ausdruck der Verhältnisse, und nicht durch die natürliche Erscheinung.«98
Doch im Lexikon der Kunst wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass der Begriff des Abstrakten zur Kennzeichnung einer bestimmten Art von Kunst umstritten oder sogar unplausibel ist. Bezogen auf den Ausdruck »abstrakte Kunst« heißt es dort weiter: »Diese Kunst wird auch konkrete Kunst genannt, weil sie von nichts abstrahiere, sondern eine reine Konkretisierung ihrer selbst sei.«99 Im Artikel »Abstraktion« wird diese begriffliche Schwierigkeit noch deutlicher ausgeführt: »Als Abstraktion verstandene Kunst führt in letzter Konsequenz zu ihrem Aufgehen im Begriff, d.h. praktisch zur Zerstörung der Kunst als Welterfassung, denn diese kann die Wirklichkeit, wenn überhaupt, sich nur auf spezifische Weise aneignen.«100 Diese Skepsis gegenüber der Kategorie der »abstrakten« Kunst bzw. Malerei wurde bereits in der Phase ihrer Entstehung von vielen Künstlern geteilt. So hat sich Kandinsky, der als einer der Vorreiter der abstrakten Malerei gilt, in mehreren Texten mit den beiden Begriffen »abstrakt« und »konkret« befasst. In Übereinstimmung mit der Erläuterung aus dem Lexikon der Kunst hält er den Begriff des »Abstrakten« als Beschreibung für Kunst eher für unpassend und schlägt stattdessen die Formulierung »konkrete Kunst« vor: »Die abstrakte Kunst verzichtet auf Gegenstände und ihre Verarbeitung.«101 »So stellt die abstrakte Kunst neben die ›reale‹ Welt eine neue, die äußerlich nichts mit der ›Realität‹ zu tun hat. Innerlich unterliegt sie den allgemeinen Gesetzen der ›kosmischen Welt‹. So wird neben die ›Naturwelt‹ eine neue ›Kunstwelt‹ gestellt – eine ebenso reale Welt, eine konkrete. Deshalb ziehe ich persönlich vor, die sogenannte ›abstrakte‹ Kunst Konkrete Kunst zu nennen.«102
Noch deutlicher äußert sich Theo van Doesburg, der 1917 mit Piet Mondrian die Künstlergruppe De Stijl gründete. Seine Definition von »konkreter
98 Mondrian, Piet: Die Neue Gestaltung, Mainz, 1974, S. 11. 99 [Ohne Autor:] »Abstrakte Kunst«, in: Olbrich, Harald (Hg.): Lexikon der Kunst, Leipzig, 1987, S. 18. 100 [Ohne Autor:] »Abstraktion«, in: Olbrich, Harald (Hg.): Lexikon der Kunst, Leipzig, 1987, S. 21. 101 Kandinsky, Wassily: »abstrakt oder konkret?«, in: ders.: Essays über Kunst und Künstler, Sulgen, Zürich, 1986, S. 224. 102 Ebenda, S. 225, Hervorh. i. O.
280 | Bildnerisches Denken
Kunst« deckt sich mit dem oben erläuterten Verständnis von »abstrakter« im Sinne gegenstandsloser Kunst: »Konkrete Kunst ist die Bezeichnung für eine Kunst ohne jede Beziehung zur visuellen Wirklichkeit, in der die bildnerischen Elemente weder Abbild der Natur noch symbolisch gemeint sind, sondern in einem Wechselspiel von (meist geometrischen) Formen nur sich selbst bedeuten.«103 Folgerichtig lehnt er den Begriff der »abstrakten Kunst« ganz ab: »Wir sehen die Zeit der reinen Malerei voraus […], die Zeit der Konkretisierung des schöpferischen Geistes. Konkrete und nicht abstrakte Malerei, denn nichts ist konkreter, wirklicher, als eine Linie, eine Farbe, eine Oberfläche […]. Konkrete und nicht abstrakte Malerei, denn der Geist hat den Zustand der Reife erreicht. Er braucht klare, intellektuelle Mittel, um sich auf konkrete Art zu manifestieren.«104
Im Gegensatz zur oben erläuterten Kategorisierung ist das Gemälde von Mondrian im Sinne van Doesburgs und Kandinskys daher eindeutig konkrete Kunst. Zusammenfassend werden folgende Argumente für die beiden gegensätzlichen Kategorisierungen des Gemäldes angeführt. Für die Einordnung als »abstrakt« spricht, dass es keine Gegenstände der sichtbaren Welt abbildet. Stattdessen werden durch die Farben und Formen bestimmte Wirkungen hervorgerufen – so das Selbstbekenntnis Mondrians und die erste Deutung im Lexikon der Kunst. Dort wird an anderer Stelle allerdings aufgezeigt, dass Kunst in einem strengen Sinne niemals abstrakt sein kann, weil das Kunstwerk durch seine Einzigartigkeit die Welt immer nur auf spezifische Weise beschreiben kann. In ähnlicher Weise argumentieren Kandinsky und van Doesburg. Sie weisen darauf hin, dass die sogenannten abstrakten Kunstwerke als materielle Manifestationen von Farbe und Form selbst Teil der Welt sind oder eine neue Welt erschaffen und daher konkret sind. Van Doesburg führt diesen Gedanken weiter, indem er betont, dass die konkrete Kunst nur sich selbst bedeutet.
103 van Doesburg, Theo: »Kommentar über die Grundlagen der konkreten Malerei«, in: Art Concret, 1930, zitiert aus: Waetzoldt, Stephan; Haas, Verena (Red.): Tendenzen der Zwanziger Jahre, 1977, S. 1/190. 104 Ebenda.
5 Bildnerisches Denken | 281
5.3.3 Die Kategorisierungen im Modell des Bildnerischen Denkens Diese widersprüchlichen Kategorisierungen des Gemäldes von Mondrian werden im Folgenden mit der hier vorgeschlagenen Begrifflichkeit des Modells des Bildnerischen Denkens verglichen. Dabei zeigt sich nicht nur, dass die hier vorgeschlagene Kategorisierung in mehrfacher Hinsicht mit den dargelegten Einordnungen anderer Autoren in Einklang zu bringen ist. Zudem wird deutlich, dass hier ein begriffliches Instrumentarium entwickelt wurde, mit dessen Hilfe die offengelegte, widersprüchliche Einordnung erklärt werden kann. Die scheinbar gegensätzlichen Blickwinkel auf das Bild können so verständlich gemacht und ihre Widersprüche aufgelöst werden. Damit wird insgesamt ein tieferes Verständnis der sogenannten »abstrakten« Bilder ermöglicht: Anstatt zwei gegensätzliche Kategorisierungen miteinander zu konfrontieren, wird gezeigt, in welcher Hinsicht jede der beiden Kategorisierungen gerechtfertigt ist, und wie sie in der Systematik des Bildnerischen Denkens miteinander vereinbar werden. In der ersten Kategorisierung wurde das Gemälde in die »abstrakte« Kunst eingeordnet. Zur Begründung dieser Einordnung verweisen das Lexikon der Kunst wie auch Mondrian und Kandinsky darauf, dass auf dem Gemälde keine Gegenstände der sichtbaren Welt abgebildet sind. Diese Einordnung kann in der Begrifflichkeit des Bildnerischen Denkens folgendermaßen ausgedrückt werden: Der harmonische Ausdruck kommt zwar nur durch die einmalige Farb- und Formzusammensetzung zustande, d. h. durch konkretisierendes Denken. Es gibt kein abstraktes Schema für diese Harmonie, kein Regelwerk, nach dem man – wie nach einer Bauanleitung – eine harmonische Komposition konstruieren könnte. Harmonie als Kompositionsprinzip lässt sich nur in der Einmaligkeit des Einzelfalls verwirklichen. Dennoch ist dieser Bildgegenstand, das Harmonieprinzip, durch die jeweils einzigartige Komposition relativ abstrakt bestimmt. Der Gegenstand des Denkens bzw. des Bildes ist, wie im Kapitel 5.3.1 erläutert, durch das Bild relativ wenig bestimmt, denn der Teil der Welt, mit dem das Bild verbunden wird, ist nicht sichtbar. Der Bildgegenstand ist eine Sichtbarmachung von etwas Unsichtbarem und kann daher durch die sichtbaren Farben und Formen und deren Zusammensetzungen nicht besonders konkret charakterisiert werden. Das kosmische Harmonieprinzip – falls es ein solches gibt – ist unsichtbar. Es wird erst dadurch sinnlich erfahrbar, dass es in einer Komposition konkretisiert wird. In dieser Deutung wird auch die Verbindung zu den anderen Kompositionen Mondrians erkennbar. Denn in allen Gemälden seines Spätwerkes hat er versucht, diesem Harmonieprinzip einen konkreten Ausdruck zu verleihen. Die Bildgegenstände dieser Bilder Mondrians
282 | Bildnerisches Denken
sind damit ähnlich miteinander verwandt, wie die Bildgegenstände der beiden Darstellungen von Dürers Mutter. Diese Beschreibung deckt sich mit Mondrians eigener Formulierung der Prinzipien seiner Malerei. Er bezeichnet sie als abstrakt, weil der Bildgegenstand etwas Universelles ist: »Schließlich, wenn das System wirklich abstrakt ist […], ist die bildliche Darstellung des Unveränderlichen und mit ihm die des Universellen gewährleistet.«105 Die zweite Kategorisierung bezeichnet das Gemälde Mondrians als konkret. Im Lexikon der Kunst wird dies damit begründet, dass Kunst sich die Welt nie durch Abstraktion aneignet. Diese Begründung kann man – unabhängig davon, ob man ihr zustimmt – im Vokabular des hier vorgestellten Modells wie folgt formulieren: Kunst entspringt immer aus einem konkretisierenden Denkvollzug und ist daher grundsätzlich immer konkret. Zumindest für das Gemälde Mondrians trifft das sicher zu, da es, wie erläutert, konkretisierendes Denken erfordert. Kandinsky und van Doesburg liefern eine andere Begründung für die Kategorisierung des Bildes als konkret. Sie betonen beide, dass das Bild einen eigenständigen Stellenwert unabhängig von der sichtbaren Welt hat. Für Kandinsky ist es Teil der realen Kunstwelt, die parallel zur Naturwelt existiert. Van Doesburg betont, dass die Gestaltungselemente – die farbigen Flächen und Linien – wirklich und daher konkret sind und nur sich selbst bedeuten. Mit der hier vorgestellten Begrifflichkeit können diese Begründungen folgendermaßen formuliert werden: Der Bildgegenstand des Gemäldes von Piet Mondrian ist dann sehr konkret, wenn das Bild nicht nur als Ausdruck eines allgemeinen Harmonieprinzips gesehen wird, sondern als einmalige Farb- und Formzusammensetzung, die selbst Gegenstand des Bildes ist. Der Bildgegenstand ist dann durch so viele Bestimmungen charakterisiert, wie überhaupt nur möglich, denn alle bildnerischen Bestimmungen sind relevant für die Charakterisierung des Bildgegenstandes. In diesem Sinne ist das Bild ein einzigartiges Individuum der Kunstwelt und daher maximal konkret. Diese Deutung entspricht der verbreiteten Interpretation »abstrakter« Bilder als reflexiv bzw. als selbstreferenziell. Im Vokabular des Bildnerischen Denkens heißt dies: Das Bild wird nicht mit einem unsichtbaren Teil der Welt verbunden, z. B. mit dem kosmischen Harmonieprinzip, sondern mit einem sichtbaren, nämlich mit sich selbst, da die als Bild betrachtete Farb- und Formzusammensetzung natürlich auch selbst Teil der Welt ist.
105 Mondrian, Piet: Die Neue Gestaltung, Mainz, 1974, S. 48.
5 Bildnerisches Denken | 283
Berücksichtigt man bei der Betrachtung des Bildes von Mondrian die Begründungen beider Kategorisierungen, gelangt man zu einem sehr viel tieferen Verständnis des Bildes, als wenn man nur eine der beiden Betrachtungsweisen zulassen würde. Das Bild ist einerseits Ausdruck eines allgemeinen Harmonieprinzips bzw. des Prinzips bildnerischer Komposition überhaupt. In diesem Sinne ist der Bildgegenstand relativ abstrakt. Andererseits kann man das Gemälde von Mondrian auch als Ausdruck seiner selbst verstehen, dann ist der Bildgegenstand relativ konkret. In einem absoluten Sinne ist es, wie alle Bilder, konkret, weil es konkretisierendes Denken erfordert. So zeigt sich, dass beide Kategorisierungen, auch wenn sie auf den ersten Blick gegensätzlich erscheinen, jeweils einen bestimmten Betrachtungswinkel auf das Bild ermöglichen, der das Verständnis des Bildes vertieft. Die Frage, welche Perspektive auf das Bild und damit welche Kategorisierung die richtige ist, erübrigt sich. Es zeigt sich, dass auch die relative Abstraktheit oder Konkretheit eines Bildes keine objektive Eigenschaft des Bildes ist, sondern durch die Betrachterperspektive entsteht. Ein Bild ist ebenso wenig an sich konkret oder abstrakt, wie ein Gegenstand an sich ein Bild ist. Sowohl das Bild wie auch das abstrakte oder konkrete Bild werden zu dem, was sie sind, durch das Denken, durch welches sie produziert oder rezipiert werden.
6 BILDERFAHRUNG ALS BILDNERISCHES DENKEN
Zu Beginn dieser Arbeit wurde die Frage aufgeworfen: »Was ist eine Bilderfahrung?«. Die Entfaltung des Modells des Bildnerischen Denkens hat gezeigt, dass für jede Art von Bilderfahrung das Bildnerische Denken verantwortlich ist, wie in Tabelle 22 nochmals zusammengefasst ist. BILDERFAHRUNG Materielle Bilder Bilder betrachten Bilder gestalten Einzeln notwendige & Einzeln notwendige & Hinreichende zusammen hinreizusammen hinreiBedingung chende Bedingungen: chende Bedingungen: Wahrnehmen Zusammensetzen Verbinden = Funktionen 1–3 des Bildnerischen Denkens
Mentale Bilder Bilder erfinden Notwendige & hinreichende Bedingung
Wahrnehmen Erfinden Erfinden Zusammensetzen Verbinden = Funktionen 1–3 des = 4. Funktion des = 4. Funktion des Bildnerischen Bildnerischen Bildnerischen Denkens Denkens Denkens
enger Bildbegriff
weiter Bildbegriff
Tabelle 22: Arten von Bilderfahrung In einem engen Bildverständnis, für das ein Bild einer materiellen Grundlage bedarf – eines Bildkörpers – gibt es zwei grundlegende Arten von Bilderfahrung: die Bildbetrachtung und die Bildgestaltung. Für beide Arten sind die ersten drei Funktionen des Bildnerischen Denkens einzeln notwendige und zusammen hinreichende Bedingungen. Bei der Bildgestaltung tritt eine
286 | Bildnerisches Denken
weitere Bedingung hinzu: die vierte Funktion des Bildnerischen Denkens, das bildnerische Erfinden. Sie ist zwar nicht notwendig, aber hinreichend, weil in ihr die ersten drei Funktionen in transformierter Form enthalten sind. Diese vierte Funktion ist außerdem notwendige und hinreichende Bedingung für eine weitere Art der Bilderfahrung, die in einem weiten Bildverständnis zu den ersten beiden Arten hinzutritt: das Erfinden von Bildern, das sich nicht auf materielle Bilder bezieht, sondern mentale Bilder erzeugt.
Bildwerke
Bildflächen
BILDERFAHRUNG Materielle Bilder visuelles Wahrnehmen & Zusammensetzen von immateriellen (formalen) Eigenschaften PICTURE (als immaterielle Bildeigenschaften) Verbinden von immateriellen (formalen) Eigenschaften IMAGE visuell-plastisches Wahrnehmen & Zusammensetzen von materiellen und immateriellen (formalen) Eigenschaften PICTURE (als materielle & immaterielle Bildeigenschaften)
Mentale Bilder Erfinden Vorstellen von Bildflächen
Erfinden Vorstellen von Bildwerken
Verbinden von materiellen und immateriellen (formalen) Eigenschaften IMAGE
Tabelle 23: Picture- und Image-Aspekt in der Bilderfahrung In Teil 2 wurde die Frage diskutiert, welche Rolle der Image- und der Picture-Aspekt bei einer Bilderfahrung spielen. Mit der hier entwickelten Systematik kann diese Frage nun anhand von Tabelle 23 unter Berücksichtigung der verschiedenen Arten von Bilderfahrung beantwortet werden. Die bei Wollheim und Wiesing thematisierte Unterscheidung zwischen den materiellen und den immateriellen, formalen Eigenschaften eines Bildes wird hierbei wieder aufgegriffen. So sind für mache Arten von Bilderfahrung nur die Letzteren, für andere hingegen beide relevant. Die Erfahrung materieller Bildflächen erfordert den Picture-Aspekt nur im Sinne immaterieller, formaler Eigenschaften, da diese nur visuell, nicht aber plastisch wahrgenommen und zusammengesetzt werden. Durch die dritte Funktion des Verbindens wird der Image-Aspekt von Bildflächen erschlossen – das, was im Bild gesehen wird bzw. der Bildgegenstand. Materielle Bildwerke erfordern nicht nur visuelles, sondern auch plastisches Wahrnehmen und Zusammensetzen.
6 Bilderfahrung als Bildnerisches Denken | 287
Für die Erfahrung dieser Bildart ist daher der Picture-Aspekt im Sinne von Materialität notwendig. Die Frage, ob bei der Betrachtung eines konkreten Gemäldes der Picture-Aspekt als Materialität ignoriert oder mitberücksichtig werden muss, deckt sich daher mit der Frage, ob das Gemälde als Bildfläche oder als Bildwerk betrachtet werden soll. Für die Erfahrung mentaler Bilder spielt der Picture-Aspekt, verstanden als Materialität, keine Rolle, da sie im wörtlichen Sinne keine Materialität besitzen. Allerdings kann man sich ein (materielles) Bildwerk als mentales Bild vorstellen. In diesem Sinne sind die vorgestellte Materialität ebenso wie die vorgestellten immateriellen, formalen Bildeigenschaften notwendige Bedingungen für die Vorstellung eines Bildwerkes. Anders ausgedrückt ist die Vorstellung davon, Farben und Formen visuell-plastisch wahrzunehmen, zusammenzusetzen und zu verbinden, notwendig für die (mentale) Erfahrung eines Bildwerkes. Diese Vorstellung wird von der vierten Funktion, dem Erfinden, geleistet. Es zeigt sich, dass das Modell des Bildnerischen Denkens die Unschärfe auflöst, die bei der Unterscheidung zwischen den beiden Aspekten festgestellt wurde. Damit liefert das Modell des Bildnerischen Denkens eine differenziertere Systematisierung von Bilderfahrung, die dennoch die Gemeinsamkeit aller Arten von Bilderfahrung begründet und erklärt. Bindendes Glied sind die vier Funktionen des Bildnerischen Denkens, die in unterschiedlicher Weise die notwendigen oder hinreichenden Bedingungen für Bilderfahrung darstellen. Vom Standpunkt des Bildnerischen Denkens kann daher folgende Stellungnahme zur Debatte um die Bilderfahrung gegeben werden: Bilderfahrung ist in jedem Fall Bildnerisches Denken. Damit kann die anfangs aufgeworfene Frage abschließend beantwortet werden. Sie lautete: »Was heißt es, etwas als Bild zu betrachten und zu gestalten?«. Die Antwort lautet: »Es heißt, bildnerisch zu denken.« Es wurde gezeigt, dass unserem Umgang mit Bildern eine eigene Denkart zugrunde liegt, die dem begrifflichen bzw. sprachlichen Denken ebenbürtig ist. In Anlehnung an ein Zitat von Mittelstraß wurde der Satz formuliert: »Ohne (sprachliche) Unterscheidungen lässt sich über die Welt nicht sprechen. Ohne (bildnerische) Unterscheidungen lässt sich über die Welt kein Bild machen.« Da Bildmedien in zunehmendem Maße zu unseren alltäglichen Kommunikationsmedien gehören, sollte die Frage, wie diese Denkart – das Bildnerische Denken – geschult und gefördert werden kann, ebenfalls vermehrt Beachtung finden. Das Modell des Bildnerischen Denkens liefert eine Grundlage zur empirischen Untersuchung entsprechender Maßnahmen und Methode.
VERZEICHNISSE
L ITERATUR [Ohne Autor:] »Abstrakte Kunst«, in: Olbrich, Harald (Hg.): Lexikon der Kunst. Architektur, Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Industrielle Formgestaltung, Kunsttheorie, Band. 1, Leipzig: E. A. Seemann, 1987, S. 18–21. Neubearbeitung der Originalausgabe: Alscher, Ludger (Hg.): Lexikon der Kunst. Architektur, Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Industrielle Formgestaltung, Kunsttheorie, Band 1, Leipzig: E. A. Seemann, 1968. [Ohne Autor:] »Abstraktion«, in: Olbrich, Harald (Hg.): Lexikon der Kunst. Architektur, Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Industrielle Formgestaltung, Kunsttheorie, Band 1, Leipzig: E. A. Seemann, 1987, S. 21. Neubearbeitung der Originalausgabe: Alscher, Ludger (Hg.): Lexikon der Kunst. Architektur, Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Industrielle Formgestaltung, Kunsttheorie, Band 1, Leipzig: E. A. Seemann, 1968. [Ohne Autor]: »Bildnerei«, in: Olbrich, Harald (Hg.): Lexikon der Kunst. Architektur, Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Industrielle Formgestaltung, Kunsttheorie, Band 1, Leipzig: E. A. Seemann, 1987, S. 557. Neubearbeitung der Originalausgabe: Alscher, Ludger (Hg.): Lexikon der Kunst. Architektur, Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Industrielle Formgestaltung, Kunsttheorie, Band 1, Leipzig: E. A. Seemann, 1968. Acham, Karl: »Abstraktion« (Teil IV), in: Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 1, Basel: Schwabe & Co, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971, S. 59–63. Aissen-Crewett, Maike: Kunstunterricht in der Grundschule, Braunschweig: Westermann, 1992, 7. Auflage 2007.
290 | Bildnerisches Denken
Angelelli, Ignacio: »Adventures of Abstraction«, in: Coniglione, Francesco; Poli, Roberto; Rollinger, Robin (Hg.): Idealization XI. Historical studies on abstraction and idealization, Amsterdam, New York: Rodopi, 2004, S. 11–35. Arnheim, Rudolf: Anschauliches Denken. Zur Einheit von Bild und Begriff, aus dem Amerikanischen übersetzt vom Verfasser, Köln: DuMont Schauberg, 1972, 8. Auflage 2001. Originalausgabe: ders.: Visual Thinking, Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1969. Arnheim, Rudolf: Visual Thinking, Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1969. Aubenque, Pierre; Kobusch, Theo; Oeing-Hanhoff, Ludger; Acham, Karl; Mittelstraß, Jürgen; Kambartel, Walter: »Abstraktion«, in: Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 1, Basel: Schwabe & Co, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971, S. 42–65. Aubenque, Pierre; Oeing-Hanhoff, Ludger: »Abstrakt/konkret«, in: Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 1, Basel: Schwabe & Co, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971, S. 33–42. Aydede, Murat: »The Language of Thought Hypothesis«, in: Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy, Herbst 2010, OnlineAusgabe: http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/languagethought/, [ohne Seitenangabe]. Barck, Karlheinz; Fontius, Martin; Schlenstedt, Dieter; Steinwachs, Burkhart; Wolfzettel, Friedrich (Hg.): Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler, 2000–2005. Baumgärtel, Gerhard: »Denk-Kunst und Bildnerisches Denken. Kritik der Concept Art«, in: Kunstforum International, Band 12, Dezember–Januar 1974/75, S. 88–111. Baumgarten, Alexander Gottlieb: »Aesthetica § 1«, in: ders: Texte zur Grundlegung der Ästhetik, übersetzt und herausgegeben von Hans Rudolf Schweizer, lateinisch-deutsch, Hamburg: Felix Meiner, 1983, S. 79–83. Baumgarten, Alexander Gottlieb: Ästhetik, Band 1, übersetzt und herausgegeben von Dagmar Mirbach, lateinisch-deutsch, Hamburg: Felix Meiner, 2007, Originalausgabe: ders: Aestetica, Frankfurt an der Oder: Johannes Christian Kleyb, 1750.
Verzeichnisse | 291
Baumgarten, Alexander Gottlieb: Metaphysica – Metaphysik, übersetzt und herausgegeben von Günter Gawlick und Lothar Kreimendahl, lateinischdeutsch, Stuttgart: Frommann-Holzboog, 2011. Originalausgabe: ders.: Metyphysica, Halle, Magdeburg: Carl Hermann Hemmerde, 1739. Becker-Carus, Christian: Allgemeine Psychologie. Eine Einführung, München: Spektrum Akademischer Verlag, Elsevier, 2004. Biedermann, Hans: »Säulen«, in: ders.: Knaurs Lexikon der Symbole, München: Knaur Verlag, 1989, 3. Auflage 1998, S. 376–377. Blasche, Siegfried: »abstrakt«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 1, Stuttgart: Metzler, 1980, korrigierter Nachdruck, 1995, unveränderte Sonderausgabe 2004, S. 37. Blasche, Siegfried: »Abstraktion«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 1, Stuttgart: Metzler, 1980, korrigierter Nachdruck, 1995, unveränderte Sonderausgabe 2004, S. 37– 38. Blondel, Maurice: Das Denken, Band 2: Die Verantwortung des Denkens und die Möglichkeit seiner Vorstellung, übersetzt von Robert Scherer, Freiburg, München: Karl Alber, 1956. Originalausgabe: ders.: La Pensée, Paris: Presses Universitaires de France, 1934. Boehm, Gottfried: »Das Bild und die hermeneutische Reflexion«, in: Figal, Günter; Gander, Hans-Helmut (Hg.): Dimensionen des Hermeneutischen. Heidegger und Gadamer, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 2005, S. 23–35. Boehm, Gottfried: »Das bildnerische Kontinuum. Gattung und Bild in der Moderne«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens, Berlin: University Press, 2007, S. 159–179. Boehm, Gottfried: »Das Zeigen der Bilder«, in: Boehm, Gottfried; Egenhofer, Sebastian; Spies, Christian (Hg.): Zeigen. Die Rhetorik des Sichtbaren, München: Wilhelm Fink, 2010, S. 19–53. Boehm, Gottfried: »Die Hintergründe des Zeigens. Deiktische Wurzeln des Bildes«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens, Berlin: University Press, 2007, S. 19–33. Boehm, Gottfried: »Die Kraft der Bilder. Die Kunst von ›Geisteskranken‹ und der Bilddiskurs«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens, Berlin: University Press, 2007, S. 229–242. Boehm, Gottfried: »Die Wiederkehr der Bilder«, in: ders. (Hg.): Was ist ein Bild?, München: Wilhelm Fink, 1994, 2. Auflage 1995, S. 11-38.
292 | Bildnerisches Denken
Boehm, Gottfried: »Einführung. Faszinationen und Argumente«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens, Berlin: University Press, 2007, S. 9–18. Boehm, Gottfried: »Jenseits der Sprache? Anmerkungen zur Logik der Bilder«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens, Berlin: University Press, 2007, S. 34–53. Boehm, Gottfried: »Unbestimmtheit. Zur Logik des Bildes«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens, Berlin: University Press, 2007, S. 199–212. Boehm, Gottfried: »Zuwachs an Sein. Hermeneutische Reflexion und bildende Kunst«, in: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens, Berlin: University Press, 2007, S. 243–268. Bormann, Claus von; Kuhlen, Rainer; Oeing-Hanhoff, Ludger; Foppa, Klaus: »Denken«, in: Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 2, Basel: Schwabe & Co, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972, S. 60–104. Brandt, Reinhard: »Das Denken und die Bilder«, in: Nortmann, Ulrich; Wagner, Christoph (Hg.): In Bildern denken? Kognitive Potentiale von Visualisierung in Kunst und Wissenschaft, München: Fink, 2010, S. 29– 42. Breyer, Herber; Otto, Gunter, Wienecke, Günter (Hg.): Kunstunterricht. Planung bildnerischer Denkprozesse, Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann, 1970, 2. Auflage 1973. Brion, Marcel: Geschichte der abstrakten Kunst, übersetzt und überarbeitet von Herma Buse, Stuttgart, Hamburg: Dt. Bücherbund, 1962. Originalausgabe: ders.: L’Art Abstrait, Paris: Edition Albin Michel, 1956. Brown, John H.: »Art, abstract«, in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, London: Routledge, 1998, überarbeitet 2011, Online-Ausgabe, http://www.rep.routledge.com/article/M00l, [ohne Seiten-angabe]. Bunge, Matthias: Zwischen Intuition und Ratio. Pole des Bildnerischen Denkens bei Kandinsky, Klee und Beuys, Stuttgart: Franz Steiner, 1996. Caldarola, Elisa: »Representation without background? A critical reading of Wollheim and Greenberg on the representational character of abstract pictures«, in: Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico, Band 5, Heft 2, Oktober 2012, Online-Ausgabe, http://www.fupress.net/index. php/aisthesis/article/view/11466/10956, [ohne Seitenangabe].
Verzeichnisse | 293
Carnap, Rudolf: Der logische Aufbau der Welt, Berlin: Weltkreis-Verlag, 1928, Hamburg: Felix Meiner, 3. Auflage, 1966. Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London: Routledge, 1998, Online-Ausgabe, http://www.rep.routledge.com, [ohne Seitenangabe]. Dewey, John: Art as experience, New York: Perigee Books Berkley Publishing, 1980. Originalausgabe: ders.: Art as experience, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1934. Ehmer, Hermann K.: »Krise und Identität – Zur Kritik einiger fachdidaktischer und fachpolitischer Kategorien«, in: Hartwig, Helmut (Hg.): Sehen
lernen. Kritik und Weiterarbeit am Konzept Visuelle Kommunikation, Köln: DuMont Schauberg, 1976, S. 13–40. Ehmer, Hermann K.: »Vorwort«, in: ders. (Hg.): Kunst/Visuelle Kommunikation. Unterrichtmodelle, Steinbach (Giessen): Anabas-Verlag, 1973, 3. Auflage 1974, S. 5–9. Eid, Klaus; Langer, Michael; Ruprecht, Hakon: Grundlagen des Kunstunterrichts, Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1994, 6. Auflage 2002. Engel, Franz; Queisner, Moritz; Tullio, Viola (Hg.): Das bildnerische Denken: Charles S. Peirce, Berlin: Akademie, 2012. Engel, Franz; Queisner, Moritz; Tullio, Viola: »Einleitung«, in: dies. (Hg.): Das bildnerische Denken: Charles S. Peirce, Berlin: Akademie, 2012, S. 39–50. Fassmann, Kurt: »Abstrakte Malerei«, in: ders. (Hg.): Kindlers Malereilexikon, Band 6: Sachwörterbuch der Weltmalerei, Zürich: Kindler, 1971, S. 10–25. Fiedler, Konrad: »Der Ursprung der künstlerischen Tätigkeit«, in: ders: Schriften über Kunst, Köln: DuMont, 1977, Nachdruck, 1996, S. 131–240. Originalausgabe: ders.: Der Ursprung der künstlerischen Tätigkeit, Leipzig: Hirzel, 1887. Flade, Antje: »Wahrnehmung«, in: Asanger, Roland; Wenninger, Gerd (Hg.): Handwörterbuch Psychologie, Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union, 1999, S. 833–838. Geoffrey Hellman: »Introduction«, in: Structure of Appearance, Harvard: President and Fellows of Harvard College, 1951, Dordrecht, Boston: D. Reidel Publishing Company, 3. Auflage, 1977, S. XIX–XLVII. Giffhorn, Hans: Kritik der Kunstpädagogik. Zur gesellschaftlichen Funktion eines Schulfachs, Köln: DuMont Schauberg, 1972.
294 | Bildnerisches Denken
Glaser-Henzer, Edith: »Einblicke in die Entwicklung der Fachdidaktik Bildnerisches Gestalten in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung: Bezüge zum Wandel in der Kunst, im kunstpädagogischen Denken und im Fach Bildnerisches Gestalten«, in: Beiträge zur Lehrerbildung, Zeitschrift zur
Theorie und Praxis der Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern, 31. Jahrgang, Heft 1: Fachdidaktik – Überlegungen und Standpunkte, 2013, S. 53–63. Gombrich, Ernst: »›The Sky is the Limit‹: The Vault of Heaven and Pictorial Vision«, in: ders.: The Image and the Eye. Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation, Oxford: Phaidon Press, 1982, S. 162–171. Gombrich, Ernst: »Experiment and Experience in the Arts«, in: ders.: The
Image and the Eye. Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation, Oxford: Phaidon Press, 1982, 215–243. Gombrich, Ernst: »Mirror and Map: Theories of Pictorial Representation«, in: ders.: The Image and the Eye. Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation, Oxford: Phaidon Press, 1982, S. 172–214. Gombrich, Ernst: »The Mask and the Face: The Perception of Physiognomic Likeness in Life and in Art«, in: ders.: The Image and the Eye. Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation, Oxford: Phaidon Press, 1982, S. 105–136. Gombrich, Ernst: Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation, New York: Pantheon Books, 1960. Gombrich, Ernst: The Sense of Order. A Study in the Psychology of Decorative Art, Oxford: Phaidon, 1979, 2. Auflage 1980. Goodman, Nelson: Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1968, Indianapolis, Cambridge: Hackett Publishing Company, 2. überarbeitete Auflage, 1976. Goodman, Nelson: Of Mind and Other Matters, Cambridge, London: Harvard University Press, 1984. Goodman, Nelson: Structure of Appearance, Havard: President and Fellows of Harvard College 1951, Dordrecht, Boston: D. Reidel Publishing Company, 3. Auflage, 1977. Goodman, Nelson; Elgin, Catherine Z.: Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences, Indianapolis: Hackett Publishing, 1988. Gottschling, Verena: Bilder im Geiste. Die Imagery-Debatte, Paderborn: Mentis, 2003.
Verzeichnisse | 295
Grimm, Jacob und Wilhelm: »Wahrnehmen«, in: dies.: Deutsches Wörterbuch, Leipzig: S. Hirzel, 1854–1961, Quellenverzeichnis, 1971, Online-Ausgabe, http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode= Vernetzung&lemid=GW02881, Band 27, Sp. 941–967. Haftmann, Werner: Paul Klee. Wege bildnerischen Denkens, München: Prestel, 1950. Hale, Bob: »Abstract objects«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London: Routledge, 1998, Online-Ausgabe, http://www.rep.routledge.com/article/N080, [ohne Seitenangabe]. Haller, Rudolf; Mittelstraß, Jürgen: »Begriff«, in: Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 1, Basel: Schwabe & Co, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971, S. 780–787. Hamilton, Sir William: »Lecture 34. The Elaborative Faculty – Classification – Abstraction«, in: ders.: Lectures on Methaphysics and Logic in four Volumes, Band 2, Edinburgh, London: William Blackwood and Sons, 1870, S. 277–290. Hartmann, Dirk: »Ist die konstruktive Abstraktionstheorie inkonsistent?«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 47, Heft 2, April–Juni 1993, S. 271–285. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: »Wer denkt abstrakt?«, in: ders.: Werke, Band 17: Vermischte Schriften, zweiter Band, Berlin: Verlag von Duncker und Humblot, 1835, S. 400–405. Heidegger, Martin: Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1929, 5. vermehrte Auflage 1991. Heßler, Martina; Mersch, Dieter (Hg.): Logik des Bildlichen. Zur Kritik der ikonischen Vernunft, Bielefeld: transcript, 2009. Heßler, Martina; Mersch, Dieter: »Einleitung: Bildlogik oder Was heißt visuelles Denken?«, in: dies. (Hg.): Logik des Bildlichen. Zur Kritik der ikonischen Vernunft, Bielefeld: transcript, 2009, S. 8–62. Hildebrandt, Toni: »›Bildnerisches Denken‹. Martin Heidegger und die bildende Kunst«, in: Espinet, David; Keiling, Tobias (Hg.): Heideggers Ursprung des Kunstwerks. Ein kooperativer Kommentar, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 2011, S. 219–234. Hochberg, Julian; Brooks, Virginia: »Pictorial Recognition as an Unlearned Ability: A Study of One Child’s Performance«, in: American Journal of Psychology, Band 75, Heft 4, Dezember 1962, S. 624–628.
296 | Bildnerisches Denken
Hopkins, Robert: »Depiction«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London: Routledge, 1998, überarbeitet 2011, Online-Ausgabe, https://www.rep.routledge.com/articles/depiction/v-2 [ohne Seitenangabe]. Imdahl, Max: »Ikonographie – Ikonologie – Ikonik«, in: ders.: Giotto Arenafresken, Ikonographie, Ikonologie, Ikonik, München: Wilhelm Fink, 1980, 2. Auflage, 1988, S. 84–98. Ingarden, Roman: »Das Bild«, in: ders.: Untersuchungen zur Ontologie der Kunst. Musikwerk – Bild –Architektur – Film, Tübingen: Niemeyer, 1962, S. 137–253. Ingarden, Roman: »Über die sogenannte ›abstrakte‹ Malerei«, in: ders.: Erlebnis, Kunstwerk und Wert. Vorträge zur Ästhetik 1937–1967, Tübingen: Niemeyer, 1969, S. 51–76. James, William: The Meaning of Truth. A Sequel to ›Pragmatism‹, London: Longmans, Green, and Co, 1909. Jamieson, Dale: »Animal language and thought«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London: Routledge, 1998, OnlineAusgabe, http://www.rep.routledge.com/article/U003, [ohne Seitenangabe]. Jäsche, Gottlob Benjamin (Hg.): »Immanuel Kants Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen«, in: Kant, Immanuel: Gesammelte Schriften, AkademieAusgabe, Abteilung I: Werke, Band 9: Logik. Physische Geographie, Pädagogik, Berlin: de Gruyter, 1923, Online-Ausgabe, http://korpora.zim.uni-due.de/Kant/aa09/, S. 1–150. Originalausgabe: ders. (Hg.): Immanuel Kants Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen, Königsberg: Friedrich Nicolovius, 1800. Jenny, Peter: »Bildnerisches Denken«, in: Die Zukunft beginnt im Kopf: Wissenschaft und Technik für die Gesellschaft, Zürich: vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, 1994, S. 126–134. Jenny, Peter: »Warum Bilder nicht allein den Spezialisten überlassen werden dürfen«, in: ders.: Das Wort, das Spiel, das Bild: Unterrichtsmethoden für die Gestaltung von Wahrnehmungsprozessen, Zürich: vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 1996, S. 218–233. Jonas, Hans: »Homo Pictor und die Differentia des Menschen«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 15, Heft 2, 1961, S. 161–176.
Verzeichnisse | 297
Kamlah, Wilhelm; Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik, Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut, 1967, 2. verbesserte und erweiterte Auflage 1973, unveränderter Nachdruck, 1990. Kandinsky, Wassily: »abstrakt oder konkret?«, in: ders.: Essays über Kunst und Künstler, Sulgen, Zürich: Benteli, 1986, S. 223–225. Dieser Aufsatz ist erstmals erscheinen im Katalog der Tentoonstelling abstracte Kunst (Ausstellung abstrakte Kunst) im Stefelijk Museum, Amsterdam, 1938. Kandinsky, Wassily: Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente, Bern: Benteli, 3. Auflage, 1955, 9. Auflage, 2009. Originalausgabe: ders.: Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente, Bauhausbücher Band 9, München: A. Langen, 1926. Kant, Immanuel: »Kritik der reinen Vernunft«, in: ders.: Gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe, Abteilung I: Werke, Band 3: Kritik der reinen Vernunft, 2. Auflage, Berlin: de Gruyter, 1911, Online-Ausgabe, http://korpora.zim.uni-due.de/Kant/aa03/. Originalausgabe: ders.: Kritik der reinen Vernunft, Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1781, 2. verbesserte Auflage, 1787. Kant, Immanuel: »Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik«, in: ders.: Gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe, Abteilung III: Handschriftlicher Nachlass, Band 20: Bemerkungen zu den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, Berlin: de Gruyter, 1971, Online-Ausgabe, http://korpora.zim.uni-due.de/Kant/aa20/, S. 253–332. Originalausgabe: ders.: Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik, Königsberg: Goebbels und Unzer, 1804. Kant, Immanuel: »Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll«, in: ders.: Gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe, Abteilung I: Werke, Band 8: Abhandlungen nach 1781, Berlin: de Gruyter, 1969, Online-Ausgabe, http://korpora.zim.uni-due.de/Kant/aa08/, S. 185–252. Originalausgabe: ders.: Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der rei-
nen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll, Königsberg: Friedrich Nicolovius, 1790. Kant, Immanuel: »Versuch den Begriff der negativen Grössen in die Weltweisheit einzuführen«, in: ders.: Gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe, Abteilung I: Werke, Band 2: Vorkritische Schriften 1757–1777, Berlin: de Gruyter, 1969, S. 165–204. Originalausgabe: ders.: Versuch
298 | Bildnerisches Denken
den Begriff der negativen Grössen in die Weltweisheit einzuführen, Königsberg: Johann Jacob Kanter, 1763. Kant, Immanuel: Gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe, Abteilung III: Handschriftlicher Nachlass, Band 16: Logik, Berlin: de Gruyter, 1924, Neudruck 1969. Khurana, Thomas: »Schema und Bild. Kant, Heidegger und das Verhältnis von Repräsentation und Abstraktion«, in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, Band 58, Heft 2, 2013, S. 203–224. Kirchner, Constanze: Kunstpädagogik für die Grundschule, Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2009. Klee, Paul: Form- und Gestaltungslehre, Band 1: Das Bildnerische Denken, herausgegeben und bearbeitet von Jürg Spiller, Basel, Stuttgart: Schwabe, 1956. Klee, Paul: Notebooks, Band 1: The Thinking Eye, herausgegeben und bearbeitet von Jürg Spiller, New York: Geroge Wittenborn, London: Lund Humpries, 1961. Originalausgabe: Klee, Paul: Form- und Gestaltungslehre, Band 1: Das Bildnerische Denken, herausgegeben und bearbeitet von Jürg Spiller, Basel, Stuttgart: Schwabe, 1956. Krautz, Jochen: »Bildnerisches Denken lehren und lernen«, in: Cron, Béatrice; Tobias, Karen Betty: Faszination Komposition. Grundelemente der Komposition im bildnerischen Bereich. Ein Werkbuch, Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2014, S. 8–12. Kulvicki, John: »Twofoldness and Visual Awareness«, in: Sachs-Hombach, Klaus; Trotzke, Rainer (Hg.): Bilder – Sehen – Denken. Zum Verhältnis
von begrifflich-philosophischen und empirisch-psychologischen Ansätzen in der bildwissenschaftlichen Forschung, Köln: Herbert von Halem, 2011, S. 66–92. Künne, Wolfgang: »Abstrakte Gegenstände via Abstraktion? Fragen zu einem Grundgedanken der Erlanger Schule«, in: Prätor, Klaus (Hg.): Aspekte der Abstraktionstheorie. Ein interdisziplinäres Kolloquium, Aachen: Rader, 1988, S. 19–24. Lange, Thomas: Das bildnerische Denken Philipp Otto Runges, Berlin, München: Deutscher Kunstbuchverlag, 2010. Lorenz, Kuno: »abstrakt«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 1, Stuttgart: Metzler, 1980, korrigierter Nachdruck, 1995, 2. neubearbeitete und wesentlich ergänzte Auflage, 2005, S. 20–21.
Verzeichnisse | 299
Lorenz, Kuno: »Abstraktum«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 1, Stuttgart: Metzler, 1980, korrigierter Nachdruck, 1995, 2. neubearbeitete und wesentlich ergänzte Auflage, 2005, S. 25–26. Lorenz, Kuno: »dual/Dualität«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 2, Stuttgart: Metzler, 1984, korrigierter Nachdruck, 1995, 2. neubearbeitete und wesentlich ergänzte Auflage, 2005, S. 249–250. Lorenz, Kuno: »konkret«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 4, Stuttgart: Metzler, 1996, 2. neubearbeitete und wesentlich ergänzte Auflage, 2010, S. 298. Lorenz, Kuno: »konkret«, Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 2, Stuttgart: Metzler, 1984, korrigierter Nachdruck, 1995, unveränderte Sonderausgabe 2004, S. 438. Lorenz, Kuno: »Konkretion«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 4, Stuttgart: Metzler, 1996, 2. neubearbeitete und wesentlich ergänzte Auflage, 2010, S. 298–299. Lorenz, Kuno: »Konkretion«, Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 2, Stuttgart: Metzler, 1984, korrigierter Nachdruck, 1995, unveränderte Sonderausgabe 2004, S. 438. Lorenz, Kuno: »Konkretum«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 4, Stuttgart: Metzler, 1996, 2. neubearbeitete und wesentlich ergänzte Auflage, 2010, S. 299. Lorenzen, Paul: »Logik und Grammatik«, in: ders.: Methodisches Denken, Frankfurt a M.: Suhrkamp,1968, 2. Auflage 1974, S. 70–80. Lorenzen, Paul: »Methodisches Denken«, in: ders.: Methodisches Denken, Frankfurt a M.: Suhrkamp,1968, 2. Auflage 1974, S. 24–59. Mach, Ernst: »Deduktion und Induktion in psychologischer Hinsicht«, in: Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung, Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1905, 2. Auflage, 1906, S. 304–319. Mach, Ernst: »Der Begriff«, in: Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung, Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1905, 2. Auflage, 1906, S. 126–143. Mach, Ernst: »Die Sprache«, in: Prinzipien der Wärmelehre, Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1896, 2. Auflage 1900, S. 406–414.
300 | Bildnerisches Denken
Mach, Ernst: »Die Vergleichung als wissenschaftliches Princip«, in: Prinzipien der Wärmelehre, Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1896, 2. Auflage 1900, S. 396–405. Mach, Ernst: »Einfluß der vorausgehenden Untersuchungen auf die Auffassung der Physik«, in: Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen, Jena: Gustav Fischer, 1886, 2. vermehrte Auflage 1900, 3. vermehrte Auflage 1902, 4. vermehrte Auflage 1903, 9. Auflage 1922, S. 251–288. Mach, Ernst: »Über das Princip der Vergleichung in der Physik«, in: Populär-wissenschaftliche Vorlesungen, Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1896, 3. Auflage 1903, S. 263–286. Mallot, Hanspeter, A.: »Visuelle Wahrnehmung«, in: Funke, Joachim; Frensch, Peter, A. (Hg.): Handbuch der Allgemeinen Psychologie – Kognition, Göttingen: Hogrefe, 2006, S. 127–137. Margolis, Eric; Laurence, Stephen: »Concepts«, in: Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy, Frühjahr 2014, Online-Ausgabe, http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/concepts/, [ohne Seitenangabe]. May, Mark: »Raumwahrnehmung«, in: Funke, Joachim; Frensch, Peter, A. (Hg.): Handbuch der Allgemeinen Psychologie – Kognition, Göttingen: Hogrefe, 2006, S. 173 –181. Meier, Georg Friedrich: Auszug aus der Vernunftlehre, Halle: Johann Justinus Gebauer, 1752, Nachdruck in: Kant, Immanuel: Gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe, Abteilung III: Handschriftlicher Nachlass, Band 16: Logik, Online-Ausgabe, http://korpora.zim.uni-due.de/Kant/ meier/, S. 1–872. Menge, Hermann; Güthling, Otto: Enzyklopädisches Wörterbuch der lateinischen und deutschen Sprache. Erster Teil, lateinisch-deutsch, Berlin: Langenscheidt, 1911, 8. Auflage 1954. Michael Jäger: Kommentierende Einführung in Baumgartens »Aesthetica«.
Zur entstehenden wissenschaftlichen Ästhetik des 18. Jahrhunderts in Deutschland, Hildesheim, New York: Georg Olms, 1980. Mill, John Stuart: »A System of Logic. Ratiocinative and Inductive Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation«, Bücher IV–VI, in: Robson, John M. (Hg.): Collected Works of John Stuart Mill, Band 8, Toronto, London: University of Toronto Press und Routledge & Kegan Paul, 1978, 2. Auflage 1981.
Verzeichnisse | 301
Originalausgabe: ders.: A System of Logic. Ratiocinative and Inductive Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation, Band 2, London: John W. Parker West Strand, 1843. Mill, John Stuart: »An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy and of the principal philosophical questions discussed in his writings«, in: Robson, John M. (Hg.): Collected Works of John Stuart Mill, Band 9, Toronto, London: University of Toronto Press und Routledge & Kegan Paul, 1979. Originalausgabe: ders.: An Examination of Sir William
Hamilton’s Philosophy and of the principal philosophical questions discussed in his writings, London: Longmans Green and Co, 1. und 2. Auflage 1865. Mitchell, W. J. T. »Four Fundamental Concepts of Image Science«, in Elkins, James (Hg.): Visual Literacy, New York: Taylor & Francis, 2008, S. 14–29. Mitchell, W. J. T.: »What Is an Image?«, in: New Literary History, Band 15, Heft 3, Frühling 1984, S. 503–537. Mitchell, W.J.T.: Picture Theory, Chicago, London: University of Chicago Press, 1994, Paperback edition 1995. Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie Wissenschaftstheorie, Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler, 1980–1996, 2. neubearbeitete und wesentlich ergänzte Auflage 2005ff. Mittelstraß, Jürgen: »Begriff«, in: ders. (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 1, Stuttgart: Metzler, 1980, korrigierter Nachdruck, 1995, 2. neubearbeitete und wesentlich ergänzte Auflage, 2005, S. 384–386. Mittelstraß, Jürgen: »Denken«, in: ders. (Hg.): Enzyklopädie Philosophie Wissenschaftstheorie, Band 1, Mannheim: Bibliographisches Institut, 1984, Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler, 1995, unveränderte Sonderausgabe 2004, S. 449–450. Mittelstraß, Jürgen: »Die Prädikation und die Wiederkehr des Gleichen«, in: ders.: Die Möglichkeit von Wissenschaft, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1974, S. 145–157. Mittelstraß, Jürgen; Lorenz, Kuno: »Denken«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie Wissenschaftstheorie, Band 2, Stuttgart: Metzler, 1984, korrigierter Nachdruck, 1995, 2. neubearbeitete und wesentlich ergänzte Auflage 2005, S. 154–156.
302 | Bildnerisches Denken
Mohr, Georg; Willaschek, Marcus: »Einleitung«, in: dies. (Hg.): Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft, Berlin: Akademie-Verlag, 1998. Mondrian, Piet: Die Neue Gestaltung. Neoplastizismus, übersetzt von Max Burchartz und Rudolf F. Hartogh, Mainz: Florian Kupferberg, 1974. Faksimile-Nachdruck der Originalausgabe: ders.: Die Neue Gestaltung. Neoplastizismus, Bauhausbücher Band 5, Eschwege: Poeschel & SchulzSchomburgk, 1925. Mulligan, Kevin: »Predication«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London: Routledge, 1998, Online-Ausgabe, http://www.rep.routledge.com/article/X028, [ohne Seitenangabe]. Niehoff, Rolf: »Bildung – Bild(er) – Bildkompetenz(en): Zu einem wesentlichen Bildungsbeitrag des Kunstunterrichts«, in: Bering, Kunibert; Niehoff, Rolf (Hg.): Bildkompetenz(en). Beiträge des Kunstunterrichts zur Bildung, Oberhausen: Athena 2009, S. 13–42. Oeing-Hanhoff, Ludger: »Abstraktion« (Teil III), in: Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel: Schwabe & Co, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971, S. 47–59. Otto, Gunter: »Nachwort über Kommunikation«, in: Breyer, Herber; Otto, Gunter, Wienecke, Günter (Hg.): Kunstunterricht. Planung bildnerischer Denkprozesse, Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann, 1970, 2. Auflage 1973, S. 169–181. Pape, Helmut: »Was ist Peirce’ bildnerisches Denken?«, in: Engel, Franz; Queisner, Moritz; Tullio, Viola (Hg.): Das bildnerische Denken: Charles S. Peirce, Berlin: Akademie, 2012, S. 65–91. Pfennig, Reinhard: Bildende Kunst der Gegenwart: Analyse und Methode, Oldenburg: Isensee, 1959. Pfennig, Reinhard: Gegenwart der Bildenden Kunst, Erziehung zum Bildnerischen Denken, Oldenburg: Isensee, 1964, 2. verbesserte und erweiterte Auflage 1967, 4. verbesserte und erweiterte Auflage 1970, 5. Auflage 1974. Posner, Roland: »Ebenen der Bildkompetenz«, in: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Was ist Bildkompetenz? Studien zur Bildwissenschaft, Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 2003, S. 17–23. Prätor, Klaus: »Einleitung«, in: ders. (Hg.): Aspekte der Abstraktionstheorie. Ein interdisziplinäres Kolloquium, Aachen: Rader, 1988, S. 4–9. Prätor, Klaus: »Wer hat Angst vor ›dem‹ Nashorn? Einige Bedenken nicht nur zur konstruktivistischen Abstraktionstheorie«, in: ders. (Hg.): As-
Verzeichnisse | 303
pekte der Abstraktionstheorie. Ein interdisziplinäres Kolloquium, Aachen: Rader, 1988, S. 64–85. Prien, Bernd: Kants Logik der Begriffe. Die Begriffslehre der formalen und transzendentalen Logik Kants. Berlin: De Gruyter, 2006. Proust, Joëlle: »Abstraction et concrétisation«, in: Dascal, Marcelo; Gerhardus, Dietfried; Lorenz, Kuno; Meggle, Georg: Sprachphilosophie –
Philosophy of Language – La philosophie du langue. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, 2. Halbband, Berlin, New York: de Gruyter, 1996, S. 1198–1210. Rajala, Abilgail Z; Reinigner, Katharine R.; Lancaster, Kimberly M., Populin, Luis, C.: »Rhesus Monkeys (Macaca mulatta) Do Recognize Themselves in the Mirror: Implications for the Evolution of Self-Recognition«, in: PLoS ONE (Public Library of Science), Band 5, Heft 9, September 2010, Online-Ausgabe, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 2947497/, [ohne Seitenangabe]. Ränsch-Trill, Barbara: »Vom abstrakten Denken des gemeinen Verstandes«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 34, Heft 1, Januar– März 1980, S. 96–107. Rey, Georges: »Concepts«, in: Craig, Edward (Hg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London: Routledge, 1998, Online-Ausgabe, http://www. rep.routledge.com/article/W008, [ohne Seitenangabe]. Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel: Schwabe & Co, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971–2007. Rosen, Gideon: »Abstract Objects«, in: Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy, Frühling 2012, Online-Ausgabe, http://plato. stanford.edu/archives/spr2012/entries/abstract-objects, [ohne Seitenan gabe]. Sachs-Hombach, Klaus: Das Bild als kommunikatives Medium. Elemente einer allgemeinen Bildwissenschaft, Köln: Herbert von Halem, 2003, 2. leicht verbesserte Auflage 2006. Sachs-Hombach, Klaus; Schirra, Jörg R. J.: »Medientheorie, visuelle Kultur und Bildanthropologie«, in: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bildtheorien. Anthropologische und kulturelle Grundlagen des Visualistic Turn, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2009, S. 393–426.
304 | Bildnerisches Denken
Sachs-Hombach, Klaus; Schürmann, Eva: »Philosophie«, in: SachsHombach, Klaus (Hg.): Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, Methoden, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2005, S. 109–123. Sandkühler, Hans-Jörg (Hg.): Enzyklopädie Philosophie, Hamburg: Felix Meiner, 1999. Scherer, Robert: »Einführung«, in: Blondel, Maurice: Das Denken, Band 1:
Die Genesis des Denkens und die Stufen seiner spontan aufsteigenden Bewegung, Freiburg, München: Karl Alber, 1956, S. VIII– XXXII. Originalausgabe: La Pensée, Paris: Presses Universitaires de France, 1934. Schirra, Joerg R. J.; Liebsch, Dimitri: »Bildmedien«, in: Schirra, Jörg R. J., Halawa, Mark; Liebsch, Dimitri; Birk, Elisabeth; Schürmann, Eva (Hg.): Glossar der Bildphilosophie, 2013, Online-Ausgabe, http://www.gib.unituebingen.de/netzwerk/glossar/index.php?title=Bildmedien&oldid=2178, [ohne Seitenangabe]. Schmidt, Stephan: »›Eine kleine Reise in das Land der besseren Erkenntnis‹: Paul Klee und der Begriff des ›bildnerischen Denkens‹«, in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, Band 56, Heft 2, 2011, S. 275–296. Schneider, Hans J.: »Abstraktion«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 1, Stuttgart: Metzler, 1980, korrigierter Nachdruck, 1995, 2. neubearbeitete und wesentlich ergänzte Auflage, 2005, S. 21–24. Schneider, Hans J: Historische und systematische Untersuchungen zur Abstraktion, Inaugural-Dissertation der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 1970, [ohne Verlag]. Schneider, Hans Julius: »Der Konstruktivismus ist kein Reduktionismus! Thesen zur konstruktivistischen Abstraktionstheorie«, in: Prätor, Klaus (Hg.): Aspekte der Abstraktionstheorie. Ein interdisziplinäres Kolloquium, Aachen: Rader, 1988, S. 164–169. Scholz, Oliver: Bild, Darstellung, Zeichen. Philosophische Theorie bildlicher Darstellung, Freiburg (Breisgau), München: Alber, 1991, 2. vollständig überarbeitete Auflage, Frankfurt a. M.: Klostermann, 2004, 3. Auflage, 2009. Schürmann, Eva: »Bildwahrmehmung«, in: Schirra, Jörg R. J., Halawa, Mark; Liebsch, Dimitri; Birk, Elisabeth; Schürmann, Eva (Hg.): Glossar der Bildphilosophie, 2013, Online-Ausgabe, http://www.gib.uni-
Verzeichnisse | 305
tuebingen.de/netzwerk/glossar/index.php?title=Bildwahrnehmung&oldi d=21807, [ohne Seitenangabe]. Schweppenhäuser, Gerhard: Ästhetik. Philosophische Grundlagen und Schlüsselbegriffe, Frankfurt a. M.: Campus, 2007. Seiffert, August: Concretum. Gegebenheit – Rechtmäßigkeit – Berichtigung, Meisenheim am Glan: Anton Hain KG, 1961. Siegwart, Geo: »›Die fundamentale Methode der Abstraktion‹. Replik auf Dirk Hartmann und Christian Thiel«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 47, Heft 4, Oktober–Dezember 1993, S. 606–614. Spiller, Jürg: »Einführung: Entstehung der pädagogischen Schriften«, in: Klee, Paul: Form- und Gestaltungslehre, Band 1: Das Bildnerische Denken, herausgegeben und bearbeitet von Jürg Spiller, Basel, Stuttgart: Schwabe, 1956, S. 9–31. Städtler, Thomas: »Schema«, in: ders.: Lexikon der Psychologie, Stuttgart: Kröner, 2003, S. 951–954. Stetter, Christian: »Zum Problem der Abstraktion in der Linguistik«, in: Prätor, Klaus (Hg.): Aspekte der Abstraktionstheorie. Ein interdisziplinäres Kolloquium, Aachen: Rader, 1988, S. 49–63. Thiel, Christian: »Geo Siegwarts Szenario. Eine katastrophentheoretische Untersuchung. Zugleich ein Versuch, enttäuschte Kenner wieder aufzurichten«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 47, Heft 2, April–Juni 1993, 261–270. Uhlemann, Brigitte; Ganslandt, Herbert, R.: »Wahrnehmung«, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 4, Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1996, unveränderte Sonderausgabe 2004, S. 601 –603. van Doesburg, Theo: »Kommentar über die Grundlagen der konkreten Malerei«, in: Art Concret, 1. Jahrgang, Heft 1, April 1930, (es folgten keine weiteren Ausgaben), zitiert aus: Waetzoldt, Stephan; Haas, Verena (Red.): Tendenzen der Zwanziger Jahre, Katalog zur Ausstellung, Berlin: Dietrich Reimer, 1977, S. 1/190–1/191. Waldenfels, Bernhard: »Das Rätsel des Sichtbaren. Kunstphänomenologische Betrachtungen im Hinblick auf den Status der modernen Malerei«, in: ders.: Der Stachel des Fremden, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1990, S. 204–224.
306 | Bildnerisches Denken
Waldenfels, Bernhard: »Der herausgeforderte Blick. Zur Orts- und Zeitbestimmung des Museums«, in: ders.: Der Stachel des Fremden, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1990, S. 225–242. Waldenfels, Bernhard: »Ordnungen des Sichtbaren. Zum Gedenken an Max Imdahl«, in: ders.: Sinnesschwellen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1999, S. 102–123. Waldenfels, Bernhard: »Spiegel, Spur und Blick. Zur Genese des Bildes«, in: Boehm, Gottfried (Hg.): Homo Pictor, München, Leipzig: Saur, 2001, S. 14–31. Waldenfels, Bernhard: Phänomenologie der Aufmerksamkeit, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2004. Waldenfels, Bernhard: Sinne und Künste im Wechselspiel. Modi ästhetischer Erfahrung, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2005. Weidemann, Hermann: »Prädikation« (Teil I), in: Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 7, Basel: Schwabe & Co, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989, S. 1194–1208. Welsch, Wolfgang: »Zur Aktualität ästhetischen Denkens«, in: ders.: Ästhetisches Denken, Stuttgart: Philipp Reclam, 1990, 7. Auflage 2010, S. 41–78. Welsch, Wolfgang: Ästhetisches Denken, Stuttgart: Philipp Reclam, 1990, 7. Auflage 2010. Welsch, Wolfgang: Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1996. Wick, Rainer: »Vorwort«, in: Jenny, Peter: Bildkonzepte, Mainz: Schmidt, Zürich: vdf, Hochschulverlag an der ETH, 2000, S. 6–14. Wienecke, Günter: »Bildnerisches Denken als Inhalt«, in: Breyer, Herber; Otto, Gunter, Wienecke, Günter (Hg.): Kunstunterricht. Planung bildnerischer Denkprozesse, Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann, 1970, 2. Auflage 1973, S. 74–97. Wienecke, Günter: »Bildnerisches Denken als Methode«, in: Breyer, Herber; Otto, Gunter, Wienecke, Günter (Hg.): Kunstunterricht. Planung bildnerischer Denkprozesse, Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann, 1970, 2. Auflage 1973, S. 98–134. Wiesing, Lambert: Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2005.
Verzeichnisse | 307
Wiesing, Lambert: Die Sichtbarkeit des Bildes, Reinbek: Rowohlt, 1997, Neuauflage Frankfurt a. M.: Campus, 2008. Wiesing, Lambert: Phänomene im Bild, München: Fink, 2000, 2. Auflage 2007. Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen, Frankfurt: Suhrkamp, 1971. Originalausgabe: ders.: Philosophische Untersuchungen – Philosophical Investigations, deutsch-englisch, herausgegeben von Elizabeth Anscombe und Rush Rhees, übersetzt von Elizabeth Anscombe, Oxford: Basil Blackwell, 1953. Wohlrapp, Harald: »Abstraktion in Marxens Wissenschaftsauffassung«, in: Prätor, Klaus (Hg.): Aspekte der Abstraktionstheorie. Ein interdisziplinäres Kolloquium, Aachen: Rader, 1988, S. 100–111. Wollheim, Richard: »On Pictorial Representation«, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Band 65, Heft 3, Sommer 1998, S. 217–226. Wollheim, Richard: Painting as an Art, Princeton: University Press, 1987. Zalta, Edward N. (Hg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy, Frühjahr 2014, Online-Ausgabe, http://plato.stanford.edu.
Zentrum Paul Klee in Bern (Hg.): »Einleitung« zu: Paul Klee – Bildnerische Form- und Gestaltungslehre, Online-Datenbank, http://www. kleegestaltungslehre.zpk.org/ee/ZPK/Archiv/ 2011/01/25/00001/.
Zentrum Paul Klee in Bern (Hg.): Paul Klee – Bildnerische Form- und Gestaltungslehre, Online-Datenbank, http://www.kleegestaltungslehre. zpk.org/ee/ZPK/Archiv/2011/01/25/00005/.
308 | Bildnerisches Denken
A BBILDUNGEN Nr. 1
Kapitel 3.1 Bob Ross: »Gebirgsspiegelung«, [ohne Jahresangabe], Öl auf Leinwand, 45,7 × 60,9 cm; © Ross, Bob; Kowalski, Annette: Freude am Malen. Landschaften in Öl, München: Basserman, 7. Auflage 2009, S. 20; © Bob Ross Inc., 2016.
Seite 107
2
Jackson Pollock: »Black and White N° 15« 1951, Kunstharzlack auf Leinwand, 142,2 × 167,7 cm, Museum Ludwig, Köln; © VG Bild-Kunst, Bonn 2016; © Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln, 2016.
107
3
See vor dem Berg, Acryl auf Papier, 30 × 40 cm, aus: Archiv der Autorin.
107
4
Josef Anton Koch: »Das Wetterhorn von der Rosenlaui aus«, 1824, Öl auf Leinwand, 94 × 83 cm, Museum Oskar Reinhard, Winterthur; © Foto: The Yorck Project: 25.000 Meisterwerke, DVD-ROM, Zweitausendeins & Directmedia Publishing GmbH, 2004.
107
5
Bob Ross: »Gebirgsspiegelung«, Ausschnitt, vgl. Abb. 1.
108
6
See vor dem Berg, Ausschnitt, Acryl auf Papier, 30 × 40 cm, aus: Archiv der Autorin, vgl. Abb. 3.
108
7
Kapitel 3.2 Zeichnung eines Gesichts, aus: Archiv der Autorin.
123
8
Farbiges Portrait, aus: Archiv der Autorin.
123
9
Albrecht Dürer: »Portrait der Mutter«, 1514, Kohle auf Papier, 42,1 × 30,3 cm, Kupferstichkabinett, Berlin; ©Foto: The Yorck Project: 25.000 Meisterwerke, DVD-ROM, Zweitausendeins & Directmedia Publishing GmbH, 2004.
123
10
Albrecht Dürer: »Porträt der Barbara Dürer, geb. Holper« (kleine Ansicht, vgl. Abb. 39), um 1490–93, Öl auf Tannenholz, 47 × 38 cm, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg; ©Foto: The Yorck Project: 25.000 Meisterwerke, DVD-ROM, Zweitausendeins & Directmedia Publishing GmbH, 2004.
123
Verzeichnisse | 309
11
Kapitel 3.4 Piktogramm 1, aus: American Institute of Graphic Arts United States Department of Transportation and designed by AIGA, online unter: www.aiga.org.
173/186
12
Piktogramm 2, aus: Vector Graphic by WebDesignHot, online unter: www.WebDesignHot.com.
173/186
13
Vgl. Abb. 10.
173/186
14
Vgl. Abb. 9.
173/186
15
Drei Dreiecke, aus: Archiv der Autorin.
179
16
Konstruktiver Beweis der Winkelsumme im Dreieck, aus: Archiv der Autorin.
182
17
Logo Rezeption & Produktion 1, aus: Archiv der Autorin.
188
18
Logo Rezeption & Produktion 2, aus: Archiv der Autorin.
188
19
Kapitel 4.1 Digitale Bearbeitung von: El Greco: »Christus am Kreuz mit zwei Stiftern«, Ausschnitt 1, vgl. Abb. 20, aus: Archiv der Autorin.
203
20
El Greco: »Christus am Kreuz mit zwei Stiftern«, Ausschnitt 1, vgl. Abb. 23.
203
21
El Greco: »Christus am Kreuz mit zwei Stiftern«, Ausschnitt 2, vgl. Abb. 23.
203
22
Mathis Gothart Grünewald: »Tauberbischofsheimer Altar«, Szene: »Die Kreuzigung Christi«, 1523–1524, Öl auf Holz, 151 × 193 cm, Kunsthalle Karlsruhe; ©Foto: The Yorck Project: 25.000 Meisterwerke, DVD-ROM, Zweitausendeins & Directmedia Publishing GmbH, 2004.
203
23
El Greco (Domenikos Theotokopoulos): »Christus am Kreuz mit zwei Stiftern«, um 1580, Öl auf Leinwand, 47 × 71 cm, Musée du Louvre, Paris; © Foto: Web Gallery of Art, 2016, online unter: www.wga.hu.
203
24
Kapitel 4.2 Caspar David Friedrich: »Frau vor untergehender Sonne«, Ausschnitt 1, vgl. Abb. 30.
221
25
Himmel, aus: Archiv der Autorin.
221
310 | Bildnerisches Denken
26
Caspar David Friedrich: »Frau vor untergehender Sonne«, Ausschnitt 2, vgl. Abb. 30.
221
27
Baum 1, aus: Archiv der Autorin.
221
28
Baum 2, aus: Archiv der Autorin.
221
29
Baum 3, aus: Archiv der Autorin.
221
30
Caspar David Friedrich: »Frau vor untergehender Sonne«, um 1818, Öl auf Leinwand, 22 × 30 cm, Museum Folkwang, Essen; ©Foto: The Yorck Project: 25.000 Meisterwerke, DVD-ROM, Zweitausendeins & Directmedia Publishing GmbH, 2004.
227
31
Digitale Bearbeitung von: Caspar David Friedrich: »Frau vor untergehender Sonne«, vgl. Abb. 30, aus: Archiv der Autorin.
228
32
Foto einer Spiegelung, aus: Archiv der Autorin.
229
33
Kapitel 5.2 Fernand Léger: »Le mécanicien« (Der Mechaniker), 1920, Öl auf Leinwand, 116 × 88,8 cm; © VG Bild-Kunst, Bonn 2016; © Foto: National Gallery of Canada, Ottawa, 2016.
256
34
Digitale Bearbeitung 1 von: Fernand Léger: »Le mécanicien« (Der Mechaniker), vgl. Abb.33, aus: Archiv der Autorin.
256
35
Digitale Bearbeitung 2 von: Fernand Léger: »Le mécanicien« (Der Mechaniker), vgl. Abb.33, aus: Archiv der Autorin.
256
36
Kompositionsanalyse zu: Fernand Léger: »Le mécanicien« (Der Mechaniker), vgl. Abb.33, aus: Archiv der Autorin.
256
37
Hyacinthe Rigaud: »Portrait des französischen Königs Ludwig der XIV«, 1701, Öl auf Leinwand, 279 × 190 cm, Musée du Louvre, Paris; ©Foto: The Yorck Project: 25.000 Meisterwerke, DVD-ROM, Zweitausendeins & Directmedia Publishing GmbH, 2004.
266
38
Kapitel 5.3 Piet Mondrian: »Tableau I«, 1921, Öl auf Leinwand, 103 × 100 cm, Gemeentemuseum, Den Haag; © Foto: Sammlung des Gemeentemuseums, Den Haag, 2016.
273
Verzeichnisse | 311
39
Albrecht Dürer: »Porträt der Barbara Dürer, geb. Holper« (große Ansicht), vgl. Abb. 10.
273
40
Komposition 1, aus: Archiv der Autorin.
275
41
Komposition 2, aus: Archiv der Autorin.
275
312 | Bildnerisches Denken
T ABELLEN Nr. 1
Kapitel 2.3 Argumentationsstruktur.
Seite 46
2
Kapitel 3.1 Die klassische Abstraktionstheorie.
57
3
Die moderne Abstraktionstheorie.
59
4
Voraussetzungen von Abstraktion in verschiedenen Theorien.
90
5
Kapitel 3.2 Vollzug und Gegenstandsbezug des abstrahierenden und konkretisierenden Denkens am Beispiel, darin: Abb. 7, 8, 9 und 10.
123
6
Kants Unterscheidung zwischen Anschauungen und Begriffen.
141
7
Unterscheidung zwischen Konkretisieren und Abstrahieren in Abgrenzung zu Kant.
142
8
Kapitel 3.3 Vergleich der alternativen Theorien des Denkens von Dewey und Welsch.
165
9
Kapitel 3.4 Übersicht abstrahierendes und konkretisierendes Denken, darin: Abb. 11, Abb. 13 und Abb. 14.
167
10
Denkarten und Medienarten am Beispiel.
171
11
Abstrahierendes und konkretisierendes Denken am Beispiel 1, darin: Abb. 11, Abb. 12, Abb. 13, Abb. 14.
173
12
Abstrahierendes und konkretisierendes Denken am Beispiel 2, darin: Abb. 11, Abb. 12, Abb. 13, Abb. 14.
173
13
Abstrahierende und konkretisierende Visualisierung, darin: Abb. 15.
179
14
Schematisierendes und Bildnerisches Denken, darin: Abb. 11, Abb. 12, Abb. 13, Abb. 14.
186
Verzeichnisse | 313
15
Kapitel 4.1 Bild, Bildfläche und Bildwerk.
16
Bedingungen der Bildbetrachtung.
211
17
Die Bildrelation.
214
18
Kapitel 4.2 Notwendige Bedingungen der Bildgestaltung.
223
19
20
21
Notwendige und hinreichende Bedingungen der Bildgestaltung. Kapitel 5.2 Denken im Zusammenhang mit Bildern. Kapitel 5.3 Kategorisierung von »abstrakten« und »konkreten« Bildern, darin: Abb. 38 und Abb. 39.
196
232
254
273
22
Kapitel 6 Arten von Bilderfahrung.
285
23
Picture- und Image-Aspekt in der Bilderfahrung.
286
Image Annette Jael Lehmann Environments: Künste – Medien – Umwelt Facetten der künstlerischen Auseinandersetzung mit Landschaft und Natur Mai 2018, ca. 250 Seiten, kart., zahlr. Abb., ca. 28,80 €, ISBN 978-3-8376-1633-0
Sabiene Autsch, Sara Hornäk (Hg.) Material und künstlerisches Handeln Positionen und Perspektiven in der Gegenwartskunst Februar 2017, ca. 240 Seiten, kart., zahlr. z.T. farb. Abb., ca. 34,99 €, ISBN 978-3-8376-3417-4
Astrit Schmidt-Burkhardt Die Kunst der Diagrammatik Perspektiven eines neuen bildwissenschaftlichen Paradigmas November 2016, ca. 280 Seiten, kart., zahlr. Abb., ca. 34,99 €, ISBN 978-3-8376-3631-4
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de
Image Leonhard Emmerling, Ines Kleesattel (Hg.) Politik der Kunst Über Möglichkeiten, das Ästhetische politisch zu denken September 2016, ca. 240 Seiten, kart., ca. 34,99 €, ISBN 978-3-8376-3452-5
Werner Fitzner (Hg.) Kunst und Fremderfahrung Verfremdungen, Affekte, Entdeckungen September 2016, ca. 250 Seiten, kart., zahlr. Abb., ca. 34,99 €, ISBN 978-3-8376-3598-0
Lilian Haberer, Annette Urban (Hg.) Bildprojektionen Filmisch-fotografische Dispositive in Kunst und Architektur Juni 2016, 324 Seiten, kart., zahlr. Abb., 29,99 €, ISBN 978-3-8376-1711-5
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de
Image Henry Keazor, Christiane Solte-Gresser (Hg.) In Bildern erzählen Frans Masereel im intermedialen Kontext
Anna Grebe Fotografische Normalisierung Zur sozio-medialen Konstruktion von Behinderung am Beispiel des Fotoarchivs der Stiftung Liebenau
Juli 2017, ca. 250 Seiten, kart., zahlr. Abb., ca. 32,99 €, ISBN 978-3-8376-2821-0
September 2016, ca. 290 Seiten, kart., zahlr. Abb., ca. 34,99 €, ISBN 978-3-8376-3494-5
Julia Bulk Neue Orte der Utopie Zur Produktion von Möglichkeitsräumen bei zeitgenössischen Künstlergruppen
Franziska Koch Die »chinesische Avantgarde« und das Dispositiv der Ausstellung Konstruktionen chinesischer Gegenwartskunst im Spannungsfeld der Globalisierung
März 2017, ca. 320 Seiten, kart., zahlr. Abb., ca. 33,99 €, ISBN 978-3-8376-1613-2
Judith Bihr Muster der Ambivalenz Subversive Praktiken in der ägyptischen Kunst der Gegenwart Januar 2017, ca. 360 Seiten, kart., zahlr. z.T. farb. Abb., ca. 39,99 €, ISBN 978-3-8376-3555-3
Johanna Gundula Eder Homo Creans Kreativität und Kreativitätsbildung im Kontext transmedialer Kunst Oktober 2016, ca. 400 Seiten, kart., zahlr. z.T. farb. Abb., ca. 39,99 €, ISBN 978-3-8376-3634-5
Susi K. Frank, Sabine Hänsgen (Hg.) Bildformeln Visuelle Erinnerungskulturen in Osteuropa September 2016, ca. 350 Seiten, kart., ca. 38,99 €, ISBN 978-3-8376-2717-6
August 2016, 746 Seiten, kart., zahlr. Abb., 49,99 €, ISBN 978-3-8376-2617-9
Jesús Muñoz Morcillo Elektronik als Schöpfungswerkzeug Die Kunsttechniken des Stephan von Huene (1932-2000) August 2016, ca. 344 Seiten, kart., zahlr. Abb., ca. 44,99 €, ISBN 978-3-8376-3626-0
Birgit Wudtke Fotokunst in Zeiten der Digitalisierung Künstlerische Strategien in der digitalen und postdigitalen Phase August 2016, ca. 220 Seiten, kart., zahlr. Abb., ca. 34,99 €, ISBN 978-3-8376-3280-4
Sabine Flach Die WissensKünste der Avantgarden Kunst, Wahrnehmungswissenschaft und Medien 1915-1930 Juni 2016, 354 Seiten, kart., zahlr. Abb., 39,99 €, ISBN 978-3-8376-3564-5
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de
Zeitschrif t für Kultur wissenschaf ten Erhard Schüttpelz, Martin Zillinger (Hg.)
Begeisterung und Blasphemie Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Heft 2/2015 Dezember 2015, 304 S., kart., zahlr. z.T. farb. Abb., 14,99 €, ISBN 978-3-8376-3162-3 E-Book: 14,99 €, ISBN 978-3-8394-3162-7 Begeisterung und Verdammung, Zivilisierung und Verwilderung liegen nah beieinander. In Heft 2/2015 der ZfK schildern die Beiträger_innen ihre Erlebnisse mit erregenden Zuständen und verletzenden Ereignissen. Die Kultivierung von »anderen Zuständen« der Trance bei Kölner Karnevalisten und italienischen Neo-Faschisten sowie begeisternde Erfahrungen im madagassischen Heavy Metal werden ebenso untersucht wie die Begegnung mit Fremdem in religiösen Feiern, im globalen Kunstbetrieb und bei kolonialen Expeditionen. Der Debattenteil widmet sich der Frage, wie wir in Europa mit Blasphemie-Vorwürfen umgehen – und diskutiert hierfür die Arbeit der französischen Ethnologin Jeanne Favret-Saada. Lust auf mehr? Die ZfK erscheint zweimal jährlich in Themenheften. Bisher liegen 18 Ausgaben vor. Die ZfK kann – als print oder E-Journal – auch im Jahresabonnement für den Preis von 20,00 € bezogen werden. Der Preis für ein Jahresabonnement des Bundles (inkl. Versand) beträgt 25,00 €. Bestellung per E-Mail unter: [email protected]
www.transcript-verlag.de






![Der Computer als Medium: Eine transdisziplinäre Theorie [1. Aufl.]
9783839404294](https://ebin.pub/img/200x200/der-computer-als-medium-eine-transdisziplinre-theorie-1-aufl-9783839404294.jpg)