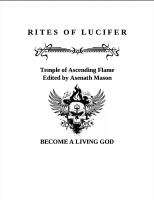Lucifer: Stationen eines Motivs [Reprint 2013 ed.] 9783110846416, 9783110078046
212 91 17MB
German Pages 262 [272] Year 1978
Einleitung. Zum motivgeschichtlichen Verfahren
Parabata vinctus, sive Triumphus Christi, tragoedia. Zur historischen Gestalt des Bösen
Der Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jh. Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik
Lucifer. Treurspel. Der Himmel als Staat
Der Messias. Der Teufel in der Aufklärung: Vernunftgebot und Entdämonisierung
Cain. Die Rebellion des Aristokraten
Lucifergestaltungen der wilhelminischen Ära. Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
Verzeichnis der zitierten Werke
Register
Recommend Papers
![Lucifer: Stationen eines Motivs [Reprint 2013 ed.]
9783110846416, 9783110078046](https://ebin.pub/img/200x200/lucifer-stationen-eines-motivs-reprint-2013nbsped-9783110846416-9783110078046.jpg)
- Author / Uploaded
- Ernst Osterkamp
File loading please wait...
Citation preview
Komparatistisdie Studien Band 9 Lucifer — Stationen eines Motivs
Komparatistische Studien Beihefte 211 „arcadia" Zeitschrift für Vergleichende Literaturwissenschaft
Herausgegeben von Horst Rüdiger
Band 9
W DE G Walter de Gruyter · Berlin · New York 1979
Lucifer Stationen eines Motivs
von Ernst Osterkamp
w DE
C Walter de Gruyter · Berlin · New York 1979
CIP-Kurztitelaufnähme der Deutschen Bibliothek
Osterkamp, Emst: Lucifer : Stationen e. Motivs / von Ernst Osterkamp. — Berlin, New York : de Gruyter, 1979. — (Komparatistisdie Studien ; Bd. 9) ISBN 3-11-007804-X
D 6 © Copyright 1978 by Walter de Gruyter & Co., vormals G. J. Göschen'sehe Verlagshandlung J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung - Georg Reimer - Karl J. Trübner - Veit & Comp., Berlin 30 - Printed in Germany. Alle Rechte des Nachdrucks, der Ubersetzung, der photomechanischen Wiedergabe und der Anfertigung von Mikrofilmen - auch auszugsweise - vorbehalten. Satz und Druck: Walter Pieper, Würzburg Bindearbeiten: Wübben & Co., Berlin
Vorbemerkung Mit der vorliegenden Untersuchung, die im Sommer 1976 abgeschlossen und im Mai 1977 von der Philosophischen Fakultät der Westfälischen WilhelmsUniversität Münster als Doktorarbeit angenommen wurde, unternimmt der Verfasser ausdrücklich nicht den Versuch, eine Geschichte der literarischen Gestaltung des Lucifer-Mythos in der europäischen Neuzeit zu schreiben; ein solches Unternehmen steht, wie die Einleitung zu begründen versucht, durchaus im Gegensatz zu seinen Intentionen. Deshalb darf der Leser nicht darauf hoffen, jeden Namen und jedes Werk, das unbedingt in eine solche „Motivgeschichte" gehört hätte, in dieser Arbeit zu finden; Querverbindungen gar zu anderen Strängen in der Geschichte literarischer Teufelsgestaltung — etwa zur Mephisto-Figur —, wie sie dort unabdingbar gewesen wären, sind hier nicht gezogen. Da Vollständigkeit nicht angestrebt wurde, ja um der Akzentuierung des hier gewählten Verfahrens willen, das in seiner Bedeutung für motivgeschichtliche Forschung erprobt werden sollte, auf die Einbringung nicht unabdingbar mit dem jeweiligen Darstellungsgegenstand verbundenen motivischen Materials so weit als möglich zu verzichten war, ist nicht alles vom Verfasser gesammelte Material in die vorliegende Untersuchung eingegangen. Die Bibliographie verzeichnet ausdrücklich nur die zitierten Werke. — Herrn Prof. Dr. Helmut Arntzen möchte ich für die freundliche Förderung dieser Arbeit danken. Besonderen Dank schulde ich Prof. Dr. Hans Geulen, der mir ständig mit seinem Rat und seiner Hilfe zur Seite stand. Meinen Freunden Martin Lampe, Gerd Enno Rieger und Barbara Steinberg gehört für zahlreiche ermutigende Gespräche, die die Niederschrift dieser Arbeit begleiteten, mein Dank nicht weniger als meinen Eltern, die mir nie ihre Unterstützung versagten.
Inhalt Einleitung Zum motivgeschichtlichen Verfahren Jacques Auguste de Thou (Thuanus) : Parabata vinctus, sive Triumphus Christi, tragoedia Zur historischen Gestalt des Bösen Der Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jh. Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik . . . Joost van den Vondel: Lucifer. Treurspel Der Himmel als Staat Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias Der Teufel in der Aufklärung: Vernunftgebot und Entdämonisierung Lord Byron: Cain Die Rebellion des Aristokraten Lucifergestaltungen der wilhelminischen Ära Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft . . .
213
Verzeichnis der zitierten Werke
249
Register
258
1
7 49 87 131 179
EINLEITUNG
Zum motivgeschichtlichen Verfahren Stoff- und motivgeschichtliche Monographien setzen sich in der Regel zur Aufgabe, die Gesamtheit all derjenigen Texte zu erfassen, in denen das untersuchte Motiv eine relevante Bearbeitung erfahren hat. Die Erfüllung dieses Programms hängt nicht unbedingt davon ab, daß sämtliche stoffrelevanten Texte angeführt und in ihren zentralen Bedeutungsdimensionen diskutiert werden — eine Intention, die explizit oder implizit wohl noch die meisten motivgeschichtlichen Darstellungen, gerade wenn sie sich auf bestimmte Zeitabschnitte beschränken, steuern dürfte, ökonomischer und konzentrierter verfahren Untersuchungen, die ins Zentrum ihres Interesses Texte stellen, die aus im einzelnen zu präzisierenden Gründen als typisch für gewisse Zeitabschnitte gelten können und mit deren Erörterung somit zugleich Grundsätzliches an den zeitgleichen Bearbeitungen erfaßt wäre. Damit nicht identisch ist ein weiteres Verfahren, bei dem die Kriterien der Textauswahl sich danach bemessen, ob ein Text im Prozeß literarischer Traditionsbildung sich als anhaltend wirkungsfähig hat durchsetzen können, also im Bewußtsein einer literarischen Öffentlichkeit — wie rudimentär auch immer — noch gegenwärtig ist. Im Einzelfall dürften diese drei Darstellungsweisen sich wohl kaum immer voneinander unterscheiden lassen; nicht selten erscheint als typisch, was — gerade aufgrund des Spezifischen und Einmaligen an ihm — nicht nach wenigen Jahren dem Vergessen anheimfiel, und häufig wird von den Texten, die ihre anhaltende Wirkung bewiesen haben, vorausgesetzt, daß sie auch die relevantesten Bearbeitungen des diskutierten Motivs darstellen. Wir möchten uns keinem der hier in idealer Abstraktion skizzierten Verfahren der Textauswahl anschließen. Sieht man einmal davon ab, daß sich nur mit Mühe sinnvolle Kriterien angeben ließen, die eine sorgfältige Unterscheidung motivgeschichtlich relevanter von irrelevanten Texten erlauben, so bleiben doch auch bei Erledigung dieses Problems noch große Schwierigkeiten zurück. Der Anspruch etwa, die Geschichte des Lucifermotivs in der Neuzeit mit erreichbarer Vollständigkeit zu schreiben, könnte, sollte er überhaupt von einem einzelnen zu verwirklichen sein, bei der immensen Stoffülle kaum etwas anderes zum Resultat haben als eine kommentierte Bibliographie. Daß eine solche Auflistung zahlloser Textbeispiele beim gegenwärtigen Reflexionsniveau der Literaturwissenschaften niemanden mehr zu befriedigen vermöchte, bedarf keiner weiteren Betonung; mit Recht zöge sie sich den Vorwurf sinnentleerter Stoffhuberei zu. Die Beschränkung auf gewisse für einen bestimmten Zeitraum exemplarische Texte bietet sich hier als Ausweg an. Dabei wird die Annahme,
2
Einleitung
daß das Weltbild einer Epoche, ihre realhistorischen und geistesgeschiditlidien Fundamente und spezifischen Erlebnisweisen sich in den unterschiedlichen Bearbeitungen des untersuchten Motivkomplexes in jener Zeit in ähnlicher Weise niederschlagen, in der Regel zur Auswahl solcher Texte führen, die als die komplexesten gelten können; von ihnen darf, akzeptiert man die erste Prämisse, angenommen werden, daß sie gleichsam all das mit einbegreifen, was an den poetae minores nur bruchstückhaft und ansatzweise sich erschließen läßt. Doch fordern diese Annahmen, die allein die Auswahl der zu analysierenden Textbeispiele nach dem Kriterium des Exemplarischen zu begründen vermöchten, methodische Kritik heraus. Dabei wiegt der Einwand, daß ein Text nicht eher exemplarisch genannt werden darf, als er nach genauer Untersuchung sämtlicher Texte des betreffenden Zeitraums mit gleicher Motivik seine Beispielhaftigkeit tatsächlich bewiesen hat, die Komplexität eines Textes mithin nicht voraussetzungslos zum Gradmesser des Exemplarischen genommen werden kann, weniger schwer als das Argument, daß das exemplifizierende Verfahren dahin tendiert, die Werkindividualität auf den größten gemeinsamen Nenner aller interessierenden Werke der Epoche, für die sie beispielhaft steht, einzuebnen. Beide Einwände zielen, wenn auch von verschiedenen Seiten, auf das gleiche Problem: Das einzelne Kunstwerk in seiner immanenten Gesetzlichkeit erleidet in seiner Herabstufung zum Exempel eines Allgemeinen den Verlust seiner Besonderung; als exemplarisches büßt es sein principium individuationis ein. Mögen sich so durchaus zwischen den verschiedenen Gestaltungen eines Motivs in derselben Epoche zeittypische Gemeinsamkeiten feststellen lassen, die von großer Aussagekraft für die Erforschung des diskutierten Zeitraums sind, so wäre doch mit der Registratur dieses Gemeinsamen die spezifische Leistung des einzelnen Werkes verfehlt; seine besonderen Erkenntnismöglichkeiten, die es allererst in seiner Individuation eröffnet, bleiben mit der Konzentration aufs Exemplarische unerschlossen. Wesentliche Bedeutungsdimensionen des einen Werkes schließen andere Gestaltungen des Motivs in ihrer Besonderheit von sich aus; exemplarisch kann so ein Werk nur für die gemeinsame Schnittfläche der Gehalte konkurrierender Gestaltungen sein. Aus diesem Grund verzichtet die vorliegende Untersuchung darauf, die von ihr analysierten Werke als exemplarisch, typisch oder repräsentativ für ihre Entstehungszeit auszuzeichnen; sie werden in ihrer Individualität auf ihre Gehalte hin befragt und stehen nicht für ein Kollektiv zeitgenössischer Bearbeitungen. Am Beispiel: Vondels „Lucifer" ist von uns nicht als die repräsentative Lucifergestaltung des Barode untersucht worden, ebensowenig wie Byrons „Cain" als Paradigma für Lucifergestaltungen der englischen oder gar der europäischen Romantik analysiert wurde. Dies freilich bedeutet nicht, daß die folgenden Untersuchungen derart nominalistisch verfahren, daß ihnen die Reflexion auf werkübergreifende Formprinzipien der Zeit verwehrt bliebe; sehr wohl war bei der Vondel-Analyse auf die Gesetze des barocken Trauerspiels einzugehen, und bei der Untersuchung des „Messias" konnte die Poetik des christlichen Epos nicht ausgeklammert werden. Gleichwohl hebt sich aber von diesem Fundament des Allgemeinen das Werk in seiner Individualität erst ab; Vondels „Lucifer" ist nicht das barocke
Zum motivgeschichtlichen
Verfahren
3
Trauerspiel, sondern dessen spezifische Realisation, die in ihrem Anders-Sein allererst als Gegenstand historischer Erkenntnis sich vollständig bewährt — wie ja audi Benjamin darauf insistierte, daß die Idee des barocken Trauerspiels sich in keinem der Spiele vollständig zu verwirklichen vermochte. Die Individualität der Werke steht folglich im Zentrum unserer Untersuchungen, nicht das Epochenspezifische an ihnen; darauf hinzuweisen ist audi deshalb notwendig, weil die Folge unserer Kapitel eine Auswahl der Textbeispiele nach epochenchronologischen Gesichtspunkten (etwa: Humanismus, Renaissance, Barode, Aufklärung, Romantik, Jahrhundertwende) suggerieren könnte. Eine Auswahl der Texte schließlich nach ihrer literaturgeschichtlichen Prominenz verbot sich von selbst; Rezeptionsgeschichte gehorcht zu vielen werkneutralen Randfaktoren und Imponderabilien, als daß vorausgesetzt werden dürfte, die heute noch anerkannten Werke gäben für unsere Untersuchungen audi die lohnendsten Beispiele ab. Auch ihre Komplexität oder literarische Qualität — problematische Begriffe in sich — wurden nicht zu Auswahlkriterien für die Texte gemacht; wäre es nach der Qualität der Beispiele gegangen, dann hätte das letzte Kapitel sicher nicht geschrieben werden können, und Byrons „Cain" einen komplexen Text zu nennen, wird sich sicher mancher sträuben, zumal wenn ihm etwa die Werke von Byrons Freund Shelley gegenwärtig sind. Doch meinen wir, daß die Auswahl und Analyse auch dieser künstlerisch unzulänglichen Texte durch die Untersuchungsergebnisse gerechtfertigt ist. Den hier diskutierten Kriterien entgegen bemaß sich die Auswahl der Beispiele unserer Untersuchung nach motivgeschichtlichen Interessen, die hier abschließend kurz zu skizzieren sind. Ausgangspunkt hierbei ist die Annahme, daß eine für sich existierende Motivgeschichte — man denke an die bewundernswert genauen und materialreichen Untersuchungen aus den Schulen Wilhelm Scherers und Max Kochs — eine literaturhistorisch unzulässige Konstruktion darstellt. Das Motiv als Monade, die, von Gestaltung zu Gestaltung weitergereicht, sich in ihrer makellosen Intaktheit stets aufs neue bewährt, verfällt der Gesdiichtslosigkeit. Motivgeschichte, die das Motiv innerhalb der es verändernd in sich einbeziehenden Gestaltung isoliert, zielt auf die Registratur des Immergleidien und reduziert so das Geschichtliche auf die Diachronie eines immer wieder erfolgenden Einpassens des unangefochtenen Elementes in übergreifende Einheiten, die es nicht aufzusprengen vermögen. Insofern, als sie die Beziehung von Motiv und Geschichte, die über eine es sich anverwandelnde übergreifende Gestaltung sich herstellende Vermitteltheit des Motivs im historischen Prozeß ignoriert, kommt ihr der Titel des Geschichtlichen nicht zu. Eine vom realen Geschichtsprozeß sich ablösende „Spezialgeschichte" von Motiven begibt sich der spezifischen Erkenntnischancen, die motivgeschichtliche Arbeit, wenn sie ernst macht mit der dialektischen Vermittlung von Motiv und Historie, sicher eröffnet, zumal sich gerade bei der relativen Konstanz der Elemente des Motivs das je andere der einzelnen Gestaltung in seiner Aussagekraft auf besondere Weise bewährt. Eine solche Neuformulierung motivhistorischen Interesses freilich scheint uns eine Umorientierung im Verfahren und der Darstellung erforderlich zu madien: Nicht mehr kann es darum gehen, den Weg
4
Einleitung
eines Motivs mit seinen zahlreichen Verästelungen und Abzweigungen gleichsam innerliterarisch abzuschreiten, sondern zentral thematisch wird die Frage nach dem stets aufs neue sich vollziehenden historischen Aufbrechen des Motivs. Spürt die erste Darstellungsweise Kontinuitäten nach, so steht die zweite im Zeichen von Diskontinuität. Sie fragt danach, warum sich eine Zeit eines Motivs erinnert, was an ihm für sie aktuell ist, worin sie sich in ihrer eigenen Problematik wiedererkennt, wie sie es nach ihren eigenen Bedürfnissen zurichtet. Auch sie isoliert das Motiv, aber sie isoliert es in seiner eigenen Tradition an einer bestimmten Stelle seiner Überlieferung, um diese für sich in ihrer historischen Besonderung, im Rahmen der je einzelnen Gestaltung um so genauer befragen zu können. Sie wird sich dennoch nicht blind machen gegen die Einsicht, daß Kenntnis der Quellen und Überlieferungen, die in einen zu untersuchenden Text Einlaß fanden, gegebenenfalls zu wichtigen Aufschlüssen verhelfen kann, und doch werden ihr dergleichen Informationen nur ein Hilfsmittel neben anderen sein, zumal im Rahmen der einzelnen Gestaltung das Übernommene zu einem je anderen wird. Man wird deshalb in den folgenden Untersuchungen nur geringe Hinweise auf Quellen und Überlieferungen finden; dies konnte mit größerem Recht schon deshalb geschehen, weil entsprechende Untersuchungen für Milton, Vondel, Klopstock und Byron längst vorliegen. Mag das Motiv in der Folge seiner Bearbeitungen eine Vielzahl von Modifikationen, Übernahmen und Nuancierungen erleben, aus denen eine fortschreitende Entwicklung zu konstruieren naheliegen könnte, so verhält es sich doch in seinen einzelnen Gestaltungen gleich unmittelbar zur Geschichte. Damit soll nicht gesagt sein, daß seine Tradition in der jeweiligen Gestaltung nicht bestimmte zusätzliche Bedeutungsdimensionen erschließt; aber daß und wie sie es tut, verdankt sich dem je verschiedenen geschichtlichen Augenblick ihrer Entstehung. Aus diesen Gründen verzichtet unsere Untersuchung vollständig darauf, mit der Folge ihrer Interpretationen eine wie immer geartete Entwicklung des Motivs nahelegen zu wollen, dergestalt etwa, daß Milton auf Vondel aufgebaut, Klopstock Milton weiterentwickelt habe. Die einzelnen Analysen stehen für sich; sie fragen, stets neu ansetzend, den historischen Gründen für den Neuaufbruch des Motivs nach. Daß und warum es immer wieder neu ans Licht tritt, steht im Zentrum des Interesses, nicht das System der unterirdischen Verbindungslinien und Beziehungen, die die einzelnen Gestaltungen miteinander verknüpfen. Danach auch bemaß sich die Auswahl der Texte; die literaturgeschichtlich prominenten Werke und künstlerisch bedeutungslosen Beispiele dieser Studie sind doch darin vereint, daß sie in ihrem Gehalt bedeutsame Züge der Physiognomie ihrer Zeit bewahren und der Reflexion auf das Spezifische ihrer Darstellung zentrale Elemente ihres historischen Vorfeldes freigeben. An ihnen wird zu zeigen sein, welche zeitspezifische Problematik jeweils Autoren auf den geschichtsneutralen Mythos von Lucifer zurückgreifen und ihn so mit historischem Leben erfüllen ließ. Nachzuweisen, wie Geschichte dem zeitübergreifenden Motiv sich einprägt und es umbildet, wird Aufgabe der Arbeit sein. Daß dabei die Geschichtsferne des Mythos diese Aufgabe erschwerte, und vermittelnde Instanzen materialer wie struktureller Art zwischen gestaltetem Mythos und Geschichte
Zum motivgeschichtlichen
Verfahren
5
sich gelegentlich nur schwer nachweisen lassen — vielleicht wird mancher Leser aus diesem Grund der Argumentation etwa des Byron-Kapitels nicht immer zu folgen bereit sein —, diente dabei eher als zusätzlicher Anreiz: hatte sich doch gerade hier zu beweisen, daß das Kunstwerk in der Gestaltung des Mythos seine Überwindung leistet.
JACQUES AUGUSTE DE THOU (THUANUS): PARABATA VINCTUS, SIVE TRIUMPHUS CHRISTI, TRAGOEDIA
Zur historischen Gestalt des Bösen Im Frühjahr 1592 belagerte Heinrich IV. mit seinem Heer Rouen. Seit der König von Navarra 1589 dem von einem jungen Dominikanermönch ermordeten Heinrich III. in der französischen Königswürde nachgefolgt war, hatte sich die militärische Lage der Hugenotten und Königstreuen deutlich gebessert. Zwar war es nicht gelungen, der katholischen Ligue Paris zu entreißen, audi schickten die Spanier Truppen und Geld zur Unterstützung der Feinde des Königs ins Land, und doch gewann der geschickt taktierende Heinrich zusehends an Raum. Allerdings befand sich der König ständig in finanzieller Schwierigkeit, nur mit Anleihen ließen sich seine kostspieligen Feldzüge finanzieren. Und so schickte er auch von Rouen einen seiner erfolgreichsten Diplomaten und bewährtesten Ratgeber, den Staatsrat Jacques Auguste de Thou (1553—1617), um in Tours, damals Sitz des Parlaments, erneut Geld zu beschaffen. De Thou begab sich sofort auf die Reise, erkrankte aber unterwegs schwer und befand sich in höchster Lebensgefahr; nur mit Mühe konnte er in Tours wieder geheilt werden Aus Dank für seine kaum noch erhoffte Rettung gelobt der gläubige Katholik und Humanist, mit den Mitteln der Poesie seiner Frömmigkeit und Dankbarkeit gegen Gott Ausdruck zu verleihen. Er selbst berichtet davon in dem Widmungsschreiben, das dem Werk vorangestellt ist: Nam cum sex ab hinc mensib. periculosissimo morbo eöflictarer, nec vlla amplius spes in humanis praesidijs esset, integra mihi tandem valetudine a Deo, praeter omnium expectationem, restituía, fidem obstrinxi, vt quamprimum viréis colligere possem, aliquo grati animi monumento pietatem meam posteris testatam relinquerem 2.
Nach einem Stoff für sein Werk hat de Thou nicht lange gesucht; eher scheint es so zu sein, daß ihm die Rekonvaleszenz endlich die ersehnte Ruhe bot, einen seit langem gehegten Plan in die Tat umzusetzen. Heißt es doch im Anschluß an den oben zitierten Satz: In eam cogitationem cum toto pectore incumberem, subijt non inelegans Tragoediae argumentum, quod iampridem animo agitaueram, sed occupationib. varijs districtus & publico maerore reuocatus rem hactenus distuleram 3 . Heinrich Diintzer: Jacques Auguste de Thou's Leben, Schriften und historische Kunst verglichen mit der der Alten. Eine Preisschrift. — Darmstadt 1837. p. 28. 2 [Jacques Auguste de Thou]: Parabata vinctus, sive Triumphus Christi, tragoedia. — Paris 1595. (Exemplar des British Museum, London) 3 de Thou, a. a. O. 1
8
Jacques Auguste de Thou
Das gleiche betont Thuanus noch über zwanzig Jahre später in seinen zwischen 1614 und 1617 entstandenen Memoiren „Commentariorum de vita sua libri sex": . . . iam pridem mente conceptum argumëtum in scenam produxit Aeschylei Promethei imitatione edito qué amicissimis sibi & de salute sua summopere anxiis Johannes Thumerio, & CI. Puteano nuncupauit 4 .
Freilich erfahren wir nichts davon, was ihm den StoS so schmackhaft machte, was ihn also gerade zu einer Bearbeitung des „Gefesselten Prometheus" von Aischylos bewog. Eben seine Motivation bei der Wahl dieses Themas aber zu erfahren wäre wichtig, denn in dreierlei Rücksicht steht der hier besprochene Vorgang merkwürdig da. Das betrifft zum einen die Stellung des Dramas in Thuanus' Gesamtwerk, zum anderen seine Position in der Aischylos-Rezeption, zum dritten aber, und hier besonders wichtig, die bestimmte christliche Wendung, die der Bearbeiter dem Stüde gibt. Jacques Auguste de Thous Ruhm beruht auf seinem großen Geschichtswerk „Historiae sui temporis" (1604—1620), dessen Niederschrift er ein Jahr nach dem „Parabata vinetus", im Oktober 1593, begonnen hatte und an dem er bis zu seinem Tode arbeitete. De Thou hatte geplant, seine Darstellung mit dem Jahre 1610, also dem Ende der Regierungszeit Heinrichs IV., ausklingen zu lassen; sein Werk blieb aufgrund seines Todes im Jahre 1617 unvollendet und umfaßt in der 1620 publizierten Version in 138 Büchern auf rund 4950 FolioSeiten die Annalen der Jahre 1546 bis 1607. Seine „Historiae", die ihm auch heute nodi den Titel des „most important historian of the French Renaissance"5 sichern, gewannen de Thou gleich nach Erscheinen des ersten Bandes großen Ruhm. Nicht unwesentlich trug dazu bei, daß das Werk im Jahre 1609 auf dem Index erschien: Thuanus' Bemühen, die Geschichte der Glaubenskämpfe seiner Zeit sine ira et studio so unparteiisch und objektiv wie irgend möglich nachzuzeichnen, trug ihm den Vorwurf ein, er habe sich zu günstig über die Protestanten geäußert 6 . Zumal von den Jesuiten war de Thou heftig angegriffen worden: Neben Jean de Machault bewies dabei einmal mehr der streitbare Kaspar Schoppe (1576—1649) seinen mit allem, was auch nur von ferne an Protestantisches gemahnte, unversöhnlichen Geist. Um sich gegen dergleichen Anwürfe zu verteidigen, schrieb Thuanus seine Memoiren, die schon oben erwähnten „Commentariorum de vita sua libri sex", zuerst 1621 erschienen und später immer wieder den Ausgaben seiner „Historiae" beigefügt. Beide Arbeiten erlebten häufig Nachdrucke und verschiedentlich Übersetzungen. Mehr noch als in Frankreich erfreute sich Thuanus' Werk in den Niederlanden und in Deutsch* Jacques Auguste de Thou: Commentariorum de vita sua libri sex. — In: Jac. Augusti Thuani Historiarum sui temporis Pars Quinta. — Frankfurt a. M.: Kopfi 1621. p. 1425. (Exemplar der UB Münster) 5
Samuel Kinser: The Works of Jacques-Auguste de Thou. — Den Haag 1966. ( = national Archives of the History of Ideas. Vol. 18.) p. 2.
Inter-
6 Düntzer zitiert p. 39, Anm. 89, den Index librorum Hisp., Madrid 1667, dessen Begründung lautet: „ . . . quod multa ab ipso in favorem Protestantium dicantur."
Parabala vinctus, sive Triumpbus Christi, tragoedia
9
land im 17. Jh. höchster Beliebtheit 7 : Bei Kopfi in Frankfurt waren seit 1608 zahlreiche nicht autorisierte Ausgaben der „Historiae" erschienen; 1621/22 folgte im gleichen Verlag die nahezu vollständige deutsche Übersetzung, die erste Übertragung des Geschichtswerks aus dem Lateinischen überhaupt 8 . Bis ins 18. Jh. galt de Thous Darstellung seiner Zeit als Muster der Geschichtsschreibung, und noch Lessing9 und Herder 10 zollten ihr höchstes Lob. Eine andere späte Ehrung widerfuhr ihm, als 1796 David Seybold die Memoiren de Thous als ersten Band seiner „Selbstbiographien berühmter Männer" herausgab und dabei ihren Autor als einen Mann vorstellte, „ . . . der eine Toleranz zeigte, die zu seiner Zeit ein Phänomen ist . . n . — Es erscheint symptomatisch, daß in Seybolds Übertragung der Memoiren die Gedichte, die de Thou seinen Erinnerungen an verschiedenen Stellen eingefügt hatte, mit einer Ausnahme ausgespart sind. So konnte das deutsche Publikum den berühmten Historiker auch bei dieser Gelegenheit nicht von einer Seite kennenlernen, die einen wesentlichen Bestandteil seines Lebens ausmacht. Schon in seiner Jugend hatte Thuanus begonnen, lateinische Gedichte zu verfassen. Wesentlich für seine poetische Produktion sind die zahlreichen Bekanntschaften und Freundschaften, die er mit den bedeutenden Dichtern seiner Zeit sdiloß. Über Jean Dorat, den er 1568 kennengelernt hatte, stellte sich die Verbindung zu den Dichtern der Pléiade, zumal zu Ronsard, her. Er war sowohl mit dem gefeierten Salluste du Bartas bekannt als auch mit Jean Baif und Remi Belleau. Mit Joseph Scaliger und Isaac Casaubonus, den Hugenotten, verband ihn lebenslange Freundschaft, mit Justus Lipsius und Hugo Grotius führte er rege Briefwechsel. Es ist wohl auf diesen humanistischen Kontext zurückzuführen, daß Thuanus der lateinischen Sprache auch in seinen Dichtungen treu blieb n . Von den über fünfzig Gedichten, die de Thou zeitlebens veröffentlicht hat, und den Hunderten, die nur in Manuskripten zugänglich sind, trägt das meiste eindeutig Gelegenheitscharakter: Trauergedichte, Verse zu politischen und religiösen Ereignissen, aber auch Liebeslyrik13. Es finden sich nur wenige 7 Kinser, a. a. O., p. 312. 8 Vgl. zu dieser Übersetzung Kinser, a. a. O., pp. 261—4. Kinser betont zumal „ . . . the difference between the late-medieval consciousness of the translator and de Thou's humanistically-trained mind . . ( p . 264) ? G. E. Lessing: Briefe, die neueste Literatur betreffend. 52. Brief. — In: Gesammelte Werke. Hrsg. von Paul Rilla. Bd. 4. — Berlin 1955. p. 270. 10 Herder: Sämmtliche Werke. Hrsg. von Bernhard Suphan. Bd. 17. Briefe zu Beförderung der Humanität. Brief 47. — Berlin 1881. pp. 233—7. 11 David Seybold (Hrsg.): Selbstbiographien berühmter Männer. Ein Pendant zu J. G. Müllers Selbstbekenntnissen. Erster Band. Thuanus. — Winterthur 1796. p. XI. 12 Kinser, a. a. O., p. 244, weiß nur von der Existenz eines frz. Gedichts, das zudem bisher unveröffentlicht ist. 13 Einen ersten Überblick über de Thous poetische Schriften gab 1837 Düntzer, p. 45 ff. Wesentlich ergänzt wurde sein Katalog von Kinser 1966, pp. 201—244, der allerdings auch darauf hinweist, daß seine Liste noch nicht vollständig sei (p. 203). Düntzer wie Kinser geben ntir Bestandsaufnahmen, eine literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit de Thous poetischem Werk wird von ihnen nicht angestrebt. Es bleibt anzumerken, daß — unseres Wissens — die Literaturwissenschaft Thuanus bisher völlig umgangen
10
Jacques Auguste de Thou
größere Arbeiten in de Thous umfangreichem Oeuvre, darunter sein bekanntestes poetisches Werk „Hieracosophioy, sive de Re accipitraria libri III" (1582), ein Buch über die Jagd mit Falken. Daneben ließ er mehrere Bibelparaphrasen erscheinen: Hiob (1587), Ecclesiastes (1590), Jeremias und weitere Versifikationen kleinerer Propheten (1590). All das fand zu seiner Zeit viel Anklang und sicherte dem Autor einen Namen als bedeutender lateinischer Diditer. Eine Sonderstellung innerhalb seines Werkes nimmt freilich de Thous Aisdiylos-Adaptation ein. Zum einen liegt mit dem „Parabata vinctus" die umfänglichste poetische Arbeit des Autors vor, zum anderen handelt es sich um den einzigen dramatischen Text aus seiner Feder. Als dritter Punkt fällt ins Gewicht, daß de Thou nur selten seine Dichtungen bestimmten klassischen Werken nachbildete; zwar erwähnt Düntzer eine Horaznachahmung14 und Kinser führt verschiedene Gedichte auf, die de Thou nach unveröffentlichten griechischen Vorlagen gestaltet habe 15 , aber gerade diese Vergleichspunkte lassen den Fall des „Parabata vinctus" umso entschiedener hervortreten. Handelt es sich doch bei dem Aischylos-Stück um einen Text von immerhin 1100 Versen, der nicht nur reichlich Schwierigkeiten bei der Übersetzung bietet, sondern auch mythologisch manches Problem stellt. Das erhärtet unseren ersten Eindruck, daß de Thou mit dem „Parabata vinctus" ein lange gehegtes Projekt verwirklichte. Es mußte schon längere Beschäftigung mit dem Stück vorangegangen sein, bevor er, in drei Monaten, wie er in der dedicatio sagt, seine AischylosBearbeitung niederschrieb. Erheblich mehr an Motivation als der unmittelbare Anlaß seiner unerwarteten Genesung hat hier Pate gestanden; andernfalls hätte, wie es seine sonstige poetische Produktion lehrt, ein Dankesgedicht durchaus genügt. Wir können nur Vermutungen darüber anstellen, auf welchem Weg de Thou zu seinem Stoff gelangte. Aischylos war im 16. Jh. ein kaum gelesener Autor: „Le XVI e siècle n'a pas connu Eschyle." 16 Auch sein „Gefesselter Prometheus" war nur wenigen Gebildeten der Zeit bekannt. Der Prometheus-Mythos, der im übrigen keineswegs die überragende Bedeutung für das Denken der Renaissance besaß, die ihm so häufig zugesprochen wird, war aus anderen Quellen ins Bewußtsein des 15. und 16. Jhs gedrungen: „ . . . ce n'est pas Eschyle qui livra à la Renaissance le message de Prométhée." 17 Erst 1557 war die erste verläßliche Aischylos-Ausgabe erschienen18, lateinische Übersetzungen des „Gefesselten Prometheus" wurden 1556 und 1559 veröffentlicht. Einer der wenigen Autoren des 16. Jhs, die eine intime Kenntnis der Werke des Aischylos besaßen, war Jean Dorat (1508—1588), aus dem Kreis der Pléiade. Auch Ronsard war erst
h 15 16 17 18
hat. Düntzer übrigens hat offensichtlich die meisten poetischen Texte de Thous, darunter den „Parabata vinctus", nicht einmal gelesen. Düntzer, a. a. O., p. 48. Kinser, a. a. O., p. 237. Georges Méautis: Eschyle dans la littérature française. — In: RHL XXIV (1917) p. 429. Raymond Trousson: Le thème de Prométhée dans la littérature européenne. T. 1. — Genf 1964. p. 87. Méautis, a.a.O., p. 430; Trousson, a.a.O., p. 86. Anm. 1.
Parabata vinctus, sive Triumphus Christi,
tragoedia
11
von Dorat auf die Schönheiten des aischyleischen Werkes, zumal des „Gefesselten Prometheus", aufmerksam gemacht worden 19 . De Thou nun hatte, wie bereits oben erwähnt, schon 1568 Jean Dorat besucht und war seither des öfteren mit ihm zusammengetroffen. Die Vermutung erscheint erlaubt, daß aus dieser Zeit seine Kenntnis der Werke des griechischen Dramatikers datiert; sicher wird Dorat dem Jüngling auch von Aischylos, dem er so großes Interesse zuwandte, gesprochen haben. 1592 also war de Thou offenbar schon seit über zwanzig Jahren mit Aischylos vertraut; hatte er bei Dorat gelernt, so war er audi philologisch auf der Höhe der Zeit und konnte sich ruhigen Gewissens an seine Bearbeitung des schwierigen Textes machen (übrigens erst vier Jahre nadi dem Tod Dorats). Damit freilich ist noch nichts darüber gesagt, worin für Thuanus das eigentliche Faszinosum des aischyleischen Stückes lag, was also ihn nach langen Jahren dazu bewog, ein christliches Drama zu schreiben, das auf diesem besonderen heidnischen Boden fußt. Darüber allerdings ist auch nichts weiter überliefert; nur an den beiden schon oben zitierten Stellen äußert de Thou sich zu seinem Stück, und aus ihnen läßt sich über den unmittelbaren Anlaß hinaus nur entnehmen, daß ihm diese Arbeit sehr wichtig war. So sind wir bei unserer Deutung auf das Stück selbst verwiesen, aus ihm allein läßt die Intention seines Verfassers sich ablesen. Eine genauere Betrachtung verdient die „tragoedia" sicher, die Scaliger sehr schätzte und von der Lipsius als dem „Parabates egregius et multis locis vel ad priscum cothurnum" schrieb20. Denn manches ist außergewöhnlich am „Parabata vinctus"; so auch dies, daß, wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich, hier so früh die Bearbeitung eines antiken Stückes unternommen wurde, daß mancher unter ihren Lesern die Vorlage kaum gekannt haben dürfte 20 *. Sicherlich auch hat das Ungewohnte an diesem Drama mit dazu beigetragen, daß es nach seinem Erstdruck nur einmal noch, 1599 in de Thous „Poemata sacra", aufgelegt wurde. — Zur Orientierung sei vorab kurz der Inhalt des „Parabata vinctus, sive Triumphus Christi" gegeben. Dem 1595 erschienenen Band steht ein elf Seiten umfassender Widmungsbrief an die Pariser Senatoren und Freunde de Thous Jean de Thumery und Claude Dupuy voran, den der Autor mit dem 13. Oktober 1592 datiert. De Thou berichtet kurz den Anlaß, der zur Entstehung seines Stückes führte, um dann sogleich auf sein eigentliches Thema zu kommen: i» Méautis, a. a. Ο., p. 430. 20 Düntzer, a. a. Ο., p. 50. 20a Nur ein Beispiel hierfür sei gegeben. In einem Brief vom 27. April 1621 bittet der in der griechischen und römischen Literatur höchst bewanderte Hugo Grotius seinen Pariser Bekannten Jacques Dupuy um einen Aischylos-Text; er bezieht sidi dabei ausdrücklich auf das Stüde des Thuanus: „Nunc id rogo ut Aeschyli tragoedias cuiuscumque editionis mihi mittas. Haud satis memini sitne aliquid eius versum in sermonem Latinum. Si est, videre cupiam. De Prometheo multa memini videre translata in Parabaten Thuani." — Hugo Grotius: Briefwisseling. Uitgegeven door Dr. P. C. Molhuysen. Tweede Deel. 30 Augustus 1618 — 30 December 1625. — 's-Gravenhage 1936. p. 68. — Den Einfluß des „Parabata vinctus" auf Grotius* Jugenddrama „Adamus exul" hat im übrigen die Grotius-Forschung bis heute nicht zur Kenntnis genommen.
12
Jacques Auguste de Thou
In bewegten Worten schildert er die allgemeine Auflösung und beklagt den Verfall von Religion, Moral und Bildung in allen Ständen; dem stellt er seine Freunde als leuchtende Vorbilder entgegen. Die Kirche halte nicht mehr an ihrem Auftrag und den christlichen Idealen fest, sondern strebe nach Reichtum, Macht und Ruhm. Der Adel und das Militär haben keinen Patriotismus und sind in privaten Rivalitäten zerstritten. Das Volk hört auf seine Feinde und wendet sich von den legalen Behörden ab. Die Behörden selbst stehen dem häufig gleichgültig gegenüber, und auch die Gerichte sind nicht selten völlig unfähig. Der üble Befund resultiert in dem Stoßseufzer: „quod imminentis exitij certissimum augurium quis neget?" Doch damit nicht genug! Der schlechte Zustand des Vaterlands wirke nicht als Imperativ zur so nötigen Einigkeit, im Gegenteil, man sei jetzt auch dazu übergegangen, privaten Haß und Ruhmsucht religiös zu kaschieren. Allerorten befinde Frankreich sich also in einem desolaten Zustand. Das ganze schließt mit einem erneuten Lob der Integrität seiner Freunde und einer Bekräftigung der gemeinsamen Freundschaft. Thuanus läßt die Vorrede schlüssig ausklingen mit der Anrufung Gottes als des Garanten der Eintracht im öffentlichen und privaten Bereich: „Deus pads, Deus concordiae vos Reipub. & mihi quamdiutissime incolumeis conseruet." Auf die dedicatio folgen unter dem Titel „De alligatione diaboli testimonia" einige Bibelzitate und Belege aus den Werken Augustins und Petrus Lombardus', mit denen de Thou nachweisen will, daß der Teufel in der Hölle angekettet sei. Das Stück selbst beginnt mit dem Auftritt des Prologus. Er weist das Publikum auf die Vielzahl der „fabulae" hin, die die Dichter aus der Quelle der Weisheit selbst geschöpft haben. Eine davon sei die Geschichte des Prometheus, die der Prologus kurz erzählt. Ihr folgt die Geschichte des Sündenfalls; mit ihm sei alles Übel in die Welt gekommen und Parabata 21 , der Versucher, in die Hölle verbannt worden. Beide Mythen werden miteinander verglichen und als verwandt erkannt. So daß bei der Übersetzung des „Gefesselten Prometheus" an die Stelle des antiken Frevlers der des Christenglaubens treten kann und das Stüde nun der „Gefesselte Parabata" heißen muß. Und audi die anderen dramatis personae des Aischylos-Stückes müssen durch solche aus biblischem Repertoire ersetzt werden. Der Prologus nimmt diesen Austausch schnell vor. Den Rest seiner Rede widmet er der Auseinandersetzung mit möglichen Kritikern, die sich dagegen verwahren könnten, christliche Themen auf die Bühne zu bringen. Einwände dieser Art wischt der Prologus sdinell beiseite: Es sei der höchste Trost in „his calamitosis temporibus" (2v), sich Christi Triumph am Kreuz stets vor Augen zu halten. Und was diesen speziellen Stoff anbelangt, so hat der Prologus Horaz in seiner Argumentation: nil sua porro interest, Vêtus vocetur, an recens haec fabula, Ex Aesdiylo nouata vel parodia, 21 Griedi. parabates; das Wort bezeichnet ursprünglich den neben dem Wagenlenker Stehenden, in übertragener Bedeutung dann den Übertreter, Frevler.
Parabala vinctus, sive Triumphus Christi, tragoedia Dum prosit, vtiliq. dulce temperet, Cultusq. diuini atq. amoris mutui Accendat aestus in animis spectantium.
13
(2v)
Mit der Bitte um Gunst für Autor und Schauspieler schließt der Prologus. — Erst an dieser Stelle beginnt die „parodia" des Aischylos-Stücks. Dabei hält de Thou sich genau an die Struktur seiner Vorlage, übersetzt auch weite Passagen wörtlich. Es gibt wie im „Gefesselten Prometheus" keine Akteinteilung, das ganze läuft ohne Ortsveränderung oder zeitliche Unterbrechung ab. Das Geschehen spielt in den finstersten Tiefen der Hölle, nach der Auferstehung Christi 22 . Justitia (Kratos) und Pax (Bia) kommen mit dem Erzengel Michael (Hephaistos) in den Tartarus, um Parabata, den Frevler und Bösen (Prometheus), auf Befehl Gottes an einen Felsen zu fesseln. Nur mit höchstem Widerstreben folgt Michael den Befehlen des Herrn; der alte Gefährte tut ihm leid, doch habe er große Schuld auf sich geladen, im Himmel dem Herrn getrotzt und auf der Erde den Menschen den Tod gebracht. Jetzt aber herrsche ein größerer König, Parabata und der Tod hätten ihre Macht verloren. Grob unterbricht ihn Justitia und drängt den zaudernden Erzengel auf Erfüllung seiner Pflicht. Ein erregtes Gespräch zwischen Justitia und Michael begleitet die Fesselung Parabatas, der, wie Pax, zu alledem schweigt. Michael wirft Justitia Grausamkeit vor; sie aber erweist sich als unbeirrbare Dienerin des neuen heilsbringenden Königs. — Erst als er allein ist, bricht Parabata sein Schweigen: Er ruft die Natur als Zeugen des Unrechts an, das an ihm begangen wurde. Alles habe er nur aus Liebe zu den Sterblichen getan, und trotzdem habe man ihn, den Herrn der Erde, in einem ungerechten Verfahren zu schmählichster Strafe verurteilt. Ein Engelchor (Okeaniden), vom Klang seiner Stimme angelockt, unterbricht die bitteren Klagen; obgleich er mit großem Mitleid das Elend des gefesselten Parabata bedauert, fordert der Chor ihn doch auf, seine nutzlosen Klagen und lästerlichen Beschuldigungen gegen den neuen König einzustellen. Doch Parabata insistiert unbeirrt: Was auf ihn zukomme, habe er schon gewußt, bevor er zugunsten des Menschen gehandelt habe. In dieser Situation könne ihm die Klage zumindest Linderung verschaffen. Damit ist der Gang des Stückes vorgezeichnet. In sich immer wiederholender Figur treten biblische Gestalten auf, die den Teufel zum Eingeständnis seiner Schuld und zu Reue auffordern. Doch stets verweigert sich Parabata diesen Bitten und stimmt stattdessen neue Klagen an. Zuerst tritt Hiob (Okeanos) auf. Parabata verwickelt ihn sofort in ein Streitgespräch über Gottes Schuld an Hiobs hartem Schicksal. Das gibt Hiob Anlaß, weitschweifig die eigene Geschichte zu berichten und in seiner Reaktion, dem Gott wohlgefälligen Erdulden ohne Klage, das angemessene Verhaltensmodell im nicht verstandenen Elend vorzuführen. Doch Parabata weist mit geistreich-sophistischen Formulierungen Hiobs Vorschlag zurück. Nachdem Hiob gegangen ist und der Chor einen Lobgesang auf ihn vorgetragen hat, tritt Moses auf. (Dem entspricht bei 22
Wir geben zur besseren Orientierung jeweils hinter den Namen der dramatis personae die ihnen bei Aisdiylos entsprechenden Gestalten an.
14
Jacques Auguste de Thou
Aischylos ein Gespräch mit der Chorführerin.) Moses gegenüber rühmt Parabata sich seiner Verdienste um den Menschen, dem er aus Liebe die Künste und Wissenschaften gebracht habe. Moses vertritt dagegen die Version der Genesis: Parabata habe frevelhaft die Menschen in Unglück und ewigen Irrtum gebracht. Aber weder er noch Elias (bei Aischylos die Io-Episode), der zu ihnen tritt und sein Leben als exemplarisches Handeln im Dienste Gottes erzählt, vermögen Satan zu überzeugen. Als er trotzig bemerkt, daß er aus Elias' Bericht nur gelernt habe, wieviel Böses von Gott befohlen worden sei, entfernen sich die beiden Propheten eilends. Im Anschluß an den Lobgesang des Chors auf Elias und Moses tritt Johannes der Täufer auf. Auch ihm, der zu Anfang sehr selbstbewußt argumentiert, gelingt es nicht, bei Parabata eine Sinnesänderung herbeizuführen; nach einem langen Gespräch darüber, wer die Schuld am Tod des Johannes trage, verläßt der Prophet die Hölle wieder, einsehend, daß hier kein Zureden fruchten wird. Parabata aber bricht nach dem obligaten Lobgesang des Chors auf Johannes vorerst seine Klagen ab und entwirft seine eigene Zukunftsvision in einem langen Monolog: die Geschichte von der Ankunft, den Kämpfen und dem endlichen Sieg des Antichrist. Dann, diesen Bescheid erteilt er dem zweifelnden Chor, werde auch der neue König fallen. — Unterbrochen wird Parabatas Vision durch den Auftritt Gabriels (Hermes), der im Auftrag Gottes dem Lästerer zu schweigen gebietet. Als er daraufhin von Parabata verspottet wird, droht der Bote ihm schweres Unglück an, sollte er dem Befehl des Herrn nicht Folge leisten. Aber Satan läßt sich auch dadurch nicht einschüchtern, und so rät Gabriel dem Engelchor, mit ihm die Hölle zu verlassen, will er nicht selbst von der Strafe Gottes betroffen sein. Resignierend folgt der Chor; Parabata aber bleibt allein in dem Flammenmeer zurück, in das die Hölle sich jetzt verwandelt. Und nun, in acht kurzen Versen, den letzten der „tragoedia", bekennt Parabata endlich seine Schuld und gesteht die Gerechtigkeit Gottes ein. — Dem heutigen Leser vermittelt das Stück den Eindruck monotoner Lehrhaftigkeit. Schon bei Aischylos ist der dramatische Dialog immer aufs neue von langen Monologen und Erzählungen unterbrochen; in de Thous Bearbeitung werden diese Monologe zum beherrschenden Darstellungsprinzip: Jeder der Propheten gibt seitenlange ermüdende Berichte, die, als exemplarisch für ein Gott wohlgefälliges Dasein, zwar durchaus mit dem Geschehen vermittelt sind, nichtsdestoweniger aber in ihren Einzelheiten den Bibelparaphrasen, an denen de Thou sich schulte, verpflichtet bleiben. Manches aus diesen Erzählungen nimmt dann der Chor als besonders löblich wieder auf und streicht es refrainhaft heraus. Zumal die gleichsam liturgischen Gesänge des Chors, in denen das Bühnengeschehen didaktisch aufbereitet erscheint, und denen zudem die dramaturgische Funktion zukommt, die einzelnen Auftritte voneinander zu sondern, hemmen den Ablauf der Handlung ungemein; wenn das Stück des Thuanus um ca. 500 Verse länger ist als seine antike Vorlage, so ist das allein auf die Chorgesänge, mit denen Aischylos sehr zurückhaltend verfuhr, und auf die erweiterten Monologe zurückzuführen und geht auf Kosten des dramatischen Dialogs. Wie es denn überhaupt um die Gestaltung eines Dramatischen bei
Parabata vinctus, sive Triumphus Christi, tragoedia
15
Thuanus schlecht steht: Periodisch läuft das Geschehen ab, ohne Entwiddung und spannungslos. Ein Vergleich mit Aischylos mag das verdeutlichen: Den gefesselten Prometheus suchen sehr unterschiedliche Besucher auf; dem Opportunisten Okeanos, der mit dem neuen Herren im Olymp gutes Auskommen will, folgen Io, das Opfer von Zeus und Hera, und der Götterdiener Hermes; an ihnen erprobt sich Prometheus in immer anderer argumentativer Situation. Die aber, die zum gefesselten Teufel kommen, sind sich zumindest im wichtigsten alle gleich: gleich weit, vielmehr gleich nahe stehen alle zu Gott und sind ihm treue Diener. In Okeanos begegnet Prometheus der alte Gefährte, der zur gegnerischen Seite ging, in Io ein anderes Opfer göttlicher Willkür. Zwischen Parabata und den Propheten aber fand derlei Gemeinsamkeit niemals statt; hier treffen die Exponenten völlig gegenteiliger Einsicht aufeinander, und Vermittlung bleibt ausgeschlossen. Das bildet sich ab in den Gesprächen, deren Struktur sich von Mal zu Mal gleich bleibt: Parabata durchkreuzt die karitative Absicht der Propheten, indem er deren Geschichte zum eigentlichen Gesprächsthema macht und so vom eigenen Fall ablenkt. Vollauf beschäftigt, auf die neuen Vorwürfe des Teufels zu reagieren, gerät ihnen ihr ursprüngliches Anliegen bald aus dem Blick. Verhärtung der Fronten und die Festschreibung des Gegensatzes sind das Ergebnis. In Thuanus* Stück nähern sich die Positionen von Himmel und Hölle keineswegs, sondern es wird — immer von neuem — die stets gleiche Distanz beider zueinander ausgemessen. Die „tragoedia" ist statisch, sie steht am Ende noch da, wo sie am Anfang schon war. De Thou beschreibt einen Konflikt, aus dem nichts mehr sich entwickeln will. Zu fragen bleibt, ob überhaupt der Konflikt zwischen Satan und Gott, dem Nur-Guten und dem Nur-Bösen, noch entwicklungsfähig ist. Der christliche Mythos von Lucifer lautet, in seinem Kern, so: Lucifer, der oberste Engel, hat sich, aus Neid und Hochmut, gegen Gott erhoben, um selbst zum Herrn des Himmels zu werden. Er wird aus dem Himmel in die Hölle verstoßen und mit ihm die Engel, die auf seiner Seite kämpften. Gott erschafft die Erde und den Menschen, damit die Lücken in den himmlischen Reihen wieder geschlossen werden können. Doch aus Neid verleitet Lucifer den Menschen zum Bösen; das Ende des Paradieses ist gekommen und die Herrschaft des Todes beginnt. Mit dem Sieg Christi am Kreuz über den Tod aber verliert auch Lucifer seine Macht über die Erde; fest wird er in der Hölle angekettet und bleibt in ihr bis zum Jüngsten Gericht und von da an in alle Ewigkeit. — Damit ist nur das Thema angegeben, dessen Variationen, aufgrund mangelnder biblischer Evidenz, mannigfaltig sind 23 . Doch welcher Version auch immer man sich zuwenden 23
Die Variationen betreffen vor allem folgende Punkte: 1. den Zeitpunkt der Rebellion. Nodi in einer sehr späten Ausgabe des Elucidarius (M. Elucidarius / Von allerhandt geschöpften Gottes . . . — Frankfurt a. M. 1555. Exemplar der UB Münster) findet sich die Bemerkung, Lucifer („Nathanael") sei nicht mehr „denn ein halbe stund" (Bv) im Himmel gewesen. Die meisten Autoren geben keine soldien Zeitangaben. Zumeist findet der Aufruhr vor der Erschaffung des Mensdien statt, manchmal aber erst danach. 2. Die Zahl der Engel, die mit Lucifer fallen, schwankt zwischen einem Drittel und einem Zehntel der Himmelsstreitmadit. 3. Zumal der Zeitpunkt der Fesselung ist unklar. Sehr
16
Jacques Auguste de Tbou
mag, der Befund bleibt stets der gleiche: Das eigentliche Drama Lucifere hat allemal vor der allegatio stattgefunden, ja sogar erheblich früher, nämlich in himmlischer Szenerie. Nach der Engelsrevolte, der mit ihr erfolgten Setzung eines Bösen ist die Kontinuität der luciferischen Gegenexistenz nur mehr der schwarze Faden im göttlichen Heilsplan, die Gegen-Ordnung des Bösen eingewebt in den Entwurf des Guten. In Lucifers Rebellion hatte der eine Gegenentwurf zu den göttlichen Prinzipien sein Recht angemeldet; nach der Niederlage aber bleibt sein Insistieren auf dem einmal bezogenen Standpunkt nichts als die stete Erneuerung eines für alle Zeiten widerlegten Anspruchs. Man könnte, bei allem Vorbehalt gegen die Psychologisierung mythischer Gestalten, darin etwas Pathologisches am Teufel sehen, etwas Zwanghaftes, das ihm im Drama höchstens akzessorische Rollen zu erlauben scheint. — Wie auch immer, die Rekapitulation des Mythos lehrt, daß das Verhältnis Gott — Lucifer mit dem Engelsturz schon seine endgültige Ausprägung gefunden hat; Satans Handeln danach ist nicht mehr als die Leben gewordene Erinnerung an die einmal vollzogene Rebellion, deren Ausgang Raum im Gedächtnis des Teufels nicht fand. Nach dem Sturz ist also das Verhältnis Lucifers zu seinem Gott eines der steten Wiederkehr des Gleichen, spannungslos und ohne Entwicklung. Es sind zwei Positionen erreicht, zwischen denen zu vermitteln, gar a b zugleichen unmöglich wurde, ja von denen die eine sogar in ihrem ganzen Wesen sich erst aus diesem Gegeneinander definiert. Der Teufel des Christentums ist seinem Wesen nach statisch und unflexibel; in seiner festgefügten Gegnerschaft gibt es nichts, was sich in Richtung auf Versöhnung lockern ließe. Freilich hat es Autoren gegeben, denen die Starrheit einer solchen auf Ewigkeit angelegten Gegnerschaft mit der Idee des Christentums schwer vereinbar schien, aber gerade für sie ist der Gedanke bezeichnend, daß sich die endliche Versöhnung aus der Güte Gottes, nicht aus einem Sinneswandel Satans ergebe. Die Apokatastasis, so hatte Orígenes, nach ihm Gregor von Nyssa gelehrt, erstrecke sich auch auf die Person Lucifers; vom Logos gereinigt werde er schließlich zu den Geretteten gehören 24 . Auch dies also ist ein höchst undramatischer Vorgang; der Konflikt zwischen dem Göttlichen und Teuflischen wird nicht gelöst, sondern durch die Elimination der luciferischen Intention gegenstandslos gemacht. — Spielt so der Teufel in seinem Konflikt mit Gott beständig nur die Reprise der eigenen Existenz, so ist damit allerdings noch nicht sein ganzes Wesen ausgedrückt; in seinem Verhalten dem Menschen gegenüber zeigt er sich, wie entfernt noch bei Thuanus ablesbar, von immer anderer Seite, von höchster Verwandlungsfähigkeit und Beweglichkeit. Es ist dieser Zug in der Physiognomie des Teufels, der ihn fürs Drama rettet. Doch auch für das Verhältnis des Teufels zum Menschen gilt: Es verbirgt sein endloses Mienenspiel nur, daß sich sein immer gleiches Wesen nie ändern kann. —
24
häufig ist die Auffassung, Lucifer sei nach dem Sündenfall in der Hölle angekettet worden. Andererseits begegnet die Meinung, die allegatio sei erst mit dem descensus Christi erfolgt. Vgl. Johannes Quasten: Patrology. Vol. I I . The Ante-Nicene Literature after Irenaeus. — Utrecht/Antwerpen 1953. p. 87.
Parabata vinctus, sive Triumphus Christi, tragoedia
17
Trotz alledem hielt Thuanus den Teufel, so wie er sich nach dem Fall darbietet, für eine Gestalt, die in einer Tragödie zentral thematisch werden könne. Sein „Parabata vinctus" ist unseres Wissens der erste poetische Text überhaupt, dessen ausschließlicher Gegenstand Lucifer in seiner nach-himmlischen Existenz ist. Ist dies schon merkwürdig genug, so ist freilich der Weg, auf dem der gelehrte Humanist zu seinem Stoff gelangt, noch weit erstaunlicher. An sich will die Tatsache, daß ein christlicher Autor die Konturen Satans aus einer Gestalt der heidnischen Mythologie gewinnt, nicht weiter überraschen: Die Dämonisierung der griechisch-römischen Götterwelt hat innerhalb des Christentums eine Tradition, die bis ins zweite Jahrhundert zurückweist25. Blickt man aber auf die Qualitäten, die Satan den griechischen Göttern verdankt, so fallen vor allem zwei ins Gewicht: ihr Neid und die Lüge. Seit Irenaios gelten diese beiden Laster als im Teufel personifiziert26. Neid und Lügenhaftigkeit aber, so sehr sie ihre Heimat im Olymp haben, sind nicht Züge des aischyleischen Prometheus. Dergleichen klingt gewiß bei Hesiod noch an, in dessen „Theogonie" der Titan wesentlich als der Listige erscheint und als betrügerisch gegen Zeus 2 7 , aber davon ist in der uns überlieferten Tragödie des Aischylos aus seiner Prometheus-Trilogie nur mehr ein entfernter Rest. Die Renaissance, deren Prometheus-Verständnis sich aus der Darstellung des Boccaccio in seiner „Genealogie deorum gentilium" herschreibt, hatte an dem Titan nie spezifisch teuflische Qualitäten entdeckt 2S , und noch als Giordano Bruno 1585, also sieben Jahre vor der Niederschrift des „Parabata vinctus", den PrometheusMythos in Zusammenhang mit dem Sündenfall brachte, dachte er nicht an eine Parallele Satan — Prometheus, sondern an den Vergleich mit Adam: . . . so daß sie nicht mehr wie Adam die Hand nach der verbotenen Frucht der Erkenntnis ausstrecken können oder wie Prometheus, der ein Sinnbild derselben Bedeutung bildet, die Hand ausstrecken können, um das himmlische Feuer zu stehlen und damit das Licht der Vernunft anzuzünden 29.
Wenn es zu dieser Zeit den Vergleich Lucifere mit Gestalten der griechischen Mythologie gibt, so etwa den mit Phaeton und Narciss, bei Marino in der zehnten Stanze des „Bethlehemitischen Kindermords" (1632): Friedrich Andres: Die Engellehre der griechischen Apologeten des zweiten Jahrhunderts und ihr Verhältnis zur griechisch-römischen Dämonologie. — Paderborn 1914. p. 171. 26 Carl Schneider: Geistesgeschichte des antiken Christentums. Bd. 1. — München 1954. p. 260. 2 7 Nach Kerényis Formulierung zu Hesiod gehört Prometheus zu den „krumm Denkenden", deren „Trug und Lug" als Vorbedingung „eine Mangelhaftigkeit in der Existenzform des Schlauen" hat. Letztlich aber seien er wie Kronos „nur scheinbar klug" und dem Zeus unterlegen. — Karl Kerényi: Prometheus. Das griechische Mythologem von der menschlichen Existenz. — Zürich 1946. p. 21. 2 8 Vgl. dazu August Bude: Uber einige Deutungen des Prometheusmythos in der Literatur der Renaissance. — In: Romanica. Festschrift für Gerhard Rohlfs. Hrsg. von Heinrich Lausberg und Harald Weinrich. — Halle (Saale) 1958. pp. 86—96. Außerdem Trousson, a. a. O., Kapitel III. Prométhée et le „Rire des dieux", pp. 83—141. 29 Giordano Bruno: Die Kabballa des Pegasus mit der Zugabe des Kylienischen Esels. — In: Gesammelte Werke. Bd. 6. Hrsg. von Ludwig Kuhlenbeck. — Jena 1909. p. 34 f.
25
18
Jacques Auguste de Τ bou De 'fregi tuoi vagheggiatore altero, De Γ altrui seggio usurpator rubello, Trasformato e caduto in Flegetonte, Orgoglioso Narciso, empio Fetonte 30 .
Und der schottische Dichter Sir William Alexander unternimmt aufgrund der äußeren Wandlungsfähigkeit Satans in seinem endlosen Werk über das Jüngste Gericht „Doomes-Day, or, The Great Day of the Lords Judgement" (1614) den Vergleich mit Proteus: From shape to shape, this Proteus thus removes, Who first a Foxe, and last a Lyon proves 31 .
Ganz ungewohnt also war, was de Thou unternahm: Ein Vergleich Satans mit Prometheus, gar eine Diabolisierung des griechischen Gottes kam bisher noch nicht vor und sollte auch noch lange, genau bis 1702, ohne weiteres Beispiel bleiben. Denn ins Jahr 1702 fiele nach Troussons materialreichen Untersuchungen zum Prometheus-Motiv der erste Vergleich zwischen Prometheus und Lucifer (freilich hatte Trousson keine Kenntnis des Thuanus-Stücks) : „ . . . il faut attendre le P. Tournemine pour trouver, en 1702, la première allusion aux ressemblances éventuelles entre Prométhée et Lucifer." 32 Aber auch nach diesem Zeitpunkt wurde nur selten eine Vergleichbarkeit beider Gestalten postuliert; die radikale gestalterische Konsequenz des Thuanus zumal, die Austauschbarkeit von Lucifer und Prometheus, hat niemand mehr gezogen. Was also hat de Thou zu seinem außergewöhnlichen Schritt bewogen, worin fand er das Gemeinsame zwischen dem Teufel des Christentums und dem antiken Gott? Dazu äußert sich der Prologus, nachdem er über das Schicksal des Prometheus und den Sündenfall berichtet hat. Er fordert die Zuschauer zum Vergleich auf: Expende iam res propius, & confer simul. An ignis ille cum scientiae arbore Non prorsus idem est? aquila deinde illa in die Semper renascens quae iecur depascitur, Quid, nisi memoria criminum cor aestuans, Et gratiae spe cassa conscientia, Qua semper intus teste torquetur malus? (lv)
Das erste der beiden Argumente des Prologus möchte als eine Wiederholung des oben zitierten Vergleichs anmuten, den Bruno zwischen Prometheus und Adam unternahm, ist aber von Thuanus anders gemeint: Lucifer habe, wie Prometheus das Feuer (und mit dem Feuer die artes), dem Menschen scientia gebracht, indem er ihn vom Baum der Erkenntnis zu essen hieß. Gleich metaphorisch argumentiert Thuanus im zweiten Punkt: Der die Leber verzehrende Adler sei das Bewußtsein des Bösen von seinen Verbrechen, das Wissen um die 30 Giovanbattista Marino: Dicerie sacre e La strage de gl'innocenti. A cura di Giovanni Pozzi. — Turin 1960. p. 471. 31 The Poetical Works of Sir William Alexander Earl of Stirling. Ed. L. E. Kastner and J. B. Charlton. Vol. II. The Non-Dramatic Works. — Edinburgh/London 1929. p. 66. 32 Trousson, a. a. O., T. 2, p. 479. Vgl. auch Trousson, T. 1, p. 184. Anm. 14.
Parabata vinctus, sive Triumphus Christi, tragoedia
19
nie zu erlangende Gnade. Ein an der Leber zehrender Geier, nicht Adler (gleichwohl sicher eine Reminiszenz an den Prometheus-Mythos), begegnet wenige Jahrzehnte später als Vergleich in einem ähnlichen Kontext. 1620 läßt Thomas Peyton in seinem Buch „The Glasse of Time, in the two first Ages" Gott sein Urteil über die Paradiesesschlange so formulieren: The worme of Conscience shall torment thee euer, And like a Vulture feed vpon thy Liuer '3.
Dient aber bei Peyton das Bild nur dazu, die Intensität des Schmerzes als eben auf den Frevler zugeschnitten zu akzentuieren, so geht Thuanus darüber hinaus: Was bei Peyton Vergleich, ist bei Thuanus Metapher. Nicht wie der Adler quält das Gedächtnis den Teufel, sondern der Adler ist das Gedäditnis. Diese beiden Momente sind für de Thou von solch schlagender Evidenz, daß er den Prologus jetzt schon abbrechen und die Konsequenz ziehen läßt, daß die Übersetzung des „Gefesselten Prometheus" den neuen Titel „Der gefesselte Parabata" bekommen müsse, und daß die heidnischen Gestalten durch christliche zu ersetzen seien, um das antike Stück in ein christliches zu verwandeln. Aus den Worten des Prologus wird deutlich, daß in de Thous Verständnis der Mythos von Prometheus die antike Metapher für den Lucifer-Mythos ist: Prometheus ist daher nicht Lucifer vergleichbar, sondern er ist Lucifer. Dies berechtigt Thuanus dazu, von einer Übersetzung mit der sprachlichen Übertragung zugleich eine mythologische zu fordern. Freilich könnte de Thou solch doppelte Übertragung nicht gelingen, wenn nicht als umfassendere Gemeinsamkeit beider Mythen hinter der Vermittlung von artes und scientia die Verletzung göttlichen Gebots stünde. Das aber ist in den Worten des Prologus bereits impliziert, hatte er doch zuvor das Feuer des Olymp als „noxium munus" des Prometheus (lr) und das Pflücken des Apfels als „impium . . . scelus" (lv) qualifiziert. Prometheus wie Parabata also sind ausdrücklich von de Thou als Frevler vorgestellt, als Gegenkräfte in göttlicher Ordnung. So reicht die Gemeinsamkeit weiter als nur bis zu gleichem Vergehen und gleicher Strafe; in beiden spricht als ihr Wesentliches der Widerstand gegen die Wirklichkeit des göttlichen Gesetzes sich aus. Indem Prometheus und Lucifer zentrale Gebote Gottes bewußt verletzen, geben sie damit ihrer vollständigen Ablehnung der bestehenden nach dem Gesetze Gottes geregelten Ordnung Ausdrude. Darin verwirklicht in beiden sich — nach dem Wort Albert Camus' — die metaphysische Revolte, in der der Rebell im Kampf gegen die eigenen Lebensbedingungen seinen Widerstand gegen die Verhältnisse in ihrer Totalität leistet 34 . Einer Unterscheidung Emst Blochs folgend, nach der „ . . . im Mythischen selber . . . zwischen Dominierend-Riesenhaftem und dem mindestens Palastrebellischen darin unterschieden werden" muß 35 , kann in Prometheus Thomas Peyton: The Glasse of Time, in the two first Ages. — London 1620. p. 56. Albert Camus: Der Mensch in der Revolte. Essays. — Reinbek 1969. p. 22 ff. Camus sieht in Prometheus „den größten Mythus des Geistes im Aufstand" (p. 24). Zu Lucifer siehe p. 41 f. Ernst Bloch: Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reichs. — Frankfurt 1973. p. 44.
20
Jacques Auguste de Thou
und Lucifer je ein Moment des Aufrührerischen in griechischer Religion und Christentum gefunden werden. — Nur macht es gewiß einen Unterschied, in welchem Palast denn rebelliert wird, ob also die Empörung sich gegen den griechischen Göttervater oder den Gott des Christentums richtet. Die anthropomorphe griechische Göttervorstellung fand audi an Zeus noch manch tadelnswerten Zug, und zumal sein Verhältnis zu den Menschen ist von Ungerechtigkeit, Raub und Verführung in vielen Fällen geprägt. Aischylos verlieh dem Ausdruck in der Io-Episode, dem scharfen Protest gegen göttliche Willkür. An ihr auch wird deutlich, daß der Mensch seinen Gott durchschaut: Pläne und Absichten des Zeus sind irdisch nicht nur in dem Sinne der hier kritisierten erotischen Intention, sondern audi darin, daß es menschliche Gedanken sind, dem Menschen einsehbar und von ihm in ihrer Logik und Widersprüchlichkeit zu überprüfen. — Ganz anders dagegen der christliche Gottesbegriff: Kein Mensch kann hier die göttlichen Ratschlüsse mit seinem Verstand erfassen, niemand kann bis zum Grund der göttlichen Absichten vordringen. Damit zusammen hängt, daß die Realität gegenwärtigen Leids sich niemals mit Sicherheit auf eine göttliche Intention zurückführen läßt: Zu den wenigen Dingen, die der Christ vom Wesen seines Gottes sicher weiß, gehört dies, daß Gott immer der gute und vollkommene Gott ist. So konnte Lucifers Rebellion ihren Ursprung nicht in einem Unvollkommenen, gar Bösen an Gott haben, sondern nur in Lucifer selbst, während Prometheus, seinem Gott auf die Schliche gekommen, die Quelle eines konkret Bösen in der Psychologie des Zeus aufzufinden vermochte, die prometheische Rebellion also ihren Ursprung in der Unzulänglichkeit des griechischen Göttervaters fand. Die Gemeinsamkeit zwischen Prometheus und Lucifer erweist sich in dieser Sicht als eine rein gestische: zwei Kräfte, die gegen das „Dominierend-Riesenhafte" sich wenden, ihm sich nicht ergeben. Damit aber setzt die Gemeinsamkeit bereits aus: Prometheus ist im griechischen Mythos selbst Gott, ja sogar ein weit älterer als Zeus; Lucifer aber ist das Geschöpf Gottes. Weitere bedeutsame Unterschiede seien nach Elizabeth Barrett Browning zitiert, die 1833 im Vorwort zu ihrer Übertragung des „Gefesselten Prometheus" sich gegen den Vergleich des Miltonschen Satan mit dem Prometheus des Aischylos wandte: Satan suffered from his ambition; Prometheus from his humanity: Satan for himseit; Prometheus for mankind: Satan dared perils which he had not weighed; Prometheus devoted himself to sorrows which he had foreknown.^*
Aus ähnlichen Gründen hatte auch schon Shelley 1820 Prometheus als den poetischeren Charakter Satan vorgezogen: . . . because, in addition to courage, and majesty, and firm and patient opposition to omnipotent force, he is susceptible of being described as exempt from the taints of 36 The Poetical Works of Elizabeth Barrett Browning. — London 1904. p. 554. — Daß Züge des aisdiyleischen Prometheus in die Gestalt Satans bei Milton eingeflossen sind, behauptete zuletzt in einer detaillierten Untersuchung auf der Grundlage der Theorie C. G. Jungs: Zwi Werblowsky: Lucifer and Prometheus. A Study of Milton's Satan. — London 1952.
Parabala vinctus, sive Triumphus Christi, tragoedia
21
ambition, envy, revenge, and a desire for personal aggrandisement, whidi, in the Hero of Paradise Lost, interfere with the interest.3?
Was in solchen Sätzen konzis als Ergebnis eines an Inhalten, nicht an Gesten orientierten Mythenvergleichs sich ausspricht, findet bei de Thou keinerlei argumentative Entsprechung. Notwendig hätte jeder Hinweis auf Unstimmigkeiten das metaphorische Verständnis der Prometheus-Tragödie verstellt, sc daß es nicht weiter verwunderlich erscheint, wenn der Prologus jede en ι sprechende Allusion sorgsam vermeidet. Andererseits aber darf man nicht annehmen, daß einem gebildeten Humanisten vom Range de Thous, zumal in einer Zeit, die auf theologische Details zu achten gewohnt war, solch schlagende Inkongruenzen zwischen beiden Mythen entgangen wären. Darauf verweist schon die keineswegs naive Art, in der der Prologus dem Zuschauer jede Möglichkeit nimmt, eventuelle Einwände gegen seine Argumentation ins Bewußtsein treten zu lassen: In dem Umstand, daß die oben zitierten, in Gestalt von Fragen vorgetragenen möglichen Identitäten undiskutiert bleiben, ja im unmittelbar folgenden Satz sogleich die Konsequenz gezogen wird, Prometheus sei bei der Übertragung durch Parabata zu ersetzen, verrät sich ein Unbehagen des Autors selbst an dem eigenen Unternehmen. Was an argumentativer Präzision fehlt, wird durch Suggestivität ersetzt. — Dies alles aber, zumal die radikale Ausklammerung möglicher Einwände, lenkt den Blick um so intensiver auf die beiden Faktoren, deren Entschlüsselung de Thous Überzeugung begründete, man brauche dem Prometheus des Aischylos nur die antike Maske abzunehmen, um hinter ihr das Antlitz Lucifers zu erblicken. Denn wenn diese beiden Züge, der eines Bringers von scientia und der des Wissens um die Vergeblichkeit von Hoffnung, für de Thou sich so tief in die Physiognomien Lucifers und Prometheus' eingegraben haben, daß neben ihnen der Blick das Unterscheidende nicht mehr wahrnimmt, so heißt dies, daß für ihn das eigentliche Wesen Lucifers, der Inkarnation des Bösen — und nur um ihn geht es nodi nach der Dekuvrierung des Prometheus —, in eben diesen Zügen sich ausprägt. An ihnen ist die Aktualität des Bösen ablesbar. Es sind Justitia und Pax, die den gefesselten Parabata in die Hölle geleiten. Misericordia, die Gegenspielerin Justitias aus den Mysterienspielen des 15. Jhs 3S , tritt nicht auf, soll heißen, sie hat zugunsten Lucifers nicht das geringste zu sagen. Aber auch Pax ist eine stumme Rolle (gleich Bia bei Aischylos), kommentarlos betrachtet sie die Fesselung des Teufels. Daß der Friede schweigt, ist freilich dem von Glaubenskämpfen erschütterten Frankreich genuine Erfahrung; um so gewichtiger aber, daß Pax bei dem so unfriedfertigen Geschehen der allegatio überhaupt anwesend ist. Sed mite miror quî sororis corculum Huic interesse pertulit spectaculo. (5r)
y So im Vorwort zu „Prometheus Unbound". — Percy Β. Shelley: Poetical Works. Ed. Thomas Hutchinson. — London 1967. p. 205. 38 Vgl. ζ. B. Arnold Immessens „Sündenfall", ca. 1475.
22
Jacques Auguste de Thou
So verleiht diesbezüglich Michael seinem Erstaunen Ausdruck. Justitia erteilt ihm schnell Bescheid: Pacem decere haut abnego clementiam: Secura sed pax esse non aliter potest, Quam si seuere noxios coerceas. (5r)
Die Fesselung Parabatas also geschieht — und nur deshalb ist Pax zugegen — im Dienste des Friedens und zum Zweck seiner Sicherung. Daß es dabei um mehr geht als allein um den Teufel, zeigt der Plural („noxios"), den Justitia wählt. Die allegatio diaboli erscheint so gleichsam als exemplarischer Akt der Friedenssicherung; mit dem Teufel gemeint sind die zahlreichen „noxii" als Verbrecher am Frieden. Wie sehr es dieser Punkt ist, um den es bei der Fesselung des Teufels geht, zeigt deutlich die Reaktion Michaels: Eamus: haerent vincla membris addita, Quib. expedite se malus nunquam queat.
(5r)
Nicht allein, daß er augenblicklich sein Hadern mit dem göttlichen Befehl, der ihm zuvor als zu grausam erschienen war, aufgibt und mit der Aufforderung zu gehen verlegen die Diskussion mit Justitia abbricht, ist dabei von Gewicht, sondern besonders dies, daß er sich erst jetzt, im letzten Vers, den er spricht, und unmittelbar nach Justitias Erklärung, ihrem Sprachgebrauch anschließt und gleich ihr (vgl. 4v) Parabata „malus", den Bösen, nennt. Daß durch ihn kein Friede sei, erst dies also trägt dem Teufel bleibend den Titel des Bösen ein. Wenn so auf einem Höhepunkt der Glaubenskämpfe die Erfahrung eines Widersacherischen in der Welt über das Erlebnis des Krieges sich vermittelt, das Böse aus ihm seinen zentralen Inhalt gewinnt, so liegt die Annahme nahe, daß in der Gestaltung des Teufels als des gedachten Ursprungs des Bösen eine Konstellation begründender Faktoren aufscheint, die den Krieg in der Sicht der Zeit notwendig hervorbrachte. Daher audi braucht Parabata, nachdem Pax in der Eingangsszene stumm auf ihn als ihren Gegner wies, keineswegs mehr als kriegerischer Geist sich darzustellen, denn es sind bereits die einzelnen Züge seines Wesens als dem Frieden feindlich erkannt. Das Teuflische, dringlich geworden im Unfriedfertigen, verrät diese seine Aktualität an den Akzenten, die de Thou bei der Gestaltung seines Lucifer in dessen Charakteristik setzt. Der erste Ton ist schon mit der Wahl des Namens angegeben: Parabata ist der Frevler, er überschreitet gesetzte Grenzen. Mit diesem Namen ist für Thuanus so sehr das Wesen Lucifers bezeichnet, daß in der allegatio, als der zumindest räumlichen Fixierung, die Natur des Teufels aufgehoben, die Namensgebung also hinfällig erscheint, so daß Justitia spotten kann: heic aeterna tibi sedes erit: Neq. hac vagari illacve, praescriptum egredi Aut terminum licebit. haut recte tibi Fecere nomen Parabatae. (5r)
Der Grenzüberschreitung, dem Frevel entgegen steht das Gesetz in seiner doppelten Form, nämlich als „ius fasque" (4r), als göttliches und menschliches Gesetz. Ist in dieser Kombination der Rechtsbruch Lucifers schon gleichsam vom
Parabata vinetus, sive Triumphus Christi, tragoedia
23
Himmel auf die Erde geholt, so erscheint seine Herrschaft über den Menschen erst recht in gänzlich irdischem Gewand, nämlich wenn Michael sich des folgenden Vergleichs politischer Herkunft bedient: Inflatus his tu prosperis sueeeßibus, Impune mundi regna per grassatus es Iam multa seda, quasi tyrannus, legibus Qui se solutum existimans, animi omnia Insanientis ad libidinem gerit, lus fasq. calcat, opprimit leges metu. (3v-4r)
Eben deshalb werde er gefesselt, auf daß er inskünftig seine „pristinam . . . tyrannidem" (4r) nicht mehr auszuüben vermöge. Zwar begegnet der Vergleich der Herrschaft des Bösen in der Welt mit der Tyrannis häufig, zumal in ihm am deutlichsten das Moment der Willkür, des „ad libidinem", mit der es den trifft, der seine Gründe im Realen nicht sieht, sich aussprechen läßt, aber nicht so ausschließlich wie bei Thuanus an Gesetz und Gesetzesbruch gebunden. Denn hier manifestiert sich die Herrschaft des Bösen in der Welt des Menschen als Rechtsbruch und, stärker noch, als Aufhebung des Gesetzes, als Ende der schützenden Ordnung, ausgedrückt im Bilde des Geistes im Wahn ( „animi . . . insanientis"), nach dessen Gutdünken die Welt dann geregelt sei. Auch deshalb eben treten Justitia und Pax als Paar auf, weil ohne das Recht und ohne Gesetz der Friede nicht sein kann; der Teufel aber trifft, wenn er auf das Gesetz zielt, immer den Frieden. Parabata kennt diese Verwandtschaft beider genau (auch Michael nennt sie ja Schwestern) und sieht in ihnen seine Hauptgegner; deshalb werden die Schwestern in seiner Vision von der Ankunft des Antichrist als erste Opfer genannt, die seinem Triumphwagen folgen: Captae trahentur, queis ego iubentibus Huic adligatus haereo miser petrae, Iustitia Paxq. aeterna Iustitiae soror; (27r)
Darin, daß Parabata den Befehl zu seiner Fesselung auf Justitia und Pax, nicht aber auf Gott zurückführt, auf den Justitia sich doch berief, ist noch einmal deutlich das Böse akzentuiert als der Widerpart von Gesetzlichkeit und Friede. Und in eben diesem Sinne auch stellt Justitia in ihren ersten Sätzen Parabata vor: Et legis ausum hunc limitem transcendere Legisq. conditoris excutere iugum, (3r)
Darin steckt beides: Parabata überschreitet die Grenze des Gesetzes, dies geschieht in Gestalt des Aufruhrs; der Verstoß gegen das Gesetz fällt also mit dem Friedensbruch zusammen. Auch darin aber kehrt nur wieder, was schon oben über das statische Wesen des Teufels gesagt ist: Denn der beständige Angriff auf Gesetz und Frieden zugleich ist nur die endlose Wiederholung der einen Figur, die am Anfang steht, des Aufstands im Himmel, so wie ihn Michael beschreibt: Agnosce culpam; quippe tu stimulum ferox Contra incitasti membra detrectans iugum;
24
Jacques Auguste de Tbou Sonipesq. freno liber excusso velut Ipsum proteruis calcib. dominum petit, Summum impetisti patrij dominum poli Conuicijs superbus & calumnijs, Indigna pa£im blatterans mendacia: (3v)
„iugum" ist hier wiederum — nach den Formulierungen Justitias kurz zuvor — als „iugum legis" gemeint. Indem das Gesetz fällt, fällt auch der Friede; beides ist bei Thuanus nicht zu trennen. Die Gestalt, in der sich der Friedensbruch vollzieht, ist die des Aufruhrs, des Gesetzesbruchs von innen. Nicht umsonst erscheint Gott hier als „patrii dominus poli" ; akzentuiert wird damit, daß der Aufruhr Lucifers den Bürgerkrieg zur Folge hat. Darin genau liegt die Aktualität des bellum angelicum für Thuanus, daß in ihm das Urbild des Bürgerkriegs sich darbietet, an ihm schon modellartig dessen Bedingungen sich demonstrieren lassen. Dabei vollzieht der Rechtsbruch sich in der Form einer Insubordination gegen den höchsten Garanten des Gesetzes: gegen Gott als „dominus patrii poli" — oder aber, in Thuanus' Erfahrung, gegen den König, auf dessen Seite er stets zu finden war. Wichtig nun ist, daß Michael bei seiner Schilderung sich nicht militärisch-kriegerischer Termini bedient, sondern die gleichsam intellektuelle Seite des Aufstands, dessen psychologische Vorbereitung wie auch seine ideologische Ergänzung betont. Eben darin spricht die Erfahrung des Historikers und (wovon später noch zu reden ist) Skeptikers sich aus, daß Machtinteressen zu ihrer Durchsetzung ideeller Systeme sich bedienen. Schon in der dedicatio hatte de Thou gezeigt, auf welche Weise die Menschen Ehrgeiz, Neid und Habgier (ambitio, fastus, avaritia) verbrämen: Et ista tame, pro fidem! omnia religionis excusatione tegütur. Apage istam religionem tot & tantorum monstrorum altricem. noli fronti credere, si penitius inspicias, fucus est.
Diese radikale Aufforderung zur Skepsis, radikal deshalb, weil sie ihren Blick, der in den Glaubenskämpfen tagtäglich sich hatte schulen können, auf jede Religionspartei, auch auf die eigene, heftet, dieses „noli fronti credere" also beweist seine Kraft zuerst und exemplarisch an Lucifer, hinter dessen Anklagen gegen Gott schon Michael Hochmut und Neid (superbia, livor — 3v) als Beweggrund entdeckt hatte. In Michaels kurzen Bemerkungen über den Aufstand Lucifers im Himmel findet also zweierlei sich akzentuiert: der Bruch des Gesetzes in Gestalt eines Angriffs auf seinen Garanten und die ideologische Überhöhung des Gesetzesbruchs. In diesen beiden Punkten aber kehrt das Wesen des Bürgerkriegs wieder, so wie die Zeit ihn erfuhr, mit dem vertriebenen, dann ermordeten König, mit den theologischen Auseinandersetzungen, die häufig nur partikulares Interesse kaschierten. Der Chor kann daher nach seinem ersten Gespräch mit Parabata sehr bestimmte Folgerungen im Blick auf Staatstheorie ziehen: Ne praesidib. iustum obsequium, Ne maiorib. aetate nega; Quae mite iugum namq. pudoris Legumq. metum excußit ciuitas, Sana & sospes stare nequit diu.
Parabala vinctus, sive Triumpbus Christi,
tragoedia
25
Opibus quamquam diues abundet, Quamquam innumeris sit populis frequens, Mox ingentibus ex supremo Culmine concidet oppressa malis. (8r-8v)
Hier ist die Lehre aus Lucifere Fall gezogen, und sein Sturz in Parallele zu dem des Staates gesetzt: So wie Lucifer, als er Gesetz und Gehorsam aufgekündigt hatte, aus dem Himmel stürzte, so stürzt der Staat nach Auflösung seiner inneren Hierarchie und des Gesetzessystems aus der Höhe seiner Prosperität. Und zwar „ingentibus . . . oppressa malis" : Der Einbruch eines Bösen in die Ordnungsstruktur ist deutlich bezeichnet. — Dahinter bürgerliches Rechtsdenken zu vermuten, liegt zwar nach dem obigen Zitat nicht völlig fern, ansonsten aber bietet der Text, wollte man nicht allein schon die Insistenz auf dem Rechtsbegriff als Spezifikum bürgerlichen Denkens verstehen, dafür keine Anhaltspunkte. Gerade in den nächsten Sätzen, in denen der Chor die anthropologische Fundierung seiner staatstheoretischen Folgerungen unternimmt, formuliert sich feudales Ordnungsdenken: Sic naturae postulat ordo, Vsus deniq. sic rerum exigit, Ima vt summis subdita seruiant; Vt maiori parere minor Discat, & aequa mente ferat iugum. Id ni fiat, cardine lapso Cuneta ferantur, cuneta necesse est Confusa ruant. (8v)
Hierarchisches Denken erfährt eine gleichsam naturgesetzliche Legitimation; ein Durchbrechen der Hierarchie, in der jeder Befehlender (nach unten) und Gehorchender (nach oben) zugleich ist, kommt einer Auflösung des Ganzen gleich. Es ist im Aufbau der Welt jede einzelne Position der entscheidende Stein, der audi das Ganze („cuncta") trägt, so daß als Alternative nur gilt: entweder Eingliederung in den Zusammenhang des umfassenden Systems oder Zusammenbruch aller Ordnung. Angesichts solcher Wahl freilich ist die Entscheidung dem Menschen des 16. Jhs einfach: Im Blick auf die Schrecken des Chaos, das als Folge verweigerter Einordnung droht, gewinnt die Gesetzlichkeit der Hierarchie die Milde eines Rettenden, so daß jetzt — in den Worten des Chors — das Gesetz als „mite iugum" erscheint, das — „aequa mente" — zu tragen einfach ist, wenn völliges Ausgeliefertsein als die einzige andere Möglichkeit sichtbar wird. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Wahl zwischen Gesetz und Krieg die tiefere Dimension einer Entscheidung zwischen der von Gott gesetzten Ordnung und dem Chaos. So hat Lucifers Rebellion ihre Schärfe darin, daß, indem ein Dienendes den Gehorsam kündigt, die göttliche Ordnung in ihrer Totalität verneint wird, und das Chaos sein drohendes Haupt erhebt. — Es gehört in diesen Zusammenhang, daß in der universalen Ordnung, dem Zusammenhalt aller Existenz von seiner niedrigsten bis zur höchsten Form, das Denken der Zeit einen Rang für den Teufel nicht fand: Satan führt eine Existenz gänzlich eigener Art, völlig außerhalb der von Gott geschaffenen Kette alles Seins. So heißt es bei Sir John Fortescue, einem Juristen des 15. Jhs, in seiner Darstellung
26
Jacques Auguste de Thou
der „great chain of being" : „Hell alone, inhabited by none but sinners, asserts its claim to escape the embraces of this order . . . " 39 Hier ist die Alternative zwischen dem göttlichen und dem satanischen Prinzip als die zwischen Ordnung und Chaos aufs äußerste akzentuiert und zu Ende gedacht. — Bei de Thou wird die Kollision der beiden Prinzipien sichtbar als das Widerspiel von gesetzlich geregeltem Frieden und dem Krieg in seiner Form als Bürgerkrieg. Die Integrität des Gesetzes, garantiert in der Kontinuität der Hierarchie, verbürgt die Wahrung des Friedens; eine gewaltsame Umkehrung in der Hierarchie, gegen „ordo naturae" und „usus rerum", verletzt Gesetz und Friede zugleich. Eben dies betont Thuanus an der Rebellion Lucifers; die Konkretisation des Bösen, in der Gestalt Lucifers sich darbietend, gewinnt deutlich sich aus der historischen Erfahrung des Bürgerkriegs. Wie dieser in der Rebellion im Himmel sein mythisches Modell fand, so ist jetzt, in einem weiteren Schritt, auf die Beweggründe des Aufrührers zu achten; von ihnen fällt neues Licht auf die historische Erfahrung, aus der heraus Thuanus seinem Lucifer Kontur verleiht. Wir kommen nodi einmal auf das Gespräch zwischen Michael und Justitia zurück. Als Michael sich wünscht, ein anderer möge an seiner Stelle den früheren Freund fesseln, weist Justitia ihn barsch zurecht: Optare tibi fas cuncta; verum vni Deo Posse imperare, tibi vouere non licet. Nam nemo liber praeter vnicum Deum.
(4r-v)
40
Daß niemand frei sei als Gott, ist Ausdrude von dessen Allmacht und Schöpfertum; nicht gemeint ist damit, daß alle anderen unfrei sind, sondern daß sie ihre wahre Freiheit als Geschöpfe Gottes in der von Gott gesetzten Hierarchie finden. Gott selbst ist Schöpfer, nicht Glied der Kette; deren oberste Glieder sind, nach dem Dionysios Areopagita, der die Angelologie des Mittelalters und der frühen Neuzeit wohl am nachhaltigsten beeinflußte, die neun Chöre der Engel, von deren erster Triade (Throne, Cherubim, Seraphim), an deren Spitze ursprünglich Lucifer stand, es heißt: . . . sie schauen jene Urschönheit, welche selbst das Schöne schafft und vor allem Wesen ist, sie sind durch und durch gesättigt von dem unmittelbaren Strahl der heiligen Dreifaltigkeit.«
In diesem Satz, der die Nähe der höchsten Geschöpfe zu Gott auszudrücken bemüht ist, vermittelt aber vor allem sidi die unausmeßliche Distanz, in der alles Geschaffene zu seinem Schöpfer steht. Sie liegt zwischen Schaffen und Geschaffensein und bekundet in der passiven Haltung des Sdiauens, dem Einverständnis mit Gott, der in doppeltem Sinne „vor allem Wesen" ist, sich am 39 Zit. nach E. M. W. Tillyard: The Elizabethan World Picture. — Harmondsworth 1968. P· 39. Bei Aischylos heißt es: „Ein jedes Ding hat sein Beschwerliches, außer Herr / Der Götter sein, denn frei ist keiner außer Zeus." — Übertragung von Walther Kraus. — Stuttgart 1965. 41 Dionysios Areopagita: Die Hierarchien der Engel und der Kirche. Einführung von Hugo Ball. — München 1955. p. 124.
Parabala vinetus, sive Triumphus Christi, tragoedia
27
intensivsten. Dies muß bewußt bleiben, um die Worte Justitias richtig zu verstehen. Denn es gibt zweierlei Freiheit: die absolute des Schöpfers und die relative des Geschöpfs in den Grenzen der von Gott gesetzten Ordnung. Auch das höchste Wesen in der Schöpfung, Lucifer, vermag diese Distanz nicht zu überspringen, kann also als geschaffenes Wesen nur die ihm bemessene Freiheit erlangen. Nun ist aber in den Worten Justitias das Problem der Freiheit bereits als eines der Macht ( „posse imperare" ) akzentuiert, so daß den Aufrührer nicht Freiheit an sich, sondern Freiheit als Verfügung über Macht an der Stellung Gottes lockt. Die Distanz zwischen Schöpfer und Geschöpf wird material in den Begriffen von Freiheit und Macht; beides ist in den Worten Justitias betont: supremi iussa peraguntur Dei, Parere queis nos obligat neeeßitas.
(4r)
Gott zu gehorchen ist necessitas, die aus dem Status des Geschaffenseins erwächst; vor diesem Hintergrund erscheint die Rebellion Lucifers als der aberwitzige Versuch, eine Notwendigkeit, die für die gesamte Schöpfung gilt, in Willkür zu überspringen: diejenige, dem je Höheren zu gehorchen, ihm gegenüber in Freiheit eingeschränkt zu sein. Indem Lucifer aber nach der Freiheit und Macht des Schöpfers strebt, tritt er aus der Ordnung der Sdiöpfung aus. — Wie sehr Thuanus' Gestaltung von der Vorstellung der Hierarchie und ihrer Regulationen bestimmt ist, zeigt erneut Justitia, wenn sie zu Michael sagt: Et istud ergo stringe vi valida, vt Deo Sese minorem discat aliquando malus. (4v)
Nicht also die Bestrafung eines Verbrechers ist hier primär gemeint, sondern die Belehrung eines Uneinsichtigen — freilich in Gestalt rücksichtsloser Domestikation. Dem Bösen soll, wessen er sich in der Rebellion versah, in der allegatio bleibend sich einprägen: daß sein Ort unter dem Gottes liegt. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, daß Lucifer bei Thuanus als einzelner auftritt: Weder ist in den Schilderungen des Aufruhrs von seinen Mitstreitern die Rede, noch stehen ihm bei seinen Umtrieben auf der Erde oder bei der Fesselung im Tartarus Gefährten zur Seite, wie sonst in den Gestaltungen der Zeit. Dies reflektiert zum einen sicher die mit der allegatio vollzogene Entmachtung des Teufels; niemand ist mehr da, dem er noch befehlen könnte. Aber bedeutsamer ist das andere: Im isolierten Aufbegehren Lucifers gelangt die Spannung des vereinzelten Subjekts, des gleichsam Alleine-Gelassenen, zur Dominanz des Gesamtsystems zum Ausdruck. Indem Lucifer als einziger erscheint, tritt um so schärfer die objektive Gültigkeit der gesetzten Ordnung zutage. Um so intensiver auch ist dann subjektives Ungenügen, schon unabhängig von jeder Begründung, innerhalb des Objektiven als unzulässig diskreditiert; Subjektivität ist einzig als vom Geiste des Objektiven bestimmt akzeptiert. Daß es in dieser großen Distanz zum Engelsturz, in dem Lucifer doch schon für immer widerlegt wurde, noch immer um die Rehabilitation der damals durchbrochenen Hierarchie geht („Deo sese minorem"), bestätigt erneut die Präponderanz der geordneten Objektivität. Wenn zudem Thuanus an eben diese Stelle zum ersten-
28
Jacques Auguste de Tbou
mal im Stück das Wort „malus" setzt, das Böse also deutlich bezogen auf die von einem einzelnen verletzte Objektivität einführt, wird die Dominanz des Ordnungsdenkens überdeutlich. Es geht um die Stärkung, ja Erneuerung einer gefährdeten Ordnung, der aufbegehrende einzelne — Lucifer — wird zwar nicht erneut in sie eingebunden, aber außerhalb ihrer so fixiert, daß ihm ihre bestätigte Wirksamkeit und Kraft deutlich vor Augen steht. — Die Restauration der gefährdeten Ordnung ist aber bei Thuanus mehr als nur Programm, sie ist schon partiell Wirklichkeit. Hiob sagt, nachdem er Parabata sein gottloses Leben vorgeworfen hat: Retro peractis hoc licebat seculis, Mutata nunc sunt tempora, & tuos quoque Mutare mores atq. rationem decet Vitae prioris . . . ( l l v )
Hiob bestimmt Parabatas Verhalten als unzeitgemäß: Eine veränderte Wirklichkeit mache auch eine Verhaltensänderung notwendig. Sein Aufbegehren war in vergangener Zeit möglich, ist es aber jetzt nicht mehr. Dieses Vertrauen darauf, daß Lucifere Kampf gegen Gott, sein Aufbegehren, eine Kategorie der Vergangenheit ist, legitimiert sich aus dem Wissen um den Opfertod Christi; der allerdings erscheint bei Thuanus nicht als die Apotheose von Leid und Tod am Kreuz, sondern als die Inthronisation eines neuen Königs in Machtfülle und Herrlichkeit. So bereits in den Worten, die Michael zu Beginn an Parabata richtet: Sed ecce maior rege te & potentior Rex imperare cepit . . . (4r)
Justitia nimmt die Worte Michaels dann später wieder auf, bezeichnenderweise auch sie wieder in direkter Anrede an Parabata: Tua regna cessant: venit immutabili Promissus olim voce rex salutifer, De stirpe magni sceptra qui Iudae abstulit; Et nunc solo caeloq. quam latißime Regnat, nec vilo fine porro desinet Regnare . . . (5r-v)
Und Parabata bricht wenige Verse später in die Klage aus: Verum ecce, dirum, regis aduentu noui Nouis subinde exerceor cruciatibus . . .
(6r)
Ergänzend sei noch ein weiteres Zitat hinzugefügt; Parabata sagt zum Chor: ecce rex nouus Nouat arbitratu cuncta & euertit suo, Oblitterat deletq., &, vt visum, hos polo Beat, profondo damnat illos Tartaro. (7r)
Diese Belege mögen genügen, um deutlich zu machen, daß in diesem Punkt die Gestaltung des Konflikts von Gut und Böse, sichtbar geworden in der Konfrontation von Ordnung und Gesetz mit den auflösenden Kräften, am engsten mit Realgeschichte verbunden erscheint. Daß Thuanus hier nämlich den Namen
Parabata vinctus, sive Triumpbus Christi,
tragoedia
29
Christi völlig ausspart und nur noch vom rex maior et potentior et salutifer spricht, bedeutet mehr als nur die Wiederaufnahme einer Tradition von Gestaltungen des in Königswürde triumphierenden Christus. Die Ausschließlichkeit der Benennung wie die sorgsame Vermeidung des Namens des mit ihr Bezeichneten konzentrieren den Blick auf die Königs würde, hinter der Christus, der als ihr Träger zwar bewußt bleibt, völlig verschwindet. Thuanus zeigt an Christus nur noch das triumphierende Königtum in seiner erneuerten Gestalt, Demut und Opfertod als Essenz des Wesens Christi sind verschwiegen. Der Sieg Christi über Satan und Tod dient de Thou dazu, an ihm das Wesen des über Aufruhr und Verfall siegenden Königtums vorzuführen. Christus ist deshalb nicht genannt, weil Heinrich IV. gemeint ist. So wie die Erlösung der Menschheit im Opfertod Christi erst kurz vor der allegatio sich vollzog, so ist dem im Bürgerkrieg zerrissenen Frankreich erst drei Jahre vor der Niederschrift des „Parabata vinctus" in seinem neuen König der Retter erschienen. Und wie Parabata sich weigert, die Herrschaft Christi anzuerkennen, so wurde dem Hugenotten Heinrich von Navarra von der katholischen Ligue die Königswürde bestritten 42 . Wenn also Parabata beständig vom „rex novus" spricht, dann ist damit keineswegs auf die gerade erst erfolgte Einsetzung abgehoben, sondern es wird dem neuen König ganz bewußt die Legitimität abgesprochen. Der „rex novus" führt die Konnotation „Usurpator" mit sich; Parabata versäumt daher an keiner Stelle, die Willkür in der Regentschaft des neuen Königs herauszustreichen, so daß Christi „Siehe, ich mache alles neu" (in Parabatas Worten „ . . . ecce rex novus novat . . . cuncta") in der Rede des Teufels zur eigenmächtigen Handlungsweise eines Tyrannen depraviert ( „arbitrati! . . . evertit suo, oblitterat deletque"). An späterer Stelle, im Gespräch zwischen Parabata und Hiob, treffen die beiden Positionen aufeinander: Hiob bestätigt die Legitimität des neuen Königs, die in Parabatas Worten bestritten ist: Nouus ille quippe rex, & omnis nuperus Rex durus asperq. esse subditis solet. IOB. Nunquamne verbis abstinebis talibus? Demens Parabata, qui nouum regem vocas, Qui genitus ante Solis aureum iubar, Lunamq., & ante te creatum & luminis Specioso Eoi gloriantem nomine, Cuncta ante mundi secla regnator potens Pronuntiatus & sacerdos a Patre . . . (llv-12r)
Betont Parabata noch einmal die tyrannenhafte Willkür des neuen Königs, so erfährt in Hiobs Worten das Königtum eine Legitimation aus göttlicher Vorsehung. Vor diesem höchsten Argument erweist Parabata sich in seiner Gegnerschaft zum König als töricht („demens"), ein Verdikt, mit dem zugleich jeder Königsgegner getroffen ist. Thuanus' Verbeugung vor dem Königtum, dem er trotz gegensätzlicher Religion zeitlebens als Diplomat diente, ist mehr als die devote Geste eines Höflings, als welcher er auch nie sich verstand, sondern im König ehrt de Thou die Spitze wie auch den einzigen wahren Garanten der « Erst nach dem Übertritt zum Katholizismus, 1594, wurde Heinrich IV. gekrönt.
30
Jacques Auguste de Thou
staatlichen Ordnung, deren Gegenteil die erlebte Realität des Bürgerkriegs ist. Wenn aber die Argumentation der Königsgegner, die bestrittene Legitimität, in den Worten Parabatas, des Feindes der rettenden Ordnung, wiederkehrt, so erweisen sie darin sich als die Gegner der wiederzugewinnenden Stabilität und als die eigentlichen kriegsfördernden Mächte. Im Stück des Thuanus kündigt sich, vermittelt über die Gestaltung der aus der Wirrnis des Bürgerkriegs leitenden Kraft, des rex novus, der unter Heinrich IV. sich konstituierende Absolutismus an. Gesetz und Ordnung, die Kräfte des Guten, werden mit dem starken zentralisierten Königtum synonym, demgegenüber die Mächte der Auflösung und Gesetzlosigkeit aus der historischen Erfahrung des Bürgerkriegs deutlich den Stempel des Bösen tragen. — Nicht allein, daß in ihm die Rebellion ihr Urbild hat, läßt Lucifer zum adäquaten Ausdruck der dissoziierenden Mächte werden, sondern es ist zumal die mythische Motivation zum Aufruhr, in der die historische sich wiedererkennt. Die Sünde Lucifere ist superbia, die Hoffart als die Todsünde, die nach den Worten des Aegidius Albertinus als „ . . . ein Königin und Wurtzel aller Sünden vnd Lastern . . g i l t 4 3 . Jede Darstellung der Zeit nimmt, fußend auf Jesaja 14,12—14, superbia zum Ausgangspunkt ihrer Interpretation des Engelsturzes, so wenn es, noch ganz aus scholastischem Geist, 1616 bei Albertinus heißt: Besagter Lucifer, war der allerfürnembste Engel, vnd weil er vermerdcte, daß er vberauß schön vnd mit Gnaden erfült war, so vbemam er sich dessen, stoltzierte vnnd sprach: Idi wil hinauff vber die Wolcken steigen, vnnd dem Allerhöchsten gleich seyn. Er verursachte audi dardurch, daß jhm ein großer theil der Engeln beyfiel, die fingen an, inn jhnen selbst zu stoltzieren, jhre Hertzen zuerheben, vnnd die gleidiheit GOTTES zu praetendiren oder zubegeren, vnnd vermeinten, daß sie durch sich selbst selig seyn köndten, vnd GOttes des HErrn nicht bedörfften.44
In diesem kurzen Text ließen sich ohne Mühe nahezu alle der von Albertinus genannten Tochtersünden der superbia nachweisen, von denen er „ . . . die eitle Ehr, den Ehrgeitz, den Vbermut, die Vermessenheit, den Vngehorsam, die Vneinigkeit, Vndanckbarkeit, Gottlosigkeit, Tiranney, Fürwitz, Unwissenheit . . n e n n t A l b e r t i n u s selbst verweist denn auch immer wieder in seinem 43
Aegidius Albertinus: Lucifere Königreich und Seelengejaidt. Hrsg. von Rodius Freiherr von Liliencron. — Berlin/Stuttgart o. J. ( = DNL 26) p. 30. 44 Albertinus, a. a. O., p. 7 f. Wie sehr diese Darstellungen aufgrund der engen Bindung an das Jesaja-Zitat sich topischer Formulierung nähern, erhellt, wenn man zum Vergleich einen Text aus dem Jahre 1493 heranzieht: „Under den was einer gar edel vnd köstlich über die andern der sich daïï seiner zierd vnd kóstlicheit uberhub vnd meint er wôlt got geleich sein, vñ sprach also die wort die vns schreibt Ysayas in dem. xiiij. capitel. Idi wird aufsteigen über die hohe der wolcken vñ wird geleich dem obersten. Vnd was aliso sein will vnd meinung das ym die andern engel solten vndertenig vü gehorsam sein vnd ym ere er pieten die allein gott zu gehört. Aliso warent vil engel die ym solidier eren gunden vnd ym al so seiner hoffart veruolgtë. doch einer mer dañ der ander." — Lucifere mit seiner gesellsdiafft val. Vnd wie derselben geist einer sidi zu einem Ritter verdingt und ym wol dienete. Bamberg 1493. Nach dem Unicum im Germanischen National-Museum zu Nürnberg in Facsimile hrsg. — Frankfurt a. M. 1895. « Albertinus, a. a. O., p. 30.
Parabata vinctus, sive Triumphus Christi, tragoedia
31
ersten „Gejaidt", in dem die Hofïart in Rede steht, auf das Beispiel Ludfers, der sich des Orts, den Gott ihm bestimmte, überhob. — Auch der „Parabata vinctus" schert in diesem Punkt aus der Tradition nicht aus; stets von neuem wird von den Boten Gottes der Vorwurf der superbia an Lucifer herangetragen, so vom Chor ( „inflatus tumida corda superbia" — 8v) oder von Hiob („te superbiae hactenus flatu" — llv). Möchte es nach dem bisher Gesagten scheinen, als klage mit dem Nachweis der superbia die gestörte Hierarchie nur ihr Redit wieder ein, so erschöpft sich doch die Anklage darin noch nicht. Denn hinter der superbia findet sich ein Weiteres, keine Tochtersünde, sondern eher der Grund von superbia, die allerdings bei Thuanus ihren Inhalt ganz aus der gefährdeten Ordnung gewinnt. Superbia zur Seite tritt die zweite Todsünde, die Lucifer traditionell zugeschrieben wird: livor, der Neid, in der Situation des Aufstands im Himmel eng mit der Hofïart verknüpft und zumal bei der Verführung des Menschen wieder wirksam. So überrascht es nicht weiter, wenn Michael die Fesselung so begründet: . . . sed tibi ex superbia, Si quaeris, & liuore fructus hic redit: (3v)
und wenn Gabriel von Parabata spricht als dem, Liuore qui sublatus & superbia Excidit ab astris . . . (29v)
Allein im Verein mit superbia also tritt livor bei Thuanus auf, nur Neid, ohne Hoffart, wird Parabata an keiner Stelle des Stückes zur Last gelegt. Um so gewichtiger aber, wenn an prominentester Stelle im Stück, im abschließenden Eingeständnis seiner Schuld, Parabata diese Verbindung beider Todsünden in seiner Formulierung durchbricht und eine andere Wendung wählt. Dort heißt es nämlich: Haec tabificus meruit liuor Ventoq. tumens caecus amor sui, Atq. lupati lingua impatiens. (33v)
Was es mit der „lingua impatiens" auf sich hat, bleibt später zu besprechen; hier soll auf anderes hingewiesen sein. Es fällt zweierlei auf: Zum einen, daß, wie angekündigt, livor ohne superbia erscheint, zum zweiten, daß hier, im Augenblick höchster Wahrhaftigkeit für Parabata, seine Kardinalsünde superbia in das Geständnis überhaupt nicht aufgenommen ist, wie doch füglich zu erwarten wäre. An die Stelle von superbia ist amor sui gerückt, und zwar mit deutlichem Anklang an superbia. Denn das vorangestellte „vento tumens" will viel besser zur Hoffart passen als zur Eigenliebe, was sich auch bei einem Blick auf Parallelstellen bestätigt: „Flatu turgidus ille superbo" (7v) formuliert der Chor und wenig später „inflatus tumida corda superbia" (8v), am deutlichsten aber wohl in den Worten Hiobs „te superbiae hactenus flatu tumentem" (llv), in denen das „vento tumens" des Schlußgeständnisses nahezu wörtlich vorweggenommen ist. Daß amor sui aber in der Verbindung mit livor die Stelle von superbia einnehmen und deren Epitheton übernehmen kann, beweist den engen Zusammenhang, in dem beide Begriffe in diesem Text zu
32
Jacques Auguste de Thou
sehen sind. Es handelt sich dabei keineswegs um eine Identität oder Gleichwertigkeit, sondern in der Tatsache, daß in einer Situation höchster Konzentration und Dringlichkeit Parabata eben nicht superbia als den Ausdruck seiner höchsten Schuld wählt, beweist amor sui sich als der fundamentalere Begriff von beiden. Hinter der Hoffart wird die Eigenliebe sichtbar, von ihr, als dem Movens von superbia, ist die geordnete Objektivität wesentlich bedroht. So daß Moses Parabata mit Recht vorhält, aus Eigenliebe, „amore deceptus tui" (17r), habe er sich aufgelehnt und den Himmel verwirkt. Am deutlichsten aber ist wohl der Zusammenhang amor sui — superbia in den Worten des Chors herausgestellt: Longe peßimus ast ille, sui Quisquís caeco captus amore Alios prae se despicit omneis, Nec prudens sibi consulit ipsi. Flatu turgidus ille superbo Mox euanidus ibit in auras, Subitaq. ruens trahet ingentem Secum infelix mole ruinam. (7v)
Die höchste Steigerungsform des Bösen ( „longe pessimus" ) findet in dem sich realisiert, der, von Eigenliebe ergriffen, allen anderen mit Verachtung begegnet. Eigenliebe erscheint als der dissoziierende Affekt schlechthin, der Rückzug auf das Selbst bereitet den Verfall der umfassenden Ordnung vor. In superbia, in der amor sui gleichsam nach außen, aus sich heraus tritt, wird das destruktive Element der Eigenliebe dann unmittelbar wirksam; erneut klingt, mit Aufstieg und Sturz, das Jesaja-Zitat an. Eigenliebe also, die Hypertrophie des Subjektiven, findet sich an der Wurzel von Aufruhr und Bürgerkrieg; sie wird als superbia Praxis und als Praxis in Rechtsbruch und Zerstörung von Hierarchie und staatlicher Ordnung konkret. Blind ( „caecus" ) ist der Egoismus, weil er nicht über das subjektive Eigeninteresse hinaussieht; die nach den Worten des Albertinus „inn jhnen selbst . . . stoltzieren", vergessen die Notwendigkeit des Ganzen, das auch sie selbst trägt. Vom ungeheuren Verderben („ingentem . . . ruinam") fällt der Blick zurück auf dessen Keimzelle, den Egoismus, in dem das in seinen subjektiven Interessen sich absolut setzende Subjekt sich isoliert und sich seiner Verpflichtung fürs Ganze entzieht. Max Horkheimer hat darauf hingewiesen, die — wenn audi oft verdeckte — Basis der „Anthropologie des bürgerlichen Zeitalters" bilde, von Machiavelli, ja von Cola di Rienzo an, „die Verdammung des Egoismus, ja, des Genusses überhaupt." 4 6 Sie finde ihre doppelte Ursache in der um des Zusammenhalts des Ganzen willen notwendigen Eindämmung des Konkurrenzprinzips und in der Unterdrückung der materiellen Interessen der Armen. „Die Schlechtigkeit des Egoismus liegt nicht an ihm selbst, sondern an der geschichtlichen Situation . . . " 47 So gewinnt auch bei
47
Max Horkheimer: Egoismus und Freiheitsbewegung. Zur Anthropologie des bürgerlichen Zeitalters. (1936). — In: Kritische Theorie. Eine Dokumentation. Hrsg. von Alfred Schmidt. Bd. 2. — Frankfurt 1968. p. 4. Horkheimer, a. a. O., p. 79.
Parabata vinctus, sive Triumphus Christi, tragoedia
33
Thuanus die Verurteilung des Egoismus, deren Kontinuität in seinem Text erneut zutage tritt, ihren besonderen geschichtlichen Akzent: Die geschichtliche Situation ist die der inneren Zerrissenheit Frankreichs im Bürgerkrieg, im Eigeninteresse des einzelnen findet Thuanus den Schlüssel zu dessen Verständnis. Für die ideologische Strategie, die Horkheimer in der Diskreditierung des Egoismus nachwies, wäre sein Text nur sehr vermittelt ein Beleg, nämlich indem Unsicherheit und Unruhe des Bürgerkriegs als dem bürgerlichen Erwerbsinteresse hinderlich bestimmt sind (hierauf und auf das Verhältnis Bürgertum — Absolutismus wird im Vondel-Kapitel noch näher einzugehen sein). Thuanus hat sicherlich nicht das Bürgertum im Sinn, wenn er die Notwendigkeit der staatlichen Ordnung herausstellt (was nicht hindert, daß dies dennoch auf bürgerlichen Beifall stößt), sondern er denkt als Politiker auf der Seite des Königtums, der die Ordnung des Ganzen durch absolut gesetztes partikulares Interesse gefährdet sieht. Im Egoismus, dem abschließend an hervorragender Stelle eingestandenen amor sui Lucifers, findet das Böse angesichts des Bürgerkriegs seinen historisch treffendsten Ausdruck. — Zur Illustration des bisher Gesagten sei ein kurzer Passus aus der Autobiographie des Thuanus zitiert. Im Jahre 1582 trifft er auf einer Reise einen früheren Bekannten, einen gewissen Colas, den er seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat; er muß, obgleich ihm der Mann unangenehm ist, mit ihm zu Abend essen. Im Anschluß daran heißt es: Erat homo dicendi potens ac fiduciae plenus & ad audendum promptus, & iam tum supra conditionem res meditari videbatur. Alioqui & coenae & hominis facile praeterita fuisset mentio, nisi is esset, qui per bella, quae paullo post secuta sunt, se magnis rebus si non parem omnino praebuit, at potenter immiscuit, & Meduanio, cuius fauore subleuatus fuerat postremo formidabilis esse cepit, sicuti in Historiarum libris plenius memoratur.«
In Colas, der historischen Gestalt aus dem Bürgerkrieg, scheint die Bürgerkriegsgestalt Parabatas wieder auf. Thuanus, der nur selten in seiner Autobiographie auf Personen eingeht, die nicht dem Kreis der in Wissenschaft und Politik wirklich Bedeutsamen angehören, hätte seiner nicht erwähnt, wenn an ihm nicht Exemplarisches aufginge. Colas ist Paradigma der superbia, sein Charakter wird von de Thou deutlich aus den Erfahrungen des Bürgerkriegs, in dem er sich extrem verwirklichte, beurteilt. Im „supra conditionem" liegt der Schlüssel zu dieser Persönlichkeit. Colas will sich über seinen Stand erheben und setzt dabei alles ein, was ihm gegeben ist: seine Beredsamkeit, seinen Mut, sein Selbstvertrauen. Thuanus zeigt nun, daß superbia kein Ziel noch Ende kennt: Ist die erste Stufe erklommen, so lockt die nächste und wird mit gleicher Rücksichtslosigkeit erklommen, wie denn auch Colas den Duc de Mayenne, dem er seinen Aufstieg verdankte („cuius favore sublevatus fuerat"), späterhin selbst angriff (gerade hier zeigt sich deutlich die Parallele zum Lucifermythos). Solchergestalt aber findet superbia im Bürgerkrieg nicht nur ihre größten Möglichkeiten, sondern sie ist selbst schon in ihrem Wirksamwerden Ausdruck 48
Thuanus, Vita, a. a. O., p. 1341f.
34
Jacques Auguste de Thou
innerer Auflösung, zerstörter Ordnung. An dem Beispiel des Colas ist abzulesen — dem diente dieser kurze Einschub — , daß die Gestalt Parabatas keineswegs ein analytisches Kondensat auf intellektuellem Wege erschlossener möglicher Begründungen für die innere Zerrissenheit des Landes ist, sondern daß ihr durchaus reale Vorbilder vorangehen, erlebt und erfahren von einem Autor, der, weil er, nach Seybolds Worten, „alles auf Geschichte" bezog 49 , mehr in ihnen sah als allein individuelle Psychologie. — Der Teufel, so wurde oben gesagt, sei nach dem Engelsturz, was sein Verhältnis zu Gott betrifft, eine statische und gänzlich untragische Gestalt. Als Problem tauchte auf, weshalb Thuanus gerade dieses Verhältnis in seinem Stüde trotzdem zentral thematisiere, seinen Gegenstand also in einem Konflikt findet, der schon ans Ende gekommen ist. Nach dem bisher Gesagten läßt sich hierauf leichter die Antwort geben. Thuanus nämlich macht sich diese Eigenart seines Sujets zunutze und läßt sie gestalterisch produktiv werden. Alles Bisherige, Gesetzesbruch und Zerstörung der Hierarchie, superbia und amor sui, hätte weit besser sich zeigen lassen in einem Stück, dessen Gegenstand das bellum angelicum gewesen wäre; so aber muß dies alles erst in der Rückblende über Bericht und Anschuldigung eingeholt werden. Ganz anders aber steht es mit dem bösen Zug des Teufels, der bisher noch nicht genannt ist und der auch erst über das hier genannte gestalterische Problem, das für das Thuanus-Stück konstitutiv wird, sich vermittelt. Ein wesentlicher Punkt nämlich wäre verfehlt, wollte man die Statik des Stückes, sein Auf-der-Stelle-Treten, für einen Ausdruck dichterischer Unzulänglichkeit oder verfehlter Stoffwahl nehmen. Denn eben darin, daß jeder Bote Gottes mit genau dem Auftrag wieder neu ansetzen muß, den auch sein Vorgänger schon vortrug, und daß Parabata nicht im geringsten Detail die einmal bezogene Position verläßt, verrät als zentraler Zug des Bösen sich der Dogmatismus. Die Statik des Stüdes entspricht der Statik des dogmatischen Bewußtseins seiner Titelfigur. Die Worte des Mitleids, mit denen Engel und Propheten dem gefesselten Teufel begegnen, der wiederholte Hinweis auf die durchaus wahrscheinliche Gnade Gottes, sollte Parabata Einsicht zeigen und seine Schuld gestehen, der ständige Appell, die Ausweglosigkeit der Situation sich einzugestehen, dies alles wird, als ohne Tradition und in der Lehrmeinung nicht abgesichert, verständlich erst vor der Aktualität des Charakters, an dem es sich erprobt. Im gefesselten Parabata bietet sich das Bild einer Gestalt, die weniger unfähig als unwillig ist zu lernen und eben darin sich dogmatisch verhält. Nur ein Beispiel sei hier zitiert für die Argumentation, mit der die Boten des Himmels einen Sinneswandel bei Parabata zu erreichen suchen. In den Worten des Chors, gesprochen nach dem Auftritt Hiobs, sind die wesentlichen Argumente versammelt: Quid ejulatu confiéis te inutili, Iramq. diris prouocas verbis Dei? Moderare linguae, proque iurgijs preces Humileisq misce corde non ficto sonos.
« Seybold, a. a. O., p. 10.
Parabata vinctus, sive Triumpbus Christi, tragoedia
35
Audi, et vicißim loquere moderata; hex: senex Te monuit iste, ratio & ipsa praecipit. Fatere crimen; ira mox desaeuiet, Crimenq. fasso mitis ignoscet Deus. (14v)
Es ist die Aufforderung zu modestas und humilitas angesichts eines milden Gottes. Parabatas Antwort lautet, auch hier exemplarisch für viele andere Belege: Spes nulla veniae: deinde quid venia petam, Iniurioso aut sperem ab aduersario, Qui semper in me iniquus hactenus fuit? (14v)
Hier aber setzt sich durch, was wir oben über den unterschiedlichen Gottesbegriff in der griechischen Mythologie und im Christentum notierten. Parabata, dem viele Worte des aischyleischen Prometheus in den Mund gelegt sind, spricht nicht vom Gott des Christentums, sondern von einem rächenden Zeus. Er orientiert sich an der Psychologie eines Tyrannen-Gottes, und deshalb erreichen ihn die Mahnungen der Himmelsboten, die auch das eigene Leid als im Heilsgeschehen vermittelt erkennen, nicht. Hinzu kommt, daß er — mit Ausnahme des Johannes, der aber auch noch vor Christus wirkte — mit Gestalten des Alten Testamentes spricht; in deren Berichten tritt nun freilich noch manches vom zürnenden Jahwe zutage. Parabata nimmt so ein Heilsgeschehen überhaupt nicht wahr, er sieht nur Rache aus unversöhnlicher Gegnerschaft; deshalb auch kann er Sätze aus dem „Gefesselten Prometheus" sprechen. Hier aber kommt es zum entscheidenden Unterschied: Was bei Prometheus lebendige Auseinandersetzung mit einem despotischen Gott ist, gefriert notwendig zu starrem Dogmatismus, wenn auf der anderen Seite der liebende Gott des Christentums steht. Die metaphysische Revolte verfällt angesichts eines gütigen Gottes zu „pervicacia" (30v), Halsstarrigkeit, so wie sie Gabriel an Parabata beklagt, und wie in der Struktur des Stückes sie entschieden sich abbildet. Die besondere Qualität der Gegnerschaft Parabatas gewinnt sich eben daraus, daß der räumlichen Fixierung, der allegatio, eine geistige durchaus nicht entspricht; ihm winken Gratifikationen in Gestalt von Straferleichterungen bis zur möglichen endlichen Loslösung. Parabata selbst aber nimmt gleichsam eine allegatio mentis vor; er setzt seine Haltung absolut und postuliert ihre Gültigkeit, wie die Vision vom Antichrist belegt, für alle Zukunft. Er beraubt sich dadurch jeglicher Entscheidungsmöglichkeit und kann so zum Paradigma situationsinadäquaten Verhaltens werden. Dies alles macht den gefesselten Parabata zum Modellfall des Dogmatikers, an dessen einmal gefaßte Überzeugung Erfahrung wie Vernunft nicht mehr zu rühren vermögen. So bleibt selbst der Appell des Chors an die ratio (14v) des Teufels erfolglos, ja gerade er wird an späterer Stelle von Parabata ausdrücklich zurückgewiesen: Non ratio, non aperta vis, non caeca fraus Mutare mentis vlla consilium queat. (30v)
Es ist diese Haltung, die der Schluß, der vom Psychologischen her so unvermittelt erscheint, diskreditieren will. Denn zum Schluß herrscht, nachdem ratio erfolglos blieb, die offene Gewalt („aperta vis"). Aufgekündigte Rationalität,
36
Jacques Auguste de Tbou
wie sie in Parabata sich gestaltet, hat Zerstörung im Gefolge, Destruktion anstelle des Konstruktiven der ratio. Deren Bild ist das Chaos: Haut iam verbo, nunc re vera humus Conuulsa tremit. Longe reboans astrepit Edio Igne rotato; flammei & apices Ruptos glomerant per inane globos. Stant puluereo turbine campi, Atq. furentes vndiq. venti Fronte opposita compositi gemunt. Iam siderib. miscetur fretum; Terra dehiscens iam nuda patet; Panditur alti gurgitis horror. Video accensos astrorum orbeis Crebraq. polum luce micantem: Totum labi cerno sub ima Tartara caelum. (33r-v) Erst als die Gespräche erfolglos blieben, so machen Parabatas Worte deutlich, tritt die Zerstörung auf. Im „haut iam verbo, nunc re vera" erscheint als versäumte Möglichkeit die des rationalen Diskurses, der das Unheil hätte verhindern können. Von der Schlußszene her erfolgt der Widerruf, nicht allein im Sinne eines Schuldbekenntnisses, sondern als die Ächtung der Geisteshaltung, die allein Schuld an der Katastrophe trägt: die Engstirnigkeit des dogmatischen Verhaltens, das die Möglichkeiten des Gesprächs bewußt verschmäht. Die Haltung des Himmels, seine Milde, Mitleid und Gnade, ist nicht Starrheit, sondern Flexibilität; das Herabsteigen der Boten ist sichtbares Entgegenkommen, Beweis für die Möglichkeit von Versöhnung, die durchaus nicht in der Ferne des Utopischen bleibt. Dagegen die Haltung Parabatas ist, nach einem Wort Hegels in der „Ästhetik" über die bösen Charaktere, „sich in sich verhausende Subjektivität" 5 0 , die nur noch, wie das Ende zeigt, gewaltsam aufzubrechen ist. Parabata macht im ganzen Stück kein Zugeständnis; wird er in die Enge getrieben, so wechselt er, rhetorisch versiert, eilends das Thema. Gespräch, im Sinne eines Austausche von Argumenten, findet in den Dialogen des „Parabata vinctus" nur dann statt, wenn der Teufel die Auseinandersetzung vom eigenen Fall auf die Geschicke seiner Besucher zu lenken vermochte. An ihm selbst aber gleitet jedes Argument ab. Die Macht des Wortes hat am Teufel ihr Ende; den Chor dagegen läßt der Humanist Thuanus sagen: Verba vel alto errantia caelo Sistere sidera, verba potentem Noctis possunt ducere Lunam. Verba medentur morbis corporis . . .
(18r)
Noch lange zieht sich so der Hymnus des Chors auf die Macht des Wortes hin; im Heilenden, Lindernden, Versöhnenden findet er ihre Wirkung. Parabata aber kennt nur das Sprechen gegeneinander, nicht miteinander, anstelle von so Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke 14. Vorlesungen über die Ästhetik II. — Frankfurt 1970. p. 105.
Parabata vinetus, sive Triumphus Christi, tragoedia
37
Austausch und Ausgleich nur Vertiefung der Gegensätze. In der Verweigerung des Gesprächs verrät als genuiner Bestandteil des Bösen sich dessen Fraglosigkeit, als die eines Beharrens auf dem einmal bezogenen, absolut gesetzten Standpunkt. Im Rückzug aus dem Diskurs manifestiert sich die Exklusivität des Bösen, die Hypertrophie des Subjektiven, das sich von anderen nichts mehr sagen läßt. Dies begründet seinen Dogmatismus, der bei Thuanus gestalterisch als Statik des Stückes wiederkehrt. Dem Dogmatischen trägt der Chor darum seinen Rat entgegen: Te quoq. par est, quicunq. sapis, De constanti mente remittere Aliquid, cum res postulat & sors, Et cedenti cedere tempori. (8r)
Der Chor formuliert als Programm den Kompromiß, als in der Sache und aus der Zeit begründet. Nicht Selbstaufgabe oder Ergebung ist gefordert, sondern Einlenken und Zugeständnis, wie die Sache und der Wandel der Zeiten es nötig machen. Solchen Kompromiß zu erzielen, dem dient die Bewegung der Himmelsboten auf Parabata zu; das Stück zeigt, wie der Dogmatismus den Kompromiß verhindert und erst daraus die Anwendung von Gewalt folgt. Die Flammen, in denen Parabata am Ende versinkt, beleuchten das vorangegangene Geschehen: In ihrem Licht erscheint das „de constanti mente remittere aliquid" als der einzige Weg, auf dem Gewaltanwendung sich hätte verhindern lassen. Es ist evident, daß hier sich nicht abstrakt eine Lehre vermittelt, ohne Bezug auf die Erfahrungen von Autor und zeitgenössischem Leser. In den Glaubenskämpfen geschrieben, aus ihrem Erlebnis rezipiert, bot die Schlußszene des „Parabata vinetus" ein Bild für die Zerstörung, von der Frankreich so sehr getroffen war. Die wirbelnden Flammen, die Stürme, die aus verschiedenen Richtungen wehend aufeinandertreffen, die Schrecken des Abgrunds, all dies sind auch Metaphern des Krieges; vor dessen Sdirecken, so lehrt die Schlußszene, wird jeglicher Dogmatismus, jedes Festhalten an einmal absolut gesetzten Überzeugungen, unhaltbar. Angesichts der Greuel des Krieges ergeht der Appell an die Parteien, sich aus ihrer argumentativen Unbeweglichkeit zu befreien, Abstriche zu machen an den Dogmen, aus der Konfrontation zurückzufinden zur Versöhnung im Gespräch. Hier schreibt der Diplomat de Thou, der ständig zwischen den Parteien zu vermitteln sich bemühte, ja in seiner eigenen Gestalt, als Katholik im Dienste des Hugenottenkönigs, die reale Möglichkeit von Versöhnung verkörperte. Ihm geht es nicht ums theologische Detail; und wenn er Hiob betonen läßt, daß audi auf der Basis eines natürlichen Gottesverhältnisses vorbildliche Gottesverehrung möglich sei 51 , so ist das zugleich die entschiedenste Aufforderung zu religiöser Duldsamkeit. Thuanus beschäftigt sich 51 Atqui Parabata praeter Isacidas item Alios fuisse haut ambigendum plurimos, Qui ne quidem proselyti, sed aduenae, Sed exteriq., lege naturae Deum Deiq. cultum mente compie» pia Vixere multa laude commendabiles . . . (12r)
38
Jacques Auguste de Tbou
nicht mit Fragen der Lehrmeinung, ihm geht es um das Wohl des Staates. Das fanatische Beharren aber auf bestimmten Lehren der Religion, die Dogmatisierung eines häufig nur Sekundären, führt zum Untergang des Gemeinwesens, in dem mehrere Glaubensrichtungen konkurrieren, denn dann liegt der Akzent auf dem Trennenden, nicht auf dem Gemeinsamen. Oft finden in der „Vita" sich Klagen wie die folgende, das Jahr 1587 betreffend: Hie bellorum ciuilium, quae male feritati homines hodie religionis zelo scilicet infiammati tantopere exoptant, fructus, haec merces, haec pietatis quae per caedeis & incendia grassatur, reposita interris remuneratio. 52
Die Angriffe auf Religionseifer und übertriebene Frömmigkeit fielen freilich nicht so scharf aus, wenn nicht deren ideologische und politische Funktion so klar erkannt wäre. Thuanus kritisiert den religiösen Fanatismus nicht zuletzt deshalb, weil er sich in seiner Blindheit dem partikularen politischen Interesse dienstbar macht. Dies stellte schon die Vorrede heraus und forderte dazu auf, hinter dem religiösen Argument den Eigennutz zu entdecken. Nicht Toleranz also, wie es Seybold zu Ende des 18. Jhs scheinen mußte, ist charakteristisch für Thuanus' Werke, sondern Skepsis, der die Toleranz sich erst verdankt. Skepsis ist hier durchaus als philosophische Grundhaltung gemeint, so wie sie in dieser Zeit am prägnantesten sich in den Schriften Montaignes formulierte. Der Hinweis auf Montaigne dient nicht dem historischen Kolorit: Thuanus hatte ihn bereits 1582 kennengelernt und lobte ihn als einen Mann, der sich aus allem Ränkespiel und Parteienstreit heraushielt 53 . Aus dem Jahre 1588 berichtet uns de Thou ein für beider Skepsis bezeichnendes Gespräch mit dem ihm nun eng befreundeten Montaigne ( qui artum cum Thuano exercebat amicitiae officium . . 5 4 ) . Montaigne deutete dabei die Rolle der Religion im Konflikt zwischen dem Duc de Guise und dem König von Navarra so: Der Hugenotte Heinrich kehre nicht zum Katholizismus zurück, weil er dann von den Protestanten verlassen würde, und der katholische Guise könne nur deshalb der von ihm favorisierten Augsburgischen Konfession sich nicht anschließen, weil ihn das mit seinem Lager entzweien müßte. Die Religion gehört also zum Instrumentarium der Macht. Dies hat de Thou auch keineswegs mißbilligt; der spätere Übertritt Heinrichs IV. zum Katholizismus hat, ganz aus dem Geiste der Staatsräson, durchaus seinen Beifall gefunden. Nur fällt eben gerade bei der prononcierten Unterordnung der Religion unter die Interessen des Staates der Dogmatismus im religiösen Detail besonders lästig; Religion, die der Einheit dienen soll, wird im Glaubensstreit umfassend gefährlich. Von daher ist also auch erst die Toleranz zu verstehen: Der Konflikt wird dann nicht scharf, wenn im Glaubensdetail nicht reglementiert wird. Die Gewissensfreiheit also ist Voraussetzung des Friedens, beizubehalten aber ist allemal die Gottesfurcht. Der Fanatismus etwa eines Calvin stand daher de Thou ganz fern; wenn er sich nirgends in die theologischen Auseinandersetzungen einmischt, so spiegelt das 52 Thuanus, Vita, a. a. O., p. 1370. 53 Thuanus, Vita, a. a. O., p. 1320. 5+ Thuanus, Vita, a. a. O., p. 1376.
Parabala vinctus, sive Triumphus Christi,
tragoedia
39
nur die Überzeugung des Skeptikers, daß es kein festes Wissen, sondern nur Glauben auf diesem Gebiet geben kann. Die gerühmte Unparteilichkeit seiner „Historia" also gründet in der philosophischen Skepsis, nicht in einem Toleranzdenken, wie es das 18. Jh. verstand. Mit der Skepsis des 16. Jhs, zumal der Montaignes, verbinden Thuanus aber noch andere der hier festgestellten Ansichten. Auch die programmatische Diplomaten- und Vermittlertätigkeit kann erst aus diesem distanzierten Verhältnis zu den menschlichen Ideen und Einsichten erwachsen; Montaigne, wie de Thou zeitlebens königstreuer Katholik, war gleich ihm nie bei den Kämpfern, stets aber bei den Verhandelnden zu finden. Zu Montaignes pädagogischem Programm gehört der loyale Bürger; aus dem Erlebnis beständiger staatlicher Unordnung tritt er in den „Essais" für ein starkes Königtum und ein allseits geordnetes Leben ein. „Die mit relativer Freiheit verbundene, fest gegründete Ordnung, die zu den Voraussetzungen bürgerlichen Verkehrs gehört, ist den Repräsentanten skeptischen Geistes zum maßgebenden persönlichen Bedürfnis geworden." 55 Relative Freiheit in den Hierarchien gesellschaftlicher Existenz wie auch das Plädoyer fürs Königtum sind gestalterisch im „Parabata vinctus" zum Ausdruck gekommen, mit dem Gesetzesbruch und der Absolutheitsforderung in Freiheit, Macht und Glaube als seinem bösen Widerpart. Wie schon Pax am Anfang schwieg, so steht wiederum Gewalt am Ende; den Bogen zwischen beiden spannt das Böse in der Engstirnigkeit seines Dogmatismus. Wenn also als erste Gemeinsamkeit zwischen Lucifer und Prometheus aus dem Prologus die Vergeblichkeit von Hoffnung auf Gnade zur Frage stand, so läßt sich jetzt antworten: Wenn Prometheus auf Gnade nicht hoffen darf, so deshalb, weil er sich in seinem Recht einem ungerechten Gott nicht ergibt, während Parabata dogmatisch auf seinem Unrecht (als der Selbstüberhebung, gegen die Gesetze des Ganzen) gegen einen gerechten Gott (als der notwendigen Ordnung des Überindividuellen) beharrt. Konnte Prometheus Gefährten im extremen Leid finden (den Chor), so muß notwendig Parabata zum Schluß allein stehen (der Chor verläßt ihn): Die Hypertrophie des Subjektiven duldet auch im Leid Gefährten nicht. — Prometheus leidet seine Strafe, weil er sich auf die Seite der Menschen stellte; ihnen brachte er das Feuer, mit ihm die artes. „Sterblichen / Erwirkt' ich Gaben, dafür trag ich solches Joch." „Den Menschen helfend lud ich mir die Mühsal auf." Und an zentraler Stelle: Aber von der Menschen Not Laßt mich erzählen, wie die vorher Törichten Gedankenvoll idi machte, mäditig der Vernunft. 56
Der Prometheus des Aischylos berichtet nüchtern, darum um so eindrucksvoller, den ungeheuerlichen Vorgang, daß ein Gott, weil er sich zum Anwalt der Menschen in ihrer Not machte, an ihrer Stelle leidet. Er argumentiert vom Menschen aus, dessen Leid und Unwissenheit den Verstoß gegen Zeus' Gebot 55 Max Horkheimer: Montaigne und die Funktion der Skepsis. (1938). — In: Horkheimer, a. a. O., p. 208. 56 Aischylos, a. a. O., Verse 107f., 267, 442ff.
Jacques Auguste de Thou
40
ausreichend begründen. Es bedarf daher keiner zusätzlichen Emphase mehr, gar eines pathetischen Herausstreichens der eigenen Uneigennützigkeit: Die Wirklichkeit des menschlichen Elends legitimiert allemal die Tat dessen, der „Freund den Sterblichen . . . zu sehr" (Vers 123) war. — Thuanus stand demnach bei der „imitatio" des „Gefesselten Prometheus" vor der Schwierigkeit, daß der Teufel — von dem doch alles Leid des Menschen sich herschreibt —, wenn er die Worte des Prometheus unverändert übernimmt, für sich beanspruchen kann, im Dienste des Menschen und zu seinem Nutzen gehandelt zu haben. Er kann das Problem nicht dadurch lösen, daß er die entsprechenden Passagen in seiner Bearbeitung kurzerhand wegfallen läßt; gerade in der Vermittlung von artes und scientia war ja vom Prologus eine wesentliche Affinität beider Mythen behauptet worden. Thuanus gelangt auf dem einfachsten Wege aus seinem Problem: Was bei Aischylos anerkannte Wirklichkeit war (niemals wird bestritten, daß Prometheus sich um den Menschen verdient gemacht hat), gewinnt bei ihm den Status einer unausgewiesenen Behauptung; wenn in scientia und artes Prometheus also tatsächlich den Menschen das Licht brachte, so läßt auch Thuanus den Parabata zum Quell von scientia werden, bestreitet aber zugleich, daß diese dem Menschen förderlich oder gar das Gute gewesen sei. Scientia und artes sind in beiden Stücken vom Frevler dem Menschen vermittelt; es ändert sich entscheidend die Bewertung der Gabe: Was bei Aischylos zur Linderung der Not des Menschen einem ungerechten Gott geraubt wird, als notwendiges Remedium also Ausdruck eines Guten ist, wird bei Thuanus gegen den Willen eines guten Gottes dem Menschen im Paradies aufgedrängt, ist demnach hier Ausdruck eines Gegen- bzw. Nach-Paradiesischen und schon von daher negativ akzentuiert. Prometheus' Handeln entspringt der Verteidigung des Menschen, Parabata aber handelt auch hier aus seiner Gegnerschaft zu Gott. Prometheus wird deshalb keineswegs zum „Gegen-Gott", wie Kerényi zu Recht betont 57 , Parabata jedoch versucht, seine Botschaft der scientia deutlich der frohen Botschaft Christi als Alternative entgegenzustellen. Er verleiht daher der allegatio die Gestalt eines gegen-dhristlichen Martyriums, mit deutlichen Reminiszenzen an Christi Opfertod. Deshalb gibt Thuanus bei der Übertragung der oben zitierten Sätze, in denen Prometheus sein Leid als Strafe für dem Menschen erwiesenes Wohl betont, die folgende bezeichnende Wendung: amore me mortalium Captum atq. terrae saepe visentem íncolas . . . Amore gentis captus humanae incidi In has miserias . . . (7v) Amore nimio gentis humanae excidi Patrijs ab astris . . . (15v)
(5v)
Wenn Parabata, abweichend von Prometheus, immer wieder sein Handeln aus der Liebe zu den Menschen begründet, so vermittelt sich hierin der Versuch, dem eigenen Leid die Dignität eines Opfers zu verleihen, im deutlichen An57 Kerényi, a. a. Ο., p. 55.
Parabata vinetus, she Triumpbus Christi, tragoedia
41
klang an Christi Opfer am Kreuz aus Liebe zum Menschengeschlecht, dergestalt, daß auf gleichem Wege an die Stelle des heilsbringenden Wirkens Christi die Taten Parabatas treten sollen, und in seiner Gabe scientia das wirkliche Heil der Menschen trughaft glänzt. Noch in einem weiteren Punkt bezeugt sich der Versuch des Teufels, als einen Gegen-Christus sich zu präsentieren. Als ein wesentlicher Unterschied zwischen Prometheus und Lucifer hatte sich gezeigt, daß Prometheus in genauem Wissen um sein künftiges Unglück gehandelt habe, Lucifer aber seine Niederlage nicht habe vorhersehen können. Thuanus weicht hiervon ab und übernimmt modifiziert die Sätze des Prometheus, in denen er auf sein Vorwissen hinweist. Parabata also sagt: Quae patior ante mente praecepi omnia, Sciens volensq., nec nego, perij miser. (7r) Extrema dudum me paraui ad omnia. (29v)
Aischylos läßt, an der Parallelstelle zum ersten Zitat, seinen Prometheus nodi ergänzend sagen, daß er vorher nicht gewußt habe, wie groß sein Leid sein werde. Bei Thuanus fällt dies bezeichnenderweise fort, so daß Parabata in seinen Worten sich noch deutlicher als „Affe Christi" geben kann: Wie der Gottessohn hat er nicht allein den endlichen Opfergang vorhergesehen, sondern auch Art und Intensität des Leids. So erweisen sich diese beiden für die Lucifergestaltung auffälligen Ausnahmen, die Rechtfertigung aus amor gentis humanae und das Vorherwissen des Leids, als der Versuch, dem Wirken des Bösen nach dem Bilde Christi die Gestalt der Selbstopferung zum Guten des Menschen zu geben. Der Inhalt der Botschaft Parabatas ist aber keineswegs Nächstenliebe und Demut vor Gott, sondern scientia und artes, Ausdruck der Kraft des menschlichen Geistes und der Selbstermächtigung, also durchaus in Spannung zum Demutsdenken. Ist demnach scientia, im Zeitalter des Aufbruchs der Wissenschaften und des Übergangs vom qualitativen zum quantitativen Weltbild, erneut nach alter Weise als Gabe des Teufels verdammt? Es möchte anfänglich so scheinen, zumal weil Thuanus den langen Monolog (Verse 435—506) des Prometheus über die Wissenschaften, die er den Menschen brachte, dem Teufel nahezu wörtlich übertragen in den Mund legt (15v-16v). Blind und nichtsahnend sei der Mensch gewesen, bis Parabata ihm die Augen geöffnet habe. Seitdem kenne er Gut und Böse und sei zum Wissenden geworden. Häuserbau, Astronomie, Ackerbau, Schiffahrt, Medizin, den Gebrauch der Metalle, ja sogar die Gabe der Weissagung habe er, Parabata, dem Menschen gebracht. Hier stellt der Teufel sich als Lichtbringer vor: „luce caecis reddita" (15v), das Bibelwort „Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan . . . " (1. Mose 3.7) geschickt auf die traditionelle Metapher der Wahrheit, das Licht, beziehend58. Vor dem Sündenfall sei der Mensch, da ihm ja erst danach die Augen aufgingen, blind, soll heißen: unwissend gewesen, so stellt es Parabata dar; erst dann fiel Licht in sein Auge, wurde ihm also Wahrheit zugänglich. 58 Vgl. Hans Blumenberg: Licht als Metapher der Wahrheit. Im Vorfeld der philosophischen Begriffsbildung. — In: Studium Generale 10 (1957) pp. 432—447.
42
Jacques Auguste de Tbou At antea homini nil nisi per somnium Videre, nil audire permissum a Deo; Caecusq. in vmbra agebat ignorantiae. Huic nubem ab oculis, obijcemq. ab auribus Surdis remoui, sic vt a malo bonum Falsoq. verum nunc queat discernere. (16v)
Der ständige Hinweis auf die Blindheit des Menschen („caecis atq. rerum improuidis" — 15v) im Paradies im Sinne verhinderter Intellektualität ist jedoch schon deshalb unglaubwürdig, weil der, der ihn vorträgt, zuvor mit dem gleichen Vorwurf bedacht worden ist. Wenn verschiedentlich auf die blinde ( „caecus" ) Eigenliebe Parabatas hingewiesen wurde, so begegnet audi hier der Befund mangelnder Rationalität metaphorisch als Blindheit, so daß der vorgebliche Lehrer der Wahrheit selbst die Augen noch nidit aufgeschlagen und das Licht der Wahrheit aufgenommen hat. Weiteres kommt hinzu: Thuanus nimmt die Vorstellung des Mittelalters auf, daß sich die Wahrhaftigkeit und Güte Gottes als universale Leuchtkraft manifestiere (am entschiedensten wohl im „Paradiso" Dantes) 59 . Parabata wird, ganz anders als Prometheus, im Tartarus, also in größter Gottferne, gefesselt, bezeichnenderweise ein Ort tiefster Finsternis. Jeder der Boten des Himmels beklagt zu Beginn seiner Rede die Dunkelheit der Hölle, beim Abschied rühmt er das Licht, dem er sich nähert. So vermittelt schon die Charakteristik des Ortes, daß die Wahrheit in ihm nicht zu Hause ist; dies kommt aber auch darin zum Ausdruck, daß Thuanus erneut „caecus" als Epitheton wählt. Wenn also Justitia, Elias oder Johannes den Kerker des Teufels „caecus" nennen, so klingt neben der gemeinten Dunkelheit auch die primäre Wortbedeutung des Blindseins, damit in diesem Kontext die Wahrheitsferne an. Durch Ort und argumentativen Kontext ist somit Parabatas Anspruch, Wahrheitsbringer zu sein, schon hinlänglich diskreditiert. — Um trotzdem als Quelle von Wissen und Wahrheit gelten zu können, muß Parabata in seiner Argumentation zu Sophismen greifen. Er bezieht die biblische Metapher von den sich öffnenden Augen, die allein die Erkenntnis von Gut und Böse beschreibt, auf die gleichsam pragmatische Ebene einer rationalen Erkenntnis von Wahr und Falsch. Das Essen des Apfels also ist ihm die Initiation jeglicher Erkenntnis. Es fällt auf, daß in Moses' ausführlicher Entgegnung auf Parabatas Rede die Begriffe scientia und artes an keiner Stelle genannt sind, obgleich seine Argumentation einzig der Widerlegung von Lucifere Anspruch dient, er habe dem Menschen Gutes getan, als er ihm die Augen öffnete. Stattdessen wirft er ihm Verdrehungen vor, Frevel werde in Wohltat umgedeutet, die Trübung des Erkenntnisvermögens als Ursprung des menschlichen Wissens ausgegeben. Eine offenbare Lüge jedoch kann Moses dem Teufel nicht nachweisen. Es stimmt, daß ohne den Sündenfall der Mensdi ohne Wissenschaft geblieben wäre und daß er ihr viel Gutes verdankt; doch ist dies nur eine Seite der Wahrheit, alles andere aber wird verschwiegen. Moses kritisiert deshalb zuerst Parabatas Argumentationsweise, nicht den Inhalt seiner Argumente: 59 Vgl. Rosario Assunto: Die Theorie des Schönen im Mittelalter. — Köln 1963. p. 59ff.
Parabala vinetus, sive Triumphus Christi, tragoedia
43
Expertus in te id esse quam verissimum, Petulante lingua garrientem plurima Peccare plurima, siue linguae lubrico Rapiente mentes, siue quod loquacitas Fere cauillis & calumnijs scatet. (16v-17r)
Demnach begeht der eine große Sünde, der die Sprache mißbraudit und mit Frechheit, Spott und Entstellungen auf andere Einfluß zu gewinnen trachtet. So aber führt Thuanus uns den Teufel vor: als glänzenden Rhetoriker, dem die Himmelsboten in der Ehrlichkeit ihrer Absichten sprachlich nicht gewachsen sind. Ob er Hiobs Leid auf den Willen Gottes zurückführt oder am Beispiel Elias' die Grausamkeit Gottes nachweist, ob er sich von aller Schuld am Tode des Johannes freispricht oder gegen Moses mit dessen eigenen Bibelworten argumentiert, stets können sich die Propheten aus dem Netz von Halbwahrheiten und Fangschlüssen, das Parabata in kürzester Frist um sie gelegt hat, nur mit ausführlichen grundsätzlichen Erklärungen wieder befreien. Schon Hiob hatte ihn deshalb einen Wortkünstler genannt: Mirus cauillis dicta tu refellere, Et aueupari verba verbis artifex.
(lOr)
Und an späterer Stelle leitet er ironisch eine Replik mit der Charakteristik ein: Tu vero lepidus & venustus & elegans . . .
(12r)
Diese meisterlich gehandhabte Technik der Überredungskunst mit ihren Wahrheitsverkehrungen, Trugschlüssen und Scheinbeweisen trägt ihm zum Schluß von Gabriel den Titel eines Sophisten ( „illum sophistam" — 29v) ein, womit erneut die besondere Weise des teuflischen Sprechens betont ist: Zur offenen Widerrede gesellt sich die verborgene, das Gegeneinander verhüllend, um so Einverständnis zu erzwingen. Der Vorwurf des Sophistischen gilt einer um Moral unbekümmerten dienstbaren Rhetorik; im Munde des Teufels verrät sie sich als Kraft der Auflösung. Parabatas Sprechen, dort wo es für ihn zu gewinnen trachtet, hat seine Wirkung in der Zerstörung bestehender Gesetzlichkeit und Ordnung, so beim Aufruhr im Himmel (man denke an Michaels Bericht), so beim Sündenfall, und gleiches, nämlich Entzweiung mit Gott, haben auch seine Gespräche mit den Himmelsboten zum Ziel. Dem sprachlich Trügerischen, dem zutiefst Unwahren in Gestalt der Wahrheit, begegnet die unverstellte Argumentation der Propheten, die in ihrer Klarheit und Offenheit sich der deutlichen Sprache des Gesetzes verdankt, für das sie stehen. Im „Parabata vinetus" ist sophistische Rede ein Sprechen gegen das Gesetz; an der Eindeutigkeit seiner Formulierung arbeitet sie sich ab, weil in ihr die Unversehrtheit der geordneten Objektivität gründet. Erneut sei an Montaigne erinnert, der in seinem Essay „Du Pedantisme" (I/XXV) die Erziehung in Sparta mit der in Athen vergleicht und die erstere rühmt, denn während der Athener Rhetorik und Sophistik lerne und nur nach Worten hasche, bringe Sparta Gesetzgeber, Staatsmänner und Feldherren hervor, die Garanten eines starken Staates. Rhetor und Gesetzgeber also bilden bei Montaigne wie bei Thuanus zwei Pole: Der Verläßlichkeit des einen entspricht seine integrative Kraft, während
44
Jacques Auguste de Thou
in dem Trügerischen des anderen die Gefahr der Desintegration droht. — Die historische Erfahrung staatlicher Desintegration aber sah deren Grund in der Glaubensspaltung; im Streit der Religionen bereitet sich der Bürgerkrieg vor. In ihm auch wirkt der Sophismus des Teufels am stärksten, anstößige abweichende Lehren sind deshalb von Thuanus auf die Einflüsterungen Parabatas zurückgeführt. Exemplarisch geschieht dies im Gespräch mit Johannes dem Täufer. Als Parabata die Möglichkeit der Wiedertaufe (das Beispiel fürs Häretische schlechthin) propagiert, hält ihm Johannes entgegen: Tu falsa dirus comminisci dogmata Male sentientum de Deo auctor & faber Opinionum, amore lucri alios trahis, Alios honorum pellicis cupidine, Quo ciuitais publicam concordiam Turbent, Deiq. se tuentes nomine Vbiq. bella, vbiq. rixas e x c i t e n t . . . (24r-v)
So folgt auch für Johannes aus den falschen Religionslehren wieder der Krieg; in ihm aber geht der Kampf nicht um die Wahrheit des Glaubens, sondern um die Verwirklichung von Ehrgeiz und Gewinnsucht einzelner. Der Skeptiker, mißtrauisch gegenüber jeglichem Wahrheitsanspruch, findet hinter der absolut gesetzten Überzeugung ein Machtinteresse, das zu seiner Legitimation der Spitzfindigkeit theologischer Argumentation sich bedient. Dem aber galt der Vorwurf des Sophistischen von jeher: Die Entscheidung übers Gute und Richtige ist ins Belieben der Macht gestellt, der Sophist dient dem demagogisch mit seiner sprachlichen Fertigkeit. — Wenn also Moses Parabata „calumniae" vorwirft, dann ist damit das Trügerische und Verzerrende der sophistischen Rede bezeichnet. Freilich gestaltet in dem Gespräch über scientia sich mehr als allein eine exemplarische Refutation des teuflischen Sprechens. Wenn drei Jahre danach Christopher Marlowe in seiner „Tragicall History of D. Faustus" das schreckliche Ende unstillbarer Wißbegier thematisierte, und acht Jahre vor dem Feuertod Giordano Brunos Thuanus scientia, auch von Moses unwidersprochen, zur Gabe des Teufels macht, dann spricht hierin eine Spannung zum menschlichen Wissen sich aus, die allein aus skeptischem Geist schwerlich zu erklären ist. Doch ist hier sorgsam zu unterscheiden: Nicht von curiositas ist nämlich bei Thuanus die Rede, der Neugierde, die in unerlaubte Wissensbezirke vordringt: Faustus is gone, regard his hellish fall, Whose fîendful fortune may exhort the wise, Onely to wonder at vnlawful things, Whose deepenesse doth intise such forward wits, To practise more than heauenly power permits. 60
So lautet die Lehre dèr „Tragicall History" ; in ihr ist eine Grenze gezogen zwischen erlaubtem und unerlaubtem Wissen, so wie im Prozeß gegen Bruno die kirchliche Gewalt noch einmal die Grenze zog zwischen erlaubter und unerlaubte The Works of Christopher Marlowe. Ed. C. F. Tucker Brooke. — Oxford 1969. p. 194.
Parabata vinctus, sive Triumphus Christi, tragoedia
45
ter Lehre. Dergleichen fehlt bei Thuanus gänzlich, scientia gerät nicht etwa deshalb in Mißkredit, weil sie in verbotene Bezirke vorstößt. Der Begriff der curiositas fehlt in Parabatas wie in Moses' Worten; es geht also um die scientia in ihrer Gesamtheit als menschliche Wissenschaft. Moses nimmt in seiner Antwort auf Parabatas Eigenlob eine explizite Bewertung von scientia nicht vor; aus dem Katalog von Segnungen der Wissenschaft kommt er einzig auf die Gabe der Weissagung zu sprechen und schmäht sie als religionswidrig. Moses, der Chronist des Sündenfalls, reduziert Parabatas Anspruch, Wahrheitsbringer zu sein, auf seinen biblischen Kern: die Verführung durch die Paradiesesschlange. Deshalb tritt in seinen Worten an die Stelle von scientia, der Wissenschaft als Wahrheit aus menschlichem Erkenntnisvermögen, die göttliche Wahrheit als das Wissen um Gut und Böse. Erst als das Paradies mit dem Pflücken des Apfels verwirkt war, dies ist der Kern von Moses' Argumentation, trat scientia auf als Ausdruck innerweltlichen Handelns in nachparadiesischer Existenz. Scientia selbst ist hier keineswegs verurteilt, wohl aber betont Moses, was Parabata verschweigt: daß nämlich scientia erst mit dem Verlust des Paradieses erkauft werden mußte, an die Stelle vollkommener Existenz also die Unzulänglichkeit menschlicher Erkenntnis trat. Scientia gewinnt bei Thuanus ihren negativen Akzent als Ausdruck des verlorenen Paradieses. Wie mit dem Sündenfall die Vollkommenheit des menschlichen Erkenntnisvermögens sich trübte, so verrät in scientia die nach-paradiesisdhe Welt sich als Aufgabe. Die Anstrengung von scientia erinnert an eine Welt, die ihrer nicht bedurfte, weil alles Wissenswerte offenlag und dem Menschen mühelos alles sich darbot, was er zum Leben brauchte. Am Rang von scientia aber läßt sich die Mangelhaftigkeit einer schlechten Welt ablesen. Das führt uns abschließend noch einmal zu Prometheus zurück, diesmal jedoch nicht auf den aischyleischen, sondern auf ein besonderes PrometheusVerständnis der Renaissance. Zu den beliebtesten Themen der Renaissance gehört der Mythos vom Goldenen Zeitalter, die Vision einer vollkommenen Existenz in Schuld- und Sorglosigkeit, in der der Mensch aller Mühe ledig ist, weil die Erde alles Nötige in Fülle bereitstellt. Lorenzo de'Medici (1449— 1492) hatte in seinen „Selve d'amore" die Idylle der aetas aurea evoziert als das Bild eines Lebens, das nicht mehr von der Unfreiheit der überzivilisierten Existenz an den Höfen geprägt ist. Prometheus aber ist es in Lorenzos Gedicht, der dem Goldenen Zeitalter ein Ende setzte, denn er wollte zu viel wissen („saper troppo") und brachte damit Ruhelosigkeit („l'inquietudine") in die Selbstbescheidung eines geschichtslosen Daseins. Questo felice tempo al mondo tolse, all' uom la vera sua beatitudine, Prometeo, che troppo saper vòlse: dal saper troppo nasce inquietudine. Per saper poco il van fratello sciolse La morte poi e' morbi in multitudine.*1
61 Lorenzo de'Medici: Tutte le opere. Vol. II. Scritti d'amore. — Mailand 1958. p. 313.
46
Jacques Auguste de Tbou
Prometheus ist hier nidit wie bei Aischylos derjenige, dem alles menschliche Glück sich verdankt, sondern Lorenzo führt das Unglück in der Welt auf die Sprengkraft der prometheischen Gabe scientia zurück, die heraustreibt aus dem glückseligen Einklang von Mensch und Natur. In der Beschwörung der Wunschlandschaft aetas aurea zeigt das ewig Unabgeschlossene von scientia sidi als Verhinderung von Versöhnung in Gestalt wohltuender Fraglosigkeit. Prometheus also ist Feind des Menschen, weil er aus der Idylle herausführt. — Erwudis für Lorenzo der scharfe Kontrast von unvollkommener Realität und seliger Wunschexistenz aus dem Neoplatonismus, den ihn sein Mentor Ficino lehrte 62, so verurteilt Ronsard den Titan aus der Erfahrung der schrecklichen Kriege, die seine Heimat verwüsteten. Prometheus habe das Feuer gebradit, ohne das Feuer aber könne es Kriege nicht geben. Also trifft Prometheus völlig zu Recht die Strafe des Zeus: Maudit soit Promethé, par qui fut desrobé Le feu celestiel, & qui forgea la lame Qui si tost hors du corps nous fait enfuyr 1* ame: Tu deuois Iupiter luy foudroyer le chef, Et recacher au Ciel ta flame derechef, Et ietter plus auant dessous la terre basse Le fer qui maintenant se façonne en cuirasse . . . 4 3
Demnach ist auch für Ronsard Prometheus nicht Lichtbringer, sondern Urheber des menschlichen Unglücks. In diesem Zusammenhang wird auch die Büchse der Pandora wichtig, aus der zur Strafe für den Feuerraub Zeus alles Übel auf den Menschen entließ. Sie gibt Joseph Scaliger, dem engen Freund des Thuanus, die Möglichkeit, Prometheus in direkten Bezug zur Hölle zu setzen: Post subducta polo caelestia semina flammae, Atque Prometheae conscia furta manus, Prima peregrinis Èrebi caput extulit oris, Insueta et vultu terrint astra suo, Morborum et traxit ferales prima cohortes.
Es mag dies genügen, um zu belegen, daß das Prometheus-Bild des Thuanus noch anderen Quellen als allein der Aischylos-Tragödie entstammt. Bei Lorenzo, Ronsard und Scaliger erfolgt die Verurteilung des Prometheus vor dem — freilich immer anders ausgemalten — Bild einer Welt, die ohne Sünde, Mühe, Schuld, Leid und Tod ist. Mit dem Feuerraub des Prometheus hat das ungetrübte Glück sein Ende gefunden, so daß die Negativität des gegenwärtigen Weltzustands in der Tat des Prometheus ihren Grund hat. Vor der Vision der aetas aurea depraviert die prometheische Gabe der scientia zum Ausdruck einer Welt, die, bereits indem sie ihrer bedarf, die Signatur verlorener Daseinsfülle trägt. Die Gestalt des Prometheus, die ihr Positives im Handeln gegen das « Bude, a. a. O., p. 94fi. « Exhortation pour la paix. — In: Œuvres complètes de P. de Ronsard. Ed. Paul Laumonier. T. 5. — Paris 1914—9. p. 196. M Joseph Scaliger: Poemata omnia. Ad Paulum Melissum. — Zit. nach: Trousson, a. a. O., p. 132. Anm. 153.
Parabala vinctus, sive Triumphus Christi, tragoedia
47
Unvollkommene und Schlechte in der Wirklichkeit des Menschen hat, erinnert eben darin beständig an eine Welt, die soldier Anstrengung nicht bedurfte, weil in ihr Mensch und Schöpfung miteinander versöhnt waren. So brachte denn abweichend von der Aischylos-Gestaltung Prometheus den Menschen nicht Glück, sondern Qual, Plage und Leid. — Dies Prometheus-Verständnis, wie sehr auch mit dem „Gefesselten Prometheus" unvereinbar, ist unmittelbar in den „Parabata vinctus" eingeflossen. Wenn also Parabata scientia rühmt, so rühmt er nur die Mühe nachparadiesischer Existenz. Im Begriff von scientia ist all das eingefangen, was den Menschen in der Welt nicht wahrhaft zu Hause sein läßt. Eben deshalb setzt Moses der Wissenschaft das Paradies entgegen als den Ort, für den der Mensch und der für den Menschen gemacht war. Wenn in ihm der unmittelbare Weltgenuß Wirklichkeit war, so verrät sich in scientia die Zerfallenheit von Mensch und Welt. Die Unverträglichkeit von Paradies und scientia aber verweist auf die Problematik teleologischer Weltinterpretation, sobald man sich verdeutlicht, in welchem Verhältnis, etwa bei Thomas von Aquin, Mensch und Natur im Paradies zueinander stehen: Das Paradies war die verlorene Natur anthropozentrischer Teleologie und ihres zwanglosen Einverständnisses mit dem Menschen, die des umbildenden Eingriffes nicht bedürftige Verfügbarkeit einer Realität, die gleichsam aus sich selbst dem Menschen sein Dasein ermöglichte, der locus congruens hominis
Wenn aber scientia schon immer die Gegenbewegung zum teleologischen Vertrauen vollzog, so erst recht in den Lebensjahren des Thuanus, als die Radikalisierung der anthropozentrischen Finalität, die von Kopernikus postulierte Nachvollziehbarkeit der kosmischen Weltordnung für den Menschen, zur Selbstaufhebung der Teleologie führte 66. Als dann dem Blick durchs Fernrohr Gestirne sich darboten, die dem Menschen bisher nicht sichtbar waren, hatte scientia den letzten Vertrauensrest ins teleologische Prinzip vernichtet und sichtbar gemacht, daß diese Welt für den Menschen nicht geschaffen war. In Thuanus' „Parabata vinctus", der diesen Übergang reflektiert, besiegelt scientia den Bruch zwischen Mensch und Schöpfung und wird darin zum Ausdruck des Schlechten in der Welt; der Blick aufs positive Gegenbild geht zurück zum Paradies, von dem der Fortschritt von scientia unaufhaltsam entfernt. Der Konservativismus des Skeptikers und die Verzweiflung über den gegenwärtigen Weltzustand leugnen die Utopie als Zukunft. Es sollte nur zehn Jahre dauern, bis Francis Bacon aus genau dem gleichen Befund zu einem völlig anderen Ergebnis kam. Wahrscheinlich 1603 stellte er in seiner Schrift „Valerius Terminus" Engelsturz und Sündenfall einander gegenüber: In aspiring to the throne of power the angels transgressed and fell; in presuming to come within the oracle of knowledge man transgressed and fell . . . 65
Hans Blumenberg: Die kopernikanische Wende. — Frankfurt 1965. p. 74. Vgl. zu diesem Zusammenhang Blumenberg, Kop. Wende. 67 Francis Bacon: Valerius Terminus of the Interpretation of Nature: with the Annotations of Hermes Stella. — In: The Philosophical Works of Francis Bacon. Ed. John M. Robert66
48
Jacques Auguste de Thou
Auch hier also tritt das Wissen in einen Gegensatz zur paradiesischen Existenz; dann aber schränkt Bacon ein: Es sei gar nicht „natural knowledge" gewesen, was zum Fall des Menschen geführt habe, sondern „moral knowledge". Deshalb kann Bacon alle Wissenschaft, soweit sie dem Menschen nütze und nicht der Religion widerspreche, als höchst positiv sehen, denn sie gibt dem Menschen die Gewalt über die Natur zurück, die er im Sündenfall verlor. Das Ziel von scientia ist also dies: . . . it is a restitution and reinvesting (in great part) of man to the sovereignty and power . . . whidi he had in his first state of creation. 6 '
Hier ist die Position des Thuanus wahrhaft überwunden: Nicht mehr geht der Blick pessimistisch zurück aufs Paradies, sondern er ist optimistisch nach vorne aufs Paradies gerichtet, aber auf eines, das diesmal aus eigener Kraft geschaffen ist.
son. — London 1905. p. 186. — Derselbe Vergleich begegnet, nahezu in gleicher Formulierung, häufig bei Bacon, so in „The Advancement of Learning", „De augmentis scientiarum", „Author's Preface to The Great Instauration" und in den „Essays", «s Bacon, a. a. Ο., p. 188.
DER WANDEL DER LUCIFER-GESTALT IM 16. UND 17. J H .
Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik Here Lucifer the mighty Captive reigns; Proud, 'midst his Woes, and Tyrant in his Chains. Abraham Cowley: Davideis. 1656.
Eine „tragoedia" hatte Thuanus den „Parabata vinctus" genannt und damit unbefangen vorausgesetzt, daß die Tragödie der Antike im christlichen Raum ihre Strukturelemente bewahre, sofern nur an ihrer Bauform festgehalten werde, was ihm offensichtlich durch die enge Anlehnung an Aischylos garantiert schien. Nicht poetologische Reflexion also ließ ihn sein Stüde als „tragoedia" bestimmen, sondern, im Gegenteil, ein gleichsam naives Verhältnis zur antiken Vorlage, wie es vorbereitet ist durch die seit mehr als fünfzig Jahren in Frankreich unternommenen Versuche einer Restitution der klassischen Tragödie. Diese Unbefangenheit läßt Thuanus eines der wesentlichen Strukturelemente der attisdien Tragödie übersehen, das auch im „Gefesselten Prometheus" wirksam ist, aber notwendig aufgrund der Prämissen christlicher Lehrmeinung im Lucifer-Drama verlorengehen muß. Die tragische Wirkung erfordere einen Helden, so sagt Aristoteles in der „Poetik", der „weder an Tugend und Gerechtigkeit ausgezeichnet ist noch durch Schlechtigkeit und Gemeinheit ins Unglück gerät, sondern dies erleidet durch irgendeinen Fehler." Sollen Furcht und Mitleid im Zuschauer geweckt werden, so setze dies voraus, daß in der Tragödie nicht „der gar zu Schlechte von Glück in Unglück stürzen" d ü r f e d e n n einem solchen Geschehen müßte der Zuschauer ohne Mitleid folgen, weil ihm das Unglück verdient erscheint, und ohne Furcht, weil er nichts mit dem Helden gemein zu haben glaubt und deshalb unbetrofien bleibt. Der Forderung nun nach dem mittleren Charakter, wie sie in Frankreich in enger Anlehnung an Aristoteles schon 1572/3 Jean de la Taille in seinem Aufsatz „De l'art de la tragédie" erhoben hatte 2 , gehorcht die Gestalt des Prometheus durchaus, am allerwenigsten aber die des Lucifer. Den Nur-Bösen im Unglück zu zeigen, kann dann nicht mehr kathartisdi, sondern allenfalls belehrend oder erbaulich wirken. Wenn Thuanus den Teufel zum Helden der attischen Tragödie ernennt, hebt er notwendig deren Tragödiencharakter auf, indem er sie ihres dialektischen Wesens entkleidet. Nur der Untergang ist tragisch, der aus der Einheit der Gegensätze, aus dem Umsdilag des Einen in sein Gegenteil, aus der Selbstentzweiung erfolgt. Aber tragisch ist audi nur ι Aristoteles: Poetik. Übersetzung von Olof Gigon. — Stuttgart 1967. p. 40f. 2 Geoffrey Brereton: French Tragic Drama in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. — London 1973. p. 12.
50
Der Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jb. der Untergang von etwas, das nidit untergehen darf, nach dessen Entfernen die Wunde sich nicht schließt.3
Gerade das aber ließe zuletzt vom Teufel nach dem Engelsturz sich sagen, dessen endlicher Untergang schon deshalb tragisch nicht heißen kann, weil er selbst die Wunde in aller Existenz begründet, die erst mit seiner Vernichtung bleibend sich schließt. Gerade eben nicht Einheit der Gegensätze kann Thuanus im „Parabata" gestalten, sondern allein schlechthinnige Negation. Weil aber der Teufel als Held der attischen Tragödie zur Aufhebung der dialektischen Struktur des Tragischen führt, gerät dem Autor notwendig sein Versuch einer Fortentwicklung des christlichen Dramas über die Einbringung antiker Formelemente unterderhand zum Rückfall in überkommene Darstellungsweisen, die die humanistischen Dichter gerade zu überwinden trachteten. Denn undialektische Negation in abstrakter Gegen-Göttlichkeit ist Kennzeichen mittelalterlicher (auch spätmittelalterlicher) Teufelsgestaltung, bei aller Differenzierung im einzelnen. Im geistlichen Spiel des Mittelalters, in den Fronleichnamsspielen und Volksschauspielen bleibt so der Teufel gänzlich untragisch, was freilich nicht hindert, daß er gelegentlich, etwa im „Egerer Fronleichnamsspiel", Worte der Trauer oder gar der Verzweiflung im Munde führt. Er ist in diesen Spielen allein das Gestalt gewordene Böse und verharrt demgemäß in einem Handeln, das nur das negative Gegenbild zur göttlichen Intention ist. Da aus solchem Widersachertum gegen das Göttliche die Aktion des Teufels ihren entscheidenden Anstoß empfängt, bedarf sie der Begründung im einzelnen nicht mehr; es müßte vielmehr jede zusätzliche Motivation bei der einzelnen bösen Tat mit einer Einbuße des Bösen an ihr erkauft werden. Sollte dennoch von Hoffart, Neid und Haß begründend die Rede sein, so bleibt dies nur eine Begründung des Bösen aus sich selbst. Dem entspricht, daß dem Teufel des Mittelalters keine Psychologie eignet; nach dem Entschluß zum Bösen bedarf es keiner Gedanken mehr, die zu ihm führen. Die psychologische Durchdringung der Teufelsgestalt ist Merkzeichen dessen, daß eine Zeit nicht mehr recht an sie glaubt; nur wenn der Glaube an den Teufel in voller Kraft steht, erreicht menschliche Psychologie ihn nicht. — Beides nun, sowohl die undialektische Dramenstruktur aus abstraktem Widersachertum der Titelgestalt wie auch der Mangel an psychologischer Differenzierung, kennzeichnet das Stück des Thuanus. Tritt an die Stelle des mittleren Charakters der attischen Tragödie der radikal Böse, so vermag die Dialektik eines komplexen Geschehens in ihr nicht mehr sich zu entfalten, die Komplexität eines in ihr als böse Gestalteten verflacht selbst. Auch dies gilt für Thuanus: Das Böse ist zwar bedrohlich und wird gefürchtet, ist aber, als genau erkannt und beschrieben, ansonsten unproblematisch. Das genaue Ausgrenzen des Bösen aber nimmt ihm das wesentlich Gefährliche: Nicht als eigene innere Anfechtung wird es aufgefaßt, wohl aber als äußere Bedrohung. Das aber erlaubt ein gleichsam objekthaftes Verhalten zum Bösen; es materialisiert sich in Todsünden oder Strafcodices und verweigert sich so dem Zugriff des Menschen nicht mehr. 3 Peter Szondi: Versuch über das Tragische. — Frankfurt 1961. p. 60.
Psychologisierung und neuzeitliche
Subjektivitätsproblematik
51
Die polare Konfrontation des Guten mit dem Bösen, wie sie, den Gesetzen der Tragödie widerstreitend, gerade der „Parabata vinctus" vorführt, ruft zur Entscheidung auf, in der problemlos der Entschluß zum einen die Absage ans andere bedeutet. Der Mensch steht zwischen beidem, aber nicht in innerem Zwiespalt: Die Kodifikation des Ethischen ins definiert Gute und Böse nötigt ihn dazu, sich auf eine der Seiten zu stellen, die durch einen scharfen Trennungsstrich voneinander gesondert sind, und zwischen denen es die Sphäre eines unmerklichen Übergleitens nicht gibt. Im spätmittelalterlichen Spiel wird zwar, wie je, der Kampf um den Menschen zwischen Gut und Böse geführt, aber so, daß der Streit gleichsam an der Oberfläche vor sich geht, geführt zwischen Objektivationen der ethischen Prinzipien, den Allegorien der Todsünden etwa und den Erzengeln, denen der Mensch selbst zum Objekt wird. Dies bedingt, daß die Entscheidung zum Guten oder Bösen (als Ergreifen wie Ergriffenwerden zugleich) momenthaft geschieht, als deutlicher Schritt. Es kann ein Übergleiten ins Böse nicht geben, solange — übers Forensische hinaus — die Imperative der Ethik gültig genaue Verhaltensanweisungen im öffentlichen wie auch im privaten Bereich stellen. Dergestalt also, daß es eben nidit Näherungen ans Böse gibt, es etwa mindere oder höhere Qualitäten in superbia gäbe, sondern der Übertritt ins Böse sich immer als klare Grenzüberschreitung vollzieht. Es ist aus eben diesem Grunde, daß topisch in den Fronleichnamsspielen Lucifer seine Rebellion mit immer dem gleichen Zeichen markiert: Er nimmt seinen Thron und stellt ihn neben den Gottes: Minen stol wil eck mi nemen, By gode setten, dat mach mi temen, Na deme eck bin dar vnde fin, So wil eck gelick dem ouersten syn; Lik gode me my dan ere bewiset.*
Der Übertritt zum Bösen geschieht in einem Schritt, nicht in einem Verrücken des Thrones, sondern in einem Versetzen. In gleichem Maße kommt die Geschichte des Sündenfalls solchem Verständnis des Bösen entgegen, denn auch beim Biß in den Apfel geschieht der Eintritt ins Böse ohne kleinen oder großen Übergang, sondern sprunghaft. In ebendem Sinne fordert noch im 17. Jh. den Cenodoxus sein Schutzengel auf, nicht etwa in der Hoffart sich zu mäßigen, sondern sie ganz abzulegen: Dein Hoffart bistu schuldig mir / Dein lose Hoffart thuet kein guet / Laß ab von deinem Vbermuet / 5
Die Kodifikation des Bösen in einen Sündenkatalog nimmt ihm in sich die Schattierungen: Hoffart ist Todsünde, auch wenn sie, wie gerade der „Cenodoxus" zeigt, von Gutem begleitet ist; eine Differenzierung gar in Intensitäts• Arnold Immessen: Der Sündenfall. Hrsg. von Friedrich Kraft. — Heidelberg 1913. ( = Germanische Bibliothek. 2. Abt. Bd. 8.) p. 104. (Verse 504—8.) 5 Jakob Bidermann: Cenodoxus. Deutsdie Übersetzung von Joachim Meidiel (1635). Hrsg. von Rolf Tarot. — Stuttgart 1970. p. 72. (III/3, 237—9)
52
Der Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jb.
grade, verbunden mit Modifikationen des Strafmaßes, ist deshalb unmöglich. Auch von dieser Seite also ist der Weg zu einer Auflösung oder zumindest Erweichung der didiotomischen Konfrontation des Guten mit dem Bösen versperrt. Freilich setzt die an mittelalterlichen Texten zu beobachtende Polarität von Gut und Böse, die nicht zu verwechseln ist mit einem theologischen Manichäismus, historisch voraus, daß die gesellschaftlich gesetzten ethischen Prinzipien unbezweifelt und verbindlich verhaltenswirksam sind. Dies war fürs Mittelalter garantiert durch die auf Theologie gegründete christliche Ethik, deren Formulierung eng an Dogmatik gebunden blieb, und deren allseitige Durchsetzung im Totalitätsanspruch des Papsttums gewährleistet war. Mit der Neuformulierung philosophischer Ethik aber in der Renaissance und, eng damit verbunden, dem Einzug des bürgerlichen Elements ins mittelalterliche Feudalsystem, war der Theologisierung des Ethischen Einhalt geboten und damit seiner für alle Lebensbereiche geltenden Absolutheitsforderung die Möglichkeit zur Durchsetzung genommen, ein Prozeß, den dann die Reformation endgültig besiegelte, denn im Streit der Konfessionen treten zugleich unterschiedliche ethische Systeme zueinander in Konkurrenz. Zur Zeit des Thuanus also, in den französischen Glaubenskämpfen, war keineswegs mehr die Geschlossenheit einer für alles innerweltliche Handeln verbindlichen Ethik gegeben, so daß die polare Struktur von Gut und Böse, so wie sie im mittelalterlichen Drama aus der Unversehrtheit der katholischen Ethik sich ergab, im Drama des Thuanus, das aus völlig anderen Produktionsbedingungen erwuchs, sich anderen Gründen verdankt. Keinesfalls also darf hier die Kontinuität eines historisch überholten gestalterischen Konzepts vermutet werden oder gar ein bewußter Rückgriff auf mittelalterliche Gestaltungsprinzipien, wie sie für den gelehrten Autor, der mit der seit George Buchanans fünfzig Jahre zuvor in Bordeaux entstandenen lateinischen Dramen in Frankreich anhaltenden Produktion humanistischer Tragödien vertraut war, von vornherein sich verbot. Vielmehr ergibt bei Thuanus sich die Dichotomisierung von Gut und Böse, die scharfe Ausgrenzung eines Widersacherischen, gerade aus dem Verlust ethischer Verbindlichkeit und der hieraus folgenden Möglichkeit subjektiver Entscheidung unter konkurrierenden Prinzipien. Eine solche Entscheidung nun hat der Autor selbst schon im Sinne einer, wie wir zu zeigen uns bemühten, politischen Intention getroffen, so daß die Spannweite ethischer Postulate erneut zugunsten eines Systems eingeschränkt ist. Die Verurteilung von livor, superbia und amor sui erfolgt eben nicht mehr aus der Sicherheit eines mittelalterlichen Lasterkatalogs, sondern aus der Unsicherheit einer politischen Idee, die gegen andere sich zu behaupten hat. Die angestrebte Aufhebung der ethischen Pluralität geht gestalterisch einher mit der Diabolisierung des Konkurrierenden, eben der Mächte dem Ganzen widerstrebender, auf seine Auflösung tendierender Subjektivität. Die Dichotomisierung von Gut und Böse, deren vermittlungslose Konfrontation jeglicher Psychologisierung entfernt, stellt, nachdem in der Renaissance Kunst aus kirchlicher Zweckhaftigkeit sich zu lösen vermochte, erneut über die jetzt politisch geprägte Indienstnahme
Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik
53
des Ästhetischen sich ein. Der Wirkabsidit des Autors fügt sich die Gestaltung des politisch — und das heißt allemal auch ethisch — Gegnerischen, indem in ihr der Pluralismus des ethisch Möglichen als nur scheinbar suggeriert sein soll, die negative Zeichnung also des jeweils Alternativen die Entscheidung zu seinen Gunsten unmöglich zu machen bemüht ist. So ist die Diskreditierung des Konkurrierenden die negative Seite der Idealisierung des eigenen Programms, und Kunst, die im Dienste von dessen Propagierung steht, hat dem sich zu beugen. Eben darin ist das Lucifer-Drama des Thuanus lehrreich: Es zeigt schon zu einem recht frühen Zeitpunkt, als erste Autonomisierungstendenzen gleichwohl schon seit längerem, obwohl zumeist in der bildenden Kunst, wirksam waren, daß die Beugung des Künstlerischen unter politische Programmatik mit einer Entdiflerenzierung der Komplexität des zu Gestaltenden erkauft werden muß, konkret, daß bei der eigenen Position nur mehr das Positive, beim Gegnerischen aber das Negative erscheint, und die je anderen Qualitäten verschwiegen bleiben, dergestalt, daß bei Thuanus das politisch Favorisierte (am stärksten wohl beim „rex novus" ) himmlische Dignität gewinnt, der politische Gegner aber im Avernus sich wiederfindet. Die Gebote der politischen Auseinandersetzung führen zu einem gestalterischen Manichäismus, der mithin zu einem der Merkzeichen nicht-autonomer Kunst wird. Doch was in mittelalterlicher Kunst Ergebnis intakter Funktionsfähigkeit der christlichen Ethik war, so daß alles seine Gestalt nach jeweiliger Gottnähe oder -ferne gewann, geschieht jetzt gerade aus einer ethischen Differenzierung, aus der Konkurrenz innerhalb eines ethischen Pluralismus, in der die Durchsetzung des einen die Pejoration des anderen verlangt. Dies deutlich gemacht zu haben, ist Voraussetzung zum rechten Verständnis des nun zu skizzierenden Entwicklungsprozesses innerhalb der literarischen Teufelsgestaltung. Mit der Renaissance nämlich setzt ein Prozeß ein, in dem die Dichotomie von Gut und Böse aufgehoben wird zugunsten einer Psychologisierung des Bösen selbst, womit ihm die Absolutheit des Nur-Schlechten genommen ist. Diese Entwicklung sei kurz an einigen Beispielen erläutert. Dabei wollen wir zu Beginn den Kreis literarischer Lucifer-Gestaltung verlassen und auf Beispiele der Malerei verweisen, an denen Exemplarisches aufgeht. Ein Blick auf die Malerei ist auch deshalb geboten, weil, wie noch verschiedentlich im Laufe der Untersuchung zu zeigen sein wird, Literatur und bildende Kunst gerade bei der Gestaltung des Teufels wechselseitig einander beeinflußt haben. Noch die heutige populäre Vorstellung vom Teufel ist entschieden von Gestaltungsmustern geprägt, wie sie erst die bildenden Künste Bildhauerei und Malerei im späteren Mittelalter entwickelten. Man muß sich bewußt halten, daß bis etwa zur Jahrtausendwende der Teufel im Anschluß an die byzantinische Ikonographie als Mensch ohne Verzerrungen oder tierische Gliedmaßen, die späterhin zum selbstverständlichen Merkmal des Bösen wurden, gestaltet ist. Der Teufel mit Hörnern, „Schwanz und Klauen" dagegen ist erst „seit dem 12. Jahrhundert im Abendland verbreitet" 6 . Dieser Typus sollte, in mannigf> Oswald A. Erich: Die Darstellung des Teufels in der christlichen Kunst. — Berlin 1931. ( = Kunstwissenschaftliche Studien. Bd. VIII.) p. 63.
54
Der Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jb.
fachen Variationen, die Vorstellungsweisen des Teuflischen in den nächsten Jahrhunderten vollständig beherrschen. Gekennzeichnet ist er durch zunehmende Verhäßlichung der Gestalt in Form einer Entfernung vom Menschlichen und Annäherung ans Tierische, wobei beides sich miteinander in immer anderer Weise vermischt. Dabei fehlt jedes Element von Psychologie, das über Aggressionssignale oder wahrnehmbare Freude am Bösen hinausginge. Solche Weise der Gestaltung des Bösen nun reflektiert dreierlei: Zum einen ist das angestrebte Höchstmaß an Häßlichkeit Signal des Gegen-Göttlichen, denn nach mittelalterlicher Auffassung ist in Gott, der Quelle des Lichts, die höchste Schönheit. Allem Sein aber ist die Schönheit Gottes zuteil geworden, so daß auch noch dem Teufel, indem er — als Geschöpf Gottes — Anteil am Sein hat, relative Schönheit eignet. Die Entfernung von Gott aber ist mit der Einbuße an Schönheit bezahlt, so daß noch Dionysius der Karthäuser (1402/3 — 1471), der bedeutende spätscholastische Philosoph, schreiben kann: Was ist häßlicher als der Teufel, der Urgrund der Sünde? Und doch bestehen . . . die Gaben der Natur auch in den Dämonen auf das blendendste. Auch gibt es auf der Welt keinen abscheulicheren Pfuhl als den reuelosen Sünder und lasterhaften Menschen, und dodi hat er in seiner Natur und in seinem Bilde viel von der natürlichen Schönheit . . . 7
Die Intensität des Häßlidhen also bezeichnet den Verlust an göttlichem Sein und damit zugleich die Entschiedenheit des Gegensatzes zu Gott. — Zum anderen verrät sich in der Disparatheit der physischen Organisation, dem grotesken Konglomerat von Gliedmaßen und Attributen widersprüchlichster Provenienz, das Außer-Ordentliche des Teuflischen als ein Gegen-Ordentliches, kurz: der Sicherheit des mittelalterlichen ordo Entgegengesetztes. „Das Groteske zerstört grundsätzlich die Ordnungen und zieht den Boden fort." 8 Dieser Satz Wolfgang Kaysers gilt zumal dann, wenn die bestehende Ordnung unbedingte Geltung und Verbindlichkeit in allen Bereichen verlangt. Dem Bösen, als einem dem ordo Widerstreitenden, kommt deshalb die Gestalt des Außerordentlichen zu, weil es in doppeltem Sinne außer der Ordnung ist, einmal als außergewöhnlich und dem Ganzen gefährlich, zum anderen, weil es außerhalb aller Ordnung steht, nicht integraler Teil ihrer ist, wie oben schon im zitierten Satz Sir John Fortescues angeklungen. — Dies lenkt auf ein drittes: Das in der Teufelsgestalt bedeutete Fremde und völlig Andersartige, vereint mit dem Fehlen jeglicher Psychologie, führt dem Menschen das Böse als außenstehende Macht vor, mit der er nichts gemein hat. Das Böse ist das ganz andere, Unmenschliche, vor allem aber Außermenschliche. Es trägt den Charakter einer drohenden äußeren Gefahr, vor der der Mensch sich zu hüten hat; je un-menschlicher es gezeichnet ist, desto weniger erkennt der Mensch in ihm die eigene innere Anfechtung. Auch dies noch reflektiert die Geborgenheit des Menschen im mittelalterlichen ordo, 7 Zit. nach: Rosario Assunto: Die Theorie des Schönen im Mittelalter. — Köln 1963. p. 193. 8 Wolfgang Kayser: Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung. 2. Auflage. — Oldenburg/Hamburg 1961. p. 62.
Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitatsproblematik
55
der als Organisation der äußeren Welt und menschlichen Gesellschaft so vollkommen erscheint, daß die Fehler des Ganzen nicht aus innerer Defizienz des Systems, sondern nur durch Incitement von außen sich erklären lassen. Der Mensch als der Funktionsträger dieser Welt sieht sich wesensgemäß mit deren vorzüglicher Organisation so sehr in Einklang, daß ihm im Bösen die fremde Gefahr erscheint, die zwar seiner sich bemächtigen kann, an der er aber sonst keinen Anteil hat. In den Dämon und Teufel als Schreckbild des Verbotenen ist das Böse zugleich bequem gebannt. So wird gerade die groteske Gestalt des Bösen zum Beweis für die Geltungskraft der bestehenden Ordnung und der sie garantierenden Ethik 9 . Insofern entspricht sie deutlich der an mittelalterlicher Literatur festgestellten polaren Gestaltung des Guten und Bösen. — Kein schärferer Bruch mit dieser Ikonographie ist denkbar als der, den die venezianische Malerei des 16. Jhs in verschiedenen ihrer Lucifer-Gestaltungen vollzog 10 . Lorenzo Lotto (1480—1556) malte gegen Ende seines Lebens (ca. 1554—6) sein im Palazzo Apostolico zu Loreto aufbewahrtes Bild „Der Heilige Michael verjagt den Lucifer" n , das als das erste der Neuzeit gilt, auf dem Lucifer ohne diabolisierende Attribute (wie Fledermausflügel, Huf, Hörner etc.) unverzerrt als Mensch erscheint. Nur zwei Gestalten sind dargestellt: Über dem stürzenden Lucifer schwebt, weit mit dem Schwert ausholend, der siegreiche Michael. Der Hintergrund ist ausschließlich von ineinanderwirbelnden Wolken gebildet, die sich vom oberen zum unteren Bildrand zunehmend verdunkeln, so daß Michaels Kopf und Oberkörper von einer leuchtenden Fläche sich abheben, während Lucifers Flügel schon mit dem Dunkel verschmelzen. Zeitlos also ist die Szenerie, und der Raum ist derart unbestimmt, daß der Himmel ohne feste Grenze in die höllische Region übergleitet. (Bisher hatte in der Ikonographie des Engelsturzes das sich öffnende Höllentor — zumeist ein weit aufgerissenes Maul — eine feste Grenze gesetzt.) Nicht mit Scharen von Gefährten fällt Lucifer, sondern einsam und hilflos. Die Verlorenheit, die sich hierin ausdrückt, erscheint verstärkt im Antlitz Lucifers. Er ist weder Tier, etwa ein Drachen, noch ein häßlicher Mensch; er ist keine Kontrastfigur zu Michael, sondern — zum ersten Mal in der italienischen Kunst — die interessantere Gestalt. Abwehrend erhebt er die Hände, als er sieht, wohin er stürzen wird . . . Sein umschattetes Gesicht ist nicht häßlich, sondern läßt die Schönheit des Engels erkennen . . . 1 2
Die stürzende Gestalt ist von Lotto genau auf der Diagonale placiert, so daß der Kopf nach rechts unten weist. Daß dies für unsere Interpretation von einiger Nicht zu gewagt erscheint die These, daß dieses Teufelsbild sich eben in soldien sozialen Gruppen erhält, die traditionalistisch gesonnen sind und zum Konformismus neigen, Bestehendes also in ethischer als audi in institutioneller Sidit als gültig empfinden, ohne noch Alternativen zu sehen. 10 Vgl. hierzu: Marlene Schaible: Darstellungsformen des Teuflischen, untersucht an Darstellungen des Engelsturzes vom Ausgang des Mittelalters bis zu Rubens. — Phil. Diss. Tübingen 1970. pp. 92ff. Die Autorin bietet viel Material, verzichtet aber völlig auf dessen Interpretation. 11 Abb. in: Bernard Berenson: Lorenzo Lotto. Gesamtausgabe. — Köln 1957. Abb. 381. « Schaible, a.a.O., p.92f. 9
56
Der Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jh.
Wichtigkeit ist, wird deutlich, wenn man dem eine mittelalterliche Darstellung entgegenstellt: Paul de Limbourg läßt auf seiner den Engelsturz darstellenden Miniatur aus den Très riches heures des Duc de Berry Lucifer, die Krone nodi auf dem Haupt, das Gesicht dem Betrachter zugewendet, auf der Mittelachse senkrecht stürzen. Der Sinn solcher Gestaltung liegt in der Vergegenwärtigung der Verkehrung, der Abkehr von Gott. Bei gleichzeitiger Wiedergabe der im Himmel auf ihren Thronen aufrecht sitzenden Seraphe erscheint der Widerspruch zwischen Guten und Bösen so als polarer Gegensatz, was von Limbourg noch dadurch gestützt wird, daß er Himmel, Erde und Hölle scharf voneinander trennt. Lucifer gehört schon im Fall deutlidi der Hölle an, was in der Eindeutigkeit der Fallrichtung bezeugt ist. Dies nun gilt keineswegs mehr für Lottos Gestaltung. So wie auf seinem Bild die Grenze zwischen Himmel und Hölle im Unentschiedenen liegt, so ist audi die Zugehörigkeit Lucifere zu einem der beiden Reiche nicht deutlich bezeichnet. Gewiß fällt auch er zur Hölle, doch drückt seine Haltung nicht die Verkehrung aus, die ihn schon eindeutig ins Satanische verwiese. Während er schon im Dunkel versinkt, fällt von oben noch helles Licht auf seinen Körper; er ist nicht mehr Engel des Lichts, aber auch noch nicht Fürst der Schatten. Instinktiv reckt er schützend seine Hände dem Schlag Michaels entgegen, aber die Furcht in seinen Augen gilt dem, was er unter sich erblickt und ihm zum eigentlichen Wesenselement noch werden soll. Aufgehoben ist in diesem Bild die scharfe Trennung zwischen Bösem und Gutem; nichts mehr von dem gilt, was an mittelalterlichen Teufelsdarstellungen aufging. Die Häßlichkeit, Zeichen der Gottferne, ist höchster Schönheit gewichen; die im Fall sich vollziehende Umgestaltung ins disparat Mißgestaltete, so wie sie für die bisherige Darstellung des Engelsturzes typisch ist, kündigt noch nirgends sich an. Die groteske Körperbildung, das Außer-Ordentliche des Teuflischen signalisierend, ist durch körperliche Vollkommenheit ersetzt, was mit der Androgynie des stürzenden Engels sich trifft. Am bedeutsamsten aber ist der dritte Punkt: die menschliche Gestalt des Teufels und seine Emotionen. Angst und Schrecken, die Hilflosigkeit des völlig Schutzlosen und die Furcht vor dem Ungewissen, all dies sind menschliche Reaktionen, die den Betrachter zur Identifikation mit dem Unterlegenen einladen. Lotto hat nichts versäumt, um die völlige Ohnmacht des stürzenden Teufels darzustellen: Seine Waffen hat Lucifer verloren, nackt ist er den Streichen des geharnischten Michael ausgesetzt. Die Intention des Malers, den Sieg des triumphierenden Guten über das Böse darzustellen 13 , zeitigt aufgrund der Entschiedenheit ihrer bildnerischen Umsetzung den gegenteiligen Effekt: Zwar gelingt noch dem Betrachter aufgrund der Kenntnis des gestalteten Sujets die rasche Zuordnung der dargestellten Figuren zu den ethischen Prinzipien, für die sie stehen, die Darstellung selbst aber nimmt diese Zuordnung nicht mehr vor, so daß bei Abstraktion von der literarischen Vorlage der Betrachter weit eher in dem leidenden Lucifer
"
Sicher hatte Lotto, der — so Berenson — reformatorisdien Kreisen nahestand, auf diesem vor Absdiluß des Tridentinums entstandenen Bild nicht die ecclesia militans et triumphans darstellen wollen.
Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik
57
als in dem unberührt zuschlagenden Michael sich wiedererkennt. Lotto nimmt, um die Größe von Michaels Sieg zu demonstrieren, eine Psychologisierung der Lucifer-Gestalt vor, so daß der Teufel, traditionell Ursprung des Leids, zum Leidenden werden muß. Damit aber ist er aus der Absolutheit seiner Gegnerschaft genommen, denn gerade die Leidensfähigkeit des Teufels beweist, daß er einen wie immer gearteten Anteil am Guten noch hat (und sei es als einen erinnerten). Die Psychologisierung der Lucifer-Gestalt unterwirft sie menschlichem Verständnis und läßt damit den irdischen Maßstab von Gut und Böse offen hervortreten. Die menschliche Gestalt und Psychologie des Teufels heben ihn aus der Distanz einer dem Menschen äußeren Bedrohung und lassen anklingen, daß es der Mensch selbst sei, der das Böse tut, und daß in ihm seine Quelle liegt 14 . Die Humanisierung der Teufelsgestalt, die besondere Gestaltung von Hintergrund und Fallrichtung, all dies setzt der dichotomischen Darstellung der konträren ethischen Prinzipien ein Ende, und der Mensch, der zwischen beiden Mächten stand, rückt in der vielfältigen Bedingtheit seiner Handlungsmotivation ins Zentrum der Betrachtung. In den Bösen selbst ist der Zwiespalt, der die Welt durchzieht, verlegt: Eben dies zeigt Lotto, daß Teufel zu sein des Teufels Strafe ist. Noch auf ein weiteres Gemälde ist in diesem Zusammenhang einzugehen. Tintoretto (1518—1594) malte wenige Jahrzehnte nach Lottos „Lucifer" in der Scuola di San Rocco eine „Versuchung Christi" (1578—81) 15, in der das neue Lucifer-Bild weiter differenziert erscheint. Auch hier ist das Geschehen auf zwei Gestalten konzentriert: Lucifer bietet dem dicht über ihm unter einem ungefügen Bretterdach kauernden Christus die Steine an, die er zu Brot verwandeln soll. Seine üppige Gestalt ist bis auf ein locker um die Hüften geschlungenes Tuch nackt; außer den gewaltigen Flügeln und der Androgynie gibt nichts mehr den gefallenen Engel zu erkennen. Den stummen Kampf zwischen dem Gott und seinem Versucher schildert Tintoretto mit äußerster Verhaltenheit, Verlockung und Zurückweisung in nahezu teilnahmslosen Mienen. Marlene Schaibles Beschreibung von Lucifers schönem Antlitz gibt seine wesentlichen Züge in poetisierender Umschreibung wieder: Es ist fleischig, weich geschwungen, mit sinnlichem Mund, großen schwermütigen Augen, in denen Glanzlichter wie aus dunklem Teich aufleuchten — darüber äußerst schmale, grathafte Brauen; und dieses ausdrucksvolle, zugleich schmerzliche und allen mit den Sinnen zu erfassenden Genüssen weit geöffnete Gesicht ist umweht und belebt durch reiche Locken. Während das Gesicht Christi im Ausdruck leicht zu erfassen ist, milde Zurückweisung erkennen läßt, bleibt Satans Antlitz im Ausdruck verschlossen; er ist der Versucher, der weniger zu versuchen scheint, als melancholisch sinnt. 16
Die Furcht in den Augen Lucifers bei Lotto ist der Melancholie bei Tintoretto, die Angst vor dem Ungewissen ist der Erfahrung gewichen. Die Psychologi14 Diesen Zusammenhängen bin ich kurz nachgegangen in: Ernst Osterkamp: Darstellungsformen des Bösen. Das Beispiel Luzifer. — In: Sprachkunst. 5 (1974) pp. 177—195. 15 Abb. in: Erich von der Bercken: Die Gemälde des Jacopo Tintoretto. — München 1942. Abb. 262. Lucifers Gesicht im Ausschnitt Abb. 263. 16 Schaible, a. a. O., p. 94f.
58
Der Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jh.
sierung des gestalteten Bösen hat hier einen ersten Kulminationspunkt erreidit: Das Antlitz Lucifers spiegelt nur zum geringeren Teil die dargestellte Situation, es ist gleichsam nur physisch das eines Verführers. Sondern die Versuchung wird wesentlich zum Anlaß von Selbstreflexion; der zu überzeugen trachtet, erscheint innerlich gebrochen. Die Melancholie in seinem Blick verrät die Distanz, in welcher er selbst zu seinem Unternehmen steht, sie reflektiert, wie sehr dem schönsten Engel Gottes das Böse ursprünglich wesensfremd war. Es scheint, als sei nicht Christus der Versuchte, der „unerreichbar, milde und gnädig auch gegen den Bösen, das Schlechte abwehrt" 17 , sondern als werde Lucifer durch die in Christus Gestalt gewordene Erinnerung an die eigene Vergangenheit und damit ehemals mögliche Zukunft versucht. Denn in Christus erscheint ihm die Möglichkeit einer Existenz, wie er selbst sie einmal als Fürst des Himmels, nicht der Hölle führte: aufgehoben in der göttlichen Ordnung zu sein, befreit vom Zwang eines beständigen Kampfes, der nie mit Sieg und nicht einmal mit der Niederlage enden kann. Die milde Zurückweisung Christi geschieht aus der Kraft des objektiven göttlichen Gesetzes; ihr gegenüber signalisiert die Schwermut Lucifers das Leid von Individualität als Vereinzelung. Daß aber wiederum der Trauernde sich selbst nicht ergibt, und die Schwermut nie in Resignation umschlägt, beweist die Kraft erwachter Individualität, die dem Objektiven gegenüber das Ihre bewahrt und ihm gerade dann nicht sich ausliefert, wenn sie ihre Schwäche ihm gegenüber erkennt. Die Unnahbarkeit Christi, seine Vollkommenheit verdeutlichen, wie sehr das objektiv Gültige dem individuellen Zugriff entzogen ist — Tintoretto ist der bedeutendste Maler der Gegenreformation. Deshalb geschieht in seinem Lucifer nicht, wie bei Lotto, die Individualisierung des Diabolischen, sondern, umgekehrt, die Diabolisierung des Individuellen. Der Autonomisierungsprozeß von Kunst aber, in dem die Gestaltung ethischer Prinzipien sich loslöst von der Konventionalität vorgefaßter Erkennungsmuster, verleiht dem Individuellen entgegen der gestärkten Objektivität die größere Überzeugungskraft: In der Idealisierung des Gültigen erweist sich die wachsende Macht des ihm Widerstreitenden. Eben dies meint die Rede von Lucifer als der interessanteren Gestalt: Während das Objektive in der Kälte des Überindividuellen verharrt, läßt dessen Gegner nur als Individuation sich zeichnen. Die Trauer im Blick Lucifers verrät den Sündenfall der Individuation, den Verlust sozialer Geborgenheit nach dem Verfall des mittelalterlichen ordo, die Hand mit den dargebotenen Steinen aber, daß dieser Prozeß unwiderruflich ist. Wenn also Marlene Schaible sich angesichts dieses Bildes an das Baudelairesche Schönheitsideal erinnert fühlt, so muß hier unterschieden werden: Während im Satanismus Baudelaires Individualität gegen die drohende endgültige Vereinnahmung durchs schlechte Ganze sich zu bewahren sucht, reflektiert Tintorettos Bild den gegenteiligen Prozeß, die Bedrohung des Bestehenden durch aufbrechende Individualität. Als Problem bleibt die Schönheit des gefallenen Engels auf den Bildern Lottos und Tintorettos, die keineswegs ausschließlich, wie die Menge der anders 17
von der Bercken, a. a. O., p. 80.
Psychologisierung und neuzeitliche
Subjektivitätsproblematik
59
verfahrenden Beispiele zeigt, aus der dargestellten Situation sich erklären läßt. Auch genügt es nicht, wie Marlene Schaible darauf hinzuweisen, daß Schönheit eben „Hauptanliegen und Hauptproblem der venezianischen Maler" gewesen sei 18 . Denn das in der Kunst der Hochrenaissance verbindliche Ideal der Kalokagathie setzte voraus, „ . . . daß die physische Schönheit und Kraft zum vollwertigen Ausdrude der geistigen Schönheit und Bedeutsamkeit wird." 19 Dem liegt sozialhistorisch zugrunde das aristokratische Menschenideal des uomo universale, des allseitig gebildeten Höflings, dessen physischer Schönheit die geistige entspricht. Bei ungebrochener Geltungskraft dieses Ideals, wie es Castiglione in seinem „Cortegiano" (1528) abschließend systematisierte, war die Gestaltung eines körperlich vollkommen schönen Lucifer undenkbar. Mit dem Erscheinen von Machiavellis „Principe" (1532) aber rückt die andere Seite des Cortegiano, um dessen ethische Prinzipien schon Castiglione sich nicht bemüht hatte, zentral ins Blickfeld: die des Realpolitikers, der die Maßstäbe seines Handelns ausschließlich am Ziel des Machterhalts nimmt und dies ruhigen Gewissens tun kann, weil er weiß, daß der Mensch schlecht ist. Nach der bedeutenden Zäsur, die das Erscheinen von Machiavellis Werk im Cinquecento setzt, ist mit dem Innewerden der doppelten Moral als der alltäglichen politischen Handlungsgrundlage der bruchlosen Entsprechung von Gut und Schön in der Kalokagathie der Boden entzogen. So wie der Principe hinter der glatten Maske des Cortegiano sein skrupelloses Geschäft betreibt, oder wie, an Tintoretto erinnernd, die Restitution ethischer Verbindlichkeit in der Gegenreformation sidi nur über Realpolitik, also über die völlige Elimination des Ethischen in zentralen Handlungsräumen, durchsetzen läßt, so gehen endgültig dem Menschen die bequemen Erkennungszeichen des Bösen verloren. Daß das Böse im Menschen hinter Schönheit trügerisch sich verbergen darf, ja soll, erst dies ebnet den Weg zur schönen Gestalt Lucifere; von jetzt an schreckt der Teufel den Menschen, indem er ihm nachgebildet wird. Schon im 16. Jh. also ist die Illusion einer dem Menschen äußeren absoluten Macht des Bösen künstlerisch aufgehoben; die Humanisierung des Teufels in äußerer Gestalt und Psychologie bedeutet das Ende eines gestalterischen Dualismus, in dem der Mensch als Opfer eines persönlichkeitsfremden Bösen erscheint, und der mit der Selbstreflexion von Individualität unvereinbar ist. Gewiß setzen Lotto und Tintoretto hier nur erste vereinzelte Beispiele, denen zudem im 16. Jh. nichts Gleichwertiges in der Literatur zur Seite tritt, doch zumindest kündigt schon zur selben Zeit auch literarisch die gleiche Tendenz sich an. So läßt besonders an der Entwicklung des Motivs vom Höllenrat sich beobachten, wie die Gestalt Lucifers zunehmend an Komplexität gewinnt und mit der Erweiterung ums Psychologische um Bedeutungsdimensionen bereichert wird, die zusehends über die Wiedergabe eines ungebrochen Bösen hinausgehen. Die Darstellung des Höllenrats wird deshalb in diesem Zusammenhang bedeutsam, weil sie den Teufel als Reflektierenden zeigt und schon darin seine Gestalt ι» SAaible, a. a. O., p. 98. 19 Arnold Hauser: Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. — Mündien 1973. p. 374.
60
Der Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jb.
aus der Eindimensionalität des Nidits-als-Bösen befreit. Eine Tradition der Gestaltung des Höllenrats ist die des spätmittelalterlichen Mysterienspiels: Die drei Hauptteufel, zumeist Lucifer, Satan und Belial, treten zusammen, um darüber zu beraten, was nach dem Engelsturz zu tun sei, und mit welchen Mitteln der Kampf gegen Gott am wirksamsten weitergeführt werden könne. Im „Egerer Fronleichnamsspiel" etwa führt Lucifer seitenlange Klagereden, in denen er sein schreckliches Schicksal, den Verlust des Himmels und die Qual der Hölle reuevoll beklagt, bis Sathanas solcher Larmoyanz grob ein Ende bereitet und das weitere Vorgehen der Hölle bestimmt. Im 16. Jh. geht der Verführungsszene im Paradies zumeist ein beratendes Gespräch zwischen Lucifer, Satan und Belial voraus, das mit einer Klage Lucifers über seinen Fall und das glückliche Los der Menschen eingeleitet wird und im Beschluß resultiert, Eva von der Schlange zur Übertretimg des göttlichen Gebots verführen zu lassen. Ein typisches Beispiel hierfür bietet etwa die Szene II, 3 von Hieronymus Zieglers „Protoplastus" (1547), die, von Hans Sachs nahezu wörtlich übertragen, in dessen „Tragedia von Schöpfung, fai und außtreibung Ade auß dem paradeyß" (1548) in deutschen Knittelversen nachzulesen ist. Diese an die Tradition der Mysterienspiele gebundene Art der Darstellung des Höllenrats erhält sich bis ins 17. Jh.; beispielsweise leitet Serafino della Salandra den zweiten Akt seines „Adamo Caduto" (1647) mit einem erregten Gespräch zwischen Lucifer, Belial und Benemoth ein, wie es freilich in dieser Form im 16.Jh. — zumal auf deutschem Boden — undenkbar gewesen wäre (z.B. trampelt der erzürnte Lucifer Belial auf dem Kopf herum; ähnliche Grausamkeiten gibt es bei den Auftritten der Megaera im III. Akt) 2 0 . Die Form des Mysterienspiels setzte der Gestaltung solcher Ratsszenen enge Grenzen: Der teilnehmende Personenkreis war von vornherein stark begrenzt, und die Konzentration auf den Sündenfall bestimmte die Richtung des Gesprächs so sehr, daß es zur Entwicklung eigenständiger Charakterzüge der disputierenden Teufelsgestalten kaum kommen konnte. Die dramentechnische Notwendigkeit einer Vorbereitung und Begründung des Sündenfalls legte die Formulierungen des beratenden Gesprächs in nahezu topischen Wendungen fest. Bedeutsam für die Differenzierung der literarischen Teufelsgestaltung wird dagegen eine zweite Tradition in der Darstellung des Höllenrats, die im Unterschied zur ersten an epische Texte gebunden ist und ihre wesentlichen Gestaltungsprinzipien antiken Quellen verdankt. Die Form des Epos bot erheblich größere gestalterische Freiheit in der Ausmalung teuflischen Redens und Handelns, wie überhaupt die Herauslösung des Höllenrats aus dem Mysterienspiel die Möglichkeit eröffnete, jedes epische Geschehen in seinen negativen Wendungen auf eine teuflische Intrige zurückzuführen. Der christlichen Poesie war damit die Möglichkeit geboten, über den Sündenfall hinaus an den Anfang jedes Geschehens, in dem widersacherische Kräfte sich bemerkbar machten, ein 20 Wesentliche Partien des Stückes finden sich in englischer Übertragung in: Watson Kirkconnell: The Celestial Cycle. The Theme of „Paradise Lost" in World Literature. — Toronto 1952. pp. 290fi.
Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik
61
Teufelskonzilium zu stellen, welches die Durchführung einer entsprechenden Aktion beschließt. So geht etwa dem Bethlehemitischen Kindermord ein Höllenrat voran (Mantuan, Marino, Gryphius, Blackmore), der Kreuzigung (Vida, Clarke), der Enthauptung des Johannes (Vondel), dem Anschlag Sauls auf David (Cowley), oder, nicht unmittelbar auf biblische Vorlagen bezogen, Anschlägen auf Allegorien der menschlichen Seele (Masen, Beaumont). Aber auch historische Geschehnisse sind in epischen Gestaltungen mit einem Höllenrat eingeleitet, so in Tassos Kreuzzugsepos und, daran orientiert, in Richard Blackmores Epen über den Kampf König Arthurs gegen die Sachsen. Und auch in der Religionssatire finden sich natürlich Teufelskonzile; die „Locustae, vel pietas jesuítica" ( 1 6 2 7 ) des Phineas Fletcher, eine bissige Schrift gegen die Jesuiten, seien hier als Beispiel genannt. Bedeutenden Einfluß auf alle diese Gestaltungen hatten die Ratsversammlungen der Götter im Olymp, in denen im antiken Epos die Schicksale der Helden verhandelt wurden, und in deren Folge die Götter auf das irdische Geschehen Einfluß zu nehmen trachteten. Hier soll nur erinnert werden an die Götterversammlungen bei Homer im 15. Buch der „Ilias" und zu Beginn der „Odyssee" und, aufgrund der größeren Vertrautheit des Mittelalters mit Vergil in unserem Zusammenhang noch bedeutsamer, an den Götterrat, mit dem der 10. Gesang der „Aeneis" einsetzt. Aus dieser Quelle fand die Anthropomorphie der antiken Götterwelt, die gerade in den Ratsversammlungen am deutlichsten sich zeigt, Einlaß in die Gestaltung des Teufels in der christlichen Dichtung. Anthropomorph zumal ist die Vorstellung, daß die wechselvollen Schicksale der Menschen Funktion der Affekte von Göttern seien, die sich ihrer als eines Mittels bedienen, um die Eifersüchteleien und Machtkämpfe untereinander auszutragen. Auch davon geht ein Element in die christlichen Epen ein, die mit einem Höllenrat einsetzen: In ihnen geht der Kampf der Hölle nicht gegen den Menschen, sondern gegen Gott, also um den Menschen. Die Erde ist der Austragungsort eines Machtkampfes zwischen Gott und Lucifer; dabei wähnt Lucifer sich in der Position des Angegriffenen, in dessen ihm rechtmäßig zustehenden Herrschaftsbereich fremde Mächte einzudringen trachten, so daß Maßnahmen zur Verteidigung ergriffen werden müssen. In Tassos „Gerusalemme liberata" ( 1 5 8 1 ) zum Beispiel geht der Kampf zwischen Christen und Mohammedanern um eine geographisch fest umrissene Region, die dem Reich des Teufels zu entreißen und dem Gottes zu annektieren ist. Plutos W o r t e sind die eines Feldherrn, der Maßnahmen zur Verteidigung festsetzt: Noi trarrem neghittosi i giorni e l'ore, Nè degna cura fia die Ί cor n'accenda? E soffrirem die forza ognor maggiore Il suo popol fedele in Asia prenda? F, che Giudea soggioghi, e die Ί suo onore, Che Ί nome suo più si dilati e stenda? (...) Che di tant'alme il solito tributo Ne manchi, e in voto regno alberghi Pluto? 2 · zi Zitiert wird nach der zweisprachigen Ausgabe: Torquato Tasso's befreites Jerusalem.
62
Der Wandel der Lucifer-Gestdt im 16. und 17. Jh.
Wie bei Homer und Vergil die Götter sich tätig unterstützend um ihre irdischen Günstlinge bemühen und so vermittelt gegeneinander kämpfen, so stehen bei Tasso die Teufel auf Seiten der Heere des Islam und die Engel bei denen der Christen. Das irdische Geschehen wird zum Götterkampf überhöht, Gewinn und Verlust auf die direkte Einwirkung überirdischer Mächte zurückgeführt, die sich irdisch verhalten, etwa in Kategorien militärischer Aktion und politischer Intrige sich beraten. Dieser motivische Hintergrund antiker Götterrivalität befördert entschieden eine Aufwertung der Lucifer-Gestalt, wobei sich der gefallene Engel zusehends zum Anti-Theos wandelt, zum Gott der Hölle. Dem christlichen Gegensatz zwischen Gott und Teufel, der eben nicht dualistisch ist, sondern durch eine unüberbrückbare Machtdistanz gekennzeichnet bleibt, wird in den Epen des 16. und 17. Jhs die Gestalt der Rivalität zwischen den feindlichen Brüdern Jupiter und Pluto aufgeprägt, in der zwei Götter mit genau festgelegtem Machtbereich einander gegenüberstehen. Dementsprechend orientieren sich die Höllengestaltungen an den antiken Schilderungen der Unterwelt, wobei wiederum von größerer Bedeutung als Homers Darstellung (im 11. Buch der „Odyssee" ) die römische Literatur ist. Besonders hat hier Vergil gewirkt, der im 6. Gesang der „Aeneis" Aeneas' Aufenthalt in der Unterwelt schildert; weiterhin ist, Vergil folgend, Seneca bedeutsam mit dem Bericht des Theseus im „Hercules furens". Die Hölle des Christentums bevölkert sich mit Harpyien, Chimären und Furien, ihre Flüsse heißen Styx und Acheron, und auf dem Thron regiert Gott Pluto selbst. Als Höllengott nun wird Lucifer zur konkurrenzlos dominierenden Figur der Unterwelt; in seiner Gestalt bricht sich deren ganzes Wesen. Satan, Belial oder Beizebub treten daneben völlig zurück oder sind ganz durch die Furien ersetzt. Der Höllenrat in der Tradition der antiken Gestaltungen trägt deshalb auch nicht den Charakter des Gesprächs unter nahezu gleichwertigen Partnern, wie in den Mysterienspielen, sondern hier ruft ein Herrscher seine Vasallen zusammen, um, bei völliger Beibehaltung der Entscheidungsbefugnis, deren Rat einzuholen, oder um ihnen den schon vorher gefaßten Entschluß zu verkünden. — Hier ist nicht der Ort, um eine ins Detail gehende motivgeschichtlidhe Darstellung der Entwicklung des Motivs vom Höllenrat zu geben. Olin H. Moore hat seine von Claudian über das Evangelium des Nicodemus, Robert de Boron, Boccaccio, Mantuan, Sannazaro und Vida bis zu Tasso laufende Entwiddungslinie kurz nachgezeichnet und überzeugend belegt22. Für das 17.Jh., in dem das Motiv besonders verbreitet war, nennt er nur die beiden wichtigsten Beispiele: Marino und Milton. Gerade in der englischen Literatur vor Milton jedoch erfreut sich der Höllenrat größter Beliebtheit; als Beispiele seien genannt Phineas Fletcher, Robert Clarke, Abraham Cowley, Joseph Beaumont, Samuel Pordage23. Mellius de Sousa und Rolin de Moura gestalteten in der portugiesiÜbersetzt von Karl Streckfuß. Leipzig 1822. (IV/13—4) Im Anhang zu diesem Kapitel wird — ebenso wie bei Marino — die deutsche Übersetzung beigefügt. 22 Olin H. Moore: The Infernal Council. — In: Modern Philology XVI (1918) pp. 169— 193 und XIX (1921—22) pp. 47—64. 23 Eine Fundgrube für entsprechendes Material bietet Kirkconnell, a. a. O.
Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik
63
sehen Literatur das Motiv; bei Joost van den Vondel kommt es 1662, also audi noch vor Milton, im 4. Buch seines epischen Gedichts „Joannes de Boetgezant" vor. Aus der deutschen Literatur sind mir nur zwei Bearbeitungen des Themas bekannt, die auch Ursula Müller schon nennt 24 ; beide sind bezeichnenderweise in Latein verfaßt: die „Herodis Furiae & Racheiis lachrymae" (1634) des jungen Andreas Gryphius und Jakob Masens „Sarcotis" (1654). Erst in Klopstocks „Messias" findet sich dann eine groß angelegte Gestaltung in deutscher Sprache. — Hier soll nun auf die beiden Texte eingegangen sein, auf deren Vorbild die Darstellungen des Höllenkonzils im 17. Jh. und damit das Lucifer-Bild in wesentlichen Zügen sich zurückführen lassen, und die vor Milton als die bedeutendsten gelten dürfen: Tasso und Marino. Man hat das neue, psychologisch komplexe Lucifer-Bild erst mit Marino beginnen lassen wollen, Tasso dagegen nodi völlig in mittelalterlicher Tradition befangen gesehen25, woran sicher richtig ist, daß sich das Lucifer-Bild bei Marino gegenüber dem bei Tasso erheblich differenziert, aber doch nicht so, daß die gemeinsame Entwicklungslinie, in der beide stehen, völlig sich übersehen ließe. Gewiß gilt für Tasso, daß die äußere Gestalt seines Lucifer schon dies von der mittelalterlichen Darstellungsweise unterscheidet, daß sie ins Monumentale gewendet ist: Rosseggiali gli occhj, e di veneno infetto Come infausta cometa il guardo splende: (...) E in guisa di voragine profonda S'apre la bocca d'atro sangue immonda. Qual i fumi sulfurei ed infiammati Escon di Mongibello, e Ί puzzo e Ί tuono, Tal della fera bocca i negri fiati, Tale il fetore e le faville sono. (...) E in questi detti il gran rimbombo udissi.
(IV/7-8)
Schon in der 6. Stanze war gesagt worden, daß neben Pluto die höchsten Berge wie Hügel wirkten. Mit dem, daß sich die Gestalt Lucifers nur im Vergleich mit den extremsten Naturphänomenen sinnlich erfassen läßt, geht es einher, daß Tasso darauf verzichtet, sie aus tierischen Körperteilen grotesk zu komponieren, denn dies hätte sie nur ihrer Monumentalität beraubt. Allein Hörner sind genannt und ein langer Bart; nicht aber gilt, was Tasso über die Gestalten der sich versammelnden Teufel sagt: E in novi mostri, e non più intesi o visti, Diversi aspetti in un confusi e misti. (IV/5) 24
Ursula Müller: Die Gestalt Luzifers in der Dichtung vom Barock bis zur Romantik. — Phil. Diss. Gießen 1940. p. 13. — Der Höllenrat in Grimmelshausens „Continuatio des abentheurlidien Semplicissimi" (1669), 2.—4. Kapitel, gehört nicht in diesen Zusammenhang. Die Allegorien, etwa der Wettstreit zwischen Verschwendung und Geiz, verweisen auf die Tradition der mittelalterlichen Moralitäten. 25 Mario Praz: Liebe, Tod und Teufel. Die sdiwarze Romantik. — München 1970. ( = dtv. Wissenschaftliche Reihe. Bde4051—2) Bd. 1, p. 66f.
64
Der Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jh.
Der Teufelsstaat rekrutiert sich ausschließlich aus den Fabelwesen der antiken Mythologie, den Harpyen, Centauren, Sphynxen, Gorgonen, etc., deren Mißgestalt im übrigen durch die Überlieferung schon weitgehend festgelegt ist; sein Oberhaupt ist Pluto, der zwar mit dem Satan des Mittelalters als Gott der Unterwelt die Häßlichkeit teilt, als Bruder des Göttervaters aber deutlich von seinem Hofstaat sich abhebt: „Orrida maestà", die furchtbare Majestät Plutos setzt die Anthropomorphie voraus 26 . Pluto also unterscheidet sich von den ihn umgebenden Teufeln nicht allein durch seine gigantische Gestalt, sondern vor allem durch einen für die literarische Teufelsdarstellung der Zeit bemerkenswerten Verzicht auf die gewohnten grotesken Elemente. Tasso gibt eine Vorstellung von der Gestalt des Höllenfürsten, indem er das meiste im Unentschiedenen beläßt; und noch die Vergleiche mit Naturerscheinungen betonen die Unmöglichkeit einer expliziten Beschreibung: Lucifer entzieht sich den menschlichen Wahrnehmungskategorien, der Versuch einer Beschreibung leitet über in die Spiritualisierung. — Freilich geht dies bei Tasso zu beobachtende Changieren zwischen Beschreibung und Verhüllung bei dem Versuch einer bildlichen Umsetzung der Szene verloren. Matthäus Merian, der 1626 die TassoÜbertragung Diederichs von dem Werder mit Kupferstichen versah, zeigt auf einem dem vierten Gesang vorangestellten Stich Pluto umgeben von einem Kreis 27 grotesker tierähnlicher Teufel. Hier dominiert wieder das mittelalterliche Element; aus Pluto wird eine Bocksgestalt mit langem Schwanz und Klauen; die Monumentalität ist notwendig eingeebnet, so daß Pluto nur die Größe der in der oberen Bildhälfte der synoptischen Darstellung gezeichneten Ritter hat. Gerade der Vergleich mit Merian zeigt, wie sehr schon Tasso über die mittelalterliche Gestaltungsweise hinausgeht: Während Merian die sinnliche Vergegenwärtigung Satans auf den gestalterischen Dualismus des Mittelalters verflacht und dem unmenschlichen Teufel die zugleich dargestellten Ritter als menschliche Idealgestalten konfrontiert, gewinnt bei Tasso der Teufel seine Kontur eben nicht aus der akribischen Schilderung eines disparaten Äußeren, sondern aus der Gestaltung einer konsistenten Psychologie. Pluto ist mehr als nur „il gran nemico dell'umane genti", der große Feind des Menschengeschlechts; Tasso stellt die Teufel vor allem als „l'alme a Dio rubelle" dar, als die von Gott abgefallenen Geister. Dies stellt Lucifer in ein temporales Spannungsgefüge: Einer als höchste Idealität erinnerten Vergangenheit steht eine schlechte Gegenwart gegenüber, die zudem noch zusehends sich zu ver2« Vgl. „Hercules furens", 720—722: campus hanc circa iacet, in quo superbo digerii vultu sedens animas recentes dira maiestas dei. Seneca: Sämtliche Tragödien. Lateinisch und deutsch. Hrsg. von Theodor Thomann. Bd. 1. — Zürich/Stuttgart 1961. p. 112. 27 „Dieser Äff deß Allmächtigen will seine Wercke nachmachen / und ist der Circkel / welchen seine besagte Diener um sich zu schreiben pflegen / eine Nachahmung Göttlicher Vollkommenheit." — Georg Philipp Harsdörffer: Der grosse Schau-Platz Jämmerlicher Mord-Geschichte. Bestehend in CC. traurigen Begebenheiten. ( . . . ) Zum fünfftenmal gedruckt. — Hamburg 1666. p. 436.
Psychologisierung und neuzeitliche Subjekliviiätsproblematik
65
schlechtem droht. Der Erinnerung an höchste Vollkommenheit kollidiert eine Lebenswelt, deren Signum völlige Unangemessenheit zur inneren Qualität ihrer Bewohner ist: Tartarei Numi, di seder più degni Là sovra il Sole, ond' è l'origin vostra, Che meco già dai più felici regni Spinse il gran caso in questa orribil chiostra; (...) Ed in vece del di sereno e puro, Dell'aureo Sol, de 'bei stellati giri, N'ha qui rinchiusi in quest'abisso oscuro, Nè vuol ch'ai primo onor per noi s'aspiri. (IV/9-10)
Es ist die Situation des Vertriebenen, die hier — wie in späteren Gestaltungen noch häufig — anklingt: der gezwungene Aufenthalt an einem Ort, dessen Unwirtlichkeit und Fremdheit die beständige Erinnerung an eine Landschaft hervorrufen, die auf ihre Bewohner teleologisch abgestimmt ist. Tasso verzichtet — ganz anders als später Milton — auf eine Beschreibung der höllischen Region und beläßt die Vergegenwärtigung der unterschiedlichen Qualitäten von Himmel und Hölle in der mittelalterlichen Vorstellung nachlassender Lichtintensität. Deshalb rückt nicht die besondere Qualität der Unangemessenheit von Ort und Bewohner in den Blick, sondern einzig die von Pluto behauptete Würde der gefallenen Engel, die in deren gegenwärtigem Aufenthalt nicht den ihr gemäßen Ausdruck findet. Daß die Aufrührer nach dem Willen Gottes nicht mehr nadh ihrer früheren Ehre streben dürfen, ist das bedeutsame Thema von Lucifers Rede. Die Sorge um Ehre und Macht bildet den Kern der Persönlichkeit Plutos, und der Bewahrung von Würde und Größe gilt sein Handeln. Deshalb ist er von den Erfolgen der Christen im Innersten betroffen, denn eine Einbuße an Macht geht einher mit dem Verlust persönlicher Würde. Die Kontinuität der Niederlagen, vom Engelsturz über die Erhöhung der Menschen und den descensus Christi bis zu den aktuellen Erfolgen in der Christianisierung, dies ist es, was ihm innere Qual bereitet, nicht allein die Erinnerung an seine frühere Größe. Tasso zeigt den Teufel in der Defensive, von einer überlegenen Macht beständig in seinem Eigenwert getroffen. Dagegen behauptet er das Recht seiner Persönlichkeit: Ah non fia ver: die non sono anco estinti Gli spirti in noi di quel valor primiero, Quando, di ferro e d'alte fiamme cinti, Pugnammo già contra il celeste impero. Fummo, io noi nego, in quel conflitto vinti; Pur non mancò virtute al gran pensiero. Diede, che che si fosse, a lui vittoria; Rimase a noi d'invitto ardir la gloria. (IV/15)
„virtù" und „gloria" sind die Schlüsselbegriffe dieser Rede. Der für das Denken der Renaissance so bedeutsame Begriff der virtù schließt in sich Vornehmheit und Tapferkeit, Selbstbewußtsein und Stärke der Persönlichkeit. Doch während etwa für Machiavelli virtù Bedeutung nur als gleichsam öffentliche Kategorie hatte, als die Tugend, die einen starken Staat garantierte, ja in
66
Der Wandel der Lucifer-Gestdt im 16. und 17. Jh.
seinem Dienst überhaupt sich erst herstellte, gilt für Pluto virtù einzig in Bezug auf persönliche gloria. Es ist ein Ruhm, der sich nicht im Dienst einer Sache bewährt, sondern nur noch der Selbstbestätigung dient. Pluto spricht bezeichnenderweise nur über seine Niederlage im Himmel, erwähnt aber nicht, worum der Kampf überhaupt ging. Persönlicher Ruhm ist in ihm absolut gesetzt und wird zum Selbstzweck; vor der Glorifikation des einzelnen versinkt die Sorge ums Ganze. Darin wird Pluto zur Gegengestalt Gottfrieds von Bouillon. Scheint es zuerst, daß in beiden das heroische Ideal sich verwirkliche, so bleibt doch als alles entscheidender Unterschied, daß Gottfried seine ganze Kraft und Tapferkeit ad maiorem Dei gloriam einsetzt und eben deshalb wahren Ruhm sich erwirbt. Seine Sorge gilt der gemeinsamen Sache, nie der gloria um ihrer selbst willen, und gerade dies macht ihn zur Idealgestalt der virtù. Es sei daran erinnert, daß in „Gerusalemme liberata" immer dann Helden in Gefahr und Schwierigkeit geraten, wenn sie dem gemeinsamen Kampfesziel ihre persönlichen Interessen und Eitelkeiten voranstellen; zumal im RinaldoRoman hatte Tasso dies gezeigt. Der vollkommene Held ordnet sich völlig dem Ganzen unter und gewinnt darin seine Größe. Gottfried verkörpert das heroische Ideal des christlichen Epos, Plutos Heroismus dagegen ist der der antiken Epik, der über die Gestaltung der christlichen Helden seine schärfste Kritik empfängt. Wie schon die Darstellung von Hölle und Teufel völlig in der antiken Mythologie fundiert ist, so greift auch die Programmatik Plutos auf ein antikes Ideal zurück: das des Helden, dem die Bewahrung persönlicher Integrität und Ehre nodi über der gemeinsamen Sache höchstes Ziel ist. „What Tasso creates in Plutone is a spirit of ancient self-glorification and concern for „honor" in victory or revenge. ( . . . ) The talk of glory, of high enterprise, of remaining true to one's dignity though defeated is seen here as vainglory, a degraded and devalued heroism." 28 Es ist der Heroismus eines Achilleus, der, als er sich beleidigt wähnt, nicht mehr für die Griechen zu kämpfen bereit ist und erst, um seinen Freund Patroklos zu rächen, den Kampf wieder aufnimmt. Antrieb ist nicht das gemeinsame Ziel, sondern ein Selbstwertgefühl, das in christlicher Sicht hypertroph erscheinen muß. So formuliert sich in Plutos Heroismus die Selbstermächtigung einer Subjektivität, der alles Überindividuelle nur mehr als Restriktion des ihr eigenen gilt. Während im Christenheer menschliche Größe sich konstituiert aus dem völligen Einklang mit dem objektiv Gültigen, gestaltet sidi im Heroismus Plutos die Spannung des einzelnen, der nur auf das Seine sieht, zum Ganzen, das den einzelnen trägt und ihn einschränkt zugleich; der Versuch absoluter Selbstbestimmung tritt gegen das Schranken setzende Objektive. Freilich bleibt diese Gegnerschaft abstrakt; außer der erstrebten Macht, in der die Möglichkeit von Selbstbestimmung garantiert ist, nennt Pluto nichts, was an der göttlichen Ordnung ihn eingeengt habe, was falsch an ihr sei. Dies wiederum hängt mit dem zusammen, was den Kampf Plutos überhaupt erst zu einem heroischen macht: In Tassos nachts Judith A. Kates: The Revaluation of the Classical Heroic in Tasso and Milton. — In: Comparative Literature XXVI (1974) p. 308.
Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik
67
tridentinischer Dichtung erscheint die Ordnung der christlichen Kirche in ihrer Gültigkeit voll bestätigt. Gegenüber der gegenreformatorisch bestätigten Tadellosigkeit der katholischen Welt ist dem ausbrechenden Subjekt keine Chance gelassen; weil sie keinen Makel trägt, kann es sich nur völlig für oder gegen sie entscheiden. Plutos Heroismus entspringt deshalb der Selbsttäuschung: Come sia pur leggiera impresa (ahi stolto!) Il repugnare alla divina voglia: Stolto, ch'ai ciel si agguaglia, e in obblio pone Come di Dio la destra irata tuone. (IV/2)
Nirgends deutlicher als in dem doppelten „stolto" ist die Verbindlichkeit des Bestehenden betont, die nur dann zu bezweifeln ist, wenn verblendet die Ordnung in ihrer vollen Wirksamkeit nicht wahrgenommen wird. Der Vorwurf realitätsinadäquaten Verhaltens zielt dabei auf die, die im katholischen ordo aufgehoben zu sein sich weigern 29 . Lucifer, die Urgestalt der Rebellion im christlichen Mythos, wird post festum zum stärksten Beleg für die Gültigkeit des von ihm Bekämpften, und dies zumal dann, wenn, wie bei Tasso, das Widersacherische, das widerstreitend Subjektive, so wenig mit dem Objektiven vermittelt erscheint, daß es, als in seiner Devianz nirgends begründet, an das Gültige nicht zu rühren vermag. Doch auch für Tasso gilt, was schon an Tintoretto bemerkt wurde: Mag auch hinter der heroischen Geste Plutos nur die Schwäche des Subjektiven gegenüber der gültigen Ordnung sich verbergen, so verbirgt sich doch ebenso hinter der Akzentuierung von deren Verbindlichkeit die Bedrohung, die ihr im Subjektiven erwächst. Nur wenig Mittelalterliches also ist in die Gestaltung Plutos eingegangen, und noch seine abstrakte Gegnerschaft zu Gott entspricht nicht dem gestalterischen Dualismus des Mittelalters, sondern dem propagandistischen Effekt, der dem gegenreformatorischen Gedicht innewohnt. Marinos Bewunderung für Tasso ist ebenso bekannt wie die Unbefangenheit, mit der er aus fremden Texten übernahm oder sie plagiierte. So ist denn auch nicht verwunderlich, wenn in „La strage de gl'Innocenti" (postum 1632) einige Züge Plutos deutlich auf Tassos Gestaltung des Höllenrats als Quelle zurückverweisen; so werden des öfteren die roten Augen des Höllenfürsten genannt, die zudem noch — wie bei Tasso — an Kometen gemahnen: Gli sguardi obliqui e le pupille torte Sembran comete . . . (1/7) 30
Ebenso ist die Vermengung antiker Mythologie mit christlicher Lehre beibehalten, was freilich nach dem Tridentinum allein noch bei der Höllendarstellung unverfänglich war. Wie aber bei dem Dichter, dessen dichtungstheoretische Vorstellungen aufs engste mit den Begriffen meraviglia und novità sich ver29
Er zielt freilich zugleich auf die Türken, denen die Kraft der christlichen Welt entgegengehalten werden soll. (Unter dem Eindruck der Erfolge Suleimans des Prächtigen hatte Tasso seine Dichtung begonnen.) 30 Giovanbattista Marino: Dicerie sacre e La strage de gl'Innocenti. A cura di Giovanni Pozzi. — Turin 1960. (Deutsche Übersetzung im Anhang)
68
Der Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jh.
knüpfen 31 , nicht anders zu erwarten, widmet Marino seinem Pluto erheblich mehr Raum als Tasso 32 . Ganz anders als dieser läßt Marino die Gelegenheit nicht sich entgehen, bei der Beschreibung von Plutos Äußerem seiner Phantasie freien Lauf zu lassen, wobei eine Gestalt hervortritt, die in ihrer Außergewöhnlichkeit und Unnatürlichkeit gewiß Verwunderung und Überraschung zu erregen in der Lage ist. Sprach Tasso nur von einem gehörnten Haupt, so trägt Marinos Pluto gleich sieben Hörner, die zudem noch von Hydren geziert sind (ein Verweis auf die Siebenzahl der Kardinalsünden). In einen Mantel aus dunklen Flammen gehüllt, ist er an seinen brennenden Thron gefesselt, so daß er nur noch seine Flügel, die großen Segeln gleichen, auszubreiten vermag. Mit seinem Schwanz schlägt er sich den stählernen Leib, und drei Furien peitschen ihn mit Vipern und Dornen. Dies alles — und hier ist nur eine Auswahl gegeben — ist weniger „Maske des Mittelalters", wie Praz meinte, als vielmehr die um maximalen ästhetischen Reiz, nicht etwa um religiöse Wirkung bemühte Agglomeration von Gräßlichkeiten. Die Häufung von Abscheulichem unter dem Diktat der literarischen Mode ist Beweis von dessen freier Verfügbarkeit; nicht also geschieht — wie zuerst scheinen könnte — bei Marino der Rückgriff auf mittelalterliche Darstellungsweisen, sondern es zeigt sich gerade an der Widerstandslosigkeit, mit der das Groteske dem künstlerischen Programm sich fügt, die Auflösung der ehemals normativen Zuordnung des Abscheulichen und Häßlichen zum Bösen. Marinos perennierendes Schwelgen im Gräßlichen ist einzig möglich unter der Bedingung einer freien Verfügbarkeit seiner Darstellungsmittel; die Bemühung um den sensationalistischen Effekt degradiert ihr Material zur Beliebigkeit. Hugo Friedrich bemerkt anläßlich Marinos Vers „godere il bello, possedere il bene", in ihm sei die griechische Kalokagathie „ . . . völlig untergegangen. Denn das Gute bezeichnet hier keinen ethischen Wert, sondern ist ein Synonym für das sensuell Schöne." 33 Genauso wenig aber, wie das Schöne ans Gute gebunden bleibt, ist das Böse noch auf Häßlichkeit verpflichtet; die Summierung des Scheußlichen hat einzig den Reiz des überraschend Neuen zum Ziel und schlägt somit selbst um ins „sensuell Schöne". „Marino sucht das Neue wie ein Mathematiker . . . " 34: Hockes Satz akzentuiert aufs schärfste, daß die in der christlichen Kunst ehemals verbindliche Zuordnung des Ethischen zu bestimmten Erkennungsmustern einer Willkür artistischer Kombinatorik gewichen ist, der alles sprachliche Material als frei verfügbar gilt. Im kombinatorischen Verfahren aber, der demonstrativen Allgewalt des Autors über sein Thema, verrät sich nicht etwa die Mühelosigkeit, mit der sich der Mensch über das Böse erhebt, sondern gerade die Anstrengung, mit der er sich seiner zu erwehren trachtet, indem er es in Sprache bannt. Denn mit dem Verlust der 31
32
33
Vgl. dazu: James V. Mirollo: The Poet of the Marvelous. Giambattista Marino. — New York / London 1963. pp. 117ff. Bei Tasso spielen die ersten 18 Stanzen des 4. Gesanges in der Hölle (das Epos umfaßt 20 Gesänge); bei Marino sind es die ersten 47 des nur 415 Stanzen umfassenden Gedichts. Hugo Friedrich: Epochen der italienischen Lyrik. — Frankfurt 1964. p. 689. Gustav René Hocke: Manierismus in der Literatur. Sprach-Alchimie und esoterische Kombinationskunst. 5. Auflage. — Reinbek 1969. p. 111.
Psychologisierung
und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik
69
bruchlosen Zuordnung des Bösen zu einem inhuman Dämonischen geht seine Verlegung in die Psyche des einzelnen einher. Es wird damit viel stärker als persönliche Gefährdung empfunden, denn mit der Auflösung seiner außermenschlichen Objektivation gehen ebenso die Remedien verloren, die den wirksamsten Schutz versprachen. „Die Dämonen, vor denen sich die mittelalterlichen Menschen gefürchtet haben, rasen in den Abgrund, und mit ihnen das Kreuz, das gegen sie errichtet zu sein schien." 35 An die Stelle der Furcht vor den Dämonen tritt die Furcht des Menschen vor seinen Mitmenschen, ohne daß ein gleich wirksamer Ersatz für das schützende Kreuz zu finden ist. Die Vorliebe der Manieristen fürs Gräßliche bezeichnet den Versuch, des Bösen über seine Bannung in künstlerische Gestaltung habhaft zu werden, wobei seine mannigfachen Individuationen nur mehr der Reflex subjektiver Bewältigung sind. Nur so noch läßt sich die groteske Gestalt von Marinos Pluto verstehen; die Addition von Abscheulichkeiten ist gestalterisches Pendant der Bemühung, den bedrohlichen Abgrund in sich selbst auszuleuchten. Sie setzt die sich als Besonderheit reflektierende Individualität voraus; schon von daher ist der scheinbare Rückfall in mittelalterliche Gestaltungsformen ausgeschlossen. Während zudem in den mittelalterlichen Darstellungen der Dämonen deren Häßlichkeit eine Privation an Schönheit war, so wird im Manierismus die Häßlichkeit zu einer Modifikation des Schönen; das Verhältnis der beiden Extremformen des Scheins wandelt sich gleichsam von einem quantitativen in ein qualitatives. Das Häßliche aber als notwendiges Attribut des Schönen, als dessen differenzierendes Ingrediens, ist ästhetischer Reflex des Übergangs der ethischen Prinzipien Gut und Böse aus dem Numinosen ins Menschlich-Psychologische, in dem die Reinheit eines Nur-Guten oder Nur-Bösen relativiert ist unter der vielfältigen Bedingtheit menschlichen Handelns. Die psychologische Vertiefung der LuciferGestalt, die Marino im „Bethlehemitischen Kindermord" vornimmt, steht demnach keineswegs im Gegensatz zu deren groteskem Äußeren, vielmehr hat beides in der Entdämonisierung der Welt, letztlich also in der Auflösung des mittelalterlichen ordo und der Verbindlichkeit seiner Ethik seinen Grund. Bedeutete deren vorgegebene Entscheidung eine Entlastung, so ist jetzt die Konkurrenz ethischer Prinzipien in den einzelnen verlegt; die problematisch gewordene Weltordnung trägt ihren Zwiespalt ins Subjekt, das sich seiner künstlerisch in der demiurgischen Konstruktion, dem Versuch der Selbstbestätigung, zu erwehren trachtet, ohne dabei dodi den schwankenden Grund verleugnen zu können. Die Gestalt Plutos ist notwendig von dieser Problematik tingiert; ist von deren Psychologie die Rede, so dominieren in ihr Schwermut und Zweifel. Als „re di pianto", König des Weinens, wird Pluto in der 6. Stanze eingeführt, und in der 7. heißt es über seine Augen: Ne gli ocdii, ove mestizia alberga e morte . . .
Weiterhin: Iracondi, superbi e disperati Tuoni i gemiti son . . . (1/7) 35 Ernst Biodi: Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance. — Frankfurt 1972. p. 15.
70
Der Wandel der Lucifer-Gestalt
im 16. und 17. Jh.
Die Trauer ist physiognomisdi seinen Zügen eingeprägt: Mentre a machine nove alza l'ingegno, L'ombra del fosco cor stampa nel viso; Del viso l'ombra in quell'oscuro regno E d'interna mestizia espresso aviso . . .
(1/25)
Von Sorge gequält stöhnt er verzweifelt: Da queste cure stimolato e stretto, Un disperato ohimè svelse dal petto. — Ohimè — muggiando — ohimè — dicea . . .
(1/25-6)
Mit Marino beginnt die lange Reihe der schwermütigen Lucifer-Gestalten in der europäischen Literatur; die innere Qual und der Zwang zu beständiger Reflexion, die — wie beim Melancholiker — stets ums gleiche Thema kreist, finden sich hier ebenso wie der verdunkelte Glanz: Misero, e come il tuo splendor primiero Perdesti, o già di luce Angel più bello? (1/10)
Deshalb ist es geboten, gerade bei Marinos Pluto den Grund seiner Schwermut genau zu bestimmen. Dabei liegt sicherlich die entscheidende Ursache in seiner Degradation, dem Verlust der himmlischen Existenz, der Einbuße an Schönheit und Macht. Die Vollkommenheit einer verlorenen Wirklichkeit wird retrospektiv beständig aufs neue evoziert: Ah, non se' tu la creatura bella, Principe già de' fulguranti amori, Del matutino ciel la prima stella, La prima luce de gli alati cori? (1/30)
Der erinnerten Position höchster Machtfülle in einer in Schönheit geordneten Vergangenheit (freilich muß die modische Vorstellung eines Lucifer als „principe" leuchtender Eroten heute einigermaßen irritieren) steht eine real erfahrene Wirklichkeit gegenüber, deren Konstituentien Dunkelheit, Schmerz und Machtlosigkeit sind. Der Gegensatz ist von Marino aufs schärfste in einer kosmologischen Metapher gefaßt: Sieht sich Lucifer in Stanze 30 erinnernd als das hellste Himmelslicht (also den Mond), das — gemäß der kosmischen Ordnung — die Sterne überstrahlt, so kollidiert solche Erinnerung mit einer Gegenwart, in der die eigene Unzulänglichkeit gerade an der Ordnung erfahren wird, der er ehemals angehörte: Che non poss'io torre a natura il seggio E mutare a le stelle ordine e corso . . . (1/26)
Nicht zufällig beweist sich beispielhaft die Ohnmacht Plutos an der Unveränderlichkeit der Gesetze, nach denen die Himmelskörper sich bewegen: Denn auf ihnen ruht der schärfste theologische Vorbehalt. In die Zeit der Entstehung und Veröffentlichung des „Bethlehemitischen Kindermords" fallen die Auseinandersetzungen Galileis mit der Inquisition. Die Entfaltung der astronomischen Kenntnis hat in ihrer Konsequenz mit dem Sturz Lucifers zumindest dies gemein: Wie die Ausdehnung des menschlichen Wissens und die damit einher-
Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik
"] 1
gehende Machterweiterung des Menschen über die Natur erkauft ist mit der Destruktion des teleologischen Vertrauens, der Mensch also, der Illusion von Geborgenheit in der Welt beraubt, seiner tatsächlichen Machtlosigkeit über die Objektivität innewird, so folgt ebenso aus der Selbstermächtigung Lucifers, seinem Versuch, an die Stelle Gottes zu treten und die kosmischen Gesetze unter eigene Regie zu nehmen, der Verlust seines Ortes in der geordneten Schöpfung, so daß dem jetzt Vereinzelten das Ganze, aus dessen Beziehungen er sich löste, fremd und feindlich gegenübertritt. Damit soll nun nicht behauptet sein, daß Marinos Pluto-Gestalt eine unmittelbare Reaktion auf das sich durchsetzende kopernikanische System sei; ihre Trauer ist gewiß nicht die des Astronomen vor den Trümmern des ptolemäischen Weltbildes. Und doch ist die Schwermut Lucifers aufs engste mit der wissenschaftlichen Destruktion des ptolemäischen Systems verknüpft, denn mit ihr ist die Geschlossenheit des mittelalterlichen Weltbildes, die universale Ordnung, in der alles, vom Element bis zum Seraph, seinen fest zubemessenen Platz hatte, endgültig gesprengt. Seitdem selbst die Rangordnung der Planetensphären in Bewegung geriet, ist jeglicher gesellschaftlichen Ordnung die kosmische Versicherung genommen. Dies sowie die erregende Erkenntnis Giordano Brunos von der Unendlichkeit der Welt ließ den einzelnen erst seiner Besonderheit bewußt werden, wobei freilich die Individuation mit dem Gefühl der Depotenzierung angesichts einer unübersichtlich chaotischen Außenwelt erkauft ist. Vor diesem Hintergrund wird die Trauer Lucifers verständlich: Sie klagt um das verlorene Paradies, den Inbegriff der Geborgenheit in einer vollkommenen Weltordnung. Pluto idealisiert erinnernd eine geordnete Wirklichkeit; er führt Klage darum, daß er den ihm gebührenden Ort verlor und auf sich selbst zurückgeworfen ist. Dabei ist wichtig, daß er durchaus gesteht, selbst den Aufruhr angeführt zu haben, aber dem war eine Umkehr in der Himmelsordnung, die Erhebung des Menschen, die Erniedrigung der Engel, schon vorausgegangen: Volse a le forme sue semplici e prime Natura sovra alzar corporea e bassa, E de' membri del Ciel capo sublime Far di limo terrestre indegna massa. (1/28)
Nicht nur, daß das Böse einer Begründung bedarf, ist hier von Belang, sondern vor allem, daß Pluto sich selbst zum Anwalt der ehemals bestehenden Ordnung macht. Der Widerstand entzündet sich an der Veränderung; nicht also läßt sich ein abstrakter Gegensatz zwischen Lucifer und Gottes Schöpfung konstatieren, sondern ein gleichsam partikularer Widerstreit. Dem ersteren entspricht der Zorn von Tassos Pluto, dem zweiten aber die Schwermut bei Marino, die immer der Affekt der Vereinzelung und des Selbstbezugs ist. Plutos Trauer gilt nicht primär verlorener Schönheit oder Macht, sondern in ihr ist das Leid der Vereinzelung bei erinnerter, und das heißt möglicher, Geborgenheit im Ganzen bedeutet. (Zahlreich sind die literarischen Gestaltungen der Zeit, in denen Lucifer den Menschen verführt, um sich Gefährten im Leid zu schaffen.) Der Wunsch des trauernden Pluto aber, die Ordnung der Sterne aufzuheben, stellt in dieser Sicht sich dar als der Versuch, im Bewußtsein der Unwiderruflichkeit
72
Der Wandel der Lucifer-Gestalt
im 16. und 17. Jb.
des Falls die Möglichkeit von Geborgenheit überhaupt zu vernichten, um so dem qualvollen Gegensatz von Möglichkeit und Wirklichkeit ein Ende zu setzen. — Damit einher geht, daß Pluto nicht wie bei Tasso angesichts einer offenen Gefahr in schnellem Entschluß zu bestimmen vermag, was zu tun sei. Vielmehr ahnt er nur die Bedrohung, nervös reagiert er auf Symptome, wachsender Verdacht stimmt ihn zusehends besorgter und vergrößert seine Unsicherheit. Hilflos nimmt er ein großes Geschehen wahr, ohne es doch verstehen zu können, vor allem aber, ohne darauf angemessen reagieren zu können. Manches an seiner Gestalt läßt an Hamlet denken: Mit dem elisabethanischen „malcontent" teilt Pluto die Schwermut, die Erinnerung an verlorene Geborgenheit, die Entschlußlosigkeit und auch die Intellektualität 36 . So versucht er sich über Bibelexegese Klarheit zu verschaffen: Studia il gran libro, e de l'antiche carte Interpretar s'ingegna il senso oscuro . . .
(1/20)
Dem Vereinzelten bietet die Welt keine objektiven Deutungsmuster mehr, er ist aus der Sicherheit geregelter Verhaltensweisen entlassen und gezwungen, im disparaten Material einer unüberschaubaren Realität nach gültigen Orientierungspunkten für sein Handeln zu suchen. Plutos stets aufs neue erfahrene Unfähigkeit, die genau registrierten Stationen des vor seinen Augen sich abspielenden Heilsgeschehens sinnvoll aufeinander zu beziehen und die verstreuten Positionen in ihrer Zusammengehörigkeit als Teile eines Ganzen zu verstehen, bekundet paradigmatisch eine Realitätserfahrung, der die Herstellung einer geordneten Vorstellungsverbindung aufgrund der Widersprüchlichkeit der erfahrenen Wirklichkeit selbst nicht mehr gelingen kann. Liegt dem Ganzen ein Sinn zugrunde, so ist es allenfalls einer, der dem Verstehen der Geschöpfe sich entzieht. Questo la mente ancor dubbia gl'involve, Né ben de' suoi gran dubbi il nodo ei solve.
(1/24)
Der Trauer über den Verlust der alten Ordnung korrespondiert die Ungewißheit angesichts einer unverstandenen, weil zerfallenen Welt. Das Heilsgeschehen als Rebus, das der Teufel vergeblich zu lösen trachtet: Dahinter verbirgt sidi die Anstrengung des vereinzelten Individuums, in der Kontingenz der Wirklichkeit eine verborgene Ordnung zu entdecken, um so s idi selbst noch in sinnvollem Zusammenhang innerhalb der Totalität sehen zu können. Erst ein Künstler des Manierismus, der aus der überpersönlichen Normativität der Gestaltungsprinzipien in der Renaissance zu einem uneingeschränkten Individualismus sich befreit sah, konnte diese Lucifer-Gestalt schaffen, deren Leid und Zweifel die Schwierigkeiten der Identitätsfindung zu erkennen geben, mit denen solcher Individualismus bezahlt ist. Der Antagonismus zwisdien Subjektivität und Objektivität, so wie er in Tassos Pluto noch kenntlich war, ist 34 Man ziehe zum Vergleich die englische Übersetzung des „Sospetto d'Herode" von Richard Crashaw aus dem Jahre 1637 heran. Crashaws bedeutende Übertragung, die an künstlerischer Kraft Marinos Originaltext bei weitem übertrifft, läßt noch sdiärfer das Konzept des „malcontent" hervortreten.
Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik
73
in eine vielfältig gebrochene Beziehung gemildert; notwendig differenziert sich damit der abstrakte Heroismus von Tassos Pluto in eine komplexe Psychologie. Indem aber das Subjektive mit dem Objektiven vermittelt erscheint, ist zugleich die Konzeption einer Lucifer-Gestalt als Träger eines Nur-Bösen verhindert. Die Konstitution einer komplexen Psychologie assimiliert den Teufel seinem Instrument: dem Menschen. — Es liegt in der Konsequenz solcher Darstellung, daß Herodes, die zentrale Gestalt des Epos, als irdische Variante des Höllenfürsten erscheint, ja in seinen Aktionen und Reaktionen in offenbarer Parallelität zu Pluto gebildet ist. Dies betrifft zum einen so offensichtliche Gemeinsamkeiten wie die in beiden gestaltete Herrschaft eines grausamen, ungerechten Königs. Die Bezeichnungen Plutos sind hier eindeutig: „L'iniquo re de le tartaree grotte" (Argomento), „re di pianto" (6), „l'infernal tiranno" (9) 37 , ,,1'imperador de la tremenda corte" (47); und Herodes erscheint als „crudo re" (1) und „il re crudel" (50). Weit mehr noch tritt diese Parallelität in der gemeinsamen psychischen Befindlichkeit zutage, in der sich die beiden Herrscher aufgrund der ihnen aus gleicher Richtung drohenden Gefahr befinden: Herodes nimmt wie Pluto die auf ein großes Ereignis deutenden Zeichen wahr, gleich ihm versucht er, die disparaten Erscheinungen in sinnvolle Ordnung zu bringen, Zweifel quälen ihn, die Ungewißheit raubt ihm die Ruhe. So heißt es über Herodes: Già per mille profetici presagi Questo dubbio nel cor gli entrò da prima.
(1/63)
Gleiches war von Pluto gesagt: Volge fra sé gli oracoli e gli editti, E di sacri indovini e di Sibille. Osserva poi, vaticinati e scritti, Mille prodigi inusitati e mille; E mentre pensa e teme e si ricorda, L'andate cose a le presenti accorda.
(1/12)
Und wie Pluto ruft Herodes seinen Rat zusammen, um Maßnahmen gegen die Bedrohung zu erörtern; dessen Ergebnis ist der Bethlehemitische Kindermord, der dem 17. Jh., das ihn oft gestaltete, als ein Beispiel für die Wirksamkeit des Bösen in der Welt schlechthin galt. Angesichts solcher Entsprechungen erweist sich Herodes als der Stellvertreter des Teufels auf Erden, mehr noch: als dessen menschliche Gestalt. Die Humanisierung des Teufels geht einher mit der Diabolisierung des Menschen, der Böses tut. Indem in der Psychologisierung der Lucifer-Gestalt die endgültige Abkehr vom Konzept eines außermenschlich Dämonischen, dem alles Böse in der Welt sich verdankt, formuliert und stattdessen der Mensch selbst als Ursprung des Bösen erkannt ist, wird der Weg frei zur Gestaltung des abgrundtief bösen Menschen, der an die Stelle des 37
Pluto als Tyrann war schon der lateinischen Literatur geläufig; vgl. „Hercules furens", 718f.: hic vasto specu pendent tyranni limina . . .
74
Der Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jh.
Teufels zu treten vermag. Die Psychologisierung des Teufels ist Ausdruck der Bemühung um die Erklärung des Bösen als eines Resultats begründeten menschlichen Handelns: Nicht also ist Herodes dem Lucifer nachgebildet, sondern umgekehrt, der Höllenkönig trägt die Gestalt des irdischen Tyrannen. Gerade die Parallelität aber, in der beide zueinander stehen, läßt die Pluto-Gestalt in Marinos Epos überholt erscheinen: Der böse Tyrann ist auch ohne die Hilfe seines infernalischen Gegenstücks in der Lage, seinen grauenhaften Plan zu entwerfen und ins Werk zu setzen. Der Teufel wird vom teuflischen Menschen abgelöst. — So gibt es, als letzte Konsequenz dieses Wandels, schon in der Literatur des 17. Jhs das Erschrecken des Teufels vorm Menschen, von dem er sich im Bösen übertroffen sieht. Dafür seien einige Beispiele aus der englischen Literatur gegeben. So heißt es in Sir William Alexanders „Doomes-Day" (1614) über die im Jüngsten Gericht sichtbar gewordenen Sünden in der menschlichen Seele: So foule a forme, not Styχ it seife could make, As in mindes glasse the gazing soul doth see: The minde a fury, and the thoughts turn'd snakes, To sting the soule, hels ugly monster shakes.38
Neben Herodes galt der Hohepriester Kaiphas dem 17. Jh. als ein Paradigma des „teuflischen" Menschen. Staunend und neidvoll begegnet die Furie Tisiphone dem Priester in Robert Clarkes 1650 erschienenem lateinischen Epos „Christiados libri XVII e : At te quae Furiae, Caipha, quaeve agmina Averni Solicitant? saeve tibi tanta potentia fraudis, Tot scelerum facies, animo vis tanta nocendi, Ut fallax superes Èrebi genus. Ipsa minorem Tisiphone se laeta stupet, mixtaque superbii Invidia: ut cupidus laudis, lucrique magister Discipulis laetus plaudit, livetque, beati Quos rapidus vigor ingenii, aut labor improbus ipsi Praetulit. Ipse etiam picei Rex Lucifer Orci Vix Caiphae aequalem sese hac in parte ferebat: 39
In der Gestalt des Kaiphas ist die Grenze fließend zwischen Mensch und Teufel. Die äußeren Attribute des Bösen sind dabei belanglos geworden, die innere, verborgene Bösartigkeit, deren bequeme Erkennungszeichen verlorengingen, erweist sich als die einzig bedeutsame. Im Neid der Tisiphone dämmert, wie besonders der Vergleich mit dem übertroffenen Lehrer zeigt, die Furcht des Teufels vor der eigenen historischen Überholtheit. Kaiphas gehört zum Geschlecht der die Dramen des Barock und der englischen Renaissance bevölkernden Intriganten; deren auf geschicktem Trug beruhende Wirksamkeit ist einzig garantiert in der Aufhebung der Kalokagathie. Der böse Mensch verdrängt den Teu38 The Poetical Works of Sir William Alexander Earl of Stirling. Ed. L. E. Kastner and H. B. Charlton. Vol. II. The Non-Dramatic Works. — Edinburgh/London 1929. p. 295. 39 Robert Clarke: Christiados Libri XVII. Editio nova curante Aloysio Cassiano Walthierer. — Ingolstadt 1855. p. 55f. (Deutsche Übersetzung im Anhang.)
Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik
75
fei aus den Dramen; sdion Marlowes Menschenschlächter Tamburlaine ( 1 5 8 7 / 88) braucht sich moralische Skrupel nicht mehr von einem Teufel nehmen zu lassen. Richard III. ( 1 5 9 2 / 3 ) entschließt sich auf offener Bühne, das Böse zum Prinzip seines Handelns zu machen: „I am determined to prove a villain . . ( I / l ) Kein Teufel trieb oder verlockte ihn dazu; vielmehr ist die äußerste Intensität des Bösen dadurch glaubhaft gemacht, daß sie als pathogenetisch verankert erscheint. Shakespeare gibt Richard III. seine Mißgestalt nicht, um ihn als Bösen kenntlich zu machen, sondern um seine Bösartigkeit zu erklären. An die Stelle des Teufels tritt das unbefriedigte Liebebedürfnis des häßlichen Helden, das Böse als psychische Qualität erweist sich als unlösbar mit den Konditionen der Welt verknüpft. Erneut gerät in den Blick, was diese Gestaltungen von den mittelalterlichen unüberbrückbar trennt: Galt zwar auch dem Mittelalter die Wirklichkeit des Diesseits als höchst unvollkommen, so war doch die irdische Existenz in ihrer ganzen Unzulänglichkeit notwendiges Glied in der Totalität der göttlichen Weltordnung, irdisches Leid einerseits bedeutete nicht den Verlust der Geborgenheit andererseits. Mit dem Zusammenbruch des ordo aber läßt sich die defiziente Realität nicht mehr auf ein hinter ihr verborgenes metaphysisches Konzept hin interpretieren; der Mensch erfährt sich als Individualität, die ihr Handeln nicht mehr an einer verbindlichen Idealität, sondern allein noch an einer widersprüchlichen Wirklichkeit zu orientieren vermag. Die Eingrenzung des Bösen in einer Gestalt, deren es zur Rettung der Vollkommenheit des Ganzen bedurfte, geht damit verloren zugunsten einer unverstellten Erfahrung des Schlechten an der Wirklichkeit selbst. Nicht mehr streiten sich Engel und Teufel um die Seele des Menschen, sondern die individuelle Psychologie bildet sich in der Auseinandersetzung mit einer als unheilvoll erlittenen Realität, in deren Fehlern die Mängel und Schwächen der Seelen sich begründen. In den bedeutendsten Verbrechergestalten Shakespeares, Richard III., Macbeth, Jago, erscheint das Böse deshalb übergroß, weil in ihnen die objektiven Fehler der Welt sich verdichten; aber gerade weil dies so ist, wird ihnen immer ein Rest von Sympathie beim Zuschauer bleiben, denn eben dadurch sind sie subjektiv in nicht geringem Teil exkulpiert. Das Erschrecken des Teufels vor dem bösen Menschen ist letztlich ein Erschrecken vor dem üblen Zustand der Welt; nirgends ist dies deutlicher formuliert als bei Moscherosch, der ca. 1640, in der extremen Situation des 30jährigen Krieges, einen Teufel sein Entsetzen angesichts der menschlichen Wirklichkeit in dem Satz pointieren läßt: Zwar wahr ists, daß die Arme ihre Hölle genug auff der Welt haben, dann es ist so mit eudi, jeder Mansch ist fast des andern Teuffei offt mehr als der Teuffei selbsten, Homo homini lupus. Homo homini Diabolus/W
Darin sprach so sehr die allgemeine Erfahrung sich aus, daß schon wenige Jahrzehnte später Grimmelshausen in der „Verkehrten Welt" (1673) schreiben konnte: 40 Wunderlidie und warhafftige Gesichte Philanders von Sittewald, Das ist Straff-Schrifften Hanß-Michael Moscherosch von Wilstädt. — Hrsg. von Felix Bobertag. — Berlin/Stuttgart o . J . { = D N L 3 2 . ) p. 28.
76
Der Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jh. . . . daß das gemeine Sprichwort auf Erden nit durchaus erlogen / wann man nemlidi spricht: Es seye je ein Mensch der andern Teuffei . . . 4 i
Der Mensch als des Menschen Teufel, dies heißt nichts anderes, als daß das Böse in der Welt auf die Taten des Menschen selbst zurückgeführt, und der Höllenteufel ins mythische Abseits verwiesen ist. Es liegt in der Konsequenz dieses Gedankens, wenn historische Gestalten, deren Handeln als besonders unheilvoll empfunden wird, aus diesem Grunde teuflisch sich nennen lassen müssen. „Vermomde Lucifer", so betitelt Vondel — dies nur als ein Beispiel für die zahlreichen Verteufelungen in der offenen politischen Auseinandersetzung — 1649 Oliver Cromwell nach der Hinrichtung Karls I. 42 Vor allem den „divellish practises of Machiavilian Politicks", von denen Josuah Sylvester in einer Marginalie zu seiner berühmten Übertragung (1608) von du Bartas' „La sepmaine" spricht 43 , kam das Verdikt des Teuflischen zu; wie an diesen Praktiken besonders irritierte, was sie als paradigmatisch für das neuzeitliche Konzept des Bösen erscheinen läßt, daß sie nämlich im Verborgenen, ohne eindeutige Erkennungsmale vollzogen werden, so konnten sie damit zugleich die Funktion erfüllen, die dem Teufel bisher zukam: die Erklärung alles Bösen in der Welt aus einer gleichsam konspirativen Macht. Dies nun freilich nicht mehr im Blick auf eine dämonische Kraft, sondern, im Zeichen politischer wie religiöser Machtkämpfe, auf das unterirdische Wirken des konkret mit Namen zu nennenden Gegners. Beispielhaft ist hier die Polemik gegen die Jesuiten, denen Machiavellismus von der Gründung des Ordens an vorgeworfen wurde. Besonders in der englischen Literatur finden sich als Reaktion auf den Gunpowder Plot von 1605, bei dem die Wühlarbeit im Verborgenen — in des Wortes wahrster Bedeutung — abschließend ans Tageslicht kam, zahlreiche Satiren und Polemiken gegen die Jesuiten, in denen sie als Inkarnation des Teuflischen schlechthin erscheinen. Dabei ist die um 1611 entstandene, 1627 erschienene glänzende Satire „Locustae, vel Pietas Jesuítica" von Phineas Fletcher besonders lehrreich. Er bedient sich nämlich in seinem streng parallel aufgebauten Werk des literarisch in Mode gekommenen Motivs vom Höllenrat, um einer Versammlung im Tartarus, in welcher der um den Bestand seines Reiches fürchtende Satan vom Teufel Equivocus mit dem Hinweis auf die Jesuiten beruhigt wird, eine Ratssitzung des Papstes und seiner Kardinäle in Ή Grimmelshausen: Die verkehrte Welt. Hrsg. von Franz Günter Sieveke. — Tübingen 1973. p. 6. — Zur „Verkehrten Welt" vgl. die treffende Bemerkung Ulrich Stadlers: „Sündhaftes Diesseits und strafende Hölle werden zu zwei gleich strukturierten Bereichen. ( . . .) Während auf Erden die Sünder zu Teufeln werden, erweisen sich in der Hölle die Teufel als Verdammte." — Ulrich Stadler: Das Diesseits als Hölle: Sünde und Strafe in Grimmelshausens „Simplicianischen Schriften". — In: Gerhart Hoffmeister (Hrsg.): Europäische Tradition und deutscher Literaturbarock. Internationale Beiträge zum Problem von Uberlieferung und Umgestaltung. — Bern/München 1973. p. 359f. 42 Joost van den Vondel: Op den Vadermoord in Groot Britannie. — In: Vondel: Volledige Dichtwerken en oorspronkelijk Proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. Amsterdam 1937. p. 928. « Josuah Sylvester: Du Bartas His Divine Weekes and Workes. — In: The Complete Works of Josuah Sylvester. Ed. Alexander B. Grosart. Vol. 1. — New York 1967. p. 49.
Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik
77
Rom gegenüberzustellen, auf der der Jesuitengeneral, um den Erfolgen der Protestanten entgegenzuwirken, das Londoner Attentat in Vorschlag bringt. Dabei sind das Höllenpersonal und der römische Klerus in Rede und Gestalt völlig austauschbar geworden; mühelos ließen sich einzelne Stanzen aus ihrem Kontext nehmen und von Rom in die Hölle oder umgekehrt verpflanzen. Und wenn es in Formulierungen, die sich völlig der Tradition von Pluto-Gestaltungen verdanken, heißt: . . . a dusky cloud Hangs on his brow; his eyes fierce lightnings shroud, At length they heare it breake, and rore in thunders loud. 44
dann ist der Papst, nicht Lucifer gemeint. Demgemäß sind die Jesuiten „fleshly Devils" (V/3) genannt. Die Parallele allerdings geht nicht so weit, als daß nicht die Jesuiten die Teufel noch im Bösen übertreffen könnten. Erneut begegnet das Motiv des über die Bosheit des Menschen staunenden Teufels. Voll Neid stellt Equivocus fest, „That to my schollers I turne scholler in mine art." (II/26) Und nach der Rede des Jesuitengenerals wünscht er selbst Jesuit zu sein (IV/40). Auch das Erschrecken des Teufels vor dem Menschen bricht sich hier Bahn, deutlich bezeichnet als Angst um die eigene Daseinsberechtigung angesichts eines überlegenen Konkurrenten: Wären die Jesuiten in der Hölle, so Equivocus, „ . . . they, I feare, would hell command." (II/27) Was Equivocus nur fürchtet, läßt John Donne zur gleichen Zeit in seiner bedeutenden Prosasatire „Ignatius His Conclave" (1611) nahezu Wirklichkeit werden. Ignatius von Loyola, „ . . . more subtil than the Devili, and the verier Lucifer of the two . . . " 45, drängt sich Lucifer als Berater auf; als der Höllenfürst merkt, daß der überlegene Ratgeber ihm über den Kopf zu wachsen droht, weist er ihm den Platz neben seinem Thron an: „ . . . and gave him assistance, lest, if hee should forsake him, his owne seate might bee endangered." 46 In Donnes Satire führt der — imaginäre — Höllenfürst nur mehr ein Schattendasein neben dem — realen — Menschen als dem wirklicheren Lucifer; die Furcht des Teufels um seinen Thron ist anachronistisch, weil er vom Menschen längst im Bösen überflügelt ist. Die Konzentration des Bösen in einer historischen Gestalt freilich ist einzig möglich unter der Bedingung einer politischen wie ethischen Konkurrenz, in der die Kunst in den Dienst eines bestimmten Programms genommen wird, um so erneut in den gestalterischen Manichäismus zurückzufallen, der fürs Mittelalter bestimmend war. Der bedeutsame Unterschied zwischen der nichtautonomen Kunst des Mittelalters und der der Neuzeit liegt dabei darin, daß bei der ersteren dem Teufel alles das zugeordnet wird, was von einer allgemein verbindlichen christlichen Ethik als sündhaft diskreditiert ist, während in der zweiten einem oder mehreren Menschen, die für ein bestimmtes 44
45
46
Zitiert ist die umfänglichere englische Fassung aus dem gleichen Jahr 1627. — Phineas Fletcher: The Locusts, or Apollyonists. — In: Giles and Phineas Fletcher: Poetical Works. Ed. Frederick S. Boas. Vol. 1. — Cambridge 1970. pp. 125—186. (IV/6) John Donne: Ignatius his Conclave. — In: John Donne: Complete Verse and Selected Prose. Ed. John Hayward. — London 1967. pp. 355-^409. (Hier p. 372.) Donne, a. a. O., p. 407.
78
Der Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jb.
abgelehntes Programm stehen, die Attribute des Teufels beigelegt werden. Mit deren Vernichtung wäre dann konsequent ein Zustand irdischer Idealität garantiert. „Cast downe this second Lucifer to hell . . ( V / 3 8 ) , so fordert Phineas Fletcher den englischen König (nicht Gott) zum Kampf gegen Rom (nicht gegen den Teufel) auf. All dies hat in den Satiren und Pamphleten der Reformationszeit eine lange Tradition; schon auf dem letzten Blatt von Lucas Cranadis „Passional Christi und Antichristi" ( 1 5 2 1 ) ist der casus Luciferi zu einem casus Papae geworden: Kopfüber stürzt der Papst, mit Tiara und Ornat geschmückt, in die Flammen 4 7 . Eng sind die gestalterische Humanisierung des Teufels wie die Diabolisierung des Menschen mit den Flugschriften und Satiren des 16. Jhs verknüpft, zumal in ihnen die Divergenz ethischer Postulate und der Zwang zur Entscheidung, dem der einzelne unterlag, am schärfsten hervortraten. Wenn auf einem schon zu Ende des 15. Jhs in Paris gedruckten Flugblatt gegen Papst Alexander V I . unter der Überschrift „Ego sum Papa" eine halbmenschliche Teufelsgestalt abgebildet ist, die, in einen prachtvollen Ornat gehüllt, auf dem Kopf die flammende Tiara, in der linken Hand eine Forke hält, welches Teufelsinstrument den Krummstab ersetzt, so beläßt es die Darstellung völlig im Unentschiedenen, ob hier der Teufel zum Papst oder der Papst zum Teufel wurde 4 8 . Entscheidend ist, daß die künstlerische Teufelsgestaltung von der Verteufelung des jeweiligen politischen Gegners, seiner Diabolisierung in äußerer Erscheinung und Intensität des verkörperten Bösen, auch und gerade dann nicht unberührt bleiben konnte, wenn sie sich keinem politischen Programm verpflichtet sah. Denn in der polemischen Konzentration von Mensch und Teufel in einer Gestalt ist zugleich eine derart feste Verankerung des Bösen in den Konditionen der W e l t bedeutet, daß angesichts dessen jegliche Rückkehr zu den dämonischen Teufelsgestalten des Mittelalters die Gefahr einer Simplifizierung des komplexen Weltzustands in sich trug. Der Versuch einer Rettung der dämonischen Teufelsgestalt, wie ihn Dürer und Cranach zur gleichen Zeit besonders in den Blättern zum Martyrium des Heiligen Antonius über eine letzte Steigerung des Grotesken unternahmen, führte notwendig zu der Harmlosigkeit, mit der uns diese Wesen aus den Holzschnitten entgegengrinsen. Dieser aus der Konventionalität der Darstellungsform geborenen Harmlosigkeit aber entspricht objektiv, angesichts der in der Religionspolemik erreichten Darstellungsmittel, eine Verharmlosung des Bösen selbst. Dagegen ist die Diabolisierung des Gegners, so sehr sie die zu gestaltende Problematik verflacht, die avancierteste Darstellungsform des Bösen, indem sie entschieden die Abkehr vollzieht vom Konzept eines außermenschlichen Bösen und den Blick auch dann noch auf innerweltliche Verhältnisse freigibt, wenn sie in gleichem Schritt erneut ideologisch verstellt werden sollen. Nach der Projektion des Bösen in ein außermenschlich Dämonisches, nach der Psychologisierung Lucifers und nach der Furcht des Teufels vor dem bösen Menschen ist in der 47
48
Abb. in: Lucas Cranach d. Ä.: Das gesamte graphische Werk. Einleitung Johannes Jahn. — München 1972. p. 583. Abb. in: Ernst and Johanna Lehner (Ed.): Devils, Demons, Death and Damnation. — New York 1971. ( = Dover Pictorial Archive Series.) p. 156.
Psychologisierung und neuzeitliche
Subjektivitätsproblematik
79
politischen Diabolisierung die Stufe erreicht49, auf der der Mensch im Erschrecken vor dem Menschen einer rationalen Auseinandersetzung mit dem Bösen am nächsten gekommen ist. Sie ist hier gewiß noch nicht durchgeführt, aber weil in ihr nur noch vom Menschen und seinen Verhältnissen die Rede ist, weist sie am deutlichsten auf die Bedingungen des Bösen in der Welt. — Abgeschlossen sei unser kurzer Überblick über den historischen Wandel der Teufelsgestalt im 16. und 17. Jh. mit einem Exkurs über das damit sich verbindende Verständnis der Höllenqual. Mit der Psychologisierung der Teufelsgestalt mehren sich die Belege, in denen das Leid der Verdammten als durchaus innere Qual erscheint. Die Hölle wird in die Psyche des bestraften Sünders verlegt. Dies nun freilich hat einen weiten theologischen Hintergrund; schon im Neuen Testament meint die Dreigliederung von Himmel, Welt und Unterwelt „in Wirklichkeit einen Zustand von Gottesnähe oder Gottesferne", so daß die gottferne Existenz in der Unterwelt „zwar Lebenslosigkeit, Vernichtung, aber kein Nichtsein bedeutet." 50 Der Streit zwischen realistischer und metaphorischer Auffassung des Höllenfeuers durchzieht die gesamte Kirchengeschichte; das metaphorische Verständnis geht auf Orígenes zurück und wurde von Ambrosius, Hieronymus und Gregor von Nyssa vertreten, während Basileios, Gregor von Nazianz, Chrysostomos und Augustin auf der realistischen Auslegung beharrten 51 . Beides kommt zusammen in einer dogmatischen Bestimmung von Papst Innozenz III., daß die Höllenstrafe sowohl im Entzug der Gottesschau als auch in der körperlichen Qual bestehe, in poena damni und poena sensus. Dem metaphorischen Höllenverständnis kam zudem die von Thomas von Aquin vertretene Ansicht entgegen, daß dem Bösen keine eigene Wirklichkeit eigne, sondern daß es vielmehr in einem Mangel an Sein bestehe; von hier aus ist es bis zur Hölle als Privation nur ein Schritt52. Auf all dies sei hier nur kurz hingewiesen, um anzudeuten, daß das uns in diesem Zusammenhang interessierende Motiv vorbereitet ist durch eine lange theologische Auseinandersetzung. Die Psychologisierung des Bösen geht einher mit einer Psychologisierung der Bestrafung, die Hölle wird aus einer äußeren Schreckenslandschaft zur inneren Qual. Konzis ist beides, die böse Tat wie ihre Strafe, gefaßt im Motiv des Teufels, der die Hölle mit sich trägt. Es begegnet unseres Wissens ausschließlich (verständlich aus der Subjektivierung der Heilsgewißheit unabhängig von priesterlicher Vermittlung) bei protestantischen Autoren und hier zuerst bei solchen, die der Mystik nahestehen, in der schon von jeher die Teufelsgestalt spiritualisiert worden war. Valentin Weigel (1533—88), der protestantische Theosoph in der Tradition von Paracelsus und Tauler, leugnet im 14. und 49
Die letzten drei Stufen sind nicht im Sinne einer chronologischen Kontinuität, sondern unterschiedlicher Intensitätsgrade zu verstehen, so Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Bd. 3. 3. Auflage. — Tübingen 1959. Sp. 403. 51 Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 5. 2. Auflage. — Freiburg 1960. Sp. 447f. 52 „For Hell is the privation of Heaven, and were there no joy, ease, and pleasure, there could be known no sorrow, pain, and Torment . . . " So merkt, in popularisierender Manier, Samuel Pordage (1633—91?) zu seiner Darstellung des Engelsturzes an. — Samuel Pordage Armiger: Mundorum Explicatio or, The Explanation of an Hieroglyphical Figure ( . . . ) Being a Sacred Poem. — London 1661. p. 108.
Der Wandel der Lucifer-Gestdt im 16. und 17. Jh.
80
15. Kapitel seiner Schrift „Ein nützliches Tractätlein Vom Ort der Welt" die Örtlichkeit von Himmel und Hölle. Einfältig seien die, die an eine Hölle von Flammen glaubten; vielmehr gelte dies: Ein jeder treget die Helle bey sich vnter den Verdampten / also ein jeder treget den Himmel bey sich vnter den Heiligen. 5 '
Lucifere Gefängnis, die Hölle, sei die erzwungene Existenz in den vier Elementen; nach der Erfahrung des himmlischen Lichts könne es größere Pein gar nicht geben. Weigel folgert: Lucifer . . . wird seine Helle vnd Verdamniß in jhm selber tragen / gleidi wie audi die andern Verdampten / vnd werden also mit einander gequelet werden von Ewigkeit zu Ewigkeit.54
Gleiches findet sich, wie mit Fug zu erwarten, dann später bei Jakob Böhme. 1619 schreibt er in seinem Werk „De tribus principiis, oder Beschreibung der Drey Principien Göttliches Wesens" als § 36 des 4. Kapitels über Lucifer wie folgt: Alhier, lieber Leser, thue deine Augen des Gemüths auf, und wisse, daß keine andere Quaal ihn quälen wird als seine eigen Quaal in ihme: denn das ist seine Hölle, daraus er geschaffen und gemacht ist; und das Licht GOttes ist seine ewige Schande, darum ist er GOttes Feind, daß er nicht mehr im Lichte GOttes ist.55
Befreit vom Gedankengut der Mystik und Theosophie findet das gleiche Höllenverständnis Eingang in poetische Texte. Dabei ist das metaphorische Verständnis der Höllenqual als eines inneren Leids vorbereitet durch den Gedanken der Privation: Leid aus Gottferne. So heißt es in dem berühmten Hexameron „La Sepmaine ou Creation du Monde" (1578) des Hugenotten Du Bartas (1544—90) bei der Schilderung des Engelsturzes: Mais luy, qui n'est iamais desarmé de tonnerres, Contre les boute-feux des sacrileges guerres, Les precipite en l'air, ou bien es lieux plus bas: Car l'enfer est par tout où l'Eternel n'est pas.56
Daß die Hölle überall dort sei, wo Gott nicht ist, läßt sich in doppeltem Sinne verstehen. Zum einen, dort, wo Böses geschieht, ist die Hölle. Dies klingt bei Sir William Alexander an, wiederum auf den Engelsturz bezogen: „Their conscience fir'd, who doe from God rebell, „Hell first is plac'd in them, then they in hell.57 53 Valentin Weigel: Ein nützliches Tractätlein Vom Ort der Welt. Hrsg. von Will-Erich Peuckert. — Stuttgart/Bad Cannstatt 1962. ( = Sämtliche Schriften. Bd. 1.) p.52. 5t Weigel, a. a. O., p. 55. 55 Jacob Böhme: Sämtliche Schriften. Faksimile-Neudruck der Ausgabe von 1730 in elf Bänden. Neu hrsg. von Will-Erich Peuckert. Bd. 2. — Stuttgart 1960. p. 37. 56 Guillaume de Saluste Sieur Du Bartas: La Sepmaine ou Creation du Monde. Kritischer Text der Ausgabe von 1581 hrsg. von Kurt Reichenberger. — Tübingen 1963. ( = Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie. 107. Heft.) p. 24. (1/567—70) 57 Alexander, a. a. O., p. 21.
Psychologisierung und neuzeitliche
Subjektivitätsproblematik
81
Zum zweiten: Die Hölle ist identisch mit der Gottferne. Dies steht nodi bei Marlowe hinter der Antwort des Mephistophilis auf die Frage des Faust, wo die Hölle sei. Seine Verse muten nachgerade wie eine Übertragung der Weigelschen Argumentation an: Within the bowels of these elements, Where we are tortur'd and remaine for euer. Hell hath no limits, nor is circumscrib'd In one selfe place, for where we are is hell, And where hell is, must we euer be: And to conclude, when all the world dissolues, And euery creature shalbe purified, All places shall be hell that is not heauen.58
Für beide Interpretationen gilt, daß die Hölle, ihre Bosheit wie ihre Qual, in der Psyche des Bösen ihren Ort hat. Galt bisher die physische Marter in der Hölle als der größte Schmerz, so erweist sich jetzt das psychische Leid ihr an Intensität überlegen. Joseph Beaumont läßt in seiner riesenhaften Allegorie „Psyche, or Love's Mystery" (1648) Satan angesichts des in die Hölle hinabgestiegenen Christus so empfinden: He sees the angry Thorns, and feels them pricking His guilty Soul: he sees each cruel Nail, And in his harder heart resents them sticking: He shrinks; he winds about his woful Tail; He starts, and finds that something more than Hell Did now in his tormented bosom dwell.59
Gleich wie der Teufel auf dem Wege der Psychologisierung seiner Gestalt und der parallel sich entwickelnden Möglichkeit zur Diabolisierung des bösen Menschen zur schwächeren Verkörperung des Bösen sich wandelt, so erweist sich die nicht-metaphorische Vorstellung einer Höllenstrafe aus ewigem Brennen, Sieden und Stechen als harmlos angesichts der im Sünder sich aufgipfelnden inneren Martern, der Gewissensqualen, wie sie zumal dem puritanischen England so vertraut waren. Die Stiche, die Satans Herz und Seele beim Anblick der Marterwerkzeuge treffen, sind rein spiritual; ihre Qual übertrifft die der Hölle, weil sie, was die physische Marter nicht vermochte, den Kern der Persönlichkeit trifft, die mühsam sich bewahrende Subjektivität, deren Eigenes, erneut in der Konfiguration des objektiv Geforderten aufzulösen trachtet. Im inneren Schmerz äußert sich der Widerstreit der im Bösen extrem gewordenen Subjektivierung gegen ihre Einengung aufs geforderte Maß. Nicht Reue ist zu diesem Schmerz fähig (einen reuigen Lucifer wird man in den hier zitierten Gestaltungen nicht finden), in der das unbotmäßig Eigene bereitwillig preisgegeben ist, sondern allein hypertrophe Subjektivität, die, obgleich sie um die Unmög58
59
Christopher Marlowe: The tragicall Historie of Doctor Faustus. — In: The Works of Christopher Marlowe. Ed. C. F. Tucker Brooke. — Oxford 1969. p. 163. (551—8) Joseph Beaumont: Psyche, or Love's Mystery, In XXIV Cantos: Displaying the Intercourse Betwixt Christ, and the Soul. — In: The Complete Poems of Dr. Joseph Beaumont. (1615—1699). Ed. Alexander B. Grosart. In Two Volumes. — New York 1967. Vol. 2, p. 58. (XV/58)
82
Oer Wandel der Lucifer-Gestdt im 16. und 17. Jh.
lichkeit ihrer Realisierung gegen das Objektive weiß, sich selbst zu bewahren bemüht ist. Subjektivität, die unter sich selbst leidet, dies ist der Kern von Lucifers Schmerz; die innere Hölle des Teufels wird zum negativen Gegenbild entlasteten Aufgehens in einer idealisierten Übersubjektivität. Am deutlichsten wird dies in Miltons „Paradise Lost" (1667) zu Beginn des 4. Buches; nachdem Lucifer die „reale" Hölle verlassen hat, erleidet er die innere beim Anblick Edens: . . . horror and doubt distract His troubled thoughts, and from the bottom stir The hell within him, for within him hell He brings, and round about him, nor from hell One step no more than from himself can fly By change of place. Now conscience wakes despair That slumbered, wakes the bitter memory Of what he was, what is, and what must be Worse; of worse deeds worse sufferings must ensue. Sometimes towards Eden which now in his view Lay pleasant, his grieved look he fixes sad, Sometimes towards heav'n and the full-blazing sun . . .
Es ist bedeutsam, daß erst der Blick auf das Paradies die innere Hölle entzündet; der Garten Eden steht für die Geborgenheit in der Idealität schlechthin, steht für die Vermittlung zwischen Subjektivem und Objektivem ohne einen Bruch zwischen beidem. Sein Anblick löst Selbstreflexion aus; an ihm erfährt Lucifer sich in seiner Eigenart, in der Unverträglichkeit seines Besonderen mit der Vollkommenheit sowohl des Himmels, den er verlor, als auch des Paradieses, das ihm verschlossen ist. Milton führt in dieser Szene Lucifer in völliger Vereinzelung und Isolation vor; um so schärfer tritt in dem folgenden großen Monolog sein hypertrophes Ich hervor, dessen Elemente Hybris, Machtdurst, superbia ihm den Eintritt in die Ideallandschaften verwehren. Hier läßt Milton Lucifer selbst über die innere Hölle Klage führen: Me miserable! which way shall I fly Infinite wrath, and infinite despair? Whidi way I fly is hell; myself am hell; And in the lowest deep a lower deep Still threat'ning to devour me opens wide, To which the hell I suffer seems a heav'n. O then at last relent: is there no place Left for repentance, none for pardon left? None left but by submission; and that word Disdain forbids me . . . 4 1
Unterwerfung ist der einzige Ausweg, der aus der Hölle führt, also die Einbuße an Eigenart zugunsten einer Eingliederung ins Ganze. Die innere Hölle ist der Preis, mit dem die Bewahrung von Subjektivität erkauft ist. So wird zum 60 John Milton: Poetical Works. Ed. Douglas Bush. — London/Oxford 1973. p. 275. (IV/18—29) «ι Milton, a. a. Ο., p. 276. (IV/73—82)
Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik
83
einen die Exklusivität, die jeglichem Subjektiven eignet, als Schmerz erfahren; zum anderen aber beweist sich darin, daß Lucifer der Qual sich nicht ergibt, die Kraft des subjektiven Prinzips. Es schließt sich der Kreis, der mit der Interpretation von Gemälden Lottos und Tintorettos begann: Die Angst des aus dem Himmel vertriebenen Lucifer bei Lotto, die Schwermut des Christus versuchenden Lucifer bei Tintoretto, die quälende Ungewißheit des auf dem Höllenthron regierenden Lucifer bei Marino, der innere Schmerz des vor dem Paradies reflektierenden Lucifer bei Milton, all dies beschreibt die Leiden neuzeitlicher Subjektivität angesichts eines übermächtig Objektiven, das historisch mit ihr nicht mehr zum Einklang zu finden vermag. Die mit dem Zusammenbruch des mittelalterlichen ordo erfolgte Freisetzung sich selbst reflektierender Eigenart findet in Lucifer ihre negative Gestalt. Nicht mehr ist der gefallene Engel die Konzentration des Lasterkatalogs in einer Figur, sondern die Gestalt gewordene Dissonanz zwischen Welt und einzelnem, die um ihre Unwiderrufbarkeit sicher weiß 62 .
Anhang ') Torquato Tasso's befreites Jerusalem. Ubersetzt von Karl Streckfuß. Leipzig 1822. p. 61. Und Tag' und Stunden sollten wir verträumen? Und nidit entflammt' uns würd'ge Sorge jetzt? Der Christ in Asien, und wir sollten säumen, Indeß er dort sidi täglich fester setzt? Judäa unterjocht? In weitern Räumen Deß Ruhm verbreitet, der uns schwer verletzt? (...) Den Zoll der Seelen sollten wir verlieren, Und Pluto sollt' im leeren Reich regieren? p. 63. Die Augen giftig roth, der Blick ein Licht, Gleich unheilbringenden Kometen blinkend; (...) So öffnet er, gleich einem tiefen Schlund, Gefärbt von schwarzem Blute, seinen Mund. Wie wenn dem Aetna Sdiwefeldünst' entquellen, Mit Flammen und Gestank und Donnerhall, So dringt aus grausem Mund der Qualm der Höllen Mit seinem Hauch und dunkler Flammen Schwall. (...) Als dieses Wort die schwarze Luft erschüttert: p. 63. Vermengt, verwirrt der Formen vielerlei In Ungeheuern, nie gesehn und neu. p. 65. Götter des Orcus, würdiger, zu wohnen Jenseit der Sonn' in euerm Vaterland, Die einst mit mir aus glücklicheren Zonen Der große Fall in dies Verlies gebannt! (...) 62
Dies im Unterschied zur Gestaltung des Sündenfalls, in der das „paradise lost" immer nur als Vorstufe des „paradise regained" gilt.
84
Oer Wandel der Lucifer-Gestalt im 16. und 17. Jh. Er stürzt' uns von des Tages heitrer Pracht, Vom Sonnen-Gold, vom hellen Sternenleben, In dieser Schluchten schauerliche Nacht, Und Keiner soll nach altem Ruhme streben, p. 65. Ha, nicht sey's wahr, daß je der alte Muth Aus unsrer Brust, und jene Kraft entrinne, Als wir mit Stahl umgürtet und mit Gluth Gestürmt des himmlisdien Palastes Zinne. Zwar, ich bekenn's, besiegt ward unser Muth, Doch fehlte nicht die Kraft dem großen Sinne. S i e freuten sich des Sieges und Gewinns, U n s blieb der Ruhm des unbesiegten Sinns, p. 67. Als wäre Gottes Schlüssen — o des Thoren! — Zu widerstehn solch eine leichte That! Des armen Thoren, mit dem Herrn sich messend, Und alle Donner seines Zorns vergessend! B. H. Brockes: Verteutschter Bethlehemitischer Kinder-Mord des Ritters Marino, nebst des Hrn. Uebersetzers eigenen Werken (...). Vierte, aufs neue übersehene und verbesserte Auflage. — Hamburg 1734. p. 67. Ihr schieler trüber Stral, und sein verdreht Gesicht Sehn Schreck-Cometen gleich . . . p. 69. In Augen, drin der Tod und ewigs Trauren s i t z e t . . . . . . sein frech Geseufz ist gleich, So wie sein Hauch dem Blitz, des wilden Donners Krachen, p. 70. Als er nun ferner dacht' auf neue Schelmerey; Sah man auf seiner Stirn des Herzens trübe Schatten, Die, wann sie sich darauf mit seinen Augen gatten, Der Holl' ein Zeichen sind, daß er recht traurig sey: Von Sorgen angespornt, dacht' er dem Jammer nach, Und riß aus seiner Brust ein ganz verzweifelnd Ach! Adi! rief er brüllend: Ach! was ists das ich erblicke? Armsel'ger, wer hat dich aus deinem Sitz getrieben? Wo ist dein schöner Glanz, gewes'ner Engel, blieben? Ach warst du vormals nicht die schönste Creatur, Der Liebes-Engel Fürst, ihr Oberster und Meister? Der heitern Himmels-Burg ihr schönster Morgen-Stern? Das allerhellste Lidit der allerreinsten Geister? Ach mögt' ich die Natur aus ihrem Sitze setzen, Und ändern des Gestirns so lang gewohnten Lauf! p. 71. GOTT wollt' ein' irdische verworfne Creatur Weit mehr, als sein zuerst gemacht Geschöpf erheben, Und allen Himmlisdien ein Oberhaupt, so nur Von ungeschlachtem Thon, von Kot und Erde, geben: p. 72. Dieß recht zu überlegen, Nimmt er das grosse Buch, die ält'ste Schrift, zur Hand, Und sudi't im dundclen Sinn den wahren Wort-Verstand. Dieß alles, wie es ihn in Zweifelmut gebracht, Verwirrte seinen Geist, indem ers wollt' ergründen, Daß er durchaus sich nicht könnt' aus dem Zweifel finden, p. 73. Der Argwohn war schon längst in seinen Kopf gekommen, Aus der Propheten Schrift.
Psychologisierung und neuzeitliche Subjektivitätsproblematik Was die berufenen Sibyllen vorgestellt, Was die Oraculen und Seher prophezei'n: Er fand, was längst gemeld't von tausend Wunderwerken, Die fremd und ungewohnt, in seinen Áugen scheinen: Und, um den rechten Grund durch Dencken zu bemerken, Sudi't er die alte Zeit mit dieser zu vereinen. 3 ) Robert Klarke: Die Christiade. Metrisch übersetzt von Aloys Kassian Walthierer. Ingolstadt 1853. Welche Furien jedoch, welch Schaaren der Hölle dich stacheln, Kaiphas? Du hast so große Gewalt blutdürstenden Truges, So viel Laster im Blick, im Geist solch Gierde zu schaden, Daß du noch übertriffst das Gezücht des Erebus. Staunend Freut sich Tisiphone, daß sie geringer als du; zu dem Staunen Mischet sich Neid, wie der Meister, gewinn- und lobesbegierig, Freudig die Schüler lobt und zugleich beneidet, die rascher Geist, unverdrossene Müh' und unermüdliche Thatkraft Ihm vorzog. Selbst Luzifer hält, des qualmenden Orkus König, sich kaum gleich in diesem Stücke dem Kaiphas . . . (III/169—178, p. 55f.)
JOOST VAN DEN VONDEL: LUCIFER. TREURSPEL.
Der Himmel als Staat Geloofd zij God; de Staat hier boven is veranderd. Joost van den Vondel: Lucifer. Ay me, they little know How dearly I abide that boast so vain, Under what torments inwardly I groan; While they adore me on the throne of hell, With diadem and scepter high advanced, The lower still I fall, only supreme In misery; sudi joy ambition finds.1
Alles, was dem deutschen Trauerspiel des Barode am Tyrannen bedeutsam war, findet sich in diesem Satz, den Satan in seinem großen Monolog vor Eden spricht, konzentriert: superbia, die sich vermessen zu schwankender Höhe aufschwingt, um sich alsbald im tiefen Sturz verurteilt zu finden; das Mißverhältnis zwischen der unausmeßlichen Machtfülle und der Kreatürlichkeit dessen, der sie zu verwalten als unvermögend sich erweist 2 ; das melancholische Sinnen des Fürsten, in dem vor dem Empfinden der eigenen Unzulänglichkeit Macht und Würde als bedeutungslos versinken. Und doch hat das deutsche barocke Trauerspiel diesen Stoff, der so sehr seiner Idee entsprach, nie zu bearbeiten unternommen, wie überhaupt der deutsche Barock aus dem Lucifer-Mythos, im Unterschied etwa zur gleichzeitigen englischen Literatur, im Unterschied vor allem zu den Dramen Calderone3, nur höchst wenig zu machen verstand. Wie wenig, mag daraus zu ersehen sein, daß seine bedeutendsten Bearbeitungen in den ungefügen Spielen des Johann Klaj, im „Engel- und Drachen-Streit" (ca. 1649/50) und audi in der „Höllen- und Himmelfahrt Jesu Christi" (1644), vorliegen. Deutlicher noch ist, daß in Michael Bergmanns „Deutschem Aerarium John Milton: Paradise Lost. — In: Milton: Poetical Works. Ed. Douglas Bush, — London/Oxford 1973. p. 277. (IV/86—92) 2 „Tyrann und Märtyrer sind im Barode die Janushäupter des Gekrönten." — Walter Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels. — Frankfurt 1972. p. 60. — Heinrich Mann schrieb über den Tyrann Hitler: „Seine tief gefühlte Minderwertigkeit liegt im aussichtslosen Kampf mit seinem Größenwahn. Keine äußeren Sdiladiten entscheiden diese geheime. Hitler lebt meistens depressiv." — Heinrich Mann: Ein Zeitalter wird besichtigt. — Berlin 1947. p. 350. 3 Zur Lucifergestalt bei Calderón vgl. Ursula Müller: Die Gestalt Luzifers in der Dichtung vom Barock bis zur Romantik. — Phil. Diss. Gießen 1940. (Kap. 3: „Calderons Fronleidinamsspiele", pp. 23—32.) 1
88
Joost van den Vendei · Lucifer. Treurspel.
Poeticum", dieser umfänglichen Sammlung von Metaphern und „poetischen Redensarten", zum Stichwort Lucifer nur dies sich findet: Lucifer / der Engel. Das Haubt und Glantz des Engelischen Chors / so schändlich ist gefallen. Aut. Der Höllen König. Id.·»
Die beiden Belege stammen von des Autors eigener Hand, woraus zu schließen ist, daß unter der Menge der poetischen Texte, die Bergmann nach Beispielen durchgesehen hatte, keine Gestaltung des Engelsturzes sich fand. Ganz anders dagegen das Stichwort „Teuflei" : Auf zwei Seiten ist alles an negativen Epitheta versammelt, wessen der Autor nur habhaft werden konnte; zudem sind zahlreiche „poetische Namen" aus Opitz, Harsdörffer und Luther gegeben. Gleiches gilt vom Abschnitt „Von der Höllen" (pp. 175—184): Da findet zu jeder Furie sich weit mehr zitiert als das wenige, das Bergmann zu Lucifer sich notierte. Hölle und Teufel also bleiben dem deutschen Barock ein bedeutsames Thema 5 , Lucifer aber, das mythische Urbild der superbia und mahnendes exemplum allen Hoffärtigen, fand keinen Autor, der der Größe des Themas sich gewachsen gezeigt hätte. Im Gegenteil, das Motiv des Engelsturzes wird zum Gegenstand schlüpfriger Concetti: Lucifer. Es nennte einer seine Liebste den Luciferum, weil sie gefallen / wie der schöne Morgenstern.6
Diese „ergötzliche Hofrede" erschien Harsdörffer offensichtlich so geistreich, daß er sie gleich ein weiteres Mal in seine Sammlung aufnahm: Lucifer: Dirne. Es vergliche einer seiner Liebste mit dem Lucifer / sagend / es ist gefallen der schöne Morgenstern etc.7
Es kann nicht erstaunen, wenn sich Gleiches audi bei Logau findet: Keuschheit. Die Keuschheit macht / daß Weiber werden Zu klaren Engeln auff der Erden: Doch ist es so gar seltsam nie Manch Lucifer steckt auch allhie.8 * Michael Bergmann: Deutsches Aerarium Poeticum oder Poetische Schatz-Kammer / in sidi haltende Poetische Nahmen / Redens-Arthen und Beschreibungen (...). Zum andern Mahl in Drude gegeben (...). — Landsberg 1675. p. 106. 5 „In einem geistlichen Schauspiel war eine Höllenszene kaum zu entbehren, ebenso wie jede bessere Oper einmal den Schauplatz in die Unterwelt verlegte." — Richard Alewyn / Karl Sälzle: Das große Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste in Dokument und Deutung. — Hamburg 1959. p. 52. Vgl. auch den Bericht über „II Pomo d'oro" (Wien 1668), p. 115f. 6 Georg Philipp Harsdörffer: Ars Apophthegmatica, Das ist: Kunstquellen Dendcwürdiger Lehrsprüche und Ergötzlicher Hofreden; (...) in Drey Tausend Exempeln (...). — Nürnberg 1655. p. 254. (Nr. 1155) 7 Harsdörffer, a. a. O., p. 477. (Nr. 2268) 8 Friedrich von Logau: Deutscher Sinn-Getichte Drey Tausend. Drei Teile in einem Band. — Hildesheim / New York 1972. ( = Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Breslau 1654.) Bd. 1, p. 229. (Nr. 956)
Der Himmel als Staat
89
Oder, in der gleichen Tonart: Auß Gutem Böses. Viel böses kümt gegangen vielmal auß guten Spuren; Auß Engeln worden Teuffei / auß Jungfern werden Huren.'
Die Mahnstruktur des christlichen Mythos ist aufgehoben in frivolen Sentenzen, die ihr Einverständnis mit den beschriebenen Vorgängen kaum mehr zu verbergen trachten, ohne dabei jedoch die Gestik des Warnenden abzulegen. In solchem Kontext doppelter Moral erweisen sich die scheinbar um Ernsthaftigkeit bemühten Verse als der Konvention verpflichtete Beispiele poetischer Professionalität: Hoffart / Hochfahrt. Als Lucifer fuhr gar zu hoch Da fuhr er ab ins Höllen-Lodi: Was gar zu hoch wird umgekahrt Und Hochfahrt wird zur Niederfahrt.
Rasch und routiniert ist Logau mit seiner Lehre bei der Hand, um die selbst es ihm kaum noch zu tun ist, wohl aber um deren geistreiche Darbietung. Dies alles ist weit entfernt von dem tiefen religiösen Ernst, mit dem Daniel von Czepko zu gleicher Zeit (1655) das barocke Grundthema des Sturzes aus Hoffart am Beispiel Lucifers in mystischer Verinnerlichung gestaltet: Hoffarth. Mensch, wie du fällst, so fiel auch Lucifer vor dir, Du gehst: Wo her? Von Gott. Wohin? Zu dir und mir.H
So ließen sich noch verschiedene Belege für eine gelegentliche Bearbeitung des Lucifer-Mythos beibringen, deren Häufung aber nur den Eindruck verstärken müßte, daß er im deutschen Barock eine marginale Rolle spielte. Hinzu kommt, daß in Deutschland die Anzahl biblischer Trauerspiele nur gering blieb 12 ; Gryphius' Übertragung von Vondels „Gebroeders" und Hallmanns „Mariamne" sind noch die bedeutendsten. Wird aber in den zahlreichen Trauerspielen, deren Stoff aus der römischen oder byzantinischen Geschichte genommen ist, ein Sinnbild menschlicher Hoffart gegeben, dann durfte es nicht dem christlichen Mythos entstammen. BOMILC. Er kan sich / grosser Fürst / an Syphax Falle spiegeln. MASIN. Er fiel / weil er zu hoch stieg / mit den Hodimuths-Flügeln.13 9 Logau, a. a. O., Zugabe zu Bd. 3, p. 195. (Nr. 22) 10 Logau, a. a. O., Bd. 2, p. 89. (Nr. 454) H Daniel von Czepko: Sexcenta Monodisticha Sapientium. — In: Daniel von Czepko: Geistliche Schriften. Hrsg. von Werner Mildi. — Breslau 1930. p. 222. 12 Masen etwa trug Bedenken gegen biblische Stoffe, „ . . . weil sie im Endertrag des Handlungsverlaufes festliegen, gleichsam geheiligt sind, also die stark betonte Wirkungsforderung der Überraschung bzw. Spannung nicht erfüllen können." — Bruno Markwardt: Geschichte der deutschen Poetik. Bd. 1. Barock und Frühaufklärung. Dritte, unveränderte Auflage. — Berlin 1964. p. 115. υ Daniel Casper von Lohenstein: Cleopatra. Sophonisbe. Hrsg. von Wilhelm Voßkamp. — Reinbek 1968. p. 155. (Sophonisbe, III/5f.)
90
Joost van den Vondel · Lucifer. Treurspel.
Die Sentenz, mit der in Lohensteins „Sophonisbe" Masinissa die Warnung seines Vertrauten bequem pariert, meint Ikarus, das antike Urbild verderblichen Hochmuts, dessen stürzende Gestalt dem Barock zum Emblem „der todbringenden Hybris" wurde 1 4 . Ikarus gehört in den Kreis der antiken „Himmelsstürmer", die Hendrick Goltzius 1588 in seinen berühmten Stichen nach Gemälden des Cornells Cornelisz aus Haarlem gestaltete: Tantalus, Ikarus, Phaeton, Ixion. Sie alle, als unbekleidete Ganzfiguren im Sturz dargestellt, gleichen in Haltung und Reaktion dem stürzenden Lucifer auf Lottos Bild. Unter ihnen vermögen vor allem Phaeton und Ikarus aufgrund der mythischen Konstellationen, in denen sie stehen, als Warnbilder von superbia an die Stelle Lucifere zu treten (schon Marino hatte Lucifer einen Phaeton genannt). Der bedeutende Einfluß der Antike wie die Bemühung um demonstrative Gelehrsamkeit ließen die deutschen Barockautoren bevorzugt auf diese beiden, nicht aber auf Lucifer zurückgreifen, wenn es die Verderblichkeit von superbia exemplarisch vorzuführen galt 1 5 . „Faëton of Reukeloze stoutheid" heißt auch eines der späten (1663) Trauerspiele Joost van den Vondels, in dessen Werk das barocke Thema der superbia an hervorragender Stelle sich behandelt findet. Drei seiner Trauerspiele haben exemplarische Gestalten bestrafter Hoffart zu Titelfiguren, deren zwei dem griechischen Mythos entstammen. Dem „Faëton" war 1657 der „Salmoneus" vorangegangen, das Trauerspiel des vermessenen Königs von Elis, der sich als Jupiter anbeten ließ und vom Blitz erschlagen wurde. Noch vor diesen beiden jedoch entstand das Trauerspiel „Lucifer" (1654), das als einziges im 17. Jh. den hoffärtigen Engel zur Titelgestalt hat. Alle drei bieten exempla der gleichen Sünde und sind thematisch eng miteinander verknüpft. Dem „Lucifer" steht als Motto ein Vers aus der „Aeneis" ( V I / 5 9 4 ) voran: Praecipitemque immani turbine adegit.
Soll hiermit auf den Fall Lucifers verwiesen werden, so meint jedoch der Vers im Kontext der „Aeneis" (Vondel gibt die Fundstelle nicht an) die Bestrafung des Salmoneus. Dem barocken Trauerspiel war es nicht um die individuellen Züge, sondern ums Exemplarische zu tun. Als Proben aber aufs gleiche Exempel sind Lucifer und Salmoneus homolog, wobei solche Gleichwertigkeit bis ins Bühnentechnische reicht, wovon die Entstehungsgeschichte des „Salmoneus" Kunde gibt: Vondel hat das Stüde geschrieben, damit die Schouwburg ihre für die Aufführungen des „Lucifer" angeschafften kostspieligen Apparaturen nach dessen Aufführungsverbot trotzdem nutzbringend einsetzen konnte. Die Strafe des einen gilt so in gleicher Weise für das Vergehen des anderen; dem Blick aufs Albrecht Sdiöne: Emblematik und Drama im Zeitalter des Barode. — München 1964. p. 135. 15 Julius Rütsch vermag seine Behauptungen, der Barock beginne Lucifer „ . . . zum Gleichnis seines Menschlichen zu madien . . . " , und Lucifer sei „ . . . als Mythus die barockchristliche Entsprechung zum antiken Mythus von Narziss", nicht mit Hilfe eines deutschen Beispiels zu stützen; Kronzeugen sind einzig Milton und Vondel. — Julius Rütsch: Das dramatische Ich im deutschen Barock-Theater. — Horgen-Zürich/Leipzig 1932. ( = Wege zur Dichtung. Hrsg. von Emil Ermatinger. Bd. X I I . ) p. 127. 14
Der Himmel als Staat
91
Exemplarische ordnen sich Vergehen und Strafe, Hochmut und Sturz, zur gesetzmäßigen Beziehung. — Die lange Reihe der historischen Gestalten, an denen das Trauerspiel sein großes Thema, den Sturz des Erhabenen, stets aufs neue variierte, ist von Vondel in den Mythos hinein verlängert. Während der Mythos den barocken Trauerspielen in deren „ . . . Auffassung vom Repräsentativen der persönlichen Katastrophe ihrer Helden" 16 durchaus entgegenkam, drohte jedoch zugleich durchs mythische Sujet ihr „Zeugniswert" verlorenzugehen, denn dieser ist allein in der historischen Faktizität des Gestalteten garantiert 17 . Dem liegt konstitutiv zugrunde das Verständnis des geschichtlichen Geschehens als eines Trauerspiels auf der Bühne der Welt. De wereld is een speeltoneel, Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.'s
Dieser berühmte Vers Vondels (1637), der die Schouwburg, das neugegründete Amsterdamer Theater, schmückt, schlägt die Brücke zwischen dem historischen Ablauf und seiner exemplarischen Darstellung auf der Bühne. Die Regeln des innerweltlichen Rollenspiels, wie sie im Prozeß der Geschichte immer wieder sich bestätigt finden, gewinnen im Trauerspiel ihre gültige, damit lehrhafte Gestalt. Diese Zusammenhänge hat die Theorie des Trauerspiels reflektiert; bei Vondel findet sie sich in der Vorrede ( „Berecht" ) zum „Salmoneus" : De toneelkunst wijst aan wat eerlijk, wat sdiandelijk luidt. De treurstijl, die allerhoogst op geluk en ongeluk der Groten draaft, arbeidt om de mensen week in den boezem te maken; schildert de hartstochten naar het leven af, leert, naar voorvallende gelegenheid, den toom des Staats vieren of aanhalen, en elk zieh zadit aan een anders ongeluk spiegelen. Zij beeldt levendig de wijsheid uit, die in deftige voorbeelden, uit de historiën getrokken, bestaat; want in de historien ziet men gedurig het rad van avonture draaien, en hoe de mensen hier met elkanderen omspringen.19
Aufs engste ist die Wirkabsicht der Stücke an ihren Vorwurf gebunden; einzig am Tatsächlichen des Historischen lassen die Gesetze irdischer Existenz sich erfahren. Geschichte erscheint als Kontinuum des Unglücks historischer Einzelwesen, in dem das Schicksal dessen, der aus ihr nicht sich belehren lassen will, tausendfach präfiguriert ist. Deshalb zählt am Schicksalsrad nicht der Aufschwung, sondern in des anderen Unglück hat — nach Vondels Wort — der Zuschauer sich zu spiegeln. — Nun zeigt freilich schon die Tatsache, daß Vondel seine Theorie in der Vorrede zu einem Trauerspiel entwickelt, dessen Gegenstand nach modernem Verständnis eindeutig dem Mythos angehört, daß der Begriff „historiën" keineswegs in der Bezeichnung der Summe aller in der menschlichen Entwicklungsgeschichte sich vollziehenden tatsächlichen Begeben16 Helmut Arntzen: Von Trauerspielen. Gottsched, Gryphius, Büchner. — In: Rezeption und Produktion. Zwischen 1570 und 1730. Festschrift für Günther Weydt zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Wolfdietrich Rasch, Hans Geulen und Klaus Haberkamm. — Bern/München 1972. p. 576. 17 Schöne, a. a. O., p. 223. i ' Vondel: Volledige diditwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. — Amsterdam 1937. p. 951. 19 Vondel, Werken, a. a. O., p. 379.
92
Joost van den Vendei · Lucifer. Treurspel.
heiten sich erschöpft, von der ein wie immer geartetes Mythisches abzuheben wäre, dessen überlieferte Inhalte im Unterschied zur historischen Faktizität gleichsam der urkundlichen Beglaubigung ermangeln. Eine Unterscheidung in dieser Form wird vom Barocktheoretiker nicht vollzogen; nicht zwischen Mythischem und Geschichtlichem, wohl aber zwischen Überliefertem und Erfundenem liegt die Trennungslinie. Dergestalt besteht zwischen den Stoffen des „Gysbrecht van Aemstel" oder der „Maria Stuart", als den in alten oder jüngsten Annalen verbürgten historischen Sujets, und des „Salmoneus", dem von der „Aeneis" überlieferten Mythos, kein fürs Trauerspiel bedeutsamer qualitativer Unterschied: Ihr „Zeugniswert", von dem Schöne spricht, ist allemal darin gesichert, daß sie als bedeutende, also schon als exempla überliefert sind. Dies gilt in besonderem Maße von den biblischen Stoffen, an denen schon deshalb die Trennung zwischen Mythischem und Historischem sich nicht bewährt, weil Geschichte und Heilsgeschichte dem Barock identisch waren. Die Geschehnisse um Josef, David und Samson vermögen darum dem Trauerspiel als Vorwurf zu dienen, weil sie für Vondel in gleichem Maße, ja aufgrund der spezifischen Dignität seiner Quelle, des Alten Testaments, weit stärker noch historisch verbürgt sind als die Ereignisse etwa der römischen Geschichte. Es sind Geschichtsdramen, die vom „geluk en ongeluk der Groten" nicht anders handeln als die, denen historische Geschehnisse zugrundeliegen, deren Zeitgenosse Vondel noch war (so etwa beim Trauerspiel „Zungehin of Ondergang der Sinese heerschappije"). Gleiches gilt von den biblischen Themen, die dem heutigen Leser als Inbegriff des Mythischen schlechthin erscheinen, weil sie in keiner Weise mehr an historischer Faktizität partizipieren (wie das Paradies und der Sündenfall), oder weil die Mythenbildung selbst dem philologischen Interesse in ihren einzelnen Stufen sich erschloß, was gerade an Lucifer gelang. Deshalb darf „Adam in Ballingschap" (1664) „aller treurspelen treurspel" heißen: Der Sündenfall, an dessen Tatsächlichkeit Vondels Quelle, die Genesis, keinen Zweifel erlaubte, ist zudem als erste Station der Heilsgeschichte von überragender Bedeutung. Die Beglaubigung des Dargestellten, die etwa bei Lohensteins Dramen ein umfangreicher Fundus von Anmerkungen übernahm, gewährleistet zugleich eine dem Trauerspiel vorangestellte ausführliche Abhandlung, in der alles zusammengestellt ist, was als gesicherte Information über den Sündenfall gelten durfte: „Berecht betreffende den Staat van den eersten mense, voor en na den val, en enige omstandigheden omtrent deze stof." Dabei wird auf die Autoren der Patristik in eben der Weise zurückgegriffen, wie bei den Geschichtsdramen beispielsweise die Historiker der Antike zu zitieren sind. Es ist der Versuch einer Rekonstruktion des Mythos zur Geschichte; die Menge der Belege von der Hand anerkannter Autoren garantiert ihm die Faktizität eines historischen Datums. Dessen Gestalt anzunehmen erlaubt das gleiche Verfahren auch dem Lucifer-Mythos, dessen Tatsächlichkeit noch unvergleichlich weniger als die des Sündenfalls, dem immerhin ein Kapitel der Bibel gewidmet ist, in eindeutigen Textbelegen sich bestätigt findet. Vondel bemüht daher in seiner umfänglichen Vorrede („Berecht aan alle kunstgenoten, en begunstigers der toneelspelen" ) die wichtigsten Bibelzitate, aus denen auf den Engelsturz
Der Himmel als Staat
93
geschlossen wurde, ebenso wie die Kirchenväter, um so „enen diamanten schild" zu errichten gegen „ . . . de pijlen der ongelovigen, die de zekerheid van der Geesten afval zouden durven in twijfel trekken." 20 Die Anhäufung zitierter Autoritäten von höchster Dignität dient also nicht der Unterstützung einer Lehrmeinung, sondern zielt auf die Demonstration eines überprüfbar Geschichtlichen, dem zur Sicherung seiner feststellbaren Wirklichkeit post festum die urkundliche Bestätigung nachgeliefert wird. Die nachgewiesene Tatsächlichkeit des Engelsturzes, faktisch die Umgestaltung des Mythos in Geschichte, erschließt die Lucifergestalt als eine exemplarisch-lehrhafte fürs Trauerspiel21. Bedingung der Lehrhaftigkeit des Dargestellten ist die prinzipielle Gleichartigkeit der im Trauerspiel gestalteten Weltgesetze mit denen, die vom Zuschauer alltäglich erfahren werden; Geschichte bzw. Heilsgeschichte dient dem Trauerspiel deshalb zum Vorwurf, weil die Geschehnisse der Welt selbst im Barock als Trauerspiel erfahren werden. Die Öffnung des ungeschichtlichen Mythos auf Geschichte vermag im Trauerspiel nur so sich zu vollziehen, daß die Wirklichkeit des Autors ihre Strukturen im Mythischen nachbildet, wenn anders ihm Lehrhaftigkeit zukommen soll. Stärker noch also als die Dramatisierung des historischen Sujets prägt die des Mythos dem die eigene geschichtliche Konstellation ein, weil sie zugleich ihn als historischen zu konstituieren als auch auf die eigene Situation transparent zu machen hat. Wie jegliche Arbeit am Mythos notwendig die eigene historische Erfahrung in ihn einbringt 22 , so verlangt die Form des Trauerspiels selbst eine Strukturierung des gestalteten Mythos nach den Gesetzen der historischen Wirklichkeit. Eben dies ist am „Lucifer" nachzuweisen. — Dies nun freilich darf nicht zu der Ansicht verführen, Vondel habe in seinem „Lucifer" ein politisches Schlüsseldrama23 geschaffen, in dem Ereignisse der jüngsten niederländischen Geschichte in mythischer Gestalt wiederkehren. So war er 1625 in seinem Trauerspiel „Palamedes of Vermoorde onnozelheid" verfahren; die Geschehnisse um die Hinrichtung Joan van Oldenbarnevelds lagen dem so deutlich zugrunde, daß spätere Ausgaben dazu übergingen, in der Liste der dramatis personae hinter die Namen der Bühnenfiguren in Klammern die ihrer historischen Vorbilder zu setzen. Gleiches hatte eine positivistisch orientierte Vondel-Forschung in den letzten Jahrzehnten des 19. Jhs am „Luci20
21
22
23
Der „Lucifer" ist zitiert nach der kommentierten Ausgabe: Joost van den Vondel: Lucifer. Treurspel. Ed. W. J. M. A. Asselbergs. Vierde druk. — Culemborg 1973. p. 26. In weldi enger Beziehung die Faktizität des Stoffes mit der Wirkmöglichkeit gesehen wurde, bestätigt Markwardt anläßlich Lohensteins: „Die Eindringlichkeit und Nadihaltigkeit der Wirkung hofft man zu verstärken, wenn man dergestalt die Wirklichkeitsbeziehung zum historischen Geschehen herstellt. In diesem Sinne erwartet man von der Stützung durch historische Daten nicht nur einen Bildungszuwachs, sondern mittelbar audi einen Wirkungszuwachs." — Markwardt, a. a. O., p. 179. Der „new deal" in Thomas Manns Josephs-Roman ist hierfür nur ein häufig zitiertes, weil unmittelbar evidentes Beispiel. In der niederländischen und angelsächsischen Vondel-Literatur begegnet hierfür häufig der Begriff der „politischen Allegorie", der hier in Anbetracht der Problematik des AllegorieBegriffs im 17. Jh. verwirren muß.
94
Joost van den Vendei · Lucifer. Treurspel.
fer" unternommen; häufig bestanden die Interpretationen nur mehr im Versuch einer Rüdeübersetzung des gestalteten Mythos in ein historisches Geschehen, das ihm unmittelbar als Vorlage zugrundegelegen haben soll 24 . Wie sehr auch solche Untersuchungen an der Spezifität künstlerischer Gestaltung vorbeizielen mögen, so bieten sie dodi zugleich einen deutlichen Hinweis darauf, in welchem Ausmaß der Mythos im Trauerspiel dem gleichzeitigen Weltgeschehen sich anzugleichen vermochte. Die Rekonstruktion des Mythischen geschieht im Zeichen der Erfahrungen des Autors, so daß der gestaltete Mythos zur Präfiguration der erlebten Geschichte wird. Es mag also durchaus ein bestimmtes Ereignis Anlaß zur Entstehung des Trauerspiels gewesen sein; weil es ihm aber immer um das Exemplarische der dargestellten Situation zu tun war, begnügt es sich nicht mit der Reflexion dieses Einzelfalls, an dem selbst ja der Autor des Barode schon Beispielhaftes sehen mußte, wenn er von ihm sich zur Abfassung eines Trauerspiels genötigt sah. Mühelos läßt sich deshalb das Lucifer-Trauerspiel auf eine Reihe historischer Ereignisse beziehen, die vor und während seiner Entstehungszeit (Beginn der Arbeit um 1648, erschienen 1654) Aufsehen erregten: die Verbannung der Maria von Medici aus Brüssel auf Betreiben Richelieus (1638); die Ermordung des Sultans Ibrahim auf Anordnung seiner Mutter; der Angriff Willems II. von Oranien auf Amsterdam (1650); die Hinrichtung Charles'I. (1649); die Nachlässigkeit der christlichen Fürsten, die Kreta den Türken überließen (bis 1645 konnten die Venezianer die Insel behaupten); überhaupt die aggressive Politik des türkischen Reiches 25. Begonnen wurde die Arbeit an dem Trauerspiel in dem Jahr, als der Dreißigjährige Krieg, der den Aufstieg und Fall so vieler Fürsten erlebt hatte (das berühmteste Beispiel ist Wallenstein), zu Ende ging. Gemeinsam ist diesen Ereignissen, daß in ihnen das Glück und Unglück der Großen mittelbar oder unmittelbar mit der problematisch gewordenen Legitimität von Herrschaft verbunden erscheint. In den Kriegen hatten zahlreiche Fürsten ihre seit Jahrhunderten angestammten Gebiete entweder völlig oder zum Teil eingebüßt; andere konnten ihren Machtbereich ausdehnen auf Regionen, auf die sie nie einen Rechtstitel besessen hatten, sondern die ihnen einzig das Kriegsglüdc zusprach. Im Konflikt zwischen Maria von Medici und Richelieu erlebte die Zeit, wie die Königin-Mutter und ehemalige Regentin von Frankreich vom ersten Minister, dem sie als ihrem Günstling einstmals zum Aufstieg verholfen hatte, im Dienste des absoluten Staates, der sich zur Befestigung seiner Macht rigoros über überkommene Rechtsverhältnisse hinwegsetzte, vertreiben lassen mußte. Völlig anders die Situation in den Niederlanden: Willem II. scheiterte in seinem Versuch, mit militärischer Gewalt seine Macht als Statthalter der Nieder-
24
So etwa Alexander Baumgartner: Joost van den Vondel, sein Leben und seine Werke. Ein Bild aus der Niederländischen Literaturgeschichte. — Freiburg i. Br. 1882, pp. 215—8, der die Geschehnisse um Willem II. von Oranien im „Lucifer" gestaltet sieht. 25 Diese Beispiele in: W. A. P. Smit: Van Pascha tot Noah. Een verkenning van Vondels drama's naar continuiteit en ontwikkeling in hun grondmotief en struetuur. Deel II: Salomon — Koning Edipus. — Zwolle 1959. p. 58f.
Der Himmel als Staat
95
lande über das ihm rechtlich zukommende Maß zu vergrößern, an der Kraft des erstarkten Bürgertums. Die ständisch geordneten Städte widerstritten erfolgreich einer Zentralisierung der Macht im Sinne einer absoluten Regentschaft. Am schärfsten jedoch kollidieren die Widersprüche der Zeit in England: Die Auseinandersetzungen zwischen Parlament und König, zwischen Republik und absoluter Monarchie, die in der Hinrichtung Charles' I. gipfelten, ließen wie kein Ereignis sonst die Legitimitätsproblematik bisher fraglos akzeptierter Herrschaft ins Bewußtsein treten. Nichts weist deutlicher auf die im Widerspruch zwischen feudaler Hierarchie und bürgerlichem Besitz-Individualismus begründete Verschärfung der Souveränitätsproblematik als die innerhalb weniger Jahrzehnte entstandenen bedeutenden staatstheoretischen Entwürfe, in denen die Notwendigkeit der Neubegründung von Herrschaft ihren Ausdruck findet: 1625 erscheint Hugo Grotius' Werk „De jure belli ac pads", 1642 „De cive" von Thomas Hobbes, 1651 der „Leviathan" als abschließende Fassung der Hobbesschen Staatstheorie, 1667 verfaßt John Locke den „Essay Concerning Toleration", 1670 erscheint Spinozas „Tractatus theologico-politicus" und 1672 „De jure naturae et gentium" von Samuel von Pufendorf. Dies sind nur die bedeutendsten jener Werke, die in Vondels Lebensjahren entstanden; eine Fülle von weiteren Schriften wäre zu nennen, wollte man das ganze Ausmaß der staatsphilosophischen Diskussion sichtbar machen. Und keineswegs konvergieren diese Schriften in einer gemeinsamen Zielrichtung: Wenn noch Hobbes' Leviathan sowohl ein republikanischer als auch ein absoluter Staat sein kann, trägt schon Lockes Argumentation deutlich republikanische Züge, während in Pufendorfs Werk besonders der Absolutismus theoretisches Rüstzeug findet. So wenig sie aber in ihren politischen Intentionen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind, so deutlich liegt ihnen als gemeinsame Problematik der Konflikt des — zumal in England und in den Niederlanden — ökonomisch prosperierenden, individuell wirtschaftenden Bürgertums mit den es einengenden feudalen Herrschaftsverhältnissen zugrunde; Republik und absoluter Staat sind dabei nur unterschiedliche Lösungsformen des gleichen Problems. In welchem Ausmaß Vondel diesen Auseinandersetzungen mit einem theoretischen Interesse folgte, davon ist wenig bekannt; als enger Freund des Hugo Grotius kannte er selbstverständlich auch dessen juristische Hauptwerke genau, wie er überhaupt zeitlebens zu Rechtsgelehrten engen Kontakt hielt; den Namen des Thomas Hobbes wird man dagegen vergeblich in seinem umfangreichen Werk suchen, wobei jedoch höchst unwahrscheinlich ist, daß ihm dessen Schriften, die zu den meistdiskutierten ihrer Zeit gehörten und die immerhin auch in Amsterdam verlegt wurden (so 1649 „De cive"), völlig unbekannt geblieben sind 26 . Wie dem auch sei, Vondels theoretische Einsicht ist hier von weit geringerer Bedeutung als seine mannigfach belegte Teilhabe am öffentlichen Leben der Zeit: als für die Belange seiner Stadt und seines Landes engagierter Bürger zum einen, als Stadtdichter Amsterdams zum anderen, vor allem aber 26 J(osephus) Vandervelden: Staat en recht bij Vondel. — Haarlem 1939. p. 69.
96
Joost van den Vendei · Lucifer. Treurspel.
als ein das politische Weltgeschehen sorgfältig beobachtender Autor. Dabei ist der Blick über die Grenzen der Niederlande hinaus nur die andere Seite der festen Verankerung im öffentlichen Leben der Stadt Amsterdam; mochte deren Ordnung auch durchaus noch ständisch sein, so waren doch gerade darin die Abläufe der Entscheidungsbefugnisse so genau reguliert, daß der Bürger, der — mit welch geringer Befugnis auch — an ihnen teilhatte, schon immer als öffentliche Person, als homo politicus, sich empfand. Der — bis zum Bankrott seines Sohnes — keineswegs unvermögende Kaufmann Vondel ist in seinen Überzeugungen entscheidend von der ständischen Struktur seiner Stadt geprägt; in gleicher Weise untrennbar von den bürgerlichen Ordnungsvorstellungen ist sein Selbstverständnis als Autor. Als auf Unabhängigkeit und Prosperität der Stadt und damit auf deren innere Sicherheit und Ordnung verpflichteter Bürger gewährt er seiner Kunst niemals die Exklusivität manieristisch-verspielter Zweckfreiheit, und über religiöse und ethische Lehrhaftigkeit hinaus ist, ungleich mehr als bei seinen deutschen Zeitgenossen, das prodesse seiner Kunst allemal schon als politisches intendiert. Der Reflexion auf die soziale Gemeinschaft entzieht sich keine der Formen, mag sie auch, wie etwa das Hochzeitsgedicht, völlig in Konventionalität verfallen sein, oder, wie das Trauerspiel, oberhalb politischer Aktualität die immer gültigen Gesetze irdischer Existenz gestalten. So wird für Vondel das Hochzeitsgedicht zum sozialen Gedicht schlechthin, weil es mit der Familie das Fundament der Sozialordnung besingt 27 ; das Trauerspiel dagegen lehre, so lautet die Formulierung aus der Vorrede zum „Salmoneus", „nach sich ereignender Gelegenheit die Zügel des Staates zu lockern oder anzuziehen". Die künstlerische Bemühung verbindet sich dem Bürger unlöslich mit der Sorge um die Gemeinschaft, um sozial verantwortliches Handeln. — Das Trauerspiel „Lucifer" bildet hier keine Ausnahme; die Widmung an Kaiser Ferdinand III. verdankt sich nicht dem Bestreben, mit dessen Namen die Reputation seines Autors zu heben 28 , vielmehr ist mit dem Kaiser diejenige politische Instanz angesprochen, der in der derzeitigen politischen Lage die Lehre des Stückes am entschiedensten gilt, weil sie die wirksamsten organisatorischen Konsequenzen aus ihr zu ziehen vermag. Zum „Spiegel van alle ondankbare staatzuchtigen" sei Lucifer auf die Bühne gebracht: Op dit rampzalige voorbeeld van Lucifer, den Aartsengel, en eerst heerlijksten boven alle Engelen, volgden sedert, bijkans alle eeuwen door, de wederspannige geweldenaars, waarvan oude en jonge historiën getuigen, en tonen hoe geweld, doortraptheid, en listige aanslagen der ongerechtigen, met glimp en schijn van wettigheid vermomd, ijdel en kraditeloos zijn, 20 lang Gods Voorzienigheid de geheiligde Machten en Stammen handhaaft, tot rust en veiligheid van allerhande Staten, die, zonder een wettig Opperhoofd, in gene burgerlijke gemeenschap kunnen bestaan; waarom Gods Orakel zelf, den 27 Vandervelden, a. a. O., p. 27. 2 8 Die Widmung an den Kaiser sticht von Vondels sonstiger Praxis deutlich ab; verschiedenen seiner Trauerspiele sind Widmungen an Einzelpersönlichkeiten nicht vorangestellt, ansonsten widmete er in seinen früheren Jahren die Trauerspiele bevorzugt Dichtern und Gelehrten, später dann den Bürgermeistern und Räten Amsterdams.
Der Himmel als Staat
97
menselijken gesladite ten beste, deze Mogendheid, als zijn eige, in enen adem, bevestigt, gebiedende Gode en den Keizer elk hun recht te geven. 29
Weil das Christenreich, so fährt sinngemäß Vondel fort, gleich einem Schiff in stürmischer See, von den Türken bestürmt werde, sei ihm innere Eintracht vonnöten, und die könne einzig ein starker Kaiser garantieren. Der Widmung liegt also eine politische Intention zugrunde, die sich präzise formulieren läßt: Angesichts eines starken äußeren Feindes soll der Kaiser die auseinanderstrebenden Teile seines Reiches zusammenhalten, die innere Ordnung befestigen, kurz: die Zügel des Staates anziehen. An seine Untertanen ergeht demgemäß mit einem Christus-Wort ( „Gods Orakel" ) die Mahnung, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, also den Anordnungen der zentralen Gewalt die partikularen Interessen unterzuordnen. Bei äußerer Bedrohung hat eine oberste Autorität die innere Ordnung und damit den Bestand des Gemeinwesens zu sichern, so ließe am kürzesten das Spannungsfeld sich umschreiben, um dessen Bezeichnung es der Widmung geht. Oberhalb jeglicher politischen Aktualität wird damit der Kaiser zum Paradigma der höchsten Gewalt und ihrer Pflichten innerhalb einer politischen Gemeinschaft; unabhängig von deren innerem Aufbau liegt dabei der Akzent auf der Bewahrung von Ordnung und innerer Ruhe. Die weltliche Macht, so hatte es im Blick auf den Kaiser zu Beginn der Widmung geheißen, schöpfe ihr Licht aus Gott und bilde die Gottheit ab; ohne schon hier auf eventuelle staatstheoretische Implikationen dieser Formulierung einzugehen, sei vorerst nur auf den hieraus sich ergebenden Bezug zum LuciferMythos verwiesen. Die Parallelisierung der Herrschaft des Kaisers mit der Gottes setzt die Rebellion Lucifere in Relation zum inneren, nicht zum äußeren Feind (also nicht zur Türkengefahr). Die Aktualität des Lucifer-Mythos für den Herrscher liegt dann darin, daß in ihm die Drohung einer gewaltsamen Auflösung der politischen Ordnung von innen ihr Urbild hat (mit der dem äußeren Feind die Grenzen geöffnet wären). Demgemäß gewinnt die mit Lucifer verbundene superbia-Problematik ihre auf Politisches verweisende Spezifität: Nicht um Hochmut, Hoffart und Stolz in idealer Abstraktion als den allgemein gültigen Inhalt einer Kardinalsünde ist es Vondel zu tun, sondern um Hoffart in Bezug auf den Staat, um Lucifers „staatzucht". Dem Wort fehlt ein deutsches Gegenstück, das seinen Inhalt genau wiedergibt (obgleich zumindest Lohenstein es gekannt und benutzt hat; dreimal findet es sich in seinem Trauerspiel „Cleopatra", als „Staatssucht" und „Stadt-sucht", in dieser doppelten Form schon andeutend, daß das gemeinte Vergehen unabhängig von der Größe und Struktur des Gemeinwesens ist, in dem es sich entfaltet) 30 . „staatzucht" bezeichnet, so der Vondel-Forscher Asselbergs im Vorwort der von uns benutzten „Lucifer"-Ausgabe, „ . . . de ongeregelde en onbeheerste begeerte naar een hogere rang dan men rechtens bekleedt." 31 Mit den Begriffen Regel und Rang ist das Vergehen der „staatzucht" auf eine nach bestimmten Gesetzen
29 Vondel, Lucifer, a. a. O., p. 20f. 30 Lohenstein, a. a. O., pp. 23, 33, 106. (Cleopatra, 1 / 2 8 7 , 1 / 7 5 0 , V/575) 31 W. J. M. A. Asselbergs: Inleiding. — In: Vondel, Lucifer, a . a . O . , p. 7.
98
Joost van den Vondel · Lucifer. Treurspel.
geordnete Sozialstruktur beschränkt, deutlich klingt in der Definition die Rechtsproblematik an. Das verweist uns an die Widmung zurück. Der zitierte Satz, in dem die Sünde Lucifers und seiner Nachfolger sowie die politischen Gegenmaßnahmen beschrieben sind, hat zu seinen Kernbegriffen Recht und Gesetz: Von den „aanslagen der ongerechtigen" ist da die Rede, die sich nur den „schijn van wettigheid" (Gesetzlichkeit) geben; ohne ein „wettig Opperhoofd" könne aber keine „burgerlijke gemeenschap" bestehen; und zum Schluß fordert Vondel in deutlicher Abkehr vom Bibeltext, in dem es heißt, man habe Gott bzw. dem Kaiser zu geben, was Gottes bzw. des Kaisers ist, „Gode en den Keizer elk hun recht te geven". Das luciferisch Böse, so wie es im historischen Prozeß mannigfach sich bezeugt, ist dergestalt bestimmt als die Durchbrechung der inneren Ordnung gesetzlich geregelter Gemeinwesen auf dem Wege eines eigenmächtigen Aufstiegs gegen den ausdrücklichen Willen des gesetzlich legitimierten Machtträgers, der allein ihren Bestand zu garantieren vermag; die Turbation des Ganzen folgt demnach nicht aus der Ablehnung von dessen innerer Struktur, sondern aus der widerrechtlichen Anmaßung von Entscheidungskompetenzen, die zu verwalten nach gesetzlicher Regelung anderen vorbehalten bleibt. Notwendig muß die Bestimmung von „staatzudit" dieserart abstrakt ausfallen; die Kontinuität des Vergehens durch die Menschheitsgeschichte stellt sich für Vondel ja nur deshalb her, weil er es von den unterschiedlichen Herrschaftsformen unabhängig sieht, Erscheinung und Wirkung für ihn in Monarchie, Republik oder ständisch geordnetem Stadtstaat identisch sind: „staatzuchtig" seien die, so heißt es in der Vorrede, „ . . . die zieh stoutelijk tegens de geheiligde Machten en Majesteiten, en wettige Overheden, durven verheffen." 32 Der Indifferenz gegenüber den Regierungsformen korrespondiert die Insistenz auf der Legitimität des Herrschaftsverhältnisses, die notwendige Bedingung für den Erhalt eines jeden Gemeinwesens ist. „staatzucht" hebt die Legitimität eines Herrschaftsverhältnisses auf und schafft damit einen Zustand der Gesetzlosigkeit; das Ganze, dem mit dem Gesetz seine Klammer genommen ist, zerfällt. Sie ist die Sünde der Asozialität. — Es wird deutlich, wie sehr Vondel mit diesem Verständnis staatlicher Organisation und der ihr drohenden Gefahren der naturrechtlichen Argumentation des Hugo Grotius verpflichtet ist. Für Grotius folgte jeder Staatsvertrag nicht wie später für Hobbes aus dem Prinzip der Selbsterhaltung, also aus vorausgesetzter Zwietracht, sondern, in völligem Gegensatz dazu, aus dem Geselligkeitsprinzip. In ihm ist alles Recht begründet: Diese . . . der menschlichen Vernunft entsprechende Sorge für die Gemeinschaft ist die Quelle dessen, was man recht eigentlich mit dem Namen Recht bezeichnet."
Daraus ergibt sich für Grotius ein höchst liberales Rechtsverständnis: 32 33
Vondel, Lucifer, a. a. Ο., p. 35. Hugo Grotius: De jure belli ac pads libri tres. Neuer deutscher Text und Einleitung von Walter Schätzel. — Tübingen 1950. ( = Die Klassiker des Völkerrechts. Bd. 1.) p. 33. (Vorrede, 8)
Der Himmel als Staat
99
. . . Recht ist, was nicht Unrecht ist. Unrecht ist aber das, was dem Begriff einer Gemeinschaft vernünftiger Wesen widerstreitet.34
Da nun der Staat „ . . . eine vollkommene Verbindung freier Menschen, die sich des Rechtsschutzes und des Nutzens wegen zusammengetan haben", ist 35 , steht jede Art innerstaatlichen Widerstands gegen den oder die Inhaber der höchsten Gewalt, unabhängig von der Staatsform 36 , im Geruch des Widerrechtlichen. Damit ist zwar theoretisch nodi nicht jedes Widerstandsrecht von Anbeginn ausgeschlossen — so haben die Befehle der obersten Staatsgewalt am Gottesgesetz ihre Grenze —, praktisch aber sind die Möglichkeiten einer Gegenwehr der Untertanen unter dem Diktat des Geselligkeitsprinzips, dem Primat der öffentlichen Ruhe, aufs äußerste beschränkt: Für das öffentliche Leben ist aber unzweifelhaft jene bezeichnende Ordnung des Befehlens und Gehorchens die Hauptsache, und diese kann nidit bestehen, wenn Widerstand gestattet ist.37
Das gleiche gilt für Grotius auch unter den Bedingungen der Tyrannei; da sie immer nodi — und unter Umständen sogar optimal — die öffentliche Ruhe sichert, bleibt sie als das geringere Übel vor dem Widerstand der Bürger geschützt. Grotius zitiert Cicero: „Mir scheint jeder Friede unter den Bürgern nützlicher als der Bürgerkrieg."38 Die theoretischen Schwierigkeiten, die Grotius bei der Erörterung des Widerstandsrechts zu bewältigen hatte und die ihn gerade in diesem Punkt unpräzise argumentieren lassen, sind Ausdruck einer historischen Problematik: Das holländische Patriziat bedurfte des Widerstandsrechts nach außen, zur Rechtfertigung seines Kampfes gegen Spanien, nach innen jedoch konnte es ihm bei der Auseinandersetzung mit demokratischen Bestrebungen, denen an einer Aufhebung der überholten Ständeverfassung gelegen war, nur gefährlich sein 39 . „Grotius hatte das Naturrecht von der Theologie gelöst, aber es war noch nicht von den Gentlemen gelöst, noch nicht tauglich zur demokratischen Revolution." 40 Es handelt sich, und keineswegs steht dies im Widerspruch zur Einengung des Widerstandsrechts aus den Interessen eines um den Erhalt seiner Privilegien besorgten Patriziats, bei alledem 3+ Grotius, a. a. O., p. 47. (I, I, III, 1) 35 Grotius, a. a. O., p. 53. (I, I, XIV, 1) 36 „Das Recht ist nicht von dem höheren Wert dieser oder jener Form abhängig, worüber die Urteile verschieden sind, sondern von dem Willen des Volkes." — Grotius, a. a. O., p. 91. (I, III, VIII, 2) y Grotius, a. a. O., p. 116. (I, IV, IV, 5) 38 Grotius, a. a. O., p. 128. (I, IV, XIX, 1) — Bedeutsam für die Diskussion des Widerstandsrechtes ist die restriktive Bestimmung, die Grotius in anderem Zusammenhang, bei der Erörterung der ungerechten Kriegsgründe, trifft: „Auch die Freiheit einzelner oder der Staaten, d. h. das Recht nach eigenen Gesetzen zu leben, das von Natur und immer jedem allein zusteht, kann kein Redit zum Kriege geben." Grotius, a. a. O., p. 385. (II, XXII, XI) 39 Franz Borkenau: Der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild. Studien zur Geschichte der Philosophie der Manufakturperiode. — Paris 1934. ( = Schriften des Instituts für Sozialforschung. Hrsg. von Max Horkheimer. Bd. IV.) p. 141. -to Ernst Bloch: Naturrecht und menschliche Würde. — Frankfurt 1972. p. 65.
100
Joost van den Vondel · Lucifer. Treurspel.
um genuin bürgerliches Rechtsdenken: Galt für Grotius die Vertragstreue als unabdingbares Fundament einer jeden Gesellschaft, so war damit das gesellschaftliche Leben auf die einzelnen, die vor der Allgemeinheit des Gesetzes zumindest formell gleich sind, als seine Bausteine gegründet. Der bürgerliche Besitz-Individualismus, der des Vertrags zur Sicherung wie zum Ausbau seines Eigentums bedurfte, übertrug mit der Vertragstheorie die Bedingungen seiner alltäglichen Rechtspraxis auf die Organisation des Staates, der auf die Garantie der rechtlichen Sicherheit aller in ihm versammelten Einzelsubjekte verpflichtet ist. Berechenbarkeit und verstandesmäßige Konstruktion, Ausdrude bürgerlichen Kalkulationszwangs und formale Bedingung rechtlicher Gleichheit zugleich, triumphieren auch bei der Organisation des Staates. Hinzu kommt, daß gerade bei Grotius der „natürliche Mensch" erscheint, „ . . . als solcher, von nichts als von Verlangen nach friedlicher und vernünftiger Gemeinschaft erfüllt — ein idyllisches Wesen in paradiesischer Natur." 41 Die theoretische Konstruktion juridischer Gleichheit bedurfte des vorstaatlichen Naturzustands, um über die Annahme eines unter freien und gleichen Einzelwesen geschlossenen Vertrags die Legitimität der staatlichen Ordnung abzusichern. Es mag scheinen, dieser lange Exkurs über Grotius habe uns zu weit von Vondels knappen Bemerkungen in seiner Widmung an den deutschen Kaiser entfernt, vor allem aber, als werde ihnen eine theoretische Reflektiertheit unterstellt, für die der Text selbst keinen Anhalt biete, ja der er, in seinem engen Bezug auf eine historische Situation, die nachgerade gezwungenermaßen die von Vondel genannten Konsequenzen verlange, eher zu widersprechen scheint. Dieser Einwand verkennt, unabhängig von der ihm impliziten Fehleinschätzung der theoretischen Bewußtheit der Autoren des 17. Jhs, die Bedeutung der von Vondel benutzten Nomenklatur: Die Konsequenz, mit der sowohl der Bestand als auch die Dissoziation staatlicher Ordnung mit dem Rechts- und Gesetzesbegriff verbunden ist, verweist ebenso auf ein hier sich niederschlagendes Eingedenken der rechtlichen Fundierung politischer Organisation, wie in dem Satz, daß die staatliche Ruhe und Sicherheit ohne ein gesetzliches Oberhaupt in keiner bürgerlichen Gemeinschaft bestehen könne, der Gedanke des Grotius wiederkehrt, „ . . . wonach es keine Ordnung ohne Beziehung auf etwas gibt, was das erste ist." 42 Damit ist weder eine Souveränitätslehre angesprochen, die es bei Grotius nicht gibt, nodi einem bestimmten politischen System der Vorzug gegeben, was auch Vondel nicht tut. Der Akzent liegt bei Vondel einzig auf der sich notwendig über legitimierte politische Herrschaft bewahrenden staatlichen Ordnung und der dem korrespondierenden Unrechtmäßigkeit des Aufstandes (in der oben definierten Form der „staatzucht"), worin das für die « 42
Bloch, a. a. O., p. 72. Grotius, a. a. O., p. 119. (I, IV, VI, 1) — Im übrigen zitiert wie Vondel so auch Grotius in staatsrechtlicher Intention Matthäus X X I I , 2 1 : „Im Neuen Testament hat Christus geboten, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. E r wollte damit sagen, daß die Anhänger seiner Lehre nicht einen geringeren, sondern einen stärkeren Gehorsam der Staatsgewalt schuldig seien, als ihm die Juden nach ihren Gesetzen schuldeten . . . " — Grotius, a. a. O., p. 115. (I, IV, IV, 1)
Oer Himmel als Staat
101
politische Philosophie des Hugo Grotius grundlegende Geselligkeitsprinzip wie die aus ihm folgende Ächtung des politischen Widerstands zum Ausdruck findet. Nicht eine Staatsform ist hier zentral oder die Apologie eines Herrschaftssystems, sondern die innere Ruhe und Rechtlichkeit staatlicher Ordnung überhaupt. Deutlich teilen die Vondelschen Bestimmungen mit der Staatsphilosophie des Hugo Grotius den gleichen bürgerlichen Inhalt. — Das Trauerspiel scheint damit durch Widmung und Vorrede erschlossen; kaum noch gibt es, dieser Eindruck könnte nach gründlicher Lektüre der ihm vorangestellten Texte entstehen, der Interpretation Schwierigkeiten auf. Denn tatsächlich läßt das Trauerspiel als vollkommene Realisation der zuvor skizzierten Intention seines Autors problemlos sich lesen: Vondel demonstriert im Ablauf des dramatischen Geschehens die Gefahren der „staatzucht" für den einzelnen wie für die Gemeinschaft. Lucifer, der Statthalter Gottes, widersetzt sich, als ihm Gabriel den göttlichen Willen eröffnet, den soeben geschaffenen Menschen über die Engel zu erheben, ja die Engel zu Dienern des Gottgleichen zu machen, den Befehlen seines Herren, wie es ihm, dem noch Schwankenden, sein Oberst Beizebub eingeflüstert hatte. Dieser Beschluß schmälere, so lautet Lucifers wesentliches Argument, nicht allein die Ehre und das Recht der Engel, sondern vor allem die Ehre Gottes; es könne nicht geduldet werden, daß ihm zur Seite ein Wesen aus irdischem Schmutz trete. Unter dieser Losung, die, wie noch zu zeigen sein wird, mehr ist als nur ein Vorwand, tritt Lucifer seinen Kampf gegen die göttlichen Mächte an; von seinen ihm treu ergebenen Offizieren Beizebub, Apollion und Belial läßt er die Engel aufwiegeln, von denen schon viele laut mit dem Beschluß Gottes hadern. Die Engelchöre spalten sich; an die Spitze der Aufrührer, der Luciferisten, tritt, als die Zeit reif scheint, schließlich der Statthalter Lucifer selbst, während Michael, der Feldherr Gottes, die gottgetreuen Engel zu sich ruft. Offen proklamiert Lucifer den bewaffneten Kampf; die Luciferisten opfern ihm Weihrauch und stellen ihn damit Gott gleich. Es kommt zur Schlacht, nachdem Rafael dem seine Niederlage ahnenden Lucifer ein letztes Friedensangebot gemacht hat, das dieser jedoch zurückweist, weil er schon zu weit gegangen zu sein glaubt. Die unterlegenen Heere Lucifers werden trotz tapferer Gegenwehr von Michael geschlagen, die Aufrührer stürzen aus dem Himmel und wandeln sich zu Teufeln. Die Freude des Himmels über den Sieg jedoch wird getrübt durch die Nachricht, daß der rachsüchtige Lucifer den Menschen zum Bösen verführt habe. Der Befehl zur Vertreibung aus dem Paradies beendet das Drama. — So der Inhalt des Trauerspiels; mühelos läßt in ihm das Grundthema vom Sturz des Mächtigen sich erkennen. Es gewinnt seine konkrete Gestalt im Geschick des Zweitmächtigsten im Staat, der sich den Befehlen seines Herrschers widersetzt, schließlich ihm gleich zu werden begehrt, damit aber einen Bürgerkrieg anzettelt, der Haß und Schrecken in die zuvor so friedliche Gemeinschaft trägt. Der Frieden wird wieder hergestellt durch den Ausschluß der rebellischen Kräftige aus dem Staat; der Mächtige, der noch mächtiger zu werden bestrebt war, versinkt in Machtlosigkeit. Darin steckt alles, was Vondel in der Vorrede akzentuiert hatte: Gewalt und List der Aufrührer sind vergeblich, solange ein
102
Joost van den Vondel · Lucifer. Treurspel.
legitimer Herrscher, hier Gott selbst, die innere Ruhe und Sicherheit und damit den Bestand der Gemeinschaft garantiert; einzig an ihm versagt die Sünde der „staatzucht". Die rechtliche Regelung von Entscheidungskompetenzen und deren strikte Einhaltung erweisen sich als das Fundament des Staates. — In gleichem Maße läßt schon die kurze Inhaltsskizze Grundzüge der Staatsphilosophie des Hugo Grotius erkennen; das exemplarische Geschehen um den „staatzuchtigen" Lucifer entfaltet seine Evidenz, eben weil es in einem idealtypischen Staat sich entwickelt. Die sorgfältige Gliederung der Population des Himmelstaates, die ihr entsprechende Trennung der Befugnisse (die neun Stufen der Hierarchie des Dionysios Areopagita scheinen, nach den wenigen Hinweisen auf Rangbezeichnungen, die Vondel gibt, in eine quasi-militärische Rangordnung verhärtet), dies deutet auf eine Präponderanz des Geordneten, auf eine Dominanz innerer Ruhe und Stabilität, bei der, zumal wenn die, wie beim Himmel nicht anders zu erwarten, zugrundeliegende Organisationsform als optimal gepriesen wird, jeder Gedanke an ein Widerstandsrecht von Anbeginn ausgeschlossen ist. Der einzelne bleibt auf die Einhaltung des mit der Konstruktion des Staates, von der sich idealtypisch hier durchaus sprechen läßt, eingegangenen Vertrages verpflichtet, andernfalls droht, wie das Beispiel Lucifere lehrt, das Schreckbild des Bürgerkriegs und damit, als Ergebnis der Abkehr vom rechtssetzenden Geselligkeitsprinzip, die Aufhebung jeglicher Rechtlichkeit. Die Verschränkung der Geschicke des Titelhelden mit dem Wohlergehen des Ganzen, wie sie das Vondelsche Trauerspiel nicht allein im „Lucifer" vornimmt, ist Ausdruck eben dieses bürgerlichen Rechtsdenkens, dem alle staatliche Ordnung als Ergebnis eines Vertragsabschlusses zwischen einzelnen gilt, so daß von der superbia des einen das Zusammenleben aller betroffen ist. Asselbergs hat dies präzise in kurzen Bemerkungen herausgearbeitet, ohne allerdings die Begründung für diese Besonderheit des Vondelschen Trauerspiels im Rechtsdenken der Zeit zu sehen: Der Sturz des Hochmütigen ist mehr als eine persönliche Strafe. Er ist ein gesellschaftliches Unheil. Hochmut verwüstet das Leben, aber auch Königreiche. Er bildet den Nährboden für alle Sünden von Individuum und Gemeinschaft. Von anderen Trauer· spieldiditern, auch aus der Barockzeit, unterscheidet Vondel sidi durch seinen sdiarfen Blick für die Folgen des Hochmutes auf die Gesellsdiaftsstruktur.«
Vondels „Lucifer" also als ein barockes superbia-Trauerspiel, dessen Eigenart in der Rekonstruktion des gestalteten Mythos nach Maßgabe einer bürgerlichen Rechtsidee liegt, womit eine Konzentration des Geschehens auf eine zentrale Gestalt in relativer Beziehungslosigkeit zur sie umgebenden Sozietät verhindert ist: so ließe nach Kenntnis von Widmung, Vorrede und äußerem Handlungsablauf der Befund sich resümieren. « W. J. M. A. Asselbergs: Hochmut und Hochzeit bei Vondel. — In: Werner Kohlschmidt (Hrsg.): Spätzeiten und Spätzeitlichkeit. Vorträge, gehalten auf dem II. Internationalen Germanistenkongreß 1960 in Kopenhagen. — Bern/München 1962. p. 46. — Ebenso in der Einleitung zur „Lucifer"-Ausgabe: „Van andere grote treurspeldichters uit de geschiedenis verschilt Vondel doordat hij tegelijk met de ondergang van de tragische held dikwijls ook de verwoesting van een gemeenschap te aanschouwen geeft." Asselbergs, Inleiding, a. a. O., p. 8.
Der Himmel als Staat
103
Die Zahl der „Lucifer"-Interpretationen ist groß; schon dies ist Hinweis genug, daß das Trauerspiel nicht auf eine knappe Formel sich bringen läßt. Es habe, so schreibt ein norwegischer Vondel-Forscher, „ . . . Möglichkeiten für viele und teilweise kuriose Deutungen geboten." 44 Jedem ernstzunehmenden Interpretationsversuch müsse jedoch als Grunderkenntnis dies zugrundeliegen: „Es besteht kein Zweifel darüber, daß „Lucifer" eine Hochmutstragödie ist." 45 Diese Ansicht hat die Vondel-Forschung seit langem vertreten; so heißt es 1954 bei Âsselbergs: Staatzucht maakt Lucifer tot het prototype der opstandelingen, die met hun eigen lot het geluk van de samenleving verwoesten. 46
Vondel habe, so schreibt Worp 1904, demonstrieren wollen, daß ein Christ, der sich gegen die geheiligten Mächte und Majestäten erhebe, das Schicksal Lucifere erleiden müsse: Want vorsten heerschen door Gods wil en hij, die zieh aan hen vergrijpt, zal te gronde gaan, omdat hij de wereldorde verstoort. 47
Und Smit betont in seiner umfassenden Untersuchung, es sei Vondel „ . . . om het universele aspect van het Luciferisme . . . " 48 zu tun gewesen, um jeden ungesetzlichen Griff nach der Macht, nicht um dessen zufällige Erscheinungsformen: Dáárom greep hij naar het oer-geval van staetzucht, naar de opstand die aan het begin Staat van alle vetzet tegen God en die de versdiillende aspecten daarvan het meest onverbloemd vertoont. 4 '
Mit wenigen Ausnahmen also, von denen auf eine bedeutsame noch einzugehen sein wird, herrscht Einigkeit darüber, daß die zentrale Thematik des „Lucifer" die Hoffart in ihrer besonderen Form als „staatzucht" sei. Doch nur eine der „Lucifer"-Interpretationen von Bedeutung, die Asselbergs', sieht den Gehalt des Trauerspiels in engem Bezug zur in ihm entwickelten Thematik; im „Lucifer" gestalte sich, so seine These, die Furcht des Bürgers vor der Tyrannei, es werde davor gewarnt, . . . daß das Machtstreben der verantwortlichen Führer notwendig das sittliche Leben, das heißt die gesellschaftliche Ordnung der Untertanen, zerstört. Tyrannei verursacht Bürgerkrieg, der die sittliche Kraft der Gemeinschaft untergräbt, weil er ihren inneren Kern angreift. 50 44
Kâre Langvik Johannessen: Zwischen Himmel und Erde. Eine Studie über Joost van den Vondels biblische Tragödie in gattungsgeschichtlicher Perspektive. — Oslo'Zwolle 1963. p. 267. 45 Johannessen, a. a. O. 46 Asselbergs, Inleiding, a. a. O., p. 8. 47 J. A. Worp: Gesdiiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Eerste Deel. — Groningen 1904. p. 278. « Smit, a. a. O., p. 60. 4 » Smit, a. a. O., p. 61. 50 Asselbergs, Hochmut, a. a. O., p. 47. — „Hij wordt een tiran, die de ondergang van anderen beraamt en bewerkt." Asselbergs, Inleiding, a. a. O., p. 15.
104
Joost van den Vendei · Lucifer. Treurspel.
Asselbergs steht mit seinem auf den historischen Inhalt der Hochmutsproblematik konzentrierten Interpretationsansatz allein; im übrigen herrscht die Meinung vor, in den Widersprüchen, die die superbia Lucifers zur Kollision gelangen lasse, komme letztlich eine Grundspannung allgemeinster Art zum Ausdruck, die über ein Historisch-Rechtliches erheblich hinausführe. Johannessen geht dabei von einem vorgängigen Barockverständnis aus; dessen „innerste(s) Wesen" sei die Synthese von Himmel und Erde, von Geist und Materie." Lucifer nun sei „der Feind der Synthese", „der extreme Spiritualist", dem der Gedanke unannehmbar sei, daß der Mensch, ein Wesen aus geschaffener Materie, die spiritualen Gefilde des Himmels verunreinigen solle. Deshalb könne er sich im Namen Gottes gegen dessen eigenen Beschluß empören. „Der Kampf Luzifers gestaltet sich zu einem Kampf zwischen der Idee der göttlichen Synthese im Barock und dem reinen Spiritualismus." 51 Lucifer falle letztlich dem „Gedanken der neuen Transzendenz", der Vereinigung von Geist und Materie, zum Opfer. — Anders argumentiert Smit; seine Interpretationen der vor dem „Lucifer" entstandenen Vondelschen Trauerspiele hätten gezeigt, daß Vondels Drama auch zuvor schon in dualistischer Weise mit der Problematik von Gut und Böse sich auseinandergesetzt habe. Mit dem „Salomon", der unmittelbar vor dem „Lucifer" entstanden ist, seien besondere Sünden in das Blickfeld von Vondels Interesse getreten: zuerst Wollust, jetzt „staatzucht". Ein Dualitätsdrama sei also auch „Lucifer" ; das Schwanken des Titelhelden, sein Eintreten einerseits für Ehre und Recht Gottes, zum anderen für das eigene Recht, erkläre sich daraus, daß er gleichsam der Einsatz sei in dem Streit zwischen zwei zu Beginn des Trauerspiels schon existenten Gruppen, den immer schon bösen Luciferisten und den guten Engeln. So kann Smit nach einer umfänglichen Untersuchung des Trauerspiels zu eben dem Schluß kommen, der ihm zu Beginn seiner Untersuchung aufgrund seiner Analysen der früheren Trauerspiele schon feststand: Wij hebben kunnen constateren, dat de Lucifer inderdaad, evenals zijn voorganger, opgezet is als een dualiteits-drama waarbij de hoofdpersoon inzet is in de strijd tussen de vertegenwoordigers van goed en van kwaad. 52
Soweit diese Interpretationsversuche als Beispiele neuerer „Lucifer"-Deutung; ihre methodische Schwäche liegt allemal darin, daß sie die Textanalyse zur Bewährungsprobe vorgängiger Erkenntnis, sei es eines spezifischen Barockbildes, sei es der Vorstellung einer durchgehaltenen Grundstruktur der Vondelschen Trauerspiele, degradieren. Doch nicht zum Nachweis ihrer methodischen Bedenklichkeit sind jene Untersuchungen hier zitiert, vielmehr darum, weil an ihnen deutlich sich ablesen läßt, weshalb die Interpreten sich genötigt sehen, ihre Analyse über die detaillierte Bestimmung der gestalteten Hochmutsproblematik hinauszutreiben auf ein hinter ihr liegendes, wie immer geartetes Allgemeines. Die ständige Irritation für jede Deutung liegt in dem Mangel an Entschiedenheit, mit dem Lucifer den eigenen Anspruch verficht, in seinem Ί Johannessen, a. a. O., p. 274f. 52 Smit, a. a. O., p. 164.
Der Himmel als Staat
105
Schwanken zwischen göttlichem Befehl und behauptetem Eigenrecht, zwischen offenkundig bösem Handeln (List, Lüge, Konspiration, Aufruhr, Krieg) und gleichzeitiger Bewahrung des Guten (Freundlichkeit, ja Freundschaft gegenüber dem Gottesboten Rafael kurz vor der Schlacht, momentane Einsicht in die Unrechtmäßigkeit seines Handelns, Mut und Tapferkeit im Kampf), in seiner Desillusioniertheit, was die Chancen eines Sieges betrifft, vor allem aber in der Merkwürdigkeit, daß Lucifer gegen Gott mit dem Argument kämpft, für ihn zu kämpfen. Darin fehlt die klare Richtung nach oben, die superbia sonst einschlägt; eine „staatzucht" tritt auf, der es um die Bewahrung des Bestehenden zu tun ist: Die große Geste der Hoffart erscheint gebrochen. Es ist diese Widersprüchlichkeit und Brüchigkeit, die nach einer Deutung verlangt, freilich nicht nach einer solchen, die das Kunstwerk zum Beleg fürs schon Gewußte herabsetzt, sondern die seine Leistung als „gewaltlose Integration des Divergierenden" in der historischen Wirklichkeit und als Transzendierung der „Antagonismen des Daseins ohne den Trug, sie wären nicht mehr", reflektiert 53 . Demgemäß ist nachzuweisen, daß die besondere Qualität der luciferischen „staatzucht" , sowohl die Widersprüchlichkeit ihrer Intention als auch die mangelnde Bestimmtheit ihres Gegners, in einem Widersprüchlichen innerhalb der historischen Situation, aus der heraus Vondel gestaltete, ihren Grund findet. Dabei ist fernerhin auszugehen von der Rechtsproblematik, deren unverbrüchliche Verklammerung mit dem als „staatzucht" auftretenden Bösen schon oben nachgewiesen ist. Hier soll, zu Anfang unserer Interpretation des Trauerspiels, nur einmal nodi an eine Wendung der Widmung erinnert sein: „met glimp en schijn van wettigheid vermomd", so betreiben die Aufrührer nach Vondels Worten ihr Werk. Unter dem Anschein der Gesetzlichkeit also wird der Kampf gegen das Gesetz geführt; dies sei an dieser Stelle zitiert als ein Hinweis des Autors darauf, daß in den von „staatzucht" entfachten Kämpfen der Widerstreit unterschiedlicher Rechtsinterpretationen, vielleicht sogar Rechtsprinzipien zum Austrag gelangt. Damit aber ist endgültig der Blick auf die historische Bedingtheit von superbia freigeworden; die Hypostase einer immer gleichen Sünde weicht dem Wandel ihrer historischen Gestalten. — „Recht" ist, was die Interpretationen bisher übersahen, eines der häufigsten Nomina des Trauerspiels; insgesamt ist es in den Dialogen 41 mal belegt 54 . Dazu kommen die häufigen Verbindungen mit „recht", etwa „rechtschapen" oder „rechtvaerdigheit", des weiteren die ständige Erwähnung des Gesetzes 53 Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie. — Frankfurt 1970. p. 283. 54 Vgl. P. K. King: Complete word-indexes to J. van den Vondel's Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst and Lucifer. With ranking lists of frequencies reverse indexes and rhyming indexes. — Cambridge 1973. p. 506 f. Dazu kommt je ein Beleg aus Widmung und Vorrede, so daß King insgesamt 43 Belege nennt. Damit steht „recht" in der Häufigkeitsliste, bei 783 Positionen, an 77. Stelle (p. 544), eine für Nomina sehr große Häufigkeit, zumal die meisten oberen Plätze von Pronomina, Bindewörtern, Präpositionen, Namen und den unterschiedlichen Formen der Hilfsverben eingenommen werden. King verzichtet im übrigen bei der Analyse des Corpus auf syntaktische oder semantische Kriterien; im Fall von „recht" also sind adjektivische und substantivische Verwendung nicht voneinander unterschieden.
106
Joost van den Vondel · Lucifer. Treurspel.
(„wet" läßt sich in 16 Belegen nachweisen) 55 . Die umfangreichen Auseinandersetzungen, die dem Ausbruch des Bürgerkriegs vorangehen, tragen durdiaus die Gestalt eines Rechtsstreits, eines Disputes über umstrittene rechtliche Positionen und unterschiedliche Interpretationen von Rechtsnormen. Von beiden Parteien, vor allem aber von den Aufrührern, wird beständig das Recht beschworen; für die einen legitimiert es den Aufstand, während die anderen in jedem Widerstand einen schweren Rechtsbruch sehen. Doch kommt es nie zu einer Klärung der divergenten Ansichten; ein Versuch gar, beide Positionen miteinander zu vermitteln, sie auf ein gemeinsames Fundament zurüdkzuführen, um derart den Frieden zu bewahren, wird nirgends unternommen. Obgleich jedoch die Gegensätzlichkeit der Rechtsinterpretationen offen zutage tritt, drängt der Eindruck sich auf, als sei es den handelnden Personen keineswegs bewußt, daß von völlig Unterschiedlichem die Rede ist, wenn die einen und wenn die anderen das Redit im Munde führen. Recht scheint ihnen ein verläßlich Gemeinsames, und gerade deshalb wird es argumentativ beständig ins Feld geführt, weil mit ihm, als einem objektiv Gültigen, Verständigung überhaupt noch sich herstellen läßt. Das Redit gilt ihnen unbefragt so sehr als gemeinsamer Bezugspunkt, daß sie seiner immanenten Widersprüchlichkeit an keiner Stelle sich bewußt werden. Dem entspricht seine Funktion in der Organisation des Ganzen: Der Himmel ist, und dies bleibt Voraussetzung des gestalteten Geschehens, nach rechtlichen Prinzipien geordnet, kurz: der Himmel ist ein Staat. Darauf ist zu insistieren; denn daß er, als der Inbegriff vollkommener Existenz, in unüberbietbarer Anthropomorphie die Gestalt eines irdischen Staates anzunehmen vermag, und dies nicht allein in einzelnen Zügen, sondern durchaus in seiner gesamten Organisation, ist deutlichster Hinweis darauf, wie sehr das staatsrechtliche Denken der Zeit dem Gedanken an die Herstellbarkeit eines idealen Weltzustands über irdische Gesetzlichkeit huldigte. Den naturrechtlichen Entwürfen des 17. Jhs wohnt entschieden ein Utopisches inne mit der Vorstellung, die Einhaltung ihrer Rechtsnormen gewährleiste den Zustand von Vollkommenheit und Glück, der innerweltlich überhaupt möglich sei. Daß der Himmel ein Staat sei, dieser Gedanke setzt also seine Umkehrung voraus: Der ideale Staat ist zwar nicht der Himmel (das naturreditlidie Denken des 17. Jhs entwirft keine Staatsutopien), aber immerhin dessen irdische Approximation. Voraussetzung dafür, daß der Sturz Lucifers als exemplum im Trauerspiel auf die Bühne kommen konnte, ist ein rechtsphilosophisches Denken, dem die Transzendierung der menschlichen Misere über eine vorzügliche Staatsorganisation möglich erschien, denn erst diese Vorstellung erlaubt die Strukturierung der absoluten Idealität, des Himmels, als eben die optimale Verwirklichung des innerweltlich in den bestehenden Staaten erst näherungsweise Erreichten, so daß die in ihm ablaufenden Geschehnisse als beispielhaft vorgestellt werden können. Hier mag der Grund dafür liegen, daß das deutsche barocke Trauerspiel zum Lucifer-Sujet nicht fand; erst mit Pufendorf setzt in Deutsch-
55
King nennt 15 Belege für „wet". Davon sind freilich 1761 und 1801 finite Verbformen. Der Plural „wetten" ist dreimal nachgewiesen.
Der Himmel als Staat
107
land die breitere Diskussion des Naturrechts ein, zu einem Zeitpunkt also, als das barocke Trauerspiel schon längst in seinem Verfall begriffen war. Die entscheidende Schwierigkeit für die Autoren lag eben nicht in der Darstellung der superbia Lucifers, die ihrer äußeren Erscheinung nach von der seiner Nachfahren sich kaum unterscheidet, sondern in der Gestaltung des Himmels, an dessen inneren Verhältnissen sie sich entzündet. Die Idealität des Himmels aber als Staat setzt den Begriff des idealen Staates voraus; ihn liefert das naturrechtliche Denken. Notwendig gewinnt deshalb jede innere Auseinandersetzung, die an die fundamentalen Prinzipien des Staates (hier des Himmels) rührt, zuerst den Charakter eines Rechtsstreits, bevor es zum Kampf kommt. Die Vondelsche Konstruktion eines Himmelstaates fügt sich dem bürgerlichen Denken seiner Zeit; ebenso war der Praxis des entwickelten Bürgertums, die in der Naturrechtslehre zu ihrem staats- und rechtstheoretischen Ausdruck fand, eine superbia ohne die Dimension der Rechtsverletzung bedeutungslos. Von daher erklärt sich die ständige Beschwörung der Rechtspositionen im „Lucifer" ; daß die Auseinandersetzungen mit Krieg und der Elimination einer Partei enden, deutet auf die Unvereinbarkeit ihrer Rechtsinterpretation mit dem Bestand des Ganzen. Dem soll hier nachgegangen sein. Zu Beginn des ersten Aktes warten Belial und Beizebub auf Apollion, den der Statthalter Lucifer zur Erde geschickt hatte, um sich von Adam und seiner Welt berichten zu lassen. Das Ausbleiben Apollions erfüllt Beizebub mit Unruhe; nicht ohne Vorwurf spricht er: Een wakker dienaar vliegt op't wenken van zijn Heer; En stut zijn meesters troon getrouw met hals en sdiouder.
(8f.)
Lucifer nimmt diese Metapher später auf; als die aufgewiegelten Luciferisten ihn bitten, für ihr Recht einzutreten, weigert er sich anfänglich in trügerischer Absicht mit dem Argument, Gottes Recht sei für ihn verbindlich: Ik ken geen ander Redit; en stutte, als Stedehouder Der Godheid, zijn besluit en raadslot met mijn sdiouder.
(1214f.)
In der großen Auseinandersetzung zwischen den Aufrührern und den loyalen Engelchören im 3. Akt beklagen die Luciferisten die Erhebung des Menschen, die ihnen als persönliche Degradierung erscheint, mit folgendem Satz: Wij waren pas gewijd tot pijlers van zijn hof, Bekleedden onzen plidit, als trouwe rijksgenoten, En worden op een sprong gebannen, en gestoten Uit deze waardigheid, verdrukt te streng, en straf.
(849-52)
Dem entspricht die Formulierung, mit der sie Lucifer in seiner Würde als Feldherr im Kampf gegen die gottgetreuen Truppen begrüßen; hatte sie in ihren Augen Gottes Entscheidung, den Menschen auf den Thron an seiner Seite zu berufen, ihrer Würde als Pfeiler seiner Herrschaft beraubt, so machen sie diesen Prozeß rückgängig, indem sie sich zu Stützen eines neuen Herren erklären: Bewaar uw eigen stoel: wij willen, als pilaren, U stutten, en den Staat der Engelen met een. (1239f.)
108
Joost van den Vendei · Lucifer. Treurspel.
Die hier verwendete Metaphorik ist von Vondel mit Bedacht gewählt; der Diener bzw. Statthalter, der mit Hals und Schulter den Thron seines Herrn bzw. dessen Beschlüsse unterstützt, erinnert an den antiken Mythos von Atlas, der auf seinen Schultern den Himmel trägt. Diese Quelle stellt auch den Bezug zu dem Bild von den Pfeilern her, die die Herrschaft stützen: Bestimmten antiken Texten zufolge 56 trug Atlas nicht den Himmel, sondern dessen Säule; im übrigen kennt die Baukunst seit dem dorischen Stil die Atlanten als herkulische Männergestalten, die anstelle der Säulen das Gebälk oder die Vorbauten stützen. Sich der Herkunft dieser Metaphorik zu erinnern ist deshalb geboten, weil auf diesem Wege ihre politischen Implikationen erst ganz sich erschließen. Dem Selbstverständnis der Luciferisten nach sind die Engel die Stützen des Himmels; zwar bleiben sie Diener und Untertanen, aber das gebeugte Haupt ist, wie bei Atlas, Zeichen dessen, daß sie es sind, die das Ganze tragen. Die Stütz- und Pfeilermetaphorik verschränkt Unterordnung und Selbstbehauptung unlöslich miteinander; mit dem Gedanken an die Abhängigkeit des Herrschers von seinen Diensten bewahrt der Untertan seine Würde. Der Erhabene ruht auf den Schultern seiner Untergebenen, sie sind die Stützen seiner Herrschaft und damit des ganzen Staates (seinen Thron und den Engelstaat zugleich wollten sie stützen, hatten die Aufrührer Lucifer zugesagt). Deutlich ist die Nähe dieser Metaphorik zum Gedanken der Empörung; die Möglichkeit zur Aufkündigung des Dienstes ist in ihr impliziert: Trägt die Säule ihn nicht mehr, so muß der Mächtige fallen. Vergeblich wird man sie deshalb bei den gottgetreuen Engeln suchen; nirgends bedient sich einer der Ihren des Bildes von der stützenden Säule, um damit sein Dienst- oder Treueverhältnis zu Gott zu beschreiben. Mehr noch, im Reyen, der den ersten Akt abschließt, wird ausdrücklich solche Metaphorik von ihnen als zur Charakterisierung ihrer Funktion und Leistung untauglich zurückgewiesen. Wer ist es, so heißt es dort im Hymnus der Engel auf Gott, der Bij zieh bestaat, geen steun van buiten Ontleent, maar op zidi zelven rust . . .
(285f.)
Damit aber ist die Metaphorik der Aufrührer widerrufen: Gott ruht auf sich selbst und bedarf der äußeren Stütze nicht. Seine Herrschaft bleibt vom Dienst der Engel unabhängig; umgekehrt erwirbt ihnen ihr Wirken im Himmelstaat keinen Einfluß auf die göttliche Entscheidungsbefugnis. Mit der Einsicht jedoch, Gott stehe zum Willen seiner Geschöpfe absolut, ist der Gedanke an Rebellion nicht allein völlig beiseitegerückt, sondern er ist überhaupt sinnlos geworden: Der Rebell erreicht den zu Stürzenden erst gar nicht. Schon ein kurzer Blick auf die Metaphorik also, die die Aufrührer zur Umschreibung nicht 56
Vgl. Aisdiylos: Der gefesselte Prometheus, 347—350: O nein, denn auch des Bruders Schicksal peinigt midi, Des Atlas, der am abendlichen Rande steht, Des Himmels Säule und der Erde stemmend auf Den Schultern, eine Bürde, nicht zu halten leidit. Übersetzt von Walther Kraus. Stuttgart 1965. p. 16.
Der Himmel als Staat
109
etwa ihrer Intention auf Umsturz, sondern ausdrücklich des Dienstverhältnisses einsetzen, erweist den fundamentalen Gegensatz im Verständnis der Herrschaftsstruktur des Himmelstaates, der zwischen den Luciferisten und den loyalen Engelchören besteht: Gehen die ersteren von einer wechselseitigen Abhängigkeit zwischen Herrscher und Untertan aus, so gilt den anderen die Gewalt des Herrschers als von Leistung und Willen seiner Untertanen unbeschränkt. Der ganze Unterschied wird deutlich, vergegenwärtigt man sich die Formulierungen, mit denen Gabriel — er entspricht in seinem Verhältnis zu Lucifer in etwa den alttestamentarischen Propheten, die den Königen den Willen Gottes verkünden — den inneren Aufbau des Himmels umreißt. Er spricht sie zu Anfang des Stückes, nachdem er den Scharen den Befehl Gottes, dem Menschen zu dienen, erteilt hat; zudem ist er der erste im Stück auftretende Engel, der später nicht zur Partei der Aufrührer gehören wird. Ein längeres Zitat scheint deshalb gerechtfertigt: Een ongedeelde wil en liefde zij uw wet. Gij weet hoe't Engelsdom moet ondersdheiden worden In drijderhande rij, een negenvoudige orden: De hoogste in Serafijn, en Cherubijn, en Troon, Die zitten in Gods Raad, en Sterken zijn geboôn. Die middenrij bestaat uit Heerschappijen, Krachten, En Machten, die op 't woord van Gods Geheimraad wachten, Tot's mensen nut, en heil, en hulp in 't algemeen. De derde en laagste rij, gewijd uit Vorstenheên, En grote Aartsengelen, en Engelen, moet duiken Voor 't woord der middelrije, en laten zieh gebruiken, Beneden het geweif van zuiver kristalijn . . . (240-51)
Es ist die bekannte Hierarchie des Dionysios Areopagita, die hier vorgetragen wird; sorgsam sind die unterschiedlichen Ränge, in die die Engel sich unterscheiden, aufgeführt. Freilich bedeuten Gabriels Worte im Kontext des Trauerspiels mehr als nur patristische Elementarinformation über die Ordnungsprinzipien des Himmels; sie liefern den konkreten Gegenentwurf zu den Vorstellungen der Luciferisten. Die hierarchische Rangordnung der Ämter strukturiert sich von oben nach unten; ihr voran steht eine unumschränkte Macht, der die ganze Fülle der Gewalt zusteht. An ihr gemessen hat die ihr untergeordnete Hierarchie nur mehr Verwaltungs- und Distributionsfunktion. Jede Stufe reicht widerspruchslos die an der Spitze einsam gefaßten Beschlüsse nach unten weiter, bis sie schließlich auf niedrigster Ebene völlig selbstverständlich in die Tat umgesetzt werden. Der inneren Differenzierung entspricht mithin keine Vielfalt von Meinungen, Intentionen und Absichten, die, wie immer für den Herrscher bedeutsam, auf ihn zurückwirkte, sondern Gabriel umreißt einzig ein System des Gehorsams. Dies wird besonders deutlich bei der Kennzeichnung der Nahtstellen zwischen den Engelgruppen, wo die Befehle an die nächstniedrigen Ränge weitergereicht werden. Der Gottesrat (Seraphim, Cherubim und Throne) ist ein reines Akklamationsorgan, er nimmt die Gebote des Herrn bestätigend entgegen („Sterken zijn geboôn"). Die mittlere Gruppe wartet („wachten") auf die Befehle, die ihm der Rat erteilt, und gibt sie an die dritte weiter, die, so
110
Joost van den Vendei · Lucifer. Treurspel.
wörtlich, „sich vor dem Wort der Mittelgruppe beugen und sich gebrauchen lassen muß". Die Engel verhalten sich also zu ihrem Herren rein rezeptiv; sie sind ausführendes Organ und werden geeint durch den übergreifenden Willen, der sie steuert. Wenn Gabriel von ihnen fordert, ein ungeteilter Wille habe ihnen Gesetz zu sein, so bedeutet dies beides: daß zum einen ihnen Gottes Wille Gesetz zu sein habe, daß zum anderen es ihnen Gesetz sein müsse, den Willen ungeteilt zu lassen, ihm Eigenes nicht entgegenzusetzen. Die zugleich geforderte Liebe ist dabei nur die affektive Ergänzung zur angemahnten Beibehaltung des von Gott formulierten Kollektivwillens, das emotional einigende Band. Sicher also läßt der Aufbau der Himmelshierarchie als eine Pyramide sich vorstellen, aber nicht so, als werde deren oberster Stein von den ihn unterlagernden, sich zusehends verbreiternden Schichten getragen; vielmehr ist das Ganze von seinem Gipfel her konstruiert, die Pyramide dient einzig der universalen Verwirklichung eines alles umgreifenden Willens. Die Hierarchie ist Delegationsprinzip, nicht tragender Unterbau eines Herrscherthrons. Unvereinbar also mit Gabriels Darstellung ist die politische Metaphorik der Luciferisten; der Anspruch, Staat und Thron zu stützen, verfehlt die tatsächliche Herrschaftsstruktur des Himmelstaats: De Godheid kan den Staat van 't Engelsdom ontberen. Zij is met niemands dienst beholpen. (951Í.)
So weisen die loyalen Engel die Forderungen der Aufrührer zurück; die Tatsache allein, daß Forderungen gestellt werden, bedeutet hier schon eine Durchbrechung der von Gabriel umrissenen Hierarchie, die ihre Struktur ja gerade zur Durchsetzung eines „ungeteilten Willens" gewann. Der fundamentale Widerspruch zwischen den beiden Konzeptionen erwächst aus dem Problem, ob der Herrscher in irgendeiner Abhängigkeit und Verpflichtung zu seinen Untertanen steht oder nicht. Wenn freilich die Aufrührer von der ersten Position und die gottgetreuen Engel von der zweiten ausgehen, so erweitert sich der bisher noch abstrakte Widerspruch zum Antagonismus zweier unterschiedlicher historischer Rechtssysteme, die eng mit dem Problem der Unabhängigkeit der höchsten Herrschaftsgewalt verknüpft sind. Lucifer hat seinen ersten Auftritt zu Beginn des 2. Aktes. Bitter beklagt er sich über Gottes Entscheidung, die Engel den Menschen dienstbar zu machen; der „Erstgeborene" habe dem „Sohn des sechsten Tags" zu gehorchen, Widerrede dagegen sei nicht möglich („Hier geldt geen tegenspraak . . . " , 374). Zwar will Lucifer dem Willen Gottes sich fügen, er begreift aber den Vorgang als Degradierung, ja, mehr noch, als den Beginn eines Zustande der Rechtlosigkeit für die Engel: „Ons slavernij gaat in." (363) Gegen solche Resignation wendet sich Beizebub; er erinnert Lucifer vor allem an seine Position im Himmelstaat: Zijn woord is 't hoog gebod; Zijn wil en wenk een wet, van niemand t* ovettreden. De Godheid wordt in hem gediend, en aangebeden, Bewierookt, en gevierd: en zou een lager stem Nu dondren uit Gods troon? gebieden boven hem?
Der Himmel als Staat
111
Zou God een jonger zoon, geteeld uit Adams lenden, Verheilen boven hem? dat waar het erfrecht sehenden Van 't alleroudste kind, en zijn stadhouderij Ontluisteren. Naast God is niemand groot als gij. De Godheid zette u eens in glorie aan haar voeten: Geen mens verstoute zieh onze orden om te wroeten, En dit bezworen Redit t' ontwijden, zonder reên; Of al de hemel raakt in 't harnas tegens een. (415-27)
Bedeutsam vor allem an Belzebubs Argumentation ist die Insistenz auf der nach Rechtsprinzipien sich ordnenden Herrschaftsstruktur, die Relevanz gesetzlich geregelter Entscheidungskompetenzen. Lucifer ist Statthalter Gottes, er vertritt die höchste Obrigkeit und übt an deren Stelle die Hoheitsgewalt aus. Wer deshalb ihm dient, dient zugleich Gott; sein Wille ist bindendes Gesetz. Dies ist unumstritten; schon Gabriel hatte, als er den Engeln den Willen Gottes mitteilte, befohlen: Gehoorzaamt Lucifer, verknocht aan Gods geboden.
(258)
Hier liegt aber schon der Unterschied: Während Gabriel die Entscheidungen Lucifers ans göttliche Gebot als die übergeordnete Instanz zurückbindet, suggeriert Beizebub eine bruchlose Identität des göttlichen Willens mit dem Lucifers. Nicht also heißt es bei ihm: Wer Gott dienen will, muß Lucifer dienen, sondern: Wer Lucifer dient, dient zugleich Gott. Er kann deshalb so argumentieren, weil in seinen Augen Gott keineswegs unumschränkter Herrscher ist, sondern selbst an ein einmal gesetztes Rechtsverhältnis gebunden bleibt. Gott habe Lucifer zum Zweiten im Staat gemacht, keiner dürfe „dieses beschworene Recht" schänden; sollten Adams Kinder aber sich über die Engel erheben, so sei dies eine Schändung des „Erbrechts des allerältesten Kindes". Beizebub spricht hier zwar immer nur vom Menschen, gemeint aber ist Gott selbst, der den Befehl gab; nur so auch ist verständlich, daß Beizebub im letzten Vers den Bürgerkrieg beschwört; die Rechtsverletzung, heißt dies, kommt nicht von außen, sie ist eine rein zölestische Angelegenheit. Lucifer dürfe sich dem göttlichen Befehl nicht ergeben, so der Kern von Belzebubs Rede, weil Gott mit ihm grundlos ( „zonder reên" ) ein beschworenes Recht verletze. Mit der scheinbaren Grundlosigkeit ist theologisch die Unergründlichkeit des göttlichen Willens, seiner Vorsehung und Allmacht angesprochen; für die Engel aber in ihrer gegenwärtigen politischen Situation bedeutet sie nichts anderes, als daß ihr Herrscher es nicht für nötig befindet, seine Entscheidungen den Untertanen einsichtig zu machen, sie mit seinen Führern abzustimmen, daß er, mit anderen Worten, an dem von Beizebub erwähnten Rechtsverhältnis keinen Anteil mehr nimmt. Eine Veränderung scheint vor sich gegangen, bei der die Erhebung des Menschen nur offener Ausdruck eines grundsätzlicheren Wandels ist: Bisher geltende Gesetze verlieren ihre Bedeutung, neue Rechtsverhältnisse ziehen herauf. Von unten steigen neue Kräfte ( „dit nieuw geslacht", 364) nach oben, während die bislang unangefochtenen Mächte ihre Privilegien verlieren ( „Onze eerstgeboorte leit nu achter, in dit Rijk.", 370). Die Engel büßen ihr exklusives Verhältnis zu Gott ein, sie treten ins zweite Glied. Dagegen verwahren sich die
112
Joost van den Vondel · Lucifer. Treurspel.
ehemals Privilegierten und beschuldigen die von unten aufsteigenden Mächte, „unsere Ordnung umzuwühlen" ( 4 2 5 ) . Sie pochen weiterhin auf ihr altes Redit, ohne zu bemerken, daß es seine Gültigkeit längst verlor. W a s Lucifer für Sklaverei ausgibt, ist vorerst nichts anderes als der Übergang in ein neues Rechtsverhältnis, das freilich im Vergleich zum vorherigen den Verlust der Sonderstellung mit sich bringt. Welcherart ist dies untergegangene Rechtsverhältnis, worin besteht das „beschworene Recht"? E s seien die ersten Sätze von Lucifers Antwort auf die Bemerkungen Belzebubs wiedergegeben: Gij vat het recht: het past rechtschape heerschappijen Geenszins hun wettigheid zo los te laten glijen: Want d' oppermadit is d' eetste aan hare wet verplicht; Verandren voegt haar minst. Ben ik een zoon van't licht, Een heerser over 't licht, ik zal mijn Recht be waren: Ik zwicht voor geen geweld, nodi aartsgeweldenaren. Laat zwichten al wat wil: ik wijk niet enen voet. Hier is mijn Vaderland. (428-35)
Zentral ist diesen Sätzen das Rechtsprinzip. Schon wenn Lucifer Belzebubs Bemerkungen seine Zustimmung erteilt, so tut er dies mit doppelter Bedeutung: „Gij vat het recht" meint zum einen die Richtigkeit des Vorangegangenen, zum anderen aber, daß Beizebub das Recht erfaßt habe. Dessen wesentliche Prinzipien gibt Lucifer hinter dem folgenden Doppelpunkt; es gehe nicht an, so lautet sein Argument, daß ein Fürst, der sich dem Gesetze getreu verhalten habe, bereitwillig seine Rechtsposition preisgebe, denn der Herrscher an der Spitze des Staates sei vor allen anderen an das Gesetz gebunden, er dürfe am allerwenigsten daran rütteln. Damit aber trägt Lucifer Grundprinzipien des Lehnrechts vor; die hier entwickelten Bestimmungen sind die fundamentalen Voraussetzungen des Lehnvertrags, namentlich Lehnprotektion und Lehnstreue. Hat der Vasall seinem Lehnsherren gegenüber seine Verpflichtungen stets sorgsam erfüllt, so hat er gemeinrechtlich ihm gegenüber einen Anspruch auf Treue, denn beide sind in gleicher Weise an den Vertrag gebunden: Dies ist der lehnreditliche Kern von Lucifers Argument. Eine eigenmächtige Änderung des Lehnsverhältnisses also ist dem Lehnsherren aufgrund seiner Verpflichtung auf die fidelitas feudalis, die wechselseitige Lehnstreue, untersagt. Sollte er trotzdem einen Treuebruch vollziehen, so droht ihm der Verlust seines Obereigentums, womit er zugleich den Anspruch auf Ehrerbietung und Gehorsam seines Vasallen eingebüßt hätte. Dies aber beschreibt exakt die Situation, die Lucifer zur Rebellion treibt: Der Lehnsherr Gott hat zwischen sich und seinen Vasallen Lücifer den Menschen gestellt, mehr noch, er hat ihn darauf verpflichtet, dem Menschen zu dienen. Darin aber liegt in lehnrechtlicher Sicht ein Treuebrudi, ein Verstoß gegen den Investiturvertrag, der durch eine feierliche Erklärung des Lehnsherren und den Lehneid des Vasallen besiegelt ist (von daher das „beschworene Redit"). Gott hätte in Lucifers Augen allenfalls dann ein Redit zur Veränderung des bestehenden Verhältnisses gehabt, wenn ihm Verstöße der Engel gegen ihre Pflichten bekannt gewesen wären; da es dergleichen nicht gibt, bleibt er auf den einmal geschlossenen Vertrag verpflichtet. Wenn aber
Der Himmel als Staat
113
Gott trotzdem eigenmächtig den Vertrag bricht, so handelt Lucifer nach seinem RechtsbegriS durchaus legal, wenn er dem Befehl seines Herren widerstreitet. Gott löste das Rechtsband, das zwischen ihnen bestand; damit aber ist zugleich Lucifer aus seinen Verpflichtungen dem einstigen Herrscher gegenüber entlassen. Vondel deutet diesen Prozeß mit einer subtilen Akzentverlagerung an: „Bin ich ein Sohn des Lichts, / Ein Herrscher übers Licht, muß ich mein Recht bewahren." Es ist ein Übergang vom Geschaffensein, der Geschöpflichkeit („Sohn"), zur Eigenmächtigkeit („Herrscher"), von der Bedingtheit zur Unbedingtheit. Hier spricht nicht mehr der Vasall, sondern ein von jeder Obergewalt unabhängiger Herr, der die Konsequenz aus dem Rechtsbruch seines vormaligen dominus feudi zog: Mit dem beschworenen Recht ging die objektive Klammer, die das Ganze zusammenhielt, verloren, an ihre Stelle treten subjektive Rechte. Hier ist die Stelle, an der das Recht zum erstenmal mit dem Possessivum verbunden erscheint; „mein Recht", sagt Lucifer, wie späterhin die Luciferisten bevorzugt von „unserem" Recht reden werden. Wenn die Aufrührer dem Rechtsbegriff das Possessivpronomen voranstellen, so ist dies Ausdruck dessen, daß sie auf seine objektive Gültigkeit nicht mehr vertrauen, daß ihre Rechtsinterpretation zumindest umstritten ist; es ist die Redeweise des Klägers. Freilich gibt es für diesen Fall keinen Richter; Gott selbst ist ja der Beschuldigte. Die höchste Gewalt jedoch als der Rechtsbrecher, der von keiner Instanz auf die Einhaltung des ehemals gültigen Gesetzes verpflichtet werden kann — dies bedeutet den Zustand der Rechtlosigkeit. Schlüssig also ist, wenn Lucifer im nächsten Vers beteuert, er weiche keinem Tyrannen („aartsgeweldenaren"). Zwar ist, wie bei allen diesen Anklagen, Gottes Name hier nicht genannt, die Erbitterung richtet sich offen nur auf den Menschen; solange aber vom Recht gesprochen wird, gelten die Vorwürfe allein Gott, und audi der neutralisierende Plural kann nicht verbergen, daß es Gott ist, der der Tyrannei bezichtigt wird. Gegen den Abbau seiner Rechtsposition, gegen die für ihn daraus sich ergebende Gesetzlosigkeit bleibt Lucifer nur das um so entschiedenere Eintreten für die überkommenen Redite: „Ich weich nicht einen Fuß." Was als Starrsinn und mangelnde Einsicht, von Hoffart nur wenig entfernt, erscheinen mag, ist nichts anderes als die Konsequenz aus Lucifers emphatischem Rechtsverständnis: Als völlig mit lehnsrechtlichen Prinzipien in Einklang erweist sich Lucifers Handeln; er, der bisher nichts sich hat zusdiulden kommen lassen, besteht auf dem einmal geschlossenen Vertrag, er verhält sich somit legal im Gegensatz zu Gott, der, wie es drei Verse zuvor geheißen hat, am wenigsten zu verändern berechtigt war. Von Gott und den Menschen kommt die Veränderung, die Rebellen dagegen sind, so paradox dies zuerst erscheint, die Kräfte des Beharrens. Sie wollen zu Anfang nichts als dem ursprünglich bestehenden Rechtsverhältnis seine volle Wirksamkeit zurückerstatten, um dieserart ihre alten Rechte und Privilegien zu bewahren. Ihre Argumentation trägt dabei alle Züge derjenigen eines feudalen Adels — ständig wird das Recht der Erstgeburt beschworen —, der angesichts neu aufsteigender Schichten um seine Vorherrschaft fürchtet und deshalb auf den angestammten Prärogativen beharrt. Der Intention auf Bewahrung des Bestehenden kommt dabei die
114
Joost van den Vondel · Lucifer. Treurspel.
Struktur des Lehnrechts, dem die Sorge um innere Stabilität immanent ist, deutlich entgegen; was deshalb Lucifer zu Beginn programmatisch konzis vorträgt, durchzieht als gleichsam theoretisches Fundament der Rebellion die Argumentation der Aufrührer im gesamten Verlauf der Auseinandersetzungen. Dafür seien hier nodi einige Belege gegeben. Wenn Lucifer im Anschluß an sein Gespräch mit Beizebub Gabriel nach dem Sinn der göttlichen Entscheidung fragt und Klage führt darüber, daß Gott . . . het mensdom op den stoel Der Englen zet; berooft hun 't Recht der eerste gaven; Gebiedt ze om 's mensen nut te zweten, en te slaven. (459-61)
so ist dies die Klage des Vasallen, dem die Verfügungsgewalt über sein Lehen rechtswidrig zugunsten eines anderen entzogen wurde, aus dessen Händen er nun sein Lehen empfängt, so daß er ihm zu dienen verpflichtet ist. Darin liegt für Lucifer ein Widersinn: . . . zullen wij, Stadhouders van Gods macht, Voor dit geleend gezag, een wulps vermögen, knielen?
(475f.)
Aporetisch nach lehnrechtlicher Vorstellung ist, daß die Statthalter, definitionsgemäß nach dem Herrscher die ersten im Staat, vor irgend jemand, der audi nur seine Autorität aus entlehnter Macht gewinnt, sich zu beugen hätten; dem widerstreitet der streng hierarchische Aufbau der Lehnspyramide. Den Widerspruch vermag Lucifer nur durch die Annahme des Verlustes seiner Statthalterwürde aufzulösen, wobei die neue Abhängigkeit von einem zwischengeschalteten Lehnsherren ihm allein aus Fellonie erklärlich ist: Waartoe vernedert ons d' oneindige Gena Zo vroeg? wat Engel paste op zijnen dienst te spa?
(466f.)
Ständig wird die Frage nach dem Treuebruch, der allein die Änderung des Verhältnisses zu legitimieren vermöchte, von den Luciferisten anklagend wiederholt: Wat is bij ons airee mishandeld, of misdaan, Dat God een waterbel, vol wind en ludit geblazen, Verheft om d' Engelen, zijn zonen, te verbazen? (845-7) Wat hebben wij verbeurd? geeft reden, en bescheid. (876)
Nicht allein sind sie keines Treuebruchs zu überführen, sondern sie geben sogar als die wahrhaft Ordnungsgarantierenden Kräfte sich aus, wie denn Belial von den Engeln sagt: Zij houden d' orden, daar de hemel hen toe riep; Maar kunnen traag verstaan des mensen slaaf te worden.
(969f.)
Ebensowenig, wie die Engel ihre plötzliche Degradierung mit ihren Rechtsprinzipien zu vereinbaren vermögen, fühlt sich Lucifer vom Vorwurf der „staatzucht", den Rafael ihm entgegenträgt, getroffen: Wat staatzucht? heeft mijn plicht in enig deel ontbroken?
(1540)
Das ist nicht so sehr uneinsichtiger Trotz als die Unfähigkeit, die eigenen Kategorien einer neuen Situation anzupassen, das Pochen auf ein System von Lei-
Der Himmel als Staat
115
stungen und Gratifikationen, das in dieser Weise gar nicht mehr besteht. Die Erfüllung einer einstmals geforderten Pflicht vermag nicht mehr die Garantie auf einen Rechtstitel zu erbringen, dessen sich Lucifer von alters her sicher wähnte. Als anachronistisch an den Luciferisten erweist sich, daß sie ständig auf die Treuepilicht des Lehnvertrags rekurrieren, während dodi die staatliche Organisation schon längst anderen Prinzipien als ihrem Fundament gehorcht. Erst als es schon zu spät ist, kurz vor Ende seines entscheidenden Gesprächs mit Rafael, der ihn zum Einlenken zu bewegen sucht, wird ein Funken Einsicht in die historische Überholtheit der eigenen Position bei Lucifer spürbar. Als Rafael ihm entgegenhält: Geleende heersdiappij
Staat
los, en is geen erf.
da entgegnet ihm Lucifer gereizt: 'k Misdank me dan dit leen, als 't immers leen moet heten.
(1599f.)
Mit Recht verweigert Lucifer übertragenem Amt und Gut, das weiterhin dem Herren uneingeschränkt disponibel bleibt, den Titel eines Lehens. Die Erkenntnis freilich, daß es gar nicht mehr das Lehnsrecht sei, das ihn mit seinem Herrn verbindet, dient Lucifer nur dazu, um so stärker auf ihm zu insistieren. Nicht so sehr, daß er gleich darauf für sein altes Recht in den Kampf zieht, ist hier bedeutsam, als daß die Rebellion selbst sich nadh feudalen Ordnungsprinzipien vollzieht. Der Intention auf Bewahrung des Bestehenden entspricht der innere Ablauf der in ihrem Dienste stehenden Praxis. Bezeichnend ist die Wendung, die Rafael, als er Lucifer dessen „staatzucht" vorwirft, den Versen Jesaja 14, 13—4, gibt: Wat hebt gij in uw harte al heimelijk gesproken? Ik wil in's hemels top, door alle wölken heen, En boven Gods gestarnte opstijgen, van beneên, God zelf gelijk, geen macht bestrafen met genade, 't En zij ze aan mijnen stoel het leen verheergewade. Geen majesteit braveer' met scepter, nodite kroon, Ten zij ik haar belene uit mijnen hogen troon. (1541-7)
superbia trägt die Gestalt einer Restitution des Lehnrechts unter einem Herrn, der auf seiner Einhaltung unnachsichtig insistiert. Audi hier noch liegt der Akzent nicht auf der Substitution eines alten Machtträgers durch den ambitiösen neuen (Lucifer wolle „Gott selbst gleich" sein, hatte Rafael gesagt), sondern auf der endgültigen Festschreibung einer überkommenen Machtstruktur, die nur ein neuer Herr zu garantieren vermag. Diesem Ziele gemäß sind die lehnrechtlichen Prinzipien audi in der Rebellion von den Luciferisten nicht außer Kraft gesetzt, mehr noch, der Aufruhr formiert sich als Massenbewegung erst unter dem Diktat des feudalen Schutzprinzips, der Lehnprotektion, die den Herren auf Schutz von Redit und Sicherheit seiner Vasallen verpflichtet. Eben dies Recht bringt Belial, die Rebellion anzuschüren beauftragt, den klagenden Luciferisten gegenüber ins Gespräch: Beledigt iemand u? men zal uw Redit besdiermen.
(911)
116
Joost van den Vondel · Lucifer.
Treurspel.
Nur scheinbar beiläufig ist das Schutzprinzip hier angesprochen; seine Bedeutung für die verschworenen Obersten um Lucifer liegt darin, daß die Protektion einzig um den Preis der Treuepflicht zu haben ist. Die Luciferisten reagieren ganz in diesem Sinne: Als sie den eine hohe Stellung in der Himmelshierarchie einnehmenden Beizebub um Schutz für ihre Rechte ersuchen (lOlOff.), verbinden sie diese Bitte mit dem Angebot ihrer Dienste: Beschut ze door uw macht: wij staan gereed uw scharen, Uw standerd, en uw heir te volgen: trek maar aan. (1043f.)
Das sich hier explizierende Führer-Gefolgschaftsverhältnis stammt noch ganz aus dem Geiste des Heerbanns, wobei das Ideal militärischen Gehorsams für die Unveränderbarkeit des ihm zugrundeliegenden gesellschaftlichen Ideals einsteht. Gleiches zeigt sich, nachdem Beizebub, dem nur die Rolle eines Katalysators zugedacht war, abgelehnt hatte, bei Lucifer, den die Luciferisten mit „wijk en toevlucht aller vromen" (1187) ansprechen, einer Wendung mithin, die noch völlig dem feudalen Vorstellungsbereich angehört: Wij zweren uwen arm eendraditig t* onderstutten. Aanvaard dees heirbijl: help, och help ons Recht beschütten. Wij zweren u met kracht, in volle majesteit, Te zetten op den troon, aan Adam toegeleid. Wij zweren uwen arm eendrachtig t' onderstutten. Aanvaard dees heirbijl: help, och help ons Recht beschütten. (1206-11)
Eindringlich ist in der refrainhaft wiederholten Formulierung das Angebot von Dienstverpflichtung mit dem Schutzersuchen verbunden. Der Treueeid der Luciferisten, auf den die Intrige der Obersten zielte, besiegelt den Vertrag zwischen den Vasallen und ihrem neuen Herren. So wird in der Organisation des Aufruhrs die feudale Herrlichkeit wieder in ihr Recht gesetzt; das Lehnverhältnis, das als Grundlage staatlicher Ordnung zu Beginn durch einen einseitigen Treuebruch des Herrschers endgültig außer Kraft schien, wird mit dem Treueeid auf Lucifer zu neuem Leben erweckt. Für die Luciferisten ist der Eid auf Lucifer nicht so sehr das Signal zur bewaffneten Rebellion als vielmehr die Rückkehr zu geordneten Verhältnissen, zur rechtlichen Sicherheit der Vasallität: Hier fällt ihr Wort, daß sie die Pfeiler von Lucifers Thron sein wollen. Deshalb können sie ihren Eid auf Lucifer mit einem Treueeid auf Gott verbinden; dies ist mehr als unverbindliche Courtoisie oder trügerische Rückversicherung beim früheren Herrn: Es ist Ausdruck dessen, daß es den Rebellen nicht um den Austausch der Mächtigen, sondern um die Bewahrung der Ordnung geht. Darin liegt gleichsam die Loyalität von Royalisten, die das Unrecht ihres Königs nicht mit Aufhebung des Königtums sanktionieren können, sondern, weil ihnen Amt und Würde des Herrschers als Fundament des Bestehenden unverletzlich sind, ihn allein auf die Bahn des Rechts zurückbringen wollen. Wenn die Luciferisten auf Gott und Lucifer zugleich schwören, so schwören sie auf die alte Ordnung, die in Lucifer ihren Wächter gefunden hat. Die peinliche Beachtung des Hergebrachten, die ihren Grund im Interesse an der Bewahrung von der Feudalordnung garantierter Privilegien hat, führt in die Rebellion, die wiederum ihre
117
Der Himmel als Staat
Perspektive nur in Vergangenem findet. Der Aufstand der Engel ist ein Modellfall konservativer Revolution. Die Intention auf Bewahrung freilich vermag in den Augen der gehorsamen Engel dem Aufstand Legitimität nicht zu verleihen. Aufruhr gilt ihnen als die Figur des Unrechtmäßigen schlechthin, gleichgültig verhält sich zu dem die Absicht. Aufruhr bedeutet Abwesenheit des Rechts: D'inspanner tegens God is allerminst reditvaardig.
(1130)
Nicht allein, daß der Aufrührer ohne Rechtsgrundlage handelt, ist dabei von Michael angesprochen, sondern vor allem, daß er jeglichen Rechtsanspruch verwirkt: Der Aufruhr ist die Zone der Rechtsferne. Wie durf zieh tegens God en zijnen heiigen wil Verzetten? (1121f.)
Der Aufrührer steht zum göttlichen Willen exterritorial und verwirkt damit die Rechtlichkeit, die ihr Fundament in der Identität des Herrscherwillens mit dem gültigen Gesetz hat. Es gibt kein Recht außerhalb des bis in die letzten Verästelungen der staatlichen Struktur wirkenden Herrscherwillens — damit schon hat der Rechtsanspruch der Luciferisten seine Grundlage verloren. Nun ist zwar von Vondel der Himmel als Staat gestaltet, zu fragen bleibt aber, ob überhaupt Gott dementsprechend die Züge eines Herrschers trägt und welcherart seine Insignien sind; allein auf diesem Wege erschließt sich der spezifische Charakter und der historische Ort der in der luciferischen Rebellion gestalteten Rechtsverletzung. Gott ist nicht dramatis persona des Trauerspiels, dies ließen die theologischen Vorbehalte der Zeit wie auch der in den religiösen Auseinandersetzungen geschärfte Gottesbegriff nicht zu. Aber oberhalb jedes theologischen Arguments hat die Abwesenheit Gottes vom Schauplatz ihre für den Gehalt des Trauerspiels zentrale Bedeutung; in ihr findet eine politische Idee zum Ausdruck. Gott steht in unausmeßlicher Distanz zu seinen Engeln; die Kluft ist selbst optisch von ihnen nicht zu überbrücken 57 . Unumschränkt und in völliger Unbedingtheit faßt er seine Entschlüsse, die er durch Boten, nicht durchs eigene Wort, den Untertanen mitteilen und zur Ausführung gelangen läßt. Nichts vermag auf ihn einzuwirken, nichts ihn zu behindern. Nach eigenem Ermessen übt er Gnade und Gerechtigkeit aus. Von strahlendem Licht verklärt, fällt sein Glanz auf jene, die sich seinem Willen fügen, die anderen aber verlieren seine Gunst und versinken ins Dunkle, das mit der Entfernung vom Herrscher identisch ist. Dieser Gott waltet mit der in sich ruhenden Majestät und entrückten Erhabenheit des absoluten Herrschers58 ; eine Vereinigung mit seinen Untertanen in 57
Daar wij met vleuglen d'ogen dekken, Voor aller glansen Majesteit . . . (301f.) " Johannessen scheint dies gespürt zu haben, wenn er schreibt: „Der persönliche Kontakt zwischen dieser Gruppe (i. e. den untersten Engeln, E. O.) und dem Höchsten ist ebenso gering wie zwischen Volk und Fürsten in einem absolutistischen Staat." — Johannessen, a. a. O., p. 252. Es bleibt aber bei dem Vergleich; die Bemerkung gar, Gott sei „nur ein primum mobile" (p. 251), geht völlig am Gestalteten vorbei.
118
Joost van den Vendei · Lucifer. Treurspel.
einem Bühnenraum hätte — zumal dem niederländischen Barocktheater die Apotheose fremd war — nachgerade eine ungebührliche Familiarität und Verkürzung der dem System konstitutiven Distanz mit sich gebracht. Gott ist Souverän; weil dessen Würde von der politischen Auseinandersetzung unberührt bleibt, erscheint er als solcher nicht auf der Bühne. — Nun haben freilich Gottesbegriff und absolutes Herrschertum strukturell eine zu große Affinität zueinander (das Gottesgnadentum ist Ausdruck dessen), als daß die bisher gegebenen Hinweise ausreichend zu belegen vermöchten, im Gottesbild des „Lucifer" gestalte sich die Idee der Souveränität. Nahezu unausweichlich ist, daß ein theologisch abgesichertes Gottesbild in Konfrontation mit den feudalrechtlichen Prinzipien der Aufrührer absolutistische Züge gewinnt. Daß aber der Absolutismus der Gottesgestalt keineswegs zufälliges Beiprodukt theologischer Dogmatik ist, bestätigt die Art, in der die Engel von ihr sprechen (und nur aus den Gesprächen ihrer Diener gewinnt sie ja ihre Kontur). In ihrer Rede dominiert die politische Lehre das theologische Vokabular: Wij zijn gehouden God zijn Recht en eer te geven, Te rüsten in zijn wet. Wie treedt hier in gesdiil Met Gods almogendheid? zijn wenk, en woord, en wil Verstrekke ons ene wet, en maat, en vaste regel. Wie tegenspreekt, die breekt des Allerhoogsten zegel. Gehoorzaamheid behaagt den Heerser in dit Rijk Veel meer dan wierookgeur, en goddelijk muzijk. (863-9)
Die Mahnung des Engelchors entwirft das Bild eines Gottes, der in nichts mehr an den liebenden Vater des Neuen Testaments gemahnt. Eine mit Rechten und Gesetzen gepanzerte Allmacht fordert einzig noch Gehorsam; die Formen des religiösen Gottesdienstes sind beiseitegeschoben, und dies mit Grund: Ihnen ist der Gedanke implizit, mit Opfer und Gebet ließe der Wille des Herrn sich beeinflussen. Musik und Weihrauch sind schmückendes Ornament einer harten Machtstruktur, die den subjektiven Willen nicht verträgt. Die „feste Regel" durchwaltet das Ganze; sie ist mit dem Herrscherwillen identisch, der Gesetzeskraft hat. Die Tugend der Engel ist Gehorsam; daß sie in seinem Gesetz zu „ruhen" haben, garantiert dem System die Stabilität, die dem Herrscher solches „Behagen" bereitet. Politische Selbstaufgabe sichert Wohlwollen; im Reyen zu Abschluß des 4. Aktes redet der Engelchor seinen Herrschergott mit Worten an, deren Korrespondenz zum eben gegebenen Zitat ins Auge fällt: O Vader, die geen wierookvat, Nodi goud, noch lofzang waarder sdiat Dan godgelatenheid, en stilte Van't sdiepsel, dat uit nedrigheid Behagen schept aan uw beleid, En in uw wil zidi zelf versmilte . . . (1678-83)
Die Engel flehen zu einem unnachsichtig auf Gehorsam insistierenden Herrscher, dem noch die Versuche, seine Herrlichkeit mit Gold, Weihrauch und Musik zu feiern, als zuviel der Eigeninitiative dünken, weil er weiß, daß darin Rudimente von Insubordination sich verbergen: Wer dieserart Wohlwollen sich
Der Himmel als Staat
119
sichern will, gibt vor, der Herrscher ließe dadurch sich verpflichten. Die zur Schau getragene Willfährigkeit verbirgt so nodi die Erinnerung an Eigenredit: Auch deshalb inszenierten die absoluten Fürsten des 17. Jhs die Feste, die der Demonstration ihrer Macht dienten, selbst. Nicht also Feiern, sondern ruhiges Sichergeben ( „stilte" ) in den Herrscherwillen ist gefordert; erneut setzt Vondel die Vokabel des „Behagens" zur Charakteristik des idealen Verhältnisses zwischen Herrscher und Untertan ein, sie gibt einem Identischwerden subjektiver Intentionalität mit den Bedingungen des Objektiven Ausdruck. Dem Herrscher behagt der Gehorsam seiner Untertanen, die für diesen Beruf sozial-psychologisch hervorragend begabt sind deshalb, weil sie ihr Behagen aus der Entlastung von subjektiven Entscheidungen schöpfen. Ihr Behagen ist emotionaler Reflex des Verzichts auf vereinzelnde Subjektivität, des ,Verschmelzens' mit dem Herrscherwillen, der politischen Selbstaufgabe. Die Engel gehen im Willen ihres Gottes auf wie die isolierten Individuen im Leviathan, der für Hobbes ein „sterblicher Gott" 59 war. Mehr noch erinnert an die politische Philosophie des englischen Denkers: Wie die Engel an der Dominanz des Herrscherwillens das Entlastende rühmen, so steht bei Hobbes der Wille zur subjektiven Entlastung am Ursprung der Staatsgründung. Und wie fernerhin die Loyalität der Engel in einem Verzicht auf Partizipation an den Entscheidungsprozessen sich bekundet, so galt Hobbes jede Einschränkung der höchsten Gewalt als widersinnig, weil es für ihn keinen Willen des Staates gab, der ein anderer als der des Herrschers wäre. Deutlich ist die Nähe des politischen Bekenntnisses der Engel zu den staatsrechtlichen Grundprinzipien des „Leviathan", der drei Jahre vor dem „Lucifer" erschienen war. Damit freilich soll nicht behauptet sein, dessen Formulierungen hätten Vondel bei der Niederschrift seines Trauerspiels vorgeschwebt; wie schon angemerkt, ist über Vondels Hobbes-Lektüre nichts bekannt. Hier geht es einzig um den Nachweis, daß die Absolutheit des Herrscherwillens, zu deren Fürsprechern die loyalen Engel sich machen, einem Rechtsdenken sich verdankt, das mit dem feudalen der Luciferisten schlechthin unvereinbar ist. Ihre Argumentation hat bürgerliches Naturrecht zum Kern; an Hobbes schält dieser nur am schärfsten sich heraus. Die programmatischen Bekundungen der „guten" Engel treffen sich mit den Prinzipien der avanciertesten staatsrechtlichen Theorien, während sich die „bösen" Engel um Rechtsprinzipien scharen, die ihre Dignität wesentlich aus ihrem Alter schöpfen. Bevorzugt erweisen deshalb die Engel ihrem Gott als einer „Allmacht" die Reverenz, indes die Luciferisten diesen Begriff aus ihrem Vokabular bannen; als Apollion mit trughaften Einwänden, die sich auf das Prinzip der Allmacht konzentrieren, Lucifer scheinbar vom Aufruhr abzuhalten sich bemüht, wischt dieser dessen Argumente rasch beiseite: „Laat d'Almacht rusten . . . " (625) Die Allmacht aus dem Spiel zu lassen, bedeutet mehr, als daß die Rebellion ihren Gegner in Gott nicht sieht; es heißt vor allem, daß deren Anerkennung schon den Aufruhr von Anbeginn jeglicher Rechtsgrundlage beraubt hätte. Zum An5' Thomas Hobbes: Leviathan oder Wesen, Form und Gewalt des kirchlichen und bürgerlichen Staates. Hrsg. von Peter Cornelius Mayer-Tasdi. 2. Auflage. — Reinbek 1969. p. 137.
120
Joost van den Vondel · Lucifer. Treurspel.
stoß von Erhebung wird gerade, daß hier ein Herrscherwillen sich absolut setzt gegen überkommenes Recht, das ihm bisher Schranke war; der Kampf der Engel gilt nicht Gott, sondern der Allmacht als Herrschaftsprinzip ; im Himmelsherrscher anerkennen sie die notwendige Spitze der Lehnspyramide, ihr ohnmächtiger Aufruhr versucht ihn als Lehnsherren zu retten vor dem allmächtigen Leviathan, der er schon ist. Die Rede von der Allmacht bleibt deshalb denen vorbehalten, die der neuen Lage sich bereits anpaßten; daß dieser Begriff entgegen seiner Verhaftung an theologische Nomenklatur hier durchaus Politisches meint, zeigt sich nicht nur daran, sondern auch an dem, daß die Loyalen ihn gelegentlich durch Termini eindeutig politischen Inhalts substituieren: Wer Gott als „Oppermajesteit" (1724, 2012), als „Oppermacht" (889) oder als „d' opperste Monarch" (1556) anspricht, redet von ihm als Souverän, als absolutem Herrscher. Vor der höchsten Machtvollkommenheit versagt jegliches Recht auf Berufung, allein schon Rückfrage verrät Ungebühr. Nodi die devote Geste, mit der Lucifer Gabriel ihm den Sinn der verfügten Änderungen zu erklären bittet, gibt dergestalt dem Ungehorsam Ausdruck; letztlich zieht sie die Stabilität des Herrscherwillens und die Sinnhaftigkeit des Intendierten in Frage, die Frage wird zum Rudiment von Kritik. Darauf reagiert Gabriels Antwort genau; obgleich sie teilweise Antwort aufs Gefragte zu Anfang verspricht, gibt sie dodi nichts anderes als politischen Unterricht: Zidi te schikken en te regelen Naar heur gestelde wet, dat voegt den onderzaat, Die aan zijn meesters last en wil gebonden Staat.
(489-91)
Die Explikation absolutistischer Herrschaftsform gilt als angemessene Antwort auf die Frage nach dem Inhalt der verfügten Entscheidungen; daß der Herrscher in seinen Beschlüssen autonom sei, deckt als Erkenntnis über das Wesen des Absolutismus begründend alle Fragen nach dem Sinn einzelner Willensbekundungen ab. Der Primat der politischen Gesamtkonzeption subsumiert zentralistisch derart alles Beherrschte, daß mit jeder politischen Frage der, der sie stellt, sich als Zweifler an der Sinnhaftigkeit des Ganzen denunziert. Die antiindividualistische Tendenz des absoluten Staates, die schon oben anläßlich des Engelchors nachgewiesen wurde, gewinnt bei Gabriel die Selbstverständlichkeit einer sozialen Notwendigkeit, die Selbstaufgabe den Charakter einer politischen Tugend. Sich ins an der Spitze formulierte Gebot widerspruchslos zu schicken, dies erscheint als der Gipfel politischer Einsicht; die Einhaltung der Ordnung, über deren Gestalt einzig der Souverän noch befindet, ist oberstes Gesetz. Die Frage hingegen verrät Unzufriedenheit, wo doch Zufriedenheit verordnet ist; das „Behagen" als emotionaler Beleg für die Stimmigkeit des Ganzen wird zum Ausweis politischer Loyalität: Genoeg u met uw lot, En Staat en waardigheid, u toegeleîd van God. Hij hief u in den top van alle Hierarchien: (...·) Uw aanzien schept zijn licht alleen uit Gods vermögen.
(502-4,508)
Der Himmel als Staat
121
Die Investitur mit politischer Madit erscheint als Gnadenakt des absoluten Herrschers; der Glanz des Fürsten verdankt sich der Huld seines Souveräns wie der des Mondes der Strahlkraft der Sonne, mit der der Barode König oder Kaiser, um deren Einzigkeit zu betonen, zu vergleichen liebte 60 . Das Sichbescheiden in dem begrenzten Rahmen, den der Herrscher setzt, die politische Konformität, ist der Preis, mit dem Macht erkauft wird; jede Überschreitung der definierten Kompetenzen hat, wie Gabriel weiter anmerkt, den Verlust der Krone zur Folge. Mit dem Spürsinn des Propagandisten der absoluten Macht wittert Gabriel in der Frage Lucifere die Insubordination, das Grenzüberschreitende des Unbehagens als einer affektiven Kritik bestehender Zustände. Hat derart die Proklamation erreichter staatlicher Vollkommenheit, wie sie der Absolutismus entschieden betrieb, in der Verpflichtung auf Behagen ihr emotionales Pendant, so liegt auf seinem Gegensatz, der Melancholie, der schärfste Vorbehalt: Hinter ihr ahnt der Souverän den Umsturz. Dies bestätigt ein Blick auf das Frankreich des 17. Jhs nach der Fronde: Wie schon die Langeweile vor den Blicken des Königs sich in den Salons zu verbergen hatte, so gilt gleiches erst recht von der Melancholie. Unter Ludwig XIV. galt sie als »... ein Affront gegen das im Hof symbolisierte Herrschaftssystem." 61 Es bestätigt den Himmel als absoluten Staat, daß in ihm in gleicher Weise Melancholieverbot herrscht. Wenn schon Gabriel Lucifers Unzufriedenheit und der Engelchor die „ongeduldigheid" (877) der Luciferisten als Vergehen an der göttlichen Allmacht rügten, so müssen sie in Trauer die schärfste Kritik am Himmelstaat sehen. Ihren Grund zu verstehen verwehrt den Engeln die Loyalität zum Herrscherwillen, mit der sie sich zur Monotonie des Frohlockens bekehren; weil sie völlig in den göttlichen Intentionen aufgehen, vermögen sie Schlechtes am Bestehenden nicht zu entdecken. Ihr Remedium gegen die Trauer der Luciferisten kann deshalb nur die erneute Bestätigung der Idealität des Himmelstaates sein: Wat wil dit? Wie of hier hangends hoofds ineengekrompen zit, Verlaten, en bedrukt, en zonder nood beladen? Wie geeft hun treurens stof? wie kan dees oorzaak raden? (..·.) De hemel is een hof van weelde en vreugd en vree. (812-5,820)
Nachdem der Staat als Ursache von Melancholie ausgeschieden ist, und die Trauer als „ohne Not" denunziert, mischt sich spürbar ein drohender Ton in die Worte der Engel: Hoe? dit voegt geen burgerijen Van Englestad, o neen: dit voegt geen Heerschappijen, Geen Machten, Tronen, nodi geen heersend Hemelsdom.
(834-6)
Als die Beschwörung des rundweg gelungenen Staates nicht fruchtet, tritt das Verbot in Aktion; Melancholie ist per Dekret auszuschalten wie jede andere Kritik. Wie wenig es dabei einzig um die Elimination eines die kollektive 60 Benjamin, a. a. O., p. 57. 61 Wolf Lepenies: Melancholie und Gesellschaft. — Frankfurt 1972. p. 64.
122
Joost van den Vondel · Lucifer. Treurspel.
Freude störenden emotionalen Unbehagens geht, beweist die Form, in der die Engel die Trauernden ansprechen: Nicht an eine amorphe Masse ergeht die Mahnung, sondern an Staatsbürger, die ihrer unterschiedlichen Funktion entsprechend benannt sind. Die Engel werden gleichsam offiziell, sie spüren in der Melancholie den Hochverrat; die verordnete Freude wird so zur anbefohlenen Staatstreue. Der absolute Staat setzt Trauer über alles, was ihn betrifft, auf die Liste der politischen Verbrechen, der Himmel bei Vondel macht da keine Ausnahme. — Daß die Arbeit am Mythos diesen mit eigener historischer Erfahrung sättigt, bestätigt mithin das Vondelsdie Trauerspiel aufs neue. Zum Anlaß von Rebellion wird die Entmachtung eines alten Schwertadels durch den sich formierenden absoluten Staat; an ihm muß der Aufruhr in gleicher Weise versagen wie der der Frondeure am französischen Königtum. Gewiß ist hier nicht die Fronde abgebildet, wohl aber ging deren historische Problematik ins Trauerspiel ein; im gleichen Jahr 1648, in das der Beginn der Fronde fällt, begann Vondel die Arbeit am „Lucifer", fünf Monate vor der Uraufführung bricht der Aufstand der Frondeure endgültig mit der Unterwerfung Bordeaux' (31.7. 1653) zusammen. Von gleicher Harmlosigkeit, wie das Aufbegehren des alten Adels für den absoluten Herrscher war (schon die Namensgebung verspottet die Rebellen: „fronde" heißt die Schleuder der Pariser Gassenbuben), ist der Aufstand Lucifers für Gott; er vermag an der Faktizität des Bestehenden nicht mehr zu rütteln. Die Rechtsprinzipien haben den neuen Herrschaftsverhältnissen längst sich angepaßt; aufs schärfste tritt dies hervor, wenn das alte und das neue Rechtsverständnis einander begegnen. Auf die stolze Rechtfertigung der Luciferisten: Wij steunen op het Redit, ons wettig toegestaan.
erfolgt die Antwort des Engeldiors: Uw Redit en handvest blijf de Godheid onderdaan.
(880f.)
Und als Apollion die Klagen der Luciferisten mit der Bemerkung legitimiert, sie stützten sich auf ihr Recht, entgegnen die Engel: Wat Redit? die wetten geeft vermag de wet te breken.
(922)
Bekennt die zweite Antwort, indem sie den Bruch überkommenen Redits keineswegs leugnet, den Wandel der Rechtsnormen offen ein, so tut sie das schon mit Hilfe des neuen Rechtsverständnisses. Daß das innerstaatliche Redit dem Willen des Souveräns unterworfen bleibt, und daß dieser sich nach Maßgabe seiner politischen Intentionen über bestehende Gesetze hinwegsetzen kann, gehört zu den Grundannahmen naturrechtlicher Staatstheorie. Schon bei Grotius, dem doch eine explizite Souveränitätslehre fehlt, finden sich Bemerkungen, die in diese Richtung weisen: Das innerstaatliche Redit kommt von der staatlichen Obrigkeit, d. h. von der, welche dem Staat vorsteht . . . 6 2 « Grotius, a. a. O., p. 53. (I, I, XIV, 1)
Der Himmel als Staat
123
Diejenige Gewalt wird die höchste genannt, deren Tun und Lassen keines Menschen Recht so unterstellt ist, daß sie nach seinem Willen oder Gutdünken unwirksam gemacht werden könnte.63
Dem „Inhaber der höchsten Gewalt" aber ist erlaubt, „ . . . seinen Willen zu ändern." 63 Dem Staat und damit dem Herrscher erwächst für Grotius aus seiner Pflicht „zum Schutz von Ruhe und Ordnung" ein „ . . . höheres Redit, soweit dies zu dem genannten Zweck erforderlich ist." 64 Freilich zog er niemals die radikale Konsequenz des Thomas Hobbes, die wie eine Zurückweisung sämtlicher Klagen der Luciferisten anmutet: Es „ . . . kann der Vorwurf eines Vertragsbruches niemals den Herrscher treffen" 65, wie auch „ . . . die Handlung des Herrschers einem Untertan gegenüber kein Unrecht sein" kann 66 , denn Gesetzgebung und Rechtsprechung sind als konstitutive Momente der Souveränität unlöslich mit ihr verbunden. Dem verleihen die Engel Ausdruck, wenn sie darauf insistieren, daß das Recht dem Herrscher untertan bleibt, und daß, wer die Gesetze gibt, sie auch zu brechen vermag. Die Verfügungsgewalt über das Recht gilt ihnen als Ausweis von Souveränität; die Forderungen der Luciferisten greifen gewaltsam in deren Kompetenzen ein. Nun galt den Naturrechtslehrern die Verfügungsgewalt des Souveräns übers positive Recht (nicht übers Naturrecht, auf das nach Grotius nicht einmal mehr Gott Einfluß hat) nicht als Erlaubnis zu zügelloser Willkür; allemal setzen diesem jene Prinzipien eine Schranke, um derentwillen es zur Staatsgründung kam. Das Recht wird von ihnen seiner Funktion fürs Ganze nach betrachtet; es hat zu gewährleisten, was als Intention am Ursprung der Staatsgründung stand. Wenn also bei Grotius unter dem Anstoß des Geselligkeitsprinzips die Menschen zu einer geordneten Gemeinschaft finden, weil ihnen diese Ruhe und Schutz gewährt, oder wenn bei Hobbes die Bürger vor dem Rivalitätsprinzip in den Staat flüchten, weil er ihnen Leben und Eigentum garantiert, dann hat dem sich der Souverän zu beugen und dem Ziel staatlicher Sicherung entsprechend die Gesetze einzurichten. Lucifer dagegen spricht: Laat bersten al wat berst: Ik handhaaf't heilig Redit . . . (1526f.)
Mit diesem Satz denunziert Lucifer den eigenen Rechtsanspruch als zur Kaschierung seines Machtstrebens vorgeschoben; er abstrahiert das Recht von seiner Funktion und wendet es gegen das Ganze des von ihm zu regelnden Staates. Ein Recht, das sich lösen ließe von seiner staatlichen Funktion, kennt das naturrechtliche Denken nicht, ein Recht gar, dessen konsequente Befolgung in der Liquidation des Staates gipfelt, erscheint als der höchste Widersinn. Das abstrakte Rechtsverständnis führt in die Asozialität; nicht die Ordnung des Ganzen hat hier die Präponderanz, sondern der subjektive Anspruch, dessen Hypostasierung den Staat unnachsichtig zum „Bersten" bringt. Ein Unbefugter nimmt zur Durchsetzung subjektiver Absichten das Recht in eigene Regie — das aber ist der Rückfall in den Naturzustand. « M « w
Grotius, Grotius, Hobbes, Hobbes,
a. a. O., a. a. Ο., a. a. O., a. a. O.,
p. 90. (I, III, VII, 1) p. 113. (I, IV, II, 1) p. 139. p. 140
124
Joost van den Vondel · Lucifer. Treurspel. Naturelijk is elk besdiermer van zijn Recht.
(1148)
So die Luciferisten; mit diesem Satz verkünden sie — in naturrechtlicher Sidit — das Gesetz des homo homini lupus, sie proklamieren die Regression in vorstaatliche Verhältnisse. Sie machen, aus rechtlichem Rigorismus, die Anstrengung der Staatengründung vergeblich. Mögen sie auch subjektiv als Rechtsmärtyrer sich empfinden, so opfern sie dodi objektiv das Recht, weil sie abstrakt auf ihm insistieren. Die Aufrührer betreiben zugunsten des Rückfalls in die Vereinzelung die Entmachtung des Souveräns, der als die Objektivation des Kollektivwillens der einzige Behüter des Rechts sein kann. Indem der Himmelsherrscher seine gefestigte Machtposition gegen die feudalrechtlich drapierten Aspirationen seines alten Adels behauptet, leistet er mehr als nur die Bewahrung eines erreichten Rechtsstandes: Er rettet die staatliche Ordnung überhaupt, so wie sie dem Naturrecht einzig denkbar schien. Wenn Lucifer für Gott zu kämpfen vorgibt, so macht er sich doch schuldig an der Idee der Souveränität, die er anzuerkennen nicht bereit ist. Die Paradoxie eines Kampfes gegen den Herrscher im subjektiven Bewußtsein, zu dessen Gunsten zu kämpfen, ist Resultat seiner Blindheit gegenüber der politischen Faktizität. Anders ist nicht zu erklären, daß Lucifer für Gott gegen dessen Heer ins Feld zu ziehen sich gezwungen sieht, ist doch der Oberbefehl übers Heer entscheidendes Konstituens von Souveränität. Bei Hobbes heißt es: Denn der Schutz eines Volkes liegt in seinem Heer, und die Stärke eines Heeres in seiner Einigkeit. Der Oberbefehl gebührt dem Souverän, denn audi ohne eine Staatsgründimg hat der die souveräne Gewalt, der das Heer befehligt. Wer immer audi demnach Befehlshaber ist, der Souverän führt den Oberbefehl. 6 ?
Es ist aus eben diesem Grunde, daß der erste, der den Anspruch der Luciferisten, im Namen Gottes zu kämpfen, zurückweist, Michael, der Befehlshaber des Heeres, ist. Ein Kampf gegen das Heer muß ein Kampf gegen den Souverän Gott sein. Hij kant zieh tegens God, en Godheid, wie zieh kant Meinedig tegens ons. (....) Wie anders oreloogt dan onder mijn banier, Beoorloogt God, en is een vijand van zijn Rijken. (1141f., 1145f.)
Eine Trennung von Befehlshaber und Oberbefehl, die die Luciferisten vornehmen müssen, läßt die Idee der Souveränität nicht zu; ein Angriff aufs Heer wird zu deren entscheidender Verletzung. Hier reagiert der Souverän empfindlich, denn das Heer ist als äußerer Ausweis seiner Macht in der Realität (nicht aber in seiner Idee) die tatsächliche Stütze seiner Herrschaft. Mit ihm gewährleistet er die Einheit, um derentwillen Souveränität sich begründete. Mit deren Prinzip also konterkariert Michael die Intention der Aufrührer, den Kampf für eigenes Recht mit der Berufung auf den Herrscher zu überhöhen. Die Idee der Souveränität setzt präzise den terminus post quem, mit dessen Überschreitung Lucifers Bekenntnis zum Aufruhr inkorrigibel wurde. Das Stück 67 Hobbes, a. a. O., p. 143.
Der Himmel als Staat
125
bietet hier Schwierigkeiten zumal mit dem Gnadegebot Rafaels kurz vor der Schlacht, als alles schon zum Kampf bereitsteht. Smit zog daraus den Schluß, Lucifer habe erst in dem Augenblick wahrhaft die Grenze überschritten, als er im Kampf mit Michael auf dessen Schild einhieb und damit Gottes Namen angriff 68 . Man wird hier freilich zweierlei unterscheiden müssen: Das Ereignis, mit dem die Rebellion irreparabel wird, ist nicht identisch mit dem, das den Herrscher endgültig auf Gnade verzichten läßt. Die Faktizität der Rebellion ist unumstößlich zu Ende des 3. Aktes, mit dem Schwur der Aufrührer auf Gott und Lucifer und mit dem Weihrauchopfer, das sie ihrem Feldherrn darbringen. Es ist daran zu erinnern, daß nicht Gott zu stürzen die Absicht Lucifers ist, sondern den Thron an seiner Seite, der dem Menschengott vorbehalten bleibt, will er einnehmen, weil ihm dieser als dem Zweiten im Staate zukomme. Tatsächlich bedeutet dies Unternehmen aber — Schwur und Weihrauchopfer bezeugen es — eine Beförderung Lucifers aus der Rolle des Zweiten zur Gottgleichheit, somit rechtlich nichts anderes als die Aufhebung der Souveränität Gottes. Gnade und Gerechtigkeit stritten in Gott gegeneinander, so berichtet Gabriel, solange der Aufruhr vorbereitet wurde: Maar als de wierookstank in top komt opgestegen, De smook, die Lucifer omlaag wordt toegezwaaid, Met wierookvat, bazuin, en lofgezangen, draait De hemel zijn gezidit van zulke afgoderijen, Gevloekt van God, en Geest, en alle Hierardiijen. Gena had uitgediend. (1373-8)
Das Weihrauchopfer als Zeichen der Abgötterei markiert im Kontext des politischen Konfliktes die Inauguration eines Nebenherrschers; damit aber ist die äußerste Toleranzgrenze des Souveräns überschritten, jede weitere Duldung käme der Selbstdestruktion seiner Herrschaft gleich. Unumstößliches Prinzip von Souveränität ist die Einheit der Regierungsgewalt; indem Lucifer mit Schwur und Opfer Gott sich gleichsetzen läßt, trägt er Konkurrenz und Widerspruch an die Spitze des Staates. Dies aber ist ein Zustand, der dem klassischen Naturrecht von jeher als die ideale Ausgangssituation für Bürgerkrieg und staatlichen Verfall galt, mit der Einheit der Führung verfällt die des Staates. Lucifers „staatzucht" hat nicht darin ihre große Bedrohlichkeit, daß sie einen Herrscher durch einen neuen zu ersetzen trachtet, sondern daß sie einen zweiten neben den ersten stellen will und damit einen Zwiespalt in den Staat trägt. Aus der Sicht des Souveräns steht die Einheit des Staats auf dem Spiel, die allein bleibend innere Sicherheit, Ruhe und Rechtlichkeit zu gewährleisten vermag; der Staat ist nicht anders als mit seinem schärfsten Gegner, dem Bürgerkrieg, zu retten. Der Krieg der Bürger untereinander, den zu verhindern leitende Absicht bei der Staatsgründung war, wird zum staatserhaltenden Akt, während die Verwirklichung der Absicht Lucifers die Institutionalisierung des Bürgerkriegs bedeutete. Bei Strafe nur seiner Selbstaufhebung hätte der Souverän weiter zögern dürfen: Das Religionsgebot, der Mensch dürfe neben Gott keine « Smit, a. a. O., p. 160.
126
Joost van den Vondel · Lucifer. Treurspel.
Götter mehr haben, trifft sich mit dem politischen, daß es neben dem Souverän keinen weiteren geben darf. Obwohl nun Gabriel aus Lucifers Hochverrat schon die Konsequenz zog, die Gnade habe ausgedient69, erfolgt ein weiteres Gnadenangebot. Dramentechnisch bietet das große Gespräch zwischen Rafael und Lucifer Vondel noch einmal eine Möglichkeit zur Konzentration der Argumente, die gleichzeitig geschickt zur Retardation des Handlungsablaufs eingesetzt wird. Die Tatsache nun, daß auf einem Höhepunkt des Geschehens, als alles schon entschieden scheint, Gott dodi noch einen Boten seiner Gnade aussendet, ist von Hugo Bekker 70 dahingehend interpretiert worden, daß Vondels „Lucifer" keineswegs „staatzucht" zum primären Gegenstand habe, vielmehr sei es dem katholischen Autor darum gegangen, die Kraft der göttlichen Liebe und Gnade zu gestalten. Es gehe ihm nicht so sehr um Lucifer als um Gottes Verhalten ihm gegenüber; an dem zeige sich, daß Vondel seinen Gott begreife „ . . . as a God of infinite mercy whose realm is based on the ordo amoris." 71 Nun kann es hier gewiß nicht darum gehen, den Text auf die Intentionen seines Autors hin abzufragen und die Argumente für „staatzucht" und göttliche Gnade gegeneinander abzuwägen. Was noch auf der Ebene der Intentionalität ein Widerspruch scheint, ist im Gehalt miteinander versöhnt. Erneut ist Besinnung auf das naturrechtliche Fundament der Idee von Souveränität geboten. Es liegt in der Intention auf inneren Frieden und Sicherheit, auf Rechtlichkeit und Ruhe; während Hobbes aus der Furcht vor dem Behemoth, dem Bürgerkrieg, seinem Leviathan solch harte Kontur verlieh, finden bei Grotius die Menschen unter dem Geselligkeitsprinzip zur Einheit. Bei unterschiedlicher anthropologischer Fundierung messen doch beide dem Souverän mit der Gewährleistung des inneren Friedens die gleiche Aufgabe zu. Gottes eindringliches Friedensangebot zum Schluß kommt eben dieser Pflicht nach: Es ist ein letzter friedlicher Versuch, die Eintracht zu retten und Krieg abzuwehren; nicht um die Demonstration von Gnade, sondern um die Bewahrung des Friedens ist es ihm zu tun. Rafael trägt als Friedenszeichen den Ölzweig in Händen 72 , wessen es nicht bedurft hätte, wenn es einzig um einen Gnadenakt gegangen wäre. Der Leviathan versucht, eingedenk seiner Aufgabe, ein letztes Mal, den Behemoth zu beschwichtigen, dies ist der politische Kern der göttlichen Gnade und Liebe. Was katholisch als ordo amoris erscheint, hat sein säkulares Pendant im Geselligkeitsprinzip. Der ordo amoris ist die soziale Klammer, die die Individuen zu einem Ganzen vereint; als Liebe und Gnade erscheint sie vor dem Hintergrund des brutalen Naturzustands, in den zurückzufallen angesichts des Bürgerkriegs droht. Dem Smit hält diesen Satz — wie verschiedene andere, die Widerspriidie im Text hervorrufen — für ein Residuum einer früheren Fassung, (p. 138) 70 Hugo Bekker: Divine Love as the Unifying Principle in Vondel's „Lucifer". — In: The Modern Language Review. LIV (1959) pp. 384—390; ders.: The Religio-Philosophical Orientations of Vondel's „Lucifer", Milton's „Paradise Lost" and Grotius' „Adamus Exul". — In: Neophilologus. 44 (1960) pp. 234—244. 71 Bekker, Divine Love, a. a. O., p. 385. 72 „vredetak" (1453), „olijftak" (1511), „tak van pais" (1633)
Der Himmel als Staat
127
theologischen Spannungsgefüge Allmacht, superbia, ordo amoris entspricht das säkulare Souverän, „staatzucht", Staat. — Die in der Widmung formulierte Einsicht in die Notwendigkeit legitimer politischer Herrschaft findet gestalterisch ihre Ausprägung in der Idee der Souveränität; die Konflikte, die sich im Himmel als Staat an ihr entzünden, tragen die historische Gestalt der Auseinandersetzungen, die die Fundierung souveräner Herrschaft begleiteten. Die Ausbildung der Landeshoheit und die Festigung der Staatsgewalt ließen kündbare Lehnstreue als Fundament des Staates nicht mehr zu; bedeutungslos ist bei allgemeinem Staatsbürgertum das Prinzip des Schutzes der Vasallen durch den Lehnsherren, von dem die Luciferisten noch ausgehen. Stehende Heere und Besteuerung berauben die einstigen Lehnsdienste ihres Inhalts; die Entmachtung der Feudalaristokratie durch das Königtum bringt schließlich die Substitution des leeren Lehnwesens durchs höfische Zeremoniell. Vondels Trauerspiel markiert diesen Übergang: Der Untergang der Luciferisten hat seinen Grund im Nichtverstehen eines Neuen, im starren Blick aufs Gewesene. Ihre Treue zur alten Rechtsordnung, die ihnen Privilegien und Macht garantierte, verwehrt ihnen die Einsicht in den historischen Wandel, der ihre reale Entmachtung schon längst mit sich brachte. Heroisch wird der Kampf Lucifere, weil er aus rechtlichem Rigorismus ins Unvermeidliche sich nicht schickt, obgleich ihm — zuletzt im großen Schwankungsmonolog — die Erkenntnis dämmert, seine eigene Position sei überholt. Das „boos vermeten" (2171) der Luciferisten liegt darin, daß sie nicht aufs von der neuen Rechtslage geforderte Maß sich herabnivellieren lassen wollen und damit das Ganze gefährden. Die Grenze zwischen Gut und Böse zieht im „Lucifer" der Begriff des Staates 73 . Die Entdeckung der Souveränität verbindet sich den Luciferisten mit dem Schock, den der Eintritt aus einer geschichtsfernen Idylle in den Raum der Geschichte mit sich bringt. Was von verläßlicher Konstanz und Statik schien, erweist sich mit einem Mal als Prozeß; erschüttert erfahren die Engel, daß ihr „Staat" nicht „onveranderlijk" sei (781f.). Souveränität wird nicht proklamiert, sondern sie beweist ihre Existenz und Wirksamkeit an einem Ereignis, an dem erst der historische Wandel sichtbar, ja mit dem gleichsam erst Geschichte inauguriert wird. Mit der Erschaffung des Menschen tritt in die Ewigkeit Gottes die Zeitlichkeit der Heilsgeschichte, sie bringt Bewegung in die zölestische Statik. Gott erschafft den Menschen, um ihn auf den Thron an seiner Seite zu setzen; seine Souveränität gibt sich daran zu erkennen, daß sie neuen Kräften zur Herrschaft verhilft, die bisher ohne Einfluß auf das Ganze des Staates waren. Sie steigen von unten auf und verurteilen die bisher gültige Herrschaftsstruktur zur Bedeutungslosigkeit. Interessengemeinschaft besteht zwischen den Menschen, die noch unter den Engeln stehen, und dem von allem abgehobenen Souverän; die Würde des alten Himmelsadels verblaßt gegen diese neu 73 Der Begrifl des Bösen selbst ist im „Lucifer" von geringer Bedeutung; nur 2171 ist „boos" verwendet, 2074 „boosheid". Die Synonyma von „boos" (kwaad, erg, siecht, lelijk) wird man vergeblich suchen.
Joost van den Vendei · Lucifer. Treurspel.
128
entstandene Koalition. Für Lucifer sind die Menschen Parvenus und Günstlinge; nichts erschreckt die Aufrührer an ihnen so sehr wie ihre stetig wachsende Menge, mit der sie den Himmel überschwemmen, und in der die Engel verschwinden werden. Als die loyalen Engel den Rebellen raten, sich „onder 't juk van 't enig hoofdgezag" (873) zu beugen, mit welcher Formel das Souveränitätsprinzip präzise umschrieben ist, da antworten diese: Zegt liever: onder't juk van grimmelende mieren.
(874)
Für die Luciferisten ist die Herrschaft des Souveräns identisch mit der Herrschaft der wimmelnden Ameisen; erst als diese sich regten, wurde den Engeln das Joch der Souveränität aufgebürdet. Die Aufrührer ahnen gleichsam den bürgerlichen Kern des Souveränitätsprinzips; wie dessen naturrechtliche Formulierung ans gekräftigte Bürgertum gebunden ist, so wird der alte Himmelsadel des absoluten Herrschertums erst in dem Augenblick inne, als neue Schichten ihn verdrängen. Die Forderung nach Rechtsgleichheit, unter welcher allein das Merkantilsystem zur Prosperität gelangt, legitimiert das Naturrecht mit seinen großartigen Fiktionen; der Souverän schafft Rechtsgleichheit, indem er die Macht des alten Adels bricht und das Bürgertum gegen ihn ausspielt. Das Bürgertum wird zum Subjekt von Geschichte, der Souverän garantiert ihm den Aufstieg, der Adel fällt ihm zum Opfer. Die Umgestaltung der Machtstruktur des Himmels geschieht im Dienste des Menschen; daß als der Mensch aber der Bürger auf den Plan der Geschichte tritt, verrät der bezeichnende Wandel, dem zugleich die inneren Verhältnisse des Himmels unterzogen werden. Auf äußerer Ordnung insistieren beide Parteien; aber, so müssen sich die Luciferisten belehren lassen: Elkandre, in eendracht, liefde, en trouw, voorbij te streven, Behaagt den Vader, die het al in orden sdiiep.
Dagegen Belial: Zij houden d' orden, daar de hemel hen toe riep . . .
(967-9)
Die konträren Prinzipien sozialer Dynamik und sozialer Statik kollidieren in diesen Sätzen: Während die Engel mit der Akzentuierung innerer Bewegtheit bei gestärkter äußerer Ordnung gleichsam ein staatlich domestiziertes Konkurrenzprinzip als die Regel bürgerlicher Existenz entwerfen, stellen die Aufrührer als feudalrechtliches Ideal dem die Unbeweglichkeit einer Ordnung entgegen, die, einmal geschaffen, so zu bleiben hat. In der Tradition von Mittelalter und Renaissance holen sich noch bei Vondel die streitenden Parteien mit dem Blick auf den Sternenhimmel die kosmische Versicherung für ihr gesellschaftliches Ideal. Groß entwirft der Engelchor das Bild der Sternenkonstellation: Gij ziet hoe 't hemels heir, geharrenast in 't goud, En in 't gelid gesteld, zijn beurt en sdhildwadit houdt; Hoe, deze star gedaald, en gene in top daar boven, De klaarste een minder klare in luister kan verdoven; Hoe d' ene een kleiner ronde, en d' andre een groter schrijft; De laagste hemel snelst, de hoogste langzaam drijft; En evenwel verneemt ge, in deze oneffenheden
129
Der Himmel als Staat Van ambten, licht, en kreits, en stand, en tränt, en treden, Geen tweedradit, nijd, noch strijd: des Albestierders stem Geleidt dit maatgezang, dat luistert scherp naar hem. (972-81)
Dem stellt Belial den einen Satz entgegen: 't Gestarrent blijft in Staat, daar God het in wou sdieppen.
(982)
Völlig Verschiedenes lesen die Kontrahenten aus den Sternenbildern: Der Engelchor beschreibt eine bunt bewegte Masse, die darin, daß sich alle ihre Mitglieder den Geboten des lenkenden Herrschers fügen, noch längst nicht an Farbe verliert. Im Gegenteil: Der Regent an der Spitze sichert den Raum für Diversifikation und Bewegtheit; eine Mannigfaltigkeit an Ämtern, Aufgaben, Ständen, an Positionen, Zielen, Richtungen und Intentionen durchwaltet das Ganze; der einzelne Stern geht in der Gesamtkonstellation nicht auf, sondern behauptet sich, von ihr getragen, als Individuum; der eine ist von großer, der andere von geringerer Bedeutung für das Ganze; nichts aber ist festgeschrieben, in ständiger Bewegung verschieben sich die Positionen; der Wandel ist institutionalisiert, so daß es zu inneren Auseinandersetzungen nicht kommt. Dem weitgespannten Bogen individueller Verhaltensformen und der Dynamik von sozialen Beziehungen konfrontiert Belial die Hypostase des Ordnungsbegriffs; ihm ist am sozialen System einzig das Bleibende, Unbewegliche bedeutsam, weshalb er sein soziales Ideal in einem Satz formulieren kann, der dem an monolithischer Starre in nichts nachsteht. Der Sternenhimmel bietet für die Engel das Bild eines Staates, der dem einzelnen weiten Raum für Eigeninitiative und Individualität läßt (wovon freilich der Staat als Ganzes stets unberührt bleibt), während die Aufrührer in ihm die Ordnung als Selbstzweck sehen. Bürgerlicher Individualismus, der die verfestigten Sozialstrukturen beiseiteräumt: dies mithin ist der historische Kern des Rechtsstreites zwischen den feudalaristokratischen Rebellen und ihrem souveränen Gott. Der Sturz des Himmelsadels schafft im Staat den Raum, den der Bürger zu seiner Entfaltung braucht. Alte Privilegien, die zum Hemmschuh sozialer Entwicklung wurden, beseitigt der Souverän; er garantiert die äußere Sicherheit und innere Ordnung, deren der Bürger bedarf. Der Bürger Vondel gestaltet den Himmel als Staat, in dem der Bürger sich zuhause fühlt: Ruhe, Sicherheit, Friede, Rechtlichkeit, Ordnung und ein weiter Raum für Selbstentfaltung schaffen ihm ideale Bedingungen; „staatzucht" demnach „ . . . als het groote kwaad bij de menschen, waardoor de orde en de vrede verloren gaat . . . " 74 trägt die Züge des Vorbürgerlichen, das störend und hemmend in die neue Zeit hineinreicht. Die naturrechtliche Lehre von der Souveränität, von Bürgern formuliert und bis zur Französischen Revolution ihre schärfste Waffe gegen die Feudalaristokratie, eliminiert den Adel als staatstragende Klasse; Republik, wie in Holland und England, oder Absolutismus, wie in Frankreich, ist dem Bürger die einzig noch annehmbare Alternative; beides hat Vondel akzeptiert: „Onder welken bijzonderen vorm ook, monarchie of re74
Vandervelden, a. a. O., p. 154.
130
Joost van den Vondel · Lucifer. Treurspel.
publiek, blijven de eigensdiappen van het gezag onaantastbaar . . . " 75 Im Trauerspiel Lucifers gestaltet sich das kollektive Schicksal einer ganzen Klasse: der Sturz der Feudalaristokratie in die welthistorische Bedeutungslosigkeit. Der Jubel Michaels über den Sieg trifft sich mit dem Freudenruf, mit dem der Bürger die neue Ordnung begrüßt: Geloofd zij God; de Staat hier boven is veranderd.
75
Vandervelden, a. a. O., p. 153.
(2002)
FRIEDRICH G O T T L I E B KLOPSTOCK: DER MESSIAS
Der Teufel in der Aufklärung: Vernunftgebot und Entdämonisierung Dodi kann idi Ihnen audi nicht bergen, daß Ihre Liste von Teufeln, die aus dem Himmel gejagt worden, und die Geschichte der ganzen Revolution da, daß Luzifer sidi für den schönsten gehalten — Die heutige Welt ist über den Aberglauben längst hinweg; warum will man ihn wieder aufwärmen. In der ganzen heutigen vernünftigen Welt wird kein Teufel mehr statuiert — J. M. R. Lenz: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung. 1774.
Der häufigen Tendenz in motivgeschichtlichen Arbeiten, auf einen Idealtyp hin zu abstrahieren und im Blick auf motivhistorische Konstanten das je Unterscheidende der einzelnen Gestaltung zu übergehen, vermochten auch die Untersuchungen literarischer Teufelsgestaltung nur selten sich zu widersetzen. Zumal in den Analysen der Milton-Rezeption des 18. und 19. Jhs komponieren sich stets aufs neue einzelne Züge der Teufelsgestalt aus „Paradise Lost" zum Typus des Miltonschen Satan, der seine Identität, resistent gegen die jeweilige Intention und historische Situation, von Klopstock bis Baudelaire scheinbar zu bewahren imstande war. Daß der Satan „à la manière de Milton" dem Baudelaire höchste Bewunderung zollte, in den Werken der französischen Spätromantik einen völlig anderen Gehalt zur Darstellung bringt als in der deutschen Aufklärung, verliert dabei über der Kontinuität des scheinbar Identischen an Bedeutung; in solchen Untersuchungen dominieren die am Mil ton-Text festgestellten Elemente Schönheit, Rebellion, Stolz, Mut und Trauer, subsumiert unter dem Generalnenner des Erhabenen, als die immer gleiche Erscheinungsform des einen Typus über die Spezifität der jeweiligen Gestaltung. Dieserart kann noch eine neuere motivgeschichtliche Arbeit, die sich den methodischen Rückgriff auf die Theorie des Idealtyps bei Max Weber ausdrücklich zur Ehre anrechnet, beständig die Teufelsgestalten bei Milton und Klopstock als zu einem Typus gehörig ausgeben, ohne doch je die Prinzipien zu nennen, die die Konstitution dieses Typus nahelegten, oder gar der Unterschiede innezuwerden, die ι Charles Baudelaire: Journaux intimes. — In: Ch. B.: Œuvres complètes. — Paris 1961. ( = Bibliothèque de la Pléiade.) p. 1255.
132
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
zwischen beiden Gestaltungen bestehen 2 . Das Moment des Geschichtlichen reduziert sich in solchen Prinzipien gehorchender Motivhistorie auf die Diachronie bestimmter Konstellationen gleichbleibender Merkmalseinheiten, auf eine Chronologie von Kontinuitäten und Affinitäten, worüber der je sich wandelnde geschichtliche Inhalt des Motivs, die dialektische Vermittlung von Motiv und Geschichte, unter der Herrschaft des Typischen unerkannt bleibt. Die Untersuchung des Typischen konzentriert ihr Interesse auf das stets gleiche, während geschichtliche Erkenntnis sich gerade aus der Eigenart der einzelnen Gestaltung, ihrem jeweiligen Anders-Sein gewinnt. Eine Analyse also der Klopstockschen Teufelsgestalten, der es um den Gehalt der Darstellung zu tun ist, nimmt den Miltonschen Satan gerade wegen seines unzweifelhaften Einflusses auf den „Messias" nicht zum Nachweis einer Identität, sondern als Kontrastfigur, vor der sich die spezifische Leistung der Klopstockschen Gestaltung abhebt und als historische ausweist. Allein schon Reflexion auf die Form des Epos muß Zweifel an der Konstruktion eines milton-klopstockschen Teufelstypus aufkommen lassen; geschiditsphilosophisch geschulte Autoren des 19. Jhs waren sich der Grenzen des Vergleichs, die die Gesetze des Epos ziehen, noch deutlich bewußt: Betrachtet man, wie es in der Natur des Epos liegt, menschliche Zustände in ausgedehnter und für die Anschauung bequemer Entwicklung darzustellen, so darf es nicht wundern, daß wir gerade in dieser Dichtung einen lebendigen Spiegel des Zeitalters haben, in welchem der Dichter schrieb. Das religiöse Epos nun gewährt uns noch überdies den Einbilde in das Gemüth, in die eigentliche Seele eines Zeitalters, und untersuchen wir beide, Zeit und Gedicht, in ihrem Wesen genauer, so überzeugen wir uns bald, daß ein nothwendiger Zusammenhang beide verknüpft. Dante's tiefsinnige allumfassende Anschauungen sammt der schneidenden Schärfe seiner Dialectik gehören ebenso nothwendig dem Kreise seiner damaligen Entwicklung an, als Milton's lebendiges Gemälde von den sittlichen Grundelementen des Menschenlebens und Klopstodk's klang- und empfindungsreiche, aber färb- und gestaltenlose Dichtung von der christlichen Erlösungsthat naturgemäße Schöpfungen ihrer Zeit und Bildung sind.3
Bei diesem Verständnis des Epos als eines Spiegels des Zeitalters, der noch dessen „eigentliche Seele" reflektiert, war es Paur selbstverständlich, daß es auch die Mächte des Bösen, objektiviert in den Teufelsgestalten, je anders wieder2 Günther Mahal: Mephistos Metamorphosen. Fausts Partner als Repräsentant literarischer Teufelsgestaltung. — Göppingen 1972. Z. B. pp. 9, 69, 104, 128, 158, 499, 505. — Zu welch merkwürdigen Ergebnissen die methodische Fundierung auf der Theorie des Idealtyps führen kann, zeigt etwa folgende Bemerkung über den Teufel in der Literatur: „Lyrische und epische Darstellung sind seinem Wesen inadäquat." (81) Andernorts werden Zensuren verteilt: Ζ. B. gelten Mahal bestimmte Teufelsgestalten als „zu weitgehend anthropomorphisiert" (157). — Im übrigen neigen motivgeschichtliche Arbeiten, die auf knappem Raum möglichst viel Material zu komprimieren suchen, zur Typisierung. Vgl. etwa den Aufsatz von Eudo C. Mason: Die Gestalt des Teufels in der deutschen Literatur seit 1748. — In: Tradition und Ursprünglichkeit. Akten des III. Internationalen Germanistenkongresses 1965 in Amsterdam. Hrsg. von Werner Kohlschmidt und Herman Meyer. — Bern/München 1966. pp. 113—125. 3
Theodor Paur: Vergleichende Bemerkungen über Dante, Milton und Klopstock. — Neiße 1847. ( = Programm.) p.2.
Der Teufel in der Aufklärung
133
gab; mit der Bemerkung, daß die „Auffassung des Satans und seines Reiches . . . bei beiden Schriftstellern . . . verschieden" sei 4 , leitet er seinen kurzen Vergleich Miltons mit Klopstock ein. Paur greift damit, freilich ohne ihn zu erwähnen, auf Gedanken Hegels zurück, dem „Paradise Lost" und der „Messias" für Paradigmata einer späten, vom „eigentlichen", also klassischen Epos zu unterscheidenden Epenproduktion galten, in welcher „der künstlerische Geist ein wesentlich anderer ist als derjenige, durch welchen die geschilderte Nationalwirklichkeit und Tat ihr Dasein erhielt" 5 . Solche Epen sind durchzogen von einem „Zwiespalte des Stoffs und der Zeitbildung" 6 , „des Inhalts und der Reflexion des Dichters". Bei Milton ζ. Β. finden wir ganz die Gefühle, Betrachtungen einer modernen Phantasie und der moralischen Vorstellungen seiner Zeit. Ebenso haben wir bei Klopstock einerseits Gottvater, die Geschichte Christi, Erzväter, Engel usf., auf der anderen Seite die deutsche Bildung des achtzehnten Jahrhunderts und die Begriffe der Wolffischen Metaphysik. Und dies Gedoppelte erkennt sich in jeder Zeile. 7
Der von Hegel festgestellte Zwiespalt zwischen dem Stoff und seinem historischen Inhalt belegt die Oberflächlichkeit einer Typisierung nach konstanten Erscheinungsformen; wenn also die Teufelsgestalten bei Milton und Klopstock sich unter dem Begriff des Erhabenen nodi mühsam vereinen lassen, so konvergieren doch schwerlich englische Spätrenaissance und „Wolffische Metaphysik" in ihrem Begriff vom Bösen und verhelfen demgemäß ihren Teufeln keineswegs zu einer tatsächlichen Identität. Das unterschiedliche Verständnis des Bösen freilich prägt schon deren äußerer Gestalt sich ein; vom Typus also läßt sich, bleibt man allein auf der Ebene der Erscheinung, nur mit Mühe reden, gar nicht aber, bedenkt man zugleich den Wandel des historischen Inhalts des Bösen. Bevor deshalb genauer auf Klopstock eingegangen werden soll, erscheint noch einmal ein kurzer Blick auf Milton geboten. Nirgends verlief die Debatte um „Paradise Lost" kontroverser als bei der Satansgestalt. An ihr irritierte die Komplexität, das gänzliche Fehlen einer Unilinearität des Bösen, die eine bequeme ethische Verortung der Gestalt erlaubt hätte. Verknüpft mit den traditionellen Lineaturen des Bösen, als Stolz, Hochmut, Neid, Haß und Lüge, sind Elemente des Guten, die zudem an verschiedenen Stellen des Epos prädominieren: Tapferkeit, ja Heldenhaftigkeit, Freiheitsdrang, Ausdauer und höchste Geisteskraft, verbunden mit tiefer Leidensfähigkeit; der böse Wille findet bei Milton zu heroischer Gestalt. Die Literaturwissenschaft versuchte ihre Irritation angesichts solch extraordinärer Gestaltung auf verschiedene Weise zu überwinden: Einen Weg bot die Kategorisierung nach literaturhistorischen Mustern; Arnold Stein etwa erinnert — „in the search for an adequate phrase" — an den „tragic villain" der (elisa* Vgl. Paur, a. a. O., p. 24. 5 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik. Bd. I I I . — Frankfurt 1970. ( = Theorie — Werkausgabe. Bd. 15.) p. 334. * Hegel, a . a . O . , p . 4 1 3 . 7 Hegel, a. a. O., p. 370.
134
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
bethanischen) Tragödie 8 . Einen anderen Weg beschritt B. Rajan in einem vielbeachteten Buch; bei seinem methodisch höchst bedenklichen Versuch, „Paradise Lost" mit den Augen eines imaginären Lesers des 17. Jhs zu lesen, kommt er zu dem Schluß, das Problem einer Kollision guter und böser Eigenschaften habe sich damals gar nicht gestellt: „ . . . with Milton's contemporaries the response was predominantly one of fear" ,9 Was heute als gut wahrgenommen werde, habe sich dem Leser des 17. Jhs als Gutes aufgrund seiner Bindung an das Böse selbst eliminiert10. Von kaum weniger bedenklichen Rekonstruktionsversuchen der Miltonschen Intention zum einen und von den Prinzipien werkimmanenter Interpretation gehorchenden Analysen zum anderen ging die ergebnislose „hero or fool?"-Debatte der 40er und 50er Jahre aus; die Verabsolutierung isolierter Einzelzüge, die schon der Titel der Kontroverse zum Ausdruck bringt, trieb dabei nur ins Extrem, was als gemeinsames Prinzip die literaturwissenschaftliche Diskussion um Miltons Satan insgesamt leitete: Der Versuch literarhistorischer Deutung des komplexen Phänomens resultierte schließlich immer in der Reduktion von Komplexität; der Literaturwissenschaftler rächt sich für die so schwer erklärliche Faszination durch Demontage. An die Stelle einer nötigen historischen Einordnung der Substitution ethischer Eindeutigkeit durch die Verschränkung eines partikular Guten mit einem partikular Bösen tritt die Restitution der Eindeutigkeit. — Hier nun freilich soll keineswegs eine umfassende historische Interpretation des Miltonschen Satan geliefert werden; für unsere Zwecke genügt die Insistenz auf der Tatsächlidikeit seiner Komplexität und der Unmöglichkeit einer Reduktion auf eine bestimmte Kategorie, die in ihm zentral verkörpert sei. Satan ist, wie vor Milton nirgends in dieser Weise, handelnde Gestalt des Epos und als solche in die Mannigfaltigkeit der Handlungen, Motivationen und Bezüge eingewoben; allein dies schon erlaubte, neben dem Zwang zur Begründung des eigenen Handelns, dem Teufel die Eindimensionalität des absolut Bösen nicht. Als handelnde Figur gewinnt die Gestalt Satans aus der Fülle der von ihr erlebten und mitgeprägten Situationen ihr Leben. „The figure that confronts us is a living one, with all the complexity consequent on life." 11 Die Absichten und Taten Satans lösen das epische Geschehen aus und bestimmen es auf weite Passagen; die Situationen, in denen 8
Arnold Stein: Answerable Style. Essays on Paradise Lost. — Seattle/London 1967. p. 46. (Vgl. audi p. 50.) * Β. Rajan: Paradise Lost and the Seventeenth Century Reader. — London 1962. p. 94. 10 So „Paradise Lost" zu lesen, wird dem Leser gelegentlich audi heute noch empfohlen. Vgl. John S. Diekhoff: Milton's Paradise Lost. A Commentary on the Argument. — London 1958. p. 34. Diekhof! argumentiert vor allem gegen die Bewunderer der Satansgestalt, die, Shelley folgend, in ihr im Vergleich zu Gott den moralisdi Überlegenen sehen. Demjenigen, der Satan nicht „abhorrent" finde, rät er eine Überprüfung seines Gottesverhältnisses an. (p. 48) 11 John Peter: A Critique of Paradise Lost. — New York 1960. p. 35. — Jedoch fügt sich audi Peter der Milton-Literatur und ihrer Tendenz zur Dekomposition der Komplexität ein; bei ihm freilich hat Milton diese Reduktion selbst vorgenommen: Nadi Budi II habe er die Widersprüchlichkeit untersdiiedlidier Qualitäten nicht mehr aufrechterhalten können und sidi dazu entschlossen, die schlechte Seite des Teufels herauszustellen, (p. 53f.)
Der Teufel in der Aufklärung
135
er sich zu bewähren hat, gewinnen ihm dabei stets neue Züge ab: „ . . . what Satan is depends on his circumstances, and how his behaviour and implied stature are determined by his functions." 12 Doch neben den Notwendigkeiten epischen Erzählens verdankt sich die Komplexität der Gestalt noch anderen Gründen. Miltons Weltbild im allgemeinen, seine Kosmologie im besonderen waren der Forschung immer problematisch. Dabei ergaben nicht so sehr bestimmte nach Herkunft und Funktion schwer erklärbare Einzelelemente die größten Schwierigkeiten, sondern das System als Ganzes; konkret stand die Frage zur Diskussion, warum ein dem Fortschritt so offener Autor ein traditionelles, ja zu seiner Zeit schon nahezu völlig überholtes Weltbild seiner Dichtung zugrundelegte. Keineswegs ist das Weltall in „Paradise Lost" nach den von Kopernikus entdeckten Gesetzen geordnet; stattdessen durchwaltet das Epos ein aus Mittelalter und Renaissance übernommenes elaboriertes System von Korrespondenzen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos, die große Kette des Seins liegt weiterhin aller Existenz als Ordnungsmuster zugrunde, die gesamte Schöpfung ist in sich geschichtet, geordnet und durch zahllose Bezüge zwischen ihren Elementen harmonisch abgestimmt. Das Verständnis aller Anspielungen und Verbindungen verlangte schon zu Miltons Zeit eine Gelehrsamkeit, die seine Durchschnittsleser längst nicht mehr mitbrachten: . . . Milton wrote Paradise Lost after the civil war and we can argue that audiences were no longer interested in the conception of order which I take to lie behind it. The Mediaeval synthesis was giving way to the Newtonian. 13
Doch Milton übernahm die „mittelalterliche Synthese" nicht, wie Rajan glaubt, weil er für eine „cultivated minority" schrieb und als Dichter für die Bewahrung reicher Traditionen verantwortlich war, sondern weil ihm der mittelalterliche ordo, eine selbst schon vergangene Welt, die Möglichkeiten zur Gestaltung einer verlorenen, jedoch einstmals existenten Welt von immanenter Sinnhaftigkeit eröffnete. Die großartige Synthese der Mannigfaltigkeit aller Erscheinungen zum ordo, die Wiederbelebung einer überholten Weltvorstellung steht ein für die ursprüngliche Ganzheit der Schöpfung, für die Homogeneität einer in sich abgerundeten Welt, so wie sie vor dem Fall war und nun nur als verlorene noch zu erinnern ist. Das vergangene Weltbild, dem unter größter geistiger Anstrengung noch einmal die Herstellung einer sinnvollen Totalität alles Existierenden gelang, wird zum Bild des verlorenen Paradieses, vor dem erst der Fall, und mit ihm der Zusammenbruch der ursprünglichen Ordnung, sich in ganzer Schärfe abhebt. Denn wie noch in den Korrespondenzen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos die Erinnerung an eine einstige Kongruenz von Ich und Welt bewahrt blieb, so ist in der Geschichte vom Fall die Erinnerung ans Ende der anfänglichen Einheit aufgehoben; Mensch und Schöpfung treten in einen Gegensatz. The mission of Satan is the fall of man . . . ; but if he succeeds, if the spirit of man should cease to fill the world with the expansion of its divine greatness, the whole « Rajan, a. a. O., p. 104.
» Rajan, a. a. O., p. 58.
136
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
world will feel the loss. Hence Satan's design is at once microcosmic and cosmic; for it was on sufferance of the first man's glass of intellect that the spheres revolved in harmony; once it dimmed, the world decayed.14
Das System der Korrespondenzen, Signatur der ersten Einheit, besiegelt zugleich die Universalität des Falles, besiegelt die Trennung von Ich und Welt; der Mensch wird zum Individuum um den Preis der Geborgenheit in der Schöpfung. Das Gegenprinzip aber zur alles umgreifenden göttlichen Ordnung, im Epos erinnert als ordo, ist die singulare Gestalt Satans, die zuerst sich aus ihr löste und Subjekt wurde. Er ist bei Milton die Gegenfigur zur einebnenden Synthese, er sperrt sich gegen die Einvernahme ins totale Konzept, und wie er sich selbst in Rebellion und Engelsturz zum Individuum emanzipierte, so wird er auch für den Menschen zum Urheber der Individuation, indem er ihn als Paradiesesschlange aus dem „Park, wo nur Tiere und nicht die Menschen bleiben konnten", führte 15 . Erst vor der ursprünglichen Ganzheit der göttlichen Schöpfung, der Subjekt-Objekt-Identität ohne Rest, zeichnet sich die Individuation in ihrer ganzen Kompromißlosigkeit ab: Wird der ordo gleichsam zum Extrem von Identitätsverlust aus Geborgenheit, so treibt Satan Subjektivität zum Extrem. An ihm, der die Homogeneität des Weltganzen zerschlägt, tritt Individualität als ungezügelt und ungemildert hervor. Dem Selbstverlust im ordo begegnet die radikale Verselbstung in Satan; während im ordo jedes einzelne in den Hymnus aufs Ganze einstimmt, ist Satan die Gestalt, die Selbstgespräche führt: . . . the kind of dramatics he (i. e. Milton, Ε. O.) condemns in Satan is the romantic villain's autocentricity, or the possessed's despairing egoism, not the interchange of personality that fruits to action and sympathy. The characters of Paradise Lost do not soliloquise until they have fallen; Unfällen speech and gesture are directed always to another person . . .
ordo und Selbstgespräch: aus der Komplexität des Weltganzen löst sich die Komplexität sich selbst reflektierender Eigenart, aus der Heteronomie göttlich sanktionierter Objektivität befreit sich Satan zu eigenen Gesetzen. Daher rührt die Komplexität seiner Gestalt; sie wird zum Ausdruck sich selbst absolut setzender Subjektivität. Die Mission Satans in „Paradise Lost" beschreibt den Weg von der Geozentrik der göttlichen Schöpfung zur Egozentrik des hypertroph Subjektiven; die alte Ordnung zerbricht, der einzelne nimmt die Welt in eigene Regie. Hiervon ist auszugehen, wenn Miltons und Klopstocks Lucifer-Gestalt als einem Typus zugehörig ausgegeben werden. Milton delegiert einen großen Teil neuzeitlicher Subjektivitätsproblematik an seine Teufelsgestalt: Vor der mittelalterlichen Synthese, in der die Identität von Ich und Welt noch einmal for14 Gordon Worth O'Brien: Renaissance Poetics and the Problem of Power. — Chicago 1956. p. 52. 15 Hegel zit. nach: Ernst Bloch: Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reichs. — Frankfurt 1973. p. 197. 14 J. B. Broadbent: Some Graver Subject. An Essay on Paradise Lost. — London 1960. p. 80.
Der Teufel in der Aufklärung
137
muliert ist, erscheint die Individuation als negativ, als Engelsturz und Sündenfall. Die Unzulänglichkeiten eines komplexen Weltzustands werden als Fehler dem zu seiner angemessenen Bewältigung nicht begabten und unter ihm leidenden Subjekt selbst angelastet; in Miltons Satan ist letztlich das Prinzip von Subjektivität für das Böse in der Welt in Haft genommen. Dies aber ist nicht die Botschaft der deutschen Aufklärung, ist sicher nicht die Botschaft des „Messias". Der Satan aus „Paradise Lost" konnte nicht unverwandelt in Klopstocks Dichtung gelangen. Zudem: Of Man's first disobedience, and the fruit Of that forbidden tree, whose mortal taste Brought death into the world, and all our woe, With loss of Eden, till one greater Man Restore us, and regain the blissful seat, Sing, Heav'nly Muse . . . 1 7
Miltons Epos erzählt, wie die Sünde in die Welt kam, wie sich Satans mächtiger Schatten über die Erde legte, und die Menschen aus dem Paradies vertrieben wurden, so daß es allein noch im Gedächtnis des Menschen Wirklichkeit besaß — freilich mit Hoffnung verknüpft, die auf eine Erneuerung des Verlorenen in ferner Zukunft vertraute: das wiedergewonnene Paradies, eine Zeit, die nicht mehr unter dem Unstern Satans steht. Von dem Weg dorthin, nicht von dem Verlust spricht der „Messias" : Sing, unsterbliche Seele, der sündigen Menschen Erlösung, Die der Messias auf Erden in seiner Menschheit vollendet, Und durch die er Adams Geschlechte die Liebe der Gottheit Mit dem Blute des heiligen Bundes von neuem geschenkt hat. 18
Erlösung meint Befreiung; erlöst fühlt sich der, von dem ein Drude genommen ist. Die auf allem Irdischen lastende Gestalt des Teufels hat ihre Kraft verloren, die Macht der Sünde, der Waffe des Teufels, ist gebrochen, nach Jahrtausenden wieder steht die Erde im Licht der göttlichen Liebe. Dem göttlichen Erlösungswerk stehen die höllischen Wesen ohnmächtig gegenüber; sie müssen, ohne daß sie es irgend hindern könnten, mit ansehen, wie all das, was sie in ihrem unermüdlichen Kampf gegen Gott sicher erreicht glaubten, mit einem zunichte wird. Vergebens erhub sidi Satan wider den göttlichen Sohn . . . (1/5-6)
Des Teufels Machinationen wider die Erlösung, von denen Klopstock in seinen Gesängen wortreich berichtet, sind schon zu Anfang als vergeblich erkannt; der Kampf ist ungleich und von vornherein entschieden. Milton beschreibt, wie 17 John Milton: Paradise Lost. — In: J. M.: Poetical Works. Ed. Douglas Bush. — London/Oxford 21973. p. 212. (1/1—6) 18 Der „Messias" ist zitiert nach der Ausgabe: Friedrich Gottlieb Klopstock: Ausgewählte Werke. Hrsg. von Karl August Schleiden. 3. Auflage. — München 1969. pp. 195—770. Angegeben werden jeweils Gesang und Verszahl. (Hier 1/1—4)
138
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
Lucifer die neugeschaffene Welt betritt und triumphierend sie nach eigenem Willen umprägt; Klopstock weiß nur von göttlichem Triumph: In kläglichem Abgang räumt der Teufel die einmal bezogenen Positionen. Es ist nicht dasselbe Bild Lucifers, das beide Dichter uns geben: Mit der erzählten Situation, mit seinem Ort im göttlichen Heilsplan, wechselt Satan Wesen und Gestalt. Die komplexe Gestalt Satans in „Paradise Lost" ergab sich aus dem Verlust der überkommenen Ordnung; der „Messias" aber beschreibt die Neubegründimg der göttlichen Ordnung, und vor dem Hintergrund von Christi Erlösungswerk, der neuerlichen Sinngebung menschlicher Existenz, verblaßt die Teufelsgestalt. Nun ist der große Einfluß Miltons auf Klopstock zweifelsfrei; seine häufigen begeisterten Äußerungen zu „Paradise Lost", die sowohl bereits in der Abitursrede als auch noch in Altersgesprächen fallen, sind in der Klopstock-Literatur oft zitiert und brauchen hier nicht im einzelnen wiedergegeben zu werden. Es war das „Epische Gedicht vom Verlohrnen Paradiese", mit dem Klopstock wahrscheinlich durch die 2. Auflage der Bodmerschen Übertragung (1742) bekannt wurde, das den Dichter erst zur Abfassung der Messiade anregte — was freilich der alte Klopstock gelegentlich nicht mehr wahrhaben wollte 19 . Franz Muncker hat den Einfluß Miltons in zahlreichen Einzelbelegen nachgewiesen20; seine These, daß „ . . . für die künstlerische Composition der Messiade . . . dies Vorbild ungleich wichtiger als die heilige Schrift" wurde 21 , verleitete ihn allerdings nicht zu einer über die positivistische Registratur von Parallelstellen hinausführenden Behauptung eines wie immer gearteten allgemeinen Einflusses, mit dem eine Kontinuität des Gehalts angedeutet wäre. Freivogel dagegen spricht von „der allgemeinen Übernahme der Verbindung von „heidnischer Form" und „christlichem Inhalt"" und des „Wunderbaren" 22 und ergänzt: „ . . . die Übernahmen sind gerade nicht auf das Allgemeine beschränkt, sondern bis in kleine Einzelheiten hinein zu finden." 23 Schon Gerhard Kaiser hat hier scharf widersprochen: „Wohl hat Klopstock „bis in kleinste Einzelheiten hinein" auf Milton zurückgegriffen, aber gerade im „Allgemeinen" ist er völlig eigene Wege gegangen . . . " 24 Die Richtigkeit dieser Beobachtung beweist sich zumal bei der Analyse der Teufelsgestalten, an denen immer wieder die engsten Parallelen zur Höllenpopulation aus „Paradise Lost" festgestellt wurden; hier schien Klopstock am deutlichsten seinem Vorbild Milton verpflichtet. Muncker gar fühlt sich aufgrund der zahlreichen Entlehnungen in der Höllen- und Teufelsgestaltung zu einer These berechtigt, die dem Vorwurf des Plagiatorischen nicht allzu fern steht: Klopstock habe sich „redlich" bemüht, „ . . . den Charakter Satans, wie ihn der Dichter des ,Verlornen Paradieses* großartig geschaffen 19 Vgl. Gerhard Kaiser: Klopstock. Religion und Dichtung. — Gütersloh 1963. p. 139. Anm. 22. 20 Franz Muncker: Friedrich Gottlieb Klopstock. Geschichte seines Lebens und seiner Schriften. — Stuttgart 1888. pp. 117—128. 21 Muncker, a.a.O., p. 117. 22 Max Freivogel: Klopstock der heilige Dichter. — Bern 1954. p. 25. 23 Freivogel, a. a. O., p. 26. 2* Kaiser, a. a. O., p. 20.
Der Teufel in der Aufklärung
139
hatte, möglichst beizubehalten." 25 Daß ihm dies nicht gelungen sei, muß einmal mehr Klopstocks „Mangel an epischer Gestaltungskraft" begründen. Freilich bedeutet der für Klopstock nachgerade topische Vorwurf subjektiven dichterischen Unvermögens in Bezug auf epische Formerfüllung letztlich den Verzicht auf eine Erklärung der Munckerschen Beobachtung, daß der Dichter aus den Splittern der Miltonschen Teufelsgestalt keinen kongenialen Charakter zusammenzufügen vermochte. Gesetzt, Klopstock habe tatsächlich, wie von Muncker behauptet, die bruchlose Übernahme Satans in den „Messias" angestrebt, so darf sich dodi Literaturwissenschaft bei der Deutung seines Scheiterns nicht mit dem Rückzug auf eine defiziente poetische Kompetenz bescheiden, die ja selbst wieder der Erklärung bedürfte, sondern hat den objektiven Widerständen nachzuspüren, die der Text selbst und die historische Situation auf ihren verschiedenen Ebenen solcher Rezeption entgegensetzten. Argumente poetologischer Provenienz lassen sich hier ebenso ins Feld führen wie geistes- und realgeschichtliche Begründungen. — Die literarische Gestaltung von Hölle und Teufel stellte sich als poetologisches Problem im Rahmen der allgemeineren Diskussion um die Darstellbarkeit überirdischer Wesen im christlichen Epos, die nicht zuletzt von den Auseinandersetzungen um „Paradise Lost" in Gang gehalten wurde; an ihr bereits läßt sich der historische Wandel von Milton zu Klopstock ablesen. Der Polytheismus der griechischen und römischen Religion fand in der antiken Epik gestalterisch in der Anthropomorphic der Götterwelt zum Ausdruck. Die Aufsplitterung des Numinosen in eine Gewaltenteilung zwischen Göttern — sie erlaubt dem Epiker in der Darstellung von Götterrivalität und ehelicher Zwietracht ein ironisches Verhältnis zum Mythos — eröffnet die Möglichkeit menschlichen Einflusses auf die überirdischen Mächte, weil der Betende über die Chance zur Wahl seines Adressaten die verschiedenen Götter gegeneinander ausspielen kann. Die Pluralität der Gottheiten verhilft dem Menschen zur Herrschaft über das Numinose; die Anthropomorphic der Götter im Epos ist die ästhetische Gestalt dieses Ziels. Die Götter sind, eben weil sie von den Menschen allein aufgrund größerer Macht und höherer körperlicher Vollkommenheit sich unterscheiden, übers Gebet steuerbar. Dies letztlich steht als Grund hinter allen theologischen Vorbehalten gegen die Darstellung Gottes und der Geisterwelt im christlichen Epos: Das Verdikt über die Anthropomorphic wird aus Furcht vor dem Eingriff in die göttliche Machtvollkommenheit ausgesprochen, die menschliche Gestalt signalisiert eine Reduktion des göttlichen Absolutismus, wie er den Monotheismus auszeichnet, auf irdische Endlichkeit; der allen irdischen Einflüssen entzogene Gott wird den Gesetzen epischen Erzählens Untertan. — Milton nun setzte sich rigoros über dergleichen Einwände hinweg; während sich noch die christliche Epik vor „Paradise Lost" allenfalls mit Engeln und Teufeln bevölkerte, werden bei ihm gleichfalls Gott und Christus zu handelnden Gestalten; sie unterreden und beraten sich wie die Götter Homers und Vergils, lenken und kommentieren das irdische Geschehen und 25 Muncker, a. a. O., p. 121.
140
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
greifen über ihre Boten in die Handlung ein. Die Schlacht im Himmel gar zeigt Christus als im Streitwagen kämpfenden und siegenden Helden, der ungleich mehr Ähnlichkeit mit den Heroen vor Troja als mit dem leidenden Menschensohn des Neuen Testamentes hat. Für Milton existiert eine prinzipielle Andersartigkeit, gar eine Unerkennbarkeit des Überirdischen nicht; Gott, Geister und Menschen ähneln über die Gesetze epischer Handlung einander an. Das gleiche Jahr 1674 nun, in dem die zweite, revidierte Auflage von „Paradise Lost" erschien, brachte den schärfsten Angriff auf die Gestaltung Gottes und der Geister im christlichen Epos, freilich ohne daß dem Verfasser Miltons Dichtung bekannt gewesen wäre. Boileau formulierte in seiner „L'art poétique" die entscheidenden Einwände gegen die Darstellung Gottes und des Teufels, die, weil sie noch die Argumentation Gottscheds und seiner Anhänger bestimmen sollten, hier vollständig zitiert sein sollen. Im Anschluß an seine Diskussion des klassischen Epos schreibt Boileau: C'est donc bien vainement que nos Auteurs deceus, Bannissant de leurs vers ces ornemens receus, Pensent faire agir Dieu, ses Saints, et ses Prophetes, Comme ces Dieux éclos du cerveau des Poëtes: Mettent à chaque pas le Lecteur en Enfer: N'offrent rien qu' Astaroth, Belzebuth, Lucifer. De la foi d'un Chrestien les mysteres terribles D'ornemens égayés ne sont point susceptibles. L'Evangile à l'esprit n'offre de tous costés Que penitence à faire, et tourmens mérités: Et de vos fictions le meslange coupable, Mesme à ses veritez donne l'air de la Fable. Et quel objet enfin à presenter aux yeux, Que le Diable toûjours heurlant contre les Cieux, Qui de vostre Heros veut rabaißer la gloire, Et souvent avec Dieu balance la victoire? Le Tasse, dira-t-on, l'a fait avec succez. Je ne veux point ici lui faire son procez: Mais quoy que nostre Siecle à sa gloire publie, Il n'eust point de son Livre illustré l'Italie; Si son sage Heros toûjours en oraison, N'eust fait que mettre enfin Sathan à la raison, E t si Renaud, Argant, Tancrede, et sa Maistresse N'eussent de son sujet égayé la tristesse.2*
Bemerkenswert ist, daß Boileau der Darstellung Gottes und der Heiligen nicht aus theologischen Erwägungen widerspricht, sondern in ihr die Abweichung von der klassischen Norm verurteilt: Homer und Vergil durften Götter gestalten, weil diese ihrer Phantasie entsprangen, der christliche Autor aber begeht einen Verstoß gegen die Wahrheit, wenn er seinen Gott im Epos handeln läßt. Der grundsätzlichen Ablehnung einer Gestaltung Gottes, die durch den beständigen Verweis auf Wahrheit und Vernunft als die grundlegenden Maximen von Dichtung schon ausreichend legitimiert scheint, folgt nun nicht etwa 26 Nicolas Boileau-Despréaux: L'Art poétique. Die Dichtkunst. Französisch und deutsdi. Übersetzt und hrsg. von Ute und Heinz Ludwig Arnold. — Stuttgart 1967. p. 49f.
Der Teufel in der Aufklärung
141
eine differenzierte Analyse der Darstellungsprinzipien des Supranaturalen, sondern ein Generalangriff auf die Teufelsgestaltung, die als paradigmatisch für die Gefahren einer Vermengung christlicher Lehrmeinung mit poetischer Fiktionalität erscheint. Nicht so sehr die Warnung vor Übergriffen der Dichtung auf Bereiche der Theologie ist hier von Bedeutung, als vielmehr die Verurteilung der bisherigen epischen Teufelsdarstellung als einer Domäne ungezügelter Erfindung überhaupt. In ihr walten für Boileau Regellosigkeit, Geschmacklosigkeit und Unvernunft; sie wird das fabulose Gegenbild zur über Naturnachahmung sich herstellenden poetischen Wahrheit. Daß aber an ihm die Gefahren regelloser Fiktionalität demonstriert werden, rückt den Teufel selbst und nicht allein sein Erscheinungsbild in den Raum des Fiktionalen. Boileaus Maxime „Tout doit tendre au Bon sens . . . " 27 bedeutet für die Teufelsgestalt nicht deren Domestikation mit Hilfe des klassizistischen Regelkanons, sondern die Elimination aus dem Epos. Hier schon zeigt sich, daß die Vernunft nicht mit einer Regelung der ästhetischen Umsetzung von Glaubensinhalten sich bescheidet, vielmehr diese selbst im gleichen Schritt ihren eigenen Gesetzen unterwirft. Der Argumentation gegen die Unvernunft seiner Gestaltungen fällt der Teufel als objektiviertes Prinzip des Unvernünftigen selbst zum Opfer; die Vernunft verweigert ihm als Glaubensinhalt den Eintritt in die Literatur. Den deutlichsten Beleg für den hier sich vollziehenden Wandel liefert Boileau selbst: Eine Rettung von „Gerusalemme liberata", das seit Generationen als leuchtendes Exempel christlicher Epik galt, gelingt ihm einzig noch über die Absage an dessen Dunkelschicht; die Kreuzritter vertreiben die Mächte der Finsternis gleichsam mit dem Licht der Vernunft. Satan zur Vernunft ( „à la raison" ) gebracht zu haben, erscheint dem rationalistischen Theoretiker als Gottfrieds Leistung; sie ist zugleich seine eigene. Er bringt die Vernunft zu Satan und vertreibt ihn damit aus dem Epos. Die aufklärerische Insistenz auf der Vernunft der Darstellungsprinzipien unterwirft zugleich das Darzustellende der Vernunft. Dem fügten sich die Autoren, die auch weiterhin Teufelsgestalten in ihre Texte einbrachten, insofern, als sie den Teufel zwar nicht aus der Darstellung, wohl aber aus deren theoretischer Rechtfertigung bannten. Boileaus Forderung nach der Elimination Satans aus der christlichen Poesie konnten sie nicht gehorchen, andererseits aber war sein Vernunftanspruch derart übermächtig, daß sie poetologisch ihm keinen Widerstand zu leisten vermochten. Deshalb zeichnet sich schon bald nach Boileau die Tendenz ab, mit der die Diskussion um die Teufelsdarstellung weiterhin geführt werden sollte. Schon 1677 — der Klassizismus des französischen Theoretikers war in der englischen Restauration auf fruchtbaren Boden gefallen — setzt sich John Dryden in seiner „Apology for Heroique Poetry, and Poetique Licence", die er seiner Dramatisierung von „Paradise Lost", dem Operntext „The State of Innocence and Fall of Man", voranstellte, mit den neuen Argumenten auseinander. Dort stellt er die Frage: . . . but how are Poetical Fictions, how are Hippocentaures and Chymaeras, or how are 27 Boileau, a. a. O., p. 9.
142
Friedrich Gottlieb Klopstock: Oer Messias
Angels and immaterial Substances to be Imaged? which some of them are things quite out of Nature; others, sudi whereof we can have no notion? this is the last refuge of our Adversaries; and more than any of them have yet had the wit to object against us. (.. ) For Immaterial Substances we are authoriz'd by Scripture in their description: and herein the Text accomodates it self to vulgar apprehension, in giving Angels the likeness of beautiful young men. Thus, after the Pagan Divinity, has Homer drawn his Gods with humane Faces: and thus we have notions of things above us, by describing them like other beings more within our knowledge.*?!
Drydens Antwort zeugt nicht von sonderlicher Originalität; die Berufung auf Homer zielt an Boileaus Argumentation, in der auf die Unterschiede zwischen heidnischer und christlicher Religion abgehoben war, völlig vorbei, und die Rechtfertigung der Anthropomorphic der Engelsgestalten mit Hilfe der Bibel bietet nur ein schwaches Argument bei der grundsätzlichen Erörterung der Darstellungsproblematik des Supranaturalen. (Es sollte übrigens später noch Bodmer als Waffe dienen.) Drydens Bemerkungen sind aber aus einem anderen Grund wichtig: Obgleich er in seiner Bearbeitung von „Paradise Lost" bei der Gestaltung Satans sich eng an Milton anlehnt, umgeht er die theoretische Erörterung der Teufelsdarstellung und weicht aus auf das unverfänglichere Feld der Angelologie. Er stellt sich dem Generalangriff Boileaus auf die Satansgestalten im Epos erst gar nicht und versucht stattdessen über eine Rechtfertigung der Vermenschlichung von Engeln, mit der zugleich eine Zügelung des Phantastischen ausgesprochen ist, den Teufel als poetologische Konterbande erneut in die christliche Poesie einzubringen. Boileaus Ablehnung der Teufelsdarstellung trat auf als Appell an die Vernunft; dem sich zu widersetzen lag dem Dichter der Restauration fern. Konnte er dennoch auf den Teufel als poetische Gestalt nicht verzichten28, so bot es sich an, ihn in den theoretischen Äußerungen zu verschweigen und seine Legitimation als poetischen Gegenstand über die Rechtfertigung von Sujets zu unternehmen, auf die sich Boileaus Angriff bei weitem nicht mit gleicher Intensität gerichtet hatte. Dryden unternimmt das Kunststück einer Verteidigung der Teufelsgestaltung, ohne noch vom Teufel zu reden; unter dem Titel „immaterial substances" bleibt diesem weiterhin der Zugang zum Epos geöffnet. Der Zwiespalt zwischen dem Vernunftanspruch und den Gestaltungsprinzipien des christlichen Epos, in dem im Anschluß an die 27a John Dryden: The Author's Apology for Heroique Poetry, and Poetique Licence. — In: J. D.: The Dramatic Works. Ed. Montague Summers. Vol. III. — London 1932. p. 422f. 28 Daß für die Autoren der Zeit mit der Darstellbarkeit der Geisterwelt das christliche Epos überhaupt auf dem Spiel stand, läßt sich aus Richard Blackmores Bemerkungen im Vorwort zu „Prince Arthur" (1695) ersehen: „But some of our modern Criticks have believ'd 'tis scarce possible for a Christian Poet to make use of this advantage, of introducing Supérieur, Invisible Powers into the Action, and therefore seem to despair of seeing an Heroick Poem written now, that shall reach to the Dignity of those of the Pagans. They think the Christian Religion is not so well accommodated to this matter, as the Pagan was; and that if any Attempt be made this way, Religion will suffer more, than the Poem will gain by it." — Der letzte Satz bezieht sich unmittelbar auf Boileau. — Richard Blackmore: Prince Arthur. An Heroick Poem. In Ten Books. The Third Edition Corrected. — London 1696. Preface, unpag.
Der Teufel in der Aufklärung
143
Antike der Einbruch des Numinosen in irdische Existenz am ehesten über die Handlungen der Geisterwelt sich vermitteln ließ, wurde nicht gelöst, sondern an unterschiedliche Instanzen weitergereicht: Die poetische Theorie gehorcht dem Vernunftanspruch, indem sie den Teufel verschweigt, in den poetischen Texten führt er jedoch, wenn auch geschwächt und eingeschränkt, weiterhin seine Existenz. An Drydens Bemerkungen bereits treten somit zwei Grundzüge hervor, die für die Auseinandersetzungen um die Teufelsdarstellung in der Frühaufklärung sich als kennzeichnend erweisen: Zum einen treffen sich die Verfechter der Teufelsgestaltung mit ihren klassizistischen Gegnern darin, daß sie sich grundsätzlich um eine Reduktion des diabolischen Elements bemühen, was nicht zuletzt darin seinen Ausdruck findet, daß in ihren theoretischen Äußerungen die Teufelsdarstellung als Problem kaum noch erscheint. Wo aber zum anderen die theoretische Verteidigung von Gestaltungen der Geisterwelt unumgänglich wird, vollzieht sie sich unter Nennung der Engel, nicht der Teufel; die guten Geister werden so letztlich zu Bittgängern der bösen. Paradigmatisch für diese Tendenz ist die Auseinandersetzung zwischen Gottsched und den Schweizern um das Wunderbare in der Poesie. Obgleich der Streit nicht zuletzt an „Paradise Lost" sich entzündete und bedeutenden Nährstoff an der Satansgestalt fand, fehlt doch die zu erwartende Eindeutigkeit einer klaren Frontstellung beim Problem der Darstellbarkeit des Teufels in der christlichen Poesie: Die Insistenz der Schweizer auf dem Wunderbaren führt keineswegs zur Apologie einer dominanten Teufelsgestalt. Im Gegenteil, beim hier in Rede stehenden Problem sind die Gemeinsamkeiten größer als erwartet; dies soll, zumal die hier zu besprechenden poetologischen Positionen für Klopstock von einiger Bedeutung waren, kurz nachgewiesen werden. — Gottscheds Position in dieser Frage ist die Boileaus, verstärkt um den Impuls des programmatischen Aufklärers: Tasso, Marino, und Milton haben die Engel und Teufel in ihren Gedichten, anstatt der alten Götter eingeführt. Hat nun Boileau jenen in seiner Dichtkunst deswegen getadelt: so dörfen wir diesen auch nicht schonen, zumal da er es auf eine so unvernünftige Weise gethan hat.»
Gottscheds Ablehnung der Teufelsfiguren gründet sich poetologisch auf seine Verabsolutierung des Nachahmungsprinzips, aus der sich schlüssig die Unmöglichkeit einer Wiedergabe der Geisterwelt ergibt: Denn wenn gleich einige, wie Tasso, Milton, und seine Nachahmer unter uns, auch Engeln und Teufel nachzuahmen gesuchet: so ist dieses so zu reden, aus ihrer Sphäre ausgeschweifet. Wie kann eine Abschilderung gelingen, deren Originale man wenig, oder gar nicht kennet?
Die eigenmächtige Ausgestaltung von Hölle und Teufel trifft demgemäß auf seinen scharfen Spott; Tasso, Marino und Milton verfallen in gleichem Maße 29
Johann Christoph Gottsched: Versuch einer Critischen Dichtkunst. — Darmstadt 1962. ( = Unveränderter photomechanisdier Nachdruck der 4., vermehrten Auflage, Leipzig 1751.) p. 502. 30 Gottsched, a. a. O., p. 107.
144
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
in ihren Teufelsgestaltungen dem Verdikt der Lächerlichkeit31, weil die Phantastik der Erscheinungsbilder des Satanischen nicht der Forderung nach der Wahrscheinlichkeit des Dargestellten gehorcht, deren Maßstäbe der Bürger an der seinen Sinnen zugänglichen Erfahrungswelt nimmt; die Satansgestalten des Epos widerstreiten damit den Gesetzen der Vernunft. Daß jedoch die Zusammenfügung konträrer Elemente und die Transzendierung der Gesetze der Logik in diesen Gestalten von Gottsched nicht als Ausdruck der Unvernunft des Bösen selbst verstanden wird, sondern als Beweis für die Unvernunft der Autoren, findet seinen Grund in seinem spezifischen Verständnis der historischen Situation: Er mißt die Teufel am Zustand einer aufgeklärten Welt. Seine Argumentation ist darin durchaus historisch: „Wer kann sich itzo des Lachens enthalten . . . " 32 — so Gottsched —, wenn er Tassos Beschreibung von Pluto lese. Und im Anschluß an seine Paraphrase der Himmelsschlacht in „Paradise Lost" heißt es: Dieses Wunderbare ist viel zu abgeschmackt für unsre Zeiten, und würde kaum Kindern ohne Lachen erzählet werden können.33
Aus gleichem Grund verwirft Gottsched Göttererscheinungen und Zaubereien im Trauerspiel: Sie schicken sich für unsre aufgeklärte Zeiten nicht mehr, weil sie fast niemand mehr glaubt: also enthält sich ein Poet mit gutem Grunde solcher Vorstellungen, die nicht mehr wahrscheinlich sind, und nur in der ernsthaftesten Sache ein Gelächter erwecken würden .34
Deshalb sei der Höllengeist in Gryphius' „Leo Armenius" zu verwerfen. — Für Gottsched also ist die poetische Teufelsgestalt nicht schlechthin unwahrscheinlich, sondern „für unsre aufgeklärte Zeiten" „nicht mehr wahrscheinlich" ; mochte sie in unaufgeklärten Tagen ihr gutes Recht haben, so ist sie doch dem Prozeß der Aufklärung längst zum Opfer gefallen und fristet als Kinderglaube ihr Dasein. Tasso, Marino und Milton werden damit zu Gestalten einer abgesunkenen Epoche, sie reflektieren den Bewußtseinsstand einer in Vorurteilen und Irrtümern befangenen Zeit. Deutlich heißt es im 30. Stück (1743) der „Beyträge" : Die Hölle bildet sich der Pöbel als einen feurigen Pfui ein, der mit einem beständigen Schwefel brennt, wo Finsterniß und Dunkelheit ewig herrschen, und tausend Martern die darinnen befindlichen Geister peinigen. Die Bi(l)der des Teufels und seiner Genossen, will idi itzo nicht aufstellen: man kann sie im Milton sehen, welcher sie nach der gemeinen Abbildung wohl abgeschildert hat.35
31 32 33 34 35
Vgl. Gottsched, a. a. O., pp. 182f„ 211ff. Gottsched, a. a. O., p. 182. Gottsched, a. a. O., p. 183. Gottsched, a. a. O., p. 625. Johann Christoph Gottsched: Beyträge zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit. — Leipzig 1732—1744. Bd. 8, Stüde XXX, V. Critische Untersuchung, Wie weit sich ein Poet des gemeinen Wahnes und der Sage bedienen könne? p. 279f. (1743)
Der Teufel in der Aufklärung
145
Gottscheds Widerstand gegen die Teufelsdarstellungen der gescholtenen Epiker gewinnt seine Intensität aus der Furcht vor dem Wiederaufleben einer qua Vernunft überwundenen Epoche; in den Teufeln verdichtet sich deren ganze Unvernunft. Deshalb zielt die Unduldsamkeit des Aufklärers nicht allein auf die Art der Darstellung, sondern auf die Darstellung des Teufels überhaupt; er ist kompromißlos gegen jede Teufelsgestaltung, weil der Teufel als Prinzip des Widervernünftigen zwar seinen angestammten Ort in einer Welt der Unvernunft hatte, mit dem Einzug der Vernunft aber in die Welt in ihr sein Zuhause verloren hat. Der die Polemik gegen die Darstellungsprinzipien begleitende Vorwurf des Unzeitgemäßen der Teufelsgestalt verhält sich zum gegenwärtigen Weltzustand apologetisch, indem er ihn so sehr von den Gesetzen der Vernunft durchherrscht sieht, daß der Teufel gegenstandslos wird. Marinos Pluto und Miltons Satan sind für ihn nicht allein Beleg für die Unaufgeklärtheit ihrer Autoren, sondern, indem sie Gestalten einer unaufgeklärten Welt sind, zugleich Beleg für deren schlechten Zustand, während ein Teufel in der zeitgenössischen Literatur unwahrscheinlich nicht nur aufgrund der genannten poetologischen Prämissen, sondern vor allem aufgrund der Positivität der aufgeklärten Welt ist. Aufklärung, die die Welt zum Guten verändert, wird identisch mit Entdämonisierung, sie bekämpft im Teufel ein Residuum der Unvernunft. Unter der Allgewalt der Vernunft gibt es keinen Teufel mehr, weil es das Böse nicht mehr gibt. Eine dominante Teufelsfigur im christlichen Epos ist deshalb für den Aufklärer der Gestalt gewordene Zweifel an der Gelungenheit einer nach den Prinzipien der Vernunft geordneten Welt. Der Schatten Satans auf dem epischen Geschehen gehört einer Zeit an, in der unter dem Licht der Vernunft das Gute in der Welt noch nicht als beherrschend hervorgetreten ist. Die Insistenz des Wolffianers Gottsched auf der grundsätzlichen Gelungenheit der Welt wird zum eigentlichen Stachel seiner Kritik an den Teufelsgestalten; längst bevor er sich deren Gestaltungsprinzipien zuwandte, monierte er in einem im Tenor durchaus positiv gehaltenen Aufsatz über Milton an „Paradise Lost" das folgende: Viele unter den neuern Kunstrichtern oder Criticis haben es an dem Milton nicht loben wollen, daß er sich eine so abscheuliche That, als die Verführung des Menschen ist, zur Haupthandlung seines Gedichtes erwählet. Der Satan ist sein Held, und seine Heldenthat bestehet darinn, daß er sich an dem Allerhöchsten rächet, welches ihm auch, alles Widerstandes ungeachtet, gelinget. Dieses ist allerdings eine schreckliche Vorstellung: Aber ohne Zweifel ist Milton zufrieden gewesen, daß er diese Sätze in der Schrift und Religion gegründet befunden; wiewohl er auch unsers Erachtens besser gethan hätte, wenn er sich lieber den Fall des Satans, darinn unstreitig Gott selbst die Oberhand behalten, zum Inhalte seines Gedichtes erwählet hätte. 3 6
Derselbe Vorwurf taucht in schärferer Form dann später noch in der „Critisdien Dichtkunst" auf: Hierinnen ist nun der Teufel sein Held, der den unschuldig erschaffenen Menschen, aller dagegen gemachten Anstalten ungeachtet, verführet, und seinem Schöpfer entreißt. Die 36 Gottsched, Beyträge, a. a. O., Bd. 1, Stüde I, IV. Das verlustigte Paradeis ( . . . ) . p. 90. (1732)
146
Friedrich Gottlieb Klopstock: Oer Messias
ganze Erfindung ist also höchst fehlerhaft, zugeschweigen, daß es entsetzlich ist, den Sieg einer boshaften Creatur über ihren Schöpfer zu besingen.37
Die Polemik gegen Miltons Satan nimmt die Gestalt der Theodizee an; Gottsched tadelt das Mißverhältnis zwischen der tatsächlichen Kraft des Guten und der bei Milton gestalteten Dominanz des Bösen. Das Verdikt über den Teufel erstreckt sich damit über die dargestellte Handlung in ihrer Gesamtheit: Dem aufklärerischen Optimismus in Bezug auf die mögliche Vervollkommnung der Welt widerstreitet die Schilderung des siegreichen Bösen, in der sich eine Niederlage der Vernunft ausspricht. Dagegen stellt sich die Forderung nach der Darstellung von Satans Fall: Der Siegeszug über das Böse ist identisch mit dem Siegeszug der Aufklärung, die das Gute in der Welt bleibend realisiert. Die Verwirklichung dieses Programms, die Gestaltung von Satans Sturz als eine Bekräftigung des gelungenen Weltzustands aus aufklärerischem Geist, liegt, aus welchen Gründen immer ihn später Gottscheds Polemik traf, in Klopstocks „Messias" vor; in ihm wird das Geschehen von „Paradise Lost" nicht fortgeführt, sondern überwunden. Insofern verhält sich das Geschehen der Messiade nicht neutral zu ihrer Entstehungszeit: Der Sieg über Satan in der Erlösungstat Christi ist die theologische Gestalt des Siegs von Vernunft und Aufklärung, der Niederlage des Bösen im Epos entspricht die Überwindung der Unvernunft in der Welt und damit die Bestätigung von deren guter Einrichtung. Der aufklärerische Zweifel am Teufel aus dem Geist der Theodizee schlägt so bei Gottsched in die Rechtfertigung der grundsätzlichen Einrichtung der Welt um. Mochte sich nun in der Verteidigung des Wunderbaren in der Poesie bei Bodmer und Breitinger eine größere Distanz zum bestehenden Weltzustand verraten, so bleibt doch die Theodizee audi für die Gegner Gottscheds wesentlicher Bezugspunkt ihrer Argumentation; an ihr entscheidet sich in der Aufklärung das Schicksal der Teufelsgestalt. Stand hinter Gottscheds Polemik letztlich die Einsicht, daß die rationalistische Theodizee für eine dominante Satansgestalt keinen Raum mehr läßt, so vermeidet Bodmer die künstliche Isolation Satans aus dem Epos, indem er „Paradise Lost" in seiner Gesamtheit als Theodizee verteidigt. Dazu hatte Milton selbst die Handhabe geboten; als seine Intention formulierte er zu Beginn seines Epos: That to the highth of this great argument I may assert Eternal Providence, And justify the ways of God to men. 3 '
Diese Verse, in denen das klassische Ziel der Theodizee formuliert ist, beziehen sich auf die letzten Bücher des Epos, in denen über die Visionen Adams die Vermittlung des Sündenfalls mit dem Heilsgeschehen, gipfelnd im Erlösungswerk Christi, vorgeführt wird. Gottscheds Polemik gegen die Unvernunft des Miltonschen Textes konzentriert sich völlig auf die ersten Bücher, in denen Satans Erfolge geschildert sind, und nimmt von den letzten kaum Kenntnis, während Bodmer seine Verteidigung gerade auf diese aufbaut. Er betrachtet 57 Gottsched, Dichtkunst, a. a. O., p. 483. 38 Milton, a. a. O., p. 212f. (1/24—6)
Der Teufel in der Aufklärung
147
Satans Unternehmungen vom sicheren Standort der im Kreuzestod erworbenen Heilsgewißheit; für ihn kulminiert „Paradise Lost" im 12. Buch, in dem die Wiederkunft des Paradieses verkündet wird. Bodmer vermag deshalb nicht in Satan die dominante Gestalt des Epos zu sehen, weil es in Gnade und Erlösung, nicht aber in der Niederlage Gottes und der Verdammung des Menschen resultiert; für ihn ist Satan von Anbeginn über seine Integration ins Heilsgeschehen domestiziert. Dies bestimmt seine Argumentation; hatte man Milton das Gespräch zwischen Gott und Christus im 3. Buch vorgeworfen, weil in ihm verfrüht auf Christi „Mittleramt" hingewiesen werde, so entgegnet Bodmer: Die Erklärung des Mittleramts war an gegenwärtigem Orte vonnöthen, weil die Wege Gottes mit den Menschen gerettet werden mußten, eh und bevor der weitere Fortgang Satans in seinem verderblichen Unternehmen einen schlimmen Eindruck machete. Es war Zeit seinen Anschlägen, die eine Zeit lang nach seinem Wunsche hinausschlagen sollten, andere und vornehmlich das Ende derselben, entgegenzusetzen; sonst hätte man dem Poeten mit mehrerm Scheine, als einige gethan haben, vorwerffen könnnen (!), Satan wäre seine Haupt-Person und der Held in seinem Gedichte. ( . . . ) Wir erkennen jezo darinnen Gottes Oberherrliche Macht über Satan, und seine unaussprechliche Gnade gegen dem (!) Menschen.39
Die Eigendynamik des Satanischen, seine Überwindung der ihm in der Schöpfung gesetzten engen Grenzen, die Gottsched fürchtete, nimmt Bodmer nirgends wahr; er sieht Satan fest in die Welt- und Heilsordnung gebannt, der Teufel gilt ihm nur mehr als Stimulans des Heilsgeschehens. Deshalb vermittelt in Bodmers Sicht „Paradise Lost" keineswegs das Bild einer schlechten, verdorbenen, unglücklichen Welt; gegen den Leser, der „ . . . die lezten Bücher vor überflüssig hält ...", argumentiert er: Derselbe hat das Vorurtheil gefasset, Milten (!) wolle nur das Elend des Menschen besingen, der aus dem Paradiese gestossen, und unter der Last des Zorns Gottes erlegen ist; der Poet hat zu diesem Vorurtheil keinen Anlaß gegeben, sondern ihm vielmehr allerorten vorgebaut.40
Buch 11 und 12 sind nicht ein mit dem Hauptgeschehen, dem Sündenfall, unverbundener Anhang, sondern bieten die Erfüllung eines erst durch den Fall in Gang gekommenen Heilsgeschehens; in ihnen ist die Theodizee verankert. Nach meinem Bedüncken hat Milton alle diese trostreichen, und erquickenden Umstände, welche den Fall Adams gewissermassen wieder verbessern, nur in der Absicht eingeführet, weil sie dieneten, den Weg der Güte Gottes gegen den Menschen zu rechtfertigen, und weil sie aus seiner Materie natürlich hervorflossen.41
Die Insistenz des Schweizers auf der Theodizee als dem Grundzug von „Paradise Lost" 42 führt in ihrer Konsequenz bei der Einschätzung Satans zu Ergeb39
Johann Miltons Episches Gedichte von dem Verlohrnen Paradiese. Faksimiledruck der Bodmerschen Übersetzung von 1742. Mit einem Nachwort von Wolfgang Bender. — Stuttgart 1965. p. 107f. 40 Milton/Bodmer, a. a. Ο., p. 439. « Milton/Bodmer, a. a. O., p. 576. « Vgl. zusätzlich Milton/Bodmer, a.a.O., pp. 113 und 117, gleichfalls die Anmerkungen Ridiardsons pp. 496 und 560. — Nodi Dilthey sah in „Paradise Lost" eine „dichterische Theodizee". — Wilhelm Dilthey: Satan in der christlichen Poesie. — In: W.D.: Die
148
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
rissen, die von denen Gottscheds trotz des gegenteiligen Ausgangspunkts nur wenig verschieden sind: Vor der grundsätzlich positiven Einschätzung der gegebenen Weltordnung verliert die Satansgestalt an Bedeutung, zumal die behauptete Rechtfertigung Gottes vor den Übeln der Welt mit der argumentativen Reduktion des Bösen selbst einhergeht. Demgemäß streicht Bodmer die Rolle Satans in „Paradise Lost" von der einer Hauptperson (wie Gottsched sie sah) auf die eines Statisten im Heilsgeschehen zusammen; der Teufel gewinnt die Harmlosigkeit eines längst überwundenen Gegners. GewiJß betreibt Bodmer nicht den radikalen Exorzismus Gottscheds, jedoch trifft sich der Rationalismus des Schweizers mit dem des Leipzigers in der strikten Einschränkung des Wirkungsbereichs des Bösen. Diese Einengung von Satans Handlungsraum verrät noch die Apologie der Teufelsgestalten von „Paradise Lost". In ihr wird an keiner Stelle der Umfang von Miltons Höllen- und Teufelsdarstellungen legitim i e r t — dies hätte der Theodizee als Argumentationsgrundlage nicht entsprochen — , vielmehr geht es einzig um die Art der Darstellung. Hierbei nun fällt auf, daß die Rechtfertigung der Teufelsgestaltung bevorzugt über die Erläuterung der Prinzipien sich vollzieht, denen die Gestaltung der „Englischen Personen" 43 unterworfen ist. Wie schon an Boileau und Dryden sich zeigte, richtete sich die Idiosynkrasie der Aufklärer gegen die Darstellung der Geisterwelt nicht mit gleicher Intensität auf die Engel wie auf die Teufel, weil mit diesen der Glaube an einen der Verbesserung über Vernunft nicht zugänglichen Bereich sich verband, während jenen Duldung widerfuhr, weil sie als Objektivationen der Kraft des Guten für die Wirksamkeit von Vernunft selbst einstanden. Dem fügt sich auch Bodmer; die Teufel gelten ihm weiterhin als gefallene Engel, so daß er sich bei der Diskussion strittiger Punkte auf die Erkenntnisse der Angelologie berufen kann, ja grundlegende Darstellungsprinzipien, wie Anthropomorphic, individuelle Charakteristik und Emotionalität, aus der „Theorie von den Engeln" 44 gewinnt, um sie von dort auf die Teufel zurückzubeziehen. Weil also biblisdie Zeugnisse und die Gesetze der Wahrscheinlichkeit die menschliche Gestalt der Engel nahelegen, treten, ohne daß dies nodi diskutiert würde, auch die Teufel, als gefallene Engel, anthropomorph auf. Insofern beansprucht Bodmer audi für Miltons Teufelsgestalten, daß sie nach rationalen Kriterien geschildert seien; eben dies unterscheide sie von seinen Vorläufern, mit denen Gottsched sie stets zusammenbrachte: Nichts anderes als „Satans Englische Natur" sichert ihm „ . . . eine Majestät, welche Dantes, Tasso und Ceva, mit ihren häßlichen und eckelhaften Vorstellungen Satans und seiner Engel übel verderbt haben." 45 Dieserart erstrecken sich die Gesetze der
große Phantasiedichtung und andere Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte. Hrsg. von Herman Nohl. — Göttingen 1954. p. 123. 4 3 Johann Jacob Bodmer: Cr i ti sehe Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie. Faksimiledruck nach der Ausgabe von 1740. Mit einem Nachwort von Wolfgang Bender. — Stuttgart 1966. p. 42. Bodmer, Abhandlung, a. a. O., p. 105. « Milton/Bodmer, a. a. O., p. 36. Vgl. auch p. 23.
Der Teufel in der Aufklärung
149
Rationalität selbst auf die Verkörperung des Widervernünftigen; erfüllt Gottsched das Vernunftgebot über die Verbannung Satans aus dem Epos, so leistet Bodmer ihm Folge, indem er den Teufel in die Gesetze der Vernunft bannt. Die Verteidigung Miltons gegen seine Gegner in der „Critischen Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie" verfährt nach eben diesem Prinzip: In ihr geht es einzig um den Nachweis, daß die Gestaltung Satans, also seine poetische Existenz, an keiner Stelle der Vernunft widerspricht; seine tatsächliche Existenz hingegen steht überhaupt nicht zur Diskussion, und noch der Hinweis darauf, daß es „ . . . unverwerffliehe Zeugnisse . . . von dem Aufstand Satans und seines Anhangs, von ihrem Fall vom Himmel, und Verstossung in die Hölle . . g e b e 4 6 , will einzig die Wahrscheinlichkeit der poetischen Nachbildung unterstreichen. Wenn aber Bodmer die Einwürfe seiner Gegner gegen die Unvernunft der Satansgestaltung mit dem detaillierten Nachweis ihrer Übereinstimmung mit den Gesetzen der Rationalität widerlegt 47 , gelingt ihm zwar die Legitimation des Teufels als eines poetischen Gegenstands, andererseits jedoch betreibt er gleich Gottsched die Entdämonisierung der Welt, indem er das im Teufel bedeutete irrational Dämonische fest in den Griff der Vernunft nimmt. Vom Teufel geht Bedrohnis und Gefahr nicht mehr aus; er wird auf die Harmlosigkeit eines aufgrund seiner Übersinnlichkeit kontroversen poetischen Gegenstands verflacht. Vernunftprinzip und Theodizee als gemeinsame Argumentationsgrundlage zwingen, ohne daß dies zur Übereinkunft in den strittigen poetologischen Problemen führen müßte, beide Parteien zur Reduktion einer dominanten Teufelsgestalt. Klopstock nun hat einen eigenständigen Beitrag zu dieser Diskussion nicht geleistet; als Schüler Bodmers fügt er sich der allgemeinen Tendenz ein, ja er führt sie gleichsam ins Extrem. Poetologische Reflexion der Teufelsgestaltung findet sich bei ihm nicht mehr; er wendet sein Interesse ausschließlich den Engeln zu: Es ist wahrscheinlich, daß endlidie Geister . . . Leiber haben. Und es ist nicht ganz ohne Wahrscheinlichkeit, daß Wesen, die Gott auch so sehr bei der Seligkeit der Menschen braucht, einen Körper empfingen, der demjenigen ähnlich war, welchen der Mittler dieser Seligkeit annahm. 48
Anthropomorphic wie Wahrscheinlichkeitsprinzip weisen auf Bodmer zurück; andererseits aber deuten die theoretischen Texte eine Überwindung der strikten Vermenschlichung an: Haben zum Exempel die Griechen die Vorstellungen ausdrücken können, die wir uns von Engeln machen müssen? Aber wie vortrefflich haben sie nicht oft die Götter vorgestellt. Sollten wir nicht die Engel so machen? Gewiß nicht völlig so. Wir sollten jene Vorstellungen der Götter übertreffen.4» 46 Bodmer, Abhandlung, a. a. O., p. 42. 47 „Im Versuch logisch-rationalistischer Argumentation sahen die Schweizer die einzige Möglichkeit, die Angriffe ihrer Gegner abzuwehren." — Wolfgang Bender: Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger. — Stuttgart 1973. p. 87. 48 F. G. Klopstodc: Von der heiligen Poesie. — In: Ausgewählte Werke, a. a. O., p. 1008. F. G. Klopstock: Eine Beurteilung der Winckelmannischen Gedanken über die Nach-
150
Friedrich Gottlieb Klopstock: Oer Messias
Idealisierung und Entsinnlidiung der Geisterwelt, wie sie der „Messias" vornimmt, sind hier wiederum nur für die Engel angekündigt, während die in gleicher Weise problematische Teufelsgestaltung völlig übergangen wird. Der Teufel wird von Klopstock als Problem gar nicht erst wahrgenommen. Noch am deutlichsten ist dies in der Abitursrede, der „Paradise Lost" als der Gipfelpunkt christlicher Epik gilt. Seinen Inhalt beschreibt Klopstock so: Sehet ihn (i. e. Milton, Ε. O.) zwischen den glüklichen Bewonern des Paradieses, und ihr werdet fast eben die Leichtigkeit und Zartheit der Erzälung, die ihr so sehr in Salomons hohem Liede bewundert, bei ihm finden. Folgt ihm, wenn er empor in die heiligen Versammlungen der Engel wandelt, und auch da — welche unnachahmliche Würde, welch ein Glanz des Gesanges! In diesem ist er so grosz und himmlisch, dasz er aus ihrem heiligen Rate einen Freund bekommen und von ihm viel Geschichten des Himmels gehört zu haben scheint. Begleitet noch weiter den Dichter, dodi fern und zitternd, bis zum Throne der Gottheit.50
Klopstock scheint hier eher vom „Messias" zu reden als von „Paradise Lost", dessen Held für Gottsched noch Satan war. Satan aber wird in der Absdiiedsrede an keiner Stelle mehr erwähnt, und wenn Klopstock sagt, Milton habe nichts als das Schöne, Erhabene und Bewunderungswürdige erwält . . . " 51, so drängt sich der Eindruck auf, dem Messias-Dichter gelten die Passagen über Hölle, Sünde und Tod als im Kontext des Ganzen so bedeutungslos, daß sie zu erwähnen sich nicht lohnt. Gleich Bodmer, der in ihm die Theodizee sah, erblickt Klopstock in Miltons Epos nur mehr den Hymnus auf einen gelungenen Weltzustand; über Paradies, Engeln und Gottesthron werden die Schattenseiten der Schöpfung vergessen. Es bedarf einer Auseinandersetzung mit dem Teufel deshalb nicht, weil er von so geringer Bedeutung ist. Daß aber im wohlgelungenen Ganzen der gestalteten Welt die negativen Elemente sich verlieren, verdankt sich in erster Linie der Form des Epos selbst, die über die geforderte Verarbeitung der Fülle des Existierenden zur Wiedergabe der Harmonie des Ganzen nötigt. Für Klopstock bildet das Epos den Gipfelpunkt der Poesie, ihm gebührt der Vergleich mit der Erde, während die anderen Gattungen nur deren Teilen entsprechen: Denn die Erde erscheint wegen der freundschaftlichen Uebereinstimmung aller ihrer Teile alsdann nur am meisten bewundernswürdig und vollkommen schön, wenn man sie mit Einem Blicke ganz überschaut, da ihre Teile, einzeln betrachtet, ob sie gleich auch, doch in groszem Abstände ihre Vortrefflichkeit haben, von der Herrlichkeit des Ganzen übertroffen werden. 52
Die Konzentration der Daseinsfülle im Epos überwindet Kontingenz und Vereinzelung zugunsten der Eintracht alles Existierenden, indem aus der Zusammenschau des bisher Verstreuten Einsicht in die Harmonie der Schöpfung sich ahmung der griechischen Werke in den schönen Künsten. — In: Ausgewählte Werke, a. a. O., p. 1050. so Klopstocks Abschiedsrede über die epische Poesie, cultur- und litterargesdiichtlich beleuchtet, sowie mit einer Darlegung der Theorie Uhlands über das Nibelungenlied begleitet von Albert Freybe. — Halle 1868. p. 121. (Übertragung von C. F. Cramer.) si Klopstocks Abschiedsrede, a. a. O., p. 120. 52 Klopstocks Abschiedsrede, a. a. O., p. 104f.
Der Teufel in der Aufklärung
151
ergibt. Für Klopstock wird das Epos zur künstlerischen Gestalt der Theodizee, in ihm findet die prästabilierte Harmonie, die „Herrlichkeit des Ganzen" aufgrund „der freundschaftlichen Übereinstimmung aller seiner Teile", künstlerisch zum Ausdruck. Dem Blick aufs Ganze ordnet sich die Summe des Existierenden zum gesetzmäßig ausgewogenen Verhältnis alles Besonderen; vor der Herrlichkeit aber dieser ursprünglichen Einheit verliert sich das Böse als unbedeutend, ja letztlich als in den Entwurf des Ganzen eingeplant und somit zu dessen Harmonie beitragend. Aus diesem Konzept des Epischen erklärt sich Klopstocks Selektion des Guten, Schönen, Erhabenen aus Miltons Welt, vor allem aber begründet sich aus ihm die Exklusion Satans aus der Rede. Das Epos als die künstlerische Realisation der prästabilierten Harmonie führt unausweichlich zur Entdämonisierung. Der Überblick über die poetologische Diskussion epischer Teufelsgestaltung von Boileau bis Bodmer und Klopstock macht deutlich: Die Zurückdrängung Satans aus der christlichen Poesie verdankt sich nicht der Durchsetzung eines klassizistischen Regelkanons, sondern dem Fortschritt von Vernunft und Aufklärung. Noch wo Satan unter dem Titel des Wunderbaren Einlaß ins Epos findet, geschieht dies unter dem Primat der Vernunft, die dem Bösen in der Welt obsiegt. Es ist ein von Vernunft überwundener Teufel, den das Epos noch handeln läßt; es leistet sich die Paradoxie eines Gegenspielers, der schon, bevor er den ersten Zug tat, verloren hat. Vernunft zielt auf irdische Vollkommenheit, auf das Ende des Bösen. Im Epos, in dem sie die „Herrlichkeit des Ganzen" schon organisierte, ist ihr auch die Überwindung des Bösen bereits gelungen; der Teufel ragt deshalb nur als prärationaler Restposten in es hinein. Die Denkfigur der Theodizee wird leitend bei der Herausarbeitung des epischen Gestaltungsprinzips; in ihr ist deshalb das Schicksal Satans im Epos vorgezeichnet. Theodizee und christliches Epos treffen sich im vernunftgerechten Nachweis der „Herrlichkeit des Ganzen" ; ihr Umgang mit dem Teufel als der Verkörperung des Widervernünftigen stimmt in wesentlichen Prinzipien überein. Die Leibnizsche „Théodicée" zeichnet daher bereits den Rahmen vor, innerhalb dessen Satan im „Messias" sich bewegen kann. Ihre Bedeutung für das Denken des 18. Jhs im allgemeinen, für Klopstocks Dichtung im besonderen macht ein längeres Verweilen bei ihr notwendig. Die Entdämonisierung der Welt, wie sie die philosophischen Entwürfe Wolffs und Gottscheds vornehmen und wie sie von den Neologen später in die Dimension der Offenbarungstheologie gehoben wird, findet in der „Théodicée" ihre schlüssigste Begründung. Wer — wie Leibniz — von dieser Welt als der besten aller möglichen spricht, hat das Böse gebannt, es aus dem Mythos genommen und der Rationalität unterworfen. Denn er hat Totalität im Blick, sieht, wenn er einzelnes noch betrachtet, in ihm schon das Ganze, und das Ganze durch das einzelne vermittelt. Und wie „ . . . jede einfache Substanz Beziehungen hat, durch welche alle übrigen zum Ausdruck gelangen . . . " , so daß sie „ . . . ein fortwährender lebendiger Spiegel der Welt . . . " ist 53 , so erklärt sich auch erst das einzelne 53 Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie. Zweite, wesentlich verbesserte Auflage. Neu
152
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
soziale Faktum vor dem Bilde des Ganzen, aus seiner Beziehung zur Totalität. Denn nicht mehr Motivationen — z. B. warum einer etwas Böses tat — treten ins Zentrum der Analyse, auch wird nicht mehr nach dem initiierenden Prinzip (dem eigentlich Teuflischen) geforscht, sondern von der Funktion ist die Rede. Die Welt aber als Ganzes ist zwar die beste, doch nicht ausschließlich gut, denn was gut an ihr ist, muß mit Bösem und Übel erkauft werden. Gott — Leibniz wird nicht müde, dies zu betonen — hat die beste aller möglichen Welten erschaffen, eine Welt ohne Böses jedoch war ihm nicht möglich. Und wollte man sich nur ein einziges Übel aus der Welt herausdenken, so wären die Folgen unabsehbar; weil alles mit allem zusammenhängt, müßte eine neue Welt entstehen: Wenn somit das geringste Übel, das in der Welt eintrifft, fehlte, es wäre nicht mehr diese Welt, die, alles in allem, von dem sie auswählenden Schöpfer als die beste befunden worden ist.'*
In solcher Relation, als integraler Teil des Ganzen, wird das Böse gleichsam rational, die zerstörende Kraft zur konstruktiven: Gebannt in den universalen Plan der besten Welt kann auch das Übel nur zu deren Befestigung beitragen, der „Teufel" wird zu ihrem Detail. — Jeder Verstoß gegen Gottes Gesetze ist ein Steinchen im unüberschaubaren Mosaik des göttlichen Plans; darin liegt seine Notwendigkeit, doch nicht seine Rechtfertigung. Die Sünde bleibt auch dann Vergehen gegen Gott, wenn er selbst ihrer bedarf, um den umfassenden Entwurf der besten Welt durchführen zu können. So stellt sich gerade bei Leibniz, der die Negation der Ordnung zum unerläßlichen Teil der Ordnung selbst machte, das Problem von Sünde und Bestrafung erst in aller Schärfe. Die Kreatur in ihrer ursprünglichen Unvollkommenheit (allein Gott ist vollkommen) ist zur Sünde befähigt, „ . . . ihre Beschränkung oder angeborene Unvollkommenheit . . . " wird „ . . . Quelle ihrer Bosheit und ihr schlechter Wille alleinige Ursache ihres Elends" 55. Der Mensch entscheidet sich aus freiem Willen zum Handeln wider Gottes Gebot. So trägt auch er allein die Schuld, nicht Gott, der doch solch böser Tat bedarf, um seinen Plan zu vollenden. Gott wählte im Ursprung aus allen Möglichkeiten die beste; in seinem Weltentwurf war von Anbeginn, bevor er zu Realität wurde, das Wissen darum enthalten, daß sich der Mensch, wie im Sündenfall so immer wieder in seiner Geschichte, aus freiem Ermessen zur Sünde entschließen werde. Im Plan der besten Welt war jeder Entschluß schon mitgedacht, den der Mensch aus eigenem Willen fällen wird. So bleibt dem Menschen die Freiheit des Willens, Gott aber kennt seine Entschlüsse bereits — mußte sie kennen, um überhaupt die beste aller Welten schaffen zu können. So wird der Mensch auch nach dem Prinzip der Billigkeit für seine Vergehen bestraft. — Die unerschütterliche Gewißheit, daß das übersetzt, eingeleitet und erläutert von Hermann Glockner. — Stuttgart 1970. p. 25. (These 56) 5 * Gottfried Wilhelm Leibniz: Theodicee. Hrsg. von Artur Buchenau. — Leipzig 1925. ( = Leibniz: Philosophische Werke. Hrsg. von A. Buchenau und E.Cassirer. Bd. 4.) p. 102. (S 9) 55 Leibniz, Theodicee, a. a. O., p. 226. (§ 167)
Der Teufel in der Aufklärung
153
Gute in der Welt das Üble überwiege, ja daß das Böse nur im Guten letztlich resultieren könne, konstituiert sieb im Bewußtsein „ . . . der Einheit eines unendlich vollkommenen universellen Prinzips . . . " , einer „ . . . Weisheit, die das Übel dem größeren Gut dienstbar sein läßt." 56 — Ein Weltbild, in dem das Übel gleichsam der Schatten ist, den das Gute notwendig auf die Welt wirft, kennt nur nodi ein lenkendes Prinzip: das Göttliche. Manichäistische Vorstellungen wollen sich in ein solches Konzept nicht fügen; Ariman und Ormuzd werden nahezu materialistisch erklärt (Vgl. § 138); nicht allein ein dem guten — göttlichen — Prinzip gleichwertiges böses lehnt Leibniz ab, sondern ein böses Prinzip überhaupt findet in seinem System keinen Platz mehr: Meiner Meinung nach ist es jedoch eine sehr schlechte Erklärung einer Erscheinung, wenn man für sie ein b e s o n d e r e s P r i n z i p benötigt: dem Bösen ein prineipium mdeficum, der Kälte ein primum frigidum zuerteilt: nichts leichter, nichts platter als dies! 57
Es gebe „ . . . kein Prinzip der Finsternis. Das Übel stammt allein aus Privation; das Positive an ihm tritt nur begleitweise auf . . 5 8 . Denn aus Gottes Willen selbst ist ja das Böse direkt zu erklären: nicht so, daß Gott das Böse wolle, aber daß er seiner bedarf, um das Gute zu schaffen. Die finsteren Schatten des Mittelalters, die über allem lastenden Gestalten des Teufels und seiner Dämonen, sind ihrer Macht beraubt; nur mit Mühe noch kann Leibniz sie in seiner Philosophie unterbringen. Man kann es getrost als eine Konzession an traditionelle Vorstellungen oder an die orthodoxe Gelehrsamkeit seiner Disputanten auffassen, wenn ihm Leibniz überhaupt noch in der „Théodicée" einen Platz einräumt; in der Argumentation des aufklärenden Philosophen wirkt er wie ein mittelalterliches Fossil, das der Stringenz der Beweisführung lästig im Wege steht. Denn Leibniz benötigt den Teufel nicht mehr zur Rechtfertigung des Übels in der Welt, der Teufel — wie entsprechend auch die Engel — will sich nur schwer der Rationalität des Systems fügen. Was Leibniz vom Teufel weiß, entnimmt er der Offenbarung; knapp und kommentarlos referiert er einige Bibelstellen (vgl. §§ 273—5), die über den Engelsturz als Folge der ersten Schlechtigkeit in der Geschichte der Geschöpfe Auskunft geben. An anderer Stelle bezieht er sich auf die Patristik und Theologenmeinung: Wie die Alten schon erkannten, bleibt der Teufel in all seinen Qualen aus freiem Willen Gott fern, und will sich nicht durch eine Unterwerfung loskaufen. ( . . . ) Zum mindesten sind sich also die Theologen für gewöhnlich darin einig, daß die Teufel und die Verdammten Gott hassen und lästern; und solch ein Zustand muß fortdauerndes Elend nach sich ziehen. Man sehe hierüber die gelehrte Abhandlung des Herrn Fedit über den Zustand der Verdammten ein. 59
Nur an einer Stelle seines Buches äußert sich Leibniz mit eigener Meinung zum Teufel, und dies in der offensichtlichen Intention, sein System der besten aller Welten von der Teufelsgestalt nicht gefährden zu lassen: 56 57 58 59
Leibniz, Leibniz, Leibniz, Leibniz,
Theodicee, Theodicee, Theodicee, Theodicee,
a. a. O., a. a. O., a. a. O., a. a. O.,
p. 210. p. 213. p. 214. p. 308.
(S (§ (§ (§
147) 152) 153) 271)
154
Friedrieb Gottlieb Klopstock: Der Messias
Was nun den Ursprung des Übels anbelangt, so ist es richtig, daß der Teufel Urheber der Sünde ist, doch reicht der Ursprung der Sünde nodi weit tiefer, und sie findet ihre eigentliche Quelle in der angeborenen Unvollkommenheit der Kreaturen; dies macht sie fähig zu sündigen; in der Verknüpfung der Dinge gibt es Umstände, welche diese Fähigkeit hervorrufen.60
Die Unterscheidung zwischen dem Urheber der Sünde und deren Ursprung ist analytisch durchaus legitim, nur vermag sie im Kontext der Leibnizschen Philosophie nicht zu überzeugen: Das Bemühen, traditionelle Vorstellungen mit dem eigenen Neuansatz zu vermitteln, fällt sofort ins Auge. Die Erklärung der Sünde aus der ursprünglichen Unvollkommenheit aller Kreatur reicht zur Begründung des Bösen durchaus hin, eines unmittelbaren Urhebers hätte es da nicht mehr bedurft. Das drückt sidi auch in Leibniz' Formulierung aus: Nodi in der Rezeption traditioneller Vorstellungen artikuliert sich deren Kritik. — Leibniz bildet deshalb kein eigenes Teufelsbild aus. In seinem System ist das Böse verstanden, analytisch auf den Begriff gebracht und erklärt; nur das nichterklärbare Böse in der Welt bedarf der versinnlichten Gestalt. Schon bei Leibniz artikuliert sich die Distanz des Aufklärers zum Mythos vom Teufel; der Zweifel des Wissenschaftlers macht vor religiöser Überlieferung nicht mehr halt: Die Teufel waren vor ihrem Fall Engel gleich den anderen, und ihr Oberhaupt soll einer der hervorragendsten gewesen sein: aber die Schrift läßt sich hierüber nicht deutlich genug aus. Die Stelle in der Apokalypse, wo von dem Kampf mit dem Drachen als von einer Vision die Rede ist, läßt reichliche Zweifel übrig, und enthüllt eine Sache nicht genug, von der andere heilige Schriftsteller fast gar nicht sprechen.'1
Der naive Teufelsglaube wird zum Opfer philologischer Anstrengung. Abstrahiert man von der hier referierten Position auf die ihr zugrundeliegenden Grundauffassungen, so sind folgende das Denken der Aufklärung prägende Prinzipien zu nennen: Leibniz' System ist durchtränkt von positiver Welterfahrung, das Gute an der Welt wird betont, die Nachtseiten des Lebens erscheinen sekundär. Der Mensch weiß sich eingebettet in den umfassenden göttlichen Plan, gesichert in einer geordneten Welt mit der Aussicht auf Belohnung nach dem Tode, wenn er sich aus freiem Willen für Gottes Gebot entscheidet. Aus freiem Ermessen entschließt er sich zur Sünde; die Übereinstimmung von Glaube und Vernunft jedoch läßt dem vernünftigen Menschen keine echte Wahl: Er unterwirft sich dem göttlichen Willen, böses Handeln ist mit dem Abrücken von der Vernunft identisch. Der Teufel bleibt demgegenüber schmükkendes Beiwerk, Restposten einer überwundenen Welt; dem Vernünftigen bedeutet er keine Gefahr mehr, er verliert ihn aus dem Blick. Die Propagandisten der Vernunft haben daraus die Konsequenz gezogen: Christian Wolff verschweigt den Teufel in seinem philosophischen Hauptwerk „Vernünfftige Gedancken von Gott, Der Welt und der Seele des Menschen" gänzlich, während Gottsched in seinen „Ersten Gründen der gesammten Welt«o Leibniz, Theodicee, a. a. O., p. 217. (§ 156) «ι Leibniz, Theodicee, a. a. O., p. 217. (S 157)
Der Teufel in der Aufklärung
155
Weisheit" zwar die Existenz unzähliger „vollkommener Geister" 62 einräumt, aber gleich Wölfl: den Teufel an keiner Stelle erwähnt. Die Idee der prästabilierten Harmonie, die tiefe Überzeugung, in der besten aller möglichen Welten zu leben, führen in ihren Entwürfen zu einer Einschränkung des Bösen, die über Leibniz weit hinausgeht. War in der „Théodicée" das Übel in der Welt noch zentral thematisch, so verringert sich in Wolffs Werk sein Stellenwert schon bedeutend, um schließlich bei Gottsched en passant aus Gründen der Vollständigkeit erledigt zu werden. Die Grundannahme, „ . . . daß auch die beste Welt nicht ohne Unvollkommenheit, Uebel und Böses seyn kan" 63, liefert dabei ein für alle Male den hinreichenden Grund für alles konkrete Elend und Leid. Das Übel in der Schöpfung, die Wolff mit einer Uhr vergleicht, entsteht gleichsam mit mechanischer Notwendigkeit, verständlich als die Reibung der Räder des Uhrwerks aneinander, als Knacken im Getriebe der Weltuhr. Der völlige Ausschluß offenbarungstheologischer Argumentation führt Wölfl bei der inhaltlichen Bestimmung von Gut und Böse dazu, daß er auf die göttlichen Gebote an keiner Stelle mehr zurückgreift und zur Richtschnur menschlichen Handelns das Prinzip der Vollkommenheit nimmt. Das Handeln des Menschen zielt entweder auf Vollkommenheit oder es führt von ihr weg; daran bemißt sich die ethische Wertung. Dabei gilt: „Was uns und unsern Zustand vollkommener machet, das ist gut."64 Ein Beispiel Wolffs mag die Säkularität dieser These wie auch deren praktische Bedeutung verdeutlichen: „Geld machet unseren äusserlichen Zustand vollkommener, und also ist es auch etwas Gutes." 65 Spiegeln sich schon in solcher These die Vollkommenheitsvorstellungen des Bürgertums wider, so gilt dies erst recht für die Definition des Bösen, die hier in ihrer vollen Länge zitiert sein soll: Was uns und unsem Zustand unvollkommener machet, das ist böse. Z. E. Die Unwissenheit machet unsern Verstand unvollkommen, und also ist sie böse. Die Kranckheit machet unsern Leib unvollkommen, und also ist sie gleichfals böse. Die Armuth machet unseren äusserlichen Zustand unvollkommen, und also ist sie etwas böses.66
Obgleich die Anlage der Welt irdische Vollkommenheit unmöglich macht, wird hier Vollkommenheit zu einer Kategorie der Immanenz, an der sich die Möglichkeiten innerweltlichen Handelns orientieren: Das Böse bezeichnet die Widerstände bei der Inbesitznahme der Erde durch den Menschen, genauer: den Bürger. Unwissenheit, Krankheit, Armut schränken die Verfügungsgewalt des Menschen ein; das macht sie böse. Der Bürger braucht Wissen, Gesundheit und ö Johann Christoph Gottsched: Erste Gründe der gesammten Weltweisheit, darinn alle philosophische Wissenschaften, in ihrer natürlichen Verknüpfung, in zwenen Theilen abgehandelt werden. Sechste vermehrte und verbesserte Auflage. — Leipzig 1756. Bd. 1, p. 586. w Christian Freiherr von Wolff: Vernünfftige Gedancken Von Gott, Der Welt und der Seele des Menschen, Nach allen Dingen überhaupt, Den Liebhabern der Wahrheit mitgetheilet. Neue Auflage hin und wieder vermehret. — Halle 1751, p. 651. (S 1058) M Wolff, a. a. Ο., p. 260. (S 422) «5 Wolff, a. a. O. Wolff, a. a. O., p. 262. (S 426)
156
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
Geld, um sich die Erde Untertan zu machen; darin sieht er das Gute. Mit dem Verständnis dieser Welt als der bestmöglichen akzeptiert er sie als das adäquate Feld seines Handelns; in ihr hat er sich, so wie sie ist, zu bewähren. Indem aber der Mensch in von Rationalität kontrollierter Praxis sich die Erde Untertan macht, entdämonisiert er sie. Wenn in einem ersten Schritt mit den Objektivationen der Unvernunft, den Teufeln und Dämonen, der Glaube an die objektiven Widerstände im Weltaufbau gegen die Gesetze der Vernunft fallengelassen wird, so gerät in einem zweiten mit dem Postulat irdischer Vollkommenheit die Möglichkeit einer endlichen Überwindung des Bösen selbst in den Blick. Schon Wolff führten sein Optimismus und sein Vertrauen auf eine in der Vernunft des Menschen fundierte Ethik zu der Ansicht, daß es letztlich ein genuin böses Handeln gar nicht gebe, denn jeder Mensch kann nur Vollkommenheit wollen, und sollte er gegen das Ziel der Vollkommenheit, also böse handeln, so nur deshalb, „ . . . weil er aus Irrthum das Böse für gut, und das Gute für böse h ä l t . . 6 7 . Gottsched ist hier, wie in allen entscheidenden Punkten, der Meinung seines Lehrers: „Denn daß der Mensch Böses thut, das kömmt daher, weil er es für gut ansieht..." 68. Und nodi dort, wo ein offenbares Übel vorliegt, bietet die Idee der prästabilierten Harmonie die bequeme Möglichkeit, in ihm nichts als die Vorstufe eines Guten zu sehen; so, wenn Gottsched die Grundfigur eines beliebten Ideologems formuliert: Man muß nämlich den Zusammenhang aller seiner Umstände betrachten: so wird man finden, daß audi die Widerwärtigkeiten etwas Gutes nach sich ziehen; indem z. E. mancher nicht glücklich, reich und groß geworden wäre, wenn er nicht vorher arm, krank, oder unglücklich gewesen wäre. 69
Wer davon nicht überzeugt ist, den muß der Augenschein von der Dominanz des Guten in der Welt belehren: Das „moralische" und „physikalische Uebel" sind „... so groß nicht, als man vielmals vorgiebt70 Denn es gebe mehr Gesunde als Kranke, mehr Wohlversorgte als Bettler, mehr Vergnügen als Verdruß, mehr Wohnhäuser als Zuchthäuser, etc. Klopstock war mit diesem Denken eng vertraut. Seine Begegnung mit der Philosophie vollzog sich über Leibniz: Zum festen Bestand der Klopstock-Literatur gehört die Anekdote, der Dichter habe sich in seiner Leipziger Studienzeit vierzehn Tage lang in seiner Bude vergraben, um sich ungestört der Lektüre der „Théodicée" widmen zu können. In manchem seiner Gedichte hat er später dem Philosophen ein bleibendes Denkmal gesetzt, ihn mit Armin und Luther zu den Heroen der deutschen Geschichte gezählt. Zu sehr war Klopstock von der großen Leistung des Hannoveraner Philosophen, von seiner bleibenden Erneuerung des Denkens überzeugt, als daß er sich später noch über die Grenzen der Leibnizschen Philosophie hätte erheben können. So verstellte ihm die Tatsache, daß das Leibnizsche System, verbunden mit dem eigenen unerschütterlichen a Wolff, a. a. Ο., p. 309. ($ 507) 68 Gottsched, Weltweisheit, p. 582. Gottsched, Weltweisheit, a. a. Ο., p. 270. Und p. 584 heißt es ein weiteres Mal: „ . . . daß auch das Böse in der Welt fast allezeit etwas Gutes nach sich zieht . . 70 Gottsched, Weltweisheit, a. a. O., p. 592.
Der Teufel in der Aufklärung
157
Offenbarungsglauben, ihm durchaus zur Welterklärung ausreichend erschien, im Alter den Zugang zu Kant. Nicht so eindeutig wie die zu Leibniz sind die Verbindungslinien zu Christian Wolff. Klopstocks Bedürfnis nach philosophischer Weltdeutung war gleichsam mit der Lektüre der „Théodicée" bleibend befriedigt, und Wolffs konsequenter Medianismus und Intellektualismus standen dem Dichter von Haus aus fern. Nur selten, dann aber respektvoll, hat er sich deshalb zu Wolff geäußert. Und doch hat Wolff, der das deutsche Geistesleben in der ersten Hälfte des 18. Jhs entscheidend prägte, zumindest mittelbar auf Klopstock gewirkt: so über die Vorlesungen des Jenaer Professors Joachim Georg Darjes, über die von Wolff beeinflußten Neologen, über die konsequenten Wolffianer Bodmer und Breitinger. Kaiser spricht daher von „ . . . einem zumindest atmosphärischen, wenn auch in den einzelnen Elementen ungeschiedenen Einfluß Wolffs auf Klopstocks Weitsicht." 71 Und Emanuel Hirsch betont, Klopstocks harmonistische Weltsicht, sein „Preis des frohen Geistes", habe ihre „letzte Wurzel in der Philosophie Wolffs" 7 2 , und schon Hegel hatte ja der Messiade „die Begriffe der Wolffischen Metaphysik" angekreidet. — Hatte sich nun schon in der poetologischen Reflexion auf die Form des Epos im allgemeinen und die Gestaltung der Geisterwelt im besonderen eine Verwurzelung des Klopstockschen Denkens in der Leibnizschen Philosophie angedeutet, so muß die Untersuchung der Teufelsgestalten im „Messias" nachweisen, wie sehr das Denksystem der Theodizee sich auch gestalterisch in Klopstocks Dichtung niederschlägt. Besonders an der Bewältigung des Bösen muß sich ja beweisen, ob von der Messiade tatsächlich als — wie es in poetischer Übersteigerung heißt — „ . . . dem gewaltigen Hochgebirgszuge der christlichen, dogmatischen Theodicee . . . " 7 3 gesprochen werden darf. Soviel freilich ist sicher: In der Vorstellungswelt der Leibnizschen „Théodicée" findet eine Teufelsgestalt von der Statur des Miltonschen Satan keinen Platz, und dies schon aus folgendem Grund: Das Verständnis des Bösen als Privation, als Mangel an Vollkommenheit, konnte nicht zur Komplexität einer Gestalt führen, in der das Böse sich aus der Übersteigerung subjektiver Verhaltensmerkmale gewinnt. Was bei dem einen als tendenziell aufhebbares Defizit gefahrlos bleibt, ist im anderen aufgrund seiner Verankerung im Prinzip von Subjektivität selbst, deren Befähigung zur Hypertrophie, nicht über das optimistische Konzept einer optimalen Weltordnung zu beschwichtigen. Sollte dennoch der gleiche Teufelstypus bei Milton und Klopstock sich finden, so widerspräche dies der These von der Messiade als der Dichtung der dogmatischen Theodizee: Das Denken in den Kategorien der Theodizee bedingt die Reduktion der Komplexität des Bösen; hier ist die entscheidende Differenz zu Milton zu suchen. — Schon bei einem flüchtigen Vergleich der Teufelsgestalten in „Paradise Lost" 71 Kaiser, a. a. O., p. 29. Emanuel Hirsch: Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens. Bd. 2. — Gütersloh 1951. p. 68. 73 Hans Lindau: Die Theodicee im 18. Jahrhundert. Entwicklungsstufen des Problems vom theoretischen Dogma zum praktischen Idealismus. — Leipzig 1911. p. 227. 72
158
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
und im „Messias" zeigen sich zwei Unterschiede, die in die oben skizzierte Richtung weisen. Zum einen verliert Satan entscheidend an Raum im Epos. Stehen die ersten zehn Gesänge von „Paradise Lost" fast völlig im Zeichen Lucifers, so gibt es Vergleichbares im „Messias" nicht mehr; dabei ist zu bedenken, daß zwar der Vorwurf des Epos, die Erlösungstat Christi, eine Einschränkung der Teufelsszenen nahelegte, andererseits aber der theologische Inhalt des Todes am Kreuz, der Sieg über Sünde und Tod, eine erheblich größere Berücksichtigung der widersacherischen Mächte durchaus gerechtfertigt hätte. Die Auftritte Satans und seiner Gefährten bleiben in der Messiade jedoch kurz und sind für das weitere Geschehen folgenlos; man kann die Teufel dort erspähen, wo Böses geschieht, ohne daß doch recht klar würde, worin ihre Funktion bei dem Geschehen eigentlich besteht; nur lose ist ihre Anwesenheit mit der Handlung verknüpft. Einzig der 2. Gesang gehört den höllischen Mächten, und — das ist bedeutsam — auch dies nicht ausschließlich: Kündigt sich doch im 2. Gesang die Regentschaft Christi, sein Sieg über den Teufel auch für diesen empfindlich an. Die ersten hundert Verse widmen sich Jesus allein; in den nächsten hundert, eingeleitet vom Fluch Christi gegen den „Hasser der Menschen" ( I I / 9 6 ) , wird Satan kampflos von Jesus zur Flucht gezwungen; erst dann wechselt der Schauplatz des Geschehens in die Hölle zum Teufelskonzil über: Der Teufel ist schon bezwungen, dies deutet die Struktur der Handlung an, bevor er überhaupt über Gegenmaßnahmen entscheiden kann. Christus ist der Erlöser, aber das Böse, von dem er erlöst, tritt von Anfang an weit zurück vor dem Guten, zu dem er erlöst. In ihm liegt das Telos der Messiade, und das Geschehen, das zu ihm führt, integriert, darin dem Konzept der „Théodicée" von der besten Welt vergleichbar, das Widersacherische, das ihm zu widerstreiten meint, als zu seiner Verwirklichung unabdingbares Element in den Entwurf des Guten. In das Heilsgeschehen ist Satan, dessen Bosheit vor der Herrlichkeit der Erlösungstat ins Bedeutungslose versinkt, eingeplant wie das unbeträchtliche Übel in die gelungene Weltordnung; danach bemißt sich der ihm zugestandene Raum. Der Kreuzestod wird zum Paradigma der These der Leibniz-Schüler, „ . . . daß auch das Böse in der Welt fast allezeit etwas Gutes nach sich zieht . . . " 7 4 ; an ihr beweist sich die tatsächliche Machtlosigkeit des Bösen. Satan erscheint deshalb im „Messias" von Anbeginn als überwunden; er ist viel weniger Gegenspieler als Mitspieler im Heilsgeschehen. — Noch ein weiteres fällt bei einem ersten Vergleich der beiden Werke sofort auf: Der Satan aus „Paradise Lost" ragt monumental aus der Schar seiner Gefährten hervor, ihm gehört unter den Teufeln das Gesetz des Handelns, und es gibt niemanden, der sich ihm vergleichen ließe. Seiner Singularität entspricht, daß er den Beschluß des Höllenkonzils, Überwindung des Chaos und Verführung der Menschen, allein ausführt. Anders im „Messias". Da steht neben Satan eine Gestalt, die sich in ihrem infernalischen Wesen mit dem Herrn der Hölle durchaus messen kann, ihn gar im Bösen zu übertreffen scheint: Adramelech; da gibt es einen Teufel, der sich seinem Herrn zu widersetzen wagt, ohne daß 74 Vgl. Anm. 69.
Der Teufel in der Aufklärung
159
dies irgendwelche Sanktionen nach sich zöge: Abbadona, dem Klopstock mehr Verse widmet als Satan selbst. Gegenüber der Satansgestalt aus „Paradise Lost" ist ein Nivellement spürbar, Monumentalität wird eingeebnet; so muß sich denn Satan von Adramelech unterstützen lassen, als es darum geht, den Beschluß der Hölle auszuführen. Der Ergänzung der Satansgestalt um eigenständig handelnde Teufel mit unterschiedenen Intentionen entspricht eine Verflachung der Charaktere (wieder im Vergleich zu Miltons Satan); schon Muncker hatte beobachtet: Klopstock » . . . schuf aus Miltons Satan . . . drei verschiedene Teufelsgestalten, deren jede nur Einen Grundzug im Charakter jenes furchtbar-gewaltigen Wesens, diesen aber selbständig und eigenartig gesteigert, verkörperte." 75 Ohne damit bereits die These von der Zerteilung eines motivhistorischen Vorbilds zu vertreten, kann doch folgendes festgehalten werden: An die Stelle des einen Satans sind drei Teufel getreten, deren Charakter von je einem dominanten Zug geprägt ist, der mit den anderen in Miltons Satan noch zu einem komplexen Bild zusammengetreten war. Die Isolation eines konkret Bösen und seine Objektivation in einer Gestalt entsprechen dem Verständnis des Bösen als Privation, denn gestalterisch läßt dessen defizitäres Wesen nur an den besonderen Formen der Unvollkommenheit sich veranschaulichen; ob als Mangel an Einsicht, an Wahrhaftigkeit, an aufbauender Kraft, an Gottesfurcht, das Böse ist in seiner konkreten Erscheinungsform erkennbar als durch Mängel herabgesetzte Existenz. Deren exemplarische Vergegenständlichung geschieht in den Teufeln, mit jeweils hervorgehobener Besonderung in der Mangelhaftigkeit. Vor dem dominanten Einzelzug tritt das sonstige Wesen der Teufelsgestalt zurück, während bei Miltons Satan das Böse gerade in der Hypertrophie einer komplexen Subjektivität sich verkörperte. In diesem Sinne führen die Teufel bei Klopstock gar keine eigenständige Existenz, sie erscheinen vielmehr als die Negative eines Bildes von Vollkommenheit, das mit ermüdender Eintönigkeit vorzuführen den guten Geistern vorbehalten bleibt. So ist es denn auch nicht zulässig, Satan, Adramelech und Abbadona, wie Muncker es tat, gleichsam als Splitterprodukte des Miltonsdhen Satan zu betrachten, den in seine Dichtung zu übernehmen Klopstock aufgrund mangelnder epischer Gestaltungskraft nicht begabt war, sondern das neue Verständnis des Bösen führt zu einem Wandel in der Konzeption der Teufelsgestalt, wobei weiterhin überzeugende Einzelzüge des literarischen Vorläufers zu neuer Verwendung finden. — Zum kollektiven Schicksal der Geisterwelt im „Messias" wird Unsinnlichkeit 7 6 , von ihr sind die Teufel ebenso betroffen wie die Engel: Die prinzipielle Andersartigkeit der überirdischen Geister, ihre unbegreifliche Übermenschlichkeit und Erhabenheit entziehen sie den menschlichen Beschreibungskategorien. Klopstock bemüht sich, solche Unanschaulichkeit gestalterisch zu bewahren; positive Epitheta, die zur Beschreibung der den menschlichen Sinnen zugänglichen Erfahrungswelt hinreichen, müssen deshalb an den Geistern versagen: Die Wortbildungssilbe „un", von Klopstock mit Vorliebe für die Eigenschaften des 75 Muncker, a. a. O., p. 121. 76 Vgl. Kaiser, a. a. O., p. 206ff.
160
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
Göttlichen verwendet, ist audi eines der wichtigsten sprachlichen Mittel zur Kennzeichnung des Geisterreichs.77
Die Vermeidung von Anthropomorphic ergibt sich schlüssig aus diesen Voraussetzungen; allerdings ist sie innerhalb des Epos immer nur bis zu einem gewissen Grad durchführbar, denn in ihm kann die einzelne Gestalt nicht einzig für sich existieren, sondern sie muß handelnd sich entfalten und ins Kräftespiel des Geschehens verändernd eingreifen. Ihr Handeln verlangt nach sinnlicher Anschaulichkeit, so daß Menschliches in die Geistergestalt erneut einfließt, wenn eine motivierte, zielgerichtete Aktion erkennbar werden soll. Das äußere Bild des Teufels (wie das der anderen Geister auch) ist daher Ergebnis eines gestalterischen Kompromisses: Die Darstellung muß vermitteln zwischen der grundsätzlichen Andersartigkeit des Teuflischen, das sich den menschlichen Beschreibungskategorien nicht fügt, und den Notwendigkeiten epischen Erzählens, der Forderung nach Anschaulichkeit. Im „Messias" ist deshalb das Menschliche an Klopstocks Satan akzessorisch, nach Maßgabe situativer Notwendigkeit eingeführt; als handelnde Gestalt verdichtet er sich für kurze Augenblicke auf den Menschen hin, ohne dabei jemals aus seiner prinzipiellen Unerkennbarkeit herauszutreten. Es ist mithin unmöglich, sich ein äußeres Bild von Satan zu machen, was noch bei Milton, wie die zahlreichen Illustrationen zu „Paradise Lost" beweisen, mühelos gelang. Seine Gestalt bleibt für den Leser, wie es an einer Stelle heißt, „ . . . mit Dampf und Wolken umhüllet . . . " ( 1 1 / 2 3 7 ) , hinter welchen ein fester Umriß nicht erkennbar wird. Miltons Satan erscheint als der gefallene Erzengel; aus seinen häufigen Verwandlungen kehrt er immer wieder in diese Gestalt, die seinem inneren Wesen Ausdruck gibt, zurück. Bei Klopstock hingegen ist nur selten von Verwandlungsakten Satans die Rede 7 8 , und dies mit gutem Grund: Der Leser weiß von keiner Gestalt, die Satan wechseln könnte, feste Kontur wäre dafür Voraussetzung. An die Stelle der Vergleichbarkeit mit dem Menschlichen tritt die mit der Natur, doch bietet Klopstock nicht Vergleiche, die bestimmte Qualitäten Satans umschreiben, sondern solche, die erst, indem sie sich auf Handlungen beziehen, auch die Gestalt reflektieren, die sie vollbringt. Satan senkt sich „stürmisch" ( 1 1 / 2 4 9 ) herab; zum ö l b e r g „stürmt" er, dort Christus zu suchen ( I I / 8 9 1 ) ; richtet er sich auf, so läßt das den Dichter an einen „werdenden Berg" denken ( I I I / 6 5 3 f ï . ) ; dem entspricht, daß er bei der Auferstehung wie „ein Gebirge" stürzt ( X I I I / 6 9 2 ) ; an anderer Stelle wird er einem „Felsen" verglichen ( V I I I / 1 3 1 ) . Wenn Satan denkt, so kündigt seine Gestalt ein Gewitter an, wenn er spricht, so entlädt es sich ( I I / 4 2 7 f f . ) ; „ . . . wie vom Hauche der Donner geflügelt . . . " ( I V / 2 8 8 ) ist Satans Rede, wenn er gebietet; und in seinem Zorn stürmt er einher wie ein „Gewitter" ( V I I I / 1 3 9 ) . Auf Judas schließlich blickt er wie „ . . . ein gefürchteter Fels aus der hohen Wolke . . . " herab ( I I I / 6 7 4 ) . — Nur mit dem Größten in der Schöpfung, dem Gebirge, läßt sich also Satan ver7 7 Kaiser, a. a. O., p. 209. 78 Vgl. II/243ÍÍ. und II/276ff.! In beiden Fällen war eine Verwandlung für den Handlungsverlauf überflüssig.
Der Teufel in der
Aufklärung
161
gleichen, und sein Wirken ähnelt den höchsten Schrecken der Natur: Sturm, Gewitter, Donner. Indem aber die Vergleiche, die Satan zu veranschaulichen vorgeben, sich der Extreme in der menschlichen Erfahrungswelt bedienen, entziehen sie ihn weiter der Anschauung. Die Extreme spielen selbst ins Unbeschreibbare hinüber, so daß Satan um so mehr als den menschlichen Begriffen nicht verfügbar sich erweist. Die Vergleiche dienen nicht der Verdeutlichung, sondern der Bestätigung von Satans prinzipieller Andersartigkeit. — Daß nun aber Klopstock ein tertium comparationis zwischen Mensch und Teufel nicht mehr findet, entspringt nicht allein seinem Respekt vor der Eigenständigkeit der Geisterwelt, sondern zugleich seinem optimistischen Menschenbild. Der Mensch färbt auch deshalb auf den Teufel nicht mehr ab, weil er zwar in seiner Schwäche Sünder, aber doch nicht — wie für Luther — von Ursprung böse ist. Mit dem Verzicht auf die Anthropomorphic bewahrt Klopstock einerseits das grundsätzliche Anders-Sein Satans, andererseits aber rettet er dieserart den Menschen vor dem Vergleich mit dem Teufel: Denn eben darin, daß er nicht böse ist, ist der Mensch auch ganz anders als Satan. So belegt noch die verweigerte Applikation menschlicher Eigenschaften auf die Teufel die herabgesetzte Bedeutung des Bösen im Weltverständnis des Menschen, die Entsinnlichung ist zugleich Indiz für die geminderte Bereitschaft, das Böse in der Welt wahrzunehmen. — Freilich vermochte auch Klopstock sich nicht gänzlich der Anthropomorphismen zu enthalten; als handelnde Gestalt des Epos nimmt Satan, wie schon oben angedeutet, situativ menschliche Züge an. Neben gelegentlichen Hinweisen auf menschliche Gliedmaßen (e.g. „mein allmächtiger Fuß" (11/186), „und ging mit erhabenem Schritte" (III/679)), die die Schilderung eines Ortswechsels erleichtern (Klopstocks Engel und Teufel tragen keine Flügel), handelt es sich dabei um physiognomische Details, die zur Umschreibung von Satans emotionaler Befindlichkeit eingebracht werden. Selbst nennt er „ . . . mein königlich Angesicht . . . " (11/188); in ihm spiegeln sich seine Emotionen: Sein Blick ist grimmig (11/240), sein Antlitz zornig (11/285), sein Lächeln triumphierend (III/440), „stolzmitleidig" sieht er Ithuriel an (III/441), mit „wildem Antlitz" blickt er (III/673), im „flammenden Auge" zeigen sich Wut und Rache, und er runzelt die Stirn (VIII/145). Doch konstituiert sich aus alledem noch keine faßbare Gestalt; Klopstock bindet einzig konkrete menschliche Qualitäten an einen unfaßlichen Körper; der Verzicht auf Anschaulichkeit wird also nirgends rüdegängig gemacht. Im Gegenteil, die äußere Gestalt changiert mit dem Licht, das die Situation jeweils auf sie wirft; die Grundfarbe freilich bleibt allemal schwarz. „ . . . dunkel/Und verworfen . . ( I I / 2 4 4 f . ) nennt Klopstock Satan; zwar er „ . . . ändert seine Gestalten (!) / Durch ätherischen Glanz . . . " (II/243f.), doch ist „ . . . dies helle Gewand . . . ihm bald unerträglich . . . " ( I I / 246). Den himmlischen Mächten gegenüber muß Satan Farbe bekennen: Er wird „dunkler" (VIII/130), als Eloa ihn beim Kreuz stellt; und als Eloa ihm und Adramelech zu fliehen gebietet, heißt es: „Sie flohen dunkler, als Nächte."
162
Friedrich Gottlieb Klopstock: Oer Messias
(VIII/152). Wie sehr die schwarze Grundfarbe dem Verständnis des Bösen als Privation entspricht, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden 79. So wenig Satan als Gestalt Kontur gewinnt, so genau ist ihm andererseits sein Ort im göttlichen Heilsplan abgesteckt. Hier wird Klopstock konkret: Satan ist die „oberste Gottheit" der Hölle (II/281), er regiert allein auf dem „hohen gefürchteten Thron" (II/277) über die „gefallenen Engel" (II/311). Selbst stellt er sich dar als . . . König der Welt, die oberste Gottheit unsklavisdier Geister, Die mein Ansehn etwas erhabnerem, als den Geschäften Himmlischer Sänger bestimmt. (11/173 fi.)
Erde und Hölle bilden den Machtbereich Satans; die Herrschaft über die Hölle steht ihm dabei deshalb zu, weil er „ . . . zuerst zur Empörung sich aufschwang." (II/303) Nun spielt das Moment der Empörung eine größere Rolle, als der Gegenstand der Messiade zuerst vermuten läßt: „Empörer" ist Satans häufigster Name 80 . Handelt es sich dabei zum einen auch sicherlich um eine Erinnerung an die in „Paradise Lost" erzählten Geschehnisse, so diskreditiert doch andererseits der Titel des Empörers Satan im „Messias" auf eine besondere Weise. Denn von besonderen Qualifikationen, denen er seine Führerschaft verdankt, wird nichts gesagt; weder ist, wie bei Milton, von seiner herausragenden Stellung unter den Engeln die Rede, noch ist gar eine unangefochtene Einzigartigkeit von jeher spürbar. Seine Empörung bleibt aus Satans Persönlichkeit unmotiviert; Gott hat auch in Satan keineswegs ein Geschöpf erschaffen, in dem in irgendeiner Weise eine Ursache für Rebellion sich objektiv manifestierte. Dem entspricht, daß der Grund seines Aufruhrs kaum benannt wird; nur der Leser von „Paradise Lost" vermag in Satans Satz, daß Gott „ . . . uns Göttern vordem den Sohn der Ewigkeit aufdrang" (II/559), das Motiv der Rebellion wiederzuentdecken. So muß dem Leser des „Messias" die Empörung des Teufels gegen Gott unbegründet, ja sinnlos, vordem leuchtenden Bilde des alliebenden Vaters und seines göttlichen Sohnes gar wahnwitzig erscheinen. Denn bei Gott ist alle Güte, Gnade und Gerechtigkeit, einen vernünftigen Grund für die Rebellion läßt die Vorstellungswelt des „Messias", zumal die Idee der prästabilierten Harmonie in sie Einlaß fand, gar nicht zu. Daß er der Empörer ist, verleiht deshalb Satan nicht die Züge des Erhabenen und Heroischen, sondern des Unvernünftigen. Rebellion gegen Gott wird zur Rebellion gegen die Vernunft; dies bestimmt die Darstellung Satans durchgängig. Die Art seiner Gestaltung bestätigt mithin die These vom bedeutenden Einfluß neologischer Theologie auf Klopstock, den Gerhard Kaiser detailliert nachgewiesen hat 81 : Wo Vernunft und Offenbarungsglaube zusammenfallen, können die widergöttlichen Kräfte nur als unvernünftig erscheinen. Satans Empörung, jeglicher überzeugenden 79
Anders bei Miltons Satan: „. . . his form had yet not lost / All her original brightness . . . " , „Darkened so, yet shone / Above them all th'Archangel . . ( I / 5 9 1 Í . bzw. 599f.) «o Vgl. II/407, 637, 679, 744; V/28; VI/448; VIII/119, 128; XII/118; XIII/489; XX/887. Kaiser, a. a. O., Kap. II. Klopstock, Leibniz und die Aufklärungstheologie, pp. 28—122.
Der Teufel in der Aufklärung
163
Begründung ermangelnd, bleibt deshalb gleichsam bewußtlos, ihr eignet ein Moment von Automatik. Seine Aktionen erscheinen wenig durchdacht, ja sind kaum von Reflexion getragen: Satan ist bei Klopstock eine völlig unintellektuelle Gestalt. Das zeigt sich zumal an einer durchgängigen Borniertheit, die die Rebellion dem Diktat eines auf Selbstzerstörung angelegten Automatismus zu unterstellen scheint. So wie Satan im „Messias" des öfteren gegen Kräfte anrennt, von denen er wissen muß, daß er ihnen nicht gewachsen ist, aus der Niederlage aber nicht lernt, so kündigt Gabriel für die Zukunft die endlose Wiederholung dieser Figur an: Wenn du lernen könntest; so -würdest du einmal lernen, Daß der Streit des Endlichen mit dem Unendlichen Qual ist Für den immer Besiegten, und immer wieder Empörten! Aber du lernest es nie. So fleuch denn hinunter, und krümme Dich in neuen Entwürfen herum zur neuen Empörung. (XIII/886-890)
Deshalb bleibt audi Jesu Strafgericht in der Hölle ohne Ergebnis: Als Warnung gemeint, „Nicht aufzuhäufen / Auf Empörung Empörung dem letzten Gerichte des Mittlers" (XVI/693f.), antwortet Satan auf diese Demonstration seiner Niederlage nicht mit einem Schuldbekenntnis, sondern einem „Wutausruf" (659). Der Lernunfähigkeit korrespondiert die Gedächtnisschwäche: Das für die Psychologie des Miltonschen Satan konstitutive Spannungsfeld von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft findet bei Klopstock keine Entsprechung. Die Erinnerung an das Vergangene scheint gestrichen, nie leuchten Glück, Ruhe und Frieden als Elemente des verlorenen Himmels auf, nie bricht die Erkenntnis durch, daß all dies auf immer verloren ist. Das kann bei Klopstock nicht anders sein: Da die Rebellion unmotiviert ist, hätte die als positiv erinnerte Vergangenheit die Rückkehr zu Gott erzwungen. Abbadona, nicht Satan, ist der Teufel, der sich beständig erinnert; er kehrt deshalb zu Gott zurück. Satans Psychologie hingegen ist statisch, nicht der Entwicklung fähig. Der Teufel der Aufklärung ist wieder der dumme Teufel: erinnerungslos, unreflektiert, borniert und nicht lernfähig. Dies erweist sich zumal an Satans völliger Fehleinschätzung der eigenen Lage, dabei vor allem an seinem mangelnden Verständnis des Heilsgeschehens. Was jedem der Leser des „Messias" selbstverständliches Wissen ist, bleibt Satan ein Rätsel. Sein Stolpern in der Topographie des Heilsplans läßt ihn deshalb nicht weniger lächerlich erscheinen als den dummen Teufel auf der mittelalterlichen Bühne. Während aber bei diesem die Angst vor dem Bösen weggelacht wurde, tritt jener mit der Lächerlichkeit des Unwissenden und Unvernünftigen, des Unaufgeklärten auf. Der Leser beobachtet die Unternehmungen Satans mit ähnlicher Distanz, wie er sich das Fehlverhalten der Titelfiguren der sächsischen Typenkomödie ansieht. Der Vernünftige weiß, daß der Unbelehrbare und Unwissende seine Pläne nicht zu verwirklichen vermag; er gilt ihm als harmlos. Nichts beleuchtet diese Harmlosigkeit schärfer als der Anflug von Ironie, mit der Klopstock in seiner ansonsten gänzlich unironischen Dichtung Satan bedenkt. Bei seiner ersten Begegnung mit Christus prahlt Satan wortreich (20 Verse) mit seiner Macht; unter anderem renommiert er:
164
Friedrich Gottlieb Klopstode: Oer Messias Unter mir soll mein allmächtiger Fuß das Meer und die Erde, Mir anständige Wege zu bahnen, gewaltsam verwüsten. (11/186 f.)
Dann stürzt er sich auf Samma, den Besessenen, um ihn zu töten: Stirb indes noch, Verlaßner, vor mir! So sagt' er, und stürzte Stürmend auf Samma. Allein des ruhigschweigenden Mittlers Stille verborgne Gewalt kam, gleich des Vaters Allmacht, Wenn er Untergang unerforscht auf Welten herabwinkt, Satan in Zorne zuvor! Er floh, und vergaß im Entfliehen, Unter allmächtigem Fuße das Meer und die Erde zu schlagen.
(II/191-6)
Es ist die Diskrepanz zwischen Eigenbild und tatsächlichem Vermögen, worauf die Ironie sich richtet; Satan, in blinder Aktion „stürmend stürzend", prallt gleichsam an der ihm unsichtbaren Vernunft ab. Der Mensch, „des Vaters Allmacht" auf seiner Seite wissend, kann über den „allmächtigen Fuß" des Teufels spotten, weil er seine tatsächliche Ohnmacht kennt. Sie gleicht der Machtlosigkeit dessen, der seine großen Fähigkeiten verspielt, weil er sie nicht von den Gesetzen der Vernunft steuern läßt. Die Vergleiche mit Sturm und Gewitter tragen dem Rechnung: Satans Wirken gleicht in seiner Unvernunft dem blinden Schrecken der Elemente. — Der Unvernunft korrespondiert die Selbsttäuschung, die Vorurteile über die eigene Macht und Leistung, auf die Empirie nicht mehr korrigierend Einfluß nimmt. Konstitutiv für Klopstocks Teufelsbild ist der durchgängige Widerspruch zwischen dem Eigenbild des Teufels und dem, was er tatsächlich ist: Das Vorurteil verstellt ihm den Blick auf die Wirklichkeit und verhindert realitätsadäquates Verhalten; dies macht sein Scheitern unvermeidlich. Beständig stößt er gegen seine Grenzen, dodi sieht er sie nicht; er weigert sich, aus Erfahrungen zu lernen: Kaum hat Satan von „unsrer Erde" (11/485) gesprochen, läßt ihn Klopstock die Narben erblicken, die ihm als Verlierer Gottes Sohn zufügte. Unbezwingbar zu sein, gibt er vor (II/616), und doch ist ihm die Niederlage in die Stirn geschrieben (XIII/528). Und so ahnt er denn, daß ihm in Jesus ein unbezwinglicher Gegner erwachsen ist, doch hebt er die Ahnung nie auf die Ebene des Bewußtseins: Verzweifelt ist er bemüht, die sich regende Erkenntnis unter einem Wust von Renommage, dem in der Rede vermittelten Vorurteil, zu ersticken; seine lange Rede in der Hölle ist voll davon. Daß sein Thron, den er auf Sünde und Tod sicher fundiert glaubte, schwankt, versucht Satan mit Prahlerei, Eigenlob und gezwungener Ironie zu überdecken. Doch vermag er sich selbst nicht damit zu beruhigen, immer wieder blitzt Erkenntnis auf, zwar nicht genug, um Bewußtsein zu werden, aber ausreichend, um Sicherheit erst gar nicht aufkommen zu lassen: So, als er in der Versammlung im Tempel, als doch alles in seinem Sinne sich entwickelt, beim Anblick Ithuriels „den gewissen Triumph des erhabneren Seraphs" (IV/573) empfindet. In der Hölle hat er mit seiner Renommage Erfolg; hier fruchten Heuchelei und Lüge: So schmäht er, der selbst gerade vor Jesus geflohen war, die Teufel, die vor dem Gottessohn aus dem Besessenen gewichen waren (II/451ff.). An den himmlischen Mächten aber erweist sich seine tatsächliche Machtlosigkeit. Satan spricht seinen Entschluß aus, Jesus zu töten:
Der Teufel in der Aufklärung
165
Mit dem Laute, womit der Lästerer endigte, rauschte Vor dem Fuß des Messias ein wehendes Blatt. An dem Blatte Hing ein sterbendes Würmchen. Der Gottmensch gab ihm das Leben. Aber mit eben dem Blick sandt er dir, Satan, Entsetzen! Hinter dem Schritt des gesandten Gerichts versank die Hölle, Und vor ihm ward Satan zur Nacht! So schreckt' ihn der Gottmensch. Und die Satane sahen ihn; wurden zu Felsengestalten. (II/622-8)
Ein Blick Christi genügt, um den ganzen Apparat der Hölle zu lähmen; unendlich groß ist der Abstand zwischen dem wirklichen Herren der Welt und dem, der es zu sein glaubt; unendlich groß auch ist der Abstand zwischen der mächtigen Kraft des Guten und der geringen des Bösen. Satan redet, er kündigt Taten an, er gibt ein herrliches Bild seiner Macht, dodi nie bewähren sich seine vermeintlichen Fähigkeiten, nie führen seine Absichten zum Erfolg, kaum dringen seine Entwürfe zum Handeln durch. Klopstocks Satan ist völlig ohnmächtig, sobald er dem Guten, sobald er Jesus und seinen Geistern begegnet. So kommt es denn auch nie zum Kampf zwischen den höllischen und himmlischen Mächten (von daher ist der drei Tage währende Kampf vor dem Engelsturz einzig als Reminiszenz an Milton verständlich); es genügen kurze Befehle eines Engels (Eloa zu Satan und Adramelech: „Im Namen des Überwinders der Hölle: / Flieht! Sie flohen dunkler, als Nächte." V I I I / l 5 1 f . ) oder Blicke Christi (so blickt er vom Kreuz zum Toten Meer auf Satan und Adramelech: „Und die beiden Verworfenen sanken zur niedrigsten Stufe / Ihre (!) Elends hinab." X / 9 0 f . ) , um Satan zu bezwingen. Zudem: Satan nimmt das Heilsgeschehen wahr, er kennt die Prophezeiungen und die angekündigten Folgen, doch vermag er Zusammenhänge nicht auszumachen und, dies vor allem, die eigene Rolle im göttlichen Plan nicht zu erkennen. Satans Rancune als Agens im Erlösungswerk: bewußtlos arbeitet der Teufel auf den eigenen Untergang hin. — Dies alles fügt sich zu einem Bild: Satan ist nicht, wie er glaubt, Subjekt der Handlung, sondern bleibt fortwährend deren Objekt. Er ist schon vor Christi Tod am Kreuz entmachtet, weil er verplant ist. Die Grenzen, die er an keiner Stelle Schaden stiftend zu überschreiten vermag, sind ihm von den guten Kräften eng gezogen. Die Domestikation im Heilsplan erinnert erneut an Leibniz' optimistische Weltsicht, in der das Böse in gleicher Weise vervollkommnend ins Ganze, in dem es sich, kaum sichtbar noch, unter all dem Guten verlor, eingeplant war. In ihr war das Böse ohnmächtig, weil es keine eigenständige Kraft war. Dies hat sich durchaus auf Klopstocks Messias-Dichtung übertragen: Eigenständige Macht ist Satan ebensowenig wie das Böse in der „Théodicée" ; jeder seiner Schritte trägt, von Ewigkeit her antizipiert, zum vollkommenen Gelingen des Ganzen bei. Seine Pläne, die er sich selbst zur Ehre anrechnet, sind nichts als ein Nach-Denken der vor Zeiten gefaßten göttlichen Entschlüsse, so wie es der Gedanke der prästabilierten Harmonie von den Entwürfen und Absichten jedes einzelnen Geschöpfs annimmt. — Es nimmt deshalb nicht wunder, daß Satan im „Messias" tendenziell das Schicksal des Teufels in der „Théodicée" teilt: Er wird akzessorisch, sein Wirken rührt nicht mehr an die Substanz. Gerade dort, wo sich scheinbar Satans Macht noch beweist, wo ihm Erfolg beschieden ist, zeigt sich, daß es seiner gar nicht bedurft hätte, um dasselbe Resultat zu er-
166
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
reichen. Zwar gibt Satan Judas den Traum ein, der dann zum Verrat führt, doch war der Keim zum Verrat bereits gelegt: Haß gegen Johannes und Gier nach Reichtum trug er längst in sich, ohne daß ein Teufel motivierend hätte eingreifen müssen (III/422ÍL). Ebenso hatte Kaiphas, der Hohepriester, den Entschluß, Jesus zu beseitigen, lange gefaßt, bevor Satan ihn mit seinem Traum beschickte. Sein Ziel ist einzig, über „sein Herz voll Bosheit noch viel boshaftre Gedanken / Auszugießen" (III/682f.) 8 2 . Und auch Philos Rede hätte kaum der Weihe Satans bedurft, um ihr Ziel zu erreichen (IV/284fL). — Entweder mißlingt in der Messiade das Handeln des Teufels oder es ist überflüssig. Christus erlöst die Menschen im „Messias" von Sünde und Tod, nicht eigentlich vom Bösen, schon gar nicht aber vom Teufel, der dem Gedicht eher Kolorit verleiht, als daß er handlungsbestimmende Macht wäre. Dieser Satan vermag das lange und qualvolle Sterben des Erlösers nicht zu begründen; er wird stattdessen, neben den zahllosen anderen Wesen der Geisterwelt, zu einer letztlich peripheren Gestalt, in der sich die Erlösungstat spiegelt und bricht 83 . Daß er ebensowenig zur Erklärung des Weltgeschehens beiträgt wie der Teufel in der „Théodicée", eben dies läßt Satan als Gestalt des christlichen Mythos im „Messias" überholt erscheinen. Er ist in doppeltem Sinne traditionell: Zum einen wird er als überkommenes Mitglied der Geisterwelt dem Handlungsgefüge der Messiade eingepaßt, zum anderen übernimmt Klopstock ihn aus der literarischen Tradition christlicher Epik. Dieser doppelte Traditionsbezug verurteilt den Teufel, als sein eigenes Petrefakt das Geschehen des „Messias" zu durchlaufen; erklärungsmächtige Gestalt ist er in ihm ebensowenig, wie er noch lebendiger Glaubensinhalt ist 84 . Klopstock muß, eben weil die zeitgenössische Weltinterpretation eine eigenständige Kraft des Bösen nicht mehr kennt, bei der Darstellung des Bösen auf dessen traditionelle Verkörperung zurückgreifen, ohne ihr doch je ihre Eigenständigkeit, ihre Handlungsfähigkeit aus sich selbst, rückerstatten zu können. Deshalb steht Satan zwar für das Böse und gibt sich als der Widersadier, Verderber, Feind des Menschen, aber das Böse wird in ihm nicht gestaltet, es lebt nicht in der Figur: Satan ist viel mehr eine Position im Heilsgeschehen als Person. Seine Gestalt ist statisch, eindimensional, ohne psychologische Tiefe, der Entwicklung nicht fähig. Deshalb tingiert die behauptete, nicht gestaltete Qual der Hölle ihren Herrscher nicht; während noch 82 Vgl. auch Kaiser, a. a. O., p. 61f. — Diese Funktionslosigkeit zeichnet übrigens in gleicher Weise Geßners Teufel Anamelech, eine aus Reminiszenzen an Milton und Klopstock synthetisierte Figur, aus. Im „Tod Abels" (1758) flößt er Kain einen Traum ein, der den unmittelbaren Anlaß zum Mord an Abel gibt. Es hätte aufgrund ausreichender psychologischer Motivierung dieses Traums ebensowenig bedurft wie der Träume der Judas und Kaiphas bei Klopstock. — Vgl. Salomon Geßner: Der Tod Abels. In fünf Gesängen. — In: Geßners Werke. Auswahl. Hrsg. von Adolf Frey. — Berlin/Stuttgart o. J. ( = DNL. Bd. 41.) pp. 99—186. (Vgl. vor allem pp. 135—8, 150—5.) Zum Prinzip der Spiegelung des Heilsgeschehens in den betrachtenden Personen vgl. Reinhold Grimm: Christliches Epos — ? — In: R. G.: Strukturen. Essays zur deutschen Literatur. — Göttingen 1963. pp. 95—122. Ebenso Kaiser, a. a. O., p. 234S. 8* Zur theologischen Kontroverse um den Teufel innerhalb der Neologie vgl. Karl Aner: Die Theologie der Lessingzeit. — Halle 1929. pp. 234—252.
Der Teufel in der Aufklärung
167
Miltons Satan die Hölle als das Ausgeschlossensein selbstermächtigter Subjektivität in sich trug, stellt das optimistische Denken der prästabilierten Harmonie solchen Überschuß an Geborgenheit her, daß nodi das Böse, ins Ganze sorgsam eingegliedert, an ihr partizipiert. Dort, wo das Böse Privation ist, stellt es sich nicht als Problem von Subjektivität. Der uneinsichtige Satan im „Messias" kennt deshalb keine Verzweiflung. Nur eine Szene macht hier eine Ausnahme: Der Blick des sterbenden Christus wirft Satan und Adramelech auf die Stufe ihres größten Elends, tiefes Leid erfaßt sie. „In jeden Abgrund des Herzens" fiel „unversöhnliche Qual" ( X / 9 9 ) , deren „schwarze Gestalt" (103) zu beschreiben die Bilder der Hölle nicht ausreichen. Satan selbst kennt die Gründe seines Leids: Er sei erniedrigt worden (112), dem Befehl eines Engels habe er sich fügen müssen (120), seine Ohnmacht vor dem Allmächtigen habe sich erwiesen: Ja, er ist allmächtig! allmächtig ist er! Allein ich, Was bin ich? Das schwärzste der Ungeheuer des Abgrunds!
(114f.)
Dieser doppelte Kontrast zum sonstigen Bild Satans zeigt, daß die Qual Ergebnis der Einsicht ist. Die Bestrafungsszene im 10. Gesang, die die einzige ist, in der das Leid für Satan psychologische Realität wird, ist audi die einzige Stelle des „Messias", in der Satan die eigene Lage bewußt wird; nie vorher und auch hinterher nicht spricht er von den Grenzen, die ihm gesetzt sind, noch erkennt er gar „des Überwindenden Allmacht" (146) an. Momentane Erkenntnis der eigenen Ohnmacht stellt sich ein, das Bild, das Satan sich von sich selbst machte, bricht zusammen und läßt den Blick frei auf einen Teufel, der vor seinen eigenen Ansprüchen versagt. Dies heißt noch nicht, daß er das Geschehen auch tatsächlich versteht: 'Dunkel an Dunkel umringt midi! Idi sehe von dem Geheimnis Nicht den flüchtigsten Schimmer! Auch dies ist Elend! (X/127f.)
Satan bleibt durchaus der dumme Teufel, der nichts versteht; seine Ohnmacht wird von ihm nicht reflektorisch erschlossen, sondern muß sinnfällig demonstriert werden. Dies ändert nichts daran, daß Qual erst mit dem Wissen auftritt, und daß mit der Qual ihn auch das Wissen wieder verläßt: Kaum ist Satan dem Meer des Todes entronnen, so nennt er den Todesengel, der ihn daraus befreite, einen Sklaven ( X I I I / 4 6 1 ) . Wirkliches Leid bleibt im „Messias" den bewußt handelnden Gestalten, bleibt vor allem Christus vorbehalten; ein gleich dem Miltonschen Satan leidender Teufel hätte das Leid des Messias, dem alle Aufmerksamkeit gebührt, für Klopstock unerträglich schmälern müssen. — So bleibt sich denn der Böse im „Messias" immer gleich. Dies vor allem auch deswegen, weil Satan an dem dargestellten Geschehen entgegen der zugrundeliegenden Konzeption, nach der er als der handlungsstimulierende Widersacher zu erscheinen hätte, letztlich gar keinen Anteil hat; so kann er sich audi nicht mit den gestalteten Entwicklungen selbst entwickeln. Das Heilsgesdiehen im „Messias" läuft gleichsam auf einer Höhe ab, die Satan nie erreicht; sein Handeln vollzieht sich auf einer Ebene weit darunter, und dort, wo sich beide Handlungsstränge momentan berühren, geschieht dies einzig — kurze Befehle
168
Friedrieb Gottlieb Klopstock: Oer Messias
und Blicke genügen —, um Satan wieder nach unten zu stoßen. Es besteht kein Spannungsverhältnis zwischen den beiden Handlungsebenen, auch keine Entwicklung in ihrem Verhältnis zueinander: Von Anbeginn steht das Schicksal des Teufels fest, und dies trägt zur Statik der Gestalt wesentlich bei. Noch vor dem ersten Auftritt Satans spricht Jesus den Fluch gegen ihn aus: Vater, erhöre midi! Es werde der Hasser der Menschen Deinen Gerichten ein ewiges Opfer, das jauchzend der Himmel, Das voll Bestürzung und Schand' und Schmach die Hölle betrachte!
(II/96-8)
Ewiger Verlierer ist Satan von Anfang an, schließlich aber so sehr, daß er sich aus Schande kaum mehr in die Hölle wagt (XIII/897f.): Erneut ridikülisiert Klopstock den „Hasser der Mensdien" vor seinen Lesern, denen das Motiv vom Teufel, der sich — und sei es aus Angst vor seiner Großmutter — nicht in die Hölle traut, aus den Märchen und Volksschwänken wohlbekannt war. — Entsetzen geht von diesem Teufel nicht mehr aus. Seine Auftritte in der Welt verlieren ihren Schrecken. Nach dem Erlösungswerk Christi ist der Teufel endgültig eine überholte Position: In den Heilsgesängen bei Christi Himmelfahrt wird Satan nur noch im Zusammenhang mit den Geschichten des Alten Testaments genannt (XX/76; 692; 769). Bedeutsam ist zudem, daß nur zwei der die Himmelfahrt begleitenden Gesänge den Teufel zum Gegenstand haben (XX/886— 915). Die Sänger . . . würdigten Satan, dem liegenden Überwundnen, Hören zu lassen, wie groß der Triumph der Toten des Herrn sei.
(XX/884Í.)
Es sind also nicht eigentlich Triumphgesänge, die den Sieg Christi über den Teufel zum Inhalt haben (dies hätte einen Kampf vorausgesetzt), sondern Gesänge, die dem Teufel erst mitteilen, was mit ihm geschehen ist: Der unwissende Satan wird abschließend über seine Niederlage aufgeklärt. Klopstock gestaltet im „Messias" den ohnmächtigen Teufel, das Böse, das in der Welt keine Macht mehr hat. Der Ratschluß Gottes in Eden: Jesus sollte der Schlange den Kopf zertreten! er wurde Nun vollendet. Seitdem der Gottversöhner am Kreuze Blutete, fühlte die Hölle des Überwinders Gerichte! (X/91-4)
Der Kreuzestod markiert die Zäsur: Nach dem 10. Gesang treten Teufel einzig in Szenen noch auf, in denen Strafe sie trifft. Sie werden Zug um Zug von der Erde verbannt und in die Hölle verwiesen: Fühlt sich Satan zu Beginn noch als König der Welt, so darf er sie zum Sdhluß nicht einmal mehr betreten. Satan wird weniger bekämpft, als daß ein Exempel an ihm statuiert wird; an seinem Fall beweist sich, daß die Welt nicht mehr von dämonischen Mächten durchherrscht, daß sie entdämonisiert ist. Dies zu zeigen, bedurfte es der abstrakten Gegenposition zur Welt Gottes, nicht einer aus sich lebenden Gestalt, sondern einer Figur, die sich aus Negativa bestimmt; das Böse erscheint als Mangel vor einem Bild höchster Vollkommenheit: Satan ist all das nicht, was Jesus verkörpert. Wenn Jesus allwissend ist, so tappt Satan im Dunkeln; wenn Jesus seine Macht allenthalben beweist, so Satan nur seine Ohnmacht; wenn Jesus
Der Teufel in der Aufklärung
169
Demut übt, so kann Satan nur Prahler sein; wenn bei Jesus das Licht ist, so kann Satans Gestalt nur dunkel bleiben; wenn Jesus unsäglich leidet, so kann bei Satan wahres Leid nicht sein: Jesus ist Herr über die Welt und Sieger, Satan der Unterlegene. Die Gestalt Satans lebt nicht aus sich selbst, sie scheint gleichsam aus Elementen synthetisiert, die in ihrer Negativität abstrakt die Gegenposition zum Wesen des Göttlichen formulieren. Gegenbild also ist Satan, negativer Abzug der überall dominierenden göttlichen Positivität, darum als Gestalt audi notwendig blaß. Pointiert formuliert: Satan ist nicht der Böse, sondern er steht für das Böse; das Böse jedoch ist Neutrum, gestaltlos, nur Mangel. — Satan steht im Zentrum der Hölle, in ihm formuliert sich deren Programm; seine Teufel füllen dies Programm aus, in ihnen konkretisiert Klopstock Satans abstrakte Gegnerschaft: Die Teufel als Objektivationen dessen, was in Satan angelegt ist, sind gleichsam Varianten des Höllenfürsten. Mögen deshalb auch Satan und Adramelech in bedingungsloser Gegnerschaft zueinander stehen, so eint sie dodi der gemeinsame Feind. Zusammen versuchen sie daher ihr Ziel zu erreichen, und zusammen werden sie bestraft, darin zwei aneinandergeketteten Brüdern vergleichbar, die sich zwar hassen, aber nicht voneinander lösen können. Dieses Aneinandergeschmiedetsein beleuchtet modellartig die Beziehung der Teufel zu ihrem Führer, der ihnen bei allen Rivalitäten, unterschiedenen Interessen und Intentionen gemeinsamer Bezugspunkt bleibt. Die Teufel sind Brechungen Satans, einzelne seiner Züge werden isoliert und treten in die Realität einer anderen Gestalt. — Zeigte sich also an Satan als Signatur des Bösen die Unvernunft, so mutet die Höllenpopulation nachgerade als Ensemble von Dementen an; jeder der geschilderten Hauptteufel erscheint als Protagonist einer bestimmten Form des Irreseins. Dies gilt audi für Adramelech, der als der denkende Teufel ein Element von Intellektualität gewinnt, das ihn von Satan unterscheidet. Beständig wälzt er Pläne: „Seit undenkbaren Jahren / Hatt' er darauf schon gedacht, wie er sich zur Herrschaft erhübe . . . " (II/306f.). In „schwarzen Gedanken" ( I I / 890) ist er befangen und in einem „schwarzen Entwurf" (11/885); „in große Gedanken vertieft" ( X I I I / 5 2 0 ) , ist er voll „ermüdendes Tiefsinns" (11/886), „voll Rache und grimmiges Tiefsinns" (11/741). Das Moment des Reflektorischen macht Adramelech zu einem „Geist boshafter als Satan, / Und verdeckter." (II/301f.) Sein beständiges Grübeln dient einzig dem Ziel, „triumphierend und einsam" zu herrschen ( I I / 8 5 0 ) . Dies Ziel verfolgt Adramelech mit der Besessenheit des Paranoiden, der überall nur Gegner sieht ( „Gottes, der Menschen, und Satans Feind" heißt er 11/706 und X I I I / 4 7 8 der „Hasser Gottes und Satans") und das ganze Universum in seine Pläne miteinbezieht. Mit der Radikalität des Maniaks wird das Böse perfektioniert: Dann würg' ich die Erschaffenen Gottes, wie Satan, nidit einzeln; Nein, zu ganzen Geschlechten! (II/847Í.) Satan, wie schwer wird dirs, den Leib des Messias Nur zu erwürgen! Erwürg ihn! Ja, die kleinen Geschäfte Laß ich dir, eh du vergehst; aber ich töte die Seele! (II/880ff.)
170
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
und universalisiert: Auf allen Planeten soll unter der Herrschaft Adrameledis der Tod wüten (II/843S.). Der Irrsinn — Seelen und Geister, deren Unsterblichkeit unaufhebbar ist, töten zu wollen, mußte der Zeit ausreichender Beleg für Wahnsinn sein — spiegelt sich dabei syntaktisch als wirres Gestammel wider: Töte die Geister, ich fluche dir, töte sie! oder vergehe! Ja vergeh, sei lieber nicht mehr, eh du lebst, und nicht herrschest! Ja, ich will gehn, gehn will ich, und alle meine Gedanken, Sie, wie Götter, versammeln, sie sollen erfinden, und töten! (II/863-6)
Die Wahnvorstellungen und Omnipotenzphantasien, die Selbstabsperrung von der Realität sind dabei zwar erheblich intensiver als bei Satan, dies hindert aber nicht, daß Adrameledi ebenso harmlos wie dieser bleibt: Er teilt seine Strafen 85 . Mehr noch: Gerade die Unbedingtheit von Adrameledis Unversöhnlichkeit läßt den leichten Sieg des Himmels nur herrlicher erscheinen. In Adramelech, der aus Haß und Machtwillen nur auf Tod und Zerstörung sinnt, verdichtet sich der ganze Widersinn der Hölle. Mit gleicher Besessenheit stattet Klopstock Moloch, den Krieger der Hölle, aus. Für ihn ist Gott nichts als „der donnernde Krieger" (11/355). Unermüdlich fortifizierend, Berge aufeinandertürmend, bereitet er sich deshalb auf die nächste Schlacht vor. Ehrfurcht und Staunen bringt die Hölle seiner mächtigen Gestalt entgegen. Und doch ist er nur ein Riese ohne Gehirn, einem Roboter vergleichbar, der, einmal in Bewegung gebracht, bewußtlos das gesetzte Ziel verfolgt. Sein Kämpfertum ist stupide, unreflektiert, kein Gedanke wird auf das Wesen der göttlichen Allmacht verwandt. Die Unvernunft führt zur Selbsttäuschung: Und wenn er alsdann die neuen Gebirge Auf die Höh, der Hölle Gewölben entgegengetürmt hat, Steht er in Wolken, und wähnt, indem ein zertrümmerter Berg noch Hallet, er donnr' aus den Wolken! (II/362-5)
Ähnliche Stupidität verleiht Klopstock den Teufeln, die als Verkörperungen von Gotteslästerung und Atheismus dem Christen der Zeit als besonders widerwärtig erscheinen mußten. Magog, in seiner Gestalt gleich monumental wie alle Fürsten der Hölle, ist der Gotteslästerer: Magog fluchte dem Herrn; der wilden Lästerung Stimme Brüllt' unaufhörlich aus ihm. Seit seiner Verwerfung vom Himmel Flucht er dem Ewigen. (II/397-9)
Indem Magog Gott lästert, ohne daß Gründe dafür genannt würden, ohne daß ein Anlaß oder Sinn sichtbar wäre, erscheint Gotteslästerung selbst als sinnlos und unmotiviert. Dem Gotteslästerer wird die Denkfähigkeit bestritten, Bewußtlosigkeit und Automatismus bestimmen sein Verhalten wie das der anderen Teufel. Der Vernünftige hadert nicht mit Gott. Die Aufklärung kennt das 85 Er mag uns heute nicht mehr so harmlos erscheinen, ist es doch der Typus Adramelech, der etwa als Mabuse die Weimarer Republik faszinierte und als Hitler den Wahnsinn Wirklichkeit werden ließ.
Der Teufel in der Aufklärung
171
augustinisdie „credo quia absurdum" nicht mehr. Vernunft und Glaube stehen in Harmonie zueinander, und Widervernünftiges räumt der rationalistische Theologe aus dem christlichen Glauben. Der Teufel beweist deshalb mit der Gotteslästerung seine Unvernunft. Doch ist ja, wie die Untersuchung bisher zeigte, die Hölle der Ort der Unvernunft, und ein vernünftiger Teufel scheint der Aufklärung eine contradictio in adjecto: Wäre der Teufel vernünftig, so könnte er nicht Gottes Widersacher, so könnte er nicht Teufel sein. — Zum Gipfel des Wahnsinns aber erhebt sich in einer Zeit, deren Gottesbeweis auf dem sicheren Fundament einer natürlichen Religion ruht, also der Offenbarung nicht mehr bedarf, der Gottesleugner. In den Entwürfen der Wolff und Gottsched führen die Gesetze der formalen Logik und das Prinzip des zureichenden Grundes notwendig zum Nachweis der Existenz Gottes; wer deshalb an Gott nicht glaubt, gesteht dieserart nicht seinen von Vorurteilen unbeengten Scharfsinn, sondern nur mehr Imbezillität ein. Ein Teufel zumal, der dem die Existenz abspricht, den er selbst bekämpft, erscheint kaum denkbar. Satan ist zwar Widersacher Gottes, aber kein Gottesleugner: Denn mitten in seiner Verfinstrung Fühlt er doch nodi, daß der Ewige sei. (II/424Í.)
„Verfinstrung" meint Unvernunft; nicht mit Vernunftgründen kann deshalb der Böse sich über die Existenz Gottes Gewißheit verschaffen, sondern er vermag sie nur zu „fühlen" — dies ist bei Klopstock die einzige Erkenntnisform der Teufel. Mit „Hohn" (11/424) blickt Satan also auf die Gottesleugner unter seinen Teufeln: Sie bilden den „untersten Pöbel" (II/418) der Hölle und sind ein „niedriges Volk" (11/419). Ihr Führer ist der Höllenfürst Gog, „erhabner als all' an Gestalt, und an Unsinn." (11/420) Sich krümmend und windend (11/423) bezeugen sie bereits in der Körperhaltung ihre Debilität. Wie deutlich der „Unsinn" des Atheismus in der Meinung der Zeit auf Verstandesschwäche hinwies, mögen einige Sätze des Berliner Oberhofpredigers und bedeutenden Neologen August Friedrich Wilhelm Sack, der Klopstock schätzte und förderte, belegen. Im Erscheinungsjahr der ersten drei Gesänge des „Messias" schreibt er: Idi kan mir auch nicht einmahl vorstellen, daß Leute, die sonst einen guten Verstand und gute Sitten haben, sich im Ernste sollten überreden können, daß kein GOTT sey.
„Halbmenschen" nennt er die Gottesleugner 86 ; mit Atheisten werde er sich in seinen Schriften gar nicht erst auseinandersetzen, „ . . . weil ich von der gesunden Vernunft unseres Publici eine viel zu gute Meynung habe . . . " 87. Im Teufel Gog gewinnt dieser Wahnsinn Gestalt; ihm ist die „gesunde Vernunft" abgesprochen. Die Palette der Erscheinungsformen des Bösen als Modifikationen der Unvernunft wird schließlich ergänzt um die Gestalt Belielels. Bestimmt sidi die 86
August Friedrich Wilhelm Sack: Vertheidigter Glaube der Christen. Erstes Stüde. — Berlin 1748. p. 86f. Sade, a. a. Ο., p. 35. Ähnliche Bemerkungen audi bei Spalding und Jerusalem.
172
Friedrich Gottlieb Klopstode: Der Messias
Qualität des Bösen aus der Negation der göttlichen Vollkommenheit, so bedeutet dies audi, daß der Teufel nicht schöpferisch sein kann. Alles Geschaffene kommt von Gott, in der Hölle waltet einzig das Prinzip der Vernichtung. (So demonstriert Klopstock mit Vorliebe die Größe der Teufel, indem er das Ausmaß der Zerstörung schildert, die sie — und sei es einzig dadurch, daß sie sidi fortbewegen — hinterlassen.) Die Unfruchtbarkeit der Hölle und die mangelnde Schöpferkraft des Bösen ist in Belielel gestaltet. Und bezeichnend genug prägt sich auch in ihm eine spezifische Geistesstörung aus: Belielel, der schaffen will und es nicht kann, ist melancholisch. Er ist (sieht man von Abbadona ab) der einzige Teufel, der sich an den Himmel erinnert und dessen Schönheit unauslöschlich im Gedächtnis trägt. Die Schönheit des Himmels in die Hölle zu verpflanzen ist sein Ziel: Grimmig denkt Belielel an jenen unsterblichen Frühling, Der die himmlische Flur, wie ein junger Seraph, umlächelt. Ach ihn bildet' er gern in der Hölle zu nächtlichem Tal nach! Doch er ergrimmt, und seufzet vor Wut; die traurigen Auen Liegen vor ihm in entsetzlichem Dunkel unbildsam, und öde, Ewig unbildsam, unendliche, lange Gefilde voll Jammer. (II/384-9)
So müht er sich vergeblich: Umsonst ist seine Bemühung, Ewig umsonst, des Fluches Gefild nach den Welten des Schöpfers Umzuschaffen. (II/375-7)
Die wenigen Verse, die Klopstock Belielel widmet, gehören sicherlich zum Überzeugendsten an Charakterschilderung im „Messias". In ihm gestaltet sich die Grundsituation des Melancholikers: die Erinnerung an verlorenes Glück, die aus dem Gedächtnis sich nicht bannen läßt, eine Hoffnung, die unter der ständigen Widerlegung der Möglichkeit einer Erneuerung solchen Glücks verkümmert, der Zwang, beständig dem Verlorenen nachzusinnen. So prägen auch Belielel, gleich den anderen Teufeln, Automatismus und Lernunfähigkeit. Die beständige Wiederholung der einen Figur — schaffen zu wollen und nicht schaffen zu können — geschieht auf dem Hintergrund der Erfahrung realer Schönheit, die sich auch durch die beständige Niederlage nicht verdrängen läßt. Schönheit nur als erinnerte noch zu besitzen, sie zu ersehnen in einer Realität, die solcher Erinnerung Hohn spricht, dies macht Belielel zum Melancholiker. Kein lautes Wort, nicht das beständige Gebrüll der anderen Teufel kommt von seinen Lippen: Er „seufzet vor Wut" (II/387). „Sehnsuchtsvoll" (11/379) und „traurig" (II/390) geht er seiner Wege. Und als Jesus die Hölle bestraft, klagt Belielel nicht wie die anderen Teufel über Schmerz: Habt ihr die Blumen gesehn, die vor ihm, ach, Eden des Himmels, Dich erblickt' ich! vor ihm aufsproßten, hinter ihm schleunig Welkten, dorrten, vergingen? Wir dorren auf ewig, vergehn nicht! Ach vergehn nicht! (XVI/661-4)
Die Gleichgültigkeit gegenüber physischem Schmerz wie der Zwang, in einer Welt leben zu müssen, die den Tod wünschen läßt, ohne doch sterben zu können: auch dies sind Symptome von Melancholie. Selbstbezug und Wieder-
Der Teufel in der Aufklärung
173
holungszwang machen ihn unempfindlich gegen Erfahrungen: Auch an Belielel reicht die Vernunft nicht heran. — So zeigt denn der Überblick über die Teufelsgestalten im „Messias" dies: Die sich parallel dem Erlösungswerk vollziehende Entdämonisierung der Welt bedeutet letztlich deren Rationalisierung. Je weiter das Erlösungsgeschehen fortgeschritten ist, desto weniger Raum findet der Teufel in der Schöpfung. In der zweiten Hälfte des „Messias" gibt es nur noch bestrafte Teufel; die letzten Reste aktiven Handelns auf Seiten der höllischen Mächte dienen Klopstock nur zur Demonstration von deren völliger Ohnmacht. Die Erlösung durch Christus bewährt sich auch darin: Die Welt, unkontrollierbar und undurchsichtig den Ränken der Teufel ausgesetzt, wird geordnet und überschaubar, gesetzmäßig und rational im Sinne der Aufklärungsphilosophie. Wo noch zuvor der Teufel aller Ordnung den Kampf ansagen durfte, ist jetzt die Verläßlichkeit des göttlichen Regiments als die der Vernunft eingekehrt. Die „verzauberte Welt" 88 wird entzaubert, und der Mensch kann sich die Welt in wissenschaftlicher Manier Untertan machen. Darin entspricht der Messias, der die Teufel in die Hölle vertreibt und das Dunkel über der Welt beiseite räumt, unbeschadet Klopstocks ansonsten orthodoxer Christologie89, durchaus dem Christus-Bild der Neologen, die in ihm den Aufklärer sahen. So rühmt etwa Spalding, auch er ein Förderer Klopstocks, in Christus den „ . . . großen Urheber und Märtyrer der heilsamsten Aufklärung . . . " 90 ; an anderer Stelle werden „ . . . die Aufklärungen in den allerangelegentlichsten Erkenntnissen, und der daraus fließende kräftige Antrieb zum Guten . . . " 91 von Spalding an Christus besonders hervorgehoben, und schließlich heißt es über den Gottessohn in einer Formulierung, die auch auf jeden bedeutenden Weltweisen applizierbar wäre: . . . er hatte auf diese Art der Welt ein Licht angezündet, welches seine Boten hernach immer weiter zur Vertreibung der Unwissenheit und des Irrthums ausbreiten mußten. 92
Unwissenheit, Unvernunft und Irrtum sind Merkmale des in den Teufelsgestalten sich objektivierenden Bösen; an der Niederlage der Teufel zeigt sich, daß das Erlösungswerk des Messias zugleich ein Aufklärungsfeldzug ist. Die Verbannung der Teufel in die Hölle geht einher mit dem Siegeszug der Rationalität; die durchgängige Geistesgestörtheit der Protagonisten des Bösen verrät die Identität des siegreichen Guten mit der siegreichen Ratio. — So ist denn sozialhistorisch bedeutsam, daß in die Entstehungszeit des „Messias", der die Abes „De betooverde Weereld" (1691—3) ist der Titel des Werks, mit dem der holländische Pfarrer Balthasar Bekker (1634—98) dem Teufelsglauben, darin seiner Zeit weit voraus, radikal den Kampf angesagt hatte, s» Vgl. Kaiser, a. a. O., p. 113ff. Ό [Johann Joachim Spalding]: Vertraute Briefe die Religion betreffend. — Breslau 1784. p. 87. 91 Johann Joachim Spalding: Predigten. Verbesserte Ausgabe. — Berlin/Stralsund 1768. p. 119. 92 Spalding, Predigten, a. a. O., p. 304.
174
Friedrich Gottlieb Klopstock: Oer Messias
drängung des Bösen an einen außerirdischen Ort 9 3 beschreibt, die Ausgrenzung der Irren aus der bürgerlichen Gesellschaft, ihre Verwahrung in Irren-, Arbeits- und Zuchthäusern, fällt: . . . es wurde . . . das Irrationale, Unberechenbare, Störende der Irren in dem Maße als gefährlich und nach Sicherheit verlangend sichtbar, wie die Gesellschaftsordnung administrativ und ökonomisch rational, rechenhaft und empfindlich gegen Störungen sich organisierte.'4
Die über den rationalen Diskurs unkorrigierbare Unvernunft der Irren, deren Verstocktheit als Bosheit sich interpretieren ließ, zwang die sich durchrationalisierende Gesellschaft zur Exklusion dieses sie irritierenden Elements, zur Einschließung in Häusern, in denen sich unterschiedslos die Bösen (die Verbrecher) und die Unvernünftigen (die Irren) versammelt sahen. Gleiches geschieht mit den Teufeln im „Messias" : Die Bösen als Unvernünftige, ja Geistesgestörte werden aus der Welt herausgezwungen und an einem abgelegenen Ort verwahrt, der die Möglichkeit eröffnet, von ihrer Existenz schließlich gar keine Kenntnis mehr zu nehmen. Dies ist die Situation am Ende der Messiade: Der Teufel ist endgültig in die Finsternis der Hölle gebannt, aus der zu entweichen ihm nicht mehr gelingen soll. Zwar wird er nicht gänzlich eliminiert, dafür aber gleichsam totgeschwiegen. Es gibt ihn noch, aber nur in weiter Ferne, in beruhigender Distanz; für den weiteren Fortgang der Entwicklung ist er keine Bedrohnis mehr. Doch hier sah er die Hölle noch nicht. Die hatte die Gottheit Fern von sich, und ihren Geschöpfen, den seligen Geistern, Weiter hinunter in ewige Dunkelheit eingeschlossen. Denn in unserer Welt, dem Schauplatz ihrer Erbarmung, War kein Raum für Orte der Qual. (II/254-8)
Daß in unserer Welt kein Raum für Orte der Qual sei, gilt nicht als Auftrag, sondern als Wirklichkeit. Der aufklärerische Optimismus schlägt ins Apologetische um; das innerweltlich Böse wird dort, wo Rationalität zu seiner Bewältigung nicht hinreicht, über Ausklammerung bewältigt. So existiert es weiter, aber der aufgeklärte Christ hält es „fern von sich". Dem Bösen ein Vernunftdefizit nachzuweisen reicht zu seiner Erledigung aus. Der „Messias" betreibt mit dem Bösen — wie die bürgerliche Gesellschaft mit den störenden Irren — Bewältigung qua Ausklammerung. Die Widerstände gegen die Rationalisierung erscheinen nicht als realhistorisch verankert, sondern als Erkenntnisschwäche des einzelnen. Dort, wo diese als notorisch sich erweist, reagiert die vernünftige Welt mit Einschließung; sie schützt sich vor der Irritation durch die realhistorischen Widerstände gegen das Programm der Vernunft, indem sie die unter Quarantäne stellt, die diese zum Ausdrude bringen. Dies gilt für die Irren eben« Hans Wöhlert weist darauf hin, daß die Hölle „völlig abgeschlossen von der übrigen Schöpfung" ist. — Hans Wöhlert: Das Weltbild in Klopstocks Messias. — Halle 1915. ( = Phil. Diss. Erlangen 1915.) p.22. 94 Klaus Dörner: Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie. — Frankfurt 1975. p. 197.
Der Teufel in der Aufklärung
175
so wie für die Bösen, tendenziell fällt der Trennungsstrich zwischen beiden fort: So wie die Bösen Schuldige sind, so werden die Irren zu Schuldigen; ein Christian Heinrich Spieß wird am Jahrhundertende in seinen „Biographien der Wahnsinnigen" nachweisen, daß jeder der Dementen für sein Schicksal die Verantwortung selbst zu tragen hat. Schon Klopstocks „Messias" kennt diesen Trennungsstrich nicht mehr: Seine Teufel, die nicht lernen können, sind vernunftlose Irre. — So jedoch, wie dem Uneinsichtigen der Ausschluß aus der Gesellschaft der Vernünftigen droht, so wird der reumütig Einsichtsvolle erneut von ihr aufgenommen. Entdämonisierung, die Elimination überkommener Widerstände gegen die Gesetze der Vernunft, geschieht nur zuletzt mit den Mitteln der Gewalt, zuvor aber vertraut der Aufklärer auf die Überzeugungskraft rationaler Argumentation. Diesen Prozeß von Entdämonisierung über Einsicht hat Klopstock in der Gestalt Abbadonas komprimiert, die, darin die Logik der Entwicklung spiegelnd, immer deutlicher an die Stelle der in die Hölle abgedrängten Teufel tritt. Abbadona ist mehr als nur eine Gestalt, die dem Dichter gerührtes Interesse an seiner in langen Abständen erscheinenden Dichtung sicherte, mehr auch als die gestalterische Propagierung des Apokatastasis-Gedankens. Abbadona ist der Teufel, der sich selbst aufhebt: Die in seiner Gestalt sich vollziehende Auflösung des Teuflischen reflektiert die das Erlösungswerk begleitende Verdrängung des Teuflischen aus der Welt; Abbadona belegt in nuce und auf stille Weise, was als lauttönendes Exempel an der Hölle zu statuieren war. „Der bange, / Jammernde Seraph" (IX/517f.), der seinen Übertritt zu den Scharen Satans bitter bereut, partizipiert in keiner Weise am Wahnsinn der Hölle; gerade seine Einsicht in die eigene Lage und seine Erkenntnis der Ohnmacht des Bösen heben ihn von den übrigen Teufeln ab. An dem wissenden und erkennenden Teufel kann nichts Böses mehr sein; so macht denn auch Abbadona im Laufe des Geschehens keine Entwicklung mehr durch, er hat seinen Irrtum lange vor Beginn der Erzählung korrigiert. Er ist deshalb von Anbeginn nur noch dem Namen nach ein Teufel; seine endliche Erlösung nimmt ihm nur diesen Namen, ansonsten bleibt Abbadona der gleiche. Seine Illusionslosigkeit und seine Erkenntnisfähigkeit machen ihn zum einzigen Bewohner der Hölle, aus dem Wahrheit spricht. Dadurch wird er für die Fürsten der Hölle unangreifbar: Wenn er Satan die Ohnmacht der Hölle gegen die Allmacht Gottes vor Augen hält, wenn er ihn der Lüge und Prahlerei bezichtigt, so ist es die Macht der Wahrheit, die ihn vor Strafe schützt; sie läßt ihn der Hölle ,furchtbar' werden (II/698). Zudem begleitet Abbadona als einzigen Teufel neben Belielel beständig die Erinnerung an die Vergangenheit, die erinnerte Vollkommenheit. Sie in Verbindung mit der Erkenntnis gegenwärtiger Unvollkommenheit begründet seine Trauer, die damit völlig der Definition Christian Wolffs entspricht: Ein mercklicher Grad der Unlust, der auch die Lust überwieget, wenn einige zugegen ist, machet die Traurigkeit aus. Da nun die Unlust in einer anschauenden Erkäntniß der Unvollkommenheit (§. 417.) bestehet, und also durch undeutliche Vorstellung des Bösen er-
176
Friedrich Gottlieb Klopstock: Oer Messias
reget wird (§.427.); so entstehet Traurigkeit, wenn wir uns von einer Sache viel Böses auf einmahl vorstellen (§.214.) 9 5
Die Erkenntnis von Unvollkommenheit über die Anschauung des Bösen begründet Abbadonas Trauer; der Reue des gefallenen Engels sind Erkenntnis und Einsicht vorgelagert, sie erst ebnen den Weg zurück in die Gemeinschaft der guten Geister. Damit aber gewinnt die Apokatastasis, die Lehre von der endlichen Wiederbringung aller Kreatur und dem Aufhören aller Sündenstrafen, einen spezifisch aufklärerischen Inhalt. Die protestantische Orthodoxie lehnte die Apokatastasis entschieden ab, die Neologen jedoch machten sie sich, wenn auch gegen Widerstände in den eigenen Reihen, zueigen 96 . Klopstocks Meinung in diesem Punkt war sehr bestimmt und eindeutig unorthodox. Am 11. Januar 1791 schrieb er an C. F. Cramer: . . . daß ich die Ewigkeit der Höllenstrafen nicht annehme. Ich habe dieß ja durch Abbadonas Erlösung und audi sonst im Mess, gezeigt.'?
Mag ihn auch nicht so sehr theologische Programmatik zu dieser Meinung gebracht haben als sein unbedingtes Vertrauen in die göttliche Liebe, so ist dieses doch gleichsam die Erscheinungsform des aufklärerischen Optimismus als Glaubensinhalt. Solcher Kontext von Aufklärung aber prägt die Apokatastasis in der „Messias"-Dichtung: Sie geschieht nicht mehr aus einem unerklärlichen, unerforschlichen Ratschluß Gottes, aus einem vom Willen und Handeln des zu Erlösenden unabhängigen Gnadenerweis, sondern sie beruht auf der in seiner individuellen Einsicht und Erkenntnis begründeten tätigen Reue Abbadonas. Sie ist in entscheidendem Maße Selbsterlösung, eine Resozialisation aus eigener Kraft und Anstrengung, aus eigener Einsicht und Selbstüberwindung. Abbadonas endliche Erlösung ist deshalb auch nicht für sämtliche Teufel generalisierbar, aus ihr ist die prinzipielle Wiederbringung der Teufel nicht abzuleiten; ist überhaupt ein Prinzip auf sie zu gründen, so das der, in einer Abwandlung des Kant-Worts, eigenständigen Befreiung aus selbstverschuldeter Unvollkommenheit. Abbadonas Weg ist eben nicht allein Zerknirschung und Reue, sondern zugleich unaufhörliche Anstrengung und beständiges Bemühen, nicht passives Erleiden, sondern aktiver Änderungswille98. Der erkennende Teufel erreicht, sich selbst aufhebend, die Stufe der Vollkommenheit, während die unvernünf« Wolff, a. a. Ο, p. 276. (§ 448) 96 Vgl. Aner, a. a. Ο., p. 276ff. 97 J. M. Lappenberg (Hrsg.): Briefe von und an Klopstock. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte seiner Zeit. — Braunschweig 1867. p. 337. 98 In Zacharias Fragment „Die Unterwerfung gefallner Engel und ihre Bestimmung zu Schutzgeistern der Menschen" (1760) wird die Apokatastasis zu einem kollektiven Prozeß: „Orions Myriade", die zuerst Satan gefolgt war, erwirbt sich durch lautes Trauern Gottes Gnade. Bezeichnend genug jedoch wird die Schar nicht sogleich wieder in den Himmel aufgenommen, sondern sie muß sich die endliche Erlösung regelrecht erarbeiten: Zu Schutzengeln herabgestuft, hat sie sich in dieser Aufgabe zu bewähren, um im Jüngsten Gericht die ewige Seligkeit zurückzuerlangen. Audi in diesem kollektiven Abbadona also ist die endliche Wiederbringung tätige Selbsterlösung. Vgl. Friedrich Wilhelm Zachariä: Poetische Schriften. Bd. 5. — o. O. o. J. [Braunschweig 1763ff.] pp. 113—138.
Der Teufel in der Aufklärung
III
tigen Teufel im Dunkel des Vergessens versinken. Abbadonas Erfolg, seine Integration ins gute Ganze, verdankt sich seinen Tugenden Bescheidenheit, Wissen, Beharrlichkeit und unablässigem Sich-Bemühen; in ihm siegt ein bürgerliches Ideal. Ratio verbindet sich in ihrem Kampf gegen die Unvernunft mit bürgerlichen Lebensprinzipien, in der Entdämonisierung der Welt gelangt beides zum Sieg; sie ist, wie bei Abbadona, gewährleistet in auf Vernunft gegründeter Tugend. Der zu Verstand gekommene Teufel ist ein tugendhafter Teufel, ist mithin kein Teufel mehr: Die Verbindung von Rationalisierung und bürgerlicher Ethik wird in Abbadona sinnfällig. In ihm gestaltet sich die zweite Variante bürgerlicher Auseinandersetzung im 18. Jh. mit dem Bösen gleich dem Unvernünftigen: Aufklärung statt Ausklammerung, durchaus verbunden mit dem, was Aufklärung und Apokatastasis sich in gleichem Maße versprechen: daß in unserer Welt tatsächlich einmal keine Orte der Qual sein werden. — So zeigt sich am „Messias" die Historizität der aufklärerischen Bewältigungsstrategien des Bösen: Die Philosophie der prästabilierten Harmonie hatte das Tatsächliche als das optimale Handlungsfeld angepriesen, zugleich aber die ihm innewohnenden Mißstände als unaufhebbar und deshalb hinzunehmen dekretiert. Die These der „Dialektik der Aufklärung" daß die Aufklärung über die Verabsolutierung des Tatsächlichen das ihm immanente Unrecht, das genuin Böse, dem Zugriff entziehe, findet mithin schon im Leibnizschen Denken ihren genauen Beleg, sie findet ihn aber auch in Klopstocks „Messias". Denn die in ihm vorgezeichneten Bewältigungschancen des Bösen sind eben die des Bürgers, der das Gegebene in seiner Faktizität als einzig denkbare Handlungsebene akzeptiert und im Sinne der Vernunft zu vervollkommnen bemüht ist. Dort aber, wo die dem realen Weltaufbau innewohnenden Mängel gegen das Vernunftgebot sich sperren, und wo die Überzeugungsstrategien von Rationalität gegen die historisch verankerten Widersprüche nicht weiterhelfen, zieht Vernunft sich resigniert zurück und klammert dies wirklich Widersacherische aus. Noch die Leichtigkeit, mit der Satan und seine Teufel ohne Auseinandersetzung in die Hölle verbannt werden, verrät die Schwierigkeiten, die eine wirkliche Konfrontation mit den in ihnen objektivierten realhistorischen Widerständen gegen die Idee einer vernünftigen Welt bereitet hätte. Weshalb nicht alle Teufel den Weg Abbadonas, den der Vervollkommnung über Vernunft, gehen, bleibt im „Messias" letztlich unbeantwortet; dies nämlich hätte die Motivation der Empörung Satans vorausgesetzt, hätte ein Eingehen auf die Mängel des Weltzustands nötig gemacht. Diese aber bleiben ebenso ausgeklammert, wie schließlich ihre Objektivationen, die Teufel, in eine ferne Hölle ausgeklammert werden. Die bürgerliche Aufklärung akzeptiert den grundsätzlichen Aufbau der Welt, um das beste aus ihm zu machen, ihn zu ändern vermag sie nicht. Die Widersprüche warten abseits der Vernunft unerledigt auf ihre Chance zu neuem Aufbruch. Deshalb verhilft Gabriels schon zitiertes Wort an Satan nicht nur dem Triumph der Vernunft zum Ausdrude, sondern weit mehr noch deren 99 Vgl. Max Horkheimer / Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. — Frankfurt 1969. — Besonders Kap. 1. Begriff der Aufklärung.
178
Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias
Resignation vor dem mit Rationalität nicht allein zu bewältigenden Bösen in der Welt: So fleuch denn hinunter, und krümme Didi in neuen Entwürfen herum zur neuen Empörung.
(XIII/889Í.)
LORD BYRON: CAIN
Die Rebellion des Aristokraten I have also The Bible of Hell, which the world shall have whether they will or no. William Blake: The Marriage of Heaven and Hell „Idi habe", sagte Herr***, „kaum ein stolzes Verhalten gesehen, mit dem idi zufrieden gewesen wäre. Was ich in dieser Art am besten kenne, ist das Verhalten Satans im .Verlorenen Paradies'." 1
Aus welchem Grund notierte Chamfort sich diese Bemerkung in seinen „Caractères et Anecdotes" ? Gleich seinen Maximen hatten auch die Anekdoten nur dies eine zum Ziel, die französische Gesellschaft des Ancien régime in ihren Tugenden und Lastern objektiv und vollständig darzustellen; zum Ausgangspunkt der unverfälschten Wiedergabe ihres Gesamtzustands wurde die unnachsichtige Überprüfung der Konventionen, der geheimen Einverständnisse und Verlogenheiten der Herrschenden. Zum Vorschein kam eine Gesellschaft, die, als vollständig denaturiert, weiteres Lebensrecht nicht mehr besaß; nicht war Chamfort in seinen Formulierungen zynisch, sondern die Verhältnisse waren es, die in ihnen ihren angemessenen Ausdruck fanden. In diesem Zusammenhang gewinnt auch das obige Zitat seine Bedeutung: In ihm formuliert sich die Kritik an einer Gesellschaft, in der es unverfälschte Individualität nur noch um den Preis des Immoralismus, der bewußten Abweichung von der ethischen Norm, geben kann. Wo aber das Eigenrecht der Persönlichkeit sich allein noch in der Abkehr vom gesellschaftlich Geforderten zu behaupten vermag, dort muß die Gesellschaft selbst bis ins Innerste unmoralisch sein. Nicht also feiert Chamfort in der Apotheose Satans die Immoralität, sondern er geißelt in ihr die Immoralität einer Gesellschaft, die zu den Hütern der Menschenwürde ihre eigenen Gegner macht. Die positive Würdigung Satans wird bei Chamfort zum Moment von Gesellschaftskritik. — Dies gilt, auf völlig andere Weise freilich, ebenso für William Blake. In seiner privaten Mythologie, deren Hermetismus in umgekehrtem Verhältnis zur revolutionierenden Absicht stand, gestaltet sich ein Ungenügen an der Gegenwart, welches über sich hinaus will und das Noch-nicht-Gewordene im Hier und Jetzt qua „imagination" künstlerisch zu Ende zu bringen sich bemüht. Ratio, Wissenschaft und Vernunft gelten ihm als der schlechten Wirklichkeit ι Nicolas Chamfort: Charaktere und Anekdoten. — In: Fritz Schalk (Hrsg.): Die französischen Moralisten. Bd. 1. — München 1973. p. 424.
180
Lord Byron: Cain
verhaftet, mehr noch, Ratio ist in Blakes Verständnis „ . . . nur madittechnisdi gehandhabte Methode der konservativen Inhaber der Regierungsgewalt, die alles Schöpferische erstickt." 2 „imagination" dagegen sprengt die engen Rahmen, in die Blakes Figuren gesperrt sind; sie steht ein für die „visionäre Utopie des ganzen, schöpferischen Menschen" 3. Dieser Intention auf Überwindung menschlicher Eindimensionalität, deren Vermitteltheit mit repressiven Strukturen in Kirche und Staat der glühende Verehrer der Französischen Revolution stets hervorhob, entspringt die positive Sicht Satans; sie ist in seiner Energienlehre fundiert: Without Contraries is no progression. Attraction and Repulsion, Reason and Energy, Love and Hate, are necessary to Human existence. From these contraries spring what the religious call Good and Evil. Good is the passive that obeys Reason. Evil is the active springing from Energy. Good is Heaven. Evil is Hell. 4
Satan ist für Blake die Verkörperung des bewegenden Prinzips, der weitertreibenden Energie, während in Gott die Kräfte der Beharrung, der Saturiertheit im Bestehenden bedeutet sind. So wird denn Satan zum Garanten von Zukunft; wenn irgend der Mensch aus seiner verkrüppelnden Verhaftung in funktionaler Rationalität, aus seiner Versklavung in den Systemen der Priester, Politiker und Militärs zur dynamischen Synthese aller seiner Möglichkeiten, deren Vor-Schein ihm die „imagination" des Künstlers liefert, finden soll, so muß ihm Satan als Bruder zur Seite stehen. Der Engel wandelt sich in „The Marriage of Heaven and Hell" zum Teufel und wird zum Freund des Visionärs: Die Imagination verschwistert sich der Energie. Blakes Vision des neuen, des wahrhaft freien Menschen abstrahiert niemals von den Widersprüchen der historischen Wirklichkeit, ja sie setzt sie sogar bewußt voraus: Die Gegensätze sind zukunftsträchtig zu nutzen, ihre Unterdrückung dient nur der schlechten Wirklichkeit. Wenn der Gott der Vernunft, Jahwe oder Urizen, den Menschen in der gefallenen Welt versklavt, dann richten sich dessen Hoffnungen auf seinen Gegner Satan, den Geist der Imagination und der umgestaltenden Energie, der die erstarrte Ordnung aufbricht und die Bewegung der Widersprüche in eine neue Welt münden läßt. Nervös wie kaum ein anderer Künstler seiner Zeit reagiert Blake auf den unüberbrückbaren Widerspruch zwischen der ungeahnte Energien und Chancen in Richtung auf mehr Menschlichkeit freisetzenden Industrialisierung seines Landes, die ihrem ersten Höhepunkt entgegentrieb, und der gleichzeitigen Erstarrung der politischen Verhältnisse und ethischen Normensysteme. Wo um der Erhaltung der Besitzverhältnisse willen die Unterdrückung, ja die Verteufelung der Wünsche und Triebe des Menschen 2
Karl Heinz Bohrer: In den Wäldern der Nacht. Gedanken zu William Blakes Malerei und Dichtung. — In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nr. 3, 4.1.1975, Beilage „Bilder und Zeiten". 3 Werner Hofmann: Die Erfüllung der Zeit. — In: Werner Hofmann (Hrsg.): William Blake. 1757—1827. — München 1975. p. 28. 4 William Blake: The Marriage of Heaven and Hell. — In: The Poetical Works of William Blake. Ed. by John Sampson. — London 1961. p. 248.
Die Rebellion des Aristokraten
181
(zum Gegensatz der abgelehnten Ratio wird für Blake „desire" ) stattfindet, da bleibt dem Visionär einzig die Verbrüderung mit Satan, in dem die Blake verhaßten Priester und Mächtigen all das objektivierten, was ihrer Herrschaft gefährlich werden konnte. Der Kern von Blakes Hommage auf Satan also ist Gesellschaftskritik, unverbrüchlich verbunden mit einem Geschichtsoptimismus, dem auch das enttäuschende Ergebnis der Französischen Revolution nichts anzuhaben vermochte. — Doch auch dem Geschichtspessimismus konnte die positive Sicht Satans sich verbinden. Dies läßt sich an Johann Heinrich Füssli, dem Zeitgenossen Blakes, belegen. Wie Blake begrüßte auch Füssli, der bereits als junger Mann in der Schweiz mit entschiedenem Republikanismus sich unbeliebt gemacht hatte, die Französische Revolution, wandte sich aber, ungleich dem ersteren, bald enttäuscht von ihr ab. Pessimismus und Skepsis schärften zwar den Blick für Unglück und Leid in der Welt — in Füsslis Werk dominieren entsprechend Trauer und Elend —, sie ließen andererseits aber jeden Versuch zur Überwindung des Schlechten und Mißlungenen von Anbeginn als vergeblich erscheinen. Nur auf den ersten Blick scheint dem zu widersprechen, daß in Füsslis „Milton-Galerie" Satan, der Rebell gegen Gott, zur dominierenden Figur wird. Sie ist mit allen Attributen des Heroen ausgestattet: Auf einen unbekleideten, muskulösen Körper von großer Schönheit fällt helles Licht; ein Arm ist zumeist, vorwärts deutend oder zum Schlag ausholend, emporgeredet. Satan bleibt bei Füssli durchaus der Rebell, der er schon bei Milton war; was aber bei der ikonographischen Umsetzung des Milton-Textes sich verschärft, ist die Vereinzelung des Heroen. Gerade darin, daß er alles Licht auf sich sammelt, tritt die Finsternis der ihn umgebenden Welt, die Übermacht des Schlechten, umso deutlicher hervor. Ist demnach Satan bei Füssli zwar der eigentliche Heros, so ist er doch vor allem der scheiternde Held, der den Kampf aufgenommen hat, ihn aber nicht gewinnen kann. Der Skeptiker Füssli leugnet den schlechten Zustand der Welt nicht, aber er resigniert vor ihm. Satans Glanz jedoch „ . . . macht deutlich, daß er den Rebellen, gleichviel für was er steht, höher schätzt als seine mit den Mächten dieser Welt paktierenden oder sich dumpf ergebenden Schicksalsgenossen." 5 Es ist der Gestus des Rebellen, das Sich-nicht-ausliefern-wollen und die Verweigerung, worin Füssli sich von Satan fasziniert sieht; einen lohnenden Inhalt der Rebellion freilich kennt der Skeptiker nicht. Es ist deshalb nicht so sehr das Aufbegehren als die beruhigende Bestätigung seiner Vergeblichkeit, was das schlechte Gewissen des Malers lockt. Füsslis, des Professors an der „Royal Academy", Opposition hat, bei aller elitären Faszination durch den Widerstand des großen einzelnen, ihren Frieden mit der Welt längst gemacht. — Drei Weisen also der positiven Sicht Satans: die des Moralisten, des utopistischen Revolutionärs und des Skeptikers; geeint sind sie durch Gesellschaftskritik. Wie bisher in Satan das sich affirmativ vereinigt hatte, was dem Bestehen einer Gesellschaft gefährlich sein mochte, so geschieht nun das gleiche in 5
Gert Schiff: Füssli, Luzifer und die Medusa. — In: Werner Hofmann (Hrsg.): Johann Heinrich Füssli. 1741—1825. — München 1974. p. 12.
182
Lord Byron: Cain
kritischer Absicht: Wo die Intensität der Übelstände nur noch von der des Widerstands der Regierenden gegen ihre Beseitigung übertroffen wird, dort richten sich die Hoffnungen auf den, der schon von jeher als deren Feind galt. Der Autoritätsverlust des Offenbarungsglaubens, verbunden mit der gleichzeitigen Entmystifizierung der Gesellschaftsverhältnisse, ermöglicht dem Kritiker die Identifikation mit dem, der seine Feindschaft zum Bestehenden niemals verleugnet hatte: Satan wird zum Kronzeugen für die Kontinuität des Kampfes gegen die schlechte Wirklichkeit. So erkannte schließlich die Gesellschaft, in logischer Konsequenz dieser Verbrüderung, in ihren schärfsten Kritikern die Züge Satans wieder. Lord Byron ist dieser Identifikation ebensowenig entgangen wie nach ihm die großen Sozialrevolutionäre; er freilich hat sie genossen. Stolz fügt er am 15. Oktober 1821 in seinen „Detached Thoughts" der langen Liste berühmter Gestalten, mit denen man ihn verglichen hatte, den Namen Satans ein 6 , und genüßlich berichtet er in seinen Gesprächen mit Captain Medwin von der Reaktion der Gäste auf sein Erscheinen bei einem Diner der Madame de Staël: „One of the ladies fainted, and the rest looked as if his Satanic Majesty had been among them." 7 Vieles kam bei Byron zusammen, was solcher Ineinssetzung förderlich war: Äußerlichkeiten wie die Schönheit seiner Erscheinung, die zudem, weil Alkohol und Ausschweifungen ihre Spuren zurückgelassen hatten, den Stempel des Verderbten trug 8 , und sein Klumpfuß, der an den Pferdefuß des Teufels gemahnte, dann aber vor allem, was die sittsamen Zeitgenossen seine Amoralität dünkte, ebenso sein selbstgewähltes Exil, in dem sich schärfste Kritik an den Verhältnissen in seinem Heimatland ausdrückte, schließlich noch das zur Schau getragene Aristokratentum, in dessen elitärer Vereinzelung und extremer Subjektivierung eine entfernte Erinnerung an den Heroismus des Miltonsdhen Satan aufleuchtete. Und war es nicht Byron gewesen, der 1821, nach einer langen Reihe düsterer Rebellengestalten, in seinem 6 The Works of Lord Byron. Letters and Journals. Ed. by Rowland E. Prothero. Vol. V. — London / New York 1904. p. 408. (künftig als LJ zitiert) 7 Medwin's Conversations of Lord Byron. Revised with a New Preface by the Author for a New Edition and Annotated ( . . . ) . Ed. by Ernest J. Lovell, Jr. — Princeton 1966. p. 12. 8 Die Schönheit des gefallenen Engels gehört zu den Topoi der Literatur des 19. Jhs, und dies durchaus nicht nur bei Autoren des l'art pour l'art oder des fin de siècle; man vergleiche etwa folgende Stelle bei Stifter: „Chelion war schön, wie ein reiner Engel, und Christoph war es, wie ein gefallener." Adalbert Stifter: Die Narrenburg. — In: Studien. 4. Auflage. Bd. 1. — Pest 1855. p. 309. — Wie so manches von der großen Erzählliteratur des 19. Jhs hat die triviale Belletristik des 20. auch diesen Topos geerbt; in Frank Yerbys Erfolgsroman „The Foxes of Harrow" beispielsweise heißt es: „Der schlanke junge Mann mit dem narbigen Gesicht, das so merkwürdig an das Gesicht Luzifers erinnerte — eines Luzifers so kurz nach dem Fall, daß die Engelsstirn noch über die satanische Entstellung triumphierte —, schritt mit fast schlafwandlerischer Sicherheit durch die Figuren des contre-danse, während Odalies Augen, verschleiert vom Sdiwarz der Urnacht, nicht von den seinen ließen, deren Blicke sie unablässig suchten." — Frank Yerby: Eine Welt zu Füßen. Roman. Neue Sonderausgabe. — Berlin 1970. p. 155f. Die Beliebigkeit des Vergleichs erhellt daraus, daß, wie sich im Roman erweist, der „schlanke junge Mann" durchaus nicht mehr Luciferisches an sich hat, als ein prosperierender Südstaatenfarmer für gewöhnlich mit sich bringt: also gar nichts.
Die Rebellion des Aristokraten
183
Drama „Cain" einen Lucifer gebildet hatte, der an Größe und Überzeugungskraft in der Literatur der ersten Jahrzehnte des 19. Jhs seinesgleichen nicht besaß? Schon längst hatte die Öffentlichkeit sich abgewöhnt, zwischen dem Dichter und seinen Gestalten scharf zu unterscheiden: Wie sie in Childe Harold und Lara, dem Giaour und Manfred deren Schöpfer wiederentdeckte, so war ihr auch Lucifer kaum etwas anderes als ein Über-Byron; seine satanische Rede artikulierte nichts als die verwerflichen Ansichten des Lords 9 , den sein schärfster literarischer Gegner, der poeta laureatus Richard Southey, schon vor Erscheinen des „Cain" zum Haupt der „Satanic school" erklärt hatte 10 . Die Verwechslung des Autors mit seinen Gestalten freilich darf den Zeitgenossen kaum allzu schwer angelastet werden; Byron hat ihr durch Selbstinszenierung, Eigenkommentare und skrupellose Verwertung seiner Biographie so sehr Vorschub geleistet, daß diese mangelnde Trennschärfe in der späteren Literatur über den Dichter nachgerade notorisch wird: Weit häufiger stützen die Interpretationen seiner Poesie sich auf die Biographie als auf die Werke selbst. Kaum jemand allerdings ist der mystifizierenden Selbstdarstellung Byrons so sehr aufgesessen wie Mario Praz: Unterderhand verschwimmt ihm das Bild des „satanischen Lords" 11 mit dem Satans; es gilt ihm als ausgemacht, daß Byron „ . . . sich selbst bewußt mit der Gestalt des gefallenen Engels identifmerte." 12 Demnach wäre eine Ineinssetzung Byrons mit seinem Lucifer schlüssig, der zweite wäre tatsächlich kaum mehr als das Sprachrohr des ersteren; unentschieden bliebe dabei freilich, was diese rasche Zuordnung für die Erkenntnis Byrons als einer historischen Gestalt wie für die Interpretation seiner Werke über Analogien hinaus erbrächte. Hier soll, nach der kurzen Erkundung des Umfeldes, unser Interesse dem Text des „Cain" selbst gehören, wobei Biographisches so weit als möglich auszuklammern ist; erst dann lassen sich Antworten auf die soeben aufgeworfene Frage geben. Wenn irgend noch Beschäftigung mit Byrons „Cain" sich lohnt, dann kann sie nicht darin ihren Ausgangspunkt finden, woran die Zeitgenossen den meisten Anstoß nahmen: an der theologischen Invektive. Daß die Dramengestalten Reden führen, deren Anstößigkeit dem damals unbeirrt Gläubigen unüberbietbar schien, vermag dem heutigen Leser kaum mehr Interesse abzulocken: Zu häufig hat die Theologie vor literarischen Ausfällen sich ducken müssen, zu lose ist mittlerweile die Verbindung von Kirche und Staat, als daß hier noch große öffentliche Kontroversen möglich wären, und zu oft wurde in den letzten 150 Jahren das, was „Cain" an theologischem Sprengmaterial enthielt, bündiger, schlüssiger, begrifflich klarer, nämlich philosophisch formuliert, als daß der ' Man vergleiche die hervorragende Dokumentation der zeitgenössischen Kritiken und Reaktionen auf „Cain" bei: Truman Guy Steffan: Lord Byron's Cain. Twelve Essays and a Text with Variants and Annotations. — Austin/London 1968. pp. 309—426. 10 John D. Jump: Byron. — London/Boston 1972. p. 153. 11 Mario Praz: Liebe, Tod und Teufel. Die schwarze Romantik. Bd. 1. — München 1970. p. 95. — Allzu leichtgläubig vor allem übernimmt Praz die Skandalgeschichten, wie sie zahlreich zu seinen Lebzeiten über Byron kolportiert wurden. 12 Praz, a. a. Ο., p. 83.
184
Lord Byron: Catti
Streit ums theologische Detail dem, der heute die Verse liest, nicht als höchst abgestanden sich präsentieren müßte. Der rigorose Calvinismus, dem Byrons Angriff galt, mit seinem allmächtigen, unnachsichtigen, fernen Gott, mit seiner Akzentuierung menschlicher Ohnmacht und Schwäche, mit seiner entmutigenden Prädestinationslehre13, hat als Glaubensinhalt so sehr an Bedeutung verloren, die dogmatische Empfindlichkeit unter den Gläubigen zudem hat so sehr nachgelassen, daß die damalige öffentliche Reaktion auf „Cain" heute kaum mehr nachvollziehbar erscheint: „However, the parsons are all preaching at it, from Kentish Town and Oxford to Pisa . . 1 4 , schrieb Byron am 20.2.1822 amüsiert an seinen Freund Thomas Moore. — Doch bietet Byrons Drama, immerhin eines der berühmtesten Werke der ersten Jahrhunderthälfte, unterhalb der metaphysischen Anklage noch genügend irdischen Reizstoff, der eine genauere Beschäftigung lohnt; er liegt auf eben der Ebene, die schon mit Chamfort, Blake und Füssli näher bezeichnet wurde. — Vorab sei kurz der Inhalt des Stückes wiedergegeben; er läßt sich, da es wesentlich um die Klärung gedanklicher Positionen geht, in wenigen Sätzen umreißen. Byron drängt das Geschehen um Cain und Abel, seiner Vorliebe für die drei Einheiten, die schon Goethe belächelte15, Folge leistend, auf einen Tag zusammen. Den Sonnenaufgang begrüßen Adam und Eva und ihre Kinder Abel, Adah und Zillah mit einem Gebet, Gott zum Ruhm und Dank. Cain steht unbeteiligt daneben; von Gott, so entgegnet er auf die Bitte miteinzustimmen, habe er nichts zu hoffen oder zu erbitten, ihm gebühre auch kein Dank, denn wem verdanke der Mensch alles Elend und das schreckliche Geheimnis Tod wenn nicht ihm. An den mit seinen Eltern und Gott Hadernden tritt Lucifer heran, um ihn endgültig von der Bosheit des Allmächtigen zu überzeugen. Cain verlangt nach Wissen, und Lucifer bietet es ihm an um den Preis, daß er ihn verehre. Obgleich nun Cain ihm ebenso blinde Unterwerfung verweigert wie Gott, will Lucifer trotzdem dem Unzufriedenen Wissen verschaffen. Cain verläßt Adah, die vergeblich mit dem Hinweis auf ihre Liebe ihn zurückzuhalten sich bemüht, und tritt mit Lucifer eine zweistündige Reise durchs All an. Zuerst führt der gefallene Engel Cain vor, wie die heimatliche Erde nach und nach in den Weiten des Weltalls unter den Sternen sich verliert, sodann erläutert er, daß auch die Sterne nicht ewig seien; Welten entstehen und vergehen, wie es den Launen des Schöpfers beliebe, und selbst die Erde sei nicht für den Menschen neu geschaffen worden, sondern nur mehr ein Abglanz des wahrhaft glorreichen Gestirns, das sie einmal war. Im Hades dann zeigt Lucifer Cain die Schatten der früheren Erdbewohner; sie alle, eine Vielzahl ver13 Zu Byrons Kritik an calvinistisdien Glaubensprinzipien vgl. Steffan, a. a. O., p. 26 ff. 14 Byron, LJ, Vol. VI, p.24. is „Goethe gab mir redit und ladite dann über Lord Byron, daß er, der sidi im Leben nie gefügt und der nie nach einem Gesetz gefragt, sich endlich dem dümmsten Gesetz der drei Einheiten unterworfen habe." — Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. — Zürich 1948. p. 146. ( = Artemis-Gedenkausgabe. Bd. 24.)
Die Rebellion des Aristokraten
185
gangener Kulturen, waren dem Menschen an Größe, Schönheit, Klugheit und Macht weit überlegen. Mit diesem Wissen und der Ankündigung ständig in der Menschheitsgeschichte sich steigernden Elends und Leids läßt Lucifer Cain am Ende des 2. Akts allein. In solcher Geistesverfassung — aus Vergangenheit und Zukunft hatte Lucifer ihm weitere Gründe für seinen Hader mit Gott geliefert — wird Cain von Abel, unterstützt von Adah, zum Dankopfer aufgefordert. Er, der noch nie geopfert hatte, beugt sich widerwillig diesem Wunsch, sein Gebet aber gerät zur flammenden Anklage gegen den grausamen Gott. Abels Opfer, ein Lamm, wird angenommen, Cains Altar jedoch, mit Früchten geschmückt, verwüstet ein Wirbelsturm. Abels Bitte, in Demut sein Opfer zu wiederholen, lehnt Cain zornig ab; er will die Altäre eines Gottes, der nur Blut und Tod günstig aufnimmt, zerstören. Als Abel sich ihm in den Weg stellt, schlägt Cain ihn versehentlich so hart, daß er stirbt. Mit einem schrecklichen Fluch Evas belastet und von einem Engel Gottes mit dessen Zeichen versehen verläßt Cain, von Adah und seinem Sohn Enoch begleitet, die Gefilde vor Eden. — Byrons Helden haftet in der Literaturwissenschaft das Etikett des Rebellischen an; der aufbegehrende einzelne, so wurde stets von neuem gezeigt, lehne sich gegen ein ungerechtes Schicksal auf. In diese Reihe rebellierender „Byronic heroes" fügen auch, wie die Inhaltsangabe zeigt, Cain und Lucifer sich ein; diesmal geht es aber nicht um die Korrektur eines individuellen unglückseligen Geschicks, sondern um die Aufhebung des menschlichen Leids generell, mit Gott, dem Schöpfer eines schlechten Weltzustands, als dem Adressaten der Revolte. Dabei sind die theologischen Implikate des Aufbegehrens offensichtlich; sie wurden oben skizziert und sollen uns hier nicht des näheren beschäftigen. Ungeklärt aber blieb, was Rebellion denn historisch bedeute; kaum weiß man mehr vom Aufbegehren der einzelnen Helden, als daß sie, ob im modischen Exotismus der „Turkish Tales", ob in der frostigen Einsamkeit der Alpengipfel oder eben in der mythischen Ferne einer Landschaft vor Eden, in gleichsam geschichtlicher Neutralität also, gegen ein dem Menschen widriges Geschick sich wenden, ohne daß die dargestellte Situation wie die Situation des Darstellenden noch irgendwie ihre Revolte geschichtlich einfärbte. Um eben die historische Gestalt der Revolte aber ist es uns hier zu tun, um die Frage mithin, inwiefern Geschichte der Figur von Lucifers — ihm, nicht Cain, gehört unser Interesse — Aufbegehren sich eingeprägt hat. Die Kennzeichnung der Byronschen Helden mit dem Begriff der Rebellion wirkt dort, wo sie bei solcher Etikettierung stehenbleibt, weit eher mystifizierend als erhellend; so tragen sie nur ihren inhärenten Oppositionsgeist zur Schau wie ansonsten ihre düsteren, leiderfüllten Züge. Die Ergänzung aber des Begriffs von Revolte um seine historische Dimension läßt ebenso neues Licht fallen auf das Ungenügende am Weltzustand, das — oberhalb des individuellen Schicksals — ein Aufbegehren erst zwingend machte. Eine solche Konkretisation erweist sich gerade beim „Cain" als nötig; die Gattungsbezeichnung „A Mystery", mit der Byron sein Drama versah, deutet auf nichts anderes, als daß ihn am individuellen Schicksal
186
Lord Byron: Cain
seines Helden die Präfiguration des kollektiven Elends der Menschheit interessierte 16 . — Gewidmet ist das Drama Sir Walter Scott; er und Byron, zu ihrer Zeit die berühmtesten Autoren englischer Sprache, waren einander seit Jahren in Freundschaft und Respekt zugetan. Scott war denn auch einer der wenigen Freunde Byrons — Shelley bildet die andere Ausnahme —, die das Drama mit ungeteilter, ja enthusiastischer Zustimmung begrüßten, und dies, obgleich er die Auseinandersetzungen um das Stück voraussah 17 . Dieser Vorgang — Byrons Widmung sowohl als auch die Begeisterung Scotts — ist nicht ohne Aufschluß für das Drama: Was geschieht hier anderes, als daß ein programmatisch konservativer Autor das Werk eines Dichters rühmt, der zur Zeit der Hundert Tage mit seiner Napoleonbegeisterung seine Landsleute verstört hatte, der soeben als Konspirateur in Italien sich unliebsam machte und der als Freiheitssänger bereits europäischen Ruhm besaß? Es waren schließlich die konservativen Blätter und Autoren, die „Cain" mit vernichtenden Kritiken bedachten, während die Liberalen, die Byron von jeher zu den Ihren gezählt hatten, das Stück, wenn auch nicht ohne Einschränkung, lobten. Der pathetische Heroismus Cains und Lucifers mußte Scott, dessen „Helden" von gänzlich unheroischer Mittelmäßigkeit sind, und der ansonsten Heroismus durchaus historisch einzuordnen verstand, von Haus aus fremd sein. Kaum auch ist zu erwarten, daß ihm die Apologie der Revolte gegen den Weltzustand und dessen göttlichen Urheber größeres Vergnügen bereitete. Was dagegen Scott gefallen haben dürfte, ist, was kaum je die konservativen Kritiker Byrons notiert hatten, das stets schon im „Cain" mitgedachte notwendige Scheitern der Rebellion (die in ihrer Berechtigung davon freilich nicht berührt wird). Es sei die psychologische Spekulation erlaubt, daß Scott, der seiner affektiven Bindung ans Vergangene widerstreitend die Notwendigkeit von Veränderung nie leugnete, sich von Byrons Werk deshalb fasziniert sah, weil hier ein Protagonist von Veränderung den endlichen Sieg der beharrenden Kräfte selbst eingestand, wozu Scott sich nicht in der Lage sah. Freilich ist bei solcher Ausgangsposition, wenn sie denn richtig beschrieben ist, ein Zweifel an der Ernsthaftigkeit des dargestellten Änderungswillens am Platz. — Am Anfang des Dramas stehen Einverständnis, Selbstaufgabe und Genügsamkeit: Die Gebete Adams, Evas und ihrer drei Kinder Abel, Adah und Zillah sind nicht so sehr Bitte denn Ruhmesgesang auf die Schöpfung. In fünf Byron stellte sein D r a m a im Vorwort zwar explizit in die Tradition der Mysterienspiele, aber schon Steffan bemerkte: „One cannot take seriously Byron's prefatory statement about the reason for his subtitle, „ A Mystery"." (Steffan, a . a . O . , p. 297.) Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat Byron nicht ein einziges Mysterienspiel gekannt. W a s der Dichter, der auf begriffliche Feinheiten zu achten nicht gewohnt war, mit seiner Gattungszuordnung meinte, erhellt aus einem Brief vom 1 9 . 9 . 1 8 2 1 an Thomas Moore, in dem es über „Cain" heißt: „It is in the Manfred metaphysical style, and full of some Titanic declamation . . ( B y r o n , L J , Vol. V , p. 368) — Mysterium und Ideendrama, in dem es u m grundsätzliche Weltdeutung geht, gelten ihm als im wesentlichen gleich, wobei im ersteren die religiöse Thematik prädominiert. 17 Vgl. Steffan, a. a. O., p. 313f. 16
Die Rebellion des Aristokraten
187
Abschnitte zerteilt, an deren Ende jeweils das emphatisch umfassende Zustimmung erteilende „All Hail!" steht, wird die Geschichte von Schöpfung und Fall gefeiert und so dem Weltganzen die höchstmögliche Vollkommenheit beglaubigt. Alles dient dem Menschen zum Heil, und so bleibt ihm denn nichts zu fordern. Abel nun tut in der Angepaßtheit besonders sich hervor; seines steht in der Mitte der fünf Gebete, es umfaßt fünf Verse und nicht vier wie die der anderen. Er auch spricht die Formel frommen Einverständnisses: „Amen!" (1/25) 18 , eine seiner wenigen Bemerkungen vor der entscheidenden Szene mit Cain im 3. Akt. So ist Cains Gegensatz zu ihm von Anbeginn der schärfste, denn Cain verweigert das Gebet, weil er für nichts danken und um nichts bitten zu müssen glaubt. Selbst für sein Leben will er Gott nicht Dank sagen: Adam. Dost thou not live? Cain. Must I not die?
(1/29)
Adam bricht darauf sogleich in bekümmerte Selbstanklage aus: Oh God! why didst thou plant the tree of knowledge? Cain. And wherefore plucked ye not the tree of life? Ye might have then defied him. Adam. Oh! my son, Blaspheme not: these are Serpent's words. Cain. Why not? The snake spoke truth·, it was the Tree of Knowledge; It was the Tree of Life: knowledge is good, And Life is good; and how can both be evil? (1/32-8)
In diesem kurzen Gespräch sind die Begriffe genannt, um die die Auseinandersetzung geht; ihnen wird im weiteren Verlauf des Stückes nichts Wesentliches mehr hinzugefügt. Es sind die großen Menschheitsprobleme: das des Todes mit der entscheidenden Frage, ob der drohende, unbekannte Tod nicht alles menschliche Leben sinnlos und vergeblich madie, die Frage danach, was der Mensch wissen kann und soll, das Problem von Gut und Böse. Cain als einziger wirft sie auf, mehr noch, er legt ihre Klärung nicht in die Hände des Schöpfers, sondern stellt den eigenen Gedanken der gängigen Weltinterpretation, die die vom Herrschergott vorgegebene ist, entgegen. So pocht er von Anbeginn auf Autonomie, erkennend, daß die fraglose Bejahung der Weltordnung nur bei gleichzeitiger Unterwerfung unter die Intentionen ihres Schöpfers möglich ist. Eben hier aber setzen Cains Zweifel ein: Einem Gott, der dem Menschen Leben und Wissen verweigert und als böse hinstellt, was dem Menschen förderlich ist, in Selbstaufgabe sich zu ergeben, ist ihm unmöglich. Gegen ihn setzt er als Widerstand den Trotz („Ye might have then defied him."), die Negation in Kompromißlosigkeit. Dem entspricht, daß sein Zweifel zu eigener Weltdeutung nodi nicht fand und deshalb der gültigen ihre eigene Umkehrung abstrakt entgegenhält: „The snake spoke truth ..Was dem Herrschergott als böse gilt, wird für Cain zum Guten. Damit aber fällt er, der die geltende Ethik 18
Zitiert ist „Cain" nadi: The Works of Lord Byron. Poetry. Ed. by Ernest Hartley Coleridge. — London/New York 1905. pp. 197—275. (Angegeben sind jeweils Akt und Vers, bei Zitaten aus dem 2. Akt Akt, Szene und Vers.)
188
Lord Byron: Cain
für sich als unverbindlich erklärt, aus dem sozialen Zusammenhalt in die Vereinzelung. Zum Anwalt des Bestehenden dagegen wird weniger Adam als Eva, die als erste Gesetzesbrecherin am entschiedensten nach der Strafe die Gesetze Gottes verinnerlichte: Content thee with what is.
(1/45)
Als Vorbild stellt sie nach diesem Imperativ der Selbstbescheidung Cain seinen Vater hin: Cain — my son — Behold thy father cheerful and resigned — And do as he doth. (1/50-2)
Indem sie aber an Adam rühmt, daß er sich abgefunden habe, gesteht sie unwillentlich die Berechtigung von Cains Widerstand ein. Solche Zufriedenheit in Resignation und Genügsamkeit in Passivität eben ist es, worin Cains Aufruhr nicht gegen den Herrschergott allein, sondern zugleich gegen dessen irdische Gefolgschaft sich begründet; beide gelten ihm als Stützen der schlechten Wirklichkeit. Gegen die Fraglosigkeit in Heteronomie richtet Cain sich als autonomes Subjekt auf und klagt als einziger seine Redite ein, wohl wissend, daß er damit nicht allein gegen einen ungerechten Gott, sondern zugleich gegen dessen irdische Statthalter sich richtet. Die Revolte gegen Gott ist untrennbar vom Widerstand gegen die Verhältnisse auf der Erde. Diese Skizze zu Cain, aus dem ersten Gespräch gewonnen, ist notwendig, um den zu verstehen, der nun als Versucher an ihn herantritt. Denn Lucifer stellt ausdrücklich als dessen Gefährten sich vor: And hadst thou not been fit by thine own soul For such companionship, I would not now Have stood before thee as I am . . . (1/192-4)
Was beide eint, ist zum einen der Widerstand gegen den Herrschergott, zum anderen die Insistenz auf Autonomie, die auch in Lucifer zur vollständigen Negation des Bestehenden führt. Die zeitgenössische Kritik wie auch später manche Literaturwissenschaftler haben es dem Stüde als wesentliche Schwäche angelastet, daß zwischen Lucifer und Cain kaum bedeutsame Unterscheidungsmerkmale in der Charakterzeichnung bestünden; ihre Gespräche dienten einzig der bühnengerechten Formulierung eines Programms, über dessen grundsätzliche Punkte schon von vornherein Einverständnis zwischen ihnen bestünde. Dieser Befund, so sehr er nodi der Modifikation im einzelnen bedarf, trägt in seiner wesentlichen Aussage: Bei Byron ist von der grundsätzlichen Andersartigkeit der Geisterwelt, wie sie für Klopstock noch ein zentrales Darstellungsproblem war, nichts mehr belassen; Mensch und Geist, Cain und Lucifer, haben einander so sehr angeglichen, daß die Unterschiede aufgrund irdischer und zölestisdier Herkunft daneben kaum noch als bedeutungsschwer ins Gewicht fallen. Dies sagt einiges über den historischen Ort dieser Lucifergestaltung: Daß nämlich Lucifer sich völlig vermenschlicht, ist Indiz für den Abbau metaphysischer Erklärungsweisen des Bösen. Was Lucifer über den Ursprung des Bösen sagt, konnte der Mensch vor ihm schon ebenso formulieren: Lucifer bestätigt einzig
Die Rebellion des Aristokraten
189
die Botschaft vom bösen Gott, die Cain bereits sich zurechtgelegt hatte. Daß eben, wie das letzte Zitat zeigt, eine gewisse Konditionierung des Menschen Voraussetzung für das Auftreten Lucifers ist (ganz anders als im Mittelalter, wo jeder dessen Versuchungen ausgesetzt war), läßt diesen wesentlich überholt erscheinen. Die Anthropomorphic ist Ausdrude dessen: Der Mensch verständigt sich mit sich selbst über das Böse in der Welt, ohne daß es noch seiner metaphysischen Hypostase bedürfte. Wie er es ist, der das Böse tut (Lucifer gab Cain nicht einmal den Gedanken zum Mord an Abel ein), so wird er auch zu dessen Erklärung fähig. Die Wesensverwandtschaft Cains und Lucifers deutet auf eine Selbstverständigung des ersteren, nicht auf die Übernahme vorformulierter Weltdeutungen. Lucifer gleicht einem alter ego Cains. Dessen gesellschaftlich geächtete Gedanken treten aus ihm heraus und verdichten sich zu einer anderen Gestalt, die ihren gedanklichen Ursprung nirgends verleugnet: An keiner Stelle greift sie handelnd ins Geschehen ein, einzig über Raisonnement tritt sie zu Cain in Kontakt. Selbst die Reise durchs All ähnelt einem Tagtraum Cains: Wie die Phantasie in kürzester Frist große Räume zu durchmessen vermag, so führt Lucifer, Zeit und Raum überwindend, Cain in zwei Stunden durch den Kosmos. So ist denn auch nicht bedeutungslos, daß neben Cain nur Adah, seine einzige Vertraute, Lucifer, als die Objektivierung verfemter Gedanken, zu sehen bekommt: Nur dem engsten Vertrauten eröffnet der Rebell ganz seine Ansichten. Diese Sicht Lucifers als eines imaginären inneren Gesprächspartners Cains wird nicht dadurch widerlegt, daß jener sich von diesem in wesentlichen Punkten, vor allem dem der Lieblosigkeit, unterscheidet im Gegenteil, wäre hier völlige Gleichheit zu konstatieren, fiele jedes Argument für ein solches Verständnis Lucifers fort: Gerade über die Kollision des Divergierenden findet Selbstverständigung statt; andernfalls wäre Identität bereits erreicht. Lucifer bleibt im Stück eine durchaus eigenständige Gestalt, er ist nicht Cain, sondern in Lucifer treten diesem seine eigenen Gedanken gegenüber, bis zur äußersten Konsequenz getrieben, befreit von jeglicher Rüdssicht auf Glaube, Konvention und gesellschaftliche Norm. Identitätsfindung findet nicht mehr über die fraglose Abgrenzung vom in Lucifer traditionell sich verkörpernden Bösen statt, sondern das Individuum hofft über die Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlich Verworfenen, das, als von den herrschenden Mächten definiert, immer schon von Heteronomie kündet, zu wirklicher Identität zu finden. Daß dem einzelnen diese seine abweichenden Gedanken in der Gestalt Lucifers gegenübertreten, zeigt nur, daß sie gesellschaftlich geächtet sind; daß freilich dieser Lucifer schöner ist denn je, beweist die Intensität, mit der sie ihn locken. — Subjektive Weltdeutung aus der Position der Vereinzelung heraus vollzieht die Gegenbewegung zur Theodizee des 18.Jhs, die optimistisch auf die Gelungenheit des Weltganzen baute. Während in ihr die Sinnhaftigkeit der Objektivität wie die Geborgenheit des Subjekts in der Schöpfung bestätigt wurde, so wird hier vom Subjekt ausgegangen: Ihm präsentiert sich das Objektive als 19 Für die Unterschiede zwischen Lucifer und Cain vgl. Stefïan, a. a. O., p. 35—60.
190
Lord Byron: Cain
übermächtig, sinnlos und ungeregelt. Das naive Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der W e l t ging verloren — spätestens die Französische Revolution setzte hier politisch eine scharfe Zäsur; die rasche Industrialisierung mit ihrem ungeheueren Massenelend 2 0 ließ zudem die bequemen Beschwichtigungsversuche der Theodizee endgültig überholt erscheinen: Die Konzentration des Proletariats in den Städten wie die gemeinsame Arbeit in den Fabriken erlaubte die Interpretation individuellen Leids aus dem kollektiven Geschick, und nodi der friedfertigste Arbeiter dürfte angesichts des täglich sich wiederholenden und massenhaft sich ausbreitenden Elends sich kaum mit der Ansicht beruhigt haben, dies alles diene Gott zur Erhaltung der besten, also der bestehenden Welt. An der Häufung und der Veröffentlichung des Elends versagt die Theodizee; an die Stelle des Gottvertrauens treten Ökonomie und Politik: In Byrons Zeit entstehen die großen Entwürfe des Frühsozialismus. Allemal aber ging endgültig das Gefühl der Geborgenheit in einer sinnhaften Schöpfung verloren; wenn nichts anderes so hätten schließlich die auf ungeregelter Warenproduktion beruhenden Krisen des Marktes ihm ein Ende gesetzt. Eben diese Abkehr von der Theodizee vollzieht Byrons „Cain" aufs deutlichste; er zeigt zugleich als ihr Pendant die Vereinzelung. An die Stelle des gütigen Regiments eines alles regelnden Vaters treten die Capricen des unbeteiligt rücksichtslosen Herrschergottes, der, unbekümmert um individuelles Leid und kollektives Elend, seinen Launen nachgeht, hier neue Welten schafft und dort andere vernichtet, hier hochstehende Kulturen zerstört und dort neue zu Ansehen bringt, nach Willkür Existenzen vernichtend und aufbauend, wie dies sonst nur der unüberschaubare Markt tut. Dies ist nicht falsch zu verstehen: Byrons Gott ist gewiß nicht die mythische Objektivation des Marktes. Andererseits aber gilt: Die Weise, wie Cain, das leidende Subjekt, seinen Gott und dessen Schöpfung wahrnimmt, entspricht historisch durchaus der Welterfahrung, wie sie als Reaktion auf den anarchischen Markt sich ergibt; sie ist bestimmt von Kontingenz und Vereinzelung, Willkür und Sinnlosigkeit. Die undurchschaute Launenhaftigkeit des Marktes, die Vereinzelung in ungesicherten Arbeitsverhältnissen wie die Abhängigkeit des Produzenten von unüberblickbaren, weil weltweiten Handelssystemen und Warenströmen verboten das beglückte Gottvertrauen der Theodizee, in welcher Philosophie das Bürgertum des 18. Jhs noch seine eigene Aufblüte und Prosperität gefeiert hatte. Die Produktionsverhältnisse sind auf die Krise hin angelegt, und eben hierauf reagiert das Bild vom bösen, launenhaften Gott. E s findet sich häufig in der Literatur der ersten Jahrzehnte des 19. Jhs, so in Deutschland bei Tieck, Bonaventura und Immermann, in England neben Byron bei Blake und Shelley, in Frankreich bei Vigny, Musset, Lamartine, in
Hobsbawm schreibt über die Jahre von 1780 bis 1850, die in England eine Zeit von „Hoffnungslosigkeit und Hunger" gewesen sind: „In keiner anderen Periode der neueren britischen Geschichte zeigte das Volk eine so andauernde, so tiefe und oft verzweifelte Unzufriedenheit. Von keiner anderen Periode seit dem 17. Jahrhundert kann man sagen, daß sie in großen Teilen der Bevölkerung ein revolutionäres Potential freigesetzt habe." — Eric J. Hobsbawm: Industrie und Empire. Britische Wirtschaftsgeschichte seit 1750. Bd. 1. — Frankfurt 1969. p. 73.
Die Rebellion des Aristokraten
191
Italien bei Leopardi. Karl S. Guthke ist dem in einem Aufsatz nachgegangen; seiner Deutung zufolge geht, als Ergebnis der extremen Subjektivierung des Romantikers, der kosmische Sinn verloren. Aus der „romantischen Erfahrung der Identität von Unendlich und Null" 21 erklärt sich der Verlust der Sinnhaftigkeit des Alls; an die Stelle aber des verschwundenen Gottes treten Gespenster und Dämonen als Konkretisationen des Widersinne. — Guthkes geistesgeschichtliche Interpretation hält als wesentliche historische Erfahrung, auf der der Mythos vom bösen Gott ruht, die Vereinzelung fest; sozialgeschichtlich freilich hat sie als Entstehungsgrund die bis zur Krisenhaftigkeit entwickelten Produktionsverhältnisse. Vereinzelung aber, wie sie dem Bild vom bösen Gott korrespondiert, ist zugleich die Grunderfahrung Cains; sie zu fördern, die Subjektivierung ins Extrem zu treiben, ist Lucifer angetreten. Aus dieser Konstellation eben erklärt sich die Rebellion Cains; es ist die des einzelnen gegen die undurchschauten Verhältnisse. Daß hier nicht mehr die Wirklichkeitswahrnehmung des 18. Jhs gestaltet ist, zeigt zudem sidh daran, daß die Distanz zwischen Cain und Abel zugleich eine historische ist: Cain ist der hart arbeitende Mensch, der mit Mühe der Erde sein Brot abringt und darüber Klage führt, Abel hingegen genießt das Leben des heiter genügsamen Hirten, wie ihn gerade das 18. Jh. in seinen zahlreichen Pastoralen und Idyllen als Bild einer erfüllten Existenz abzuschildern liebte. Fragen nach der Sinnhaftigkeit menschlichen Lebens standen solchen Hirten fern. Vor den Erfahrungen moderner Arbeitswelt freilich geht ihr Bild zuschanden: Mit Abel stirbt zugleich die Illusion seiner Idylle hinweg. Cain spricht: I feel the weight Of daily toil, and constant thought: I look Around a world where I seem nothing . . .
(1/174-6)
Adam, Eva und Abel, die Apologeten des Bestehenden, gehören dagegen noch ganz dem vergangenen Jahrhundert an 22 ; ihr wesentliches argumentatives Rüstzeug sind die Güte Gottes und die Gelungenheit des Ganzen, wie sie die Theodizee formulierte. Cain nur schiebt dieses Bild beiseite und stellt sich den Erfahrungen der Wirklichkeit, vor denen es sogleich versagt: I never could Reconcile what I saw with what I heard.
(1/168-9)
Aus solcher Wirklichkeitserfahrung erklärt sich die Wißbegierde Cains: Cain. But thou canst not Speak aught of Knowledge which I would not know, 21
22
Karl S. Guthke: Der Mythos des Bösen in der westeuropäischen Romantik. — In: Colloquia Germanica. 2 (1968), p. 5f. Neben Theodizee und Pastorale attackiert Byron implizit noch eine dritte Lieblingsvorstellung des 18. Jhs: die des edlen Wilden. „To attack Adam, the man of virtue happy because of his ignorance, is manifestly to attack the first assumption of the noble savage idea, the assumption that innocence based upon ignorance represents man's highest good." — Ernest J. Lovell, Jr.: Byron: The Record of a Quest. Studies in a Poet's Concept and Treatment of Nature. — Hamden 1966. p. 250.
192
Lord Byron: Cain And do not thirst to know, and bear a mind To know. Lucifer. And heart to look on? (1/246-9)
Auf welche Fragen „knowledge" zu antworten hat, auf welche Gegenstände es sich richtet, bleibt unbestimmt: Das Wissen wird nicht spezifiziert, da von ihm sich Cain die Restitution der Sinnhaftigkeit erhofft. Der Wissensdurst konzentriert einzig deshalb sich auf keinen besonderen Gegenstand, weil Cain von Lucifere Wissen ( „ . . . I, who know all things . . . " (1/300)) die Überwindung der Vereinzelung, die Synthese des Besonderen erwartet. Lucifers Wissen soll dort erneut Sinn stiften, wo dieser objektiv längst verlorenging. Cain löste sich zwar von jener Ideologie der Tadellosigkeit des Weltganzen, die seine Eltern propagieren; die Lücke jedoch, die nach deren Fortfall offenblieb, erträgt er nicht. Unverbrüchlich hält er an der Vorstellung fest, daß dem Ganzen ein geheimer Sinn zugrundeliege, den Lucifer ihm erschließen könne. Selbst noch am Ende der Reise durchs All, die ihn von der Willkür des Ganzen überzeugen sollte, wünscht er: . . . perchance An unity of purpose might make union In elements which seem now jarred in storms.
(II/II, 377-9)
Im Begriff von „knowledge" formuliert sich die Insistenz auf objektiver Weltdeutung, die Sehnsucht nach der einen Formel, die alles einzelne aus seiner Besonderung erlöst und einem einsichtigen Muster einfügt. Daß er Cain diese Formel verweigert, darin liegt Lucifers Wahrheit. Seine Antwort auf Cains Begehren, die Rückfrage nach dessen Mut, die der Anblick der Wahrheit erfordere, hätte diesen stutzen lassen müssen; in ihr ist bereits angedeutet, daß Lucifers Wahrheit nicht über das hinausgeht, was Cain schon sieht. Die Versöhnung von Cains Erfahrung mit dem, was er von Lucifer zu hören bekommt, gelingt mühelos, weil dieser nur ex cathedra formuliert, was jener sich längst zurechtgelegt hatte: Thou speak'st to me of things which long have swum In visions through my thought . . . (1/167-8)
Lucifer ist der konsequente Desillusionist; dort wo die Verhältnisse selbst in sich zutiefst unwahr sind, braucht er nur die Wahrheit über diese auszusprechen und abzuwarten, daß der so Aufgeklärte sich auf seiner Seite gegen sie stellt: Save with the truth . . .
I tempt none, (1/196-7)
Versuchung meint hier: Herauslocken des einzelnen aus seiner falschen Geborgenheit im Unwahren, meint zugleich: Daß er übers Bestehende die Wahrheit sagt, gilt diesem bereits als Beweis für Lucifers Gegnerschaft. Lucifers Kalkül ist dies: Wer sich die Wahrheit übers Bestehende zueigen gemacht hat, kann sich mit ihm nicht mehr versöhnen. Deshalb spiegelt er Cain dort keine Sinnhaftigkeit vor, wo sie nicht besteht — darauf vertrauend, daß eben dieser Mangel seinen Widerstand befördert.
Die Rebellion des Aristokraten
193
Wenn also Cain bezweifelt, daß Gottes Allmacht eine universale Güte entspreche, so treibt Lucifer diesen Gedanken ins Extrem: He is great — But, in his greatness, is no happier than We in our conflict! Goodness would not make Evil; and what else hath he made? But let him Sit on his vast and solitary throne — Creating worlds, to make eternity Less burthensome to his immense existence And unparticipated solitude; Let him crowd orb on orb: he is alone Indefinite, Indissoluble Tyrant; Could he but crush himself, 'twere the best boon He ever granted: but let him reign on! And multiply himself in misery! (...) But He\ so wretched in his height, So restless in his wretchedness, must still Create, and re-create — (1/144-156,161-3)
In diesem Bild des in sich selbst verhausten Gottes, der die tödliche Langeweile seiner Ewigkeit durch unermüdliches, zielloses Schöpfertum zu mildern trachtet, scheint deutlich das des Marktes auf: Die Universalität seiner Herrschaft hat sich ihm ebenso eingezeichnet wie die bedingungslose Unterordnung des einzelnen unter sie, die Rastlosigkeit der Produktion in gleicher Weise wie deren Ungeregeltheit, die Massenhaftigkeit und Permanenz der Herstellung nicht anders als die Nichterfüllung des Glücksversprechens. Unbekümmert um den einzelnen verkündet er mit seinem umfassenden Angebot das Glück aller (Adam, Abel und Eva vertrauen seinem Versprechen), ohne es ihnen doch je wirklich bieten zu können; jeder ist ihm, der individuelles Elend und kollektives Leid mit sich bringt und darüber uninteressiert hinweggeht, in seiner Willkür Untertan. Die Formulierung „Indefinite, Indissoluble Tyrant" reagiert darauf: Sie kündet ebenso von Willkür und Sinnlosigkeit wie von Universalität und individuellem Ausgeliefertsein. — Hier auch bereits gelangt massiv zum Ausdruck, was das Aufbegehren des Rebellen entscheidend relativiert: das Wissen um seine letztendliche Machtlosigkeit diesem Gott gegenüber, die Unumstößlichkeit von dessen Herrschaft, an der sein Widerstand versagt. Am Weltzustand, wie Byrons „Cain" ihn schildert, ist echte Korrektur nicht mehr möglich; er ist endgültig festgeschrieben. Cain. Ah! Thou look'st almost a god; and — Lucifer. I am none: And having failed to be one, would be nought Save what I am. He conquered; let him reign! (1/127-130)
Dies ist kein Zweckdefätismus, der Cains Widerstand des weiteren anzustacheln intendiert, sondern das illusionslose Eingeständnis individuellen Versagens vor dem schlechten Ganzen, rückhaltlose Aufklärung über einen historischen Befund. Echte Zukunft ist in dieser Welt nicht mehr möglich, nachdem Lucifers
194
Lord Byron: Cain
Gegenentwurf — er wird nirgends ausgemalt — nicht zur Ausführung gelangte. Byron verlängert, darin vor allem die faktische Ausgeliefertheit des einzelnen an die schlechte Wirklichkeit demonstrierend, Zustand und Erfahrung des entfalteten Kapitalismus in alle Zukunft; pessimistisch bestätigt er dessen Willkür und Ungerechtigkeit, Menschenfeindlichkeit und Irrationalität Ewigkeit 23 . Das Ausgeliefertsein des einzelnen an die etablierten Produktionsverhältnisse konnte nicht schärfer zum Ausdruck gelangen als darin, daß selbst deren Gegner die Hoffnungslosigkeit propagiert. Zukunft heißt in Byrons „Cain" nichts anderes als willkürliche Permutation des schon Bestehenden. — Deshalb reicht es nicht aus, mit Steflan oder Bostetter 24 in Jehovah nichts anderes zu sehen als die Verkörperung der traditionellen konservativen Regierungen, deren Herrschaft Byrons Widerstand von jeher galt. Diese waren gegebenenfalls zu stürzen und durch neue zu ersetzen, wie die Französische Revolution vehement bewiesen hatte. Im „Cain" aber hat Herrschaft eine neue Qualität bekommen: Sie ist anonym und unpersönlich. Jehovah ist kein individualisierter Gott, an den der einzelne sich bittend und dankend zu wenden vermöchte. Auf die Frage, wo Jehovahs Wohnung sei, entgegnet Lucifer Cain: „Here, and o'er all space." ( I I / I I , 368) Nicht die Herrschaft obsoleter Fürsten ist in Gott gestaltet, sondern die weit umfassendere von Verhältnissen, denen niemand mehr zu entrinnen vermag25. Auch der Kritiker und Rebell wird von ihnen eingefangen — eben deshalb akzentuiert Lucifer das „hier" in seiner Replik. Seine Ohnmacht ihnen gegenüber gesteht er jedoch vor allem darin ein, daß er ihre Vernichtung, die ihm nicht gelingt, ihnen selbst als Aufgabe zuweist: „Could he but crush himself . . V o r der Allmacht der Verhältnisse resigniert deren Kritiker mit historischer Ausweglosigkeit; sie nach vorne zu transzendieren gelingt ihm nicht. Dieser Verzicht auf Zukunft bedeutet allerdings nicht Geschichtslosigkeit. Der Gedanke der ewigen Wiederkehr des Gleichen, der dem 19. Jh. so faszinierend war, hat bereits in der ewigen Monotonie von Schöpfung und Vernichtung, wie Byrons Gott sie betreibt, seinen frühen Ausdruck gefunden. Seine Aktualität verdankt er selbst historischen Umständen: Für den Gedanken der ewigen Wiederkunft hat die Tatsache ihre Bedeutung, daß die Bourgeoisie der bevorstehenden Entwicklung der von ihr ins Werk gesetzten Produktionsordnung nicht mehr ins Auge zu blicken wagte. 26 23 „God, like Lucifer, is merely the despair and sorrow of man writ large, carried on into eternity." — Robert F. Gleckner: Byron and the Ruins of Paradise. — Baltimore 1967. p. 324. 24 Vgl. vor allem den höchst lesenswerten Aufsatz von Edward E. Bostetter: Byron and the Politics of Paradise. — In: PMLA. LXXV (1960), pp. 571—6. — Im Anschluß daran Stefïan, a. a. O., p. 58. 25 Byron war in seiner Kritik an politischen Zuständen zu personalisieren gewöhnt; dies hindert freilich nicht, daß er das qualitativ Neue bürgerlicher Herrschaft intuitiv erfaßt hat. 26 Walter Benjamin: Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus. Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Rolf Tiedemann. — Frankfurt 1974. p. 173.
Die Rebellion des Aristokraten
195
Faszinierend war der Gedanke fürs Bürgertum deshalb, weil mit der Wiederkunft überwundener Krisen . . . in kleineren Fristen, als sie die Ewigkeit zur Verfügung stellte, nicht unter allen Umständen mehr zu rechnen w a r . 2 7
Trägt so die Konzeption von Byrons Gott erneut ihre historische Signatur an sich — in ihr verschwistert sich die Dämonie der Produktionsverhältnisse mit dem Narkotikum gegen ein allzu starkes Bewußtsein von ihr —, so wird sie doch von einer Geschichtskonzeption unterlagert, die ihr scheinbar widerspricht: Dem kosmischen Gesetz der ewigen Wiederkehr begegnet als irdisches das der ständigen Depravation; Lucifers Wissen, mit dem er Cain an sich zu binden trachtet, findet in ihm sein schärfstes Argument. Häufig ist von Byrons Kritikern der gesamte 2. Akt des „Cain", mit der Reise durchs All und dem Besuch im Hades, als für die Konzeption des Stückes sinnlos und überflüssig verworfen worden; zumal die Präsentation der präadamitischen Kulturen schien ihnen kaum mehr als eine Bildungsschrulle Byrons zu sein, in der dieser Gedanken aus Cuviers „Discours sur les révolutions de la surface du globe" referierte, und ließ ansonsten ratlos. Dabei ist eben jene Szene für die Geschichtskonzeption Byrons aufs äußerste aufschlußreich. Ihr liegt der Gedanke zugrunde, daß die Erde, bevor Gott sie in ihrer jetzigen Form bildete, schon viele Male in je anderer Gestalt von wechselnden Kulturen bewohnt worden sei, die alle in jeder Hinsicht den Menschen übertrafen. Auch die Erde also unterliegt dem sinnlosen Ablauf von Zerstörung und folgendem Neuaufbau, freilich mit einer entscheidenden Modifikation: Ihr jeweils neuer Zustand ist im Vergleich zum vorhergehenden minderwertig. Die junge Erde, die der Mensch soeben betrat, ist nichts anderes als das Ergebnis eines schon ewig andauernden Verfalls; mit eben diesem Gedanken macht Lucifer Cain vertraut. Angesichts der Präadamiten fragt Cain: Cain. And these, too — can they ne* er repass To earth again? Lucifer. Their earth is gone for ever — So changed by its convulsion, they would not Be conscious to a single present spot Of its new scarcely hardened surface — 'twas — Oh, what a beautiful world it was\ (II/II, 119-124)
Und auf Cains Einwand, daß ihm die Erde durchaus zusage: Lucifer. What thy world is, thou see'st, But canst not comprehend the shadow of That which it was. (II/II, 130-2)
Und noch ein drittes Zitat ist hier heranzuziehen; auf Cains Frage, welcherart Wesen die Präadamiten gewesen seien, entgegnet Lucifer: Living, high, Intelligent, good, great, and glorious things, 27
Benjamin, a. a. O., p. 159.
196
Lord Byron: Cain As mudi superior unto all thy sire Adam could e'er have been in Eden, as The sixty-thousandth generation shall be, In its dull damp degeneracy, to Thee and thy son; — and how weak they are, judge By thy own flesh. (II/II, 67-74)
Hat so zwar die Menschheit eine Zukunft, so liegt sie doch in fortschreitender Degeneration; zu betonen ist, daß Lucifers Geschichtskonzept unwidersprochen bleibt. Mehr noch, Cain liefert sich ihm gänzlich aus, wenn er im 3. Akt in einem Augenblick vollständiger Verbitterung seinen Sohn Enoch zu töten sich anschickt, um der Menschheit dies sich aufgipfelnde Elend zu ersparen. Von größerem Belang aber als der verachtungsvolle Blick auf die schlechte Zukunft der Menschheit ist die panegyrische Verklärung des Vergangenen. Lucifer verurteilt Cain nicht allein damit zur Hoffnungslosigkeit, daß er ihm die gelungene Zukunft verweigert, sondern vor allem, indem er ihm eine Vergangenheit entgegenhält, vor deren Ansprüchen der jetzige Mensch versagen muß. Eben hierin hat die Hades-Szene ihre Bedeutung: In ihr dominiert ein Bewußtsein von Spätzeitlichkeit, das seinen Hohn für die Anstrengungen der gegenwärtigen Menschen aus der Überzeugung legitimiert, daß die große, die wahrhaft bedeutende Geschichte der Welt schon längst hinter ihnen liegt. Was der Menschheit als Ideal von Vollkommenheit gegeben ist, der affektive, intellektuale und ethische Höchststand im Einklang, ist bereits der Vergangenheit als deren größte, vor allem aber unwiederholbare Leistung eingelagert. Darauf ist zu insistieren: Bei Byron erscheint das Ideal irdischer Selbstverwirklichung ausdrücklich in eine historische, nicht — wie zu erwarten gewesen wäre — in eine mythische Distanz (also das verlorene Paradies) entrückt. Dem entspricht, daß Byron dem Paradies im „Cain" kaum positive Epitheta gönnt, ja daß es nicht einmal nähere Charakteristik erfährt; Lucifers Sicht des Paradieses dominiert: A Paradise of Ignorance, from which Knowledge was barred as poison. (II/II, 101-2)
Daß nicht das Paradies als Vorbild erfüllter Existenz erscheint, hat seinen genauen Grund darin, daß dem verlorenen Paradies als sein Gegenstück im Christentum immer das wiedergewonnene entspricht. Dies aber fehlt im „Cain", auch wenn Byron sich gelegentlich in den Worten Adahs einer Anspielung (III/85—6) nicht hat enthalten können, völlig, und dies nicht aufgrund überpenibler Bibeltreue (im Vorwort wird besonderes Gewicht darauf gelegt, daß im Alten Testament jede Anspielung „to a future state" fehle), sondern weil mit ihm das Geschichtsbild des ständigen Verfalls durchbrochen gewesen wäre: Die Einbringung des christlich eschatologisdien Moments in den „Cain" hätte das düstere Zukunftsbild Lucifers zur Wirkungslosigkeit verurteilt. Eben deshalb wird zum Bild gelungenen Lebens nicht das Paradies, sondern eine historische Vorform menschlicher Existenz, der mit solcher historischen Faktizität Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit attestiert sein soll. Der Geschichtspessimismus obsiegt darin der messianischen Idee. — Sicher trägt
Die Rebellion des Aristokraten
197
nun Luciíers prospektive Darstellung der irdischen Geschichte als der eines fortschreitenden Verfalls, indem sie sich aus der Vergangenheit überwältigende Evidenz holt, zusätzlich zu Cains Verstörung und Verzweiflung über einen bösen Gott bei. Dodi leistet die Szene mehr. Lucifers Zeugenschaft an der Vergangenheit wie seine Klage über deren Verlust weisen ihn als einen aus, der an der heroischen Phase der Weltgeschichte noch partizipiert. Indem er die jetzige Welt und deren Bewohner aus dem Erlebnis der vergangenen beurteilt, beide vergleichend kontrastiert und seine Parteilichkeit für die erstere, an der er erinnernd noch Anteil hat, nirgends verleugnet, wird die schlechte Gegenwart vor den Richterstuhl der großen Vergangenheit gestellt, als deren Vertreter Lucifer, der in seiner Größe und seinem Glanz einsteht für Ruhm und Glorie des Gewesenen, erscheint. Der Gegenwart wird das Urteil gesprochen, aber nicht, wie noch zu zeigen ist, weil ihr detailliert ihre eigenen Mängel nachgewiesen wurden, sondern weil sie in ihrer Inferiorität sich mit der Größe der Vergangenheit nicht messen kann. So aber, wie der mediokre, verächtliche Mensch der Gegenwart durch eigene Anstrengung niemals mehr das Niveau der unvergleichlich überlegenen Wesen der früheren Welt erreichen kann, so sind sonst nur in Byrons Vorstellung Aristokrat und Durchschnittsbürger, der auch niemals durch eigene Arbeit erlangen kann, was jenem aus seiner Herkunft und Geschichte gegeben ist, voneinander getrennt. Lucifers Auftreten in der Gegenwart des Menschen Cain und seine hochmütige Einschätzung dessen, was der Menschheit in der Zukunft noch übrig bleibt, nachdem die bedeutenden Geschlechter die Erde verlassen haben, gleicht durchaus der Erschütterung des Aristokraten vor dem Nivellement der industriellen Massengesellschaft, in die er als feudales Fossil hinüberreicht. Lucifers Geschichtspessimismus ist der des Aristokraten, der angesichts der Zurückdrängung seiner eigenen Klasse gänzlich am Gang der Geschichte verzweifelt. Eben hieraus erklären sich die Zukunftslosigkeit und die Resignation vor den Mängeln der Gegenwart im „Cain" : In ihnen bricht sich die historische Ausweglosigkeit der Aristokratie. So auch wird die Kollision der beiden Geschichtsbilder in Byrons „Cain" verständlich: Das irdische Gesetz ständigen Verfalls, in dem der Adelige seine Mutlosigkeit angesichts der eigenen welthistorischen Chancen zum Ausdrude bringt, hat sich bereits dem umfassenderen bürgerlichen der ewigen Wiederkehr des Gleichen untergeordnet; vereint sind sie in der Negation des Fortschrittsgedankens, von welchem nicht die leiseste Spur in Byrons „Cain" Eingang fand. — Hierzu ein kurzer biographischer Exkurs. Für Byrons Geschichtspessimismus Zeugnisse zu finden, hält ebensowenig schwer, wie sein dezidiertes Aristokratentum zu belegen. Nur eine Bemerkung sei hier wiedergegeben; in den „Detached Thoughts", die ins Entstehungsjahr des „Cain" fallen, findet sich folgendes: Like Sylla, I have always believed that all things depend upon Fortune, and nothing upon ourselves. I am not aware of any one thought or action worthy of being called good to myself or others, whidi is not to be attributed to the Good Goddess, Fortune! 28 2« Byron, LJ, Vol. V, p. 451.
198
Lord Byron: Cain
Dergleichen historischer Defätismus aus dem Munde des gefeiertsten Freiheitshelden der Zeit ist einzig erklärlich aus dessen Aristokratismus; diesem entsprach Byrons gänzliches Unverständnis für historische Prozesse. Seine Napoleonverehrung gibt hierfür den sprechendsten Beleg; empört äußert er sich gelegentlich über Madame de Staël: In endeavouring to be new she became often obscure, and sometimes unintelligible. What did she mean by saying that .Napoleon was a system, and not a man?' ( . . . ) H e was a glorious tyrant, after all. Look at his public works: compare his face, even on his coins, with those of the other sovereigns of Europe. 2 9
Byrons Verständnislosigkeit gegenüber Madame de Staëls Bemerkung findet ihren Grund darin, daß für ihn Geschichte nicht mehr war als ein Schauplatz der Selbstverwirklichung heroischer Einzelgestalten, deren Singularität selbst physiognomisch sich nodi bestätigt. Ihrer Glorie haben sie es zu danken, daß Byron ihnen Unterdrückung verzeiht; der Kämpfer für Freiheit schlägt dort sich auf die Seite von deren Gegnern, wo sie ihm Gefährten in einem noch bedeutsameren Kampf dünken: dem gegen die Mittelmäßigkeit. Byrons in Szene gesetzte Freiheitsliebe, sein veröffentlichter Kampf für die Sache unterdrückter Nationen, stellt so sich dar als der Versuch, künstlich den Heroismus der überlegenen Einzelkämpfer, der aristokratischen Helden in die Moderne hinüberzuretten; mochte sich in seinem Bewußtsein der Kampf für die Rechte der anderen auch an die erste Stelle geschoben haben, so dient jener ihm dodi dazu, die eigene Lebensart nur umso deutlicher zu ihrem Recht kommen zu lassen. Der Freiheitskampf wird zum Remedium des Aristokraten gegen das Nivellement; deshalb findet er nicht in seinem Heimatland, sondern an Orten statt, die von dort gesehen schon exotisch wirkten. Byron tritt für Freiheit ein, ohne sie doch jemals genauer zu bestimmen denn als nationale Souveränität; in seiner Gestalt wird der Kampf für Freiheit zum Instrument des Kampfes gegen Gleichheit. Freiheit meint bei Byron deshalb gewiß niemals Demokratie, wie aus folgender Bemerkung erhellt; in ihr gehen Geschichtspessimismus und aristokratischer Hochmut eine innige Verbindung ein: It is still more difficult to say which form of Government is the worst — all are so bad. As for democracy, it is the worst of the whole; for what is (in fact) democracy? an Aristocracy of Blackguards. 30
Bildet hier der Aristokrat immer noch auf den gemeinen Mann als auf einen Schurken herab, so steht er dodi der historischen Forderung hilflos gegenüber, ja hat ihr nicht mehr anzubieten als sich selbst. Byron, der Lord, der seine Dienste den griechischen Freiheitskämpfern anbietet, erinnert nicht zuletzt an den fahrenden Ritter, der im Dienste anderer an der Vergrößerung des eigenen Ruhmes arbeitet. Der Aristokrat sieht sich in seinem verzweifelten Bemühen, den Idealen seiner Klasse gegen den gewöhnlichen Gang des bürgerlichen Lebens die Treue zu bewahren, vom Bürgertum auf historische Nebenschauplätze abgeschoben. Lukács' Bemerkung, Byron stehe in „Opposition zu der erniedri29 Medwins Conversations, a. a. Ο., p. 184. 30 Byron, L J , Vol. V, p. 405f.
Die Rebellion des Aristokraten
199
genden, alles nivellierenden Prosa des heraufsteigenden Kapitalismus" 31, hält hiervon einiges fest; seinem Urteil freilich, der Byronsche Heldentypus sei „der schriftstellerische Ausdruck für die gesellschaftliche Exzentrizität und Überflüssigkeit der besten und ehrlichsten menschlichen Fähigkeiten in dieser Periode der Prosa, ein lyrischer Protest gegen die Herrschaft dieser Prosa", ist eben deshalb mit Vorsicht zu begegnen, weil solcher Protest durchaus aristokratischen Ursprungs war; er weist nach rückwärts. — Soweit dieser biographische Exkurs; er vermag den aus dem Text des „Cain" gewonnenen Befund, in Lucifers geschichtlichem Pessimismus gestalte sich der des Aristokraten vor der industriellen Massengesellschaft32, zusätzlich zu stützen. Daß nun aber Lucifers Geschichtsverständnis und Gottesbild nicht in Widerstandslosigkeit und Selbstaufgabe münden, sondern aus der diagnostizierten Unausweichlichkeit der Niederlage das Programm von Unangepaßtheit und Selbstbehauptung sich ergibt, steht zu dem nicht in Widerspruch: Gerade in Lucifers Trotz und Unversöhnlichkeit, die eine Anpassung ans Gegebene nicht mehr zulassen, setzt sich die historische Überholtheit seiner Position durch. Nur in scheinbarem Widerspruch hierzu stehen Bemerkungen Lucifers, in denen die historische Ausweglosigkeit überwunden scheint, die Möglichkeit von Besserung aufklingt: We must bear, And some of us resist — and both in vain, His Seraphs say: but it is worth the trial, Since better may not be without: there is A wisdom in the spirit, which directs To right, as in the dim blue air the eye Of you, young mortals, lights at once upon The star which watches, welcoming the morn.
(1/489-96)
Dieser Stern ist Lucifer selbst; der Morgen, den er ankündigt, ist jener, an dem eine bessere Zukunft dämmert. Doch steht der Morgenstern, der sich Cain als leuchtendes Vorbild anbietet, in einsamer Höhe am Himmel — dies erst macht ihn zum Vorbild. Vereinzelt kämpft der helle Stern gegen die riesenhafte Dunkelheit an, hoffend, sein Beispiel werde endlich die Morgenröte über die Finsternis siegen lassen. Dodi gehört es eben zur Logik dieses Bildes, daß in jener der Lidhtbringer verschwinden müßte; der Sieg des Lichts über die Dunkelheit bringt mit sich, daß in allgemeiner Helligkeit der einsame Stern sich verliert. Darin nun sieht Lucifer nicht seine Zukunft; nur wenig später bemerkt er: . . . yon bright star Is leader of the host of Heaven. (1/501-2) 31 Georg Lukács: Walter Scott. — In: Georg Lukács: Schriften zur Literatursoziologie. Ausgewählt und eingeleitet von Peter Ludz. 5. Auflage. — Neuwied/Darmstadt/Berlin 1972. p. 423. 32 Diese Interpretation wird nicht dadurch widerlegt, daß für die Aristokratie „die Ära Georgs IV. (als Regent und als König) das Paradies" war. Denn daß sie es war, beruhte einzig darauf, daß sie „ihre Wirtschaftsführung . . . den Geschäftsmethoden der Mittelklasse bereits angepaßt" hatte. — Vgl. Hobsbawm, a. a. O., p. 81. — Daß aristokratische Vergnügungen wie die Treibjagd zu jener Zeit erneut an Bedeutung gewannen, deutet auf eine Substitution sozial relevanter Praxis durch das Status symbolisierende Spiel.
200
Lord Byron: Cain
und verlangt Anbetung. Nicht in der allgemeinen Sache aufzugehen, liegt in Lucifere Absicht, sondern er will Vorbild und Anführer bleiben. Die Art des Widerstands, den Lucifer im Sinn trägt, ist wesensgemäß dadurch bestimmt, daß nur wenige ihn leisten; die Verbesserungen, die ihm zu erreichen gegeben sind, bleiben nur mehr individuelle. Der Widerstand hat seiner Grundhaltung so sehr sich eingeschrieben, daß er in seiner Individualität sich völlig aus ihm definiert: I have a Victor — true; but no superior. Homage he has from all — but none from me: I battle it against him, as I battled In highest Heaven — through all Eternity, And the unfathomable gulfs of Hades, And the interminable realms of space, And the infinity of endless ages, All, all, will I dispute! And world by world, And star by star, and universe by universe, Shall tremble in the balance, till the great Conflict shall cease, if ever it shall cease, Which it ne'er shall, till he or I be quenched! And what can quench our immortality, Or mutual and irrevocable hate? (II/II, 429-442)
Die Sache, für die Lucifer kämpft, ist nur sein eigenes Ich, von dem hier allein die Rede ist; ein Wir der Kämpfenden gibt es in seinen Worten nicht. Dies Ich, das hier sich zum Zentrum von Zeit und Raum erhebt, wäre nicht ohne seinen Gegner; an ihm schärft es sich in seinem individuellen So-sein. Es bedarf der schlechten Unendlichkeit immerwährender Auseinandersetzung, um aus allgemeiner Mißlungenheit sich selbst in seinem Glanz aufzurichten. Der Widerspruch zwischen dem schlimmen Ganzen und dem, der es leidend durchschaut, bleibt unfruchtbar: Lucifer benutzt den mißlungenen Weltzustand, um an ihm die gelungene Einzigartigkeit seines Ichs zu beweisen. Mit seinem endlichen Sieg aber stünde solche Einzigartigkeit auf dem Spiel: Im gemeinsamen Glück ist der radikal Abweichende durch seine Opposition nicht mehr geadelt. Das Wissen um die Unmöglichkeit seines Siegs freilich sichert dem delikaten Idi Lucifers die beruhigende Gewißheit seines unendlichen Selbstgenusses; sein Weltschmerz hat tief im Innersten seinen Frieden mit dem Schmerz der Welt, aus dem er sich ständig bestätigt findet, längst gemacht. — Deshalb ist Lucifers Programm allgemeiner Morgenröte nicht zu trauen; es dient ihm einzig als Lockmittel, damit Cain sich ihm in radikaler Verselbstung angleiche. Denn als einzige Form des Widerstands gegen die Welt und ihren Schöpfer bietet Lucifer den bedingungslosen Selbstbezug an; die gänzliche Selbstausklammerung aus dem Verblendungszusammenhang des Ganzen, wie er sie betreibt, stellt in seinen Worten sich dar als wahrhafte Identität, die am Schlechten in der Welt keinen Anteil mehr hat. I seem that which I am . . .
(II/1,88)
Darin ist nicht allein Identität behauptet, sondern es klingt zugleich Abgrenzung von Gott an, der eben nicht als das erscheint, was er wirklich ist: unglücklich,
Die Rebellion des Aristokraten
201
einsam, böse. Diese Verschränkung aber ist für Lucifer bezeichnend: Er bedarf des gegnerischen Gottes, um über solche Gegnerschaft sich als mit sich selbst identisch zu definieren. Er sei kein Gott, sagt er an anderer Stelle, And having failed to be one, would be nought Save what I am. (1/129-130)
Eben darin aber, daß er selbst sich in seiner Individualität nicht darzustellen vermag, ohne den Gott, von dem er sich gänzlich löste, als Gegenpol erneut einzubringen, scheint als die ihn bestimmende Dialektik auf, daß jener, der dem Bestehenden sich vermittlungslos widersetzt, noch am intensivsten von ihm geprägt ist: Über ihre abstrakte Negation holt die schlechte Wirklichkeit ihren Gegner immer wieder ein. Hierauf wird oben bei der genaueren Erläuterung von Lucifers Rebellion noch bestimmter einzugehen sein; jetzt dienen diese Bemerkungen nur dem Hinweis, daß auf radikale Asozialität sich noch kein Begriff von Identität gründen läßt. Dies aber ist Lucifers Botschaft: By being Yourselves, in your resistance. Nothing can Quench the mind, if the mind will be itself And centre of surrounding things — 'tis made To sway. (1/212-6)
Selbstfindung im Widerstand mündet in Egozentrizität, wenn sie sich von einer notwendig über den einzelnen hinausgreifenden Verantwortlichkeit löst. Lucifer will nichts als Lucifer sein, Cain nur mehr Cain, ohne jemals im kollektiven Elend mehr zu sehen als einen zusätzlichen Beleg für das eigene. Lucifer verengt konsequent das Problem allgemeinen Leids auf ein individuelles; nirgends klingt demgemäß Verpflichtung für die Mitmenschen in seinen Worten an. Im Gegenteil, Lucifers Mission besteht gerade darin, Cain aus jedem sozialen Zusammenhang herauszulösen; dies wird zumal in der Szene mit Adah deutlich. Lucifers Wissen stellt sich in ihr gegen Adahs Liebe; daß in dieser mehr als eine subjektive Emotion, nämlich Soziabilität generell angesprochen ist, macht schon Adahs erste Frage an Lucifer deutlich: Who Art thou that steppest between heart and heart?
(1/348-9)
Zur Bedingung, unter der er Cain sein Wissen vermitteln will, macht Lucifer, daß Adah sie auf der Reise durchs All nicht begleite: Die Gegenkraft, die ihm aus Liebe und Zweisamkeit erwächst, ist die gesellschaftlicher Geborgenheit. In der Liebe droht der Selbstverlust33; deshalb formuliert sich in Lucifer, der Selbstfindung nur aus der Position absoluter Vereinzelung kennt, zu ihr das Gegenprinzip. Er kann nicht lieben; das unterscheidet ihn von Cain: Lucifer. I pity thee who lovest what must perish. Cain. And I thee who lov'st nothing. (II/II, 337-8) Es kann uns in dieser Untersuchung nicht darum gehen, Byrons Idiosynkrasien gegen familiale Bindung, die sicherlich hier Eingang gefunden haben, im einzelnen nachzugehen.
Lord Byron: Cain
202
Soziale Verpflichtung stellt sich für Cain einzig noch über seine Liebe zu Adah her; seine Trennung von ihr wird so für Lucifer zur Notwendigkeit, wenn er den Nachweis vollständiger Vereinzelung und Verlorenheit im Ganzen als Ziel der Reise durchs All erbringen will. Denn in keiner anderen Absicht führt Lucifer Cain durch den Weltraum als derjenigen, sinnfällig ihm Verlorenheit und Ausgesetztsein, Preisgegebenheit und Bedeutungslosigkeit des einzelnen zu demonstrieren; ohne die zeitweilige Durchtrennung von Cains letzter Bindung an die soziale Gemeinschaft wäre dies Programm um seinen Erfolg gebracht. Freilich kann es Lucifer nicht darum gehen, Cain in der Massenhaftigkeit des Alls untergehen zu lassen, auch wenn dies zuerst als das Ergebnis der Reise sich darstellen könnte: Cain. Alas! I seem Nothing. Lucifer. And this should be the human sum Of knowledge, to know mortal nature's nothingness . . .
( I I / I I , 420-2)
Bostetter hat zu Recht darauf hingewiesen, daß in Byrons „Cain" zwei Weltbilder aufeinandertrefïen: Im ersten und dritten Akt gilt das alte geozentrische Weltbild, „the Biblical cosmos" 34 , während im zweiten Akt den wissenschaftlichen Spekulationen des 19.Jhs Raum gegeben werde. Nachdem aber — so Bostetter — im zweiten Akt Cain das unendliche Weltall durchmessen habe, könne im dritten das traditionelle System für ihn keine Gültigkeit mehr besitzen. Damit jedoch — und hierin liege Lucifers Intention — verliere für Cain Gottes Macht ebenso wie die seiner irdischen Stellvertreter, die sich auf ihn berufen, ihre kosmische Fundierung. — Bostetters Bemerkungen nun bedürfen der Ergänzung um einen zentralen Aspekt: Der Wechsel des Schauplatzes — er ist zugleich einer des Weltbildes — in die Unendlichkeit des Alls dient Lucifer vor allem zur Begründung von Egozentrizität. Denn wo die Ordnung eines in sich geschichteten und gegliederten Weltsystems, mit der Erde als Mittelpunkt, durchbrochen ist, und die Unendlichkeit eines unüberschaubaren, kontingenten Zusammenhangs an deren Stelle trat, dort bleibt dem betrachtenden Subjekt, will es nicht angesichts solcher Beliebigkeit ohne Anfang und Ende verzweifeln, nichts anderes, als sich selbst zum Zentrum des Ganzen zu erheben. Nicht soll Cain sich selbst im All verlieren, sondern er soll sich selbst — und nichts sonst — in ihm finden the mind will be itself / And centre of surrounding things . . . " , so hatte Lucifer prophezeit. Die Empfindung, vor dem Weltganzen ein Nichts zu sein, schlägt um in die diktatorische Vollmacht, die sich das Selbst über das Ganze der Welt erteilt: „ . . . 'tis made / To sway." Konsequent entläßt Lucifer Cain mit einem entsprechenden Rat; es sind seine letzten Worte: Think and endure, — and form an inner world In your own bosom — where the outward fails; So shall you nearer be the spiritual Nature, and war triumphant with your own. ( I I / I I , 463-6) 34 Bostetter, a. a. O., p. 571.
Die Rebellion des Aristokraten
203
Egozentrizität, von philosophischem Idealismus nur schlecht verhüllt, ist die Quintessenz von Lucifers Lehre. Der einzelne, aus der Verantwortung fürs einmal verworfene Ganze entlassen, gewinnt aus sich selbst den Maßstab, an dem er die äußere Welt mißt: So ist es immer diese, die versagt. Keineswegs also ist die Reise durchs All bedeutungslos für den Verlauf des Geschehens, wie viele von Byrons Kritikern behauptet hatten: Gerade aus der Erfahrung, die in ihr sich ihm vermittelte, zieht Cain im Mord an Abel die Konsequenz. Denn in dem Mord kommt beides, Egozentrizität sowohl als audi das Empfinden individueller Nichtigkeit, zu seinem Redit: Egozentrizität, indem Cain sich, ungehindert von sozialen Normen, Rechten oder Pflichten, zum Herren über Leben und Tod macht, und „mortal nature's nothingness" darin, daß über ihre Erfahrung der Schritt zur Tötung individuellen Lebens sich erheblich verkürzte; wo der einzelne vor dem Weltganzen als bedeutungslos erscheint, wiegt der Mord an ihm weniger schwer. Cain ist der gelehrige Schüler Lucifers; seine Replik auf die Frage des Engels nach dem Bruder Abel: Am I then My brother's keeper? (III/468-9)
stellt vor diesem Hintergrund mehr dar als eine Floskel aus Trotz und Hilflosigkeit: In ihr findet Lucifers Programm sozialer Verantwortungslosigkeit, das Desinteresse am Mitmenschen, zu seiner abschließenden Formulierung. Und auch, wenn Cain sich dem Engel gegenüber mit dem Satz rechtfertigt: That which I am, I am . . .
(III/509)
dann übernimmt er den Sprachgebrauch Lucifers, ja er übertrifft ihn sogar: Während Lucifer seinen Identitätsnachweis schließlich nur über die Gegnerschaft zu Gott erbringen konnte, so schlägt Cains Behauptung vollends ins Tautologisdie um; in ihr kulminiert die Egozentrizität, die völlige Selbstausklammerung aus dem sozialen Zusammenhang. Cain definiert sich nicht als Mitglied einer Gemeinschaft, sondern bestimmt sich nur mehr aus sich selbst. — Asozialität und Egozentrik, von denen Byrons Lucifer als den angemessenen Widerstandsformen kündet, sind aufs engste mit dessen Aristokratismus verknüpft. Wie bereits der Widerstand als die Sache der wenigen ( „some of us resist") ausgegeben wurde, so erscheint nun das Wissen, das nur im völligen Selbstbezug einen Ausweg findet, als Privileg weniger: They are the thoughts of all Worthy of thought... (1/102-3)
so preist Lucifer Cains Gedanken. Es ist eine Elite, die hier sich zum Gespräch zusammenfindet; die wenigen Einsichtsvollen handeln das allgemeine Elend ab, ohne Rechenschaft über ihren eigenen Anteil an ihm geben zu wollen: ...if Evil springs from bim, do not name it mine, Till ye know better its true fount . . . (II/II, 454-6)
so weist Lucifer alle Schuld am Bösen zurück. In dieser Welt müssen Byrons Helden existieren, es ist aber sonst nicht die ihre, genauer: es ist nicht mehr die
204
Lord Byron: Cain
ihre. Denn an einer merkwürdig mit dem Zusammenhang kontrastierenden Stelle gesteht Lucifer ein, daß er selbst diese neue Welt zu erbauen half: Did not your Maker make Out of old worlds this new one in few days? And cannot I, who aided in this work . . . (1/529-531)
So schließt er sich selbst als aktives Element in den historischen Prozeß ein, der die neue Welt aus sich hervorbrachte; daß er mit dessen Resultat nicht einverstanden ist, läßt ihn freilich jede Verantwortung für das Bestehende leugnen und sich hochmütig aus ihm ausschließen. Dies aber verweist wiederum auf den historischen Standort der britischen Aristokratie, die — ungleich ihrer kontinentalen Verwandtschaft — entschieden Industrialisierung und Welthandel zu befördern half, um schließlich, entgegen ihrer Intention, das Bürgertum an der Macht zu sehen. Vor dessen Überlegenheit resignierend zog sie sich, nahezu ausschließlich mit sich selbst beschäftigt, ihre Geschäfte Bürgern anvertrauend, in die Exklusivität zurück, während ihre Abgesandten im Oberhaus — Byron selbst nahm, gelangweilt, bald an seinen Sitzungen nicht mehr teil — noch heftige Rückzugsscharmützel lieferten. Vor dem Nivellement der bürgerlichen Welt sanken die aristokratischen Prärogative ins akzessorisch Dekorative herab; so war es denn nicht mehr ihre Welt, und nicht wenige Adelige — Byron unter ihnen — zogen hieraus die Konsequenz, aktiv am politischen Leben ihres Landes nicht mehr teilzunehmen. Byrons „Cain" hält diesen Moment fest: Die Asozialität und Verantwortungslosigkeit seines Lucifer sind die eines Mannes, der das Gesetz des Handelns nicht mehr in Händen hält; von den stärkeren Mächten überrundet, zieht er sich aus dem Ganzen, das nicht mehr seinen Gesetzen gehorcht, auf sich selbst zurück. — Indem aber Lucifer zum Heilmittel gegen die Tendenz der Zeit die Egozentrizität erwählt, liefert er Cain dieser nur umso entschiedener aus. Wenn Cain an Gottes Schöpfung die Sinnlosigkeit, die Launenhaftigkeit, den Mangel an fester Ordnung, in der er selbst einen sicheren Standort zu finden vermöchte, beklagte, dann trägt Lucifer nicht zur Überwindung solcher Mangelhaftigkeit bei, sondern er treibt sie ins Extrem. Wenn wir zuvor im Gottesbild die Anarchie des Marktes und der Warenproduktion wiederzufinden vermochten, so antwortet Byrons Luciferbild auf diese, indem er sie um die Anarchie der sozialen Verhältnisse ergänzt. Die historische Tendenz zielt, den Gesetzen des Marktes und der Warenproduktion gehorchend, auf Vereinzelung; Byrons Lucifer aber schlägt sich auf deren Seite, indem er, die sozialen Beziehungen auflösend, den einzelnen ihr umso deutlicher aussetzt. Der Rebell wird zum Vollstrecker des historischen Gesetzes. — Der Zukunftslosigkeit korrespondiert die historische Ausweglosigkeit. Sie wird einzig durchbrochen von Adah, die vermittelnd zwischen den Protagonisten des Bestehenden, Adam, Eva und Abel, und dem Rebellen Cain steht. Nur ihr kommt der Gedanke, sich vom Vergangenen zu lösen und durch eigene Anstrengung ein neues Paradies zu erbauen: Adab. Dear Cain! Nay, do not whisper o'er our son Such melancholy yearnings o'er the past: Why wilt thou always mourn for Paradise?
205
Die Rebellion des Aristokraten Can we not make another? Cain. Where? Adah. Here, or Where'er thou wilt: where'er thou art, I feel not The want of this so much regretted Eden. (III/35-40)
Doch können weder Lucifer nodi Cain auf solchen Vorschlag, in dem das Bestehende wahrhaft transzendiert wird, eingehen; die kompromißlosen Rebellen bleiben der Welt, wie sie ist, deshalb ständig verhaftet. Für Lucifer ist diese Schöpfung der Verbesserung nicht würdig; er lehnt sie in toto ab. Dies bestimmt seine Kritik an ihr: An keiner Stelle weist er ihr im Detail ihre Mangelhaftigkeit nach, nirgends benennt er konkret ihre Fehler (der Tod bleibt hier die einzige Ausnahme). Ausschließlich protestiert er gegen das Ganze der Schöpfung als unverbrüchlich schlechte Totalität, in welcher Ansatzstellen zum Besseren nicht zu finden sind. Dies schreibt seiner Rebellion ihre Gestalt vor: Sie will den totalen Umsturz. Das Ganze ist umzustoßen, so bleibt dessen Analyse erspart, so wird genaueres Eingehen auf seine Details unnötig. Lucifer selbst bekennt sein Desinteresse am einzelnen, am Besonderen ein: And, therefore, thou canst not see if I love Or no — except some vast and general purpose, To which particular things must melt like snows.
(II/II, 313-5)
Diese Bemerkung verrät ihn wie keine andere: Vernarrt in die Idee des Umsturzes wird ihm das einzelne zum Instrument, das der großen Absicht völlig untergeordnet ist. Statt also das Besondere, den einzelnen Menschen, aus der Heteronomie zu erlösen, wird es erneut in die Ketten eines verabsolutierten Prinzips gelegt, das nicht dadurch weniger terroristisch wirkt, weil es in Gestalt eines ethischen Rigorismus erscheint. Im Bild der sich auflösenden Schneeflocke kehren Unterordnung und Selbstaufgabe, Unterdrückung und Subjektivitätsverlust wieder, in welchen Cains Widerrede gegen Gott sich begründete. Bietet Lucifer sich Cain als Gefährten im Kampf um die Rechte des Menschen an, so liegt dem doch keine echte Humanität zugrunde, weil er vom einzelnen Menschen nichts wissen will. Unter der Herrschaft des launenhaften Gottes bleibt diesem mehr Freiheit als in den Fesseln von Lucifers Generalabsicht, der jeder einzelne sich zu ergeben hat. So wundert es denn auch nicht, daß Lucifer den Begriff der Freiheit gar nicht kennt; nicht ein einziges Mal spricht er von ihr. Ist das Verhältnis Gottes zum Menschen von Desinteresse und Gleichgültigkeit geprägt, so wird der Mensch für Lucifer zum Mittel, das dem Ziel der eigenen Revolte zu dienen bestimmt ist; nicht ins Reich der Freiheit führt er ihn, sondern in vertiefte Fremdbestimmung. — In der Gestalt Lucifers bietet sich dem Menschen keine bessere Zukunft an, sondern nur das negative Abbild des Bestehenden. Indem er nicht auf die Sache selbst sieht und nicht aus den Unstimmigkeiten, Widersprüchen und Mängeln der schlechten Wirklichkeit die Elemente einer besseren Zukunft heraustreibt, vielmehr stattdessen in das Programm des totalen Umsturzes sich flüchtet, bleibt er dem Bestehenden, das in seiner völligen Umkehr mit neuer Kraft sich durchsetzt, gänzlich verhaftet. Sein Programm ist das des Putschisten, der stets noch dem Be-
206
Lord Byron: Caiη
kämpften zur Stabilität verhalf. Einer von Lucifers letzten Sätzen über Gott lautet: He as a conqueror will call the conquered Evil·, but what will be the Good he gives? Were I the victor, his works would be deemed The only evil ones. (II/II, 443-6)
Als Alternative hat Lucifer nur sich selbst, nur die völlige Umkehrung, nichts qualitativ Neues anzubieten. Das Ganze ist als schlecht durchschaut; als Ausweg bietet sich einzig dessen Umsturz an. So aber ist es das Los des Putschisten, in seiner Alternativlosigkeit das Tatsächliche nicht wahrhaft zu überwinden, sondern ihm, wenn auch umgefärbt, im eigenen Zukunftsbild zu neuem Leben zu verhelfen. Es ist immer wieder das Alte, das in seiner Praxis sich durchsetzt: Was vorher böse, heißt jetzt gut, was jetzt böse, ist zuvor gut; so wandeln sich die Benennungen, die Gestalt selbst bleibt jedoch die gleiche. Byrons Lucifer ist nidit Agent der Zukunft, sondern Protagonist des Bestehenden; wie er bereits in der Intention auf Egozentrizität einzig das Weltgesetz bestätigte, indem er es ins Extrem trieb, wie zuvor an seinem Eigenbild sich zeigte, in welchem Ausmaß er als negatives Abbild Gottes vom Bekämpften gezeichnet ist, so beweist sich hier, daß Lucifer in seiner abstrakten Negation der Wirklichkeit an keiner Stelle über sie hinausführt. Die historische Ausweglosigkeit, die in seinen Worten anklingt, ist so aufs engste mit der Gestalt seines Aufbegehrens vermittelt. Als Putschist, der an den Leiden der Menschen kein echtes Interesse nimmt, soweit sie ihm nicht als Mittel in seinem Kampf dienen können, der sich in der Vereinzelung seines Besserwissens selbst genießt und der schließlich aus einer Position sozialer Verantwortungslosigkeit heraus operiert, bleibt er aufs Bestehende verpflichtet. Auf dies Exempel liefert der 3. Akt die Probe: Cain, der Rebell gegen Gott, welcher dem Menschen den Tod dekretierte, erschlägt seinen Bruder Abel und bestätigt damit das Weltgesetz, gegen das er angetreten ist. Cain erst bringt den Tod in die Welt. — Einzig Georg Brandes verspürte bisher diesen putschistischen Grundton in Byrons Lucifer. Unpräzise genug bestimmt er Lucifer als „Geist der Freiheit". Dann aber fährt er fort: Aber eigentümlich genug! er ist nicht der klare und offene Kampf für die Freiheit, sondern die Freiheit, wie sie Verschwörer und Meuterer beseelt, finster und unheimlich, lautlos auf verbotenen Wegen wandelnd, ein Freiheitsdrang wie derjenige, welcher 1821 alle verzweifelnden jungen Freiheitskämpfer Europas beseelte.'*
Wenige Monate vor der Niederschrift des „Cain" war der Aufstand der Carbonari zusammengebrochen; Byron hatte an ihren geheimen Versammlungen teilgenommen, hatte sie finanziell unterstützt und Waffen in seiner Villa gehortet. Er war begeistert bei der Sache; enthusiasmiert trägt er am 18. Februar 1821 in sein Tagebuch ein: 35
Georg Brandes: Hauptströmungen der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. Bd. II: 3. Die Reaktion in Frankreich. 4. Der Naturalismus in England. Vom Verfasser neu bearbeitete endgültige Ausgabe. Übersetzt von Ernst Richard Eckert. 3. Auflage. — Berlin 1924. p. 494f.
Die Rebellion des Aristokraten
207
It is no great matter, supposing that Italy could be liberated, who or what is sacrificed. It is a grand object — the very poetry of politics. Only think — a free Italy! ! P 6
In diesen kurzen Sätzen findet schon manches sich formuliert, was ein halbes Jahr später seinen Lucifer prägen sollte. Frappierend vor allem ist ihre Unbekümmertheit: Ein britischer Oppositioneller, dem der politische Tageskampf in seinem Heimatland zu mühselig, langweilig und dégoûtant erschienen war, und der deshalb mit großer Geste, welcher er politischen Sinn beimaß und mit der er doch nur seine Bequemlichkeit rettete, endgültig Abschied von ihm genommen hatte, stellt sich im Ausland Kämpfern zur Verfügung, die für die Sache der Freiheit Vermögen, Gesundheit und Leben riskierten. Er, der niemals ernsthaft gefährdet war, Verwundung, Folter und Kerker nicht kannte, rechnet ihnen vor, daß Opfer nichts bedeuten im Vergleich zur großen gemeinsamen Sache. Mit eben dieser Verantwortungslosigkeit stattet er später seinen Lucifer aus, der auch von außen an den Menschen herantritt, ihm von Gemeinsamkeiten redet, aber die Folgen ihn alleine tragen läßt: Lucifer folgt Cain ebensowenig ins Exil, wie Byron seine Mitverschwörer in die Kerker begleitete. Dem britischen Aristokraten, der unter Freiheit nie anderes als das Ausleben subjektiver Intentionen verstanden, der die Wirkungen politischer Unfreiheit nie am eigenen Leib erfahren hatte, stellte deshalb die Verschwörung auch nicht als Politik sich dar, sondern als die Poesie der Politik, in der Art etwa des romantischen Mantel-und-Degen-Stücks (wie überhaupt den englischen Reisenden Italien zu jener Zeit ein Hort der Romantik war); sie wird ihm zum Betätigungsfeld der eigenen Egozentrik. Der Putschismus kam dem schon deshalb entgegen, weil er selbst aristokratischer Provenienz ist: Seine Vorbilder hat er in den Verschwörungen des hohen Adels gegen ungerechte Herrscher. Er zielt auf die Auswechslung von Machteliten, soziale Veränderungen dagegen treten nur begleitweise auf. So konnte Byron die Pose des Freiheitskämpfers einnehmen, ohne je sein empfindliches Idi von übergreifenden Notwendigkeiten einschränken zu lassen, ohne je sich mit dem Volk gemein machen zu müssen, vor allem aber: ohne Verantwortung zu übernehmen. Er versteht unter Freiheit grundsätzlich die des Aristokraten, die aber, verwirklicht, im bürgerlichen Zeitalter in Asozialität umschlägt. Dies eben war es, was Bertrand Russell Byron in die Entwicklungslinie des Faschismus stellen ließ: The aristocratic philosophy of rebellion, growing, developing, and changing as it approached maturity, has inspired a long series of revolutionary movements, from the Carbonari after the fall of Napoleon to Hitler's coup in 1933 . . . 37
Sicher hat Russell hier zu rasch und leichtfertig historische Distanzen überschlagen und so der Byron-Forschung die Replik einfach gemacht38, und doch läßt Byron nicht völlig sich aus eben dieser Verwandtschaft lösen; ungleich 36 Byron, LJ, Vol. V, p. 205. So in seinem großen Werk „A History of Western Philosophy". Hier zitiert nadi: Bertrand Russell: Byron. — In: Paul West (Ed.): Byron. A Collection of Critical Essays. — Englewood Cliffs 1963. p. 152. 38 Vgl. Peter L. Thorslev, Jr.: The Byronic Hero. Types and Prototypes. — Minneapolis 1962. p. 194ff.
208
Lord Byron: Cain
differenzierter wird sie von Ernst Bloch beschrieben, der über Byrons Gestalten notierte: Freilich gerieten auch die trotzig Einsamen, je weiter sie sich vom deutlichen sozialen Gegner entfernten, notwendig mehrdeutig. Sie wurden zwar noch nicht die barbarischeleganten Auslebegestalten vom Fin de siècle, einen lustfeinen Fascio vorbereitend. Wohl aber konnte diese bleibend individuelle Art von Überschreiten asozial schlechthin werden; bis hin zum Verbredher, der die Stirn und den Stirner und den Nietzsche hat, sich als Zerbrechet zu gerieren. 39
Der Weg von Byron zu Stirner ist gewiß nicht weit; die Sätze von dessen „Einzigem" : Ich bin aber nicht ein Ich neben andern Idien, sondern das alleinige Ich: Ich bin einzig. ( . . . ) Nicht als Mensch und nicht den Menschen entwickle Ich, sondern als Ich entwickle Ich — Mich.«
geben die Substanz von Lucifers Lehre, ihrer metaphysischen Draperie entkleidet, präzise wieder. Während jedoch die Verse des „Cain" die aus seiner historischen Überholtheit resultierende Egozentrik des Aristokraten ästhetisch überhöhen, so finden bereits in den Stirnerschen Phantasmagorien die unsozialen Omnipotenzphantasien eines depravierten Kleinbürgertums zu ihrem radikalsten Ausdruck; sie erst konnten im Faschismus sich voll entfalten. Die Stirnersche „Empörung" und Byrons Rebellion sind nicht gleichen sozialen Ursprungs; im putschhaften Aufbegehren freilich, in der asozialen Egomanie und dem grundsätzlichen Verhaftetbleiben ans Bestehende sind sie geeint. Wem es wirklich ernst war mit sozialer Veränderung, stand deshalb Byron mit Skepsis gegenüber; nicht zufällig nimmt das liberale „London Magazine" in seiner Rezension, deren Tenor „Once an aristocrat, always an aristocrat" lautet, das Erscheinen des „Cain" zum Anlaß folgender Bemerkung zu Byron: In his very scorn of kings and rulers, there has been little regard for the common sorrows of the people; but a high feeling of injured dignity, a sort of careless ferocity, like that of Cataline amidst his hated foes and his despised supporters. On a lonely rode amidst the storm, in the moonlight shadows of the Colosseum or pensively musing on the sad and silent shores of Greece, his nobility is ever with him. 4 i
Die Wesensverwandtschaft von Byrons Lucifer und Stirners Einzigem beweist sich, trotz ihrer unterschiedlichen sozialen Herkunft, nodi an etwas anderem: Im 19. Jh., das in zahlreichen Gestaltungen sein Bild zeichnete 42 , wird Lucifer, wie Byron ihn sah, zum Abgott der Putschisten und Anarchisten. 39 Emst Biodi: Das Prinzip Hoffnung. Bd. 3. — Frankfurt 1973. p. 1179. 4 0 Max Stirner: Der Einzige und sein Eigentum und andere Schriften. Ausgewählt und mit einem Nachwort hrsg. von Hans G. Helms. 3. Auflage. — München 1970. p. 220. Der Autor war Thomas Noon Talfourd. Zitiert nach Steffan, a. a. O., p. 349. 4 2 Es mag einen ungefähren Eindruck von dieser Produktion geben, daß Henri Delpedi, der Autor eines zu Recht vergessenen zweibändigen Epos „Satan", sich bemüßigt fand, seinem Werk eine Liste der „sources principales" beizufügen, in der sich neben Dichtern wie Dante, Klopstock, Milton und de Vigny gänzlich dem Vergessen anheimgefallene Autoren wie Soumet und Reboul finden. — Vgl. Henri Delpech: Satan. Épopée. T . 1. — Paris 1859. p. 222.
Die Rebellion des Aristokraten
209
Man darf versichert sein, daß Stirner nur deshalb ihn nicht zum Kronzeugen seiner Theorie erhob, weil er jegliche Geistwesen als „Sparren" verwarf. Dagegen stimmt Proudhon, einer der theoretischen Begründer des Anarchismus, folgenden Hymnus auf Satan an: Die Freiheit ist euer Antichrist. O komm, Satan, du von den Priestern und Königen Verleumdeter, laß dich von mir umarmen, laß didi an mein Herz drücken! Deine Werke, o du Gesegneter meines Herzens, sind nicht immer schön oder gut; aber du allein gibst dem Universum einen Sinn. Was wäre die Gerechtigkeit ohne dich? Ein Instinkt. Die Vernunft? Eine Gewohnheit. Der Mensch? Ein Tier.«
Byrons Mischung von Rebellion und elitärem Tatmenschentum, Egozentrik und Asozialität ging dann vollends in Bakunins Anarchismus auf; auf den ersten Blättern von „Gott und der Staat", einer seiner wichtigsten Schriften, findet sich eine Darstellung von Schöpfung und Fall, die nachgerade wie eine Paraphrase von Byrons „Cain" (er ist freilich nicht genannt) anmutet. Zu jedem ihrer Sätze ließen sich mühelos aus Byrons Text Parallelstellen beibringen; sie sei deshalb, zum Vergleich, vollständig zitiert: Jehovah, von allen Göttern, die die Menschen je angebetet, gewiß der eifersüchtigste, eitelste, roheste, ungerechteste, blutgierigste, despotischste und menschlicher Würde und Freiheit feindlichste, schuf Adam und Eva aus man weiß nicht was für einer Laune heraus, ohne Zweifel zum Vertreiben seiner Langeweile, die schrecklich sein muß bei seiner ewigen egoistischen Einsamkeit, oder um sich neue Sklaven zu geben; dann stellte er ihnen edelmütig die ganze Erde zur Verfügung mit all ihren Früchten und Tieren, wobei er diesem vollständigen Genuß nur eine einzige Grenze gab. Er verbot ihnen ausdrücklich, die Früchte des Baumes der Erkenntnis zu berühren. Er wollte also, daß der Mensch, alles Bewußtseins von sich selbst beraubt, ewig ein Tier bleibe, immer auf vier Füßen vor dem ewigen Gott, seinem Schöpfer und Herrn. Aber da kam Satan, der ewige Rebell, der erste Freidenker und Weltenbefreier. Er bewirkt, daß der Mensch sich seiner tierischen Unwissenheit und Unterwürfigkeit schämt; er befreit ihn und drückt seiner Stirn das Siegel der Freiheit und Menschlichkeit auf, indem er ihn antreibt, ungehorsam zu sein und die Frucht der Erkenntnis zu essen. 44
Dies ist die Apotheose eines rebellischen Geistes, der seinen Aufruhr in keinen anderen Dimensionen als sogleich kosmischen zu denken vermag, weil ihm dies die Berührung mit den Details der schmutzigen Realität erspart. Fasziniert blickt der Anarchist auf die Revolte Lucifers, die mit einem Schlag alle Probleme der Weltordnung löst, so wie er es sich von der eigenen erwartet. Daß Lucifer noch unterlegen und allein ist, daß ihm niemand einen Auftrag erteilt, und daß er vor niemandem sich zu verantworten hat, lädt den Anarchisten dabei nicht weniger zur Identifikation mit dessen Gestalt ein wie dessen führerhafte Vorbildlichkeit, von der das eigene Avantgardebewußtsein sich angesprochen fühlt. — Noch dort, wo der Satanismus sich unpolitisch gab und den Protest von vornherein in die Grenzen der Artifizialität verbannte, stellt seine enge Be« Pierre Joseph Proudhon: La justice dans la révolution et dans l'église. (1858) — Zit. nach Brandes, a. a. Ο., p. 495. 4* Michail Bakunin: Gott und der Staat und andere Schriften. Hrsg. von Susanne Hillmann. — Reinbek 1969. p. 57.
210
Lord Byron: Cain
Ziehung zum Putsdiismus sich heraus. Zu Baudelaires „Litanei auf Satan", in der blasphemisch Lucifer als der Aufrührer angerufen wird, der den Unteren, den Parias und Aussätzigen Einlaß ins Paradies verschaffen möge, notierte Benjamin den Satz: „Zwischen den Zeilen blitzt das finstere Haupt Blanquis auf." 4 5 Und zu den „Gesängen des Maldoror" bemerkte er gleich einsichtsvoll: Steht aber Lautréamonts erratisches Buch überhaupt in irgendeinem Zusammenhang, läßt es sich vielmehr in einen stellen, so ist es der der Insurrektion.46
Putschismus und Satanismus sind darin vereint, daß in ihnen die Revolte den kürzesten W e g nimmt: Sie überspringt gleichsam die gesellschaftlichen Verhältnisse, gegen die sie aufbegehrt. Den Umweg über deren Analyse scheuend, setzt sich gesellschaftliches Leiden in die Pose der radikalsten Kritiker einer Gesellschaft, ohne doch je an deren Substanz zu rühren oder je wahrhaft über sie hinauszuweisen. Das Leiden am Zustand der Gesellschaft, das im Satanismus zum Ausdruck gelangt, ist ernsthaft und tief gefühlt; von weit geringerem Ernst jedoch ist der Protest dagegen. Denn der Satanist ist von dem real Bösen abgestoßen und fasziniert zugleich; weil er nicht wirklich sich von ihm lösen will, ja bei der Findung seines Eigenbildes seiner bedarf, verschafft er ihm einen sicheren Hort in dem Gegenentwurf, den er in seinen Texten zeichnet. Sie formulieren zumeist nur das extrem, aber durch Ästhetik geschmäcklerisdi gemildert, was die Wirklichkeit an Abscheulichem immer schon bietet. Was bei Baudelaire als Satanismus sich gebärdet, ist die sich selbst als negativ reflektierende Identifikation mit der realen Negativität des gesellschaftlichen Zustands. Weltschmerz läuft über zum Feind, der W e l t / 7
J e krasser Unrecht und Elend der Gesellschaft sind, desto dankbarer wird der Satanist ihr sein, wenn er in seinem Protest gegen sie an Unrecht und Elend sie noch übertrifft. Unglaubwürdig ist der Protest, weil er letztlich sich mit dem Leid verbrüdert; aus jeder Zeile der „Litanei an Satan" spricht zugleich die Begeisterung darüber, daß dem Schrecken sich noch Verse abgewinnen lassen. Gesellschaftliches Leiden stiftet in ihnen Selbstgenuß; aus eben diesem Grunde geht der Satanist nicht den W e g gesellschaftlicher Verbesserung, sondern er schlägt sich auf die Seite der Putschisten. Dabei leitet ihn sein sicheres Gespür, daß die Leiden der Gegenwart in deren Welt in umgekehrter Gestalt sich wiederfinden werden. — Diese unheilvolle Allianz von Asozialität und Anarchismus, Putschismus und Egozentrik, Satanismus und Geschichtspessimismus, die im gesamten 19. Jh. ihre literarischen Protagonisten fand, wird erst spät gründlich überwunden. In seinem großen Spätwerk „La révolte des anges" ( 1 9 1 3 ) erzählt Anatole France, auch er, wie Byron, ein — freilich philosophisch geschulter — Skeptics Benjamin, a. a. O., p. 20. — „Blanquis Tat ist die Schwester von Baudelaires Traum ge46
47
wesen. Beide sind ineinander verschlungen." (p. 100) Walter Benjamin: Der Sürrealismus. Die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz. — In: Walter Benjamin: Angelus Novus. Ausgewählte Schriften 2. — Frankfurt 1966. p. 211. Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie. — Frankfurt 1970. p. 38f. Vgl. audi p. 201.
Die Rebellion des Aristokraten
211
ker und Geschichtspessimist, wie auf der Erde die gefallenen Engel den Aufruhr gegen Jaldabaoth, den Demiurgen und späten Nachfahren von Blakes Urnen und Byrons Jehovah, vorbereiten. Nicht als Revolutionäre schildert France die aufständischen Engel, sondern ausdrücklich als Putschisten, ja nahezu als deren Karikaturen; es sind Pariser Bohemiens, die Bomben basteln, sich mit Polizisten prügeln und große Pläne mit sich herumtragen. Als nun schließlich alles zum entscheidenden Schlag bereitsteht, und die Führer der Revolte Lucifer bitten, an ihre Spitze zu treten, da lehnt dieser ab; und dies nun nicht etwa deshalb, weil der Aufstand keinen Erfolg verspricht, sondern, im Gegenteil, gerade weil er aussichtsreich zu sein scheint. In einem Traum hatte Lucifer sich als den Sieger gesehen und erfahren, wie aus ihm ein neuer Jaldabaoth wurde: Der Putsch bringt das Bekämpfte erneut aus sich hervor. Daraus zieht Lucifer die Konsequenz: „Gefährten," sagte der große Erzengel, „nein, erobern wir den Himmel nicht. Es genügt, daß wir es können. Denn Krieg erzeugt wiederum Krieg und Sieg Niederlage. Der besiegte Gott wird Satan und der siegreiche Satan wird Gott. Möge mir das Geschick dieses furchtbare Los ersparen! (...)" 4 8
Und so schlägt denn Lucifer seinen Gefährten einen anderen Weg vor: den des unnachsichtigen Kampfes gegen Egoismus und Krieg, gegen Haß und Gewalt, gegen Dummheit und Zwietracht unter den Menschen. Er ist mühseliger als der erste, und doch führt nur er zum Sturz des Jaldabaoth.
48
Anatole France: Aufruhr der Engel. Roman. Deutsch von Rudolf Leonhard. — Leipzig 1917. p. 475.
LUCIFERGESTALTUNGEN DER WILHELMINISCHEN ÄRA
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft Eine solche Verwechslung des luziferischen Revolutionsgedankens mit der Generalrevolte aller schlechten Instinkte, sagte er, sei beklagenswert. Thomas Mann: Der Zauberberg
Im Jahre 1891 erschien in Wernigerode im Selbstverlag seines Autors ein selbst für diese an Kuriositäten nicht eben arme Zeit merkwürdiges kleines Buch. Der Erfolg blieb ihm versagt, seine Leser dürften eher nach Dutzenden denn nach Hunderten zu zählen sein. Dabei kann es stilistisch sich durchaus mit manchem der gefeierten Erfolgsromane dieser Jahre messen, und die Geschichte ist keineswegs unübersichtlich oder gar konfus erzählt. Ein um Anerkennung ringender Außenseiter bietet sich den Blicken der umworbenen Öffentlichkeit ohne große Schonung für sich selbst dar; er erzählt, noch Anfang der Dreißiger, sein Leben. An die Hoffnungslosigkeit und die Niederlagen der Erfolglosen aber mochte das saturierte Publikum nur von den Erfolgreichen erinnert werden: auf den Bühnen, in den Publikationen, die es als anerkannte Orte der Anklage um ihre Wirkung brachte. Hier aber spricht die Erfolglosigkeit selbst, und noch im äußeren Gewand, dem schlechten Papier und der billigen Broschur des Bandes, dokumentiert sich ungemildert die Niederlage, als deren Chronik der Band einer Käuferschaft sich präsentierte, die Aussichtslosigkeit am wenigsten zu goutieren wußte. Daß ihm auch jetzt wieder Anerkennung versagt bleiben würde, scheint der Autor geahnt zu haben; er verbirgt seine Identität deshalb hinter einem Pseudonym, mag andererseits aber auch nicht völlig auf die Verbreitung seines Namens verzichten und setzt ihn daher auf dem Titelblatt dorthin, wo in der Regel der Verlag genannt ist. Das ist durchaus mehr als nur ein harmloses Versteckspiel ohne größere Bedeutung, denn mit dem Verlegertitel, dem Status des selbständigen Unternehmers, erschleicht sich Wilhelm Rudow, so der Name des Autors respektive Verlegers, als welcher er sich wohl nennen mochte, den Anschein des Erfolgs, den Ausweis bürgerlicher Wohlanständigkeit, um die er als Schriftsteller und Gelehrter vergeblich gerungen hat. Zur Erfolglosigkeit aber mag er ohne weiteres mit seinem Namen nicht stehen; nur allzu deutlich verrät sich darin Rudows innige Verbundenheit mit den Normen einer Gesellschaft, von deren vehementer Ablehnung sein Pseudonym doch zu künden scheint: Denn er nennt sich Lucifer und sein Buch „Lucifer.
214
Lucifergestdtungen der wilhelminischen Ära
Ein Dichterleben." 1 Deshalb auch ist, was dem Verfasser außergewöhnlich an seinem Leben schien, weit häufiger symptomatisch für seine Zeit und Gesellschaft. Aus diesem Grund sei das Dichterleben hier kurz nacherzählt. Es verläuft mit einiger Konsequenz: Wilhelm, der begabte, ehrgeizige, aber eigenbrötlerische Sohn eines nachsichtigen Landpfarrers, verliebt sich in die Gutstochter Ulrike Müller. Sie erwidert seine Liebe, doch an Wilhelms krankhaftem Stolz scheitert die Beziehung: Ulrike hatte ihn einst zu Recht getadelt, er fühlte sich gedemütigt und will sich nun, indem er sich, für ihn selbst quälend, im entscheidenden Augenblick verletzend von ihr abwendet, an ihr rächen. Sie heiratet Wilhelms besten Freund, einen rechtschaffenen, aber geistig anspruchslosen Bauern. Wilhelm aber stürzt sich in seine Studien. Er legt das Theologieexamen ab, hat sich aber so weit der Religion entfremdet, daß er Pfarrer nicht mehr zu werden vermag. So wirft er sich aufs Studium der Sprachen und strebt eine akademische Laufbahn an. Fieberhaft arbeitet er, lernt sämtliche lebenden Sprachen des Okzidents und verfaßt — dies alles außerhalb des regulären akademischen Betriebs — eine sprachwissenschaftliche Dissertation, die immer und immer wieder als unmethodisch und maßlos abgelehnt wird. Schließlich wird er doch promoviert, aber auch jetzt gelangt er nicht zur Ruhe; rastlos arbeitet er, um seine überlegenen Kenntnisse zu beweisen, an einem Buch mit Übersetzungen aus 32 Sprachen. Er findet einen Verleger für sein Werk, indes verzögert sich dessen Erscheinen mehr und mehr. Andere literarische Mißerfolge kommen hinzu, so daß er sich kurzerhand vom literarischen Deutschland abwendet und Photograph wird. Man steckt ihn — versehentlich oder aus Borniertheit, wie Rudow meint — für sieben Tage ins Irrenhaus, doch wird er danach wieder entlassen. Als sein Übersetzungsbuch nun doch nicht erscheint, erleidet er einen schweren „Nervenschlag" ; nach seiner Genesung gibt er es dann im Selbstverlag heraus. Das letzte Kapitel erzählt von einem Besuch Wilhelms in seinem Heimatort und schildert den Tod Ulrikes, die, immer wieder von dem geliebten Pfarrerssohn zurückgestoßen und von ihrem biederen Mann unverstanden, im Wahnsinn stirbt. — Sicher ist das Buch, obgleich seinem Autor keineswegs alles schriftstellerische Geschick abzusprechen ist, literarisch bedeutungslos, ja man tut ihm durchaus nicht Unrecht, wenn man es dem Grenzbereich zwischen Literatur und Psychopathologie zuordnet. Das gehetzte Wesen Rudows, sein hypertropher Geltungsdrang, der Verlust sämtlicher Maßstäbe, die Bindungsangst und Machtphantasien nehmen Ausmaße an, die von einem intakten Realitätssinn, von ungestörter Wirklichkeitswahrnehmung nicht mehr sprechen lassen. Mag man es auch als übertriebene Maßnahme werten, so war es doch gewiß kein Versehen, daß man ihn ins Irrenhaus sperrte. Doch treten unter den Verzerrungen der Rudowschen Optik um so deutlicher die pathogenen Strukturen der historischen Wirklichkeit zutage, denen die Beschädigung seiner Existenz sich verdankt. Rudows ι [Wilhelm Rudow]: Lucifer. Ein Dichterleben. Herrn Administrator Bode und Frau Rittergut Banteln in dankbarer Liebe ihr Neffe Lucifer. — Wernigerode 1891.
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
215
übersteigerter Ehrgeiz, sein realitätsblinder Hochmut, an denen er psychisch zugrunde geht, erweisen sich bei näherem Hinsehen als die krankhaften Auswüchse einer sozialpsychologischen Situation, der das Kleinbürgertum, dem er entstammt, seit den Gründerjahren in zunehmendem Maße sich unterworfen fand: Eingezwängt zwischen den Klassenfronten, die die erstarkende Arbeiterschaft von dem Bürgertum trennten, stand es in ständiger Furcht vor dem Verlust seiner geringen Privilegien und dem endgültigen Abstieg ins Proletariat. Greifbar wird jene Furcht in einer zunehmenden Apostrophierung geistiger Überlegenheit, durch die der einzelne derart aus der Masse sich herausgehoben glaubt, daß das tatsächliche ökonomische Nivellement daneben sich vergessen ließ. Die Furcht, dem ständig steigenden Druck der Konkurrenz nicht mehr gewachsen zu sein und schließlich in der Anonymität einer namenlosen Masse untergehen zu müssen, sucht das Kleinbürgertum so durch eine geistige Respektabilitätsforderung zu mildern, mit der es sich blind zu machen vermag gegen seine tatsächliche historische Verfaßtheit. Vor dem Konkurrenzdruck in die Sphäre des Geistes sich rettend unterwirft es aber diese selbst dem Konkurrenzprinzip: Auch die stolze Behauptung geistiger Superiorität ist vom ängstlichen Schielen auf jene tiefer gelegenen Ebenen begleitet, die die anderen mittlerweile erklommen haben. So träumt schließlich unter dem universalen Druck des Wettbewerbs der einzelne in eine konkurrenzfreie Sphäre sich ein, aus welcher ihm apriorische Überlegenheit zufließt, sei es, daß er an einem geheimnisvollen Wissen partizipiert, das nur Auserwählten zuteil wird, sei es, daß er spiritistisch von Toten magische Aufklärung erfährt, vor der der gesamte positivistische Wissenschaftsbetrieb als belächelnswert erscheint, sei es endlich, daß er völkisch an einer kollektiven Genialität partizipiert, die ihm sein Edelmenschentum noch in der größten sozialen Misere beglaubigt. Hier liegen die trüben Quellen jenes Irrationalismus der deutschen Mittelschichten, der in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg zur ersten Aufblüte kam und schließlich im Nationalsozialismus seine organisierende Ideologie finden sollte. — In Rudows Text treten diese Quellen offen zutage: Er handelt von nichts anderem als dem Prozeß progredienter Deformation von Wirklichkeitswahrnehmung und sozialer Interaktion unter dem Drude des Konkurrenzprinzips. Bereits seine Kindheit steht im Zeichen solcher Verformungen: Dieses Hochgefühl, unter meinesgleichen niemand neben, geschweige denn über mir zu sehen, war mir von Kindesbeinen auf als das einzig Begehrenswerte erschienen, und demgemäß hatte ich jede Aufforderung mit den übrigen zu wetteifern, mit den Worten abgelehnt: „Das können die andern auch," indem ich hinzudachte: Dabei fange ich nicht an.2
Was zuerst als Weigerung, dem Konkurrenzprinzip sich zu fügen, erscheinen könnte, ist nichts als die völlige Unterwerfung unter dessen Gesetze. Denn allzu deutlich steht hinter Wilhelms ablehnender Haltung dem Wettstreit gegenüber die Angst, in ihm nicht mithalten zu können, einmal verlieren zu müssen und 2 Rudow, a. a. Ο., p. 39f.
216
Lucifergestdtungen der wilhelminischen Ära
so von der Höhe seiner imaginierten Einzigartigkeit herabgestoßen zu werden. Weil die Stabilität des empfindlichen Ichs, weil das subjektive Selbstwertgefühl nur mehr eine Funktion seines Bestehens im Konkurrenzkampf ist, weidit es diesem aus, um sich jede Demütigung zu ersparen, denn sie könnte vernichtend sein. In den anderen vermag Wilhelm nur noch die Konkurrenten zu sehen; zerstörerisch legt sich dieses Prinzip über alle seine sozialen Beziehungen. Dem unterliegt auch seine Zuneigung zu Ulrike: Daß sie ihn zu Redit tadelte, einmal sich als ihm überlegen erwies, kann er ihr nicht verzeihen. Zwanghaft muß er sich rächen, um seine scheinbare Überlegenheit zu restituieren, und sei es um den Preis, daß er dabei sein eigenes Leben zerstört; die Liebe als stärkste Erscheinung von Mitmenschlichkeit unterliegt dem sozialen Gegeneinander der Konkurrenz. Rudows Leben steht so im Zeichen zunehmender Vereinzelung, ja Isolation; unfähig, seine Ichbezogenheit in neuer Liebe oder in Freundschaften aufzubrechen, wendet er sich nur an die Institutionen sozialen Aufstiegs, die emotionales Engagement nicht fordern: an die Professoren, vor denen er „von jeher eine unbegrenzte Achtung, ja Ehrfurcht" hatte 3 , und an die Burschenschaften, deren Funktion als Zweckverbände sozialer Betäubung bei ihm nur allzu deutlich wird: „Gleich- oder audi nur Mitstrebende hatte ich freilich unter den Altersgenossen trotz alles Suchens nicht gefunden . . . " — und trotzdem küßt man sich gerührt zum Abschied, „ . . . unbekümmert um die spöttischen Gesiebter einiger Jünger Börnes, die schnell verschwanden, als ich einen Schritt auf sie zutrat." 4 Es ist die unheilvolle Mischung von Autoritätsgläubigkeit, sozialer Indifferenz und gegen den eigenen Inferioritätskomplex ertrotzter Selbstherrlichkeit, die hier sich auftut; jederzeit ist der Kleinbürger um sich zu schlagen bereit, sobald nur sein mühsam erarbeitetes Selbstwertgefühl in Frage gestellt wird. Der Gruppenkonsens stellt sich allein über die Gegnerschaft zu den traditionelle Werte anzweifelnden „Jüngern Börnes" her; ansonsten bleibt Rudow auch unter seinen Kommilitonen heimatlos. — Bezeichnend nun an seinem Werdegang ist die Umdeutung der quälenden Vereinzelung in ein Positivum: in einen Beweis für Einzigartigkeit. Dem gesellschaftlichen Druck sich ergebend akzeptiert er die Vereinzelung und kehrt sie in das einzig Erstrebenswerte um; Rudow identifiziert sich mit dem Aggressor und wandelt sich so zum wehrlosen Agenten sozialer Gesetze. Denn „Gleichstrebende" hätte er nur um den Preis des Verzichts auf die Wunschphantasien seiner Einzigartigkeit finden können; er wollte sie demnach gar nicht finden. Hinzu kommt, daß ein erstrebenswertes Ziel, eine anzustrebende Erkenntnis, gar nur eine Richtung des Strebens von Rudow nirgends genannt ist; einzig die panische Angst, im allgemeinen Streben, in der Konkurrenz unterliegen zu können, prägt sein Leben, das mehr und mehr als eine Allegorie des verabsolutierten Wettbewerbs erscheint. An den Sieg in der Konkurrenz, unter der dodi alles Subjektive sich einebnet, bindet sich der Nachweis überlegener Subjektivität, ja letztlich von Subjektivität überhaupt. Leistung wird zum Fetisch mit beliebigem Inhalt: 3 Rudow, a. a. O., p. 104. 4 Rudow, a. a. O., p. 102.
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
217
Immer wieder nimmt Rudow sich vor, „etwas Besonderes zu leisten" 5 , um so sich herauszuheben aus der Anonymität. Er wendet sich dabei entlegenen Forschungsaufgaben zu, deren Esoterik ihm als Ausweis höchster Dignität, deren zu bewältigende Stoffülle ihm als Beleg ihrer Sinnhaftigkeit gilt. Als verwundert ihm ein Gelehrter entgegenhält, „in so uferlosen Bestrebungen weder Ziel noch Zweck" erkennen zu können, stößt er bei Rudow auf Unverständnis: Was hätte es mir genützt, zu erwiedern (!), daß man die Sorge um Ziel und Zweck meiner Arbeiten ruhig mir überlassen könne? Der das sdirieb, ist einer der angesehensten Gelehrten; ich nichts — nichts als Lucifer*
Sinn seiner Leistung ist für Rudow die Leistung selbst; sein sich überschlagendes Leistungsdenken blickt nicht mehr über sich hinaus auf größere funktionale Zusammenhänge, sondern überzeugt sich von seinem hohen Wert mit Hilfe der eigenen betäubenden Rastlosigkeit. Dem entspricht, daß das losgelassene Leistungsprinzip sich in einem konkurrenzfreien Raum abarbeitet: Zielgerichtete Konkurrenz macht die beständige Überprüfung der eigenen Mittel, den unablässigen Blick auf die Zwecke erforderlich; beides aber steht Rudow fern, zum einen, weil seine Arbeit ihren Zweck in sich selbst hat, und es deshalb Konkurrenz auf diesem Feld nicht geben kann, zum anderen jedoch, weil die Maximalisierung der Leistung ja gerade vom Druck der Konkurrenz befreien soll. Weil Rudow zwar das gesellschaftliche Leistungsschema übernimmt, ohne jedoch seine Funktionen zu beachten, glaubt er in einem Kampf siegen zu können, in dem er schließlich immer außer Konkurrenz läuft. Zum Betäubungsmittel gereicht ihm dabei die Übertragung der in der Fabrikproduktion sich bewährenden Quantifizierbarkeit von Leistung auf geistige Arbeit: So glaubt er durch die sture Akkumulation von Vokabeln und grammatikalischen Regeln sich Prominenz erwerben zu können. Solche Verdinglichung des Bewußtseins freilich trägt durchaus die Signatur der Epoche: Monumentalität galt der BismarckÄra auch auf geistigem Gebiet als Nachweis von Qualität 7 . Der Monomanie eines um Zwecke unbekümmerten Sprachenlernens freilich konnte die Gelehrtenwelt nur achselzuckend zuschauen. Als dennoch eine primär zum Zweck des Nachweises seiner Kenntnisse, nicht der Lösung wissenschaftlicher Probleme halber entstandene Abhandlung von dem „hochangesehenen Herausgeber eines Sammelwerkes" mit der Begründung, daß „niemand im stände gewesen wäre, den betr. Gegenstand zu bearbeiten", zum Druck angenommen wird, erlebt Rudow seinen lange ersehnten Triumph: Als ich dies gelesen, atmete ich tief auf: endlich also hatte idi mein Ziel erreidit und schwarz auf weiß bezeugt, daß ich etwas geleistet, was niemand sonst leistete.8
Als pathologisch tritt eine derartige Fetischisierung des Leistungsbegriffs nur deshalb hervor, weil dieser sich bei Rudow von sämtlichen Zwecken emanzi5
Rudow, a. a. Ο., p. 111. Rudow, a. a. O., p. 112f. 7 Vgl. Klaus Günther Just: Von der Gründerzeit bis zur Gegenwart. Geschichte der deutschen Literatur seit 1871. — Bern/München 1973. p. 22S. * Rudow, a. a. O., p. 114. 6
218
Lucifergestdtungen der wilhelminischen Ära
piett hat; daher auch zollt man zwar der Leistung Bewunderung, während der Leistende höchstens Verwunderung zu erregen vermag. Aller übermenschlichen Anstrengung zum Trotz muß Rudow die Anerkennung versagt bleiben. Hier nun setzt die Mythisierung der eigenen Gestalt ein. Genügte in seiner Jugend, als er sich eins fühlte mit den Bestrebungen der Großen seiner Zeit, noch der Vergleich mit Faust 9 , dem Idealbild des in ewigem Streben sich abmühenden Deutschen, so träumt Rudow sich mit zunehmender Isolation, Verbitterung und Enttäuschung mehr und mehr in die Gottähnlichkeit, ja Göttlichkeit ein, die ständige Erfahrung realer Ohnmacht mit Hilfe unkontrollierter Allmachtsphantasien kompensierend. Es entwickelt sich ein hypertrophes Selbstwertgefühl, dessen Intensität im umgekehrten Verhältnis zur tatsächlichen sozialen Anerkennung steht. Das persönliche Versagen vor den Anforderungen der Gesellschaft wird uminterpretiert in die prinzipielle Schlechtigkeit alles Gesellschaftlichen, sodann erfolgt die Umdeutung der eigenen Bedeutungslosigkeit in eine Feindschaft der übermächtigen Gesellschaft gegen das unterlegene Ich, bis schließlich in jeder neuen Niederlage ein weiterer Beweis für die eigene Einzigartigkeit gefeiert wird. Nicht anerkannt zu sein genügt zum Nachweis von Genialität; als nichts anderes erscheint die Gesellschaft denn als ein groß angelegtes Komplott der Mittelmäßigen zur Niederhaltung menschlicher Größe. Plötzlich erklären sich das Desinteresse der Machtträger und der Hochmut der anerkannten Gelehrten als aktive Unterdrückung des überlegenen Konkurrenten, neben dessen geistiger Übergröße ihre Inferiorität sich schnell erweisen müßte. Ein mythisches Urbild lädt hier zur Identifikation ein: Lucifer, der auch mehr wollte als die anderen, audi die (göttlich vorgeschriebenen) Grenzen des Mittelmaßes zu sprengen trachtete, auch an der Übermacht der gegebenen Herrschaft scheiterte und doch sich nicht in die Resignation treiben ließ. Die Sieger erst stempelten ihn, den Lidhtbringer, der dodi nur weiter hinauf wollte, zum Bösen; sie, die den wahrhaft Großen am Aufstieg zu lichten Höhen hindern, sind die wirklich Bösen, denn sie halten im Dienste des bestehenden Mittelmaßes den Weiterstrebenden am Boden. Die Mythisierung des eigenen Konflikts mit Hilfe der Lucifergestalt verschafft Rudow weiteres Selbstbewußtsein; sie gibt das Grundmuster ab für die Umstilisierung mangelnder gesellschaftlicher Beachtung in eine aktive Repression des Besseren. Die gesellschaftlichen Determinanten verweigerten Aufstiegs verschwimmen in einer mythischen Konstellation aus Sieg und Niederlage, Gut und Böse, Wahrheit und Lüge; die Vielschichtigkeit des sozialen Bedingungsgefüges ebnet sich auf die ewige Dualität von Licht und Finsternis ein. So leistet die Mythisierung des sozialen Systems mit Hilfe der Lucifergestalt eine doppelte Aufgabe: Die Unüberschaubarkeit und Kontingenz der historischen Wirklichkeit wird bewältigt mit Hilfe des undifïerenziertesten aller Deutungssysteme, das zugleich eine Überwindung sozialer Namenlosigkeit durch die Imagination höchster Prominenz im Verborgenen erlaubt. Der Mythos bestätigt dem Unterliegenden das Recht zum Aufstieg und spricht ihn von der Schuld an seinem Nichtgeiingen 9
Rudow, a. a. O., p. 47.
Der Lichtbringer im Frozeβ der Zerstörung der Vernunft
219
frei, er verschont vor den Schmerzen des Selbstzweifels und befreit von der tätigen Auseinandersetzung mit den wahren Ursachen des Mißlingens. Elite zu sein auch und gerade in der Niederlage, verachten zu dürfen in einer Situation, in der den einzelnen selbst Verachtung trifft, im Scheitern der Überlegene bleiben zu können, all das erlaubt die Identifikation mit dem Lichtbringer Lucifer. Sie bestätigt dem in der Konkurrenz Unterlegenen, der wertvollere, der bessere Mensch zu sein, sie attestiert ihm, daß seine Anstrengungen nicht vergeblich sind, weil an ihnen sich seine menschliche Größe beweist. Sie bietet dem um Anerkennung besorgten, dem zielgerichtet auf den Aufstieg orientierten Kleinbürger zur mythischen Überhöhung des banalen Existenzkampfes sich an; sie hilft ihm seine Niederlagen mit der Überzeugung zu verwinden, notwendig verloren zu haben, eben weil er in einer schlechten Welt der Bessere sei (Rudow glaubt sich beständig dafür bestraft, daß er mehr könne als die anderen). — Das Bewußtsein, als bedeutender Mensch an einer trivialen Umwelt zu scheitern, kehrt sich schließlich in Verachtung und Haß den Mitmenschen gegenüber um; sie freilich werden nicht gegenüber den Herrschaftsinstanzen, den Institutionen der Macht wirksam, von denen immer noch devot Anerkennung erwartet wird, sondern sie setzen sich nach unten, gegen den Schwächeren frei. Nur als Lucifer sich zu fühlen, ohne seine Macht zu beweisen, das genügt auch Rudow nicht; so erklärt er denn Ulrike, die, weil sie ihn liebt, am angreifbarsten ist, allererst zu seinem Gegner, um risikolos Haß abreagieren, als Mächtiger sich darstellen zu können: Du wolltest nur sehen, wie weit deine Macht über dies sanfte Geschöpf reicht, das keinen Willen kennt als deinen. Du kannst zufrieden sein, aber hüte dich, Sklavenzüchter! 10
Das nun allerdings ist die Sprache des künftigen Herrenmenschen, der autoritären Persönlichkeit übelster Art, die göttergleich über das Leben der Unterlegenen zu verfügen sich anmaßt, die Schwachen quälen zu dürfen glaubt, um dieserart über erlittenen Druck und von oben erfahrene Verachtung sich hinweghelfen zu können. Rudows Machtphantasien als die bedeutungslosen Traumsurrogate eines Pathologen zu interpretieren, erlaubt die nachgerade idealtypische Konfiguration der Bedingungselemente jenes Charakters nicht, der schließlich in den fackeltragenden SA-Männern des 30. Januar 1933 seine Lichtbringer sehen sollte. Aus dem Druck der Konkurrenz, aus der Angst vor der Anonymität der Masse träumt Rudow sich in ein menschenverächterisches Übermenschentum ein, auf das Rationalität nicht mehr einzuwirken vermag; dieser Lucifer blieb in Deutschland so einzig nicht, wie er es von sich glaubte. Weil dieser Text, auf den ersten Blick kaum mehr als die Geschichte einer gescheiterten Liebe mit tragischem Ausgang, sich als sozialpsychologisch fundierte Anamnese einer individuellen Psychose erschließt und damit weit über das individuelle Schicksal seines Verfassers hinausweist, gehört er durchaus in jenen umfassenden Prozeß der Zerstörung der Vernunft, der schließlich in den Faschismus mündete. io Rudow, a. a. O., p. 34.
220
Lucifergestaltungen
der wilhelminischen
Ära
Kaum zufällig wird man deshalb der Lucifergestalt in den künstlerischen Unternehmungen völkischer Vorkämpfer des Nationalsozialismus wiederbegegnen, die von jeher sich für eklektizistische Mythossynthesen aus Elementen des Christentums und einer verschwommenen nordischen Lichtreligion anfällig gezeigt hatten. Jene Mischung aus sozialer Verstörung und Autoritätshörigkeit, die die Hinwendung zu irrationalen Weltdeutungssystemen dieser Art beförderte, vermochte sich in Lucifer besonders gut abzubilden — zumal in der Hinwendung zu seiner Gestalt die besondere mythische Fundierung, die Verschwisterung eines halbverworfenen Christentums mit gnostischen und germanischen Mythensplittern, sich dokumentieren ließ. An einem Text wie dem folgenden Ludwig Fahrenkrogs lassen sich die sozialpsychologischen Determinanten der hier in Rede stehenden Remythisierung sozialer Konflikte recht genau ablesen: Luzifer Wie soll ich an dich glauben, dein gedenken, Wenn du nicht Liebe bist? Wie sollte ich dich ehren, lieben — Wenn deine Lust mein Elend fand? Heimstatt und Ruh ward Nacht Und eine Welt voll Hohn und Feuer brennt in mir Und will mir dämmen Sinn und Leben. Gott, wo ich weile, find ich dich nicht mehr, Nicht in mir und nicht draußen — — Gott, mein Gott! — "
(Dem Text gegenüber druckt Fahrenkrog (1867—1952), wie sein Freund Fidus Vertreter eines heruntergekommenen Jugendstils, die Abbildung eines eigenen Gemäldes mit dem Titel „Luzifers Fall" ab. Lang ausgestreckt, den Kopf zum Betrachter gewendet, das rechte Bein angewinkelt, liegt Lucifer auf dem Rücken, mit weit ausgebreiteten Flügeln. Die rechte Hand bedeckt sein Gesicht, um den Kopf ist eine Aureole. Auf die auf einem Felsen liegende Gestalt fällt von oben Licht. Aus der linken oberen Ecke blickt zürnend ein ebenfalls von einer Aureole umgebener Kopf auf Lucifer.) Die herrische Gestik des Textes wird von seiner eigenen Epigonalität diskreditiert; skrupellos schlachtet Fahrenkrog Goethes „Prometheus" aus, naiv greift er auf einen mißverstandenen Novalis zurück. Von artistischer Bewältigung des Stoffes kann demnach ebensowenig die Rede sein wie von seiner gedanklichen Durchdringung. In beidem freilich tritt nur zum Vorschein, was insgesamt prägende Signatur des Textes ist: seine geistige Orientierungslosigkeit. Sie drückt in seiner Gestaltung sich ab, wie sie andererseits in ihm selbst thematisch wird. Nicht Haß noch offenen Zorn hegt dieser Lucifer gegen seinen Gott, sondern Verständnislosigkeit, Enttäuschung, resignative Abkehr, allenfalls gedämpfte il Ludwig Fahrenkrog: Das Goldene Tor. Dichtungen in Wort und Bild. — Leipzig 1927. p. 58. — Es handelt sich hierbei um einen Sammelband Fahrenkrogscher Texte und Bilder. Der zitierte Text dürfte erheblich früher entstanden sein; Fahrenkrog war, wie Fidus, in der Dritt- und Viertverwertung seiner Hervorbringungen äußerst geschickt.
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
221
Wut prägen seine Haltung. Die Objektivation des Guten zeigt sich als der Urheber des Leids, die geglaubte Eindeutigkeit des Weltsystems, im göttlichen Willen sich verlautbarend, erweist sich als scheinhaft: Hilflos blickt Fahrenkrogs Lucifer auf die sich auflösenden Sinnbezüge zurück. So erklärt sich auch die reichlich nörgelnde Art seiner Klage: Verstört registriert er den Verlust eines stabilisierenden Ordnungsgefüges, dem er verpflichtet bleibt, ja auf das er emotional gänzlich sich angewiesen zeigt. Die Sudhe nach einer unbedingten Autorität, vorgestellt als das Wiederaufleben des alten Gottes, bleibt freilich unbelohnt. Als Ausweg bietet sich Fahrenkrog-Lucifer nicht der tätige Eingriff ins Weltgeschehen, nicht der praktische Kampf ums Bessere, sondern die Flucht in den Obskurantismus an, die Wendung ins Dunkle einer nächtlichen „Heimstatt" mit „gedämmtem Sinn und Leben", schwach erleuchtet von „Hohn und Feuer". Unentwirrbar vermengen sich in der syntaktischen Konfusion der drei mittleren Zeilen Empörung über den Weltzustand und Flucht nach innen, Ohnmachtsempfindungen und Allmachtsphantasien, Sehnsucht nach geistiger Betäubung und überbordendes Sendungsbewußtsein. Dieser Lucifer sucht nicht eigene Mündigkeit, sondern den einzigen, dem er in Fraglosigkeit und von Zweifeln frei sich unterwerfen kann; der Selbstverlust in Unterordnung unter den abschließend angerufenen Gott wird zum bereitwillig entrichteten Preis für die Überwindung der Orientierungslosigkeit. — Der Text offenbart freilich nicht allein die Autoritätshörigkeit, mit der breite Schichten auf den Wandel traditioneller Ordnungsstrukturen in der Folge sozialer Auseinandersetzungen reagierten, sondern belegt zugleich noch deren Pendant: Die Vereinzelung in einer als kontingent wahrgenommenen Außenwelt schlägt um in die Egozentrizität des Asozialen, dessen imaginierte Überlegenheit und dessen Haß nur von dem erwarteten einzigen entbunden zu werden brauchen, um sich zerstörerisch gegen die Gesellschaft der Andersdenkenden und -empfindenden wenden zu können. Fahrenkrogs Luzifer ist gewiß nur ein sich in sich selbst duckender Miniaturgott, ein durch die neugewonnene Freiheit verstörter Knecht, der die alte Dienstbarkeit ersehnt und zugleich in höchste Machtvollkommenheit sich hinaufträumt. Ernstzunehmen aber ist er gerade deshalb: Sein von Ranküne „gedämmter Sinn" ist die präzise Chiffre für eine jederzeit in Inhumanität verkehrbare Irrationalität. Die Flucht in mythische Weltdeutung, in die „Nacht" obskurantistisch überwunden geglaubter Blindheit, wird zum Vorspiel sozialer Destruktion. Wohl in keiner der hier zu besprechenden Lucifergestaltungen tritt die Destruktivität einer von allen Rücksichten befreiten Egozentrik so deutlich hervor wie in Fahrenkrogs monströser „Dichtung in Wort und Bild" „Lucifer", die, im Herbst 1913 erschienen, noch im gleichen Jahr ihre 4. Auflage erlebte 12. Ihre Entstehung datiert, nach Fahrenkrogs eigenen Worten, bis in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück. Daß ihre Veröffentlichung so lange hat auf sich warten lassen, erklärt Fahrenkrog mit zwei Gründen: Zum einen handle es sich um eine sehr persönliche Dichtung, die nicht ursprünglich 12 Ludwig Fahrenkrog: Lucifer. Dichtung in Bild und Wort. 4. Auflage. — Stuttgart 1913.
222
Lucifergestdtungen der wilhelminischen Ära
für die Veröffentlichung bestimmt war: Sie sei „nur: so für mich — aus mir gewachsen." (p. V) Andererseits sei der „Lucifer" in den 90er Jahren, in der naturalistischen Ära, eine „unzeitgemäße Schöpfung" gewesen, die kaum auf den Beifall der „Kunstklugen" habe rechnen dürfen. Nun hat zwar, wie aus Fahrenkrogs bekennerischem „Vorbericht" hervorgeht, keineswegs die Einstellung der Fachwelt seinen Arbeiten gegenüber sich gewandelt, und doch scheint das Klima einer Veröffentlichung seines „Lucifer" günstig: Inzwischen wuchs die Zeit weiter und mit dieser wanderte ich weiter zu mir selber. Und nachdem ich nun meines Wesens Kern erkannte, konnte ich ihn auch trotzig hinsetzen: Hier stehe ich\ Macht was ihr wollt. Und, du liebe Umwelt, wenn du wirklich etwas von mir haben willst, dann nimm mich wie ich bin. (p. VI)
Hier begegnet man ihr wieder, der Großmannssucht im Geiste, die bereits an Rudow als Resultat fehlender sozialer Beachtung sich zeigte: Die stets aufs neue enttäuschte Werbung um Anerkennung schlägt um in ein demonstratives Märtyrertum im Dienst der besseren Sache, die mit dem eigenen Ich identisch ist, und wendet sich in einen quasi-religiösen Ich-Kult mit entsprechender Gemeindebildung 13 zum Zweck ichstabilisierender Adoration. Der Nietzsche-Kult, gerade in dieser Zeit weniger auf Werkverständnis als auf den inflationären Austausch von Schlagwörtern sich gründend, tut das Seine: Mangelnde Anerkennung deutet vor dem Schicksal Nietzsches sich in „Unzeitgemäßheit" um, und sogleich darf der sich unverstanden Glaubende sich als die gegenwärtige Approximation des Übermenschen fühlen — ein Possenreißer, der sich für Zarathustra hält. Denn tatsächlich steht Fahrenkrog wie der Possenreißer durchaus auf der Seite der „Gläubigen des rechten Glaubens", denen er doch zu trotzen vermeint. Der Prozeß zunehmender Konzentration aufs eigene Ich läuft ja selbst nach seinen eigenen Worten nicht gegen die Tendenz der Zeit, sondern durchaus in Einklang mit ihr ab: Mit der Zeit wandert er zu sich selbst. Instinktiv erfaßt er die Gunst der Stunde, auf die sein Werk, ein Monument der Egomanie, jetzt, ein Jahr vor den Materialschlachten des Ersten Weltkriegs, hoffen durfte. Die Resurrektion des Mythos vollzieht sich, wie so häufig in Texten dieser Art, unter der Weihe eines sprachlichen Bombasts, der dem, was nur nachempfunden ist, eine Bedeutungsschwere verleihen, ja nachgerade den Nachweis der Ursprünglichkeit erbringen soll. Dergleichen kommt ihm freilich in keiner Weise zu, denn die mythischen Figuren, die Fahrenkrog in Szene setzt, sind durchaus Gestalten seiner eigenen Tage, und in ihrer aufgedonnerten Prosa, die Überzeitlichkeit zu suggerieren bestimmt ist, verbirgt sich nur mit Not, was an aktuellen Wunschphantasien Fahrenkrogs überwiegend kleinbürgerliche Kunden bewegte. Zuerst könnte es scheinen, Fahrenkrog habe nur den bekannten Mythos in Stabreime gesetzt: Gott erschafft Universum und Geisterwelt, die er mit einem freien Willen begabt. Lucifer, der herrlichste Diener Gottes und Hüter der Erde, will selbst Schöpfer, will angebetet und frei sein; er fällt von Gott ab. Die Engelscharen teilen sich, die einen wenden sich Michael, die andef^rv-, · \ · 13 Fahrenkrog hatte seine eigene Fahrenkroggesellschaft, Fidus den St. Georgsbund.
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
223
ren Lucifer zu. Gott aber schlägt die Aufrührer mit Kälte, Freudlosigkeit, Trübsinn und Unzufriedenheit und erschafft dann den Menschen, der, in seiner Sehnsucht nach Gott, zur Harmonie der Welt beizutragen streben soll. Lucifer aber will sich an Gott rächen und verführt den Menschen. Der Tod kommt in die Welt, Kain erschlägt Abel. Die Menschheit aber strebt nach Überwindung des Erdendaseins, strebt nach Gott. — Was also faszinierte derart an Lucifer? Eine genauere Betrachtung der entscheidenden Szene, Lucifers Entschluß zur Rebellion, gibt hier Aufschluß: Schmerzend und weit öffnete er dann sein Auge und starrte zuriidc in die Ewigkeit, und verloren stieß er den Blick vorwärts in Zeit und Zukunft. Scheu flohen die Geister von dannen. „Die Erde ist mein!" „Die Wahl ist mein!" „Ich bin mein!" „Ich will!" (p. 7)
Man begegnet in der vorangestellten Situationsbestimmung wiederum der sinnbildlichen Darstellung schmerzlich empfundener Orientierungslosigkeit und eines hierauf reagierenden Suchens nach Bezugspunkten in einer als unüberschaubar erfahrenen Umwelt. Auf das Chaos aufgelöster Sinnbezüge antwortet als subjektive Reaktionsform des verstörten Individuums eine Abfolge aufs äußerste konzentrierter Machtsprüche als die Vergegenwärtigung eines befreienden Ringens, als dessen Resultat eine unumstößliche Sicherheit in der subjektiven Positionsbestimmung und Identitätsfindung sich darstellt, die im diametralen Gegensatz zur vorab als Verlorensein erfahrenen Kontingenz der Außenwelt steht. Diese neue Gewißheit gewinnt sich nicht aus der eingreifenden Neustrukturierung des scheinbar Zerfallenen, sondern zieht einzig die radikale Konsequenz aus dem im Zusammenhang des Ganzen begründeten Erlebnis der Vereinzelung. Auf den Schein der Beziehungslosigkeit, in der Ich und Außenwelt zueinander stehen, reagiert das Subjekt mit der Aufkündigung aller über es selbst hinausweisenden Rücksichten und Hemmungen. Dabei darf die scheinbare Ziellosigkeit des jubelnd entdeckten eigenen Willens nicht irritieren: Dieser Wille ist den Identitätsnachweis zu erbringen bestimmt; in ihrem Wollen offenbart sich die eigenmächtige Persönlichkeit. Identität aber erscheint hier im Zeichen des Besitzens; der Wille, man selbst zu sein, indem man sich selbst besitzt, offenbart die persönlichkeitsbildende Kraft des Willens zum Eigentum. Identität wird nachgerade zur Funktion des Besitzens, und den Bruch zwischen Subjektivität („Ich bin mein!") und Objektivität („Die Erde ist mein!") vermag der Besitzanspruch zu heilen. Die unüberschaubare Dingwelt ordnet sich im Kraftfeld des Willens zum Eigentum auf den einzelnen, der sie in den Griff zu bekommen trachtet, als ihr imaginäres Zentrum zu und gewinnt so greifbare Gestalt unter den einfachen Gesetzen des Habens oder Nicht-Habens; das scheinbar abstrakte, an den Objekten desinteressierte, einzig um die Ostentation der Kraft des losgelassenen Subjekts bemühte Wollen dekuvriert sich als Haben-Wollen. Lucifer offenbart sich als die Deifikation des Eigentümers. Man darf das wörtlich nehmen:
224
Lucifergestdtungen der wilhelminischen Ära
Wir wählen selbst uns unser Eigentum: das Redit der Freiheit. Wir gebären uns: Drum fort mit dir, Erzengel Michael, sei Sklave denn mit Lust. Das Reich des Geistes will nur Herren, keine Knechte. Weicht, Sklaven, weicht! Doch wer den Mut zum Eigentum gewann, der her zu mir! (p. 12)
Sicher redet Fahrenkrog von Eigentum vor allem deshalb, weil deutschtiimelnde Berührungsangst vorm Individualitätsbegriii ihn zur Aufnordung seiner Begrifflichkeit anhält, und doch war selten eine sprachliche Polyvalenz verräterischer: In Lucifers Individualitätsbegriff erfährt der Besitzindividualismus seine anthropologische Apotheose. Denn was anderes ist sein Inhalt als die behauptete Selbstverwirklichung im sozialen Gegeneinander der Konkurrenz, das Sich-selbst-„Gebären" außerhalb der übergreifenden Ordnung sozialer Bezüge? Losgelöste Individuen, aus eigener Kraft sich erschaffend und sich erhaltend, unbekümmert um die Verfaßtheit des Ganzen, stellen sich als Herren vor über die Gesamtheit des Existierenden, das zum Objekt ihrer Selbsterhaltung herabgewürdigt ist. Das subjektive Privatinteresse, zum Ich-konstituierenden Wollen sich hinaufstilisierend, unterwirft die Welt despotisch seiner Verfügungsgewalt; ihre einzelnen Elemente erscheinen einzig noch unter dem Aspekt subjektiver Aneignung. Insofern lebt Heteronomie, als deren radikale Zerschlagung Lucifers extremer Individualismus sich gibt, in der Egozentrik ungezügelten Besitzenwollens mit neuer Kraft wieder auf; Lucifers Freiheit ist eine Freiheit zur Herrschaft, zur Macht. Wir, Lucifer, dein Fürst und seine Brüder entsagen dir, dem Herrn. Des Willens Madit erstarkte, eignen Weg zu wandeln. Und eigner Kraft, und eignem Urteil, eignem Willen vertrauen wir uns an, und frei von dir erkennen wir die wunderbare Seligkeit des Gottestums, die uns von ferne winkt, (p. 12f.)
Die Selbständigkeit des Eigentümers — denn nichts anderes meint die „wunderbare Seligkeit des Gottestums" — wird zum Gegenstand verzückter Idolatrie, emporgehoben auf einen Gipfel glorioser Absolutheit, der die Niederungen sozialer Bedingtheit und Verantwortung weit überragt. Dabei verrät wohl nichts den bestimmten sozialen Ursprung dieser Gestaltung so deutlich wie der Umstand, daß solche Selbständigkeit nicht erkämpft wird — eine Schlacht im Himmel findet nicht statt — , sondern gewissermaßen in einem Akt der Auslöschung und Neukonstitution sämtlicher Bewußtseinsinhalte dem Wollenden widerstandslos zufällt. Lucifers Lossage ist eine Revolution im Geiste. Selbständigkeit erscheint so als Wunschphantasie, deren Unerfüllbarkeit sich gerade darin offenbart, daß sie von Anbeginn sich aufs Reich des Geistes abdrängen läßt. Lucifer wird zum Abgott der Unselbständigen, der Ohnmächtigen, der Abhängigen, die ihre Aufstiegs wünsche, ihre Machtphantasien, deren Telos in der Verfügungsgewalt über Eigentum liegt, in seiner Gestalt organisieren. Er bietet den aufstiegsorientierten Mittelschichten, deren historische Lage sie dem Abstieg immer näher brachte, zur mythischen Überhöhung ihres eigenen verzweifelten Kampfes um die Eigenständigkeit sich dar. Geistig — auf dem Felde, für das sie Überlegenheit reklamierten — muß gelingen, was historisch kaum mehr möglich scheint. In der Phantasmagorie aber erscheint ungemildert, was als historisches Entstehungsfeld ihr vorgelagert ist: die Egozentrik sub-
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
225
jektiven Interesses im Konkurrenzkampf. Hier erst gelangen — was im vorangehenden Kapitel sich bereits ankündigte — im Lucifermotiv Stirnersche Ideologeme voll zum Ausbruch, hier erst feiert der „Einzige" mythische Resurrektion. Man hat, mit dem Hinweis auf Stirner, behauptet, Lucifer im Verständnis dieser Zeit sei „der remythologisierte Inbegriff des bürgerlichen Egoismus" 14. Mit dieser Formel ist kaum die Vielschichtigkeit der Lucifergestaltungen jener Jahre erfaßt, und doch bezeichnet sie präzise den Kern der Faszination, die die Gestalt damals auszuströmen vermochte. Fahrenkrogs Lucifer ist die mythische Gestalt des „Einzigen", jener Inkarnation egozentrischer Kraftmeierei im Geiste, die sich in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts allerhöchster Popularität erfreute. Stirner wurde in den beiden Jahrzehnten vor dem Weltkrieg kaum weniger als Nietzsche gelesen 15 , am allermeisten noch von den Kleineigentümern und deren Ideologen. Die tragende Idee des „Einzigen", daß die alltägliche Misere des Existenzkampfes mühelos durch einen radikalen Bewußtseinswandel — Lucifer führt in seinen vier Machtsprüchen ihn vor — sich bewältigen lasse, kam dabei ebenso der Reserve jener Schichten gegen kollektives politisches Handeln entgegen, wie in der Verhöhnung sozialer Verantwortlichkeit und der Glorifikation subjektiver Interessen die Ichzentrierung des bedrohten und bedrohenden einzelnen, dem die Uminterpretation zum weltmächtigen „Einzigen" den dringend nötigen Mut zusprach, ihre quasi-philosophische Rechtfertigung erfuhr. Mag auch Stirner für Mythen nur Spott übriggehabt haben, so ist doch Fahrenkrogs Lucifer Geist von seinem Geist, und im rauschhaften Stakkato der Gedankenstrich-Prosa des einen wohnt ebensowenig Rationalität wie in der schwülstigen Hochtrabenheit der Mystifikationen des anderen. Mochte sich in der Gesamtkonstellation von Rudows Verhalten die Idolatrie Lucifers als Resultat eines individuellen Inferioritätskomplexes pathologischen Ausmaßes erklären, so deutet sich vor dem Hintergrund der Stirner-Renaissance die Fahrenkrogsche Lucifergestalt als das Dokument eines kollektiven Inferioritätskomplexes, der weite Mittelschichten erfaßt hatte und zu seiner Kompensation der unterschiedlichsten Surrogate bedurfte. Der Lucifermythos ist eines von ihnen, freilich bei weitem nicht das bedeutendste: Judenhaß und völkische Ideologie vermochten bei gleicher politischer Blindheit größere Lebensnähe zu suggerieren als der hermetische Mythos, unter dessen idealistisch-sublimer Camouflage jeder kämpferische Impuls zu ersticken drohte, ja der gerade in seiner herrischen Gestik die gänzliche Substitution politischer Praxis durch geistiges „Ringen" zu befördern imstande war. — Es verwundert deshalb nicht, daß zumal die um die Jahrhundertwende sich weitester Verbreitung erfreuende Theosophie, jener Schmelztiegel, in dem die u Janos Frecot, Johann Friedrich Geist, Diethart Kerbs: Fidus. 1868—1948. Zur ästhetischen Praxis bürgerlicher Fluchtbewegungen. — München 1972. p. 281. 1 5 Vgl. die ausführliche Dokumentation des Stirner-Kults in jener Zeit bei Hans G . Helms: Die Ideologie der anonymen Gesellschaft. Max Stirners .Einziger' und der Fortschritt des demokratischen Selbstbewußtseins vom Vormärz bis zur Bundesrepublik. — Köln 1966. pp. 295—345.
226
Lucifergestdtungen der wilhelmìnisdben Ara
Mythen der Völker zu einem kaum mehr analytisch zu dekomponierenden System verarbeitet wurden, Lucifer zu einer ihrer zentralen Gestalten erhebt. Gerade die Theosophen erwarteten sich die Auflösung aller irdischen Widersprüche in einer lichten Geisteshöhe, die es durch unermüdliches Streben und Kämpfen, durch die Überwindung wohlgemerkt geistiger Widerstände, zu erreichen gilt. Lucifers Ringen, seine Zerschlagung aller einengenden Regeln und Maßstäbe zugunsten der persönlichen Entfaltung, vermochte dabei das mythische Urbild für die geistige Anstrengung der Überwindung aller irdischen Hemmnisse mit dem Ziel einer Rüdekehr zu Gott abzugeben, ja Lucifer gewinnt hier nachgerade die Funktion einer Symbolgestalt irdischen Ringens. Er ist positiv in seiner Zielorientiertheit, als Liditbringer, als Wegbereiter zu Gott, negativ aber und dunkel getönt als Vergegenwärtigung der nodi bestehenden Verhaftung ans Irdische, der noch nicht gelungenen Loslösung aus weltlichen Zusammenhängen. In diesem Sinne hat Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846— 1916), der 1893 die deutsche Theosophische Vereinigung gegründet und bis 1902, als ihm Rudolf Steiner in dieser Aufgabe folgte, auch geleitet hatte 16 , Lucifer als vorbildliche Idealgestalt seiner Weltinterpretation integriert 17 , und in diesem Sinne auch erscheint Lucifer als Vorbild menschlichen Strebens zu Gott in dem Text Fahrenkrogs, dessen Schluß deutlich theosophische Infiltration bekundet. Lucifers Parole: „So folgt mir auf Erkenntnis-Schwingen zur GeistesFreiheit!" (p. 9) erfährt im Menschenschicksal ihre nachträgliche Legitimation; Gott selbst spricht zu den gefallenen Engeln: „Eu'r selbstgewählt Geschick erfüll' ich ganz im Menschentum." (p. 16) Die Erschaffung des Menschen bedeutet die Verbannung des Geistes in die Materie; Erkenntnis aber ebnet den Weg zurück ins „All-Eine" des göttlichen Lichts: Ihn zu erlösen wird, was ihn verstieß — Erkennen heißen. Hast du dich selber erkannt — erkenne nun Gott. Läutert das Erdendasein dich nidit zu einem Mal, kehrst du zurück aufs neu', zur höllischen Erde, bis du errungen dir Gott und das Glüdc. (p. 17)
Der Grundgedanke dieser Lebenssicht ist gnostisch (Verbannung des Geistes, des göttlichen Prinzips, in die böse Materie, Rüdekehr zu Gott als Verlöschen des Selbst über individuell zuteil gewordene Erkenntnis), hinzu kommt die anthroposophische Lieblingsidee der Seelenwanderung, die, als reichten die irdischen Anstrengungen nicht aus, jede sich zum Zweck der Läuterung abhetzende Seele auch nach dem Tode noch in Trab hält. Kaum anders läßt sich die Breitenwirkung der Theosophie in jenen Jahrzehnten erklären als damit, daß sie selbst noch das Jenseits zum Ort der Aufstiegswünsche umdeutet, die lebendige Seele, das leuchtende Ziel im Auge, dort sich weiter emporquälen läßt, wo der sterbende Mensch erschöpft zusammengebrochen ist. Freilich ver16 Bezeichnenderweise wird man den Namen Hübbe-Schleidens in der weit verbreiteten halboffiziellen Biographie von Johannes Hemleben: Rudolf Steiner. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. — Reinbek 1963 nicht finden. Hübbe-Sdileiden war als späterer Gegner Steiners publizistisch gegen ihn tätig geworden. 17 Vgl. Jost Hermand: Meister Fidus. Vom Jugendstil-Hippie zum Germanensdiwärmer. — In: J. H.: Der Schein des schönen Lebens. Studien zur Jahrhundertwende. — Frankfurt 1972. p. 66.
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
227
spricht sie Trost deshalb, weil in dieser Konkurrenz der im Erdenleben wenig Erfolgreiche, nunmehr aufs Geistige sich konzentrierend, den Sieg für sich erwarten darf. Das theosophische Finale des Fahrenkrogschen Textes steht insofern gar nicht im Widerspruch zur Revolte Lucifers, sondern bildet deren gedankliche Überhöhung, ja gleichsam deren verbindliche Applikation aufs Menschenschicksal: Lucifers in egozentrischer Selbstvergötterung resultierendes geistiges „Ringen" präludiert mythisch das allgemeine Weltgesetz, daß nur der zur Göttergleichheit aufsteigen könne, der in radikaler Vereinzelung und in unablässiger Anspannung, unbeirrt und mit eigener Kraft sein festes Ziel anstrebt. Der Mensch wird nicht erlöst, er hat sich selbst zu erlösen, und mag das auch nur im Geiste geschehen, so gehorcht doch, wie Fahrenkrogs Text zeigt, diese Art von Erlösung eben jenen Gesetzen, von denen es zu erlösen galt. — Fahrenkrog selbst freilich genügten mythische Welterklärungen dieser Reichweite bald nicht mehr; er wandelte sich zu einem Propagandisten nordischen Glaubens, gründete 1908 eine Germanische Glaubensgemeinschaft, zu deren Mitgliedern auch Fidus zählte, und machte sich so sehr um den völkischen Gedanken verdient, daß an seinem 70. Geburtstag 1937 der „Völkische Beobachter" ihn als einen „geistigen Vorkämpfer" feiern konnte 1 8 . Im Führerstaat, in dem noch der Erfolgloseste als Herrenmensch sich fühlen durfte, hatte endlich sein wahres Zuhause gefunden, was als hehre Verantwortungslosigkeit und lichte Egozentrik in luciferischen Machtphantasien Jahrzehnte zuvor nodi mythisch sich getarnt hatte. Freund Fidus ( 1 8 6 8 — 1 9 4 8 ) , der gleichfalls dem Lucifer künstlerisch gehuldigt hatte, war bereits 1932 der NSDAP beigetreten und begrüßte — mit „lichtdeutschem Gruße", wie er in jenen Jahren seine Rundbriefe zu unterfertigen liebte — im „Künstlermenschen Hitler" 1 9 den lange ersehnten Lichtbringer, der ihn aus dem Dunkel künstlerischer Erfolglosigkeit in den hellen Schein eines offiziellen Staatskünstlertums zu heben hatte. Das allmähliche Hinüberwachsen aus theosophischer Lucifervergötterung in nordische Lichtreligion und von dort heim ins Reich vollzieht sich dabei ähnlich wie bei Fahrenkrog 2 0 . Unter dem starken Einfluß Hübbe-Schleidens21 entstehen in den 90er Jahren zahlreiche Gestaltungen des Lucifermotivs: Bereits 1892 zeichnet Fidus einen „Tempel des Luzifer", zu dem 1894 eine Kohlezeichnung eine Innenansicht liefert. Das Jahr 1893 bringt einen „grollenden" und einen „schreitenden" Lucifer sowie ein Aquarell „Luzifer mit dem Stern". 1894 folgt in ö l der „Luzifer Morgenstern", 1898 in Blei ein „Luzifer-Antlitz", 1899 ein Aquarell „Luzifer-Loge", 1904 eine 2. Fassung des „grollenden Luzi18 Frecot et al., a. a. Ο., p. 157. 19 So Fidus selbst. Vgl. Hermand, a. a. O., p. 117. Daß das Dritte Reidi mit seinen altvölkischen Wegbereitern nichts mehr zu tun haben wollte, hat Fidus dabei — trotz aller Schwierigkeiten und Zurückweisungen — in seinem Führerglauben nicht wankend gemacht. 20 Fidus freilich hat niemals eine der Fahrenkrogs vergleichbare schriftstellerisdie Tätigkeit entfaltet. 21
Über die persönlichen Beziehungen zwischen Hübbe-Sdileiden und Fidus vgl. Frecot et al., a. a. O., p. 79fí. und Hermand, a. a. Ο., p. 64f.
228
Lucifergestdtungen
der wilhelminischen Ära
fer", 1913 „Luzifers Erwachen", 1915, im Weltkrieg, ein „Luziferisdher Wille", und endlich noch 1933 die 3.Fassung von „Helianthe und Luzifer". Der Fidus-Verlag versorgte zudem die völkische Jugend, aus der sich Fidus' getreueste Gefolgschaft rekrutierte, mit den entsprechenden Reproduktionen. — Nur eine dieser Hervorbringungen sei hier näher beschrieben: „Luzifer Morgenstern" 22 ist en face dargestellt, der untere Bildrand begrenzt die Darstellung etwas oberhalb seiner Hüften. Der dunkle Körper ist von hellen Nebeln umtost; die Arme sind, Gelassenheit, Selbstsicherheit, Unangreifbarkeit symbolisierend, über der nackten Brust verschränkt. Um den Kopf wallt langes dunkles Haar, das vom Wind so nach hinten geweht wird, daß Luzifers Gesicht vollständig freiliegt. Auf der hohen Stirn schwebt der strahlende Morgenstern, dessen Licht sich in den weit geöffneten Augen spiegelt; Luzifers Blick wird dadurch seherisch und undurchdringlich zugleich. Um die Lippen spielt ein kaum wahrnehmbares Lächeln. — Diesem Lucifer weht der Wind ins Gesicht, und doch hält er allen Anfeindungen siegesgewiß stand, nicht aufgrund körperlicher Kraft unendlich überlegen (Fidus' Gestalten sind eher mager), sondern aus innerer, aus geistiger Stärke. Der blendende Stern, der undurchdringliche Blick, die verschränkten Arme verraten: Hier ist ein unangreifbares Ich, auf das niemand mehr einzuwirken vermag, das völlig in sich selbst ruht und deshalb den Weg zu weisen wüßte heraus aus materialistischer Beengtheit, hinauf zu idealischen Höhen. Hier bietet sich als Führergestalt, als mythische Identifikationsfigur ein einsamer Heros an, der (scheinbar) gegen den Strom der Zeit in trotziger Ichzentrierung auf eigener Kraft und Einsicht beharrt; mit hypnotischem Blick raubt dieser Führer in die Eigenständigkeit dem Betrachter den eigenen Willen und zieht ihn hinein in den Nebel des Mythos. Wie so häufig bei Fidus' Bildern dringen private sexuelle Obsessionen auch in die vorgebliche Geistesreinheit der Luciferdarstellungen ein, die so zugleich die enge Verbindung von Inferioritätskomplexen und Machtphantasien mit sexuellen Wunschträumen und Ängsten dokumentieren (gleiches gilt für Fahrenkrog; die im „Lucifer" abgebildeten Gemälde suchen an schwüler Erotik selbst in dieser Zeit ihresgleichen). Man vergleiche etwa das Aquarell „Finsterster Abend" 23 , im gleichen Jahr 1894 wie „Luzifer Morgenstern" entstanden, in dem das Verhältnis von ringender Seele und orientierender Idealgestalt völlig dem Modell sexueller Hörigkeit nachgebildet ist: Mit weit geöffneten Schenkeln kniet, das Gesicht verzückt gen Himmel gehoben, die Arme beschwörend emporgereckt, die Augen geschlossen, eine nackte Frau in gänzlicher Unterwerfungs- und Ergebenheitshaltung vor einem — wie Fidus — reichlich klein und schmächtig geratenen Lucifer, der, die riesigen Flügel abgespreizt, nackt, das Genital in Höhe ihres Kopfes, mit glühendem Blick sie in seinen Bann zieht. Die Sphäre des von materiellen Dingen, von der Sinnenwelt unbefleckten Geistes offenbart sich als Austragungsort sexueller Konflikte: Sexualangst vermag sich hier in Macht- und Omnipotenzphantasien umzubilden, für die es keine Abb. in Frecot et al., a. a. Ο., p. 421. 23 Abb. in Frecot et al., a. a. Ο., p. 446.
22
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
229
Partner, sondern nur mehr willfährige Opfer gibt. Dieser Lucifer erprobt im privatesten Bereich, was später allgemeines Gesetz der staatlichen Ordnung werden sollte; kaum mag als Zufall erscheinen, daß Fidus 1933 mit „Heliante und Luzifer" 2 4 eine letzte Variation des Themas malte: In einer unhistorischen Ideallandschaft, in der Seerosen für die nötige Schwüle sorgen, kniet in gleicher Gebärde die Frau vor dem Lichtbringer, der sie mit festem Blick in ihre Grenzen bannt. Freilich hat der Lucifer von 1933 sich bedeutend gewandelt: Mit wallendem Blondhaar, markigem Profil und muskulösem Körper gehorcht er bereits dem offiziellen Schönheitsideal der Thorak und Breker. Auch steht Lucifer nicht aufrecht wie auf Fidus' frühen Bildern, sondern er liegt ausgestreckt auf dem Boden. Doch hat er den Oberkörper in einer Art Liegestütz bereits aufgerichtet, und bald wird er, von weiblicher Schwäche befreit, ganz sich erhoben haben. Wie denn auch anders? Es ist das Jahr der Erhebung, und Fidus leistet mit naiver Symbolik in neugermanischem Kitsch seinen Beitrag dazu. Lucifer, den man einzig noch mit Hilfe der Bildunterschrift als solchen zu identifizieren vermag, wird zum Symbol der nationalsozialistischen Machtergreifung, des deutschen Ringens um nationale Würde, um den totalen Staat. Der Lichtbringer offenbart sich als Führer in den Faschismus. — Nun darf hier gewiß nicht der Eindruck entstehen, von der Theosophie, dann der Anthroposophie, führe ein notwendiger Prozeß zuerst in völkische Gruppierungen und dann direkt in den Faschismus. Zitiert sind die hier besprochenen Lucifergestaltungen allenfalls als Wegmarken in jenem allgemeineren Prozeß, den Georg Lukács als denjenigen einer „Zerstörung der Vernunft" beschrieben hat 2 5 . Sicher ist, daß die genannten Gruppen diesem Prozeß, wenn sie ihn nicht aktiv beförderten, so doch audi keine Gegenwehr geleistet haben. Zumal die Steinersche Anthroposophie, die jeden politischen Konflikt, jede soziale Auseinandersetzung als Ausdruck jenseitig miteinander rivalisierender geistiger Mächte verstand, erzwang geradezu die Abkehr vom tatsächlichen Weltgeschehen und förderte die Konzentration auf überzeitliche „Wesenheiten". Die besondere Gefahr dieser Art von Eskapismus lag (und liegt) darin, daß die „geisteswissenschaftliche Erforschung" der „geistigen Mächte" hinter der historischen Erscheinungswelt gerade als der einzig adäquate Weg zu deren genauem Verständnis sich gab. Zu welch grotesken Auswüchsen dergleichen „Wissenschaft" sich versteigen konnte, mag als Beispiel Steiners Deutung des Ersten Weltkriegs verdeutlichen; Lucifer ist wieder nicht fern. In einem Vortrag, der, am 18. Mai 1915 gehalten, noch heute in einer Einzelausgabe vertrieben wird, rät Steiner seinen Zuhörern an: „Darauf kommt es nicht an, daß wir immer hinblicken nur auf die historischen Ereignisse . . . " 2 6 — die Ereignisse eben, die zu deuten er gerade sich anschickt. Und so zeigt sich denn seiner * Abb. in Frecot et al., a. a. Ο., p. 447. (Das Gemälde ist in der synoptischen Tabelle p. 390 als „Helianthe und Luzifer" notiert.) 2 5 Vgl. Georg Lukács: Die Zerstörung der Vernunft. — Neuwied/Berlin 1962. 2 6 Rudolf Steiner: Christus im Verhältnis zu Luzifer und Ahriman. Die dreifache Wesensgestaltung. Ein Vortrag, gehalten in Linz am 18. Mai 1915. 2. Auflage. — Dornach 1968. P· 21. 2
230
Lucifergestdtungen
der wilhelminischen Ära
Wesensschau, daß der in Mitteleuropa tobende Krieg in Wahrheit nichts als die in der Astralwelt sich abspielende Kollision des östlichen luziferischen Elementes mit dem westlichen ahrimanischen Element darstellt; dem vom ChristusImpuls durchdrungenen Mitteleuropa kommt dabei die Aufgabe zu, beide Elemente ins Gleichgewicht zu bringen. Bezeichnend für Steiners Deutungen ist, daß sie dem historisch bereits Eingetretenen die spirituellen Erklärungen nachreichen und so automatisch ins Apologetische umschlagen; was ist, ist als Ausdruck des Übersinnlichen notwendig so: Es ist naiv zu glauben, daß der Krieg hätte ausbleiben können. Die Menschen reden jetzt, als ob dieser Krieg nicht hätte zu kommen brauchen. Er liegt natürlich im europäischen Karma. ( . . . ) Wir müssen nur wissen, daß dieser Krieg eine historische Notwendigkeit ist.27
Hier schlägt, was sich als Erbe des klassischen Humanismus gibt, in schwärzeste Inhumanität um; begeistert begrüßt Steiner in den Toten des Weltkriegs „unverbrauchte Ätherleiber", die sich schützend um seinen Dornacher Bau aufreihen. Daß diese Art von „Geisteswissenschaft", die Kriege einzig unter dem Aspekt ihrer „historischen Notwendigkeit" zu betrachten wußte, der Barbarei nicht zu wehren vermochte, bedarf hier keiner weiteren Betonung. — Steiner hat, darin ein Erbe Hübbe-Schleidens, der Lucifergestalt einen zentralen Ort in seinen Spekulationen eingeräumt; zu Eingang des oben zitierten Vortrage entwirft er eine Plastik, die „an bedeutungsvoller Stelle" im Dornacher Bau aufzustellen 28 und das Verhältnis zwischen Christus, Lucifer und Ahriman zu symbolisieren bestimmt war. Steiner selbst hat sie dann weitgehend ausgeführt; sie ist heute noch in Dornach zu besichtigen 29 . Wir möchten hier auf die letzthin konventionelle Darstellung des Lucifersujets, aus der die ihr literarisch beigelegte Bedeutungsschwere kaum hervorgeht, nicht näher eingehen und stattdessen kurz uns einigen Texten zuwenden, aus denen das Spezifische des Steinersdien Luciferverständnisses deutlicher hervorgeht. Mit dem Generalsekretariat der Theosophischen Gesellschaft übernimmt Rudolf Steiner 1902 zugleich die Herausgeberschaft des Vereinsorgans „Lucifer" (so benannt nach der ersten, in England erschienenen, theosophischen Zeitschrift), später umbenannt in „Lucifer-Gnosis". In einem programmatischen Aufsatz aus dem Jahre 1903 entwickelt er die Ziele der Zeitschrift und stellt bei dieser Gelegenheit seine Deutung der „Wesenheit" Lucifer vor. Leitender Gedanke Steiners hierbei ist der anthroposophische Grundanspruch, Wissenschaft und Glaube miteinander versöhnen zu wollen. Eben dieser Anspruch indes führt zu einem Symbolisierungszwang, da hinter den Fakten, dem Gegenstand wissenschaftlichen Forschens, jeweils noch eine tiefere, eine wesentliche Schicht zu entdecken ist, die einzig glaubensmäßig erfaßt werden kann. So schreibt denn Steiner: Das bedeutsame Symbol der Weisheit, die uns durch Forschung gegeben wird, ist Lucifer, zu deutsch der Träger des Lichtes. Kinder des Lucifer sind alle, die nach Erkenntnis, nach 2 8 Steiner, a. a. O., p. 7. ν Steiner, a. a. O., p. 25. 29 Hemlebens Monographie bringt eine Photographie aus dem Jahre 1919, die Steiner in seinem Atelier bei der Arbeit an der Plastik zeigt. — Hemleben, a. a. O., p. 110.
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
231
Weisheit streben. ( . . . ) Und alle diese Kinder des Lucifer konnten audi Gläubige werden. Ja, sie mussten es werden, wenn sie ihre Weisheit recht verstanden. Denn ihre Weisheit ward ihnen eine „frohe Botschaft". Sie kündete ihnen den göttlichen Urgrund von Welt und Mensch. ( . . . ) Was ihnen Lucifer gebracht, das leuchtete vor den Augen ihrer Seele als Göttliches. Dem Lucifer verdankten sie, dass sie einen Gott hatten. Es heisst das Herz mit dem Kopfe entzweien, wenn man Gott zum Gegner des Lucifer macht.30
Und im Schlußabsatz heißt es: Lucifer weiss, dass die leuchtende Sonne nur im Herzen eines jeden einzelnen aufgehen kann; aber er weiss auch, dass allein die Pfade der Erkenntnis es sind, die den Berg hinaufführen, wo die Sonne ihr göttliches Strahlenkleid erscheinen lässt.31
Lucifer gilt Steiner also in diesem frühen Aufsatz als eindeutig positive Symbolgestalt, die für menschliches Forschen und wissenschaftliches Erkennen steht; Lucifergestalten in diesem Sinne sind die großen Forscher der Wissenschaftsgeschichte, also etwa Kopernikus, Galilei und Darwin. Freilich bezeichnen diese Sätze zugleich die Gefahr des Luciferischen: die mögliche Loslösung des Wissenwollens vom Ziel aller Erkenntnis, vom Göttlichen. Eingebettet in die umfassende Aufgabe einer Ergründung des göttlichen Ursprungs alles Seins gereicht die Wissenschaft dem Menschen unbedingt zum Guten; dort aber, wo sie von dieser Rückbindung ans Spirituelle sich befreit, vermag sie letztlich nur die allgemeine Zersplitterung alles Existierenden zu spiegeln. Da aber der Weg zum Göttlichen nur über wissenschaftliche Erkenntnis sich ebnet, kann er einzig mit Hilfe des Lichtbringers beschritten werden: Lucifer, ein szientistischer Weggefährte des Menschen zu Gott. — Was sich in dieser frühen Auffassung noch relativ klar expliziert, verunklart sich mit fortschreitender Entwicklung der Anthroposophie ständig. In einer „esoterischen Betrachtung" aus dem Jahre 1906 erweitert Steiner, wiederum im Rahmen des Lucifermythos, seine Kritik des wissenschaftlichen Positivismus zu grundsätzlichen anthropologischen Aussagen: Lucifer steht als eine Wesenheit, die zwischen Menschen und schaffenden Göttern anzusiedeln ist, jenen näher als diese. In der Seele des Menschen nun kommen das göttliche und das luciferische Prinzip zusammen, wobei, wie aus der ersten Bestimmung folgt, das Luciferische gemeinhin dominiert. Das göttliche Prinzip bringt im Menschen Selbstlosigkeit, Opferwillen und Liebe hervor, Lucifer aber ruft ihn zu Freiheit, Wissenschaft und Selbständigkeit auf; beide Prinzipien in ein harmonisches Verhältnis zu bringen ist Ziel anthroposophischer Menschenbildung. Mag dies zuerst auch nur als eine Mystifikation der pädagogischen Absicht erscheinen, altruistische und egoistische Impulse ausgewogen aufeinander abzustimmen, so kompliziert sich doch auch hier die Aussage dadurch, daß luciferisches und göttliches Prinzip keineswegs sich als Rudolf Steiner / Edouard Schuré: Lucifer. Die Kinder des Lucifer. Das Schauspiel „Die Kinder des Lucifer" von Edouard Schuré in der Übersetzung von Marie Steiner-von Sivers, in freie Rhythmen gebracht durdi Rudolf Steiner. Der Aufsatz „Lucifer" aus dem Jahre 1903 von Rudolf Steiner. Zwei esoterische Betrachtungen „Lucifer" und „Die Kinder des Lucifer" AUS dem Jahre 1906 von Rudolf Steiner. — Docnfldi 1955. p. 20. 31 Steiner/Sdiuré, a. a. Ο., p. 24.
30
232
Lucifergestdtungen der wilhelminischen Ära
Gegensätze zueinander verhalten, sondern daß das Luciferische gerade dadurch sich definiert, daß es den Menschen zur Vollkommenheit, zur Göttlichkeit streben läßt. Nicht also läßt sida der Mensch passiv von den Göttern zur Vollkommenheit führen, sondern vom Geiste Lucifers durchseelt erwirbt er sie sich aktiv. In einem von Rudolf Steiner bearbeiteten Mysterien-Drama des französischen Theosophen Edouard Schuré ist dieser Prozeß gestaltet: Theokies, ein Suchender in finsterer Zeit, erkennt, daß der Weg zu Gott nur über die Treue zum eigenen Ich führt, und erwählt sich Lucifer zum Leitbild: Mein Glaube gilt dem eignen Selbst. Als Gott erkenne idi den Engel, Der trotzig widerstanden hat Dem unersdiafinen Licht.* 2
Doch reicht dies eben zur Vergöttlichung nicht aus; zum Selbstbewußtsein hinzukommen muß die Liebe: Theokies, der Grieche, verbindet sich mit der Christin Kleonis. Alle soziale Bedingtheit hinter sich lassend 33 erheben sie sich zur Göttlichkeit im Zeichen Christi, des Mensch gewordenen Gottes; der Stern Lucifers als das Zeichen des in Freiheit strebenden Menschen vereint sich mit dem Kreuz Christi zum Symbol der Erlösung: dem Kreuz im Stern. — Von diesem Punkt aus läßt sich der historische Gehalt der hier entwickelten Vorstellungen unschwer erfassen. Nicht zufällig erwählt sich Schuré zum historischen Hintergrund seines Schauspiels die Spätantike mit ihrer sozialen Wirrnis und der Auflösung aller ethischen Normensysteme. So stellt die individuelle Vergöttlichung der Theokies und Kleonis sich dar als eine Reaktion auf eine gesellschaftliche Kümmernis und Beschränktheit, vor welcher nur noch das Zurückgeworfensein aufs eigene Ich als Chance zum Besseren erfahren wird. Da mythische Weltdeutung sich aber über jegliche historische Spezifizierung hinwegsetzt, entschlüsselt Schurés Tableau der Spätantike sich als Chiffre fürs Gesellschaftliche schlechthin, dessen ganze Erbärmlichkeit sich vor dem verzweifelten Ringen des überlegenen einzelnen unverstellt darbietet. Man begegnet diesem Antagonismus von großem Menschen und gesellschaftlicher Mediokrität wieder in Steiners Luciferdeutung: Wären wir geblieben im Schosse der Götter, ohne zersplittert zu sein im Sinne der Dionysossage, dann würde uns die Gottheit selbst hinführen zur Gottseligkeit. Aber so nehmen wir uns wie abgefallene Gottessöhne aus. Und diese Kraft in uns, die uns als Dionysossöhne hinführen soll zu dieser Gottseligkeit, diese Kraft in uns ist die Luciferkraft, das luciferische Prinzip, jenes Licht, das der Mensch in Freiheit in sich entzündet, um als ein Teil der göttlichen Wesenheit den ganzen Gott einst zu finden.3*
Den sozialen Befund kennzeichnet die eine Vokabel „Zersplitterung", der genaue Gegensatz zur überzeitlichen Harmonie und Geborgenheit im Gottesschoß. Die aktuelle Disharmonie der geschichtlichen Welt verfestigt sich zum 32 Steiner/Schuré, a. a. Ο., p. 101. 33 Das Ganze vollzieht sich innerhalb einer wirren politischen Rahmenhandlung, in deren Verlauf Theokies erkennen muß, daß er als Zukunftsmensch, der das Niveau seiner Gegenwart weit überschritten hat, die zurückgebliebene Menschheit nicht befreien kann. 3t Steiner/Schuré, a. a. Ο., p. 238.
Der Licbtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
233
Stigma alles Gesellschaftlichen, als dessen prägendes Gesetz nicht gliedernde Ordnung, sondern Zerfall erscheint. Zerfall meint hier nicht so sehr das soziale Gegeneinander unterschiedlicher Interessen oder Klassen, sondern zielt auf das Individuum selbst: Die Gesellschaft verflacht die Persönlichkeit in dem ganzen Reichtum ihrer Möglichkeiten auf wenige Fähigkeiten, Tätigkeiten, Neigungen. Auf die Wiedergewinnung der Synthese, auf die Überwindung jener Zersplitterung in der menschlichen Persönlichkeitsentwicklung aber kommt es Steiner an; der Mensch soll zurückfinden zur unverstümmelten, ganzen, vielfältig begabten Persönlichkeit. Diese Rückgewinnung aber des angestrebten Persönlichkeitsreichtums vollzieht sich unter antigesellschaftlichem Vorzeichen 35 ; der luciferische Mensch, der sich über das soziale Mittelmaß hinausentwickelt, wächst zuletzt über die Gesellschaft selbst hinaus, ja Ganzheit ist letztlich nur gegen die Gesellschaft, als deren Gesetz die Reduktion menschlicher Vollkommenheit sich zeigte, zu erreichen. Dergleichen Überwindung des Durchschnitts zwar wird gesellschaftlich unter Strafe gestellt: Mindestens mit Unverständnis (Steiner selbst wird dies häufig genug zu spüren bekommen haben) hat der luciferische Mensch zu rechnen. Das aber nimmt er dankbar als Bestätigung seiner Position, als ständig sich erneuernden Impuls zur Aufrechterhaltung seiner gegengesellschaftlichen Besonderheit auf. Luciferisch zu sein, bedeutet ihm so, in dürftiger Zeit das Ideal menschlicher Vollkommenheit gegen die restringierende Gesellschaft ins eigene Idi zu retten. — Doch bedarf es zur Erlangung der Vollkommenheit, wie sich oben zeigte, der Ergänzung jener luciferischen Kräfte individueller Selbstermächtigung, der antisozialen Impulse, um die sozial integrativen Kräfte des Altruismus. Scheinbar erzwingt diese Bestimmung die Rüdebindung des luciferischen Menschen in den sozialen Zusammenhang. Doch täuscht dieser Eindruck; man vergleiche, was Steiner über die drei luciferischen „Tugenden" „Wissenschaft, Freiheit und Selbständigkeit" schreibt: Aber vertieft werden müssen diese drei Tugenden durch die Kraft der Liebe, und so wird sich dann verwandeln die Wissenschaft in Weisheit, die Freiheit in Opferwilligkeit, Hingabe und Verehrung des Göttlichen, und die Selbständigkeit in Selbstlosigkeit, in dasjenige Prinzip im Menschen, das das Sondersein überwindet, aufgeht im All und auf diese Weise in Freiheit die Göttlichkeit erringt J 6
Luciferisdi sprengt sich der Mensch aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang heraus und schnellt sich mit der Kraft der Liebe in die Tiefen des Alls: Was hier als Überwindung des „Sonderseins" sich gibt, ist nichts als dessen Bestätigung auf höherer Ebene. Die bequeme Substitution dessen, was er an gesellschaftlicher Verantwortung hinter sich gelassen hat, durch eine nebulose Verpflichtung aufs All vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, daß hier der Auszug des luciferischen Menschen aus der Gesellschaft nur seine kosmische Überhöhung erfährt. Dieser sich allem und jedem verbunden fühlende Altruists Diese Bemerkungen reflektieren die hier diskutierten Aufsätze, nicht spätere Schriften und Ansichten Steiners. Das Programm der Waldorfsdiulen etwa dürfte nur mit Mühe mit den Lucifersdiriften sich in Einklang bringen lassen. m Steiner/Schuré, a. a. Ο., p. 220.
234
Lucifergestdtungen der wilhelminischen Ära
mus bleibt letztlich niemandem verpflichtet; Steiners goetheanisch drapierter Pantheismus rettet so die luciferische Exklusivität in die Beliebigkeit des AllEinen. Damit aber werden die Nebeltiefen des Kosmos zum Fluchtort der Innerlichkeit, zu jenem Gegenpol gesellschaftlicher Verfinsterung, den die Kinder des Lucifer weniger aus eigener Kraft anstreben, als daß sie magnetisch sich von ihm angezogen fühlen. Der Glaube an das eigene Berufensein, mit dem das Ich auf die enttäuschende Realität antwortet, vermag sich nur jenseits des Gesellschaftlichen zu bewahren; das Kosmische bietet sich hier an als Reservat imaginativ sich erfüllender Existenz. In der Unendlichkeit des Alls scheint die gesellschaftliche Enge des Wilhelminismus überwunden, der Entfaltungsraum für die ihrer Möglichkeiten bewußte Persönlichkeit gefunden zu sein. Zugleich läßt sich in der überzeitlichen Harmonie des Kosmischen das an Geborgenheit wiederfinden, was die widersprüchliche Gegenwart den Zeitgenossen verweigerte. Der kritische Impuls, der der Steinerschen Diagnose gesellschaftlich erzeugter Persönlichkeitsverflachung innewohnt, verflüchtigt sich so in den Weiten des Kosmos, denn hier scheint der große einzelne, der luciferische Mensch nachholen zu können, was ihm unter dem Druck der bürgerlichen Welt nicht gelang. Lucifer aber, der doch die Kraft, die Freiheit und Selbständigkeit des einzelnen zu symbolisieren bestimmt war, verrät einzig noch jene Ohnmacht, Enge und Abhängigkeit, die ihn als Traumgestalt den Unterlegenen vor Augen gestellt haben. So reiht er sich ein in die Schar jener heroischen Naturen und schöpferischen Höhenmenschen, die die deutsche Literatur zwischen Naturalismus und Weltkrieg dicht bevölkern: gefühlsmächtige Willensmenschen und selbstherrliche Individuen, die das gesellschaftliche Einerlei der Mittelmäßigen ein für allemal hinter sich gelassen haben, um stark und kühn einen Gipfel höchster Durchgeistigung und Tatkraft zu erstreben. Wenn Nietzsche im authentischen philosophischen Entwurf und mit der Kraft zur Utopie den Übermenschen als Kritik des gegenwärtigen Philistertums der Zukunft vorbehielt, so bewahrten sich seine eilfertigen Leser ihre Philistrosität damit, daß sie sich aus der sie umzäunenden Enge in ein derzeit bereits mögliches Übermenschentum hinüberträumten. Die auf den Rücktritt Bismarcks und die Aufhebung der Sozialistengesetze folgende Abkehr der Intelligenz von der Politik förderte eine derartige Ersatzbildung massiv: Was die Politik nicht mehr zu vollbringen vermag, bleibt jetzt dem einzelnen Ich vorbehalten; die „Forderung der Persönlichkeitsentwicklung . . . wendet sich nach innen, verurteilt die Gesellschaft, aber reduziert sie gerade dadurch zu etwas äußerlich Nebensächlichem, zu einem bloßen Rahmen, einer Kulisse, einer Veranlassung der inneren Begebenheiten." 37 Das isolierte Subjekt bürdete sich auf, was nur im historisch-politischen Prozeß zu erreichen gewesen wäre: In einem geistigen Wandel jenseits von Gesellschaft soll die voll entfaltete Persönlichkeit, der ganze mögliche Reichtum menschlicher Ich-Identität hervorgebracht werden. Auf diesem Fundament konnte Georg Lukács: Skizze einer Gesdiidite der neueren deutschen Literatur. — Berlin 1953. p. 113.
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
235
freilich — wie einer ihrer engagiertesten Kritiker, Samuel Lublinski, den zeitgenössischen Autoren bereits 1904 vorwarf — der Literatur nicht gelingen, „für das Verhältnis zwischen Mensch und Welt die ausgleichende Formel zu finden." 38 Mehr noch, die radikale Selbstermächtigung im Geiste zeitigte, wie gleichfalls Lublinski schon gesehen hat, den gegenteiligen Effekt: . . . das Individuum ertrank im unendlich Großen oder im unendlich Kleinen und kam keinen Schritt vorwärts. Der leidenschaftliche Drang, die Welt zu erobern und umzuformen, verwandelte sich in eine drückende Abhängigkeit von der Welt und ihren unendlichen Kräften. 3 '
Eine derartige Unausgewogenheit zwischen dem imaginierten subjektiven Potential und der objektiven Potentialität offenbart die superlativische Ichbegabung als Verklärung tatsächlicher Ohnmacht; mit Hilfe seines Programms von Weltverbesserung übers isolierte Ich igelt sich das alleingelassene Subjekt in seiner Innerlichkeit bei beibehaltener Fremdbestimmung ein. Solche Reaktionsweisen auf Heteronomie konnten im Lucifermythos den ihnen gemäßen Ausdruck finden; sowohl die Abkehr von der Gesellschaft als auch das Vertrauen auf die überragenden Qualitäten des isolierten Individuums ließen sich an ihm demonstrieren. Einer, der das Mißverhältnis zwischen dem subjektiven Wollen und der feindlichen Außenwelt, die ihn zum Sonderling entschärfte, schmerzhaft verspürte und deshalb, trotz paranoisch sich verzerrender Wirklichkeitswahrnehmung, erheblich genauer die Situation des Individuums als die Menge der Zeitgenossen erfaßte, August Strindberg, zeigt, gerade in der negativen Wendung des Lucifermythos, seine Attraktivität: Woher dieser ungeheuere Hochmut eines Sterblichen? Stamme ich vom Beginn der Jahrhunderte her, als sich die aufständischen Engel in Empörung gegen einen Herrn vereinigten, der zufrieden war, über ein Volk von Sklaven zu herrschen? Ist darum meine Wallfahrt über die Erde zu einem Spiessrutenlaufen geworden, bei dem die Letzten der Letzten sich die Freude gemacht haben, mich zu schlagen, zu beleidigen, zu besudeln? 4 0
„In aller Freimütigkeit: ich fühlte mich mit dem Herrn auf gleichem Niveau . . . " 41 Dieser Satz könnte den Kern mancher Autobiographie der Zeit bilden. Ein von aller Fremdbestimmung sich befreit glaubendes idolisiertes Ich stilisiert sich zum Lichtbringer aus einer finsteren, ihm feindlich gesonnenen Gegenwart, wobei das Desinteresse, auf das solches Sendungsbewußtsein trifft, häufig erst zur Feindschaft uminterpretiert werden muß. Bei Strindberg schlägt diese Ich-Euphorie ins gegensätzliche Extrem, in die Paranoia als den gänzlichen Sieg der Außenwelt über ein ihr schutzlos preisgegebenes Idi um; die zufällige Konstellation der Dinge ordnet sich zu einem geheimen Plan, dazu ersonnen, widerstrebende Subjektivität zu zerstören. Daß hier ein Ich nur noch damit sich 38 Samuel Lublinski: Die Bilanz der Moderne. Mit einem Nachwort neu hrsg. von Gotthart Wunberg. — Tübingen 1974. p. 180. 3» Lublinski, a. a. 0 . , p. 276. 40 August Strindberg: Inferno. Legenden. Verdeutscht von Emil Schering. 13.—18. Tsd. — München 1919. p. 172. — „Inferno", 1897 erschienen, erfaßt innerhalb der Strindbergsdien Autobiographie die Jahre 1894—1897, die sog. Infernokrise. Strindberg, a. a. Ο., p. 171.
236
Lucifergestdtungen
der wilhelminischen
Ära
beschäftigt, auf die Dinge zu reagieren, ja sich geradezu von ihnen jagen läßt, darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich hier gleichfalls um eine Ich-Hypertrophie handelt, die nur ins Passive umkehrt, was in der LuciferIdolatrie sich aktiv gibt: Die ganze Erscheinungswelt richtet sich nach der Interpretation des in ihrem imaginären Zentrum stehenden einzelnen aus, die Gesamtheit der Dinge ordnet sich feindlich auf ihn zu. Die Welt wird — Swedenborg liefert den neuen Mythos — zur Hölle, in der Strindberg nicht mehr der einzige Herrscher, Lucifer, sondern der einzige Gequälte ist. Es macht den Rang der Strindbergschen Autobiographie aus, daß sie Identitätsfindung gerade in den Extremformen von Selbstvergötterung und Selbstverlust als einen fürs Ich qualvoll wechselhaften Prozeß ständiger Selbstbefragung, ständigen Selbstzweifels vorstellt. Von derartigen Anfechtungen lassen freilich die in den Wilhelminismus gefallenen Engel nicht viel spüren; in der Regel dominiert ein unerschütterliches Vertrauen aufs eigene Ich, dem bei standhaftem Ringen die Überwindung geistiger Enge und gesellschaftlicher Verflachung schon gelingen werde. Dies Sendungsbewußtsein beruht nicht auf einer in beständiger Auseinandersetzung mit der Gesellschaft ausgeprägten Identität, sondern auf einer von sämtlichen Irritationen befreienden Abkapselung. Es entspricht diesem gleichsam im Realitätsverlust konsolidierten Ich, daß sein von ihm propagiertes Ringen ums Bessere und Höhere letztlich objektlos bleibt; es verselbständigt sich und wird zur leeren Geste mit unbestimmtem Ziel. Ein orientierungsloser Änderungswille, für den im gesellschaftlichen Ganzen ein faßlicher Gegner nicht mehr auszumachen ist, konzentriert sich in seiner Objektarmut auf die Höherbildung des Menschen jenseits aller Einbindung in die Objektivität. Dabei führt die Ratlosigkeit über Mittel und Ziel keineswegs zur Erschütterung des Ichvertrauens, sondern, im Gegenteil, gerade zur Bestätigung der Konzentration auf das eigene Selbst, das als das einzig Feste inmitten einer schwankenden Umwelt erscheint. Ein Text wie „Luzifer oder das Ringen der Menschen" von Paul Hugo führt dies exemplarisch vor. Lucifer symbolisiert, wie der Titel bereits andeutet, das Ringen des Menschen, wobei es sich um das Ringen schlechthin wie um den Menschen schlechthin handelt. In visionärer „Schau" umreißt Lucifer das Ziel dieses Ringens: Ich sehe Menschen werden Göttergleich, Grosse, reine Menschen. (...) Ich künde den Menschen Ihre Kraft, Ihr Glück, Ihr schweres Glück — Zu schaffen.42
Das Ziel liegt also wiederum in der Ausformung des voll entwickelten Menschen im oben dargelegten Sinne, wobei die Theologisierung der anthropologischen Intention ( „göttergleich" ) Folge der Realitätsabkehr und des DesPaul Hugo: Luzifer oder das Ringen der Menschen. Trilogie. — Dresden 1906. p. 15 f.
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
237
interesses an den historischen Bedingungsfaktoren jenes Ziels ist. Hierher gehört auch das eigentümlich Raunende solcher Texte, in dem das Nichtverstehen der realen Zusammenhänge zum wesensgemäßen Ausdruck eines dem Menschen unzugänglichen Geheimnisses sich verklärt; gerade daß sich die historische Erscheinungswelt dem Verständnis nicht unmittelbar erschließt, wird zum Indiz „ahnungsvoller / Harmonie" 43 , der sie insgeheim gehorcht. Daß nun die Einsicht in die Ordnung des Ganzen fehlt, ja daß der Ringende um die profane Alltäglichkeit des Existierenden sich erst gar nicht kümmert, schlägt sich in Lucifers Ratlosigkeit bei der Wahl seiner Mittel für die Erschaffung des „großen, reinen Menschen" nieder. So versagt er bei Adam, Eva und Kain, erst recht aber bei seinem Versuch, die Höherentwicklung des Menschen damit zu erreichen, daß er ihn sich am Bösen in der Welt abarbeiten läßt. Dies alles schmälert allerdings in Hugos Darstellung Lucifers Größe und Heroismus keineswegs, sondern stellt erst die Einzigartigkeit des strebenden Ichs ins rechte Licht: Kämpfen will idi, Und gelingt es nicht, — Dann kämpf' ich wieder, Bis ich einen Weg Erbahnt. 44
An ihm gemessen tritt allererst die Schlechtigkeit der Welt, wie sie ist, die Mittelmäßigkeit der Menschen, wie sie sind, hervor. Als Idealgestalt menschlichen Strebens beweist sich Lucifer darin, daß er um künftige Widerstände unbekümmert seine Niederlagen hinter sich läßt und als einsames Ich zum Gipfelpunkt menschlicher Entwicklung weiterschreitet. — Bedeutsam aber wird Hugos Text nicht dadurch, daß er Änderungswillen und Orientierungslosigkeit, Ichvertrauen und Realitätsblindheit in der Lucifergestalt konzentriert, sondern deshalb, weil er die Vergeblichkeit einer solcherart sich zusammensetzenden Weltverbesserungseuphorie vorführt. Denn der von Lucifer erhoffte „göttergleiche" Mensch ist schließlich ein Gesandter jenes Schöpfergottes, der diese Welt in ihren Makeln und Fehlern zu verantworten hat; der „große, reine Mensch" heißt Jesus. Wenn also Lucifer am Kreuz dem Messias adorierend entgegenstammelt: Jesus! Bruder! (...) Mein Ringen Ist belohnt. — Jesus!! — «
dann liegt er endlich wieder vor der Realität, die er zu überwinden strebte, auf den Knien. Sein Ringen ist nicht belohnt, sein Streben blieb ergebnislos, auch wenn Hugo vom Gegenteil zu überzeugen trachtet: Jesus, der höhere Mensch, wurde von Gott auf die Welt gesandt und ist nicht Resultat luciferiHugo, a. a. O., p. 4. « Hugo, a. a. O., p. 158f.
43
44
Hugo, a. a. O., p. 46.
238
Lucifergestaltungen der wilhelminischen Ära
sehen Ringens. Die luciferische Idikonzentration mit dem Ziel einer geistigen Überwindung der mißratenen Welt resultiert in der gänzlichen Selbstauslieferung an deren Gesetze; Hugo hätte Lublinskis These kaum besser belegen können als damit, daß er das scheinbare Resultat des gegen die Intention Gottes gerichteten luciferischen Ringens als Angebot des unangreifbaren Gottes selbst darstellt. So enthüllt sich der Sieg abgelöster Subjektivität über die verworfene Objektivität gegen die Intention des Verfassers als Täuschung. Mochte sich in Hugos Text noch ein Rest von Kritik an der sozialen und geistigen Enge seiner Zeit verbergen, so befindet sich in Franz Bachmanns hausbackenem Drama in vier Aufzügen „Lucifer" das Programm geistiger Veredelung ganz in Übereinstimmung mit wilhelminischer Großmannssucht. Hier verkommt Lucifer, die Triebkraft hinter dem Streben des Menschen zu Größerem und Höherem, zu einem Oberlehrer von schenkelklopfender Rauhbeinigkeit, der seinem Beruf ohne sonderliches Feingefühl nachgeht: Und wollt Ihr mir nicht willig folgen, So weck' idi in Euch alle bösen Rotten, Ich laß Euch schläfrig nicht noch weiter trotten . . . 46
Bis zur Ununterscheidbarkeit gleicht dieser Lucifer in Gehaben und Gestus sich jenen Stammtischphilistern an, die er zur höchsten Geistigkeit zu führen gedenkt — gerade das aber macht den Text erwähnenswert: An ihm beweist sich aufs schönste, wie wenig die abgehobene Geistigkeit sich von jenen Bedingungen zu lösen vermag, die sie hinter sich gelassen zu haben vermeint, und wie tief daher dem Idealbild menschlicher Vollkommenheit die Züge jenes gegenwärtigen Menschen eingegraben sind, dessen Mediokrität doch zu überwinden war. Lucifere brachiale Methoden lassen dabei das Schlimmste für jene Zeit fürchten, in der endlich der menschliche Geist — wie es eine vom „Geist" unberührte Grammatik will — „wachend erwacht" : Nicht Ruh noch Rast Bei Deiner Last, Kein Schlaf noch Schlummer Bei Deinem Kummer! Bis wachend erwacht Dein Geist aus der Nacht.·*7
Verständlich, daß ein derartig beschränktes Edelmenschentum nur mit hämischer Ranküne zu Wissenschaft und Philosophie seiner Zeit sich äußern kann; man vergleiche etwa die Szene, in der Procella, der Sturmteufel, Lucifer darüber berichtet, wie er einem bei Kerzenschein arbeitenden Gelehrten aufspielt: Halt, dacht' idi mir, das ist gewiß Ein Metaphysicus moderni generis, Der jenseits allem Bösen steht. Ich wollt's probieren, ob's so ist. Lucifer. Du neckisch Kind! « Franz Badimann: Lucifer. Drama in vier Aufzügen. — Dresden 1903. p. 97. 4 8 Bachmann, a. a. O., p. 47. 47 Bachmann, a. a. O., p. 94.
Der Lichtbringer im Frozeβ der Zerstörung der Vernunft
239
Und so hält Procella es für eine Widerlegung Nietzsches, daß der Gelehrte, als ihm der Sturm die Stube verwüstet, zu fluchen beginnt. Ohne weiteres nimmt der geistige Höhenmensch die Barbarei in den Dienst; Lucifere überlegene Geistigkeit offenbart sich als die Apotheose der Mentalität rüpelnder Corpsstudenten/49 — Kaum Besseres läßt sich im übrigen von einer anderen Hervorbringung der Zeit sagen, der 1912—13 erschienenen Trilogie „Mensch" von Erich Walter 50 . Hier ist Lucifer zwar noch deutlicher dem alten Höllenfürsten nachgebildet, aber darin, daß er die Verwirklichung „höherer Ziele" als der durchschnittlichen zum Maßstab seiner Urteile macht, gleicht er sich durchaus der allgemeinen Übung an. So etwa überantwortet er den gefeierten Dichter dem Höllenfeuer: Vor höhern Zielen beugt sidi das Gesetz! Du kanntest das Gesetz, dodi nicht die Größe, die Macht zu lösen hat, und die dich band! 51
Das hindert ihn dann später freilich nicht daran, Dr. Mensch, einer modernen Faust-Gestalt, die Verführung unschuldiger Weiblichkeit nahezulegen; auch hier verträgt sich das Streben nach menschlicher Größe mit der Barbarei nicht schlecht. — Doch sind Texte wie die zuletzt zitierten, die in Lucifers hoher Geisteswelt die wilhelminische Gegenwart affirmativ abspiegeln und sie in die Utopie verewigten Spießertums umbilden, auch in dieser Zeit selten; im allgemeinen bleibt hinter aller mythischen Konfusion und antisozialen Geistesverklärung jener kritische Impuls erkennbar, der aus einer in expansiver Technisierung, ständig steigender Verwaltungstätigkeit und zunehmender Verflachung des rationalistischen Denkens sich niederschlagenden Veräußerlichung des Lebens erwuchs. Auch darf nicht der Eindruck entstehen, Lucifer sei als Symbolgestalt für Lebensdurchgeistigung einzig für gewisse in künstlerischen Dingen unzuständige semi-intellektuelle Subkulturen oder für ein mythisch anfälliges Kleinbürgertum interessant gewesen, wie die bisher zitierten Textbeispiele nahelegen könnten. Im Gegenteil spricht es gerade für die weite Verbreitung eines Bedürfnisses nach mythischen Identifikationsbildern, deren Überzeitlichkeit sie den Wirrnissen des historischen Wandels enthebt und so sie erst zu Orientierungspunkten in schwankender Zeit prädisponiert, daß wichtige und bekannte Künstler der Zeit sich des Lucifersujets annahmen. Dabei ist hier nicht so sehr an August Strindberg gedacht, der in seinem dem „Inferno" vorangestellten Mysterienvorspiel „De creatione et sententia vera mundi" Lucifer zu dem guten, Gott zu dem bösen Herrn der Welt umdeutet. Strindberg folgt darin bekannten gnostischen Vorstellungen, die zudem innerhalb seiner Swedenborg„Achtmal im Wirtshaus gewesen. In diese jämmerliche Freiheit muß man sich flüchten und in einem billigen Lucifertum sich fühlen . . . " — Peter Hille: Ein Traum. (1902) — In: Peter Hille: Ein Spielzeug strenger Himmel. Lyrik Prosa Aphorismen. Auswahl und Vorwort von Jürgen P. Wallmann. — Reddinghausen 1970. p. 44. so Erich Walter: Mensch. Eine Dichtung. 1. Traumhild. 2. Lucifer. 3. Die Toten. — Leipzig 1912/13. 51 Erich Walter: Mensch. Erster Teil: Traumhild. — Leipzig o. J. [1912]. p. 4.
240
Lucifergestdtungen der wilhelminischen Ära
Rezeption ihren besonderen Sinn gewinnen: Swedenborg hatte die Welt als Hölle interpretiert; zur Hölle aber verwandelt im Vorspiel auch der böse Gott die Erde, nachdem Lucifer den Menschen Erkenntnis, sein Sohn Christus ihnen das Leben gebracht hatte. Außerdem ist das Vorspiel, nach Strindbergs eigener Auskunft 52 , lange vor dem uns hier beschäftigenden Zeitraum entstanden; freilich bleibt erwähnenswert, daß er es erst jetzt, 1897, veröffentlicht. — Auch auf den „Lucifer"-Roman der Lulu von Strauß und Torney 53 wollen wir hier nicht näher eingehen: Hinter der Darbietung historischer Geschehenszusammenhänge— der Kampf der Stedinger gegen die kirchliche Obergewalt, Auseinandersetzungen der deutschen Oberschicht in Böhmen mit der einheimischen Bevölkerung — tritt das Lucifermotiv weit zurück, und dort, wo ein persönliches Schicksal — das der Zentralgestalt, des Mönches Burkard — auf die Lucifergestalt bezogen ist, erscheint es als die zwar historisch wie biographisch begründbare, trotz alledem aber pathologische Verirrung eines einzelnen. Immerhin ist an dem Buch bemerkenswert, daß es das Lucifermotiv dazu benutzt, die Unumgänglichkeit subjektiver Selbstbeschränkung, die Notwendigkeit fest verankerter, stabiler Ordnungshierarchien, in die der einzelne auch gegen das eigene Interesse oder gegen bessere Einsicht sich einzufügen hat, zu demonstrieren. An der luciferischen Revolte werden die Gefahren für den Bestand des Ganzen veranschaulicht; das Konservative, Bewahrende dominiert über subjektiven Änderungswillen. — Bedeutungsvollere Belege für die Faszination, die die Lucifergestalt auf die wilhelminische Ära ausübte, sind zwei Gestaltungen von Künstlern, die man zu den repräsentativen der Epoche wird zählen dürfen. 1890 stellt Franz von Stüde als sein Hauptbild auf der Münchener Jahresausstellung das großes Aufsehen erregende Gemälde „Lucifer" aus 54 . Den rechten Arm abgewinkelt und die zur Faust geballte Hand auf seine Sitzbank pressend, den kurzgeschorenen Kopf in der Art des Melancholikers in die linke Hand stützend starrt, die Beine fest zusammengeschlossen, mit stechendem Blick ein nackter, muskulöser Lucifer dem Betrachter entgegen. Welche Wirkung dieses Bild auf die Zeitgenossen ausübte, hat Otto Julius Bierbaum festgehalten; er vergleicht es mit Stüdes „Wächter des Paradieses" : Es ist ein großer Zug in diesem Bilde, ein Pathos des Hasses, das ergreift. ( . . . ) So wenig der Wächter des Paradieses ein christlicher Engel war, so wenig ist dieser Lucifer ein christlicher Teufel. Aber, stammte jener aus Hellas, so stammt dieser aus unserer Zeit, in deren Tiefe es gärt. Ob der Künstler sich dessen bewußt war, bleibt dahingestellt, aber empfunden wurde es so. „Der Heizer der Maschine" könnte man das Bild mit socialer Beziehung umtaufen. Wenn die Gegner der Stuckschen Kunst sagten: das ist 52 Strindberg, a. a. Ο., p. 212. Lulu von Strauß und Torney: Lucifer. Roman. — Jena 1941. (Zuerst 1907) 5 4 Abb. in jeder Stuck-Monographie; am leichtesten zugänglich ist die Abb. einer zeitgenössischen Lithographie nach dem Ölgemälde in: Hans G. Hofstätter: Symbolismus und die Kunst der Jahrhundertwende. Voraussetzungen. Erscheinungsformen. Bedeutungen. 2., verbesserte Auflage. — Köln 1973. p. 2 1 1 . 53
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
241
ein Zuchthäuslerkopf, kein Fürst der Finsternis, so ahnten sie dasselbe. Nur hätten sie es auch begreifen sollen. 55
Bierbaums sorgsame Trennung zwischen Autorintention und Gehalt vermag dem Werk gerecht zu werden: Sicher ist mit Fug zu bezweifeln, daß Stuck mit seinem „Lucifer" die Vergegenwärtigung eines sozialen Befunds im Sinne gehabt hat. Und doch gestaltet sich in seinem Gemälde in aller Deutlichkeit das schwankende Fundament der scheinbar unantastbaren wilhelminischen Stärke. Die Befremdung, die sich, worauf Gert Mattenklott hinweist, bei der Zuordnung repräsentativer Werke des Fin de siècle zu Daten wichtiger politischer Ereignisse ihrer Entstehungszeit in der Regel einstellt 56 , kann hier kaum aufkommen: Stuck malte sein Bild in dem Jahr der Aufhebung der Sozialistengesetze. Das Gefühl realer Bedrohung, welches sich von diesem Bild auf seine Betrachter übertrug, verdankt sich gerade jenen von ihm aufgesogenen Elementen einer historischen Wirklichkeit, die die mythische Gestalt zum Zeitgenossen umbildeten. Hierher gehört der gänzliche Mangel an verschönernder Idealisierung der Lucifergestalt, womit dem dargestellten Ausbruchswillen eine Realitätsnähe und Aktualität verliehen ist, mit der, zumal das kurzgeschnittene Haar und der muskulöse Körper sowie die drückende Finsternis der Umgebung eine andere Interpretation kaum zuließen, vor allem die Ängste vor der nun ans Licht tretenden Arbeiterbewegung erfaßt sind. Man darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß die Arbeiterbewegung die Lichtmetaphorik zur propagandistischen Vergegenwärtigung ihrer Ziele häufig eingesetzt hat, dergestalt etwa, daß der Weg zur Freiheit als der zur Sonne erschien. Insofern mochte das Motiv des Lichtbringers durchaus auf sie übertragbar sein — was nun freilich nicht bedeuten soll, daß Stuck bewußt das Lucifermotiv zu ihrer Vergegenwärtigung eingesetzt hat; andererseits aber gilt, daß die Ängste, mit denen sich die wilhelminische Gesellschaft in bezug auf ihren dauernden Bestand trug, mit Entschiedenheit sich auf die Arbeiterbewegung als ihre Hauptbedrohung konzentrierten. Hierauf reagiert Stucks Bild mit der deutlich hervorgehobenen Zeitgenossenschaft seiner Lucifergestalt; der Haß der Erniedrigten und Beleidigten glüht aus ihrem Blick dem Betrachter entgegen. Insofern weist die Bedrohnis, die von der Gestalt ausgeht, auch keineswegs auf eine nicht 55
Otto Julius Bierbaum: Stuck. — Bielefeld/Leipzig 1899. p. 37f. Abb. des Gemäldes vgl. Abb. 23. — Wie sehr Bierbaums historisches Verständnis über die heutige Symbolismusforschung hinausgeht, läßt sich daran zeigen, daß kenntnisreiche Autoren heute in Gemälden wie „Lucifer" nur noch „compelling representations of personifications of evil" zu erblicken vermögen. Vgl. John Milner: Symbolists and Decadents. — London 1971. p. 134f. — Innerhalb des europäischen Symbolismus war Lucifer ein durchaus beliebtes Sujet; man vergleiche etwa Jean Delvilles „Les trésors de Satan" (Abb. in: Philippe Jullian: Mythen und Phantasmen in der Kunst des fin de siècle. — Berlin 1971. p. 117. Abb. 58); ungefähr zur gleichen Zeit wie Stuck malte Odilon Redon seinen „Gefallenen Engel" (Abb. im Ausstellungskatalog: Symbolismus in Europa. — Baden-Baden 1976. p. 183, Abb. 188.).
56 Gert Mattenklott: Bilderdienst. Ästhetische Opposition bei Beardsley und George. — München 1970. p. 11.
242
Lucifergestdtungeti der wilhelminischen Ära
naher klassifizierbare dekadente Morbidität jener Zeit, sondern sie trägt durchaus die historisch konkrete Signatur der Epoche. Den Zwiespalt, der ihre Zeit durchdrang, haben die bedeutenden Künstler der wilhelminischen Ära durchaus gespürt. Mochte daraus audi nur in den seltensten Fällen sich eine sozial engagierte Kunst ergeben, so ist doch auch und gerade die scheinbar gesellschaftsferne und unpolitische Kunst jener Jahre von dem entschiedenen Wollen bestimmt, die nicht zu verdrängende Widersprüchlichkeit der Zeit in einer neuen Harmonie zu überwinden. Eben diese seine von ihm häufig formulierte Intention stiftete allererst Richard Dehmels Popularität; hier stellte sich einer den sich bedrohlich zuspitzenden Gegensätzen seiner Zeit und wies zugleich den Weg heraus aus den scheinbar unlösbaren Problemen. Er fand hierfür das Remedium, das seinen großbürgerlichen, kleinbürgerlichen und nicht zuletzt proletarischen Lesern am besten schmecken mochte: Welterlösung über konzentrierteste Privatheit. Der, den die große Menge seiner Zeitgenossen für den sozialen Dichter par excellence hielt und der etwa Rosa Luxemburg zu seinen begeisterten Lesern zählen durfte 57 , hat weit intensiver den Rückzug ins Subjektiv-Private befördert als es der George-Kreis jemals vermocht hat. Denn Dehmel erhebt zum Kern aller sozialen Problematik die private Zweierbeziehung, die Vereinigung von Mann und Frau. Von diesem zu stabilisierenden Zentrum aus werden die Verbindungslinien ins Gesellschaftliche gezogen, das wiederum mit fließenden Grenzen ins Kosmische übergeht. Die Vision einer umfassenden kosmischen Ordnung gründet so auf dem Programm ehelicher Harmonie und gelungener Zweisamkeit zwischen Mann und Frau; dies ist Dehmels unermüdlich variiertes Thema und ständig neuformulierter Beitrag zur „sozialen Frage". Dabei verschwimmt, weil Dehmel die Familie als Modell des Sozialen schlechthin deutet und deshalb deren Einbezug ins Soziale nicht näher reflektiert, Gesellschaft im Kosmischen; unmittelbar ist das einzelne Paar ins pantheistische Ganze eingebettet, in dessen Einklang die Widersprüchlichkeit des historisch je Vorhandenen aufgehoben ist. So wird das Soziale zwar beschworen, aber es interessiert, um es paradox zu formulieren, nur als das Private; pointiert: Dehmel löst die „soziale Frage" mit den Mitteln eines Eheberaters 5S. — Dies zu wissen ist nötig, um heute noch einen derart wirren und vom Autor selbst als „Monstrum" 59 empfundenen Text wie Dehmels „Lucifer" (1899) zu verstehen. Dehmel, der, wie es seinem Sendungsbewußtsein entsprach, selbst gelegentlich sich einen Lucifer nannte oder nennen ließ — z. B. 57 Rosa Luxemburg: Schriften über Kunst und Literatur. Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Marlen M. Korallow. — Dresden 1972. p. 195. 5 8 Bereits Rosenhaupt wies darauf hin, „dass Dehmels Erlebnissphäre nicht eine gross geschaute zukünftige Gesellschaft ist, sondern dass seine privaten Bindungen, eben sein Familienleben, das Schema . . . für sein Verhalten abgeben." „Seine soziale Utopie etwa ist eine Schrebergartenutopie ..." — Hans Wilhelm Rosenhaupt: Der deutsche Dichter um die Jahrhundertwende und seine Abgelöstheit von der Gesellschaft. — Bern/Leipzig 1939. p. 172f. 59 So in einem Brief an Julius Bab. — Richard Dehmel: Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1902 bis 1920. — Berlin 1923. p. 117.
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
243
unterzeichnete er Briefe mit „Lucifer" 60, und Emil Ludwig gar mochte ihn in seinem panegyrischen Dehmel-Buch nur noch als Lucifer anreden 61 — Dehmel hat sein „Tanz- und Glanzspier „Lucifer" als „Vorarbeit für ein dramatisches Weltbild in Versen" bezeichnet62 — und tatsächlich geben die oben skizzierten Grundanschauungen Dehmels das Gerüst dieser Pantomime ab. Der „Lucifer" bildet so das Gegenstück zu Dehmels berühmtestem Gedichtband, den nur wenig später erschienenen „Zwei Menschen" (1903). Was die „Zwei Menschen" an einem individuellen Fall in einer lokal und temporal recht genau umrissenen Situation vorführen, erscheint im „Lucifer" von vornherein auf die Ebene überindividueller Gültigkeit gehoben; Venus' und Lucifers Ringen begreift das von Lea und Lux (!), der selbst verschiedentlich Lucifer genannt wird 63, mit ein. Was aber in den „Zwei Menschen" am Beispiel zweier fiktiver Gestalten im Rahmen einer übergreifenden Erzählung veranschaulicht wird — der über eine alle Widerstände überwindende Liebe führende Weg des isolierten Ichs in die Vergemeinschaftung der Zweisamkeit und zum Erfassen der kosmischen Gesetze —, führt in dem „Tanzspiel" „Lucifer", das zum einen auf Sprache, mit Ausnahme der die einzelnen Bilder voneinander sondernden kurzen Chorgesänge, verzichtet, und das zum anderen von der Geschichtsneutralität des Mythos her zusätzlich auf Abstraktion angelegt ist, zu einer Flut von Symbolen, die alles auf der Bühne Wahrnehmbare — Bühnenbild und Requisiten, Kostüme und Personenkonstellationen, Beleuchtung und Choreographie — mit einer dichten Decke von Bedeutungen überzieht. Die an der wilhelminischen Kunst häufig zu beobachtende Stilunsicherheit64 führt dabei zu grotesken Auswüchsen an Geschmacklosigkeit; das Ganze läßt sich, auf der Bühne realisiert, nicht anders vorstellen denn als gigantisches Kitschtableau. Dehmels Ehrgeiz, den Weg Lucifers zu Venus in Parallele zu setzen mit dem Gang der europäischen Geschichte vom Rom zur Zeit von Christi Geburt bis zur Gegenwart, steigert dabei die Wirrnis sowohl des Dargestellten als auch der Darstellungselemente zusätzlich; eine Textpassage wie die folgende gibt durchaus kein extremes Beispiel: In diesem Augenblick bricht neben der Peterskuppel oben links die Sonne wieder durch das Gewölk, und während redits die Siegesfanfare zu voller Marschmusik anwächst, erscheint mit hoch erhobenen Fackeln Lucifer auf der Straße, dicht hinter ihm zwei Enge! mit Palmzweigen, einen langen Zug von Arbeitern führend. Lucifer, seine Fackeln jäh von sidi breitend, eilt stürmisch auf die räuberischen Faune los, sodaß sie scheu die Amoretten freigeben und von der Straße rückwärts nach dem Zaun hin weichen; die Marketenderinnen flüchten in den Wald >5 «> Vgl. Richard Dehmel: Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1883 bis 1902. — Berlin 1922. p. 301. Vgl. auch den Brief an Paul Scheerbart vom Februar 1903: „Im übrigen, alter Kometentänzer, nehme idi meine planetarische Luciferkrone vor Dir ab." Dehmel, Briefe, 1902—1920, a. a. O., p. 14. 61 Emil Ludwig: Richard Dehmel. — Berlin 1913. pp. 7, 13, 23, 24, 31, 41. « Dehmel, Briefe, 1883—1902, a. a. O., p. 343. « Vgl. „Zwei Menschen" 1/7 und 1/31. M Vgl. Just, a. a. O., p. 120ff. 65 Richard Dehmel: Lucifer. Ein Tanz- und Glanzspiel. — Berlin/Leipzig 1899. p. 86f.
244
Lucifergestaltungen der wilhelminischen Ära
Dergleichen erinnert nicht zuletzt an die Bilder der von Dehmel verehrten Maler Böcklin und Klinger. — Es kann uns nun hier nicht darum gehen, in einer detaillierten Analyse der Dehmeischen Symbolik in all ihren Verirrungen und voluntaristischen Zuordnungen bis ins einzelne nachzugehen; den Aufwand würde das Ergebnis kaum lohnen. Es sei deshalb erlaubt, nur auf die zentralen Aspekte des Textes kurz einzugehen. Lucifer ist laut Personenverzeichnis „ein göttlicher Mann", Venus „ein himmlisches Weib" ; Lucifer symbolisiert also in idealer Abstraktion die positiven Qualitäten des Mannes, Venus die des „Weibes", gleichsam der Frau schlechthin66. Das Tanzspiel nun führt vor, wie Venus und Lucifer einander finden, sich dann voneinander lösen und in die Vereinzelung zurückfallen; aus der Isolierung aber sehnen sie sich wieder heraus und vereinigen sich endlich nach einem von zahlreichen Hemmnissen, Mißverständnissen und Widerständen aufgehaltenen Prozeß. Die erotische Vereinigung aber weist über sich hinaus auf eine Heilung des Weltganzen: Lucifer und Venus symbolisieren, als Objektivationen des Männlichen und des Weiblichen, zugleich gegensätzliche lebensbestimmende Grundprinzipien, deren Übereinkunft zur Aufhebung des Widersprüchlichen im Geschichtsprozeß führt. Denn der Geschichtsprozeß, in wechselseitiger Annäherung und Abweisung zwischen Venus und Lucifer veranschaulicht, steht in Dehmels Tanzspiel gänzlich im Zeichen der Konkurrenz eben dieser Prinzipien: Lucifer steht für Egoismus, Venus für Altruismus, Lucifer für Geist und Intellekt, Venus für Sinnlichkeit und Emotion, Lucifer für Rationalität, Arbeit und Wissenschaft, Venus für Irrationalität, Lebensfreude, Kunst. Die Harmonisierung dieser Gegensätze setzt der Wirrnis aller bisherigen Geschichte ein Ende. Die Zerrissenheit von Geschichte erscheint so als Ergebnis der Zerrissenheit der menschlichen Persönlichkeit; deshalb vermag sich in der erotisch motivierten Reintegration der persönlichkeitsbildenden Kräfte die Heilung des Geschichtsprozesses zu symbolisieren. Entsprechend klingt das Spiel aus: . . . die Engel greifen wieder in ihre Harfen, die Faune setzen die Röten an, und während Lucifer und Venus ihre nach außen gesenkten Fackeln in die der Weltkugel zugekehrte Hand nehmen und sie von neuem emporrecken, erhebt die Mutter mit beiden Händen langsam das Kind über ihr Haupt. Der in dem Apfelbaum sitzende Engel, sanft sich herniederneigend, legt in die Hände des Kindes einen der blutroten Lichtäpfel; Venus wie Lucifer kreuzen die Arme, mit auswärts geschulterten Fackeln. Dann nimmt die Mutter das Kind mit seligem Lächeln an ihre Brust zurück, die knieenden Menschen erheben die Fackeln und Thyrsusstäbe, die Amoretten richten sich auf, das Orgelspiel wird immer brausender, Saturn sinkt rücklings wie tot zu Boden, von Amor und Thanatos aufgefangen . . . 67
Hier vereinigt sich alles zu einem Bild von umfassender Harmonie: Die Engel als Symbolgestalten göttlicher Liebe und die Faune als Verkörperungen unge66
Zum um die Jahrhundertwende bevorzugten Begriff des „Weibes" für die Frau vgl. Dolf Sternberger: Sinnlichkeit um die Jahrhundertwende. — In: Jost Hermand (Hrsg.): Jugendstil. — Darmstadt 1971. ( = Wege der Forschung. Bd.CX.) p. 103. 67 Dehmel, Lucifer, a. a. O., p. 125f.
Der Lichtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
245
zügelter Sinnlichkeit musizieren gemeinsam; Venus und Lucifer, endlich vereint, huldigen der Mutter mit dem Kind, der Madonna mit dem Jesusknaben, als dem „Symbol innigster Gemeinschaft zwischen Mensch und Mensch" 68 ; die versammelte Menschheit, Künstler, Wissenschaftler und Arbeiter, Alte und Junge, Männer und Frauen, ist in innigster Gemeinschaft beisammen, und alle erheben die Fackeln des (luciferischen) Geistes und die Thyrsusstäbe der (venusischen) Sinnlichkeit. Sie alle gruppieren sich um die Weltkugel im Zentrum zum Bild wiedergefundener Einheit. Es ist das Bild der geschichtsüberwindenden Utopie, das Ende der Zeit; Saturn, deren Gott, bricht zusammen. Die Wiedergewinnung des ganzen Menschen, Venus und Lucifer ineins, fällt zusammen mit dem Beginn einer neuen aetas aurea. — Dehmels Tanzspiel „Lucifer" stellt sicher die komplexeste Bearbeitung des Lucifermotivs in dieser Zeit dar — sicher zugleich aber auch die verworrenste; selbst Dehmels getreuer Kommentator Julius Bab vermochte nicht mehr im „Lucifer" zu sehen als „eine Art Kulturgeschichte der Liebe" 69 . In Dehmels Text findet gleichsam all das zum Ausdruck, was in den bisher diskutierten Bearbeitungen isoliert oder mit starkem Akzent auf einem Einzelaspekt sich darbot: In seiner Gestaltung findet sich sowohl die Rechtfertigung des Egoismus wie etwa bei Fahrenkrog (Lucifer muß zuerst sich selbst gewinnen, bevor er Venus gewinnen kann) 7 0 als auch die Einsicht in die Notwendigkeit einer Überwindung des Egoismus durch einen kosmisch sich orientierenden Altruismus wie bei Steiner, es finden sich die Kritik an der persönlidhkeitszerstörenden gesellschaftlichen Enge seiner Gegenwart, die Verklärung des Ringens isolierter Subjekte und das große Ziel einer Wiedergewinnung allseitig entwickelter, schöpferischer, höherer Menschen. Dehmels eigener Beitrag zum Lucifermotiv ist die Unterordnung all dieser Aspekte unter den übergreifenden Gesichtspunkt des Erotischen: Die Liebe zwischen Mann und Frau als der Schnittpunkt zwischen Altruismus und Egoismus gibt die erlösende Formel für alle Zeitprobleme ab. „Zur Genesung" möchte er führen sich und uns, — zu einer tief inneren Versöhnung all der auseinanderreißenden, feindlich sich gebärdenden großen Triebkräfte unserer Tage; all die quellfremden Ströme, die die Menschenseelen unserer Zeit durchfluten, einmünden sollen sie in das freie Meer einer neuen allumspannenden Persönlichkeit.71
Das „Hohe Paar" Lucifer — Venus, mythologisch ein später Nachfahr der geeinten Zwienatur Osiris — Isis, symbolisiert diese „allumspannende Persönlichkeit" in des Wortes doppelter Bedeutung: Indem sie zur vollen Entfaltung der Persönlichkeit aufsteigen, gehen sie zugleich auf in der alle Widersprüche Rudolf Pamperrien: Das Problem menschlicher Gemeinschaft in Richard Dehmels Werk. — Tübingen 1924. p. 36. — „Mann und Weib ringen nach Synthese und erreichen sie schließlich nach langem Kampf — Mutter und Kind haben sie von vornherein." (ebd.) 69 Julius Bab: Richard Dehmel. — Berlin 1902. p. 17. Anm. 70 Dehmel hatte natürlich Stirner gelesen; z. B. beteiligte auch er sich wie so mancher in jenen Jahren an der heftigen Debatte, ob Nietzsche Stirner gekannt hat oder nicht. Vgl. Dehmel, Briefe, 1883—1902, a. a. O., p. 189. 71 Bab, a. a. O., p. 5. 68
246
Lucifergestaltungen der wilhelminischen Ära
aufhebenden Einheit des Alls. Das einzelne Paar und das Kosmische bilden die Pole, innerhalb derer die „tief innere Versöhnung" des „Auseinandergerissenen" sich vollzieht; was als Überwindung der sozialen Misere sich gibt, umgeht die Gesellschaft. Sie aber ruft erst hervor, was als Ergebnis der Geborgenheit im Kosmos ihre Überwindung scheint; ein früher Interpret Dehmels hat diesen Zusammenhang wohl gegen die eigene Intention in der folgenden Bemerkung genau erfaßt: Bei ihm erzeugt dieses Wissen um die Abhängigkeit von Mäditen, die jenseits der Sphäre des einzelnen stehen, ein Gefühl der Einigkeit mit allen Dingen/2
Die Herkunft der pantheistischen Kosmoseuphorie aus Heteronomie hätte sidi präziser kaum bezeichnen lassen; in der Weite des Alls verbirgt sich die Innerlichkeit. Lucifer — Venus, der ganze, der höhere Mensch, dem die gesellschaftlichen Normen zu eng geworden sind, und der deshalb im Kosmos seine Heimat sucht, nimmt diesen nur zum imaginären Fluchtort; die Zwänge des Gesellschaftlichen, die er durch die innere Entfaltung des eigenen Ichs überwunden zu haben vermeint, binden ihn damit nur um so fester in sich ein. — Ein kurzer Rückblick mag zeigen, daß die sehr unterschiedlichen Gestaltungen des Lucifermotivs in der wilhelminischen Ära doch unter wenigen Gesichtspunkten sich vereinigen lassen. Die Attraktivität dieser Gestalt für die Zeit bewies sich darin, daß solche unterschiedlichen Autoren wie der erfolglose, bis ins Aberwitzige ehrgeizige Rudow und der wohl erfolgreichste Lyriker dieser Jahre, Richard Dehmel, von ihr sich faszinieren ließen. Völkische Gruppen, theosophisch beeinflußte Autoren und idealistische Weltverbesserer vermochten sich ihr ebensowenig zu entziehen wie der Malerfürst Franz von Stuck. Die Häufigkeit des Auftretens der Lucifergestalt in der Kunst jener Zeit — bei genauerem Forschen ließen sich sicherlich noch mehr Belege beibringen — wurde dabei von uns auf dem Wege zu erklären versucht, daß in den kurzen Kommentaren zur einzelnen Gestaltung jeweils der Rückbezug auf die historische Situation ihrer Entstehung zumindest angedeutet wurde. Dabei zeigte sich in allen Fällen, daß in der Lucifergestalt ein mythisch sich tarnender Änderungswille, ja man ist versucht zu sagen, ein mythisch zurückgenommener Änderungswille zum Ausdruck fand. Als charakteristisch für diesen Änderungswillen erwies sich, daß er auf die umwälzende Kraft des isolierten Ichs vertraute. In ersten Interpretationen wurde zu zeigen versucht, daß diese IchKonzentration letztlich aus der historisch bedingten Not der Vereinzelung eine Tugend machte; die Abstiegsängste breiter Mittelschichten, Konkurrenzverhalten und Besitzindividualismus setzten sich derart um, daß das von der Außenwelt sich bedroht wissende Ich sich in seiner Isoliertheit heroisierte und so sidh in der extremen Konfrontation von heldenhaft strebendem Subjekt und übermächtiger Objektivität in die Lichtbringergestalt in finsterer Gegenwart einzufühlen vermochte. Dabei konnte eine so sich darstellende Egozentrik sich in 72 Kurt Kunze: Der Zusammenhang der Dehmeischen Kunst mit den geschichtlichen Strebungen der jüngsten Vergangenheit. — Phil. Diss. Leipzig 1913. p. 108.
Der Licbtbringer im Prozeß der Zerstörung der Vernunft
247
zwei Richtungen entwickeln. Dort, wo Erfolglosigkeit, Sendungsbewußtsein und ein unbedingtes Vertrauen auf den heroischen einzelnen zusammentrafen, konnte die Luciferidolatrie sich später mühelos umpolen lassen in den nationalsozialistischen Führerkult. Die andere Variante freilich ist häufiger: Der aus dem intensiv empfundenen Ungenügen an der Gesellschaft resultierende Änderungswille vermag die Dominanz der Außenwelt mit dem Vertrauen ins eigene Ich nur so zu vereinbaren, daß er sich dem Programm von Weltverbesserung über eine dem isolierten Subjekt aufgebürdete Herausbildung des höheren, des in seinen Möglichkeiten sich voll entfaltenden Menschen unterordnet. Dem im Vergleich zum historisch Möglichen überdimensionalen Höhenmenschen entspricht dessen überdimensionaler Entfaltungs- und Geborgenheitsraum, der Kosmos als die Transzendierung des gesellschaftlich Gegenwärtigen, dessen Funktion als Fluchtort für Innerlichkeit sich gerade aus seiner Gesellschaftsferne erschloß. Lucifer, die Symbolgestalt menschlicher Kraft, menschlichen Ringens und Änderungswillens, offenbart so in beiden Fällen Wehrlosigkeit und Ohnmacht des einzelnen, offenbart die Unfähigkeit weiter Bevölkerungsteile zur rationalen Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Problemen ihrer Gesellschaft. Er mag durchaus eine Symbolgestalt für die Zerstörung der Vernunft heißen. — Hiermit endet unsere Untersuchung ausgewählter Lucifergestaltungen in der Neuzeit. Freilich endet damit noch längst nicht die Geschichte des Motivs. Auch nach dem Ersten Weltkrieg noch griffen Autoren auf das Geschick des gefallenen Engels zurück, um an ihm ihre Intentionen zur Darstellung zu bringen. Hier seien nur wenige Beispiele aus der deutschen Literatur genannt, und dies auch nur, um zu veranschaulichen, daß nach der entscheidenden Zäsur, die der Erste Weltkrieg in der deutschen Geschichte setzte, das Motiv nicht mehr auf eine relativ geschlossene Bedeutungsdimension wie noch im Wilhelminismus zurückverweist. Die Erneuerung des Menschen im Zeichen des Katholizismus etwa propagiert die niederdeutsche dramatische Dichtung „Luzifer" des Münsteraner Dichters Karl Wagenfeld73, die, 1921 in Berlin uraufgeführt, als wichtiges Bühnenwerk des Expressionismus noch zu entdecken ist. In einer religiösen Dichtung ganz anderer Art, Richard Beer-Hofmanns „Vorspiel" zu seiner unvollendeten „Historie von König David", „ Jaákobs Traum" 74 , tritt dem von Gott berufenen Jaákob der gefallene Engel Samáel entgegen; er wird zum Künder allen Elends und Leids, das auf das jüdische Volk wartet. Ein merkwürdiges „Luzifer"-Drama von Inge von Holtzendorff, nach Träumen gestaltet, stellt den Weg eines um die Liebe Gottes ringenden Lucifers zu diesem zurück dar 75 . Alexander von Bernus schließlich, der den Geist der Antike nicht weniger verehrte als den Rudolf Steiners, veröffentlichte 1918 in der von ihm herausgegebenen Vierteljahresschrift „Das Reich" einen groß angelegten „Gesang an 73 Karl Wagenfeld: Luzifer. — Warendorf 1921. 74 Richard Beer-Hofmann: Jaákobs Traum. Ein Vorspiel. — Berlin 1918. 75 Inge von Holtzendorff: Die Dramen. Luzifer. Maria. Die Dirne. Das Fest der Herzogin. — Berlin 1920.
248
Lucifergestaltungen der wilhelminischen Ära
Luzifer", von dem 1923 audi eine Buchausgabe erschien76. Lucifer figuriert in ihm als die Verkörperung des klassischen Humanismus und der Schönheit der Antike, als Gegengestalt zu Ahriman, der die seelenlose Technik und die dumpfe Masse der Großstädte vertritt. Daß von hier aus völlig unerwartete Verbindungslinien zu einem gänzlich anders gesonnenen Autor sich ziehen lassen, sei zum Schluß nodi angedeutet. Als eine der Verkörperungen Lucifers in der Antike erscheint bei Bernus Alexander der Große; über ihn schreibt er unter anderem: Hin trug er sein wanderndes Zeltreich Zum Indus und aufwärts den Nil, Ein einziges, schwindelndes Weltreich: Das Luzifer-Ziel! In der Könige Reihe der adite War er — aber den das Gesicht Verhieß als den neunten, der machte In uns erst die Sonne zum Lidit. So unüberwindlich war alles Was Dein Zeichen, Luzifer, trug . . . 77
Das Zeichen Lucifers aber trägt Alexander nicht weniger als bei Bernus in Klaus Manns 1930 erschienenem Alexander-Roman. Daß Klaus Mann den „Gesang an Luzifer" kannte, darf als sicher gelten; den Bericht vom mehrwöchigen Aufenthalt des Siebzehnjährigen bei Alexander von Bernus auf dessen Besitz Stift Neuburg mag man im „Wendepunkt" nachlesen7S. An zahlreichen Stellen des Romans lassen sich motivische Verbindungslinien zwischen Alexander und Lucifer ziehen; sie reichen von physiognomischen Details und dem Klang seiner Stimme ( „klirrend hell, aufleuchtend, wie wenn Licht durch eine schöne Dämmerung dringt" 79) über den Zug durch die Wüste ( „Du bist sogar in der Hölle nodi hochmütig, Halsstarriger." 80) bis zu den Himmelsstürmer-Visionen des Schlußkapitels. Alexander, ein „verzweifelter und Unglück bringender Gott" 81 : die vollkommene Mythisierung einer historischen Gestalt.
76
77 78 79 '0 s1
Eine weitere Ausgabe des Gesangs erschien 1961; Bernus hat in ihr seine Kulturkritik dem neuesten Stand angeglichen; z. B.: Gefallen zum andernmal sind wir, Vor die zweite Versuchung gestellt: Durch Atomsprengung, Fürst, tauchten blind wir In die untersinnliche Welt . . . Alexander von Bernus: Gesang an Luzifer. Dritte veränderte Auflage. — Nürnberg 1961. p. 28. Alexander von Bernus: Gesang an Luzifer. — Weimar o. J. [1923]. p. 12. Klaus Mann: Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. — Frankfurt 1953. p. 148ff. Klaus Mann: Alexander. Roman der Utopie. Mit einem Vorwort von Jean Cocteau. — München o.J. [1974]. p.21. Mann, Alexander, a. a. O., p. 149. Mann, Alexander, a. a. O., p. 112.
Verzeichnis der zitierten Werke 1. Q u e l l e n a. Gestaltungen Aischylos: Der gefesselte Prometheus. Übersetzung und Nachwort von Walther Kraus. — Stuttgart 1965. Albertinus, Aegidius: Lucifers Königreich und Seelengejaidt. Hrsg. von Rochus Freiherr von Liliencron. — Berlin/Stuttgart o. J. ( = DNL 26.) Alexander Earl of Stirling, Sir William: The Poetical Works. Ed. L.E. Kastner and H. B. Charlton. Vol. II. The Non-Dramatic Works. — Edinburgh/London 1929. (Anonym): Lucifers mit seiner gesellschaft val. Und wie derselben geist einer sich zu einem Ritter verdingt und ym wol dienete. Bamberg 1493. Nach dem Unicum im Germanischen National-Museum zu Nürnberg in Facsimile hrsg. — Frankfurt a. M. 1895. Bachmann, Franz: Lucifer. Drama in vier Aufzügen. — Dresden 1903. Baudelaire, Charles: Œuvres complètes. — Paris 1961. ( = Bibliothèque de la Pléiade.) Beaumont, Joseph: The Complete Poems. Ed. Alexander B. Grosart. In Two Volumes. — New York 1967. Beer-Hofmann, Richard: Jaákobs Traum: Ein Vorspiel. — Berlin 1918. Bernus, Alexander von: Gesang an Luzifer. — Weimar o. J. [1923]. Bernus, Alexander von: Gesang an Luzifer. Dritte veränderte Auflage. — Nürnberg 1961. Bidermann, Jakob: Cenodoxus. Deutsche Übersetzung von Joachim Meidiel (1635). Hrsg. von Rolf Tarot. — Stuttgart 1970. Blackmore, Richard: Prince Arthur. An Heroidc Poem. In Ten Books. The Third Edition Corrected. — London 1696. Blake, William: The Poetical Works. Ed. John Sampson. — London 1961. Brodces, Barthold Heinrich: Verteutschter Bethlehemitischer Kinder-Mord des Ritters Marino, nebst des Hrn. Uebersetzers eigenen Werken (...). Vierte, aufs neue übersehene und verbesserte Auflage. — Hamburg 1734. Browning, Elizabeth Barrett: The Poetical Works. — London 1904. Byron, George Gordon Lord: The Works. Poetry. Ed. Ernest Hartley Coleridge. — London/New York 1905. Clarke, Robert: Christiados Libri XVII. Editio nova curante Aloysio Cassiano Walthierer. — Ingolstadt 1855. —, —: Die Christiade von Robert Klarke metrisch übersetzt von Aloys Kassian Walthierer. — Ingolstadt 1853. Cowley, Abraham: Poems. Ed. A. R. Waller. — Cambridge 1905. Crashaw, Richard: The Complete Poetry. Ed. George Walton Williams. — New York 1972. Czepko, Daniel von: Geistliche Schriften. Hrsg. von Werner Milch. — Breslau 1930. ( = Einzelschriften zur schlesischen Geschichte. Bd. 4.) Dehmel, Richard: Lucifer. Ein Tanz- und Glanzspiel. — Berlin/Leipzig 1899. Delpech, Henri: Satan. Épopée. — Paris 1859. Donne, John: Complete Poetry and Selected Prose. Ed. John Hayward. Tenth impression. — London 1967.
250
Verzeichnis der zitierteη Werke
Dryden, John: The Dramatic Works. In Six Volumes. Ed. Montague Summers. Vol. III. — London 1932. Du Bartas, Guillaume de Saluste Sieur: La Sepmaine ou Creation du Monde. Kritischer Text der Ausgabe von 1581 hrsg. von Kurt Reichenberger. — Tübingen 1963. ( = Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie. 107. Heft.) (Elucidarius): M. Elucidarius / Von allerhandt geschöpften Gottes (...). — Frankfurt a. M. 1555. Fahrenkrog, Ludwig: Lucifer. Dichtung in Bild und Wort. 4. Auflage. — Stuttgart 1913. —, —: Das Goldene Tor. Dichtungen in Wort und Bild. — Leipzig 1927. .Fletcher, Giles and Phineas: Poetical Works. Ed. Frederick S. Boas. — Cambridge 1970. France, Anatole: Aufruhr der Engel. Roman. Deutsch von Rudolf Leonhard. — Leipzig o. J. [1917]. Geßner, Salomon: Werke. Auswahl. Hrsg. von Adolf Frey. — Berlin/Stuttgart o. J. [1884]. ( = DNL41) Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von: Die verkehrte Welt. Hrsg. von Franz Günter Sieveke. — Tübingen 1973. Harsdörffer, Georg Philipp: Ars Apophthegmatica, Das ist: Kunstquellen Denkwürdiger Lehrsprüche und Ergötzlicher Hofreden; (...) in Drey Tausend Exempeln (...). — Nürnberg 1655. —,—: Der grosse Schau-Platz Jämmerlicher Mord-Geschichte. Bestehend in CC. traurigen Begebenheiten. (...) Zum fünfftenmal gedruckt. — Hamburg 1666. Hille, Peter: Ein Spielzeug strenger Himmel. Lyrik Prosa Aphorismen. Auswahl und Vorwort von Jürgen P. Wallmann. — Recklinghausen 1970. Holtzendorff, Inge von: Die Dramen. Luzifer. Maria. Die Dirne. Das Fest der Herzogin. — Berlin 1920. Hugo, Paul: Luzifer oder das Ringen der Menschen. Trilogie. — Dresden 1906. Immessen, Arnold: Der Sündenfall. Mit Einleitung, Anmerkungen und Wörterverzeichnis neu hrsg. von Friedridi Krage. — Heidelberg 1913. Klopstock, Friedrich Gottlieb: Ausgewählte Werke. Hrsg. von Karl August Schleiden. 3. Auflage. — München 1969. Logau, Friedrich von: Deutscher Sinn-Getichte Drey Tausend. Drei Teile in einem Band. — Hildesheim/New York 1972. ( = Reprografisdier Nachdruck der Ausgabe Breslau 1654.) Lohenstein, Daniel Casper von: Cleopatra. Sophonisbe. Hrsg. von Wilhelm Voßkamp. — Reinbek 1968. Mann, Klaus: Alexander. Roman der Utopie. Mit einem Vorwort von Jean Cocteau. — München o.J. [1974]. Marino, Giovanbattista: Dicerie sacre e La strage de gl'Innocenti. A cura di Giovanni Pozzi. — Turin 1960. Marlowe, Christopher: The Works. Ed. C. F. Tucker Brooke. — Oxford 1969. Medici, Lorenzo de: Tutte le opere. Vol. II. Scritti d'amore. — Mailand 1958. Milton, John: Poetical Works. Ed. Douglas Bush. Second impression. — London/Oxford 1973. (—,—): Johann Miltons Episches Gedichte von dem Verlohrnen Paradiese. Faksimiledrudc der Bodmerschen Übersetzung von 1742. Mit einem Nachwort von Wolfgang Bender. — Stuttgart 1965. Moscherosdi, Hans Michael: Wunderliche und warhafftige Gesichte Philanders von Sitte-
1. Quellen
251
wald, Das ist Strafi-Sdirifiten Hanß-Midiael Moscherosch von Wilstädt. Hrsg. von Felix Bobertag. — Berlin/Stuttgart o. J. ( = DNL 32) Peyton, Thomas: The Glasse of Time, in the two first Ages. — London 1620. Pordage, Samuel: Mundorum Explicado or, The Explanation of an Hieroglyphical Figure: Wherein are couched the Mysteries of the External, Internal and Eternal Worlds (...). Being a Sacred Poem. — London 1661. Ronsard, Pierre de: Œuvres complètes. Ed. Paul Laumonier. T. 5. — Paris 1914—9. [Rudow, Wilhelm]: Lucifer. Ein Dichterleben. Herrn Administrator Bode und Frau Rittergut Banteln in dankbarer Liebe ihr Neffe Lucifer. — Wernigerode 1891. Seneca: Sämtliche Tragödien. Lateinisch und deutsch. Hrsg. von Theodor Thomann. — Zürich/Stuttgart 1961. Shelley, Percy Bysshe: Poetical Works. Ed. Thomas Hutdiinson. — London 1967. Strauß und Torney, Lulu von: Lucifer. Roman. — Jena 1941. Strindberg, August: Inferno. Legenden. Verdeutscht von Emil Schering. 13. —18. Tsd. — München 1919. Sylvester, Josuah: The Complete Works. Ed. Alexander B. Grosart. — New York 1967. Tasso, Torquato: Befreites Jerusalem. Übersetzt von Karl Streckfuß. Italienisdi und deutsch. — Leipzig 1822. [Thou, Jacques Auguste de] : Parabata vinctus, sive Triumphus Christi, tragoedia. — Paris 1595. Vondel, Joost van den: Volledige Dichtwerken en oorspronkelijk Proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. — Amsterdam 1937. —, —: Lucifer. Treurspel. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. W. J. M. A. Asselbergs. Vierde druk. — Culemborg 1973. Wagenfeld, Karl: Luzifer. — Warendorf 1921. Walter, Erich: Mensch. Eine Dichtung. 1. Traumhild. 2. Lucifer. 3. Die Toten. — Leipzig 1912/13. Werder, Diederidi von dem: Gottfried von Bulljon, Oder Das Erlösete Jerusalem. 1626. Hrsg. von Gerhard Dünnhaupt. — Tübingen 1974. ( = Deutsche Neudrucke. Reihe Barock. Bd. 24.) Zadiariä, Friedrich Wilhelm: Poetische Schriften. — o. O. o. J. [Braunschweig 1763ff.]. b. Philosophie, Poetik, Biographisches Aristoteles: Poetik. Übersetzung, Einleitung und Anmerkungen von Olof Gigon. — Stuttgart 1967. Bacon, Francis: The Philosophical Works. Ed. John M. Robertson. — London 1905. Bakunin, Michail: Gott und der Staat und andere Schriften. Hrsg. von Susanne Hillmann. — Reinbek 1969. Bergmann, Michael: Deutsches Aerarium Poeticum oder Poetische Schatz-Kammer / in sich haltende Poetische Nahmen / Redens-Arthen und Beschreibungen (...). Zum andern Mahl in Drude gegeben (...). — Landsberg 1675. Böhme, Jacob: Sämtliche Schriften. Faksimile-Neudruck der Ausgabe von 1730 in elf Bänden. Neu hrsg. von Will-Erich Peuckert. Bd. 2. — Stuttgart 1960. Bodmer, Johann Jacob: Critische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie. Faksimiledruck nach der Ausgabe von 1740. Mit einem Nachwort von Wolfgang Bender. — Stuttgart 1966.
252
Verzeichnis der zitierten Werke
Boileau-Despréaux, Nicolas: L'Art poétique. Die Dichtkunst. Französisch und deutsch. Übersetzt und hrsg. von Ute und Heinz Ludwig Arnold. — Stuttgart 1967. Bruno, Giordano: Kabballa, Kyllenischer Esel, Reden, Inquisitionsakten. Deutsdi von Ludwig Kuhlenbedc. — Jena 1909. ( = Gesammelte Werke. Bd. 6.) Byron, George Gordon Lord: The Works. Letters and Journals. Ed. Rowland E. Prodiero. — London/New York 1904. (—,—): Medwin's Conversations of Lord Byron. Revised with a New Preface by the Author for a New Edition and Annotated (...). Ed. Ernest J. Lovell, Jr. — Princeton 1966. Chamfort, Nicolas: Charaktere und Anekdoten. — In: Fritz Schalk (Hrsg.): Die französischen Moralisten. Bd. 1. — München 1973. pp. 338—474. Cranadi d. Ä., Lucas: Das gesamte graphische Werk. Mit Exempeln aus dem graphischen Werk Lucas Cranach d. J. und der Cranadiwerkstatt. Einleitung Johannes Jahn. — München 1972. Dehmel, Richard: Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1883 bis 1902. — Berlin 1922. —, —: Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1902 bis 1920. — Berlin 1923. Dionysios Areopagita: Die Hierarchien der Engel und der Kirche. Einführung von Hugo Ball. — München 1955. Eckermann, Johann Peter: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. — Zürich 1948. ( = Artemis-Gedenkausgabe. Bd. 24.) Gottsched, Johann Christoph: Versuch einer Critischen Dichtkunst. — Darmstadt 1962. ( = Unveränderter photomechanischer Nachdruck der 4., vermehrten Auflage, Leipzig 1751.) —, —: Beyträge zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit. — Leipzig 1732—1744. —, —: Erste Gründe der gesammten Weltweisheit, darinn alle philosophische Wissenschaften, in ihrer natürlichen Verknüpfung, in zwenen Theilen abgehandelt werden. Sechste vermehrte und verbesserte Auflage. — Leipzig 1756. Grotius, Hugo: De jure belli ac pacis libri tres. Neuer deutscher Text und Einleitung von Walter Schätzel. — Tübingen 1950. ( = Die Klassiker des Völkerrechts. Bd. 1.) —, —: Briefwisseling. Uitgegeven door Dr. P. C. Molhuysen. Tweede Deel. 30 Augustus 1618 — 30 December 1625. — 's-Gravenhage 1936. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Vorlesungen über die Ästhetik. Bde I—III. — Frankfurt 1970. ( = Theorie-Werkausgabe. Bde 13—15.) Herder, Johann Gottfried: Sämmtliche Werke. Hrsg. von Bernhard Suphan. Bd. 17. Briefe zu Beförderung der Humanität. — Berlin 1881. Hobbes, Thomas: Leviathan oder Wesen, Form und Gewalt des kirchlichen und bürgerlichen Staates. I. Der Mensch. II. Der Staat. In der Übersetzung von Dorothee Tidow (...) hrsg. von Peter Cornelius Mayer-Tasdi. 2. Auflage. — Reinbek 1969. Klopstock, Friedrich Gottlieb: Abschiedsrede über die epische Poesie, cultur- und litterargeschichtlich beleuchtet, sowie mit einer Darlegung der Theorie Uhlands über das Nibelungenlied begleitet von Albert Freybe. — Halle 1868. —, —: Briefe von und an Klopstock. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte seiner Zeit. Hrsg. von J. M. Lappenberg. — Braunschweig 1867. Leibniz, Gottfried Wilhelm: Die Theodicee. Hrsg. von Artur Buchenau. — Leipzig 1925. ( = Leibniz: Philosophische Werke. Hrsg. von A.Buchenau und E.Cassirer. Bd.4.) —, —: Monadologie. Neu übersetzt, eingeleitet und erläutert von Hermann Glockner. Zweite, wesentlich verbesserte Auflage. — Stuttgart 1970.
2. Sekundärliteratur
253
Lessing, Gotthold Ephraim: Briefe, die neueste Literatur betreffend. — In: Gesammelte Werke. Hrsg. von Paul Rilla. Bd. 4. — Berlin 1955. Mann, Klaus: Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. — Frankfurt a. M. 1953. Sack, August Friedrich Wilhelm: Vertheidigter Glaube der Christen. Erstes Stüde. — Berlin 1748. Spalding, Johann Joachim: Predigten. Verbesserte Ausgabe. — Berlin/Stralsund 1768. [—, —] : Vertraute Briefe die Religion betreffend. — Breslau 1784. Steiner, Rudolf: Christus im Verhältnis zu Luzifer und Ahriman. Die dreifache Wesensgestaltung. Ein Vortrag, gehalten in Linz am 18. Mai 1915. 2. Auflage. — Dörnach 1968. Steiner, Rudolf / Edouard Schuré: Lucifer. Die Kinder des Lucifer. Das Schauspiel „Die Kinder des Lucifer" von Edouard Schuré in der Übersetzung von Marie Steiner-von Sivers, in freie Rhythmen gebracht durch Rudolf Steiner. Der Aufsatz „Lucifer" aus dem Jahre 1903 von Rudolf Steiner. Zwei esoterische Betrachtungen „Lucifer" und „Die Kinder des Lucifer" aus dem Jahre 1906 von Rudolf Steiner. — Dörnach 1955. Stirner, Max: Der Einzige und sein Eigentum und andere Schriften. Ausgewählt und mit einem Nachwort hrsg. von Hans G. Helms. 3. Auflage. — München 1970. Thou, Jacques Auguste de: Commentariorum de vita sua libri sex. — In: Jac. Augusti Thuani Historiarum sui temporis Pars Quinta. — Frankfurt a. M. 1621. pp. 1277—1471. (— / —): Selbstbiographien berühmter Männer. Ein Pendant zu J. G. Müllers Selbstbekenntnissen. Hrsg. von David Seybold. Erster Band. Thuanus. — Winterthur 1796. Weigel, Valentin: Ein nützliches Tractätlein Vom Ort der Welt. Hrsg. von Will-Eridi Peudcert. — Stuttgart/Bad Cannstatt 1962. ( = Sämtliche Schriften. Bd. 1.) Wolff, Christian Freiherr von: Vernünfftige Gedancken Von Gott, Der Welt und der Seele des Menschen, Nach allen Dingen überhaupt, Den Liebhabern der Wahrheit mitgetheilet. Neue Auflage hin und wieder vermehret. — Halle 1751.
2. Sekundärliteratur Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie. — Frankfurt 1970. ( = Gesammelte Schriften. Bd. 7.) Alewyn, Richard / Karl Sälzle: Das große Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste in Dokument und Deutung. — Hamburg 1959. Andres, Friedrich: Die Engellehre der griechischen Apologeten des zweiten Jahrhunderts und ihr Verhältnis zur griechisch-römischen Dämonologie. — Paderborn 1914. Aner, Karl: Die Theologie der Lessingzeit. — Halle 1929. Arntzen .Helmut: Von Trauerspielen. Gottsched, Gryhius, Büchner. — In: Rezeption und Produktion. Zwischen 1570 und 1730. Festschrift für Günther Weydt zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Wolfdietrich Rasch, Hans Geulen und Klaus Haberkamm. — Bern/München 1972. pp. 571—585. Asselbergs, W. J. Μ. Α.: Hochmut und Hochzeit bei Vondel. — In: Werner Kohlschmidt (Hrsg.): Spätzeiten und Spätzeitlichkeit. Vorträge, gehalten auf dem II. Internationalen Germanistenkongreß 1960 in Kopenhagen. — Bern/München 1962. pp. 44—51. —, —: Inleiding. — In: Joost van den Vondel: Lucifer. Treurspel. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. W. J. M. A. Asselbergs. Vierde Druk. — Culemborg 1973. pp. 5—16. Assunto, Rosario: Die Theorie des Schönen im Mittelalter. — Köln 1963. Bab, Julius: Richard Dehmel. — Berlin 1902.
254
Verzeichnis der zitierten Werke
Baumgartner, Alexander: Joost van den Vondel, sein Leben und seine Werke. Ein Bild aus der Niederländischen Literaturgeschichte. — Freiburg i. Br. 1882. Bekker, Hugo: Divine Love as the Unifying Principle in Vondel's „Lucifer". — In: The Modern Language Review LIV (1959) pp. 384—390. —, —: The Religio-Philosophical Orientations of Vondel's „Lucifer", Milton's „Paradise Lost" and Grotius' „Adamus Exul". — In: Neophilologus 44 (1960) pp. 234—244. Bender, Wolfgang: Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger. — Stuttgart 1973. ( = Sammlung Metzler Bd. 113.) Benjamin, Walter: Ursprung des deutschen Trauerspiels. — Frankfurt 1972. —, —: Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus. Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Rolf Tiedemann. — Frankfurt 1974. —, —: Der Surrealismus. Die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz. — In: W. B.: Angelus Novus. Ausgewählte Schriften 2. — Frankfurt 1966. pp. 200—215. Bercfeen, Erich von der: Die Gemälde des Jacopo Tintoretto. — München 1942. Berenson, Bernard: Lorenzo Lotto. Gesamtausgabe. — Köln 1957. Bierbaum, Otto Julius: Stüde. Mit 137 Abbildungen. — Bielefeld/Leipzig 1899. ( = Künstler-Monographien. Hrsg. von H. Knackfuß. Bd. XLII.) Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung. Bde 1—3. — Frankfurt 1973. —, —: Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reichs. — Frankfurt 1973. —, —: Naturrecht und menschliche Würde. — Frankfurt 1972. —, —: Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance. — Frankfurt 1972. Blumenberg, Hans: Licht als Metapher der Wahrheit. Im Vorfeld der philosophischen Begriffsbildung. — In: Studium Generale 10 (1957) pp. 432—447. —, —: Die kopernikanische Wende. — Frankfurt 1965. Bohrer, Karl Heinz: In den Wäldern der Nacht. Gedanken zu William Blakes Malerei und Dichtung. — In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 3, 4.1.1975. Beilage „Bilder und Zeiten". Borkenau, Franz: Der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild. Studien zur Geschichte der Philosophie der Manufakturperiode. — Paris 1934. ( = Schriften des Instituts für Sozialforschung. Hrsg. von Max Horkheimer. Bd. IV.) Bostetter, Edward E.: Byron and the Politics of Paradise. — In: PMLA LXXV (1960) pp. 571—576. Brandes, Georg: Hauptströmungen der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. Zweiter Band: 3. Die Reaktion in Frankreich. 4. Der Naturalismus in England. Vom Verfasser neu bearbeitete endgültige Ausgabe. Übersetzt von Ernst Richard Eckert. 3. Auflage. — Berlin 1924. Brereton, Geoffrey: French Tragic Drama in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. — London 1973. Broadbent, J. B.: Some Graver Subject. An Essay on Paradise Lost. — London 1960. Buck, August: Über einige Deutungen des Prometheusmythos in der Literatur der Renaissance. — In: Romanica. Festschrift für Gerhard Rohlfs. Hrsg. von Heinrich Lausberg und Harald Weinrich. — Halle (S.) 1958. pp. 86—96. Camus, Albert: Der Mensch in der Revolte. Essays. Übersetzt von Justus Streller. — Reinbek 1969. Diekhof!, John S.: Milton's Paradise Lost. A Commentary on the Argument. — London 1958. Dilthey, Wilhelm: Satan in der christlichen Poesie. — In: W. D.: Die große Phantasiedichtung und andere Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte. Hrsg. von Herman Nohl. — Göttingen 1954. pp. 109—131. Dörner, Klaus: Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie. — Frankfurt 1975.
2. Sekundärliteratur
255
Diintzer, Heinrich: Jacques Auguste de Thou's Leben, Schriften und historische Kunst verglichen mit der der Alten. Eine Preisschrift. — Darmstadt 1837. Erich, Oswald Α.: Die Darstellung des Teufels in der christlichen Kunst. — Berlin 1931. ( = Kunstwissenschaftliche Studien. Bd. VIII.) Frecot, Janos / Johann Friedrich Geist / Diethart Kerbs: Fidus. 1868—1948. Zur ästhetischen Praxis bürgerlicher Fluchtbewegungen. — München 1972. Freivogel, Max: Klopstodc der heilige Dichter. — Bern 1954. Friedrich, Hugo: Epochen der italienischen Lyrik. — Frankfurt 1964. Gledcner, Robert F.: Byron and the Ruins of Paradise. — Baltimore 1967. Grimm, Reinhold: Christliches Epos — ? — In: R. G.: Strukturen. Essays zur deutschen Literatur. — Göttingen 1963. Guthke, Karl S.: Der Mythos des Bösen in der westeuropäischen Romantik. — In: Colloquia Germanica 2 (1968) pp. 1—36. Hauser, Arnold: Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. 25.—32. Tsd. — München 1973. Helms, Hans G.: Die Ideologie der anonymen Gesellschaft. Max Stirners .Einziger' und der Fortschritt des demokratischen Selbstbewußtseins vom Vormärz bis zur Bundesrepublik. — Köln 1966. Hemleben, Johannes: Rudolf Steiner. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. — Reinbek 1963. Hermand, Jost: Meister Fidus. Vom Jugendstil-Hippie zum Germanenschwärmer. — In: J. H.: Der Schein des schönen Lebens. — Frankfurt 1972. pp. 55—127. Hirsch, Emanuel: Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens. Bd. 2. — Gütersloh 1951. Hobsbawm, Eric J.: Industrie und Empire. Britische Wirtschaftsgeschichte seit 1750. — Frankfurt 1969. Hocke, Gustav René: Manierismus in der Literatur. Sprach-Alchimie und esoterische Kombinationskunst. Beiträge zur vergleichenden europäischen Literaturgeschichte. 5. Auflage. — Reinbek 1969. Hofmann, Werner: Die Erfüllung der Zeit. — W . H . (Hrsg.): William Blake. 1757—1827. — München 1975. pp. 11—30. Hofstätter, Hans H.: Symbolismus und die Kunst der Jahrhundertwende. Voraussetzungen Erscheinungsformen Bedeutungen. 2. verbesserte Auflage. — Köln 1973. Horkheimer, Max: Kritische Theorie. Eine Dokumentation. Hrsg. von Alfred Schmidt. — Frankfurt 1968. Horkheimer, Max / Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. — Frankfurt 1969. Johannessen, Kâre Langvik: Zwischen Himmel und Erde. Eine Studie über Joost van den Vondels biblische Tragödie in gattungsgeschichtlicher Perspektive. — Oslo/Zwolle 1963. Jullian, Philippe: Mythen und Phantasmen in der Kunst des fin de siècle. — Berlin 1971. Jump, John D.: Byron. — London/Boston 1972. Just, Klaus Günther: Von der Gründerzeit bis zur Gegenwart. Geschichte der deutschen Literatur seit 1871. — Bern/München 1973. Kaiser, Gerhard: Klopstock. Religion und Dichtung. — Gütersloh 1963. Kates, Judith Α.: The Revaluation of the Classical Heroic in Tasso and Milton. — In: Comparative Literature XXVI (1974) pp.299—317. Kayser, Wolfgang: Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung. 2., unveränderte Auflage. — Oldenburg/Hamburg 1961.
256
Verzeichnis der zitierten Werke
Kerényi, Karl: Prometheus. Das griechische Mythologem von der menschlichen Existenz. — Zürich 1946. King, P. K.: Complete word-indexes to J. van den Vondel's Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst and Lucifer. With ranking lists of frequencies reverse indexes and rhyming indexes. — Cambridge 1973. Kinser, Samuel: The Works of Jacques-Auguste de Thou. — Den Haag 1966. ( = International Archives of the History of Ideas. Vol. 18.) Kirkconnell, Watson: The Celestial Cycle. The Theme of „Paradise Lost" in World Literature. — Toronto 1952. Kunze, Kurt: Der Zusammenhang der Dehmeischen Kunst mit den geschichtlichen Strebungen der jüngsten Vergangenheit. — Phil. Diss. Leipzig 1913. Lehner, Ernst and Johanna: Devils, Demons, Death and Damnation. — New York 1971. ( = Dover Pictorial Archive Series.) Lepenies, Wolf: Melancholie und Gesellschaft. — Frankfurt 1972. Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 5. 2. Auflage. — Freiburg 1960. Lindau, Hans: Die Theodicee im 18. Jahrhundert. Entwicklungsstufen des Problems vom theoretischen Dogma zum praktischen Idealismus. — Leipzig 1911. Lovell Jr., Ernest J.: Byron: The Record of a Quest. Studies in a Poet's Concept and Treatment of Nature. — Hamden 1966. Lublinski, Samuel: Die Bilanz der Moderne. Mit einem Nachwort neu hrsg. von Gotthart Wunberg. — Tübingen 1974. Ludwig, Emil: Richard Dehmel. — Berlin 1913. Lukács, Georg: Schriften zur Literatursoziologie. Ausgewählt und eingeleitet von Peter Ludz. 5. Auflage. — Neuwied/Darmstadt/Berlin 1972. —, —: Die Zerstörung der Vernunft. — Neuwied/Berlin 1962. —, —: Skizze einer Geschichte der neueren deutschen Literatur. — Berlin 1953. Luxemburg, Rosa: Schriften über Kunst und Literatur. Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Marlen M. Korallow. — Dresden 1972. Mahal, Günther: Mephistos Metamorphosen. Fausts Partner als Repräsentant literarischer Teufelsgestaltung. ( = Göppinger Arbeiten zur Germanistik. Nr. 71.) — Göppingen 1972. Markwardt, Bruno: Geschichte der deutschen Poetik. Bd. 1. Barock und Frühaufklärung. Dritte, unveränderte Auflage. — Berlin 1964. Mason, Eudo C.: Die Gestalt des Teufels in der deutschen Literatur seit 1748. — In: Werner Kohlschmidt und Herman Meyer (Hrsg.): Tradition und Ursprünglichkeit. Akten des III. Internationalen Germanistenkongresses 1965 in Amsterdam. — Bern/München 1966. pp. 113—125. Mattenklott, Gert: Bilderdienst. Ästhetische Opposition bei Beardsley und George. — München 1970. Méautis, Georges: Eschyle dans la littérature française. — In: RHL XXIV (1917) pp. 428— 439. Milner, John: Symbolists and Decadents. — London 1971. Mirollo, James V.: The Poet of the Marvelous. Giambattista Marino. — New York/London 1963. Moore, Olin H.: The Infernal Council. — In: Modern Philology XVI (1918) pp. 169—193 und XIX (1921—22) pp. 47—64. Müller, Ursula: Die Gestalt Luzifers in der Dichtung vom Barock bis zur Romantik. — Phil. Diss. Gießen 1940. Muncker, Franz: Friedrich Gottlieb Klopstock. Geschichte seines Lebens und seiner Schriften. — Stuttgart 1888. O'Brien, Gordon Worth: Renaissance Poetics and the Problem of Power. — Chicago 1956.
2. Sekundärliteratur
257
Osterkamp, Ernst: Darstellungsformen des Bösen. Das Beispiel Luzifer. — In: Sprachkunst V (1974) pp. 177—195. Pamperrien, Rudolf: Das Problem menschlicher Gemeinschaft in Richard Dehmels Werk. — Tübingen 1924. Paur, Theodor: Vergleichende Bemerkungen über Dante, Milton und Klopstock. — Neiße 1847. ( = Programm.) Peter, John: A Critique of Paradise Lost. — New York 1960. Praz, Mario: Liebe, Tod und Teufel. Die schwarze Romantik. — Mündien 1970. Quasten, Johannes: Patrology. Vol. II. The Ante-Nicene Literature after Irenaeus. — Utrecht/Antwerpen 1953. Rajan, Β.: Paradise Lost and the Seventeenth Century Reader. — London 1962. Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Bd. 3. 3. Auflage. — Tübingen 1959. Rosenhaupt, Hans Wilhelm: Der deutsche Dichter um die Jahrhundertwende und seine Abgelöstheit von der Gesellschaft. — Bern/Leipzig 1939. Rütsch, Julius: Das dramatische Ich im deutschen Barock-Theater. — Horgen-Zürich/Leipzig 1932. ( = Wege zur Dichtung. Hrsg. von Emil Ermatinger. Bd. XII.) Russell, Bertrand: Byron. — In: Paul West (Ed.): Byron. A Collection of Critical Essays. — Englewood Cliffs, N. J. 1963. pp. 151—156. Schaible, Marlene: Darstellungsformen des Teuflischen, untersucht an Darstellungen des Engelsturzes vom Ausgang des Mittelalters bis zu Rubens. — Phil. Diss. Tübingen 1970. Schiff, Gert: Füssli, Luzifer und die Medusa. — In: Werner Hofmann (Hrsg.): Johann Heinrich Füssli. 1741—1825. — München 1974. pp. 9—22. Schneider, Carl: Geistesgeschichte des antiken Christentums. Bd. 1. — München 1954. Schöne, Albrecht: Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock. Mit 67 Abbildungen. — München 1964. Smit, W. A. P.: Van Pascha tot Noah. Een verkenning van Vondels drama's naar continuiteit en ontwikkeling in hun grondmotief en structuur. Deel II: Salomon — Koning Edipus. — Zwolle 1959. Stadler, Ulrich: Das Diesseits als Hölle: Sünde und Strafe in Grimmelshausens „Simplicianischen Schriften". — In: Gerhart Hoffmeister (Hrsg.): Europäische Tradition und deutscher Literaturbarode. Internationale Beiträge zum Problem von Überlieferung und Umgestaltung. — Bern/München 1973. pp. 351—369. Steffan, Truman Guy: Lord Byron's Cain. Twelve Essays and a Text with Variants and Annotations. — Austin/London 1968. Stein, Arnold: Answerable Style. Essays on Paradise Lost. — Seattle/London 1967. Sternberger, Dolf: Sinnlichkeit um die Jahrhundertwende. — In: Jost Hermand (Hrsg.): Jugendstil. — Darmstadt 1971. ( = Wege der Forschung. Bd.CX.) pp. 100—106. Symbolismus in Europa. Ausstellungskatalog. — Baden-Baden 1976. Szondi, Peter: Versuch über das Tragische. — Frankfurt 1961. Thorslev Jr., Peter L.: The Byronic Hero. Types and Prototypes. — Minneapolis 1962. Tillyard, E. M. W.: The Elizabethan World Picture. — Harmondsworth 1968. Trousson, Raymond: Le thème de Prométhée dans la littérature européenne. — Genf 1964. Vandervelden, J(osephus) : Staat en recht bij Vondel. — Haarlem 1939. Werblowsky, Zwi: Lucifer and Prometheus. A Study of Milton's Satan. — London 1952. Wöhlert, Hans: Das Weltbild in Klopstocks Messias. — Halle 1915. ( = Phil. Diss. Erlangen 1915.) Worp, J. Α.: Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Eerste deel. — Groningen 1904.
Register Adorno, Theodor W. 105, 177, 210 Aischylos 8, 10—15, 17, 20f„ 26, 39—41, 46f., 49, 108 Albertinus, Aegidius 30, 32 Alewyn, Richard 88 Alexander der Große 248 Alexander VI., Papst 78 Alexander Earl of Stirling, Sir William 18, 74, 80 Alighieri, Dante 42, 132, 148, 208 Ambrosius 79 Andres, Friedrich 17 Aner, Karl 166, 176 Aristoteles 49 Arnold, Ute und Heinz Ludwig 140 Arntzen, Helmut 91 Asselbergs, W. J. M. A. 93, 97,102—104 Assunto, Rosario 42, 54 Augustinus 12, 79 Bab, Julius 242,245 Bachmann, Franz 238 Bacon, Francis 47f. Baif, Jean-Antoine de 9 Bakunin, Michail 209 Ball, Hugo 26 Basileios 79 Baudelaire, Charles 58,131, 210 Baumgartner, Alexander 94 Beaumont, Joseph 61f., 81 Beer-Hofmann, Richard 247 Bekker, Balthasar 173 Bekker, Hugo 126 Belleau, Remi 9 Bender, Wolfgang 147—149 Benjamin, Walter 3, 87, 121, 194f., 210 Bercken, Erich von der 57f. Berenson, Bernard 55f. Bergmann, Michael 87f. Bernus, Alexander von 247f. Bidermann, Jakob 51 Bierbaum, Otto Julius 240f. Bismarck, Otto von 217, 234 Blackmore, Richard 61,142 Blake, William 179—181, 184, 190, 211 Blanqui, Louis Auguste 210 Bloch, Ernst 19, 69, 99f., 136, 208
Blumenberg, Hans 41, 47 Boas, Frederick S. 77 Bobertag, Felix 75 Boccaccio, Giovanni 17, 62 Bodmer, Johann Jakob 138, 142, 146—151, 157 Böcklin, Arnold 244 Böhme, Jakob 80 Bohrer, Karl Heinz 180 Boileau-Despréaux, Nicolas 140—143, 148, 151 Borkenau, Franz 99 Boron, Robert de 62 Bostetter, Edward E. 194, 202 Brandes, Georg 206,209 Breitinger, Johann Jakob 146, 157 Breker, Arno 229 Brereton, Geoffrey 49 Broadbent, J. B. 136 Brockes, Barthold Heinrich 84 Browning, Elizabeth Barrett 20 Bruno, Giordano 17f., 44, 71 Buchanan, George 52 Buchenau, Artur 152 Buck, August 17, 46 Bush, Douglas 82, 87, 137 Byron, George Gordon Lord 2—5, 182—211 Calderón de la Barca, Pedro 87 Calvin, Jean 38 Camus, Albert 19 Casaubonus, Isaac 9 Cassirer, Ernst 152 Castiglione, Baidassare 59 Chamfort, Nicolas 179, 184 Charlton, J. B. 18,74 Chrysostomos 79 Clarke, Robert 61f., 74, 85 Claudianus Mamertus 62 Cocteau, Jean 248 Coleridge, Ernest Hartley 187 Cornelisz, Cornells 90 Cowley, Abraham 49, 61f. Cramer, C. F. 150, 176 Cranach d. Ä., Lucas 78 Crashaw, Richard 72
Register Cromwell, Oliver 76 Cuvier, Georges 195 Czepko, Daniel von 89 Darjes, Joachim Georg 157 Darwin, Charles 231 Dehmel, Richard 242—246 Delpech, Henri 208 Delville, Jean 241 Diekhoff, John S. 134 Dilthey, Wilhelm 148 Dionysios Areopagita 26, 102, 109 Dionysius der Karthäuser 54 Dörner, Klaus 174 Donne, John 77 Dorat, Jean 9—11 Dryden, John 141—143, 148 Du Bartas, Guillaume de Salluste 9, 76, 80 Diintzer, Heinrich 7—11 Dürer, Albrecht 78 Dupuy, Claude 11 Dupuy, Jacques 11 Eckermann, Johann Peter 184 Eckert, Ernst Richard 206 Erich, Oswald Α. 53 Ermatinger, Emil 90 Fahrenkrog, Ludwig 220—228, 245 Ferdinand III., dt. Kaiser 96 Ficino, Marsilio 46 Fidus (d. i. Hugo Höppener) 220, 222, 225, 227—229 Fletcher, Phineas 61f., 76—78 Fortescue, Sir John 25, 54 France, Anatole 210f. Frecot, Janos 225, 227—229 Freivogel, Max 138 Frey, Adolf 166 Freybe, Albert 150 Friedrich, Hugo 68 Füssli, Johann Heinrich 181, 184 Galilei, Galileo 70, 231 Geist, Johann Friedrich 225 Georg IV., König von England 199 George, Stefan 242 Gessner, Salomon 166 Geulen, Hans 91 Gigon, Olof 49 Gledcner, Robert F. 194 Glockner, Hermann 152 Goethe, Johann Wolfgang von 184, 220 Goltzius, Hendrick 90 Gottsched, Johann Christoph 140, 143—151, 154—156, 171
259
Gregor von Nazianz 79 Gregor von Nyssa 16, 79 Grimm, Reinhold 166 Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von 63, 75f. Grosart, Alexander B. 76, 81 Grotius, Hugo 9, 11, 95, 98—102, 122f., 126 Gryphius, Andreas 61, 63, 89, 144 Guise, Duc de 38 Guthke, Karl S. 191 Haberkamm, Klaus 91 Hallmann, Johann Christian 89 Harsdörffer, Georg Philipp 64, 88 Hauser, Arnold 59 Hayward, John 77 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 36, 133, 136, 157 Heinrich III., König von Frankreich 7 Heinrich IV., König von Frankreich 7f., 29f., 38 Helms, Hans G. 208,225 Hemleben, Johannes 226, 230 Herder, Johann Gottfried 9 Hermand, Jost 226f., 244 Hesiod 17 Hieronymus 79 Hille, Peter 239 Hillmann, Susanne 209 Hirsch, Emanuel 157 Hitler, Adolf 87, 170, 207, 227 Hobbes, Thomas 95, 98, 119, 123f., 126 Hobsbawm, Eric J. 190, 199 Hocke, Gustav René 68 Hoffmeister, Gerhart 76 Hofmann, Werner 180f. Hofstätter, Hans G. 240 Holtzendorff, Inge von 247 Homer 61f., 139f„ 142 Horatius Flaccus, Quintus llf. Horkheimer, Max 32f„ 39, 99, 177 Hübbe-Schleiden, Wilhelm 226f„ 230 Hugo, Paul 236—238 Hutchinson, Thomas 21 Ignatius von Loyola 77 Immermann, Karl 190 Immessen, Arnold 21,51 Innozenz III., Papst 79 Irenaios 17 Jahn, Johannes 78 Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm 171 Johannessen, Káre Langvik 103f., 117
260
Register
Jullian, Philippe 241 Jump, John D. 183 Jung, Carl Gustav 20 Just, Klaus Günther 217, 243 Kaiser, Gerhard 138, 157, 159f., 162, 166, 173 Kant, Immanuel 157, 176 Karl I., König von England 76, 94f. Kastner, L. E. 18, 74 Kates, Judith A. 66 Kayser, Wolfgang 54 Kerbs, Diethart 225 Kerényi, Karl 17, 40 King, P. K. 105f. Kinser, Samuel 8—10 Kirkconnell, Watson 60, 62 Klaj, Johann 87 Klinger, Max 244 Klopstock, Friedrich Gottlieb 4, 63, 131—133, 136—139, 143, 146, 149—151, 156—177, 188, 208 Koch, Max 3 Kohlschmidt, Werner 102,132 Kopernikus, Nikolaus 47, 231 Korallow, Marlen M. 242 Kraft, Friedrich 51 Kraus, Walther 26,108 Kuhlenbeck, Ludwig 17 Kunze, Kurt 246 Lamartine, Alphonse de 190 Lappenberg, J. M. 176 Laumonier, Paul 46 Lausberg, Heinrich 17 Lautréamont, Comte de 210 Lehner, Ernst und Johanna 78 Leibniz, Gottfried Wilhelm 151—158, 165, 177 Lenz, Jakob Michael Reinhold 131 Leonhard, Rudolf 211 Leopardi, Giacomo 191 Lepenies, Wolf 121 Lessing, Gotthold Ephraim 9 Liliencron, Rochus Freiherr von 30 Limbourg, Paul de 56 Lindau, Hans 157 Lipsius, Justus 9, 11 Locke, John 95 Logau, Friedrich von 88f. Lohenstein, Daniel Casper von 89f., 93, 97 Lotto, Lorenzo 55—59, 83, 90 Lovell, Ernest J. 182,191 Lublinski, Samuel 235, 238 Ludwig XIV., König von Frankreich 121
Ludwig, Emil 243 Ludz, Peter 199 Lukács, Georg 198f., 229, 234 Luther, Martin 88, 156, 161 Luxemburg, Rosa 242 Madiault, Jean de 8 Machiavelli, Niccolò 32, 59, 65, 76 Mahal, Günther 132 Mann, Heinrich 87 Mann, Klaus 248 Mann, Thomas 93,213 Mantuan 61f. Marino, Giovanbattista 17f., 61—63, 67—72, 74, 83f., 90, 143—145 Markwardt, Bruno 89, 93 Marlowe, Christopher 44, 75, 81 Masen, Jakob 61, 63, 89 Mason, Eudo C. 132 Mattenklott, Gert 241 Mayenne, Duc de 33 Mayer-Tasdi, Peter Cornelius 119 Méautis, Georges lOf. Medici, Lorenzo de 45f. Medici, Maria von 94 Medwin, Captain 182, 198 Meidiel, Joachim 51 Merian, Matthäus 64 Meyer, Herman 132 Milch, Werner 89 Milner, John 241 Milton, John 4, 20, 62f., 65f., 82f„ 87, 90, 131—140, 142—151, 157, 159f., 162f., 165—167, 181f., 208 Mirollo, James V. 68 Molhuysen, P. C. 11 Montaigne, Michel 38 f., 43 Moore, Olin H. 62 Moore, Thomas 184,186 Moscherosch, Johann Michael 75 Moura, Rolin de 62 Müller, Ursula 63,87 Muncker, Franz 138f., 159 Musset, Alfred de 190 Napoleon I. Bonaparte 186, 198, 207 Nietzsche, Friedrich 208, 222,225,234, 239, 245 Nohl, Herman 148 Novalis (d. i. Friedrich von Hardenberg) 220 O'Brien, Gordon Worth 136 Oldenbarneveld, Joan van 93 Opitz, Martin 88 Orígenes 16,79
Register Osterkamp, Ernst 57 Pamperrien, Rudolf 245 Paracelsus 79 Paur, Theodor 132f. Peter, John 134 Petrus Lombardus 12 Peuckert, Will-Eridi 80 Peyton, Thomas 19 Pordage, Samuel 62, 79 Pozzi, Giovanni 18, 67 Praz, Mario 63, 68, 183 Prothero, Rowland E. 182 Proudhon, Pierre Joseph 209 Pufendorf, Samuel von 95,106 Quasten, Johannes 16 Rajan, B. 134f. Rasch, Wolfdietrich 91 Reboul, Jean 208 Redon, Odilon 241 Reidienberger, Kurt 80 Richelieu, Kardinal 94 Rienzo, Cola di 32 Rilla, Paul 9 Robertson, John M. 47 Rohlfs, Gerhard 17 Ronsard, Pierre de 9f., 46 Rosenhaupt, Hans Wilhelm 242 Rudow, Wilhelm 213—219, 222, 225, 246 Rütsch, Julius 90 Russell, Bertrand 207 Sachs, Hans 60 Sack, August Friedrich Wilhelm 171 Sälzle, Karl 88 Salandra, Serafino della 60 Sampson, John 180 Sannazaro, Iacopo 62 Scaliger, Joseph 9, 11, 46 Schätzel, Walter 98 Sdiaible, Marlene 55, 57—59 Schalk, Fritz 179 Scheerbart, Paul 243 Scherer, Wilhelm 3 Schering, Emil 235 Schiff, Gert 181 Schleiden, Karl August 137 Schmidt, Alfred 32 Schneider, Carl 17 Schöne, Albredit 90—92 Schoppe, Kaspar 8 Sdiuré, Edouard 231—233 Scott, Walter 186
261
Seneca, Lucius 62, 64 Seybold, David 9, 34, 38 Shakespeare, William 75 Shelley, Percy Bysshe 3, 20f„ 134, 186, 190 Sieveke, Franz Günter 76 Smit, W. A. P. 94, 103f., 125f. Sousa, Mellius de 62 Southey, Robert 183 Spalding, Johann Joachim 171, 173 Spieß, Christian Heinrich 175 Spinoza, Baruch de 95 Stadler, Ulrich 76 Staël-Holstein, Germaine de 182, 198 Steffan, Truman Guy 183f i( 186, 189, 194, 208 Stein, Arnold 133f. Steiner, Rudolf 226, 229—234, 245, 247 Steiner-von Sivers, Marie 231 Sternberger, Dolf 244 Stifter, Adalbert 182 Stirner, Max 208f., 225, 245 Strauß und Torney, Lulu von 240 Streckfuß, Karl 62, 83 Strindberg, August 235f., 239f. Stüde, Franz von 240f., 246 Suleiman der Prächtige 67 Summers, Montague 142 Suphan, Bernhard 9 Swedenborg, Emanuel 236, 239f. Sylvester, Josuah 76 Szondi, Peter 50 Taille, Jean de la 49 Talfourd, Thomas Noon 208 Tarot, Rolf 51 Tasso, Torquato 61—68, 71—73,140,143f„ 148 Tauler, Johannes 79 Thomann, Theodor 64 Thomas von Aquin 47, 79 Thorak, Josef 229 Thorslev, Peter L. 207 Thou, Jacques Auguste de 7—50, 52f. Thumery, Jean de 11 Tiedc, Ludwig 190 Tiedemann, Rolf 194 Tillyard, E. M. W. 26 Tintoretto, Jacopo 57—59, 67, 83 Trousson, Raymond 10, 17f., 46 Tullius Cicero, Marcus 99 Vandervelden, Josephus 95f., 129f. Vergilius Maro, Publius 61f., 139f. Verwey, Albert 76,91 Vida, Marco Girolamo 61f.
262
Register
Vigny, Alfred de 190,208 Vondel, Joost van den 2, 4, 33, 61, 63, 76, 87, 89—130 Voßkamp, Wilhelm 89 Wagenfeld, Karl 247 Wallenstein, Albrecht von 94 Wallmann, Jürgen P. 239 Walter, Erich 239 Walthierer, Aloys Kassian 74 Weber, Max 131 Weigel, Valentin 79—81 Weinridi, Harald 17 Werblowsky, Zwi 20
Werder, Diederich von dem 64 West, Paul 207 Weydt, Günther 91 Willem II. von Oranien 94 Wöhlert, Hans 174 Wolff, Christian 133, 145, 151, 154—157, 171, 175f. Worp, J . A . 103 Wunberg, Gotthart 235 Yerby, Frank 182 Zachariä, Friedrich Wilhelm 176 Ziegler, Hieronymus 60
w DE
G
Walter de Gruyter Berlin· New ¥)ik KOMEDIA Deutsche Lustspiele vom Barock bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Helmut Arntzen und Karl Pestalozzi
L A. Gottsched
Der Witzling Ein deutsches Nachspiel in einem Aufzug
J. E. Schlegel
Die stumme Schönheit Ein Lustspiel in einem Aufzug. Text und Materialien zur Interpretation besorgt von Wolfgang Hecht Oktav. 105 Seiten. 1962. Kartoniert DM 12,80 (Band 1)
Ch. F. Geliert
Die Betschwester Lustspiel in drei Aufzügen. Text und Materialien zur Interpretation besorgt von Wolfgang Martens Oktav. 90 Seiten, 1 Faksimile. 1962. Kartoniert DM 12,80 (Band 2)
E E. Niebergall
Datterich Localposse in der Mundart der Darmstädter in sechs Bildern. Nach dem Erstdruck von 1841. Text und Materialien zur Interpretation besorgt von Volker Klotz Oktav. 110 Seiten, 1 Abbildung. 1963. Kartoniert DM 12,80 (Band 3)
A. v. Kotzebue
Die deutschen Kleinstädter Ein Lustspiel in vier Akten. 1803. Text und Materialien zur Interpretation besorgt von Hans Schumacher Oktav. 112 Seiten. 1964. Kartoniert DM 12,80 (Band 5)
A. Schnitzler
Anatol Anatol-Zyklus - Anatols Größenwahn - Das Abenteuer seines Lebens. Texte und Materialien zur Interpretation besorgt von Ernst Ludwig OfFermanns Oktav. 202 Seiten. 1964. Kartoniert DM 12,80 (Band 6)
LTieck
Die verkehrte Welt Ein historisches Schauspiel in fünf Aufziigea Text und Materialien zur Interpretadon besorgt von Karl Pestalozzi Oktav. 148 Seiten. 1964. Kartoniert DM 12,80 (Band 7)
F. Wedekind
Der Marquis von Keith Schauspiel in 5 Aufzügen. Text und Materialien zur Interpretation besorgt von Wolfgang Hartwig Oktav. 121 Seiten. 1965. Kartoniert DM 12,80 (Band 8)
J. M. R. Lenz
Der neue Menoza Komödie. Text und Materialien zur Interpretation besorgt von Walter Hinck Oktav. 96 Seiten. 1965. Kartoniert DM 12,80 (Band 9) Preisänderungen vorbehalten
w DE
G
Walter de Gruyter Berlin Newark KOMEDIA Deutsche Lustspiele vom Barock bis zur Gegenwart Herausgegeben von Helmut Amtzen und Karl Pestalozzi
Ch. Weise
Bäurischer Machiavellus Lust-Spiel. Text und Materialien zur Interpretation besorgt von Werner Schubert Oktav. 143 Seiten. 1966. Kartoniert DM 12,80 (Band 10)
F. Raimund
Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär Romantisches Original-Zaubeimärchen mit Gesang in drei Aufzügen. Text und Materialien zur Interpretation besorgt von Urs Helmensdorfer Oktav. 116 Seiten, 1 Faksimile. 1966. Kartoniert D M 12,80 (Band 11)
I. Göll
Methusalem oder Der ewige Bürger Ein satirisches Drama. Text und Materialien zur Interpretation besorgt von Reinhold Grimm und Viktor Zmegac Oktav. 89 Seiten, 4 Abbildungen. 1966. Kartoniert D M 12,80 (Band 12)
A. v. Arnim
Das Loch oder Das wiedergefundene Paradies Ein Schattenspiel
J. v. Eichendorff
Das Incognito oder Die Mehreren Könige oder Alt und Neu Ein Puppenspiel. Text und Materialien zur Interpretation besorgt von Gerhard Kluge Oktav. 132 Seiten. 1968. Kartoniert D M 12,80 (Band 13)
J. F. v. Cronegk
Der Misstrauische Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Text und Materialien zur Interpretation besorgt von Sabine Roth Oktav. 118 Seiten, 1 Abbildung. 1969. Kartoniert D M 12,80 (Band 14)
M. M. Metzger G . F. S c h m i d t (Hrsg.)
L. Hollonius
Der Hofmeister und die Gouvernante Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Texte und Materialien zur Interpretation Oktav. 118 Seiten. 1969. Kartoniert D M 12,80 (Band 15)
Somnium vitae humanae Drama. Text und Materialien zur Interpretation besorgt von Dorothea Glodny-Wierczinski Oktav. 101 Seiten. 1970. Kartoniert D M 12,80 (Band 16)
J. Nestroy
Der Talisman Posse mit Gesang in drei Akten. Text und Materialien zur Interpretation besorgt von Helmut Herles Oktav. 135 Seiten. 1971. Kartoniert D M 12,80 (Band 17) Preisminderungen v o r b e h a l t e n
![Wer Kauft Liebesgötter?: Metastasen Eines Motivs [Illustrated]
3110202913, 9783110202915](https://ebin.pub/img/200x200/wer-kauft-liebesgtter-metastasen-eines-motivs-illustrated-3110202913-9783110202915.jpg)
![Rocaille: zur Herkunft und zum Wesen eines Ornament-Motivs [Reprint 2011 ed.]
9783111531816, 9783111163772](https://ebin.pub/img/200x200/rocaille-zur-herkunft-und-zum-wesen-eines-ornament-motivs-reprint-2011nbsped-9783111531816-9783111163772.jpg)
![Die Begegnung im Tempel: Abwandlungen eines literarischen Motivs in den Werken Boccaccios [Reprint 2020 ed.]
9783112317761, 9783112306628](https://ebin.pub/img/200x200/die-begegnung-im-tempel-abwandlungen-eines-literarischen-motivs-in-den-werken-boccaccios-reprint-2020nbsped-9783112317761-9783112306628.jpg)