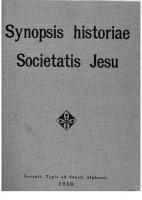Geistesgegenwart: Das mystische Fortleben Jesu 3534271386, 9783534271382
Rare Book
125 69 2MB
German Pages [226] Year 2019
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorwort
Einführung
Erstes Kapitel: Vororientierung
1. Die Anrufung
2. Die Verdüsterung
3. Die Invokation
4. Komm heraus!
5. Die Rückbezüglichkeit
6. Lasst ihn gehen!
7. Die präsentische Heilserfahrung
8. Das Zugesprochensein
Zweites Kapitel: Der Zugang
1. Die Provokation
2. Das Zeitbild
3. Die conditio humana
4. Die conditio mundana
5. Die conditio religiosa
6. Die Neuentdeckung
7. Der inwendige Lehrer
8. Die Morgenschau
Drittes Kapitel: Die Erschließung
1. Die Fulguration
2. Die Lesarten
3. Die Gottessuggestion
4. Der akustische Zugang
5. Der optische Zugang
6. Der haptische Zugang
7. Die Begründung
8. Die Botschaft
9. Das Prisma
Viertes Kapitel: Die Vertiefung
1. Die Proklamation
2. Die Verwirklichung
3. Die Neomorphose
4. Die Selbstfindung
5. Die Lebensleistung
6. Die Umsetzung
7. Die Inversion
Fünftes Kapitel: Die Verzweigung
1. Die Innovation
2. Die Vorgaben
3. Die Selbstversöhnung
4. Die Verwandlung
5. Der Begleiter
6. Die Idealisierung
7. Die Konkretisierung
8. Die Vielgestalt
Sechstes Kapitel: Das Fortleben
1. Die Konzeption
2. Das Sensorium
3. Das Panorama
4. Die Topologie
5. Die Geschichtsgestalt
6. Der Schatten
Siebtes Kapitel: Der Rückbezug
1. Der Vermittler
2. Die Identitätsfindung
3. Streuung und Konvergenz
4. Die Begriffsbestimmung
Anhang
Verzeichnis der Namen
Im Text zitierte Werke von Eugen Biser
Die Eugen-Biser-Stiftung
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Eugen Biser
File loading please wait...
Citation preview
Eugen Biser
Geistesgegenwart
Eugen Biser
Geistesgegenwart Das mystische Fortleben Jesu
Mit einer Einführung von Martin Thurner
Im Auftrag der Eugen-Biser-Stiftung aus dem Nachlass herausgegeben von Richard Heinzmann und Monika Schmid
In memorian Prof. Dr. Dr. h.c. Katharina Reiß Mitbegründerin der Eugen-Biser-Stiftung *17. April 1923 †16. April 2018
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme. wbg Academic ist ein Imprint der wbg. © 2019 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht. Satz: Satz & mehr, Besigheim Umschlaggestaltung: Harald Braun, Helmstedt Umschlagabbildung: Jesus Christus, Detail eines Mosaiks aus San Apollinare Nuovo, Ravenna, © akg / Bible Land Pictures Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier Printed in Germany Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de ISBN 978-3-534-27138-2 Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich: eBook (PDF): ISBN 978-3-534-74534-0 eBook (Epub): ISBN 978-3-534-74535-7
Inhalt Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 9
Erstes Kapitel Vororientierung 1. Die Anrufung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Die Verdüsterung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Die Invokation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Komm heraus! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Die Rückbezüglichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Lasst ihn gehen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Die präsentische Heilserfahrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Das Zugesprochensein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 13 15 16 18 20 21 24
Zweites Kapitel Der Zugang 1. Die Provokation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Das Zeitbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Die conditio humana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Die conditio mundana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Die conditio religiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Die Neuentdeckung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Der inwendige Lehrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Die Morgenschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 31 33 39 44 55 56 58
Drittes Kapitel Die Erschließung 1. Die Fulguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Die Lesarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Die Gottessuggestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Der akustische Zugang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Der optische Zugang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Der haptische Zugang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Die Begründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Die Botschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Das Prisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 69 72 74 79 84 87 94 98
5
Inhalt
Viertes Kapitel Die Vertiefung 1. Die Proklamation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Die Verwirklichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Die Neomorphose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Die Selbstfindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Die Lebensleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Die Umsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Die Inversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 106 108 111 116 121 125
Fünftes Kapitel Die Verzweigung 1. Die Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Die Vorgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Die Selbstversöhnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Die Verwandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Der Begleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Die Idealisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Die Konkretisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Die Vielgestalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135 137 139 143 145 150 157 163
Sechstes Kapitel Das Fortleben 1. Die Konzeption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Das Sensorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Das Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Die Topologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Die Geschichtsgestalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Der Schatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170 172 176 183 190 195
Siebtes Kapitel Der Rückbezug 1. Der Vermittler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Die Identitätsfindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Streuung und Konvergenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Die Begriffsbestimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201 203 212 214
Anhang Verzeichnis der Namen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Im Text zitierte Werke von Eugen Biser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Die Eugen-Biser-Stiftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 6
Vorwort
M
it der Publikation der „Geistesgegenwart. Das mystische Fortleben Jesu“ ist die von Eugen Biser (1918 – 2014) selbst als systematischer Abschluss seines Lebenswerkes konzipierte Trilogie vollendet. Im Vorwort des von ihm 2007 noch herausgegebenen ersten Bandes der Trilogie „Gotteskindschaft. Die Erhebung zu Gott“ schreibt Biser: „Gedacht ist das Gesamtkonzept als theoretische Rechtfertigung der Stiftung, die sich die Erschließung und Präsentation meiner Theologie zum Ziel gesetzt hat und dabei nicht nur auf das bereits in über einhundert Büchern und einer großen Zahl von kleineren Veröffentlichungen vorliegende Schrifttum angewiesen sein sollte. Ihr möchte die damit begonnene Trilogie die Zukunftsperspektive meines theologischen Konzepts erschließen und damit ihren Bemühungen entgegenkommen“ (a.a.O., S. 9). In der Zukunftsorientierung seiner Theologie – und darum geht es Biser – kommt der „Geistesgegenwart“ grundlegende und zentrale Bedeutung zu. Schon einer seiner frühesten Aufsätze von 1952 galt dem Thema der Pneumatologie (Die Einheit des Geistes, in: Münchener Theologische Zeitschrift 3, 1952, S. 33 – 53; S. 136 – 150). Die von Eugen Biser nicht mehr redigierte Originalvorlage für diese Publikation ist Fragment. Abgesehen von drei Brüchen im Text, fehlt der Schluss. Im Blick auf eine Publikation war das Fehlen eines wissenschaftlichen Apparates besonders gravierend. Von ca. 510 bezifferten Verweisen auf Fußnoten, die ausnahmslos nicht ausgeführt waren, waren annähernd 200 Stellen nur markiert, ohne jede weitere Angabe; bei etwa 240 Verweisen war nur der Name des Autors angemerkt. Zahlreiche direkte Zitate waren ohne Quellenverweis, zahlreiche indirekte Zitate waren so markant, dass Angaben zu Autor und Werk von der Sache her unabdingbar erforderlich waren. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Passagen mit beziffertem Verweis waren zweifelsfrei Selbstverweise Eugen Bisers. Nach Vorgabe der von ihm selbst verantworteten Publikationen und gemäß dem Standard seiner Veröffentlichungen wurden sie ausgeführt und im Anhang unter „Im Text zitierte Werke von Eugen Biser“ aufgelistet. Bei dieser Sachlage gab es nur die Alternative: Entweder man verzichtete auf eine Veröffentlichung, oder der Text musste unter erheblichem Arbeitsaufwand – ohne in den Inhalt einzugreifen – in eine wissenschaftlich verantwortete und dadurch für die Wissenschaft brauchbare Fassung gebracht werden. Die Herausgeber haben sich für die Veröffentlichung entschieden – nicht nur weil es sich dabei um ein verpflichtendes und einzulösendes Vermächtnis von Eugen Biser handelt, sondern auch weil das Thema, die Gegenwart des Geistes, sein gesamtes theologisches Denken von Anfang an wie ein Leitgedanke durchzieht. Wenn es darum geht, Bisers Theologie im Einzelnen wie im Ganzen zu erschließen – und das ist die Aufgabe seiner Stiftung –, ist die „Geistesgegenwart“ als letzter Baustein seiner theologischen Gesamtkonzeption unverzichtbar. Wie schon beim zweiten Band der Trilogie, „Christomathie. Eine Neulektüre des Evangeliums“ (2018), erforderte die Erstellung eines druckreifen Textes, der wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und damit eine Veröffentlichung rechtfertigt, eine umfassende Kenntnis des Gesamtwerkes von Eugen Biser und einen außerordentlichen Arbeitsaufwand. Ohne hohe wissenschaftliche Kompetenz, unermüdliche Ausdauer bei den Recherchen und unverzichtbare Akribie im Einzelnen wäre die Publikation nicht zu re7
Vorwort
alisieren gewesen. Frau Lic. theol. Monika Schmid M. A., wissenschaftliche Mitarbeiterin der Eugen-Biser-Stiftung, hat sich, wie schon bei der Veröffentlichung der „Christomathie“ und auf Grund ihrer dabei gewonnenen Detailkenntnis, dieser Aufgabe mit Erfolg angenommen. Dafür gelten Ihr großer Dank und höchste Anerkennung. Herrn P. Dr. Johannes Baar SJ und Herrn Dr. Max Bader gebührt besonderer Dank für das sorgfältige Gegenlesen des Textes. Seine Verbundenheit mit Eugen Biser und der Eugen-Biser-Stiftung hat SKH Herzog Franz von Bayern erneut durch seine großzügige finanzielle Unterstützung dieses Bandes zum Ausdruck gebracht. Hierfür ist ihm die Stiftung sehr dankbar. Gleiches gilt der Erzdiözese Freiburg, der Heimatdiözese von Eugen Biser, vor allem der Erzbischof-Hermann-Stiftung. Die Stiftung weiß sich insbesondere Herrn Generalvikar Dr. Axel Mehlmann verbunden, der nicht nur die finanzielle Förderung der Publikation vermittelt hat, sondern auch dafür, dass er die Stiftung und deren Arbeit nachdrücklich unterstützt. Nicht unerwähnt soll die kompetente verlegerische Betreuung durch die Wissenschaftliche Buchgesellschaft und die gute Zusammenarbeit mit der für diese Publikation zuständigen Lektorin, Frau Susanne Fischer, bleiben.
8
Einführung
W
er die Gelegenheit hatte, mit Eugen Biser (1918–2014) in den letzten Jahren seines Lebens Gespräche über sein theologisches Denken zu führen, konnte miterleben, wie er in inspirierter Frische überraschend unkonventionelle Wege beschritt. So äußerte er mit zunehmendem Alter immer mehr Anerkennung für einen mittelalterlichen Denker, der in seiner theologischen wie außerkirchlichen Wirkungsgeschichte zahlreichen Kontroversen und Verdächtigungen ausgesetzt war: Joachim von Fiore (1135–1202). Bisers Faszination galt dabei dem Gedanken Joachims, den christlichen Glauben an die göttliche Trinität geschichtsphilosophisch auszulegen: Auf ein Zeitalter des Vaters (Gesetz) folgt dasjenige des Sohnes (Kirche) bis es endgültig vom Reich des Geistes (Freiheit) abgelöst wird. Dass Joachims geisttheologisches Konzept des „Dritten Reiches“ schon in der mittelalterlichen Kirche bekämpft und dann schließlich von der nationalsozialistischen Ideologie in sein schieres Gegenteil pervertiert wurde, wertete Biser als verlustreichen Irrweg, den es wiedergutzumachen gilt. Am Ende seines Denkweges war es Biser daran gelegen, sein umfangreiches Gesamtwerk in eine Synthese zu bringen, die Zukunft eröffnet. Im Rückblick erscheint es alles andere als ein Zufall zu sein, dass Bisers letztes, zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichtes Buch-Manuspkript die „Geistesgegenwart“ ist. Es ist geplant als der letzte Teil einer „Trilogie“, deren vorausgehende Bände die Titel „Gotteskindschaft“ und „Christomathie“ tragen. Biser hinterließ mit der abschließenden Trilogie eine Art theologische Summe, in der er den klassischerweise in der systematischen Theologie entfalteten Trinitätsgedanken heilsgeschichtlich auslegte. Dabei erscheinen die dem Vater und dem Sohn zugedachten Eigenschaften und Wirkungen nicht primär als innergeschichtliche Vorstufen zu einem Zeitalter des Geistes, sondern vielmehr als dessen immanente Ermöglichungsbedingungen. In der „Gotteskindschaft“ reflektiert Biser das Verhältnis des (glaubenden) Menschen zum Vatergott als Voraussetzung dafür, dass der Mensch seine ihm als „uneingelöstes Versprechen“ gegebenen Möglichkeiten in Freiheit entfalten kann. Nach Biser ist der Mensch noch weit davon entfernt, all das zu verwirklichen, was ihm von seiner Schöpfung her eröffnet wäre. Als Grund für dieses Zurückbleiben des Menschen hinter seinen Möglichkeiten diagnostiziert Biser blockierende Hemmungen, die ihrerseits aus der Angst des Menschen resultieren, nicht als der angenommen zu werden, der er ist, insbesondere in seinem Scheitern. Erst der Bezug zum Vatergott, der jeden Menschen in bedingungsloser Liebe annimmt, befreit in seiner therapeutischen Wirkung den Menschen zum Ergreifen seiner offenen Zukunft in Freiheit. Als unwiderrufliche Mitteilung dieser lebenseröffnenden Zusage deutet Biser das göttliche Sohn-Wort Jesus Christus. In seinem Projekt der „Christomathie“ erläutert er den Christusbezug als einen Verstehensprozess, in welchem Gott den Menschen in eine personal-dialogische Gemeinschaft mit sich hineinnimmt. Jesus erscheint so nicht als vergangene historische Gestalt, sondern als der „inwendige Lehrer“, der im Herzen jener, die an ihn als seine Botschaft glauben, fortlebt. Die Christuswirklichkeit erweist sich damit als ein mystisches Geschehen, das als ein lebendiges Interpretament alle dogmatischen Glaubenssätze auf sich hin relativiert. Weil die in der Liebeszusage des Vaters eröffnete Freiheit in der inneren Begegnung mit dem Sohnwort geschenkt wird, erfüllt sie sich in der „Geistesgegenwart“. Das Fortle9
Einführung
ben des Auferstandenen besteht in einer geistgewirkten Präsenz, welche allein alle Grenzen von Zeit und Ort überwinden kann. Aus dieser theologisch notwendigen Einsicht zieht Biser nun die Konsequenz, dass die Gegenwart der Liebe des Vaters in Jesus Christus durch den Heiligen Geist weder auf eine konfessionelle Dogmatik noch gar auf die Grenzen einer institutionell verfassten Kirche beschränkt werden kann. Auffällig ist, dass in Bisers Denken ekklesiologische Themen wie Kirchenverfassung, Ämterfrage, Hierarchie, Priestertum, Lehrautorität u. a. keine bemerkenswerte Rolle spielen. Noch auffälliger ist, dass er auch der klassischen Lehre von den Sakramenten kein großes Schwergewicht gibt, selbst der Lehre von der Eucharistie nicht. Dabei war Eugen Biser aus Überzeugung Priester der Katholischen Kirche und hat allsonntäglich in der vollen Münchner Universitätskirche St. Ludwig die Hl. Messe zelebriert. Daraus kann geschlossen werden, dass konkrete institutionell-sakramentale Gestalten für ihn zwar existenziell unverzichtbar waren, aber kein Gegenstand theoretisch-dogmatischer Festlegungen mehr sein sollten. Die Zukunft des Christentums besteht entscheidend in einer Wende zum PneumatologischMystischen. „Gott“ tritt damit aus den abgegrenzten Räumen und deren oft unverständlichen Sprachspielen heraus in die Freiheitszukunft der Welt. Mit seinem Ansatz der Geistesgegenwart überwindet die Theologie des katholischen Theologen Biser nicht nur das Trennende zu den evangelisch-reformatorischen Kirchen mit ihrer Distanz zu den Institutionen und zu den orthodoxen Ostkirchen mit ihrer pneumatischen Bildwelt, sondern auch die Dichotomie zwischen Welt- und Heilsgeschichte. Dies erlaubt es Biser, den für Neuzeit und Moderne zentralen Gedanken einer freien Säkularität durchaus theologisch zu legitimieren und christlich zu durchdringen. Auch wo der Bezug zum Christentum nicht explizit sichtbar ist oder genannt wird, kann der Heilige Geist gegenwärtig sein. Aufgrund dieser Einsicht kann Biser den Horizont des Religionsphilosophen nicht nur auf die Werke der säkularen Kultur erweitern, wie er es durch zahlreiche Interpretationen von Werken der Kunst, Literatur und Musik von Beginn seines Forschens an getan hat, bereits zu einer Zeit, als dies alles andere als Mode war. Selbst im Werk erklärter Antichristen wie Friedrich Nietzsche vermochte er so positive Ansätze für die Erneuerung einer christlichen Theologie zu entdecken. Bisers Theologie der Geistesgegenwart eröffnet auf globaler Ebene auch aus christlichen Wurzeln eine ganz neue Sicht der anderen Weltreligionen. Wenn man die anderen Religionen potenziell auch als Orte der Gegenwart des Heiligen Geistes deuten kann, dann ermöglicht sich damit für die christliche Kultur ein neuer Weg, mit den anderen Weltreligionen in einen fruchtbaren, auf gegenseitige Bereicherung angelegten Dialog zu treten. In seinem Konzept der Geistesgegenwart formuliert Biser also nichts weniger als eine christliche Antwort auf die modernen Phänomene von Säkularisation und Globalisierung. Damit gibt er zu verstehen, dass Christ-Sein und moderne Welt sich keinesfalls ausschließen, sondern dass auf der Grundlage der traditionell christlichen Lehre vom Heiligen Geist sich ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Wenn die „Geistesgegenwart“ das letzte, erst posthum publizierte Wort eines Theologen ist, öffnet er damit sein zurückliegendes Werk sinngebend einer noch zu erfüllenden Zukunft. München, im Spätjahr 2018
10
Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Thurner Vorsitzender des Stiftungsrates der Eugen-Biser-Stiftung
Erstes Kapitel
Vororientierung 1. Die Anrufung
W
er sich vornimmt, dem Zeitalter ins Herz zu schauen, ist im Blick auf große Vorbilder versucht, vor jedem weiteren Schritt die Musen anzurufen. Denn es könnte ihm sonst wie dem Erzähler in Goethes „Faust“, der sich stattdessen dem Gesang der Erzengel hingibt1, widerfahren, daß sich die übergangenen Musen am Ende doch noch einstellen, verwandelt in die „grauen Weiber“ namens Mangel, Schuld, Not und Sorge, und daß ihn letztere mit Blindheit schlägt2. Davor warnt bereits eine ungleich ältere Erzählung. Sie führt zurück ans „Krankenlager“ des von dem über ihn verhängten Todesurteil niedergeworfenen Boëthius, das die um sein Schicksal trauernden Musen umstehen, um dessen Schmerz „Worte einzugeben“. Doch ihr Zuspruch wird jäh von der Erscheinung der „Philosophie“ unterbrochen, die den Trösterinnen vorwirft, die Leiden des Kranken mit ihrem süßen Gift noch zu mehren, und sie schließlich aus dem Kerker vertreibt. Dann aber stellt sie ihrem einstigen Schüler die Diagnose: Es besteht keine Gefahr; er leidet an Lethargie, der gewöhnlichen Krankheit eines genarrten Geistes. Er hat sich selbst ein wenig vergessen; er wird sich leicht erinnern, dann wenigstens, wenn er mich zuvor erkannt hat3. Die auf „Lethargie“ lautende Diagnose läßt in zweifacher Hinsicht aufhorchen. Zunächst schon durch ihre verblüffende Aktualität, denn sie bringt mit erstaunlicher Treffsicherheit auch das Grundübel der Gegenwart zum Vorschein: die lähmende Resignation, die sich allenthalben, besonders im Gefolge der Kirchenkrise, aber auch in der Reaktion auf eine weithin als chimärisch empfundene Zeitsituation, bemerkbar macht. Sodann aber auch in ihrem Zusammenhang mit der Vertreibung der Musen. Denn diese verführen durch das süße Gift ihres Zuspruchs, wie der Eingang der „Consolatio“ nur zu deutlich bestätigt, zur Rückschau: Der ich einst heitere Lieder in frischem Eifer vollendet, bin zum Beginne, ach, trauriger Weise gedrängt. Siehe, zerrissene Musen befehlen mir, was ich schreibe, und mit Tränen benetzt mir das Gesicht Elegie! 1 J. W. von Goethe, Faust I, Prolog im Himmel, V. 243 – 270, in: ders., Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust, hrsg. u. kommentiert v. E. Trunz, Jubiläumsausg., unveränd. Nachdruck, München 2014, S. 16. 2 Ders., Faust II, 5. Akt: Mitternacht, V. 11382 – 11498, a.a.O., S. 343 – 346. 3 Boëthius, Trost der Philosophie I, 2. Prosa, aus dem Lat. übs. u. hrsg. v. K. Büchner, Bremen 1964, S. 5; ausführlicher dazu: R. Heinzmann, Philosophie des Mittelalters (Grundkurs Philosophie 7), Stuttgart 3/2008, S. 95 – 115.
11
Vororientierung
Die wenigstens konnten Gefahr nicht und Schrecken besiegen, daß sie nicht doch als Geleit folgten auf unserem Weg. Die einst der ruhmvolle Stolz beglückter und prangender Jugend, trübe trösten sie jetzt meines, des Greises Geschick4. Dieser wird nach dem Einspruch der Philosophie sein Geschick nie bestehen lernen. Deshalb tritt die Philosophie an die Stelle der falschen Trösterinnen, um ihrem Schüler auf seinem Leidensweg beizustehen. Sie kommt, wie es ihrer visionären Erscheinung entspricht, unvermutet und ungerufen. Doch das ist die Vergünstigung für den, dessen Denkweg im Begriff steht, sich als Leidensweg zu vollenden, und dem durch den bevorstehenden Tod die härteste Gegenprobe zu seinem Denken abverlangt ist. Den anderen bleibt nur der Bittweg. Wenn sich somit das Mißgeschick des Faust-Erzählers nicht wiederholen soll, bedarf es einer Anrufung gleich der zu Beginn der homerischen Epen, der sich nach Boëthius sogar Dante beim Eintritt in das „Zweite Reich“ seiner Jenseitsreise, das Purgatorio, verpflichtet fühlt. Doch dabei blieb die von Boëthius markierte Zäsur unbeachtet. Wie es Adornos vieldiskutierter Behauptung zufolge nach Auschwitz kein lyrisches Gedicht mehr geben kann, so gibt es nach Boëthius keine Anrufung der Musen mehr. Was tritt an ihre Stelle? Auf der Suche nach den „höheren Charismen“ antwortet Paulus darauf: Jetzt aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe; am größten unter ihnen aber ist die Liebe (1Kor 13,13). Glaube, Hoffnung, Liebe – sie sind, im Kontext des Ersten Korintherbriefs gesehen, die Früchte jener Kreuzesweisheit, die sich über das philosophische Weisheitsstreben erhob und seinen Geltungsanspruch widerlegte. An sie kann man sich halten. Doch kann man sie auch anrufen? Die Last der Antwort wird dem Fragesteller nur im Fall der Hoffnung abgenommen, wenn die nach dem ersten Zusammentreffen mit ihrem mörderischen Gegenspieler mühsam um Fassung ringende Leonore in Ludwig van Beethovens „Fidelio“ von dem auf dunklen Wolken ruhenden „Farbenbogen“ singt, dessen Anblick ihr aufwallendes Blut beschwichtigt: Komm, Hoffnung, laß den letzten Stern Der Müden nicht erbleichen! Erhell’ mein Ziel, sei’s noch so fern, Die Liebe wird’s erreichen5. Sie ist durch das Friedenszeichen des Regenbogens – ein unverkennbarer Hinweis auf den Ausklang der biblischen Sintfluterzählung – wie durch ein Portal in ihre eigene Zukunft geschritten, in der sie die geplante Rettung des Gatten bewirken wird. Was ihr diese Zu4 Boëthius, Trost der Philosophie I, 1. Prosa, a.a.O., S. 1. 5 L. v. Beethoven, Fidelio, op. 72, 1. Akt, 6. Auftritt, Nr. 9, Rezitativ und Arie.
12
2. Die Verdüsterung
kunft eröffnet und ihr dem Ziel entgegengehen hilft, ist der Gegenstand ihrer Anrufung, die Hoffnung. Diese muß sie gestalthaft wahrgenommen haben, damit sie sich zu ihrer Anrufung erheben konnte. Die Hoffnung bewahrt auch Paulus vor dem Scheitern, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den heiligen Geist, der uns gegeben ist“ (Röm 5,5). Im Sinn des paulinischen Geistbegriffs ist die Hoffnung damit auf den durch seinen Geist den Glaubenden innewohnenden Christus zurückgeführt. Ihn nennt der Kolosserbrief ausdrücklich sogar unsere „Hoffnung“ (Kol 1,27). Unmittelbarer noch wird er von der Römerstelle mit der Liebe gleichgestellt. Und damit greift der Gedanke nochmals auf Leonores Beschwörung des Farbenbogens zurück, der, gerade auch nach dem Sintflutbericht, „auf dunklen Wolken ruht“. Denn Jesus ist im Sinn der neutestamentlichen Botschaft zunächst der Friedensstifter. Er verheißt den Frieden, „den die Welt nicht geben kann“ (Joh 14,27). Und der Epheserbrief steigert sich sogar zu der Aussage: „Er ist unser Friede“ (Eph 2,14). Nach Wilhelm Lütgert ist er im gleichen Sinn aber auch die leibhaftige Verkörperung der Gottesliebe6. In seinem Wort wie in seinem Handeln und Leiden hat Jesus die vom Gottesgeheimnis ausgehenden Bedrohungen eliminiert und dort, wo der fromme Sinn der Menschheit zwischen Faszination und Schrecken schwankte, das „Wahrzeichen“ der bedingungslosen Liebe zum Vorschein gebracht. Diese Liebe gewinnt in ihm ein Antlitz, kommt in ihm zu Wort, wird in ihm fühlbar. Deshalb kann sie mit und in ihm angerufen werden. Gleiches trifft schließlich auch auf den Glauben zu. Galt dieser lange als ein Für-wahrHalten von Sätzen, so bricht sich heute zunehmend die Erkenntnis Bahn, daß er sich nicht auf die Sätze, sondern auf den von ihnen umschriebenen Inhalt, letztlich auf den bezieht, der die Glaubensbahn gebrochen und die Sache des Glaubens bis zur Identifikation mit ihr an sich gezogen hat. Deshalb kann der frühchristliche Märtyrerbischof Ignatius von Antiochien den Adressaten seines Smyrnäerbriefs – im Blick auf das Menschensohnwort von Lk 9,26 – versichern: Er wird sich eurer nicht schämen, der vollkommene Glaube, Jesus Christus7.
2. Die Verdüsterung Aber kann man heute noch so von Glaube, Hoffnung und Liebe reden, kann man sie anreden und anrufen, wie die ihrer Inspirationsquelle so sicheren Dichter der Vorzeit die 6 Dazu: W. Lütgert, Die Johanneische Christologie, 2., völlig neu bearb. Aufl., Gütersloh 1916, S. 50 – 64: Die Einheit Jesu mit Gott; ferner: ders., Die Liebe im Neuen Testament. Ein Beitrag zur Geschichte des Urchristentums, Leipzig 1905. 7 Ignatius von Antiochien, An die Smyrnäer 10,2, in: Die Apostolischen Väter, aus dem Griech. übs. v. F. Zeller (Bibliothek der Kirchenväter – im Folgenden abgekürzt: BKV – 1. Reihe, Bd. 35), München 1918, S. 147 – 152, S. 151; ferner: K. Berger u. C. Nord, Das Neue Testament und frühchristliche Schriften. Übersetzung und Kommentar, Frankfurt a. M. u. a. 1999, S. 806 – 810, S. 809.
13
Vororientierung
Musen anriefen? Alles spricht dagegen, denn der Glaube, um bei ihm einzusetzen, erleidet eine beispiellose Krise, die bei der Kirchenleitung dazu führte, auf seiner lehrhaften Umschreibung zu bestehen und ihn dadurch in die Nähe einer Ideologie zu rücken. Dies brachte erhebliche Teile des Kirchenvolkes dazu, den Auferstehungsglauben gegen die asiatische Reinkarnationsvorstellung auszutauschen und dadurch das Herzstück aus ihm herauszubrechen; und es bestärkte schließlich sogar namhafte Theologen in der Neigung, einzelne Mysterien, wenn nicht gar den Christenglauben insgesamt, aus dem ägyptischen Mythos oder doch wenigstens aus den alttestamentlichen Vorgegebenheiten herzuleiten und dadurch entweder den Unterschied zwischen den beiden Testamenten oder die ungleich gravierendere Differenz zwischen Glauben und Mythos einzuebnen. Im Gefolge der Krise, in die der eschatologische Impuls geriet und die Hans Urs von Balthasar veranlaßte, die Eschatologie als den „Wetterwinkel“ der Gegenwartstheologie zu bezeichnen8, erging es aber der Hoffnung nicht besser. Nachdem die Aufklärung den Glauben in Wissen aufzuheben suchte, und die Liebe, nach dem Urteil Romano Guardinis, in der frostigen Atmosphäre der Neuzeit erkaltete9, blieb die Hoffnung, wie Ingeborg Bachmann in ihrem Gedicht „Früher Mittag“ feststellt, von den göttlichen Tugenden zwar als einzige zurück, doch kauert sie „erblindet im Licht“10 und außer Stande, den dieses Licht ausstrahlenden „Stern der Müden“ wahrzunehmen. Denn der Hoffnung waren buchstäblich die Augen ausgestoßen worden, als sie im Gefolge des Säkularisierungsprozesses – der gleichzeitig die Eschatologie in ihre gegenwärtige Krise stürzte – von ihrem jenseitigen Erfüllungsziel abgekoppelt und auf innerweltlich Machbares zurückgenommen wurde, so daß nur noch auf irdische Wohlfahrt, nicht mehr jedoch auf den Anbruch des endzeitlichen Gottesreiches zu hoffen war. Da hilft es auch wenig, wenn sich das Gedicht Bachmanns in der Folge zu dem Aufruf steigert: Lös ihr die Fessel, führ sie die Halde herab, leg ihr die Hand auf das Aug, daß sie kein Schatten versengt!11 Noch einmal: Wie soll angesichts dieser ruinösen Situation noch geglaubt, geliebt und gehofft werden? Und wie können diese von der Tradition als „göttliche“ gerühmten Tugenden je noch Adressaten einer Anrufung sein? Den hilfreichen Wink gibt der letzte Appellant an den Beistand der Musen: Dante. Hatte er in seiner „Göttlichen Komödie“ zu Beginn des „Purgatorio“ den geistigen Aufschwung noch von den Musen, allen voran von Kalliope, der Muse des dichterischen Wortes, erbeten, so zu Beginn des „Paradiso“ vom göttlichen Musenführer, von Apoll. Übertragen auf die Frage nach dem, worauf sich die Anrufung angesichts des Verfalls der 8 H. U. v. Balthasar, Eschatologie, in: J. Feiner u. a. (Hgg.), Fragen der Theologie heute, Einsiedeln u. a. 1957, S. 403 – 421, S. 403. 9 R. Guardini, Das Ende der Neuzeit. Ein Versuch zur Orientierung (1950); Die Macht. Versuch einer Wegweisung, in: ders., Werke, hrsg. v. F. Henrich, Sachbereich Anthropologie und Kulturkritik, Mainz u. a. 1986, S. 9 – 94, S. 94; dazu: E. Biser, Der inwendige Lehrer. Der Weg zu Selbstfindung und Heilung (1994), Norderstedt 2002, S. 53f. 10 I. Bachmann, Früher Mittag, in: dies., Werke, hrsg. v. C. Koschel u. a., Bd. 1: Gedichte, Hörspiele, Libretti, Übersetzungen, München u. a. 4/1993, S. 44f, S. 45. 11 Ebd.
14
3. Die Invokation
göttlichen Tugenden noch richten kann, weist dieser Fingerzeig eindeutig auf den im Glauben Bejahten, in der Hoffnung Ersehnten und in der Liebe Geliebten hin: auf Jesus. Denn ihn kann man, um ein kühnes Wort Theodor Haeckers aufzunehmen, eher noch schlagen, als daß er zurückschlägt, immer noch finden, auch wenn er sich zu entziehen droht und darum auch dann noch anrufen, wenn er sich, wie in der Stunde seiner Passion, in antwortloses Schweigen zu hüllen scheint. Doch wie muß sich seine Anrufung gestalten?
3. Die Invokation Wenn der Gedankengang an dieser Stelle nicht einer trügerischen Vorwegnahme des Ergebnisses verfallen soll, ist ein Seitenblick auf die paulinische Gebetslehre erforderlich. Sie besagt, auf den Punkt gebracht: Im Gebet geht es, wie immer dies motiviert sei, stets um Gott. Und der Beter ist ebenso wie der Adressat, an den er sich wendet, in einer letzten Hinsicht gleichfalls Gott. So sieht es Paulus in dem von Johann Sebastian Bach tiefsinnig vertonten Satz des Römerbriefs (Röm 8,26f): Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sichs gebühret; sondern der Geist selbst vertritt uns aufs beste mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen forschet, der weiß was des Geistes Sinn sei, denn er vetritt die Heiligen nach dem, das Gott gefällt (BWV 226)12. So sehr Gott der Adressat der Anrufung bleibt, stellt er sich doch diesem Wort zufolge gleichzeitig in Gestalt seines Geistes – paulinisch gesehen: der pneumatischen Selbstübereignung Christi – auf die Seite des ratlosen Beters, um dessen Schwachheit durch seinen Beistand aufzuhelfen. So wird das Gebet zu einem Ereignis des Selbstverhältnisses und der Selbstverständigung Gottes – im Herzen des Beters. Damit öffnet sich die aus der Aporie herausführende Perspektive. Diese Aporie besteht darin, daß der Anzurufende keineswegs so fraglos erreichbar ist wie etwa der Chor der von Apoll angeführten Musen, die zumindest partiell das dem Anrufenden verliehene Ingenium verkörpern. Zwar lebt die Christenheit vom Bewußtsein der vielfachen – sakramentalen und spirituellen – Gegenwart ihres Stifters und Herrn. Doch diese wird von ihr immer nur als eine „angehbare“, nicht jedoch, wie es in der Intention der Anrufung liegt, auch „aufrufbare“ Gegenwart empfunden. Nun aber zeigt sich, daß diese Barriere von dem Anzurufenden selbst überwunden wird, sofern er sich in seiner spirituellen Präsenz auf die Seite des Rufenden stellt. Eben dies geschieht, wenn sich der – mit Jesus identische – Geist der Gebetsnot des Menschen annimmt und sich mit einem „Seufzen“ sogar auf dessen „Unmündigkeit“ einläßt. Denn dadurch nimmt er die Sache seiner Anrufung selbst in die Hand, um sie aus seiner absoluten Kompetenz zum Ziel zu führen.
12 Dazu: E. Biser, Der Zuspruch des Geistes, in: ders., Der Mensch im Horizont Gottes, hrsg. v. P. Jentzmik, Limburg 2007, S. 129 – 139; ferner: U. Wilckens, Der Brief an die Römer, Teilbd. 2: Röm 6-11 (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, Bd. 6/2), Zürich u. a., 3/1993, S. 160ff; S. 179f.
15
Vororientierung
Freilich ist damit auch eine Grundbedingung des gesamten Vorhabens angegeben: Es muß, um überhaupt ins Werk gesetzt werden zu können, die Bedingung einer „Invokation“, also eines Gebets, erfüllen und demgemäß im Stil einer „theologia cordis“ durchgeführt werden. Das wird dem Beter an keiner Stelle die von Hegel geforderte „Anstrengung des Begriffs“ ersparen13; doch wird er sich bei jedem Schritt bewußt bleiben müssen, daß er sich letztlich nur so auf sein Ziel zubewegen kann, wie es der johanneische Jesus mit dem Wort umschreibt: Niemand kommt zu mir, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht“ (Joh 6,44). Zweifellos würde sich die Richtigkeit dieser Annahme eindrucksvoll bestätigen, wenn sich zeigen sollte, daß große Argumentationskonzepte, wie etwa der anselmische Gottesbeweis, von ihrem Ansatz her Gebetsstruktur aufweisen. Als Kronzeuge könnte dafür der vorhin eher beiläufig erwähnte Hegel aufgerufen werden, da er mit einer sonst kaum einmal erreichten Klarheit dafür einsteht, daß allen Gottesbeweisen solange „etwas Schiefes“ anhaftet, als sie nicht im Sinne einer „Erhebung des Geistes“ geführt werden, und daß dies in erster Linie auf den – von ihm ohnehin privilegierten – anselmischen Beweisgang zutrifft14. Zur Evidenz würde diese Annahme vollends gelangen, wenn sich überdies zeigen ließe, daß die Geistesgeschichte, ungeachtet ihres zunehmend säkularistischen Erscheinungsbildes, in der Bahn des anselmischen Arguments verliefe und dadurch insgeheim als betende Anrufung des sie trotz aller Bestreitungen umkreisenden Gottes zu gelten hat. Fraglos würde diese Überlegung entscheidend an Plausibilität gewinnen, wenn sich schon im Evangelium eine Szene ausfindig machen ließe, die dem entspricht und demgemäß als dessen biblische Verifikation angesehen werden könnte: eine Szene, in der Jesus angesichts der Inkompetenz der Anrufenden auf deren Seite tritt, um, stellvertretend für sie, sich selber an- und aufzurufen. Diese Szene gibt es, so seltsam dies klingen mag, tatsächlich, auch wenn sie in der angenommenen Funktion erst deutlich gemacht werden muß. Es handelt sich um die letzte und krönende Wunderszene des Johannesevangeliums, mit welcher Jesus zugleich seine Passion heraufbeschwört: um die Auferweckung des Lazarus (Joh 11,17-46).
4. Komm heraus! Wenn die Szene im Sinn einer christologischen Anrufung zum Sprechen gebracht werden soll, muß zunächst die refrainartig wiederholte Anrede der beiden Schwestern stärker als in der üblichen Auslegung ausgeleuchtet werden. Denn in nahezu wörtlicher Wiederholung wenden sich beide an den „zu spät“ am Ort des Geschehens eingetroffenen Jesus mit den Worten: 13 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes (1807), nach dem Text der Originalausgabe hrsg. v. J. Hoffmeister, Hamburg 6/1952, S. 48. 14 Dazu: Ders., Ausführung des ontologischen Beweises in den Vorlesungen über Religionsphilosophie vom Jahre 1831, in: ders., Werke in zwanzig Bänden, auf d. Grundlage d. Werke v. 1832 – 1845 neu ed., red. v. E. Moldenhauer u. a., Bd. 17: Vorlesungen über die Philosophie der Religion II, Frankfurt a. M. 1986, S. 528 – 535.
16
4. Komm heraus!
Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben (Joh 11,21). Wenn Maria dann im Unterschied zu ihrer Schwester Marta nicht auch noch die Beteuerung hinzufügt: Aber selbst jetzt weiß ich, daß Gott dir geben wird, um was du ihn bittest (Joh 11,32), ist das im Vergleich dazu nicht, wie vielfach angenommen wird, ein Defizit, sondern eine Steigerung, weil Maria im Anschluß an ihre Frage, ebenso wie in der Folge auch Jesus selbst, in Tränen ausbricht und so in eine einzigartige emotionale Verbindung mit Jesus tritt. Ebensowenig bezieht sich die „Erregung“, in die Jesus bei ihren Worten gerät (Joh 11,32), auf den mangelnden Glauben der Umstehenden oder auf die ihm im Tod des Freundes entgegentretende Macht des Todes15, sondern auf den Übergang vom Schmerz zur rettenden Tat. Wenn es sich aber so verhält, hat Jesus die Anrede der Schwestern, die schwerlich einer Bitte gleichkam, in sich in eben diesem Sinn zu Ende gedacht. Er fühlt sich in seiner rettenden Machtvollkommenheit angerufen und zur Wundertat provoziert. Dann aber beginnt die Szene tatsächlich mit einer, wenn auch nur ihm verständlichen, Anrufung. Doch wem gilt sie? Wenn das deutlich werden soll, muß die Sache der Anrufung auf eine breitere Basis gestellt werden, wie sie Paulus schuf, als er angesichts des sich ins Überdimensionale dehnenden Missionsfeldes die geradezu selbstquälerischen Fragen stellte: Wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie glauben, wenn sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn niemand verkündet? (Röm 10,14) Kurz zuvor hatte er diese Bedenken noch mit dem Einwand unterlaufen: Sprich nicht in deinem Herzen: Wer wird in den Himmel hinaufsteigen? – nämlich um Christus herabzuholen. Oder: Wer wird in den Abgrund hinabsteigen, um Christus von den Toten heraufzuführen? Denn so sagt die Schrift: Nahe ist dir das Wort, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen (Röm 10,6ff). Zwar nimmt Paulus, wenn er, fast widerwillig, auf seine „Erscheinungen und Offenbarungen“ zu sprechen kommt und berichtet, daß er einmal „bis in den dritten Himmel“ entrückt worden sei (2Kor 12,1f), durchaus nicht für sich in Anspruch, von dort den erhöhten Christus herabgeholt zu haben; wohl aber erweckt das Johannesevangelium an einer Stelle den Anschein, daß das Umgekehrte einer Heraufführung Jesu aus dem Totenreich geschah. Das ist der Hintersinn der Szene von der Auferweckung des Lazarus, obwohl dafür nur Irritationen und Wahrscheinlichkeiten zu sprechen scheinen.
15 Dazu: J. Kremer, Lazarus – die Geschichte einer Auferstehung. Text, Wirkungsgeschichte und Botschaft von Joh 11,1-46, Stuttgart 1985.
17
Vororientierung
Dazu gehört schon das von Guardini als auffällig empfundene Schweigen des Auferweckten16. Hätte er sich nicht spätestens bei dem zu Ehren des Wundertäters veranstalteten Festmahl veranlaßt sehen müssen, sich bei seinem Retter, wie andere, denen vorher geholfen worden war, zu bedanken? Indessen ist die Erwähnung der Gastmahlsszene ohnehin sekundär. Damit verstärkt sich die Schemenhaftigkeit des Auferweckten, die schon dadurch betont war, daß er – ein „Wunder im Wunder“17 – an Händen und Füßen gebunden, aus der Grabhöhle, offensichtlich mehr noch vom Machtwort Jesu gezogen als aus eigener Initiative, hervorkommt. Entscheidend fällt aber erst die Beobachtung ins Gewicht, daß die Szene konsequent auf die Auferstehung Jesu hin stilisiert ist. Zu dieser verhält sie sich wie eine zeichenhafte Vorwegnahme, ja wie ein Versprechen zu seiner Erfüllung, um nicht zu sagen, wie die Exposition zur Durchführung. Darauf deutet schon die Beschreibung des Grabes hin (Joh 11,38), erst recht die gleichsinnige Erwähnung von Schweißtuch und Leinenbinden, insbesondere aber der die endzeitliche „Stimme des Gottessohnes“ (Joh 5,25-29) antizipierende „Befehlsruf ”: „Lazarus, komm heraus!“ (Joh 11,43), mit welchem Jesus den Toten zu neuem Leben erweckt.
5. Die Rückbezüglichkeit Daß dieser Ruf auch rückbezüglich, also im Sinn einer „Selbsterweckung“ verstanden werden kann, wird – die gnostische Vorstellung von einer Duplizierung und „Vielgestaltigkeit“ Christi zunächst noch beiseite lassend – sowohl durch biblische wie durch kunstund literarhistorische Hinweise nahegelegt. Zu jenen zählt in erster Linie der Selbsteinwand, den Jesus in der Nazaretszene des Lukasevangeliums macht, wenn er dem gegen ihn aufgebrachten Auditorium erklärt: Sicher werdet ihr mir jetzt das Sprichwort entgegenhalten: Arzt, heile dich selbst! (Lk 4,23)18 In haßverzerrter Form wird ihm dieser Einwand dann nochmals entgegenklingen, wenn ihn die höhnenden Zuschauer seiner Kreuzigung auffordern, vom Kreuz herabzusteigen, um dadurch seinen Sendungsanspruch unter Beweis zu stellen (Mk 15,32 par). Damit stilisieren sie ihn vollends zur Figur des „verwundeten Arztes“, der die von ihm behandelte Krankheit zuerst am eigenen Leib überwinden muß19. Doch können sie in ihrem Haß nicht ahnen, daß er diese „Heilung“ in Bälde aufs wunderbarste vollbringen wird: 16 R. Guardini, Der Herr. Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu Christi, 8., unveränd. Aufl., Würzburg 1951, S. 149 – 156; S. 220 – 225. 17 R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, Teil 2: Kommentar zu Kap. 5 – 12 (Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Bd. 4.2), Freiburg i. Br. 1971, S. 427f. 18 Dazu: E. Biser, Theologie als Therapie (1985), unveränd. Nachdruck, Norderstedt 2002, S. 148 – 151: Der verwundete Therapeut. 19 Dazu: S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, in: ders., Werkausgabe, aus dem Dän. übs. u. hrsg. v. E. Hirsch u. a., Bd. 2: Einübung im Christentum. Der Augenblick, Düsseldorf u. a. 1971 [im Folgenden abgekürzt: Werkausgabe Bd. 2], S. 9 – 307, S. 102; dazu: E. Biser, Gotteskindschaft. Die Erhebung zu Gott, Darmstadt 2007, S. 89.
18
5. Die Rückbezüglichkeit
im Ereignis seiner Auferstehung. Bevor das geschieht, antwortet er auf ihre Herausforderung, indem er in Gestalt des toten Freundes letztlich sich selbst zu neuem Leben ruft. Als biblischer Hinweis darf aber wohl auch die Aussage des Epheserbriefs über das Heranreifen der Glaubenden zum „Vollalter Christi“ (Eph 4,13) in Anspruch genommen werden20, da die Aussage – im Horizont der paulinischen Lehre vom mystischen Christusleib gesehen – dem Gedanken nahekommt, daß Christus in den Glaubenden zum Vollbewußtsein seiner selbst erwacht. Aus kunsthistorischer Sicht spricht dafür die nach einem Stich Rembrandts gemalte „Auferweckung des Lazarus“ von Vincent van Gogh, die sich wie eine spiegelverkehrte „Nacherzählung“ von Rembrandts „Auferstehung Christi“ ausnimmt: hier die wie unter einer geheimnisvollen Sonne aufscheinende Gestalt des Engels, der sich mit weit ausgebreiteten Flügeln über die Szene erhebt, während er mit der einen Hand die Deckplatte von dem sarkophagartigen Grab Christi emporreißt und in der anderen das Schweißtuch hält, das er vom Gesicht des – mühsam – Auferstehenden weggenommen hatte; dort unter der gleichen Sonne die Gestalt der Schwester, die mit ihren vor Entsetzen und Staunen ausgebreiteten Armen die Flügel des Engels zu imitieren scheint. Auch sie hat das Schweißtuch vom Gesicht des Toten entfernt und in freudigem Erschrecken die Zeichen des wiederkehrenden Lebens wahrgenommen. Die Gestalt Christi fehlt. Ist es ein Zufall, daß der Auferweckte nach Haltung und Physiognomie dem auferstehenden Christus auf dem Rembrandt-Gemälde gleicht? Oder wird hier das Motiv der Vorwegnahme der Auferstehung Jesu in der Erweckung des Lazarus bis an den Rand der Gleichsetzung vorangetrieben, so daß die Szene auf den – umgedeuteten – Besuch der Frauen am Grab Jesu durchsichtig wird? Dem ist als literarische Parallele noch die eigentliche Verdoppelung der Christusfigur in Hölderlins Hymne „Friedensfeier“ hinzuzufügen21. In abendlicher Stille, in der der Geist aufblüht, ruft der Dichter zum Fest, zu dem sich „liebende Gäste“ beschieden haben, versammelt um den „Fürsten des Fests“, in dem der in Christus Gestalt gewordene Friede in Erscheinung tritt. Zu ihm ruft der Dichter den Jüngling, wie er ihn von der Szene am Jakobsbrunnen her – „unter syrischer Palme“, umrauscht vom Kornfeld, das reif zur Ernte steht – kennt22. Das aber ist eindeutig der Fall einer Anrufung Jesu, jedoch im Sinn einer Einladung zu sich selbst, also einer Hinführung des historischen Jesus zur Hoheitsgestalt seiner Verherrlichung und „Idealisierung“, insbesondere zur Gestalt des von ihm gegebenen (Joh 14,27) und mit ihm identischen (Eph 2,14) Friedens. Der besondere Wert dieses literarischen Belegs liegt in der nunmehr möglichen Rückkoppelung des Gesagten mit dem Anliegen der Anrufung. Was, wenn auch nur umrißhaft, deutlich wurde, war die Vorstellung einer Evokation Jesu zu sich selbst. Im Hintersinn der Lazarusepisode wurde der Befehl Jesu als Aufruf an sich zum Ziel der Erweckung zu seinem definitiven Leben hörbar. Nun aber zeigt sich, daß diese Selbstbegegnung auf den Vorgang seiner Anrufung zurückweist und an ihn anknüpft. Insofern macht sich der Dichter das Interesse aller zueigen, wenn er den „Jüngling“ des Evangeliums zum Fest des „Fürsten“ einlädt. In diesem Sinn begann Hölderlin einen Entwurf zu seiner Friedenshymne mit der Strophe:
20 Dazu: R. Schnackenburg, Der Brief an die Epheser (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, Bd. 10), Zürich u. a. 1982, S. 187ff. 21 F. Hölderlin, Friedensfeier, in: ders., Sämtliche Werke (Große Stuttgarter Ausgabe), hrsg. v. F. Beißner, Bd. 3, Stuttgart 1957, S. 531 – 538. 22 A.a.O., V. 43ff, S. 534.
19
Vororientierung
Versöhnender der du nimmergeglaubt Nun da bist, Freundesgestalt mir Annimmst Unsterblicher, aber wohl Erkenn ich das Hohe, Das mir die Knie beugt, Und fast wie ein Blinder muß ich Dich, himmlischer fragen wozu du mir, Woher du seiest, seeliger Friede!23 Eindringlicher kann nicht mehr umschrieben werden, warum jeder Vertiefung in die geistige und zumal in die religiöse Situation der Zeit, analog zur Anrufung der Musen, eine Anrufung Jesu vorangehen muß.
6. Lasst ihn gehen! Wie er bei der Erweckung der Tochter des Jairus anordnet, „dem Mädchen etwas zu essen zu geben“ (Mk 5,43), so kümmert sich Jesus auch in der Lazarusszene um das Schicksal des Herausgerufenen, indem er befiehlt: Bindet ihn los und laßt ihn gehen! (Joh 11,44) In der kirchlichen Tradition wurde dieser Befehl durchweg metaphorisch, meist – wie bei Hieronymus – auf die „Fesseln der Sünde“, gelegentlich auch – wie bei Origenes – auf die nach 2Kor 3,16ff vom Gesicht des Glaubenden weggefallene Hülle bezogen. Was aber besagt dieser Befehl, wenn er unter Voraussetzung des „Hintersinns“ auf Jesus bezogen wird? Eine erstaunliche Antwort darauf gibt Albert Schweitzer mit der Schlußbetrachtung seiner „Geschichte der Leben-Jesu-Forschung“ in der neu bearbeiteten Auflage von 1913, in der er das Ergebnis seines gewaltigen Unternehmens zusammenfaßt: Es ist der Leben-Jesu-Forschung merkwürdig ergangen. Sie zog aus, um den historischen Jesus zu finden, und meinte, sie könnte ihn dann, wie er ist, als Lehrer und Heiland in unsere Zeit hineinstellen. Sie löste die Bande, mit denen er seit Jahrhunderten an den Felsen der Kirchenlehre gefesselt war, und freute sich, als wieder Leben und Bewegung in die Gestalt kam und sie den historischen Menschen Jesus auf sich zukommen sah. Aber er blieb nicht stehen, sondern ging an unserer Zeit vorüber und kehrte in die seinige zurück24. Im Anschluß daran gibt Schweitzer auch zu verstehen, warum die von diesem Zurückweichen Jesu ebenso befreite wie erschreckte Theologie Jesus mit allen Künsten und Gewaltmitteln nicht in der Gegenwart festzuhalten vermochte, sondern ziehen lassen mu23 Ders., Versöhnender der du nimmergeglaubt. Erste Fassung, V. 1 – 8, a.a.O., Bd. 2, Stuttgart 1951, S. 130 – 132, S. 130. 24 A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Bd. 2, München u. a. 1966 (Lizenzausgabe), S. 620.
20
7. Die präsentische Heilserfahrung
ßte. Es war einerseits die Eigengesetzlichkeit des Vorgangs, die das „befreite Pendel“ in seine ursprüngliche Lage zurückschwingen ließ. Andererseits aber war es vor allem die Folge der auf Jesus angesetzten Methode, also der historischen Kritik. Ihr wirft Schweitzer vor, das ihr eingeschriebene Ziel nicht erreicht und dadurch das historische Fundament, auf welchem Jesus tatsächlich stehe, verfehlt zu haben. Denn dazu gehöre nun einmal die Gewalt, mit der sich der historische Jesus in seinen „Imperatorenworten“ zur Geltung brachte, aber auch das „Eschatologische in seinen Gedanken“, das seine unvergleichliche Größe ausmache. Das eine aber habe sie durch die Egalisierung seiner Sprache eingeebnet; das andere sei bei ihr zu kurz gekommen, weil sie aus ihrer Denkwelt keinen Zugang gefunden, deutlicher noch: weil sie trotz der auf eine Endzeitsituation hindeutenden Zeichen der Zeit nicht an ein von Gott zu erwartendes Zeitenende geglaubt habe25. Im Namen Jesu, wie er ihn sah, bricht Schweitzer damit den Stab über die humanistischliberal bestimmte Theologie seiner Zeit, gleichzeitig aber auch über die Gegenwartstheologie, soweit sich diese dem Instrumentarium der historisch-kritischen Methode verschreibt. Seine Zustimmung findet sie nur, sofern es ihr gelang, die Gestalt Jesu von den Banden zu befreien, mit denen er „seit Jahrhunderten an den Felsen der Kirchenlehre gefesselt war“. Unwillkürlich stimmt er sich damit auf den Befehl des Erweckers in der Lazarusszene ein, der nunmehr in den Satz gefaßt werden könnte: Bindet mich los und laßt mich gehen! Doch in dieser Fassung bezieht sich der Befehl nicht nur auf die von Schweitzer angesprochene Fesselung Jesu an den „Felsen der Kirchenlehre“, sondern zweifellos auch auf die nicht minder harten Zwänge der historisch-kritischen Methode. Daß diese ihn zu ihrer schmerzlichen Überraschung „nicht festhalten“, sondern in seine Vorzeit „ziehen lassen“ mußte, entsprach nämlich ihrem spezifischen Geschichtsverständnis, das als historisch gewiß nur gelten ließ, was sich als glaubhaft bezeugtes Faktum in dessen eindeutig umschriebenem Gewesensein festmachen ließ. Unter völlig neuen Perspektiven, wie sie durch Ernst Käsemanns Kritik an Rudolf Bultmann eröffnet worden waren, vertiefte das Karl Barth durch seine ironische Bemerkung, daß sich maßgebende Neutestamentler zu seiner „nicht geringen Verblüffung aufs neue, mit Schwertern und Stangen bewehrt, auf die Suche nach dem ‚historischen Jesus‘ begeben haben“, woran er sich selbst jedoch „lieber nicht beteiligen möchte“26. Was die von Schweitzer kritisierte Forschung an dem in seine Zeit zurückgetretenen Jesus wahrnahm, widerstrebte jedoch überdies ihrer vom Geist des aufgeklärten Humanismus geprägten Denkweise. Weder durch seinen gebieterischen Einsatz für das Gottesreich und die „Imperatorenworte“, mit denen Jesus diesem Bahn brach, noch für die Naherwartung, die seine Botschaft bestimmte, hatte sie ein Organ. So wuchs die Entfremdung, in die sie ihn zunächst nur methodologisch abgedrängt hatte. Aber darf es dabei bleiben?
7. Die präsentische Heilserfahrung Bei diesem „Rückzug“ Jesu in seine Vorzeit darf es – auch nach Schweitzers Meinung – so wenig bleiben wie bei der nicht minder bedrohlichen Möglichkeit, daß er „an unserer Zeit“ vorbeigeht. Das eine könnte seiner Meinung nach durch den konsequenten Abbau 25 A.a.O., S. 622. 26 K. Barth, How my mind has changed, in: Evangelische Theologie 20 (1960) 3, S. 97 – 106, S. 104.
21
Vororientierung
des Jesusbildes verhindert werden, das sich die liberale Theologie zurechtgelegt hatte, das andere durch die Einsicht, daß Jesus der Gegenwart Entscheidendes zu sagen, ja gerade in ihr, wie Schweitzer abschließend betont, seine Aufgaben zu lösen habe: Als ein Unbekannter und Namenloser kommt er zu uns, wie er am Gestade des Sees an jene Männer, die nicht wußten, wer er war, herantrat. Er sagt dasselbe Wort: Du aber folge mir nach! und stellt uns vor die Aufgabe, die er in unserer Zeit lösen muß. Er gebietet. Und denjenigen, welche ihm gehorchen, Weisen und Unweisen, wird er sich offenbaren in dem, was sie in seiner Gemeinschaft an Frieden, Wirken, Kämpfen und Leiden erleben dürfen, und als ein unaussprechliches Geheimnis werden sie erfahren, wer er ist …27. Daß der Versuch, Jesus in seiner ebenso faszinierenden wie schockierenden Aktualität zur Geltung zu bringen, in Kämpfe verstrickt, in Mitleidenschaft mit ihm zieht und zu einem nie gefühlten Frieden in ihm verhilft, ist nach Schweitzers Hinweisen begreiflich. Aufhorchen läßt aber seine Ankündigung, daß ihn diese Kampf- und Leidensgemeinschaft mit ihm zu einer neuen Erschließung des Geheimnisses führt und daß ihm dafür nicht einmal die Vokabel „offenbaren“ zu hoch gegriffen ist. Denn damit spricht Schweitzer der Gegenwart, die er illusionslos als eine Zeit des auf allen Gebieten bemerkbaren kulturellen „Stillstands“ kennzeichnet, zugleich eine einzigartige Affinität zu den Intentionen Jesu zu, sofern sie durch ihre geistige Armut dazu gedrängt werde, ihre Hoffnungen in Formeln zu bekunden, die als Äquivalente des Wollens und Hoffens Jesu, zumal aber seines „Begriffs des Reiches Gottes“ gelten können. Wenn Schweitzer auch auf die in diesem Zusammenhang zu gewärtigende Initiative Jesu – das Leitmotiv des vorliegenden Gedankengangs – nicht eingeht, bestimmt er doch auf eine hochaktuelle Weise das Verhältnis, das zu Jesus aufgenommen werden müsse. Als hätte er bereits die Prognose Karl Rahners im Ohr, wonach der Christ der Zukunft „ein Mystiker sei oder nicht mehr sei“28, versichert er: Im letzten Grunde ist unser Verhältnis zu Jesus mystischer Art. Keine Persönlichkeit der Vergangenheit kann durch geschicht-liche Betrachtung oder durch Erwägungen über ihre autoritative Bedeutung lebendig in die Gegenwart hineingestellt werden. Eine Beziehung zu ihr gewinnen wir erst, wenn wir in der Erkenntnis eines gemeinsamen Wollens mit ihr zusammengeführt werden, eine Klärung, Bereicherung und Belebung unseres Willens in dem ihrigen erfahren und uns selbst in ihr wiederfinden. In diesem Sinne ist überhaupt jedes tiefere Verhältnis zwischen Menschen mystischer Art. Unsere Religion, insoweit sie sich als spezifisch christlich erweist, ist also nicht so sehr Jesuskult als Jesusmystik29.
27 A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Bd. 2, a.a.O., S. 630. 28 K. Rahner, Zur Theologie und Spiritualität der Pfarrseelsorge, in: ders., Schriften zur Theologie, Bd. 14, Zürich 1980, S. 148 – 165, S. 161. 29 A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Bd. 2, a.a.O., S. 630.
22
7. Die präsentische Heilserfahrung
Mit diesem Wort greift Schweitzer über die gesamte auf ihn folgende Entwicklung, die, vereinfachend gesprochen, durch die dialektische Theologie Barths, durch die Entmythologisierung Bultmanns, durch die Hermeneutik im Gefolge Friedrich Schleiermachers und Hans-Georg Gadamers und durch die politische Theologie von Jürgen Moltmann und Johann Baptist Metz bis hin zur lateinamerikanischen Befreiungstheologie gekennzeichnet ist, bis auf die Gegenwart vor. Denn sie hat sich, nicht zuletzt durch das Traumverständnis Eugen Drewermanns30, zu der Einsicht erhoben, daß die Sache Jesu nur im Präsens verhandelt werden kann. Drewermann ist seinen Kritikern bei allem, was sie gegen ihn einwenden, in der Erkenntnis voraus, daß die religiöse Krise nur durch eine aktuelle Aneignung des Heils überwunden werden kann31. In der Frage nach dem konkreten Vollzug dieser Aneignung ist Schweitzer allerdings auch Drewermann durch die Erkenntnis überlegen, daß der von Jesus gestifteten Glaubensform nicht schon durch einen „Jesuskult“ – und erst recht nicht durch eine Jesussymbolik –, sondern nur durch eine „Jesusmystik“ Genüge geschieht. Und er überbietet selbst diesen Begriff noch durch den Hinweis, daß diese Jesusmystik in einer „Klärung, Bereicherung und Belebung unseres Willens“ in dem seinigen bestehe und schließlich dazu führe, daß wir uns selbst in Jesus wiederfinden. Damit tritt die bereits umschriebene Grundbedingung des Vorhabens in ein noch helleres Licht. Was bisher nur formal als eine betende Annäherung an das Ziel bestimmt wurde, das sich mit zunehmender Deutlichkeit als eine zum rettenden Prinzip durchstoßende Zeitdiagnose erwies, kann nunmehr inhaltlich beschrieben werden. Letzte Absicht des Vorhabens muß die Erweckung einer Jesusmystik sein, die der Forderung nach einer präsentischen Heilserfahrung gerecht wird. Das aber heißt zugleich, daß, zumindest prinzipiell, ein zu allen bisherigen Verfahren entgegengesetzter Weg eingeschlagen werden soll. In immer neuen Anläufen wurde der Versuch unternommen, die Entwicklung des Christenglaubens nachzuzeichnen, seine Stationen und Umbrüche zu beschreiben und die wechselnden Jesusbilder, wie sie der sich ständig wandelnde Glaube zeitigte, aufzurufen. Hier geht es stattdessen umgekehrt darum, die von Jesus ausgehenden Impulse, Gewährungen und Denkanstöße, Orientierungs- und Entscheidungshilfen aufzuweisen, auch wenn diese vordergründig als theologische Entwürfe und Direktiven in Erscheinung treten. Hat das gewohnte Verfahren die Struktur einer Christologie, so kann man das hier Vorgeschlagene und ins Werk Gesetzte mit einem altchristlichen Begriff als „Christomathie“ bezeichnen. Was ist damit gemeint?
30 Dazu: G. Lüdemann, Texte und Träume. Ein Gang durch das Markusevangelium in Auseinandersetzung mit Eugen Drewermann, Göttingen 1992, S. 9 – 47: Hinführung zu Drewermann oder: Träume – die vergessene Sprache Gottes?; ferner: U. H. J. Körtner, Theologie des Wortes Gottes. Positionen – Probleme – Perspektiven, Göttingen 2001, S. 131 – 135: Träume – Gottes vergessene Sprache?. 31 Dazu: E. Biser, Der inwendige Lehrer, a.a.O., S. 39; S. 77f.
23
Vororientierung
8. Das Zugesprochensein Der Begriff „Christomathie“ stammt von Ignatius von Antiochien, der auf seinem Todesweg nach Rom der Gemeinde von Philadelphia schrieb: Ich vertraue der Gnade Jesu Christi, der jede Fessel von euch nehmen wird. Ich ermahne euch, nichts aus Streitsucht zu tun, sondern gemäß der Lehre Christi [christomathia]32. Zur näheren Bestimmung dieser „Christomathie“ gibt der Fortgang des Briefs einen bemerkenswerten Aufschluß: Da hörte ich einige sagen: Wenn ich etwas nicht in den Urkunden, im Evangelium finde, glaube ich nicht; und als ich ihnen erwiderte, dass es geschrieben steht, gaben sie mir zur Antwort: dies steht ja in Frage. Mir aber ist Urkunde Jesus Christus; mir sind die unversehrten Urkunden sein Kreuz, sein Tod, seine Auferstehung und der durch ihn begründete Glaube; in diesen will ich durch euer Gebet gerechtfertigt werden33. Dem fügt Ignatius hinzu: Die Priester waren eine gute Einrichtung, doch besser ist der Hohepriester Jesus Christus, der in das Innerste des himmlischen Heiligtums eintreten darf. Ihm allein sind Gottes Geheimnisse anvertraut. Er ist die Tür zum Vater34. In dieser Zusatzaussage kommt, hochaktuell, das Medienproblem ins Spiel. Die Kontrahenten insistieren auf einer vom Bibeltext gebotenen Belegstelle, während Ignatius selbst auf den zurückgreift, der in den Texten gemeint ist und in ihnen „zu Wort kommt“. Was aber die Entstehung der Texte anlangt, so scheint er die Meinung des Papias von Hierapolis zu teilen, für den die aus Büchern geschöpften Berichte niemals denselben Wert haben konnten wie das lebendige mündliche Zeugnis35. Danach ist mit dem Begriff „Christomathie“ eine „Lehre“ angesprochen, die zu ihrer Herkunft noch so sehr offensteht, daß in ihr ein Nachklang der Stimme ihres Urhebers hörbar ist, eine Lehre also, die man sich in diesem Sinn „gesagt sein lassen“ muß. Schon auf Grund dieser wenigen Hinweise ist ein von dem gewohnten deutlich verschiedenes Rezeptionsverhalten gefordert. Während beim Textverstehen der optische 32 Ignatius von Antiochien, An die Philadelphier 8,1f, a.a.O. (BKV, 1. Reihe, Bd. 35), S. 142 – 146, S. 145; ferner: K. Berger u. C. Nord, Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, a.a.O., S. 801 – 805, S. 803f. 33 Ebd.; dazu: E. Biser, Eine Christus-Hermeneutik, in: ders., Die Entdeckung des Christentums. Der alte Glaube und das neue Jahrtausend, Freiburg i. Br. u. a. 2/2201, S. 105 – 119. 34 Ignatius von Antiochien, An die Philadelphier 9,1, in: K. Berger u. C. Nord, Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, a.a.O., S. 804. 35 Nach Eusebius v. Caesarea, Kirchengeschichte, aus dem Griech. übs. v. Ph. Haeuser, III 39, in: ders., Ausgewählte Schriften (BKV, 2. Reihe, Bd. 1, II), München 1932, S. 150 – 154, S. 151.
24
8. Das Zugesprochensein
Eindruck dominiert, ist hier in erster Linie eine hörende, also auf das akustische Moment achtende Einstellung vonnöten. Dabei bezieht sich diese nicht etwa auf den rezipierten Wortlaut, sondern auf den vom Ursprung der Mitteilung her erklingenden und selbst bei völlig stillem Verhalten hörbaren „Unterton“. Denn hier gilt in gesteigerter Form, was eine Nachlaßnotiz Nietzsches als den innersten „Anlaß“ des Verstehens ausmacht: Das Verständlichste an der Sprache ist nicht das Wort selber, sondern Ton, Stärke, Modulation, Tempo, mit denen eine Reihe von Worten gesprochen werden – kurz die Musik hinter den Worten, die Leidenschaft hinter dieser Musik, die Person hinter dieser Leidenschaft: alles das also, was nicht g e s c h r i e b e n werden kann36. Von daher gewinnt dann auch der Begriff „Lehre“ einen von dem üblichen deutlich unterschiedenen Sinn, den man genauer als „prozessual“ bezeichnen könnte. Noch am besten ließe sich das mit „Belehrung“ wiedergeben. Was mit der Christomathie zur Rede steht, ist somit keine festumschriebene Doktrin, die in einer Summe von Sätzen zusammengefaßt werden könnte, sondern ein Vorgang, bei dem der, den Ignatius die Urkunde des Glaubens, den Hohepriester des Allerheiligsten und die Tür zum Vater nennt, das Denken des von ihm Belehrten inspiriert und leitet. Damit ist keineswegs verneint, daß sich die Aneignung auch dieser Lehre – wie jeder anderen – in Sätze verfaßt und satzhaft wiedergegeben werden kann. Insofern nimmt die Christomathie rückläufig immer wieder christologisches Gepräge an, ganz abgesehen davon, daß sie nur in dieser Form mit der Christologie in ein Wechselverhältnis zu treten vermag. Doch geht es dabei nicht darum, die christologischen Positionen zu korrigieren oder zu ergänzen, sondern um den Versuch, sie im Gegensinn zu ihrer „Diktion“ lesbar zu machen. Diese Positionen haben von ihrer Entstehung her den Charakter von Entwürfen, die durch Argumentationsketten strukturiert und systemhaft aufgebaut sind. In der Korrepondenz mit der Christomathie gewinnen sie jedoch die Form von Zusagen. Jetzt dominiert in ihnen weniger das spekulative als vielmehr das rezeptiv-dialogische Moment. Denn die Christomathie lebt in gegenstandstheoretischer Hinsicht von der Einsicht, daß der Gegenstand der Theologie nicht im Modus des Vorhandenseins, sondern in dem des Zugesprochenseins gegeben ist. Doch damit ist der Gesichtskreis der Anrufung bereits auf den der Zugangs- und Prinzipienfrage hin überschritten. Davon ist eine erste Konkretisierung dessen zu erwarten, was bisher nur in präludierender Rede angesprochen werden konnte.
36 F. Nietzsche, Nachgelassenes Fragment (Sommer – Herbst 1882), 3 [1] 296, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, hrsg. v. G. Colli u. a., München u. a. 1980 [im Folgenden abgekürzt: KSA], Bd. 10, S. 89.
25
Zweites Kapitel
Der Zugang 1. Die Provokation
D
ie Frage des Zugangs führt über feste Positionen und kritische Analysen hinein in die Dynamik dessen, was das Wort verspricht: die Öffnung der Tür zu dem, was bisher verschlossen war. Vor allem anderen muß sich jedoch zeigen, was dazu drängt, den Zugang zu einer präsentischen Heilserfahrung zu suchen. So stellt sich das Problem der Anrufung hier nochmals, jedoch in nahezu dramatisch gesteigerter Form. Schon das läßt erwarten, daß darauf nur in wiederholten Anläufen Auskunft gegeben werden kann. Der Blick ins Zeitgeschehen, um den es der Eingangsbemerkung zufolge zu tun ist, bleibt unwillkürlich an dem epochalen Umbruch haften, auch wenn sich der davon verbliebene Eindruck schon wieder im Gestrüpp der Tagesprobleme und Tagesmiseren zu verflüchtigen droht. Wer vergegenwärtigt sich noch, daß im Spätherbst 1989 vorwiegend junge Menschen mit dem Ruf „Freiheit“ oder „Jesus“ auf den Lippen einen höchst gefährlichen Weg in den „freien Westen“ suchten und damit erheblich zur Auslösung der großen Wende beitrugen? Wer ist sich noch bewußt, was der Fall des Eisernen Vorhangs für Millionen von Menschen an Entlastung und Hoffnung bedeutete, daß sich kaum gewagte Träume zu verwirklichen schienen, ja daß der nach den beiden Weltkriegen so glühend ersehnte Weltfriede – bis zur jähen Zerstörung dieser Hoffnung durch den verhängnisvollen Falkland-Krieg – in greifbare Nähe gerückt war? Die Freiheit – verheißungsvoll wie nie zuvor: der Friede – auf Hautnähe herangerückt: Das zog eine Umordnung des Ideenhimmels nach sich, die diesen beiden eine Spitzenposition einbrachte. Und der Vorrangstellung entsprach ein qualitativer Zuwachs. Denn beide, Freiheit und Friede, hatten die Grenze der bloßen Idealität überschritten und sich auf eine geradezu antlitzhaft personale Weise zur Geltung gebracht. Was die Freiheit betrifft, so war sie für sensible Zeitzeugen wie Martin Buber freilich längst schon als eine für sich selbst einstehende und zu sich „provozierende“ Geistesmacht fühlbar geworden37. Mit allen Zeichen der Ergriffenheit erklärt Buber deshalb in seiner „Rede über das Erzieherische“: Freiheit oder, wie ihr rechtmäßiger altdeutscher Name ist: Freihals – ich liebe ihr aufblitzendes Gesicht: es blitzt aus dem Dunkel auf und verlischt, aber es hat dein Herz gefeit. Ich bin ihr zugetan, ich bin allzeit bereit, um sie mitzukämpfen. Um die Erscheinung des Blitzes, nicht länger während, als das Auge ihr standzuhalten vermag. Um das Vibrieren des Züngleins, das zu lang niedergezogen und starr war. Ich gebe meine linke Hand dem Aufrührer und meine rechte dem Ketzer: voran! Aber ich vertraue ihnen nicht. Sie verstehen zu sterben, aber 37 Dazu: E. Biser, Provokationen der Freiheit. Antriebe und Ziele des emanzipierten Bewußtseins, München u. a. 1974, S. 17 – 21.
26
1. Die Provokation
das ist nicht genug. Ich liebe die Freiheit, aber ich glaube nicht an sie. Wie könnte man an sie glauben, wenn man ihr ins Gesicht gesehen hat! Es ist der Blitz der Alldeutigkeit – der Allmöglichkeit. Um die kämpfen wir, immer wieder, von je her, siegreich und vergebens38. Mit diesem Wort vollzieht Buber einen grundsätzlichen Stilbruch in der Frage des Umgangs mit der Freiheit, denn er macht deutlich, daß sie nicht nur erkämpft, erlitten und reflektiert, sondern nicht zuletzt auch in ihrer provokatorischen Selbsterkundung vernommen sein will. Darin trat ihm Jahrzehnte später und von ganz anderen Voraussetzungen her der kämpferisch gestimmte Ernst Käsemann an die Seite. Nach dem Freiheitsentzug unter den faschistischen Diktaturen vernahm Käsemann sogar ausdrücklich den „Ruf der Freiheit“, den er in seiner titelgleichen Schrift auf „Jesu Inspiration“ zurückführte und deshalb überall dort zu vernehmen glaubte, wo diese die lehrhaften Festschreibungen und institutionellen Strukturen durchbricht. Das spitzte sich für ihn letztlich in der Frage zu, ob Jesus „liberal“ war. Seine Antwort: Liberal war er anders als alle andern […]. Er war einzigartig darin, daß er in der Freiheit der Gotteskindschaft stand, lebte und starb, handelte und sprach. Die Freiheit der versöhnten, aus der Verlorenheit zurückgerufenen Gotteskinder ist seine Offenbarung, seine Herrlichkeit, Gabe und Forderung. Seit ihm und durch ihn ist diese Freiheit der Gotteskinder die wahre Signatur des Evangeliums und das ausschlaggebende Kriterium für alles, was sich christlich nennt, insofern natürlich auch für das Unchristliche, das sich kirchlich, konfessionell, religiös und theologisch tarnt39. Vermutlich wird hier sogar das Motiv dieses neuen Umgangs erkennbar. Die Freiheit gehört, wie sich nunmehr zeigt, nicht nur zu den großen Errungenschaften und idealen Zielsetzungen des Menschengeistes, sondern zuvor noch zu den entscheidenden Vergünstigungen und Vorgegebenheiten, aus denen dieser lebt. Das ordnet sie ebenso dem Frieden wie der Hoffnung und der Weisheit zu, die mit ihr zusammen die Spitzengruppe des Ideenkosmos bilden, deren Zusammengehörigkeit nicht zuletzt dadurch erwiesen wird, daß sie – und nur sie – von der neutestamentlichen Botschaft mit Jesus identifiziert werden. Erst recht trifft das auf den Frieden zu, der längst schon in dieser provokatorischen Tendenz erkannt wurde, im Grunde schon von Nikolaus von Kues, der unter dem Eindruck der Eroberung Konstantinopels durch die Truppen des osmanischen Sultans Mehmed II. (1453) seine Friedensschrift „De pace fidei“ verfaßte und darin das fleischgewordene Wort Gottes – selbst angesichts der gefesselten und in Gefangenschaft verschleppten oder ermordeten Menschen – für eine Zurückführung der religiösen Spaltungen und Differenzen „auf eine einzige Religion“ plädieren ließ40. Wort38 M. Buber, Rede über das Erzieherische (1925), in: ders., Werke, Bd. 1: Schriften zur Philosophie, München u. a. 1962, S. 787 – 808, S. 796. 39 E. Käsemann, War Jesus liberal?, in: ders., Der Ruf der Freiheit, 3., unveränd. Aufl., Tübingen 1968, S. 19 – 53, S. 52f. 40 Nikolaus von Kues, De pace fidei – Der Friede im Glauben, in: ders., Philosophisch-theologische Schriften, Studien- u. Jubiläumsausgabe lat.-dt., hrsg. v. L. Gabriel, übs. v. D. u. W. Dupré, Bd. 3, Wien 1967, S. 705 – 797, S. 710.
27
Der Zugang
gewaltig schlossen sich dem die „Friedensklagen“ der Humanisten und Spiritualisten der Reformationszeit an, an ihrer Spitze Erasmus von Rotterdam mit seiner „Querela pacis“, die in dem Aufschrei gipfelt: O ihr Herzen, seid ihr härter als Diamant, in so vielen Dingen gibt es Gemeinschaft und im Leben so eine unerklärliche Uneinigkeit? Für alle gilt das gleiche Gesetz der Geburt, die gleiche Unabänderlichkeit des Alterns und des Sterbens. Denselben Herrn haben alle Völker, denselben Gründer der Religion, mit demselben Blut sind alle erlöst, in die gleichen sakralen Geheimnisse sind alle eingeweiht, mit den gleichen Sakramenten gespeist, jede einzelne Gabe, die daraus kommt, entspringt derselben Quelle, und ist gleichermaßen allen gemeinsam. Alle bilden eine große Gemeinde, die Kirche des Herrn, und schließlich haben alle die gleiche Gunst. Jenes himmlische Jerusalem, nach dem die Christen sich aufrichtig sehnen, hat ja seinen Namen nach der Vision des Friedens, dessen Nachbild inzwischen die Kirche darstellt. Wie ist es möglich, daß diese so sehr von ihrem Vorbild abweicht? Erreichte die an Mitteln so erfindungsreiche Natur so lange nichts, richtete selbst Christus mit so vielen Lehren, Mysterien und Symbolen nichts aus?41 Gleiches gilt von der „erblindeten“, gegenüber ihrem endzeitlichen Erfüllungsziel abgeblendeten Hoffnung, die sich heute, nachdem das Traumbild der marxistischen Sozialutopie zerstob42, erstmals wieder zu ihrer ursprünglichen Zielsetzung erheben kann. Auch dem hatten Charles Péguy und Gabriel Marcel lange zuvor schon Bahn gebrochen: Péguy durch sein von leidvoller Erfahrung eingegebenes Plädoyer für das unscheinbare kleine Mädchen „Hoffnung“, die kindliche unter ihren Schwestern Glaube und Liebe, die er gleichwohl die „Prinzessin der göttlichen Tugenden“ nennt43, weil sie sich als die direkteste „Agentin“ Gottes dem Sog des Alterns und der Todverfallenheit widersetzt und sich so als das Gegenprinzip zu Zeit und Vergänglichkeit erweist; Marcel, indem er in seiner „Homo viator“ betitelten Philosophie der Hoffnung44 dem cartesianischen Zweifel das christliche „Ich hoffe“ entgegensetzt und diese Überschreitung der „Vorstellungen und Formeln“ in die Gewißheit ausmünden läßt: Ich hoffe auf dich für uns45.
41 Erasmus von Rotterdam, Die Klage des Friedens [Querela pacis (1517)], aus d. Lat. übs. u. hrsg. v. B. Hannemann, München u. a.1985, S. 68f. 42 Dazu: J. Fest, Der zerstörte Traum. Vom Ende des utopischen Zeitalters, Berlin 1991. 43 Ch. Péguy, Hölle und Hoffnung (Note sur Descartes, 96 – 122), in: ders., Wir stehen alle an der Front. Eine Prosa-Auswahl von Hans Urs von Balthasar, aus d. Franz. übs. u. hrsg. v. H. U. v. Balthasar, Einsiedeln 1953, S. 54 – 57, S. 57. 44 G. Marcel, Homo viator. Philosophie der Hoffnung (Homo viator. Prolégomènes a une métaphysique de l’espérance, 1944), aus dem Franz. übs. v. W. Rüttenauer, Düsseldorf 1949. 45 Ders., Entwurf einer Phänomenologie und einer Metaphysik der Hoffnung, in: ders., Werkauswahl, hrsg. v. P. Grotzer u. a., Bd. 1: Hoffnung in einer zerbrochenen Welt? Vorlesungen und Aufsätze, Paderborn u. a. 1992, S. 118 – 154, S. 147.
28
1. Die Provokation
Daß es auch der Weisheit gegeben ist, für sich einzustehen und zu sich einzuladen, spricht schon aus ihrer alttestamentlichen Bezeugung. Nicht nur, daß sie auf den Straßen und Plätzen ihre Stimme erhebt (Spr 1,20f), um die Bedürftigen zu ihrem Mahl einzuladen; vielmehr kommt sie ihren Liebhabern wie eine Mutter entgegen, um sie bei sich aufzunehmen (Sir 15,2) und sie Leben und göttliches Wohlgefallen finden zu lassen (Spr 8,35). Erst recht aber gewinnt sie in dem Antlitz und Stimme, der als ihre leibhaftige Vergegenwärtigung in dieser Welt der Torheit und des Wahns mit dem Ruf: „Kommet her zu mir!“, zur Lebensgemeinschaft mit sich einlädt46. Selbst im Dunkel der Kreuzestorheit hatte Paulus in ihm den Inbegriff der Gottesweisheit entdeckt (1Kor 1,30)47. Unter dem Einfluß der griechischen Philosophie, der sich Paulus doch mit aller Entschiedenheit widersetzt hatte, reflektiert die Folgezeit die Botschaft Jesu freilich fast ausschließlich im Horizont eines mit der Summe der Denkbarkeiten gleichgesetzten Wahrheitsbegriffs. Eine neue Situation entstand erst, nachdem Nietzsche nach dem „Schwamm“ Ausschau hielt, der den Horizont des unüberdenklich Größten auslöschte und den Blick in das „Jenseits“ von Gott freigab: In der Tat, wir Philosophen und „freien Geister“ fühlen uns bei der Nachricht, daß der „alte Gott tot“ ist, wie von einer neuen Morgenröte angestrahlt; unser Herz strömt dabei über von Dankbarkeit, Erstaunen, Ahnung, Erwartung, – endlich erscheint uns der Horizont wieder frei, gesetzt selbst, daß er nicht hell ist, endlich dürfen unsre Schiffe wieder auslaufen, auf jede Gefahr hin auslaufen, jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder erlaubt, das Meer, u n s e r Meer liegt wieder offen da, vielleicht gab es noch niemals ein so „offenes Meer“48. Doch dieses Hochgefühl hielt nicht stand. Denn auf diesem Meer verlor sich, wie sich in der Folge nur allzu rasch zeigte, nicht nur alles, woran man sich „halten konnte“; vielmehr führte die gewagte Argonautenfahrt49, zu der der Weg nun offenstand, in den Verlust jeder, auch der letzten Gewißheit. Denn mit dem Entschluß zur Ausfahrt brachen die Argonauten nicht nur die Brücke, sondern „das Land“ hinter sich ab. Das bringt Nietzsche, mit Hans Blumenberg gesprochen, in die Situation des „Schiffbruchs mit Zuschauern“50, dem als letzte Genugtuung, wie er später sagen wird, nur noch das „Vergnügen“ bleibt, sich neugierig „die Seele bei lebendigem Leibe“ aufzuschlitzen51, also Zuschauer seines eigenen Untergangs zu sein. Indessen war das angesteuerte Meer auch in dem Sinn „offen“, daß die vordem niedergehaltenen Vorgegebenheiten denkbar wurden und der Sinn für die primordialen Vergünstigungen neu erwachte. Schien vordem für Marcel alles auf den „Untergang der Weisheit“ hinzudeuten, so schlug jetzt die Stunde ihrer Wiederkehr, nicht nur in Form der Aufwertung, die Wladimir Solowjews Weisheitsspekulation erfuhr52, sondern auch 46 S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, in: ders., Werkausgabe Bd. 2, S. 17. 47 Dazu: L. Schenke, Die Urgemeinde. Geschichtliche und theologische Entwicklung, Stuttgart u. a. 1990, S. 148 – 156: „Jesus Sophia“. 48 F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft V, § 343, in: ders., KSA, Bd. 3, S. 573f, S. 574. 49 Ders., Die fröhliche Wissenschaft V, § 382, in: ders., KSA, Bd. 3, S. 635 – 637. 50 H. Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher, Frankfurt a. M. 1979. 51 F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral III, § 9, in: ders., KSA 5, S. 356 – 359, S. 357. 52 W. Solowjew, Ausgewählte Werke, aus d. Russ. übs. v. H. Köhler, Bd. 3: Zwölf Vorlesungen über das Gottmenschentum (1877), Jena 1921.
29
Der Zugang
gestalthaft, sofern sich die beiden Symbolgestalten der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik, Sophie Scholl und Edith Stein, nach Art der zugleich jugendlich und bejahrt wirkenden Erscheinung der „Philosophie“ am Krankenlager des Boëthius, zu einer einzigen Konfiguration der Weisheit verbinden. Denn die Weisheit ist die für sich einstehende und werbende und die in beidem sich gewährende Wahrheit, die Wahrheit, die aus dem Ereignis der Gottesoffenbarung hervorgeht. Verglichen mit der einleitenden Anrufung, kommt das einer deutlichen Steigerung gleich. Während die theologischen Tugenden angerufen werden mußten, rufen die das Geistesleben bestimmenden Ideen letztlich zu sich selbst. Das könnte freilich trotz aller Belege kaum glaubhaft gemacht werden, wenn es nicht durch das Zeitgeschehen entscheidend an Profil gewänne. Das aber ist, in Abwandlung eines altchristlichen Grundsatzes gesprochen, mehr noch durch Leiden als durch Forschen, und das besagt: mehr durch den von den mörderischen Nationalkonflikten und dem Elend in den Hungergebieten ausgehenden Leidensdruck als durch die triumphalen Leistungen der Forschung und Technik bestimmt. Dadurch wurde die von den geschichtlichen Umständen besonders hart getroffene Lyrikerin Nelly Sachs dazu gebracht, das Zeitgeschehen in der Szene vom Opfer Abrahams gespiegelt zu sehen und als eine „Landschaft aus Schreien“ zu beschreiben: In der Nacht, wo Sterben Genähtes zu trennen beginnt, reißt die Landschaft aus Schreien den schwarzen Verband auf, über Moria, dem Klippenabsturz zu Gott, schwebt des Opfermessers Fahne Abrahams Herz-Sohn-Schrei am großen Ohr der Bibel liegt er bewahrt53. In einer letzten Steigerung bezieht die Dichterin diese „Landschaft“ zurück auf den Todesschrei des Gekreuzigten: Christus nahm ab an Feuer Erde Wasser baute aus Luft noch einen Schrei und das Licht im schwarzumrätselten Laub der einsamsten Stunde wurde ein Auge und sah54.
53 Aus: N. Sachs, Landschaft aus Schreien, zitiert nach: K.-J. Kuschel (Hg.), Der andere Jesus. Ein Lesebuch moderner literarischer Texte, München u. a. 2/1987, S. 376. 54 Aus: N. Sachs, David, zitiert nach: K.-J. Kuschel (Hg.), Der andere Jesus, a.a.O., S. 379.
30
2. Das Zeitbild
Während der Todesschrei zum Himmel dringt, wandelt sich das verlöschende Licht zu einem Auge, von dem sich der Leser erblickt und befragt sieht. In diesem Blick gewinnt der aus der Landschaft von Schreien ausgehende Anruf eine letzte Dringlichkeit. Gleichzeitig weiß sich der Erblickte nach seinem Verhältnis zu Freiheit, Friede, Hoffnung und Weisheit und nach seiner Antwort auf ihre Provokationen zur Rede gestellt. Und es entlastet ihn nur wenig, wenn er bemerkt, daß sich der zum Schrei und Auge gewordene Anruf durch ihn hindurch an die Instanz richtet, von der allein Abhilfe zu erwarten ist. Denn im gleichen Atemzug wird ihm auch schon klar, daß die Zuwendung dieser Hilfe an sein Engagement geknüpft ist.
2. Das Zeitbild Wenn die Gegenwart tatsächlich dadurch gekennzeichnet ist, daß in ihr – trotz aller Triumphe der Wissenschaft und Technik – mehr gelitten als geleistet wurde, muß sich von hier aus ein Einblick in das Zeitgeschehen ergeben, der, wenn er glückt, die Richtigkeit des eingeschlagenen Verfahrens bestätigt und die mit ihm geweckten Erwartungen rechtfertigt. Das kommt einer prinzipiellen Vorentscheidung gleich, die für den Bereich der Philosophie mit großer Entschiedenheit von Max Horkheimer in seiner „Kritik der instrumentellen Vernunft“ umschrieben wurde. Im Blick auf die „namenlosen Märtyrer der Konzentrationslager“, in denen er die Symbole einer neu ins Leben zu rufenden Menschheit erblickt, fordert er: Aufgabe der Philosophie ist es, was sie getan haben, in eine Sprache zu übersetzen, die gehört wird, auch wenn ihre vergänglichen Stimmen durch die Tyrannei zum Schweigen gebracht wurden55. Als Paul Celan mit seiner „Todesfuge“ und Arnold Schönberg mit seiner Kantate „Ein Überlebender aus Warschau“ das bekannte Verdikt Theodor W. Adornos56 durchbrachen und mit ihren Werken bewiesen, daß Kunst nicht nur nach Auschwitz möglich ist, sondern daß das Grauen selbst künstlerisch zur Sprache gebracht werden kann, bewiesen sie zugleich, daß sich die Forderung Horkheimers keineswegs auf den Bereich der Philosophie beschränkt. Sie betrifft auch nicht nur Lyrik und Kunst, sondern gilt nicht zuletzt auch für die immer noch im Systemdenken befangene und vorwiegend für die im religiösen Sinne Erfolgreichen engagierte Theologie. Sie wird lernen müssen, auch die gescheiterten Glaubensversuche in ihre Konzepte einzubeziehen und die Verstummten deren eigener Geschichte der Vergessenheit zu entreißen. Den entscheidenden Schritt dazu wird die Theologie dann getan haben, wenn sie den Gedankenschritt von Nelly Sachs, verstanden als das aus dem Zeitgeschehen aufsteigende De profundis, in ihre Reflexion einbezieht. Sogar die Brücke dazu wurde ihr von der Dichterin geschlagen, sofern sie den
55 M. Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende, hrsg. v. A. Schmidt, Frankfurt a. M. 1967, S. 152. 56 Th. W. Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft (1949), in: ders. Gesammelte Schriften in zwanzig Bänden, Bd. 10.1: Prismen; Ohne Leitbild, Frankfurt a. M. 1977, S. 11 – 30, S. 30: „ […] nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“.
31
Der Zugang
Notschrei der Zeit auf den Todesschrei Jesu zurückbezog und damit auf das Motiv, das wie kaum ein anderes zu neuer und intensiverer Würdigung ansteht. Wenn auf Grund der formkritischen Analyse der Passionsberichte anzunehmen ist, daß Jesus spätestens nach seinem Bekenntniswort vor dem Hohepriester (Mk 14,62) die ihm zugefügte Tortur schweigend über sich ergehen ließ und dieses Schweigen erst mit seinem Todesschrei brach, gewinnt dieser Schrei im Konzept seiner Gottesverkündigung einen überragenden Stellenwert, so daß er geradezu als deren Höhepunkt begriffen werden muß. Mit diesem Ruf steht – wie Jürgen Moltmann richtig sah, aber in negativer Dialektik deutete – nicht nur seine persönliche und theologische Existenz, sondern seine ganze Gottesverkündigung auf dem Spiel57 – und dies insofern, als sich Jesus erst mit seinem Todesschrei definitiv und unwiderruflich zu dem Gott durchrang, dessen Herz er mit seiner Anrede „Abba – Vater“ erschlossen hatte58. Wenn das, wie Nikolaus von Kues meinte, die zugleich gewaltigste und letzte Verlautbarung der „großen Stimme“ war, durch die sich Gott in der Menschheitsgeschichte vernehmen ließ, fallen beim Bedenken dieses „lauten Schreies“ auch alle Stimmen mit ins Gewicht, die sich jemals – berufen oder nicht – mit dieser Gottesstimme zu einem Chor zusammenschlossen59. Berufene Rufer waren die Propheten, die entweder in alttestamentlicher „Vorzeit“ die Sache Gottes vertraten oder in neutestamentlicher „Nachzeit“ als Sprecher des erhöhten Christus die Verkündigung des historischen Jesus ergänzten. Wenn der das sprachliche Medium durchbrechende Todesschrei Jesu wirklich vernommen und in seiner Offenbarungsqualität begriffen werden soll, bedarf es der Einstimmung, die unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht besser erzielt werden kann als durch das Hinhören auf das, was uns die „Landschaft aus Schreien“ sagen will, und durch den insistenten Versuch, den durch den Terror der Jahrhunderte, gleich welcher Provenienz, Verstummten zu einer Stimme zu verhelfen. Wenn man sich die Bandbreite der Bedeutungen vergegenwärtigt, die dem Todesschrei Jesu unterlegt wurden und die von Verzweiflung und Schrecken bis zu Ergebung und Vertrauen reichen, wird man sich noch am ehesten dazu verstehen, die Vielstimmigkeit der aus dem Zeitgeschehen aufsteigenden Auf- und Notschreie in dem Ruf „De profundis“ zusammengefaßt zu sehen, zumal Martin Heidegger diesen sogar noch aus dem „Gott ist tot“ von Nietzsches „tollem Menschen“ herauszuhören glaubte: Der tolle Mensch […] ist eindeutig […] derjenige, der Gott sucht, indem er nach Gott schreit. Vielleicht hat da ein Denkender wirklich de profundis geschrieen? Und das Ohr unseres Denkens? Hört es den Schrei immer noch nicht?60
57 Dazu: J. Moltmann, Theologie der Hoffnung, in: J. B. Bauer (Hg.), Entwürfe der Theologie, Graz u. a. 1985, S. 235 – 257, S. 243f; ferner: ders., Der Weg Jesu Christi. Christologie in messianischen Dimensionen, München 1989, S. 173: „Ich sah in dem gottverlassenen Schrei, mit dem Christus am Kreuz stirbt, das Kriterium für alle Theologie, die christlich zu sein beansprucht.“ 58 Dazu: J. Jeremias, Abba. Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte, Göttingen 1966, S. 63: „Das Abba der Gottesanrede Jesu enthüllt das Herzstück seines Gottesverhältnisses.“ 59 Nikolaus von Kues, Excitationes 1.3, zitiert nach: H. de Lubac, Katholizismus als Gemeinschaft (Catholicisme, 1938), aus dem Franz. übs. v. H. U. v. Balthasar, Einsiedeln u. a. 1943, S. 405f. 60 M. Heidegger, Nietzsches Wort „Gott ist tot“ (1943), in: ders., Holzwege, Frankfurt a. M. 4/1963, S. 193 – 247, S. 246f.
32
3. Die conditio humana
Keiner hat das Ohr des Denkens für das große „De profundis“ so sehr geschärft wie der „verwundete Denker“ Joseph Bernhart in seinem gleichlautenden Werk61, der diesen Notschrei ebenso vielfältig wie gleichsinnig vernahm: im „Thronstreit“ zwischen dem amor des Verlangens und dem amor caritatis, im Selbstwiderspruch Luthers und in der Drangsal des zwischen der Skylla des Autonomiestrebens und der Charybdis der Verzweiflung hin- und hergerissenen Menschen. Er hörte diese Schreie schließlich „ausklingen“ in dem Ruf des Gottverlassenen am Kreuz. Mit der „Totenklage“ des tollen Menschen im Ohr, deutet er die Gottverlassenheit des Gekreuzigten als eine Selbstentzweiung Gottes, in der der Verlassene und Abgestoßene „wie jedes Geschöpf in Not“ nach Gott schreit und, da sein Schrei die Qualität des vollkommensten Gebetes hat, in seiner Gottesnot „gleichsam, als wenn Gott nicht wäre, ihn erschafft“ und dies „im Namen aller Kreatur“62. So ist er auf dem Tiefpunkt seiner Selbstentäußerung „die offene Wunde letzter Tragik“, das leibhaftige Zeichen göttlicher Selbstentzweiung und Selbstversöhnung, von dem nicht auszudenken ist, wieviel uns in ihm gesagt wurde. Doch etwas davon wird hörbar in dem Wort, mit welchem Bernharts „De profundis“ schließt: Er ist auferstanden, aber mit Wunden. Mit Wunden, aber mit verklärten63.
3. Die conditio humana Als Theologe ist Bernhart ebenso Existenzdenker wie Geschichtsdenker, der als solcher dafür einsteht, daß die menschliche Geschichtsfähigkeit darin gründet, daß der Mensch eine „Geschichte mit sich selbst” durchlebt, die er zwischen den Polen Selbstaneignung und Selbstverfehlung auszutragen hat64. Deshalb darf sein Schlußwort von dem noch in seiner Verklärung von Wunden Gezeichneten als Aufforderung verstanden werden, dieses Paradox zunächst, wie es nach Henri de Lubac schon bei den Kirchenvätern geschah65, auf den Menschen, dann auf das Zeitgeschehen und schließlich auf die Situation des Glaubens zu beziehen. Zunächst fällt der durch den Notschrei geschärfte Blick auf den Menschen, weil es zu den entscheidenden Einsichten der Zeit gehört, daß seine Sache letztlich nur exklamatorisch, also in Form von Auf- und Notrufen zur Sprache gebracht werden kann. Die Darstellungen im Feld der neueren Kunst, angefangen bei Georges Rouault und Pablo Picasso bis hin zu Max Beckmann und Francis Bacon, bestätigen dies ebenso wie die Zeugnisse der Dichtung, die lediglich mit den Namen William Faulkner, Hermann Broch und Heinrich Böll angesprochen seien, und die der Musik, die in Alban Bergs „Dem Andenken eines Engels“ gewidmeten Violinkonzert, Bernd Alois Zimmermanns „Liturgischer Aktion“ und Henryk Góreckis dritter Sinfonie dafür besonders eindringliche Belege schuf. Doch hat es nicht den Anschein, daß sich auch die philosophische Anthropologie schon 61 62 63 64
J. Bernhart, De profundis, mit einem Vorw. v. E. Biser zur Neuausgabe, Weißenhorn 5/1985. A.a.O., S. 191. A.a.O., S. 192. Dazu: E. Biser, Glaubenserweckung. Das Christentum an der Jahrtausendwende, Düsseldorf 2000, S. 85f. 65 H. de Lubac, Paradoxe des gelebten Glaubens (Paradoxes, 1946), aus dem Franz. übs. v. L. u. M. Zimmerer, Düsseldorf 1950, S. 5.
33
Der Zugang
wirklich von dem davon ausgehenden Anstoß bewegen ließ. Ebenso öffnet sich die Theologie nur zögernd, wenn nicht sogar widerwillig, den auf eine Revision ihres Menschenbildes drängenden Vorhaltungen. Und was schließlich die kirchliche Verkündigung anlangt, so erweckt sie geradezu den Eindruck, als gehe sie, fixiert auf das Bild eines von Lebenslust überschäumenden und von Leidenschaften umgetriebenen Menschen, weitgehend an den konkret existierenden Menschen vorbei. Zweifellos entstammt der Schrei einer Zerrissenheit, die gerade das betrifft, worauf sich der auf das „Wesen“ achtende Blick des vorstellenden Denkens – und damit das Augenmerk der klassischen Anthropologie – richtete. Und unter diesem Eindruck brach sich bei Franz Rosenzweig, Martin Buber und Rudolf Bultmann die Erkenntnis Bahn, daß die Grundfrage der klassischen Anthropologie zugunsten einer „älteren“ und radikaleren, der biblischen nämlich, aufgegeben werden müsse. Wie jene noch alle Fragen des Geistes, also die Fragen: „Was kann ich wissen?“, „Was soll ich tun?“, „Was darf ich hoffen?“ – mit Immanuel Kant also die Fragestellungen der Philosophie, der Ethik und Religion – in der ihnen vorgeordneten Frage: „Was ist der Mensch?“, zusammenfaßt, so ruft der Gott der Bibel den sündig gewordenen Menschen mit der Frage: „Wo bist du?“ (Gen 3,8), zur Besinnung auf sich selbst. In seinem Bericht über die Entstehung des dialogischen Prinzips grenzt Buber seinen Weggenossen Rosenzweig, diesen „erstaunlichen Schüler“ Hermann Cohens, der sich vom Neukantianismus zur Religion aus den Quellen des Judentums zurückgetastet hatte, von dessen Lehrer mit den Worten ab: Aber in dem Verstehen des Du als eines gesprochenen geht er, von der dichten Konkretheit seines Sprachdenkens befeuert, bemerkenswert über Cohen hinaus: die wesentliche Gesprochenheit des Du ist ihm in Gottes an Adam gerichtetem „Wo bist du?“ gefaßt, und dieses ausdeutend fragt er: „Wo ist ein solches selbständiges, dem verborgenen Gott frei gegenüberstehendes Du, an dem er sich als Ich entdecken konnte?“ Daß nun von hier aus innerbiblisch ein Weg zu jenem „Ich habe dich beim Namen gerufen. Du bist mein“ sichtbar wird, mit dem Gott sich „als der Urheber und Eröffner dieses ganzen Zwiegesprächs zwischen ihm und der Seele“ ausweist, das ist Rosenzweigs bedeutungsvoller theologischer Beitrag zu unserer Sache66. Derselben Erkenntnis nähert sich auch Bultmann, wenn er seine Betrachtung über das Menschenbild der Bibel in die Sätze ausklingen läßt: „Adam, wo bist du?“ – rief einst den ersten Menschen Gottes Ruf aus seinem Versteck vor das Auge des Richters, so ist „in Christus“ der Ruf „Adam, wo bist du?“ zum Ruf der Gnade geworden, der den Menschen aus der Verlorenheit an die Welt der Unterschiede und Ungleichheiten zurückruft in das Reich der „himmlischen Gestalten“, deren verklärtes Sein keine differenzierenden „Kleider und Falten“ mehr verbergen67. 66 M. Buber, Zur Geschichte des dialogischen Prinzips, in: ders. Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 291 – 305, S. 296. 67 R. Bultmann, Adam, wo bist du? Über das Menschenbild der Bibel (1945), in: Glauben und Verstehen, Bd. 2, Tübingen 3/1961, S. 105 – 116, S. 116.
34
3. Die conditio humana
Das aber ist der Ruf, dem der Mensch bereits „als der gilt, der er erst werden soll“, der ihn also aus seiner Verfallenheit zur Höhe seiner Werdemöglichkeit zurückruft68. So gesehen, mißt dieser Ruf bereits die ganze Geschichte des Menschen mit sich selber aus. In seiner Hinfälligkeit schwebt er in der Gefahr, von sich selbst abfallen zu können und zum Opfer manipulierender Mächte zu werden. Mit untrügerischem Raubtierinstinkt nahmen die Diktatoren aller Schattierungen die diese Geschichte durchziehende Spur auf, um den Menschen dorthin zu stoßen, wohin er abzufallen drohte. Auch spricht vieles für die These Neil Postmans, wonach das Erbe der Diktaturen von den audiovisuellen Medien übernommen worden sei. Denn sie brächten den Rezipienten mit ihren persuasiven Mitteln dahin, sich lustvoll dem zu unterwerfen, was er unter dem Druck des Terrors nur widerstrebend hinnahm: seine Funktionalisierung zu einem Faktor der modernen Leistungs- und Konsumgesellschaft69. Deshalb seien, wie das dramatische Gefälle zwischen George Orwell und Aldous Huxley zeige, heute nicht mehr diejenigen zu fürchten, die Bücher verbrennen, wohl aber jene, die den Menschen die Neigung zum Bücherlesen abgewöhnen; nicht mehr diejenigen, die ihm Informationen vorenthalten, sondern jene, die uns derartig mit Informationen überhäufen, „daß wir uns vor ihnen nur in Passivität und Selbstbespiegelung retten können“; und nicht mehr diejenigen, die die Wahrheit unterdrücken, sondern jene, die „die Wahrheit in einem Meer von Belanglosigkeiten“ untergehen lassen70. Was die anthropologischen Folgen dieser „Verödung“ betrifft, so läßt sie sich dahingehend bestimmen, daß der medienabhängige Mensch zu einer „Metapher seiner selbst“ verflacht und dem Zustand der von Herbert Marcuse beschriebenen „Eindimensionalität“ verfällt71. Wenn er dann doch dagegen aufbegehrt und dem funktionalisierenden Druck die von Marcuse geforderte „Große Weigerung“ entgegensetzt72, dann auf Grund der Instanz, die sich der ihm zugefügten „Kenose“, der Entäußerung von innen her, widersetzt und ihn zugleich zu Akten personaler Selbstaneignung aufruft. Das aber ist jene nach breiterer Anerkennung verlangende basale Gewissensform, die – vergleichbar der Funktion, die Kant der anthropologischen Grundfrage zuschreibt – den dimensionalen Gewissensformen, also der ethischen, kognitiven und ästhetischen, zugrundeliegt und über den Grad der personalen Integration des Menschen befindet. Dieses „Existenzgewissen“ urteilt somit weder über Gut und Böse, Wahr und Falsch, Kunst und Kitsch, sondern über das menschliche Selbstverhältnis. Es warnt vor der Gefahr, sich fallen und treiben zu lassen und ermutigt zu jedem Schritt, der den Menschen auf den Weg der von Guardini insinuierten „Annahme seiner selbst“ voranbringt73. 68 Dazu in Auswahl: E. Biser, Ist der Mensch, was er sein kann? Eine anthropologische Reflexion, in: Stimmen der Zeit 199 (1981), S. 291 – 300; ders., Der Mensch – das uneingelöste Versprechen. Entwurf einer Modalanthropologie, Düsseldorf 2/1996; ders., Wo bist du? Antwort auf die Frage nach dem Menschen, Leutesdorf 2/2002. 69 N. Postman, Wir amüsieren uns zu Tode. Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie (Amusing Ourselves to Death, 1985), aus dem Amerik. übs. v. R. Kaiser, Frankfurt a. M. 5/1986, S. 7f. 70 A.a.O., S. 7f; S. 189 – 198. 71 H. Marcuse, Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft (One-Dimensional Man, 1964), aus dem Amerik. übs. v. A. Schmidt, ungek. Sonderausgabe, Neuwied u. a. 1970, S. 139 – 215; ferner: E. Biser, Zur Situation des Menschen im Medienzeitalter, München 1988. 72 H. Marcuse, a.a.O., S. 81 – 86; 266ff. 73 So der Titel einer als Monographie erstmals 1960 veröffentlichten Studie von Romano Guardini, in: ders., Werke, hrsg. v. F. Henrich, Sachbereich Jugend und Lebensgestaltung, Mainz u. a. 1993, S. 7–31.
35
Der Zugang
Das Wissen um diesen „Gewissensgrund“ ist alt und läßt sich bis auf Nikolaus von Kues und die Renaissancephilosophie zurückverfolgen. So ist für Bovillus, der in seiner Schrift „De Sapiente“ wesentliche Anregungen der cusanischen Spekulation und der Florentiner Akademie verarbeitete, dem Menschen das Sein nicht als fertiger Bestand gegeben, sondern mit Hilfe von „virtus“ und „ars“ zur Gestaltung aufgegeben74. Und Nikolaus von Kues vernimmt in der Tiefe seines Geistes den Zuspruch, der ihn dadurch zur Selbstannahme drängt, daß er den himmlischen Beistand von dessen Initiative abhängig macht. Denn das ist nach Ernst Cassirer der Sinn des Schlüsselsatzes der Cusanusschrift „Vom Sehen Gottes“: Und wenn ich so im Schweigen der Betrachtung verstumme, antwortest Du mir, Herr, tief in meinem Herzen und sagst: Sei du dein und ich werde dein sein75. Eben daran sieht sich der heutige Mensch jedoch vielfach gehindert; und darin besteht vermutlich ein entscheidender Grund seiner religiösen Not. Belastet vom „Geist der Schwere“ ist ihm nicht nur, wie dies in ungewöhnlicher Sensibilität schon Reinhold Schneider registrierte, sein Lebenswille gebrochen, sondern ebenso ist sein Wille zur Selbstaneignung gelähmt. Damit verliert er auch das Wissen um seine elementare Zugehörigkeit. Weil sich diese zugleich auf den Frieden mit sich selbst und seine Geborgenheit in Gott bezieht, vermag er auf die Frage: „Wo bist du?“, nicht mehr zu antworten. Denn er erfährt sich als das im wörtlichen Sinne „utopische“, und das besagt: ortlose und „unbehauste“ Wesen76. Auf ihn trifft zu, was Goethes Faust beim Abstieg zu den Müttern auf die Frage nach dem Weg von Mephistopheles zu hören bekommt: Kein Weg! Ins Unbetretene, Nicht zu Betretende; ein Weg ans Unerbetene, Nicht zu Erbittende. Bist du bereit? – […] Hast du Begriff von Öd’ und Einsamkeit?77 Diesen Begriff lieferte Nietzsche nach, der, bewußter als andere, die „große Öde“ jenseits von Gott durchmessen und die „azurne Einsamkeit“ dessen durchlitten hat, dem kein „Wächter und Freund“ für seine sieben Einsamkeiten, kein Vergelter und kein „Verbesserer letzter Hand“ und „keine Ruhestatt“ für sein ausgebranntes Herz blieb78. Fraglos hatte Ortega y Gasset etwas ganz anderes im Sinn als er den Menschen das „utopische Wesen“ nannte79. Ihm ging es um seine einzigartige Möglichkeit, sich aus der
74 Dazu: E. Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, Leipzig u. a. 1927, S. 94. 75 Nikolaus von Kues, De visione Dei – Die Gottes-Schau, c. 7, in: ders., Philosophisch-theologische Schriften, Bd. 3, a.a.O., S. 116 – 123, S. 121; ferner: E. Cassirer, a.a.O., S. 32 – 38; S. 69f. 76 Dazu: H. E. Holthusen, Der unbehauste Mensch. Motive und Probleme der modernen Literatur, München 1951. 77 J. W. v. Goethe, Faust II, Finstere Galerie, V. 6222 – 6227, in: ders., Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust, a.a.O., S. 191. 78 F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft IV, § 285, in: ders., KSA 3, S. 527f, S. 527. 79 Dazu: J. Ortega y Gasset, Vom Menschen als utopischem Wesen. Vier Essays, aus dem Span. übs. v. G. Kilpper u. a., Stuttgart 1951.
36
3. Die conditio humana
Verausgabung an die Gegenstandswelt in sich selbst zurückzuziehen und „in sich selbst zu versenken“, um sich so als personales „Selbst“ und als Ausgangspunkt zu gewinnen, und aus sich auch wieder – zu Akten der Weltgestaltung – herauszugehen80. Freilich sieht Ortega auch die Kehrseite dessen, also den Menschen, der sich „verloren und schiffbrüchig zwischen den Dingen“ vorkommt und darin die Not der Selbstentfremdung erfährt81. So gerät ihm sein Leben zur Odyssee, die sich gleicherweise vom nivellierenden Fortschrittswahn wie vom „Imperativ Nietzsches ‚Lebt gefährlich!‘“ fernhalten muß, um in selbstverantwortlicher Wachsamkeit das Ziel eines geglückten Menschseins zu erreichen82. Müßte der Mensch aber nicht in einem neuen, wesentlicheren Sinn „utopisch“ genannt werden, der auch seine religiöse Dimension betrifft? Dann erschiene er als ein von ihm selbst vielfach verweigertes, von Gott jedoch letztlich eingelöstes Versprechen83. In dieser Sicht würde er biblisch vor allem vom Römerbrief bestätigt, der sich als Zeugnis zuletzt dadurch nahelegt, daß er vom Menschen in letzter Zuspitzung exklamatorisch redet und sich angesichts der menschlichen Verfehlungen und Verfallsformen zu dem Aufschrei steigert: Ich unglücklicher Mensch, wer wird mich von diesem todverfallenen Leib befreien? (Röm 7,24)84 Das hatte Paulus im Blick auf die Szene vom Tanz um das Goldene Kalb mit dem Gedanken unterbaut, daß der Mensch die ihm angestammte Gottebenbildlichkeit aufgeben und sich auf tierische Modelle festlegen könne (Röm 1,23). So jedenfalls sieht es der Renaissancephilosoph Pico della Mirandola, wenn er den Schöpfer zu seiner Vorzugskreatur sagen läßt: Ich habe dich in die Mitte der Welt gesetzt, damit du von dort bequem um dich schaust, was es alles in dieser Welt gibt. Wir haben dich weder als einen Himmlischen noch als einen Irdischen, weder als einen Sterblichen noch als einen Unsterblichen geschaffen, damit du als dein eigener, vollkommen frei und ehrenhalber schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die Form bestimmst, in der du zu leben wünschst. Es steht dir frei, in die Unterwelt des Viehes zu entarten. Es steht dir ebenso frei, in die höhere Welt des Göttlichen dich durch den Entschluß deines eigenen Geistes zu erheben85. Utopisch ist der Mensch demzufolge darin, daß er sich selbst überschreiten und zu noch nicht erreichten Seinsweisen steigern kann. Das stellt ihn freilich vor die neue und wo-
80 Ders., Insichselbst-Versenkung und Selbstentfremdung (Ensimismamiento y alteración, 1939), in: ders., Vom Menschen als utopischem Wesen, a.a.O., S. 55 – 91; S. 65 – 68. 81 A.a.O., S. 63; S. 72. 82 A.a.O., S. 77ff. 83 Dazu: E. Biser, Der Mensch – das uneingelöste Versprechen, a.a.O., S. 187 – 191: Das utopische Wesen. 84 Dazu: W. Schmithals, Die theologische Anthropologie des Paulus. Auslegung von Röm 7,178,39, Stuttgart u. a. 1980, S. 73f. 85 G. Pico della Mirandola, Über die Würde des Menschen. Nebst einigen Briefen und der Lebensbeschreibung Pico della Mirandolas, nach der Gesamtausgabe der Werke Picos, Basel 1557, ausgew. u. übertr. v. H. W. Rüssel, [Amsterdam] 1940, S. 50f.
37
Der Zugang
möglich noch radikalere Alternative, die Maurice Blondel in Fortführung patristischer Ansätze zu dem „Dilemma“ zuspitzte: ohne Gott und gegen Gott […] oder durch Gott und mit Gott86. Die eine Alternative steht im Licht des schließlich auf den Menschen zurückschlagenden Herrschaftswissens, das in dieser Rückbezüglichkeit darauf abzielt, die an Gott abgetretenen Attribute zurückzugewinnen für den Menschen, als seine, wie Nietzsche formulierte, „schönste Apologie“87. Ziel dieses „Exzesses“ ist, wie Nietzsche gegen wachsende Bedenken behauptete, eine usurpierte Gotthaftigkeit, denn: w e n n es Götter gäbe, wie hielte ich’s aus, kein Gott zu sein!88 Zu ironischer Skepsis wuchsen diese Bedenken aber schon bei Sigmund Freud an, für den dieses Ziel nur noch mit Hilfe technischer Prothesen und um den Preis einer skurrilen Zerrform von Gottebenbildlichkeit zu erreichen war. Mit Hilfe der modernen Hochtechnik habe sich der Mensch zwar göttliche Qualitäten angeeignet; wie man in einer Extrapolation des Freudschen Ansatzes erläutern könnte: in der Weltraumfahrt etwas von göttlicher Allgegenwart, in der Nachrichtentechnik ein Stück göttlicher Allwissenheit und mit dem Eingriff in die Evolution sogar einen Anteil am göttlichen Schöpfertum. So hat er sich der Erreichung des göttlichen Ideals spürbar angenähert: Freilich nur so, wie man nach allgemein menschlichem Urteil Ideale zu erreichen pflegt. Nicht vollkommen, in einigen Stücken gar nicht, in anderen nur so halbwegs. Der Mensch ist sozusagen eine Art Prothesengott geworden, recht großartig, wenn er alle seine Hilfsorgane anlegt, aber sie sind nicht mit ihm verwachsen und machen ihm gelegentlich noch viel zu schaffen89. Mit der Figur des Prothesengottes leuchtete Freud die Innenseite der ökologischen Katastrophe aus, auch wenn diese steckbriefartige Täterbeschreibung noch kaum in ihrer alarmierenden Bedeutung erfaßt worden ist. Umso radikaler stellt sich dann aber die Frage nach der gültigen, der rettenden Alternative. Nach Blondel steht sie unter dem Vorzeichen „mit Gott und durch Gott“, und das ist, gerade im Sinn von Blondels Immanenzapologie, gleichbedeutend mit der Frage nach der Aktualität der christlichen Botschaft90. Daß sie erfragt werden muß, ist die Folge des Widerspruchs, in den sie durch die Zeitverhältnisse geriet. Darum muß diesen Zeitverhältnissen Rechnung getragen werden, bevor die gegenwärtige Glaubenssituation genauer überprüft werden kann. 86 M. Blondel, Die Aktion (1893). Versuch einer Kritik des Lebens und einer Wissenschaft der Praktik (L’action 1893, 1930), aus dem Franz. übs. v. R. Scherer, Freiburg i. Br. u. a.1965, S. 381. 87 F. Nietzsche, Nachgelassenes Fragment 11 [87], in: ders., KSA 13, S. 41. 88 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra II, Auf den glückseligen Inseln, in: ders., KSA 4, S. 109 – 112, S. 110. 89 S. Freud, Das Unbehagen in der Kultur (1930 [1929]), in: ders., Kulturtheoretische Schriften, Frankfurt a. M. 1986, S. 191 – 270, S. 222. 90 Dazu: E. Seiterich, Wege der Glaubensbegründung nach der sogenannten Immanenzapologetik, Freiburg i. Br. 1938, S. 44 – 84, bes. S. 53.
38
4. Die conditio mundana
Nach der conditio humana stehen damit die conditio mundana und danach die conditio religiosa zur Diskussion.
4. Die conditio mundana Wer in den durch die Wo-Frage aufgerissenen „Abgrund Mensch“ blickt91, erkennt dort, zusammenfassend gesprochen, den Menschen als das „utopischdekadente“ Wesen: nach Selbstüberschreitung verlangend und ständig der Gefahr der Selbstverfehlung ausgesetzt. Wenn der Bruch mit der klassischen Fragestellung, wie angenommen, durch die Grenzerfahrungen des vergangenen und dieses Jahrhunderts erzwungen wurde, ist zu vermuten, daß der Gegenwart ein vergleichbares Zeitbild zugrundeliegt, daß sich also auch in ihr gegensinnige Tendenzen, aufstrebende ebenso wie Verfallstendenzen überschneiden. Leben wir also in einer utopisch-atavistischen Zeit? Ein neuerlicher Blick auf die Zeitgenossen scheint diese Vermutung allerdings, zusammen mit dem erschlossenen Menschenbild, zu widerlegen. Denn einem Wort Paul Valérys zufolge lebt der heutige Mensch mit dem Rücken zur Zukunft92. Unter den ihn befallenden Ängsten steht die Zukunftsangst mit an erster Stelle. Um die gestern noch lautstark propagierte Futurologie ist es still geworden. Stattdessen verstärken sich die Unheils- und Katastrophenprognosen, die den Ausblick auf das Kommende zusätzlich verdunkeln. Und der große Traum, der das vergangene Jahrhundert bis knapp vor dessen Ende in seinen Bann geschlagen hatte, die marxistische Sozialutopie, scheint unwiderruflich und durchaus zum Segen der von ihr genarrten Menschheit ausgeträumt. So jedenfalls votierte, mit sichtlicher Erleichterung, Joachim Fest in seinem Essay „Der zerstörte Traum“, der den durch das spektakuläre Scheitern des sozialistischen Experiments Desillusionierten die Rückkehr zum alltäglich Machbaren empfahl, nicht ohne ihnen zugleich die durch die Unheilsgeschichte der Menschheit vielfach bestätigte Gefährlichkeit des Träumens vor Augen geführt zu haben93. Vergeblich, denn während er die Ernüchterung nach dem Zerstieben des roten Traumes pries, hatte bereits der grüne Traum die jäh unterbrochene Verzauberung erneut in Gang gesetzt. Die Utopie lebte fort; sie hatte lediglich die Inhalte ausgetauscht. Das wäre freilich nicht möglich gewesen, wenn die Utopie die ausgehende Neuzeit nicht wesentlicher, als dies den ideologischen Formen möglich war, bestimmt hätte. Und in dieser basalen Form – vor allem in ihrem Selbstwiderspruch – lag auch der Grund für die Unfähigkeit des heutigen Menschen, der Zukunft hoffend und entschieden entgegenzusehen. In dieser grundlegenden Form ist die Utopie dem Fortschritt verhaftet, in welchem, wie Karl Löwith zeigte, Elemente, um nicht zu sagen: Fragmente, der christlichen Hoffnung wirksam sind94. Wie die Erörterung der Passion der vom Evangelium freigesetzten 91 Augustinus, Bekenntnisse IV, 14, aus dem Lat. übs. v. A. Hofmann (BKV, 1. Reihe, Bd. 18; Augustinus Bd. VII – im Folgenden abgekürzt: 1. Reihe, Bd. 18, VII), München 1914, S. 74. 92 Dazu: K. Löwith, Paul Valéry. Grundzüge seines philosophischen Denkens, Göttingen 1971, S. 99. 93 Dazu: J. Fest, Der zerstörte Traum, a.a.O., S. 17 – 25. 94 Dazu: K. Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie (Meaning in History, 1949/1953, aus dem Amerik. übs. v. H. Kesting), in: ders., Sämtliche Schriften, Bd. 2: Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Zur Kritik der Geschichtsphilosophie, Stuttgart 1983, S. 7 – 240, S. 218 – 222.
39
Der Zugang
Ideen zeigen wird, wurde die Hoffnung im Zug dieser Passion von ihrem endzeitlichen Ziel abgekoppelt und auf innerweltlich Machbares zurückgenommen: politisch auf die Heraufführung des sozialen Wohlfahrtsstaates, letztlich in seinen faschistischen und sozialistischen Erscheinungsformen; zuvor aber noch auf den Inbegriff der Machbarkeiten, auf die Technik. Denn mit der Entwicklung der Technik zog nicht nur das vorstellende Denken, wie Heidegger betonte, die bisher radikalsten Konsequenzen; mit ihr war, insbesondere im Feld der Hochtechnik, nach der Einsicht des späten Freud ein signifikanter Wandel der Zielsetzungen verbunden. In ihren spektakulärsten Errungenschaften – wie der Kernspaltung, der Mondlandung und der Gentransformation – wandte sich die moderne Hochtechnik der Verwirklichung uralter Menschheitsträume zu: der Gewinnung des „himmlischen Feuers“, der Sternenreise oder der Schaffung eines „homunculus“, während die Beseitigung irdischer Notstände immer wieder vertagt und auf die lange Bank geschoben wird. Steht nach Löwith der Fortschritt im Begriff, „selbst progressiv“ zu werden und so zum Selbstzweck zu entarten95, so zielt er nach Freud auf die Realisierung des Utopischen ab. Machbare Utopien treten an die Stelle des ursprünglichen Hoffnungsziels. Doch damit war der Sehnsuchtsblick, die Aussicht „nach drüben“ endgültig verstellt. Über der technisch hergestellten Zukunft ist die wirkliche Zukunft verloren. Und der in den „Weltinnenraum“ gebannte Mensch kehrte ihr tatsächlich, wie Valéry sah, den Rücken96. Dennoch hat der Vorgang eine eminent metaphysische Dimension, die dahin bestimmt werden kann, daß sich die Distanz von Möglichkeit und Wirklichkeit, Können und Sein, wenngleich registrierbar nur für den Bereich des technisch Machbaren, signifikant verringerte. Denkmodelle, die wie das anselmische Argument oder das cartesianische Cogito auf die Überwindung dieser Distanz abzielen, gewinnen dadurch unversehens an Aktualität. Vermutlich ist es sogar darin begründet, daß der Gottesbeweis aus der Idee des summum cogitabile, also aus dem denkerischen Grenzbegriff, und die Frage nach dem „philosophischen Selbstbewußtsein“, wie Gerhard Krüger das Problem der Subjektivität bezeichnete97, im philosophischen Disput der Gegenwart einen so hohen Stellenwert erlangte. Den entscheidenden Beweis für den utopischen Grundzug der Gegenwart erbrachte jedoch das Zeitgeschehen mit der Wende von 1989, die sich in mehreren Hinsichten von allen vergleichbaren Ereignissen, ausgenommen die „sanfte Revolution“ Jesu, abhob. Denn es handelte sich, ungeachtet ihres welthistorischen Tiefgangs, um eine Revolution ohne Blutvergießen, ohne beherrschende Leitfigur, ohne Strategie und ideologisches Programm. Dennoch war sie von wahrhaft epochaler Auswirkung: Sie brachte mit dem Einsturz des Eisernen Vorhangs das Ende der zweigeteilten Welt, die Befreiung der Ostvölker aus der stalinistischen Diktatur, die Selbstauflösung des Warschauer Pakts und die Wiedervereinigung Deutschlands. Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts, der die Welt jahrzehntelang mit der Drohung eines mit Nuklearwaffen ausgetragenen Dritten Weltkriegs lähmte, der die Wirtschaftskraft 95 Ders., Das Verhängnis des Fortschritts (1961), in: ders., Sämtliche Schriften, Bd. 2, a.a.O., S. 392 – 410, S. 400; dazu: E. Biser, Glaubensprognose. Orientierung in postsäkularistischer Zeit, Graz u. a. 1991, S. 51 – 57: Die Sicht Karl Löwiths. 96 Dazu: E. Biser, Die glaubensgeschichtliche Wende. Eine theologische Positionsbestimmung, Graz 1986, S. 65 – 75: Die Krise der Fortschrittsidee. 97 Dazu: G. Krüger, Die Herkunft des philosophischen Selbstbewußtseins, in: ders., Freiheit und Weltverwaltung. Aufsätze zur Philosophie der Geschichte, Freiburg u. a. 1958, S. 11 – 69.
40
4. Die conditio mundana
vieler Nationen gebunden und die kulturelle Landschaft zerrissen hatte, war der Weltfriede unversehens in fast greifbare Nähe gerückt, das geeinte Europa von einem politischen Traumziel zu einer realisierbaren Größe geworden, ganz zu schweigen von den Chancen und Aufgaben, die der jahrzehntelang blockierte kulturelle Austausch mit sich bringt. Dem tiefer Blickenden konnte auch nicht entgehen, daß sich damit erneut die Distanz von Möglichkeiten und Realität in einer Weise verringert hatte, was erkenntnistheoretische Konsequenzen erster Ordnung nach sich zog. Sie betreffen zunächst das Ereignis selbst. Denn angesichts des aus jedem bekannten Rahmen herausfallenden Verlaufs mußte sich der Beobachter entweder mit einem Kausalitätsverzicht abfinden oder sich dem Gedanken an den Eingriff einer transzendenten Geschichtsmacht beugen. Wenn der freiheitliche Aufbruch letztlich einer göttlichen „Einmischung“ in das Zeitgeschehen zuzuschreiben war, rückte er aus biblischer Perspektive spontan an das Exoduserlebnis Israels heran, so daß das Lied der Mirjam – jedoch ohne den Schlußvers: „Rosse und Wagen warf er ins Meer“ – aufs neue angestimmt werden müßte: Singt dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben! (Ex 15,21) Doch davon sind nicht einmal Spuren und Ansätze zu erkennen! Stattdessen hat sich der berufenen Zeitdeuter, der Literaten ebenso wie der Theologen und Philosophen, eine bleierne Sprachlosigkeit bemächtigt. Dabei hätten sich vor allem die Theologen durch dieses mächtigste „Zeichen der Zeit“ angesprochen und herausgefordert fühlen müssen. Denn fürs erste brachte die Wende im Zug ihrer erkenntnistheoretischen Konsequenzen für sie eine Bestätigung der zu Beginn der 60er Jahre von einem Theologenkreis um Wolfhart Pannenberg diskutierten These von der Offenbarungsrelevanz der Geschichte, genauer noch, von einer „indirekten Selbstoffenbarung Gottes durch die von Gott gewirkte Geschichte“98. Daß sich der offenbarende Gott nicht nur im prophetischen und inkarnierten „Wort“, sondern auch in der Metasprache der Geschichte mitteilt, schlägt aber insbesondere für jenes Heilsereignis zu Buch, das trotz seiner glaubensgeschichtlichen Schlüssel- und Zentralposition schlagartig ins Zwielicht geriet: die Auferstehung Jesu, die so sehr an Evidenz verloren zu haben scheint, daß eine bedenklich hohe Anzahl von Gläubigen dazu neigt, den Auferstehungsglauben gegen die Reinkarnationsidee auszutauschen. Das dürfte sich letztlich daraus erklären, daß die Auferstehung Jesu nach ihrer Bestreitung durch die von Reimarus auf ihre kritische Höhe getriebene Aufklärung und durch die von Novalis in seinen „Hymnen an die Nacht“ proklamierte „Wende“ zwar wieder sagbar, nicht jedoch auch wirklich denkbar geworden war. Ihre Denkbarkeit aber ist eindeutig an Erfahrungen geknüpft, die ein Walten der Vorsehung, verstanden als einen göttlichen Eingriff in den Geschichtsgang, einleuchtend und einsichtig erscheinen lassen: an Erfahrungen, die, wie Schelling formulierte, den Blick dafür erschließen, wie „die wahre, die innere Geschichte in die bloß äußere hindurchbrechend hereintritt“99. Wenn je einmal, war eine derartige Erfahrung beim freiheitlichen Auf- und Umbruch gegeben, der nach allen Lehren der Geschichte als das schlechthin Unerhoffbare zu gelten 98 W. Pannenberg, Einführung, in: ders. (Hg.), Offenbarung als Geschichte, Göttingen 3/1965, S. 7 – 20, S. 20; dazu: E. Biser, Gott verstehen. Erwägungen zum Verhältnis Mensch und Offenbarung, München u. a. 1971, S. 34 – 38. 99 F. W. J. v. Schelling, Philosophie der Offenbarung, unveränd. reprograph. Nachdr. d. aus d. hss. Nachlaß hrsg. Ausg. v. 1858, Bd. 2, Darmstadt 1990, S. 219.
41
Der Zugang
hat, da totalitäre Mächte, wie dies das Untergangsszenario des Dritten Reiches mit erschreckender Eindringlichkeit zeigte, mit dem Versuch eines umfassenden Vernichtungsschlages von der geschichtlichen Bühne abzutreten pflegen. Seither steht die Auferstehung Jesu nicht mehr wie ein erratischer Block unkoordinierbar und „anstößig“ im menschlichen Denkraum; seitdem erscheint sie vielmehr, wie der Gottesgedanke selbst, als dessen Grenzwert, dem eine Deutungsform nach Art des anselmischen Gottesbeweises entspricht. Nicht umsonst zieht dieses Argument die Aufmerksamkeit moderner Philosophie, vor allem in ihrer sprachanalytischen Ausrichtung, auf sich, nachdem Adorno schon vor Jahren auf „das Unauslöschliche an ihm“ aufmerksam machte100. Seitdem gewann die gegenwärtige Lebenswelt aber insgesamt eine neue Qualität. Ohne aufzuhören, eine „Landschaft aus Schreien“ zu sein, mischte sich in das vielstimmige Klagegeschrei doch ebenso leise wie unüberhörbar ein Jubelton ein, wie er seit Christi Geburt immer dann hörbar wurde, wenn sich der Himmel zur Erde neigte. Das „Ohr unseres Denkens“ – hört es diesen Ton immer noch nicht? Daß es ihn so gut wie ganz überhört, erklärt sich vermutlich daraus, daß er von den Stimmen der Klagenden und Anklagenden übertönt wird. Doch diese erhoben sich für den überdeutlichen Gegenzug, der das Zeitalter als ebenso atavistisch und rückschlägig wie utopisch erweist. Die Rückschlägigkeit kündigte sich bereits in der blutigen Abrechnung mit dem Ceauşescu-Regime in Rumänien an und wurde vollends manifest, als die Hoffnung auf den fast schon greifbar gewordenen Weltfrieden durch den Golfkrieg und durch die sich wie ein Flächenbrand ausdehnenden Nationalkonflikte zunichte gemacht wurde. Wo nach jahrzehntelanger Unterdrückung eine Wiedergeburt der Menschlichkeit zu erhoffen war, kam es zu Rückschlägen in die schlimmste Barbarei. Als wäre das Maß des Erlittenen noch nicht übervoll, wurden alte Feindbilder hervorgeholt und längst überwunden geglaubte National- und Religionskonflikte neuerlich heraufbeschworen und auf brutalste Weise ausgetragen. Löwiths prophetisches Wort vom „Verhängnis des Fortschritts“, das sich vornehmlich auf dessen eigene Progressivität stützte, verwies jedoch auf die den meisten Zeitgenossen weit näherliegende Form der Rückschlägigkeit: auf die Folgen der unter dem Antrieb des Herrschaftswissens ständig eskalierenden Technik. Durch kaum etwas wird der Grad der bewußtseinsprägenden Rolle dieser Folgen so drastisch beleuchtet wie durch den Umstand, daß die an der Spitze der Ängste stehende Zukunftsangst weithin identisch ist mit der Angst vor der drohenden Umweltzerstörung. Wie das Schlagwort von der „Apocalypse Now“ bestätigt, steht diese zweifellos virulenteste Angst sogar im Begriff, sich mit den gerade vor und seit der Jahrtausendwende anschwellenden apokalyptischen Angstvorstellungen unheilvoll zu amalgamieren. Mit dem Begriff „Angst“ ist auch schon die metaphysische Dimension des atavistischen Gegenzugs angesprochen. Während sich im Bereich der realisierten Utopien die Distanz von Möglichkeit und Wirklichkeit verringerte, bewirkt die Angst, was Hartmut von Hentig den in einem strukturellen Sinne angsterzeugenden Medien nachsagte: das „allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit“101. Im Grunde übertrug er mit dieser These lediglich die Angstanalyse Heideggers auf den Komplex der Medien, die er damit faktisch als großen Angstmacher der Gegenwart entlarvte. Dies jedoch nicht auf dem Weg 100 Th. W. Adorno, Anmerkungen zum philosophischen Denken, in: ders. Gesammelte Schriften in zwanzig Bänden, Bd. 10.2: Eingriffe; Stichworte; Anhang, Frankfurt a. M. 1977, S. 599–607, S. 606. 101 H. v. Hentig, Das allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit. Ein Pädagoge ermutigt zum Nachdenken über die Neuen Medien, München u. a. 1984.
42
4. Die conditio mundana
einer Kritik der periodisch in angsterzeugender Tendenz gebotenen Inhalte, sondern auf dem einer Strukturanalyse. Denn mit der ständig perfektionierten Vertauschung der Wirklichkeit mit dem von ihnen gebotenen Reproduktionen zerreißen sie das ohnehin nur lose Band zwischen Mensch und Welt. Und durch die Isolation, in die sie den Rezipienten abdrängen, untergraben sie gleichzeitig den sozialen Konnex102. Indessen führt die Medienszene noch in einem radikaleren Sinn in die „Tiefe“ des Zeitgeschehens. Denn durch die Vertauschung der Realität mit bildhaft-akustischen Reproduktionen versetzen sie den Rezipienten auf die kulturgeschichtlich längst überschrittene Stufe der prälogischen und vorliterarischen Denk und Kommunikationsformen. Geistesgeschichtlich gesehen betreiben sie somit – synchron mit der in Thomas Manns „Doktor Faustus“ proklamierten „Zurücknahme“ und Nietzsches „Widerruf“ des anselmischen Arguments – die Zurücknahme des platonischen Höhlengleichnisses103. Allabendlich versetzen sie den Rezipienten wieder in die „hadesartige Höhle“ der Trugbilder104, mit deren Identifizierung sich die darin „Befangenen“ und Gefesselten die Zeit vertreiben. Mit dem Hadesvergleich sind aber auch weitere Zeiterscheinungen angesprochen. Fürs erste die im Hades herrschende Finsternis und Angst. Dann aber auch diejenigen, die sich die dort herrschende „Idolenszene“ zu Nutze machen, um den die Gefesselten ebenso täuschenden wie beschäftigenden Schatten ihre eigenen Projektionen, Trugbilder und Illusionen hinzuzufügen. Angesprochen ist somit der ganze „Markt der Meinungen“, nicht zuletzt aber auch das Chaos der weltanschaulichen und religiösen Angebote, in das sich zunehmend Gurus aus Ost und West einmischen. Damit ist auch die verbreitete Verunsicherung in Glaubensdingen gemeint, die sogar das Zentralgeheimnis betrifft und dem Einsickern pseudoreligiöser Motive Vorschub leistet. Im Hinblick darauf ist der von Platon beschriebene Rettungsakt von höchster Aktualität. Er besteht in einer mühevollen Umgewöhnung, die mit der Ablösung von den in ihrer Scheinhaftigkeit durchschauten Bildern beginnt, sich in die schmerzende Angewöhnung an das Tageslicht fortsetzt und in der Schau zuerst des Nachthimmels mit seinem Mond- und Sternenlicht und schließlich des Taghimmels mit der alles überstrahlenden Sonne gipfelt. Das Gleichnis schließt beziehungsvoll mit einer Anspielung auf das Schicksal des Sokrates: Wenn ein solcher nun wieder hinunterstiege und […] in der Begutachtung jener Schatten wetteifern sollte mit denen, die immer dort gefangen gewesen, während es ihm noch vor den Augen flimmert […], würde man ihn nicht auslachen und von ihm sagen, er sei mit verdorbenen Augen von oben zurückgekommen, und es lohne nicht, daß man versuche hinaufzukommen; sondern man müsse jeden, der sie lösen und hinaufbringen wollte, wenn man seiner nur habhaft werden und ihn umbringen könnte, auch wirklich umbringen?105. 102 Dazu: E. Biser, Die glaubensgeschichtliche Wende, a.a.O., S. 57 – 65: Die totale Medienwelt; ders., Der Mensch im Medienzeitalter, München 1988. 103 Dazu: E. Biser, Einweisung ins Christentum (1997), Düsseldorf 2004, S. 170ff; ferner: ders., Gottsucher oder Antichrist. Nietzsches provokative Kritik des Christentums, Salzburg 1982, S. 65 – 68: Der gleichnishafte Widerruf; S. 55 – 57: Die zentrale Dokumentation. 104 E. Hoffmann, Platon, Zürich 1950, S. 66f. 105 Platon, Politeia VII, 516e-517a, in: ders., Werke in acht Bänden, hrsg. v. G. Eigler, aus dem Griech. übs. v. F. Schleiermacher, Bd. 4: Politeia – Der Staat, Darmstadt 1971, S. 555 – 638, S. 561ff.
43
Der Zugang
Die Kirchenväter, allen voran Origenes, haben den damit gemeinten Sokrates bewundert und ihn wegen seines Todesmutes sogar mit Jesus verglichen106. Das steigert David Friedrich Strauß zu der Bemerkung, daß im ganzen vorchristlichen Altertum keine Gestalt zu finden sei, „die mehr Verwandtschaft mit Christus hätte, als die des Sokrates“107. Auch Nietzsche glaubte die Faszination des Sokrates darin entdeckt zu haben, daß er den Anschein erwecke, „ein Arzt, ein Heiland zu sein“108. Und Balthasar zeigt sich geradezu bestürzt von dem unheimlichen Durchblick, der sich in Platons Schilderung des grausamen Endes des Gerechten, „vom ersten Martyrer der Philosophie auf Golgotha hin“109, ergibt. Bei dieser Blickverengung auf die Passion wird jedoch die Gemeinsamkeit in der Lebenstat ausgeblendet. Sie besteht in der Befreiung der Menschen aus Wahnvorstellungen und Trugbildern: bei Sokrates aus den Voreingenommenheiten des Alltags, bei Jesus aus der Vorstellungswelt einer „knechtischen Religiosität“; bei Sokrates mit dem Ziel einer „docta ignorantia“, bei Jesus mit dem Hochziel der mitwissenden Gottesfreundschaft; bei Sokrates durch das seiner Grenzen bewußt gewordene Denken, bei Jesus durch den von ihm erweckten und erfüllten Glauben. Wenn dem Rechnung getragen werden soll, dann nur in Form einer Invokation, die den Notschrei, in dem die Sache des konkret existierenden Menschen Ausdruck findet, mit dem aus der „Landschaft“ der Gegenwart aufsteigenden De profundis zusammenfaßt und sich zugleich an den wendet, der allein Abhilfe schaffen kann, also in Form einer Anrufung Jesu. Ihm allein ist es gegeben, aus dem Dunkel des Hades herauszuführen, die sich in die Denkwelt der Gegenwart einnistenden Idole und Trugbilder zu vertreiben und die von diesen betriebene Wiederverzauberung durch das Licht der mit Jesus identischen Wahrheit zu überwinden. Was bei der Besinnung auf die Lazarus-Geschichte nur vermutet werden konnte, verdichtet sich jetzt zur Gewißheit. Der Befehlsruf: „Komm heraus!”, galt keinem andern, sondern ihm selbst. Und im selben Augenblick wird auch schon klar, daß diese Anrufung, so sehr sie von allen Hellsichtigen mitgesprochen werden sollte, letztlich von ihm selbst ausgehen muß. Er ist der Rufer und der Angerufene. Nur er kann dem atavistischen Zug der Zeit widerstehen und dort, wo alles in Wahn und Barbarei zurückzusinken droht, dem utopischen Gegenzug zur Vorherrschaft verhelfen. Nur er kann durch seine Utopie Hoffnung erwecken. Entspricht dem aber auch die derzeitige religiöse und insbesondere die glaubensgeschichtliche Situation?
5. Die conditio religiosa Schon ein flüchtiger Blick auf die conditio religiosa, wie sie konkret gegeben ist, zeigt dasselbe Spannungsverhältnis von Zug und Gegenzug, wenngleich in anderer Gewich106 Dazu: A. v. Harnack, Sokrates und die alte Kirche (1900), in: ders., Ausgewählte Reden und Aufsätze, hrsg. v. A. v. Zahn-Harnack u. a., Berlin 1951, S. 25–41, bes. S. 34f; ferner: E. Benz, Christus und Sokrates in der alten Kirche. Ein Beitrag zum altkirchlichen Verständnis des Märtyrers und des Martyriums, in: Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft 43 (1950/51), S. 195–224. 107 D. F. Strauß, Das Leben Jesu für das deutsche Volk bearbeitet, Leipzig 2/1864, S. 181. 108 F. Nietzsche, Götzen-Dämmerung, Das Problem des Sokrates, § 11, in: ders., KSA 6, S. 72f, S. 72. 109 H. U. v. Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, Bd. 3.1: Im Raum der Metaphysik, Einsiedeln 1965, S. 157.
44
5. Die conditio religiosa
tung. Denn der religiöse Mensch ist, wie Hans Erich Nossack mit der Erbitterung eines enttäuschten Atheisten registrierte, schon vom Begriff „religio“ her traditionsverhaftet und „rückständig“110, so daß der progressive Zug eher als Ausnahme, wenn nicht gar als revolutionärer Ausbruch erscheint. Im weiten Spektrum der Weltreligionen hat sich nur das Judentum – und in seinem Gefolge das Christentum – aus dem Bann der Rückbindung an die kosmisch-naturhaften Gegebenheiten gelöst und zur Hoffnung auf eine messianisch-endzeitliche Zukunft erhoben. Der Preis bestand in der Lockerung des Weltbezugs, der im Buch Hiob zu einem förmlichen Fluch auf die Schöpfung (Hi 3,1-16) und in den neutestamentlichen Schriften zu einer nicht weniger dezidierten Absage an die Welt in ihrer Vergänglichkeit (1Kor 7,31; 1Joh 2,17) führt. Dafür gewannen beide Religionen ein sonst nirgendwo erreichtes Verständnis der Geschichte, die sie progressiv, als einen wenngleich dramatisch bewegten Fortschritt zum Eschaton, begriffen. Wie Hans Waldenfels in seinem Werk „Begegnung der Religionen“ nachwies, griff diese Zukunftsorientierung in Gestalt des daraus abgeleiteten Säkularisierungsprozesses auch auf andere Weltreligionen, insbesondere im asiatischen Lebensraum, über111, ausgenommen das Einzugsgebiet des Islam, der sich gegenüber säkularistischen Tendenzen zunehmend resistent erwies. Stattdessen entwickelte sich der Islam, vorab im Feld seiner schiitischen Variante, zu einem Herd des Fundamentalismus, in dem der rückgewandte Zug der Religion seinen bisher aggressivsten und effizientesten Ausdruck fand. Wie das über den Verfasser der „Satanischen Verse“, Salman Rushdie, verhängte Todesurteil lehrt, bezieht sich dieser grundsätzlich auf die Absolutsetzung der die jeweilige Religion bestimmenden Autorität, also im Fall des Islam auf die des Koran, im Fall des Christentums auf die der Bibel, in ultrakonservativen Kreisen des Katholizismus auch auf die der Autorität des Papstes. Demgemäß ist im christlichen Bereich ein biblizistischer Fundamentalismus von einem ekklesialen zu unterscheiden, von dem sich als dritte Variante ein spiritueller abhebt, dem es um die Festlegung auf eine bestimmte Lebensform zu tun ist. Gemeinsam ist diesen Varianten die Verwechslung der christlichen Lehre mit einer Ideologie, also mit einem System nicht hinterfragbarer und mit einem Interpretationsverbot belegter Sätze, wie es der ideellen Selbstdarstellung totalitärer Machtsysteme entspricht. Gemeinsam ist ihnen aber auch ein mit schlechtem, aber perfekt unterdrücktem Gewissen erbrachtes sacrificium intellectus – die Fähigkeit zu dieser „Virtuosenleistung“ ist nach Max Weber „das entscheidende Merkmal des positiv religiösen Menschen“112 – das sie mit Aggressionen gegen „Andersdenkende“, insbesondere aber gegen die Vertreter der progressiven Gegenrichtung zu kompensieren pflegen. Im Fundamentalismus hat, so gesehen, der „Geist der Schwere“ methodische Gestalt gewonnen und sich zu einem innerkirchlichen Machtpotential von erheblichem Einfluß entwickelt. Bevor dem analogen Erscheinungsbild der Kirche nachgegangen werden kann, stellt sich noch die Frage nach dem Begriff des Christentums. Zwar hat Guardini in seinem Versuch über das „Wesen des Christentums“, mit dem er sich dem schon von Ludwig
110 Dazu: H. E. Nossack, Proligio. Ein Traktat über die Zukunft des Menschen, in: ders., Die schwache Position der Literatur. Reden und Aufsätze, Frankfurt a. M. 2/1967, S. 165 – 175, S. 173f. 111 Dazu: H. Waldenfels, Begegnung der Religionen. Theologische Versuche I, Bonn 1990, S. 185–212. 112 M. Weber, Wissenschaft als Beruf (1919), in: ders., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hrsg. v. J. Winckelmann, 3., erw. u. verb. Auflage, Tübingen 1968, S. 582 – 613, S. 611.
45
Der Zugang
Feuerbach und Adolf von Harnack diskutierten Thema stellte113, die Möglichkeit einer Wesensbestimmung ausdrücklich verneint, denn: Es gibt keine abstrakte Bestimmung dieses Wesens. Es gibt keine Lehre, kein Grundgefüge sittlicher Werte, keine religiöse Haltung und Lebensordnung, die von der Person Christi abgelöst, und von denen dann gesagt werden könnte, sie seien das Christliche. Das Christliche ist ER SELBST; das, was durch Ihn zum Menschen gelangt und das Verhältnis, das der Mensch durch Ihn zu Gott haben kann114. Dennoch hat sich unter der Hand eine Wesensbestimmung eingebürgert, die dessen Verständnis nachhaltiger als jede kategoriale Umschreibung prägt. Anstatt mit Guardini von einer fragenden Mitte auszugehen, ordnet diese Bestimmung das Christentum in das große Panorama der Weltreligionen ein, in welchem sie ihm einen Platz in nächster Nachbarschaft zum Buddhismus zuweist. Als hätte Guardini diese Tendenz bereits im Blick gehabt, zieht er Jesus ausdrücklich mit Buddha in Vergleich, dem er nachrühmt, wie sonst kein anderer außer Jesus, wenngleich mit diametral entgegengesetzter Tendenz, „Hand ans Sein selbst“ gelegt zu haben115. Wenn Jesus den gebrochenen Menschen dadurch heilt, daß er ihn zur Höhe der Gotteskindschaft erhebt, versucht Buddha, dessen Leidverhaftung dadurch zu begegnen, daß er den Menschen anleitet, die Kette der Ursachen zu zerreißen, den Lebenswillen in sich abzutöten, sein Selbstbewußtsein auszulöschen und so in das Nirwana einzugehen. Wo das Christentum im Widerspruch dazu dem Buddhismus zugeordnet wird, erscheint es einer unvordenklichen, bis in neutestamentliche Zeit zurückreichenden Tradition zufolge als eine ausgesprochen asketische, auf Opfer und Buße begründete Religion. Es gehört mit zur Wirkungsgeschichte Guardinis, mehr aber noch zu den Folgen eines umfassenden, mühsamen Lernprozesses, daß sich darin ein Bruch abzeichnet, der einem radikalen Perspektivenwechsel gleichkommt und auf eine Neubestimmung des Christentums drängt. In Abgrenzung von Buddhismus und Islam besagt dies: Das Christentum ist keine asketische und nomothetische, sondern eine mystische und therapeutische Religion. Freilich wird sich diese Einsicht nur gegen schwerste Widerstände Bahn brechen. Denn mit der Absage an seinen asketischen Charakter kommt, zusammen mit der Satisfaktions- und Opfertheorie, auch die ganze darauf gegründete Lebenspraxis ins Wanken. Und mit der Absage an jede Form einer Gesetzesreligion verliert das Christentum in letzter Konsequenz auch seine gesellschaftlich-politische Funktion. Denn nur als Gesetzesreligion konnte es, meist unter antipaulinischer Berufung auf den Römerbrief (Röm 13,1-7), wie Jacob Taubes nachwies116, als „staatstragende Ordnungsmacht“ ausgegeben werden. Dazu kommen die historischen Gewichte, die in die Waagschale des christlichen Asketismus fallen. Erste An113 L. Feuerbach, Das Wesen des Christentums, Leipzig 1941; A. v. Harnack, Das Wesen des Christentums. Sechzehn Vorlesungen vor Studierenden aller Facultäten im Wintersemester 1899/ 1900 an der Universität Berlin gehalten, Leipzig 1900. 114 R. Guardini, Das Wesen des Christentums (1938); Die menschliche Wirklichkeit des Herrn, in: ders., Werke, hrsg. v. F. Henrich, Sachbereich Christus und Christentum, Mainz u. a. 7/1991, S. 7 – 70, S. 68. 115 Ders., Der Herr, a.a.O., S. 360f. 116 Dazu: J. Taubes, Die politische Theologie des Paulus. Vorträge, hrsg. v. A. Assmann u. a., München 1993, S. 72 – 75.
46
5. Die conditio religiosa
sätze finden sich, abgesehen von Paulus, schon im Evangelium. So antwortet Jesus auf die an ihn gerichtete Fastenfrage mit dem Hinweis auf die in und mit ihm angebrochene Heilszeit: Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? (Mk 2,19) Im unmittelbaren Anschluß daran meldet sich die um Rechtfertigung ihrer Fastenpraxis bemühte Urgemeinde mit einer fast wörtlichen Wiederholung des Logions und folgendem Zusatz zu Wort: Es werden aber Tage kommen, da ihnen der Bräutigam entrissen wird: an jenem Tag werden sie fasten (Mk 2,20)117. Was die junge Christenheit bewog, die von Jesus angekündigte Freudenzeit mit einer Zeit des Trauerns und der Entsagung zu vertauschen, dürfte in der Amalgamierung zweier Motive zu suchen sein: einmal der jüdischen Opfervorstellung, die im selben Maß, wie sie vom Judentum nach der Zerstörung des Tempels aufgegeben wurde, bei ihr Einzug hielt und schließlich sogar das Bild des von Jesus entdeckten, verkündigten und erlittenen Gottes verschattete; sodann des gnostischen Asketismus, der im selben Maß an Boden gewann, wie die Orientierung am Kosmos verfiel und ebenso weltflüchtigen wie leibfeindlichen Tendenzen Raum gab118. In diesem Sinn versichert ein von Löwith in Erinnerung gerufenes spätantikes Fragment: Einst wird aus Überdruß der Menschen der Kosmos weder bewundert werden noch anbetungswürdig erscheinen. Dieses größte Gut in seiner Gesamtheit, das Beste, was je gewesen ist, ist, und zu schauen sein wird, es wird in Gefahr geraten. Es wird dem Menschen eine Last sein und verachtet werden119. Jetzt setzte sich, denkbar konträr dazu, die Überzeugung durch, daß sich der Christ nur durch Abstoßung dessen, was ihn an die Welt fesselte, zur Höhe des Geistig-Göttlichen erheben könne. Durch Entzug der natürlichen Eigenschaften, durch den er den Leib seiner Tiefe, Breite und Länge beraube, lehrt Klemens von Alexandrien in seinen „Stromateis“, gewinne der Christ die Stufe der Schau und die Fähigkeit, sich in die „Größe Christi“ zu versenken und sich der „Wahrnehmung des Allmächtigen“ zu nähern120. Deshalb betet die Gemeinde derer, die sich gleich Paulus der Welt „gekreuzigt“ wissen (Gal 6,14), bei jedem Gottesdienst: Es komme Gnade und vergehe die Welt […], Komm, Herr, amen121. 117 Dazu: L. Schenke, Die Urgemeinde, a.a.O., S. 171f; S. 275. 118 Dazu: E. Biser, Einweisung ins Christentum, a.a.O., S. 93 – 110. 119 Zitiert nach: K. Löwith, Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis zu Nietzsche, Göttingen 1967, S. 15f. 120 Klemens von Alexandrien, Teppiche. Wissenschaftliche Darlegungen entsprechend der wahren Philosophie (Stromateis) V 71,2-3, aus dem Griech. übs. v. O. Stählin (BKV, 2. Reihe, Bd. 19), München 1937, S. 180f. 121 Die Didache, Kap. 10,6, in: K. Berger u. C. Nord, Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, a.a.O., S. 308.
47
Der Zugang
Wie stark sich diese Einschätzung über die Jahrhunderte hinweg durchhielt, zeigt die Ansicht Jacob Burckhardts, daß sich die „radikale Veränderung in den Gedanken und Herzen der Menschen“, die mit dem Zusammenbruch der antiken Welt einherging und „vom fortschrittlichen Optimismus zum asketischen Pessimismus“ führte122, heute nochmals ereignen und eine Wiedergeburt des „asketischen Menschen“ ermöglichen könne. Deshalb bestehe die einzige, dem Christentum noch verbleibende Chance in der Rückbesinnung auf „seine Grundidee vom Leiden dieser Welt“ und in der Rückkehr zu seinem asketischen Charakter, denn die Geschichte lehre, daß es immer dann auf seiner Höhe stand, „wenn es sein Anderssein gegenüber der weltlichen Kultur behauptete123. Gemessen an diesem Gewicht wird die Gegenperspektive nur durch einen gewaltigen Kraftakt zu gewinnen sein. Doch ist sie zu gewinnen, weil es darum geht, mit der Freudenbotschaft Jesu gleichzuziehen. Wer sich darum bemüht, hat diese Botschaft und mit ihr zusammen den auf seiner Seite, der nach unverkennbaren Anzeichen in neuer Selbstvergegenwärtigung begriffen ist, so daß auch aus dieser Sicht alles für seine Anrufung spricht. Ein erster Schritt ist aber bereits mit dem Umbruch im Begriff des Christentums getan. Denn die Geschichte lehrt ebenfalls, daß bislang noch alle tiefgreifenden Veränderungen der menschlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse mit einem Bewußtseinswandel begannen. Das gegenwärtige Kirchenbild stellt sich wie eine Konkretisierung dieser gegensinnigen Begriffsbestimmungen dar. Auf der einen Seite strebt die Kirche, wie nur in den großen Wendezeiten ihrer Geschichte, ihrer ureigenen Zukunft, dem durch sie kommenden Gottesreich, entgegen. Auf der anderen Seite fällt sie in zahlreichen Erscheinungen auf Positionen vor dem Zweiten Vatikanum zurück. So stehen sich zwei Modelle in ständig schärferer Polarisierung entgegen. Und es hat augenblicklich nicht den Anschein, als bestehe noch Aussicht auf einen versöhnenden Ausgleich. Zu stark driften die jeweiligen Konzeptionen auseinander: hier das Konzept des monolithisch im Strom der Zeit stehenden und ihm kraft seiner Sendung und der Festigkeit seines Gefüges trotzenden Gottesbaus, dort das Bild der ihrem Vollbewußtsein entgegenreifenden Glaubensgemeinschaft124. Wie schon diese knappe Charakteristik erkennen läßt, stützen sich beide Konzepte auf dieselbe Basis, den Epheserbrief, der unter den neutestamentlichen Schriften die am weitesten ausgearbeitete Ekklesiologie bietet. Rudolf Schnackenburg, der das Kirchenbild des Briefs besonders sorgfältig nachzeichnete125, nähert sich ihm in zwei Schritten: zunächst über das Motiv der Einwohnung Christi in den Herzen der Glaubenden (Eph 3,17), das bei dem Württembergischen Reformator Johannes Brenz zur Identifizierung Jesu mit dem „inneren Menschen“ – fraglos eine Variante des beim frühen Augustinus auftauchenden Bildes des „inwendigen Lehrers“ – und im Gefolge Adolf Deissmanns bei Alfred Wikenhauser zum Begriff einer „Christusmystik“ führte126. Sodann über die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Judentum, der er durch alle Stufen und Abstürze der Deutungsgeschichte nachgeht127. 122 Nach: K. Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, in: ders., Sämtliche Schriften, Bd. 2, a.a.O., S. 7 – 240, S. 30 – 41: Burckhardt, S. 33. 123 A.a.O., S. 40. 124 Dazu: E. Biser, Glaubensprognose, a.a.O., S. 160 – 168: Die Erblast der Versäumnisse: Das unaufgearbeitete Konzil. 125 Dazu: R. Schnackenburg, Der Brief an die Epheser, a.a.O., S. 299 – 319. 126 A.a.O., S. 329 – 332. 127 A.a.O., S. 332 – 336.
48
5. Die conditio religiosa
Als erstes bietet sich das vom kirchlichen Institutionsdenken jeder Zeit favorisierte Bild des nach Eph 2,20ff „auf das Fundament der Apostel und Propheten“ gegründeten und durch Christus als Grund- und Schlußstein zusammengehaltenen Gottesbaus an. Dabei fand Klemens von Alexandrien die glücklichste Lösung der Frage nach der genaueren Funktion des zusammenhaltenden Steins, als er sie mit der These beantwortete: Christus aber ist beides, die Grundlage und der darauf errichtete Bau, da durch ihn sowohl der Anfang als auch das Ende ist128. In der die Kirchen spaltenden Frage, welche von ihnen auf das vom Epheserbrief beschriebene Fundament begründet sei, wurde der Doppelbegriff „Apostel und Propheten“ seit der Reformation unterschiedlich akzentuiert, freilich nie so, daß die apostolische Gründung, wie es nahegelegen hätte, der katholischen Kirche und die prophetische den Kirchen der Reformation zugesprochen worden wäre, obwohl sich schon früh die Einsicht durchgesetzt hatte, daß mit den „Propheten“ nach 1Kor 12,28 nur die neutestamentlichen „Geistträger“ gemeint sein konnten129. Dem fügt der Epheserbrief in großartiger Antithese das dynamische Bild der von der durch die unterschiedlichen „Dienstleistungen“ der Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer auferbauten Kirche hinzu, die als lebendige „Einheit des Glaubens“ ihrem Vollalter, dem „vollkommenen Mannesalter des Gottessohnes“ entgegenreift (Eph 4,7-16)130. Kaum einmal wird der Glaube so sehr an das kollektive Subjekt der Glaubensgemeinschaft gebunden wie hier, zumal das den Leser einbeziehende „Wir“ keinen Zweifel an dieser übergreifenden Sicht aufkommen läßt. Und nirgendwo wird deutlicher gesagt, daß der Sinn des Glaubens in der wachsenden Erkenntnis des Gottessohnes besteht, der, wie die Stelle zumindest ahnen läßt, in diesem Reifeprozeß zugleich zu sich selbst erwacht. Heute geht der Riß freilich schon lange nicht mehr durch die Konfessionen, die in leidvoller Erfahrung zu der Einsicht gelangten, daß sie, ungeachtet ihrer jeweiligen Zuordnung zu den Aposteln und Propheten, letztlich auf den gegründet sind, außer dem nach 1Kor 3,11 kein anderer Grund gelegt werden kann. Heute geht der Riß vielmehr nach Art eines vertikalen Schismas quer durch die bisher Getrennten, und dies im Sinne der beiden, jetzt aber gegen die Intention des Epheserbriefs polarisierten Kirchenbilder. Während sich die Kirchenspitze, offensichtlich auch im Bereich der reformatorischen Kirchen, auf das statuarisch-autoritäre Modell festlegt, nimmt das davon irritierte Kirchenvolk zunehmend seine Zuflucht zu dem dynamischen Gegenmodell, wobei ihm freilich mehr die ihm zugestandenen Rechte als die damit verbundenen Aufgaben und Zielsetzungen vor Augen stehen. Dabei treten zunehmend divergierende und trotz aller Aufrufe zu einem „innerkirchlichen Ökumenismus“ kaum noch auszugleichende Grundentscheidungen zutage. Kennzeichnend für das ekklesiale Modell ist ein Wahrheitsanspruch, der sich vom Ursprung im göttlichen Offenbarungswort auf die lehramtliche Vermittlung verlagerte, so daß das Lehramt als die letzte, nicht mehr zu hinterfragende Instanz einer mehr verwalteten als zugesprochenen Wahrheit erscheint. Dem entspricht die „deduktive“ Deutung des Kommunikationsprozesses. Entscheidend ist in dieser Sicht der Spruch der 128 Klemens von Alexandrien, Teppiche (Stromateis) VII 55,5, a.a.O. (BKV 2. Reihe, Bd. 20), S. 61. 129 Dazu: R. Schnackenburg, Christus, Geist und Gemeinde (Eph 4,1-16), in: B. Lindars u. a. (Hgg.), Christ and Spirit in the New Testament, Cambridge 1973, S. 279 – 296, S. 293f. 130 Dazu: Ders., Der Brief an die Epheser, a.a.O., S. 171 – 196.
49
Der Zugang
Kirchenspitze, dem auf Seiten des Kirchenvolkes ein durch „kindlichen Gehorsam“ geprägtes Rezeptionsverhalten entspricht. Daß zu einer echten Kommunikation auch die Möglichkeit der Rückäußerung gehört, da der Sprecher erfahren muß, wie sein Wort jeweils aufgenommen wird – ob mit Zustimmung, Kritik oder Skepsis –, bleibt in diesem Modell ebenso ausgeblendet wie die fundamentale Tatsache, daß alledem ein unhaltbares Theoriemodell zugrundeliegt. Denn in der christlichen Glaubensgemeinschaft gibt es keine „passiven Mitglieder“, sondern nur eine gemeinsame, wenngleich hierarchisch gestufte Partizipation an der einen Wahrheit, die allen zusammen gegeben ist. Hier setzt das „dialogische“ Gegenmodell ein, das, genauer besehen, von zwei Grundgedanken getragen ist: einmal vom Gedanken der Transparenz der Wahrheitsvermittlung, der davon ausgeht, daß im christlichen Glauben die Inhalte immer nur im Modus des Zugesprochenseins gegeben sind, und daß deshalb der Spruch des Lehramts dem Kriterium der „Durchhörbarkeit“ unterliegt. Gehorsame Zustimmung verdient danach nur das, was von dem in Schrift und Tradition verlautbarten Offenbarungswort abgedeckt ist. Dem korrespondiert der Gedanke der aktiven Partizipation des Kirchenvolks, der in dessen kreativer und nicht nur rezeptiver Beteiligung an der kirchlichen Wahrheitsfindung kulminiert. Das schließt die Anerkennung des als höchste Vermittlungsinstanz begriffenen Lehramts durchaus mit ein. Doch verbindet sich mit diesem Gegenmodell inzwischen ein so hohes Protestpotential, daß auch von dieser Seite ein Brückenschlag kaum noch zu erhoffen ist. Wenn eine Lösung der Krise gelingen soll, dann nur auf dem Weg einer Analyse, die das divergierende Kirchenbild in den größeren Rahmen der glaubensgeschichtlichen Situation hineinstellt und aus dieser zu begreifen sucht. Als unumgängliche Vorfrage stellt sich die nach der Verfassung des durch die Tendenzkräfte der Gegenwart eher geschwächten als stimulierten religiösen Sinnes. Denn der Mensch ist heute durch den Verfall der „geistigen Gehäuse“ und den wachsenden Informationsdruck den umlaufenden Meinungen und Beeinflussungen stärker ausgesetzt als in den durch soziale Schichtung und geistige Barrieren gekennzeichneten vergangenen Epochen. Erheblich gesteigert wird diese Anfälligkeit noch durch die extremen Belastungen dieses Jahrhunderts, die, wie bereits deutlich wurde, das Selbstverhältnis des Menschen in Mitleidenschaft zogen. Mit dem Menschen selbst änderte sich aber unvermeidlich auch dessen Verhältnis zum Numinosen und Heiligen. Im Anschluß an Augustinus unterschied Rudolf Otto in diesem Verhältnis bekanntlich zwei miteinander verspannte Komponenten, die das Heilige zugleich als das mysterium tremendum und fascinosum erscheinen lassen131. Inzwischen verlagerte sich diese Sachbestimmung offensichtlich zunehmend auf den religiösen Akt. Während das Moment des Schreckens auf den Menschen selbst zurückschlug, so daß er mehr noch vor sich selbst als vor Gott erschrickt, verlor er fast völlig die Fähigkeit, sich für etwas, und wäre es das Göttlich-Größte, zu begeistern. Darin stand Augustinus’ Vorwegnahme des Bestimmungsversuchs der heutigen Stimmungslage fühlbar näher, besonders in der klassischen Formulierung seines Bekenntniswerkes: Was ist das da, das mir entgegenleuchtet und mein Herz trifft, ohne es zu verletzen, so daß ich erschaudere und erglühe – erschaudere, insoweit ich ihm unähnlich, und erglühe, insoweit ich ihm ähnlich bin?132 131 Dazu: R. Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, Breslau 8/1922, S. 54f. 132 Augustinus, Bekenntnisse XI, 9, a.a.O. (BKV, 1. Reihe, Bd. 18, VII), S. 244f.
50
5. Die conditio religiosa
Danach war es gerade dieser auf das Selbstgefühl zurückgeschlagene Schrecken, der in Form der den heutigen Menschen umtreibenden Lebensangst zwar nicht den Enthusiasmus, es sei denn in dessen anfänglichster Form, wohl aber das stürmische Verlangen nach Halt und Rettung in ihm weckte. Unversehens kommt damit die De-profundis-Struktur in der conditio religiosa, wie sie heute gegeben ist, zum Vorschein; ins Theoretische gewendet: ein Verhältnis, wie es einer sich realisierenden Utopie oder, theologisch gesehen, dem anselmischen Argument zugrundeliegt. Noch wichtiger ist jedoch der Einblick in die Glaubenssituation, wie er sich nunmehr ergibt. Wie angedeutet, ist auch die Glaubenssituation durch die Dialektik gekennzeichnet, wie sie sich im Blick auf das Zeitgeschehen, die Verfassung des Menschen und die religiöse Situation ergab. Gleichzeitig ist jedoch ein deutlicher Unterschied zu verzeichnen. Während sich bei den durchschrittenen Feldern die gegensätzlichen Pole unüberbrückt gegenüberstanden, lösen sie hier eine Bewegung aus, die nur mit dem Begriff „Glaubenswende“ zulänglich beschrieben werden kann. Nicht zuletzt besteht darin der Grund für die Hoffnung, daß von hier, dem aktuellen Glaubensgeschehen aus, die bestehenden Spannungen gelöst und die durch sie entstandenen Konflikte aufgearbeitet werden können. Daß das Feld des Glaubens in Bewegung gekommen ist, ergibt sich vor allem aus der in ihm aufgetretenen Ungleichzeitigkeit, die sich, merkantil ausgedrückt, in einem Mißverhältnis von Angebot und Nachfrage darstellt. Es entspricht einem nach der Reformation einsetzenden Funktionswandel, wohl aber auch der Eigengesetzlichkeit des ekklesialen Modells, daß die lehramtlichen Äußerungen eine zunehmend moralische Kopflastigkeit aufweisen. Nachdem die dogmatische Einheit, die schon in der christlichen Antike wiederholt in Frage stand, durch die Glaubensspaltung definitiv zerbrochen war, zog das keineswegs das zu befürchtende Ende des abendländischen Christentums nach sich. Vielmehr wuchs der Kirche eine neue und, mit Hans Küng gesagt, das „Weltethos“ betreffende Aufgabe zu: Sie wurde zur Stimme des Weltgewissens. Wenn sie sich zu aktuellen Zeitfragen, zu politischen und sozialen Notständen äußerte, ging es vorwiegend um das Interesse der Friedensicherung, des wirtschaftlichen Ausgleichs und der sozialen Gerechtigkeit. Aus unterschiedlichen Gründen, bei denen die Schärfung des verebbenden Sündenbewußtseins die Hauptrolle spielte, ging es dem nach innen gerichteten Wort des Lehramts dann aber vorrangig um Fragen der Sexualethik. Da das öffentliche Bewußtsein aber immer noch im Begriff steht, sich aus der kollektiven Sexualneurose der Vorzeit zu befreien, kam es auf diesem Feld zu einem der schwersten Konflikte der Kirchengeschichte, der den Vergleich mit den dogmatischen Kämpfen der Frühzeit aushält und in seinen Folgen noch nicht abzuschätzen ist. Sicher ist nur, daß hier das Epizentrum des großen Bebens liegt, das die Kirche in ihrem Gesamtgefüge erzittern läßt und eine bisher nicht gekannte Entfremdung zwischen Spitze und Basis – das „vertikale Schisma“ – heraufbeschwört133. Daß hier auch das „Gewicht“ zu suchen ist, das die „Schwere“ des Ungeistes ausmacht, der das kirchliche Leben in jeder Weise belastet, bedarf kaum der Erwähnung. Die damit heraufbeschworene Ungleichzeitigkeit wird jedoch erst aus der Gegenbewegung erhellt, in welcher der Christenglaube – quer durch die Konfessionen – seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts und allgemein fühlbar seit dem Zweiten Vatikanum begriffen ist. Ihren programmatischen Ausdruck fand diese Gegenbewegung in dem prophetischen Rahnerwort, der Christ der Zukunft werde ein Mystiker sein oder er werde 133 Dazu: E. Biser, Glaubensprognose, a.a.O., S. 196 – 203: Das vertikale Schisma.
51
Der Zugang
überhaupt nicht sein134. Geradezu spiegelbildlich verhielt sich dazu die Christentumskritik Nietzsches, die sich am klarsten in dem „Durchblick“ äußert, die ihm gegen Ende seiner „Genealogie der Moral“ gelingt. Danach unterliegt das Christentum gleich allen großen Kulturgestalten dem Gesetz der Selbstaufhebung. Nachdem es zunächst „als Dogma“ zugrundegehen mußte, und zwar „an seiner eigenen Moral“, muß es nun auch „a l s M o r a l noch zu Grunde gehen“135, und jetzt an seinem Willen zu unbedingter Wahrhaftigkeit, in der es sich schließlich gegen seine eigenen Voraussetzungen wendet: Nachdem die christliche Wahrhaftigkeit einen Schluss nach dem anderen gezogen hat, zieht sie am Ende ihren s t ä r k s t e n Schluss, ihren Schluss g e g e n sich selbst136. Instinktsicher hatte Nietzsche in der Hellsichtigkeit seines Hasses diese Schlagseite wahrgenommen, die das Schiff der Kirche zum Kentern zu bringen drohte: die Kopflastigkeit einer zur Moral hin verlagerten Heilsbotschaft. Und nicht weniger treffsicher machte er für den von ihm erhofften Untergang einen kritisch verengten und als solchen gegen die eigenen Fundamente gewendeten Wahrheitsbegriff verantwortlich. Vieles spricht dafür, daß ihm dabei der Religionsunterricht in Schulpforta vor Augen stand, der ihn mit den negativen Auswirkungen der historisch-kritischen Methode bekannt gemacht hatte. Nachdem diese, so Nietzsches Schulfreund Paul Deussen, in Schulpforta an den Klassikern eingeübt worden sei, habe sie sich ganz von selbst „auf das biblische Gebiet übertragen“ und so die Gläubigkeit „untergraben“137. Fühlbar wurde dieser Umschwung am nachhaltigsten in der sich rapide wandelnden Glaubenserwartung, die der jahrhundertelang herrschenden geradezu diametral entgegensteht. Richtete sich jene – bei gleichzeitiger Geringschätzung der irdischen Wohlfahrt – auf das jenseitige Heil und auf eine möglichst plastische und im Fall des Unheils auch möglichst drastische Veranschaulichung der jenseitigen Bereiche, so geht es der heutigen Glaubenserwartung vor allen Dingen um die Bewältigung der diesseitigen Existenznot und der sich epidemisch ausbreitenden Lebensangst. Nicht die Vertröstung auf das Jenseits, sondern Hilfe, Ermutigung und Bestärkung im Diesseits ist ihr vorrangig. Weil sich der Glaubende zunehmend des Synergismus bewußt wird, in dem er, wie Guardini in seiner nachgelassenen Schrift „Die Existenz des Christen“ betonte138, mit anderen, ihm womöglich räumlich und zeitlich Fernstehenden, begriffen ist, folgt im Deutlichkeitsgrad auf die Glaubenserwartung eine nicht minder gewandelte Glaubensvermittlung. Lag der bisher praktizierten das – nach Joseph Ratzinger überlebte – Instruktionsmodell zugrunde, so bricht sich zunehmend die Erkenntnis Bahn: Wir werden zum Glauben bewogen, nicht erzogen139.
134 Dazu nochmals: K. Rahner, Zur Theologie und Spiritualität der Pfarrseelsorge, in: ders., Schriften zur Theologie, Bd. 14, a.a.O., S. 161. 135 F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral III, § 27, in: ders., KSA, Bd. 5, S. 408 – 410, S. 410. 136 Ebd. 137 P. Deussen, Erinnerungen an Friedrich Nietzsche, Leipzig 1901, S. 4. 138 R. Guardini, Die Existenz des Christen, hrsg. aus d. Nachlaß, München u. a. 2/1977, S. 409. 139 Dazu: E. Biser, Bewogen, nicht erzogen. Der aktuelle Weg der Glaubensvermittlung, in: Archiv für Religionspsychologie 20 (1992), S. 59 – 66.
52
5. Die conditio religiosa
Daß sich das alte Modell überlebt hat, hängt zweifellos damit zusammen, daß es sich einseitig am Lehrbegriff des Christentums orientierte und dadurch der Tendenz Vorschub leistete, die Vermittlung im Stil einer Indoktrination zu betreiben. Doch der Wahrheit des Evangeliums wird nur eine insinuative Vermittlung gerecht. Jesus vermittelte sie, indem er die Menschen in den Bann seiner Persönlichkeit zog. Was er ihnen zu sagen hatte und was er von ihnen forderte, war in diesem übersprachlichen „Wort“ bereits mitgesagt. Und Paulus ging es bei allem, was er zur lehrhaften Gestaltung der Botschaft beigetragen hatte, letztlich doch immer nur darum, daß Christus in seinen Adressaten Gestalt gewinne (Gal 4,19). Wenn die heutige Glaubensvermittlung den Ballast des Instruktionsmodells abzuwerfen und sich auf dieses allein gültige Vorbild einzustimmen sucht, wird sie ihre Zuflucht zu Paradigmen des vorgelebten und sich suggestiv vermittelnden Glaubens nehmen müssen. Auf der Suche nach diesem „gelebten“ Glaubenszeugnis wird sie sich aber auch die von der Kunst in überwältigender Fülle gebotenen Zeugnisse nicht entgehen lassen. Vor allem aber wird sie sich darauf besinnen müssen, daß der Glaube aus dem stellvertretenden und teilnehmenden Dienst erwächst, den sich die Glaubenden gegenseitig, bewußt oder unbewußt, erweisen: bewußt im Erweis von Wort und Liebe, unbewußt in der Lebens- und Leidensgemeinschaft, in der sie miteinander stehen. Schon hier wurde deutlich, daß das entscheidende Kriterium der Glaubenswende darin besteht, daß der Glaube, der lange genug als Forderung und Pflicht empfunden wurde, zusehends ein menschliches Gesicht gewinnt. Das hat ursächlich mit der „anthropologischen Wende“ zu tun, die Gerhold Becker als den „Generalansatz“ in der „gegenwärtigen theologischen Landschaft“ bezeichnete140. Sie läßt sich in letzter Vereinfachung auf den Satz zurückführen, daß in jeder Aussage über Gott der Mensch mitgesagt ist. Daraus erklärt sich nun auch der Wandel in Sachen der Glaubensbegründung und des Glaubensbegriffs. Stützte sich die Begründung im Sinn des fundamentaltheologischen Beweisgangs auf eine Verkettung von Argumenten, in denen es um das Dasein Gottes, die Wünschbarkeit einer Offenbarung, um deren tatsächliches Ergangensein im Wort der Propheten und im Lebenswerk Jesu und schließlich um die Stiftung seiner Kirche geht, so bindet der heutige Christ seine Glaubensbereitschaft an das, was Rahner unter der „Mystik “ der kommenden Glaubensform verstand: Gott zu erfahren. Dahinter verbirgt sich ein subtiles, aber ganz entscheidendes Interesse. Denn „Gründe“ gleich welcher Art liegen ihrem Wesen nach „zurück“. Der Christenglaube aber untersteht, wie im Blick auf Drewermann bereits deutlich wurde, der sich ständig vertiefenden Einsicht, daß ihm letztlich nur durch einen präsentischen Beistand geholfen werden kann. Und darauf zielt der „Christ von morgen“, sofern es ihm um Gotteserfahrung zu tun ist. Demgegenüber zeigt sich die Vermenschlichung im Glaubensbegriff darin, daß sich die strenge Physiognomie des Gehorsams zu der „ansprechenden“ des Verstehens lichtete. Abgesehen von der Eigenbewegung des Glaubens, die auf diesen Wandel hinwirkte, war das auch die Folge der umfassenden Autoritätskrise, die eine Neubestimmung der auctoritas des Offenbarungsgottes erzwang. Auf einem Höhepunkt seiner „philosophischen Hermeneutik“ zeigte Gadamer, daß Autorität „ihren letzten Grund nicht in einem Akte der Unterwerfung und der Abdikation der Vernunft, sondern in einem Akt der Anerkennung und der Erkenntnis“ hat141. Im Hinblick auf die sich im Offenbarungsakt 140 G. Becker, Theologie in der Gegenwart. Tendenzen und Perspektiven, Regensburg 1978, S. 108. 141 H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, in: ders., Gesammelte Werke, Bd. 1: Hermeneutik, 5., durchges. u. erw. Aufl., Tübingen 1986, S. 281 – 290: Die Rehabilitierung von Autorität und Tradition, bes. S. 284.
53
Der Zugang
bekundende Gottesautorität besagt dies, daß Jesu Autorität nicht die des Allmächtigen ist – abgesehen von der Apokalypse heißt Gott in den neutestamentlichen Kernschriften nur ein einziges Mal, und auch hier im Kontext eines sinnstörenden Einschubs, „Pantokrator“ (2Kor 6,18) –, sondern die des „Lehrers“, der den Menschen das für dessen Heil und Selbstfindung Wesentlichste zu sagen hat: sich selbst! In diesem Sinn hat der Glaube – mit Gadamer gesprochen – „überhaupt nichts mit Gehorsam“ zu tun142. Zwar ist ihm nach wie vor das Autoritätsmoment eingestiftet, jedoch nach Art einer „Vorgabe“, die den Prozeß des Verstehens in Gang setzt. Denn dies intendiert der Schlüsselsatz, mit dem der johanneische Jesus die Seinen vom Stand der unwissenden Knechtschaft zu dem der mitwissenden Freunde erhebt: Nicht mehr Knechte nenne ich euch; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Freunde habe ich euch genannt, weil ich euch alles gesagt habe, was mir von meinem Vater mitgeteilt worden ist (Joh 15,15)143. Glaube als ein sich lebenslang vertiefendes Gott-Verstehen, darauf bewegt sich der gewandelte Glaubensbegriff zu. Aber könnte er das, ohne von außen und innen bewegt zu sein? Daß dabei epochale Rahmenbedingungen ins Spiel kommen, daß der in Bewegung geratene Glaube somit auch vom Zeitgeschehen ergriffen ist, steht nach der Sichtung des Umfelds außer Frage. Doch worin besteht die Achse, um die sich die Glaubenswende insgesamt bewegt? Worin ist ihr innerer Antrieb zu suchen? Das klärt sich in dem Spiegel, der das Glaubensgeschehen von Anfang reflektiert, der Theologie. Das Panorama der Gegenwartstheologie bietet insofern ein verwirrendes Bild, als sie von innen bewegt ist, ohne gleichzeitig vom Zeitgeschehen wirklich ergriffen zu sein. Als prototypisch kann dafür das „Triptychon“ Hans Urs von Balthasars gelten, dem zwar die prospektive Kategorie der Ästhetik zugrundeliegt, das aber gleichzeitig auf einer restaurativen Ausgangsposition beharrt und dadurch einem tragischen Selbstwiderspruch verfällt144. Zwar werden periphere Positionen geschleift; doch verweigert es sich gleichzeitig der Rezeption dessen, was in glaubens- und theologiegeschichtlicher Hinsicht „an der Zeit“ war. So zog die Gegenwartstheologie zwar die entscheidende Konsequenz aus dem als ihre große Inspirationsquelle begriffenen Zweiten Vatikanum; was aber die Fühlung mit dem aktuellen Zeitgeschehen betrifft, so verfielen die Theologen in ein ähnlich betroffenes Schweigen wie die mit der Verarbeitung des „zerstörten Traumes“ befaßten Literaten und die der postmodernen Ratlosigkeit verfallenen Philosophen. Umso erstaunlicher ist der seit längerem beobachtete Prozeß der Selbstkorrektur, der, vereinfachend gesprochen, dazu führte, daß die Theologie die auf dem Weg zur Gewinnung ihrer Systemgestalt abgestoßenen Dimensionen zurückzugewinnen suchte: als ihre, wie man mit Nietzsche sagen könnte145, „schönste Apologie“. Um die Wiedergewinnung der sozialen Dimension und des Wissens um die kollektive Verfassung des Glaubenssubjekts geht es der von Moltmann und Metz entworfenen und in der lateinamerikanischen 142 A.a.O., S. 285. 143 Dazu: R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, Teil 3: Kommentar zu Kap. 13 – 21 (Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Bd. 4.3), Freiburg i. Br. 1975, S. 125f. 144 Dazu: E. Biser, Dombau oder Triptychon. Zum Abschluß der Trilogie Hans Urs von Balthasars, in: Theologische Revue 84 (1988), Sp. 177 – 184. 145 F. Nietzsche, Nachgelassenes Fragment 12 [34], in: ders., KSA 9, S. 582.
54
6. Die Neuentdeckung
Befreiungstheologie zu weltweiter Wirkung gelangten Politischen Theologie; um die Wiedergewinnung der ästhetischen Dimension dem Triptychon Balthasars und der theologischen Symbolik Drewermanns; und um die Wiedergewinnung der Dimension des heilenden Heils der sich erst allmählich ausgestaltenden therapeutischen Theologie146. Dieser horizontalen Erweiterung entspricht eine vertikale Vertiefung, sofern die „Grundkurs-Idee“ Karl Rahners – wie Max Seckler glaubhaft zu machen suchte147 – der Ausarbeitung einer „sapientialen Theologie“ und damit der Wiedergewinnung des weisheitlichen Fundamentalansatzes galt. In einem gebrochenen Verhältnis zum Zeitgeschehen steht aber auch die evangelische Theologie, sofern sie mit Wolfhart Pannenberg und Eberhard Jüngel auf der Unverzichtbarkeit der Rechtfertigungslehre besteht oder doch mit Ulrich Wilckens dafür plädiert, daß der weithin verdunkelte Horizont der Rechtfertigung in gemeinsamem und redlichem Bemühen zurückgewonnen werden müsse148. Dabei hatte Günter Rohrmoser schon vor Jahren gefragt, ob der Mensch der Gegenwart überhaupt noch von der Frage Luthers: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?, und damit von der existentiellen Prämisse des Rechtfertigungsgedankens erreicht werde149. Und das mit Recht, denn die in ihrem Tiefgang noch längst nicht voll begriffene Autoritätskrise hatte mit dem „Pantokrator“ auch den göttlichen Gesetzgeber und strafenden Richter getroffen und als deren subjektives Pendant den Schwund des Sündenbewußtseins, gestützt auf das Gefühl einer umfassenden Exkulpierung – aber auch auf die Rückfrage der modernen Theologie nach dem Todesverständnis Jesu –, nach sich gezogen. In dieser Frage kam es zu einem seltsamen Schulterschluß zwischen katholischem Lehramt und evangelischer Theologie. Beide werden lernen müssen, sorgsamer als bisher auf die Zeichen der Zeit und deren oft verblüffende Widerspiegelung im biblischen Wort zu achten. Und am Anfang dieses Lernprozesses wird die Erkenntnis stehen müssen, daß gerade die am schwersten deutbaren dieser Zeichen nicht vom Zeitgeist, sondern vom „Finger Gottes“ an die Wand des Zeitalters geschrieben wurden.
6. Die Neuentdeckung Das glaubensgeschichtliche Zentralereignis, auf das die Theologie mit erstaunlicher Einfühlungskraft und Kreativität einstimmte, kann nicht ohne Berücksichtigung des Gegenmotivs gewürdigt werden. Denn die „Auferstehung“ des Sohnes in Gestalt der Neuentdeckung Jesu hatte den „Tod“ des Vaters zur Voraussetzung, konkret ausgedrückt: die Destruktion des durch die Attribute der Allmacht, Gerechtkeit und Barmherzigkeit ge146 Dazu in Auswahl: E. Biser, Theologie als Therapie (1985), unveränd. Nachdr., Norderstedt 2002; ders., Kann Glaube heilen?, in: Meditation 21 (1995), S. 13 – 17; ders., Aufriß einer therapeutischen Theologie, in: Geist und Leben 70 (1997), S. 199 – 209. 147 M. Seckler, Das eine Ganze und die Theologie. Fundamentaltheologische Überlegungen zum wissenschaftstheoretischen Status der Grundkurs-Idee Karl Rahners, in: E. Klinger u. a. (Hgg.), Glaube im Prozeß. Christsein nach dem II. Vaticanum, Freiburg i. Br. 1984. S. 826 – 852. 148 Dazu: G. Wenz, Die Rechtfertigungslehre als articulus stantis et cadentis ecclesiae, in: ders., Grundfragen ökumenischer Theologie. Gesammelte Aufsätze, Bd. 1, Göttingen 1999, S. 75 – 89. 149 G. Rohrmoser, Geistige Wende, warum?, Mainz 1984, S. 67; ferner: E. Biser, Das Spiegelkabinett. Wohin führt die Rechtfertigungsdebatte?, in: Stimmen der Zeit 216 (1998), S. 375 – 385.
55
Der Zugang
prägten Gottesbildes. Die von Freud beobachtete Konstituierung des irdischen „Prothesengottes“, der mit Hilfe der modernen Hochtechnik göttliche Attribute an sich riß, hatte somit ein „Vorspiel im Himmel“, das mit Nietzsches Proklamation des Todes Gottes einsetzte, sich in Freuds martialischer These vom Vatermord zugunsten der Erhebung des Sohnes fortsetzte und sich – vermittelt durch Ernst Bloch, Erich Fromm und die Vertreter der Gott-ist-tot-Theologie – noch in der von Hans Jonas „mit Furcht und Zittern“ in Gang gesetzten Gotteskritik nach Auschwitz widerspiegelt150. Was sich in diesem Prozeß abspielte, war die ein Jahrhundert überschreitende Bestätigung dessen, was Buber bereits an den Romangestalten Dostojewskijs abgelesen hatte: „ein Sichklammern an den Sohn unter Ablehnung des Vaters“151. Es bleibe dahingestellt, ob damit mehr als der dunkle Hintergrund der Neuentdeckung aufgerissen wurde und ebenso, ob Buber mit seinem Satz am Ende eine verborgene Ader der glaubensgeschichtlichen Entwicklung berührte; fest steht, daß der Vorgang als solcher nur als Konsequenz des vom Zweiten Vatikanum entwickelten Offenbarungsbegriffs zu erklären ist. Hatte das Erste Vatikanum die Gottesoffenbarungen noch in der „Veröffentlichung göttlicher Dekrete“ gesehen, so ist nach der Konstitution „Dei Verbum“ deren „Sinn“ der Offenbarer selbst, und er in der Vielfalt seiner Selbstdarstellungen: in seinem Reden ebenso wie in seinem Schweigen, in seinem Handeln ebenso wie in seinem Leiden, zumal aber im Ereignis seiner Auferstehung und in der Totalität seiner Lebenswirklichkeit. Im Grunde war damit der Grundriß des christologischen Neuansatzes geboten, der in der Jesusliteratur der beginnenden Siebzigerjahre auf geradezu eruptive Weise Gestalt gewann152. Bemerkenswert ist zunächst schon die Synchronizität des Vorgangs, der nicht zufällig auf dem Höhepunkt der Studentenrevolte einsetzte, die ihrerseits, im Kontext des Weltbegriffs gesehen, mit ihrer extrem gesellschaftspolitischen Ausrichtung im diametralen Gegensatz zur triumphalsten Leistung der modernen Hoch-[Technik …153].
7. Der inwendige Lehrer Kaum einmal war der Verfasser des Essays „Der Atem des Geistes“, Eugen RosenstockHuessy, so sehr von diesem Atem berührt, wie bei der Wiederentdeckung der Frühschrift „De magistro“, mit der sich Augustinus von seinem Beruf als Rhetor verabschiedete und zugleich seinem früh vollendeten Sohn Adeodat ein literarisches Denkmal setzte154. Im Kern des Dialogs geht es der Auskunft des Interpreten zufolge um die Entmachtung des Lehrers, sofern dieser die Herrschaft über die Wahrheit beansprucht. Stattdessen besteht 150 H. Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme (1984), Frankfurt a. M. 1987, S. 7. 151 M. Buber, Zwei Glaubensweisen (1950), in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 651 – 782, S. 750. 152 Dazu: G. Langenhorst, Jesus im Spiegel seiner Autobiographie. Schriftsteller schreiben das Evangelium aus der Perspektive Jesu neu, in: Stimmen der Zeit 216 (1998), S. 842 – 852; K.-J. Kuschel, Jesus im Spiegel der Weltliteratur. Eine Jahrhundertbilanz in Texten und Einführungen, Düsseldorf 1999. 153 154 Dazu: E. Rosenstock-Huessy, Der Atem des Geistes, Frankfurt a. M. 1950, S. 95 – 165; ferner: E. Biser, Der inwendige Lehrer, a.a.O., S. 14ff.
56
7. Der inwendige Lehrer
Augustinus auf einer „Dreiecksbeziehung“, denn soviel der Lehrer an Geist und Kunst in seine Mitteilung investieren mag, und so hoch die Rezeptionsfähigkeit seines Partners zu veranschlagen ist, ist das „Wunder des Verstehens“ doch nie nur die Frucht des Zusammenspiels, sondern Folge der Einmischung des Dritten, den Augustinus im Anschluß an das Herrenwort, in dem sich Jesus als der „alleinige Lehrer“ bezeichnet (Mt 23,8), den „inwendigen Lehrer“ nennt. Selten sei wohl, so Rosenstock-Huessy, ein Schriftwort „mit größerer Wucht neu zum Leben“ erweckt worden wie in diesem Dialog155, der dem Gesprächspartner Augustinus’ das bewegende Schlußwort überläßt: Ich habe jedenfalls durch das, was mir deine Worte zu verstehen gaben, gelernt, daß der Mensch durch Worte allein nur die Anregung empfängt, wie er sich belehren soll, und daß es nur ein kleiner Teil ist, den die Sprache zu enthüllen vermag von dem, was sich ein Sprechender denkt. Klar geworden ist mir aber, daß, wenn ein Lehrer etwas Wahres sagt, DER allein uns lehrt, der uns durch die äußeren Worte von Seinem Wohnen in unserm Inneren benachrichtigt. Er ist es, den ich, wenn mir seine Gnade hilft, lieben will mit einer um so heißeren Glut, als ich Fortschritte machen werde in der Lehre156. Da das von Augustinus gedeutete Herrenwort aus der Position des erhöhten Christus gesprochen ist, kann die Aneignung des Gedankens nur über den Versuch gelingen, ihn in den Horizont analoger Aussagen zu stellen. Dies führt zunächst zur Figur des Parakleten, von dem der johanneische Jesus sagt, daß er die Seinen „alles lehren und an alles erinnern“ werde, was er ihnen als der abschließende Offenbarer des Vaters mitgeteilt habe (Joh 14,26). Und er fügt hinzu, daß dieser „andere“ und mit ihm doch zugleich identische Beistand, „von dem, was er hört, reden“ und sie so „in alle Wahrheit einführen“ werde (Joh 16,13). Eine ähnliche Gleichsetzung vollzieht Paulus mit dem Satz „der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn waltet, da ist Freiheit“ (2Kor 3,17). Wozu diese als Freisetzung gemeinte Freiheit führt, erklärt er in dem Satz des Römerbriefs, der das johanneische Wort von der mitwissenden Christusfreundschaft (Joh 15,15) vorwegnimmt: Ihr habt doch nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, so daß ihr euch aufs neue fürchten müßtet, ihr habt vielmehr den Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba – Vater! (Röm 8,15) Nur scheinbar tritt hier die Lehre in den Hintergrund, da der vom Geist Jesu Ergriffene zum Mitsprecher des Wortes erklärt wird, mit welchem Jesus die Gottesferne überwindet und das Herz des Vaters, verstanden als der Inbegriff der Gotteswahrheit, erschließt. Geht es in den Johannesstellen mehr um die vom inwendigen Lehrer erschlossenen Inhalte, so hier um den Kompetenzgewinn, der zur Aneignung der Inhalte verhilft. Im Rückblick gewinnt damit das Anliegen der Christomathie und der darauf basierenden Geistesgegenwart ein deutlicheres Profil. Es erscheint nun als die „Resultante“ der beiden Bestimmungen, wobei sich die johanneische Bestimmung auf den Lehrgehalt be155 E. Rosenstock-Huessy, a.a.O., S. 151. 156 Augustinus, Der Lehrer. De magistro liber unus, 14,46, aus dem Lat. übs. u. hrsg. v. C. J. Perl, Paderborn 1959, S. 77.
57
Der Zugang
zieht, während die paulinische die „Form“ verdeutlicht, in der er geboten wird. Es ist die Form der Zusage und insofern dieselbe, wie sie im Evangelium vorliegt, wenn auch in einer meist übersehenen Fassung. Denn genauer besehen hat die Aussage dort nie die Gestalt einer herauskristallisierten, und das besagt, voll vergegenständlichten und ausgearbeiteten Lehre. Vielmehr ist selbst in den ausgesprochenen Lehrstücken der Lehrende mit seinem Mitteilungswillen präsent. So bleibt in allem objektiv Gesagten ein nicht objektivierbarer Rest, wie er insbesondere in den johanneischen Ich-bin-Worten und in dem „Ich-aber-sage-euch“ der Bergpredigt hörbar ist. In der Christologie wurde dieser Impuls so weit zurückgedrängt, daß er den Charakter von Aussagen über dieses Wort annahm. Demgegenüber lebt die Christomathie vom Nachhall des mitteilenden Wortes in der Mitteilung und der nachwirkenden Präsenz des Lehrers in der Lehre. Das führt im Verhältnis zur Christologie keineswegs zu einer Verdoppelung, wohl aber zur Bannung der Gefahr, daß das Gesagte entleert, vergegenständlicht und am Ende gegen die Intention des Sprechers gewendet wird. Es geht in ihr somit darum, den Originalton der Botschaft hörbar, den ihr von ihrem Ursprung her eingehauchten „Atem des Geistes“ und den in ihr fortwirkenden Impuls fühlbar zu machen, also darum, ihre Systemgestalt zu unterlaufen und die Lehre davor zu bewahren, zur ideologisch verhärteten „Doktrin“ zu erstarren. So hat die Christomathie weithin den Charakter eines Korrektivs, das stets mit der Christologie zusammengeschaut sein will. Das gilt auch von der Figur des inwendigen Lehrers, der mehr lebendiges Interpretament als die integrale Vollgestalt des in der Geschichte fortlebenden Christus ist und doch von diesem nie völlig abgehoben werden kann. Und erst recht gilt das von den Verstehensformen, die sich durch ihn ergeben. Sie verhalten sich zwar gleichfalls gegensinnig zu der immer noch vorherrschenden historisch-kritischen Methode; doch können sie sich nur im Zusammenspiel mit dieser als fruchtbar erweisen. Umso mehr ist nun nach der entscheidenden Differenz zu fragen.
8. Die Morgenschau Wenn die Christomathie das dynamische Pendant zur Christologie bildet, muß zunächst die Frage des Antriebs definitiv geklärt werden. Denn bisher wurden mit dem Begriff der Glaubenswende ebenso wie mit dem Hinweis auf deren Achse, die Neuentdeckung Jesu, nur Teilantworten gegeben. Wenn diese vervollständigt werden sollen, ist es aber erforderlich, nochmals auf das über den Begriff des Christentums Gesagte zurückzublenden und zuzusehen, wie es zu dessen lehrhafter und hierarchischer Ausgestaltung kam. Die entscheidende Auskunft gab die moderne Exegese, als sie die Wende vom verkündigenden Jesus zum verkündigten Christus, also vom Glaubenden zum Geglaubten und vom Lehrenden zur Lehre genauer ins Auge faßte. Anton Vögtle, der sich am intensivsten um die Erhellung dieser Wende bemüht hat, verwies in diesem Zusammenhang auf das zwischen den beiden Aspekten waltende „Kontinuum“, das er in der Bindung der ReichGottes-Botschaft Jesu an Jesus selbst, also an die Person des Botschafters, erblickt157. In 157 A. Vögtle, Der verkündigende und verkündigte Jesus „Christus“, in: J. Sauer (Hg.), Wer ist Jesus Christus?, a.a.O., S. 27 – 91; S. 74.
58
8. Die Morgenschau
seiner „Dynamik des Anfangs“ nennt Vögtle, ungeachtet der von ihm aufgewiesenen Kontinuität, dann aber auch den Grund der erstaunlichen Perspektivendrehung: die Auferstehung Jesu, durch die der scheinbar Gescheiterte und Verworfene von Gott auf einzigartige Weise bestätigt und gerechtfertigt wurde, und dies mit der spontanen Folge, daß er nun alle religiöse Bedeutung oder, wie im Anschluß an frühere Wendungen gesagt werden könnte, alle verfügbaren Attribute, besonders in Gestalt der Hoheitstitel, an sich riß158. Jetzt kristallisierte sich seine Verkündigung zu der von einem Absolutheitsanspruch getragenen Botschaft, seine Unterweisung zur allverbindlichen Lehre und das „neue Gebot“, zu dem er die Seinen verpflichtete, zu dem in seinem Namen verfügten Gesetz. Zusammengerufen von seinem Wort wußten sich dessen Hörer dann aber auch angehalten, sein Gedächtnis in kultischer Feier zu begehen. Und aus demselben Impuls ging schließlich die hierarchische Ämterordnung hervor, die seiner Gründung Struktur und Zusammenhang verlieh. Bei allem, was dieser Prozeß zur Ausgestaltung und Stabilisierung des Christentums beitrug, brachte er jedoch auch die Gefahr mit sich, der jede derartige Verfestigung unterliegt. Sie läßt sich in den Begriffen „Vergegenständlichung“ und „Erstarrung“ umschreiben. Denn jetzt trat der Künder des Gottesreiches seiner Stiftung als Herr gegenüber; jetzt wurde der „Wegbereiter des Glaubens“ (Hebr 12,2) zu dessen Inbegriff und Gegenstand, und jetzt geriet der zu seiner Nachfolge Rufende in den Aspekt des Gesetzgebers. Wenn aber die von ihm ausgehende Insinuation nicht in den Anschein einer Fremdbestimmung geraten, wenn die von ihm gebrachte Freiheit nicht dem Stabilisierungsinteresse geopfert und wenn seine Einladung nicht, wie es dann tatsächlich bei Augustinus geschah159, als „Nötigung“ mißdeutet werden sollte, bedurfte es einer umfassenden Gegeninitiative, die der drohenden Verfestigung entgegenwirkte. Diese Initiative konnte freilich nur von dem ausgehen, der zum Bild Gottes erklärt, auf das Podest seines Herrentums erhoben, zum Inbegriff der Lehre erklärt und so in den Schrein der doktrinalen, kultischen und lebenspraktischen Vergegenständlichung eingeschlossen worden war. Er selbst mußte diesen Schrein sprengen, von dem ihn distanzierenden Podest herabsteigen und das Bild, das von ihm entstanden war, in sein lebendiges Antlitz zurückverwandeln. Denn der Kristallisationsprozeß, der sich auf alle Bereiche des kirchlichen Lebens erstreckt hatte, konnte nur durch seine Entgegenkunft aufgehalten und revidiert werden. Es spricht für die hohe Sensibilität der Urgemeinde, daß sie die Fühlung dieser Gegeninitiative schon in den neutestamentlichen Schriften bekundet. Exponent dessen ist Paulus, der wie kein anderer zur lehrhaften Ausgestaltung der Christusbotschaft beitrug, gleichzeitig aber die Lehre so entwickelte, daß sie von der Glut seines Ergriffenseins (Phil 3,12) erfüllt blieb. Zwar hinterließ er, wie Felix Porsch bemerkt, kein ausgearbeitetes System; wohl aber liegt seinen Aussagen „eine sie alle tragende ‚Tiefenstruktur‘ zugrunde“160, die die Teilstücke zu einer Einheit verklammert. Was diese betrifft, so gilt die Feststellung Bultmanns, wonach in ihr „jeder Satz über Gott […] zugleich ein Satz über den Menschen [ist] und umgekehrt“, und „in diesem Sinn ist die paulinische Theo158 Dazu: Ders., Die Dynamik des Anfangs. Leben und Fragen der jungen Kirche, Freiburg i. Br. u. a. 1988, S. 30ff; ferner: E. Biser, Glaubenserweckung, a.a.O., S. 137f. 159 Augustinus, Epistula 93, II.5, in: Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus ausgewählte Briefe, aus dem Lat. übs. v. A. Hofmann (BKV, 1. Reihe, Bd. 30), München u. a. 1917, S. 217. 160 F. Porsch, Viele Stimmen – ein Glaube. Anfänge, Entfaltung und Grundzüge neutestamentlicher Theologie, Kevelaer u. a. 1982, S. 158.
59
Der Zugang
logie zugleich Anthropologie“161. Gleiches gelte aber auch von der Christologie des Apostels, weil es ihm nicht um eine Wesensbestimmung Jesu, sondern um das von ihm gewirkte „Heil von Welt und Mensch“ zu tun sei: So ist auch jeder Satz über Christus ein Satz über den Menschen und umgekehrt; und die paulinische Christologie ist zugleich Soteriologie162. Doch mit nicht geringerem Nachdruck besteht Paulus darauf, daß er sich nicht erkühne, etwas zu sagen, was nicht von Christus durch ihn gewirkt worden sei (Röm 15,18). Und wie zum Beweis dafür läßt er in jedem seiner Sätze sein Damaskuserlebnis nachklingen, das seinem Originalzeugnis zufolge darin bestand, daß ihm Gott aus reiner Liebe das Geheimnis seines Sohnes offenbarte (Gal 1,16)163. In jener Stunde wurde er somit nicht nur im gleichen Sinne Auferstehungszeuge wie Petrus und die Zwölf (1Kor 15,5), sondern Zeuge der ewigen Selbstverständigung Gottes, Mitwisser um das Geheimnis des Sohnes, in dem sich Gott der Welt erschloß und mitteilte. Das ist der Grundton, auf den die gesamte Botschaft des Apostels abgestimmt ist, der Impuls, der in seinen Aussagen nachwirkt und sie zu ihrer inneren Einheit zusammenfaßt. Den vollen Beweis erbringt jedoch erst die umrätselte Gruppe, die sich zu Beginn des großen Johannesbriefs mit der Behauptung zu Wort meldet: Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände betastet haben, das Wort des Lebens […], das verkünden wir euch (1Joh 1,1ff)164. Zwei mögliche Erklärungen dieser schwierigen Aussage bieten sich an: Bezieht sie sich auf die Augenzeugen, die den Auferstandenen hören, sehen und nach der Thomasszene des Johannesevangeliums (Joh 20,24-29) sogar betasten konnten? Da diese Annahme durch den Zeitenabstand hinfällig wird, entscheidet sich Schnackenburg für die inkarnatorische Lösung, nach der sich die behauptete Wahrnehmung auf den „im Fleische“ erschienenen Logos bezieht165. Doch in diesem Fall hätte die Fleischwerdung des „Wortes“, von dem es lediglich heißt, daß es „beim Vater war“ und erschienen ist, ungleich stärker hervorgehoben werden müssen. So bietet sich als dritte Lösung die kühn anmutende, bei näherem Zusehen aber allein einleuchtende Annahme an, daß sich die Stelle auf ein neuerliches Vernehmen, Schauen und Ergreifen dessen bezieht, den gerade die johanneische Gemeinde als den sie beseelenden, bestärkenden und inspirierenden Herrn in ihrer Mitte wußte. Wenn es sich aber so verhält, spricht der Briefeingang davon, daß jene Gegeninitiative tatsächlich einsetzte, die dem Kristallisationsprozeß entgegenwirkte 161 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, 9. Aufl., durchges. u. ergänzt v. O. Merk, Tübingen 1984, S. 191f. 162 A.a.O., S. 192. 163 Dazu: E. Biser, Der unbekannte Paulus, Düsseldorf 2003, S. 94f. 164 Dazu: R. Schnackenburg, Die Johannesbriefe (Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Bd. 13.3), Freiburg i. Br. u. a. 1953, S. 42 – 56; ferner: H.-J. Klauck, Der erste Johannesbrief (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, Bd. 23.1), Zürich u. a. 1991, S. 53 – 78. 165 Ebd.
60
8. Die Morgenschau
und zu neuer Wahrnehmung des Künders in der Verkündigung, des Lehrers in der Lehre und des Stifters in der Stiftung verhalf166. Von dieser Gegenbewegung ist in erster Linie der Begriff des Christentums berührt. Da deren Richtungssinn nach vorwärts weist, drängt sie das Christentum in seine eschatologische Perspektive. So entspricht es der Anrufung, mit der sich die bei der Kultfeier versammelte Gemeinde der Nähe ihres Herrn versicherte, im sehnsüchtigen „Maranatha“, wie es am Ende des Ersten Korintherbriefs (1Kor 16,22) und der Apokalypse (Apk 22,20) erklingt. Zwar drückt es, mit Ludger Schenke gesprochen, das eschatologische Bewußtsein der Gemeinde „und ihre angespannte Naherwartung“ aus167. Doch ist es vor allem präsentisch gemeint, als Jubelruf über den als anwesend und gegenwärtig wirksam erfahrenen Herrn, zusammenfassend gesagt: als Ausdruck einer zur Zukunft hin geöffneten Gegenwart168. Wenn das in den Begriff des Christentums eingebracht werden soll, dann sicher am wirkungsvollsten dadurch, daß es als die „Weltutopie“ Jesu bezeichnet wird. Denn dadurch ist der Begriff unmittelbar in das Koordinatensystem der Gegenwart hineingestellt. Auf der einen Seite ist diese, ideologisch gesehen, durch den Verfall der marxistischen Sozialutopie gekennzeichnet, auf der anderen Seite kaum weniger durch die in die entstandene Lücke eindringenden Ersatzutopien esoterischer oder ökologischer Art. Ging die marxistische Utopie an ihrer Kopflastigkeit gegenüber der Realität zugrunde, so wird den Ersatzutopien ihre Realitätsferne zum Verhängnis werden. Dennoch verbietet sich der von Joachim Fest vorgeschlagene Ausweg, der auf den Versuch hinausläuft, die Menschen zum Traumverzicht zu bewegen169. In dieser Situation könnte das sich seiner eschatologischen Dimension bewußt gewordene Christentum dem heutigen Menschen als die allein noch verbleibende utopische Alternative nahegebracht werden. Davon könnte der Mensch sich umso mehr angesprochen fühlen, als er unter dem Eindruck der fehlgeschlagenen Utopien dieser Zeit gerade nicht die ihm von Fest angeratene Konsequenz zieht, sondern im Gegenteil davon ausgeht, daß die entstandene Lücke ausgefüllt werden müsse: ausgefüllt durch die Utopie Jesu, die heute geradezu danach schreit, konsequenter als bisher im Geist ihres Schöpfers übernommen und verwirklicht zu werden. Indessen hat die mystische Gegenbewegung vor allem erkenntniskritische Konsequenzen, wie sie mit dem Begriff „Morgenschau“, also dem augustinischen Gedanken der „cognitio matutina“, angesprochen sind. Angeregt durch die refrainartige Wendung des biblischen Schöpfungsberichts: „Es wurde Abend und es wurde Morgen“ (Gen 1, 1-31), die sich seltsam mit der vorangehenden Erschaffung des Lichtes zu stoßen schien, hatte Augustinus die hinreißende Konzeption entwickelt, daß das abendliche Dunkel dadurch entstanden sei, daß Gott das wie eine Koruskation seiner Herrlichkeit entstandene Licht auf sich zurückgewendet habe, so daß das inzwischen Geschaffene nur noch in seinem eigenen, ungleich matteren Licht erkennbar gewesen sei. So stehen für ihn zwei Erkennt166 Dazu nochmals: A. Vögtle, Der verkündigende und verkündigte Jesus „Christus“, in: J. Sauer (Hg.), Wer ist Jesus Christus?, a.a.O., S. 90f. 167 L. Schenke, Die Urgemeinde, a.a.O., S. 98f. 168 Dazu: E. Biser, Das Antlitz. Christologie von innen, Düsseldorf 1999, S. 262f: Das Maranatha. 169 J. Fest, Der zerstörte Traum, a.a.O., S. 81 – 103: Leben ohne Utopie; zur Kritik daran: E. Biser, Hat der Glaube eine Zukunft?, a.a.O., S. 89f: Ausgeträumt?; ferner: ders., Glaubenserweckung, a.a.O., S. 42: „Die Absage an die Utopie, gleichviel ob sie theoretisch oder praktisch erfolgt, richtet sich […] letztlich gegen die Hoffnung und deren religiöse Herkunft.“
61
Der Zugang
nisformen einander gegenüber: eine „morgendliche“, die das Seiende im Licht des göttlichen Wortes erblickt, und eine „abendliche“, die der Dinge in dem von ihnen selbst ausgehenden Dämmerschein ansichtig wird170. Vermittelt durch die Mystik des Mittelalters wirkte das Theorem gleich anderen Motiven unterschwellig weiter, bis es in kritischer Zuspitzung in Franz Rosenzweigs nachgelassenem „Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand“ wieder auflebte und hier in seltsamem Rückbezug zu dem „Krankenbesuch“, den die „Philosophie“ ihrem vom Todesurteil niedergerworfenen Schüler Boëthius abstattet. Jetzt tritt der Verfasser des Werkes „Der Stern der Erlösung“, für welches er mit dem „Büchlein“ die Prolegomena nachreichen wollte, an ihre Stelle, auch in dem Sinn, daß er sich unwillkürlich mit ihr identifiziert. Auch in der Diagnose stimmt er erstaunlich genau mit der Diagnose der „Trösterin des Boëthius“ überein, wenn er den Zustand seines „Patienten“ beschreibt: Er fühlte sich wie gelähmt. Die Starrheit des Staunens hatte ihn befallen. Seine Hände mochten nicht mehr zugreifen, denn wer gab ihnen das Recht des Griffs, seine Füße mochten nicht mehr ausschreiten, denn wer verbürgte Boden ihrem Tritt. Seine Augen mochten nicht mehr ausschauen, denn wer bewies ihnen, daß kein Traum sie narre. Und so mochten seine Ohren nicht mehr hören, denn wer war der andere, auf den sie hätten hören sollen, sein Mund nicht mehr reden, denn lohnte es sich ins Leere schöpfen? Was war ihm geschehen? Gestern noch war er fröhlich und unbefangen seines Weges gegangen, hatte die Frucht vom Baume, die ihm seine Augen wiesen, gebrochen, hatte mit dem Begegnenden Gruß und Rede getauscht. Und plötzlich war er irre an allem geworden171. Ein ungeheurer Text! Denn damit legt sich Rosenzweig mit der gesamten idealistischen Denktradition an, die seit Platon ihren Ansatz im philosophischen Staunen erblickt und davon ausgeht, daß darin auch schon die Elemente reflektierender Vergewisserung gegeben sind. All dies stellt der Text in Frage, indem er, ausgehend von der Redewendung, daß einer starr vor Staunen ist, das gegensinnige Element der „Starrheit“ in diesem vermeintlichen Urerlebnis aufdeckt. Daran zerbricht die sich anbahnende Vergewisserung, so daß die Organe dem Erkennenden den Dienst versagen: die Hände, weil sie ins Leere zu greifen fürchten, die Füße, weil sie ins Bodenlose zu treten meinen, die Augen und Ohren, weil sie sich zu täuschen glauben, und der Mund, weil er an der Existenz des Gegenübers zweifelt. Auf die Spur dieser Kritik scheint Rosenzweig durch Rosenstock-Huessy gebracht worden zu sein, der zu Eingang seines „Atem des Geistes“ vermerkt, daß er während des Ersten Weltkriegs für den späteren Verfasser des „Stern der Erlösung“ den Entwurf einer im Ich-Du-Verhältnis zentrierten Sprachlehre ausgearbeitet habe, die gegen eine Erziehung Einspruch erhob, in der schon die Schulkinder auf eine Idee und Wirklichkeit, Geist 170 Dazu: Augustinus, De genesi ad litteram libri duodecim IV, c. 22,39, in: ders., De genesi ad litteram libri duodecim; Eiusdem libri capitula; De genesi ad litteram imperfectus liber; Locutionum in Heptateuchum septem (CSEL 28,1), hrsg. v. I. Zycha, Prag u. a. 1894, S. 121f. 171 F. Rosenzweig, Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand (1964), hrsg. v. N. Glatzer, Düsseldorf 1964, S. 34; dazu: Eugen Biser, Theologie als Therapie. Zur Wiedergewinnung einer verlorenen Dimension (1985), unv. Nachdr. Norderstedt 2002, S. 34 – 51: Therapeutische Modelle.
62
8. Die Morgenschau
und Leib unterscheidende Denkweise festgelegt werden, „in der sich Leib und Seele anstarren“ und „die unbegreifliche Spaltung in Begriff und Ding als der Weisheit letzter Schluß gilt“172. Zwar erzielt dieses unterscheidende Denken einen exakten Einblick in das Gegebene. Sein Gewinn ist der Begriff, die sich darauf aufbauende Wissenschaft und deren eminent wirkmächtige Anwendung in Gestalt der Technik, dies alles jedoch um den übergroßen Preis der Trennung, die sich schließlich in der Form rächt, daß der zum Machthaber der Welt gewordene Mensch ebenso die Kontrolle über seinen Machtbereich wie über sich selbst verliert. Zuvor aber hatte er bereits die Wirklichkeit verloren, weil er der begrifflich erfaßten Wesenheiten nur dadurch ansichtig werden konnte, daß er sie in ihr Gewesensein zurückstieß und nur ein Begriffsbild von ihnen behielt. Dem kann nur durch eine radikale Blickwendung abgeholfen werden. Es gilt, die „abendliche“ Retrospektive des Wesendenkens – denn das Wesen ist nach Hegel immer schon das Gewesene – aufzugeben und das Seiende im „flußaufwärts“ ziehenden Strom des lebendigen Geschehens zu erfassen. Das aber gelingt nicht durch den ausgrenzenden Zugriff der Begrifflichkeit, sondern nur durch den nennenden Aufruf, also mit Hilfe des Namens. Bei dieser Wiederentdeckung des nennenden Denkens orientiert sich Rosenzweig am biblischen Schöpfungsbericht, der die Tiere durch Verleihung des Namens zu ihrer jeweiligen Bestimmung gelangen läßt (Gen 2,19f). Im Einklang mit seiner biblischen Inspirationsquelle stellt er damit der begrifflichen Weltbemächtigung die Vollendung der Welt durch namentliche Nennung entgegen173 – eine noch kaum wahrgenommene, geschweige denn erprobte Möglichkeit, mit der Widerspenstigkeit des Seienden zugleich ordnend und schonend umzugehen. Daß diese Möglichkeit bisher unerprobt blieb, hängt zweifellos damit zusammen, daß sie, um ernsthaft in Erwägung gezogen zu werden, nicht dort ansetzen darf, wo sich das Begriffsdenken des Seienden bemächtigt, sondern auf einem weit höheren Niveau. Höher kann aber nicht gegriffen werden als in der Christomathie. Sie ist fürs erste der exemplarische Fall einer mit der Denkform des Namens operierenden Wissenschaft, und das schon ab ihrem Ursprung bei Ignatius von Antiochien174. Denn in unmittelbarer Nachbarschaft dieser ignatianischen Fundstelle wird Jesus der „Hohepriester“, die „Tür zum Vater“ und „unsere gemeinsame Hoffnung“ genannt, im weiteren Kontext der Briefe „unser unerschütterliches Leben“, der „eine Arzt“ und „unser Herr“, „Menschensohn und Gottessohn“, das „aus dem Schweigen hervorgegangene Wort“ und der „vollkommene Glaube“175. Damit greift die Christomathie zurück auf den Anfang, an dem die „im Namen Jesu“ Predigenden begannen, von ihm in substantivischem Namen zu reden, also sein Geheimnis in „Sätzen heiligen Rechtes“176 und bildhafter Schau zu umschreiben. Dokumente dieser Ausgangsphase sind, wie Hugolinus Langkammer glaubhaft machte, die neutestamentlichen Christuslieder177, die Jesus das „fleischgewordene Wort“ (Joh 1,14), 172 173 174 175
E. Rosenstock-Huessy, Der Atem des Geistes, a.a.O., S. 8f. F. Rosenzweig, Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand, a.a.O., S. 88. Ignatius von Antiochien, An die Philadelphier 8,2, a.a.O. (BKV, 1. Reihe, Bd. 35), S. 145. Ders., An die Philadelphier 9,1; 11,2, a.a.O. (BKV, 1. Reihe, Bd. 35), S. 145; S. 146; An die Epheser 3,2; 7,2; 20,2, a.a.O., S. 118; S. 120; S. 125; An die Magnesier 8,2, a.a.O., S. 129; An die Smyrnäer 10,2, a.a.O., S. 151. 176 Dazu: E. Käsemann, Sätze heiligen Rechts im Neuen Testament (1954), in: ders., Exegetische Versuche und Besinnungen, Bd. 2, Göttingen 3/1970, S. 69 – 82. 177 Dazu: H. Langkammer, Jesus in der Sprache der neutestamentlichen Christuslieder, in: H. Frankemölle u. a. (Hgg.), Vom Urchristentum zu Jesus, Freiburg i. Br. u. a. 1988, S. 467 – 486.
63
Der Zugang
das „Bild des unsichtbaren Gottes“ (Kol 1,15) und „unseren Frieden“ (Eph 2,14) nennen. Belege der Kulminationsphase sind die von Boy Hinrichs als strukturierende Faktoren erwiesenen Ich-bin-Worte des Johannesevangeliums178. Während aus den johanneischen Ich-bin-Worten eindeutig der Erhöhte spricht, stellt sich im Fall des Titels „Menschensohn“ die in der Forschung noch immer kontrovers diskutierte Frage, ob er als Selbstbezeichnung des historischen Jesus gelten könne oder der Reflexion der Urgemeinde entstamme179. Die Christomathie, die von der Rückverwandlung des Verkündigten in den Verkündigenden lebt, neigt von ihrem Ansatz her zur Bejahung dieser Frage180. Denn nur so läßt sich zeigen, daß Jesus die mit seiner Existenz verkoppelte Entscheidung, der er zunächst ausweicht, nach dem als „galiläische Krise“ bezeichneten Umschwung der Verhältnisse jedoch bewußt herbeiführt. Vor allem aber läßt sich nur unter dieser Voraussetzung einsichtig machen, daß Jesus seinen Todesweg in dem Bewußtsein antritt, damit die letzte Voraussetzung für den Anbruch des Gottesreichs zu erfüllen. Unter dieser Voraussetzung entspricht der Verlauf seiner Lebensgeschichte dann vollends dem Modell, das die ausdeutende Urgemeinde in ihr entdeckte: dem Weg der Weisheit, die von ihrem himmlischen Ursprungsort in die Menschenwelt herabsteigt, nach ihrer Verwerfung aber wieder dorthin zurückkehrt181. In der Folge tritt die Gestalt Jesu immer deutlicher in den Horizont der Weisheit. Gleich ihr heißt er „Bild Gottes“ (2Kor 4,4), gleich ihr beschreitet er den Weg der Erniedrigung (Phil 2,6ff), um die Menschen mit Worten aus dem Buch Jesus Sirach (Sir 6,23ff; 24,19ff) zur Lebensgemeinschaft mit sich einzuladen; gleich ihr kehrt er nach seiner Verwerfung an seinen himmlischen Ursprungsort zurück. Jetzt erst bricht die Differenz zur Christologie vollends auf. Während diese das Geheimnis Jesu, wenngleich gestützt auf die urchristlichen Titel, im Horizont des hellenistischen Wahrheitsbegriffs reflektiert und so zu einer systematischen Explikation ihres Gegenstands gelangt, denken ihn Christomathie und Geistesgegenwart konsequent im Licht der Weisheit. Weisheit aber ist die gewährte und als solche immer neu zukommende Wahrheit, Wahrheit dagegen die Summe der Denkbarkeiten, die in der rückschauenden Reflexion auf diese gefunden wird. Deshalb betrifft der Unterschied weniger die Inhalte als vielmehr die Blickrichtung. Die Christologie denkt im vergehenden Dämmerlicht des Abends, das sie jedoch ihre Inhalte im verglühenden Licht nur umso präziser sehen und erfassen läßt. Die Geistesgegenwart denkt im Morgenglanz der Weisheit – mit der Folge, daß sie auf das Anwachsen des Lichtes warten muß, um erkennen zu können. Sie muß sich gedulden, das ist ihre Not, gerade auch im Hinblick auf den rapiden Fortschritt der Wissenschaften. Doch kommt ihr darin das Herrenwort zu Hilfe, das vor der Rückschau warnt: „Keiner, der die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, taugt für das Reich Gottes“ (Lk 9,62), „Denkt an Lots Frau!” (Lk 17,32). Zum vertrauens178 Dazu: B. Hinrichs, „Ich bin“. Die Konsistenz des Johannes-Evangeliums in der Konzentration auf das Wort Jesu (Stuttgarter Bibelstudien, 133), Stuttgart 1988, S. 16; S. 94ff. 179 Dazu: L. Schenke, Die Urgemeinde, a.a.O., S. 127f; 147f; A. Vögtle, Der verkündigende und verkündigte Jesus „Christus“, in: J. Sauer (Hg.), Wer ist Jesus Christus?, a.a.O., S. 46ff; E. Schweizer, Jesus Christus im vielfältigen Zeugnis des Neuen Testaments, München u. a. 1968, S. 57 – 62. 180 Dazu: E. Biser, Glaubenserweckung, a.a.O., S. 176f: Die Existenzfrage; ferner: ders., Gotteskindschaft, a.a.O., S. 72f; S. 144. 181 Dazu: Ph. Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen und die Apostolischen Väter, Berlin u. a. 1975, S. 324f; S. 446.
64
8. Die Morgenschau
vollen Vor- und Aufblick ermutigt dagegen Lk 21,28: „Wenn ihr das alles kommen seht, so schaut auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht!“ Das ist der seltene Fall, wo das Evangelium dem Mythos die Hand reicht. Denn auch im Orpheus-Mythos ist die Rückführung der Gattin aus dem Hades an die Bedingung gebunden, die im Libretto der Oper „Orpheus und Eurydike“ von Christoph Willibald Gluck folgenden Wortlaut hat: Eh du die Erde erreichest, hüte dich, einen Blick auf die Gattin zu tun, sonst verwirkst du ihr Leben und verlierst sie auf ewig182. Ebenso mahnt der Engel in Dantes „Göttlicher Komödie“ die Jenseitswanderer am Portal des Läuterungsberges: Geht ein; doch merket wohl, daß jeder, Wenn hinter sich er blickt, zurück muß kehren183. Und noch in Franz Werfels „Stern der Ungeborenen“ werden die Besucher des „Wintergartens“ ermahnt, „nur nicht zurückzublicken“, und der Erzähler fragt sich unwillkürlich: Nur nicht zurückblicken im Hades. Woher kenne ich das?184 Er kennt es aus der Erfahrung einer unvordenklichen Geschichte, in die sich schließlich die Stimme der Bibel einmischte, um das Verbot des Mythos durch die Aufforderung zu Aufblick und Vorausschau zu überholen. Wer dieser Aufforderung gehorcht, hat die Schwelle zur Geistesgegenwart überschritten und grundsätzlich auch schon die durch sie eröffnete Perspektive gewonnen. Doch was bekommt er in ihr zu Gesicht? Das ist die Frage nach ihren Inhalten und zusammen mit ihr die Frage nach deren Erschließung.
182 C. W. Gluck, Orpheus und Eurydike, 1. Aufzug, 3. Szene, Nr. 14, Rezitativ. 183 Dante Alighieri, Die Göttliche Komödie (La Commedia, 1472) II 9, 131f, aus d. Ital. übs. v. Philalethes (König Johann von Sachsen), mit einem Nachw. v. R. Guardini, Berlin [1965], S. 178. 184 F. Werfel, Stern der Ungeborenen. Ein Reiseroman (1946), 8.-9. Tsd., Frankfurt a. M. 1998 (Gesammelte Werke in Einzelbänden, hrsg. v. K. Beck), S. 665.
65
Drittes Kapitel
Die Erschließung 1. Die Fulguration
D
as Alpha und Omega der Christomathie war und ist die Präsenz des Lehrers in seiner Geistesgegenwart. Sie ist spiegelbildlich zu dem zu sehen, was Rosenzweig als die „Starrheit des Staunens“ diagnostiziert hatte. In dieser Erstarrung hatte der Begreifende das nachvollzogen, was er zu begreifen suchte: einen aus dem Strom des Geschehens ausgegliederten, scharf konturierten und deshalb eindeutig bestimmbaren Gegenstand. Doch damit hatte er sich selbst von der ihm entgegenstrebenden Welt abgegrenzt, die ihm, dem denkenden Subjekt, nun als objektiv gegebene „res extensa“ gegenüberstand. Demgegenüber zielt das nennende Denken nicht auf „Vergegenständlichung“, sondern auf „Vergegenwärtigung“: zunächst des mit seinem Namen aufgerufenen Sachverhalts. In der Rückbesinnung auf seinen Vollzug zielt es dann aber auch auf die Vergegenwärtigung des denkenden Subjekts, das sich, mit dem angesprochenen Sachverhalt zusammen, zu je höherer „Geistesgegenwart“ aufgerufen sieht. Denn was geschieht, wenn er, der Rufende, selbst beim Namen gerufen wird? Die, wie es Rosenzweig scheinen will, „sehr einfache“ Antwort lautet: Der Mensch wird wachgerufen, zur Geistesgegenwart gezwungen. Er wird in die Gegenwart, seine Gegenwart, und in sein Inneres, in sich selbst, hineingerufen185.
Dort aber, in seinem Inneren, vernimmt er, christlich gedeutet, den von Nikolaus von Kues registrierten Appell: „Sei dein eigen!“186, und hier, in diesem mystischen Anruf, tritt ihm als Rufer der entgegen, der ihm erst zu voller Identität verhilft: der inwendige Lehrer. Doch damit gewinnt der von Rosenzweig eher beiläufig eingesetzte Begriff „Geistesgegenwart“ eine weit über die subjektive Identitätsfindung hinausreichende Dimension. Was sich im Inneren des zu sich selbst Gerufenen abspielt, erscheint als Nachhall des apokalyptischen Ausrufs: „Ja, ich komme bald!“ (Apk 22,20), mit dem der Erhöhte dem sehnsüchtigen „Maranatha“ der Gemeinde zuvorkommt, ganz so, als wolle er es eher noch provozieren als beantworten. Diese Konsekution läßt aber darauf schließen, daß der Sehnsuchtsruf in erster Linie präsentisch und erst in zweiter Hinsicht futurisch gemeint ist: als Vergewisserung, daß der Erhöhte, ungeachtet seiner Entrückung in die Herrlichkeit des Vaters, zugleich da ist, inmitten der in seinem Namen Versammelten, oder, mit dem apokalyptischen Bildwort ausgedrückt, als Einladung an den „vor der Tür“ Stehenden, einzutreten und das Gastmahl der Lebensgemeinschaft mit den Seinen zu halten (Apk 3,20). Gerade im Licht dieser von Jürgen Roloff überzeugend erklärten Text185 F. Rosenzweig, Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand, a.a.O., S. 87f. 186 Nikolaus von Kues, De visione Dei – Die Gottes-Schau c. 7, in: ders., Philosophisch-theologische Schriften, Bd. 3, a.a.O., S. 116 – 123, S. 121.
66
1. Die Fulguration
stelle187 ist an dem vorrangig präsentischen Sinn des Sehnsuchtsrufs nicht zu zweifeln. Nur noch durch die Tür getrennt, steht der Herr bereit, um bei den Seinen Einkehr zu halten. Und er läßt es an deutlichen Zeichen seiner Nähe nicht fehlen: Rufend und klopfend begehrt er Einlaß. Jetzt muß nur noch die Tür geöffnet oder, wie Angelius Silesius sagen wird, die „Mittelwand muß weg“188; dann, so spricht der Sich-Vergegenwärtigende in dialogischer Anrede, werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir (Apk 3,20). Es ist das Mahl, in dem Jesus gleichzeitig Gastgeber und Gast, Wirt und Speise ist. Denn wie nach Roloff diesem dem Bildwort zugrundeliegenden Gleichnis von der Wachsamkeit bei der nächtlichen Heimkehr (Lk 12,35ff) zu entnehmen ist, wird er daran zu erkennen sein, daß er, der Gast, sich gürtet, um die ihn Aufnehmenden zu bedienen – und dies bis zu jener Extremform, daß er sich ihnen als „das Brot des Lebens“ (Joh 6,35) selbst zu essen gibt. Davon spricht das Wort aus dem apokalyptischen Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea im Bild von seinem Eintritt durch die sich ihm öffnende Tür (Apk 3,20). Im Evangelium gebraucht Jesus dafür aber ein ungleich vehementeres Bild, das geradezu dazu provoziert, sein präsentisches Kommen auf den von Konrad Lorenz gebrauchten und von Carl Friedrich von Weizsäcker aufgenommenen Begriff der „Fulguration“ zu bringen189. Weizsäcker, der darunter das „blitzartige“ Entstehen neuer Strukturen versteht190, fühlt sich dabei an das platonische Höhlengleichnis erinnert. Ungleich näher liegt jedoch die Erinnerung an die Stelle aus Platons Siebtem Brief (341c-d), der die Geburt des Gedankens aus dem intensiven, gemeinsamen Umgang mit dem Problem „und aus dem gemeinsamen Leben“ erklärt und den Vorgang selbst mit dem aus einem Funkensprung hervorgehenden und in der Seele fortleuchtenden Lichtschein vergleicht191. Von einer „Fulguration“ spricht tatsächlich auch Jesus, aber nicht im Sinne eines in ihm selbst aufflammenden Lichts, sondern des Feuerbrandes, den er auf Erden entfachen will: Feuer auf die Erde zu werfen, bin ich gekommen, und wie sehr wünschte ich, daß es schon brenne! (Lk 12,49) Weil der Ausdruck als Semitismus zu gelten hat, muß „werfen“ nach Joachim Jeremias hier mit „anzünden“ gleichgesetzt werden192. Da sich die Aktion jedoch auf das „Gekom187 Dazu: J. Roloff, Die Offenbarung des Johannes (Zürcher Bibelkommentare NT, Bd. 18), Zürich 1984, S. 62ff. 188 Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann, hrsg. v. Th. Rody, Aschaffenburg 1947, 2. Buch, Nr. 43: S. 40. 189 K. Lorenz, Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte des menschlichen Erkennens, München 2/1973, S. 47ff. 190 C. F. v. Weizsäcker, Meditation und Wahrnehmung, in: ders., Zeit und Wissen, München u. a. 1995, S. 488 – 504, S. 494. 191 Platon, Der siebte Brief, 341c-d, in: ders., Werke in acht Bänden, hrsg. v. G. Eigler, aus dem Griech. übs. v. F. Schleiermacher, Bd. 5: Phaidros, Parmenides, Briefe, Darmstadt 1983, S. 366 – 443, S. 413. 192 J. Jeremias, Die Gleichnisse Jesu, Göttingen 11/1998, S. 163, Anm. 9.
67
Die Erschließung
mensein“ Jesu, also auf seine Sendung bezieht, kann damit nur seine Reich-Gottes-Verkündigung gemeint sein. So sieht es auch Milan Machoveč, wenn er in seinem Jesusbuch „für Atheisten“ fragt, wodurch Jesus „die Welt in Brand gesetzt“ habe193. Die „Fackel“, mit der dies geschah, war gerade auch nach Jesu Selbstverständnis seine Botschaft von dem in und mit ihm anbrechenden Gottesreich. Schon ein diffuses Verständnis dieses Motivs genügt, um deutlich zu machen, daß es ihm dabei um den – nach der Schöpfung – gewaltigsten Eingriff Gottes in das Weltgeschehen und insbesondere in die gesellschaftlichen Verhältnisse zu tun ist. Reich Gottes: Das ist, schon oberflächlich betrachtet, die Vorstellung von der Welt, die, will man ihre Dynamik ermessen, nur mit der des „explodierenden Universums“ der modernen Astrophysik verglichen werden kann. Reich Gottes: Das ist die radikalste Sozialutopie, die jemals entworfen und der Menschheit als Strebeziel vor Augen gestellt wurde. Reich Gottes: Das ist schließlich der Gedanke an eine vom göttlichen „Oben“ her ins Werk gesetzte Umgestaltung aller Dinge. Zweifellos verdankt der Gedanke seine Sprengkraft dem von Bultmann herausgestellten Umstand, daß das Reich Gottes als „eschatologischer Begriff“ zu gelten hat. Weder blicke Jesus dabei auf die schon abgelaufenen Weltperioden zurück, um den Eintritt der Endzeit berechnen zu können, noch lasse er sich auf eine phantastische Ausmalung des Endes im Sinn der spätjüdischen Apokalyptik ein. Vielmehr werde alles „verschlungen von dem einzigen Gedanken, daß dann Gott herrschen wird“194 – ein Gedanke, so möchte man im Blick auf ein Jesusbild Dostojewskijs hinzufügen, „groß wie die ganze Welt“ und, wie noch zu ergänzen wäre, „so tief wie sein eigenes Lebensgeheimnis“. Doch selbst das überbietet Machoveč durch die Beantwortung der von ihm gestellten Frage, wie Jesus durch seine Botschaft die Welt in Brand zu setzen vermochte. Seine Antwort: nicht durch die Überlegenheit seines theoretischen Programms, sondern vor allem deshalb, weil dieses Programm ihn selbst darstellte, weil er also mit ihm identisch war195. Damit nimmt Machoveč, bewußt oder unbewußt, eine Spur auf, die Søren Kierkegaard ausgelegt hatte, als er es wagte, den johanneischen Ich-bin-Worten eine Formel von vergleichbarer Intensität anzufügen, nämlich den in seiner Prägnanz geradezu schockierenden Satz: „Der Helfer ist die Hilfe“196. Mit diesem Kernsatz der von ihm begründeten „Christologie von innen“ arbeitet er mit einer zuvor nie erreichten Klarheit die Differenz heraus, durch die sich Jesus von den übrigen Wohltätern der Menschheit bei allem, was ihn mit diesen verbindet, unterscheidet. So sehr er gleich ihnen die Wahrheit zu lehren, die Sittlichkeit zu heben und die Gesellschaftsordnung zu vermenschlichen suchte, gab er doch in und mit seinen Gaben zugleich das, was keiner außer ihm zu geben vermochte: sich selbst! Die Umarmung seiner Liebe, das ist die „Ruhe“, die er den Bedrückten und Beladenen in seiner „Großen Einladung“ (Mt 11,28) – für Kierkegaard der Schlüsselsatz des ganzen Evangeliums197 – zusichert. Seine leibhaftige Selbstübereignung, das ist das „Brot“, das er den Hungernden mit seinem Wort: „Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh 6,35.48), reicht. In diesen Worten schlägt die Flamme, die er auf Erden entfachte, nach innen. Und es fragt sich, genau wie bei der Lazarusperikope, ob seine Ankündigung, 193 M. Machoveč, Jesus für Atheisten (Jezus za ateiste, 1977). Mit einem Geleitwort von Helmut Gollwitzer, aus dem Tschechischen übs. v. P. Kruntorad, Stuttgart 5/1977, S. 93. 194 R. Bultmann, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, Zürich 1949, S. 96. 195 M. Machoveč, Jesus für Atheisten, a.a.O., S. 93. 196 S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, in: ders., Werkausgabe Bd. 2, S. 19. 197 A.a.O., S. 18.
68
2. Die Lesarten
er sei gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, nicht auch rückbezüglich gelesen werden kann. Aber wird damit der Bogen des methodisch Zulässigen nicht bis zum Zerbrechen gespannt? Geht das, was Kierkegaard entdeckte und Machoveč, auf seinen Schultern stehend, behauptete, nicht über alles wissenschaftlich Vertretbare hinaus? Angesichts dieser Befragung überraschen beide durch ihr affirmatives, wenngleich unterschiedlich akzentuiertes Verhältnis zur historischen Kritik. Dabei überbietet die methodologische Vorüberlegung Helmut Gollwitzers zu dem Jesusbuch von Machoveč den bekannten Standpunkt Ernst Troeltschs, daß nicht mehr hinter diese Methode zurückgegangen werden könne, durch die These von ihrer – sowohl die Konfessionen als womöglich auch Christen und Atheisten – „zusammenführenden“ Funktion198. Dagegen unterläuft Kierkegaard die ihm durchaus vertraute Methode durch den Versuch, in den Text hineinzuhorchen, um den Unterton zu vernehmen, der alles zu einer umfassenden Passionsaussage zusammenstimmt199. Wie sehr er ihr dennoch verpflichtet ist, zeigt seine Würdigung der Großen Einladung, in der er das bestimmende Leitwort des gesamten Evangeliums gefunden zu haben glaubte. Denn selbst angenommen – und damit nimmt Kierkegaard das Ergebnis der heutigen Forschung vorweg –, daß der Einladende das Wort niemals in seinem Erdenleben gesprochen hätte, drückte er es gleichwohl durch die schweigende „Wohlredenheit“, durch die stille Beredtsamkeit seiner Tat aufs eindringlichste aus200; denn in seinem Leben gab es nicht das Mindeste, was dieser Einladung widersprochen hätte. Das aber kommt, bei aller Anerkennung, einem Vorbehalt gegen die historische Kritik gleich, der darauf schließen läßt, daß es legitime Zugänge zum Schriftwort gibt, die genauer herausgestellt werden müssen. Worin bestehen sie?
2. Die Lesarten Eine erste Antwort verbindet sich mit dem Namen Karl Rahner, auch wenn die Größe seiner Leistung in diesem Zusammenhang mehr in der von ihm gestellten Frage als in deren Beantwortung besteht. Gleichwohl muß sie als innovatorischer Beitrag zur biblischen Methodendiskussion gewürdigt werden. Dabei wies er lediglich auf einen Umstand hin, der dem Systematiker eher als dem mit der Textanalyse befaßten Exegeten auffallen mußte. In seinem Beitrag „Theos im Neuen Testament“ bemerkt er: Das erste, was uns auffällt, wenn wir nach dem Gottesbegriff der Männer des NT fragen, ist die Selbstverständlichkeit ihres Gottesbewußtseins. Eine Frage einfachhin darnach bloß, ob Gott existiere, kennen diese Männer eigentlich nicht. Eine Qual, erst nach Gott fragen zu müssen, sich erst langsam und besinnend überhaupt den Boden schaffen zu müssen, von dem aus so etwas wie ein Ahnen, Erfühlen oder Erkennen Gottes erst möglich wird, ein Gefühl, daß Gott sich dem fragenden Zugriff des Menschen eigentlich immer wieder entziehe, eine Furcht, ob nicht etwa Gott am Ende doch 198 Dazu: H. Gollwitzer, Geleitwort, in: M. Machoveč, Jesus für Atheisten, a.a.O., S. VII-XVII. 199 S. Kierkegaard, a.a.O., S. 102. 200 A.a.O., S. 18.
69
Die Erschließung
nichts sei als eine ungeheure Projektion der Sehnsüchte und Nöte des Menschen ins Objektive, ein Leiden an der Gottesfrage: von all diesen und ähnlichen Haltungen des modernen Gottesbewußtseins weiß das NT nichts201. Wie kaum einmal sonst werden in dieser Feststellung die Frustrationen aufgerufen, die der heutige Bibelleser bei der Lektüre der neutestamentlichen Schriften erlebt und erleidet. Weder gehen sie auf die Qualen ein, in die ihn die Gottesfrage stürzt, noch bemühen sie sich, seine Not durch Strategien der Vergewisserung zu beheben. Und vollends ist ihnen die Anfechtung, die sich mit dem Begriff des Entzugs und der Abwesenheit Gottes verbindet, fremd. Denn Gott ist für sie – und darin besteht die befremdende Alternative – einfach da und dies als die „eines Beweises und einer Erklärung nicht bedürfende Tatsache“202. Das wirkt, auch wenn es zunächst widersprüchlich erscheint, wie eine Antizipation des anselmischen Arguments. Denn Gott wird in diesen Texten tatsächlich so gedacht, daß mit dem Gedanken an ihn die Gewißheit seiner Existenz mitgegeben ist, sein Nichtsein aber als denkunmöglich erscheint. Das bestärkt einerseits den immer schon gehegten Verdacht, daß in dem anselmischen Gottesbeweis anders als im Regelfall gesprochen wird, andererseits aber auch die Vermutung, daß sich die Entdeckung Rahners letztlich auf ein Sprachproblem bezieht, deutlicher noch, auf die Frage, ob in den neutestamentlichen Schriften von Gott nicht in transinformativer Weise gesprochen werde. Für Rahner löst sich das von ihm angesprochene Problem durch die für das Verständnis der neutestamentlichen Autoren ebenso einfache wie „gewaltige Tatsache, daß Gott selbst sich geoffenbart“ und in die von ihnen bezeugte Geschichte handelnd eingegriffen hat. Und die daran angeschlossene Ableitung nimmt sich tatsächlich wie eine fortschreitende Erhärtung und Explikation dieser These aus. Doch an einer Stelle überschreitet er, zumindest verbal, den Gedankengang mit der Feststellung, daß für die von ihm befragten Autoren das „Wissen um Gott“ in einer „unlöslichen Verbindung“ mit ihrer „Erfahrung der Wirklichkeit Christi“ stehe203. Das klingt zwar zunächst nur wie eine Konkretisierung des Begriffs „Offenbarung“, sofern sich diese abschließend und unüberholbar in der Person und Lebensgeschichte Jesu ereignete. Wenn man jedoch bedenkt, daß Rahner seine Prognose, der Christ der Zukunft werde ein „Mystiker“ sein, mit dem Zusatz erläutert: „einer, der etwas ‚erfahren‘ hat“204, nämlich eine „aus der Mitte der Existenz kommende Erfahrung Gottes“205, gewinnt das Wort von der „Erfahrung der Wirklichkeit Christi“ doch einen ungleich höheren Stellenwert, der zur Rückfrage nach der Erfahrung und ihrer sprachlichen Umsetzung nötigt. Was diese anlangt, so steht die Bibel insgesamt noch jenseits der modernen Einengung der Sprache auf ihre informative Funktion. Ihr ist nicht nur bewußt, daß man mit Wor201 K. Rahner, Theos im Neuen Testament (1942), in: ders., Schriften zur Theologie, Bd. 1, Einsiedeln u. a. 1954, S. 91 – 167, S. 108. 202 Ebd.; dazu: E. Biser, Die Suspendierung der Gottesfrage. Erwägungen zu einer innovatorischen These Karl Rahners (1984), in: ders., Glaubensimpulse. Beiträge zur Glaubenstheorie und Religionsphilosophie, Würzburg 1988, S. 189 – 207. 203 K. Rahner, Theos im Neuen Testament, in: ders., Schriften zur Theologie, Bd. 1, a.a.O., S. 113. 204 K. Rahner, Frömmigkeit früher und heute, in: ders., Schriften zur Theologie, Bd. 7, Einsiedeln u. a. 1966, S. 11 – 31, S. 22. 205 K. Rahner, Zur Theologie und Spiritualität der Pfarrseelsorge, in: ders., Schriften zur Theologie, Bd. 14, a.a.O., S. 161.
70
2. Die Lesarten
ten beten, beschwören, kränken und heilen, sondern auch im Wort sich zeigen – „Rede, daß ich dich sehe!“206 –, ja sogar, wie Paulus dies für sich (1Kor 5,3) in Anspruch nimmt, sich vergegenwärtigen kann. Die Bibel macht vielmehr von diesen Möglichkeiten im vollen Umfang Gebrauch. Den Extremfall dieses transinformativen „Sprachgebrauchs“ aber markiert der Eingangssatz des Johannesprologs, der im Licht des bekannten Wortes von Marshall McLuhan: „the medium is the message“, das Medium ist die Botschaft207, spontan in seiner medientheoretischen Bedeutung erkennbar wird. Denn im Unterschied zur Benennung Christi als Brot, Licht, Hirte, Tür, Weg und Leben sagt der Satz: „Im Anfang war das Wort“ (Joh 1,1), von ihm keine Qualität, sondern die Funktion aus, die leibhaftige Botschaft und das vollkommene Medium des sich in ihm offenbarenden Gottes zu sein. Nur so schließt sich der Ring vom Anfang zum Schluß des Johannesprologs, der die eingangs begrifflich ausgedrückte Funktion in den Satz zusammenfaßt: Keiner hat Gott je gesehen; doch der eingeborene Gott, der am Herzen des Vaters ruht: er hat uns Kunde gebracht (Joh 1,18). Im Rückblick auf diese Stelle gewinnt die von Rahner den neutestamentlichen Autoren zugeschriebene Erfahrung deutlichere Kontur, die gleichzeitig begreiflich macht, weshalb auf Jesus nur sehr zögernd qualifizierende Titel wie Messias, Sohn oder Herr übertragen wurden, obwohl diese doch regelrecht „in der Luft lagen“. Sie blieben zunächst in der Schwebe, weil die Tradenten noch ganz dem Eindruck unterstanden, in seiner Person und seiner Lebens- und Leidensgeschichte von Gott angerufen und angesprochen worden zu sein. Jesus war für sie, in der von Ernst Fuchs gebrauchten Terminologie ausgedrückt, in erster Linie ein „Sprachereignis“, das die Ferne Gottes aufhob und sie ins Einvernehmen mit ihm zog208. Nicht weniger auffällig ist aber auch, daß die neutestamentlichen Autoren keine Notwendigkeit zu empfinden scheinen, die ihrer Botschaft zugrundeliegenden Fakten zu sichern, ja daß sich der zweifellos zeitkritischste unter ihnen, Paulus, dazu eigentümlich indifferent verhält; denn selbst wenn er Christus „dem Fleische nach“, also in seiner geschichtlichen Erscheinung, gekannt haben sollte, kenne er ihn, wie er ausdrücklich versichert, „jetzt doch nicht mehr so“ (2Kor 5,16). Und das, obwohl in der Kontroverse mit der Gnosis klar geworden war, daß mit der Verbürgtheit der historischen Fakten die Botschaft des Evangeliums stand und fiel. Zwar fehlt es nicht an eindringlichen Zeugnissen der „Autopsie“. Doch bezieht sich gerade die nachdrücklichste unter ihnen, die Bezeugung des Lanzenstichs in die Seite des Gekreuzigten (Joh 19,33ff), eindeutig auf die „Symbolik“ dieses Vorgangs, nicht auf dessen Faktizität.
206 J. G. Hamann, Aesthetica in nuce. Eine Rhapsodie in Kabbalistischer Prose (1762), in: ders., Schriften zur Sprache, Frankfurt a. M. 1967, S. 105 – 127, S. 108; dazu: Th. Brose, Johann Georg Hamann und David Hume. Metaphysik und Glaube im Spannungsfeld der Aufklärung, Bd. 2, Frankfurt a. M. 2006, S. 440 – 485: Aesthetica in nuce. 207 M. McLuhan, Die magischen Kanäle (Understanding Media, 1964), aus d. Engl. übs. v. M. Amann, Frankfurt a. M. u. a. 1968, S. 13; dazu: E. Biser, Glaubenserweckung, a.a.O., S. 157. 208 Dazu: Ernst Fuchs, Marburger Hermeneutik, Tübingen 1968, S. 201; ferner: ders., Das Sprachereignis in der Verkündigung Jesu, in der Theologie des Paulus und im Ostergeschehen, in: ders., Gesammelte Aufsätze, Bd. 1: Zum hermeneutischen Problem in der Theologie, Tübingen 1959, S. 281 – 305.
71
Die Erschließung
3. Die Gottessuggestion Auf Grund dieser Überlegungen könnte die Beobachtung Rahners auch zu der Aussage fortgeschrieben werden: Das erste, was auffällt, wenn wir das Neue Testament aufschlagen, ist der Verzicht der Autoren auf jede historische Verifizierung ihrer Botschaft. Eine Sorge, daß sie mit einem Mythos verwechselt werden könnte, kennen sie nicht. Stattdessen rekurriert Paulus auf den seinen Adressaten „ins Herz geschriebenen“ Brief (2Kor 3,2f), um sie die Evidenz seiner Verkündigung erfahren zu lassen: Im Matthäusevangelium sichert der verkündigende (Mt 18,20) und auferstandene Jesus (Mt 28,20) den in seinem Namen Versammelten, ja sogar den noch Zweifelnden (Mt 28,17) seine bleibende Gegenwart zu, während der johanneische Jesus die Distanz zu den Lesern des Evangeliums, in der Sprache Kierkegaards: zu den „Schülern zweiter Hand“, mit der Seligpreisung der nicht Sehenden und doch Glaubenden (Joh 20,29) überbrückt. Und am Ende der Apokalypse greift der als himmlischer Autor des Buches redende Jesus auf Selbstbezeichnungen in den einleitenden Sendschreiben zurück (Apk 22,16), um seiner Zusicherung: „Ja, ich komme bald“, letzten Nachdruck zu verleihen. Das alles spricht für eine, mit Rahner zu reden, „Erfahrung der Wirklichkeit“, und zwar der präsentischen Wirklichkeit und Geistesgegenwart Christi, die alles kompensiert, was der durch das Fluidum der Aufklärung und die Gotteskritik der Neuzeit hindurchgegangene Leser vermißt: Gottesbeweise und historische Bezeugung. Im einzelnen durchmißt diese Kompensation zwei Stufen, die dann doch auf eine einzige Elementarerfahrung hinführen. Am Anfang steht offensichtlich ein Erlebnis des Ergriffenseins durch den, den die neutestamentlichen Schriften verkünden, ohne ihn je ganz zu vergegenständlichen. Denn stets schlägt am Ende der beschreibenden und interpretierenden Aussagen über ihn ein nicht objektivierbarer „Rest“ durch, in welchem der Dargestellte sich selbst vernehmen, erkennen und fühlen läßt. Das setzt freilich von seiten des Rezipienten voraus, daß er die Bedingungen des „impliziten Lesers“ erfüllt209, daß er sich also den Text im Vollsinn des Ausdrucks „gesagt sein läßt“, weil nur dann die Bedingung dafür gegeben ist, daß sich von der Gegenseite her der inwendige Lehrer in den Verstehensakt einmischt und ihn zum Ziel bringt. Der Sehweise der Christomathie entspricht somit, wie sich nunmehr zeigt, kein inhaltlich bestimmtes, sondern ein „transparentes“ Jesusbild, wie es schon im Eingangssatz des Johannesprologs aufscheint. Anders als in den Ich-bin-Worten des Evangeliums ist in dieser Benennung Jesu – als des uranfänglichen Logos – die Gestalt Jesu „durchlässig“ für den, der sich in ihr bekundet, darstellt und mitteilt. Was sich im Horizont der Christologie zu einer Fülle von Qualifikationen entfaltet, nimmt hier in Form einer Medialbestimmung seinen Anfang. Wenn man darauf die im Sinn des Schlüsselsatzes: „the medium is the message“, zu stellende Frage nach der „Botschaft“ dieses Mediums bezieht, kann die Antwort nur lauten: Es ist der sich darin verlautbarende und vergegenwärtigende Gott. Denn im Sinn des christlichen Dogmas, das sich darin von allen Formen des antiken und modernen Subordinatianismus unterscheidet, ist Jesus nicht, wie im Regelfall, Medium in einem abkünftig-reproduktiven, sondern in einem „wesensgleichen“, und das besagt, den von ihm Bezeugten vollgültig repräsentierenden Sinn. 209 Dazu: W. Iser, Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, München 4/1994, S. 50 – 67: Leserkonzepte und das Konzept des impliziten Lesers.
72
3. Die Gottessuggestion
Mit dieser Erkenntnis ist dann auch schon die zweite Stufe der anvisierten Kompensation erreicht. So wenig die neutestamentliche Botschaft einer formellen Erhärtung der Historizität des Heilbringers bedarf, kann ihr das Fehlen eines Gottesbeweises als Mangel angelastet werden. Im Gegenteil: Schon der Versuch einer Beweisführung würde das in Frage stellen, was sie stattdessen in einer alle Beweiskraft übertreffenden Weise bietet: eine Gottes-Suggestion, die im Leser einen Bewußtseinswandel bewirkt. Denn je tiefer er sich „einliest“, desto mehr verschieben sich für ihn die Gewichte, so daß ihm der zuvor unerreichbar ferne Gott zum Erstgewissen und Erstwirklichen wird, während die Alltagsrealität an Schwere und Dringlichkeit verliert. Zuletzt aber könnte man beide Kompensationen in dem Satz zusammenfassen, daß die neutestamentlichen Autoren keine Beweise für die Historizität Jesu und die Existenz Gottes erbrachten, weil sie dem Eindruck unterstanden, im Umgang mit der Gestalt und Lebensgeschichte Jesu von Gott unmittelbar angesprochen und ins Einvernehmen gezogen worden zu sein, und weil ihre ganze Anstrengung sich darauf richtete, diesen Eindruck auf die Leser ihrer Werke zu übertragen. Seiner ganzen Natur nach drängt dieses Initiationserlebnis darauf, entfaltet und zu konkreten Leseanweisungen ausgearbeitet zu werden. Zuvor ist jedoch eine Erinnerung unumgänglich, welche die Qualifikation der Christomathie als Korrektiv zur Christologie betrifft. Was damit von den beiden Konzeptionen festgestellt wurde, gilt uneingeschränkt auch für das Methodenproblem, also für das Verhältnis der christomathischen Lesarten zur historischen Kritik. Denn diese ist auch in deren Sicht nicht hintergehbar. Was die historisch-kritische Befragung der Texte an Einsichten zutage förderte, kann mit Hilfe anderer Zugänge in keiner Weise ersetzt oder widerlegt werden, auch nicht hinsichtlich der Unterscheidung originärer und nachgestalteter Jesusworte. Nicht zuletzt gilt das angesichts neuerer Tendenzen, die Evangelien aus ideologischer Voreingenommenheit und zuletzt sogar unter Berufung auf angebliche Qumran-Funde zurückzudatieren, ganz so, als könne die vielberufene „Authentizität“ der Texte durch Verringerung des Zeitenabstands gesichert oder doch wenigstens wahrscheinlich gemacht werden. Sofern sich hinter diesen Tendenzen die Absicht verbirgt, Jesus in die Rolle eines „Schulhauptes“ abzudrängen und seine Botschaft zu einer lehrhaften Instruktion zu verflachen, kann sich der christomathische Ansatz, dem es wesentlich um die Erschließung der transinformativen Dimensionen des Textes zu tun ist, gerade im Hinblick auf die zentrale Bedeutung für die Geistesgegenwart nicht energisch genug davon abgrenzen210. Was aber die Differenzierung anlangt, so bietet sich dafür als „Kronzeuge“ der Eingang des Ersten Johannesbriefs an, wo sich eine autoritative Gruppe über den Verfasser des folgenden Schreibens erhebt und eine subtile „Augenzeugenschaft“ für sich in Anspruch nimmt. Mit feierlicher Betonung, die keinen Widerspruch duldet, besteht sie darauf, das von ihr verkündete „Wort des Lebens“ gehört, mit eigenen Augen gesehen und sogar mit Händen betastet zu haben (1Joh 1,1). Da die rückbezüglichen Erklärungen, die diese dreifache Wahrnehmung entweder auf die Erscheinungen des Auferstandenen oder auf die Inkarnation des Logos beziehen möchten, aus unterschiedlichen Gründen an der Textaussage scheitern, bleibt nur die präsentische Deutung. Die aber entnimmt der Stelle, daß für die aus ihr sprechende Gruppe der von ihr Bezeugte und Verkündete auf neue Weise hörbar, sichtbar und fühlbar wurde – und daß sie aus der dadurch gewonnenen Kompetenz redet. Wenn es sich aber so verhält, schlugen sich in ihrem Zeugnis drei Er210 Dazu: E. Biser u. R. Heinzmann, Theologie der Zukunft. Eugen Biser im Gespräch mit Richard Heinzmann, 3., unveränd. Aufl., Darmstadt 2010, S. 88 – 92.
73
Die Erschließung
fahrungsweisen und Sprachqualitäten nieder, die rückläufig durch drei darauf abgestimmten Lesarten zu erschließen sind: durch eine akustische, eine optische und eine haptische.
4. Der akustische Zugang Die akustische Lesart muß schon deshalb an der Spitze stehen, weil das Evangelium seinem Wesen nach Botschaft und Verkündigung ist, die von einem jeden, der „Ohren hat zu hören“ (Mt 11,15), vernommen sein will. Denn vom Evangelium gilt, schon auf Grund des soziokulturellen Zusammenhangs, uneingeschränkt, was Buber für die Thora und was Günter Lanczkowski, wenngleich abgeschwächt, auch für den Koran geltend macht: Bei aller Betonung ihres Schriftcharakters sind beide von ihrer Ursprungsbedeutung her zur mündlichen „Vorlesung“ bestimmt, und das besagt, sie wollen mehr noch gehört als gelesen werden211. Verhält es sich demnach mit der Bibel so wie mit einer Muschel, bei der man nur das Ohr eng genug an die Öffnung zu legen braucht, um, wie es heißt, das Rauschen des Meeres – auf die Bibel bezogen: das Brausen des Geistes und die sich aus diesem erhebende Stimme der Gottesoffenbarung – zu vernehmen? Doch wo ist bei ihr die Öffnung? Wie bei Reinhold Schneider – „ich höre den fernen Gesang“ – in der Krypta212? Wie bei Søren Kierkegaard in der Klage Jesu über das von ihm ausgehende Ärgernis? Wie bei Johann Georg Hamann in der Tiefe des durch das Bibelwort hellhörig gewordenen Herzens? Oder wie bei Nikolaus von Kues überall dort, wo in ihrem Wortlaut die „große Stimme“ des zu sich rufenden Gottes hörbar wird? Gleichwohl: Obschon nur Niederschlag und oft genug sogar „Abbreviatur“ der prophetischen und apostolischen Verkündigung, wollen die biblischen Texte auf den in ihnen erklingenden „Unterton“ hin gehört werden, auch wenn die Zeugen dieses Hörens nur schwer auszumachen und zum Reden zu bringen sind. Immerhin lassen sich einige von ihnen namhaft machen, an ihrer Spitze Augustinus, der als der Entdecker des inwendigen Lehrers, des magister interior, auf eine besondere Hellhörigkeit für die aus den biblischen Texten – für ihn in erster Linie aus den Gebetsworten der Psalmen – erklingende Stimme entwickelte und als erster auch schon einzelne Modulationen unterschied. Darauf bezieht sich die Mahnung in seinem Psalmenkommentar (42,1): Gut sollten wir diese Stimme kennenlernen, diese glücklich singende, diese schmerzvoll stöhnende, diese in Hoffnung aufjubelnde, in ihrem gegenwärtigen Zustand aber seufzende Stimme, gut sollten wir sie kennenlernen, sie zuinnerst vernehmen, um sie uns zueigen zu machen213. 211 Dazu: E. Biser, Glaubensprognose, a.a.O., S. 371f; ferner: ders., Der inwendige Lehrer, a.a.O., S. 79 – 82: Der akustische Zugang. 212 R. Schneider, Winter in Wien. Aus meinen Notizbüchern 1957/58, Freiburg i. Br. 2/1958, S. 79; dazu: E. Biser, Versöhnter Abschied. Zum geistigen Vorgang in Schneiders „Winter in Wien“ (1981), in: ders., Glaubensimpulse, a.a.O., S. 381 – 400, S. 391; ferner: ders., Die glaubensgeschichtliche Wende, a.a.O., S. 199 – 208: Die „Krypta“ des Glaubens. 213 Augustinus, Enarratio in ps 42, c. 1, in: ders., Opera omnia, hrsg. v. J.-P. Migne, Bd. 4 (PL, Bd. 36), Paris 1861, Sp. 476.
74
4. Der akustische Zugang
Fast hat es den Anschein, als entwickle Augustinus diese Modulationen spiegelbildlich zum Spektrum seiner eigenen Sprachwelt, die sich, am eindrucksvollsten in seinen Psalmenkommentaren und seinen „Confessiones“ von Äußerungen der Dankbarkeit, des Bedauerns und der Klage bis zur Höhe wahrer Sprachekstase erhebt, bisweilen aber auch, wie etwa in dem monotonen Lehrgedicht gegen die Donatisten214, in die Niederungen primitiver Sprachpolemik abstürzt. Wenn diese Annahme zuträfe, stünde bei Augustinus nicht nur der von ihm durchmessene Denkweg, sondern auch seine Sprachwelt in engster Beziehung zu seiner Lebensgeschichte. Für seine Sprachwelt würde dann Ähnliches gelten wie für seinen Versuch, von seiner psychischen Selbsterfahrung auf das trinitarische Gottesgeheimnis zurückzuschließen215. Von da an wird das Vernehmen der göttlichen Stimme zu einem Grundmotiv der gesamten – insbesondere aber der abendländischen – Theologie. Bei Bonaventura, der eine ausdrückliche „Theologie des Wortes“ entwickelt216 und sich dabei intensiv auf den Eingang des Johannesevangeliums und des Ersten Johannesbriefs bezieht, ist Jesus nicht nur das inkarnierte und als solches in seiner Verhüllung den Vater offenbarende Wort, sondern überdies das „medium in omnibus“, und das gerade in seiner Erniedrigung bis zum Kreuz, das ihn – mit Heinrich Seuse gesprochen, der diesen Gedanken weiterentwickelt – durch die eindringliche Sprache seiner Wunden als das weit aufgeschlagene, „zerdehnte Buch“ seines gekreuzigten Leibes offenbart217. Dementsprechend wird durch Jesus der Chor aller Stimmen hörbar, die sich jemals zu Gott erhoben, vor allem aber die Stimme dessen, der sich ihrer annimmt und sie mit seinem Offenbarungswort beantwortet, also seine eigene, mystisch vernommene Stimme. Nachdem – wie Johannes Chrysostomos lehrt – „Christus die Zwischenwand zwischen Himmel und Erde niedergelegt hat“218, erklingt durch ihn der himmlische Lobgesang, der als solcher aber dahin tendiert, ins verstehbare Wort verdichtet zu werden. Im Zug dieses Vorgangs schauen die Mystiker auf dem Höhepunkt ihrer Erhebung das Antlitz Christi, das auf übersprachliche Weise zu ihnen spricht und sie seiner Herrlichkeit anverwandelt. So bezeugt es vor allem Heinrich Seuse in der Wiedergabe der Gespräche, die er mit der Ewigen Weisheit führt. Ebenso urteilt Meister Eckhart: Nun spricht […] die Braut im Hohenliede: Ich habe überstiegen alle Berge und all meine Vermögen […] bis an die dunkle Kraft des Vaters, wo alle Rede endet219. Wie sich der göttliche Zuspruch, oft über Abgründe der Sprachnot hinweg, ins nachgestaltende Menschenwort umsetzt, sagt in Wendungen, die gleichzeitig an die Konfessionen des Jeremia und an Platons Siebten Brief erinnern, der große Mystiker der Ostkirche, Symeon der Neue Theologe: 214 Ders., Psalmus contra partem Donati, in: ders., Scripta contra Donatistas, Teil 1 (CSEL 51), hrsg. v. M. Petschenig, Wien u. a. 1908, S. 1 – 15. 215 Ders., Fünfzehn Bücher über die Dreifaltigkeit (De trinitate) XI, c. 4; XIV, c. 11, aus dem Lat. übs. v. M. Schmaus (BKV, 2. Reihe, Bd. 14), Kempten u. a. 1935, S. 106 – 108; S. 229 – 231. 216 Dazu: A. Gerken, Theologie des Wortes. Das Verhältnis von Schöpfung und Inkarnation bei Bonaventura, Düsseldorf 1963. 217 Nach: H. S. Denifle, Das geistliche Leben. Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts, hrsg. u. eingel. v. A. Auer, Salzburg u. a. 9/1936, S. 316. 218 Zitiert nach: E. Benz, Die Vision. Erfahrungsformen und Bilderwelt, Stuttgart 1969, S. 419. 219 Zitiert nach: M. Buber, Ekstatische Konfessionen, Heidelberg 5/1984, S. XXIX.
75
Die Erschließung
Meine Zunge entbehrt der Worte, und was in mir geschieht, sieht mein Geist wohl, aber er erklärt es nicht. Er betrachtet und will aussprechen, aber das Wort findet er nicht. Er schaut das Unsichtbare, das aller Gestalt Ledige, durchaus Einfache, nicht Zusammengesetzte, und an Größe Unendliche. Denn er erblickt keinen Anfang, und kein Ende schaut er, und ist gänzlich keiner Mitte bewußt, und weiß nicht, wie er das sagen soll, was er sieht. Etwas Ganzes erscheint, wie ich meine, und nicht mit dem Wesen selbst, sondern durch eine Teilnahme. Denn an Feuer entzündest du Feuer und das ganze Feuer empfängst du: jenes aber bleibt ungemindert und ungeteilt wie vordem […] Ich weiß nicht. Und ich wollte schweigen – daß ich’s doch vermöchte: aber das Wunder, des Schauers voll, erregt die Seele und erschließt meinen unreinen Mund: und der nun in meinem dunklen Herzen den Anfang erweckt hat, zwingt mich Unwilligen zum Reden220. Während sich bei Augustinus die Reihe der Stufungen, in denen er die göttliche Stimme vernimmt, spiegelbildlich zum Ausdruck der eigenen Ausdrucksweisen darstellt, geht Petrus Damiani den unterschiedlichen Tonlagen des liturgischen Betens nach, die sich vom flehentlichen Bittgebet bis zu Lob und Jubel und vom Zuspruch des „Dominus vobiscum“ bis zur Segensspendung strecken221. Wie eine modulationsreiche Beantwortung dessen entspricht dem das Theorem der „Großen Stimme“, das Nikolaus von Kues in offenbarungstheoretischer Zusammenschau dieser Ansätze entwickelt: Wir besitzen einen Erlöser, der ein universaler Mittler ist, alle Dinge erfüllt und der Erstgeborene aller Geschöpfe ist. Dieser Jesus ließ von Anfang der Welt an in seinen erlösten Gliedern eine einzige Stimme erschallen, eine Stimme, die nach und nach anschwoll, bis sie in ihm selbst am lautesten wurde, damals, als er seinen Geist aufgab. […] Das ist diese große Stimme, die in der Tiefe unseres Geistes ertönt, die die Propheten in uns hineinrufen, um uns anzuhalten, den einzigen Schöpfer zu verehren, die Tugend zu üben, uns zum Erlöser zu flüchten […]. Nachdem diese große Stimme jahrhundertelang ununterbrochen sich gesteigert hatte bis auf Johannes, die Stimme des Rufenden in der Wüste, der mit dem Finger auf den Erlöser hinwies, hat sie endlich Menschengestalt angenommen und am Ende einer langen Reihe von Modulationen, bestehend aus Lehren und Wundern, die uns zeigen sollten, daß von allen schrecklichen Dingen das schrecklichste von der Liebe gewählt werden mußte, nämlich der sinnliche Tod, stieß sie einen großen Schrei aus und verschied222. Hier stehen die Modulationen, anders als bei Augustinus, in engster Wechselbeziehung zu der im Todesschrei ausklingenden Lebensgeschichte Jesu, die geradezu als das strukturie220 Zitiert nach: M. Buber, a.a.O., S. 41f. 221 Dazu: H. de Lubac, Katholizismus als Gemeinschaft , a.a.O., S. 353f; S. 410 – 415. 222 Nikolaus von Kues, Sermo XXVIII, pars 1 u. 2, zitiert nach: H. de Lubac, a.a.O., S. 404f.
76
4. Der akustische Zugang
rende Prinzip der unterschiedlichen Ausdrucksformen und Klangfarben erscheint. Leicht lassen sich die von Jesus überlieferten Dankesworte – wie etwa seine Huldigung an den Vater (Lk 10,21f) oder die dem Vater zugeeigneten Gebete – dem augustinischen „Flehen“ und „Jubeln“ und die Äußerungen der Bedrückung (Lk 12,50; Joh 12,23-28) und der Verlassenheit (Mk 15,34) dem „Stöhnen“ zuordnen. Vor allem aber besticht das cusanische Konzept dadurch, daß es die unterschiedlichen „Tonlagen“ als Äußerungsformen des einen, mit dem Zeugnis der Propheten einsetzenden und im Menschenherzen widerklingenden Offenbarungswortes zu verstehen gibt. Damit verglichen, heben die übrigen Zeugnisse einzelne Ausdrucksformen hervor. Dabei fällt auf, daß die literarisch-theologischen unter ihnen ausschließlich den dunklen Tönungen angehören. Dazu zählt das „Londoner Erlebnis“, das für Hamann die Wende in seiner „Höllenfahrt der Selbsterkenntnis“ brachte223. Lange schon, so berichtet er in seinen „Gedanken über meinen Lebenslauf“, habe er Gott um einen wahren Freund gebeten und ihn schließlich in seinem eigenen Herzen gefunden224. Zur entscheidenden Entdeckung aber sei ihm die Lektüre der Geschichte von Kain und Abel geraten: Ich fühlte mein Herz klopfen, ich hörte eine Stimme in der Tiefe desselben seufzen und jammern, als die Stimme des Bluts, als die Stimme eines erschlagenen Bruders, der sein Blut rächen wollte, wenn ich […] fortführe, mein Ohr gegen selbiges zu verstopfen […]. Ich fühlte auf einmal mein Herz quillen, es ergoß sich in Tränen und ich konnte es nicht länger – ich konnte es nicht länger meinem Gott verhehlen, daß ich der Brudermörder, der Brudermörder seines eingeborenen Sohnes war […]. Ich fühlte Gott Lob! jetzt mein Herz ruhiger als ich es jemals in meinem Leben gehabt. In den Augenblicken, worin die Schwermut hat aufsteigen wollen, bin ich mit einem Trost überschwemmt worden, dessen Quelle ich mir selbst nicht zuschreiben kann und den kein Mensch im Stande ist, so überschwenglich seinem Nächsten einzuflößen. Ich bin erschrocken über den Überfluß desselben; er verschlang alle Furcht, alle Traurigkeit, alles Mißtrauen, daß ich keine Spur davon in meinem Gemüt mehr finden konnte225. Vor allem aber ist an dieser Stelle Kierkegaard zu nennen, der als Entdecker der akustischen Lesart zu gelten hat. Auf einem Höhepunkt seiner „Einübung im Christentum“ spricht er davon, daß Jesus im „letzten Abschnitt seines Lebens“ nicht nur der Becher des menschenmöglichen Leidens – beginnend mit dem nächtlichen Verrat, seiner Verhöhnung, Mißhandlung und der „fürchterlichen Einsamkeit“ inmitten der tobenden Feinde – gereicht worden sei, sondern daß er ihn ein zweites Mal zu kosten bekam, und jetzt gefüllt mit der unvergleichlich größeren Bitterkeit, die in seinem Wissen darum bestand, daß viele an seinem Leiden wie an seiner Liebe Anstoß nehmen würden: ein 223 Dazu: Th. Brose, Johann Georg Hamann und David Hume, Bd. 1, a.a.O., S. 119 – 133: Hamanns „Höllenfahrt der Selbsterkenntnis“. 224 J. G. Hamann, Gedanken über meinen Lebenslauf (1758), in: ders., Sämtliche Werke, hrsg. v. J. Nadler, Bd. 2: Schriften über Philosophie, Philologie, Kritik: 1758 – 1763, Wien 1950, S. 9 – 54, S. 38f. 225 A.a.O., S. 40; dazu: Th. Brose, Johann Georg Hamann und David Hume, Bd. 1, a.a.O., S. 125f.
77
Die Erschließung
Leiden, das kein Mensch zu begreifen vermag, denn es begreifen zu wollen, wäre Vermessenheit. Und er begründet das mit einem frömmigkeitsgeschichtlichen Rückblick: Es ist, sonderlich in älteren Zeiten, viel und oft über die Leiden Christi geredet worden, wie er verspottet wurde, gegeißelt, gekreuzigt. Darüber scheint man jedoch eine ganz andre Art Leiden zu vergessen, das Leiden der Innerlichkeit, das Leiden der Seele, oder, so müßte man es wohl nennen, das Geheimnis der Leiden226. Von diesem „Leidensgeheimnis“, das kein Mensch in seinem Leid und seiner Tiefe begreifen könne, klinge etwas – man könnte verdeutlichend sagen: ein Unterton – allenthalben nach, das selbst noch in den freudigsten Jesusworten wie in der Seligpreisung zu vernehmen sei, mit dem Jesus das Messiasbekenntnis des Petrus beantwortete227. Eine ganz andere Perspektive erschließt sich jedoch, wenn man – wie es insbesondere die Berichte der Mystiker, welche himmlische Lobgesänge vernahmen, nahelegen – die musikalischen Zeugnisse in die Erkundung einbezieht228. Diese Zeugnisse sind umso beweiskräftiger, je mehr sich ihre Motivfindung, wie das exemplarisch bei Beethoven geschieht, auf das Sprachmelos der Texte bezieht229. Innerhalb des Beethovenschen Werkes bieten sich dafür zunächst profane Belege an, wie etwa das „Le-be-wohl“ zu Beginn der Klaviersonate „Les Adieux“ (op. 81a) oder das auf ein frühes „Vivat, vivat Rudolphus“ zurückgreifende Kopfmotiv der Hammerklaviersonate (op. 106) und das Wechselgespräch: „Muß es sein? – Es muß sein!“, im Finale des letzten Streichquartetts (op. 135). Doch steuert vor allem die Missa solemnis (op. 123) sakrale Motivgestalten bei, wie insbesondere das Eingangswort, das „Descendit de coelis“ und das „et homo factus est“ des Credo-Satzes. Subtiler gestaltet sich der Nachweis im Fall der von Bach übernommenen Motive, unter denen hier das zweimal – sowohl im Kopfsatz der Cellosonate (op. 69) als auch im Arioso der Klaviersonate Nr. 21 in As-Dur (op. 110) – aufscheinende „Es ist vollbracht“ aus Bachs Johannespassion zu nennen ist. Denn dadurch ergibt sich ein Brückenschlag zu Bachs Vertonungen des Evangelientextes in den beiden großen Passionswerken, die sich in ihrer Motivfindung immer wieder vom Wortlaut inspirieren lassen230, angefangen bei den Einsetzungsworten und der Verlassenheitsklage Jesu in der Matthäuspassion bis hin zu dem von Beethoven aus der Johannespassion zitierten „Es ist vollbracht“. In seiner theologiekritischen Studie „Matthäuspassion“ ging Hans Blumenberg mit besonderem Nachdruck auf die Abba-Anrufung ein, um so das Gefälle zum Eli-Ausruf des Sterbenden voll ausmessen zu können. Zweifellos geht er mit Bach eine weite Strecke einig, wenn er diesem Ruf den Doppelsinn entnimmt, daß der von Gott Verlassene nicht in die Nacht von Golgota hinausschreit, son-
226 S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, in: ders., Werkausgabe Bd. 2, S. 139. 227 A.a.O., S. 102. 228 Dazu in Auswahl: E. Biser, Tönende Vergewisserung. Gibt es einen musikalischen Gottesbeweis?, in: ders., Gott im Horizont des Menschen, hrsg. v. P. Jentzmik, Limburg 2001, S. 159–177; ders., Musik als Dialog mit Gott und Mensch. Oder: Der hörbare Faden der Ariadne, in: zur debatte. Themen der Katholischen Akademie in Bayern 33 (2003) 2, S. 24f; ders., Der Ursprung der christlichen Musik, in: Aufgang. Jahrbuch für Denken, Dichten, Musik 1 (2004), S. 215–218. 229 Ausführlicher dazu, mit Literaturangaben: E. Biser, Theologische Sprachtheorie und Hermeneutik, München 1970, S. 221 – 232: Die sprachliche Elementarstruktur, bes. S. 228f, Anm. 57. 230 Dazu: E. Biser, Bach als Wiederentdecker der paulinischen Heilsbotschaft, in: ders., Glaubensimpulse, a.a.O., S. 324 – 336.
78
5. Der optische Zugang
dern dem klagt, von dem er sich verlassen fühlt, auch wenn er sich von Bach dann mit der Bemerkung abkehrt, daß dieser Schrei sogar „dem toten Gott“ und diesem sogar „erst recht“ gelten könne231. Im Blick auf seine geradezu kanonische Geltung im angelsächsischen Kulturraum muß im gleichen Atemzug mit den Bachschen Passionen Georg Friedrich Händels „Messias“ genannt werden, dessen Nähe zum musikalisch gedeuteten „Wort“ Johann Gottfried Herder zu der Bemerkung veranlaßte: Auch wo ein sichtbarer Gegenstand vorsteht, der Gekreuzigte, die Mutter mit ihrem Kinde u.f. schildert die Musik nicht, sondern spricht Worte der Empfindung232. Diese Empfindung war für den unter dem Eindruck eines geradezu ekstatischen Inspirationserlebnisses schaffenden Komponisten offensichtlich derart positiv, daß sie sogar den Passionsteil des Werkes bestimmt und diesen in das krönende „Halleluja“ ausklingen läßt. Nicht umsonst glaubte der Komponist der Überlieferung zufolge bei der Niederschrift des „Halleluja“ den Himmel offen zu sehen, wobei er sich mit Paulus nicht sicher war, ob ihm das „im Leibe oder außer dem Leibe“ widerfahren sei. Was in diesen Werken musikalisch gestaltet wurde, hebt die wohl bedeutendste Oratorienschöpfung des vergangenen Jahrhunderts, Franz Schmidts „Das Buch mit sieben Siegeln“ ins visionäre Bild233. Nach dem Bericht der Apokalypse tritt das geschlachtete Lamm vor den Thron Gottes, um das siebenfach versiegelte Buch seiner Ratschlüsse entgegenzunehmen und die Siegel zu öffnen. Daß sich der Komponist durch diese Szene selbst ermächtigt sah, spiegelt sich in seinem kühnen Umgang mit dem Text, den er nicht nur durch breite Einschübe erweitert, sondern bisweilen auch umdeutet, wenn er den bei der Öffnung des ersten Siegels erscheinenden Reiter auf dem weißen Roß auf den bezieht, der „Wort Gottes“ (Apk 19,13) heißt234. Einen ähnlichen Anspruch erhebt er, wenn er nach dem mächtigen „Halleluja“, in dem das Werk gipfelt, den Verfasser des Geheimnisbuches noch einmal mit der Versicherung, daß er all dies gesehen und gehört habe, zu Wort kommen läßt und dem – offensichtlich im Rückbezug auf sich selbst – hinzufügt: „Hört auf meine Worte!“235
5. Der optische Zugang Im Blick auf das durchgängige Bemühen des Komponisten, die visionären Bilder der Apoklypse musikalisch zu setzen, könnte man auf sein Oratorium den Erfahrungssatz beziehen, daß nach Anbruch der Dämmerung verschwindende Farbunterschiede beim 231 H. Blumenberg, Matthäuspassion, Frankfurt a. M. 1988, S. 110; S. 220f; dazu: E. Biser, Theologische Trauerarbeit. Zu Hans Blumenbergs „Matthäuspassion“, in: Theologische Revue 85 (1989), Sp. 441 – 452. 232 J. G. Herder, Wissenschaften, Ereignisse und Charaktere des vergangenen Jahrhunderts, in: ders., Werke in zehn Bänden, Bd. 10: Adrastea, hrsg. v. G. Arnold, Frankfurt a. M. 2000, S. 490 – 569, S. 554f. 233 Dazu: A. Arbeiter, Einführung in „Das Buch mit sieben Siegeln“. Oratorium von Franz Schmidt, Judenburg 1958. 234 A.a.O., S. 4; S. 8; S. 17ff. 235 A.a.O., S. 39.
79
Die Erschließung
Erklingen eines Tones wieder erkennbar werden. Damit verlagert sich das Interesse von der akustischen auf die optische Lesart. Weil Worte das vorzüglichste Mittel sind, jemanden „ins Bild zu setzen“, bewirkt auch das Offenbarungswort eine Imagination von dem, was es besagt. Sein Empfänger könnte im Vorgriff auf die von ihm ersehnte Gottesoffenbarung mit Hamann sagen: Rede, daß ich dich sehe!236 Und die Selbstdarstellung des Offenbarungswortes entspricht tatsächlich von Anfang an dieser Erwartung. Mose tritt dem brennenden Dornbusch näher, um das eigentümliche Schauspiel anzuschauen (Ex 3,3); bei Jesaja und Jeremia ereignet sich die Berufung im Zusammenhang mit einer visionären Schau, beim einen ist es der von Seraphen umschwebte Gottesthron (Jes 6,1-7), beim anderen ein aufblühender Mandelzweig und ein überschäumender Kessel (Jer 1,11ff); bei Paulus besteht die Berufung nach Gal 1,15f zwar primär im Erlebnis einer göttlichen Selbstmitteilung, doch klärt sich das vernommene Wort zugleich „zum Aufgang der Gottherrlichkeit auf dem Antlitz Jesu Christi“ (2Kor 4,6). Darauf bezieht sich der Wahrheitswert der auf die „Schau der Gestalt“ abhebenden Offenbarungstheorie Hans Urs von Balthasars237, die freilich in der von ihm angenommenen Prioritätenfolge – Sehen vor Hören – dem gesamtbiblischen Zeugnis widerspricht. Rezeptionstheoretisch geht die optische Lesart darauf zurück, daß dem Glaubenden, wie schon der Epheserbrief (Eph 1,18) betont und wie in dessen Gefolge der Jesuitentheologe Pierre Rousselot ausarbeitete, erleuchtete „Herzensaugen“ gegeben sind; offenbarungstheoretisch darauf, daß der offenbarende Eingriff Gottes in die Menschheitsgeschichte vielfach mit einem Aufleuchten des „kabod“ Gottes, des Glanzes seines Lichts im Dunkel der Welt, verbunden ist; wahrheitstheoretisch darauf, daß sich die Offenbarungswahrheit im Unterschied zur Systemwahrheit, wie es der augustinischen Metapher von der „facies veritatis“ entspricht238, antlitzhaft lichtet und ihren Empfänger in einen Blickdialog mit sich zieht. Das Motiv taucht schon im Evangelium auf, besonders „sprechend“ in der Szene mit dem sich um die Jüngerschaft bewerbenden Reichen, dem Jesus nach dem Markusbericht (Mk 10,21) mit einem liebevollen Blick entgegenkommt, beziehungsreich sodann in der visionären Schau seiner kommenden Herrlichkeit, mit der er die Identitätsfrage des Hohepriesters beantwortet (Mk 14,62), und dann nochmals in dem Blick, mit dem er Petrus dessen klägliches Versagen zu Bewußtsein (Lk 22,61) bringt. Dies aber hat schon ein Vorspiel in der Frage, mit der Philon von Alexandrien auf das Schriftwort eingeht, daß Abraham „dem Herrn gegenüber stand“ (Gen 18,22): Denn wann ist es wahrscheinlich, daß eine Denkseele nicht mehr auf einer Waage schwankt und festzustehen vermag, als wenn sie sich Gott gegenüber befindet, ihn sehend und von ihm gesehen?239 236 J. G. Hamann, Aesthetica in nuce, in: ders., Schriften zur Sprache, a.a.O., S. 108; dazu: Th. Brose, Johann Georg Hamann und David Hume, Bd. 2, a.a.O., S. 440 – 485, bes. S. 479. 237 Dazu: H. U. v. Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, Bd. 1: Schau der Gestalt, Einsiedeln 1961. 238 Augustinus, Selbstgespräche II, 35, in: ders., Selbstgespräche. Von der Unsterblichkeit der Seele, lat. u. dt., hrsg. v. H. Fuchs u. übs. v. H. Müller, München u. a. 3/2002, S. 150. 239 Philo von Alexandria, Über die Träume – De somniis, in: ders., Die Werke in deutscher Übersetzung, hrsg. v. L. Cohn u. a., Bd. 6, Berlin 2/1962, S. 163 – 277, S. 264.
80
5. Der optische Zugang
Von da an durchzieht das Motiv, mehr noch in seiner philonischen als in seiner neutestamentlichen Gestalt, in schmaler, aber kontinuierlicher Tradition die gesamte Geistesgeschichte bis tief ins 19. Jahrhundert hinein, wo es sich zu extremen Gegensätzen entzweit. Es blitzt förmlich auf in Augustinus’ beseligtem Geständnis: Spät habe ich dich geliebt, o Schönheit, so alt und doch immer neu, spät habe ich dich geliebt. Und siehe, du warst in meinem Innern und ich draußen; und draußen suchte ich dich und stürzte mich in meiner Häßlichkeit auf die schönen Gebilde, die du geschaffen. Du warst bei mir, aber ich nicht bei dir. Weit weg von dir zog mich, was doch keinen Bestand hätte, wenn es nicht in dir wäre. Du hast mich laut gerufen und meine Taubheit zerrissen; du hast geblitzt und geleuchtet und meine Blindheit verscheucht. Du hast mir süßen Duft zugeweht; ich habe ihn eingesogen, und nun seufze ich nach dir240. Ausgesprochene Höhepunkte erreicht die Motivgeschichte vor allem in den Gottesspekulationen von Anselm und Nikolaus von Kues. In Anselms „Proslogion“ steigert sich der Beter zu dem Ausruf: O höchstes und unzugängliches Licht, o ganze und selige Wahrheit, wie weit bist Du von mir, der ich Dir so nahe bin! Wie entrückt bist Du meinem Blick, der ich Deinem Blick so gegenwärtig bin!241 Demgegenüber kreist die cusanische Abhandlung „Vom Sehen Gottes“ um die Frage: Was anderes ist Dein Sehen, Herr, […] als daß ich Dich sehe: indem Du mich ansiehst, läßt Du, der verborgene Gott, Dich von mir erblicken […]. Nichts anderes ist es Dich zu sehen, als daß Du den Dich Sehenden ansiehst242. Wie an anderen Stellen des Werkes fällt auch hier jene anthropozentrische Umgewichtung auf, die Michael Landmann von einem „Rückstoß des Menschen auf sich selbst“ sprechen läßt243 und in ersten, kaum merklichen Ansätzen auf jene verzweifelte Emanzipation vorausweist, mit der die Motivgeschichte bei Nietzsche abbricht244. Zuvor sei jedoch der literarischen Variante des Motivs in Eduard Mörikes Gedicht „Göttliche Reminiszenz“ gedacht, die von Guardini in ihrem überragenden Stellenwert entdeckt wurde245. 240 Augustinus, Bekenntnisse X, 27, a.a.O. (BKV, 1. Reihe, Bd. 18, VII), S. 244f. 241 Anselm von Canterbury, Proslogion c. 16, lat.-dt., hrsg. u. übs. v. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt 1962, S. 112. 242 Nikolaus von Kues, De visione Dei – Die Gottes-Schau, c. 5, in: ders., Philosophisch-theologische Schriften, Bd. 3, a.a.O., S. 108 – 111, S. 109. 243 M. Landmann, De homine. Der Mensch im Spiegel seines Gedankens, Freiburg i. Br. u. a. 1962, S. 136. 244 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra IV, Der hässlichste Mensch, in: ders., KSA 4, S. 327 – 332, S. 331: „er sah mit Augen, welche A l l e s sahn […]. Der Gott, der Alles sah, a u c h d e n M e n s c h e n : dieser Gott musste sterben!“. 245 R. Guardini, Gegenwart und Geheimnis. Eine Auslegung von fünf Gedichten Eduard Mörikes, Würzburg 1957, S. 50 – 64.
81
Die Erschließung
Das auf den Eingang des Johannesprologs bezogene Gedicht schildert zunächst in einer idyllischen, in den schwäbischen Jura verlegten Szene, wie ein alter Hirt dem etwa fünfjährigen Jesusknaben eine Versteinerung überreicht: Der Knabe hat das Wunderding beschaut, und jetzt, Gleichsam betroffen, spannet sich der weite Blick, Entgegen dir, doch wirklich ohne Gegenstand, Durchdringend ew’ge Zeitenferne, grenzenlos: Als wittre durch die überwölkte Stirn ein Blitz Der Gottheit, ein Erinnern, das im gleichen Nu Erloschen sein wird; und das welterschaffende, Das Wort von Anfang, als ein spielend Erdenkind, Mit Lächeln zeigt’s unwissend dir sein eigen Werk246. Der Blick des Kindes ist „ganz ohne Gegenstand“, weil völlig in sich gekehrt, zum ewigen Ursprung hin, wo es wie die kindliche Weisheit vor dem Schöpfer auf dem Erdenrund spielte und spielend sein Werk mitgestaltete. Und gleichzeitig stand dieser Blick dem vom Gedicht dialogisch angesprochenen Leser entgegen, um ihn, geheimnisvoll, in den Vorgang dieses göttlich-schöpferischen Erinnerns einzubeziehen. In eigentümlicher Abwandlung begegnet diese Szene nochmals in einem der Briefe, die Nastassja Filippowna, die Magdalenen-Gestalt in Dostojewskijs Roman „Der Idiot“, an ihre Rivalin und durch diese an den Fürsten richtet. Darin beschreibt sie ein Jesusbild, wie sie es sich gelegentlich auszumalen sucht: Jesus ist allein, nur zusammen mit einem Kind, das bewundernd zu ihm aufschaut. Selbstvergessen läßt er seine Hand auf dem Köpfchen des Kindes ruhen: Er blickt in die Ferne, nach dem Horizont; ein ruhiger Gedanke, groß wie die Welt, liegt in seinem Blick; sein Gesicht ist traurig247. Der Blick Jesu in dem sich der weltumspannende Gedanke des Gottesreichs spiegelt, ist nicht mehr dem Betrachter zugewandt, sondern seinem vorgeahnten Ende entgegengerichtet und deshalb voller Trauer. Nicht umsonst hat die innerlich bereits dem Tod verfallene Verfasserin der Briefe dieses Bild entworfen. Kontrapunktisch dazu vollzieht sich bei Nietzsche eine gewaltsame Emanzipation aus der Betroffenheit durch den göttlichen Blick, von dem er sich noch in seiner Herzenstiefe berührt fühlte. In der Folge aber ergeht es ihm wie Daniel in Jean-Paul Sartres Roman „Le sursis“, von dem es heißt: Er war G e g e n s t a n d eines Blicks. Ein Blick, der ihn bis auf den Grund erforschte, der ihn mit Messerstichen durchdrang und nicht sein Blick war; ein undurchsichtiger Blick, die Nacht in Person, die ihn dort auf dem Grunde seiner selbst erwartete und die ihn dazu
246 E. Mörike, Göttliche Reminiscenz, in: ders., Werke und Briefe, hrsg. v. H.-H. Krummacher, Bd. 1: Gedichte. Ausgabe von 1867, Teil 1: Text, Stuttgart 2003, S. 258f. 247 F. M. Dostojewskij, Der Idiot (Idiot, russ., 1868/69), 3. Teil, in: ders., Die großen Romane, aus dem Russ. übs. v. H. Röhl, Frankfurt a. M. 1981, Bd. 5, S. 119.
82
5. Der optische Zugang
verurteilte, er selbst zu sein […]. Ich werde g e s e h e n . Durchsichtig, durchsichtig, durchbohrt. Von wem nur?248 Bei Nietzsche steht dagegen die Herkunft des Blicks außer Frage. Es ist das ihn aus dem Dunkel anblickende göttliche Auge, von dem er sich „darnieder geblitzt“, durchbohrt und gemartert fühlt249. Deshalb rechtfertigt der „häßlichste Mensch“, den Zarathustra als den Mörder Gottes enträtselt, seine Untat mit der Begründung: Aber er – m u s s t e sterben: er sah mit Augen, welche A l l e s sahn, – er sah des Menschen Tiefen und Gründe, alle seine verhehlte Schmach und Hässlichkeit. Sein Mitleiden kannte keine Scham: er kroch in meine schmutzigsten Winkel, dieser Neugierigste, Über-Zudringliche, Über-Mitleidige musste sterben. Er sah immer m i c h: an einem solchen Zeugen wollte ich Rache haben – oder selber nicht leben250. Daß selbst diese Blick-Beschwörung noch überboten werden kann, bewies Marc Chagall mit seinem in neunjährigem Ringen vollendeten Gemälde „Der Engelsturz“, das die Schrecknisse des über sein heimatliches Witebsk hereinbrechenden Bombenkriegs in die apokalyptische Szene mit dem vom Himmel gestürzten Drachen spiegelt251. Dabei beläßt der Künstler dem Unheilbringer noch seine ursprüngliche Engelsgestalt, sofern er ihn nicht sogar mit der sternengekrönten Frau der Apokalypse zusammenschaut. Wie die Pendeluhr in der oberen Bildmitte anzeigt, hat die Stunde der Endzeit geschlagen; doch nur bedingt, denn mit dem Einbruch der Vernichtungsgewalten hält gleichzeitig ein neues Prinzip, Gestalt geworden in der betont weiblich dargestellten Gestalt des Engels, Einzug in die sich auflösende Welt. Davor bringt sich der Thoraträger als Hüter der versinkenden Schriftkultur mit Verwünschungen auf den Lippen in Sicherheit, während ein zufälliger Beobachter buchstäblich den Boden unter den Füßen verliert. Was das Werk sonst noch aufführt, der Tierkopf und die sich selbst spielende Geige als Symbole der in Mitleidenschaft gezogenen Natur und Kunst, aber auch die Zeichen des Sakralen: Madonna, Kerze und Kruzifix, treten zurück, sobald sich der Blick des Betrachters in das weit aufgerissene Auge des Stürzenden versenkt hat. Dieser Widerblick stellt ihn zur Rede und reißt ihn gleichzeitig in das apokalyptische Geschehen hinein, ohne daß klare Eindeutigkeit entsteht. Kaum bleibt ihm eine andere Wahl als daß er sich auf
248 J.-P. Sartre, Der Aufschub (Les chemins de la liberté, Bd. 2: Le sursis, 1945), aus d. Franz. übs. v. H. G. Brenner, Reinbek 1972, S. 104; dazu: E. Biser, Der schwere Weg der Gottesfrage, Düsseldorf 1982, S. 64, Anm. 61: Den theoretischen Unterbau dieser Aussage „bietet das Kapitel ‚Der Blick‘ in Sartres Hauptwerk: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie [(L’Être et le Néant, 1943), aus dem Franz. übs. v. J. Streller u. a.], Hamburg 1962, S. 338 – 397.“ 249 F. Nietzsche, Dionysos-Dithyramben, in: ders., KSA 6, S. 375 – 410, S. 398; dazu: E. Biser, Der schwere Weg der Gottesfrage, a.a.O., S. 61ff. 250 Ders., Also sprach Zarathustra IV, Der hässlichste Mensch, in: ders., KSA 4, S. 331. 251 Dazu: E. Biser, Das Antlitz des Menschen. Zur religiösen Dimension der Malerei. Gedeutet an drei Hauptwerken, in: W. Böhme (Hg.), Wo ist Gott zu finden?, Karlsruhe 1985, S. 43 – 54, S. 43 – 46: Der „Engelsturz“ von Marc Chagall.
83
Die Erschließung
das bezieht, was wie eine vom Himmel hereinbrechende Stichflamme alles zu versengen droht. Damit ist freilich der Gegenpol zu dem erreicht, was sich Philon vom göttlichen Blick versprach: Festigkeit auf der Waage des Daseins. Deshalb verfaßt sich das ganze Interesse an dieser Stelle zu der Frage, wo in aller Welt der Blick zu gewärtigen ist, der dem ins Schwanken Geratenen Halt und Stand verleiht. Die Antwort ist identisch mit der Beantwortung der noch offenen Frage nach dem „Ort“, an dem der Leidens- und Freudenton zu vernehmen ist, auf den sich die akustische Lesart einstimmt. Für diese lautet die Antwort: dort, wo die „große Stimme“, die sich bis zum Todesschrei Jesu steigerte, ihren authentischen Niederschlag gefunden hat, also im biblischen Schriftwort. Demgemäß lautet die Antwort für die optische Lesart: dort, wo im Gitterwerk der Texte das Antlitz des Gekreuzigten und Auferstandenen aufscheint oder – jetzt zusammenfassend gesprochen – wo sich, wie Nelly Sachs dichtete, aus der Luft der letzten Atemzüge des Gekreuzigten der große Schrei aufbaute und sich im Dunkel der einsamsten Stunde ein Auge abhob „und sah“. Denn der Schüler der Christomathie ist daran zu erkennen, daß er sich die Texte „gesagt sein läßt“ und das in ihnen Wahrgenommene, wie Paulus es fordert, in sich spiegelt. Paulus entwickelt diesen Gedanken im Kontext seiner spirituellen Hermeneutik (2Kor 3,1-18), die davon ausgeht, daß gläubiges Verstehen aus der Konvergenz von Innen und Außen hervorgeht. Was in Gestalt des Schrifttextes als äußere Vorgegebenheit zur Kenntnis genommen wird, ist seinem Konzept zufolge dem Leser in Gestalt des „inwendigen Briefs“ bereits ins Herz geschrieben, so daß es nur noch durch den äußeren Wortlaut „aufgerufen” zu werden braucht252. Umgekehrt liegt auf dem vorgegebenen Text solange eine Decke, als er nicht durch das innerlich Eingeschriebene, man könnte verdeutlichend sagen: durch den inwendigen Lehrer, beleuchtet und entschlüsselt wird.
6. Der haptische Zugang Paulus spricht davon, daß bei diesem Vorgang „die Decke weggenommen wird“ (2Kor 3,16); und er gebraucht dabei eine Metapher, die beim Leseakt auf ein energetisches Moment schließen läßt und damit die Brücke zur haptischen Lesart schlägt. Was es mit dieser auf sich hat, wird kaum irgendwo deutlicher als in dem Wort, das, von der Sprachqualität her gesehen, die geheime Mitte des Johannesevangeliums bildet und vermutlich sogar als die Achse aller Evangelienschriften begriffen sein will. Es markiert den Höhepunkt des von Jesus vor dem Eintritt in sein Leiden gesprochenen Abschiedsgebets, auf dem er das Knechtsgewand der Niedrigkeit und des Bittens abwirft, um von seinem Vater die ihm seit Anbeginn zukommende Herrlichkeit für die Seinen einzufordern: Vater, ich will, daß die, die du mir gegeben hast, dort bei mir seien, wo ich bin, damit sie die Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt (Joh 17,24). 252 Dazu: G. Theißen, Psychologische Aspekte paulinischer Theologie, Göttingen 1983, S. 144ff; ferner: H. Lietzmann, An die Korinther I/II (Handbuch zum Neuen Testament, 9), 4., von W. G. Kümmel erg. Aufl., Tübingen 1949, S. 112 – 115.
84
6. Der haptische Zugang
Alles rücke hier in den „Schatten eines majestätischen ‚Ich will‘“, meint Ernst Käsemann bei der Erklärung dieser kaum auszulotenden Stelle253. Er hätte richtiger von dem „Licht“ sprechen sollen, das von dieser Stelle ausgeht und über das ganze Evangelium ausgebreitet liegt. Doch sollte man wohl besser noch von der „Hand“ reden, die aus diesem Wort nach dem Leser greift, um ihn dorthin zu ziehen, wo das menschgewordene Wort nach Joh 1,18 am Herzen des Vaters ruht, wo ihm nach Joh 15,15 alles vom Vater mitgeteilt ist und deshalb alles religiöse Reden, christlich gesehen, seinen Ursprung hat. Wenn Jesus mit seinem – das ganze Evangelium durchtönenden – Machtwort vom Vater fordert, daß er die Seinen, die ihm seit Anbeginn zukommende Herrlichkeit schauen lasse, wird die enge Verklammerung der haptischen Perspektive mit der optischen deutlich, und wenn er die ihm Zugehörenden außerdem als diejenigen bezeichnet, die sein Wort angenommen und bewahrt haben (Joh 17,8), macht er überdies klar, daß Gleiches auch von der akustischen Perspektive gilt. All diese Perspektiven aber sind, wie sich gleichfalls zeigt, elementare Explikationen des Glaubens, den man im johanneischen Verständnis als ein vermitteltes Hören, als ein Sehen im Nichtsehen und als ein Fühlen im Entzug bestimmen könnte. Doch wo tritt das haptische Moment sonst noch zutage? Im Kontext der Evangelien findet sich das haptische Moment überall dort, wo Jesus, um nur die eindringlichsten Szenen zu nennen, Ohren und Zunge eines Taubstummen berührt (Mk 7,33f), wo er die Quaste seines Gewandes von der blutflüssigen Frau berühren läßt (Lk 8,42-46) und wo er die Hand des verstorbenen Mädchens ergreift, um es ins Leben zurückzurufen (Mk 5,41). Als besonders eindrucksvoll erweist sich in diesem – und nicht nur in diesem – Zusammenhang sodann die Szene mit dem sinkenden Petrus, dessen Notschrei Jesus damit beantwortet, daß er die Hand ausstreckt, ihn ergreift und in Sicherheit bringt (Mt 14,31f). Dagegen ist die johanneische Szene, die sich spontan als Belegstelle anbietet, die Erscheinung des Auferstandenen vor dem Zweifler Thomas (Joh 20,24-29), nur bedingt beweiskräftig, da offen bleibt, ob es wirklich zu der von dem „Ungläubigen“ geforderten Berührung der Wundmale kommt. Wohl aber gibt die über ihn hinweggesprochene Seligpreisung derer, „die nicht sehen und doch glauben“ (Joh 20,29), zu verstehen, daß sie im Entzug der äußeren Wahrnehmung durch den äußeren Glauben ebenso „berühren“ wie „sehen“ und, wie im Sinn des Gesamtkontextes zu ergänzen ist, auch „hören“. Denn in dem ihnen zugesprochenen „Selig“ klingt ein letztes Mal das machtvolle „Ich will“ nach, mit welchem Jesus die Seinen dorthin versetzt, wo er selbst der Hörer der göttlichen Selbstmitteilung, der Schauende der göttlichen Herrlichkeit und der am Herzen des Vaters Geborgene ist. Umso nachdrücklicher muß nun aber auf die eschatologische Variante des paulinischen Osterzeugnisses verwiesen werden. Nachdem der Apostel zunächst davon sprach, daß ihm in seiner Damaskusvision das Geheimnis des Gottessohnes geoffenbart wurde (Gal 1,15f) und daß sich dieses übersprachliche Gotteswort im Antlitz des Auferstandenen geklärt habe (2Kor 4,6), versichert Paulus in einem dritten Anlauf, daß er dabei so machtvoll von Christus „ergriffen“ wurde, daß ihm sein Leben fortan in dem Bestreben bestehe, ihn seinerseits immer vollkommener zu ergreifen (Phil 3,12). Vom Impuls dieses Ergriffenseins ist sein – noch in Händels Inspirationserlebnis nachklingendes – Wort von seiner Entrückung in den dritten Himmel (2Kor 12,2ff) eingegeben und, unmittelbarer noch, sein Geständnis, daß er sich nicht erkühne, etwas zu sagen, was nicht von Christus durch ihn bewirkt worden sei (Röm 15,18). 253 E. Käsemann, Jesu letzter Wille nach Joh 17, Tübingen 1966, S. 16; dazu: E. Biser, Das Antlitz, a.a.O., S. 78f.
85
Die Erschließung
Daß das Erlebnis der Befestigung den Aufstieg des Geistes, im Grunde sogar seine Selbstüberschreitung, voraussetzt, macht Augustinus deutlich, wenn er auf dem Höhepunkt seiner Ostia-Vision von der ewigen Weisheit berichtet: Und während wir von ihr redeten und nach ihr verlangten, berührten wir sie leise in einem Augenblicke höchster Herzenserhebung; dann seufzten wir auf und ließen dort „die Erstlinge unseres Geistes“ gefesselt zurück254. Vermittelt durch den Begriff der Weisheit steigert sich für Augustinus das Gefühl des Festgebundenseins in ihr sodann zu dem der Gottesfühlung, von der es heißt: […] gleichwie wir uns jetzt erhoben und in reißendem Gedankenfluge die ewige, unvergängliche Weisheit berührten; wenn endlich dieser Zustand anhielte und alle anderen Vorstellungen weit niederer Art verschwänden und nur diese eine den Schauenden hinrisse und in sich aufnähme und in innerlicher Wonne bärge, kurz daß dies ein Gleichnis des ewigen Lebens wäre wie jener Augenblick höchster Erkenntnis, nach dem wir geseufzt – wäre dies nicht der Zeitpunkt, von dem geschrieben steht: „Geh ein in die Freude deines Herrn“?255. Ein starker Anstoß geht dabei von dem pseudo-dionysischen Gedanken aus, daß Gott mehr durch ein wahrnehmendes Erleiden als durch spekulatives Forschen erkannt werde: non solum discens, sed patiens divina256. Denn immer dann, wenn der Exzeß der geistigen Erhebung erreicht ist, schlägt der erkennende Zugriff in das Gefühl eines Ergriffenseins um. Diese Vorstellung setzt schon bei Augustinus ein, sofern das spekulative Element sich bei ihm mit der Vorstellung von einem inneren Berühren, Schmecken und Fühlen – attingere, sapere und sentire – verbindet257. In der Folge verzweigt sich das Motiv in zwei Varianten: in die spekulative, die auf den anselmischen Gottesbeweis hinführt und das unüberdenklich Größte als das „Umgreifende“ erfährt, das in seiner Unübersteigbarkeit die Gewähr seiner Existenz in sich birgt, und in die sensualistische, die über Bernhard von Clairvaux und Heinrich Seuse zu jener Vorstellung der mystischen Umarmung führt, die in den spätmittelalterlichen ChristusJohannes-Gruppen ihren ebenso luziden wie kühnen Ausdruck finden. Denn in der spätmittelalterlichen Kunst wird hier nicht nur das symbolische Verständnis des von Jesus geliebten Jüngers vorweggenommen, sondern zugleich auch die Berührung des Göttlichen auf ihren christologischen Ermöglichungsgrund zurückgeführt258. Nach Bernhard von Clairvaux muß der von vielfacher Not bedrängte Mensch oftmals Gott anflehen: 254 Augustinus, Bekenntnisse IX, 10, a.a.O. (BKV, 1. Reihe, Bd. 18, VII), S. 206. 255 A.a.O., S. 207. 256 Dionysius Pseudo-Areopagita, Schriften über „Göttliche Namen“ – De divinis nominibus, c. 2,9, in: Des heiligen Dionysius Areopagita ausgewählte Schriften, Bd. 2, aus dem Griech. übs. v. J. Stiglmayr (BKV, 2. Reihe, Bd. 2), Kempten u. a. 1933, S. 44. 257 Dazu: Augustinus, Bekenntnisse X, 6; 8, a.a.O. (BKV, 1. Reihe, Bd. 18, VII), S. 220 – 223; S. 223 – 226. 258 Dazu: H. Wentzel, Die Christus-Johannes-Gruppen des XIV. Jahrhunderts, Stuttgart 2/1960.
86
7. Die Begründung
Im Anflehen aber wird er verkosten, im Verkosten aber erfahren, wie süß der Herr ist. So geschieht es, daß uns schließlich seine verkostete Süße mehr zu reiner Gottesliebe anlockt, als unsere Notlage uns dazu drängt259. Und Seuse sieht sich in einer Vision sogar selbst in die Rolle des geliebten Jüngers versetzt, der seinen Kopf an die Brust der ewigen Weisheit neigt und in dieser unaussprechlichen Umarmung die Worte vernimmt: Je liebreicher du mich umfängst und je unkörperlicher du mich küssest, um so liebreicher und um so freundlicher wirst du in meiner ewigen Klarheit umfangen260. Unverkennbar greift die johanneische Szene mit dem an der Brust Jesu liegenden Jünger zurück auf das am Schluß des Johannesprologs aufscheinende Bild von dem am Herzen des Vaters ruhenden „Einziggeborenen“ (Joh 1,18)261. Unüberhörbar ist das aber auch das Ziel der Forderung, zu der sich Jesus in seinem Abschiedsgebet steigert. Dorthin „will“ er die Seinen versetzt sehen, wo er selbst seit Anbeginn beheimatet ist. Sich dorthin bewegen lassen, ist letzter Sinn der haptischen Lesart.
7. Die Begründung Aber ist von derart pauschalen Kategorien ein nennenswerter Effekt zu erwarten? Die Beantwortung dieser Frage muß in zwei Schritten erfolgen: in einem ersten Schritt, der die Forderung nach Alternativen zur historischen Kritik rechtfertigt und auf eine Kritik ihres kritischen Ansatzes hinausläuft; und in einem zweiten, der sich mit einer bisher übersehenen Qualität der Bibeltexte befaßt. Denn diese wurden seit dem von Franz Overbeck unternommenen Vorstoß lediglich als literarische Produkte gewürdigt262, wobei die Frage ihrer Zugehörigkeit zur Kategorie der Groß- oder Kleinliteratur und die Bestimmung der jeweiligen literarischen Gattung die Diskussion in Atem hielt. Doch selbst den vorzüglichsten Kennern ihrer Entstehungsverhältnisse kommt es nicht in den Sinn, sie nach ihrem Mediencharakter zu befragen – und das selbst angesichts der Tatsache, daß der Eintritt ins totale Medienzeitalter die von dem Siegeszug der audiovisuellen Medien in den Hintergrund gedrängte Schriftkultur in die bisher schwerste Krise ihrer Geschichte stürzte. Nur der Thoraträger auf Marc Chagalls „Engelsturz“ trifft Anstalten, die von ihm gehüteten Schriftrollen vor den hereinbrechenden Mächten in Sicherheit zu bringen. Dagegen entwickeln die von ihm verkörperten Experten noch nicht einmal ein Bewußt259 Bernhard von Clairvaux, Über die Gottesliebe (1127), in: S. Grotefeld u. a. (Hgg.), Quellentexte theologischer Ethik. Von der Alten Kirche bis zur Gegenwart, Stuttgart 2006, S. 63 – 67: Auszüge aus Bernhard von Clairvaux’ „Buch über die Gottesliebe“, S. 65. 260 Zitiert nach: M. Buber, Ekstatische Konfessionen, a.a.O., S. 90. 261 Dazu: E. Biser, Was ist mit diesem? Eine Improvisation über das Thema des von Jesus geliebten Jüngers, in: C. Breytenbach u. a. (Hgg.), Anfänge der Christologie. Festschrift für Ferdinand Hahn zum 65. Geburtstag, Göttingen 1991, S. 323 – 336. 262 Dazu: F. Overbeck, Über die Anfänge der patristischen Literatur (1882), Darmstadt 1984.
87
Die Erschließung
sein davon, daß die von ihnen in alle Richtungen durchforschte Bibel ein Buch und, als das „Buch der Bücher“, der Exponent der Printmedien ist. Damit blieben sie jedoch den Mindestbeitrag schuldig, der im Interesse der Krisenbewältigung gerade von ihnen, den Erstberufenen im Umgang mit Medien, zu erwarten gewesen wäre. Was aber rechtfertigt die Kritik an der historischen Kritik, deren Leistungskraft doch schon daran zu ersehen ist, daß die Exegese stillschweigend die über Jahrhunderte hinweg von der Dogmatik eingenommene Spitzenposition im Konzert der theologischen Wissenschaften von dieser übernahm? Gerechtfertigt ist diese Kritik nicht durch die von ihr erbrachten Ergebnisse, die zu den glänzendsten und hilfreichsten zählen, die von der theologischen Forschung jemals erbracht wurden und als solche keinesfalls wieder aufgegeben werden können. Gerechtfertigt ist sie noch nicht einmal durch ihren kritischen Ansatz, also dadurch, daß sie hauptsächlich trennend, unterscheidend und auflösend mit den Texten umgeht; denn zum einen verdankt sie dieser vorwiegend analytischen Textbehandlung den Großteil ihrer wissenschaftlichen Leistungen; und zum andern steht sie damit nicht, wie ihr immer wieder vorgeworfen wird, im Widerspruch zum Glauben, da diesem selbst ein kritisches Moment eingestiftet ist. Nur auf Grund seiner Fähigkeit zu kritischer Selbstunterscheidung vermag der Glaube seine Identität gegenüber der Vielfalt weltanschaulicher Angebote und, wesentlicher noch, gegenüber seiner Bedrohung durch Wahn und Aberglauben zu bewahren. Und nur auf Grund dieser kritischen Komponente steht er den neuzeitlichen Tendenzkräften – wie insbesondere der Aufklärung – nicht hilflos, sondern als kompetenter Gesprächspartner gegenüber. Bedürfte es noch eines Beweises dafür, so erbrächte ihn das Verhältnis von Paulus zu Jesus. In dessen Botschaft überwog das affirmative Moment so sehr, daß sich, wie keiner hellsichtiger als Kierkegaard erkannte, gerade daran der Widerspruch entzündete. Denn als es Jesus gelang – so die im modernen Sinn unkritische, in essentieller Hinsicht jedoch ausnehmend kritische Deutung Kierkegaards –, seiner Botschaft den luzidesten Ausdruck zu verleihen, indem er sich das „Brot des Lebens“ nannte, erregte er damit keineswegs das stürmische Verlangen der Menschenmenge nach diesem Brot, sondern gehässige Ablehnung: Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? (Joh 6,60). Diesem geradezu tödlichen Effekt sucht Paulus die Spitze abzubrechen, indem er das kritische Moment, das ihm ohnehin im Blut lag, in den Glauben aufnahm, so daß sich die Kritik an ihm buchstäblich totläuft. Für Paulus ist der Glaube von Haus aus kritisch, so daß er in seiner charismatischen Überhöhung zur „Unterscheidung der Geister“ (1Kor 12,10) befähigt. Was zum Glauben quersteht, ist vielmehr das Geschichtsverständnis der historischen Kritik. Dem Wesensdenken verhaftet, gliedert sie, wie im Sinne Rosenzweigs zu sagen ist, die ihr Geschichtsbild tragenden Fakten aus dem Strom des Geschehens aus, um sie anderen zuordnen und von wieder anderen absetzen zu können. Hierin tritt sie in einen diametralen Gegensatz zum Geschichtsbild des Glaubens, der bei aller Verankerung in historischen Begebenheiten davon lebt, daß diese in die Gegenwart der Glaubenden hineinwirken und als fortwirkende geltend gemacht werden können. Das führt im Feld der historisch-kritischen Interpretation zu falschen Polarisierungen, die dazu veranlassen, fortwirkend Gemeintes entweder faktizistisch festzuschreiben oder ins Reich des Mythisch-Legendären zu verweisen. Hier setzt die mit den christomathischen Lesarten einhergehende Korrektur ein. Von ihrem Ergebnis her läßt sich diese in einen einzigen Satz 88
7. Die Begründung
zusammenfassen: Die historische Kritik ist, vom Selbstverständnis der Paulusbriefe her gesehen, ein Instrument des „toten Buchstabens“, an dem der „lebendigmachende Geist“ des Schriftworts erstirbt. Alles liegt somit daran, das, was er trennte, in höherem Sinn zu vereinen, und das, was er zum Gegenstand erstarren ließ, mit Geist und Leben zu erfüllen. Das kann nur über die Wahrnehmung des Mediencharakters der biblischen Schriften gelingen263. Was ergibt sich daraus? Zunächst die Einsicht in ein bisher übersehenes oder doch nicht hinreichend gewürdigtes Strukturgesetz, das eine eigentümlich eskalierende Bedeutungsspanne aufweist. Im unteren Skalenbereich geht es um die schlichte Tatsache, daß die als Medium begriffene Bibel immer nur eine Reproduktion, also ein literarischer Niederschlag der Botschaft, nicht aber diese selber ist. Ihre Spitze erreicht die Skala hingegen in dem von dem kanadischen Medientheoretiker Marshall McLuhan aufgestellten, aber, wie sich zeigen wird, grundbiblischen Satz, daß das Medium selbst die Botschaft ist: „the medium is the message“264. Des weiteren ergibt sich ein Einblick in die spezifischen Auswirkungen des Strukturgesetzes auf die reproduzierten Inhalte, die als die medialen Strategien gekennzeichnet seien. Und schließlich Einsicht in die Folgen, die sich mit der Frage umschreiben lassen: Verändern Medien die Botschaft? Um das mediale Strukturgesetz in den Blick zu bekommen, tut man gut daran, das christliche Offenbarungsverständnis im Unterschied zu dem der beiden anderen Offenbarungsreligionen, Judentum und Islam, ins Auge zu fassen. Symptomatisch für das Jüdische ist der bekenntnishafte Ausspruch des Propheten Jeremia: Fanden sich Worte von dir, so verschlang ich sie; dein Wort wurde mir zum Glück und zur Freude meines Herzens; denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott Zebaoth (Jer 15,16)265. Während im Schöpfungsbericht, der jeweils mit dem „Und Gott sprach“ einsetzt, das Gotteswort mit der Wucht eines Elementarereignisses in die Welt einbricht, die es gleichzeitig aus dem Nichts „hervorruft“, kommt hier, spiegelbildlich dazu, die „unstillbare Gier“ des Menschen nach dieser Himmelsspeise zu Wort. Hierin bezeugt sich eine Gotteserfahrung, für die Gott trotz der konventionellen Rede vom „Gott der Heerscharen“ nicht der siegreich Herrschende, sondern der sich dialogisch Mitteilende ist. So entspricht es dann auch vollauf der Szene vom brennenden Dornbusch, mit der die Geschichte des jüdischen Prophetismus und seines Offenbarungsverständnisses ihren Ausgang nimmt: Gott übereignet sich dem Empfänger der Offenbarung und Träger der Sendung durch die Nennung seines Namens. Offenbarung ereignet sich im Wort. Das gilt so sehr, daß davon auch der schriftliche Niederschlag des Wortes betroffen ist. Denn ihrer Herkunft nach entspricht die mündliche Verkündigung der worthaften Selbstmitteilung Gottes weit mehr als deren Festschreibung zu einem heiligen Text266. Insofern tendiert der Text ständig dazu, in die ihm zugrundeliegende Mündlichkeit rückübersetzt zu werden. Dazu erklärt Martin Buber in seinen „Schriften zur Bibel“: 263 Dazu: E. Biser, Die Bibel als Medium. Zur medienkritischen Schlüsselposition der Theologie, Heidelberg 1990. 264 M. McLuhan, Die magischen Kanäle, a.a.O., S. 13. 265 Dazu: G. v. Rad, Die Botschaft der Propheten, München u. a. 1967 (Lizenzausgabe), S. 167. 266 Dazu: E. Biser, Wort Gottes in Menschensprache, in: P. Gordan (Hg.), Evangelium und Inkulturation (1492 – 1992), Graz u. a. 1993, S. 51 – 77.
89
Die Erschließung
In der jüdischen Tradition ist die Schrift bestimmt, vorgetragen zu werden; das sogenannte Akzentsystem, das Wort um Wort des Textes begleitet, dient zum rechtmäßigen Zurückgehen auf seine Gesprochenheit; schon die hebräische Bezeichnung für „lesen“ bedeutet: ausrufen, der traditionelle Name der Bibel ist: „die Lesung“, eigentlich also: die Ausrufung; und Gott sagt zu Josua nicht, das Buch der Thora solle ihm nicht aus den Augen, sondern, es solle ihm nicht „aus dem Munde“ weichen267. Demgegenüber besteht der Islam, der im Interesse der Abgrenzung nunmehr anvisiert werden muß, auf der Textgestalt der an Mohammed in der „Nacht der Macht“ – also in einer Stunde gebieterischer Übermächtigung – an diesen ergangenen Gottesoffenbarung. Eindringlicher noch als die Sure 96,1-5268 betont dies die islamische Legende, wonach in dieser Nacht der Engel Gabriel erschien, um dem Propheten den himmlischen Koran in Form eines mit dem „Text“ der Gottesgedanken beschriebenen Seidentuchs zu übermitteln. Bezeichnend ist die Gewaltsamkeit des Vorgangs. Dreimal preßt der Engel das Tuch dem Widerstrebenden mit wachsendem Nachdruck auf das Gesicht, bis dieser, als er fast zu sterben glaubt, unversehens lesen kann. Insofern steht der solcher Art entstandene Koran in einem linearen Verhältnis zu seinem göttlichen Urheber: Er ist das „notengetreue“ Replikat der Gedanken und Willensdekrete Allahs. Dabei ergeben sich freilich spezifische Berührungspunkte sowohl mit dem jüdischen als auch dem christlichen Offenbarungskonzept. Nach Lanczkowski bezeichnet „Koran“ ursprünglich die gottesdienstliche Schriftlesung, so daß er wie die jüdische Thora mit der Vokabel „Lesung“ wiedergegeben werden müßte269. Und Mohammed versichert in einer an Paulus erinnernden Wendung, daß ihm nach der nächtlichen Engelerscheinung war, als trüge er die ihm mitgeteilten Worte „ins Herz geschrieben“. Nach wiederholten Annäherungen an diese Konzeption grenzte sich die Christenheit davon aufs klarste in der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung „Dei Verbum“ des Zweiten Vatikanums ab270. Nach „Dei Verbum“ ereignet sich die Gottesoffenbarung abschließend und – der Logik dieses Konzepts entsprechend – unüberholbar in der Menschwerdung des Gottessohnes, der als solcher das leibhaftige „Wort Gottes“ und dessen personale Selbstdarstellung, medientheoretisch ausgedrückt: die in den heiligen Schriften von ihm enthaltene Botschaft, ist. Offenbarer Gottes ist Jesus dieser Sicht zufolge ebenso in seinem Wort wie in seinem Schweigen, ebenso in seinem Handeln wie in seinem Leiden, zumal aber im Ereignis seiner Auferstehung, und damit in der Totalität seiner Person und Lebensgeschichte, denn:
267 M. Buber, Über die Wortwahl in einer Verdeutschung der Schrift, in: ders., Werke, Bd. 2: Schriften zur Bibel, München u. a. 1964, S. 1111 – 1130, S. 1114. 268 Sure 96,1-5: „Lies! Im Namen deines Herrn, der erschuf, / Erschuf den Menschen aus geronnenem Blut. / Lies, denn dein Herr ist allgütig, / Der die Feder gelehrt, / Gelehrt den Menschen, was er nicht gewußt.“, in: Der Koran, aus d. Arab. übs. v. M. Henning, hrsg. v. A. Schimmel, Stuttgart 2006, S. 597. 269 Dazu: G. Lanczkowski, Heilige Schriften. Inhalt, Textgestalt und Überlieferung, Stuttgart 1956, S. 68. 270 Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung „Dei Verbum“, in: H. Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Entscheidungen, lat.-dt., hrsg. v. P. Hünermann, Freiburg i. Br. u. a. 40/2005, 4201 – 4235.
90
7. Die Begründung
er ist es also, der durch seine ganze Gegenwart und Verkündigung, durch Worte und Werke, durch Zeichen und Wunder, vor allem aber durch seinen Tod und seine glorreiche Auferstehung von den Toten, schließlich durch die Sendung des Geistes der Wahrheit die Offenbarung erfüllt und somit abschließt und durch göttliches Zeugnis bekräftigt, daß Gott wirklich mit uns ist, um uns aus der Finsternis der Sünde und des Todes zu befreien und zu ewigem Leben zu erwecken (DV 4)271. Im Unterschied zu den anderen „Abrahams-Religionen“ hat das Christentum somit nicht als primäre, sondern als sekundäre Schriftreligion zu gelten. Daß es eine eigene „Heilige Schrift“ hervorbrachte, war die Folge eines „höheren Zufalls“, nicht die eines ausdrücklichen oder mittelbaren Auftrags seines Stifters. Erst im Eingangswort der Apokalypse ergeht an den Seher der Befehl: „Schreibe auf, was du gesehen hast“ (Offb 1‚11). Doch das ist, in charismatischer Brechung, die Stimme des damaligen Glaubensbewußtseins, das darauf drängte, die ihm zugesprochene und überlieferte Botschaft zu dokumentieren und in eine reproduzierbare Form zu gießen. Als Auslöser für die Entstehung der neutestamentlichen Schriften wirkten vielmehr die soziokulturellen Gegebenheiten, die im Tod der Augen und Ohrenzeugen, im Ausbleiben der in Bälde erwarteten Wiederkunft und nicht zuletzt in der sprunghaften Ausbreitung des Christentums – in erster Linie das Ergebnis der paulinischen Mission – bestanden. Ohne daß er die Folgen absehen konnte, die in nichts Geringerem als in der Ausgestaltung der neutestamentlichen Schriften bestanden, legte Paulus den Grundstein dazu, als er sich zur schriftlichen Korrespondenz mit seinen Gemeinden entschloß. Dabei erhob er sich dadurch über seine eigene Leistung, daß er bereits die Grenzen des von ihm eingesetzten Mediums erkannte, genauer noch, daß er sich über dessen Undurchlässigkeit für transinformative Sprachqualitäten im klaren war. Unüberhörbar spricht das aus seiner Klage: Ich wollte, ich könnte bei euch sein, um euch mit anderer Stimme zureden zu können; so aber bin ich ganz ratlos (Gal 4,20)272. Kaum etwas belastet die Verständigung von Glaube und Zeitgeist so sehr wie der Verfall des von Paulus inaugurierten und in der Folge wenigstens partiell fortentwickelten Medienbewußtseins. Denn alle Zeichen deuten darauf hin, daß die gegenwärtige Lebenswelt, wie bereits vermerkt, in Kürze die Form einer totalen Medienwelt annehmen wird. Ihr wird die theologische Reflexion auf den Glauben nur dann gewachsen sein, wenn sie im Rückgriff auf die Ansätze bei Paulus und der Folgezeit ein zulängliches Medienbewußtsein entwickelt. Für den Glauben aber spitzt sich das in die Frage zu: „Verändern Medien die Botschaft?“273 Nach Paulus trifft das mindestens in dem Sinn zu, daß die Medien wesentliche und gerade für die Verkündigung wichtige Sprachqualitäten ausfiltern, ein Mangel, der für Paulus nur durch persönliches Zureden kompensiert werden könnte. Für die Folgezeit stellt sich die Minderung dagegen eher quantitativ als Verknappung und Zerdehnung, als 271 A.a.O., 4204. 272 Dazu: F. Mußner, Der Galaterbrief (Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Bd. 9), 5., erw. Aufl., Freiburg i. Br. u. a. 1988, S. 313 – 316. 273 So der gleichnamige Aufsatz von E. Biser in: Lebendige Seelsorge 38 (1987), S. 242 – 251.
91
Die Erschließung
Abbreviatur und Extension, dar. So spricht Hilarius von Poitiers – wenngleich in theologischer und nicht medienanalytischer Rede – davon, daß das selige Wort bei seiner Herablassung eine Verkürzung „bis zu Empfängnis und Wiege und Kindheit“ erlitten habe, während es nach Gregor von Nyssa in seinem Kreuzestod eine Dehnung erfuhr, die es bei aller damit verbundenen Qual zu weltweiter Wirkung gelangen ließ274. Daß bei derartigen Bestimmungen der Verschriftungsprozeß mitbedacht wurde, vermutlich sogar modellhaft im Hintergrund stand, macht Heinrich Seuse klar, wenn er in einer Wiederaufnahme des Dehnungsmotivs von dem „zerdehnten Buch“ des ans Kreuz Geschlagenen spricht. Das entwickelte die Barock-Theologie zu einer Drei-Stadien-Lehre des göttlichen Wortes, das sich im Programm des Bibliotheksaals der ehemaligen Prämonstratenserabtei von Schussenried in folgender Fassung niederschlug: Verbum in carne abbreviatum, in cruce extensum, in coelo immensum275. Aus dem quantifizierenden Längsschnitt läßt sich aber die qualitative Minderung durchaus erschließen. Denn die Abbreviatur deutet auf die medienbedingte Zurücknahme des Ausdrucksvolumens auf den Informationswert der Aussage hin, während die Extension den Gedanken nahelegt, daß an die Stelle der ausgefilterten Qualitäten medienspezifische Ersatzleistungen treten, die sogar an eine Pseudomorphose der Aussage denken lassen. Evident wird diese dann vollends bei den audiovisuellen Medien, die ihre Inhalte, ihrer strukturellen Regie zufolge, im Sinne von Traum und Show inszenieren. Daß damit eine ergiebige Spur aufgenommen wurde, bestätigt schon ein flüchtiger Blick ins Evangelium. Zwar werden die durchgängigen Verkürzungen der markinischen Vorgaben im Matthäus-Evangelium der literarischen Eigenart des ersten Evangeliums zuzuschreiben sein, nicht jedoch die – bisweilen auf einen einzigen Satz komprimierten – Kurzformeln, mit denen die Worte Jesu, insbesondere die Gleichnisse, wiedergegeben werden. Angesichts der Breite und Detailfreudigkeit des orientalischen Erzählstils ist es undenkbar, daß Jesus gerade die als Spitzenleistungen seiner sprachlichen Kreativität angesehenen Gleichnisse in der Verknappung der überlieferten Fassungen „verschenkte“. Somit geht die Raffung zumindest hier auf das Konto des reproduzierenden Mediums, das dem Gleichnis, zusammen mit der Aura, auch seine Dramatik und ausschwingende Gestalt entzog. Zusammen mit den Gleichnissen gehören auch die Seligpreisungen zu den sprachlichen Spitzenleistungen Jesu. Hier bietet die unterschiedliche Überlieferung ein anschauliches Beispiel für die medienbedingte Dehnung. Während die dialogisch zustoßende Fassung des Lukasevangeliums (Lk 6,20 – 23), wie auch die Parallelüberlieferung im Thomas-Evangelium (Log. 54) nahelegt276, den ursprünglichen Wortlaut bewahrt 274 Hilarius von Poitiers, Zwölf Bücher über die Dreieinigkeit IX, 4, aus dem Lateinischen übs. v. A. Antweiler (BKV, 2. Reihe, Bd. 6, II), München 1933, S. 69; Gregor von Nyssa, Große Katechese, c. XXXII, 2, in: Des heiligen Bischofs Gregor von Nyssa Schriften, aus dem Griech. übs. (BKV, 1. Reihe, Bd. 56), München 1927, S. 1 – 85, S. 64. 275 Dazu: E. Biser, Die Bibel als Medium,a.a.O., S. 35 – 41: Exkurs II. Ein kunstgeschichtlicher Reflex der ‚Abbreviatur‘ und ‚Extension‘ des Wortes; ferner: ders., Glaubensimpulse, a.a.O., S. 28 – 46: Die Geburt des Glaubens aus dem Wort. 276 Thomas-Evangelium, Logion 54, in: K. Berger u. C. Nord, Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, a.a.O., S. 644 – 669, S. 657.
92
7. Die Begründung
haben dürfte, verrät die interpretierende und versachlichende Wiedergabe im MatthäusEvangelium die durch das Medium gewonnene Distanz, die sich in den erläuternden und absichernden Zusätzen der Matthäus-Version (Mt 5,3-12) spiegelt277. Auf eine mystische Vertiefung des Dehnungsmoments – vor dem Hintergrund eines medientheoretischen Reflexes – läßt der an Seuse ergehende Zuspruch schließen: Das ist der Anfang in der Schule der Weisheit, den man da liest in dem aufgetanen, zerdehnten Buche meines gekreuzigten Leibes278. Der von dem Medium geforderte Leseakt hat zweifellos nicht nur rezeptiven, sondern auch kompensatorischen Sinn. Um zum Verständnis zu gelangen, muß er das durch die Abbreviatur Verknappte zu ergänzen und das durch die Dehnung Verflachte in seinem originären Profil wiederherzustellen suchen – das aber keinesfalls mit Hilfe einer Prozedur, die der medialen Pseudomorphose entspricht, sondern im Anschluß an die im Text verbliebenen Residuen. Und darauf zielt die Christomathie als Korrektiv zur historischen Kritik. Denn mit der Christomathie verbindet sich ein kreatives Rezeptionsverhalten. Insofern geht es der akustischen Lesart darum, den Text auf seine „Untertöne“ abzuhören, um ihm die von der „Oberfläche“ eher verdeckte als bezeichnete Sinntiefe abzugewinnen; der optischen darum, in der Vielfalt seiner Darstellungsweisen das in ihm aufscheinende „Antlitz der Wahrheit“, von dem der frühe Augustinus sprach279, wahrzunehmen; und der haptischen darum, sich von dem in ihm fortwirkenden Impuls ebenso ergreifen zu lassen wie den von ihm gebotenen Halt zu ergreifen. Schwerlich hätte Kierkegaard die Wechselrede Jesu mit Petrus als Ausdruck einer Lebenskrise begreifen können, wenn er in der Seligpreisung des Antwortenden – diesen „freudigsten“ aller Jesusworte – nicht den Leidenston vernommen hätte, wie es dann auch Buber auf Grund seiner spezifisch jüdischen Einfühlung in das Evangelium bestätigte. Schwerlich hätte sodann Seuse den zerdehnten Leib des Gekreuzigten als das weit geöffnete Lehrbuch der Weisheit auffassen können, wenn er nicht von dessen Blick berührt und getroffen worden wäre. Und schwerlich hätte Rahner den von den neutestamentlichen Autoren unterlassenen Gottesbeweis vermissen können, wenn er nicht in haptischem Zugriff die Gottessuggestion wahrgenommen hätte, die von den Texten – wenngleich in unterschiedlicher Deutlichkeit – ausgeht. Das stellt die Christomathie in ein beziehungsreiches Wechselverhältnis zum medialen Schriftverständnis. Die in ihrem Mediencharakter begriffene Bibel erheischt ein Interpretationskonzept, das sich gegensinnig zur Christologie verhält: die Christomathie. Und diese steigert die Sensibilität für die ebenso einfache wie leicht zu übersehende Tatsache: Die Bibel ist ein Buch!280
277 Dazu: L. Schenke, Die Urgemeinde, a.a.O., S. 30f; ferner: E. Biser, Das Antlitz, a.a.O., S. 96. 278 Zitiert nach: H. S. Denifle, Das geistliche Leben. Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts, a.a.O., S. 316. 279 Augustinus, Selbstgespräche II, 35, in: ders., Selbstgespräche. Von der Unsterblichkeit der Seele, lat. u. dt., übs. v. H. Müller, hrsg. v. H. Fuchs, München u. a. 3/2002, S. 150. 280 Dazu: E. Biser, Wort Gottes in Menschensprache, in: P. Gordan (Hg.), Evangelium und Inkulturation (1492 – 1992), a.a.O., S. 51 – 77, S. 75f; ferner: E. Biser, Das Buch in medienkritischer Sicht, in: K. Reiß (Hg.), Vom Wort zum Text. Medienkritische Perspektiven, München 1987, S. 11 – 29.
93
Die Erschließung
8. Die Botschaft Nach McLuhan geht vom Medium eine Botschaft aus, die in dessen Struktur gründet und deshalb vor jeder Übermittlung inhaltlicher Art als solche zu vernehmen ist. Bei den elektronischen Medien ist diese Botschaft die Ankündigung des totalen Medienzeitalters, zusammen mit der Heraufkunft des in jeder Hinsicht mediatisierten Menschen281. Wie aber lautet die Botschaft der als Medium begriffenen Bibel? Im Angang zur vollen Beantwortung dieser Frage muß das Schriftwort aufgerufen werden, das die größte Nähe zu McLuhans Schlüsselwort aufweist und in seinem Medienbezug von Goethe wahrgenommen wurde: In der Paktszene erklärt der in seinem Übersetzungsversuch unterbrochene Faust dem auf „was Geschriebnem“ bestehenden Mephisto: Und mich soll ein Versprechen halten? Doch dieser Wahn ist uns ins Herz gelegt, Wer mag sich gern davon befreien? Beglückt, wer Treue rein im Busen trägt, Kein Opfer wird ihn je gereuen! Allein ein Pergament, beschrieben und beprägt, Ist ein Gespenst, vor dem sich alle scheuen. Das Wort erstirbt schon in der Feder, Die Herrschaft führen Wachs und Leder282. Es muß offen bleiben, ob Faust dabei auch an das „Wort von Anbeginn“ denkt, um dessen Übersetzung er sich kurz zuvor, wenngleich schon in teuflischer Umstrickung, bemüht hatte. Dagegen kommt seine Voreingenommenheit gegen das Medium unverkennbar in beiden vorangehenden Übersetzungsversuchen ins Spiel. Daß er das „Wort“, von dem geschrieben steht, daß es „im Anfang“ war, „so hoch unmöglich schätzen“ konnte, hängt, nach den folgenden Ersatzbildungen – „Sinn“, „Kraft“, „Tat“ – zu schließen283, mit dessen inhaltsleerem Medialcharakter zusammen. Denn der mit ihm gemeinte Offenbarer steht ganz für den, der in ihm vernommen (Joh 14,10), gesehen (Joh 14,9) und erfahren sein will. Nur zögernd greift er daher nach den umlaufenden Titeln wie Menschensohn und Messias; und erst die nachösterliche Deutung wird ihn definitiv mit Namen belegen, die auf seine göttliche Herkunft und Sendung schließen lassen. Indessen gibt es einen verläßlicheren Weg, um die Suche nach dem neutestamentlichen Äquivalent des medientheoretischen Schlüsselwortes ans Ziel zu bringen. Er führt zurück zur Aufarbeitung des von Rahner bei den neutestamentlichen Autoren registrierten Defizits. Und diese besagt: Sie bedurften keiner argumentativen Stützung ihres Gottesglaubens und sahen sich deshalb auch nicht veranlaßt, ihren Schriften derartige Stützen einzufügen, weil sie noch ganz – auch bei ihrem Schreibakt – unter dem Eindruck standen, durch ihre Lebensgemeinschaft mit Jesus von Gott angerufen, angesprochen und ins Einvernehmen gezogen worden zu sein. Auf der im Johannesevangelium erreich-
281 Dazu: E. Biser, Zur Situation des Menschen im Medienzeitalter, a.a.O., S. 27 – 33: Der mediatisierte Mensch; S. 34 – 38: Eine Reproduktion seiner selbst. 282 J. W. v. Goethe, Faust I, Studierzimmer, V. 1721 – 1729, in: ders., Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust, a.a.O., S. 57f. 283 A.a.O., V. 1224 – 1237, S. 44.
94
8. Die Botschaft
ten höchsten Reflexionsstufe verfaßte sich das dann aus innerer Folgerichtigkeit in den Satz, der diese Erfahrung mit programmatischer Prägnanz zum Ausdruck bringt: Im Anfang war das Wort (Joh 1,1)284. Wie Fausts Vorbehalt zeigt, stehen der Annahme dieses Satzes Widerstände entgegen, die an ihm vor allem Inhaltsbestimmungen vermissen, obwohl sich der Prolog dem dadurch widersetzt, daß er im Fortgang des Eingangssatzes das Wort nur durch Formalbeziehungen – es ist „bei Gott“ und „von Gottes Wesen“ – erläutert. Dennoch hätte dem Leser des Evangeliums weit mehr der Satz: „Im Anfang war die Wahrheit“, und dem Angehörigen des johanneischen Kreises eher der Satz: „Im Anfang war die Liebe“, entsprochen. Auf die vermeintliche Inhaltsarmut dürften auch die Tendenzen zu einer bibel- und religionsgeschichtlichen Herleitung zurückzuführen sein. Noch am wenigsten trifft das auf die Herleitung aus der jüdischen Vorstellung vom göttlichen Wort zu, da diese, wie die Parallelbildungen „Engel Jahwes“ und „Weisheit“ zeigen, der Suche nach Mittel- und Vermittlungsbegriffen entstammen, die das Geschichtswalten des transzendenten Gottes denkbar machen. Im Blick auf die Weisheit stellt Gerhard von Rad die von ihm offengelassene Frage: Was ist das eigentlich, das einerseits so tief mit allem Geschöpflichen verbunden ist und andererseits ein Teil des Waltens Jahwes zu sein scheint und auf den Menschen eindringt?285 Umso mehr gilt dies für die von Bultmann favorisierte religionsgeschichtliche Herleitung, die mit ihren Bestimmungsversuchen den Sinn des Satzes schon im Ansatz verdeckt286. Denn dieser sagt von dem Offenbarer lediglich aus, daß er das Wort, das Mundstück, die Selbstmitteilung oder, wie Ernst Haenchen formulierte, nur „Wort, Werk und Wille des Vaters“ und als solcher das Medium der Gottesoffenbarung ist287. In der Auslegungsgeschichte wurde dies jedoch von Anfang an von inhaltlichen Bestimmungen überlagert, und dies mit folgenschweren Auswirkungen. Denn kaum einmal bewahrheitete sich die von Thomas von Aquin zu Beginn seiner Abhandlung „De ente et essentia“ geäußerte Überzeugung, daß ein kleiner Irrtum im Ansatz zu schweren Verzerrungen in der Ausgestaltung führt288, so sehr wie hier. Die erste Verwechslung der Medialaussage mit einer Inhaltsbestimmung war die schon in der Frühpatristik einsetzende, vor allem aber von Origenes in der Tradition der 284 Dazu: R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, Teil 1: Einleitung und Kommentar zu Kap. 1 – 4 (Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Bd. 4.1), Freiburg i. Br. 1965, S. 257 – 269. 285 G. v. Rad, Weisheit in Israel, Neukirchen-Vluyn 1970, S. 205. 286 Dazu: R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, Bd. 2), Göttingen 11/1950, S. 1 – 57: Der Prolog, bes. S. 18: „Soll es [Logos] übersetzt werden, so kann es nur heißen ‚Wort‘, wie das schon durch den gnostischen Mythos gegeben ist“; ferner: ders., Der religionsgeschichtliche Hintergrund des Prologs zum Johannes-Evangelium (1923), in: ders., Exegetica. Aufsätze zur Erforschung des Neuen Testaments, hrsg. v. E. Dinkler, Tübingen 1967, S. 10 – 35. 287 Dazu: E. Haenchen, Das Johannesevangelium und sein Kommentar (1962/63), in: ders., Gesammelte Aufsätze, Bd. 2: Die Bibel und Wir, Tübingen 1968, S. 208 – 234, S. 218. 288 Thomas v. Aquin, De ente et essentia – Das Seiende und das Wesen, lat.-dt., übs. u. hrsg. v. F. L. Beeretz, 2., verb. Aufl., Stuttgart 1987, S. 5.
95
Die Erschließung
alexandrinischen Katechetenschule betriebene Gleichsetzung von Wort und Logos im platonischen Verständnis des Ausdrucks. Der Gleichklang war freilich so verblüffend und die mit der Gleichsetzung eingehandelte Interpretationsmöglichkeit so überwältigend, daß erst die heutige Hellenismuskritik den Irrtum voll ans Licht brachte289. Demgegenüber verhindert die religionsgeschichtliche Herleitung Bultmanns und der Bultmann-Schule, zusammen mit den Deutungsversuchen, die methodisch auf ihrer Linie liegen, auch heute noch die Erfassung des Medialcharakters des Satzes. Denn sie gehen insgesamt davon aus, daß mit ihm eine Qualifikation gemeint oder doch verbunden ist. Wenn aber je ein Satz, dann „stirbt“ dieser nach Anthony Flew den „Tod durch tausend Modifikationen“290. Und Faust behält im Blick auf diese Fixierungsversuche recht mit der Behauptung: Das Wort erstirbt schon in der Feder291. Wie selten einmal bestätigt sich hier, daß weniger mehr sein kann. Denn wer den Eingangssatz des Johannesprologs als Medialaussage auffaßt – und nur er –, kann nach der mit dem fleischgewordenen Wort gegebenen Botschaft fragen. Sie ist ebenso einfach wie total: Gott! Das muß nicht zuletzt im Rückblick auf die schon wiederholt angesprochene innovatorische These Karl Rahners betont werden. Die neutestamentlichen Schriften bedurften keiner argumentativen Abstützung, weil sie – in ihrem Medialcharakter erfaßt, ungeachtet ihrer Vielsinnigkeit, ihrer Inkonzinnitäten und Widersprüche – eine einzige, sie allenthalben durchtönende Botschaft vortragen: Gott. Doch gilt dasselbe, wie im Blick auf Blaise Pascals Lehre von den drei Ordnungen zu bedenken ist, nicht auch für Jesus selbst? Brauchte er sich nicht deshalb weder im Bereich der politischen Macht noch in dem der wissenschaftlichen Erkenntnis hervorzutun? Und hatte er, wie dem hinzuzufügen ist, nicht bereits mit dem, was er in der überaus kurzen Zeit seines öffentlichen Wirkens leistete, genug getan, weil alles, was er lehrte und lebte, beredter noch als Worte, von Gott sprach? Oder wie es Pascal formulierte: Jesus Christus, der keine Güter besessen und in den Wissenschaften nichts vollbracht hat, ist in der Ordnung der Heiligkeit. Er hat weder etwas erfunden, noch hat er regiert; aber er ist demütig gewesen, geduldig, heilig, heilig, heilig vor Gott, furchtbar den bösen Geistern und ohne Sünde. In welcher gewaltigen Pracht, in welch überwältigender Herrlichkeit ist er den Augen des Herzens, die die Weisheit schauen, erschienen!292
289 Dazu: Cl. Tresmontant, Biblisches Denken und hellenische Überlieferung. Ein Versuch (Essai sur la pensée hébraïque, 1953), aus d. Franz. übs. v. F. Stier, Düsseldorf 1956, S. 76f; S. 149; S. 154 – 162; ferner: R. Heinzmann, Philosophie des Mittelalters, a.a.O., S. 17 – 25: Grundstrukturen griechischen und christlichen Denkens. 290 A. Flew, Theologie und Falsifikation (Theology and Falsification, 1955), in: I. U. Dalferth (Hg.), Sprachlogik des Glaubens. Texte analytischer Religionsphilosophie und Theologie zur religiösen Sprache, München 1974, S. 84 – 87, S. 85. 291 J. W. v. Goethe, Faust I, Studierzimmer, V. 1728, in: ders., Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust, a.a.O., S. 57. 292 B. Pascal, Über die Religion und über einige andere Gegenstände (Pensées, 1670), aus d. Franz. übs. u. hrsg. v. E. Wasmuth, Heidelberg 1954, Frgm. 793, S. 372 – 374, S. 373.
96
8. Die Botschaft
Wenn man diesen, mit Guardini gesprochen, „außerordentlichen Text“ vor dem Hintergrund von Pascals Aussage über die Verborgenheit Gottes liest293, drängt sich der Gedanke auf, daß diese für ihn als Denkenden schmerzlichste Barriere im Falle Jesu, so wie er ihn gerade in diesem Text sieht, aufgehoben ist. So wie er in seiner Macht und Glanzlosigkeit den „Augen des Herzens in überwältigender Herrlichkeit“ aufleuchtet, ist er, im Blick auf die These Rahners, der leibhaftige Gottesbeweis, der alle anderen erübrigt. Und im Rückgriff auf eine Bestimmung Bonaventuras kann man ihn mit demselben Recht das „Medium“ nennen, in dem sich das Gottesgeheimnis lichtet und mitteilt294. Wenn Bonaventura von Jesus außerdem sagt, er sei „communicans in naturis“, greift er umgekehrt auf Pascal vor, der mit großem Nachdruck versichert: Nur durch Jesus Christus kennen wir Gott. Ohne diesen Mittler ist jede Gemeinschaft mit Gott ausgelöscht; durch Jesus Christus kennen wir Gott. Alle, die vorgaben, Gott ohne Jesus Christus kennen und ohne Jesus Christus beweisen zu können, hatten nur machtlose Beweise295. Pascal steigert diese These im folgenden Fragment zu der Behauptung: Nicht nur Gott kennen wir allein durch Jesus Christus, auch uns selbst kennen wir nur durch Jesus Christus, Leben und Tod kennen wir allein durch Jesus Christus. Ohne Jesus Christus wissen wir weder, was unser Leben, noch was unser Tod, noch was Gott ist, noch was wir selber sind296. Denn nur er ist es, der diesen Gedanken begründet, dem man sich ohne Anmaßung nähert und ohne Verzweiflung beugt297. Dennoch stellt er in dem Fragment von den drei Ordnungen an Jesus ein vom christlichen Triumphalismus nur ungern hingenommenes Defizit fest. Zwar gilt von Jesus, daß er als himmlischer Herrscher keine irdischen Machtansprüche erhebt: „non eripit mortalia, qui regna dat coelestia“. Danach ist das geheime und offene Machtstreben der Kirche im Bund mit einer Theologie, die es nur mit den in religiöser Hinsicht Erfolgreichen hält, ein einziger, wenngleich stummer Protest gegen das „Versagen“ Jesu im politischen und wissenschaftlichen Bereich, auch wenn dieser Vorbehalt von dem Wissen untergraben ist, daß es sich dabei um ein bewußtes „Sich-Versagen“ handelt. Hätte er es den Seinen nicht viel leichter gemacht, wenn er sich als Ordner der Welt und nicht nur, wie Reinhold Schneider gegen dieses Wunschziel geltend machte, als „unsere tödliche Freiheit“298 erwiesen hätte? Und wäre ihm die Zustimmung der Intelligenz nicht sicher gewesen, wenn er sich nicht wenigstens ansatzweise vom mythischen Weltbild und dem animistischen Krankheitsverständnis seines Umfelds distanziert hätte? 293 A.a.O., Frgm. 556, S. 250 – 254, S. 253. 294 Bonaventura, Collatio I, in: ders., Collationes in Hexaemeron – Das Sechstagewerk, aus d. Lat. übs. u. eingel. v. W. Nyssen, München 1964, S. 64 – 101, bes. S. 74f. 295 B. Pascal, a.a.O., Frgm. 547, S. 239f. 296 A.a.O., Frgm. 548, S. 240f, S. 240. 297 A.a.O., S. 241. 298 R. Schneider, Winter in Wien, a.a.O., S. 18.
97
Die Erschließung
9. Das Prisma Wenn man sich die schroffe Zurückweisung vergegenwärtigt, mit der Jesus auf den Versuch reagiert, ihn von seinem Leidensweg abzubringen (Mk 8,33), können ihm Fragen dieser Art – dazu angetan, die Medienfunktion Jesu in eine weniger affirmative Sicht zu rücken – nicht ganz ferngelegen haben. Danach ist er nicht einfach auf Gott hin transparent, vielmehr bricht sich das göttliche Licht in ihm wie in einem Prisma. Und diese Brechung bedeutet für ihn Mühe, Kampf und Leid. Zwar bleibt es bei dem geradezu enthusiastisch klingenden Wort, das ihm die weisheitlich denkende Gemeinde in den Mund legte: Alles ist mir von meinem Vater übergeben; und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will (Lk 10,22). Doch was muß, so ist des weiteren zu fragen, in dem Schöpfer dieses Wortes vor sich gegangen sein, wenn er Jesus zunächst so radikal distanzierte, um sich seine „Offenbarung“ dann derart zusprechen zu können? Spiegelte er in sich dann nicht den, der die Andersheit Gottes bis in das Entsetzen der Gottverlassenheit erlitten haben mußte, um sich seiner im Durchbruch dieser Schmerzens- und Schweigemauer vollkommen zu versichern? Wenn diese Fragen berechtigt sind, muß die Medienfunktion Jesu dramatischer als bisher gedacht werden. Dann entspringt die Gottesverkündigung Jesu einem mit seiner Gottessohnschaft nicht fraglos gegebenen, sondern einem gerade ihretwegen hart erkämpften und gegen den Widerspruch – nicht nur der Sünder (Hebr 12,3) – errungenen Besitz. Wenn es sich aber so verhält, lassen sich drei Aspekte der Brechung unterscheiden. Ein erster, erkämpfter, dem es um die Überwindung der Andersheit Gottes geht; ein zweiter, erlittener, der sich auf den Gottesentzug bezieht, und ein dritter, ein gewährter und erfahrener, der mit der Selbstübereignung Gottes an den Sohn, trinitarisch gesehen: mit dessen Selbsterkenntnis in ihm, gegeben ist. Sofern der erste mit dem Schweigen Gottes, der zweite mit der Gottesfinsternis und der dritte mit der Fühlung der Gottverbundenheit zu tun hat, kann man sich dabei auch an die drei Lesarten – die akustische, die optische und die haptische – erinnert fühlen. „Erkämpft“: In seiner Gottesverkündigung nahm es Jesus mit der Last der gesamten Religionsgeschichte auf, sofern diese bei aller Gegensätzlichkeit der jeweiligen Positionen einhellig von einem gespaltenen, zwischen Erbarmung und Drohung schwankenden Gottesbild ausgeht, von dem Gott, in dessen Begriff das mysterium fascinosum mit dem mysterium tremendum zu einer dialektischen Spannungseinheit verknüpft ist. Zweifellos kamen zeitgeschichtliche, auch mit seinem Verhältnis zu Johannes dem Täufer gegebene Gründe bei diesem Kampf gegen das gespaltene Gottesbild seiner Vor- und Umwelt mit ins Spiel. Der letzte Beweggrund für sein kühnes Unterfangen konnte jedoch nur in der Erfahrung bestehen, daß dieser rätselhafte Gott, der sich jeweils in die gegensinnige Andersheit zurückzuziehen schien, von sich aus diesem Zwiespalt ein Ende setzte, indem er sein ewiges Schweigen brach und zu ihm, dem Erwählten, redete. Insofern war es ein Kampf, den Jesus, gestützt auf den über ihm ausgerufenen „Namen“ Gottes, gegen das überkommene Gottesbild der Menschheit führte. „Erlitten“: Die Gesprächsbeziehung, in der Jesus mit seinem Gott steht, weist nach Auskunft der Evangelien ein deutlich absteigendes Gefälle auf. Während sein Wirken mit dem Anruf der Gottesstimme bei der Taufe (Mk 1‚11) beginnt, vernimmt er in der Kri98
9. Das Prisma
senstunde seines Lebens, in die ihn der Massenabfall stürzt, den Anruf dieser Stimme nur noch aus Freundesmund (Mt 16,16); dann, in einem Augenblick neuerlicher Erschütterung, nur noch in Form eines vom Volk als Donnerschlag empfundenen Anrufs (Joh 12,27ff), in seiner Ölbergstunde nur noch in Gestalt einer zeichenhaften Tröstung (Mk 22,43), bis ihn schließlich am Kreuz ein antwortloses Schweigen entgegenschlägt. So wird die Last, die er mit dem von ihm erkämpften Gottesbild auf sich genommen hat, schließlich ganz auf ihn abgewälzt, so daß er nur noch erleidend für seinen Gott einstehen kann. „Erfahren“: Dieses Ende schlägt in unvergleichlicher Dialektik um in die Vollendung, die der Gekreuzigte im Ereignis seiner Auferstehung an sich erfährt. Jenseits aller Erkenntnis- und Sprachgrenzen nimmt ihn jetzt, mit einem urchristlichen Hymnus gesprochen, die Gottwirklichkeit in sich auf: Geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, geschaut von den Engeln, verkündet unter der Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit (1Tim 3,16). Diesem Hymnus zufolge ist Jesus aber nicht nur in die von ihm zunächst erkämpfte und dann erlittene Gotteswirklichkeit „aufgenommen“, sondern gleichzeitig auch, wie eine gegen Bultmann gerichtete und schließlich doch von ihm akzeptierte Wendung sagt, „ins Kerygma auferstanden“299. Durch das Ereignis seiner Auferstehung wurde der, der sich in Wort und Tat zum Sprecher Gottes und zu seinem eigenen Sprecher gemacht hatte, zu dessen Wort, und der, der dem Glauben Bahn gebrochen hatte, zu dessen Inhalt und Gegenstand. Was in Jesu Verhältnis zu Gott und dessen alle Kategorien sprengender „Fühlung“ begonnen und sich bis zur „Einwohnung“ in ihm gesteigert hatte, wurde so in seinem Verhältnis zur glaubenden Gemeinde zu einer lehrhaft-dogmatischen „Festlegung“, die aber doch nur der ideelle Ausdruck dafür war, daß Jesus auch in ihr „Wohnung“ gefunden hatte. Doch schon im Licht dieser vorläufigen Thematisierung bestätigt sich die Vermutung, daß die Vorstellung vom Medium Gottes zum Bild des brechenden Prismas weiterentwikkelt werden muß. Dabei hatte die Brechung die Folge, daß der Schatten der bedrohlichen und beängstigenden Andersheit aus dem Gottesbild ausgeblendet und stattdessen das Bild des „Vaters der Erbarmung und Gott allen Trostes“ (2Kor 1,3) in einer zuvor nicht einmal erahnten Eindeutigkeit zum Vorschein kam. Aber dieser Umriß war vorläufig, weil erst die Vertiefung in die Lebens- und Werdegeschichte Jesu volle Klarheit über sein Gottesbild und Selbstverhältnis bringen kann. Wie verhält es sich damit?
299 R. Bultmann, Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen Jesus (1960), in: ders., Exegetica, a.a.O., S. 445 – 469, S. 469.
99
Viertes Kapitel
Die Vertiefung 1. Die Proklamation
A
uch nach der Schilderung der Evangelien kann das Auftreten Jesu nach der Gefangennahme des Täufers kaum besser als mit dem Begriff der Fulguration verdeutlicht werden. Denn mit seiner Botschaft entzündet er tatsächlich ein weithin leuchtendes Feuer im Dunkel der „in Finsternis und Todesschatten“ liegenden Welt (Mt 4,12-17). Und gleichzeitig greift er die der Hand des Johannes entzogene Fackel auf, um sie aufs Neue zum Leuchten zu bringen. Oder nun wörtlich: Nachdem Johannes ins Gefängnis geworfen worden war, durchzog Jesus das galiläische Land und verkündete die frohe Botschaft Gottes. Er sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an die Heilsbotschaft! (Mk 1,14f)300 Dies ist eine Proklamation, die in der ganzen Religionsgeschichte einzigartig dasteht! Keine göttliche Mitteilung wie im Fall Mohammeds und erst recht keine Erleuchtung wie im Falle Buddhas, sondern die Ansage einer neuen Zukunft, der die Welt entgegengeht, sofern sich die Hörer dieser Verheißung ihr nur erschließen. Umso nachdrücklicher stellt sich die Frage, wie Jesus zu dieser Botschaft kam, und im Zusammenhang damit die Begleitfrage, ob sie mit seinem Gottesverhältnis zu tun hat, etwa so, daß sie sich dazu wie die Schale zum Kern verhielt. Denn es muß gerade im Falle Jesu, der vom Glauben als der Gottessohn begriffen wird, doch auffallen, daß in seiner Urbotschaft von Gott nur mittelbar, nicht aber direkt und thematisch als von dem Urheber und Grund des von Jesus proklamierten Reiches die Rede ist. Hängt das damit zusammen, daß sich Jesu Gottesverhältnis, mehr als bisher angenommen wurde, in dem von ihm verkündeten und heraufgeführten Gottesreich spiegelt? Oder sah er sich von seinem Gottesverhältnis her so unmittelbar an diesen Gedanken verwiesen, daß er glauben durfte, damit auch schon alles Wesentliche über Gott selbst gesagt zu haben? Mit Recht wundert sich Hartmut Stegemann darüber, daß sich heute kaum noch jemand fragt, was Jesus zu seiner Proklamation des Gottesreichs veranlaßt habe, da darin doch seine Differenz gegenüber der Verkündigung des Täufers und das Proprium seiner Botschaft bestand, die das Christentum als eine neue und bei aller Verwurzelung im Judentum eigenständige Religion erwies301. Damit setzte Stegemann die bisher sträflich vernachlässigte Frage, wie Jesus zu der für ihn und seine Botschaft zentralen Thematik des Gottesreichs gekommen sei, definitiv auf die theologische Tagesordnung. Zwei Möglich300 Dazu: J. Ernst, Das Evangelium nach Markus (Regensburger Neues Testament), Regensburg 1981, S. 47 – 54. 301 Dazu: H. Stegemann, Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus. Ein Sachbuch, 2., durchges. Aufl., Freiburg i. Br. 1993, S. 317.
100
1. Die Proklamation
keiten scheiden für ihn dabei von vornherein aus: Anlaß war nicht etwa ein ausdrückliches Berufungserlebnis, wie es von Markus (Mk 1,10f) im Sinn einer nachträglichen Stilisierung, aber gerade nicht in dem dafür allein beweiskräftigen Ich-bin-Stil, überliefert wird. Denn das hätte Jesus, höchst widersprüchlich, im gleichen Atemzug zum Schüler und Überwinder des Täufers gemacht, da dieser – trotz nachträglicher Angleichung an die Jesusbotschaft (Mt 3,1f) – nie vom Gottesreich gesprochen habe302. Gleiches gelte aber auch von der Annahme, daß Jesus den Gedanken aus der jüdischen Tradition und damit aus seiner religiösen Umwelt vernommen habe, da er sowohl in den Prophetentexten als auch in den Qumranschriften nur sporadisch und nie in der ihm von Jesus zugelegten Bedeutung vertreten sei. Als Erklärungsmöglichkeit verbleibt für Stegemann demgegenüber lediglich die aus den Wundertaten Jesu, die von ihm als Eingriffe Gottes ins Weltgeschehen erlebt und als Zeichen der anbrechenden Gottesherrschaft gedeutet worden seien303. Doch stellt dieser Erklärungsversuch die Verhältnisse nicht auf den Kopf? Setzt er doch voraus, daß Jesus im Sinne einiger verhaltener Andeutungen – wie etwa im Fall des Blinden von Bethsaida (Mk 8,22-26) – von seinen eigenen Leistungen überrascht wurde, zumindest in dem Sinn, daß er nach einer zulänglichen Deutung erst suchen mußte. Vor allem aber bleibt dann immer noch unerklärt, wie er bei dieser Suche gerade zum ReichGottes-Begriff gelangte und warum er gerade ihn als den passenden Schlüssel zu seinen Wundertaten empfand. Liegt da die umgekehrte Konsekution nicht weit näher: daß Jesus, getragen von der Aufgabe, das Reich Gottes heraufzuführen, seine Wunder als eine Art „Tatsprache“ einsetzte, um seiner Botschaft vom anbrechenden Gottesreich Nachdruck zu verleihen und Zeichen seiner bereits beginnenden Heraufkunft zu setzen? Vermutlich ist der Rückbezug auf den Täufer jedoch keine vollständige Fehlanzeige. Denn das zwischen Jesus und Johannes aufbrechende – und in der Folge auch zwischen ihm und seiner Gemeinde entstehende – Problem war das der Parusieverzögerung. Entgegen seiner Ankündigung des „großen und furchtbaren Tags“ des unmittelbar bevorstehenden Endgerichts (Mal 3,23f; Mk 6,14f) waren, wie Jesus erkannte, die Axt noch nicht an die Wurzel der Bäume gelegt (Lk 3,9) und der „Tag der Rache“ nach Lk 4,19 – in der prophetischen Urfassung nach Jes 61,2 – noch nicht gekommen, wohl aber das „Gnadenjahr vom Herrn“ angesagt und der „Tag des Heils“ angebrochen (2Kor 6,2). Doch dieser zeitlichen Diastase mußte ein räumliches Äquivalent entsprechen, es mußte dem Heilshandeln des erbarmenden Gottes ein Wirkfeld „eingeräumt“ werden. Das erklärt zwar nicht die Konzeption des Gedankens, wohl aber die dafür erforderliche Disposition. Das Verhältnis Jesu zum Täufer führt jedoch noch auf eine weitere und entscheidende Spur. Denn nach dem dafür besonders aufschlußreichen Lukasbericht (Lk 3,21f) vernimmt Jesus die ihn zum Gottessohn erklärende Himmelsstimme als Antwort auf sein Gebet. Das aber nötigt zu der Frage, ob Jesus nicht im Vollzug seines Betens zur Konzeption des Gottesreiches und seiner Beauftragung zu dessen Heraufführung gelangt sei. Die Frage stellt sich umso dringlicher, als die Evangelien kaum einen Zug im Erscheinungsbild Jesu so sehr hervorheben wie den, daß er ein großer Beter war. Sie betonen nicht nur, daß er ganze Nächte im Gebet verbringt (Mk 1,35), sondern lassen ihn auch entscheidende Ereignisse seines Lebens, angefangen bei der Taufe (Lk 3,21) und Verklärung (Lk 9,29) bis hin zu seinem Eintritt in die Passion (Mt 26,36; Joh 17,1ff), betend erleben: 302 Ebd. 303 A.a.O., S. 323 – 328.
101
Die Vertiefung
Vor der Brotvermehrung spricht er ein Dankgebet (Mt 15,36); vor der Apostelwahl verbringt er eine ganze Nacht im Gebet (Lk 6,12); vor der Heilung des Taubstummen blickt er zum Himmel auf (Mk 7,34), ebenso vor der Auferweckung des Lazarus (Joh 11,41); und mit einem Segensgebet eröffnet er beim letzten Mahl die Deuteworte über Brot und Wein (Mk 14,22f). In dieser Hinsicht rückt keine Gestalt des Alten Bundes so nah an ihn heran wie die des Propheten Jeremia, von dem es heißt: „Das ist der Freund unserer Brüder, der so viel für das Volk und die heilige Stadt betet“ (2Makk 15,14), und der auf einem Höhepunkt seiner „Konfessionen“ versichert: Fanden sich Worte von dir, so verschlang ich sie; dein Wort wurde mir zum Glück und zur Freude meines Herzens; denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott Zebaoth (Jer 15,16)304. Wie aus der Abba-Anrufung Jesu zu erschließen ist, wußte er den Gottesnamen in einem weit höheren Sinn über sich ausgerufen und, in und durch den göttlichen Geheimnisnamen, gleich Mose mit Gott selbst beschenkt. Denn nach Gerhard von Rads tiefsinniger Deutung der Szene am brennenden Dornbusch (Ex 3,2-8) legt sich Gott mit der Übereignung des Namens in die Hand des Offenbarungsträgers305. Weil aber Gottes Gaben stets auch die Aufgaben des Empfängers sind, drängte sich ihm das „geheiligt werde dein Name“ als erste Bitte auf seine Lippen. Sofern er damit die Heiligung des Gottesnamens zu seinem vordringlichsten Gebetsanliegen erhebt, weiß er sich, da er um Gottes ureigene Sache betet, der Erhörung dieser Bitte schon im Augenblick ihrer Äußerung versichert. Und er weiß es, weil er im selben Atemzug begreift, daß er selbst der „Ort“ und Inbegriff dieser Erhörung ist. Wie er durch die Instruktion der Jünger, die von ihm über das rechte Beten belehrt werden wollten (Lk 11,1ff), diese, zumindest nach Auffassung der neueren Spiritualität, in sein eigenes Beten hineinnahm, weiß er sich selbst in Gottes ureigenes Anliegen aufgenommen. Dadurch gewinnt sein Gottesverhältnis rückläufig eine alle kreatürlichen Maße und Kategorien sprengende Tiefe und Intimität, die sich noch am ehesten mit Augustinus auf die Formel bringen läßt: Ich werde dich erkennen, der du mich erkennst, „ich werde erkennen, wie auch ich erkannt bin“[…] und in dieser Hoffnung freue ich mich306. Wie das Gebet den Weg Jesu zu seinem Gottes- und Sohnesbewußtsein erschloß, führt es auch zu seiner Konzeption des Gottesreichs. Denn indem er sich zur Heiligung des Gottesnamens beauftragt wußte und im Erlebnis seiner Erhörung sich selbst als das Ereignis dieser Heiligung begriff, stellte sich ihm unabweislich die Frage nach der Ausführung dieser Aufgabe. Es galt, den Gottesnamen, der über ihn ausgerufen war, über die Welt in ihrer Gottvergessenheit und Verfallenheit auszurufen und sie dadurch für ihren Urheber und Herrn zurückzugewinnen. Der aber trat ihr nun nicht mehr in der Distanz des Schöpfers und Richters entgegen, sondern als der sich ihrer Not Annehmende, der aufs 304 Dazu: G. v. Rad, Theologie des Alten Testaments, Bd. 2: Die Theologie der prophetischen Überlieferungen Israels, München 9/1987, S. 209 – 214, S. 209. 305 Ders., Theologie des Alten Testaments, Bd. 1: Die Theologie der geschichtlichen Überlieferungen Israels, München 9/1987, S. 193 – 200. 306 Augustinus, Bekenntnisse X, 1, a.a.O. (BKV, 1. Reihe, Bd. 18, VII), S. 215.
102
1. Die Proklamation
neue die Hand an ihre Wurzeln legte, um sie auf eine höhere, ihm nähere Stufe der Verwirklichung zu heben. Dafür hielt die jüdische Tradition, wie Stegemann zeigt, längst schon den Begriff der Königsherrschaft Gottes, malkuta d’alaha, bereit307, der auch den Herrschaftsbereich Gottes bezeichnen kann, jedoch keine spezifischen Bezüge zu aktuellem Geschehen im Himmel oder auf Erden erkennen läßt. Doch damit bot sich Jesus auch schon das begriffliche Gefäß an, das er in der Folge mit dem Inhalt des von ihm entzündeten „Feuers“ – und letztlich mit sich selber – füllte. Mit einiger Deutlichkeit lassen die von den Evangelien gebotenen Daten erkennen, daß diese innovatorische Adaptation in zwei Stufen erfolgte. In einer ersten, die sich unter der Sonne des galiläischen Frühlings vollzog, und in einer zweiten, die von der großen Lebenskrise verdüstert war. Von der ersten vermittelt die von Jesus am Täufer geübte Korrektur einen Begriff. Denn dessen wortgewaltige Ansage des bevorstehenden Gottesgerichts konnte nicht nur angesichts der von Gott „gestundeten Zeit“, die der verlorenen Menschheit ein „Gnadenjahr vom Herrn“ (Lk 4,19) gewährte, nicht bestehen; sie war auch hinfällig geworden, weil sie nach Konzeption und Kontur der ausgelöschten Andersheit Gottes entstammte. Das erzwang die Korrektur, die zunächst ein Vakuum entstehen ließ, um dieses dann mit Jesu Verkündigung des Gottesreichs auszufüllen. Von dieser Korrektur spricht die Antwort, die Jesus dem verunsicherten und an ihm zweifelnden Täufer zukommenläßt: Geht und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Und selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt (Lk 7,22f). Anstelle des von Johannes angedrohten Gerichts besteht Jesus auf Erweisen des göttlichen Erbarmens, das sich in der Beseitigung des menschlichen Elends in dessen schreiendsten Formen äußert. Freilich: Der von Jesus gegen die Anfrage ausgespielte Begriff des Gottesreichs war im Vergleich zu den apokalyptischen Bildern des Täufers eigentümlich konturenlos. Auf die Frage nach den Anzeichen seines Kommens antwortet er sogar: Das Gottesreich kommt nicht in sichtbarer Erscheinung. Man kann auch nicht sagen: Seht, es ist hier, oder: Es ist dort! Denn siehe, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch (Lk 17,20f). Klar ist lediglich die Zielsetzung. Wo das im Prinzip bereits angebrochene Gottesreich empirische Gestalt gewinnt, weicht das menschliche Elend, insbesondere auch in seinen selbstverschuldeten Formen, während die soziale Interaktion insgesamt auf einen höheren, göttlicheren Nenner gelangt. Doch fehlt diesem Modell die zentrierende Mitte, die umso dringender erkundet werden muß, als nur sie die Verwandlung zu erklären vermag. Gott ist zwar der Herr und Urheber seines Reiches und zugleich der, der es – gleich seiner satanischen Widerspiegelung (Lk 4,6) – aus souveräner Machtvollkommenheit „vergibt“. Doch worin besteht seine inspirierende, tragende und bewegende Mitte? Darauf kann wiederum nur so geantwortet werden wie auf die Frage nach der vollgültigen Heiligung des Gottesnamens, als deren Inbegriff sich der betende Jesus selbst erfuhr. Ebenso erging es ihm bei seiner Bitte um das Kommen des Gottesreiches. Hier 307 Dazu: H. Stegemann, Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus, a.a.O., S. 323.
103
Die Vertiefung
ließ schon der im Grunde nur für Personen zulässige Ausdruck erkennen, daß er, der Bittende, selbst die gesuchte Mitte ist. Weil er auch dabei um Gottes ureigene Sache betet, ist ihm die Bitte schon bei der Anrufung erfüllt, und dies, wie im ersten Fall, in und mit ihm selbst. So wird das Gottesreich zum Horizont seines Denkens, zum Inbegriff seiner Selbstfindung, zum Gesetz seines Handelns und in alledem zu seinem Lebensinhalt und Schicksal. In der Erscheinungsvielfalt dieses Reiches sieht er sich auf folgenreiche Weise gespiegelt; in dessen Heraufführung findet er sein höchstes Glück; an ihm erleidet er aber auch auf dem Höhepunkt seiner Wirksamkeit die einschneidende Lebenskrise. Denn es ist im Grunde die auf ihre Mitte zurückgenommene Verkündigung des Gottesreiches, die ihm bei seinem Wort: „Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh 6,48), die Absage seiner Zuhörer und in deren Folge den Massenabfall einträgt. Man muß die von Kierkegaard gebotene Lesehilfe heranziehen und sie mit Bubers Einblick in diese Szene verbinden, man muß also, in diesem Kontext gesprochen, den tragischen Ausgang der Brotrede (Joh 6,60-71) auf die Jüngerbefragung bei Caesarea Philippi (Mk 8,28-30; Mt 17,13-20) zurückbeziehen, wenn dieser Zusammenhang in seiner ganzen Dramatik erkennbar werden soll308. In dieser Beleuchtung gelesen, erlebt Jesus unter dem Eindruck des Massenabfalls eine auf seine Kreuzesnot vorausweisende Erschütterung, die ihm mit dem Sinn seiner Sendung auch den Sinn seiner selbst in Frage stellt. Doch erfährt er im Gegenzug dazu auch eine zweifache Kompensation: eine erste, bezeugte, die ihm das Wort der Himmelsstimme aus Freundesmund zuspricht, wenn Petrus versichert, „du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“ (Mt 16,16; Joh 6,69). Und eine zweite, nur hypothetisch zu fordernde, die sich aus Jesu Verhältnis zum Menschensohn ergibt. Hatte er diesen, wie es in den verschiedenen Fassungen des Schlüsselwortes (Lk 12,8;9,26; Mk 8,38) anklingt, anfänglich als eine von ihm verschiedene himmlische Fürsprechergestalt angesehen, so mußte es jetzt, wo dieser Fürsprecher für das abtrünnig gewordene Gottesvolk einzustehen hatte, zu dem für die Bewußtseinsgeschichte Jesu entscheidenden Wendepunkt gekommen sein, an dem Jesus selbst in die Rolle dieses Fürsprechers eintrat, um für die von ihm Abgefallenen Vergebung zu erwirken. In der großen Thronvision des Buches Daniel wird „mit den Wolken des Himmels“ ein wie ein Mensch Gestalteter vor den „Hochbetagten“ gebracht, von dem es heißt: Ihm wurde Vollmacht gegeben, Herrschaft und Gewalt, alle Völker, Stämme und Sprachen werden ihm dienen. Denn seine Vollmacht bleibt bestehen und seine Herrschaft ist unvergänglich (Dan 7,13f). In dem Augenblick, da sich Jesus mit dieser Himmelsgestalt identifiziert, stürzt buchstäblich der Himmel ein, da das von den Propheten dort Gesehene jetzt durch den irdisch wirkenden Jesus vollzogen wird. Wenn man aber bedenkt, daß damit die Peripetie der Lebensgeschichte Jesu erreicht ist, mit der ihn sein Weg wie der der Weisheit zu seinem himmlischen Ursprungsort zurückführt, ist damit zugleich die Möglichkeit eröffnet, daß sich der Vorgang umkehrt und das, was dem Irdischen noch zu tun bleibt, durch den Erhöhten vollendet wird. In diesem Wechselspiel zeichnet sich, wenngleich nur andeutungsweise, etwas Grundlegendes ab: ein Eingriff ins Wirklichkeitsgefüge! Was sich heute, in der Stunde der sich 308 Dazu: M. Buber, Zwei Glaubensweisen, in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 730ff.
104
1. Die Proklamation
Zug um Zug realisierenden Utopien – im Feld der Hochtechnik zunächst, die sich damit als „getätigte Metaphysik“ erweist, dann aber auch im Ereignis der geschichtlichen Wende – als das Proprium des Zeitgeschehens zeigt: die signifikante Verringerung der Distanz von Möglichkeit und Wirklichkeit, sie wird hier als das längst vorgegebene Elementardatum der Wirkungsgeschichte Jesu erkennbar. Denn in stärkster Abstraktion gesprochen, geht es darin um eine im Vergleich zur gewohnten Diastase engere Verknüpfung von Idee und Realität, Utopie und Wirklichkeit, Sehnsucht und Erfüllung. Wie in seinem Verhältnis zum Menschensohn, in dem er sich schließlich entdeckt und wiederfindet, holt Jesus auch in seinem Wirken den Himmel der Möglichkeiten und Wünschbarkeiten auf den Boden der Realität herab, indem er in diesen das Samenkorn einer großen Utopie einsenkt. Doch diese Aussage bedarf einer entscheidenden Korrektur. Denn anders als der Platoniker denkt Jesus nicht vertikal, sondern im Sinn des jüdischen Geschichtsverständnisses futurisch. Er wirft den „Schleuderstein“ seiner Utopie in die Zukunft seiner endzeitlichen Wiederkunft. Und dies sogar angesichts seines nahen Todes, den er mit der Verheißung überspringt, er werde den Kelch der Tischgemeinschaft mit den Seinen nach seinem blutigen Ende aufs neue trinken im Reich Gottes. Zwar vermutete Nietzsche, daß damit das Schwergewicht des Lebens in das „Jenseits“ verlegt werde. Das Gegenteil ist der Fall! Durch den Wurf ins Kommende wird alle Positivität in das Ziel der Geschichte verlegt und dadurch dem Noch-Nicht, fast im Sinne Ernst Blochs309, jenes Übergewicht verliehen, das alle Sehnsuchts- und Hoffnungskraft an sich reißt. Das aber war nur möglich, weil die Distanz von Wirklichkeit und Möglichkeit verringert und diese als inspirierender und bewegender Vorgriff auf die Realität ausgewiesen worden war. Von der präsentischen Kraft des Kommenden ist das „Maranatha“ der Urgemeinde ebenso eingegeben wie die „präsentische Eschatologie“ des Johannesevangeliums310. In beiden Fällen hat sich der Ausgangsvorgang umgekehrt. Hatte der irdische Jesus durch seine Selbstidentifikation mit dem Menschensohn den Himmel auf die Erde herabgeholt, so steht er jetzt, als der Erhöhte, im Begriff, sein Erdenwerk aus der „Höhe“ seiner Entrückung zu vollenden. Doch will diese Höhe weniger räumlich als vielmehr zeitlich gesehen und erfahren werden: als das, wie Maximus Confessor sagt, bevorstehende und anzustrebende Ziel. „Bevorstehend“, weil dort der Vollender bereitsteht, den es, paulinisch ausgedrückt, bei seiner Wiederkunft im Triumphzug einzuholen gilt (1Thess 4,13-18), und der dieses „letzte Kapitel der Weltgeschichte“ dadurch herbeiführt, daß er die ihm Unterworfenen in seine eigene Unterwerfung unter den End-Vollender, Gott, hineinnimmt (1Kor 15,20-28). Doch will dieses Ziel gleichzeitig mit aller Kraft „angestrebt“ werden, weil sich an ihm, wenn je einmal, die Kreativität des Glaubens bewähren muß.
309 E. Bloch, Zur Ontologie des Noch-Nicht-Seins. Ein Vortrag, in: ders., Philosophische Grundfragen, Teil 1: Zur Ontologie des Noch-Nicht-Seins. Ein Vortrag und zwei Abhandlungen, Frankfurt a. M. 1961, S. 11 – 40. 310 Dazu: E. Biser, Das Antlitz, a.a.O., S. 262f: Das Maranatha.
105
Die Vertiefung
2. Die Verwirklichung Im Blick auf das programmatische Wort Jesu, daß er nicht gekommen sei, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen (Mk 10,45), tritt innerhalb dieses Kontextes das ethisch-operative Moment hervor. Das gilt aber auch schon für das Sohnesbewußtsein Jesu, das für Jesus die Verpflichtung einschloß, es bei aller Ausschließlichkeit an andere weiterzugeben. Der Aufnahme in die göttliche Liebesfülle entsprungen, schloß diese Ausschließlichkeit niemand aus, wohl aber, ungeachtet der mit ihr gegebenen Ausnahmestellung Jesu, alle in sich ein. Mit Recht bezogen die Kirchenväter das paulinische „Allen alles geworden“ (1Kor 9,20) in seiner höchsten Steigerung auf ihn. Wenn die Erhebung zu Gottes Sohnschaft allen mitgeteilt werden sollte, bedurfte es jedoch eines Mittelbegriffs, der so davon sprach, daß sich die Hörer in das Gesagte einbezogen wußten. Dafür war kein Begriff geeigneter als der des Gottesreichs. In ihm fand Jesus das sprachliche Gefäß, durch das er den Reichtum seiner Seele verschenken und die Beschenkten in das Glück seiner Sohnschaft aufnehmen konnte. Reich Gottes – das ist, so gesehen, der ins Soziale geweitete Selbstbegriff Jesu, oder, umgekehrt gesehen, seine mit ihm identische Sozialutopie – ein Begriff, der nicht nur gedacht, sondern promulgiert und getätigt sein wollte. Getätigt zunächst schon in Gestalt der Sprachleistung Jesu, die Jesus dadurch in Angriff genommen hatte, daß er sein Sohnesbewußtsein in das Gefäß des Reich-Gottes-Begriffs goß. Doch diese Vokabel erwies sich, rückbezüglich auf ihn selbst, als ein Prisma, das das in ihm aufleuchtende Licht in den Farbenkreis des Regenbogens auffächerte. So jedenfalls scheint es der Matthäusevangelist aufgefaßt zu haben, als er die dialogisch zustoßenden Seligpreisungen der Lukasversion zur Siebenzahl fortschrieb und bei der letzten, der Seligpreisung der Friedensstifter, sogar erkennen ließ, daß es sich dabei um die Weitergabe des Sohnesbewußtseins handelte, denn: Selig sind die Friedfertigen; sie werden Söhne Gottes heißen! (Mt 5,9) Mit gleicher Deutlichkeit betont die den Kleinen und Unmündigen geltende Seligpreisung der „Armen im Geist“ (Mt 5,3), daß Jesus mit diesen Zusagen dem Reich Gottes Bahn zu brechen suchte, „denn ihnen gehört das Reich der Himmel“ – wie Matthäus mit Rücksicht auf judenchristliche Leser formuliert. Selig gepriesen wird in den übrigen Rühmungen auch, was nach mundaner Einschätzung untüchtig, schwächlich und töricht ist und im Lebenskampf auf verlorenem Posten steht. Doch mit dem von der ganzen Wucht seiner religiösen Energie getragenen „Selig“ bricht Jesus das von diesen Vorurteilen eingenommene Denken auf, um dem Raum und Geltung zu verschaffen, was er unter „Reich Gottes“ versteht. Doch war damit erst ein Anfang gemacht. Auf den erweckenden und aufbrechenden Anruf mußte das Werk der Gestaltung und Befestigung folgen, das dem Anfang Dauer verlieh. Deshalb geht die Proklamation des Gottesreichs in die Verkündigung und diese in die Tätigung über. In die Verkündigung zunächst, denn der heilsame Schock, den die Seligpreisungen auslösten, mußte aufgefangen und in die Insinuation einer neuen Denkungsart umgesetzt werden. Das bezweckte Jesus mit Hilfe einer sprachlichen Innovation, die der Neuheit seiner Botschaft in nichts nachstand: mit der Schaffung seiner Bildworte, Sprachbilder und Gleichnisse. Er, der mit seinem Wort nach dem Urteil der Hörer diesen Entsetzen einjagen konnte, nahm das Bild zu Hilfe, um seinem Wort Nachdruck 106
2. Die Verwirklichung
und Dauer zu verleihen. Freilich verwendet er das Bild so wenig illustrativ, wie er das Wort in rein informativer Absicht verwendete. Vielmehr bezieht er zu diesen modernen Fehlverständnissen die ausdrückliche Gegenposition. Er hatte Worte, um selbst Taube damit wachzurütteln, und Bilder, um, wenn nicht Blinde, so doch Schwachsichtige sehend zu machen. Das Wort von denen, die Mücken sieben und Kamele verschlucken (Mt 23,24), schlug den damit Angegriffenen auf den Magen. Und das Bild von dem im eigenen Auge steckenden Balken (Mt 7,3ff) reizt unwillkürlich zur Nachprüfung, ob es sich nicht wirklich so verhalte. Aber das meiste vollbrachte Jesus, als er Wort und Bild zu jener einzigartigen Sythese verwob, aus der der Wurf seiner Gleichnisse hervorging. Entgegen den inadäquaten Interpretationen, die, beginnend mit der schon in den Evangelien einsetzenden Allegorese, in ihrer Deutungsgeschichte auf sie angesetzt wurden, sind sie angemessen nur aus ihrem funktionalen Zusammenhang mit Jesu Gottes-Reich-Predigt zu verstehen. Weil in ihnen stets das Unerwartete, Unerhoffte und oft genug auch Unerträgliche geschieht, wirken sie auf den Umbruch des Denkens hin, den Jesus mit seinem Metanoia-Ruf fordert. So versetzen sie die Hörer in jene „Armut des Geistes“, der nach der ersten Seligpreisung das Gottesreich gehört. Betrieb er mit den Seligpreisungen die Desillusionierung, die seine Hörer der „Weltbefangenheit“ entriß und so, mit Max Weber gesprochen, auf die „Entzauberung“ ihres Denkens hinwirkte, so verfolgte er mit den Gleichnissen das Gegenteil: das Werk der „Wiederverzauberung“. Vor den Augen der Hörer läßt er eine geradezu surrealistisch anmutende Welt entstehen, in der alle Proportionen umgedreht, die gewohnten Geltungen suspendiert und die eingespielten Lebensregeln außer Kraft gesetzt, wenn nicht geradezu in ihr Gegenteil verkehrt sind. Indessen bleibt es nicht bei dieser Frustration. Denn mitten im Entzug stellt sich, wie sonst nur noch beim Gebet, eine leise Gewährung ein. Das aus seinen Verankerungen gerissene Denken stürzt keineswegs ins Nichts, sondern gewinnt im Verlust der gewohnten Sicherungen jenen „doppelten Boden“, den das Gottesreich bietet. Die Gleichnisse sind somit, bildlich gesprochen, die weit geöffneten Arme, mit denen Jesus nicht nur die „Bedrückten und Beladenen“, sondern mit ihnen zusammen auch die Stolzen und Reichen an sich zieht, sofern sie sich nur dem Joch seiner Sprachsuggestion beugen. So erhob sich aus der Katharsis die Schau, die ihrerseits zur Einbeziehung und Einbürgerung in das, wenn auch noch so umrißhaft wahrgenommene, Gottesreich drängte. Wenn die Befestigung gelingen sollte, mußte die in alledem aufscheinende Wahrheit aber nicht nur erkannt, sondern auch getätigt werden. Und dies in erster Linie durch den Botschafter des Gottesreiches selbst. Deshalb legt Jesus auf die Tatverkündigung in Gestalt seiner Zeichen und Wunder nicht weniger Gewicht als auf die Wortverkündigung. Für ihn hält das kommende Gottesreich jetzt schon Einzug in der todverfallenen und leidbeschwerten Lebenswelt, wenn er den Blinden das Augenlicht, den Tauben das Gehör, den Gelähmten die Bewegungsfähigkeit und den Aussätzigen die Gesundheit schenkt und damit die gesellschaftliche Wiedereingliederung ermöglicht. Ausdrücklich bestätigt wird der Zusammenhang seines Heilswirkens mit der Reich-Gottes-Verkündigung im Fall seiner Dämonenaustreibungen311, die als die bestbezeugten Heilungswunder Jesu zu gelten haben. Seinen erbitterten Gegnern, die ihn des Teufelsbundes bezichtigen, gibt er zu bedenken:
311 Dazu: J. Moltmann, Der Weg Jesu Christi, a.a.O., S. 126f.
107
Die Vertiefung
Doch wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen (Lk 11,20). Ungleich schwerer läßt sich beweisen, daß Jesus dem Gottesreich auch durch sein Leiden Bahn bricht. Davon spricht aber gerade das bereits angeführte Wort, das verläßlicher als jedes andere über Jesu Selbsteinschätzung in der Abschiedsstunde Aufschluß gibt: Amen, ich sage euch: von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich davon neu trinke im Reiche Gottes (Mk 14,25). Nie ist der „Stein“ der Sache Jesu weiter in die von Gott erhoffte Zukunft geschleudert worden als mit diesem Wort. Und nie ist darum das Christentum so entschieden in den Aspekt einer Utopie – der Sozialutopie Jesu – gerückt worden wie hier. Indessen blieb es nicht bei dieser unbestimmten Offenheit nach vorn; vielmehr bestand der letzte Akt der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu in dem Ereignis, das seinem Entwurf die Qualität einer realisierten Utopie verlieh: in seiner Auferstehung. Mit ihr begann er tatsächlich die „Frucht des Weinstocks“ von neuem zu trinken: in der Mahlgemeinschaft derer, die sich zu seinem Gedächtnis versammelt hatten, um seine Anwesenheit unter ihnen zu feiern. Immer wieder laufen alle Linien darauf hin.
3. Die Neomorphose Das zog freilich eine tiefgreifende Umformung der Reich-Gottes-Idee nach sich, und das in einer Form, die hier den Ursprung aller ideellen Metamorphosen suchen läßt. Was die Ambivalenz der Bestimmung „mitten unter euch“ (Lk 17,20) nur vermuten ließ, wurde jetzt zur Gewißheit: der „Ort“, an dem sich das Gottesreich auszugestalten beginnt, war und ist die durch die Präsenz des Erhöhten konstituierte christliche Innerlichkeit. Das zog bei Paulus, dem Protagonisten dieser Neomorphose, einen Begriffswandel nach sich, der nur in der Passion, die die christlichen Ideen im Sog des Säkularisierungsprozesses erlitten, ein Gegenstück hat. Denn Paulus spricht nur noch beiläufig – wie etwa in Gal 5,21, 1Kor 4,20, 1Kor 6,9, 1Kor 15,50 oder Röm 14,17 – vom „Reich Gottes“, mit umso größerem Nachdruck jedoch von dessen elementarer Wirkung, der Freiheit. Dabei verleiht er dem aus dem hellenistischen Umfeld stammenden Begriff „eleutheria“ einen Stellenwert, der dem des Gottesreich-Gedankens in der Verkündigung Jesu gleichkommt312. Freilich würde das noch nicht zu dem Schluß berechtigen, daß Paulus dort, wo Jesus von dem in und mit ihm anbrechenden Gottesreich redet, von Freiheit spricht, wenn damit nicht eine tiefgreifende Umgestaltung Hand in Hand ginge. Wiederum war es Nietzsche, der sich diese Idee im Zug seiner polemischen Identifikation mit dem Evangelium in der – so Löwith313 – „antichristlichen Bergpredigt“ seines „Zarathustra“ zu eigen machte:
312 Dazu: E. Biser, Einweisung ins Christentum, a.a.O., S. 355f. 313 K. Löwith, Nietzsches antichristliche Bergpredigt (1962), in: ders., Sämtliche Schriften, Bd. 6, a.a.O., S. 467 – 484.
108
3. Die Neomorphose
Frei wovon? Was schiert das Zarathustra! Hell aber soll mir dein Auge künden: frei w o z u ?314 So sehr es Jesus auch darum ging, die Fesseln, durch welche Satan die ihm Verfallenen niederzwang, zu sprengen (Lk 13,16), richtete sich sein Freiheitswille doch in erster Linie auf die Freisetzung höherer Seins- und Verhaltensweisen. Das aber nimmt die paulinische Proklamation der Freiheit in vollem Umfang auf. Gilt die Zuwendung Jesu in erster Linie den Bedrückten und Beladenen, so geht es Paulus vorrangig um die Beseitigung der das menschliche Denken und Streben beengenden Zwänge. Daher sein lebenslanger und zuletzt mit seinem Leben bezahlter Kampf gegen das von ihm trotz aller Wertschätzung als beengend und lähmend empfundene jüdische Gesetz, aber auch der triumphale Ton, mit dem er die Entmachtung der „Weltelemente“ (Gal 4,3.9) durch den Auferstehungssieg Christi verkündet. Denn er sieht Juden und Heiden derselben Unfreiheit verfallen. Während jene im Netz der Gesetzesvorschriften gefangen sind, sind diese durch den im Gegenzug zur verfallenden Religiosität des Heidentums aufkommenden Schicksalsglauben gelähmt315. Niedergehalten durch diese „Weltelemente“, nicht minder aber auch durch das zum religiösen Selbstzweck erhobene Gesetz, war für ihn die ganze Menschheit dem Zustand der Unmündigkeit verfallen (Gal 4,3), der die besten Kräfte niederhielt und alle auf einen unwürdigen Infantilismus zurückwarf. Dem setzte die mit der Sendung des Sohnes beginnende und durch dessen Auferstehung vollendete Gottestat ein Ende: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn geboren aus einer Frau und dem Gesetz unterworfen, damit er die dem Gesetz Unterworfenen befreite, und damit wir die Sohnschaft erlangten (Gal 4,4f)316. Wenn es noch eines Beweises für die Gleichsinnigkeit der beiden Proklamationen bedürfte, würde er durch die damit jeweils verbundene Aussage von der Zeitenwende erbracht – bei Jesus affirmativ: „Die Zeit ist erfüllt“, bei Paulus rückblickend auf die von Jesus bewirkte Zäsur: „als die Zeit erfüllt war“. Beide Male will das in der Lautstärke eines Donnerschlags gehört werden. Nicht umsonst klingt es bei Paulus nochmals, fast wie ein Echo, nach: Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe: Neues ist geworden! (2Kor 4,7) Der von der Menschheit ausgesagte Zustand der Entmündigung gilt aber, wie Paulus es dann überwältigend im Römerbrief entfaltet, auch von der gesamten Schöpfung. Sie liegt ächzend und stöhnend in Geburtswehen (Röm 8,18), während sie „mit vorgestrecktem Kopf“ (Röm 8,19) der Stunde ihrer „Entbindung“ zum Status der Gotteskindschaft entgegenharrt. Doch Paulus ist mehr noch Geschichtsdenker als Seinsdenker. Für ihn hatte sich die von den Menschen erfahrene und gestaltete Zeit regelrecht „gestaut“, so daß ein 314 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra I, Vom Wege des Schaffenden, in: ders., KSA 4, S. 80 – 82, S. 81. 315 Dazu: R. Bultmann, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, a.a.O., S. 163 – 173. 316 Dazu: F. Mußner, Der Galaterbrief, a.a.O., S. 268 – 274.
109
Die Vertiefung
umfassender Erwartungsdruck in ihm entstand, der die Sehnsucht der Menschheit erfüllen, ihre Unterdrückung wenden und ihre Leiden beheben konnte. Daß dafür die Stunde gekommen war, ist für Jesus gleichbedeutend mit dem Anbruch des Gottesreichs, für Paulus mit der befreienden Sendung des Gottessohnes, die der Entmündigung ein Ende setzte und die aus der Unterdrückung Befreiten dem Hochziel der Gotteskindschaft entgegenführte. Doch damit gerät er nun seinerseits unter einen Sinndruck, der sich schließlich in dem pleonastischen Satz des Galaterbriefs entlädt: Zur Freiheit hat uns Christus befreit! (Gal 5,1)317 Doch damit ist die Identität der beiden Konzeptionen noch nicht völlig erwiesen. Sie kommt definitiv erst dann zum Vorschein, wenn beide auf ihren innersten Ermöglichungs- und Sinngrund zurückgeführt werden. Denn beide sind, radikal gesehen, nur Synonyme für Jesus selbst. In beiden Fällen wurde der Nachweis erst im Gefolge der späteren Intepretationsgeschichte erbracht: für die Reich-Gottes-Verkündigung Jesu durch Origenes, der den Botschafter zum Inhalt erklärte und ihn die „autobasileia“, das Gottesreich in Person, nannte318; für Paulus durch Hegel mit der in dessen „Philosophie der Weltgeschichte“ entwickelten These, daß diese im „Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit“ bestehe, die nach ihren Vorstufen im Orient und in der griechischen Polis ihre Vollgestalt erst im Christentum erlangte319. So erscheint Jesus ebenso als der Stifter und das Sinnziel des verkündeten Reiches wie der von Paulus proklamierten Freiheit. Wer sich seinem Reich verschreibt, tritt in seine Macht- und Lebenssphäre; und wer mit ganzem Einsatz nach Freiheit strebt, ist insgeheim von ihm bewegt320. Das leuchtet im ersten Fall freilich eher ein als im zweiten. Wenn das Gottesreich von Jesus zum vorrangigen Gebetsanliegen erhoben wurde, und er um dieses ureigene Anliegen Gottes nicht beten konnte, ohne erhört zu werden, füllte die Gewährung dieser Bitte in einer nur noch mit seinem Sohnesbewußtsein vergleichbaren Weise sein ganzes Bewußtsein aus, so daß er sie in diesem Reich gespiegelt sehen und wiederfinden mußte. Insofern bringt das Wort von der „autobasileia“ nur das auf den Begriff, was den Daten des Evangeliums zu entnehmen ist. Gilt Gleiches aber auch für die Freiheit? Danach ist umso mehr zu fragen, als diese im Unterschied zu Weisheit, Hoffnung und Frieden niemals mit Jesus gleichgesetzt wird. Spiegelbildlich dazu wagte es Paulus im Unterschied zu dem von ihm ebenso bewunderten wie befehdeten Charismatikern, niemals Herrenworte aus eigener Erfindung und Befugnis zu gestalten, obwohl er für sich in Anspruch nimmt, nichts zu sagen, was nicht von Christus in ihm bewirkt wurde (Röm 15,18). Indessen wird man von dem, der „an Christi statt“ zur Versöhnung mit Gott aufruft (2Kor 5,20), annehmen dürfen, daß er sich wie kein anderer in das Interesse Jesu versetzte. Dabei muß Paulus klar geworden sein, daß sich dieses Interesse nicht mehr wie zu Jesu Lebzeiten mit „Reich Gottes“ umschreiben ließ, weil es so weder der nach der Auferstehung Jesu eingetretenen Zäsur noch der inzwischen entstandenen soziokulturellen 317 A.a.O., S. 342 – 345. 318 Dazu: R. Gögler, Zur Theologie des biblischen Wortes bei Origenes, Düsseldorf 1963, S. 264; ferner: H. Merklein, Jesus, Künder des Reiches Gottes, in: ders., Studien zu Jesus und Paulus, Tübingen 1987, S. 127 – 156, S. 153. 319 Nach K. Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen (1950), in: ders., Sämtliche Schriften, Bd. 2, a.a.O., S. 240 – 279, S. 268f. 320 Dazu: E. Biser, Hat der Glaube eine Zukunft?, a.a.O., S. 160 – 182: Die Religion der Freiheit.
110
4. Die Selbstfindung
Situation entsprach. Im Gefolge einer wahrhaft kongenialen Einfühlung muß er sodann begriffen haben, daß angesichts der weltweit gewandelten Situation das, was der Begriff „Reich Gottes“ meinte, nur mit Hilfe einer sprachlichen Neuschöpfung zur Geltung zu bringen war, die sich zudem auf die in seinem hellenistischen Umfeld vorherrschende Sinnerwartung einstimmen mußte. So sagte er anstatt „Reich Gottes“ mit ebensoviel Überzeugung wie Emphase: Freiheit!321
4. Die Selbstfindung Ihrem Grundansatz – den auf Jesus bezogenen Hoheitstiteln – folgend, arbeitet die Christologie die Einzigartigkeit und göttliche Würde Jesu am Leitfaden seines Gottesverhältnisses heraus. Sie denkt somit im Grunde auf Christus hin. Da die Christomathie umgekehrt, also von ihm her, zu denken sucht, geht sie bei der Bestimmung von seiner Einzigartigkeit, seinem Welt- und Selbstverhältnis aus. Anders als für die Christologie stellt sich damit für die Christomathie vorrangig die Frage nach Jesu Identitäts- und Selbstfindung. Freilich stieß auch die christologische Forschung schon seit längerem auf das damit angesprochene Problem, als sie das in dem „Pro vobis“ ausgedrückte Grundverhalten Jesu entdeckte und bisweilen, wenig glücklich, von seiner „Proexistenz“ sprach322. Im Grunde war schon Kierkegaard der Entdecker dieses Wesenszuges, den er mit dem Schlüsselsatz: „Der Helfer ist die Hilfe“, auf den Begriff brachte323. Doch entging ihm ebenso wie der modernen Ausarbeitung die Rückbezüglichkeit dieses Zuges, der als solcher überhaupt erst erklärbar ist, wenn er als Folge des Identifikationsaktes Jesu begriffen wird. Das angedeutete Defizit hängt freilich nicht nur mit der unterschiedlichen Denkrichtung, sondern nicht weniger mit einer zweifachen Vernachlässigung zusammen: zunächst der des Menschen in seiner konkreten Existenzkrise. Trotz der „anthropologischen Wende“, die immer noch als eines der signifikantesten Lebenszeichen der Gegenwartstheologie zu gelten hat, zog diese nicht wirklich mit der aktuellen Verfassung des Menschen gleich. Sonst hätte sie intensiver auf die Identitätskrise eingehen müssen, die seit der Romantik – am vehementesten aber durch Heinrich von Kleist und Heinrich Heine – beklagt wurde. In diesem Fall hätte sich ihr die Rückfrage nach der Identitätsfindung Jesu fast von selber auferlegt. Nicht weniger fällt in diesem Zusammenhang die Vernachlässigung des paulinischen Selbstzeugnisses ins Gewicht. Denn Paulus gibt im unmittelbaren Kontext der authentischen Bezeugung seines Ostererlebnisses (Gal 1,15f) zu verstehen, daß er von dem ihm ins Herz gesprochenen Gottessohn zu seiner Identität geführt wurde. Bestand diese für ihn vordem vorrangig in Akten der Abgrenzung und Polarisierung gegenüber dem Feindbild, zu dem ihm seine Vorstellung von Jesus geronnen war, so lautet ihre Formel nunmehr: 321 A.a.O., S. 163: „Sosehr der Gedanke der christlichen Freiheit immer wieder, am nachdrücklichsten in Luther, energische Befürworter fand, kam es doch nirgendwo dazu, daß er in den Rang eines theologischen Prinzips […] erhoben wurde.“ 322 Dazu: H. Schürmann, „Pro-Existenz“ als christologischer Grundbegriff (1985), in: ders., Jesus – Gestalt und Geheimnis. Gesammelte Beiträge, hrsg. v. K. Scholtissek, Paderborn 1994, S. 286–315. 323 S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, in: ders., Werkausgabe Bd. 2, S. 19.
111
Die Vertiefung
Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir (Gal 2,20)324. Das vervollständigt er im darauffolgenden Satz mit einem Bekenntnis, das die gewonnene Lebensform begründend auf ihren Urheber zurückbezieht: Sofern ich noch im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Gottessohn, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat (Gal 2,20). Wenn irgendwo, liegt hier der Schlüssel für die Wendungen, in denen Paulus davon spricht, daß Jesus zum „Diener der Beschneidung“ (Röm 15,8) und, direkter noch, für uns arm geworden sei, damit wir „durch seine Armut reich“ würden (2Kor 8,9). Doch mit diesen Aussagen erhebt sich Paulus über den Gedanken des bloßen Hingegebenseins Jesu, da Jesus für ihn bereits die Vorstufe für seine Einholung, besser gesagt: für sein „Aufleben“ in den Glaubenden ist. Was Jesus war und tat, war für Paulus stets nur die Bedingung für das, was Jesus in den Seinen und für sie „ist“. Denn Christus heißt für Paulus „das Leben“ – und das Sterben ist Gewinn (Phil 1,21). Das aber muß mit Wikenhauser dahin verstanden werden, daß der, der am Kreuze starb, jetzt, als Auferstandener, sein Leben in ihm führt325. Wenn aber in diesem Sinn von einem „Aufleben“ und „Erwachen“ Jesu in den Seinen gesprochen werden kann, ist von ihm eine Identitätsfindung ausgesagt, die der neuen Identität, zu der Paulus in seinem Damaskuserlebnis durchbrach, vollauf entspricht: der Identität durch Übereignung, nicht durch Abgrenzung, oder kürzer: der Identität in dem zu eigen genommenen Anderen, der Identität im mitgeteilten, nicht nur mitteilenden Du. Wenn man die Zäsur von Kreuz und Auferstehung auch noch so hoch ansetzt, so wird man doch daraus auf die vorösterliche Seinsweise Jesu zurückschließen dürfen. Denn auch für ihn gilt der Grundsatz des Cusaners, daß die gottentstammte Seinsweise nichts „anderes“ aus dem Menschen macht, sondern ihn nur das auf neue und „andere“ Weise sein läßt, was er zuvor schon war326. Auch wenn das zunächst als heuristischer Fingerzeig gelten kann, ist es doch dazu angetan, Verhaltensstrukturen des historischen Jesus aufzudecken, die auf eine von der gewohnten weit unterschiedene, ja ihr geradezu entgegengesetzte Selbstfindung schließen lassen. Besteht die gewohnte Selbstfindung in Akten der Abgrenzung und Selbstunterscheidung, so im Falle Jesu in einer zuständlichen Selbstmitteilung und Selbstübereignung. Schon auf Erden lebt er sein Leben in den Seinen und bezieht diese, sofern sie nur nicht widerstreben, in seinen Existenzakt mit ein. Auf dem Höhepunkt seiner Einfühlung in das Lebensgeheimnis Jesu, den er ausgerechnet im „Antichrist“ erreicht, wagt Nietzsche sogar die Behauptung, daß diese Form des liebenden Selbstgewinns noch nicht einmal vor Jesu Feinden und Henkern haltmacht: Und er bittet, er leidet, er liebt m i t denen, i n denen, die ihm Böses tun327. 324 Dazu: A. Deissmann, Paulus. Eine kultur- und religionsgeschichtliche Skizze, Tübingen 2/1925, S. 107 – 124; ferner: E. Biser, Der unbekannte Paulus, a.a.O., S. 274f. 325 A. Wikenhauser, Die Christusmystik des Apostels Paulus, 2., umgearb. u. erw. Aufl., Freiburg i. Br. 1956, S. 44. 326 Nikolaus von Kues, De filiatione Dei – Die Gotteskindschaft, in: ders., Philosophisch-theologische Schriften, Bd. 2, a.a.O., S. 609 – 643, S. 615. 327 F. Nietzsche, Der Antichrist, § 35, in: ders., KSA 6, S. 207.
112
4. Die Selbstfindung
Vor dem Hintergrund dieses Wortes gewinnen eine Reihe von Äußerungen, Aktivitäten und Motiven der Jesus-Vita unversehens ein neues und schärferes Profil, so etwa jene die Aussendung der Jünger begründenden Worte: „Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab“ (Lk 10,16); oder die von Kierkegaard als programmatisches Leitwort herausgestellte Große Einladung an die Bedrückten und Beladenen, denen er die „Ruhe“ der Lebensgemeinschaft mit sich zusichert (Mt 11,28); sodann – und vor allem – die sakramentale Selbstübereignung beim letzten Mahl, begleitet von dem Deutewort: „Das ist mein Leib“ – gleichbedeutend mit: „Das ist mein Selbst“ – „für euch“ (1Kor 11,24); und nicht zuletzt das johanneische Wort vom Sich-Verströmen, das bereits im Gespräch mit der Samariterin anklingt (Joh 4,13f), sich dann steigert zu der mit lauter Stimme ausgerufenen Verheißung: „Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Herzen fließen“ (Joh 7,38), bis hin zu seiner Erfüllung, wenn aus der durchbohrten Seite des Gekreuzigten „Blut und Wasser“ hervortreten (Joh 19,34). Wie nunmehr deutlich wird, spricht aus alledem ein personaler Mehrwert. Wer so redet, handelt, lebt und stirbt, findet anders als andere zu sich selbst. Indem er sich vergibt, kommt er zu sich; indem er sich an andere verliert, erwacht er zu sich selbst. Das aber kommt bereits mit aller nur wünschenswerten Klarheit in dem Wort zum Ausdruck: Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen (Mk 10,45). Nach Bubers Aussagen in seiner genialen Jugendschrift „Ich und Du“ vollzieht sich die menschliche Identitätsfindung in Akten der Abgrenzung von anderen und anderem. Wir sagen „Du“ und „Es“, um „Ich“ sagen zu können328. Wenn Jesus seine Identität demgegenüber in Akten der Selbstübereignung gewinnt, ist nun erst recht nach den Vorzugszielen seiner Hingabe zu fragen. Für den, der nach dem Bericht der Evangelien durch die bei seiner Taufe ertönende Himmelsstimme oder, wie vor dem Hintergrund des modernen Verständnisses der Szene anzunehmen ist, durch seine Gebetserfahrung zum Bewußtsein seiner Gottessohnschaft und damit seines Aufgenommenseins in das Gottesleben geführt wurde, für den war erstes und vorrangiges Ziel seiner Selbstübereignung selbstverständlich Gott. Sie war seine existentielle Replik auf die von ihm erfahrene Entgegenkunft und, in ihrer Konsequenz, Ursprung und Urbild des Glaubens. Für den, der sich dazu gesandt wußte, nicht bedient zu werden, sondern zu dienen, und der diese Dienstbarkeit bis zu dem sakramental bekräftigten Satz steigerte: „Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh 6,35.48), war aber auch die Menschheit nahezu gleichrangiges Hingabeziel. Wie die Weisheit, so interpretiert das die reflektierende Gemeinde, suchte er Wohnung und Aufnahme in „heiligen Seelen“, um sie, wie er dann in den johanneischen Abschiedsreden ausdrücklich bestätigt, zu seinen „Freunden“ heranzubilden. Als der „Stärkere“, der der satanischen Fremdherrschaft ein Ende macht, will er von dem gereinigten und geschmückten Haus des unerfüllten Menschen Besitz ergreifen, um es mit seiner Anwesenheit zu beschenken (Lk 11,24ff). Doch gibt es auch eine kampflose Art der Besitzergreifung, die ihm ungleich mehr entspricht, nämlich den Glauben, den der Verfasser des Epheserbriefs mit dem Gebetswunsch verbindet: Durch den Glauben möge Christus in euren Herzen wohnen (Eph 3,17). 328 Dazu: M. Buber, Ich und Du (1921), in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 77 – 170, S. 97ff.
113
Die Vertiefung
Das rückt den Glauben in eine noch viel zu wenig erschlossene, ausgesprochen christomathische Perspektive. Die christologische Perspektive, die auf Jesus hin denkt, kennt Jesus nur als den Inhalt und Gegenstand des Glaubens, dagegen geht die Christomathie von seiner entgegenkommenden Initiative und damit von seinem Identifikationsakt aus. In dieser Sicht ist Glaube nicht nur die rezeptive Akzeptanz der in Jesus ergangenen Gottesoffenbarung, sondern zustimmender Mitvollzug seines Identifikationsaktes, also mitvollziehende Einwilligung in die Selbstfindung und Vergegenwärtigung Jesu im Glaubenden. Wenn sich der Durchbruch ins Sohnesbewußtsein aber, wie angenommen, im Beten Jesu ereignete, und wenn das Hauptanliegen dieses Betens in der Heraufkunft des Gottesreiches bestand‚ dann war dieses, mehr noch als bisher deutlich wurde, auch ein Vorzugsfeld seiner Selbstfindung. Dann rührte Origines mit der Bezeichnung von Jesus als „autobasileia“ letztlich an Jesu Identifikationsakt. Darauf muß abgehoben werden, weil sich erst so die seine ganze Kreativität mobilisierende Leidenschaft erklärt, mit der er sich für das Gottesreich verwendet und einsetzt – „verwendet“ insofern, als das Gottesreich für ihn absolute Priorität hat. Wer sich ihm dabei wie seine Gegner, die ihn unter Berufung auf das Sabbatgebot an seinem Heilswirken zu hindern suchen, in den Weg stellt, löst einen Sturm der Erregung in ihm aus (Mk 3,1-6). Und den Städten, die sich seiner Botschaft versagen, droht er, zumindest aus der Sicht der nacherzählenden Gemeinde, Verwüstung und den Sturz in die Hölle an (Lk 10,13ff). Im Blick auf das sich ihm verweigernde Jerusalem steigert er sich sogar zu einem Wort, in dem er geradezu mit dem seine Bürger in sich bergenden Reich verschmilzt: Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt; ihr aber habt nicht gewollt (Lk 13,34). Nicht weniger vorbehaltlos setzt er sich aber auch – und das mit seiner ganzen Kreativität – für das Kommen des Gottesreiches ein. Ihm gelten die Spitzen seiner Sprachleistung, ihm gilt der ihn oft bis an den Rand der Erschöpfung treibende Einsatz seiner Wunderkraft. Denn es ist ihm offensichtlich nicht genug, vom Reich Gottes in Worten zu reden, wie sie nach dem Eindruck der Hörer nie zuvor vernommen wurden (Mk 1,27). Er, der Wortgewaltige, stößt hier vielmehr an eine ihn peinigende Sprachbarriere, die er schließlich durch den Überstieg in eine transverbale Sprache, die Tatsprache seiner Wunder, überwindet. Indessen ist seine Identitätsfindung im Gottesreich auf beziehungsreiche Weise mit einer zweiten Identitätsfindung verknüpft: seiner Identifikation mit dem Menschensohn329. Auch wenn deren Werdegeschichte in der Forschung immer umstritten ist, spricht doch ihre Logik dafür, daß sie eine Entwicklung von der „Gezweiung“ zur Gleichsetzung durchlief. Anfänglich erblickte sie in Jesus, dem Menschensohn, den himmlischen Repräsentanten Israels, der nach Dan 7,14 die Sache des auserwählten Volkes vor dem Thron Gottes vertritt und von diesem mit der Heraufführung seines Reiches beauftragt wird. Trotz der widerstreitenden Einschätzung der Interpreten wird man diese Vorstufe doch dem Drohwort entnehmen können:
329 Dazu: A. Vögtle, Die „Gretchenfrage“ des Menschensohnproblems. Bilanz und Perspektive, Freiburg 1994; ferner: E. Biser, Einweisung ins Christentum, S. 143; S. 306.
114
4. Die Selbstfindung
Zu jedem, der sich zu mir vor den Menschen bekennt, wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Und wer mich vor den Menschen verleugnet, den wird auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes verleugnen (Lk 12,8f)330. Unverkennbar grenzt sich hier das im Vordersatz redende „Ich“ von dem im Nachsatz genannten „Menschensohn“ ab. Dann aber muß es in der Bewußtseinsgeschichte Jesu den von den Evangelien nicht ausdrücklich vermerkten Augenblick gegeben haben, in dem er sich in der Himmelsgestalt des Menschensohnes wiedererkannte und im Akt seiner Selbstidentifikation mit ihr buchstäblich den Himmel auf die Erde herabholte. Fortan trug er die Anliegen und Nöte seines Volkes, aber auch seine Fehlleistungen und Verfehlungen vor das Angesicht seines Gottes. Fortan entschied sich an dem Verhalten zu ihm Heil oder Unheil, fortan ereignete sich in ihm das rettende Gottesgericht. Über den Zeitpunkt dieses Durchbruchs lassen sich nur Mutmaßungen anstellen. Noch am wahrscheinlichsten ist die Annahme, daß er mit der vom Massenabfall ausgelösten Lebenskrise zusammenhängt, auf die Buber auf Grund der ihm eigenen Sensibilität aufmerksam wurde und auf die er in seinem Schlüsselwerk „Zwei Glaubensweisen“ aufmerksam machte331. An der „Wegscheide seines Schicksals und schicksäligen Werkes“ angekommen, erleidet Jesus gleich allen großen Lehrmeistern des Glaubens einen Einbruch seines Bewußtseins, der sich schließlich zur Ungewißheit steigert, „ ‚wer‘ er sei“332. Daß es sich dabei um die Stunde des Massenabfalls handelt, wie sie am deutlichsten das Johannesevangelium (Joh 6,60-71) berichtet, wird freilich erst deutlich, wenn man Bubers Deutung mit derjenigen Kierkegaards zusammennimmt, der die bei Buber nur angedeutete Lebenskrise mit der Reaktion der Menge auf die Brotrede Jesu erklärt333. Auf deren Höhepunkt hatte Jesus den Sinn seiner Sendung, seines Liebeswillens und seiner Hingabebereitschaft in den suggestiven Satz zusammengefaßt: „Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh 6,35.48). Doch anstelle des zu erwartenden Gedränges derer, die ihm dieses Lebensbrot aus der Hand zu reißen suchen, geschieht, so Kierkegaard, das Gegenteil: ein unübersehbares Gedränge von Menschen, welche zurückfliehen und schaudern, bis daß sie fortstürmen und niedertreten, sodaß man, wo man aus dem Ausgang auf das schließen wollte, was gesagt worden ist, weit eher schließen möchte, es sei gesagt worden: „Bleibt ferne, ferne, ihr Unheiligen“, und nicht: „Kommet her“334. Dadurch aber mußte sich ihm – so wiederum Buber – der Sinn seiner Sendung und, radikaler noch, der seines Daseins verrätseln, so daß er sich schließlich an seine Weggefährten mit der Frage wendet, wer er in ihren Augen sei335. In der Konsequenz der bisherigen Lebensgeschichte müßte sich jetzt die Himmelsstimme mit der Zusage einmischen, die bereits nach Jesu Taufe an ihn ergangen war: „Und wenn sich alle von dir zurückziehen, 330 331 332 333 334 335
Dazu: L. Schenke, Die Urgemeinde, a.a.O., S. 127 – 132. M. Buber, Zwei Glaubensweisen, in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 651 – 782. A.a.O., S. 672. Dazu: E. Biser, Der Freund. Annäherungen an Jesus, 2/1989, S. 190ff. S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, in: ders., Werkausgabe Bd. 2, S. 28. M. Buber, Zwei Glaubensweisen, in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 732.
115
Die Vertiefung
du bist und bleibst mein geliebter Sohn!“ Doch der Himmel schweigt. Stattdessen meldet sich Petrus zu Wort, um ihm das zuzusprechen, was der Himmel zu sagen hätte: „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“ (Mt 16,16), ein Zuspruch, der von Jesus von da an als Eingebung seines „himmlischen Vaters“ verstanden und mit der Ernennung des Petrus zum Felsengrund der Kirche beantwortet wird (Mt 16,17f)336. Diese Differenz zwischen der ausbleibenden Himmelsstimme und dem Messiasbekenntnis des Petrus ist gleichbedeutend mit dem Augenblick, in dem sich der Blick Jesu auf die himmlische Szene mit dem vor dem Thron Gottes stehenden Menschensohn richtet, der, wenn je, dann jetzt die Sache Jesu vor Gottes Angesicht vertritt. Doch in diesem Augenblick muß es auch schon zur Verschmelzung des Aufblickenden mit dem Geschauten gekommen sein. Hier nimmt dann dieser Annahme zufolge das seinen Anfang, was sich, wie wiederum Buber erklärt, vor dem Tribunal des Hohepriesters abspielt, wenn Jesus dessen Frage nach seiner Identität mit der visionären, auf seine kommende Verherrlichung vorausblickenden Versicherung beantwortet: Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen (Mk 14,62)337. Das ist, angesichts der akuten Todesdrohnung, das visionär erschaute Bild von Jesu Sieg nach allem Kampf und Leiden und auch von seiner Ruhe nach dem Sturm. Nach Nietzsche sind es bekanntlich gerade die „stillsten Worte“, die „den Sturm bringen“338. Keiner hat aber jemals stillere Worte gefunden als der, der das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht löschen wollte. Worin bestand dann der „Sturm“, den er heraufbeschwor, worin seine wahrhaft stürmische Lebensleistung?
5. Die Lebensleistung Keiner hat sich mit größeren Lettern in die Geschichte der Menschheit eingeschrieben als Jesus. Aber nur selten wird nach seiner Lebensleistung und zumal nach seiner zentralen Lebenstat gefragt. Zu vollständig scheint das Volumen dieser Frage durch die Formel ausgefüllt, die ihn den „Erlöser der Welt“ nennt. Doch ist mit dieser Formel, auch wenn sie mit dem Gedanken von seinem Sühnetod unterbaut wird, alles erklärt? Verlangt nicht gerade sie nach einer Erklärung, die nur von der Rückfrage nach der Lebensleistung Jesu erbracht werden kann? Der Versuch einer Beantwortung kann zeitgeschichtlich angegangen werden, und dies im Blick auf die hochbrisante politische Situation, mit der sich Jesus konfrontiert sah339. Israel befindet sich während seiner Wirksamkeit in einem höchst labilen politischen 336 Dazu: A. Vögtle, Das Problem der Herkunft von „Mt 16,17-19“, in: ders., Offenbarungsgeschehen und Wirkungsgeschichte. Neutestamentliche Beiträge, Freiburg i. Br. u. a. 1985, S. 109 – 140, bes. S. 135ff. 337 M. Buber, Zwei Glaubensweisen, in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 731f. 338 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra II, Die stillste Stunde, in: ders., KSA 4, S. 187 – 190, S. 189. 339 Dazu: J. D. Crossan, Der historische Jesus (The Historical Jesus, 1991), aus dem Engl. übs. v. P. Hahlbrock, München 1994, S. 237 – 307.
116
5. Die Lebensleistung
Gleichgewicht, das durch begrenzte Zugeständnisse der römischen „Besatzungsmacht“ und ungleich größere Konzessionen von seiten der führenden Sadduzäergruppe zustandekam, gleichzeitig aber durch die kompromißlose Kampfbereitschaft der Zeloten-Partei extrem gefährdet war340. Den drohenden Untergang Jerusalems und seines Volkes vor Augen, versuchte Jesus – so die zeitgeschichtliche Erklärung seiner Lebensleistung – diesen Extremisten den religiösen Vorwand ihrer Aggressivität aus der Hand zu schlagen, indem er ihrem Gottesbild den Boden entzog. Denn dieses leistete einer Selbsteinschätzung Vorschub, die es den Zeloten erlaubte, sich als den verlängerten Arm der göttlichen Strafgerechtigkeit gegenüber den heidnischen Gottesfeinden zu fühlen. Ihre Entschlossenheit zum Freiheitskampf um jeden Preis, auch um den des eigenen Lebens und des Untergangs der von ihnen vertretenen Sache, erfuhr eine höchst wirkungsvolle theologische Sanktionierung. Auf das tragische Prinzip zurückgeführt, war das der Gott, der nach Jes 45,7 ebenso das Licht wie das Dunkel erschuf und ebenso das Heil wie das Unheil bewirkt, der als der zärtlich Liebende zugleich der unerbittlich Rächende ist und dessen vielfach angedrohtes Gericht nicht rasch genug über die Feinde seines auserwählten Volkes heraufbeschworen werden konnte. Wenn die Dinge nicht den von ihnen tatsächlich genommenen Verlauf nehmen und Jerusalem von Tod und Untergang verschont werden sollte, mußte die Zelotengruppe von ihrer Strategie und Motivation abgebracht werden. Damit mag es schon zusammenhängen, daß Jesus mindestens einen daraus, Simon den Zeloten, vermutlich aber auch Judas, den Sikarier – so eine mögliche Lesart seines geläufigeren Beinamens „Iskariot“ – in seine Zwölfergruppe aufnahm341. Und höchst wahrscheinlich bezieht sich auch sein distanziertes Urteil über die „Galiläer“ darauf, die Pilatus während einer durchaus friedlich begonnenen Demonstration niedermachen ließ: Damals kamen einige zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, so daß sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen: Glaubt ihr, daß diese Galiläer größere Sünder als alle anderen waren, weil das mit ihnen geschehen ist? Nein, im Gegenteil, denn ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt (Lk 13,1ff)342. Doch ließ es Jesus bei diesem Entgegenkommen in der Jüngerwahl und dieser Kritik an einer im Vorfeld des Freiheitskampfes gestarteten Aktion nicht bewenden. Vielmehr griff er in das Gottesbild dieser Gruppe und damit seines ganzen Volkes ein. Aufschlußreiches Dokument des Eingriffs ist der lukanische Bericht von seiner Antrittsrede im heimatlichen Nazaret, die nach dem Urteil der anfänglich begeisterten Zuhörer in eine einzigartige Provokation ausartet. Denn er bricht aus dem von ihm rezitierten und durch sich selbst interpretierten Jesaja-Text – „heute hat sich dieses Schriftwort vor euren Ohren erfüllt“ (Lk 4,21) – die den Hörern vertraute Schlußwendung, die den „Tag der Rache“ androht, heraus, so daß das Prophetenwort in die Ankündigung des „Gnadenjahrs vom
340 Dazu: L. Schenke, Die Urgemeinde, a.a.O., S. 293 – 297. 341 Dazu: G. Theißen, Lokalkolorit und Zeitgeschichte in den Evangelien. Ein Beitrag zur Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen 2/1992, S. 186ff. 342 Dazu: J. Ernst, Das Evangelium nach Lukas (Regensburger Neues Testament), 6., überarb. Aufl., Regensburg 1993, S. 311 – 314.
117
Die Vertiefung
Herrn“ ausmündet (Lk 4,19). Doch damit verletzt er seine Hörer in ihrer religiösen Grundvorstellung. Und die Reaktion läßt nicht auf sich warten: Als sie das hörten, gerieten alle in der Synagoge in helle Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn dort hinabzustürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg (Lk 4,28ff)343. In dieselbe Richtung weist der bereits erwähnte Bescheid, mit dem Jesus die von dem gefangenen Täufer an ihn gerichtete Frage beantwortet: Es ist nicht, wie dieser annahm, die Stunde des entbrennenden Gotteszorns und des über die Welt hereinbrechenden Gerichts, sondern die Zeit der Erbarmung, des Heils und der Heilung (Lk 7,18-23), wie es dann Paulus, der Fortdenker der Jesus-Botschaft in den Satz zusammenfaßt: Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade; jetzt ist er da, der Tag des Heils (2Kor 6,2). Wenn diese Aussagen ihr volles Gewicht behalten sollen, muß von ihnen auf das Gottesbild Jesu zurückgeschlossen werden können. Das ist gleichbedeutend mit dem Versuch, seiner Lebensleistung das volle Profil abzugewinnen. Denn diese bestand, wie sich nunmehr zeigt, in einer Korrektur, um nicht zu sagen, in einem radikalen Eingriff in das Gottesbild Israels und mit ihm in das der gesamten Menschheit, der Jesus als den größten Revolutionär der Religionsgeschichte erweist. Was Israel betrifft, so drängen zwar die prophetischen Aussagen über die väterliche, ja mütterliche Liebe und Erbarmung Gottes seit alters in Richtung auf die von Jesus bewirkte Korrektur. Doch waren die jüdischen Unheilserfahrungen, gerade auch in der von Christen dominierten Umwelt, so überwältigend, daß Martin Buber am Schluß seiner „Reden über das Judentum“ die Bilanz mit den Worten zog: Stehen wir bezwungen vor dem verborgenen Antlitz Gottes, wie der tragische Held der Griechen vor dem antlitzlosen Verhängnis? Nein, sondern wir rechten auch jetzt noch, auch wir noch, mit Gott, eben mit ihm, den wir einst […] zu unserem Herrn erwählt haben. Wir schicken uns nicht in das irdische Sein, wir ringen um seine Erlösung, und wir rufen rechtend die Hilfe unseres Herrn, des wieder und noch Verborgenen an. In solchem Stande harren wir seiner Stimme, komme sie aus dem Sturm oder aus einer Stille, die darauf folgt. Mag seine künftige Erscheinung keiner früheren gleichen, wir werden unseren grausamen und gütigen Herrn wiedererkennen344. Wie sehr das dem Gottesbild der Menschheit entspricht, wird besser als durch jeden religionsgeschichtlichen Nachweis dadurch bestätigt, daß Rudolf Otto das „Heilige“, und 343 Dazu: U. Busse, Das Nazareth-Manifest Jesu. Eine Einführung in das lukanische Jesusbild nach Lk 4,16-30, Stuttgart 1978, S. 28; S. 45f. 344 M. Buber, An der Wende (1951), in: ders., Der Jude und sein Judentum. Gesammelte Aufsätze und Reden, Köln 1963, S. 141 – 179, S. 178f.
118
5. Die Lebensleistung
damit die religiöse Grunderfahrung der Menschheit, durch die Koinzidenz von mysterium tremendum und mysterium fascinosum bestimmt sah345. Darauf muß umso mehr zurückgeblendet werden, als erst von hier aus deutlich wird, daß der zeitgeschichtlichen Perspektive, aus der die Korrektur zunächst hergeleitet wurde, eine wesentlichere – lebens- und bewußtseinsgeschichtliche – zugrundelag. Diese Perspektive betrifft zugleich die kämpferische Seite des Vorgangs, der die Bezeichnung Jesu als „Revolutionär“ überhaupt erst rechtfertigt. Lebensgeschichtlich gesehen, fiel ihm das neue Gottesbild keineswegs in den Schoß. Vielmehr trat ihm lebenslang immer wieder der Schatten der göttlichen Andersheit in den Weg, gegen den er die ihm zugesprochene Sohnschaft und mit ihr das Wissen um seine Geborgenheit am Herzen des bedingungslos liebenden Vaters stets neu behaupten mußte. Nach der Darstellung der Evangelien geschieht das schon in der auf die Taufe folgenden Versuchungsszene, die ihn mit dem heimtückischen „Wenn du der Sohn Gottes bist“ (Lk 4,3.9) in seinem Sohnesbewußtsein zu erschüttern sucht und ihm als Kompensation für den Abfall sogar die Weltherrschaft von Satans Gnaden in Aussicht stellt. Es geschieht sodann, zumindest hintergründig, in der Stunde des Massenabfalls, die ihn nach der zweifellos zutreffenden Deutung Bubers in seinem Sendungs- und Selbstbewußtsein verunsichert. Es geschieht wiederum in den beiden Szenen, in denen er, konfrontiert mit seinem unabwendbaren Todesgeschick, von seiner „Erschütterung“ (Joh 12,27) und seiner „Trübsal bis zum Tode“ (Mk 14,34) spricht. Und es geschieht in äußerster Steigerung, wenn er in der Qual seines Sterbens die Not der Gottverlassenheit durchleidet. Und wenn der Johannesevangelist sodann in schroffem Gegensatz dazu in dem Todesschrei Jesu den Jubel dessen heraushört, der jetzt, auf dem Tiefpunkt der Passion, sein Lebenswerk vollendet sieht (Joh 19,30), hat das zweifellos auch den Sinn, daß er sich definitiv in der Liebe aufgenommen sieht, zu der er sich gegen alle Anfechtung lebenslang bekannt hat. Sterbend überwindet er voll- und endgültig den Gott der Angst und des Schreckens, weil er inmitten seiner Qualen die Bestätigung seiner Sohnschaft erfahren hatte, die er nun, im Durchbrechen aller Sprachgrenzen, mit seinem Todesschrei beantwortet: einem Schrei, der gleicherweise das Entsetzen über das ihm zugefügte Unrecht wie die Gewißheit bekundet, gerade jetzt, wo alles dagegen zu sprechen scheint, am Ziel aller Lebensmühe angelangt zu sein. Dennoch handelt es sich in alledem um das Paradigma einer „sanften“ Revolution. Auf die kürzeste Formel gebracht, bestand diese Revolution darin, daß Jesus den Schatten des Grauenhaften und Furchterregenden aus dem Gottesbild der Menschheit ersatzlos tilgte und dort, wo der fromme Sinn zwischen Furcht und Liebe schwankte, weil er sich einem gleicherweise ängstigenden und begeisternden Gott, dem Gott der mit dem Schrecken gepaarten Liebe, gegenübersah, das Antlitz des bedingungslos liebenden Vaters zum Vorschein brachte. „Sanft“ ist diese Revolution jedoch nicht schon wegen des von ihr ans Licht gehobenen Inhalts, sondern vor allem wegen des von Jesus eingesetzten Mittels: Den neuen Gott seiner Verkündigung erschloß Jesus nicht etwa durch eine Machttat, sondern durch das Wagnis, den unbegreiflichen und den Menschen mit seinen Gedanken himmelhoch überragenden Gott mit der kindlichen Zärtlichkeitsanrede „Abba – Vater“ anzurufen. Mit dieser Anrufung ließ er die Schattenzone der Gottesangst definitiv hinter sich; mit ihr durchbrach er die Schweigemauer der Unzugänglichkeit Gottes; mit ihr überbrückte er den Abgrund der Gottesferne. Doch das ist lediglich eine Umschreibung des von Pau345 R. Otto, Das Heilige, a.a.O., S. 54f.
119
Die Vertiefung
lus wiederholt geäußerten Gedankens, daß Jesus durch seine Heilstat den „Zugang zum Vater“ erschloß. Die Lebensleistung Jesu, die in dieser Ergründung des neuen Gottes der bedingungslosen Liebe gipfelt, liegt hier, wenn irgendwo, inmitten des Evangeliums und weist jedem anderen Motiv seinen Ort und Stellenwert zu. Alles andere will dann von dieser Mitte her begriffen und das Ganze auf diese Mitte hin gelesen werden. Diese Folgerung ist umso wichtiger, als im Evangelium sowohl mit Restbeständen der von Jesus überwundenen Gottesvorstellung als auch mit rückschlägigen Tendenzen zu rechnen ist, die Jesu Innovation im Sinn der überkommenen Religiosität zu egalisieren, wenn nicht sogar zu überlagern sucht. Missionsgeschichtlich hängt das damit zusammen, daß nach dem Bericht der Apostelgeschichte (Apg 6,7) „auch eine große Anzahl von Priestern“ zur Urgemeinde stieß und mit ihnen Vertreter einer Gruppe, die, wie an der Vorgeschichte des Apostels Paulus abzulesen ist, besonders stark durch eine auf Sündenbewußtsein und Sühnevorstellungen gegründete Religiosität geprägt und auf Grund ihrer überlegenen Schulung überdies in der Lage waren, ihre Anschauungen im neuen Feld zur Geltung zu bringen346. Ungleich gewichtiger ist jedoch der anthropologische Grund. Denn das zwiespältige, zwischen Faszination und Schrecken schwankende Gottesbild der Tradition entspricht – wie schon seine Verbreitung in sämtlichen Weltreligionen und die Tatsache, daß es sich bis in die Jungsteinzeit zurückverfolgen läßt, beweisen – weit mehr der menschlichen Verfassung als das Gottesbild der unausweichlichen Eindeutigkeit, zu welchem Jesus überredet. Mehr noch: In jenem gespaltenen Gottesbild sieht sich der Mensch in seinem eigenen Zwiespalt überdimensional gespiegelt, sofern nicht sogar das Umgekehrte anzunehmen ist, nämlich daß dieses Bild als Projektion der zwiespältigen Selbsterfahrung des Menschen zu gelten hat. Die Anwendung drängt sich geradezu auf. Von den vielfältigen Motiven des Evangeliums eignet jenen die höchste Priorität, die nach Inhalt und Tendenz dem neuen Gott der bedingungslosen Liebe entsprechen, während den an das traditionelle Gottesbild erinnernden Motiven allenfalls nachgeordnete Bedeutung zukommt. Da sie aber als Inhalte der Heiligen Schrift nicht einfach beiseite geschoben werden können, wird es darum zu tun sein, sie im Sinn des Zentrums neu zu interpretieren. Auch die Beispiele liegen nahezu auf der Hand. Nahe dem Zentrum stehen, wie kaum noch betont zu werden braucht, das Gottesreich und die als dessen zeitgschichtlicher Vorgriff verstandene Kirche, die Gotteskindschaft und alle Formen ihrer mystischen und ethischen Verwirklichung, die Mysterien des Glaubens, die Wege der Hoffnung und die Taten der Liebe. Deutlich distanziert ist demgegenüber der ganze Komplex der religiös motivierten Drohungen und Strafsanktionen, wie Gericht, Verdammnis und Hölle, aber auch die vielfältigen Formen einer zum Selbstzweck erhobenen Askese und einer restriktiven Ethik. In diesem Zusammenhang wird man sich nochmals daran erinnern müssen, daß das Christentum von seiner Mitte her, entgegen seiner historisch gewachsenen Einschätzung, keine asketische und nomothetische, sondern eine therapeutische und mystische Religion ist. Bei der sachgerechten Interpretation des Evangeliums wird es deshalb darum gehen, die gegensinnigen Überlagerungen von den aus der Zentralbotschaft hergeleiteten Daten abzuheben und diese mit aller Kraft zur Geltung zu bringen. Dabei kommt im Einzelfall wohl auch der entgegengesetzte Weg in Betracht, wie ihn Kierkegaard und Sartre einschlugen: 346 Dazu: E. Biser, Habt ihr das alles verstanden?, in: ders., Die Entdeckung des Christentums, a.a.O., S. 76 – 91, S. 78f.
120
6. Die Umsetzung
jener, wenn er seine Leser als „Symparanekromenoi“, als „Mitverstorbene“, anredet; dieser, wenn er die Hölle, extrem aktualisierend, mit den „anderen“ gleichsetzt: „L’enfer, c’est les autres“347. Sofern sich in alledem eine elementare „Hierarchie der Wahrheiten“ abzeichnet, darf daraus auf einen genealogischen Zusammenhang geschlossen werden. Dann haben diese Wahrheiten als Folgen der zentralen Lebensleistung Jesu zu gelten, die in ihnen ihre lehrhafte und lebenspraktische Darstellung erlangte. Das aber führt nun definitiv zu der bereits angeschnittenen, aber nur fragmentarisch beantworteten Frage nach der Umsetzung, und damit zu der Frage, wie aus Jesu Entdeckung des neuen Gottes die Schwerpunkte seiner Verkündigung hervorgingen und wie sich aus dieser die christliche Lehre entwickelte.
6. Die Umsetzung An die Beantwortung der Fragen führen zwei weitere Fragen heran: Wie wurde aus dem Entdecker das Medium? Und wie wirkte sich dieses auf die Gestalt seiner Verkündigung aus? Auf die erste Frage ließe sich schwerlich eine einleuchtende Antwort finden, wenn sie nicht vom Evangelium selbst, und hier im weisheitlichen Jubelruf Jesu gegeben würde, der in der Aussage gipfelt: Alles ist mir von meinem Vater übergeben, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will (Mt 11,27)348. Jesu Ringen um den neuen Gott war, einschließlich seines Kampfes gegen die Schatten der göttlichen Andersheit, letztlich ein Geschenk, durch das sich Gott ihm wie keinem anderen Offenbarungsträger übereignete. Es war, bildlich ausgedrückt, der Spiegel, in dem sich Gott wiedererkannte, die Schale, in die er seine Lebens- und Seinsfülle ergoß. So wird Jesus zum lebendigen „Ort“, an dem sich Gott in dieser ihm vielfach entfremdeten Welt wiederfindet, zur „Hand“, durch die er seine Nähe fühlen läßt, und zum „Mund“, durch den er sich, mitten im Gewirr der zu ihm rufenden und ihn bestreitenden Stimmen, verlautbart. Wenn das einsichtig werden soll, müssen allerdings christomathische Gedanken wiederbelebt werden, wie sie im Gefolge des späten Fichte von Schleiermacher und im Anschluß an Troeltsch von Wilhelm Herrmann entwickelt wurden. Dessen weit unterschätzte Bedeutung besteht darin, daß er, zumindest mittelbar, deutlich machte, daß die von Kant und dem frühen Fichte in seinem „Versuch einer Kritik aller Offenbarung“ – von 1792 – erhobenen Einwände gegen die Idee eines offenbarenden Geschichtshandelns Gottes als Folgen eines überzogenen, gegenüber den eigenen Voraussetzungen abgeblen347 J.-P. Sartre, Geschlossene Gesellschaft. Stück in einem Akt (Huis clos, 1944), in: ders., Gesammelte Werke in Einzelausgaben, aus dem Franz. übs. v. T. König, Bd. 3: Theaterstücke, Reinbek 1988, S. 59; S. Kierkegaard, Der Unglücklichste. Eine begeisterte Ansprache an die Symparanekromenoi, in: ders., Entweder – Oder (1885), aus d. Dän. übs. v. E. Hirsch, 1. Teil, Düsseldorf 1956, S. 231 – 245. 348 Dazu: L. Schenke, Die Urgemeinde, a.a.O., S. 153f.
121
Die Vertiefung
deten Vernunftbegriffs zu gelten haben349, während der Mensch bei offener Selbsterkenntnis begreift, daß er gerade nicht der sich autonom Setzende und Entwerfende, sondern der aus vorgängiger „Abhängigkeit” zu sich selbst Kommende ist. Schon das Selbstsein läßt sich nur als Bruch der „personbildenden göttlichen Einwirkung auf die menschliche Natur“350 begreifen. Erst recht gilt das von dem mit dem Dasein Jesu gegebenen „ursprünglichen“ Eindruck, der der „Zeugung eines neuen persönlichen Lebens“ gleichkommt351, die von ihm ausgeht und – mit Schleiermacher gesprochen – „als eine Fortsetzung jener personbildenden“ Einwirkung zu begreifen ist. Das steigert Herrmann zu dem Gedanken des „bezwingenden“ und „überwältigenden“ Eingreifens Jesu in das Leben des Glaubenden, das sich ihm daraus erklärt, daß Jesus in seiner Person die rettende „Heilstatsache“ und als solche der lebendige „Grund unseres Glaubens“ ist, der den auf uns einwirkenden Gott manifestiert352. Hier steht jedoch bei Herrmann, wie Ingo Broer bemerkt, das Motiv des Heilshandelns Gottes durch Jesus so sehr im Vordergrund, daß die Rückfrage nach Gottes Handeln an und in Jesus völlig entfällt. Jesus ist in dieser Sicht völlig auf Gott hin transparent, Mittler, der den Glaubenden in eine unmittelbare Gottesbeziehung versetzt353. Das aber kann, auf die Ausgangsposition zurückbezogen, nur bedeuten, daß Jesus ganz von Gottes Gegenwart erfüllt, ganz vom Gottesgeist durchströmt, ganz Gefäß und Medium des sich in ihm mitteilenden Gottes ist, anders ausgedrückt: daß ihm, wie es sein weisheitliches Selbstzeugnis bestätigt, alles von seinem Vater „übergeben“ ist. Worin bestand dann aber die Umsetzung oder, genauer gefragt, womit begann sie? Um im Bild des Mediums zu bleiben: Die Umsetzung begann mit der Ausblendung der bedrohlichen Schattenseite des Gottesgeheimnisses! Das aber zeigt Jesus, gegensinnig zu der Perspektive Herrmanns, in einer lebensgeschichtlichen Interaktion mit Gott, die sich von der kreativen Auslegung seines Geheimnisses mehr und mehr zu dessen leidender Ergründung fortentwickelt. Doch in dem Augenblick, in welchem die zunächst zurückgedämmten Schatten definitiv über ihm zusammenzuschlagen drohen, bricht er sich mit einem Todesschrei endgültig zu dem Gott Bahn, den er in seiner Selbstzuwendung als den Gott der bedingungslosen und nie widerrufenen Liebe entdeckt. Den entscheidenden Wendepunkt erreicht die Umsetzung aber fraglos in der Auferstehung Jesu. Das zeigt sich schon daran, daß der Auferstandene den Zeugen seines gottgeschenkten Lebens in hieratischer Hoheit entgegentritt: distanziert selbst dort, wo er – wie in der Begegnung mit Magdalena – zu trösten scheint (Joh 20,15ff) und – wie in der Thomasszene – zur Berührung seiner Wundmale auffordert (Joh 20,27), bis auf das nachgetragene Gespräch mit Petrus (Joh 21,15ff) ohne jeden Rückbezug auf seine Lebens- und Leidensgeschichte, ganz Bild und Gestalt geworden, da sich seine Reden durchweg als nachösterliche Bildungen erweisen. Hier baut sich in der neueren Diskus349 Dazu: W. Herrmann, Warum bedarf unser Glaube geschichtlicher Tatsachen? (2/1891), in: ders., Schriften zur Grundlegung der Theologie, Teil I, hrsg. v. P. Fischer-Appelt, München 1966, S. 81 – 103, S. 90 – 93. 350 F. Schleiermacher, Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt, 2. Bd., 3., unveränd. Ausg., Berlin 1836, § 100.2, S. 95 – 98, S. 97. 351 W. Herrmann, Der geschichtliche Christus, der Grund unseres Glaubens (1892), in: ders., Schriften zur Grundlegung der Theologie, Teil I, a.a.O., S. 149 – 185, S. 183. 352 A.a.O., S. 160ff; S. 173f; S. 183f. 353 A.a.O., S. 169 – 174; S. 184; ferner: ders., Der Glaube an Gott und die Wissenschaft unserer Zeit (1905), in: ders., Schriften zur Grundlegung der Theologie, Teil I, a.a.O., S. 242 – 263, S. 262f.
122
6. Die Umsetzung
sion freilich ein Einwand auf, der, sofern er nicht ausgeräumt werden könnte, den Fortgang der Argumentation blockieren würde. Gegen die von der Mehrheit der Theologen, mit Vögtle und Kessler an ihrer Spitze, verfolgte Tendenz, die Auferstehung Jesu zum prägenden Schlüsselereignis der Glaubensgeschichte zu erheben, machten Broer und vor ihm schon Verweyen geltend, daß dadurch der „Ostergraben“ über Gebühr „verschärft“ und die Kontinuität zwischen der Lebens- und Wirkungsgeschichte Jesu gefährdet würde354. Zu weit würden dadurch die „Schüler erster Hand“, als welche Kierkegaard die Augenzeugen des Heilsgeschehens bezeichnete, von den auf ihr Wort hin Glaubenden, den „Schülern zweiter Hand“, distanziert355. Wenn erst die Auferstehung den Heilsmittleranspruch Jesu legitimiere, verliere nicht nur seine Reich-Gottes-Verkündigung und sein Ruf in die Nachfolge ihr glaubensbegründendes Gewicht; vielmehr werde dann ein zweites, in der Auferstehung Jesu bestehendes Heilshandeln Gottes erforderlich, das zu einer unerträglichen Verdoppelung des Offenbarungsgeschehens führe. Verweyen spitzt seine Argumentation schließlich in die ironische Frage zu, ob der Glaube eines Jüngers, der selbst, wie ein dem vatikanischen Geheimarchiv unterstelltes Konstrukt will, unter dem Eindruck des Kreuzestodes Jesu für ihn in den Tod gegangen sei, am Ende gar als „theologisch verdächtig“ angesehen werden müsse. Diese Frage ist vom Evangelium eindeutig in und mit der Person des die Hinrichtung Jesu überwachenden Hauptmanns beantwortet, der unter dem Eindruck des Todesschreis, mit welchem der Gekreuzigte stirbt, in das Bekenntnis ausbricht: „Wahrhaftig, dieser Mann war Gottes Sohn!“ (Mk 15,39), und damit, wie gegen alle abschwächenden Deutungen zu sagen ist, das Bekenntnis der jungen Kirche artikuliert. Nur hätte er so niemals sprechen können, wenn er den Todesschrei nicht als worthafte Antizipation der Auferstehung (Hebr 5,7) vernommen hätte. Und damit fällt, auch wenn das zunächst nicht einsichtig ist, der Blick auf den, der zum Schaden der ganzen Diskussion übergangen oder doch in seiner Bedeutung herabgestuft wurde, obwohl nur er über seine Ostererfahrung Auskunft gibt: auf Paulus, auf den gerade auch auf die heutige Glaubenserwartung eingehenden und auf die von ihr gestellten Fragen antwortenden Osterzeugen356. Der Todesschrei des Gekreuzigten verwandelte sich in Paulus – und damit rechtfertigt sich der Übergang zu ihm – zum „Wort“ der göttlichen Selbstmitteilung, das ihm in seiner Damaskusstunde ins Herz gesprochen wurde. Damit gewann er, wie Christian Dietzfelbinger nachwies357, den Ausgangs- und Angelpunkt seiner gesamten Theologie, gegenüber dem nach 2Kor 5,16 alles Vorwissen, aber auch alles, was ihm durch die Gemeinden in Damaskus und Antiochia zufloß, verblaßte. Für ihn beginnt das Christsein, paradigmatisch für die gesamte Christenheit, mit der Auferstehung Jesu. Es hieße, sich gegen sein ganzes Selbstverständnis auflehnen, wenn man ihn deshalb zum „Schüler 354 Dazu: H. Verweyen, Die Ostererscheinungen Jesu in fundamentaltheologischer Sicht, in: Zeitschrift für katholische Theologie 103 (1981), S. 426 – 445; ferner: ders., Gottes letztes Wort. Grundriß der Fundamentaltheologie, Düsseldorf 1991, S. 441 – 452; I. Broer, Der Glaube an die Auferstehung Jesu und das geschichtliche Verständnis des Glaubens in der Neuzeit, in: H. Verweyen (Hg.), Osterglaube ohne Auferstehung? Diskussion mit Gerd Lüdemann, Freiburg i. Br. u. a. 1995, S. 47 – 64. 355 Dazu: H. Verweyen, Christologische Brennpunkte, 2., erw. Aufl., Essen 1985, S. 42ff; S. 109. 356 E. Biser, Der unbekannte Paulus, a.a.O., S. 44f. 357 Dazu: C. Dietzfelbinger, Die Berufung des Paulus als Ursprung seiner Theologie, NeukirchenVluyn 1985, bes. S. 90 – 137.
123
Die Vertiefung
zweiter Hand“ herabstufen wollte. Denn er ordnet sich denen völlig ranggleich zu, die schon vor ihm Apostel waren. Was er von diesen und deren Gemeinden an Kenntnissen gewinnt, hat für ihn den Charakter einer Rekonstruktion. Und das gilt, wie er wenigstens indirekt zu verstehen gibt, auch von allem, was die Evangelien über das geschichtliche „Vorleben“ Jesu mitteilen. Das aber heißt, daß der „Ostergraben“ keineswegs ungebührlich „verschärft“ wurde, weil er gar nicht tief genug angesetzt werden kann358. Insofern behält Herrmann durchaus recht, wenn er vom Handeln Gottes an Jesus auf das zurückblendet, was dieser auf abschließende und unüberbietbare Weise im Ereignis seiner Auferstehung wurde: zu Mund und Bild und in beiden zum Medium der Selbstmitteilung Gottes. Damit ist die Auferstehung definitiv als der entscheidende Wendepunkt im Umsetzungsprozeß erwiesen. Was damit begann, daß sich Jesus in den ihm wie keinem anderen zugewandten Gott hineinlebte, daß er sich aber auch zu dem sich immer tiefer verschattenden Gott durchkämpfte und die Position der Liebe gegen alle Anwandlungen der Andersheit behauptete, erfuhr seine Krönung im Ereignis seiner Auferstehung. Doch diese Krönung kam einem fundamentalen Paradigmenwechsel gleich. Er folgte der von Herrmann gewiesenen Richtung und gewann konkrete Gestalt in einem vor allem von Vögtle durchdachten Theorem. Danach verwandelte sich unter dem Impuls des Ostergeschehens – wie schon hervorgehoben – der verkündigende Jesus in den verkündigten Christus, der zum Glauben führende Jesus in den geglaubten Christus und der lehrende Jesus in den Inbegriff der christlichen Lehre. Es entsprach der angedeuteten Grenzsituation des Apostels Paulus, daß dieser am entschiedensten auf den beschriebenen Umschwung reagierte, sofern er ihn nicht sogar als erster auf den Begriff brachte. Auf geradezu programmatische Weise geschieht das zu Beginn seiner Korrespondenz mit der Gemeinde von Korinth, der er sich als kompromißloser Vertreter der Kreuzesbotschaft präsentiert. Zwar sei das Kreuz den Juden ein Skandal, den Heiden eine Torheit, den Glaubenden jedoch „Gottes Kraft und Gottes Weisheit“ (1Kor 1,23f). Im Grunde wiederholt Paulus damit nur sein Bekenntnis zur Auferstehung des Gekreuzigten, jedoch unter dem ideellen Aspekt, der sich ihm durch die alttestamentliche Weisheitsspekulation nahelegte359. Doch zusammen mit der Weisheit drängen sich ihm drei weitere substantivische Synonyme auf, die er jetzt auf Jesus überträgt, um nicht zu sagen, auf die er Jesus festlegt: Er ist für uns von Gott zur Weisheit geworden, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung (1Kor 1,30). Damit nimmt er auf folgenreiche Weise vorweg, was der johanneische Jesus für sich beansprucht, wenn er sich als das Licht der Welt (Joh 9,3;12,46) und als den Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6) bezeichnet. Die Folgen zeigen sich schon im Briefwerk der Paulus-Schule, die Jesus „unseren Frieden“ (Eph 2,14) und „die Hoffnung auf die Herrlichkeit“ (Kol 1,27) nennt. Damit waren Eckdaten angegeben, innerhalb derer die Gestalt Jesu zunehmend abstrakte Züge annahm, so daß er, selbst auf die Gefahr hin, den „Tod durch tausend Modifikationen“ zu erleiden, substantivisch ausgesagt werden konnte. Das aber war gleichbedeutend mit der Feststellung, daß er, mit der Formel des Hebräerbriefs gesprochen, vom „Wegbereiter“ zum „Vollender“ des Glaubens (Hebr 12,2), also 358 Dazu: E. Biser, Einweisung ins Christentum, a.a.O., S. 52 – 56. 359 Dazu: G. Theißen, Psychologische Aspekte paulinischer Theologie, Göttingen 1983, S. 342.
124
7. Die Inversion
von dessen Initiator zu dessen Herrn und Gegenstand, geworden war. Darauf bezog sich sodann die dogmatische Explikation des christologischen Mysteriums mit der Folge, daß sich dieses schließlich in eine systematisch ausgearbeitete Lehre verwandelte. Sie war das Werk der nacharbeitenden theologischen Reflexion, die ihre Legitimität letztlich der Tatsache verdankte, daß der Umsetzung jener reflektierende Transformationsprozeß zugrundelag, durch den Jesus sein Sohnesbewußtsein in das Gefäß des Reich-Gottes-Gedankens goß, auch wenn es sich dabei um eine Reflexion eigener Ordnung handelte. Zwar war in dieser lehrhaften Umsetzung ein für Predigt, Unterweisung und Lebensorientierung unerläßliches Instrument gewonnen, doch fehlte der Lehrgestalt der personale Impuls, der die von Paulus eingesetzten Begriffe noch fühlbar durchdrang. Insofern war mit der lehrhaften Ausgestaltung eine Wegscheide erreicht, die mit der elementaren Dialektik des Christentums zu tun hat. Denn auf der einen Seite bedarf es der Verfestigung zur Lehre, weil Verkündigung, argumentative Darstellung und Wegweisung nur in dieser Form möglich sind. Auf der anderen Seite drohen dadurch die Gefahr der Erstarrung und damit der Tod der Dynamik, mit der Jesus seine Botschaft in die Welt gerufen und Paulus sie in seinem Briefwerk fortgeschrieben hatte. So verschärft sich die Dialektik zur Aporie, die bei noch so großer Anstrengung theologischer oder pastoraler Art keine menschliche Initiative aufkommen läßt, so daß deren Überwindung zuletzt nur von einem Impuls aus der Mitte des Glaubens, also vom Geglaubten selbst, erwartet werden kann. Doch kann man einen derartigen Anstoß überhaupt in Erwägung ziehen? Handelt es sich bei der Entwicklung von der Botschaft zur Lehre nicht um einen irreversiblen Prozeß, auf den neben dem inneren Entwicklungsgesetz auch die Inkulturation des Christentums, vor allem im abendländischen Denkraum, hinarbeitete?
7. Die Inversion Die Lösung ergibt sich aus einem genaueren Blick auf den Ursprung. Denn dieser bietet bei aufmerksamem Zusehen ein komplexeres Bild, als daß nur von einer Fortentwicklung der Botschaft zur Lehre gesprochen werden könnte. Mit einer dazu gegensinnigen Tendenz ist umso mehr zu rechnen, als die Gefahr der Erstarrung, vor allem infolge der Überlagerung durch ein neu aufkommendes Gesetzesdenken, schon in urchristlicher Zeit empfunden wurde. Exponent dieser für ihn deprimierenden Erfahrung ist Paulus, der darauf umso sensibler reagieren mußte, als er die Freiheitsgestalt des Christentums mit größter Entschiedenheit herausgestellt und den Schlüsselbegriff der Jesusbotschaft durch „Freiheit“ ersetzt hatte. Dem gilt sein Kampf um die galatischen Gemeinden, die er einem Netz von lähmenden Vorschriften verfallen sieht, darin besteht sein Konflikt mit Petrus, dem er allzu große Nachgiebigkeit gegenüber den Gegnern der Gewissensfreiheit vorwirft, das ist das Grundanliegen seines gesamten Lebenswerks. Woher dieser leidenschaftliche Einsatz für die Sache der Freiheit, die ihm den Haß der Gesetzesfanatiker und letztlich den Tod einträgt? Die Antwort des Apostels klingt paradox: Er kämpfte, weil er kämpfen mußte, weil er sich dazu gedrängt und genötigt wußte, gedrängt von der Liebe (2Kor 5,14), die für ihn der befreienden Zuwendung Jesu entstammt, und genötigt durch den auf ihm lastenden „Zwang“ (1Kor 9,16), das Evangelium zu verkündigen. Wenn man sich daran erinnert, daß Paulus nichts zu sagen wagt, was nicht von Christus in ihm bewirkt wird (Röm 15,18), wird hier im Kern seiner Motivation das Gegenmotiv zu seinem ungeheuren Leistungs125
Die Vertiefung
willen deutlich. Was ihn bewegt, ist somit nur vordergründig seine Willensenergie, letztlich dagegen der ihm zum Identitätsgrund gewordene Christus. Das verweist zurück auf sein Damaskuserlebnis, in dem ihm der Gottessohn ins Herz gesprochen und im höchsten Sinn des Wortes „mitgeteilt“ worden war, so daß ihm das Leben nur in dem Wunsch besteht, den immer vollständiger zu begreifen, von dem er in jener Gnadenstunde ergriffen wurde (Phil 3,12). Das aber heißt, daß die von ihm vollzogene Festlegung Jesu auf die Begriffe Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung von Anfang an von jener „drängenden“ Gegenbewegung unterfangen war, die ihn sein Denken als ein vorgängiges Erkanntsein (1Kor 13,12; Gal 4,9) und sein Handeln als Ausfluß der in ihm wohnenden Kraft Christi (2Kor 12,9; Phil 4,13) begreifen läßt. Davon rührt es letztlich her, daß seine Festlegungen immer schon von Impulsen überholt sind, die seiner Theologie – im Unterschied zu jeder späteren – das dynamische, nie eindeutig zu verrechnende Gepräge verleihen. Deshalb schlägt gerade in Zeiten der Systematisierung und der doktrinalen Festlegungen seine Stunde, denn wie kein anderer erweist er sich dann als das leibhaftige Prinzip des Aufbruchs in der Dynamik. Da die Fixierungstendenzen mit dem zunehmenden Abstand vom Ursprung wuchsen, verwundert es nicht, daß auch Symptome der Gegenbewegung dazu in den neutestamentlichen Spätschriften hervortreten. So redet der Hebräerbrief von einem neuerlichen Zuspruch des Geistes, den er mit der wiederholten Mahnung unterstreicht: „Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht“ (Hebr 3,7.15). Und an dieser – von Hamann aufgenommenen – Stelle „hört“ er das Blut Jesu lauter reden als das Blut des erschlagenen Abel (Hebr 12,24). Das signifikanteste Dokument dieser „Gegensteuerung“ ist jedoch zweifellos der im Zusammenhang mit den alternativen Lesarten angesprochene Eingang des Ersten Johannesbriefs, der sich schon dadurch vom Kontext – nicht nur des Briefs, sondern aller neutestamentlichen Schriften – abhebt, daß sich in ihm ein Kollektiv zu Wort meldet. Dies ist womöglich die Stimme des sich als Kollektiv verstehenden Glaubensubjekts, das die Aussagen des Briefs mit der Versicherung unterbaut: Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und mit unseren Hände betastet haben, das Wort des Lebens, das […] verkünden wir euch (1Joh 1,1ff)360. Die bisherigen Erklärungsversuche, die in dem Wort, wie seine traditionelle Auslegung will, die Stimme der Auferstehungszeugen vernehmen möchten, oder aber in ihm – mit der Schnackenburg-Schule – eine Anspielung auf die Inkarnation vermuten, scheitern entweder schon an der zeitlichen Distanz oder an der genaueren Überprüfung des Wortlauts, der keinerlei Hinweis auf die Faktizität der Menschwerdung Christi erkennen läßt. Indessen sind die beiden Deutungen dazu angetan, das Dilemma kenntlich zu machen, in das die Stelle vermutlich eingreift. Denn schon in neutestamentlicher Zeit kündigt sich der große Paradigmenwechsel an, der nach mehreren Anzeichen gerade heute im Begriff steht, zurückgenommen zu werden: die Ablösung des Kreuzes- und Auferstehungsmodells durch das Inkarnationsparadigma, das sich im Gegenzug zur paulinischen Kreuzespredigt durchzusetzen begann und bis zu den theologischen Entwürfen Rahners und Balthasars herrschend blieb. Das Eingangswort des Briefs plädiert jedoch weder für das eine noch für das andere Paradigma, sondern für eine sie übergreifende Alternative, die einer von ihm aufs deut360 Dazu: H.-J. Klauck, Der erste Johannesbrief, a.a.O., S. 53 – 78.
126
7. Die Inversion
lichste bezeugten Erfahrung entstammt. Sie konnte vermutlich nur durch eine gebündelte Sensibilität gewonnen und nur im Chor von mehreren zur Sprache gebracht werden, denn sie durchbrach das Konzept, zu dem sich der Glaube der Urgemeinde auskristallisiert hatte und dem der hierarchische Aufbau der jungen Kirche entsprach. Wenn man sich die Beruhigung vergegenwärtigt, die von diesem Stillstand der – mit Vögtle gesprochen – „Dynamik des Anfangs“ ausging, konnte nur eine kleine Avantgarde den Mut zu neuerlichem Aufbruch aufbringen. Doch war es, wie sie mit Nachdruck betonte, nicht ihr Progressismus, der sie dazu bewog, sondern ein Impuls, der vom Glaubensinhalt selber ausging. Von sich selbst aus sprengte Jesus die vergegenständlichenden Gefäße, in die er gefaßt worden war, so daß er auf neue Weise hörbar, schaubar und fühlbar wurde. Nicht mehr wie in der Stunde der Initiation, als die Hörer Jesu über seine mit Vollmacht vorgetragene Botschaft staunten, auch nicht mehr so, wie Jesus selbst die Wahrheit dieser Botschaft in seinen Machttaten aufleuchten ließ, und noch weniger so, wie er die Kranken seine heilende Hand fühlen ließ. Nein, die Stimme, die die Sprecher des Eingangswortes vernahmen, kam nicht mehr von außen, sondern von innen. Was sie erblickten, sahen sie nicht mit ihren leiblichen Augen, sondern mit den Augen des Herzens, von denen der Epheserbrief (Eph 1,18) sprach. Und ihr Ergreifen gilt nicht dem des von der Retterhand ergriffenen Petrus, sondern dem des Paulus, dessen Lebenswunsch darin besteht, den immer vollständiger zu begreifen, von dem er sich in seinem Damaskuserlebnis ergriffen wußte. Auf die Frage, wie es zu dieser neuen Wahrnehmung kam, hätten sie vermutlich nur mit Kierkegaard antworten können: weil Jesus im Unterschied zu allen anderen seine Wirkungen als Person überragt – vermutlich mit dem verdeutlichenden Zusatz, daß Jesus sie mit seinem Fortleben auch „überlebt“, und dies in dem Sinn, daß er sie immer wieder mit seiner lebendigen Anwesenheit erfüllte und über das, was sie jeweils geworden waren, hinauswachsen ließ. In diese Richtung war die Forschung längst schon von Beda Venerabilis gewiesen worden, als er das „Betasten“ auf die „Fühlung“ des an der Brust Jesu ruhenden Lieblingsjüngers bezog. Damit spielte er auf die Darstellung der „Johannesminne“ an, die sich erstmals als Illustration zu einem Gebet Anselms von Canterbury findet und sich auf den wie schlafend an der Brust Jesu ruhenden Lieblingsjünger bezieht361. Er hört, traumversunken, mit dem inneren Ohr, er sieht mit den Augen des Herzens und er fühlt, daß er gehalten und umgriffen ist. Das ist exakt die Position, aus der heraus auch das Kollektiv des johanneischen Briefs hört, sieht und fühlt. Was es bezeugt, ist die dreifach gefächerte Wahrnehmung der mystischen Initiative, die der Verkündigte ergreift, um den Glauben aus seiner lehrhaften Gestalt wieder auf seine dialogische Ur- und Ursprungsform zurückzuführen. So gesehen ist die Geschichte des Christentums nicht nur durch Initiativen und Rückschläge, sondern nicht weniger auch durch spirituelle Aufbrüche, nicht selten in Zusammenhang mit schweren Krisen, bestimmt, die, in ihrer Konsequenz begriffen, den eigentlichen Lebensrhythmus der Glaubensgeschichte bestimmen. Sie bilden die „Wachstumsringe“ im Heranreifen der Glaubensgemeinschaft und die „Stationen“ in ihrer mystischen Biographie. Bevor diese in Betracht gezogen werden kann, stellt sich jedoch die Frage nach ihrer Aktualität. Gehören derartige Aufbrüche nicht längst der Vergangenheit an, so daß von ihnen allenfalls in nostalgischer Retrospektive gespro361 Dazu: O. Pächt, The Illustrations of St. Anselm’s Prayers and Meditations, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 19 (1956) 1/2, S. 68 – 83, S. 73; S. 77ff; ferner: H. Wentzel, Die Christus-Johannes-Gruppen des XIV. Jahrhunderts, Stuttgart 2/1960.
127
Die Vertiefung
chen werden kann? Und wenn es immer noch vergleichbare Impulse geben sollte: Ist das Gewicht der in langen Jahrhunderten gewachsenen Strukturen nicht derart übermächtig, daß sie unmöglich dagegen aufkommen? Das ist die Frage nach ihrem Gegenwartsbezug. Die verblüffende Antwort darauf lautet: Die Inversion in der durch den johanneischen Brief dokumentierten Zeit hätte überhaupt nicht wahrgenommen werden können, wenn die Gegenwart nicht die Sensibilität dafür geweckt hätte. Anstöße dazu sind freilich ganz unterschiedlicher Art. Sie reichen von dem von den lehramtlichen Ideologisierungs- und Disziplinierungstendenzen ausgehenden Leidensdruck bis hin zu Erfahrungen, die, wie man in Anlehnung an das bekannte Leitwort Guardinis formulieren könnte, auf ein Erwachen Jesu im Glaubensbewußtsein der Gegenwart schließen lassen. Kaum weniger spricht dafür aber auch die gewandelte Glaubenserwartung, die sich im großen Zusammenhang der glaubensgeschichtlichen Wende abzeichnet. Sie zielt vorrangig auf eine Botschaft des Trostes, der Ermutigung und Angstüberwindung, hintergründig aber auf das, was diese allererst ermöglicht: auf eine Neuinterpretation des Glaubens und seiner Mysterien362. Die überwältigende Zustimmung, die Drewermann mit seiner Erschließung des Evangeliums fand, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß er mit ihr an diese Erwartung rührte363. Erwartungen kommen aber nicht von ungefähr. Vielmehr reagieren sie jeweils auf etwas, das im Kommen ist. Wegweisender Ausdruck dessen ist das urchristliche „Maranatha“ (Apk 22,20)364, bei dessen Auslegung sich allerdings noch immer zwei gegensinnige Positionen gegenüberstehen: die mehrheitlich vertretene eschatologische, die in dem Ruf die Bitte um die Beschleunigung der Wiederkunft Christi vernimmt und den Gebrauch der Formel durch Paulus (1Kor 16,22) als christologische Steigerung dieses Sehnsuchtsrufs begreift365; und eine präsentische, die die Anrufung als ekstatische Bestätigung des inspirierenden Gekommenseins Jesu bei den zu seinem Andenken Versammelten auffaßt. Inzwischen schaltete sich Kessler mit einem Vermittlungsvorschlag ein, in dem er zu bedenken gab, daß das „Maranatha“ zwar die baldige Wiederkunft Jesu erflehe, jedoch „von dem schon gegenwärtig Erhöhten gehört“ und erhört sein wolle366. Wie die zwiespältige Rede von dem „gegenwärtig Erhöhten“ erkennen läßt, ist damit aber noch nicht alles gesagt. Denn das „Maranatha“ ruft zwar dessen endzeitliches Kommen hervor, es „antwortet“ jedoch auf die Erfahrung des aktuellen „Gekommenseins“, also auf Erfahrungen der konkreten, bewegenden, bestärkenden und inspirierenden Anwesenheit unter denen, die sich nach Mt 18,20 in Jesu Namen versammelten; es antwortet, anders ausgedrückt, auf die zum spirituellen Erlebnis gewordene Inversion. 362 Dazu: E. Biser, Die glaubensgeschichtliche Wende, a.a.O., S. 209 – 217: Die Theologie im Stadium der Selbstkorrektur. S. 254 – 266: Das Zentralereignis. 363 Dazu: E. Biser, Der inwendige Lehrer, a.a.O., S. 156. 364 Dazu: L. Schenke, Die Urgemeinde, a.a.O., S. 98f. 365 Dazu: F. Hahn, Christologische Hoheitstitel. Ihre Geschichte im frühen Christentum (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, Bd. 83), Göttingen 3/1966, S. 100 – 106. 366 Dazu: H. Kessler, Sucht den Lebenden nicht bei den Toten. Die Auferstehung Jesu Christi in biblischer, fundamentaltheologischer und systematischer Sicht, Neuausgabe Würzburg 1995, S. 113f.
128
7. Die Inversion
Es ist kein gutes Zeichen, daß das „Maranatha“ schon in der folgenden Generation auf den Lippen der Beter erstarrt und allenfalls in der herabgestimmten Tonart des „Kyrie eleison“ weiterlebte. Und es spricht auch nicht für einen lebendigen Glauben, wenn heute in der Diskussion um und mit Drewermann die Frage der Rechtgläubigkeit ausschließlich an den historischen Rückbezug gebunden und dabei übersehen wird, daß der Umstrittene seinen Kontrahenten immerhin die Einsicht voraus hat, daß sich der Glaube nicht so sehr auf das Gewesensein als vielmehr auf die aktuelle Präsenz des Geglaubten bezieht367. Doch gleichviel, ob dieses Verstummen bisher, aus welchen Gründen auch immer, verständlich war, so ist es dies seit der Wende von 1989 sicher nicht mehr. Denn damals schlug die glaubensgeschichtliche Inversion bis in den politischen Bereich durch und dies in Gestalt einer Revolution, die an Tiefgang selbst die Französische Revolution in den Schatten stellt und sich doch als ein Ereignis ohne Führer, ohne Strategie und zumal ohne Blutvergießen jeder Kausalerklärung entzieht, so daß sich der Betrachter entweder zum Kausalverzicht oder zur Annahme einer transzendenten, dem göttlichen Geschichtsgrund entstammenden vermittelten Initiative veranlaßt sieht. Im ersten Fall wird sich der Betrachter freilich von Bultmann darüber belehren lassen müssen, daß er damit – mit Reinhard Wittram gesprochen – das adäquate „Interesse an der Geschichte“ aufgibt368, da dieses Partizipation und Mitbetroffenheit voraussetzt. Denn mit der Geschichte verhalte es sich wie mit dem mikrophysikalischen Bereich, in dem die klassische Scheidung von res cogitans und res extensa hinfällig wird, weil der Beobachter mitkonstituierend in das „Objekt“ eingeht. Sie kennt nur Täter und Opfer, nicht aber den distanzierten und im angenommenen Fall schon auf ein verstehendes Nahverhältnis zu ihr verzichtenden Betrachter. Doch worin besteht der glaubensgeschichtliche Zusammenhang und was spricht für ihn? Daß die Weltgeschichte, ungeachtet ihrer Einbrüche und Exzesse, in einem synchronen Verhältnis zur Glaubensgeschichte steht, war eine Intuition Erich Przywaras, die von Gertrud von le Fort aufgenommen und in ihrem Gesamtwerk ausgearbeitet wurde369. Danach empfangen die einzelnen Epochen ihre innerste Sinnbestimmung aus je einem Stadium der Lebensgeschichte Jesu, so daß die einen im Zeichen der Menschwerdung, die anderen in dem der Passion und Auferstehung stehen, während wieder andere vom Vorgefühl der Parusie erschüttert sind. Die Dichterin läßt auch keinen Zweifel daran, welche Stunde es ihrer Überzeugung nach heute geschlagen hat. Es ist die Stunde der Todesangst in „Die Letzte am Schafott“ und die der Gottverlassenheit in „Die Abberufung der Jungfrau von Barby“, aber auch die der sich ankündigenden Auferstehung Jesu in „Die Tochter Farinatas“.
367 368 R. Wittram, Das Interesse an der Geschichte. Zwölf Vorlesungen über Fragen des zeitgenössischen Geschichtsverständnisses, Göttingen 3/1968; ferner: R. Bultmann, Jesus (1924), München u. a. 1964 (Lizenzausgabe), S. 7 – 15. 369 Dazu: E. Biser, Überredung zur Liebe. Die dichterische Daseinsdeutung Gertrud von le Forts, Regensburg 1980, S. 129 – 159.
129
Die Vertiefung
Wenn man ihr darin zu folgen bereit ist, läßt sich auch schon das Kriterium ausmachen, das für die religiöse Relevanz der Wende spricht, denn unter der Voraussetzung, daß es sich um ein auf göttliche Intervention zurückgehendes Ereignis handelte, wurde durch den freiheitlichen Aufbruch das wieder denkbar, was durch die Aufklärung „innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ für undenkbar erklärt und, nach seiner Verdrängung aus dem Sprachgebrauch, durch Novalis in seinen „Hymnen an die Nacht“ lediglich wieder sagbar gemacht worden war370. Umgekehrt bestätigt das neue Denkbarwerden gerade dieses Mysteriums, daß die Gegenwart, wie le Fort zu wissen glaubte, im Zeichen der sich ankündigenden und glaubensgeschichtlich neu ereignenden Auferstehung Jesu steht. Daß sie richtig votierte, machte das zentrale Ereignis der glaubensgeschichtlichen Entwicklung deutlich: die Neuentdeckung Jesu, die nicht genauer als mit der Rede von seinem Erwachen in Glauben und Unglauben der Gegenwart umschrieben werden kann – im Glauben, weil das Ereignis die Glaubenskräfte, auch jenseits der etablierten Kirchen, auf sich konzentrierte; und selbst im Unglauben, weil sich an dieser Neuentdekkung auch Atheisten wie Machoveč und Agnostiker wie Blumenberg beteiligten371. Vor diesem Hintergrund kann nun der Sinn der Inversion genauer bestimmt werden. Wenn die „doktrinale Umsetzung“ darin bestand, daß der Botschafter zur Botschaft, der „Wegbereiter“ des Glaubens zu dessen „Vollender“ und Gegenstand und der Lehrende zum Inbegriff der Lehre wurde, besteht der Zentralvorgang der Inversion darin, daß sich der Schrein der Vergegenständlichung öffnet, daß der zum Objekt des Glaubens Erhobene vom Podest seines – mit Guardini gesprochen – „Herrentums“ herabsteigt und der lehrhaft Ausgelegte und Umschriebene wiederum zu lehren beginnt. Dies jedoch, wie dem unverzüglich hinzuzufügen ist, nicht im Stil seiner historischen Lehrtätigkeit, auf die die Ohren- und Augenzeugen mit dem Ausruf reagierten: „Eine neue Lehre, und mit Vollmacht wird sie vorgetragen“ (Mk 1,27), sondern in der Innerlichkeitssprache des inwendigen Lehrers. Glaubhaft wird diese Bestimmung allerdings erst, wenn gezeigt werden kann, was sie bewirkt. Denn nur unter der Bedingung des Wirkungsnachweises wird einsichtig, daß die Inversion die drohende Erstarrung aufbricht und die „Dynamik des Anfangs“ zum gegenwärtigen Ereignis werden läßt. Doch was, so ist nun zu fragen, bewirkte sie in der Stunde des Anfangs und wie begegnete sie damals der drohenden Festlegung und Erstarrung, vor allem in der von Paulus gefürchteten und bekämpften Form? Die Antwort auf diese Frage geben in erster Linie die im Bereich des neutestamentlichen Charismatikertums entstandenen sekundären Herrenworte, die, soziologisch gesehen, den gewandelten Bedürfnissen der nachösterlichen Zeit entsprachen. Wenn dieser Gesichtspunkt, wie die Beschreibung der Gemeinde zu Beginn des ersten Korintherbriefs zeigt, dem neutestamentlichen Denken auch nicht fernliegt, sucht es den Grund doch nicht in der kreativen Bewältigung der entstandenen Situation, sondern in einer Selbstbekundung des den Seinen innewohnenden Herrn. In den von den Charismatikern geschaffenen Worten wurde der im „Maranatha“ als gegenwärtig Angerufene seinerseits beredt. Am klarsten bringt das ein Wort der „Oden Salomons“ zum Ausdruck: 370 Dazu: E. Biser, Abstieg und Auferstehung. Die geistige Welt in Novalis’ Hymnen an die Nacht, Heidelberg 1954, S. 57 – 79: Die Geschichte. 371 M. Machoveč, Jesus für Atheisten, Stuttgart 1972; H. Blumenberg, Matthäuspassion, Frankfurt a. M. 1988; ferner: E. Biser, Der Freund, a.a.O., S. 22 – 38: Die Neuentdeckung; ders., Überwindung der Glaubenskrise. Wege zur spirituellen Aneignung, München 1997, S. 37 – 42: Glaubenswende.
130
7. Die Inversion
Ich bin auferstanden, bin bei ihnen und rede durch ihren Mund372. Von der Absicht dieses Redens künden besonders eindringlich und eindrucksvoll die Sendschreiben der Apokalypse: das Schreiben an Ephesus mit dem Vorwurf, von der „ersten Liebe abgefallen“ zu sein und dem Aufruf, zu den „früheren Werken“ zurückzukehren (Apk 2,4f); das Schreiben an Sardes mit dem Weckruf: „Werde wach und stärke den Rest, der schon im Sterben liegt!“ (Apk 3,2); und sogar das Wort an die mit dem „Ausspeien“ bedrohte Gemeinde von Laodicea, das mit der unerwarteten Verheißung schließt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren und das Mahl mit ihm halten und er mit mir (Apk 3,20)373. Kaum weniger beredt sind aber auch die zwar „stilleren“ Worte der der gleichen Kategorie zuzuordnenden Abschiedsreden des Johannesevangeliums, die freilich mehr auf intensivere Aneignung des Heils als auf Wiederbelebung der „ersten Liebe“ drängen. Darauf zielt die Verheißung des Parakleten, der „in alle Wahrheit führt“ und „an alles erinnert“, was Jesus in seinem irdischen Wirken lehrte; darauf drängt insbesondere das Schlüsselwort, das dazu auffordert, den Standort des unwissenden Knechtes mit dem des mitwissenden Freundes zu vertauschen (Joh 15,15). Das aber zielt insgesamt auf die Sprengung der durch den Fixierungsprozeß entstandenen Konturen, besser gesagt, auf die Rückverwandlung der Lehre in den Dialog. Wenn dieser Prototyp der Inversion als maßgeblich für alle folgenden Vorgänge vergleichbarer Art angesehen werden kann, wird auch für die gegenwärtige Zeit Ähnliches gelten – „Ähnliches“, denn im Unterschied zum Prototyp kommt heute die politische Dimension mit ins Spiel. Und hier droht der geistige Aufbruch über der „Kostenrechnung“ nahezu in Vergessenheit zu geraten. Anstelle der gesunkenen Mauern erheben sich aus Enttäuschungs- und Frustrationserlebnissen gebildete neue, die den Blick für das gegen alle Prognosen und Erwartungen Gewährte verstellen. Wenn die Wende bei aller Würdigung der daran beteiligten Teilursachen letztlich nur religiös zu erklären ist und somit als die zeitgeschichtliche „Speerspitze“ der Glaubenswende zu gelten hat, wird der von ihr ausgehende Appell in erster Linie als Anstoß zur Beseitigung der neu entstandenen Mauern begriffen werden müssen. Das ist in erster Linie die Mauer der fatalen Sprachlosigkeit, der Philosophen und Literaten und leider auch Theologen angesichts des doch mit Händen zu greifenden Wunders verfielen; dann aber auch die Mauer, die sich, die Sprachlosigkeit bedingend, der Wahrnehmung der unermeßlichen Vergünstigungen entgegenstellte: des fast schon in Reichweite gelangten Weltfriedens und der im selben Atemzug zu nennenden ungeteilten Freiheit, zusammen mit der Chance der Wiedergeburt einer Menschlichkeit, die der aus den Polarisierungen des Ost-West-Konflikts entlassenen Welt erwuchs. Daß gerade diese Begriffe genannt werden mußten, ist nicht nur in ihrer bewußtseinsbildenden und deshalb die politische Umgangssprache beherrschenden Rolle begründet, sondern mehr noch darin, daß sie zu jenen höchsten Gütern zählen, die entweder allen 372 H. Grimme, Die Oden Salomos, a.a.O., S. 99; ferner: K. Berger u. C. Nord, Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, a.a.O., S. 970. 373 Dazu: A. Vögtle, Das Buch mit den sieben Siegeln. Die Offenbarung des Johannes in Auswahl gedeutet, Freiburg i. Br. u. a. 1981, S. 31 – 46.
131
Die Vertiefung
oder aber, im Fall ihrer partiellen Verweigerung, auch den scheinbar Begünstigten nur bedingt zugute kommen. Indessen war das Ereignis nicht nur von religiöser und kultureller, sondern auch von erkenntnistheoretischer Relevanz. Denn es markierte zwar nicht das von Guardini angekündigte „Ende der Neuzeit“, wohl aber die auch in geistiger Hinsicht tiefste Zäsur in ihrer bisherigen Geschichte. Stand diese bisher, wie Guardini in seiner Analyse deutlich machte, im Zeichen eines sich sowohl gegen jede Vorgegebenheit wie gegen die offenbarende Entgegenkunft Gottes autonom setzenden Denkens, so weckte die Wende definitiv den Sinn für die Vorgaben und Vorgegebenheiten des Daseins, denen zuvor schon die Vertreter des dialogischen Prinzips das Wort geredet hatten. Für die davon in vielfacher Hinsicht betroffene Kirche besagt das, daß sie sich als Hort und Hüterin der von der Wende zu neuer Geltung gebrachten Güter wiederentdecken muß als den Raum der von Jesus erwirkten und von Paulus mit dem Einsatz seiner ganzen Lebenskraft proklamierten Freiheit und damit zugleich als den Raum des Aufatmens, der Entlastung und der Allverbundenheit, als den Raum dann aber auch des getätigten und immerfort neu erkämpften Friedens und in alledem als den Raum der gelebten und lebendig praktizierten Menschlichkeit, der Solidarität und der Toleranz. Darauf wirkte die Inversion vor allem dadurch hin, daß sie den im Binnenraum der Kirche herrschenden Geist der Schwere wie nur je in einer von Jesus bewirkten Dämonenaustreibung vom Ansatz her überwindet, um stattdessen den Geist der ersten Stunde, den Paulus als den der Liebe, der Freude und des Friedens beschrieb (Gal 5,23), wieder aufleben zu lassen. Was das für den Begriff des Christentums bedeutet, sagt in programmatischer Eindringlichkeit das Herrenwort, mit dem Jesus in typischer Apophthegmensprache die Kritik der Pharisäer zurückweist: Sie kamen und fragten ihn: Warum fasten die Jünger des Johannes und warum fasten deine Jünger nicht? Jesus antwortete ihnen: Hochzeitsgäste können doch nicht fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist! (Mk 2,18f)374 Das ist die Stimme des Asketismus, der sich gegen die klare Intention Jesu alsbald auch in seiner eigenen Glaubensgemeinschaft durchsetzte und diesen „Sieg“ mit dem ergänzenden Zusatz verewigte: Es werden aber Tage kommen, da ihnen der Bräutigam entrissen wird; dann, an jenem Tag, werden auch sie fasten (Mk 2,20). Die Motivation ist denkbar prekär, denn sie beruft sich nicht auf den dafür einzig relevanten Willen Gottes, sondern auf die Abwesenheit des „Bräutigams“, also auf die Entrückung Jesu bis zu seiner Parusie, und sie deutet diesen „Wartestand“ insgeheim als eine Zeit neuer Gottesferne, die asketisches Verhalten begründet und fordert. Aus johanneischer Sicht ist das jedoch eine Fehlinterpretation, da das „Gehen“ Jesu die Bedingung für die Sendung des Geistes und seiner eigenen geistgewirkten Anwesenheit unter den Seinen ist. Wer diesem unbestreitbaren Tatbestand Rechnung zu tragen sucht, muß gegen das Gewicht einer annähernd zweitausendjährigen Tradition und gegen die Unsumme 374 Dazu: L. Schenke, Die Urgemeinde, a.a.O., S. 171f.
132
7. Die Inversion
von Leiden, die im Namen eines asketisch verstandenen Christentums gesucht, erduldet und zugefügt wurden, den unumgänglichen Schluß ziehen, daß das Christentum entgegen seiner herrschenden Einschätzung weder wie der Buddhismus als eine asketische noch wie der Islam als eine nomothetische, sondern von seinem Ursprung her als eine therapeutische, und, paulinisch gesehen, mystische Religion zu gelten hat. Denn unter den primordialen Selbstbezeichnungen Jesu ragt neben der Bezeichnung als „Bräutigam“ der mit ihm anbrechenden Heilszeit die zweite hervor, die der nicht minder programmatische Satz auf den Begriff bringt: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken (Mk 2,17), der keineswegs zwei Kategorien des „Heilens“ und des „Heilsbedürftigen“ unterscheidet, sondern alle zu „Kranken“ erklärt, nur mit dem Unterschied, daß die sich für „gesund“ Erachtenden ihren heils- und heilungsbedürftigen Zustand ignorieren. Nach allen Anzeichen zu schließen, wird sich an dieser Frage die Zukunft des Christentums, zumindest in dem von ihm entscheidend geprägten abendländischen Kulturraum, entscheiden. Denn inzwischen schmilzt die Anzahl derer, die sich, wie die Adressaten des Herrenwortes, über ihr Elend hinwegtäuschen und sich für „gesund“ halten, während Resignation und Lebensangst den weitaus meisten das Eingeständnis abpressen, daß sie „krank“ sind und des rettenden Therapeuten bedürfen. Eine vom Asketismus eingegebene und geprägte Botschaft ginge nicht nur an ihnen vorbei, sondern müßte sie auch in ihrer Glaubenserwartung verfehlen. Denn diese zielt auf eine Religion der „Heilung von Grund auf“, wie Kierkegaard seine „Einübung im Christentum“ ursprünglich betitelte, auf eine Religion der am existentiellen Zwiespalt des Menschen ansetzenden Versöhnung, des seinen Sinnschmerz lindernden Trostes, der seiner Schwäche aufhelfenden Ermutigung und der seiner Lebensangst begegnenden Angstüberwindung. Zu alledem muß das Christentum nicht erst stilisiert werden, weil es diese Qualitäten in seinem Grundbestand enthält und jederzeit aufs neue freizusetzen vermag. Wohl aber muß es in diesem Wesensbestand trotz aller Überlagerungen wiederentdeckt und neu zur Geltung gebracht werden. Schon die Einsicht in diese Notwendigkeit wäre nicht möglich, wenn nicht ein Impuls von seiten der Mitte her darauf drängen würde. Kein Zweifel: Die Zukunft des Christentums liegt in der Rückbesinnung und Rückführung auf seinen Ursprung. Nur darf das nicht in Form eines restaurativen oder gar nostalgischen Regresses geschehen, sondern in Form einer Vorwärtsstrategie, der schon Maximus Confessor mit der These Ausdruck verliehen hatte: Denn es durfte der Ursprung nicht so gesucht werden, als ob er im Rücken läge; vielmehr sollte er als das Ziel erkundet werden, das vorne liegt. So sollte der Mensch durch das Ende den verlassenen Ursprung kennenlernen, nachdem er das Ende nicht aus dem Ursprung zu erkennen vermochte375.
375 Maximus Confessor, Quaestiones ad Thalassium, q. LIX, in: ders., Quaestiones ad Thalassium II: Quaestiones LVI-LXV (CCSG 22), hrsg. v. C. Laga u. a., Turnhout u. a. 1990, S. 44 – 71, S. 62; ferner: E. Biser, Einweisung ins Christentum, a.a.O., S. 176 – 180: Fortschritt zum Ursprung.
133
Die Vertiefung
In der Hellsichtigkeit des nahen Todes, als ihm freilich nach eigenem Bekunden schon nicht mehr zu helfen war, hatte sich auch Heinrich von Kleist zu dieser Einsicht durchgerungen: Doch das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns; wir müssen die Reise um die Welt machen und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist376. Im Dialog mit den Weltreligionen, in dem das Christentum gleicherweise bestreitenden wie bestätigenden Zeitgeist und in dem sich in seiner Abgründigkeit erfahrenden Menschen macht das Christentum dieser Zeit die von Kleist geforderte „Reise um die Welt“. Und das gesuchte Paradies des Ursprungs beginnt sich in dem Maß zu öffnen, wie es diesen Dialog als Einübung in die Zwiesprache mit dem begreift, der den Schrein seiner Vergegenständlichung sprengt und vom Podest seines Herrentums herabsteigt, um durch die Stimme des inwendigen Lehrers erneut zu Wort zu kommen. Noch einmal: An der Aufnahme dieses Dialogs entscheidet sich die Zukunft des Christentums. Wenn er in Gang kommt, gehört ihm, entgegen allen Befürchtungen und pessimistischen Prognosen, die Zukunft.
376 Heinrich von Kleist, Über das Marionettentheater, in: ders., Sämtliche Werke und Briefe in vier Bänden, hrsg. v. I.-M. Barth u. a., Bd. 3: Erzählungen, Anekdoten, Gedichte, Schriften, Frankfurt a. M. 1990, S. 555 – 563, S. 559.
134
Fünftes Kapitel
Die Verzweigung 1. Die Innovation
D
ie Zukunft des Christentums, auf die hin sich die Gegenwart, gerade auch in ihrer Gestalt als Geistesgegenwart, ereignet, lebt von dessen Vergangenheit. Und die Inversion, die diese Zukunft eröffnet, hat das innovatorische Elementarereignis zur Voraussetzung, das dem Christenglauben Gestalt und Gepräge verlieh: die Auferstehung Jesu. Sie ist zugleich Kulminations- und Wendepunkt seiner Lebensgeschichte, das Ereignis der definitiven Bestätigung seiner Sendung und Verifikation seiner Botschaft, Übergang von seiner Historizität in sein geschichtliches Fortleben, von seiner Lebens- zu seiner Wirkungsgeschichte. Daran ändern die in jüngerer Zeit von ganz unterschiedlichen Seiten vorgetragenen Abschwächungsversuche, denen das „Paradigma vom ‚Ostergraben‘“ die Kontinuität zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens zu zerreißen scheint377, trotz der Vielfalt ihrer Einwände und Argumente nichts. Sie sind freilich dazu angetan, einen Perspektivenwechsel in der Auferstehungsdiskussion einzuleiten. Während bisher der Akzent fast ausschließlich auf der Frage lag, was die Auferstehung in dogmatischer, sozialer, also kirchenbildender, und spiritueller Hinsicht bewirkte, tritt jetzt die schon seit längerem von Anton Vögtle und Rudolf Pesch aufgeworfene Frage, wie es überhaupt zum Osterglauben kam378, definitiv in den Vordergrund. Sie wurde inzwischen von Peter Fiedler zur Frage nach den „vorösterlichen Vorgaben des Auferstehungsglaubens“ verschärft379. In der Tat: Wenn man die vor allem von Hansjürgen Verweyen gestellte Frage nach der Kontinuität zwischen dem „irdischen“ Jesus und dem erhöhten Christus380 nicht offen lassen und die damit heraufbeschworenen Gefahren nicht in Kauf nehmen will, muß die Auferstehung nicht nur wie bisher nach vorwärts, sondern auch nach rückwärts, also auf die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu hin, gedeutet werden. Dann bietet sich, wie auch von der Forschung zunehmend gesehen wird, als erstes Motiv die Basileia-Botschaft Jesu an, die durch sein Kreuz radikal widerlegt und als Fehlschlag erwiesen zu sein schien381. Dem aber widerspricht aufs nachdrücklichste das im Bewußtsein des nahen Todes gesprochene Verheißungswort: 377 Dazu: H. Verweyen, Gottes letztes Wort, a.a.O., S. 446f. 378 Dazu: A. Vögtle u. R. Pesch, Wie kam es zum Osterglauben?, Düsseldorf 1975. 379 Dazu: P. Fiedler, Vorösterliche Vorgaben für den Osterglauben, in: I. Broer u. a. (Hgg.), „Der Herr ist wahrhaft auferstanden“ (Lk 24,34). Biblische und systematische Beiträge zur Entstehung des Osterglaubens, Stuttgart 1988, S. 9 – 28. 380 Dazu: H. Verweyen, Die Sache mit den Ostererscheinungen, in: I. Broer u. a. (Hgg.), „Der Herr ist wahrhaft auferstanden“ (Lk 24,34), a.a.O., S. 63 – 80. 381 Dazu: P. Fiedler, Vorösterliche Vorgaben für den Osterglauben, in: I. Broer u. a. (Hgg.), „Der Herr ist wahrhaft auferstanden“ (Lk 24,34), a.a.O., S. 25; A. Vögtle, Grundfragen der Diskussion um das heilsmittlerische Todesverständnis Jesu, in: ders., Offenbarungsgeschehen und Wirkungsgeschichte, a.a.O., S. 141 – 167, bes. S. 165ff; ders., Die Dynamik des Anfangs, a.a.O., S. 12.
135
Die Verzweigung
Wahrlich, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich davon neu trinken werde im Reich Gottes (Mk 14,25)382. In diesem mehrheitlich als authentisches Herrenwort angesehenen Ausspruch bringt Jesus nicht nur die Überzeugung zum Ausdruck, daß seine „Sache“ weitergeht, sondern nicht weniger auch die Gewißheit seiner eigenen Todüberwindung. Und mit dieser Gewißheit ist auch das von Jesus erstrebte Reich in die gottgeschenkte Zukunft hinein gerettet. Das aber hat zur Voraussetzung, daß sich Jesus, wie bereits deutlich wurde, mit seiner Sache identifizierte, gleichviel, ob diese Identifikation im Medium der Menschensohnidee oder, wie angenommen, in seinem Gebet erfolgte. Das läßt sich in Abwandlung eines extremen Nietzschewortes noch präziser bestimmen. Es steht als Spitzenaussage in Nietzsches „Antichrist“ und lautet: Das Wort schon „Christentum“ ist ein Mißverständnis –, im Grunde gab es nur Einen Christen, und der starb am Kreuz383. Im Hinblick darauf könnte man, wenn freilich in ähnlicher Zuspitzung, sagen: Im Grunde gab es nur einen Repräsentanten des Gottesreiches, und der gelangte mit ihm zusammen zu neuer Lebenswirklichkeit durch seine Auferstehung. Damit wäre zunächst schon gesagt, daß Jesus die scheinbar gescheiterte Sache des Gottesreiches durch die Auferstehung in sein nachösterliches Leben hinüberrettete. Sodann wäre damit angedeutet, daß seine Sache in die österliche Metamorphose einbezogen ist und damit auch für jene Neukonzeption offensteht, wie sie Paulus vollzog, als er anstatt des Gottesreichs die von Christus gewirkte „Freiheit“ proklamierte. Und schließlich ist in alledem mitgesagt, daß die Identifikation Jesu mit dem Gottesreich als eine der grundlegenden „Vorgaben“ des Osterglaubens zu gelten hat. Gleiches gilt aber auch von der These Verweyens, daß der Osterglaube auf die Glaubensstiftung des irdischen Jesus aufbaue, die im wesentlichen im Ruf zu seiner Nachfolge bestand. Zweifellos gilt von der österlichen Innovation dasselbe, was von Jesu zentraler Lebensleistung zu sagen ist: Sie hat, wie alle großen Entdeckungen, nicht den Charakter einer Neuschöpfung, sondern den einer innovatorischen Um- und Neugestaltung religionsund lebensgeschichtlicher Vorgegebenheiten. Deshalb geht alles, was Jesus im Umgang mit den Zwölfen und seinen Anhängern aufgebaut und bewirkt hat, als Element und Bestandteil in das österliche Lebens- und Glaubensereignis ein. Doch gewinnt es durch dieses eine vorher nicht absehbare Integration. Das gilt erst recht von Jesus selbst, der in seinen österlichen Erscheinungen als derselbe erkannt sein will, der bei den Seinen „einund ausgegangen war“ (Apg 1,21) und doch, um es mit Nikolaus von Kues zu sagen, nun auf ganz andere Weise das geworden ist, was er vordem war. Theologisch konnte die Differenz in der Kontinuität nicht besser ausgedrückt werden als durch den Satz, daß der Botschafter zur Botschaft, der Wegbereiter des Glaubens zu dessen gegenständlichem Vollender und der Lehrer zum Inbegriff der Lehre geworden war. Insofern hatte dann aber der „letzte der Auferstehungszeugen“, der nach 2Kor 5,16 keine Kenntnis des historischen Jesus für sich in Anspruch nimmt, in der Schau des Auferstandenen auch jenen gesehen, der ihm vorher lediglich als Feindbild vor Augen stand, so daß für ihn die Dif382 Dazu: W. G. Kümmel, Vierzig Jahre Jesusforschung (1950 – 1990), Weinheim 1994, S. 490 – 497. 383 F. Nietzsche, Der Antichrist, § 35, in: ders., KSA 6, S. 207.
136
2. Die Vorgaben
ferenz zwischen dem Schüler erster und zweiter Hand, auf die ihn schon Guardini festlegen wollte, entfällt384. Und sie entfällt, wie dem hinzuzufügen ist, auch für den, der ihm nach Röm 10,9 durch den Glauben in sein Ostererlebnis hinein folgt, weil er damit den von Lessing entdeckten „garstigen, breiten Graben“385 übersprungen hat.
2. Die Vorgaben Indessen stößt die Suche nach den vorösterlichen Auferstehungsdaten zuletzt – und vor allem – auf die zentrale, das Gottesbild betreffende Lebensleistung Jesu. Und das umso mehr, als der Kreuzestod Jesu zu einer politisch motivierten „Nebensache“ herabsänke, wenn er nicht, wie Jürgen Becker betont, durch seine „anstößige Gottesauslegung“ der Anlaß gewesen wäre, deren Vertreter durch die Hinrichtung zum Schweigen gebracht werden sollte386. Denn so sehr sein Gottesdienst in der jüdischen Tradition verankert ist, verfuhr er mit dieser Tradition doch extrem selektiv, sofern er den Gott der Sühneforderung und Rache ersatzlos aus seiner Gottesverkündigung strich, um stattdessen den Gott der Erbarmung, der Liebe und Treue desto kraftvoller herauszustellen. Indessen geriet das Gottesbild dadurch unvermeidlich in eine Schieflage, die den Hörer dieser Botschaft nicht weniger irritieren mußte als das Schwanken, in das ihn das durch die Dialektik von mysterium fascinosum und mysterium tremendum versetzte. Deshalb ist die Lebensleistung Jesu erst dann voll begriffen, wenn man einsieht, daß sein Gottesbild aus dem Wagnis hervorging, das Gottesgeheimnis durch das Medium seiner selbst zu erschließen, und wenn man versteht, daß Jesus in diesem zweiten und entscheidenden Schritt die ausgeblendeten Züge durch sich selbst kompensierte. Kaum einmal wurde das sensibler registriert als von Martin Buber, der diesen Eingriff freilich der nachgestaltenden Jüngergemeinde zur Last legt. Sie habe die „Präsenz des Einen Bildlosen“ durch ein Gottesbild ersetzt, „dessen eine, dem Menschen zugekehrte Seite […] ein Menschengesicht zeigt“387. Doch dazu hätte die Jüngergemeinde sich niemals erkühnt, wenn es nicht schon durch Jesus selbst geschehen wäre, der diesen entscheidenden Schritt dadurch vollzog, daß er Gott seine eigenen Züge verlieh und so das göttliche Geheimnis in seinem Antlitz aufscheinen ließ. In dieser zutiefst menschlichen und doch nur ihm möglichen Kompensation der ausgeklammerten Attribute des Zornes, des Schreckens und der Rache stand die entscheidende „Vorgabe“, mit der er seine Auferstehung lebensgeschichtlich vorwegnahm. Denn damit war Gott im höchsten Sinn des Ausdrucks „herausgefordert“ und gefragt, ob er dieses neue und mit der gesamten Religionsgeschichte brechende Bild von ihm bestätige. Da die Vertreter der überkommenen Religion Jesus dafür zum Kreuzestod verurteilten, konnte die göttliche Legitimation nicht glaubhafter als durch seine Erweckung vom Tod bestehen. Umgekehrt weist die Besinnung auf das Zentralereignis der Christentumsge384 Dazu: H. Verweyen, Gottes letztes Wort, a.a.O., S. 450 – 465, bes. S. 464f. 385 G. E. Lessing, Über den Beweis des Geistes und der Kraft, in: ders., Werke und Briefe in zwölf Bänden, Bd. 8: Werke 1774 – 1778, hrsg. v. A. Schilson, Frankfurt a. M. 1989, S. 437 – 445, S. 443. 386 Dazu: J. Becker, Das Gottesbild Jesu und die älteste Auslegung von Ostern, in: ders., Annäherungen. Zur urchristlichen Theologiegeschichte und zum Umgang mit ihren Quellen. Ausgewählte Aufsätze, hrsg. v. U. Mell, Berlin u. a. 1995, S. 23 – 47, S. 26f. 387 M. Buber, Zwei Glaubensweisen, in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 747.
137
Die Verzweigung
schichte damit nochmals auf die Lebensleistung Jesu zurück, die es nun genauer zu bestimmen gilt. Denn welcher Art war, so ist nunmehr zu fragen, die von ihm gewirkte Innovation? Bestand sie, wie bereits angedeutet, in einer völligen Neuschöpfung oder, wie etwa im Fall des anselmischen Gottesbeweises oder des cartesianischen Denkansatzes, in der Umwertung und Umschmelzung von bereits vorgegebenen und bekannten Daten? Angesichts der tiefen Verwurzelung Jesu in der sozialen, politischen und zumal religiösen Tradition seines Volkes kommt nur die zweite „verarbeitende“ Form in Betracht. Und hier führt die Linie zurück bis zu dem Gott, der den Regenbogen über der aus der Sintflut hervorgegangenen Welt wölbt und gegen die Aufwallung seines Zornes gegenüber der sündigen Menschheit beschließt, die Erde niemals mehr durch eine Wasserflut zu verwüsten (Gen 9,15), zumal aber führt sie zu dem kaum einmal als „Vorspiel“ der jesuanischen Innovation gewürdigten Gespräch Jahwes mit Abraham, dem Vater des Glaubens (Röm 4,16), in dem Abraham in die Konturen einer an den „Menschensohn“ erinnernden himmlischen Fürsprechergestalt hineinwächst – nach Gerhard von Rad indessen so, daß er mit seiner Fürbitte für das in „himmelschreiende“ Sünde gefallene Sodom (Gen 18,20) nur bis an die Grenze des menschlich Erdenklichen geht und auf beziehungsreiche Weise den letzten und äußersten Schritt, Gott zum Verzicht auf das bereits beschlossene Strafgericht zu drängen, unterläßt388. Von da spannt sich der Bogen der Bekundungen der Liebe und des Erbarmens dann weiter zum Zeugnis der Propheten, insbesondere des Hosea, der, so von Rad, eine Aussage wagt, „deren Kühnheit in der ganzen Prophetie ohne Beispiel ist“: Wie sollte ich dich fallenlassen, Ephraim, dich aufgeben, Israel? […] Mein Herz kehrt sich in mir um, mein ganzes Erbarmen ist entbrannt. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken, will Ephraim nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte (Hos 11,8f)389. Mit „Seilen der Liebe“, so versichert Hosea im Auftakt zu dieser Stelle, wolle er fortan sein Volk an sich ziehen (Hos 11,4). An Gefühlswert wird das allenfalls noch von der Ezechielstelle übertroffen, die Gott erzählen läßt, wie er Israel als ein in seinem Blut liegendes Kind in der Wüste auffand, wie er sich seiner annahm, es einkleidete und schmückte, um ihm schließlich seine geliebte Braut anzuvermählen (Ez 16,1-14), und von der deuterojesajanischen Zwiesprache zwischen ihm und dem sich über seine Verlassenheit beklagenden Volk: Aber du, Zion, klagst: Jahwe hat mich verlassen, mein Herr hat mich vergessen. Vergißt denn eine Frau ihr Kind, ohne sich der Frucht ihres Leibes zu erbarmen? Und selbst wenn sie vergessen könnte, so vergesse doch ich dich nicht. Siehe, ich habe dich in meine Hände eingeschrieben (Jes 49,14ff)390.
388 Dazu: G. v. Rad, Das erste Buch Mose. Genesis (Das Alte Testament deutsch, 2 – 4), Göttingen 12/1987, S. 165 – 170: Das Zwiegespräch Adams mit Gott 18,20 – 33. 389 Ders., Die Botschaft der Propheten, a.a.O., S. 113. 390 A.a.O., S. 212f.
138
3. Die Selbstversöhnung
Wie eine drohende Wolke stehen dem jedoch bei allen Propheten die Worte vom glühenden Zorn und der unnachsichtigen Strafgerechtigkeit Gottes entgegen, der gerade auch bei Hosea, dem Propheten der liebenden Erbarmung, von sich sagt: Wie ein Eitergeschwür bin ich für Ephraim geworden, wie Wurmfraß für das Haus Juda (Hos 5,12)391. In der Folge häufen sich geradezu die Bilder von der erschreckenden Gegnerschaft Jahwes. Er lauert seinem Volk auf wie ein blutgieriger Tiger und eine rasende Bärin (Hos 13,7), er ist eine Falle für Israel (Jes 8,14) und ein verzehrendes Feuer (Hos 8,14). Im Blick auf diese Antithese wird der religiösen Großtat Jesu erst die Feststellung gerecht, daß er sich durch die Wolke der göttlichen Andersheit hindurchgekämpft und die Gegnerschaft Gottes wie Jakob in seinem nächtlichen Kampf (Gen 32,25ff; Hos 12,4f) niedergerungen hat, um sich ganz auf die Seite dessen zu schlagen, der Barmherzigkeit will und nicht Strafe, weil er wie keiner vor ihm das Gotteswort auf sich beziehen konnte: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; deshalb habe ich dir die Treue gewahrt (Jer 31,3). Wenn Jesus in seiner Gotteskorrektur auf diese Tradition zurückgreift, dann mit dem Ziel, ihr einen bisher ungeahnten Stellenwert zuzuweisen. Was Buber von der Liebesforderung der Bergpredigt sagt, gilt dann auch hier, und hier sogar in einem gesteigerten Sinn: Sie ist „tief mit jüdischer Glaubenswirklichkeit verbunden und überbietet sie zugleich“392. Das faßt das Neue Testament auf seiner höchsten Reflexionsstufe in den Satz, daß Gott nicht nur liebt, sondern „die Liebe“ ist (1Joh 4,16). Die damit erreichte Höhe wird erst dann ersichtlich, wenn man sich an den platonischen Grundsatz erinnert, daß die Gottheit zwar Ziel des menschlichen Liebesverlangens ist, ihrerseits jedoch auf Grund ihrer Allgenügsamkeit nicht liebt. Mit der johanneischen Antithese geht wirklich, wie die Bergpredigt sagt, die Gottessonne über Gut und Böse auf (Mt 5,45), denn dieser Gott ist, wie die lukanische Parallelstelle versichert, sogar gütig gegen jeden, auch gegen die Undankbaren und Bösen (Lk 6,35).
3. Die Selbstversöhnung Doch dieser Innovation Jesu antwortet eine zweite, die sich an ihm selbst ereignet. Sie antwortet, genauer noch, auf das blutige Ende, das er sich durch seine Gottesverkündigung zuzieht. Denn damit war, wie bereits erwähnt, Gott auf extreme Weise herausgefordert. Wenn der Lohn der Welt für Jesu Bekenntnis zu dem Gott der bedingungslosen Liebe in seinem Kreuzestod bestand, konnte Gott das damit gefällte Urteil nur dadurch aufheben, daß er ihn dem Tod entriß und in sein unvergängliches Leben aufnahm. So war seine Auferstehung die jedes Argument überbietende Verifikation seiner Gottesbotschaft. Mit ihr stand Gott selbst dafür ein, daß er so, wie ihn Jesus entdeckt und verkündet hatte, gesehen, verehrt und geliebt sein wollte. 391 A.a.O., S. 112. 392 M. Buber, Zwei Glaubensweisen, in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 700f.
139
Die Verzweigung
Diese Innensicht muß jedoch durch eine Annäherung von außen her unterbaut werden. Und diese wird nicht sinnvoller als bei der Reaktion der Jünger auf den Tod Jesu einsetzen können. Trotz aller Abschwächungsversuche lassen die Berichte keinen Zweifel daran, daß die Hinrichtung ihres Meisters die Jünger mit niederschmetternder Wucht getroffen haben muß, die sie ebenso wie in ihrem Lebenskonzept, so nach Lk 24,19ff, auch in ihren religiösen Hoffnungen aus der Bahn warf. Die, wie es scheint, kopflose Flucht in das heimatliche Galiläa läßt keine andere Deutung zu. Der zum Kreuzestod Verurteilte mußte ihnen, wie der Schluß des Hebräerbriefs (Hebr 13,12f) zu verstehen gibt, gesellschaftlich ausgestoßen, mit seinem Sendungsanspruch gescheitert und überdies von Gott verworfen (Dt 21,23) erscheinen. Auch das muß gegen neuere Abschwächungs- und Umdeutungsversuche festgehalten werden. Denn der ganze Argumentationszusammenhang, in welchem Paulus den auf dem Gekreuzigten lastenden „Fluch“ erwähnt (Gal 3,13), bräche in sich zusammen, wenn dieser nur die Umstände seines Sterbens und nicht ihn selbst beträfe393. Dafür spricht auch, fast erschütternder noch, die Tatsache, daß die einzige Anspielung des Auferstandenen auf die Stunde seiner Passion (Joh 21,15ff) die dreimalige Verleugnung des Petrus und damit den Beginn der Jüngerflucht betrifft394. „Menschlich verworfen“: Jesus stirbt nicht nur als ein von der Gesellschaft Ausgestoßener, wie es schon das Lukasevangelium mit dem die Logik des Vorgangs umkehrenden Satz: „Und sie warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn“ (Lk 20,15), zum Ausdruck bringt; sein Tod erscheint vielmehr auch als der denkbar radikalste Einspruch gegen alles, was er an Hoffnungen in den Menschen gesetzt und im Menschen erweckt hatte, so daß, mit Paulus gesprochen, die ganze Sache des Menschen auf den exklamatorischen Satz zurückzufallen scheint: Ich unglücklicher Mensch; wer wird mich von diesem todverfallenen Leib befreien? (Röm 7,24) „Konzeptionell gescheitert“: Der auf die Heraufführung der messianischen Heilszeit gerichtete Sendungsanspruch erscheint durch den Kreuzestod Jesu widerlegt wie das auf die Errichtung des Gottesreichs abzielende Lebenswerk, zu dem sich Jesus nach Mk 14,25 sogar noch mit seinem Verheißungswort beim letzten Mahl bekennt. Alle Hoffnungen auf eine geistige Erneuerung, auf einen gesellschaftlichen Wandel und eine neid- und haßfreie Mitmenschlichkeit, die sich mit ihm verbunden hatten, schienen mit ihm ins Grab gesunken zu sein. Der Mensch, so schien dieser Tod zu beweisen, werde dem Menschen fortan wieder ein Wolf und nicht, wie der Gekreuzigte wollte, der „Nächste“ sein. „Religiös fallengelassen“: Wenn auf Jesus, wie Paulus versichert, das alttestamentliche Fluchwort über die Gekreuzigten zutraf, hatte Gott selbst über die Kühnheit, ihn einseitig und unwiderrruflich auf seine Vaterliebe festzulegen, geurteilt, indem er diesen kühnsten aller Neuerer, und mit ihm das von ihm errichtete Gottesbild, verwarf. Es blieb somit bei dem zwiespältigen Gott der Religionsgeschichte, der sich jederzeit aus dem Inbegriff des Erbarmens in den des Zorns und des Grauens verwandeln kann. Und niemand hatte das je schrecklicher zu spüren bekommen als der, der sich, wie es nun 393 F. Mußner, Der Galaterbrief, a.a.O., S. 231 – 234; ferner: E. Biser, Der unbekannte Paulus, a.a.O., S. 206f. 394 Dazu: U. Wilckens, Das Evangelium nach Johannes (Das Neue Testament Deutsch, Teilbd. 4), Göttingen 18/2000, S. 326ff; ferner: E. Biser, Das Antlitz, a.a.O., S. 285.
140
3. Die Selbstversöhnung
schien, ebenso kühn wie vermessen, auf den Gott der Liebe berufen und auf ihn seine ganze Verkündigung gebaut hatte. Das Kreuz war so, paulinisch formuliert, das „Nein“ Gottes zu einer auf reine Affirmation gegründeten Religiösität; in ihm widersprach Gott aufs schrecklichste dem, der alles auf das „Ja“ gesetzt hatte (2Kor 1,18ff). Dieser Eindruck mußte die Anhänger Jesu in einen Abgrund von Zweifeln stürzen, aus dem sich, wie Nietzsche in der Hellsichtigkeit seines Hasses erkannte, zwei Fragen erhoben: Erst der Tod, dieser unerwartete schmähliche Tod […], erst diese schauerlichste Paradoxie brachte die Jünger vor das eigentliche Rätsel: „w e r w a r d a s? w a s w a r d a s?“395 Das war die Frage nach dem Sinn der Katastrophe und zuvor schon die Frage nach der Identität des Opfers. Obwohl die Jüngergruppe über Anhaltspunkte zur Beantwortung von beidem verfügte, war sie doch von der Wucht dieser zweifachen Herausforderung weit überfordert. Man geht kaum fehl, wenn man ihre Flucht in diesen Zusammenhang bringt. Was sie, wie dies am deutlichsten an den Emmaus-Jüngern zu ersehen ist, aus Jerusalem, dem Grab ihrer Hoffnungen, vertrieb, war der Druck und das für sie undurchdringliche Dunkel dieser Fragen. In dieses Dunkel fiel, überraschend und überwältigend, Licht durch die Erscheinungen des Auferstandenen. Wenn man beides, das Dunkel und den Lichteinfall, in ihrem Verweisungszusammenhang begreift, ist es in erster Linie das Licht, wie es beim Zustandekommen des Verstehensaktes entsteht. So bestätigen es dann auch die EmmausJünger, wenn sie den Eindruck des Lehrgesprächs, das ihnen im Zug eines Schriftbeweises den Sinn des Kreuzes deutete, in den Satz zusammenfassen: Brannte nicht das Herz in uns, als er unterwegs zu uns redete und uns die Schriften erschloß? (Lk 24,32) Zusammengenommen mit der Beobachtung, daß in den ältesten Auferstehungszeugnissen stets Gott das Subjekt des Geschehens ist, nötigt das geradezu zu dem Schluß, daß die Auferstehung Jesu in erster Linie als die göttliche Interpretation des Kreuzes zu verstehen ist. Das erinnert so sehr an die Auffassung Bultmanns, daß es unbedingt damit in Beziehung gesetzt und, soweit erforderlich, auch noch davon abgegrenzt werden muß. Denn die Abgrenzung erfolgte bereits mit aller Klarheit durch das Adjektiv „göttlich“, während für Bultmann die subjektiv menschliche Perspektive im Vordergrund steht. Für ihn ist Ostern die mit dem Anfang der Glaubensgeschichte koinzidierende Deutung des Kreuzes, das dadurch in eine zugleich vom Glauben bewirkte und Glauben stiftende Beleuchtung gerückt wurde, oder, wie er nach dem Streit um die „Entmythologisierung“ gesagt haben würde, dessen „existentiale Interpretation“396. Das Defizit seiner Position wird schon dadurch erkenntlich, daß er das Licht, in dem das glaubenspraktisch interpretierte Kreuz erscheint, von dem beim durchschnittlichen Verstehen aufflammenden Licht nicht zu unterscheiden vermag. Zwar hat dieses durchaus mit dem „Wunder“ zu tun, das Gadamer beim Zustandekommen des Wort- oder
395 F. Nietzsche, Der Antichrist, § 40, in: ders., KSA 6, S. 213. 396 Dazu: E. Biser, Hermeneutische Integration. Zur Frage der Herkunft von Rudolf Bultmanns existentialer Interpretation, in: ders., Glaubensimpulse, a.a.O., S. 350 – 369.
141
Die Verzweigung
Textverstehens eintreten sah397. Doch damit verglichen hat das Licht der göttlichen Interpretation bei aller Nähe doch eine neue Qualität, die dort am deutlichsten zutage tritt, wo die Auferstehung Jesu zum lebensgeschichtlich dokumentierten und referierten Ereignis wurde: in der Damaskusvision des Apostels Paulus. Davon bietet freilich nicht der auf problematische Überlieferungen gestützte und dramatisch inszenierte Bericht der Apostelgeschichte (Apg 9,3-9; 22,6-11; 26,12-18) den erwünschten Aufschluß, sondern ausschließlich das Selbstzeugnis, das Paulus vor allem im Galaterbrief und in seiner Korrespondenz mit Korinth erstattet. Dort beschreibt er die ihm widerfahrene Christophanie zunächst als ein den Erscheinungen der übrigen Osterzeugen gleichwertiges (1Kor 15,3-8), ihn befreiendes und auf eine neue Lebensstufe hebendes Ereignis (1Kor 9,1). Daß es die Qualität einer sein ganzes Denken und Leben erfüllenden Mitteilung aufwies, hatte er zuvor schon im „Urzeugnis“ des Galaterbriefs und hier mit der Aussage beschrieben: Da gefiel es Gott in seiner Güte, […] seinen Sohn in mir zu offenbaren (Gal 1,15f)398. Von dem damit verbundenen Lichterlebnis spricht dann in voller Ausdrücklichkeit die dritte Stelle, die das Widerfahrnis auf die Lichtschöpfung am Weltenmorgen zurückbezieht: Gott, der gesagt hat: „Es werde Licht“, er hat es auch in unseren Herzen tagen lassen zum strahlenden Aufgang der Gottherrlichkeit auf dem Antlitz Christi (2Kor 4,6). Wie die Rückblende verdeutlicht, handelt es sich somit um eine ausgesprochene „Urzündung“, die das Kreuz in ein derart „unvorhergesehenes“ Licht rückte, daß dieser Inbegriff des Unheils als sein äußerstes Gegenteil, als die Quelle von Leben, Segen und Heil, erkennbar wurde. Durch sein Ostererlebnis wurde Paulus somit zu einer Neulektüre der Todeschiffre bewogen, als die ihm das Kreuz bisher vor Augen gestanden hatte. Doch von alledem abgesehen, gibt er schon dadurch, daß er Gott den Urheber seines Ostererlebnisses nennt, also schon durch seinen Sprachgebrauch, zu verstehen, daß die Auferstehung für ihn einer göttlichen Interpretation des Kreuzes gleichkommt. Dafür spricht überdies, daß er es wagt, sogar die Interpretamente zu benennen, die dabei ins Spiel kommen. Auskunft darüber gibt der an die Gemeinde von Korinth gerichtete Schlüsselsatz: Er ist für uns von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und Erlösung geworden (1Kor 1,30)399. 397 H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, a.a.O., S. 297: „Es ist die Aufgabe der Hermeneutik, dies Wunder des Verstehens aufzuklären, das nicht eine geheimnisvolle Kommunion der Seelen, sondern eine Teilhabe am gemeinsamen Sinn ist.“ 398 Dazu: J. Becker, Paulus. Der Apostel der Völker, Tübingen 1989, S. 73 – 81: Die Berufung des Pharisäers zum Heidenapostel; ferner: F. Hahn, Theologie des Neuen Testaments, Bd. 1: Die Vielfalt des Neuen Testaments, Tübingen 2002, S. 296f. 399 Dazu: A. Strobel, Der erste Brief an die Korinther (Zürcher Bibelkommentare NT; 6,1), Zürich 1989, S. 56f.
142
4. Die Verwandlung
Wenn Paulus die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu nach dem Modell der Sendung, des Erdenwirkens und der Entrückung der göttlichen Weisheit stilisierte, wenn er das Heilswerk Jesu als das Werk der Rechtfertigung auslegte, wenn er schon im ersten seiner Briefe das seiner Verkündigung eingestiftete Ethos mit dem Satz umriß: „Das ist der Wille Gottes – eure Heiligung“ (1Thess 4,3), und wenn er das von Gott mit dem Leben, dem Leiden und der Erhöhung seines Sohnes verfolgte Ziel mit dem Begriff „Erlösung“ umschrieb, folgte er dabei seinem Selbstverständnis gemäß nicht so sehr den von ihm vorgefundenen Denkmustern als vielmehr den ihm zusammen mit seiner Christophanie gegebenen Direktiven. Denn Gottes machtvolle Interpretamente hoben das in seiner Schwachheit „deutungslose“ Zeichen des Kreuzes nicht nur ins Licht, sie eröffneten vielmehr zugleich die Perspektiven, in denen es fortan gesehen, gedeutet, verkündet und in die Lebenspraxis umgesetzt werden sollte. Das schließt für Paulus jedoch keineswegs aus, daß ihm diese Kategorien vorgegeben waren durch jene, „die schon vor mir Apostel waren“ (Gal 1,17), durch deren Gemeinden und durch das weltanschauliche Umfeld, in dem er sich bewegte400. Gottes Zutun bestand für ihn dagegen im Sinn seiner Lehre von der Unterscheidung der Geister (1Kor 12,10) vor allem darin, daß er ihn in der Gemengelage der umlaufenden Modelle die zutreffenden finden und irreführende zurückweisen ließ. Man kann sich fragen, ob hinter seinem Kampf gegen die „Gesetzesleute“, die die durch Christus gewirkte Freiheit wieder „unter das Joch der alten Knechtschaft“ beugen wollten (Gal 5,1), am Ende nicht die sich wohl damals schon abzeichnende Tendenz stand, das Kreuz als „Sühneopfer“ und das Heilswerk als Satisfaktionsleistung zu deuten? Hätte er sich wohl mit der zwar plastischen und ausdrucksvollen, ihm aber doch fremden Schau anfreunden können, die der Hebräerbrief von Jesu Heilstat entwarf? Und widersprach er nicht deshalb so leidenschaftlich jedem Versuch, ein „anderes Evangelium“ einzuführen (Gal 1,6ff), weil er durch die von ihm rezipierten Interpretamente gegen andere, dazu querstehende, sensibilisiert war? Doch worin bestand der Kern der göttlichen Interpretation?
4. Die Verwandlung Mit Paulus geantwortet: in einer radikalen Aufwertung des scheinbaren Unwerts, des Inbegriffs der Ohnmacht und Torheit zum Erweis göttlicher Macht und Weisheit (1Kor 1,22ff)! Das ist unter dem Eindruck kritischer Missionserfahrung und der Herausforderung durch die hellenistische Denkwelt gesagt und gibt deshalb einen bemerkenswerten Aufschluß über den Anstoß, der Paulus zur weisheitlichen Deutung Jesu führte. Auch kamen bei der Formulierung dieser Schlüsselaussage, wie der Fortgang des Kapitels (1Kor 1,26ff) zeigt, kirchensoziologische Erfahrungen mit ins Spiel, wie sie sich Paulus im Umgang mit der Adressatengemeinde aufgedrängt hatten. Entscheidend aber war die Entdeckung, daß dort, wo, menschlich gesehen, alles widerlegt und vernichtet zu sein schien, Gott den entscheidenden Neubeginn gesetzt hatte, für dessen Größenordnung nur die Schöpfung den zulänglichen Maßstab bereit hielt. Was durch die Auferstehung im Abgrund des Kreuzestodes zum Vorschein kam, war dieselbe Macht, die die Welt aus dem Nichts hervorrief, und eine Weisheit, die die Philosophie gemäß ihrem Grundver400 Dazu: E. Biser, Einweisung ins Christentum, a.a.O., S. 317; ders., Paulus für Christen, Freiburg i. Br. u. a. 1985, S. 23.
143
Die Verzweigung
ständnis suchte: den Inbegriff einer als Entbergung des Welt- und Gottesgeheimnisses begriffenen Wahrheit. Dem aber wird nur die Feststellung gerecht, daß in der Auferstehung Jesu Gott nochmals Hand an die Welt legte, um das Ende des „Wartestandes“ (Röm 8,18ff) zu verfügen, in den sie durch ihre Todverfallenheit geraten war, und um sie damit, positiver formuliert, über ihren kreatürlichen Seinsstand zu heben und jenem genealogischen anzunähern, der im Vollsinn nur dem „eingeborenen Sohn“ zukommt. Nicht umsonst hatte dieser den ganzen Abgrund der Kontigenz durchlitten – und dies bis zum Notschrei über das Unheil der Todverfallenheit (Röm 7,24) – und so die Motivation für den Ratschluß geschaffen, die unter das Sklavenjoch des Todesgesetzes gebeugte Welt der herrlichen Freiheit der Gotteskinder entgegenzuführen (Röm 8,20ff). Doch dieser „energetischen“ Perspektive entspricht auch eine „didaktische“. Und sie besteht in der Erkenntnis, daß die Auferstehung alle nur erdenkliche Bedeutsamkeit, also allen Sinn und Wert, an sich riß und auf den Auferstandenen übertrug. Das betraf, wie die neutestamentlichen Identifikationsaussagen verdeutlichen, schon alles, was an Glanz auf den Gütern des Lebens – also auf Brot und Wasser, Licht und Liebe, Freiheit und Friede – liegt. Denn die nachösterliche Verkündigung konnte sich darin nicht genug tun, den Auferstandenen im Glanz der damit angesprochenen Bedeutungen erstrahlen zu lassen. Doch betraf es in erster Linie das, was sich an Sinngehalten mit der Gottesoffenbarung verband. Ohne daß der an die Väter und Propheten ergangenen und in den Schriften niedergelegten Gottesoffenbarung im mindesten Abbruch geschah, erschien er nun doch als der unüberbietbare Gipfel der Offenbarungsgeschichte, besser noch gesagt, als deren zentrierende Mitte, in der alle Sinnlinien konvergierten. Was Paulus mit der Qualifikation des Auferstandenen als Gottes „Weisheit“ zum Ausdruck brachte, faßte der johanneische Kreis noch präziser in die Aussage: „Im Anfang war das Wort“ (Joh 1,1), die Jesus zum Medium der göttlichen Selbstmitteilung erklärte. Das kam jenem radikalen Paradigmenwechsel gleich, der den Botschafter zur Botschaft, den Glaubensvermittler zum Glaubensobjekt und den Lehrer zur Lehre werden ließ. Die Folgen waren von größter Tragweite. Die Aufbruchbewegung, die Jesus ausgelöst hatte und die in den Wandercharismatikern noch eine Zeitlang weiterlebte, kam zum Stillstand; die von seinem eschatologischen Impuls getragene Gruppe strebte nach einer konsolidierten und hierarchisch strukturierten Gestalt. Und die von Jesus selbst mit einem sich fortpflanzenden Feuerbrand (Lk 12,49) verglichene Botschaft „erstarrte“ zur klar umrissenen und in der Folge sogar „festgeschriebenen“ Doktrin. Dieser Umbruch spiegelt sich in einem charakteristischen Zug der Erscheinungsberichte, auf den Anton Vögtle mit der schockierenden Bemerkung hinwies, daß bei genauerer Überprüfung überhaupt keine verbalen Äußerungen des Auferstandenen nachzuweisen sind401. Wer sich davon die Augen öffnen läßt, erkennt unschwer die an einen Filmschnitt gemahnende Zäsur, die die Erscheinungsberichte von der Lebens- und Leidensgeschichte trennt. Der zum „Wort“ des Offenbarers Gewordene ist, in schärfstem Gegensatz zur unablässigen Redetätigkeit des historischen Jesus, stumm, mit Ausnahme vielleicht der Anrede an Maria von Magdala (Joh 20,14ff), was diese Erscheinungsszene beziehungsreich an die Damaskusvision heranrückt. Sofern er redet, sind es die ihm in 401 A. Vögtle, Die Dynamik des Anfangs, a.a.O., S. 51; ferner: ders., Die Herausforderung des Osterglaubens, in: ders., Biblischer Osterglaube. Hintergründe – Deutungen – Herausforderungen, hrsg. v. R. Hoppe, Neukirchen-Vluyn 1999, S. 29 – 113, S. 72 – 91: Hat der Erscheinende gesprochen?; S. 99.
144
5. Der Begleiter
den Mund gelegten Reflexionen der nachösterlichen Gemeinde, sofern sich in seinem Reden nicht sogar, wie im Emmaus-Gespräch, deren Osterkatechese spiegelt. Was er selbst zu sagen hat, geht dagegen völlig in seine Erscheinung ein. Er spricht als Gestalt und Bild. Und auch in dieser Metamorphose befremdet die Tatsache, daß die Erscheinungsberichte im Unterschied zu Paulus, der vom Aufleuchten der Gottherrlichkeit auf dem Antlitz spricht (2Kor 4,6), gerade das Wichtigste, eine Beschreibung seines Blicks und seines Gesichts, unterlassen402. Umso auffälliger ist der Effekt: die Verwandlung des „Vorbilds“ in das Kultbild und der Botschaft in die Doktrin. Daß das Christentum im Unterschied vor allem zum Islam eine Theologie entwickelt, war also keineswegs, wie immer noch angenommen wird, nur die Folge seiner Wechselwirkung mit der jüdischen Weisheitslehre und der hellenistischen Philosophie, sondern eine Spontanwirkung der Auferstehung. Im Sinn der vorangehenden Überlegungen ließe sich das auch mit dem Satz umschreiben: Die göttliche Interpretation drängte auf menschliche Auslegung, die sich dann freilich, beginnend mit den apostolischen Vätern, den Apologeten und den Schulhäuptern der beiden Katechetenschulen, das Instrumentarium der zeitgenössischen Philosophie zunutze machte. Es lag somit letztlich in der Konsequenz des Osterereignisses, daß die Gestalt und Botschaft Jesu zum Gegenstand der Christologie, sein Heilswerk zum Thema der Soteriologie, seine Stiftung zum Motiv der Ekklesiologie und seine Verheißung zum Reflexionsgrund der Eschatologie wurde. Doch damit war, wie bereits hervorgehoben, über Ostern noch keineswegs das letzte Wort gesprochen. Denn der zunächst Verstummte war zu sehr Botschafter und Künder, als daß er nicht aufs neue hätte zu Wort kommen wollen. Das von den Berichten zunächst ausgesparte Antlitz wollte, wie das schon Paulus widerfuhr, wieder wahrgenommen werden. Und der zum Kultbild Erhobene wollte auf neue Weise gefühlt und „ergriffen“ werden. Wie anders ließe es sich erklären, daß schon in spätapostolischer Zeit, kaum daß der beschriebene Prozeß einen hinreichenden Deutlichkeitsgrad erreicht hatte, die mystische Inversion einsetzte, wie sich das in dem in seiner Aussagekraft nicht hoch genug zu veranschlagende Eingangswort des großen Johannesbriefs (1Joh 1,1f) bekundet. Jetzt wurde das Wort auf neue Weise beredt, das Bild als ein lebendig Anblickendes wahrgenommen und der Entrückte als der ins Glaubensgeschehen Eingreifende fühlbar. Das aber heißt, daß die Auferstehung nicht auf ihr geschichtlich-metahistorisches Gewesensein eingegrenzt werden darf. Ostern geht weiter: Es ist ein Gotteswerk „in progress“, ein Anfang, der sein Ziel erst im Eschaton erreicht, der aber gerade heute, in der Stunde dieser Wahrnehmung, aufgenommen und weitergeführt sein will, so wie er in der anfänglichen Sternstunde der Christenheit weitergeführt wurde. Von beidem muß nunmehr die Rede sein.
5. Der Begleiter Wenn an einer Stelle des Gedankengangs die anfängliche Anrufung, die sich von den – bereits eingangs erwähnten – Musen an den Ternar der göttlichen Tugenden verweisen ließ, wiederholt und womöglich noch gesteigert werden muß, dann hier. Denn es geht um die Entdeckung einer in dieser Rolle noch nicht erkannten Schlüsselgestalt, die 402 Dazu: E. Biser, Das Antlitz, a.a.O., S. 72f.
145
Die Verzweigung
gleichwohl nicht umgangen werden darf, wenn der zur Geistesgegenwart führende Prozeß erkundet und nachgezeichnet werden soll. Nach Lage der Dinge kann die erstrebte Identifizierung nur auf dem Weg einer Annäherung, eher noch einer Anleihe, gelingen, weil spirituelle Gegebenheiten oft im Außenraum – und in äußeren Parallelerscheinungen – deutlicher in Erscheinung treten als an ihrem Ursprungsort. In diesem Fall bildet den Außenraum die Literatur. Sie hat sich, wenn man von dem ironisch-sarkastischen Titelraub in Ödön von Horváths Stück „Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein kleiner Totentanz in fünf Bildern“ absieht, des göttlichen Ternars vor allem im Werk dreier Autoren angenommen: des Glaubens im Spätwerk Reinhold Schneiders, der Hoffnung in Ingeborg Bachmanns Gedicht „Früher Mittag“ und der Liebe im Werk Gertrud von le Forts. Bei Schneider geht es freilich um den vom gebrochenen Lebenswillen untergrabenen und schließlich sogar rätselhaft „entzogenen“ Glauben, bei Bachmann um eine Hoffnung, von der es heißt, sie kauere „erblindet im Licht“403. Affirmativ handelt nur le Fort von ihrem Zentralmotiv und vertritt dies in der Spitzenaussage ihrer Novelle „Plus ultra“ sogar in einer Form, die sich bewußt gegen die unvordenkliche Trennung von Eros und Agape mit dem Satz auflehnt: Denn wisse, Kind, es gibt in alle Ewigkeit nur eine Liebe, die stammt vom Himmel, auch wenn diese Welt sie irdisch nennt – Gott nimmt sie an als wäre sie ihm selber dargeboten404. […405] Das aber heißt, daß der Lieblingsjünger ganz auf Jesus hin und aus seiner Zuwendung zu ihm begriffen werden muß und das nicht zuletzt im Blick auf den Folgesatz der Redaktion, die genau zu wissen glaubt, was es mit dem geliebten Jünger auf sich hat, und nicht zögert, ihn mit dem Zeugen und Verfasser des Evangeliums gleichzusetzen (Joh 21,24)406. Dagegen verweist die Antwort Jesu an Petrus mit ihrem Zentralbegriff „bleiben“ in eine ganz andere Richtung. Denn jetzt erscheint der geliebte Jünger geradezu als Inbegriff dessen, was Jesus mit dem Stichwort „bleiben“ verbindet: an ihm wie der Zweig am Rebstock zu bleiben (Joh 15,5ff), in seiner Liebe zu bleiben (Joh 15,9f), ja durch den Genuß seines Fleisches und Bluts in ihm selbst zu bleiben (Joh 6,56). So ist der „geliebte Jünger“ der in Jesus „Bleibende“407, etwas distanzierter ausgedrückt: Jesu unablässiger, unzertrennlicher Begleiter. Doch was bedeutet er? Was ist durch ihn geklärt? Was hat er zu sagen?
403 R. Schneider, Winter in Wien. Aus meinen Notizbüchern 1957/58, Freiburg i. Br. 1958; I. Bachmann, Früher Mittag, in: dies., Werke, a.a.O., S. 44f, S. 45. 404 G. v. le Fort, Plus ultra (1950), in: Gertrud von le Fort erzählt. Mit einem Nachwort von Eugen Biser, Frankfurt a. M. u. a. 1993, S. 162 – 220, S. 205. 405 406 Dazu: U. Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, a.a.O., S. 329ff. 407 Ebd.
146
5. Der Begleiter
Fürs erste ist hervorzuheben, daß das Evangelium, dem dieser Jünger wie ein Ornament eingefügt wurde, nach Ausweis dieser Hervorbringung ein Kunstwerk ist. Denn nur Kunstwerke nach Art von Goethes „Faust“ und „Wilhelm Meister“, Joseph von Eichendorffs „Ahnung und Gegenwart“ oder Thomas Manns „Doktor Faustus“ sind durch derartige Symbolfiguren ausgezeichnet408. Das gilt streng genommen freilich nur für die aus einer „relecture“ des Grundtextes hervorgegangene „Übertextung“, der der geliebte Jünger angehört und die gerade an den ihn betreffenden Fundstellen als solche hervortritt409. Es gilt in abgeschwächter Hinsicht dann auch von der Gestalt, die das Ganze durch diese Hinzufügungen erfuhr. Wie Boy Hinrichs zeigte, ist diese Kunstgestalt vor allem durch die Ich-bin-Worte bestimmt, um die sich die Redestücke des Evangeliums wie um Kristallisationskerne gruppieren410. Da es sich dabei mehrheitlich – wie etwa beim zweiten Teil der Abschiedsreden oder dem sie beschließenden Gebet – um nachgestaltete Herrenworte handelt, entspricht die Jüngerfigur in erster Linie dem Legitimationsdruck, dem sich ihr Schöpfer durch diese Improvisationen aussetzt. Als Legitimationsgestalt begriffen, erwies sie ihn als den ins Leidensgeheimnis Jesu Eingeweihten, als den mit seinem Vermächtnis Beauftragten und als den im Vergleich zu Petrus Behenderen und Sensibleren. Wer durch ihn legitimiert war, konnte das Wagnis, den Erhöhten durch sich sprechen zu lassen, ohne Kompetenzüberschreitung eingehen. Er war aber nicht weniger auch Erschließungs- und Interpretationsfigur, die in der Szene vom Grabbesuch als die sehende Gestalt – „er sah und glaubte“ (Joh 20,8) – vorgestellt wird. Als solche steht sie nicht nur für die aus einer „relecture“, sondern auch für die aus einer Re-Vision hervorgegangenen Teile des Evangeliums. Durch den geliebten Jünger scheint sich der Autor darüber auszuweisen, daß er das Motiv „verströmen – trinken“ sowohl im Gespräch mit der Samariterin (Joh 4,8-14) als auch bei Jesu Aufritt beim Laubhüttenfest (Joh 7,37ff) entfaltete, daß er die Dialektik von Blindheit und Sehen zur Szene mit dem Blindgeborenen fortbildete (Joh 9,35-41) und daß er das Verheißungswort von der die Toten aus den Gräbern rufenden Stimme des Gottessohnes (Joh 5,25-29) zur hochdramatischen Szene von der Auferweckung des Lazarus (Joh 11,38-44) ausge408 409 410 Dazu: B. Hinrichs, „Ich bin“. Die Konsistenz des Johannes-Evangeliums in der Konzentration auf das Wort Jesu, Stuttgart 1988.
147
Die Verzweigung
staltete. Sofern dabei tatsächlich von einer Re-Vision des Textes gesprochen werden kann, läßt sich sogar eine Vermutung über die Art dieses Verfahrens anstellen. Dann benutzte der Autor die Symbolfigur des geliebten Jüngers nach Art eines Prismas, um die im Evangelium auftretenden Motive hervorzuheben und auf symbolhaft-dramatische Weise in Szene zu setzen. Demgegenüber ist der Jesusbegleiter, textintern gesehen, eine Integrationsfigur, und dies schon dadurch, daß er aus einer Montage von mehreren Modellen hervorging, in erster Linie aus einer idealisierenden Nachzeichnung des Apostels Paulus, wie dies schon Bultmann anmerkte, obwohl eine Gleichsetzung mit diesem aus nur zu naheliegenden, sachlichen wie theologischen Gründen unmöglich sei411. Doch steht Paulus dem geliebten Jünger näher als jeder andere. Das gilt schon für den mit der Wendung „in der Nacht, als er verraten wurde“ einsetzenden Abendmahlsbericht (1Kor 11,23), sodann für die Zentralstellung der Kreuzespredigt in der Verkündigung des Apostels und nicht zuletzt für den antiochenischen Konflikt (Gal 2,11-17), der an den Wettlauf der beiden Jünger zum Grab und damit zum Ziel des Auferstehungsglaubens (Joh 20,3-9) erinnert. Daß der geliebte Jünger in der Auslegungsgeschichte mit einer ganzen Reihe von Personen aus dem Umkreis Jesu, angefangen von Nathanael bis zu Lazarus und Judas, identifiziert wurde, beweist bei aller Unhaltbarkeit dieser Versuche, daß in ihm disparate Züge im Sinn einer Bildmontage vereinigt sind und als solche einen Anreiz zu immer neuen Vergleichen und Identifikationsversuchen bieten412. Demgegenüber verweist der Text selbst nur auf zwei Figuren, die auf seine Gestaltung eingewirkt haben könnten: auf den nach Art einer Auslöser- und Kontrastfigur auf ihn bezogenen Petrus, der die Einführung des Jüngers durch seine Frage motiviert und ihn beim Wettlauf als den ihm an Schnelligkeit und Sensibilität Überlegenen profiliert, und auf die mit ihm unter dem Kreuz stehende Maria, die darauf hingewirkt haben mag, daß er in der spätgotischen Kunst auffallend weibliche Züge aufweist, auch darin ein biblischer Vorgriff auf die hermaphroditisch anmutenden Geniusgestalten Goethes. Integrationsfigur ist der geliebte Jünger vor allem aber dadurch, daß in ihm der von Kierkegaard markierte Unterschied von Schülern erster und zweiter Hand aufgehoben ist. Auch von ihm wird gesagt, daß er durch einen Akt des Sehens zum Glauben kommt; doch ist dieses Sehen von dem der Auferstehungszeugen grundverschieden. Denn sie gehen mit dem Protokollsatz: „Ich habe den Herrn gesehen“, in die Fundamente des Glaubens ein. Und sie bezeugen damit, daß ihnen eine Erscheinung des Auferstandenen zuteil wurde. Ihm, dem geliebten Jünger, genügt dagegen der Anblick von Schweißtuch und Binden, der ihm das innere Auge für die Wahrheit der Auferstehung öffnet (Joh 20,8). Konkret aber gilt von dem „gegenstandslosen“ Sehen des geliebten Jüngers, was dann das
411 R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes, a.a.O., S. 370, Anm. 1. 412
148
5. Der Begleiter
ursprüngliche Schlußwort des Evangeliums in den Satz zusammenfaßt: „Selig, die nicht sehen und doch glauben!“ (Joh 20,29) Darin zeichnet sich aber bereits eine weitere Perspektive ab, in der der Jesusbegleiter als Identifikations- und Reflexionsfigur erscheint. Als Identifikationsfigur zunächst, weil es so ihrer Genese und Bestimmung entspricht. Hervorgegangen aus dem Bedürfnis des Autors, sich über sein Recht auf „Fortschreibung“ des Evangeliums auszuweisen, entwarf dieser in ihr ein Hochbild seiner selbst, das ihn in einem Verhältnis der Intimität und Auschließlichkeit mit Jesus erscheinen ließ. Was selbst Paulus nicht gewagt hatte, konnte jetzt durch ihn geschehen: stellvertretend für den Erhöhten und als dessen Mund das zu sagen, was über die Botschaft des Irdischen hinaus der nachösterlichen Gemeinde und insbesondere den Adressaten des Evangeliums gesagt werden mußte. In der Offenheit seiner Idealität wirkte das Hochbild aber auch auf die Leser des Evangeliums zurück. Und dies nicht nur nach Art eines Suchbildes, in welchem die Deutungsgeschichte die unterschiedlichsten Gestalten aus dem Umkreis Jesu gespiegelt sah, sondern als Anreiz zur Selbstidentifikation. Als Repräsentant des idealen Leserverhaltens und damit als Konfiguration des „impliziten Lesers“ lädt der geliebte Jünger in der stillen Beredtsamkeit des Hochbildes dazu ein, sich in ihm wiederzuerkennen und es ihm gleichzutun: sich mit ihm in die Herzensnot des Verratenen und Verlassenen zu versetzen, mit ihm und Maria unter das Kreuz zu treten und im Wettlauf um den Osterglauben schon im Blick auf Relikte und Spuren zu diesem zu gelangen. Mit der Identifikation im mystischen Zenit seiner selbst stieß der Autor aber unvermeidlich auf den Identifikationsakt Jesu und auf die Wahrnehmung, daß sich dieser im Gegensinn zu der gewohnten Wahrnehmung vollzog. Was er dabei zu fühlen bekam, war nicht die Umgrenzung dessen, der sich von ihm unterschied, sondern dessen „Entgegenkommen“, das ihn zu Mitsein und Mitwisserschaft bewog. Er erkannte ihn, doch so, daß er sich zugleich von ihm erkannt wußte. Er sah sich in ihm gespiegelt, doch so, daß er ihm dadurch angestaltet wurde. Das polte seinen Denkakt um. Sein „cogito“ – und im paulinischen Umfeld kann davon durchaus schon die Rede sein – verwandelte sich in ein „cogitor“413. Und seine Reflexion wurde tatsächlich zu dem, was das Wort besagt: zur Rückspiegelung seiner selbst im Medium des Geschauten. Er erkannte sich in ihm und wußte, daß sich der Erkannte seinerseits in ihm wiederfand. Jetzt wußte er sich in die Lebenssphäre Jesu aufgenommen und seiner Lebensgeschichte zugeordnet. Seinen Platz aber fand er dort, wo in der Stunde des Verrats auch die noch bei Jesus Verbliebenen von ihm abzufallen begannen und eine tödliche Vereinsamung nach seinem Herzen griff; er fand ihn dann wieder unter dem Kreuz, wo keiner bereitstand, sein Vermächtnis entgegenzunehmen; und er fand ihn nochmals, als es darum ging, den ersten Strahl des Auferstehungslichtes wahrzunehmen. Doch dadurch wußte er sich nun auch ermächtigt, stellvertretend für den zu sprechen, der ihm zur Identitätsmitte geworden war und darauf drängte, unter den gewandelten Verhältnissen erneut zu Wort zu kommen. Darin bestand seine Legitimation, das Evangelium fortzuschreiben, ihm die aus seiner Re-Vision hervorgegangenen Glanzlichter aufzusetzen und ihm die abschließende Gestalt zu verleihen. Doch wer war der, in dem er sich gespiegelt sah und in dessen Namen er redete?
413 F. v. Baader, Vorrede, in: ders., Philosophische Schriften und Aufsätze, Bd. 2, Münster 1832, S. III-XXXII, S. X: „weil Gott mich denkend mein Denken durchdringt, und ich mich durch Ihn gedacht finde (cogito quia cogitor)“.
149
Die Verzweigung
6. Die Idealisierung Die sich auf diese Frage spontan aufdrängende Antwort lautet: Es war der vom Tod Erweckte, der sich in seinen österlichen Erscheinungen, wie das vom Urzeugnis (1Kor 15,3-8) gebrauchte „ophthe“ betont, zu erkennen gab. Ungleich schwieriger ist die Beantwortung der Frage, als was er sich nun erkennen ließ. Denn die Zeichen seiner Identität mit dem am Kreuz Gestorbenen sind auffallend schwach. Zwar trägt er an seinem Auferstehungleib die Wundmale, doch kommt er, abgesehen von der seltsam abgehoben wirkenden Anspielung in Form der dreifachen Befragung des Petrus (Joh 20,15ff), mit keinem Wort auf seine Lebens- und Leidensgeschichte zurück, so daß seine Gestalt von dort keinerlei Bereicherung erfährt. Was er in den Ostergeschichten dann tatsächlich sagt, sind Worte der Gemeinde, ihrer Verarbeitung des Osterglaubens, ihrer Argumentation und ihrer Katechese. Dieser eher enttäuschend wirkende Befund kann aber auch positiv gelesen werden. Und dann ist er ein höchst beredter Hinweis darauf, daß das Bild des Auferstandenen die vergleichsweise spärlichen Farben dem gestaltenden Glauben der Gemeinde verdankt. Denn offensichtlich war deren Glaube im Unterschied zum zunehmend rezeptiven Glaubensverständnis der Folgezeit im Vollsinn des Wortes kreativ. Zwar legte sie wie Paulus größtes Gewicht auf das, was nach 1Kor 15,3 überliefert und als solches „vom Herrn“ sanktioniert war (1Kor 11,23). Das aber hinderte sie nicht im geringsten, sich mit ihren Erfahrungen, Einsichten und Intuitionen in den vorgefundenen Entwurf – und als Entwurf muß das überlieferte Bild von ihm aufgefaßt worden sein – einzubringen. Ja, man wird die lebensgeschichtliche Anreicherung des christologischen Hoheitsbildes, zu der sich Paulus auf Grund von Mißständen beim korinthischen Herrenmahl veranlaßt sah, bereits als einen Akt kreativer Aus- und Fortgestaltung ansehen dürfen. Doch widerspricht das, so ist vor jedem weiteren Schritt zu fragen, nicht dem Prinzip der Christomathie? Kann das, wenn überhaupt, als Mitvollzug der glaubensgeschichtlichen Inversion begriffen und anerkannt werden? Oder fällt hier nicht alles doch wieder in das Schwerefeld der Christologie zurück? Die Gefahr bestünde tatsächlich, wenn die anvisierte Idealisierung nicht im Licht der johanneischen Symbolfigur stünde. Denn erst ihre Idealität machte es denkbar, daß der Erhöhte, mit Ferdinand Hahn gesprochen, als Idealgestalt des historischen Jesus begriffen werden kann. Umgekehrt wird an keiner Stelle so deutlich wie hier, daß der geliebte Jünger als die zentrale Schlüsselfigur der Christomathie zu gelten hat. In ihr ist, wie in der Figur der Johannesminne alles Entgegennahme einer vorgängigen Entgegenkunft und Gewährung, und in ihr flutet das Gewährte wieder zu seinem Ursprung zurück. So ist in ihr alles Erkennen der Reflex eines vorgängigen Erkanntseins, alle Hingabe die Frucht einer entgegenkommenden Zuwendung, alle Leistung nur die Folge eines zuvorkommenden Impulses. Entspringt das philosophische Denken einem Akt des Staunens, so das christomathische, wie es sich in dieser Symbolfigur darstellt und wie es nach Heidegger dem etymologischen Zusammenhang von Denken und Danken entspricht414, einem Akt der Dankbarkeit: dem dankbaren Eingehen auf das, was, entgegen aller Skepsis und Sorge, ohne jede Vorleistung gegeben und da ist. Das gilt uneingeschränkt auch für die nachösterliche Idealisierung Jesu. Von einer „Verzweigung“ muß in dem vorliegenden 414 Dazu: M. Heidegger, Gesamtausgabe Abt. 1, Bd. 8: Was heißt Denken?, hrsg. v. P. L. Coriando, Frankfurt a. M. 2002, S. 149ff.
150
6. Die Idealisierung
Kontext schon deshalb die Rede sein, weil sich der Gedankengang hier erstmals fühlbar von der bloßen Rekonstruktion entfernt. Denn im Sinne der Christomathie ist nicht so sehr zu fragen, wie es damals dazu kam, sondern, bei aller Würdigung des historischen Vorgangs, wie es sich damit heute und morgen verhalten wird. Das ist aber auch die Frage nach den bei der Idealisierung herangezogenen Modellen und den bei der Interpretation eingesetzten Interpretamenten. Dabei wirken diese darauf hin, daß das Hochbild tatsächlich in die Vielfalt seiner Sinngehalte ausgelegt wird, während die Modelle dafür sorgen, daß die Auslegung nicht zu einer rationalen Ableitung gerät, sondern – im Sinn der Christomathie – den Charakter einer Selbstauslegung des Erhöhten behält. Schon bei der Gestaltzeichnung des Jesusbegleiters wurde deutlich, daß bei ihm allenfalls hintergründig Interpretamente, vor allem poetischer Art, ins Spiel kommen, während sich die Gestalt selbst in erster Linie als das Konstrukt dreier Modelle erweist: des paulinischen, des marianischen und des petrinischen. Sie bauen sich in ihm zu einer Lesehilfe auf, sofern sie als solche schon auf binnentextliche Zusammenhänge hin transparent sind: Paulus für die mit der Stunde des Verrats einsetzende Passion, Maria für den Rückbezug auf das „Noch nicht“ von Kana und Petrus für die Profilierung seines Konkurrenten beim österlichen Wettlauf. Damit erhärtet sich die Funktionsbestimmung des Begleiters. Er ist tatsächlich, wie bereits angedeutet, Lesehilfe und Prisma, dessen sich der Autor, mit einem Wort des späten Nietzsche gesprochen, „wie eines starken Vergrößerungsglases“ bedient415, um schwer erkennbare Zusammenhänge deutlich werden zu lassen. Demgegenüber gehen in die Idealisierung der Christusgestalt vor allem Begriffe wie die in den johanneischen Hoheitsworten angesprochenen ein, also Wahrheit, Wort und Leben, aber auch Vorstellungen, wie sie sich in den Titeln „Kyrios“, „Messias“, „Erlöser“ und „Gottessohn“ niederschlugen. Die Rolle der Leitidee fiel dabei jedoch, wie bereits gezeigt, der aus alttestamentlicher Überlieferung entnommenen Idee der Weisheit zu, die mit ihrer Sendung, Einladung, Fremdheit und Rückkehr vor allem für die Gestaltung der Jesus-Vita bestimmend wurde. Doch erschöpfte sich der Idealisierungsprozeß weder damit, daß diese Sinngehalte nach Art von Attributen in die Gestaltzeichnung eingetragen wurden, noch mit der dramatischen Explikation des Lebensweges; vielmehr mußte mit dem Eintritt des Christentums in die hellenistische Welt und seinem Aufstieg zum Rang einer Weltreligion auch das Verhältnis Jesu zum Kosmos und zur Welt des Geistes genauer bestimmt werden. Auch dafür hielt das Alte Testament kategoriale Deutemuster bereit. In der christologischen Integration dieser Begriffe bewies vor allem die Paulus-Schule ihre schöpferische Kraft. Gestützt auf weisheitliche Aussagen, erklärte nun der Kolosserbrief: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare wie das Unsichtbare, seien es Throne oder Hoheiten, Mächte oder Gewalten; alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist vor allem, und alles hat in ihm Bestand (Kol 1,15ff). 415 F. Nietzsche, Ecce homo, Warum ich so weise bin, § 7, in: ders., KSA 6, S. 274; dazu: G. Colli, Nachwort: Die Schriften von 1888, in: KSA 6, S. 447 – 458, S. 456; ferner: E. Biser, Nietzsche für Christen. Eine Herausforderung, Leutesdorf 2000, S. 57f.
151
Die Verzweigung
Darüber war indessen nicht in Vergessenheit geraten, daß Paulus die Schöpfung in ungeheurer Dynamik begriffen sah: in Wehen liegend und mit vorgestrecktem Kopf dem Erfüllungsziel der Gotteskindschaft entgegenharrend (Röm 8,18-20.23). In Erinnerung daran eröffnet der Kolosserbrief die Innensicht seines Christusbildes mit dem Wort: Christus in euch, er ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit (Kol 1,17). Demgegenüber arbeitet der Epheserbrief, wiederum gestützt auf alttestamentliche Aussagen, den Friedensaspekt des Heilswerks heraus, wenn er versichert: Denn er ist unser Friede: Er hat beide geeint und die Trennwand der alten Feindschaft niedergerissen […]. Er hat als Friedensstifter beide zu einem einzigen neuen Menschen umgeschaffen (Eph 2,14f). Und auch darüber war nicht vergessen worden, daß Paulus selbst das Christentum als Religion der durch Jesus erwirkten Freiheit bestimmte, auch wenn er im Unterschied zu seiner Schule die formelle Identifikation unterließ. Sichtbar wird die Abzweigung, sobald man die kognitiven Bedingungen des Fortgangs zu erkunden sucht. Denn offensichtlich war die Leistungskraft der genannten Modelle und Interpretamente erschöpft. Dafür spricht der schon in spätapostolischer Zeit einsetzende Wildwuchs der Gnosis, die heterogene Deutehilfen, oft apokryphen Ursprungs, heranzog, um ihre Systeme auf- und ausbauen zu können. Doch welche Hilfen hätten sich tatsächlich angeboten? Wenn man die Idee des Epheserbriefs vom Heranreifen der Glaubensgemeinschaft zum Vollalter Christi (Eph 4,13), diesen Vorklang der Vorstellung von dem in den Seinen fortlebenden Christus, zugrundelegt, kann die Antwort nur lauten: das kollektive Glaubenssubjekt und dessen Selbstbegriff! Als Lese- und Deutehilfe kämen demgemäß Gestalten und Konzepte in Betracht, in denen die Sache Jesu erkennbar „weiterging“. Dabei ist in erster Linie an Paulus und Ignatius von Antiochien, von denen authentische Selbstzeugnisse vorliegen, aber auch an Ideen wie die weit in die Folgezeit ausstrahlende „Rekapitulationsidee“ des Irenäus von Lyon zu denken416. Zunächst ist Paulus hervorzuheben, denn er „lebt“ im Bewußtsein, daß gerade nicht er, sondern Christus in ihm lebt (Gal 2,20), ja sein „Leben ist“ (Phil 1,21). Wenn also in irgendeiner Lebensgeschichte das Fortleben Christi zu ermitteln ist, dann gewiß in der des Paulus. Zu denken ist aber ebenso an Ignatius, der die noch fehlende Identfikation, nämlich die des Glaubens mit seinem Wegbereiter und Vollender, vollzieht. Er nimmt das paulinische Motiv des Mitgekreuzigtseins mit dem Bekenntnis: „Meine Liebe ist gekreuzigt“ (Röm 7,2), auf und sieht dem Tod mit dem Verlangen entgegen, durch die Zähne der Bestien zermahlen, zu einem „reinen Brot Christi“ (Röm 4,1) zu werden417. So erreicht er eine äußerste Nähe zu dem, der sich das Brot des Lebens nennt und seine Selbsthingabe durch das sakramentale Zeichen des Brotes besiegelt. Demgegenüber bestand die Leistung der Paulus-Schule vor allem darin, daß sie sich mit ihren Identifikationen zum ideellen Fortleben Jesu bekannte. Wo – gemäß der ignatianischen Ergänzung – geglaubt, wo gehofft, wo Frieden gestiftet und Freiheit erwirkt wird, ist ihrer Überzeugung nach Jesus am Werk, der unter diesem Namen angerufen 416 Zur Rekapitualtionslehre des Irenäus von Lyon und deren Wirkungsgeschichte: E. Biser, Glaubensprognose, a.a.O., S. 100 – 106: Der patristische Entwurf: Die Rekapitulation der Welt. 417 Ignatius von Antiochien, An die Römer 7,2; 4,1, a.a.O. (BKV, 1. Reihe, Bd. 35), S. 140; S. 138.
152
6. Die Idealisierung
werden kann. Und das gilt gleicherweise von der Fortführung dieser Tradition durch Origenes, der Christus den „autologos“, die „autosophia“ und die „autobasileia“ nennt und damit neue Felder der ideellen Selbstvergegenwärtigung Jesu umschreibt418. Fast gleichrangig ordnet sich dem aber auch die irenäische Rekapitulationsidee zu, die sich wie eine krönende Zusammenfassung dieser Motive ausnimmt und damit doch nur entfaltet, was der Epheserbrief in das Wort gefaßt hatte: Er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es sich in ihm vorgenommen hatte. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, das All in Christus als Haupt zusammenzufassen, das Irdische wie das Himmlische in ihm (Eph 1,9f)419. Das ist, in dieser vorläufigen Sicht erfaßt, vor allem eine Aussage über die Universalität und integrative Kraft der göttlichen Heilstat. Sie läßt nichts unberührt. Sie nimmt sich jeder Gegebenheit an, besonders dessen, was unausgereift und Fragment geblieben war. Das aber ist im Sinne dieser Schau die ganze, nach Paulus in Wehen liegende Welt, auch dort, wo sie sich dem Blick der Griechen als Inbegriff des Vollkommenen, als Kosmos, darstellte. Denn schon Vergil wußte um die „Tränen der Dinge“, und in den Augen der antiken Götterstatuen spiegeln sich, bei all ihrer überirdischen Schönheit, Trauer und Melancholie. Hier setzt die in Kreuz und Auferstehung Christi „getätigte“ Heilstat an, um das Unerfüllte, Vergebliche und Verfehlte einer von diesem selbst her unerhoffbaren Vollendung zuzuführen. Doch konnte sie nur vollenden, was zuvor zuende gedacht war. Damit tritt erneut der ideelle Aspekt in den Vordergrund. Denn Jesus ist, wie sich abzuzeichnen beginnt, ebenso eine Gestalt der Geistes wie der Religions- und Glaubensgeschichte. Sein Geist entspringt zwar dem, was nach 1Kor 2,11 nur er selbst erforscht: den Tiefen der Gottheit, doch greift er, deutend, lenkend, inspirierend und korrigierend auch in das Geistesleben der Menschheit ein, und dies so sehr, daß es erst von der Geisterfahrung der Christenheit her als solches erkennbar wurde und genannt werden konnte. Das aber setzt voraus, daß die sich in der Heilstat ereignende Gottesoffenbarung der menschlichen Ideation entgegenkommt, wenn nicht sogar zuvorkommt, um sie, durch sie imprägniert, auf sich als Zielgrund integrieren zu können. Eben dies leistete die frühpatristische Logosspekulation durch die vor allem von Justin entwickelte Lehre vom „logos spermatikos“, der samenhaft ausgesprengten und aller Ideenbildung eingesenkten Gotteswahrheit420. So wurde es verständlich, daß alles Denken, in Anlehnung an ein großes Pauluswort gesprochen (2Kor 10,4f), durch die Rekapitulation „gefangengenommen“ und der Herrschaft des in seiner Vollgestalt erschienenen Logos unterworfen wurde. In geistesgeschichtlicher Perspektive schattete sich darin die Vision voraus, die Paulus auf dem Höhepunkt seiner Lehre vom – mit Kleist gesprochen – „letzten Kapitel von der Geschichte der Welt“421 entwirft. Zuerst muß dem, der die Last der ganzen Welt auf sich genommen und dafür den schrecklichsten Tod erlitten hatte, 418 Dazu: E. Biser, Jesus für Christen. Eine Herausforderung, Freiburg i. Br. 1984, S. 42; S. 50. 419 Dazu: Irenäus v. Lyon, Adversus haereses III 16,6, in: ders., Adversus haereses. Gegen die Häresien, Bd. 3 (Fontes Christiani, Bd. 8.3), übs. u. eingel. v. N. Brox, Freiburg u. a. 1995, S. 198 – 203, S. 201. 420 Dazu: R. Heinzmann, Philosophie des Mittelalters, a.a.O., S. 41f. 421 H. v. Kleist, Über das Marionettentheater, in: ders., Sämtliche Werke und Briefe in vier Bänden, a.a.O., S. 563.
153
Die Verzweigung
alles, was sich je gegen ihn erhob, und zuletzt sogar die Macht des Todes, unterworfen werden: Doch wenn ihm alles unterworfen ist, wird sich der Sohn dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles und in allem sei (1Kor 15,28). Das ist zwar ganz von Gott her gesagt, doch Paulus weiß auch um eine menschliche Antizipation dieses Endgeschehens, wenn er einen jeden zum Zentrum der sich ihm zuordnenden Dinge erklärt: Alles gehört euch […], Welt, Leben und Tod, Gegenwart und Zukunft: Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott (1Kor 3,21ff). Dem Hauptakzent zufolge ist das im Stil einer Zueignung gesagt, doch im Licht der Rekapitulationsidee kann und muß das auch unter dem Gesichtspunkt der menschlichen Mitwirkung gedacht werden. Dann impliziert das Wort vom menschlichen Allbesitz den Gedanken der Allverantwortung. Wem alles gehört, das ist für Paulus der, der selber „allen alles geworden ist“ (1Kor 9,22), der auch allen verpflichtet ist. Für die Endvision aber heißt das, daß sie ebenso als Aufgabe wie als Ereignis begriffen und als solche mitvollzogen werden muß – und das, wie jetzt im Vollsinn des erwähnten Missionswortes (2Kor 10,4f) gesagt werden kann, auch und gerade durch Akte einer ideellen Integration. Wenn dem am Ziel der Geschichte Inthronisierten nach 1Kor 15,28 alles unterworfen werden muß, dann zunächst schon in der Weise, daß ihm alles, was ihm geistig entgegenstand – und Paulus spricht von Sinngespinsten und Bollwerken, die sich gegen ihn erhoben – unterworfen, zugedacht und attribuiert werden muß. Was die Auferstehung bewirkte, als sie alle Bedeutungen, Sinngehalte und Werte an sich riß und auf den Auferstandenen übertrug, muß, wenn der Auferstandene nach Hahn wirklich die Idealgestalt des Irdischen ist, durch einen Prozeß idealisierender Zueignung mitvollzogen werden. Damit machte die nachösterliche Verkündigung einen Anfang, als sie die umlaufenden Hoheitstitel auf Jesus übertrug und ihn den Kyrios, den Gottessohn, das Wort, die Weisheit und den Frieden nannte422. Doch offensichtlich ist das ebenso sehr eine vollbrachte Leistung wie ein noch offenes Desiderat. Deshalb steht am Ende der neutestamentlichen Schriften in Gestalt der Eingangsvision der Apokalypse ein Bild, das wie eine Einladung zu ideeller Nachgestaltung wirkt. Dort erscheint Christus dem apokalyptischen Seher in himmelragender Gestalt, die sich wie ein Mosaik aus allem, was glänzt und leuchtet, zusammensetzt: das Gesicht erstrahlend wie die Sonne in ihrer vollen Kraft, die Augen wie Feuerflammen, Haupt und Haare wie weiße Wolle und Schnee, in seiner Rechten ein Diadem aus sieben Sternen, die Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel und die Füße wie glühendes Erz, umgeben von sieben mächtigen Leuchtern, die seine Erscheinung zusätzlich anstrahlen (Apk 1,12-16). In der Vielfalt dieses Glanzes ist er, wie es im Angang dazu heißt, der getreue Zeuge (Apk 1,5) und als solcher die leibhaftige Erscheinung des sich in ihm mitteilenden und offenbarenden Gottes. Daß sich damit ein Appell verbindet, wird freilich nur auf Grund der vom Jesusbegleiter gebotenen Lesehilfe ersichtlich. Er aber reflektiert das erschaute Bild in einer 422 Dazu: E. Biser, Die Entdeckung des Christentums, a.a.O., S. 279 – 293: Die Rangfolge der Titel.
154
6. Die Idealisierung
Weise, daß der Schauende, mit Paulus gesprochen, in das Geschaute „hineinverwandelt“ wird (2Kor 3,18). Dabei liegt es in der Natur dieses Mediums, daß die Reflexion spontan in Interpretation übergeht. Und ebenso entspricht es seiner Eigengesetzlichkeit, daß diese kreativ verstanden werden muß, so daß „interpretieren“ hier soviel wie „integrieren“, um nicht zu sagen „rekonstruieren“, besagt. Was in der Eingangsvision der Apokalypse modellhaft aufscheint, muß somit nachgestaltet und mit den Mitteln des Interpretierenden reproduziert werden. Wie er sich das ihm zugesprochene Gotteswort gesagt sein lassen muß, muß er sich das vor ihm erstehende Bild „einbilden“, um es dann neu und kreativ hervorzubringen, wie es Hölderlin in dem warnenden Satz seiner PatmosHymne andeutet: Zwar Eisen träget der Schacht, Und glühende Harze der Ätna, So hätt’ ich Reichtum, Ein Bild zu bilden, und ähnlich Zu schaun, wie er gewesen, den Christ […]423. Da sich der Dichter mit dieser Warnung vor „knechtischer Nachahmung“ nicht selbst verurteilt, kann sich diese nur auf die hybriden Versuche derartiger Neugestaltungen beziehen, auch wenn er damit die drohende Gefahr zunächst in sich selbst zu bannen sucht. Durch diese Gegenvorstellung immunisiert, macht er sich dann aber doch in den in seinem „Patmos“ gipfelnden letzten Hymnen ans Werk, um Christus, an dem er „zu sehr“ zu hängen glaubt, als den im Vergleich zu den mythischen Heilbringern „Einzigen“ zu rühmen und ihn in der Friedenshymne – wenn die Hinführung des „Jünglings“ zum „Fürsten des Fests“ im Blick auf das Eingangswort der Vorstudie so interpretiert werden darf – sogar mit sich selbst zu „versöhnen“. Dabei scheint er sich insgeheim von dem Vorsatz des Angelus Silesius leiten zu lassen: Ich selbst muß Sonne sein, ich muß mit meinen Strahlen Das farbenlose Meer der ganzen Gottheit malen424. Damit nahm er, wenngleich in mythischer Sprache, die zum „kosmischen Christus“ hinführende Spur des Kolosserbriefes auf, während er sich gleichzeitig dem Umbruch im Weltbegriff widersetzte, der das Universum durch die nach Vico „ganz gewiß vom Menschen gemachte“ gesellschaftliche Welt verdrängte425. So stand sein Christusbild in einem höchst spannungsreichen Wechselverhältnis zum Zeitgeist. Dabei versteht er, wie er es in seiner zugleich warnenden und selbstkritischen Bildsprache ausdrückt, sein Christusbild durchaus als dichterisch-spirituelle „Hervorbringung“, bei der das Überlieferungsgut und das in „festen Buchstaben“ Niedergelegte mit dem „Magma“ seines Inneren verschmolzen wird. Das wirft rückläufig ein Licht auf die Eingangsvision der Apokalypse. Wenn man mit Ferdinand Hahn annimmt, daß die das Geheimnisbuch eröffnende Christophanie die Mitte zwischen visionärer Erfahrung und artifizieller Konstruktion 423 F. Hölderlin, Patmos, V. 162 – 172, in: ders., Sämtliche Werke (Große Stuttgarter Ausgabe), hrsg. v. F. Beißner, Bd. 2, Stuttgart 1953, S. 165 – 172, S. 170. 424 Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann, 1. Buch, Nr. 115, a.a.O., S. 14. 425 Nach: K. Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, in: ders., Sämtliche Schriften, Bd. 2, a.a.O., S. 7 – 240, S. 125 – 149: Vico, S. 130.
155
Die Verzweigung
hält, wird man sie als bildhafte Projektion der Titel- und Prädikationschristologie der ersten Stunde deuten dürfen. So gesehen ist sie der Reflex der Bezeichnungen, die Jesus das Wort, die Weisheit, den Herrn und Erlöser, die Hoffnung und den Frieden nennen. Im Sinn des christomathischen Ansatzes wird man sogar den Umkehrschluß ziehen können, wonach die Eingangsvision, jetzt in ihrer visionären Komponente gesehen, nur das zum Vorschein brachte, was längst zuvor als bildhaftes Modell der frühen Christusspekulation voranleuchtete und als solches den intuitiven Anreiz zur Übertragung der großen Namen und Begriffe auf Jesus bildete. Dann aber ist zu fragen, ob sich dieser Anreiz bereits erschöpfte oder ob nicht eine geheime Konsequenz darin liegt, daß das Neue Testament mit der bildmächtigen Herausstellung des ihm vorschwebenden Modells schließt, um so zur Fortsetzung des ideierenden und idealisierenden Prozesses anzureizen. Dann ließen sich zunächst schon die christologischen Entwürfe der Folgezeit mit Einschluß der als häretisch abgewiesenen Entwürfe, aber auch die soteriologischen Konzepte, wie die irenäische Rekapitulationslehre und die anselmische Satisfaktionstheorie, als Antworten auf den visionären Anruf verstehen. Somit ließen sich dann die Logos-Christologie des Origenes, die Inkarnationschristologie des Athanasius, die Entrückungschristologie des Bonaventura und die Verhüllungschristologie Kierkegaards, um nur diese wenigen Beispiele anzuführen, als Versuche deuten, dem von der Apokalypse-Vision ausgehenden Anstoß zu genügen. Wenn aber die Annahme zutrifft, daß der Anreiz noch fortbesteht, kommt die mit ihm aufgeworfene Frage erst dann zur Ruhe, wenn man sie auch auf die Gegenwart und die von ihr gegebene Antwort bezieht. Die aber besteht in erster Linie in der umfassenden Neuentdeckung Jesu, auf welche die Theologie mit dem Entwurf dreier Modelle, einer Christologie von oben, von unten und von innen, reagierte426. Doch diese Neuentdeckung ist erst dann voll ins Visier gebracht, wenn die Insinuation beachtet wird, die im Zentrum dieses Prozesses vom Geglaubten selber ausgeht. Insofern ist das heutige Christusbild wesentlich von der Inversion geprägt, die als der zentrale Beweggrund der glaubensgeschichtlichen Wende auszumachen ist. Am bisherigen Ende der vielfältigen Entwürfe, mit denen die Glaubensgeschichte auf die prototypische Christusvision der Apokalypse antwortete, steht somit ein Bild, das durch das Hervortreten des Botschafters aus der Botschaft, des Wegbereiters aus dem Glaubensgegenstand und des Lehrers aus der Lehre gekennzeichnet ist: ein Christusbild also, das mehr Erscheinung als Entwurf, mehr Zueignung als Aneignung, mehr Gewährung als Konstrukt ist. Im Vorgriff auf das erst am Ziel des Gedankengangs voll zu klärende Resultat kann davon hier und jetzt nur so viel gesagt werden, daß es sich um ein im subtilsten Sinne „indirektes“, ikonenhaft sich selbst vermittelndes Jesusbild handelt, um eine, wie zu Beginn der Apokalypse gesagt wird, schaubare Stimme (Apk 1,12), die gleicherweise aus der Verkündigung der Kirche wie aus der Tiefe des Herzens ertönt, um ein Antlitz, das im Gitterwerk der Texte aufscheint, und um eine Lehre, wie sie der „inwendige Lehrer“ erteilt.
426 Dazu: E. Biser, Einweisung ins Christentum, a.a.O., S. 87; ferner: ders., Der Freund, a.a.O., S. 22 – 38: Die Neuentdeckung.
156
7. Die Konkretisierung
7. Die Konkretisierung Die sich schon in der ersten Stunde abzeichnende Gefahr des Christenglaubens droht ihm von seiten jener Tendenzen, die auf seine gnostische Verflüchtigung abzielen. Dieser Gefahr kann er sich nur, wie seit Anbeginn, durch Akte konsequenter Konkretisierung erwehren. So ist es ihm schon durch seine Herkunft aus dem religiösen Akt auferlegt, dem es, vor allem in seinem betenden Vollzug, mit Buber gesprochen, um die Fühlung der Gotteswirklichkeit, ja um die Verankerung des Beters in dieser Wirklichkeit zu tun ist427. Und so ist es ihm vor allem durch seinen Charakter als Auferstehungsglaube eingeschrieben. Deshalb wird die Konkretisierung prinzipiell in der Bemühung der Glaubenden bestehen müssen, sich der Faktizität der Auferstehung Jesu neu zu vergewissern. Doch worin bestehen die faktischen Bereiche der anzustrebenden Konkretisierung? Wenn man mit Wikenhauser davon ausgeht, daß der am Kreuz Gestorbene nun als Auferstandener in den Glaubenden weiterlebt428, wird diese Frage in erster Linie mit dem Hinweis auf die Spiritualität zu beantworten sein. Denn die christliche Spiritualität ist, von ihrem Prinzip her gesehen, das Bewußtwerden und das meditative Eingehen auf die mit der Auferstehung einsetzende Wirkungsgeschichte Jesu, da sich diese, wie Kierkegaard erkannte, von jeder anderen dadurch unterscheidet, daß der Wirkende in ihr präsent bleibt und, mit Wikenhauser gesprochen, sein Leben in ihr neu durchlebt. Es kennzeichnet die gegenwärtige Bewußtseinslage, daß im modernen Sprachgebrauch die Grenzen zwischen Spiritualität und Mystik fließend geworden sind429. Da aber die Mystik zentral durch das Moment der Inversion bestimmt ist, stellt sich hier wie in anderen Bereichen die Frage nach den Vorgegebenheiten. Sofern sich die so verstandene Spiritualität aus dem Osterglauben herleitet, kommt das einer Wiederaufnahme der Frage Peter Fiedlers nach den „vorösterlichen“ Vorgaben des Osterglaubens gleich. Nur geht es jetzt nicht mehr wie bei Fiedler und Verweyen um die lebensgeschichtlichen Daten, die den Jüngerkreis auf die Todüberwindung ihres Meisters vorbereiteten, sondern um die bewußtseins- und erkenntnistheoretischen Vorgegebenheiten und Dispositionen430. In bewußtseinsgeschichtlicher Hinsicht ist die Fragestellung längst bekannt. In dieser Form löste sie eine Fülle von Spekulationen, hauptsächlich psychologischer Art, aus, die bei den durch den Tod ihres Meisters aufs schwerste getroffenen Jüngern Anlagen eidetischer Art vermuteten, Dispositionen also, die im Bund mit Gefühlen des Ressentiments und des Kompensationsbedürfnisses zu den – meist halluzinatorisch gedeuteten – Ostererscheinungen führten431. Von diesen immanentistischen Erklärungsversuchen kann die hier zur Diskussion stehende Frage nicht scharf genug unterschieden werden. Sie geht davon aus, daß die Erscheinungen, so sehr sie die Jünger mit der Wucht eines unvorhergesehenen und überwältigenden Ereignisses überkamen und von ihnen mit Bestürzung und anfänglichem Unglauben aufgenommen wurden, als solche gar nicht hätten rezi427 Dazu: E. Biser, Der inwendige Lehrer, a.a.O., S. 96f: Die Gebetshilfe. 428 Dazu nochmals: A. Wikenhauser, Die Christusmystik des Apostels Paulus, a.a.O., S. 44. 429 Dazu: E. Biser u. R. Heinzmann, Mensch und Spiritualität. Eugen Biser und Richard Heinzmann im Gespräch, Darmstadt 2008, S. 74 – 134: Grundlagen christlicher Spiritualität. 430 Dazu: A. Vögtle, Wie kam es zum Osterglauben?, in: ders. u. R. Pesch, Wie kam es zum Osterglauben?, a.a.O., S. 9 – 131, S. 84f; S. 99 – 103. 431 Dazu: A. Lang Fundamentaltheologie, Bd. 1: Die Sendung Christi, 4., neubearb. Aufl., München 1967, S. 269 – 273; ferner: M. Reichardt, Psychologische Erklärung der Ostererscheinungen?, in: Bibel und Kirche 52 (1997) 1, S. 26 – 33.
157
Die Verzweigung
piert werden können, wenn sie nicht auf kategoriale Anknüpfungspunkte getroffen wären. Es ist die Frage, die sich ebenso für Paulus stellt, da dieser von der Damaskusvision – für ihn eine den übrigen gleichrangige Ostererscheinung – unmöglich hätte verwandelt werden können, wenn sich nicht hinter dem wütenden Fanatiker ein Entbehrender und nach Sinnerfüllung Verlangender verborgen hätte432. Nun steht es im Fall des Apostels um die Beweislage ungleich günstiger als im Fall der übrigen Osterzeugen, da nur er über sein Erlebnis und dessen Vor- und Nachgeschichte Auskunft gibt. Doch auch bei ihm verwirrt sich das Spiel der Interpretationen, wenn es darum geht, ihm in jene „Tiefe“ zu folgen, in die der „Pfahl im Fleisch“ (2Kor 12,7) hineinstößt. Hier schuf freilich einer seiner kompetentesten Deuter, Kierkegaard, Klarheit, als er in seiner Studie „Der Begriff Angst“ die psychologischen und pathologischen Erklärungsversuche mit einer lässigen Handbewegung beiseiteschob, um sie durch den von keinem anderen gefaßten Gedanken zu überbieten, der Pfahl im Fleisch bedeute: die Angst433. Damit kommt hinter dem sich sehnenden und nach Erfüllung verlangenden Paulus ein ganz anderer zum Vorschein: der geängstete. Überzeugend wäre dieser Rückschluß allerdings erst unter der Voraussetzung, daß der Satansbote mit seinem Pfahl in eine Wunde stieß, an welcher Paulus schon lebenslang blutete. Dem entspricht immerhin sein Existenzverständnis, das in dem exklamatorischen Satz des Römerbriefs zum Ausdruck kommt: Ich unglücklicher Mensch! Wer wird mich von diesem todverfallenen Leib befreien? (Röm 7,24) Verständlich würde von dieser Prämisse her vor allem aber die antichristliche Aggressivität des Geängsteten. Nach aller Erfahrung macht die Angst gegenüber ihren vermeintlichen oder wirklichen Anlässen aggressiv. Das galt für Paulus gegenüber den „Anhängern des Weges“ (Apg 9,2) in dreifacher Steigerung: Sie standen für tiefgreifende Veränderungen im Bereich der überkommenen Religiosität; sie stellten zusammen mit dem Gesetz die „väterlichen Überlieferungen“ (Gal 1,14) in Frage; und sie erweckten bei ihm insgeheim den Eindruck, dabei sogar auf dem angemesseneren „Weg“ zu sein. Deshalb sprechen starke Gründe für die Vermutung, daß die Aktivität des Verfolgers letztlich der Angst entsprang. Spiegelbildlich entspricht dem der im Markusschluß überlieferte älteste Osterbericht der Evangelien, der mit der Bemerkung abbricht, daß die durch Engelmund mit der Auferstehungsbotschaft beauftragten Frauen voll Angst und Schrecken vom Grab flohen. Und sie sagten niemandem etwas davon; denn sie fürchteten sich (Mk 16,8)434. Das ist nun freilich nicht die vermutete kategoriale Vorgegebenheit, sondern eine transzendentale, denn die Angst offenbart, wie Kierkegaard lange vor Heidegger erkannte, das 432 Dazu: E. Biser, Paulus. Zeuge, Mystiker, Vordenker, München 1992, S. 39 – 43: Der sensible Fanatiker. 433 A.a.O., S. 154 – 161: Der Pfahl im Fleisch. 434 Dazu: J. Ernst, Das Evangelium nach Markus (Regensburger Neues Testament), Regensburg 1981, S. 482 – 491.
158
7. Die Konkretisierung
Nichts435. Wenn von Paulus und dem Markusschluß auf die übrigen Osterzeugen geschlossen werden darf, kommt hier der gesuchte Zusammenhang mit der Spiritualität, genauer noch mit dem in seiner mystischen Tiefe begriffenen Gebet, zum Vorschein. Denn das Gebet ist nach Martin Buber „letztlich die Bitte um Kundgabe der göttlichen Gegenwart, um das dialogische Spürbarwerden dieser Gegenwart“436. Das aber ist gleichbedeutend mit der Erkenntnis: Gebet ist Angstüberwindung. Denn dem Eindruck des Geängsteten, gleich dem sinkenden Petrus in eine bodenlose Tiefe zu stürzen, ist nichts so entgegengesetzt, wie das Gefühl, dem Abgrund entrissen und in die Gotteswirklichkeit aufgenommen oder doch mit deren größter und beschwichtigender Fühlung beschenkt zu werden. Nie wurde das, abzüglich der Szene mit dem sinkenden und durch die Retterhand Jesu in Sicherheit gebrachten Petrus (Mt 14,22-33), eindrucksvoller in Szene gesetzt als in Gertrud von le Forts Novelle „Die Letzte am Schafott“, die das von Angst stigmatisierte Leben der Titelheldin unter die wie eine Initiale wirkende Bemerkung stellt: Es war, als schwebe dieses bedauernswerte kleine Leben in der beständigen Erwartung irgendeines grauenvollen Ereignisses […], oder als reiche sein großer, erschrockener Kinderblick durch das feste Gefüge des gesicherten Daseins überall in eine entsetzliche Zerbrechlichkeit hinab437. Zusammengenommen mit der Bemerkung des Erzählers, er habe seit seinen Kindertagen beim Gebet ein eigentümliches „Absinken, gleichsam durch alle Stockwerke des Seins“ erlebt, bis „auf den Grund der Dinge, wo kein Fallen mehr möglich ist“438, läßt das auf ein erstaunliches Wechselverhältnis schließen. Danach ist die Angst ein zu früh abgebrochenes Gebet und dieses bis in die letzten Tiefen durchgehaltene Angst439. Das schließt kategoriale Dispositionen keineswegs aus, auch wenn sie als „kategorial“ nur bezeichnet werden können, weil sie den Eindruck des Kreuzestodes allenfalls fragmentarisch überdauerten. Dazu gehörte der inchoative Impuls, der von der Reich-GottesBotschaft Jesu ausging und mit dieser eine erst in der Parusie erreichte Zukunft verhieß. Damit verband sich aber auch die Hoffnung, daß die „Sache Jesu weitergeht“440, auch wenn er selbst den Tod erleiden mußte. Und das war zudem getragen von der von der Person und Tätigkeit Jesu ausgehenden Gottessuggestion, die durch den Kreuzestod zwar erschüttert, aber nicht ausgelöscht wurde. Unterfangen und umgriffen wurde jedoch all das durch die Angst, die sich bei einzelnen Jüngern sogar zu heller Panik steigerte und schließlich die ganze Gruppe zur Flucht veranlaßte. Sie schuf inmitten ihrer desperaten Verfassung eine spezifische Ansprechbarkeit für Rettung, die den Osterzeugen dann tat435 M. Heidegger, Was ist Metaphysik? (1929), Frankfurt a. M. 11/1975, S. 32; S. Kierkegaard, Werke, hrsg. v. L. Richter, Reinbek 1960, Bd.1: Der Begriff Angst, S. 89; dazu: U. H. J. Körtner, Weltangst und Weltende. Eine theologische Interpretation der Apokalyptik, Göttingen 1988, S. 101f. 436 M. Buber, Gottesfinsternis. Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie (1953), in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 503 – 603, S. 596. 437 G. v. le Fort, Die Letzte am Schafott (1931), Stuttgart 1983, S. 10. 438 A.a.O., S. 14. 439 Dazu: E. Biser, Die glaubensgeschichtliche Wende, a.a.O., S. 140f. 440 Dazu: W. Marxsen, Die Sache Jesu geht weiter, Gütersloh 1976; E. Schillebeeckx, Jesus. Die Geschichte von einem Lebenden (Jezus, het verhaal van een levende, 1974), aus dem Niederl. übs. v. H. Zulauf, Freiburg i. Br. u. a. 1975.
159
Die Verzweigung
sächlich in Gestalt des vom Tod Erretteten entgegentrat; sie machte sie hellsichtig für seine Erscheinungen. Den Schlußstein dieser Ableitung müßte freilich die ungewöhnliche Annahme bilden, daß es sich in den Ostererscheinungen um eine Gebetsszene handelte. Doch so abwegig der Gedanke zunächst auch wirkt, entspricht dem doch die Logik der Szene. Sie wird eröffnet von der „Trauer“ derer, die den Untergang ihrer höchsten Hoffnung beklagen (Lk 24,17). Sie steigert sich zu der Skepsis des Zweiflers, der sich nicht mit bloßem Hörensagen abgeben will (Joh 20,25). Und sie erreicht ihre Peripetie in der wiederholten Selbstpräsentation des Auferstandenen. In dieser Abfolge gesehen entsprechen die Ostererscheinungen dem mit der Szene des sinkenden Petrus gegebenen Modell. Trauer und Skepsis der noch unter dem Schock des Kreuzestodes Stehenden entsprechen seinem Notschrei; die Erscheinungen selbst wirken wie die ihnen entgegengestreckte Retterhand. In dem von ihr gebotenen Halt besteht die Konkretisierung, wie sie von der Spiritualität erwartet und geboten werden kann. Sie ist gleichbedeutend mit dem Erlebnis der Befestigung, in dem gerade auch die größten Zeugnisse der spirituellen Erhebung wie der „Aufstieg des Moses“ des Gregor von Nyssa oder die Ostia-Vision Augustinus’ ausmünden441. Sie erreichen, mit Buber gesprochen, ihr Ziel im Fühlbarwerden der Gotteswirklichkeit, augustinisch ausgedrückt, in der Berührung der über allem Wesenden ewigen Weisheit. Und dadurch gewinnt der sich zu Gott Erhebende unverbrüchlichen Halt und unerschütterlichen Stand. Der inneren Konkretisierung entspricht aber vor allem auch die gleichfalls vom Ostergeschehen ausgehende äußere, durch die die Jesusbewegung ihre Sozialgestalt erlangte. Wenn man sich der heutigen Forschung anschließt, hatte die von dem historischen und auferstandenen Jesus ausgelöste Bewegung – der Dynamik der Reich-Gottes-Botschaft und dem österlichen Impuls entsprechend – in erster Linie ein dynamisches Gepräge, wie es sich in den Wandercharismatikern der ersten Stunde darstellt442. Sie sahen sich gespiegelt in der Zeichnung der Propheten, die von ihrem Umherirren durch Wüsten, Berge und Erdhöhlen spricht (Hebr 11,37f), im Selbstportrait des Apostels Paulus, der im Leidenskatalog des zweiten Korintherbriefs von seinen gefahrvollen Reisen berichtet (2Kor 11,16-33), darüber hinaus in den Jesusworten, die von der Heimatlosigkeit des Menschensohns sprechen, zumal in Jesu Antwort an den Landesherrn, der ihn mit dem Tod bedroht: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen, heute und morgen, und am dritten Tag bin ich am Ziel. Doch heute und morgen und übermorgen muß ich weiterwandern, weil es nicht angeht, daß ein Prophet außerhalb Jerusalems zugrundegeht (Lk 13,32f). Im Hinblick darauf lebten die Wandercharismatiker das radikale Ethos der Reich-GottesBotschaft, das sie zum Verzicht auf jeden Besitz und jede Form einer materiellen Lebenssicherung verpflichtete und so zu Hoffnungsträgern für den baldigen Anbruch des Gottesreiches werden ließ. Doch schon die frühe Korrektur dieses Rigorismus, die den Boten 441 Dazu: Gregor von Nyssa, Der Aufstieg des Moses (De vita Moysis), aus d. Griech. übs. u. eingel. v. M. Blum, Freiburg i. Br. 1963; P. Henry, Die Vision zu Ostia (La vision d’Ostie, 1938), in: C. Andresen (Hg.), Zum Augustin-Gespräch der Gegenwart, Darmstadt 1962, S. 201 – 270. 442 Dazu: L. Schenke, Die Urgemeinde, a.a.O., S. 217ff.
160
7. Die Konkretisierung
das Tragen von Sandalen und eines Stocks, vor allem zur Abwehr von Angriffen, erlaubte, deutet auf eine Gegenbewegung hin, die dem Stabilitätsinteresse Rechnung trug und, anders als die durch den historischen Jesus ausgelöste Wanderbewegung, primär auf das Ostererlebnis zurückging. Der heutige Forschungsstand läßt keinen Zweifel daran, daß die von Paulus überlieferte Zeugenliste – die Magna Charta des Osterglaubens überhaupt – zumindest unterschwellig einem aitiologischen Interesse diente. Denn genannt werden insbesondere die „Säulen“ der urchristlichen Gemeinde, und unter ihnen an erster Stelle der noch mit seinem aramäischen Namen Kephas gekennzeichnete Petrus, dem als dem ersten Osterzeugen die Konsolidierung der Jüngergruppe zuzuschreiben ist. In diesem Sinn spricht Heinrich Kraft geradezu von der „Gründung der Urgemeinde durch die Erscheinungen des Auferstandenen“443. Nach der heute vorherrschenden Auffassung, die sich vor allem in der Diskussion mit der von Hans von Campenhausen angenommenen Abfolge der Osterereignisse entwickelte444, nimmt Petrus die Spitzenposition ein, weil er in Galiläa, dem Ziel der Jüngerflucht, zum ersten Zeugen einer Christophanie wurde, dem es in der Folge gelingt, die versprengte Jüngergruppe zu konsolidieren und zur Rückkehr nach Jerusalem zu bewegen, wo sie dann das kollektive Ostererlebnis des Pfingstfestes in ihrem wiedergewonnenen Glauben bestärkt. Eine Zeitlang dürfte dieser mittlerweile fortgeführten und vertieften Deutung zufolge auch der Zwölferkreis eine unterstützende Rolle gespielt haben, bevor er in der Gruppe der an übernächster Stelle genannten Gesamtheit der Apostel aufging. Zuvor aber nennt die Liste noch den „Herrenbruder Jakobus“, der nach einer auch von Paulus (Gal 1,19) bestätigten Überlieferung nach Petrus die Führung der Urgemeinde in Jerusalem übernahm. Darin werden bereits Umrisse der Sozialisation und Organisation der Urgemeinde sichtbar. Deutlich ist vor allem das hierarchische Prinzip. Denn prinzipiell baut sich die Gemeinde von oben her auf, wobei die Empfänger der ersten Ostererscheinungen die Führungspositionen einnehmen. Bei der näheren Bestimmung des Aufbaus denkt Kraft an einen noch von Jesus selbst eingesetzten Dreierkreis, gebildet aus Simon Petrus und den Zebedäussöhnen Jakobus und Johannes, dem die im Galaterbrief (Gal 2,9) als „Säulenapostel“ bezeichneten Petrus, Jakobus und Johannes entsprechen445. Paulus spreche, so Kraft, sogar „nicht ohne Empfindlichkeit“ von dem hohen Ansehen, in dem diese im Vergleich zu ihm, dem trotz seiner überragenden Leistung (1Kor 15,10) ständig Angefochtenen, genießen446. Diese Dreiergruppe bildete den „inneren Kreis“ um Jesus, der ebenso an den Höhen – der Verklärung – wie an den Tiefen – des Gebetskampfes in Getsemani – des Lebensweges Jesu teilnimmt und dessen Aufgabe, wie das alte Verheißungswort an Petrus zeigt, vor allem in der inneren Konsolidierung der Gemeinde besteht: Simon, Simon, der Satan hat sich ausbedungen, daß er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, daß dein Glaube nicht wanke. Und wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke du deinerseits deine Brüder (Lk 22,31f).
443 H. Kraft, Die Entstehung des Christentums, Darmstadt 1981, S. 207 – 214. 444 Dazu: H. v. Campenhausen, Der Ablauf der Osterereignisse und das leere Grab, 2., verbesserte u. erg. Aufl., Heidelberg 1958. 445 H. Kraft, Die Entstehung des Christentums, a.a.O., S. 124ff. 446 A.a.O., S. 126.
161
Die Verzweigung
Von einer Verleugnung und einem nachträglichen Zurückfinden des Petrus ist in diesem von Lukas nachträglich korrigierten Logion nicht die Rede, wohl aber von seiner zweifellos dem gesamten Dreierkreis geltenden Aufgabe, die Jüngergemeinde, wie es dann auch in den nachösterlichen Tagen geschah, in ihrem Glauben neu zu bestätigen und zu bestärken. Demgegenüber ist dem von Paulus an zweiter Stelle genannten Zwölferkreis eine eher prospektive Aufgabe zugewiesen: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Neugestaltung der Dinge, wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit erscheint, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten (Mt 19,28). In der Einsetzung dieser Gruppe hatte Jesus von Anfang an den – erst durch intensive Missionstätigkeit einzulösenden – Anspruch auf das Zwölf-Stämme-Volk Israel erhoben447. Sie hatte er zu den „verlorenen Schafen“ dieses Volkes ausgesandt, so wie er selbst in unablässiger Wanderschaft begriffen war. Insofern verkörpert diese Gruppe, antagonistisch zur hierarchischen Struktur, das dynamische Element der Jesusbewegung, das in den urchristlichen Wandercharismatikern fortlebte. In ihrem Charismatikertum wirkte zweifellos die exorzistische Tätigkeit Jesu nach, die, wie Gerd Theißen urteilt, dem ganzen Urchristentum weithin den Charakter einer „exorzistischen Bewegung“ verlieh448 und es so als die religiöse Antwort auf eine nur mit Dämonie zu erklärende politische Grenzsituation erscheinen ließ. Vor allem aber wußten sie sich als Boten und Sprecher des über die Urgemeinde ausgegossenen Geistes449, der sie bewog, das Kommen des Reiches Gottes anzukündigen (Mt 10,7), den Menschen den Frieden zuzusprechen (Lk 10,5f), ihnen in Sätzen heiligen Rechts die neue Lebensordnung zu verdeutlichen und ihnen diese in einer rigorosen Lebenspraxis vorzuleben450. Wuchtig kommt dieser Rigorismus in dem umrätselten „Stürmerspruch“ zum Ausdruck: Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Gottesreich verkündet und jeder drängt sich mit Gewalt hinein (Lk 16,16). In diesem mitreißend „drängenden“ Logion spiegelt sich wie in kaum einem anderen die Dynamik einer Bewegung, die sich unter Zeitdruck gestellt und dadurch genötigt fühlte, selbst unter Mißachtung so populärer Konventionen wie des gegenseitigen Sich-Begrüßens (Lk 10,4) die ihnen aufgetragene Sache voranzutreiben. Suggestiv kommt das in den von Lukas überlieferten „Nachfolgeszenen“ zum Ausdruck: Unterwegs sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst, Herr. Da sprach Jesus zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester; der Menschensohn aber hat nichts, wo447 A.a.O., S. 141f. 448 G. Theißen, Urchristliche Wundergeschichten. Ein Beitrag zur formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien, Gütersloh 1974, S. 248. 449 Dazu: H. Kraft, Die Entstehung des Christentums, a.a.O., S. 145 – 150: Die Boten Jesu, bes. S. 147. 450 Dazu: L. Schenke, Die Urgemeinde, a.a.O., S. 219 – 230.
162
8. Die Vielgestalt
hin er sein Haupt legen könnte. Zu einem andern sprach er: Folge mir nach! Der aber sagte: Herr, erlaube mir, erst hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Da sprach Jesus zu ihm: Laß die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkünde das Reich Gottes! Ein anderer sprach: Ich will dir nachfolgen, Herr; gestatte mir zuerst aber noch, von meinen Hausgenossen Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, taugt für das Reich Gottes (Lk 9,5762)451. Durch die Gleichzeitigkeit der beiden Tendenzen, des Strebens nach Stabilität wie es die „Säulenapostel“ verkörperten und der Dynamik, wie sie die Zwölfergruppe und die Wandercharismatiker vertraten, kam es unvermeidlich zur Überschneidung zweier Interessenssphären, die nicht nur Konflikte heraufbeschwor, sondern auch zu einer Differenzierung der Lebensformen und der ihnen korrespondierenden Denkweisen führte. Der Konflikt, der dann vor allem von Paulus ausgetragen wurde, kündigte sich in der Spannung zwischen den „Hebräern“ und den „Hellenisten“ an452, auf die die Apostelgeschichte im Vorfeld ihrer Stephanus- und Paulusberichte eingeht (Apg 6,1). Von den sich verzweigenden Anschauungen vermitteln demgegenüber die Paulusbriefe einen plastischen Eindruck, sofern man nur die Originalbriefe des Apostels mit den Schreiben seiner Schule, mit dem Kolosser- und Epheserbrief und mit den von seinen Epigonen unter den gewandelten Bedingungen der neutestamentlichen Spätzeit verfaßten Pastoralbriefen, vergleicht. In den von der Paulus-Schule verfaßten „Gefangenschaftsbriefen“ gewinnt das Heilswerk Christi geschichtsprägende, ja sogar kosmische Dimensionen, während die Pastoralbriefe die Verfestigung der Botschaft zur „gesunden Lehre“ und die Ausgestaltung der Kirche im Sinn der Ämterhierarchie dokumentieren. Das wirkte unvermeidlich auf das Christusbild zurück. Es nahm, fast im Rhythmus des Fortgangs der Sache Jesu, einen perspektivischen, vielgesichtigen Charakter an, der in diesem Pluralismus den Dimensionen der Verkündigung entsprach; denn diese erstreckte sich nach einem urchristlichen Hymnus nicht nur auf die Reiche der Welt, sondern sogar auf die jenseitigen Bereiche: Groß ist das Geheimnis unseres Glaubens: Er wurde offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, geschaut von den Engeln, verkündet unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit (1Tim 3,16)453.
8. Die Vielgestalt Idealisierung und Konkretisierung führten, auf das Christusbild der Urgemeinde zurückbezogen, zum gleichen Effekt: Der immer mehr in seiner Einzigartigkeit Begriffene erschien in der Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven. Dabei war die Vielfalt sogar die er451 A.a.O., S. 221; S. 229. 452 A.a.O., S. 174 – 179; S. 188 – 196. 453 Dazu: E. Schweizer, Jesus Christus im vielfältigen Zeugnis des Neuen Testaments, a.a.O., S. 76; S. 81f.
163
Die Verzweigung
klärte Frucht der Einzigkeit. Denn um diese zu betonen, wurden die auf Jesus bezogenen Prädikationen substantiviert und mit dem durch sie Qualifizierten gleichgesetzt. Das aber geschah nicht so sehr im Gefolge der spekulativen Ausdeutung als vielmehr in der Konsequenz der Auferstehung, die Jesus definitiv zum Inhalt der Verkündigung werden ließ. Jetzt erschien er nicht nur als der endzeitliche und als solcher unüberholbare Botschafter Gottes, sondern als dessen ureigenes Wort, nicht nur als der messianische Friedensbringer, sondern als der Friede in Person, nicht nur als der, der die von ihren eigenen Zwängen niedergehaltene Menschheit wieder aufatmen und hoffen ließ, sondern als die leibhaftige Hoffnung. Wie weit die christologischen Perspektiven damit auseinandertraten, zeigte sich vollends erst im vergangenen Jahrhundert, als in relativ kurzer Folge nacheinander mit Karl Barth eine Theologie des Wortes, mit Joseph Comblin eine Theologie des Friedens und mit Jürgen Moltmann eine Theologie der Hoffnung entstanden454. Im Durchgang durch die Geschichte des Idealisierungsprozesses wurde klar, daß die Entwicklung dieser Prädikationschristologie in erster Linie die Leistung der PaulusSchule war, die aber in der Tatsache, daß sie keine Christologie der Freiheit hervorbrachte, auch schon eine Überlagerung des paulinischen Impulses durch lebenspraktische Anliegen – wie die Hoffnung – und gesellschaftlich-politische Interessen – wie den Frieden – erkennen läßt. In diese Richtung trieb dann aber auch die ekklesiale Konkretisierung die angedeutete Entwicklung voran. Darauf wirkte insbesondere der Stil der Paulusvision hin. Da sich der Apostel als „Herold“ in dem von ihm angeführten Siegeszug Jesu verstand, genügte es ihm, den Christusnamen in den großen Kommunen, besonders aber in den Provinzhauptstädten durch seine Predigt auszurufen, weil nach seinem Verständnis damit die betreffende Region bereits für die Herrschaft Christi in Anspruch genommen war. Nur so läßt sich seine Behauptung rechtfertigen, wonach es ihm in relativ kurzer Zeit gelang, das Evangelium in weitem Bogen von Jerusalem bis Illyrien zu tragen (Röm 15,19). Im Zug dieses Missionsverfahrens entstand zwar eine Vielzahl von Gemeinden, aber keine sie alle zusammenfassende Kirche. Umgekehrt begünstigte das die Entwicklung einer Vielfalt von Christologien, die sich jedoch nur in Grenzfällen widersprachen, in der Hauptsache jedoch zu einem mosaikartigen Gesamtbild ergänzten. Ein instruktives Modell dessen entwirft der Eingang der Apokalypse, sofern man nur die Sendschreiben rückbezüglich auf die Eingangsvision, näherhin als deren perspektivische „Entfaltung“, versteht. Nicht umsonst nehmen sie einleitend jeweils Bezug auf ein Motiv der visionären Erscheinung: der Brief an Ephesus auf das Sternendiadem in der Rechten Christi und auf die ihn umstehenden goldenen Leuchter (Apk 2,1), der Brief an Smyrna auf seine Erweckung vom Tod zum Leben (Apk 2,8), der Brief an Pergamon auf das zweischneidige Schwert in seinem Mund (2,12), der Brief an Thyatira auf seine Augen gleich Feuerflammen und seine Füße gleich Glanzerz (Apk 2,18), der Brief an Sardes auf seinen Besitz der Geister Gottes und der sieben Sterne (Apk 3,1), der Brief an Philadelphia auf den Schlüssel Davids (Apk 3,7) und der Brief an Laodicea auf seine Bezeichnung als das „Amen“ und „der getreue Zeuge“ (Apk 3,14). Wenn man bedenkt, daß der Auftraggeber der Sendschreiben mit diesen Selbstbezeichnungen seinen auf den Zustand der jeweiligen Gemeinde abgestimmten Zuspruch motiviert, sind damit zugleich Perspektiven seiner Anschauung eröffnet, die ebenso zu selbstständiger Entfaltung anregen wie sie rückläufig im Hoheitsbild des Erscheinenden konvergieren. Den Hauptgrund der Verzweigung aber hatte, schon vor der divergierenden Interessenlage seiner Schule, Paulus selbst ins Spiel gebracht, als er im Zug seiner Fundamental454 Dazu: E. Biser, Die glaubensgeschichtliche Wende, a.a.O., S. 295 – 301: Identität im Umbruch.
164
8. Die Vielgestalt
interpretation (1Kor 1,30) Jesus den „von Gott her zur Weisheit“ Gewordenen nannte. Denn damit hatte er nicht nur das Modell aufgerufen, das – rückwirkend – bei der Gestaltung der Jesus-Vita leitend wurde, sondern auch dem mit und nach ihm einsetzenden Differenzierungsprozeß den entscheidenden Anstoß gegeben. Aufschluß darüber gibt das Wort der Paulus-Schule, die im Epheserbrief von der „mannigfaltigen“ Weisheit Gottes – mit der Konnotation ihres Facetten- und Farbenreichtums – spricht (Eph 3,10). Von der Bedeutung dieses Begriffs vermittelt Gregor von Nyssa einen Eindruck, wenn er in seinem Hoheliedkommentar in Anspielung auf das Epheserwort erklärt: Denn in Wahrheit wird den überhimmlischen Gewalten durch die Kirche die buntgestaltige Weisheit Gottes kund, die aus Gegensätzen ihre großen Wunder zaubert. Wie wurde denn durch Tod Leben, und Gerechtigkeit durch Sünde, und durch Fluch Segen, und Glorie durch Schande, und durch Ohnmacht Stärke? Bis auf diese Zeit kannten die überhimmlischen Mächte bloß die einfache und einzigförmige Weisheit Gottes […]. Diese buntfarbige Gestalt der Weisheit Gottes aber, die aus den Verschlingungen der Gegensätze entsteht, wurde ihnen jetzt durch die Kirche offenbart455. Im Fortgang seiner Betrachtung steigert sich Gregor zu dem Gedanken, daß das christologische Paradox – daß das Wort Fleisch wird, daß wir durch seine Wunden geheilt sind, daß seine Ohnmacht die Gegner besiegt und daß in ihm das Unsichtbare sichtbar wird – nicht nur, wie er im Sinn des Epheserwortes sagte, durch die Kirche verkündet, sondern durch sie als Medium erkennbar wird; denn in der Kirche schuf sich Christus die Braut, durch die hindurch die Schönheit des Bräutigams geschaut werden kann. Wie der, der den Glanz der Sonne nicht erträgt, sie „im Abglanz des Wassers“ zu sehen vermag, so lernen die „Freunde des Bräutigams“ im Antlitz der nach den Gesichtszügen Christi gestalteten Kirche „den Unsichtbaren in durchdringenderer Klarheit“ zu erblicken456. Die in Erinnerung an die Selbstbezeichnung des Täufers (Joh 3,29) gewählte Rede von den „Freunden des Bräutigams“ führt, über die gleichsinnige Jüngerbezeichnung auf einem Höhepunkt der Abschiedsreden (Joh 15,15), letztlich zu dem zurück, auf den diese Bezeichnung am meisten zutrifft: zu dem geliebten Jünger, und damit zur Schlüsselfigur des Johannesevangeliums. Ihm ist im höchsten Sinne „alles gesagt“ und nach Joh 19,27 „übergeben“; von ihm gilt im besonderen, daß er nichts hat, was er nicht empfangen hätte (1Kor 4,7); denn der Stoff, aus dem er geschaffen ist, ist der seines Geliebtseins durch Jesus. Insofern führt er in die „esoterische“ Dimension des Evangeliums457, dorthin also, wo der von ihm bis unter das Kreuz und in das Grab Begleitete unverrückt 455 Gregor von Nyssa, Der versiegelte Quell. Auslegung des Hohen Liedes, in Kürzung übertr. u. eingel. v. H. U. v. Balthasar, 3., nach d. krit. Ausg. durchges. Aufl., Einsiedeln 1984, S. 72f. 456 A.a.O., S. 73. 457
165
Die Verzweigung
und unverrückbar am Herzen des Vaters ruht, wo alles, was er vollbringt, seinen Ausgang nimmt und alles, was ihm widerfährt, letztlich ausmündet. Insofern ist der Jesusbegleiter der mystische Exponent des Evangeliums, in dem die für die Mystik typische Inversion figurale Gestalt angenommen hat. Aus demselben Grund ist er der erkenntnisleitende Disponent der Christomathie hin zur Geistesgegenwart, die nun vor jedem weiteren Schritt dazu nötigt, die gesichtete Verzweigung aus ihrer Perspektive zu begreifen. Dazu verhilft die Szene, zu deren Bezeugung sich der geliebte Jünger vor allem aufgerufen weiß, von der Durchbohrung der Seite Jesu, von der es heißt: und sogleich floß Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, bezeugt es, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, daß er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt (Joh 19,34f)458. Wie die kurz zuvor geschilderte Anwesenheit des geliebten Jüngers mit Maria unter dem Kreuz im Rückbezug auf das „Noch-Nicht“ von Kana gelesen sein will, so diese „Verströmung“ im Rückblick auf die Selbstpräsentation Jesu beim Laubhüttenfest, die in dem weisheitlich klingenden Ruf gipfelt: Wenn einer dürstet, komme er zu mir; und es trinke, wer an mich glaubt. Denn so sagt die Schrift: Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Innern fließen (Joh 7,37f)459. Es kennzeichnet die Vergeßlichkeit der heutigen Theologie, daß Joachim Kügler dieses ursprüngliche Satzverständnis in subtiler Beweisführung zu sichern sucht, obwohl der Nachweis von Hugo Rahner, gestützt auf die ältere Vätertradition, schon lange davor erbracht worden war460. Danach bezeichnet sich Jesus der ursprünglichen Lesart zufolge selbst als den Quellgrund der seinem Innern entströmenden Wasser des Heils, während sich unter origenistischem Einfluß die später bevorzugte Interpunktion durchsetze, die den Glaubenden zu einer Quelle der Heilsvermittlung erklärt. In seiner Re-Vision des Textes entwickelte der Endgestalter des Evangeliums daraus die Szene von der Durchbohrung der Seite Jesu, so wie er kurz zuvor bei dem Wort des Gekreuzigten an Maria und den geliebten Jünger das „Noch-Nicht“ von Kana aufgegriffen und szenisch „fortgeschrieben“ hatte. Jetzt stand allerdings der Kreuzestod so sehr im Vordergrund, daß das Motivwort „Wasser“ durch „Blut und Wasser“ vervollständigt werden mußte. Da dieser Rückbezug bei der Erklärung in den Hintergrund geriet, verlagert
458 Dazu: U. Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, a.a.O., S. 300f. 459 A.a.O., S. 132 – 135. 460 H. Rahner, Flumina de ventre Christi. Die patristische Auslegung von Joh 7,37.38, in: ders., Die Symbole der Kirche, a.a.O., S. 175 – 564.
166
8. Die Vielgestalt
sich diese einerseits auf das – heute wieder sehr aktuelle – Interesse der Sicherung des Todes Jesu, das auch durchaus dem Textzusammenhang entspricht, andererseits aber auch auf eine allegorische Deutung, die in Gestalt von Wasser und Blut entweder die beiden Hauptsakramente Taufe und Eucharistie oder aber die durch diese beiden symbolisierte Kirche aus der Seitenwunde Jesu hervorgehen sah461. Im vorliegenden Kontext ist das Echo besonders wichtig, das die Szene im Ersten Johannesbrief gefunden hat. Ohne daß einer „Trennungschristologie“ Zugeständnisse gemacht werden, wie sie von den gnostischen Gegnern vertreten worden zu sein scheint, spricht der Text im Blick auf die Durchbohrungsszene doch von einem zweifachen „Gekommensein“ Jesu: Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist: Jesus Christus; nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dafür Zeugnis ablegt; denn der Geist ist die Wahrheit. Drei sind es also, die Zeugnis ablegen: der Geist, das Wasser und das Blut; und diese drei sind eins (1Joh 5,6ff). Daß hier die Motivworte zur Formel „Wasser und Blut“ umgestellt sind, könnte sehr wohl mit einer damals „verbreiteten Taufchristologie“ zusammenhängen. Ohne deren Ansatz zu bestreiten, hebe die Stelle aber doch – so Hans-Josef Klauck in seinem Kommentar der Johannesbriefe – mit Nachdruck auf das gleichwertige Gekommensein Jesu „im Blute“ ab, das zudem vom „Geist“ bezeugt und bestätigt werde462. Ungeachtet der Identität des Heilbringers, werden damit doch zwei Formen seines Gekommenseins unterschieden, und dies offensichtlich im Gedanken an die im Briefprolog bekundete Erfahrung seiner hörbar, sichtbar und fühlbar gewordenen Präsenz. Sie stellt sich im Sinn dieser Aussage auf zwei Wegen ein: auf dem der im Bildwort des Sich-Verströmens – „Wasser“ – angesprochenen lebenslangen Selbstübereignung Jesu und auf den seiner Todeshingabe – „Blut“. Was eingangs im Blick auf die Lazarusperikope nur postuliert werden konnte, gewinnt damit erheblich an Relevanz: Schon in den neutestamentlichen Spätschriften, vor allem derjenigen johanneischer Provenienz, hebt sich ein Zug zur Duplizierung der Gestalt Jesu ab, auch wenn es sich dabei zunächst nur um unterschiedliche Formen seiner Anwesenheit handelt. Was in den kanonischen Schriften nur Andeutung bleibt, bricht dann in den gnostischen Schriften zu voller Entzweiung und Vielgestaltigkeit auseinander. Sie verdienen schon deshalb erhöhte Beachtung, weil ihnen gerade in diesem Zusammenhang heuristischer Wert zukommt. Denn jenseits der durch die Kanonbildung ebenso praktizierten wie repräsentierten Kontrolle konnten sich in ihnen Motive entfalten, die in der auf die Identität des Erlösers ausgerichteten Kirchenlehre allenfalls andeutungsweise zur Geltung kamen. Wie die vor allem von Martin Werner, Carl Schneider, Karlmann Beyschlag und Eric Osborn zusammengetragenen Fundstellen zeigen463, erfährt im Raum dieses nach- und 461 A.a.O., S. 176. 462 Dazu: H.-J. Klauck, Die Johannesbriefe, Darmstadt 1991, S. 11 – 13; S. 129 (3); S. 148f. 463 M. Werner, Entstehung des christlichen Dogmas, problemgeschichtlich dargestellt, Stuttgart 1941; C. Schneider, Geistesgeschichte des antiken Christentums I, München 1954; K. Beyschlag, Die verborgene Überlieferung von Christus, München u. a. 1969; E. Osborn, Anfänge des christlichen Denkens: Justin, Irenäus, Tertullian, Klemens (The Beginning of Christian Philosophy, 1981), aus d. Engl. übs. u. hrsg. v. J. Bernard, Düsseldorf 1987.
167
Die Verzweigung
außerkanonischen Schrifttums vor allem das von den Thomasakten angesprochene Motiv der „Vielgestaltigkeit“ Jesu eine ungewöhnlich reiche Orchestrierung. Dieser Prozeß setzt schon bei dem Apologeten Justin ein, für den Jesus zugleich „partikular und universal“ ist464: Er ist das von Gott in die Welt hineingesprochene Wort, das sich durch Raum und Zeit erstreckt, und er hebt die Widersprüche der Philosophen in sich auf. Das spiegelt sich in der Vielfalt seiner Namen: König, Priester, Herr, Engel, Mensch und Gott, Haupt, Steuermann, Eckstein. Deshalb sind in ihm auch die über die Könige und Propheten Israels ausgegossenen Geistesgaben geeint und „zur Ruhe gekommen“. Aus demselben Grund weist seine Lebensgeschichte zwei deutlich unterschiedene Phasen auf: in seiner Kindheit eine Zeit der Zurückhaltung, jedoch bereits erfüllt von seiner Macht, die er dann in seinem öffentlichen Wirken zum Besten der Menschen entfaltet. Schon bei seiner Taufe fing das Wasser des Jordans Feuer. So gießt er nunmehr seine Gaben aufs neue über die an ihn Glaubenden aus. Alle, die im Irrtum befangen sind, zieht er in seine befreiende „Gefangenschaft“. Dieser „universale Christus“ hört nie auf, alle zusammenzufassen und alle zu „Freundschaft, Segen, Sinnesänderung und brüderliches Zusammenleben“ zu bewegen465. In den Schriften der Gnostiker erscheint Christus gelegentlich sogar im Stern von Bethlehem, dann als Psalmen singendes Kind im Paradies, als eines der von Herodes ermordeten Kinder, als kleiner Junge, als Zwölfjähriger, als Jüngling „von erhabener Gestalt“, bisweilen mit einer brennenden Lampe in der Hand, als jugendlicher Schäfer, als Steuermann, als einer der Apostel, von denen vor allem Johannes, Philippus, Thomas und Paulus genannt werden, in einer Schau der Montanistin Priscilla sogar als Frau, dann wieder als Greis von „höchster Schönheit“, bald unscheinbar klein, dann riesengroß, jung und uralt, weich und unerbittlich hart, einmal am Kreuz, dann wieder gestaltlos als reines Licht. Das bewegt die apokryphen Thomasakten, wie erwähnt, zum ausdrücklichen Lob seiner „Vielgestalt“: Preis sei dir, vielgestaltiger Jesus, dir sei Preis, der du […] uns ermutigst und stärkst und (Freude) gibst und uns tröstest und in allen Gefahren beistehst und unsere Schwachheit stärkst!466 In den zuletzt aufgeführten Gegensätzen erinnert die polymorphe Gestaltzeichnung Jesu ebenso an die Erscheinung der Kirche im altchristlichen „Hirte des Hermas“ wie an die der „Philosophie“ am Krankenlager des Boëthius, die ebenso jugendfrisch wie hochbetagt wirkt und von schwer bestimmbarer Gestalt ist: Denn bald erschien sie im gewöhnlichen Maß eines Menschen, bald schien sie mit ihrem Scheitel den Himmel zu berühren467. Darin gleicht sie der dem Hermas erscheinenden Kirche, die diesem zunächst wie eine Greisin, dann von jugendlichem Gesicht, aber altem Körper und grauen Haaren vor464 Dazu: E. Osborn, Anfänge des christlichen Denkens, a.a.O., S. 291f. 465 Ebd. 466 Thomasakten 153, in: W. Schneemelcher (Hg.), Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung, Bd. 2: Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes, Tübingen 5/1989, S. 361; dazu: E. Biser, Der inwendige Lehrer, a.a.O., S. 23: Der Vielgestaltige. 467 Boëthius, Trost der Philosophie I, 1. Prosa, a.a.O., S. 2.
168
8. Die Vielgestalt
kommt, um schließlich ein jugendschönes Aussehen anzunehmen. Dabei wird ihm nachträglich klargemacht, daß es sein eigener, zunächst gealterter und dann erneuerter Geisteszustand war, der ihm die Gestalt der Kirche einmal greisenhaft und dann verjüngt erscheinen ließ468. In dieser Verspannung von groß und klein, jung und alt, streng und mild, universal und partikular wird, wenngleich in bildhafter Sprache, die Dialektik sichtbar, in der die Christusgestalt jeweils gesehen wird – und gesehen sein will. Im Vorblick auf die irenäische Rekapitulationslehre könnte man sogar sagen, daß Christus die Gegensätze des Daseins und des Denkens in sich umgreifen, integrieren und aufheben muß, um „allen alles“ zu sein, den Kindern ein Kind, den Armen ein Bettler, den Mächtigen ein Herrscher, den Denkenden das Licht, den Sehnenden die Hoffnung, den Ringenden der Friede. Mehr noch: Es hat sogar den Anschein, als ob es der seltsamen Duplizierung der Christusgestalt, ihrer Entzweiung in Gegensatzpaare, bedurfte, damit diese dialektische Sicht erschlossen und damit in Christus der Schlüssel zu dem die Welt ebenso zerreißenden wie bewegenden Gegensätzen gewonnen werden konnte. Indessen sind in dieser Sicht die Extreme nicht nur dialektisch verspannt; vielmehr bringt es deren genuine Bildhaftigkeit mit sich, daß Zwischen- und Übergangsformen in Erscheinung treten, die einerseits der Jesus-Vita, andererseits aber auch der frühen Christologie entsprechen. Demgemäß erscheint Jesus einmal als Kind, dann als Heranwachsender, als Jüngling in apollinischer Schönheit, als Hirt und Steuermann, als ein – offensichtlich sich selbst sendender – Apostel, als Gekreuzigter und als reines Licht, vermutlich der Abglanz seiner Verherrlichung. Das sind, in ihrer Konsekution gesehen, die Stadien der Lebensgeschichte Jesu, die sich so als der lebendigkonkrete Inhalt dessen erweist, was die Dialektik formal umreißt. Das wirkt zunächst wie eine kaleidoskopartige Zusammenschau dessen, was Jesus war, doch die Dialektik hat, zweifellos nicht erst in der Konzeption Hegels, nicht so sehr retrovertierten als vielmehr prospektiven Charakter. Sie will „nach vorwärts“, mit Erich Przywara gesprochen: „flußaufwärts“, gedacht und gelesen werden. So gesehen handelt es sich hier um die Weichenstellung, an der sich die christomathische Sicht definitiv von der rückschauend-christologischen abhebt. Im Anschein, daß hier lebensgeschichtliche Daten rekapituliert werden, geht es tatsächlich um die Wirkungsgeschichte Jesu, verstanden als die Wirkungsgeschichte dessen, der nicht nur in seinen Folgen, sondern in diesen und durch diese selber fortlebt.
468 Der Hirt des Hermas II,4.1; III,11-13, in: K. Berger u. C. Nord, Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, a.a.O., S. 824; S. 833f.
169
Sechstes Kapitel
Das Fortleben 1. Die Konzeption
W
enn die Rede vom „fortlebenden Christus“ – das Hauptthema der Geistesgegenwart – konkrete Gestalt annehmen soll, muß zunächst die Christomathie als die der Geistesgegenwart zugrundeliegende Denkweise in Erinnerung gerufen werden. Sie wurde intuitiv eröffnet durch die Erkenntnis Kierkegaards, daß Jesus als Person alle seine Wirkungen überragt, so daß diese, wenn sie voll gewichtet werden sollen, in seinen „Gestaltbegriff“ integriert und er seinerseits zu ihnen hinzugedacht werden muß. Im Grunde war das bereits in den Nominaldefinitionen mitgesagt, die Jesus die Weisheit, den Glauben, die Hoffnung und den Frieden nannten. Denn im Rückschluß ist mit ihnen zum Ausdruck gebracht, daß sich die religiöse Weisheitssuche letztlich auf ihn bezieht – dies ist, nebenbei bemerkt, die zentrale Rechtfertigung des Konzepts einer „christlichen Philosophie“ –, und daß im Glauben ebenso wie in der Hoffnung und im Frieden nicht nur ein Schattenwurf seiner Lebensleistung, sondern Jesus selbst angetroffen, erreicht und gefunden wird. Explizit wird diese Weichenstellung jedoch erst durch die vom Epheserbrief gesetzten Markierungen. Die erste betrifft die – mit zentralen Wendungen der johanneischen Abschiedsreden übereinstimmende – Aussage, daß Christus in den Herzen der Glaubenden „wohne“ (Eph 3,17), die zweite, noch signifikantere, das Wort vom Heranreifen der Glaubensgemeinschaft zum „Vollalter Christi“ (Eph 4,13). Denn damit wird zweifellos eine geschichtliche, wenn nicht gar eine die Gesamtgeschichte durchgreifende Perspektive eröffnet. Mehr noch: Hier wird ein „Christusbild im Werden“ entworfen, der Umriß einer Gestalt, die sich aus dem Glauben der Vielen erhebt, sie einbegreift und überwächst und durch sie zur Vollendung gelangt. Auch wenn das im Zug der Naherwartung schon für eine nahe Zukunft in Aussicht genommen sein sollte, ist doch keine zeitliche Grenze gezogen, so daß der angesprochene Prozeß, so sehr er partiell ans Ziel gelangen könnte, grundsätzlich für den gesamten Geschichtsverlauf gilt. Wichtiger noch für die Bestimmung der Denkweise ist jedoch der zugrundeliegende Geschichtsbegriff, der als solcher wohl erstmals von Martin Kähler ausgearbeitet wurde. Denn er unterschied in Abgrenzung vom historischen Begriff der Geschichte eine geschehene und eine geschehende Geschichte, wobei er sich bewußt auf das Hineinwirken der Ereignisse und Taten in die Folgezeit bezog469. Damit verletzte er den Ansatz der historischen Kritik an seiner empfindlichsten Stelle. Denn diese widerspricht bei aller Effizi469 Dazu: M. Kähler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus (1892), neu hrsg. v. E. Wolf, 2., erw. Aufl., München 1956, S. 37 – 39.
170
1. Die Konzeption
enz der biblischen Denkweise nicht etwa durch das – von dieser durchaus geteilte – Moment der Kritik, wohl aber durch ihren Geschichtsbegriff, der sich faktizistisch auf das Gewesene und als solches im Abgrund der Vergangenheit Versunkene bezieht, Gedanken eines Fortwirkens jedoch ausblendet. Daß von dem Kählerschen Geschichtsverständnis aber nicht nur eine Methode, sondern die philosophische Denkform insgesamt betroffen ist, brachte Franz Rosenzweig in den bereits erwähnten Prolegomena zu seinem Jahrhundertwerk „Der Stern der Erlösung“ ans Licht. Denn er verfolgte den faktizistisch verengten Geschichtsbegriff zurück bis in das philosophische Initiationserlebnis des Staunens, indem er, einer Weisung des allgemeinen Sprachgebrauchs folgend, von der „Starrheit des Staunens“ sprach. In der Diagnose, die er in seinem „Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand“ dem von dieser Starrheit befallenen Menschengeist stellte, heißt es: Der Patient hat sich zu Bett legen müssen, er konnte plötzlich keine der notwendigen Handlungen des Alltags mehr vollbringen. Er fühlte sich wie gelähmt. Die Starrheit des Staunens hatte ihn befallen. Seine Hände mochten nicht mehr zugreifen, denn wer gab ihnen das Recht des Griffs, seine Füße mochten nicht mehr ausschreiten, denn wer verbürgte Boden ihrem Tritt. Seine Augen mochten nicht mehr ausschauen, denn wer bewies ihnen, daß kein Traum sie narre. Und so mochten seine Ohren nicht mehr hören, denn wer war der andere, auf den sie hätten hören sollen, sein Mund nicht mehr reden, denn lohnte es sich, ins Leere schöpfen?470 Das zwingt zur Frage nach einer möglichen Alternative zum philosophischen Staunen, die nicht der mit dem Starrheitsmoment bezeichneten Einseitigkeit unterliegt. Im Gespräch mit seinem Kritiker Gerhard Krüger verwies Guardini in vergleichbarem Zusammenhang auf die Sorge, die nicht nur das Wesen eines Sachverhalts, sondern auch dessen Folgen in den Blick nehme471. Indessen tritt bei diesem Vorschlag die Negativität noch deutlicher zutage als im Fall des Staunens. Deswegen wird man sich, wenngleich mit Hilfe einer der gewagten Etymologien Heideggers, eher noch vom Denken an das Danken verweisen lassen und zusehen, ob nicht in der Dankbarkeit der gültigere Schlüssel vorliegt472. Denn für sie ist das Vorhandene ein im Vollsinn des Wortes „Gegebenes“, das als solches ebenso zurückweist auf eine Herkunft, der es sich verdankt, wie es auf eine Zukunft vorausweist, die sich mit der Einsicht in die mit dem Gegebenen gestellte Aufgabe auftut. Auffällig spiegelt sich dieser Befund in der Einschätzung, die die konkurrierenden Begriffe in den neutestamentlichen Schriften finden. Vom Staunen der Zuhörer ist ausdrücklich bei Jesu Antrittsrede in Nazaret die Rede:
470 F. Rosenzweig, Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand, a.a.O., S. 34. 471 Dazu: Unsere geschichtliche Zukunft. Ein Gespräch über „Das Ende der Neuzeit“ zwischen Clemens Münster, Walter Dirks, Gerhard Krüger und Romano Guardini, Würzburg [1953], S. 53 – 94: G. Krüger, Unsere geschichtliche Zukunft; S. 95 – 108: R. Guardini, Unsere geschichtliche Zukunft. Eine Antwort auf Gerhard Krüger, S. 96f. 472 Dazu nochmals: M. Heidegger, Gesamtausgabe Abt. 1, Bd. 8: Was heißt Denken?, a.a.O., S. 149ff.
171
Das Fortleben
Alle staunten über die Worte der Huld, die aus seinem Mund kamen. Und sie sagten: Ist das nicht der Sohn Josefs? (Lk 4,22) Wie der Fortgang der Stelle zeigt, führt hier das Staunen nicht zur Erstarrung, sondern zu jener Selbstverweigerung, die in der Sprache des Evangeliums „Ärgernis“ heißt (Lk 4,28f). Noch deutlicher ist die wiederholte Absage an die Sorge, die sich nicht einmal auf den kommenden Tag beziehen soll, geschweige denn auf Nahrung und Kleidung (Lk 12,22). Das müßte der zur Gotteskindschaft Berufene schon von den Lilien des Feldes lernen, die, obwohl sie weder arbeiten noch spinnen, besser gekleidet sind als Salomon in seiner Königspracht (Lk 12,27). Dagegen fordert Jesus die Dankbarkeit ausdrücklich ein, doch das nicht etwa aus persönlichem, sondern aus betont altruistischem Interesse. Denn nur dem einen der zehn geheilten Aussätzigen, der zurückkehrt, um seinem Retter zu danken, gilt das Wort, das dessen vollständiges Heilsein bewirkt: „Steh auf, dein Glaube hat dich gerettet“ (Lk 17,19). Keiner stimmte sich auf dieses Geheiß entschiedener ein als Paulus, der fast alle Briefe mit einer Danksagung an Gott eröffnet (Röm 1,8; 1Kor 1,4; Phil 1,3; Phlm 1,4) und die Adressaten des Kolosserbriefs auf dem Höhepunkt seiner Paränese auffordert: In euren Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder seines Leibes. Seid dankbar! (Kol 3,15) Anfang und Ziel der Christomathie könnten schwerlich genauer bestimmt werden. Denn ihr Ziel kann nur das sein, was der johanneische Jesus seine ureigene und nur von ihm zu erhoffende Gabe an die Menschheit nennt: seinen Frieden (Joh 14,27). Ebenso kann ihre denkerische Initiation nur in der dankbaren Einstimmung auf die zu erhoffende Selbstvergegenwärtigung Jesu bestehen. Denn unter allen Vorgaben und Vorgegebenheiten ist für den Glauben und seine genuine Theorie, die Christomathie, diese mystische Entgegenkunft die wichtigste. Wenn das feststeht, spitzt sich aber alles in die Frage nach dem Sensorium zu, das ihr zur Wahrnehmung dieser Entgegenkunft verhilft. Es ist dies die Frage nach ihrem kognitiven Organ und nach der sie kennzeichnenden Sehweise.
2. Das Sensorium Beim Versuch einer Beantwortung dieser Frage wird man sich zunächst an die Ausgangsposition des Gedankengangs zu erinnern haben, der mit einer Invokation begann. Sie aber war Ausdruck des Bestrebens, den schwankend gewordenen Glauben auf einen, um nicht zu sagen auf d e n festen Grund zu bringen. Wenn er gefunden werden soll, muß zunächst die kognitive Fähigkeit des Glaubens geklärt werden, und dies vor allem im Bruch zu der verbreiteten Ansicht, die sich in der Redewendung vom „blinden Glauben“ niederschlug. Denn der Glaube ist das akkurate Gegenteil: Er ist ein sehendes Gesehensein, das den Epheserbrief veranlaßt, von den „erleuchteten Herzensaugen“ seiner Adressaten zu reden (Eph 1,18). Darauf stützte sich der unter tragischen Umständen im Ersten Weltkrieg gefallene Jesuitentheologe Pierre Rousselot, als er in seinem denkwürdigen Essay „Die Augen des Glaubens“ dem Glauben eine von der „Seinsliebe“ geleitete Erkenntniskraft zuschrieb und dabei den ein halbes Jahrhundert später von Jürgen Habermas herausgearbeiteten Zusammenhang von Erkenntnis und Interesse ansprach, denn: 172
2. Das Sensorium
Nicht nur bestimmt jede affektive Haltung eine Sicht durch Liebe, vielmehr ist jede Sicht überhaupt eine Sicht durch Liebe […] Die Vernunft, hingerissen, sozusagen bezaubert und fasziniert von dem Gott, der ihr die Kraft gab, ihn zu fassen, ist nichts anderes als pure Liebe zum Sein473. Durch die Liebe erfährt die Vernunft somit jene befreiende Entschränkung, die sie im Sinne des scholastischen Grundsatzes: „ubi amor, ibi oculus“, sehen läßt, daß die geoffenbarte Gotteswahrheit glaubwürdig ist. Wie Rousselot mit seiner Vorwegnahme der Idee des erkenntnisleitenden Interesses auf Habermas vorausgriff, griff er mit der Vorstellung von der befreienden und horizonterweiternden Wirkung der Liebe auf den Möhlerschen Gedanken von dem durch die Einigungskraft der Liebe zustande kommenden kollektiven Erkenntnissubjekt zurück. Faßt man das mit der Intuition Rousselots zusammen, so erscheint die vom göttlich-größten Gut faszinierte und zu ihm hingerissene Liebe als das erkenntnisleitende Interesse des Glaubens, dies jedoch so, daß dadurch dessen Subjekt nach Eph 4,13 erweitert und in die Gemeinschaft der Mitglaubenden integriert wird. So entsteht ein geistiges Universum, das als lebendige Spiegelung des Göttlich-Größten im Unterschied zu dem in seine Perspektivität eingegrenzten Individuum erst wirklich zur Gotteserkenntnis fähig ist. Auf die Frage nach dem zu dieser „Universalisierung“ verhelfenden Prinzip antwortet Adam Möhler in seiner Jugendschrift „Die Einheit in der Kirche“: In der Liebe erweitern wir uns, die Einzelwesen, zum Ganzen: die Liebe erfasset Gott474. Doch der Gedanke Rousselots hat noch ungleich tiefere Wurzeln. Er führt zurück zur Überzeugung der mittelalterlichen Sozialmystiker von der gegenseitigen Einwohnung der in Glaube und Liebe Verbundenen, von da zurück zu Augustinus’ Rückführung des menschlichen Liebeserweises auf den sich in den Seinen liebenden Christus – „unus Christus amans seipsum“475 –, um schließlich, vermittelt durch die johanneische Zurücknahme der Liebe auf ein vorgängiges Geliebtsein durch Gott (1Joh 4,20), bei der Symbolfigur des geliebten Jüngers anzulangen, der jetzt in seiner Rolle als Jesusbegleiter genauer in den Blick genommen werden muß. Zuvor aber muß diese Bezeichnung erläutert werden, die keineswegs aus der Luft gegriffen, sondern einer Rätselfigur des auf den Gotenkönig Theoderich zurückgehenden christologischen Mosaikzyklus von Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna entnommen ist476. Es ist die Figur des Christusbegleiters, der auch dort auftritt, wo das Evangelium – wie in der Szene am Jakobsbrunnen – die Anwesenheit der Jünger ausdrücklich verneint (Joh 4,8) und der das Verhalten Jesu mit akklamatorischen und bezeugenden Gesten 473 P. Rousselot, Die Augen des Glaubens (Les yeux de la foi, 1910), aus dem Franz. übs. v. A. Mantel u. a., Einsiedeln 1963, S. 53. 474 A. Möhler, Die Einheit in der Kirche oder das Princip des Katholicismus, Tübingen 2/1843, S. 100. 475 Augustinus, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus decem, 10,3, in: ders., Opera omnia, hrsg. v. J.-P. Migne, Bd. 3.2 (PL, Bd. 35), Paris 1902, Sp. 1977 – 2062, Sp. 2055. 476 Dazu: C.-O. Nordström, Ravennastudien. Ideengeschichtliche und ikonographische Studien über die Mosaiken von Ravenna, Stockholm 1953, S. 55 – 87.
173
Das Fortleben
kommentiert. Insofern wirkt er wie eine „Verlängerung“ der Auftritte des geliebten Jüngers bis in die Anfänge der Wirksamkeit Jesu zurück. Was jetzt aber in den Vordergrund tritt, ist seine kollektive Stellvertreterfunktion. Denn gerade in seiner ravennatischen, zweifellos durch arianische Glaubensvorstellungen eingegebenen Darstellung steht er für die teils gegenwärtige, teils abwesende Jüngergruppe und, wesentlicher noch, für den Glauben der Betrachter des Zyklus. So aber ist er Medium im zweifachen Sinn des Ausdrucks: nicht nur der Vermittler des in Jesus hörbar, sichtbar und fühlbar gewordenen Offenbarungswortes, sondern auch Übereigner der glaubenden und liebenden Zustimmung der Seinen an ihn. Und als die Vorbedingung dessen: das leibhaftige Sensorium ihrer Einfühlung in das von ihnen geglaubte und mit ihrer Liebeskraft umgriffene Gottesgeheimnis. Während der Rückgang zum Ursprung zuletzt bei der Verkörperung des Sensoriums anlangte, führt die Gegenrichtung zur theoretischen Klärung. Dort sind neben dem eher beiläufig erwähnten Jürgen Habermas vor allem Martin Buber und Peter Wust zu nennen. Wust wegen seiner Vorstellung von einem die Individuen verbindenden und zu einer gegenseitigen Interaktion verknüpfenden „nexus animarum“477, die sich ihm vermutlich durch die Gedankenwelt des Nikolaus von Kues nahegelegt hatte, insbesondere durch dessen Prinzip des „quodlibet in quolibet“, dieser wechselseitigen Durchdringung der Einzelwesen, wie sie das Zweite Buch der „Docta ignorantia“ annimmt478. Demgegenüber entwickelte Buber, gestützt auf sein dialogisches Prinzip, die für die theoretische Vertiefung hochbedeutsame Idee des „Zwischenmenschlichen“, zu dem sich die Interaktion der Individuen aufbaut, um in ihm ihr stabilisierendes Zentrum und ihre ideale Aktionsmitte zu gewinnen479. Es ist die von Alexander von Villers und von Ferdinand Ebner vorweggenommene Entdeckung, daß sich in der Kommunikation von Ich und Du etwas „zuträgt“, was beide überwächst und sie zu einer ihr jeweiliges Zentrum überbietenden Einheit verbindet480. Bietet sich damit nicht ein neuer Zugang zum Jesusbegleiter an? Gewiß, er ist ganz aus dem Stoff der ihn umfangenden Liebe Christi gebildet. Doch steht er als Idealfigur zugleich für die, auf die sich diese Liebe konkret bezieht. Das sind fraglos alle, die sich gleich ihm in das Leidensgeheimnis Jesu vertiefen und ihm in das Geheimnis seiner Auferstehung folgen. Insofern baut er sich nach Art des „Zwischenmenschen“ zwischen den Lesern und dem im Text des Evangeliums Gemeinten auf, um ihre Gedanken und Emotionen – wie es der Philipperbrief vom Frieden sagt – nach Art eines regulativen und integrativen Prinzips zu bestimmen481. Wenn der Philipperbrief dem Frieden genauer noch zuschreibt, daß er „Gedanken und Herzen in Christus Jesus bewahrt“ (Phil 4,7), besagt das für den Christusbegleiter, daß er in erster Linie für die Anwesenheit und die unterschiedlichen Formen, hauptsächlich aber für die die Seinen umgreifende und umfangende Selbstvergegenwärtigung Jesu sensibilisiert. So aber ist seine Bezeichnung als Sensorium erst voll gerechtfertigt. Doch worin besteht die von Buber ebenso wie von Wust angesprochene kommunikative Qualität des Motivs? 477 P. Wust, Die Dialektik des Geistes, Augsburg 1928, S. 512 – 530. 478 Nikolaus von Kues, De docta ignorantia – Die wissende Unwissenheit II, c. 5, in: ders., Philosophisch-theologische Schriften, Bd. 1, a.a.O., S. 344 – 349. 479 M. Buber, Elemente des Zwischenmenschlichen, in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 267 – 289. 480 A.a.O., S. 289; ders., Zur Geschichte des dialogischen Prinzips, a.a.O., S. 291 – 305, bes. S. 300; ferner: Th. Steinbüchel, Der Umbruch des Denkens. Die Frage nach der christlichen Existenz, erläutert an Ferdinand Ebners Menschdeutung, Regensburg 1936; E. Biser, Buber für Christen, Freiburg i. Br. u. a. 1988, S. 78 – 85: Das Zwischenmenschliche. 481 Dazu: E. Biser, Das Antlitz, a.a.O., S. 95f: Der Zwischenmensch.
174
2. Das Sensorium
Eine deskriptive Antwort darauf gab schon Guardini, als er diesen Synergismus zur Vorstellung von einem wechselseitigen Sukkurs der Glaubenden, selbst ohne deren Wissen, fortentwickelt482. Auf den Begriff gebracht wurde sie jedoch erst von der lateinamerikanischen Befreiungstheologie, sofern sie die von der politischen Theologie vollzogene Korrektur der privatistischen Engführung des theologischen Gedankens mit der Wiederentdeckung des kollektiven Glaubenssubjekts krönte. Denn, wie Claus Bussmann betont: Subjekt dieser Theologie ist nicht das Individuum – der theologische Denker –, sondern ein Kollektiv – das Volk –‚ aus dessen Mitte heraus der Theologe sie formuliert483. Wenn das zu einer genaueren Bestimmung des Sensoriums verhelfen soll, muß es in vertikaler und horizontaler Richtung genauer ausgeleuchtet werden. Vertikal: In diesem „Ganzen“ spiegelt sich das Göttlich-Größte nicht direkt, sondern, wie es der Ausdruck nahelegt, im „Spiegel“ der schon von der alttestamentlichen Weisheitsspekulation so bezeichneten und von Paulus mit Jesus ausdrücklich identifizierten und – zumindest ansatzweise – zur Strukturierung seines Heilswegs herangezogenen Mittelbegriffs der „Weisheit“. In dieser Weisheit und den unterschiedlichen Formen ihrer Konkretisierung erblickt das kollektive Glaubenssubjekt sein Hochbild; bei dessen Anblick erwacht es zum Bewußtsein seiner selbst. Hier rührt es dann aber auch an das Geheimnis des in den Seinen fortlebenden Christus und an die spezifischen Erscheinungsweisen seiner Anwesenheit, letztlich sogar an die „Orte“ seiner Einwohnung und seines Fortwirkens in dem, was die romantische Theologie als den „Geist des Christentums“ bezeichnete. Demgegenüber stößt die horizontale Ausleuchtung auf die unterschiedlichen Formen innerkirchlicher Interaktion und Solidarität, angefangen von der Gemeinde und Gruppen, Ordens- und Schulbildung bis hin zu jenen Formen übergreifender Verständigung, in denen Rahner das Organ kollektiver Konsensbildung und Wahrheitsfindung erblickte484. Da diese Übereinkunft aus unterschiedlichen Formen gläubiger Interaktion erwächst, ist darin auch das selektiv-diakritische Moment gegeben, das dem Sensorium zur Wahrnehmung einzelner Formen der Anwesenheit verhilft. So entspricht der Gemeindebildung die sakramentale, der Ordens- und Gruppenbildung die charismatische, der karitativen Dienstleistung die im Gleichnis vom Weltgericht (Mt 25,31-46) angesprochene funktionale und der Schul- und Richtungsbildung die ideelle Form. Doch dadurch wird der Gedanke des Fortlebens keineswegs gesprengt, da alle Formen in diesem Leitgedanken integriert und eingebunden sind. Paulus, der angesichts der Vielfalt der in Korinth kultivierten Charismen vor einer ähnlichen Frage stand, fand die Lösung im Begriff des die unterschiedlichen Geistesgaben wie seine Glieder umgreifenden Herrenleibs485. Daß sich die Suche nach dem differenzierenden Moment hier auf der richtigen Spur befindet, bestätigt sich dadurch, daß Paulus zu den Geistesgaben auch die der Hermeneutik und der Unterscheidung (1Kor 12,10) rechnet. Sie sind, wie der erste Fall lehrt, ge482 Dazu nochmals: R. Guardini, Die Existenz des Christen, a.a.O., S. 409. 483 C. Bussmann, Befreiung durch Jesus? Die Christologie der lateinamerikanischen Befreiungstheologie, München 1980, S. 27. 484 Dazu: K. Rahner, Kleines Fragment „Über die kollektive Findung der Wahrheit“, in: ders., Schriften zur Theologie, Bd. 6, Einsiedeln u. a. 1965, S. 104 – 110. 485 Dazu: E. Biser, Der unbekannte Paulus, a.a.O., S. 126.
175
Das Fortleben
fragt, wenn der Überschwang des Geistes die Sprachgrenzen durchbricht und wenn es gilt, das Gestammel der „Zungenreden“ in die Ordnung des Verständlichen zurückzuholen. Nicht weniger gefragt sind sie – so der zweite Fall –‚ wenn es darum zu tun ist, im Widerstreit der Lehrmeinungen die richtige von den abweichenden zu unterscheiden. Doch damit verlagert sich die Suche von den kultischen und sozialen Formen des Fortlebens Jesu auf die ideellen und strukturellen, aber auch auf die spirituellen und mystischen, sofern man nur bedenkt, daß dem Zungenreden, auf das sich die geistgewirkte Hermeneutik bezieht, das Erlebnis eines inspirativen Ergriffenseins durch den Erhöhten zugrundeliegt. In der Verzweigung kommt es so zu einer Abzweigung, bei der sich der Blickpunkt des suchenden Interesses von den etablierten Formen des Fortlebens zunehmend auf die spontanen und „sublimierten“ verlagert.
3. Das Panorama Jetzt schon zeichnet sich ein ganzes Panorama von Erscheinungsformen und „Fundstellen“ der Geistesgegenwart ab. Dabei läßt der erste Begriff eher an dynamisch-geschichtliche, der zweite eher an statisch-lokale Formen denken. Bei der ersten Gruppe muß nochmals zwischen „momentanen“ und „kontinuierlichen“ Formen unterschieden werden. „Momentan“, also als unerwartete Eingebung und Entgegenkunft, wenn nicht geradezu als mystischer Einbruch, werden insbesondere die visionären Formen der Selbstvergegenwärtigung Jesu erlebt, die in den Ostererscheinungen ihren Anfang nehmen. Gegen deren verhaltene oder offene Anzweiflung in der heutigen Diskussion muß an dem Fulgurationscharakter dieser Erscheinungen festgehalten werden. Das schließt „vorösterliche“ Vorgaben des Osterglaubens umso weniger aus, als ohne diese „kategorialen Dispositionen“ die Erscheinungen als die des Auferstandenen gar nicht hätten wahrgenommen werden können. Indessen bestehen diese Vorgaben nicht in einem aktiv durchgehaltenen Glauben der Jünger, sondern allenfalls in dessen kontinuierlicher Ermöglichung durch die Zusicherung Jesu, er werde den Kelch der Tischgemeinschaft mit ihnen neu trinken im kommenden Gottesreich (Mk 14,25). Das Dilemma, in das die theologische Osterdiskussion an dieser sensibelsten Stelle geriet, ist, wie nicht nachdrücklich genug betont werden kann, die Folge der fast durchgängigen Vernachlässigung des paulinischen Osterzeugnisses. Denn der Protokollsatz: „Ich habe den Herrn gesehen“ (1Kor 9,1; 15,8), auf den sich alle Aussagen der in den Evangelien erwähnten Zeugen zurückführen lassen, erlaubt in seiner unauflöslichen Prägnanz keinen Rückschluß auf das Zustandekommen der die Zeugnisse tragenden Gewißheit. Ganz anders verhält es sich mit dem „antwortenden Osterzeugen“ Paulus, der geradezu auf kritische Rückfragen nach dem Motto seines Ostererlebnisses gewartet zu haben scheint. Er tritt aus dem Verbund der sich nur stilistisch und theologisch profilierenden Autoren als einziger in scharf konturierter Individualität hervor. Und er zerschlägt den Knoten der sich überschneidenden Rezeptionsprobleme, indem er zu den Lesern seiner Briefe ein unmittelbar dialogisches Verhältnis aufnimmt. Dabei arbeitet er gleichzeitig die mit seinem Zeugnis gegebene Rezeptions- und Medienproblematik auf. Das eine durch seinen Begriff des „inneren Briefs“ (2Kor 3,2f), durch den der Leser insofern zum „Mitautor“ wird, als er sich das Mitgeteilte durch den Zuspruch des Geistes bereits „gesagt sein“ ließ. Das zweite durch sein Theorem vom „toten Buchstaben und lebendig machenden Geist“ (2Kor 3,6), das dem Ansinnen an die Leser gleichkommt, die durch 176
3. Das Panorama
die Medialstruktur – im Sinne des „verbum abbreviatum” und des „verbum extensum“ – fragmentierte Aussage durch geistgegebene Lesarten zu kompensieren. Von daher gewinnt die Paulusfrage: „Habe ich nicht den Herrn Jesus gesehen?“ (1Kor 9,1), eine den Protokollsatz der übrigen Osterzeugen weit überbietende Relevanz. Im Kontext seiner weiteren Aussagen (Gal 1,15f; 2Kor 3,17f; 4,6; Phil 3,12) gelesen, bildet sie den Auftakt zu seinem Versuch, den Leser in sein Ostererlebnis hineinzunehmen. Was ihm vor Damaskus „aufging“, war ein Zuspruch, der ihm auf visionäre Weise „einleuchtete“ und ihn zugleich mit verwandelnder Kraft „ergriff“. Darin zeichnet sich bereits der Grundriß aller späteren Präsenzerlebnisse ab, sofern sie momentan-visionäres Gepräge aufweisen, nur mit dem Unterschied, daß im einen Fall mehr das akustische, im anderen das optische oder haptische Element in den Vordergrund tritt. Mit einem akustischen Eindruck setzt die Eingangsvision der Apokalypse ein, die ihren Drehpunkt in der nahezu paradoxen Aussage des Visionärs hat: Da wandte ich mich um, um die Stimme zu sehen, die zu mir redete (Apk 1,12). Demgegenüber tritt in der Stephanusvision der geschaute Inhalt ausschließlich ins Bild. Was dieses zu sagen hat, kommt im Vergleich zur „Selbstanzeige“ Jesu – „von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen“ (Mk 14,62) – darin zum Ausdruck, daß Jesus zur Rechten Gottes „steht“ (Apg 7,55f). Damit verglichen, hebt die Ostia-Vision, in der Augustinus sein Bekehrungserlebnis ausmünden läßt, das haptische Moment hervor. Was Sohn und Mutter bei ihrem geistigen Aufstieg durch alle Stufen der Weltordnung erleben, ist eine Befestigung im wandellosen Sein der ewigen Weisheit, die sie „mit einem vollen Herzschlag“ berühren. Ähnlich ergeht es Dostojewskijs Aljoscha, dem „engelgleichen“ unter den Brüdern Karamasow, in der großen Initiationsstunde seines Lebens, von der es heißt: Ihm war, als träfen von all diesen zahllosen Welten Gottes unsichtbare Fäden in ihm zusammen, und seine Seele erbebte „in der Berührung mit anderen Welten“. […] Und mit jedem Augenblick fühlte er immer deutlicher, wurde es ihm immer mehr bewußt, daß etwas Festes und Unerschütterliches, wie dieses Himmelsgewölbe, in seine Seele einzog – wie eine Idee sich seines Verstandes bemächtigte, und zwar für sein ganzes Leben und für alle Ewigkeit486. In dieser Auffächerung dessen, was die Ostererscheinungen in einzelnen Komponenten an Qualität enthalten, zeigt sich auf das deutlichste, daß die angesprochenen Visionen, mit Ausnahme wohl der Stephanusvision, nicht auf derselben Ebene wie jene liegen. Zwar haben die christlichen Visionen in einer noch näher zu bedenkenden Weise ihren Ursprung in den Ostererscheinungen, doch gehören diese schon auf Grund ihres unaufhebbaren Geschichtsbezugs, nicht weniger aber auch auf Grund ihres Inhalts, einer eigenen, höheren Ordnung an, denn, so Schelling: 486 Zitiert nach: R. Guardini, Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk. Studien über den Glauben (1933), in: ders., Werke, hrsg. v. F. Henrich, Sachbereich Gestalt- und Werkdeutungen, Mainz u. a. 1989, S. 120.
177
Das Fortleben
Tatsachen dieser höhern Geschichte, wie die Auferstehung Christi, sind wie Blitze, in denen die innere Geschichte in die äußere, sie durchkreuzend, durchbrechend, hervortritt487. Unüberhörbar ist damit das Lessingproblem des garstigen breiten Grabens angesprochen, der das „ein für alle Mal“ und als solches uneinholbar Geschehene von dessen geschichtlicher Fortwirkung und dem Glauben daran trennt. Man könnte die Differenz zwischen den Ostererscheinungen und den die Glaubensgeschichte durchziehenden Christusvisionen dadurch verdeutlichen, daß man sie einander wie das Original den Reproduktionen entgegensetzt und dies als die Höchstform der Interpretationsgeschichte des Ostergeschehens bezeichnet. Doch Interpretationen holen das einst Gesagte und Geschehene nur intentional, nicht aber wirklich aus der Vergangenheit herauf. Dazu ist nur das Geschehene selbst im Stande und auch dieses nur im Grenzfall der Auferstehung Jesu. Denn sie bildet den einzigartigen Fall eines Geschichtsereignisses, das seinem Wesen nach nicht in die Geschichte „eingeht“ und in ihrem Strom versinkt, sondern dies als Gestaltungsmacht durchwirkt, um an ihrem Ende alles Geschehen an sich zu reißen. Noch flüchtiger als die visionären Erlebnisse wirken die vor allem in der Frühzeit des Christentums und hier besonders an der kirchlichen Randszene auftretenden Charismen. Von der Bemühung des Apostels Paulus, sie in die Ordnung des Gemeindelebens einzubinden, ist in den um die Mitte des zweiten Jahrhunderts entstandenen „Oden Salomos“ nichts mehr zu spüren. Vielmehr versichert ihr Verfasser: Wie der Wind die Saiten der Zither zum Schwingen bringt, daß sie singen, so schwingt der Geist des Herrn in meinen Gliedern488. Daß dieses exzessive Charismatikertum gerade in Phrygien, der Heimat des vor allem durch den späten Tertullian bezeugten Montanismus, um sich griff, könnte nach der Vermutung von Ronald A. Knox mit der dort noch nachwirkenden Verehrung der Kybele zusammenhängen, deren orgiastische Kulte überregionales Aufsehen erregten. Von dort sprang die von dem Ekstatiker Montanus gegründete und von den Prophetinnen Priscilla und Maximilla geförderte Bewegung nach Nordafrika über, wobei sie zunehmend asketischen und apokalyptischen Charakter annahm489 – weshalb sich Tertullian, ihr wortgewaltiger Propagandist, fragen konnte, was denn die Nahrungssorgen mit dem Jüngsten Tag zu tun haben. Doch selbst der große Gnosiskritiker Irenäus erklärt: … wer vermöchte alle die Gnaden aufzuzählen, welche die Kirche auf der ganzen Welt von Gott empfängt490. 487 F. W. J. v. Schelling, Urfassung der Philosophie der Offenbarung, hrsg. v. W. E. Erhardt, Teilbd. 2, Hamburg 1992, S. 599. 488 K. Berger u. C. Nord, Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, a.a.O., S. 938; ferner: H. Grimme, Die Oden Salomos, a.a.O., S. 11. 489 Dazu: R. A. Knox, Christliches Schwärmertum. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte (Enthusiasm, 1950), aus d. Engl. übs. v. P. Havelaar u. a., Köln u. a. 1957, S. 36 – 58, bes. S. 36 – 41; ferner: C. Andresen u. A. M. Ritter, Geschichte des Christentums, Bd. 1.1: Altertum, Stuttgart u. a. 1993, S. 25. 490 Irenäus v. Lyon, Adversus haereses II 32,4, in: ders., Adversus haereses. Gegen die Häresien, Bd. 2 (Fontes Christiani, Bd. 8.2), übs. u. eingel. v. N. Brox, Freiburg u. a. 1993, S. 279 – 281, S. 281.
178
3. Das Panorama
Ihre tiefste Wurzel hat diese Erscheinung in den urchristlichen Wandercharismatikern die sich der radikalen Nachfolge Jesu verschrieben und als Lehrer, Propheten und Wundertäter das Land durchzogen, getragen von der Gewißheit: „Wer euch hört, der hört mich“ (Lk 10,16), und gestützt auf die Zusicherung: Wenn sie euch wegführen, um euch auszuliefern, so trefft keine Vorsorge, was ihr dann reden sollt. Sagt vielmehr das, was euch in jener Stunde eingegeben wird! Denn nicht ihr werdet dann reden, sondern der Heilige Geist (Mk 13,11). Zweifellos bezogen die Charismatiker das nicht nur auf die in dem Logion angenommene Grenzsituation, sondern grundsätzlich auf die geistgewirkte Art ihres Redens. So könnte das Wandercharismatikertum, lange vor Entstehung des johanneischen Kreises, als die Geburtsstätte jener einzigartigen Sprachschöpfungen gelten, aus der die nachgestalteten Herrenworte hervorgingen. Mit ihrem Programm, die radikale Nachfolge Jesu zu üben, lenken die Wandercharismatiker den Blick von den peritorischen zu den zuständlichen Formen der Geistesgegenwart. Sie lassen sich am besten im Rückblick auf die Elementarform der Zuwendung ausfindig machen, durch die Jesus den Jüngerkreis im Horizont der von ihm ausgehenden Gottessuggestion an sich band. Denn mit dem von Max Weber übernommenen Hinweis auf dessen Zugehörigkeit zum Typus des „charismatischen Führers“ ist es nicht getan, da der von ihm ausgehende Impuls die Absage an Familie, Besitz und gesellschaftliche Position auf die Dauer und insbesondere angesichts seiner ständig wachsenden Konfliktlage nicht kompensieren konnte491. Angesichts der nachlassenden Existenzsicherung konnte die erste dieser Bindungen nur in einer transzendenten, die gewohnten Sicherungsmechanismen überbietenden Verankerung im Dasein bestehen. Davon vermittelt eine als Höhepunkt gekennzeichnete Stelle aus le Forts Roman „Das Schweißtuch der Veronika“ einen dichterischen Begriff, wenn die vom Entsetzen über ihren dämonischen Zwang zur Selbstaufgabe erschauernde Gegenspielerin der Titelgestalt erklärt: Denn die Seele des Menschen ist im All befestigt einzig durch die Erbarmung Gottes, und sobald sie sich von dieser löst, kann man sie nicht mehr erkennen492. Wie sich diese „Befestigung“ für die Jünger gestaltete, zeigt die in ihrer Symbolkraft kaum auszuschöpfende Szene mit dem sinkenden Petrus, der sich auf das Wagnis einläßt, die relative Sicherheit des von den Wellen gepeitschten Bootes aufzugeben, um dem ihm zum Inbegriff des Heils gewordenen Herrn über die Wogen entgegenzugehen, der dann aber angesichts der auf ihn eindringenden Vernichtungsgewalten den kaum gewonnenen Halt verliert und unterzugehen droht:
491 Dazu: M. Weber, Die drei reinen Typen legitimer Herrschaft, in: ders., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, a.a.O., S. 475 – 488, S. 481 – 488: Charismatische Herrschaft. 492 G. v. le Fort, Das Schweißtuch der Veronika (1928), Teil 1: Der römische Brunnen, München 1991, S. 294.
179
Das Fortleben
Als er aber den Wind und die Wellen bemerkte, bekam er es mit der Angst zu tun und begann zu sinken. Da schrie er: Herr, rette mich! (Mt 14,31) In dieser Szene verwandelt sich Petrus aus seiner historischen Individualität zusehends in den Typus des todverfallenen Menschen, dem sich auf dem Tiefpunkt seiner Verlorenheit ein verzweifeltes De profundis entringt. Die rettende Heilandshand, die ihn seiner Not entreißt, wird im selben Maß zum Symbol der Hilfe, die im Zerbrechen aller kontingenten Sicherungen bleibt und den im Abgrund versinkenden Menschen in der unverbrüchlichen Gotteswirklichkeit verankert. Befestigend wirkt des weiteren aber auch der Ruf Jesu in seine Nachfolge. Damit stellt er den Jüngern eine Aufgabe, die alles himmelhoch überbietet, was sie von ihrer eng bemessenen Lebenswelt zu erwarten hatten, gleichviel, ob sie – wie Petrus, Andreas und die Zebedäus-Söhne – dem Fischfang nachgingen, ob sie – wie Levi, dem Sohn des Alphäus – dem arrivierten, wegen dessen Kollaboration mit der römischen Staatsmacht jedoch verhaßten Stand der Zolleinnehmer angehörten oder – wie Simon Kananäus, dem Zeloten – im Freiheitskampf gegen Rom ihr höchstes Lebensziel erblickten. Zwar gab es in diesem NachfolgeVerhältnis kein Aufrücken in die Meisterschaft, dafür aber die Teilnahme an Jesu Lebenswerk, an der Durchsetzung seiner Ziele, ja sogar an seiner Sendung. Damit erschloß sich ihnen ein Sinnziel, wie es ihnen jenseits dieser Beziehung nie ins Blickfeld getreten wäre. Am unmittelbarsten erfuhren sie diese Befestigung jedoch in der Geborgenheit, in die sie sich durch Jesus aufgenommen fühlten. Sie war gegenüber allen Verunsicherungen, wie sie sich etwa in der Fasten- oder Steuerfrage (Mt 9,14; 17,24) bekunden, derart dominant, daß sie die beim Abschiedsmahl an sie gerichtete Frage, ob ihnen in der entbehrungsreichen Lebensgemeinschaft mit Jesus irgendetwas gefehlt habe, spontan verneinen müssen (Lk 22,35). Nie aber kommt das Motiv eindrucksvoller zur Sprache als in dem Wehruf über das sich seinem Retter verweigernde Jerusalem: Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt; ihr aber habt nicht gewollt! (Lk 13,34) Eben dies hat die kleine Schar seiner Getreuen bei ihm gefunden: Geborgenheit im Schatten seiner Flügel, den Flügeln seiner Zuwendung, Fürsorge und Liebe. Das hielt sie an ihm trotz aller Abschreckungen fest. Es ist riskant von da in die Gegenwart zu extrapolieren; aber das Wagnis muß im Interesse des Ziels, der Geistesgegenwart also, unternommen werden. Denn wo ist heute die Hand zu fassen, die den Versinkenden dem Abgrund entreißt; wo erklingt heute der Ruf in die Nachfolge; und wo sind heute die Flügel der bergenden Liebe zu fühlen? Noch am ehesten wird man auf halber Strecke fündig. So beim anselmischen Gottesbeweis, der das, was Augustinus nur mit einem „vollen Herzschlag“ berührte – die Fühlung der wandellosen Weisheit –, zu einem Erkenntnisakt verdichtet, der im Erdenken des unüberdenklich Größten dessen Wirklichkeit erfaßt. Oder bei Nikolaus von Kues, für den sich die Aufforderung zur „Annahme seiner selbst“ mit der Zusicherung des existenzbegründenden Beistands – „dann bin ich dein eigen!“ – verbindet. Vor allem aber bei dem, was die spätgotische „Johannesminne“ symbolisiert. Denn in ihr wurde aus den „Flügeln“ die Umarmung jener Liebe, die nach Kierkegaard keinen mehr, dessen sie sich je einmal angenommen hatte, aus ihrer Umhegung entläßt. 180
3. Das Panorama
Doch wie die Bindungen an Jesus umgriffen und getragen waren von der von ihm ausgehenden Gottessuggestion, so deren mittelalterliche Entsprechungen vom Horizont jenes Gottesbegriffs, den Anselm zum formellen Beweis fortbilden konnte, weil er als das tragende Substrat des Epochenbewußtseins vorgegeben war. Zudem wirkte der paulinische Hoffnungsimpuls, getragen vom Wissen um die Entmachtung der Schicksalsgewalten, noch so stark nach, daß in dieser Zeit der Hungersnöte, der Pestepidemien und der Hexenfurcht die Angst weder zum Thema philosophischer noch theologischer Reflexion geworden ist. Heute nimmt zwar nicht, wie Adorno Heidegger vorwirft, der Tod493, wohl aber die Angst den Platz des totgesagten Gottes ein. Das treibt zwar das Verlangen nach definitiver Verankerung auf einen bisher nicht erreichten Höhepunkt, doch rückt es auch die Erfüllung in eine schier unerreichbare Ferne. Zu fern liegt auch schon die Ekstase Aljoschas, der sich durch unsichtbare Fäden an die Himmelswelten gebunden und dadurch für Zeit und Ewigkeit gefestigt fühlt. Denn dafür bietet schon das von der Astrophysik entworfene Bild des explodierenden Universums nicht mehr den geringsten Anknüpfungspunkt, von dem schon von Karl Jaspers registrierten, von Reinhold Schneider leidvoll bestätigten Weltverlust des heutigen Menschen ganz zu schweigen. Nochmals: Wo ist heute die bergende Hand; wo ertönt der sinnstiftende Ruf; wo sind die Flügel der bergenden Liebe? Wenn es zutrifft, daß der fortlebende Christus heute nach le Fort seine GetsemaniStunde durchlebt, und daß seine Sache nach Newman „wie im Todeskampf“ liegt, muß angenommen werden, daß der spezifische Modus der Geistesgegenwart heute der des Entzugs ist. Das Licht wird, wie in der Spekulation des Maximus Confessor, als „Dunkelstrahl“ gesehen494, die Fülle als Leere empfunden, der Halt als „freier Fall“ erlebt. Spiegelbildlich zu dem bisher vom Evangelium her Erschlossenen könnte das nun rückläufig auf das Evangelium bezogen und von dorther begründet werden. Denn dort antwortet Jesus auf die Kunde, daß er gesucht werde, mit der Aufforderung, weiterzuziehen (Mk 1,37f); dort weist er das Ansinnen der Syro-Phönikierin ebenso wie das der eigenen Mutter zunächst mit schroffen und kränkenden Worten zurück (Mk 7,27; Joh 2,4); dort entzieht (Joh 6,15) und verbirgt er sich (Joh 8,59); und dort verwehrt er der ersten Zeugin seiner Auferstehung die Berührung mit dem zurückweisenden Wort: „Halte mich nicht fest!“ (Joh 20,17). Findet sich dort aber auch der zur Lösung verhelfende Fingerzeig? Er findet sich vermutlich dort, wo im Kontext der – mit den Paulusbriefen beginnenden – neutestamentlichen Schriften erstmals die Gattung „Evangelium“ in Erscheinung tritt: in der als das „Evangelium nach Markus“ betitelten Evangelienschrift. Sie stellt bekanntlich durch den abrupt abbrechenden Schluß vor die Frage, wie ein offensichtlich aus der Verkündigung hervorgegangener und seiner ganzen Zielsetzung nach ihr dienender Text so widersprüchlich schließen konnte; denn von den Frauen, denen am Grab durch eine Engelerscheinung Jesu Auferstehung und das Wiedersehen mit ihm angesagt worden war, heißt es: Sie verließen das Grab und flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatten sie gepackt. Und sie sagten niemand etwas davon; denn sie fürchteten sich (Mk 16,8). 493 Th. W. Adorno, Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie, Frankfurt a. M. 8/1977, S. 115. 494 Dazu: H. U. v. Balthasar, Kosmische Liturgie. Das Weltbild Maximus’ des Bekenners, 2., völlig veränd. Aufl., Einsiedeln 1961, S. 73 – 84: Der finstere Strahl.
181
Das Fortleben
Auf die Paradoxie des Satzes verwies Klaus Berger mit der Beobachtung, daß der Leser durch den Evangelisten das erfahre, was die Frauen niemandem gesagt hatten495. Doch das Drama des Satzes spielt sich zunächst nicht zwischen dem Leser und dem Autor, sondern zwischen dem Leser und den mit dem Zeugnis beauftragten und es in ihrem Schrecken doch verweigernden Frauen ab. Denn bevor der Leser realisiert, daß er trotz des Schweigens der Frauen durch den Evangelisten zum Mitwisser wurde, greift der Schrecken auf ihn selber über, so daß er um das Gelingen der Osterbotschaft fürchten muß. Da er sich aber gleichzeitig durch den Evangelisten auf den Wissensstand der Frauen gehoben weiß, löst sich die Spannung dadurch, daß er das Ansinnen verspürt, seinerseits in die Bresche zu springen und, gestützt auf den „allwissenden Autor“, das zu bezeugen, was die Frauen verschwiegen. Dadurch schließt sich der Ring vom Ende zum Anfang des Evangeliums. Wie dort der Rufer in der Wüste erschien (Mk 1,3), sieht sich nun der Leser beauftragt, denen seine Stimme zu leihen, die, durch ihre Angst gelähmt, verstummten. Dazu sieht sich der Leser durch die emotionale Übereinkunft mit den Frauen zusätzlich motiviert. Denn er lebt zuständlich in der Angst, der jene nur okkasionell, durch die an sie ergangene Engelsbotschaft, verfallen waren. Diese Angst gilt es zu überwinden, wenn das Versagen der Frauen kompensiert werden soll. Das aber wird dem Leser umso eher gelingen, als er im Unterschied zu den Frauen am Grab begreift, daß das Evangelium keine Botschaft des Rechts, sondern der Angstüberwindung ist, und daß er in erster Linie durch die Auferstehung Jesu qualifiziert ist, dies zu bezeugen. So drängt ihn der Schluß des Markus-Evangeliums in eine Aufgabe ähnlich derjenigen, die sich – wie schon erwähnt – nach Max Horkheimer der Philosophie dieses Jahrhunderts angesichts der Opfer der terroristischen Gewalt insgesamt stellt: Aufgabe der Philosophie ist es, was sie getan haben, in eine Sprache zu übersetzen, die gehört wird, auch wenn ihre vergänglichen Stimmen durch die Tyrannei zum Schweigen gebracht wurden496. Nach Horkheimer votiert somit der „Text“ der Zeitgeschichte ähnlich wie der Markusschluß: Er wälzt gleichfalls die Beweis- und Zeugnislast auf den „Leser“ ab. Dieser muß sagen, was die Verstummten, wenngleich aus höchst unterschiedlichen Gründen, verschwiegen. Das mißt ihm aber dann eine weit höhere Kreativität zu, als sie dem Begriff des „Rezipienten“ in der durchschnittlichen Einschätzung zukommt. Doch gerade so entspricht es der Situation, für die der Hinweis des Evangeliums erfragt wurde: der Situation des gleicherweise von der Kirchenkrise wie seiner eigenen Lebensangst bedrängten Christen, der sich ungeachtet dieser Doppelbelastung zu einer Gegeninitiative genötigt – und befähigt – sieht: genötigt, weil er begreift, daß dem zweifachen Notstand nur gewehrt werden kann, wenn er aus seiner traditionellen Rezeptivität hervortritt und die Initiative ergreift; aber auch befähigt, weil ihm der Beweggrund seiner Initiative, die Auferstehung Jesu, durch die erkenntnistheoretischen Konsequenzen auf neue Weise denkbar geworden ist und weil er sie auf Grund der glaubensgeschichtlichen Inversion als die Mitte aller präsentischen Heilserfahrung begreift. 495 K. Berger, Die Auferstehung des Propheten und die Erhöhung des Menschensohnes. Traditionsgeschichtliche Untersuchung zur Deutung des Geschickes Jesu in frühchristlichen Texten, Göttingen 1976, S. 496, Anm. 219. 496 M. Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende, hrsg. v. A. Schmidt, Frankfurt a. M. 1967, S. 152.
182
4. Die Topologie
4. Die Topologie Mit dem Begriff der Inversion ist die Erinnerung daran aufgerufen, daß der zur Botschaft, zum Glaubensobjekt und zur Lehre Gewordene in Augenblicken drohender Erstarrung, also auch und gerade heute, erneut zu Wort kommen will. Das nötigt spontan zur Frage nach dem Wie und Wo, wobei sich nach Ausweis der Osterereignisse das Wie weitgehend aus dem Wo ergibt. Denn es fällt auf, daß der Auferstandene in den Erscheinungen am leeren Grab (Joh 20,1-18) und im Raum Jerusalem (Lk 24,13-49; Joh 20,1929) dialogisch auf die Verfassung der jeweiligen Zeugen eingeht, während er in den Erscheinungen, die sich in Galiläa ereignen (Mt 28,16-20; Joh 21,1-23), einen eher hieratischen Eindruck erweckt. Und davon nochmals verschieden ist seine Erscheinungsweise in der paulinischen Damaskusvision, in der er als das von Gott zugesprochene (Gal 1,15f), manifestierte (2Kor 4,6) und den Adressaten ergreifende (Phil 3,12) Offenbarungswort erfahren wird. So scheint der Erscheinungsmodus in einer kaum ergründbaren Abhängigkeit vom jeweiligen Erscheinungsort – der Begriff „Ort“ im weitesten Sinn genommen – zu stehen. Doch damit spitzt sich die gesamte Fragestellung auf eine „Topologie“ der präsentischen Heilserfahrungen zu. Das Recht dieser Fragestellung gründet zweifellos darin, daß auf Grund seiner im Urchristentum erfahrenen „Geistmächtigkeit“ Jesus selbst, der Kyrios und Menschensohn, zum „Ort der Gottesoffenbarung“ wurde497. So erlebt ihn Stephanus in seiner Todesvison: zwar erhöht in die Herrlichkeit Gottes, aber bereitstehend zum Beistand für seinen ersten Blutzeugen. Und so hatte es Jesus bei der Berufung des Nathanael selbst in Aussicht gestellt: Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes über dem Menschensohn auf- und niedersteigen sehen (Joh 1,51). Danach ist er tatsächlich der „Ort“, an dem sich der Himmel zur Erde neigt, um deren Kostbarstes, den Menschensohn Jesus, in sich aufzunehmen und mit ihr in eine Wechselbeziehung zu treten. Für die Anwendung dieses Befundes auf die Gegenwart ist Hans Kesslers Frage nach der situativ bedingten „Versprachlichung“ der christologischen Grunderkenntnis hilfreich498, zumal sie mit Beobachtungen, in denen sie den Horizont der christologischen Denkweise zur Christomathie hin überschreitet, einhergeht. Danach erklärt sich das Zustandekommen der unterschiedlichen Aussagen für die Heilsbedeutung Jesu zum einen aus deren unterschiedlichem „Sitz im Leben“ der Urgemeinde, also aus deren Gebetsleben, Taufpraxis, Missionstätigkeit und Selbstverteidigung, zum anderen aus den unterschiedlichen Entstehungsräumen und deren „Lokalkolorit“, so aus den aramäisch und hebräisch sprechenden Gemeinden im Großraum Jerusalem und den hellenistisch geprägten Gemeinden von Judenchristen außerhalb Palästinas499. So entstehen nach Kessler nahezu gleichzeitig und gleichberechtigt eine Erhöhungs- und Erwäh-
497 Dazu: H. Kessler, Sucht den Lebenden nicht bei den Toten, a.a.O., S. 237; S. 305 – 307; S. 310; S. 365f. 498 A.a.O., S. 267 – 283; S. 367 – 390. 499 Dazu: G. Theißen, Lokalkolorit und Zeitgeschichte in den Evangelien. Ein Beitrag zur Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen 2/1992.
183
Das Fortleben
lungschristologie neben einer Präexistenz- und Inkarnationschristologie, ebenso ursprünglich dann aber auch eine Wort- und Weisheitschristologie, um nur die wichtigsten Formen anzusprechen. „Text“ besagt Vergangenheit, „Wort“ und „Sprache“ dagegen Gegenwart. Sofern es in den aufgeführten Deutungsentwürfen um unterschiedliche Formen der „Versprachlichung“ geht, dienen diese nicht so sehr der Umschreibung dessen, was Jesus im Sinne von Wesensbestimmungen „war“, als vielmehr um Nennformen, in denen seine fortwirkende Präsenz „an- und aufgerufen“ werden kann. Obwohl christologisch aufgefaßt und verarbeitet, sind sie ursprünglich doch christomathisch konzipiert: Explikationen des primordialen „Maranatha“, mit dem sich die Urgemeinde der gegenwärtig wirkenden Heils- und Geistmacht dessen versichert, den sie um seine baldige Wiederkunft anrief. Denn im Streit um die futurische oder präsentische Bedeutung dieser Anrufung kann mit Kessler durch die Erkenntnis die Spitze abgebrochen werden, daß das „Maranatha“, auch wenn es sich auf den kommenden „Kyrios“ bezieht, von dem präsentisch Anwesenden vernommen und erhört sein will500. Zur Unterbauung dessen wird man sich an die schon fast vergessene Kritik erinnern müssen, die Gerhard Koch, halb zustimmend, an Bultmann übte, für den – wie ihm die ungleich radikalere und von ihm schließlich doch akzeptierte Kritik Karl Barths vorwarf501 – Jesus Christus in den Osterglauben und „ins Kerygma hinein auferstanden“ war502. Demgegenüber markiert die Auferstehung für Koch den Übergang von der Lebens- zur Wirkungsgeschichte Jesu, denn im Ereignis seiner Auferstehung sprengt Jesus, wie man im Anschluß an Koch sagen könnte, das Koordinatensystem von Raum und Zeit in Richtung auf eine kosmische Allgegenwart und eine allzeit währende Geschichtspräsenz. Danach ist Jesus, in letzter Vereinfachung gesprochen, „in die Geschichte hinein“ auferstanden503, eine Wendung, die in modifizierter Form auch bei Rahner und Piet Schoonenberg wiederkehrt: bei Rahner abgewandelt zu der These, daß er „in den Glauben seiner Jünger“, bei Schoonenberg, daß er „in seine Gemeinde“ hinein auferstanden sei504. Vor diesem Hintergrund kann nun definitiv nach den „Orten“ heutiger Präsenzerfahrung gefragt und daraus der Grundriß einer Topologie abgeleitet werden. Das aber ist gleichbedeutend mit der Frage nach der – von der theologischen Rezeption und Fortbildung zu unterscheidenden – aktuellen Gestalt der urchristlichen Deutungsformen des „Mysteriums Jesu“. Gegenüber der theologischen Rezeption ergibt sich hier erneut eine Abzweigung in Richtung auf die säkularistische Denkwelt der Gegenwart. Wie leben die urchristlichen Deutungsformen hier, in der Anfechtung durch das aufgeklärte und dadurch der Offenbarung entfremdete Dasein, fort? Das ist die Frage nach ausgesprochenen „Quer- und Kümmerformen“ der urchristlichen Konzeptionen, mit Rahner gesprochen: nach Formen ihres „anonymen Fortlebens“ in der heutigen Denk- und Lebenswelt. 500 Dazu: H. Kessler, Sucht den Lebenden nicht bei den Toten, a.a.O., S. 114; S. 268; S. 501 – 504. 501 Dazu: K. Barth, Rudolf Bultmann. Ein Versuch, ihn zu verstehen, Zürich 1952 (Theologische Studien, 34); G. Koch, Die Auferstehung Jesu Christi, Tübingen 1959, S. 131 – 147: Die Reduktion von Ostern in das Kerygma (R. Bultmann). 502 R. Bultmann, Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen Jesus (1960), in: ders., Exegetica, a.a.O., S. 469. 503 G. Koch, Die Auferstehung Jesu Christi, a.a.O., S. 106; S. 154; S. 174. 504 P. Schoonenberg, Wege nach Emmaus. Unser Glaube an die Auferstehung Jesu, Graz u. a. 1974, S. 63; K. Rahner, Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums, Freiburg i. Br. u. a. 6/1976, S. 263.
184
4. Die Topologie
Die Wegscheide, an der die Abzweigung ihren Anfang nimmt, besteht in der zweifellos bedeutsamsten Nachwirkung des Zweiten Vatikanums und des ungeheuren „Staus“, durch den das Konzil letztlich erzwungen wurde: in der Neuentdeckung Jesu im Glauben – und Unglauben – der Gegenwart. Mit ihrer abschätzigen Kennzeichnung als die „sogenannte Jesus-Welle“ verwies Wilhelm Dantine auf deren soziologischen Ursprung in der nordamerikanischen Bewegung der „Jesus-People“, die in der von Andrew Lloyd Webber vertonten Rock-Oper „Jesus Christ – Superstar“ ihre künstlerische Selbstdarstellung – auch im kritischen Sinn des Ausdrucks – fand505. Bemerkenswert waren vor allem der literarische Niederschlag dieses Aufbruchs und seine theologische Verarbeitung. Von der Wucht des Vorgangs zeugt die Tatsache, daß sich an diesem weiträumig und wie auf geheime Verabredung gleichzeitig zu Beginn der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts einsetzenden „Disput um Jesus“506 neben christlichen Autoren auch Juden und Atheisten und neben Theologen auch Philosophen, Psychologen und Literaten beteiligten. Hervorgehoben seien lediglich die Schriften und Jesusbücher von Leszek Kolakowski, „Jesus Christus – Prophet und Reformator“ (1971), Shalom Ben-Chorin, „Bruder Jesus“ (1972), Milan Machoveč, „Jesus für Atheisten“ (1972), René Girard, „La Violance et le Sacré“ (1972), Hans Küng, „Christ sein“ (1974), Edward Schillebeeckx, „Jesus. Die Geschichte von einem Lebenden“ (1975) und Hans Blumenberg, „Matthäuspassion“ (1988). […507] [… wie Guardini] in seinem Jesusbuch „Der Herr“ erklärt: Unerhörter Gedanke! Erträglich nur im Glauben, daß Christus wirklich der Inbegriff ist; und in der Liebe, die mit ihm eins werden will. Oder wäre der Gedanke, mit Einem zusammengefügt zu sein – nicht nur verbunden im Leben und Tun, sondern ineinsgewachsen in Sein und Selbst – zu ertragen, falls er nicht als Jener geliebt würde, durch den ich mein eigentliches Ich finde, das des Kindes Gottes, und mein eigentliches Du, nämlich den Vater?508 In seinen autobiographischen Aufzeichnungen nennt Guardini das Motiv, das ihm dazu verhalf, sich, wenngleich zögernd, zu diesem „unerhörten Gedanken“ durchzuringen, wenn er gesteht, in der neutestamentlichen Rede vom „Hergeben der Seele“ (Mt 10,39) – verstanden als Aufruf zur Selbstübereignung an die Kirche – den Weg zur Lösung seiner Existenzfrage gefunden zu haben509. Der geistesgeschichtliche Durchbruch durch die ihm entgegenstehende Barriere erfolgte jedoch auf einem ganz anderen, durch die stufenweise fortschreitende Entdeckung der „Zwischenmenschlichkeit“ markierten Weg. 505 Dazu: W. Dantine, Jesus von Nazareth in der gegenwärtigen Diskussion, Gütersloh 1974, S. 13 – 18. 506 W. Kern, Disput um Jesus und um die Kirche. Aspekte, Reflexionen, Innsbruck u. a. 1980. 507 508 R. Guardini, Der Herr, a.a.O., S. 542f. 509 Ders., Berichte über mein Leben. Autobiographische Aufzeichnungen, aus dem Nachlaß hrsg. v. F. Henrich, Düsseldorf 1984, S. 71f.
185
Das Fortleben
Dieser Weg beginnt mit Äußerungen des Basilius über das Verhältnis zu seinem Studienfreund Gregor von Nazianz, für das ihm in seiner Gedächtnisrede auf den Freund keine Kennzeichnung zu hoch gegriffen ist: Sie seien einander „alles“ gewesen, ein Herz und eine Seele, ja eine Seele in zwei Körpern510. Er setzt sich wie in einem Negativ fort in Augustinus’ Totenklage über den ihm entrissenen Jugendfreund, dessen plötzlicher Tod ihm die Vaterstadt zur Qual, das Elternhaus zum Elend, alle Erinnerungen an ihn, der nun mit einem Mal fehlte, zur Folter, ja das Leben selbst zum Greuel werden ließ, weil es ihm, wie er in wörtlicher Wiederholung des Basiliusworts sagt, vorgekommen sei, daß er mit dem Freund zusammen „nur eine Seele in zwei Körpern“ gewesen, nun aber durch seinen Tod gezwungen worden sei, als „halber Mensch“ fortzuleben511. Vom Tiefgang dieses Lebensbruchs zeugt nicht zuletzt der Umstand, daß Augustinus gerade in diesem Kontext bemerkt, daß er sich selbst „zu einem großen Rätsel“ geworden sei512. Zur Qualität einer formalen Sozialmystik erheben sich diese Ansätze jedoch erst im Mittelalter, und hier schon in der Schrift des Abtes Aelred von Rievaulx „Über die geistliche Freundschaft“, „De spirituali amicitia“. Unter Berufung auf die Freundesanrede Jesu (Joh 15,15) fühlt Aelred seine Seele in die seiner Mitbrüder „ausgegossen“ und deren Liebe in sich einziehen; denn die Liebe Christi wecke die Freundesliebe, und eine Zuneigung löse die andere aus, so daß der Freund, der dem Freund im Geiste Christi anhänge, zuletzt mit diesem verschmilzt513. Das steigert ein mittelalterlicher Kommentator des Claudianus Mamertus zu der dialogisch gestalteten Versicherung: Du bist mir gegenwärtig, und ich bin dir in deinem Gebet gegenwärtig. Sei nicht erstaunt darüber, daß ich von Gegenwart rede; denn wenn du mich liebst, und mich darum liebst, weil du in mir das Bild Gottes erblickst, das du liebst, so bin ich dir ebenso gegenwärtig, wie du dir selbst […]. So sind wir, das Gleiche suchend, zum Gleichen hinstrebend, einander immerdar gegenwärtig, in Gott, in dem wir uns lieben514. Zurückgedrängt durch den Siegeszug des monadischen Subjektivismus, lebte dieses Wissen im Schatten der romantischen Identitätskrise aufs neue auf, so etwa in Franz von Baaders Wort vom „Zentralherzen“, in dem sich die Menschen aneinander sättigen und erneuern, und in Möhlers Gedanken von der die Einzelnen zum Ganzen erweiternden Liebe515. Daran knüpft Peter Wusts Vorstellung von dem die vielen Individuen verknüpfenden „nexus animarum“ an516, vor allem aber Bubers Entdeckung des „Zwischenmenschlichen“ als dem Ort gegenseitiger Akzeptanz und Übereignung, von dem es im
510 Gregor v. Nazianz, Oratio 43,19.20, in: ders., Opera quae exstant omnia, hrsg. v. J.-P. Migne, Bd. 2 (PG, Bd. 36), Paris 1858, 785D-786C. 511 Augustinus, Bekenntnisse IV, 6, a.a.O. (BKV, 1. Reihe, Bd. 18, VII), S. 66. 512 A.a.O. IV, 4, a.a.O., S. 64. 513 Dazu: Aelred von Rieval, Über die geistliche Freundschaft, lat.-dt., übs. v. R. Haacke, Trier 1978, S. 83ff; S. 55ff. 514 Zitiert nach: H. de Lubac, Katholizismus als Gemeinschaft , a.a.O., S. 72f. 515 F. v. Baader, Vierzig Sätze aus einer religiösen Erotik (1831), in: Franz von Baader’s sämmtliche Werke, hrsg. v. F. Hoffmann, 1. Hauptabth., Bd. 4, Leipzig 1853, S. 179 – 200, S. 195; J. A. Möhler, Die Einheit in der Kirche oder das Princip des Katholicismus, a.a.O., S. 100. 516 P. Wust, Die Dialektik des Geistes, a.a.O., S. 512 – 530.
186
4. Die Topologie
Blick auf den „heimlich und scheu nach einem Ja des Seindürfens“ ausschauenden Menschen heißt: einander reichen die Menschen das Himmelsbrot des Selbstseins517. Das alles hatte Nikolaus von Kues an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit mit der die Vorstellung der monadischen Geschlossenheit der Individualität aufbrechenden Idee des „Alles in Allem“ vorweggenommen, die er im Blick auf 1Kor 15,28 mit der Aufforderung verdeutlicht: Wenn du aufmerksam überlegst, wirst du erkennen, daß jedes wirklich bestehende Ding darin ruht, daß alles in ihm es selbst und es selbst in Gott Gott ist. Man sieht die wundervolle Einheit, die wunderbare Gleichheit und die wunderbarste Verknüpfung der Dinge, da Alles in Allem ist518. Damit brach Nikolaus von Kues einem Selbstbegriff Bahn, der bei allem Willen zur Selbstsetzung zugleich zum Wissen um den Verweisungszusammenhang und der Kompenetranz der Individuen getragen war und somit die mystische Einwohnung bei aller „Entlegenheit“ auch im Horizont subjektzentrierten Bewußtseins denkbar macht. Im Angang zu dem angeführten Durchbruch hat Guardini auf die Epheserstelle (Eph 4,13) verwiesen, die vermutlich den Gedanken der lebensgeschichtlichen Präsenz Jesu aufkommen ließ. Und im Anschluß daran hatte er Christus als die „Gestalt“ beschrieben, die alle Äußerungen des Christen durchdringe, die seine Lebensakte zur Einheit verbinde und so sein Christsein bestimme: In jedem Einzelnen anders, nach der Weise seines Wesens: Anders im Mann als in der Frau, anders im Kind als im Erwachsenen, anders in dieser Begabung als in jener […]. In jedem Christen lebt Christus gleichsam sein Leben neu: ist zuerst Kind und reift dann heran, bis er das volle Alter des mündigen Christen erreicht. Darin aber wächst er, daß der Glaube wächst, die Liebe erstarkt, der Christ sich immer klarer seines Christseins bewußt wird und mit immer größerer Tiefe und Verantwortung sein christliches Dasein lebt519. Paraphrasierend nimmt Guardini damit einen Gedanken auf, den Gregor von Nyssa mit weitreichender Nachwirkung bis in die Hochscholastik hinein in seinem Hoheliedkommentar entwickelt hatte: Das uns geborene Kindlein ist Jesus, der in denen, die ihn aufnehmen, auf verschiedene Weise heranwächst an Weisheit und Alter und Gnade. Denn er ist nicht in jedem der gleiche. Je nach dem Gnadenmaß dessen, in dem er Gestalt annimmt und je nachdem der ihn 517 M. Buber, Urdistanz und Beziehung (1950), in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 411 – 423, S. 423. 518 Nikolaus von Kues, De docta ignorantia – Die wissende Unwissenheit II, c. 5, in: ders., Philosophisch-theologische Schriften, Bd. 1, a.a.O., S. 344 – 349, S. 347. 519 R. Guardini, Der Herr, a.a.O., S. 342.
187
Das Fortleben
Aufnehmende dazu fähig ist, so erscheint auch er entweder als Kind, oder als Wachsender oder als Vollendeter520. Und in einer Art Vorgriff auf das cusanische Theorem des „quodlibet in quolibet“ verdeutlicht Gregor von Nyssa diese Identität in den unterschiedlichen Stadien mit dem Bild, daß ein blühender Rebzweig noch keineswegs Wein ist, wohl aber die Blüte die kommende Frucht verbirgt. Intoniert ist damit das aus der frühen Trinitätslehre hervorgegangene Theorem der Gottesgeburt, das im Zug der spekulativ entfalteten Lehre von der Gotteskindschaft mit Augustinus den „inneren Menschen“ und in der Mystik mit Meister Eckhart den „Seelengrund“ und das „Herz der Seele“ zum Ort der spirituell gespiegelten Zeugung des Gottessohnes erklärt. Denn dreifach ist, wie es in einer Thomas von Aquin zugeschriebenen Weihnachtspredigt heißt, die Geburt Christi: ewig aus dem Vater, zeitlich aus der Mutter und geistlich aus dem Herzen521. Mit dieser Gottesgeburt beginnt die individuelle Reprise der Lebensgeschichte Jesu, die im Idealfall alle Stadien der originären durchläuft, faktisch jedoch, wie Gregor von Nyssa im Blick auf die unterschiedlichen Dispositionen der Empfänger sagt, auch auf einem der Frühstadien stehenbleiben kann. Ja, bei Hippolyt und Methodius von Olympos taucht sogar der Gedanke von der „täglichen“ Neugeburt Jesu im Herzen der Glaubenden auf, die schwerlich mit der Vorstellung von der Rekapitulation der ganzen Lebensgeschichte verbunden ist. Als das überragende Paradigma dieses von Christus durchformten Lebens gilt Franz von Assisi, von dem Thomas von Celano sagt: Immer war er mit Jesus beschäftigt. Jesus trug er stets im Herzen, Jesus im Mund, Jesus in den Ohren, Jesus in den Augen, Jesus in den Händen, Jesus in den übrigen Gliedern522. Das ist der Fall der von Buber gleicherweise verworfenen wie bewunderten „anderen Art der Unmittelbarkeit“, die aus der Einvernahme eines anderen erwächst: Daraus wächst eine Konkretheit der Beziehung, die nach der sakramentalen Einverleibung des Du verlangt, aber persönlich weitergehen kann, bis zur Einselbstung, zum Selbsttragen dieser Leiden, zum Selbstempfangen dieser Wunden und Wundmale – und zur Menschenliebe „von ihm aus“523. Während für die Patristik Jesus „täglich“ im Glaubenden neu geboren werden muß, will er für Symeon den Neuen Theologen „täglich“ in einem jeden, der in der Anfechtung mit 520 Zitiert nach: H. Rahner, Die Gottesgeburt. Die Lehre der Kirchenväter von der Geburt Christi im Herzen der Gläubigen (1935), in: ders., Die Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der Väter, Salzburg 1964, S. 13 – 87, S. 50f. 521 Des heiligen Thomas von Aquin, des englischen Lehrers, Predigten auf das ganze Kirchenjahr, aus d. Lat. übs. [v. J. N. P. Oischinger], Regensburg 1845, S. 323. 522 Thomas v. Celano, Leben und Wunder des heiligen Franziskus von Assisi. Einführung, Übersetzung und Anmerkungen v. E. Grau (Franziskanische Quellenschriften, Bd. 5), 4., neu bearb. Aufl., Werl/Westf. 1988, Erste Lebensbeschreibung (1228/1229), II. Buch, Kap. 9, S. 186 – 190, S. 190. 523 M. Buber, Zwei Glaubensweisen, in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 749.
188
4. Die Topologie
ihm ausharrt, auferstehen, dies freilich im getätigten Glauben, da erst dieser die Bedingung der Auferstehung erfüllt524. Ihren spekulativen Höhepunkt erreicht das Theorem von der Gottesgeburt jedoch bei Meister Eckhart, der den Gedanken streng aus seinem Trinitätsbegriff und seiner Lehre von der Gotteskindschaft entwickelt. Danach vollzieht sich zwischen Gott und dem „gotteinigen“ Menschen eine Art Idiomenkommunikation, so daß sich alles, was das Gotteswort von Christus sagt, auch an ihm bewahrheitet. Doch nicht genug damit: Nun übernimmt der dem Gottesleben Angestaltete auch Gottes ureigenes Wirken, so daß von ihm gesagt werden kann, daß er nicht nur mit Gott zusammen Himmel und Erde erschafft, sondern sogar zum Erzeuger seines ewigen Wortes wird. So geht er vollkommen in den Lebensvollzug Christi ein: Er wird, durchdrungen von Christus selbst, zum Gott – in der Person Christi525. Diese streng theologische Ableitung muß jedoch im Interesse der Denkbarkeit durch eine anthropologische ersetzt werden. Denn dafür genügt die dialogische Erweiterung des Subjektbegriffs noch nicht, da sie mit ihrer synchronen Sicht dem diachronen Aspekt des Fortlebens nicht gerecht wird. Das leistet erst die ansatzweise von Guardini entwickelte Modalanthropologie, die davon ausgeht, daß die Geschichtsfähigkeit des Menschen in dessen „Geschichte mit sich selbst“ begründet ist: Wie in jeder Geschichte gibt es auch in dieser Höhen und Tiefen. Ihre Niederlagen bestehen in Zuständen der Selbstvergessenheit und Selbstverwerfung, ihre Siege in Akten der Selbstergreifung und Selbsttranszendenz526. In diesem Aspekt reichen die Wurzeln der Modalanthropologie weit in die Vorzeit hinab. Schon bei Gregor von Nyssa findet sich der Gedanke, daß es neben der körperlichen Geburt, die sich zufällig ereignet, eine zweite aus freier Selbstentscheidung gibt: Solche Geburt geschieht […] aus freiem Willen. Und wir sind gewissermaßen unsere eigenen Väter, indem wir uns selbst zeugen nach unserem Willen und aus eigenem Entschluß uns bilden nach dem Bild unseres Wollens527. Daran knüpft der Renaissance-Philosoph Pico della Mirandola an, wenn er in seinem Traktat „Über die Würde des Menschen“ den Schöpfer zum Menschen sagen läßt: Wir haben dich weder als einen Himmlischen noch als einen Irdischen, weder als einen Sterblichen noch als einen Unsterblichen geschaffen, damit du als dein eigener, vollkommen frei und ehrenhalber schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die Form bestimmst, in der du zu leben wünschst. Es steht dir frei, in die Unter524 Dazu: K. Beyschlag, Was heißt mystische Erfahrung? Entwickelt an den Beispielen Euagrios Pontikos und Symeon, dem Neuen Theologen, in: H. Reller u. a. (Hgg.), Herausforderung: Religiöse Erfahrung. Vom Verhältnis evangelischer Frömmigkeit zu Meditation und Mystik, Göttingen 1980, S. 169 – 196. 525 Dazu: O. Karrer, Meister Eckehart. Das System seiner religiösen Lehre und Lebensweisheit (Textbuch aus den gedruckten und ungedruckten Quellen), München 1926, S. 124. 526 Dazu: E. Biser, Der Mensch – das uneingelöste Versprechen. Entwurf einer Modalanthropologie, a.a.O., S. 187 – 191: Das utopische Wesen; ders., Die glaubensgeschichtliche Wende, a.a.O., S. 80 – 87: Das utopisch-antiquierte Wesen. 527 Gregor von Nyssa, Der Aufstieg des Moses, a.a.O., S. 52.
189
Das Fortleben
welt des Viehes zu entarten. Es steht dir ebenso frei, in die höhere Welt des Göttlichen dich durch den Entschluß deines eigenen Geistes zu erheben528. Gegenüber der statischen Sicht der klassischen Anthropologie ist das Menschsein in dieser Anthropologie in einer prozessualen Bewegung auf sich selbst und sein göttliches Erfüllungsziel hin begriffen. Verknüpft mit dem „kommunikativen“ Subjektbegriff, wird es so zum „Raum“, in welchem sich das mit der Gottesgeburt einsetzenden „Nachleben“ Jesu ereignen und dessen Lebensgeschichte zum individuellen Formgesetz werden kann. Nimmt man nun die modernen Formen der „Besessenheit“ in Gestalt von Fremdbestimmung, erwünschter oder erlittener Bewußtseinsveränderung, also von Drogenrausch und Gehirnwäsche, und insbesondere in Gestalt der sich epidemisch ausbreitenden Medienabhängigkeit hinzu, so erscheint die Idee des Nachlebens Jesu als die rettende Alternative zu den angesprochenen Verfallsformen. Das läßt sich kaum besser als mit dem Predigtwort verdeutlichen, mit dem Johannes Tauler das Wunder rühmte, daß Gott „alle Tage und alle Augenblicke in einer jeglichen guten heiligen Seele“ geboren werde. Darauf bezieht sich auch Taulers Mahnung: denn soll sie diese Geburt in sich fühlen und ihrer gewahr werden, so muß das durch Einkehr und Umkehr aller ihrer Kräfte geschehen. In dieser Geburt wird Gott der Seele in stärkerem Maße zu eigen, gibt er sich inniger hin, als es bei allem Eigentum, das sie je erwarb, geschah. In der Heiligen Schrift lesen wir: „Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt“; das will sagen: er ist unser, und unser Eigen zumal, mehr denn alles, was eigen heißt, er wird zu aller Zeit, ohne Unterlaß in uns geboren529.
5. Die Geschichtsgestalt Gemessen an dem universalen Sendungsanspruch, den Jesus erhebt, erweckt der Gedanke seines nachösterlichen Fortlebens zunächst aber nicht die – wenngleich psychologisch näherliegende – Vorstellung von seinem individuellen Nachleben als vielmehr die seiner geschichtsgestaltenden Wirkmacht. So meint es zweifellos Gerhard Koch, wenn er von der Auferstehung Jesu „in die Geschichte hinein“ spricht530, und so liegt es auch dem bekannten Gebetswort Newmans zugrunde, wonach die Sache Christi heute „wie im Todeskampfe“ liege, das sich aber zugleich dazu bekennt, daß Christus nie mächtiger durch die Erdenzeit schritt und sein Kommen nie deutlicher spürbar war „als jetzt“531. Angesichts der sich ausbreitenden Geschichtsskepsis, die Goethe mit dem resignierenden Wort von der Geschichte als einem „Gewebe von Unsinn“ vorwegge528 G. Pico della Mirandola, Über die Würde des Menschen, a.a.O., S. 50f. 529 J. Tauler, Am heutigen Tage (Weihnachten), in: ders., Predigten, Bd. 1, übertr. u. hrsg. v. G. Hofmann, Einsiedeln 1979, S. 13 – 21, S. 14. 530 Dazu nochmals: G. Koch, Die Auferstehung Jesu Christi, a.a.O., S. 174. 531 Nach: G. Söhngen, Kardinal Newman. Sein Gottesgedanke und seine Denkergestalt, Bonn 1946, S. 71.
190
5. Die Geschichtsgestalt
nommen hatte532, ist hier noch entschiedener als zuvor nach der Denkbarkeit des Motivs zu fragen. Die Beantwortung dieser Frage muß auf die, wie Gerhard von Rad formulierte, „Entstehung des hebräischen Geschichtsdenkens“ zurückgreifen, die auf die „auch in religionsgeschichtlicher Hinsicht erregende Tatsache“ zurückgeht, daß in dem vom altorientalischen Mythos beherrschten Raum „von einem kleinen Volk ein völlig anderes Verständnis von dem göttlichen Heilsgeschehen“ entwickelt wurde533. Verbunden mit dem Wissen, daß alles, angefangen von Geburt und Sterben bis hin zu Säen und Ernten, Lieben und Hassen, Krieg und Frieden, seine „Zeit“ hat (Prd 3,1-8), geht dieses Geschichtsverständnis ursächlich auf die Erfahrung Israels zurück, seine Identität einem göttlichen Führungs- und Erziehungsplan zu verdanken, wie sie sich dann, ebenso plastisch wie drastisch in dem Bild Hesekiels von dem von Gott in der Wüste aufgelesenen und zu seiner Braut herangebildeten Findlingskind ausdrückte (Hes 16,1-24). Auf einer höheren Reflexionsstufe wiederholte sich diese Genese des Geschichtsbewußtseins dann in der nachexilischen Spätzeit, als Israel nach dem Verstummen der Propheten lernte, seine geschichtlichen Erfahrungen im Spiegel der Weisheitsidee zu reflektieren (Weish 10,1-19,22). Demgegenüber nahm die christliche Geschichtstheologie ihren Anfang mit der Erkenntnis, daß Jesus keineswegs gekommen war, um die verstörte Ordnung des Anfangs wiederherzustellen, sondern zu dem Ziel, die in Wehen liegende und unter dem Joch der Todverfallenheit stöhnende Welt dem Ziel ihrer endzeitlichen Befreiung, der Gottesherrschaft, entgegenzuführen, daß er sich also, mit Helmut Köster gesprochen, als der „Herr der Zukunft“ erwies534. Aus dem Bewußtsein, dadurch in einer nach Ingeborg Bachmann „gestundeten Zeit“ zu leben, entwickelte sich in der Folge die christliche Geschichtstheologie. Weil der Erlöser, wie die frühchristliche Deutung der Symbolik des Kreuzes sagt, die Welt in ihrer Breite und Länge, Höhe und Tiefe umfaßt, ruft er alles Zerstreute zur Erkenntnis des Vaters zusammen535. Das impliziert den Gedanken, daß der Geschichtsgang zwar nicht, wie Hegel sagen wird, in einem beständigen Fortschritt in Sachen der Freiheit, wohl aber zu wachsender Gotteserkenntnis begriffen ist, da in der Geschichte die Vorsehung wirkt, die den geschichtlichen Prozeß im Sinn des göttlichen Erziehungsplans steuert. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Chiliasmus, der die Vollendung der Welt nach einer tausenjährigen Herrschaft Christi erwartete. Während sich bei Tertullian daraus das mit der antiken Tradition brechende Konzept eines linearen Geschichtsgangs entwickelte, fiel Origenes im Bann seiner Apokatastasis-Lehre wieder auf zyklische Modellvorstellungen zurück. Ihm trat in Eusebius der Vertreter eines ausgesprochenen Geschichtsoptimismus
532 Nach: K. Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen (1950), in: ders., Sämtliche Schriften, Bd. 2, a.a.O., S. 240 – 279, S. 268. 533 Dazu: G. v. Rad, Theologie des Alten Testaments, Bd. 2, a.a.O., S. 107 – 121: Die Entstehung des hebräischen Geschichtsdenkens, bes. S. 121. 534 H. Köster, Grundtypen und Kriterien frühchristlicher Glaubensbekenntnisse, in: ders. u. J. M. Robinson, Entwicklungslinien durch die Welt des frühen Christentums, Tübingen 1971, S. 191 – 215, S. 197 – 201: Jesus als Herr der Zukunft. 535 Dazu: Irenäus v. Lyon, Darlegung der apostolischen Verkündigung I 3,34, in: ders., Epideixis; Adversus haereses, Bd. 1 (Fontes Christiani, Bd. 8.1), übs. u. eingel. v. N. Brox, Freiburg u. a. 1993, S. 56; ferner: E. Biser, Theologische Sprachtheorie und Hermeneutik, a.a.O., S. 44 – 49: Apostolische und antignostische Väter, bes. S. 47.
191
Das Fortleben
entgegen, der den zu einer Vielzahl von Völkern mit ihren Interessenkonflikten und Kriegen führenden Polytheismus schon durch die monotheistische Gesetzesreligion, vollkommen aber erst durch das Imperium Konstantins überwunden sah, das der Welt mit der Glaubenseinheit den endgültigen Frieden brachte536. Zu ihrer vollen Größe erhob sich die Geschichtstheologie erst bei Augustinus, wenn freilich im Widerspruch zu Eusebius und zudem mit einer pessimistischen Schlagseite. Denn Augustinus begreift den Geschichtsgang im Grunde nur als den unablässigen Konflikt von „civitas Dei“ und „civitas terrestris“, der mit dem endzeitlichen Sieg der göttlichen Sache endet. Bei ihm überdeckt nicht nur der prädestinierende Gotteswille die Vorsehung; vielmehr entfällt mit dieser auch die menschliche Freiheit und damit das Prinzip des kulturell-religiösen Fortschritts537. Zu tief hatte ihn die Eroberung Roms durch die Truppen Alarichs als Vorzeichen des politischen Niedergangs erschüttert, als daß ihm eine konstruktive Fortentwicklung denkbar gewesen wäre. Darin sah er sich auch durch die beiden Modelle bestätigt, die sich ihm zur Deutung des Geschichtsgangs anboten. Die auf das göttliche Sechstagewerk zurückgehende Epochenteilung führte ihn zur Unterscheidung von einer Zeit der Gesetzlosigkeit, einer Zeit des Gesetzes und einer Zeit der Gnade538. In ihr aber hatte die göttliche Innovation in Gestalt der Menschwerdung Christi einen Höhepunkt geschaffen, im Vergleich zu dem nichts auch nur annähernd Gleichwertiges, sondern allenfalls Niedergang und Verfall zu erwarten waren. Erinnert dieses Modell an Eusebius, so das zweite an Irenäus, bei dem nach Norbert Brox erstmals eine „selbstbiographische“ Geschichtsinterpretation vorliegt539. Demnach folgt die Menschheitsgeschichte den Stadien des menschlichen Lebensablaufs, so daß auf eine Phase der Kindheit und Jugend ein Reife- und Altersstadium folgt. Von der gegenwärtig erreichten „senectus mundi“ ist aber wiederum nichts Positives zu erwarten, da das Alter für Augustinus vorwiegend durch Verfall und Niedergang gekennzeichnet ist. Indessen strebt die Geschichte auch nach dieser pessimistischen Sicht dem endzeitlichen Gottesreich entgegen, in dem alle Tränen trocknen und das durchlittene Meer von Leiden durch die Seligkeit des „Gott alles und in allem“ aufgehoben werden. So sehr es zutrifft, daß Karl Löwith die Linearität dieses Konzepts in christentumskritischer Absicht gegen das zyklische Modell der Antike ausspielte, hält der Angriff Kurt Flaschs gegen ihn doch einer näheren Überprüfung nicht stand540. Auch wenn sich bei griechischen und römischen Autoren als Folge des platonischen Aufstiegsmodells Ansätze zu einem linearen Geschichtsverständnis finden, fehlt ihm doch gerade das, was dieses allein rechtfertigt: die christliche Vorstellung von dem alle Geschichte vollendenden Eschaton. Deshalb kann die Geschichte für sie, wie mit letzter Eindringlichkeit Nietzsche verdeutlichte, nur das in ewigen Kreisläufen wiederholen, was schon einmal war: das Gleiche541. 536 Dazu: C. Andresen u. A. M. Ritter, Geschichte des Christentums, Bd. 1.1, a.a.O., S. 24f; S. 63f; S. 67f. 537 Dazu: K. Flasch, Augustin. Eine Einführung in sein Denken, Stuttgart 1980, S. 374; S. 395 – 402. 538 A.a.O., S. 371ff; S. 374 – 384: Zur Entwicklung der augustinischen Geschichtstheorie. 539 Dazu: N. Brox, Offenbarung, Gnosis und gnostischer Mythos bei Irenäus von Lyon. Zur Charakteristik der Systeme, Salzburg u. a. 1966, S. 180 – 189: Die Heilsgeschichte. 540 K. Flasch, Augustin, a.a.O., S. 369: „Der von Karl Löwith in polemischer Absicht gegen das Christentum hervorgehobene Gegensatz von griechischer und christlicher Geschichtsauffassung ist historisch nicht haltbar.“ 541 Dazu: K. Löwith, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen, Stuttgart 1956, S. 113 – 126: Die antichristliche Wiederholung der Antike auf der Spitze der Aktualität; S. 161 – 178: Die ewige Wiederkehr des Gleichen und die Wiederholung des Selben.
192
5. Die Geschichtsgestalt
Sofern sich im Eschaton das Ereignis der Auferstehung vollendet, bietet sich dem linearen Konzept nicht nur das Modell der menschlichen Lebensgeschichte als Gliederungshilfe im allgemeinen an; vielmehr gilt das nun insbesondere für die Lebensgeschichte Jesu. Was die Geschichte, ungeachtet ihrer Eigengesetzlichkeit, ungeachtet insbesondere ihrer Schrecknisse und Abstürze, bringt, ist im Leben und Leiden Jesu vorweggenommen. Wie in einer Umkehrung des einst vieldiskutierten „biogenetischen Grundgesetzes“ rekapituliert der Geschichtsgang dann das, was sich in der Lebensgeschichte Jesu an Wachstum und Stillstand, Durchbrüchen und Rückschlägen, Siegen und Niederlagen, ereignete. Damit aber ist auch schon die Denkbarkeit dieses zunächst eher mysteriös erscheinenden Geschichtskonzeptes erwiesen. Doch was besagt die Geschichte, wenn man sie unter diesem Gesichtspunkt durchmustert? Nach Erich Przywara, dessen thematischen Beitrag Hans Urs von Balthasar in Erinnerung rief, ist die prinzipielle Antwort längst schon im Kirchenjahr vorgegeben, sofern es in einer Weise an die Jesus-Vita erinnert, daß darin das Gesetz der Zeiten entschlüsselt ist542. Danach spielt die Christenheit Jahr um Jahr das aufs Neue durch, was sie bereits durchlebte und was ihr noch meist ohne ausgeprägtes Wissen um ihren aktuellen Stand, bevorsteht. Wenn sie sich dabei in das Stadium des Kindseins Jesu vertieft, steht ihr allerdings schon das seiner Reife und bei dieser bereits das seiner Passion vor Augen, so wie sie diese nur mit seiner Verherrlichung zusammendenken kann. So hat sie bei jeder Station der Jesus-Vita immer schon deren Gesamtablauf im Blick. Dies jedoch nicht so, als werde das Ganze nun doch wieder in einen vorgegebenen Zyklus eingeschlossen, sondern in beständigem Hinblick auf das zeitlich und endzeitlich Kommende. Oder nun in der Sicht Przywaras: So ist es wohl wahr, daß wir jetzt nicht mehr im Advent leben, nicht mehr in der Weihnacht, nicht mehr in den Schaudern von Gethsemani und Golgotha, nicht mehr in den Jubelstürmen von Ostern und dem Feuer von Pfingsten, sondern Glieder sind Christi, der zur Rechten des Vaters sitzt, und wir mit ihm „der Hoffnung nach“, so daß die Ruhe des ewigen Sabbats bereits in unser Leben hineinatmet543. Daran gemessen nimmt sich das Geschichtsbild Gertrud von le Forts wie eine dichterische Umsetzung dieser Konzeption aus, nur daß sie gegenüber dem „nicht mehr“ Przywaras die zeitgeschichtliche Relevanz der Jesus-Vita betont. Danach empfangen die Epochen der Menschheitsgeschichte seit Christus ihre innerste Sinnzuweisung aus je einem Stadium der Lebensgeschichte Jesu, so daß einige, wie „Das Gericht des Meeres“ zu verstehen gibt, im Zeichen der vorgefühlten Menschwerdung, einige andere, nach der „Letzten am Schafott“ und der „Abberufung der Jungfrau von Barby“, im Zeichen der Todesangst Jesu und seiner Kreuzesnot stehen, während andere, wie die „Opferflamme“ und die „Tochter Farinatas“ andeuten, im aufdämmernden Osterlicht stehen, und wieder andere, wie es die „Magdeburgische Hochzeit“ und die „Consolata“ zum Ausdruck bringen, vom Vorgefühl des Endgerichts ergriffen sind. Wie sich eine individuelle Lebensgeschichte zum Miterleben und Miterleiden der Jesus-Vita gestalten kann, zeigt die Dichterin demgegen542 E. Przywara, Kirchenjahr. Die christliche Spannungseinheit, Freiburg i. Br. 1923. 543 Zitiert nach: H. U. v. Balthasar, Das Ganze im Fragment. Aspekte der Geschichtsphilosophie, Einsiedeln 1963, S. 325.
193
Das Fortleben
über in ihrem mystischen – nicht aber autobiographischen – Schlüsselroman „Das Schweißtuch der Veronika“. In beiden Perspektiven liegt der aktuelle Akzent auf der Passion, denn le Fort bekennt sich mit einer ihrer Figuren zu der Überzeugung, daß die Geschichte in die Stunde von Getsmani und Golgata eingetreten sei, so daß alle Gewährung im Modus des Entzugs, wenn nicht geradezu der Verweigerung erfolgt. So war es ihr auch lebensgeschichtlich durch die von ihr geforderte Entsagung auferlegt, die für sie freilich aus ihrer Logik in „Entzückung“ umschlägt: die österliche Konsequenz des von ihr dargebrachten Lebensopfers544. Fast gleichzeitig mit Balthasar griff Walter Kern in seinen gedankentiefen „Überlegungen zur Metaphysik des Geistes“ in diesen geschichtstheologischen Disput ein545. Für ihn leidet die Erörterung noch immer darunter, daß der von der Geistspekulation des Deutschen Idealismus angeregte Entwurf, wie er von der Theologie des vorletzten Jahrhunderts entwickelt worden war, blockiert durch einen überzogenen Identitätsbegriff, nicht aufgenommen und weitergeführt wurde. Freilich besteht auch seinem Ansatz zufolge das Christsein, zumal im „Teilraum der Kirche“, zunächst darin, daß das Einzelschicksal Anschluß an den Lebensweg Jesu findet. Doch weitet sich diese individuelle Perspektive alsbald ins Universale, wenn mit dem Hebräerbrief das menschliche Schicksal insgesamt demjenigen Jesu zugeordnet wird. Als dieser anstelle der ihm in Aussicht gestellten Freude das Kreuz auf sich nahm (Hebr 12,2), geschah das mit dem Ziel, diejenigen zu befreien, die lebenslang das Sklavenjoch der Todesfurcht zu tragen hatten (Hebr 2,14). Dadurch verleiht der epochale Nachvollzug der Jesus-Vita der Menschheitsgeschichte einen übergreifenden Sinn. Sie wird im Vorgriff auf die endzeitliche Todüberwindung (1Kor 15,26) zum ständigen Fortschritt in der Befreiung von der Todesangst, zur ständig fortschreitenden Angstüberwindung. Wenn die empirische Bewußtseinslage dem zu widersprechen scheint, dann nur, weil es ihr auf Grund mangelnder Vermittlung bis zur Stunde nicht gelang, sich auf die mystische „Tiefenströmung“ der Geschichte rückzubeziehen und ihr die angstüberwindenden Impulse zu entnehmen. Bei aller Analogie ist das keine Anleihe bei Hegels spekulativem Geschichtskonzept, sondern die Konsequenz aus der glaubensgeschichtlichen Entwicklung, die gerade heute einen entscheidenden Schritt mit der Erkenntnis vorankam, daß der wahre Gegensatz des Glaubens nicht, wie allgemein angenommen, im Unglauben und seiner militanten Speerspitze, dem Atheismus, zu suchen ist, sondern in der Angst. Indem sie den von ihr Befallenen ins Bodenlose stürzt, ist sie der Widerpart des religiösen Aktes, der seiner ganzen Intention zufolge darauf abzielt, den letzten, göttlichen Halt in der Bodenlosigkeit des Daseins zu gewinnen. Damit wird die Theodizee, mit Kern gesprochen, definitiv zur Kosmo- und Anthropodizee546. Doch gerade so entspricht es der christomathischen Perspektive. Was ihr zufolge gerechtfertigt werden muß, ist nicht etwa Gott, der, konsequent gedacht, über allen menschlichen Anfragen und Anzweiflungen steht, sondern der todverfallene Mensch, und er in der Form, daß er sich selbst in seiner Todverfallenheit annehmen lernt.
544 Dazu: E. Biser, Überredung zur Liebe, a.a.O., S. 226f; S. 232. 545 W. Kern, Einheit-in-Mannigfaltigkeit. Fragmentarische Überlegungen zur Metaphysik des Geistes (1964), in: ders., Geist und Glaube. Fundamentaltheologische Vermittlungen zwischen Mensch und Offenbarung, hrsg. v. K. H. Neufeld, Innsbruck u. a. 1992, S. 76 – 108. 546 Ders., Theodizee: Kosmodizee durch Christus, in: ders., Geist und Glaube, a.a.O., S. 109 – 145, S. 134.
194
6. Der Schatten
Wenn jede Epoche, wie das tiefsinnige Ranke-Wort sagt, „unmittelbar zu Gott“ ist547, ist sie es auch zur lebensgeschichtlichen Tat Jesu. Dann wiederholt sich das Verhältnis des individuellen zum geschichtlichen Fortleben nochmals im Verhältnis der einzelnen Epochen zur Gesamtgeschichte. So wie sich an Pfingsten die Geburt des fortlebenden Christus ereignet und wie dieser in seiner Parusie das in der Auferstehung vorweggenommene Ziel seiner Lebensbahn erreicht, ist auch jede Epoche von seiner Lebensgeschichte durchformt. Das schließt keineswegs aus, daß jede Epoche, wie le Fort deutete, ihre Sinnzuweisung zugleich aus einem bestimmten Stadium dieser Lebensgeschichte empfängt. Es besagt aber, daß die epochal durchmessene Lebensgeschichte einmal im Zeichen der Menschwerdung, dann wieder in dem der Aktivität oder in dem der Passion und Auferstehung steht. So könnte erklärt werden, daß die theologische Reflexion bisweilen dazu neigte, ihre Spekulation für den Gesichtspunkt der Menschwerdung zu entwickeln, um dann wieder auf das paulinische Kreuzesparadigma zurückzugreifen oder johanneisch von der präsentischen Eschatologie auszugehen. Die Konsequenzen der zeitgeschichtlichen Perspektive des Fortlebens sind denkbar weitreichend. Nicht nur, daß sich das Epheserwort vom Heranreifen der Glaubensgemeinschaft zum Vollalter Christi mit plastisch gegliedertem Sinn als ein Fortschreiben von kindlichen Anfängen über Stadien des Wachsens und der Prüfung bis zur Vollendung füllt; vielmehr wird nun der ganze Prozeß erstmals als ein Fortschreiten des Zusich-selbst-Kommens des Geglaubten in den Glaubenden begreiflich. Das erfordert eine dramatische Steigerung der kreativen Komponente des bisher vorwiegend rezeptiv verstandenen Glaubensaktes. Weil der „Ort“ des Erwachens in den Glaubenden selbst besteht, sind diese zu dessen ermöglichendem Mitvollzug aufgefordert. Auch sie müssen den durch die Jesus-Vita vorgezeichneten Weg durchschreiten, müssen sich in das NochNicht des Kindseins einfügen, müssen die Wachstumsschmerzen des Reifens ertragen, die Verunsicherungen bestehen, die Konflikte austragen und im Dunkel der Prüfung ausharren. Nur so können sie lernen, die Grenze der Gegenständlichkeit in Richtung auf die Identität hin zu überschreiten, ohne diese je zu usurpieren. Denn in der Heteronomie blieben sie unwissende Knechte; mit der angemaßten Identität versänken sie in blasphemischem Wahn. Was ihnen als wahres und höchstes Ziel offensteht, ist jedoch jene mystische Koexistenz, die das Johannesevangelium die Erwählung zur Freundschaft nennt (Joh 15,9-16).
6. Der Schatten Durch dieses Stichwort aufgerufen, tritt der Christusbegleiter erneut – und nun definitiv – ins Visier, nachdem er nach seiner Einführung im Schlußteil des Johannesevangeliums bereits zweimal ins Bild getreten war. Das erste Mal in der häretisch schrägen Perspektive des Arianismus, wenn im christologischen Zyklus der ehemaligen Palastkirche Theoderichs in Ravenna, dem heutigen Sant’Apollinare Nuovo, neben Jesus die Figur des sein Wirken mit emphatischen Gesten kommentierenden Christusbegleiters erscheint, dies freilich nicht gerade in den Szenen, die das vierte Evangelium für seinen Auftritt 547 L. v. Ranke, Erster Vortrag vom 25. September 1854, in: ders., Aus Werk und Nachlass, Bd. 2: Über die Epochen der neueren Geschichte, hrsg. v. Th. Schieder u. a., München u. a. 1971, S. 53 – 76, S. 59f.
195
Das Fortleben
reservierte. Und dann nochmals, und jetzt in einer geradezu symbolischen Zusammenschau mit Jesus, in der hochmittelalterlichen Figur der „Johannesminne“, die heute, in der Stunde der mystisch akzentuierten Glaubenserwartung, wie kaum einmal zuvor zur Neuentdeckung ansteht. Mit der bloßen Wiederaufnahme der mittelalterlichen Symbolfigur der Gottesfreundschaft ist es freilich nicht getan, es sei denn, daß man den mystischen Schlaf des an die Schulter Jesu gelehnten Lieblingsjüngers, wie es anfänglich wohl auch gemeint war, zeitkritisch, als zeitvergessen-zeitlose Versenkung in das Geheimnis des göttlichen Freundes, deutet. Denn die Herauslösung der Zweiergruppe aus der Abendmahlsszene ist offensichtlich als Hinweis darauf zu verstehen, daß an ihr etwas zum Vorschein kommt, was sie der historischen Einmaligkeit des Abendmahls enthebt und was in dieser Überzeitlichkeit doch nur dadurch glaubhaft werden kann, daß der geliebte Jünger das nachahmt, was der Liebende seit Ewigkeit ist: der seinerseits am Herzen des Vaters Ruhende. So sind in der Symbolgruppe drei Zeitebenen ebenso voneinander abgehoben wie miteinander verbunden: die heilsgeschichtliche Ebene der Abendmahlsszene, die überzeitliche der aus ihr herausgelösten Gruppe und die gleichzeitige, die sich aus dem Rückbezug der zweiten aus der ersten ergibt und geradezu danach schreit, auf das Lessingproblem des „garstigen breiten Grabens“ hin ausgelegt zu werden. Während Lessing daran verzweifelte, den ihn von der Heilsgeschichte trennenden Graben jemals überspringen zu können – so wie später Kleist daran verzweifelte, die allein noch Rettung verheißende „Reise um die Welt“ zurücklegen zu können –, wird hier, in der Johannesminne, das Unausdenkliche zum Ereignis: Die Heilszeit öffnet sich in die Gegenwart hinein, und diese sieht sich in jener vorweggenommen. Im Bild gesprochen: Als Jesus den bevorstehenden Verrat ankündigt und keiner aus der tatsächlichen Mahlgemeinschaft reagiert, ruft er insgeheim seine Wirkungsgeschichte an, die ihm dadurch antwortet, daß sie ihm den geliebten Jünger als Inbegriff des ihm über Jahrtausende hinweg entgegengebrachten Mitleids an die Seite stellt. Das aber könnte sie nicht, wenn Jesus sich nicht – wie mit seinen Gaben so auch mit seinem Schmerz und seinem Selbstsein – in ihr vergegenwärtigt hätte, wenn er also nicht als der in ihr Fortwirkende und Fortleidende zu gelten hätte. So gesehen ist in dieser Symbolgruppe die von Kierkegaard gefundene und in dem Schlüsselsatz: „Der Helfer ist die Hilfe“, umschriebene Lösung des Lessingproblems vorweggenommen. Es lag eben nicht an Lessings „alten Beinen“, wie er sich in seiner Antwort auf den kritischen Zuspruch Jacobis ausdrückte548, sondern am menschlichen Unvermögen überhaupt, daß er den trennenden Graben nicht überspringen konnte. Vielmehr konnte die Überbrückung nur aus der Gegenrichtung und nur durch den erfolgen, der in die Vergangenheit des Gewesenen gesunken zu sein schien, der jedoch durch seine Selbstgewährung das Koordinatensystem von Raum und Zeit durchbrach und, zusammen mit den Denkformen, auch die „Anschauungsformen“ aufhob, um allenthalben und allzeit gegenwärtig zu sein – mit anderen Worten: Übersprungen wird der breite Graben nicht von Seiten des Glaubenden, sondern von Seiten des Geglaubten. Deshalb greift die von Hans Kessler gegen Lessing erhobene Kritik, soviel Richtiges sie anspricht, zu kurz. Zwar gründet der Glaube, wie Kessler zurecht einwendet, nicht nur auf Nachrichten vom Heilswerk Jesu, sondern auf ihm selbst und der „Evidenz seiner Gegenwart“; was für diese aber geltend gemacht wird – Jesu spirituelle Anwesenheit in der Glaubens548 Dazu: F. H. Jacobi, Über die Lehre des Spinoza [in Briefen an den Herrn Moses Mendelsohn], in: ders., Werke, Leipzig 1819, Bd. 4, 1. Abth., S. 37 – 94, S. 74.
196
6. Der Schatten
gemeinschaft, im Schriftwort und Herrenmahl und in der „gewöhnlichen Mystik der Glaubenden“ –, bezeichnet nur formal, was empirisch zur Geltung gebracht werden müßte und deshalb der vollen Verifikation ermangelt549. Denn diese wäre erst dann erbracht, wenn sich die beiden Formen des Fortlebens Jesu, die individuelle und die geschichtliche, zur Deckung bringen ließen, wenn also die individuelle Lebenszeit mit ihren Erfahrungswerten als eine Abbreviatur der welt- und zeitgeschichtlich fortgeschriebenen Jesus-Vita begriffen würde. Boëthius, der sich wie schon der frühe Augustinus vor dasselbe Problem gestellt sah, fand die mögliche Lösung im Rückgriff auf die antike Hypothese von der Weltseele, verstanden als die kosmische Verklammerung der subjektiven Lebenszeit und inneren Zeiterfahrung mit der universalen Weltzeit. Und die moderne Theologie scheint sich in einzelnen ihrer Vertreter dieser Position wieder anzunähern. Die wirkliche Lösung bietet jedoch nicht der Kosmos, sondern die Konvergenz von Lebens- und Zeitgeschichte, wie sie die mittelalterliche Mystik in der Symbolgruppe der Johannesminne ins Bild hob. Denn in ihrer Symbolik begriffen, wird hier die Heilszeit zum Horizont der Lebenszeit und diese zum Schlüssel, der den – mit Walter Wimmel gesprochen550 – „Großtext“ der Geschichte aus der Sicht der subjektiven Biographie lesbar macht. Doch wie kann dieser subtile Verweisungszusammenhang heute, nach der Erosion durch Aufklärung und Säkularisierung, aktualisiert und – womöglich sogar als rückbezügliche Lesehilfe für die Deutung des Ursprungs – fruchtbar gemacht werden? Das ist die Frage nach den Furchen und Spuren, die das Fortleben Jesu im Feld des Geisteslebens hinterließ. Bevor dieser Frage nachgegangen werden kann, muß jedoch die Vorfrage der Orientierungs- und Leitfigur geklärt werden, die der Spurensuche voranleuchten muß, wenn diese zum Erfolg führen soll. Damit ist freilich schon im Angang eine zu große, zu eidetisch-plastische Erwartung geweckt. Denn der Säkularisierungsprozeß endete, wie schon Nietzsche erkannte, in einem Ikonoklasmus, der sich gegen die überkommene Bilderwelt richtete und diese, sofern sie nicht völlig zertrümmert wurde, auf Strukturen und Perspektiven reduzierte. Was von den Bildern blieb, war, wie sich gleichfalls bei Nietzsche zeigt, die Optik, verstanden als die auf die bildhaften Restbestände gerichtete Sehweise und die von einer irritierten Sinnerwartung gesteuerte Blickrichtung. Es ist ein offenes und noch nicht fündig gewordenes, im Dunkel der Zeitsituation aber doch erleuchtetes Sehen. Doch wodurch ist es erleuchtet? Die Frage kann philosophisch und theologisch beantwortet werden. Theologisch in Erinnerung an Pierre Rousselots Theorem von den letztlich durch sich selbst erhellten „Augen des Glaubens“, der nach seiner von Thomas von Aquin übernommenen Ansicht nicht glauben könnte, wenn er das zu Glaubende nicht „sehen würde“551. Denn im Glauben fallen für ihn Sehen und Gesehensein in eins, weil das geglaubte Mysterium erhellend auf den ihm zugewandten Menschengeist einstrahlt552. Noch näher führt die philosophische Antwort an den zu klärenden Sachverhalt heran. Sie ergibt sich aus der 549 Dazu: H. Kessler, Sucht den Lebenden nicht bei den Toten, a.a.O., S. 237 – 245; S. 262; S. 377 – 390. 550 W. Wimmel, Die Kultur holt uns ein. Die Bedeutung der Textualität für das geschichtliche Werden, Würzburg 1981; dazu: E. Biser, Die glaubensgeschichtliche Wende, a.a.O., S. 147f. 551 P. Rousselot, Die Augen des Glaubens, a.a.O., S. 21f. 552 A.a.O., S. 37f; S. 59; S. 67 – 75; zur Auseinandersetzung mit dem Ansatz Rousselots: E. Biser, Glaubensverständnis. Grundriß einer hermeneutischen Fundamentaltheologie, Freiburg i. Br. u. a. 1975, S. 38f.
197
Das Fortleben
berühmten Stelle aus Platons Siebtem Brief, die von dem nicht in Worte zu fassenden Zustandekommen der Erkenntnis spricht und dieses mit der Wendung umschreibt: […] aus häufiger gemeinsamer Bemühung um die Sache selbst und aus dem gemeisamen Leben entsteht es plötzlich – wie ein Feuer, das von einem übergesprungenen Funken entfacht wurde – in der Seele und nährt sich dann schon aus sich heraus weiter553. Bei Adelbert von Chamisso steht der Schatten für die durch das von außen kommende Licht gewonnene Kontur, also für die aus der gesellschaftlichen Interaktion hervorgehende Identität. Insofern spielt „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ das romantische Leitmotiv der Identitätskrise durch, mit dem die Reaktion auf die Aufklärung den Gegenpol zum cartesianisch-humanistischen Subjektbegriff erreichte. Auch für den Nachromantiker Nietzsche ist der Schatten das Symbol der Selbstentzweiung, der er sich aussetzt, um sie, die er sich selbst zu dem Ziel verordnete, wieder „guter Nachbar der nächsten Dinge“ und seiner selbst zu werden, erfolgreich auf sich anwenden zu können554. Aus welcher „Tiefe“ er den Schatten zu sich sprechen läßt, macht der gegen eine Eloge Voltaires ausgetauschte Aphorismus „Die Hadesfahrt“ deutlich, den Nietzsche anfügte, als er in „Menschliches, Allzumenschliches“ bereits mit der Aphorismenfolge „Der Wanderer und sein Schatten“ beschäftigt war555. Unter Berufung darauf, daß er, wie Odysseus, schon in der Unterwelt gewesen sei, um sich dort mit den ihm wichtigen Denkern der Vorzeit zu unterreden, bittet er hier die Lebenden um Nachsicht dafür, daß sie ihm mitunter wie Schatten vorkommen, während jene ihm so lebendig scheinen, als ob sie nun, nach dem Tode, nimmermehr lebensmüde werden könnten. Doch damit gibt Nietzsche zu verstehen, daß er in Gestalt des Schattens zu sich wie zu einem bereits Abgeschiedenen redet, wenn freilich nicht mehr resignierend, wie er noch in einem Brief an Peter Gast gesteht556, derart „vom Tod umgeben“ zu sein, daß er ihn stündlich fassen könne, sondern mit dem entschiedenen Willen, eine „zeitweilige Erkrankung an der gefährlichsten Form der Romantik“ unter und hinter sich zu bringen557. In dieser abkünftigen Form weist das Motiv zurück auf seine zentrale Artikulation in der Cusanusschrift „Vom Sehen Gottes“, wo es in einer überraschenden Oszillation mit dem gleichzeitig als sehender und reflektierender „Spiegel der Ewigkeit“ angerufenen Gott erscheint. Von ihm heißt es im Blick auf das zu Beginn der Schrift erwähnte Bild des Allsehenden: Manchmal erscheinst Du, als wärest Du Schatten und bist doch Licht. Denn, wenn ich sehe, wie der Blick Deines Bildes sich meinen geänderten Bewegungen entsprechend zu ändern scheint und mir Dein Antlitz verwandelt vorkommt, weil ich mich gewandelt habe, dann scheinst Du wie ein Schatten zu sein, der den sich wandelnden Bewegungen des Gehenden folgt. Weil ich ein lebender Schatten bin und Du die Wahrheit, schließe ich aus der Veränderung des Schat553 Platon, Der siebte Brief, 341c-d, in: ders., Werke in acht Bänden, Bd. 5, a.a.O., S. 413. 554 F. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches II: 2. Der Wanderer und sein Schatten, § 16, in: ders., KSA 2, S. 550f, S. 551. 555 A.a.O., 1. Vermischte Meinungen und Sprüche, § 408, in: ders., KSA 2, S. 533f. 556 An Heinrich Köselitz [alias Peter Gast], 11. September 1879, in: F. Nietzsche, Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden, hrsg. v. G. Colli u. a., München u. a. 2/2003, Bd. 5: Januar 1875 – Dezember 1879, Nr. 880, S. 441 – 443. 557 Ders., Menschliches, Allzumenschliches II: Vorrede, § 2, in: ders., KSA 2, S. 371f, S. 371.
198
6. Der Schatten
tens, daß sich die Wahrheit verändert hat. Mein Gott, Du bist so der Schatten, daß Du die Wahrheit bist, und so das Abbild von mir und jedem anderen, daß Du das Urbild bist558. Hier tritt der Schatten in einen ambivalenten Doppelaspekt, der sich aus cusanischer Sicht letztlich daraus erklärt, daß Gott solange in der Gegensinnigkeit von Andersheit und Innigkeit, Ferne und Intimität, Hoheit und Nähe, Schrecken und Trost und hier von Sehendem und Gesehenem erscheint, als er nicht im Medium des menschgewordenen Mittlers gesucht und gesehen wird, von dem es am Schluß der „Docta ignorantia“ heißt: Wer so in Jesus eingeht, vor dem weicht alles zurück und weder die Schriften noch diese Welt können ihm Schwierigkeiten bereiten, weil er wegen des Geistes Christi, der in ihm wohnt und der das Ziel des geistigen Verlangens ist, in Jesus umgewandelt wird559. Ohne diesen „Eintritt“ bleibt Gott der unausdenkliche Zusammensturz der Gegensätze; in der christomathischen Sicht, zu der sich der späte Nikolaus von Kues erhebt, wird diese Koinzidenz jedoch zu der vom Cherub bewachten Paradiesesmauer, die nur durch die von Christus gebildete Pforte durchschritten werden kann. Wenn das gelingt, tritt das Gottesgeheimnis in den Aspekt jener befreienden und tröstenden Eindeutigkeit, die nicht mehr Kampf, sondern Versöhnung der Gegensätze besagt und Gott als Inbegriff des – von Nikolaus von Kues lebenslang ersehnten – Friedens erweist. Doch damit fällt der Schatten endgültig auf den Begleiter zurück, so daß dieser definitiv als der mit Jesus einhergehende Schattenwurf erscheint. Was das an Intimität und Intensität der Beziehung besagt, kann am besten der Stelle entnommen werden, an der Nietzsche im abschließenden Maskenzug seines „Zarathustra“ nochmals auf das Motiv zurückkommt. Im Kontext dieser „mit der Laune eines Hanswurst“ gedichteten Blasphemie, die auf weite Strecken von biblischen Anspielungen durchsetzt ist, gesteht der „Schatten“ dem von ihm begleiteten Zarathustra: Mit dir zerbrach ich, was je mein Herz verehrte, alle Grenzsteine und Bilder warf ich um, den gefährlichsten Wünschen lief ich nach, – wahrlich, über jedwedes Verbrechen lief ich einmal hinweg. Mit dir verlernte ich den Glauben an Worte und Werte und große Namen560. Auf die Rolle des Jesusbegleiters zurückbezogen, besagt dessen „schattenhaftes“ Verhältnis zu Jesus soviel wie: ihm, soweit es nur angeht, in allen Kühnheiten seiner lebens- und wirkungsgeschichtlichen Errungenschaften nachzustreben und ihm auch dorthin zu folgen, wo er sich jedem Nachvollzug zu entziehen droht, also dorthin, wo er sich der 558 Nikolaus von Kues, De visione Dei – Die Gottes-Schau c. 15, in: ders., Philosophisch-theologische Schriften, Bd. 3, a.a.O., S. 158 – 165, S. 161. 559 Ders., De docta ignorantia – Die wissende Unwissenheit III, Brief des Autors an den Herrn Kardinal Julianus, in: ders., Philosophisch-theologische Schriften, Bd. 1, a.a.O., S. 514 – 517, S. 517. 560 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra IV, Der Schatten, in: ders., KSA 4, S. 338 – 341, S. 340; dazu: E. Biser, Gottsucher oder Antichrist, a.a.O., S. 110 – 114.
199
Das Fortleben
Auseinandersetzung stellt, wenn kluges Nachgeben geboten erscheint, wo er sich verbirgt, wenn man seinen machtvollen Selbsterweis erwartet, wo er das überbietet, was bereits gelungen und perfekt zu sein scheint, wo er Forderungen stellt, die ins Fleisch des Lebenswillens schneiden, wo er sich in Verhältnisse einmischt, die jeder lieber mit sich selbst ausmachen möchte, wo er ein Mitspracherecht auf das geltend macht, was nach allgemeiner Ansicht niemanden etwas angeht, wo er geistige und ethische Orientierung beansprucht, indem er die Ordnung der Gerechtigkeit dem sanften Diktat der Liebe unterwirft und indem er das in und mit ihm kommende Gottesreich als das Hochziel menschlichen Zusammenlebens erweist, und wo er in alledem Hand an den Identifikationsakt der Seinen legt und seine eigene Identität von ihrer glaubenden und liebenden Zuwendung abhängig macht. Bei aller Aktualität trifft all das in erster Linie auf das zu, was durch ihn lebensgeschichtlich getan wurde und unter diesem Gesichtspunkt nochmals bedacht werden muß. Doch betrifft es nicht weniger sein wirkungsgeschichtliches Nach- und Fortleben, also die Frage, wie er sich in den Gang der Welt und Geistesgeschichte einmischt. Damit sind die beiden nächsten Schritte des Gedankengangs umrissen561.
561
200
Siebtes Kapitel
Der Rückbezug 1. Der Vermittler
W
ie kann der „Gestrige“ (Hebr 13,8) der „Heutige“ sein? Wie kann er in seinen Wirkungen selbst wahrgenommen und erfahren werden? Wie ist seine Geistesgegenwart möglich? Diese Fragen wurden bisher nur nachösterlich beantwortet. Zunächst mit Kierkegaard und Machoveč, die beide auch die Identität Jesu von dem, was er lebte und wirkte, abhoben. Sodann mit Gerhard Koch, der die Auferstehung als Jesu Eintritt in die Geschichte versteht. Danach machten die Ostererscheinungen den Zeugen – und den auf ihr Zeugnis hin Glaubenden – deutlich, daß der Gekreuzigte in dem Sinn „erhöht“ wurde, daß er, johanneisch gesehen, das Koordinatensystem von Raum und Zeit durchbrach und sich nach Joh 7,38 als Lebensstrom in die ihm zugewandte Welt ergoß, daß er, ungeachtet seiner bleibenden Individualität, zugleich im Personzentrum der Glaubenden auflebte und daß er die von ihm Ergriffenen zugleich in einer mystischen Lebenseinheit mit sich selbst integrierte. Man wird sich hüten müssen, beim Versuch einer Klärung dieses „Zugleich“ von Einst und Jetzt, Individualität und Allverbundenheit mit der Tür ins Haus zu fallen, und stattdessen den Zugang dort suchen müssen, wo er sich organisch bietet: bei Paulus. Zwar steht der Apostel nicht, wie Guardini irrtümlich annahm, auf der Seite der „Schüler zweiter Hand“, die ihren Glauben auf das Wort der Augenzeugen stützen, wohl aber zwischen beiden. Als der „mit Christus Gekreuzigte“ (Gal 2,19) ist er zwar auf denkbar drastische Weise dem historischen Jesus verhaftet; doch entnimmt er sein ganzes Wissen um Jesus der ihm vor Damaskus übereigneten Gottesoffenbarung (Gal 1,12). Das distanziert ihn von den „anfänglichen Augenzeugen“ (Lk 1,2) ebenso, wie es ihn mit diesen verbindet. Doch eben diese Zwischenstellung zwingt Paulus in jene einzigartige Nähe zu Jesus, die ihn mehr als jeden anderen als die Modellgestalt erweist, nach der die Idealfigur des johanneischen Lieblingsjüngers gestaltet ist, so daß er sich wie dieser, nur mit ungleich größerem Eigengewicht, als Lese- und Deutehilfe anbietet. In Paulus ist, um damit einzusetzen, die individuelle Lebenszeit von der im Kreuz und in der Auferstehung gipfelnden Heilszeit übergriffen; in ihm öffnet sich diese in die Geschichte hinein, so daß es nur natürlich ist, daß sich auch für ihn das Koordinatensystem von Raum und Zeit lockert. Während er noch im Galaterbrief (Gal 4,20) an den Gitterstäben des von ihm eingesetzten Mediums rüttelt und sich in dem Wunsch verzehrt, bei den angefochtenen Adressaten zu sein, weiß er schon in der folgenden Korrespondenz mit Korinth, daß den Adressaten das, was er ihnen zu sagen hat, durch den Gottesgeist bereits ins Herz geschrieben ist (2Kor 3,2). Deshalb kann er ihnen, wie dann auch den Christen von Philippi, versichern, daß er sie, ungeachtet seiner räumlichen Ferne, in seinem Herzen trage (Phil 1,7) und ihnen, obwohl im Briefwort abwesend, in der „Tat des Geistes“ gegenwärtig sei (1Kor 5,3), ihnen verbunden im Leben wie im Sterben (2Kor 7,3). Diese literarisch essentielle Selbstvergegenwärtigung erreicht einen ersten Höhepunkt in der Reaktion des Apostels auf den korinthischen „Skandalfall“, der ihn zu der Aussage provoziert: 201
Der Rückbezug
Was mich angeht, so habe ich leiblich zwar abwesend, geistig aber anwesend – mein Urteil über den, der sich so vergangen hat, gefällt, als ob ich persönlich anwesend wäre: Im Namen Jesu wollen wir uns versammeln, ihr und mein Geist, und zusammen mit der Kraft Jesu, unseres Herrn, diesen Menschen dem Satan übergeben zum Verderben seines Fleisches, damit sein Geist am Tag des Herrn gerettet werde (1Kor 5,3ff). Wenn je einmal handelt Paulus hier – zur Empörung seiner Kritiker – nicht „im Geist der Sanftmut“, sondern, wie er es der Gemeinde unmittelbar zuvor angedroht hatte, „mit dem Stock“ (1Kor 4,21). Empört über den Vorfall, läuft er zu seiner vollen Größe auf, die ihn, getragen von der Macht des Geistes Jesu, die räumliche Distanz überwinden und sein – extrem hartes – Urteil über den Übeltäter sprechen läßt. Ganz anders am Ende der Korrespondenz, wo sich Paulus seinerseits von der Gemeinde aufgefordert sieht, seine energetische Verbundenheit mit Christus unter Beweis zu stellen. Anstatt darauf einzugehen, wälzt er die Beweislast an die Antragsteller mit der Aufforderung ab: Prüft euch doch selbst, ob ihr im Glauben steht, erprobt euch selbst! Oder merkt ihr nicht, daß Christus in euch ist? Wenn nicht, dann hättet ihr die Probe nicht bestanden (2Kor 13,5f)562. Wenn Paulus derart spiegelverkehrt argumentiert, dann unter der Voraussetzung, daß der von der Gemeinde erbrachte Beweis ihrer Ermächtigung durch Christus auch für ihn selber gilt, weil er ihnen, wie er ausdrücklich versicherte, „im Leben und im Sterben“, vor allem aber durch die mystische Zugehörigkeit zu Christus verbunden ist. Darin, und nicht nur in der Sorge um ihr Glaubenswachstum, ist es begründet, daß ihm ihr Versagen ebenso nahegeht wie ihr Wachsen und Reifen. Deshalb strahlt die gelungene Selbstprüfung in einer Weise auf ihn zurück, daß sie dem von ihm geforderten Beweis gleichkommt. Es ist wohl nur einer antignostischen Voreingenommenheit – wie sie auch bei Günther Bornkamm vorliegt – zuzuschreiben, wenn Walter Schmithals die korinthischen Charismatiker, die aus dem Bewußtsein des in ihnen auf- und fortlebenden Christus agieren, gerade darin einem gnostischen All-Einheitsmythos, konkret gesprochen: dem Mythos vom „erlösten Erlöser“, verfallen sieht563. Gnostisch ist in ihrem Selbstbewußtsein allenfalls die überzogene Konsequenz, die sie im Gefühl der bereits eingetretenen endzeitlichen Vollendung leben läßt, nicht jedoch ihre aus der Ergriffenheit durch Christus geschöpfte 562 Dazu: E. Biser, Der unbekannte Paulus, a.a.O., S. 227f. 563 Dazu: W. Schmithals, Die Gnosis in Korinth. Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 3., bearb. u. erg. Aufl., Göttingen 1969, S. 137 – 146.
202
2. Die Identitätsfindung
Identität. Mit dieser zieht sie ebenso mit dem paulinischen „nicht mehr ich – Christus in mir“ (Gal 2,20) gleich, wie sie auf die „Isochristoi“, die „Christusgleichen“, der patristischen Mystik vorgreift, die Alois Dempf in seinem Werk über die altchristliche Kulturgeschichte in Erinnerung rief564.
2. Die Identitätsfindung Doch nun von diesen „Christusgleichen“ zurück zum „heiligen Original“, also zu Jesus! Denn mit der bisherigen Verhältnisbestimmung seines vor- und nachösterlichen Lebens ist es nicht getan. Danach erschien die Auferstehung lediglich als große „Lebenswende“, durch die sich die individuelle Lebensgeschichte Jesu als universales Christusgeschehen in der Geschichte fortsetzte. Das hat, wie sich zeigte, aber nicht nur die existenzverwandelnde Macht der Auferstehung, sondern nicht weniger auch die noch bei Paulus nachwirkende Fähigkeit Jesu zur Selbstvergegenwärtigung, wie sie von Kierkegaard empfunden und auf den Begriff gebracht wurde, zur Voraussetzung. Sie aber muß, wenn die Lebensgeschichte Jesu nicht in zwei disparate Hälften auseinanderbrechen soll, bereits in seiner historischen Lebenszeit ihren Anfang genommen haben. Da sie als der zentrale „Beweggrund“ seines Fortlebens anzusehen ist, tritt sie in diesem freilich so sehr in den Vordergrund, daß sie auch die Jesusdarstellung der Evangelien überstrahlt. Demgemäß gestaltet sich die Spurensuche ausgesprochen schwierig. Indessen gab der Kronzeuge Kierkegaard einen wichtigen Hinweis, wie hinter die Überlagerungen zurückgegriffen werden kann. Denn er ist im Zweifel, ob das von ihm als Schlüsselwort des Evangeliums herausgestellte Logion: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig seid und beladen“ (Mt 11,28), als originäres Jesuswort gelten könne: So spricht er, und die, welche mit ihm gelebt haben, sie sahen es, und siehe, es ist wahrlich in seiner Weise zu leben nicht das Mindeste, das dem widerspräche. Mit der schweigenden und wahrhaftigen Wohlredenheit der Tat drückt sein Leben es aus, und hätte er es gleich niemals gesprochen, dies Wort, sein Leben drückt es aus […]. Er steht zu seinem Wort, oder er ist selber sein Wort, er ist, was er sagt, auch in diesem Sinn ist er das Wort565. Inzwischen zeigte die kritische Forschung, daß es sich bei dem von Kierkegaard ins Zentrum des Evangeliums gerückten Ausspruch tatsächlich um ein in Anlehnung an die alttestamentliche Weisheitsschriften nachgestaltetes Herrenwort handelt, das Jesus im Spiel der „Frau Weisheit“ zur Tisch- und Lebensgemeinschaft mit sich rufen läßt566. Umso wichtiger ist der von Kierkegaard gewiesene Weg einer Verifikation. Mit der stillen Beredtsamkeit der Tat, so Kierkegaard, habe Jesus durch sein Dasein und seine Selbstdarstellung nie etwas anderes als diese fortwährende Einladung an die Bedrückten und Be564 Dazu: A. Dempf, Geistesgeschichte der altchristlichen Kultur, Stuttgart 1964, S. 177f. 565 S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, in: ders., Werkausgabe Bd. 2, S. 18. 566 Dazu: F. Christ, Jesus und Sophia. Die Sophia-Christologie bei den Synoptikern, Zürich 1970, S. 100 – 119; S. 120 – 135; ferner: B. Lang, Frau Weisheit: Deutung einer biblischen Gestalt, Düsseldorf 1975.
203
Der Rückbezug
ladenen ausgesprochen und zu der mit der Verheißung der „Ruhe“ gemeinten Lebensgemeinschaft mit sich aufgerufen. Der Hinweis gewinnt noch an Profil, wenn man die Beobachtung Kierkegaards hinzunimmt, daß sich Jesus uneingeschränkt allen zuwendet, dabei aber einem jeden so, als gäbe es nur ihn567, in aller Welt nur diesen einen, und daß er keinen je wieder aus seiner Zuwendung entläßt, dessen er sich einmal angenommen hat. Damit verweist der Fingerzeig eindeutig auf den von der neueren Theologie als Inbegriff des Sozialverhaltens Jesu entdeckten „Tisch der Sünder“, um den in erster Linie die Adressaten seiner Seligpreisungen, also die ins gesellschaftliche und wirtschaftliche Abseits Gedrängten, versammelt sind568. Die von ihm zugesicherte Ruhe besagt zwar Entlastung von der Fron ihres bedrückenden Schicksals, aber nur um den Preis, daß ihnen das „Joch“ der mit der Nachfolge verbundenen Forderungen, darunter die gerade für sie härteste Forderung der Feindesliebe, aufgebürdet wird. Daß man dieses Joch dennoch „sanft“ und seine Bürde „leicht“ nennen kann, ist nur deshalb verständlich, weil Jesus auf dem Weg der Nachfolge „vorangeht“ und sich auch selbst unter das von ihm aufgebürdete Joch stellt, also verständlich nur unter der Voraussetzung, daß er mit den Seinen eine sie bestärkende, aufrichtende und ermutigende Lebensgemeinschaft eingeht. Daß diese Lebensgemeinschaft zustandekam, war in jener einzigartigen Identitätsfindung begründet, die sich auf dem zur durchschnittlichen Identitätsfindung diametral entgegengesetzten Weg vollzieht, weil sie ihr Ziel in Akten der Hingabe, der Selbstentäußerung und Liebe erreicht: Identitätsfindung im anderen, nicht in der Abgrenzung und Unterscheidung von ihm. Wenn aber diese Voraussetzung gegeben war, finden sich hier die Ansätze zu jener Selbstübereignung, die Kierkegaard mit dem Schlüsselsatz: „Der Helfer ist die Hilfe“, zum Lebensprogramm Jesu erklärte. Von hier aus kann die Spurensuche in zwei Richtungen weiterverfolgt werden. Die eine ergibt sich aus der Beobachtung, daß sich am Tisch der Lebensgemeinschaft mit Jesus die Adressaten seiner Seligpreisungen, und damit seiner Wortverkündigung, versammelt haben, die zweite aus dem Umstand, daß Kierkegaard seinen Schlüsselsatz aus einer Betrachtung des therapeutischen Verhaltens Jesu herleitet: Der Helfer ist die Hilfe. O, wunderlich, er, der alle einlädt, allen helfen will, seine Art, den Kranken zu behandeln, ist ganz als wäre sie auf jeden Einzelnen angelegt, als hätte er an jedem Kranken, den er hat, nur den einen Kranken569. Im Regelfall müsse sich ein Arzt auf seine vielen Kranken verteilen, er müsse den einen verlassen, um sich dem nächsten zuzuwenden. Und so fielen Helfer und Hilfe auseinander. Wenn aber, wie bei ihm, der Helfer die Hilfe ist, könne er alle einladen und doch bei jedem fortwährend bleiben. Damit ist die Spurensuche eindeutig an die Wundertätigkeit Jesu verwiesen, die in Einzelfällen, wie in Mk 7,29f und Lk 7,1-10, als Fernheilung beschrieben wird, meist jedoch die von ihm erbetene Heilung durch Berührung (Mk 1,31;5,41;7,33;8,23; Lk 13,13), einmal sogar durch „Kraftübertragung“ (Mk 5,30) erfolgt. Während Matthäus diesen Zug aus seinem Referat der Episode tilgt (vgl. Mt 9,22 mit Mk 5,30), gestaltet ihn Lukas zu einem ausdrücklichen Jesuswort um: 567 Dazu: S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, a.a.O., S. 19f. 568 Dazu: E. Biser, Das Antlitz, a.a.O., S. 214 – 217: Der Tisch der Sünder. 569 S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, in: ders., Werkausgabe Bd. 2, S. 19.
204
2. Die Identitätsfindung
Es hat mich jemand angerührt. Denn ich habe gespürt, wie eine Kraft von mir ausging (Lk 8,46). Hier tritt Jesus unverkennbar in ein synergetisches, um nicht zu sagen, symbiotisches Verhältnis zum leidenden Menschen, dem er durch einen „Schub“ seiner Lebenskraft zur Gesundung verhilft. Ähnliches darf dann auch von jenen Heilungen angenommen werden, die durch Handauflegung und Berührung erfolgen. Stets wird der Helfer dadurch zur effektiven Hilfe, daß er etwas von seinem energetischen Selbstsein in die Leidenden „einfließen“ läßt. Dem entspricht dann auch der spontane Wunsch der Geheilten, bei ihrem Retter „bleiben“ zu dürfen (Mk 5,18). Damit reagieren sie auf eine Zuwendung, die sich nicht in der punktuellen Hilfe erschöpfte, sondern so, wie sie aus einer Übereignung hervorging, eine bleibende Verbundenheit intendiert. Demgegenüber schlägt der Umstand, daß in erster Linie die Adressaten der Seligpreisungen um den „Tisch der Sünder“ versammelt sind, die Brücke zur Sprachwelt Jesu und zu den in ihr ausgelegten Spuren seiner Selbstübereignung. Wie eine Erläuterung des Zuspruchs: „Selig ihr Weinenden, denn ihr werdet lachen!“ (Lk 6,21), wirkt Jesu Antwort auf den Vorwurf, daß seine Jünger im Unterschied zu denen des Johannes und der Pharisäer nicht fasten: Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten (Mk 2,19).570 Gleichviel, ob sich Jesus damit selbst schon als den „Bräutigam“ des von Gott umworbenen neuen Bundesvolkes bezeichnete, spricht dieses Logion von einem Zustand, den er durch seine Anwesenheit heraufführt und der kein asketisches Verhalten duldet. Dieser Zustand aber gründet nicht nur in seiner Autorität, sondern in der mit ihm identischen Heilsmacht. Über diesem Logion liegt sogar ein österlicher Glanz, den es keineswegs erst seiner nachösterlichen, einen urchristlichen Diskussionsstand spiegelnden Stilisierung, sondern seiner eigenen Aussagekraft verdankt. Darin weist das Logion auf das große Abschiedswort voraus, mit dem sich Jesus angesichts der akuten Todesdrohung zum baldigen Anbruch des Gottesreichs bekennt: Wahrlich, ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich davon aufs neue trinke im Reiche Gottes (Mk 14,25)571. Wichtig ist nicht nur die sich in diesem Wort bekundende Gewißheit der Todüberwindung, sondern vor allem auch deren Erfüllungsziel: das als endzeitliche Gemeinschaft mit den Seinen verstandene Gottesreich. Sofern sich das Denken Jesu darauf nun nochmals sammelt, schließt sich der thematische Bogen mit dem Bericht von seiner „Urverkündigung“, die nach Mk 1,15 gleichfalls der Proklamation des Gottesreichs galt. Was aus ihr nur erschlossen werden kann, wird nunmehr manifest: die Verklammerung der Idee mit seiner Person. Hier schon erhält, mit Edward Schillebeeckx gesprochen, das
570 Dazu wiederum: L. Schenke, Die Urgemeinde, a.a.O., S. 171f. 571 Dazu: W. G. Kümmel, Vierzig Jahre Jesusforschung (1950 – 1990), a.a.O., S. 490 – 497.
205
Der Rückbezug
Gottesreich „das Antlitz Jesu Christi“572. Demgemäß nimmt hier auch schon die Reflexion ihren Anfang, die Origenes mit der Kennzeichnung Jesu als „autobasileia“ auf den Gipfel führte573. Das setzt eine existentielle Verarbeitung des Gedankens voraus, in der ein Großteil der Lebensleistung Jesu besteht. Sie erstreckt sich von der Aneignung im Gebet und in der Identifikation mit dem Menschensohn bis zur sprachlichen und operationalen Umsetzung, also bis zur Proklamation des nach Lk 17,20 letztlich Unausdenklichen und Unsagbaren durch das Wort seiner Gleichnisse und die „Tatsprache“ seiner Wunder. Es gehört zu den wesentlichen Erkenntnissen der neueren Jesusforschung, daß Gleichnisse und Wunder keinen Selbstzweck verfolgen, sondern nach Ausweis einer zentralen Selbstinterpretation im Dienst der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu stehen. Seinen erbitterten Gegnern, die ihn des Teufelsbundes bezichtigen, gibt Jesus zu bedenken: Doch wenn ich die Dämonen mit dem Finger Gottes austreibe, ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen (Lk 11,20)574. Nach dem bildstarken Ausdruck Eberhard Jüngels ragt diesem Jesuswort zufolge das Gottesreich „als Finger Gottes in die Gegenwart herein“575. Für Helmut Köster sind die Wunder Jesu demgemäß keine „Beweise seines Besitzes göttlicher Kraft“, sondern Demonstrationen eines eschatologischen Vorgangs, und als solche „Teil seiner eschatologischen Predigt“, die die Hörer auf diesen Vorgang, den Einbruch des Gottesreiches, einzustimmen sucht576. Mehr noch als von seinen Seligpreisungen und Antithesen gilt das Gesagte von den Gleichnissen Jesu, in denen seine Sprachleistung ihren Gipfel erreicht. Nach Jüngel brach sich in der vor allem von Joachim Jeremias, Ernst Fuchs und Ernst Lohmeyer vorangetragenen Gleichnisforschung die Erkenntnis Bahn, daß die Gleichnisse von ihrem Ansatz her den Reich-Gottes-Gedanken entfalten und zudem als verhüllte Selbstanzeigen des historischen Jesus zu gelten haben. Das koppelte Lohmeyer mit der These, daß sich Jesus in seiner Selbstauslegung als Menschensohn selbst zum Gleichnis erkläre, an die Erkenntnis zurück, daß ein Großteil seiner Lebensleistung in der Durchdringung der Reich-Gottes-Idee mit seinem Selbstsein bestand577. Doch damit gewinnt der Leitgedanke der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu bereits so sehr gleichnishaftes Gepräge, daß seine Explikation in Gleichnissen als nahezu unausweichliche Konsequenz erscheint. Jesus redete in Gleichnissen – nach dem überspitzten wie zutreffenden Zusatz des Markusevangeliums: „und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen“ (Mk 4,34) –‚ weil er sich selbst
572 E. Schillebeeckx, Jesus, a.a.O., S. 284 – 354; S. 472ff. 573 Dazu nochmals: R. Gögler, Zur Theologie des biblischen Wortes bei Origenes, Düsseldorf 1963, S. 264; ferner: H. Merklein, Jesus, Künder des Reiches Gottes, in: ders., Studien zu Jesus und Paulus, Tübingen 1987, S. 127 – 156, S. 153. 574 Dazu nochmals: J. Moltmann, Der Weg Jesu Christi, a.a.O.,S. 126f. 575 E. Jüngel, Paulus und Jesus. Eine Untersuchung zur Präzisierung der Frage nach dem Ursprung der Christologie, Tübingen 1962, S. 185. 576 H. Köster, Grundtypen und Kriterien frühchristlicher Glaubensbekenntnisse, in: ders. u. J. M. Robinson, Entwicklungslinien durch die Welt des frühen Christentums, a.a.O., S. 191 – 215, S. 202. 577 Dazu: E. Lohmeyer, Vom Sinn der Gleichnisse Jesu (1938), in: ders., Urchristliche Mystik. Neutestamentliche Studien, Darmstadt 1956, S. 123 – 157, S. 146; S. 156f.
206
2. Die Identitätsfindung
als Metapher seines Gottes begriff, weil er also selbst ein Gleichnis war578. Wenn es sich aber so verhält, müssen sich in seiner gleichnishaften Selbstdarstellung auch Spuren jener Selbstübereignung finden, die lebensgeschichtlich nachgewiesen werden müssen, wenn sie nachösterlich glaubhaft werden sollen. Als perspektivenreiches Ganzes ins Auge gefaßt, bieten die Gleichnisse fürs erste ein bizarres und nahezu zu einem „Negativ“ verfremdetes, auf jeden Fall aber surrealistisch anmutendes Bild von der Welt, der sie zwar ihre Stoffe entnehmen, dies jedoch in der unübersehbaren Tendenz, sie auf etwas anderes hin zu überholen. Die Verfremdungstendenz spricht aus den Gleichniserzählungen, die es wie die vom dienenden Herrn (Lk 12,35-38), vom betrügerischen Verwalter (Lk 16,1-8) und von den Weinbergarbeitern (Mt 20,1-15) darauf angelegt haben, die eingefahrenen Vorurteile zu entkräften und die gängigen Maßstäbe, selbst die von Recht und Unrecht, zu zerbrechen. Eine Überholungstendenz spricht aus den Gleichniserzählungen, die wie die vom Schatz im Acker (Mt 13,44) oder die vom großen Gastmahl (Lk 14,15-24) die Welt in das Licht einer größeren Verheißung tauchen. Doch gilt das im Grunde auch von jenen Gleichniserzählungen, die wie das Gleichnis von der Senfstaude (Mk 4,30ff) oder vom Sauerteig (Lk 13,20f) von der Kraft des Unscheinbaren oder wie das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,30-35) oder vom Finden des Verlorenen (Lk 15,3-32) berichten. Denn zumal in der letzten Gruppe geschieht das nach allen Erfahrungsregeln kaum noch zu Erhoffende. Hier kommt in den Gleichnissen, sofern man sie nur als ein Ganzes betrachtet, das in ihnen waltende Formgesetz von Systole und Diastole zum Vorschein. Sie „entfremden“ im Sinne der von Jesus geforderten Metanoia dem mundanen Regelsystem, um dem „Kommenden“ Raum zu schaffen, dem die von ihnen ausgeübte Sprachsuggestion letztlich gilt: dem Gottesreich. Das unterstreichen sie durch ihr von der gewohnten Norm abweichendes Zeitverhältnis. Auch wenn das Gleichnis vom Unkraut (Mt 13,24-30) zur Geduld mahnt, vermittelt doch das vom dienenden Herrn, vom Türhüter (Mk 13,34ff) und zumal das von der verschlossenen Tür (Lk 13,24-27) den Eindruck einer „gestauten“ und ihrem Ende entgegendrängenden Zeit, die sich im Bild eines zu unvermuteter Stunde zurückkehrenden „Herrn“ erfüllt. Es ist, immer noch im Bild gesprochen, die Stunde der „Auszahlung“, wenngleich ohne Rücksicht auf die Größe der erbrachten Leistung (Mt 20,8-15), der „Belohnung“ für Wachsamkeit (Lk 12,37f) und Risikobereitschaft (Mt 25,19-23), aber auch der unnachsichtigen Bestrafung der Ängstlich-Untätigen (Mt 25,24-30) und Unzuverlässigen (Mt 24,48-51). Nimmt man hinzu, daß dieses Ziel in der Matthäus-Version des Gastmahlgleichnisses auch mit dem Bild eines königlichen Hochzeitsmahls umschrieben wird (Mt 22,2), so läßt sich dem Ganzen eine Gesamtaussage entnehmen, die auf die „Urverkündigung Jesu“ zurückweist; als Brücke bietet sich dabei das Logion an, das die Fastenpflicht für Jünger mit dem Argument zurückweist: „Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie doch nicht fasten“ (Mk 2,29). Unter Berücksichtigung dieses die präsentische Heilserfahrung betonenden Bildworts läßt sich sagen, daß die Gleichnisse dasselbe, nur mit einer eschatologischen „Rückung“, besagen, was nach dem markinischen Summarium am Anfang der Verkündigung Jesu steht:
578 Dazu: E. Schweizer, Jesus, das Gleichnis Gottes. Was wissen wir wirklich vom Leben Jesu? (Jesus, the Parable of God. What Do We Really Know About Jesus?, 1994), aus dem Amerik. übs., Göttingen 2/1996, S. 39f.
207
Der Rückbezug
Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes nah; kehrt um und glaubt an die Heilsbotschaft (Mk 1,15). Selbst wenn nach heutiger Annahme – wie Helmut Merklein betont – nur das Mittelstück des Logions auf Jesus selbst zurückgeht, leuchtet der angenommene Zusammenhang ein. Dann „amplifizieren“ die Gleichnisse das, was die Wendung: „Das Reich Gottes ist nah“, in eine Kurzform zusammenfaßt. Sein Nahegekommensein kann dann nur auf den bezogen werden, in dessen Wort und Wirken das Gottesreich anbricht und der sich deswegen in Gleichnissen ausspricht, weil er „selbst eine Parabel i n n u c e “ ist579. Stillschweigend war in dieser Ableitung die akustische Lesart zugrunde gelegt, wie sie im Zug der Erschließung, zusammen mit der optischen und haptischen, erschlossen worden war. Ihr geht es darum, den nach Kierkegaard in allen Herrenworten hörbaren Leidenston, nach Hamann die Klage des zum Himmel rufenden Blutes des erschlagenen Bruders, nach Nikolaus von Kues die in allen Formen der Gottesoffenbarung erklingende „große Stimme“ im Wortlaut der Texte zu vernehmen. In den Gleichnissen ist dieser Ton offensichtlich höher gestimmt, so daß er mit dem Ruf der Großen Einladung zusammenklingt, die, wiederum nach Kierkegaard, den Cantus firmus des ganzen Evangeliums bildet. Es ist die Einladung an die Bedrückten und Beladenen, modern ausgedrückt: an die „Erniedrigten und Beleidigten“, denen Jesus die „Ruhe“ der Tisch- und Lebensgemeinschaft mit ihm zusichert. Dieser einladende Ruf hat sich in den Gleichnissen vervielfältigt und gleichzeitig in eine Fülle von Modulationen umgesetzt, doch so, daß darin immer noch der Grundton der Einladung vernommen werden kann. Umgekehrt stimmt dieser Grundton die Vielfalt der Gleichnisse zu einer Gesamtaussage zusammen, die sich aber von einer sachlichen „Quersumme“ dadurch unterscheidet, daß sie als die fortklingende Stimme ihres Sprechers hörbar wird: als Stimme, durch die er persönlich und aktuell zu sich ruft. In diesem Ruf kündigt sich die Zuwendung an, durch die sich der Geschichtliche in der Geschichte vergegenwärtigt. Wenn es zutrifft, daß beim Hören eines Tones Farbunterschiede, die zu verwischen drohen, wieder wahrgenommen werden können, verweist die akustische Lesart auch schon von sich aus auf die optische, der es ihrer ganzen Zielsetzung nach darum gehen muß, im Gitterwerk der Gleichniserzählungen mit der Vielfalt ihrer Szenarien und Figuren das Antlitz ihres Schöpfers wahrzunehmen. Denn zweifellos gilt auch von den in ihrer Sprachqualität erfaßten Gleichnissen das, was Goethe für sich in Anspruch nahm, als er seine Werke eine „große Konfession“580 – optisch ausgedrückt: ein unwillkürliches Selbstportrait – nannte. Wenn es auch unangemessen wäre, von ihnen ein Psychogramm Jesu zu erwarten, ist es doch erlaubt, nach ihren autobiographischen Implikationen Ausschau zu halten und sie als indirektes Selbstzeugnis zu lesen. Dann darf aus der Beschreibung des Finderglücks (Mt 13,44) auf die Entdeckerfreude Jesu beim „Fund“ seines Zentralmotivs zurückgeschlossen werden. Dann spricht aus dem Staunen über das Wachstum des Kleinen und Unscheinbaren (Mt 13,31ff) Jesu Vertrauen in die Durchsetzungskraft der eigenen Sache. Dann zeugt die Betroffenheit über den Eintritt des Unerwarteten (Lk 11,5ff;12,39) für sein Gefaßtsein auf Überraschungen günstiger und widriger Art, dann läßt die bis zu schroffen Gegensätzen gespannte Bandbreite 579 E. Lohmeyer, Vom Sinn der Gleichnisse Jesu (1938), in: ders., Urchristliche Mystik, a.a.O., S. 146. 580 J. W. v. Goethe, Werke, Kommentare und Register, Hamburger Ausgabe in 14 Bänden., Bd. 9: Autobiographische Schriften I, hrsg. v. E. Trunz, München 14/2002, S. 283.
208
2. Die Identitätsfindung
der Motive auf die Spannung in Jesu Weltbild schließen: Auf der einen Seite steht sein Vertrauen in die Kräfte, die das Kleine heranreifen lassen, die die Beharrlichkeit – wie im Gleichnis von der Aussaat (Mk 4,26-29) – belohnen und in aussichtsloser Situation, wie sie in den Erzählungen vom Finden des Verlorenen vorausgesetzt sind, den rettenden Umschwung herbeiführen. Auf der anderen Seite finden sich sein Erschrecken über die Anfälligkeit der Dinge für Rost und Wurmfraß, der Menschen für Unglück – wie Einbruch (Mt 24,43f) und Überfall (Lk 10,30) – und der Verhältnisse für Verderbnis – wie im Gleichnis vom Unkraut (Mt 13,24-30) und im Gleichnis von den Winzern (Mk 12,1-12). Vor dem Hintergrund dieses zwiespältigen Weltbilds lassen sich dann auch Spuren des Schicksals ausfindig machen, mit dem sich Jesus konfrontiert sieht, nicht zuletzt aber auch Hinweise auf die Art, wie er diesem Schicksal begegnet. Dann wird man in der Absage der Erstgeladenen im Gastmahlgleichnis (Lk 14,18ff) ein Echo des Massenabfalls vernehmen, der die auf die Passion hinführende Lebenswende markiert. Dann wird man in der Einladung der Krüppel und Bettler (Lk 14,21) seine Hinwendung zu den Benachteiligten und Enterbten angezeigt finden, in der Fürbitte des Weingärtners (Lk 13,8) dagegen seine großmütige Reaktion auf die bittere Enttäuschung und in dem Gleichnis vom Mord im Weinberg (Mk 12,1-9) die Andeutung seiner Verarbeitung des ihm bevorstehenden Todesgeschicks. Vorausgesetzt, daß der abschließende Disput mit den Gegnern und mit dem Hinweis auf den von den Bauleuten verworfenen, zuletzt aber zum Eckstein gewordenen Baustein (Mk 12,10) einen Rückschluß auf den ursprünglichen Kontext erlaubt, wird man darin sogar eine Vorausschattung der gleichsinnigen Antwort Jesu auf seine Befragung durch den Hohepriester (Mk 14,62) erblicken, die von Buber als die visionäre Bewältigung der durch den Massenabfall heraufbeschworenen Identitätskrise gedeutet wurde: „Wer bist du?“, ist er nun selber gefragt worden, wie er einst die Jünger fragte, wer er sei, er aber, mit fernen Augen, antwortet dem Sinn nach: „Ihr werdet den sehen, der ich werden soll“. Er sieht ihn jetzt: ich bins. Er sagt es nicht, aber es gibt Hörer, die es zu hören meinen, weil sie ihn, den Sehenden, sehen581. Das ist die visionäre Schau, mit der der auf der Schicksalsschneide Stehende der Deutung Bubers zufolge die Blickbahn eröffnet, in welche die Zeugen seiner Ostererscheinung eintreten und mit ihnen, wenngleich in abkünftiger Form, alle, die seiner jemals in visionärer, intuitiver oder künstlerischer „Einbildung“ ansichtig wurden. Wenn sich die Schau im Augenblick der letzten, das Todesurteil heraufbeschwörenden Äußerung Jesu, also vorösterlich ereignete, obwohl sie sich in ihrer Konsequenz erst nachösterlich manifestierte, darf sie mit noch größerem Recht als im Fall der sonstigen Vorgegebenheit auf die Lebensgeschichte Jesu zurückverfolgt werden. Die damit aufgenommene Spur führt, abgesehen von den Jüngerberufungen (Joh 1,35-41), zu denen auch die gescheiterte Berufung des jungen Reichen (Mt 19,16-26) zu rechnen ist, aus innerer Konsequenz zu den Gleichnissen, auch wenn sie sich im Maß der Annäherung verwischt. Indessen sind die Gleichniserzählungen nur dann als parabolisches Portrait Jesu glaubhaft, wenn sie zumindest indirekt seinen Blick spiegeln. Das aber ist dann der Fall, wenn der Ausklang der zweifellos letzten Gleichnisse vom Mord im Weinberg und vom verworfenen Eckstein
581 M. Buber, Zwei Glaubensweisen, in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 732.
209
Der Rückbezug
tatsächlich auf die visionäre Selbstwahrnehmung Jesu vor dem Richterstuhl des Hohepriesters bezogen werden dürfen. Wenn dieses verhüllte Selbstportrait zum Vorschein kommen soll, muß der Großtext der Gleichnisse wie ein Palimpsest behandelt werden. Freilich zeichnet sich bei diesem Verfahren kein ausgearbeitetes Bildnis ab. Was sich allenfalls abhebt, ist ein Portrait im Stil des Manieristen Arcimboldo, jenem Maler der Spätrenaissance, der in seinen berühmten Darstellungen Elemente der unterschiedlichsten Art – Früchte, Tiere, Töpfe, Bücher – einander collageartig so zuordnete, daß daraus bizarre Köpfe entstanden. Wer aber im Gitterwerk der Texte erst einmal das aufdämmernde Antlitz des Erzählers entdeckte, gewinnt einen Blick dafür, daß sich bei längerer Betrachtung Saat und Sauerteig, Netz und Perle, Lamm und Drachme, aber auch Vorgänge wie Einbruch und Fund, Einladung und Abrechnung, Hausbau und Rettung zu surrealistischen Strukturen verbinden, die, zusammengenommen, das gesuchte Antlitz ergeben. Die Überlegung mußte bis an diese Schwelle vorangetrieben werden, weil sich erst so die Chance ergibt, den Blick, den Jesus in den Gleichnissen auf die Welt wirft, gespiegelt durch sie, auf den Hörer eindringen zu lassen. Denn das, was sich in thematischer und motivischer Hinsicht zunächst nicht vereinbaren zu lassen scheint, wird durch diesen Blick zusammengefaßt und als überbegriffliche Einheit sichtbar. Damit tritt erneut die Rolle der Gleichnisse bei der Versprachlichung des „Reich-Gottes-Gedankens“ in den Vordergrund. Zu deren stärkerer Ausleuchtung bedarf es nunmehr der dritten Lesart, die als die „haptische“ ausgemacht wurde, weil sie auf die energetische Komponente der Texte eingeht. In ihrer nachösterlichen Erfahrung bezieht sich diese, wie Paulus (Phil 3,12) zu verstehen gibt, zwar durchaus auch auf den individuellen Heilsgewinn, primär jedoch, wie anderen Hinweisen – etwa Mt 18,20 und Mt 28,20 – zu entnehmen ist, auf die Konstituierung der Glaubensgemeinschaft. In vorösterlicher Sicht entspricht dem die wirkmächtige Verkündigung des Gottesreichs. Sie beginnt, wie bereits angedeutet, mit dem geradezu systematischen Abbau der mundanen Wertungen und Verhaltensweisen, wenn die Kraft des Unscheinbaren gerühmt, die Risikobereitschaft belohnt, die Maßstäbe von Recht und Unrecht zerbrochen, die Letzten den Ersten vorgezogen werden und der Rangunterschied von Herr und Knecht eingeebnet wird. Indessen schafft Jesus damit nur das Vakuum, das seiner Zielsetzung zufolge durch das „Geheimnis des Gottesreichs“ und, tiefer noch, durch ihn selbst ausgefüllt werden soll. Das spricht am vernehmlichsten aus dem durch le Fort wohl am tiefsinnigsten gedeuteten Gleichnis vom Teufelshaus (Lk 11,24ff), das le Forts Verständnis zufolge vor dem Vertrauen auf die Stabilität der „geordneten Zustände“ warnt, weil sich gerade die vordergründige Ordnung vielfach als Einfallstor der Dämonie erweist582. Ihr kann, so die Spitzenaussage des Textes, auf Dauer nur widerstanden werden, wenn das von Fehlbesetzungen geräumte Haus durch den bewohnt wird, der aus dem Kampf mit den Zerstörungsmächten als der Überlegene und „Stärkere“ hervorging (Lk 11,21f). Von da fällt der Blick spontan auf die Gleichnisse von der „Heimholung“ der Verlorenen und darin auf die Suche des Hirten (Lk 15,4f), auf die das ganze Haus auskehrende Frau (Lk 15,8), auf den den Heimkehrer ebenso liebevoll wie großmütig aufnehmenden Vater (Lk 15,20-24), kaum weniger aber auch auf den durch die Dringlichkeit der wiederholten Einladung betonten Wunsch des Gastgebers, daß sein Haus „voll werde“ (Lk 14,23), zumal dieses
582 G. v. le Fort, Unser Weg durch die Nacht (1949), in: Gertrud von le Fort erzählt, a.a.O., S. 13 – 24, S. 15f.
210
2. Die Identitätsfindung
Gleichnis durch eine auf das Gottesreich bezogene Seligpreisung – die einzige, die einem anderen als Jesus in den Mund gelegt ist – eingeleitet wird: Selig, wer am Mahl im Reich Gottes teilnehmen will! (Lk 14,15) Unüberhörbar klingt diese Seligpreisung, im Kontext der Gleichnisse verfolgt, in dem Lob des Geldgebers für die erfolgreichen Talentenverwalter nach (Mt 25,21ff), ebenso aber auch in der Anerkennung, die der Despot – so jedenfalls in Bergengruens Nacherzählung „Der Großtyrann und das Gericht“ – dem betrügerischen Verwalter für dessen Schläue zollt (Lk 16,8). Wenn mit diesem Lob, wie aus der fragmentarischen Struktur der Erzählung zu schließen ist, ursprünglich die von der schockierten Urgemeinde abgebrochene Wiedereinsetzung des Betrügers in seine anfängliche Position verbunden war, wird darin – wie in den analogen Äußerungen – die Erfüllung dessen fühlbar, was sich der Sprecher der Seligpreisungen ersehnte. In diesem Sinn wurde das „Geh ein in die Freude deines Herrn!“ (Mt 25,21 ff) von Augustinus verstanden, als er die Befestigung in der ewigen Weisheit am Ziel der Ostia-Vision als die Erfüllung dieses Wortes deutete583. Sofern Augustinus damit die Erkenntnis Bubers vorwegnahm, daß es im Gebet letztlich um eben diese Befestigung, verstanden als das „Spürbarwerden“ der Gotteswirklichkeit584, gehe, drängt sich fast unabweislich die Schlußfolgerung auf, daß die Gleichnisse, auf ihre innerste Intention zurückverfolgt, das sind, was in dem Gleichnis von den ungleichen Betern (Lk 18,9-14) zum ausdrücklichen Thema wird: szenisch aufbereitete Gebete. Wenn das zutrifft, wollen die Gebete jenseits von dem, was sie besagen, etwas zeigen, vor allem aber etwas bewirken im Sinn einer Einbeziehung und Verankerung. Dafür spricht zunächst schon die auffällige Übereistimmung mit der Lebensgeschichte Jesu, angefangen beim „Fund“ seiner Leitidee – Schatz und Perle – und dem Vertrauen in deren Wachstums- und Durchsetzungskraft – Senfstaude und Sauerteig – bis hin zur Widerspiegelung seiner Lebenskrise – Gastmahl –, seines Kampfes gegen eine menschenverachtende Kult- und Gesetzesideologie – Weinbergarbeiter, Barmherziger Samariter, ungleiche Beter – und der Vorahnung seiner Passion – Mord im Weinberg –, erst recht aber ihre Strukturierung durch seine Reich-Gottes-Verkündigung. Mit ihrer Kritik der eingefahrenen Kategorien verhelfen sie zur Umkehr des Denkens und Wertens, mit ihrer Entfremdungsstrategie zur Loslösung von den herrschenden Verhältnissen, mit ihren Schreck- und Weckrufen zur Öffnung für das Kommende und mit ihrem suggestiven Rückbezug auf die Person ihres Sprechers die, wenngleich dramatisch umspielte, Annäherung an ihn als Mitte und Inbegriff des von ihm verkündeten Reiches. Gerade auch dort, wo die Tür vor seiner Tischgemeinschaft – wie im Gleichnis von der verschlossenen Tür (Lk 13,25ff) – zuzuschlagen droht, spricht aus diesen Gleichnissen die Aufforderung: Ringt danach, durch die enge Tür einzugehen; denn ich sage euch, viele werden versuchen einzutreten, aber es wird ihnen nicht gelingen (Lk 13,24)585. Wenn es ihnen doch gelingt, dann nicht auf Grund ihrer Anstrengung, sondern weil sie der, der sie abzuweisen scheint, in Wahrheit an sich zieht. Das aber nötigt zu einer noch 583 Augustinus, Bekenntnisse IX, 10, a.a.O. (BKV, 1. Reihe, Bd. 18, VII), S. 206f. 584 M. Buber, Gottesfinsternis, in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 596. 585 Dazu: J. Ernst, Das Evangelium nach Lukas, a.a.O., S. 318 – 321.
211
Der Rückbezug
präziseren Bestimmung. Danach sind die Gleichnisse nicht nur Gebete im allgemeinen Sinn des Begriffs, sondern an Jesus gerichtete Anrufungen, und als solche die vorösterliche Artikulation des urchristlichen „Maranatha“, das den Angerufenen ebenso herbeifleht, wie es seine bestärkende und inspirierende Gegenwart bestätigt. Nicht als habe Jesus das Gebet, das er nach Lk 11,1f die Jünger lehrte, schon so auf sich selbst zurückgelenkt, wie es am Schluß des Johannesevangeliums geschieht. Dort spricht der Zweifler Thomas, überwältigt von seinem Ostererlebnis, mit seinem Ruf „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh 20,28) nach Bubers Deutung das erste Gebet als „Christ im Sinne des christlichen Dogmas“586. Wohl aber nimmt er die Hörer der Gleichnisse in sein eigenes Gebet um das Kommen des Reiches hinein, so daß das Erbetene in und durch ihn zu ihnen kommt. So gesehen sind die Gleichnisse ebenso Anrufung wie Gewährung, weil sie sich als Eingebungen dessen erweisen, der um Gottes ureigene Sache – das Reich Gottes – nicht beten konnte, ohne der Erhörung seiner Bitte nicht schon im Augenblick ihrer Äußerung versichert zu sein. Sofern sich das auf sie, die Hörer der Gleichnisse, überträgt, erschließt sich ihnen die Tür, die im warnenden Gegenbild zuzufallen droht. Im Maß, wie sie auf das Gehörte eingehen, sind sie bereits in das Reich aufgenommen und eingebürgert, das in den Gleichnisreden Jesu im höchsten Sinn des Ausdrucks „auf sie zukommt“. Das erlaubt einen letzten Rückschluß auf den Entstehungsgrund der Gleichnisse. Er kann nur im Gebet Jesu bestehen. In seinem Gebet kann er, mit Eichendorff gesprochen, das „Zauberwort“ sagen, welches das in den Dingen seiner Lebenswelt schlafende „Lied“ zum Klingen bringt, so daß die Hörer nun nicht mehr nur mit Vergil von ihren „Tränen“, sondern mehr noch mit Paulus von der „Hoffnung“ sprechen, die darin besteht, zusammen mit den Glaubenden zur herrlichen Freiheit der Gotteskinder, jesuanisch ausgedrückt: zur Herrlichkeit des Gottesreichs, geführt zu werden. So aber stehen gerade auch die Gleichnisreden Jesu dafür ein, daß sein Wille zu bleibender Präsenz, der mit seiner Auferstehung sinn- und formbestimmend wurde, schon in seiner vorösterlichen Lebensgeschichte am Werk ist.
3. Streuung und Konvergenz Das Christentum trat mit einem höchst spannungsreichen Begriff seines Stifters den Siegeszug in die Weltgeschichte an: mit dem Glauben an das individuelle und mystische Fortleben Jesu. Durch die Auferstehung hatte er die raumzeitlichen Schranken durchbrochen und sich so an die Seinen weitergegeben, daß er das Leben ihres Lebens wurde und sie zu einer von ihm durchseelten und in ihm geeinten Gemeinschaft zusammenschloß. Gleichzeitig aber war er ihnen durch dasselbe Ereignis entrückt und an seinen Ursprungsort am Herzen des Vaters zurückgekehrt. Doch damit brach der Glaube an ihn keineswegs in gegensätzliche Perspektiven auseinander, vielmehr erschien das eine als die Bedingung des anderen: das mystische Fortleben im Kollektiv der ihm Zugehörigen als der genuine „Ort“ seines geschichtlichen Wirkens, das in erster Linie die Auferbauung der Kirche bezweckte, und sein individuelles „Überleben“ als der Konvergenzgrund, der die vielfältigen Formen seines Wirkens in der Welt zu einer transpersonalen Aktionsge586 M. Buber, Zwei Glaubensweisen, in: ders., Werke, Bd. 1, a.a.O., S. 747; ferner: E. Biser, Buber für Christen, a.a.O., S. 115.
212
3. Streuung und Konvergenz
meinschaft integrierte – dies aber nicht so sehr in Form seiner präsentischen Wirkung als vielmehr auf das Ziel seiner Wiederkunft hin, also in der Weise, die – nach Heidegger und des ihn präzisierenden Walter F. Otto – als der Logos verstanden werden muß: als ein „Versammeltsein auf etwas hin“587. Damit entsteht eine triadische Beziehungsfigur, die, unbeschadet der ideengeschichtlichen Herleitung, den spekulativen Erklärungsgrund für die johanneische Gleichsetzung Jesu mit dem uranfänglichen Logos abgeben könnte, vermutlich sogar für die früheste Entfaltung der Trinitätslehre. Denn der in die Herrlichkeit des Vaters Aufgenommene ist dessen Wort, das jetzt schon vernommen sein will, aber erst bei seiner Wiederkunft ganz verstanden sein wird. Der trinitarische Kontext ergibt sich daraus, daß dieses Wort – nach Jes 55,10f und 1Kor 15,28 – nach Vollendung seines Werkes zu seinem Sprecher zurückkehrt, also in jener Rückbezüglichkeit begriffen ist, die – zumindest nach Hegel – die Achse der Trinitätsspekulation bildet588. Schon diese Andeutungen genügen, um die auf das Eschaton zielende Spannungseinheit von individuellem und mystischem Fortleben als den zentralen Quellgrund der urchristlichen Inspiration und Initiative auszumachen. In diesem Spannungsfeld ereignete sich fürs erste die elementare Geisterfahrung, der die Charismatiker der ersten Stunde ihr Selbstbewußtsein, die Missionare ihr Sendungsbewußtsein, die Vorsteher der Gemeinden ihr Rollenbewußtsein und die von ihnen geleiteten Gemeinden ebenso die Entfaltung wie den Zusammenhalt ihres spirituellen Lebens verdanken. In ihm gewann der Glaube jene primordiale Gestalt, die aus der Verwandlung des Botschafters in die Botschaft, des Glaubenden in den Geglaubten und des Lehrenden in die Lehre hervorging. Aus ihr erwuchs die spezifisch christliche Spiritualität, der von allen Vorformen abgehobene Kult, die Initiative zur Schaffung einer eigenen Heiligen Schrift, das auf das Prinzip Liebe gegründete Ethos, der Wille zu radikaler Selbstunterscheidung vom Lebensstil der Umwelt und der zu konsequenter Nachfolge entschlossene, sogar zur Hingabe des Lebens bereite Glaubensgeist. Wenn irgendwo, liegt darum hier auch der Ursprung der Theologie, da die Spannung nicht nur auf operationalen, sondern nicht weniger auch auf theoretischen Ausgleich drängt. Vor allem aber nahm hier jene ideelle Wirkungsgeschichte Jesu ihren Ausgang, durch die Jesus als strukturierendes Prinzip in das Geistesleben der Folgezeit einging und diesem den von Guardini gerühmten „Ernst“ der personalen Selbst- und Weltverantwortung verlieh589. Es liegt auf der Hand, daß davon auch der Begriff des Christentums betroffen ist. Bevor den anderen Aspekten nachgegangen werden kann, muß daher im Interesse der prinzipiellen Klärung zunächst die Frage nach der Begriffsbestimmung von „christlich“ aufgeworfen und im Licht der beschriebenen Initialposition beantwortet werden.
587 Dazu: E. Biser, Theologische Sprachtheorie und Hermeneutik, a.a.O., S. 44. 588 Dazu: E. Biser, Glaubensprognose, a.a.O., S. 74f. 589 R. Guardini, Das Ende der Neuzeit; Die Macht, in: ders., Werke, a.a.O., S. 94; dazu: E. Biser, Die glaubensgeschichtliche Wende, a.a.O., S. 92f.
213
Der Rückbezug
4. Die Begriffsbestimmung Fürs erste bestätigt sich die „Wesensbestimmung“, die Guardini (1938) in schroffem Gegensatz zu Harnacks Ausgrenzung des Sohnes aus dem Evangelium zu der Feststellung bewog: Es gibt keine abstrakte Bestimmung dieses Wesens. Es gibt keine Lehre, kein Grundgefüge sittlicher Werte, keine religiöse Haltung und Lebensordnung, die von der Person Christi abgelöst, und von denen dann gesagt werden könnte, sie seien das Christliche. Das Christliche ist ER SELBST; das, was durch Ihn zum Menschen gelangt und das Verhältnis, das der Mensch durch Ihn zu Gott haben kann. […] Die Person Jesu Christi in ihrer geschichtlichen Einmaligkeit und ewigen Herrlichkeit ist selbst die Kategorie, welche Sein, Tun und Lehre des Christlichen bestimmt590. Das Christentum könne, so hatte Guardini zuvor schon in seinem Pascal-Buch in ausdrücklicher Anspielung auf Harnack betont, nur an Jesu Sein und Tun abgelesen werden, denn: Es gibt kein von ihm abtrennbares – ich unterstreiche: von ihm abtrennbares, in einem freischwebenden Begriffsystem auszudrückendes „Wesen des Christentums“. Das Wesen des Christentums ist Er. Das, was Er ist; das, woraus Er kommt und wohin Er geht: das, was in Ihm und um Ihn her lebt – lebendig vernommen aus seinem Munde, abgelesen von seinem Antlitz591. Wenn sich im Religionsdisput der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts Karl Barth gegen die Zuordnung des Christentums zu den übrigen Weltreligionen verwahrte, dann war sein Protest in dem von Guardini herausgearbeiteten Befund begründet592. Denn unter den Religionen, die sich wie der Buddhismus und Konfuzianismus gleich ihm nach ihren Stiftern benennen, geht nur das Christentum vom Fortleben seines Stifters in der von ihm gebildeten Glaubensgemeinschaft aus. Das nötigt bei aller Anerkenntnis des Christentums als genuiner und als solche im Judentum wurzelnder Religion zu einer ersten und grundlegenden Unterscheidung: Im Unterschied zu den übrigen Religionen ist das Christentum eine von seinem Prinzip her mystische Religion. Das muß im Blick auf die im Schwerefeld der Aufklärung aufgekommene und von Nietzsche, wie es scheint, vergeblich attackierte Einschätzung des Christentums als einer wesenhaft moralischen Religion kontrastiert werden, am besten im Vergleich mit dem Konfuzianismus, der in der kanonischen, aber wohl nicht mehr von Konfuzius redigierten Schrift „Li Gi“ erklärt: 590 R. Guardini, Das Wesen des Christentums (1938); Die menschliche Wirklichkeit des Herrn, in: ders., Werke, a.a.O., S. 68f; dazu: E. Biser, Interpretation und Veränderung. Werk und Wirkung Romano Guardinis, Paderborn u. a. 1979, S. 65 – 80. 591 R. Guardini, Christliches Bewußtsein. Versuche über Pascal (1935), in: ders., Werke, hrsg. v. F. Henrich, Sachbereich Gestalt- und Werkdeutungen, Mainz u. a. 1991, S. 43f. 592 Dazu: E. Biser, Interpretation und Veränderung, a.a.O., S. 78f.
214
4. Die Begriffsbestimmung
Liebe zum Lernen führt zur Weisheit, kräftiges Handeln führt hin zur Menschlichkeit, sich schämen können führt zum Mut. Wer diese drei Dinge weiß, der weiß, wodurch er seine Person zu bilden hat. Wer weiß, wodurch er seine Person zu bilden hat, der weiß, wodurch er die Menschen ordnen kann. Wer weiß, wodurch er die Menschen ordnen kann, der weiß, wodurch er die Welt, den Staat, das Haus ordnen kann593. Wie die Übereinstimmung in der „Goldenen Regel“ zeigt, die sich ebenso in der Lehre des Konfuzius wie in der Bergpredigt Jesu (Mt 7,12) findet, geht es auch dem Christentum um die Vertiefung der menschlichen Sittlichkeit. Im Unterschied zum Konfuzianismus zeigt sich, daß das Christentum zwar eine Ethik hat, nicht aber wie jener eine Ethik ist.
Das Christentum als mystische Religion „fand seine Identität darin, daß sein Stifter in ihm und einem jeden seiner Anhänger fortlebt. Alle diese Komponenten versammeln sich im Begriff der Geistesgegenwart. Er bezeichnet somit ebenso sehr die geistgewirkte Einwohnung Christi wie deren Fortwirken im Gang der Glaubensgeschichte, ebenso sehr die Gestaltung des individuellen Glaubensvollzugs wie dessen Beitrag zur Konsolidierung der Glaubensgemeinschaft, und nicht zuletzt deren Rückwirkung auf den Denkakt des Glaubenden.“ „Ziel der Suche nach der Mitte des Christentums ist: die Geistesgegenwart des Geglaubten in den Glaubenden, des Ersehnten in den Hoffenden und des Geliebten in den Liebenden“594.
593 Li Gi. Das Buch der Sitte des älteren und jüngeren Dai. Aufzeichnungen über Kultur und Religion des alten China, aus d. Chin. übs. u. erl. v. R. Wilhelm, Jena 1930, S. 11. 594 E. Biser, Der unbekannte Paulus, a.a.O., S. 132; ders., Glaubenserweckung, a.a.O., S. 296.
215
Anhang
Verzeichnis der Namen A Adorno, Theodor W. 31, 42, 181 Aelred von Rievaulx 186 Alarich 192 Verzeichnis der Namen Andresen, Carl 160, 178, 192 Angelus Silesius 67, 155 Anselm von Canterbury 16, 40, 42, 43, 51, 81, 86, 127, 138, 156, 180, 181 Arbeiter, Albert 79 Athanasius 156 Augustinus, Aurelius 39, 48, 50, 56, 57, 59, 61, 62, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 86, 93, 102, 160, 173, 180, 186, 188, 192, 197, 211
B Baader, Franz von 149, 186 Bach, Johann Sebastian 15, 78, 79 Bachmann, Ingeborg 14, 146, 191 Bacon, Francis 33 Balthasar, Hans Urs von 14, 44, 54, 55, 80, 126, 181, 193, 194 Barth, Karl 21, 23, 164, 184, 214 Basilius von Caesarea 186 Bauer, Johannes Baptist 32 Becker, Gerhold 53 Becker, Jürgen 137, 142 Beckmann, Max 33 Beda Venerabilis 127 Beethoven, Ludwig van 12, 78 Ben-Chorin, Schalom 123 Ben-Chorin, Shalom 185 Benz, Ernst 44, 75 Berg, Alban 33 Berger, Klaus 13, 24, 47, 92, 131, 169, 178, 182 Bernhard von Clairvaux 86, 87 Bernhart, Joseph 33, 223 Beyschlag, Karlmann 167, 189 Bloch, Ernst 56, 105 Blondel, Maurice 38 Blumenberg, Hans 29, 78, 79, 130, 185 Boëthius, Anicius Manlius Severinus 11, 12, 30, 62, 168, 197 Böhme, Wolfgang 83, 222 Böll, Heinrich 33
216
Bonaventura 75, 97, 156 Bornkamm, Günther 202 Bovillus, Carolus (Bouelles, Charles de) 36 Brenz, Johannes 48 Breytenbach, Cilliers 87, 148, 223 Broch, Hermann 33 Broer, Ingo 123, 135 Brose, Thomas 71, 77, 80 Brox, Norbert 192 Buber, Martin 26, 27, 34, 56, 74, 75, 76, 87, 89, 90, 104, 113, 115, 116, 118, 119, 137, 139, 157, 159, 160, 174, 186, 187, 188, 209, 211, 212 Bultmann, Rudolf 21, 23, 34, 59, 60, 68, 95, 99, 109, 129, 141, 148, 184 Burckhardt, Jacob 48 Busse, Ulrich 118 Bussmann, Claus 175
C Campenhausen, Hans von 161 Cassirer, Ernst 36 Celan, Paul 31 Chagall, Marc 83, 87 Chamisso, Adelbert von 198 Christ, Felix 203 Cohen, Hermann 34 Colli, Giorgio 151 Comblin, Joseph 164 Crossan, John Dominic 116
D Dalferth, Ingolf U. 96 Dante Alighieri 14, 65 Dantine, Wilhelm 185 Dantine, Wilhelm Felix Ferdinand 185 Deissmann, Adolf 48, 112 Dempf, Alois 203 Denifle, Heinrich Seuse 75, 93 Denzinger, Heinrich 90 Descartes, René 28, 40, 138, 198 Deussen, Paul 52 Dietzfelbinger, Christian 123 Dionysius Pseudo-Areopagita 86
Verzeichnis der Namen Dostojewskij, Fjodor M. 56, 82 Drewermann, Eugen 23, 53, 55, 128, 129
E Ebner, Ferdinand 174 Eckhart, Meister 75, 188, 189 Eichendorff, Joseph von 147 Emrich, Wilhelm 147 Erasmus von Rotterdam 28 Ernst, Josef 100, 117, 158, 211 Eusebius von Caesarea 24, 191, 192
F Faulkner, William C. 33 Feiner, Johannes 14 Fest, Joachim 28, 39, 61 Feuerbach, Ludwig 46 Fiedler, Peter 135, 157 Flasch, Kurt 192 Flew, Anthony 96 Frankemölle, Hubert 63 Freud, Sigmund 38, 40, 56 Fromm, Erich 56 Fuchs, Ernst 71, 206
G Gadamer, Hans-Georg 23, 53, 141, 142 Gast, Peter 198 Gerken, Alexander 75 Girard, René 185 Gluck, Christoph Willibald 65 Goethe, Johann Wolfgang von 11, 36, 94, 96, 147, 190, 208 Gogh, Vincent van 19 Gögler, Rolf 110, 206 Gollwitzer, Helmut 69 Gordan, Paulus 89, 93, 223 Górecki, Henryk M. 33 Gregor von Nazianz 186 Gregor von Nyssa 92, 160, 165, 187, 188, 189 Grimme, Hubert 131, 178 Grotefeld, Stefan 87 Guardini, Romano 14, 18, 35, 45, 46, 52, 81, 128, 130, 132, 137, 171, 175, 177, 185, 187, 189, 201, 213, 214
H Habermas, Jürgen 172, 173, 174 Haecker, Theodor 15 Haenchen, Ernst 95
Hahn, Ferdinand 128, 142, 154, 155 Hamann, Johann Georg 71, 74, 77, 80, 126, 208 Händel, Georg Friedrich 79, 85 Harnack, Adolf von 44, 46, 214 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 16, 63, 110, 169, 191, 194 Heidegger, Martin 32, 40, 42, 150, 158, 159, 171, 181 Heine, Heinrich 111 Heinzmann, Richard 11, 73, 96, 153, 157 Henry, Paul 160 Hentig, Hartmut von 42 Herder, Johann Gottfried 79 Herrmann, Wilhelm 122 Hieronymus 20 Hilarius von Poitiers 92 Hinrichs, Boy 64, 147 Hippolyt von Rom 188 Hoffmann, Ernst 43 Hölderlin, Friedrich 19, 20, 155 Holthusen, Hans Egon 36 Horkheimer, Max 31, 182 Horváth, Ödön von 146 Huxley, Aldous 35
I Ignatius von Antiochien 13, 24, 25, 63, 152 Irenäus von Lyon 152, 153, 156, 169, 178, 191, 192 Iser, Wolfgang 72
J Jacobi, Friedrich Heinrich 196 Jaspers, Karl 181 Jeremias, Joachim 32, 67, 206 Johannes Chrysostomos 75 Jonas, Hans 56 Jüngel, Eberhard 55, 206
K Kähler, Martin 170, 171 Kant, Immanuel 34, 35 Karrer, Otto 189 Käsemann, Ernst 21, 27, 63, 85 Kern, Walter 185, 194 Kessler, Hans 128, 183, 184, 196, 197 Kierkegaard, Søren 18, 29, 68, 69, 72, 74, 77, 78, 88, 104, 111, 113, 115, 121, 127, 133,
217
Verzeichnis der Namen 156, 157, 158, 159, 170, 180, 196, 201, 203, 204, 208 Klauck, Hans-Josef 60, 126, 167 Kleist, Heinrich von 111, 134, 153, 196 Klemens von Alexandrien 47, 49 Klinger, Elmar 55 Knox, Ronald A. 178 Koch, Gerhard 184, 190, 201 Kolakowski, Leszek 185 Konstantin 192 Körtner, Ulrich H. J. 23, 159 Köselitz, Heinrich 198 Köster, Helmut 191, 206 Kraft, Heinrich 161, 162 Kremer, Jacob 17 Krüger, Gerhard 40, 171 Kügler, Joachim 148, 166 Kümmel, Werner Georg 136, 205 Küng, Hans 51, 185 Kuschel, Karl-Josef 30, 56
L Lanczkowski, Günter 74, 90 Landmann, Michael 81 Lang, Albert 157 Lang, Bernhard 203 Langenhorst, Georg 56 Langkammer, Hugolinus 63 le Fort, Gertrud von 129, 130, 146, 159, 179, 193, 194, 195, 210 Lessing, Gotthold Ephraim 137, 178, 196 Lietzmann, Hans 84 Lindars, Barnabas 49 Lohmeyer, Ernst 206, 208 Lorenzen, Thorwaldsen 147 Lorenz, Konrad 67 Löwith, Karl 39, 40, 42, 47, 48, 108, 110, 155, 191, 192 Lubac, Henri de 32, 33, 76, 186 Lüdemann, Gerd 23 Lütgert, Wilhelm 13 Luther, Martin 33, 55
M Machoveč, Milan 68, 69, 130, 185, 201 Mamertus, Claudianus 186 Mann, Thomas 43, 147 Marcel, Gabriel 28, 29 Marcuse, Herbert 35 Marxsen, Wilhelm 159
218
Maximilla 178 Maximus Confessor 105, 133 McLuhan, Marshall 71, 89 Merklein, Helmut 110, 206, 208 Methodius von Olympos 188 Metz, Johann Baptist 23, 54 Möhler, Johann Adam 173, 186 Moltmann, Jürgen 23, 32, 54, 107, 164, 206 Montanus 178 Mörike, Eduard 81, 82 Mußner, Franz 91, 109, 140
N Newman, John Henry 190 Nietzsche, Friedrich 25, 29, 32, 36, 38, 43, 44, 52, 54, 56, 81, 82, 83, 105, 108, 109, 112, 116, 136, 141, 151, 192, 197, 198, 199, 214 Nikolaus von Kues 27, 32, 36, 66, 74, 76, 77, 81, 112, 136, 174, 180, 187, 188, 198, 199, 208 Nord, Christiane 13, 24, 47, 92, 131, 169, 178 Nordström, Carl-Otto 173 Nossack, Hans Erich 45 Novalis (Hardenberg, Friedrich von) 41, 130
O Origenes 20, 44, 110, 156, 166, 191, 206 Ortega y Gasset, José 36, 37 Orwell, George 35 Osborn, Eric F. 167, 168 Otto, Rudolf 50, 118, 119 Overbeck, Franz 87
P Pächt, Otto 127 Pannenberg, Wolfhart 41, 55 Papias von Hierapolis 24 Pascal, Blaise 96, 97, 214 Péguy, Charles 28 Pesch, Rudolf 135, 157 Petrus Damiani 76 Philon von Alexandrien 80, 81, 84 Picasso, Pablo 33 Pico della Mirandola, Giovanni 37, 189, 190 Platon 43, 44, 62, 67, 105, 139, 192, 198 Porsch, Felix 59 Postman, Neil 35 Priscilla 178 Przywara, Erich 129, 169, 193
Verzeichnis der Namen
R Rad, Gerhard von 89, 95, 102, 138, 191 Rahner, Hugo 166, 188 Rahner, Karl 22, 51, 52, 53, 55, 70, 71, 72, 126, 175, 184 Ranke, Leopold von 195 Ratzinger, Joseph 52 Reichardt, Michael 157 Reimarus, Hermann Samuel 41 Reiß, Katharina 93, 222 Reller, Horst 189 Rijn, Rembrandt van 19 Ritter, Adolf Martin 178, 192 Robinson, James M. 191, 206 Rohrmoser, Günter 55 Roloff, Jürgen 67 RosenstockHuessy, Eugen 56, 57, 62, 63 Rosenzweig, Franz 34, 62, 63, 66, 88, 171 Rouault, Georges 33 Rousselot, Pierre 80, 172, 173, 197 Rushdie, Salman 45
S Sachs, Nelly 30, 31, 84 Sanders, Ed Parish 165 Sartre, Jean-Paul 82, 83, 121 Sauer, Joseph 58, 61, 64 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von 41, 177, 178 Schenke, Ludger 29, 47, 61, 64, 93, 115, 117, 121, 128, 132, 160, 162, 205 Schillebeeckx, Edward 159, 185, 205, 206 Schleiermacher, Friedrich 122 Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst 23 Schmidt, Franz 79 Schmithals, Walter 202 Schnackenburg, Rudolf 18, 19, 48, 49, 54, 60, 95, 126 Schneemelcher, Wilhelm 168 Schneider, Carl 167 Schneider, Reinhold 36, 74, 97, 146, 181 Scholl, Sophie 30 Schönberg, Arnold 31 Schoonenberg, Piet 184 Schürmann, Heinz 111 Schweitzer, Albert 20, 21, 22, 23 Schweizer, Eduard 64, 163, 207 Seckler, Max 55 Seiterich, Eugen 38
Seuse, Heinrich 75, 86, 87, 92, 93 Söhngen, Gottlieb 190 Sokrates 43, 44 Solowjew, Wladimir 29 Stegemann, Hartmut 100, 101, 103 Steinbüchel, Theodor 174 Stein, Edith 30 Strauß, David Friedrich 44 Strobel, August 142 Symeon der Neue Theologe 188
T Taubes, Jakob 46 Tauler, Johannes 190 Tertullian 178, 191 Theißen, Gerd 84, 117, 124, 162, 183 Theoderich 173, 195 Thomas von Aquin 95, 188, 197 Thomas von Celano 188 Tresmontant, Claude 96
V Valéry, Paul 39, 40 Verweyen, Hansjürgen 123, 135, 136, 137, 157 Vico, Giambattista 155 Vielhauer, Philipp 64 Villers, Alexander von 174 Vögtle, Anton 58, 59, 61, 64, 114, 116, 127, 131, 135, 144, 157 Voltaire (Arouet, François-Marie) 198
W Waldenfels, Hans 45 Webber, Andrew Lloyd 185 Weber, Max 45, 107, 179 Weizsäcker, Carl Friedrich von 67 Wentzel, Hans 86, 127 Wenz, Gunther 55 Werfel, Franz 65 Werner, Martin 167 Wikenhauser, Alfred 48, 112, 157 Wilckens, Ulrich 15, 55, 140, 146, 166 Wimmel, Walter 197 Wittram, Reinhard 129 Wust, Peter 174, 186
Z Zimmermann, Bernd Alois 33
219
Im Text zitierte Werke von Eugen Biser Abstieg und Auferstehung. Die geistige Welt in Novalis Hymnen an die Nacht, Heidelberg 1954. Im Text zitierte Werke von Eugen Biser Aufriß einer therapeutischen Theologie, in: Geist und Leben 70 (1997), S. 199 – 209. Bewogen, nicht erzogen. Der aktuelle Weg der Glaubensvermittlung, in: Archiv für Religionspsychologie 20 (1992), S. 59 – 66. Buber für Christen, Freiburg i. Br. u. a. 1988. Christomathie. Eine Neulektüre des Evangeliums, aus d. Nachlass hrsg., Darmstadt 2018. Das Antlitz. Christologie von innen, Düsseldorf 1999. Das Antlitz des Menschen. Zur religiösen Dimension der Malerei. Gedeutet an drei Hauptwerken, in: W. Böhme (Hg.), Wo ist Gott zu finden?, Karlsruhe 1985, S. 43 – 54. Das Buch in medienkritischer Sicht, in: K. Reiß (Hg.), Vom Wort zum Text. Medienkritische Perspektiven, München 1987, S. 11 – 29. Das Spiegelkabinett. Wohin führt die Rechtfertigungsdebatte?, in: Stimmen der Zeit 216 (1998), S. 375 – 385. Der Freund. Annäherungen an Jesus, 2/1989. Der inwendige Lehrer. Der Weg zu Selbstfindung und Heilung (1994), Norderstedt 2002. Der Mensch – das uneingelöste Versprechen. Entwurf einer Modalanthropologie, Düsseldorf 2/1996. Der Mensch im Horizont Gottes, hrsg. v. P. Jentzmik, Limburg 2007. Der Mensch im Medienzeitalter, München 1988. Der schwere Weg der Gottesfrage, Düsseldorf 1982. Der unbekannte Paulus, Düsseldorf 2003. Der Ursprung der christlichen Musik, in: Aufgang. Jahrbuch für Denken, Dichten, Musik 1 (2004), S. 215 – 218. Die Bibel als Medium. Zur medienkritischen Schlüsselposition der Theologie, Heidelberg 1990. Die Entdeckung des Christentums. Der alte Glaube und das neue Jahrtausend, Freiburg i. Br. u. a. 2/2001. Die glaubensgeschichtliche Wende. Eine theologische Positionsbestimmung, Graz 1986. Dombau oder Triptychon. Zum Abschluß der Trilogie Hans Urs von Balthasars, in: Theologische Revue 84 (1988), Sp. 177 – 184. Einweisung ins Christentum (1997), Düsseldorf 2004. Glaubenserweckung. Das Christentum an der Jahrtausendwende, Düsseldorf 2000. Glaubensimpulse. Beiträge zur Glaubenstheorie und Religionsphilosophie, Würzburg 1988. Glaubensprognose. Orientierung in postsäkularistischer Zeit, Graz u. a. 1991. Glaubensverständnis. Grundriß einer hermeneutischen Fundamentaltheologie, Freiburg i. Br. u. a. 1975. Gotteskindschaft. Die Erhebung zu Gott, Darmstadt 2007. Gott im Horizont des Menschen, hrsg. v. P. Jentzmik, Limburg 2001. Gottsucher oder Antichrist. Nietzsches provokative Kritik des Christentums, Salzburg 1982. Gott verstehen. Erwägungen zum Verhältnis Mensch und Offenbarung, München u. a. 1971. 220
Im Text zitierte Werke von Eugen Biser
Hat der Glaube eine Zukunft?, Düsseldorf 3/1997. Interpretation und Veränderung. Werk und Wirkung Romano Guardinis, Paderborn u. a. 1979. Ist der Mensch, was er sein kann? Eine anthropologische Reflexion, in: Stimmen der Zeit 199 (1981), S. 291 – 300. Jesus für Christen. Eine Herausforderung, Freiburg i. Br. 1984. Kann Glaube heilen?, in: Meditation 21 (1995), S. 13 – 17. Mensch und Spiritualität. Eugen Biser und Richard Heinzmann im Gespräch, Darmstadt 2008. Musik als Dialog mit Gott und Mensch. Oder: Der hörbare Faden der Ariadne, in: zur debatte. Themen der Katholischen Akademie in Bayern 33 (2003) 2, S. 24f. Nietzsche für Christen. Eine Herausforderung, Leutesdorf 2000. Paulus für Christen, Freiburg i. Br. u. a. 1985. Paulus. Zeuge, Mystiker, Vordenker, München 1992. Provokationen der Freiheit. Antriebe und Ziele des emanzipierten Bewußtseins, München u. a. 1974. Theologie als Therapie (1985), unveränd. Nachdruck, Norderstedt 2002. Theologie der Zukunft. Eugen Biser im Gespräch mit Richard Heinzmann (2005), Darmstadt 3/2010. Theologische Sprachtheorie und Hermeneutik, München 1970. Theologische Trauerarbeit. Zu Hans Blumenbergs „Matthäuspassion“, in: Theologische Revue 85 (1989), Sp. 441 – 452. Überredung zur Liebe. Die dichterische Daseinsdeutung Gertrud von le Forts, Regensburg 1980. Überwindung der Glaubenskrise. Wege zur spirituellen Aneignung, München 1997. Verändern Medien die Botschaft?, in: Lebendige Seelsorge 38 (1987), S. 242 – 251. Vorwort, in: J. Bernhart, De profundis, mit einem Vorw. v. E. Biser zur Neuausgabe, Weißenhorn 5/1985. Was ist mit diesem? Eine Improvisation über das Thema des von Jesus geliebten Jüngers, in: C. Breytenbach u. a. (Hgg.), Anfänge der Christologie. Festschrift für Ferdinand Hahn zum 65. Geburtstag, Göttingen 1991, S. 323 – 336. Wo bist du? Antwort auf die Frage nach dem Menschen, Leutesdorf 2/2002. Wort Gottes in Menschensprache, in: P. Gordan (Hg.), Evangelium und Inkulturation (1492 – 1992), Graz u. a. 1993, S. 51 – 77. Zur Situation des Menschen im Medienzeitalter, München 1988. Zum Gesamtwerk Eugen Bisers: www.eugen-biser-bibliographie.de.
221
Die Eugen-Biser-Stiftung: Dialog aus christlichem Ursprung Die Stiftung ist im Christentum verankert und dem Gedankengut Eugen Bisers verpflichtet, dessen Werk sie erschließt und verbreitet. Eugen Biser verstand die christliche Botschaft der bedingungslosen Liebeszusage Gottes als Ermutigung für den Menschen, sein Leben auf die Zukunft hin offen und angstfrei zu gestalten. Der Mensch – das uneingelöste Versprechen, so lautet ein Buchtitel von Eugen Biser. Seiner Auffassung nach ist der Mensch noch weit entfernt von dem, was er sein kann und soll, denn er wird in seiner Entwicklung von der Angst gehemmt, nicht als der angenommen zu werden, der er ist. Religionen helfen dabei, mit ihren je eigenen Wahrheiten, diese Ängste durch Zusagen von Hoffnung und Sinn zu überwinden. Bei einem Zusammentreffen mehrerer Religionen ist es Voraussetzung für einen friedlichen, zielführenden Dialog, dass die Dialogpartner ihre je eigene Religion verstehen. Getreu ihrem Motto „Dialog aus christlichem Ursprung“ sieht sich die im Jahr 2002 gegründete, gemeinnützige Eugen-Biser-Stiftung als Brückenbauer zwischen den Religionen. Ihr Kernanliegen ist die Förderung des Friedens zwischen den Religionen als Beitrag für ein gelingendes Zusammenleben in der demokratischen Gesellschaft.
„Zukunft des Christentums“ in theologischer und in gesellschaftlicher Hinsicht Eugen Bisers „Theologie der Zukunft“ gibt dem unsere Kultur prägenden christlichen Glauben eine Deutung, die ihn als Impuls für die Bewältigung der Probleme der Gegenwart neu wirksam machen kann. Die hohe Sensibilität Eugen Bisers für die aktuellen Probleme von Kirche und Welt macht ihn zu einem in die Zukunft weisenden und im besten Sinne modernen Denker. Seine visionäre und innovative Kraft reicht weit über den christlichen Raum hinaus und gewinnt dadurch für Mensch und Gesellschaft grundsätzliche Bedeutung. 222
Deshalb widmet sich die Eugen-Biser-Stiftung der Bewahrung, Erschließung, Fortführung und Verbreitung seines theologischen und philosophischen Werkes, zu dem eine vollständige Bibliographie im Internet gepflegt wird: www.bibliographie.eugen-biserstiftung.de. Die Stiftung setzt sich wie ihr Namensgeber für die Vermittlung der Grundwerte des Christentums ein und gibt Impulse in Veranstaltungsreihen, Tagungen, Symposien, Fernsehsendungen, Einzelveranstaltungen sowie in einem breiten Angebot von Publikationen.
Eugen-Biser-Stiftungslehrstuhl Die Bedeutung der Religionsphilosophie Eugen Bisers für die Vermittlung des Kerns der christlichen Botschaft in die moderne Welt hinein war der Grund, weshalb Freunde und Förderer durch ihre Finanzierungszusagen der Eugen-Biser-Stiftung im Jahr 2014 die Errichtung eines Eugen-Biser-Stiftungslehrstuhls an der „Hochschule für Philosophie“ in München ermöglicht haben. Der Inhaber des Lehrstuhls soll aus dem Geist und Denken Eugen Bisers die Schnittstellen der christlichen Existenzanalyse zur Religions- und Subjektphilosophie aufzeigen, um gemäß Bisers Wirken, die christliche Offenbarung als Antwort auf die Fragen der Menschen der Gegenwart darzulegen.
„Dialog aus christlichem Ursprung“ mit anderen Weltreligionen, Weltanschauungen und Kulturen Im interreligiösen und interkulturellen Dialog, den die Eugen-Biser-Stiftung „aus christlichem Ursprung“ führt, befasst sie sich aufgrund der großen gesellschaftlichen Bedeutung gegenwärtig vor allem mit der Verständigung zwischen Christen und Muslimen. Als Fundament für ihre Bildungsveranstaltungen in Religion, Gesellschaft und Politik dienen das von der Stiftung in Kooperation mit Wissenschaftlern der Universität Ankara erarbeitete mehrsprachige christlich-islamische Lexikon des Dialogs sowie das Handbuch Christentum und Islam in Deutschland, das gesellschaftliche, rechtliche und politische Aspekte umfasst. Auf dieser Grundlage führt die Stiftung praxisorientierte interreligiöse Bildungsprojekte in der schulischen und außerschulischen Jugend- und Erwachsenenarbeit durch. Hinzu kommen Symposien, Expertentagungen und Veröffentlichungen. Im Jahr 2019 gründet die Eugen-Biser-Stiftung eine „Islamberatung in Bayern“, um die Zusammenarbeit zwischen bayerischen Kommunen und islamischen Organisationen zu fördern.
Eugen-Biser-Preis Die Stiftung vergibt den Eugen-Biser-Preis in unregelmäßigen Abständen. Sie ehrt damit Persönlichkeiten, die sich wissenschaftlich mit dem Werk Eugen Bisers befassen oder die sich aktiv für den Dialog und die Begegnung mit anderen Religionen, Weltanschauungen 223
und Kulturen einsetzen in dem Bemühen um Freiheit, Toleranz und Frieden. Preisträgerinnen und Preisträger sind Dr. h. c. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (2016), Professor Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages (2012), Prinz Ghazi bin Muhammad bin Talal, Haschemitisches Königreich von Jordanien, Dr. Mustafa Cerić, Großmufti von Bosnien und Herzegowina, und Scheich Habib Ali Zain al-Abideen al-Jifri, Vereinigte Arabische Emirate (2008), Karl Kardinal Lehmann, Bischof von Mainz und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (2005), Professor Dr. Dr. h. c. Ferdinand Hahn, Lehrstuhlinhaber für Neues Testament an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München (2003).
Gremien der Eugen-Biser-Stiftung Ehrenpräsident der Stiftung ist Prof. Dr. Richard Heinzmann. Dem ehrenamtlich tätigen Stiftungsrat gehören Prof. Dr. Dr. h. c. Martin Thurner (Vorsitz), Dr. Heiner Köster (stellvertretender Vorsitz), Prof. Dr. Martin Arneth, Prof. Dr. Walter Homolka, Prof. Dr. Ömer Özsoy, Prof. Dr. Jörg Lauster und Prof. Dr. Markus Vogt an. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vorstands sind Marianne Köster (Vorsitz) und Michaela Leitner; hauptamtliches Mitglied ist Dipl. theol. Stefan Zinsmeister M. A. Dr. Günther Beckstein ist Vorsitzender des ehrenamtlichen Kuratoriums, sein Stellvertreter Dr. Thomas von Mitschke-Collande (Stand Februar 2019).
Dank Ihre Arbeit kann die Eugen-Biser-Stiftung nur leisten aufgrund der ehrenamtlichen Mitarbeit vieler Freunde der Stiftung, großzügiger finanzieller Förderung und dem treuen Engagement ihres Freundeskreises. Für diese und jede weitere Unterstützung ist die Stiftung außerordentlich dankbar.
EUGEN-BISER-STIFTUNG Pappenheimstraße 4 · 80335 München Telefon 089-18 00 68-11 · Fax -16 [email protected] www.eugen-biser-stiftung.de
224