Albert Camus oder der glückliche Sisyphos - Albert Camus ou Sisyphe heureux 9783737001465, 9783847101468, 9783847001461
119 9 3MB
German Pages [461] Year 2013
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Willi Jung
File loading please wait...
Citation preview
Deutschland und Frankreich im wissenschaftlichen Dialog Le dialogue scientifique franco-allemand
Band / Volume 4
Herausgegeben von Willi Jung, Catherine Robert und FranÅoise R¦tif Collection dirig¦e par Willi Jung, Catherine Robert et FranÅoise R¦tif
Willi Jung (Hg.)
Albert Camus oder der glückliche Sisyphos – Albert Camus ou Sisyphe heureux
V& R unipress Bonn University Press
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-8471-0146-8 ISBN 978-3-8470-0146-1 (E-Book) Veröffentlichungen der Bonn University Press erscheinen im Verlag V& R unipress GmbH. Gedruckt in Zusammenarbeit mit dem Büro für Hochschulkooperation der französischen Botschaft (Nordrhein-Westfalen und Hessen). Ó 2013, V& R unipress in Göttingen / www.vr-unipress.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Printed in Germany. Titelbild: Oliver Jordan (Köln), Albert Camus, 190 x 110 cm Druck und Bindung: CPI Buch Bücher.de GmbH, Birkach Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
I. Engagement: Philosophie, Ethik und Politik Rodion Ebbighausen (Augsburg) Camus und der Terrorismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Jeanyves Gu¦rin (Paris) Camus et la revue Esprit (1944 – 1976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Christoph Kann (Düsseldorf) Albert Camus – ein Cartesianer des Absurden?
. . . . . . . . . . . . . .
53
Lou Marin (Marseille) Camus und seine libertäre Kritik der Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Rupert Neudeck (Troisdorf) Die Pest als Vorbild für die Humanitäre Arbeit . . . . . . . . . . . . . . .
89
Hans-Joachim Pieper (Bonn) Revolte gegen das Absurde: Zur Philosophie Albert Camus’ . . . . . . . . 103 Anne-Kathrin Reif (Wuppertal) Vom Absurden zur Liebe – der unbekannte Camus
. . . . . . . . . . . . 119
Elmar Schmidt (Bonn) Camus im kolonialen Algerien der 30er Jahre: MisÀre de la Kabylie
. . . 141
Knut Wenzel (Frankfurt am Main) Verteidigung des Relativen. Albert Camus und das Christentum . . . . . 157
6
Inhalt
Heiner Wittmann (Stuttgart) Kunst und Moral. Albert Camus und seine Nobelpreisrede . . . . . . . . 173
II. Ästhetik: Narrativik und Dramatik Willi Jung (Bonn) Schuld und Gedächtnis – La Chute von Albert Camus . . . . . . . . . . . 195 Michela Landi (Firenze) »Mal, soit mon bien«. La question du dandy de Baudelaire Camus . . . 219 Frank Reza Links (Bonn) »Ce que je dois l’Espagne« ou le SiÀcle d’Or dans le th¦tre de Camus . 243 Frank Reza Links (Bonn) Über das Verhandeln zeitloser Themen: Ein Interview mit der Theaterregisseurin Jette Steckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Helmut Meter (Klagenfurt) L’Exil et le Royaume ou Camus moraliste moderne
. . . . . . . . . . . . 271
Pierre-Louis Rey (Paris) Camus fut-il »romancier«? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
III. Tradition und Moderne: Rezeption und Intertextualität Dorothee Gall (Bonn) Die Chance der Humanität angesichts der Pest: eine komparatistische Studie zu Thukydides, Lukrez und Camus . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Christoph Hoch (Bonn) Jugend in der Alg¦rie franÅaise: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten (Albert Camus Le Premier homme, Kateb Yacine Nedjma) . . . . . 323 Brigitte Sändig (Berlin) Camus im Osten. Zur Rezeption des Autors in der DDR und in osteuropäischen Ländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Thomas A. Schmitz (Bonn) Camus und der griechische Mythos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Inhalt
7
B¦n¦dicte Vauthier (Bern) Albert Camus: du panth¦on aux manuels de litt¦rature franÅaise et francophone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Franz Rudolf Weller (Bonn) Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland (West und Ost) nach 1945. Eine kritische Bilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Maurice Weyembergh (Bruxelles) Camus et Dostoevski. La L¦gende du Grand Inquisiteur et ses interpr¦tations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Die Autoren – Les Auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Vorwort
Am Ende seines philosophischen Essays über den Menschen in der Revolte schreibt Albert Camus, dass man sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen müsse. Damit hat er eine sprachliche Formel gefunden, die noch heute in Porträtskizzen Verwendung findet und gerade in Feuilletons gerne zitiert wird. Auch im Deutschen ist diese Formel (»Man muß sich X als einen glücklichen Menschen vorstellen«) weit verbreitet, sie verleiht Camus damit auch sprachlich in unserer Zeit Präsenz. Den Zusammenhang mit der griechischen Mythologie stellt man dabei nicht mehr unbedingt her. Die griechische Mythologie und Homers Odyssee (XI, 593 – 600) erzählen von Sisyphos, dem Sohn des Windgottes Aiolos. Er war einerseits Gründer und König von Korinth und gilt andererseits als Archetyp des Frevlers. Man sagt ihm Verschlagenheit nach, denn er überlistete und fesselte den Tod (Thanatos) und verwirklichte damit einen Menschheitstraum: Niemand konnte mehr sterben. Als schließlich Ares den Thanatos wieder befreit hatte, musste Sisyphos in die Unterwelt, und die ihm auferlegte Strafe machte »Weltgeschichte«: er musste einen Felsbrocken auf einen Berg wälzen, der jedoch stets kurz vor Erreichen des Ziels hinabrollte, ein Akt, der sich ins Unendliche fortsetzt. Die Sisyphusarbeit gilt uns daher noch heute als Synonym für vergebliche Mühen. Albert Camus’ Essay Le mythe de Sisyphe (1942) leistet vor diesem Hintergrund einen Mythentransfer von der Antike in die Gegenwart, er aktualisiert und variiert den antiken Mythos: Sisyphos steht für die absurde Situation des modernen Menschen in seinem aussichtslosen und alltäglichen Streben, die gegebene Welt zu überwinden, die evidente »Grundlosigkeit« des Seins mit einem »pourtant«, einem »dennoch« zu »begründen«. Wenn Camus nun hier selbst als glücklicher Sisyphos im Titel des Bandes ausgewiesen ist, mag sich der Leser zu Recht fragen, ob diese Schlussfolgerung überhaupt gezogen werden kann. Der noch relativ jung verstorbene Autor – er wurde tragisches Opfer eines Verkehrsunfalls und teilt somit das Schicksal vieler Menschenopfer des Automobilzeitalters – gilt als eminenter französischer Intellektueller des 20. Jahrhunderts. Seine bescheidene algerische Herkunft hatte
10
Vorwort
ihn gewiss nicht dazu prädestiniert. Die Einfachheit der Lebensverhältnisse, in denen er aufwuchs, die Bildungsferne und die durch die Tuberkulosekrankheit schon in jungen Jahren erfahrene Endlichkeit des Seins im Allgemeinen und die des eigenen Seins im Besonderen mochten geradezu als Katalysatoren seines Lebenshungers und seiner Suche nach dem Glück gewirkt haben. Wenn es für ihn je einen Raum des Glücks gegeben hat, dann war es der Mittelmeerraum, und in diesem Raum vorzugsweise Griechenland. Die schon zu seinen Lebzeiten beeindruckende Rezeption seines Werkes, die Verleihung des Friedensnobelpreises und die in seinen Lebensspuren immer wieder aufleuchtenden Momente des Glücks können ohne Zweifel als Indikatoren eines glücklichen Camus-Sisyphos gesehen werden, bei aller berechtigten Skepsis dem Glücksbegriff gegenüber. Camus’ Glückssetzung ergibt sich aus der Aktion, nicht der Reaktion. Das Bewußtsein der Absurdität unseres Seins schließt das Glück nicht aus, im Gegenteil, es begründet es, so will es Camus’ Variation des Sisyphos-Mythos. Warum sollte man den Glücksbegriff im Umkehrschluss daher nicht auch auf Camus selbst anwenden? Der vorliegende Sammelband vereinigt Beiträge, die zum Teil auf Gastvorträge an der Universität Bonn zurückgehen, aber auch Originalbeiträge, die eigens für diesen Band verfasst worden sind. Europäische Camus-Forscher und passionierte Leser haben zum Gelingen dieses Sammelbandes beigetragen, der im zeitlichen Umfeld des 100. Geburtstages (2013) und des 50. Todestages (2010) erscheint und in gewisser Weise eine »Arbeit am Mythos« im Sinne Blumenbergs dokumentiert. Camus selbst scheint zum Mythos geworden zu sein als Repräsentant einer Generation des 20. Jahrhunderts, die die immer wieder hereinbrechenden historischen und individuellen Katastrophen als persönliche Herausforderung begriffen hat im festen Glauben an den Sieg des Humanitären. Die Beiträge des Sammelbandes sind insgesamt ein eindrucksvoller Ausweis der Vitalität der Camus-Studien. Gerade im Jahr des 100. Geburtstages von Albert Camus ist es ein besonderes Anliegen, die Vertreter der europäischen CamusForschung in einem Sammelband zu Wort kommen zu lassen. Für die Gliederung der Beiträge sind gewiss unterschiedliche Verfahrensweisen denkbar ; der Herausgeber hat sich aber am Ende dafür entschieden, die Beiträge drei Sektionen zuzuordnen. Diese drei Sektionen versuchen der Vielfalt des Werkes von Albert Camus gerecht zu werden. Die erste Sektion versammelt zum Thema Engagement Abhandlungen zu Fragen von Philosophie, Ethik und Politik. Die zweite Sektion widmet sich unter der Überschrift Ästhetik dem literarischen Œuvre von Albert Camus, seiner Narrativik und Dramatik. Die dritte Sektion ist schließlich dem Verhältnis von Tradition und Moderne gewidmet und behandelt Fragen der Rezeption und der Intertextualität. Alle Beiträge haben ihre jeweilige Spezifizität; Homogenität der Beiträge wurde zwar angestrebt, gleichwohl sollten die redaktionellen Freiheiten der Autoren so wenig wie möglich beschnitten
Vorwort
11
werden. Das mag bei dem ein oder anderen Leser zwar einen Eindruck von Disparatheit erwecken, bei genauerer Betrachtung wird aber ersichtlich, dass diese Unterschiede eher formal als inhaltlich zu sehen sind. Die Beiträger lehren überwiegend an deutschen, französischen, aber auch italienischen, österreichischen und Schweizer Universitäten. Neben international profilierten Camus-Forschern sind auch zahlreiche Romanisten vertreten, die sich seit vielen Jahren und Jahrzehnten intensiv mit Camus auseinandergesetzt haben, aber hier zum ersten Mal eine einschlägige Veröffentlichung vorlegen. Camus erreicht bis heute zwar eine große Zahl von Lesern, aber dennoch ist die Camus-Forschung selbst – etwa im Vergleich zur Sartre-Forschung – keineswegs vergleichbar stark an den Universitäten vertreten. Möge dieser Band, so die Hoffnung des Herausgebers, der Beschäftigung mit Camus’ Leben und Werk auch über das Jubiläumsjahr hinaus neue Impulse geben. Das Vorwort darf nicht enden ohne ein Wort zum Camus-Porträt auf dem Einband. Es stammt von dem Kölner Maler Oliver Jordan. Er gehört zu jenen Künstlern, die von Leben und Werk Albert Camus’ in besonderer Weise geprägt wurden und deren künstlerisches Werk dadurch auch in tiefergehender Weise inspiriert ist. Dem Maler bin ich zu außerordentlichem Dank verpflichtet, dass er dem Verlag und mir großzügig die Rechte für die Wiedergabe seines CamusPorträts gewährt hat. Das Porträt zeigt auf beeindruckende Weise die Prägung dieses Ausnahmeschriftstellers durch die algerische Herkunft und die Farben seiner Heimat. Das Porträt ist typisch für Jordans Porträttechnik, die mit starkem Pinselstrich Konturen und Farben des Porträtierten, in diesem Falle im mediterranen Licht, erscheinen lässt. Das algerische Lokalkolorit scheint ins Dichterporträt übersetzt und verleiht diesem Porträt durchdringende Tiefe und Nachdenklichkeit. Zum Schluss ein Wort des Dankes an alle Autorinnen und Autoren für ihre vorzüglichen Beiträge zu diesem Band, der ohne sie nicht zustande gekommen wäre. Danken möchte ich auch dem Verlag, insbesondere Liane Reichl und Ruth Vachek, für die ausgezeichnete Betreuung des Bandes, und ganz besonders auch Marie Bellec und Birgit Müller, die mich bei der redaktionellen Bearbeitung der Beiträge umsichtig und tatkräftig unterstützt haben. Willi Jung
I. Engagement: Philosophie, Ethik und Politik
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
Camus und der Terrorismus
Abstract: Ausgehend von einer allgemeinen Analyse des Terrorismus stellt sich die Frage nach der Abgrenzung von berechtigtem Freiheitskampf und terroristischer Gewalt. Albert Camus, der sich sowohl in der R¦sistance engagiert als auch Stellung zum Algerienkonflikt genommen hat, kann zu diesem Abgrenzungsproblem Maßgebliches beitragen. Vor dem Hintergrund dieses Problems soll zuerst Camus’ Auffassung der Auflehnung und der Revolte erörtert werden. Dabei wird deutlich, dass die Revolte in sich selbst eine Grenze hervorbringt, bei deren Überschreitung der gerechtfertigte Widerstand in den Nihilismus, Totalitarismus oder Terrorismus umschlägt. Camus fordert diese Grenze aber nicht nur ein, sondern gibt auch eine Bestimmung der Grenze, und zwar anhand der vier Kriterien des maßvollen Widerstands: 1. Unvermeidbarkeit der Gewalt, 2. Bewusstsein des Zwiespalts der Gewalt, 3. Sühne der Gewalt, 4. Verschonung der Unschuldigen.
Einleitung und Vorbemerkungen – das Phänomen des Terrors Die Anschläge vom 11. September 2001 sind in das kollektive Gedächtnis unserer Zeit unauslöschlich eingebrannt. Für die meisten Europäer bekam das Phänomen Terrorismus an diesem Datum nicht nur eine ungeheure Aktualität und Präsenz, sondern auch einen Namen. Seither wird der Terrorismus oft mit Al-Qaida gleichgesetzt und einem radikalfundamentalistischen Islam zugeordnet. Die suggestive Kraft der Bilder vom 11. September und die darauf folgenden Jahre, die im Zeichen des »Kriegs gegen den Terror«1 standen, machen oft ver1 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass George W. Bush den »Krieg gegen den Terror« und nicht den »Krieg gegen den Terrorismus« erklärt hat. Terror ist ein Begriff mit wesentlich größerem Umfang (vgl. dazu: Hoffman, Bruce: Terrorismus. Der unerklärte Krieg. Neue Gefahren politischer Gewalt, Frankfurt am Main 2006, S. 48).
16
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
gessen, dass der Terrorismus weder eine typische Erscheinung des 21. Jahrhunderts noch an einen spezifischen kulturellen, politischen oder religiösen Hintergrund gebunden ist. So mordeten im 20. Jahrhundert allein in Europa – um nur eine kleine Auswahl zu nennen – die RAF in Deutschland, die ETA in Spanien, die IRA in Irland, die Brigate Rosse in Italien, die Action Directe in Frankreich. Auch außerhalb Europas gab und gibt es eine Vielzahl terroristischer Organisationen, die aus jedem denkbaren kulturellen, politischen und religiösen Hintergrund stammen: die Irgun in Palästina, die PLO, die Hamas, die al-Aqsua-Märtyrer-Brigaden im Nahen Osten, die PKK in der Türkei, die Tamil Tigers in Sri Lanka, die AUMSekte in Japan und die so genannten White Supremacists in den USA.2 Es ist also festzuhalten, dass es fast überall auf der Welt Terrorismus gegeben hat und auch heute noch gibt sowie dass der Terrorismus ein vielgestaltiges Phänomen ist, das sich unabhängig von bestimmten kulturellen, politischen oder religiösen Strömungen entwickelt. Dennoch verändert sich der Terrorismus der Gegenwart aufgrund technologischer Neuerungen quantitativ. Die Folge davon ist, dass sein Bedrohungspotenzial enorm zugenommen hat. Fortschritte in der Miniaturisierung und der Entwicklung von chemischen, biologischen und nuklearen Waffen führen dazu, dass das Zerstörungs- und Tötungspotenzial von Einzeltätern oder kleiner Gruppen immens gesteigert wird. Zugleich vereinfacht das Internet einerseits die Kommunikation terroristischer Vereinigungen untereinander und ermöglicht andererseits eine effektvollere und massenwirksamere Propaganda, auf die der Terrorismus abzielt. Trotz dieser Veränderungen der Mittel und Möglichkeiten bleiben aber die Motive des Terrorismus im Kern erhalten.3 Die Komplexität des Phänomens erfordert zuerst einmal eine möglichst prägnante Definition. Allerdings ist festzustellen, dass bis heute nicht verbindlich geklärt ist, was der Begriff »Terrorismus« genau bezeichnet und wer eigentlich »Terrorist« ist. Allein in den USA existiert eine Vielzahl von Definitionen, die sich sogar von Behörde zu Behörde unterscheiden.4 Weder die UNO noch die Europäische Union hat sich geeinigt, was juristisch unter Terrorismus zu verstehen ist, und auch in Deutschland weisen die einschlägigen Kommentare des Strafgesetzbuchs nur darauf hin, dass es keine klare Definition gibt.5 2 Vgl. Wernicke, Christian: Die Killer-Zone des Captain Hutaree. In: Süddeutsche Zeitung (Nr. 75) 2010, S. 12. 3 Hoffmann: Terrorismus, S. 444 ff. 4 Vgl. Townshend, Charles: Terrorismus, Stuttgart 2005, S. 11 und Hoffman: Terrorismus, S. 66 ff. 5 Vgl. Townshend: Terrorismus, S. 11 f.; Schneckener, Ulrich: Globaler Terrorismus. In: Information zur politischen Bildung (Nr. 280), 3. Quartal 2003, S. 53 f.; Hoffman: Terrorismus, S. 21 ff.; vgl. Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland:
Camus und der Terrorismus
17
Es ist so schwierig, den Terrorismus zu definieren, weil es für eine Definition immer einer klaren Abgrenzung bedarf, die beim Phänomen des Terrorismus nicht bzw. kaum geleistet werden kann. Borradori spricht mit Bezug auf Derrida vom »problem-ridden«6 Begriff Terrorismus, der mit einer Vielzahl von impliziten und expliziten Bedeutungsdimensionen behaftet ist. Jeder, der den Terrorismus definieren will, muss sich mit dem Abgrenzungsproblem auseinandersetzen, das sich durch zwei Fragen verdeutlichen lässt: 1. Inwiefern ist der Terrorismus von »krimineller Gewalt oder militärischen Aktionen«7 zu unterscheiden? 2. Was unterscheidet einen Terroristen von einem Freiheitskämpfer? Zur ersten Frage: Der Terrorist ist erstens i. d. R. keine Person, die es auf private Vorteile oder Bereicherung abgesehen hat. Insofern ist er kein Krimineller. Der Terrorist ist zweitens kein Mitglied einer regulären Armee, obwohl der Zweck einer Armee und eines Terroristen grundsätzlich vergleichbar sind. Die Armee führt einen Krieg, der, wie Clausewitz schreibt, »ein Akt der Gewalt« ist, »um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen.«8 Den gleichen Zweck verfolgt der Terrorist. Der Unterschied liegt darin, dass die Mittel zur Erreichung dieses Zwecks verschieden sind. Krieg ist als offener Kampf definiert9, während sich der Terrorismus gerade durch die Vermeidung des offenen Kampfes auszeichnet: »Krieg will letztendlich zwingen, Terror beeindrucken. Krieg ist physisch, Terror mental.«10 Da der Terrorist nicht über die militärischen Mittel verfügt, um Gebiete zu erobern und dauerhaft zu kontrollieren, verlegt er seinen Wirkungsraum zwangsläufig auf die psychische Ebene. Die Armee erreicht ihr Ziel, wenn sie den Gegner militärisch besiegt, der Terrorist erreicht sein Ziel, wenn es ihm gelingt, seinen Gegner mental zu dominieren. Allerdings ist hier anzumerken, dass sich auch Armeen wiederholt des Mittels www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/TerrorismusOK/TerrorismusbekaempfungVN.html (14. 09. 2008): »Immer wieder wird die Forderung erhoben, der Internationale Gerichtshof solle ›Terrorismus‹ als Straftatbestand in sein Statut aufnehmen. Dies setzt jedoch voraus, dass der Tatbestand klar definiert ist. Daran fehlt es einstweilen noch.« Auch in Kommentaren zum Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland (§ 129a Bildung terroristischer Vereinigungen) wird auf die Schwierigkeit, den Terrorismus zu definieren, hingewiesen (vgl. Lenckner, Theodor ; Sternberg-Lieben, Detlev : Strafgesetzbuch. Kommentar, München 2006, S. 1290). 6 Vgl. Borradori, Giovanna: Philosophy in a Time of Terror. Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida, Chicago / London 2003, XIII, 139. 7 Townshend: Terrorismus, S. 11. 8 Clausewitz, Carl von: Vom Kriege. Hinterlassene Werke des Generals Carl von Clausewitz. Drei Bände, hrsg. von Marie von Clausewitz, Berlin 1832 – 1834, Buch I, Kapitel 1, Abschnitt 2. 9 Vgl. Townshend: Terrorismus, S. 15. 10 Townshend: Terrorismus, S. 26.
18
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
des Terrors bedient haben und bedienen, um ihre Ziele zu erreichen. Man denke an Massenhinrichtungen von Zivilisten durch deutsche Wehrmachtssoldaten, die Flächenbombardements der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs oder den Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Alle derartigen Aktionen zielten weniger auf einen unmittelbaren militärischen Zweck, als auf einen psychologischen Effekt. Ziel war es, die Bevölkerung einzuschüchtern oder unter Druck zu setzen, um jeden Widerstand zu brechen und den Gegner von innen heraus zu besiegen. Daraus ergibt sich eine wichtige Unterscheidung, nämlich die von Terror und Terrorismus. Terror ist eine Strategie oder eine Methode, die von Staaten, regulären Armeen und terroristischen Gruppierungen angewandt werden kann. Im Gegensatz zu Staaten und Armeen, die den Terror neben anderen Mitteln anwenden, ist der Terrorist aber auf die Anwendung des Terrors beschränkt, insofern er nicht über die militärischen oder staatlichen Mittel verfügt, um seine Machtansprüche durchzusetzen. Camus unterscheidet auf die gleiche Weise, wenn er auf der einen Seite vom staatlichen und auf der anderen Seite vom individuellen Terror spricht.11 Zur Bestimmung des Phänomens Terror bzw. Terrorismus lässt sich also ein erster Punkt festhalten: »Terror« stammt aus dem Lateinischen und lässt sich mit »Angst« oder »Schrecken« übersetzen. Das zeigt bereits an, dass die Verbreitung von Terror in erster Linie eine Methode oder Strategie ist. Dieser Methode kann sich sowohl ein Staat als auch eine nichtstaatliche Gruppe oder Organisation bedienen. Im ersten Fall spricht man von staatlichem Terror, im zweiten Fall von individuellem Terror. Mit dem Begriff Terrorismus ist in der Regel nur der individuelle Terror gemeint.12 Die Unterscheidung ist wichtig, wie im Vorgriff auf Späteres angemerkt werden soll, da die vier Kriterien für den maßvollen Widerstand, die Camus vorgibt, für den individuellen Terror bzw. die Revolution von unten gelten und nicht für Staaten bzw. Armeen. 11 Vgl. Camus, Albert: Der Mensch in der Revolte, Reinbek bei Hamburg 1997 (Sigle: MR), S. 171 und 202. 12 Camus kennt neben dem staatlichen und dem individuellen Terror noch eine dritte Form des Terrors, nämlich die Entlassung des Menschen in eine rein geschichtlich gedeutete Welt, in der der Atomkrieg möglich ist und der Einzelne in der Mechanik des politischen Kalküls zermahlen wird, also einer Welt, die den Dialog unmöglich gemacht hat: »Es stimmt also, von der sehr allgemeinen Angst vor einem Krieg, den jedermann vorbereitet, bis zur ganz spezifischen Angst vor den tödlichen Ideologien leben wir im Terror. Wir leben im Terror, weil das Überzeugen nicht mehr möglich ist, weil der Mensch der Geschichte gänzlich ausgeliefert worden ist und sich nicht mehr jener Seite seiner selbst zuwenden kann, die ebenso wahr ist wie die historische Seite und der er in der Schönheit der Welt und ihrer Gestalt begegnet; weil wir in einer Welt der Abstraktion leben, einer Welt der Büros und Maschinen, der absoluten Ideen und des undifferenzierten Sektierertums.« (Camus, Albert: Das Jahrhundert der Angst. In: Weder Opfer noch Henker. Über eine neue Weltordnung, Zürich 2006, S. 11 f.) Der Terror des Kalten Kriegs bleibt im Weiteren unberücksichtigt.
Camus und der Terrorismus
19
Zur zweiten Frage: Was unterscheidet einen Terroristen von einem Freiheitskämpfer? Im Rahmen dieses Aufsatzes soll insbesondere diese Frage in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden, denn es ist dies eine zentrale Frage, auf die auch Camus eine Antwort zu geben versucht hat. Die Problematik der Abgrenzung von Freiheitskämpfer und Terrorist ergibt sich aus der Tatsache, dass der Begriff Terrorismus eine »Etikettierung«13 ist, d. h. niemand nennt sich (bis auf ganz seltene Ausnahmen) selbst Terrorist, bzw. die »herabsetzende[]«14 Bezeichnung Terrorist wird dem Terroristen immer nur von seinen Gegnern verliehen. Wer Terrorist und wer Freiheitskämpfer ist, hängt fundamental vom eigenen Standpunkt ab und ist demnach fast »unvermeidlich subjektiv«15. Der Begriff Freiheitskämpfer lässt sich übrigens im vorliegenden Zusammenhang durch eine Reihe von Begriffen ersetzen: der Rebell, der Revolutionär, der Partisan, der Untergrundkämpfer, der Guerilla usw. Beispielhaft lässt sich der zweite Punkt des Abgrenzungsproblems an den Reaktionen auf die Geiselnahme in München von 1972 illustrieren. Der damalige UN-Generalsekretär Kurt Waldheim schlug nach den Ereignissen vor, den internationalen Terrorismus stärker zu bekämpfen. Das stieß allerdings auf Widerstand von Seiten einiger arabischer, afrikanischer und asiatischer Staaten, die befürchteten, dass dadurch keine Befreiungsbewegung – die ja von den Unterdrückern immer als terroristisch bezeichnet werden würde – Unterstützung der Vereinten Nationen erwarten könne. Folglich würde ein solches Gesetz repressive Staaten absichern. Es kam zu keiner Einigung.16 Trotz aller genannten Schwierigkeiten soll zum Schluss dieser Einleitung noch auf drei weitere Punkte hingewiesen werden, die zur Umgrenzung oder Beschreibung des Phänomens Terrorismus herangezogen werden können. Dabei stütze ich mich weniger auf juristische als auf soziologische und politikwissenschaftliche Untersuchungen. Es handelt sich nur um eine summarische Auflistung, die hier nicht weiter erörtert werden kann: Der individuelle Terror ist erstens gekennzeichnet durch die »Nichtverfügbarkeit von Macht und Herrschaft«17 und zweitens durch eine im weitesten Sinne ideologische Zielsetzung. Unter Ideologie verstehe ich hier religiöse, nationalistische, ethnische oder weltanschauliche Überzeugungen. Den ideologischen Zielen soll durch die terroristische Aktion zum Sieg verholfen werden. 13 14 15 16
Townshend: Terrorismus, S. 11. Hoffman: Terrorismus, S. 54. Hoffman: Terrorismus, S. 54. Bis heute scheitert eine Einigung am Widerstand einzelner Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (vor allem der OIC). Vgl. www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/TerrorismusOK/Terrorismus-bekaempfungVN.html (14. 09. 2008) Vgl. Hoffman: Terrorismus, S. 55 f. 17 Meyers Lexikon online. Artikel Terrorismus (01. 08. 2008).
20
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
Der Terrorismus ist eine Gewaltstrategie, die auf den größtmöglichen »psychologischen Effekt«18 abzielt. Zeitlich begrenzte Gewalttaten bzw. die Androhung von Gewalt sind dabei das meist verwendete Mittel (neben Propaganda, Videobotschaften etc.). Terroristische Vereinigungen müssen psychologischen Zwang ausüben, da ihnen keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Insofern ist es in einem gewissen Sinne »rational«, mit den Angriffen auf unschuldige bzw. wehrlose Opfer zu zielen: »Das Wesen des Terrorismus besteht in der Anwendung von bewaffneter Gewalt gegen Unbewaffnete.«19 Der Terrorismus ist entgegen einer weit verbreiteten Meinung eine rationale Strategie, zu der sich die Täter »oftmals erst widerstrebend und nach ausführlichen Überlegungen […] durchgerungen haben«20, um ihre politisch-ideologischen Ziele durchzusetzen. Diese knappe Einleitung in das Problemfeld des Terrorismus soll nicht nur die Vielschichtigkeit und Komplexität des Phänomens vor Augen stellen, sondern auch die Basis bereitstellen, auf der sich Albert Camus’ Auseinandersetzung mit dem Terrorismus einordnen und interpretieren lässt.
Résistance und Algerienkrieg – Freiheitskampf oder Terrorismus? Die in der Einleitung aufgeworfene Frage nach der Differenz von Freiheitskämpfer und Terrorist wird für die folgenden Überlegungen maßgeblich sein. Albert Camus ist im besonderen Maße geeignet, um auf diese schwierige Frage eine Antwort zu geben, denn er hat sich die längste Zeit seines Lebens immer wieder mit ihr auseinandersetzen müssen und auch auseinandergesetzt. Während der Besetzung Frankreichs durch das Deutsche Reich hat Camus als Herausgeber, Redakteur und Autor eine der einflussreichsten Zeitungen der R¦sistance – den Combat – entscheidend mitgestaltet. Er war also direkt involviert in den Widerstandskampf der Franzosen, ohne allerdings selbst zu den Waffen zu greifen. Der Widerstandskampf wurde von den deutschen Besatzern selbstverständlich als Terrorismus gebrandmarkt und die R¦sistance hat sich auch terroristischer Taktiken bedient. Dazu ist noch anzumerken, dass der Terrorismus in weitaus erheblicherem Maße auf Propaganda angewiesen ist als der militärische Kampf, dass Camus’ Engagement aus Sicht der Besatzer also ohne Zweifel eine terroristische Bedrohung darstellte.21 Wenige Jahre später, als sich in Algerien, der Heimat Camus’, die Bevölkerung 18 19 20 21
Schneckener : Globaler Terrorismus, S. 53. Townshend: Terrorismus, S. 17. Hoffman: Terrorismus, S. 17. Vgl. für die Zusammenhänge von Terrorismus und öffentlicher Meinung, Medien und Propaganda Hoffman: Terrorismus, Kapitel 6 – 8.
Camus und der Terrorismus
21
unter Führung der FLN gegen das Kolonialregime Frankreichs erhob, kam es zu einer Vielzahl von Anschlägen, die Camus als terroristisch verurteilt hat. Auf der einen Seite befürwortet und unterstützt Camus den Widerstand gegen die Repression durch die Nazis, auf der anderen Seite aber verurteilt Camus die Unabhängigkeitsbestrebungen der algerischen Urbevölkerung. Diese Gegenüberstellung ist in ihrer Vereinfachung pauschalisierend. Camus hat es sich nicht so einfach gemacht und gesagt, die R¦sistance habe in Frankreich einen durchweg gerechtfertigten Kampf gegen die deutschen Unterdrücker ausgefochten, während die Algerier eine terroristische Mordkampagne gegen Franzosen und französischstämmige Bewohner in Gang gesetzt haben. Camus war sich sowohl der Verbrechen der R¦sistance als auch der berechtigten Ansprüche der Algerier bewusst. Er kannte den Terror der französischen Kolonialtruppen und war weit davon entfernt, ihn zu relativieren oder zu verleugnen. Sicherlich war Camus’ Sicht der Ereignisse auch von persönlicher Betroffenheit und seiner tiefen Verbindung mit seiner Heimat Algerien, aus der er seine künstlerische Kraft schöpfte, beeinflusst.22 Dennoch unterstützte Camus die R¦sistance und kritisierte die Unabhängigkeitsbestrebungen der Algerier. Die etwas vereinfachte und zugleich verallgemeinerte Frage, die sich von selbst aufdrängt, lautet: Warum spricht Camus auf der einen Seite von Freiheitskampf, auf der anderen von Terrorismus? Um auf diese Frage – losgelöst von Camus’ persönlichen Verstrickungen in den Algerienkonflikt – eine gründlich erwogene Antwort geben zu können, ist es notwendig, Camus’ Denken in seinen Grundzügen darzulegen.
Der Mythos von Sisyphos – Die Auflehnung Zu seinen Lebzeiten veröffentlicht Camus zwei Essaybände – 1942 Der Mythos von Sisyphos und 1951 Der Mensch in der Revolte –, in denen er seinen theoretischen Überzeugungen und Ansichten Ausdruck verleiht. In beiden Werken übernimmt die Auflehnung, der Widerstand bzw. die Revolte eine zentrale Funktion. Ich weise auf diesen Punkt hin, da der Terrorismus ohne Zweifel eine Form der Auflehnung bzw. des Widerstands ist. Die Auflehnung ist eine der drei Konsequenzen, die Camus am Ende seiner Reflexionen über das Absurde in Der Mythos von Sisyphos zieht. Er schreibt: »Eine der wenigen philosophisch kohärenten Positionen ist demnach die Auf22 Vgl. dazu die Artikel Alg¦rie und Guerre d’Alg¦rie in: Gu¦rin, Jeanyves (Hrsg.): Dictionnaire Albert Camus, Paris 2009, S. 30 ff. Vgl. Sändig, Brigitte: Albert Camus. Autonomie und Solidarität, Würzburg 2004 , S. 46 ff. (Zweimal algerische Kolonialgeschichte – Kateb: Nedjma, Camus: Le Premier Homme.)
22
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
lehnung.«23 Um Camus’ Haltung zum Terrorismus zu verstehen, muss also zuerst erklärt werden, warum die Auflehnung eine philosophisch kohärente Position ist. Die Ausgangsfrage in Der Mythos von Sisyphos ist die Frage nach dem Selbstmord, d.i. die Frage, »ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht […].«24 Die Frage nach dem Selbstmord stellt sich Camus angesichts der absurden Erfahrung, die, wie er betont, für ihn einen »Ausgangspunkt« und keine »Schlussfolgerung«25 darstellt. Camus geht es vor allem um die »Konsequenzen«26, die aus der absurden Erfahrung gezogen werden müssen. Was bezeichnet die absurde Erfahrung? Die absurde Erfahrung ist sowohl eine Entdeckung des Gefühls27 als auch des Intellekts28. Sie äußert sich vor allem in einem Zwiespalt: »Das Absurde entsteht aus diesem Zusammenstoß zwischen dem Ruf des Menschen und dem vernunftlosen Schweigen der Welt.«29 Für die Entstehung des Absurden bedarf es also auf der einen Seite eines fragenden, sinnsuchenden Menschen und auf der anderen Seite einer Welt, die keine Antworten liefert. Das Absurde ist demnach eine Erfahrung, die dem Menschen deutlich macht, dass er von Fragen bedrängt wird, die er allein nicht beantworten, für die er aber auch in der Welt keine Antworten finden kann. Der Zwiespalt, von dem hier die Rede ist, kann als grundlegendes Moment des Camusschen Denkens bezeichnet werden. Es findet sich nicht nur in Der Mythos von Sisyphos, sondern bleibt auch bestimmend in Der Mensch in der Revolte. Das liegt daran, dass der Zwiespalt, der sich in besonderer Klarheit im Absurden zeigt, für Camus »weltliches und menschliches Sein charakterisiert«30. Das Absurde als Ausdruck des Zwiespalts ist, so Camus, unbedingt festzuhalten, weil es eine »erste Wahrheit«31 ist. Camus fragt auf Grundlage dieser Wahrheit erneut, ob der Selbstmord eine Handlungsalternative ist, und kommt zu dem Schluss, dass der Selbstmord abgelehnt werden muss, weil er zur Auslöschung dieser ersten Wahrheit führen würde, die nur entstehen kann, wenn der lebendige Mensch mit der schweigenden Welt konfrontiert ist. Kurz, der Selbstmord ist keine Konsequenz, die aus der absurden Erfahrung gezogen werden kann. 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Camus, Albert: Der Mythos des Sisyphos, Reinbek bei Hamburg 1999 (Sigle: MS), S. 72. MS, S. 11. MS, S. 10. MS, S. 26. MS, S. 20: »Das Gefühl der Absurdität kann an jeder beliebigen Straßenecke jeden beliebigen Menschen anspringen.« Vgl. MS, S. 27 ff. MS, S. 41. Vgl. Schlette, Heinz Robert: Albert Camus heute. In: Camus, Albert: Weder Opfer noch Henker, Zürich 2006, S. 64. Vgl. MS, S. 45.
Camus und der Terrorismus
23
Da die absurde Erfahrung, insofern sie keine Werte setzt, nur ein Ausgangspunkt sein kann, sucht Camus, dem es ja um die Konsequenzen geht, nach Alternativen zum Selbstmord. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Auflehnung eine mögliche Haltung des Menschen ist, denn die Auflehnung erkennt die Absurdität zugleich an und weigert sich doch, mit ihr einverstanden zu sein. Auf einer höheren Stufe wiederholt die Auflehnung die Zwiespältigkeit: Anerkennung des Gegebenen und Verweigerung des Einverständnisses mit dem Gegebenen. Die Auflehnung, so Camus, verleiht dadurch »dem Leben seinen Wert«32, ohne ihm allerdings einen tieferen Sinn zu verleihen. Sisyphos, der Rebell des Absurden, den man sich, wie Camus schreibt, glücklich vorstellen muss33, hat die Haltung der permanenten Auflehnung verinnerlicht. Er wälzt den Stein auf den Gipfel und lehnt die absurde Strafe der Götter durch Verachtung34 ab »und macht aus dem Schicksal eine menschliche Angelegenheit, die unter Menschen geregelt werden muß.«35 Anders gesagt, erkennt Sisyphos an, was ist, nämlich die Tatsache, dass er den Stein wälzen muss, aber er weigert sich zugleich, das Gegebene als Strafe aufzufassen. In einem gewissen Sinne sprengt Sisyphos die Ketten der Götter, er ist ein »metaphysischer Terrorist«, der in den Kampf gegen die Ordnung des Kosmos eingetreten ist. Allerdings ist Sisyphos einsam. Die Frage nach dem Selbstmord ist ihrem Wesen nach eine egoistische Frage. Wenn der Rebell Sisyphos sich aber auf dem Gipfel des Berges umblicken würde, dann könnte er entdecken, dass er nicht alleine ist, sondern umgeben von anderen Menschen, die ihren Felsen wälzen. Angesichts der Entdeckung, dass die Gipfel bis zum Horizont und darüber hinaus existieren, muss nicht mehr die Frage nach dem Selbstmord, sondern nach dem Mord gestellt werden: »In der Zeit des Neinsagens konnte es nützlich sein, das Problem des Selbstmordes zu erörtern. In der Zeit der Ideologien muß man sich mit dem Mord auseinandersetzen.«36 Die Frage nach dem Mord drängt sich auf, sobald der Einzelne gewahr wird, dass er nicht allein in der Welt ist. Eben das ist der Ausgangspunkt in Der Mensch in der Revolte.
32 33 34 35 36
MS, S. 73. Vgl. MS, S. 160. Vgl. MS, S. 156. MS, S. 159. MR, S. 10.
24
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
Der Mensch in der Revolte – Revolte und Revolution Camus geht in Der Mensch in der Revolte von der Beobachtung aus, dass die Verbrecher des 20. Jahrhunderts nicht mehr aus Leidenschaft oder im Affekt handeln, sondern aus Kalkül und aufgrund der »Philosophie«37. Sie behaupten, dass der Mord »vernünftig oder durch ein philosophisches System gerechtfertigt sei«38. Die »Doktrin« bzw. die »Ideologie«39 ersetzt die subjektive Motivation des Verbrechers. Die Rechtfertigungsversuche des Verbrechens durch die Ideologie will Camus prüfen, indem er eine kritische Geschichte der Revolte und der revolutionären Ideologien verfasst. Dazu trifft Camus die grundlegende Unterscheidung von metaphysischer und historischer Revolte. Camus definiert die metaphysische Revolte wie folgt: Sie »ist die Bewegung, mit der ein Mensch sich gegen seine Lebensbedingungen und die ganze Schöpfung auflehnt. Sie ist metaphysisch, weil sie die Ziele des Menschen und der Schöpfung bestreitet«40. Anders gesagt revoltiert der metaphysische Rebell gegen die Welt als Ganze. Er richtet sich gegen Gott, er weigert sich, die Ordnung der Dinge anzuerkennen. Sisyphos ist ein Beispiel für einen metaphysischen Rebellen. Während die metaphysische Revolte aber bloß Zeugnis ablegt41 und ihre Überzeugungen nicht in der Wirklichkeit (der Geschichte) realisiert – was auch schwerlich möglich ist, denn weder kann man Gott noch das Universum mit einer Bombe auslöschen –, ist die historische Revolte die »Einführung der Idee in die geschichtliche Erfahrung«42. Damit wird die Revolte zur Revolution. Bei Revolte und Revolution handelt es sich um zwei gegenläufige Bewegungen: Die Revolte hebt in der Erfahrung der Wirklichkeit an und schreitet zur Idee fort. Die Revolution geht von der Idee aus und will sie in der Wirklichkeit manifestieren.43 Anders gesagt entwirft die metaphysische Revolte die Theorie, die mittels der historischen Revolution in der Wirklichkeit umgesetzt werden soll. Demnach ist der Terrorismus eine Form der historischen Revolte, denn der Terrorist versucht, eine Ideologie – die das Produkt einer metaphysischen Revolte ist – in der faktischen Welt zu installieren. 37 38 39 40 41
MR, S. 9. MR, S. 9. MR, S. 10. MR, S. 35. Zeugnis ablegen ist eine wichtige Kategorie in Camus’ Denken: »Das Werk ist ein Geständnis, ich muß Zeugnis ablegen.« (Camus, Albert: Tagebücher 1935 – 1951, Reinbek bei Hamburg 1997, S. 13.) 42 MR, S. 126. 43 Vgl. MR, S. 126.
Camus und der Terrorismus
25
Die von Camus getroffene Unterscheidung von Revolte und Revolution ist damit geklärt. Ungeklärt ist allerdings noch, was die Revolte ursprünglich ist. Anders gefragt: »Was ist ein Mensch in der Revolte?«44 Camus antwortet: »Ein Mensch, der nein sagt. Aber wenn er ablehnt, verzichtet er doch nicht, er ist auch ein Mensch, der ja sagt aus erster Regung heraus.«45 Der Zwiespalt begegnet also am Ursprung der Revolte wieder. Der Rebell verneint die herrschende Ordnung; er kann sie nur verneinen, weil er sich einer Grenze bewusst46 geworden ist, die er bejaht. Die Grenze wiederum entsteht durch einen positiven Wert, den der Rebell setzt. Er gleicht darin Sisyphos, der das von den Göttern verhängte Schicksal zu seinem Schicksal macht. Der Terrorist wiederum ähnelt dem Rebell, denn auch er verneint eine herrschende Ordnung und will an ihre Stelle eine andere Ordnung setzen, die er bejaht. Der Wert, von dem gerade die Rede war, ist nach Camus ein »gemeinsame[s] Gut«47, das der Rebell am Ursprung der Revolte für alle und nicht nur für sich beansprucht. Genauer gesprochen hat dieser Wert für Camus universale Geltung. Das wird unter anderem bewiesen, wenn der Rebell bereit ist, für »die Sache« zu sterben: »Wenn das Individuum tatsächlich im Laufe der Revolte den Tod auf sich nimmt […], so zeigt es dadurch, daß es sich opfert zugunsten eines Gutes, von dem es glaubt, daß es über sein eigenes Geschick hinausreicht. […] Es handelt also im Namen eines noch ungeklärten Wertes, von dem es jedoch zum mindesten fühlt, daß er ihm und allen anderen Menschen gemeinsam ist.«48 Forderte der Rebell den Wert nur für sich, wäre es sinnlos dafür zu sterben. Die Universalität des Wertes leitet Camus außerdem noch aus der menschlichen Natur ab: »Die Analyse der Revolte führt mindestens zum Verdacht, daß es […] im Gegensatz zu den Postulaten des heutigen Denkens eine menschliche Natur gibt.«49 Der Wert bekommt aufgrund dieser menschlichen Natur eine freilich noch unscharfe Kontur. Die menschliche Natur setzt, weil sie allen gemeinsam ist, ein Maß der Revolte, die »ihrem Wesen nach nicht egoistisch«50 sein soll und im Kern von einer menschlichen »Solidarität«51 getragen wird. Der 44 45 46 47 48 49
MR, S. 21. MR, S. 21. Zur Bedeutung der Bewusstwerdung vgl. MR, S. 23 und MS, S. 157. MR, S. 23. MR, S. 23. MR, S. 24. Es besteht bei dieser Argumentation allerdings der berechtigte Verdacht eines Zirkelschlusses: Die Revolte und ihr Maß führen zur Annahme der menschlichen Natur, die menschliche Natur führt zum Maß der Revolte. Nicht weniger problematisch ist die Setzung einer menschlichen Natur (vgl. zum Problem der Setzung Schlette: Albert Camus heute, S. 69). Anzumerken ist zu Camus’ Gunsten noch, dass er keinen philosophischen Traktat schreibt, in dem er die menschliche Natur beweisen will, er verleiht vielmehr einer Intuition Ausdruck, die für ihn Evidenzcharakter hat. 50 MR, S. 24. 51 MR, S. 25.
26
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
Rebell fordert deswegen am Ursprung der Revolte ein, dass er und alle anderen als Menschen respektiert und geachtet werden. Dazu gehört unbedingt, das Leben als »das einzige notwendige Gut«52 anzuerkennen, denn Leben ist die Voraussetzung der absurden Erfahrung, aus der alle bisherigen Überlegungen hervorgegangen sind. So wie der Selbstmord verboten ist, weil er die erste Wahrheit des Absurden auslöschen würde, ist der Mord verboten, weil er die erste Wahrheit der Revolte auslöschen würde. Camus spricht der Solidarität, wie sie am Ursprung der Revolte gemäß der menschlichen Natur aufzufinden ist, den gleichen Evidenzcharakter zu wie dem Descartesschen Cogito ergo sum – »Ich denke, also bin ich« –, wenn er schreibt: »Ich empöre mich, also sind wir.«53 Immer wenn die metaphysische Revolte den Grundsatz der Solidarität, ihr Maß und die Gegebenheiten der menschlichen Natur verrät, führt sie unweigerlich in den Nihilismus. Was ist für Camus der Nihilismus? Camus unterscheidet mindestens drei Formen. Erstens den Nihilismus der absoluten Verneinung54, der von Zerstörung zu Zerstörung eilt und in eine »Raserei«55 der Vernichtung mündet. Man findet ihn bei de Sade, den Romantikern Milton, Baudelaire und Lacenaire. Am Ende wartet das »Reich der Knechtschaft«56. Zweitens den Nihilismus der absoluten Gerechtigkeit, wie er bei Dostojewskijs Iwan aus Die Brüder Karamasow zu finden ist.57 Die Revolte »endet mit ihm [Iwan] im Wahnsinn«58. Das Gegenstück zur absoluten Verneinung bildet drittens die absolute Bejahung, deren bedeutendste Vertreter Stirner und Nietzsche sind.59 Nach Camus führen alle drei Varianten des Nihilismus zu einer Relativierung des menschlichen Lebens: »Jedesmal, wenn sie [die metaphysische Revolte] die Abweisung alles Bestehenden, das absolute Nein vergöttlicht, tötet sie. Jedesmal, wenn sie blind das Bestehende gutheißt und das absolute Ja ausruft, tötet sie.«60 Das liegt daran, dass alle Formen des Nihilismus etwas Absolutes anstreben: »Man kann auf zwei Arten« – die der Verneinung und die der Bejahung – »Nihilist sein, beide Male durch eine Unmäßigkeit nach dem Absoluten.«61 Das 52 MR, S. 13. Vgl. Sändig: Albert Camus. Eine Einführung in Leben und Werk, Leipzig 1992, S. 123 f. 53 MR, S. 31. 54 Vgl. MR, S. 48 ff. (Die absolute Verneinung). 55 MR, S. 61. 56 MR, S. 48. 57 MR, S. 69 ff. 58 MR, S. 76. 59 Vgl. MR, S. 76 ff. (Die absolute Bejahung). 60 Vgl. MR, S. 119, 277. Zur absoluten Bejahung: »Alles bejahen setzt voraus, daß man den Mord bejaht.« (MR, S. 92). 61 MR, S. 119. Zu Camus’ »Zurückweisung jenes fatalen, weil mörderischen Absolutheits-
Camus und der Terrorismus
27
Absolute entsteht aus der natürlichen Tendenz des Menschen, sich vom Zwiespalt zu befreien, obwohl der Zwiespalt das Wesentliche der menschlichen Natur ausmacht.62 Wer das Absolute anstrebt, kann auf den Einzelnen keine Rücksicht nehmen, das Leben muss sich dem Absoluten unterordnen. Zusammengefasst ist der Nihilismus also das Ergebnis einer Bewegung, die vom Relativen des Zwiespalts, das sich aus der menschlichen Natur ergibt, zum Absoluten führt. Deswegen lässt sich jeder Nihilismus auch auf die Formel bringen: »Nihilist ist nicht derjenige, der an nichts glaubt, sondern derjenige, der nicht glaubt an das, was ist.«63 Das, was ist, ist für Camus die menschliche Natur. Sie setzt Grenzen, weil der Mensch nicht beliebig formbar ist.64
Die Revolution Wenn die Revolte geschichtlich wird – und hier nähern sich die Überlegungen wieder dem Terrorismus an –, überträgt sich der Zwiespalt der Revolte auf die Revolution. Freilich mit dem bedeutsamen Unterschied, dass die Revolution im Gegensatz zur Revolte realistisch ist65, d. h., dass in der Geschichte nicht nur metaphysische Überzeugungen, sondern von metaphysischen Überzeugungen untermauerte Macht- und Gewaltansprüche aufeinander treffen. Es ist deswegen berechtigt, im Falle der Revolution von einem Zwiespalt der Gewalt zu sprechen. Der Zwiespalt des Denkens wird zu einem Zwiespalt des Handelns bzw. der Gewalt. Dieser Zwiespalt bezeichnet zugleich ein Dilemma66, in das jeder Revolutionär gerät. Camus ist nämlich der Überzeugung, dass die Gewaltlosigkeit in bestimmten Situationen zur Vermehrung der Gewalt beiträgt.67 Wer sich gegen
62 63 64 65 66 67
wahns« vgl. Schlette, Heinz Robert: Albert Camus: Welt und Revolte, Freiburg / München 1980, S. 102. Was ich hier als Tendenz bezeichne, hat vielleicht seine Wurzeln in der menschlichen Sehnsucht nach Einheit (vgl. dazu: Schlette: Albert Camus: Welt und Revolte, S. 34). MR, S. 85. Vgl. MR, S. 281. Vgl. MR, S. 26: »Die Revolte ist nicht realistisch.« Vgl. zum Dilemma: Ebert: Camus und der russische Terrorismus. In: Sändig, Brigitte (Hrsg.): »Ich revoltiere also sind wir.« Nach dem Mauerfall: Diskussion um Albert Camus’ »Der Mensch in der Revolte«, Nettersheim 2009, S. 52. Die nicht vollständige Ablehnung der Gewalt führt meines Erachtens nicht zu einem Widerspruch, wie Lou Marin in Ursprung der Revolte S. 88 f. behauptet (Marin, Lou: Ursprung der Revolte. Albert Camus und der Anarchismus, Heidelberg 1998). Natürlich ist es richtig, dass es Möglichkeiten des Protests gibt, die auf physische Gewalt verzichten, und insofern Gewaltlosigkeit nicht einfach mit Nichtstun gleichgesetzt werden darf (man denke an Gandhi oder den Zusammenbruch der DDR); dennoch gibt es Formen der Unterdrückung, in denen
28
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
eine tyrannische Diktatur wie z. B. das Dritte Reich nicht auflehnt, macht sich mitschuldig, da er den Mord nicht verhindert. Wenn der Rebell aber gegen die Unterdrücker vorgeht – sie tötet –, wird er selbst zum Gewalttäter : »Sobald der Rebell zuschlägt, schneidet er die Welt entzwei. Er erhob sich im Namen der Identität mit dem andern, er opfert diese Identität, indem er den Unterschied im Blut besiegelt.«68 Camus schlussfolgert: »Die vollständige Gewaltlosigkeit begründet auf negative Weise die Knechtschaft und ihre Gewalttätigkeit; die systematische Gewalt zerstört positiv die lebendige Gemeinschaft und das Sein, das wir von ihr empfangen.«69 Wenn das so ist, dann stellt sich die Frage, wann und unter welchen Umständen es möglich, ja vielleicht sogar unumgänglich ist, zur Gewalt zu greifen. Die Ausgangsfrage – Freiheitskämpfer oder Terrorist – ist letztlich ein Folgeproblem dieser Frage. Dabei lehnt Camus immer und ohne Ausnahme eine Rechtfertigung der Gewalt als eines positiven Wertes ab. Auf diesen Punkt möchte ich ausdrücklich hinweisen. Camus lässt keinen Zweifel: Die Gewalt ist zugleich unvermeidbar und nicht zu rechtfertigen.70 Sie ist unvermeidbar, weil eine Welt ganz ohne Gewalt eine Fiktion ist. Wer nicht Opfer sein will, muss sich mit Gewalt gegen die Henker wehren. Gewalt ist aber zugleich immer ungerechtfertigt, weil der Geist der Revolte aufgrund der menschlichen Natur dem Mord widerspricht: »Die Logik antwortet, daß Mord und Revolte widerspruchsvoll sind. Wenn ein einziger Mensch tatsächlich getötet wird, verliert der Revoltierende auf gewisse Weise das Recht, von der Gemeinschaft der Menschen zu sprechen, von der er indes seine Rechtfertigung ableitete.«71 Viele Kritiker haben Camus wegen dieser Konzeption Realitätsferne und Naivität vorgeworfen.72 Der Vorwurf lautet, dass Camus’ Idee utopisch sei, weil
68 69 70 71 72
ziviler Ungehorsam nicht ausreicht (z. B. das Warschauer Ghetto, die Herrschaft der Roten Khmer). MR, 317. MR, S. 329. Vgl. Ebert: Camus und der russische Terrorismus, S. 47. MR, S. 317. Ich denke dabei vor allem an Sartre und seinen Kreis und erinnere an die heftige Auseinandersetzung anlässlich des Erscheinens von Der Mensch in der Revolte und der anschließenden Diskussion in der Temps Modernes (vgl. Sartre, Jean-Paul: Krieg im Frieden 2. Reden, Polemiken, Stellungnahmen 1952 – 1956, Reinbek bei Hamburg 1982, S. 7 – 51; L¦vy, Bernard-Henri: Sartre. Der Philosoph des 20. Jahrhunderts, München / Wien 2002, S. 391ff; Sändig, Brigitte: Was kann Kunst? In: Albert Camus. Autonomie und Solidarität, S. 77 ff.; Todd, Olivier : Albert Camus. Ein Leben, Reinbek bei Hamburg 2001, S. 605 ff. Schlette: Albert Camus heute, S. 57 ff.). Sogar noch 1961, nach Camus’ Tod, streitet Sartre in dem Vorwort zu Fanons Die Verdammten dieser Erde gegen Camus. Fanon, der den Kampf gegen den Kolonialismus mit allen Mitteln fordert, wird von Sartre gegen Camus bestätigt: »Sie [die Kolonisierten] haben nur eine einzige Aufgabe, ein einziges Ziel: den Kolonialismus mit allen Mitteln zum Teufel jagen.« (Sartre, Jean-Paul: Vorwort zu Die Verdammten dieser Erde, S. 18. In: Fanon, Frantz: Die Verdammten dieser Erde, Frankfurt am Main 1967). Explizit wendet
Camus und der Terrorismus
29
er eine Welt ohne Gewalt und Mord fordere.73 Das war aber nie Camus’ Forderung. Er sagt ausdrücklich: »Mit einem Wort, Leute wie ich möchten keineswegs eine Welt, in der man sich nicht tötet (wir sind nicht so verrückt!), sondern eine Welt, in welcher der Mord nicht legitimiert ist.«74 Camus’ Anspruch ist demnach viel bescheidener.75 Er spricht nicht von der Utopie eines ewigen Friedens, sondern von einer ganz konkreten Forderung, von einem Minimalkonsens: Es geht ihm um die Weigerung, »den Mord zu legitimieren.«76 Nicht mehr und nicht weniger. Wenn der Mord und die Gewalt nicht gerechtfertigt werden können, es aber unter bestimmten Umständen doch geboten ist, sich gegen die Gewalt mit Gewalt zu wehren, muss Camus diese Umstände benennen. Diese Umstände markieren dann nämlich die Grenze, die zwischen maßvollem Widerstand und schrankenloser Gewalt verläuft. Meiner Ansicht nach lassen sich insgesamt vier Kriterien ausmachen, die für Camus die entscheidende Grenze zwischen maßvollem Widerstand und schrankenlosem Terror bezeichnen. Für sie spielt der Zwiespalt eine fundamentale Rolle und er wird in fast jedem Punkt der Argumentation wieder begegnen. Dabei verfasst Camus keinen praktischen Leitfaden zum Widerstand, er erklärt nicht, welche Strategie erlaubt sei und welche nicht. Stattdessen weist er
73
74 75
76
sich Sartre gegen Camus drei Seiten später, wenn er schreibt: »Sie sehen gut aus, unsere Gewaltlosen: weder Opfer noch Henker. Kommt mir bloß nicht damit!« (Sartre: Vorwort zu Die Verdammten dieser Erde, S. 21). Sartre bezieht sich ohne Zweifel auf eine Essaysammlung Camus’, die den Titel »Weder Opfer noch Henker« trägt. Sartres Argument für die schrankenlose Gewalt lautet: »Wenn die Gewalt heute Abend begonnen hätte, wenn es auf der Erde niemals Ausbeutung noch Unterdrückung gegeben hätte, dann könnte die demonstrative Gewaltlosigkeit vielleicht den Streit besänftigen. Aber wenn das ganze System bis zu euren gewaltlosen Gedanken von einer tausendjährigen Unterdrückung bedingt ist, dann dient eure Passivität nur dazu, euch auf die Seite der Unterdrücker zu treiben.« (Sartre: Vorwort zu Die Verdammten dieser Erde, S. 21) Dem ist Einiges zu entgegnen: Zum Ersten gerät Sartre mit seinen Aussagen zweifellos in den Teufelskreis der Kasuistik des Blutes, von der später noch die Rede sein wird; zum Zweiten befestigt Sartre mit diesem Argument die Endlosigkeit der Gewalt, die auch nicht in einem zukünftigen System (einer klassenlosen Gesellschaft) enden würde; zum Dritten missversteht Sartre Camus gründlich, wenn er ihm Passivität vorwirft. Es gibt eine Aktivität jenseits schrankenloser Gewalt. Nicht zuletzt war sich Camus immer bewusst, dass die Gewalt eine Konstante in der menschlichen Geschichte darstellt, der es freilich mit aller Kraft zu begegnen gilt. Vgl. Camus, Albert: Menschen retten. In: Camus: Weder Opfer noch Henker, S. 15. Vgl. auch Heist, Walter : Das Fragwürdige an Albert Camus. Über den politischen Aspekt seines Werkes. In: Schlette, Heinz-Robert (Hrsg.): Wege der deutschen Camus-Rezeption, Darmstadt 1975, S. 170: »Schließlich proklamiert er [Camus] so etwas wie eine humane Utopie gegen die inhumanen Utopien der Ideologien.« Camus: Menschen retten, S. 16. Schon in Der Mensch in der Revolte war der hier benannte Standpunkt der Ausgangspunkt: »Es ist das Anliegen dieses Essays, einmal mehr die Realität von heute: das Verbrechen aus logischer Überlegung anzuerkennen und seine Rechtfertigungen zu prüfen.« (MR, S. 9 f., Hervorhebung vom Verf.) Camus: Weder Opfer noch Henker, S. 218.
30
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
nachdrücklich und in vielen Punkten überzeugend darauf hin, dass selbst angesichts der Bedrohung durch einen allgemeinen Terror nicht alles erlaubt ist. Heinz Robert Schlette formuliert das so: »Mit einer Kasuistik, die sich, gewissermaßen am grünen Tisch, mit der Frage beschäftigt, was im revolutionären Kampf gegen eine Tyrannei erlaubt sei, wird man Camus nicht gerecht. Er lehrt uns nur, daß es eine Ehre und daß es eine Grenze gibt.«77
Der maßvolle Widerstand Die vier Kriterien, die jetzt benannt und erörtert werden sollen, wurden aus verschiedenen Texten Camus’ zusammengetragen. Besonders wichtig sind die Briefe an einen deutschen Freund, das Theaterstück Die Gerechten und einige Aufsätze zu Algerien.78 Sie sollen Antwort geben auf die Frage, wann Gewalt ungerechtfertigt, aber unvermeidbar ist und damit die Grenze zwischen gerechtfertigtem Widerstand und schrankenlosem Terrorismus aufzeigen. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, die Unterscheidung des staatlichen und des individuellen Terrors in Erinnerung zu rufen. Die Grenze der Gewalt, von der im Folgenden die Rede sein wird, ist die Grenze für eine Gewalt von unten. Für einen Staat – die Gewalt von oben – müssen andere, engere Grenzen gelten. Ohne darauf ausführlich eingehen zu können, lässt sich an der gezielten Tötung exemplarisch verdeutlichen, worin der Unterschied besteht: Während Camus die Todesstrafe als Strafe im Namen eines Staates ohne Ausnahme ablehnt79, hält er es unter gewissen Umständen und im Rahmen bestimmter Grenzen für erlaubt, dass der Revolutionär seinen Unterdrücker tötet. Die Todesstrafe im Namen des Staates zerstört das Gesetz, in dessen Namen sie ausgesprochen wird. Der Staat entzieht sich seine eigene Legitimation. Der Revolutionär, der tötet, überschreitet ebenfalls eine Grenze, die er nur wieder bestätigen kann, indem er in seinen eigenen Tod einwilligt. Aber im Gegensatz zum Rebell kann der Staat, wenn er seinen Zweck erfüllen soll, sich nicht selbst zerstören. Auf diesen letzten Punkt wird das Folgende noch ausführlicher eingehen. Was schreibt Camus also zu der Gewalt von unten in den benannten Texten? Zu Anfang der Briefe heißt es, dass sowohl die Nazis, die Camus mit dem »ihr« in den Briefen meint, als auch die freien Europäer, die er unter dem »wir« ver77 Schlette, Heinz Robert: »Der Sinn der Geschichte von morgen«. Albert Camus’ Hoffnung, Frankfurt am Main 1995, S. 71. 78 In französischer Sprache gibt es eine Textsammlung der Schriften Camus’ zum Thema Terrorismus: Camus, Albert; Levi-Valensi, Jacqueline (Hrsg.): R¦flexions sur le Terrorisme, ohne Ort 2002. 79 Vgl. Camus, Albert: Die Guillotine. In: Fragen der Zeit. Reinbek bei Hamburg 1997, S. 101 ff.
Camus und der Terrorismus
31
standen wissen möchte80, gleichermaßen davon ausgegangen sind, dass die Welt keinen »tieferen Sinn habe«81. Dass der tiefere Sinn fehlt, heißt, dass die absurde Erfahrung allgemein geworden ist: Der Mensch fragt, die Welt schweigt. Aber, und da liegt der erste entscheidende Unterschied, während die freien Europäer sich mit dem Fehlen des Sinnes nicht einverstanden erklärt haben, waren die Nazis bereit, mit der Sinnlosigkeit zu kollaborieren. Aus der Sinnlosigkeit schlossen die Nazis, dass »der Mensch nichts sei und man seine Seele töten könne«82, die freien Europäer aber, dass man sich gegen die Sinnlosigkeit auflehnen und den Wert des Lebens verteidigen müsse. Es handelt sich um folgende Entscheidung: Angesichts der Sinnlosigkeit der Welt kann man sich entschließen, die Ungerechtigkeit zu vergrößern oder für die Gerechtigkeit und eine »schlichte Menschlichkeit«83, wie es in dem Aufruf für einen Burgfrieden in Algerien heißt, einzutreten. Im ersten Fall macht man sich zum Werkzeug des Nihilismus, im zweiten Fall zum Kämpfer für die Gerechtigkeit. Das bedeutet übrigens nicht, dass die Welt mit dieser Entscheidung einen tieferen Sinn erhalten hat. Es geht Camus nur um die »Treue zur Erde«, wie er in Anlehnung an Nietzsche84 schreibt. Der Erde treu bleiben, das bedeutet, die Wurzeln nicht zu verlieren, im Zwiespalt aushalten, der Natur verbunden bleiben – kurz, dem Leben einen Wert geben: »Ich jedoch habe mich für die Gerechtigkeit entschieden, um der Erde treu zu bleiben. Ich glaube weiterhin, daß unserer Welt kein tieferer Sinn innewohnt. Aber ich weiß, daß etwas in ihr Sinn hat, und das ist der Mensch, denn er ist das einzige Wesen, das Sinn fordert. Diese Welt besitzt zumindest die Wahrheit des Menschen, und unsere Aufgabe besteht darin, ihm seine Gründe gegen das Schicksal in die Hand zu geben. Und die Welt hat keine anderen Seinsgründe als den Menschen, und ihn muß man retten, wenn man die Vorstellung retten will, die man sich vom Leben macht.«85 Im Gegensatz dazu waren es die Nazis, die, von der Gewissheit ihrer eigenen Überzeugungen vorangetrieben, Europa mit Krieg überzogen. Die freien Eu80 Vgl. Camus, Albert: Briefe an einen deutschen Freund. In: Camus: Fragen der Zeit, S. 9. Es geht Camus also nicht um die Gegenüberstellung zweier Völker, sondern zweier Geisteshaltungen. 81 Camus: Briefe an einen deutschen Freund, S. 28. 82 Camus: Briefe an einen deutschen Freund, S. 28. 83 Camus, Albert: Aufruf für einen Burgfrieden in Algerien. In: Camus: Fragen der Zeit, S. 176. Camus’ humanistische Grundhaltung kann vielleicht am besten als Ontophilie bezeichnet werden (vgl. zu Camus’ Humanismus Schlette: Albert Camus: Welt und Revolte, S. 65 – 96). 84 Vgl. Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra, München 1999, S. 14 f. Vgl. Günzel: Erde: Treue zur Erde. In: Ottmann, Henning (Hrsg.): Nietzsche Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart / Weimar 2000, S. 219. Zur Bedeutung Nietzsches für Camus vgl. Weyembergh, Maurice: Camus und Nietzsche. In: Sändig (Hrsg.): »Ich revoltiere also sind wir.«, S. 89 – 107. 85 Camus: Briefe an einen deutschen Freund, S. 29.
32
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
ropäer wiederum ließen sich so leicht besiegen, weil sie sich ihrer Sache nicht so sicher waren und vor dem Mord zurückschreckten: »Ihr seid über uns hergefallen, während wir damit beschäftigt waren, in unseren Herzen zu prüfen, ob wir das Recht auf unserer Seite hätten.«86 Aber jede Zeit des Innehaltens geht vorbei, denn in der Geschichte ist die Zeit, anders als im theoretischen Diskurs, nicht unendlich. Nachdem die freien Europäer ihr Zögern und ihre Skrupel »sehr teuer bezahlt«87 hatten, haben sie sich dazu entschlossen, ihrerseits zu töten, um der Tyrannei entgegenzutreten. Dass man »bezahlen« muss, wenn man andere tötet, ist ein wichtiges Motiv in Camus’ Reflexionen über die Gewalt. Darauf werde ich gleich zurückkommen. Entscheidend ist für Camus in den Briefen noch, dass die Nazis den freien Europäern den Kampf aufgezwungen haben, indem sie die freien Europäer in das Dilemma des Tötens oder Getötetwerdens getrieben haben: »Wir mußten auf eure Philosophie eingehen, einwilligen, euch ein wenig ähnlich zu werden. […] Wir waren gezwungen, euch ein wenig nachzuahmen, um nicht zu sterben.«88 Unter der Bedingung der aufgezwungenen Gewalt kann man nach Camus mit »reinen Händen«89 in den Kampf eintreten.90 Das erste Kriterium des Widerstands lautet demnach: Der Revolutionär darf nur dann zur Gewalt greifen, wenn er dazu gezwungen wird, also wenn er mit der Alternative Töten oder Getötetwerden konfrontiert ist. Es darf allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass dieses Kriterium mit Schwierigkeiten verbunden ist, die Camus selbst sieht und als »Kasuistik des Blutes«91 bezeichnet. In der Kasuistik des Blutes fragen die Unterdrücker und Revolutionäre gleichermaßen nach der Verantwortung für die Gewalt, um die eigene Gewaltanwendung zu rechtfertigen. Ihre Frage lautet: Wer hat zuerst getötet? In einer Welt, in der die Gewalt aber immer schon existiert hat, kann die Frage nach dem Ursprung der Aggression nicht beantwortet werden. Erst recht nicht im »Todessturm«92 einer eskalierenden Gewalt, wo »der ewige Streit um die ursprüngliche Verantwortung seinen Sinn«93 gänzlich verloren hat. In diesem Kriterium steckt folglich ein Relativismus. Das liegt schlicht an der Tatsache, dass alle Ereignisse in Kausalketten eingebettet sind, die nicht spontan anheben, sondern für die sich immer weiter zurückreichende Ursachen angeben lassen. 86 87 88 89 90
Camus: Briefe an einen deutschen Freund, S. 12. Camus: Briefe an einen deutschen Freund, S. 13. Camus: Briefe an einen deutschen Freund, S. 30 f. Camus: Briefe an einen deutschen Freund, S. 13. Vgl. Camus: Die Befreiung von Paris. In: Camus: Fragen der Zeit, S. 35: »Die Zeit wird bezeugen, dass Frankreichs Männer nicht töten wollten und daß sie mit reinen Händen in einen Krieg getreten sind, den sie nicht gewollt haben.« 91 Camus: Vorwort zur algerischen Chronik. In: Camus: Fragen der Zeit, S. 163. 92 Camus: Brief an einen algerischen Aktivisten. In: Camus: Fragen der Zeit, S. 174. 93 Camus: Aufruf für einen Burgfrieden in Algerien, S. 180.
Camus und der Terrorismus
33
Wer den ersten Stein geworfen, die erste Beleidigung ausgesprochen oder die erste Unachtsamkeit begangen hat, lässt sich niemals zweifelsfrei feststellen. Camus sieht, im Gegensatz zu Sartre, dass eine Aufrechnung der Gewalt (vgl. dazu oben, Anm. 72) in eine unendliche Fortsetzung der Gewalt münden muss.94 Das zweite Kriterium – das bereits erörtert wurde – besagt: Der Widerstandskämpfer muss sich seiner Sache in gewissem Sinne unsicher sei. Er muss sich des Dilemmas bzw. des Zwiespalts der Gewalt jederzeit bewusst bleiben. Er weiß, dass er sich durch die Verneinung des anderen von dem Wert entfernt, den die Bewegung seiner Revolte an ihrem Ursprung gesetzt hat. Das Kriterium folgt aus den Überlegungen zum Zwiespalt. Der Revolutionär kann die Gewalt drittens sühnen, wenn er für sie »bezahlt«. Das wurde eben schon angedeutet. In den Briefen heißt es: »Nur das besitzt man wirklich, was man bezahlt hat.«95 Das dritte Kriterium lässt sich anhand des Theaterstücks Die Gerechten96 und des Passus’ Die zartfühlenden Mörder aus Der Mensch in der Revolte verdeutlichen. Beide handeln von Kaliajew, einem russischen Sozialrevolutionär, der im Februar 1905 eine Bombe auf den Großfürsten Sergej geworfen hat, die diesen tötete. Kaliajew wurde gefasst und hingerichtet. Das Theaterstück basiert auf den tatsächlichen Ereignissen, die Camus in seinem Essay Der Mensch in der Revolte kritisch kommentiert. Der vierte Akt des Theaterstücks kreist um die Frage, ob Kaliajew ein Mörder ist oder ein Rebell im Sinne der ursprünglichen Revolte. Niemand, auch nicht Kaliajew, bestreitet dabei, dass er einen Menschen getötet hat, aber während der Polizeivorsteher Skuratow und die Frau des Großfürsten nur einen Mord darin sehen, sagt Kaliajew: »Ich habe die Bombe auf eure Tyrannei geworfen, nicht auf einen Menschen.«97 Und: »Was für ein Mord? Ich weiß nur von einer Tat der Gerechtigkeit.«98 Aber alle diese Rechtfertigungsstrategien wiegen nicht so viel wie das im folgenden Satz Kaliajews verborgene Argument: »Nur wenn ich nicht stürbe, wäre ich ein Mörder.«99 Wenn der Attentäter die Tat mit seinem eigenen Tod sühnt, wird ein gewisses Gleichgewicht hergestellt. Das Attentat erfährt 94 Der Schlusssatz von Eberts Vortrag Camus und der russische Terrorismus zeigt die große Relevanz dieser Problematik: »Revolte in unseren Tagen – sollte sie sich nicht darauf richten, darüber nachzudenken, wie der Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen wäre?« (S. 61) 95 Camus: Briefe an einen deutschen Freund, S. 14. 96 Uraufführung 15. Dezember 1949 im Th¦tre H¦bertot (vgl. Schlette: »Der Sinn der Geschichte von morgen«, S. 61. Dort findet man noch weitere Hintergrundinformationen und Literaturhinweise auf die historischen Ereignisse, die Camus als Vorlage dienten. Vgl. dazu auch Ebert: Camus und der russische Terrorismus). Vgl. Hoffman: Terrorismus, S. 27 f. Hoffman erwähnt dort das Prinzip der Narodnaya Wolya, der die halb fiktive Figur Kaliajew angehört. Es besagt, »keinen Tropfen überflüssigen Blutes« (ebd., S. 28) zu vergießen. 97 Camus, Albert: Die Gerechten. In: Camus: Albert Camus: Dramen, Reinbek bei Hamburg 1999, S. 221. 98 Camus: Die Gerechten, S. 224. 99 Camus: Die Gerechten, S. 225 (Hervorhebung vom Verf.).
34
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
seine Rechtfertigung im Tod des Attentäters. Die Formel lautet im Theaterstück: »Töten und sterben.«100 Sie ist, so Camus, die einzig mögliche Umwandlung des Zwiespalts von Töten oder Getötetwerden. Wie ist das zu verstehen? Wer mordet, verrät die ursprüngliche Bewegung der Revolte, die in der Anerkennung einer allgemeinen Grenze besteht. Der tötende Rebell überschreitet diese Grenze und bestätigt aber dann ihr Recht, wenn er sein eigenes Leben für »die Idee«101 opfert. Die Einheit der Welt, die der Rebell zugleich fordert und zerstört, kann nur wiederhergestellt werden, wenn der Rebell nun seinerseits seinen Tod akzeptiert, womit er nach Camus zeigt, »daß der Mord unmöglich ist«102. In einem gewissen Sinne ist der maßvolle Rebell unschuldig schuldig; die Revolte wird »im Grenzfall durch unschuldige Mörder verkörpert«103. Der Attentäter solidarisiert sich im Tod mit seinem Opfer ; er bestätigt den Wert, dem er mit seiner Gewalttat zum Sieg verhelfen wollte: »Jenseits dieser äußersten Grenze«, fährt Camus fort, »beginnt der Nihilismus.«104 Dieses Kriterium birgt erhebliche Schwierigkeiten (man denke nur an Selbstmordattentäter), wie ich mit Blick auf Späteres anmerken möchte. Das Theaterstück Die Gerechten weist darüber hinaus noch auf eine zweite Grenze hin, die der Rebell immer wahren muss, will er nicht zum Werkzeug der schrankenlosen Gewalt und des vollständigen Nihilismus werden. Es handelt sich um das Gesetz, die Unschuldigen zu verschonen. Das Kriterium der Verschonung Unschuldiger ist das vierte und letzte.105 Zwischen den Terroristen entbrennt im Theaterstück eine Diskussion über diese Grenze anlässlich eines ersten Attentatversuchs auf den Großfürsten, der gescheitert ist, weil sich Kaliajew weigert, die Bombe auf den Wagen zu werfen, in dem neben dem Großfürsten noch zwei Kinder sitzen. Stepan, der Kontrahent Kaliajews und der Terroristin Dora, der sein Vorbild in der realen Gestalt Netschajews gehabt haben könnte106, sagt: »An dem Tag, da wir beschließen, keine Rücksicht auf Kinder zu nehmen, sind wir die Herren der Welt, und an dem Tag wird die Revolution siegen.«107 Dora entgegnet: »An dem Tag wird die Revolu100 101 102 103 104 105
Camus: Die Gerechten, S. 197. Camus: Die Gerechten, S. 197. MR, S. 318. MR, S. 334. MR, S. 318. Vgl. zur Unschuld auch MR, S. 10: »Es geht darum zu wissen, ob die Unschuld, sobald sie zu handeln anfängt, sich vom Töten nicht abhalten kann.« 106 Vgl. zu Netschajew MR, S. 184 ff. Netschajew radikalisierte die Ideen Bakunins und ordnete alle Werte dem Ziel der Revolution unter : Jede Form des Verrats, der Folter und des Verbrechens seien gestattet, wenn sie der Revolution dienten. Vgl. dazu auch Ebert: Camus und der russische Terrorismus, S. 54 f. 107 Camus: Die Gerechten, S. 203.
Camus und der Terrorismus
35
tion von der ganzen Menschheit gehaßt.«108 Stepan ist offensichtlich der Überzeugung, dass der Revolution, um zu siegen, jedes Mittel recht sein muss, denn die Gegner der Revolution scheuen ebenfalls vor nichts zurück. Er ruft aus: »Es gibt keine Grenzen.«109 Damit bezieht er den Standpunkt der Nihilisten, deren Ausruf lautet: »Nichts ist wahr, alles ist erlaubt!«110 Aber genau damit verrät Stepan aus Kaliajews und Doras Sicht das Erbe der ursprünglichen Revolte, die eine Grenze einfordert, die für alle Menschen gleichermaßen gilt, auch und vor allem für den Widerstandskämpfer. Camus kommt auf die im Theaterstück formulierte Forderung auch in anderen Texten immer wieder zurück. In seinem Aufruf für einen Burgfrieden in Algerien, einem Vortragstext, den Camus in Algerien gegen den Terror gehalten hat111, schreibt er : »[…] nichts rechtfertigt den Tod der Unschuldigen. Im ganzen Verlauf der Geschichte haben die Menschen, unfähig, den Krieg an sich abzuschaffen, sich bemüht, seine Auswirkungen zu begrenzen […].«112 Ausdruck findet die Forderung, Unschuldige zu verschonen, im Begriff der Ehre, einem zentralen Terminus der Camusschen Ethik. Camus schreibt in seinem Vorwort zur algerischen Chronik: »Das blinde Niedermetzeln einer unschuldigen Menge, in der der Mörder im vorhinein gewiß ist, Frauen und Kinder zu treffen, wird jede Sache jederzeit entehren.«113 Freilich ist der Begriff der Ehre problematisch, dient er doch in anderen Zusammenhängen auch zur Rechtfertigung von Gewalt. Man denke nur an die Ganoven-Ehre der Mafia, den Ehrenmord oder die Rechtfertigung des Terrorismus durch die angeblichen und tatsächlichen Ehrverletzungen, wie sie z. B. von amerikanischen Soldaten aus Sicht vieler Muslime im Irak verübt werden.114 Camus, der von sich sagt »ich habe mich nie entschließen können […] auf das Wort Ehre zu spucken«115, verortet die Ehre jenseits dieser fragwürdigen Ehrvorstellungen, aber auch jenseits einer formalen Moral, die aus seiner Sicht 108 Camus: Die Gerechten, S. 203. 109 Camus: Die Gerechten, S. 204. 110 Den Ausspruch hat Camus vermutlich von Nietzsche übernommen. Vgl. Nietzsche: Zur Genealogie der Moral, München 1999, S. 399. Camus greift ihn verschiedentlich in Der Mensch in der Revolte auf: MR, S. 82; sinngemäß MR, S. 11, 72. Vermutlich stammt das Zitat aber ursprünglich von Hassan-i Sabbah, dem Anführer einer ismailitischen Religionsgemeinschaft, die heute unter dem Namen Assassinen bekannt ist. Die Assassinen stellen eine der ältesten bekannten terroristischen Gruppierungen dar (vgl. Townshend: Terrorismus, S. 135). 111 Gehalten am 22. Januar 1956. Zu den beträchtlichen Schwierigkeiten und der nicht unerheblichen Gefahr, die den Vortrag begleitet hat, vgl. Todd: Albert Camus, S. 675 ff. 112 Camus: Aufruf für einen Burgfrieden in Algerien, S. 179. 113 Camus: Vorwort zur algerischen Chronik. In: Camus: Fragen der Zeit, S. 163. 114 Vgl. Döbler, Katharina: Ehre – welche Ehre? In: Die Zeit (Nr. 33), 7. August 2004. 115 Camus: Die Wette unserer Generation. In: Camus, Albert; Wernicke, Horst (Hrsg.): Unter dem Zeichen der Freiheit, Reinbek bei Hamburg 1997, S. 242
36
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
letztlich immer zynisch wird.116 Ehre ist eine Erfahrung, deren ethische Reichweite Camus im Alltag, z. B. in Belcourt oder beim Sport, kennengelernt hat: »der Sport, bei dem ich meinen einzigen echten ethischen Unterricht genossen habe.«117 Sie lässt sich vielleicht am besten mittels seines posthum erschienen, Fragment gebliebenen Werks Der erste Mensch rekonstruieren. Die Ehre ist eine »Mannespflicht«118, die verlangt, sich nicht alles gefallen zu lassen. Aber diese Haltung führt zum Konflikt, in dem der junge Jacques – die Hauptfigur des Romans – bald lernt, dass Gewalt zwiespältig ist: »Und so begriff er, daß der Krieg nicht gut ist, da einen Menschen zu besiegen ebenso bitter ist, wie von ihm besiegt zu werden.«119 Schließlich gehört zur Ehre – der »allerelementarsten Moral« –, dass der Mensch auf die Lüge verzichtet: »Dunkel spürte er, dass man die, die man liebt, nicht in wesentlichen Dingen anlügt, weil man dann nicht mehr mit ihnen leben und sie nicht mehr lieben könnte.«120 Ehre lässt sich demnach nicht formalisieren, nicht durch abstrakte Reflexion gewinnen, sie ist etwas, das dem Menschen gemäß seiner Natur innewohnt. Will man einen philosophischen Terminus bemühen, ist die Ehre am ehesten dem moral sense vergleichbar. Die Ehre gebietet aber nicht nur, die Unschuldigen zu verschonen, sondern auch, den Gegner jederzeit als Menschen zu achten. Deswegen heißt es in den Briefen: »Und Euch [gemeint sind die Nazis] zum Trotz werde ich Euch den Namen Mensch nicht absprechen. Wenn wir unserem Glauben treu sein wollen, sind wir gezwungen, das in euch zu achten, was ihr bei den anderen nicht achtet.«121 Erst die »Ermordung von Unschuldigen« macht den Kampf »unversöhnlich«122, erst die Weigerung, den Gegner als Menschen zu sehen, vollendet den Nihilismus. Die Ehre bestimmt damit zugleich den Unterschied zwischen der »Realpolitik«, wie sie von den Nazis und Stalin installiert wurde, und der »Politik der Ehre«123. Dieser durch die Ehre markierte Unterschied mag, wie Camus selbst sagt, nur eine »Nuance[]«124 sein angesichts der Tatsache, dass beide Seiten töten; aber die Nuance ist fundamental, denn sie macht es möglich, zugleich ein Leben zu 116 Vgl. Camus: Die Wette unserer Generation 242 f. Vgl. MR, S. 145: »Ist die Moral formal, so verschlingt sie alles.« 117 Camus: Die Wette unserer Generation, S. 243. 118 Camus: Der erste Mensch, Reinbek bei Hamburg 1999, S. 133. 119 Camus: Der erste Mensch, S. 177. 120 Camus: Der erste Mensch, S. 222. 121 Camus: Briefe an einen deutschen Freund, S. 31. 122 Camus: Aufruf für einen Burgfrieden in Algerien, S. 182. 123 Camus: Briefe an einen deutschen Freund, S. 17. 124 Camus: Briefe an einen deutschen Freund, S. 32. Vgl. zum schmalen Grat von maßvollem Widerstand und Terror auch Ebert: Camus und der russische Terrorismus, S. 49.
Camus und der Terrorismus
37
beenden und den Wert des Lebens zu achten. Die Ehre zeigt an, ob sich der Rebell noch auf Seiten der Gerechtigkeit befindet oder schon zur Befestigung der Ungerechtigkeit beiträgt, ob er maßvoll Widerstand leistet oder schrankenlosen Terror verbreitet: »Es gibt also so etwas wie die Ehre in der revolutionären Aktion, eine Ehre, die darin besteht, daß man die humanethische Zielsetzung nie aus dem Blick verliert, deretwegen die Revolte überhaupt nur geschieht. Die Widerstandskämpfer können sich nur dann nicht für Mörder halten – als welche sie ihre Gegner selbstverständlich bezeichnen –, wenn sie diese Ehre empfinden und die fanatische Revolution, die die Ehre verrät, ablehnen.«125 Die vier Kriterien des maßvollen Widerstands, die die Grenze zwischen ursprünglicher Revolte bzw. Revolution und Terror markieren, sind jetzt zusammengetragen. Sie lauten, in aller Kürze wiederholt: – Unvermeidbarkeit der Gewalt angesichts der Alternative Töten oder Getötetwerden. – Bewusstsein des Zwiespalts der Gewalt. – Sühne der Gewalt durch den eigenen Tod: »Töten und sterben.« – Unschuldige verschonen und den Gegner stets als Menschen achten.
Der Terrorismus Mit den vier Kriterien ist die Grenze zwischen maßvollem Widerstand und schrankenloser Gewalt bezeichnet. Der Terrorist verstößt im Gegensatz zum ursprünglichen Revolutionär bzw. zum Freiheitskämpfer gegen eines oder mehrere dieser Kriterien. So wie der Nihilismus die Folge einer schrankenlosen Revolte ist, ist der Terror die Folge einer schrankenlosen Revolution. Nihilismus und Terrorismus bilden eine komplementäre Einheit. Der Terrorismus ist die geschichtliche Waffe, durch die der theoretische Nihilismus geschichtlich wird. Wenn der Terror herrscht, »gibt es weder Regel noch Maß mehr, dann ist die Sache eines jeden gleich viel wert, und der ziel- und gesetzlose Krieg besiegelt den Triumph des Nihilismus«126. Vollendeter Nihilismus und Herrschaft des Terrors machen den Dialog unmöglich, denn die Begriffe verlieren ihre Bedeutung. Alles wird in Beliebigkeit überführt: »Aber in allen Lagern verändert der Terror für die Dauer seiner Herrschaft die Ordnung der Begriffe.«127 Der Nihilismus, dessen Schlachtruf »Nichts ist wahr, alles ist erlaubt!« lautet, findet sein Pendant im Terrorismus, dessen Grundsatz lautet: »Der Zweck heiligt die Mittel!« Oder, mit 125 Schlette: »Der Sinn der Geschichte von morgen«, S. 65. 126 Camus: Vorwort zur algerischen Chronik, S.161. 127 Camus: Vorwort zur algerischen Chronik, S.161.
38
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
Camus’ eigenen Worten: »Denn der Terror ist nur zu rechtfertigen, wenn man den Grundsatz ›Der Zweck heiligt die Mittel‹ anerkennt. Und diesem Grundsatz kann nur beigepflichtet werden, wenn man die Wirksamkeit einer Handlung als absolutes Ziel setzt, wie es in den nihilistischen Ideologien der Fall ist (alles ist erlaubt, was zählt, ist allein der Erfolg) oder in den Philosophien, die die Geschichte zu einem Absolutum erheben […].«128 Was den Nihilisten ebenso wie den Terroristen auszeichnet, ist, dass er seine subjektiven Überzeugungen zum absoluten Maßstab erhebt. Die Verabsolutierung der subjektiven Überzeugungen ungeachtet der menschlichen Natur ist nach Camus die »philosophische Definition des Terrors«129. Prüft man die vier Kriterien vor dem Hintergrund der terroristischen Denkweise »Der Zweck heiligt die Mittel«, dann stellt man fest, dass der Terrorist allenfalls das erste der vier Kriterien anerkennen kann. Er wird nämlich in fast allen Fällen argumentieren, dass ihm keine andere Wahl bleibt, um seine politischen Ziele durchzusetzen, als Terror zu verüben, weil seine Gegner ihn eher töten als politisch-ideologischen Einfluss gewinnen lassen würden. Der Terrorist kann den Zwiespalt oder das Dilemma der Gewalt – das zweite Kriterium – nicht gelten lassen, wenn der Zweck die Mittel heiligt. Denn in diesem Fall setzt der Terrorist kein universales Gut, das für alle gelten soll, sondern alles wird dem absoluten Ziel untergeordnet. Universalität ist bei Camus immer an den Menschen gebunden. Universal ist ein Wert – z. B. die Solidarität –, weil er für alle Menschen gilt, und nicht, weil er über allen Menschen steht. Es geht Camus um universale Solidarität und nicht um die absolute Geltung einer abstrakten Idee. Der Terrorist bejaht und verabsolutiert eine partikulare Ideologie, die gerade nicht alle Menschen einschließt, sondern bloß eine Idee bzw. exklusive Gruppe vor Augen hat. Das dritte Kriterium, die Sühne der Tat, kann der Terrorist gleichfalls nicht anerkennen. Denn die Logik des »Der Zweck heiligt die Mittel«, verbietet dem Terroristen, wenn möglich, zu sterben, um den Kampf mit allen Mitteln fortzusetzen.130 In den eigenen Tod willigt der Terrorist nur dann ein, wenn er keine andere Wahl hat. In diesen Fällen opfert sich der Terrorist zwar, aber er zeigt damit nur, dass er bereit ist, jedes Mittel zur Erreichung seines politischen Ziels zu nutzen. Gerade in der Bereitschaft des Selbstmordattentäters zeigt sich der nihilistische Aspekt besonders deutlich, denn der Selbstmordattentäter macht sich selbst zum Mittel für einen Zweck, womit er den ursprünglichen Wert der Revolte verletzt. Der Revolutionär demgegenüber begeht die Tat, entkommt und stellt sich schließlich freiwillig, um Zeugnis abzulegen über die Grenze, die er 128 Camus: Weder Opfer noch Henker, S. 216. 129 MR, S. 275. 130 Vgl. MR, S. 184 ff.
Camus und der Terrorismus
39
mit seiner Tat zugleich einfordert und doch überschritten hat. Der Selbstmordattentäter zielt auf Effizienz, das bedeutet, je mehr Unschuldige sterben, desto besser ; der Revolutionär dagegen will ein Gleichgewicht herstellen, das er mit seinem eigenen Tod besiegelt. Es wird an diesem hoch problematischen Kriterium erneut deutlich, wie schmal der Grat zwischen Widerstand und Terror ist. »Töten und sterben«: diese Formel kann nur dann Geltung haben, wenn der Widerstandskämpfer für alle, also auch für sein Opfer stirbt. Eben das aber bestreitet die Formel vom heiligen oder absoluten Zweck, da die Opfer vor dem absoluten Ziel unbedeutend werden. Viertens verstößt der Terrorist gegen das Gebot, die Unschuldigen zu verschonen und seine Gegner als Menschen zu achten. Jeder, der in irgendeiner Form an der Ungerechtigkeit oder Unterdrückung partizipiert, so würde der Terrorist sagen, ist schuldig. Jeder, der die Ideologie des Terroristen nicht befördert, ist ebenfalls schuldig, weil er verhindert oder verzögert, dass sich die neue Ordnung in der Welt etabliert. Dieser radikalen Logik zufolge ist sogar jedes Kind schuldig. Der absolute Terrorist geht noch weiter : Da es ihm darum geht, die Angsterzeugung zu maximieren, lautet seine Formel: Je unschuldiger und wehrloser die Opfer, desto wirksamer die Bombe. Was Camus, den Sartre in seinem Nachruf einen »eigensinnige[n] Humanisten«131 genannt hat, in all seinen Schriften der schrankenlosen Gewalt und dem durch Schrankenlosigkeit definierten Terrorismus entgegenhält, ist das Bekenntnis zu einem Maß und einer Grenze. Und diesem Maß sind auch der Widerstand und die Revolte zu unterwerfen, ohne dieses Maß wird nämlich jedes menschliche Streben zuletzt grenzenlos und mörderisch.
Schluss Es ist vielleicht berechtigt, Camus vorzuwerfen, dass er mit seinen Forderungen, der Gewalt ein Maß zu geben, an den historischen Realitäten vorbeigeht. Aber man darf sich hier keines Sein-Sollen-Fehlschlusses schuldig machen. Auch wenn es zutrifft, dass die Gewalt in der Geschichte der Menschheit eine Konstante darstellt, muss man sich mit dieser Konstante nicht abfinden: »Wenn es auch wahr ist, daß zumindest in geschichtlicher Sicht keine Werte überleben, für die nicht gekämpft wird […], so genügt doch der Kampf (oder die Gewalt) nicht, um sie zu rechtfertigen. Der Kampf selber muß durch diese Werte gerechtfertigt und erleuchtet werden. Sich für seine Wahrheit schlagen und aufpassen, daß man sie nicht mit den gleichen Waffen totschlägt, mit denen man sie verteidigt – 131 Sartre, Jean-Paul: Albert Camus, S. 103.
40
Rodion Ebbighausen (Augsburg)
nur um diesen doppelten Preis gewinnen die Worte wieder ihren lebendigen Sinn. Wenn der Intellektuelle das weiß, ist es seine Aufgabe, nach besten Kräften in jedem Lager die Grenzen der Gewalt und der Gerechtigkeit abzustecken […].«132 Auch der Vorwurf, dass Camus keine praktische Alternative entworfen habe133, geht an Camus’ Absicht vorbei. Camus, der sich selbst – im guten Sinne des Wortes – als Moralisten und nicht als Politiker, der sich als Schriftsteller und nicht als Philosophen verstanden hat,134 wollte mit seinen Überlegungen in seinem Essay Der Mensch in der Revolte nicht den Weg der historischen Revolte, d. h. von der Theorie zur Praxis gehen, sondern den der metaphysischen Revolte, also den von der konkreten Erfahrung zur Idee. Und die Erfahrungen seiner Zeit – das Dritte Reich, der Algerienkrieg, der Faschismus in Spanien – haben ihn zu einer einfachen Intuition geführt, die er nicht müde wurde zu wiederholen: Die Menschen müssen sich verdienen, »als freie Menschen zu leben, das heißt als Menschen, die sich weigern, Terror zu üben und Terror zu erdulden.«135
132 Camus: Vorwort zur algerischen Chronik, S. 168. 133 Vgl. Tarrow, Susan: Exile from the Kingdom. A political Rereading of Albert Camus, Alabama 1985, S. 144 und S. 146: »A major omission in his argument is the lack of any practical socialist alternative.« 134 Vgl. Schlette: Albert Camus: Welt und Revolte, S. 15: »Ich bin kein Philosoph. Ich glaube nicht genug an die Vernunft, um an ein System zu glauben. Was mich interessiert, ist, zu wissen, wie man leben soll.« (Interview »Servir«, 20. Dezember 1945). 135 Camus: Aufruf für einen Burgfrieden in Algerien, S. 186.
Jeanyves Gu¦rin (Paris)
Camus et la revue Esprit (1944 – 1976)
Il faut sortir Camus de son face face avec Sartre. Il avait d’autres contemporains, notamment Esprit. Fond¦e en 1932, cette revue est, au d¦part, l’organe d’un mouvement personnaliste qui, dans le sillage de Charles P¦guy, se donne pour tche de d¦solidariser les ¦lites chr¦tiennes du d¦sordre ¦tabli. Si les catholiques sont nombreux dans sa r¦daction comme dans son lectorat, ses responsables ont refus¦ de la soumettre au contrúle doctrinal de l’Êglise. Cette »revue d’agr¦g¦s«1, comme l’appelle Michel Winock, largement ouverte des protestants, des Juifs, des incroyants2, s’est voulue un espace de d¦bats. Ses trois premiers directeurs, Emmanuel Mounier (1905 – 1950), Albert B¦guin (1901 – 1957) et Jean-Marie Domenach (1922 – 1997), et leurs collaborateurs mÀnent un dialogue au long cours avec des personnalit¦s qui ne partagent pas toutes leurs conceptions. Camus a ¦t¦ l’une d’entre elles. Les relations entre Camus et la revue Esprit ont ¦t¦ complexes et l’¦change in¦gal. Le d¦bat se situe trois niveaux. L’un, r¦current et essentiel pour les personnalistes, est philosophique, c’est celui du penseur incroyant et des chr¦tiens. Le second est litt¦raire, c’est celui d’un ¦crivain et de ses critiques. Le troisiÀme est politique. Il met en jeu des r¦actions l’¦v¦nement, une id¦e du pouvoir et de la soci¦t¦ id¦ale. Il ne semble pas qu’¦tudiant puis journaliste, le jeune Camus ait lu r¦guliÀrement une revue qui, avant la guerre, est pass¦e par une »¦tape doctrinaire«3 qui ne pouvait que la lui rendre indigeste sinon r¦barbative. õ l’austÀre revue personnaliste, il pr¦fÀre Monde et surtout la Nouvelle Revue franÅaise. Ses matres n’¦taient pas des collaborateurs ni ses camarades des lecteurs d’Esprit. Jean Grenier, pour sa part, ne lui a pas confi¦ le moindre texte. C’est d’abord un homme de la NRF. Camus a rencontr¦ Brice Parain la fin de la guerre. C’est avant 1 Michel Winock, »Esprit«, des intellectuels dans la cit¦ 1930 – 1950, Paris, Seuil, coll. »Points«, 1999, p. 40. 2 Jean-Marie Domenach parle de »l’œcum¦nisme concret« de la revue (Mounier, Seuil, coll. »Ecrivains de tous les temps«, 1980, p. 61). 3 Emmanuel Mounier, »Cinq ¦tapes d’Esprit«, Dieu vivant n8 16, 1950, p. 43.
42
Jeanyves Guérin (Paris)
1940 que ce dernier fut un collaborateur r¦gulier d’Esprit. Dans les ann¦es 1930, il existait certes un groupe Esprit Alger. Grenier y avait mÞme pr¦sent¦ un expos¦. Dans la mesure o¾ son responsable, »l¦gat«4 de la revue en Alg¦rie, est Max-Pol Fouchet, qui y publie dix-neuf articles avant 1940, on peut consid¦rer que Camus en connat l’existence, mais qu’il n’a certainement pas fr¦quent¦ le groupe. La politique, sans parler de leurs amours, s¦pare les deux hommes. L’un est socialiste, l’autre communiste, puis anarchisant. Le mouvement Combat s’inscrit dans la continuit¦ des mouvements nonconformistes des ann¦es 19305. Il a ¦t¦ sous forte influence personnaliste. Henri Frenay, son fondateur, est un officier catholique. Il a eu des liens avec Mounier auquel il confie un ¦ph¦mÀre groupe d’¦tudes doctrinales. Il a ses entr¦es l’¦cole d’Uriage o¾ Mounier, Bertrand d’Astorg et Jean Lacroix donnent des conf¦rences6. Au d¦part, les d¦mocrates-chr¦tiens y sont en force: FranÅois de Menthon, Pierre-Henri Teitgen, Alfred Coste-Floret, Edmond Michelet. Claude Bourdet qui appartient au comit¦ directeur du mouvement, a donn¦ Esprit deux articles avant 1941 et deux aprÀs 1944. Mounier, pour sa part, est li¦ Bertie Albrecht. Tous deux sont sur le mÞme banc des accus¦s en 1942. Le procureur de l’Êtat franÅais accuse alors le philosophe personnaliste d’Þtre »le directeur spirituel de la R¦sistance«. Par la suite, Combat, Franc-Tireur et Lib¦ration-Sud se fondent dans les Mouvements unis de R¦sistance. Du mouvement, il ne reste qu’un journal clandestin o¾ l’agnostique Pia puis Camus relaient le chr¦tien Bourdet. Cette histoire a laiss¦ des r¦f¦rences communes, implicites ou explicites, des connivences. En 1944 – 1945, les ¦changes entre Combat et Esprit sont les plus intenses. Le journal salue la relance de la revue et fait souvent ¦cho ses sommaires. Plusieurs de ses r¦dacteurs, Albert Ollivier, Paul Bodin, Bernard Voyenne, Jean-Paul de Dadelsen, Jacques Lemarchand donnent entre un et trois textes, g¦n¦ralement courts, au mensuel personnaliste. Dans un placard de publicit¦, Mounier et Claude-Edmonde Magny figurent au nombre de ses collaborateurs. Le premier a ses entr¦es au quotidien du fait des relations nou¦es dans la clandestinit¦. Il y publie divers articles ou tribunes libres, notamment un hommage Bertie Albrecht, des papiers sur l’engagement, l’urgence d’une r¦forme administrative, le dialogue franco-allemand, la situation des r¦fugi¦s juifs et deux reportages, l’un sur l’Autriche7, l’autre sur l’Afrique noire franÅaise8. Le second est l’avant4 Michel Winock, Op. cit. p. 150. 5 Voir Jean-Louis Loubet del Bayle, Les Non-conformistes des ann¦es 30, Seuil, coll. »Points Histoire«, 2001; Marie Granet et Henri Michel, Combat. Histoire d’un mouvement de R¦sistance, de juin 1940 juillet 1943, PUF, coll. »Esprit de la r¦sistance«, 1957. 6 Henri Frenay, La nuit finira, Robert Laffont, coll. »V¦cu«, 1973; Voir aussi Robert Belot, Henri Frenay. De la R¦sistance l’Europe, Seuil, 2003. 7 Combat, 9 – 13 aot 1946.
Camus et la revue Esprit (1944 – 1976)
43
texte d’un livre publi¦ peu aprÀs. En revanche, on ne trouve aucune contribution de ses proches, Jean Lacroix, Jean-Marie Domenach, Henri Marrou, FranÅois Goguel. L’Alg¦rois et le Grenoblois, le licenci¦ et l’agr¦g¦ de philosophie, celui qui ne croit pas au Ciel et celui qui y croit s’estiment sans jamais avoir ¦t¦ intimes. Les deux hommes ont nou¦ une correspondance entre 1946 et 1949. Quels qu’aient ¦t¦ leurs d¦saccords, les deux hommes n’ont pas ¦t¦ en situation de pol¦miquer. »Sans que vous le sachiez, ¦crit Camus au Mounier, j’ai fait beaucoup de chemin au-devant de vous. C’est ce que je r¦sumerai en disant que de toutes les positions qu’on peut inspecter, c’est de la vútre que je me sens aujourd’hui le plus prÀs«9. Il se dit »lecteur fidÀle et amical«, mais son œuvre ¦crite, notamment L’Homme r¦volt¦, n’en porte pas la trace. Camus ne se r¦fÀre peu prÀs jamais ses contemporains. Dans Actuelles, il r¦ussit ne pas citer Merleau-Ponty de mÞme que, dans L’Homme r¦volt¦, Raymond Aron. Esprit avait publi¦ des pages lumineuses de Ricoeur sur le tragique10. Il ne donne pas l’impression de les avoir lues quand il donne sa conf¦rence d’AthÀnes sur l’avenir de la trag¦die. Il n’inscrit pas ses ¦crits dans le paysage acad¦mique. C’est d¦j certains ¦gards un essayiste m¦diatique. Les signatures de Camus et de Mounier figurent au bas des mÞmes textes, ainsi du manifeste pour la paix et une Europe socialiste que publie Esprit en novembre 1947. Les deux auteurs sont oppos¦s la politique des blocs et cherchent une troisiÀme voie. Ils envisagent des Êtats-Unis d’Europe neutres. Ils se rencontrent plusieurs reprises dans la proximit¦ du RDR. Tous deux enfin, comme Andr¦ Breton, Jean Paulhan, Raymond Queneau et l’abb¦ Pierre, ont sympathis¦ avec l’entreprise mondialiste de Garry Davis. Cet ancien pilote s’¦tait d¦clar¦ citoyen du monde. Son mouvement fit long feu. Lorsque reparat Esprit en d¦cembre 1944, son ¦quipe, rajeunie et renouvel¦e par l’apport de r¦sistants, prÞte une grande attention l’œuvre de Camus que L’Êtranger et ses ¦ditoriaux de Combat ont notabilis¦. Le magistÀre du journaliste agace les personnalistes. Mounier reproche au quotidien d’adopter une »attitude spectaculaire« et ses ¦ditorialistes de se comporter comme des »juges austÀres qui distribuent l’¦loge et le blme comme d’une chaire d’o¾ l’on ne sent pas toujours passer la grande fraternit¦ des difficult¦s communes«11. Ne peut-on pas faire le mÞme reproche Mounier, Jean Lacroix et alii? »Il est, ¦crit Emmanuel Mounier aprÀs avoir lu Ni Victimes ni bourreaux, de ceux que l’on voudrait avoir comme adversaires«. Il approuve le diagnostic, mais 8 9 10 11
Combat, 18 – 31 mai 1947. Bulletin des amis d’Emmanuel Mounier, n8 64, octobre 1985. Paul Ricoeur, »Sur le tragique«, Esprit, mai 1953. Emmanuel Mounier, »Esprit et l’actualit¦ politique«, Esprit, aot 1945, p. 442.
44
Jeanyves Guérin (Paris)
juge les propositions insuffisantes. »Sauver les corps« est un mot d’ordre trop court. »Est-ce l ce qui peut d¦finir un salut public quand une soci¦t¦ s’effondre? […] Peut-on passer d’une affirmation morale une conduite politique?«12. Une certaine d¦ception se lit dans la note. Un peu plus tút, Marc Beigbeder jugeait sa position politique »aussi d¦cid¦e que nuanc¦e«13, mais, comme Mounier, il jugeait d¦mobilisatrice la th¦matique de l’absurde d¦velopp¦e dans Le Mythe de Sisyphe et attendait de son auteur qu’il r¦am¦naget sa philosophie. Camus s’est d¦gris¦, lui pas encore. L’un est devenu r¦formiste, l’autre, comme ses proches, se veut encore r¦volutionnaire. La Peste fait l’objet d’une longue ¦tude de Bertrand d’Astorg. Le critique est un ancien de la revue, on peut le consid¦rer comme un chr¦tien de gauche. Il avait rendu compte de la conf¦rence prononc¦e par Camus chez les Dominicains du boulevard de La Tour-Maubourg14. Il rapproche Rieux des m¦decins de Georges Duhamel et limite le propos civique du livre une »apologie de la non-violence absolue« ou une »guerre d’usure« contre la violence. Il juge le »message gandhiste« du roman noble mais inadapt¦ aux exigences de l’heure. En aot 1944, »Tarrou n’aurait pas ¦t¦ sur les barricades mais dans les ¦quipes de la CroixRouge. Seulement, si tout le monde est en casque blanc ou le petit drapeau la main, qui fera le coup de feu sur les barricades?«15 L’on ne peut en rester l’objection de conscience et un pacifisme int¦gral. L’argument est formul¦ sans acrimonie, il sera ult¦rieurement d¦tourn¦ dans un sens hostile. õ ce point de l’analyse, on peut noter des r¦ticences sur le th¦tre de Camus. Esprit a quatre chroniqueurs dramatiques dans la p¦riode, Pierre-Aim¦ Touchard, Georges Lerminier, Marc Beigbeder et Alfred Simon. Chacun d’eux s¦lectionne quelques spectacles et en parle longuement. Seuls le second et le troisiÀme ont rendu compte d’une piÀce, en l’occurrence de Caligula et des Justes. La faveur du dernier qui officie pendant plusieurs d¦cennies, va au TNP et au Nouveau Th¦tre. Les collaborateurs d’Esprit qui commentent les ¦crits de Camus considÀrent celui-ci comme un romancier ou un dramaturge, pas comme un penseur de premier ordre. Plus g¦n¦ralement ils se m¦fient des belles mes. Mais ils le m¦nagent. Son naturisme, son h¦donisme paens vont contre un ¦thos personnaliste qui a longtemps ¦t¦ passablement puritain. Il y a moralistes et moralistes. En janvier 1950, Esprit publie dans une mÞme livraison une longue ¦tude de 12 Emmanuel Mounier, »Camus parle«, Esprit, janvier 1947, p. 156 – 157. 13 Marc Beigbeder, »Le monde n’est pas absurde«, Esprit, f¦vrier 1945, p. 415. 14 Bertrand d’Astorg, »Encore Camus«, Esprit, janvier 1947, p. 168 – 170. »Ce solitaire, ¦crivaitil, recherche la fraternit¦ des hommes«. 15 Bertrand d’Astorg, »De La Peste ou d’un nouvel humanitarisme«, Esprit, octobre 1947, p. 615 – 621. L’article est repris in Bertrand d’Astorg, Aspects de la litt¦rature europ¦enne depuis 1945, Seuil, 1952, p. 191 – 200.
Camus et la revue Esprit (1944 – 1976)
45
Mounier et un article de Rachel Bespaloff16 qui font date. Le premier texte se pr¦sente comme une ¦tude fouill¦e et synth¦tique de l’œuvre prise dans sa totalit¦. Camus, pour lui, est moins un »¦crivain d’id¦es« qu’un artiste et un moraliste inscrit dans une tradition classique. Il lui reconnat un »esprit de mesure et de rigueur«. Il commence par confronter l’id¦e pseudo-nihiliste d’absurde aux conceptions de Kafka et de Malraux. L’homme absurde est cern¦, non pas lib¦r¦. La culpabilit¦ l’obsÀde. »La mort de Dieu n’ouvre pas le printemps de l’humanit¦, mais un morne tragique cellulaire«. Camus pr¦fÀre le bonheur l’h¦rosme ou la saintet¦ et refuse aussi bien les absolus que les abstractions. Il a le choix de devenir »Duhamel ou Bernanos«. Il est clair que l’auteur pr¦fÀre la seconde branche de l’alternative. La guerre lui a r¦v¦l¦ la place de la violence et de la ruse. DÀs lors la question du crime, et particuliÀrement du crime l¦gal, est cardinale. »C’est au nom du bonheur qu’il prend le parti des victimes«. Tolsto n’est pas loin. La »vieille sensibilit¦ anarchiste« fait retour chez lui. Mounier lui prÞtant l’ »aveuglement obstin¦« de Tarrou, conclut un »essoufflement de l’œuvre«17. Alors qu’il vient d’¦crire une Introduction aux existentialismes, il se garde de ranger Camus dans cette ¦cole, comme le font alors la plupart des critiques. Il n’est pas indiff¦rent que cette r¦¦valuation de Camus par les personnalistes concide avec leur prise de distance par rapport au parti communiste. õ Mounier d¦c¦d¦ pr¦matur¦ment succÀde Albert B¦guin, un grand critique litt¦raire ouvert aux ¦critures nouvelles. Camus et lui ont figur¦ au comit¦ de r¦daction de l’¦ph¦mÀre mensuel Emp¦docle. L’on verra un signe dans le fait qu’il a assur¦ lui-mÞme la recension de L’Homme r¦volt¦ au lieu de la confier un philosophe, Jean Lacroix ou Paul Ricoeur18. L’article de B¦guin est fouill¦ et globalement ¦logieux. »Nous en avons pour longtemps avant de nous mettre en rÀgle avec les problÀmes que Camus nous invite m¦diter«19. S’il lui reproche d’accorder trop de place l’id¦ologie, s’il fait des objections la g¦n¦alogie des totalitarismes, il en juge la critique l¦gitime. Il admet l’id¦e centrale du livre, savoir que l’idoltrie de l’histoire hypostasi¦e et l’eschatologisme des r¦volutions contemporaines constituent la forme extrÞme d’un nihilisme qui fait peu de cas de la personne humaine. La mort de Dieu laisse l’homme face une religion meurtriÀre dont les appareils sont les desservants. Sa critique du communisme et du marxisme, estime-t-il, ne se fait pas sur des bases r¦actionnaires. Un rap-
16 Rachel Bespaloff, »Le monde du condamn¦ mort«, Esprit, janvier 1950. 17 Emmanuel Mounier, »Albert Camus ou l’appel des humili¦s«, Esprit, janvier 1950. L’article est repris dans L’Espoir des d¦sesp¦r¦s (Seuil, 1953). 18 Ce dernier, d’ailleurs, publie une longue ¦tude de l’ouvrage dans la revue Christianisme social. Voir Paul Ricoeur, Lectures 2, La contr¦e des philosophes, Seuil, 1992. 19 Albert B¦guin, »La r¦volte et le bonheur«, Esprit, avril 1952, p. 736 – 746.
46
Jeanyves Guérin (Paris)
prochement devient possible. En 1952, Camus donne un texte Esprit.20 C’est celui d’une allocution en faveur de militants espagnols. Il n’y en aura pas d’autres. Trois ans plus tard, en effet, une vive pol¦mique oppose Camus au bouillant r¦dacteur en chef de la revue personnaliste, Jean-Marie Domenach21. Pr¦faÅant l’ouvrage de l’universitaire am¦ricain Konrad Bieber sur les ¦crivains de la r¦sistance, il avait affirm¦ que les intellectuels progressistes avaient vocation Þtre des collaborateurs du pouvoir communiste dans une France occup¦e par l’Arm¦e rouge. Domenach s’¦tait senti vis¦, alors que Camus pensait d’abord Sartre et aux Temps modernes. Dans son compte-rendu de l’ouvrage, il avait volontairement omis de mentionner sa pr¦face. La controverse s’¦tait poursuivie dans la revue T¦moins. Il est possible qu’elle ait laiss¦ quelques traces dans La Chute. Cet ouvrage ne fait l’objet d’aucun compte-rendu. Les ponts sont coup¦s. Mais, un peu plus tard, parat une longue ¦tude synth¦tique de Jean Conilh22, une des plus int¦ressantes parues du vivant de l’auteur. Le paradoxe est que Camus et Domenach pol¦miquent alors que leurs trajectoires convergent. Au moment des ¦v¦nements de Budapest, en 1956, les r¦actions de Camus et d’Esprit23, sont identiques. Leur condamnation de l’intervention sovi¦tique est ferme, quand celle de Sartre est embarrass¦e. L’article implacable de Pierre Emmanuel a mÞme des accents camusiens. On aurait pu attendre des actions communes, une synergie. Rien de cela n’arrive. C’est de Preuves que Camus se sent le plus proche. Il a quitt¦ L’Express. Il reste un franctireur. Son attitude face aux ¦v¦nements d’Alg¦rie n’am¦liore ni ne d¦t¦riore ses rapports avec Esprit. Avant la guerre, la revue avait ¦t¦ l’un des rares lieux o¾ s’¦nonÅait une critique sinon de la colonisation en soi, du moins de ses abus criants24. En 1933, elle avait publi¦ un num¦ro sur l’Indochine. MisÀre de la Kabylie s’inscrit dans la mÞme logique. AprÀs la guerre, c’est l’Afrique du Nord que s’int¦ressent les personnalistes25. Ils soutiennent la d¦colonisation en g¦n¦ral. En avril 1947, un ¦ditorial est titr¦ »Pr¦venons la guerre d’Afrique du Nord«. Dans les ann¦es qui suivent, la revue donne la parole Andr¦ Mandouze, Francis Jeanson, Louis Massignon. AprÀs 1954, il est question de l’Alg¦rie dans 20 Albert Camus, »Chroniques«, Esprit, avril 1952 et Œuvres complÀtes, t. 3, Gallimard, coll. »BibliothÀque de la Pl¦iade«, 2008, p. 888 – 891. 21 D’aprÀs Olivier Todd (Camus, une vie, Gallimard, coll. »Folio«, 1999, p. 796), Camus aurait refus¦ un d¦bat sur L’Homme r¦volt¦ organis¦ au Centre catholique des intellectuels franÅais (CCIF). Il y aurait ¦t¦ confront¦ Raymond Aron, Thierry Maulnier, Claude Bourdet et JeanMarie Domenach. 22 Jean Conilh, »L’exil sans royaume«, Esprit, n8 260 et 261, avril et mai 1957, p. 529 – 543 et 673 – 692. 23 Pierre Emmanuel, »Les oreilles du roi Midas«, Esprit, d¦cembre 1956. 24 Voir Olivier Lacombe, »La colonisation devant la conscience chr¦tienne«, Esprit, mars 1933. 25 Esprit
Camus et la revue Esprit (1944 – 1976)
47
presque toutes les livraisons. Plusieurs amis de Camus, Jean Daniel, Jean S¦nac, Albert Memmi, donnent des articles et des t¦moignages. En novembre 1955 parat un ensemble d’articles r¦unis sous un surtitre sans ¦quivoque: »ArrÞtons la guerre d’Alg¦rie«. Un ¦ditorial anonyme le pr¦cÀde. Camus, sans Þtre nomm¦, y est discrÀtement ¦gratign¦: »On peut toujours ›condamner les violences d’o¾ qu’elles viennent‹, c’est humaniste et r¦confortant«26. Ses prises de position ne suscitent guÀre d’¦chos. Jean-Marie Domenach, devenu directeur de la revue en 1957, n’a pas cherch¦ l’affrontement. Les personnalistes pr¦conisent la n¦gociation avec les nationalistes et condamnent clairement la pratique de la torture. Mais ils ont conscience de la complexit¦ du cas alg¦rien. Les analyses de Camus et d’Esprit parfois se recoupent. Leurs conclusions cependant divergent nettement. Jamais le premier n’aurait ¦crit: »L’Alg¦rie ne restera avec nous que si elle n’est plus nous«27. L’¦ditorialiste pr¦conise des contacts imm¦diats entre les autorit¦s franÅaises et les repr¦sentants de la r¦bellion. De ses p¦riphrases, l’on peut tirer une id¦e: l’»issue politique« des n¦gociations ne peut Þtre que l’ind¦pendance. Camus, on le sait, refuse cat¦goriquement cette hypothÀse. Quand meurt Camus, Jean-Marie Domenach se charge de la n¦crologie. Son article paru dans le Journal plusieurs voix est empreint d’une ¦motion non feinte. »Nous l’aimions, ¦crit-il, et nous ne savions pas le lui dire […]. Aucun contemporain n’a tenu une telle place parmi nous […]. C’¦tait un compagnon de nos jours«. Ce fut un homme seul. »Il lui a manqu¦ une v¦ritable action militante«. Et le directeur d’Esprit de dresser ce portrait presque p¦guyste de son an¦: »Il ¦tait gauche, avec lucidit¦, avec amertume, mais non point moiti¦; c’est un homme qui ne se r¦tractait pas; il s’armait de ses fid¦lit¦s, mais du moins il ne transigeait pas avec elles«28. Par la suite, Domenach consacre quelques pages d¦pourvues d’animosit¦ Camus dans Le Retour du tragique29 et pr¦face l’ouvrage de Joseph Hermet, Camus et le christianisme.30 Dans les ann¦es 1970, les positions r¦solument antitotalitaires d’Esprit, le soutien apport¦ aux dissidents et Solidarnosc, l’affirmation du paradigme d¦mocratique s’inscrivent dans le droit fil des positions que Camus avait d¦fendues dans les ann¦es 1950 sans que, affaire de g¦n¦ration sans doute, ses animateurs revendiquent une quelconque filiation. Ce sont Alexandre Solj¦nitsyne, Hannah Arendt, Cornelius Castoriadis et Claude Lefort qui leur servent de r¦f¦rences. Au colloque de Nanterre, en 1985, Paul Thibaud, alors directeur de la revue, juge qu’il a ¦t¦ lucide sur la guerre d’Alg¦rie, ses effets et le terrorisme et 26 »Une affaire int¦rieure«, Esprit, novembre 1955. Texte repris in Esprit. Êcrire contre la guerre d’Alg¦rie, 1947 – 1962, Hachette, coll. »Pluriel Histoire«, 2002, p. 145. 27 Op. cit. p. 151. 28 Jean-Marie Domenach, »Albert Camus«, f¦vrier 1960, p. 280 – 283. 29 Jean-Marie Domenach, Le Retour du tragique, Seuil, coll. »Esprit«, 1967. 30 Joseph Hermet, Camus et le christianisme. L’esp¦rance en procÀs, Beauchesne, 1976.
48
Jeanyves Guérin (Paris)
que l’id¦e de trÞve civile ¦tait noble, mais inaudible. »Parce qu’il est de ceux que l’¦v¦nement a le plus bless¦s, conclut-il, Camus pourrait Þtre au d¦part d’une reconsid¦ration non manich¦enne du pass¦ et d’une ouverture vers un avenir lib¦r¦ des rancœurs, mÞme justifi¦es«31. Ajoutons que deux anciens d’Esprit, qui occupent de fortes positions dans le champ intellectuel et m¦diatique, Michel Winock et Jacques Julliard ont manifest¦ leur sympathie envers Camus et ses choix politiques dans leurs travaux sur les intellectuels32. On retrouverait bien des concordances entre les analyses politiques de Julliard et celles rassembl¦es dans les trois volumes d’Actuelles. Esprit et Combat, Mounier et Camus appartiennent une ¦glise de gauche ¦clat¦e en chapelles. L’on perÅoit mieux aujourd’hui ce que l’un et l’autre doivent aux non–conformistes des ann¦es 30. Les id¦es de ceux-ci, si elles n’ont pas ¦t¦ reprises par les forces politiques, ont diffus¦ dans les milieux intellectuels. La R¦sistance y a puis¦ des thÀmes. Mounier pr¦conise, aprÀs Jacques Maritain, la primaut¦ du spirituel. Il a d’abord fait sien le slogan des non-conformistes, »ni droite ni gauche«. Dans les ann¦es 1930, il effectue un trajet qui l’ancre gauche – comme le prouvent son opposition la guerre d’Êthiopie, son appui raisonn¦ au Front populaire et surtout son soutien la R¦publique espagnole. La revue, influenc¦e par Nicolas Berdiaev et Victor Serge, reste n¦anmoins r¦serv¦e l’¦gard du communisme sovi¦tique. La voie est alors ¦troite pour qui refuse le fascisme, le communisme et le capitalisme. Camus, n¦ dans un milieu peu politis¦, a rejoint les rangs du parti communiste au mÞme moment. Il n’y reste que deux ans. Il soutient le Front populaire, mais reproche L¦on Blum d’avoir c¦d¦ la pression des ¦lus alg¦riens et d’avoir abandonn¦ les r¦publicains espagnols. On signalera que la majorit¦ de la revue personnaliste, surmontant ses tendances pacifistes, se prononce clairement contre les accords de Munich. õ l’¦poque, Camus ne s’est pas prononc¦ sur le sujet. On peut constater un chass¦-crois¦. S’il a ¦t¦ communiste, de 1935 1937, Camus n’a jamais ¦t¦ marxiste. L’influence de Grenier et la lecture de Nietzsche l’ont immunis¦ durablement contre l’esprit d’orthodoxie. C’est aux sources de la pens¦e libertaire qu’il puise ses analyses et ressource son ¦thos. õ Esprit, on fait le trajet adverse. On disserte volontiers sur la r¦volution spirituelle dans les ann¦es 1930. On est alors proudhonien. On refuse le mat¦rialisme historique, la vision dialectique donc fataliste de l’histoire. AprÀs 1945, la conjoncture est autre: les personnalistes s’imposent une lecture intensive de Marx et privil¦gient le dia31 Intervention de Paul Thibaud in Jeanyves Gu¦rin (dir.), Camus et la politique, L’Harmattan, 1986, p.197. 32 Michel Winock, Le SiÀcle des intellectuels, Seuil, coll. »Points«, 1999, 496 – 498, 500 – 513, 615 – 619 et passim. Jacques Julliard en personne a r¦dig¦ la notice »Camus« dans le Dictionnaire des intellectuels franÅais qu’il a dirig¦ avec Winock (Seuil, 1996).
Camus et la revue Esprit (1944 – 1976)
49
logue avec les communistes. L’exp¦rience sovi¦tique, fermement critiqu¦e avant 1940, est vue avec plus de sympathie, l’effet Stalingrad ayant jou¦. Mounier et surtout Jean Lacroix minimisent ses aspects totalitaires et acceptent de facto la sovi¦tisation de l’Europe centrale. Ils prennent soin de distinguer un marxisme ouvert conciliable avec la foi chr¦tienne et un marxisme scolastique33. Camus, de Ni Victimes ni bourreaux L’Homme r¦volt¦, s’est montr¦ plus lucide et vigilant. En 1944, l’¦ditorialiste de Combat use d’un lexique r¦volutionnaire qui fait penser celui d’Esprit avant 1940. Puis il comprend que la r¦volution est impossible. Il cesse de m¦nager les communistes. Il oppose un non possumus, un dubito l’id¦ologie marxiste dans Ni Victimes ni bourreaux. La double critique de la philosophie marxiste et du communisme sovi¦tique d¦velopp¦e dans L’Homme r¦volt¦ consonne avec celle que faisaient les personnalistes dans les ann¦es 1930. Il aurait pu faire siennes ces remarques de Jacques Maritain et de Nicolas Berdiaeff, lequel ¦crivait dans Esprit: »Les principes radicaux du d¦sordre capitaliste sont exasp¦r¦s, pas chang¦s«34. »Le mat¦rialisme, il l’a emprunt¦ la philosophie de la bourgeoisie ¦clair¦e du XIXe siÀcle. L’¦conomisme, il l’a pris la soci¦t¦ capitaliste du XIXe siÀcle«35. Le communisme ne d¦truit pas la soci¦t¦ capitaliste, il la parachÀve. On a remplac¦ des exploiteurs par d’autres exploiteurs. On n’a pas aboli l’exploitation, on l’a aggrav¦e36. Les arguments sont les mÞmes. Camus en tire les cons¦quences pragmatiques: il relativise le politique, il s’affirme social-d¦mocrate et r¦formiste. Il envisage un nouvel ordre international et, dans La Peste, imagine une ONG avant l’heure. Rieux n’est-il pas le premier des french doctors? Il faudra attendre les ann¦es 1950 pour qu’Esprit s’engage dans cette voie. Le trajet que Camus a fait en quelques mois, les personnalistes mettront plusieurs ann¦es le parcourir. D’autres, il est vrai, mettront plusieurs dizaines d’ann¦es. Les personnalistes ont ¦t¦ des critiques r¦solus et parfois imprudents de la d¦mocratie repr¦sentative et de son personnel. Mounier n’a-t-il pas un jour parl¦ de la »pourriture parlementaire«37 ? La d¦mocratie personnaliste qu’il lui oppose reste floue. La confiance qu’ils mettent dans le peuple est ambiguÚ. La question institutionnelle n’int¦resse pas ces philosophes. Leur »antipodisme« doit beaucoup P¦guy et Proudhon. L’argent, en l’occurrence les matres de l’¦conomie capitaliste, les sp¦culateurs et les productivistes en tirent les ficelles. Camus n’a pas les mÞmes lectures l’¦poque, mais il a l’exp¦rience d’un militant puis d’un journaliste. La droite la plus r¦actionnaire ¦tait au pouvoir Alger et la gauche gouvernementale, en l’occurrence, un parti radical li¦ au lobby colonial y 33 34 35 36 37
Esprit, janvier 1948. Jacques Maritain, Esprit, mars 1933, p. 906. Nicolas Berdiaeff, Esprit, octobre 1932, p. 123. Op. cit. p. 133. Emmanuel Mounier, Esprit, mars 1934, p. 911.
50
Jeanyves Guérin (Paris)
tenait lieu d’opposition. Le r¦dacteur d’Alger r¦publicain se montre hostile aux professionnels de la politique, mais circonspect quand il s’agit de critiquer les dysfonctionnements de la d¦mocratie. L’¦ditorialiste de Combat critique les jeux des partis et le rúle de l’argent en des termes qui rappellent ceux de Mounier. C’est aussi un legs de Frenay qui ¦tait trÀs hostile aux partis. C’est aux radicaux, notamment Daladier et Herriot, que les deux hommes r¦servent leurs traits les plus ac¦r¦s. Ils leur imputent la faillite de la TroisiÀme R¦publique. Entre temps, il y a eu l’¦t¦ 40. L’¦v¦nement a abasourdi Camus, il n’a pas surpris Mounier. Tous deux, repr¦sentatifs en cela de la R¦sistance, appellent une r¦novation des institutions et une relÀve politique. D’o¾ l’importance qu’ils accordent l’¦puration et aux nationalisations qui sont, pour eux, autant de gages. AprÀs 1945, Mounier met une sourdine sa critique de la d¦mocratie. Jean Lacroix et lui parlent de d¦mocratie populaire. Camus tient, lui, la d¦mocratie comme une valeur. Il met une sourdine son anticapitalisme. Il n’est pas prÞt sacrifier la d¦mocratie la r¦volution socialiste. Sa perspective est r¦formiste parce que sa diachronie est courte: elle exclut les lendemains qui chantent. Esprit a eu des tendances pacifistes et combat r¦solument les nationalismes. Camus est sur les mÞmes positions. Cela l’amÀne, aprÀs la guerre, soutenir l’entreprise de r¦conciliation franco-allemande dans les mÞmes lieux que Mounier et surtout envisager l’unification europ¦enne dans une perspective f¦d¦raliste que les personnalistes, pour leur part, ont abandonn¦e38. L’essentiel est ailleurs. De 1946 1949, les personnalistes nouent un dialogue difficile avec les communistes. Camus est persuad¦ dÀs 1946 que le danger majeur, pour l’Europe, vient du communisme sovi¦tique et que le PCF est son instrument. Camus semble sinon avoir pris Esprit pour un bloc monolithique, du moins avoir mal appr¦ci¦ le long d¦bat qui s’y tient propos du communisme. On peut discerner trois positions: les id¦ologues, les d¦mocrates, les pragmatiques. Les premiers – Jean Lacroix, Paul Fraisse, Marc Beigbeder – voient dans les communistes des partenaires privil¦gi¦s et font la part belle l’analyse marxiste. Les seconds – Albert B¦guin, Henri Marrou, FranÅois Goguel –, au contraire, sont r¦ticents sur cette strat¦gie et sur les concessions qu’elle impose. Les troisiÀmes – Mounier, Domenach – s’efforcent de concilier les inconciliables. Les troisiÀmes, d’abord alli¦s des premiers, se rapprochent des seconds. Les personnalistes reprennent leur compte la critique des totalitarismes. L’antifascisme n’est pas un. Parce que le communisme stalinien l’a capt¦ ou a failli le capter, on oublie qu’il a exist¦ d’autres variantes que la variante communiste; l’une est catholique, l’autre lib¦rale-d¦mocratique. Camus ne se situe ni dans l’une ni dans l’autre. Esprit est antitotalitaire dans les ann¦es 1930, antianticommuniste dans les ann¦es 1946 – 1949 et antitotalitaire dans les ann¦es 38 Bernard Voyenne, Esprit, novembre 1948. Voyenne a collabor¦ au premier Combat.
Camus et la revue Esprit (1944 – 1976)
51
1970. Camus, de son cút¦, a ¦largi son antifascisme en antitotalitarisme dÀs la fin des ann¦es 1940. C’est ainsi qu’il faut lire Actuelles, La Peste et L’Homme r¦volt¦. De L’Êtranger La Chute en passant par La Peste et L’Êtat de siÀge, la pol¦mique antichr¦tienne est lisible. Son incroyance a ¦loign¦ Camus d’Esprit. Ses relations avec les chr¦tiens ont parfois ¦t¦ difficiles, mÞme si parmi les proches, il y a quelques catholiques convaincus, et d’abord ce Ren¦ Leynaud qu’il ¦rige en h¦ros m¦connu de la R¦sistance. Les faits sont l. õ Combat, aucun journaliste ne suit les questions religieuses. Si Bernanos est l’objet de remarques toujours ¦logieuses, Claudel fait les frais de la verve de Su¦tone, pseudonyme de Camus39. La controverse avec Mauriac propos de l’¦puration devient celle d’un incroyant et d’un chr¦tien, elle oppose le tenant de la justice celui de la charit¦ en croire Camus. Si on relit les textes, on peut voir qu’il n’en est rien. Le d¦saccord est d’abord politique40. Au mÞme moment, l’¦ditorialiste controverse avec L’Aube, il reproche son inertie Pierre-Henri Teitgen, d¦mocrate-chr¦tien devenu ministre de l’Information. On aurait pu penser qu’avec les chr¦tiens de gauche, les relations seraient plus faciles. Il y a chr¦tiens de gauche et chr¦tiens de gauche. Les uns sont des d¦mocrates convaincus: d¦Åus par le MRP, ils soutiennent MendÀs France en 1954 – 1955 et bien plus tard la DeuxiÀme Gauche; les autres, marxistes ou progressistes, sont destin¦s devenir tút ou tard les faire-valoir, les idiots utiles du parti communiste. Camus n’a pas vu que, dans les ann¦es 1950, les premiers, parmi lesquels se retrouvent les personnalistes, pouvaient Þtre ses alli¦s. C’est entre l’Esprit des ann¦es 1930 et le Camus de 1944 – 1945 que les convergences politiques sont les plus fortes. Dans les ann¦es 1950, les analyses se rapprochent sans vraiment confluer. Pour les personnalistes, Camus est un ¦crivain, ce n’est pas un philosophe. L’homme m¦rite le respect. Ce pourrait Þtre un compagnon de combat et un partenaire de d¦bat. Il n’a pas voulu l’Þtre. L’¦parpillement de la gauche antitotalitaire explique sa faiblesse face au progressisme marxiste. Le Th¦tre de l’Êquipe et Combat ont aid¦ Camus produire son œuvre dramatique et ses ¦ditoriaux. AprÀs cette date, il a manqu¦ l’essayiste de s’inscrire dans une communaut¦ d’intellectuels. Esprit aurait pu lui fournir le milieu fraternel et les alli¦s qui lui ont manqu¦. Il a mal perÅu le d¦bat dont la revue personnaliste fut le th¦tre et l’a vue comme un p¦riodique catholique politiquement sr.
39 Voir les entr¦es Bernanos et Claudel du Dictionnaire Albert Camus (Robert Laffont, coll. »Bouquins«, 2010). 40 Voir Jeanyves Gu¦rin, Camus. Portrait de l’artiste en citoyen, FranÅois Bourin, 1993, p. 43 – 62.
Christoph Kann (Düsseldorf)
Albert Camus – ein Cartesianer des Absurden?
1.
Methodischer und affektiver Zweifel
Der Mensch, sagt Camus, fordert von sich selbst, »nur mit dem zu leben, was er weiß, sich nur mit dem einzurichten, was ist, und nichts einzuschalten, was nicht gewiß ist«.1 Man mag entgegnen, dass nichts gewiss sei, aber auch das »ist immerhin eine Gewißheit«.2 Kaum zufällig fühlen wir uns an die emphatischen Gewissheitsansprüche des Descartes erinnert, dem es in den Meditationen um einen zweifelsfreien Neuaufbau allen Wissens geht und der in seiner Methodenschrift »alles bloß Wahrscheinliche für nahezu falsch« hält.3 Die erste Gewissheit aber, mit der wir nach Camus zu leben und in der wir uns einzurichten haben, ist nach gängiger Interpretation die Evidenz des Absurden, versinnbildlicht durch den sich auf immer ohne dauerhaftes Ergebnis abmühenden Sisyphos. »Das Absurde«, bemerkt Camus, »hat alle Anzeichen der Gewißheit.«4 Sein Motiv einer unermüdlichen Suche nach lebensstabilisierender Orientierung, die in der unhintergehbaren Gewissheit des Absurden an ihre Grenzen 1 A. Camus, Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde (=MS), Reinbek 1968 (zuerst 1959), 48. – Weitere Werke Camus’ werden hier nach folgenden Textausgaben zitiert: Licht und Schatten (=LS), in: Kleine Prosa (=KP), Reinbek 1973 (zuerst 1961), 29 – 71; Hochzeit des Lichts (=HL), in: Hochzeit des Lichts/Heimkehr nach Tipasa. Mittelmeer-Essays, Hamburg/Zürich 1988, 7 – 46; Christliche Metaphysik und Neoplatonismus (= CMN), Reinbek 1978; Tagebücher 1935 – 1951 (=TB), Reinbek 1997 (Neuausgabe; zuerst 2 Bd., 1963/1967); Der Mensch in der Revolte. Essays (=MR), Reinbek 2009 (zuerst 1969). 2 MS, 48. 3 R. Descartes, Von der Methode I, Hamburg 1960, 7. 4 TB, 111. In diesem Sinne thematisiert Turnher (2002), 300, das Absurde als »Ausgangsevidenz«. Affinitäten des Motivs einer Evidenz des Absurden zu dem cartesischen Rekurs auf einen evidenten Ausgangspunkt des Wissensaufbaus registriert Pieper (1990), 146, Anm. 18, wie folgt: »Camus hat Descartes sehr geschätzt, und ein wenig erinnert seine Suche nach einem Sinn, der vom Standpunkt des Absurden her nicht negiert werden kann, ohne daß er im Akt der Negation wieder bestätigt wird, an Descartes’ methodischen Rückgang auf ein unbezweifelbares Prinzip, dessen Gültigkeit nicht einmal unter der fiktiven Annahme eines den Menschen boshaft täuschenden genius malignus bestritten werden könnte.«
54
Christoph Kann (Düsseldorf)
stößt, lässt Camus’ Kennzeichnung als »Cartesianer des Absurden« durch Sartre auf den ersten Blick plausibel erscheinen.5 Camus selbst gibt mehrfach Hinweise auf Anknüpfungspunkte seines Denkens an Descartes’ Philosophie und Methodologie. Für ihn ist das Absurde »ein Ausgangspunkt, die Entsprechung, auf dem Feld der Existenz, von Descartes’ methodischem Zweifel. Das Absurde in sich selbst ist Widerspruch.«6 Bei genauem Hinsehen wird man Entsprechungen im Hinblick auf die cartesische Zweifelsbewegung wie auch auf das Cogito, ergo sum als einzige, die Grenzen jener Zweifelsbewegung markierende Erkenntnis wahrnehmen – und damit den Selbstwiderspruch des als universell angelegten Zweifels.7 Wie nach Descartes der Mensch sich in der Suche nach stabiler Erkenntnis immer wieder getäuscht sieht und letztlich noch auf keinem einzigen Gebiet seiner Wahrheitssuche zu definitiven Ergebnissen gelangen konnte, so ist nach Camus der Mensch in seiner Lebens- und Weltorientierung immer wieder und auf allen Gebieten mit der Erfahrung des Verfehlten, Vergeblichen, Sinnlosen konfrontiert. Wie Descartes als nicht mehr hintergehbare Einsicht das Cogito ausmacht, das zugleich die Grenzen möglichen Zweifels und den Ausgangspunkt für einen Neuaufbau des Wissens bildet, so stellt das Absurde bzw. die Erfahrung des Absurden eine auf alle menschlichen Sinneserwartungen beziehbare, selbst nicht mehr absurde Einsicht dar, die einerseits skeptische Grenzerfahrung ist und andererseits als Ausgangspunkt für die Reflexion auf Gründe und Implikationen jener Absurditätserfahrung fungiert. Descartes resümiert, dass er am Ende und als Resultat seines Ausbildungsweges in keinem Wissensbereich zu Erkenntnissen gelangt war, die der Stabilität des methodisch ermittelten Cogito als einziger definitiver Wahrheit gleichkommen würden. Analog entwirft Camus das Bild des Menschen, der an seinem Lebensende erkennen muss, »daß er Jahre damit verbracht hat, sich einer einzigen Wahrheit zu versichern«.8 Indem er anfügt, dass »eine einzige Wahrheit – wenn sie evident ist – genügt, um ein Dasein zu führen«,9 nähert er sich der cartesischen Auffassung an, dass die eine Wahrheit des Cogito evidente und hinreichende Prämisse für den Neuaufbau allen Wissens ist. So wie das Cogito des Descartes nicht nur Grenzen des Zweifels, sondern auch eine erste Gewissheit markiert, so markiert auch die Einsicht in die Absurdität zugleich die 5 Die bekannte Formulierung, die Turnher (2002), 300, als »sehr treffend« bezeichnet, findet sich in Sartre (1968), 103. Für Speck (1982), 135, ist die genannte Kennzeichnung insofern gerechtfertigt, als »das Absurde« für Camus »das einzig Gegebene« und »gleichsam das Apriori seines Philosophierens« darstelle; er wendet aber relativierend ein, dass das »Problem der Absurdität« lediglich der »Ausgangspunkt« von Camus’ Denken sei. 6 MR, 15. 7 Vgl. hierzu auch Pieper (1984), 108 – 110. 8 MS, 72. 9 Ebd.
Albert Camus – ein Cartesianer des Absurden?
55
Artikulation dieser Einsicht und weist damit über die Absurdität hinaus: »Das Absurde hat, wie der methodische Zweifel, Tabula rasa gemacht. […] Doch wie der Zweifel kann es, indem es zu sich zurückkehrt, einer neuen Forschung die Richtung weisen. Die Überlegung setzt sich dann in der gleichen Weise fort. Ich rufe, daß ich an nichts glaube und daß alles absurd ist, aber ich kann an meinem Ausruf nicht zweifeln, und zum mindesten muß ich an meinen Protest glauben. Die erste und einzige Gewißheit, die mir so im Innern der absurden Erfahrung gegeben ist, ist die Revolte.«10 Werden aber – jenseits der Parallelen von Zweifel und Absurditätserfahrung, von erster Gewissheit und Revolte – nicht auch Grenzen der Vergleichbarkeit beider Positionen sichtbar? Anders als bei Descartes ist mit Camus’ Gewissheitsanspruch, der sich in der Evidenz des Absurden manifestiert, kaum ein diskursiv zu ermittelndes, objektivierbares Ergebnis der gezielt und methodisch eingesetzten Vernunft angesprochen. Vielmehr überkommt uns die Evidenz des Absurden zuweilen spontan in der Form eines situativ unabweisbaren Gefühls: »Das Gefühl der Absurdität kann einen beliebigen Menschen an einer beliebigen Straßenecke anspringen. […] Alle großen Taten und alle großen Gedanken haben in ihren Anfängen etwas Lächerliches. Die bedeutenden Werke werden oft an einer Straßenecke oder in der Windfangtür eines Restaurants geboren. So ist es auch mit der Absurdität.«11 Das »Klima der Absurdität« erschließt sich nicht argumentativ, sondern affektiv ; es enthält Elemente des Fraglichwerdens vertrauter Verhältnisse, des Überdrusses und der Fremdheit im Bezug zu anderen oder zu sich selbst, des Sinnverlusts unseres Lebens im kleinen und im großen Maßstab.12 Camus’ Werke indessen vermitteln Eindrücke, die mit dem Bild uns anspringender Absurdität angesichts einer fragwürdig werdenden Lebenspraxis, mit Lächerlichkeit, Irritation und Düsternis, kaum zusammenpassen. Für das zu dem Absurden gleichsam komplementäre Motiv steht eine ästhetisierende Selbst- und Weltwahrnehmung, verknüpft mit wiederholten emphatischen Bekenntnissen der Liebe zum Leben, die in einer reichen Fülle suggestiver Begriffe wie »Sonne«, »Meer«, »Wärme«, und »Licht« Ausdruck findet. Vor allem der Lichtbegriff steht im Zentrum von Camus’ mediterran inspirierter Empfin10 MR, 17. 11 MS, 15 f. 12 MS, 16. Aus der Vielzahl von Untersuchungen, die sich dem Motiv bzw. dem Begriff des Absurden bei Camus widmen, sei neben diversen einschlägigen Beiträgen in Schlette (1975) exemplarisch hingewiesen auf Rath (1984) sowie auf die neueren Arbeiten von Foley (2008), 5 – 28, und Galle (2009), 53 – 64. Camus selbst stellt fest, dass man mit einer »vollständigen Aufzählung« der »Gefühle, die Absurdes zulassen«, das Absurde nicht erschöpfend erfasst habe; MS, 17, Anm. 1. Vgl. auch Walz (2007), 342, der dementsprechend am Vorliegen eines definitorischen klaren Begriffs des Absurden bzw. der Absurdität bei Camus zweifelt.
56
Christoph Kann (Düsseldorf)
dungswelt. Insofern ist zu berücksichtigen, dass das Motiv des Absurden, mag sich dieses in Camus’ Schriften auch variantenreich ausformuliert finden, keinesfalls eine Verabsolutierung erfährt,13 sondern nur als ein Moment innerhalb einer von Gegensätzen geprägten Konstellation auftritt: Im Zentrum von Camus’ philosophisch-literarischem Werk stehen »Grundantinomien des menschlichen Seins«,14 innerhalb derer das Absurde seinen spezifischen, aber auch relativen Ort hat. Aus diesen Anfangsbemerkungen ergibt sich das Spektrum der hier weiter zu behandelnden Fragestellung: In welchem Verhältnis stehen bei Camus die Motive des Absurden und des Lichts, wie lassen sich beide vermitteln und welchem ist Priorität zuzuschreiben? Wie verhält sich die nach der einen oder anderen Seite zu fixierende Priorität zu der Kennzeichnung Camus’ als »Cartesianer des Absurden«? Bevor ich auf dasjenige eingehe, was sich, komplementär zum Zentralmotiv des Absurden, als Lichtmotiv im Zentrum einer rhapsodischen Lichtmetaphysik kennzeichnen lässt, möchte ich vorbereitend Camus am Konzept einer cartesischen Philosophie der Subjektivität messen, um über Seitenblicke auf seine philosophiegeschichtlichen Prämissen schließlich auf die Leitfrage der Typisierbarkeit Camus’ als »Cartesianer des Absurden« zurückzukommen.
2.
Subjekt und Natur
Wenn man von einer cartesischen Philosophie der Subjektivität spricht, dann denkt man zunächst an die besondere, neuartige Weise, in der Descartes das erkennende Subjekt zum Thema philosophischer Reflexion gemacht hat. Das berühmte Cogito, ergo sum steht für den archimedischen Punkt des Neuaufbaus allen Wissens, für Grenzen möglichen Zweifels und für eine nicht mehr hintergehbare erste Erkenntnis. Allerdings wurde das Cogito auch zur Zielscheibe eines Antiintellektualismus, der geltend macht, dass die Denkbewegung, die durch das Cogito methodisch eingekreist und ermittelt wird, nur eine bestimmte Seite, einen isolierten Aspekt unseres Selbst erschließt, und dass wir in unserer Subjektivität mehr erfahren, als uns in Form distinkter Erkenntnisse bewusst wird. Aus dieser Sicht greift Subjektivitätsphilosophie grundsätzlich zu kurz, wenn sie sich auf die Reflexion diskursiven Denkens beschränkt und dabei jene Erfahrungsdimensionen ausblendet, die mit Gefühl, Ahnung oder Empfindung 13 Gegen entsprechende Einseitigkeiten der Camus-Rezeption wenden sich die nach wie vor maßgeblichen Arbeiten von Schlette (1975), 1 – 11 und 176 – 200. 14 So die prägnante Formulierung von Walz (2007), 338, der treffend hinzufügt: »Deshalb bewegt sich Camus von vornherein in einem Spannungsfeld von erfahrener Absurdität und Positivität des Lebens.«
Albert Camus – ein Cartesianer des Absurden?
57
zu tun haben. Folgt man der Perspektive einer entsprechend erweiterten Bestimmung von Subjektivitätsphilosophie, dann wird man Camus als einen Autor wahrnehmen, der weniger das erkennende als vielmehr das empfindende Subjekt zum Thema philosophisch-ästhetischer Reflexion macht.15 Betrachten wir also Camus als Subjektivitätsphilosophen in einem auf ästhetisches Empfinden konzentrierten Sinn, dann zeigt sich diese Typisierung in seinen Werken vielfältig bestätigt, etwa wenn er bekennt: »Es ist nicht leicht, der zu werden, der man ist, und die eigene Tiefe auszuloten. Beim Anblick aber der überdauernden Chenouaberge füllte mein Herz sich mit seltsam beruhigender Gewißheit. Ich lernte atmen, ich ordnete mich ein und erfüllte das eigne Maß.«16 Hier entfaltet sich Subjektivitätsphilosophie in autobiographischem Modus, und schon dieser Umstand lässt uns Camus in eine Traditionslinie nicht nur mit Descartes, sondern etwa auch mit Augustinus einordnen. Augustinus’ Confessiones, Soliloquia und Retractationes sind ebenfalls als Dokumente der Selbstfindung und Selbstwerdung, über Tiefen und Untiefen hinweg, anzusprechen.17 Die Formel »Werden, der man ist« – ein Motiv, das Camus aus Nietzsches Ecce homo bekannt gewesen sein dürfte18 – erscheint zunächst paradox und hat doch guten Sinn. Man kann aktuell werden wollen, was oder wer man latent bzw. dispositionell längst ist, woraufhin man angelegt ist; man ist aufgefordert, seine individuellen Möglichkeiten und Kräfte zu erkennen und zur Entfaltung kommen zu lassen. Wer sich in diesem Sinne selbst erkennen oder ermessen will, darf nicht oder nicht nur auf sich selbst schauen. Selbsterkenntnis impliziert Einordnungswissen. Camus jedenfalls blickt nach außen, in die Welt, er betrachtet die Berge. Wenn ihm das, wie zitiert, »beruhigende Gewissheit« gewährt, fühlen wir uns bereits an den Certismus des cartesischen Projekts erinnert, müssen aber differenzieren: Descartes gelangt zur Gewissheit des Erkennens – Camus gelangt zur Authentizität des Seins und Empfindens. Aktuell werden, der man dispositionell ist, kann man nur scheinbar für sich selbst. Die eigene Tiefe, das eigene Maß ergibt sich aus der Einordnung bzw. Zuordnung zu Äußerem, und das ist bei Camus die Natur, in der man wurzelt und deren Teil man selbst ist, die einen jedoch als Ganzes überdauert und die in ihrer Unermesslichkeit die eigene 15 In diesem Sinne stellt Kampits (1968), 12, fest, dass Camus’ Ausführungen »einem Seinsbezug von Mensch und Welt verhaftet bleiben, der vor jeder Erkenntnisrelation da ist […]«. 16 HL, 10 f. 17 Selbstwerdung über das Ausloten der eigenen Tiefe, so Camus’ Bild, macht der Roman Tiefe von H. Mankell (2004, dt. 2005) zum durchgehenden Topos – in düsterer Anschaulichkeit und Prägnanz. 18 Nietzsches philosophisch-autobiographische Spätschrift trägt den Untertitel »Wie man wird, was man ist«, der auf Pindars Satz »Werde, der du bist« (aus den Pythischen Oden II, 72 zurückgeht).
58
Christoph Kann (Düsseldorf)
verhältnismäßige Begrenztheit erkennen oder erspüren lässt.19 Sich einzuordnen heißt sich räumlich zu situieren – Camus spürt die »unerträgliche Größe des gluterfüllten Himmels« –, aber eben auch sich im zeitlichen Maßstab wahrzunehmen – er betrachtet (wie oben zitiert) die »überdauernden Chenouaberge«.20 Wer das Überdauern der Natur erkennt und anerkennt, wer die Gewissheit der erkannten und anerkannten Ordnungsverhältnisse als beruhigend erfährt, nähert sich dem Selbst- und Weltbild der Stoa an und damit ihrem Ideal eines Lebens in Einklang mit der Natur,21 ihrem Verständnis der Einordnung des Einzelnen in eine übergeordnete, vernunfthafte Konstellation, aus der sich nicht zuletzt die eigene Endlichkeit als natürliche Endlichkeit ergibt. Die Natur erweist sich als idealer Referenzpunkt für Camus’ Selbstwerdungsund Selbstverständigungsprozess, die Realisierung seiner Subjektivität und seiner Authentizität: »Alles hier läßt mich gelten, wie ich bin; ich gebe nichts von mir auf und brauche keine Maske: es genügt mir, daß ich geduldig wie schwierige Wissenschaft lerne: zu leben, die so viel wichtiger ist als alle die Lebenskunst der anderen.«22 Nichts Eigenes aufzugeben und keine Maske zu brauchen ist Anspruch für den, dessen Maßstab, wiederum im stoischen Sinn, nicht die anderen, die vielen, sind, sondern eben die Natur. Man ist nur dann ganz man selbst, wenn man sich erfährt als aufgehend in der Natur, dem integralen Ganzen. Camus empfindet und schildert, wie sein Blut »im gleichen Rhythmus pulste und dröhnte wie das mächtige allgegenwärtige Herz der Natur. Der Wind verwandelte mich in ein Zubehör meiner kahlen und verdorrten Umgebung; seine flüchtige Umarmung versteinerte mich, bis ich, Stein unter Steinen, einsam wie eine Säule oder ein Ölbaum unter dem Sommerhimmel stand.«23 So lässt die Natur Camus eine andersartige, höhere Einordnungsqualität erfahren als die soziale Umgebung, von der man sich, folgen wir stoischem (und epikureischem) Denken, möglichst zurückziehen sollte. Auch das Bild vom Lernen des Lebens, schwierig wie das Lernen von Wissenschaft, mutet stoisch an. Bei Seneca erfahren wir von den allmählichen Fortschritten seines Briefpartners Lucilius, der von ihm selbst, dem Mentor, Hilfe zur Selbsthilfe, erfährt und sich einem naturgemäßen Leben in produktiver Einsamkeit annähert. Wer die soziale Umgebung als Maßstab richtiger Lebensführung anerkennt, kann auf Masken an19 Zu Camus’ naturalistischem Sensualismus vgl. auch Pieper (1984), 66 ff., aus deren Sicht Camus »den Vorgang der Vereinigung des Menschen mit der Natur als einen Prozeß der Selbstauflösung, des Sichverlierens und Aufgehens im Kräftespiel des Kosmos« begreift (ebd., 68). 20 HL, 10 f. 21 Vgl. das Motiv des naturgemäßen Lebens (secundum naturam vivere) in Senecas Epistulae morales 5, 13, 16 und 41. 22 HL, 12 f. 23 HL, 17.
Albert Camus – ein Cartesianer des Absurden?
59
gewiesen sein, die ihm die Natur als Maßstab nicht abverlangt. Seine naturgemäße Rolle kann Camus auch ohne Maske spielen – sie lässt ihn positiv bilanzieren: »Und eben dies empfand ich: ich hatte meine Rolle gut gespielt. Ich hatte meine Menschenpflicht getan und hatte einen ganzen langen Tag in Freude verbracht; und war mir so auch nichts Ungewöhnliches gelungen, ich hatte doch ergriffenen Herzens jenem Lebenssinn gehorcht, der uns bisweilen befiehlt, glücklich zu sein. Wir finden alsdann die Einsamkeit wieder – und sind es zufrieden.«24 Camus’ Worte können als ästhetisierende Fortsetzung der stoischen Lebensphilosophie gelesen werden. Über die Natur als idealen Referenzpunkt des eigenen Selbstwerdungs- und Selbstverständigungsprozesses äußert sich Camus am eindringlichsten in den Essays von Licht und Schatten und Hochzeit des Lichts, die durchzogen sind von Impressionen des Lebenssinns, des Erfülltseins und des Glücks. Beide Werke versprechen Aufschluss in der Frage, ob Camus im Sinne einer die Rezeption dominierenden Kennzeichnung als Denker des Absurden bzw., wie Sartre zuspitzend sagt, als »Cartesianer des Absurden« anzusehen ist, oder aber, wofür hier argumentiert werden soll, eher als Protagonist einer Empfindsamkeit für Sonne, Meer, Wärme, Leben und Licht, also eines ästhetisierenden, oft verklärenden Naturbezugs und letztlich einer »Welt- und Naturbejahung«.25 Zur Verdeutlichung einer entsprechenden Typisierung ist primär auszugehen von dem Werk Licht und Schatten.
3.
Licht und Schatten
Die frühe Essay-Sammlung Licht und Schatten entstand 1935 – 36 und wurde 1937 in Algerien veröffentlicht. Nachdem die kleine Erstauflage schnell vergriffen war, lehnte Camus eine Neuauflage lange Zeit ab. Der Grund lag in vermeintlichen Unzulänglichkeiten oder Mängeln, die Camus nur andeutet, wenn er Licht und Schatten 1958 im Vorwort zu der dann endlich doch realisierten Neuauflage eine Schwerfälligkeit der Form vorwirft.26 Auch in anderen seiner Werke nimmt Camus Mängel wahr, aber die von Licht und Schatten bedrücken ihn besonders. Hier nämlich geht es um Inhalte, die ihm, »am meisten am Herzen liegen«, da dieses Werk für ihn »einen bedeutenden Wert als Zeugnis« besitzt.27 Camus gibt eine Begründung, die autobiographische Dia24 HL, 15. 25 Walz (2007), 340. Vgl. in diesem Sinne auch Camus’ Tagebuchnotiz vom Mai 1935 (TB, 30): »Sich nicht von der Welt lossagen. Man kann sein Leben nicht verfehlen, wenn man es ins Licht stellt.« 26 LS, 30. 27 Ebd.
60
Christoph Kann (Düsseldorf)
gnose sein will aber doch darüber hinausweist, insofern sie Elemente einer Theorie bzw. eines Psychogramms des Künstlers bietet: »Jeder Künstler besitzt nämlich in seinem tiefsten Inneren eine einzige Quelle, die ein Leben lang speist, was er ist und was er sagt.«28 Deutlich skizziert Camus das Bild von der Leitidee, die ein künstlerisches (und philosophisches) Werk als Ganzes durchzieht, es in annähernd naturalistischem Sinne am Leben hält, und spitzt dieses Bild dann autobiographisch zu: »Aber zum Schluß haben meine Fehler, meine Unwissenheit und meine Treue mich immer wieder auf jenen alten Weg zurückgeführt, den ich mit Licht und Schatten zu bahnen begonnen habe, dessen Spuren sich in allem finden, was ich später schuf […]«.29 In der Geistesgeschichte finden sich kaum eindeutigere autobiographische Bekenntnisse zur eigenen Leitidee, zum eigenen Schlüsselwerk als bei Camus: »Wenn es mir […] nicht eines Tages gelingt, Licht und Schatten nochmals zu schreiben, werde ich mein Leben lang nichts erreicht haben […].30 Die essentielle Bedeutung des in Licht und Schatten und ähnlich in Hochzeit des Lichts entwickelten lebensbejahenden Lichtmotivs kommt nicht zuletzt in Camus’ Nobelpreisrede (1957) zum Ausdruck: »Ich habe nie vermocht, auf das Licht zu verzichten, das Glück des Seins, das freie Leben, in dem ich aufgewachsen bin.«31 Camus bezieht sich auf jenes Licht und seine Assoziationen in unterschiedlichsten Zusammenhängen, vor allem aber da, wo er die Atmosphäre der Städte, Landschaften und Strände seiner algerischen Heimat vermitteln will. Dabei lässt die autobiographische Reflexion immer wieder erkennen, dass ihm Licht mehr bedeutet als eine stimmungsvolle ästhetische Kulisse. Wenn das Licht nicht nur metaphorisch das »freie Leben«, sondern auch das »Glück des Seins« repräsentiert, erfährt es eine hedonistisch verstärkte existentielle Bedeutung im Sinne einer Lichtmetaphysik, wie sie in der Geistesgeschichte seit alters her ihre Vorbilder findet. Bereits im vorplatonischen Denken, etwa bei Heraklit und Parmenides, stehen sich Licht und Finsternis als zwei komplementäre Wirklichkeiten gegenüber, die, sich jeweils negierend, zugleich aneinander gebunden 28 LS, 31. Vgl. auch TB, 18, wo Camus in Ausführungen vom Januar 1936 zu einer »[e]rsten Formulierung der Themen von Hochzeit des Lichts« (Anm. des Herausgebers) gelangt. 29 LS, 38. 30 LS, 39. Mit guten Gründen hat die Interpretation auch andere Leitideen in Camus’ Werk nennbar gemacht. Exemplarisch sei auf Welt und Revolte verwiesen, die Schlette (1980) als Brennpunkte hervorhebt. Doch abgesehen davon, dass diese wiederum von Hengelbrock (1982), 15, als »Endprodukte einer Reflexion« bezeichnet und entsprechend als genuine Leitideen Camus’ (im Sinne von »einfachen und großen Bildern«; ebd., 14) relativiert werden, kann sich die hier vorgeschlagene Alternative, Licht und Schatten als Leitideen zur Geltung zu bringen, deutlicher auf Camus’ eigenes Selbstverständnis berufen. Vgl. in diesem Sinne auch Trageser-Rebetez (1995), 11, die »Licht« und »Schatten« als »Schlüsselbegriffe«, als »die Quintessenz seines Fühlens und Denkens«, betont; zu einer Bestandsaufnahme der Forschung unter dieser Perspektive vgl. ebd., 12 – 15. 31 KP, 9.
Albert Camus – ein Cartesianer des Absurden?
61
und aufeinander verwiesen sind. Die Einsicht in diese Konstellation ist in Camus’ Werk überall greifbar – zwar kaum im Modus der systematischen Ausgestaltung, aber doch als durchgängiges, eigenständig ausgeprägtes Motiv.32 Die Leitidee unseres Autors wird also repräsentiert durch Licht und Schatten. »Ich weiß, daß meine Quelle sich in Licht und Schatten befindet, in jener Welt der Armut und des Lichtes, in der ich lange Jahre gelebt habe […].«33 Camus fühlt sich »halbwegs zwischen das Elend und die Sonne gestellt«: Für ihn konnte die Armut nicht zum Unglück werden, denn »das Licht breitete seine Schätze über sie aus«,34 und selbst »meine Auflehnung« wurde von diesem Licht erhellt, d. h. gleichsam stimuliert und zur Wirksamkeit gebracht.35 Camus verortet sich, sein Künstlerleben, zwischen die Pole des Elends, das ihn hinderte zu glauben, »daß alles unter der Sonne und in der Geschichte gut sei«, und der Sonne selbst, die ihn lehrte, »daß die Geschichte nicht alles ist«.36 Damit ist ein grundlegender Antagonismus formuliert, der Camus’ Weltbild ebenso prägt wie sein Verständnis künstlerischen Schaffens: Kunst kann es für ihn nicht geben ohne ein »Ablehnen und ein Bejahen«,37 also das Urteil, das ihn sich selbst einordnen lässt in jene natürliche Konstellation des Elends und der Sonne, die ihn überhaupt erst zum Künstler werden ließ. Doch ist Camus’ ästhetisch beschworene Lichtempfindung letztlich nie eindeutig und ungebrochen, sondern zugleich auf ihr Gegenteil verwiesen: »Der wahre Mut besteht immer noch darin, die Augen weder vor dem Licht noch vor dem Tod zu verschließen. Wie kann man überhaupt das Band beschreiben, das diese verzehrende Liebe zum Leben mit jener geheimen Verzweiflung verknüpft?«38 Hier kommt nicht nur ein einzelnes Prinzip, das Licht, zur Sprache, sondern dichotomisches Denken, ein Denken in Antagonismen. Wiederholt kontrastiert Camus Licht und Tod, Lebensgier und Todesangst, Fluch und Seligkeit, Licht und Schatten, Licht und Armut, Sonne und Elend, die »Wahrheit der Sonne, die auch die Wahrheit meines Todes sein wird«.39 Seine Antagonis32 33 34 35
36 37 38 39
Zur ideengeschichtlichen Tradition der Lichtmetaphysik vgl. Bremer (1973). LS, 31. Ebd. Die Formulierung des Originals lautet »mes r¦voltes«. Erläuternd spricht Camus von der Auflehnung »im Namen aller Menschen, damit das Leben aller Menschen ins Licht erhoben werde« (ebd.). In der deutschsprachigen Rezeption hat sich das Wort »Revolte« als Kennzeichnung eines Lebensentwurfs, der gegen die behauptete Absurdität der menschlichen Existenz aufbegehrt, terminologisch verfestigt. Wie die von Camus gelegentlich (wie hier) verwendeten Pluralformen mit der Kennzeichnung »Revolte« harmonieren, wäre Gegenstand einer eigenen Untersuchung. Zum Begriffsfeld »Auflehnung« und »Revolte« (sowie »Revolution«) vgl. auch Bollnow (1975), 267 – 269. LS, 31. Ebd. LS, 71. HL, 12.
62
Christoph Kann (Düsseldorf)
men bedeuten Spannung und Konflikt, zugleich Balance im Wechselspiel von Gegensätzen: »Der Trost dieser Welt besteht darin, daß es kein unaufhörliches Leiden gibt. Ein Schmerz vergeht, und eine Freude entsteht. Sie halten sich die Waage. Diese Welt ist ausgeglichen.«40 Selbst das Absurde ist kein Absolutes, sondern geht auf im antagonistischen Grundmuster : »Glück und Absurdität entstammen ein und derselben Erde. Sie sind untrennbar miteinander verbunden.«41 Der ursprüngliche und zentrale Antagonismus, fixiert in dem Titel des gleichnamigen Schlüsselwerks, ist der von Licht und Schatten. Gegen Ende von Licht und Schatten heißt es: »Wer bin ich und was kann ich anderes tun, als auf das Spiel der Blätter und des Lichts eingehen? […] Wenn ich versuche, zu mir selbst zu gelangen, vermag ich es nur in der Tiefe dieses Lichts. Und wenn ich versuche, diese zarte Köstlichkeit zu verstehen und zu kosten, die das Geheimnis der Welt preisgibt, finde ich auf dem Grund des Weltalls mich selbst. Mich selbst, das heißt diese überwältigende Empfindung, die mich von allem Beiwerk befreit.«42 Der Befreiungsprozess, der Camus zu sich selbst gelangen lässt, ist gebunden an eine Empfindung des Substantiellen, Wesentlichen, die das Akzidentelle, Beiläufige abstreift. Während die Anfangsworte unseres Zitats, »Wer bin ich«, noch an die Reflexion des Cartesianers denken lassen, nähert sich Camus einer Antwort auf die gestellte Frage, indem er die vorrationale Ebene betont. Die Versuche »zu verstehen und zu kosten« zielen nicht auf intellektuelles Nachvollziehen, sondern kreisen um Dimensionen des Empfindens. Ist das hier skizzierte Camus-Bild einseitig, weil es die frühen Essays Licht und Schatten zu sehr in den Vordergrund rückt? Die autobiographische Selbsteinschätzung, wonach gerade dort die Quelle liegt, aus der sich Camus’ Werk lebensgeschichtlich speist, durchzieht mehr oder weniger alle seine Hauptwerke. Auch die späten Essays Der Mensch in der Revolte münden in visionären Reflexionen, in denen die Motive der Frühschriften ihre bruchlose Fortsetzung finden: Das »mittelmeerische Denken«, das »Sonnendenken«, lässt die »Mediterranen immer im gleichen Licht« leben – »[i]m Lichte bleibt die Welt unsere erste und letzte Liebe.«43 Camus’ Welt ist immer wieder eine Welt des Lichts, der Lichtempfindung. Doch wo zeigt sich der Übergang von Lichtempfindung zur Lichtmetaphysik?
40 41 42 43
TB, 271 f. MS, 100. LS, 70. MR, 335, 338 f., 344. Zum »mittelmeerischen Denken« vgl. Bousquet (1977).
Albert Camus – ein Cartesianer des Absurden?
4.
63
Immanenz und Transzendenz
Auch in die einfühlsame Schilderung des algerischen Sommers lässt Camus sein Gewissheitsmotiv einfließen: »Sich einem Lande verbunden zu fühlen, einige Menschen zu lieben und zu wissen, dass es einen Ort gibt, wo das Herz seinen Frieden findet – lauter Gewißheiten, die viel für das Leben eines Menschen bedeuten, obschon man sich damit zweifellos nicht begnügen kann.«44 Camus’ lebensbedeutsame Gewissheiten sind freilich den rationalistischen Gewissheiten des Descartes nicht gleichzusetzen. Die Gewissheiten des Cogito, die als archimedischer Ausgangspunkt des Wissenschaftsneuaufbaus dienen mögen, aber kaum der außerwissenschaftlichen Praxis, sind dem Existenzphilosophen Camus zu puristisch, weltabgewandt und intellektualistisch, um lebensbedeutsam zu sein. Lebensbedeutsame Gewissheiten haben gegenüber den wissenschaftlich-philosophischen Gewissheiten des Descartes einen anderen epistemischen Status: Wissenschaftlich-philosophische Gewissheiten sind von propositionaler Struktur. Lebensbedeutsame Gewissheiten müssen einer propositionalen Form nicht zugänglich sein bzw. können und wollen dies nicht, sie werden gespürt, sie werden nicht argumentativ, sondern intuitiv gewonnen und abgesichert, sie sind Sache des Gefühls, der Empfindung. Wenn aber Camus feststellt, dass »man sich damit zweifellos nicht begnügen kann«, scheint er die Einfachheit seiner lebensbedeutsamen Gewissheiten als Unzulänglichkeit bzw. Defizit zu empfinden. Kann das die Valenz und Reichweite jener Gewissheiten beeinträchtigen? Camus bekennt, »vom Leben selber« nicht mehr zu wissen, »als was voll Ungeschicklichkeit in Licht und Schatten steht«.45 Die Rede von Gewissheiten, mit denen man sich »zweifellos nicht begnügen« kann, suggeriert jedenfalls die Frage, was wir erwarten dürfen, d. h. wie jener Raum zu füllen ist, in den die Gewissheiten des Lebens nicht ohne weiteres hineinreichen. Scheinbar beiläufig konfrontiert uns Camus schon im nächsten Satz von Licht und Schatten mit seiner Metaphysik: »Und doch sehnt sich der Mensch zu gewissen Zeiten mit allen Fibern nach dieser Heimat seiner Seele. ›Ja, dorthin müssen wir zurückkehren.‹ Und ist es denn so erstaunlich, daß man diese Vereinigung, die Plotin ersehnte, hier auf Erden findet? Hier verkünden die Sonne und das Meer diese Einheit.«46 44 HL, 31. 45 LS, 37 (Vorwort 2. Aufl.). 46 HL, 31. Vgl. Joisten (2003), 247, die feststellt, dass Camus an der vorliegenden Textstelle seine »eigenen Gewißheiten« denjenigen »einer neuplatonisch-christlichen Ausdeutung der Welt« gegenüberstelle. Der Kontrastpunkt zum Neuplatonismus indessen scheint in erster Linie in Camus’ eigener Auffassung davon zu bestehen, was unter der »Heimat der Seele« zu verstehen bzw. wo diese zu verorten sei. Wenn Camus von »Gewissheiten, die viel für das Leben eines Menschen bedeuten« spricht, muss dies nicht gegen Plotin gerichtet sein, sondern
64
Christoph Kann (Düsseldorf)
Das Bild der Heimat der Seele ist ein platonisch-neuplatonisches Motiv, das Camus vor allem von seiner intensiven Beschäftigung mit Plotin her kannte. Das dritte Kapitel seiner Examensschrift Christliche Metaphysik und Neoplatonismus, »Die mystische Vernunft«, beschäftigt sich bekanntlich mit Plotins Enneaden und beansprucht programmatisch, »die Bedeutung und die Rolle der neuplatonischen Lösung in der Entwicklung der christlichen Metaphysik zu bestimmen«.47 Im Rahmen der theologischen Ausrichtung des Neuplatonismus wird aus der Rückkehr der Seele in ihre angestammte Heimat – ein aus Platons Phaidon her vertrautes Motiv – der erkennende Aufstieg zu Gott. Wie geht Camus nun mit diesem Motiv um? Was ihm aus der neuplatonischen Philosophie als transzendenter, die Erfahrung übersteigender Vorgang geläufig ist, will er umdeuten zu einem sich von metaphysischer Letztbegründung distanzierenden, immanenten und insofern die diesseitige Erfahrung aufwertenden Vorgang. Der Suchweg zurück zur Heimat seiner Seele ist ein Grundmotiv in Camus’ entschieden anthropologisch-anthropozentrischem Denken.48 Demnach beschäftigt jener Suchweg den Menschen nicht akzidentell als ein Vorgang unter anderen, sondern ist ihm im Sinne einer essentiellen conditio humana vorgegeben: »Der Mensch erfüllt nur dort die Möglichkeiten seines Mensch-seins, wo er eine Heimat hat, auf die er sich sehnend ausrichtet.«49 Camus greift in dem erwähnten Kapitel »Die mystische Vernunft« das Heimat-Motiv mehrfach auf und gelangt zu vier zentralen Aussagen: (1) »[…] das Eine erkennen heißt in seine Heimat zurückkehren.« (2) »Nicht die Erscheinung sucht Plotin, sondern vielmehr jene Rückseite der Dinge, die sein ›verlorenes Paradies‹ ist. Und jedes Ding hienieden wird zur lebendigen Erinnerung an diese ferne Heimat des Weisen.« (3) »Die Seele ist Verlangen nach Gott und Sehnsucht nach einer verlorenen Heimat.« (4) »Man […] muß zurückkehren in jene Heimat, deren Erinnerung bisweilen die Rastlosigkeit unserer Seele erhellt.«50 Zurecht kann jene verlorene und dennoch existenziell präsente Heimat als »Ziel- und Fluchtpunkt menschlichen Strebens« angesehen werden, den Camus aus dem
47 48 49 50
kann den Anti-Intellektualismus der französischen Gegenwartsphilosophie ausdrücken, der sich immer wieder gegen die cartesischen Gewissheitsansprüche artikuliert hat. In diesem Sinne betont bereits Kampits (1968), 44, eine durch die »erstaunliche Parallele« des Gewissheitsmotivs verdeckte Differenz der »existentiellen Gewißheit« Camus’ und der rationalistischen Gewissheit des Cartesianismus. CMN, 100. Zu Camus’ Examensschrift vgl. die differenzierten Studien von Schlette (1975), 329 – 340, und Lauble (1979). Zu dem Topos einer »Heimat der Seele« vgl. Joisten (2003), zu dessen Präsenz bei Camus (Joisten identifiziert und erörtert vier Vorkommnisse des Wortes »Heimat« in Camus’ Examensschrift) vgl. ebd., 242 – 250. Joisten (2003), 237. Die Zentralstellen (1) bis (4) finden sich in CMN, 77, 78, 90 und 94.
Albert Camus – ein Cartesianer des Absurden?
65
Neuplatonismus bzw. aus dessen Transzendenzlehre gewinnt und in seine anthropozentrische Konzeption bzw. in seine eigene Immanenzlehre umdeutend übernimmt, wobei vier unterschiedliche Momente jenes Heimatmotivs – Rückkehr, Erinnerung, Verlangen bzw. Sehnsucht und Unterwegssein – spürbar bleiben.51 Über die alten Griechen urteilt Camus: »Ihr Evangelium lautete: Unser Reich ist von dieser Welt.«52 Dasselbe Motiv greift er, sich vom Christentum distanzierend, in seinen Tagebüchern wieder auf: »Ich bin glücklich in dieser Welt, denn mein Reich ist von dieser Welt.«53 Camus’ Bekenntnis zur diesseitigen Welt steht im Zentrum seines Philosophierens und bleibt bestimmend für seine Weltund Selbstwahrnehmung: »Ich lerne, daß es kein übermenschliches Glück gibt und keine Ewigkeit außer dem Hinfließen der Tage.«54 Deutlicher kann man seine Auffassung der Immanenz, der eigentlichen Beheimatung der Seele in der zeitlichen Welt, auf der Erde und in der Natur, nicht zum Ausdruck bringen. Camus als Philosoph der Immanenz weist die Transzendenzorientierung eines Plotin weniger zurück, als dass er sie umdeutet und transformiert. Wenn Camus fragt, ob es denn »so erstaunlich« sei, dass die von Plotin »ersehnte« Vereinigung der Seele mit ihrer ursprünglichen Einheit auf der Erde, also weltimmanent, zu finden und zu erreichen sei,55 weist er hin auf die besondere Bedeutung von Sonne und Meer, welche diese Einheit unserer Seele mit ihrer Heimat gleichsam verkünden. Es ist eine Einheit, die sich, wie es im nächsten Satz heißt, »[d]em Herzen offenbart«, also der Intuition im Gegensatz zur argumentierenden, diskursiven Vernunft. Letztlich ist wohl am treffendsten von einem »betonte[n] Immanentismus«56 oder, komplementär dazu, von »Camus’ Abkehr von einer transzendent-übermenschlichen Dimension« und einer »Hinwendung zum diesseitigen Erfahrungsraum des Menschen«57 zu sprechen. Denn die metaphysische Ewigkeit Plotins wird ersetzt durch die erfahrene Zeitlichkeit erlebter Tage; das übermenschliche Glück wird zurückgewiesen zugunsten des menschlichen, erfahrenen Glücks, eines Glücks eben von dieser Welt. Dem 51 52 53 54 55 56
Vgl. Joisten (2003), 238 und 246. CMN, 24 f.; vgl. ebd., 37 f. TB, 18. HL, 31. HL, 31. Lauble (1978), 19; hier zeigt sich auch die Fragwürdigkeit bzw. die Grenze der Analogie, die Pieper (1990), 142, zwischen dem platonischen Aufstieg des Menschen aus der Höhle bzw. der neuplatonischen Vereinigung mit seinem ideellen Ursprung einerseits und der Hingabe des Menschen an die Natur sowie der »Vereinigung mit einem geliebten Menschen« andererseits zieht: die transzendierende und die immanent bleibende »Identitätsfindung« (ebd.) sind trotz des gemeinsamen Moments der »Selbstentgrenzung« (ebd., Anm. 12) jedenfalls zu unterscheiden. 57 Joisten (2003), 239.
66
Christoph Kann (Düsseldorf)
transzendenten Glück und der transzendenten Ewigkeit werden weltimmanentes Glück und weltliche Dauer gegenübergestellt. Der Antagonismus von Transzendenz und Immanenz verdankt sich bei Camus konsequenterweise keiner philosophischen Reflexion, sondern dem Lernen (»ich lerne«), der gewonnenen Erfahrung, und der ästhetisch empfundenen Wirklichkeit. Auch hier lässt sich stoisches Denken wiederfinden: Camus betrachtet den Menschen als zielstrebig Fortschreitenden, als proficiens auf dem Weg zum selbstgenügsamen Erkennen des Diesseitigen: »Ja, der Mensch ist sein eigenes Ziel. Und er ist sein einziges Ziel. Wenn er etwas sein will, dann nur in diesem Leben«.58 Deutlich, auch verächtlich, wendet sich Camus gegen das verstiegene Pathos des Transzendenzdenkens, denn wirklich bedeutsam scheint ihm nur das unmittelbar Erlebbare: »Diese lächerlichen und zugleich wesentlichen Gaben und diese so bedingten Wahrheiten sind die einzigen, die mich erschüttern. Die anderen ›idealen‹ Wahrheiten zu begreifen, fehlt es mir an Seele. Ich behaupte nicht, daß man zum Tier werden soll, sondern nur, daß ich am Glück der Engel keinen Geschmack finde. Ich weiß nur dies: daß der Himmel länger dauern wird als ich. Und was soll ich ewig nennen außer den Dingen, die meinen Tod überdauern? Ich rede hier nicht einer billigen Zufriedenheit des Geschöpfes mit seinem Zustand das Wort. Das ist etwas ganz anderes. Es ist nicht immer leicht, ein Mensch zu sein, und erst recht nicht ein reiner Mensch. Rein sein aber heißt, jene Heimat der Seele wiederfinden, wo wir uns dieser Welt verwandt fühlen, wo das Blut in unsern Adern im gleichen Rhythmus pocht wie der glühende Puls der Mittagssonne.«59 Die Transzendenzorientierung der neuplatonischen Philosophie ist für Camus nicht Gegenstand einer philosophisch-argumentativen Zurückweisung. Sie ist Gegenstand eines empfundenen Ungenügens, sie beeindruckt ihn nicht, sie berührt ihn nicht einmal, sie verfehlt seinen »Geschmack«. Eine Heimat der Seele ist aus seiner Sicht nicht im spekulativen philosophischen Systembau zu finden, wie der Neuplatonismus ihn anbietet, sondern da, wo sie empfunden und gefühlt werden kann, und zwar in jenen Kategorien der Einheit und Einstimmigkeit, wie sie insbesondere in der stoischen Naturphilosophie entwickelt wurden. Ist es unter diesen Voraussetzungen überhaupt gerechtfertigt, bei Camus von Metaphysik, insbesondere einer Lichtmetaphysik zu sprechen? Nicht unbegründet, aber doch allzu plakativ wurde Camus eine »Abkehr von jeder metaphysischen Spekulation« mit ihrem »unehrliche[n] Illusionismus« nachgesagt.60 Programmatische Abkehr von Metaphysik, sei es einer bestimmten Version oder von Metaphysik überhaupt, heißt nicht zwangsläufig, dass man Metaphysik 58 MS, 75. 59 HL, 31 f. 60 Jeschke (1958), 465.
Albert Camus – ein Cartesianer des Absurden?
67
tatsächlich hinter sich gelassen hat. Die Konzentration auf immanente metaphysische Prinzipien bedeutet keine Abkehr von jeder Metaphysik. Camus verwendet einen weiten, unspezifischen Metaphysikbegriff, wenn er von einer »Welt der Eifersucht, des Ehrgeizes, des Egoismus oder des Großmuts« spricht und erklärt: »Eine Welt – das heißt: eine Metaphysik und eine Geisteshaltung.«61 Inwiefern nun kann er einerseits mit einer Abkehr von den spezifischen Ansprüchen einer Transzendenzmetaphysik und andererseits, wie beiläufig angemerkt, mit der Tradition von Lichtmetaphysik identifiziert werden? Hinweise sind aus einem Einblick in eine wesentliche Verzweigung jener Tradition zu gewinnen:62 Das aristotelische Denken ist geprägt durch die Reduktion des Licht-Dunkel-Antagonismus auf dessen eine, eigentliche Seite, das Licht, dem das Dunkel nicht als selbständige, positiv zu fassende Wirklichkeit, sondern, im Sinne eines bloß Negativen oder Privativen, als Mangel oder Fehlen des Lichts, gegenübergestellt wird. Die platonische Lichtmetaphysik indessen bedient sich des Vorstellungsrahmens eines ideellen, geistigen Lichts, das als transzendentaler Seins- und Erkenntnisgrund von dem sinnenfälligen Licht als nachrangigem, abgeleitetem Phänomen unterschieden wird. Begreift man nun die Geschichte der Lichtmetaphysik (unter Zurückstellung näherer Differenzierungen) als zweigeteilte, von einem Privations- und einem Transzendenzmotiv geprägte Entwicklungslinie, die in je eigener Weise von der ursprünglichen Auffassung einer anschaulichen Präsenz der beiden symmetrischen Wirklichkeiten Licht und Dunkel wegführt, dann ist Camus als ein Autor zu lesen, der die beschriebene metaphysische Distanzierung von jener unmittelbaren anschaulichen Präsenz wiederum rückgängig macht. Für ihn ist das Licht keine jenseitige, sondern eine diesseitige Wirklichkeit, der das Dunkel bzw. der Schatten nicht negierend oder privativ nachgeordnet ist, sondern als gleichursprüngliches, gleichwirkliches Pendant gegenübersteht – eben in der Weise, in welcher Licht und Schatten in der vorphilosophischen Anschauung als komplementäre Phänomene unmittelbar präsent sind. Schreibt man Camus dennoch eine latente oder rhapsodische Lichtmetaphysik zu, dann in dem Sinne, dass er die Erfahrung von Licht und Schatten als omnipräsente und unmittelbare Empfindungsdaten, letztlich als Grundmodi unseres Weltbezugs, zur Geltung bringt. Die empfundene Symmetrie von Licht und Schatten, die sich bereits in Nietzsches »Nachgesang« zu Jenseits von Gut und Böse visionär angedeutet und zu der
61 MS, 15. Zu der letztlich aporetischen Forschungsdebatte seiner Haltung zur Metaphysik findet sich bei Camus (TB, 271) selbst eine aufschlussreiche Antwort: »Es ist […] lächerlich, zu fragen: ›Ist Metaphysik möglich?‹ Die Metaphysik ist.« 62 Vgl. Bremer (1973), 22 – 27.
68
Christoph Kann (Düsseldorf)
bekannten Hochzeits-Metapher versinnbildlicht findet,63 hat in Camus’ Hochzeit des Lichts ihren vielleicht prägnantesten Ausdruck gefunden.
5.
Gewissheiten des Empfindens – Camus’ »Lieblingsphilosophie«
Kann Camus, so unsere Eingangsfrage, als »Cartesianer des Absurden« gelten? Subjektivitätsphilosophie artikuliert sich bei Camus als ein Ansatz, der weniger das Erkennen als vielmehr das Empfinden des Subjekts zum Thema macht. Camus kann somit unter der Voraussetzung als Cartesianer gelten, dass seine Gewissheiten nicht Gewissheiten des Erkennens, sondern eben des Empfindens sind. Gewissheiten des Empfindens fehlt es aber gerade an jener Art von Eindeutigkeit und Alternativlosigkeit, die wir mit Gewissheiten des Erkennens im cartesischen Sinne verbinden. Gewissheiten des Empfindens sind von jener Ambivalenz, die in Camus’ diversen Dichotomien, geradezu Kippbildern des Empfindens, repräsentiert durch Licht und Schatten, zum Ausdruck kommt, während das cartesische Cogito sich dadurch auszeichnet, dass seiner Gewissheit (schon aus logischen Gründen) nicht eine antagonistische Gewissheit gegenüberstehen kann. Aber was ist das primäre Datum von Camus’ Gewissheiten des Empfindens? Seine autobiographische Positionierung verweist auf Licht und Schatten. Dem Licht gegenüber steht der Schatten, stellvertretend für eine Vielzahl von Dichotomien oder Antagonismen in Camus’ Denken. Zugleich ist seine Lichtmetaphysik geprägt von programmatischer Absage an jede Transzendenz und ihre richtungweisende, stabilisierende Wirkung. Das macht die ästhetische Erfahrung von Sonne und Licht anfällig für ein kontingentes, situatives Umschlagen in die Erfahrung des Absurden. Stellt man die Frage nach dem Eigentlichen, Primären, dann ist man nach Camus’ Selbstwahrnehmung auf das Licht als die genuine Quelle, das leitmotivische Thema seines Schaffens verwiesen. Im letzten Kapitel von Der Mythos von Sisyphos lesen wir : »Ohne Schatten gibt es kein Licht;«64 spontan möchte man erwidern: Ohne Licht gibt es keinen Schatten. Das Licht findet sich bei Camus aufgewertet zum Gegenstand, zur Quelle sowie zur Bedingung der Möglichkeit des ästhetischen Empfindens, die uns in spezifischem Sinn von einer Lichtmetaphysik als zentralem Topos in Camus’ Denken sprechen lässt. 63 F. Nietzsche, »Aus hohen Bergen. Nachgesang«, in: Jenseits von Gut und Böse (Kritische Studienausgabe v. G. Colli/M. Montinari, Bd. 5, 243): »Freund Zarathustra kam, der Gast der Gäste! Nun lacht die Welt, der grause Vorhang riss, Die Hochzeit kam für Licht und Finsterniss …« 64 MS, 101.
Albert Camus – ein Cartesianer des Absurden?
69
Die Kennzeichnung Camus’ als »Cartesianer des Absurden« erweist sich demnach in zweierlei Hinsicht als fragwürdig: Insofern ein Charakteristikum des Cartesianismus darin besteht, nach Gewissheiten des Erkennens zu suchen und auf diese eine Erneuerung von Wissen bzw. Wissenschaft zu gründen, geht es Camus gemäß seinem ausdrücklichen Bekenntnis um Gewissheiten des Empfindens. Gewissheiten des Erkennens sind von propositionaler Struktur – Gewissheiten des Empfindens entziehen sich dem Bereich des in Form distinkter Erkenntnisse Fassbaren und einzelner Behauptungssätze adäquat Ausdrückbaren. Camus kann also als Cartesianer allenfalls in dem modifizierten Sinne gelten, dass er nicht an Gewissheiten des Erkennens, sondern an Gewissheiten des Empfindens orientiert ist. Dem mag man entgegenhalten, dass unter Cartesianismus eine facettenreichere Strömung zu verstehen ist als in den vorliegenden Ausführungen vorausgesetzt. So lässt sich mit Blick auf Camus etwa ein »natürlicher Cartesianismus« von einem »Cartesianismus der Bildung« unterscheiden.65 Im Sinne des »natürlichen Cartesianismus« als eine für die französische Geisteswelt charakteristische »Vorherrschaft einer personenbezogenen, skeptischen Sensibilität« fungiert ein »ich empfinde« als erste Gewissheit und zugleich als Filter jeden Weltbezugs.66 Demgegenüber besteht der (wiederum variantenreiche) Cartesianismus der Bildung in einem Grundtyp rationalistisch-kritischen Philosophierens, der das Bewusstsein als einzig adäquaten Ausgangspunkt des Verhältnisses von erkennendem Subjekt und erkannter Welt voraussetzt. Wie die vorliegenden Ausführungen zeigen sollen, liegt eine entscheidende Besonderheit von Camus’ Denken gerade in der speziellen Gewichtung einer ursprünglichen Evidenz des Empfindens, was uns jenes Denken einem natürlichen Cartesianismus, kaum aber dem intellektualistischen Cartesianismus der Bildung zuordnen lässt.67 Unabhängig von der Frage einer Typisierung von Camus’ Cartesianismus bleibt zu berücksichtigen, dass mit dem Motiv des Absurden nicht die erste oder 65 Vgl. Hengelbrock (1982), 29 – 31. 66 Ebd., 29. 67 Diese inadäquate Zuordnung findet sich bei Hengelbrock (1982), 31, der eine Subsumtion von Camus’ Absurdem als »erste Wahrheit« unter den Cartesianismus der Bildung vornimmt und jene »erste Wahrheit« ausdrücklich mit der »zugleich von Descartes und Kant inspirierte [n] Grundfigur des Philosophierens« im Sinne der rationalistischen Traditionslinie identifiziert. Wenn man »die Absurdität« von den »präreflexive[n] Gewißheiten« abgrenzt und als »erste reflexive Wahrheit« betrachtet (ebd., 37, Anm. 2), verfehlt man Camus’ eingangs referiertes Bild der kontingent-beiläufigen Begegnung mit dem Absurden, das einen gleichsam »an einer beliebigen Straßenecke anspringen« könne; vgl. MS, 15. Treffender ist dagegen Hengelbrocks Bemerkung, auch Camus habe (ebenso wie Sartre) »sein Cogito«, das indessen »rein praktischer Natur« sei (ebd., 83). Jedenfalls ist das Absurde als Camus’ theoretisch entwickeltes und in diesem Sinne reflexives Konzept von der lebenspraktischen, präreflexiven Begegnung mit dem Absurden zu unterscheiden.
70
Christoph Kann (Düsseldorf)
eigentliche Leitidee Camus’ angesprochen ist. Richtungsweisend wird für ihn früh das aus Plotins Denken gewonnene Motiv des erkennenden Aufstiegs der Seele zu Gott – ein Aufstieg, der dem empfindenden Subjekt die Heimat seiner Seele neu erschließen soll. Verkürzt man nun den Gedanken der Heimat der Seele um seine transzendenten Implikationen und deutet ihn um zu einem Immanenzmotiv, dann läuft die Suche der Seele nach ihrer Heimat gewissermaßen leer und wird gerade dann porös für die Empfindung des Absurden. Das Eigentliche aber, was die Seele nach Camus überhaupt erst zu ihrer heimatsuchenden Ausrichtung stimuliert, ist das Licht, das insofern als primäres Datum seiner sehnsuchtsvollen Empfindungsbewegung anzusprechen ist. So bleibt schließlich das Ergebnis, Camus als Cartesianer zu verstehen, dem es nicht um Gewissheiten des Erkennens, sondern eben des Empfindens geht, wobei das primäre Empfindungsdatum das Licht ist. Will allerdings die Seele ihre Heimat nicht in einem transzendenten, sondern einem immanenten Bereich verorten, ist sie mit der Fragilität des Fluchtpunkts ihrer Suche konfrontiert, der immer auch ein Kipppunkt ist: Die diesseitigen, immanenten Verhältnisse lassen uns, wie Camus mehr empfindet als erkennt, Licht immer nur mit dem Pendant von Schatten, das Helle immer nur mit dem Pendant des Dunklen erfahren. Zu registrieren ist freilich, dass damit auch die Gewissheiten des Empfindens oft genug Gewissheiten des Empfinden-Wollens bleiben, die sich nur sporadisch und situativ zu Gewissheiten des tatsächlich realisierten Empfindens verdichten. Stellt man dem Bild von Camus als »Cartesianer des Absurden« das Bild des lebensbejahenden, natursensitiven Ästheten gegenüber, rückt man, so könnte ein Einwand lauten, ein Motiv in den Vordergrund, das, von Camus selbst (und zahlreichen Interpreten) immer schon mitgemeint war : Wir müssen uns, wie es am Ende von Camus’ Hauptwerk an vielzitierter Stelle heißt, »Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen«,68 und auch der spätere Camus sieht den Menschen zu einem Lebenskonzept imstande und herausgefordert, das empfundener Absurdität etwas entgegenzusetzen hat – die Revolte. Der Begriff der Revolte konnotiert die Möglichkeit, der menschlichen Existenz wieder einen relativen Sinn zu geben, was den Sinn einer ästhetisch empfundenen Existenz nicht ausschließen wird. Mit einem glücklichen Sisyphos freilich geht es um die Reaktion auf die Erfahrung des Absurden, und die Revolte steht für die Reaktion auf bzw. das Aufbegehren gegen empfundene Absurdität. Die vorliegenden Ausführungen sollten dagegen deutlich machen, dass das Licht als lebensbejahendes Prinzip ein gegenüber dem Absurden vorrangiges Moment in Camus’ Denken ist: Die conditio humana besteht in einer organischen Einordnung in immanente Natur- und Lebenszusammenhänge, deren ästhetischer Impuls unsere primäre existenzielle Grunderfahrung ist. Diese Grunderfahrung wird 68 MS, 101.
Albert Camus – ein Cartesianer des Absurden?
71
bei Camus brüchig dadurch, dass er sie nicht mehr an eine transzendente Größe zurückbinden kann oder will. Die speziell hieraus resultierende Empfindung des Absurden mag uns immer wieder einholen, ist aber glücklicherweise auch für Camus keine ungebrochene, definitive: Sie lässt uns, verweigern wir uns dem Anerkennen der Einsicht in transzendente Dimensionen, etwa einer anspruchsvollen Metaphysik, gleichwohl Möglichkeiten einer Revolte im Sinne eines diesseitigen, lebenspraktischen Aufbegehrens gegen die Empfindung des Absurden. Der zentrale Befund, dass bei Camus einer Philosophie des Absurden noch eine völlig andersartige Philosophie gegenübersteht, kann sich wiederum auf ihn selbst berufen: »Wir müssen uns dazu entschließen, in die Belange des Denkens die notwendige Unterscheidung zwischen einleuchtender Philosophie und Lieblingsphilosophie einzuführen. Mit anderen Worten, wir können zu einer Philosophie gelangen, die dem Geist und dem Herzen zuwider ist, die sich aber aufdrängt. So ist die mir einleuchtende Philosophie das Absurde. Aber das hindert mich nicht, eine Lieblingsphilosophie zu haben (oder vielmehr zu kennen): Z.B.: ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Geist und Welt, Harmonie, Fülle usw. … Glücklich ist der Denker, der seiner Neigung folgt – verbannt ist jener, der das ablehnt – um der Wahrheit willen – mit Bedauern, aber mit Entschlossenheit …«69 Nach den vorliegenden Ausführungen liegt es nahe, Camus’ »Lieblingsphilosophie« der Harmonie von Geist und Welt mit seinem ästhetisierenden Naturempfinden und seiner Lichtmetaphysik zu assoziieren. Zugleich gibt uns Camus selbst die Begründung für die hier entwickelte Einordnung und Typisierung: Für den Cartesianer des Empfindens hat die ihm nur »einleuchtende Philosophie« des Absurden weder Priorität noch Verbindlichkeit; die seiner Neigung entsprechende »Lieblingsphilosophie« des Lichts als Prinzip und Referenzpunkt ästhetischen Weltbezugs wird jedenfalls Vorrang haben, denn sie verspricht Glück.70
Literatur Bollnow, Otto Friedrich: »Von der absurden Welt zum mittelmeerischen Gedanken. Bemerkungen zu Camus’ neuem Buch ›Der Mensch in der Revolte‹«, in: Schlette, Heinz Robert (Hg.): Wege der deutschen Camus-Rezeption, Darmstadt 1975, 265 – 280. Bousquet, FranÅois: Camus le m¦diterran¦en, Camus l’ancien, Quebec 1977. 69 TB, 260 f. Camus’ Formulierung »philosophie de pr¦f¦rence« gibt Lauble (1978), 19, paraphrasierend zusätzlich mit »Präferenzphilosophie« wieder ; vgl. hierzu auch Lauble (1984), 45 ff. 70 Ich danke Susanna Melkonian und Oliver Victor für die kritische Durchsicht des Manuskripts.
72
Christoph Kann (Düsseldorf)
Bremer, Dieter : »Hinweise zum griechischen Ursprung und zur europäischen Geschichte der Lichtmetaphysik«, in: Archiv für Begriffsgeschichte 17 (1973), 7 – 35. Foley, John: Albert Camus. From the Absurd to Revolt, Stocksfield 2008. Galle, Roland: Der Existentialismus, Paderborn 2009. Hengelbrock, Jürgen: Albert Camus. Ursprünglichkeit der Empfindung und Krisis des Denkens, Freiburg/München 1982. Jeschke, Hans: »Albert Camus – Bild einer geistigen Existenz«; in: Die Neueren Sprachen 1 (1958), 459 – 473. Joisten, Karen: Philosophie der Heimat – Heimat der Philosophie, Berlin 2003. Kampits, Peter : Der Mythos vom Menschen. Zum Atheismus und Humanismus Albert Camus’, Salzburg 1968. Lauble, Michael: »Albert Camus’ Philosophische Examensschrift im Kontext der Grundstruktur seines Denkens«, Einleitung in: Camus, Albert: Christliche Metaphysik und Neoplatonismus, Reinbek 1978, 7 – 22. Ders.: »Vom Evangelium zur Metaphysik. Über Albert Camus’ philosophische Examensschrift«, in: ders. (Hg.): Der unbekannte Camus. Zur Aktualität seines Denkens, Düsseldorf 1979, 36 – 73. Ders.: Sinnverlangen und Welterfahrung. Albert Camus’ Philosophie der Endlichkeit, Düsseldorf 1984. Pieper, Annemarie: Albert Camus, München 1984. Dies.: »Albert Camus. Die Frage nach dem Sinn in einer absurden Zeit«, in: Fleischer, Margot (Hg.): Philosophen des 20. Jahrhunderts, Darmstadt 1990, 137 – 152. Rath, Matthias: Albert Camus – Absurdität und Revolte. Eine Einführung in sein Werk und die deutsche Rezeption, Frankfurt a.M. 1984. Sartre, Jean-Paul: Porträts und Perspektiven, Reinbek 1968. Schlette, Heinz Robert (Hg.): Wege der deutschen Camus-Rezeption, Darmstadt 1975. Ders.: Welt und Revolte, Freiburg/München 1980. Speck, Josef: »Albert Camus: Die Grundantinomien des menschlichen Daseins«, in: ders. (Hg.): Grundprobleme der großen Philosophen – Philosophie der Gegenwart V, Göttingen 1982, 126 – 177. Trageser-Rebetez, FranÅoise: Die Symbolik von Licht und Schatten bei Albert Camus. Paradigmenanalyse im Spannungsfeld der Polarität Natur – Geschichte, GenÀve 1995. Turnher, Rainer : »Albert Camus«, in: Turnher, Rainer/Röd, Wolfgang/Schmidinger, Heinrich (Hg.): Die Philosophie des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts 3. Lebensphilosophie und Existenzphilosophie (Geschichte der Philosophie, hrsg. v. W. Röd, Bd. XIII), München 2002, 296 – 319. Walz, Norbert: Kritische Ethik der Natur. Ein pathozentrisch-existenzphilosophischer Beitrag zu den normativen Grundlagen der kritischen Theorie, Würzburg 2007.
Lou Marin (Marseille)
Camus und seine libertäre Kritik der Gewalt
*
»Eigentum ist Mord.« »Praktische Moral. Sich nie an die Gerichte wenden. Das Geld verschenken oder verlieren. Es nie nutzbringend anlegen, es nie suchen, es nie fordern.« (Albert Camus: Tagebuch März 1951-Dezember 1959, Reinbek 1993, S. 73)
Camus (1913 – 1960) hat uns etwas zu sagen, heute mehr denn je, mitten in der Krise des weltweiten Kapitalismus, während wir dem fünfzigsten Jahr seines Todes gedenken. Morgen, zum Gedenken seines hundertsten Geburtstags, können wir eine Lawine von Würdigungen erwarten – Ausstellungen, Tagungen, Wiederaufnahmen seiner Theaterstücke; alles im Rahmen von Marseille-Provence, der europäischen Kulturhauptstadt für das Jahr 2013. Aber wer hört Camus wirklich zu? Ganz sicher weder die politische Klasse an der Macht, noch die Klasse der etablierten Intellektuellen, die im Dienste der Macht steht. Sie alle verfolgen ein anderes Projekt: Sie wollen das Denken von Camus verbiegen, ihn entradikalisieren, ihn reduzieren auf die einzige Tatsache, dass er die Staatskommunismen Osteuropas während des Kalten Krieges lange vor ihnen selbst denunziert hat – anders gesagt, sie wollen aus ihm einen braven Soldaten der westlichen Demokratie machen, so wie sie ist und so wie sie wollen, dass sie auf alle Ewigkeit bleiben soll. Sie wollen sich des intellektuellen Erbes Camus’ bemächtigen; sie wollen, dass Camus ihr Philosoph werde. Sie wollen Camus all seiner Ideen und seiner Prinzipien entleeren, die Wahrheit über seine politischen Positionen verbergen, kurz und einfach: Sie wollen lügen. Nur zu, macht was ihr nicht lassen könnt, aber zählt nicht auf uns, zählt nicht auf diejenigen LeserInnen, die über den wirklichen Camus reden wollen, und über Camus’ WeggenossInnen des Zweifels: die Libertären, die Kriegsdienstverweigerer, die gewaltfreien AnarchistInnen, die revolutionären SyndikalistInnen und die vergessenen AntikolonialistInnen – diejenigen also, die das * Deutsche Übersetzung von »Camus et sa critique libertaire de la violence« (IndigÀne Êditions, Montpellier 2010). Originalbeitrag für die Internationalen Albert Camus Tage 2010 in Wuppertal (www.camus-lebt.de). Erstübersetzung ins Deutsche von Lou Marin. Das Copyright für die deutsche Übersetzung liegt bei der Internationalen Armin T. Wegner Gesellschaft e.V., Wuppertal (www.armin-t-wegner.de).
74
Lou Marin (Marseille)
Gedächtnis der Besiegten besitzen. Es ist unsere ureigenste Aufgabe, euch nicht gewähren zu lassen. Es liegt an uns, den intellektuellen und öffentlichen Kampf dafür aufzunehmen, dass anerkannt wird, was Camus heute für die Arbeiterbewegung und die weltweite Bewegung für eine andere Globalisierung bedeutet, die daran arbeitet, eine Gesellschaft aufzubauen, die zugleich sozialistisch und libertär ist. Jene aber, was wollen sie gegen dieses Projekt verwirklichen? Sie wollen aus Camus einen Weggenossen von Sarkozy machen, wie es die angeblichen französischen Intellektuellen von heute durchzusetzen hoffen. Sie wollen aus ihm einen Kompagnon dieses Präsidentschaftskandidaten machen, der seinen Wahlkampf als Programm präsentierte, die Ideen von ’68 zu bekämpfen. Im Kontrast dazu sei an die Einschätzung des Anarchisten Maurice Joyeux erinnert, dass »von allen zeitgenössischen Werken es Der Mensch in der Revolte von Camus war, der auf angemessenste Weise die Bestrebungen der jungen Studenten und Arbeiter ausgedrückt hat, die dann später den Mai 1968 machen sollten.«1 Nun, wie ist das möglich, sich auf den Ideengeber der Revolte zu berufen? Wie kann Sarkozy Camus zu seinem Lieblingsschriftsteller verwandeln?2 Wie können diejenigen, welche die Ideen von ’68 vernichten wollten, Camus für ihre Zwecke einspannen, ihn, der die Revoltierenden von ’68 inspiriert hat? Nun, es gibt dafür ein Mittel, nämlich die »Nouvelles Philosophes« herbei zu zitieren, die Intellektuellen der Macht, die bereit sind, ’68 so lange zu »erklären«3, bis Camus, ihr erklärter Gegner, einer der ihren wird. Aber das ist nichts Neues. Camus hat selbst daran erinnert: »… die geschichtliche Mission des Proletariats [bestand] während hundertfünfzig Jahren, ausgenommen im Paris der Kommune, dem letzten Zufluchtsort der revoltierenden Revolution, darin, verraten zu werden. Die Proletarier haben gekämpft und sind gestorben, um die Macht Militärs oder Intellektuellen, zukünftigen Militärs, zu geben, die sie ihrerseits knechteten.«4 Camus war der erste Anti-Kommunist, sagen die »Erklärer« von ’68 für Sarkozy5 – und fertig ist der Lack! Es ist nur die Wiederholung der Meinung der ZeitgenossInnen von Camus, derjenigen, die ihn damals erbittert bekämpft haben. Aber Camus war nicht einfach nur gegen den Staatskommunismus, er repräsentierte viel mehr. Er kritisierte alle Formen und Systeme der Gewalt. 1 Maurice Joyeux, zitiert nach Lou Marin: »Introduction«, in ders. (Hg.), Albert Camus et les libertaires (1948 – 1960), Marseille 2008, S. 39. 2 Ebd. 3 Anspielung auf das Buch von Andr¦ und RaphaÚl Glucksmann: Mai 68 – 15 – expliqu¦ Nicolas Sarkozy, Paris 2008. 4 Albert Camus: Der Mensch in der Revolte, Reinbek 1969, S. 177. 5 Siehe Anmerkung 3.
Camus und seine libertäre Kritik der Gewalt
75
Camus war zu gleicher Zeit auch antibourgeois und antikapitalistisch. Und das nicht nur aufgrund seiner eigenen Herkunft aus einer armen Familie der Vorstädte Algiers, sondern auch, weil »die bürgerliche Gesellschaft von der Freiheit redet, ohne sie in die Tat umzusetzen.«6 Was hat denn die bourgeoise Gesellschaft tatsächlich erreicht? Sogar die heutigen Freiheiten – so reduziert sie auch sein mögen – stammen nicht von ihr. In seiner Rede Restaurer la valeur de la libert¦7, die er vor revolutionären SyndikalistInnen am 10. Mai 1953 in St.–Êtienne gehalten hat, spitzte Camus das zu, was man in gleicher Weise auch heute über die Epoche Sarkozy sagen könnte: »Die Gesellschaft des Kapitals und der Ausbeutung wurde meines Wissens nie beauftragt, für Freiheit und Gerechtigkeit zu sorgen. Die Polizeistaaten sind nie in den Verdacht gekommen, in den Kellern, wo sie ihre Kunden befragen, rechtswissenschaftliche Hochschulkurse abzuhalten. Wenn sie also unterdrücken oder ausbeuten, gehorchen sie nur ihrem Daseinszweck, und wer immer ihnen unkontrolliertes Verfügungsrecht über die Freiheit einräumt, darf sich nicht wundern, sie also gleich entehrt zu sehen. […] Die Freiheit ist Sache der Unterdrückten, und ihre Beschützer stammten zu allen Zeiten aus unterdrückten Völkern. […] Insbesondere sind die paar demokratischen Freiheiten, denen wir noch teilhaftig bleiben, keine leeren Illusionen, die wir uns widerspruchslos rauben lassen dürfen. Sie stellen genau das dar, was uns von den großen revolutionären Eroberungen der letzten zwei Jahrhunderte verbleibt. Sie sind keineswegs die Verneinung der echten Freiheit, wie so viele listige Demagogen uns dies aufschwatzen wollen. Es gibt keine Idealfreiheit, die uns eines Tages mit einem Schlag geschenkt würde, so wie man am Ende seines Lebens seine Rente bezieht. Die Freiheiten müssen erkämpft werden, eine nach der anderen, und die uns verbleibenden sind Etappen, unzureichende, gewiß, aber doch Etappen auf dem Weg zu einer greifbaren Befreiung. Wenn wir einwilligen, sie abschaffen zu lassen, bringt uns das keinen Schritt vorwärts. Im Gegenteil, es ist ein Rückschritt, ein Rückzug, und eines Tages werden wir den Weg von neuem gehen müssen, aber dieser neue Kampf wird wiederum den Schweiß und das Blut der Menschen kosten. […] Und wenn dieses unerbittliche Jahrhundert uns etwas gelehrt hat, dann die Tatsache, daß die wirtschaftliche Revolution entweder frei oder aber nicht sein wird, so wie auch die Befreiung entweder wirtschaftlich oder aber überhaupt nicht sein wird. Die Unterdrückten wollen nicht nur von ihrem Hunger befreit sein, sondern auch von ihren Herren.«8
6 Albert Camus: »Brot und Freiheit«, in ders.: Fragen der Zeit, Reinbek 1977, S. 77 f. 7 Der Titel wurde übersetzt als »Brot und Freiheit«, siehe Anm. 6. Wörtliche Übersetzung: »Den Wert der Freiheit wiedereinführen«. 8 Albert Camus: »Brot und Freiheit«, in ders.: Fragen der Zeit, Reinbek 1977, S. 76 – 80.
76
Lou Marin (Marseille)
All das ist wahrlich das Gegenteil der Verteidigung einer bourgeoisen Gesellschaft la Sarkozy. Camus war kein naiver Anti-Kommunist, ein simpler Prediger des Anti-Totalitarismus und daher ein Verteidiger ihrer Demokratie – er war ein nicht-marxistischer, nicht-cäsaristischer Sozialist, ein libertärer Sozialist. Ja, er forderte eine Moral ein, aber eine revolutionäre Moral, keine bürgerliche und heuchlerische Doppelmoral. Seine Kritik bezog sich zugleich auf die staatskommunistische Gesellschaft und auf die kapitalistische Gesellschaft, um auf eine grundsätzliche Kritik der Arbeitsbedingungen in Industriegesellschaften hinauszulaufen: »Schließlich fallen die kapitalistische und die sozialistische Gesellschaft zusammen, insofern sie im Hinblick auf die gleiche Verheißung und durch das gleiche Mittel: die industrielle Produktion, knechten. Doch die eine gibt ihre Verheißung im Namen formaler Prinzipien, die zu verkörpern sie unfähig ist und die durch die angewandten Mittel geleugnet werden. Die andere rechtfertigt ihre Prophezeiung im Namen der einzigen Wirklichkeit und verstümmelt am Ende die Wirklichkeit. Die Gesellschaft der Produktion produziert nur, sie erschafft nicht.«9 Darum wird die Sarkozy-Parole vom »Mehr arbeiten, um mehr zu verdienen« von Camus komplett zurückgewiesen, denn diese Parole ist ausschließlich und auf zynische Weise lediglich produktivistisch. Camus fuhr in Der Mensch in der Revolte auf rätselhafte Weise fort: »Die Revolte ist nicht an sich ein Element der Kultur. Aber sie geht jeder Kultur voraus.«10 Was wollte er damit sagen? Er wollte das Ausmaß der Gewalt im Gedächtnis behalten, welches das Zeitalter der Industrialisierung gegen Bauern/ Bäuerinnen und Handwerker-Familien ausübte. Und die Industrialisierung war nicht ausschließlich eine kapitalistische Entwicklung: »Unter einem ihrer Aspekte kann die Geschichte des Sozialismus in unserem Jahrhundert als Kampf der Arbeiterbewegung gegen die Bauernklasse betrachtet werden. Dieser Kampf setzt auf der Ebene der Geschichte den ideologischen Kampf des 19. Jahrhunderts zwischen autoritärem und freiheitlichem Sozialismus fort, dessen bäuerliche und handwerkliche Ursprünge offenkundig sind.«11 Das Wort »artisanal« (handwerklich) ähnelt im Französischen nicht zufällig dem Wort »artiste« (Künstler). Das historische Vermächtnis der Revolten von Bauern und Bäuerinnen gegen die Industrialisierung hat sich heute zur Utopie gewandelt, die dem produktivistischen Prinzip der Produktion ein moralisches entgegen hält: die Kenntnisse, ein Produkt mit nützlichem Gebrauchswert für das alltägliche Leben zu erschaffen – wobei der Sinn der Arbeit darin besteht, sich an der eigenen Kreativität zu erfreuen und die Befriedigung aus dem Ansehen des tatsächlichen 9 Albert Camus: Der Mensch in der Revolte, Reinbek 1969, S. 221 f. 10 Ebd., S. 222. 11 Im Original: »entre le socialisme autoritaire et le socialisme libertaire«, also eigentlich »zwischen autoritärem und libertärem Sozialismus«, vgl. Albert Camus: Der Mensch in der Revolte, Reinbek 1969, S. 173, sowie Albert Camus: L’homme r¦volt¦, Paris 1985, S. 269.
Camus und seine libertäre Kritik der Gewalt
77
Produkts eigener Arbeit herrührt. Das sind die Worte von Camus: »Die industrielle Gesellschaft wird nur dann den Weg zu einer Kultur bahnen, wenn sie dem Arbeiter seine Würde als Schöpfer zurückgibt, d. h. wenn sie sein Interesse und seine Gedanken ebenso auf die Arbeit wie auf ihr Produkt lenkt. Die nunmehr notwendige Zivilisation wird in den Klassen wie im Individuum nicht mehr den Arbeiter vom Schöpfer trennen können, ebenso wenig wie die künstlerische Schöpfung daran denkt, die Form und den Inhalt, die Geschichte und den Geist zu trennen. So wird sie allen die Würde zuerkennen, die die Revolte behauptet hat. […] Jede Schöpfung verneint in sich die Welt des Herrn und des Sklaven. […] Jedesmal wenn die Revolution in einem Menschen den Künstler tötet, der er hätte sein können, entkräftet sie sich selbst ein wenig mehr.«12 Heute begehen in den produktivistischen und nicht-schöpferischen Arbeitszellen des neoliberalen Kapitalismus ArbeiterInnen von France T¦l¦com und vergleichbaren Unternehmen in bisher nicht dagewesener Zahl Selbstmord.13 Darin liegt die Wahrheit von Camus. Mit ihm bleiben die Morde des Kapitalismus unter den Bauern und Bäuerinnen – überall auf der Welt – ebenso im kollektiven Gedächtnis wie die Morde des zeitgenössischen Kapitalismus. Darum hatte Camus recht, wenn er sagte: »Eigentum ist Mord.« Seine Kapitalismuskritik war nicht marxistisch, sondern moralisch. Sie wurde inspiriert durch die Kritik der Libertären und der Anarcho-SyndikalistInnen. Der Kapitalismus, das ist vor allem strukturelle Gewalt. Und es war in diesem libertären Milieu, wo Camus FreundInnen fand und von dem er Einflüsse für seine Kritik des politischen Mordes aufnahm.
Die Entwicklung der Gewaltkritik bei Camus während der Résistance und in der Nachkriegszeit Aber war Camus nicht R¦sistancekämpfer? Hatte er nicht in seiner R¦sistancezeitung Combat die Befreiung von Paris durch die Kugeln der Maschinengewehre bejubelt? Angesichts der nationalsozialistischen Besatzung hat er daran erinnert, dass ihn diese Pest die Gegengewalt gelehrt hat, gegen seinen Willen. Denn als er, noch in Algerien lebend, mit der R¦sistance begonnen hatte, war er noch Pazifist gewesen. 1939 war er zusammen mit seinem Freund Pascal 12 Im Original: »… un peu plus«, darum wird der Übersetzung angefügt: »… ein wenig mehr«; Lou Marin. Vgl. Albert Camus: Der Mensch in der Revolte, Reinbek 1969, S. 222 – 224. 13 Die Selbstmordwelle von ArbeiterInnen von Call-Centern bei France T¦l¦com wurde im Jahr 2009 zum Bestandteil öffentlicher Kritik an modernen Arbeitsbedingungen in Frankreich, vgl. z. B. Jean-Pierre Barou: »Sarkozy, Camus et le travail«, in Lib¦ration, 9. 7. 2009.
78
Lou Marin (Marseille)
Pia Redakteur der kleinen Tageszeitung Le Soir R¦publicain. Beide haben sie in der Phase der »Drúle de guerre« (vom 1.9. 1939 bis zum Überfall Hitlers auf Frankreich im Mai 1940), als sie sich mit einer französischen Militärdiktatur konfrontiert sahen, die in Algerien deklariert worden war – die französische Regierung gab in ihrer Kolonie also vor, die Demokratie dadurch zu schützen, dass sie die Diktatur praktizierte –, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung in Kriegszeiten verteidigt: »Wir können ganz besonders nicht oft genug darauf hinweisen, dass sich bei den letzten Wahlen in England ein ›pazifistischer‹ Kandidat zur Wahl präsentieren konnte, und dass unter allen Umständen in der englischen Gesetzgebung die Kriegsdienstverweigerung durch das ausgeübte Beispiel erlaubt ist. Das bezeugt die Dimension des freiheitlichen Klimas in Britannien. Und es zeugt von der Ehre und der Kraft einer Demokratie, solch essentielle Freiheiten ausgewogen zur Geltung bringen zu können.«14 Der Kampf um Kriegsdienstverweigerung ist grundlegend für Camus, weil »die Selbstachtung eine individuelle Eigenschaft ist und nur für den Einzelnen gilt.«15 Schon einige Zeit vorher hatte Camus in der Vorgängerzeitung L’Alger R¦publicain Antikriegsartikel mit dem Pseudonym Der Kriegsdienstverweigerer unterzeichnet.16 Und in einem Text unter dem Titel Profession de foi (Glaubensbekenntnis), der Ende November 1939 im Soir R¦publicain veröffentlicht werden sollte, aber zensiert wurde, schrieben Camus und Pia erneut: »Wir sind überzeugte Pazifisten. Wir lehnen die Verfolgungen und diktatorischen Maßnahmen der Regierung ab, auch wenn sie sich gegen Kommunisten richten. […] Heute, wo alle Parteien ihre Ziele verraten haben, wo die Politik alles entwürdigt hat, bleibt dem Menschen nurmehr das Gewissen in seiner Einsamkeit und sein Glaube an die menschlichen und individuellen Werte.«17 Zur gleichen Zeit, im Jahre 1939, schrieb ein Kriegsdienstverweigerer des Ersten Weltkrieges, der Anarchist Louis Lecoin, einen Aufruf gegen den Krieg – Paix imm¦diate! (Frieden sofort!) –, der ihm zunächst das Gefängnis in der Pariser Region einbringen sollte, danach das Lager Gurs, dann eines in Djelfa/ Algerien, und schließlich eines in Sidi bel AbbÀs, ebenfalls in Algerien.18 Wir sollten hier die Rolle eines weiteren Kriegsdienstverweigerers des Ersten Weltkriegs, genauer : eines Deserteurs, erwähnen, der ins Schweizer Exil flüchtete und dort später, im Jahr 1952 die Zeitschrift T¦moins (Zeugen) gründete, Jean14 Zit. nach »Notre position«, in Le Soir R¦publicain, 6. November 1939, in Albert Camus: Cahiers Albert Camus 3, Fragments d’un combat 1938 – 1940. Alger R¦publicain, Le Soir R¦publicain, Bd. II, Paris 1978, S. 720, Übersetzung Lou Marin. 15 Ebd., S. 722. 16 Olivier Todd: Albert Camus. Une vie, Paris 1996, S. 200. 17 Pascal Pia, Albert Camus: »Profession de foi«, in Cahiers Albert Camus 3, siehe Anm. 14, S. 728 – 729. 18 Herbert R. Lottman: Albert Camus, Paris 1978, S. 646.
Camus und seine libertäre Kritik der Gewalt
79
Paul Samson, und der wiederum ein enger Freund Camus’ werden sollte. Der italienische Schriftsteller Ignazio Silone, der selbst in den dreißiger Jahren ins Schweizer Exil ging, sollte dort Samson kennenlernen und seine politischen Ansichten beträchtlich ändern. Davon zeugen sowohl sein Austritt aus der Kommunistischen Partei Italiens (KPI) 1931 als auch im Jahr 1942, mitten im Krieg, die überraschende Veröffentlichung seines Manifest für den zivilen Ungehorsam: Silone vertritt dort die Idee, dass die italienische Bevölkerung den Faschismus nicht bewaffnet hätte bekämpfen müssen, sondern durch die Weigerung, die Gesetze anzuwenden, Steuern zu zahlen und mit der Macht zusammenzuarbeiten, weil »der zivile Ungehorsam, wenn er von einer großen Zahl von Menschen praktiziert wird, eine politische Waffe von immenser Wirkung ist; eine Waffe, die fähig ist, den repressiven Apparat der Diktatur zu paralysieren. Es ist eine Kampfform ohne Blutvergießen, an der jeder teilnehmen kann.«19 Camus war unterdessen bei anderen Positionen angelangt. Weil er keine gewaltfreie Widerstandsstrategie kannte, identifizierte er sie damit, ins Gefängnis zu gehen – der Strafe also, die man Lecoin auferlegt hatte, der übrigens wusste, dass ihn das erwartete. Diese Erfahrung war in Camus’ Augen immerhin respektabel genug, um direkt nach Ende des Zweiten Weltkrieges Kontakt mit Lecoin aufzunehmen. Während der R¦sistance jedoch unterstützte Camus als Journalist bei Combat den bewaffneten Widerstand, und achtete doch gleichzeitig darauf, sich von den Methoden zu unterscheiden, die die Nazis anwandten: Er wandte sich gegen Exekutionen deutscher Kriegsgefangener – ein Vorgeschmack auf seinen Widerstand gegen die Todesstrafe in der Nachkriegszeit. Er weigerte sich, einige direkte Aktionen zu unterstützen wie etwa das Attentat auf den deutschen Feldkommandanten Karl Holtz in Nantes, das die Hinrichtung von fünfzig Geiseln durch die Nazis nach sich zog. Solche Aktionen waren eine Strategie der Kommunistischen Partei Frankreichs (KPF) innerhalb der R¦sistance, um den Hass der französischen Bevölkerung zu steigern angesichts der angekündigten und erwarteten Reaktion der Nazis. Camus war gegen eine solche Taktik. Für ihn war sie ein Sophismus, ein abstraktes Mittel, um ein Ziel zu erreichen, das bewusst die Wahrscheinlichkeit in Kauf nahm, dass Unschuldige dabei zu Tode kommen. Solch einer Gleichung der Wahrscheinlichkeitsrechnung setzte Camus in seinem Theaterstück Die Gerechten dann eine arithmetische Gleichung entgegen: Man nimmt ein Leben nur dann, wenn man sicher ist, dass man nicht Unschuldige zu Tode verurteilt und wenn man dabei sein eigenes Leben zum Ausgleich hingibt oder riskiert. Daher die Gleichung: 19 Ignazio Silone, zit. nach Alessandro Bresolin: »Le choix des camarades: Camus, Chiaromonte, Caffi, Silone«, in Les Rencontres M¦diterrann¦ennes, in Albert Camus: Le don de la libert¦: Les relations d’Albert Camus avec les libertaires, Lourmarin 2009, S. 34.
80
Lou Marin (Marseille)
Ein Leben genommen, ein Leben gegeben = 0. Camus war vor allem mit den KommunistInnen innerhalb des CNE (»Comit¦ national des ¦crivains) uneins über diese Strategie innerhalb der R¦sistance. Als Camus im Jahr 1940 während der Nazi-Besatzung gerade nach Paris gezogen war und seine erste Arbeit in der Hauptstadt als Redaktionssekretär bei Paris Soir erhalten hatte, lernte er die französische Anarchistin Rirette Matrejean kennen, die dort als Korrektorin arbeitete. Es war eine entscheidende Begegnung. Vor dem Ersten Weltkrieg war sie zusammen mit ihrem in Belgien geborenen, aus einer russischen Flüchtlingsfamilie stammenden Freund Victor Kibaltchitch, der dann den Namen Victor Serge annehmen sollte, Mitherausgeberin der Zeitung L’Anarchie. Serge wurde nach dem Ersten Weltkrieg Kommunist, ging in die UdSSR und wurde dort verfolgt. Er konnte 1936 nach Belgien und Frankreich aufgrund einer internationalen Solidaritätskampagne zurückkehren. Durch die Vermittlung von Rirette Matrejean konnte Camus Victor Serge in Paris direkt vor dem Exodus besuchen, der auf die Ankündigung der Besetzung der Stadt durch die Deutschen folgte. Während der nachfolgenden drei Monate des Exodus, die sie bis nach Lyon führte, irrten Matrejean und Camus zusammen mit der Equipe der Zeitung in Südfrankreich umher. In dieser Zeit entstanden die herzlichen Beziehungen des Journalisten Camus mit Druckern, Setzern und Korrektoren, die damals oft anarcho-syndikalistischer Tendenz waren. Man kann deshalb zusammenfassen, dass es Rirette Matrejean war, die Camus in die libertäre Denktradition einführte. Camus sollte Rirette in den fünfziger Jahren wiedersehen, während der Pariser Treffen eines Kreises um die Zeitschrift T¦moins, die entweder in ihrer Wohnung oder in derjenigen von Robert Proix, eines weiteren libertären Genossen, oder bei Camus selbst stattfanden. Die Schicksale von Victor Serge oder von Nicolas Lazarevitch, eines weiteren Anarchosyndikalisten, der ebenfalls eine enttäuschende Erfahrung in der UdSSR gemacht hatte und dort 1924 ins Gefängnis geworfen worden war, oder auch von Ida Mett, der Lebensgefährtin des Letzteren, haben Camus’ Stellungnahmen gegen die sowjetischen Lager in den Anfangszeiten des Kalten Krieges geprägt.20 Zur gleichen Zeit hatte er direkt nach der Befreiung von der Nazi-Besatzung die spanischen RevolutionärInnen im Exil getroffen, vor allem Fernando Gûmez Pelez, Redakteur der Solidaridad Obrera, der Wochenzeitung der CNT (Nationale Arbeits-Föderation), wo zahlreiche Artikel von Camus in spanischer Übersetzung erscheinen sollten. Als der Kalte Krieg ausbricht, ist Camus keineswegs – besonders als Weggefährte der spanischen AnarchistInnen – dabei, 20 Lou Marin: »Introduction«, in Albert Camus et les libertaires (1948 – 1960), siehe Anm. 1, S. 18 f.; Sylvain Boulouque: »R¦seaux et affinit¦s: les amiti¦s libertaires d’Albert Camus«, in Le don de la libert¦: Les relations d’Albert Camus avec les libertaires, a. a. O., S. 14 – 17.
Camus und seine libertäre Kritik der Gewalt
81
ein simpler Mitläufer des westlichen Blocks und von dessen Anti-Kommunismus zu werden. »Ich werde diese abscheuliche Pest Westeuropas nicht entschuldigen, weil sie auch im Osten wütet«21, so wird er ausrufen und sich so als einer der wenigen französischen Intellektuellen erweisen, der sich an zahlreichen Hilfskampagnen für die spanischen Exilierten oder für Gefangene Francos beteiligt, die von der Todesstrafe bedroht sind. Die spanischen AnarchistInnen schätzten seine Unabhängigkeit, wie es diese Worte von Benito Milla in einem Artikel der Solidaridad Obrera vom Dezember 1948 ausdrücken: »Er war von allen Rücksichtnahmen frei. Niemand konnte besser das schändliche Arrangement anprangern, das die Welt mit Spanien einging und noch eingeht. Als Spanier grüßen wir in Camus einen der seltenen Menschen, der uns verstand und uns verteidigte, ohne uns zu instrumentalisieren.«22 Für die spanischen AktivistInnen war der Zweite Weltkrieg noch längst nicht beendet. Sie sympathisierten noch mit der Notwendigkeit, angesichts der Franco-Diktatur zu den Mitteln der »Gegen-Gewalt« zu greifen. Aber Camus war seinerseits bestrebt, der Gewalt Grenzen aufzuerlegen; und nicht nur der kapitalistischen, militaristischen und diktatorischen Gewalt, sondern auch der revolutionären Gewalt. Was diesen Punkt anbetrifft, waren sowohl die Begegnungen von Camus mit italienischen wie auch US-amerikanischen Libertären entscheidend. So hatte Nicola Chiaromonte bereits im April 1941 in Algier Camus kennengelernt, wohin Letzterer kurzzeitig aufgrund seiner Lungenkrankheit zurückgekehrt war. Chiaromonte flüchtete dann weiter ins Exil nach New York und fand dort Anschluss an den Intellektuellenzirkel um Dwight und Nancy McDonald, die engagierte JournalistInnen waren. Um 1944 entfernte sich dieses Ehepaar vom trotzkistischen Einfluss, der von der Zeitschrift Partisan Review ausgeübt wurde, um mit Politics eine unabhängige Zeitschrift mit libertärem Geist zu gründen. Es war dann Chiaromonte, der Camus zunächst einlud, eine Reise in die Vereinigten Staaten zu machen, die von März bis Juni 1946 stattfand23 und der Camus dabei in den Kreis um die McDonalds einführte. In seinem französischen Exil in den dreißiger Jahren war Chiaromonte stark von dem Anarchisten Andrea Caffi geprägt worden, der später zuweilen »der Walter Benjamin Italiens« genannt wurde. Caffi war dann in der ersten Nachkriegszeit zusammen mit Chiaromonte in New Yorker Exil gewesen. Im Januar 1946 erschien ein Artikel von Caffi in Politics, in dem er die Gewalt kritisch analysierte. Dieser Artikel sollte dann das dritte Kapitel des bekanntesten Buches von Caffi 21 Albert Camus, zit. nach Freddy Gomez: »Fraternit¦ des combats, fid¦lit¦ des solitudes: Camus et Solidaridad Obrera«, in Albert Camus et les libertaires (1948 – 1960), siehe Anm. 1, S. 338 f. 22 Benito Milla, zit. nach Freddy Gomez, ebd., S. 328. 23 Alessandro Bresolin: »Le choix des camarades: Camus, Chiaromonte, Caffi, Silone«, in Le don de la libert¦: Les relations d’Albert Camus avec les libertaires, siehe Anm. 19, S. 27 – 29.
82
Lou Marin (Marseille)
werden, das Critica della violenza (Kritik der Gewalt) hieß und 1966 von Chiaromonte publiziert wurde, elf Jahre nach Caffis Tod. Als Camus seinerseits mit dem Schiff in die Vereinigten Staaten reiste und dabei zum ersten Mal in der Nachkriegszeit etwas Abstand von den Ereignissen und Zeit zum Nachdenken hatte, arbeitete er an seiner Rede La crise de l’homme (Die Krise des Menschen), die er dann in den USA und Kanada mehrfach halten sollte und in der er seine Zeit als Epoche der Angst und des Terrors charakterisiert hat, in welcher der Dialog und die Überzeugung durch das Argument unmöglich geworden seien. In den Diskussionen, die er darüber mit Caffi, Chiaromonte und den McDonalds führte, und in denen er seine Betroffenheit angesichts der Gewaltfaszination seiner ZeitgenossInnen nicht verhehlte24, wurde Camus sich darüber klar, aus welchen Gründen sich sein Freund Chiaromonte für die Gewaltfreiheit entschieden hatte – eine Positionsbestimmung, die »angesichts der tragischen Erfahrung des Zweiten Weltkrieges radikal geworden war. Er (Chiaromonte; d.A.) hatte sie (die Gewaltfreiheit; d.A.) auf solider Basis reflektiert, die von Tolstoi über Simone Weil bis zum Pazifismus der europäischen revolutionären Tradition geht. Aber die Gewaltfreiheit, die er weiter entwickelte, nährte sich von den Thesen seines Lehrers, Caffi, nach denen die Gewalt ›unvereinbar war mit den Werten der Zivilisation und der gesellschaftsfähigen Menschlichkeit, die wir beschützen wollen. […] Mit der Gewalt verleugnen wir notwendig die Werte, die unser Lebenssinn sind‹. Caffi bestand sehr auf den Verbindungen zwischen der Idee der Gesellschaft und der Idee der Gewaltfreiheit: ›Es besteht ein unausweichlicher Gegensatz zwischen dem Streben nach Gesellschaftsfähigkeit und dem Machtwillen. Jede Gewalt ist, per Definition, anti-sozial‹.«24 Diese Begegnungen mit Chiaromonte, Caffi – ihm sollte Camus nach seiner Rückkehr aus den USA nach Paris im Jahr 1948 sogar eine Arbeitsstelle beim Gallimard Verlag verschaffen – und den McDonalds führte zum Entschluss Camus’, zwei wichtige Initiativen weiter zu verfolgen: Einmal auf theoretischer Ebene die Artikelserie Weder Opfer noch Henker, die im Herbst 1946, gleich nach seiner Rückkehr aus den USA, in der Tageszeitung Combat erschien. Dort beschrieb Camus seine Epoche als Zeitalter der Angst, die den Dialog unmöglich gemacht habe, und lancierte seinen Aufruf für die Abschaffung der Todesstrafe und für einen neuen Internationalismus – es war dies eine direkte Weiterentwicklung des Vortragstextes von La crise de l’homme. Die zweite Initiative, eher praktischer Art, war die Gründung der Groupes de liaison internationales (GLI; Internationale Verbindungsgruppen), mit denen Camus und seine libertären FreundInnen zusammen mit einigen Trotzkisten ab 1949 Kampagnen für die spanischen Internierten von Franco-Spanien sowie des Lagers Karaganda in der 24 Ebd., S. 35.
Camus und seine libertäre Kritik der Gewalt
83
UdSSR organisieren sollten – die spanischen Flüchtlinge von 1936 – 39 hatten gehofft, in der UdSSR ein Asylland zu finden, stattdessen wurden sie Objekt von Verfolgungen. Dank der Kontakte zu Chiaromonte und zu Robert Proix – Letzterer war ein Freund des Deserteurs Jean-Paul Samson, der in die Schweiz geflüchtet war – traf Camus im Jahr 1948 auch zum ersten Mal den italienischen Schriftsteller Ignazio Silone. Sie sollten eine dauerhafte Freundschaft eingehen und sich bei zahlreichen Kampagnen für die spanische Sache einsetzen, des Weiteren für osteuropäische DissidentInnen wie auch für Kriegsdienstverweigerer und gegen die Todesstrafe. Camus und Silone publizierten zudem beide in der libertären italienischen Zeitschrift Volont, die von Giovanna Caleffi-Berneri herausgegeben wurde und deren Bekanntschaft Camus zu Beginn der fünfziger Jahre machte. Chiaromonte und Silone wiederum sollten dann zusammen im Jahr 1953 in Italien die Zeitschrift Tempo Presente gründen, »die beste italienische Zeitung der heutigen Zeit«, wie sogar Giovanna Berneri meinte.25 Es war Andr¦ Prudhommeaux gewesen26, einer der Hauptinitiatoren bei der Gründung der F¦d¦ration Anarchiste FranÅaise (Französische Anarchistische Föderation), der Camus 1948 zu einem Treffen mit AnarchistInnen mitnahm, dem Cercle des Êtudiants Anarchistes (Zirkel anarchistischer Studenten). Prudhommeaux hatte die Intention Camus’ verstanden, die Gewalt in allen politischen Strömungen kritisieren zu wollen: die Staatsgewalt – die Camus bald darauf »metaphysisch« nennen sollte – ebenso wie die revolutionäre Gewalt – die er »historisch« nennen sollte. Wir erinnern uns, dass Jean-Paul Sartre, seinerseits Weggefährte der französischen KommunistInnen, im Jahr 1952 besonders allergisch auf Camus’ Der Mensch in der Revolte (erschienen 1951) und die darin enthaltene radikale Kritik der historisch gerechtfertigten Gewalt reagiert hat. In D¦fense de l’Homme, der Nachkriegs-Zeitschrift von Louis Lecoin, ging Prudhommeaux seinerseits auf die Polemik zwischen Camus und Andr¦ Breton über entsprechende Passagen in Der Mensch in der Revolte ein und brachte die Differenzen, jenseits des Streits mit Sartre, auf den Punkt, dass sich hier zwei Generationen gegenüber standen, diejenigen von Breton, dem »Papst des Surrealismus«, und diejenige von Camus: »Ist es ein Konflikt der Temperamente? Ja, zweifellos, aber auch ein Konflikt der Generationen, was von der Kritik anscheinend nicht thematisiert worden ist. Der Surrealismus ist aus der ›Dada‹Bewegung entstanden und seine Ursprünge gehen auf das Ende des Ersten Weltkrieges zurück, auf eine junge Generation, die mit einem Krieg konfrontiert 25 Ebd., S. 29 – 31; Zitat von Giovanna Berneri S. 31. 26 Vgl. Charles Jacquier : »›Une sagesse hauteur d’homme‹. Albert Camus et la revue T¦moins«, in Le don de la libert¦: Les relations d’Albert Camus avec les libertaires, siehe Anm. 19, S. 103.
84
Lou Marin (Marseille)
worden war, den sie nicht gemacht hatte und an den sie nicht mehr glaubte. […] Im Gegensatz dazu muss die Haltung von Camus als direkte Kriegserfahrung gesehen werden. Seine Revolte gehörte denen […], die den Faschismus, den Nationalsozialismus, den Bolschewismus als Machtsysteme im Erwachsenenalter erlebt hatten; sie gehörte auch denen (wie es bei Camus der Fall war), die inmitten der entfesselten Weltkatastrophe Nummer Zwei zu ihrer intellektuellen Reife gelangt waren, sei es im Untergrund oder im Exil. Für sie ist es eher natürlich, die essentiell defensive Haltung des Verweigerers zu verstehen und zum Ausdruck zu bringen, welche das Leben und die Werte überhaupt bedroht sieht, als eine unbegrenzt offensive Haltung des Subversiven, den der Kompromiss mit der Realität anwidert und der den allgemeinen Untergang noch bejubelt als Vorläufer einer mysteriösen Wiederauferstehung oder als ein Phänomen, das man auf wundersame Weise ›gratis‹ zu erleben bekommt.«27 Das Gefühl, über den Zustand seiner Epoche am Ausgang des Weltkrieges schockiert zu sein, sowie seine Begegnungen mit den französischen, US-amerikanischen und italienischen Libertären bewirkten bei Camus eine Rückerinnerung an die Kriegsdienstverweigerer, die er im Jahr 1939 in der Algierer Tageszeitung Le Soir R¦publicain so sehr verteidigt hatte. So trifft er Louis Lecoin28 und Maurice Jouyeux29 während der Solidaritätskampagne für den USamerikanischen Ex-Bomberpiloten des Zweiten Weltkriegs, Garry Davis, im Dezember 1948: Garry Davis hatte seinen Pass verbrannt und forderte öffentlich, als »Weltbürger« anerkannt zu werden. Er wollte die UN von ihrer Abhängigkeit durch die Nationalstaaten befreien. Über Silone nahm Camus dann auch im November 1950 freundschaftliche Beziehungen mit dem ehemaligen Deserteur Jean-Paul Samson auf und beteiligte sich von Anbeginn als Mitglied des redaktionellen Kreises um die freigeistig-libertäre Zeitung T¦moins im Jahr 1953, für die er regelmäßig Beiträge einbrachte oder vorschlug.30
27 Andr¦ Prunier (Pseudonym von Andr¦ Prudhommeaux): »Breton ou Camus. Les limites de la r¦volte«, in Albert Camus et les libertaires (1948 – 1960), siehe Anm. 1, S. 83 – 85. 28 Lecoin hatte das Solidaritätskomitee für Garry Davis gegründet; vgl. C¦cilia und Normann: »Ein Leben für Antimilitarismus und Anarchismus«, in Graswurzelrevolution, Nr. 202, November 1995, S. 15. 29 Herbert R. Lottman, siehe Anm. 18, S. 461. 30 Charles Jacquier : »›Une sagesse hauteur d’homme‹. Albert Camus et la revue T¦moins«, in Le don de la libert¦: Les relations d’Albert Camus avec les libertaires, siehe Anm. 19, S. 107.
Camus und seine libertäre Kritik der Gewalt
85
Die Entwicklung der Gewaltkritik bei Camus von Der Mensch in der Revolte bis zu seiner Position gegenüber der Front de Libération National (FLN) und dem Algerienkrieg Die veränderten Stellungnahmen in der Nachkriegszeit von Camus zur revolutionären Gewalt zeigten sich das erste Mal 1949 in der Zeitschrift von Lecoin, D¦fense de l’Homme. In einem inszenierten Gespräch mit sich selbst, das er Dialogue pour le dialogue (Dialog um des Dialogs Willen) nannte, stellt sich Camus die Frage: »Bedeutet das Gewaltfreiheit?« und antwortet darauf: »Ich glaube, dass die Gewalt unvermeidlich ist. Die Jahre der Besatzung haben mich das gelehrt […]. Ich sage nur, dass man der Gewalt jegliche Legitimierung verweigern muss. Sie ist gleichzeitig notwendig und nicht zu rechtfertigen. Also glaube ich, dass man sie in ihrem Ausnahmecharakter präzise einhegen muss und sie an ihre Grenzen binden muss, die man ihr setzen kann. Das heißt zu sagen, dass man ihr weder legalistische noch philosophische Geltung zusprechen kann.«31 Aufgrund seiner Beteiligung an der R¦sistance hatte Camus lange Zeit gezögert, sich im Begriff der Gewaltfreiheit wiederzufinden. Tatsächlich ist es eine Frage der Begrifflichkeit, der Definition. Denn noch im Jahr 1951 präzisiert er seine Definition in Der Mensch in der Revolte: »Die vollständige Gewaltlosigkeit begründet auf negative Weise die Knechtschaft und ihre Gewalttätigkeit; die systematische Gewalt zerstört positiv die lebendige Gemeinschaft und das Sein, das wir von ihr empfangen. Um fruchtbar zu sein, müssen die beiden Begriffe eine Grenze finden.«32 Darin lag sein wirkliches Anliegen: der Gewalt Grenzen zu setzen. Aber der gewaltfreie Anarchismus mit seiner Taktik des gewaltfreien Widerstands oder seinem Konzept der gewaltfreien Revolution ist nicht weit von dieser Position entfernt, im Gegenteil: Der gewaltfreie Anarchismus meint keineswegs eine verabsolutierte Gewaltfreiheit im Sinne des »Nichtstuns«, was praktisch das Geschehenlassen der Gewalt bedeutet. Nichtstun – das ist Gewalt im Sinne eines Geschehenlassens von Gewalt, ohne ihr Grenzen entgegenzusetzen. In Wirklichkeit ist die Gewaltfreiheit für gewaltfreie AnarchistInnen deswegen eine Kampfform, die ihren Zielsetzungen treu bleibt. Sie richtet sich gegen die herrschende Gewalt, aber ohne deren Mittel einzusetzen und erweist sich daher als sehr camusianisch – Generalstreiks, Hungerstreiks, Boykotts, Steuerzahlungsverweigerungen, Wehrpflichtverweigerung, gewaltfreie Sachbeschädigung (Sabotage), ziviler Ungehorsam… In dieser Zeit hatte Camus die Strategie der Gewaltfreiheit noch nicht wirklich studiert. Aber er umreißt dieses 31 Albert Camus: »Dialogue pour le dialogue«, in Albert Camus et les libertaires (1948 – 1960), siehe Anm. 1, S. 80. 32 Albert Camus: Der Mensch in der Revolte, Reinbek 1969, S. 236.
86
Lou Marin (Marseille)
Konzept in seinem Hauptwerk Der Mensch in der Revolte: »Rechtfertigt das Ziel die Mittel? Das ist möglich. Doch wer wird das Ziel rechtfertigen? Auf diese Frage, die das geschichtliche Denken offenläßt, antwortet die Revolte: die Mittel.«33 Und es finden sich darin sogar Sätze, welche zu den Fundamenten des heutigen gewaltfrei-anarchistischen Denkens gehören: »Wenn diese Welt keinen höheren Sinn, der Mensch nur den Menschen als Bürgen hat, genügt es, daß ein Mensch ein einziges Wesen aus der Gesellschaft der Lebenden ausschließt, um selbst von ihr ausgeschlossen zu sein. […] Aber wenn ein einziges Wesen in der unersetzlichen Welt der Brüderlichkeit fehlt, ist sie entvölkert.«34 Ein Jahr später, am 12. März 1952, schreibt Camus in einem Brief an Êtienne Benoist: »Ich habe mich […] mit der Theorie der Gewaltlosigkeit befasst und komme fast zu dem Schluß, daß sie eine Wahrheit ist, die man als Beispiel verkünden sollte. Aber dazu bedarf es einer Größe, die mir fehlt.«35 In einem Gespräch mit Druckern, Typographen und KorrektorInnen am 21. Dezember 1957, das Nicolas Lazarevitch im Rahmen der Zeitschrift des revolutionären Syndikalismus, La R¦volution prol¦tarienne, organisiert hatte, erklärte der gerade erst zum Nobelpreisträger gekürte Camus: »Sagen wir, daß jedenfalls die Revolutionen mit Maschinengewehren an den Straßenecken vorüber sind.«36 Nicht jede Form der Revolution wird hier als überholt bezeichnet, lediglich die blutigen Revolutionen. Der Schriftsteller war gerade von einem fünftägigen Aufenthalt aus Schweden zurückgekehrt, wo er nicht nur seinen Preis entgegengenommen hatte, sondern auch die Räume der Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC; Schwedische Arbeiter-Zentralorganisation) besucht und sich wiederholt mit dem internationalen Anarchosyndikalisten Helmut Rüdiger ausgetauscht hatte. Gegenüber der Front de Lib¦ration Nationale (FLN; Nationale Befreiungsfront) hatte Camus während des Algerienkrieges kontinuierlich Messali Hadj unterstützt, mit dem er sich in den Jahren 1935 – 37 für eine gemeinsame Kampffront der antikolonialen französischen und der »indigenen« ArbeiterInnen eingesetzt hatte. Hadj näherte sich dem trotzkistischen und anarchosyndikalistischen Milieu um die R¦volution prol¦tarienne in den fünfziger Jahren an, sowohl er wie Camus schrieben in dieser Zeit in der Zeitschrift. Die Bewegung des Syndikalisten Messali Hadj nannte sich in den fünfziger Jahren MNA (1954 – 56 Mouvement National Alg¦rien; danach Mouvement Nord-Africain; 33 Ebd., S. 237. 34 Ebd., S. 237 f. 35 Albert Camus: »Lettre Êtienne Benoist«, 12. März 1952, zit. nach Olivier Todd: Albert Camus. Ein Leben, Reinbek 1999, S. 502. 36 »Albert Camus chez les travailleurs du Livre«, in Albert Camus et les libertaires (1948 – 1960), siehe Anm. 1, S. 303.
Camus und seine libertäre Kritik der Gewalt
87
Bewegung Nationales Algerien, danach Bewegung Nord-Afrikas) und erwies sich als weniger stark gewaltbefürwortend als die FLN. Durch seine Kritik an den von der FLN ausgeübten Terrormethoden gegen die Zivilbevölkerung näherte sich Camus in dieser Zeit immer mehr M.K. Gandhi an. Bereits am 22. November 1955 schrieb er eine erstaunliche Hommage an den Mahatma in der eher sozialdemokratischen Zeitschrift L’Express und präsentierte darin den Inder als »den größten Menschen in unserer Geschichte«.37 Dann war von Camus zur Revolte in Algerien im April/Mai 1958 folgende Stellungnahme zu lesen: »Schließlich hat Gandhi bewiesen, daß man für sein Volk kämpfen und sogar siegen kann, ohne auch nur einen einzigen Tag aufzuhören, Achtung zu verdienen. Das blinde Niedermetzeln einer unschuldigen Menge, in der der Mörder von vorneherein gewiß ist, Frauen und Kinder zu treffen, wird jede Sache jederzeit entehren.«38 Und schließlich schrieb Camus im Oktober 1958 anlässlich des Starts der Kampagne für ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung einen Entwurf, der vom Comit¦ de patronage de Secours aux objecteurs de conscience (Komitee der Schirmherrschaft für die Rettung von Kriegsdienstverweigerern) gutgeheißen wurde und worin es heißt: »Darüber hinaus hat sich die Gewaltfreiheit, über die man so oft spottet, in manchen Fällen als sehr effektiv erwiesen, während der bewaffnete Widerstand fast immer sein Ziel verfehlte. Über die Bedeutung der Bewegung von Gandhi muss in diesem Zusammenhang nichts mehr gesagt werden.«39 Aus den Gründen einer solchen Positionsentwicklung hat die indische Übersetzerin von Camus, Sharad Chandra, recht, wenn sie schreibt, er hätte es wohl gern gesehen, dass »die algerischen Nationalisten diese Politik des passiven Widerstands übernommen hätten«40,die in Wirklichkeit sehr aktiv war. Hier endet der Parcours von Camus zu dieser Frage, von den dreißiger Jahren bis zu den letzten Jahren seines Lebens. Seine Gewaltkritik hatte eine doppelte Dimension: Sie war zugleich Kritik der herrschenden Gewalt, die kapitalistisch und die Gewalt der bourgeoisen Macht war, und sie war gleichzeitig eine Kritik der revolutionären Verirrung, welche die Revolution gefährdet, weil sie die Werte der Revolte nicht mehr respektiert. Denn Camus hatte eine unblutige Revolution im Kopf. Er hat diese doppelte Kritik im Dialog mit dem libertären Milieu und innerhalb dieses Milieus entwickelt. Heute wird es unsere Aufgabe 37 Albert Camus: »La chaussette et le rouet«, in Albert Camus: Cahiers Albert Camus 6. Albert Camus ¦ditorialiste »L’Express« (mai 1955–f¦vrier 1956), Paris 1987, S. 107. 38 Albert Camus: »Vorwort zur Algerischen Chronik«, in ders.: Fragen der Zeit, Reinbek 1977, S. 146. 39 Albert Camus/Comit¦e du patronage de Secours aux objecteurs de conscience: »Proposition d’un statut pour les objecteurs de conscience«, in Albert Camus et les libertaires (1948 – 1960), siehe Anm. 1, S. 95. 40 Sharad Chandra: Albert Camus et l’Inde, Montpellier 2008, S. 63.
88
Lou Marin (Marseille)
sein, Camus vor den zahlreichen Versuchen zu retten, woher immer sie auch kommen mögen, seine libertäre Gewaltkritik ins Abseits zu drängen, sowie seine Befürwortung einer lebensbejahenden Revolution zu negieren.
Rupert Neudeck (Troisdorf) *
Die Pest als Vorbild für die Humanitäre Arbeit
Ich lese in dem Buch über die »Aufstände gegen Fremdherrschaft« von William R. Polk: »Widerstand gegen Fremdherrschaft«: »Einem denkwürdigen Ausspruch zufolge war in Algerien damals in den 50er Jahren die Folter ein ›Krebsgeschwür der Demokratie‹ geworden. Hass, Angst und Scham, wohin man blickte (in Algier). Selbst ein so gebildeter und kultivierter Schriftsteller wie Albert CAMUS entschuldigte die Brutalität der Franzosen!«1
Wichtig erscheint mir, das vorher schon zu korrigieren, bevor ich zu meinem eigentlichen Thema komme. Albert Camus hatte 1958 vor der gefährlich falschen Reaktion auf den Terror und die Terroristen gewarnt: »Die Folter (der französischen Militärs) hat vielleicht erlaubt, dreißig Bomben aufzufinden, aber sie hat gleichzeitig fünfzig neue Terroristen auf den Plan geworfen, die auf andere Art und anderswo noch mehr Unschuldige in den Tod schicken werden«.
Die dramatischen Warnungen Camus’ vor der falschen Reaktion Frankreichs auf den Terror der FLN waren noch imprägniert von der Hoffnung, dass die eine Million Algerienfranzosen, zu denen Camus sich zählte, ihre Heimat nicht verlieren würden und dass die Algerier die Chance auf ein menschenwürdiges Leben haben würden. Es war der erste Konflikt, in dem klar wurde: Wer nur mit harten militärischen Attacken auf den Terror reagiert, wird am Ende alles verlieren. Früher habe ich noch gezögert, den folgenden Satz von Camus als einen aller Humanitären zu ehren und zu achten. Aber auch Bernhard-Henri L¦vy (BHL) – der zu Lebzeiten eher auf der Seite von Jean-Paul Sartre stand – hat sich jetzt dazu bekannt. Er habe früher – so BHL – gedacht, dass sei einer der kurzen Sätze, die einem im Zustand der Ermattung entschlüpfen, weil man der dummen Fragen der Journalisten überdrüssig ist. Doch in diesem Punkt sei er sich nicht * Der Beitrag von Rupert Neudeck wird hier in der Fassung des Vortragsmanuskripts abgedruckt. 1 William R. Polk, Aufstand. Widerstand gegen Fremdherrschaft: vom Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bis zum Irak, Hamburg 2009, S. 200.
90
Rupert Neudeck (Troisdorf)
sicher. Er hat diesen Satz bei der Nobelpreisrede in Stockholm gesagt und dann in einem Brief an Amrouche, in dem er schreibt, ohne dass ein Dummkopf ihm die Galle zum Überlaufen gebracht hätte: »Keine gute Sache, so unschuldig und gerecht sie sein mag, wird mich von der Solidarität mit meiner Mutter abbringen, denn sie ist die wichtigste gute Sache in der Welt.« Alles erscheint so, als sei der große Algero-Franzose der Meistervordenker der Humanitären gewesen. Der Mentor und unser Pilgervater. »Je me r¦volte donc nous sommes« – das ist der Ausgangspunkt aller humanitären Aktionen in Kriegs-, in Bürgerkriegs- und in Naturkatastrophen. Man protestiert dagegen, dass Menschen auf Grund ihrer Geburt und ihrer Geographie einfach von vornherein schlechter gestellt sind als andere in unserer westlich-zivilisierten Welt. Wie jetzt wieder in HAITI. »Je me R¦volte donc NOUS Sommes«2 ist natürlich eine große Herausforderung für den westlichen Individualisten, der sich ja nur ganz mühselig und schwerfällig in die Revolte als kollektive Bewegung einreiht. »Dans la r¦volte, l’homme se d¦passe en autrui«3 : In der Revolte übersteigt der Mensch sich selbst. Das Bestehen von Camus auf dem Glück, »le bonheur«, hat eine entscheidende Distanz zu dem Denken von J.P. Sartre: In »Materialismus und Revolution« hatte Sartre erklärt: Glück gibt es nur, wenn es »empfunden, und erfahren« wird. »Glück« sei wesensmäßig Subjektivität«.
A.
Anarchismus – Libertäre Gedanken
Die Pest enthält alle Elemente des Camus-Denkens, auch schon die anarchistisch-libertären Ideen und Postulate, die so wertvoll wären in unserer staats- und bürokratieversessenen Zeit. Alle Debatten sind aufgehoben in dem Gespräch, das Tarrou mit dem Arzt Dr. Rieux führt gegen Schluss des Romans. Aus dem Wohlstand kommend – berichtet Tarrou – habe ich mit achtzehn die Armut kennengelernt. Was mich interessierte, war die Todesstrafe. Sein Vater war ›avocat g¦n¦ral‹, Staatsanwalt, und hatte ihn in eine Gerichtssitzung mitgenommen, wo es Todesurteile gab. »Haben Sie gesehen, wie ein Mensch erschossen wird? Nein natürlich nicht, das geschieht im Allgemeinen auf Einladung, und das Publikum wird vorher ausgesucht.« Wissen Sie – fährt er fort –: »dass die Schützen auf ganz kurze Entfernung auf die Herzgegend zielen und dort mit ihren großen Kugeln ein Loch reißen, in das man die Faust stecken könnte?« Er macht in diesem Roman ein Wortspiel, spricht davon, dass er in so einer Gesellschaft, in der befohlene Morde an der Tagesordnung sind, ein 2 Hervorhebungen durch den Autor. 3 HR 1951, S. 432.
Die Pest als Vorbild für die Humanitäre Arbeit
91
»Verpesteter« (pestif¦r¦) ist. Er sei in all diesen Jahren ein Verpesteter gewesen, »obwohl ich doch glaubte, mit allen Kräften gegen die Pest zu kämpfen«. Ich habe – so fährt Tarrou fort – indirekt das Todesurteil von Tausenden von Menschen unterschrieben, und diesen Tod sogar verursacht. Warum, könnte man fragen? Das ist das Bekenntnis dieser russischen Nihilisten und der Libertären, denen Camus anhing: »Indem ich die Taten und Prinzipien guthieß, die dieses Todesurteil unausweichlich nach sich zogen«. Er hat sich gegen das Verurteilen entschieden, gegen die roten Roben, gegen die Vorstellung, dass nur andere schuldig und wir unschuldig sind. Es ist diese Stelle auch schon eine Vorausschau auf diese wunderbare, uns alle in dieser Gesellschaft demaskierende Vorstellung von Unschuld als Ausnahme. Wie das Beispiel eines jungen Franzosen, der in einem Nazi-Lager auftaucht und dem Henker oder Richter zuruft: »Ich bin ein Sonderfall, ich bin nämlich unschuldig« (Der Fall). Und dann kommt noch einmal diese Aufteilung zwischen dem, was Regierungen machen und dem, was die Nicht-Regierungsaktivitäten tun: Da war die rote Eule, synonym für den Staat, dieses widerliche Abenteuer, bei dem widerliche, verpestete Münder einem Mann in Ketten verkünden, dass er gleich sterben werde, damit er tatsächlich starb. Dann aber der Auftrag an die NROArbeit: »Meine Sache war das Loch in der Brust.«- Und die große Weigerung, die auch schon hier angesagt ist, le refus: Dass ich mich – so Tarrou – »für meinen Teil weigern würde, dieser ekelhaften Schlachterei je eine einzige, eine einzige Rechtfertigung zu geben«. Bescheiden sagt Tarrou, um nicht zu großkotzig zu wirken: Seit langer Zeit »schäme ich mich«. Der Roman ist auch eine Studie darüber, wie man und worüber man sich schämen kann – la Honte: »Seit langer Zeit schäme ich mich, schäme mich tödlich, dass auch ich, wenn auch nur von ferne, wenn auch aus einer guten Gesinnung ein Mörder gewesen bin«. So in Afghanistan, so vorher im Irak, so vielleicht morgen im Iran, so gestern im Gazastreifen. Das Morden mit gutem Gewissen.
B.
Die Logik des Tötens
Tarrou fährt fort: »Ich schäme mich, dass auch ich, wenn auch nur von ferne, ein Mörder gewesen bin. Mit der Zeit habe ich festgestellt, dass selbst die, die bessere sind als andere, heute nicht umhin können, zu töten und töten zu lassen, weil es in der Logik liegt, in der sie leben, und dass wir in dieser Welt keine Bewegung machen können, ohne Gefahr zu laufen, zu töten.« Und er steigert das noch mit Bezug auf diese Pest, die nur mit einer anarchischen Bewegung bekämpft werden kann. »Ich habe mich weiter geschämt, denn wir sind alle im Zustand der Pest.
92
Rupert Neudeck (Troisdorf)
Ich habe den Frieden verloren. Ich suche ihn noch heute, indem ich versuche, alle zu verstehen und niemandes Todfeind zu sein.« Was die Menschen erleichtern kann, ist sowenig Böses wie möglich zuzufügen und sogar ein wenig Gutes. Und da sind wir wieder bei der Humanitären Arbeit. Unser Matre Tarrou sagt: »…deshalb habe er beschlossen alles abzulehnen, was von nah oder fern tötet oder rechtfertigt, dass getötet wird«. Die Pest berichtet nun von Grunderfahrungen des Glücks und von der Verhinderung dieser Erfahrung durch die alle gleichmachende »PEST«. Den Zustand der Verhinderung des Glücks durch die Pest nennt Camus la s¦paration, die Trennung. Die durch die Pest Getrennten haben »ihr seltsames Vorrecht eingebüßt, das sie im Anfang bewahrten«. Die Pest hatte sie gezwungen, die Selbstsucht der Liebe und den Vorteil, den die Liebenden daraus zogen, aufzugeben. Während die glücklichen Liebenden vorher zu erkennen waren, sehen sie jetzt »ganz gewöhnlich aus, einfach wie alle Leute«. Der Grund für diese Gleichheit liegt darin, dass die »Pest« allen Menschen die Zukunftsperspektive verbaut, mit Ausnahme vielleicht derjenigen, die »Heilige ohne Gott«, oder bescheidener : Menschen sein wollen. Die Pest spricht nach Camus dieser individuellen Liebe oder Freundschaft das Todesurteil: »Denn die Liebe verlangt ein wenig Zukunft, und für uns gab es nichts mehr als Augenblicke«.
I.
Salut oder Santé?
Gegen Schluss des Romans kommen die Meinungsunterschiede des Arztes und des Priesters Paneloux zum Ausdruck. Rieux drückt noch einmal die anonyme Botschaft aus, die von seiner Arbeit ausgeht, die sich nicht an eine transzendente Botschaft bindet, sondern sich nur der »Ehrfurcht vor dem Leben« verdankt. Französisch heißt es in diesem Gespräch zwischen dem Pater, der schon längst in den Sanitätskomitees arbeitet und sich die Hände schmutzig macht: »Le salut de l’Homme est un trop grand mot pour moi. Je ne vais pas si loin. C’est sa sant¦ qui m’int¦resse, sa sant¦ d’abord« [»Das Heil, das ewige Seelenheil des Menschen, das ist ein viel zu großes Wort für mich. Ich gehe nicht so weit. Es ist wirklich die Gesundheit des Menschen, die mich interessiert, die Gesundheit zuerst.«]
In diesem Gespräch wird die solidarische Grundlage von Gläubigen und Ungläubigen, Christen und Laizisten, Muslimen und Säkularen deutlich, die alle nicht in einer Kirche leben, sondern in einer konkreten Situation der Pest, in der sie aufgerufen sind, etwas für ihresgleichen, für das Leben ihrer Mitmenschen zu tun.
Die Pest als Vorbild für die Humanitäre Arbeit
93
Camus hat vorausgeahnt, dass die humanitäre Bewegung für viele in Europa eine Art Kirchen- und Sinnersatz werden wird, wo die Mehrzahl derer, die da mitmachen, ihre frömmsten Stunden nicht mehr in der Kirche verbracht haben. Paneloux hat am Ende dieses Gesprächs noch einmal eine gewisse Traurigkeit, als er feststellen muss, dass er den Arzt Dr. Rieux nun nicht überzeugt hat. Dr. Rieux aber sagt eher fröhlich: Was wird das schon machen? »Was ich hasse, das ist der Tod und das Übel. Das wissen Sie sehr gut. Und ob Sie das nun wollen oder nicht, wir sind in einem Boot, um sie zu erleiden und zu bekämpfen.« »Nous sommes ensemble pour les souffrir et les combattre.«
Und Rieux hat eine Handlungsanweisung, die der gesamten Tarif- und Versicherungsordnung in Europa widerspricht. Auch den Hundertschaften und Ambulanz-Einheiten der UNO, die alle arbeitsteilige Mandate mit sich führen, die ihnen immer wieder hilfreich belegen, dass sie nicht zuständig sind. Rieux im Gespräch mit dem windigen Journalisten Rambert, den er immerhin durch sein Vorbild abgehalten hat, illegal die Peststadt zu verlassen und der Verpflichtung, die keine juristische, sondern nur eine moralische ist, zu folgen. Da kommt Rieux auf das Fundamentalprinzip der humanitären Arbeit. Man darf sich nie darauf einlassen, dass man von einer Situation, einer Katastrophe, einem Erdbeben, einer Pestepidemie, von HIV oder der Ebola-Seuche alles weiß, um dann etwas zu TUN. Man kann nicht zugleich heilen und alles wissen. Also dann heilen wir wenigstens so schnell wie möglich. Das ist das, was am dringlichsten verlangt wird. »Ah, dit Rieux, on ne peut pas en mÞme temps gu¦rir et savoir. Alors gu¦rissons le plus vite possible. C’est le plus press¦!«4
Da ist auf seine nicht christliche, nicht theologische Art für uns Moderne das Samariter-Gleichnis aufgehoben. Dieses Gleichnis beschwört uns ja auch, nicht erst die Bedingungen der Möglichkeit unserer Hilfestellung zu erfragen. Sondern es ist die sofortige Heilung und Pflege dieses Menschen gefordert, der da zwischen Jerusalem und Jericho unter die Räuber fiel. Ich habe hunderte von Uno-Beamten erlebt, die mit bestem Gewissen in so einer Situation das Weite gesucht haben.
4 La Peste, Livre de poche, S. 191.
94 II.
Rupert Neudeck (Troisdorf)
Die Schönheit der Welt – und die Schöpfung, in der Kinder gemartert werden!
In dem Roman wird ein Widerspruch im Denken Camus’ aufgezeigt. Einmal (1.) wird die Natur als die Quelle allen Lebens, aller Freude und allen Glücks erklärt. An anderer Stelle (2.) richtet sich die Revolte des Menschen gerade gegen diese Schöpfung, die verantwortlich ist für all das, was Camus das »kosmische Böse« nennt. Der Arzt Rieux sagt es dem katholischen Priester Paneloux fast schreiend ins Gesicht beim grauenvollen Sterben, dem langen Todeskampf eines unschuldigen Kindes: »Nein Pater, ich habe eine andere Vorstellung von der Liebe. Und ich werde mich bis in den Tod hinein weigern, die Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemartert werden«5. Das sagt er als Entgegnung zu der Äußerung von Paneloux: »Aber vielleicht sollten wir lieben, was wir nicht begreifen können«. Auch Tarrou entwickelt eine solche negative Einschätzung der Schöpfung: »Was naturgegeben ist, das sind die Mikroben. Alles Übrige, die Gesundheit, die Rechtlichkeit ist eine Folge des Willens, und zwar eines Willens, der nie erlahmen darf. »Ce qui est naturel, c’est le microbe. Le reste, la sant¦, l’int¦grit¦, la puret¦, si vous voulez, c’est un effet de la volont¦ et de la Tension…«6 Deshalb heißt es in der Pest, die darin wieder dem Humanitären Helfer seinen Platz anweist: Es sei besser, »gegen das menschliche Elend zu kämpfen, als die Hände zu einem Gott zu erheben, der schweigt«.7 Der Kampf gegen diese Pest – die mehr ist als diese Pest, die heute Guantanamo und Baghram ist, und heute die Idee, wir müssen per body count so viele Taliban vernichten wie möglich, dieser Kampf gegen die »injustice ¦ternelle« bleibt eine »unbeendbare Niederlage«.8 Sie ist kein Erfolg. Sie misst sich nicht in Statistiken des Erfolges. Oder, um es drastischer für unsere Tage zu sagen, die Camus nicht mehr miterlebt: Die Reporterin der New York Times, Carlotta Gall, berichtete aus Afghanistan, wo ich mich vor zwei Wochen auch herumgetrieben habe: »Um sich in dieses Gebiet vorzukämpfen und es von aufständischen TALIBAN zu befreien (!), wälzten sich die NATO-Truppen durch Obstgärten, rissen Mauern und sogar Häuser nieder und zerstörten Weingärten und Melonenfelder… ›Sie sind nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sie sind gekommen, um uns zu vernichten‹, sagte Haji Abdul Ghafar, 60 Jahre alt, ein Ältester im Dorfrat von Sperwan.«9
5 6 7 8 9
Ebd., S. 139. La Peste, S. 149; Pl-L, S. 14 – 24. PL-L, S. 1321. Pl-L, S. 1322. William R. Polk, Aufstand, S. 300, siehe Anm. 2.
Die Pest als Vorbild für die Humanitäre Arbeit
95
Exkurs Alles findet sich über die richtige Entwicklungspolitik gesagt in La MisÀre dans la Kabylie. Wiederum in der Kabylei, wo der junge investigative Reporter Albert Camus schon 1938 für den Alger R¦publicain schrieb und er vergleichbares Elend wahrnahm. Diese Reportage, die in der Pl¦iade-Ausgabe nur die Seiten 905 bis 938 einnimmt, wurde nach einer Reise zu Beginn des Jahres 1939 in den kabylischen Bergen geschrieben und vom 5. bis 15. Juni 1939 im dem Alger R¦publicain gedruckt. Es handele sich, so Camus, um ein dicht besiedeltes Gebiet, das in der Gegend von Djurdjura 247 Einwohner pro Quadratkilometer aufweist. Es seien zwar schon an die 50.000 Kabylen ausgewandert, jährlich würde aber die Summe von 40 Millionen Francs in das Heimatgebiet zurückfließen. Aber jetzt sei auch die Möglichkeit zur Emigration verbaut. 40 % der Familien lebten mit weniger als 1000 Francs im Monat. Und jede Familie habe eben mindestens 5 – 6 Mitglieder oder Kinder. Für viele sei die Distel eine Basis der Ernährung, der Weizen ist für viele viel zu teuer. Camus wusste damals schon, dass es nicht reicht, milde Gaben und Barmherzigkeit aufzufahren, die Kabylen müssten selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen. Er gibt einen kurzen Dialog mit einem Kind wieder, das gerade eine Weizenlieferung erhalten hat: »Pour combien de jours ? 15 jours. Vous Þtes combien dans la famille? Cinq. Vous n’avez pas de figues? Non, vous mettez de l’huile dans la galette? -Non. On met de l’eau. Il est parti avec un regard m¦fiant.«
Um alle Unkenrufe und Lästerer Camus’ zum Schweigen zu bringen, auch für diesen Tag hier in Bonn, will ich die Stelle im Original zitieren, die den stärksten anti-kolonialen Akzent ausdrückt: »La souffrance et la faim d’un peuple. On aura senti que la misÀre ici n’est pas une formule ni un thÀme de m¦ditation. Elle EST. Elle CRIE et elle DÊSESPðRE. Encore: qu’avons-nous fait pour elle et avons-nous le droit de nous d¦tourner d’elle? Je ne sais pas si on l’aura compris.«
Camus hat die moderne Kritik an der Entwicklungshilfe für Afrika schon damals präventiv aufgehoben. Im Schlusskapitel der Reportage hat er die drei Schritte, die zu einer Erholung des Landes führen können, klar benannt: »Par une politique de grands travaux, par la g¦n¦ralisation de l’enseignement professionnel, et par l’organisation de l’¦migration«.10 10 A.a.O., S. 930.
96
Rupert Neudeck (Troisdorf)
Er muss ja nicht daran erinnern, dass die Kabylei Straßen und Wasserdämme und Brunnen braucht. Und das könnte man eben anders organisieren. Die jungen Leute müssen alle an ihrem Land mitarbeiten. »Une politique de grands travaux en mÞme temps qu’il absorberait une partie du chúmage et qu’elle ¦leverait les salaires un niveau normal«, diese Politik würde der Kabylei den ökonomischen Mehrwert bringen, dessen Nutzen der Bevölkerung zugute kommt. Es fehlt in diesem Artikel nur noch der präventive Verweis auf die Mikro-Kredite von Mohammed Yunus. Immer wieder und für alle Politik, damals von Frankreich, heute von der Europäischen Union gilt das, was Camus den Kabylen und sich selbst ins Stammbuch schreibt: Wenn es jemanden gibt, der das Los der Kabylen verbessern kann, dann ist es zuerst der Kabyle selbst. »Si quelqu’un peut am¦liorer le sort des Kabyles, c’est d’abord le Kabyle lui-mÞme«11.
Und er besteht immer wieder darauf: Es geht nicht um eine politische Politik, es geht um eine menschliche, es geht nicht um Parteipolitik. Darunter fasst er den Begriff »politique politicienne.«
III.
Die Freiwilligkeit des Kampfes: Kein Erfolg (Erfolg ist kein der Begriff der Humanitären)
Das trotzdem oder gerade deswegen Großartige in der humanitären Arbeit, sowohl der des Helfers wie der des indirekten Helfers, des Spenders nämlich, besteht in der Freiwilligkeit dieses Kampfes. Das macht die Nicht-RegierungsArbeit abseits der Subventionen, abseits der Verpflichtungen, die der neue BMZMinister Dirk Niebel den Helfern aufstülpen möchte, so großartig. Man kann sie nicht befehlen. Man muss durch den Freispruch zu diesem Kampf kommen.12 Deshalb ist die Begegnung des Arztes als des Prototyps des Humanitären mit dem windigen Journalisten Rambert so wichtig in der Pest. Niemand muss diese Arbeit tun. Es gibt drei Unterredungen zwischen Rambert und Rieux. In der ersten (S. 123) fragt Rieux nach der Frau Ramberts, als der Quelle des individuellen Glücks, um derenwillen Rambert die Stadt verlassen wollte. Rambert: »Aber wenn er fortginge, müsste er sich schämen.« Und das würde ihn in seiner Liebe zu der Wartenden stören. Aber Rieux richtete sich auf und sagte mit fester 11 A.a.O., S. 924. 12 Evtl. die Geschichte von Helmut Schmidt und den Ministerpräsidenten.
Die Pest als Vorbild für die Humanitäre Arbeit
97
Stimme, dies sei Blödsinn, man brauche sich nicht zu schämen, wenn man das Glück vorziehe. Dann kommt es zur zweiten Unterredung. Rieux und Tarrou haben erfahren, dass Rambert einen ungesetzlichen Fluchtweg aus der Stadt heraus sucht. Rambert, so hatten sie erfahren, war in den Schmugglerkreisen der Polizei aufgefallen. Rieux gab Rambert den Rat, sich zu beeilen. Er würde aber gebraucht in dem Team der freiwilligen Sanitätskräfte. Jedem Helfer, ob er nach Afghanistan, nach Haiti oder in den Kongo geht, wird dieselbe Frage gestellt, wie sie Rambert sich und Rieux stellte: »Warum hindern Sie mich denn nicht am Weggehen? Sie haben doch die Möglichkeit?« Rieux schüttelte den Kopf, und sagte, das sei Ramberts Angelegenheit, er habe sich für das Glück entschieden, und er, Rieux, habe ihm keine Gründe entgegenzusetzen. Er fühlte sich in dieser Sache außerstande, zu beurteilen, was gut und was böse ist. Rambert fragt dann erneut: »Und warum raten Sie mir dann, unter diesen Umständen, mich zu beeilen?« Rieux (lächelnd): »Vielleicht habe auch ich Lust, etwas für das Glück zu tun?« Rambert sagt dem Arzt: er würde sich schämen, wenn er jetzt hier verduften würde, wo ja etwas zu tun ist. Und das würde ihn in der Liebe zu der, die er daheimgelassen hat, stören. Aber Rieux richtete sich mit Macht auf und sagte, das sei Blödsinn: Man müsse sich nicht schämen, wenn man das Glück vorziehe. »Que cela ¦tait stupide et qu’il n’avait pas de honte pr¦f¦rer le bonheur.«
Ja, sagt dann aber Rambert und fasst die Begründung humanitärer Arbeit mit diesem Roman von Camus mit den wenigen Worten zusammen: »Ja, aber man muss sich schämen, allein glücklich zu sein!« »Oui mais il peut y avoir de la honte Þtre heureux tout seul.«13
IV.
Nicht auf der Seite der Henker
Es darf der Titel einer Aufsatzsammlung von Albert Camus auch deskriptiv für die Beschreibung der Arbeit der Humanitären gelten: »Ni Victimes ni Bourreaux«.14 »Die Menschen wollen weder Opfer noch Henker sein«. Henker können sie in keinem Fall sein, aber sie revoltieren gegen den Zustand des Opfers, sie werden aktiv, auch ohne demokratische, aristokratische, monarchische Legiti-
13 A.a.O., S. 190. 14 Actuelles III, 1958, S. 335.
98
Rupert Neudeck (Troisdorf)
mation. Camus war nie parteipolitisch, darin glich er den Humanitären wie ein eineiiger Zwilling dem anderen. Humanitäre respektieren die Werte und die besondere Lebenskultur der Menschen, bei denen sie sich aufhalten. »Die Rechte hat meistens im Namen von Frankreichs Ehre das gebilligt, was dieser Ehre am meisten zuwiderlief. Die Linke hat meistens im Namen der Gerechtigkeit entschuldigt, was jeder wahren Gerechtigkeit ins Gesicht schlug. So hat die Rechte der Linken das Monopol des Moralischen überlassen und diese der Rechten das Monopol des Patriotischen«.15 Das ist die Beobachtung der Humanitären, die weder die Ehre verraten noch die Gerechtigkeit, die sie aber beide nicht im Sinne einer Ideologie pervertieren oder camouflieren. Der Humanitäre tut eine extrem und genuin politische Arbeit, aber er handelt nicht politisch im Sinne einer parteipolitischen Auseinandersetzung. Die Werte, die er dieser Arbeit voranstellt, hat er der humanitären Arbeit und den humanitären Arbeitern verpflichtend gemacht: »Dialogue, concorde, r¦conciliation, rassembler und r¦unir.« Er handelt auch nicht humanitär. Oder wie es die verballhornte Sprache der Politik will: Militär-humanitär, nicht im Sinne von humanitären Provincial Reconstruction Teams. Es hat sich ja zumal im deutschen Sprachraum ein perverser Missbrauch des großen Titels und Namens des Humanitären ausgebildet, der dadurch entstanden ist, dass auch Militärs und Armeen, das Pentagon wie die Bonner Hardthöhe diesen Titel reklamieren können. Es würde Sinn machen, sich etymologisch und semantisch zu fragen, seit wann wir in Europa und der westlichen Welt auf vertrautem Fuße mit dem Begriff »Humanitäre« leben? Als die Pest auf Deutsch erschien, gab damals der Historiker der Existenzphilosophie, Otto Friedrich Bollnow, in der Zeitschrift Die Sammlung eine erste Interpretation. Darin finden sich noch »Humanisten«. Humanitäre gab es 1948 noch nicht. Aber mit dem Mythos vom Sisyphos hatte Camus schon den »paradoxen Helden« oder mit Tarrou aus der Pest den »Heiligen ohne Gott« geprägt: das sind die Humanitären, die mit dem Dauerzustand der Pest leben und sich nicht dem Fatalismus überlassen, die ankämpfen gegen diese Grenzsituation, in die die Menschen geraten. Der erste Humanitäre ist der Arzt, der versucht, das Übel zu begrenzen. Der zweite, der sich erst zur Solidarität mit den Opfern durchringen muss gegen seine Straf- und Drohtheologie, ist der katholische Theologe P. Paneloux SJ. Er kommt in seiner zweiten Predigt vom »Ihr«, das er den Gläubigen entgegenschmettert, zum »Wir«. Das, was er in der ersten Predigt gesagt hatte, bliebe wahr. Aber vielleicht hätte er es noch ohne Barmherzigkeit gedacht und gesagt.16 15 Actuelles III, 1958, S. 895. 16 Die Pest, S. 104 f.
Die Pest als Vorbild für die Humanitäre Arbeit
99
»Chose curieuse encore, il ne disait plus ›Vous‹, mais ›Nous‹«. Das ist der Weg des Humanitären, der aus der hypertroph-individualistischen Haltung und Verfassung unserer Wohlstandsgesellschaft herausspringt, der vom »solitaire« zum »solidaire« wird. Es gibt keine Möglichkeit mehr, sich zu distanzieren, wie er es in der ersten Bußpredigt noch getan hat: »Meine Brüder, ihr seid im Unglück, meine Brüder, ihr habt es verdient.« Da eben ist er der Humanitäre, der tätige Barmherzigkeit übt und leistet. Gewissermaßen ändert sich bei Camus die lebensleitende Frage: Nicht mehr geht es darum: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Weil diese Frage auch ganz subjektiv und individualistisch ist, wie auch die Antwort auf diese Frage. Sondern, es geht um die Frage: »Wie bekomme ich eine gnädige Menschheit?«
V.
Der humanitäre Korridor
Das, was am 22. Januar 1956 Albert Camus in Algier versucht hat, würde heute von Nicht-Regierungsaktivitäten vollzogen. Er hat damals bei einem Rundgespräch Franzosen und Araber gemeinsam zum Schutz der gefährdeten Zivilbevölkerung aufgefordert. Das ist heute das Merkmal und Kainsmal der humanitären Arbeit. Immer hart am Rande der Vergeblichkeit versucht der Humanitäre das Ruder für sich selbst und die ihm konkret in einer Ambulanz, einem Dorf, einer Schule Anvertrauten herumzureißen und etwas zu tun. Das was Kritiker damals, wie Francis Jeanson, die Rote Kreuz-Moral des Romans Die Pest nannten, das ist der Ehrentitel der Humanitären Arbeit. Uns kann man gar nichts Höheres nachsagen als eine Moral nach den Genfer RotKreuz-Konventionen! Das, was damals als Schimpfwort gemeint war, ist der volle Ehrentitel dieser Arbeit, es gibt keine größere Ehre. Die Pest hat unter Camus’ Werken die allergrößte Bewunderung und Leseverbreitung gefunden. Nichts von Camus kann sich darin sonnen, von Millionen Lesern und zwar wirklichen Lesern – wahrgenommen worden zu sein. Dieses Buch hat bisher überhaupt keine Anerkennung an den Altären der Rezensenten noch der Philosophen gefunden, denn einerseits ist das keine in Prosa- und Fiktionsform geronnene Philosophie, noch ist es der geronnene Zeitgeist, sondern es ist eine Aktionsform, die man sich gern gefallen lässt. Die Rezensenten sind immer gleich weitergegangen, und haben dem Roman Thesen vorgehalten, die er nicht erfüllen konnte, denn er lebt in seinen Vorbildern und Helden, die nicht auf Thesen reduziert werden können.17 Von heute aus gesehen kann ich mir kein größeres Fehlurteil vorstellen als das 17 Walter Heist, in Heinz Robert Schlette (Hg.), Wege der Deutschen Camus-Rezeption, Darmstadt, 1975, S. 170.
100
Rupert Neudeck (Troisdorf)
von Walter Heist in dem eben genannten Sammelband zur Camus-Rezeption über die Pest – die auch nur auf zwei Seiten abgehandelt wird: »Durch die Art der Problemstellung: hier Mensch, hier unfassbare Naturgewalt, werde der Akzent mit Notwendigkeit nicht auf die Wirksamkeit eines grundsätzlichen Kampfes gelegt, sondern auf die moralische Richtigkeit menschlichen Verhaltens« (…) »Wider den Willen Camus’ und wahrscheinlich, ohne dass es ihm bewusst wurde, geht von dem Buch eine seltsame Lähmung aus.«
Sowohl der Roman als auch das Theaterstück wurden eine Basis für die Arbeit der Humanitären. Ursprünglich war die Figur des barmherzigen Samariters dominierend für das christliche Abendland. Die Bußorden, die Barfußorden, die Franziskaner waren der radikale Ausdruck einer solchen Bewegung. In unserer säkularen und laizistischen Zeit gibt es weiterhin dieses Bedürfnis. Aber jetzt weniger nach dem Barfußmönch als nach dem Barfußarzt.
VI.
Die Pest ist der frontale Angriff auf die Zuständigen.
Nirgends kommen sie vor, weil sie in Stunden der Pest und der Not versagen: Der Administrateur ist eine traurige Gestalt, der Richter ebenfalls. Nur der Arzt und die Sanitätskommissionen, heute würden wir sagen, NGOs, sind dabei, in diesem Augenblick das einzig Richtige zu tun. »J’ai un plan d’organisation pour des sanitaires volontaires. Autorisez-moi m’en occuper et laissons l’administration cút¦.«18 Rieux akzeptiert, warnt aber den überschwänglichen Helfer Tarrou: Du kannst dabei krepieren. Tun – nicht Papiere machen und Büros eröffnen. »Pour le moment il y a des malades et il faut les gu¦rir.«19
VII.
Meine persönliche Geschichte.
Man kann sich sogar als Journalist nützlich machen. Tarrou: Stabsbesprechung – »L’¦pid¦mie est une affaire de chacun et chacun doit faire son devoir. Les formations de sanitaires sont ouvertes tous. Rambert: »En quoi vous serai-je utile? Eh bien dans nos formations sanitaires«.20 Zurück zu Albert Camus und der absurden Unverschämtheit seines Verschwindens am 4. 1. 1960. Er wäre in den Wirren der produktiven Studentenunruhen im Mai 1968 gerade mal 55 Jahre alt gewesen. Und es hätte alle Welt Zeit gehabt, der lückenlosen Bestätigung seiner Thesen aus dem »L’Homme R¦volt¦« 18 La Peste, S. 118. 19 Ebd., S.120. 20 Ebd., S. 144.
Die Pest als Vorbild für die Humanitäre Arbeit
101
beizuwohnen21. Nicht Raymond Aron, sondern Albert Camus hätte Jean-Paul Sartre 1979 in den Êlys¦e begleitet, um bei Giscard d’Estaing um Aufnahmeplätze für die von der »Ile de LumiÀre« und der Cap Anamur geretteten Bootsflüchtlinge einzukommen. Beim Sturz des Kommunismus und dem Fall der Mauer wäre Albert Camus 76 Jahre alt (oder jung) gewesen, bei dem Kommunismus, dessen standhafter Gegner er gegen alle Pariser Moden gewesen war. Und bei Beginn des unerhörten Europa-Krieges, 1992, und der Brudermörderischen Kriege, Serben gegen Kroaten und Slowenen, Kroaten gegen Muslimische Bosnier, Serben und Kroaten gegen die Muslime, Serben gegen Albaner, wäre er 79 Jahre alt gewesen. Hätte er sich wie zur Zeit des Algerienkrieges mit einem jener Aufrufe zum zivilen Ungehorsam an die Öffentlichkeit gewagt, auf die er sich so gut verstand? Oder hätte er sich rückhaltlos auf die Seite derer gestellt, die den Belagerten von Sarajevo gegen die serbischen Mörder beistanden? Aber lassen wir diese Traurigkeit beiseite und freuen uns, dass er uns ein Dokument hinterlassen hat, das die Ethik und die Ästhetik des humanitären Kampfes gegen das Leiden und die Ungerechtigkeit der condition humaine begründet. Hätte Albert Camus nur die MisÀre de la Kabylie und die Peste geschrieben, uns Humanitären hätte er damit ein unwiederbringliches Geschenk gemacht, für das wir bis heute und bis in diese Tage der Erinnerung an seinen absurden Tod an der Platane auf dem Weg zwischen Champigny-sur-Yonne und Villeneuve-la-Guyard am 4. Januar 1960 dankbar sind. Er hätte sich die Magna Charta der Humanitären Deutschen auch zu eigen machen können, die uns 1984 Heinrich Böll in Holstebro im Odin Teatret formulierte: Es ist schön, ein hungerndes Kind zu sättigen, Ihm die Tränen zu trocknen, Ihm die Nase zu putzen, Es ist schön, einen Kranken zu heilen. Ein Bereich der Ästhetik, den wir noch nicht entdeckt haben, ist die Schönheit des Rechts. Über die Schönheit der Künste, eines Menschen, der Natur können wir uns halbwegs einigen. Aber : Recht und Gerechtigkeit sind auch schön, w e n n sie vollzogen werden.
21 B. H. L¦vy, FAZ, 3. Januar 2010.
Hans-Joachim Pieper (Bonn)
Revolte gegen das Absurde: Zur Philosophie Albert Camus’
Revolte gegen das Absurde, dieser Titel mag Widerspruch provozieren. Hat Camus – in seiner philosophischen Frühschrift »Der Mythos des Sisyphos«1 – nicht gerade verlangt, dem Absurden standzuhalten, im Absurden zu verbleiben und allen Verlockungen von Sinn- und Erlösungsangeboten strikt zu widerstehen? Ich denke, dass dieser Titel sich dennoch rechtfertigen lässt, ja, dass er einen großen Teil dessen umfasst, was das Leben und Denken Camus’ geprägt hat – Revolte gegen das Absurde. Denn die Revolte, die Auflehnung, von der Camus auch schon im »Mythos des Sisyphos« spricht (vgl. MS, S. 50), bedeutet ja keineswegs Erlösung und letzte Sinnerfüllung, sondern permanente Bewegung, Aufmerksamkeit und Wachheit gerade für die Absurditäten und Paradoxien des Menschseins. Und die Revolte, die Camus zu einer angemessenen Reaktion angesichts des Absurden erklärt, ist auch eine Revolte gegen die bedrohlichen, zermürbenden, das Leben selbst in Zweifel ziehenden Aspekte des Absurden – auch wenn das Absurde insgesamt nach dem Verständnis Camus’ nicht überwunden werden kann und auch nicht überwunden werden soll. Das Absurde und die Revolte: Um Camus’ philosophisches Denken schlagwortartig zu umreißen, soll ein weiterer Aspekt gleich zu Beginn an die Seite dieser Begriffe gestellt werden: der Aspekt des Maßes und der Grenze, der sich in Camus’ Naturverbundenheit und seiner Liebe zum Leben zum Ausdruck bringt. Drei Gestalten der griechischen Sage markieren so Camus’ zentrale Gedanken und weisen – nach einer kurzen Betrachtung von Camus’ Biographie – auch unseren Überlegungen den Weg: Sisyphos, der Inbegriff des Absurden, Prometheus, der gegen die Götter revoltiert, und Nemesis, »die Göttin des Maßes, nicht der Rache«,2 die den »Maßlosen« Verderben bringt,3 wie Camus erklärt. 1 Albert Camus, Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde. Hamburg, Juni 1959, 5. Auflage, Januar 1980; im Folgenden: MS. 2 Albert Camus, Helenas Exil, in: Ders., Hochzeit des Lichts. Aus dem Französischen von Peter Gan und Monique Lang. Hamburg – Zürich, 2. Auflage, 2010, S. 119 – 126; ebd., S. 120. 3 Albert Camus, Der Mensch in der Revolte. Essays. Reinbek bei Hamburg, Juli 1969, 24. Auflage, Februar 2001, S. 334; im Folgenden: MR.
104
1.
Hans-Joachim Pieper (Bonn)
Vita
Das Leben Albert Camus’, das ich kurz skizzieren will, endete am 4. Januar 1960 in dem kleinen Ort Villeblevin – südlich von Paris – auf dem Beifahrersitz eines Facel Vega FVS. Auch der Fahrer des Wagens, Michel Gallimard, kam bei diesem Unfall ums Leben. Der Wagen war, wahrscheinlich wegen eines geplatzten Reifens, frontal gegen einen Baum geprallt. 1951 hatte Camus notiert: »Zuweilen wünschte ich mir einen gewaltsamen Tod – gleichsam einen Tod, der es entschuldbar macht, wenn man gegen das Herausreißen der Seele aufbegehrt. Zu anderen Zeiten träumte ich von einem langen, völlig bewusst erlebten Ende, damit wenigstens nicht gesagt werden könne, ich sei überrascht worden – in meiner Abwesenheit – mit einem Wort, um zu wissen … Aber man erstickt in der Erde.«4 Auf der Höhe seines Ruhms, am Wendepunkt einer Lebens- und Schaffenskrise, die ihn über Jahre gequält hatte, ist Camus »überrascht worden«. Hinter ihm lag ein beeindruckender Weg: vom kleinen Jungen aus einem Armenviertel in Algier zum Nobelpreisträger für Literatur mit Wohnsitzen in Paris und der Provence, vom Sprössling einer Familie, in der es weder Zeitungen noch Bücher gab, zum Verfasser von Romanen und Essays, die auf der ganzen Welt gelesen wurden. Als zweiter Sohn mittelloser französischer Einwanderer wurde Camus am 7. November 1913 in einem Dorf in Ostalgerien geboren. Schon neun Monate später greift die Weltgeschichte in sein Leben ein: Der erste Weltkrieg bricht aus, Camus’ Vater wird einberufen und stirbt am 11. Oktober 1914 an den Folgen einer Verwundung in der ersten Marneschlacht.5 Madame Camus zieht mit den beiden Söhnen zu ihrer Mutter nach Algier. Im hinterlassenen Romanfragment »Der erste Mensch«, an dem er kurz vor seinem Tode gearbeitet hat, hat Camus seine Kindheit in Algier eindringlich beschrieben: die zutiefst geliebte, halbtaube Mutter, die als Putzfrau für den Lebensunterhalt sorgte, die gefürchtete Großmutter, die Schläge mit dem Ochsenziemer für das bewährteste Erziehungsmittel hielt6, die Arbeiter des Viertels, mit denen der Onkel zur Jagd ging und in der Kneipe zusammensaß. Von den, wie er schreibt, »Reichtümern und Freuden der Armut« (EM, S. 356), der Kameradschaft, Freundschaft und Liebe7, hat Camus sein Leben lang gezehrt. Was einen Ausweg aus der Armut verhieß, bedeutete zugleich die sukzessive Entfremdung von Familie und Herkunft: der Besuch des Gymnasiums, der ihm 4 Albert Camus, Tagebücher 1935 – 1951. Reinbek bei Hamburg, 3. Auflage, 1976, S. 310; im Folgenden: T 1935 – 51. 5 Vgl. Brigitte Sändig, Albert Camus. Reinbek bei Hamburg 1995, S. 12. 6 Vgl. Albert Camus, Der erste Mensch. Deutsch von Uli Aumüller. Reinbek bei Hamburg, Sonderausgabe 2010, S. 75; im Folgenden: EM. 7 Vgl. Sändig, a. a. O., S. 14.
Revolte gegen das Absurde: Zur Philosophie Albert Camus’
105
auf Drängen seines Lehrers Louis Germain gestattet wurde. Von 1924 – 1931 besucht Camus das Lyzeum in Algier, anschließend studiert er an der dortigen Universität. Er schließt sein Studium 1936 mit einem Diplom in Philosophie ab. Während dieser Jahre engagiert sich Camus in der Kommunistischen Partei (von 1934 – 1937), er gründet eine Theatergruppe und ist – was weniger bekannt sein dürfte – begeisterter Fußballspieler in der Universitätsmannschaft. Schon in seiner Kindheit überwog die Lust am Fußball seine Angst vor den Schlägen der Großmutter, und noch in den 50er-Jahren gesteht Camus seine Rührung über die Fernsehbilder brasilianischer Fußballspieler, die sich ihrer Freudentränen schämen. Einen tiefen Riss hat Camus’ Selbstverständnis erlitten, als er 1930 – noch als Schüler auf dem Gymnasium also – an Lungentuberkulose erkrankte, eine Beeinträchtigung, die seiner Aktivität auch in späteren Jahren immer wieder Grenzen setzte. 1934 heiratet Camus Simone Hi¦, von der er sich bereits 1936 getrennt hat (die Ehe wurde 1940 geschieden).8 Von einer – noch mit Simone Hi¦ unternommenen – Europareise unterbrochen, bleibt Camus bis 1940 in Algier. Er betätigt sich als Journalist und bringt erste schriftstellerische Projekte auf den Weg: den erst posthum veröffentlichten Roman »Der glückliche Tod« und die Prosasammlungen »Licht und Schatten« und »Hochzeit des Lichts«. Während des Krieges hält sich Camus die meiste Zeit in Frankreich auf, zunächst in Paris, dann in Clermont-Ferrand, schließlich erneut in Paris. Camus heiratet ein zweites Mal: Francine Faur, eine Studentin aus einer wohlhabenden Familie in Oran; 1945 werden die Zwillinge Jean und Catherine geboren. Nachdem im Juni und Oktober 1942 die Erzählung »Der Fremde« und der Essay »Der Mythos des Sisyphos« erschienen waren, gehörte Camus – der sich bereits in Lyon der R¦sistance angeschlossen hatte – zum inneren Kreis der französischen Intellektuellen. Ab 1943 war er Lektor im Verlag Gallimard, zugleich vertrat er den Chefredakteursposten der Widerstandszeitung »Combat«, an der auch Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Andr¦ Gide und andere hochrangige Autoren mitwirkten. Nach Ende des Krieges gehörte Camus zu den wichtigsten Repräsentanten der französischen Literatur.9 Mit dem Erscheinen des Romans »Die Pest« im Juni 1947 avancierte er geradezu zum Bestsellerautor. Er erhält den »Prix des Critiques« und wird zu Vortragsreisen unter anderem in die USA und nach Kanada eingeladen. Ein erneuter Krankheitsausbruch während einer 8 In der letzten Tagebucheintragung vor seinem Tod notiert Camus: »Das erste Geschöpf, das ich geliebt habe und dem ich treu war, ist mir in den Drogen, im Verrat entglitten. Vielleicht rührt vieles von dort her, aus Eitelkeit, aus Furcht, wieder zu leiden, dabei habe ich doch viele Leiden auf mich genommen. Aber seitdem bin ich meinerseits allen entglitten, und irgendwie wollte ich, dass mir alle entglitten.« Albert Camus, Tagebuch März 1951- Dezember 1959. Reinbek bei Hamburg, Oktober 1993, Neuausgabe 1997, S. 352; im Folgenden: T 1951 – 59. 9 Vgl. Sändig, a. a. O., S. 76.
106
Hans-Joachim Pieper (Bonn)
Südamerikareise zwingt ihn, sich eine Weile zurückzuziehen. In einer Notiz von 1952 heißt es: »Was mich immer aus aller Niedergeschlagenheit gerettet hat, ist der Umstand, dass ich nie aufgehört habe, an das zu glauben, was ich in Ermangelung eines treffenderen Worts ›meinen Stern‹ nenne. Aber heute glaube ich nicht mehr daran.« (T 1951 – 59, S. 67) In der Zurückgezogenheit eines südfranzösischen Gebirgsdorfes (Cabris) entsteht Camus’ zweiter bedeutender philosophischer Essay : »L’Homme r¦volt¦« – »Der Mensch in der Revolte«. Camus’ in diesem Werk und auch bei anderen Gelegenheiten deutlich formulierte Ablehnung von Ideologien, die um der Zukunft willen über Menschenopfer großzügig hinwegsehen, führt zum Bruch mit Sartre und anderen linken Intellektuellen, die zu den stalinistischen Konzentrationslagern schweigen. Wenig später, im November 1954, beginnt der Befreiungskrieg in Algerien. Camus versucht zu vermitteln. Unter großen Gefahren wirbt er in Algier für Versöhnung, dafür, wenigstens die Zivilbevölkerung zu schonen. In Algier, in politischer Aktion fühlt sich Camus wie befreit: »Ja, zum ersten Mal seit Monaten war ich beim Aufstehen glücklich«, lesen wir und: »Ich habe den Stern wiedergefunden.« (T 1951 – 59, S. 229) Allerdings muss man wohl konstatieren, dass Camus, dessen Familie zwar zu den Kolonialisten, aber nicht zu den Kolonialherren gehörte, sich die Geschichte der kolonialen Eroberung und das Schicksal der »autochthonen Bevölkerung« Algeriens10 nie wirklich klar gemacht hat. Für ihn war Algerien seine Heimat, und Heimat hatte für ihn nichts mit Besitz und Macht zu tun, sondern mit den Jahren der Kindheit in einer Atmosphäre armseliger Solidarität, mit den glücklichen Momenten, wie er schreibt, »unter dem Schutz der gleichgültigen Gottheiten Sonne, Meer oder Elend« (EM, S. 275 f.). Die Verleihung des Nobelpreises für Literatur im Jahre 1957 rückt Camus noch mehr ins Licht der Öffentlichkeit. Er erlebt die »Händlergesellschaft«11, insbesondere das Großstadtleben in Paris, zunehmend als zerstörerisch und sucht Zuflucht in einem Haus in Lourmarin in der Provence. Hier beginnt er mit der Arbeit am dritten Zyklus seines Schaffens: dem »Zyklus des Absurden und der Revolte« sollte ein »Zyklus der Liebe« folgen.12 Dazu ist es nicht mehr gekommen. Doch scheint Camus in der letzten Zeit vor seinem Tod gelungen zu sein, was er für ein Privileg der Reichen hielt. In Anspielung auf Proust heißt es bei Camus: »Die verlorene Zeit wird nur bei den Reichen wiedergefunden. Für die Armen verzeichnet sie nur die undeutlichen Spuren des Weges zum Tode.« (EM, S. 109) Die Einsicht vor Augen, dass eine Rückkehr nach Algerien für ihn 10 Vgl. Sändig, a. a. O., S. 100. 11 Vgl. Sändig, a. a. O., S. 120. 12 Sändig, a. a. O., S. 8; vgl. ebd., S. 127.
Revolte gegen das Absurde: Zur Philosophie Albert Camus’
107
nicht mehr in Frage komme, im Schutz der Abgeschiedenheit seiner neuen »Heimstatt« in der Provence öffnet sich für Camus das Reich seiner Kindheit, geben sich ihm die Quellen seines Lebenswillens und seiner Kreativität zu erkennen: »[…] er konnte endlich schlafen«, heißt es in »Der erste Mensch«, »und in die Kindheit zurückkehren, von der er nie erlöst worden war, zu diesem Geheimnis aus Licht und warmherziger Armut, die ihm geholfen hatte, zu leben und alles zu meistern.« (EM, S. 59)
2.
Sisyphos
»Die Götter hatten Sisyphos dazu verurteilt, unablässig einen Felsblock einen Berg hinaufzuwälzen, von dessen Gipfel der Stein von selbst wieder hinunterrollte. Sie hatten mit einiger Berechtigung bedacht, dass es keine fürchterlichere Strafe gibt als eine unnütze und aussichtslose Arbeit.« (MS, S. 98) So beginnt Camus’ Version des Mythos von Sisyphos, und sie endet bekanntlich mit den Worten: »Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.« (MS, S. 101) Nun ist die Verbindung einer gleichförmigen, von keinem höheren Sinn beseelten Tätigkeit mit dem Empfinden von Glück kein völlig abwegiger Gedanke. Aber die Haltung des Camusschen Sisyphos hat weder etwas zu tun mit dem auf das Nächstliegende beschränkten Bewusstsein eines naiven Wilden la Rousseau noch mit der weisen Resignation eines Candide, den Voltaire am Ende zahlreicher Abenteuer in der besten aller möglichen Welten seinen Garten bestellen lässt. Der Sisyphos Camus’ ist bei vollem, aufgeklärtem Bewusstsein. Er weiß um die Freuden des Lebens, die ihm versagt sind, er weiß um die Unabänderlichkeit und ewige Dauer seines Schicksals. Aber Sisyphos ist auch nicht resigniert. Er ergibt sich nicht demütig in sein Los, sondern übernimmt voller Verachtung für das Schicksal und die Götter sein Leben als »persönliches Geschick«, als seine ureigene Sache: »Jedes Gran dieses Steins«, schreibt Camus, »jeder Splitter dieses durchnächtigten Berges bedeutet allein für ihn eine ganze Welt. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen.« (MS, S. 101) Sisyphos hält seiner ausweglosen, absolut sinnlosen Lage nicht nur stand. Sisyphos triumphiert über sie, indem er aus ihr das Glück eines nur auf sich selbst gestellten menschlichen Lebens schöpft. Scheint normalerweise gerade die Ewigkeit, die Unsterblichkeit des sich mühenden Sisyphos als das wahrhaft Tragische dieses Schicksals, muss man dem Sisyphos Camus’ unterstellen: Hier will das Absurde Ewigkeit, hier wäre der Tod die größte Bedrohung. Insofern stellt Sisyphos bei Camus nicht nur den Inbegriff, sondern in der Tat den »Held[en] des Absurden« dar (MS, S. 99).
108
Hans-Joachim Pieper (Bonn)
Das Absurde – so lautet der zentrale Begriff von Camus’ erstem philosophischen Essay »Der Mythos von Sisyphos«. Gibt es eine Logik, die unweigerlich vom Absurden zum Tode führt, fragt Camus. Ist ein sinnloses Leben erstrebenswert oder wenigstens möglich, oder bleibt uns angesichts der Widersprüche und Herausforderungen des Daseins nichts anderes übrig, als Selbstmord zu begehen, sei es den »philosophischen Selbstmord« (MS, S. 29) durch einen »Sprung« (MS, S. 33) in Metaphysik und Glauben, sei es den Selbstmord im engeren, biologischen Sinne? Camus’ Essay ist ein leidenschaftliches Plädoyer für ein Leben ohne Glauben und Hoffnung, ohne Illusionen, ohne Sinn, kurz gesagt: für ein Leben im permanenten Bewusstsein des Absurden. Wann reden wir davon, dass etwas absurd sei? Camus nennt einige Beispiele: »Wenn ich einen Unschuldigen eines ungeheuerlichen Verbrechens bezichtige, wenn ich von einem tugendhaften Menschen behaupte, er habe seine leibliche Schwester begehrt, so wird er mir antworten, das sei absurd.« Oder : »Wenn ich sehe, wie ein Mensch sich mit blanker Waffe auf eine Maschinengewehrgruppe stürzt, dann werde ich sein Unternehmen absurd finden.« (MS, S. 30) »Das ist absurd bedeutet«, so meint Camus: »Das ist unmöglich, aber auch: Das ist ein Widerspruch in sich.« (MS, S. 30) Allen Urteilen über etwas Absurdes liegt ein Vergleich zugrunde: »Das Absurde ist im wesentlichen ein Zwiespalt« (MS, S. 30 f.), der sich aus einem Missverhältnis ergibt, aus einem Widerspruch zwischen einem Urteil und den Tatsachen, zwischen einer Handlungsabsicht und den Kräfteverhältnissen in der Welt (vgl. MS, S. 30). Und das soll auch für die fundamentale Absurdität des menschlichen Lebens gelten: Eindruck und Begriff des Absurden entstehen grundsätzlich nur in einer vergleichenden Gegenüberstellung. Ich komme darauf zurück. Bei aller Gelehrsamkeit und allen kritischen Seitenblicken auf zeitgenössische philosophische Theorien handelt es sich bei Camus’ Essay weniger um eine akademisch-wissenschaftliche Arbeit als vielmehr um die emphatische Untersuchung eines zutiefst existenziellen Problems. Und unsere Existenz trägt sich keineswegs nur geistig, sondern auch emotional und leiblich zu. Unsere Urteile über die Welt hängen nicht nur vom Verstande, sondern in hohem Maße auch von Gefühlen ab. Camus trägt dem Rechnung, indem er sowohl das »Gefühl der Absurdität« (MS, S. 15) als auch ihren Begriff untersucht. Große Gefühle schaffen ihr eigenes »Klima« (MS, S. 15), verleihen der Welt ein ihnen eigentümliches Gepräge. Wie macht sich das »Klima der Absurdität« (MS, S. 16) bemerkbar, auf welche Weise springt das »Gefühl der Absurdität« (MS, S. 15) einen Menschen an? Es hebt an, wenn jemand einen Blick von außen auf sein alltägliches Leben wirft und sich fragt »Warum?« und »Wozu?«. »Dann«, so Camus, »stürzen die Kulissen ein. Aufstehen, Straßenbahn, vier Stunden Büro oder Fabrik, Essen, Straßenbahn, vier Stunden Arbeit, Essen, Schlafen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, immer derselbe Rhythmus –
Revolte gegen das Absurde: Zur Philosophie Albert Camus’
109
das ist sehr lange ein bequemer Weg. Eines Tages aber steht das ›Warum‹ da, und mit diesem Überdruss, in den sich Erstaunen mischt, fängt alles an.« (MS, S. 16) Das Erschrecken darüber, wie die Zeit vergeht und dass man ihr unentrinnbar unterliegt, kann Ausdruck des Gefühls des Absurden sein (MS, S. 17). Einmal aus der Selbstverständlichkeit des alltäglichen Lebens herausgetreten, »ergreift uns« (MS, S. 17) das Gefühl der »Verfremdung«, das Gefühl der Fremdheit der Welt, ihrer Undurchdringbarkeit und »primitiven Feindseligkeit« (MS, S. 17 f.): »Eine Sekunde lang verstehen wir die Welt nicht mehr […]. Die Welt entgleitet uns: sie wird wieder sie selbst.« (MS, S. 18) Aber auch die Menschen können uns mit einem Mal mechanisch, sinnlos, unmenschlich erscheinen, ebenso wie wir bisweilen unserem eigenen Spiegelbild, unseren eigenen Fotografien wie etwas Fremdem gegenüberstehen (MS, S. 18). In alledem meldet sich nach Camus das Gefühl des Absurden. Und schließlich ergreift angesichts des Todes das »Grauen« von uns Besitz: Grauen über die »blutige Mathematik, die über uns herrscht« und all unser Mühen und Streben mit »Nutzlosigkeit« überzieht (MS, S. 18 f.). Aber auch der Verstand, auch das Denken erweist sich nach Camus als eine Quelle des Absurden. Das Denken verwickelt sich in Widersprüche, sobald es sich zu Allheitsaussagen hinreißen lässt – etwa dem Satz »Alles ist wahr« oder dem gegenteiligen, alles sei falsch (MS, S. 19) –, die Wissenschaften ergehen sich in Hypothesen, Metaphern und Konstruktionen (MS, S. 22 f.), und auch die Betrachtung unserer selbst führt lediglich zur Gewissheit unserer Existenz – ohne inhaltliche Einsicht und Erklärung: »Ich werde mir selbst immer fremd bleiben.« (MS, S.22) Das leidenschaftliche Verlangen nach »Klarheit«, nach einer geordneten, bis ins Letzte verständlichen Welt, die dem Menschen eine vertraute Heimat bietet, bleibt nach Camus’ Verständnis ungestillt. Absolute, letzte Erkenntnis ist uns verwehrt. Auch das Streben nach Wahrheit endet im Absurden, endet bei der Feststellung, dass sich die Welt an sich vor unserem Forschungsdrang verschließt: »Von wem oder wovon kann ich tatsächlich behaupten: ›Das kenne ich!‹ Das Herz in mir kann ich fühlen, und ich schließe daraus, dass es existiert. Die Welt kann ich berühren, und auch daraus schließe ich, dass sie existiert. Damit aber hört mein ganzes Wissen auf; alles andere ist Konstruktion.« (MS, S. 21) Wie gesehen gibt es nach Camus also zwei Quellen für das »Klima« und den Begriff des Absurden: das Gefühl und den forschenden Verstand. Mehr noch als beim Gefühl des Absurden tritt allerdings bezüglich des Verstandes hervor, was ich schon angedeutet habe: Das Absurde resultiert stets aus einer vergleichenden Gegenüberstellung, es besteht in einem Missverhältnis, in einem »Zwiespalt«, wie Camus formuliert, zwischen dem Menschen und seinem Verlangen auf der einen und der Welt auf der anderen Seite: »Das Absurde entsteht aus [der] Gegenüberstellung des Menschen, der fragt, und der Welt, die vernunft-
110
Hans-Joachim Pieper (Bonn)
widrig schweigt.« (MS, S. 29) Nicht die Welt ist absurd und auch das fragende Verlangen des Menschen nicht: Das Absurde ergibt sich vielmehr »aus ihrem Zwiegespräch«, aus der Konfrontation »des Irrationalen und des glühenden Verlangens nach Klarheit, das im tiefsten Innern des Menschen laut wird. Das Absurde hängt« also »ebenso sehr vom Menschen ab, wie von der Welt« (MS, S. 23), vom »Irrationalen« ebenso wie vom »Heimweh des Menschen« (MS, S. 29). Camus bezeichnet den »Begriff des Absurden« als seine »Erste Wahrheit«. Daran gelte es festzuhalten, davon – vom Absurden – sei als vom »einzig Gegebene[n]« auszugehen (MS, S. 31). Das bedeutet zweierlei: Camus duldet kein Ausweichen, keinen Sprung in metaphysische Spekulationen. Zum zweiten: Am Absurden festzuhalten, bedeutet auch, das Zwiegespräch in Gang zu halten. Nur dann bleibt das Absurde als verweigerte Heimat, unbeantwortetes Fragen und Verlangen im Bewusstsein, wenn das Heimweh, das Verlangen, das Fragen wach gehalten und permanent erneuert werden. Es gibt keine Antwort, es gibt keinen Sinn – das bekommt nur jemand zu hören, der fragt und nach Sinn verlangt. Camus formuliert die paradoxe Bemerkung: »Das Absurde hat nur insoweit einen Sinn, als man sich mit ihm nicht einverstanden erklärt.« (MS, S. 32) »Dem Absurden ins Auge sehen« (MS, S. 49) und sich gegen das Absurde erheben, das ist ein und dieselbe Bewegung. Die Auflehnung besteht im Sinnverlangen, in den Forderungen an die Welt, die das Absurde allererst generieren. Daran hält das Denken fest: Keine Hoffnung, kein Glaube, kein Trost kommt dem Bewusstsein des Absurden zu Hilfe. Sisyphos macht sich keine Illusionen über die Sinnlosigkeit und Unentrinnbarkeit seines Geschicks. Das Bewusstsein des Absurden lässt jedoch noch eine Auflehnung in einem anderen Sinne zu. »Nichts ist entschieden. Aber alles ist verwandelt«, sagt Camus (MS, S. 48). Wer am Absurden festhält, für den gibt es kein Morgen (vgl. MS, S. 52), sondern »die Hölle des Gegenwärtigen ist sein Reich« (MS, S. 48). Aber in dieser »Hölle« steckt zugleich, wenn Sie diesen Ausdruck gestatten, sein Himmelreich: Der absurde Mensch gleicht einem zum Tode Verurteilten – der Tod ist seine einzige Gewissheit –, dessen Freiheit, dessen »Verfügungsmacht« (MS, S. 53) über die Gegenwart seines Lebens gewaltig gesteigert ist. Er kann der Zukunft, der Hoffnung entsagen und sich ganz seinem zwar absurden, sinnlosen, aber dennoch (möglicherweise) lebenswerten Dasein widmen. An die Stelle der metaphysischen Freiheit tritt seine Handlungsfreiheit. Die »Gleichgültigkeit« gegenüber der Zukunft weckt »das leidenschaftliche Verlangen, alles Gegebene auszuschöpfen« und dabei weniger auf die Qualität der Erfahrungen zu setzen als auf ihre Quantität (MS, S. 54). In der »Auflehnung« und »Freiheit« angesichts des Absurden kommt es ihm darauf an, »so intensiv wie möglich [zu] leben« (MS, S. 56). So wird Leidenschaft – nach Auflehnung und Freiheit – zur dritten Schlussfolgerung, die Camus aus dem Absurden zieht (MS, S. 57). In einem Satz:
Revolte gegen das Absurde: Zur Philosophie Albert Camus’
111
Das Leben ist lebenswert, auch wenn es keinen Sinn hat. Die Absurdität des Lebens führt nicht konsequenterweise zum Selbstmord. Auch ein sinnloses Leben kann sich lohnen, und nur ein Leben, das im Bewusstsein der Absurdität gelebt wird, scheint nach Camus den Titel der »Redlichkeit« (MS, S. 46) und Aufrichtigkeit zu verdienen.
3.
Prometheus
Auch über einen anderen Helden der griechischen Mythologie, über Prometheus, hat Camus seine eigene Version geschrieben. Sie findet sich in »Der Mensch in der Revolte«, am Ende von Camus’ Auseinandersetzung mit den Revolutionen der Neuzeit. Prometheus, so heißt es, »schreit seinen Hass auf die Götter und seine Liebe zu den Menschen heraus, wendet sich verachtungsvoll von Zeus ab und kommt zu den Sterblichen, um sie zum Ansturm gegen den Himmel zu führen. Doch die Menschen sind schwach oder feig; man muss sie organisieren. Sie lieben das unmittelbare Vergnügen und Glück; man muss sie lehren, um zu wachsen, den Honig der Tage zu verschmähen. So wird auch Prometheus zum Lehrer, der zuerst lehrt, darauf befiehlt. Der Kampf dauert noch länger an und wird aufreibend. Die Menschen zweifeln zuerst am Sonnenstaat und seinem Bestehen. Man muss sie vor sich selbst retten. Der Held sagt ihnen darauf, er kenne den Staat, er allein. Die daran zweifeln, werden in die Wüste getrieben, an einen Felsen genagelt, den grausamen Vögeln zum Fraß vorgeworfen. Die andern gehen fortan im Dunkeln, hinter dem einsamen, gedankenversunkenen Meister. Prometheus, der Einsame, ist Gott geworden und herrscht über die Einsamkeit der Menschen. Aber von Zeus hat er nur die Einsamkeit und die Grausamkeit angenommen, er ist nicht mehr Prometheus, er ist Cäsar. Der wahre, ewige Prometheus hat nun die Gestalt eines seiner Opfer. Der gleiche Schrei aus der Tiefe der Zeit hallt noch immer in der Weite der skythischen Wüste.« (MR, S. 276) Wenn Camus’ Augenmerk in dieser Parabel auch vor allem dem Problem der Pervertierung historischer Revolutionen gilt, ihrem oft zu beobachtenden Umschlagen von Empörung und berechtigtem Aufruhr in Gewalt und Terror, finden sich darin keimhaft doch sämtliche Elemente, die für sein Konzept des »Menschen in der Revolte« bedeutsam sind: die metaphysische Revolte, die sich gegen die Götter und das menschliche Schicksal im Ganzen empört, die historische Revolte, in der sich Gedemütigte und Unterdrückte gegen die Machthaber erheben und ihre Situation verbessern wollen, die schon angedeutete Gefahr des Umschlagens der Revolte in eine Revolution, in der Funktionäre, Ideologien und Terrorakte dominieren, und der »wahre, ewige Prometheus« als Symbolfigur der immerwährenden Auflehnung, der lebendigen, permanenten Revolte.
112
Hans-Joachim Pieper (Bonn)
Auflehnung, Revolte hat Camus, wie gesagt, bereits im »Mythos des Sisyphos« als eine angemessene Haltung gegenüber dem Absurden angeführt. Man kann darüber streiten, ob das Absurde die von Camus genannten Reaktionen – Intensivierung der Leidenschaft, Stärkung des Freiheitsbewusstseins und eben die Auflehnung – tatsächlich so zwingend nahe legt, wie Camus es suggeriert, oder ob sich nicht aus dem Absurden eine strikt nihilistische Haltung ebenso folgern ließe. Festzuhalten ist, dass Camus die Position vertritt, dass (1.) das Absurde erst aus der Konfrontation des menschlichen Verlangens mit der gleichgültig schweigenden Realität entsteht und dass (2.) ein aufrichtiges Leben verlangt, dem Absurden ins Auge zu sehen. Das aber heißt, nicht aufzuhören, Fragen zu stellen, Heimat und Einheit in der Welt zu fordern, mit anderen Worten am Leben zu bleiben und dem Leben – so absurd [›sisyphosisch‹] es auch sein mag – so viel Gutes abzutrotzen wie möglich. »Der letzte Schluss der absurden Argumentation«, so schreibt Camus in »Der Mensch in der Revolte« (auf den »Mythos des Sisyphos« zurückblickend), »ist in der Tat die Verwerfung des Selbstmordes und die Erhaltung jener hoffnungslosen Kluft zwischen der Frage des Menschen und dem Schweigen der Welt.« (MR, S. 12) Das Absurde, so meint Camus, führt über sich hinaus (vgl. ebd., S. 17). Wenn das Absurde wach gehalten, wenn es im Bewusstsein gehalten werden soll, dann setzt es zumindest einen Wert unabdingbar voraus: nämlich das Leben. Die absurde Überlegung führt dazu, »das Leben als das einzig notwendige Gut« anzuerkennen (MR, S. 13): »Um sagen zu können, dass das Leben absurd ist, muss das Bewusstsein Leben haben.« (Ebd.) Man kann, wie gesagt, bezweifeln, dass die Einsicht in die Absurdität des Lebens verlangt, dass diese Einsicht auch im Bewusstsein gehalten und ausgesprochen wird. Neben einer solchen absurd-rationalen Wahl kennt Camus sehr wohl eine andere Instanz der Entscheidung: »Die Entscheidung des Körpers«, so heißt es bereits im »Sisyphos«, »gilt ebenso viel wie eine geistige Entscheidung, und der Körper scheut die Vernichtung. Wir gewöhnen uns ans Leben, ehe wir uns ans Denken gewöhnen.« (MS, S. 13) Und in »Der Mensch in der Revolte« findet sich der prägnante Hinweis, dass »doch Leben an sich schon ein Werturteilen ist. Atmen heißt urteilen.« (MR, S. 15) Man könnte also sagen: Der Mensch lebt und fragt und fordert Einheit und Sinn, und so generiert er das Absurde, angesichts dessen er vor der Wahl steht, alles und alle – einschließlich seiner selbst – zu vernichten (vgl. MR, S. 14) oder aber das Absurde zu leben bzw. zu leben und dem Absurden standzuhalten. Und wenn er sich für das Letztere entscheidet – eine Entscheidung, die mit jedem Atemzug bekräftigt wird –, dann ist darin auch die Anerkennung eines fundamentalen Wertes beschlossen: die Anerkennung des Lebens »als [des] einzig notwendige[n] Gut[s]« (MR, S. 13), dem man die weiteren »Schlussfolgerungen« aus dem Absurden, die Werte der Freiheit und der Leidenschaft, mag anhängen können. Das Absurde leben zu wollen, heißt auf jeden Fall immer auch leben zu wollen.
Revolte gegen das Absurde: Zur Philosophie Albert Camus’
113
Anhand dieser Überlegung ist zunächst herauszustellen, was Camus als den Grundzug der Revolte überhaupt erkennt. Die Bewegung der Revolte ist stets ambivalent, sie enthält stets Ablehnung und Bejahung, Ja und Nein in einem (MR, S. 21). Wer revoltiert, empört sich gegen etwas. Aber er tut das im Namen eines anderen, eines Wertes, den er bedroht sieht und bewahren will. Wer dem Absurden trotzt, wendet sich gegen die sinnlos-stumme, ungerechte Welt und sein tödliches Verhängnis. Zugleich hält er am Leben fest, das er nicht hergeben, sondern im Gegenteil in leidenschaftlicher Freiheit genießen will. In »Der Mensch in der Revolte« geht Camus noch einen entscheidenden Schritt weiter : Während Sisyphos mit sich und seinem Schicksal allein ist, begegnet Prometheus uns als Streiter für die Menschen. Tritt in der Revolte, in der Empörung gegen Absurdität und Unrecht, das Leben als »das höchste Gut« (MR, S. 22) hervor, ist es nach Camus doch nicht nur das einzelne, je eigene Leben, worum es dabei geht. Wer revoltiert, meint Camus, tut das im Namen aller Menschen. Die »Bewegung der Revolte« ist die Geburtsszenerie der »Solidarität der Menschen«, und diese Solidarität wiederum legitimiert und limitiert die »Bewegung der Revolte« (MR, S. 30). Bevor ich darauf näher eingehe, sei kurz die historische Situation in Erinnerung gebracht, in der Camus – nach seinem Verständnis – diese Überlegungen formuliert hat. Diese historische Situation ist zum Einen geistesgeschichtlich – man kann auch sagen »metaphysisch« – zu bestimmen. »Wir leben in einer entheiligten Geschichte«, schreibt Camus. »Kann man fern des Heiligen und seiner absoluten Werte eine Verhaltensregel finden, ist die Frage, die die Revolte stellt.« (MR, S. 30) An Einem besteht für Camus kein Zweifel: Die Verbindlichkeiten, die aus den Gesetzen eines Gottes und seiner – vor allem christlichen – Vertreter abgeleitet wurden, sind endgültig dahin. »Gott ist tot«, die Berufung auf ewige, heilige Werte kommt nur noch als Ausweichen, als Flucht vor der Wahrheit des Absurden in Betracht. Die »metaphysische Revolte« ist nunmehr nur noch die des Einzelnen gegen seine sinnlose Verlassenheit auf der Welt, gegen das Todesurteil, das über ihn verhängt ist – Motive, die, wie gesehen, das Bewusstsein des Absurden mit hervorbringen. Die geistesgeschichtlichmetaphysische Revolte setzt sich in historischen, politischen Revolten und Revolutionen fort. Nicht mehr das Reich Gottes, sondern das Reich des Menschen wird als Ziel der Geschichte proklamiert. Der »Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit«13 sah sich auf eine harte Probe gestellt angesichts des nihilistischen Zerstörungswahns der Faschisten – die Lehren dieses historischen Kapitels hat Camus überdeutlich vor Augen. Dass auch dort, wo man sich Fortschritt und Freiheit auf die Fahnen geheftet hat, die Freiheit und das Bewusstsein davon dem 13 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, Band I: Die Vernunft in der Geschichte. Hrsg. von Johannes Hoffmeister, Hamburg 1955, S. 63.
114
Hans-Joachim Pieper (Bonn)
vermeintlichen Fortschritt zum Opfer fallen können, das konnte Camus unter anderem an der Geschichte der russischen Revolution und ihrer Entwicklung zum Stalinismus ablesen: »Diejenigen, die sich im Namen des Irrationalen in die Geschichte stürzen, mit dem Ruf, sie habe keinen Sinn, stoßen auf Knechtschaft und Terror und münden in die Welt der Konzentrationslager ein. Die sich in die Geschichte stürzen und ihre absolute Vernünftigkeit predigen, stoßen auf Knechtschaft und Terror und münden in die Welt der Konzentrationslager ein.« (MR, S. 277) So lautet Camus’ Fazit angesichts seiner historischen Situation. Beide Projekte bedeuten nach seiner Auffassung einen Verrat an der Revolte, verraten die ursprüngliche zwischenmenschliche Solidarität. Über den Faschismus braucht man dabei nicht weiter zu reden. Die Revolution jedoch ist in gewisser Weise tragisch. Geboren aus einem zutiefst menschlichen Verlangen nach Gerechtigkeit und Freiheit gerät ihr Ziel zu einem am Ende der Geschichte verorteten Ideal, das zu erreichen jedes Mittel recht ist. Wenn die Revolte degeneriert, wird sie zur Revolution. »Wer seine Freundin oder seinen Freund liebt«, so Camus, »liebt ihn in der Gegenwart, die Revolution will jedoch einen Menschen lieben, der noch nicht da ist«, der erst noch »entstehen soll« (MR, S. 270). Prometheus wird zum Lehrer und schließlich zu Cäsar. Die Revolte, der »wahre, ewige Prometheus hat nun die Gestalt eines seiner Opfer« (MR, S. 276). Auch wer die Gegenwart einer ersehnten, Heil versprechenden Zukunft unterordnet, weicht dem Absurden aus und verfällt dem Nihilismus (vgl. MR, S. 277): der Vorstellung, dass das konkrete, aktuelle Leben belanglos und deshalb alles erlaubt sei. Camus situiert die Revolte zwischen dem »Alles ist erlaubt« als der totalen Resignation vor dem Absurden und dem »Alles ist erlaubt um der besseren Zukunft willen« einer in Heilsglauben verfallenen politischen Doktrin. Die Revolte bedeutet das Standhalten im Absurden; sie bedeutet stets Verneinung und Bejahung in einem. Zunächst ist sie Trotz gegen Sinnlosigkeit und Todesurteil und zugleich Bejahung des Lebens. Dann aber ist sie nach Camus auch dasjenige Aufbegehren, in dem nicht nur der Wert des eigenen Lebens, sondern auch der des Lebens der anderen erkannt und bejaht wird. Camus vermittelt diese Anerkennung des Wertes der anderen über folgende Überlegung: Wer revoltiert, wer sich empört und aufbegehrt, der richtet sich gegen eine Gewalt, die sich auf etwas erstreckt oder zu erstrecken droht, von dem er erkennt, dass er es unbedingt bewahren muss. »Bis hierher und nicht weiter« (MR, S. 21), sagt der Revoltierende, hier verläuft eine »Grenze«. Wird diese Grenze überschritten, dann wird etwas, ein Teil von mir, verletzt, der nicht verletzt werden darf. Wer revoltiert, entdeckt also in der negativen, aufbegehrenden Bewegung zugleich einen Wert, einen »Teil seiner selbst« (MR, S. 21), der geschützt werden muss. Dieser Wert ist nun keineswegs immer gleich das Leben, sondern er hat sehr häufig etwas mit dem zu tun, was man »Menschenwürde« (vgl. MR, S. 26) nennt.
Revolte gegen das Absurde: Zur Philosophie Albert Camus’
115
Spätestens dann, wenn der Revoltierende sich bereit findet, für diesen Wert – Freiheit z. B. (vgl. MR, S. 23) – sein eigenes Leben zu opfern, spätestens dann wird offensichtlich, dass es ihm nicht um ihn allein, sondern dass es ihm um alle Menschen geht, dass er in der Revolte den Wert, sagen wir der Freiheit, als einen Wert anerkennt, der allen Menschen gemeinsam ist. Mit den Worten Camus’: »Wenn das Individuum tatsächlich im Lauf der Revolte den Tod auf sich nimmt […], so zeigt es dadurch, dass es sich opfert zugunsten eines Gutes, von dem es glaubt, dass es über sein eigenes Geschick hinausreicht. […] Es handelt also im Namen eines noch ungeklärten Wertes, von dem es jedoch zum mindesten fühlt, dass er ihm und allen anderen Menschen gemeinsam ist.« (MR, S. 23) Camus wagt die Vermutung, dass es eine allgemeine »menschliche Natur« gebe (MR, S. 24), eine »allen Menschen gemeinsame Würde« (MR, S. 26), von der man dann ggf. auch entsprechende Rechte (Menschenrechte) ableiten könnte. Mit diesen Begriffen ist man jedoch allzu schnell zur Hand. Dass es eine allgemeine Menschennatur gebe, ist gerade von Camus’ Zeitgenossen zum Teil energisch bestritten worden; ob es eine Menschenwürde gibt und worin sie besteht und wem sie überhaupt zukommt, ist bis heute Gegenstand von Kontroversen, und im Namen der Menschenrechte lassen sich nicht nur Revolutionen, sondern auch Angriffskriege initiieren. Die Stärke von Camus’ Konzept der Revolte liegt meines Erachtens darin, hinter diese Abstrakta zurückzugehen. Camus appelliert an die Logik des Herzens, an unsere lebendige Erfahrung. Die Revolte bringt einen Wert hervor. Sie bringt ihn hervor in dem doppelten Sinn, dass sie ihn neu generiert, dass sie ihn als einen neuen Wert produziert, der jedoch zugleich mit dem Bewusstsein verknüpft ist, einen Wert, ein Recht aller Menschen zu verkörpern, einen Wert, der zum Menschsein dazugehört und in der Revolte nur entdeckt, ans Licht gebracht worden ist. Revolte, Wertschöpfung und Solidarität beruhen auf einer Grenzerfahrung, der Erfahrung, dass die Grenze der Unterdrückung, der Demütigung, des Elends erreicht sei: »Lieber aufrecht sterben als auf den Knien leben« (MR, S. 23), kann Ausdruck einer solchen Grenze sein. Oder die Worte des Dr. Rieux in Camus’ Roman »Die Pest«: »[…] ich werde mich bis in den Tod hinein weigern, die Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemartert werden.«14 Auch die Identifikation mit dem Leiden anderer (MR, S. 24) kann Ausdruck einer solchen Empörung sein. Dass die Empörung nicht individuell oder gar egoistisch sein muss, ist daran besonders gut abzulesen.15 Der »ewige, wahre Prometheus« empört sich überall dort, wo solcherart die Grenze überschritten wird – und mag, was als Revolte begann, auch zur 14 Albert Camus, Die Pest. Hamburg 1950/1985, S. 143. 15 Mitleid ist zu schwach. Empörung enthält stets einen Handlungsimpuls, wenn es auch nicht immer zur Handlung kommen mag. Die tatsächliche Bekräftigung eines Wertes scheint aber in der Bereitschaft zu liegen, dafür zu sterben.
116
Hans-Joachim Pieper (Bonn)
Revolution und zum Staatsterror entarten: Prometheus findet sich stets auf der Seite der Opfer. Allerdings wird man sich fragen: Wie weit darf die Revolte gehen? War »Der Mythos des Sisyphos« der Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Absurden und dem Selbstmord gewidmet, so lautet eine der zentralen Fragen des »Menschen in der Revolte«: Gibt es eine Legitimation für Mord? Was soll Prometheus tun, wenn sich die Gedemütigten und Unterdrückten nur mit Gewalt befreien können, wenn die Revolte selbst Opfer fordert? – Die Revolte ist eine Grenzerfahrung: Sie entdeckt einen Wert, der nicht verletzt werden darf, und sie stiftet mit diesem Wert ein Band zwischenmenschlicher Solidarität (vgl. MR, S. 317). Darf dieses Band sogleich wieder zerschnitten werden? Verliert nicht der Revoltierende, der sich auf die »Gemeinschaft der Menschen« beruft, dieses Recht, sobald auch nur »ein einziger Mensch tatsächlich getötet wird« (ebd.)? Camus charakterisiert dieses Dilemma, diese »innere Zerrissenheit« des Revoltierenden in unerbittlicher Klarheit: »Sobald der Rebell zuschlägt«, so Camus, »schneidet er die Welt entzwei. Er erhob sich im Namen der Identität eines Menschen mit dem andern, er opfert diese Identität, indem er den Unterschied im Blut besiegelt.« (Ebd.) Mord ist das Äußerste, Mord lässt sich nicht integrieren, auch nicht in die Revolte. Er ist die schreckliche Ausnahme, hinzunehmen allenfalls als der Schrei der Verzweiflung, in dem der sich empörende Mensch sich nicht anders zu helfen weiß, als indem er das Band der Solidarität in ein und demselben Akt knüpft und wieder zerreißt. Die Ungeheuerlichkeit dieses Geschehens verlangt, dass beide – Opfer und Täter – vom Erdboden verschwinden. Wenn sich Prometheus gezwungen sieht, um der Revolte willen, um der Menschheit und der Menschlichkeit willen zu töten, kann er die absolute Grenzverletzung, die damit geschieht, nur noch dadurch quittieren, dass er in seinen eigenen Tod einwilligt. »Der Revoltierende kann sich nur auf eine Weise mit der mörderischen Tat versöhnen«, schreibt Camus: »durch die Hinnahme seines eigenen Tods. Er tötet und stirbt, damit es ersichtlich werde, dass der Mord unmöglich ist.« (MR, S. 318) Indem ich den anderen töte, töte ich mich selbst. Kaum etwas kann die Grenze und das Maß, die in der Revolte entdeckt werden, so bewusst machen wie ihre unausweichlich scheinende Verletzung in einem Akt revoltierender Gewalt.16 16 Mit Blick auf Camus’ Stück »Die Gerechten« fasst Schlette zusammen: »Es gibt also so etwas wie die Ehre in der revolutionären Aktion, eine Ehre, die darin besteht, dass man die humanethische Zielsetzung nie aus dem Blick verliert, deretwegen die Revolte überhaupt nur geschieht. Die Widerstandskämpfer können sich nur dann nicht auch selbst für Mörder halten […], wenn sie diese Ehre empfinden und die fanatische Revolution, die die Ehre verrät, ablehnen. Hier offenbart sich mitten in der revolutionären Aktion – eine Grenze, die nicht überschritten werden darf, und damit ein Wert: der Wert des Humanen und des Ja zum
Revolte gegen das Absurde: Zur Philosophie Albert Camus’
4.
117
Nemesis
Widersprüchlich und zwiegesichtig wie die Revolte selbst scheint auf den ersten Blick auch die Göttin, die Camus zur Bewahrung von Maß und Grenze anruft: Nemesis, Göttin sowohl der »Vergeltung« als auch der »Gerechtigkeit«.17 »Nemesis wacht«, schreibt Camus in seinem Essay »Helenas Exil«. »Nemesis wacht, die Göttin des Maßes, nicht der Rache. Alle, die die Grenzen überschreiten, werden von ihr unerbittlich gestraft.«18 Vergeltung soll alle die treffen, die maßlos sind, die die Grenzen verletzen und überschreiten. Darin besteht die Gerechtigkeit. Statt zu erobern, statt im Namen wessen und wovon auch immer Menschen, Welt und Gegenwart zu opfern, gilt es, Maß zu halten und Grenzen zu achten. Auch darin besteht die Gerechtigkeit. Aber von welchen Grenzen, von welchem Maß ist dabei eigentlich die Rede? Die göttlichen Gebote und ehernen Regeln der Vernunft sind im Absurden untergegangen. Alles Leben, alle Zukunft, alle Werte müssen wir Menschen selber finden. Das Absurde, so sagt Camus, führt über sich hinaus in der Revolte (MR, S. 17), und die Revolte ist es, die die Grenzen aufzeigt und das Maß vorgibt: »Die Revolte ist das Maß, sie befiehlt es, verteidigt es und erschafft es neu durch die Geschichte und ihre Wirren hindurch.« (MR, S. 339). »Bis hierher und nicht weiter« (MR, S. 21), so lautet der Urimpuls der Revolte. Die Empörung verteidigt die Grenze, jenseits derer menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich ist, und sie erkennt darin die Gemeinsamkeit aller, die zwischenmenschliche Solidarität. Die Revolte stiftet ihre Werte: den Wert des Anderen, seines Lebens und seiner Freiheit, den Wert der Gemeinschaft, den Wert, sich gegen Knechtschaft, Lüge und Terror zu erheben (vgl. MR, S. 319). Den Wert des Menschseins in sich und im anderen zu erfahren, bedeutet zugleich einzusehen, dass die eigene Freiheit ihre Grenze an der Freiheit des anderen hat, dass Freiheit und Gerechtigkeit sich »gegenseitig begrenzen« müssen (MR, S. 328). Die so gezogenen Grenzen, die daraus erwachsenden Werte sind, wie gesagt, keine übergeordneten, ewigen Wahrheiten. Sie sind Geschöpfe der Revolte, Erfahrungen des Menschen, der sich gegen sein Schicksal empört. »Der von der Revolte zutage gebrachte moralische Wert«, sagt Camus, gewinnt »[i]n Tat und Leben. Nur wenn der Kämpfer bereit ist, wegen dieses Wertes auch sein eigenes Leben einzusetzen, ja auf sein eigenes Glück zu verzichten […], ist er kein Mörder, kein Verbrecher, sondern ein Vollstrecker der größeren Gerechtigkeit gegenüber einer tyrannischen ›Ordnung‹.« Heinz Robert Schlette, »La Russie sera belle«. Zu Camus’ Drama »Les Justes«, in: Ders., »Der Sinn der Geschichte von morgen«. Albert Camus’ Hoffnung. Frankfurt am Main 1995, S. 58 – 71; ebd., S. 65. 17 Vgl. Gustav Schwab, Die schönsten Sagen des klassischen Altertums. Bayreuth 1974, S. 188, S. 226. 18 Albert Camus, Helenas Exil, a. a. O., S. 120.
118
Hans-Joachim Pieper (Bonn)
Wahrheit […] nur Wirklichkeit, wenn ein Mensch für ihn sein Leben lässt oder es ihm weiht« (MR, S. 334). Insofern ist er ein historisch gewordener Wert, und er ist ein Wert dadurch, dass Menschen für ihn gekämpft und gelebt und ihn eventuell mit ihrem Tod bezeugt haben. Man kann vielleicht sagen: Respekt vor dem Leben, Freiheit, Gleichheit und Solidarität sind Werte, die in der Geschichte errungen wurden und die jeder aktuell nachvollziehen kann, indem er sich seinerseits – sei es gegenüber dem eigenen, sei es gegenüber dem Schicksal anderer – in die Revolte begibt. Wir empören uns über Hungertote, über sinnlose bzw. von Macht- und Profitstreben motivierte Kriege, über skrupellose Tyrannen und alle Gewalt gegenüber Wehrlosen. Wir empören uns, d. h. wir erfahren und erkennen an, dass dabei etwas geschieht, das nicht geschehen soll, dass es letzte, menschlich-heilige Grenzen verletzt. Aber auch Nemesis, die Göttin des Maßes und der Gerechtigkeit, kann nur in Gestalt von Menschen wirken. Wie gesehen, entgeht es Camus keineswegs, dass dieses Wirken selbst nicht immer ohne Gewalt auskommt. Auch hier gilt, wie schon angedeutet, sein Appell zur Bewahrung der Grenzen: »Wie der Rebell den Mord als die Grenze betrachtet, die er, wenn er danach die Hand ausstreckt, durch seinen Tod bestätigen muss, kann die Gewalt nur eine äußerste Grenze sein, die sich einer andern Gewalt entgegenstellt […].« (MR, S. 329) Doch Camus, der sich über die Maßlosigkeit von Gewalt und Eroberungssucht der historisch agierenden Menschen empört, der in der Revolte die Quelle einer »Philosophie der Grenzen« (MR, S. 326) erkennt, macht – außer dem Leben und Freiheit verlangenden »menschlichen Wesen« (MR, S. 320) – noch eine andere Grenze geltend. Er stellt die Natur der Geschichte zur Seite. Die zum »Stoff« (MR, S. 337), zum bloßen Material geknechtete Natur – auch sie fordert ihr Maß, auch sie kann sich empören. »Die Natur jedoch bleibt«, beginnt eine oft zitierte Stelle in »Helenas Exil«. »Sie setzt dem Irrsinn der Menschen ihre ruhigen Himmel und ihren Sinn entgegen. Bis auch das Atom Feuer fängt und die Geschichte im Triumph der Vernunft und im Untergang der Menschheit endet. Doch die Griechen sagten nie, dass die Grenzen nicht überschritten werden könnten. Sie sagten, die Grenze bestehe, und jener werde ohne Gnade getroffen, der sie zu überschreiten wage.«19 Aber noch ist der »große Pan […] nicht tot«. Noch birgt die Natur jenen »unverletzten Teil der Wirklichkeit, den man Schönheit nennt« (MR, S. 313). Und so verbindet sich – in den Augen Camus’ – mit dem Geist der Revolte »eine sonderbare Liebe« (MR, S. 342): zu den »Gedemütigten« (ebd.), zu dem, was wirklich ist: die Welt und die lebendigen Menschen (MR, S. 344).
19 Albert Camus, Helenas Exil, a. a. O., S. 124.
Anne-Kathrin Reif (Wuppertal)
Vom Absurden zur Liebe – der unbekannte Camus
Selten haben die Anlage eines Werkes und die Erfordernisse des geschichtlichen Augenblicks so eindeutig verlangt, dass ein Schriftsteller am Leben bleibe. […] Für alle, die ihn liebten, liegt in diesem Tod etwas unerträglich Absurdes. Aber wir werden lernen müssen, dieses verstümmelte Werk als ein Ganzes zu sehen.
So schrieb der einstige Weggefährte und spätere intellektuelle Gegner Jean-Paul Sartre in seinem Nachruf auf Albert Camus nach dessen plötzlichem Unfalltod im Jahre 1960.1 Mehr als 50 Jahre lang haben sich die Camus-Interpreten dieses Postulat Sartres nun weitgehend zu eigen gemacht. Meine – unbescheidene – These lautet: Es ist an der Zeit, genau damit Schluss zu machen. Dieses Werk ist ein verstümmeltes, es ist nicht abgeschlossen, und wir sollten uns genau diese Stelle, an der es gewaltsam abgebrochen wurde, genauer ansehen. Den Anhaltspunkt dazu liefert Camus selbst. 1946 gab er während eines Amerika-Aufenthaltes ein Interview für die New Yorker Zeitung Post, welches der Biograph Herbert Lottmann wie folgt wiedergibt: Auf zukünftige Pläne angesprochen, erwähnte er den in sich abgeschlossenen Buchzyklus über das Absurde und beschrieb den geplanten über die Revolte. Schließlich wolle er einen Roman, einen Essay und ein Stück schreiben, die sich auf das Konzept »Wir sind« gründen. Und dann? »Dann«, sagte er lächelnd, »wird es eine vierte Phase geben in der ich ein Buch über die Liebe schreiben werde.«2
Auch der Camus-Interpret Franz Rauhut berichtet in einem Aufsatz über eine persönliche Unterredung, die er mit Camus im Herbst 1951 führte, von einer Äußerung, die in die selbe Richtung weist: – Ich will Ihnen sagen, dass ich an einem Buch arbeite, das den Titel L’Homme r¦volt¦ hat. […] Es ist ein Essay, der sich an den Mythe de Sisyphe anschließen soll. – Also ein weiteres Glied in der Kette ihrer Ideen. – Mein Denken geht durch Stadien. Das erste Stadium war das des »Absurden«. […] 1 Jean-Paul Sartre, Albert Camus. France-Observateur 7. 1. 1960, deutsch abgedruckt in Sartre: Portraits und Perspektiven, Hamburg 1971, S. 102 – 104. 2 Lottmann, Albert Camus. Eine Biographie, Hamburg 1986, S. 235.
120
Anne-Kathrin Reif (Wuppertal)
Das zweite ist das der »Revolte« (Camus nennt jeweils die zugehörigen Werke). Das dritte wird das der »Liebe« sein.3
In seinen Arbeitstagebüchern finden wir bereits 1946 einen »Arbeitsplan«, in dem Camus die schon fertiggestellten Werke in den großen Zusammenhang eines vorgestellten »Gesamtwerkes« einordnet und die auf das Absurde folgenden Reihen entwirft; auch hier findet sich der Entwurf einer Reihe von Werken, welche die Liebe zum Thema haben sollten.4 Wie die später noch vollendeten Werke zeigen, hat sich Camus genauestens an diesen Plan gehalten und gewissermaßen Punkt für Punkt abgehakt. Nun können wir in der Tat nicht umhin, anzuerkennen, dass Camus den letzten Abschnitt seines Werkes nicht mehr hat ausarbeiten können, und es ist selbstverständlich müßig, über dessen Inhalte zu spekulieren. Ebenso falsch ist es allerdings – so lautet meine These – , diese über einen so langen Zeitraum geplante Fortführung seines Denkens zu ignorieren. Steht es erstens so (und das ist außer Zweifel), dass das Werk von Camus verschiedene Stadien durchläuft – und steht es zweitens so, dass sich die Fortführung des Stadiums der Revolte mit innerer Notwendigkeit aus dem Stadium des Absurden entwickelt (das wiederum lässt sich nachweisen), dann wiederum liegt es nahe anzunehmen, dass auch das geplante Stadium der Liebe mit vergleichbarer Folgerichtigkeit aus den bisherigen Stadien hätte hervorgehen müssen. Eine Arbeitsnotiz aus dem Zusammenhang mit der Arbeit an Der Mensch in der Revolte bestätigt dies. Es heißt dort: »Revolte. […] So ist es nicht möglich, vom Absurden ausgehend die Revolte zu durchleben, ohne an irgendeinem Punkt auf die Erfahrung der Liebe zu stoßen, die zu definieren bleibt« (TB, S. 221). Steht es also so, dass die Stadien mit einer gewissen inneren Notwendigkeit auf- und auseinander folgen, dann müsste sich gleichsam auch die Spur des erst geplanten Stadiums der Liebe in den vorhandenen Werken zurückverfolgen und die Bedeutung der Liebe für die Weiterentwicklung des Denkens von Camus nachweisen lassen. Der Problemzyklus der Liebe bildet so gesehen nicht etwa ein zusätzliches, nachträglich angehängtes Thema – er wäre der geheime Anfang und das offenbare Ziel der gesamten Denkbewegung und aller Werkabschnitte im Gesamtplan von Albert Camus. Dies angenommen, können wir zwar keine Aussagen über die Inhalte dieses geplanten Stadiums treffen – aber wir können von diesem erweiterten Standpunkt aus gleichsam im Rückblick die Spur des erst geplanten Stadiums der Liebe im gesamten Werk zurückverfolgen und die Bedeutung der Liebe für die 3 Franz Rauhut, Albert Camus oder vom Nihilismus zu Maß und Menschenliebe, in: Deutschland-Frankreich, Ludwigsburger Beiträge Bd 2 (1957), S. 190. 4 Vgl. TB, S. 234 f; TB II, S. 236.
Vom Absurden zur Liebe – der unbekannte Camus
121
Weiterentwicklung seines Denkens nachweisen. Unter dieser neuen Perspektive erscheinen auch die vermeintlich bereits »durchinterpretierten« Werke Camus’ in neuem Licht. Denn dann zeigt sich: Obwohl keines der hinterlassenen Werke sich ausdrücklich dem Thema der Liebe widmet, ja, obwohl es nicht einmal irgendwo eine längere zusammenhängende Textpassage zu diesem Thema in seinem Werk gibt, begegnet uns die Liebe überall. Wir können das natürlich in diesem Rahmen nicht entfernt in seiner ganzen Fülle nachvollziehen, sondern nur sehr summarisch und in großen Schritten diese Denkbewegung, die vom Absurden über die Revolte hinaus zur Liebe führt, verfolgen. Dabei leitet uns eine frühe Notiz von Camus (aus dem Jahr 1938). Sie lautet: Elend und Größe dieser Welt: Sie bietet nicht Wahrheiten sondern Liebesmöglichkeiten. Es herrscht das Absurde, und die Liebe errettet davor (TB, S. 60).5
Beginnen wir also mit dem ersten Themenkreis, gewissermaßen mit der Bestandsaufnahme dessen, was ist: »Die Welt bietet keine Wahrheiten« und »es herrscht das Absurde«. Wenigstens schlaglichtartig müssen wir zunächst diesen Begriff, der das Denken Camus’ so sehr bestimmt, dass er ihm das Etikett eines »Propheten des Absurden« eingetragen hat, noch einmal einholen.
Das Absurde Wir alle kennen den Begriff aus der Alltagssprache. »Das ist absurd!« sagen wir, wenn wir etwas als vollkommen widersinnig empfinden, etwas, das in sich widersprüchlich ist oder ein krasses Missverhältnis beinhaltet. Im Denken Camus’ bezeichnet der Begriff jedoch nicht einzelne widersprüchliche Sachverhalte, sondern das Grundverhältnis unserer Existenz schlechthin. In einem eklatanten Missverhältnis nämlich stehen zwei nicht zu leugnende Tatbestände: Das eine ist die Vernunftnatur bzw. das Vernunftstreben des Menschen – und das andere ist die irrationale, von unverständlichen Zufällen geprägte Verfasstheit der Welt – das Chaos unserer Wirklichkeit mit ihren sinnlosen Kriegen und sinnlosem Leid, den unvorhersehbaren Schicksalsschlägen, dem sinnblinden Widerfahrnis des Todes; diese Welt, wo Glück und Not niemals gerecht verteilt sind und wir das, was geschieht, niemals befriedigend auf Vernunftgründe zurückführen können. Und oft genug auch nicht das, was wir selbst tun – denn diese Spaltung geht durch den Menschen selbst hindurch – gefangen in den Widersprüchen 5 »MisÀre et grandeur de ce monde: il n’offre point de v¦rit¦s mais des amour. L’Absurdit¦ rÀgne et l’amour en sauve« (CA I, S. 116). Ausführlich zum Thema: »Die Welt bietet nicht Wahrheit, sondern Liebesmöglichkeiten.« Zur Bedeutung der Liebe im Werk von Albert Camus. Inaugural-Dissertation, Wuppertal 1999.
122
Anne-Kathrin Reif (Wuppertal)
zwischen Körper und Geist, Vernunft und Irrationalität ist er selbst es ja, der in seinen Handlungen die Verfassung der Welt mit bestimmt. Die Verfasstheit der Welt als das Seiende im Ganzen, im Chaos ihrer Erscheinungen, ist für das endlich-begrenzte Erkenntnisvermögen des Menschen schlechthin nicht verstehbar. Alle Anstrengungen der Vernunft, zu letzter Erkenntnis zu gelangen, müssen daher an der Verfassung der Welt scheitern. Und dieses Scheitern seines Vernunftstrebens erfährt der Mensch nach Camus als einen Bruch mit der Welt: Solange der Geist in der reglosen Welt seiner Hoffnungen schweigt, spiegelt und ordnet sich alles zu jener Einheit, die sein Heimweh ersehnt. Bei seiner ersten Regung aber wird diese Welt brüchig, sie stürzt ein, und eine Unzahl schillernder Bruchstücke bietet sich der Erkenntnis dar. Wir müssen es verzweifelt aufgeben, aus ihnen jemals die vertraute und ruhige Oberfläche, die uns den Frieden des Herzens geben würde, wiederherzustellen. (MS, S. 21)
Das Streben des Menschen nach Erkenntnis, seine Sehnsucht nach VerstehenKönnen einerseits und die uns irrational erscheinende Verfassung der Welt andererseits sind zwei Tatbestände, die uns mit gleicher Evidenz vorliegen. Keiner von beiden ist für sich genommen absurd. Das Absurde bricht erst dann auf, wenn die unvernünftige Welt mit dem Anspruch des Menschen auf letzte Klarheit konfrontiert wird, mit ihrem »Verlangen nach Glück und Vernunft. Das Absurde entsteht aus dieser Gegenüberstellung des Menschen, der fragt, und der Welt, die vernunftwidrig schweigt« (MS, S. 29). Ganz entsprechend der allgemeinen Struktur des Begriffs ›absurd‹ besteht also auch das Absurde im engeren Sinne in einem Missverhältnis: zwischen dem Sinnanspruch des Menschen und der Sinnlosigkeit der Welt; zwischen der menschlichen Sehnsucht nach Einheit und der Welt, die dieses Verlangen abstößt. Nun wird diese Analyse der menschlichen Grundsituation wahrscheinlich niemanden sonderlich überraschen oder erschrecken – ein Blick in die Tageszeitung oder die abendlichen Fernsehnachrichten genügt, um sie bestätigt zu sehen. Freilich: Wir richten uns dennoch in dieser Welt ein und fühlen uns zumeist auch leidlich behaglich. In unserer durchschnittlich-alltäglichen Existenz sind die »letzten Fragen« nach dem Einheitsgrund alles Seienden und dem Sinn von Sein überhaupt nicht die Fragen, auf die sich unsere Sorgen und Besorgungen richten. Dass ›Welt‹ als die ›Gesamtheit alles dessen, was ist‹ – und damit die Gesamtheit aller Geschehnisse in Natur und Geschichte – sich nicht auf einheitliche Denkbegriffe zurückführen lässt, mit Hilfe derer sich alles als sinnvoll geordnet erweisen würde, ist zunächst eine abstrakte Erkenntnis. Alltäglich fühlen wir uns durchaus nicht stets durch eine Kluft von der Welt getrennt, und wir ordnen unser Dasein nach Zielen und Zwecken, die wir zunächst durchaus
Vom Absurden zur Liebe – der unbekannte Camus
123
für sinnvoll halten. Ob wir unzufrieden sind oder nicht hängt davon ab, ob sich die Hoffnungen und Erwartungen erfüllen, die wir wie selbstverständlich an unser Tun knüpfen – und wenn die Erfüllung dieser Hoffnungen ausbleibt, vertrösten wir uns auf ein immer neues ›Morgen‹. Aber, so Camus, in jedem Leben gibt es einen Moment, »da stürzen die Kulissen ein« (vgl. MS, S.16). Das ist dann der Moment, wo wir anfangen Fragen zu stellen, auf die die Antworten ausbleiben. Es sind dies nicht die Fragen eines objektiven Erkenntnisinteresses, sondern es sind jene existenziell verstandenen Fragen nach dem »wozu« und »warum«, dem »wohin«, dem »wann« und »wie lange«; es sind die Grundfragen unseres Existierens. Sie können uns unvermittelt überkommen – bei dem einen ist es vielleicht der Verlust der beruflichen Existenz, bei dem anderen eine schwere Krankheit oder der Tod eines nahen Menschen, was die gewohnte Welt zum Einsturz bringt. Die uns existenziell bedrängenden Fragen können aber auch (das zeigt Camus in Der Mythos des Sisyphos) gleichsam unmerklich auf der Ebene der Stimmungen und Befindlichkeiten aus unserem Dasein selbst aufsteigen: – etwa in den Gefühlen von tiefer Langeweile und Leere, wo uns alles sinnlos erscheint – im Gefühl des Überdrusses an den immer gleichen Abläufen unseres Alltags – im Grauen angesichts der verrinnenden Lebenszeit – bis hin zum Lebensekel und dem Gefühl der Fremdheit, wenn wir nicht mehr wissen, wohin wir gehören und uns in dieser Welt nicht mehr zu Hause fühlen. In solchen Stimmungen schleicht sich das Absurde auch in ein zuvor fragloses, wohlgeordnetes Leben ein – und die Beschreibung dieser »absurden Stimmungen« liest sich über weite Teile wie eine Bestandsaufnahme des Krankheitsbildes der Depression, die heute mehr denn je zur Volkskrankheit zu werden droht. Aber hierbei handelt es sich – im Horizont der Philosophie des Absurden – nicht um ein Krankheitsbild unter anderen, das sich mit entsprechender Medikation bekämpfen und glücklichenfalls heilen ließe. Und wir reden hier auch nicht von gelegentlichen, von bestimmten Auslösern provozierten Verstimmungen. Wir reden hier von solchen existenzialen Stimmungen, in denen uns die im Alltag verdeckte Verfassung unserer Existenz schlechthin offenbar wird. Wenn wir hier von einer Krankheit reden wollten, dann wäre es schlicht die, die man Leben nennt, oder anders: die »Krankheit zum Tode«, wie Kierkegaard es genannt hat. Wohl gibt es eine tröstende, rettende und deshalb vielleicht so verlockende Möglichkeit, dieser Konfrontation mit dem Absurden zu entkommen: der Glaube an Gott, die Rettung in eine Religion, welche Antworten auf die existenzialen Fragen bereithält. Etwa die, dass unsere wahre Heimat nicht von dieser
124
Anne-Kathrin Reif (Wuppertal)
Welt ist und wir sie erst in einem jenseitige Leben finden werden; oder die, dass all dem, was wir nicht verstehen können, eine höhere Ordnung, ein verborgener Sinn zugrunde liegt, den wir nur nicht erkennen können. Aber das, so Camus, können wir nicht wissen – und dabei müssen wir es bewenden lassen. »Ich weiß nicht, ob diese Welt einen Sinn hat, der über sie hinausgeht«, schreibt er. »Aber ich weiß, dass ich diesen Sinn nicht kenne und dass ich ihn zunächst unmöglich erkennen kann. Was bedeutet mir ein Sinn, der außerhalb meiner Situation liegt? Ich kann nur innerhalb menschlicher Grenzen etwas begreifen« (MS, S. 47).6 Und als Mensch haben wir diese Grenzen einzuhalten, so Camus. Sie mit einem Sprung in den Glauben zu überspringen ist für ihn »philosophischer Selbstmord« (MS, S. 29 f). Weichen wir diesen Fragen also weder in die alltägliche Verdeckung noch in den Glauben aus, dann stehen wir vor der schlechthinnigen Sinnfrage unseres Existierens, dann gilt es, Antwort zu geben, ob sich dieses Leben im Angesicht des Absurden lohnt, oder nicht – d. h. radikal formuliert zugleich: Ob der angemessene Schluss aus der Erkenntnis der Absurdität nicht der wäre, diesem Leben ein Ende zu setzen. Deshalb kann Camus sagen (der berühmte Anfang des Mythos von Sisyphos): »Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord. Die Entscheidung, ob das Leben sich lohne oder nicht, beantwortet die Grundfrage der Philosophie« (MS, S. 9). Wir können hier den Gang dieser Untersuchung nicht nachvollziehen, wir können nur das Ergebnis vorwegnehmen, zu dem Camus am Ende kommt, und es ist – zumindest nach der Radikalität der Ausgangssituation – ein erstaunliches Ergebnis: Am Ende steht nicht der Selbstmord und auch nicht ein resignatives Verharren in der Verzweiflung, am Ende steht das Glück in Aussicht. Es ist dies freilich ein eigenartiges Glück: das Glück des Sisyphos. Der absurde Mensch – d. h. der Mensch, der im Bewusstsein der Absurdität lebt und daraus die rechten Schlüsse für seine Existenz gezogen hat – ist vom Schlage eines Sisyphos. Wie Sisyphos, der dazu verdammt ist, in sinnloser Anstrengung einen Felsbrocken immer wieder auf einen Gipfel zu wälzen, von dem er unweigerlich wieder hinabstürzen wird, ist sich auch der absurde Mensch hellsichtig und redlich bewusst, dass sein Leben und sein Tun kein letztes Ziel und keine letzte Vollendung haben wird und dass alle Qual, alles Mühsal, alles Leid, das dieses Leben mit sich bringen wird, vergeblich ist. Am Ende wird sich kein verborgener Sinn enthüllen und es wartet keine Belohnung. Und doch, so lautet bekanntlich der letzte Satz des Mythos von Sisyphos, müssen wir uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und das ist keine Ironie. 6 »Je ne sais pas si ce monde a un sens qui le d¦passe« (E, S. 136). Die deutsche Übersetzung »…der über mich hinausgeht« (MS, S. 47) legt offenbar die erste Auflage zugrunde, in der es hieß »…un sens qui me d¦passe« (vgl. E, S. 1439).
Vom Absurden zur Liebe – der unbekannte Camus
125
Denn für den Menschen, der sich hellen Bewusstseins dem Tatbestand der Absurdität stellt, springt auch ein Ertrag heraus: – Er besteht in einem Zugewinn an Freiheit, mit der der Mensch nun über sein eigenes Leben verfügt. – Er besteht in der Revolte gegen die absurde Grundverfassung unseres Daseins, in der der Mensch seinen Stolz wiedergewinnt, obwohl (oder gerade weil) er weiß, dass er den absurden Zwiespalt niemals aus der Welt schaffen kann. – Und er besteht in einem Zuwachs an Leidenschaft, d. h. an unbedingter Hinwendung an das Leben und in dem Zuwachs an Bewusstheit, mit der wir unsere Gegenwart ganz ausschöpfen und von der Zukunft absehen, die nicht bei uns steht. Ein radikales Beispiel für solch eine bedingungslose Leidenschaft für das Leben liefert die Figur des beinamputierten Krüppels Zagreus in Camus’ frühem Roman Der glückliche Tod: »Hören Sie zu«, sagt Zagreus zu dem Büroangestellten Mersault, der ihn später umbringen wird, »und sehen Sie mich an. Man hilft mir bei der Verrichtung meiner Bedürfnisse. Und danach wäscht man mich und trocknet mich ab. Schlimmer noch, ich bezahle jemanden dafür. Und doch, ich werde nie etwas tun, um ein Leben abzukürzen, an das ich so sehr glaube. Ich würde noch Schlimmeres auf mich nehmen, blind zu sein, stumm, alles was Sie wollen, wofern ich nur in meinem Leib diese düstere glühende Flamme fühle, die mein Ich ist, mein lebendiges Ich. Ich würde einzig daran denken, dem Leben dafür zu danken, dass es mir erlaubt hat, noch weiter in dieser Weise zu brennen« (GT, S. 38). Die Figur des Zagreus verkörpert dabei in freilich extremer Form den absurden Menschen, der ganz in der Gegenwart aufgeht und diese nicht an ein mit zweifelhaften Hoffnungen besetztes »Morgen« verschenkt, von dem er nicht weiß, ob es überhaupt eintreten wird. Der Gewinn an Gegenwärtigkeit und der Verzicht darauf, diese Welt auf eine jenseitige hin zu übersteigen, bedeuten wiederum in eins einen Zuwachs an sinnlicher Präsenz für den Menschen. »Mein Reich ist von dieser Welt«, schreibt Camus in Abwandlung des Christus-Wortes.7 Einzig »von dieser Welt« ist auch das Reich des Sisyphos, der mit einer List die Götter betrog und den Tod in Fesseln legte; der aus dem Hades zurückkehrte, woraufhin er »noch viele Jahre lebte, am leuchtenden Meer, auf der lächelnden Erde« – dafür nimmt er die Qual der Strafe auf sich. Und auch für den Menschen, der sich dem Absurden stellt, bedeutet Leben vor allem »fühlen, auf dieser Erde fühlen«. Existieren heißt so verstanden auch wieder, wie bei den frühen Griechen: leibhafte Anwesenheit im 7 TB, S. 11, vgl. Evangelium des Johannes 18,36
126
Anne-Kathrin Reif (Wuppertal)
Licht der Sonne, im Anblick der Schönheit der Welt – und dieses vergängliche, gegenwärtige Glück kann – nach Camus – kein Jenseits aufwiegen. »Dank einer Inkonsequenz, die bei einem so gewitzten Volk merkwürdig ist, meinten die Griechen, dass Menschen, die jung sterben, Lieblinge der Götter wären. Das stimmt nur, wenn man sich damit abfinden kann, dass der Eintritt in die lächerliche Welt der Götter zugleich bedeutet, für immer die reinste aller Freuden zu verlieren: nämlich zu fühlen, und zwar auf dieser Erde zu fühlen« (MS, S. 56). Es gibt also auch für den absurden Menschen das Glück im emphatischen Sinne, den je und je momenthaften ganz und gar glücklichen Augenblick, den Augenblick vollkommener Präsenz, wenn das »auf dieser Erde fühlen« auch wirklich als die »reinste aller Freuden« erfahren wird, und der Mensch sich nicht durch eine Kluft von der Welt getrennt fühlt. Nur : Denkend – so viel steht am Ende des Sisyphos fest – denkend können wir den absurden Zwiespalt der menschlichen Existenz, an dem wir leiden, niemals aufheben. Wie aber dann? Die Antwort liefert das eingangs genannte Zitat: Indem wir die Liebesmöglichkeiten annehmen, die die Welt uns trotz allem bietet und ihnen liebend entsprechen – denn die Welt bietet eben keine Wahrheiten, dafür aber Liebesmöglichkeiten – und das ist zugleich ihr Elend und ihre Größe.
Die Liebesmöglichkeiten Diese »Liebesmöglichkeiten« hat Albert Camus in seinen frühen literarischen Essays, die unter dem Titel Licht und Schatten (original: L’envers et l’endroit) und Noces (dt. Hochzeit des Lichts) erschienen sind, immer wieder geradezu hymnisch beschworen. Wir entdecken sie freilich nur, wenn wir diese »Liebesmöglichkeiten« nicht vorschnell auf die zwischenmenschliche, geschlechtliche Liebe reduzieren. Camus unterscheidet hier nicht zwischen verschiedenen Arten dieser Liebesmöglichkeiten. In Hochzeit in Tipasa schreibt er : Hier begreife ich, was man Herrlichkeit nennt: das Recht, ohne Maß zu lieben. Es gibt nur diese eine, einzige Liebe in der Welt. Wer einen Frauenleib umarmt, presst auch ein Stück jener unbegreiflichen Freude an sich, die vom Himmel aufs Meer niederströmt (HL, S. 80).
Jene glückhaften Einheitserlebnisse, wo sich die Kluft des Absurden für aus der Zeit herausgehobene Momente schließt, finden statt sowohl als Vereinigung mit der Welt wie auch als Vereinigung mit einem anderen Menschen. In beiden Fällen handelt es sich um einen erotischen Akt, einen Liebesakt, und beide stellen zwei unterschiedliche Spielarten einer einzigen Liebe dar, der Liebe zum
Vom Absurden zur Liebe – der unbekannte Camus
127
Leben. Wie sehr sich beide Arten von Vereinigungserlebnissen mischen und durchdringen können, wird besonders deutlich in folgender Notiz: Nächte des Glücks ohne Maß unter einem Regen von Sternen. Was man an sich presst – ist es ein Körper oder die laue Nacht? Und jene Gewitternacht, da die Blitze die Dünen entlangliefen, erstarben, auf den Sand und in die Augen orangefarbene oder weißliche Glanzlichter setzten. So eine Vereinigung ist unvergesslich (TB, S. 119).
Wie die erotische Vereinigung zweier Körper vollzieht sich auch die Vereinigung mit der Welt in einer »Umarmung«, einem Eindringen und Sich-Öffnen, und der Teil der Welt, der dieses Wechselspiel von Sich-Einlassen und AufgenommenWerden vorzugsweise ermöglicht, ist für Camus das Meer : Nackt muss ich sein und muss dann, mit allen Gerüchen der Erde behaftet, ins Meer tauchen, mich reinigen in seinen Salzwassern und auf meiner Haut die Umarmung von Meer und Erde empfinden, nach der beide so lange schon verlangen (HL, S. 79).
Ebenso kann der Wind zum Medium der Vereinigung werden (wie in der Episode Der Wind in Djemila), wo der Mensch sich gleichsam einfügt in den Atemrhythmus der Natur; und das Einatmen selbst kann zu einer erotischen Bewegung werden: Im In-Sich-Einsaugen die Sinne erregender und berauschender Düfte. Überall in der natürlichen Welt bedeutet das Verströmen solcher Düfte gleichsam das Setzen von »Liebessignalen«, und so kann auch der Duft, den die Welt verströmt, als eine Einladung zur Vereinigung, zur »Hochzeit«, empfunden werden. Camus hat, mehrfach variiert, diese sinnliche Wirkung der Düfte in ein hoch erotisches Bild gefasst: In dieser Zeit verbreiten die Johannisbrotbäume ihren Liebe erregenden Duft über ganz Algerien – abends, wenn nach dem Regen der feuchte Leib der Erde einen Geruch wie bittere Mandeln ausströmt und ausruht, nachdem er sich den ganzen Sommer der Sonne hingegeben hat. Aufs neue bekräftigt dieser Duft die Hochzeit des Menschen und der Erde und erweckt in uns die einzige Liebe, die wahrhaft männlich ist in dieser Welt: hochherzig und vergänglich zugleich. (Sommer in Algier, HL, S. 106).
Wir sollten hier allerdings Camus korrigieren und »männlich« durch »menschlich« ersetzen… »Hochherzig und vergänglich zugleich« – denn diese Liebeserlebnisse können niemals dauern und Einheit dauerhaft herstellen. Nach der Vereinigung folgt unweigerlich die Trennung, und der Mensch fällt in seine Einsamkeit zurück. Die Schönheit der Welt, die Liebe zum Leben, das sinnlich erfahrbare Glück und das Einheitserleben gehören zusammen – sie bilden in ihrer wechselseitigen Bedingtheit sozusagen die »Lichtseite« der Welt. Aber diese Lichtseite existiert nur in Verbindung mit der komplementären Schattenseite von Einsamkeit, Vergänglichkeit und Sterben-Müssen (auch davon handeln diese frühen Essays und Erzählungen, z. B. in Zwischen Ja und Nein, Ironie, oder Tod im
128
Anne-Kathrin Reif (Wuppertal)
Herzen). Immer gilt: »Es gibt keine Liebe zum Leben ohne Verzweiflung am Leben« – und Camus schreibt weiter : Zwischen dieser Vorder- und dieser Rückseite der Welt will ich nicht wählen […]. Der wahre Mut besteht immer noch darin, die Augen weder vor dem Licht noch vor dem Tod zu verschließen. Wie kann man überhaupt das Band beschreiben, das diese verzehrende Liebe zum Leben mit jener geheimen Verzweiflung verknüpft? (LS, S. 73 f)
Hier ist er wieder : der Zwiespalt des Absurden. Er lässt sich nicht dauerhaft schließen oder aufheben. Aber die Beschreibung der Glücks- und Vereinigungserlebnisse in den Essays zeigen, dass es dem Menschen trotz seines grundsätzlichen Bewusstseins der Absurdität möglich ist, das Trennende je und je zu überwinden und augenblickshaft in glücklichem Einklang mit der Welt zu leben. Und sie zeigen, dass dies ermöglicht wird durch die Liebe als einer eigenen, Geist und Sinnlichkeit vermittelnden Fähigkeit des Menschen. Das glückhafte Erleben, die Vereinigung selbst, ist immer auch unverfügbar, sie lässt sich nicht einfachhin »herstellen«, sondern bleibt Ereignis. Aber die Liebe – wie Camus sie hier schildert – enthält auch Wesensmerkmale, die in der Verfügbarkeit des Menschen selbst stehen – sie machen seine Fähigkeit zur Liebe aus und sie sind nicht unverfügbar, sie bedürfen der eigenen Entschlossenheit. Es sind im Wesentlichen zwei Elemente, in denen sich diese manifestiert: die Hingabe und die Treue, freilich eine besondere Art von Treue. Hingabe verlangt die Bereitschaft, sich zu öffnen und offenzuhalten; sie hat den Charakter der Gabe, des Von-sich-selbst-abgebens, das zugleich ein Von-sich-selbst-absehen ist, um sich auf ein Anderes einzulassen und Anderes in sich einzulassen. Wo dagegen auf der Abgrenzung, dem Sich-Verschließen oder der Verhärtung bestanden wird, kann sich keine Vereinigung ereignen; hier schließt sich der Mensch selbst von den Liebesmöglichkeiten, die die Welt ihm bietet, aus – und wird im Zustand der Getrenntheit, des »Exils« wie es bei Camus heißt, verharren müssen. Ähnlich steht es mit der Treue. Nur innerhalb der Grenzen dieser Welt ist in der Erfahrung der Liebe auch Glück möglich. »Die Welt ist schön, und außer ihr ist kein Heil« (HL, S. 118) – so lautet das Credo von Camus. Deshalb gilt es, diesen Gegenstand der Liebe festzuhalten, die Welt in ihrer irdisch-sinnlichen Schönheit nicht umwillen eines außerhalb dieser Welt liegenden »Heils« zu »verraten« – der Welt gleichsam die Treue zu halten. Es ist dies jene Haltung der Treue, die nach Camus’ Interpretation auch Sisyphos lehrt: Jene »größere Treue, die die Götter leugnet und die Steine wälzt« (MS, S. 101). Diese Haltung der Treue, die auf eigenem Entschluss gründet, bildet ein Gegengewicht gegenüber dem Moment des Unverfügbaren, das der Liebe (wie allen Gefühlen) zu eigen ist. Treue setzt keine Gegenseitigkeit voraus. Sie ist eine Haltung der Selbstverpflichtung aus Freiheit, ein freiwilliges Sich-Binden, das unter Umständen auch
Vom Absurden zur Liebe – der unbekannte Camus
129
einseitig an einer Beziehung festhält; sie ist eine Haltung, die die eigene Offenheit für etwas auch dann bewahrt, wenn dieses andere sich entzieht, und die damit die Möglichkeit der Beziehung auch über Trennendes hinweg offenhält. Die Trennung aber ist, wie gesagt, unvermeidlich. Denn der Verstand wird wieder Fragen stellen, er muss es sogar, weil auch dies zur Natur des Menschen gehört. Und diese Fragen werden immer wieder auf das Schweigen der Welt treffen. Aber in der Liebe erfahren wir, dass es auch ein Schweigen gibt, das nicht Stummheit und Verweigerung von Antwort ist, sondern Verzicht auf Rede, ein einvernehmliches Schweigen, weil Reden – und Fragen – überflüssig ist. Das klingt an, wenn Camus schreibt (In Liebe zum Leben aus Licht und Schatten): Denn was ich damals entdeckte, war nicht eine nach Menschenmaß geschaffene Welt, sondern eine Welt, die über dem Menschen zusammenschlägt. Nein, nicht weil sie meine Fragen beantwortet hätte, sondern weil sie sie vielmehr überflüssig machte, war die Sprache dieser Länder im Einklang mit dem Ton, der tief in meinem Inneren widerhallte (LS, S. 68).
Von dieser Art ist auch das Schweigen von Liebenden in jenen (seltenen) Augenblicken, wo die gegenseitige Liebe eine so große Evidenz hat, dass alle Fragen überflüssig erscheinen müssen; und ebenso wie zwischen Liebenden besteht zwischen Mensch und Welt der Augenblick dieses vollkommenen Einklangs so lange, wie nicht neuerliches Fragen – nach Grund und Bestand, Größe und Dauer, Möglichkeit und Unmöglichkeit… – das einvernehmliche Schweigen bricht. So lange das Weltverhältnis des Menschen ein bloß vernunftgeleitetes, vom Streben nach Erkenntnis und der Suche nach »Wahrheit« geprägtes ist, wird ihm das Erlebnis von glückhafter Einheit unzugänglich bleiben und er wird in Zerrissenheit, Widerspruch und Zwiespalt des Absurden verharren – denn die Welt bietet dem Menschen keine Wahrheiten. Wenn er aber die Liebesmöglichkeiten annimmt, die die Welt ihm bietet, dann kann er für glückliche Momente »Rettung« vor dem Absurden erfahren und glückhafte Einheit erleben. Sein Bedürfnis nach Erkenntnis und sein Verlangen nach Dauer kann dadurch freilich nicht gestillt, sondern nur zeitweilig aufgehoben werden. Deshalb ist die Tatsache, dass die Welt dem Menschen keine Wahrheiten bietet, sondern »nur« Liebesmöglichkeiten, zugleich ihr Elend und ihre Größe. Die Frage nach einer möglichen Rettung vor dem Absurden ist damit also schon beantwortet: Rettung in dem Sinne, dass wir der Absurdität unseres Daseins entgehen könnten, sie dauerhaft aufheben könnten, die Kluft schließen, Einheit dauerhaft herstellen – kann es nicht geben. Die Kategorie des absurden Menschen im Hinblick auf die Zeit ist nicht Dauer, nicht Ewigkeit, sondern der Augenblick. Alle Versuche, dauerhaft Einheit herzustellen, müssen scheitern. In allen literarischen und dramatischen Werken, die dem Stadium der Absurdität
130
Anne-Kathrin Reif (Wuppertal)
zuzurechnen sind, spielt eben dies eine wichtige Rolle. Lassen Sie uns einen kurzen Blick darauf werfen.
Lebensentwürfe des Absurden Die absurden Werke – Der Fremde, Caligula und Das Missverständnis – sind gleichsam Spiegelbilder der Absurdität, und sie spielen jeweils verschiedene Lebensentwürfe im Angesicht des Absurden durch. Die Liebe freilich, so scheint es, suchen wir in ihnen vergeblich. Wir können hier nicht die einzelnen Werke in den Blick nehmen, sondern nur das Ergebnis einer genaueren Werkanalyse vorwegnehmen. Und dann springt heraus: Alle diese Lebensentwürfe nehmen ihren Ausgangspunkt vom Bewusstsein der Absurdität und ziehen Schlüsse daraus für ihr Existieren, die bis zu einem gewissen Grade konsequent sind. Aber in jedem dieser Entwürfe gibt es einen Punkt, an dem ihre innere Logik in ihr Gegenteil umschlägt. Dieser Punkt verdichtet sich in der Thematik des Mordes, die in allen genannten Werken zentral ist. Das ist kein Zufall. Denn im absurden Denken gibt es auf der rationalen Ebene kein Argument mehr gegen den Mord: Er vernichtet nur, was ohnehin sinnlos geworden ist. Es ist dieses Dilemma, das Camus als die »Sackgasse des Absurden«8 bezeichnet und zum Ausgangspunkt des »Stadiums der Revolte« gemacht hat. In dieser Sackgasse enden alle Protagonisten des »Stadiums der Absurdität«. Für Meursault, den Fremden, gilt wie für Martha, die Protagonistin in Das Missverständnis, derselbe Widerspruch wie für Caligula – nämlich aus Treue zu sich selbst dem Menschen untreu zu werden (vgl. DR, S. 9). Meursault, Martha und Caligula versuchen auf ihre Weise, das Absurde zu überwinden und Einheit herzustellen. Aber jeder von ihnen verwickelt sich in den Widerspruch, das Absurde in Gestalt von Ungerechtigkeit, Leiden und Tod, gegen das sie sich revoltierend auflehnen, durch das eigene Handeln noch zu vergrößern, statt die Kluft zu verringern. Es ist deshalb kein Zufall, dass Camus keinen seiner absurden Helden überleben lässt, denn diese Lebensentwürfe enden in einer
8 In einem Brief an Jean Grenier schreibt Camus: »Glauben Sie vor allem nicht, dass das, was Sie gegen das Absurde schreiben, mich nicht berührt. Ich sehe sehr wohl, dass der Gedanke des Absurden […] in eine Sackgasse führt, kann man in einer Sackgasse leben, das ist das Problem. Auf jeden Fall zeigt sich, dass die Wahrheit unannehmbar sein kann für den, der sie findet.« (Albert Camus – Jean Grenier, Correspondance: 1932 – 1960, Gallimard, Paris 1981, Brief vom 9. 3. 1943, S. 89). Und in Der Mensch in der Revolte heißt es: »Das Absurde hat, wie der methodische Zweifel, Tabula rasa gemacht. Es lässt uns in der Sackgasse zurück. Doch wie der Zweifel kann es, indem es zu sich zurückkehrt, einer neuen Forschung die Richtung weisen« (MR, S. 12 f).
Vom Absurden zur Liebe – der unbekannte Camus
131
Sackgasse. So wartet Meursault am Ende auf seine Hinrichtung, Caligula lässt sich bereitwillig ermorden, Martha und ihre Mutter suchen selbst den Tod. Dies aber ist nicht wiederum ein bloßer Spiegel der Absurdität selbst – auch wenn sich jedes Werk für sich genommen so lesen lässt. Nehmen wir aber nicht das einzelne, sondern das gesamte Werk in den Blick, dann zeigt sich: Camus verfolgt hier eine bestimmte Methode. Er habe, so sagt er in einem Interview 1957 in Stockholm, in den Werken der Absurdität zunächst die Negation darstellen wollen, obwohl er gewusst habe, dass man in der Negation nicht leben kann. Und er fügte hinzu: »Aber das war für mich, wenn Sie so wollen, wie der methodische Zweifel Descartes«9. Camus verfolgt die Methode, die innere Logik der Lebensentwürfe seiner absurden Helden bis in ihre letzten Konsequenzen hineinzutreiben, bis zu dem Punkt, an dem die innere Logik dieser Entwürfe in ihr Gegenteil umschlägt. Dieser Punkt markiert die Stelle, an der das Denken die Richtung ändern muss. Die »Negation«, die Camus in seinen absurden Werken darstellt, bildet, richtig besehen, das »Positive« indirekt schon mit ab – wie eine Gussform oder das Negativ einer Fotografie. Wir müssten demnach den Blick auf das richten, was in der »Negation« fehlt, um daraus das Positive ableiten zu können. Und in der Tat bringt die genaue Analyse der einzelnen Werke eine entscheidende Gemeinsamkeit aller Protagonisten des Absurden zu Tage, die sich gerade durch ein »Fehlen«, durch einen Mangel bekundet: Es fehlt ihnen jede unmittelbar gefühlshafte Verbindung zum Anderen in den Weisen von Liebe, Freundschaft oder Mitleid; alle entbehren in der ein oder anderen Weise der Liebe. Das aber ist keine bloße Nicht-Vorhandenheit und Nicht-Thematisierung, sondern es ist die Thematisierung des Nicht-Vorhandenen; es ist die Präsenz der Lücke, die das Fehlende als Fehlendes deutlich macht. Der Weg, der aus der Sackgasse herausführt, wird dabei schon offen gehalten – und zwar durch »Nebenfiguren«, denen die Interpreten bislang wenig Beachtung schenkten. In Caligula ist es z. B. dessen Geliebte Caesonia, die auf schlichte Weise die Widersprüchlichkeit von Caligulas Revolte auf den Punkt bringt, wenn sie sagt: »In meinem Alter weiß man, dass das Leben nicht gut ist. Aber wenn das Böse schon auf der Erde ist, warum dann noch dazu beitragen wollen?« (DR, S. 27) – oder wenn sie 9 »Oui, j’avais un plan pr¦cis quand j’ai commenc¦ mon oeuvre: je voulais d’abord exprimer la n¦gation. Sous trois formes. Romanesque: ce fut L’Êtranger. Dramatique: Caligula, Le Malentendu. Id¦ologique: Le Mythe de Sisyphe. Je n’aurais pu en parler si je ne l’avais v¦cu; je n’ai aucune imagination. Mais c’¦tait pour moi, si vous voulez bien, le doute m¦thodique de Descartes. Je savais que l’on ne peut vivre dans la n¦gation et je l’annoncais dans la pr¦face au Mythe de Sisyphe; je pr¦voyais le positif sous les trois formes encore. Romanesque: La Peste. Dramatique: L’Êtat de siÀge et Les Justes. Id¦ologique: L’Homme r¦volt¦. J’entrevoyais d¦j une troisiÀme couche, autour du thÀme de l’amour. Ce sont les projets que j’ai en train« (E, S. 1610).
132
Anne-Kathrin Reif (Wuppertal)
Caligula, gegen dessen blindwütige Zerstörung gerichtet, auffordert: »Gebrauche deine Macht, um das, was noch geliebt werden kann, inniger zu lieben. Auch das Mögliche verdient, dass ihm seine Möglichkeiten gewährt werden« (DR, S. 27).
Auch in Le Malentendu (Das Missverständnis), dem düstersten Stück von Camus, gibt es so eine Figur, Maria, die Frau des Protagonisten Jan. Maria kämpft um den Bestand ihrer Liebe. Und die Liebe ist in ihren Augen einfach: Sie kennt nur die Wahrhaftigkeit. Sie ist eindeutig. Und es gibt in der Liebe nichts Wichtigeres als die Zeit, die man mit einander verbringen kann, nichts Kostbareres als die Gegenwart des Geliebten: Männer wissen nie, wie die Liebe sein muss. Nichts befriedigt sie. Sie vermögen nichts anderes, als zu träumen, neue Aufgaben zu ersinnen, neue Länder und neue Heimstätten zu suchen. Wir hingegen wissen, dass wir uns beeilen müssen zu lieben, dass es darauf ankommt, das gleiche Lager zu teilen, uns die Hand zu reichen, das Fernsein zu fürchten. Wer richtig liebt, hängt keinen Träumen nach (DR, S. 83 f).
Camus sagte selbst über Le Malentendu, die Moral des Stücks sei eine der »Aufrichtigkeit«: Wenn ein Mensch erkannt werden will, dann muss er ganz einfach sagen, wer er ist. Wenn er schweigt oder wenn er lügt, stirbt er einsam und stürzt alles um ihn herum ins Unglück. Wenn er dagegen die Wahrheit sagt, wird er zweifellos auch sterben, aber erst, nachdem er den anderen und sich selbst geholfen hat, zu leben (TRN, S. 1793).
Werke der Revolte Die Lücke, die das Stadium der Absurdität offen gelassen hat, füllt Camus bis zu einem gewissen Grade, indem er in den folgenden Werken die Kategorie der Revolte durch die Solidarität ergänzt. Die einsame und den anderen ausschließende Auflehnung gegen das Absurde wird zum gemeinsamen Kampf; die Revolte wandelt sich von der »r¦volte solitaire« zur »r¦volte solidaire«. Beispielhaft führt Camus dies vor im Kampf des Dr. Bernard Rieux gegen die Pest, in dem gleichnamigen Roman; und dann am Beispiel der historischen Revolte, im Kampf der russischen Revolutionäre für eine gerechte Gesellschaft in dem Drama Die Gerechten. In der Schrift Der Mensch in der Revolte bringt er dann die zuvor in literarischer und dramatischer Form entwickelte Problematik in einer umfangreichen philosophisch-historischen Untersuchung auf den Begriff. Mit der Feststellung und Untersuchung dieser (je nach Betrachtung) Wendung oder Weiterentwicklung des Denkens des Absurden in das Stadium der Revolte, endet in der Regel die Analyse und Interpretation des Oeuvres von Albert Camus. Doch von einem erweiterten Blickpunkt – nämlich gleichsam rückwärts von dem zukünftigen Stadium der Liebe aus – müssen wir auch diese Werke, ebenso
Vom Absurden zur Liebe – der unbekannte Camus
133
wie die der Absurdität, neu lesen. Und nun wundert es uns nicht mehr, wenn wir feststellen, dass sich Camus hier der nämlichen Methode – des auf das Feld der Existenz übertragenen »cartesianischen Zweifels« – bedient hat. Wieder treibt er den Gedanken von seinem rechtmäßigen Ausgangspunkt bis in einen nicht auflösbaren Widerspruch hinein und macht so eine neue Lücke sichtbar. Der Widerspruch entsteht, wenn die solidarische Revolte in einer geschichtlichen Situation zur Revolution wird, unter Umständen werden muss, und damit wiederum zusammenfällt mit einer Zustimmung zum Mord. In seinem Drama Die Gerechten, das Camus in der historischen Situation der Russischen Revolution von 1905 ansiedelt, spitzt er diesen Konflikt zu in der Auseinandersetzung zwischen den Revolutionären um die Frage nach der Rechtfertigung des Mordes für eine bessere, gerechtere Welt. Stephan, der Anführer, bejaht den Mord bedingungslos, für ihn gilt: Für eine bessere Zukunft müssen eben Opfer gebracht werden, selbst wenn diese unschuldig sind. Für Iwan Kaliajew, genannt Janek, ist der Mord – selbst der an einem Tyrannen – dagegen zugleich »notwendig und unentschuldbar«; der Mord an Unschuldigen aber schlechthin nicht zu rechtfertigen. Er wirft die Bombe auf die Kutsche des Großfürsten nicht, als er darin dessen kleine Nichte und Neffen wahrnimmt. In einem zweiten Anlauf gelingt ihm das Attentat – er wird verhaftet und verweigert später die Begnadigung, weil sich dieser Mord für ihn nur durch den eigenen Tod rechtfertigen lässt. Die Revolutionäre morden »aus Liebe zum Menschen«, aus Solidarität mit den Ausgebeuteten und Unterdrückten, für eine bessere Welt, in der es keinen Hunger, keine Not, Ungerechtigkeit und Unfreiheit mehr geben soll – eine Welt mithin, die uns dann vielleicht nicht mehr absurd erscheint. Aber dabei geraten sie in den Widerspruch, den Menschen, in dessen Namen sie angetreten waren, in Wahrheit zu vergessen. Die gewaltsame Revolution gibt den Wert des Lebens und auch die Solidarität gegenüber allen Mitlebenden preis, indem sie nämlich die Gegenwart der Zukunft opfert, das imaginäre Glück des zukünftigen über das reale Leid des gegenwärtigen Menschen stellt – so verliert die Revolte als Revolution jedes Maß und endet in der Abstraktion. (Es ist diese Haltung Camus’, daran sei nur am Rande erinnert, die schließlich nach Erscheinen seiner Schrift Der Mensch in der Revolte zum Bruch mit Sartre geführt hat). Auch in Die Gerechten gibt es eine Figur, die diesen Widerspruch zumindest erkennt, wenn sie ihn auch nicht auflösen kann; es ist Dora (wohl auch kein Zufall, dass diese Rolle immer den Frauen zukommt): »Wenn der Tod die einzige Lösung ist, befinden wir uns nicht auf dem rechten Weg. Der rechte Weg führt zum Leben, an die Sonne« (DR, S. 230). Dennoch wählt sie die Bombe und den Tod, denn, so sagt sie: »Es ist so viel leichter, an seinen Widersprüchen zu sterben, als mit ihnen zu leben« (DR, S. 231). Genau darum aber geht es. Es geht darum, mit den Widersprüchen, d. h. mit
134
Anne-Kathrin Reif (Wuppertal)
der Absurdität zu leben, und sie gleichwohl nicht zu bejahen – und deshalb nach Möglichkeit auch nicht aus eigener Schuld dazu beizutragen. Und dennoch werden wir die Widersprüche unserer Existenz niemals aus der Welt schaffen. »Der Mensch kann alles in sich zügeln, was Zügelung verdient«, schreibt Camus in Der Mensch in der Revolte. »Er muss in der Schöpfung in Ordnung bringen, was in Ordnung gebracht werden kann. Und darauf werden die Kinder immer zu Unrecht sterben, selbst in der vollkommenen Gesellschaft. Auch bei seiner größten Anstrengung kann der Mensch sich nur vornehmen, den Schmerz der Welt mengenmäßig zu vermindern. Aber Leiden und Ungerechtigkeit werden bleiben und, wie begrenzt auch immer, nie aufhören, ein Skandal zu sein« (MR, S. 245). Wissend, dass wir das Absurde nicht aus der Welt schaffen können, besteht die wahre Revolte darin, in der Gegenwart das Leid zu verringern, und so viel Glück und Leben dagegen zu setzen, wie nur möglich. Und dieses Maß, das die historische Revolte entbehrt, findet die Revolte in der Liebe. Denn die Liebe richtet sich nicht auf etwas Imaginäres, sondern auf den konkreten, den gegenwärtigen Menschen; und sie setzt nicht einen zukünftigen, vorgestellten Wert voraus, sie ist selbst Wert setzend. Die wahre Großzügigkeit der Zukunft gegenüber besteht darin, in der Gegenwart alles zu geben. Die Revolte beweist dadurch, dass sie die Bewegung des Lebens selbst ist, und dass man sie nicht leugnen kann, ohne auf das Leben zu verzichten. […] Sie ist somit Liebe und Fruchtbarkeit, oder sie ist nichts (MR, S. 246).
Resumee Wir haben also – in sehr groben Zügen – die Spur der Liebe im Werk Albert Camus’ zurückverfolgt und ansatzweise die Veränderung erfahren, die unsere Einschätzung der einzelnen Werke in diesem Lichte erfährt. Wie aber steht es am Ende mit der Frage nach der »Rettung« vor dem Absurden durch die Liebe? Kann man überhaupt von »Rettung« sprechen angesichts dieser sporadischen Momente glückhaften Einheitserlebens, in denen das Glück oft genug auch noch einen bitteren Beigeschmack hat, weil ja die ausstehende Trennung immer schon inbegriffen ist? Was brächte die Liebe anderes als eine Reihe kleiner Fluchten aus der Realität des Absurden, ein kurzes Atemholen der Seele, um den aussichtslosen Kampf gegen die Absurdität wieder aufnehmen zu können? Ich möchte abschließend einige Punkte zur Bedeutung der Liebe, wie sie sich aus dem Denken Camus’ – dieses gleichsam weiter denkend – herausdestillieren lassen, schlagwortartig zusammenfassen. 1. Da ist zunächst das, was man als die »ethische Dimension« des Themas zusammenfassen könnte. Es geht ja bei Camus nicht um eine bloße Zustands-
Vom Absurden zur Liebe – der unbekannte Camus
135
beschreibung, sondern um die Frage, wie mit diesem Zustand zu leben ist, und welche Konsequenzen für das Handeln daraus zu ziehen sind. »Wenn ich hier eine Morallehre schreiben müsste, würde das Buch 100 Seiten umfassen, und davon wären 99 leer. Auf die letzte würde ich schreiben: ›Ich kenne nur eine einzige Pflicht, und das ist die Pflicht zu lieben‹«, notierte Camus bereits 1937 in sein Arbeitstagebuch (TB, S. 36). Der letzte Werkabschnitt der Revolte zeigt bereits, wie sich die Kategorie der Revolte mit der der Liebe zusammenschließt. Dennoch geht am Ende die Liebe bei Camus nicht in einer Art atheistischer Nächstenethik auf. Denn die Revolte, gleich welcher Form, stiftet keine Heimat und kein Glück in absurder Welt. 2. Darum aber geht es bei Camus: Es geht immer – und vor allem – darum, die Glücksmöglichkeiten für den Menschen zu bewahren. Und diese findet der Mensch in einem leiblich-sinnlichen Welterleben, das ein Liebeserleben ist, und das in glücklichen Momenten auch die Verwirklichung einer konkreten geschlechtlichen Liebe mit einschließt. Es lässt sich in allen Werken zeigen, dass Camus diesen Glauben an das sinnlich erfahrbare Glück, wie er es bereits in seinen frühen literarischen Essays gepriesen hatte, nie aufgegeben hat. Im Lichte einer Neubewertung seines Werkes unter der Leithinsicht der Liebe müssen wir auch und vor allem diese frühen Schriften, aus denen ich eingangs zitiert habe, neu bewerten. Sie wurden bislang von den Interpreten zumeist als Ausdruck eines »vor-absurden« Stadiums bewertet – gleichsam als Ausdruck eines paradiesischen Einheitszustandes zwischen Mensch und Welt, der mit dem Aufbrechen des Bewusstseins der Absurdität unwiederbringlich verloren geht. Dies ist m. E. jedoch unhaltbar. Denn in all diesen Essays findet sich bereits eine dichte Durchdringung von Einheitserleben und Getrenntheit, Vorder- und Rückseite, Licht und Schatten eben. Bei der Neuauflage der Essays im Jahre 1941 schrieb Camus, er stimme trotz künstlerischer Vorbehalte einer erneuten Veröffentlichung zu, da diese Essays im Grunde schon alles enthielten, worauf es ihm ankomme. Das Werk, welches er noch verwirklichen wollte, sollte »auf diese oder jene Weise Licht und Schatten gleichen und von einer gewissen Art Liebe handeln«, und er werde nichts erreicht haben, wenn es ihm nicht gelänge, eines Tages Licht und Schatten neu zu schreiben (vgl. LE, S. 22). In seinem letzten Roman Der erste Mensch, dessen Manuskript Camus bei seinem Unfalltod bei sich hatte und der erst mit über 30jähriger Verspätung 1992 veröffentlicht wurde, kehrt er zu den Themen seiner frühen Schriften zurück. Und es wundert uns deshalb nicht, wenn er in einem seiner »Arbeitspläne« diesen Roman bereits dem geplanten Werkstadium der Liebe zurechnet (vgl. TB II, S. 236). 3. Ein wichtiger Aspekt hierbei im philosophischen Zusammenhang ist die »Rehabilitierung« der Leiblichkeit, die ja bekanntlich in der Geschichte der Philosophie so gut wie keine Rolle spielt; von der platonisch-christlichen Tradition gar als an-sich-nichtig denunziert wurde. Gerade darin, dass Camus die
136
Anne-Kathrin Reif (Wuppertal)
Bedeutung von Körper und Sinnlichkeit als einen eigenen Weltzugang herausstellt, macht ihn m. E. für die gegenwärtige Philosophie, die sich erst seit jüngerer Zeit mit der Bedeutung der Leiblichkeit beschäftigt, höchst aktuell und interessant. 4. Derselbe Aspekt macht das Denken Camus’ wiederum höchst aktuell für die Erfordernisse einer an den Problemen der Gegenwart orientierten Ethik. Wenn nämlich die Schönheit der naturhaften Welt, wenn die Liebesmöglichkeiten, die sie uns bietet, unsere – wenigstens zeitweise – Rettung vor dem Absurden bedeutet, dann sind wir aufgefordert, unser Verhältnis zur Welt, das wohl in der Regel weniger eines der Liebe als eines der Vernutzung und Ausbeutung ist, radikal zu überdenken. Denn dann muss es umso dringlicher erscheinen, diese Liebesmöglichkeiten, die die Welt uns bietet, zu hüten und zu bewahren und sie nicht durch immer weitere vernutzende Eingriffe zu zerstören. 5. Und schließlich lernen wir auch etwas über die Liebe selbst, darüber was Liebe ist und sein kann, und darüber, wie wir lieben sollen. Denn es braucht nicht nur die von der Welt dargebrachten Liebesmöglichkeiten, es braucht auch den eigenen Entschluss, über immer wieder neu ausstehende Trennung, Entzug, Enttäuschung hinweg, sich selbst liebend für neue Vereinigungsmöglichkeiten offen zu halten. Tun wir das nicht, dann schließen wir uns selbst ein im Zwiespalt der Absurdität und ein für alle mal aus von dem Glück, das uns wenigstens zeitweise rettet. Dann aber dörrt unser Wesen aus. So verstehen wir jetzt, wenn Camus in Heimkehr nach Tipasa schreibt: Auf den sandigen Hängen, die mit Heliotrop überdeckt waren wie mit dem Schaum, den die wilden Wogen der letzten Tage zurückgelassen hatten, blickte ich in der Mittagsstunde auf das Meer, das sich kaum bewegte, und löschte jenen zweifachen Durst, den man nicht lange hinhalten kann, ohne dass unser Wesen ausdörrt: zu lieben und zu bewundern. Denn nicht geliebt zu werden ist nur misslicher Zufall, nicht zu lieben jedoch ist Unglück (HT, S. 176).
Ausblick Wir könnten mit diesem wunderbaren Zitat glücklich schließen… Aber ich kann doch nicht umhin, noch ein klein wenig Wasser in den Wein zu gießen. Denn nichts liegt mir ferner, als Camus für eine eigene, schön ausgedachte Theorie zu vereinnahmen und dabei einen rundum hoffnungsvollen, tröstlichen, gleichsam weichgespülten Camus zu präsentieren. Schauen wir uns seine letzten, 1989 erstmals veröffentlichen Arbeitstagebücher an, können Irritationen nicht ausbleiben. Denn hier häufen sich literarische Fragmente und Notizen mit ausgesprochen pessimistischem Charakter in Bezug auf die Liebe. Etwa dies: »Wir können nichts auf die Liebe gründen: Sie ist
Vom Absurden zur Liebe – der unbekannte Camus
137
Flucht, Zerrissenheit, wunderbare Augenblicke oder Fall ohne Aufschub« (TB I, S. 190). Oder : »Das alternde Herz. Geliebt zu haben, ohne dass doch etwas gerettet wäre!« (TB I, S. 198) Äußerungen wie diese (und etliche mehr) lassen die Frage aufkommen, ob Camus in seinem letzten geplanten Werkzyklus die Frage nach einer möglichen »Rettung« vor dem Absurden durch die Liebe nicht doch abschlägig beantwortet hätte und dem Scheitern des ursprünglichen Ansatzes Gestalt verliehen hätte. Auch der Tenor der entsprechenden Romanfragmente in diesen Carnets, die mehr vom Scheitern als vom Gelingen der Liebe und von der Unzulänglichkeit oder Unfähigkeit zu lieben sprechen, scheint in diese Richtung zu weisen. Doch Vorsicht. Zunächst einmal stehen wir vor der Schwierigkeit, dass die Notizen in den Carnets mit den Jahren einen zunehmend persönlicheren Tagebuch-Charakter annehmen; zuweilen verbirgt auch der einer Notiz vorangestellte Zusatz »Roman« kaum deren private Natur. Dass Camus’ eigene schwierige Liebeserfahrungen hier eingeflossen sind, dürfte außer Frage stehen. Indessen: Auch in den Literarischen Essays, auch in Der glückliche Tod, in Der Fremde, in Die Pest, Der Fall und anderen Arbeiten sind die biographischen Anteile unverkennbar, ohne dass die Bedeutung der Werke sich darauf reduzieren ließe. Erinnern wir uns: Sowohl in Bezug auf die Werke des Absurden wie auf die der Revolte konnten wir Camus’ Arbeitsmethode des auf das Feld der Existenz übertragenen »cartesischen Zweifels« verfolgen, wobei Camus den als richtig festgestellten Ausgangsgedanken in der Konkretion der gelebten Existenz durchspielt, ihn in seine Extreme und damit in seine Widersprüche hineintreibt: Denn jeder Gedanke hat sich erst auf dem Feld der Existenz zu bewähren. Wenn Camus, nachdem die Notwendigkeit der Liebe als einer die Revolte ergänzende und fortführende Kategorie erwiesen ist, nun die in der Konkretion der zwischenmenschlichen, partnerschaftlichen Liebe entstehenden Schwierigkeiten und Widersprüche aufdeckt, so bleibt er diesem Verfahren treu. Die Rechtmäßigkeit des Ausgangsgedankens wird damit nicht negiert, ebenso wenig wie durch die in der Konkretion aufgedeckten Schwierigkeiten und Widersprüche der Urtatbestand des Absurden und die Notwendigkeit der Revolte negiert werden. Im Gegenteil – gerade eine Ausarbeitung des »Stadiums der Liebe« in Form einer alle Widersprüche aufhebenden Erlösungsvorstellung müsste als äußerst fragwürdig angesehen werden. Gewiss kennen wir jenes durch die Liebe ermöglichte, glückhafte Einheitserleben, das uns momentweise aller Getrenntheit und Zwiespältigkeit der menschlichen Existenz enthebt. Aber wie viel Unglück und Schmerz, Missverstehen, Enttäuschung und Zwiespalt bringt auch und gerade das hervor, was uns allein Rettung verspricht. Wie könnte ein existenzialer Denker vom Range Camus’ diesen Widerspruch übergehen? Die Liebe mag uns – zeitweise – vor dem Absurden retten, erlösen kann sie
138
Anne-Kathrin Reif (Wuppertal)
uns nicht. Alle Widersprüche der menschlichen Existenz müssen in der konkret gelebten zwischenmenschlichen Liebesbeziehung noch einmal gelöst, versöhnt, ausgehalten, ins Maß gebracht werden. Ebenso wie die Liebe die absurde Gestimmtheit aufzuheben vermag, kann sie dieser in Langeweile und leerlaufendem Immer-Gleichen anheimfallen. Ebenso wie in der Liebe das gerade noch Fremde gleichsam mit einem Schlag zum Allervertrautesten und der andere zur »Heimat« werden kann, ebenso können wir plötzlich in die Getrenntheit zurückfallen. Die Leidenschaft, die die Liebe beflügelt, verzehrt sich selbst; das Dilemma, dass die Leidenschaft nicht zugleich dauern kann und brennen, bleibt ungelöst. Ungelöst bleibt auch der Zwiespalt zwischen dem Bedürfnis nach Bindung und dem Wunsch nach Freiheit; auszuhalten bleibt die menschliche Bedingtheit, dass auch die Liebe nichts gegen den Tod vermag, und dass lieben für den Menschen letztlich immer heißt: das zu lieben, was sterben muss. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen: Viel Stoff für weitere Werke. Die Fragmente in den Carnets zeigen, dass sich Camus genau dieser Themen bereits angenommen hatte. Folgen wir auch hier dem methodischen Denken von Camus, welches in der Negation immer schon die sich notwendig ergebende Position mit abbildet, dann zeichnet sich am Ende als Ergebnis mindestens dieses ab: Im Sinne einer absoluten Aufhebung des Zwiespalts menschlicher Existenz und als Überwindung der menschlichen Getrenntheit im Sinne absoluter Einheit dürfen wir von der Liebe keine Rettung erwarten. Und dennoch bleibt die Liebe jene spezifisch menschliche, Geist und Sinnlichkeit vermittelnde, einheitsstiftende Kraft, die uns je und je ermöglicht, glücklich den Zwiespalt des Absurden zu überwinden. Nur ist vielleicht jene schwierige Liebe, welche dies vollbringt, noch nicht gelernt: die Liebe, welche um die Unmöglichkeit von Dauer und absoluter Einheit weiß, und die gleichwohl nach jedem schmerzhaften Rückfall in die Getrenntheit ohne Bitterkeit und ohne Reue den Stein wieder aufnimmt, um ihn abermals auf den Gipfel zu wälzen. Es scheint, als habe auch Albert Camus den Mut nicht verloren, sich erneut daran zu versuchen, wenn er im Juni 1957 schreibt: Das Leben, das wunderbare Leben, seine Ungerechtigkeit, sein Ruhm, seine Leidenschaft, seine Kämpfe, das Leben beginnt neu. Noch immer die Kraft, zu lieben und alles zu schaffen. (TB II, S.25)
Vom Absurden zur Liebe – der unbekannte Camus
139
Quellen- und Abkürzungsverzeichnis Werkausgaben Th¦tre R¦cits Nouvelles. Pr¦face par Jean Grenier. Textes ¦tablis et annot¦s par Roger Quilliot. (BibliothÀque de la Pl¦iade), Gallimard: Paris 1962 (TRN). Essais. Introduction par Roger Quilliot. Textes ¦tablis et annot¦s par Roger Quilliot et Louis Faucon. (BibliothÀque de la Pl¦iade), Gallimard: Paris 1965 (E). Carnets I, Mai 1935 – F¦vrier 1942. Gallimard: Paris 1962 (CA I). Carnets II, Janvier 1942 – Mars 1951. Gallimard: Paris 1964 (CA II). Carnets III, Mars 1951 – D¦cembre 1959. Gallimard: Paris 1989 (CA III).
Übersetzungen Literarische Essays. Rowohlt: Hamburg 1959 (LE). Enthält: Licht und Schatten (LS), Hochzeit des Lichts (HL), Heimkehr nach Tipasa (HT). Rowohlt: Hamburg 1959. Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde. Rowohlt: Reinbek 1959 (Übers.: H.G. Brenner und W. Rasch); zuerst Bad Salzig u. Düsseldorf 1950. Dramen. Rowohlt: Reinbek 1962 (Übers.: Guido Meister) (DR). Der Mensch in der Revolte. Rowohlt: Reinbek 1969 (Übers.: Justus Streller. Neubearbeitet von Georges Schlocker unter Mitarbeit von FranÅois Bondy) (MR). Tagebücher 1935 – 1951. Rowohlt: Reinbek 1972 (Übers.: Guido Meister) (TB I). Tagebücher 1951 – 1959. Rowohlt: Reinbek 1991 (Übers.: Guido Meister) (TB II). Der glückliche Tod. Rowohlt: Reinbek 1983 (Übers.: Eva Rechel-Mertens) (GT). Der erste Mensch. Rowohlt: Reinbek 1995 (Übers.: Uli Aumüller).
Elmar Schmidt (Bonn)
Camus im kolonialen Algerien der 30er Jahre: Misère de la Kabylie
[…] la France ne peut pas refuser des colonies au nom d’un id¦al d¦mocratique tant qu’elle y maintiendra des formes de domination anti-d¦mocratiques. […] on ne fait pas l’empire contre les sujets de l’empire. Et surtout on ne fait pas l’empire avec le d¦cret R¦gnier, le Code de l’indig¦nat et les lois d’exception.1
Mit diesen Worten formuliert Albert Camus am 25. April 1939 in der linksorientierten Tageszeitung Alger R¦publicain seine Kritik an der französischen Kolonialpolitik. Verschiedene für Camus’ Algeriendiskurs der 30er Jahre kennzeichnende Elemente scheinen in dem hier wiedergegebenen Zitat durch: Er bezieht Stellung gegen die Umsetzung und gesetzlich implementierte Institutionalisierung des kolonialen Projekts, hinterfragt jedoch nicht dessen Existenzberechtigung als solche. Er bemüht sich, die ideologischen Widersprüche der französischen Kolonialpolitik aufzuzeigen und verwickelt sich so in neue, letztlich nicht aufzulösende Gegensätze. Das koloniale empire, das per definitionem auf gewaltsamer Aneignung basiert, scheint ihm lediglich schlecht umgesetzt – die paradoxe Möglichkeit eines empire pour les sujets de l’empire lässt Camus offen. Zudem überlagern andere Diskurse die Auseinandersetzung mit der Situation des kolonialen Algerien. Der hier zitierte Artikel mit dem Titel Contre l’imp¦rialisme versteht sich keinesfalls als Generalabrechnung mit dem europäischen Imperialismus des 19. und 20. Jahrhunderts. Er ist vielmehr die Besprechung des zwei Tage zuvor gehaltenen Vortrags eines gewissen R.-E. Charlier, der sich vorrangig mit der aggressiven Außenpolitik der faschistischen Staaten Europas auseinandersetzt. Die Kolonialpolitik wird in diesem Zuge als nachgeordnete seconde id¦e ebenfalls thematisiert: Une seconde id¦e qu’il nous parait utile de signaler ici, c’est la d¦finition que M. Charlier donna de la question coloniale. Sous un de ses aspects, elle lui parait comme un conflit entre les imp¦rialismes satisfaits et les imp¦rialismes affam¦s. Et cependant, la question ne se pose pas de savoir si on doit c¦der ou non tel ou tel territoire. Un peuple et son pays 1 Camus, Albert: »Contre l’imp¦rialisme. Une conf¦rence de M. R.-E. Charlier«, in: Camus, Albert: Oeuvres complÀtes I (1931 – 1944), Paris: Gallimard 2006, S. 641.
142
Elmar Schmidt (Bonn)
ne constituent pas une monnaie d’¦change, mais une personne morale qu’il s’agit de consulter. M. Charlier se rallie en bref une sorte de demi-autonomie accord¦e aux peuples colonis¦s et compl¦t¦e par un condominium de pays europ¦ens qui internationaliserait le march¦ colonial ¦conomique.2
Der Konflikt, der hier der question coloniale zugrunde gelegt wird, ist nicht derjenige zwischen Befürwortern und Gegnern des kolonialen Projekts, zwischen dominanten und dominierten Kulturen. Vielmehr handelt es sich um den Widerstreit zwischen solchen Großmächten, die den kolonialen Status quo bewahren möchten, und jenen Staaten, die ihren Machtbereich zukünftig noch ausdehnen wollen. Der Redner verweist darauf, dass es die humanistische Moral gebiete, die Kolonialisierten hierbei einzubeziehen – in welcher genauen Angelegenheit bleibt jedoch offen. Autonomiezugeständnisse und Öffnung der Märkte unter europäischer Planungsgewalt – so der von Camus unterstütze Vorschlag – sollen die Antwort auf die hier dennoch durchscheinende und zu jener Zeit im gesellschaftlichen Klima Algeriens schon spürbare Krise des Kolonialismus sein. Wie im einleitenden Zitat zu sehen, benennt Camus im algerischen Rahmen zuvorderst die juristischen Fundamente des kolonialen Algerien als Auslöser dieser Krise. Der d¦cret R¦gnier, erlassen 1935 als Reaktion auf die immer lauter zu vernehmenden Proteste der sich formierenden Unabhängigkeitsbewegungen gegen die Ungerechtigkeiten des kolonialen Systems, verbot jegliche Kritik an der souverainet¦ franÅaise oder an der Form ihrer Durchsetzung bei Gefängnisstrafe.3 Der Code de l’indig¦nat, in Algerien im Jahre 1875 eingeführt, zementierte die vertikal ausgerichteten kolonialen Machtstrukturen durch die Festschreibung unterschiedlicher Rechtslagen für französischstämmige citoyens und algerische sujets in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. So wurden letztere nicht nur auf den bloßen Status kolonialer Untergebener reduziert, sondern zudem einem permanenten rechtlichen Ausnahmezustand unterworfen.4 Vor dem ersten Weltkrieg war der Widerstand gegen diese Form der kolonialen Herrschaft vor allem im ländlichen Raum angesiedelt. In den 20er Jahren verlagerte er sich – unter dem Druck der weltweiten Wirtschaftskrisen, die Algerien außergewöhnlich hart trafen und zu zunehmender Landflucht und Urbanisierung führten – in die städtischen Zentren. Dort wurde die Forderung nach mehr Gerechtigkeit und Unabhängigkeit von verschiedenen politischen Protagonisten formuliert. Die Kritik der Theologen der ulemas war in erster 2 Ebd. 3 Vgl. Julien, Charles Andr¦ / Ageron, Charles Robert: Histoire de l’Alg¦rie contemporaine, Paris: Presses Univ. de France 1979, S. 341. 4 Vgl. auch Le Cour Grandmaison, Olivier : De l’indig¦nat. Anatomie d’un »monstre« juridique: Le droit colonial en Alg¦rie et dans l’Empire franÅais, Paris: Zones 2010.
Camus im kolonialen Algerien der 30er Jahre: Misère de la Kabylie
143
Linie islamisch-arabisch motiviert. Ferhat Abbas und die Jeunes Alg¦riens forderten unter Berufung auf die Ideale der französischen Revolution gleiche Rechte für die algerischen indigÀnes ein. Die Bewegung des Êtoile nord-africaine unter der Führung von Messali Hadj schließlich trat am vehementesten für die Befreiung nicht nur Algeriens, sondern ganz Nordafrikas ein.5 Wie wir sehen, war Gedankengut, das eindeutig antikoloniale Stellung bezog, zu der Zeit, zu der Camus für den Alger R¦publicain seine Besprechung von Contre l’imp¦rialisme verfasste, in Algerien durchaus vorhanden. Warum also prägt es nicht auch diesen Artikel mit dem eigentlich vielsagenden Titel? An dieser Stelle empfiehlt sich ein kurzer Seitenblick auf Camus’ Biographie. 1939 ist er 25 Jahre alt. Er hat bereits kleine Auflagen seiner ersten Werke L’envers et l’endroit und Noces veröffentlicht, mit R¦volte dans les Asturies erste Schritte ins Theater gewagt und mit seiner Eröffnungsansprache in der Maison de la Culture über das Konzept der M¦diterran¦e ein Gründungsmanifest der Êcole d’Alger abgeliefert. Seit September 1938 arbeitet er bei der neugegründeten Zeitung seines Freundes Pascal Pia, dem Alger R¦publicain. In Frankreich ist die Front populaire, der sich der Alger R¦publicain und die Êcole d’Alger programmatisch verpflichtet fühlten, schon längst wieder auseinander gebrochen. Der Faschismus beherrscht Italien, Deutschland und jetzt auch Spanien, und Europa steht am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Diese spannungsgeladene Situation ist, wie bereits angedeutet, auch der exemplarisch zu lesende, zentrale Punkt in Contre l’imp¦rialisme. Der Text spiegelt damit einen Trend der Zeit wieder, der das Denken und Handeln der progressiven Linken des französischen Algeriens bestimmte. Exemplarisch hierfür steht die ideologische Entwicklung der kommunistischen Partei. Auch wenn Camus 1939 schon kein Mitglied mehr war, so blieb er doch von einer entscheidenden Wende im Bezug zur question coloniale nicht unbeeinflusst, »his political stance was in harmony with the politics of the Front Populaire and the PCA«6. Ena Vulor erklärt die zeitgenössische Verschiebung politischer Dringlichkeiten: The growing threat posed by Germany, Italy, and Spain would lead, however, to a sort of ›nationalization‹ of the Party, whereby issues not affecting the metropolis directly were relegated to secondary position. […] Algerian colonial problems which were initially at the forefront, would henceforth be regarded as ancillary to domestic problems. […] Clearly, then, the struggle against Fascism submerged colonial issues.7 5 Vgl. Stora, Benjamin: Histoire de l’Alg¦rie coloniale (1830 – 1954), Paris: La D¦couverte 2004, S. 50. 6 Vgl. auch Haddour, Azzedine: Colonial Myths. History and Narrative, Manchester : Manchester University Press 2000, S. 29. 7 Vulor, Ena: Colonial and anti-colonial discourses. Albert Camus and Algeria. An intertextual dialogue with Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, and Mohammed Dib, Lanham: Univ. Press of America 2000, S. 44.
144
Elmar Schmidt (Bonn)
Diese Verschiebung der Prioritäten im Angesicht des sich ausbreitenden Faschismus in Europa – weg von der Kritik am Kolonialismus, hin zum Kampf gegen den Faschismus – markiert auch den thematischen Fokus von Contre l’imp¦rialisme. Neben Beiträgen zu kulturellen und literarischen Themen verfasst Camus jedoch auch andere Artikel für den Alger R¦publicain, in denen er die koloniale Problematik deutlicher thematisiert und in komplexere Diskursschichten und -strukturen einschreibt. Einen dieser Texte wollen wir im Folgenden herausgreifen, um Camus’ Algeriendiskurs der ausklingenden 30er Jahre greifbar zu machen: MisÀre de la Kabylie. Veröffentlicht wurde die Reportage zwischen dem 5. und dem 15. Juni, in einer täglich fortgesetzten Kolumne. Vorausgegangen waren Recherchen und Feldstudien, in deren Verlauf Camus die im Osten Algiers gelegene Region der Kabylei mit dem Auto besuchte. Er wurde hierbei von lokalen Führen und Übersetzern begleitet, da er weder des Arabischen noch der lokalen Varianten des Berberischen mächtig war.8
Misère de la Kabylie I: Unmenschliche Armut und antike Größe Camus’ Bericht umfasst elf Teile, in denen er die erbärmlichen Lebensumstände der Bewohner der algerischen Kabylie beschreibt und diese zumeist auf verschiedene Aspekte des kolonialen Systems zurückführt. Im ersten, einleitenden Teil fasst er die im Weiteren zu behandelnden Teilbereiche der von ihm vorgefundenen Realität zusammen: La surpopulation, les salaires insultants, l’habitat mis¦rable, le manque d’eau et des communications, l’¦tat sanitaire et l’assistance insuffisante, l’enseignement au comptegouttes, tout cela contribue la d¦tresse du paysan et c’est tout cela que nous illustrerons.9
Camus gibt sich hierbei als Augen-Zeuge. Die auffällige Rekurrenz von Verben des Sehens und Betrachtens und die Verwendung von Fotos belegen diesen Anspruch. Er verleugnet somit nicht die Subjektivität seines Berichts und unterstreicht zugleich die Authentizität seiner vor Ort gewonnen Eindrücke. Diese formuliert er teilweise mit grotesk anmutender, hyperrealistischer Schärfe aus: Dans cette lumiÀre rare, ces odeurs animales et cette fum¦e qui prenait la gorge, jamais le visage de la misÀre ne m’avait paru plus d¦sesp¦rant. Je dois dire que je n’¦tais pas fier. Je n’avais pas envie de poser de questions. Mais j’ai pourtant demand¦ la plus jeune des 8 Vgl. etwa Todd, Olivier : Albert Camus. Une vie, Paris: Gallimard 1996. 9 Camus, Albert: »MisÀre de la Kabylie«, in: Camus, Albert: Fragments d’un combat 1938 – 1940. Alger r¦publicain. Le soir r¦publicain, Paris: Gallimard 1978, S. 281.
Camus im kolonialen Algerien der 30er Jahre: Misère de la Kabylie
145
femmes qui soutenait son ventre ¦norme de ses deux mains: »O¾ couchez vous?« Elle m’a r¦pondu: »L« en d¦signant mes pieds le sol nu, prÀs de la rigole d’urine.10
Er verleiht seiner Reportage Objektivität, indem er bemüht ist, die Impressionen der Feldstudie weitestgehend mit statistischen Fakten zu untermauern. So widmet er sich über ganze Passagen etwa der Aufzählung von regionalen Lohnunterschieden, unfairen Preisen für Agrarprodukte aus der Region oder überproportionierten Größen von Dorfschulklassen im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Camus macht für die Missstände, die grassierende Armut und den allgegenwärtigen Hunger vor allem die Kolonialverwaltung Algeriens verantwortlich. Er kritisiert ungerechte Gesetzgebungen, die im Code de l’indig¦nat festgeschriebene Ungleichbehandlung von colons und indigÀnes, das Fehlen von Hilfsmittel und den ineffizienten Einsatz der vorhandenen Ressourcen. Er beanstandet eine Politik, die einige wenige infrastrukturelle Prestigeobjekte bauen lässt, um nach außen den Erfolg der mission civilisatrice vorzuspiegeln, während der Rest der Region im Elend versinkt. Er vertieft seine Kritik, indem er Fälle aufzählt, in denen Hilfslieferungen politisch missbraucht werden, wenn Bedürftige, die kolonialismuskritische Ansichten vertreten, bewusst übergangen werden. Er wendet sich mit scharfen Worten gegen französische Siedler, die Profite maximieren, indem sie einheimische Arbeitskräfte ausbeuten und gegen Banken, die die Bevölkerung in einen cercle vicieux der Schuldnerschaft treiben. Ebenso geht er auf die Stereotypen kolonialer Rhetorik ein: […] je voudrais faire justice de certains arguments que nous connaissons bien en Alg¦rie et qui s’appuient sur la »mentalit¦« kabyle pour trouver des excuses la situation actuelle. […] Il est m¦prisable de dire que ce peuple s’adapte tout. M. Albert Lebrun lui-mÞme, si on lui donnait 200 francs par mois pour sa subsistance, s’adapterait la vie sous les ponts […]. Il est m¦prisable de dire que ce peuple n’a pas les mÞmes besoins que nous. […] Il est curieux de voir comment les qualit¦s d’un peuple peuvent servir justifier l’abaissement o¾ on le tient et comment la sobri¦t¦ proverbiale du paysan kabyle peut l¦gitimer la faim qui le ronge.11
Wie wir sehen, scheint Camus die Funktionsweisen kolonialer Machtstrukturen und ihre legitimierenden Mechanismen und Strategien sehr wohl zu erkennen und zu durchschauen. Die Bewohner der Kabylie selbst besetzt er in seinem Artikel mit äußerst positiven Attributen. Er potenziert das allgemeine Bild der Ungerechtigkeiten und findet in ihnen ein diskursives Gegenbild zu den kritisierten Praktiken der Kolonialverwaltung und der Siedler. Schon in den ersten Sätzen der Reportage 10 Ebd. S. 300. 11 Ebd. S. 294.
146
Elmar Schmidt (Bonn)
scheint dies durch. Camus nimmt den Leser scheinbar persönlich mit auf die Reise durch die Region und zieht einen einleitenden Vergleich mit dem antiken Griechenland: Qu’on aborde les premiers pentes de la Kabylie, voir ces petits villages group¦s autour de points naturels, ces hommes drap¦s de laine blanche, ces chemins bord¦s d’oliviers, de figuiers et de cactus, cette simplicit¦ enfin de la vie et du paysage comme cet accord entre l’homme et sa terre, on ne peut s’empÞcher de penser la GrÀce. Et si l’on songe ce que l’on sait du peuple kabyle, sa fiert¦, la vie de ces villages farouchement ind¦pendants, la constitution qu’ils se sont donn¦e (une des plus d¦mocratiques qui soit), leur juridiction enfin qui n’a jamais pr¦vu de peine de prison tant l’amour de ce peuple pour la libert¦ est grande, alors la ressemblance se fait plus fort et l’on comprend la sympathie instinctive qu’on peut vouer ces hommes.12
Misère de la Kabylie II: Einheit durch Assimilierung Camus beschreibt die Bewohner der Kabylei als freiheitsliebend, grundlegend demokratisch und gerecht. Darüber hinaus erscheinen sie ihm äußerst wissbegierig, friedfertig und als »un peuple dont l’adresse et l’esprit d’assimilation sont devenues proverbiaux«13. Er plädiert für eine Politik der Assimilierung durch Verständigung und betont, dass diese gewünscht werde: En tout cas, si l’on veut vraiment une assimilation, et que ce peuple si digne soit franÅais, il ne faut pas commencer par le s¦parer des FranÅais. Si je l’ai bien compris, c’est tout ce qu’il demande. Et mon sentiment, c’est qu’alors seulement la connaissance mutuelle commencera. Je dis »commencera« car, il faut bien le dire, elle n’a pas encore ¦t¦ faite et par l s’expliquent les erreurs de nos politiques.14
Auch wenn er die Auswüchse der Kolonialherrschaft kritisiert, so zweifelt er doch den Status Algeriens als Teil Frankreichs nie an. Er prangert Ungerechtigkeit an, führt diese aber darauf zurück, dass die Entscheidungsträger in Politik und kapitalistischer Wirtschaft vom rechten Pfad der zivilisatorischen Mission abgekommen seien. Als pied-noir stellt er seine eigene Anwesenheit im Land keineswegs in Frage. Armut und das Elend führt er zurück auf eine falsch betriebene Kolonialpolitik, aber auch auf die Rückständigkeit »[d’]un peuple qui vit avec trois siÀcles de retard«15. Auch hieraus resultiere die französische Pflicht der ›Zivilisierung‹, »pour le mieux-Þtre d’hommes dont, sans doute, nous
12 13 14 15
Ebd. S. 278. Ebd. S. 328. Ebd. S. 314. Ebd. S. 294.
Camus im kolonialen Algerien der 30er Jahre: Misère de la Kabylie
147
n’avons pas encore fait des FranÅais, mais qui nous demandons des sacrifices de FranÅais«16.
Widersprüche: Humanistische Moral und koloniale Assimilation Wie wir sehen, ist dieser journalistische Text Camus’ aus dem Jahre 1939 geprägt durch den Widerspruch zwischen Kritik am Kolonialismus einerseits und Affirmation der französischen Herrschaft über Algerien andererseits. Vulor führt diesen Gegensatz zurück auf den zivilisatorischen Anspruch des kolonialen Selbstverständnisses selbst, und zeigt, wie auch Camus und die Vertreter der Êcole d’Alger dessen integrales Paradox nicht auflösen konnten: l’Êcole d’Alger, strong French assimilation advocates subsuming both early indigenous elites and liberal pied-noir, ignores the contradictions inherent in the guiding principle of the French civilizing mission which reposes on a set of binary contradictions: imperialist/humanist; oppressive/egalitarian; and elitist/assimilating. The colonial venture, riding on the wings of capitalism, and therefore overexploitation of a majority by a minority, contradicts any humanist claims.17
Die sich in MisÀre de la Kabylie offenbarende Kluft zwischen der Kritik am kolonialen Projekt und der Bestätigung der Kerngedanken der mission civilisatrice entwickelt sich aus einem dem Konzept der assimilation zugrundeliegenden Gegensatz zwischen ideologischem Anspruch und realer Praxis. Sollten durch eine eurozentristisch definierte Assimilierung eigentlich die Werte der französischen Revolution, Fortschritt, Freiheit und Teilhabe an der europäischen Moderne in die Welt getragen werden, so wurde das Konzept in der kolonialen Realität zur rhetorischen Legitimierung von Unterdrückung, Ungleichheit und kolonialherrschaftlichen Privilegien. In Camus’ Text manifestiert sich zudem eine zeitgenössische Auseinandersetzung um die konzeptuelle Ausdefinierung der assimilation. Eine Assimilierungspolitik, wie Camus sie hier einfordert, bleibt zwar einem grundlegend kolonialen Gedanken verhaftet. Sie ist jedoch, wie Carroll belegt, gleichzeitig auch als offene Kritik an bestehenden Verhältnissen zu verstehen: In 1939, such a demand for assimilation and democratic rights for all Algerians was in fact more radical than Camus’ critics have generally acknowledged. In any case, there can be no doubt that the grand colons of Algeria realized that Camus represented an enemy to their interests and that effective assimilation of all French subjects in Algeria 16 Ebd. S. 327 f. 17 Vulor, Ena: Colonial and anti-colonial discourses. Albert Camus and Algeria. An intertextual dialogue with Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, and Mohammed Dib, Lanham: Univ. Press of America 2000, S. 36.
148
Elmar Schmidt (Bonn)
would bring the demise of colonialism and thus destroy their exorbitant privileges and the abusive economic and political power they exercised.18
Deutlich wird der prägende Gegensatz zwischen Camus’ kritischer Einstellung zur kolonialen Realität und in seinen letztlich doch in kolonialen Parametern operierenden Forderungen noch einmal in der folgenden Passage, aus dem abschließenden Teil von MisÀre de la Kabylie: Car, si la conquÞte coloniale pouvait jamais trouver une excuse, c’est dans la mesure o¾ elle aide les peuples conquis garder leur personnalit¦. Et si nous avons un devoir en ce pays, il est de permettre l’une des populations les plus fiÀres et les plus humaines en ce monde de rester fidÀle elle-mÞme et son destin. Le destin de ce peuple, je ne crois pas me tromper en disant qu’il est la fois de travailler et de contempler, et de donner par l des leÅons de sagesse aux conqu¦rants inquiets que nous sommes. Sachons du moins nous faire pardonner cette fiÀvre et ce besoin de pouvoir, si naturel aux m¦diocres, en prenant sur nous les charges et les besoins d’un peuple plus sage, pour le livrer tout entier sa grandeur profonde.19
Der nicht auflösbare Widerspruch zwischen imperialistischem und humanistischem Anspruch entwickelt sich hier eminent in der Frage algerischer arabischberberischer Identität. Deren authentischer Ausdruck soll gerade durch das koloniale Projekt bewahrt und sogar gefördert werden. Die per se vertikal ausgerichteten Machtstrukturen kolonialer Dominanz sollen auf einer moralischen Ebene gleichsam umgekehrt werden, wenn der Kolonialisierte, der sich durch seine innere Größe auszeichnet, dem Kolonialherren des leÅons de sagesse erteilt. Den moralisch überhöhten kolonialen ›Anderen‹ verankert Camus vor allem in der essentialisierenden Zusammenführung einer imaginierten Identität des sujet indigÀne und dem als besonders ursprünglich erfahrenen algerischen Naturraum. Deutlich wird dies etwa im folgenden Beispiel: Devant cet immense paysage o¾ la lumiÀre du matin bondissait, au-dessus de ce trou vertigineux o¾ les arbres paraissaient des bu¦es et dont la terre fumait sous le soleil, je comprenais quel lien pouvait unir ces hommes entre eux et quel accord les liait leur terre. Je comprenais aussi combien peu leur et ¦t¦ n¦cessaire pour vivre aussi en accord avec eux-mÞmes. Et comment, alors, n’aurais-je pas compris ce d¦sir d’administrer leur vie et cet app¦tit de devenir enfin ce qu’ils sont profond¦ment: des hommes courageux et conscients chez qui nous pourrons sans fausse honte prendre des leÅons de grandeur et de justice.20
18 Carroll, David: Albert Camus, the Algerian. Colonialism, Terrorism, Justice, New York: Columbia Univ. Press 2007, S. 135. 19 Camus, Albert: »MisÀre de la Kabylie«, in: Camus, Albert: Fragments d’un combat 1938 – 1940. Alger r¦publicain. Le soir r¦publicain, Paris: Gallimard 1978, S. 335 f. 20 Ebd. S. 324.
Camus im kolonialen Algerien der 30er Jahre: Misère de la Kabylie
149
Trotz der moralischen Überhöhung dient hier die essentialistische Darstellungsweise, im Sinne der Ausdefinierung des kolonialen ›Anderen‹ durch die Zuschreibung einer homogenisierten kollektiven Identität21, der Konstruktion eines kulturell unterlegenen kolonialen sujets. Dieses kann von der Übernahme europäischer Werte und Normen nur profitieren. Humanistisches Sendungsbewusstsein, »tendaciously molded on the discourse of the ›Enlightenment‹ of the 18th century, resulting from the contact of populations that were considered primitive and uncultured and the European civilizing conquistadores«22, trifft auf den naturverbundenen edlen Wilden. Letzterer dient in bester Tradition Rousseaus zur Kritik an den eigenen gesellschaftlichen Verhältnissen und rechtfertigt gleichzeitig die mission civilisatrice. Französischer Fortschritt und vermeintliche algerische Ursprünglichkeit sollen sich – unter französischer Führung – ergänzen. So sehr Camus auch um Kritik an der algerischen Realität bemüht ist, so sehr er auch die institutionalisierte Ungleichheit anprangert – von den grundlegenden Parametern der mission civilisatrice scheint er sich nicht lösen zu können. Schon in den 70er Jahren formulierte Conor Cruise O’Brien den Vorwurf, Camus’ Werk bezeuge den typischen halluzinierenden Realitätsverlust des linksliberalen pied-noir: […] as his articles in MisÀre en Kabylie [sic!] and elsewhere show, he was honorably insistent that France in Algeria should live up to her professions, and this insistence more than once got him into trouble. The point is rather that in the position of the leftwing colonist there are usually strong elements of estrangement, unreality, and even hallucination.23
Miteinander verschmolzen werden die einander eigentlich widersprechenden Elemente von freiheitlichen Werten und kolonialer Ideologie laut O’Brien in der – anerzogenen – mythischen Verklärung der französischen Präsenz in Algerien: »The splendid rationalist system of education which molded Camus was propagating, in relation to his own social context, a myth: that of French Algeria.«24 Wie wir gesehen haben, bestätigt und rechtfertigt Camus in MisÀre de la Kabylie durchaus die französische Präsenz in Algerien. Im Folgenden wird jedoch zu klären sein, ob er sich damit in seiner Reportage tatsächlich unhinterfragt in die Kontinuität des Mythos vom organisch französischen Algerien stellt – schließlich war dieser doch der Grundpfeiler jenes Systems kolonialer 21 Vgl. etwa Ashcroft, Bill / Griffiths, Gareth / Tiffin, Helen: Post-Colonial Studies. The Key Concepts, London: Routledge 2007, S. 74. 22 Kassoul, Acha / Maougal, Mohamed-Lakhdar : The Algerian destiny of Albert Camus, Bethesda: Academica Press 2006, S. 162. 23 O’Brien, Conor Cruise: Albert Camus of Europe and Africa, New York: Viking Press 1970, S. 10 f. 24 Ebda.
150
Elmar Schmidt (Bonn)
Machtausübung, das Camus gleichzeitig auch so vehement hinterfragte25. Auf diese Weise wird zu beleuchten sein, in welchen größeren Zusammenhängen Camus’ Algeriendiskurs in MisÀre de la Kabylie zu verorten ist. Mythische Interpretationen der kolonialen Realität im Widerstreit: Latinit¦ vs. M¦diterran¦e Versteht man den myth of French Algeria, den O’Brien beklagt, als eine die Realität mythisch ausdeutende koloniale Legitimierungsstrategie, so lässt sich diese vor allem in den Werken der Alg¦rianistes um Schriftsteller wie Robert Randau und Louis Bertrand wiederfinden. Im Zentrum dieses Diskurses stand die Latinit¦, mit deren Hilfe die koloniale Aneignung Algeriens zur Rückeroberung eines Frankreich zustehenden römischen Erbes umgedeutet wurde. Die nordafrikanische Realität wurde diesem Grundgedanken angepasst. Arabischberberische Traditionen und Geschichte mussten ebenso negiert werden wie die einheimische Bevölkerung selbst26. So besteht das paradiesisch-jungfräuliche Algerien eines Bertrand vor allem aus Sonne, Früchten und Zeugnissen römischer Vergangenheit, und wird als Symbol europäischer Stärke in lateinischer Tradition interpretiert: Pays du soleil et de la plus pure lumiÀre! Nourrice de bl¦s et de raisins, terres des marbres et des essences pr¦cieuses, mÀre des statues et des temples, qui trúnes dans la pompe de tes colonnes et de tes arcs de triomphe, de quels bienfaits ne te suis-je point revendable! […] Tu rattachas ma pens¦e ¦gar¦e au solide appui de la tradition, en ¦talant sous mes yeux la majest¦ de tes ruines, en me jetant parmi des peuples venus de tous les bords de la M¦diterran¦e maternelle, et dont la conscience est sœur de la mienne… Ah! puissent-ils, en se retrouvant sur ton sol, reprendre avec ferveur le sentiment invincible de la fraternit¦ qui les unit jadis! Puisse cette mer, o¾ je suis, redevenir, comme au temps de Rome la Grande, la fois le symbole et le chemin de l’Alliance entre les nations latines! … Mare nostrum! Qu’elle soit notre mer tout jamais!27
Der vorgefundene Raum scheint menschenleer und dient der Projektion eines Besitzanspruchs, der mit imperialem Gestus als historische Verpflichtung inszeniert wird. Das koloniale Projekt Frankreichs erscheint als legitime Wiederaneignung eines verloren gegangenen, ureigenen Territoriums. Eventuelle Ansprüche der nordafrikanischen Bevölkerung werden erst gar nicht in Erwägung gezogen, genauso wie deren Präsenz selbst vernachlässigt wird. Als 25 Carroll äußert die gleichen Zweifel an O’Briens These mit Bezug auf Camus’ Romanwerk, in: Carroll, David: »Camus’s Algeria: Birthrights, Colonial Injustice, and the Fiction of a FrenchAlgerian People«, MLN, Vol. 112, No. 4, (Sep., 1997), S. 522. 26 Vgl etwa Vulor, Ena: Colonial and anti-colonial discourses. Albert Camus and Algeria. An intertextual dialogue with Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, and Mohammed Dib, Lanham: Univ. Press of America 2000, S. XV. 27 Bertrand, Louis: Le livre de la M¦diterran¦e, Paris: Plon-Nourrit 1923, S. 330 f.
Camus im kolonialen Algerien der 30er Jahre: Misère de la Kabylie
151
Herzstück des kolonialen Projekts wird die natürliche Vorherrschaft Europas im Mittelmeerraum definiert – »die culture m¦diterran¦enne wird […] synonym mit der culture latine gesetzt«.28 Die Semantisierung des Mittelmeers als besonderem Kulturraum und die damit verbundene Suche nach neuen Möglichkeiten der Verortung des kolonialen Algeriens ist auch Teil der zeitgenössischen Überlegungen Camus’. Wir kommen hier wieder zurück auf die Êcole d’Alger : Politisch links stehend und zumeist, wie auch Camus, den unteren Gesellschaftsschichten der pieds-noirs entstammend, entwickelt diese lose Gruppe junger Literaten um den Vordenker Gabriel Audisio das Konzept der M¦diterran¦e. Dieses lässt sich auch und gerade als Gegenentwurf zu eben jenem auf vermeintliche römische Wurzeln zurückgreifenden myth of French Algeria der Alg¦rianistes verstehen, dessen Proliferation O’Brien eigentlich Camus unterstellt. Die M¦diterran¦e der Êcole d’Alger versteht sich als – durchaus utopisch gedachter – Versuch, eine im Mittelmeerraum zentrierte, neue Identität zu entwerfen, die nationale Grenzen überschreitet. In diesem Sinne propagiert Camus in La culture indigÀne. La nouvelle culture m¦diterran¦enne ein humanistisches Wertesystem der menschlichen Solidarität, das die Kulturen der Region im harmonischen Miteinander zu einen vermag: Nous n’avons qu’ ouvrir les yeux pour avoir conscience de notre tche: faire entendre que la culture ne se comprend que mise au service de la vie, que l’esprit peut ne pas Þtre l’ennemi de l’homme. De mÞme que le soleil m¦diterran¦en est le mÞme pour tous les hommes, l’effort de l’intelligence humaine doit Þtre un patrimoine commun et non une source de conflits et de meurtres.29
In seinem Eröffnungsvortrag für die Maison de la Culture formuliert Camus im Februar 1937 sein Konzept der M¦diterran¦e explizit im polemisierenden Gegensatz zur Latinit¦: »Toute l’erreur vient de ce qu’on confond M¦diterran¦e et Latinit¦ et qu’on place Rome ce qui commenÅa dans AthÀnes.«30 Er widerspricht einer […] M¦diterran¦e abstraite et conventionnelle que figurent Rome et les Romains. Ce peuple d’imitateurs sans imagination imagina pourtant de remplacer le g¦nie artistique et le sens de la vie qui leur manquent par le g¦nie guerrier. […] Et ce n’est mÞme pas le
28 Richter, Elke: »(Kultur)Theorien des Mittelmeers«, in: Arend, Elisabeth / Richter, Elke / Sollte-Gresser, Christiane (Hrsg.): Mittelmeerdiskurse in Literatur und Film. La M¦diterran¦e: repr¦sentations litt¦raires et cin¦matographiques, Frankfurt a.M.: Lang 2010, S. 302. 29 Camus, Albert: »La culture indigÀne. La nouvelle culture m¦diterran¦enne«, in: Camus, Albert: Essais, Paris: Gallimard 1965, S. 1327. 30 Ebd. S. 1321.
152
Elmar Schmidt (Bonn)
g¦nie essentiel de la GrÀce qu’ils imitÀrent, mais les fruits de sa d¦cadence et de ces erreurs.31
Erinnern wir uns an die einleitende Passage aus MisÀre de la Kabylie. Camus setzt hier Landschaft, Bevölkerung und Kultur der Region in Bezug zum antiken Griechenland. Er hebt in diesem Zusammenhang insbesondere die Freiheitsliebe, die basisdemokratische Tradition und das friedliche Zusammenleben der Kabylen hervor. Der zunächst seltsam anmutende Vergleich der scheinbar ›antiken‹ Vorzüge der Kabylen gewinnt vor dem Referenzhintergrund der M¦diterran¦e neue Bedeutungen. Gabriel Audisio, sein Mitstreiter in der Êcole d’Alger, wollte u. a. mit der Betonung des griechischen Erbes ein Argument gegen die Latinit¦ der kolonialen Ideologie formulieren, die Besitzansprüche in Nordafrika aus einem vermeintlichen römischen Erbe ableitete. Die Referenz auf das antike Griechenland in MisÀre de la Kabylie knüpft an Audisios Auslegung an. Camus bringt entsprechend dem Diskurs der M¦diterran¦e das symbolische Kapital der griechischen Antike gegen die römischen Traditionen der Latinit¦ in Stellung. Die realen Bewohner der Kabylei werden symbolisch der algerischen Realität enthoben und im Bereich des mythisch überhöhten »g¦nie m¦diterran¦en«32 verortet. Camus spiegelt in ihnen das antike Griechenland und integriert sie in sein Projekt der M¦diterran¦e. Zugleich kann er dieses hiermit im Rückschluss bestätigen. Die Hervorhebung der Ursprünglichkeit, Friedfertigkeit, moralischen Größe und demokratischen Tradition, die Camus in den Bewohnern der Kabylei erkennen will, aber auch das fortlaufende Plädoyer für eine Politik der Versöhnung, der main fraternelle qu’il faut tendre, kann man vor diesem Hintergrund als argumentative Versatzstücke der M¦diterran¦e sehen. Auch die essentialisierende Verbindung von imaginierter indigener Identität und algerischer ›mediterraner‹ Natur entspricht der Rhetorik der Êcole d’Alger, »de sourires, de soleil et de mer«33. »Appropriating the old Romantic dichotomy nature/culture, Camus privileges ›nature‹ over ›culture‹, and using it (nature) as synonymous to the new ›Mediterranean humanism‹, ›la vraie culture‹.«34 Wie wir sehen, greift Camus sowohl in MisÀre de la Kabylie wie auch in den Ausführungen zur M¦diterran¦e zur Ausdeutung der Realität auf mythische Elemente zurück. In seinem Vortrag La culture indigÀne. La nouvelle culture m¦diterran¦enne setzt er dem Mythos vom naturgegeben französischen Alge-
31 32 33 34
Ebd. S. 1324. Edb. S. 1325. Ebd. S. 1326. Vulor, Ena: Colonial and anti-colonial discourses. Albert Camus and Algeria. An intertextual dialogue with Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, and Mohammed Dib, Lanham: Univ. Press of America 2000, S. 41.
Camus im kolonialen Algerien der 30er Jahre: Misère de la Kabylie
153
rien eine neue, ebenfalls mythisch ausgedeutete Option entgegen. Edwige Talbayev bestimmt diese im Rahmen der Êcole d’Alger wie folgt: […] their vision of the colonial situation […] goes beyond the dominant discursive framing of French colonial society and opens new spaces for identification – that of a mythical pan-Mediterranean identity that, in a humanist fashion, would transcend national and religious divisions.»35
Dass dieser mediterrane Humanismus europäisch dominiert bleibt, die Assimilierung der kolonialisierten Algerier als positiv besetztes Ziel festgeschrieben wird, und Camus die Brille des im kolonialen System sozialisierten pied-noir letztendlich nicht ablegen kann, bleibt jedoch unumstritten. Das Problem scheint hierbei vor allem eines der Kontexte, der Adressaten und der dementsprechend genutzten Codes zu sein. Das Konzept der M¦diterran¦e wird bei dem beschriebenen ›Widerstreit der Mythen‹ um die Deutungshoheit der algerischen Realität nicht unbedingt gegen die Grundprinzipien des Kolonialismus in Stellung gebracht. Vielmehr richtet es sich gegen Kapitalismus, Nationalismus, Konservatismus und Faschismus. Camus schreibt nicht für antikoloniale Freiheitskämpfer, sondern gegen die konservativ-kapitalistische Elite des französischen Algeriens und unter dem Eindruck des sich ankündigenden Zweiten Weltkrieges. Und so steht auch in La culture indigÀne. La nouvelle culture m¦diterran¦enne die Absage an die aggressive Politik der deutschen, italienischen und spanischen Faschisten im Vordergrund, die – so Camus – dem kriegerischen Geist der kolonialen Latinit¦ entspreche. Die einheimische Bevölkerung wird stets im Zusammenhang mit der »rencontre unique dans l’histoire et la geographie n¦e entre l’Orient et l’Occident«36 thematisiert und verbleibt somit in letzter Konsequenz als bloßes Pendant zur europäischen Präsenz. In MisÀre de la Kabylie rückt die einheimische Bevölkerung – der Thematik der Reportage entsprechend – wieder in den Vordergrund. Der mediterrane Mythos bestimmt jedoch als Filter die Wahrnehmung und Deutung des kolonialen Algerien. Er wird in MisÀre de la Kabylie zum Katalysator der Wiederaneignung einer dem pied-noir der 30er Jahre scheinbar entgleitenden algerischen Realität, in »a space where myth and reality coalesce«37. Der algerische Literaturwissenschaftler Mohamed Maougal erkennt in Camus’ Werk eine »confrontation 35 Talbayev, Edwige: »Between nostalgia and desire: l’Ecole d’Alger’s transnational identifications and the case for a Mediterranean relation«, in: International Journal of Francophone Studies 10: 3 (2007), S. 364. 36 Camus, Albert: »La culture indigÀne. La nouvelle culture m¦diterran¦enne«, in: Camus, Albert: Essais, Paris: Gallimard 1965, S. 1325. 37 Vulor, Ena: Colonial and anti-colonial discourses. Albert Camus and Algeria. An intertextual dialogue with Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, and Mohammed Dib, Lanham: Univ. Press of America 2000, S. 34.
154
Elmar Schmidt (Bonn)
plus ou moins ouverte, plus ou moins manifeste entre l’histoire et le mythe«38. In deren Verlauf entscheidet sich der Autor für den Mythos, da ihm die Geschichte »trop cruelle et trop turbulente, destructive de toute humanit¦, r¦ductrice de tout humanisme«39 erscheint.
Fazit: Camus auf der Suche nach der französisch-algerischen Identität Der postkoloniale Vorwurf der Perpetuierung kolonialer Ideologie, so wie er sich etwa im folgenden Kommentar von Edward Said zu Camus’ Romanwerk manifestiert, lässt sich letztlich nicht von der Hand weisen: What I want to do is to see Camus’ fiction as an element in France’s methodically constructed political geography of Algeria, which took many generations to complete, the better to see it as providing an arresting account of the political and interpretive contest to represent, inhabit, and possess the territory itself […]. Camus’ writing is informed by an extraordinary belated, in some ways incapacitated colonial sensibility, which enacts an imperial gesture […].40
Allerdings erscheint es nun so, als wäre Camus’ unkritische Haltung gegenüber den grundlegenden Parametern des Kolonialismus nicht als bewusster Akt der Herrschaftslegitimierung zu verstehen – was Said im Übrigen auch nicht direkt unterstellt. Vielmehr erscheint sie als Nebenprodukt der eigentlichen Suche nach einer mythisch verklärten Utopie, der »M¦diterran¦e devenue une patrie mythique«41. In diesem Sinne wären die Widersprüche in MisÀre de la Kabylie darauf zurückzuführen, dass Camus, obwohl er sich als Augenzeuge gibt, die koloniale Realität dennoch nicht richtig sehen kann. Vielmehr verweigert er sich dieser Realität und schafft sich im Kampf um die nicht mehr adäquat zu verortende, bröckelnde Identität des pied noir seinen eigenen Filter. Die mythisch fundierte Interpretation wird zum Versuch, die Widersprüche zwischen der Kritik an der Umsetzung des kolonialen Projekts und der Affirmation des Grundgedankens der mission civilisatrice zu nivellieren oder zumindest zu überblenden.42 Je ursprünglicher, naturverbundener, basisdemokratischer und 38 Maougal, Mohamed Lakhdar : »Discours et symboles. 1936 – 1959«, in: Maougal, Mohamed Lakhdar (Hrsg.): Albert Camus. Assassinat post-mortem, Alger : Apic 2004, S. 22. 39 Ebd. 40 Said, Edward: Culture and Imperialism, New York: Vintage 1994, S. 176. 41 L¦vi-Valensi, Jaqueline: »La M¦diterran¦e d’Albert Camus: une mythologie du r¦el«, in: Carmignani, Paul (Hrsg.): Rythmes et lumiÀres de la M¦diterran¦e, Perpignan: Presses Univ. de Perpignan 2003, S. 275. 42 Vgl. Haddour, Azzedine: Colonial Myths. History and Narrative, Manchester : Manchester University Press 2000, S. 33.
Camus im kolonialen Algerien der 30er Jahre: Misère de la Kabylie
155
›edler‹ Camus die ›wilden‹ Kabylen imaginiert43, desto besser lassen sie sich unter sein Konzept der transzendenten mediterranen vrai culture subsumieren – und desto weniger verweisen sie auf eine eventuelle, grundlegende Deplatziertheit der pied-noirs in Algerien. Denn letztlich geht es in Camus’ Reportage nicht nur um die Offenlegung von Armut und Unterdrückung der Bevölkerung der Kabylei. Es geht vielmehr auch um die Verortung des eigenen Selbst im zeitgenössischen Algerien. Im Angesicht der ersten Zeichen von antikolonialem Widerstand und algerischem Nationalismus lässt sich das Konzept der M¦diterran¦e, gerade mit seiner sehnsüchtigen Utopie von Grenzüberschreitung und menschlicher Solidarität, als Ausdruck von identitärer Selbstentfremdung definieren. In der mythischen Überhöhung der Kabylen offenbart sich eine »fundamental relation to difference and otherness that is, at the same time, an integral part of a self that remains in large part a stranger to itself«44. Mit Camus erleben wir in MisÀre de la Kabylie den pied-noir, der zu spüren beginnt, dass der Verlauf der Geschichte seiner Präsenz in Algerien langsam die Legitimation entzieht. Aus dem Versuch der Bestimmung einer eigenen algerischen Identität erwächst auch die M¦diterran¦e. Gleichzeitig zeugt diese von der zeitgenössischen Suche nach Möglichkeiten, sich in ein konstruktives Verhältnis zu den arabisch-berberischen ›Anderen‹ zu setzen, ebenso wie vom Scheitern dieser Suche und dem konsequenten Ausweichen in die Bereiche der mythisch verklärten Utopie.
Bibliographie Ashcroft, Bill / Griffiths, Gareth / Tiffin, Helen: Post-Colonial Studies. The Key Concepts, London: Routledge 2007. Bertrand, Louis: Le livre de la M¦diterran¦e, Paris: Plon-Nourrit 1923. Camus, Albert: »Contre l’imp¦rialisme. Une conf¦rence de M. R.-E. Charlier«, in: Camus, Albert: Œuvres complÀtes I (1931 – 1944), Paris: Gallimard 2006. Camus, Albert: »La culture indigÀne. La nouvelle culture m¦diterran¦enne«, in: Camus, Albert: Essais, Paris: Gallimard 1965.
43 Hier entspricht Camus im Übrigen einer weiteren Konstante der französischen kolonialen Imagination. Diese überhöhte die berberstämmigen Bevölkerungsteile Nordafrikas positiv, so wie die arabischen Bevölkerungsteile tendenziell mit negativen Attributen belegt wurden. Im Rahmen der zeitgenössischen Kolonialpolitik diente dies auch der Legitimierung von Herrschaftsausübung im Sinne des klassischen divide et impera. Vgl. etwa Lorcin, Patricia: Imperial Identities: Stereotyping, Prejudice and Race in Colonial Algeria, London: Tauris 1995. 44 Carroll, David: Albert Camus, the Algerian. Colonialism, Terrorism, Justice, New York: Columbia Univ. Press 2007, p. 8.
156
Elmar Schmidt (Bonn)
Camus, Albert: »MisÀre de la Kabylie«, in: Camus, Albert: Fragments d’un combat 1938 – 1940. Alger r¦publicain. Le soir r¦publicain, Paris: Gallimard 1978. Carroll, David: Albert Camus, the Algerian. Colonialism, Terrorism, Justice, New York: Columbia Univ. Press 2007. Carroll, David: »Camus’s Algeria: Birthrights, Colonial Injustice, and the Fiction of a French-Algerian People«, MLN, Vol. 112, No. 4, (Sep., 1997). Haddour, Azzedine: Colonial Myths. History and Narrative, Manchester : Manchester University Press 2000. Julien, Charles Andr¦ / Ageron, Charles Robert: Histoire de l’Alg¦rie contemporaine, Paris: Presses Univ. de France 1979. Kassoul, Acha / Maougal, Mohamed-Lakhdar : The Algerian destiny of Albert Camus, Bethesda: Academica Press 2006. Le Cour Grandmaison, Olivier : De l’indig¦nat. Anatomie d’un »monstre« juridique: Le droit colonial en Alg¦rie et dans l’Empire franÅais, Paris: Zones 2010. L¦vi-Valensi, Jaqueline: »La M¦diterran¦e d’Albert Camus: une mythologie du r¦el«, in: Carmignani, Paul (Hrsg.): Rythmes et lumiÀres de la M¦diterran¦e, Perpignan: Presses Univ. de Perpignan 2003. Lorcin, Patricia: Imperial Identities: Stereotyping, Prejudice and Race in Colonial Algeria, London: Tauris 1995. Maougal, Mohamed Lakhdar : »Discours et symboles. 1936 – 1959«, in: Maougal, Mohamed Lakhdar (Hrsg.): Albert Camus. Assassinat post-mortem, Alger : Apic 2004. O’Brien, Conor Cruise: Albert Camus of Europe and Africa, New York: Viking Press 1970. Richter, Elke: »(Kultur)Theorien des Mittelmeers«, in: Arend, Elisabeth / Richter, Elke / Sollte-Gresser, Christiane (Hrsg.): Mittelmeerdiskurse in Literatur und Film. La M¦diterran¦e: repr¦sentations litt¦raires et cin¦matographiques, Frankfurt a.M.: Lang 2010. Said, Edward: Culture and Imperialism, New York: Vintage 1994. Stora, Benjamin: Histoire de l’Alg¦rie coloniale (1830 – 1954), Paris: La D¦couverte 2004. Talbayev, Edwige: »Between nostalgia and desire: l’Ecole d’Alger’s transnational identifications and the case for a Mediterranean relation«, in: International Journal of Francophone Studies 10: 3 (2007). Todd, Olivier : Albert Camus. Une vie, Paris: Gallimard 1996. Vulor, Ena: Colonial and anti-colonial discourses. Albert Camus and Algeria. An intertextual dialogue with Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, and Mohammed Dib, Lanham: Univ. Press of America 2000.
Knut Wenzel (Frankfurt am Main)
Verteidigung des Relativen. Albert Camus und das Christentum
1.
Einleitung
Zuschreibungen und Unterscheidungen sind stets anfechtbar. Albert Camus hat zu Lebzeiten und sein Werk wirkungsgeschichtlich unter beidem gelitten – so etwa in der von L’homme r¦volt¦ 1951 ausgelösten Auseinandersetzung mit dem Kreis um Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, aber auch sein Werk, nämlich unter dem Etikett des Existentialismus.1 Und dennoch kommt man ohne Zuschreibungen und Unterscheidungen nicht aus, soll ein Werk, also ein komplexes und mit Autorschaft behaftetes Bedeutungsgewebe, zum Sprechen gebracht werden können. Im besten Fall sind solche Zuschreibungen und Unterscheidungen als Eingriffe in das Werk zu verstehen, die das Werk selbst herausfordert – wenn auch vielleicht nicht legitimiert. Das Interpretieren ist also keine harmlos-harmonische Werkpflege, sondern fügt ihm, wenn sie gelingt, etwas zu, verletzt und bereichert es zugleich. Hierin verbirgt sich wenigstens der Kern einer Ethik des Interpretierens. Wenn ich Camus als Theologe zu lesen versuche, liegt die Gefahr einer mehr verletzenden als bereichernden Interpretation nahe. Denn Camus hat die Bedeutungsansprüche, für die das Christentum steht, zurückgewiesen.2 Ein erster Ankerpunkt für einen theologischen Eingriff in das Werk Camus’ 1 »Ich betrachte mich ganz und gar nicht als einen ›Existentialisten’«. So Camus 1943 in einem Brief an Jean Grenier, zitiert nach: Martina Yadel, L’homme r¦volt¦ – eine Einführung, in: Brigitte Sändig/Rainer Graupner (Hg.), Ich revoltiere, also sind wir. Albert Camus – 40 Jahre »Der Mensch in der Revolte«, Berlin 1991 (Stephanus-Stiftung Berlin-Weißensee), S. 1 – 19, hier: S. 5. 2 Die Literatur zu Albert Camus’ Verhältnis zum Christentum ist umfangreich. Deswegen wird nicht damit zu rechnen sein, dass ich hier noch irgendetwas Neues beitragen kann. Exemplarisch seien die folgenden Titel genannt: Sabine Dramm/Hermann Düringer (Hg.), Albert Camus und die Christen. Eine Provokation, Frankfurt 2002 (= Arnoldshainer Texte 117); Heinz Robert Schlette, »Griechen und Christen« bei S. Weil und A. Camus, in: Orientierung 69 (2005), S. 149 – 152; Carole Auroy, Art.: Christianisme, in: Dictionnaire Camus, Paris 2009, S. 139 – 142.
158
Knut Wenzel (Frankfurt am Main)
scheint nun darin zu liegen, daß diese Zurückweisung von unterschiedlicher Schärfe ist, ja sogar in der sanften Form einer Einladung zum Gespräch, zur Kooperation erscheinen kann: eine Einladung als Antwort auf eine Einladung, nämlich zu einem Vortrag im Dominikanerkloster von Latour-Maubourg im Jahr 1948.3 Wir werden diese unterschiedlichen Intensitäten der Zurückweisung des Christentums durch Albert Camus exemplarisch zu untersuchen haben. Doch möchte ich das nicht tun, ohne den Deutungsrahmen anzugeben, der meine Überlegungen leitet. Diesen versuche ich im Aussagekern des Werks von Camus selbst zu verankern – durch eine Zuschreibung. Damit sind alle eingangs angedeuteten Fragen und Gefahren im Spiel, vermehrt um die Vermessenheit, so etwas wie den Bedeutungskern eines Werks identifizieren zu wollen.4
2.
Licht und Erde
Ohne nun die Zeit und den Raum für eine philologische Absicherung meiner Zuschreibung zu haben, sei sie hier ungeschützt genannt und zum Ausgangspunkt der weiteren Differenzierungen genommen: Im Zentrum des Werks von Albert Camus, an seinem Ursprung, steht nicht eine Negation, nicht ein Aufbegehren, sondern eine buchstäblich elementare Affirmation, ein »Überschuß an Bejahung«5 : nämlich die wohl lebensgeschichtlich verankerte, aber begrifflich-theoretisch nicht weiter aufschlüsselbare Affirmation des Lichts und der Erde. Ich sehe davon ab, das naturgemäß reiche Füllhorn der religiös-politischen Metaphorik dieser Grundworte hier auszuschütten – nicht zuletzt deswegen, weil eine solche barocke Anakreontik Camus nicht gerecht werden würde. Licht und Erde mögen hier einfach für die Grundelemente einer Lebens-Welt stehen, die Camus bewohnt hat, aus der seine literarischen, philosophischen und politischen Entwürfe und Hoffnungen ihre anamnetische Substanz ziehen, die unter der Chiffre des Mittelmeerischen firmiert6 und die schließlich auch den Erfahrungs- und Überzeugungsgrund seiner Zurückweisung des Christentums bildet. 3 Vgl. Albert Camus, Der Ungläubige und die Christen, in: Ders., Fragen der Zeit, Reinbek 1997, S. 65 – 70. 4 Die Überlegungen dieses Beitrags beziehen sich vor allem auf die Pest, auf L’homme r¦volt¦ sowie auf den 1948 vor Dominikanern gehaltenen Vortrag. Vgl. aber zu einer eingehenden theologischen Auseinandersetzung mit La Chute: Knut Wenzel, Schuld und Wahn. Theologische Bemerkungen zu Albert Camus’ La Chute, in: Heinz Robert Schlette (Red.), Absturz und Zwielicht. 50 Jahre »La Chute« von Albert Camus, Bensberg 2008 (= Bensberger Protokolle 109), S. 96 – 110. 5 Heinz Robert Schlette, Albert Camus heute, in: Ders., Aporie und Glaube. Schriften zur Philosophie und Theologie, München 1970, S. 79 – 101, hier : S. 89. 6 Vgl. hierzu etwa die Ausführungen zum mittelmeerischen Denken in L’homme r¦volt¦: Der Mensch in der Revolte, Reinbek 1969, S. 241 – 244.
Verteidigung des Relativen. Albert Camus und das Christentum
159
Die Welt aus Licht und Erde ist, um gleich einem Missverständnis entgegen zu wirken, keine menschenleere oder menschenferne Welt. Die leeren, höchstens statuarisch dekorierten Piazzen und Campi Giorgio De Chiricos stellen eine ganz andere Ikonisierung des Mittelmeerischen dar. Camus ist solcher und jeder metaphysischen Monumentalisierung der Lebenswelt ausdrücklich abholt. Seine Welt aus Licht und Erde sei vielmehr jene Welt, die den Menschen kennt, ihn unmittelbar trägt und umgibt – wie eben nur der wirkliche Boden trägt und die lichtdurchflutete und erwärmte Luft umfängt. Licht und Erde stehen für eine unverborgene und nichts verbergende, oder jedenfalls zugängliche Konkretheit. Die Affirmation am Grund seines Denkens ist also kein nietzscheanischer Vitalismus, sondern eine nüchterne Freude an der Konkretheit. Diese Affirmation erlaubt es ihm, niemals seine Herkunft aus ärmsten Verhältnissen, hart am Rand des Existenzminimums, und niemals seine illiterate Mutter vergessen und verraten zu können, sondern im Gegenteil am Ende seines vor der Zeit abreißenden Werks und Lebens zu dieser Herkunft und zur Gestalt der Mutter zurückzukehren, wie zu einem Neueinsetzen seines Schreibens.7 Diese konkrete Lebendigkeit, die wie gesagt kein naturhafter Vitalismus ist, sondern das Leben der einfachen Leute meint, bleibt der lebensgeschichtliche Bezeugungskern so mancher späteren Theoriebildungen, politischen Interventionen und eben auch seiner Haltung zum Christentum und zur Religion allgemein. Bewohnt und erfahren hat Camus diese Welt von Licht und Erde aus der Perspektive eines Jungen, der in der kleinbürgerlichen bis subproletarischen Kultur eines Stadtrandbezirks aufwächst. Seiner Erinnerung daran bleibt das Wissen um die Bedrohtheit dieser Kultur eingeprägt.8 So sehr sie auch in sich ihre Widersprüche und Grobheiten, ihr Verletzungspotential haben mag; es lebt sich in dieser prekären Welt unter der permanenten Drohung vor allem ökonomischer Zerstörung. Wie unvollkommen diese Welt in sich sein mag – sie hat ein Recht darauf, nicht von außen zerstört zu werden. Es gibt eine Dignität der normalen, kleinen, Alltagskultur.
7 Vgl. den unvollendeten und erst posthum erschienenen Roman: Albert Camus, Der erste Mensch, Reinbek 1995. 8 Camus wächst in Belcourt, einem dichtbevölkerten Arbeiterviertel in Algier auf: »Als früher, unauslöschlicher Kindheitseindruck entstand für Camus hier das Bild eines zusammengehörigen, mittellosen und dennoch lebensfrohen Menschenschlags, dem er sich zugehörig fühlte, dessen Not und dessen Daseinsfreude er teilen wollte.« Brigitte Sändig, Albert Camus. Eine Einführung in Leben und Werk, Leipzig 1992, S. 15.
160
3.
Knut Wenzel (Frankfurt am Main)
»Jenseits von Lästerung und Gebet«
Im Roman Die Pest stellt Camus die Lebenswelt nicht nur unter die Bedrohung der Epidemie. Würde es dabei bleiben, könnte sich Folgendes ereignen (und Camus schildert es auch): Die tödliche Seuche wird aufgenommen in die Alltagskultur. Die Menschen suchen nach Wegen, mit ihr zurecht zu kommen, und diese alltagskulturelle Verarbeitung der außeralltäglichen Bedrohung begleitet sie womöglich bis zu ihrem Tod; die Menschen begleiten einander bis zum Tod. Aber die Pest kommt zweimal über die Lebenswelt der Menschen, und das zweite Mal im Modus der Deutung: als Strafe, als Geißel.9 Die Deutung, die Pater Paneloux der Pest gibt, kommt wie von oben, aus einer Sphäre des Prinzipiellen und Allgemeinen, herab und senkt sich tödlich auf die ohnehin real bedrohte Lebenswelt: Paneloux’ Interpretation spricht den Menschen das Recht und die Möglichkeit ab, mit der Pest umzugehen, sie durch die Filiationen alltagskultureller Bearbeitung zu führen, sie dadurch, wenn sie schon nicht medizinisch besiegbar ist, in ihrer dämonischen Wucht zu depotenzieren. Paneloux spricht den Menschen dies ab, indem er ihnen zuspricht: das lähmende, weil prinzipiell und unkonkret gesagte Wort der Schuld. Es wäre einmal lohnenswert, das Gesamtwerk Albert Camus’ als eine hermeneutische Analyse der Wirklichkeit und des Diskurses der Schuld zu interpretieren. Hier nun begegnet die Rede von der Schuld als eine generelle und nicht etwa als eine bestimmte Negation, welche letztere doch aus Anknüpfung und Kritik bestünde, also analytisch-kritische Kraft hätte, die die Lebenswelt, auch wenn sie diese, ja, indem sie diese kritisiert, würdigt: nämlich als konkreten Ort der Entscheidung über die Wahrheit der menschlichen Existenz. Der Autor – oder die Erzählung – hat aber Erbarmen mit dem Pater und gesteht ihm zu, was dieser selbst sich noch dann versagt, als es bereits geschehen ist: eine durch Erfahrung induzierte Veränderung: Paneloux hält eine zweite Predigt, mit der Camus der Kirche nebenbei eine kleine Lektion in Sachen Lehrentwicklung erteilt: Diese zweite Predigt ist in wesentlichen Aspekten anders, wie gesagt aufgrund von Erfahrungen, die Paneloux gemacht hat, und dennoch heißt es vom Pater, der in diesem Moment gewissermaßen für die Kirche insgesamt steht, die auf die Geschichte ihres Lehrens zurückschaut: »Was Pater Paneloux schon an der gleichen Stelle gepredigt hatte, blieb wahr – das war zumindest seine Überzeugung.« Höchstens dass er es in seiner ersten Predigt etwas am Ton der Nächstenliebe hat fehlen lassen.10 Aber der Pater ist weiter als er selbst in seinem ausdrücklichen, sozusagen amtlichen Bewusstsein weiß. Er 9 Vgl. Albert Camus, Die Pest, in: Ders., Das Frühwerk, Düsseldorf 1956, S. 111 – 389, hier : S. 193 – 198. 10 A.a.O., S. 309.
Verteidigung des Relativen. Albert Camus und das Christentum
161
hat mittlerweile in Sanitätsgruppen gearbeitet, hat Sterbende begleitet, die Erfahrung der Ohnmacht angesichts des Tods und der Angst um das eigene Leben gemacht. Camus zeigt, dass diese Erfahrungen nicht stumm gemacht, sondern von einem deutenden Diskurs begleitet werden. Emblematisch für das anteilnehmende – und darin seine spezifische Kritik formende – Denken Camus’ steht die Schilderung vom Tod eines Kinds. Beide zentralen Figuren des Dr. Rieux und des Pater Paneloux bezeugen dessen Sterben. Nicht ohne Bedacht, sondern wiederum als eine ans Christentum adressierte Lektion läßt Camus den Arzt mit einem Satz Widerspruch gegen die erste Predigt des Pater einlegen, der eine ganze Theologie aufspießt, eine Theologie, die schon geographisch naheliegt, die Camus selbst zudem einigermaßen bekannt ist11 und die er im Roman längst ausdrücklich ins Spiel gebracht hat, indem er den Pater sich für seine erste Predigt von seinen Augustinus-Studien losreißen lässt12 : »Ah! Der wenigstens war unschuldig, das wissen Sie wohl!« (304) Der Pesttod dieses Kinds steht gegen die Verquickung von Leid und Schuld und lässt, so wäre mit Blick auf den hier im Hintergrund anwesenden Augustinus zu interpolieren, auch keinen Raum für eine theoretische Umschiffung dieses faktischen Nein durch die Konstruierung einer Erbsündentheologie. Die Behauptung, dass einem Kind eine Schuld anzurechnen ist, die es gleichwohl nicht personal zu verantworten hat, ist zwar spektakulär, aber keine Begründung. In dem Gespräch, das sich zwischen Pater Paneloux und Dr. Rieux nach dem gemeinsam bekämpften und dann bezeugten Tod des Kinds ergibt, fällt, wiederum ausgesprochen vom Arzt, jener Satz, der zu den bekanntesten Stellungnahmen Camus’ zum Christentum gehört, seine Version der Theodizee-Frage: »… ich werde mich bis in den Tod hinein weigern, die Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemartert werden.« (S. 305) Bei näherem Hinsehen verliert dieser Satz womöglich etwas an Aussagekraft: Warum wird das Leiden von Kindern stets als besonders grausam wahrgenommen? Weil sie als unschuldig gelten? Das deutet Dr. Rieux an. Und warum, so müsste die Gegenfrage lauten, sollte das Leid, das Erwachsene trifft, weniger grausam sein? Hat Leid doch etwas mit Schuld zu tun? Dr. Rieux wäre demnach wenigstens noch Resten eines solchen Denkens verhaftet, eines Denkens, an dessen Überwindung sich bereits das Alte Testament in mehreren Anläufen abgearbeitet hat. Dann wendet sich jedoch das Gespräch zwischen Arzt und Pater einem anderen Thema mit weitreichenden theologischen Implikationen zu. Als Antwort 11 Camus’ philosophische Examensschrift von 1936, die den Titel »Christliche Metaphysik und Neuplatonismus« trägt, sollte ursprünglich heißen: »Hellenismus und Christentum, Plotin und Augustinus«. Vgl. hierzu Heinz Robert Schlette, Albert Camus’ philosophische Examensschrift »Christliche Metaphysik und Neuplatonismus«, in: Ders. (Hg.), Wege der deutschen Camus-Rezeption, Darmstadt 1975, S. 329 – 340. 12 Vgl. Albert Camus, Die Pest (Anm. 9), S. 192.
162
Knut Wenzel (Frankfurt am Main)
auf den soeben zitierten Ausruf des Arzts und in einem nicht eindeutigen Rückbezug auf den Tod des Kinds führt der Pater das Thema der Gnade ein: »’Ach, Herr Doktor’, sagte er traurig, ›eben habe ich erkannt, was Gnade heißt’.« (S. 305) Camus gibt durch die Antwort des Arztes zu erkennen, dass er um den hier virulenten theologischen Topos weiß: »Die [i.e. die Gnade] habe ich nicht, ich weiß. Aber ich will nicht mit Ihnen darüber streiten. Wir arbeiten miteinander für etwas, das uns jenseits von Lästerung und Gebet vereint.« (S. 305) Eine Erörterung dieses Topos in seiner (neuzeitlich) klassischen Gestalt, nämlich als Frage nach dem Verhältnis von Gnade und Freiheit, interessiert Camus freilich nicht. Er gibt dieser Frage eine andere, zukunftsträchtige Wendung, ohne dabei übrigens eine mit theologischen Bedeutungsimplikationen operierende Sprache zu verlassen, werden doch die Begriffe der Gnade und der menschlichen Tätigkeit auf den des Heils bezogen: »… ja, auch Sie arbeiten für das Heil der Menschen« (S. 305). Dies dem Agnostiker als Agnostiker zuzusprechen bedeutet aber, den Horizont des allgemeinen theologischen Bewusstseins der Zeit zu überschreiten und eine Position zu formulieren, die auch heute noch innerkirchlich Anstoß erregen kann. Dr. Rieux bietet seinerseits dem Pater an, das so unterschiedlich motivierte, von divergenten Überzeugungsgeschichten getragene Handeln als ein kooperatives Handeln aufzufassen, das also schon auf der Ebene der Praxis verbindet, und das zudem durch die unterscheidenden Überzeugungsgeschichten hindurch von einem identischen, also von beiden geteilten Ziel getragen ist. Man kann das, was Camus hier von der Figur des Arzts her sagt, pointiert so wiedergeben: Die unterschiedlichen Überzeugungsgeschichten des agnostischen Humanismus und des Christentums, die den jeweiligen lebensweltlichen Resonanzraum der Handlungsmotive des Arzts und des Klerikers bilden, rechtfertigen sich in dem Maß, wie sie auf ein gemeinsames, sie übersteigendes Ziel hin durchsichtig werden. Die den eigenen theologischen Horizont aufbrechende Leistung des Paters besteht darin, dieses gemeinsame Handlungsziel innerhalb der eigenen Überzeugungssprache zur Geltung zu bringen: Indem er das Handeln des agnostischen Arzts Dr. Rieux als »Mitarbeit am Heil der Menschen« bezeichnet, identifiziert er im Tun des Anderen das eigene Anliegen; er versetzt sich dadurch in die Lage, vermittels der partikularen Sprache seiner christlichen Glaubensüberlieferung das diese tragende universale Anliegen zum Ausdruck zu bringen. Kirchenoffiziell ist diese Position als authentische und legitime Auslegung des christlichen Glaubens erst durch das Zweite Vatikanische Konzil rezipiert worden.13 13 In ihrem Schlußwort betont die Pastoralkonstitution Gaudium et spes, daß die Kirche »kraft ihrer Sendung … zum Zeichen jener Brüderlichkeit, die einen aufrichtigen Dialog ermöglicht und gedeihen läßt«, wird. Dieser Dialog, in dem die Kirche ihre missionarische Dimension nicht verleugnet, sondern gerade verwirklicht, beinhaltet die Anerkennung anderer
Verteidigung des Relativen. Albert Camus und das Christentum
4.
163
Jenseits der Theodizee-Frage?
Unmittelbar auf die Schilderung dieses Gesprächs lässt Camus die Erzählung der zweiten Predigt des Paters folgen. Sie wird nicht, wie die erste, szenisch inszeniert; sie kommt aus der Ferne der Erzählvergangenheit. Auch sonst ist manches anders: Auffallend weniger Zuhörer sind zugegen, nicht nur aufgrund der grassierenden Seuche, sondern auch aus Gründen ihrer Bewältigung. Die Religiosität, so führt der Erzähler aus, hat sich unter dem Einfluss der Pest geändert: Ihre öffentlich-inszenierte Form zerbricht ins Privat-Esoterisch-Magische. »Sie trugen lieber einen Talisman oder Amulett des heiligen Rochus als dass sie zur Messe gingen.« Denn als Tag um Tag unter der Seuche verstrich, »begann man zu fürchten, das Unheil werde überhaupt kein Ende nehmen, und mit einem Schlag wurde das Aufhören der Seuche zum Gegenstand aller Hoffnungen. So machten unter der Hand verschiedene Prophezeiungen die Runde, die Magiern zugeschrieben wurden oder Heiligen der katholischen Kirche.« (S. 307) Auch der Pater spricht nun anders, nicht mehr zu den Menschen, gegen sie, sondern von einer gemeinsamen Situation: Sein Blick auf die Pest ist nicht mehr die aburteilende »ihr«-Perspektive, sondern die ihn, den Sprechenden, selbst involvierende »wir«-Perspektive (vgl. S. 308). Auch ist ihm der Furor des Deutens abhanden gekommen, von dem die erste Predigt beseelt war. Sein damaliger unbeirrbarer Wille zur Erklärung der Pest verband den Pater mit den Talismanträgern und Prophetiegläubigen. Nun aber hat die Bezeugung des Sterbens eines Kindes ihm diesen Willen, dessen »Richtigkeit«, genommen. Aber nicht seinen Glauben. Sondern ihm eine neue Schärfe gegeben. Sie kann einen gläubigen, theologisch nicht ungebildeten Leser durchaus beunruhigen. Pater Paneloux verlangt von seinen Zuhörern (und zuallererst von sich selbst) nicht weniger als einen je tieferen Glauben angesichts des theologisch nun nicht mehr (weg)erklärbaren Leidens eines unschuldigen Kindes. Pater Paneloux, dessen Ruf als Gelehrter und Prediger schon zu Beginn der Chronik der Pest verzeichnet wird (S. 192), ist durch die Erfahrungen während der Pest zu einem besseren Theologen geworden. Der Erzähler – der »Geist der Erzählung« (Thomas Mann) –, hier dem Pater sehr nah und ihm Worte zusprechend, die dieser selbst vielleicht nicht aufbrächte, offenbart die theologische Begründung einer Verweigerung der Rechtfertigung des Leidens unschuldiger Kinder : »Es wäre für ihn [den Pater] ein Leichtes gewesen zu sagen, dass die Ewigkeit himmlischer Freuden, die das Kind erwartete, sein Leiden aufwiegen konnte; aber in Wahrheit wusste er nichts darüber. Denn wer konnte schon behaupten, dass eine ewig dauernde Freude einen Augenblick menschlichen Schmerzes aufwog? Jedenfalls würdiger Überzeugungstraditionen, seien diese religiös oder säkular. Vgl. hierzu ausführlicher die Nummern 91 und 92 der Pastoralkonstitution.
164
Knut Wenzel (Frankfurt am Main)
kein Christ, dessen Schmerz der Meister in seinen Gliedern und in seiner Seele empfunden hat.« (S. 310) Jesus selbst, den die Christen als den Gesalbten Gottes bekennen, steht gegen eine solche passionsvergessene Deutung. Wie vermittelt sich aber die Figur Jesu in die konkrete Lebenssituation der Menschen? Camus mutet den Christen und insbesondere den professionellen Deutern unter ihnen zu, dass ihre theologischen Interpretationskategorien auf die Bestätigung durch ein Erfahrungswissen angewiesen seien. Exakt dieses Erfahrungswissen macht es Pater Paneloux nun unmöglich, eine integrierende Erklärung des Leids vorzulegen. Wo aber das Leid nicht mehr integrierbar ist – etwa als gerechte Strafantwort auf begangene Schuld –, steht doch die Theodizee-Frage im Raum. Pater Paneloux stellt diese Frage nicht. Vielmehr konfrontiert er seine Zuhörer mit der Notwendigkeit eines angesichts solch nicht rechtfertigbaren Leids noch radikaleren Glaubens. Dieser sei die Forderung einer »Religion der Pestzeit« – die »nicht die Religion aller Tage sein« kann (S. 310). Er scheut sich nicht, diese Forderung in einer skandalisierenden Sprache vorzubringen: Er spricht von der Erniedrigung, die das Leid eines unschuldigen Kinds für den »Geist wie für das Herz« bedeutet, und er fordert die Einwilligung in diese Erniedrigung. Er verlangt von den Christen, »sich Gottes Willen ganz zu überlassen, selbst wenn er unverständlich wäre« (S. 311). Man kann diese Überzeugung des Paters in eine Linie nordafrikanischer Theologie einordnen und sich an den Tertullian zugeschriebenen Satz »credo quia absurdum est« (»ich glaube, weil es absurd ist«) erinnert sehen.14 Man kann sich auch der Aktualität dieser Position vergewissern, indem man die Aufforderung, sich auch einem unverständlichen und also »unvernünftigen« Gotteswillen zu überlassen, auf die Zurückweisung einer solchen Glaubenskonzeption und das dagegen gehaltene Plädoyer für den Gedanken eines wesensgemäß »vernünftigen« Gottes bezieht, wie sie von Papst Benedikt XVI. in seiner Regensburger Vorlesung vorgebracht worden sind. Man wird dann zugleich sagen müssen, dass das von Papst Benedikt zurückgewiesene Glaubens- und Gottesverständnis auch innerhalb des Christentums nicht abseitig ist, sondern eine prominente Linie darstellt – vom Nominalismus bis Kierkegaard –, und dass deswegen Camus, der seinen Pater Paneloux Anklänge hieran sagen lässt, der Vorwurf, er wäre mit dem Christentum nicht vertraut und es sei deswegen überflüssig, »das falsche Christentum zu untersuchen, mit dem die Gestalt des Paters geschaffen wurde«,15 nicht treffen kann. Dazu ist die Nähe der Glaubensposition des Paters zu jenem Glaubensverständnis, wie es Søren
14 Vgl. hierzu Heinz Robert Schlette, Camus’ PÀre Paneloux und die Aporetik des Leidens, in: Ders. (Hg.), Erkenntnis und Erinnerung. Albert Camus’ Pest-Chronik, Bonn 1998, S. 91 – 114, hier : S. 107 – 109. 15 So das von Heinz Robert Schlette, a. a. O., S. 105, zitierte Urteil Germain-Paul G¦linas’.
Verteidigung des Relativen. Albert Camus und das Christentum
165
Kierkegaard in seiner Interpretation des Isaakopfers entwickelt, zu offenkundig.16 Man wird aber vor allem sagen müssen, dass Camus hier keine Karikatur des Christentums zeichnet, um es dann desto leichter erledigen zu können. Man wird Camus auch in der Darstellung des Pater Paneloux und seiner Theologie ernst nehmen und mit demselben Ernst der in dieser zweiten Predigt skizzierten Theologie begegnen müssen. Camus’ Größe ist hier womöglich darin anzutreffen, dass er in den Überlegungen des Paters eine echte Gegenposition zur eigenen Überzeugung zu Wort kommen lässt. Worin aber bestünde diese letztlich? Der Pater hat, wie gesagt, seit seiner ersten Predigt eine erfahrungsmäßige, denkerische und deswegen auch theologische Entwicklung durchgemacht. Dies kristallisiert sich an dem Stellenwert, den er dem Tod jenes Kinds in seinen Überlegungen beimisst: Nicht mehr ist dem Pater eine integrale Erklärung der Pest und der von ihr betroffenen Welt insgesamt zuhanden. Nicht vermag es alle ewige Freude – also die Seligkeit, die Vollendung –, das Leiden und den Tod eines einzigen Kinds aufzuwiegen. Der Tod eines Kinds neutralisiert das, was, hier in der Sprache christlicher Eschatologie, die vollendet erfüllte Bedeutung aller Wirklichkeit ist. Diese nämlich gibt es nicht, solange auch nur ein Kind leidet. Der Tod eines einzigen Kinds erhält hier einen absoluten, das Ganze betreffenden Stellenwert. Das ist der Ausgangspunkt, den der Pater noch gewissermaßen mit Camus selbst teilt. Wenn die Wirkung des einen individuellen Leidens und Sterbens an die Grundfesten einer lebbaren und bewohnbaren Welt rührt, muss die Antwort ebenso radikal sein. Sie lautet bei Pater Paneloux: »Es gilt, alles zu glauben oder alles zu leugnen. Und wer unter euch wagte es, alles zu leugnen?« (S. 310) Das »Es gilt« ist die Forderung, die sich aus dem Skandalon des Leidens und Sterbens eines unschuldigen Kinds ergibt. Alles weitere, was nun noch zu sagen ist, verhält sich zu den zitierten Sätzen (und einem weiteren, auf den noch einzugehen sein wird) wie die Paraphrase zu einer ungeheuer verdichteten Metapher : das ausschöpfend, was nicht wortwörtlich da steht. Es gilt: zu entscheiden, ob die Absurdität des Todes eines Menschen, der in so eindeutiger Weise für seinen Tod nichts kann – der unschuldig ist –, eine Absurdität, die nicht in sich abgekapselt 16 In seiner Schrift Furcht und Zittern von 1843. Zur Bedeutung der Position Kierkegaards im Kontext der Debatte um Papst Benedikts Regensburger Vorlesung vgl. Knut Wenzel, Vernünftiger Glaube. Bemerkungen zur Regensburger Vorlesung Papst Bendikts XVI., in: Ders. (Hg.), Die Religionen und die Vernunft. Die Debatte um die Regensburger Vorlesung des Papsts, Freiburg 2007, S. 99 – 118, hier : S. 112 – 114. Daß Camus sich mit Kierkegaard intensiv beschäftigt hat, nämlich in Zusammenhang mit seiner Arbeit am Mythos von Sisyphos, ist bekannt (vgl. Heinz Robert Schlette, a. a. O., S. 106). Camus’ Kenntnis jener Schrift Kierkegaards und ihr Einfluss auf die Theologie des Pater Peneloux ist also nicht auszuschließen.
166
Knut Wenzel (Frankfurt am Main)
bleibt, sondern (wie die Pest) die gesamte Wirklichkeit als ein Bedeutungsganzes und bedeutendes Ganzes in Mitleidenschaft zieht, ohne dass die BedeutungsZerstörungs-Dynamik dieser partikularen Absurdität (Bedeutungs-Losigkeit) irgendwie eindämmbar wäre – zu entscheiden also, ob man dieser Absurdisierung aller Wirklichkeit, dieser unaufhaltsamen Bedeutungs-Zerstörung der Wirklichkeit als Ganzer zustimmt, in die einstimmt, konform zu ihrer Dynamik alles fahren lässt – oder nicht. Dieses »nicht« darf, soll es standhalten können, nicht nur eine negative Stellungnahme sein – ein Nein zu einem Nein –; diese Verneinung eines sehr realen Nein muss ein positives, bejahendes Fundament haben. Was bejaht dieses Nein an seinem Grund? Es bejaht, dass diese absurditätsbedrohte konkrete, leibhaftige Menschenwelt Wert und Bedeutung hat. Diese Bejahung wird gegen den Augenschein gesprochen – der nichts Scheinhaftes an sich hat, sondern die reflexionsvermittelte Wahrnehmung des Faktischen ist. Die Positionsnahme für Wert und Bedeutung dieser Welt muss sich kontrafaktisch behaupten. »Alles zu glauben oder alles zu leugnen« – diese Alternative meint demnach nicht: Naivität contra Realismus, sondern Nicht-Aufgabe der Bedeutsamkeit dieser Welt contra Aufgabe derselben. Camus, dessen Philosophie des Absurden vielleicht für das Aufgeben der Bedeutsamkeit der Welt steht, hat die Welt nie aufgegeben. Darin steht er auf der Seite des Paters. Dieser aber sagt (Camus selbst lässt ihn sagen): Die Affirmation des einen geschieht in der Affirmation des anderen. Wenn wir der Welt keine Bedeutung mehr geben, geben wie sie selbst auf. »Alles zu glauben« heißt also, die Bedeutsamkeit der Welt in ihrer Totalität anzunehmen – angesichts eines faktischen Einspruchs dagegen. »Alles zu glauben« heißt dann, Gott als den zugleich welt-transzendenten und weltengagierten Fürsprecher dieser Bedeutsamkeit anzunehmen. Auf diesem Weg etwa lässt sich eine nicht-zynische Paraphrase des Paneloux’schen Axioms entwickeln: das Festhalten an der Bedeutsamkeit der Welt insgesamt – gegen die faktische Absurdität des Todes, für die bleibende Bedeutsamkeit des Gestorbenen. Dieser Glaube ist kein Triumph über das Absurde, sondern muss ihm standhalten. Christen teilen dieselbe Situation mit den Nicht-Glaubenden. Der Erzähler lässt das den Pater, wiederum mit einer zugespitzten Schärfe, durch jenen zweiten Satz festhalten, der als Echo des ersten am Ende dieses Gedankengangs steht: Der Christ »werde wählen, alles zu glauben, um nicht gezwungen zu sein, alles zu leugnen.« (S. 311) Ein solches Glauben ist weder selbstverständlich noch geht es leicht von der Hand. Es bedeutet vielmehr, sich und in eins damit auch die Welt aus dem Zwang einer Situation der Annihilierung der Bedeutung loszureißen. Der Welt eine Bedeutung zu unterstellen, ist hier nicht (mehr) Ausdruck eines traditionsreichen Ordnungsdenkens, wie es, bei aller apokalyptischen Dramatisierung, noch für die erste Predigt Geltung hatte. Jetzt ist diese Zuschreibung einer Bedeutung an die Welt ein Akt der Parteinahme für
Verteidigung des Relativen. Albert Camus und das Christentum
167
sie, ein Akt des Aufbegehrens gegen die Zerstörung ihrer Bedeutung. Indem der Pater den Glauben als diese Zuschreibung auffasst, bestimmt er ihn durch seine Weltbezogenheit. Dies ist nicht als integrale Glaubensanalyse miss-, aber als Verankerung des Glaubens in der Welt zu verstehen – im Sinn wiederum eines Satzes von Tertullian, demzufolge das Geschick des »Fleischs« der Angelpunkt des Heils ist.17
5.
Verbunden in der »Civitas des Zwiegesprächs«
Jenseits des Parabolischen der Pest machen die Figuren des Dr. Rieux, des Pater Paneloux, des Tarrou hinreichend deutlich, worum es Camus geht: um die Welt in ihrer Hiesigkeit, die er bedroht sieht. In seinem Vortrag vor Dominikanern im Jahr 1948 bedient er sich einer rein apokalyptischen Sprache, um dieser Bedrohung Ausdruck zu verleihen: »Wir befinden uns dem Bösen gegenüber … Zwischen den Mächten des Schreckens und denen des Zwiegesprächs ist ein gewaltiger, ungleicher Kampf entbrannt.«18 In diesem Kampf hofft er sich mit den Christen auf derselben Seite. Er erwartet von ihnen eine deutliche, nicht kompromisslerische Stellungnahme, die nicht »in das dunkle Gewand der Enzyklika« gekleidet ist (S. 70). Damit spielt er auf das Ausbleiben einer unmissverständlichen Verurteilung des Nationalsozialismus durch Rom an, was sich nicht wiederholen darf (S. 67). Im Zeitalter der Ideologien, das in der unmittelbaren Nachkriegszeit naturgemäß besonders heftig tobte, will Camus keine Konversionen. Vielmehr : »die heutige Welt verlangt von den Christen, dass sie Christen bleiben.« (S. 66) In diesem Satz drückt sich seine eigene Haltung zum Christentum aus. Was er will, ist Kooperation und Diskurs: praktisches und diskursives Miteinander. Ohne dies ausgearbeitet zu haben, gibt er seinen Zuhörern im Kloster des Predigerordens zu verstehen, dass er in diesem Punkt auf Seiten Pater Paneloux’ steht: Das Christentum erweist die weltliche Relevanz seiner Lehre in einer Praxis der Kooperation. Für Camus wäre eine solche Praxis schon aussagekräftig genug, wenn sie nur unmissverständlich für eine »Civitas des Zwiegesprächs« (S. 69) Partei ergreift. An der christlichen Doktrin als solcher war Camus, sieht man einmal vom Komplex der Erbsündenlehre und weniger anderer Einzelmomente ab, weitgehend uninteressiert. Auch scheint er die Vorbehalte vieler Menschen gegen Doktrinen geteilt und womöglich deswegen kein Verständnis für die Funktion der Doktrin innerhalb eines kulturellen, religiösen, etc. Bedeutungsgewebes gehabt zu haben, die idealtypisch darin besteht, einen methodisch geführten Diskurs thematischer Selbstvergewisserung 17 »Caro cardo salutis«. Tertullian, De carn. resurr. VIII. (De resurrectione mortuorum VIII, 18 Albert Camus, Der Ungläubige und die Christen (Anm. 3), S. 69.
168
Knut Wenzel (Frankfurt am Main)
hinsichtlich der eigenen Überzeugungen und Optionen zu ermöglichen. Diese sind nicht schon dadurch begründet, dass sie intuitiv einleuchten. Um lebensweltlich tragfähig und intersubjektiv vermittelbar zu sein, brauchen sie den Stoff einer Überzeugungstradition genauso wie das Argument einer vernünftigen Begründung. Dies sind, wenn man so will, die zwei Quellen der Lehre und der Theologie des Christentums. Jede neu gewonnene oder veränderte Überzeugung muss dann allerdings durch dieses Gewebe aus Überlieferung und Vernunftargumentation hindurchgeführt werden, was kaum ohne Rückwirkungen auf es vor sich gehen kann. Spuren eines solchen Durchdenkens einer neu gewonnenen Überzeugung finden sich in der zweiten Predigt des Paters. Camus vergegenwärtigt diesen Prozess des Durchdenkens erzählerisch, indem er in die narrative Schilderung der Predigt Einsprengsel wörtlicher Zitate und paraphrasierte Passagen einmontiert, und sogar den Erzähler mutmaßen lässt, was der Pater »sagen würde«;19 der Prediger befindet sich immer noch im denkerischen Gespräch mit sich selbst und präsentiert keineswegs ein fertiges und poliertes Ergebnis desselben. Camus, der seine Gedanken wohl nie im ruhigen Bewusstsein der Unangefochtenheit entwickelt hat20, gewährt in der Person des Pater Paneloux der christlichen Position – als einer, zu der er sich nicht bekennen kann – den Raum, sich mit sich selbst zu verständigen, mit sich zu ringen, sich weiter zu entwickeln – und in all dem sich als Anfrage an seine, Camus’ eigene Position zu präsentieren. Camus verwirklicht das sokratische Ideal einer »Civitas des Zwiegesprächs« selbst, zu dem er gern das Christentum sich selbst verpflichten sehen möchte. Der Gedanke einer Gesellschaft des Diskurses – welcher, mit Camus, durch die Doktrin nicht behindert werden darf und, mit dem Christentum, durch die Doktrin begründet und geschützt werden soll – besitzt eine Familienähnlichkeit (wenn auch wohl ohne wirkungsgeschichtlichen Zusammenhang) mit der Formulierung desselben Ideals durch Hannah Arendt, die im sokratischen Durchdenken welchen Gegenstands auch immer als Gespräch mit sich selbst den Typos des Denkens schlechthin erblickt.21 Wenn er auch der doktrinal-verpflichtenden Dimension der inhaltlichen Bestimmung des christlichen Glaubens misstraut, nimmt Camus diese dennoch 19 Vgl. Albert Camus, Die Pest (Anm. 9), S. 310. 20 So, wie geschichtlicher Fortschritt eben nicht als ›geschichtlicher Fortschritt’ daherkommt, sondern »von Millionen einzelner Menschen erweckt, belebt und unterhalten wird, Menschen, deren Tun und Werke jeden Tag die Grenzen und die plumpe Augenfälligkeit der Geschichte abstreiten, um flüchtig die stets bedrohte Wahrheit aufleuchten zu lassen, die ein jeder auf seinem Leiden und seiner Freude für alle aufrichtet«. Albert Camus, Der Künstler und seine Zeit, in: Ders., Fragen der Zeit, Reinbek 1997, S. 229 – 250, hier: S. 259. 21 Vgl. etwa Hannah Arendt, Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik, München 2006, S. 154 f.
Verteidigung des Relativen. Albert Camus und das Christentum
169
als ein Reservoir der Bedeutungen wahr, das auch der Agnostiker interpretatorisch fruchtbar machen kann. Und so lässt er Tarrou am Ende einer langen Lebensbeichte seine Suche nach innerem Frieden, der für ihn wesentlich moralisch ist, der davon abhängt, an der allumfassenden Zerstörung der Welt nicht teilzunehmen – in seiner Sprache: nicht zum Mörder zu werden, und wenn unvermeidlicherweise doch, dann wenigstens ein »unschuldiger Mörder« zu sein (S. 338) –, diese seine Sehnsucht in der Sprache der Religion artikulieren: »›Eigentlich‹, sagte Tarrou schlicht, ›möchte ich gerne wissen, wie man ein Heiliger wird.‹« Auf den Einwand des Dr. Rieux, dass der Begriff des Heiligen den Begriff Gottes impliziert und der Wunsch, ein solcher zu werden, faktisch den Glauben an Gott, antwortet Tarrou: »Eben. Kann man ohne Gott ein Heiliger sein, das ist das einzig wirkliche Problem, das ich heute kenne.« (S. 339) Tarrous Problem klingt, zumal soeben seinem Verständnis des Heiligen eine moralische Dimension beigemessen worden ist, nach der Frage, die heute gern und vorschnell wieder verneint wird, nämlich ob eine Normenbegründung ohne Rekurs auf eine absolute Instanz möglich wäre. Möglicherweise schließt Tarrous Problem diese Frage mit ein – dann aber mit dem Ergebnis, dass Tarrou strikt für eine autonome Moralbegründung votieren würde. Seine Frage zielt freilich darüber hinaus: Heilig zu sein heißt, sich hinzugeben, in einem absoluten Sinn: die ganze Existenz erfassend und zugleich sich ablösend – von der Welt, so heißt es dann immer, gemeint ist aber : von einengenden Bindungen an die und von verletzenden Verstrickungen in der »Welt«. Heiliger zu sein bedeutet dann, die unter den realen Bedingungen gelebter Existenz errungenen Bruchstücke von Freiheit (bestenfalls als solche kennen wir sie) in einer Weise auf das personale Zentrum eines Menschen konzentriert und ausgerichtet zu erleben, wie sie niemand herstellen, höchstens sich schenken lassen könnte. Wie aber heilig sein, wenn diese Hingabe an keinen absoluten Adressaten mehr sich wenden kann? Das agnostische Gefälle der Gedankenwelt Camus’ legt nahe, den verlorenen Adressaten – Gott – nicht durch einen anderen zu ersetzen. Trotz Nietzsches Einfluss steht die Figur des Heiligen bei Camus nicht für eine Hingabe an ›das Leben‹ oder ›die Welt‹. Der ganze Effekt von Tarrous Suche nach einem Heiligsein ohne Gott besteht schließlich darin, die Stelle des Adressaten dieser Hingabe unbesetzt zu lassen. Denn hierdurch wird diese Hingabe an (etwas, jemanden) umgedeutet in eine Hingabe in der Welt, im Leben. Camus’ agnostischer Begriff des Heiligen betont den Ort des Heiligseins, und koste das auch die Preisgabe eines Woraufhin solchen Heiligseins.
170
6.
Knut Wenzel (Frankfurt am Main)
Verteidigung des Relativen
Durch die Figur des Tarrou plädiert Camus für ein Konzept des Heiligen, das von einem Transzendenzbezug losgelöst gedacht wird, der dieses Heilige in der Weise bestimmt, dass er es von der Welt abzieht, ablenkt. Camus hat mehrfach das Diesseits, die Hiesigkeit – so ist der Begriff der Welt hier gemeint – gegen jeden Sog darüber hinaus verteidigt: so, wenn er in dem Vortrag vor den Dominikanern gegen Gabriel Marcel einwendet, dass dieser »absolute Werte verteidigen [will], wie etwa das Schamgefühl und die göttliche Wahrheit des Menschen, während es darum geht, die paar vorläufigen Werte zu bewahren, die ihm gestatten werden, eines Tages und völlig unbehelligt für diese absoluten Werte weiterzukämpfen …«22 Was ist aber unter einem vorläufigen, relativen Wert, einer valeur moyenne, zu verstehen? Die Beantwortung dieser Frage erfordert es, sich in den Werk- und Debattenkontext von L’homme r¦volt¦ zu begeben.23 Camus formuliert sein Ringen um die valeur moyenne in den weltanschaulichen Alternativen seiner Zeit: So steht der Kommunismus für die Notwendigkeit der Gestaltung der Welt durch die Menschen, eine Notwendigkeit die entsteht, »[w]enn es keine ewigen Werte gibt«24. Das Christentum repräsentierte demgegenüber die ewigen Werte. Camus ist mit dieser Alternative keineswegs zufrieden; er sieht sich denen zugehörig, »die von einer unmöglichen Synthese träumen«25. Auch wenn die Zuordnung (Kommunismus: Gestaltung der Welt – Christentum: ewige Werte) heute nicht mehr überzeugen kann, wiewohl das (kirchlich-katholische) Christentum nicht davon freizusprechen ist, sich überlang eben so präsentiert zu haben, wie Camus es wahrnehmen musste, ist doch Camus’ Verlangen nach einer Synthese durchaus nachvollziehbar. Bezeichnet er selbst diese Synthese auch als unmöglich, gibt er mit L’homme r¦volt¦ doch einen Rahmen an, innerhalb dessen sie zu verwirklichen wäre. Denn die Negation des Aufbegehrens, der Revolte, birgt eine grundlegendere Affirmation: »Ein Mensch, der Nein sagt«, ist gleichzeitig »ein Mensch, der Ja sagt, Ja nämlich zu dem, was er mit seinem Nein zu erhalten sucht«26. Der revoltierende Mensch ist das Gegenteil eines Nihilisten27; Camus bindet 22 Albert Camus, Der Ungläubige und die Christen (Anm. 3), S. 68. 23 Vgl. hierzu den von Brigitte Sändig und Rainer Graupner herausgegebenen Dokumentationsband: Ich revoltiere, also sind wir. Albert Camus – 40 Jahre (Anm. 1). 24 So Camus in einem Brief an Jean Grenier, zitiert nach: Martina Yadel, L’homme r¦volt¦ – eine Einführung, in: a. a. O., S. 1 – 19, hier:S. 4. 25 Ebd. 26 Martina Yadel, L’homme r¦volt¦, a. a. O., S. 5. 27 Vgl. hierzu die ausdrückliche Zurückweisung des Nihilismus im Schlussabschnitt von L’homme r¦volt¦: Der Mensch in der Revolte, Reinbek 1969, S. 244 – 248.
Verteidigung des Relativen. Albert Camus und das Christentum
171
aber die Geltung von Werten an ihren Entdeckungszusammenhang: Sie sind nicht ›ewig‹ im Sinn einer abstrakten Idee, unabhängig und unberührt von menschlicher, konkreter Wirklichkeit, in die hinein sie dann deduziert werden. Vielmehr : Sie erschließen sich durch jenes Nein, das der revoltierende Mensch tatkräftig ausspricht und das in seinem Kern ein Ja ist, eine Affirmation von Unaufgebbarem. Dies wird aber erst als solches im Moment seiner Bedrohung erkennbar, wenn gegen seine Zerstörung oder Preisgabe aufbegehrt werden muss. In ganz anderer und doch analoger Weise ist der Kampf gegen eine abstrakte Werteordnung auch in der katholischen Theologie geführt worden, nämlich durch Karl Rahner, der natürlich nie den Menschen oder den Christen als homme r¦volt¦ bestimmen würde, aber doch ähnlich wie Camus sagt, dass die Werte, auf die ein Mensch sich in seinem Handeln bezieht, nicht in einer allgemeinen Prinzipienordnung allzeit und immergleich verfügbar sind, sondern in der jeweilig konkreten, irreduzibel heterogenen Entscheidungssituation erkannt, anerkannt und geltend gemacht werden müssen. Die hierbei aufgerufene Entscheidungsinstanz ist auch für die Christen nicht die Morallehre der Kirche – diese ist vielmehr eine Komponente der pluralen Entscheidungssituation –, sondern die (in jedem Menschen inkarnierte) praktische Vernunft.28 Nun ist Camus kein Kantianer (und Rahner auch nur in Maßen); und doch wäre eine Verständigung zwischen dem Philosophen des homme r¦volt¦ und dem katholischen Theologen denkbar. Die sich an dieser Stelle nahe legende Frage nach einer näheren Bestimmung dessen, was mit der Geste der Revolte beinahe unwillkürlich bejaht wird, öffnet den Blick auf einen bemerkenswerten Bedeutungszusammenhang. In der Revolte sprengt der Mensch bislang geltende Lebensbestimmungen auf und überwindet, sei es aus einer depravierten, sei es aus einer privilegierten Position heraus, was ihn vom Anderen trennt; er realisiert dabei – und entdeckt als Wert – die Solidarität, das vielzählige An-die-Seite-eines-Anderen-Treten, das aus der Überwindung des gesellschaftlich, ökonomisch, kulturell, ethnisch und eben auch religiös Trennenden gewonnen wird. Martina Yadel hat darauf hingewiesen, dass Camus in einer später nicht wieder aufgegriffenen Formulierung von dieser durch die Revolte erschlossenen Wirklichkeit der Solidarität als von einer »horizontalen Transzendenz« spricht.29 Bemerkenswert wird dies dadurch, dass, mutmaßlich ohne Bezug zu Camus, Jürgen Habermas das Erbe des biblischen Monotheismus in säkularer Übersetzung in der Intersubjektivität aufbewahrt
28 Vgl. Karl Rahner, Theologische Reflexionen zum Problem der Säkularisation, in: Ders., Schriften zur Theologie VIII, Einsiedeln-Zürich-Köln 1967, S. 637 – 666. 29 Martina Yadel, L’homme r¦volt¦ (Anm. 23), S. 5.
172
Knut Wenzel (Frankfurt am Main)
sieht und diese Übersetzung mit einer bekannt gewordenen Wendung als »Transzendenz von innen, Transzendenz ins Diesseits« bezeichnet.30 Camus jedenfalls hält für sich fest: »[H]in und her gerissen zwischen der Welt, die unzulänglich ist, und Gott, den er nicht besitzt, entscheidet der absurde Geist sich leidenschaftlich für die Welt. Id.: Zwischen dem Relativen und dem Absoluten schwankend, stürzt er sich mit Feuereifer ins Relative.«31 Dieses Notat steht im Kontext der Reflexionen über die Revolte. In ihrem bejahenden Kern ist die Revolte also ein Engagement »mit Leidenschaft« für das Relative: für die Lebensrealität in ihrer Kontingenz, Diskontinuität, Fragilität, Endlichkeit. Diese gilt es zu verteidigen, auch gegen ein Christentum, das zumindest in Camus’ Wahrnehmung sich noch weitgehend von dieser relativen Welt ab- und einem absoluten Gott zugewandt hat. Dass eben dieser Gottesglaube nicht notwendigerweise zu einer Weltabkehr, zu einem Verrat an der Welt, führen muss, dies ist Camus’ Verständnis für die Bedeutungsarchitektur des Christentums durchaus zugänglich; die Bedeutung des Inkarnationsgedankens ist ihm klar : »Und wenn dieser Gott uns anrührt, so dank seines Menschenantlitzes«32. Als Religion des inkarnierten Absoluten ist das Christentum eigentlich eine Religion der Verteidigung des Relativen; denn dieses Relative hat Gott in Jesus aus Nazaret angenommen.33 Vielleicht aber muss das Christentum sich erst durch Einsprüche wie den von Albert Camus an seinen Bedeutungskern erinnern lassen; denn hat nicht Jesus gezeigt und vergegenwärtigt, was der Heilswille Gottes ist, indem er das Wort Gottes unter den Menschen verkündigt (Lk 17,20 f) und sich den Einfachen, Armen, Bedürftigen, Sündigen vorbehaltlos zugewandt hat? Hat er nicht die Würde des ›relativen’ Menschenlebens gegen kultische und ethische Prinzipalismen verteidigt? Ein solches sich auf Jesus rückbesinnendes Christentum könnte von Albert Camus womöglich als Bundesgenosse in der Verteidigung des Relativen erkannt und anerkannt werden.
30 Vgl. hierzu die Replik dieses Titels, die Habermas auf kritische Rückfragen und Ergänzungen von Theologinnen und Theologen 1988 auf einer Tagung in Chicago gegeben hat; in: Jürgen Habermas, Texte und Kontexte, Frankfurt 1991, S. 127 – 156, bes. S. 145 und 155 f. 31 Albert Camus, Tagebücher 1935 – 1951, Reinbek 1997, S. 244. 32 A.a.O., S. 161. 33 Vgl. hierzu Knut Wenzel, Die Endlichkeit würdigen, in: zur Debatte 35(2005), S. 14 – 16.
Heiner Wittmann (Stuttgart)
Kunst und Moral. Albert Camus und seine Nobelpreisrede
Verhältnis und Bedeutung von Kunst und Freiheit im Werk Albert Camus’ und die daraus entstehende Begründung für seine Ideologiekritik werden meist übersehen. Die Unabhängigkeit, die er für andere und für sich als Künstler einforderte, setzte ihn unerbittlichen Angriffen ganz besonders aus dem linken Lager aus. Was nach all diesen Kämpfen bleibt, ist die ungebrochene Aktualität seines Werkes, die Camus’ Hellsichtigkeit im Nachhinein in beeindruckender Weise bestätigt. In seinen theoretischen und fiktionalen Werken entwickelt er eine Auffassung von Kunst, die für ihn untrennbar mit der Freiheit verbunden ist. Doch trotz seiner eindeutig vorgetragenen Positionsbestimmung von Künstler und Schriftsteller einschließlich ihrer Aufgaben wird sein Werk – besonders für Schüler – heute immer noch auf die Bestimmung des Absurden reduziert. Erst allmählich entsteht in der Öffentlichkeit ein anderes Bild von Camus.1 Das liegt nicht daran, dass seine Gegner, die sein Werk in einseitiger Weise zu ihren Zwecken vereinnahmen wollten, aufgegeben haben oder heute verstummt sind: es liegt eher daran, dass man sich an Camus als einen Intellektuellen erinnert, dessen Typ heute vermisst wird. Sein präzise aufeinander abgestimmtes fiktionales und theoretisches Werk, das die neue Pl¦iade-Ausgabe vorlegt, stellt ihn als Romancier, Theoretiker, Theaterautor, Journalisten, Intellektuellen und auch
1 Vgl. J. Altwegg, Das Comeback des ersten Menschen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. Dezember 2009; N. Minkmar, Das Mißverständnis. Soviel mehr als Sisyphos. Die neue Ausgabe seiner Werke in Frankreich revidiert unser Bild von Camus, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 21. Mai 2006. In der Radiosendung am 17. Januar 2010: »›Les yeux ouverts‹: regard sur l’œuvre d’Albert Camus« von Canal Acad¦mique (www.canalacademie. com/ida5309-Les-yeux-ouverts-regard-sur-l.html – 12. 3. 2010) erinnerte P.-L. Rey, der rund 40 Einträge für den Dictionnaire Albert Camus, hrsg. v. Y. Gu¦rin, Paris 2009, verfasst hat, daran, dass es noch heute Erstaunen hervorrufen würde, wenn man Camus als einen Künstler bezeichnen würde. In dieser Sendung weist Rey auch darauf hin, wie systematisch Camus die Aufgaben des Künstlers besonders in Le mythe de Sisyphe und in L’homme r¦volt¦ dargestellt hat. Vgl. E. Cazenave, Albert Camus et le monde de l’Art, 1913 – 1960, Anet 2009.
174
Heiner Wittmann (Stuttgart)
als einen Künstler vor, der sich immer wieder mit Nachdruck zu tagespolitischen Fragen deutlich und vernehmbar zu Wort meldet. Es ist müßig, nach der größeren oder geringeren Bedeutung Sartres oder Camus’ zu fragen. Camus war mehr Schriftsteller, Sartre mehr Philosoph. Beide vertraten trotz politischer Differenzen in ihrem Gesamtwerk die Auffassung, dass Freiheit und Kunst untrennbar sind. Sartre verband Literatur und Philosophie in seinem Werk durch Künstlerporträts.2 Es geht immer wieder um die Frage, wie bildende Künstler, Dichter und Schriftsteller ihre Freiheit zugunsten neuer Entwicklungen in der Kunst einsetzen und umgekehrt, wie sie ihre Kunst als Bestätigung der Freiheit des Menschen ausüben. So wie Sartre die Grundzüge seiner Philosophie am Ende von L’imaginaire definiert, so hat sich Camus ebenfalls in seinen frühen Schriften wie in »L’art de la communion«3 (vor 1933) mit der Kunst beschäftigt und sein ganzes Werk als eine Interpretation ästhetischer Reflexionen verstanden. Dies bestätigen auch die Einträge in seinen Tagebüchern. Freiheit und Kunst bedeuten für ihn die unabdingbare Grundlage für jeden Künstler ; mit der Revolte jedoch geht er noch einen Schritt weiter. Die Auflehnung des Künstlers gegen die als absurd empfundene Welt ist eine Revolte, die er auch den Ideologien, die die Freiheit der Kunst beschneiden wollen, nachdrücklich entgegenstellt. Die Verbindung von Kunst und Freiheit, die er in seiner Nobelpreisrede in Stockholm vorträgt, beruft sich auf sein Gesamtwerk. Er trägt in seiner Dankesrede keine abstrakten Forderungen vor, sondern den Kern seines Selbstverständnisses und die Überlegenheit der Kunst über Ideologien und Politik.4 Die folgenden Überlegungen fragen folglich nach der Tragweite der Ästhetik im Werk Camus’. In welchem Verhältnis steht seine Ideologiekritik zu seinen Aussagen über die Kunst? In seiner Nobelpreisrede erscheinen mehrere Entwicklungslinien seines Werkes. Die zahlreichen Einträge zur Kunst in seinen Tagebüchern5, die als Einleitungen und Kommentare zu seinen Werken zu verstehen sind, belegen sein Interesse für ästhetische Fragen. Schon in Le mythe de Sisyphe weist er auf die grundsätzliche Bedeutung der Kunst hin.6 Mit L’homme 2 Vgl. H. Wittmann, Sartre und die Kunst. Die Porträtstudien von Tintoretto bis Flaubert, Tübingen 1996. 3 Vgl. im Folgenden A. Camus, Le mythe de Sisyphe, in: ders., Œuvres complÀtes, t. I, 1931 – 1944, hrsg. v. J. L¦vi-Valensi, Paris 2006, S. 960 – 965. 4 Dies gilt auch für das Werk von Jean-Paul Sartre, vgl. H. Wittmann, Aesthetics in Sartre and Camus. The Challenge of Freedom, Reihe Dialoghi / Dialogues. Literatur und Kultur Italiens und Frankreichs, hrsg. v. D. Hoeges, Band 13, Frankfurt/M. 2009, S. 7. 5 Vgl. A. Camus, Carnets. Mai 1935 – d¦cembre 1948, in: ders., Œuvres complÀtes, t. II, 1945 – 1948, hrsg. v. J. L¦vi-Valensi, Paris 2006, S. 1029, vgl. A. Camus, Carnets. F¦vrier 1949 – d¦cembre 1959, in: ders., Œuvres complÀtes, t. IV, 1957 – 1959, hrsg. v. R. Gay-Crosier, Paris, 2008, S. 1079, 1100. 6 Vgl. A. Camus, Le mythe de Sisyphe, in: ders., Œuvres complÀtes, t. I, a. a. O., S. 283 – 300.
Kunst und Moral. Albert Camus und seine Nobelpreisrede
175
r¦volt¦ (1951) entwickelt er eine Ideologiekritik, die auf heftige Kritik seiner Rezensenten trifft. Er besteht auf seiner Position und benutzt einen Begriff der Revolte, der gegen die Welt gerichtet ist, und der die Bedeutung der politischen Revolte, die seine Gegner im Sinn haben, übersteigt.
Die Kunst als eine Revolte gegen die Welt Camus’ Kunstbegriff ist auf zwei Ebenen zu analysieren, die sich gegenseitig bedingen. Le mythe de Sisyphe konzentriert sich auf eine Diagnose des Absurden und bringt die Kunst in eine Verbindung mit den Leidenschaften des Menschen, der das Ausmaß seiner Lage begriffen hat. L’homme r¦volt¦ formuliert eine Theorie der Kunst und des künstlerischen Schaffens. Das Kapitel »L’art et la r¦volte« in L’homme r¦volt¦7 systematisiert die Ergebnisse seiner Untersuchung unter dem Aspekt der Ästhetik. Die anderen Formen der Revolte, die er in den vorhergehenden Kapiteln dargestellt hatte, lassen die Revolte als eine Bewegung der Verweigerung und zugleich als die eines Neuanfangs erscheinen. Die historische Betrachtung zeigt, wie Revolten immer wieder in Gefahr geraten, ihre Ziele zu verfehlen und in den Terror abzugleiten. Indem die Kunst ausdrücklich in den Dienst der Revolte gestellt wird, erweitert sich der Anspruch der Kunst, ohne deren Grundlage jede Revolte ihre Bestimmung verfehlen wird. Folgt man dieser Argumentation, wird die Kunst zum Korrektiv der Revolte. Die Kunst ist eine Revolte gegen die Welt in dem Sinne, wie diese unvollkommen ist. Mit dieser Bemerkung knüpft Camus wieder an die Ergebnisse von Le mythe de Sisyphe an. Aber hier geht er weiter, denn es ist die Aufgabe des Künstlers, der Realität eine andere Form zu geben. Die Kunst versteht er von daher weder als eine völlige Verweigerung noch als eine Ablehnung dessen, was ist. Es ist die Sache des Künstlers, darüber zu entscheiden, wieviel Realität ein Werk verlieren darf. Mit diesen Bemerkungen wiederholt er einen der wichtigsten ästhetischen Ansprüche, die er an ein Werk stellt: Zu den größten Werken gehörten die, so lautet sein Kriterium, in denen der Künstler eine Balance zwischen der Realität und der Verweigerung bewahrt. Diese Aussage ist keine bloße Empfehlung, sie enthält eine Aufforderung und zugleich eine Bedingung. Diese Balance kann dem Künstler nur dann gelingen, wenn er bereit ist, das Los aller zu teilen, und sein Werk nicht auf Hass und Missachtung gründet. Dieser Anspruch wird auch auf die Gestaltung des Werkes selber übertragen. Erst wenn auch im Werk diese schwierige Balance zwischen der Schönheit und dem Schmerz gehalten wird, kann der Künstler auf einem 7 A. Camus, L’homme r¦volt¦, in: ders., Œuvres complÀtes, t. III, 1949 – 1956, hrsg. v. R. GayCroisier, Paris 2008, S. 278 – 299.
176
Heiner Wittmann (Stuttgart)
schmalen Grat seine persönliche Gestaltungsfreiheit und damit die Freiheit der Kunst finden, an der, so kann der Gedanke weitergeführt werden, alle teilhaben können. Werke, die diese Bemühungen nicht erkennen lassen, verbannt Camus in den Bereich des Nihilismus und der Sterilität. Die Schönheit ist für Camus nicht der alleinige Maßstab zur Beurteilung eines Werkes. Er konzentriert seine Ästhetik auf die Analyse der Stellung des Menschen in der Welt. Die Gewissheit, dass die Absurdität nicht aufhebbar ist, fordert die Handlungen des Menschen geradezu heraus. Absurdität und Revolte ergänzen einander. Die Revolte gründet für Camus auf einem individuellen Werturteil, mit dem der Rebell sich gegen eine bestimmte Situation auflehnt. In L’¦tranger fügt Meursault sich dem Unausweichlichen, nicht ohne vorher seinem Beichtvater die Absurdität seiner Situation unmissverständlich verdeutlicht zu haben. Rieux in La peste ruft mit seiner Revolte gegen das Übel der Seuche andere erfolgreich zum Widerstand auf und besteht einen zunächst aussichtslosen Kampf siegreich. Die unterschiedlichen Situationen der Protagonisten seiner Romane, Theaterstücke und Erzählungen geben zu erkennen, dass Camus keine eindeutige Moral, die dem Menschen helfen könnte, seine absurde Lage zu akzeptieren, formulieren möchte. Ihm geht es zuerst um ein Verständnis der Absurdität, dann um ihre Beschreibung durch die Kunst und den Künstler, wodurch die Handlungsspielräume auch gegenüber einem ungewissen Schicksal erkannt werden können. Die ästhetische Form seiner literarischen Werke sollte das Thema einer eigenen Untersuchung sein, die aber hier nicht erörtert wird. Es ist die Ästhetik im Sinne einer Beschreibung und einer Rechtfertigung der Welt, die der Mensch dem Absurden entgegensetzt,8 notiert Camus Ende 1942 in sein Tagebuch. Diese Bemerkung wurde zu seinem Programm und zum Kern seines ästhetischen Ansatzes. In der Spannung gegenüber der Welt bleibt dem Menschen das eigene Werk als einzige Chance, sein Bewusstsein zu bewahren. Schöpfen heißt zweimal leben,9 lautet hier die Zusammenfassung dieses Gedankens. Die Kunst eröffnet den Menschen Möglichkeiten und Ansätze, ihre eigenen Werte zu erkennen und so etwas Neues zu schaffen. Diesen Aspekt bewahrt sich die Kunst nur, wenn sie ihre Autonomie verteidigt, wenn sie ideologische Vorgaben verweigert und sich ohne Kompromisse der Verteidigung von Freiheit und Wahrheit verpflichtet fühlt. Diese spezifische Ästhetik hat Camus zum Mittelpunkt seines schriftstellerischen Schaffens gemacht, dessen Grundsätze er auch gegenüber den Widrigkeiten seiner Zeit nicht aufgegeben hat. Gerade in den Wirren des Krieges und der Besatzungszeit hat er in Le mythe de Sisyphe die 8 Vgl. A. Camus, Carnets. Mai 1935 – d¦cembre 1948, in: ders., Œuvres complÀtes, t. II, a. a. O., S. 994.: »Le monde absurde ne reÅoit qu’une justification esth¦tique.« 9 Vgl. Le mythe de Sisyphe, a. a. O., S. 283 f.: »Cr¦er, c’est vivre deux fois.«
Kunst und Moral. Albert Camus und seine Nobelpreisrede
177
Kunst als eine Antwort auf das Absurde und später in La peste Doktor Rieux als unerschrockenen Kämpfer gegen das Übel zum Wohl des Gemeinwesens dargestellt. Es ist sein unbestreitbarer Verdienst während der Kriegswirren, des folgenden Kalten Krieges und während des Algerienkonflikts auf der grundlegenden Bedeutung ästhetischer Reflexion nachdrücklich insistiert zu haben. Trotz der offenkundigen, im Übrigen unaufhebbaren Zeitgebundenheit verleiht Camus’ Ästhetik seinem Werk eine Aktualität, die nichts von ihrer Intensität verloren hat.
Die Anfänge: Kunst und Literatur Im Dezember 1938 gründet Camus zusammen mit Emmanuel RoblÀs die Zeitschrift Rivages10 mit dem Untertitel »Revue de culture m¦diterran¦enne«, zu deren Redaktionskomitee auch Jean Hytier (1899 – 1983) gehörte. Vor dem Erscheinen der dritten Nummer wird Rivages vom Vichy-Regime verboten. Zusammen mit Jean Grenier, Jacques Heurgon und Ren¦ Poirier gehörte Jean Hytier 1933 zu Camus’ Lehrern in der Universität von Algier. Von 1948 bis zu seiner Emeritierung 1967 lehrte Hytier an der Columbia-Universität in New York. In seiner Einleitung der ersten Ausgabe der Zeitschrift Rivages11 erläutert Camus die Idee für den Titel dieser Zeitschrift mit der Jugendbewegung und der Leidenschaft für den Menschen und seine Werke, die an den Ufern seines Landes entstanden sind. Die Zeitschrift soll sich allen Künsten widmen, besonders in einer Zeit, in der Doktrinen uns von der Welt trennen wollen, fügt Camus hinzu. In Jean Hytiers Buch Les arts de la litt¦rature12 findet Camus Ende 1942 einen Hinweis auf den Dramaturgen, der nur seinen eigenen Ideen folgt, unter der Bedingung, dass dies auch notwendig sei.13 Damit darf angenommen werden, dass ihm Hytiers Buch vertraut war. Es enthält sechs Essays, die die Poesie (1926), das Drama (1932), die Kunst des Romans (1939), die Literaturästhetik, die Literaturgeschichte und das künstlerische Verhalten (beide 1937) untersuchen. In seinem Vorwort formuliert Hytier die Hoffnung, der Leser möge verstehen, dass es notwendig sei, eine ästhetische Theorie für die Untersuchung literarischer Werke zu entwickeln. Außerdem betont er den Wunsch, die Theorie 10 Vgl. A. Camus, Rivages. Revue de culture m¦diterran¦enne, in: ders., Œuvres complÀtes, t. I, a. a. O., S. 869 – 871. Die Zeitschrift Rivages: revue de culture m¦diterran¦enne, N81, 1938, N82, 1939, Alger. 11 Vgl. im Folgenden Camus, Rivages, a. a. O. 12 Vgl. J. Hytier, Les arts de la litt¦rature, Paris 1945, S. 55, zuerst erschienen: Alger 1941. 13 Vgl. A. Camus, Carnets. Mai 1935 – d¦cembre 1948, in: ders., Œuvres complÀtes, t. II, a. a. O., S. 932.
178
Heiner Wittmann (Stuttgart)
auf die Literaturästhetik zu beschränken, ohne in die Philosophie oder in die Literaturgeschichte eintreten zu wollen. Wie bei einem Maler geht es beim Autor eines Romans um die Interpretation seiner Sichtweise und das Maß an Originalität, das er seinem Werk vermitteln konnte. Im Vergleich zur Realität wird der Roman als falsch erscheinen, er wird aber auch als »wahr erscheinen«, weil die Imagination des Autors die Illusion einer Welt erzeugen muss. Das Werk hat immer eine Art Gleichgewicht14 einzuhalten. Hytier bezeichnet dies als eine »conduite de mesure«, die Camus15 später immer wieder aufgreifen wird. Mitte 1950 notiert er in seinem Tagebuch eine Einteilung, wie er sich sein Werk vorstellt: »I. Le Mythe de Sisyphe (absurde). – II. Le Mythe de Prom¦th¦e (r¦volte). – III. Le Mythe de N¦mesis«.16 Schon Anfang 1947 erwähnt er in seinem Tagebuch N¦m¦sis, die Göttin des Maßes, und warnt alle, die das Maß überschreiten, vor ihrer Zerstörung.17 Anamnese und Diagnose finden im ersten Werkteil statt, dann folgt mit der Entscheidung eine Aktion, wobei die Revolte im Sinne Camus’ auch eine Haltung sein wird, die sich gegen die Unvollständigkeit der Welt richtet und die in ihren Ansprüchen und Zielen Verhältnismäßigkeit wahren muss. Die Revolte darf ihre eigenen Werte nicht verletzen. Dieses Maß als Kriterium, wie Camus es anwendet, stammt aus der Literaturkritik, womit sich der literaturhistorische und -ästhetische Ansatz von L’homme r¦volt¦ erklären lässt. Hytier versteht unter »mesure« keine Mäßigung, sondern etwas, das einem Ganzen eine angemessene Form und Struktur verleiht. Die Sammlung seiner sechs Essays sensibilisiert die Leser für die Tragweite ästhetischer Fragen. Diese Vorträge enthalten seine Ansätze zu einer Literaturkritik und vermitteln Schriftstellern und Künstlern Aufschluss über die Wirkung ihrer Werke. Darin liegt die Bedeutung von Hytiers Buch für Camus. Einzelne Parallelen zu bestimmten Sachverhalten könnten möglicherweise noch zusätzlich identifiziert werden, ohne aber dazu beizutragen, den grundsätzlichen Blick auf die Bedeutung der Ästhetik im Werk Camus’ noch weiter zu öffnen.
14 Vgl. J. Hytier, Les arts de la litt¦rature, a. a. O., S. 154 f. 15 Vgl. A. Camus, Noces Tipasa, in: ders., Noces, in: ders. Œuvres complÀtes, t. I, a. a. O., S. 106: »Ce n’est pas si facile de devenir ce qu’on est, de retrouver sa mesure profonde«, und S. 107: »Je comprends ici ce qu’on appelle gloire: le droit d’aimer sans mesure.« Vgl. den Abschnitt »Mesure et d¦mesure«, in: A. Camus, L’homme r¦volt¦, in: ders., Œuvres complÀtes, t. III, a. a. O., S. 313 – 316. 16 A. Camus, Carnets. F¦vrier 1949 – d¦cembre 1959, in: ders., Œuvres complÀtes, t. IV, S. 1093. 17 Vgl. A. Camus, Carnets. Mai 1935 – d¦cembre 1948, in: ders., Œuvres complÀtes, t. II, S. 1082.
Kunst und Moral. Albert Camus und seine Nobelpreisrede
179
Die Autonomie der Kunst Im Februar 1950 notiert Camus in seinem Tagebuch die Idee, ein Buch über die Ästhetik18 zu verfassen. Dieses Buch hat er nie geschrieben, aber die Analyse seiner theoretischen und erzählerischen Werke lässt sein Konzept der Autonomie der Kunst erkennen, das er mit seinem ganzen Gewicht den Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts entgegensetzt. Der Mensch stellt Fragen an die Welt, die vernunftwidrig schweigt, heißt es in Le mythe de Sisyphe. Aus diesem Zwiespalt entwickelt Camus das Absurde als eine Diagnose. Was folgt, ist die bereits erwähnte Aufforderung, das Absurde mit der Revolte anzunehmen. Angesichts der unauflösbaren Widersprüche des Menschen, denen er nicht entkommen kann, bedeutet das Denken, wie Camus es darlegt, eine Welt zu schaffen19, wobei die Kunst hilft, ein eigenes Universum zu begründen, eine Art Arrangement mit seinen Zweifeln und mit allem, was ihn von der Welt trennt. Indem er diese Aufgabe annimmt, stellt er die Bedingungen und ist für sie verantwortlich. Das ist sein ästhetischer Ansatz, den er der Absurdität entgegenstellt. Am Ende des Kapitels »La cr¦ation absurde« warnt Camus davor, den Respekt vor dem Absurden aufzugeben, denn wenn es nicht mehr den Zwiespalt und die Revolte illustriert, sondern für Illusionen steht, ist es nicht mehr zweckfrei.20 Kunstformen, die solche Hoffnungen nähren, haben sich vereinnahmen lassen. Dieses Räsonnement ist ein Plädoyer für die Autonomie der Kunst. Sie muss um ihrer Wirkung willen unabhängig bleiben. Im Vorwort der amerikanischen Ausgabe (September 1955) von Le mythe de Sisyphe21 kommt das Absurde nicht vor. Stattdessen resümiert er hier die Untersuchung mit der Frage nach dem Selbstmord, der sich als illegitim erweist, selbst wenn man nicht an Gott glaubt. Inmitten des französischen und europäischen Desasters von 1940 legt das Buch dar, dass es selbst inmitten des Nihilismus etwas gebe, wodurch er überwunden werde. Le mythe de Sisyphe ist für seinen Autor eine Einladung, mitten in der Wüste zu leben und etwas zu erschaffen. Es geht um eine Balance zwischen Zustimmung und Verweigerung, die den Künstler und seine Berufung definiert. Die amerikanischen Leser sollten in diesem Buch alle Überlegungen des Künstlers über seine Gründe, die ihn zum Leben und zum Arbeiten veranlassen, wiederfinden. Im Zusammenhang mit der Kunst kann der Gebrauch des Adjektivs absurd zu 18 Vgl. A. Camus, Carnets. F¦vrier 1949 – d¦cembre 1959, in: ders., Œuvres complÀtes, t. IV, S. 1079. 19 Vgl. im Folgenden A. Camus, Le mythe de Sisyphe, in: ders., Œuvres complÀtes, t. I, a. a. O., S. 287 – 290. 20 Vgl. ders., Le mythe de Sisyphe, a. a. O., S. 289. 21 Vgl. A. Camus, Pr¦face l’¦dition am¦ricaine, in: ders., Œuvres complÀtes, t. III, a. a. O., S. 955 f.
180
Heiner Wittmann (Stuttgart)
Missverständnissen verleiten, wenn Camus vom Künstler als dem absurdesten der Menschen spricht.22 Gemeint ist in diesem Zusammenhang nicht eine Sinnlosigkeit seines Handelns und seiner Werke, sondern es geht gerade um die Einsicht in die Absurdität seiner Situation als eine Vorbedingung, die es ihm erst ermöglicht, über sein ganzes künstlerisches Potential verfügen zu können. Autonomie und Verantwortung sind zwei der wesentlichen Qualitätsmerkmale, die mit Camus’ Ästhetik verbunden sind.
Kunst und Politik als Revolte gegen die Welt 1946 sagt Camus in seiner Artikelserie Ni victimes ni bourreaux in Combat23 den Ideologien und besonders dem Marxismus den Kampf an: Konservative oder sozialistische Politikansätze werden sich künftig nicht mehr nur in einem nationalen Rahmen ausbreiten, und folglich werde es den einsamen Revolutionär nicht mehr geben können. Nationale Lösungen oder gar kontinentale Lösungen stellt er in Abrede, die neue Ordnung kann für ihn nur universal sein. Es gibt heute keine Inseln mehr, stellt Camus fest, und die Grenzen sind unnütz. Auf diese Weise definiert er in wenigen Sätzen das, was heute als »Globalisierung« bezeichnet wird, und formuliert zugleich ihre Folgen, die den Ideologien jeden Nährboden entziehen. Die Ideologiekritik hat er in seinem Vortrag »Le t¦moin de la libert¦«, den er am 20. Dezember 1948 anlässlich eines internationalen Schriftstellerkongresses gehalten hat, verschärft.24 Im Mittelpunkt dieses Vortrags stehen die enge Verbindung von Kunst und Politik sowie die Aufgaben des Künstlers. Im ersten Satz nennt er das Thema und die Stoßrichtung seines Angriffs: »Mittelmäßige und grausame Ideologien« bewegen die Menschen, die vor allem Scham empfinden. Er warnt die Künstler davor, sich ihre Aufgaben diktieren und sich von einer Ideologie vereinnahmen zu lassen. Er bezeichnet Politik und Kunst als zwei Seiten derselben Revolte gegen die Unordnung der Welt. Die Kunst ist ein Bollwerk gegen die Ideologien. Das Kunstwerk ist ihnen überlegen, denn es stellt sich den Eroberungen der Ideologie entgegen, so lautet Camus’ Urteil. Der Künstler, der seine Aufgabe nicht im Kampf, sondern durch die Kunst gefunden habe, ist in erster Linie »ein Zeuge der Freiheit«. Kein Künstler kann sich diesem Engagement entziehen, um sich stattdessen auf eine Moral oder eine Tugend zu berufen. Angesichts des Unglücks in der Welt ist es eine Aufgabe des Künstlers, sich dieser Welt entgegenzustellen, denn er muss mit seiner Kunst zum Ver22 Vgl. ders., Le mythe de Sisyphe, a.a.o., S. 282. 23 Vgl. Camus, Le t¦moin de la libert¦, in: ders., Œuvres complÀtes, t. II, a. a. O., S. 492 f. 24 Vgl. im Folgenden, Camus, Le t¦moin de la libert¦, a. a. O., S. 488 – 495.
Kunst und Moral. Albert Camus und seine Nobelpreisrede
181
ständnis dieser Welt beitragen. Aus der Beschreibung der Welt entwickelt sich der Widerstand, den Camus als kompromisslose Haltung vom Künstler fordert. Er bezeichnet die Verweigerung ohne Zugeständnis oder den Verzicht auf die Kunst als die einzige kohärente Haltung des Künstlers. Mit diesen Überlegungen warnt Camus den Künstler davor, jemals ein Komplize derer zu werden, die sich der Sprache und der Mittel der Ideologie bedienen. Er setzt sich in kompromissloser Weise für den Anspruch der Kunst ein, die er den Ideologien für überlegen hält. Kunst bedeutet für ihn Dialog, denn alle Künstler, so die Schlussbemerkung seines Vortrags, haben die Aufgabe, bis zum Ende das Recht ihrer Gegner zu verteidigen, nicht ihrer Ansicht zu sein. 1951 präzisiert Camus seine Überlegungen mit einer historisch und vor allem literaturhistorisch fundierten Analyse und trifft mit L’homme r¦volt¦ zielsicher einen besonders empfindlichen Nerv seiner Zeit. Die Revolte, die Werte schaffen soll, wird als Korrektiv der Revolution an die Seite gestellt. L’homme r¦volt¦ untersucht die Möglichkeiten, Aufgaben und Pflichten der Schriftsteller, Intellektuellen und Künstler angesichts einer Politik, die sich von jeder Moral entfernt hat. Die Distanz zwischen Moral und Politik ist hingegen nicht das Ergebnis dieses Essays; es geht um die Frage, inwieweit Moral Macht beeinflussen kann,25 und wie der Verlust von Werten verhindert und damit ein Scheitern der Revolte abgewehrt werden kann. Gibt es fundamentale moralische Werte, die trotz aller gegenteiligen Anzeichen direkt oder indirekt das Handeln der Menschen bestimmen können? Diese Frage wird auf der ersten Seite des Essays beantwortet. Der Ursprung jeder Revolte ist eine Verweigerung, die mit dem, was für den Rebellen einen Wert bedeutet, begründet wird. Die Kriegswirren und der folgende Kalte Krieg hatten die Auseinandersetzung um die Kunst zu kurz kommen lassen, und Camus greift mit einem neuen Ansatz in L’homme r¦volt¦ das Thema der Kunst wieder auf. Er versucht, die Revolte aus einer historischen Rückschau herzuleiten und zu begründen, wobei er in erster Linie eine Literaturgeschichte statt einer politischen Geschichte vorlegt. Gerade in Hinsicht auf die Unterscheidung zwischen Revolte und Revolution kann er sich aber inmitten des Kalten Krieges einer Interpretation der Nachkriegsideologien, besonders des Marxismus, nicht verschließen. Dabei verliert er nie seine Perspektive aus dem Blick, aus der heraus er die ideologischen Grundsätze vieler anderer kritisch betrachtet. Das Ergebnis ist von denjenigen, die nicht bereit waren, sich auf seine Argumentation einzulassen, scharf kritisiert worden. Francis Jeanson schreibt einen herben Verriss von L’homme 25 Zur Moral, Macht und Politik vgl. D. Hoeges, Niccolý Machiavelli. Die Macht und der Schein, München 2000, ders. Niccolý Machiavelli. Dichter – Poeta. Mit sämtlichen Gedichten, deutsch/italienisch. Con tutte le poesie, tedesco/italiano, Peter Lang Verlag, Frankfurt/M. u. a. 2006; jetzt auch ders., Niccolý Machiavelli, Il principe: Ein Kunstwerk, in: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, 33. Jg, 3/4/2009, S. 435.
182
Heiner Wittmann (Stuttgart)
r¦volt¦, der in den Temps Modernes erscheint.26 Der folgende öffentlich ausgetragene Streit zwischen Camus und Sartre spielt sich nur auf einer politischen Ebene ab und erreicht keinesfalls das ästhetische Niveau ihrer Werke. Die ideologisch aufgeheizten Debatten in den Jahrzehnten nach Kriegsende haben dazu geführt, dass bei Camus – übrigens auch bei Sartre – die herausragende Bedeutung der Kunst für ihr Gesamtwerk nicht wahrgenommen wurde. Die Beurteilung der Ideologien und ihrer Gefahren, die beide artikulierten, ging nicht aus ihren unmittelbaren zeitgeschichtlichen Erlebnissen, sondern aus ihren Überlegungen zur Kunst hervor, mit denen für beide die Forderung nach einer absoluten Freiheit für den Künstler als einer conditio sine qua non seines Schaffens verbunden ist. Es waren also nicht die politischen Auseinandersetzungen, die ihre Werke bestimmten. Beide ließen sich in ihren Reaktionen auf die Politik ihrer Zeit von ästhetischen und moralischen Überlegungen leiten, die ihren Ursprung in ihren Werken hatten. Mit der Revolte begründet Camus in L’homme r¦volt¦ nur zum Teil seine Haltung gegenüber dem Absurden. Die ästhetische Dimension bestimmt seine Argumentation, mit der in diesem Essay der Künstler und damit die Kunst selbst zum eigentlichen Träger der Revolte wird. Die Revolte ist kein Selbstzweck, sie ist auch kein einzelner Akt, sondern sie wird als eine Haltung definiert, und diese wird am besten durch den Künstler verkörpert, der zum Vorbild wird. Die Kunst gilt als seine Moral, heißt es in L’homme r¦volt¦27: Die Moral ist nicht das einzige Kriterium, nach dem die Revolte beurteilt wird. Die Kunst erhält in L’homme r¦volt¦ wegen ihrer Fähigkeit, etwas Neues zu schaffen, einen besonderen Stellenwert.
Revolte, Kunst und Freiheit Aus den Parallelen zwischen Revolte und Kunst wird die Überlegenheit der Revolte gegenüber der Revolution hergeleitet. Dieser Ansatz machte das Buch in den Augen vieler und besonders in denen seiner Gegner zu einer politischen Untersuchung. Es wird dadurch besonders angreifbar, obgleich eine deutliche Distanz in Form des literaturgeschichtlichen Ansatzes seiner Argumentation zu 26 Vgl. F. Jeanson, Albert Camus ou l’me r¦volt¦e, in: Les Temps modernes 79, Paris 1952, S. 2070 – 2090. Vgl. auch A. Camus, R¦volte et servitude, in: ders., Œuvres complÀtes, t. III, a. a. O., S. 412 – 434; J.-P. Sartre, R¦ponse Albert Camus, in: ders., Situations, IV. Portraits, Paris 1964, S. 90 – 125.Vgl. auch: F. Jeanson, Pour tout vous dire, in: Les Temps modernes 82, August 1952, S. 354 – 383. Vgl. H. Wittmann, Albert Camus. Kunst und Moral, a. a. O., S. 85 – 100. 27 Vgl. A. Camus, Carnets. Mai 1935 – d¦cembre 1948, in: ders., Œuvres complÀtes, t. III, a. a. O., S. 106.
Kunst und Moral. Albert Camus und seine Nobelpreisrede
183
den akuten Fragen und Problemen nicht zu übersehen ist, die aus den Vorgängen des Kalten Krieges resultieren. Mit der Geschichte der Revolte, die sich auf Schriftsteller und Intellektuelle stützt, wird mit L’homme r¦volt¦ gezeigt, dass es nicht ausreicht, eine Kritik an den Ideologien lediglich auf einer politischen Ebene zu formulieren. Diese historische und ästhetische Dimension des Werkes wurde zu Beginn der fünfziger Jahren geflissentlich übersehen. Sie passte seinen Kritikern nicht in ihr Konzept. Zu aufgeladen waren die Fronten im Kalten Krieg. Die Vorhersage, dass alle Revolutionen, die ihre Grundlagen vernachlässigen, einen totalitären Charakter annehmen und scheitern, war ein Vorgriff auf die Zeitenwende von 1989. Die Kritik am Marxismus, die in L’homme r¦volt¦ unter der Überschrift »Das Scheitern der Prophezeiung«28 zusammengefasst wird, macht aus Camus Anfang der fünfziger Jahre einen Außenseiter. War er hellsichtiger als seine Gegner? Auf jeden Fall hatte er den Weg der Desillusionierung, den andere noch vor sich hatten, nach seinem kurzen Zwischenspiel 1936 als Mitglied der P.C.F. bereits lange hinter sich.29 In Bezug auf seine eigene Epoche zeigt er sich überzeugt, dass die ideologischen Auseinandersetzungen die Kunst vor neue Herausforderungen stellen würden. Sein Essay über die Revolte war ein Aufruf, dieser Gefährdung der Kunst entgegenzutreten. Wer die in seinem Essay beschworenen Gefahren und die ästhetischen Perspektiven nicht wahrhaben wollte oder aus politischen Gründen egoistische Ziele vertrat, musste das Buch gründlich missverstehen. Die kollektiven Leidenschaften – so kennzeichnet dieser Essay die Situation nach dem Krieg und meint damit die Ideologien – gewannen die Oberhand über die individuellen Leidenschaften. Gegenüber einem solchen Totalitätsanspruch bleibt nur noch die Hoffnung, dass die Schöpfung und damit die Kunst die Einheit bewahren wird. Camus warnt vor diesem Spannungsverhältnis, dem der Künstler nicht entkommen kann. In L’homme r¦volt¦ erscheint die Grenze zwischen Kunst und Politik nur in den Augen der möglichen Gegner dieses Essays verschleiert. Tatsächlich erhält die Kunst in diesem Essay eine präzise definierte Position auch im Rahmen der Politik. Mit dem literaturhistorischen Ansatz des Essays wird unmissverständlich die Bedeutung der Schriftsteller und Künstler als Vordenker gesellschaftlicher Veränderungen präzise benannt.30 Revolutionen sind kurzfristige Ereig28 Vgl. A. Camus, L’homme r¦volt¦, a. a. O., S. 244 – 255. 29 Vgl. J. Grenier, Correspondance. 1932 – 1960 (hg. v. M. Dobrenn), Paris 1981, S. 22 (A. C. an J. Grenier, 21. 8. [1935]): »Mais pr¦cis¦ment dans l’exp¦rience que je tenterai, je me refuserai toujours mettre entre la vie et l’homme un volume du Capital.« 30 Wie kann Literatur einen Beitrag zur Geschichte leisten, ohne ihre ästhetische Autonomie preiszugeben? Diese Frage bildet den verbindenden Leitgedanken der Aufsätze in der Festschrift für Dirk Hoeges. Vgl. C. Rohwetter, M. Slavuljica, H. Wittmann (Hrsg.), Literarische Autonomie und intellektuelles Engagement. Der Beitrag der französischen und ita-
184
Heiner Wittmann (Stuttgart)
nisse, die längerfristig von Literaten beeinflussbar sind, die aber auf Abwege geraten müssen, sobald diese ihre Tätigkeit in den Dienst der herrschenden Ideologien stellen. Historisch gesehen gilt dies auch für Revolten oder Rebellionen. Die Revolte, die der Autor im Sinn hat, baut auf eine Würde, die allen Menschen gemein ist. In diesem Rahmen umfasst die Kunst für den Menschen mehr als seine bloße Stellung in der Geschichte. Eine Distanz des Autors gegenüber der Geschichte oder der historischen Dimension des Menschen ist in diesen Zeilen aber nicht erkennbar. Die Kunst stärkt die Stellung des Menschen in der Geschichte, indem sie ihm Raum für den Ausdruck seiner persönlichen Überzeugungen, seinen Handlungsspielraum und damit Unabhängigkeit verleiht. Dies zielt auf seine Freiheit, gegen deren Einschränkung sein ganzes künstlerisches Schaffen gerichtet ist. Die unaufhebbare Verbindung von Kunst und Freiheit ist für die Interpretation und auch für die künftige Wirkung von Camus’ Werk von grundlegender Bedeutung. In seiner nicht datierten »Verteidigung von L’homme r¦volt¦«31, die nach dem Erscheinen kritischer Rezensionen zu seinem Buch entstanden ist, wiederholt er nachdrücklich, dass die Kunst einer herannahenden Katastrophe – gemeint sind die Konsequenzen, die sich aus der Konfrontation der kommunistischen und der westlichen Welt ergeben können – entgegengestellt werden muss. Seine Mahnung an die Adresse der Künstler, nicht untätig zu sein, ist ein leidenschaftlicher Aufruf, trotz oder gerade angesichts drohender Gefahren sich für ihre Werte einzusetzen.
Die Verantwortung des Künstlers Der Künstler ist niemandem Rechenschaft schuldig, er ist auf sich gestellt und nur so in der Lage, mit seiner Kunst etwas Neues zu schaffen. Er gibt der Welt eine Gestalt, die ihr fehlt. »Der Künstler erschafft die Welt seinerseits neu.«32 Aber der Künstler lebt nicht gelöst und frei von allen Bezügen. Er ist für die Freiheit und auch für die der Kunst verantwortlich. In seinem fiktionalen Werk, in seinen theoretischen Schriften und auch in sonstigen Beiträgen, die Camus z. B. für L’Express verfasst hat, sowie in seinen Stellungnahmen anlässlich verschiedener Interviews äußert er sich immer wieder zu den Aufgaben des Künstlers. lienischen Literatur zur europäischen Geschichte (15.–20. Jh.), Festschrift für Dirk Hoeges zum 60. Geburtstag, Frankfurt/M. 2004. 31 Vgl. A. Camus, D¦fense de »L’homme r¦volte’«, in: ders., Œuvres complÀtes, t. III, a. a. O., S. 366 – 378. 32 Vgl. A. Camus, L’homme r¦volt¦, in: ders., Œuvres complÀtes, t. III, a. a. O., S. 280. Übersetzt v. Vf. Vgl. im Folgenden S. 280 – 283.
Kunst und Moral. Albert Camus und seine Nobelpreisrede
185
»La vie d’artiste«33 erscheint am 20. Dezember 1955 in L’Express. Anlässlich eines Artikels über den Komponisten Tibor Harsanyi (1898 – 1954) und seine vergeblichen Bemühungen, die französische Staatsangehörigkeit zu erlangen, erinnert Camus an die Notiz eines Beamten bezüglich der Anfrage des Künstlers: Harsanyi übe einen Beruf aus, der in sozialer Hinsicht unnötig sei, hatte der Beamte festgestellt. Die Gesellschaft nimmt die Funktion und die Aufgaben des Künstlers nicht ernst, ihre einzige Anerkennung besteht in der Steuerlast, die ihnen aufgedrückt wird, stellt Camus fest. Was bleibt dem Künstler dann noch, um als ein Zeuge der Freiheit und seiner Unabhängigkeit aufzutreten? Von der Gesellschaft kann er sich nicht trennen, gerade weil er mit ihr solidarisch sein muss. Diese Forderung wird Camus zwei Jahre später in Stockholm mit Nachdruck erneut formulieren. Um die Würde seines Metiers zu begründen, bleibt dem Künstler nur das Bemühen um ein Verständnis dessen, was seine Arbeit behindert, und sich zu weigern, sich von der Gesellschaft abzusetzen. Privilegien sind nicht seine Sache, er benötigt sie nicht, er braucht nur seine Arbeit. Jedoch muss der Künstler ein Gleichgewicht zwischen Engagement und Vereinnahmung einhalten. Nur wenn er sich gleichzeitig gegen eine Knebelung seiner Kunst zur Wehr zu setzen weiß und seine Anstrengungen zugunsten seiner künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten nicht aufgibt und so seine Freiheit in der Gesellschaft behauptet, kann er eine andauernde Wirkung erzielen. In einem Interview mit Jean Bloch-Michel, das im Oktober 1957 unter der Überschrift »Le pari de notre g¦n¦ration« in Demain34 erscheint, wird Camus nach dem Engagement des Künstlers gefragt. Er kann sich nicht ohne Unterlass als Aktivist für etwas einsetzen. Aber auch der Elfenbeinturm bleibt ihm verwehrt, genauso wie er sich verausgabt, wenn er sich nur in der politischen Arena bewegt. Das Ziel der Kunst besteht für ihn darin, die Freiheit und die Verantwortung zu verstärken. In Bezug auf die Ideologien erinnert er an die Vorgänge in Ost-Berlin, Posen und Budapest, die den Zusammenbruch eines gigantischen Mythos bewirkt haben. Die wirkliche Kunst öffnet sich nur dem Künstler, der die Dramen seiner Zeit nicht ignoriert, sondern zu ihnen Stellung bezieht, und der seiner Zeit gegenüber Distanz zu wahren weiß. Diese Spannung, die ihn wachsenden Gefahren aussetzt, definiert seine Aufgabe. Camus greift diesen Gedanken in seiner Nobelpreisrede wieder auf, wenn er die Schönheit und die Gemeinschaft erwähnt, die beide für ihn Bezugspunkte seiner Kunst sind. 33 Vgl. im Folgenden: A. Camus, La vie d’artiste, in: ders., Œuvres complÀtes, t. III, a. a. O., S. 1062 – 1064. 34 Vgl. im Folgenden: A. Camus, Le pari de notre g¦n¦ration [L’artiste et son temps], in: ders., Œuvres complÀtes, t. IV, a. a. O., S. 582 – 588, ursprünglich erschienen in: Demain, Nr. 98, 24.–30. Oktober 1957 und unter dem Titel »L’artiste et son temps. Albert Camus, laur¦at du prix Nobel r¦pond aux questions de Jean Bloch-Michel«, in: Ocidente (Portugal), Nr. 237, janvier–juin 1958, S. 6 – 12.
186
Heiner Wittmann (Stuttgart)
Nach der Nobelpreisrede betont Camus erneut am 14. Dezember in einem Vortrag in der Universität von Uppsala35 die enge Verbundenheit des Künstlers mit seiner eigenen Zeit. Wie in Stockholm trägt er eine Positionsbestimmung des Künstlers vor. Nach einem kurzen historischen Abriss und der Zurückweisung des sozialistischen Realismus schlägt er eine Definition der Kunst vor. Der Schriftsteller kann sich nicht mehr isolieren, denn selbst sein Schweigen setzt ihn Vorwürfen aus. Heute ist der Künstler mitten im Geschehen, und das hat Folgen für die Kunst. Die Schaffung von Kunstwerken ist gefährlich geworden, und die Frage lautet, ob inmitten aller Schergen so vieler Ideologien die Freiheit der Schöpfung erhalten bleibt. Nicht der Staat bedroht die Kunst, sondern die Künstler selbst stellen ihr Talent in Frage. Die Folgen dieser Beobachtungen sind gravierend, weil sie den Künstler aufgrund seines eigenen Verschuldens zusätzlichen Gefahren aussetzen. »Ist Kunst ein verlogener Luxus?« lautet die zentrale Frage. Solche Art von Kunst könnte im Spiel sein, wenn Künstler sich äußern, ohne sich in das Geschehen einzumischen. Camus relativiert im Folgenden selbst diese Frage, da für ihn der Künstler seinen Platz mitten in der Arena hat. Er darf seine Revolte nicht verabsolutieren, ohne sich in zusätzliche Gefahr zu begeben. Es gibt eine Kunst, die sich nach den vermeintlichen Wünschen des Publikums richtet; die sich nur an Symbolen und Zeichen orientiert und zudem die Werte der Freiheit missachtet. In beiden Fällen führt die Kunst zur Zerstörung der Realität. Die Kunst, die Camus im Sinn hat, ist eine andere. Er warnt die Künstler davor, in erster Linie Brandstifter sein zu wollen, denn dann würde man sich immer mehr nur noch auf ihre Person konzentrieren und Kritik wie Zustimmung würden nur noch sporadisch und zufällig erteilt werden. Der zweite Abschnitt widmet sich dem Publikum, an das der Künstler sich wendet, und den Themen, über die er spricht. Im Wesentlichen geht es dabei um den Realismus, dessen Entwicklung zum sozialistischen Realismus nur Widersprüche erzeugt hat, und der zu einer Knechtschaft der Kunst geführt hat. Der sozialistische Realismus hat nichts mit der wirklich großen Kunst zu tun. Beide ästhetischen Ansätze, sowohl die Verweigerung aktueller Fragen als auch der Verzicht auf alles, was nicht aktuell ist, wie Camus den Realismus sozialistischer Prägung umschreibt, führen zur Lüge und zur Unterdrückung der Kunst. Im dritten Abschnitt entwickelt Camus eine Definition von Kunst. Noch deutlicher als in seiner Dankesrede erklärt er die Kunst zu einer Revolte besonders gegen das Flüchtige und Unfertige in der Welt. Die Kunst gibt der Realität eine andere Form, ohne den Bezug zur Realität aufzugeben. Kunst ist Zustimmung und Verweigerung zugleich, und je stärker die Auflehnung gegen 35 Vgl. A. Camus, Conf¦rence du 14 d¦cembre, in: ders., Œuvres complÀtes, t. IV, a. a. O., S. 245 – 265.
Kunst und Moral. Albert Camus und seine Nobelpreisrede
187
die Welt ist, umso mehr muss die Realität als ein Gegengewicht gegenüber der Revolte dienen. Die Bestimmung der Kunst als etwas, das der Realität eine andere Form gibt, orientiert sich hier nicht an der Aussagekraft oder der Wirkung, sondern sie untersucht nur ihr Verhältnis zur Realität. So eingeengt diese Definition auch erscheint, sie evoziert den Entstehungsprozess der Kunst und nimmt die Absichten und die Ziele des Künstlers in den Blick. Stimmt seine Justierung von Imagination und Realität, verliert er nicht die Chancen der Kunst aus den Augen, kann er etwas Neues entwickeln, wenn er die Freiheit bewahrt und seiner Verantwortung gerecht wird. Die Unabhängigkeit des Künstlers wird von einer martialisch anmutenden Definition des Intellektuellen begleitet. Der engagierte Künstler ist mit seinem Freiheitsanspruch ein Freischärler. Die Schönheit, die seine Ehrlichkeit begleitet, beruft sich nicht auf seinen Egoismus, sondern sie ist eine Lektion »harter Brüderlichkeit«. Wiederum fällt kein Wort über das Absurde, aber Camus stellt den Künstler vor seine Verantwortung und bestätigt, dass der Künstler sich künftig seiner Verantwortung nicht mehr entziehen kann. Er muss sich ihr stellen und Partei ergreifen. Jede Veröffentlichung ist ein Akt, und Camus weiß nur selbst zu gut, dass die Leidenschaften seiner Zeit nichts vergeben. Ob der Künstler es will oder nicht, sein öffentlicher Auftritt wird an seiner Haltung gemessen. Er begibt sich erst dann in Gefahr, wenn er an der Notwendigkeit seiner Kunst zweifelt. Heute wird gefragt, ob Kunst nicht nur ein verlogener Luxus sei, und man braucht sich nicht zu wundern, dass die Gesellschaft aus der Kunst kein Instrument der Befreiung gemacht hat, sondern eher eine Art Übung ohne besondere Konsequenzen, gerade geeignet zur Zerstreuung. Aus einer solchen Haltung entsteht die Unverantwortlichkeit des Künstlers, die Theorie des »l’art pour l’art« und zugleich die Einsamkeit des Künstlers, die dann aber nicht mehr von ihm selbst gewählt ist, sondern aus seiner Untätigkeit folgt, wie man hinzufügen darf. Die Zusammenfassung des Vortrags hebt noch einmal hervor, dass künftig Künstler sich ihrer Verantwortung bewusst sein müssen. Inmitten aller Gefahren gibt es eine Hoffnung. Der ständige Kampf muss nicht unbedingt die Zukunft prägen. Die großen Veränderungen kündigen sich leise an.36
36 Vgl. A. Camus, Conf¦rence du 14 d¦cembre 1957, in: ders., Œuvres complÀtes, t. IV, a. a. O., S. 265: »Les grandes id¦es, on l’a dit, viennent dans le monde sur les pattes de colombe. PeutÞtre alors, si nous prÞtions l’oreille, entendrions-nous, au milieu du vacarme des empires et des nations, comme un faible bruit d’ailes, le doux-remue-m¦nage de la vie et de l’espoir.«
188
Heiner Wittmann (Stuttgart)
Die Nobelpreisrede: Wahrheit und Freiheit Die Rede zur Verleihung des Nobelpreises am 10. Dezember 1957 in Stockholm37 war für Camus eine Gelegenheit, die Bedeutung der Kunst in ihrer unaufhebbaren Verbindung mit der Freiheit als eine Verpflichtung für ihn wie für alle Künstler hervorzuheben. Seine Rede vermittelt einen Schlüssel zum Verständnis seines Gesamtwerkes. Er spricht von der Kunst, ohne die er nicht leben kann. Sie verträgt keine Einsamkeit. Der Künstler teilt die Kunst mit allen anderen, einer Gemeinschaft, der er sich nicht entziehen kann. Er braucht aber auch die Schönheit als einen zweiten Bezugspunkt. Damit sind die beiden wichtigsten Faktoren seines ästhetischen Credos genannt. Zum einen sind es die Menschen, wobei er sich ausdrücklich nicht auf eine bestimmte Gruppe bezieht, und zum anderen ist es die Schönheit, die er als ästhetische Orientierung definiert.38 Der Versuch, die eigene innere Orientierung zu finden, gelingt ihm nur durch die Kunst und seine Definition der Rolle des Schriftstellers. Damit ist der Aufbau der Rede bezeichnet. Die Kunst ist ein Mittel, möglichst viele Menschen zu erreichen. Der Schriftsteller kann seine Kunst nur ausüben, wenn er sie nicht in den Dienst derer stellt, die Geschichte machen, sondern wenn er sich für die engagiert, die sie erleiden. Niemand ist dieser Aufgabe wirklich gewachsen. Nimmt der Schriftsteller aber die Verpflichtung zur Wahrheit und Freiheit an, kann er sich den Herausforderungen stellen, vorausgesetzt, er entzieht sich der Unterdrückung und weigert sich zu lügen. Achtet der Künstler nicht auf seine Unabhängigkeit, verliert er die Kunst als ein Mittel, sie gegen Unterdrückung einzusetzen. Wenn er der Tyrannei Zugeständnisse macht, wird es einsam um ihn. Die hier geäußerte Warnung ist nicht zu überhören. Sie wird deutlich und subtil zugleich vorgetragen. Der Schriftsteller wird sein selbstgewähltes Exil nur dann verlassen können, wenn er sein Freiheitsprivileg nutzt und die Mittel der Kunst einsetzt, um sich Gehör zu verschaffen. Der zweite Teil der Rede bezieht sich auf die Zeitgeschichte der vergangenen zwanzig Jahre, den Weltkrieg, den folgenden Kalten Krieg und die Perspektive der nuklearen Zerstörung. Schreiben zu können ist eine Ehre, die dazu verpflichtet, das Unglück und die Hoffnung mit allen zu teilen. Die Zeitgenossen sind heute einer besonderen Bedrohung ausgesetzt, die jeden Optimismus verbietet. Um die Situationsbeschreibung zu vervollständigen und die gemeinsamen Aufgaben zu skizzieren, verleiht er dem Wunsch Ausdruck, auch den 37 Vgl. im Folgenden: A. Camus, Discours de SuÀde. Discours du 10 d¦cembre 1957, in: ders., Œuvres complÀtes, t. IV, a. a. O. S. 237 – 242. Vgl. H. Wittmann, Albert Camus. Kunst und Moral, Reihe Dialoghi / Dialogues. Literatur und Kultur Italiens und Frankreichs, hrsg. v. D. Hoeges, Band 6, Frankfurt/M. 2002, S. 101 – 104. 38 Vgl. ders., Discours de SuÀde, a.a.O., S. 1072 ff.
Kunst und Moral. Albert Camus und seine Nobelpreisrede
189
Irrtum derjenigen zu verstehen, die sich aus Verzweiflung in die Nihilismen ihrer Epoche gestürzt haben. Deutlicher ist die Kritik an den Ideologien seiner Zeit kaum zu formulieren. Mit dieser Warnung vor den Nihilismen zielt er auf seine Kritiker, Jean-Paul Sartre und Francis Jeanson eingeschlossen, die ihn 1952 wegen L’homme r¦volt¦ angegriffen hatten, weil sie in erster Linie die darin enthaltene Ideologiekritik nicht teilten. Die meisten aber, so heißt es in der Rede, und damit drückt er seine Hoffnung aus, haben sich diesem Nihilismus verweigert. Jetzt geht es darum, den Frieden wiederherzustellen, der alle Menschen in eine Allianz einschließt, die sich auf Wahrheit und Freiheit gründet. Dieser Allianz soll die Ehre gelten, die mit diesem Preis verbunden ist. Camus versteht den Preis als eine Ehre für alle, die diesen Kampf teilen, keine Privilegien, sondern nur Unglück und Verfolgung kennen. Ihm geht es um eine Ästhetik des Engagements, die die Diagnose des Absurden hinter sich gelassen hat. Was bleibt, ist die unausgesprochene aber implizite Aufforderung, die sich an den Künstler richtet, das Absurde mittels der Revolte anzunehmen. Der dritte Teil der Rede nennt die Bedingungen, unter denen der Künstler erfolgreich sein kann. Er wird keine Moral formulieren können. Ebenso gibt es keine vordefinierten Lösungen für die Wahrheit, er muss sie immer wieder neu bestimmen. Die Freiheit ist gefährlich, weil sie auch berauschend wirken kann. Folglich kann der Schriftsteller kein Tugendprediger sein; er muss dennoch wissen, dass er die beiden Ziele, Freiheit und Wahrheit, vor sich hat. Camus justiert mit dieser Rede, die die Wörter absurd und Revolte nicht nennt, die Gewichte für die Interpretation seines Werkes. Übergeht man den ästhetischen Anspruch seiner Überlegungen durch die allseits bekannte einseitige Fixierung auf das Absurde, das heute immer noch als ein wichtiges Kennzeichen seines Werkes in den Vordergrund gestellt wird, muss man auch die Folgen einer solchen Interpretation zur Kenntnis nehmen. Die heute immer noch geläufige Interpretation der Werke von Camus kann in dem ihm gewidmeten Artikel der Online-Enzyklopädie Wikipedia (Stand: Mai 2010) nachgelesen werden. Dort wird das Absurde im Werk Camus’ als eine Trennung zwischen dem nach Sinn suchenden Menschen und einer sinnlosen Welt definiert. In dem gleichen Artikel wird auch der Tod als ein für Camus absolutes Ende bezeichnet, das wie das Leben keinen Sinn habe. Das ist die Folge davon, wenn mehrere Autoren der »kollektiven Intelligenz« sich an einer Interpretation versuchen, ohne das Werk zu kennen. An keiner Stelle spricht Camus von einer Sinnlosigkeit des Lebens, so etwas findet sich nur als Folge oberflächlicher Darstellungen, die bis zum Überdruss das Absurde wiederholen, ohne zum eigentlichen Kern seines Werkes vorzudringen. Solange Camus’ Werk mit der Definition des Absurden gleichgesetzt wird oder die Lektüre von Le mythe de Sisyphe nach der ersten Hälfte beendet wird, muss die ästhetische
190
Heiner Wittmann (Stuttgart)
Dimension seines Werkes unerkannt bleiben. Dann ist es einfach, seine Ideologiekritik auf eine nur politische Dimension zu reduzieren und gleichzeitig an den öffentlich ausgetragenen Streit mit Sartre zu erinnern, der zum definitiven Bruch ihrer Freundschaft führte. Lässt man diese biographischen Details hinter sich, um sich auf den Zusammenhang von Kunst, Revolte und Freiheit zu konzentrieren, so wie Le mythe de Sisyphe und L’homme r¦volt¦ ihn darlegen, treten Parallelen zum Werk von Sartre hervor, die sich zumindest auf einer theoretischen Ebene hinsichtlich der Unabhängigkeit des Intellektuellen mit Aussagen Camus’ decken.39 Im Gegensatz zu Camus wollte Sartre ein compagnon de route der P.C.F. sein, bevor er diesen Versuch 1956 aufgab. Aber seine Künstlerporträts zeigen in eindeutiger Weise, dass auch er die Freiheit und die Unabhängigkeit als eine conditio sine qua non jedes künstlerischen Schaffens versteht. Die Zeitenwende von 1989 hat Camus in Bezug auf seine Ideologiekritik Recht gegeben. Wenn man aber sein Verhältnis zu Sartre nicht allein auf die Politik reduziert, wird man in ihren Werken den gleichen dringenden Appell an die Freiheit finden, den beide in ihrer Prosa und in ihren theoretischen Schriften ausdrücklich formuliert haben.
Die Unmöglichkeit einer Moral Im Mittelpunkt von Camus’ Werken, seinen Romanen, Novellen, Theaterstücken, theoretischen Schriften und auch Zeitungsartikeln, steht immer wieder die berechtigte Weigerung, sich aufgrund moralischer Vorstellungen vereinnahmen zu lassen. In L’¦tranger ist Meursault einer Gesellschaft ausgeliefert, in der Moralvorstellungen diktiert werden, die zu seiner Hinrichtung beitragen. Kaliajev in Les justes hasst den Despotismus und verübt ein Attentat auf den Großherzog. Für ihn ist die Revolution eine Chance, die dem Leben gegeben werden muss.40 Rieux überzeugt in La peste seine Mitstreiter Rambert und Tarrou, dem Virus Widerstand zu leisten und die Hoffnung nicht zu vergessen. In La chute beklagt Jean-Baptiste Clamence in einer Amsterdamer Bar die Vorurteile und die Moralvorstellungen der Menschen. Gilbert Jonas in Camus’ Novelle »Jonas ou l’artiste au travail«, die 1957 in L’Exil et le royaume erscheint, denkt über die Chancen einer Ästhetik nach. »Solidaire« oder »solitaire« hatte er quer über seine Leinwand geschrieben.41 Das ist ein Hinweis auf die Moral: Der
39 Vgl. H. Wittmann, Aesthetics in Sartre and Camus. The Challenge of Freedom, a. a. O., S. 141 – 151. 40 Vgl. A. Camus, Les Justes, in: ders., Œuvres complÀtes, t. III, a. a. O., S. 13. 41 Vgl. A. Camus, Jonas ou l’artiste au travail, in: ders., Œuvres complÀtes, t. IV, a. a. O., S. 83.
Kunst und Moral. Albert Camus und seine Nobelpreisrede
191
Künstler kann sich seiner Verantwortung nie entziehen. Der Künstler sollte mit allen anderen solidarisch sein oder er bleibt alleine. Camus verbindet seine Ästhetik mit der Frage, ob aus der Kunst eine Regel abzuleiten sei. Tatsächlich hat er jedem seiner Werke wie u. a. Caligula, L’¦tranger, Le mythe de Sisyphe oder La Chute einen bestimmten Platz in seinem Gesamtwerk zugewiesen. In jedem dieser Werke sind einzelne Elemente erkennbar, die sich zu seiner Moral zusammenfügen lassen. Jedoch hat er diese eigenen Ansätze immer wieder in Frage gestellt und in seinen letzten Tagebucheintragungen sich skeptisch zu der Möglichkeit geäußert, überhaupt eine Moral formulieren zu können. Ein Eintrag im Juni 1959 kündigt die Aufgabe der moralischen Sichtweise an, weil sie zu Abstraktion und Ungerechtigkeit führt und Fanatismus und Blindheit fördert.42 Ihre Bilanz hat ihn enttäuscht. Aber das ist kein wirklicher Misserfolg. Die Notizen im Anhang zum Premier homme beziehen sich auf die Kunst und auf seine eigenen Motive, die man nicht von seinen Überlegungen zur Moral trennen kann: Das, was ihn immer unterstützt habe, sei »die große Vorstellung, die sehr große Vorstellung, die er sich immer von der Kunst gemacht habe.«43 Wenn er möglicherweise selbst glaubte, er sei mit seinem Versuch gescheitert, eine Moral auf dem Weg über die Kunst zu bestimmen, so gehört dennoch sein Ringen um den für ihn gültigen Wahrheitsgehalt einer Moral zum Kernbestand seiner Ästhetik. Die Analyse seiner unterschiedlichen Ansätze zeigt Kontinuitäten und Brüche in seinem Werk. Sie lassen sich aber dennoch zu einem Gesamtbild seines Werkes zusammenfügen, das dessen Eigenständigkeit belegen kann. So wenig wie es in der Politik keine festgeschriebene Moral gibt, kann es auch in der Kunst keine Moral geben. Daher ist einem Künstler keine Moral vorzuschreiben, aber Camus dringt darauf, ihn stets an die moralische Dimension seines Schaffens zu erinnern. Seine Ästhetik enthält die Einsicht, dass die für den Menschen absurde Welt sich seinem Bemühen, sie zu verstehen, nicht verschließt, sondern die Aktivität, mit der er ihr entgegentritt, geradezu herausfordert. In Camus’ Werk sind Kunst und Moral unmittelbar und in einer für sein ganzes Schaffen konstitutiven Art miteinander verbunden. Es ist die Ästhetik, die in seinem Werk seine moralischen Überlegungen überhaupt erst fundiert und verständlich werden lässt.
42 Vgl. A. Camus, Carnets. F¦vrier 1949 – d¦cembre 1959, a. a. O., S. 1298. 43 Vgl. A. Camus, Le premier homme, in: ders., Œuvres complÀtes, t. III, a. a. O., S. 945. In der neuen Ausgabe findet sich die Anmerkung, diese Passage sei von Camus gestrichen worden.
192
Heiner Wittmann (Stuttgart)
Zusammenfassung Die besondere Stellung der Kunst und die Bedeutung seines moralischen Ansatzes in seinen theoretischen Schriften in Verbindung mit seinem erzählerischen Werk wird erst verstanden, wenn man die Suche nach seinem ideologischen Standpunkt aufgibt und darauf verzichtet, ihn für die eine oder andere Ideologie zu vereinnahmen. Die Vielfalt in seinem Werk folgt keiner Beliebigkeit. Als Theaterautor, Schriftsteller, Künstler und Journalist verfolgt er systematisch die Verbindung von Literatur und Kunst, um deren gemeinsame Verantwortung gegenüber der Freiheit zu demonstrieren. Mit seinen Zeitungsartikeln in Combat und L’Express hat er die praktische Anwendung seiner Überlegungen unter Beweis gestellt, so wie diese von seinen Romanfiguren verkörpert werden. Trotz der offenkundigen Zeitgebundenheit seines Werkes bietet Camus’ Ästhetik auch heute noch eine besondere Aktualität, die die Freiheit der Kunst, den ungebundenen Standort des Künstlers, die enge Verbindung zwischen dem theoretischen und dem fiktionalen Werk und vor allem den Kampf gegen die politische Einseitigkeit in Form von Ideologien nachdrücklich bestätigt. Die Intellektuellen, Schriftsteller und Künstler sind mit ihren Werken den politischen Ideologien voraus. Die Ideologien nützen der Kunst nicht, sondern es ist die Freiheit, die der Kunst ihren Weg bahnt. Camus’ Werk weist auf einen epochalen Humanismus hin, den er aus den europäischen und globalen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts entwickelt. Der Existentialismus Camus’, seine Konzeption von Freiheit und Verantwortung, konstituiert sich im Wesentlichen über die Kunst.
II. Ästhetik: Narrativik und Dramatik
Willi Jung (Bonn)
Schuld und Gedächtnis – La Chute von Albert Camus
1.
Camus’ Werk im Spannungsverhältnis von Literatur und Philosophie
Jeder Roman ist eine ins Bild gesetzte Philosophie. Diese ästhetische Grundposition hat Camus in seinen großen theoretischen Schriften1 behandelt, das Spannungsverhältnis durchzieht das ganze Werk dieses noch relativ jung verstorbenen Ausnahmeschriftstellers (1913 – 1960). Überraschend schnell wurde der frühe Ruhm von Albert Camus in den Kriegsjahren zwischen 1942 und 1944 begründet: L’Etranger (1942) und Le mythe de Sisyphe (1942) wurden enthusiastisch aufgenommen, nicht weniger die Theaterstücke: Caligula wurde 1942 in Paris mit G¦rard Philipe erstaufgeführt, Le Malentendu 1944. Zwischen 1947 und 1951 bestätigte dann eine zweite Gruppe von Werken diesen Ruhm erneut: La peste (1947), die Theaterstücke L’Etat de siÀge (1948) und Les justes (1949) und ein zweites Essay, L’Homme r¦volt¦ (1951). Schon bald wurde jedoch ideologische Polemik laut in Les temps modernes gegen L’homme r¦volt¦, denn Sartre warf Camus eine idealistische, moralistische und antikommunistische Haltung vor. Ab 1956 kündigte sich dann eine dritte Gruppe von Werken an mit La chute (1956) und den sechs Novellen der Sammlung L’Exil et le Royaume (1957). Posthum erschien 1994 Le premier homme, vierunddreißig Jahre nach Camus’ Tod, herausgegeben von seiner Tochter Catherine.2
1 Vgl. die Kapitel »Philosophie et roman« (Le mythe de Sisyphe), in: Albert Camus, Œuvres complÀtes, t. I, 1931 – 1944, hrsg. v. Jacqueline L¦vi-Valensi, Paris 2006, S. 283 – 290; »Roman et r¦volte« (L’Homme r¦volt¦), in: Albert Camus, Œuvres complÀtes, t. III, 1949 – 1956, hrsg. v. Raymond Gay-Crosier, Paris 2008, S. 283 – 291. Vgl. auch Fr¦d¦ric Worms, La philosophie en France au XXe siÀcle. Moments, Paris 2009, S. 320 – 336. 2 Zu Albert Camus’ Leben und Werk vgl. die vorzügliche Monographie von Brigitte Sändig, Albert Camus, Hamburg 2000 (11995). Anläßlich des 50.Todestages von Albert Camus erschienen zahlreiche Artikel, besonders hervorzuheben ist der exzellente Beitrag von Iris Radisch, »Der Zeitgenosse unserer Träume«, in: DIE ZEIT (1) 2010. Zum 50. Todestag Camus’ erschien auch eine neue Biographie von Virgil Tanase, Camus, Paris 2010.
196
Willi Jung (Bonn)
Als Journalist hatte Camus zahlreiche politische Aufsätze und Artikel geschrieben, die er ab 1950 in drei Bänden unter dem Titel Actuelles herausgab. Nach seinem Tod erschienen 1962 die Carnets und schon 1965 eine zweibändige Pl¦iade-Ausgabe. In den Cahiers Albert Camus wurden einige Inedita, wie der unvollendete Jugendroman La mort heureuse, publiziert. Camus’ Werk wurde – wie bei wenigen Autoren zuvor – in einer zweiten vierbändigen Pl¦iade-Ausgabe in den Jahren von 2006 bis 2008 neu verlegt. Das zeitgenössische Echo auf ihn war groß. Sartre redete in einem Artikel zu L’Etranger einer abstrakten Deutung das Wort, derzufolge der Etranger die Illustration der im Mythe de Sisyphe entwickelten Theorie des Absurden sei.3 Orthodox marxistischen Kritikern missfiel Camus; diese Kritik war jedoch ungerecht, wie die späteren Analysen vor allem seiner fiktionalen Prosa zeigten. Im Hinblick auf diese ideologischen Positionierungen hat nicht zuletzt auch der Gang der Geschichte Camus’ visionäre Geschichtsphilosophie bestätigt. Camus selbst hatte sein Werk in den Carnets in Blöcke geordnet: »le cycle de l’Absurde«, »le cycle de la R¦volte«, »le cycle de la Mesure«, an letzterem arbeitete er bis zu seinem Tode; geplant war darüber hinaus der »cycle de l’Amour«. Jeder Zyklus stand im Zeichen einer emblematischen Figur : Sisyphos, Prometheus, Nemesis, und jeder sollte einen Erzähltext, Theaterstücke und einen Essay enthalten. Le mythe de Sisyphe diagnostiziert und vertreibt durch Reflexion und Bewusstmachung das »mal du siÀcle«, den latenten Nihilismus. Das Absurde ist, in der modernen, desakralisierten Welt, die Sackgasse, in der das zum Absoluten und Ganzen strebende Denken endet. Hier gründet der Nihilismus, der das Leben entwertet. Camus schlägt sich und dem Leser vor, nicht länger gegen die unlösbaren Paradoxa der condition humaine anzugehen, sondern sich dem zuzuwenden, was sich greifen lässt, nämlich dem menschlichen Glück. Es gilt, einen modernen, glücklichen Sisyphos zu erdenken, zu erfinden. In L’homme r¦volt¦ geht Camus der Frage der – prometheischen – Befreiung des Menschen von Göttern, Zwängen und Ordnungen im westlichen Denken nach. Er prüft diese Revolte auf ihrem Weg von der Befreiung zur totalitären – freiheits- und rechtsfeindlichen – Ideologie (Faschismus, Stalinismus) und Tyrannei. Der Essay endet mit einer kurzen ironischen Erzählung, die die Geschichte des modernen Prometheus erzählt. Unter der Maske des mythischen Helden entdeckt Camus eine weitere Maske: die des mystifizierenden Cäsar, der sich verlogen in die egoistische, sterile Selbstvergötzung einließ. Das positive Gegenthema ist die schöpferische Revolte, für die beispielhaft die Aktivität des Künstlers steht. 3 Jean-Paul Sartre, »Explication de L’Etranger«, in: ders., Situations I, Paris 1947, S. 99 – 121 (zuerst erschienen in Cahiers du Sud, Februar 1943).
Schuld und Gedächtnis – La Chute von Albert Camus
197
Beide Essays entsprechen dem dynamischen Rhythmus des Camus’schen Denkens, das, an sein Ende gekommen, den neuen Aufbruch beginnt und die Maskierungen immer neu aufdeckt. Nicht zuletzt an Zarathustras Bild des Künstlers und Nietzsche erinnert dieses Denken. Camus’ Helden, besonders Meursault (L’Etranger), erschaffen sich (in der IchErzählung) und ihre Geschichte selbst, allein im Wort und im Text und belassen mit ihrer Präsenz dem Leser seine Autonomie. La Peste ist sprachlich planvoll und kontrolliert als Zeugenbericht des Arztes in Oran, Dr. Rieux, in der 3. Person geschrieben. La chute ist im Wechsel Monolog und Dialog des Protagonisten, JeanBaptiste Clamence, des »juge-p¦nitent«, der in einer Bar in Amsterdam mit einem zufälligen Unterredner spricht, zu dessen alter Ego er sich macht. Dieser Monolog wird fortgesetzt in der Novelle Le Ren¦gat in der langen inneren Klage des stummen Renegaten-Priesters, die sich in der Wüste um ihn verliert. In den übrigen Novellen von L’Exil et le Royaume verwendet Camus die ErErzählung, bei weiterer Bemühung um die Autonomie derselben. Auch die scheinbar realistischen Novellen (Les muets, die Geschichte eines gescheiterten Streiks; L’húte, das Dilemma eines Lehrers auf dem algerischen Hochplateau) überschreiten die geographisch präzise lokalisierte Realität, die im Allgemeinen eine algerische Realität ist. Titel, Landschaften und Klima wirken wie Signale. Clamence ist in La Chute Gefangener der Nebel und der konzentrischen Kanäle Amsterdams, der Lehrer in L’Húte ist im Niemandsland zwischen Siedlern und Arabern. Die Bedeutung wird nie explizit gemacht, und auch wo, wie in La Peste, die Allegorie angekündigt wird, bleiben dunkle Räume, die sich weder aus der Okkupation – auf die Camus verweist – ganz erklären lassen noch aus der metaphysischen Thematik der condition humaine, die den Hintergrund bildet. La Peste, La Chute und Le Ren¦gat sind keine einfachen Texte, sie haben sich jeder endgültigen Exegese stets widersetzt. Camus’ Erzähltexte sind mythisch und mithin uneindeutig, ohne Schluss, mit der Frage endend. Meursault, der zum Tode Verurteilte, wird im Text nicht hingerichtet. Clamence kann seine Confessio, seine Beichte und Anklage morgen wieder neu beginnen, und niemand wird aus der Klage des Renegaten Illusion und Wirklichkeit vollends isolieren können. Camus erneuerte das Erzählen Gides, das in Nietzsche gründet, mit hoher poetischer Dichte und thematischer Fülle. Sartre hatte am Etranger die für Paris ungewohnte algerische Färbung hervorgehoben. Die Armenviertel von Alger und die prachtvolle Landschaft bilden tatsächlich die Pole von Camus’ Schreiben, etwa ab L’Envers et l’Endroit (1937) und Noces Tipasa (1938). Camus war Mitglied einer Gruppe von Algeriern – mit Claude de Fr¦minville, Gabriel Audisio, später Jules Roy und Emmanuel RoblÀs -, die einer neuen algerischen Kultur Heimatrecht geben wollten. Später beeinflussten Politik und R¦sistance-Teilnahme seinen »Cycle de la r¦volte«.
198
Willi Jung (Bonn)
Nach dem in der Peste beschriebenen langen Kampf gegen die gemachten politischen Erfahrungen braucht es dann viel Zeit, bis L’Exil et le Royaume abgeschlossen ist. Camus löst sich von der surrealistischen Ästhetik und dem Existentialismus, orientiert sich an klassischen Modellen, und er sucht die strenge Form. Dabei stellt er jedes Erklärungssystem, jede Ideologie in Frage, stellt zwischen Autor, Leser und Text, ab L’Etranger wenigstens, neue Verbindungen her. Die Person wird fortschreitend uneindeutiger, z. B. in La Chute und Le Ren¦gat, das Ende ist offen. Der Text bleibt in seiner eigenen, linguistisch-thematischen Logik verhaftet, ist nicht Abbild der beobachteten Realität oder deren subjektive Spiegelung. Die Fiktion enthüllt und verbirgt eine fiktive Subjektivität; den Sinn hat der Leser sozusagen nach zu erschaffen. Hier weist Camus vor auf den Nouveau Roman.
2.
Zur Entstehung und Thematik von La Chute
Nach dieser Charakterisierung des Camus’schen Werks soll nun La Chute unter der Fragestellung von Schuld und Gedächtnis näherhin analysiert werden. Im Oktober 1954 unternahm Camus eine Kurzreise nach Holland, die entscheidend zur Genese dieses Werks beitrug; denn Klima, Bilder und Landschaften Hollands gaben den Themen, die ihn damals beschäftigten, erst einen Rahmen. Dabei konnte keineswegs von einer realistischen Schilderung die Rede sein, Holland verkörperte für ihn vielmehr die Kehrseite des Mittelmeeres und des Lichts, das Land erschien ihm wie eine Vision, konkret und symbolträchtig zugleich. Nach Jacqueline L¦vi-Valensi ist zu vermuten, dass diese Holland-Reise zur Präzisierung seines Buchprojektes beitrug: im November 1954 notiert er : »Titre nouvelle: un puritain de notre temps«4. Etwas später äußerte er sich auch zu seinen damaligen Schreibblockaden, obgleich ihn viele Themen in diesem Zeitraum beschäftigt haben5. Eine Reise nach Italien führt ihn auch zu einer gedanklichen Auseinandersetzung mit dem Thema der Vorhimmel (Limbes)6, die ja im Stadtporträt Amsterdams eine Rolle spielen. Die Verleihung des Goncourt-Preises an Simone de Beauvoir im Dezember für Les mandarins lässt seinen Groll gegenüber den Existentialisten erneut aufflammen: »les actes douteux de la vie de Sartre me sont g¦n¦reusement coll¦s sur le dos«7; und zwei Tage später – Camus ist immer noch in Italien - findet sich jene entscheidende 4 5 6 7
Albert Camus, Carnets III (mars 1951-d¦cembre 1959), Gallimard 1989, S. 131. Ebd., S. 138. Ebd., S. 144. Ebd., S. 146 – 147.
Schuld und Gedächtnis – La Chute von Albert Camus
199
Notiz, d. h. der Begriff und das Wort selbst, die damals so neu und fruchtbar waren: der des »Juge-p¦nitent«, des Bußrichters: »Existentialisme. Quand ils s’accusent, on peut Þtre sr que c’est toujours pour accabler les autres. Des jugesp¦nitents«8. Der 1956 erschienene und als »Bericht« bezeichnete Roman La Chute9 ist für Jean-Paul Sartre »le plus beau peut-Þtre et le moins compris«10 der Bücher Camus’. Worum geht es in diesem Werk? In einer Amsterdamer Hafenkneipe, die in Anspielung auf Dantes Inferno als »Hölle« bezeichnet wird, wobei Amsterdam als »negative Landschaft« im Gegensatz zum mediterranen Süden steht11, macht ein Pariser Tourist die Bekanntschaft eines französischen 8 Ebd., S. 147. 9 Ausgaben: Paris 1956; Paris 1962 (in: Albert Camus, Th¦tre, r¦cits et nouvelles, hrsg. v. Roger Quilliot, Paris 1962 im Folgenden abgekürzt: TRN); Paris 1972 (Folio); Albert Camus, Œuvres complÀtes, t. III, 1949 – 1956, hrsg. v. Raymond Gay-Crosier, Paris 2008, S. 695 – 765, im Folgenden abgekürzt: Pl.III. Übersetzungen: Albert Camus, Der Fall. Ins Dt. übersetzt von Guido G. Meister, Hamburg 1957 (im Folgenden Camus, Der Fall); Albert Camus, Der Fall. Ins Dt. übersetzt von Guido G. Meister, Frankfurt a.M. 1963 (Bibliothek Suhrkamp); Albert Camus, Der Fall. Ins Dt. übersetzt von Guido G. Meister, Reinbek 1968; Albert Camus, Der Fall. Ins Dt. übertragen v. Georg Goyert, Berlin 1977; Albert Camus, Der Fall. Ins Dt. übersetzt von Guido G. Meister, Reinbek 1983 (zuletzt 1985 auch als rororo-Taschenbuchausgabe); Albert Camus, Der Fall, in: Juristische Zeitgeschichte, Berlin 2008, Bd. 34, mit einem Nachwort von Brigitte Sändig, einer klugen und überzeugenden Interpretation des Romans. Analysen: Louis Arsac/Arturo Horcajo/Marianne Revel-Mouroz (Hg.), Analyses et r¦flexions sur »La Chute« d’Albert Camus, Paris 1997; FranÅois-Jean Authier, Êtude sur Albert Camus »La Chute«, Paris 1997; Klaus Bahners, Erläuterungen zu Albert Camus’ »Der Fremde«, »Der Fall«, Hollfeld (Oberfranken) 1996; Joseph Blank, Am Rande des Kontinents oder die spätbürgerliche Hölle. Zur Interpretation von Camus’ »Der Fall«, in: Heinz-Robert Schlette (Hg.), Wege der deutschen Camus-Rezeption, Darmstadt 1975, S. 357 – 385; außerdem in Joseph Blank, Der Mensch am Ende der Moral, Düsseldorf 1971, S. 9 – 33; Laurence Bougault, Êtude sur »La Chute« d’Albert Camus, Paris 1998; Margaret E. Gray, Les »Juges IntÀgres« de Clamence. Une lecture psychanalytique de »La Chute«, in: Lionel Dubois (Hg.), Albert Camus entre la misÀre et le soleil. Actes du 2iÀme colloque international de Poitiers sur Albert Camus, les 29 – 30 – 31 mai 1997, Poitiers 1997, S. 73 – 80; Gisela Schlüter, Kalkulierte Konfession. Camus’ »La Chute« im Kontext, in: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte XXIII, 1999, S. 133 – 145; Martina Yadel, »La Chute« von Camus. Ansätze zu einer Interpretation, Bonn 1984; Martina Yadel, La Chute – Der Fall. Selbstanalyse und Zeitkritik in der verzerrten Optik eines negativen Propheten, in: Franz-Josef Klehr/Heinz-Robert Schlette (Hg.), Der Camus der fünfziger Jahre, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Stuttgart 1997, S. 15 – 37; Martina Yadel, Schuld oder Verhängnis? »Der Fremde« und »Der Fall«, in: Heinz-Robert, Schlette / Markwart Herzog (Hg.), »Mein Reich ist von dieser Welt«. Das Menschenbild Albert Camus’, Stuttgart/Berlin/Köln 2000, S. 39 – 68. 10 Jean-Paul Sartre, Situations IV, Paris 1964, S. 127. 11 Adrian van den Howen, Amsterdam as a source of symbols for Camus »The Fall«, in: Canadian Journal of Netherlandic Studies 14 (2), 1993, S. 33 – 38; Harriet Hustis: Falling for Dante. The Inferno in Albert Camus’ »La Chute«, in: Mosaic 40 (4), 2007, S. 1 – 16; Peter Kuon: Lo mio maestro e’l mio autore. Die produktive Rezeption der Divina Commedia in der Erzählliteratur der Moderne, Frankfurt a.M. 1993 (darin: Die Freiheit der Wahl – »Inferno«, »Purgatorio« und »Paradiso« in »La Chute« von Albert Camus, S. 78 – 206).
200
Willi Jung (Bonn)
Rechtsanwalts, der ihm seine Lebensgeschichte erzählt. Der Partner des Erzählers ist stets gegenwärtig, ohne dass ihm eigene Repliken eingeräumt werden. Seine Antworten und Einwände lassen sich aus den Reaktionen des Erzählers rekonstruieren. Der ehemalige Anwalt Jean-Baptiste Clamence stellt sich vor als »Buß-Richter«. Dieses offensichtliche Paradoxon wird durch andere unterstrichen, z. B. durch die Diskrepanz zwischen verkommener äußerer Erscheinung und gepflegtem Konversationsstil. Seine Selbstcharakteristik lautet: Mein Beruf ist doppelt, wie der ganze Mensch. Der Januskopf ist das selbstgewählte Symbol seines Lebens. Als Pariser Anwalt war er besonders den sogenannten »edlen Fällen« zugetan, das heißt solchen Rechtsfällen, die außer juristischem Können auch noch Großmut, Mitgefühl und Selbstlosigkeit von ihm forderten. Der Zustand absoluter Selbstsicherheit wird eines Tages erschüttert, als er auf einem nächtlichen Gang hinter sich ein sarkastisches Lachen hört, das auf der Höhe des Pont des Arts aus dem Nichts kommt, ihn aber doch verfolgt, und das er schließlich aus sich selbst zu vernehmen glaubt. Sein Einverständnis mit sich selbst und der Welt wird problematisch, der Drang zur Selbstanalyse stürzt ihn von seiner Höhe herab, auf der er bis dahin unangefochten gelebt hat. Allmählich erkennt er, dass seine Bescheidenheit nur der Selbstbeweihräucherung, seine Demut nur der Herrschsucht diente: Seine angeblichen Tugenden erweisen sich – an dieser Stelle knüpft Camus an La Rochefoucauld und die Tradition der französischen Moralisten an – als verkappte Laster. Besonders schwer wiegt bei Clamences Gedächtniserforschung der tödliche Sprung einer jungen Frau vom Pont Royal in die Seine, den er als einziger beobachtet hat, ohne freilich einen Rettungsversuch zu unternehmen. Er verliert das sichere Bewusstsein eigener Immunität und Größe, bemüht sich aber verzweifelt, der Anklage durch das eigene quälende Gewissen zu entgehen. Sein Vergehen, sein Fall oder gar Sündenfall besteht darin, sich im entscheidenden Augenblick herausgehalten zu haben; die zu büßende Schuld entspricht seiner Unentschiedenheit, seiner Teilnahmslosigkeit – eine der Voraussetzungen für das Funktionieren der menschlichen Hölle. Seine »antichristlichen« Konsequenzen aus dieser Selbsterforschung legt er seinem Partner in langen Monologen von geschliffener Logik dar, Monologen, die zudem eine große Vertrautheit mit der juristischen Rhetorik belegen: In einer Zeit, in der Gott nicht mehr Mode ist, und kein absolutes Gesetz als Maßstab existiert, erhebt jeder sich zum Richter über alle. Doch alle diese Richter aus Anmaßung fallen früher oder später selbst in den Stand der Büßer. Clamence kehrt den Sachverhalt um: Er wird in einer immer wiederholten Beichte und Buße allen künftigen Richtern das Schwert aus der Hand nehmen. In der Pose Satans fasst er diese Beichte aber so ab, dass sie jedermann zum Spiegel seines eigenen Lebens und er, Jean Clamence, zu jedermanns Richter wird. Clamence erhebt sich zum satanischen Herrscher einer Welt, die im Zustand der Gleichgültigkeit und Unentschiedenheit verharrt. Sein Pro-
Schuld und Gedächtnis – La Chute von Albert Camus
201
phetenwort lautet: Richtet, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Dieser kurze Blick auf die Entstehung und den Inhalt der Erzählung lässt bereits erkennen, wie zentral die Begriffe von culpabilit¦ und m¦moire, von Schuld und Gedächtnis in diesem Werk sind, auf die im folgenden näher eingegangen werden soll.
3.
Schuld und (Sünden-)Fall
Das Wort Schuld findet bekanntlich in mehreren Bedeutungen Verwendung: 1) als das Geschuldete (debitum), 2) als das Verschuldete (culpa) im Sinne der Verfehlung eines normativ vorgegebenen Handlungsziels, 3) als der durch die Verfehlung angerichtete Schaden und 4) als existentielle Schuld im Sinn des Zurückbleibens hinter den eigenen Idealen oder Lebensmöglichkeiten.12 Die Religionen und das antike Drama vor allem zeigen, dass Schuldigwerden eine Urerfahrung des Menschen darstellt. Sie findet in den mythologischen Erzählungen aller Völker ihren Ausdruck. Der Philosoph Martin Heidegger hält Schuld für unvermeidlich, da man mit jeder Entscheidung für eine Handlungsmöglichkeit gleichzeitig alle anderen Möglichkeiten verwirft und damit vieles, was möglich gewesen wäre, nicht realisiert, also anderen schuldig bleibt. Im ethischen Sinne setzt Schuldigwerden die Freiheit, Verantwortlichkeit und Moralität des Menschen voraus, d. h. die Möglichkeit, zwischen Alternativen zu wählen, sich dieser Entscheidung bewusst zu sein und moralische Normen anzuerkennen. Der Titel von Camus’ Erzählung La Chute spielt mit der Polysemie des Wortes: im Französischen bedeutet Chute sowohl Sturz, Fall als auch Sündenfall. Im engeren Sinne wendet Camus den Begriff hier an für die existentielle Wende oder – wie es in seinem Werk wiederholt heißt – den Augenblick, in dem der Vorhang reißt und uns die Absurdität unseres Tuns bewusst wird. In der Bedeutung des Sündenfalls ist zugleich die Konnotation der Sünde bzw. Schuld impliziert, für die der Mensch ein Gefühl entwickelt, das Schuldgefühl, dem im Französischen das Wort »Culpabilit¦« entspricht. Wer Schuld auf sich geladen hat, weiß, dass ihm ein Urteil, Gericht oder gar Jüngstes Gericht droht. Camus erfindet den im Französischen neuen Begriff des juge-p¦nitent, des Büßers, der zugleich auch Richter ist.13 Indem er in einer dynamischen Beichte sein 12 Vgl. den Artikel »Schuld« im Lexikon für Theologie und Kirche (LTHK), hrsg. v. Walter Kasper et al., Freiburg im Breisgau 32000, Bd. 9, S. 276 – 283. Grundlegend in Frankreich ist Paul Ricœur, Philosophie de la volont¦ 2 : Finitude et culpabilit¦ 1, L’homme faillible; Finitude et culpabilit¦ 2, La symbolique du mal, Aubier, 1960 (dt. Übersetzung : Paul Ricœur, Die Fehlbarkeit des Menschen. Phänomenologie der Schuld, Bd. 1 (1960), Freiburg/München 2002; Symbolik des Bösen. Phänomenologie der Schuld, Bd. 2 (1960), Freiburg/München 2002). 13 Die Anspielung auf den Bußprediger Johannes den Täufer ist augenscheinlich. »Da wir denn alle Richter sind, sind wir alle voreinander schuldig, jeder auf seine hässliche Menschenart
202
Willi Jung (Bonn)
Selbstporträt entwirft, hält er zugleich seinem Gegenüber den Spiegel vor und will ihn dazu veranlassen, sich selbst ebenfalls zu porträtieren. Der Bußrichter richtet sich selbst, damit auch andere sich richten und selbst Bußrichter werden. Bekanntlich sind die Themen von Schuld und Unschuld wie auch die damit zusammenhängende Idee des Urteils im gesamten Werk Camus’ präsent. In La Chute nehmen sie einen weiten Raum ein; aber während es fast überall darum geht, für die Unschuld des Menschen zu plädieren, wird er in La Chute mit einer Demonstration seiner Schuld überhäuft, am Ende wird die Begrifflichkeit dieser zentralen Thematik in ihr Gegenteil verkehrt. Das überrascht, denn der Glaube an die grundständige Unschuld des Menschen erscheint wie ein Gründungsmythos des Camusschen Denkens; die Unschuld des Menschen vor der Welt, so wie sie in Noces besungen wird; aber auch jene des absurden Menschen, der »n’entend pas la notion de p¦ch¦ […]. On voudrait lui faire reconnatre sa culpabilit¦. Lui se sent innocent. õ vrai dire, il ne sent que cela, son innocence irr¦parable«14. 1937 hatte Camus in seinen Carnets bereits davon gesprochen, daß der Unschuldige nichts zu erklären habe, 1936 definierte er ebendort den Intellektuellen als jemanden, der an Persönlichkeitsspaltung leide. Diese Duplizität läßt einen neuen Blick auf sich selbst zu, und dieser Blick wiederum gefährdet jene Naivität, die die Unschuld voraussetzt. Die Beschäftigung mit dem Schuldthema ist bei Camus nachweislich von seiner Beschäftigung mit dem Christentum geprägt.15 Nach Camus ist das Christentum eine Religion der Ungerechtigkeit. Seit seiner M¦taphysique chr¦tienne et n¦oplatonisme, der Abschlussarbeit seines Diplúme d’¦tudes sup¦rieures, hat er sich mit der Frage beschäftigt, wie Sünde und Erlösung das christliche Denken vom Denken der Griechen trennen. Als ein Beispiel dafür dient ihm Helena, die als schönste Frau von Aphrodite dem Paris versprochen und von diesem entführt wurde. Dies war dann der Anlass zum Trojanischen Krieg. »H¦lÀne n’est pas coupable mais victime des dieux. AprÀs la catastrophe elle reprend le cours de sa
ein Christus, einer um den anderen ans Kreuz geschlagen und da sterbend, mit der Frage auf den Lippen. Wir wären es wenigstens, wenn ich, Johannes Clamans, nicht den Ausweg gefunden hätte, die einzige Lösung, kurzum die Wahrheit…« (Camus, Der Fall, S. 96 – 97). 14 Zit. nach Jacqueline L¦vi-Valensi, Commente. La chute d’Albert Camus. Paris 1996, S. 93. Vgl. Jeanyves Gu¦rin, »Les chemins de la culpabilit¦«, in: La Licorne (20) 1991, S. 153 – 163. 15 Susanne Alexandre, »La Chute« de Camus. Le christianisme de Jean-Baptiste et le paganisme de Clamence«, in: Êcole des lettres II LXXXIX, 13 (15 mai 1998), S. 37 – 48; Alberto BarreraVidal, Pr¦sence du vocabulaire chr¦tien dans l’œuvre de Camus, in: Êtudes Romanes (1) 1989, S. 55 – 64; Yehuda L. Cohn, Les sources bibliques dans l’œuvre de Camus, in: Fernande Bartfeld (Hg.), Albert Camus. Parcours m¦diterran¦ens, Jerusalem 1998, S. 45 – 54; Sabine Dramm, Albert Camus und die Christen. Eine Provokation, Frankfurt a.M. 2002; Joseph Hermet, Camus et le christianisme, Paris 1976; Thomas Simons, Camus Stellung zum christlichen Glauben, Königstein 1979; Claude Vig¦e, La nostalgie du sacr¦ chez Camus, in: ders., Aux sources de la litt¦rature moderne 1. Les artistes de la faim, Paris 1989, S. 253 – 286.
Schuld und Gedächtnis – La Chute von Albert Camus
203
vie«16, so die Interpretation Camus’. Für ihn besteht der offenkundigste Skandal des Christentums darin, dass der Mensch schon von Geburt an von der Todsünde gezeichnet ist. Neben der christlichen Schuldphilosophie beschäftigt ihn aber auch die Schuldphilosophie seiner Zeitgenossen. Denn er reagiert ab 1950 gereizt auf all jene, die sich darin gefallen, Schuldgefühle bei sich zu erwecken, um besser Ihresgleichen anklagen zu können. Damit nimmt er vor allem die Existentialisten ins Visier, die sich bereitwillig – wie etwa Jean-Paul Sartre – zu Weggefährten der Kommunisten gemacht haben. Aus ihrem eigenen Schuldbekenntnis leiten sie nach Camus das Recht ab, bei anderen Schuldgefühle zu wecken. So nehmen sie der Menschheit jede Selbstachtung und Zukunftshoffnung und bereiten am Ende der Knechtschaft den Weg. Clamence verkörpert sozusagen modellhaft diese Haltung in La Chute. Während Caligula, nachdem er seine Untergebenen angeklagt hat, sich schließlich selbst verurteilte, geht Clamence viel subtiler vor, er beginnt damit, sich mit allen Sünden zu beladen, um am Ende zu dem Schluss zu kommen, dass die Menschheit, deren Ebenbild er ja ist, vollständig aus Schuldigen besteht. Clamence wir somit zu einem Helden unserer Zeit, er gehört zu jener Generation, die die Schrecken des 2. Weltkriegs erlebt hat und von daher auch aus gutem Grunde am Menschen verzweifeln kann. Ihre Erlebnisse akzeptiert Clamence als einzige Entschuldigung, die ihn wiederum davon abhält, ein absolutes Urteil über sie zu fällen. Wessen soll ich oder kann ich mich anklagen? Wessen klagt mich die Gesellschaft an? Diese Fragen stehen im Zentrum von La Chute wie bereits früher auch im Zentrum des Etranger. Das von Clamence empfundene oder geheuchelte Schuldgefühl betrifft vorrangig seine Art zu sein, z. B. seine übertriebene Selbstzufriedenheit, die Diskrepanz zwischen dem Bild, das er von sich in der Gesellschaft vermittelt und dem, was er wirklich war. Er lebte mit anderen Worten in einem permanenten Zustand der Lüge. Da er nicht für das, was er war, verurteilt werden könnte, klagt sich Clamence auch für das an, was er tut17. »So breit und bunt die Palette der Verfehlungen auch sein mag, entscheidend ist ein einziges Verbrechen, das diesen Namen nicht einmal verdient, weil es als pures Negativum, als Ausfall die Möglichkeit von Verbrechen überhaupt in Frage stellt und letztlich so auch Moral unmöglich macht. Es ist die unschuldig-schuldige Unentschiedenheit, die geistige Trägheit. Dies ist die Kernerfahrung aus dem Schlüsselerlebnis.«18 Die Bußpredigt führt am Ende nicht aus der Hölle heraus
16 Albert Camus, Carnets II (janvier 1942-mars 1951), Gallimard 1964, S. 199. 17 Kriminelle Gleichgültigkeit gegenüber einer verzweifelten jungen Frau und einem Kameraden in der Gefangenschaft – er trank das Wasser eines Sterbenden, obwohl er gleichzeitig Papst war. Vgl. die neue Pl¦iade-Ausgabe von La Chute, Pl.III, S. 755. 18 So der frühere Bonner Theologe und Altrektor Franz Böckle, Fundamentalmoral, München 1977, S. 103. In dem Kapitel »Schuld als Phänomen« behandelt er in § 6 Reflektierte
204
Willi Jung (Bonn)
und Clamence’ Stimme erklingt weiterhin als Stimme des Rufers in der Wüste »Amsterdam«, die zu verlassen er sich weigert. Er tut Buße einzig und allein, um weiterhin richten zu können. Und selbst wenn ihm ein zweites Mal Gelegenheit gegeben würde, den befreienden Sprung in die Seine zu tun, um ein Menschenleben zu retten, so würde er auch dann sein Leben nicht aufs Spiel setzen. »Ein zweites Mal, ha! Welch ein Leichtsinn! (…) Jetzt ist es zu spät, es wird immer zu spät sein. Zum Glück!«19 Dem Eingeständnis der Schuld folgt in der Regel die Strafe. Da die Verbrechen der unterlassenen Hilfeleistung, die er eingestanden oder auch erfunden hat, ihn nicht vor Gericht bringen können, schließt Clamence seine Beichte mit der Enthüllung eines anderen Verbrechens ab, nämlich der Hehlerei im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Gemäldes. In den Augen des Lesers wiegt dies vielleicht deutlich weniger, man hat aber in diesem Falle mit einer Gefängnisstrafe zu rechnen. Die Lektion von La Chute steht alles in allem im Gegensatz zur Lektion des Êtranger: denn Meursault wurde weniger für das verurteilt, was er getan hatte, als wegen der Persönlichkeit, die man ihm zuschrieb. Gleichwohl scheint aber in beiden Fällen die Rechtmäßigkeit der Justiz erschüttert. Nach Pierre-Louis Rey ergänzen sich diese beiden Erzählungen, sie illustrieren eine Unstimmigkeit zwischen der Schuld eines Angeklagten und der Strafe, der er sich in der Gesellschaft aussetzt.20 An dieser Stelle sollte ein kleines Detail Erwähnung finden, das wie ein Leitmotiv den Text durchzieht. Wie eine geisterhafte Heimsuchung wirkt im Erzähltext die Episode des schwarzen Punktes auf dem Ozean, die Clamence unmittelbar an einen Ertrunkenen denken lässt und ihn schicksalhaft an seinen Schuldkomplex erinnert, nämlich die unterlassene Hilfeleistung. Aus dem Meer wird in Clamences Dialog ein Taufbecken, das Meerwasser wird das bittere Wasser seiner Taufe, aus dem er niemals neu geboren werden kann. Daraus ergeben sich die Anerkenntis der Schuld und der Rückzug in das Verlies. Schuld ist nicht unbedingt, so Clamence, Ergebnis göttlichen Wirkens, sondern Menschenwerk: »Je compris aussi qu’il (=le cri) continuerait de m’attendre sur les mers et les fleuves, partout enfin o¾ se trouverait l’eau amÀre de mon baptÞme. (…) Nous ne sortirons jamais de ce b¦nitier immense.«21 »Il fallait se soumettre et reconnatre sa culpabilit¦. Il fallait vivre dans le malconfort. (…) nous ne pouvons affirmer l’innocence de personne, tandis que nous pouvons Schulderfahrung auch zahlreiche ›Fälle‹ aus der Literatur, u. a. Camus’ La chute. Eine gedanklich und sprachlich auch heute noch faszinierende Lektüre. 19 Camus, Der Fall, S. 138. 20 Pierre-Louis Rey, [Art.] »culpabilit¦«, in: Dictionnaire Albert Camus, hrsg. v. Jeanyves Gu¦rin, Paris 2009 (im Folgenden Dictionnaire Albert Camus), S. 191 – 193; s. a. Carina Gadourek, Les Innocents et les coupables. Essai d’ex¦gÀse de l’œuvre de Camus, La Haye 1963. 21 Pl.III, S. 747.
Schuld und Gedächtnis – La Chute von Albert Camus
205
affirmer coup sr la culpabilit¦ de tous. Chaque homme t¦moigne du crime de tous les autres, voil ma foi, mon esp¦rance. Croyez-moi, les religions se trompent dÀs l’instant qu’elles font de la morale et qu’elles fulminent des commandements. Dieu n’est pas n¦cessaire pour cr¦er la culpabilit¦, ni punir. Nos semblables y suffisent, aid¦s par nous-mÞmes.«22
Camus führt dann anschließend nach Knut Wenzel den Schulddiskurs mit einem Thema zusammen, das auf den ersten Blick als wenig ergiebig erscheinen mag: mit der Selbstliebe. Der Büßer-Richter spricht von seiner vormaligen Existenz als Anwalt als von einem Menschen, der »zutiefst zufrieden mit sich selber« war23 ; er formuliert den Gedanken der Selbstliebe in einer Sentenz: »So ist der Mensch, Verehrtester, er hat zwei Gesichter : er kann nicht lieben, ohne sich selbst zu lieben«24 ; mit der selbstentblößenden und doch nie wirklich vertrauenerweckenden Offenheit seiner Beichte bekennt der Büßer-Richter sich auch zur egoistischen Seite der Eigenliebe25 ; unter Rückgriff auf das alte Motiv der Alternative vom Biegen oder Brechen26 wird schließlich die zentrale SelbstErklärung formuliert: »Man stirbt, wenn es sein muss, man will lieber brechen als biegen. Ich jedoch biege, weil ich fortfahre, mich zu lieben.«27 Damit sieht nun das Verhältnis von Schuld und Selbstliebe anders, konfliktiver aus: Schuld folgt nicht aus einer – falschen – Selbstliebe, sondern sie berührt gewissermaßen die Wurzel, den Kern des Selbst, so dass die Möglichkeit der Selbstliebe, also die Möglichkeit der lebens-notwendigen Annahme seiner selbst, fraglich wird. Sehr allgemein angesetzt, ist die hier virulente, von La Chute gestellte Frage die, wie man angesichts der Schuld noch leben kann, wie man angesichts der radikalen Infragestellung des Selbst durch die Schuld noch ›man selbst‹ sein kann. Insofern entbehrt die Schuldbesessenheit des Büßer-Richters bei aller Wahnhaftigkeit nicht einer gewissen Rationalität: denn was könnte mehr in den Wahnsinn treiben als die radikale, an die Wurzel gehende Infragestellung des eigenen Selbst – dessen also, was man selbst ist?28
22 23 24 25 26 27 28
Ebd., S. 747. Camus, Der Fall, S. 26. Ebd., S. 30. Ebd., S. 42. Vgl. hierzu Albrecht Schöne, Vom Biegen und Brechen, Göttingen 1991. Camus, Der Fall, S. 64 f. Nach Knut Wenzel, »Schuld und Wahn«. Theologische Bemerkungen zu Albert Camus’ »La Chute«, in: Absturz und Zwielicht. 50 Jahre »La Chute« von Albert Camus. Bensberger Protokolle 109, hrsg v. Wolfgang Isenberg, Bensberg 2008, S. 96 u. S. 101.
206
4.
Willi Jung (Bonn)
Gedächtnis (mémoire) und Schuldbekenntnis (confessio)
Die Infragestellung des eigenen Selbst kann nun in eine inquisitorische, schmerzliche Gedächtnisarbeit münden. Im Rahmen einer Beichte spricht man von der Gewissenserforschung, in der Psychologie und ebenso in diesem Camus-Text findet der Terminus ›Exploration‹ Verwendung: Peu peu, la m¦moire m’y est cependant revenue. Ou plutút je suis revenu elle, et j’y ai trouv¦ le souvenir qui m’attendait. Avant de vous en parler, permettez-moi, mon cher compatriote, de vous donner quelques exemples (qui vous serviront, j’en suis sr) de ce que j’ai d¦couvert au cours de mon exploration.29
Um diese Textstelle sinnvoll einordnen zu können, scheint ein Rückgriff auf den Kirchenlehrer Augustinus sinnvoll, der im Anschluss an platonisches Denken im zehnten Buch seiner Confessiones30 jene Gedächtnistheologie entwickelte, die zugleich eine Gedächtnisphilosophie ist und sich stärker an Ideen als an Erinnerung orientiert. Er beschreibt die Memoria als weite Gefilde und Hallen, als eine grenzenlose Innenwelt, deren Umfang und Tiefe nicht zu ergründen sind, da sogar das Gedächtnis selbst Gegenstand des Gedächtnisses ist, und auch das Vergessen darin aufbewahrt bleibt. Wir wissen, dass Camus nicht nur aufgrund seiner Herkunft, sondern auch aufgrund seiner philosophischen Examensschrift mit dem Denken des Augustinus vertraut war. Camus’ Verhältnis zum lateinischen Kirchenvater ist zwar voller Bewunderung, aber zugleich auch konfliktgeladen, wie es Maurice Weyembergh wegweisend in seinem Artikel »Saint Augustin« im Dictionnaire Camus beschreibt.31 Noch ein zweiter Rückgriff sei erlaubt. Petrarcas Naturerfahrung auf dem Mont Ventoux, wo er die Worte des Augustinus las, steht am Anfang des modernen Naturverständnisses; er hat Natur erstmals als Landschaft, das heißt im ästhetisch erfahrenen Ausschnitt des Ganzen, gesehen und sein Erlebnis trotzdem als Frucht und Erzeugnis des theoretischen Geistes nach einer Formulierung des Philosophen Joachim Ritter gedeutet. Einen so weiten kulturellen Raum eröffnet mithin die Reflexion der augustinischen Memoria, dass über Petrarca die europäische Naturdichtung und die Landschaftsmalerei durch sie ihre Grundlage erhielten. Wenn Albert Camus Amsterdam und die diese Stadt 29 Pl.III, S. 719. 30 »Les hommes s’en vont admirer les cimes des montagnes, les vagues ¦normes de la mer, le large cours des fleuves, les cútes de l’Oc¦an, les r¦volutions des astres, et ils se d¦tournent d’eux-mÞmes! Ils ne trouvent point admirable que je parle de toutes ces choses sans les voir de mes yeux; cependant je ne pourrais en parler, si ces montagnes, ces vagues, ces fleuves, ces astres que j’ai vus, cet oc¦an, auquel je crois sur le t¦moignage d’autrui, je ne le voyais int¦rieurement, dans ma m¦moire, avec les dimensions que percevraient mes regards audehors«, zit. nach Saint Augustin, Les confessions, Paris 2008, S. 247. 31 Dictionnaire Albert Camus, S. 65 – 67.
Schuld und Gedächtnis – La Chute von Albert Camus
207
umgebende Landschaft als »paysage n¦gatif«32 wahrnimmt, so stellt er sich bewusst in diese Wahrnehmungstradition. Für Camus ist Amsterdam das danteske Inferno, symbolisiert durch Nebel und Kanäle, sozusagen die Gegenlandschaft zum Mittelmeer, vor allem Sizilien und Griechenland. »La GrÀce, o¾ se r¦sument puret¦, lumiÀre, v¦rit¦, innocence, ne peut que d¦river, hors d’atteinte, »au bord« des eaux fig¦es et de l’encerclement de la m¦moire«.33 Gedächtnis und Erinnerung sind bis heute ein Grundproblem der Philosophie.34 Platon (polit. 614b f.) war der Überzeugung, daß die Ideen im Gedächtnis aufbewahrt, aber erst durch Erinnerung zugänglich werden. Im Gegensatz dazu wird in der aristotelischen Tradition Gedächtnis als Fähigkeit der Seele verstanden, Formen der sichtbaren Gegenstände aufzunehmen und festzuhalten. Nach Freud werden Erinnerungen und vergessene Ereignisse im Allgemeinen von uns ins Unbewusste verdrängt, entweder schockieren sie unser soziales Bewusstsein, oder zwingen uns zum Nachdenken, zum Überdenken unserer Sicht der Dinge, der Menschen und vor allem von uns selbst. Das ist in der Tat Gegenstand jener Gedächtnisarbeit, die Clamence35 in La Chute vornimmt. »Nous nous confessons ceux qui nous ressemblent et qui partagent nos faiblesses.«36 »D’ailleurs, je n’aime plus que les confessions, et les auteurs de confessions ¦crivent surtout pour ne pas se confesser, pour ne rien dire de ce qu’ils savent. Quand ils pr¦tendent passer aux aveux, c’est le moment de se m¦fier, on va maquiller le cadavre.«37 »Toujours est-il qu’aprÀs de longues ¦tudes sur moi-mÞme, j’ai mis au jour la duplicit¦ profonde de la cr¦ature. J’ai compris alors, force de fouiller dans ma m¦moire, que la modestie m’aidait briller, l’humilit¦ vaincre et la vertu opprimer. Je faisais la guerre par des moyens pacifiques et j’obtenais enfin, par les moyens du d¦sint¦ressement, tout ce que je convoitais.«38 »…on ne pouvait mourir sans avoir avou¦ tous ses mensonges. Non pas Dieu, ni un de ses repr¦sentants, j’¦tais au-dessus de Åa, vous le pensez bien. Non, il s’agissait de l’avouer aux hommes, un ami, ou une femme aim¦e, par exemple.«39
In gelungenen Maximen entwirft Clamence sozusagen eine Moral des Bekenntnisses und entlarvt auch die inhärente Scheinheiligkeit, die er auf die Duplizität oder Janusköpfigkeit des Menschen zurückführt. Am Ende eines 32 Pl.III, S. 729. 33 Zit. nach Jacqueline L¦vi-Valensi, La chute d’Albert Camus, (foliothÀque 58), Gallimard 1996, S. 124 – 126. 34 Vgl. Roberta L. Klatzky, Gedächtnis und Bewußtsein, Stuttgart 1989. 35 Zu Clamence als Reinkarnation des Sokrates in Amsterdam vgl. Paul Gifford, Socrates in Amsterdam. The uses of irony in »La Chute«, in: Modern Language Review LXXIII, 1978, S. 499 – 512. 36 Pl.III, S. 734. 37 Pl.III, S. 752. 38 Pl.III, S. 735. 39 Pl.III, S. 738.
208
Willi Jung (Bonn)
Lebens sollte man, so Clamence, alle seine Lügen – und gemeint sind hier vor allem die Lebenslügen – bekannt haben, nicht einem Gott, sondern vielmehr einem nahestehenden Menschen. Eine gewissenhafte Selbsterforschung inventarisiert also immer auch die eigenen Vergehen. Das Gedächtnis entläßt uns nicht aus unserer Schuld. Unser Umgang mit ihr muß ins Bekennen führen, und zwar rein humanistisch im Angesicht von Mensch zu Mensch. Auch hier lehnt Camus wieder den metaphysischen Sprung ab. Das Thema des Gedächtnisses kehrt häufig in Camus’ Werk wieder, sowohl in den fiktiven als auch in den essayistischen und journalistischen Schriften. Dabei kann das Wort Gedächtnis unterschiedliche Bedeutungen haben. In Actuelles II typisiert Camus wiederholt unsere Zeit als eine Zeit ohne Gedächtnis und versteht darunter das historische Gedächtnis. In La Chute spricht Clamence etwa wiederholt davon, dass er sein Gedächtnis wiederfinden müsste, hier ist natürlich das individuelle Erinnerungsvermögen gemeint. Maurice Weyembergh, einer der großen Camus-Kenner, fragt sich daher auch zu Recht, warum der Schriftsteller Camus mit einem solchen Nachdruck die Rolle des Gedächtnisses, der Erinnerung und des Vergessens betont hat40. Folgt man Maurice Weyembergh, so sind für Camus’ Fixierung auf das Gedächtnis zumindest vier Gründe zu nennen.41 Da ist zunächst Camus’ schon sehr früh formulierte Konzeption, nach der der Mensch die Natur zurückerobern und neu entdecken müsse, dafür stehen paradigmatisch Ruinenlandschaften wie Tipasa. Der zweite Grund liegt in der Endlichkeit nicht nur der Zivilisationen, sondern auch der Individuen. Camus war sich dessen im Übrigen sehr bewusst – das ist der dritte Grund –, dass verlorene Zeit sich nur bei den Reichen wiederfindet und nicht da, wo Armut herrscht, wo das Wort und das Geschriebene selten und die Menschen Analphabeten sind, wie er es in Le Premier Homme entwickelt hat. Der vierte Grund für die Betonung des Gedächtnisses ist die Angst vor Gedächtnisblockaden, gar vor Gedächtnisverlust. In seinen Carnets II und III beklagt sich Camus wiederholt über Gedächtnismängel und das Vergessen. Nach Camus gilt es, gegen die Allgegenwart des Vergessens, gegen die Endlichkeit und die Kontingenz Strategien zu entwickeln, z. B. ein Tagebuch zu führen und Zeugen zu befragen. Aber der die ganze Existenz beherrschende Königsweg scheint ihm die Alchimie der Kunst, und hier vor allem das Schreiben. Sein großes Vorbild ist 40 Maurice Weymbergh, [Art.] »m¦moire«, in: Dictionnaire Albert Camus, S. 529 – 532; ders., »La m¦moire du juge-p¦nitent«, in: Raymond Gay-Crosier (Hg.), Textes, intertextes, contextes autour de »La Chute«. Revue des Lettres Modernes, Albert Camus 15, Dives sur Mer 1993, S. 63 – 78 (im Folgenden Gay-Crosier, Textes, intertextes, contextes autour de »La Chute«); ders., Albert Camus ou la m¦moire des origines, Brüssel 1998. Vgl. auch Paul Ricœur, La m¦moire, l’histoire, l’oubli, Paris 2000, S. 617, wo er sich auf La Chute bezieht. 41 Ich folge hier der Argumentation von Maurice Weyembergh in »La m¦moire du juge-p¦nitent«, s. Anm. 40.
Schuld und Gedächtnis – La Chute von Albert Camus
209
Marcel Proust, und es ist gewiss kein Zufall, wenn ihm Camus in L’homme r¦volt¦ einige Kommentare widmet. Wenn die Welt des amerikanischen Romans eine Welt gedächtnisloser Menschen ist, so ist Prousts Welt nach Camus schon für sich allein genommen ein Gedächtnis. Dieses Gedächtnis lehnt die Vergeudung der Welt ab und löst aus einem wiedergefundenen Duft das Geheimnis eines neuen und alten Universums heraus. Seiner Berufung getreu muss der Künstler, wie es Camus in seiner Nobelpreisrede erläutert, der Tage und Gesichter Gedächtnis bewahren. Die Kunst des Schriftstellers ist also nicht nur Erinnerungsarbeit – in der griechischen Mythologie ist das Gedächtnis bekanntlich die Mutter der Musen – sondern auch das Gedenken. Das Gedächtnis spielt mithin eine außerordentlich positive Rolle im Denken und Werk von Camus. Vom Schriftsteller erwartet Camus, dass er nicht blind gegenüber Techniken ist, die es verfälschen, denn totalitäre Regime beugen die Geschichte und schreiben sie nach den politischen Opportunitäten des Augenblicks um. Clamence empfindet in La Chute Scham angesichts seines Verhaltens beim Selbstmord einer jungen Frau, die sich von der Höhe des Pont Royal ins Wasser gestürzt hat, ohne dass er auch nur im Geringsten einen Rettungsversuch unternommen hätte. »J’ai oubli¦ ce que j’ai pens¦ alors«.42 »Il me semble en tout cas que ce sentiment (=la honte) ne m’a plus quitt¦ depuis cette aventure que j’ai trouv¦e au centre de ma m¦moire et dont je ne peux diff¦rer plus longtemps le r¦cit, malgr¦ mes digressions et les efforts d’une invention laquelle, je l’espÀre, vous rendez justice.«43
Angesichts seines schuldhaften Verhaltens in der Vergangenheit befasst sich Clamence intensiv mit Gedächtnisspielen, es überrascht daher nicht, daß er auch schon Strategien entwickelt hat, um das Gedächtnis zu manipulieren. Als BußRichter bedient er sich immer wieder einer betäubenden Rhetorik, damit die realen Erinnerungen nicht wieder plötzlich aus dem »Meer« der Erinnerungen auftauchen und erneut – und vielleicht noch stärker als bisher- seine Existenz beeinträchtigen.44 J’exerce Donc Mexico-City, depuis quelque temps, mon utile profession. Elle consiste d’abord, vous en avez fait l’exp¦rience pratiquer la confession publique aussi souvent que possible. Je m’accuse, en long et en large. Ce n’est pas difficile, j’ai maintenant de la 42 Pl.III, S. 729. 43 Pl.III, S. 728. 44 Vgl. Maurice Weymbergh, [Art.] »m¦moire«, in: Dictionnaire Albert Camus, S. 529 – 532; ders., Albert Camus ou la m¦moire des origines, Brüssel 1998. Vgl. Xavier Bonnier : Clamence ou le solilogue absolut, in: Po¦tique XXIII, 1992, S. 299 – 313; Raymond Gay-Crosier, Les codes ironiques dans »La Chute«. Un humanisme rebours, in: Gilles Philippe/AgnÀs Spiquel (Hg.), Pour un humanisme romanesque. M¦langes offerts Jacqueline L¦vi-Valensy, Paris 1999.
210
Willi Jung (Bonn)
m¦moire. Mais attention, je ne m’accuse pas grossiÀrement, grands coups sur la poitrine. Non, je navigue souplement, je multiplie les nuances, les digressions aussi, j’adapte enfin mon discours l’auditeur, j’amÀne ce dernier rench¦rir. Je mÞle ce qui me concerne et ce qui regarde les autres. Je prends les traits communs, les exp¦riences que nous avons ensemble souffertes, les faiblesses que nous partageons, le bon ton, l’homme du jour enfin, tel qu’il s¦vit en moi et chez les autres. Avec cela, je fabrique un portrait qui est celui de tous et de personne. Un masque en somme, assez semblable ceux du carnaval, la fois fidÀles et simplifi¦s, et devant lesquels on se dit: »tiens, je l’ai rencontr¦, celui-l.« Quand le portrait est termin¦, comme ce soir, je le montre, plein de d¦solation: »Voil, h¦las ! ce que je suis.« Le r¦quisitoire est achev¦. Mais, du mÞme coup, le portrait que je tends mes contemporains devient un miroir.45
Der Bußrichter gibt in dieser zentralen Textstelle vor, durch Selbstanklage und öffentliche Beichte sein Gedächtnis wiedergefunden zu haben. So entsteht am Ende ein Porträt, das zugleich das Porträt aller oder keines ist. Es ist ein typisierendes Porträt, in dem sich alle wiederfinden können und in dem sie auch alle wiederfinden, vergleichbar einer Karnevalsmaske. Die Anklagerede des Bußrichters mündet am Ende in ein allgemeines Porträt, das er seinen Zeitgenossen wie einen Spiegel vorhält. In seinem Artikel »La m¦moire du juge-p¦nitent«46 analysiert Maurice Weyembergh, auf den ich an dieser Stelle noch einmal zurückkommen will, die Vielschichtigkeit der doppelzüngigen Mnemotechnik, die für Clamences Rede kennzeichnend ist. Darin entdeckt er vier Gedächtnisregister : 1. das mit dem Wasser zusammenhängende Gedächtnis, 2. das Gedächtnis, das die Geschichte des Bußrichters nachzeichnet, 3. jenes, das sich der Strafe entsinnt, und schließlich 4. jenes, das Clamence dazu bringen wird, dem Jüngsten Gericht vorzusitzen. Mit Hinweisen auf den nicht ausgeführten Sprung ins kalte SeineWasser zur Rettung der jungen Frau und immer wieder auch mit Verweisen auf die Bibel lenkt Clamence den Leser-Gesprächspartner schließlich von der Möglichkeit sogar des Vergessens und der Wahrheit ab und verstrickt ihn in das Labyrinth eines Gedächtnisses, das immer wieder um sich selber kreist. Albert Camus’ Roman La Chute ist mithin eine Form von Gedächtnisarbeit, die quasi archäologisch das Innere zu erforschen vorgibt, um die eigene Schuld und das Schuldig-geworden-sein zu identifizieren, es aber dann sogleich wieder zu relativieren. Dabei setzt er narrativ oft sehr geschickt Episoden, Anekdoten etc. aus seinem Leben ein. Z.B. die Episode von einem blinden Bettler, den er gebeten hatte, später noch einmal an seinen Tisch im Restaurant zurückzukehren, führt zu folgender Analyse durch Clamence: »So ist das, wir haben das Licht verloren, die Morgenröte, die heilige Unschuld dessen, der sich selbst 45 Pl.III, S. 761 [Kursivsetzung von WJ]. Vgl. auch Camus, Der Fall, S. 114 – 115. 46 In: Gay-Crosier, Textes, intertextes, contextes autour de »La Chute«, S. 63 – 78, s. Anm. 40.
Schuld und Gedächtnis – La Chute von Albert Camus
211
vergibt«47. Die Gedächtnisarbeit des Protagonisten erfolgt in einer pseudodialogischen Kommunikationsstruktur, in der der Adressat sich nicht äußert und nur aus den Anreden und Fragen des überwiegend monologisierenden Sprechers schemenhaft zu erschließen ist, oder ist es vielmehr das Alter Ego des Sprechers? Grundmuster dieses Dialogs ist die Beichte, deren Ziel es hier jedoch ist, das Gegenüber seinerseits zu einer Beichte zu veranlassen. Während der Beichtvater sich die Auflistung der vorgetragenen Sünden anhört, eventuell nachfragt und kommentiert, und demjenigen, der bereut, vergibt und eine Buße auferlegt, geht der Bußrichter Jean-Baptiste Clamence den umgekehrten Weg: er zeigt sich als Büßer, um anschließend über andere richten zu können, um sich selbst mit gebührender Selbstironie am Ende als Gottvater des Jüngsten Gerichts zu inthronisieren und so dem Urteil zu entgehen, »sich nicht ständig richten zu lassen, so dass der Spruch nie gefällt wird«.48
5.
Der Buß-Richter und das »Jüngste Gericht«
Das erste Manuskript der Erzählung La Chute trug den Titel Le jugement dernier. Daraus lässt sich konsequent die Bedeutung ableiten, die Camus diesem Thema des Jüngsten Gerichts generell einräumt.49 »Vous parliez du jugement dernier. Permettez-moi d’en rire respectueusement. Je l’attends de pied ferme: j’ai connu ce qu’il y a de pire, qui est le jugement des hommes.«50 So heißt es aus dem Munde von Clamence, und seine Worte erinnern natürlich an Sartres berühmte Formel aus Huis clos, der Geschlossenen Gesellschaft: Die Hölle, das sind die anderen. Clamence spricht anschließend im Text von einer Spuckzelle als Form der Bestrafung und zieht daraus die Schlussfolgerung: »N’attendez pas le Jugement dernier. Il a lieu tous les jours.«51 Nicht auszuschließen ist hier auch indirekt eine Anspielung auf die Passion Christi, denn der Leidensweg begann mit dem Aufsetzen der Dornenkrone, Hohn, Spott und Spucken. Und auch von Jesus Christus selbst spricht Clamence als von dem »Anderen, den man ge47 Camus, Der Fall, S. 119. 48 Ebd., S.65. 49 »Il nous faudrait la patience d’attendre le Jugement dernier. Mais voil, nous sommes tous press¦s: Si press¦s mÞme que j’ai ¦t¦ oblig¦ de me faire juge-p¦nitent. Cependant, J’ai d d’abord m’arranger de mes d¦couvertes et me mettre en rÀgle avec le rire de mes contemporains. õ partir du soir o¾ j’ai ¦t¦ appel¦, car j’ai ¦t¦ appel¦ r¦ellement, j’ai d r¦pondre ou du moins chercher la r¦ponse. Ce n’¦tait pas facile; j’ai longtemps err¦. Il a fallu d’abord que ce rire perp¦tuel, et les rieurs, m’apprissent voir plus clair en moi, d¦couvrir enfin que je n’¦tais pas simple. Ne souriez pas, cette v¦rit¦ n’est pas aussi premiÀre qu’elle parat. On appelle v¦rit¦s premiÀres, celles qu’on d¦couvre aprÀs toutes les autres, voil tout«, Pl.III, S. 735. 50 Pl.III, S. 747. 51 Pl.III, S. 748.
212
Willi Jung (Bonn)
kreuzigt hat«52 durchaus als einem Parallelfall zu sich selbst. Denn auch Jesus Christus habe, mittelbar durch den Kindermord zu Bethlehem, ein »unschuldiges Verbrechen«53 auf sich geladen und, seiner Schuld bewusst, in die Kreuzigung eingewilligt. »Und dann ist er für immer weggegangen, hat sie [=die Menschen] urteilen und richten lassen, mit Vergebung auf der Zunge und Verdammung im Herzen«54, erklärt Clamence. »Il a cri¦ son agonie et c’est pourquoi je l’aime, mon ami, qui est mort sans savoir. Le malheur est qu’il nous a laiss¦s seuls, pour continuer, quoiqu’il arrive, mÞme lorsque nous nichons dans le malconfort, sachant notre tour ce qu’il savait, mais incapables de faire ce qu’il a fait et de mourir comme lui«.55
Aus dem Zitat ergibt sich eine dezidierte Sympathie für den ersten Christen, und von Christus spricht Clamence gar als von seinem Freund. Zugleich erhebt er eine Klage über die Verlassenheit der Menschen und deren Unfähigkeit zur Nachfolge Christi. Camus’ Auseinandersetzung mit dem Christentum erweist sich hier als eine sehr produktive, gar von Empathie getragener Dialog mit der Theologie. Das ist sozusagen die eine, die theologische Lesart. Nun kann man die Erzählung La Chute gewissermaßen ja auch als eine Art Kriminalgeschichte lesen, ganz besonders aufgrund des Kunstraubthemas.56 Im Zentrum steht »Die Anbetung des Lammes«, der Genter Altar57, ein 1432 vollendetes Polyptychon der Brüder van Eyck. Das Gemälde besteht aus 10 Eichenholztafeln und enthält ein vollständiges ikonographisches Programm, das sich vor allem auf den Text der Apokalypse nach Johannes stützt. Dieses Werk in der Kathedrale SaintBavon in Gent steht am Anfang der flämischen Kunstrevolution und stellt ein Meisterwerk der frühen flämischen Malerei dar.58 52 53 54 55 56
TRN, S. 1530. TRN, S. 1531. TRN, S. 1532 f. Pl.III, S. 749. Eine ausführliche Dokumentation dieses Kriminalfalls liegt jetzt vor von Andr¦ Van der Elst/ Michel de Bom, Le vol de l’agneau mystique, L’histoire d’une incroyable ¦nigme, Paris 2009. 57 »Uneinheitlich dagegen ist der Bildaufbau bei geöffneten Flügeln. Die unteren Tafeln stellen die Anbetung des Lammes dar : Auf der Mitteltafel sind in einer tropisch blühenden Landschaft Engel, Heilige, Märtyrer, Apostel und Propheten um das Lamm Gottes gruppiert; auf den vier Außenflügeln nähern sich von links die gerechten Richter und die Könige, von rechts Eremiten und Pilger. (Der Flügel mit den Richtern wurde gestohlen und ist durch eine moderne Kopie ersetzt.) Die Anlage scheint zum größten Teil von Hubert zu stammen, die Ausführung hingegen ist von Jans Hand. Die schwer mit Juwelen beladenen Gestalten von Maria, Gottvater und dem Hl. Johannes d. T. krönen die Mitteltafel in feierlicher Monumentalität.« [Kindlers Malerei-Lexikon. Zürich 1964 – 1971, in: Digitale Bibliothek, Bd.22, Directmedia, Berlin 2002, S. 2770 – 2796] 58 Ebd. Vgl. auch die Analyse von Fabrice Hadjadj, L’agneau mystique. Le retable de Gand d¦voil¦, Paris 2008.
Schuld und Gedächtnis – La Chute von Albert Camus
213
214
Willi Jung (Bonn)
Schuld und Gedächtnis – La Chute von Albert Camus
215
Zwei Tafeln des Flügelaltars wurden 1934 von einem Küster gestohlen. Eine hat der Dieb zurückgegeben (Johannes der Täufer), aber er starb, bevor er sagen konnte, wo sich die zweite Tafel befindet, diejenige der Gerechten Richter (unten links in der obigen Abbildung). Sie wurde niemals mehr aufgefunden, aber eine getreue Kopie von Jef Vanderveken befindet sich heute an ihrer Stelle. Dieses gestohlene Gemälde findet nun Eingang in Camus’ Roman, gewiß ein geschickter Kunstgriff, denn das Gemälde, das Jean-Baptiste Clamence bei sich aufbewahrt, sind diese gerechten Richter.59 Camus hatte sich für diesen Kunstraub, der die Öffentlichkeit bis heute immer wieder neu bewegt, nachweislich interessiert. In seinen Carnets notiert er im Juli 1958, dass der Schuldige wohl ein Priester war »qui avait vol¦ le volet parce qu’il ne pouvait supporter de voir des juges prÀs de l’Agneau mystique«.60 Die Verbrecherthematik ist in Camus’ Text nicht von der Hand zu weisen. Clamence ist Offizierssohn – wie er beiläufig anzumerken pflegt –, aus dem ein Rechtsanwalt und damit ein potentieller Verteidiger sowohl der Kriminellen als auch deren Opfer geworden ist. Clamence unterstellt dem Menschen eine generelle Tendenz zu einer universalen Kriminalität. Seiner Ansicht nach träumt jeder intelligente Mensch davon, einmal ein Gangster zu sein. Nun ist der frühere Pariser Staranwalt in seinem selbstgewählten Exil gewiss ein advocatus diaboli als Rechtsberater und Anwalt der Amsterdamer Unterwelt (z. B. des Gorilla) und der Kunstraubszene. Im symbolischen Delikt der Geschichte wird die Bedeutung der Transgression am Ende der Erzählung erst offenkundig: es ist der Diebstahl oder vielmehr die ›Hehlerei‹ mit dem Gemälde Les Juges intÀgres. Denn diese Richter sind nach Clamence Sinnbild der institutionalisierten Lüge. Sie folgten den Kreuzrittern ins Heilige Land, dessen Verwaltung sie übernehmen sollten. Mit seinen Affekten pflegt der Mensch unterschiedlich umzugehen: er nähert sich der Welt als ’Fremder’, er entlarvt oder besser noch, er überführt sie61. Im letzten Kapitel von La Chute scheint daher der Titel Les Juges intÀgres gar eine Wende ins Boshafte zu nehmen, denn hier wird Clamence bitter und zynisch. Diese Textstelle könnte man aber auch hermeneutisch anders auflösen und in dem heiteren Gemälde von van Eyck einen erlösenden Kontrapunkt zur Ironie der Sprache von Clamence sehen. Auf weitere Spekulationen sei verzichtet und die Frage darf offenbleiben. Unzweifelhaft sieht sich der Bußrichter Clamence am Ende in selbstironischer Überhöhung in der Rolle Gottvaters beim Jüngsten Gericht – dem ursprünglichen Titel der Erzählung -, in Anlehnung an van Eycks Gemälde der »Anbetung 59 Jean Gassin: »La Chute« et le retable de »L’Agneau mystique«. Êtude de structure, in: Raymond Gay-Crosier (Hg.), Albert Camus 1980. Second International Conference, Feb. 21 – 23 1980, Gainsville 1980, S. 132 – 141. 60 Albert Camus, Carnets III (mars 1951-d¦cembre 1959), Gallimard 1989, S. 189. 61 Paul-Laurent Assoun, »Le pardon au pÀre: La Chute saisie par la psychanalyse«, in: Collectif, analyses & r¦flexions sur La Chute d’Albert Camus, Paris 1997, S. 115.
216
Willi Jung (Bonn)
des Lammes«. Clamence erhebt sich zum satanischen Herrscher einer Welt, die im Zustand der Gleichgültigkeit und Unentschiedenheit verharrt. Quelle ivresse de se sentir Dieu le pÀre et de distribuer des certificats d¦finitifs de mauvaise vie et mœurs. Je trúne parmi mes vilains anges, la cime du ciel hollandais, je regarde monter vers moi, sortant des brumes et de l’eau, la multitude du Jugement dernier. Ils s’¦lÀvent lentement, je vois arriver d¦j le premier d’entre eux. Sur sa face ¦gar¦e, moiti¦ cach¦e par une main, je lis la tristesse de la condition commune, et le d¦sespoir de ne pouvoir y ¦chapper. Et moi, je plains sans absoudre, je comprends sans pardonner et surtout, ah, je sens enfin que l’on m’adore !62
Clamence empfindet am Ende seines moralischen Falls offenbar noch Freude an seiner Schuld, das Gericht wird ihm zu einer Lust, die sich aus dem Bewusstsein einer immer latent am Horizont gegenwärtigen Schuld und der aus der Ausübung eines ewigen Gerichts kommenden Macht nährt. Damit sind wir nicht mehr weit entfernt von Sartres Geschlossener Gesellschaft: das Höllentor kann sich öffnen, aber keiner will seinen Moralismus aufgeben noch die Wonnen der Unehrlichkeit63. Dem Urteil zu entgehen heißt folglich in einen Abgrund zu stürzen. Nach der durch das Lachen verursachten Erschütterung seiner Existenz findet Clamence in sich selbst nichts anderes als ein die Schuld ins Unendliche verschiebendes Spiegelspiel. Camus macht – mit Einschränkungen, versteht sich – aus Clamence eine Art Sisyphos der Ethik.64 Lesbar erscheint manches in einer Parallele zum Gemälde von Van Eyck, das bei Camus in La Chute zum Referenzkunstwerk für die Thematisierung des Richters und des Jüngsten Gerichts wird. In van Eycks Gemälde laufen im Grunde alle Themen zusammen, die hier schon angedeutet wurden: der Sündenfall (Adam und Eva) und das Vergehen (die Hehlerei mit dem Gemälde), das Urteil (inklusive der Juges intÀgres) und das Jüngste Gericht, und das Verhältnis von Gedächtnis und Geschichte. »Das Gedächtnis, aus dem die Geschichte schöpft und die es ihrerseits füllt, versucht die Vergangenheit nur zu retten, um der Gegenwart und Zukunft zu dienen. Handeln wir so, dass das Kollektivgedächtnis der Befreiung und nicht der Versklavung der Menschen dient«, formuliert der französische Historiker Jacques Le Goff.65 Bei Clamence ist die Frage angebracht, worauf seine Gedächtnisarbeit abzielt, vielleicht ist es ja eher die Manipulation seines Gegenübers und am Ende auch seine intellektuelle Versklavung? Der Roman findet sein Ende in einer Apotheose: Clamence nimmt, wie wir gesehen haben, die Rolle Gottvaters beim Jüngsten Gericht ein. Und sein 62 Pl.III, S. 763. 63 Siehe zur »mauvaise foi«: Roland Galle, Der Existentialismus, Paderborn 2009, S. 23 – 30. 64 Vgl. hierzu Jean-Pierre Damour, »Moralit¦s et moralisme«, in: Collectif, analyses & r¦flexions sur La Chute d’Albert Camus, Paris 1997, S. 92 – 93. 65 Jacques Le Goff, Histoire et m¦moire, Paris1988 (11981), S. 177 [Übers. v. WJ].
Schuld und Gedächtnis – La Chute von Albert Camus
217
Prophetenwort lautet: Richtet, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. In einem kühnen dialektischen Denkprozess hat Camus hier das Bibelwort, und damit einen wichtigen Grundsatz der christlichen Moral, ins Gegenteil verkehrt und quasi ein Gebäude »negativer« Theologie errichtet. Er hat damit das moderne Dasein ohne Gott konsequent zu Ende gedacht und ad absurdum geführt. Camus hat sich mehrfach gegen den Vorwurf verteidigt, ein Philosoph des Absurden zu sein. Immer versuche der Mensch, durch das Absurde der Bedrängnis zu entgehen, indem er die Herausforderung annimmt, bejaht und dadurch in gewissem Sinne überwindet. In La Peste war es Camus gelungen, der absurden Existenz durch die menschliche Solidarität einen Sinn zu geben. In La Chute wird die Quintessenz der Pest als Hypothese und negative Utopie hingestellt: Wenn Clamence seine absurde Doppelexistenz akzeptiert und seine Mitmenschen in diese einbezieht, dann bedeutet das allenfalls eine negative, pervertierte Solidarität des einzelnen mit allen und vielleicht das komplizenhafte Einverständnis mit der allgemeinen »Pest«. Aber bleiben wir bescheiden: Gilt nicht weiterhin das Wort Sartres über dieses Werk als das schönste vielleicht und das am wenigsten verstandene, widerstrebt der Text nicht am Ende jeder Exegese, bleibt er nicht eine Herausforderung an den Leser und Interpreten, die das Werk nie ganz entschlüsseln werden, da es in der Hermeneutik kein Jüngstes Gericht gibt?
Michela Landi (Firenze)
»Mal, soit mon bien«. La question du dandy de Baudelaire à Camus
Dans Microm¦gas, Voltaire s’en prend Fontenelle, qui, pour plaire la Marquise de la MesnadiÀre, compare, dans l’Essai sur la pluralit¦ des mondes habit¦s, la nature une assembl¦e de blondes et de brunes bien par¦es. – »Eh, qu’ai-je faire de vos brunes. La nature est la nature. Pourquoi lui chercher des comparaisons? – Pour vous plaire«, r¦pondit le s¦cretaire de l’Acad¦mie de Saturne, alias Fontenelle1. On le sait, Voltaire d¦fendait, au risque de ne pas plaire, la v¦rit¦ de la lettre jusqu’ la tautologie, et r¦cusait toute comparaison, toute m¦taphore. La philosophie des LumiÀres, avec son amour de la v¦rit¦ comme nudit¦ des choses, est sans doute l’origine du »d¦pouillement« moderne: le corps de la lettre, jadis instrument de l’esprit, reprend ses droits. Les oripeaux m¦taphysiques du sujet ¦tant tomb¦s, voici devant nous la nature sans adjectifs, la nature tautologique. L’homme moderne s’arrange de cette mise nu: dÀs que la nature se d¦couvre l’homme, elle se veut comme l’expression imm¦diate de l’int¦rÞt subjectif: s’il n’y a plus de telos, comme le dira Camus dans l’Homme r¦volt¦ en citant Dostoevski, que chacun se voue la satisfaction de ses d¦sirs2. Et c’est, tout paisiblement, le triomphe de la physiocratie, savoir, la loi lib¦rale de la nature appliqu¦e la soci¦t¦; autrement dit, le nihilisme. En effet, physiocratie et d¦mocratie vont de pair : tous les hommes sont ¦gaux devant le tribunal de la nature. Le jeune Scipion en t¦moigne qui, dans Caligula, ¦crit des vains poÀmes sur la nature pour se consoler de son destin, celui »de n’Þtre pas C¦sar«3. D’ailleurs, C¦sar, alias Caligula, l’empereur-dandy, ne cache pas que sa passion pour la vie »ne se satisfera pas de la nature«: contre tous les »candides« r¦volutionnaires, les »purs dans le bien«, il y a des »purs dans le mal«: des r¦volt¦s pour qui la haine est une
1 Voltaire, Microm¦gas, dans Microm¦gas, Zadig, Candide, Paris, Flammarion, 1994, p. 50. 2 »[…] S’il n’y a plus de vertu, il n’y a pas plus de loi: ,Tout est permis‘«. A. Camus, L’homme r¦volt¦, Paris, Gallimard, 1951, p. 82. 3 A. Camus, Caligula, Paris, Gallimard, 1958, p. 77. Caligula est, en tant qu’empereur-dieu, l’incarnation du destin mÞme: »On ne comprend pas le destin et c’est pourquoi je me suis fait destin». Ibid., p. 96.
220
Michela Landi (Firenze)
r¦demption4. Si l’homme voltairien est d¦j absurde, il n’en prend pas conscience, car la conscience est justement, comme le dit Camus, dans la »comparaison« »entre un ¦tat de fait et une certaine r¦alit¦«, »entre une action et le monde qui la d¦passe«5. Cette comparaison est, avant de se savoir telle, un travestissement. C’est pourquoi Camus renie, aprÀs Baudelaire, le point d’arriv¦e des existentialistes: ces derniers, »partis de l’absurde sur les d¦combres de la raison«, »trouvent une raison d’esp¦rer dans ce qui les d¦munit«6. Baudelaire a saisi peut-Þtre le premier, dans ce »d¦pouillement«, l’accommodement de l’homme au droit naturel prún¦ par les physiocrates, et a reconnu en mÞme temps dans l’esprit du dandy la n¦cessit¦ de d¦passer les lois de la nature par les lois sup¦rieures d’une »toilette« rigoureuse7, expression, avant tout, d’une hygiÀne morale. C’est pourquoi il fait sienne, dans la Fanfarlo, la maxime de Diderot, ce philosophe abtardi, pionnier du romantisme, et partisan de l’imagination, du travestissement et de la »parure«: l’incr¦dulit¦ est quelquefois le vice d’un sot, et la cr¦dulit¦ le d¦faut d’un homme d’esprit. L’homme d’esprit voit loin dans l’immensit¦ des possibles, le sot ne voit guÀre de possible que ce qui est. C’est l peut-Þtre ce qui rend l’un pusillanime et l’autre t¦m¦raire8.
L’»aride grammaire« des LumiÀres, qui est d¦j la grammaire sans Dieu de Nietzsche, se doit d’Þtre r¦incarn¦e dans un corps rituel qui repr¦sente, lui seul, une source vivante de re-po¦tisation du monde. L’adjectif comble alors, chez Baudelaire, cette fonction: il est le »vÞtement transparent« qui habille et colore la »majest¦ substantielle« du nom9 : tel le voile translucide de l’illusion qui cache la Nature10, il protÀge, comme il le dit dans La Fanfarlo, »le fantúme ador¦ de son imagination« »contre les yeux du vulgaire«11. Cette cat¦gorie grammaticale est alors l’¦gal de la toilette par laquelle le dandy s’¦chappe l’horror vacui de son Þtre mortel12. En fait, si le sujet est, d¦sormais, »mis nu« comme une femme, il 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ibid., pp. 80 – 81. A. Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, p. 50. Ibid., pp. 52 – 53. Ch. Baudelaire, Le dandy, dans Le peintre de la vie moderne, Œuvres complÀtes [OC], II, Paris, Gallimard, La Pl¦iade, 1974, pp. 709 – 712. Plusieurs r¦flexions sur le mÞme sujet figurent aussi dans les Journaux intimes, OC, I, pp. 649 – 710. Ibid., La Fanfarlo, OC, I, p. 568. Cf. D. Diderot, Pens¦es philosophiques, XXXII, ¦d. critique de R. Niklaus, GenÀve, Droz, 1965, p. 125. Ch. Baudelaire, Le poÀme du haschisch, OC, I, p. 431. »Il y a, dit Sartre, une distance originelle de Baudelaire au monde […]; entre les objets et lui s’insÀre toujours une translucidit¦«. J.-P. Sartre, Baudelaire, Paris, Gallimard, [1947], 1975, p. 24. Ch. Baudelaire, La Fanfarlo, OC, I, p. 576. Voir aussi: Sartre, Baudelaire, cit., p. 106. »La femme est le contraire du Dandy. Donc elle doit faire horreur. […] La femme est naturelle, c’est--dire abominable«. Id., Mon cœur mis nu, III, 5, OC, p. 677.
»Mal, soit mon bien«. La question du dandy de Baudelaire à Camus
221
vient ressembler celle qui – selon le mot de Sartre propos de Baudelaire – »se pare pour plaire et son vÞtement, son fard la livrent en partie, en partie la dissimulent«13. L’adjectif est en somme, par rapport au nom qui est pr¦sence de l’Þtre nu, sans d¦terminations, un accident, une »parure« (epitheton; ¦tymologiquement: »ce qu’on met dessus«) et fonctionne, dans un univers mat¦riel, comme de l’esprit: il marque une transcendance dans l’immanence14. Voici pourquoi le dandy, tout en ¦tant cynique, est spirituel. Aucune rh¦torique n’est arbitraire, comme on le voudrait dans ce monde sans contrainte et sans mystÀre: elle est en effet, au dire de Baudelaire, »une organisation de rÀgles r¦clam¦es par l’organisation mÞme de l’Þtre spirituel«15. Il en va de mÞme pour le corps rituel du dandy ou de la danseuse: cette »harmonie mat¦rielle« qui fait du sujet »une belle architecture, plus le mouvement«, est un »mat¦rialisme absolu« qui n’est pas loin, selon l’auteur de La Fanfarlo, »de l’id¦alisme le plus pur«16. Ce corps est maintenant ador¦ comme une idole: emblÀme ¦ph¦mÀre d’une beaut¦-v¦rit¦ ¦ternelle. Le dandy peut paratre tout proche de celle que Sartre appelle, avec Comte et Marx, anti-nature, ou anti-physis17: dans une conception mat¦rialiste et t¦l¦ologique en mÞme temps, c’est par la force-travail qu’on transforme en effet la matiÀre brute en manufact; l’homme naturel en homme civilis¦. Mais, comme quelqu’un l’a bien vu (c’¦tait, par exemple, Val¦ry propos du Montesquieu des Lettres persanes), au comble de la civilisation voici encore le gouvernement de la nature. Par rapport, donc, une soci¦t¦ paresseuse et »anti-artiste«, qui, h¦ritiÀre de la R¦volution, »ressemble Voltaire«18 et ses proches physiocrates; une soci¦t¦ fascin¦e par la »joie de descendre«19 o¾ l’art se doit d’Þtre »art pour tous« s’il ne veut pas souffrir l’exil de la cit¦20, le dandy, hostile la r¦demption de l’homme industriel, est celui qui se fait le porte-parole, par une »sagesse abr¦g¦e«21 exprim¦e par la »moralit¦ de la toilette«22, d’une »dynamique morale«23 vou¦e une r¦demption artistique du sujet. Avec toute sa nature, tout son corps, 13 J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 141. 14 Dans l’¦l¦gance mat¦rielle Baudelaire voit le symbole de la sup¦riorit¦ aristocratique de l’esprit. Ibid., p. 710. 15 Ch. Baudelaire, L’œuvre et la vie de Delacroix, OC, II, p. 751. 16 Ibid., La Fanfarlo, OC, I, p. 577. 17 J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., pp. 96 – 97. 18 Ch. Baudelaire, Mon cœur mis nu, OC, I, 687. 19 Ibid., p. 683. 20 »On observera […] l’hostilit¦ l’art qu’ont montr¦e tous les r¦formateurs r¦volutionnaires«, ¦crit Camus au d¦but de »R¦volte et art«. A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 317. 21 Ch. Baudelaire, HygiÀne, OC I, p. 671. 22 Ibid., Mon cœeur mis nu, OC, I, p. 694. Balzac avait ¦crit, dans son Trait¦ de la vie ¦l¦gante, que »L’incurie de la toilette est un suicide moral«. H. de Balzac, Trait¦ de la vie ¦l¦gante, in La com¦die humaine, XXIII, Etudes analytiques, Paris, Garnier, 2008, p. 563. 23 Ch. Baudelaire, Mon cœur mis nu, OC I, p. 706.
222
Michela Landi (Firenze)
le dandy aspire »monter en grade« et, se faisant un esprit asc¦tique, »h¦ros, ou Saint«24, imite l’effort cr¦ateur de l’œuvre d’art: reflet elle-mÞme, son tour, de la cr¦ation du monde25. Œuvre de soi, autocr¦ation immanente et ¦ph¦mÀre d’un Þtre – ou d’une chose, qui se sent d¦j abandonn¦e des dieux – Sartre dira que Baudelaire »a toute sa vie, par orgueil et rancune, tent¦ de se faire chose aux yeux des autres et aux siens propres«26 – le dandy t¦moigne d’une »morale de l’effort« dont Sartre souligne plusieurs reprises la »vanit¦«: cet effort vise, en effet, ses yeux, ¦chapper, en mÞme temps, l’Þtre et l’existence, la nature et au systÀme du travail qui la remplace. Mais si, l’instar de la po¦sie le dandy, »image affaiblie du choix absolu des Valeurs inconditionnelles«, »ne sert pas«27, n¦anmoins sa rh¦torique est un art dramatique: il est, en tant que pr¦sence artistique du vivant, trÀs prÀs du »corps th¦tral« dont parle Camus. En tant que tel, ce corps r¦sumerait, selon l’auteur du Mythe de Sisyphe, »toute une esth¦tique et toute une morale«28 : la pens¦e humili¦e, dit-il, »n’a jamais cess¦ d’Þtre vivante«29. Un corps qui, se mouvant dans l’espace pour ex¦cuter ce que Kierkegaard appelait, avec m¦pris, »la valse de l’instant«30, apprend n¦anmoins, dans la vanit¦ de son acte, les limites de sa libert¦: la »valse m¦lancolique« qu’¦voquait ¦galement Baudelaire dans Harmonie du soir31, nous la retrouverons sans ¦pithÀtes chez Sisyphe, le »travailleur inutile de l’enfer«32 car, c’est, maintenant d¦voil¦e, la destin¦e de l’homme absurde: »r¦p¦ter et pi¦tiner«33. La »toilette«, est donc ce qui cache encore au sujet cette r¦alit¦ d¦finitive: ce stade, »corps et esprit serr¦s«34, continue Camus, il n’y a pas de diff¦rence entre l’art et la vie, »il n’y a pas de frontiÀre entre le paratre et l’Þtre«35 : c’est encore le corps qui »apporte la connaissance«36. Ainsi, Caesonia, dans Caligula, n’a »d’autre dieu que [son] corps«37. 24 Ibid., p. 693. 25 Cf. Sartre: »il poursuit l’id¦al impossible de se cr¦er lui-mÞme […] c’est sa propre existence qu’il essaie de cr¦er«. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 146. 26 Ibid., p. 74. 27 Ibid., pp. 123 – 125. Sartre oppose le culte de l’Art pour l’Art la »litt¦rature engag¦e« de Hugo, Sand et Pierre Leroux. Ces derniers ¦taient, nous le savons, l’objet du m¦pris de Baudelaire. Et Sartre, d’ajouter, propos de Baudelaire: »Il ne sert pas, il demeure avare et ferm¦ sur soi, il ne se compromet pas dans sa cr¦ation«. Ibid., p. 176. Pour la th¦orie de l’inutilit¦ de la po¦sie, cf. J.-P. Sartre, Qu’est-ce que la litt¦rature?, Paris, Gallimard, 1948, p. 18. 28 A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 112. 29 Ibid., p. 40. 30 S. Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, III, dans Miettes philosophiques, Le concept de l’angoisse, Trait¦ du d¦sespoir Paris, Gallimard, »Tel«, 1990, p. 274. 31 Ch. Baudelaire, Harmonie du soir, in Les fleurs du mal, OC I, cit., p. 47. 32 A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 163. 33 Ibid., p. 156. 34 Ibid., pp. 113 – 114. 35 Ibid., p. 158. »A quel point le paratre fait l’Þtre, c’est ce qu’il [l’acteur] d¦montre«, ¦crivait-il plus haut. Ibid., p. 111.
»Mal, soit mon bien«. La question du dandy de Baudelaire à Camus
223
D¦j, nous le voyons bien, le dandy n’est pas loin de r¦pondre, par ses moyens, ce que Camus demandera l’artiste qui se sait absurde: un geste » styliser«, qui emprisonne »dans une expression significative la fureur passagÀre des corps ou le tournoiement infini des attitudes«. Voici, alors, »le modÀle, le type, l’immobile perfection qui apaisera, pour un moment, l’incessante fiÀvre des hommes«38. Si l’art, servi selon Camus par une »pens¦e n¦gative« – »travailler et cr¦er pour rien« et »cr¦er sans appel« constituent la maniÀre privil¦gi¦e de vivre: »vivre deux fois«39 – mais ¦galement par un effort quotidien de discipline, patience, lucidit¦, matrise de soi, pers¦verance dans un effort tenu pour st¦rile, bref, par une ascÀse40, le dandy serait, dans sa »self-purification and anti-humanity«41, un avatar de l’homme absurde, et, oserai-je dire qu’il serait mÞme, dans ce contexte (car, comme nous le dit bien M. Foucault, l’homme est une invention r¦cente) le premier homme. Se forgeant soi-mÞme par ses propres mains d’artiste-d¦miurge, il r¦pond, le premier, ce que Camus ¦crit dans »R¦volte et art«: »Chacun […] cherche faire de sa vie une œuvre d’art«, ou, encore, »donner une forme une chose vivante«42 : cette distinction, chÀre Baudelaire, dans laquelle Sartre voit la marque de la diff¦rence43, ou autrement l’expression d’un ¦cartÀlement entre »Þtre et exister«44, cette primaut¦ de la forme personnelle donn¦e la matiÀre en partage, est ce que Camus appelle, nous le verrons mieux, le style: »Qu’une seule chose vivante ait sa forme en ce monde, dit-il, et il [l’homme] sera r¦concili¦ !«45 La cr¦ation, m¦pris¦e par Sartre en tant que responsabilit¦ limit¦e, est, pour Camus, le trait marquant de la r¦volte. La possibilit¦ d’expression de l’existence par ses actes ¦tant infinie (c’est bien celle que Camus d¦finit l’aspiration la totalit¦ des r¦volutionnaires) il faut, par l’art, op¦rer un choix, »cadrer sa toile«46, en vue de reproduire, d’une vie sans bornes, l’unit¦ dans l’espace, ou autrement une »pr¦sence impos¦e ce qui devient«.47 Et si la belle architecture du dandy est cette pr¦sence mÞme se faisant pr¦sence artistique, la toilette n’est-elle pas ce cadre, barriÀre qui s¦pare l’artifice social du sujet de son immense nature, d’aprÀs Le cadre de Baudelaire?48 Si »la vie est sans style«, et l’homme, selon Camus, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Ibid., p. 113. Ibid., Caligula, cit., p. 31. Ibid., »R¦volte et art«, in L’homme r¦volt¦, cit., p. 321. Ibid., Le mythe de Sisyphe, cit., pp. 139 et 154. Ibid., p. 156. Ch. Baudelaire, OC, I, p. 659. A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 326. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 179. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., pp. 75 et 94. A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 327. Ibid., Le mythe de Sisyphe, p. 321. Ibid. p. 322. »Comme un beau cadre ajoute la peinture,/[…]Je ne sais quoi d’¦trange et d’enchant¦/En
224
Michela Landi (Firenze)
»cherche en vain cette forme qui lui donnerait les limites entre lesquelles il serait roi«49, voici que Camus se d¦tache encore une fois de la pens¦e sartrienne. C’est, en fait, ce »mettre en forme […] son corps ou ses attitudes«, et ces »pens¦es corporifi¦es«50, qui font du corps un poÀme, et du poÀme un corps, que Sartre renie; car, ses yeux, cela est le propre d’un homme qui pr¦fÀre »la cr¦ation po¦tique toutes les espÀces de l’action«51. Et c’est justement propos de Baudelaire que Sartre vise Camus, son ancien proche: »Supplice ou lucidit¦, cette tension apparat […] comme l’essentiel du dandysme et comme l’askÀsis stocienne; et, tout en mÞme temps, elle est horreur de la vie, crainte perp¦tuelle de se salir et de se compromettre«.52 Face l’intellectuel r¦volutionnaire – le h¦ros sartrien cút¦ de Hugo et de G. Sand – l’artiste camusien d¦couvre, cút¦ de Baudelaire, sa solitude53, et le m¦pris des hommes: le dandy, premier des »existentiels«, est aussi le premier faire l’¦preuve d’une »confrontation entre l’appel humain et le silence d¦raisonnable du monde«54. Caligula connat cette »immonde solitude«: celle »des poÀtes et des impuissants«55. Elle condamne le sujet un repli sur lui-mÞme, au physique et au moral: ou autrement, vivre et mourir, comme Sartre le rappelle en citant, cút¦ de Camus56, ce passage de Baudelaire, »devant un miroir«57. Ainsi, continue l’auteur de La naus¦e, Baudelaire »se pare pour se travestir et ainsi se surprendre; il avoue dans La Fanfarlo, qu’il se regarde dans tous les miroirs58 ; c’est qu’il veut s’y d¦couvrir tel qu’il est«. Mais ce que cet »Þtre«, continue Sartre, »recherche dans la glace, c’est lui-mÞme, tel qu’il s’est compos¦«59. Ce miroir, c’est bien, pour le dire avec Kierkegaard, la conscience » son stade esth¦tique«; mais cette conscience annonce l’homme absurde: »D’une
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
l’isolant de l’immense nature,//Ainsi bijoux, meubles, m¦taux, dorure,/S’adaptaient juste sa rare beaut¦; […]/et tout semblait lui servir de bordure«. Ch. Baudelaire, Un fantúme, III, »Le cadre«, OC, I, p. 39. A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 327. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 163. Ibid., p.176. Ibid., p. 173. »Sentiment de solitude […], sentiment de destin¦e ¦ternellement solitaire«. Ch. Baudelaire, Mon cœur mis nu, OC, I, p. 680. A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 46. Ibid., Caligula, cit., p. 82. »Vivre et mourir devant un miroir«, telle ¦tait, selon Baudelaire, la devise du dandy.»[…] Le dandy est par fonction un oppositionnel«. Ibid., L’homme r¦volt¦, cit., p. 75. Ch.Baudelaire, Mon cœur mis nu, OC, I, 678. »Baudelaire – ¦crit Sartre – est l’homme qui ne s’oublie jamais. Il se regarde voir; il regarde pour se voir regarder«. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 23. C’est le protagoniste, Samuel Cramer, qui, par son temp¦rament de com¦dien, allait regarder dans le miroir ses ¦tats d’me: »Une larme lui germait-elle dans le coin de l’œil quelque souvenir, il allait sa glace se regarder pleurer«. Ch. Baudelaire, La Fanfarlo, OC I, p. 554. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 144.
»Mal, soit mon bien«. La question du dandy de Baudelaire à Camus
225
certaine maniÀre«, ¦crit Camus dans L’homme r¦volt¦, »l’absurde qui pr¦tend exprimer l’homme dans sa solitude le fait vivre devant un miroir«60 : et c’est, comme nous le savons, l’obsession de Caligula. Face une d¦mocratie sans art, voici l’aristocratie de l’esprit. Il s’agit d’un parti que l’aristocrate Dom Juan pourtant refuse, au nom de celle que Camus appelle une vie sans appel61: face au choix op¦r¦ par le s¦ducteur, qui renonce toute conscience et toute morale, le dandy vit et pers¦vÀre dans la conscience du mal; savoir, dans une terrible moralit¦. Mais si Dom Juan est, selon Baudelaire, le calme h¦ros qui ne daignait rien voir62, l’¦tranger qui, » certaines secondes, vient notre rencontre dans une glace« […] ce sera l’absurde, comme Camus le dit dans Le mythe de Sisyphe63 ; et ce sont d¦j, devant cette glace qui s¦pare, selon Sartre, la conscience r¦flexive de la conscience r¦fl¦chie64, l’opposition et la lutte sans repos65. Le memento de sa conscience de r¦volt¦ pers¦cutait Baudelaire, que Sartre cite: »Dans quel embarras m’as-tu plong¦, mon Dieu ! Il me faut absolument un peu de repos, je ne demande plus que cela«66. C’est, selon Sartre, »le grand repos de la pierre et des Þtres inanim¦s«67 que l’homme aurait par une »adh¦sion totale de soi soi«68 : Moi=Moi. Caligula, h¦ros absurde de tous les temps, scandalis¦ par la mort et loin autant du calme antique auquel aspirait, selon Barbey d’Aurevilly, le dandy69, que du d¦senchantement, ressemble beaucoup l’auteur de Mon cœur mis nu:70 l’empereurdandy d¦fie en effet sa d¦mence devant un miroir, prononÅant son propre nom avec son »doigt sur la glace«71. Comme Caligula, Baudelaire a fait, Sartre le dit bien, l’exp¦rience d’une alt¦rit¦ formelle que la plupart se htent d’oublier, 60 A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 21. 61 Dom Juan, qui a choisi la »vie sans appel«, ne sait pas »regarder les portraits«. A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., pp. 78, 86, 95, 103. 62 Ch. Baudelaire, Dom Juan aux enfers, in Les fleurs du mal, OC I, pp. 19 – 20. 63 A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 31. 64 J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 27 passim. 65 A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 51. 66 J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 34. 67 Ibid., p. 149. 68 »Son souhait le plus cher – ¦crit encore Sartre – est d’Þtre, comme la pierre, la statue, dans le repos tranquille de l’immuabilit¦, mais que cette imp¦n¦trabilit¦ calme, cette permanence, cette adh¦sion totale de soi soi soit pr¦cis¦ment conf¦r¦e sa libre conscience en tant qu’elle est libre et en tant qu’elle est conscience«. Ibid., p. 157. 69 »Le dandysme introduit le calme antique au sein des agitations modernes; mais le calme des Anciens venait de l’harmonie de leurs facult¦s et de la pl¦nitude d’une vie librement d¦velopp¦e, tandis que le calme du dandysme est la pose d’un esprit qui doit avoir fait le tour de beaucoup d’id¦es et qui est trop d¦got¦ pour s’animer«. B. d’Aurevilly, Du dandysme et de Georges Brummel, Paris, Payot & Rivages, 1997, p. 57. 70 Parmi les projets de Baudelaire figurent »Un drame romain« et une »Jeunesse de C¦sar«. Ch. Baudelaire, OC, I, 645 – 646. 71 A. Camus, Caligula, cit., p. 44.
226
Michela Landi (Firenze)
savoir »l’¦preuve purement n¦gative de la s¦paration, et son exp¦rience a port¦ sur la forme universelle de la subjectivit¦, forme st¦rile que Hegel d¦finit par l’¦galit¦: Moi=Moi«72. Voici donc que, aux yeux de Sartre, l’orgueil du dandy et de Caligula, seraient l’effet »d’une illusion […] selon laquelle l’int¦rieur d’un homme se calquerait sur son ext¦rieur«73. Ressemblance un d¦tail prÀs: Caligula, qui marche en rond, faisant tourner le miroir sur lui-mÞme74, est, certes, un existentiel avant la lettre. Cependant, en empereur qu’il est, il a sur ses sujets un pouvoir artistique – arbiter elegantiae – autant qu’un pouvoir de vie: un pouvoir sans limites75, dont il se sert jusqu’ nier l’homme et le monde76. La r¦volte est au pouvoir, mais elle s’ignore en ces temps-l de l’histoire, puisque, comme Camus le voit bien, elle nat avec le christianisme77 et prend son acception m¦taphysique dÀs la fin du XVIIIe siÀcle78. õ cette ¦poque, l’art meurt, et l’histoire commence, tout comme la fin de la piÀce; et cela par la premiÀre action r¦volutionnaire de Caligula, la brisure du miroir79. Une pareille action, valeur initiatique, avait ¦t¦ accomplie par un alter ego de Baudelaire, le mauvais vitrier protagoniste du poÀme en prose ¦ponyme. Ces plaisanteries nerveuses ne sont pas sans p¦ril, et on peut souvent les payer cher. Mais qu’importe l’¦ternit¦ de la damnation qui a trouv¦ dans une seconde l’infini de la jouissance?80 Et, cút¦ des bons philosophes, il y aura au XVIIIe siÀcle le mauvais Diderot pour marquer, dans son Neveu de Rameau – que Camus cite dans L’homme r¦volt¦81 – la prise de conscience d’un certain absurde, qui n’est pas dans le souverain, bien install¦ dans son essence immobile, factum rationis, mais dans ses sujets, tous ext¦rieurs lui, et oblig¦s de prendre, par rapport au monde-Dieu et au destin qu’il incarne encore, des positions82. AprÀs, ce sera le nihilisme naturaliste, savoir le droit pour tous d’affirmer, comme Caligula: »je suis libre«83, et, pareillement: »je suis artiste«. De l’autre cút¦, ce sera alors la r¦volte 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., pp. 20 – 21. Ibid., p. 25. A. Camus, Caligula, cit., p. 142. »Les autres cr¦ent par d¦faut de pouvoir. Moi, je n’ai pas besoin d’une œuvre: je vis«. Ibid., p. 137. Ibid., p. 51. A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 48. Ibid., p. 45. A. Camus, Caligula, cit., p. 150. Ch. Baudelaire, Le mauvais vitrier, OC I, p. 287. »Entre le neveu de Rameau et les ,conqu¦rants‘ du XXe siÀcle, Byron et Shelley se battent d¦j, quoique ostensiblement, pour la libert¦«. A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 77. »Le pis, c’est la posture contrainte o¾ nous tient le besoin. […] Il n’y a dans tout un royaume qu’un homme qui marche, c’est le souverain. Tout le reste prend des positions«. D. Diderot, Le Neveu de Rameau, Paris, Librairie G¦n¦rale FranÅaise, 1984, pp. 105 – 106. A. Camus, Caligula, cit., p. 66.
»Mal, soit mon bien«. La question du dandy de Baudelaire à Camus
227
m¦taphysique, le triomphe du pouvoir de vie ou de mort par la cr¦ation antagoniste, ou, autrement, le »pouvoir meurtrier de la po¦sie« que Caligula annonce avec sa vie et que Camus entrevoit, comme un danger, dans le dandysme litt¦raire. Si en effet, Baudelaire le dira bien aprÀs Diderot: »Dieu est le seul qui, pour r¦gner, n’a pas besoin d’exister«84, Dieu, pourtant, n’est plus: »se donner encore la peine de nier Dieu, ¦crit-il, est le seul scandale«85. Dieu mÞme est un scandale, ajoute-t-il, »un scandale qui rapporte«86, et il faut entendre, par ce verbe polys¦mique, autant la nouvelle Chose capitale, le Dieu rentable, le Dieu-argent des d¦mocrates, que le fait mÞme de mettre en relation, par un Dieu-masque, l’homme et son monde: chez le r¦volt¦ m¦taphysique, qui d¦nonce en Dieu, selon le mot mÞme de L’homme r¦volt¦, »le pÀre de la mort et le suprÞme scandale«87, l’absurde est encore une fois, aprÀs le Mythe de Sisyphe, dans la comparaison, que Voltaire refusait, entre »un ¦tat de fait et une certaine r¦alit¦«88. Et Baudelaire ne note-t-il pas, se faisant d¦j si prÀs de Camus, que »le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c’est qu’il existe«?89. Sartre le dit bien: Baudelaire est l’homme qui, »¦prouvant le plus profond¦ment sa condition d’homme, a le plus passionn¦ment cherch¦ se la masquer«90. Une incoh¦rence s’amorce dans la pens¦e de Camus si on compare son image du dandy avec son id¦e de l’homme absurde: mais il s’agit, comme nous le verrons, d’une dialectique f¦conde, qui marque, par rapport celle de Sartre, son originalit¦. Camus situe »la r¦volte des dandys« au cœur de celle qu’il d¦finit, dans L’homme r¦volt¦, la r¦volte m¦taphysique. Apanage des gens de lettres, cat¦gorie que Baudelaire qualifie, rappelons-le, comme l’ennemie du monde91, la r¦volte m¦taphysique se fait l’expression, par rapport un int¦rÞt g¦n¦ral qui touche l’abjection mat¦rialiste, des int¦rÞts hautains d’une minorit¦ sectaire. Cette citadelle id¦ologique, visant sauvegarder, par l’abn¦gation, un monde irrationnel et esth¦tis¦, est, aux yeux de Camus, l’¦gale des chteaux o¾ Sade se livrait, par l’esprit, au mal sans limites pour perfectionner l’¦poque r¦publicaine du d¦senchantement. Camus voit dans cette attitude l’essor mÞme du nihilisme, allant jusqu’ justifier l’une de ses r¦alisations les plus extrÞmes, les camps d’exterminations92. Ce jugement, avanc¦ dans »R¦volte et art« se rapproche alors de maniÀre surprenante de celui que Sartre formule dans son Baudelaire. 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Ch. Baudelaire, Fus¦es, OC I, p. 649. Ibid., p. 666. Ibid., p. 660. A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 42. Ibid., Le mythe de Sisyphe, cit., p. 50. »L’absurde est essentiellement un divorce. Il n’est ni dans l’un ni dans l’autre des ¦l¦ments compar¦s. Il nat de leur confrontation«. Ibid., p. 50. Ch. Baudelaire, Fus¦es, OC I, p. 665. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 41. Ch. Baudelaire, Mon cœur mis nu, OC I, p. 695. A. Camus, L’homme r¦volt¦, p. 74.
228
Michela Landi (Firenze)
Homme hostile l’action (par le fait que l’action mÞme est soumise au d¦terminisme), Baudelaire cherche dans la cr¦ation, au dire de Sartre, l’expression de la pure libert¦ et de la gratuit¦ de la conscience93, capables de faire le mal absolu: on est tout prÀs, nous le voyons, du pouvoir meurtrier de la po¦sie qui confond, selon Camus, l’art et la vie, et que Caligula repr¦sente. Camus se situe encore sur le mÞme plan par rapport Sartre lorsqu’il reconnat, cette r¦volte, une mauvaise conscience: la diff¦rence du r¦volutionnaire, qui veut changer le monde, le r¦volt¦, dit Sartre, »a soin de maintenir intacts les abus dont il souffre pour pouvoir se r¦volter contre eux«94. Camus ne s’exprime pas autrement: »Ce h¦ros est ,fatal‘, parce que la fatalit¦ confond le bien et le mal sans que l’homme puisse s’en d¦fendre«.95 Mais si le rapport du mal et de la po¦sie nat, selon Sartre, au moment o¾, »par-dessus le march¦, la po¦sie prend le mal pour objet«, et c’est alors que »ces deux espÀces de cr¦ation responsabilit¦ limit¦e se rejoignent et se fondent« et que nous »poss¦dons, pour le coup, une fleur du mal«96 dont l’effet est tout simplement l’inutilit¦. Camus voit dans la po¦sie la possibilit¦ du mal responsabilit¦ totale: elle a, pour lui, bien ¦videmment, une valeur ¦thique que Sartre ne lui reconnat pas. Et c’est bien l le point de d¦part. Il ne fait pas de doute qu’il s’agit, pour le dandy, d’une r¦alit¦ g¦ographiquement et historiquement situ¦e, et qu’elle est marqu¦e par sa situation autant que l’est, certains ¦gards, le jugement que lui r¦servent Sartre et Camus. Il nous parat par cela essentiel de d¦historiciser ces deux r¦alit¦s – r¦alit¦ du siÀcle jugeant, et r¦alit¦ du siÀcle jug¦ – pour montrer les analogies profondes qui existent, comme nous l’avons avanc¦, entre le dandy et l’homme absurde camusien. La distance entre Baudelaire et Camus nous apparatrait – si l’on adopte librement les cat¦gories kirkegardiennes de Ou bien…ou bien97 – comme la repr¦sentation d’un procÀs qui mÀne, par une prise de conscience successive, du stade esth¦tique (le stade de Don Juan et de Caligula, en mÞme temps dandys, s¦ducteurs, r¦volt¦s m¦taphysiques et hommes absurdes) au stade ¦thique, marqu¦ par la responsabilit¦ et le consentement. Mais ce procÀs – qu’on jugera nous-mÞme trop ais¦ment comme un procÀs ¦volutif, telle est notre confiance dans la t¦l¦ologie de l’histoire – n’est nullement satisfaisant. Baudelaire, ennemi, nous l’avons dit, d’une morale ax¦e sur les droits sans limites de la nature, fonde, par la rigueur esth¦tique, une ¦thique de la responsabilit¦ totale. Prenant conscience, en effet, de l’illusion t¦l¦ologique de l’histoire, il voit trop bien que notre avenir radieux d’hommes civilis¦s par le progrÀs mat¦riel se referme dans un cercle vicieux: nature-culture-nature. On parlera donc, propos de Baudelaire, 93 94 95 96 97
J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 42. Ibid., p. 50. A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 71. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 68. S. Kierkegaard, Ou bien…ou bien (Aut-aut), Paris, Gallimard [1943], 2005.
»Mal, soit mon bien«. La question du dandy de Baudelaire à Camus
229
de la contre-affirmation pol¦mique d’un stade ¦thique de l’humanit¦. Il n’y a qu’un pas pour rejoindre, avec Camus, un nouvel humanisme: la reconnaissance de l’absurde attend de lui, en mÞme temps, une synthÀse et un consentement, qui permette, maintenant, de fonder l’Empire des hommes.98 D’ailleurs, Camus reconnat, dans tout acte de r¦volte, l’exigence m¦taphysique de l’unit¦, l’impossibilit¦ de s’en saisir, et la fabrication d’un univers de remplacement. En tant que fabricatrice d’univers, la r¦volte est en effet – du moins en partie comme il le dit – une exigence esth¦tique99. Or, ce passage est, nous le comprenons, en contradiction avec son id¦e du dandy, telle qu’elle est formul¦e, notamment, dans »La r¦volte du dandy«. Disons tout d’abord que, dans une œuvre thÀse telle que l’est L’homme r¦volt¦, ce passage repr¦sente, en quelque sorte, une transition n¦cessaire: une n¦gativit¦ surmonter. Par rapport Baudelaire – et Sartre, qui reconnat l’absurde une connotation morale et p¦jorative en mÞme temps100 – l’acquisition d’un bonheur dans l’absurde demande un double affranchissement: de la morale d’un cút¦; du problÀme du mal de l’autre. Si, chez Baudelaire, autant que chez Sartre, un certain substantialisme cat¦gorique s¦parant l’esth¦tique de l’¦thique parat, en somme, enfermer le dandy et l’homme absurde dans leur n¦gativit¦ morale, Camus r¦duit le dandysme son ¦tat de ph¦nomÀne historique: en vue d’un perfectionnement de la conscience ¦thique, cette r¦volte immorale fraie le chemin la d¦couverte d’un humanisme d¦finitivement ¦mancip¦ de la loi morale. Le culte du personnage, loin de se rattacher, comme on pourrait le croire, au culte de l’individu101 dans la soci¦t¦ de masse, s’y oppose. Il cr¦e, tout d’abord, une exemplarit¦ qui, d’abord imit¦e par une communaut¦ restreinte d’initi¦s, est destin¦e fonder, sans passer par la r¦volution qui tue pour affirmer, celle que Sartre appelle »une ¦thique plus large et plus f¦conde«.102 Ce nouvel humanisme, pr¦conis¦ par Camus, se forge une ¦thique sans ¦pithÀtes; une ¦thique qui, int¦rioris¦e, intellectualis¦e et matris¦e, s’affranchit d¦finitivement de ses adjuvants mat¦riels et de ses ext¦riorisations pr¦dicatives. Entre, en somme, le paratre du dandy, et le faire du r¦volutionnaire103, entre le formalisme pur et le r¦alisme, il y a »le grand art, le style, le vrai visage de la r¦volte«:
98 A. Camus, L’homme r¦volt¦., cit., p. 44. 99 Ibid., p. 320. 100 »l’acte cr¦ateur du peintre ou du poÀte, vid¦ de sa substance, prend forme d’acte strictement gratuit […] et mÞme absurde«. Cette id¦e morale, qui associe st¦rilit¦ et absurde est trÀs proche de la morale de Baudelaire qui, dans Le mauvais vitrier, se sentait pouss¦, nous l’avons vu, »ex¦cuter les actes les plus absurdes et souvent mÞme les plus dangereux«. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 135. 101 A. Camus, »La r¦volte des dandys«, in L’homme r¦volt¦, cit., p. 74. 102 J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 46. 103 A. Camus, »R¦volte et art«, in L’homme r¦volt¦, cit., p. 328.
230
Michela Landi (Firenze)
celui-ci se tient, comme Camus le dit dans »R¦volte et art«, »entre ces deux h¦r¦sies«104. Voyons, donc, quelles sont les ¦tapes de l’acquisition d’un nouvel humanisme. Le point de d¦part, pour le dandy, autant que pour l’homme absurde, est sans doute la r¦volte devant la perte de sens du monde moderne: attitude qui nat du refus de deux injustices qui se situent au mÞme plan et dont l’une, accidentelle, r¦vÀle l’autre, essentielle: une injustice historique et politique favorise certainement la prise de conscience d’une injustice radicale de l’Þtre au monde. Voici pourquoi l’homme qui prend conscience est, juste avant d’Þtre proprement parler, absurde, forc¦ment excentrique: le rester dehors (ex-centrum) que cet adjectif ¦voque au sens ¦tymologique, est exactement le mÞme, on le sait, qui fonde l’id¦e d’existence (ex-sistere). Loin d’Þtre, comme le veut ce moment Camus, la »nostalgie d’une morale«105, la r¦volte romantique traduit d¦j, sa maniÀre, et dans sa r¦alit¦ propre, le refus d’un monde que la r¦volution bourgeoise avait r¦tabli dans son immuable et profitable essence: un monde nouveau coh¦rent, selon les mots de Cherea, qui refuse de mener une action r¦volutionnaire contre Caligula106 : cette essence o¾ l’homme moral vient se retrouver, est d¦sormais une nature lib¦rale et banale jusqu’au meurtre; le dandy, autant que l’homme absurde, sont alors, pareillement, les enfants gt¦s du positivisme qui, Camus le voit bien, est l’apoth¦ose des certitudes ¦difiantes des LumiÀres, de la »pens¦e satisfaite«107. Si la r¦volution se fait par le d¦pouillement de tout signe ext¦rieur, de toute ¦pithÀte mystifiante et par la provocation des paradoxes (la r¦volution est elle-mÞme un paradoxe, puisque dans le but de faire le bien elle fait tomber des tÞtes dans un siÀcle comme dans l’autre) la r¦volte se fait par l’ironie, qui est tout d’abord ( son stade esth¦tique), travestissement: simulation, dissimulation de soi. L’ironie, que Baudelaire tient pour une qualit¦ litt¦raire fondamentale108 et que Barbey d’Aurevilly considÀre, aprÀs Balzac, comme »un g¦nie qui dispense de tous les autres«109, commence justement par un geste inutile: celui d’habiller d’une v¦rit¦-autre, sciemment ¦ph¦mÀre, le monde qu’avait d¦pouill¦ le sarcasme de Voltaire, paresseux aux yeux de Baudelaire110. Au philosophe qui m¦prise une morale de l’effort pour r¦affirmer une v¦rit¦ de nature accueillie en pr¦texte pour toute action immorale, et ses h¦ritiers s’opposeront donc par l’ironie, deux moments diff¦rents de l’histoire, ceux qui 104 105 106 107 108
Ibid., p. 339. Ibid., p. 104. Ibid., Caligula, cit., p. 52. Id., Le mythe de Sysiphe, cit., p. 156. »Deux qualit¦s litt¦raires fondamentales: surnaturalisme et ironie«. Ch. Baudelaire, Fus¦es, OC I, p. 658. 109 Barbey d’Aurevilly, Du dandysme et de Georges Brummel, cit., p. 77. 110 Ch. Baudelaire, Mon cœur mis nu, OC I, p. 688.
»Mal, soit mon bien«. La question du dandy de Baudelaire à Camus
231
ont refaire l’homme en tant qu’Þtre dont la dignit¦ est faite par la volont¦ et la conscience; un Þtre auquel Vigny d¦j – ce dandy auquel Camus reconnat la haineuse atonie de l’indiff¦rence du bien et du mal,111 – avait voulu ressembler : Sisyphe. Et Camus de remarquer, dans Le mythe de Sisyphe, qu’»aucune des ¦vidences ironiques, des contradictions d¦risoires qui d¦pr¦cient la raison« n’¦chappe l’homme absurde.112 Une ¦tape ult¦rieure de cette acquisition est repr¦sent¦e par l’affranchissement, de la part du sujet, et du siÀcle qui est le sien, des oripeaux m¦taphysiques qui entravent l’essor du nouvel humanisme. Le culte du moi qu’inaugure le dandy en constitue sans doute le premier stade: le dandysme affirme, comme on l’a vu, une transcendance de soi. L’esprit lucif¦rien qui condamne entre temps le sujet une lutte acharn¦e contre un scandale au visage divin est, Camus le voit tout aussi bien, une arme logique113 dans les mains du r¦volt¦. Et s’il y a, cút¦ des crimes de passion, des crimes de logique, comme Camus le dit dans l’incipit de L’homme r¦volt¦114, le crime commis par le r¦volt¦ romantique n’est que la d¦mesure. Il s’agit, par cela, d’une action qui reste individuelle, ou sectaire: dans son d¦fi de la loi morale et divine, l’artiste romantique n’invente pas le r¦volutionnaire, il invente son contraire, le dandy. Celui-ci, trouvant une solution provisoire dans l’attitude se ferait, notamment, »admirer sur les planches«115 (on pense, sans doute, l’albatros baudelairien), au cours d’une lutte spectaculaire avec »ce Mal qui est son seul Bien«. Dans cette lutte men¦e contre le Mal du monde (dont toute la diff¦rence, entre Baudelaire et Camus, est dans la majuscule all¦gorisante), le dandy ne s’¦rige point en h¦ros positif (en h¦ros r¦volutionnaire), voire en victime sacrificielle: l’image de l’albatros, ce bouc ¦missaire, ne se retrouve-t-elle pas dans l’attitude de Meursault qui, la fin de l’Êtranger, condamn¦ par un tribunal absurde, est (autant que Baudelaire, qui a vu la corolle coup¦e quelques siens fleurs, chefs-d’œuvre immoraux d’un existentialisme naissant) avide des hu¦es de l’assistance, sa seule r¦demption? Ainsi Caligula: »Et il me faut du monde, des spectateurs, des victimes et des coupables«116. Ne faudrait-il pas voir alors, dans ce Lucifer d’occasion que Baudelaire reconnat d’ailleurs comme l’¦gal d’un Dieu d¦chu, cruel et th¦riomorphe, le masque transcendant du th¦ocrate qui juge, dans un tribunal, l’innocent? C’est, en effet, le »visage bÞte et incompr¦hensible des dieux« que Caligula nous montre117. La parade des procÀs, le jeu terrible du juge d’instruction et de l’accus¦, remarque d’ailleurs Camus, 111 112 113 114 115 116 117
A. Camus, »La r¦volte des dandys«, in L’homme r¦volt¦, cit., p. 72. Ibid., Le mythe de Sisyphe, cit., p. 43. Ibid., L’homme r¦volt¦, cit., p. 74. Ibid., p.15. Ibid., p. 74. Ibid., Caligula, cit., p. 42. Ibid., p. 97.
232
Michela Landi (Firenze)
prouve que le r¦volt¦ romantique, »refusant ce qu’il ¦tait, se condamnait provisoirement au paratre dans le malheureux espoir de conqu¦rir un Þtre plus profond«118. Une troisiÀme ¦tape, dans cet apprentissage, est repr¦sent¦e par la n¦cessit¦ d’opposer une culture mat¦rialiste mue par le d¦sir de r¦gresser vers un eud¦monisme facile dict¦ par la nature, une culture philosophique qui demande de l’effort authentiquement progressif ses adeptes. C’est, de prime abord, le rigorisme sectaire et asc¦tique du dandy : op¦ration, sans doute, de surcompensation identitaire119 au moment o¾ l’homme, ayant perdu ses certitudes d’Þtre dans le monde, vise se construire en tant qu’Þtre pour soi. Or, si la soci¦t¦ s’accepte au premier d¦gr¦, par ce qu’elle a, le philosophe doit construire son bien. Cette recherche de soi passe, nous l’avons soulign¦, par son stade esth¦tique, autrement dit par une ext¦riorisation mat¦rielle de l’Þtre: sa ph¦nom¦nologie, c’est d’abord son paratre, ou le ph¦nomÀne individuel. Camus voit par cela dans le dandy, qui cr¦e sa propre unit¦ par des moyens esth¦tiques, une forme d¦grad¦e de l’ascÀse120, car l’unit¦ entre le sujet et le monde qu’elle vise ne se passe pas encore de l’opposition et de la sp¦cularit¦: le d¦doublement et l’autoscopie, que Sartre analyse dans son Baudelaire, sont, dans leur cruaut¦, ce qui annonce, ¦thiquement, l’acceptation de soi, savoir, une nouvelle position, ou thÀse: le nouvel humanisme dont on parle. Et, on le sait d¦sormais, tout apprentissage de soi passe par un d¦placement, par une excentricit¦, par un voyage de formation autour de son propre monde. Par l, Sartre le dit bien, »quelque chose s’est produit qui n’existait pas auparavant que rien ne peut effacer et qui n’¦tait aucunement pr¦par¦ par l’¦conomie rigoureuse du monde: il s’agit d’une œuvre de luxe, gratuite et impr¦visible«121. Si le dandy, pour Sartre comme pour Camus, joue sa vie, faute de pouvoir la vivre122, il est dans le bon chemin pour rejoindre ce Sisyphe qui, roulant la pierre de sa damnation, aura trouv¦, contre son bonheur de remplacement, son acquiescement dans le mouvement perp¦tuel: seul paradoxe consentant la conscience, et la vie. Une derniÀre ¦tape, et la plus ardue, est marqu¦e par l’acquisition d’une conscience du rapport intersubjectif que l’homme absurde entretient avec son Þtre-artiste; il s’agit d’une question qui se lie strictement la pr¦c¦dente, car, ce qu’elle met en jeu est le rapport entre le stade esth¦tique et le stade ¦thique du 118 Ibid., L’homme r¦volt¦, cit., p. 78. 119 Sartre dit, ce propos, que »son effort essentiel est […] pour se r¦cup¦rer«. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 144. 120 A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 75. 121 J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 68. 122 A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 76. Sartre remarque, ce propos que Baudelaire, »en consacrant ses efforts et ses soins cultiver des anomalies sans efficace […] accepte d’Þtre consid¦r¦ comme un adolescent qui joue«. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 69.
»Mal, soit mon bien«. La question du dandy de Baudelaire à Camus
233
sujet; entre le ph¦nomÀne et le noumÀne; entre le paratre et l’Þtre; et, encore, entre une v¦rit¦ morale et sa m¦taphore artistique. Cette question, qui demeure ouverte dans la philosophie de Camus, se pose surtout propos de Baudelaire, qui incarne ce dualisme de faÅon embl¦matique. Du r¦volt¦ m¦taphysique, au r¦volt¦ romantique Camus en vient finalement, dans L’homme r¦volt¦, la »r¦volte du dandy«, et, incontournable, le nom de Baudelaire s’impose, car il est bien, comme il le dit avant d’entrer en matiÀre, le »th¦oricien le plus profond du dandysme«123. õ la diff¦rence de Victor Hugo, pantin de la r¦volte qui finira par servir la r¦volution bourgeoise, Baudelaire est, ¦crit Camus, prendre au s¦rieux. Il m¦rite, cút¦ de Lacenaire, gentilhomme criminel auteur de nombreux meurtres, l’appellation de poÀte du crime. Or, nous le savons, Baudelaire, admirateur de Sade, n’a, l’instar de son pr¦decesseur, tu¦ homme. L’auteur des Fleurs du mal avait horreur du crime comme il avait horreur de la nature124, laquelle incite l’homme, comme Sartre le rappelle en citant Le mauvais vitrier, »ex¦cuter les actes les plus absurdes et souvent mÞme les plus dangereux«125. Donc, sa seule faute a ¦t¦, parat-il, de reconnatre l’absurde dans la nature, qui nous force irr¦sistiblement vers l’action, vers l’histoire; et d’avoir alors admis que, par cela mÞme, le crime est dans le monde: »Tout en ce monde sue le crime«126, d’aprÀs le passage de Mon cœur mis nu [XLIV] que Camus cite. Cela fait, selon Camus, que Baudelaire est, l’exemple de Sade, un homme de lettres parfait. Que veut-il dire? Qu’ayant tu¦ en imagination, il »a mis au-dessus de tout ,le crime moral auquel on parvient par ¦crit‘«127. D’ailleurs, Baudelaire mÞme, Sartre le rappelle avec Cr¦pet, »se traite en criminel, se d¦clare coupable ,de tous les cút¦s‘«128. Sartre prend, cút¦ de Camus, Baudelaire au pied de la lettre, en affirmant que »chez lui le crime est concert¦, accompli d¦lib¦r¦ment et presque par contrainte«129 : l’impossibilit¦ d’agir pour le bien (de respecter une morale) est, en soi, semble-t-il, un crime. DÀs ce moment – moment qu’on appellerait, avec Caligula, de la po¦sie meurtriÀre130 – »les ¦crits feront commettre des crimes«131. C’est, ¦videmment, la faute Sade. Mais il faut aussi reconnatre Sade le m¦rite d’avoir le premier, par le malentendu qu’il a 123 A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 77. 124 »Les horreurs de Juin. Folie du peuple et folie de la bourgeoisie. Amour naturel du crime«. Ch. Baudelaire, Mon cœur mis nu, V, OC I, 679. 125 Ibid., Le mauvais vitrier, OC, I, p. 285. Cf. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 33. 126 A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 76. Camus ¦crit, plus loin, que la r¦volte, »d¦tourn¦e ses origines et cyniquement travestie, oscille tous le niveaux entre le sacrifice et le meurtre«. Ibid., p. 350. 127 Ibid., p. 68. 128 J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 44. 129 Ibid., p. 173. 130 A. Camus, Caligula, cit., p. 62. 131 Ibid., L’homme r¦volt¦, cit., p. 69.
234
Michela Landi (Firenze)
encourag¦, »orient¦ la r¦volte sur les chemins de l’art«132 : au sommet de la d¦ch¦ance d’une aristocratie cynique qui encourage la R¦publique, l’espoir pour tous de l’homme absurde se d¦gage. Baudelaire, remarque encore Camus, a, par rapport Lacenaire, »moins de rigueur, mais du g¦nie«133 pour avoir cr¦¦, cút¦ de Sade, son jardin du mal: et le mal serait plutút dans le fait d’avoir enclos ce jardin, hortus conclusus que Voltaire pr¦tendait cultiver pour que l’int¦rÞt individuel se mue en int¦rÞt g¦n¦ral. La faute Baudelaire, est-elle, en somme, r¦elle ou m¦taphorique; humaine ou artistique? C’est l que se joue la question la plus d¦licate de la pens¦e camusienne; savoir la distinction entre la morale sociale et l’¦thique artistique. Autrement dit: est-ce que l’art a une morale? Et peut-il, par cela mÞme, Þtre immoral? Le crime m¦taphorique a, dans ce cas, la mÞme valeur que le crime r¦el? Une chose est certaine: si Baudelaire a cat¦goriquement r¦fus¦ d’attribuer l’art une morale (une morale sociale qui, ancien apanage de l’Êglise, allait se d¦verser dans le lacisme bourgeois) c’est que l’art est, lui-mÞme, une ¦thique; il a, comme le dandy, ses propres principes formels valeur substantielle. Le problÀme surgit au moment o¾ ce stade esth¦tique est historiquement d¦pass¦, et un surcrot de tragique oblige l’homme jeter son masque et denoncer le mal moral qu’on fait par l’histoire. L’intellectuel se trouve alors devant une impasse: faire œuvre d’art, et jouer sa propre et immuable ¦thique r¦volt¦e, ou faire, comme l’a fait Sartre, œuvre thÀse, adoptant la langue et le style qui furent, et le seront toujours, de la r¦volution. Les deux perspectives sont ¦galement hostiles Camus: l’une tombe, selon la th¦orie formul¦e dans »R¦volte et style«134 qu’on vient de mentionner, sur le formalisme, qui expulse le r¦el; l’autre sur le r¦alisme, qui expulse l’art. Ce qu’il recommande c’est plutút, nous l’avons vu, une stylisation; savoir, une volont¦ de correction que l’artiste doit exprimer dans la repr¦sentation du r¦el. Le grand style est alors une »stylisation invisible, c’est dire incarn¦e«: »une exag¦ration qui soit proportionnelle elle-mÞme«135. Quoi de plus proche la po¦tique de Baudelaire? Le th¦oricien du dandysme recommande avec Balzac (ce dernier, que Camus qualifie de romancier philosophe136 ¦tant ¦galement l’auteur d’un Trait¦ de la vie ¦l¦gante) la distinction. Il entend, par ce substantif, une simplicit¦ absolue137, qui est la meilleure maniÀre de se distinguer, consistant en une originalit¦ contenue dans les limites ext¦132 133 134 135 136
Ibid. Ibid., p. 76. Ibid., pp. 334 – 339. Ibid., p. 339. Selon Camus Balzac est, avec Stendhal, un romancier philosophe: le contraire d’un ¦crivain thÀse, qui, persuad¦ de l’inutilit¦ de la cr¦ation, ¦crit en image plutút qu’en raisonnement. Ibid., Le mythe de Sisyphe, cit., pp. 137 – 138. 137 Sartre cite cette d¦finition. Cf. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 136.
»Mal, soit mon bien«. La question du dandy de Baudelaire à Camus
235
rieures des convenances138. Camus ne s’est pas trop ¦loign¦ de Baudelaire, admettant que »l’effort cr¦ateur refait le monde […] avec une l¦gÀre gauchissure qui est la marque de l’art et de la protestation«139. Et de citer, un peu plus loin, dans »R¦volte et style«, un autre dandy de l’esprit, et idiot de la famille: Flaubert, dont la stylisation, source de distinction et de correction du r¦el, a d’abord ¦t¦ prise, comme pour Baudelaire, pour la r¦alit¦ des choses: c’est la raison du procÀs Mme Bovary. Nous voyons donc que la »tension ininterrompue entre la forme et la matiÀre, le devenir et l’esprit, l’histoire et les valeurs« que Camus prúne est, dans ses principes, la mÞme que souhaite Baudelaire pour le dandy litt¦raire140. Mais, pour revenir »La r¦volte des dandys«, Camus reproche encore Baudelaire le conformisme id¦ologique que ce dernier doit Joseph de Maistre, son matre penser141: c’est le conformisme du conservateur. Or, une nouvelle question se pose: »est-ce que le conservatisme est-il un conformisme«, pour reprendre une formule sartrienne? Le conformisme que Baudelaire attaque est celui de la pens¦e voltairienne, nourrie d’h¦donisme scientiste et progressiste, que la classe bourgeoise post-r¦volutionnaire avait adopt¦. Donc, un certain conservatisme, qui demande plus de spiritualit¦ et de rigueur une soci¦t¦ mat¦rialiste et laxiste, n’est, de ce temps-l, que l’expression de la r¦volte. D’ailleurs, la contradiction, affirme Camus dans Le mythe de Sisyphe, est »peutÞtre la plus subtile de toutes les formes spirituelles«142. Pour en revenir »La r¦volte du dandy«, Camus voit, dans le poÀte des Fleurs du mal, le cr¦ateur d’une doctrine centr¦e autour de la mort et du bourreau143. Or, Baudelaire est celui qui est le plus loin d’une doctrine: son ironie – l’ironie du r¦volt¦ que Camus recommande plusieurs reprises: »ce sont les philosophes ironiques qui font les oeuvres passionn¦es«144 – le maintient constamment dans le vif d’une dialectique, si ce n’est d’une maieutique. Et les sujets de la mort, du bourreau et de la victime qui figurent, pour utiliser les cat¦gories sartriennes, au centre de la conscience r¦flexive-r¦fl¦chie de Baudelaire, sont bien, cút¦ du crime, nous l’avons rappel¦, au cœur de la philosophie de Camus. C’est Sartre qui,
138 Ch. Baudelaire, Le dandy, OC I, p.710. 139 Ibid., p. 338. 140 L’¦pilemme de L’homme r¦volt¦, qui s’inspire peut-Þtre d’H¦raclite: »L’arc se tord, le bois crie. Au sommet de la plus haute tension va jaillir l’¦lan d’une droite flÀche« (A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 382) n’est pas sans rappeler la dynamique intellectuelle de Baudelaire, souvent repr¦sent¦e par l’arc et la flÀche (cf. La mort des artistes; Le mauvais vitrier, Fus¦es). 141 »De Maistre et Edgar Poe m’ont appris raisonner«. Ch. Baudelaire, Fus¦es, OC I, p. 669. 142 A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 92. 143 Ibid., L’homme r¦volt¦, cit., p. 77. 144 Ibid., Le mythe de Sisyphe, cit., p. 157.
236
Michela Landi (Firenze)
cette fois, dit le dernier mot: »Pour qui r¦fl¦chit, toute entreprise est absurde; Baudelaire a baign¦ dans cette absurdit¦«145. Si on compare, finalement, les deux sections: »La R¦volte m¦taphysique« et »R¦volte et art«, qui constituent deux diff¦rents moments de r¦flexion au sein de L’homme r¦volt¦, des incoh¦rences s’esquissent qui r¦vÀlent la grande modernit¦ de Camus: modernit¦ au sens plein, mÞme de franchir les barriÀres historiques qui font de quelques auteurs des auteurs situ¦s. Devant Baudelaire, ce grand proche, Camus d¦couvre son impens¦. Pour l’¦luder, il pense en moraliste, reniant la litt¦rature salvatrice, le sacrifice, et la mort r¦demptrice. Il est vrai que, un siÀcle auparavant, il y avait lutter encore contre Dieu et une th¦ocratie r¦sistante; car Dieu, ou le Juge, ¦taient l, monstrueux d¦j, avant de disparatre. Et le fait que Baudelaire ¦tait encore trop th¦ologien, comme Camus le dit encore, est, apparemment, sa seule faute historique. Mais c’est juste aprÀs lui que Dieu est mort, et avec lui la grammaire du monde qui donnait un sens transcendant la vie collective. Camus est donc son h¦ritier, et tout l’humanisme existentialiste qui a eu affaire avec le grand thÀme de la libert¦ lui est redevable. Contre les chemins de la libert¦ sartriens, Camus a d¦couvert en elle ses limites: l’homme absurde d¦couvre, avec le dandy, »qu’il n’¦tait pas r¦ellement libre«146. Il nous faut consid¦rer, pour terminer, deux ¦crits de Camus qui, affect¦s par une compl¦mentarit¦, ont comme protagonistes deux artistes qui incarnent ce mÞme d¦doublement: Il s’agit de »L’artiste en prison«147, pr¦face la traduction franÅaise de Ballad of Reading Gaol de O. Wilde, et de Jonas ou l’artiste au travail148. Dans le premier de ces deux ¦crits Camus annonce ce qu’il va soutenir dans son c¦lÀbre »Discours de SuÀde«, lors de la remise du prix Nobel, le 10 d¦cembre de 1957: l’art n’est pas une r¦jouissance solitaire, voire un moyen de concerner le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privil¦gi¦e des souffrances et des joies communes149. Wilde, le dandy, le cynique, l’homme blas¦ de Decay of Lying avait exprim¦ le divorce entre deux r¦alit¦s: l’œuvre unique d’un cút¦, la r¦p¦tition du monde de l’autre. Cet ¦tranger d’avant la lettre, qui ne croyait pas en l’existence de la prison terrestre pour des Þtres d¦j s¦par¦s du monde, connat, comme Meursault, la geúle juste avant de mourir : trait¦ en esclave, d¦pouill¦ de sa distinction et condamn¦ la v¦rit¦ de la lettre, c’est l qu’il renie l’art comme sa seule vie: un grand artiste – pour qui valent les mots de Baudelaire repenti: »C’est peut-Þtre un bien d’avoir ¦t¦ d¦nud¦ et d¦po¦tis¦, je 145 J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., pp. 30 – 31. 146 A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 83. 147 A. Camus, L’artiste en prison (Essais critiques) in Essais. Êd. ¦tablie par R. Quilliot et L. Faucon, Paris, Gallimard, La Pl¦iade, 1965, pp. 1123 – 1129. 148 Ibid., Jonas ou l’artiste au travail (L’exil et le royaume) in Th¦tre, r¦cits, nouvelles. Textes ¦tablis et annot¦s par R. Quilliot, Paris, Gallimard, La Pl¦iade, 1962, pp. 1627 – 1652. 149 Ibid., »Discours de SuÀde« du 10 d¦cembre 1957, in Essais, cit., pp. 1069 – 1076.
»Mal, soit mon bien«. La question du dandy de Baudelaire à Camus
237
comprends mieux ce qui me manquait«150 – n’¦tait pas n¦ qu’il est mort: Wilde annonÅait en fait »aux initi¦s – c’est bien la conclusion de la pr¦face – qu’un grand artiste, n¦ depuis peu, venait de mourir«151. Mais si c’est bien l’esclavage, r¦el et m¦taphysique, qui, selon la thÀse de L’homme r¦volt¦, d¦clenche la conscience de l’absurde et la r¦volte, Jonas, l’¦gal biblique de Sisyphe et de Prom¦th¦e, celui qui d¦sob¦it Dieu et refuse le salut, devient, dans Jonas ou l’artiste au travail, la personnification mÞme de l’artiste trahi: contre l’espoir hugolien dans une morale naturelle, espoir r¦volutionnaire et bourgeois selon qui »rien n’est solitaire, tout est solidaire«152, Jonas est l’artiste qui, entour¦ par l’apparente solidarit¦ de ses proches et admirateurs, connat sa solitude: »Rateau regardait la toile, entiÀrement blanche, au centre de laquelle Jonas avait seulement ¦crit, en trÀs petits caractÀres, un mot qu’on pouvait d¦chiffrer, mais dont on ne savait s’il fallait y lire solitaire ou solidaire«153.
La conclusion de Jonas, de rappeler, par antiphrase, le livre tout blanc laiss¦ par le candide Microm¦gas en h¦ritage ses successeurs (ouvrant ainsi le rÀgne heureux de l’initiative individuelle dans le jugement)154, souligne plutút la st¦rilit¦ morale qui entoure le protagoniste: »l’artiste, mÞme trÀs fÞt¦, est seul«, constate d’ailleurs Camus dans L’artiste et son temps155. Jonas ressent, par cela mÞme, le besoin de chercher des preuves d’existence par-del le jugement des hommes; il faut s’exiler, en artiste, pour conqu¦rir son propre royaume. Ainsi, Jonas est, l’instar de Baudelaire, ou de Meursault, ou de Caligula, celui qui recherche, par le m¦pris universel, une r¦demption: »Quand j’aurai inspir¦ le d¦got et l’horreur universels j’aurai conquis la solitude«, c’est le mot baudelairien des Fus¦es que Sartre cite justement avec m¦pris156. Et Camus ne reconnat-il pas, d’ailleurs, qu’il aurait ¦t¦ irresponsable, pour Rimbaud, pour Nietzsche, de vivre coude coude avec leur soci¦t¦ mercantile?157 Le problÀme d’une conciliation entre la responsabilit¦ de l’artiste et l’isolement de celui-ci, n¦cessaire sa cr¦ation, fait l’originalit¦ de la pens¦e camusienne, cút¦ d’une autre question: l’artiste, en tant que tel, n’est pas oblig¦ de prendre la parole; et il est sr que celui-ci, en tant qu’homme, est un criminel s’il sert le mal, s’il se salit les mains. Face au »verbiage
150 151 152 153 154 155
Ch. Baudelaire, lettre sa mÀre du 16 juillet 1839. Cf. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 78. A. Camus, L’artiste en prison, cit., p. 1129. V. Hugo, Œuvres complÀtes, V, Critique, Paris, Laffont, «Bouquins”, 1984, p. 508. A. Camus, Jonas ou l’artiste au travail, cit., p. 1652. Voltaire, Microm¦gas, cit., p.66. A. Camus, »L’artiste et son temps«. Conf¦rence du 14 d¦cembre 1957, »Discours de SuÀde«, Essais, cit., p. 1083. 156 Ch. Baudelaire, Fus¦es, OC, I, p. 660. Cf. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 52. 157 »Ceux qui ont vraiment rompu s’appelaient Rimbaud, Nietzsche«. A. Camus, »L’artiste et son temps«, cit., p. 1083.
238
Michela Landi (Firenze)
humanitaire« de Sartre, qui, par des »provocations cyniques«158 r¦sout ais¦ment ce dualisme – pour lui l’art, la po¦sie, »ne sert pas, elle ne sert qu’elle-mÞme«, tandis que l’intellectuel doit servir la r¦volution – Camus – quelqu’un y a vu mÞme l’image du dandy159 – reste n¦anmoins un vrai r¦volt¦: la beaut¦, dit-il, presque r¦p¦tant ce que Baudelaire disait dans »Aux bourgeois« dans le Salon de 1846,160 »ne fait pas les R¦volutions, mais les R¦volutions ont besoin d’elle«161. Contre le chemin de la libert¦ qui mÀne l’homme vers son t¦los, sa bonne voie, d¦sormais toute laque, du progrÀs convenable aux soci¦t¦s productrices162, la r¦volte de Camus fait, au nom d’une soci¦t¦ cr¦atrice, le procÀs la libert¦ totale163, qu’elle soit dans l’homme, ou dans l’artiste. Contre la vraie d¦mesure, que Camus reconnat alors dans la »division du travail«164, o¾ le travail mÞme a »cess¦ d’Þtre cr¦ateur«165, l’artiste est l’homme total: h¦ritier, en cela encore, du dandy dont on louait avant tout, de Balzac, Baudelaire, Barbey d’Aurevilly, le fait d’Þtre encore homme »d’¦ducation g¦n¦rale«166. Et ce n’est peut-Þtre pas par hasard que Camus en appelle plusieurs reprises, dans »R¦volte et art«167, un peintre que Baudelaire considÀre ¦galement comme le modÀle de l’artiste-dandy pour Þtre en mÞme temps rigoureux dans son m¦tier et »homme d’¦ducation g¦n¦rale«168 : Delacroix. Ce dernier est (par rapport la »division du travail« que pratiquent certains artistes-ouvriers) le seul qui ait trait¦ la nature, selon Baudelaire, comme un dictionnaire, savoir comme une »composition«169 ; par cela il 158 Ibid., L’Homme r¦volt¦, cit., p. 370. 159 Voir, par exemple, G. Scaraffia, Dizionario del dandy, Palermo, Sellerio, 2007 et S. Lanuzza, Vita da dandy. Gli antisnob nella societ, nella storia, nella letteratura, Viterbo, Nuovi Equilibri, 1999. 160 »Vous poss¦dez le gouvernement de la cit¦, et cela est juste, car vous Þtes la force. Mais il faut que vous soyez aptes sentir la beaut¦; car comme aucun d’entre vous ne peut aujourd’hui se passer de puissance, nul n’a le droit de se passer de po¦sie«. Ch. Baudelaire, »Aux bourgeois«, Salon de 1846, OC, II, p. 415. 161 A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 345. 162 Ibid., p. 340. 163 Ibid., p. 355. 164 Ibid., p. 368. 165 Ibid., p. 341. »Il serait injuste, et d’ailleurs utopique – ajoute-t-il – que Shakespeare diriget la soci¦t¦ des cordonniers. Mais il serait tout aussi d¦sastreux que la soci¦t¦ des cordonniers pr¦tendt se passer de Shakespeare«. Ibid. C’est le mÞme sujet qu’il traite dans la mise en scÀne des Poss¦d¦s de Dostoevskij: »Que tout le monde aille pieds nus et que vive Shakespeare…«. Ibid., Th¦tre, r¦cits, nouvelles, cit., pp. 925 – 1075. 166 H. de Balzac, Trait¦ de la vie ¦l¦gante, in La com¦die humaine, XXIII, Paris, Garnier, 2008, p. 532; Ch. Baudelaire, Mon cœur mis nu, OC I, p. 689. 167 A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., pp. 321, 336 – 337. 168 »Or, EugÀne Delacroix ¦tait, en mÞme temps qu’un peintre ¦pris de son m¦tier, un homme d’¦ducation g¦n¦rale, au contraire des autres artistes modernes qui, pour la plupart, ne sont guÀre que d’illustres ou d’obscurs rapins, de tristes sp¦cialistes, […] de purs ouvriers«. Ch. Baudelaire, L’œuvre et la vie d’EugÀne Delacroix, II, OC II, p. 745. 169 Ibid., p. 747.
»Mal, soit mon bien«. La question du dandy de Baudelaire à Camus
239
r¦pond, il est vrai, aux yeux de Sartre, la volont¦ du poÀte de »se reprendre, se corriger, comme on corrige un tableau ou un poÀme«170. Mais, bien plus, il pratique celle que Camus appelle une »redistribution d’¦l¦ments puis¦s dans le r¦el«: ce n’est que par cette redistribution, source d’harmonie g¦n¦rale de la vie et de l’art, qu’on donne l’univers recr¦¦ »son unit¦ et ses limites«171. L’artiste, l¦gislateur non reconnu, selon Shelley que Camus cite, est ainsi appel¦ »donner sa loi au monde«172. Camus rejoint ainsi, ce sujet mÞme, le Baudelaire du »Dandy«173 o¾ il est reconnu que le dandysme »est une institution en dehors des lois«, qui a des »lois rigoureuses auxquelles sont strictement soumis tous ses sujets«174. Dans l’invocation camusienne N¦mesis en tant que d¦esse de la mesure175, on voit finalement renatre, des cendres mÞmes de la Fatalit¦ contre laquelle se r¦voltaient les romantiques, une »pens¦e des limites«176. Toute d¦m¦sur¦e qu’elle ¦tait, dans sa premiÀre hybris esth¦tique, la r¦volte m¦taphysique, est, comme Camus le reconnat dans »R¦volte et art«, »pr¦alable toute civilisation«177: dans sa quÞte de rigueur et d’ordre, elle »porte au jour la mesure«178 qui consiste, contre les laborieuses apocalypses r¦volutionnaires, dans la pure tension de la r¦volte179. Baudelaire – que Sartre a accus¦ de ne pas avoir fait le saut pour atteindre le stade ¦thique, comme Kierkegaard le recommandait180, et pour Þtre rest¦, se d¦couvrant de trop dans le monde181, immobile dans une tension maudite entre Þtre et existence182 – enseigne malgr¦ tout, Camus, qu’il ne faut pas sauter, en conc¦dant l’action qui cache l’absurde183, mais plutút il faut rester 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
182 183
J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 146. Ibid. p. 336. Ibid. Ch. Baudelaire, »Le dandy«, in Le peintre de la vie moderne, OC II, p. 709 – 712. Ibid., p. 709. A. Camus, L’homme r¦volt¦, cit., p. 370. Ibid., p. 367. Ibid., p. 341. Ibid., p. 368. Dans le chapitre: »R¦volte et Art«, un g¦nie est »un r¦volt¦ qui a trouv¦ sa mesure«. Ibid., p. 338. Ibid., p. 375. »Kierkegaard veut gu¦rir. Gu¦rir, c’est son vœu forcen¦, celui qui court dans tout son journal. Tout l’effort de son intelligence est d’¦chapper l’antinomie de la condition humaine«. Id., Le mythe de Sisyphe, cit., p. 60. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 176. Le thÀme principal de La Naus¦e de Sartre est mentionn¦ par Camus dans Le mythe de Sisyphe: »Ce malaise devant l’inhumanit¦ de l’homme mÞme, cette incalculable chute devant l’image de ce que nous sommes, cette ,naus¦e‘ comme l’appelle un auteur de nos jours, c’est aussi l’absurde«. A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 31. J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 174. »Le saut sous toutes ses formes, la pr¦cipitation dans le divin ou l’¦ternel, l’abandon aux illusions du quotidien ou de l’id¦e, tous ces ¦crans cachent l’absurde«. A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 125.
240
Michela Landi (Firenze)
debout dans »l’instant subtil qui pr¦cÀde le saut«, en se maintenant »sur cette arÞte vertigineuse«184. Ainsi, la pens¦e de Camus rejoint, encore une fois, celle de Baudelaire, dont la lucidit¦ r¦flexive a permis, aux yeux de Sartre, »de formuler l’id¦al de sa possession de soi: l’homme est vraiment lui-mÞme, dans le bien comme dans le mal, l’extrÞme pointe de la tension«185. Mais si, selon Sartre, »L’homme heureux a perdu la tension de son me, il est tomb¦«186, l’acte de Sisyphe, qui refuse d’abord son salut et finit par accepter son destin, est, certes, embl¦matique, dans sa chute et sa remont¦e perp¦tuelle, du parcours intellectuel que l’homme a accompli dans ces trois derniers siÀcles pour s’imaginer heureux, selon la thÀse camusienne de Sisyphe187. Un cercle se referme – ou une spirale? Entre l’homme qui travaille et l’homme oisif188, entre le producteur et le parasite, entre la libert¦ et la fatalit¦, il y a l’homme qui pense et agit dans ses limites propres; et l’artiste en tant qu’ouvrier conscient de son art. Entre le tout est bien de Leibniz et du candide Voltaire, qui avaient cr¦¦ pour l’homme une v¦rit¦ d¦nud¦e et d¦po¦tis¦e, et le mal absolu du r¦volt¦ m¦taphysique qui conquiert, aux enfers, son existence maudite (c’est bien le Sisyphe baudelairien, marqu¦ par le guignon)189 on remonte l’arÞte vers une nouvelle essence, qui accepte le p¦ch¦ sans Dieu190. L’acte st¦rile, que Sartre m¦prisait191, est au cœur de notre r¦demption terrestre: Tout ce qui fait travailler et s’agiter l’homme utilise l’espoir. La seule pens¦e qui ne soit mensongÀre est donc une pens¦e st¦rile. Dans le monde absurde, la valeur d’une notion ou d’une vie se mesure une inf¦condit¦192.
Ce »pain suppl¦mentaire«193 remplace maintenant le panis supersubstantialis que Baudelaire ¦voque, ironiquement, dans la Muse v¦nale194, et nourrit ceux qui, 184 Ibid., pp. 73 – 74. Voir aussi p. 77: »on lui demande de sauter. Tout ce qu’il peut r¦pondre, c’est qu’il ne comprend pas bien, que cela n’est pas ¦vident«. 185 J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 125. La nouveaut¦ par rapport aux autres romantiques, continue Sartre, »est d’avoir pr¦sent¦ l’aspiration comme une ,tension des forces spirituelles‘ et non pas comme une dissolution«. Ibid., p. 126. 186 Ibid., p. 88. 187 »Il faut imaginer Sisyphe heureux«. A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 168. 188 Dans son Trait¦ de la vie ¦l¦gante Balzac distingue trois »classes d’Þtres cr¦¦s par les mœurs modernes«: »L’homme qui travaille, l’homme qui pense, l’homme qui ne fait rien«, ou, autrement, »La vie occup¦e, la vie d’artiste, la vie ¦l¦gante«. H. de Balzac, Trait¦ de la vie ¦l¦gante, cit., pp. 517 – 518. 189 Ch. Baudelaire, «Le guignon”, in Les fleurs du mal, OC I, p. 17. 190 A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 62. 191 »Justement parce que c’est un jeu vide, Baudelaire s’y plat; des actes nuls et st¦riles, sans post¦rit¦, un mal fantúme, vis¦, sugg¦r¦, plus que r¦alis¦«, J.-P. Sartre, Baudelaire, cit., p. 74. 192 A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 98. 193 Ibid., L’homme r¦volt¦, cit., p. 319. 194 »Il te faut pour gagner ton pain de chaque soir […]/Chanter des Te Deum auxquels tu ne crois guÀre«. Ch. Baudelaire, »La muse v¦nale«, in Les fleurs du mal, OC I, p. 15.
»Mal, soit mon bien«. La question du dandy de Baudelaire à Camus
241
aprÀs avoir chant¦, dans »l’me du vin«195 leur d¦senchantement, vont puiser sati¦t¦ dans »le vin de l’absurde et le pain de l’indiff¦rence«196. Nil mirari, ne s’¦merveiller de rien et savoir regarder197; le mot cher au dandy revient dans l’»indiff¦rence clairvoyante«198 qui caract¦rise l’homme absurde. Pour ce dernier, »La libert¦ concide avec l’h¦rosme. Elle est l’asc¦tisme du grand homme, ,l’arc le plus tendu qui soit‘«199. »Mal, soit mon bien«200 c’est alors, aprÀs le »cri de l’innocence outrag¦e« du dandy, le mot de la sagesse sans espoir de l’homme absurde.
195 196 197 198 199 200
Ibid., »L’me du vin«, ibid., p. 105. A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 77. Barbey d’Aurevilly, Du dandysme et de Georges Brummel, cit., pp. 18 et 57. A. Camus, Le mythe de Sisyphe, cit., p. 131. Ibid., L’homme r¦volt¦, cit., p. 99. Ibid., p. 71.
Frank Reza Links (Bonn)
»Ce que je dois à l’Espagne« ou le Siècle d’Or dans le théâtre de Camus »_Patrie des r¦volt¦s, ses plus grandes œuvres sont des cris vers l’impossible. En chacune d’elles, le monde est mis en accusation en mÞme temps qu’il est glorifi¦.« Albert Camus1
õ l’occasion du cinquantenaire de la mort d’Albert Camus, il convient de revisiter la production litt¦raire et journalistique de l’auteur, comme nous le proposons dans ce tome. L’œuvre de l’¦crivain franco-alg¦rien, qui a grandi dans diff¦rentes cultures europ¦ennes, fait preuve d’une remarquable sensibilit¦ interculturelle. En lisant ses romans, ses articles, ses essais philosophiques et ses piÀces de th¦tre, nous nous rendons compte que ses origines espagnoles ont fortement influenc¦ son engagement litt¦raire que Camus lui-mÞme voit comme »une dette«2 envers l’Espagne. Il considÀre le pays de la p¦ninsule ib¦rique comme ¦tant sa »deuxiÀme patrie«3, alors qu’il n’y a ¦t¦ qu’une fois4. Les deux drames R¦volte dans les Asturies(1936) etL’Êtat de siÀge(1948)5, situ¦s de l’autre cút¦ des Pyr¦n¦es, sont les preuves les plus explicites de cette hispanophilie6. 1 Voir L¦vi-Valensi, Jacqueline: »Camus et l’Espagne« in: D¦jeux, Jean (¦d.): Espagne et Alg¦rie au XXe siÀcle. Contacts culturels et cr¦ation litt¦raire, Paris: L’Harmattan, 1985, pp. 141 – 159, ici p. 141. 2 Camus, Albert: »Ce que je dois l’Espagne« in idem: Œuvres complÀtes, tome 4, Paris: Gallimard, 2006, pp. 591 – 594, ici p. 594. 3 Rufat, H¦lÀne: »Espagne« in: Gu¦rin, Jeanyves (¦d.): Dictionnaire Albert Camus, Paris: Robert Laffont, 2009, pp. 260 – 263, ici p. 260. 4 Coombs, Ilona: »N¦anmoins, pour autant que l’on sache, Camus ne fut jamais en Espagne l’exception d’un court s¦jour Majorque« in: idem: Camus, homme de th¦tre, Paris: Nizet, 1968, p. 147.Pourtant, lors d’une interview le 25 d¦cembre 1945, Camus affirme: »Je veux simplement revenir en Espagne, o¾ je me sentirai chez moi plus que partout ailleurs, et je ne veux pas y aller tant que Franco y sera.« Voir Camus, Albert: »L’Espagne continue d’Þtre pour nous une plaie qui ne se ferme pas« in: idem: Œuvres complÀtes, tome 2, Paris: Gallimard, 2006, pp. 661 – 665, ici p. 665. 5 õ propos de L’Êtat de siÀge, Camus d¦fend clairement son choix qui l’ a conduit mettre l’action de la piÀce en Espagne. Voir pour ceci Camus, Albert: »Pourquoi l’Espagne?« in idem: Œuvres complÀtes, tome 2, Paris: Gallimard, 2006, 483 – 487.
244
Frank Reza Links (Bonn)
Cependant, au moment o¾ la presse actuelle comm¦more le 4 janvier 1960,six des plus grands journaux transr¦gionaux7 de la p¦ninsule ne font aucun moment r¦f¦rence la solidarit¦ de l’¦crivain pour le pays durant la dictature franquiste. Ceci est d’autant plus frappant que Camus n’a cess¦, dans ses piÀces ou dans ses articles, de s’exprimer pour une Espagne libre8. Sur vingt-et-un articles, seul un, du correspondant Juan Pedro QuiÇonero pour le journal ABC,mentionne la grande passion de Camus pour le th¦tre espagnol du SiÀcle d’Or, particuliÀrement celui de Lope de Vega et de Calderûn de la Barca9. Mais ce ne sont pas seulement les »grands espagnols«10, comme il a l’habitude de les nommer,qui l’int¦ressent. Ainsi, dans de nombreux articles sur l’Espagne, Camus se r¦fÀre maintes fois aux deux auteurs contemporains Miguel de Unamuno11et Federico Garca Lorca12. Si ces ¦crivains du XXe siÀcle sont cit¦s dans un contexte de litt¦rature engag¦e, les dramaturges et les piÀces de la Renaissance et du Baroque espagnols sontplutút la source d’une production artistique13. En 6 Nombreux sont les ¦tudes consacr¦es aux traces espagnoles dans l’œuvre d’Albert Camus. C’est surtout Jacqueline L¦vi-Valensi qui a signal¦ maintes fois dans quelle mesure cette dette dont parle l’auteur s’exprime dans ses textes. Et nous pourrions en trouver bien d’autres. La bibliographie la fin de cette contribution en proposera un bref aperÅu. 7 Nous avons consult¦ un total de 21 articles parus en ligne entre le30 d¦cembre 2009et le 07 janvier 2010. Les journaux suivants ont fait l’objet d’¦tude: ABC (http://www.abc.es); El Mundo (http://www.elmundo.es); El Pas (http://www.elpais.com); La Razûn (http:// www.larazon.es); La Vanguardia (http://www.lavanguardia.es) ; Pfflblico (http://www.publico.es). 8 Pour une ¦tude plus exhaustive, nous renvoyons aux monographies et m¦langes suivants: Figuero, Javier : Albert Camus ou l’Espagne exalt¦e, G¦menos: Autres Temps, 2008 ; Rauer, Monika: Interkulturelle Aspekte im Schaffen von Albert Camus: Der Spanienbezug, Wien: LIT, 2005, (Romanistik, 14) ; Temple, Fr¦d¦ric-Jacques (¦d.): Albert Camus et l’Espagne, Aixen-Provence: Êdisud, 2005. 9 Cf. QuiÇonero, Juan Pedro: »[…] y soÇo por escrito grandes montajes del teatro ureo espaÇol en los escenarios franceses. Camus sintiû por Lope de Vega y Calderûn una pasiûn muy viva, desde su primera juventud, hasta el fin« dans idem: »Camus, el humanismo rebelde« dans: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02 – 01 – 2010/abc/Cultura/camusel-humanismo-rebelde_1132830473333.html [10/08/2010]. 10 Camus, Albert: »Interview ,Paris-Th¦tre‘« in: idem: Œuvres complÀtes, tome 3, Paris: Gallimard, 2006, pp. 577 – 582, ici p. 580. 11 Camus, Albert: »L’Espagne de Franco est introduite la sauvette dans le temple bien chauff¦ de la culture et de l’¦ducation pendant que l’Espagne de CervantÀs et d’Unamuno es tune fois de plus jet¦e la rue« in idem: »L’Espagne et la culture« in idem: Œuvres complÀtes, tome 3, Paris: Gallimard, 2006, pp. 434 – 439, ici p. 434. 12 Camus, Albert: »Pr¦face ,L’Espagne libre« in: idem: Œuvres complÀtes, tome 2, Paris: Gallimard, 2006, pp. 665 – 669, ici 667. Ernesto JareÇo et respectivement Jacqueline L¦viValensi ont ¦tabli d’ailleurs certains parallÀles entre le travail esth¦tique et th¦tral de Lorca avec sa troupe de th¦tre La Barraca et Le Th¦tre de l’Êquipe d’Albert Camus. Cf. JareÇo, Ernesto: »,El caballero de Olmedo‘, Garca Lorca y Albert Camus« in: Papeles de Son Armadans, 58/1970, pp. 219 – 242 et L¦vi-Valensi, Jacqueline: »R¦alit¦ et symbole de l’Espagne dans l’œuvre de Camus« in: La Revue des Lettres Modernes, 170 – 174/1968, 149 – 178. 13 Mais ce ne sont pas seulement les piÀces en tant que telles que l’auteur met en scÀne. Il
»Ce que je dois à l’Espagne« ou le Siècle d’Or dans le théâtre de Camus
245
effet, Camus adapte et met en scÀne des piÀces, comme La C¦lestine, de l’auteur Francisco de Rojas avec Le Th¦tre de l’Êquipe en Alg¦rie14, le drame religieux La D¦votion la croix, comme La C¦lestine, de Pedro Calderûn de la Barca en 1953 et la comedia Le chevalier d’Olmedo de Lope de Vega en 195715. Son ambition est de»faire connatre le grand th¦tre espagnol, peu connu en France, parce que peu ou mal traduit«16. L’acte d’adaptation est pour Camus un acte d’¦criture, donc un acte de cr¦ation et de mise en scÀne17. TrÀs influenc¦ par les id¦es esth¦tiques des premiers metteurs en scÀne du XXe siÀcle, comme Erwin Piscator18 et son matre Jacques Copeau19, Albert Camus souhaite contribuer la revitalisation de la scÀne20. Les deux drames espagnols ¦voqu¦s plus haut, mis en scÀne dans le cadre du Festival d’art dramatique Angers dans les ann¦es 1950, correspondent ce projet. Comme l’a d¦j signal¦ Ilona Coombs, Albert Camus profite du chteau d’Angers pour revenir aux sources du th¦tre espagnol du SiÀcle d’Or puisque ces
14 15
16 17
18
19 20
compare mÞme ses propres textes th¦traux avec les œuvres baroques. De cette maniÀre, il souligne une fois de plus l’influence consid¦rable de l’Espagne sur Camus. A propos de L’Êtat de siÀge, il met en relief que »L’Êtat de siÀge n’est pas une piÀce de conception classique. On pourrait la rapprocher, au contraire, de ce qu’on appelait, dans notre Moyen ffge, les moralit¦s et, en Espagne, les autos sacramentales, sorte de spectacles all¦goriques qui mettaient en scÀne des sujets connus l’avance de tous les spectateurs« in: idem: »Pr¦face l’¦dition am¦ricaine du th¦tre« in Camus, Albert: Th¦tre, r¦cits, nouvelles, Paris: Gallimard, 1962, 1729 – 1734, ici 1732. Cf. Freeman, Edward: The Theatre of Albert Camus. A critical study, London: Mehtuen& Co, 1971, 127. Toutes les r¦f¦rences bibliographiques suivantes de ces deux piÀces, ainsi que d’autres textes camusiens que nous ¦tudierons renvoient aux Œuvres complÀtes dans l’¦dition de la BibliothÀque de la Pl¦iade de 2006. Les chiffres romains se r¦fÀrent aux tomes correspondants; les chiffres arabes indiquent la page en question. Camus, Albert: »Interview ,Paris-Th¦tre‘« in: ders: IV, 580. Cf. Camus, Albert: »Quand j’adapte, c’est le metteur en scÀne qui travaille selon l’id¦e qu’il a du th¦tre. Je crois, en effet, au spectacle total, conÅu, inspir¦ et dirig¦ par le mÞme esprit, ¦crit et mis en scÀne par le mÞme homme, ce qui permet d’obtenir l’unit¦ de ton, du style, du rythme qui sont les atouts essentiels d’un spectacle« in: idem: »Pourquoi je fais du th¦tre?« in: idem: Œuvres complÀtes, tome 4, Paris: Gallimard, 2006, 609. Cf. L¦vi-Valensi, Jacqueline: »[…] il faut rappeler R¦volte dans les Asturies, cr¦ation collective, qui collait l’actualit¦ historique de l’Espagne […] Mais on est ¦tonn¦, la lecture de la piÀce, de ses audaces sc¦niques, qui sont fond¦es sur la conception d’un th¦tre actif, inspir¦, directement ou non, de Piscator et d’Artaud.« in: »Camus et le th¦tre: quelques faits, quelques questions« in: idem (¦d.): Camus et le th¦tre. Actes du colloque tenu Amiens du 31 mai au 2 juin 1988, Paris: Imec, 1992, 13 – 18, ici 14. Cf. Camus, Albert: »Copeau, seul matre« in: idem:Œuvres complÀtes, tome 4, Paris: Gallimard, 2006, pp. 615 sq. Dans ce contexte, George Mariscal a observ¦ une modernit¦ consid¦rable de La d¦votion la croix d une possible lecture de la piÀce comme ¦tant du th¦tre total. Cf. Mariscal, George: »Iconografa y t¦cnica emblemtica en Calderûn: La devociûn de la cruz« in: Revista canadiense de estudios hispnicos, 5, 3/1981, 339 – 354. Voir aussi Freeman, Edward: op.cit., 130.
246
Frank Reza Links (Bonn)
coulisses s’apprÞtent pour une comparaison aux corrales baroques21. Plus que ses propres piÀces, dont les critiques ont souvent men¦ des malentendus, les adaptations espagnoles ont un succÀs unanime et font parler d’elles22. Ainsi, les premiÀres ¦tudes ayant pour objet le th¦tre espagnol dans l’œuvre de Camus paraissent dÀs les ann¦es 1960. Certes, depuis le rapport entre le SiÀcle d’Or et l’¦crivain franco-alg¦rien a ¦t¦ souvent abord¦; mais nous trouvons principalement des articles sur la genÀse des adaptations23. Rares sont les ¦tudes qui cherchent un lien entre le contenu des piÀces de Calderûn et Lope de Vega et les id¦es esth¦tiques et philosophiques de Camus. C’est pourquoi nous voulons essayer de tisser un lien entre certains concepts camusiens et la pens¦e baroque. Bien que l’accent soit mis sur les deux adaptations men¦es au tr¦teau d’Angers, d’autres exemples seront ¦galement mentionn¦s. En comparant l’¦ph¦mÀre et l’amour avec l’absurde, nous voulons proposer une analyse de la r¦volte dans les piÀces du SiÀcle d’Or. De cette faÅon, nous nous int¦ressons la question de savoir si l’int¦rÞt pour le th¦tre baroque ne va pas plus loin que la passion de Camus pour la dramaturgie classique. Pour ceci, nous partons du principe de Camus que, je cite, »le th¦tre est un lieu de v¦rit¦« (IV, 608). Cette v¦rit¦ est, selon le dramaturge »cach¦e« et ne peut Þtre d¦voil¦e qu’en pr¦sence de »personnages d’un autre siÀcle«. Comme nous l’avons d¦j mentionn¦ plus haut, la culture espagnole est quasiment omnipr¦sente dans l’œuvre de Camus, y compris dans son essai Le 21 Cf. Coombs, Ilona, op.cit., 143. Par rapport au Chevalier d’Olmedo, l’autrice constate: »Camus utilisait au mieux les multiples lieux sc¦niques qu’offrait le chteau d’Angers pour permettre au spectateur de suivre l’action dans les endroits les plus diff¦rents, ce qui contribuait au mouvement de la piÀce aussi bien qu’ la vari¦t¦ des tableaux« (157). Voir aussi: Lupo, Virginie: »La d¦votion la Croix et Le Chevalier d’Olmedo. Deux t¦moignages d’Albert Camus, de son amour de l’acteur et de son sens th¦tral profond«, in: Temple, Fr¦d¦ricJacques (¦d.): Albert Camus et l’Espagne, Aix-en-Provence: Êdisud, 2005, 33 – 49, ici 34. 22 Cf. Bartfeld, Fernande: »Le th¦tre de Camus, lieu d’une ¦criture contrari¦e« in: L¦vi-Valensi, Jacqueline (¦d.): Camus et le th¦tre. Actes du colloque tenu Amiens du 31 mai au 2 juin 1988, Paris: Imec, 1992, 177 – 185, ici 177. 23 Les ¦tudes suivantes, entre autres, focalisent principalement la genÀse des piÀces en question: Cots Vicente, Montserrat: »Camus traductor : La devociûn de la cruz de Calderûn« in: Revisa anthropos: huellas del conocimiento, 199/2003, 138 – 139. Couch, John Philip: »Camus’ Dramatic Adaptions and Translations« in: The French Review, 33, 1/1959, 27 – 36. DenglerGassin, Robert: »Albert Camus adaptateur de Lope de Vega: Le Chevalier d’Olmedo« in: L¦viValensi, Jacqueline (¦d.): Camus et le th¦tre. Actes du colloque tenu Amiens du 31 mai au 2 juin 1988, Paris: Imec, 1992, 221 – 228. Durn, Manuel: »Camus and the spanish theatre« in: Yale French Studies, 25/1960, 126 – 131. Lupo, Virginie: »La d¦votion la Croix et Le Chevalier d’Olmedo. Deux t¦moignages d’Albert Camus, de son amour de l’acteur et de son sens th¦tral profond«, in: Temple, Fr¦d¦ric-Jacques (¦d.): Albert Camus et l’Espagne, Aix-enProvence: Êdisud, 2005, 33 – 49. Schmidt, Marie-France: »La D¦votion la Croix, de Calderûn Camus: langage et dramaturgie« in: L¦vi-Valensi, Jacqueline (¦d.): Camus et le th¦tre. Actes du colloque tenu Amiens du 31 mai au 2 juin 1988, Paris: Imec, 1992, 195 – 210.
»Ce que je dois à l’Espagne« ou le Siècle d’Or dans le théâtre de Camus
247
mythe de Sisyphe (1942). Dans cette description de l’homme absurde, deux chapitres illustrent particuliÀrement notre propos. Observons dans un premier temps la conjonction entre l’¦ph¦mÀre et l’absurde que Camus ¦tudie dans »La Com¦die«24. Regardons pour ceci le passage suivant: Quoi d’¦tonnant trouver une gloire p¦rissable btie sur les plus ¦ph¦mÀres des cr¦ations? L’acteur a trois heures pour Þtre Iago ou Alceste, PhÀdre ou Glocester. Dans ce court passage, il les fait natre et mourir sur cinquante mÀtres carr¦s de planches. Jamais l’absurde n’a ¦t¦ si bien ni si longtemps illustr¦. […] Pass¦ le plateau, Sigismond n’est plus rien. Deux heures aprÀs, on le voit qui dne en ville. C’est alors que la vie est un songe. (I, 273)25
Il est incontestable que l’¦crivain fait ici r¦f¦rence au protagoniste du drame philosophique La vie est un songe (1636) de Calderûn26. Ancr¦ dans l’id¦e de l’¦ph¦mÀre de l’Þtre humain qui pr¦domine la culture baroque, Camus entreprend une interpr¦tation moderne de la vanit¦. Chez Calderûn, l’homme est dup¦ tout au long de sa vie. Ce n’est que dans l’au-del qu’il s’en rend compte, d’o¾ la cons¦quence logique du d¦senchantement27. Nous nous souvenons du soliloque principal de Sigismond la fin de la deuxiÀme journ¦e, qui, assourdi et enferm¦ dans une tour, se croit mort et commence r¦fl¦chir sur la vie: […] puisque nous sommes dans un monde si singulier que vivre, ce n’est que rÞver, et que l’exp¦rience m’enseigne que l’homme qui vit rÞve ce qu’il est, jusqu’au r¦veil. Le roi rÞve qu’il est roi et vit dans cette illusion […] et il se trouve quelqu’un pour vouloir r¦gner, en sachant qu’il se r¦veillera dans le sommeil de la mort! […] Qu’est-ce que la vie? Un d¦lire. Qu’est-ce que la vie? Une illusion, une ombre, une fiction; et le plus grand bien est peu de chose, car toute la vie est un songe, et les songes sont des songes.28
Mais tandis que l’¦ph¦mÀre cald¦ronien est marqu¦ par une forte connotation religieuse, Camus lie l’absurde l’¦vanescence de l’existence humaine dans le pr¦sent.
24 Cf. Camus, Albert: »La Com¦die« in: idem: »Le mythe de Sisyphe« in: idem: Œuvres complÀtes, tome 1, Paris: Gallimard, 2006, 272 – 277. 25 Mise en relief par l’auteur. 26 Rappelons dans ce contexte qu’Albert Camus avait ¦galement envisag¦ de mettre en scÀne La vie est un songe de Calderûn. Cf. Camus, Albert: »Un ,nouveau‘ th¦tre« in: idem: Œuvres complÀtes, tome 4, Paris: Gallimard, 2006, 652 – 658, ici 657. Par ailleurs, Virginie Lupo souligne que »Calderon ¦tait particuliÀrement appr¦ci¦ par Camus, qui avait encore des projets d’adaptation de piÀces du th¦tre espagnol avec Le Magicien prodigieux et La Vie est un songe, toujours de Calderon, et L’Êtoile de S¦ville, de Lope de Vega« in: op.cit., 36. 27 Cf. Brioso, Jorge: »¿Cûmo hacer las cosas con los enigmas? La vida es sueÇo o el drama del desengaÇo« in: Bulletin of the Comediantes 56, 1/2004, 55 – 75, ici 61. 28 Calderûn de la Barca, Pedro: La vie est un songe in Marrast, Robert (¦d.): Th¦tre espagnole du XVIIe siÀcle, tome 2, Paris: Gallimard, 1999, 930 – 990, ici 970 – 971.
248
Frank Reza Links (Bonn)
Dans le chapitre intitul¦ »Le Don Juanisme«29, le sujet trait¦ est la relation entre l’amour et l’absurde30. Il est ¦vident que le titre renvoie ici au protagoniste homonyme de la piÀce El Burlador de Sevilla (1619) de Tirso de Molina. En prenant comme exemple ce personnage principal, Camus d¦montre: »s’il suffisait d’aimer, les choses seraient trop simples. Plus on aime et plus l’absurde se consolide« (I, 267). Par cette phrase initiale, il d¦fend l’attitude de Don Juan d’¦chapper la vie absurde en aimant beaucoup de femmes, puisque le philosophe lui-mÞme pose la question, presque rh¦torique: »Pourquoi faudrait-il aimer rarement pour aimer beaucoup?«. L’homme est alors absurde en pensant qu’il faut maintenir un concept de l’amour qui est plutút »par¦ des illusions de l’¦ternel. Tous les sp¦cialistes de la passion nous l’apprennent, il n’y a d’amour ¦ternel que contrari¦« (I, 269). L’amour absurde est pr¦sent dans les deux piÀces que nous analysons. Examinons d’abord Le Chevalier d’Olmedo31. Cette com¦die, ¦crite entre 1615 et 1626, est fond¦e sur une chanson populaire m¦di¦vale dont l’action peut Þtre compar¦e celle de Rom¦o et Juliette ou bien celle de la C¦lestine32. Don Alonso, le chevalier d’Olmedo, est amoureux de doÇa InÀs; pourtant, celle-ci est d¦j promise don Rodrigo. õ l’aide de l’entremetteuse Fabia, le chevalier cherche la conqu¦rir. Don Alonso essaie donc d’obtenir la faveur d’InÀs lors d’une corrida, dont il sort vainqueur, plein de gloire et d’estime. L’amour et le mariage entre les deux amants semblent alors r¦alisable, mais au moment o¾ le pÀre d’InÀs, don Pedro, consent l’union, le rival Rodrigo assassine son concurrent. DÀs la scÀne d’exposition, le spectateur est familiaris¦ avec l’intrigue principale. Les deux amants avouent leurs sentiments r¦ciproques leurs confidents. Lorsqu’InÀs s’adresse doÇa L¦onor pour lui confesser son trouble, celle-ci r¦pond: Doña Léonor : L’amour lance ses traits en aveugle, il tombe rarement juste et manque souvent son but. Mais enfin, bien que j’aime don Fernando et que je me sente oblig¦e de plaider pour ce Rodrigo si d¦test¦ puis qu’il est son ami, il faut avouer que cet ¦tranger a grand air. Doña Inès: Son regard a attir¦ le mien. Je crois que j’ai vu dans ses yeux le mÞme trouble que je ressentais d¦j et qu’alors j’ai laiss¦ paratre. Mais peut-Þtre a-t-il d¦j quitt¦ la ville! Doña Léonor : Je ne crois pas qu’il puisse vivre loin de toi. (IV, 179) 29 Cf. Camus, Albert: »Le Don Juanisme« in: idem: »Le mythe de Sisyphe« in: idem: Œuvres complÀtes, I, Paris: Gallimard, 2006, 267 – 272. 30 Cf. Corbic, Arnaud: Camus. L’absurde, la r¦volte, l’amour, Paris: Les Êditions de l’Atelier /Êditions OuvriÀres, 2003. 31 Dans ce drame, Francisco Rico relie d’ailleurs le sujet de l’amour celui de la mort et de l’ironie. Cf. Rico, Francisco: »El caballero de Olmedo. Amor, muerte, irona« in: Papeles de Son Armadans, 67, 139/1967, 38 – 56. 32 Arellano, Ignacio: Historia del teatro espaÇol del siglo XVII, Madrid: Ctedra, 1995, 198.
»Ce que je dois à l’Espagne« ou le Siècle d’Or dans le théâtre de Camus
249
Il est ¦vident que ce trouble int¦rieur conditionne les actes de l’Þtre humain. õ l’¦poque baroque, le geste de faire preuve de son honneur travers la bataille ¦tait encore une n¦cessit¦ sociale. Mais, pour Camus, ces actes de conquÞte de l’amour etde l’honneur ne peuvent que culminer dans l’absurde. C’est ainsi qu’il ¦nonce dans Le mythe de Sisyphe: »Il n’est guÀre de passion sans lutte. Un pareil amour ne trouve de fin que dans l’ultime contradiction qui est la mort. […] L encore, il y a plusieurs faÅons de se suicider dont l’une est le don total et l’oubli de sa propre personne« (I, 269 sq.). La conception du suicide dans ce contexte reste assez ouverte et permet, de cette faÅon, d’affirmer que les deux protagonistes, Alonso et InÀs se montrent comme ¦tant des hommes absurdes dont la seule raison d’Þtre semble se r¦duire l’amour mutuel. Tous les deux meurent d’une certaine faÅon: InÀs d¦laisse sa propre personne et don Alonso meurt lors d’un malentendu. Ainsi, nous pouvons approuver l’observation d’Edward Freeman que le th¦tre baroque a inspir¦ Camus pour son traitement de l’existence humaine33. Pour ce qui est de La d¦votion la croix, l’amour absurde se dessine de faÅon, pour ainsi dire, paradoxale. Eus¦bio et Julia, marqu¦s tous deux dÀs la naissance par une petite croix sur leur poitrine, s’aiment. Contre la volont¦ et l’honneur de la famille de Julia, l’anti-h¦ros Eus¦bio cherche trouver des moyens pour s’¦chapper avec sa bien-aim¦e. Il tue alors le frÀre de Julia, Lisardo, et tombe dans la disgrce. Julia, envoy¦e dans un couvent, doit alors se priver de tout amour profane. Lorsqu’ Eus¦bio essaie de la sauver, il d¦couvre pour la premiÀre fois que son amante a aussi une sorte de grain de beaut¦ en forme de croix. Il fuit alors le couvent et tombe au moment de descendre une ¦chelle – une chute camusienne par excellence. Leur amour est alors impossible et finalement, Eus¦bio, homme absurde, meurt lors d’un combat. Il est ¦vident que la trajectoire de ce personnage principal confirme la thÀse de Camus sur l’amour absurde. Dans ce contexte, il faut aussi ¦tudier la signification de la croix dans cette piÀce. DÀs le titre, le terme croix est ¦voqu¦ tout au long de l’action et devient ainsi le leitmotiv de l’intrigue. Tout tourne autour de ce symbole religieux. Selon le christianisme, l’axe horizontal repr¦sente l’attachement de l’homme avec la Terre ainsi qu’avec autrui, l’axe vertical, l’union entre l’homme et le divin34. Si l’intention cald¦ronienne est impr¦gn¦e d’une connotation chr¦tienne, cette lecture ne convient pas la piÀce adapt¦e par Camus. Car il est bien connu que le philosophe s’oppose aux doctrines catholiques35. Mais si nous prenons en 33 Cf. Freeman, Edward: op.cit., 130. 34 Cf. Heinz-Mohr, Gerd: »Kreuz« in: idem: Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen Kunst, Düsseldorf / Köln: Eugen Diederichs, 61981, 164 – 166, ici 164. 35 Il faut rappeler qu’Albert Camus s’oppose de faÅon v¦h¦mente contre le rúle de l’Êglise catholique en Espagne, comme il l’affirme par rapport L’Êtat de siÀge dans l’article »Pourquoi l’Espagne?« paru dans Combat en 1948: »J’avais, au contraire, dans ma piÀce dire quel a ¦t¦ le rúle de l’Êglise d’Espagne. Et si je l’ai fait odieux, c’est qu’ la face du monde,
250
Frank Reza Links (Bonn)
compte la symbolique initiale de la croix, nous remarquons que cet attachement n’est point possible dans le cas de la D¦votion. L’union de frÀre et sœur par la croix est diam¦tralement oppos¦e l’union des deux amants. La lutte pour l’amour des deux protagonistes est vou¦e l’¦chec, d’o¾ l’absurdit¦ de l’Þtre. C’est ainsi que Julia d¦clame sa situation en disant: »Je t’aime et le destin nous hait, je voudrais en mÞme temps te punir et te d¦fendre. Des pens¦es contraires m’¦garent, la douleur me jette en avant quand la piti¦ me retient. Me voici dans la nuit !«(III, 532). Tandis que la croix est donc le symbole salvateur des chr¦tiens, elle devient dans ce contexte le symbole de la fatalit¦ qui conditionne l’existence humaine. Quoique ces personnages du th¦tre espagnol soient des hommes absurdes par rapport leur conception de l’amour, les protagonistes sont ¦galement des hommes r¦volt¦s contre le systÀme totalitaire et rigide dans lequel la puissance sociale de l’honneur domine la libert¦ individuelle. Nous avons vu, dans l’exemple de la D¦votion, que le couple principal est stigmatis¦ par une croix. Celle-ci en fait d’eux des ¦trangers qui ne sont pas en harmonie avec le reste de la soci¦t¦, comme le constate Eus¦bio plusieurs moments: »Je suis Eus¦bio. Qu’avez-vous tous contre moi?«(III, 537). Forc¦s par l’amour, les deux amants sont prÞts faire des sacrifices. C’est la jeune fille Julia qui se manifeste dans ce cadre comme ¦tant un homme r¦volt¦ qui r¦clame d’abord le cogito camusien pour soi-mÞme. N’oublions pas que cette piÀce parat l’¦poque baroque o¾ le statut de la femme dans la soci¦t¦ n’avait pas encore cette importance qu’elle a de nos jours. Et pourtant, elle use de sa premiÀre valeur en se r¦voltant contre son pÀre au moment o¾ il lui annonce de l’envoyer au couvent: »Seigneur, l’autorit¦ d’un pÀre qui surpasse toutes les autres peut certainement disposer de la vie. Mais elle ne commande pas la libert¦. N’et-il pas mieux valu me faire d’abord connatre vos intentions? N’auriez-vous pu aussi vous inqui¦ter de mes d¦sirs?«(III, 528). Bien qu’elle cÀde la volont¦ parentale, elle ne cesse de »d¦fend[re] [sa] libert¦« (ibid.) que nous pourrons mÞme consid¦rer comme sa libert¦ de femme. Eus¦bio s’enfuit du couvent aprÀs avoir aperÅu la croix sur la poitrine de Julia; celle-ci ne se laisse pas faire et s’¦vade de la prison cl¦ricale et assassine cruellement tout homme qui veut la priver de son droit de libert¦36. Ainsi, elle proclame la fin du deuxiÀme acte: le rúle de l’Êglise d’Espagne a ¦t¦ odieux. Si dure que cette v¦rit¦ soit pour vous, vous vous consolerez en pensant que la scÀne qui vous gÞne ne dure qu’une minute, tandis que celle qui offense encore la conscience europ¦enne dure depuis dix ans.« Camus, Albert: »Pourquoi l’Espagne ?« in: idem: Œuvres complÀtes, tome 2, Paris: Gallimard, 2006, 486. Par rapport la position de Camus envers le christianisme, nous renvoyons par exemple Corbic, Arnaud: Camus. L’absurde, la r¦volte, l’amour, Paris: Les Êditions de l’Atelier /Êditions OuvriÀres, 2003, 35. 36 Ainsi, elle proclame la fin du deuxiÀme acte: »Alors, si d¦j vous avez jamais refus¦ de
»Ce que je dois à l’Espagne« ou le Siècle d’Or dans le théâtre de Camus
251
Alors, si d¦j vous avez jamais refus¦ de m’absoudre, que le monde ¦pouvant¦ et le siÀcle surpris sachent que d¦sormais les crimes d’une femme d¦sesp¦r¦e feront horreur au p¦ch¦, assombriront la face du ciel et terrifieront l’enfer lui-mÞme! (III, 548)
Le personnage principal se r¦volte alors contre les rÀgles d¦pass¦es et fonde sa propre morale. Et pour Camus, le remplacement de l’ordre par la morale signifie la r¦volution37. Ainsi, la protagoniste semble parfaitement interpr¦ter le propos du philosophe et s’approche mÞme du h¦ros homonyme de Caligula38. Pendant que Julia seule se r¦volte contre l’autorit¦ de son pÀre, le cogito camusien n’est combl¦ qu’au moment o¾ nous, en tant que spectateurs, cr¦ons ce »lien commun qui fonde sur tous les hommes la premiÀre valeur«, afin d’arriver au »Je me r¦volte, donc nous sommes«.39 C’est ce sujet-l qu’il faudrait se demander si l’int¦rÞt de monter des piÀces du SiÀcle d’Or ne va pas au-del de la passion pour les piÀces baroques. Il ne faut pas n¦gliger que les espagnols, avec lesquels Camus est toujours solidaire, se trouve dans un systÀme totalitaire et dictatorial. Quand l’Espagne entre l’UNESCO en novembre 1952, la vision absurde du monde semble avoir atteint son sommet. õ peu prÀs six mois avant la premiÀre de la D¦votion Angers, Albert Camus publie l’article intitul¦ »L’Espagne et la culture«40 traitant pr¦cis¦ment de cette entr¦e l’UNESCO qui ¦tait un ¦v¦nement crucial pour le d¦veloppement de la politique culturelle l’¦chelle mondiale. De ce fait, il n’est pas inattendu que Camus se serve des »grands espagnols« pour critiquer que, je cite, »ce n’est pas Calderon ni Lope de Vega que les d¦mocraties viennent d’accueillir dans leur soci¦t¦ d’¦ducateurs mais Joseph Goebbels« (III, 435). L’¦crivain franÅais est bien conscient de la censure franquiste et de la production artistique du pays pendant l’oppression militaire. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que le th¦tre du SiÀcle d’Or a connu une renaissance pendant le franquisme et les piÀces de Lope de Vega et Calderûn ont mÞme ¦t¦ port¦es l’¦cran afin de les exporter comme ¦tant la v¦ritable culture espagnole41. Si nous proposons alors une lecture des
37 38 39 40 41
m’absoudre, que le monde ¦pouvant¦ et le siÀcle surpris sachent que d¦sormais les crimes d’une femme d¦sesp¦r¦e feront horreur au p¦ch¦, assombriront la face du ciel et terrifieront l’enfer lui-mÞme !« (III, 548) Par ailleurs, tout un monologue de Julia fait d¦couvrir ses actes mortels (cf. III, 551 s.). Cf. Camus, Albert: »Pourquoi l’Espagne?« in: idem: Œuvres complÀtes, tome 2, Paris: Gallimard, 2006, 526. Cf. Couch, John Philip: op.cit., 31. Camus, Albert: L’homme r¦volt¦, Paris: Gallimard, 1101952, 36. Cf. Camus, Albert: »L’Espagne et la culture (30 novembre 1952)«, in: idem: Œuvres complÀtes, III, Paris: Gallimard, 2006, 434 ss. Pour la renaissance et l’instrumentalisation du th¦tre baroque pendant le franquisme, voir Oliva, C¦sar : El teatro desde 1936, Madrid: Alhambra, 1989 et, entre autres, P¦rez Bowie, Jos¦ Antonio: Cine, literatura y poder. La adaptaciûn cinematogrfica durante el primer franquismo (1939 – 1950), Salamanca: Librera Cervantes, 2004.
252
Frank Reza Links (Bonn)
piÀces adapt¦es au sein de l’id¦e de r¦volte, cela va l’encontre de l’id¦ologie franquiste. Si nous revenons l’id¦e initiale de cette contribution que le th¦tre est un lieu de v¦rit¦ cach¦e qui ne peut Þtre d¦voil¦e qu’en pr¦sence de »personnages d’un autre siÀcle« (IV, 608), nous pourrons affirmer que les protagonistes des piÀces baroques n’incarnent pas seulement des sujets universels, mais peuvent parfaitement Þtre vues comme ¦tant une r¦ponse camusienne par rapport l’actualit¦ politique et culturelle en Espagne. En conclusion, nous aimerions rappeler que Camus dirige La D¦votion la croix et Le Chevalier d’Olmedo dans les avant-propos, la jeunesse. Il est fort probable que les jeunes g¦n¦rations aient ¦t¦ sensibles une autre interpr¦tation des grands classiques espagnols. Nous avons essay¦ de montrer que l’adaptation des piÀces espagnoles du baroque n’a pas seulement permis Camus de se manifester en tant que metteur en scÀne et homme de th¦tre, mais aussi de d¦montrer l’universalit¦ de sa pens¦e que nous pouvons ¦galement appliquer des textes anciens. Par ailleurs, nous esp¦rons avoir illustr¦ qu’ partir d’une lecture camusienne, ces piÀces sont une forme de litt¦rature solidaire. Si l’influence espagnole est omnipr¦sente dans l’œuvre d’Albert Camus, il serait fort int¦ressant de voir dans quelle mesure, ses piÀces de th¦tre avaient un impact sur la production th¦trale en Espagne, comme l’affirme C¦sar Oliva42.
Bibliographie Œuvres Calderûn de la Barca, Pedro: La vie est un songe in Marrast, Robert (¦d.): Th¦tre espagnol du XVIIe siÀcle, tome 2, Paris: Gallimard, 1999. Camus, Albert: Th¦tre, r¦cits, nouvelles, Paris: Gallimard, 1962. Camus, Albert: Œuvres complÀtes, tomes 1 – 4, Paris: Gallimard, 2006.
Articles de presse ABC Anonyme: »Sarkozy lo quiere en el Panteûn de Hombres Ilustres« in: http://www.abc.es/ hemeroteca/historico-02 – 01 – 2010/abc/Cultura/sarkozy-lo-quiere-en-el-panteon-dehombres-ilustres_1132830475259.html [10/08/2010]. 42 C¦sar Oliva (op.cit.) d¦montre que le drame Les Justes (1949) d’Albert Camus ¦tait une source d’inspiration pour les piÀces r¦aliste d’Antonio Buero Vallejo (225). Par ailleurs, il indique qu’en 1973, El PequeÇo Teatro avait mis Les Justes au programme (367).
»Ce que je dois à l’Espagne« ou le Siècle d’Or dans le théâtre de Camus
253
Camacho, Ignacio: »Un h¦roe moderno« in: http://www.abc.es/hemeroteca/historico04 – 01 – 2010/abc/Opinion/un-heroe-moderno_1132857797355.html [10/08/2010]. Martn Ferrand, M.: »Del ayer y del maÇana« in: http://www.abc.es/hemeroteca/historico03 – 01 – 2010/abc/Opinion/del-ayer-y-del-ma%C3 %B1ana_1132844194639.html [10/ 08/2010]. QuiÇonero, Juan Pedro: »Camus, el humanismo rebelde« in: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02 – 01 – 2010/abc/Cultura/camus-el-humanismo-rebelde_1132830473333.html [consult¦ le 10/08/2010]. Viana, Israel: »Camus y la muerte ,ms iditota‘« in: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04 – 01 – 2010/abc/Historicas/camus-y-la-muerte-mas-idiota_1132862431989.html [10/08/2010].
El Mundo DPA: »,Solitario y solidario‘: 50 aÇos de la muerte de Albert Camus« in: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/03/cultura/1262540639.html [10/08/2010].
El País Altuna, Bel¦n: »Camus, la justicia« in: http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Camus/ justicia/elpepiesppvs/20100106elpvas_14/Tes [10/08/2010]. EFE: »Francia rinde tributo a Camus« in: http://www.elpais.com/articulo/cultura/Francia/ rinde/tributo/Camus/elpepucul/20100104elpepucul_1/Tes [10/08/2010]. Izpizua, Luis Daniel: »La voz de Camus« in: http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/ voz/Camus/elpepiesppvs/20100107elpvas_19/Tes [10/08/2010]. Ridao, Jos¦ Mara: »La verdad transparente de Camus« in: http://www.elpais.com/articulo/ cultura/verdad/transparente/Camus/elpepicul/20100102elpepicul_3/Tes [10/08/2010]. Rodrguez Rivero, Manuel: »Un hombre del Sur« in: http://www.elpais.com/articulo/ cultura/hombre/Sur/elpepicul/20091230elpepicul_3/Tes [10/08/2010]. Trueba, David: »Recuerdo« in: http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/Recuerdo/elpepirtv/20100106elpepirtv_3/Tes [10/08/2010].
La Razón Albisu, Javier (EFE): »Se cumple medio siglo de la muerte del gran escritor. Francia quiere llevar a Camus al panteûn de los ,dioses‘« in: http://larazon.es/hemeroteca/8058francia-quiere-llevar-a-camus-al-panteon-de-los-dioses [10/08/2010]. Anonyme: »Un ,outsider‘ en el Panteûn« in: http://larazon.es/hemeroteca/7593-un-outsider-en-el-panteon [10/08/2010]. Cano, Germn: »Al final Camus tuvo razûn« in: http://larazon.es/hemeroteca/5835-alfinal-camus-tuvo-razon [10/08/2010]. Gundn, J.A.: »Nostalgia de Camus« in: http://larazon.es/hemeroteca/144-nostalgia-decamus [10/08/2010]. Vidal, C¦sar : »,Calgula‘« in: http://larazon.es/hemeroteca/6771-caligula [10/08/2010].
254
Frank Reza Links (Bonn)
La Vanguardia Albisu, Javier (EFE): »Medio siglo sin el escritor Albert Camus« in: http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20100101/53859489180/medio-siglo-sin-el-escritor-albert-camus-paris-nobel-marie-curie-victor-hugo-voltaire-francia-primer.html [10/08/2010]. Carreras, Francesc de: »El incûmodo Albert Camus« in: http://www.lavanguardia.es/ cultura/noticias/20100107/53862407017/el-incomodo-albert-camus-europa-nobelunion-sovietica-academia-sueca-universidad-gallimard-caligula-.html [10/08/2010]. Santamara, Sergio: »Carta a un amigo« in: http://www.lavanguardia.es/lv24 h/20100107/ 53862440619.html [10/08/2010].
Público P¦rez, Andr¦s: »La resistencia de Camus persiste 50 aÇos despu¦s« in: http://www.publico.es/culturas/282759/resistencia/camus/persiste/anos/despues [10/08/2010].
Littérature secondaire Abbou, Andr¦: »Le th¦tre de la d¦mesure« in: L¦vi-Valensi, Jacqueline (¦d.): Camus et le th¦tre. Actes du colloque tenu Amiens du 31 mai au 2 juin 1988, Paris: Imec, 1992, 171 – 176. Arellano, Ignacio: Historia del teatro espaÇol del siglo XVII, Madrid: Ctedra, 1995. Bartfeld, Fernande: »Le th¦tre de Camus, lieu d’une ¦criture contrari¦e« in: L¦vi-Valensi, Jacqueline (¦d.): Camus et le th¦tre. Actes du colloque tenu Amiens du 31 mai au 2 juin 1988, Paris: Imec, 1992, 177 – 185. Brahimi, Denise: »R¦volte, R¦volution, Terreur« in Toumi, Alex Baylee (¦d.): Albert Camus, pr¦curseur. M¦diterran¦e d’hier et d’aujourd’hui, New York: Peter Lang, 2009, 117 – 125. Brioso, Jorge: »¿Cûmo hacer las cosas con los enigmas? La vida es sueÇo o el drama del desengaÇo« in: Bulletin of the Comediantes 56, 1/2004, 55 – 75. Burton, Grace: »The creation of myth in Calderûn’s La devociûn de la cruz« in: Revista de estudios hispnicos, 21/1994, 9 – 23. Coombs, Ilona: Camus, homme de th¦tre, Paris: Nizet, 1968. Corbic, Arnaud: Camus. L’absurde, la r¦volte, l’amour, Paris: Les Êditions de l’Atelier /Êditions OuvriÀres, 2003. Cots Vicente, Montserrat: »Camus traductor : La devociûn de la cruz de Calderûn« in Revisa anthropos: huellas del conocimiento, 199/2003, 138 – 139. Couch, John Philip: »Camus’ Dramatic Adaptions and Translations« in: The French Review, 33, 1/1959, 27 – 36. Delgado Morales, Manuel: »La devociûn de la cruz: Entre la crueldad humana y la clemencia divina« in Anuario Calderoniano, 2/2009, 97 – 109. Dengler-Gassin, Robert: »Albert Camus adaptateur de Lope de Vega: Le Chevalier d’Olmedo« in L¦vi-Valensi, Jacqueline (¦d.): Camus et le th¦tre. Actes du colloque tenu Amiens du 31 mai au 2 juin 1988, Paris: Imec, 1992, 221 – 228.
»Ce que je dois à l’Espagne« ou le Siècle d’Or dans le théâtre de Camus
255
Durn, Manuel: »Camus and the spanish theatre« in: Yale French Studies, 25/1960, 126 – 131. Gay-Crosier : Les envers d’un ¦chec. Êtude sur le th¦tre d’Albert Camus, Paris: Minard, 1983. Gregorio, Alicia de: »DoÇa In¦s como antiherona en El caballero de Olmedo« in: Revista de Estudios Hispanicos, 21/1994, 77 – 84. Gu¦rin, Jeanyves: Le th¦tre en France de 1914 1950, Paris: Honor¦ Champion, 2007. Gu¦rin, Jeanyves (¦d.): Dictionnaire Albert Camus, Paris: Robert Laffont, 2009. Figuero, Javier : Albert Camus ou l’Espagne exalt¦e, G¦menos: Autres Temps, 2008. Freeman, Edward: The Theatre of Albert Camus. A critical study, London: Mehtuen& Co, 1971. Friedman, Edward H.: »The other side of the metaphor : An approach to La devociûn de la cruz« in: McGaha, Michael D.: Approaches to the Theater of Calderûn, Washington, DC: UP of America, 1982, 129 – 141. Heinz-Mohr, Gerd:Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen Kunst, Düsseldorf / Köln: Eugen Diederichs, 61981, 164 – 166, ici 164. Ingber, Alix: »El juego de motivos contextuales en El caballero de Olmedo« in La torre: revista general de la Universidad de Puerto Rico, 1.3 – 4/1987, 429 – 444. JareÇo, Ernesto: »,El caballero de Olmedo‘, Garca Lorca y Albert Camus« in: Papeles de Son Armadans, 58/1970, 219 – 242. King, Willard F.: »El caballero de Olmedo: »Poetic justice or destiny?« in Kossoff, A. David/ Amor y Vzquez, Jos¦ (¦ds.): Homenaje a William F. Fichter : Estudios sobre el teatro antiguo hispnico y otros ensayos, Madrid: Castalia, 1971, 367 – 379. L¦vi-Valensi, Jacqueline: »R¦alit¦ et symbole de l’Espagne dans l’œuvre de Camus« in: La Revue des Lettres Modernes, 170 – 174/1968, 149 – 178. –: »Camus et l’Espagne« in D¦jeux, Jean (¦d.): Espagne et Alg¦rie au XXe siÀcle. Contacts culturels et cr¦ation litt¦raire, Paris: L’Harmattan, 1985, 141 – 159. –: »Camus et le th¦tre: quelques faits, quelques questions« in: L¦vi-Valensi, Jacqueline (¦d.): Camus et le th¦tre. Actes du colloque tenu Amiens du 31 mai au 2 juin 1988, Paris: Imec, 1992, 13 – 18. –: »La EspaÇa de Camus: smbolo de libertad y humanismo« in Revisa anthropos: huellas del conocimiento, 199/2003, 140 – 148. L¦vi-Valensi, Jacqueline (¦d.): Camus et le th¦tre. Actes du colloque tenu Amiens du 31 mai au 2 juin 1988, Paris: Imec, 1992. Lupo, Virginie: »Camus y la pasiûn por el teatro« in Revisa anthropos: huellas del conocimiento, 199/2003, 73 – 85. –: »La d¦votion la Croix et Le Chevalier d’Olmedo. Deux t¦moignages d’Albert Camus, de son amour de l’acteur et de son sens th¦tral profond«, in Temple, Fr¦d¦ric-Jacques (¦d.): Albert Camus et l’Espagne, Aix-en-Provence: Êdisud, 2005, 33 – 49. Margerrison, Christine: »Camus and the theatre« in: Hughes, Edward J. (¦d.): The Cambridge Companion to Camus, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 67 – 78. Marisal, George: »Iconografa y t¦cnica emblemtica en Calderûn: La devociûn de la cruz« in: Revista canadiense de estudios hispnicos, 5, 3/1981, 339 – 354. Oliva, C¦sar : El teatro desde 1936, Madrid: Alhambra, 1989. P¦rez Bowie, Jos¦ Antonio: Cine, literatura y poder. La adaptaciûn cinematogrfica durante el primer franquismo (1939 – 1950), Salamanca: Librera Cervantes, 2004.
256
Frank Reza Links (Bonn)
Rauer, Monika: Interkulturelle Aspekte im Schaffen von Albert Camus: Der Spanienbezug, Wien: LIT, 2005 (Romanistik, 14). Rico, Francisco: »El caballero de Olmedo. Amor, muerte, irona« in: Papeles de Son Armadans, 67, 139, 1967, pp. 38 – 56. Rufat, H¦lÀne: »Espagne« in: Gu¦rin, Jeanyves (¦d.): Dictionnaire Albert Camus, Paris: Robert Laffont, 2009, pp. 260 – 263. Schmidt, Marie-France: »La D¦votion la Croix, de Calderûn Camus: langage et dramaturgie« in L¦vi-Valensi, Jacqueline (¦d.): Camus et le th¦tre. Actes du colloque tenu Amiens du 31 mai au 2 juin 1988, Paris: Imec, 1992, pp. 195 – 210. Temple, Fr¦d¦ric-Jacques (¦d.): Albert Camus et l’Espagne, Aix-en-Provence: Êdisud, 2005. Wernicke, Horst: »Camus’ Entwurf vom brüderlichen Menschen« in Schlette, Heinz Robert / Herzog, Markwart (¦ds.): «Mein Reich ist von dieser Welt«. Das Menschenbild Albert Camus’, Stuttgart: Kohlhammer, 2000, pp. 109 – 123. Weyembergh, Maurice: »Absurde« in: Gu¦rin, Jeanyves (¦d.): Dictionnaire Albert Camus, Paris: Robert Laffont, 2009, pp. 7 – 10.
Frank Reza Links (Bonn)
Über das Verhandeln zeitloser Themen: Ein Interview mit der Theaterregisseurin Jette Steckel
Betrachtet man die Spielpläne der letzten fünf Jahre in deutschen Stadt- und Staatstheatern, so lässt sich feststellen, dass Camus’ Dramenwerk weiterhin von einem signifikanten Interesse ist. Eine Erhebung zeigt, dass in dieser Zeit 14 Inszenierungen von Camus’ Texten auf die Bühne kamen, während insbesondere die Romanadaptation seines Romans Der Fremde (1942) sich großer Beliebtheit seitens der Regisseure erfreut.1 Hierbei dominieren postdramatische und zeitgenössische Interpretationen der Stücke, wie beispielsweise Martin Nimz’ Die Gerechten am Schauspiel Frankfurt,2 wodurch die Präsenz seiner Stoffe aufrechterhalten wird. Gerade im Kontext des 50. Todestages des Autors, finden in der Spielzeit 2009/2010 zahlreiche ›Wiederbegegnungen‹ mit dem Œuvre des französischen Intellektuellen statt. Doch obschon das Interesse an Albert Camus’ Thesen nicht abreißt, scheinen diese wiederum im Vergleich zu Jean Paul Sartre eher »angestaubt«3, wie Uwe Wittstock von der Tageszeitung Die Welt 1 Für diese Erhebung wurden Theaterrezensionen herangezogen, die sich in erster Linie auf dem Internetportal www.nachtkritik.de befinden. Davon ausgehend wurden weitere Besprechungen auf den Webseiten der entsprechenden Theaterhäuser herausgesucht. Der Untersuchungszeitraum beträgt die Spielzeiten 2005/2006 – 2009/2010. Eine chronologische Aufstellung der Inszenierungen findet sich am Ende dieses Beitrags. 2 Claudia Schülke: »Smarte Terroristen: Martin Nimz inszeniert Albert Camus’ Stück über ›Die Gerechten‹« in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. 09. 2005, o.S. [http://www.faz.net/-00mosi, 31. 08. 2010]. 3 Wittstock, Uwe: »Wer tötet, muß getötet werden. Das Schauspiel Frankfurt läßt Sartre und Camus von den alten Zeiten des Terrors reden« in: http://www.welt.de/print-welt/article167460/Wer_toetet_muss_getoetet_werden.html, 28. 09. 2005, o.S. [31. 08. 2010]. Ähnlich argumentiert Christine Wahl in ihrer Besprechung zu Gil Mehmerts Inszenierung von Das Missverständnis am Deutschen Theater in Berlin: »Was an der Oberfläche nach einem Samstagabend-Thriller klingt, ist de facto ein philosophischer Beitrag zur Kategorie des Absurden, das Albert Camus bereits in seinem Essay »Der Mythos von Sisyphos« zur Grundverfasstheit der menschlichen Existenz erklärt hatte. In diesem Sinne wollte er seinen 1941 während der deutschen Besatzung in Frankreich entstandenen Dreiakter »Das Missverständnis« als »Versuch einer modernen Tragödie« verstanden wissen, deren Figuren bisweilen entsprechend abstrakte Ideen vor sich her tragen. Und Ideenträger lassen sich bekanntlich nicht leicht auf der Bühne inszenieren. Schon gar nicht, wenn die unmittelbare
258
Frank Reza Links (Bonn)
im Rahmen der Nimz-Inszenierung kommentiert. Im Gegensatz hierzu titelt Irene Bazinger von der Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass Albert Camus als »Der Autor für die frische Regisseursgeneration« gilt.4 Diese Meinungsdivergenz wirft folglich die Frage auf, inwiefern nun wirklich von einer Aktualität der Themen Camus’ gesprochen werden kann. In diesem Zusammenhang fand am 12. 05. 2010 ein Gespräch mit der Theaterregisseurin Jette Steckel (*1982) im Salon Schmitz (Köln) statt, das von Frank Reza Links geführt wurde. Die Regisseurin, die in erster Linie mit ihrer Dramaturgin Katrin Sadlowski zusammenarbeitet, hat ihr Regiestudium an der Theaterakademie Hamburg mit einer Inszenierung von Albert Camus’ Die Gerechten beendet und wurde 2007 von der Zeitschrift Theater heute zur Nachwuchsregisseurin des Jahres ausgezeichnet.5 Ihr nächstes Camus Theaterstück, Caligula6, hat sie am Deutschen Theater Berlin in der Spielzeit 2008/2009 inszeniert und plante für 2009/2010 eine Adaption von Der Fremde am Schauspiel Köln. Die Regisseurin sprach sich ganz eindeutig für die Zeitlosigkeit der Thesen Camus’ aus, die es auf der Bühne zu verhandeln gilt. Ihr Ziel ist ferner, dass das Publikum durch ihre Inszenierungen eine Haltung gegenüber diesen Thesen entwickelt. Während des Gesprächs stellte sich heraus, dass die Wiederbegegnung mit Camus gerade für die junge Generation, die sogenannte Generation Y, von hoher Aktualität ist. FRL: Jette, du hast 2007 dein Regie-Diplom an der Hamburger Theaterakademie absolviert. Für dein Abschlussprojekt brachtest du Die Gerechten von Albert Camus auf die Bühne. Wie kam es dazu, dass du dich zum einen für Camus und zum anderen für die Gerechten entschieden hast?
Dringlichkeit ihrer Kopfinhalte über sechzig Jahre zurückliegt: Ein Problem, das auch Gil Mehmerts Inszenierung in den Kammerspielen des Deutschen Theaters nicht zu lösen weiß.« Siehe Wahl, Christine: »Trost der Tragödie« in: http://www.tagesspiegel.de/kultur/trost-dertragoedie/1331198.html, 23. 09. 2008 [31. 08. 2010]. 4 Siehe Bazinger, Irene: »Ist denn niemand hier? Der Autor für die frische Regisseursgeneration: Zweimal Camus in Berliner Theatern« in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. 09. 2008, S. 35. 5 Siehe Waniek, Ellen: Gerettet? Spiegelungen des prekären Sinn-Subjekts im jungen deutschen Regietheater, Marburg: Tectum, 2008 (Kleine Mainzer Schriften zur Theaterwissenschaft, 15), S. 3. 6 Für diese Inszenierung erhielt Jette Steckel 2009 den dotierten Publikumspreis des Theaterfestivals Radikal Jung am Münchner Volkstheater. Siehe JNM: »Theaterlandschaft von morgen. Jette Steckels Caligula gewinnt Publikumspreis bei Radikal Jung« in: http:// www.nachtkritik.de/index.php?view=article& catid=126& id=2722 %3Ajette-steckels-caligula-gewinnt-publikumspreis-bei-radikal-jung& tmpl=component& print=1& layout=default& page=& option=com_content& Itemid=100057 [31. 08. 2010].
Über das Verhandeln zeitloser Themen
259
JS: Eigentlich fing es so an, dass ich irgendwann einmal in den Sommerferien aus dem Bücherregal den Fremden herausgezogen und gelesen habe und so anfing, mich für Camus zu interessieren. Ich habe nämlich in der Schule keinen Kontakt dazu gehabt. Dann haben wir uns in der Uni ein wenig mit Sartre beschäftigt und dadurch habe ich angefangen, mich für die Franzosen im Allgemeinen zu interessieren. Und dann habe ich ein Stück fürs Diplom gesucht. Eigentlich muss man sagen, dass ich eine Gruppe von Leuten hatte, mit denen ich fest gearbeitet habe und das waren vier Jungs. Das heißt, dass ich erst einmal auf der Suche nach einem Stück war mit einer gleichberechtigten Rollenverteilung für junge Männer. Ich habe Die Gerechten gelesen und fand es genau das Richtige. Und zwar weil ich Camus’ Texte lese und sie einfach absolut zeitlos finde. Ich glaube das Tolle an ihm, ganz subjektiv gesagt, ist, dass es eine fast menschliche Verhandlung von den unbeantwortbaren philosophischen Fragen ist. Es gibt ja immer diesen großen Streit, ob er nun ein Philosoph ist oder nicht. Und das ist der Punkt, warum Camus auf dem Theater in gewisser Weise so gut funktioniert; weil er so unlogisch, so subjektiv und menschlich denkt und schreibt; weil er die Widersprüche zulässt. Das Verhandeln der Absurdität, und der Versuch konsequent zu sein, ist das Interessante. Zum Beispiel das Töten. Wenn man anfängt, darüber zu sprechen, kommt man ja immer, oder zumindest ich komme immer, zum gedanklichen Error. Man kann ja immer sagen, »Ich bin gegen Gewalt«, aber wenn man sich Camus’ Satz »Die Frage ist, ob man sich, sobald man zu handeln beginnt, vom Töten nicht abhalten kann«, reinzieht, dann bin ich ja schon schuldig, nur weil ich einen Nike-Turnschuh trage. Genau das ist die Frage in den Gerechten: Dürfen wir töten, um Tod zu verhindern oder dürfen wir nicht? Und das begann mich zu faszinieren. Wir hatten damals ja noch Zeit, uns wirklich mit Stoffen auseinanderzusetzen. Wir haben über vier Wochen nur Der Mensch in der Revolte gelesen und uns völlig darin verloren. FRL: Ihr habt Euch sozusagen richtig darauf vorbereitet. Es ging daher nicht nur darum, Camus zu inszenieren, sondern ihr wolltet wissen, was dahinter steckt. JS: Ja. Das wollten wir. Wir hatten so eine Arbeitsweise in der Gruppe, dass wir nur Projekte oder Themen behandeln, die uns in einer gewissen Weise selber betreffen, die in dem Moment wichtig für uns waren. Wir setzten voraus, dass wir Theater als eine Form von Diskurs betrachten und haben uns erstmal über ziemlich lange Zeit mit dem Stoff abgeglichen. Was sagt der Stoff oder was will der Autor und was wollen wir jetzt damit und wie können wir das ausdrücken? Also die Spanne oder die Differenz zwischen uns und dem Autor gemessen. Da stellt sich ja immer auch die Frage der Werktreue: Darf man interpretieren oder was ist Interpretation? Wir haben immer so gearbeitet, dass wir versucht haben, zu erklären, warum wir Sachen so interpretieren oder warum wir das jetzt so
260
Frank Reza Links (Bonn)
erzählen wollen, ohne den Autor damit überfahren zu wollen. Wir haben also erst einmal über vier Wochen Der Mythos des Sisyphos und Der Mensch in der Revolte gelesen und sozusagen versucht, mit Camus zu diskutieren. Was finden wir richtig und was falsch? Das Ergebnis wurde dann Teil der Arbeit. Am Anfang gab es zum Beispiel Bilder, durch die jeder Einzelne versucht hat auszudrücken, warum er den Stoff jetzt macht. FRL: Das heißt, ihr lasst in der Vorbereitung Camus’ theoretische Texte miteinfließen, doch inszeniert diese nicht. JS: Doch. FRL: Ihr habt also Zitate, wie zum Beispiel aus dem Sisyphos und Der Mensch in der Revolte integriert. JS: Ja, vor allem Der Mensch in der Revolte. Genau deswegen, weil wir diese Frage, ob Töten oder nicht und den Gewissenskonflikt und die Handlungsfolgen damit ausfüllen wollten. Camus erklärt ja in Der Mensch in der Revolte die Handlungsketten: Warum bin ich immer schuldig. Warum töte ich indirekt und kann also, der Konsequenz nach, auch direkt töten, weil ich, kaum lebendig, ein Mörder bin. Die Schauspieler sind zwischendrin ausgestiegen und haben mit Camus’ Texten sozusagen die Fragen der Figuren nochmal ausführlicher verhandelt. FRL: Folglich eine Art Spiegelung? JS: Ja, eine zweite Ebene. Es gab die Ebene der Handlung und die Ebene des Diskurses. In den Gerechten gibt es ja zum Beispiel den Monolog von Stepan über das Töten der Kinder des Großherzogs. Auf der Höhe der einzelnen diskursiven Standpunkte, z. B. diesem, sind die Figuren ausgestiegen und haben mit Camus nochmals diese Frage vertieft oder jenseits ihrer Figur diskutiert. FRL: Man hat somit auf der einen Seite den Schauspieler, der die Figur interpretiert und auf der anderen Seite den Schauspieler als Camus’ Sprachrohr. JS: Ja, eigentlich den Spieler. Der Schauspieler, der Stepan gespielt hat, hielt zum Beispiel am Anfang ein Bild hoch, das für ihn den Auslöser dafür darstellt, warum man sich fragen muss, ob man nun töten darf oder nicht. Das waren also Bilder, die mit Gewalt zu tun hatten. Jeder hatte eigentlich eine ganz persönliche Idee. Dann sind sie in die Handlung eingestiegen, ganz offensichtlich, indem sie Kostüme angelegt haben. Dann gab es den Strang der Geschichte und zwi-
Über das Verhandeln zeitloser Themen
261
schendrin sind sie immer wieder ausgestiegen und haben mit dem Buch in der Hand, als Zeichen, die Fragen nochmal auf anderer Ebene verhandelt. Aber in persönlicher Form: Einer hat zum Beispiel gerappt, ein anderer hat es einfach gesagt und wieder einer hat es vorgelesen. Eigentlich nur, um die persönliche Auseinandersetzung der Spieler mit den Fragen widerzuspiegeln. FRL: Mit den Gerechten war es ja dann nicht vorbei. Seither hast du ein weiteres Camus Theaterstück inszeniert, nämlich Caligula. Für die Spielzeit 2009/2010 war Der Fremde am Schauspiel Köln geplant. Suchst du die Stücke selbst aus oder wirst du mit den Inszenierungen beauftragt? JS: Nein, nein! Ich komme immer wieder damit an. FRL: Können wir vielleicht sogar sagen, dass du von Camus’ Theater fasziniert bist? JS: Ja, total! Aber ich muss das auch im Zusammenhang mit meiner Dramaturgin Katrin Sadlowski sehen. Denn mit ihr gemeinsam sind die Projekte und die endgültigen Fassungen entstanden, Caligula und Die Gerechten. Sie studierte Germanistik und Philosophie und ist somit der andere Teil der Geschichte oder dieses Interesses. FRL: Du sagst, dass du dich intensiv mit den theoretischen Texten Camus’ beschäftigst. Kann man sagen, dass diese philosophische Konzeption eventuell Auswirkungen hat auf andere Stücke, die du inszenierst oder behandelst du das dann unabhängig? Das heißt, gibt es einen Camus’schen Zug bei deiner letzten Shakespeare Inszenierung beispielsweise? JS: Das ist schwer zu sagen, denn ich habe mich ja daran genähert. Letztendlich kann man sagen, dass er so sehr widerspiegelt, was mich an großen Fragen interessiert oder an Fragen, die ich auch gerne dem Theater stellen möchte, dass ich das gar nicht so trennen kann. Wenn ich die beiden Camus-Arbeiten nehme, die ich schon gemacht habe, dann sind sie für mich inhaltlich auf jeden Fall die wichtigsten gewesen. Im Gegensatz zu Shakespeare oder anderen, weil es die Stücke sind, die mich im Moment am meisten umkreisen. Deshalb kann ich nicht sagen, dass ich immer einen Camus’schen Zug in einer Shakespeare-Inszenierung habe, weil sich seine Arbeit erst mal mit meinem Interesse deckt. Aber in der Konzeption glaube ich schon. Ich bin tendenziell ziemlich thesenhaft in dem, wie ich inszeniere. Und ich würde sagen, dass Camus’ Stücke thesenhaft sind. Wir haben uns überhaupt nicht für einen Naturalismus in Caligula oder in den Gerechten interessiert.
262
Frank Reza Links (Bonn)
FRL: Es geht euch um die Nachricht, die Camus damit transportiert und alles andere wird herausgenommen. JS: Ja, genau. FRL: Gerade wenn du die theoretische Konzeption Camus’ heranziehst, arbeitest du dann auch an der Übersetzung der fremdsprachlichen Texte selbst, wenn du diese adaptierst? Ich habe gesehen, dass zum Beispiel Othello eine Zusammenarbeit mit deinem Vater war. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Text modernisiert wird, sondern dass man versucht, ihn von der Übersetzung her nochmals zu adaptieren. Oder hältst du dich an eine feste Übersetzung? JS: Nein, wir haben eigentlich beide komplett neu übersetzt oder besser gesagt: zusammengesetzt. Da es krasse Unterschiede gibt, haben wir verschiedene Übersetzungen nebeneinander gelegt. Katrin kann Französisch und sie hat es mir dann auch nochmal aus dem Original übersetzt. Wir haben also schon in die Richtung gearbeitet, die uns am meisten interessierte. Übersetzung ist meiner Meinung nach immer Interpretation, es geht gar nicht anders. FRL: Camus’ Sprache ist ja im Vergleich zu Shakespeare recht modern. Ich kann mir daher vorstellen, dass es im Falle von Othello einer anderen Arbeit an der Sprache bedurfte. JS: Ja, eben. Da ist es eine totale Interpretation, weil man ja eigentlich eine neue Sprache erfinden muss. Und bei Camus ist es immer so, dass die kleinsten Färbungen in Ausdrücken eine ganz andere Bedeutung der Aussage erwirken können. Die Konnotation mancher Wörter ist eine ganz andere im Deutschen als im Französischen und dadurch kommen so schnell Missverständnisse auf. Man muss ja sehr genau verstehen, wie er ein Wort benutzt. FRL: Ja, das Missverständnis ist ja wie ein roter Faden, der sich durch Camus’ Werk, vor allem auch sein Theater, zieht. – Kommen wir vielleicht nochmal auf Camus’ Paradigmen zu sprechen. Seine existentialistischen Ideen lassen sich auf einige Schlagworte zusammenfassen wie »die Revolte« und »das Absurde«. Du hast ja auch hierzu den Mythos des Sisyphos oder Mensch in der Revolte gelesen. Wir haben bereits gesehen, dass diese Konzepte in deinen Inszenierungen einen hohen Stellenwert haben. JS: Ja, sie interessieren mich sogar mehr als die Stücke.
Über das Verhandeln zeitloser Themen
263
FRL: Dann würde mich interessieren, wie du »Revolte« und das »Absurde« unabhängig von Camus definierst. Denn ich nehme an, dass gerade die Aussage »Ich revoltiere, also sind wir« etwas in dir aufgeweckt hat. JS: »Revolte« ist für mich in erster Linie einfach Auflehnung gegen was auch immer und irgendwie auch Erneuerung. »Wenn die Revolte eine Philosophie begründen könnte, dann wäre es eine Philosophie der Grenzen« sagt Camus. Das »Absurde« ist für mich der Begriff, der da anfängt, wo man keinen anderen mehr hat. Absurd ist für mich ein unglaublich menschliches Wort, weil es eigentlich nicht erklärbar ist, weil es die Undefinierbarkeit definiert. FRL: Gerade dieses nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen, könnte man da sagen, dass es eine Generationsgeschichte ist? Camus war ja in den 1960er Jahren eine ganz wichtige Figur, aber in den 1990er Jahren hatte man sich ein bisschen an Camus und Sartre satt gelesen. In der Schule wurde Camus zur Pflichtlektüre und man wurde der ganzen Geschichte ein wenig überdrüssig. Aber ich habe selbst an mir festgestellt, dass die jetzige Re-Lektüre eine viel stärkere Wirkung hatte. Kannst du dir vorstellen, dass diese Wiederbelebung Camus’, wie wir vorhin sagten, eine Sache unserer Generation, der Generation Y, geworden ist? Stehen wir vielleicht, bedingt durch eine Flut von multimedialen Einflüssen, vor einer absurden Welt? Und lesen wir deshalb Camus nochmal neu? JS: Ich glaube schon. Der Begriff Revolte ist ja etwas, das überhaupt nicht vorhanden ist. Wir sind ja die Langweiler und werden ständig stilisiert als die »Nicht-Auflehner«, »Jugend ohne Charakter«, die langweiligen Kinder der 68er. Und dadurch ist das erst einmal ein Begriff, der in mir eine Kontroverse auslöst. Denn ganz einfach ausgedrückt, strahlt er auf mich eine große Faszination aus, aber gleichzeitig auch eine Ohnmacht. Ich bin so ein Kind, das immer das Gefühl hatte, gerne revoltieren zu wollen. Ich verstehe aber nur sehr schwer wofür und wogegen ich eigentlich sein soll. Und das ist ein Konflikt, den – ich weiß nicht, ob unsere ganze Generation – aber den habe ich auf jeden Fall. Die Zusammenhänge sind oft so undurchschaubar und wirken absurd. Jegliche Art von Handlung wird so wahnsinnig indirekt. Dieser Konflikt ist wohl der Grund, warum Camus so eingeschlagen hat bei uns. Wenn wir nochmal den Nike-Schuh oder den Mausklick nehmen: Du hast keinen direkten Bezug mehr zu deiner Handlung. Ich glaube, dass die Frage nach der Konsequenz unserer Handlungen, wie Camus sie in Der Mensch in der Revolte beschreibt, heute sehr aktuell ist. Denn es hat mit der Gegenwart zu tun, dass wir kein Verhältnis mehr zu unseren Handlungen haben können. Ich weiß einfach nicht, welche Kettenreaktionen ich auslöse, wenn ich bestimmte Dinge tue, wie einfach nur eine Plastiktüte in den
264
Frank Reza Links (Bonn)
Müll zu schmeißen. Welche Arbeitskräfte, die schlecht bezahlt sind, giftige Dämpfe einatmen und ihre Lunge zu Grunde richten, wenn sie die Tüte recyceln müssen und was dann für ein Rauch ins Ozonloch steigt, das mich wiederum sterben lässt an Krebs und was weiß ich nicht noch alles. Wir sind einfach überinformiert über jede kleine Auswirkung, die jede Handlung haben kann. Und den Gedanken, per se, wenn ich lebe, schuldig zu sein, finde ich unglaublich erleichternd. Da kommt Camus auch schließlich hin in Der Mensch in der Revolte. Wenn man ein kollektives Bewusstsein zur Schuld entwickeln könnte, auch historisch, könnte man mit ganz viel falscher Moral aufräumen und an viel produktiveren Punkten in einem Gesamtkontext leben lernen. Das ist ja völlig größenwahnsinnig, welche Thesen er da aufstellt, doch ich kann da ziemlich lange mithalten. Ich bin eben ein Kind meiner Zeit, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, denen ging es auch so, deswegen könnte ich es nun wagen, ein neues Interesse an diesen Fragen auf eine Generation zu übertragen. FRL: Das war der Eindruck, den ich von deiner Arbeit gewonnen habe. Zumal, wenn ich mir anschaue, wer bei Caligula im Ensemble dabei war. Das sind ja alles Leute aus unserer Generation, von denen keiner älter als 30 ist. Ich kann mir deshalb schon vorstellen, dass man durch Camus eine Bestätigung, eine Antwort auf eine Frage bekommt, die einen eventuell beschäftigt. Wenn man natürlich reflektiert ist, denn es trifft ja nicht auf alle Leute zu, die in den 1980er Jahren geboren sind. JS: Absolut und es war so. FRL: Gerade auch im Hinblick auf die Arbeit an der Rolle, kann ich mir vorstellen, dass man sich als Schauspieler sehr gut mit der Figur identifizieren kann, wenn man so arbeitet wie ihr. Die Beschäftigung mit dem Kontext hilft, die Interpretation nochmal ganz anders zu gestalten. JS: Man muss sich sogar mit dem Kontext auseinandersetzen. Beispielsweise ist Caligula in der Gaußstraße am Thalia in Hamburg übernommen worden und wurde, was äußerst fragwürdig ist, bis auf den Hauptdarsteller umbesetzt. Da haben wir auch noch mal ein bisschen Mensch in der Revolte gelesen. Mir ist es, ehrlich gesagt, ein Graus, die Schauspieler interpretieren zu sehen, ohne dass sie bis zu einem gewissen Grad in diesen Diskurs eingedrungen sind und die Gelegenheit hatten, sich sozusagen gemeinsam mit dem Team eine Meinung zum Stoff zu bilden, auch wenn die nicht deckend mit der Figur ist. Die Aussagen sind so krass, dass man eine klare Haltung dazu haben sollte.
Über das Verhandeln zeitloser Themen
265
FRL: Nochmal zu Caligula. Wir hatten vorhin schon einmal über die Interpretation gesprochen und bei Camus wird Caligula am Schluss umgebracht. Doch aus den Rezensionen zu deiner Inszenierung geht hervor, dass er Selbstmord begeht. JS: Naja, das ist interpretierbar. Ich wollte gerne, dass es in der Schwebe bleibt, ob das alles ein Gedankenkonstrukt ist oder wirklich passiert, was man da sieht. Ich musste mir ganz praktisch überlegen, wie ich die vielen Morde darstellen kann, ohne dass es eine Lachnummer wird. Das einzige Sinnbild ist daher ein Kopierer. Die Leute, die reinkommen, werden kopiert und im Laufe der drei Jahre des Mordens – es gibt also einen Zeitsprung im Stück – kommen ihre Köpfe aus dem Kopierer und werden wie eine Totengalerie an der Wand aufgehängt. Wir haben die Patrizier gestrichen und ich habe das Publikum zu den Patriziern erklärt. Es gibt dadurch immer auch eine theatrale Ebene neben der des Kaisers des römischen Reiches, auf der man sagen könnte, der Hauptdarsteller vergewaltigt uns hier gerade alle. Der schließt die Tür ab und sagt: »Ich mache jetzt, was ich will. Ich bringe euch alle um!« Und das ist eine Art von Spiel mit der Wahrnehmung aus dem Theaterraum heraus. Und auf der Ebene des Spiels, nämlich kopieren heißt töten, bringt er sich selber um. Wir hatten auch einmal ein Ende, bei dem alle reinkamen und ihn getötet haben, aber das haben wir dann gestrichen. Deswegen ist das Kopieren ein Selbstmord auf der Ebene des Spiels. Denn eigentlich wünscht er sich ja nichts mehr, als zu sterben, wenn wir an die Szene mit Scipio denken, in der er ihn geradezu darum bittet, getötet zu werden. FRL: Ich würde nun ganz gerne zum Fremden kommen. Du hast einmal gesagt, »die Gesellschaft ist ein Netz«. Was passiert, wenn ich als Individuum in diesem Netz gefangen bin oder sogar durchfalle? Werde ich dann zum »Fremden«? JS: Was ich am Fremden zeitgeistgemäß oder aktuell finde, ist die Art der Fremdheit gegenüber der Gesellschaft. Nicht in dem Sinne, dass man Fremder ist, sondern mitten in der Gesellschaft lebt und einem das Leben sozusagen fremd ist. Obwohl man dieses Leben täglich physisch lebt. Die Teilnahmslosigkeit am Leben ist das, was ich nachvollziehbar oder nachempfindbar finde. FRL: Der Fremde ist ja auch der erste Roman Camus’, den du gerne auf die Bühne bringen möchtest. Welche Möglichkeiten beziehungsweise welche Grenzen siehst du in der Romanadaptation? JS: Eigentlich sehe ich erst einmal keine Grenzen. Romane haben ja immer ihre Plastizität in den Beschreibungen von Gerüchen, Landschaften, Gefühlen, Licht.
266
Frank Reza Links (Bonn)
Gerade das Licht in Algerien ist ja im Fremden sehr stark beschrieben. Und das finde ich das Schwierige bei der Übersetzung in eine theatrale Sprache. Die Dinge nur zu sagen wird irgendwann langweilig im Theater. Deshalb ist es eine krasse Aneignung, wenn man nur die Übersetzung der eigenen Fantasie zeigt und nicht das, was da steht. Genau wie in Filmen zu Romanen. Dadurch ist es ja ein bisschen ein Sich-zu-eigen-Machen. Und das könnte eine Grenze sein. Das Schmerzliche ist dann, dass man nicht alles erzählen kann. FRL: Bei diesem Projekt wird wahrscheinlich auch wieder dein Hauptfokus sein, wie du Camus’ Ideen durch die Geschichte transportieren kannst. JS: Ja, genau. FRL: In deinen Inszenierungen, beispielsweise Caligula oder Othello, brichst du mit der 4. Wand und bindest das Publikum in das Geschehen mit ein. In den Theaterkritiken zu Caligula hieß es sogar, dass es eine ständige Angstmache war. Erlaube mir die provokante Frage: Muss das sein? JS: Also ich will es so, weil nach meiner Meinung die Möglichkeit des Theaters – gegenüber allen anderen Formen der Kunst – ist die der direkten Begegnung. Es gibt keinen anderen Ort, wo der Mensch dem Menschen gegenübersteht. Und das ist der Hauptpunkt, mit dem ich das rechtfertige. Ich bin dankbar, wenn man mir als Zuschauer die Handlung nachvollziehbar macht, auch emotional. Ich habe es bei keinem anderen Stück so intensiv betrieben, wie bei diesen zwei. Bei den Gerechten saßen alle in einem Kreis Zuschauer, wie Spieler und dann wurde in diesem Kreis gespielt. Wenn das, was ein Schauspieler redet, nicht auf die empfindbare Ebene überspringt, dass man in einer gewissen Weise auch Angst bekommt, kann das alles wahnsinnig dröge bleiben. Für mich ist das Einbeziehen eine Möglichkeit, dem Zuschauer physisch nachvollziehbar zu machen, wovon gesprochen wird. Was ist es für ein Gefühl, in einer Gewaltherrschaft zu sein, zum Beispiel? Ich will das im Theater in gewisser Weise reproduzieren. Deshalb ist es aus meiner Perspektive sozusagen eine Dienstleistung. FRL: Das beantwortet dann ja auch den Leitspruch Camus’ »Ich revoltiere, also sind wir«. JS: Ja, genau. Ich möchte gerne, dass das Publikum eine Aggression gegenüber Caligula empfindet. Sicherlich gibt es auch Leute, die das ätzend finden. Mir ist es jedenfalls wichtig, demgegenüber eine Haltung zu entwickeln. Und wenn es eine aggressive ist, dann ist das doch unterm Strich herrlich. Das Publikum soll
Über das Verhandeln zeitloser Themen
267
aus dem Saal gehen und nicht nur einen schönen Abend verbracht haben, sondern auch eine Haltung entwickelt haben. FRL: Du hast schon zwei Camus Stücke inszeniert, zum Fremden gibt es bereits eine Idee. Planst du oder könntest du dir vorstellen, weitere Werke Albert Camus’ auf die Bühne zu bringen? JS: Ja, ich würde am liebsten alles von Camus machen. Es gibt für mich in der Gegenwart keinen, der in einer solchen Akribie die ganz großen Fragen behandelt. Und das ist ja auch das, was ihn theaterfähig macht. Es sind zeitlose Fragen, die wir uns wohl nie beantworten werden.
Camus auf deutschen Bühnen (2005 – 2010) Spielzeit 2005 – 2006 Die Gerechten – Schauspiel Frankfurt, Regie: Martin Nimz – Theater Aachen, Regie: Wulf Twiehaus
Spielzeit 2006 – 2007 Keine Inszenierungen
Spielzeit 2007 – 2008 Der Fremde – Oldenburgisches Staatstheater, Regie: Albrecht Hirche
Spielzeit 2008 – 2009 Caligula – Deutsches Theater Berlin, Regie: Jette Steckel – Theaterakademie Hamburg, Regie: Alexander Riemenschneider
268
Frank Reza Links (Bonn)
Der Fremde – Haus des Schauspiels Frankfurt / Maxim-Gorki-Theater Berlin, Regie: Sebastian Baumgarten Das Missverständnis – Kammerspiele Deutsches Theater Berlin, Regie: Gil Mehmert Terror, Revolte, Glück – Theater Aachen, Regie: Ludger Engels
Spielzeit 2009 – 2010 Belagerungszustand – Münchner Kammerspiele, Regie: Christoph Frick Der Fremde – Maxim-Gorki-Theater Berlin, Regie: Sebastian Baumgarten – Euro Theater Central Theater Bonn, Regie: Jan Steinbach Die Gerechten – Hessisches Landestheater Marburg, Regie: Ekkehard Dannewitz Das Missverständnis – Theater Konstanz, Regie: Wolfram Mehring Die Pest – Schauspiel Frankfurt, Regie: Martin Kloepfer
Auswahlbibliographie Bazinger, Irene: »Ist denn niemand hier? Der Autor für die frische Regisseursgeneration: Zweimal Camus in Berliner Theatern« in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. 09. 2008, S. 35. JNM: »Theaterlandschaft von morgen. Jette Steckels Caligula gewinnt Publikumspreis bei Radikal Jung« in http://www.nachtkritik.de/index.php?view=article& catid= 126& id=2722 %3Ajette-steckels-caligula-gewinnt-publikumspreis-bei-radikaljung& tmpl=component& print=1& layout=default& page=& option=com_content& Itemid=100057, 23. 04. 2009, o.S. [31. 08. 2010]. Schülke, Claudia: »Smarte Terroristen: Martin Nimz inszeniert Albert Camus’ Stück über ›Die Gerechten‹« in http://www.faz.net/-00mosi, 25. 09. 2005, o.S. [31. 08. 2010].
Über das Verhandeln zeitloser Themen
269
Wahl, Christine: »Trost der Tragödie« in http://www.tagesspiegel.de/kultur/trost-dertragoedie/1331198.html, 23. 09. 2008, o.S. [31. 08. 2010]. Waniek, Ellen: Gerettet? Spiegelungen des prekären Sinn-Subjekts im jungen deutschen Regietheater, Marburg: Tectum, 2008 (Kleine Mainzer Schriften zur Theaterwissenschaft, 15). Wittstock, Uwe: »Wer tötet, muß getötet werden. Das Schauspiel Frankfurt läßt Sartre und Camus von den alten Zeiten des Terrors reden« in http://www.welt.de/print-welt/article167460/Wer_toetet_muss_getoetet_werden.html, 28. 09. 2005, o.S. [31. 08. 2010].
Helmut Meter (Klagenfurt)
L’Exil et le Royaume ou Camus moraliste moderne
Consid¦rer Camus comme un moraliste du fait de certains aspects de son œuvre litt¦raire est monnaie courante. Nul doute que ses textes ne relÀvent plusieurs ¦gards d’une philosophia moralis ou des effets d’une science morale d’empreinte traditionnelle pour ce qui est de leur orientation anthropologique de base1. Chez Camus, tout comme dans la pens¦e des auteurs de la lign¦e moraliste, l’observation du comportement humain se montre une pr¦occupation continue. Si, dans son cas, cela ne se reflÀte pas dans l’option pour les genres textuels affins provenant de la tradition, ses ¦crits sont toutefois parsem¦s d’une rh¦torique de l’humain qui vise des attitudes possibles face un monde aux facettes multiples et ne se prÞtant point un accÀs normatif. On peut voir l le cút¦ descriptif du m¦tier de moraliste, le parti pris plutút neutre d’un observateur qui se consacre circonscrire la ph¦nom¦nalit¦ de ce qui parat perceptible dans le champ de l’action humaine. Or, la diff¦rence des moralistes traditionnels2, Camus observateur ne semble pas avoir comme objet d’¦tudes un univers d¦j bel et bien constitu¦ comme la soci¦t¦ courtoise de La Rochefoucauld ou la cour et la ville chez Montesquieu. C’est un premier attribut moderne de son moralisme que de cr¦er une fiction litt¦raire valeur autonome pour l’assujettir ensuite ou, en mÞme temps, une interrogation de type anthropologique. Cependant, plusieurs textes de notre auteur se caract¦risent qui plus est par une observation partiale, voire par des paradigmes humains non orthodoxes par rapport une norme plus g¦n¦rale. Ainsi L’Êtranger et Le Mythe de Sisyphe proposent des cat¦gories humaines 1 Cf., par exemple, les ouvrages suivants: Lev Braun, Witness of Decline. Albert Camus, moralist of the Absurd, Rutherford (N.J.), Fairleigh Dickinson University Press, 1974; Bernard East, Albert Camus la recherche d’une morale, Montr¦al-Paris, Bellarmin et Cerf, 1984; Michel Jarrety, La Morale dans l’¦criture: Camus, Char, Cioran, Paris, Êditions Le Manuscrit, 2006 (Coll. »L’Esprit des lettres«). 2 Sur le compte des moralistes, voir, entre autres, Louis van Delft, Le Moraliste classique. Essai de d¦finition et de typologie, GenÀve, Droz, 1982 ; Margot Kruse, Beiträge zur französischen Moralistik, hrsg. von Joachim Küpper, Berlin et al., de Gruyter, 2003.
272
Helmut Meter (Klagenfurt)
in¦dites dans la mesure o¾ l’anthropologie conventionnelle se trouve visiblement alt¦r¦e. C’est l’avÀnement d’un moralisme neuf qui se dessine et qui, de plus, prend le contrepied des certitudes jusqu’alors acquises. Ces ph¦nomÀnes nouveaux se pr¦sentent alors autant comme les s¦quelles d’une anthropologie historique au niveau de mutations in¦vitables dans le secteur humain que comme les suggestions originales d’un auteur aux prises avec les al¦as d’un monde de plus en plus ¦nigmatique. Mais le nouveau ne se fraye pas son chemin tout simplement comme tel. On aperÅoit derriÀre lui une conscience critique qui l’appuie et qui le justifie l’occasion, manquant ainsi au pari traditionnel de l’enregistrement objectif de l’existant d’o¾ r¦sultent les conclusions axiologiques respectives. Pourtant, Camus fait ¦galement preuve de cette mÞme attitude dans un contexte plutút conventionnel comme celui du roman de La Peste. Dans la construction du texte, une mentalit¦ favorable l’¦gard de la r¦volte contre le mal all¦goris¦ se fait clairement jour. DÀs lors, il est ¦vident que Camus moraliste prend position et ne se cantonne pas dans le secteur d’une perception distanci¦e. Les lectures du recueil de nouvelles L’Exil et le Royaume semblent pr¦supposer le mÞme profil d’un Camus moraliste l’intention moralisante. Pour cette raison, les six textes r¦unis en volume ont presque toujours ¦t¦ interpr¦t¦s au gr¦ de l’opposition ¦l¦mentaire propos¦e par les termes antinomiques du titre du recueil3. Ainsi Camus favoriserait-il ¦videmment une ¦volution de ses personnages dans la direction du »royaume«, m¦taphore de bonheur et libert¦, au d¦triment de l’ »exil«, image d’une existence n¦gative par excellence. Par cons¦quent, les nouvelles auraient comme but soit de montrer une voie vers la pl¦nitude de l’Þtre, soit de tracer l’itin¦raire ¦viter en direction de l’¦chec existentiel. Si c’est le sch¦ma d’analyse mis en œuvre par la plupart des contributions critiques4, il en r¦sulte l’image d’un auteur aux contours bien d¦limit¦s par une pens¦e univoque, voire un message inconditionnel. C’est sans aucun doute un mode de compr¦-
3 C’est, par exemple, le cas dans le remarquable essai de Noyer-Weidner qui a pr¦sent¦ une des premiÀres vues d’ensemble du recueil camusien en se consacrant sa technique narrative. Dans un processus d¦termin¦ par une technique du chiffrage – la solution des nouvelles serait inscrite in nuce dans la premiÀre apparition des personnages – s’exprimerait bien la polarit¦ entre l’exil et le royaume. Le d¦nominateur commun des r¦cits serait enfin le problÀme de la solitude, alors que le point de repÀre subjectif pourrait Þtre identifi¦ dans l’humanit¦ personnelle de l’auteur. Cf. Alfred Noyer-Weidner, »Albert Camus im Stadium der Novelle«, in Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur LXX, H. 1/2 u. 3/4 (1960), pp. 1 – 38, ici: pp. 16 – 17 et 31. 4 Pour un choix bibliographique sommaire quant aux ¦tudes critiques sur le recueil de Camus, voir la rubrique sp¦ciale dans le secteur »Bibliographie« de l’¦dition Albert Camus, Œuvres complÀtes, IV. 1957 – 1959. Êd. publi¦e sous la direction de Raymond Gay-Crosier, avec, pour ce volume, la collaboration de Robert Dengler et al., Paris, Gallimard, 2008 (BibliothÀque de la Pl¦iade), p. 1592.
L’Exil et le Royaume ou Camus moraliste moderne
273
hension apte voir ¦voluer Camus vers des convictions de plus en plus claires, fixes et concrÀtes et, le cas ¦ch¦ant, vers un humanisme programmatique. Mais en est-il vraiment ainsi? MÞme si l’on voulait admettre que la r¦daction des nouvelles ne soit qu’une ¦tape provisoire sur le trajet vers des objectifs narratifs plus ambitieux, il serait toutefois trÀs surprenant que la r¦alisation d’un tel projet se base sur une s¦miotique d¦termin¦e par un contraste ¦l¦mentaire et plus conforme un trait¦ moral qu’ un texte de fiction. Tenter de lire les r¦cits suivant des critÀres diff¦rents s’impose donc et cela n’est que cons¦quent dans le cadre d’un renouvellement de la lecture de l’auteur Camus5. La question initiale aborder est celle de la s¦mantique du titre6. »Et« comme agent coordinateur est-il le signe d’une simple juxtaposition de deux concepts incompatibles et ainsi une faÅon d’exprimer leur contraste fondamental? C’est ce qui a d¦termin¦ bien des approches du recueil par le pass¦. Il s’en d¦gage une dichotomie insurmontable, peut-Þtre mÞme une vision du monde manich¦enne. Mais la conjonction du titre pourrait Þtre comprise aussi d’une autre maniÀre, savoir en tant que lien qui unit ¦troitement les deux termes aux connotations variables. En ce cas, l’exil ne serait pas imaginable et plus forte raison vivable sans la pr¦sence concomitante du royaume et vice versa. Autrement dit: l’exil et le royaume formeraient plutút un ensemble inextricable, et l’int¦gration s¦mantique des oppos¦s ferait fonction de cl¦ pour la lecture. Il appartiendrait donc au paradoxe de donner la mesure des nouvelles et d’orienter la pens¦e de Camus. V¦rifions la port¦e de cette hypothÀse. Avec »La Femme adultÀre« (Ex., pp. 3 – 18), Camus propose la lib¦ration, ¦motionnelle et mentale, d’une ¦pouse de son mariage maints ¦gards insatisfaisant. C’est une exp¦rience nocturne bouleversante et exceptionnelle qui semble changer la vie de la protagoniste jamais7. 5 Dans la suite de cet article, nous nous r¦f¦rons l’¦dition suivante: Albert Camus, L’Exil et le Royaume. Texte ¦tabli, pr¦sent¦ et annot¦ par Alain Schaffner, in Id., Œuvres complÀtes, IV, op.cit. [n. 4], pp. 1 – 112. Toutes les citations et les renvois dans notre texte se fondent sur cette ¦dition. On se limitera ult¦rieurement indiquer le sigle Ex. et les seules pages. 6 Rappelons que Camus a chang¦ le titre de Nouvelles de l’exil pr¦vu originairement (cf. les annotations d’Alain Schaffner dans Camus, L’Exil, op.cit. [n. 5], p. 1344). Dans le titre, Cryle voit la mise en valeur de »la seule v¦ritable unit¦ du recueil«. Si l’auteur mettait ainsi en ¦vidence les deux thÀmes fondamentaux de ses textes, selon Cryle il faudrait toutefois se rendre compte du fait que la nature de l’exil »fait de lui un ¦tat ais¦ment reconnaissable«, tandis que le royaume resterait »impr¦visible, inexplicable«. Cf. Peter Cryle, Bilan critique: »L’Exil et le Royaume« d’Albert Camus. Essai d’analyse, Paris, Lettres Modernes / Minard, 1973 (»Situations«, 28), pp. 28 – 29. 7 Est-il permis de voir dans cette exp¦rience des accents lyriques? Chaulet-Achour d¦cerne plusieurs nouvelles du recueil impr¦gn¦es d’un »lyrisme […] contrúl¦«. Cet aspect de l’¦criture camusienne serait l’indice de »certains traits autobiographiques«, dans la mesure o¾ l’on pourrait y lire quelque »transposition de l’exp¦rience personnelle«. Cf. Christiane Chaulet-Achour, »Lyrisme en contrebande: espaces et personnages dans ›L’Exil et le Royaume‹ d’Albert Camus«, in Camus et le lyrisme. Textes r¦unis par Jacqueline L¦vi-Valensi et AgnÀs Spiquel, Paris, SEDES, 1997, pp. 173 – 181, ici: pp. 173 – 174.
274
Helmut Meter (Klagenfurt)
L’adultÀre, c’est l’irruption de la nature nord-africaine dans l’me de Janine, un ¦v¦nement v¦cu l’instar d’une excitation orgastique. D¦j trÀs impressionn¦e par une premiÀre approche de la »terre sÀche« des hauts plateaux d¦sertiques, Janine conÅoit l’id¦e d’un »¦trange royaume«, d’un »royaume« qui, »de tout temps, lui avait ¦t¦ promis« et qui »jamais, pourtant, […] ne serait le sien, plus jamais, sinon ce fugitif instant, peut-Þtre« (Ex., p. 14). C’est d¦j l’indice d’une relativisation de l’acte lib¦rateur qu’il ne faut pas oublier pour comprendre la fin o¾ Janine, rentr¦e l’hútel, se trouve face son mari un peu ¦gar¦ et laisse libre cours ses larmes en lui disant: »Ce n’est rien, mon ch¦ri, […], ce n’est rien.« (Ex., p. 18). Le royaume connu dans peu de moments heureux n’est pas stable; il a mÞme d¦sormais le statut d’un souvenir et se r¦duit dÀs lors l’id¦e d’une vie heureuse mais non r¦alisable volont¦8. Avoir v¦cu le royaume s¦pare Janine de Marcel, mentalement et ¦motionnellement. Mais il y a un lien affectif qui reste. C’est ce qui r¦sulte de l’apostrophe »mon ch¦ri« dans la phrase finale, qui ne saurait Þtre interpr¦t¦e comme une simple formule rh¦torique. Le fait que Camus y recoure pour caract¦riser le comportement de son h¦rone signale une scission dans l’existence de celle-ci. Elle ne pourra vivre cút¦ du mari que dans la conscience d’Þtre exil¦e d’un royaume briÀvement connu mais dor¦navant hors d’atteinte9. Les rares situations de bonheur modeste v¦cues avec Marcel semblent toutefois de nature pouvoir perp¦tuer une vie en commun, mais celle-ci assigne cependant Janine la charge d’un homme qui ne saurait comprendre sa vie cheval sur l’exil et le royaume. Une interf¦rence inextricable de l’exil et du royaume se concr¦tise ¦galement dans le texte »L’Húte« (Ex., pp. 46 – 58). L’instituteur Daru est conscient d’Þtre l’habitant d’un pays »[…] cruel vivre, mÞme sans les hommes, qui, pourtant, n’arrangeaient rien. […] Partout ailleurs, il se sentait exil¦.« (Ex., p. 48). Est-ce que la fin qui le voit menac¦ par les camarades de son húte arabe l’oblige vivre en exil10 ? Le texte se clút sur la phrase: »Dans ce vaste pays qu’il avait tant aim¦, il 8 L’int¦rÞt de cette nouvelle r¦sulterait aussi de l’int¦gration narrative d’une perspective f¦minine et d’une perspective masculine, r¦alis¦e par l’enchevÞtrement du point de vue du narrateur et de celui de Janine. De la sorte, Camus aurait transpos¦ sa propre exp¦rience, ses propres d¦sirs dans un personnage f¦minin qui convainc. Il reste pourtant le problÀme de savoir comment un narrateur peut Þtre qualifi¦ de masculin du moment que l’¦quation: auteur = narrateur est narratologiquement injustifiable. Cf. Brigitte Sändig, »Marie, Martha, la mÀre … Camus’ Frauengestalten«, in »Mein Reich ist nicht von dieser Welt«. Das Menschenbild Albert Camus’, hrsg. von Heinz Robert Schlette und Markwart Herzog, Stuttgart et al., Kohlhammer, 2000 (Irseer Dialoge, 4), pp. 89 – 106, ici: pp. 104 – 105. 9 Reconnatre la briÀvet¦ et la perte irr¦m¦diable de son bonheur ¦quivaudrait pour Janine, selon Kouidis, une prise de conscience ironique (»ironic realization«). Mais il n’explique pas cette ironie. Cf. Apostolos P. Kouidis, »Light as a symbol of self-awareness in ›La Femme adultÀre‹«, in Romance Notes XLII, n. 2 (2002), pp. 323 – 328, ici: p. 327. 10 La menace finale a donn¦ lieu maintes sp¦culations difficilement compatibles avec les donn¦es informatives du texte mÞme. La plus os¦e comprend l’option de l’Arabe de se rendre
L’Exil et le Royaume ou Camus moraliste moderne
275
¦tait seul.« (Ex., p. 58). Si cela nous signale la fin de son amour, ce n’est pas l’¦quivalent de la haine11. Le royaume s’est sensiblement teint¦ d’exil. Mais il n’est pas dit qu’une vie ailleurs offrirait Daru un exil mineur. Et sa solitude n’est que le fruit du seul comportement pour lui possible suivant les donn¦es de sa conscience: mettre l’arabe meurtrier devant sa propre d¦cision de choisir ou la prison ou la libert¦12. Dans ce sens, Þtre »seul« signifie avoir agi selon des critÀres humainement justes, selon des principes dignes d’un royaume. Exil et royaume sont encore ins¦parables13. Les lectures ainsi propos¦es font ressortir les qualit¦s m¦taphoriques changeantes qu’assument les mots-cl¦s du titre g¦n¦ral. Mais cela ressort de toute approche du recueil r¦alis¦e jusqu’ pr¦sent. Camus offre des intrigues caract¦ris¦es par un enchevÞtrement continuel des deux concepts portants de son ¦criture. Ce faisant, il utilise alternativement les registres issus de la d¦notation et ceux relevant de la connotation, mais il recourt ¦galement l’interp¦n¦tration des deux niveaux. C’est bien ce qui r¦sulte du texte »Les muets« (Ex., pp. 34 – 45). Si la base du message est apparente, la fin du r¦cit soulÀve cependant un problÀme. La grÀve des ouvriers de la tonnellerie a ¦chou¦, mais ils refusent de communiquer avec la prison et de renoncer sa libert¦ comme ¦tant motiv¦e par l’intention de cr¦er de s¦rieuses difficult¦s Daru. Mais aucun aspect de la description de l’Arabe ne saurait justifier une telle hypothÀse. Cf. Stephen Eric Bronner, Camus. Portrait of a moralist, MinneapolisLondon, University of Minnesota Press, 1999, pp. 131 – 132. 11 Le plus-que-parfait dans l’¦nonc¦ »avait tant aim¦« marque la fin d’un ¦tat d’me. Mais rien ne permet de le comprendre cat¦goriquement comme la conscience qu’aurait Daru de son futur assassinat in¦vitable par la main des frÀres de son prisonnier arabe. Voir, pour cette interpr¦tation, Laura G. Durand, »Thematic counterpart in ›L’Exil et le Royaume‹«, in The French Review 47, n. 6 (1974), pp. 1110 – 1122, ici: p. 1114 (»Daru […] condemns himself to death at the hands of the Arab’s friends.«). 12 Hirdt propose, en revanche, une lecture bas¦e sur un ¦chec de Daru. Celui-ci ¦chouerait dans la mesure o¾ il d¦chargerait une responsabilit¦ et d¦cision sur un Þtre incapable de les assumer. Il y aurait, entre les destins des deux protagonistes, un parall¦lisme d¦j pr¦sent dans la double signification du titre de la nouvelle. Si cela parat pertinent, le critique tend invalider cependant ses propres arguments au moment o¾ il considÀre l’Arabe comme conscient des problÀmes qu’il aurait au sein de sa propre communaut¦ et face aux normes culturelles et morales de celle-ci. Sous cet angle, l’exil de l’Arabe serait in¦vitable, et la d¦cision qu’il prend se r¦vÀlerait simplement le moindre de deux maux. Or, ce moment l, il n’y aurait plus d’¦chec de Daru. Voir Willi Hirdt, »Camus: ›L’Húte‹«, in Die französische Novelle, hrsg. von Wolfram Krömer, Düsseldorf, Bagel, 1976, pp. 272 – 280, ici: pp. 275 et 277 – 279. 13 Dans l’orniÀre de la s¦miotique du r¦cit d’A. J. Greimas, Elisabeth Korthals Altes (»Normes et valeurs dans le r¦cit«, in Revue des Sciences Humaines LXXII, n. 201 (1986), pp. 35 – 47, ici: pp. 46 – 47) examine »L’Húte« et conclut que le texte d¦montre »l’occultation de l’histoire par Daru au profit d’une vision […] sub specie aeternitatis et l’¦chelle de l’humanit¦ ou de l’individu, tout en montrant l’impossibilit¦ d’¦chapper aux contraintes de l’histoire«, ce qui ferait de Daru une »victime« et non un »responsable«.
276
Helmut Meter (Klagenfurt)
leur patron, pourtant aucunement assimilable au clich¦ de l’exploiteur. Leur mentalit¦ reste entiÀrement d¦termin¦e par le conflit social, mÞme quand la fille du patron tombe gravement malade. Tous continuent maintenir leur mutisme absolu, personne ne r¦ussit aborder le pÀre d’une faÅon spontan¦e, en cherchant le comprendre dans son besoin ¦l¦mentaire de recevoir un peu d’attention comme un Þtre afflig¦14. Yvars, le protagoniste de la nouvelle, ressent ce problÀme, mais il refoule son erreur. Rentr¦ chez lui, il raconte tout Fernande, son ¦pouse, »en lui tenant la main, comme aux premiers temps de leur mariage« (Ex., p. 45). Et le texte se termine ainsi: »›Ah, c’est de sa faute!‹ dit-il. Il aurait voulu Þtre jeune, et que Fernande le ft encore, et ils seraient partis, de l’autre cút¦ de la mer.« (Ex., p. 45). Le royaume d’une autre vie semble loin, l’exil de la vie alg¦rienne par contre in¦vitable. Mais, en v¦rit¦, les deux concepts ne sont pas attribuables des r¦alit¦s g¦ographiques. Le d¦sir d’Yvars semble Þtre une fuite, puisque les conflits de travail et un besoin d’humanit¦ inconditionn¦e se r¦vÀlent des ph¦nomÀnes qui ne sont pas sp¦cifiquement li¦s au monde nord-africain. L’exil et le royaume, travers leur pr¦sence simultan¦e, constituent alors l’existence comme telle. Et c’est un ensemble enchevÞtr¦ qui r¦pugne visiblement se dissoudre au profit de deux entit¦s isol¦es dont la plus d¦sirable pourrait Þtre ais¦ment choisie. L’humaine condition consiste faire les comptes avec cette donn¦e bic¦phale. L’antinomie s¦mantique int¦gr¦e, la concidence des oppos¦s, est particuliÀrement visible dans »Jonas ou l’Artiste au travail« (Ex., pp. 59 – 83). La crise existentielle et artistique du peintre Jonas – qui s’ensuit d’un d¦rÀglement personnel et dans la cr¦ation – aboutit un processus d’isolement intense qui se solde par une prise de conscience concr¦tis¦e en un seul mot sur une »toile, entiÀrement blanche« (Ex., p. 83) o¾ Jonas a ¦crit »en trÀs petits caractÀres, un mot qu’on pouvait d¦chiffrer, mais dont on ne savait s’il fallait y lire solitaire ou solidaire« (Ex., p. 83)15. Le croisement de deux notions contraires reprend, sur un plan hi¦rarchique inf¦rieur et de faÅon plus condens¦e, la caract¦ristique du titre g¦n¦ral. C’est le mÞme principe au niveau phonologique, d¦montrant, en outre, plus imm¦diatement l’indissolubilit¦ de la coexistence des antonymes. DÀs lors, le royaume de Jonas – ou son exil – se situe aussi bien du cút¦ d’une condition de 14 Ici on peut noter, sur les traces de Showalter, qui l’on doit l’¦tude la plus complexe de L’Exil et le Royaume, que le silence peut Þtre consid¦r¦ comme l’une des premiÀres rencontres de l’humanit¦ avec l’absurde. »The universe that we expect will tell us of the glories of God or at least of the wonders of nature is in fact a silent desert.« Cf. English Showalter Jr., Exiles and Strangers. A reading of Camus’s ›Exile and the Kingdom‹, Columbus, Ohio State University Press, 1984, p. 69. 15 Dans son explication du texte qui se r¦fÀre ¦troitement la biographie de Camus, Pierre Louis Rey (Camus. Une morale de la beaut¦, Paris, SEDES, 2000, pp. 34 – 35) voit le message du peintre limit¦ » un mot, c’est--dire […] la n¦gation de la peinture«. Jonas ne serait pas capable de traduire son message »par les moyens de son art«. Il reste pourtant savoir, si c’est un signe que l’artiste »abandonne son m¦tier«.
L’Exil et le Royaume ou Camus moraliste moderne
277
solitaire que de celle de solidaire. On ne saurait opter pour l’une sans accoler l’autre16. Camus ne trace pas de morale univoque. Cette modernit¦, qui met profit le paradoxe pour refuser les convictions fallacieuses, se pr¦sente comme tributaire d’une condition humaine tourment¦e. C’est la volont¦ de l’engagement humain en soi qui importe et non des certitudes fragiles. Savoir ce que signifie l’exil et ce que veut dire le royaume et d¦sirer celuici est une chose. §tre simultan¦ment soumis aux appels des deux instances en est une autre. Et c’est ce que Camus met en œuvre. Or il reste voir, pour v¦rifier la pertinence de notre argumentation, si celle-ci passe l’¦preuve des particularit¦s retrouvables dans les deux nouvelles restantes, qui, depuis toujours, semblent les exemples les plus frappants en vue d’une nette s¦paration des sphÀres d’exil et de royaume. Ainsi »Le Ren¦gat ou Un esprit confus« appartiendrait-il entiÀrement l’exil tandis que »La pierre qui pousse« nous mettrait en pr¦sence de la conquÞte d’un royaume? La premiÀre de ces deux nouvelles (Ex., pp. 19 – 33) est en effet d¦termin¦e par un contenu tout fait n¦gatif. Dans son immense d¦sir de l’ordre (Ex., p. 19), un ex-prÞtre catholique de la France m¦tropolitaine cherche missionner les »sauvages« du d¦sert alg¦rien m¦ridional. Il ¦choue quand, captur¦, il se voit consacr¦ comme esclave au f¦tiche des indigÀnes qui lui infligent des supplices jusqu’au point de lui faire adopter une nouvelle croyance »de la haine« (Ex., p. 27). Dans le f¦tiche et son sorcier, le narrateur la premiÀre personne adore, en effet, »le principe m¦chant du monde« et il se voit »prisonnier de son royaume« (Ex., p. 29). D¦sormais, »installer« le royaume visible du »mal« (Ex., p. 29) se r¦vÀle l’unique objectif du prÞtre apostasi¦. Fort de sa nouvelle »v¦rit¦ implacable« (Ex., p. 29), il s’oppose la morale europ¦enne et, aux confins du d¦sert, il attend l’arriv¦e d’un autre missionnaire annonc¦ pour le tuer en disciple fidÀle de son f¦tiche17. Mais, vers la fin du r¦cit, qui s’articule en un long monologue, il est pris de doute implorant le secours des »hommes autrefois fraternels« (Ex., p. 32) et conjurant en mÞme temps le sorcier, son »matre bien-aim¦« (Ex., pp. 32 – 33), »d’Þtre bon« (58) et d’abandonner la haine pour refaire ensemble »la cit¦ de la mis¦ricorde« (Ex., p. 33). Et le tout finit par l’unique phrase de narration ex16 Dans un sens plus g¦n¦ral, Miller d¦couvre la coh¦rence du recueil de nouvelles »dans cette ¦laboration paradoxale des thÀmes de la solitude et de la solidarit¦«. Chaque nouvelle d¦finirait » sa maniÀre« les deux abstractions du titre. Voir Owen J. Miller, »›L’Exil et le Royaume‹: coh¦rence du recueil«, in Camus nouvelliste. »L’Exil et le Royaume«. Textes r¦unis par Brian T. Fitch, Paris 1973 (La Revue des Lettres Modernes 360 – 365 (1973) ; Albert Camus 6), pp. 21 – 50, ici: p. 28. 17 Showalter y voit une ironie tragique, puisque sa longue exp¦rience comme esclave amÀnerait le ren¦gat har ce qui pourrait Þtre sa d¦livrance – »the symbol of his disgust is also his savior«. Dans de nombreux mythes religieux, comme dans l’histoire du Christ, les gens ne seraient pas en mesure de reconnatre le sauveur, quand il arrive, et le tueraient. Cf. Showalter Jr., Exiles, op.cit. [n. 14], p. 40.
278
Helmut Meter (Klagenfurt)
tradi¦g¦tique: »Une poign¦e de sel emplit la bouche de l’esclave bavard.« (Ex., p. 33). C’est dans cette nouvelle – tout comme dans la derniÀre du recueil – que le terme de royaume est le plus pr¦sent – par quatre fois –, mais o¾, parallÀlement, l’exil semble l’emporter de loin sur lui. Il ne faut pas oublier, cependant, la structure homodi¦g¦tique du r¦cit. »L’esprit confus«, au bout de son changement de front id¦ologique, ne sait plus vraiment o¾ trouver sa propre v¦rit¦18. Du »royaume« initial de l’ordre chr¦tien en passant par le »royaume« du »mal« pour se leurrer la fin de nouveau des bienfaits de son ancienne croyance, le protagoniste se pr¦sente d¦pourvu de critÀres fiables pour discerner les sphÀres d’exil et de royaume. La confusion des deux d¦rive des limites de son caractÀre fix¦es dÀs le titre du texte. Mais quel que soit le statut subjectif du personnage narrateur, il y a un ind¦niable m¦lange des sphÀres en question. Si dans les autres nouvelles, ces sphÀres, bien que reconnaissables, ne sont pas s¦parables, ici elles semblent mÞme interchangeables. Pourtant, cette confusion ult¦rieure d’exil et de royaume annulerait aprÀs tout la conception bipolaire comme telle. C’est pourquoi la phrase de clúture marque l’¦chec du narrateur et sa r¦probation19. õ premiÀre vue, »La Pierre qui pousse« (Ex., pp. 84 – 111) nous mÀne aux antipodes du »Ren¦gat«. Cette fois-ci, la porte d’un royaume semble Þtre largement ouverte en fin de narration. L’ing¦nieur d’Arrast, arriv¦ dans la grande forÞt br¦silienne pour le compte d’une soci¦t¦ franÅaise afin de pourvoir la construction d’une digue prÀs de la ville d’Iguape, fait la connaissance d’un habitant des »bas quartiers« (Ex., p. 92), le »coq«, qui, pour avoir ¦t¦ sauv¦ aprÀs un naufrage, a promis »au bon J¦sus« (Ex., p. 96) de porter sur la tÞte, lors de la procession pour la fÞte de Saint Georges, une lourde pierre. La veille de la procession, dans une fÞte des bas quartiers, d’Arrast est le t¦moin de pratiques occultes de la population noire, qui, au bout d’une longue danse collective, sombre dans une transe g¦n¦rale. D’Arrast, malgr¦ une certaine emprise de l’atmosphÀre sur lui, se sent enfin mal l’aise et ¦prouve de la »naus¦e« (Ex., p. 102) avant d’Þtre envahi par »l’¦cœurement« (Ex., p. 104) aprÀs s’Þtre enfui sur les instances de la communaut¦ en d¦lire qui ne voulait plus de sa pr¦sence. Le lendemain, le coq, affaibli par la nuit orgiaque, ¦choue porter son ¦norme 18 D’un ¦change d’id¦es avec Jean Grenier r¦sulte que, pour Camus, l’»esprit confus« devait Þtre l’origine un symbole pour »les intellectuels de gauche«. Voir Olivier Todd, Albert Camus. Une vie. Êdition revue et corrig¦e, Paris, Gallimard, 1996 (N.R.F. Biographies), p. 655. 19 Patricia J. Johnson (Camus et Robbe-Grillet. Structure et techniques narratives dans »Le Ren¦gat« de Camus et »Le Voyeur« de Robbe-Grillet, Paris, Nizet, 1972) propose de d¦placer l’int¦rÞt critique du secteur de l’analyse th¦matique la question des »exp¦riences stylistiques et structurales qui font l’int¦rÞt v¦ritable du r¦cit« et dans lesquelles elle d¦cÀle bon nombre de techniques similaires celles du roman de Robbe-Grillet (cf. pp. 121 – 122). Il reste cependant savoir sur quoi pourrait d¦boucher une telle affinit¦ sur le plan s¦mantique.
L’Exil et le Royaume ou Camus moraliste moderne
279
fardeau jusqu’ l’¦glise. Spontan¦ment, d’Arrast se charge de la pierre de l’homme ¦puis¦, mais, au lieu de la porter l’¦glise, il la d¦pose dans la pauvre case du coq, se sentant empli »d’un bonheur tumultueux« (Ex., p. 111) et saluant »la vie qui recommenÅait« (Ex., p. 111)20. Silencieusement, la famille du coq – avec son frÀre comme porte-parole – se r¦unit autour de la pierre. Puis, la nouvelle se clút sur la phrase: »Le frÀre s’¦carta un peu du coq et se tournant vers d’Arrast, sans le regarder, lui montra la place vide: ›Assieds-toi avec nous.‹« (Ex., p. 111). La joie de l’ing¦nieur et son accueil explicite dans le petit groupe des pauvres semblent Þtre les ingr¦dients d’un royaume peine trouv¦. D’Arrast, arriv¦ dans la forÞt vierge moins pour le travail que pour »l’occasion d’une surprise, ou d’une rencontre« (Ex., p. 95) ind¦finissable, parat Þtre arriv¦ au seuil d’une f¦licit¦ longuement recherch¦e et donc la fin d’un exil. Mais le repr¦sentant de la famille ne le regarde mÞme pas et prend en outre un peu de distance envers le coq. On le voit, l’accueil comporte une attitude de r¦serve. On se souvient alors de la fÞte des indigÀnes o¾ la pr¦sence de d’Arrast ne fut tol¦r¦e que temporairement. L’appartenance culturelle diff¦rente se montre un obstacle s¦rieux, d’autant plus que la foi catholique de la population se double de la permanence subliminale de vieux mythes. Saint Georges et le »dieu cornu« (Ex., p. 100) voisinent l’un avec l’autre. De plus, d’Arrast, sans foi religieuse, n’a pas r¦ussi ramener le coq temps de la fÞte pour que celui-ci puisse affronter sa tche ext¦nuante frais et dispos. Il a manqu¦ cette promesse. Et il n’est pas du tout sr que son acte fraternel – l’exclusion du cadre religieux – soit entiÀrement le bienvenu21. Vu 20 Dans une analyse textuelle guid¦e par l’aspect de la symbolique de l’eau, Walker cherche montrer que, dans cette nouvelle, la religion chr¦tienne est intimement li¦e une image n¦gative de l’eau, d’une eau qui – vu les tristes conditions du territoire – est responsable de la misÀre et de la souffrance de la population locale. Ainsi le christianisme se r¦vÀlerait comme une force oppressive, et, par son acte solidaire, d’Arrast affirmerait »that he will not accept further oppression of Christianity and the church ›de style colonial‹ with its suggestion of social and political injustice and exploitation«. Si c’¦tait vrai, cela reviendrait pourvoir le subconscient du protagoniste d’une logique inexorable – chose trÀs invraisemblable. Celui-ci agit, en effet, »sans savoir pourquoi« (Ex., p. 110) en se d¦tournant du chemin de l’¦glise, mais, si l’on en croyait Walker, il ferait en mÞme temps preuve d’une vision bien articul¦e de l’histoire. Cf. David Walker, »Camus: ›La Pierre qui pousse‹ (from ›L’Exil et le royaume‹, 1957)«, in Short French Fiction: essays on the short story in France in the twentieth century. Edited by John Ernest Flower, Exeter, University of Exeter Press, 1998, pp. 42 – 59, ici: pp. 48, 50, 58 – 59. 21 Justement, Miller pense qu’au fond d’Arrast manque la promesse du coq qui fut de porter la pierre l’¦glise. En la portant dans la case du p¦nitent – en d¦pit des protestations de celui-ci et de la population pr¦sente – il commet un acte qui »constitue une compromission« et »ne d¦voile qu’une solidarit¦ relative avec le coq«. Puisque d¦poser le fardeau l’¦glise signifierait, pour d’Arrast, l’acceptation du monde superstitieux et primitif du coq, il ¦viterait de commettre »un acte d’infid¦lit¦ lui-mÞme«. Cf. Miller, »›L’Exil et le Royaume‹«, op.cit. [n. 16], pp. 35 – 36.
280
Helmut Meter (Klagenfurt)
l’atmosphÀre silencieuse en famille, la promesse non accomplie du coq pourrait compter plus que l’action solidaire de d’Arrast. Consid¦r¦ par ce biais, le royaume final prend des dimensions modestes, oblig¦ qu’il est de c¦der un important terrain l’exil, un »exil« (Ex., p. 104) ressenti d¦j auparavant par d’Arrast par son envie de »vomir ce pays tout entier« (Ex., p. 104). L’interf¦rence de l’exil et du royaume s’avÀre encore la cl¦ de vote du cosmos des nouvelles de Camus. Que faut-il donc d¦duire de ce r¦sultat significatif ? L’exil et le royaume constituent, dans leur dialectique, sans nul doute un champ de tension. Mais il s’agit l d’une tension particuliÀre dans la mesure o¾ les termes antith¦tiques ne repr¦sentent pas vraiment une alternative22. Au fond, les personnages de Camus sont essentiellement d¦pourvus d’un authentique choix, l’exil pouvant se r¦v¦ler royaume et inversement, au moins au niveau d’une prise de conscience d¦coulant de leurs exp¦riences respectives. Ainsi s’explique une ambigut¦ continue des registres rh¦toriques dont l’indice principal se montre l’accouplement terminologique de valeurs incompatibles sur le plan de l’action concrÀte23. La combinaison de »solitaire« et »solidaire« n’en est qu’un exemple marquant. Autrement dit: du moment que les champs s¦mantiques de l’exil et du royaume ne font qu’interf¦rer, frisant la congruence r¦ciproque, les actants se trouvent dans l’impossibilit¦ d’opter pour l’un des deux secteurs ou se voient plac¦s dans une situation dont ils ne sauraient vraiment qualifier l’appartenance. Si dialectique entre exil et royaume il y a, celle-ci s’avÀre si incessante qu’elle finit par s’articuler comme une structure stable24. La dialectique ne d¦bouchant pas sur une synthÀse 22 Faut-il voir l un effet de »l’absurde« ou serait-ce courir le risque d’activer une cat¦gorie passe-partout l’¦gard de l’œuvre camusienne? Knabe souligne justement que, dans les six nouvelles, les d¦cisions des personnages sont prises »soudainement sans l’intervention directe de la conscience«, que »la vie ne se d¦roule pas selon un processus logique« et qu’ »une tendance l’irrationnel et l’absurde« d¦termine les d¦cisions prises face aux conflits. Or, peut-on se limiter au constat de »r¦sultats […] absurdes« ou ne serait-il pas n¦cessaire de leur attribuer une fonction plus plausible, d’autant plus que la question de l’absurde comme tel ne semble pas Þtre une pr¦occupation de Camus dans la deuxiÀme moiti¦ des ann¦es cinquante? Cf., quant cette probl¦matique, Peter-Eckhard Knabe, »Essai d’interpr¦tation de la ›pol¦mique interne‹ dans ›L’Exil et le Royaume‹ d’Albert Camus«, in Le Discours pol¦mique. Aspects th¦oriques et interpr¦tations, ¦dit¦ par Georg Roellenbleck, Tübingen, Narr / Paris, Place, 1985 (Êtudes litt¦raires franÅaises, 36), pp. 75 – 84, en particulier pp. 78 et 80. 23 Cryle soutient justement que »les nouvelles se terminent presque toutes de faÅon ambiguÚ et que le recueil entier nous enseigne qu’il faut toujours savoir accepter l’ambigut¦«. Voir Cryle, Bilan, op.cit. [n. 6], pp. 28 – 29. 24 Quant l’ensemble du recueil, Cryle parle seulement »d’une unit¦ en train de se faire« et relÀve plutút les divergences entre les textes, vu que les lecteurs ¦taient situ¦s d’embl¦e »dans l’univers d’une conscience individuelle«. S’il est certes vrai que »chaque r¦cit constitue un nouveau d¦part«, on ne saurait pourtant que difficilement mettre profit, pour une compr¦hension succincte, la constatation que l’on se trouve plus prÀs de »l’aphorisme nietzs-
L’Exil et le Royaume ou Camus moraliste moderne
281
au sens d’une troisiÀme dimension disponible – tertium non datur –, les personnages camusiens restent fig¦s dans un temps et dans un espace dont ils ne peuvent franchir les limites25. En d¦finitive, c’est bien un cadre existentiel de principe qui se profile derriÀre les circonstances concrÀtes o¾ ¦voluent les h¦ros des nouvelles. Pour cette raison, ils ne sont pas »en situation« au sens sartrien mais figurent comme les ¦manations d’une pens¦e qui se d¦couvre non historique quant son intention ultime. On aperÅoit ainsi un fond d’humanisme dans le monde de Camus26. Dans ce que ses situations narratives offrent de typologique, voire de symptomatique, se manifeste alors une qualit¦ constante, tendance immuable, sinon de valeurs humaines, au moins de ph¦nom¦nalit¦ humaine. Il ne s’agit l point d’un humanisme autoritaire qui prescrit des rÀgles, mais plutút d’un humanisme de forme, de structures ¦v¦nementielles de base dans l’exp¦rience de »l’homme«, pour reprendre un terme courant propre Camus. Le fait qu’il revient au paradoxe de se r¦v¦ler la caract¦ristique de ce monde typologique lui donne de l’originalit¦, mais restreint en mÞme temps le champ d’action qui lui est propre. En derniÀre analyse, toute d¦cision qui s’offre virtuellement aux personnages en jeu implique en mÞme temps les donn¦es de son contraire. Or, Camus n’en d¦duit ¦videmment pas une attitude d’indiff¦rence ou de paralysie. Encore que les hommes mis en cause soient dans l’impossibilit¦ de faire un vrai choix ou que leurs donn¦es existentielles ne permettent rien de tel, ils sont toutefois contraints de faire les comptes avec leur propre r¦alit¦ sp¦cifique et incontournable. On peut discerner, sans difficult¦s, dans cette obligation prendre une position face au monde, la concr¦tisation fictionnelle qui r¦sulte du »double pari de v¦rit¦ et de libert¦« assign¦ par Camus, dans un de ses Discours de SuÀde, comme »tche immense« pour sa propre g¦n¦ration27. Dans ce sens, l’univers fictionnel du dernier Camus est encore r¦gi par des individus; des individus confront¦s des questions qui les mettent l’¦preuve dans leur stricte individualit¦ sans recours possible d’autres instances. C’est ch¦en que du roman-fleuve«. Cf. Peter Cryle, »Diversit¦ et symbole dans ›L’Exil et le Royaume‹«, in Camus nouvelliste, op.cit. [n. 16], pp. 7 – 19, ici: pp. 9 – 11. 25 Pour Cielens, les six protagonistes ont en commun une r¦ussite importante: ils essaient »d’enrayer« leur divergence int¦rieure »qui les empÞche de rester fidÀles eux-mÞmes et tous y parviennent, plus ou moins complÀtement […]«. Mais, un tel ¦quilibre ne serait-il pas le gage d’un »royaume« fondamental et dÀs lors en d¦saccord net avec la dialectique ¦l¦mentaire pr¦sente dÀs le titre du texte? Cf. Isabelle Cielens, Trois fonctions de l’exil dans les œuvres de fiction d’Albert Camus: initiation, r¦volte, conflit d’identit¦, Uppsala 1985 (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Romanica Upsaliensia, 36), pp. 186 – 187. 26 Pour la question de l’humanisme chez Camus, voir les pertinentes pages introductives de Heinz Robert Schlette, »Einführung«, in »Mein Reich ist nicht von dieser Welt«. Das Menschenbild Albert Camus’, Stuttgart et al., Kohlhammer, 2000 (Irseer Dialoge, 4), pp. 13 – 20. 27 Cf. Albert Camus, Discours de SuÀde, in Id., Œuvres complÀtes, IV, op.cit [n. 4], pp. 235 – 265, ici: p. 242.
282
Helmut Meter (Klagenfurt)
une r¦alit¦ de souffrance et de noblesse humaine la fois, d¦nu¦e d’ancrage m¦taphysique. Ici se d¦cÀle la leÅon de Nietzsche28, cit¦ maintes fois comme exemple pour la rupture avec une soci¦t¦ artificielle au nom de »la responsabilit¦« d’un »art v¦ritable«29. Et se distancier des normes ¦tablies de la soci¦t¦ de son temps, on le sait, est pour Camus la condition pr¦alable pour une cr¦ation artistique non »loin de la soci¦t¦« mais dans le sens d’un rassemblement qui tienne compte d’une »r¦alit¦« effective, non cr¦¦e par l’artiste mÞme et dÀs lors non illusoire30. Le texte de Camus s’inscrit alors dans l’id¦ologie de la modernit¦. Il n’y a pas de v¦ritable crise du sujet, et plus forte raison il ne saurait Þtre question de mort du sujet selon les critÀres du postmodernisme. C’est pourquoi les nouvelles de Camus se refusent aux tentatives de les revendiquer pour l’¦volution litt¦raire vers une conception contemporaine r¦fractaire tout genre d’humanisme. Cela a port¦ un coup sensible la r¦ception de l’auteur dans les derniÀres d¦cades vu que, par-dessus le march¦, il ne se prÞte mÞme pas faire fonction d’annonciateur ou de pr¦curseur d’un type d’¦criture inspir¦e par les th¦orÀmes poststructuralistes. Au contraire, il y a quantit¦ de raisons pour lire Camus suivant les amples registres d’une mim¦sis classique sans pour autant en faire un traditionnaliste en marge de la modernit¦31. C’est que le fond moderne de son œuvre r¦side dans la construction d’une intrigue narrative qui focalise de possibles engagements susceptibles de virer l’aporie, le choix r¦alis¦ n’¦tant jamais sr de ne pas signifier son oppos¦. Mais dans cet univers il n’y a pas moyen de se d¦rober un choix, puisque le but de l’¦mancipation humaine se montre l’objectif principal de toute l’entreprise. On comprend donc que pour les r¦cits de L’Exil et le Royaume Camus ait recours au genre classique de la nouvelle. La nouvelle se voit fonciÀrement d¦termin¦e par un effet ¦v¦nementiel de surprise. Elle accentue une action »inoue«32 dont l’essence concide en g¦n¦ral avec la clúture du r¦cit – tout 28 Pour les lectures de Nietzsche, bas¦es en partie sur des traductions peu fiables, voir notamment Frantz Favre, »Quand Camus lisait Nietzsche«, in »Le Premier homme« en perspective. Textes r¦unis et pr¦sent¦s par Raymond Gay-Crosier, Paris-Caen, Lettres Modernes / Minard, 2004 (La Revue des Lettres Modernes 1722 – 1726 ; Albert Camus 20), pp. 197 – 206. 29 Cf. Camus, Discours de SuÀde, op.cit. [n. 27], pp. 251 et 253. 30 Cf. ibidem, p. 253. 31 C’est bien l’occasion de rappeler l’heureuse formule de »dangereux classique« propos¦e pour un auteur que l’on »enseigne sur tous les continents« et qu’on »lit dans toutes les classes sociales«. Cf. Todd, Albert Camus, op.cit. [n. 18], p. 759. 32 Voir, pour cette d¦finition de Goethe, l’entretien avec Eckermann du 29 janvier 1827. Cf. Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Mit einer Einführung herausgegeben von Ernst Beutler, München, DTV, 1976 [19481], pp. 222 – 227, ici: p. 225. Cet aspect est particuliÀrement important pour l’esth¦tique de la nouvelle, vu qu’il se trouve aussi chez Cervantes. Ainsi, dans le »Coloquio de los perros«, Cipion parle d’un ›cas merveilleux et jamais vu‹, (»caso portentoso y jams visto«). Cf. Miguel de Cervantes Sa-
L’Exil et le Royaume ou Camus moraliste moderne
283
comme dans le recueil camusien. Et ainsi la nouvelle comporte un cút¦ implicitement didactique. Sans pr¦senter de morale directe, par son seul agencement elle propose toutefois une moralit¦. Ceci ne saurait s’effectuer en dehors d’un cadre anthropologique d¦fini, si peu qu’il soit explicit¦. L’¦v¦nement de la nouvelle et ses dimensions actantielles tiennent ainsi lieu de paradigme humain ou d’exemple, ce qui n’est pas sans rappeler qu’aux sources du genre de la nouvelle il y a, du moins en partie, l’exemplum. Ainsi, c’est ¦galement par ce choix g¦n¦rique de la nouvelle que Camus s’avÀre moraliste. õ l’instar des moralistes majeurs, il pr¦sente des observations pertinentes quant aux comportements humains mettant profit les ressorts rh¦toriques de l’antithÀse et du paradoxe33. Mais l’enseignement qu’il transmet n’est pas uniforme. C’est toutefois, malgr¦ les avatars impond¦rables des situations, un appel l’engagement humain sous le signe de la libert¦ et de la dignit¦ individuelles. Si la r¦ussite d’une telle attitude n’est jamais assur¦e, celle-ci se base pourtant sur la conviction d’un quand mÞme. Ce qui int¦resse en vue d’une action n’est pas de l’ordre d’une logique du possible. L’intention vise plutút une ¦thique constitutive, imp¦rieuse et interindividuelle. Il ne s’agit pas d’un code moral circonstanci¦ mais de l’aptitude cong¦nitale un comportement naturel d’humanit¦. Il s’ensuit que la conduite des personnages de Camus face une d¦cision importante l’¦gard d’un autre ne se caract¦rise pas par un ¦tat de r¦flexion ou de d¦lib¦ration mais plutút par une sensibilit¦ imm¦diate34. Le dernier Camus, sous le profil de moraliste, on le voit encore, est visiblement empreint de la question de solidarit¦, bien que tout comportement solidaire d’un chacun puisse se solder la fin par sa condition de solitaire35. Moralement avedra, Novelas ejemplares, in Id., Obras Completas. Recopilaciûn, estudio preliminar, prûlogos y notas por Ýngel Valbuena Prat, Madrid, Aguilar, 196715, pp. 769 – 1026, ici: p. 1019. 33 õ la fin de son ¦tude des symboles dans l’œuvre de Camus, Gassin conclut que »la symbolique camusienne semble […] d¦fier le sens commun«. Ce »paradoxe« serait, en effet, »l’une des preuves plus sres de l’authenticit¦ de la pens¦e symbolisante de Camus«. Cf. Jean Gassin, L’Univers symbolique d’Albert Camus. Essai d’interpr¦tation psychanalytique, Paris, Minard, 1981 (»la th¦sothÀque« – r¦flexion et recherche universitaire – no 6), pp. 260 – 261. 34 C’est poser la question d’individualit¦ sp¦cifique ou de propri¦t¦ individuelle ind¦pendamment des cat¦gories d’exp¦rience, de r¦flexion et de conscience de soi-mÞme. Les tentatives d’expliquer le concept d’individualit¦ chez Camus par le recours des d¦lib¦rations plutút philosophiques sont nombreuses. Mais on connat aussi les doutes soulev¦s par un tel ancrage – voulu ou non – de l’auteur dans les systÀmes de pens¦e. Voir, comme un exemple r¦cent pourvu d’autocritique, Robert C. Solomon, Dark feelings, grim thoughts. Experience and Reflection in Camus and Sartre, Oxford et al., Oxford University Press, pp. 213 – 214. 35 Rappelons que Sändig, la biographe allemande la plus fiable de Camus, souligne que le recueil de nouvelles a d’abord ¦t¦ reÅu avec r¦serve, ce qu’elle explique par le fait que les lecteurs n’y auraient pas trouv¦ le Camus qu’ils cherchaient, savoir le guide clair et pr¦cis en
284
Helmut Meter (Klagenfurt)
parlant, la solidarit¦ semblerait Þtre l’ouverture non seulement sur une contextualisation historique et sociale pr¦cise des r¦cits, mais aussi sur une prise de position politique. õ cet ¦gard cependant, Camus montre une h¦sitation remarquable. L’aspect historique, s’il est pr¦sent, se d¦fait suffisamment de ses d¦terminantes temporelles pour n’assumer qu’une physionomie temporaire et donc cat¦goriellement non-historique mais g¦n¦rale. Aussi la question alg¦rienne, pourtant abord¦e dans quatre nouvelles, ne sert-elle guÀre ouvrir une voie une perspective historique et politique36. C’est l’enjeu humain comme tel qui prend le dessus et fait muer le cadre r¦f¦rentiel nord-africain en un d¦cor accidentellement donn¦ pour mettre en relief une situation intemporelle. Reste relever, par ce biais, que Camus envisage moins une anthropologie historique qu’une anthropologie tout court. Ce sont bien l les dessous substantialistes de sa narration vou¦s priver son univers fictionnel de toute t¦l¦ologie ult¦rieure, les probl¦matiques relev¦es se montrant, en effet, autonomes. Elles ne font nullement entrevoir des solutions susceptibles de mener d’autres niveaux de r¦flexion. Exempt de progressivit¦, c’est un microcosme caractÀre r¦p¦titif, les questions de base que comporte l’existence ne pouvant subir de v¦ritables mutations. Et le facteur du semper idem reprend structurellement – et peut-Þtre quelque peu mentalement – le principe it¦ratif du Mythe de Sisyphe. On d¦bouche donc, quant aux derniers textes narratifs de notre auteur, sur une textualit¦ topique, et maints ¦gards le recueil des nouvelles peut Þtre lu comme le grand topos de l’humanisme ¦l¦mentaire. De cette faÅon, la pratique litt¦raire de Camus dans ses nouvelles, si peu qu’elle soit moralement explicative ou manifestement nourrie de critÀres philosophiques, s’inscrit encore dans ce que l’on est convenu d’appeler les m¦gar¦cits du pass¦. Mais comme il s’agit d’un m¦gar¦cit en abr¦g¦, d¦nu¦ de toute revendication collective et mise en enjeu du futur, Camus ne se range pas parmi les d¦miurges id¦ologiques visant imp¦rativement l’avenir de l’humanit¦. En revanche, il fait cavalier seul. Cela l’¦loigne encore de l’orniÀre d’une litt¦rarit¦ contemporaine transculturelle qui a en vue l’homog¦n¦it¦ des paramÀtres esth¦tiques partir d’un concept d’identit¦ sans frontiÀres. Certes, l’humanisme iconique de ses textes parat d¦signer Camus comme le repr¦sentant d’une morale inconditionn¦e, affranchie de toute particularit¦ culturelle. »L’Húte«, »La questions morales. Voir Brigitte Sändig, Albert Camus. Eine Einführung in Leben und Werk, 3., überarb. Aufl., Leipzig, Reclam, 1992 (Reclam-Bibliothek, 1006), p. 251. 36 Discerner, chez Camus, une »position alg¦rienne« est autre chose. Celle-ci, entendue comme »ligne de partage« entre l’Europe et l’Alg¦rie, comme »position paradoxale d’exil chez soi«, peut Þtre consid¦r¦e, avec de bonnes raisons, comme »la source privil¦gi¦e de sa vision, de sa lucidit¦, de son ¦criture«. Cf. Jean-Jacques Gonzales, »Dissonance de Camus«, in Albert Camus et les ¦critures alg¦riennes. Quelles traces?, Aix-en-Provence, ÊDISUD, 2004, pp. 63 – 80, ici: p. 78.
L’Exil et le Royaume ou Camus moraliste moderne
285
Pierre qui pousse« et encore – bien qu’ex negativo – »Le Ren¦gat« en t¦moignent nettement. Il ne faut pas oublier cependant que les enjeux d’humanit¦ mis en œuvre r¦pondent une tradition europ¦enne et par cons¦quent franÅaise. Qu’il s’agisse de »libert¦« et de »v¦rit¦« – revendiqu¦es maintes reprises comme cat¦gories fondamentales de tout acte existentiel malgr¦ leur profil herm¦neutique variable – ou de facteurs repr¦sentant l’exp¦rience commune des hommes tels »la mer, les pluies, le besoin, le d¦sir, la lutte contre la mort«37, ce sont l toujours des notions et ph¦nomÀnes qui renvoient, sinon visiblement, au moins de faÅon cach¦e, un patrimoine philosophique et spirituel de l’Europe38. Et les actants appel¦s les faire valoir dans les nouvelles sont des FranÅais. Tout rapprochement d’une autre culture dans l’espace narratif du dernier Camus, qu’il r¦ussisse ou non, est d’abord sens unique et fait ainsi preuve d’un d¦calage culturel. Le moraliste enregistre l’¦tat de fait, mais l’action morale envers l’autre, si elle annonce une sup¦riorit¦ au d¦part, ne se limite pas un acte de condescendance. La morale, au point z¦ro de toute r¦flexion, ne permet pas d’agir autrement39. On peut se demander alors si l’attribut franÅais des personnages mis en vedette renvoie un fief culturel sp¦cifique – dans le bien comme dans le mal. Sans doute la question porte mettre nu une forte base occidentale de la pens¦e camusienne. Pour cel¦e qu’elle soit, elle existe pourtant et donne la mesure aux exemples de moralit¦ dans les textes tout comme au regard du moraliste. Et dans les ¦crits th¦oriques qui jalonnent l’¦laboration des nouvelles, Camus ne se cache nullement de son appartenance la culture de l’Occident40. Mais l’arch¦ologie du savoir europ¦en n’est guÀre la mode de notre temps et donc elle n’est pas de mise pour la critique litt¦raire. R¦animer l’int¦rÞt pour Camus reviendrait entre autres d¦gager ses racines occidentales et relever ce qu’elles apportent une mo37 Cf. Camus, Discours de SuÀde, op.cit. [n. 27], p. 254. 38 Gu¦rin note clairement que »les r¦f¦rences culturelles« de Camus »sont, dÀs les ann¦es 1930, europ¦ennes et occidentales« et que – suivant ses essais – il pr¦voyait l’¦chec des »mauvais g¦nies de l’Europe«, r¦sultat n¦cessaire pour se souvenir »qu’il existe une autre tradition« qui est positive. Camus n’¦tait donc pas du tout pessimiste quant l’Europe. Cf. Jeanyves Gu¦rin, »L’Europe dans la pens¦e et l’œuvre de Camus«, in Albert Camus. Textes r¦unis par Paul-F. Smets l’occasion du 25e anniversaire de la mort de l’¦crivain [Colloque International du 19 avril 1985], Bruxelles, Bruylant / Êditions de l’Universit¦ de Bruxelles, 1985, pp. 57 – 70, ici: pp. 59, 63 et 68. 39 S’il faut voir dans le Camus du temps de L’Exil et le Royaume un penseur qui propage comme id¦e »a quasi-biological humanistic essence« – tout en r¦gressant ainsi vers un essentialisme –, reste toutefois peu sr. Qu’il mine enfin, sur cette voie, la »grande r¦volte de l’authenticit¦ contre la notion d’objectivit¦« semble une conclusion assez hasardeuse, vu que »l’authenticit¦«, son tour, ne saurait Þtre imagin¦e sans un fondement humaniste convaincant. Cf. Jacob Golomb, In search of authenticity. From Kierkegaard to Camus, LondonNew York, Routledge, 1995, p. 168. 40 Cf. Camus, Discours de SuÀde, op.cit. [n. 27], pp. 262 – 263.
286
Helmut Meter (Klagenfurt)
dernit¦ d¦concertante mais non d¦pourvue d’espoir ou encore montrer dans quel sens elles contribuent en former la physionomie. Les nouvelles de L’Exil et le Royaume pourraient se r¦v¦ler un ¦l¦ment important pour accomplir cette tche d¦licate et indispensable la fois.
Pierre-Louis Rey (Paris)
Camus fut-il »romancier«?
La premiÀre ¦dition globale des œuvres de Camus, ¦dition de luxe orn¦e de trente-deux aquarelles et publi¦e chez Gallimard en 1958, s’intitulait R¦cits et th¦tre. Quatre ans plus tard, c’est sous le titre Th¦tre, r¦cits, nouvelles que sera r¦unie son œuvre de fiction dans la Pl¦iade (¦dition de Roger Quilliot). Les couvertures de ces deux ¦ditions laissent ignorer au lecteur non pr¦venu que Camus est un romancier, sauf consid¦rer le roman comme une sous-cat¦gorie du r¦cit. Le terme de »r¦cit« a en effet, parmi d’autres, deux sens principaux: il d¦signe tantút une cat¦gorie g¦n¦rale (tout texte, en prose ou en vers, qui raconte une histoire vraie ou imaginaire), tantút un type particulier d’œuvre narrative en prose ( la diff¦rence du roman, qui soumet le lecteur l’illusion d’un monde dans lequel, comme dans la vie, on progresse au hasard, le r¦cit est explicitement subordonn¦ la parole d’une autorit¦, vraie ou imaginaire, qui oriente notre lecture vers un d¦nouement d¦termin¦ d’avance). L’Êtranger et La Chute furent sous-titr¦s, selon les cas, »r¦cits« ou »romans«; La Peste a souvent ¦t¦ consid¦r¦e comme une »chronique«; quant au Premier homme, dont l’identit¦ g¦n¦rique posera aussi problÀme, elle ne figurait ¦videmment pas dans le corpus de la premiÀre Pl¦iade. On peut supposer que les titres des volumes compos¦s en 1958 et en 1962 n’ont pas ¦t¦ choisis au hasard. Aussi vague que soit l’acception du terme »r¦cit«, aucun ¦diteur n’aurait l’id¦e d’y recourir pour pr¦senter les œuvres de Balzac, de Stendhal, de Flaubert, ou, s’en tenir des ¦crivains du XXe siÀcle, de Mauriac ou de Malraux. MÞme les œuvres de fiction de Gide, homme d’un seul roman (Les Faux Monnayeurs), ont ¦t¦ r¦unies dans la Pl¦iade sous le titre Romans et r¦cits. Mon propos est d’examiner la pertinence de ce choix (que la nouvelle Pl¦iade, ob¦issant un classement entiÀrement chronologique sans souci des genres, n’avait pas chance de corriger) au regard des canons traditionnels de la critique, puis des cat¦gories utilis¦es par Camus, chez qui revient souvent le mot »roman«, mais dans des emplois parfois inattendus. Le roman, pour engendrer un monde concurrent du monde r¦el, a besoin de s’inscrire dans une dur¦e. La longueur r¦duite de L’Êtranger et de La Chute (un peu plus de cent-cinquante pages dans les ¦ditions originales ou de poche,
288
Pierre-Louis Rey (Paris)
soixante-dix peine dans la Pl¦iade) a probablement contribu¦ les faire ¦tiqueter comme »r¦cits«. Mais le Dictionnaire des œuvres de Laffont-Bompiani, par exemple, qui qualifie de »r¦cits« les deux ouvrages de Camus, appelle »roman« l’Adolphe de Benjamin Constant, dont la longueur est presque identique. On tiendra un critÀre sans doute plus solide si on considÀre le mode narratif de L’Êtranger et de La Chute. Chacun sait combien est ambiguÚ la perspective de L’Êtranger. Il ne s’agit pas d’un pseudo-journal intime, d’abord parce que l’auteur prÞte Meursault des formulations dont celui-ci serait incapable, ensuite parce que le r¦cit, aprÀs avoir ¦pous¦ le fil des ¦v¦nements, s’en distancie dans la deuxiÀme partie pour devenir r¦capitulatif. Si on appelle »r¦cit« un ouvrage dans lequel la personnalit¦ de celui qui autorise le contenu de l’histoire pr¦vaut sur l’univers qu’il suscite, L’Êtranger ne r¦pond pas davantage cette d¦finition. L’ouvrage de Camus est mÞme moins un r¦cit que celui de Benjamin Constant dans la mesure o¾ son point de d¦part ne se situe pas, comme dans Adolphe, au terme d’une histoire dont seront ensuite retrac¦es les ¦tapes: la dur¦e ouverte de L’Êtranger laisse le lecteur incertain sur la suite de l’intrigue et sur son d¦nouement. Le cas de La Chute est plus compliqu¦. On l’appelle plus souvent que L’Êtranger »r¦cit« parce que la parole de l’unique personnage s’y identifie naturellement celle de l’auteur (quitte consid¦rer que Camus contrefait sa voix), et parce que Clamence semble, aprÀs avoir rúd¦ son num¦ro auprÀs d’autres clients, »r¦citer« une leÅon apprise dont il a fix¦ le moment, le lieu et les modalit¦s du d¦nouement. Si La Chute se r¦duit au r¦cit artificieux de Clamence, distribu¦ en cinq journ¦es dans un d¦cor dont il n’a laiss¦ aucun d¦tail au hasard, il faut admettre que la forme de l’œuvre se rend transparente son sujet, comme si Clamence en ¦tait la fois l’auteur et le metteur en scÀne. Ce parti s’impose si on suppose que l’interlocuteur de Clamence n’est qu’un fantúme issu de son imagination. Aucun accident impr¦vu ne saurait alors troubler la perfection d’un r¦cit que l’unique personnage conduit sa guise. Il en va autrement si on prÞte consistance l’interlocuteur, au point de l’imaginer r¦tif la strat¦gie du jugep¦nitent. Faute de parvenir ses fins en racontant la noyade de la jeune femme, celui-ci rench¦rirait en recourant l’¦pisode encore plus accablant pour sa conscience du camp de prisonniers. Le d¦nouement, r¦v¦lant dans le compagnon de rencontre une figure d’avocat et non de policier, ne sera pas, ce compte, le fruit d’une astucieuse invention de Clamence, mais un coup de th¦tre qui, en le mettant face son miroir, porte au comble son d¦sespoir. On se gardera alors de confondre le sujet et le genre de l’ouvrage: le sc¦nario soigneusement agenc¦ est sorti des rails o¾ Clamence voulait le placer ; le juge-p¦nitent a ¦t¦ livr¦ l’aventure d’une rencontre; son r¦cit n’est que la piÀce principale d’un roman dont le d¦nouement ¦tait impr¦visible. Le risque de confusion entre le sujet et le genre de l’œuvre est plus aigu encore
Camus fut-il »romancier«?
289
propos de La Peste, souvent qualifi¦e de »chronique« sous pr¦texte que l’intrigue y concide presque int¦gralement avec la chronique tenue par le docteur Rieux. L’¦quivoque s’alimente des notes prises par Camus dans ses Carnets en janvierf¦vrier 1942 sur ce qu’il appelle »le style chronique« de Stendhal: »Le Rouge et le Noir a comme sous-titre Chronique de 1830. Les Chroniques italiennes (etc.)«1. Mais c’est pour contraindre son art de romancier que Stendhal adopte le »style chronique«, et Chronique de 1830 (ou Chronique du XIXe siÀcle) n’est que le soustitre d’un ouvrage auquel personne ne songe d¦nier la qualit¦ de »roman«. Au demeurant, le sous-titre ft-il devenu le titre principal, le regard port¦ par le lecteur sur Le Rouge et le Noir n’en aurait pas ¦t¦ chang¦: personne ne met en doute que Chronique du rÀgne de Charles IX soit un roman, M¦rim¦e se servant de ce titre pour accrotre, comme il est naturel chez un romancier, l’illusion de r¦alit¦ et pour minimiser fallacieusement la part qu’il a prise la construction de l’intrigue. Pour user d’une autre comparaison, Le Lys dans la vall¦e est aussi largement occup¦ par la lettre de F¦lix de Vandenesse Natalie de Manerville que La Peste par la chronique du docteur Rieux, sans que jamais personne ait rang¦ le roman de Balzac dans la litt¦rature ¦pistolaire. Ces questions d’¦tiquettes g¦n¦riques, qui ne sauraient laisser les ¦diteurs indiff¦rents, semblent souvent pour Camus un souci secondaire. õ propos de La Chute, il d¦clarera dans sa derniÀre interview (20 d¦cembre 1959): »J’y ai utilis¦ une technique de th¦tre (le monologue dramatique et le dialogue implicite) pour d¦crire un com¦dien tragique. J’ai adapt¦ la forme au sujet, voil tout«2. Quand il mÀne de front, avant la guerre, trois projets qui puisent une mÞme inspiration (»les trois Absurdes«, comme il les d¦signe dans ses Carnets3), la diversit¦ de leurs genres n’est pas un sujet de r¦flexion majeur. On est tout de mÞme troubl¦ de le voir noter la date de »juillet 37«: »Pour le Roman du joueur«, sachant que le manuscrit de Caligula portera en sous-titre »Le Joueur«. A-t-il h¦sit¦ un temps mettre sur scÀne ou en roman le thÀme du jeu? En aot de la mÞme ann¦e, sous le titre »Le Joueur«, il marque: »Pour roman«, et, afin de pr¦ciser l’»Histoire du grand Amour«, il indique entre parenthÀses: »CollÀge Sainte-Chantal«, collÀge de filles de Belcourt qu’on retrouvera d¦guis¦ dans Le Premier Homme sous le nom de Sainte-Odile4. Les Carnets ne sp¦cifient jamais qu’il conÅoit L’Êtranger comme un roman. C’est pourtant ainsi, l’inverse, qu’il d¦signe son projet de La Mort heureuse: »Roman: l’homme qui a compris que, pour vivre, il fallait Þtre riche, qui se donne 1 Albert Camus, Œuvres complÀtes, ¦dition de Jacqueline L¦vi-Valensi, BibliothÀque de la Pl¦iade, Gallimard, t. II, 2006, p. 940 (d¦sormais abr¦g¦ en OC. Les t. I et II, 2006, ont ¦t¦ dirig¦s par J. L¦vi-Valensi; les t. III et IV, 2008, par Raymond Gay-Crosier) 2 OC, t. IV, p. 663. 3 »21 f¦vrier 1941. Termin¦ Sisyphe. Les trois Absurdes sont achev¦s« (OC, t. I, p. 920). 4 OC, t. II, p. 821 et 825.
290
Pierre-Louis Rey (Paris)
tout entier cette conquÞte de l’argent, y r¦ussit, vit et meurt heureux« (aot 1937), »Faire pr¦c¦der roman de fragments de journal« (26 septembre 1937), note-t-il encore, avant de d¦velopper, en d¦cembre 1937, un synopsis de son ouvrage d¦coup¦ en »Roman, Ire P.«, »Roman, IVe P.«, etc.5 Ainsi l’ouvrage rat¦ est-il obstin¦ment qualifi¦ de »roman«, au contraire de l’ouvrage r¦ussi (L’Êtranger), qui ne reÅoit pas d’¦tiquette. Ce paradoxe est confirm¦ dans la suite des Carnets. Entre 1942 et 1944, Camus d¦signe par son titre, Les S¦par¦s ou La Peste, l’ouvrage qui a d¦j pris consistance, mais il s’ouvre dans le mÞme temps une foule d’autres pistes sous l’indication: »Roman«. õ titre d’exemples, en 1943: »Roman du suicid¦ terme. Fix¦ un an – sa formidable sup¦riorit¦ du fait que la mort lui est indiff¦rente. / Le lier roman sur amour?« (c’est deux romans, distincts de La Peste, qu’il semble ici songer). »Roman. Qu’est-ce que l’amour pour elle: ce vide, ce petit creux en elle depuis qu’ils se sont reconnus, cet appel des amants l’un vers l’autre, criant leurs noms«. »Roman. Celle qui a tout fait manquer par distraction […].« »Dimanche 24 septembre 1944. Lettre.«/ Roman: »Nuit d’aveux, de larmes et de baisers. […]«. »Roman. Un Þtre beau. Et il fait tout pardonner«. Un peu plus loin: »Roman sur la justice«6. Des exemples de la sorte, group¦s ici en quelques pages, on en trouverait prÀs de cinquante dans l’ensemble des Carnets. En 1951, c’est une silhouette f¦minine sur fond de paysage qui lui offre une promesse d’¦criture: »Roman. C. et sa robe fleurs. Les prairies du soir. La lumiÀre oblique«. Un peu plus loin, il esquisse un plan qui ne sera pas suivi d’effet: »Roman. PremiÀre partie: match de football. DeuxiÀme partie: corrida«. Parfois, il indique des personnages, comme on le ferait pour des rúles destin¦s la scÀne: »Roman. Deux personnages: l’ami allemand. – Marcel H.« Il lui arrive au reste, comme peut-Þtre l’¦poque o¾ le »joueur« pouvait Þtre un h¦ros de th¦tre ou de roman, d’h¦siter entre les deux genres: »Roman (ou piÀce) – Personnage: Ellan«7. La plupart du temps, ce sont des fragments intimes qu’il destine un d¦veloppement romanesque qui ne viendra jamais; mais on lit aussi bien, la fin de 1951 ou au d¦but de 1952: »Roman Picaresque. Journaliste – De l’Afrique l’univers entier«8, sujet qui d¦passerait ¦videmment son exp¦rience personnelle. Il est exceptionnel qu’une des notations r¦dig¦es vers cette ¦poque la suite de »Roman« se retrouve dans un texte ult¦rieur ; c’est le cas pour »Roman. Sous l’occupation, s’aperÅoit quel point il est devenu nationaliste son d¦pit de voir un chien errant suivre joyeusement un soldat allemand«9, dont on lira un ¦cho dans La Chute10. Parmi 5 6 7 8 9
Ibid., p. 827, 836, 848. Ibid., p. 1015 1018. OC, t. IV, p. 1111 1122. Ibid., p. 1124. Ibid., p. 1125.
Camus fut-il »romancier«?
291
ces ¦bauches, g¦n¦ralement d’une ou deux lignes, s’aperÅoit la vocation du roman d’exprimer la fois le particulier et le g¦n¦ral: »Roman universel. Le tank qui se retourne et se d¦fait comme un mille-pattes«, ¦crit Camus fin 1944 ou d¦but 194511, scÀne tragico-comique, moment ponctuel de la guerre, qui donne une image de l’universalit¦ de la condition humaine. Dans cette acception, le »roman« diffÀre peu du »mythe« auquel, dans la lign¦e du Moby Dick de Melville, s’apparentera La Peste. En 1950, auteur de L’Êtranger et de La Peste, Camus ne se considÀre pas comme un vrai romancier. »Mon œuvre pendant ces deux premiers cycles: des Þtres sans mensonges, donc non r¦els. Ils ne sont pas au monde. C’est pourquoi sans doute et jusqu’ici je ne suis pas un romancier au sens o¾ on l’entend. Mais plutút un artiste qui cr¦e des mythes la mesure de sa passion et de son angoisse. C’est pourquoi aussi les Þtres qui m’ont transport¦ en ce monde sont toujours ceux qui avaient la force et l’exclusivit¦ de ces mythes«, note-t-il cette date dans ses Carnets12. §tre, ou plutút devenir un romancier »au sens o¾ on l’entend«, alors qu’il joue si souvent de maniÀre indiff¦rente, dirait-on, avec les ¦tiquettes g¦n¦riques, on peut l’expliquer au regard de l’importance accord¦e au roman dans ses deux essais philosophiques. Le roman est mis en gloire dans Le Mythe de Sisyphe, o¾ le sous-chapitre »Philosophie et roman« le privil¦gie (de pr¦f¦rence au th¦tre ou la po¦sie) en tant que »Cr¦ation absurde«, et, au chapitre »R¦volte et art« de L’Homme r¦volt¦, le genre est encore investi, sous la rubrique »Roman et r¦volte«, d’une mission ¦minente. Camus justifie ainsi la repr¦sentativit¦ exorbitante qu’il accorde au genre romanesque: celui-ci »n’a pas cess¦ de s’enrichir et de s’¦tendre jusqu’ nos jours, en mÞme temps que le mouvement critique et r¦volutionnaire. Le roman nat en mÞme temps que l’esprit de r¦volte et il traduit, sur le plan esth¦tique, la mÞme ambition«13. La contradiction entre la valorisation du roman dans les ¦crits th¦oriques et sa r¦duction des miettes dans les Carnets n’est qu’apparente. Si le geste d’¦crire un roman est, au plan artistique, le plus haut t¦moignage de la r¦volte, on s’explique que l’¦crivain se d¦signe lui-mÞme le sommet de la montagne chaque fois qu’il entrevoit une possibilit¦ de cr¦ation. Des tentatives sisyph¦ennes de Camus pour aboutir un roman qui, selon l’expression plusieurs fois r¦p¦t¦e des Carnets, »corrigerait« la Cr¦ation, on trouve dans la tentative sans cesse recommenc¦e de Grand, dans La Peste, un reflet d¦risoire et ¦mouvant, mÞme si ce n’est pas un »roman« que celui-ci s’est explicitement attel¦ (il parle de son »travail«, de son »manuscrit«, et, comme pour respecter sa 10 Voir OC, t. III, p. 753. 11 OC, t. II, p. 1021. 12 OC, t. IV, p. 1090 – 1091. Les »deux premiers cycles« sont ceux de l’absurde et de la r¦volte. Leur succ¦dera le cycle, trop tút interrompu, de l’amour. 13 L’Homme r¦volt¦, dans OC, t. III, p. 283.
292
Pierre-Louis Rey (Paris)
discr¦tion, Tarrou lui en demande des nouvelles sous la forme: »Comment va l’amazone?«14). Le caractÀre fragmentaire ou provisoire des r¦ussites du romancier s’¦claire grce deux emplois ¦tranges que fait ailleurs Camus du mot »roman«. Dans Noces (»Le d¦sert«), il explique que les peintres primitifs italiens »ont le privilÀge de se faire les romanciers du corps. C’est qu’ils travaillent dans cette matiÀre magnifique et futile qui s’appelle le pr¦sent. Et le pr¦sent se figure toujours dans un geste«. La formule est illustr¦e, dans les lignes suivantes, par le tableau de la Flagellation de Piero della Francesca. õ l’oppos¦ du formalisme, o¾ se r¦fugie trop souvent la peinture du XXe siÀcle, les peintres italiens ont su saisir l’instant dans sa pl¦nitude. »Ce supplice n’a pas de suite«, ¦crit curieusement Camus pour d¦signer la flagellation du Christ, vision profane de la scÀne sacr¦e qui lui confÀre un autre type de grandeur : h¦ros de l’absurde, le Christ martyr se change ici en une figure de l’Antiquit¦ pr¦-chr¦tienne. En saisissant l’instant, le peintre »romancier du corps« donne l’id¦e d’une ¦ternit¦ sans rapport avec celle que les Êvangiles promettent aux chr¦tiens. Un autre artiste m¦rite, chez Camus, la qualification inattendue de »romancier«: il s’agit de Chamfort. »Nos plus grands moralistes ne sont pas des faiseurs de maximes, ce sont des romanciers«, ¦crit Camus dans une Introduction ses Maximes et anecdotes15. Du roman qui se d¦couvre de faÅon fragment¦e au fil des Maximes, le h¦ros est ¦videmment Chamfort lui-mÞme. »C’est le roman du refus, le r¦cit d’une n¦gation de tout qui finit par s’¦tendre la n¦gation de soi, une course vers l’absolu qui s’achÀve dans la rage du n¦ant«. Ce roman, qui s’achÀve »au milieu d’un monde boulevers¦ o¾ chaque jour une dizaine de tÞtes rebondissent au fond d’un panier«, donnerait une id¦e sans doute moins ¦mouvante de la tentative de r¦volte si les fragments qui le composent avaient ¦t¦ enchss¦s dans une intrigue traditionnelle et soumis la rh¦torique du r¦cit. Le Christ face ses bourreaux, Chamfort dans un monde en fusion: les deux h¦ros en butte une ¦poque hostile illustrent ce qui fait l’essence du roman, le conflit de l’individu et de la soci¦t¦. Le g¦nie du peintre italien et de l’auteur des Maximes est d’exprimer par la force de l’instant plutút qu’en s’inscrivant dans une dur¦e un moment tragique (meurtre ou suicide) de la condition humaine. On pourrait croire que Camus s’attache en priorit¦, pour mieux t¦moigner de la lourde tche de Sisyphe et de l’inanit¦ de ses efforts, l’¦bauche du geste de l’artiste, et, parcourir ses Carnets sans connatre son œuvre, on le prendrait pour un maniaque de l’esquisse et de l’inachÀvement. Ce serait oublier qu’il accorde la pr¦f¦rence aux auteurs de trÀs longs romans. Proust, qui ne lui inspire guÀre d’analyses litt¦raires, le fascine surtout parce qu’il a r¦ussi composer un 14 OC, t. II, p. 127. 15 Voir OC, t. I, p. 923 – 933.
Camus fut-il »romancier«?
293
roman de trois mille pages en surmontant (circonstance qui avait lieu de le toucher personnellement) les ¦preuves de la maladie. Melville, Tolsto, Dostoevski figurent ¦galement dans son Panth¦on. Leurs monuments ne sont pas des modÀles de perfection classique, mais La Princesse de ClÀves, mieux taill¦e pour le got franÅais que les romans russes, n’est pas davantage aux yeux de Camus le chef-d’œuvre d’¦quilibre et de composition que c¦lÀbrent les manuels de litt¦rature. Le palmarÀs des admirations de Camus dessine une fresque de g¦ants plutút que les contours d’une th¦orie du roman. Celle-ci est r¦cus¦e dans les Carnets dÀs mars ou avril 1943: »Ce qui attire beaucoup de gens vers le roman, c’est qu’apparemment c’est un genre qui n’a pas de style. En fait il exige le style le plus difficile, celui qui se soumet tout entier l’objet. On peut ainsi imaginer un auteur ¦crivant chacun de ses romans dans un style diff¦rent.«16 On sait que l’œuvre d’art suppose, pour Camus, une tension entre le r¦el et la forme ( c¦der l’un ou l’autre, on sombre dans le r¦alisme ou dans le formalisme). L’ »objet« dont il est ici question ne doit donc pas Þtre identifi¦ au r¦el: s’il ¦tait tout entier soumis au r¦el, le roman serait indigne de son ambition artistique. Au moins est-il tributaire de la r¦alit¦ qui inspire le romancier au moment o¾ celui-ci compose son œuvre. Il n’¦vacue pas la forme (ou le style), mais, plus que dans la po¦sie ou le th¦tre, la tension, inh¦rente l’œuvre d’art, y d¦porte l’artiste hors de lui-mÞme. Cette conception trouve son illustration grce l’œuvre de Camus lui-mÞme: L’Êtranger, La Peste, La Chute ont ¦t¦ ¦crits dans des styles diff¦rents. Elle pose une question pr¦occupante lorsqu’il s’agit d’ouvrages compos¦s sur une trÀs longue p¦riode, parfois au long d’une vie entiÀre. Goethe a fait observer que l’¦crivain qui achÀve une œuvre n’est pas le mÞme homme que celui qui l’a commenc¦, r¦flexion qui s’applique particuliÀrement son Wilhelm Meister et qui met en cause l’unit¦ de style de l’¦crivain, non seulement d’un livre un autre, mais, ce qui est plus pr¦occupant, au sein d’un mÞme ouvrage. La r¦flexion de Goethe nous conduit au Premier Homme, roman commenc¦ en 1953 et toujours en chantier sept ans plus tard. De 1953 date plus exactement le moment o¾ Camus trouve le sujet de son roman (un homme de quarante ans se rend sur la tombe de son pÀre et d¦couvre qu’il ¦tait plus jeune, quand il est mort, que lui-mÞme ne l’est aujourd’hui), mais l’inspiration profonde de l’ouvrage ¦tait pr¦sente jusqu’ un certain point dans L’Envers et l’Endroit (1937) et plus explicitement dans les Carnets r¦dig¦s vers le d¦but de la guerre. Le Premier Homme est en somme le roman inachev¦ de toute une vie, tragiquement interrompue. En avril 1940, Camus ¦voque, la suite de »Roman (2e partie – cons¦quences)«, l’histoire d’un homme qui s’appellerait »J.C.« 17; tout en se gardant de conclure 16 OC, t. II, p. 991. 17 Ibid., p. 913.
294
Pierre-Louis Rey (Paris)
qu’il donne ici naissance au personnage de Jacques Cormery, on constate qu’il songe dÀs cette ¦poque un roman dont le h¦ros serait christique. En 1942 se multiplient dans les Carnets des notations qui se retrouveront dans Le Premier Homme (la sieste, les livres de la bibliothÀque municipale, les jeux de la rue, l’appartement pauvre o¾ les objets n’ont pas de noms…). õ deux reprises, elles sont group¦es sous le titre »Enfance pauvre«. õ partir de l’automne 1946, les ¦l¦ments d’un r¦cit de l’enfance pauvre sont pr¦c¦d¦s de l’indication »roman«; partir de 1953, apparat la mention du titre, »Premier Homme«, parfois assortie de »roman« et souvent suivie d’¦bauches de plans. En 1945, Camus note »Roman d’amour : Jessica«18, sans qu’on sache, comme pour le »J. C.« apparu en 1940, si ce pr¦nom shakespearien qui ¦tait apparu en 1939 dans Noces19 d¦signe d¦sormais l’h¦rone du Premier Homme. Il la d¦signe pour le moins partir de 1954: »Les ¦tapes de Jessica: La petite fille sensuelle […]«20. Mais, d¦tail instructif sur la maniÀre dont se compose un personnage romanesque, Camus prÞtera la figure de Jessica des paroles emprunt¦es Mi, toute jeune femme qu’il n’a pas encore rencontr¦e l’¦poque o¾ son personnage ¦merge des brouillons. La vie rejoint et nourrit la cr¦ation romanesque autant que la cr¦ation romanesque se nourrit de la vie. õ la question de Jean-Claude Brisville: »Quelle est votre m¦thode de travail?«, Camus r¦pond en 1959: »Des notes, des bouts de papier, la rÞverie vague, et tout cela des ann¦es durant. Un jour vient l’id¦e, la conception, qui coagule ces particules ¦parses. Alors commence un long et p¦nible travail de mise en ordre. Et d’autant plus long que mon anarchie profonde est d¦mesur¦e.«21 Toutes les grandes œuvres de Camus ont ¦t¦ le fruit d’une lente gestation. Il a ¦labor¦ au long de quatre ann¦es environ les cent-cinquante pages de L’Êtranger et de La Chute; La Peste l’a occup¦ pendant plus de cinq ans. Le rythme de composition de Camus est, somme toute, comparable celui de Flaubert, ces diff¦rences prÀs qu’il a toujours en train au moins deux ou trois ouvrages la fois, qu’il se laisse plus que l’ermite de Croisset d¦vorer par le monde ext¦rieur (la politique, les femmes, la vie en somme…) et que ses h¦sitations portent moins sur les d¦tails du style et l’harmonie de la phrase que sur la conception g¦n¦rale de l’œuvre. L’¦cart qui s¦pare la publication de chacun de ses r¦cits (ou romans) est suffisamment important pour qu’il ait eu chaque fois le temps de devenir un autre homme, et qu’ chaque phase de sa vie corresponde un »style«: L’Êtranger pr¦sente l’envers tragique du soleil de Noces, La Peste reflÀte l’angoisse de la s¦paration et de la guerre, La Chute porte la marque ironique d’un combat amer 18 19 20 21
Ibid., p. 1043. Voir OC, t. I, p. 130. Voir OC, t. IV, p. 1188. Ibid., p. 612.
Camus fut-il »romancier«?
295
men¦ contre les partisans de la servitude. Pour passer de Madame Bovary Salammbú, d’un extrÞme l’autre dit-on sommairement dans les manuels de litt¦rature, Flaubert change de palette et travaille sur des nuances de composition, de rythme et d’¦criture. Son style pr¦d¦termine l’œuvre. Chez Camus, l’inverse, les circonstances ext¦rieures et la conscience de l’artiste modÀlent le style, qui ¦volue parce que le monde ¦volue. Au mois d’octobre 1953, quand s’impose son esprit le sujet du Premier Homme, Camus d¦cide de se consacrer totalement son art. »Publication d’Actuelles II. L’inventaire est termin¦ – le commentaire et la pol¦mique. D¦sormais, la cr¦ation.«22 Cette r¦solution, que les brlures de l’actualit¦ vont mettre rapidement mal, signifie que son monde int¦rieur (son univers d’artiste) doit prendre le pas sur le monde ext¦rieur. Le 30 du mÞme mois, il ¦crit Ren¦ Char : »Oui, renoncer l’enfance est impossible. Et pourtant, il faut s’en s¦parer, un jour, ext¦rieurement au moins. Mais Þtre un homme, subir d’Þtre un homme et parfois, aussi, subir les hommes, quelle peine ! Concidence: je pensais aussi ces derniers temps Alger et mon enfance. Mais j’ai grandi dans des rues poussi¦reuses, sur des plages sales. Nous nagions, et un peu plus loin c’¦tait la mer pure. La vie ¦tait dure chez moi et j’¦tais prodigieusement heureux, la plupart du temps«23. Composer Le Premier Homme, c’est donc renouer avec ce qu’il ¦tait l’¦poque o¾ il ¦crivait, la premiÀre page de ses Carnets, en 1935: »L’œuvre d’art est un aveu, il me faut t¦moigner«24, o¾ il composait L’Envers et l’Endroit, puis prenait des notes sur ses Carnets en vue d’un hypoth¦tique roman sur »l’enfance pauvre«. Sans doute songe-t-il pr¦cis¦ment son roman quand il ¦crit dans la Pr¦face la r¦¦dition de L’Envers et l’Endroit (1958): »Chaque artiste garde ainsi, au fond de lui, une source unique qui alimente pendant sa vie ce qu’il est et ce qu’il dit«25. S’il est vrai que chacun de ses romans a ¦t¦ jusqu’ pr¦sent ¦crit »dans un style diff¦rent« parce qu’il changeait d’ »objet« par rapport au pr¦c¦dent, la trÀs longue genÀse du Premier Homme ne devrait pas faire obstacle l’unit¦ du style puisque l’ »objet« du livre est cette fois l’¦crivain fidÀle son enfance, sa mÀre qui ne vieillit pas et une Alg¦rie qui, contre l’¦vidence historique, ne change pas non plus, offrant en pleine guerre l’espoir insens¦ d’un nouveau d¦part. La r¦flexion de Goethe n’a pas lieu de s’appliquer au Premier Homme puisque, en composant son roman, Camus redevient ce qu’il fut jadis. Alors que, jusqu’au d¦but des ann¦es 1950, les Carnets fourmillent de d¦parts de romans dont il n’¦crira pas les premiÀres lignes, aprÀs 1953 il note des observations, des souvenirs, des informations appel¦s nourrir le roman qu’il a, cette fois, vraiment 22 23 24 25
Ibid., p. 1179. Albert Camus-Ren¦ Char, Correspondance (1946 – 1959), Gallimard, 2007, p. 114. OC, t. I, p. 795. Ibid., p. 32.
296
Pierre-Louis Rey (Paris)
entrepris, mÞme s’il attendra les s¦jours Lourmarin de 1959 pour lui donner de l’ampleur. On peut supposer qu’il renonce d¦sormais aux »Þtres sans mensonges, donc non r¦els« qui avaient, ses yeux, empli son œuvre romanesque jusque vers 1950 et qui avaient fait de lui un auteur de »mythes«. õ Meursault, consacr¦ comme »le seul christ que nous m¦ritions«26, ou Rieux, que ses vertus imposÀrent comme une forme de saint laque, s’oppose Jacques Cormery, qualifi¦ plusieurs fois de »monstre« dans les notes du Premier Homme. La sinc¦rit¦ ¦tait promise Þtre le ressort principal de l’ouvrage inaugural du »cycle de l’amour«, o¾ La Chute aurait fait l’effet, si Camus l’avait men¦ bien, d’une simple parenthÀse. Quel et ¦t¦ le style de ce roman d’une maturit¦ qui retourne la source? L’inachÀvement du manuscrit commande la prudence. Aurait-il conserv¦ ces phrases lyriques longues de deux pages et plus? Aurait-il int¦gr¦ son ¦criture trÀs classique les ¦chantillons du langage alg¦rois dont la saveur se lit plutút dans des notes ou des appendices? Le narrateur d’õ la recherche du temps perdu s’avance en tremblant, la derniÀre page du Temps retrouv¦, au seuil de l’œuvre immense qui s’offre son inspiration. Quoique la maladie le menace en permanence, Camus n’¦prouve srement pas, l’¦poque o¾ commence ¦clore son roman, une angoisse comparable celle du narrateur de la Recherche et de Proust lui-mÞme. C’est une autre forme du destin qui viendra briser son rÞve. Avec L’Êtranger, La Peste et mÞme avec La Chute, Camus avait, quoiqu’on ait pu dire, fait œuvre de romancier. Mais les ¦loges qu’on lui d¦cernait ¦taient toujours en d¦calage avec ses ambitions. õ propos de L’Êtranger, certains critiques lui parlÀrent de l’influence du roman am¦ricain, alors que, confia-t-il, il aurait donn¦ »cent Hemingway pour un Stendhal ou un Benjamin Constant«27. Le rapprochement propos¦ par d’autres lecteurs entre La Chute et les tentatives du »nouveau roman«28 lui parut juste titre saugrenu. Et les commentaires les plus ¦logieux de La Peste ne firent pas de place son dessein, r¦v¦l¦ dans les Carnets, de s’inscrire dans le sillage du Moby Dick de Melville. Sans doute parce qu’il nous est parvenu tronqu¦, Le Premier Homme a pu Þtre accueilli comme une autobiographie d¦guis¦e, voire comme une autofiction. C’est pourtant, outre le roman d’amour dont Jessica et ¦t¦ l’h¦rone, une fresque de l’histoire coloniale que Camus dessine dans ses brouillons. L’exemple de Guerre et paix est pr¦sent son esprit l’¦poque o¾ il entreprend Le Premier Homme29. Peut-Þtre cette parent¦ lui aurait-elle ¦t¦ reconnue si le temps lui avait ¦t¦ accord¦. 26 27 28 29
Pr¦face l’¦dition am¦ricaine de L’Êtranger, OC, t. I, p. 216. Interview donn¦e aux Nouvelles litt¦raires (15 novembre 1945), OC, t. II, p. 658. Voir la »DerniÀre interview«, dans OC, t. IV, p. 663. Quand il note en 1949 dans ses Carnets au sujet de Tolsto: »Il est n¦ en 1828. Il a ¦crit La Guerre et la Paix entre 1863 et 1869. Entre 35 et 41 ans« (OC, t. IV, p. 1068), Camus, alors g¦ de trente-six ans, semble bien se donner un exemple suivre.
Camus fut-il »romancier«?
297
Nous risquerons l’hypothÀse que Camus, dans ses Carnets, appelle »roman« chaque espoir, mÞme fugace, de s’aventurer dans une grande œuvre. Il h¦site en revanche qualifier de ce nom des r¦ussites qu’il juge probablement modestes au regard de l’ambition d¦mesur¦e qu’il confÀre au genre romanesque dans Le Mythe de Sisyphe et L’Homme r¦volt¦. AprÀs avoir ¦chou¦ dans le dessein, qui lui tenait sans doute le plus cœur, de rivaliser avec Eschyle ou Shakespeare dans la lign¦e des grands auteurs tragiques, il esp¦ra peut-Þtre, grce au Premier Homme, rejoindre la sphÀre des romanciers qu’il plaÅait au sommet.
III. Tradition und Moderne: Rezeption und Intertextualität
Dorothee Gall (Bonn)
Die Chance der Humanität angesichts der Pest: eine komparatistische Studie zu Thukydides, Lukrez und Camus Meinem verehrten Lehrer Clemens Zintzen zum 80. Geburtstag
Auf die Frage, wie sich die Humanität in der Krise bewähre, findet Cicero im vierten Buch seiner Tusculanae disputationes eine Antwort, die sein eigenes humanitas-Ideal mit der stoischen Affektlehre verschmilzt. Es heißt hier : Der Unterschied nämlich zwischen den geistig regen und den stumpfen Menschen liegt darin, dass die intelligenten, wie korinthisches Erz dem Rost, eher langsam der Krankheit anheimfallen und sich ziemlich rasch erholen, die Stumpfen aber nicht. Und der Sinn eines intelligenten Menschen verfällt auch nicht in jede Krankheit oder Verstörung; auf jeden Fall nicht in irgendetwas Verwildertes und Übermäßiges; manches davon hat aber auch zunächst den Anschein der humanitas, wie Mitleid, Kummer, Furcht. (Tusc. 4, 32)1
Zwei Aspekte scheinen mir an diesem Passus besonders bemerkenswert: zum einen die Bewertung der Intelligenz als moralische Kraft, der eine Art Immunisierung gegen den Affekt zugewiesen wird; zweitens die Dichotomie der Affekte – hier die verwilderten und übermäßigen, dort die scheinbar der humanitas selbst adäquaten, wie Mitleid, Kummer und Furcht. Nach der hier von Cicero referierten Affekttheorie ist es eine Frage der geistigen Kultur, inwieweit und welchen Affekten man sich hingibt; und selbst der homo acutus und ingeniosus – vom stoischen Weisen ist hier freilich nicht die Rede – mag den Affekten Mitleid, Kummer und Furcht anheimfallen, die in der humanitas selbst zu wurzeln scheinen. Cicero spricht von Krankheit, morbus, und innerer Verstörung, perturbatio. Um die brutalste Krankheitserfahrung, die eine Gesellschaft treffen und verstören kann, geht es in der vorliegenden Untersuchung; diese Krankheit wird den Namen Pest tragen, auch wenn der lateinische Begriff pestis, ebenso wie der 1 Inter acutos autem et inter hebetes interest, quod ingeniosi, ut aes Corinthium in aeruginem, sic illi in morbum et incidunt tardius et recreantur ocius, hebetes non item. Nec vero in omnem morbum ac perturbationem animus ingeniosi cadit; non enim in ulla ecferata et immania; quaedam autem humanitatis quoque habent primam speciem, ut misericordia aegritudo metus.
302
Dorothee Gall (Bonn)
griechische, loimûs, allgemeiner jede Seuche meint und in antiken und mittelalterlichen Zeugnissen auch Epidemien wie Typhus oder Cholera mit diesem Namen bezeichnet wurden. Im Zentrum meiner Studie stehen drei Pest-Berichte, deren intertextuelle Verwebung in der Forschung längst bekannt ist: Ihre Autoren sind Thukydides, Lukrez und Camus. Meine Untersuchung soll einige bisher unbeachtete Facetten von Camus’ Thukydides-Rezeption aufdecken; die Leitfrage, die ich dabei an die drei Texte richten werde, ist aus dem zitierten Cicero-Text abgeleitet: Welche Chancen messen die drei Autoren der Bewährung in der Krise, dem Widerstand gegen die Pest zu? Camus’ Roman La Peste, erschienen 1947, schildert in der Form einer Chronik eine natürlich fiktive Pest-Epidemie in der algerischen Stadt Oran, dem Geburtsort des Autors. Antagonisten der Seuche sind der Arzt Rieux und sein Kollege Castel; der Journalist Rambert, den die von den Behörden verhängte Quarantäne von der Frau trennt, die er liebt; der junge Revolutionär Tarrou, der zum engagierten Organisator der medizinischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pest wird; ein Priester, PÀre Paneloux, der sich angesichts der Gewalt der Seuche zunächst der Gnade Gottes anvertraut und schließlich an ihr zu verzweifeln droht. Was all diese Gestalten miteinander verbindet, ist ihr Wille, der Katastrophe, die allein von Leid, Schmerz und der mörderischen Macht des Zufalls bestimmt zu sein scheint, das eigene Handeln entgegenzusetzen. Für sein sujet standen Camus zahlreiche literarische Vorbilder zur Verfügung. Eine Seuche gehört zu den Plagen, mit denen Gott Pharao und sein Volk schlägt, bis Moses die Juden fortführen darf (Ex. 9,9).2 Apoll sendet eine Seuche gegen das vor Troia lagernde Heer der Griechen, bis Agamemnon die Tochter des Apollonpriesters Chryses aus seinem Zelt entlässt (Ilias 1); eine Seuche verheert die Stadt Theben, in der Ödipus herrscht, der schuldlos-schuldige Mörder seines Vaters und Gatte seiner Mutter (Sophokles, Oedipus tyrannus, und in expressiver Schilderung Seneca, Oedipus) – und das sind nur einige Beispiele von vielen; insgesamt 31 Pestdarstellungen vom Alten Testament bis Camus analysiert der Leipziger Romanist Jürgen Grimm in seiner Studie »Die literarische Darstellung der Pest in der Antike und in der Romania« von 1965;3 und es gibt weit mehr noch, auf die er nur kurz verweist. In den biblischen Schriften und in den griechischen Mythen ist die Epidemie immer eine Geißel der Götter : Sie zwingt zur Umkehr und stellt damit die zuvor 2 Vgl. auch die Stellensammlung in Carnet II, S. 66: »Bible: Deut¦ronome, XXVIII, 21; XXXII, 24. L¦vitique, XXVI, 25. Amos, IV, 10. Exode, IX, 4 [gemeint ist wohl eher IX, 3]; IX, 15; XII, 29 [Tötung der Erstgeborenen]; J¦r¦mie, XXIV, 10; XIV, 12; VI, 19; XXI, 7 et 9. Ez¦chiel, V, 12; VI, 12; VII, 15.« 3 Grimm, Jürgen: Die literarische Darstellung der Pest in der Antike und in der Romania, München 1965 (Freiburger Schriften zur Romanischen Philologie VI).
Die Chance der Humanität angesichts der Pest
303
gestörte Ordnung wieder her. Auf dieses Erzähl- und Deutungsmodell menschlicher Schuld und göttlicher Strafe greifen später auch christliche Schriftsteller zurück – von dem byzantinischen Historiker Prokop, der die Pest unter Justinian im Konstantinopel der Jahre 541/2 schildert,4 bis hin zu Daniel Defoes Roman Journal of the plague year, dessen Ich-Erzähler die große Pest in London von 1665 als göttliches Gericht deutet: Nor was this by any new medicine found out, or new method of cure discovered, or by any experience in the operation which the physicians or surgeons had attained to; but it was evidently from the secret invisible hand of Him that had at first sent this disease as a judgment upon us; and let the atheistic part of mankind call my saying this what they please, it is no enthusiasm. It was acknowledged at that time by all mankind.5
Die Erfahrung des Schrecklichen ist, wie es scheint, nur im Rückgriff auf die Transzendenz auszuhalten.6 Anders ist das im frühesten historiographischen Pest-Bericht, dem des Thukydides. In seinem Ende des 5. vorchristlichen Jahrhunderts verfassten Geschichtswerk Der peloponnesische Krieg schildert der Historiker das Wüten einer Seuche in Athen in den Jahren 430 – 426; gemeint ist vielleicht Typhus. Der Seuchenschilderung unmittelbar voraus geht die berühmte Rede des athenischen Staatsmannes und Feldherrn Perikles auf die Gefallenen des ersten Kriegsjahres. Perikles starb wenig später an der Krankheit; Thukydides selbst erkrankte an ihr und überlebte. Von den mythischen bzw. fiktionalen Seuchenschilderungen hebt sich die historische durch ihre Rationalität ab. Thukydides hält das Schreckliche aus. Seine Darstellung verzichtet auf jegliche religiöse Begründung; hier dient die Epidemie keiner Sühnung oder Wiederherstellung der Gerechtigkeit, umgekehrt stiftet sie Chaos und vernichtet die bürgerliche Ordnung, deren Schönheit die Rede des Perikles eben noch beschworen hat. 4 Prokop, Bella, S. 222 f.; der Pest-Bericht ist eng an Thukydides angelehnt, deutet aber die Seuche im Unterschied zu dem attischen Historiker, der sie rein rational betrachtet, als göttliche Heimsuchung. In der Berufung auf die Transzendenz, um dem Schrecken Sinn zu verleihen, setzt Mischa Meier den Wendepunkt von klassischer zu mittelalterlicher Geschichtsschreibung an: »Geschichtsschreibung in traditionell-profanhistorischer Manier ist nicht mehr möglich, weil die von ihr zur Verfügung gestellten Deutungsmuster nicht mehr greifen.« (Meier, M.: Von Prokop zu Gregor von Tours, in: Gesundheit – Krankheit. Kulturtransfer medizinischen Wissens von der Spätantike bis in die Frühe Neuzeit, hrsg. v. Florian Steger u. Kay Peter Jankrift, Köln u. a. 2004, S. 19 – 40, hier 28). 5 Journal of the plague year, S. 309. Die erste Ausgabe des Romans, London 1722, trägt den Titel: A Journal of the Plague Year Being Observations or Memorials, Of the most Remarkable Ocurrences, As well Publick as Private, Which happened in London During the last Great Visitation In 1665, Written by a Citizen who continued all the while in London. Ihr folgt die Ausgabe London 1927, nach der zitiert wird. 6 Vgl. Grandolini, Simonetta: Colpa, peste e contestazione politica: dal mito alla storia, in: Giornale Italiano di filologia 2002, 54 (2), S. 177 – 195.
304
Dorothee Gall (Bonn)
Thukydides’ Bericht folgt einem relativ klaren Schema: Er illustriert zunächst die Gewalt der Seuche im Hinweis auf die Hilflosigkeit der Ärzte: Denn auch die Ärzte konnten anfangs, da sie in Unwissenheit [über die Natur der Seuche] behandelten, nicht helfen, vielmehr starben sie selbst am meisten, da sie auch am meisten mit ihr in Berührung kamen; auch wirkte keine andere menschliche Kunst. Und wieviel sie auch in den Tempeln um Hilfe flehten oder sich der Orakelsprüche und ähnlicher Dinge bedienten, es war alles nutzlos; am Ende ließen sie davon ab, von dem Übel besiegt. (2, 47, 4)7
Jegliche Spekulation über Ursprung und Ursache der Seuche wehrt Thukydides unmittelbar ab: Es soll nun jeder über sie sagen, was er für richtig hält, der Arzt und der Laie: Wo sie wahrscheinlich entstanden ist und welche Ursachen der Veränderung er für geeignet hält, die Kraft zu einem so großen Umschwung zu besitzen; ich werde nur darlegen, wie sie verlief, und woran man die Krankheit, wenn sie erneut hereinbrechen sollte, am ehesten erkennen könnte, wenn man schon etwas von ihr weiß, das will ich bekannt machen, der ich selbst erkrankte und selbst andere leiden sah. (2, 48, 3)8
Dezidiert schildert er Verlauf und Symptome der Epidemie (49); selbst die Tiere meiden die Leichen oder gehen an ihnen zugrunde; bald gibt es in der Stadt weder Vögel noch Hunde mehr (50). Die Erkrankten sterben, unabhängig davon, ob sie von ihren Angehörigen und Freunden sorgsam gepflegt oder aus Angst vor Ansteckung vernachlässigt werden (51, 1 – 3). Tatsächlich infizieren sich die meisten der Pflegenden; nur die wenigen Überlebenden erkranken kein zweites Mal (51, 4 – 6).9 Bald ist die auf Grund der Belagerung übervölkerte Stadt in allen Häusern und Straßen angefüllt mit Toten und Sterbenden (52, 1 – 3); selbst die Totenriten können unter diesen Verhältnissen nicht länger gewahrt werden (52, 4); Verzweiflung, Genusssucht und eine allgemeine Verwahrlosung der Sitten ergreifen die Menschen (53). 7 Oute c±q Qatqo· Eqjoum t¹ pq_tom heqape}omter !cmo_ô, !kk’ aqto· l\kista 5hm,sjom fs\ ja· l\kista pqos0sam, oute %kkg !mhqype_a t]wmg oqdel_a· fsa te pq¹r Reqo?r Rj]teusam C lamte_oir ja· to?r toio}toir 1wq^samto, p\mta !myvek/ Gm, tekeut_mt]r te aqt_m !p]stgsam rp¹ toO jajoO mij~lemoi. (Thucydides, ed. O. Luschnat, vol. I, libri I – II, Leipzig 1960). 8 kec]ty l³m owm peq· aqtoO ¢r 6jastor cicm~sjei ja· Qatq¹r ja· Qdi~tgr, !v’ ftou eQj¹r Gm cem]shai aqt|, ja· t±r aQt_ar ûstimar mol_fei tosa}tgr letabok/r Rjam±r eWmai d}malim 1r t¹ letast/sai swe?m· 1c½ d³ oX|m te 1c_cmeto k]ny, ja· !v’ ¨m %m tir sjop_m, eU pote ja· awhir 1pip]soi, l\kist’ #m 5woi ti pqoeid½r lµ !cmoe?m, taOta dgk~sy aqt|r te mos^sar ja· aqt¹r Qd½m %kkour p\swomtar. 9 Hier liegt der erste nachweisbare Hinweis überhaupt auf das Bewusstsein von dem Phänomen der Ansteckung vor; vgl. Hornblower, Simon: A Commentary on Thucydides, Vol. I, Books I – III, ad loc. – Dass allerdings die Angehörigen bereits fürchten konnten, die Erkrankten aufzusuchen, könnte die Vermutung nahelegen, dass dieses Wissen nicht erst in der Athener Epidemie gewonnen wurde; so Solomon, J.: Thucydides and the Recognition of Contagion, in: Maia 37, 1985, S. 121 ff.
Die Chance der Humanität angesichts der Pest
305
Mit deutlich skeptischen Hinweisen auf Orakel, die rückwirkend als Ankündigung der Seuche gedeutet wurden, schließt Thukydides seinen Seuchenbericht ab (54).10 Die thukydideische Schilderung der Athener Epidemie prägt unverkennbar das Ende eines lateinischen Lehrgedichts aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts vor Chr.: Lukrez, De rerum natura.11 Lukrez bekennt sich zur Philosophie Epikurs, die in ihrer Theologie jede Anteilnahme der Götter an den Menschen leugnet und in ihrer Physik alle Phänomene und Prozesse auf stofflich-atomare Grundlagen zurückführt; die materielle Struktur der Seele aber bedingt nach epikureischer Doktrin deren gemeinsames Sterben mit dem Körper, der Tod ist also kein Übel, da weder Körper noch Seele ihn wahrnehmen. Für Lukrez bietet die Epidemie zwei Ansatzpunkte philosophischer Argumentation: Seuchen gehören zu den irdischen Phänomenen, die menschlicher Aberglaube fälschlich dem Wirken der Götter zuschreibt; so gilt es zunächst, ihren innerweltlich-materiellen Ursprung zu erklären. Dann aber zeigen die Reaktionen der Betroffenen auf die Seuche auch, wie schädlich für Glück und Seelenfrieden die Götter- und Todesfurcht sind: Beide müssen also als verfehlte Meinungen bekämpft werden. Ob Lukrez Thukydides gelesen oder ihn nur indirekt, vielleicht vermittelt durch zeitgenössische medizinische Literatur, zur Kenntnis genommen hat, ist in der Forschung umstritten.12 In jedem Fall wird der griechische Text recht genau hinter den lateinischen Hexametern sichtbar. Auch bei Lukrez finden wir Erwägungen zum Ursprungsort der Krankheit (6,1138 – 44); dargestellt werden ihre Symptome (1145 – 69), ihre Auswirkungen auf die Tiere (1215 – 24), die dem Brauch widersprechenden Begräbnisse, die Trostlosigkeit der Infizierten (1230 – 34), das allgemeine Sterben, gleichermaßen bei Pflege oder Vernachlässigung (1235 – 51). Wie Thukydides evoziert auch Lukrez das Bild einer Stadt, die erfüllt ist von Leichen – sogar in ihren Tempeln, denn auch die Götterfurcht liegt danieder (1252 – 77). Mit Thukydides und Lukrez sind die beiden wichtigsten antiken Quellen späterer Pestliteratur benannt; die thukydideische Darstellung hat – selten unmittelbar, meist vermittelt durch Lukrez und spätere Autoren13 (Thukydides 10 Vgl. Demont, Paul: Les oracles delphiques relatifs aux pestilences et Thucydide, in: Kernos 1990 III, S. 147 – 156. 11 Vgl. Stoddard, Kate: Thucydides, Lucretius and the end of the De rerum natura, in: Maia 48, 1996, S. 107 – 128. 12 Vgl. Stückelberger, Alfred: Vestigia Democritea. Die Rezeption der Lehre von den Atomen in der antiken Naturwissenschaft und Medizin, Basel 1984. 13 So führt beispielsweise Giovanni Getto die Verwandtschaft des Pestberichts in Boccaccios Decamerone auf die Historia Langobardorum des Paulus Diaconus zurück (Getto, Giovanni: La peste del »Decameron« e il problema della fonte Lucreziana, in: ders.: Immagini e problemi di letteratura italiana, Mailand 1966, S. 57). Vgl. auch Grimm (Anm. 3), S. 31.
306
Dorothee Gall (Bonn)
konnte im Westen erst ab dem 16. Jh. wieder gelesen werden) – die Motive vorgegeben, die für alle folgenden Pestschilderungen prägend wurden. In diese Traditionslinie ordnet sich auch Camus ein; und er tut dies nicht ohne eine direkte hommage an seine Vorbilder. In der Chronologie des Romans geschieht dies gleich, nachdem die Ärzte Rieux und Castel vorsichtig wagen, der Epidemie den Namen der Pest zu geben.14 Und natürlich ist es der Chronist Rieux, der die Stichworte liefert und damit auf die Prätexte des Autors verweist: Er vergegenwärtigt sich diverse historische Seuchenereignisse, darunter auch »AthÀnes empest¦e et d¦sert¦e par les oiseaux« und »ces bchers dont parle LucrÀce et que les Ath¦niens frapp¦s par la maladie ¦levaient devant la mer«.15 Hier ist allerdings ein kleiner Kommentar einzufügen: Camus hat Thukydides nachweislich studiert.16 Das Motiv der Scheiterhaufen hat, wie noch zu zeigen sein wird, bei Thukydides und Lukrez eine hohe Bedeutung, und Camus’ Verständnis der alten Texte tritt nicht zuletzt darin zutage, dass gerade diese Assoziation sich seiner Romanfigur als erste aufdrängt. Dass diese Scheiterhaufen aber am Meer errichtet wurden, wird bei keinem der beiden antiken Autoren erzählt. Offensichtlich mischt sich eine andere Assoziation in den intertextuellen Verweis hinein, vielleicht eine unmittelbare Erfahrung, vielleicht die Scheiterhaufen der Griechen in Ilias 1 oder der des Patroklos (Ilias 23,125 f.), die unmittelbar an der Küste errichtet wurden. Die kleine Ungenauigkeit, ob absichtlich oder unabsichtlich, demonstriert, dass es Camus natürlich nicht um präzise Quellenarbeit ging. Den Gestus des poeta doctus deuten die Reminiszenzen des Erzählers nur an, ohne ihn realiter zu beanspruchen.17 14 Albert Camus: Œuvres complÀtes, II, 1944 – 1948 (¦d. par J. L¦vi-Valensi, R. Gay-Crosier et al.), 2006, S. 58. Alle Zitate aus La Peste folgen dieser Ausgabe. 15 »[…] la peste. Le mot ne contenait pas seulement ce que la science voulait bien y mettre, mais une longue suite d’images extraordinaires qui ne s’accordaient pas avec cette ville jaune et grise, mod¦r¦ment anim¦e cette heure […] Et une tranquillit¦ si pacifique et si indiff¦rente niait presque sans effort les vieilles images du fl¦au, AthÀnes empest¦e et d¦sert¦e par les oiseaux […] Et le docteur Rieux, qui regardait le golfe, pensait ces bchers dont parle LucrÀce et que les Ath¦niens frapp¦s par la maladie ¦levaient devant la mer. On y portait les morts durant la nuit, mais la place manquait et les vivants se battaient coups de torches pour y placer ceux qui leur avaient ¦t¦ chers, soutenant des luttes sanglantes plutút que d’abandonner leurs cadavres.« (S. 60 f.) 16 Das belegen die Carnets aus der Entstehungszeit des Romans (besonders deutlich I, S. 249: »Thucydide fait dire P¦riclÀs que ce qui est particulier aux Ath¦niens ›c’est d’avoir une extrÞme audace et, cependant, de bien peser leurs entreprises‹. Les triÀres victorieuses Salamine ¦taient conduites par les Ath¦niens les plus mis¦rables.« Vgl. aber auch die vielfachen Verweise auf Thukydides in den Archives de la Peste. I Exhortation aux M¦decins de la Peste, in: Les Cahiers de la Pl¦iade, 1974 (s. u. Anm. 19), und in Stephans Chronik (s. u. mit Anm. 19). 17 Forest kommentiert diesen Textpassus in folgender Weise: »En quelques lignes d¦filent les images horribles n¦es de l’histoire imm¦moriale de la maladie. Tout au long du roman – mais
Die Chance der Humanität angesichts der Pest
307
In dieselbe Richtung – den planvollen Verzicht auf einen übermäßig prononcierten Anschluss an die antiken Vorbilder – weist auch die Streichung der ursprünglich geplanten Gestalt des klassischen Philologen Philippe Stephan.18 In seinen Tagebüchern, den Carnets, skizziert Camus ihn als »professeur de latingrec«19 – der jetzt versteht, dass er bisher weder Thukydides noch Lukrez verstanden hat: »Il comprend qu’il n’avait pas compris jusque-l Thucydide et LucrÀce.«20 Was damit gemeint ist, geht aus Stephans Chronik deutlich hervor:21 Ainsi ces textes qu’on peut lire avec distraction en temps ordinaire montrent leur vrai visage celui qui a d¦j ¦prouv¦ l’exp¦rience dont ils parlent. Ils nous informent en effet d’une religion sans merci et sans prÞtres, aux rites sanglants et aux fÞtes meurtriÀres. Et ils nous apportent en mÞme temps les rÀgles morales de cette nouvelle doctrine.22
Neben diese beiden durch den Erzähler eingebrachten Prätexte treten weitere, auf die der Autor hinweist. Als Motto hat er seinem Werk einen kurzen Text aus Daniel Defoes Robinson Crusoe vorangestellt: Il est aussi raisonnable de repr¦senter une espÀce d’emprisonnement par une autre que de repr¦senter n’importe quelle chose qui existe r¦ellement par quelque chose qui n’existe pas.23
Das Zitat klärt eine der Intentionen von Camus’ Roman: Die Pest im durch die Quarantäne verschlossenen Oran ist (auch) Allegorie für den Faschismus, für die
18
19 20
21 22 23
jamais de maniÀre aussi forte que dans ce passage – elles feront retour et scanderont la progression de l’¦pid¦mie. Camus, cependant, a choisi de n’avoir recours celles-ci que de maniÀre rare et discrÀte.« ( Forest, Philippe: Camus. Êtude de L’Êtranger, La Peste, Les Justes, La Chute. Analyses et commentaires) Alleur 1992, S. 134. Gaillard sieht – zu Unrecht, wie ich meine – in dieser Stelle die einzige echte Thukydides-Reminiszenz, verweist aber auf den identischen Ton bei Thukydides und Camus (Gaillard, Pol: La Peste. Camus. Analyse critique, Paris 1972, S. 44). In den Carnets beschäftigt sich Camus wiederholt mit ihm; seiner Unzufriedenheit mit der Konzeption dieser Romanfigur gibt er in Carnet II, S. 67, unter dem Stichwort »2e version«, Ausdruck: »Peut-Þtre: refaire Stephan entiÀrement en supprimant thÀme de l’amour. Stephan manque de d¦veloppement.« In Carnet II, S. 100 erscheint er als »professeur sentimental«. Carnets I, S. 229: »Ville heureuse. On vit suivant des systÀmes diff¦rents. La peste: r¦duit tous les systÀmes. Mais ils meurent quand mÞme. Deux fois inutile. Un philosophe y ¦crit »une anthologie des actions insignificantes«. Il tiendra, sous cet angle, le journal de la peste. (Un autre journal mais sous l’angle path¦tique. Un professeur de latin-grec. Il comprend qu’il n’avait pas compris jusque-l Thucydide et LucrÀce.« Vgl. auch seine Chronik in: Œuvres complÀtes (s. o. Anm. 14), S. 251 ff., hier 263, und Carnet II, S. 91: »Trois plans dans l’œuvre: Tarrou qui d¦crit par le menu; Stephan qui ¦voque le g¦n¦ral; Rieux qui concilie dans la conversion sup¦rieure du diagnostic relatif.« Œuvres complÀtes (s. o. Anm. 14), S. 251 ff. Œuvres complÀtes (s. o. Anm. 14) S. 260; zu Stephans Chronik vgl. Demont, Paul: La Peste: un in¦dit d’Albert Camus, lecteur de Thucydide, in: Antike und Abendland 1996/42, S. 137 – 154. Vgl. Carnet II, S. 175.
308
Dorothee Gall (Bonn)
Besatzung Frankreichs durch die Deutschen im 2. Weltkrieg; die Maßnahmen gegen die Seuche bedeuten also (auch) die französische R¦sistance.24 Damit stimmt überein, dass der Erzähler Rieux, im Ringen um den richtigen Ausdruck für das Ziel, auf das sich die Sehnsucht der Menschen während der Pest gerichtet hat, neben die Liebe den Frieden stellt.25 Der allegorischen Qualität des Textes leistet ein Aspekt aus Thukydides besonderen Vorschub: Thukydides’ Pestschilderung konzentriert sich auf Athen; damit ist ganz einfach die reale Situation des von den Spartanern belagerten Athen erfasst, das sich hinter seinen langen Mauern verschanzt. Diese historisch bedingte Begrenzung der Seuche auf einen Stadtraum hat sich ganz offensichtlich einigen späteren Pestberichten vermittelt: Bei Prokop ist es das Konstantinopel des 6. Jahrhunderts, bei Ovid in den Metamorphosen Ägina,26 bei Boccaccio Florenz, bei Manzoni Mailand, bei Defoe London.27 Dass eine solche räumliche Konzentration nicht zwingend ist, belegen z. B. die eng an Lukrez angelehnte Tierseuche in Vergils Georgica 3 und der Bericht des Paulus Diaconus in der Historia Langobardum, der eine ganze Landschaft umgreift; und weder Thukydides noch beispielsweise Manzoni oder Defoe beschränken die Pest allein auf den Stadtraum; vielmehr zeichnen beide nach bestem Wissen ihren Weg in die Stadt nach und berücksichtigen auch in einem gewissen Umfang die Ausbreitung der Seuche in der Umgebung.28 Camus macht die Pest allein zu einem Problem Orans. Diese perspektivische Verengung bietet natürlich erzähltechnische Vorteile; v. a. ging es Camus aber doch wohl um die symbolische Repräsentation des belagerten Frankreichs. Auch hier berührt sich Camus nach Meinung neuerer Interpreten aus der Klassischen Philologie mit Thukydides: Dessen Seuchenbericht, integriert in die historia des peloponnesischen Krieges, greife über sein unmittelbares Thema hinaus und symbolisiere den Krieg 24 Eine Lesart, die Camus gegenüber Roland Barthes brieflich verteidigt (Œuvres complÀtes, S. 286: »La Peste, dont j’ai voulu qu’elle se lise sur plusieurs port¦es, a cependant comme contenu ¦vident la lutte de la r¦sistance europ¦enne contre le nazisme«). 25 Zur Sehnsucht der Menschen während der Pest: »D’autres, plus rares, comme Tarrou peutÞtre, avaient d¦sir¦ la r¦union avec quelque chose qu’ils ne pouvaient pas d¦finir, mais qui leur paraissait le seul bien d¦sirable. Et faute d’un autre nom, ils l’appelaient quelquefois la paix.« (S. 241) 26 Ovid, Metamorphosen 7, 517 – 660. 27 Grimm (Anm. 3), S. 42 f., sieht hier nur die Realität der Epidemie, die zur Einschließung der Stadt führe. 28 Defoe erklärt gleich im ersten Abschnitt seines journal, die Pest sei aus Holland nach London gekommen, und nennt auch vermutete Ursprungsorte, von denen sie nach Holland gekommen sei (S. 1). Um einen Eindruck von der Situation außerhalb der Stadt zu vermitteln, führt er drei Männer ein, die aus London fliehen (S. 152 ff.); sie finden in den Dörfern eine hochgradig alarmierte Bevölkerung vor, unter der es zudem bereits Pestfälle gibt. Die Männer meiden den Kontakt (»they ought to be as careful the country did not infect them as that they did not infect the country«, S. 175) und überleben in der Wildnis.
Die Chance der Humanität angesichts der Pest
309
selbst;29 das allgemeine Sterben in Athen nehme die Niederlage der Stadt im Krieg voraus.30 Die allegorische Dimension von Camus’ Pest31 ist damit aber noch nicht ausgelotet: Dass die Seuche mehr darstellt als nur den metaphorischen Ausdruck einer konkreten historischen Bedrohung, dokumentieren seine Tagebücher : Hier betont der Autor die Nähe seines Romans zu Hermann Melvilles Moby Dick;32 wie dort der weiße Wal, so ist, darf man schließen, auch die Pest Symbol des Gegen-Menschlichen, des Leides und Todes überhaupt, und ihr gilt ein ebenso erbitterter Widerstand, wie ihn Kapitän Ahab, bis zum eigenen Untergang, dem weißen Wal widmen wird. Analog kann man auf jeden Fall über Lukrez sagen, dass seine von Thukydides inspirierte Seuchenschilderung sich weit von dem einmaligen historischen Ereignis löst und zur Allegorie der condicio humana überhaupt wird; ebenso ist übrigens auch Prokops Pest in Konstantinopel interpretiert worden, und Manzonis Pest in den ›Promessi Sposi‹ gilt Gervais und anderen als Symbol des Bösen schlechthin.33 Aber kein anderer Autor hat die Pest so deutlich und mehrschichtig zur Allegorie erhoben wie Camus: In ihre Bilder kleidet er seine Erfahrungen der Besatzung Frankreichs im Krieg ebenso wie sein Programm einer existenzialistischen Humanität.34 Angesichts dieser Bedeutungsfülle, fast möchte man sagen: Bedeutungsüberfrachtung, überrascht es, wie eng sich Camus in manchen Details, aber auch in den großen Zügen seiner Erzählung an Thukydides und Lukrez anschließt. 29 Vgl. dazu Patzer, Harald: Das Problem der Geschichtsschreibung des Thukydides und die thukydideische Frage, Neue deutsche Forschungen 6, Berlin 1937. 30 Paul Demont (Anm. 21) weist darauf hin, dass bei Thukydides die Pestschilderung unmittelbar auf die Leichenrede des Perikles folgt – die Schilderung des Untergangs von Recht und Frömmigkeit auf die Beschwörung menschlicher Humanität, die Darstellung des Sterbens in Athen auf die Rühmung Athens als eine durch ihre Autarkie glückliche Stadt (S. 143 f.). 31 Vgl. dazu Carnet II, S. 50: »La Peste a un sens social et un sens m¦taphysique. C’est exactement le mÞme. Cette ambigut¦ est aussi celle de L’Êtranger.« 32 Vgl. Carnet I, S. 250: »Moby Dick et le symbole, […]«. Im weiteren Text notiert Camus Seitenzahlen, vermutlich aus seiner Moby Dick-Ausgabe. 33 Vgl. Gervais, Alice: A propos de la »Peste« d’AthÀnes: Thucydide et la litt¦rature de l’¦pid¦mie, in: Bull. de l’assoc. G. Bud¦, 1972, S. 395 – 429, hier 397: »Enfin, n’oublions pas qu’il y a l une de ces situations exceptionnelles qui jouent un rúle de r¦v¦lateur de la psychologie collective et individuelle tout ensemble.« Meyer kommt in seinem Aufsatz zur »Geschichte der Pest« zu dem Ergebnis: »Die Geschichte der Pest ist die Geschichte einer die Menschheit prägenden, sie durchwaltenden Metapher!« (Meyer, Hans: Geschichte der Pest – Geschichte einer Metapher. Historische Marginalien zu einem zeitgenössischen Thema, in: Anregung 41, 1995, S. 169 – 174, hier 169). 34 Vgl. Carnet II, S. 72 (zur 2. Fassung der Pest): »Je veux exprimer au moyen de la peste l’¦touffement dont nous avons tous souffert et l’atmosphÀre de menace et d’exil dans laquelle nous avons v¦cu. Je veux du mÞme coup ¦tendre cette interpr¦tation la notion d’existence en g¦n¦ral. La peste donnera l’image de ceux qui dans cette guerre ont eu la part de la r¦flexion, du silence – et celle da la souffrance morale.«
310
Dorothee Gall (Bonn)
Hier liegt keineswegs nur ein ganz allgemeiner Einfluss vor im Sinne der Palimpsest-Theorie moderner Literaturwissenschaft. Vielmehr transponiert Camus planmäßig zahlreiche Motive aus Thukydides, ein Verfahren, das freilich erst die genau vergleichende Analyse aufdeckt. Das gilt zunächst für die Fiktion der Historizität: Die Pest in Oran hat nie stattgefunden, Camus gelingt es aber, sie in dieselbe Unmittelbarkeit des historisch Verbürgten zu rücken, wie es Thukydides mit der Athener Epidemie tut. Instrumente dieser Stilisierung sind hier wie dort der Anspruch des objektiven Berichts: die Einteilung der Krankheit in Phasen, die in chronologischer Folge referiert werden; die genaue Angabe von Monaten bzw. Jahreszeiten; der Bericht über alle, d. h. die Gemeinschaft der Bürger. Bei Thukydides beruht die Authentizität des Dargestellten natürlich auf seiner Faktizität; Camus’ Pest ist fiktional; ihre Authentizität gewinnt sie aus ihrer allegorischen Valenz. Deren Spannbreite wird nicht zuletzt durch eine weitere Anspielung auf Thukydides’ Erzählhaltung und -intention erläutert. In seinem vielzitierten Methodenkapitel 1, 22 bestimmt Thukydides das Ziel seines Geschichtswerks, späteren Generationen als unveräußerlicher Besitz zur Verfügung zu stehen: Die aber, die das Gewesene klar erkennen wollen und damit auch das Zukünftige, das, nach der menschlichen Natur,35 wieder einmal gleich oder ähnlich sein wird, werden das als nützlich beurteilen, und das wird mir genügen: Es ist als ein Besitz für immer aufgestellt statt als Prunkrede für einmaliges Hören. (Thuk. 1, 22, 4)36
Und direkt zu Beginn des Passus über die Epidemie erklärt er : […]ich werde nur darlegen, wie sie verlief, und woran man die Krankheit, wenn sie erneut hereinbrechen sollte, am ehesten erkennen könnte, wenn man schon etwas von ihr weiß, das will ich bekannt machen, der ich selbst erkrankte und selbst andere leiden sah. (2, 48, 3)37
35 Zu Thukydides’ Konzept der »menschlichen Natur« (!mhype¸a v¼sir) vgl. Rechenauer, Georg: Thukydides und die hippokratische Medizin. Naturwissenschaftliche Methodik als Modell für Geschichtsdeutung, Hildesheim u. a. 1991 (Spudasmata 47). 36 nsoi d³ bouk^somtai t_m te cemol]mym t¹ sav³r sjope?m ja· t_m lekk|mtym pot³ awhir jat± t¹ !mhq~pimom toio}tym ja· paqapkgs_ym 5seshai, ¡v]kila jq_meim aqt± !qjo}mtyr 6nei. jt/l\ te 1r aQe· l÷kkom C !c~misla 1r t¹ paqawq/la !jo}eim n}cjeitai. Zur Parallelität zwischen dem Schluss des Methodenkapitels und dem Beginn der Pestschilderung vgl. Leven, Karl-Heinz: »Das Einzige von allem, was wirklich jede Erwartung überstieg«: Thukydides, Perikles und die Pest in Athen, in: Axel Karenberg, Christian Leitz (Hrsg.): Heilkunde und Hochkultur I. Geburt, Seuche und Traumdeutung in den antiken Zivilisationen des Mittelmeerraumes (Naturwissenschaft – Philosophie – Geschichte 14), S. 71 – 84, hier 81. S.a. Grimm (Anm. 3), S. 39. 37 9c½ d³ oX|m te 1c_cmeto k]ny, ja· !v’ ¨m %m tir sjop_m, eU pote ja· awhir 1pip]soi, l\kist’ #m 5woi ti pqoeid½r lµ !cmoe?m, taOta dgk~sy aqt|r te mos^sar ja· aqt¹r Qd½m %kkour p\swomtar.
Die Chance der Humanität angesichts der Pest
311
Dass man – um es schlicht auszudrücken – aus der Geschichtsschreibung lernen kann, vertritt auch der Arzt Rieux, auch er unter Rekurs auf die menschliche Natur : Rieux d¦cida alors de r¦diger le r¦cit qui s’achÀve ici, pour ne pas Þtre de ceux qui se taisent, pour t¦moigner en faveur de ces pestif¦r¦s, pour laisser du moins un souvenir de l’injustice et de la violence qui leur avaient ¦t¦ faites, et pour dire simplement ce qu’on apprend au milieu des fl¦aux, qu’il y a dans les hommes plus de choses admirer que de choses m¦priser. (248)38
Gerade in der grundsätzlichen Analogie tritt aber ein bedeutsamer Unterschied hervor: Während Thukydides’ Ziel nur auf Erkenntnis bzw., im zweiten zitierten Text, auf die frühzeitige Diagnose gerichtet ist, vertritt der Arzt Rieux das Recht der Opfer auf memoria; und er verweist auf die Bewährung des Menschen in der Krise; und diese Bewährung hängt nicht vom Ausgang, von Erfolg oder Misserfolg, Leben oder Tod, ab, sondern sie findet ihre Rechtfertigung in sich selbst. Zum Anrecht auf memoria ist übrigens ein kleines Motiv des Roman-Endes bei Camus zu berücksichtigen, der sich wie ein ansatzweise kritischer Kommentar zu Thukydides liest. Rieux unterhält sich mit einem seiner Patienten, dem alten Asthmatiker, wie er immer bezeichnet wird, über das geplante Denkmal für die Toten der Pest, »une stÞle ou une plaque« … »Et il y aura des discours.« (247) In einem Thukydides derart affinen Kontext muss der Passus an die Rede des Perikles über die Gefallenen des ersten Kriegsjahres erinnern, bei Thukydides unmittelbar vor der Pest referiert – zumal wenn man berücksichtigt, dass auch Camus’ Pest im weiteren Sinn für den Krieg steht. Camus rezipiert das Motiv mit sanft verhaltener Ironie, die wohl nicht Thukydides gilt, sondern überhaupt den Ritualen der memoria in Stein und Rhetorik. Solcher Ritualisierung ist unaufdringlich die Moral des Chronisten entgegengestellt, die nicht das Leiden und Sterben an sich heroisiert, sondern die Bewährung – eben, dass es am Menschen mehr zu bewundern als zu verachten gibt. Ein Unterschied scheint darin zu liegen, dass der antike Historiograph nach eigenem Bekunden an der Pest erkrankte und sie überlebte, während Camus’ Chronist Rieux verschont bleibt. Das gilt aber nur auf der Ebene des Literalsinns; in seiner Definition der Pest als einer geistigen Haltung und allgemeinen Bedrohung39 fällt Rieux (wie ja auch Tarrou, der dies explizit äußert) in das Kol38 Vgl. auch Carnet II, S. 181. Wesentlich pessimistischer stellt sich allerdings der frühere, aber schon ausdrücklich auf die 2. Version des Romans bezogene Tagebucheintrag, Carnet II, S. 68, dar : »Moralit¦ de la peste: elle n’a servi rien ni personne. Il n’y a que ceux que la mort a touch¦s en eux ou dans leurs proches qui sont instruits. Mais la v¦rit¦ qu’ils ont ainsi conquise ne concerne qu’eux-mÞmes. Elle est sans avenir.« 39 Vgl. Carnet II, S. 72 (zur 2. Fassung der Pest): »Je veux exprimer au moyen de la peste l’¦touffement dont nous avons tous souffert et l’atmosphÀre de menace et d’exil dans laquelle nous avons v¦cu. Je veux du mÞme coup ¦tendre cette interpr¦tation la notion d’existence
312
Dorothee Gall (Bonn)
lektiv der Verseuchten mit hinein – so dass der Erzähler am Ende seines Berichts sagen kann: C’est ainsi qu’il n’est pas une des angoisses de ses concitoyens qu’il n’ait partag¦e, aucune situation qui n’ait ¦t¦ aussi la sienne. (244)40
Zu den bei Thukydides prominenten Motiven gehört die Ohnmacht der Religion: Gebete und Orakelsprüche versagen (2, 47, 4). Der Historiker grenzt sich hier in eigener Zeugenschaft besonders von den mythischen Pestdarstellungen ab, wo die Krankheit erst durch die Erkenntnis und den Vollzug des göttlichen Willens zum Erliegen kommt. Lukrez greift das Motiv auf und verknüpft es mit einem bei Thukydides an anderer Stelle berichteten Phänomen: Auch in den Tempeln liegen die Toten, Religion und Götter werden nicht mehr beachtet, zu groß ist das Leid. So wird für den Epikureer die Pest zum Paradigma für die Sinnlosigkeit und Schwäche der Religion.41 Das Ringen zwischen Glauben, Agnostizismus und Atheismus ist eines der großen Themen bei Camus, und auch die Hinwendung der Menschen in der Stadt zum Heiligenkult und zu abergläubischen Bräuchen wird im Roman, vor allem in der zweiten Predigt des Priesters Paneloux (187 ff.), beschworen. Der nüchternen Haltung des Thukydides steht Camus aber ebenso fern wie dem epikureischen Glauben an die Gleichgültigkeit des Todes: Er wirft, in den ausführlich protokollierten Gesprächen Rieux’ mit Paneloux und Tarrou, die Frage der Theodizee auf und kontrastiert der in ihrer moralischen Qualität deklassierten Transzendenz die menschlichen Güte. Ich komme zurück auf das Motiv der Bestattungsriten.42 Bei Thukydides sorgen die Angehörigen aus Mangel an Mitteln rasch für eine Verbrennung: Viele wandten sich schamlosen Verfahren [der Beisetzung] zu, aus Mangel am Nötigsten, weil ihnen schon so viele vorher gestorben waren: Denn auf fremde Scheiterhaufen legten sie, denen zuvorkommend, die sie aufgehäuft hatten, ihren Leichnam und zündeten ihn an; andre warfen den, den sie trugen, auf einen, der schon brannte, hinauf und gingen fort. (2, 52, 4)43
40 41
42 43
en g¦n¦ral. La peste donnera l’image de ceux qui dans cette guerre ont eu la part de la r¦flexion, du silence – et celle da la souffrance morale.« Ganz ähnlich auch Defoe – wie schon der ausführliche Titel (s. o. Anm. 5) verdeutlicht. omnia denique sancta deum delubra replerat / corporibus mors exanimis onerataque passim / cuncta cadaveribus caelestum templa manebant, / hospitibus loca quae complerant aedituentes. / nec iam religio divom nec numina magni / pendebantur enim: praesens dolor exsuperabat (6,1272 – 77). – Schließlich hatte der Tod auch die Heiligtümer der Götter angefüllt mit Leichen und alle Tempel der Himmlischen blieben voller Leichen, da die Aufseher der Tempel diese Orte mit Fremden angefüllt hatten. Man achtete den Götterglauben und die göttlichen Wesen nur noch gering: Der gegenwärtige Schmerz triumphierte. Vgl. hierzu: Gilarrondo Miguel, scar : La tradiciûn clsica del tema de la peste: los ritos funerarios, in: Urbs aeterna, S. 481 – 491. Ja· pokko· 1r !maisw}mtour h^jar 1tq\pomto sp\mei t_m 1pitgde_ym di± t¹ suwmo»r Edg
Die Chance der Humanität angesichts der Pest
313
Auch bei Lukrez werden fremde Scheiterhaufen annektiert: Ihre eigenen Verwandten legten sie mit lautem Geschrei auf Holzstöße, die für andre geschichtet waren, und zündeten sie dann mit der Fackel an und stritten sich oft lieber bis aufs Blut, als dass sie die Leichen im Stich ließen. (6, 1283 – 1286)44
Dem römischen Lehrdichter geht es um mehr als nur die Hilflosigkeit der Bürger und eine letzte Anstrengung gegen den Untergang der Zivilisation: Die Sorge für die Toten ist ihm letzter Prüfstein für die Absurditäten des menschlichen Irrglaubens, der noch den Toten Empfindung und Bedürfnisse zuspricht; in die philosophisch begründete Missbilligung des Epikureers mischt sich aber doch auch der Respekt des Römers vor solcher Solidarität bis zum letzten. Camus widmet dem Problem der Bestattungen viel Erzählraum. Etwas skrupulös berichtet der Chronist von den Verfahren, die angewandt werden, als sich die Seuche auf ihrem Höhepunkt befindet (153 ff.). Dabei verteilt er die beiden Aspekte des thukydideischen Berichts auf zwei Handlungsträger : Die Abkehr von den üblichen Bestattungsbräuchen schreibt er den Behörden zu: Sie untersagen die üblichen Riten45 und lösen das Problem der zunehmenden Sterberate wirkungsvoll, indem sie die Toten in Zügen zur Küste bringen; die Rücksicht auf das Empfinden der Lebenden nimmt dabei stetig ab, wie es eben die große Zahl der Toten erzwingt. Der Erzähler referiert dies nüchtern, wenngleich mit leichter Ironie (oder vielleicht auch einem gewissen Schrecken)46 angesichts der bürokratischen Perfektion. Die Bürger aber suchen auch in der Not noch eine persönliche Geste der Trauer und Anteilnahme: Et pendant toute la fin de l’¦t¦, comme au milieu des pluies de l’automne, on put voir le long de la corniche, au cœur de chaque nuit, passer d’¦tranges convois de tramways sans voyageurs, brinquebalant au-dessus de la mer. Les habitants avaient fini par savoir ce qu’il en ¦tait. Et malgr¦ les patrouilles qui interdisaient l’accÀs de la corniche, des groupes parvenaient se glisser bien souvent dans les rochers qui surplombent les vagues, et lancer des fleurs dans les baladeuses, au passage des tramways. (157)
Der Totenkult erscheint nicht, wie bei Lukrez, als Folge des Aberglaubens, und auch nicht, wie bei Thukydides, als Symptom einer im Chaos versinkenden
pqotehm\mai sv_sim· 1p· puq±r c±q !kkotq_ar vh\samter to»r m^samtar oR l³m 1pih]mter t¹m 2aut_m mejq¹m rv/ptom, oR d³ jaiol]mou %kkou 1pibak|mter %myhem dm v]qoiem !p0sam. 44 namque suos consanguineos aliena rogorum / insuper extructa ingenti clamore locabant / subdebantque faces, multo cum sanguine saepe / rixantes, potius quam corpora desererentur. 45 La Peste, S. 153: »Eh bien, ce qui caract¦risait au d¦but nos c¦r¦monies c’¦tait la rapidit¦! Toutes les formalit¦s avaient ¦t¦ simplifi¦es et d’une maniÀre g¦n¦rale la pompe fun¦raire avait ¦t¦ supprim¦e.« 46 Vgl. Camus, Archives de la Peste. II Discours de la Peste ses administr¦s, in: Les Cahiers de la Pl¦iade, 1974, S. 153 f.
314
Dorothee Gall (Bonn)
Stadt, sondern als beharrliche Erfüllung einer menschlichen Pflicht – ein Sieg menschlicher Solidarität.47 Die in Rieux’ Chronik gestiftete memoria gilt nicht nur den Opfern, sondern auch den Antagonisten der Pest. Über die bloße Empathie des Miterlebens und Miterleidens, die Thukydides primär vermittelt, stellt Camus damit die Chance der Tätigkeit, des Widerstands (la r¦volte).48 Einen solchen Widerstand deutet freilich auch Thukydides an: Wenn sie sich aus Furcht gegenseitig nicht besuchen wollten, starben sie einsam, und viele Häuser starben gänzlich aus, weil keiner da war, der sie pflegen wollte; wenn sie einander aber aufsuchten, gingen sie zugrunde, vor allem die, die der Tugend noch Wert beimaßen. Denn aus Schamgefühl schonten sie sich nicht und gingen zu ihren Freunden. (2, 51, 5)49
Ähnlich Lukrez: Die sich aber zur Hilfe anboten, gingen zugrunde durch Ansteckung und die Mühe, die ihre Scham sie zwang auf sich zu nehmen und das mit Schmeicheln vermischte Klagen der Erkrankten. Gerade die Besten erlitten den Tod auf diese Art. (6, 1243 – 46)50
Thukydides wie Lukrez begegnen denen, die in der Krankheit den Pflichten der Menschlichkeit nachkommen und die der humanitas adäquaten Affekte Kummer, Leid, Mitleid nicht verleugnen, mit Respekt;51 von einer »Chance der Humanität angesichts der Seuche« kann man aber in beiden antiken Texten wenig finden; mit der Nüchternheit des Historikers konstatiert Thukydides die Nutzlosigkeit aller Bemühungen; Lukrez illustriert sie mit dem Pathos des Lehrdichters. Beide lenken den Blick des Lesers vor allem auf die Opfer der Seuche. Deren Leid und Sterben schildert auch Camus’ Chronist Rieux; in seiner fiktionalen Chronik liegt aber das Hauptaugenmerk auf denen, die trotz ihrer Verzweiflung und Ermattung den Kampf weiterführen und sich, soweit dies möglich ist, für die Wahrung der Menschenwürde in Krankheit und Tod ein47 So auch akzentuiert im Brief an Roland Barthes (s. o. Anm. 40), der (wie Camus referiert, S. 286) dem Roman »une morale antihistorique et une politique de solitude« vorhielt: »S’il y a ¦volution de L’Êtranger La Peste, elle s’est faite dans le sens de la solidarit¦ et de la participation.« (S. 286) 48 Vgl. Carnet II, S. 69: »[…] il faut Þtre un fou, un criminel ou un lche pour consentir la peste, et en face d’elle le seul mot d’ordre d’un homme est la r¦volte.« 49 EUte c±q lµ (h´koiem dediºter !kk¶koir pqosi´mai, !p¾kkumto 1q/loi, ja· oQj¸ai pokka· 1jem¾hgsam !poq¸ô toO heqape¼somtor; eUte pqos¸oiem, dievhe¸qomto, ja· l²kista oR !qet/r ti letapoio¼lemoi; aQsw¼m, c±q Ave¸doum sv_m aqt_m 1siºmter paq± to»r v¸kour. 50 qui fuerant autem praesto, contagibus ibant / atque labore, pudor quem tum cogebat obire / blandaque lassorum vox mixta voce querellae. / optimus hoc leti genus ergo quisque subibat. 51 Blößner, Norbert: Emotionen als Wegbereiter der Vernunft? Festschrift H. Gärtner, 2004, S. 111 – 135, deckt auch in Lukrez’ Seuchenschilderung die Empörung des Lehrdichters über das Unrecht der Pest auf.
Die Chance der Humanität angesichts der Pest
315
setzen – also gewissermaßen einen Humanismus der Revolte praktizieren.52 Unter dem Stichwort »Peste« notiert Camus im Tagebuch: Tous luttent – et chacun sa faÅon. La seule lchet¦ est de se mettre genoux … On vit sortir des tas de nouveaux moralistes et leur conclusion ¦tait toujours la mÞme: il faut se mettre genoux. Mais Rieux r¦pondait: il faut lutter de telle et telle faÅon.53
Der irrationalen Gewalt der Pest begegnet die kampfbereite humanitas des Arztes und seiner Mitstreiter, und sie begegnet ihr zwar mit ähnlicher Hilflosigkeit wie bei Thukydides und Lukrez, aber keineswegs vergeblich.54 Rieux wird zum Zentrum des Widerstandes gegen die Pest; und wie der Arzt gegen die Seuche kämpft, so streitet hier auch der freie Bürger gegen die Unterwerfung durch ein grausames und amoralisches Regime, der gute Mensch gegen das Böse schlechthin. Das ist ein Kampf mit mythischer Dimension. Und tatsächlich tut Camus einiges, um die Epidemie künstlich zu mythisieren bzw. zu dämonisieren. Bereits Thukydides strebt danach, die Ursachen der Seuche im Rahmen der medizinischen Kenntnisse seiner Zeit zu erläutern: Nüchtern zeichnet er ihre Phänomene nach und deutet bereits Zusammenhänge wie den der Ansteckung durch den Kontakt mit Kranken und der Immunisierung der Überlebenden vorsichtig an. Selbstsicherer geht Lukrez vor und bietet eine genaue Erklärung für die Entstehung der Krankheit: Neben den dem Körper zuträglichen Atomen gebe es auch schädliche Stoffe; wenn diese sich zusammenrotteten, verpesteten sie die Atemluft, das Wasser und die Feldfrucht und kämen so zu den Menschen.55 Diese mit dogmatischer Sicherheit vorgebrachte atomistische Aitiologie der Seuche hat natürlich im Kontext epikureischer Philosophie einen sehr 52 Camus verwendet für ihre Qualität den Begriff des »h¦roisme civil« (Carnet II, S. 68); vgl. aber die Diskussion um den Heroismus zwischen Rieux und Rambert (S. 146 f.), in der Rieux den Begriff durch honnÞtet¦ ersetzt. – In Carnet II, S. 102, hält er den folgenden Gedanken fest: »L’humanisme ne m’ennuie pas: il me sourit mÞme. Mais je le trouve court.« Wenn hier (was mir keineswegs sicher scheint) Humanismus nicht als Epoche, sondern als geistigmoralische Haltung gemeint ist, dürfte es die Qualität der r¦volte sein, deren Fehlen Camus bemängelt. 53 Carnet II, S. 107. 54 In dieselbe Richtung – nämlich eine Ausweitung der Perspektive über die Darstellung der Ereignisse und ihrer Ursachen hinaus zum Kampf unter dem Leitstern eines existenzialistischen Trotzes – weist auch die im Vergleich zu Thukydides intensivierte und besser motivierte Zeugenschaft und Anteilnahme des Chronisten; die Dimensionen seiner Beteiligung bleiben bei dem Historiker ungeklärt; dass aber ein Arzt an allen Phänomenen und Etappen der Epidemie aktiv Anteil nehmen kann, ist unmittelbar einsichtig (s. o. Anm. 14). 55 Vgl. Lukrez 6, 1138 – 1144; 6, 1151 – 1155; dazu Klaus Bergdolt, Pestbeschreibung und Seuchentheorie bei Lukrez, in: Karenberg, Axel (Hg.): Heilkunde und Hochkultur I. Geburt, Seuche und Traumdeutung in den antiken Zivilisationen des Mittelmeerraumes, Münster 2000 (Naturwissenschaft, Philosophie, Geschichte 14), S. 51 – 58.
316
Dorothee Gall (Bonn)
konkreten Zweck: Sie widerspricht dem Glauben an ein Mitwirken numinoser Mächte. Mitte des 20. Jh. besaß die Medizinwissenschaft hinlängliche Kenntnisse über die Pest und ihre Ansteckungswege; Camus hätte seiner Seuche eine weit präzisere Ursprungs- und Entwicklungsgeschichte zuweisen können. Er tut dies aber erstaunlich maßvoll; tatsächlich ist von den Ratten die Rede, und es fallen auch gelegentlich die Worte Mikroben und Bazillus, und dennoch bleibt das Entstehen der Pest ebenso unerklärlich wie ihr Nachlassen. Vor allem der Schlusspassus des Romans hüllt die Seuche in das Gewand einer mythischen Heimsuchung: Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparat jamais, qu’il peut rester pendant des dizaines d’ann¦es endormi dans les meubles et le linge, qu’il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-Þtre, le jour viendrait o¾, pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste r¦veillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cit¦ heureuse. (248)
Im Kontext der politischen Interpretation erinnert das an den Schlusssatz aus Brechts Aufhaltbarem Aufstieg des Arturo Ui: »Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch«. Als Schlusssentenz einer allgemein anthropologischen Allegorie verweist es auf die Fragilität menschlichen Glücks. Innerhalb eines existenzialistisch geprägten Romans akzentuiert der Satz die Bedeutung des Wissens, der Einsicht in die Gesetze der Welt, die den Wissenden befähigt, sich, wenn die Bedrohung weicht, dem verfehlten Überschwang des Glücks ebenso zu entziehen wie in der Bedrohung der Verzweiflung. Damit ist eine stoische Grundhaltung angesprochen, die sich hier freilich nicht dem Vertrauen auf den göttlichen logos verdankt, sondern umgekehrt dem Bewusstsein, dass ein solcher logos nicht existiert.56 Die im eingangs zitierten Cicero-Passus angesprochene Einheit von Erkenntnisfähigkeit und Affektbeherrschung findet sich in Camus’ Roman in einer Art affektspezifischer Ständeklausel wieder ; auch hier ist Thukydides konstruktiv rezipiert: Bei ihm (wie auch bei vielen seiner Nachfolger)57 führt die Seuche zu einer Umkehrung der Besitzverhältnisse, zu hemmungslosem Genussstreben und dem Niedergang von Recht und Religion: 56 Stoischer Ataraxie entspricht in den Archives de la Peste, S. 151 der Satz: »L’me pacifi¦e reste la plus ferme.« 57 In dieser Deutung der Pest wird Thukydides prägend für alle späteren Pestberichte; vgl. Leven (Anm. 34), S. 82: »Die Ausstrahlungskraft der thukydideischen Schilderung bis in die moderne Literatur, etwa Albert Camus’ Die Pest (1947) und darüber hinaus, liegt freilich nicht in ihrer medizinischen Detailtreue, sondern in dem komplexen Gesamteindruck der Seuche als Bedrohung der Zivilisation schlechthin.«
Die Chance der Humanität angesichts der Pest
317
Auch sonst war die Krankheit für die Stadt der Anfang der Sittenlosigkeit. Leichter wagte man jetzt zu tun, woran man früher nur geheim gedacht hatte; sie sahen ja den raschen Umschwung zwischen den vom Glück Begünstigten, die ganz plötzlich starben, und denen, die zuvor nichts besessen hatten, jetzt aber auch das besaßen, was jenen gehört hatte. Und so hielten sie es für recht, auf schnelle Vorteile und auf das Vergnügen aus zu sein, da sie ja glaubten, ihre Körpern und ebenso ihr Besitz sei ihnen nur für einen Tag gegeben. Keiner war mehr bereit, länger auszuhalten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, da er für ungewiss hielt, ob er nicht, bevor er es erreicht hätte, sterben müsste. Was aber süß war im Augenblick und was woher auch immer Gewinn versprach, das galt jetzt als schön und nützlich. Weder Götterfurcht noch Menschengesetz hielt sie noch; denn zum einen urteilten sie, es sei gleich, ob man fromm sei oder nicht, da sie alle in gleicher Weise sterben sahen, und andererseits glaubte keiner, dass er für seine Vergehen noch Gerichtsverhandlung und Strafe erleiden müsse; viel mehr bedrohe sie das schon verhängte Todesurteil, und bevor es über sie hereinbreche, sei es doch angemessen, noch ein wenig vom Leben zu genießen. (2, 53, 1 – 4)58
Auch Camus verweist in verschiedenen Phasen der Seuche auf die wachsende Genusssucht der Menschen. Der Verlust an Religiosität wird während Paneloux’ 2. Predigt deutlich, als die Kirche nur schwach besucht ist. Für einen Patienten Rieux’, den alten Cottard, wird die Pest sogar zur Garantin seiner Sicherheit; sie setzt die Strafverfolgung aus, die er wegen eines nicht näher bezeichneten Delikts fürchten muss.59 Seine Suche nach Lebensgenuss wird zum Symptom der ganzen Bevölkerung: Ce qui Cottard, quelque mois auparavant, cherchait dans les lieux publics, le luxe et la vie ample, ce dont il rÞvait sans pouvoir se satisfaire, c’est--dire la jouissance effr¦n¦e, un peuple entier s’y portait maintenant. Alors que le prix de toutes choses montait irr¦sistiblement, on n’avait jamais tant gaspill¦ d’argent, et quand le n¦cessaire manquait la plupart, on n’avait jamais mieux dissip¦ le superflu. (169)
Und im letzten Teil seines Romans protokolliert Rieux die Lebensgier der Bürger von Oran, gerade angesichts der nachlassenden Seuche: 58 Pq_t|m te Gqne ja· 1r tükka t0 p|kei 1p· pk]om !mol_ar t¹ m|sgla. Nøom c±q 1t|kla tir $ pq|teqom !pejq}pteto lµ jah’ Bdomµm poie?m, !cw_stqovom tµm letabokµm bq_mter t_m te eqdail|mym ja· aQvmid_yr hm,sj|mtym ja· t_m oqd³m pq|teqom jejtgl]mym, eqh»r d³ t!je_mym 1w|mtym. ¦ste tawe_ar t±r 1pauq]seir ja· pq¹r t¹ teqpm¹m An_oum poie?shai, 1v^leqa t\ te s~lata ja· t± wq^lata blo_yr Bco}lemoi. ja· t¹ l³m pqostakaipyqe?m t` d|namti jak` oqde·r pq|hulor Gm, %dgkom mol_fym eQ pq·m 1p’ aqt¹ 1khe?m diavhaq^setai· fti d³ Edg te Bd» pamtaw|hem te 1r aqt¹ jeqdak]om, toOto ja· jak¹m ja· wq^silom jat]stg. he_m d³ v|bor C !mhq~pym m|lor oqde·r !pe?qce, t¹ l³m jq_momter 1m blo_\ ja· s]beim ja· lµ 1j toO p\mtar bq÷m 1m Us\ !pokkul]mour, t_m d³ "laqtgl\tym oqde·r 1kp_fym l]wqi toO d_jgm cem]shai bio»r #m tµm tilyq_am !mtidoOmai, pok» d³ le_fy tµm Edg jatexgvisl]mgm sv_m 1pijqelash/mai, Dm pq·m 1lpese?m eQj¹r eWmai toO b_ou ti !pokaOsai. 59 Das Motiv ist ausführlich vorbereitet in einem Tagebucheintrag aus der ersten Hälfte des Jahres 1942: Carnet II (1942 – 1951) S. 17.
318
Dorothee Gall (Bonn)
Chez les uns, la peste avait enracin¦ un scepticisme profond dont ils ne pouvaient pas se d¦barasser. […] Chez les autres, au contraire, et ils se recrutaient sp¦cialement chez ceux qui avaient v¦cu jusque-l s¦par¦s des Þtres qu’ils aimaient, aprÀs ce long temps de claustration et d’abattement, le vent d’espoir qui se levait avait allum¦ une fiÀvre et une impatience qui leur enlevaient toute matrise d’eux-mÞmes. Une sorte de panique les prenait la pens¦e qu’ils pouvaient, si prÀs du but, mourir peut-Þtre, qu’ils ne reverraient pas l’Þtre qu’ils ch¦rissaient et que ces longues souffrances ne leur seraient pas pay¦es. (222)
Überschaut man das Personal des Romans, so sind es die Intellektuellen, die Gebildeten und Künstler, die dieser Genusssucht nicht zum Opfer fallen und in der Krise die Kraft zum Widerstand wahren: neben den Ärzten der Journalist Rambert, der Priester Paneloux, der Richter Othon, der um den ersten Satz seines Romans ringende Schreiber Grand, der aus großbürgerlichen Verhältnissen stammende und Künstlerkreisen nahestehende Tarrou.60 Ihnen ist gemeinsam mit dem Rentner Cottard die große Masse kontrastiert, die sich der Krankheit ausliefert, im physischen Sterben oder in der moralischen Vernachlässigung.61 Am Rande sei bemerkt, dass auch nur hier, in der gesichtslosen Menge, Frauen vorkommen – sieht man von Rieux’ alter Mutter ab, die ihrem Sohn ergeben den Haushalt führt.62 Das Konzept einer Überwindung der Pest (in ihrer Bedeutungsvielfalt) durch die Kraft der Intelligenz ist gänzlich unverschleiert in der Exhortation aux M¦decins de la Peste dargelegt, die Camus 1947 in den Cahiers de la Pl¦iade veröffentlichte: Vous donc, m¦decins de la peste, devez vous fortifier contre l’id¦e de la mort et vous r¦concilier avec elle, avant d’entrer dans le royaume que la peste lui pr¦pare. Si vous Þtes vainqueurs sur ce point, vous le serez partout et l’on vous verra sourire au milieu de la terreur. Concluez qu’il vous faut une philosophie.63
60 Hier wirkt sich Camus’ Konzept von der r¦volte aus, die auf der (philosophischen) Analyse der Verhältnisse (»monde absurde«) beruht; die Revolte ist also eine Art Privileg derer, die der philosophischen Analyse fähig sind (vgl. Carnet II, S. 81, unter dem Stichwort: »Essai sur la R¦volte«). 61 Ebd.; Carnet II, S. 36, vergleicht Camus die »Peste« und den »Êtranger«: »L’Êtranger d¦crit la nudit¦ de l’homme en face de l’absurde. La Peste, l’¦quivalence profonde des points de vue individuels en face du mÞme absurde. C’est un progrÀs qui se pr¦cisera dans d’autres œuvres. Mais, de plus, La Peste d¦montre que l’absurde n’apprend rien. C’est le progrÀs d¦finitif.« 62 Ramberts Geliebte bleibt der Stadt fern und ist nur als »Gegenstand der Sehnsucht« präsent; Rieux’ Frau verlässt vor Ausbruch der Pest die Stadt und stirbt im Sanatorium; auch Othons Frau bleibt Randfigur. 63 Camus, Archives de la Peste. I Exhortation aux M¦decins de la Peste, in: Les Cahiers de la Pl¦iade, 1974, S. 150.
Die Chance der Humanität angesichts der Pest
319
Wenige Zeilen später formuliert Camus hier seinen Widerspruch zu Thukydides:64 Ne donnez pas raison Thucydide, parlant de la peste d’AthÀnes et disant que les m¦decins n’¦taient d’aucun secours parce que, dans le principe, ils traitaient du mal sans le connatre. Le fl¦au aime le secret des taniÀres. Portez-y la lumiÀre de l’intelligence et de l’¦quit¦.65
Camus interpretiert (in verkürzender Deutung) die nüchtern pessimistische Erzählhaltung des Thukydides als Billigung der menschlichen Ohnmacht und des Todes, der er den Kampf ansagt: Vous ne devrez pas, vous ne devrez jamais vous habituer voir les hommes mourir la faÅon des mouches, comme ils le font dans nos rues, aujourd’hui, et comme ils l’ont toujours fait depuis qu’ AthÀnes, la peste a reÅu son nom. Vous ne cesserez pas d’Þtre constern¦s par ces gorges noires dont parle Thucydide.66
So plakativ, dass der Schwäche des Volkes die heroische Selbstlosigkeit der Intellektuellen entgegengestellt würde, verfährt Camus aber nun doch nicht. Eine Brücke zwischen beiden Gruppen baut der Glaube an das Anrecht des Menschen auf Glück. Deutlicher noch als in der Toleranz Rieux’ gegenüber Cottard und der das Ende der Pest wie eine Erlösung feiernden Menge (248) wird das in seiner Einstellung zu Rambert, den die Quarantäne von seiner Geliebten getrennt hat. Mit allen Mitteln versucht er, aus der Stadt zu entkommen. Der zeitgenössische Leser kann kaum anders, als in ihm einen potenziellen Ausbreiter der Seuche zu sehen und seine Verantwortungslosigkeit zu tadeln. Anders der Erzähler Rieux: Die Versuche Ramberts und anderer, aus der in ihrer Quarantäne abgeschlossenen Stadt zu entkommen, wertet er weder von einem medizinischen, noch von einem moralischen Standpunkt aus, sondern lässt sie – als Suche nach dem Glück – gelten: Rieux […] dit que c’¦tait l’affaire de Rambert, que ce dernier avait choisi le bonheur et que lui, Rieux, n’avait pas d’arguments lui opposer. Il se sentait incapable de juger de ce qui ¦tait bien ou de ce qui ¦tait mal en cette affaire. (173 f.)
Das ist, wie mir scheint, nicht allein der politischen oder metaphysischen Allegorie geschuldet, gemäß der die Seuche zur kriegerischen Belagerung oder zum Bösen schlechthin wird. Es entspricht auch einer humanistischen Anthropologie, die zwei Modelle miteinander vermittelt: die Pflichtethik und den Anspruch des einzelnen, das Potenzial des eigenen Lebens zu entfalten. In diesem Zusammenhang wird eine Gestalt bei Camus interessant: Kehren 64 S.o. S. 65 Camus, Archives de la Peste. I Exhortation aux M¦decins de la Peste, in: Les Cahiers de la Pl¦iade, 1974, S. 151. 66 Ebd.
320
Dorothee Gall (Bonn)
wir zurück zum Tagebucheintrag: Ein zweites Journal sollte in der ersten Fassung auf einen Philosophen zurückgehen und sich als Anthologie unbedeutender Ereignisse darstellen.67 Auch dieser Philosoph ist in der letztlich veröffentlichten Fassung nicht mehr kenntlich. Tatsächlich gibt es aber einen zweiten Bericht, nämlich den des Tarrou, und dieser ist ausdrücklich als »besondere Chronik, welche sich scheinbar absichtlich an das Unbedeutende hält« bezeichnet: Mais il s’agit d’une chronique trÀs particuliÀre qui semble ob¦ir une parti pris d’insignifiance. (50)
In Tarrous Charakterisierung scheint mir aber nun ein bisher in der Forschung nicht erkannter Restbestand einer philosophischen Charakterisierung zu liegen; sie folgt einem Muster, das ich mit aller gebotenen Vorsicht als epikureisch bezeichnen möchte. Die erste Erwähnung seiner Chronik wird von einigen Angaben zu seiner Person begleitet, darunter : Bonhomme, toujours souriant, il semblait Þtre l’ami de tous les plaisirs normaux sans en Þtre l’esclave. (49)
Die Geringschätzung der natürlichen Freuden, der naturalia, wäre stoisch, ihr Genuss in Freiheit ist epikureisch. Epikureisch ist auch der Kampf gegen den Aberglauben, der sich auf Physik und Empirie stützt: Zu Beginn seiner Chronik referiert Tarrou ein Gespräch mit dem Nachtportier seines Hotels. Dieser schließt aus dem Tod der Ratten auf ein Unglück: »Quand les rats quittent le navire …« Je lui ai r¦pondu que c’¦tait vrai dans le cas des bateaux, mais qu’on ne l’avait jamais v¦rifi¦ pour les villes. (52)
Auf eine Nachfrage des Portiers nach seinen eigenen Befürchtungen erklärt Tarrou: – La seule chose qui m’int¦resse, lui ai-je dit, c’est de trouver la paix int¦rieure. (52)
Der Begriff ist in zu programmatischer Weise eine Übersetzung der epikureischen Ataraxie, um nicht Aufmerksamkeit zu erwecken. Wenig später betont Tarrou gegenüber dem Hoteldirektor, es sei ihm gleichgültig, ob die Krankheit ansteckend sei oder nicht (55), eine Art Bekenntnis zur Gleichgültigkeit des Todes in korrekter epikureischer Manier (33). Auch Tarrous Frage, ob man ohne Gott ein Heiliger sein könne, stößt vor in die Dimensionen epikureischer Ethik und Anthropologie: 67 Laut Tagebucheintrag (Carnet II, S. 83 ff.) verfolgte Camus selbst den Plan einer »Anthologie de l’insignifiance« (S. 83); als Beispiele des insignifiant führt er u. a. das von Tarrou referierte Motiv »le vieux et le chat« an (S. 85). Es scheint sich um eine Szene zu handeln, die Camus in Oran beobachtet hat; vgl. Carnet I, S. 221 (Oran. Janvier 41).
Die Chance der Humanität angesichts der Pest
321
Peut-on Þtre un saint sans Dieu, c’est le seul problÀme concret que je connaisse aujourd’hui. (211)
Und schließlich lässt Camus ihn noch Rieux die Freundschaft antragen – vielleicht eine Anspielung auf den epikureischen Freundschaftskult.68 Die Protagonisten von Tarrous Chronik sind die kleinen Leute:69 der alte Mann, der die Katzen anlockt und ihnen auf den Kopf spuckt; Cottard in seiner Angst vor Verfolgung und seiner irrationalen Hoffnung auf die Pest.70 Auch in dieser Hinwendung zu den Ängsten und Wirrnissen der Menschen kann man eine Parallele zur hellenistischen und ganz besonders der epikureischen Philosophie sehen. Camus’ literarisches Werk ist – vor allem in seiner weitgespannten Mythenrezeption – antiken Texten und Motiven tiefgreifend verpflichtet. Seine Tagebucheinträge dokumentieren, dass er sich in der Entstehungszeit der Pest ausführlich mit der griechischen Kultur beschäftigt hat. Er schreibt in dieser Zeit an seiner Diplomarbeit über Plotin und Augustinus, reflektiert über den Anspruch des Christentums und der griechischen Philosophie und Kultur und konstatiert – in lapidarer, aber doch erstaunlich affirmativ wirkender Weise – die Unmöglichkeit, die Kulturleistungen der Griechen ohne die Hilfe von Sklaven zu generieren.71 Auf Thukydides und verschiedene Ereignisse des Peloponnesischen Krieges verweist er mehrfach, dazwischen eingeschoben sind Notizen zu Melvilles Moby Dick. Dass sein Roman La Peste nicht nur im Sinn allgemeiner Hypertextualität von Thukydides und weiteren Subtexten profitiert, ist innerhalb der Romanistik von Forschern wie Grimm, Demont, Gervais und Brigitte Sändig längst erkannt;72 mein Ziel war, einige bisher unentdeckte Facetten dieser Arbeit am Subtext aufzudecken. Dabei ergibt sich folgendes Bild: Wie schon Lukrez, distanziert sich auch Camus in Wertung und Erzählhaltung von Thukydides. Die erzählerische Großform des Romans an sich verlangt natürlich eine weitere Ausgestaltung, v. a. die Ergänzung des Kollektivs durch handelnde oder leidende Individuen, wie sie auch Defoe bietet, wenngleich nicht in ähnlicher Eindringlichkeit; andere Variationen sind ganz deutlich der be68 »Savez-vous, dit-il, ce qui nous devrions faire pour l’amiti¦? – Ce que vous voulez, dit Rieux.« (S. 211) 69 Vgl. Weyembergh, Maurice: Literatur und Zeugnis. Die Pest als Chronik, in: Erkenntnis und Erinnerung. Albert Camus’ Pest-Chronik. Interpretation und Aktualität, hrsg. v. Heinz Robert Schlette, Bonn 1998, S. 13 – 34, hier 27: Tarrou ist ein Geschichtsschreiber dessen, was keine Geschichte hat. 70 »Il y avait pourtant dans la ville un homme qui ne paraissait ni ¦puis¦ ni d¦courag¦, et qui restait l’image vivante de la satisfaction. C’¦tait Cottard. […]« (S. 167). 71 Vgl. Carnet I, S. 234 und 247 f. 72 Sändig, Brigitte: Der Krieg ist aus. Das Ende der Pest/des Krieges bei Camus und Fühmann, in: Erkenntnis und Erinnerung (vgl. Anm. 61) S. 115 – 162.
322
Dorothee Gall (Bonn)
sonderen Stilisierung der Pest als Roman der R¦sistance geschuldet. Den stärksten Impetus zur Neustilisierung gegenüber Thukydides und Lukrez liefert aber – wie nicht anders zu erwarten – Camus’ existenzialistisches Credo von der Sinnhaltigkeit des Widerstands gegen die Absurdität der Welt. Gegen den betroffenen, aber nur Zeugnis ablegenden Chronisten Thukydides setzt er die in Rieux repräsentierte Einheit des Chronisten mit dem Arzt; gegen das verhalten pessimistische Menschenbild von Thukydides und Lukrez setzt er die Chance der Bewährung durch eine Humanität des Widerstands. Wie Thukydides erhebt Camus die Pest zum Symbol von Krieg und Tod; wie Lukrez verleiht er ihr den Charakter einer menschlichen Bewährungsprobe in einer entgötterten bzw. von ungerechten Göttern gelenkten Welt.73 In dieses existenzialistisch geprägte Programm mischen sich Züge einer stoischen Ethik, verbunden mit dem elitären humanitas-Gedanken Ciceros und dem epikureischen Leitbegriff der Glückseligkeit: Anders als seine literarischen Prätexte konfrontiert Camus der Pest auf all ihren allegorischen Ebenen die Humanität im stoischen Sinn: als sich der Verstörung widersetzende Kraft, die die Klugen und Wissenden befähigt, gegen die Katastrophe zu kämpfen und zugleich denen, die ihr physisch oder psychisch erliegen, mit Verständnis zu begegnen; die gegen die Seuche nicht Resignation oder das starre Ideal der Gleichgültigkeit des Todes setzt, sondern unter allen Schrecken das Recht des Menschen auf ein glückliches Leben vertritt.
73 So sehr präzise formuliert in den Archives de la Peste, S. 151 f. »Vous serez fermes, face cette ¦trange tyrannie. Vous ne servirez pas cette religon aussi vieille que les cultes les plus anciens. Elle tua PericlÀs, alors qu’il ne voulait d’autre gloire que de n’avoir fait prendre le deuil aucun citoyen, et elle n’a pas cess¦, depuis ce meurtre illustre jusqu’au jour o¾ elle vint s’abattre sur notre ville innocente, de d¦cimer les hommes et d’exiger le sacrifice des enfants. Quand mÞme cette religion nous viendrait du ciel, il faudrait dire alors que le ciel est injuste.«
Christoph Hoch (Bonn)
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten (Albert Camus Le Premier homme, Kateb Yacine Nedjma)
»Revisiter Camus« – das heißt aus der Perspektive der Französischdidaktik auf eine lange und erfolgreiche Geschichte der Literaturvermittlung zu blicken. Wenn auch in den meisten Bundesländern heute keine verbindliche Lektüreliste mehr existiert und die Zentralabiturvorgaben wechselnde Pflichtmedien vorsehen, bleibt Camus doch weiterhin einer der Lieblingsautoren des heimlichen Lehrplans deutscher Französischlehrerinnen und -lehrer.1 Der thematische Kontext für die schulische Behandlung seiner Texte – etwa »les problÀmes existentiels de l’homme moderne«2 – verweist dabei in der einen oder anderen Formulierung auf die literarische und philosophische Bewegung des Existentialismus. Kurz: Camus ist ein Klassiker des Französischunterrichts, aber nur bezogen auf eine vorherrschende Fragestellung (Existentialismus), die meist anhand weniger Texte (L’Etranger oder »L’Húte«) behandelt wird. Im Unterschied dazu soll Camus auf den folgenden Seiten im Zusammenhang mit einem anderen Themenkomplex aus dem Bereich der francophonie in den Blick genommen werden: der französischen Kolonialisierung Algeriens. Die unterrichtliche Auseinandersetzung mit dieser politisch, sozial und ideologisch implikationsreichen Konfliktgeschichte zielt zunächst auf den Erwerb von Kenntnissen. Gilt es doch, zumindest einige der Etappen einer gut 130 Jahre dauernden Kolonial-Historie zu erarbeiten. Als Eckpunkte genannt seien hier nur der französische Eroberungsfeldzug von 1830; der dadurch ausgelöste algerische Volkskrieg unter dem Berberführer Abd el-Kader bis 1847 1 Vgl. die empirisch gestützten Ergebnisse von Franz-Rudolf Weller : »Literatur im Französischunterricht heute«, in: französisch heute (2) 2000, S. 138 – 159. Camus belegt demnach den ersten Platz und bildet zusammen mit Sartre, MoliÀre, Ionesco, Saint-Exup¦ry und Maupassant den Kanon der Schul-Klassiker. Zur Frage der fälligen Kanonauffrischung vgl. Andreas Nieweler (Hg.): Fachdidaktik Französisch. Tradition – Innovation – Praxis. Stuttgart 2006, S. 208 f. 2 Zentralabiturvorgaben für das Fach Französisch (NRW), gültig für die Jahre 2010 – 12, online verfügbar unter : http://www.standardsicherung.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=5 [18. 8. 2010].
324
Christoph Hoch (Bonn)
sowie der daraufhin einsetzende, meist lokal bis zum Ersten Weltkrieg geführte bewaffnete Widerstand; die andauernde Landnahme durch gut 900.000 französische Siedler ; die nach den Unruhen von S¦tif und Guelma 1945 erstarkte, auf politischer Ebene bereits seit den 1920er Jahren bestehende nationalistische Unabhängigkeitsbewegung; und schließlich die Eskalation des Konfliktes im Algerienkrieg (1954 – 62) sowie die unter Führung der Nationalen Befreiungsfront (Front de Lib¦ration Nationale, FLN) im März 1962 erstrittene Unabhängigkeit. Dies kann im Fachunterricht oder besser noch im fächerverbindenden bzw. fächerübergreifenden Unterricht geschehen. In jedem Fall ist die Zusammenstellung eines gemischten Dossiers zur Algerien-Problematik notwendig, das, nach gängigen didaktischen Prinzipien organisiert, eine Vielzahl von Materialien verschiedener Mediengattungen enthält.3 Entsprechende Themendossiers liegen vor, die sich leicht um die im Folgenden behandelten literarischen Texte ergänzen lassen.4 Geeignet sind diese für die Analyse- oder Transferphase einer Unterrichtsreihe zum Thema, sei es am Ende der Oberstufe, sei es in universitären Grundstudiumsveranstaltungen zur civilisation franÅaise et francophone. Der angesprochene Kenntniserwerb ist aber nur die eine Seite des anvisierten Lernprozesses. Auf der anderen steht die Begegnung mit zumindest zwei fremden Kulturen, die zudem noch der Vergangenheit angehören: der Kolonie Algerien und der Metropole Frankreich. Damit Lerner in einer den reinen Wissenserwerb überschreitenden Kulturbegegnung Erfahrungen machen können, die ihre bisherigen Vorstellungen und Dispositionen erweitern und verändern, bedarf es eines geeigneten fremdkulturellen Pendants. In Ermangelung persönlicher Kontakte mit colonisateurs und colonis¦s kommt dabei die Literatur ins Spiel. Zur unterrichtlichen Behandlung vorschlagen möchte ich dafür zwei autobiographisch angelegte, während der 1950er Jahre entstandene Romane, die beide Seiten der damals noch ungelösten Kolonialproblematik aus der Erfahrungsperspektive jugendlicher Protagonisten beleuchten. Die Rede ist erstens 3 Vgl. immer noch Udo Wolff: »Textarbeit und Dossierkonstruktion – Zum Problem der Progression im Französischunterricht der Sekundarstufe II«, in: Praxis des neusprachlichen Unterrichts (22/2) 1975, S. 181 – 197. 4 Josef Bessen: »Algerien und die algerisch-französischen Beziehungen als Themen von Französischkursen«, in: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung aus dem Konstanzer SLI (30) 1996, S. 36 – 63. Manfred Overmann: »Module multim¦dia sur la guerre d’Alg¦rie«, in: Christine Michler (Hg.): Demokratische Werte im Unterricht des Französischen als Fremdsprache / Les valeurs d¦mocratiques dans l’enseignement du franÅais langue ¦trangÀre (Schriften zur Didaktik der romanischen Sprachen, Band 2). Augsburg 2005, S. 66 – 82. Weitaus umfangreicher ist Overmanns multimediales Dossier aus dem Jahr 2007: L’Alg¦rie – Dossier de textes avec des fiches p¦dagogiques: 4Àme ann¦e – bac (+2), online verfügbar auf der Homepage der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg (Didaktik der französischen Sprache und Literatur): http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf4/algerie/ index.htm [18. 8. 2010].
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
325
von Camus’ postum veröffentlichtem Romanfragment Le Premier homme, der bislang nur ausnahmsweise Gegenstand schulischen Unterrichts geworden sein dürfte;5 zweitens von Kateb Yacines 1956 erschienenem Debütroman Nedjma.6 Im Kontext der formulierten Fragestellung können und sollen diese Texte nicht als Ganzschrift, sondern in kürzeren Auszügen kontrastiv behandelt werden – ein Vorgehen, das aufgrund des Fragmentcharakters des ersten und der schwer überschaubaren Perspektivenvielfalt, achronologischen Erzählstruktur und streckenweise starken sprachlichen Markiertheit des zweiten ohnedies unvermeidbar ist.7 Die folgenden Ausführungen unterteilen sich in: 1. eine Klärung relevanter fremdsprachendidaktischer Prämissen; die Präsentation und Kontextualisierung jeweils zweier Textauszüge aus den Romanen von 2. Albert Camus und 3. Kateb Yacine samt Hintergrundinformationen und Interpretationshinweisen; sowie 4. ein abschließendes Fazit. Die vorgelegten Ergebnisse verstehen sich als notwendige Vorarbeiten für den Lehrgebrauch der behandelten Texte; Detailaspekte der methodisch-didaktischen Unterrichtsgestaltung können hier aus Platzgründen nicht diskutiert werden und sollen an anderer Stelle eine Konkretisierung erfahren.
5 Vorgeschlagen wird die schulische Behandlung von Le premier homme vom Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW (Hg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Französisch. Frechen 1999, S. 61, 63. Einen sinnvollen Kontext bieten Unterrichtsreihen mit landeskundlich-interkultureller Ausrichtung, deren thematische Schwerpunkte bspw. »la guerre d’Alg¦rie« oder (im fächerübergreifenden Unterricht) der »Kolonialismus in Afrika« (ebd., S. 61 bzw. 78) sein können. Lehrplanhinweise beschränken sich hier und im Folgenden auf das Land NRW. 6 Angeregt wurde die Textauswahl von Brigitte Sändig: »Zweimal algerische Kolonialgeschichte. Kateb Yacine: ›Nedjma‹, Albert Camus: ›Le Premier homme‹«, in: Arend, Elisabeth / Kirsch, Fritz Peter (Hg.): Der erwiderte Blick. Literarische Begegnungen und Konfrontationen zwischen den Ländern des Maghreb, Frankreich und Okzitanien / Regards sur le Maghreb. Regards sur la France. Les ¦crivains de langue franÅaise et occitane la recherche de l’autre. Würzburg 1998, S. 29 – 38. Während Nedjma als Schullektüre noch zu entdecken ist, figuriert der Roman bei Frank Baasner / Peter Kuon: Was sollen Romanisten lesen. Berlin 1994, S. 28, als ›Sternchentext‹ im romanistischen Lesekanon. 7 Zur komplizierten Romanarchitektur von Nedjma vgl. Brigitte Sändig: »Zweimal algerische Nationalgeschichte«, a.a.O., S. 29; die von einigen zeitgenössischen Rezensenten bemängelte Unverständlichkeit des Romans kommentiert und widerlegt Peter Sarter : Kolonialismus im Roman. Aspekte algerischer Literatur französischer Sprache und ihrer Rezeption am Beispiel von Kateb Yacines ›Nedjma‹. Frankfurt/M., Bern 1977, S. 7 ff.
326
1.
Christoph Hoch (Bonn)
Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
Die vorliegende Problematik fällt aus didaktischer Sicht in den Bereich des Interkulturellen Lernens – ein Ansatz, der das traditionelle, mehr auf Kognition zielende Konzept der Landeskunde ersetzt und u. a. um die Dimension des emotionalen Erlebens von Fremdheit erweitert hat. Auch wenn zu recht darauf bestanden wird, dass konkretes Wissen über die Zielkultur als Grundlage jeder Erklärungs- und Deutungskompetenz eine wesentliche Voraussetzung für kompetentes interkulturelles Handeln bzw. das kommunikative Verhandeln eigen- und anderskultureller Vorstellungen darstellt,8 setzt der deutsche Ansatz des Interkulturellen Lernens doch unverkennbar auf Individualisierung und Affektbetonung. Im Mittelpunkt stehen die Ausrichtung auf emotionales Erleben, die Präferierung individueller Wahrnehmungsäußerungen und (Text)Interpretationen. Dahinter steht ein Kulturbegriff, der zwar soziale Standardisierungen berücksichtigt, aber wesentlich als individuell-psychologisches Orientierungsschema gefasst wird. Bereits auf der Ebene der fremdsprachendidaktischen Modellierung besteht somit ein deutlicher Kontrast zur französischen Tradition. Der auf dem Symposium von Santiago de Chile (1970) ausformulierte Kultur- und Sprachbegriff der civilisation franÅaise ist mit seiner Ebenendifferenzierung zwischen den r¦alit¦s, den Erscheinungsformen und dem System von Kultur geschichtswissenschaftlich-soziologisch ausgerichtet und orientiert Unterricht methodisch von Inhalten und Lernprozessen her.9 Beides sollte zur Vermeidung der Einseitigkeit berücksichtigt werden. Von größerer Bedeutung für das hier interessierende Thema aber ist die bereits angerissene Frage nach der Funktion literarischer Texte für interkulturelle Lernprozesse, gleich ob diese primär hermeneutisch oder sozial-kognitiv angelegt werden. Die fachdidaktische Diskussion der letzten zehn Jahre hat darauf eine Vielzahl theoretischer wie praktischer Antworten gegeben. Den Ausgangspunkt bildet die Überlegung, dass bei der Rezeption literarischer Werke, die im Unterschied zu referentiellen Darstellungen faktischer Zusammenhänge (Sachtexte) ästhetisch modellierte Sinnentwürfe darstellen, gerade aufgrund ihrer Offenheit und Mehrdimensionalität die Empathiefähigkeit ge8 In diesem Sinne argumentieren bspw. Wolfgang Pütz: »Zwischen Realienkunde und interkulturellem Lernen. Zur Aktualität des Landeskunde-Begriffs in der Fremdsprachendidaktik«, in: Französisch heute (4) 1998, S. 352 – 358, und Eynar Leupold: »Landeskundliches Curriculum«, in: Bausch, Karl-Richard / Christ, Herbert et al. (Hg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 5. Auflage. Tübingen 2007, S. 127 – 133, hier S. 131. 9 Vgl. Dagmar Abendroth-Timmer : »Konzepte Interkulturellen Lernens und ihre Umsetzung in Lehrwerken«, in: Meißner, Franz-Joseph / Reinfried, Marcus (Hg.): Bausteine für einen neokommunikativen Unterricht: Lernerzentrierung, Ganzheitlichkeit, Handlungsorientierung, Interkulturalität, Mehrsprachigkeitsdidaktik. Tübingen 2001, S. 135 – 149, hier S. 135 – 137.
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
327
schult und die Koordination verschiedener Perspektiven angebahnt wird. Es geht also darum, mithilfe von Literatur bei der Behandlung interkulturell relevanter Themen schulischen Lernern Erfahrungen zu ermöglichen, die sie in ihrer Realität sonst nicht machen könnten (nämlich mit fremden Augen zu sehen). Dabei kann von Parallelen »zwischen den Prozessen lebensweltlicher und fiktionaler Identitätskonstruktionen« ausgegangen werden.10 Die Textauswahl ist entsprechend anzulegen: Sie soll helfen, weniger vorurteilsbezogen, klischeehaft und ethnozentrisch auf fremdkulturelle Welten zu schauen, und – um ein Wort Rortys aufzugreifen – als »Mittel der Erlösung aus der Selbstbezogenheit« wirken.11 Funktionieren kann dies aber nur, wenn der Leser/Lerner12 mit literarischen Texten bzw. darin inszenierten Figuren konfrontiert wird, die weder einen zu vertrauten noch einen zu distanten Charakter haben. Zentral für die weitere Ausarbeitung entsprechender didaktischer Konzepte steht der Begriff »Perspektivenwechsel«. Schüler sollen in die Lage versetzt werden, kulturspezifische Differenzen auf eigene Verstehenshorizonte zu beziehen, kulturbedingte Sichtweisen zu erkennen und sie durch Übernahme zu erproben sowie dabei gleichzeitig kritisch-reflektive Distanz wie Empathie zu entwickeln.13 Wie dieses schwer messbare, komplexe Bündel kognitiver und affektiver Fähigkeiten entwickelt werden kann, wurde besonders im Kontext des Giessener Graduiertenkollegs »Didaktik des Fremdverstehens« diskutiert.14 10 Roy Sommer : Fictions of Migration. Ein Beitrag zur Gattungstypologie des zeitgenössischen interkulturellen Romans in Großbritannien. Trier 2001, S. 68. 11 Richard Rorty : »Der Roman als Mittel zur Erlösung aus der Selbstbezogenheit«, in: Küpper, Joachim / Menke, Christoph (Hg.): Dimensionen ästhetischer Erfahrung. Frankfurt/M. 2003, S. 49 – 68. 12 Die Begriffe Leser, Lerner, Schüler sind hier und im Folgenden als generisches Maskulinum zu verstehen. 13 Ministerium für Schule und Weiterbildung (Hg.): Richtlinien und Lehrpläne, a.a.O., S. 45. Die Fähigkeit, eine »mehrperspektivische Betrachtung der Wirklichkeit« (ebd., S. XVIII) bzw. »multiperspektivische und mehrdimensionale Sichtweisen« (ebd., S. XIX) ausbilden, lasse sich demnach besonders durch »interkulturelle Lernprozesse unterstützen«. Insgesamt heben die Lehrplanvorgaben dabei auf eine nicht näher erklärte Kombination von Elementen der Landeskunde und des Interkulturellen Lernens ab, sollen Schüler doch die Gelegenheit erhalten, »exemplarisches soziokulturelles Wissen zu erwerben, sich mit sprachlicher und kultureller Pluralität auseinander zu setzen, durch Wahrnehmung und Perspektivwechsel sensibilisiert zu werden und Fertigkeiten der interkulturellen Kommunikation zu erwerben« (ebd., S. 10). 14 Vgl. insbes. das Herausgebervorwort: »Grundzüge einer Theorie und Didaktik des Fremdverstehens beim Lehren und Lernen fremder Sprachen«, in: Bredella, Lothar / Meißner, Franz-Joseph / Nünning, Ansgar / Rösler, Dietmar (Hg.): Wie ist Fremdverstehen lehr- und lernbar? (Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik) Tübingen 2000, S. IX – LII, sowie in demselben Band Ansgar Nünning: »›Intermisunderstanding‹ – Prolegomena zu einer literaturdidaktischen Theorie des Fremdverstehens: Erzählerische Vermittlung, Perspektivenwechsel und Perspektivenübernahme«, S. 84 – 123. Auf die Differenzierung zwischen dem hier gewählten, in schulnahen Kontexten meist präferierten Begriff des
328
Christoph Hoch (Bonn)
Ansgar Nünning hat in seiner literaturdidaktischen Theorie des Fremdverstehens verschiedene Begründungsansätze vorgestellt und unter Rückgriff auf Erkenntnisse der kognitiven Entwicklungspsychologie besonders auf die als »Dezentrierung« bekannte Differenzierung zwischen eigener und fremder Erkenntnisperspektiven abgehoben.15 Zu unterscheiden ist demnach zwischen drei Dezentrierungs-Typen: der Perspektivendifferenzierung (Unterschiede zwischen verschiedenen Perspektiven kennen und ertragen können), der Perspektivenübernahme (die fremde Perspektive in Probehandlungen einnehmen und inhaltlich ausgestalten können) und der Perspektivenkoordination (auf einer Meta-Ebene unterschiedliche Perspektiven erfassen, vergleichen und zwischen ihnen vermitteln können).16 Heruntergebrochen auf den Verarbeitungsprozess von Literatur zum formulierten Thema bedeutet das: Der Leser vollzieht zunächst intuitiv in der Begegnung mit Einzelschicksalen ihm fremde menschliche Erfahrungen in der Kolonialgesellschaft nach. Die perspektivische Brechung des literarischen Texts zeigt ihm in einem zweiten Schritt die Perspektivengebundenheit von Wirklichkeitserfahrungen. Durch die gezielte Konfrontation mit unterschiedlichen Perspektiven auf den gemeinsamen thematischen Fokus »Algerien« lernt er konkurrierende Sichtweisen kennen und nachzuvollziehen. Das Nebeneinander verschiedener literarischer Figuren verdeutlicht den Perspektivenwechsel und schult die Perspektivenkoordination. Dabei greifen je nach Text und (durch geeignete Aufgabenstellung gesteuerte) Rezeption, Prozesse des Perspektivenwechsels und der Perspektivenkoordination auf der Ebene der Figuren und der Text-Leser-Interaktion ineinander. Bezieht man diese Feststellungen auf die getroffene Textauswahl, ergeben sich Kriterien für ihre Eignung und damit zugleich Hinweise auf Aspekte, die bei der Behandlung zu berücksichtigen sind: – Beide Romane vermitteln – im Unterschied etwa zu Sachtexten – Geschichte aus der subjektiven Perspektive jugendlicher, mit der (Re)Konstruktion ihrer Identität beschäftigter Protagonisten, deren Qualität als fiktive Zeitzeugen durch den autobiographischen Charakter der Texte zusätzlich markiert wird;
Interkulturellen Lernens und dem weiter gefassten Ansatz des Fremdverstehens kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden; vgl. dazu Franz-Joseph Meißner / Marcus Bär : »Didaktik des Fremdverstehens / Interkulturellen Lernens in Lehrwerken des Spanischunterrichts«, in: Bredella, Lothar / Christ, Herbert (Hg.): Fremdverstehen und interkulturelle Kompetenz. Tübingen 2007, S. 109 – 132, hier S. 115 – 118. 15 Ansgar Nünning: »Fremdverstehen und Bildung durch neue Weltansichten: Perspektivenvielfalt, Perspektivenwechsel und Perspektivenübernahme durch Literatur«, in: Hallet, Wolfgang / Nünning, Ansgar (Hg.): Neue Ansätze und Konzepte der Literatur- und Kulturdidaktik. Trier 2007, S. 123 – 142, hier S. 135. 16 Ebd.
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
–
–
–
–
2.
329
beides regt auf Leserseite zur Perspektivübernahme und Auseinandersetzung an.17 Das Alter der Figuren und ihre durch die Textauswahl fokussierten Erfahrungen bspw. in der Schule bringen sie jungen Lesern näher, obwohl diesen der Kolonialkontext samt seiner existentiellen Konflikte zunächst fremd ist; hier bieten sich Bezüge zu ethnischen, religiösen oder (inter)kulturellen Konflikten in Gegenwartsgesellschaften infolge der globalen Migration an. Die Protagonisten – Jacques und Georges bei Camus, Mustapha und Rachid bei Yacine – lassen sich der relevanten Trias colonisateur – colonis¦ – m¦tropole18 zuordnen, brechen aber aufgrund ihrer jeweiligen Sozialisation und Erfahrungen die historisch richtige, der Komplexität realer Lebenszusammenhänge gleichwohl nicht entsprechende Täter/Opfer-Dichotomie teilweise auf. Im Textvergleich kann die angestrebte Differenzierung standpunktabhängiger Wahrnehmungen besser geleistet und aufgrund der eindeutigen kulturellen bzw. sozialen Zuordnung der verschiedenen Figuren abschließend in eine Koordination ihrer jeweiligen Perspektiven überführt werden.19 Schließlich ist die thematisch-inhaltliche Auseinandersetzung mit den Texten immer wieder um die (textanalytische) Berücksichtigung ihrer spezifisch literarischen Form zu ergänzen, um zu verstehen, auf welche Weise die perspektivische Vereinnahmung oder Distanzierung des Lesers erreicht werden.
Albert Camus: Le Premier homme
Das Romanfragment Le Premier homme wurde 1994, also erst 34 Jahre nach dem Unfalltod Camus’ aus dem Nachlass veröffentlicht. Das Thema dieser autobiographischen, literarisch gebrochenen Schrift ist die Rekonstruktion der in Algerien zwischen bitterer Armut und glücklichen Kinderjahren verbrachten Ju17 Vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung (Hg.): Richtlinien und Lehrpläne, a.a.O., S. 60. 18 Definiert sind die Begriffe m¦tropole bzw. m¦tropolitain innerhalb des Kolonialdiskurses als Frankreich (Staat) bzw. dessen Bewohner im Unterschied zur colonie bzw. deren unterschiedlichen Bewohnergruppen: den im vorliegenden Fall europäischen bzw. französischen colons oder colonisateurs sowie den kolonialisierten Einheimischen, den colonis¦s. 19 Vgl. für kontrastive Textbehandlungen in interkulturellen Lernkontexten mit ähnlicher Zielsetzung Wilma Melde: »Aspekte einer Didaktik des Fremdverstehens – erläutert am Thema ›Marseille, une ville riche en couleurs et en contrastes‹«, in: Börner, Wolfgang / Vogel, Klaus (Hg.): Kulturkontraste im universitären Fremdsprachenunterricht. Bochum 1997, S. 142 – 158; Michael Wendt: »Zum Thema ›Fremdheit‹ in Texten für den späteinsetzenden Spanischunterricht«, in: Christ, Herbert / Legutke, Michael K. (Hg.): Fremde Texte verstehen (Fs. für Lothar Bredella zum 60. Geburtstag). Tübingen 1996, S. 135 – 147.
330
Christoph Hoch (Bonn)
gend des Protagonisten Jacques Cormery, der unschwer als Alter-Ego des Autors Camus zu erkennen ist. Präsentiert wird die im Laufe einer Algerienreise stattfindende Erkundung der eigenen Ursprünge und die Suche nach dem unbekannten, früh verstorbenen Vater, Henri Cormery, aus der Perspektive eines Er-Erzählers. Dieser berichtet aus seiner Erzählgegenwart heraus, den vom Algerienkrieg geprägten späten 1950er Jahren, Vergangenes und Gegenwärtiges. Der Leser kann somit entscheidende Etappen der algerischen Vita des Autors in Romanform nachvollziehen: Die Geburt Camus’ am 7. November 1913 auf einem Weingut bei Mondovi im algerischen d¦partement Constantine; den Besuch der Grundschule von Belcourt (Algier); einige wenige Episoden aus den folgenden Jahren in der Hauptstadt, wo Camus bis 1940 lebte, das Gymnasium besuchte, Philosophie- und Literatur studierte und schließlich als Journalist tätig war sowie seine Gründe für die spätere Übersiedlung nach Frankreich. Im Zusammenhang mit dem skizzierten Unterrichtsprojekt interessiert der Roman als subjektiv perspektivierter Lebensbericht über eine Jugend in der französischen Kolonie Algerien,20 die Camus auch später explizit als zentralen Bezugspunkt seines Schreibens benannt hat.21 Ausgewählt wurden dafür zwei Textpassagen, die insofern die Individual- mit der Kollektivgeschichte verbinden, als dass darin auf der Figuren- bzw. Erzählerebene explizit (auto)biographische Erlebnisse mit Beobachtungen des historisch-gesellschaftlichen Kontextes verknüpft sind. Als Baustein für Interkulturelles Lernen im Sinne des Perspektivwechsels bietet sich der Text dadurch besonders an, dass der »kolonialistische Hintergrund mit seinen kulturellen, religiösen, sozialen Aspekten wie Konflikten« – anders als Jürg Altwegg meint – gerade nicht in »politisch und historisch äußerst differenzierter Form«22 dargestellt wird. Vielmehr überwiegt eine deutlich subjektiv gefärbte Perspektive, deren Voraussetzungen der Erzähler offen benennt. Auf der Leserseite kann damit zugleich emotionale Anteilwie kognitiv-analytische Distanznahme entstehen.
20 Raymond Gay-Crosier : »Camus urbi et orbi«, in: Ders. (Hg.): Albert Camus 20 : ›Le Premier homme‹ en perspective. Paris-Caen 2004, S. 3 – 11, hier S. 3: »Mais outre une autobiographie peine d¦guis¦e, ce fragment de roman promet aussi de retracer la p¦nible histoire de l’¦migration et des incessantes migrations des habitants d’une colonie en crise. Cependant, cette fresque transg¦n¦rationnelle assume d’embl¦e […] des proportions ¦piques et mythiques.« 21 Albert Camus: Essais, hg. von Roger Quillot und Louis Faucon. Paris (Bibl. de la Pl¦iade) 1965, S. 1892, Anm. 1: »Je n’ai jamais rien ¦crit qui ne se rattache de prÀs ou de loin la terre o¾ je suis n¦. C’est elle, et son malheur, que vont toutes mes pens¦es.« Quillot zitiert diese Stelle in seinem Kommentar zu den Discours de SuÀde aus einem Interview Camus’ mit Franc-Tireur. 22 Jürg Altwegg: »Der erste Fremde. Albert Camus’ algerische Kindheit«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (222) 23. 9. 1995 (Literatur).
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
331
2.1 Der erste, dem Kapitel »Lyc¦e« entnommene Textabschnitt23 beginnt mit einer Beschreibung des ersten Schultages Jacques’ am französischen Gymnasium in Algier : Lorsque […] Jacques Cormery […] vit le wattman, prÀs duquel Pierre et lui se tenaient l’avant de la motrice […] et que le v¦hicule quitta l’arrÞt de Belcourt, il se retourna pour essayer d’apercevoir, quelques mÀtres de l, sa mÀre et sa grand-mÀre, pench¦es encore la fenÞtre, pour l’accompagner encore un peu dans ce premier d¦part vers le myst¦rieux lyc¦e […]. (PH 185)
Es folgt eine eindringliche, auf wenige Seiten beschränkte sozio-kulturelle Verortung des Protagonisten im Kontext seines »pays d’immigration« (PH 186), der euro-algerischen Kolonialgesellschaft Algiers. Auf der einen Seite stehen Jacques, sein Freund Pierre und die Mutter, die nach dem frühen Tod ihres Mannes gezwungen war, mit dem Sohn bei der tyrannischen Großmutter in einem Armenvorort in Algier, Belcourt, unterzukommen. Auf der anderen Seite wartet die fremde und »geheimnisvolle« Welt des Innenstadt-Gymnasiums, das Jacques nur mit Hilfe eines Stipendiums besuchen kann. Geschickt zwischen erlebter Rede und kommentierendem Bericht wechselnd, versetzt der Erzähler den Leser zunächst in die Gegenwart einer von Armut, Ignoranz und sozialer Deklassiertheit gezeichneten Immigrantenfamilie: »[…] chez eux, l’ignorance ¦tait […] totale. Ni l’image, ni la chose ¦crite, ni l’information parl¦e, ni la culture superficielle qui nat de la banale conversation ne les avaient atteints.« (PH 186) Anstelle von Zeitungen, Büchern oder Radio lernt der Junge daheim nur die nötigsten Dinge des täglichen Bedarfs kennen. Das Milieu, in dem er aufwächst, ist geprägt von den Mitgliedern seiner »famille ignorante« (PH 186). Zudem fehlt der Vater. Ist dieser doch bereits 1914, also ein Jahr nach der Übersiedlung ins koloniale Algerien und der Geburt Jacques’ im Jahr 1913, zum Militär eingezogen worden, um gleich zu Beginn des Zweiten Weltkrieges an einer Verwundung in der Marneschlacht zu sterben. Die Mutter, wie die Großmutter eine Analphabetin (PH 189), bezieht daher eine kleine »pension de veuve de guerre« (ebd.). Gleichwohl ist sie gezwungen, als Putz- und Haushaltshilfe in Geschäften (ebd.) und bei wohlhabenderen Familien (PH 187) zu arbeiten, um so im täglichen Kampf um das Überleben wenigsten das Geld für die Ernährung ihrer Kinder zu verdienen. Relevant für das Thema Algerien ist diese Schilderung einer nahezu proletarischen Kolonialjugend aber nicht nur aufgrund ihrer Eindringlichkeit. Ali Y¦des hat hervorgehoben, dass die in Le Premier homme erzählerisch reinszenierte Familiengeschichte Camus’ als typisch für große Teile der euroalgerischen 23 Albert Camus: Le Premier homme. Paris (Gallimard) 1994, S. 185 – 192 (aus dem Beginn des ersten Kapitels des zweiten Teils). Zitate aus Le Premier homme (PH) werden im Folgenden mit Siglen- und Seitenangabe nachgewiesen.
332
Christoph Hoch (Bonn)
Kolonialgesellschaft gelten kann. Wie Jacques’ Familie erweist sich die Gemeinschaft meist armer europäischer Siedler in der Alg¦rie franÅaise insgesamt als eine »culture hybride«24 : Aufgewachsen in multikulturellen Familien (wie viele pieds-noirs ist Jacques das Kind eines Franzosen und einer Spanierin)25 und gänzlich fremd in der Araber- bzw. Berberkultur Nordafrikas, haben die europäischen Siedler-Emigranten einen Identitäts- und Traditionsverlust erlitten, der sie auch kulturell vom geographisch weit entfernten Mutterland trennt. Wie für viele andere seiner Generation lässt sich für den jungen Camus bzw. seinen Roman-Helden daher sagen, dass er zwar »franÅais de pÀre et de culture«26 ist. Seine identitätsstiftende Sozialisation aber findet im Spannungsfeld zwischen der France m¦tropolitaine, deren Kultur Jacques erst in der Schule kennen lernt,27 und der Regionalkultur statt. Dieses Milieu bleibt weitgehend unberührt von den »valeurs ou […] clich¦s traditionnels« (PH 187), etwa der bürgerlichen Wertetradition und dem Katholizismus Frankreichs. Hier spricht man ein Französisch, das in Ausdruck und Akzent einen »alg¦rianisme des bas-fonds«28 verrät, oder (wie im Umfeld Jacques’) Spanisch und lebt mit mehr oder weniger starken lokalen Einflüssen. Das gilt zumal für die in Algerien geborene Generation armer Siedlerkinder, deren Milieu sie in Spiel und Schule auch mit arabischen Kindern in Kontakt bringt.29 Y¦des zufolge ist für diese vom westlichen Imperialismus hervorgebrachte Gesellschaft ein ambivalentes Verhältnis zum Land, in dem sie lebt, charakteristisch. Das betrifft einerseits die enge Verbundenheit mit dem nordafrikanischen Land, das den Francoalgeriern zwar politisch nicht gehört, dem sie aber physisch und affektiv untrennbar und alternativlos verbunden sind. Andererseits ist damit das oft von der Vorstellung eigener Überlegenheit geprägte Verhältnis zur autochthonen arabischen Bevölkerung berührt. Ohne hier auf die unter noch zu erörternde Frage der politischen Haltung gegenüber den colonis¦s in Le Premier homme näher einzugehen, ist zunächst festzuhalten, dass der Erzähler Jacques’ Weg ins Gymnasium 24 Ali Y¦des: Camus l’Alg¦rien. Paris 2003, S. 15. 25 Albert Camus: »L’Êt¦«, in: Ders.: Essais, a.a.O., S. 848: »Les FranÅais d’Alg¦rie sont une race btarde, faite de m¦langes impr¦vus. Espagnols et Alsaciens, Italiens, Maltais, Juifs, Grecs enfin s’y sont rencontr¦s.« 26 Abdallah Naaman: La Mort de Camus. Beyrouth 1980, S. 38. 27 Vgl. den Erzählerkommentar (PH 68) zu den mehr als vagen Vorstellungen, die Jacques’ spanischstämmige Mutter – »[…] qui ne pouvait mÞme pas avoir l’id¦e de l’histoire ni de la g¦ographie, qui savait seulement qu’elle vivait sur de la terre prÀs de la mer […]« – von Frankreich hat: »[…] la France ¦tait de l’autre cút¦ de la mer […], ¦tant d’ailleurs un lieu obscur perdu dans une nuit ind¦cise o¾ l’on abordait par un port appel¦ Marseille qu’elle imaginait comme le port d’Alger, o¾ brillait une ville qu’on disait trÀs belle et qui s’appelait Paris […].« 28 Anne Durand: Le cas d’Albert Camus (L’Êpoque camusienne). Paris 1961, S. 43 f. 29 PH 218: »On pouvait jouer au football, le plus souvent avec une balle de chiffon et des ¦quipes de gosses, arabes et franÅais, qui se formaient spontan¦ment.«
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
333
zum Anlass für einen kritischen Kommentar über die ethnischen oder besser rassistischen Grenzen der Kolonialgesellschaft nimmt. Angedeutet wird dabei auch, dass die erlebte Realität die politische Rhetorik der kolonialen Administration, der zufolge alle Bewohner dieses nordafrikanischen d¦partement Franzosen sind, dementiert: Dans ce pays d’immigration […] les frontiÀres entre les classes ¦taient moins marqu¦es qu’entre les races. Si les enfants [Jacques et Pierre, C.H.] avaient ¦t¦ arabes, leur sentiment et ¦t¦ plus douloureux et plus amer. Du reste, alors qu’ils avaient des camarades arabes l’¦cole communale, les lyc¦ens arabes ¦taient l’exception, et ils ¦taient toujours des fils de notables fortun¦s. (PH 186 f.)
Dass die Grenzen zwischen den »races« nahezu unüberwindbar sind, heißt aber nicht, dass die Differenzen zwischen den »classes« deshalb verschwinden. Deutlich wird das bereits am ersten Schultag. Zusammen mit den schwer wiegenden sozialen Unterschieden, die Jacques hier erstmals bewusst werden, klärt sich dabei auch die Rolle, die die Metropole im kolonialen Algerien seiner Jugendjahre spielt. Tatsächlich kommt es bereits bei den zu Schuljahrsbeginn üblichen Fragen nach dem familiären Status zu einem regelrechten clash zwischen der kolonialen Unter- und Oberschichtenkultur : Jacques Konfessionszugehörigkeit erscheint zweifelhaft (PH 186); es stellt sich heraus, dass seine Mutter als Putzfrau in die sozial stigmatisierte Berufsgruppe der »domestique[s]« (PH 187) fällt; und zur Verblüffung des Vorstadtjungen irritiert den Lehrer auch der offen zugegebene Analphabetismus der Familie Jacques’ (PH 189 f.). Die Erfahrung der eigenen alg¦rianit¦ und der durch den Tod des Vaters ausgelösten sozialen Deklassiertheit löst in Jacques ein Gefühl der Scham aus: »d’un seul coup il [Jacques, C.H.] connut la honte et la honte d’avoir honte« (PH 187). Dieses Gefühl der ihn isolierenden »singularit¦« (PH 186, 187) wird sich im Laufe des späteren sozialen Aufstiegs des Protagonisten und seiner Übersiedlung nach Frankreich nach und nach zu einem regelrechten Schuldkomplex steigern. Relevanter für den vorliegenden Kontext aber ist etwas anderes. Jacques macht in der neuen Schule noch eine weitere irritierende Entdeckung: »Il ¦tait encore plus d¦sorient¦ par les jeunes m¦tropolitains que les hasards de la carriÀre paternelle avaient men¦s Alger« (PH 190). Einer diese privilegierten Neuankömmlinge ist Georges Didier, mit dem Jacques sich aufgrund gemeinsamer Lektürevorlieben vorübergehend anfreundet. Dieser vom Erzähler auf zwei Seiten porträtierte »fils d’un officier catholique trÀs pratiquant« (ebd.) gerät zur idealen Kontrastfigur Jacques’. Georges’ Vater ist ein katholischer Offizier, seine Mutter frönt der Hausmusik, die Schwester widmet sich der Stickerei. Der Junge selbst, der im Unterschied zu Jacques klare Vorstellungen »de
334
Christoph Hoch (Bonn)
la foi et de la morale« (ebd.) besitzt, wird für Camus’ Alter-Ego zur »exotischen« (PH 192) Verkörperung der ihm fremden eurofranzösischen bürgerlichen Identität: C’est avec Didier que Jacques comprit ce qu’¦tait une famille franÅaise moyenne. Son ami avait en France une maison de famille o¾ il retournait aux vacances […] et o¾ l’on conservait les lettres de la famille, des souvenirs, des photos. Il connaissait l’histoire de ses grands-parents et des arriÀre-grands-parents, d’un aeul aussi qui avait ¦t¦ marin Trafalgar, et cette longue histoire, vivante dans son imagination, le fournissait aussi d’exemples et de pr¦ceptes pour la conduite de tous les jours. (PH 190 f.)
Camus’ Erzähler kommentiert diese Differenz-Erfahrung mit dem Hinweis darauf, dass Jacques (wie auch Pierre) alle Attribute einer derart gesicherten Identitätskonstruktion fehlen, einschließlich moralischer Wertvorstellungen. Denn Jacques verfüge nur über eine »morale des plus ¦l¦mentaires« (PH 192), die ihm zwar den Unterschied zwischen Recht und Unrecht erkennen lasse, aber nicht zwischen Gut und Schlecht zu differenzieren erlaube. Allein gelassen fühlt Jacques sich auch von einer anderen Instanz, Frankreich, oder wie Georges es unter Verwendung einer Vokabel nennt, die Jacques nicht kennt und die seine Mutter ihm nicht erklären kann, der »patrie« im fernen Europa:30 »[…] quand il [Georges, C.H.] parlait de la France, il disait ›notre patrie‹ et acceptait d’avance les sacrifices que cette patrie pouvait demander.« (PH 191) Das betrifft die Kolonialfrage, die Jacques als solche gar nicht bewusst ist, ebenso wie den Tod des Vaters, den der Junge schmerzhaft vermisst. Dass es neben seiner privaten auch eine politische Haltung zum Tod gibt, erklärt ihm Georges mit den Worten: »[…] ton pÀre est mort pour la patrie« (PH 191). Was ist damit gemeint? Jacques versucht, die Worte des Freundes vor dem Hintergrund des eigenen vagen Wertehorizonts zu deuten: […] pour lui la France ¦tait une absente […], un peu comme […] ce Dieu dont il avait entendu parler hors de chez lui et qui, apparemment, ¦tait le dispensateur souverain des biens et des maux, sur qui on ne pouvait influer mais qui pouvait tout, au contraire, sur la destin¦e des hommes. (PH 191)
Anstelle von Nationalismus und Religion – zwei Größen, die für das koloniale Sendungs- und Überlegenheitsgefühl la Georges eine zentrale Rolle spielen – steht das Leben der petits blancs von Belcourt unter einem anderen Stern: Jacques, et Pierre aussi, […] se sentait d’une autre espÀce, sans pass¦, ni maison de famille, ni grenier bourr¦ de lettres et de photos, citoyens th¦oriques d’une nation impr¦cise o¾ la neige couvrait les toits alors qu’eux-mÞmes grandissaient sous un soleil 30 PH 191: »›Maman, qu’est-ce que c’est la patrie?‹ avait-il dit un jour. Elle avait eu l’air effray¦ comme chaque fois qu’elle ne comprenait pas. ›Je ne sais pas, avait-elle dit. Non. – C’est la France. – Ah! Oui!‹ Et elle avait paru soulag¦e.«
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
335
fixe et sauvage […], enfants ignor¦s et ignorants de Dieu […], incapables de concevoir la vie future tant la vie pr¦sente leur paraissait in¦puisable chaque jour sous la protection des divinit¦s indiff¦rentes du soleil, de la mer ou de la misÀre. (PH 192)
Entsprechend reklamiert der Erzähler für Jacques und seinesgleichen eine für Camus typische apolitische, von Sonne, Landschaftserleben und Armut geprägte ›mittelmeerische‹ Identität. Für die formulierte Fragestellung ist es relevant, auf die überindividuelle Repräsentativität der in Le Premier homme formulierten Erfahrungen des Halbwaisen hinzuweisen. Hilfreich dafür ist wieder Y¦des’ sozialgeschichtliche Rekonstruktion.31 Er weist darauf hin, dass viele der ersten Siedlergeneration an ihnen unbekannten Krankheiten starben, während weiter besonders Junggesellen in die Kolonie strömten, die schon bei der Ankunft an eine baldige Rückkehr nach Frankreich dachten. Erleichtert durch nur schwach ausgeprägte religiöse Wertbindungen, kam es daher zur Geburt zahlreicher unehelicher Kinder, die bei ihren alleinerziehenden Müttern aufwuchsen. Für die vaterlose Jugend anderer trug die Metropole direkt die Verantwortung. Schon während des Ersten Weltkrieges ordnete sie eine Massenmobilmachung unter den arabischen und französischen Algeriern an, die so zahlreich im Feindfeuer starben, dass sie unzählige Waisenkinder zurückließen: […] les troupes d’Afrique […] fondaient sous le feu comme des poup¦es de cire multicolores, et chaque jour des centaines d’orphelins naissaient dans tous les coins d’Alg¦rie, arabes et franÅais, fils et filles sans pÀre qui devraient ensuite apprendre vivre sans leÅon et sans h¦ritage. (PH 70)
Die von der großen Geschichte verantwortete Vaterlosigkeit erlebt Jacques als moralisches Vakuum. Rückblickend erkennt er : »J’ai besoin de mon pÀre«.32 Das Schicksal des »monstre« Jacque ist aber auch ein kollektives, sein Blick auf die eigene Jugend in Algerien, seine als Geschichts- und Traditionslosigkeit empfundene alg¦rianit¦, sein Fremdheitsgefühl und seine Vorwurfshaltung gegenüber Frankreich – all dies darf als ebenso repräsentativ gelten wie die affektive Verbundenheit mit dem Kolonialland. 2.2 Aufgegriffen und vertieft werden diese Themen in der zweiten ausgewählten Passage, dem Kapitel »Mondovi: La colonisation et le pÀre«.33 Auf der Ebene der
31 Zum Folgenden vgl. Ali Y¦des: Camus, a.a.O., S. 140 f. 32 PH 40: »J’ai essay¦ de trouver moi-mÞme, dÀs le d¦but, tout enfant, ce qui ¦tait bien et ce qui ¦tait mal – puisque personne autour de moi ne pouvait me le dire. Et puis je reconnais maintenant que tout m’abandonne, que j’ai besoin que quelqu’un me montre la voie et me donne blme et louange, non selon le pouvoir mais selon l’autorit¦, j’ai besoin de mon pÀre.« 33 PH 165 – 182 (siebtes und letztes Kapitel des ersten Romanteils). Für eine Übersicht über die
336
Christoph Hoch (Bonn)
Textorganisation geht dieses Kapitel der ersten Textstelle voraus, sollte aber aufgrund seines Inhaltes und seiner chronologisch späteren Position auf der Ebene der Handlungsfolge, der histoire des Romans, erst nach der Schulszene behandelt werden. Am Ende seiner »Recherche du pÀre« – wie der erste Teil des Romans programmatisch überschrieben ist – reist Jacques vor dem Hintergrund des tobenden Algerienkrieges nach Mondovi, seinem kleinen ostalgerischen Geburtsort. Wie der Leser später erfährt, hatte der Vater Henri, ein Elsässer, hier 1913 die Stelle eines Gutsverwalters angenommen und damit sein kurzes Kolonialabenteuer begonnen. Er kam als einer jener 1871 vor den Deutschen geflohenen »pers¦cut¦s-pers¦cuteurs« (PH 178) nach Nordafrika, wo ihm wie so vielen anderen von der französischen Regierung ein algerischer Grundbesitz als Siedlungsland zugewiesen wurde, dessen einheimischer Besitzer während eines Aufstandes gegen die Kolonialherren getötet worden war. Die evozierte Gegenwart der Kapitelhandlung ist die des Er-Erzählers, wobei mehrfach zwischen dessen Gegenwart und verschiedenen Ebenen der erinnerten oder von anderen Figuren erzählten Vergangenheit gewechselt wird. Bereits die ersten Zeilen markieren den zeitlichen Abstand zur Kindheit: Maintenant il ¦tait grand… Sur la route de Búne Mondovi, la voiture o¾ se trouvait J. Cormery croisait des jeeps h¦ris¦es de fusils et qui circulaient lentement… (PH 165)
Auf seiner Suche nach Zeitzeugen begegnet Jacques im Folgenden dem alten Arzt, der Hilfe bei seiner Geburt geleistet hatte, dem arabischen Wärter Tamzal sowie, kurz nach der Ankunft, dem gegenwärtigen Bewohner und Bewirtschafter des Mondovi-Guts, dem colon Veillard. Tatsächlich kommt Jacques im sprichwörtlich letzten Moment. Durch koloniale Gewalt und dadurch ausgelöste Gegengewalt der colonis¦s ist die Gegend für Franzosen nahezu unbewohnbar geworden. Die meisten, so Veillard, seien nach den letzten Gräueltaten durch aufständische Einheimische und den darauf folgenden Evakuierungsdirektiven der Kolonialverwaltung zur Aufgabe gezwungen worden.34 Dass Jacques »p¦lerinage« (PH 166) zum Elternhaus vergeblich ist, hat aber einen anderen Grund, Kapitelhandlung vgl. Klaus Bahners: Erläuterungen zu Albert Camus ›Der erste Mensch‹. Hollfeld 2000, S. 41 f. 34 PH 167: »›La r¦gion ¦tait devenue invivable. Il fallait dormir avec le fusil. Quand la ferme Raskil a ¦t¦ attaqu¦e, vous vous souvenez? – Non, dit Jacques. – Si, le pÀre et ses deux fils ¦gorg¦s, la mÀre et la fille longuement viol¦es et puis mort… Le pr¦fet avait eu le malheur de dire aux agriculteurs assembl¦s qu’il fallait reconsid¦rer les questions [coloniales], la maniÀre de traiter les Arabes et qu’une page ¦tait tourn¦e maintenant.‹« Zur Geschichte der Wiedereingliederung der schätzungsweise 900.000 pieds-noirs nach deren Rückkehr nach Frankreich vgl. Anthony Rowley : »La R¦insertion ¦conomique des rapatri¦s«, in: Rioux, Jean-Pierre (Hg.): La Guerre d’Alg¦rie et les FranÅais (Colloque de l’Institut d’histoire du temps pr¦sent). Paris 1990, S. 348 – 352.
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
337
wie Veillard weiter erklärt: »Ici, on ne garde rien. On abat et on reconstruit. On pense l’avenir et on oublie le reste.« (ebd.) Dieser vergessene oder besser verdrängte »Rest«, wie Veillard es nennt, umfasst alles, was Jacques sucht: die Geschichte und Identität seines Vaters. Die Geschichtsvergessenheit der Siedler ist unverkennbar eine Schutzhaltung, denn im Unterschied zum zivilisierten Europa ist die Welt der armen colons geprägt von kultureller Identitätslosigkeit und Traditionsverlust.35 Mit Härte gegen sich, die Kinder und die »ouvriers arabes« (PH 167) haben die Siedler alten Schlages unter schwierigen Bedingungen ihre Existenz aufgebaut. Unabdingbar dafür war die bei den meisten nun schwindende Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Als Reaktion auf diese Enttäuschung reist Jacques durch eine malerisch evozierte Landschaft in Begleitung Veillards zum alten Arzt nach Solferino zurück, wo er zwar wieder nichts Näheres über den Vater erfährt, dafür aber eine detaillierte Erzählung über die Kolonialgeschichte zu hören bekommt. Es folgt eine achtseitige, vom Beginn der Kolonialisierung um die Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Erzählgegenwart reichende Geschichtsbetrachtung, in der es dem Autor nicht um die Darlegung eines korrekten politischen Bewusstseins geht, sondern um die zwangsläufig einseitigen Sicht jener Einwanderer, als deren Kind der Leser Jacques im ersten Textauszug kennen gelernt hat. Darin mischen sich wichtige landeskundliche und historische Fakten mit eindringlichen Bildern des Leids – und zwar nicht der colonis¦s, sondern der colons. Die Schilderung der von den »regards hostiles des Arabes« (PH 174) begleiteten Landnahme durch die europäischen »¦migrants« (ebd.) verdichtet sich nach und nach zu einem nahezu apokalyptischen Szenario: Auf ihren verstreut gelegenen Parzellen angekommen, kämpfen sie gegen das Klima, sintflutartigen Regen und die Cholera; sie wehren sich gegen Löwen, Viehdiebe, arabische Banden und Überfälle durch anderen französische Kolonien (PH 176). Der Tod ist allgegenwärtig: »[…] les deux tiers des ¦migrants ¦taient morts, l comme dans toute l’Alg¦rie, sans avoir touch¦ la pioche et la charrue.« (ebd.) Wer aber überlebte, musste nicht nur den täglichen Kampf ums Dasein bestehen, sondern auch die großen »insurrections« (ebd.) der Einheimischen in den folgenden Jahrzehnten. In diesem Zusammenhang wird auch die kritische Sicht auf die m¦tropole erneut deutlich: Die einfachen colons (und mehr noch die Angestellten und Lohnarbeiter unter den FranÅais d’Alg¦rie) leisten in einer stets gefährlichen Umgebung harte Arbeit, deren Gewinn allein die ferne Metropole einstreicht; die Opfer des Kolonialsystems sind hier eindeutig die Algerienfranzosen, während Camus in 35 PH 181 (mit dem einzigen Rekurs auf einen Ich-Erzähler im Roman): »La M¦diterran¦e s¦parait en moi deux univers, l’un o¾ dans des espaces mesur¦s les souvenirs et les noms ¦taient conserv¦s, l’autre o¾ le vent de sable effaÅait les traces des hommes sur de grands espaces.«
338
Christoph Hoch (Bonn)
den Bewohnern Frankreichs die eigentlichen »profiteurs de la colonisation«36 erkennt. Der Erzähler lässt seinen Protagonisten große Teile dieser Geschichte auf dem Rückflug von Solferino nach Algier Revue passieren. Den Vater imaginiert Jacques dabei als eine anonyme Figur in der Masse der vergessenen Einwanderer. Den »air sombre et tourn¦ vers l’avenir« (PH 177) der Siedler, dem er bei der Ankunft in Mondovi begegnet war und den er bereits von zu Hause kennt, versteht er jetzt als generationsübergreifendes Kondensat einer Lebenserfahrung. Waren die meisten der späteren colonisateurs doch auf der Flucht vor Not und Verfolgung nach Afrika gezogen, wo nicht das versprochene Glück, sondern die »rencontre de la douleur et de la pierre« (PH 178) auf sie wartete. Als Fazit zum Leben in der jetzt endgültig in die Krise geratenen Kolonie formuliert der Protagonist: »Toutes ces g¦n¦rations, tous ces hommes venus de tants de pays diff¦rents […] avaient disparu sans laisser de traces, referm¦s sur euxmÞmes. Un immense oubli s’¦tait ¦tendu sur eux […].« (PH 179) Die Suche nach dem Vater gerät damit vollends zur Begegnung mit der Geschichte – und zwar in existentielle, ja mythischer Dimension. Denn in dem Maße wie Jacques versteht, dass er seinen Vater niemals kennen lernen wird, gelangt er zu einer erst durch dieses Scheitern möglichen Einsicht: »[…] il n’y avait que le mystÀre de la pauvret¦« (PH 180). Die Armut des Kolonialistenlebens führt in die existentielle Anonymität – »l’anonymat« (ebd.) – oder das Vergessen: »[…] l’oubli o¾ chacun ¦tait le premier homme, o¾ lui-mÞme avait d s’¦lever seul […]« (PH 181). Gleich dem Vater oder jedem anderen colons sieht Jacques daher auch sich als einen »ersten Menschen«, einen, den das koloniale Schicksal um all das beraubt hat, was er als Jugendlicher im Umgang mit Georges kennen gelernt hatte und später ganz alleine für sich finden musste: eine Moral und eine Wahrheit, um ein Mensch zu werden.37 Er selbst hatte diese »vie pauvre« in Algerien nicht ertragen und war deshalb nach Frankreich geflohen,38 um jetzt durch die Rückkehr in seine »vraie patrie« (PH 182) in sich die Ursprünge des Kindes einer ihrem Ende 36 Albert Camus: »Chroniques alg¦riennes (La bonne conscience)«, in: Ders.: Essais, a.a.O., S. 973 – 975, hier S. 974. In diesem im Oktober 1955 in L’Express erschienenen Artikel beklagt Camus das schlechte, von Missverständnissen und der Gleichgültigkeit Frankreichs geprägte Verhältnis »entre la m¦tropole et les FranÅais d’Alg¦rie« (ebd., S. 973); er geht dabei auch näher auf die Situation letzterer ein: »Ils sont n¦s l-bas, ils y mourront, et voudraient seulement que ce ne soit pas dans la terreur ou la menace, ni massacr¦s au fond de leurs mines. Faut-il donc que ces FranÅais laborieux, isol¦s dans leur bled et leurs villages, soient offerts au massacre pour expier les immenses p¦ch¦s de la France colonisatrice?« (ebd., S. 974) 37 PH 181: »[…] il lui avait fallu apprendre seul, grandir seul, en force, en puissance, trouver seul sa moral et sa v¦rit¦, natre enfin comme homme […].« 38 PH 181 f.: »Lui avait essay¦ d’¦chapper l’anonymat, la vie pauvre […], il n’avait pu vivre au niveau de cette patience aveugle, sans phrases, sans autre projet que l’imm¦diat.«
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
339
zugehenden Kolonialepoche aufzudecken: den »homme monstrueux et [banal]« (PH 182 [Klammer im Original]). Es kann nicht überraschen, dass auch die Darstellung des Landes auf diesen Seiten die oben bereits konstatierte Ambivalenz bestätigt und vertieft. Einerseits ist Algerien das mythisch-mittelmeerische »pays de l’hospitalit¦« (PH 170), in dem Jacques inmitten der Armut, unter südlicher Sonne und in herzlicher Verbundenheit mit Verwandten und Freunden seine Jugend verbringt. Andererseits mutiert der nordafrikanische »rivage heureux« (PH 182) als Kolonialland zu einem »pays immense et hostile« (PH 172), zu einem »pays ennemi, qui refusait l’occupation« (PH 176) und wird als »pays sans nom« (PH 180) den Kolonisatoren zu einer Wüste, in der sie zum Untergang in Elend und Anonymität verdammt sind. Dem »Rest«, um das oben zitierte Wort Veillards aufzugreifen, nämlich Algerien als Heimatland der arabischen Algerier, wird der Leser in Camus’ Rekonstruktion seiner Jugend in den Kolonien nicht begegnen. Ähnliches gilt für die damit berührte Darstellung der colonis¦s. Auch wenn die Araber in Le Premier homme deutlich individueller und positiver beschrieben werden als in anderen literarischen Werken Camus’, ist doch verschiedentlich kritisch bemerkt worden, dass sie nicht in ihrer »spezifischen sozialen, historischen und politischen Befindlichkeit« als Teil des Kolonialsystems gesehen werden.39 Tatsächlich ragen aus der immer wieder als Bedrohung dargestellten anonymen Masse der Einheimischen – »[…] ils ¦taient si nombreux […] que par leur nombre, bien que r¦sign¦s et fatigu¦s, ils faisaient planer une menace invisible qu’on reniflait dans l’air des rues […]« (PH 257 f.) – nur einzelne Figuren wie der erwähnte Tamzal als namentlich erwähnte positive Bezugspersonen heraus. Gleichwohl formulieren die hier zur Lektüre vorgeschlagenen Seiten eine elementare Nähe zu den »Verdammten dieser Erde« (Frantz Fanon). Am Ende seiner kolonialen Leidensgeschichte nähert sich der zwischen dem m¦tropolitain einerseits und dem colonis¦ andererseits stehende colonisateur letzterem an. Jacques eigene »tribu« (PH 180) müsse, wie es am Ende des Kolonialismuskapitels heißt, ihre »fraternit¦ de race et de destin« (PH 181) mit den einheimischen Algeriern erkennen. Damit wird selbstverständlich Wesentliches unterschlagen. Der nach innen gerichtete Blick auf eigene Befindlichkeit fokussiert die zwischen nostalgischer Verklärung, Verbitterung und Trotz changierende Reaktion auf die koloniale Realität. Anders als etwa in den zeitgenössischen politischen Zeitungsartikeln Camus’ gerät dabei die repressive äu39 Wolf Albes: »Glückliche Kindheit im kolonialen Algerien? Albert Camus’ ›Le Premier Homme‹ (1959/1994) und Jean P¦l¦gris ›Les Oliviers de la Justice‹ (1959/1961) – ein Vergleich zweier Rückblicke«, in: Arend, Elisabeth / Kirsch, Fritz Peter (Hg.): Der erwiderte Blick, a.a.O., S. 39 – 50, hier S. 42. Vgl. dort auch die vielen Stellennachweise zur positiven Darstellung einzelner Araber-Figuren. Zur »repr¦sentation de la population alg¦rienne autochtone« siehe ferner Ali Y¦des: Camus, a.a.O., S. 26 f.
340
Christoph Hoch (Bonn)
ßere Reaktion vieler Vertreter dieses »Stammes« ebenso in Vergessenheit wie die mehr als nur feinen Unterschiede, die dann doch zwischen armem pied-noir und arabe bestanden haben. Dazu passt auch die optimistische Zukunftsprognose, die Veillard inmitten des gewaltsamen Konfliktes zwischen beiden Gruppen stellt: On est fait pour s’entendre. Aussi bÞtes et brutes que nous, mais le mÞme sang d’homme. On va encore un peu se tuer, se couper les couilles et se torturer un brin. Et puis on recommencera vivre entre hommes. C’est le pays qui veut Åa. (PH 168 f.)
Verständlich wird dieses politische Fehlurteil des colon vielleicht als Ergebnis eines 100-jährigen Assimilationsprozesses.40 Der Autor des Romans, Camus, jedenfalls schien dieses Credo zu teilen. Als er 1957 kurz der Verleihung des Nobelpreises nach dem Grund für sein Schweigen zur Algerienfrage und nach seiner Haltung zum Unabhängigkeitskampf befragt wurde, antwortete er : »J’ai ¦t¦ et je suis toujours partisan d’une Alg¦rie juste, o¾ les deux populations doivent vivre en paix et dans l’¦galit¦.«41
3.
Kateb Yacine: Nedjma
Der 1929 in Constantine geborene Kateb Yacine schuf mit seinem ersten, 1956 erschienen Roman Nedjma ein sogleich breit rezipiertes Referenzwerk für die damals noch junge frankophone Literatur Algeriens, wo das Werk bis heute als Klassiker gilt.42 Aus Protest gegen den französischen Kolonisator behielt der Autor die beim Aufrufen von Personen in der Verwaltungspraxis übliche Umkehrung von Vor- und Familiennamen bei und nannte sich Kateb (eigentlich der Nachname) Yacine (ursprünglicher Vorname). Der Sohn einer angesehenen algerischen Juristenfamilie besuchte in S¦tif das städtische collÀge, als er 1945 mit sechzehn Jahren eher zufällig die auch für ihn prägende Erfahrung des Aufstandes von S¦tif machte. Als Teilnehmer an den nationalistischen Demonstrationen, die mit einem Massaker französischer Militär- und Polizeiangehöriger an 40.000 Algeriern endete, wurde er inhaftiert. Während der ohne Verhandlung erduldeten Haft entdeckte Yacine eigenen Aussagen zufolge seine 40 Klaus Bahners: Erläuterungen, a.a.O., S. 41. 41 Zitiert nach Olivier Todd: Albert Camus: Une vie, Paris 1996, S. 700. Zu der auf algerischer Seite teilweise sehr vehement geführten Auseinandersetzung mit den Aussagen und dem späteren Schweigen Camus’ zur Kolonial-Problematik vgl. die reich dokumentierte Darstellung von Christiane Chaulet-Achour : »Albert Camus, l’Alg¦rien. Tensions citoyennes, fraternit¦s litt¦raires«, in: Association ›Les Rencontres M¦diterran¦ennes Albert Camus’ (Hg.): Albert Camus et les ¦critures alg¦riennes. Quelles traces? Aix-en-Provence 2004, S. 13 – 33. 42 Zur fortune des Romans vgl. Charles Bonn: Kateb Yacine ›Nedjma‹. Paris 1990, S. 112 – 123.
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
341
Leidenschaft für die nationale Befreiung und die Literatur.43 Nach dem Abbruch der vom Vater gewollten Fortsetzung der Schullaufbahn an einem Gymnasium in Búne (heute Annaba) trat er bereits mit siebzehn Jahren als Autor literarischer Texte und als Journalist (wie Camus in der Redaktion des Alger R¦publicain) hervor und wurde im Laufe seines unsteten, u. a. von Gelegenheitsjobs und Reisen, beispielsweise nach Frankreich, gezeichneten Lebens als einer der ersten Autoren der frankophonen Literatur Nordafrikas zu einem viel beachteten Verfechter des politischen Befreiungskampfes besonders der algerischen Berber. Diese Erfahrungen schreiben sich auch in Yacines Debutroman Nedjma ein. Eindringlich wirken sie vor allem deshalb, weil der Autor auf plakative politische Aussagen verzichtet und einen perspektivisch gebrochenen, polyphonen Roman vorlegt, der als »rencontre […] entre l’histoire collective et l’histoire individuelle«44 verstanden werden kann. Im Mittelpunkt der Handlung stehen vier annähernd gleichaltrige jugendliche Freunde: Lakhdar, Mourad, Rachid und Mustapha. Wie Kateb Yacine sind sie Angehörige des ostalgerischen Stammes des ursprünglich türkischen Ahnvaters Keblout, werden in mehr oder weniger direkter Weise durch den Aufstand von S¦tif geprägt und setzen sich daraufhin politisch für die nationalistische Befreiung von der französischen Kolonialmacht ein. Ihre Viten bringen sie folglich in Konflikt mit dem herrschenden Gesetz: Lakhdar und Mustapha nehmen im Schüleralter am Aufstand von S¦tif teil, werden inhaftiert und gefoltert; Mourad tötet den rassistischen französischen Bauunternehmer Ricard und wird ebenso wie Rachid, der während des Krieges aus der Armee desertiert, von der Polizei aufgegriffen und ins Gefängnis von LambÀse gesperrt. Gemeinsam ist den vier Protagonisten zudem ihre Leidenschaft für die eponyme Heldin Nedjma. Nedjma (das arabische Wort für »Stern«)45 kann als Symbol für Algerien gedeutet werden und bildet den gemeinsamen Bezugspunkt der achronologisch-assoziativ erzählten JungmännerViten, die bis in die 1950er Jahre reichen und – wie die Algerienreise in Le Premier homme – u. a. im ostalgerischen Búne (Annaba), in S¦tif, Guelma oder Constantine angesiedelt sind. Die vier Lebensgeschichten zeigen also unverkennbar autobiographische Züge.46 Auch aus diesem Grund lassen sich die vier
43 Im Nouvel Observateur vom 18. Januar 1967 beschreibt Kateb Yacine rückblickend die Wirkung des S¦tif-Aufstandes mit den Worten: »J’ai d¦couvert alors les deux choses qui me sont les plus chÀres, la po¦sie et la r¦volution.« Zit. nach Charles Bonn: Kateb Yacine, a.a.O., S. 9. 44 Charles Bonn: Kateb Yacine, a.a.O., S. 11. 45 Vgl. Charles Bonn: Kateb Yacine, a.a.O., S. 10, der Nedjma als »symbole en partie de la nation venir« deutet und in diesem Zusammenhang auf den Umstand verweist, dass Yacine Mitglied des von Messali Hadj gegründeten Etoile Nord-Africaine (ENA) war. 46 Vgl. dazu ausführlicher Peter Sarter : Kolonialismus im Roman, a.a.O., S. 125 – 129.
342
Christoph Hoch (Bonn)
Protagonisten als dem Autor verwandte Alter-Ego-Figuren oder gar als eine »Art kollektiver Held«47 verstehen. 3.1 Im Mittelpunkt des ersten, gut zehnseitigen Romanauszugs stehen Mustaphas Schulerlebnisse sowie seine spätere, im unmittelbaren Anschluss an die Gymnasialzeit geschilderte Teilnahme am S¦tif-Aufstand im Jahr 1945.48 Sozialisiert im kleinstädtischen Milieu halbwegs wohlhabender, assimilierter Algerier, gehört er jener Schicht an, die Jacques Comery als »fils de notables fortun¦s« kennen gelernt hat: Sein Vater, Mohamed Gharib, arbeitet als beamteter Übersetzer in Guelma und ist nach dem Erwerb des Diploms eines oukil im Jahre 1919 zum Zeitpunkt der Erzählgegenwart von Mustaphas Schulbesuch als Anwalt des muslimischen Rechts tätig. Aber obwohl die Familie damit echter Armut enthoben ist, der Vater einen freundlichen Umgang mit den petits blancs seines Viertels in S¦tif pflegt und der Junge die französische Schule besucht, bleiben die Verhältnisse prekär – und dies nicht nur in finanzieller Hinsicht. Aus ganz anderer Perspektive als bei Camus und mit notgedrungen schärferem Blick für das gesellschaftliche Ganze der Kolonialordnung wird auf diesen Seiten geschildert, wie die arabische Identität des jugendlichen Protagonisten und damit auch die Differenz zwischen colonisateur und colonis¦ im Bewusstsein Mustaphas Gestalt annimmt. Das verdeutlicht eine Szene, in der die Schüler nach dem Schulschluss von den Eltern abgeholt werden: A quatre heures, Matre Gharib attend son fils la sortie. Mustapha ne voit que le pantalon bouffant et le fez. Il rougit. Les ¦coliers s’attroupent devant l’oukil. Leurs pÀres, eux, ont srement des chapeaux et des pantalons longs; Mustapha sent les larmes venir; les autres restent group¦s autour du PÀre; curiosit¦ ou m¦pris? Un uniforme pour tous les pÀres; voil ce qu’implore le regard mouill¦ de Mustapha […]. (N 216 [Hervorhebung im Original])
Fez und Pluderhose des Vaters werden für den Sohn, der wie die Mitschüler und deren Väter » la franÅaise« (N 213) gekleidet ist, zu den Erkennungsmarken seiner Andersheit. Der Junge reagiert beschämt. Die Innensichtperspektive zeigt, dass er sich an den anderen orientiert (empfinden sie beim Anblick seines 47 Brigitte Sändig: »Zweimal algerische Nationalgeschichte«, a.a.O., S. 30. 48 Kateb Yacine: Nedjma. Paris (Êditions du Seuil) 1956, S. 216 – 222 (Kapitel X – XII des 5. Teils) und S. 225 – 229 (Kapitel I – II des sich anschließenden 6. Teils). Zitate aus Nedjma (N) werden im Folgenden mit Siglen- und Seitenangabe nachgewiesen. Hingewiesen sei auch auf die deutsche Übersetzung Kateb Yacine: Nedschma. Aus dem Französischen übertragen von W. M. Guggenheimer. Frankfurt/M. 1958 (S. 251 – 259 bzw. S. 260 – 265). Zur Frage der Datierung der auf diesen Seiten geschilderten Erlebnisse, die von den späten 1920er Jahren bis ins Jahr 1945 reichen, vgl. Charles Bonn: Kateb Yacine, a.a.O., S. 34, und Peter Sarter : Kolonialismus im Roman, a.a.O., S. 77.
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
343
Vaters »Neugierde« oder »Verachtung«?) und sich die unüberbrückbare Differenz zwischen arabes und franÅais einfach aus der Welt wünscht (gäbe es doch eine »Uniform für Väter«!). Kurz: Der jugendliche Leser Yacines begegnet hier jenem »viel schmerzhafteren und bitteren Gefühl« der Ausgrenzung, das Camus’ Erzähler mit Blick auf die arabischen Mitschüler Jacques’ nur erahnen konnte. Ähnliches wiederholt sich beim Spiel der Schulgefährten. Einmal ist Mustapha zusammen mit Luigi und Albert in dessen Garten. Sie haben sich der Militärsachen von Alberts Vater, einem Gefängniswärter, bemächtigt und spielen französische Soldaten; Mustapha gibt den General. Da auch Lakhdar, einer der anderen drei Protagonisten des Romans, neuerdings die Schule besucht, ist seine Person Anlass für einen Dialog, in dem Integration und Ausgrenzung erneut Hand in Hand gehen: Maintenant Lakhdar est dans notre ¦cole. Il n’est plus avec les bergers. – Si on lui disait de s’engager dans notre arm¦e? – Mon pÀre ne voudra pas, souffle Albert. – Pourquoi? – Pas de voyous, pas d’Arabes dans le jardin, dit Papa. Il ne voudra pas, dit Albert. Luigi s’arrÞte de vider l’eau. – Mais du moment que notre g¦n¦ral est un Arabe? – Oui, dit Albert, c’est un Arabe, mais son pÀre est avocat. Mustapha ne fait que rougir. (N 218 [Hervorhebung im Original])
Die Unterschiede zwischen den Gruppen werden hier von den euroalgerischen Aktanten noch weiter ausdifferenziert als in der vorausgehenden Szene. Obwohl den weißen colonisateurs untergeordnet, darf Mustapha als Sohn eines Anwalts den Garten des Kleinbürgers Giovanni betreten; Lakhdar, dem arabischen Stiefsohn eines Krämers, wird dieses Privileg aufgrund seiner geringeren sozialen Herkunft nicht zuteil. Seine eigene problematische Stellung zwischen den Fronten wird Mustapha hier erneut schamhaft bewusst. Die Gräben innerhalb der Kolonialgesellschaft vertiefen sich in seiner Wahrnehmung durch solche Erlebnisse zusehends. Der eingeschlagene Integrationsweg des Sohnes assimilierter Araber wird, wie sich nur wenige Seiten später zeigt, scheitern und ins Gegenteil umschlagen. Dass neben Jacques und dem Mittelschichtjungen Georges mit Mustapha jetzt ein weitere jugendliche Figur aus dem Ensemble der Kolonialgesellschaft tritt, stellt im Sinne der inter- und intrakulturellen Perspektivenschulung eine wichtige Ergänzung dar. Rücken die in Le Premier homme einander diametral gegenüber gestellten Gruppen armer colons und begüterter colonisateurs doch zusammen, sobald auch die colonis¦s ins Spiel kommen. Für das Lernziel der Perspektivenkoordination ist dies ein wichtiger Beitrag. Mit der Auswahl thematisch und historisch verwandter Schulszenen aus den Romanen Camus’ und Yacines wird ein setting aufgebaut, das didaktisch umso effektiver erscheint, als
344
Christoph Hoch (Bonn)
damit in einer für jugendliche Leser nachvollziehbaren und glaubwürdigen Weise erkennbar wird, wie der ihnen vertraute Ort Schule zur Begegnungs- und Trennungsstätte zugleich avanciert. Hilfreich für den Prozess des interkulturellen Lernens ist das Nedjma-Kapitel aber auch aufgrund der Erzählweise. Yacine verleiht zumal dem europäischen Leser einen ihm fremden Blick auf das Geschehen. Er vermittelt ihm Kolonialerfahrungen aus der Perspektive der ›anderen‹, nämlich der einheimischen Bewohner Algeriens, indem er die Figur selbst mit den Mitteln der erlebten oder direkten Rede sowie des inneren Monologs zu Worte kommen lässt. Damit schafft er wichtige Voraussetzungen für das Gelingen eines weiteren Schrittes: die Perspektivübernahme. Auf diese Weise erlebt der Leser am Ende des Schulkapitels auch den Bruch in der Schulkarriere des ehemaligen Vorzeigeschülers Mustaphas mit. Die exemplarische Begebenheit trägt sich im Herbst 1944 am französischen Gymnasium von S¦tif zu und liegt damit chronologisch deutlich nach den zuvor angesprochenen Schulszenen. Wie sich zeigen wird, hat Mustapha aus diesen früheren Erfahrungen gelernt. Die Araber feiern an diesem Tag Mulud (den Geburtstag des Propheten) und schicken ihre Kinder daher nicht ins lyc¦e. Der strenge französische Lehrer Temple lässt das nicht gelten und hat für diesen Tag in Mustaphas naturwissenschaftlichem Lieblingsfach eine Klausur vorgesehen. Von den muslimischen Schülern ist nur Mustapha erschienen. Er hat sich jedoch vorgenommen, aus Solidarität nur ein weißes Blatt abzugeben. Auch eine (als innerer Monolog wiedergegebene) Rechtfertigung hat er sich bereits zurecht gelegt: »Cher matre je ne remettrai pas la copie… c’est aujourd’hui le Mouloud… Nos fÞtes ne sont pas pr¦vues dans vos calendaires. Les camarades ont bien fait de ne pas venir.« (N 221) Aber er kommt gar nicht mehr dazu, seine Überlegungen vorzubringen. Denn während M. Temple die Namen der Abwesenden vorliest, wird Mustapha unter den Augen der mit einem Ausdruck des Entsetzens und des Triumphs auf ihn starrenden Mitschüler zum Direktor gerufen. Dieser konfrontiert Mustapha mit Auszügen aus einer von ihm verfassten Schrift, aus der Monsieur le principal längere Passagen vorliest: – … Êcoutez bien ce que je vais vous lire. Je cite au hasard: ›Sur les milliers d’enfants qui croupissent dans les rues, nous sommes quelques coll¦giens, entour¦s de m¦fiance. Allons-nous server de larbins, ou nous contenter de ›professions liberals‹ pour devenir notre tour des privil¦gi¦s? Pouvons-nous avoir une autre ambition?‹ […]. (N 222 [Hervorhebung im Original])
Ohne den Jungen zu Wort kommen zu lassen, springt er zu einer anderen Textstelle, in der Mustapha die französische Kolonialpolitik mit der von Tacitus berichteten römischen Unterwerfung Englands verglichen hatte. Gemeinsam sei
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
345
beiden die Strategie der gezielten Desozialisation des Unterworfenen, die als Zivilisierungsofferte getarnte kulturelle Korrumpierung: […] ›Les Bretons vivaient en sauvages, toujours prÞts la guerre; pour les accoutumer, par les plaisirs, au repos et la tranquillit¦, il (Agricola) les exhorta en particulier […]; insensiblement, on se laissa aller aux s¦ductions de nos vices; on rechercha nos portiques, nos bains, nos festins ¦l¦gants; et ces hommes sans exp¦rience [les Bretons, C.H.] appelaient civilisation ce qui faisait partie de leur servitude… Voil ce qu’on lit dans Tacite. Voil comment nous, descendants des Numides, subissions pr¦sent la colonisation des Gaulois!‹ (N 222 [Hervorhebung im Original])
Sie gegen uns, »Gallier« versus »Numider«, das kann dem Schuldirektor nicht gleichgültig sein. Die Folge: Mustapha wird für acht Tage vom Schulbesuch suspendiert. Weit folgenreicher aber ist der von Yacine hier in einer Szene exemplarisch verdichtete historische Kontext des Romangeschehens. Peter Sarter hat in seiner Nedjma-Studie ausführlich und mit zahlreichen aussagekräftigen Zeitdokumenten rekonstruiert, in welcher Form auch die Schulpolitik im d¦partement Algerien Teil des kolonialen Systems war.49 Im Mittelpunkt stand realiter weniger die offiziell vorgeschützte Alphabetisierungsabsicht, sondern die Ausbildung weniger Kolonialintellektueller. Diese »¦volu¦s« sollten und mussten ihre privilegierte Stellung mit der Entfremdung von ihrer sozialen und kulturellen Bezugsgruppe bezahlen, um als kollaborationswillige Agenten kolonialer Interessen eine Mittlerfunktion zwischen der arabischen Bevölkerung und dem französischen Machthaber zu erfüllen. Nur am Rande hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die Rolle der französischen Sprache und damit auf eine Problematik, die auch den Autor des Romans Nedjma berührt. Bedient sich doch auch Yacine – nicht zuletzt in Ermangelung einer für seine Zwecke geeigneten arabischen Sprach- und Genretradition – des Literaturidioms seiner Unterdrücker ; allerdings ohne damit die eigene kulturelle Identität aufzugeben.50 Wie der soziale Aufstieg eines Araberjungen durch Schulbildung und damit zugleich der Versuch seiner Vereinnahmung durch den colonisateur misslingt, führt Mustaphas Zeit am lyc¦e vor. Dass dieses Scheitern zur Ausbildung einer nationalistisch begründeten Widerstandshaltung führt, wurde bereits in dem 49 Vgl. Peter Sarter : Kolonialismus im Roman, a.a.O., S. 65 – 68. 50 Charles Bonn: Kateb Yacine, a.a.O., S. 48 f., bemerkt dazu: »Car le drame de l’Alg¦rie colonis¦e […] est que les langages de son expression lui sont impos¦s de l’ext¦rieur. La d¦pendance culturelle et politique est d’abord la non-matrise des langages dans lesquels se dire. […] : le discours islamique et le discours tribal gardent un grand prestige. Mais ils sont inadapt¦s un d¦bat dont les termes sont impos¦s par la culture europ¦enne, laquelle v¦hicule une conception de l’Histoire et de la Nation diff¦rentes de celles d’une culture arabomusulmane d¦labr¦e.« Yacines »travail politique de l’¦crivain« habe daher darin bestanden, einen »langage de l’identit¦ et de l’action« (ebd.) zu erfinden.
346
Christoph Hoch (Bonn)
antikolonialistischen Pamphlet Mustaphas deutlich. Den nächsten Schritt in die Konfrontation gehen Yacines Protagonisten Mustapha und Lakhdar bereits wenige Monate später. Zu Beginn des Folgekapitels stehen sie inmitten jener Demonstration, die am 8. Mai 1945 anlässlich des Sieges der Alliierten über das faschistische Deutschland standfand.51 Wieder wird auf wenigen Seiten erlebte Geschichte vermittelt – hier der mit dem Namen S¦tif verbundene Volksaufstand und dessen blutige Niederschlagung. Bereits der Beginn verspricht Unheil. Lakhdar nutzt jetzt die Schule – Repräsentant der Ordnung und des Wissens der Kolonialmacht – zur Proklamation nationaler Unabhängigkeitsbestrebungen, indem er Parolen wie »Ind¦pendance de l’Alg¦rie« in die Bänke und Türen schnitzt. Ein auktorialer Erzähler kommentiert: »Lakhdar et Mustapha quittent le cercle de la jeunesse, la recherche des banderoles.« (N 227) Aus ihrer Kindheit entlassen, reihen sich beide in die Schar der algerischen Demonstranten ein, deren Beschreibung einen kollektiven Aktanten evoziert. Die sozialen Unterschiede, Interessenkonflikte und regionalen Differenzen spielen in dieser Notsolidarität aus Vertretern aller möglichen Berufe und Gruppen keine Rolle mehr : Les paysans sont prÞts pour le d¦fil¦. […] Ouvriers agricoles, ouvriers, commerÅants. Soleil. Beaucoup de monde. L’Allemagne a capitul¦. Couples. Brasserie bond¦es. Les cloches. C¦r¦monie officielle; monument aux morts. La police se tient distance. […] Lakhdar et Mustapha marchent cúte cúte. (N 227 [Hervorhebung im Original])
Das Ende des europäischen Kampfes gegen Nazi-Deutschland markiert für sie wie für viele Algerier den Beginn ihres Kampfes gegen die Kolonialmacht. Der in S¦tif gefeierte Sieg ist ein Sieg der Franzosen. Wenn Mustapha sich anlässlich dieser Feier fragt »est-ce vraiment la victoire?« (ebd.) und an die bereits 1870 und 1918, also immer zu Kriegszeiten gemachten Reformversprechen zur Besserstellung der algerischen Bevölkerung erinnert, wenn er inmitten der von ihm als »unangreifbarer Tausendfüßler« beschriebenen Menge ein Gefühl für die eigene Macht entwickelt, dann drückt er damit aus, was viele Algerier 1945 empfunden haben. Die nationalistischen Töne auf der Demonstration verschärfen sich, die algerische Nationalhymne wird gesungen und die französi-
51 Interpretationen dieser Romanstelle bieten Peter Sarter : Kolonialismus im Roman, a.a.O., S. 88 – 106, und Sabiha Boukhelouf: Les Instances ¦nonÅantes dans l’œuvre de Kateb Yacine (ThÀse de doctorat, Paris VIII) 1997, S. 214 – 218, online verfügbar unter : http://www.limag.refer.org/Theses/Boukhelouf%20Kateb.PDF [18. 8. 2010].
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
347
schen Ordnungskräfte weichen zurück, beginnen aber aus sicherer Entfernung auf die mitgeführten algerischen Fahnen zu schießen. Geschildert wird die auf wenige Minuten verkürzte Eskalation in einem sprachlich nicht besonders stark markierten Stakkato der Eindrücke und Stimmen. Ein alter algerischer Soldat greift zu seiner Trompete: »Zum Wecken oder zum heiligen Krieg?« (N 228) Auf diese vom Erzähler gestellte Frage gibt es keine Antwort mehr. Das Massaker hebt an: Maschinengewehrfeuer fegt über den Platz, und diejenigen, die nicht sterben, suchen das Weite. Zu ihnen gehört auch Mustapha. Während er den Heimweg antritt, geraten die Folgen dieses Ereignisses für den gesamten ostalgerischen Raum in den Blick: Der »administrateur« will die Ordnung wieder herstellen, die »colons« haben Razzien durchgesetzt und sich zu bewaffneten Milizen zusammengeschlossen (N 229). Auf den Aufmarsch der Algerier als einer mehr imaginären als realen Macht reagieren die Besatzer mit einer ebenfalls einstimmigen Demonstration ihrer Stärke, die Yacine nur ausschnitthaft referiert: Die senegalesischen Einheit marschieren auf, es folgt eine Welle von Verhaftungen, Vergewaltigungen, Erschießungen. Schließlich wird auch Mustaphas Vater, der »matre Gharib«, als ein vermeintlicher Rädelsführer des Aufstandes zur Rechenschaft gezogen. Offenkundig widerspricht diese überwiegend aus der Sicht Mustaphas geschilderte und um gelegentliche Erzählerkommentare ergänzte Lektion in Kolonialgeschichte derjenigen Camus’. Das gilt auch und besonders für die Rolle der Algerienfranzosen. In Jacques’ Version der Dinge waren sie, ähnlich den colonis¦s, Opfer des kolonialen Systems. Bei Yacine figurieren sie in der Schulwie in der S¦tif-Szene als wesentliche Mitverursacher der fortschreitenden Konfrontation zwischen Arabern und Europäern. Nimmt die militärische Repression doch nicht zuletzt auf ihr Drängen hin eine gewalttätige Form an. Historisch gesehen, schadeten die colons mit ihrer Verweigerungshaltung gegenüber allen Reformbestrebungen sich selber.52 Denn erst durch die von ihnen mit initiierte Radikalisierung selbst assimilationswilliger Algerier wie Mustapha oder Lakhdar wurde der Weg zum Algerienkrieg geebnet. Camus’ französischer Siedler Veillard leidet unter den Folgen dieser Entwicklung, deren Ursachen er (genauso wie Jacques) aus Befangenheit in der eignen Sicht und aus Selbstschutz nicht versteht. 3.2 Gegenstand der zweiten Nedjma-Passage53 ist gewissermaßen die Vor- und Nachgeschichte dieser Erlebnisse. Kolonialhistorie wird darin (durchaus ähn52 Vgl. Peter Sarter : Kolonialismus im Roman, a.a.O., S. 86. 53 Kateb Yacine: Nedjma, a.a.O., S. 96 – 103 (IX.-X. Kapitel des 3. Teils) und S. 123 – 129 (X.-XII. [sic!] Kapitel des 3. Teils); in der deutschen Übersetzung Kateb Yacine: Nedschma, a.a.O., S. 105 – 115 und S. 139 – 147. Die achronologische Erzählweise macht es möglich, diese gut 13 Seiten zu einer inhaltlich kohärenten Einheit zusammenzufassen. In der Erzählchronologie
348
Christoph Hoch (Bonn)
lich wie bei Camus) als großes historisches Fresko aus der Sicht von Beteiligten geboten. Yacines Leser erhalten damit Gelegenheit, Individualgeschichten wie die Schul- und S¦tif-Erlebnisse innerhalb des Kontextes einer umfassenden Stammeserzählung zu verorten. Der agierende Protagonist ist diesmal Rachid, dem mit der Figur des Scheichs Si Mokhtar ein letzter Überlebender der Väter-Generation zur Seite gestellt wird. In dem Maße, wie auf der Handlungsebene die drängenden Fragen nach der Identität Nedjmas und den Umstände des gewaltsamen Todes von Rachids Vater zunächst ungeklärt bleiben, avanciert Si Mokhtar für Rachid zur zentralen Bezugsfigur auf der Suche nach Antworten. Mehr noch: Als Freund und Verwandter der toten Väter Rachids und Murats (N 100 f.) sowie als Nachfahre des ihnen allen gemeinsamen »ancÞtre Keblout« (N 98) wird Si Mokhtar bald zu einem Ersatz-Vater für Rachid – einem »faux pÀre« (N 97), der den Jungen liebt wie einen eigenen Sohn (N 129).54 Rachid, der die Nähe des alternden Scheichs sucht, unternimmt mit ihm eine Pilgerfahrt nach Mekka, während derer es zu einem Gespräch über die kollektive Geschichtserfahrung des Stammes kommt. Anders als im Falle der Kolonialjugend Jacques Cormerys ist diese gezeichnet vom Trauma der Unterdrückung, gezielten Ausrottung und administrativen Teilung der ursprünglichen BerberGemeinschaft. Erzählt wird diese Initiation in die mythische Kollektivgeschichte in zwei kürzeren Textabschnitten, die beide Teile der erwähnten Unterhaltung zwischen Rachid und Si Mokhtar während der Überfahrt nach Mekka wiedergeben. In der ersten, in Búne lokalisierten Szene schildert der fieberkranke Rachid seinem Freund Murat die verwickelten genealogischen und schicksalhaften Verbindungen ihrer Väter. Der zweite Textauszug führt in Form einer »confession« (N 98) über die Ahnen, über ihrer Unterdrückung sowie über die daraus abgeleitete politische Zukunftsvision eines befreiten und geeinten Algeriens vor, wie der jugendliche Protagonist die eigene Identität durch Erinnerungsarbeit, durch das weitererzählte Wissen über seinen Stamm findet und damit zugleich eine zukunftsgerichtet politische Perspektive übernimmt, die sein weiteres Handeln bestimmen wird. Eine zentrale Rolle spielen dabei die toten Väter : J’en [de mon pÀre, C.H.] parle sans avoir jamais connu mon pÀre, car il mourut sous le feu de son propre fusil, tu¦ au fond d’une grotte par un inconnu qui dut s’enfuir, ou se cacher pendant l’enquÞte, et nul n’a encore pu l’identifier. […] c’est dans cette grotte gehen diese Textstellen dem zuvor behandelten Romanauszug voraus, bezieht sich aber auf Ereignisse, die historisch später angesiedelt sind. Vgl. das Erzähldiagramm mit Datierungen bei Charles Bonn, Kateb Yacine, a.a.O., S. 34. 54 Zur Vertiefung bietet sich die Behandlung der ausführlichen Beschreibung der Beziehung zwischen beiden Figuren (N 91) sowie des anschließenden Kontrastporträts (N 92) an.
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
349
que fut d¦couvert le cadavre de mon pÀre; sa nuque ¦tait cribl¦e de plombs; le fusil vide tranait ses pieds. Lorsque je naquis, lorsque s’¦levÀrent mes premiers cris parmi les impr¦cations de ma mÀre d¦j veuve, l’enquÞte suivait son cours. (N 101)
Den Vater bzw. die Väter nicht zu kennen heißt (anders als bei Camus) für den Berberjungen aber nicht, ohne sie aufzuwachsen: »[…] ce sont des mes d’ancÞtres qui nous occupent« (N 97), erklärt Rachid. Das Erbe dieser Ahnen ist ein doppeltes: einerseits die sie verbindende Zugehörigkeit zur tribu, andererseits aber auch die erlittene Niederlage im Kampf gegen den colonisateur. Dieses als »drame ¦ternis¦« oder »vieil ¦chec charg¦ de gloire« (N 97) bezeichnete Trauma liegt wie ein Schatten auf der jüngeren Generation. Durch die Fremdherrschaft entwurzelt, finden sie daher auch in den Vätern keine Orientierungshilfe bei der Konstruktion ihrer Identität und Lebensentwürfe. Das galt bereits für Mustapha, der sich als Junge vor der französischen Schule für seinen arabischen Vater schämte. Und das gilt in noch größerem Maße hier für den Halbwaisen Rachid. Der Tod des eigenen Vaters verdeutlicht ihm ein Problem, das auch andere junge Keblouti seiner Generation haben: »[C’est] l’ombre des pÀres, des juges, des guides que nous suivons la trace, en d¦pit de notre chemin, sans jamais savoir o¾ ils sont.« (ebd.) Si Mokhtar, der wie die Väter selbst eine ambivalente Figur bleibt, versucht, dieses Dilemma mit seinen mehrseitigen »r¦v¦lations passionn¦es« (N 128) über die Stammesgeschichte rückgängig zu machen. Er hebt an mit der Darlegung seines der nomadischen Tradition verpflichteten Genealogie-Verständnisses, das er demjenigen der Franzosen explizit entgegensetzt. Seine Rhetorik verfolgt dabei zweifellos das Ziel, die fremdkulturelle Überformung durch Rekurs auf tradierte Selbstbeschreibungskonventionen der Berber zu korrigieren. Der »Stamm« sei nicht in den Begriffen von Verwandtschaft zu fassen, wie die Franzosen sie verstehen.55 Vielmehr handele es sich um eine teilweise ungesicherte Filiation über weite geographische Räume. Ihr vermutlich ursprünglich turkstämmiges, unter der Führung des Stammvaters Keblout über Spanien nach Nordafrika gelangtes Nomadenvolk habe in Verbindung mit anderen Traditionslinien eher zufällig in Ostalgerien eine Heimat gefunden. Hier nun verbindet sich die »histoire de nos tribus« (N 124) mit dem kolonialen Drama seit 1830. Zunächst habe der Clan der Keblouti im Unterschied zu anderen lange erfolgreich Widerstand gegen den französischen Aggressor geleistet und unbehelligt von den Besatzern in der Einsamkeit der Wälder auf dem Berg Nadhor bei Constantine leben können. Aber schließlich habe die »conquÞte franÅaise« (N 125) auch vor ihnen nicht halt gemacht. Die Ermordung eines 55 N 124: »… Oui la tribu. Il ne s’agit pas d’une parent¦ au sens o¾ la comprennent les FranÅais; notre tribu, autant qu’on s’en souvienne, avait d venir du Moyen-Orient, passer par l’Espagne et s¦journer au Maroc, sous la conduite de Keblout. […].«
350
Christoph Hoch (Bonn)
Offiziers aus dem französischen Expeditionskorps diente als Vorwand, um die Familienoberhäupter zu exekutieren. Die meisten Keblouti ergriffen daraufhin aus Angst vor Verfolgung die Flucht, auf der sie zum Selbstschutz stammesfremde Namen annahmen, während nur wenige im Stammland zurückblieben. Administrative Repressionen wie die Aufteilung dieser Überlebenden in vier Register sowie das Verbot des Familiennamens taten dann das ihre zur endgültigen Entwurzelung des Stammes. Diese Geschichte stellt Si Mokhtar zur Unterweisung Rachids zudem in den größeren politikgeschichtlich-landeskundlichen Rahmen der französischen Eroberungsgeschichte nach 1830 und der sie begleitenden algerischen Freiheitskämpfe unter Führung des »Abd el-Kader« (N 102). In ihm erkennt Si Mokhtar den einzigen Araberführer, der fähig gewesen wäre, die Stämme zur Nation zu einen – »le seul chef capable d’unifier les tribus pour s’¦lever au stade de la nation« (ebd.). Eben dies aber hätten die Franzosen vereitelt, so dass das Fazit lautet: Die Führer der algerischen Stämme, die auf den Schätzen saßen und die Überlieferung hüteten, wurden in blutigen Kämpfen zumeist getötet oder enteignet; ihre Söhne sind von der Niederlage ruiniert, expropriiert und erniedrigt, bewahren aber alle Zukunftschancen. Si Mokhtars bildreicher Argumentation zufolge stellt diese Niederlage ihre größte Chance dar, weil sie wie ein »aufgepfropfter Reis« den angeschlagenen »Baum der Nation« zu neuen Blüten treiben könne: »[…] mais la conquÞte ¦tait un mal n¦cessaire, une greffe douloureuse apportant une promesse de progrÀs l’arbre de la nation entam¦ par la hache.« (ebd.) Was im Großen gilt, gilt auch im Kleineren der Kablouti-Geschichte : »Toutes nos d¦faites […] porteront leurs fruits hors de saison.« (N 129) Ist also das alte Band »de la tradition, de l’honneur, de la certitude« (N 98) zerschnitten, bleibt zur Realisierung des von Si Mokhtar ersonnenen Programms einer Wiedergeburt aus den Ruinen der Stammmoschee auf dem Nadhor nur ein Weg: Anknüpfend an die erschütterte, von Tod, Vertreibung und inzestuöser Nachkommenschaft bedrohte, aber nach wie vor lebendige Nomadentradition, will der Scheich Rachid mit seiner illegitimen Tochter Nedjma verbinden.56 Am Ursprungsort ihres Stammes soll so die Tradition neu begründet und damit auch 56 Gleichzeitig schließt er aber diese Eheschließung kategorisch aus. Nicht zuletzt aufgrund der vielfältigen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Figuren erscheint Nedjma damit doch eher wie eine Schwester. Sabiha Boukhelouf: Les Instances ¦nonÅantes, a.a.O., S. 130, kommentiert die Stelle mit den Worten: »Ainsi, le mariage est frapp¦ d’interdit. Cela peut Þtre lu comme une appr¦hension de l’inceste, puisque les liens parentaux ont ¦t¦ brouill¦s. Mais, cet interdit est peut-Þtre un moyen d’¦viter des conflits futurs qui opposeraient les diff¦rentes tribus se r¦clamant de Nedjma et d¦sirant sa possession. Elle doit Þtre tous et personne en particulier comme la patrie dont elle est la figure. […] Ce qui permet d’affirmer que Nedjma est la m¦taphore de l’Alg¦rie, de la ›nation‹ que visait Si Mokhtar.«
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
351
der Geist der Revolte von S¦tif, der die orientierungslosen Söhne beseelt, durch Rekurs auf die Geschichte gestärkt werden. Die Zielperspektive bleibt die politische Nation: Tu dois songer la destin¦e de ce pays d’o¾ nous venons, qui n’est pas une province franÅaise, et qui n’a ni bey ni sultan; tu penses peut-Þtre l’Alg¦rie toujours envahie, son inextricable pass¦, car nous ne somme pas une nation, pas encore, sache-le : nous ne sommes que des tribus d¦cim¦es. Ce n’est pas revenir en arriÀre que d’honorer notre tribu, le seul lien qui nous reste pour nous r¦unir et nous retrouver, mÞme si nous esp¦rons mieux que cela… (N 128 f.)
Diese Utopie der unmittelbaren Wiederanknüpfung an tradierte Stammesgenealogien mit dem Fernziel der Bildung einer modernen nationalen Einheit wird im Roman (wie in der historischen Realität zumal der 1950er Jahre) nicht eingelöst. Bezeichnenderweise lehnen die letzten echten Keblouti die beiden Männer ab, weil sie sich mit den Franzosen arrangiert hatten. Si Mokhdar wird erschossen, Rachid vertrieben. Aber auch ohne in der unterrichtlichen Behandlung auf die komplexe Handlungsfortführung einzugehen, kann anhand dieses Auszuges Wesentliches deutlich gemacht werden: dass nämlich »algerisches Nationalbewusstsein wie auch individuelle Identität unter den Bedingungen des Kolonialismus anzusetzen hat an der Vergangenheit, dass der Stamm nicht einfach eine überholte soziale Formation ist, sondern Grundlage der Entwicklung einer Nation.«57 Im Kontext der Unterrichtsreihe ist damit ein Anschluss an die Kolonialgeschichte insgesamt geschaffen. Hinzuweisen ist dabei vor allem auf die dem nationalen Befreiungskampf Algeriens eigene modernistische Verbindung traditioneller Elemente (Islam, Stammeskultur) mit einem Nationenbegriff, wie er nur der neueren europäischen Ideengeschichte (hier dem französischen nation-Gedanken) entliehen werden konnte. Im Vergleich der beiden kontrastiv gelesenen Romane ergeben sich zwei Versionen einer Geschichte. Beide vermitteln Eindrücke vom Leben in der Alg¦rie franÅaise als ›Geschichte von unten‹, konstruieren sich aus der Perspektive nicht der Sieger, sondern von Besiegten. Dass sie einander dennoch diametral gegenüberstehen, kann angesichts der unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeit der Aktanten, nicht verwundert. Wie zur Würdigung beider Autoren hinzugefügt werden sollte, ist damit aber nicht das Verhältnis zwischen Kateb Yacine und Albert Camus beschrieben. Camus hat schon in der 1939 im Alger R¦publicain erschienenen Artikelserie »MisÀre de la Kabylie« die Not und große Freiheitsliebe des ostalgerischen Berbervolkes so deutlich benannt, dass die Zeitung daraufhin von offizieller französischer Seite zensiert wurde. Unter Algeriern hat ihm das große Bewunderung eingebracht. Erst durch die Verschärfung der 57 Peter Sarter : Kolonialismus im Roman, a.a.O., S. 139.
352
Christoph Hoch (Bonn)
Auseinandersetzung im Algerienkrieg und das Schweigen Camus’ in den späten 1950er Jahren kam es zu den angesprochenen Konflikten. 1957 schrieb Yacine, der damals wie Camus in Frankreich lebte, an den frisch gekürten Nobelpreisträger : »Exil¦s du mÞme royaume nous voici comme deux frÀres ennemis […]. On crie dans les ruines de Tipasa et du Nadhor. Irons-nous ensemble apaiser le spectre de la discorde ou bien est-il trop tard?«58
4.
Fazit
Die vorgestellten Romanauszüge vermitteln im kontrastiven Vergleich ebenso sich widersprechende wie sich ergänzende, immer aber fremde Blicke auf ein zunehmend in die Krise geratendes Kolonialsystem. Nachvollziehbar werden diese fiktionalisierten Lebenserfahrungen durch die Perspektive der sehr unterschiedlich sozialisierten und agierenden Figuren beider Romane. Für die Differenzierung und Koordination ihrer Haltungen ist die kontrastive Betrachtung notwendig. Erst sie verdeutlicht die unterschiedlichen »Voraussetzungssysteme« (S. J. Schmidt), mit denen die Autoren ihre Protagonisten ausgestattet haben. Gemeint ist damit »das jeweilige Wirklichkeitsmodell eines Aktanten, die von ihm internalisierten Werte, Normen und Konventionen, sprachliche und enzyklopädische Kenntnisse ebenso wie Handlungsbeschränkungen politischer, ökonomischer, sozialer Natur.«59 Wie die Wirklichkeitsmodelle des Algerienfranzosen Jacques, des m¦tropolitain Georges sowie der Berberjungen Mustapha und Lakhdar durch ihr jeweiliges Umfeld in der Kolonie Algerien und durch Kontaktsituationen bspw. in Schule und Verwandtschaft geprägt wurden, haben die Textauszüge verdeutlicht. Damit zumal jugendliche Leser diese Dimension voll erfassen können, bedarf es (neben der sprachlichen Arbeit an und mit den Texten) einiger landeskundlich-historischer Faktenkenntnisse, ohne deren Erarbeitung die unterrichtliche Behandlung der Romane nicht gelingen kann. Notwendiges allgemeines Kontextwissen ist sinnvoller Weise bereits vor der Lektüre bereitzustellen. Detailaspekte aber sollten nicht ›vorgelernt‹, sondern »an Stellen innerhalb des Leseprozesses eingegeben werden, wo es für das Verständnis erforderlich ist und aus dem Text selbst nicht abgeleitet werden kann«.60 58 Zitiert nach Abdelmadjid Kaouah: »Dialogue d’outre-tombe: Kateb Yacine et Albert Camus«, in: Association ›Les Rencontres M¦diterran¦ennes Albert Camus‹ (Hg.): Albert Camus, a.a.O., S. 51 – 55, hier S. 51. 59 Helmut Hauptmeier / Siegfried J. Schmidt: Einführung in die Empirische Literaturwissenschaft. Braunschweig, Wiesbaden 1985, S. 63. 60 Swantje Ehlers: »Gegenrede«, in: Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts (11) 1994, S. 60.
Jugend in der Algérie française: Interkulturelles Lernen mit literarischen Texten
353
Historische Fakten aus der europäischen Kolonialgeschichte erzählen zwangsläufig eine Geschichte über Unrecht und Unterdrückung. Darauf ist nachdrücklich hinzuweisen. Lerner mit Kapiteln dieser Geschichte zu konfrontieren, führt aber leicht zu simplifizierenden Kategorisierungen nach dem Wir/Sie-Schema. Auch bei dem Thema L’Alg¦rie franÅaise bieten sich solche reduktionistischen Dichotomien wie Europa/Nordafrika oder Einheimischer/ Fremder an.61 Wenn es jedoch darum geht, ›Eigenes‹ und ›Fremdes‹ dialogisch zueinander in Beziehung zu setzen, um nicht nur Vergangenes besser zu verstehen, sondern auch für gegenwärtige Situationen die eigene interkulturelle Handlungsfähigkeit zu schulen, sind derart essentialistische Schemata schädlich. Die Beschäftigung mit literarisch gestalteten Einzelschicksalen wie denen in Le Premier homme oder Nedjma bietet sich da als ein mögliches Korrektiv an. Begegnet der Leser doch komplexen, in ihrer kulturellen Identität meist gebrochenen Figuren, die in der Zusammenschau ein weit differenzierteres Bild historischer Prozesse und damit auch ethnischer Konflikte vermitteln. Charaktere wie Veillard oder in weit geringerem Maße auch Jacques sind nicht nur objektiv Teil eines Unrechtsystems, sondern begreifen sich zugleich aus nachvollziehbaren Gründen subjektiv als dessen Opfer. Mustapha und Lakhdar wird allen Assimilationsbemühungen zum Trotz der soziale Aufstieg verweigert und somit der Weg zu einem antagonistischen Nationalismus bereitet, den sie allein vielleicht nicht gefunden hätten. Rachid schließlich ist der eigenen kulturellen Identität bereits so weit entfremdet, dass ein Stammespatriarch wie Si Mokhtar ihn erst in die Geschichte der tribu einweihen muss, nur damit er am Ende doch von den eigenen Leuten als Kollaborateur (lies: als Fremder) vertrieben wird. Intra- und Interkulturelle (Lern-)Prozesse finden also bereits auf der Handlungsebene der Texte statt. Die Grenzen zwischen Eigenem und Fremdem verschieben sich dabei und werden in der Auseinandersetzung mit dem jeweils dominanten (sei französischen, sei es arabischen) Kulturmodell durch wechselnde Selbstpositionierungsversuche der Helden immer wieder neu gezogen. Können heutige Schüler (bzw. Studierende) diese Positionen nachvollziehen und im Sinne des lebensweltlichen Transfers aus ihnen lernen?62 Die Voraussetzungen dafür sind gut: In europäischen Immigrationsländern wie Frankreich und Deutschland sind in je unterschiedlicher Weise ethnisch, religiös und/oder 61 Zur Kritik solcher Dichotomisierungen durch die postkoloniale Ethnologie (Mc Carthy, Said) vgl. Caroline Schmauser : »Texte von ›Colonisateur‹ und ›Beur‹ – Manifestation unvereinbarer Dualität?«, in: Arend, Elisabeth / Kirsch, Fritz Peter (Hg.): Der erwiderte Blick, a.a.O., S. 83 – 100, hier S. 84 f. 62 Zur Frage, ob und wie man »durch Fremdverstehen Konflikte lösen könne«, vgl. Lothar Bredella: »Die Bedeutung von Innen- und Außenperspektive für die Didaktik des Fremdverstehens. Revisited«, in: Bredella, Lothar / Christ, Herbert (Hg.): Fremdverstehen, a.a.O., S. 11 – 30, hier S. 27 f.
354
Christoph Hoch (Bonn)
interkulturell geprägten Konflikte, die zumal in Frankreich oft eine direkte Folge der Kolonialgeschichte darstellen, bekanntlich an der Tagesordnung.63 Einen Bezug zwischen den hier behandelten Texten und der Gegenwart von Lernern herzustellen, dürfte daher nicht schwerfallen und ließe sich zudem durch ergänzende Medien (bspw. der jüngst begonnen Verfilmung von Le Premier homme)64 sowie Lektüren (etwa geeigneter Texte der neueren Beur-Literatur)65 auch fremdsprachendidaktisch gewinnbringend gestalten.
63 Vgl. Christiane Fäcke: Transkulturalität und fremdsprachliche Literatur. Eine empirische Studie zu mentalen Prozessen von primär mono- oder bikulturell sozialisierten Jugendlichen. Frankfurt/M. 2006. Fäcke belegt, dass für heutige Schülergenerationen, die oft selber einen bikulturellen Hintergrund haben, koloniale und postkoloniale Literatur einen hohen Identifikationswert besitzt und deshalb eine besonders geeignete Lektüre darstellt. Aufgrund der empirischen Fundierung stellt diese Studie eine wichtige Ergänzung des abstrakt interaktionistischen Ansatzes dar, den die eingangs zitierten Autoren (Nünning, Bredella) vertreten. 64 Gianni Amelio hat seine seit längerem angekündigte Verfilmung des Romans (mit Jacques Gamblin in der Rolle des Jacques Cormery) im Frühjahr 2010 an Drehorten in Algerien und Frankreich begonnen. Authentische Bilddarstellungen und Druckgraphiken u. a. zur algerischen Kolonialthematik finden sich in großer Zahl und thematisch hilfreich aufbereitet sowie kommentiert bei Nicolas Bancel / Pascal Blanchard / Laurent Gervereau (BDICACHAC) (Hg.): Images et Colonies. Iconographie et propagande coloniale sur l’Afrique franÅaise de 1880 1962. Paris 1993. 65 Ein Beispiel dafür bietet die kontrastive Lektüre von Le Premier homme und Azouz Begags Jugendbuch Les Voleurs d’¦critures von Caroline Schmauser : »Texte von ›Colonisateur‹ und ›Beur‹«, a.a.O. Vgl. auch Wolfgang Hallet: »›La rue Bleu n’est pas bleu. L’Arabe n’est pas arabe.‹ Das Spiel der Texte und Kulturen in ›Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran‹ und im Fremdsprachenunterricht«, in: Schumann, Adelheid (Hg.): Kulturwissenschaften und Fremdsprachendidaktik im Dialog. Perspektiven eines interkulturellen Französischunterrichts. Frankfurt/M. 2005, S. 99 – 112.
Brigitte Sändig (Berlin)
Camus im Osten. Zur Rezeption des Autors in der DDR und in osteuropäischen Ländern
Zur Wirkung und Bedeutung Camus’ in der DDR und in einigen osteuropäischen Ländern vor dem Fall des Eisernen Vorhangs habe ich mich bereits unter verschiedenen Gesichtspunkten geäußert. Neben regelrechten Rezeptions-Aufarbeitungen1 haben mich dabei Themen wie Camus’ Reaktion auf den Aufstand von 19532 oder die Bedeutung Camus’ für die Opposition in der DDR und den osteuropäischen Ländern3 oder auch, in weiterem Sinne, das Widerstandspotential interessiert, das französische Kultur in diesem besonderen politischkulturellen Kontext besaß4. Dabei hat sich kulturelles mit politischem Interesse, haben sich literarische Erlebnisse mit Lebenseindrücken verbunden. Das ist unausbleiblich bei einem Autor, von dem Günter Grass, Camus-Anhänger von Jugend an, sagte, dass er »einer der letzten Philosophen war, bei denen das Geschriebene und das Handeln zusammengehörten.«5 Dementsprechend ist auch die Rezeptionsgeschichte Camus’, zumal in den hier angesprochenen Teilen Europas, meinen Erfahrungen nach nicht nur eine literarische oder intellektuelle, sondern eine reale, in Handlungsvorgänge und Lebensabläufe eingreifende. Der kroatische Verfasser einer Camus-Monographie, Jere Tarle, sagt es ganz 1 »Camus en R¦publique D¦mocratique Allemande«. In: Revue des Lettres modernes, Albert Camus, no 18, 1999, S. 39 – 60. 2 »La libert¦ une et indivisible – Albert Camus face au soulÀvement de 1953 en RDA« (im Druck). 3 Camus im Osten. Zeugnisse der Wirkung Camus’ in Zeiten politischer Teilung, Potsdam 2000; »La v¦rit¦ comme valeur ou: Quelques remarques sur l’importance de Camus pour les pays de l’Est«. In: Albert Camus et le mensonge, Paris 2004, S. 145 – 158; »L’immunit¦ envers la ›pens¦e captive‹«. In: Agnes Spiquel/Alain Schaffner (Hg.), Albert Camus et l’exigence morale, Paris 2006, S. 245 – 258; »Une pens¦e en action – l’opposition en RDA et Camus«, in: Revue des Lettres modernes, Albert Camus, no 22, 2009, S. 175 – 197. 4 »Französische Kultur in der DDR – ein Widerstandspotential?«, in: V¦ronique Liard, Marion George (Hrsg.), Spiegelungen – Brechungen. Frankreichbilder in deutschsprachigen Kulturkontexten, Berlin 2011 (im Druck). 5 Wenn wir von Europa sprechen. Ein Dialog. Günter Grass im Gespräch mit der französischen Journalistin FranÅoise Giroud, Frankfurt a.M. 1989, S. 87.
356
Brigitte Sändig (Berlin)
drastisch: »Camus findet die bittere Bestätigung seiner Analysen in den Revolten in Ostberlin, Poznan und Budapest.«6 Camus nahm solch eine Bestätigung nicht nur passiv oder gar befriedigt wahr, sondern erhob bekanntlich in allen drei Fällen Protest; im Falle Ostberlins ist dieser Protest7 meines Wissens die einzige direkte Stellungnahme Camus’ zu Vorkommnissen im Nachkriegsdeutschland. Den Aufstand selbst bezeichnet Camus als »das bedeutsamste Ereignis, das seit der Befreiung stattgefunden hat«8. Dies muss erwähnt werden, weil Camus damit einer der wenigen »westlichen« Intellektuellen war, der nicht auf das scheinrevolutionäre Heilsversprechen des sowjetisch dominierten Blocks hereinfiel und von dem sich Andersdenkende im östlichen Teil Europas demzufolge nicht alleingelassen fühlten. Dass es sich bei ihm um einen großen, schließlich mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Autor handelte, machte die Unterstützung noch um vieles wertvoller – waren politische Stellungnahme und kulturelle Leistung des Autors für diese Andersdenkenden doch beinahe eins. Daher hat Camus, das möchte ich eingangs aus meiner Erfahrung heraus behaupten, im sogenannten »sozialistischen Lager«, zu dem die DDR ja gehörte, bis zu dessen Ende ein starkes und fast unwandelbares Prestige genossen, das womöglich etwas mehr dem politischen Denker und Akteur als dem Schriftsteller galt. Dieses Ungleichgewicht ergab sich wohl als eine Art Gegenreaktion aus dem Anspruch der den Staat lenkenden Einheitspartei, »die gesamte gesellschaftliche Entwicklung in allen ihren Aspekten zu planen und zu steuern«9 – also auch die kulturellen und künstlerischen Prozesse; kulturelles Interesse musste demzufolge, auch auf der Gegenseite, immer mit politischem verbunden sein. – Die »r¦ception allemande«, die ich als Stichwort in dem jüngst erschienenen Dictionnaire Camus von Jeanyves Gu¦rin bearbeitet habe10, teilt sich daher meiner Meinung nach bis zum Fall der Mauer deutlich in zwei Rezeptionsstränge: den ost- und den westdeutschen. Ich komme nun zu einigen Details der Camus-Rezeption in der DDR, die ich z. T. aus eigenem Erleben wiedergebe. – Ausgangspunkt und zäh haftendes Klischee der Beurteilung Camus’, die nichts anderes als ein Generalverriss war, lieferte der marxistische Philosoph Georg Lukcs in Die Zerstörung der Ver-
6 Jere Tarle, Albert Camus: knjizˇevnost, politika, filozofija, Zagreb, Hrvatsko Filozofsko Drusˇtvo 1991, S. 58. 7 Zuerst erschienen in T¦moins, 11e ann¦e, no 5, 1954, S. 1 – 10; »17 juin 1953«, in: Albert Camus, Œuvres complÀtes, III, 1949 – 1956, Paris, Gallimard 2008, S. 925 – 929. 8 T¦moins, 11e ann¦e, no 5, 1954, S. 9. 9 Sigrid Meuschel, »Überlegungen zu einer Herrschafts- und Gesellschaftsgeschichte der DDR«, Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft, Jg. 19, H. 1, 1993, S. 5. (gesamter Artikel: S. 5 – 14). 10 Dictionnaire Albert Camus. Sous la direction de Jeanyves Gu¦rin, Paris, Êdition Robert Laffont 2009, S. 741 – 744.
Camus im Osten
357
nunft11, einem Buch, das in den fünfziger Jahren erschien und in dem der Autor die Zunahme irrationalistischer Strömungen in der westlichen Philosophie mit dem Verfall des Bürgertums analogisiert. Camus erscheint in diesem für die Literaturtheorie der DDR kanonischen Buch als ein besonders abstoßender Vertreter des Nihilismus. Einige Kostproben: Camus, hier kurioserweise zusammen mit Huysmans genannt, fände »in der Verzweiflung selbst eine eitle und kokette Selbstbefriedigung«12 ; dann werden Kafka und Camus als »die literarischen Parallelerscheinungen zur direkt apologetischen Ökonomie« und als »literarische Vertreter der nihilistischen Verzweiflung«13 charakterisiert; Lukcs spricht schließlich von »demagogischen Unsinnigkeiten von Camus«14 und von dessen »individualistischem Rückzug aus der wirklichen Geschichte […] im Namen einer ›Suprageschichte‹«15 ; als positives Gegenbeispiel führt er hier Sartre an. Damit bezieht sich Lukcs – sein Buch erschien 1953 – offenkundig nur auf den Camus des Homme r¦volt¦ und des Disputs mit Sartre. Der Vorwurf des »Rückzugs aus der wirklichen Geschichte« zielt auf den Umstand, dass Camus das Vorhandensein sowjetischer Konzentrationslager brandmarkte und sich generell mit dem politischen Prinzip des Zwecks, der die Mittel heiligt, auseinandersetzte. Mit eben dieser Denkfigur wurden die »noch« vorhandenen Fehler des Sozialismus erklärt, und wer sich dagegen wandte, galt automatisch als Antikommunist, also als Feind, der zu negieren oder zu diffamieren war. Camus, mit diesem Etikett behaftet, war damit einer der von offizieller Seite bestgehassten und unter systemkritischen Lesern populärsten französischen Autoren. Die – illegale – Lektüre Camus’16 war in der DDR, dem Teil eines geteilten Landes mit gemeinsamer Sprache und, zumal vor dem Bau der Mauer, starkem geistigen Austausch, immerhin möglich und sehr gefragt. Demzufolge hatten nicht gleichgeschaltete Mitarbeiter belletristischer Verlage den Autor sehr wohl im Auge, sahen einen Vorstoß aber vorerst als sinnlos an. Ein Lektor aus dem Verlag Volk und Welt, dem wichtigsten Verlag für internationale Literatur17, erinnert sich folgendermaßen an die Situation Ende der fünfziger Jahre: »Kein DDR-Verlag wagte sich damals an Albert Camus heran […] Wenig opti11 12 13 14 15 16
Berlin, Aufbau-Verlag 1954. Ebd., S. 230. Ebd., S. 619. Ebd., S. 621. Ebd., S. 662. Neben den vor allem im Rowohlt-Verlag Hamburg erschienenen Übersetzungen der literarischen und essayistischen Werke Camus’ sind auch die dort verlegten Sammelbände von besonderer politischer Brisanz: Fragen der Zeit (1960) und Verteidigung der Freiheit. Politische Essays (1968). 17 S. ein Buch, das anhand einer umfangreichen Dokumentation die verlegerische Leistung dieses Verlages würdigt: Simone Barck, Siegfried Lokatis (Hrsg.), Fenster zur Welt. Eine Geschichte des DDR-Verlages Volk & Welt, Berlin, Ch. Links Verlag 2003.
358
Brigitte Sändig (Berlin)
mistisch klopften wir aus diesem Grund seine Bücher und Theaterstücke auf Beweise ab, die das Unmögliche doch möglich machen sollten. Am ehesten bot sich noch der Roman Die Pest an […]«18. Die Kulturfunktionäre freilich hatten für ihr Verdikt kaum irgendwelche Informations- und Argumentationsanstrengungen nötig. In ihrer Denkfaulheit genügte ihnen das einmal von einer sakrosankten Autorität gefällte Urteil, das hinfort kontinuierlich und unumstößlich stand oder, wie sie es wünschten, stehen sollte. Denn ganz so einfach ging es nicht, zumindest nicht auf Dauer. Der Nobelpreisträger von 1957 konnte nicht völlig totgeschwiegen werden. Zwei kurze Artikel – die ersten über Camus seit Bestehen der DDR – erschienen aus diesem Anlass in zwei Kulturzeitschriften; sie zeigen die immerhin vorhandene Spanne der Möglichkeiten: Der erste mit dem Titel »Belohnter Antikommunismus« ist feindselig und verleumderisch; hier wird Camus als »unfertiger Wirrkopf« bezeichnet, der es »angeblich besser weiß als Marx und Engels selbst«; in literarischer Hinsicht billigt der Schreiber Camus »eine künstlerische Weise« zu, »die wohl ein Talent verrät, indes nicht einmal als künftige Verheißung bewertet werden kann.«19 Der Autor des zweiten Artikels versteht hingegen etwas vom Denken Camus’; hier heißt es: »Die Welt ist für ihn [Camus] eine Absurdität, der lediglich der handelnde Mensch einen Sinn verleiht.«20 Der erste Artikel ist mit vollem Namen gezeichnet, der zweite nur mit den Initialen; der erste trägt den genannten Titel, der zweite keinen. So sieht das Kräfteverhältnis in Sachen Camus am Ende der fünfziger Jahre aus. Auf der anderen Seite hatte der Totalverriss von Seiten der Kulturfunktionäre fast automatisch ein gesteigertes Publikumsinteresse zur Folge, das bei literaturengagierten Verlagsmitarbeitern, die vor allem in den unteren Rängen zu finden waren, Handlungsdrang auslöste. Die Frage einer Camus-Veröffentlichung stand mehr denn je im Raum. Das erste Werk, mit dem 1965 der Weg für den hochproblematischen Autor eröffnet wurde, war Die Pest. Wie immer bei solchen vom Publikum gefragten und ideologisch »bedenklichen« Werken wurde eine Auflage von 10.000 Exemplaren festgelegt, und dem Text musste ein Nachwort beigegeben werden. Die Funktion solcher Nachworte sollte ursprünglich, neben der Vorstellung des Autors, Kritik und Begradigung seiner ideologischen Fehlposition sein; von dieser Funktion entfernten sich die Nachworte indessen im Zuge eines gewissen Erschlaffens der ideologischen Gängelung immer mehr. Nichtsdestoweniger blieben sie unabdingbar für das Erscheinen problematischer Literatur. Daher stellt eine französische Histori18 Klaus Möckel, »Vom Kleinen Prinzen zum Zimmer der Träume«, in: Ebenda, S. 127 (gesamter Artikel: 125 – 131). 19 Alfred Antkowiak, »Belohnter Antikommunismus? Bemerkungen zur Verleihung des Nobelpreises an Albert Camus«, in: Sonntag, Nr. 50, 1957, S. 7. 20 S. C., (Unbetitelter Artikel), in: Aufbau, Nr. 12, 1957, S. 655.
Camus im Osten
359
kerin der Rezeption französischer Literatur in der DDR zu Recht fest: »[…] elle [la postface] fut le lieu d’un combat pour la litt¦rature.«21 Das Erscheinen eines vormals so krass verrissenen Autors erforderte Erklärungen; deren Autoren22 mussten einen schwierigen Spagat zwischen sachgerechter Einschätzung und – mehr oder weniger starkem – Zugeständnis an die bisherige Verteufelung vollziehen. Ein kleiner Sieg war aber allein die Tatsache, dass dem Roman Camus’ im Neuen Deutschland, dem »Zentralorgan der sozialistischen Einheitspartei«, nun vier Spalten zugestanden wurden. – Die Pest sollte in den fünfundzwanzig Jahren, die die DDR noch bestand, weitere vier Mal aufgelegt werden und wurde somit das in der DDR verbreitetste Werk Camus’. Am Beginn der achtziger Jahre lag das gesamte literarische Werk Camus’ in der DDR vor. Dass jedes dieser Bücher auf großes, infolge der beschränkten Auflagen nie voll befriedigtes Publikumsinteresse traf, kann ich nur mitteilen; anhand von Verkaufsziffern ist dies nicht zu belegen, da die Auflage von vornherein festgelegt war und auch bei Bedarf nicht erhöht wurde. So kann als Beweis des Gefragtseins nur der Umstand gelten, dass die Bücher sofort nach Erscheinen ausverkauft, das heißt für viele potentielle Käufer gar nicht erreichbar waren. Und schlimmer noch: Die als politisch gefährlich geltenden Essays, allen voran L’Homme r¦volt¦, wie auch die Carnets, Schaffenstagebücher Camus’ mit gelegentlichen politischen Aussagen, wurden in der DDR nie veröffentlicht. Bei dieser Lage der Dinge ging ich Anfang der achtziger Jahre ans Schreiben einer Camus-Biographie, die der Reclam-Verlag Leipzig in einer etablierten Biographien-Reihe herausbringen wollte23. Das konnte nicht ohne Verrenkungen abgehen: Mit der unglückseligen Geschichte Camus’ in der DDR im Hinterkopf und von dem Wunsche beseelt, nicht für den Papierkorb zu schreiben, habe ich einige politische Fakten von besonderer Brisanz verschwiegen, habe ich – das allerdings mit Überzeugung – Camus’ antikolonialistisches Engagement und seine R¦sistance-Leistung hervorgehoben und habe ich meinem Gegenstand gegenüber generell eher eine Haltung der Verteidigung als der Sympathie bezeigt. In meiner Arbeitsstelle, dem »Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR«, musste ich mich einer Diskussion über das Manuskript meiner Arbeit stellen; die Möglichkeit, dass die Diskussion in eine Verurteilung umschlüge – so dass die Arbeit nicht publiziert werden könnte – musste ich ins Auge fassen. Das Fazit war : Meine Arbeit wurde, mit Vorbe21 Danielle Roudnicky-Risterucci, La R¦ception de la litt¦rature franÅaie du XXe siÀcle en R.D.A. o¾ l’histoire d’une utopie, ThÀse de doctorat, Universit¦ de Sorbonne IV, 1996, S. 141. 22 Rolf Recknagel, »Zwischen R¦sistance und Resignation«, in: Sonntag, Nr. 34, 1965, S. 9 – 12; Günther Cwojdrak, »Bemerkungen zu Camus«, in: Weltbühne, Nr. 4, 1966, S. 101 – 109; Manfred Naumann, »Albert Camus und die Pest«, in: Neues Deutschland, Nr. 40, 1966, Supplement Nr. 2, S. 15. 23 Brigitte Sändig, Albert Camus. Eine Einführung in Leben und Werk, Leipzig, Reclam 1983.
360
Brigitte Sändig (Berlin)
halten, akzeptiert. Gerügt wurde allerdings eine »hagiographisch eingefärbte Darstellungsweise«24 – ein Tadel, hinter dem sich die noch immer bestehende Berührungsangst mit dem lange geschmähten Autor verbarg, der jedoch auch meiner zu weit gehenden, aus der politischen Situation geborenen Identifizierung galt. Die drakonischen »Festlegungen für den Fortgang der Arbeiten« waren: »1. Dr. Sändig legt die überarbeitete Fassung erstmals nach einem Vierteljahr in der Forschungsgruppe vor. 2. Sie konsultiert Spezialisten für die zu bearbeitenden Probleme.«25 Trotz des unvermeidlichen Anteils von Selbstzensur in der ersten Auflage der Biographie von 1983 (den ich übrigens in den zwei weiteren Auflagen von 1988 und 1992 weitgehend tilgen konnte) war gerade diese erste Vorstellung Camus’ für das DDR-Publikum von besonderem Reiz. Die Biographie war sogleich nach ihrem Erscheinen vergriffen; in Lesungen und Diskussionen schlug mir großes Interesse an dem Gegenstand entgegen. Solches Interesse zeigte sich übrigens auch in der aktiven Aufnahme Camus’ durch Schriftsteller und Künstler in der DDR. Es seien hier nur die Namen der Autoren Franz Fühmann, Uwe Kolbe, Günter Kunert, Christoph Hein, Rainer Kunze und des Malers Wolfgang Mattheuer genannt. Deren Texte, Gedichte und Holzschnitte zeugen davon, dass Camus in der DDR gegenwärtig und lebendig war ; bei Kunze geht das bis zu folgendem Eintrag in die Akte seiner Bespitzelung, wo, durchaus verständnisvoll, mitgeteilt wird: »K. will (nach Camus) Auge in Auge mit dem Nichts leben und im Bewußtsein der Absurdität dieses Daseins Mensch sein; er will dem Einzelnen helfen, Solidarität üben; […] Für R.K. existiert das Absurde auch in der DDR.«26 Inwiefern konnte aber, wenn tatsächlich Opposition geleistet wurde, Camus als Stützung begriffen werden? Auch er ist sicher in der Notiz eines unangepassten Philosophiehistorikers gemeint, in der die Rede ist von »[…] Hilfe […] bei einigen Schriftstellern und Künstlern, deren moralisches Engagement Befreiung bedeutete«27. Gezielter ist die Aussage des oppositionellen Schriftstellers Lutz Rathenow, dass »Sartre und Camus […] Muster für subversive Sprachstrategien [lieferten] und […] die oppositionellen Zirkel [stärkten]«28. Wie ist Camus zu dieser Wirkung gelangt? Bekanntlich hat sich Camus gegen eine vorgebliche »Logik der Geschichte« ausgesprochen, das heißt gegen die Behauptung totalitärer Denker oder Re24 Maschinenschriftliches Protokoll der Verteidigung der Camus-Biographie von Dr. Sändig am 18.12.81, S. 1. 25 Ebd., S. 4. 26 Zitiert nach: Rainer Kunze, Deckname Lyrik, Frankfurt a.M., Fischer-Verlag 1990, S. 76. 27 Guntolf Herzberg (1990), Überwindungen. Schubladen-Texte 1975 – 1980, Berlin 1990, S. 60. 28 Zitiert nach: Ulrich Pfeil, Die »anderen« deutsch-französischen Beziehungen. Die DDR und Frankreich 1949 – 1990, Köln, Weimar, Wien 2004, S. 14.
Camus im Osten
361
gimes, Sachwalter eherner historischer Gesetze zu sein; dieser Logik gegenüber pochte er auf Werte, »die über die Geschichte hinausgehen« – Werte wie »Dialog«, »Solidarität«, »Wahrheit«. – Dem möchte ich einige Verlautbarungen der artikulationsstärksten oppositionellen Kraft in der DDR, der protestantischen Kirche, gegenüberstellen; in diese Position gelangte die Kirche auf Grund der Tatsache, dass sie »in der DDR die einzige wirklich unabhängige und nicht von außen gelenkte oder innerlich gleichgeschaltete Institution« war29, und dass sie die daraus erwachsenden Möglichkeiten institutionell und in Einzelverantwortung wahrnahm. So erarbeitete eine christliche Gruppe zur Verteidigung der Menschenrechte 1987 ein Papier mit dem Titel »Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung«30, in dem Abgrenzung und Dialog folgendermaßen miteinander konfrontiert werden: Die für die meisten Menschen in der DDR unüberwindlichen Auslandsgrenzen hätten zu einer tödlichen Erstarrung des gesellschaftlichen Lebens geführt, denn nur durch den Dialog zwischen den Bürgern verschiedener Länder könne Vertrauen zwischen Menschen und Völkern entstehen. Auch sei die Solidarität über Ländergrenzen hinweg eines der wichtigsten Ziele von Christen. – Ein Mitglied der Redaktionsgruppe hat die Argumente der Gegner eines offenen Umgangs mit dem Papier reflektiert, die es in der Synode gab und die in der Furcht, die Regierenden zu provozieren, zu diskreter Behandlung des Papiers rieten. Das lehnt der Schreibende ab; er meint, dass ein Text, der bewirken soll, »[…] dass die Synode […] in einer Lebensfrage unseres Volkes die Wahrheit sagen und ein Stück Offenheit […] in Anspruch nehmen möge«31, nicht Gegenstand einer Geheimverhandlung sein könne. Diese Argumentation trifft sich, bei aller Unterschiedlichkeit der Situation, mit Camus’ Idee der »discussion libre«, etwa im Falle des Algerien-Konfliktes. Dort strebte Camus »tables rondes« an, Gespräche auf gleichem Niveau, zu genau definierten Gegenständen, um so den Schlagabtausch von Totschlags-Argumenten von beiden Seiten zumindest zu unterbrechen. In der kurzen Zeit der Bürgerbewegung sind die Runden Tische in der DDR bekanntlich Realität geworden. Camus’ politisches Denken nach der Erfahrung des Nationalsozialismus ist auf die Entdeckung und Entwicklung von Werten gerichtet, die sich, die »Logik der Geschichte« durchbrechend, in einfacher, klarer Sprache vermitteln lassen. In diese Richtung gingen auch das gedankliche und praktische Bestreben der Oppositionsgruppen. Unter der Überschrift »Totale Ethik« schreibt deren His29 Markus Meckel/Martin Gutzeit, Opposition in der DDR. Zehn Jahre kirchliche Friedensarbeit – kommentierte Quellentexte, Köln 1994, S. 140. 30 Stephan Bickhardt (Hg.), Recht ströme wie Wasser. Christen in der DDR für die Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung. Ein Arbeitsbuch, Berlin 1988, S. 16 – 17. 31 Hans-Jürgen Fischbeck, »Gedanken zur Einbringung des Antrags in die Synode BerlinBrandenburg«, in: Ebenda, S. 19.
362
Brigitte Sändig (Berlin)
toriograph: »Die Gruppen waren am schöpferischen Prozeß der Neuformulierung von Werten beteiligt und entwickelten im Laufe der letzten Jahre eine zunehmende sachliche Kompetenz in sozialethischen Fragen.«32 Er schreibt den Gruppen »[…] die Kraft der einfachen moralischen Botschaften« zu, die umso wirksamer waren, als »Die Funktionsträger des Systems […] selbst keine Botschaften [hatten]«33. Solidarität und Wahrheit, zwei zentrale Begriffe des politischen Denkens von Camus, wurden in ihrem Bedeutungsgehalt auch für die oppositionellen Gruppen entscheidend. In ihrer um brennende Themen wie Frieden, Menschenrechte, Abrüstung zentrierten Arbeit erlebten sie Solidarität in vertrauensvollem Miteinander, bei einiger Gefährdung. Doch nicht nur untereinander, sondern mit den Belangen der gesamten Gesellschaft fühlten sie sich solidarisch. In dem »Aufruf zur Einmischung in eigener Sache«, mit dem im September 1989 zur Gründung der Bürgerbewegung Demokratie jetzt! aufgerufen wurde, heißt es: »Laßt uns gemeinsam nachdenken über unsere Zukunft, über eine solidarische Gesellschaft, in der soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenwürde für alle gewahrt sind.«34 – Ein unverzichtbarer Wert für die oppositionellen Gruppen war angesichts der immer abenteuerlicher werdenden offiziellen Lügen die Wahrheit – verstanden nicht als ehernes Postulat, sondern als Suche nach Übereinstimmung mit den Tatsachen und dem Mut, sich dazu zu bekennen. Dazu eine Reflexion von 1997, angestellt von demjenigen, der zehn Jahre früher die kirchliche Synode aufgefordert hatte, »in einer Lebensfrage unseres Volkes die Wahrheit [zu] sagen«: »[…] die beiden Punkte, die aus unserer bürgerrechtlichen Tradition festgehalten und weitergetragen werden müssen: der Kampf gegen den Totalitarismus dieser Art [gemeint ist der des Marktes] und das Festhalten an dem Anspruch, dass es so etwas wie die Wahrheit doch gibt.«35 Camus wurde, ob bewusst oder unbewusst, in das Denken und Handeln der oppositionellen Gruppen aufgenommen. Auch heute ist er in dieser Rolle nicht vergessen. So schreibt Friedrich Schorlemmer, Theologe, Vertreter der Bürgerbewegung der DDR und auch gegenwärtig ein kritischer Beobachter und Kommentator der Zeitläufte, beim Lesen von Camus’ politischen Essays: »Camus sieht klar und hört nicht auf zu hoffen. Er weiß um die tödlichen Widersprüche; aber er wird nicht zynisch.«36 32 Ehrhart Neubert, Eine protestantische Revolution, Zepernick 1990, S. 54. 33 Ebd., S. 68/9. 34 Gerhard Rein (Hg.), Die Opposition in der DDR. Entwürfe für einen anderen Sozialismus, Berlin 1989, S. 60. 35 Hans-Jürgen Fischbeck, Wir bleiben hier! Das politische Vermächtnis von Oppositionsgruppen und der Bürgerbewegung der DDR, Berlin 1997, S. 37. 36 Friedrich Schorlemmer, »Ich lese gerade…«, Die Zeit (40) 1993, S. 84.
Camus im Osten
363
Nun noch einige Bemerkungen zur Rezeption Camus’ in den Ländern des Ostblocks; hier stammen meine Kenntnisse und Eindrücke natürlich nur aus zweiter Hand und sind fragmentarisch37. – Vorausgeschickt sei, dass der Umstand, dass die DDR im Unterschied zu den anderen Ländern des Ostblocks keine nationale Legitimation besaß und dass sie der am weitesten westlich gelegene Vorposten des »sozialistischen Lagers« war, zu exzeptioneller Ängstlichkeit des Regimes, auch in kulturellen Angelegenheiten, führte. Daher stellten Fahrten nach Ungarn, Polen oder die Tschechoslowakei für wissbegierige Geister in der DDR zu Zeiten des Reiseverbots nach Westen die einzige Gelegenheit dar, eine gewisse kulturelle Offenheit zu spüren und den Informationshunger teilweise zu befriedigen. Der lockerere Umgang, der von den Kulturfunktionären dieser Länder – freilich in an- und abschwellenden Wogen – mit Kulturströmungen und Kunst aus dem »Westen« gepflegt wurde, brachte auch in Sachen Camus eine günstigere Informations- und Publikationssituation mit sich. – In der Tschechoslowakei, die sich, ebenso wie Polen, französischer Kultur traditionell nahe fühlte, war Camus bereits Ende der vierziger Jahre durch eine Übersetzung von L’Etranger kein Unbekannter. Dank solchen Vorlaufs und einer viel stärkeren Front aufgeschlossener Kommentatoren als in der DDR, gelangte, wie eine Theaterhistorikerin berichtet, im Zuge des Liberalisierungsprozesses der sechziger Jahre, als die Stunde also günstig war, fast das gesamte dramatische Werk Camus’ auf die Bühnen des Landes – zusammen mit, um nur die Franzosen zu nennen, Ionesco, Beckett, Sartre, Genet. Doch auch diese tschechische Autorin bemerkt in Hinblick auf die generelle Lage: »Ein kulturelles und geistiges Leben mit zwei Gesichtern, dem offiziellen und dem versteckten, war – bei uns wie im gesamten ›Ostblock‹ – offensichtliche Wirklichkeit […]«38 – In Ungarn wurde Camus in den sechziger und siebziger Jahren stark übersetzt, gelesen, kommentiert – übersetzt wurde freilich ebenfalls »nur« der literarische Camus; den politischen Denker hielt man sich auch hier vom Leibe. Ein ungarischer Kollege schreibt: »Die damalige Wirkung stellt […] einen Widerspruch in sich dar, denn es handelt sich um […] eine Zeit, in welcher der soziale Frieden in Ungarn auf einer grundlegenden Unwahrheit über den Aufstand vom Oktober 1956 beruhte. [Dennoch] gelangte das Kadar-Regime im Bereich der Kultur […] zu einer immer toleranteren Politik.«39 Die Frage, ob man »von einer Art Sympathiewelle« sprechen könne, »durch die Camus zu einer besonderen Stellung 37 Ich beziehe mich dabei auch auf Aussagen der Autoren des von mir herausgegebenen Sammelbandes Camus im Osten. Zeugnisse der Wirkung Camus’ zu Zeiten der Teilung Europas, Potsdam 2000. 38 Jana Patocˇkov, »Albert Camus auf den tschechischen Bühnen der sechziger Jahre«, in: Ebenda, S. 96. 39 Andor Horvth, »›Gott sich selbst zurückgeben‹ – Ungarische Lesarten Camus‹«, in: Ebenda, S. 47.
364
Brigitte Sändig (Berlin)
im intellektuellen Klima Ungarns dieser Jahre gelangte«40, beantwortet der Autor des Artikels mit Ja. – Besonders merkwürdig war die Situation in Rumänien. Da Ceaus¸escu, der als irrwitziger Diktator in die Geschichte eingegangen ist, in den sechziger und siebziger Jahren einen Kurs gewisser politischer Eigenständigkeit verfolgte, war das Kulturleben in dieser Tauwetterperiode relativ unreglementiert; in diesen Jahren wurden, außer L’Homme r¦volt¦, alle Werke Camus’ übersetzt und mehrere Bücher über Camus in Rumänien publiziert. Nach Aussage einer rumänischen Kollegin war Camus zu dieser Zeit »der am meisten übersetzte französische (wenn nicht überhaupt ausländische) Schriftsteller«41. Das Tauwetter währte indes nur kurz; »Camus zu übersetzen, ohne ihn dabei zu verleumden, stellte 1976 bereits eine mutige Handlung dar«42, schreibt diese Kollegin. Dennoch bekannte sich die große rumänische Camus-Übersetzerin und -Kommentatorin Irina Mavrodin in einem persönlichen Gespräch auch in den achtziger Jahren noch zum Ethos des unbeirrten Fortfahrens in den Bemühungen um Camus. Im Jahr 2000 schrieb sie mir dann: C’¦tait notre forme de r¦sistance, une r¦sistance par la litt¦rature, par la culture, un certain moment la seule possible (et donc la seule efficace), vu la duret¦ du r¦gime dictatorial de Ceaus¸escu. Aujourd’hui, dans certains milieux intellectuels roumains, ce concept (»la r¦sistance par la culture«) est trÀs controvers¦, mais, mon avis, il explique la continuit¦ que l’on a pu maintenir en Roumanie par rapport une tradition culturelle occidentale, notamment franÅaise.43
– So, wie die offizielle Rezeption Camus’ anfangs in der Sowjetunion verlief, wird sie als rigide Vorgabe für die DDR-Rezeption erkennbar : ignorante Herabsetzungen, ja Beschimpfungen an die Adresse des »eingefleischten Antikommunisten« in den fünfziger Jahren. Nach Aussage des russisch-französischen Camus-Kenners EugÀne Kouchkine hatten französische Intellektuelle unrühmlichen Anteil daran; so habe sich Louis Aragon der Veröffentlichung von Camus in der UdSSR kategorisch widersetzt44. Doch gab es in der Sowjetunion eine – mehr oder weniger verborgen wirkende – Gegenkraft zur intellektuellen Beschränkung: die kulturbewusste sowjetische Intelligenzija, die besonders für die »russische Prägung« in Camus’ Werk empfänglich war und deren exponierter Vertreter Sacharow etwa zu Camus’ Nobelpreisrede sagte: »Diese Rede klingt ganz nach Puschkin, das ist genau der Puschkinsche Ehrenkodex.«45 Auch Pasternak war ein Vermittler Camus’ in der Sowjetunion – inoffiziell wie die 40 41 42 43 44
Ebd. Virginia Baciu, »Albert Camus in Rumänien«, in: Ebd., S. 10. Ebd., S. 17. Brief von Irina Mavrodin an Brigitte Sändig vom 14. April 2000. S. EugÀne Kouchkine, »Camus im Lande der Sowjets«, in: Brigitte Sändig (Hrsg.), Camus im Osten. Zeugnisse der Wirkung Camus’ zu Zeiten der Teilung Europas, a. a. O., S. 62. 45 Zitiert nach: Ebd., S. 60.
Camus im Osten
365
ersten Camus-Übersetzungen, die sämtlich im Samizdat erschienen. Doch Ende der sechziger Jahre lag auch hier das literarische Werk Camus’ in offizieller Übersetzung vor. Die Kommentare stammten aus der Feder des hervorragenden sowjetischen Kenners des französischen Existentialismus, Samari Welikowski, von dem Kouchkine sagt: »Man kann sagen, dass die sowjetischen Leser Camus aus den Händen von Samari Welikowski empfangen haben.«46 Welikowski, ein unorthodoxer Marxist und scharfsinniger Kritiker, hat schließlich in seinem Camus-Buch Die Grenzen des unglücklichen Bewusstseins47 mit der leidigen Zweiteilung von Camus’ Werk in einen – abzulehnenden – philosophischen Strang und einen – bedingt zu bejahenden – literarischen, der die gesamte Camus-Rezeption des Ostblocks prägte, Schluss gemacht; in einer Haltung kritischen Verständnisses stellte er das Schaffen Camus’ als fundamentale Einheit dar, gruppiert um die Achsen Freude am Leben/Tragik der menschlichen Existenz. – Kouchkine schließt seinen Rezeptions-Aufsatz mit den Worten: »Camus […] ist, ganz offensichtlich, dank jahrzehntelanger Anstrengung in die russische Literatur eingedrungen und hat sie dabei bereichert […]«48 Solche Bereicherung war für die Literaturen – und nicht nur für diese, sondern auch für die Menschen – in den vormaligen Ländern des Ostblocks eine vitale Notwendigkeit.
46 Ebd., S. 68. 47 Samari Welikowski, Die Grenzen des unglücklichen Bewußtseins. Theater, Prosa, philosophische Essayistik und Ästhetik von Albert Camus (russ.), Moskau 1973. 48 EugÀne Kouchkine, »Camus im Lande der Sowjets«, in: Brigitte Sändig (Hrsg.), Camus im Osten. Zeugnisse der Wirkung Camus’ zu Zeiten der Teilung Europas, a. a. O., S. 80.
Thomas A. Schmitz (Bonn)
Camus und der griechische Mythos
Wer sich für die über die Maßen reiche Wirkungsgeschichte der antiken Kultur und Literatur in Frankreich interessiert, wird gewiss an andere Autoren eher denken als an Albert Camus. Zweifelsohne gibt es in seinem Werk eine Reihe von Zeugnissen der Rezeption der Antike. Am bekanntesten ist sicherlich sein erstmals 1943 publizierter Mythe de Sisyphe, der aus der mythischen Gestalt des Sisyphos ein Symbol des menschlichen Daseins in einer kalten und fremden Welt macht; der Schlusssatz, man müsse sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen, hat inzwischen den Rang eines geflügelten Wortes erhalten.1 Vielleicht denkt man auch an sein Theaterstück Caligula, ebenfalls noch während des zweiten Weltkriegs entstanden und im Mai 1944 publiziert, mit seiner provokanten Neudeutung der Figur dieses in der historiographischen Tradition so übel beleumundeten Kaisers.2 Darüber hinaus jedoch scheint die Antike, insbesondere die griechische Mythologie, um die es in diesem Beitrag gehen soll, in den bekannten Stücken von Camus’ Schaffen keine sonderlich bedeutende Rolle zu spielen. Mit dieser auf den ersten Blick geringen Rolle der antiken Mythologie in seinem Werk scheint übereinzustimmen, dass Camus selbst in seinen Aussagen über Literatur des öfteren betont, dass neue historische Konstellationen auch neue literarische Formen erfordern;3 deshalb äußert er sich scheinbar abschätzig über die Relevanz von Mythen: »Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes.«4 Doch blickt man genauer auf sein Werk, so stellt man fest, dass diese Ablehnung des antiken Mythos nur ein polemisches Argument gegen literarische Traditionalisten ist; tatsächlich steht Camus dem antiken Mythos deutlich näher, als es zunächst den Anschein hat. Der Mythe de Sisyphe steht in seinem Werk 1 2 3 4
Zu Camus’ Sisyphosfigur vgl. Archambault (1972), 19 – 25; Hühn (2005). Vgl. zuletzt Bastien (2005); Bastien (2006). Vgl. Scheel (1973), 299 – 300. Camus wird hier nach der Standardausgabe zitiert: Albert Camus, Œuvres complÀtes, 4 Bde (Pl¦iade), Paris 2006 – 2008; das Zitat stammt aus Les Noces, OC 1, 107.
368
Thomas A. Schmitz (Bonn)
nicht isoliert, sondern ist Bestandteil einer ganzen Reihe von Figuren und Motiven der griechischen Mythologie, die in seinen Schriften wie Leitmotive immer wiederkehren und Camus über lange Zeit beschäftigt haben. Wenn wir mit Sisyphos beginnen, so ist bemerkenswert, dass Camus selbst den Essai über diese mythische Figur zunächst als ersten einer dreiteiligen Reihe geplant hatte. Auf Sisyphos als Bild der Absurdität des menschlichen Daseins sollte eine Darstellung des Prometheusmythos als Bild der Revolte folgen; als abschließender dritter Teil war eine Nemesis geplant. Nemesis ist die griechische Göttin der Vergeltung und der ausgleichenden Gerechtigkeit, die Camus wohl als Symbol der »mesure«, des Menschenmaßes in unserer Welt, und der Akzeptanz unseres Platzes in dieser Welt darstellen wollte.5 Diesen Plan hat Camus bekanntlich nicht mehr umgesetzt. Zwar spielt Prometheus in seinem 1951 publizierten Essai L’Homme r¦volt¦ noch eine wichtige Rolle, aber der mythische Titan wird hier nicht mehr als zentrale Symbolfigur in den Vordergrund gestellt. Die Absicht, die Gestalt der Nemesis für Aspekte seiner Philosophie als Symbolfigur zu verwenden, scheint Camus später ganz aufgegeben zu haben; jedenfalls finden sich keine weiteren Erwähnungen in seinen Notizen oder in seinem veröffentlichten Werk. Interessant ist die Beobachtung, dass Camus mit der projektierten und zumindest teilweise durchgeführten Abfolge Sisyphos – Prometheus seinen eigenen Weg durch die griechische Mythologie gewissermaßen umkehrte. Die Figur des Prometheus hatte ihn schon seit längerer Zeit fasziniert.6 Der Anfang seiner Beschäftigung mit dieser Gestalt des Mythos lässt sich wohl nicht genau datieren, aber einen ersten Höhepunkt kann man deutlich feststellen: Im Jahr 1936 hatte sich Camus intensiv mit dem Gefesselten Prometheus beschäftigt, einem antiken Drama, das unter den Tragödien des Aischylos überliefert ist, dessen Authentizität unter den Philologen allerdings umstritten ist. Diese Diskussion über die Echtheit des Stückes war gerade in der Zeit, als Camus sich mit dem Text beschäftigte, höchst virulent geworden; 1929 hatte der deutsche Philologe Wilhelm Schmid in einer Abhandlung die Zuschreibung an Aischylos energisch bestritten.7 Camus jedoch scheint davon keine Kenntnis gehabt zu haben; für ihn bleibt der Gefesselte Prometheus ein Stück des Aischylos. Camus richtete das Drama für die Bühne des von ihm 1936 gegründeten Th¦tre du travail in Algier ein, wo es im März 1937 mehrfach gespielt wurde. Leider wird diese Bühnenfassung in der neuen Pl¦iade-Ausgabe nicht vollständig abgedruckt; H. P. Lund hat in einem soeben erschienenen Aufsatz das 5 S. die Notiz aus den Carnets, OC 2, 1083: »N¦m¦sis – d¦esse de la mesure. Tous ceux qui ont d¦pass¦ la mesure seront impitoyablement d¦truits.« Vgl. Scheel (1973), 312 – 313. 6 Zu Prometheus in der europäischen Literatur vgl. Trousson (2001); zu Prometheus bei Camus Bree (1976). 7 Schmid (1929).
Camus und der griechische Mythos
369
handschriftliche Material gesichtet und eine Analyse vorgelegt.8 Camus verkürzt den Text des antiken Dramas und spitzt ihn plakativ auf seine Hauptaussagen zu. Die lange Io-Szene, in der die junge Geliebte des Zeus selbst über ihre bisherigen Irrfahrten berichtet und von Prometheus eine ausführliche Prophezeiung erhält, dass sie noch die gesamte antike Welt werde durchwandern müssen (Gefesselter Prometheus 640 – 876), lässt Camus aus nachvollziehbaren Gründen entfallen; dieser geographische Exkurs konnte für Zuschauer des zwanzigsten Jahrhunderts nicht mehr von Interesse sein. Für das Verständnis von Camus’ Textdeutung entscheidend jedoch ist ein anderer Aspekt: Systematisch entfernt er alle Hinweise, die auf eine spätere Aussöhnung zwischen Prometheus und Zeus deuten. Sein Prometheus zeigt nicht die geringste Kompromissbereitschaft; stolz und ungebrochen nimmt er sein Leiden auf sich, ohne jede Aussicht auf eine Besserung seiner Lage – hier ist also die Prometheusgestalt des Homme r¦volt¦ bereits angelegt. Die Faszination mit der Prometheusgestalt wird ebenfalls sichtbar in dem Essai Prom¦th¦e aux enfers, den Camus 1946 schrieb. Deutlich klingt hier noch das Entsetzen über den gerade beendeten Weltkrieg und die Zweifel hinsichtlich der Ambivalenz des technologischen Fortschritts nach, wenn Camus nun in Prometheus zwar einerseits den Kulturbringer sieht (ein Aspekt, der auch in dem antiken Prometheusdrama eine wichtige Rolle spielt und den Camus deshalb aus seiner früheren Arbeit genau kannte), andererseits aber energisch darauf hinweist, dass sich die Funktion des Prometheus eben nicht auf den technokratischen Fortschritt reduzieren lässt: Prometheus wollte den Menschen mit der Technik zugleich auch Freiheit und Selbstbestimmung bringen, während »wir heute« die Technik von dieser Freiheit des Menschen trennen zu können glauben. Käme Prometheus zu uns heutigen Menschen, müsste er mit seinem Anspruch an Freiheit und Würde wieder das Martyrium leiden: »Les voix ennemies qui insulteraient alors le vaincu seraient les mÞmes qui retentissent au seuil de la trag¦die eschylienne: celles de la Force et de la Violence.«9 Prometheus gewinnt in diesem Essai neue Dimensionen hinzu: Zwar bleibt er immer noch der Revoltierende, dessen Hartnäckigkeit (»obstination«) Camus bewundert, aber zugleich erscheint er auch als Vorläufer all derjenigen, die zu allen Zeiten, auch heute noch, bereit sind, für eine Sache zu kämpfen in vollem Bewusstsein, dass nicht sie selbst die Früchte ihrer Arbeit werden ernten können.10 Damit weist die
8 Lund (2008); vgl. zu dieser Aufführung auch Scheel (1973), 310 f. 9 Camus, OC 3, 589. Mit »Force« und »Violence« sind die beiden allegorischen Figuren Kratos (Herrschaft) und Bia (Gewalt) gemeint, die in dem antiken Stück im Prolog auftreten, um Prometheus gewaltsam in den Kaukasus zu führen, wo er von Hephaist festgeschmiedet wird. 10 Auch dieser Aspekt ist bereits in dem antiken Drama angelegt, wenn Prometheus vom Chor
370
Thomas A. Schmitz (Bonn)
Prometheusgestalt über die Revolte und die Sinnlosigkeit des Daseins hinaus auf das politische Engagement der Nachkriegsjahre. Neben diesen beiden Schlüsselerzählungen von Sisyphus und Prometheus kann man eine Reihe weiterer mythologischer Gestalten erwähnen, denen Camus zwar nicht eine ganz so zentrale Rolle zuweist, die aber an einzelnen Stellen seines Werkes wichtige Funktionen übernehmen. Insbesondere drei dieser mythologischen Figuren seien hier genannt: (1) In dem Essai Le Minotaure ou la halte d’Oran, wohl 1941 fertiggestellt, schildert Camus den »ennui« und die Klaustrophobie der von ihm (vielleicht auch aus biographischen Gründen) wenig geschätzten algerischen Stadt Oran. Zur Darstellung bedient er sich der antiken Gestalt des Minotaurus: Oran ist für Camus ein Labyrinth, das vom Minotaurus bewohnt wird. Oran est un grand mur circulaire et jaune, recouvert d’un ciel dur. Au d¦but, on erre dans le labyrinthe, on cherche la mer comme le signe d’Ariane. Mais on tourne en rond dans des rues fauves et oppressantes, et, la fin, le Minotaure d¦vore les Oranais: c’est l’ennui. Depuis longtemps, les Oranais n’errent plus. Ils ont accept¦ d’Þtre mang¦s.
Im antiken Mythos werden in einem grauenhaften Ritual junge Menschen dem Minotaurus im Labyrinth zum Opfer gebracht und von ihm gefressen, bis der Heros Theseus das Ungeheuer überwindet und mit Hilfe des berühmten Ariadnefadens wieder aus dem Labyrinth herausfindet. In Oran hingegen suchen die Menschen nicht einmal mehr nach diesem Faden; sie haben sich in ihr Schicksal ergeben. Doch in einer ironischen Volte beschließt Camus den Essai mit der überraschenden Interpretation, dass eben in diesem Akzeptieren des Schicksals zugleich auch die Befreiung liegt:11 Voil, peut-Þtre, le fil d’Ariane de cette ville somnambule et fr¦n¦tique. On y apprend les vertus, toutes provisoires, d’un certain ennui. Pour Þtre ¦pargn¦, il faut dire »oui« au Minotaure. C’est une vieille et f¦conde sagesse.
(2) Etwas später, 1948, entsteht der Essai L’Exil d’H¦lÀne, Ren¦ Char gewidmet. Hier ist es die Gestalt der Helena, die Camus zu einem Symbol für die Stellung des modernen Menschen macht, oder genauer : in der Helenagestalt bündelt Camus den Unterschied zwischen antiker und moderner Welt.12 Während die Griechen die Grenzen des menschlichen Daseins kannten und mit einem Arzt verglichen wird, der sich selbst nicht helfen kann (473 – 475). Dass hier Camus’ Erfahrungen aus der R¦sistance einfließen, liegt auf der Hand. 11 Camus OC 3, 584. 12 Zu Helena in der französischen Literatur s. Newman-Gordon (1968), zu Helena bei Camus bes. 162 – 166; vgl. weiter Scheel (1973), 316.
Camus und der griechische Mythos
371
akzeptierten, jagt der moderne Mensch nach dem Absoluten und hat deshalb in seiner Maßlosigkeit die Welt hässlich gemacht. In einer paradoxen Wendung spricht Camus deshalb der modernen westlichen Welt kategorisch das Recht ab, sich auf das Erbe der Antike zu beziehen, beschwört andererseits aber eben dieses Erbe herauf, wenn er emphatisch auf den Freiheitskampf der Griechen gegen die Perser verweist:13 Voil pourquoi il est ind¦cent de proclamer aujourd’hui que nous sommes les fils de la GrÀce. Ou alors nous en sommes les fils ren¦gats. PlaÅant l’histoire sur le trúne de Dieu, nous marchons vers la th¦ocratie, comme ceux que les Grecs appelaient Barbares et qu’ils ont combattus jusqu’ la mort dans les eaux de Salamine.
Aus dem Abstand von mehr als 60 Jahren mag uns das Pathos dieser Zeilen befremden; die in ihnen geäußerten Gedanken aber sind heute so lebendig, wie sie es kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren: Die moderne Weigerung, menschliche Grenzen anzuerkennen, ist oftmals auch ein Zeugnis fehlender Liebe zu den Menschen. In den hymnischen Schlussworten des Essais finden wir wieder Positionen von Prom¦th¦e aux enfers wieder (der Verweis auf die Entbehrungen derjenigen, die für eine Zukunft arbeiten, die sie selbst nicht mehr erleben werden) und zugleich einen geradezu flehentlichen Appell, die moderne Welt möge wieder den Werten folgen, zu deren Symbol Camus hier die antike Schönheit und Helena macht:14 L’ignorance reconnue, le refus du fanatisme, les bornes du monde et de l’homme, le visage aim¦, la beaut¦ enfin, voici le camp o¾ nous rejoindrons les Grecs. D’une certaine maniÀre, le sens de l’histoire de demain n’est pas celui qu’on croit. Il est dans la lutte entre la cr¦ation et l’inquisition. Malgr¦ le prix que coteront aux artistes leurs mains vides, on peut esp¦rer leur victoire. Une fois de plus, la philosophie des t¦nÀbres se dissipera au-dessus de la mer ¦clatante. ¬ pens¦e de midi, la guerre de Troie se livre loin des champs de bataille! Cette fois encore, les murs terribles de la cit¦ moderne tomberont pour livrer, »me sereine comme le calme des mers«, la beaut¦ d’H¦lÀne.
Helena war bereits in der antiken Literatur eine überaus ambivalente Gestalt: Dass sie ihren Mann Menelaos verließ, um mit Paris nach Troia zu fliehen, ist Auslöser des troianischen Kriegs, einer Katastrophe, die unzählige Menschen das Leben kostet und Leid und Trauer über Besiegte und Sieger zugleich bringt. Zugleich jedoch ist sie Tochter des Zeus, von unbeschreiblicher Schönheit und am Ende vielleicht doch nur unschuldiges Werkzeug der Götter. Camus’ Passage nimmt diese Ambivalenz auf: Die Schönheit Helenas muss aus den »schrecklichen Mauern der modernen Stadt« gerettet, das Schöne im Schrecken gefunden werden. Auch das Zitat »me sereine comme le calme des mers«, das die mo13 OC 3, 598. 14 OC 3, 601.
372
Thomas A. Schmitz (Bonn)
dernen Camus-Herausgeber nicht nachweisen konnten,15 ist in diesem Kontext zu sehen: Es entstammt dem zweiten Stasimon (Chorlied) des Agamemnon des Aischylos, in dem der Chor die Vorgeschichte des troianischen Kriegs analysiert. Helena wird dort einerseits mit etymologischem Spiel als »Zerstörerin von Schiffen, Männern und Stadt« (2k]maur 6kamdqor 2k]ptokir, 690) bezeichnet, andererseits schildert Aischylos ihre Ankunft in der Stadt als die eines »Gedankens windstiller Meeresruhe« (vq|mgla … mgm]lou cak\mar, 740).16 (3) Schließlich sei genannt die Gestalt des Abenteurers und Heimkehrers Odysseus. Bereits in seinem Prometheusessai verwendet Camus diese Figur, um seine Sehnsucht nach dem Licht und der Schönheit Griechenlands darzustellen, eine Sehnsucht, die bei ihm als Symptom und Symbol nicht nur einer materiellen, sondern besonders einer geistigen Heimatlosigkeit gedeutet werden sollte: In dem Jahr, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, habe er eine Reise nach Griechenland unternehmen wollen, »pour refaire le p¦riple d’Ulysse«.17 Auch in dem gerade zitierten Helenaessai wird Odysseus wieder genannt: Seine Entscheidung, die ihm von Kalypso angebotene Unsterblichkeit zugunsten der gefahrvollen Rückkehr in seine Heimat, zu seiner Frau Penelope (und damit letztlich zugunsten seines Todes) abzulehnen, spielt hier die Rolle eines Paradigmas für das Akzeptieren der menschlichen Beschränkung, wie es »die Griechen« so exemplarisch vorgeführt haben.18 Ulysse peut choisir chez Calypso entre l’immortalit¦ et la terre de la patrie. Il choisit la terre, et la mort avec elle. Une si simple grandeur nous est aujourd’hui ¦trangÀre. D’autres diront que nous manquons d’humilit¦.
Dass Camus also zumindest in einer gewissen Phase seines Schaffens des öfteren Gestalten und Situationen aus der griechischen Mythologie wählte, um seine Botschaft zu vermitteln, lässt sich aus dieser Reihe deutlich erkennen. Hervorzuheben bleibt, dass Prometheus, Helena und Odysseus nicht lediglich als rhetorischer Schmuck oder poetisches Beiwerk verwendet werden; vielmehr lädt Camus ihre Gestalten mit Bedeutung auf und erwähnt sie an argumentativ 15 Es findet sich bereits in den Carnets; die Herausgeber bezeichnen es OC 2, 1083 als »douteux«. 16 Die von Camus zitierte Passage findet sich wörtlich in derselben Übersetzung in Pierron (1875), 277; dieses Werk erlebte im 19. Jahrhundert eine Reihe von Auflagen; die hier zitierte ist die siebte. Möglicherweise ist dies die Quelle für Camus’ Zitat. Dass seine Verwendung der Mythologie oftmals nicht auf direkter Kenntnis der antiken Texte beruhte, sondern auf Handbüchern und sekundären Quellen, betonen etwa (bisweilen mit geradezu moralischer Entrüstung über seine Arbeitsweise) Archambault (1972) oder Gay-Crosier (1976), 199. 17 OC 3, 590. 18 OC 3, 600.
Camus und der griechische Mythos
373
entscheidenden Stellen seiner Essais. Weil er bei seinem Publikum eine Vertrautheit mit diesen mythischen Gestalten (zumindest in den Hauptzügen des Mythos) voraussetzen kann, erlauben ihm diese Namen, komplexe Hintergründe und Entwicklungen in wenigen Worten zu bündeln: Prometheus, der unbeugsame Kämpfer; Helena, die im letzten Grund unberührbare Schönheit; Odysseus, der Irrfahrer und Heimkehrer. Selbstverständlich folgt Camus mit dieser argumentativen Verwendung des antiken Mythos einem Zug, der in der französischen Literatur seiner Zeit sehr ausgeprägt zu finden ist: So hatte etwa Andr¦ Gide kurz vor Camus den Prometheusmythos in humorvoller Weise gestaltet und in seinem Th¦s¦e den Titelhelden als skrupellosen Verführer, den Minotaurus hingegen als überaus schönes und eben dadurch gefährliches Monster darstellt.19 Solche provokativen, spielerischen, kritischen, neue Aspekte herauskehrenden Adaptationen antiker Mythen waren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Frankreich vielfach zu finden; es genügt, hier etwa auf Autoren wie Jean Giraudoux, Jean Anouilh, Marguerite Yourcenar oder auch auf Künstler wie Picasso zu verweisen. Mir geht es hier jedoch nicht um den (zweifelsohne interessanten) synchronen Vergleich von Camus’ Mythenverwendung mit der seiner Zeitgenossen; vielmehr möchte ich die Frage stellen, in welcher Beziehung Camus’ Behandlung des Mythos zu der Weise steht, wie der Mythos in der Antike selbst erzählt und verwendet wurde. Die Frage, was eigentlich ein antiker Mythos sei, ist notorisch schwierig zu beantworten.20 Dennoch kann man versuchen, eine Minimaldefinition zu geben, die sich in den letzten Jahrzehnten als Konsens etabliert hat; sie würde etwa folgendermaßen lauten: »Ein antiker Mythos ist eine traditionelle Geschichte, meist über Götter und Heroen. Sie wird von ihrem Erzähler als Argument eingesetzt; ihre argumentative Kraft beruht darauf, dass ihr von den Rezipienten eine gewisse Glaubwürdigkeit und Autorität zuerkannt wird.«21 Zwei wichtige Aspekte dieser Definition seien noch einmal hervorgehoben: (1) Mythen werden, zumindest in den frühen Epochen der Antike, nicht um ihrer selbst willen erzählt, aus reiner Erzählfreude, sondern man setzt sie ein, weil man eine bestimmte Wirkung erzielen möchte: Die von einem Mythos Angesprochenen sollen zu Modifikation ihres Verhaltens aufgefordert, gelobt oder getadelt, zum Nachdenken gebracht oder emotional 19 Le Prom¦th¦e mal enchan¦, 1899; Th¦s¦e, 1946. In Pollard (1970) findet sich eine Reihe wichtiger Angaben zum starken Interesse für Theseus im Frankreich der dreißiger und vierziger Jahre. 20 Aus der schwer überschaubaren Fülle an Literatur seien lediglich einige wichtige neuere Beiträge exemplarisch genannt: Vernant (1974), Kirk (1974), Detienne (1981), Veyne (1983), Bremmer (1987), Edmunds (1990), Sad (1994), Woodard (2007). 21 Einige Beispiele für neuere Arbeiten: Bremmer in Bremmer (1987), 1 – 9; Edmunds in Edmunds (1990), bes. 15; Graf (1999), 7 – 14.
374
Thomas A. Schmitz (Bonn)
beeinflusst werden. Die Bandbreite der argumentativen Absichten, die Sprecher mit einem Mythos verfolgen können, ist groß; im Vordergrund des Sprechaktes steht aber regelmäßig diese konative, auf das Gegenüber ausgerichtete Einstellung. In dieser argumentativen Funktion gehören Mythen in den Bereich des aWmor (ainos), d. h. der Rede, die mit Nebengedanken auf ein bestimmtes Ziel hin gesprochen wird; in dieselbe Kategorie gehören etwa auch Fabeln. Weil Mythen regelmäßig aus dieser argumentativen Funktion heraus gesprochen werden, werden sie meist nicht in ihrer Gänze erzählt, sondern lediglich die Teile, die für den jeweiligen Kontext, das jeweilige Argument relevant sind. (2) Obwohl Mythen traditionelle Geschichten sind und ihnen aus dieser Traditionalität Autorität zuwächst, sind sie veränderlich. Die großen Linien der Erzählung bleiben im Allgemeinen erhalten (so ist etwa keine Version des Mythos vorstellbar, in der Odysseus nicht nach Hause gelangt, sondern es vorzieht, doch bei Kalypso zu bleiben und dort die von ihr angebotene Unsterblichkeit zu genießen). Doch die Details können, je nach Aussageabsicht und Kontext, je nach Genre und Publikum, sehr frei variiert werden.22 Unsere attischen Tragödien dafür besonders klares Beispiel: wie Orest seine Mutter Klytaimnestra bestraft, wie er anschließend mit dieser Strafe umgeht, was aus ihm und seiner Schwester Elektra wird, kann völlig unterschiedlich dargestellt werden; Dichter nehmen sich hier ganz selbstverständlich größte Freiheiten. Im Lauf seiner Rezeptionsgeschichte in der westlichen Kultur hat der griechische Mythos eine Reihe von Verwandlungen durchgemacht. Bereits in hellenistischer Zeit, also seit dem dritten vorchristlichen Jahrhundert, entstehen mythographische Handbücher, die sich bemühen, die in der griechischen Literatur bisher lediglich in Ausschnitten überlieferten Mythen möglichst vollständig und systematisch zu sammeln;23 diese konsolidierende und bewahrende Sammeltätigkeit setzt sich in der römischen Kultur fort.24 Diese Sammlungen haben ihrerseits wieder Rückwirkungen auf die in hellenistischer und römischer Zeit entstehende Literatur : Die poetae docti verwenden die gesammelten Mythen nun als Stoff für ihre Erzählungen und zur Dekoration; die argumentative Funktion des Mythos geht zwar nicht völlig verloren, rückt jedoch in den Hintergrund. Ein illustratives Beispiel dieser »modernen« Verwendung des griechischen Mythos sind Ovids Metamorphosen, entstanden in den Jahren um die Zeitenwende: Ovid bedient sich aus dem Fundus des Mythos, den er aus den Texten seiner poeti22 Vgl. dazu etwa March (1987). 23 S. Carolyn Higbie in Woodard (2007), 237 – 254. 24 S. Cameron (2004).
Camus und der griechische Mythos
375
schen Vorgänger, aber auch aus Handbüchern und Sammlungen kennt, um daraus seinen eigenen bunten Strauß von mythologischen Verwandlungsgeschichten zu produzieren. Für die Wirkungsgeschichte des griechischen Mythos in der europäischen Kultur gibt es wohl keinen einflussreicheren Text als die Metamorphosen, aus denen zahllose Dichter, Philosophen, bildende Künstler und Intellektuelle den griechischen Mythos kennenlernten.25 Diese gelehrte, mit Kenntnissen und Erwartungen eines ebenfalls gebildeten Publikums spielende Art der Mythenbehandlung setzt sich in der Renaissance fort und gelangt so bis in die Moderne; gerade die französische Literatur bietet dafür zahlreiche Beispiele seit dem 16. bis in das 21. Jahrhundert. Camus geht in seinem Bezug auf antike Mythen über eine solche rein dekorative oder intellektuell-spielerische Verwendung weit hinaus und berührt sich darin mit einer Reihe antiker Vorläufer ; pointiert könnte man sagen, dass er in seiner Mythenrezeption nicht trotz, sondern gerade wegen seiner skeptischen Haltung zum konventionellen, bildungsbürgerlich sanktionierten Gebrauch des Mythos den Verwendungsweisen der Antike selbst näher kommt als viele seiner Zeitgenossen, bei denen der Mythos oberflächlich eine bedeutendere Rolle zu spielen scheint als bei ihm. Diese These möchte ich anhand von drei Aspekten kurz erläutern: (1) Dass auch Camus Mythen nicht aus reiner Erzählfreude vollständig wiedergibt, sondern lediglich einige wenige relevante Details aufgreift, und dass er in seine Mythen nachdrücklich eingreift, sie wandelt und dem jeweiligen Kontext anpasst, haben wir bereits gesehen; desgleichen, dass er sich in dieser Verwendung von Mythen mit einer Reihe seiner Zeitgenossen vergleichen lässt. Nachzutragen ist hier, dass er darin bereits auf antike Vorgänger verweisen kann und dies auch explizit tut. Einen Beleg dafür, dass sich Camus mit seiner Mythenverwendung bewusst in antike Traditionen stellt, finden wir etwa am Beginn seines Prom¦th¦e aux enfers. Hier zitiert Camus als Motto eine Passage aus Lukians Prometheus:26 Lukian, ein satirischer Schriftsteller des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, setzt das pseudo-aischyleische Drama in einen Dialog zwischen Hermes und Prometheus im Kaukasus um; dabei lässt er Prometheus in ausgefeilter Diktion 25 S. dazu etwa Martindale (1988); Walter und Horn (1995). 26 OC 3, 589: »Il me semblait qu’il manquait quelque chose la divinit¦ tant qu’il n’existait rien lui opposer.« Es handelt sich um ein (leicht abgeändertes) Zitat aus der langen Verteidigungsrede, die Lukian seinen Prometheus halten lässt; er verteidigt seine Schaffung der Menschen dort mit den Worten ja· c±q 1mde?m ti ålgm t` he_\, lµ emtor toO 1mamt_ou aqt` ja· pq¹r d 5lekkem B 1n]tasir cicmol]mg eqdailom]steqom !pova_meim aqt| (12: »Ich glaubte, dem Göttlichen fehle etwas, wenn es keinen Gegenspieler hätte und nichts, wodurch ein prüfender Vergleich erweisen könnte, dass das Göttliche glücklicher ist.«). Charakteristischerweise lässt Camus den zweiten Teil des Satzes weg und spitzt die Aussage dadurch in Hinsicht auf einen revoltierenden, ungebrochenen Prometheus zu; vgl. oben S. 369.
376
Thomas A. Schmitz (Bonn)
und rhetorisch raffinierter Argumentation seine angeblichen Verfehlungen begründen. Dass dies für Lukian mehr gewesen sein könnte als eine bloße Demonstration rhetorischer Brillanz durch paradoxe Argumentation, wie sie für die sog. Zweite Sophistik ganz typisch war, kann man vermuten, wenn man beachtet, dass Lukian in einer anderen kleinen Schrift sich selbst mit Prometheus identifiziert und sich in dessen Tradition gestellt hatte.27 Auch andere Umwertungen mythischer Gestalten, die wir bei Camus finden, begegnen uns bereits in der Antike: Dass die Gestalt der Helena in der griechischen Literatur von schillernder Ambivalenz war, hatte ich bereits erwähnt (o. S. 371); an Stimmen, die sie von der Verantwortung am Ausbruch des Troianischen Kriegs freisprechen, fehlt es nicht. Der Sophist Gorgias schrieb im fünften Jh. v. Chr. eine Lobrede auf sie, in der er sie von aller Schuld zu befreien versucht, ein Jahrhundert später schrieb Isokrates eine Verteidigungsrede;28 die Fassung, nicht sie selbst, sondern lediglich ihr Scheinbild sei mit Paris nach Troia gegangen, wurde von dem Lyriker Stesichoros im sechsten Jh. v. Chr. in der berühmten Palinodie (fr. 192 PMG) gestaltet und in der 412 v. Chr. aufgeführten Helena des Euripides unsterblich gemacht. Auch die Gestalt des Sisyphos hatte bereits im fünften Jh. v. Chr. eine ›philosophische‹ Deutung erfahren: der Sophist Kritias macht in einem Drama Sisyphos zum Symbol des gegen die Religion aufbegehrenden Menschen.29 Damit soll nicht gesagt sein, dass Camus all diese Texte kannte und genau gelesen hatte; die Feststellung, dass er oft nicht aus der Kenntnis der Primärtexte schöpfte, sondern sich auf Handbücher und Sekundärliteratur verließ, trifft sicherlich zu. Dennoch ist zumindest im Fall Lukians die Kenntnis unbestreitbar, und im Allgemeinen scheint sich Camus der Tatsache bewusst, dass sein Umgang mit dem Mythos nicht etwas völlig Neuartiges oder Ungewöhnliches darstellt, sondern bereits durch den antiken Umgang mit Mythen sanktioniert ist. (2) Dass Camus antike Mythen weder als nostalgische Reminiszenz oder gar als bildungsbürgerlichen Nachweis seiner intellektuellen Kompetenz noch als bloßes intertextuelles Spiel zur Verständigung mit seinen Lesern erzählt, dürfte offensichtlich geworden sein. Seine Texte verhindern, dass die Bezüge auf die antike Mythologie lediglich als unproblematischer rhetorischer Schmuck wahrgenommen werden. Besonders deutlich wird dies in seinem Prom¦th¦e aux enfers. Mythen, so führt Camus hier emphatisch aus, bleiben nur dann lebendig, wenn wir Menschen ihrem Aufruf Folge leisten: »Les 27 Vgl. Romm (1990); Hopkinson (2008), 109 – 118. 28 Gorgias frg. 11 DK; vgl. dazu Poulakos (1983) und Valiavitcharska (2006); Isokrates or. 10; dazu Papillon (1995) und Tuszyn´ska-Maciejewska (1987). 29 Zuschreibung und Deutung der Fragmente sind umstritten; s. Davies (1989).
Camus und der griechische Mythos
377
mythes n’ont pas de vie par eux-mÞmes. Ils attendent que nous les incarnions. Qu’un seul homme au monde r¦ponde leur appel, et ils nous offrent leur sÀve intacte. Nous avons pr¦server celui-ci et faire que son sommeil ne soit point mortel pour que la r¦surrection devienne possible.«30 Dass der Mythos für Camus nicht nur eine attraktive poetische Erzählung ist, sondern eine Appellstruktur hat und damit die Grenzen des bloßen »Sprechens über die Welt« überwinden soll in Richtung auf einen wirksamen Sprechakt, hat in einem gedankenreichen Aufsatz 2003 Marcel Lepper gezeigt;31 Lepper bezeichnet diesen Aspekt als »Sprache jenseits der Sprache«. Diese Appellstruktur greift die argumentative Funktion des Mythos auf, die wir als grundlegende Aufgabe mythischen Erzählens in der Frühphase der griechischen Kultur kennengelernt haben: Auch dort soll der Mythos seine Zuhörer zu etwas bewegen, sie beeinflussen und zum Denken und Handeln veranlassen. Wenn Camus also in der zitierten Passage plakativ davon spricht, in sich selbst hätten Mythen kein Leben, so scheint er genau diesen Wirkungsaspekt des Mythos zu beschreiben. (3) Wir wir bereits gesehen haben, verwendet und adaptiert Camus antike Mythen in vielfältiger Weise. Eine dieser Formen freierer Adaptation, ebenfalls von Lepper zutreffend beschrieben, besteht in einer Art von Sprechen, das die überzeitlichen und unveränderlichen Aspekte der Welt gegenüber der wandelbaren menschlichen Geschichte betont; Lepper spricht hier von der »Aktualisierung eines vorgeblichen ›Immer-Schon‹«.32 Hier scheint mir eine Ergänzung notwendig: Wir haben gesehen, dass antike Mythen traditionelle Geschichten sind, die für das Hier und Jetzt relevant bleiben. In ihnen sind also in dialektischer Weise Nähe und Ferne zugleich ausgedrückt. Leppers Betonung des Ewigen, Unveränderlichen scheint mir jedoch nur einen dieser beiden Pole in den Blick zu nehmen. Zweifelsohne betont Camus in seiner Mythenverwendung immer wieder die Relevanz des Mythos für uns Heutige; als Beleg seien hier lediglich einige Sätze vom Beginn des Prom¦th¦e aux enfers zitiert:33 »Que signifie Prom¦th¦e pour l’homme d’aujourd’hui? On pourrait dire sans doute que ce r¦volt¦ dress¦ contre les dieux est le modÀle de l’homme contemporain et que cette protestation ¦lev¦e, il y a des milliers d’ann¦es, dans les d¦serts de la Scythie, s’achÀve aujourd’hui dans une convulsion historique qui n’a pas son ¦gale.« Liest man diese Sätze jedoch genauer, so erkennt man auch, dass Camus gleichzeitig die räumliche und zeitliche Distanz des Mythischen gegenüber 30 31 32 33
OC 3, 591. Lepper (2003). Ebd. 472; vgl. bereits Scheel (1973), 304. OC 3, 589.
378
Thomas A. Schmitz (Bonn)
unserer gegenwärtigen Welt betont: Zwar hat die Prometheusgestalt Bedeutung auch für unsere Welt, aber es handelt sich um eine Erzählung, die von uns Heutigen durch Jahrtausende getrennt ist und die sich in der Wüste Skythiens, also am Ende der Welt, abspielte. Dass wir die Welt der Griechen wiedergewinnen, dass Schönheit und ein Anerkennen menschlicher Grenzen wieder wichtig werden können, diesen Gedanken formuliert Camus als Hoffnung, verlegt ihn in die Zukunft und entzieht ihn damit dem augenblicklichen Zugriff.34 Dass der Titel seines Essais lautet »Helena im Exil«, dass Camus seine Odysseusreise nach Griechenland eben nicht unternehmen konnte, sondern hier im Norden und in der Barbarei des Kriegs gefangenblieb (o. S. 372), dass ein (zweifelsohne verklärtes) Griechenland deshalb bei ihm zu einem Sehnsuchtsort wird, scheint mir nicht so sehr als biographisches Detail wichtig zu sein wie als Denkfigur : Die Antike und ihr Mythos sind bei Camus nicht nur zeitlos, sondern zugleich auch zeitlich entrückt (und damit zeitlich verortet); sie sind eine distanzierte Tradition, die uns nicht einfach zur Verfügung steht, sondern aktiv wiedergewonnen werden muss. Camus hat bekanntlich die Welt des Mittelmeerraums immer wieder als geradezu mystische Einheit genannt, in deren Licht und Schönheit sich Algerien und die Antike, Oran und Athen berühren. In einem Interview hat Camus selbst diesen Zusammenhang in diesen poetischen Worten ausgedrückt: »Je suis n¦ pauvre, sous un ciel heureux, dans une nature avec laquelle on sent un accord, non une hostilit¦. Je n’ai donc pas commenc¦ par le d¦chirement, mais par la pl¦nitude. Ensuite… Mais je me sens un cœur grec.«35 Dass in diesem leicht übersehenen Satz von Camus’ »griechischem Herzen« mehr Wahrheit liegt, als man auf den ersten Blick wahrnimmt, habe ich auf diesen Seiten zu zeigen versucht.
Bibliographie Archambault, Paul J.: Camus’ Hellenic Sources, Chapel Hill 1972. Bastien, Sophie: »Le Caligula de l’histoire, un empereur d¦j camusien«, in: French Studies 59 (2005), 351 – 363. ––: Caligula et Camus. Interf¦rences transhistoriques, Amsterdam 2006. Bree, Germaine: »Avatars of Prometheus. A Shifting Camusian Image«, in: Crant, Phillip, Hrsg.: Mythology in French Literature. Columbia 1976, 138 – 148. Bremmer, Jan, Hrsg.: Interpretations of Greek Mythology, London 1987. 34 S. das Zitat o. S. 371. 35 Zitiert nach Scheel (1973), 300.
Camus und der griechische Mythos
379
Cameron, Alan: Greek Mythography in the Roman World, Oxford 2004. Davies, Malcolm: »Sisyphus and the Invention of Religion«, in: Bulletin of the Institute of Classical Studies 36 (1989), 16 – 32. Detienne, Marcel: L’Invention de la mythologie, Paris 1981. Edmunds, Lowell, Hrsg.: Approaches to Greek Myth, Baltimore 1990. Gay-Crosier, Raymond: Camus, Darmstadt 1976. Graf, Fritz: Griechische Mythologie. Eine Einführung, Düsseldorf 1999. Hopkinson, Neil: Lucian. A Selection, Cambridge (Engl.) 2008. Hühn, Helmut: »Revolte gegen das Absurde: Sisyphos nach Camus«, in: Seidensticker, Bernd, und Martin Vöhler, Hrsgg.: Mythenkorrekturen. Zu einer paradoxalen Form der Mythenrezeption. Berlin 2005, 345 – 368. Kirk, Geoffrey S.: The Nature of Greek Myths, London 1974. Lepper, Marcel: »Negative Theologie und Arbeit am Mythos bei Camus«, in: Germanischromanische Monatsschrift 53 (2003), 463 – 475. Lund, Hans Peter : »Le Prom¦th¦e enchan¦ de Camus«, in: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 32 (2008), 83 – 103. March, Jennifer : The Creative Poet. Studies in the Treatment of Myths in Greek Poetry, London 1987. Martindale, Charles, Hrsg.: Ovid Renewed. Ovidian Influences on Literature and Art from the Middle Ages to the Twentieth Century, Cambridge (Engl.) 1988. Newman-Gordon, Pauline: H¦lÀne de Sparte. La Fortune du Mythe en France, Paris 1968. Papillon, Terry L.: »Isocrates on Gorgias and Helen«, in: Classical Journal 91 (1995), 377 – 391. Pierron, Alexis: Histoire de la litt¦rature grecque, Paris 1875. Pollard, Patrick: »The Sources of Andr¦ Gide’s ›Th¦s¦e‹«, in: Modern Language Review 65 (1970), 290 – 297. Poulakos, John: »Gorgias Encomium to Helen and the Defense of Rhetoric«, in: Rhetorica 1 (1983), 1 – 16. Romm, James: »Wax, Stone, and Promethean Clay : Lucian as Plastic Artist«, in: Classical Antiquity 9 (1990), 74 – 98. Sad, Suzanne: Approches de la mythologie grecque, Paris 1994. Scheel, Hans Ludwig: »Zur Bedeutung der griechischen Mythologie für Albert Camus«, in: Heitmann, Klaus, und Eckhart Schroeder, Hrsgg.: Renatae litterae. Studien zum Nachleben der Antike und zur europäischen Renaissance August Buck zum 60. Geburtstag am 3. 12. 1971 dargebracht von Freunden und Schülern. Frankfurt am Main 1973, 299 – 317. Schmid, Wilhelm: Untersuchungen zum gefesselten Prometheus, Stuttgart 1929. Trousson, Raymond: Le thÀme de Prom¦th¦e dans la litt¦rature europ¦enne, Genf 2001. Tuszyn´ska-Maciejewska, Krystyna: »Gorgias’ and Isocrates’ Different Encomia of Helen«, in: Eos 75 (1987), 279 – 289. Valiavitcharska, Vessela: »Correct Logos and Truth in Gorias’ Encomium of Helen«, in: Rhetorica 24 (2006), 147 – 161. Vernant, Jean-Pierre: Mythe et religion en Gre`ce ancienne, Paris 1974. Veyne, Paul: Les Grecs ont-ils cru leurs mythes?, Paris 1983. Walter, Hermann, und Hans-Jürgen Horn, Hrsgg.: Die Rezeption der »Metamorphosen«
380
Thomas A. Schmitz (Bonn)
des Ovid in der Neuzeit: der antike Mythos in Text und Bild. Internationales Symposion der Werner Reimers-Stiftung, Bad Homburg v. d.H. (22. bis 25. April 1991), Berlin 1995. Woodard, Roger D., Hrsg.: The Cambridge Companion to Greek Mythology, Cambridge (Engl.) 2007.
B¦n¦dicte Vauthier (Bern)
Albert Camus: du panthéon aux manuels de littérature française et francophone
En novembre 2009, la France a ¦t¦ secou¦e par un bref s¦isme, cons¦cutif la d¦claration du Pr¦sident de la R¦publique de »vouloir voir Albert Camus au panth¦on«1. L’annonce a eu l’effet d’une bombe et fait la une des m¦dias: journaux, radio, t¦l¦vision, donnant aussitút lieu un d¦bat pol¦mique. Rien d’¦tonnant ! Car si l’œuvre de l’¦crivain, Nobel de litt¦rature, peut Þtre qualifi¦e de »consensuelle«, il n’en va pas n¦cessairement de mÞme de sa personne, dont l’histoire est indissociablement li¦e celle – douloureuse – de l’Alg¦rie. Tenons-en pour preuve les interpr¦tations politiques qui ont pu Þtre donn¦es l’initiative pr¦sidentielle. Interrog¦ sur France Inter, l’ancien Ministre socialiste de la Culture, Jacques Lang, d¦clarait: »C’est une id¦e qui me parat une bonne id¦e si la famille donne son accord. Albert Camus repr¦sente ou incarne un moment fort de la litt¦rature mais aussi et surtout une vision de l’humanisme dont nous avons aujourd’hui tant besoin. Et c’est un choix heureux«2. C’est sur le plateau des matinales de »Canal+« que FranÅois Bayrou, pr¦sident du Mouvement D¦mocrate, ¦tait amen¦ prendre position sur le sujet. »Certaines personnes ont plus le got de la panth¦onisation que moi. Car je pense que la reconnaissance nationale n’a pas besoin de pompe et je suis sr que Camus n’aurait pas aim¦ cette pompe-l«. »Le pouvoir politique, et sp¦cialement ce pouvoir-l, a tendance trop manipuler les symboles et fait du sentiment profond de la nation un mat¦riel de communication«. »D’une certaine maniÀre, il y a une r¦cup¦ration gÞnante avec le temps, il ne se passe pas de semaines, sans qu’on ait ce genre d’orchestration-l.«3 1 Arnaud Leparmentier, »Sarkozy souhaite faire rentrer Camus au panth¦on«, Le monde, 19 novembre 2010 http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/11/19/sarkozy-souhaite-faireentrer-albert-camus-au-pantheon_1269540_823448.html (consult¦ le 9/10/2010). 2 Propos recueillis sur France Info: »Albert Camus au panth¦on«, en ligne http://www.franceinfo.com/culture-livres-2009 – 11 – 19-albert-camus-au-pantheon-371017 – 36 – 39.html (consult¦ le 19/10/2010). 3 Propos reproduits sur le site officiel du Mouvement D¦mocrate http://www.mouvement democrate.fr/medias/bayrou-la-matinale-canal-plus-201109.html (consult¦ le 9/10/2010).
382
Bénédicte Vauthier (Bern)
õ l’autre bout de l’¦chiquier politique, c’est en termes de manipulation ¦lectorale qu’¦tait amen¦ se situer le pr¦sident du Front National, Jean-Marie Le Pen, le premier aussi mettre en avant les origines pied-noir de l’¦crivain – et nous reviendrons sur les interpr¦tations possibles du terme. Telle ¦tait la raison qui l’amenait consid¦rer le choix de Sarkozy comme une manœuvre en vue de s¦duire l’¦lectorat sympathisant du front national. »Sur le principe, je suis assez d’accord puisque c’est un ¦crivain franÅais de grande renomm¦e, mais la date laquelle survient cette proposition est tout de mÞme singuliÀrement ¦lectoraliste«. […] »C’est un choix ¦lectoraliste. Celui d’un ¦crivain piednoir quatre mois des ¦lections r¦gionales o¾ probablement la majorit¦ va subir une lourde d¦faite, je crois que c’est assez ¦vident.«4
Si l’on excepte le caractÀre humaniste de l’¦crivain mis en avant par Lang et ses origines pied-noir rappel¦es par Jean-Marie Le Pen, les prises de position ¦voqu¦es r¦vÀlent avant tout l’amalgame qui, d’entr¦e de jeu, s’est op¦r¦ dans l’opinion publique entre la figure d’Albert Camus et une certaine politique culturelle de l’actuel pr¦sident de la R¦publique. Or pour Thomas Legrand, ¦ditorialiste politique sur France Inter, »refuser l’id¦e que Camus puisse Þtre ›panth¦onis¦‹ sous pr¦texte que Nicolas Sarkozy aurait quelques arriÀres pens¦es politiciennes, c’est aussi une forme d’instrumentalisation«5. Un propos ou une mise en garde que peut corroborer l’invective lanc¦e par Frank Planeille certains camusiens frileux. õ l’encontre de ces derniers, cet artisan des r¦cents volumes de la Pl¦iade consacr¦s l’¦crivain pr¦f¦rait mettre en avant la »valeur hautement symbolique«, »hors r¦seau politique« – mais est-ce possible? – d’un Camus rejoignant »ceux qui sont devenus les symboles d’un pays ou en tout cas des valeurs qu’il doit d¦fendre«6. Plus nuanc¦, Thomas Legrand, que nous citions pr¦c¦demment, ne cachait pas que les r¦actions enregistr¦es l’annonce d’une panth¦onisation de Camus ne pouvaient Þtre comprises hors du vaste »d¦bat sur l’identit¦ nationale« ouvert quelques 4 AFP, 20 novembre 2010, en ligne: Le figaro.fr: http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/11/20/ 01011 – 20091120FILWWW00495-camuspantheon-electoraliste-le-pen.php (consult¦ le 9/10/ 2010). 5 Thomas Legrand, »Entre ici, Albert Camus?«, Slate.fr le 23 novembre 2010. En ligne http:// www.slate.fr/story/13385/sarkozy-camus-pantheon-entre-ici-albert-camus (consult¦ le 9/10/ 2010). 6 Voir sa chronique virulente »Albert Camus et l’opinion des silencieux« o¾ il prend parti d’autres camusiens de renom: Olivier Todd, Jean-Yves Gu¦rin, Pierre Berg¦: Le monde, 2 d¦cembre 2009 http://www.lemonde.fr/idees/article/2009/12/02/albert-camus-et-l-opiniondes-silencieux-par-franck-planeille_1274952_3232.html (consult¦ le 9/10/2010). Fin janvier 2010, FranÅois-Xavier Ajavon a dress¦ une espÀce de bilan des avatars des deux mois de pol¦mique, sous le titre »Albert Camus au Panth¦on de la Sarkodyss¦e«, dans Actu Philosophia, en ligne http://www.actu-philosophia.com/spip.php?article194
Albert Camus: du panthéon aux manuels de littérature française
383
semaines plus tút7, et de certains d¦tournements ou r¦cup¦rations id¦ologiques d¦j op¦r¦s par Sarkozy8. Or nul doute que c’est avant tout ce danger »d’instrumentalisation politique de l’histoire«9 qu’ont voulu d¦noncer les chercheurs en sciences humaines et en lettres. Les sp¦cialistes de l’œuvre camusienne (Olivier Todd, Jean Daniel, JeanYves Gu¦rin, Pierre Berg¦, etc.) et les historiens ont ainsi tour tour cherch¦ d¦voiler les enjeux sous-jacents l’amalgame Sarkozy-Camus. Rappelons briÀvement la position des litt¦raires, avant de nous arrÞter en compagnie des historiens sur les enjeux de cette initiative qui ne doit pas Þtre analys¦e comme un cas isol¦ car elle renvoie aussi la maniÀre dont le Pr¦sident ¦crit l’histoire de France10 depuis son arriv¦e la tÞte du pays. Par ce biais, j’en viendrai au cœur de mon analyse, savoir ce que disent – et taisent – d’Albert Camus les manuels de litt¦rature franÅaise utilis¦s en classe de Ire, ¦tant entendu que ces manuels, comme bien d’autres manuels scolaires, tels ceux d’histoire, »sont de v¦ritables v¦hicules de l’histoire officielle«. »Ce sont des ¦chantillons
7 Annonc¦ par Nicolas Sarkozy lors de sa campagne pr¦sidentielle en mars 2009, le d¦bat s’est ouvert le 2 novembre 2009 et n’a cess¦ de faire la une des m¦dias des semaines durant. Page officielle du MinistÀre de l’immigration: http://www.debatidentitenationale.fr/organisation/ les-objectifs-du-debat.html 8 Dans son article, Thomas Legrand reconnat que »le d¦luge de critiques est assez significatif de l’image qu’a maintenant Nicolas Sarkozy. Sur le papier, l’initiative a tout pour Þtre consensuelle. Si elle suscite tant d’oppositions, c’est parce que d’autres initiatives, comparables en terme de fabrication de ce qu’il est convenu d’appeler maintenant notre ›roman national‹, je veux parler de la lecture de la lettre de Guy Múquet ou de l’appel d¦battre sur l’identit¦ franÅaise, sentaient trop l’opportunisme symbolique«. Article cit¦, http://www.slate.fr/story/ 13385/sarkozy-camus-pantheon-entre-ici-albert-camus 9 Voir Comment Nicolas Sarkozy ¦crit l’histoire de France. Dictionnaire critique (dir. Laurence De Cock, Fanny Madeline, Nicolas Offenstadt & Sophie Wahnich), Paris, Agone, 2008, [p. 5]. La mention fait partie de la d¦claration du Comit¦ de Vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH), reproduite au d¦but de l’ouvrage cit¦. Le terme revient ¦galement dans l’introduction collective o¾ l’on peut lire: »Confusion des cat¦gories politiques et panth¦onisation, l’instrumentalisation de l’histoire dans le discours de Nicolas Sarkozy est si multiforme que l’on serait tent¦ de parler de ›temps sarkozyen de l’histoire‹« (Op. cit., p. 19). 10 Comment Nicolas Sarkozy ¦crit l’histoire de France, tel est le titre du bref essai collectif, dont le sous-titre Dictionnaire critique indique clairement les objectifs poursuivis par leurs auteurs. Il s’agit de revenir sur un certain nombre de mots-cl¦s objets de manipulation et de d¦tournement dans les mains du chef de l’Êtat: »La forme d’exposition que nous avons retenue – un petit dictionnaire critique –, lit-on dans l’introduction, permet de souligner un rapport l’histoire sur le mode de la culture du zapping et du self-service. L’emploi tous azimuts des grandes figures du pass¦ – bien que souvent r¦duit un simple name dropping – participe la construction d’une m¦moire factice destin¦e ›tous les FranÅais‹; ou plutút ceux qui n’auraient d’autre m¦moire que nationale, qui ne seraient ni de droite, ni de gauche, la fois nationalistes, r¦publicains, socialistes, communistes, gaullistes, etc., c’est--dire toutes les m¦moires (ou plutút aucune)« (Op. cit., p. 14).
384
Bénédicte Vauthier (Bern)
particuliÀrement r¦v¦lateurs de ce qu’un Êtat veut faire passer en tant que m¦moire officielle«11. Pour les camusiens hostiles l’initiative pr¦sidentielle, la cons¦cration ¦tait ridicule parce qu’elle contredisait ouvertement les valeurs personnelles, culturelles voire politiques de l’¦crivain. Olivier Todd, biographe de Camus, n’a pas h¦sit¦ parler »d’une op¦ration gadget«. Je pense que Åa fait partie d’une technique de r¦cup¦ration des milieux intellectuels. Je pense que c’est un contresens absolu sur l’œuvre et la personne d’Albert Camus et j’espÀre que les h¦ritiers d’Albert Camus, qui en ont le droit, je crois, s’opposeront cette op¦ration. […] Je pense surtout que la personne de Camus t¦moigne d’un grand m¦pris des honneurs officiels. […] Je [ne] pense pas qu’Albert Camus ait besoin de Sarkozy, je crois que Sarkozy a beaucoup plus besoin de quelques ¦tincelles intellectuelles12.
»M¦pris des honneurs officiels« ou non (on ne peut oublier que Camus a accept¦ le Nobel), c’est bien l’amalgame Sarkozy-Camus ou plus exactement la r¦cup¦ration de celui-ci par celui-l que Sophie Wahnich, chercheuse au CNRS et codirectrice de l’ouvrage collectif Comment Nicolas Sarkozy ¦crit l’histoire de France, et Christian Delporte, professeur d’histoire contemporaine l’universit¦ Versailles-Saint-Quentin, ont accept¦ de commenter sur France Info en se plaÅant dans une perspective historique plus large, c’est--dire qui prend en compte l’id¦e de la construction d’un »roman national« d¦j ¦voqu¦e par Legrand13. Au cours d’un d¦bat d’une dizaine de minutes, les deux historiens se sont attard¦s sur le rúle que la panth¦onisation a jou¦ au cours des mandats pr¦sidentiels de FranÅois Mitterrand, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Ils ont ainsi rappel¦ que la panth¦onisation n’a en soi rien de pol¦mique puisque qu’il s’agit d’une pr¦rogative pr¦sidentielle qui permet ceux qui en b¦n¦ficient de marquer l’histoire de leur empreinte par un geste symbolique. Pour Christian Delporte, Jacques Chirac a inscrit sa pr¦sidence sous le signe de la »repentance«, attitude qui s’est traduite par une s¦rie de »comm¦morations«. La d¦marche de Sarkozy peut Þtre comprise comme une »r¦action« celle de son pr¦d¦cesseur. õ l’inverse de celui-ci, ce que Sarkozy souhaite et r¦clame, c’est un »retour la fiert¦ nationale«. 11 Maurice T. Maschino, »L’histoire expurg¦e de la guerre d’Alg¦rie. La colonisation telle qu’on l’enseigne«, Le Monde diplomatique, 563, f¦vrier 2001, p. 8 – 9 (Article repris dans ManiÀre de voir, 58, jullet-aot 2001). 12 Propos recueillis sur France Info: »Albert Camus au panth¦on«, en ligne: http://www.franceinfo.com/culture-livres-2009 – 11 – 19-albert-camus-au-pantheon-371017 – 36 – 39.html (consult¦ le 11/10/2010). 13 Le d¦bat d’une dizaine de minutes du 20 novembre 2009, anim¦ par Jean Leymarie peut Þtre ¦cout¦ sur le site de France Info: http://www.france-info.com/chroniques-debats-matin2009 – 11 – 20-nicolas-sarkozy-veut-voir-albert-camus-au-pantheon-371225 – 81 – 189.html (consult¦ le 9/10/2010).
Albert Camus: du panthéon aux manuels de littérature française
385
Loin d’embrasser le point de vue »cliv¦« de son collÀgue, Sophie Wahnich le nuanÅa dans une r¦plique assez longue14, que nous transcrivons ci-dessous. Reprenons au mot la question du passage de ce qu’aurait ¦t¦ la repentance du cút¦ de Jacques Chirac et la fiert¦ nationale du cút¦ de Nicolas Sarkozy. Je pense que c’est un clivage qui est relativement faux parce que le problÀme, ce n’est pas tellement d’Þtre ni dans la repentance ni dans la fiert¦ mais comme l’avait dit, il y a d¦j un certain moment, Jürgen Habermas, d’entretenir aprÀs les ¦v¦nements tragiques du xxe siÀcle un rapport critique l’histoire et donc de refuser justement un rapport qui serait un rapport d’usage qui conduirait refabriquer une unit¦ nationale l o¾ l’histoire et les consciences ne peuvent Þtre que d¦chir¦es aprÀs certains ¦v¦nements. Donc, il ne s’agit pas d’Þtre dans la repentance au sens o¾ quelque chose serait perp¦tu¦ de g¦n¦ration en g¦n¦ration, des choses inacceptables qui ont eu lieu dans l’histoire de France, que ce soit la collaboration, que ce soit la torture en Alg¦rie, que ce soient mÞme les choses assez ¦tranges qui se sont pass¦es au Rwanda, il s’agit d’entretenir un rapport critique pour que politiquement on fasse en sorte que cela ne se r¦pÀte pas. Donc vouloir refabriquer une histoire finalement qui soit un peu mythique, c’est une maniÀre de construire nouveau des identifications nationales qui vont faire obstacle la possibilit¦ de ce rapport critique.
La citation est longue mais elle montre trÀs clairement la difficult¦ laquelle renvoie le choix de Nicolas Sarkozy. Celle-ci n’est autre que celle que Wahnich avait r¦sum¦e en parlant de la maniÀre dont Nicolas Sarkozy cherche »effacer, [] estomper le clivage politique, ce qu’il n’a cess¦ de faire dans ses usages de la m¦moire nationale«. Comme le d¦clarent ¦galement les historiens du collectif Comment Nicolas Sarkozy ¦crit l’histoire de France: Plus g¦n¦ralement, le conflit est donc ce qui disparat dans le discours sarkozyen. Bien loin d’admettre que le conflit politique pourrait Þtre la base de la vie d¦mocratique, la rh¦torique du candidat puis du pr¦sident s’¦chine effacer tout ce qui serait susceptible de faire division15.
En quoi le d¦bat suscit¦ par une panth¦onisation de Camus est-il r¦v¦lateur de ce processus de fabrication d’une m¦moire que nous pourrions qualifier d’»unanimiste«? Son œuvre, sa personne sont-elles aussi consensuelles qu’on ne le dit? Le consensus dont il est fait ¦tat ne traduit-il pas aussi une forme d’amn¦sie collective, pr¦cis¦ment l’endroit de la question de l’identit¦ nationale? Ainsi de quelle partie de l’histoire de France, de l’histoire de la litt¦rature en langue franÅaise faut-il faire l’¦conomie pour pouvoir faire rentrer Camus au Panth¦on, »symbole extraordinaire«, aux dires de Sarkozy? Symbole, certes, mais de quoi?, 14 De toute ¦vidence, ces nuances ne contredisent pas l’affirmation de Delporte. Et on ne s’¦tonnera pas de trouver une entr¦e »repentance« dans le Dictionnaire critique d¦j cit¦ (p. 156 – 160), avec des renvois »l’esclavage dans les colonies franÅaises«, au »pass¦ colonial« et Vichy. 15 L. De Cock, F. Madeline, N. Offenstadt & S. Wahnich, »Introduction«, op. cit., p. 19.
386
Bénédicte Vauthier (Bern)
telle est la question qu’il faut se poser, si l’on n’oublie pas que le »syncr¦tisme historique« mis en place par Nicolas Sarkozy a pour principale fonction de d¦politiser l’histoire en neutralisant ou en d¦tournant la charge id¦ologique de ses symboles. Cette strat¦gie, th¦oris¦e et baptis¦e la »d¦saffiliation« par Henri Guaino […], vise capter les valeurs historiques de la gauche pour semer le doute dans les repÀres m¦moriels mÞme les plus ¦tablis16. Un bref examen des courtes notes bio-bibliographiques qui accompagnent l’introduction l’œuvre d’Albert Camus dans quatre manuels scolaires r¦cents (Bordas, Hachette, Nathan, Hatier, 2007) peut nous mettre sur la voie de ce qu’il faut, a fallu et faudra passer sous silence, notamment pour pouvoir faire rentrer Camus au panth¦on. Afin de faciliter la lecture comparative des notices, j’ai introduit des crochets avec des chiffres romains qui renvoient quelques jalons de la vie camusienne:[1] naissance en Alg¦rie, [2] accident de voiture, [3] origines modestes, [4] prix Nobel, [5] engagement, [6] relation avec Sartre, [7] Guerre d’Alg¦rie, [8] Titres mentionn¦s, que je commenterai par la suite. FranÅais 1re. Textes et perspectives (dir. J.-P. Aubrit & D. Labouret), Paris, Bordas, 2007.
Soleils d’encre. Lettres et langue. Livre unique 1re (dir. Line Carpentier), Paris, Hachette, 2007. Camus (1913 – 1960) Camus Albert (1913 – 1960) N¦ en Alg¦rie [1] Êcrivain franÅais. dans un milieu Du lyrisme de modeste [3], orphelin d’un pÀre L’Envers et l’endroit (1937) la prise de tu¦ la guerre, conscience de Albert Camus, travers les ¦preuves l’absurde par l’interm¦diaire de (maladie, ¦chec conjugal) forme sa l’essai Le mythe de Sisyphe (1942) et du pens¦e et son ¦criture dans l’¦tude roman L’¦tranger (1942) [8], Camus de la philosophie, l’activit¦ th¦trale et d¦couvre la solidarit¦ en le journalisme. Il vient en m¦tropole participant la R¦sistance pendant [7] o¾ il termine la seconde guerre L’¦tranger (1942), mondiale [5]. salu¦ par Sartre et D’individuelle avec Malraux, et Le Caligula en 1944, la mythe de Sisyphe, r¦volte se fait essai sur l’absurde
FranÅais litt¦rature. 1re toutes s¦ries (dir. Dominique Rinc¦), Paris, Nathan, 2007.
Litt¦rature premiÀre. Des textes aux s¦quences (dir. H¦lÀne Sabbah), Paris, Hatier, 2007.
Albert Camus, n¦ en Alg¦rie en 1913 [1], n’a qu’un an quand son pÀre meurt la guerre. Êlev¦ par sa mÀre dans un quartier pauvre d’Alger [3], il poursuit aprÀs le bac des ¦tudes de philosophie mais doit renoncer l’enseignement cause de la tuberculose. S¦duit par le th¦tre (Caligula, 1944), il devient journaliste sous la R¦sistance [5] et connait la c¦l¦brit¦ avec un essai (Le mythe de
N¦ Mondovi, en Alg¦rie [1], dans une famille pauvre [3], il s’oriente vers le journalisme puis vers la litt¦rature, avec plusieurs romans, L’¦tranger (1942), La peste (1947). Passionn¦ par le th¦tre, il met en scÀne les piÀces d’autres auteurs, dont certaines qu’il traduit, puis les siennes, comme Les justes (1949). Le malentendu, Caligula. Êcrivain engag¦ [5], Camus voit son œuvre r¦compens¦e par le
16 L. De Cock, F. Madeline, N. Offenstadt & S. Wahnich, »Introduction«, op. cit., p. 15 [Nous soulignons].
Albert Camus: du panthéon aux manuels de littérature française
() [8]. R¦sistant, r¦dacteur en chef du journal Combat la Lib¦ration, Camus ne s¦pare pas la pens¦e de l’action [5]. Au lendemain de la guerre, il est consid¦r¦ come un chef de file, avec Sartre, du courant »existentialiste« [6]. Son autorit¦ morale est confort¦e par le succÀs de La peste (1947); il ¦crit aussi beaucoup pour le th¦tre. Mais la libert¦ d’esprit de L’homme r¦volt¦ d¦concerte, tout comme La chute (1956), qui met en cause la bonne conscience des intellectuels. Il reÅoit le prix Nobel en 1957 [4], trois ans avant sa mort dans un accident de voiture [2]. Des publications posthumes (Le premier homme, 1994) confirment la profondeur lumineuse d’une œuvre qui est une exaltation de la vie jusque dans l’exigence de r¦volte.
collective avec La peste en 1947. L’homme r¦volt¦, en 1951, le s¦pare de Sartre et des existentialistes: La Chute en 1956 rend compte de cette rupture [6]. Il reÅoit, en 1957, le Prix Nobel de litt¦rature [4].
Sisyphe, 1942) et deux romans (L’¦tranger, 1942 et La peste, 1947). D’abord proche de Sartre et des existentialistes, il se s¦pare d’eux aprÀs la Guerre et la publication trÀs contest¦e de L’homme r¦volt¦ (1951) [6]. Par la suite, la maladie, des problÀmes personnels et la guerre d’Alg¦rie [7] provoqueront chez lui une grave crise int¦rieure dont t¦moigne La Chute, son dernier roman. Camus meurt dans un accident de voiture en 1960 [2], trois ans aprÀs avoir ¦t¦ consacr¦ par le prix Nobel [4].
387
prix Nobel de litt¦rature en 1957 [4]. Il meurt en 1960 dans un accident de voiture [2].
Si l’on excepte la notice de Carpentier, qui se contente de mentionner les dates de naissance (1913) et de mort de l’¦crivain (1960), faisant l’¦conomie des origines »alg¦riennes« [1] et du mortel accident de voiture [2], qui dote Camus d’une dimension tout particuliÀrement tragique, on commencera par observer que seules les trois autres manuels mentionnent ¦galement qu’Albert Camus est n¦ en Alg¦rie, dans une famille pauvre [3].
388
Bénédicte Vauthier (Bern)
La notice de Sabbah n’est guÀre plus prolixe que celle de Carpentier et s’en tient quelques axes directeurs de l’œuvre plurielle de Camus. Chez celui-ci, elle se d¦ploie en lyrique, essai, roman, alors qu’aux cút¦s du roman, Sabbah mentionne le journalisme, le th¦tre et la traduction et adaptation th¦trales. Facettes que l’on retrouve chez Aubrit/Labouret et Rinc¦, qui y ajoutent ¦galement la philosophie. Bien entendu, l’obtention du prix Nobel, cons¦cration suprÞme s’il en est [4], est mentionn¦e dans toutes les notices. La brÀve mention d’»¦crivain engag¦« de Sabbah peut renvoyer celle de »solidarit¦« chez Carpentier, une »d¦couverte« soi-disant cons¦cutive son engagement dans la R¦sistance pendant la Seconde Guerre mondiale [5]. Dans les notices de Rinc¦ et d’Aubrit/Labouret, on trouvera ¦galement une r¦f¦rence explicite l’engagement de l’¦crivain, dimension qui renvoie elle aussi la profession de »journaliste sous la R¦sistance« ou de »r¦dacteur en chef du journal Combat la Lib¦ration« [5bis]. Malheureusement, ce renvoi l’histoire glorieuse de la France oblitÀre dans le mÞme temps la facette de l’engagement solidaire du jeune Camus, r¦dacteur en 1939 des EnquÞtes en Kabylie publi¦es dans Alger R¦publicain, dont il n’est jamais dit le moindre mot. Chez Carpentier, tout comme chez Rinc¦ et Aubrit/Labouret, il est fait r¦f¦rence la proximit¦, puis la rupture aprÀs-guerre, avec les existentialistes, notamment avec son chef de file: Jean-Paul Sartre [6]. Enfin, si Aubrit/Labouret font discrÀtement allusion l’arriv¦e de Camus »en m¦tropole« – ce qui implique le d¦part et l’¦loignement provisoire de la terre natale, l’Alg¦rie, colonie franÅaise –, seul Rinc¦ mentionnera explicitement la »guerre d’Alg¦rie« [7] au nombre des ¦preuves (maladie, problÀmes personnels versus ¦chec conjugal chez Aubrit/Labouret) que traversa l’¦crivain, provoquant chez lui »une grave crise int¦rieure«. Si on se tourne vers les extraits d’œuvres mis au programme, on verra que ce sont g¦n¦ralement L’¦tranger et La peste qui retiennent prioritairement l’attention pour aborder la probl¦matique du roman et la question du personnage [8]. Et ce mÞme si dans trois des manuels cit¦s, de brefs fragments d’essai tir¦s de Le mythe de Sisyphe, Les justes, L’homme r¦volt¦ sont ¦galement retenus dans un cadre plus argumentatif. On le voit, la place accord¦e la facette alg¦rienne de Camus – position alg¦rienne, ¦crira Jean-Jacques Gonzales – est r¦duite sa plus simple expression dans ces diff¦rentes pr¦sentations, qui confortent, par contre, la trajectoire de ce qu’il est »convenu d’appeler un ›classique‹« de la litt¦rature franÅaise. Ou comme le dit Carpentier dans un saisissant raccourci: »Albert Camus. Êcrivain franÅais«. Or la question qui m¦rite d’Þtre pos¦e est celle de savoir si on peut comprendre cette œuvre – tout la fois universaliste et profond¦ment concrÀte et enracin¦e dans sa terre natale – en faisant abstraction de ses origines alg¦riennes. C’est l’Alg¦rie qui le fait ¦crire, qui donne sÀve et sang son œuvre, voil
Albert Camus: du panthéon aux manuels de littérature française
389
pourquoi pendant de longues ann¦es l’Alg¦rie occupera une position fantomatique dans son œuvre, qu’elle apparatra en des ¦clairs aussitút ¦teints, qu’il partira pour la France, qu’il oubliera l’Alg¦rie, qui lui sera rappel¦e par la guerre, qui fermera cette parenthÀse qui s¦pare L’envers et l’endroit […]. C’est pourquoi Þtre ¦crivain sera pour lui au bout du compte expliciter cette position alg¦rienne17. Si l’on excepte la pr¦sentation de Carpentier qui cite effectivement L’envers et l’endroit (»confidentielle publication alg¦roise«18 parue chez Charlot en 1937, suivie de Noces, en 1939) mais passe totalement sous silence l’Alg¦rie au sens large (naissance, engagement, guerre, etc.), dans les manuels scolaires, l’œuvre litt¦raire de Camus semble effectivement commencer avec ses succÀs parisiens de 1942: L’¦tranger et Le mythe de Sisyphe, tous deux publi¦s chez Gallimard. De la mÞme maniÀre, on trouve dans ces notices tous les ingr¦dients qui peuvent Þtre rang¦s au nombre de »l’institutionnalisation« de Camus, figure-phare de l’¦cole – plus que de l’universit¦ – r¦publicaine. Mentionnons ce titre la trajectoire brillante du jeune pupille de la nation qui ¦tudie la philosophie, renonce l’enseignement pour motif de sant¦ et se lance dans l’¦criture; l’adoubement par Sartre, suivi de l’in¦luctable parallÀle Sartre-Camus par le biais du binúme existentialisme-philosophie de l’absurde; la remise du prix Nobel, »¦preuve de classicisation. Pour l’opinion franÅaise, si friande de prix litt¦raires, elle a valeur de prix Goncourt plan¦taire, d’Oscar des belles-lettres, de Coupe du monde de la litt¦rature«19 ; ou enfin l’¦dition en format de poche, »label de modernit¦ et de qualit¦«20 et tremplin de la cons¦cration acad¦mique. Selon Fraisse, »Camus est le plus ¦dit¦ des ›grands auteurs‹ contemporains enseign¦s dans le cadre scolaire: 22,614 millions d’exemplaires en 1997«, dont 60 % reviennent deux titres: L’¦tranger et La peste, auxquels est souvent r¦duite l’œuvre camusienne, malgr¦ »l’effort de la communaut¦ scolaire et universitaire«21 pour ¦viter cet ¦cueil. L’examen des quatre manuels de 2007 cit¦s ci-dessus, qui, tous font une place de choix L’¦tranger ou La peste, corrobore ainsi la tendance amorc¦e fin des ann¦es quatre-vingt, une tendance d¦j observ¦e par Fraisse en 2003, et d¦nonc¦e vingt ans plus tút par Yves Reuter qui accusait Lagarde et Michard d’Þtre l’origine de ce gauchissement de l’œuvre. Les manuels les plus r¦cents, conduits sans doute des imp¦ratifs de r¦duction du nombre de textes cit¦s, la suite de l’abandon de la tomaison par siÀcle et en 17 Jean-Jacques Gonzales, Albert Camus. L’exil absolu, Houilles, Editions Manucius, 2007, p. 33. 18 Emmanuel Fraisse, »Camus et l’¦cole en France: propos d’une institutionnalisation«, in Albert Camus et les ¦critures du XXe siÀcle, Arras, Artois Presses Universit¦s, 2003, p. 283 – 294, citation p. 284. 19 Emmanuel Fraisse, »Camus et l’¦cole en France«, p. 287. 20 Emmanuel Fraisse, »Camus et l’¦cole en France«, p. 287. 21 Emmanuel Fraisse, »Camus et l’¦cole en France«, p. 288.
390
Bénédicte Vauthier (Bern)
fonction de l’adoption de nouveaux programmes, ont, eux, tendance se recentrer sur L’¦tranger. Mieux ou pire, il arrive que la critique proprement universitaire semble s’excuser d’en Þtre r¦duite citer L’¦tranger et La peste22. Sur la base de ma double exp¦rience d’¦tudiante romaniste, puis d’enseignante de franÅais l’¦tranger, je dirais mÞme que le plus grave est et reste finalement que L’¦tranger est effectivement trop souvent r¦duit »une entr¦e commode pour des lecteurs de ›franÅais langue ¦trangÀre‹ ou une ›philosophie pour classes terminales‹«,23 ce qui fait ¦cran la »multiplicit¦ de lectures« que recÀle non seulement ce texte mais aussi l’œuvre tout entiÀre de Camus. Lectures au nombre desquelles il faut compter celle de l’¦tranger, de l’exil¦ que Camus a ¦t¦ tant en Alg¦rie qu’en France. Albert Camus. L’exil absolu, a ¦crit Jean-Jacques Gonzales, dans un saisissant raccourci pour nous raconter l’histoire de Camus qui est aussi une g¦ographie: »Le territoire, c’est l’Alg¦rie, l’histoire, c’est celle de la colonisation«24. Nous voici donc retourn¦s notre point de d¦part, c’est--dire l’escamotage de cette histoire de France et de la litt¦rature franÅaise o¾ l’histoire et les consciences ne peuvent Þtre que d¦chir¦es. Nous voici revenus la possible ambigut¦ sous jacente la panth¦onisation d’un Camus, »figure consensuelle, prix Nobel de litt¦rature, r¦sistant, intellectuel qui ne s’est pas compromis avec le totalitarisme sovi¦tique, homme de paix«25. Tout cela est vrai, certes, mais o¾ est la figure moins universaliste d’un Camus d¦chir¦, et attach¦ sa terre natale, celle d’»un homme qui lie les deux rives de la M¦diterran¦e«, celle de l’¦ternel exil¦, une facette que les manuels scolaires ont tendance passer sous silence alors mÞme que cette dimension ¦blouissante, aveuglante mÞme de son œuvre permettrait d’aborder enfin les questions m¦morielle et identitaire, aux cút¦s de thÀmes non moins complexes tels que la colonisation, la guerre d’Alg¦rie, l’immigration, ¦tant entendu qu’on ne peut pr¦tendre comprendre le visage de la France d’aujourd’hui si l’on fait abstraction de son histoire coloniale26. Dans un article qui n’a rien perdu de son actualit¦: »L’Histoire expurg¦e de la guerre d’Alg¦rie. La colonisation telle qu’on l’enseigne«, Maschino s’en prenait vivement aux concepteurs des manuels scolaires et aux professeurs d’histoire, faussaires des m¦moires collectives. Faisant siens les propos d’un enseignant, il d¦clarait ainsi: »La d¦colonisation, la guerre d’Alg¦rie, c’est un peu comme une 22 23 24 25 26
Emmanuel Fraisse, »Camus et l’¦cole en France«, p. 293. Emmanuel Fraisse, »Camus et l’¦cole en France«, p. 294. Jean-Jacques Gonzales, Albert Camus. L’exil absolu, op. cit., p. 15. Ce sont les termes utilis¦s par Christian Delporte pour pr¦senter l’auteur. Voir note 13. Voir Benjamin Stora, La gangrÀne et l’oubli. La m¦moire de la guerre d’Alg¦rie, Paris, La D¦couverte/Poche, 1998 [1991, 1e ¦d.] et Le transfert de m¦moire. De l’»Alg¦rie franÅaise« au racisme anti-arabe, Paris, La D¦couverte, 1999.
Albert Camus: du panthéon aux manuels de littérature française
391
¦toile qui s’¦loigne, […] ce n’est d¦j plus qu’un point dans le ciel. Un point […] que demain on ne verra plus«27. õ en croire les historiens du petit Dictionnaire critique d¦j cit¦, ce danger risque fort de se voir confirm¦ par la politique sarkozyste »imp¦nitente«, vu ce que fait Nicolas Sarkozy lorsqu’il dit ne pas vouloir expier les »fautes« pass¦es et s’adresse ceux sur les ¦paules desquels le poids de l’histoire ne pÀse pas? Il se dote d’une conception de »la France« caract¦ris¦e par la fiert¦ nationale, r¦affirme le pouvoir de l’autorit¦ politique de d¦terminer quelles versions de l’histoire doivent non seulement Þtre enseign¦es mais apprises par tous […]28. Or, l’œuvre de Camus, tout comme la litt¦rature francophone (notamment d’Alg¦rie) permettraient d’¦viter cet ¦cueil, car ce sont des voies royales qui donnent accÀs cette histoire plurielle. AprÀs avoir publi¦ une Anthologie des ¦crivains maghr¦bins d’expression franÅaise (qui avait soulev¦ quelques pol¦miques), Albert Memmi a ¦t¦ le premier offrir une Anthologie des ¦crivains franÅais du Maghreb (1969), osant r¦unir des auteurs aux profils id¦ologiques et aux motivations litt¦raires bien diff¦rents, tels Louis Bertrand, Isabelle Eberhardt, Robert Randau, Jean P¦legri, Jules Roy ou encore Albert Camus… pour ne citer que les plus connus aujourd’hui encore. Conscient de la n¦cessit¦ de r¦tablir le dialogue, de redonner vie Un rÞve de fraternit¦29 – partag¦ par les »hommes de bonne volont¦« mais frustr¦ par la guerre –, l’auteur justement c¦lÀbre du Portrait du colonis¦ pr¦c¦d¦ du Portrait du colonisateur (1957) poursuivait ainsi son entreprise de »confrontation« des communaut¦s, des points de vue. Le tome I pourrait ainsi r¦unir les ¦l¦ments d’une espÀce de moi collectif, de ce que l’on appelait naguÀre les IndigÀnes, leurs misÀres, leurs aspirations et leurs r¦voltes. Le tome II […] grouperait, en un autre portrait-synthÀse, les habitants europ¦ens, ou d’origine europ¦enne, des ex-colonies30. Cherchant ensuite »r¦sumer en une formule deux traits capitaux de ces deux mouvements, si imm¦diatement contemporains«, il d¦clarait: »Si l’un des signes communs dominants des ¦crivains maghr¦bins ¦tait la r¦volte, celui des ¦cri27 Maurice T. Maschino, »L’histoire expurg¦e de la guerre d’Alg¦rie. La colonisation telle qu’on l’enseigne«, Le Monde diplomatique, 563, f¦vrier 2001, p. 8 – 9 (Article repris dans ManiÀre de voir, 58, juillet-aot 2001). 28 L. De Cock, F. Madeline, N. Offenstadt & S. Wahnich, »Introduction«, op. cit., p. 19 29 Nous reprenons ici le titre de l’anthologie de Guy Degas, qui chercha, lui aussi, r¦unir, au sein d’un mÞme volume cette fois, ces hommes de bonne volont¦ issus des deux rives de la M¦diterran¦e et qui ont cherch¦ partager des rÞves de fraternit¦ (Guy Degas, ¦d., Alg¦rie. Un rÞve de fraternit¦, Paris, Omnibus, 1997). 30 Albert Memmi, »Une litt¦rature de s¦paration«, Introduction Anthologie des ¦crivains franÅais du Maghreb (sous la direction d’Albert Memmi), Paris, Pr¦sence Africaine, 1969, p. 12.
392
Bénédicte Vauthier (Bern)
vains franÅais du Maghreb fut la s¦paration«. Et c’est de cette s¦paration, que l’œuvre de Camus toute entiÀre est avant tout embl¦matique. J’ai sugg¦r¦ que L’¦tranger de Camus, c’¦tait probablement d’abord Camus lui-mÞme ¦tranger dans son pays natal, et pas seulement, comme on le pr¦tend, l’exp¦rience d’une ¦tranget¦ m¦taphysique, ou psychologique, n¦e de l’absurde condition humaine. Toute l’œuvre de Camus pourrait Þtre reprise dans cette perspective, depuis Le Malentendu, au titre alors si ¦vident jusqu’ L’exil et le royaume qui devient alors si concrÀtement ¦vocateur, et qui fut son dernier livre; comme si le destin avait ainsi voulu cerner d¦finitivement la physionomie du plus grand ¦crivain maghr¦bin actuel. […] Serait-ce tellement hasardeux de supposer que la litt¦rature des ¦crivains franÅais d’Afrique du Nord traduit les impossibilit¦s et les d¦sespoirs des excolonisateurs, comme la litt¦rature des Maghr¦bins traduisait les impossibilit¦s et les d¦sespoirs des ex-colonis¦s? Et que ces impossibilit¦s proviennent en premier lieu de cette position d’Þtre s¦par¦, ¦tranger dans son pays natal, qui marquait irr¦m¦diablement le Colonisateur en colonie?31 En r¦alit¦, la s¦paration qu’¦voque Memmi – qui je dois, ainsi qu’ Edward Sad, d’avoir appris relire l’œuvre de Camus la lumiÀre des m¦moires d’Alg¦rie – doit Þtre ¦largie aux deux rives de la M¦diterran¦e car, comme l’a montr¦ r¦cemment Jean-Jacques Gonzales, Camus l’Alg¦rien n’est pas moins s¦par¦ de l’Alg¦rie »indigÀne« qu’il ne l’est de la France. C’est une thÀse assez semblable celle du triple exil des Pieds-Noirs – exil historique, g¦ographique et linguistique – expos¦e par Jean-Jacques Gonzales que nous avions essay¦ de d¦velopper en ¦laborant en Espagne nos Memoria(s) de Argelia. La literatura francûfona – argelina y francesa – al servicio de la historia, dont seules des »Balises pour une Anthologie de litt¦rature francophone« ont ¦t¦ ensuite publi¦es en franÅais32. En conjuguant les analyses d’Ahmed Lanasri, de Benjamin Stora et de Francis Manzano, nous avions tent¦ de montrer pourquoi la litt¦rature francophone – franÅaise et alg¦rienne – ¦labor¦e des deux cút¦s de la M¦diterran¦e ne pouvait Þtre comprise qu’au d¦part d’un triangle id¦ologique (M¦tropole/»IndigÀnes«/Colonie de peuplement), de la longue dur¦e (colonisation/guerre d’Alg¦rie/exil et immigration) et d’un triangle linguistique (berbÀre/roman/arabe), trois ¦l¦ments susceptibles de nous faire revisiter la partie dramatique de l’histoire de France et d’Alg¦rie et de faire dialoguer des textes qui ne sont compr¦hensibles qu’en regard les uns des autres. 31 Albert Memmi, »Une litt¦rature de la s¦paration«, op. cit., p. 17. 32 M¦moria(s) de Argelia. La literatura francûfona – argelina y francesa – al servicio de la historia (Estudio, ediciûn y notas de B¦n¦dicte Vauthier, Prefacio de Benjamin Stora), Madrid, UAM, 2004 et »Memoire(s) d’Alg¦rie: Balises pour une anthologie de litt¦rature francophone – franÅaise et alg¦rienne – au service de l’histoire«, Expressions maghr¦bines, vol. 2, n8 1, ¦t¦ 2003, p. 175 – 194.
Albert Camus: du panthéon aux manuels de littérature française
393
Nous avions, certes, peut-Þtre fait la part (trop) belle Edward Sad, dont les analyses consacr¦es Camus dans Culture et imp¦rialisme avaient retenu toute notre attention, nous portant tourner notre regard sur la dimension »n¦gative« de la position alg¦rienne de Camus, qui pouvait alors Þtre apparent¦e aux ¦crivains coloniaux – et aux FranÅais d’Alg¦rie. Nous pensons aujourd’hui, avec Benjamin Stora et Jean-Jacques Gonzales, que cette dimension ne doit pas masquer une autre absence, tout aussi douloureuse: »l’absence de Camus aux Arabes«. Les Arabes sont loin, distants. Mais il y a deux sortes de distance, d’¦loignement: l’une qui s’apparenterait une n¦gation, celle qu’une certaine critique croit entrevoir, une autre qui marquerait au contraire, l’affirmation d’une pr¦sence inaccessible, souveraine, inatteignable, celle l’¦vidence ¦crite par Camus. Les Arabes d¦tiennent la v¦rit¦ de ce pays, et cette v¦rit¦ est muette, comme leurs visages, ou parle une langue ¦trangÀre, la leur. Rien ne peut Þtre dit, si ce n’est la pr¦sence lointaine et irr¦futable, et l’¦tranget¦ du s¦jour alg¦rien33. Si la distance qui s’apparente une n¦gation renvoie la lecture camusienne d’Edward Sad34, celle de l’affirmation renvoie la position alg¦rienne que JeanJacques Gonzales retrouve du premier au dernier ¦crit de Camus, de L’envers et l’endroit au bouleversant ¦crit posthume, Le premier homme. Cette position ou posture alg¦rienne n’est autre que la leÅon que Camus tira de son matre Jean Grenier : DerriÀre l’endroit il y a un envers. Mais ce que lui apprend Grenier ce n’est pas exactement cela; cela tout le monde le sait. Ce que lui apprend Grenier, c’est le et: ce n’est pas l’envers ou l’endroit, c’est l’envers et l’endroit. Tout se joue dans la conjonction, pas dans la disjonction35. »Position intenable«, nous le savons, que l’histoire se chargera de balayer. Position probablement utopique parce qu’arriv¦e trop tard, ce qui expliquent que Jean Amrouche et Mouloud Feraoun aient eu alors raison contre Camus36, dans leur lucidit¦ tragique. 33 Jean-Jacques Gonzales, Albert Camus. L’exil absolu, op. cit., p. 31. Voir ¦galement son article, du mÞme titre in Albert Camus et les ¦critures du XXe siÀcle, Arras, Artois Presses Universit¦s, 2003, p. 369 – 379. 34 Pour une relecture critique des analyses d’Edward Said, voir Bernard Mouralis, »Edward W. Said et Albert Camus: un malentendu«, in AA.VV., Albert Camus et les ¦critures du XXe siÀcle, Arras, Artois presses Universit¦s, 2003, p. 239 – 254; Benjamin Stora, »Cuando la literatura cuenta y desvela historias«, Prefacio a Memoria(s) de Argelia. La literatura francûfona – argelina y francesa – al servicio de la historia, Madrid, UAM, 2004, p. 14; B¦n¦dicte Vauthier, »Introducciûn« a Memorias de Argelia, op. cit., p. 25 – 27. 35 Jean-Jacques Gonzales, Albert Camus. L’exil absolu, op. cit., p. 22. 36 Voir Jean-Jacques Gonzales, Albert Camus. L’exil absolu, op. cit., p. 119 et B¦n¦dicte Vauthier, »Introducciûn«, op. cit., p. 31 – 32. Feraoun revient sur l’alg¦rianit¦ de Camus dans
394
Bénédicte Vauthier (Bern)
Camus, qui ne verra pas le d¦nouement du conflit fratricide, »sera donc un ›tratre‹ pour les deux camps. õ l’intersection des deux points de vue, ceux qui veulent se r¦approprier une terre qui est la leur l’origine, les Alg¦riens musulmans, et ceux qui considÀrent que cette terre leur appartient d¦sormais, les FranÅais d’Alg¦rie, Albert Camus annonce ce que peut Þtre la position d’un intellectuel«37. Tel est, nos yeux, le seul sens possible donner un Albert Camus pied-noir, un Albert Camus qui »s’est toujours senti alg¦rien. Il voulait le croire. Il l’a dit maintes fois. Il n’a jamais renonc¦«. »La guerre, c’est entre la France et l’Alg¦rie, entre le FranÅais et l’Alg¦rien, et Camus est les deux – Alg¦rien et FranÅais – o¾ si l’on veut, ni l’un, ni l’autre«38. Alors Camus au panth¦on? Pourquoi pas, condition toutefois qu’on ne se trompe pas sur la valeur du symbole et sur le sens de l’¦tranget¦ camusienne !
deux articles bouleversants: »La source de nos communs malheurs (Lettre Albert Camus) [septembre 1958] et «Le dernier message (Hommage Camus) [avril 1960], tous deux repris dans L’anniversaire, Paris, Seuil, coll. Points Roman, p. 35 – 44 et 45 – 52. 37 Benjamin Stora, »Il y a cinquante ans, le prix Nobel de litt¦rature ¦tait attribu¦ Albert Camus« (Conf¦rence donn¦e par Benjamin Stora au mus¦e de la M¦diterrann¦e de Stockholm le 6 octobre 2007), Les guerres sans fin. Un historien, la France et l’Alg¦rie, Paris, Stock, 2008, p. 164. 38 Jean-Jacques Gonzales, Albert Camus. L’exil absolu, op. cit., p. 10.
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland (West und Ost) nach 1945. Eine kritische Bilanz
1.
Einige Schlaglichter auf die Aktualität Albert Camus’
Wenn ein Internationaler Camus-Kongress in Deutschland stattfindet, liegt es nahe, dass wenigstens in Umrissen die Wege der deutschen Camus-Rezeption thematisiert werden, wobei auch Irrwege, Missverständnisse und offensichtliche Selbstbilder der Mittler eine Rolle zu spielen haben. Seit Anfang der 90er Jahre wird auch in Deutschland eine »Renaissance von Albert Camus« proklamiert. So veröffentlichte die Schweizer Kulturzeitschrift du im Juni 1992 ein Themenheft »Wiederbegegnung mit Albert Camus« (Heft Nr. 6). In fast allen neueren deutschen Camus-Publikationen ist – quasi selbstverständlich – von der Aktualität, der Gegenwart Albert Camus’ die Rede, nicht selten in einem emphatischen Einleitungs- und Schlusskapitel. Heinz Robert Schlette, der Altmeister der deutschen Camus-Forschung, betonte immer wieder »die außerordentlich große Wirkung, die nach wie vor von dem Werk Camus’ ausgeht« (Schlette 1995, S. 5). Schon in der Einleitung zu seinem Sammelband Wege der Forschung von 1975 war er von der »bleibenden Aktualität der Camusschen Position und Fragestellung« überzeugt (Schlette 1975, S. 8). In Lourmarin beginnt die hochnoble Würdigung, die Iris Radisch von der Literaturredaktion der ZEIT dem »Zeitgenossen unserer Träume« aus Anlass des Unfalltodes vor 50 Jahren gewidmet hat. Ich möchte aus diesem Artikel, stellvertretend für andere, die aus demselben Anlass in der deutschen Presse erschienen sind, einige Sätze zitieren: Zwei Tage später, am Dreikönigstag, ist Camus wieder in seinem Haus in Lourmarin. In einem schlichten Eichensarg. Sein Freund Ren¦ Char und sein alter Lehrer Jean Grenier halten die Totenwache. Man trägt ihn direkt von seinem Haus auf den gegenüberliegenden Friedhof. Kein Geistlicher hat ihn begleitet. […] Der Süden ist sein Gegengift zu Europa, das seinen Schönheitssinn der Maßlosigkeit geopfert hat, das nach Büro riecht und daran glaubt, sein Glück kaufen und in die Garage stellen zu können. […]
396
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Camus träumt den Traum vieler europäischer Intellektueller, die sich ein geopoetisches Arkadien höherer geistiger und natürlicher Einfachheit zusammenreimen, das sie aus der Komplexitätsfalle der Moderne und aus dem Hamsterrad des Materialismus erlöst. […] Die Aufsätze gegen Camus sind lange im Papiermüll verschwunden und zu neuen Aufsätzen recycelt worden. Der Zauber der »zwei oder drei einfachen, großen Bilder«, die Camus über den Umweg der Kunst wiederfinden wollte, macht ihn noch immer zum Zeitgenossen unserer Träume. […] Es war sein griechisches »Sonnendenken«, das Camus schließlich über den genialen, viel gebildeteren und philosophisch brillanteren Sartre triumphieren ließ, der sich für seinen selbst verfassten Geschichtsroman mehr interessiert hat als für den sowjetischen Gulag oder die Alte von nebenan. (Radisch 2009, S. 72)
Noch am Abend des 4. Januar 2010 zeigte ARTE den Dokumentarfilm Albert Camus: Kampf mit dem Absurden von James Kent (Erstausstrahlung 1996). Und speziell zum 50. Todestag brachte WDR 5 am 4.–6. Januar 2010 eine neue Hörspielfassung in drei Teilen der Pest, aufgenommen im Berliner »Studio 4« des ehemaligen DDR-Rundfunks, mit Götz Schubert (der selbst eine private Ostgeschichte hat) in der Rolle des Dr. Rieux. Und ebenfalls im Januar startete der Rowohlt-Verlag eine hübsche kleinformatige rote Pocket-Reihe, mit den CamusRennern des Verlags: Der Fremde, Die Pest, Der erste Mensch. Herausragendes, ganz unerwartetes Ereignis war 1994 die Veröffentlichung des unfertigen Romans Le premier Homme, der bereits ein Jahr später bei Rowohlt in deutscher Übersetzung erschien. Zusammen mit der 1997 gestarteten Taschenbuchausgabe erreichte der posthume Roman Camus’ lt. Mitteilung des Programmleiters Belletristik eine Gesamtverkaufszahl von 225.251 Exemplaren. Längst ist Albert Camus, ohne vergleichbares Beispiel in der modernen französischen Literatur, das Opfer der medialen Macht seiner internationalen Exegeten, mit der Tendenz zunehmender Enigmatisierung. Unter den Verlagsbestsellern, die sein Verleger Gallimard seit 1911 statistisch erfasst, rangiert an erster Stelle L’Etranger, gefolgt von La Peste und Saint-Exup¦rys Le petit Prince. In einer rückblickenden Rede zu den deutsch-französischen Beziehungen seit 1945 anlässlich der 6. Deutsch-Französischen Kulturgespräche des FrankreichZentrums der Universität Freiburg am 15. 11. 2007 beschwor der bekannte Philosoph Peter Sloterdijk als herausragende Nachkriegsfigur Albert Camus, »der die großen europäischen Versöhnungsworte nach dem Krieg geschrieben hatte« (Sloterdijk 2008, S. 47). »Er war es, der nach den Gewaltexzessen der ersten Jahrhunderthälfte unkorrumpierbar an das irdische Maß erinnerte und die unverhandelbare Verbindlichkeit zivilisierender Besinnung hochhielt.« (S. 46 f.) Als Beleg für den anhaltenden Nachruhm Camus’, seinen moralischen Vorbildcharakter und hohen menschlichen Zeugniswert werden auch einige
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
397
werkexterne, biographische Faktoren angeführt (R¦sistance, Nobelpreis, tragischer Unfalltod [mit 47 Jahren] u. a.), welche bis heute das Bild von Albert Camus im öffentlichen Bewusstsein bestimmen, das auch seine Kritiker, ja Gegner (überwiegend aus dem Lager des älteren Rivalen, Sartres, dem dieser Nachruhm versagt geblieben ist) nicht trüben konnten. Wesentlich soll uns im Folgenden die Frage beschäftigen, wer eigentlich exegetisch publizistisch für Camus zuständig ist? Welche wissenschaftlichfachliche Zunft? Etwa die Religionsphilosophen, die sich Albert Camus als einen der Ihren einverleibt haben; die Romanisten, die relativ spät und nur vereinzelt Interesse an Albert Camus gefunden haben?
2.
Die besonderen Bedingungsfelder der deutschen Camus-Rezeption nach 1945
Ich kann es mir ersparen, auf den Rezeptionsbegriff allgemein, den derzeitigen Diskussionsstand usw. einzugehen. Auch auf den imagologischen Aspekt, Camus’ Deutschlandbild, das noch nicht systematisch untersucht und dargestellt worden ist, möchte ich nur kurz eingehen. Die Weite und Diversität meines Themas – im Zusammenspiel der Kriterien von Wirkung, Rezeption und Nachruhm literarischer Werke – erlaubt es mir im vorgegebenen Zeitrahmen leider nicht, die einzelnen Aspekte der deutschen Camus-Rezeption nach 1945 genauer und immer mit Belegen abzuhandeln. Leider muss auch festgestellt werden, dass die internationale Camus-Forschung keineswegs so vernetzt ist, wie das wünschenswert und technisch möglich wäre. Viele deutsche Publikationen von Rang sind im Ausland, auch im benachbarten Frankreich, nicht wahrgenommen worden. Das ist natürlich auch ein Sprachproblem unserer französischen Kollegen. Zunächst muss ein quantitativer Aspekt bedacht werden, der eine Rezeptionsgeschichte belastet: Über keinen Autor der französischen Literatur des 20. Jahrhunderts ist so viel geschrieben worden wie über Camus. Auch wenn die genaue Zahl aus verschiedenen Gründen kaum noch erfassbar ist, fällt auf, dass die Mehrzahl der Darstellungen (Studien, Monografien, Dissertationen usw.) nicht literaturwissenschaftlicher oder linguistischer Provenienz ist, sondern aus anderen Disziplinen stammt: Philosophie und Theologie (hier besonders in der Mischform ›Religionsphilosophie‹), Politikwissenschaft und Staatsphilosophie; Publikationsschwerpunkte, die offensichtlich etwas mit deutscher Mentalität und Erwartungshaltung zu tun haben. In der Masse der kaum noch zu erfassenden deutschen Sekundärliteratur über Camus und sein Werk gibt es Autoren, die in ihrer Arbeit ein Kapitel zur
398
Franz Rudolf Weller (Bonn)
»Rezeption« von Camus in Deutschland einfügen. Bei genauerer Betrachtung der mitgeteilten Details bleibt der Eindruck eines vorwissenschaftlichen Gebrauchs eines Begriffs, dessen komplexe Implikationen nicht mitbedacht sind. In vielen Publikationen dominiert das anagogische Verfahren der Exegese, d. h. die Interpretation des Textes durch Hineinlegen eines höheren Sinnes, was durch zerpflückte Camus-Zitate (es sind immer wieder dieselben) leicht gelingt; dazu meistens leider in deutscher Übersetzung (über deren Qualität man sich selten Gedanken macht). Als Repräsentanten der »culture r¦ceptive« (im Französischen geht das mit dem Adjektiv) fragen manche Forscher nicht nach den Bedingungen, die zu den Werken Camus’ geführt haben. Auch das häufig anzutreffende epilogische Kapitel »Albert Camus heute« bleibt clich¦haft-repetitiv bis nichtssagend. Im Spannungsfeld der klassischen Trias Autor – Text – Leser bleibt unberücksichtigt, dass Rezeption in unserem konkreten Fall die Problematik des Literaturtransfers zu bedenken hat, d. h. die Kategorie der Aneignung eines Fremden, direkt oder in der Übersetzung der Sprache des Rezipienten, denn Albert Camus hat keines seiner Werke für deutsche Leser geschrieben, auch nicht die fiktiven Lettres un ami allemand. Für diese Irrwege in der deutschen Camus-Forschung hat der wohl beste Kenner Albert Camus’ klare Worte gefunden: »Was […] bei deutschen Philosophen (und Theologen) heutzutage über Camus zu lesen ist, ist fast ausnahmslos kläglich.« (Schlette 1980, S. 8; ähnlich Pieper 1984, S. 10). Schlettes Herausgabe des Camus-Bandes in der bekannten Reihe »Wege der Forschung« (1975) mit 18 Aufsätzen aus verschiedenen deutschen Zeitschriften zwischen 1946 bis 1971 war ein verdienstvoller Anfang zur Darstellung der deutschen Camus-Rezeption nach 1945. Seine im November 1974 abgeschlossene Bibliografie »Veröffentlichungen über Albert Camus in deutscher Sprache« (S. 387 – 398) enthält 210 Titel (einschließlich der ins Deutsche übersetzten Arbeiten). Übersetzte Sekundärliteratur gehört natürlich auch zum komplexen Rezeptionsfeld wie die bibliographisch schwer erfassbaren Camus gewidmeten Auftritte und Vorstellungen auf den Bühnen, in Rundfunk und Fernsehen sowie in Veranstaltungen der regionalen Fort- und Weiterbildung. Auch der 1976 in der Titelreihe »Wege der Forschung« der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Albert Camus gewidmete Band des renommierten CamusSpezialisten (Schweizer Herkunft) Raymond Gay-Crosier war zur damaligen Zeit eine wichtige Veröffentlichung, wenn auch hinsichtlich der deutschsprachigen Arbeiten manche Lücken zu beklagen waren. Da ein solches Ein-MannUnternehmen heute nicht mehr realisierbar ist, hat der Autor auf eine Aktualisierung verzichtet. Für die Zeit von 1990 bis 2009 hat er immerhin eine thematisch und nach Werken gegliederte Auswahlbibliografie ins Internet gestellt: Bibliographie s¦lective et cumulative des travaux r¦cents consacr¦s Albert Camus (http://www.clas.ufl.edu/users/gaycros/Bibliog.htm). Ein dringendes
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
399
Desiderat ist das deutsche Gegenstück zur vorbildlich dokumentierten Dissertation des Düsseldorfer Romanisten Jürgen Rehbein: Albert Camus. Vermittlung und Rezeption in Frankreich. Über Bedingungen literarischen Erfolgs (1978). Leider besteht keine Chance, dass der Autor seine empirisch-literatursoziologische Darstellung aktualisiert. Rezeptionsgeschichtlich ist ein schon 1963 erschienener Band in der Reihe »Configuration critique d’Albert Camus« der Revue des Lettres Modernes zu erwähnen: Camus devant la critique de langue allemande, herausgegeben nicht von einem deutschen Camus-Forscher, sondern von einem in Österreich geborenen naturalisierten »professeur de la Mission universitaire franÅaise en Allemagne«, Richard Thieberger, der auch die erste deutsche Camus-Monografie verfasst hat (vgl. Thieberger 1960). Der Band vereint 12 Beiträge (Originale und Wiederabdrucke) aus den Bereichen Philologie, Philosophie, Jura, Publizistik, Theaterkritik und Fremdsprachendidaktik. Da es bis heute keine Gesamtdarstellung zur Geschichte der Camus-Rezeption in Deutschland gibt, möchte ich exemplarisch auf eine holländische Studie hinweisen, die meines Erachtens neue Akzente setzt in einer soziologisch orientierten Rezeptionsforschung: Pour une Sociologie de la r¦ception: Lecteurs et lectures de l’œuvre d’Albert Camus en Flandre et en Pays-Bas. (Gerritsen/Ragi 1998) Da bisher immer von Camus und Deutschland die Rede war, muss eine Besonderheit in der deutschen Rezeptionsgeschichte erwähnt werden: Aus der Nachkriegssituation des geteilten Deutschland ergab sich für den östlichen Teil eine massive von Moskau gesteuerte ideologische Ächtung Camus’ bis zum Fall der Mauer 1989, wozu später noch mehr zu sagen sein wird. Diese staatlich über Jahrzehnte verhinderte Rezeption schloss natürlich nicht aus, dass Camus von einigen regimekritischen Intellektuellen, Schriftstellern usw. »unter der Hand« gelesen worden ist. Auch nach der Wende hat im Bereich der ehemaligen DDR = Neuen Bundesländern keine nennenswerte Camus-Rezeption stattgefunden. Eine rezeptionsstrategisch wichtige Rolle spielt der Rowohlt-Verlag, der seit Anfang der fünfziger Jahre die deutschen Rechte am Werk Camus’ besitzt, mit allen positiven wie negativen Folgen einer monopolistischen Machtausübung im Verlagswesen – vergleichbar der parallelen Situation des Hauses Gallimard, in dem Albert Camus selbst über Jahre ein wichtiger Angestellter war. Um die Respektierung authentischer, Autorreputation und Textqualität wahrender Rezeption hat sich der Rowohlt-Verlag als deutscher »Alleinverwerter« jahrelang wenig gekümmert. Nachdem die meisten Camus-Ausgaben über die Jahre sinkende Verkaufszahlen aufwiesen, hat der Verlag sich endlich entschlossen, sowohl die wichtigsten fiktionalen Werke sowie die beiden »fachsprachlichen« (d.i. philosophischen) Titel neu übersetzen zu lassen. Der Sammelband Dramen verkauft sich nicht so gut (152.804 in der gebundenen Ausgabe seit 1962; Ta-
400
Franz Rudolf Weller (Bonn)
schenbuchausgaben – auch einzelner Dramen – gibt es nicht.) Hier ist es editorisch ziemlich schludrig zugegangen: Das »Vorwort« (S. 9 – 14), das eindeutig von Camus stammt, was nicht mitgeteilt wird, ist zusammengestoppelt (was auch nicht gesagt wird): teils aus einem Interview, teils aus einem Zeitschriftenaufsatz (Vgl. »Pr¦face l’¦dition am¦ricaine de ›Caligula‹ and Three other Plays.« von 1957, abgedruckt in Bd. I der neuen Pl¦iade-Ausgabe 2006, S. 446 – 450). Wie zu erwarten, rangiert Der Fall weit abgeschlagen hinter den beiden früheren Romanen (63.421 seit 1997). Einige Titel gibt es als Hörbücher : Der Femde; Die Pest; Der erste Mensch; Caligula. Verkaufszahlen liegen nicht vor. Zusätzlich zu den hier genannten Einzelausgaben sind bei Rowohlt im Laufe der Jahre mehrere Camus-Anthologien erschienen: eine ältere von Camus noch selbst getroffene Auswahl Fragen der Zeit (7.851 seit 1997); Unter dem Zeichen der Freiheit (ein Camus-Zitat). Camus-Lesebuch, Herausgegeben von Horst Wernicke (10.293 Neuausgabe 1997): eine Auswahl von 16 Texten, selbstständigen Artikeln oder – ein bedenkliches Unternehmen wie aus Zeiten der Kürzungspraxis didaktisch bearbeiteter fremdsprachlicher »Schulausgaben« in deutscher Übersetzung – Auszügen/Kapiteln aus einzelnen literarischen und philosophischen Werken; Verteidigung der Freiheit. Politische Essays (8.373 seit 1997) und eine ältere, schon 1961 erstmals erschienene Taschenbuchausgabe (11.361 seit 1997) mit einigen wichtigen Texten aus Camus’ ganzer Schaffenszeit: Nobelpreisrede; Der Künstler und seine Zeit; Licht und Schatten (Frühe Essays aus den Jahren 1935/1936); Briefe an einen deutschen Freund; Der Abtrünnige; Die Stummen; Der Gast (aus der Novellensammlung Das Exil und das Reich). Schließlich ist noch eine editorisch kuriose Buchbindersynthese zu erwähnen: Albert Camus. Ein Lesebuch mit Bildern. Ausgewählt von Barbara Hoffmeister (2003). Die Inhaltsauswahl wird zwar nicht begründet, vermag aber als Einstieg für Anfänger in einige camustypische Werke aus verschiedenen Schaffensperioden zu gefallen: Der Fremde; »Sonnenessays«, d.i. Sommer in Algier ; Helenas Exil; Das Meer ; ferner das Drama Die Gerechten sowie drei Novellen aus dem Band Das Exil und das Reich (Die Ehebrecherin; Der Abtrünnige; Jonas). Es folgt dann noch ganz überraschend, aber konzeptionell durchaus überzeugend, eingebunden und mit neuer Paginierung, der Abdruck einer Camus-Monografie »Dargestellt von Brigitte Sändig« (Vgl. Sändig 1995c). Mit fünf lieferbaren Titeln leistet sich Rowohlt eine respektable und preiswerte Reihe von Camus-Anthologien (mit einigen wenigen inhaltlichen Überschneidungen). Camus in deutscher Übersetzung bleibt ein problematischer Punkt unter den die Rezeption bedingenden Einflussfaktoren, weil die translatorische Kompetenz das sicher wichtigste Instrument interkultureller literarischer Kommunikation ist – neben den anderen über den Geschmack der schweigenden Mehrheit urteilenden Rezensenten, professionellen Kritikern, universitären Forschern usw. Von den literarischen Anfängen in Algerien bis zu Camus’ frühem Unfalltod
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
401
erstreckt sich ein Publikationsrhythmus mit Intervallen und Verzögerungen, mit unterschiedlichen Gewichtungen einzelner Werke, deren distributionale Anomalien im Ausland zu unmittelbaren oder zeitversetzten oder nur über das Original möglichen Formen der Rezeption führen können. Einige Beispiele: Die 1937 erstmals (noch in Algier) veröffentlichten Jugendschriften L’Envers et l’endroit sind erst 1959 in deutscher Übersetzung erschienen, ähnlich die frühe Essaysammlung Noces (Algier 1938) erst in Zürich (Arche) 1950 unter dem blumigen Titel Hochzeit des Lichts. Impressionen am Rande der Wüste. Der Vorläufer-Roman des Etranger, La Mort heureuse, entstanden 1936/38, erschien erst 1971 nach Camus’ Tod, aber schon ein Jahr später in einer deutschen Übersetzung, ähnlich – nach kontroversen Diskussionen im Verlag Gallimard – der Fragment gebliebene letzte Roman Le premier Homme 1994, schon ein Jahr später in deutscher Übersetzung. Das quantitativ ungewöhnliche Ausmaß an sog. »Ecrits posthumes« Camus’ ist erst durch die Veröffentlichung der neuen vierbändigen Pl¦iade-Ausgabe sichtbar geworden. Man darf gespannt sein, was von diesen »Archivalien« in deutscher Übersetzung auf den Markt kommt. Vorrangig müssten – im Sinne einer Korrektur am einseitig verengten deutschen Camus-Bild (was ich im Einzelnen noch begründen möchte) – die »politischen« Einlassungen des engagierten Schriftstellers und Journalisten Albert Camus von den Job-Anfängen in Algier bis zu den medialen und persönlichen Interventionen des mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Moralisten (»un h¦ros de notre temps (…) d’une int¦grit¦ presque sans exemple«, wie Gabriel Marcel in seinem Nachruf 1960 schrieb) auch ins Deutsche übersetzt werden: »Articles« in Alger R¦publicain und Le Soir r¦publicain (1938 – 1940); »Articles« in Combat »clandestin« (1944); »Actuelles III. Chroniques alg¦riennes« (1939 – 1958); »Actuelles. Chroniques.« Artikel in L’Express (1955 – 1956) sowie die zahlreichen Artikel für andere Zeitungen und Periodika, abgedruckt unter dem Titel »Actuelles II. Chroniques 1948 – 1953.« In den wissenschaftlichen Publikationen über Camus und sein Werk dominieren bis heute einerseits moralische Aspekte (die ja gerade bei Schriftstellern nicht selbstverständlich positiv in Erscheinung treten) sowie – damit korrelierend – philosophische und theologische Fragestellungen andererseits, die meist schon im Ansatz eine verengte Wahrnehmung erkennen lassen, gegen die sich Camus vergeblich immer wieder gewehrt hat. Das stark in den Vordergrund getretene Interesse an Albert Camus dem Algerier, am Algerienproblem allgemein als ein verdrängter Teil der Nachkriegsgeschichte Frankreichs, würde eine besondere Untersuchung verdienen. Brigitte Sändig, die nach ihrem Studium einige Zeit als DDR-Entwicklungshelferin in Algerien tätig war, hat in ihren Camus-Monografien dieses Algerien-Syndrom sehr deutlich thematisiert. (Vgl. auch Jurt 1997). Die Zeitschrift lendemains hat 2009 »Camus et l’Alg¦rie« ein
402
Franz Rudolf Weller (Bonn)
umfangreiches Dossier gewidmet (Mustapha Trabelsi [ed.] Nr. 134/135). Wegen der Aktualität des Themas ist auch an zwei ältere einschlägige Arbeiten zu erinnern: »Albert Camus, der Afrikaner.« von Erwin K. Münz (Begegnung 5, 1950, S. 179 – 183) sowie »Albert Camus und ›die Araber‹.« von Heinz Robert Schlette (Zeitgeschichte Vol 2, 1 [1974], S. 1 – 8).
3.
Camus und Deutschland
Was wie ein Buchtitel klingt, erweist sich bei näherer Betrachtung als ein Bündel heterogener, mosaiksteinartiger Facetten, die kein richtiges Gesamtbild ergeben, nicht zu vergleichen mit dem Deutschlandbezug eines Gide, Giraudoux oder Tournier. Camus war, anders als viele seiner Zunftkollegen, kein Schriftsteller, der gern auf Lese- und Vortragsreisen ging; auch war er – schon aus gesundheitlichen Gründen – kein Freund von öffentlichen Auftritten und Diskussionen. Sein freiheitliches Denken und seine moralische Integrität erlaubten es ihm nicht, zu Schriftstellerkongressen nach Berlin oder Moskau zu reisen. Mit der ihm schicksalhaft zugefallenen Zwitterstellung als »FranÅais d’Alg¦rie« hat er sich zeitlebens beschäftigen müssen, was ganz konkret auch in einem häufigen »Pendelverkehr« zwischen Algerien und Frankreich zum Ausdruck kommt. Via nordafrikanisches Geburtsland verstand Albert Camus sich gern als halber Spanier, mütterlicherseits (»par le sang moiti¦ Espagnol«), obwohl er das Land selbst (»une plaie qui ne se ferme pas« erklärte Camus in einem Interview vom 29. Dezember 1945 für L’Espagne r¦publicaine in Toulouse [Vgl. Pl II, S. 661]) aus naheliegenden Gründen nie besucht hat. Die Österreicherin Monika Rauer hat die Beziehungen Camus’ zur spanischen Geisteswelt in einer sehr lesenswerten Dissertation dargestellt: Interkulturelle Aspekte im Schaffen von Albert Camus: Der Spanienbezug. Diss. 2004. (Wien 2005) Eine solche imagologische Studie zum Deutschlandbild Camus’ bleibt ein Desiderat der Forschung. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist Albert Camus – zumeist nicht privat, sondern in offizieller Mission zu Vorträgen in verschiedene europäische und außereuropäische Länder gereist: 1946 in die USA (wo er übrigens vom damaligen Kulturrat an der französischen Botschaft, Claude L¦vi-Strauss, betreut wurde); 1948 Kurzaufenthalte in London und Edinburgh, 1949 Aufenthalte in verschiedenen Ländern Südamerikas (Brasilien, Argentinien, Uruguay, Chile); 1954 Holland; Griechenland 1955 und 1958; Italien 1955, 1959; 1957 Schweden, aus Anlass der Verleihung des Nobelpreises für Literatur. Es ist bewundernswert, wie Albert Camus diese Reiseaktivitäten überwiegend mit öffentlichen Auftritten trotz seiner früh angeschlagenen Gesundheit überstanden hat. Zum Rezeptionsfeld eines ausländischen Schriftstellers gehören gewiss auch
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
403
die Eindrücke, die er im Gastland hinterlassen hat; ferner die Frage, wie er über seine Reisen geurteilt hat; ob er sich vielleicht mit der Sprache und Kultur des Gastlandes beschäftigt hat. Quellenmaterial liefern im Falle ›Camus in Deutschland‹ zwei Reisen, eine private des 23-jährigen (1936) sowie eine offizielle des 32-jährigen (1945), die man sich gegensätzlicher kaum denken kann. Weitere Reisen Camus’ nach Deutschland, etwa zu Lesungen oder Vorträgen, sind mir nicht bekannt. Die erste Reise Juli/August 1936, an der auch Camus’ junge Frau Simone Hi¦ teilnahm, die der 21-jährige Student im Juni 1934 geheiratet hatte, ging zurück auf eine Initiative von Yves Bourgeois, einem hochintelligenten Studienfreund, agr¦g¦ d’anglais, der alles erreicht hatte, was Albert Camus schon aus gesundheitlichen Gründen verwehrt blieb. Diese Reise, die der Hobby-Kajaksportler Bourgeois im Hinblick auf Camus’ fortschreitende Lungenkrankheit so niemals hätte planen dürfen, war in jeder Hinsicht ein Fiasko: Die Finanzierung der Reise war bis zuletzt ein Problem; die Entdeckung des Ehebruchs seiner drogenabhängigen Frau war Anlass für das Ende seiner überstürzten Studentenehe; Camus war nach seiner im Juni 1935 bestandenen »Licence de philosophie« arbeitslos, mit ungewisser beruflicher Zukunft. Die Route dieser »Europa«Reise, wie es überhöht in einigen Biografien heißt, führte über Berchtesgaden (wo sie Aufmärsche mit bayerischer NS-Folklore erlebten), Salzburg (wo sie eine Aufführung des religiösen Mysterienspiels Jedermann (von Hofmannsthal) besuchten, Innsbruck nach Prag, wo Camus eine Woche allein im Hotel verbringt, weil er aus Krankheitsgründen gezwungen war, auf Teile des sporttouristischen Programms der Reise zu verzichten (Vgl. »La Mort dans l’me« im Essayband L’Envers et l’endroit). Die weiteren Stationen waren Dresden, Olmütz, Wien und dann – den »mediterranen« Camus sichtlich aufheiternd – Venedig, Vicenza, Verona. Die klimatisch negative Wirkung des »Nordens« (man erinnert sich an Germaine de StaÚls berühmtes »Deutschlandbuch« von 1813) ist stärker als der politische Eindruck von Hitler und Mussolini, die er – völlig überraschend – in seiner Rede am 8. Februar 1937 zur Eröffnung der »Maison de la culture« in Alger (Camus war vorübergehend der Generalsekretär) in jugendlich-ehrgeizigem Übermut vorurteilsgetränkt vergleicht und gegen die »nouvelle culture m¦diterran¦enne« absetzt. (Vgl. Pl I, S. 567 – 572 u. 1366 f.) Das symbolischtopografische Nachwirken dieser missglückten ersten Deutschlandreise hat O. Lubrich an drei frühen Texten (Carnets, L’Envers et l’endroit, La Mort heureuse) herausgearbeitet. Die Reise, die Albert Camus im Juni 1945 als Leitartikler der ehemaligen Widerstandszeitung Combat in die französische Besatzungszone Baden-Württembergs – in Uniform, wie das für Kriegskorrespondenten üblich war – unternahm, war nicht touristisch-privater Natur; die »Images de l’Allemagne occup¦e« (Vgl. Pl. II, S. 627 – 630) erschienen in der Wochenendausgabe von
404
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Combat (Magazine 30. Juni/1. Juli 1945), ein redaktioneller Anreiz für breitere Leserkreise, dem aber kein Erfolg beschieden war. Obwohl: Das Thema und der Name des Autors waren gut gewählt: Albert Camus war ein inzwischen renommierter Schriftsteller ; fest angestellt bei der Zeitung und seinem Verlag Gallimard, also endlich ohne finanzielle Sorgen. Seit 1940 war er – nolens volens, muss man sagen – mit der sehr musikalischen Francine Faure verheiratet, die als Mathematiklehrerin in Oran arbeitete. Ständige ärztliche Kontrolle und regelmäßige Therapiemaßnahmen unterstützten ihn im Kampf gegen die Tuberkulose. Auf dem Weg in das von Franzosen besetzte Land, das einen fürchterlichen Krieg verloren hatte, das er daher in einer gespannten Erwartungshaltung betrat, erlebte er in den ostfranzösischen Departments zunächst ein Land der Toten, der Verwüstung und des menschlichen Leids: »un visage d’apocalypse la mesure de ses violences pass¦es« (627). Etwas ganz Anderes, Unglaubliches, ein Kontrastbild erwartete ihn: Erwartung, Wissen und Anschauung, Begegnung klafften weit und schmerzlich auseinander : »Je ne puis noter ici que l’incertitude o¾ je me suis trouv¦, pendant tout ce voyage en Allemagne, incapable que j’¦tais de raccorder ce que je savais avec ce que je voyais.« (630) Camus erlebt eine Stimmung von Glück und Ruhe, wie in einem Traum; ein friedliches Zusammenleben zwischen deutscher Bevölkerung und französischen Soldaten, eine »stup¦fiante impression de vacances« (629) der überwiegend nordafrikanischen Soldaten am Bodensee. So sind auch die beiden Abschnitte überschrieben: »L’Allemagne idyllique« und »Impression de vacances«. Zutiefst verwirrt und innerlich gespalten im Urteil über diesen Teil Nachkriegsdeutschlands, das erst am Anfang der Aufarbeitung seiner Vergangenheit und der daraus folgenden Verantwortung stand, resümiert Camus eine Erkenntnis, die den politisch engagierten Schriftsteller bis zu seinem Unfalltod beschäftigen sollte: »Il y avait l deux mondes que je ne pouvais raccrocher l’un l’autre et j’y voyais l’image des d¦chirements de cette malheureuse Europe, partag¦e entre ses victimes et ses bourreaux, la recherche d’une justice pour toujours incompatible avec sa douleur.« (630) Brigitte Sändig hat diesen Gedanken in einem lesenswerten Aufsatz, erschienen in der Zeitschrift Dokumente, fortgeführt (Vgl. Sändig 1999; wieder abgedruckt in Sändig 2004, S. 141 – 148 und Siepe 2008).
4.
Die Präsenz Deutschlands in Albert Camus’ Werken
Da die Gegenwart Deutschlands in den Werken Camus’ bisher nicht systematisch erforscht worden ist, allenfalls Ergebnisse einzelner Aspekte vorliegen, muss ich mich im Folgenden auf eine annalistisch-summarische Bestandsaufnahme beschränken.
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
405
Jeder Camus-Kenner weiß, dass Deutschland, seine jüngere Geschichte seit Luther (für Camus der typische »Nordique«), dass deutscher Geist, insbesondere deutsche Politik und Ideologie thematisch allgegenwärtig sind in den Werken, sowohl fiktionalen wie philosophischen und tagesaktuellen Artikeln des politischen Publizisten der ersten Nachkriegsjahre, vor allem aber der fünfziger Jahre bis zu seinem Unfalltod 1960. Zuerst denkt man an die bekannten, aber wenig gelesenen Lettres un ami allemand, dessen deutschen Nazi-Adressaten es nie gegeben hat. Sowohl beim französischen Nachkriegspublikum wie später in Deutschland haben diese Briefe keine mit anderen Werken Camus’ vergleichbare Resonanz gefunden. In Deutschland wurden sie erstmals 1960 übersetzt für die Anthologie Fragen der Zeit, deren Auswahl noch Camus selbst besorgt hatte. In der deutschen Sekundärliteratur wird nicht immer bedacht, dass die Briefe Camus’ (christlichem) Freund Ren¦ Leynaud gewidmet sind, einem 1944 in Lyon von den Deutschen erschossenen Widerstandskämpfer, so dass sie auch als appellatives Dokument eines Mitglieds der R¦sistance verstanden worden sind. Da zwischen den vier offenen Briefen große zeitliche Abstände liegen (1943 bis 1945 für die Briefe 1 – 3; der vierte ist erst 1948 veröffentlicht worden), sollten sie als Fragmente einer allgemeineren, grundsätzlichen Reflexion über Schuld und Sühne, Vergessen und Vergeben, also in einem »imagologischen« Kontext früherer »mythischer« Deutschlandbilder gelesen werden. Ausgehend von Germaine de StaÚls De l’Allemagne (1813) und Val¦rys La ConquÞte allemande (1897) hat Gerhard R. Kaiser die »Symbolische Konstruktion des Deutschen« in Camus’ Lettres un ami allemand einer kritischen Analyse unterzogen und eine Entwicklung »zunehmend negativer Mythisierung« festgestellt (Kaiser 2005, S. 296): »In mythisch-symbolischer Verdichtung erscheint der deutsche Freund als der philosophisch-inspirierte verbrecherische Täter der Weltgeschichte. Eben dies sichert den Lettres un ami allemand eine anhaltend irritierende Aktualität.« (S. 297) Kaisers »These von der ins Verworfene, ins mythisch Böse, ins Diabolische verzerrten symbolischen Konstruktion des Deutschen in den Lettres un ami allemand« (S. 299) findet nach seiner Einschätzung eine Parallele in Thomas Manns anmaßenden Betrachtungen eines Unpolitischen (1918). Kaiser wirft Camus »ein illusionäres französisches Selbstbild« vor (S. 288), »Ausdruck eines Dünkels« (S. 289). Entgegen dem verbreiteten Camus-Bild, das mit dem von Vercors in Le Silence de la mer (1942) übereinstimmt, vermutet Kaiser »Züge eines hochmütigen politischen Sittenrichters«: »Nicht zuletzt Haß, Verachtung und Ressentiment werden auch die Niederschrift der Lettres un ami allemand bestimmt haben.« (S. 291 f.) Als gegenläufiges Zeugnis für einen ganz anderen Camus kann ein Leitartikel angeführt werden, der aus Anlass des zweiten Jahrestages der deutschen Kapitulation unter dem Titel »Anniversaire« am 7. Mai 1947 in Combat erschienen
406
Franz Rudolf Weller (Bonn)
ist. Mit Blick auf die nach dem Krieg zu schaffende Neuordnung Europas ist die Aussöhnung mit Deutschland ein pragmatisches Gebot der Stunde. Der Leitartikel des Chefredakteurs schließt mit einem geradezu pathetischen Aufruf zur Vernunft: »Quels que soient notre passion int¦rieure et le souvenir de nos r¦voltes, nous savons bien que la paix du monde a besoin d’une Allemagne pacifi¦e, et qu’on ne pacie pas un pays en l’exilant jamais de l’ordre international. Si le dialogue avec l’Allemagne est encore possible, c’est la raison mÞme qu’on le reprenne.« (Pl. II, S. 432) Ein solcher hellsichtiger Friedensappell ist natürlich auch vor dem Hintergrund des neuen (Kalten) Krieges, des sich verschärfenden Ost-West-Konfliktes zu sehen (»L’Allemagne est devenue un enjeu entre la Russie et l’Am¦rique« (S. 432), der für den Schriftsteller Albert Camus auf Jahrzehnte eine verhängnisvolle Rolle spielen sollte. Vom August 1944 bis Juni 1947 war Albert Camus Chefredakteur und »¦ditorialiste« des Combat. In dieser Zeit hat er sich immer wieder zunächst über das absehbare Ende Nazi-Deutschlands geäußert, dann sich besorgt – wie wir gesehen haben – die Frage gestellt, was aus dem deutschen Volk nach Kriegsende werden würde, wobei die Einbindung Deutschlands in einen größeren transnationalen Verständigungsprozess oberste Priorität hatte. Die Überbetonung, ja mythische Überhöhung des mediterranen Kulturkreises zu Lasten eines »maßlosen, verbrecherischen Machtwahns« des Nordens (Kaiser 2005, S. 301) hat bisher eine Gesamtwürdigung des »Europäers« Albert Camus verhindert. Wie die Eintragung in ein Reisetagebuch liest sich »La Mort dans l’me« aus dem ein Jahr nach der ersten Deutschlandreise Camus’ in Algier erschienenen frühen Essayband L’Envers et l’endroit (Pl I, S. 55 – 63). Zusammen mit dem folgenden Essay »Amour de vivre« wird hier schon die das Gesamtwerk prägende mythische Antithetik zwischen dem negativ konnotierten mitteleuropäischen Norden, dem tristen, lichtlosen Europa, und der positiv besetzten mittelmeerischen Sehnsucht deutlich. In den Reiseetappen Prag und Vicenza wiederholt sich nochmals die schon im Titel des Essaybandes enthaltene Alternanz. Wie im Exil, fremd und ausgeschlossen, auf einem Tiefpunkt seiner Existenz bezieht der junge Camus für eine Woche – in Erwartung seiner treulosen Ehefrau und des Freundes – Zimmer Nr. 34 eines Prager Hotels; in dem etwa zeitgleich entstandenen ersten, zugunsten des Etranger verworfenen Romans La Mort heureuse, der postum erst 1971 veröffentlicht worden ist, kehrt Mersault auf einer Europareise an den Ort einer existentiellen Krise des Autors zurück und erlebt – in Zimmer Nr. 34 seines Prager Hotels – ein ähnliches Trauma der Fremdheit und des Ausgeschlossenseins (Vgl. Pl I, S. 1138). Assoziativ stellt sich ein Bezug her zu der finsteren Tragödie Le Malentendu (1944) – und damit Deutschland noch weiter nach Norden verlassend – zu dem nebligen, nassen Amsterdam in Camus’ letztem zu seinen Lebzeiten veröffentlichten Roman La Chute (1956).
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
407
Die Pest-Chronik von 1947 – auch in Deutschland ein Long-Bestseller – symbolisiert – nach Camus’ eigenem Bekenntnis – den Kampf der europäischen R¦sistance gegen den Faschismus; und in der Uraufführung der dramatischen Version der Pest, in L’Etat de siÀge durch den Co-Autor Jean-Louis Barrault (1948) erschien die Figur der Pest auf der Bühne in einer SS-Uniform. Hier ist ein ungewöhnlicher, wenig bekannter Fall von Selbstzensur oder Spurentilgung des Verlags Gallimard (oder der Camus-Erben?) in Zeiten unbewältigter Vergangenheit (»Die langen Schatten von Vichy«) einzufügen. Von Albert Camus gibt es m.W. ein einziges, authentisches »piÀce radiophonique«, das Ende 1948 entstanden und im April 1949 im Pariser Rundfunk gesendet worden ist, also lange nach der Lib¦ration. Sein Titel Les Silences de Paris verweist motivisch und inhaltlich auf die berühmte Erzählung Le Silence de la mer von Vercors (1942) und Sartres Essay La R¦publique du silence (1944), setzt andererseits als kleine monologische Pest-Parabel aus der Okkupationszeit 1940 – 1944 auch den politischen Camus der Lettres un ami allemand und der Peste bzw. des Etat de siÀge fort. Leider ist das französische Original erst in Bd. III der neuen Pl¦iade-Ausgabe veröffentlicht worden, während eine deutsche Übersetzung bereits 1963 bei Rowohlt erschienen und in den folgenden Jahren mehrfach als Hörspiel von mehreren deutschen Rundfunksendern ausgestrahlt worden ist (Vgl. dazu Fricke 1983, S. 432 – 435 u. Siepe 2008, S. 153 – 166, vor allem dessen Beitrag in diesem Band). Wenn man die (auto)biografische Schiene mit Blick auf das Deutschlandbild in seinen fiktionalen Werken ins Auge fasst, ist zuerst das postum 1994 veröffentlichte Romanfragment Le premier Homme zu erwähnen. Im zweiten Kapitel des ersten Teils »Recherche du pÀre« findet die Hauptfigur Jacques Cormery (alias Albert Camus) auf einer Gedenkstätte für Kriegsopfer eine Namensliste, die auch seinen Vater aufführt: »bless¦ mortellement la bataille de la Marne, mort Saint-Brieuc le 11 octobre 1914« (Pl. IV, S. 753). 1947 hat Albert Camus selbst auf einer Reise durch die Bretagne das Grab seines Vaters Lucien Camus aufgesucht, im September verwundet während der Marne-Schlacht, gestorben am 11. Oktober im Militärkrankenhaus von Saint-Brieuc. Weder die beiden kurzen Deutschlandbesuche Camus’, noch deren Widerspiegelungen in einigen fiktionalen Werken, noch das zeitgeschichtliche politische Engagement des Journalisten haben Camus’ Deutschlandbild so nachhaltig – im Positiven wie im Negativen – geprägt wie der Einfluss deutscher Philosophie und Zeitgeschichte auf die beiden philosophischen Werke Le Mythe de Sisyphe (1942) und L’Homme r¦volt¦ (1951). Hegel, Marx, Husserl, Jaspers, Scheler, Heidegger sind direkt oder indirekt allgegenwärtig. In seinem Vorwort zur amerikanischen Dissertation von Konrad Bieber L’Allemagne vue par les ¦crivains de la R¦sistance franÅaise (1954), in der Camus ein ganzes Kapitel gewidmet ist, betont Camus erneut den Einfluss insbesondere Nietzsches: »Je
408
Franz Rudolf Weller (Bonn)
dois Nietzsche une partie de ce que je suis.« (Abdruck in Pl III, S. 934 – 938; hier : S. 937) Dem jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber (Wien 1878 – 1965) schickte er ein Exemplar des Homme r¦volt¦, worauf der Beschenkte begeistert antwortete: »Monsieur et cher confrÀre, Ihr Buch L’Homme r¦volt¦ scheint mir von solcher Wichtigkeit für das menschliche Leben in dieser Stunde, daß ich dem Mosad Bialik, dem nationalen Verlag Israels, dessen Vorstand ich angehöre, empfehlen möchte, es ins Hebräische übersetzen zu lassen.« (Buber, Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten. Bd. III, 1975, S. 312) Die Übersetzung ist 1970 in Tel Aviv erschienen. Camus antwortete erfreut und geehrt und fügte hinzu, er habe Ich und Du (1923) – die wichtigste Schrift zum dialogischen Prinzip Martin Bubers (FRW) – »mit großer Bewunderung und Gewinn gelesen« (ebda. S. 313). Die französische Übersetzung unter dem Titel Le Je et le Tu war 1923 erschienen. Hannah Arendt (1906 – 1975), Soziologin und Politologin, die 1940 in die USA emigriert war und dort 1946 einen Artikel über den französischen Existenzialismus veröffentlicht hatte, versuchte anlässlich eines Kurzbesuchs in Paris am 21. April 1952, Kontakt zu Camus aufzunehmen: »Je suis Paris pour quelques semaines et j’aimerais beaucoup vous voir si cela peut s’arranger, sans vous incommoder. J’ai lu L’Homme r¦volt¦ que j’aime beaucoup. A vrai dire, c’est la seule raison de cette note.« (Pl. III, S. 1226; ferner Weyembergh 1998, S. 151 – 164). Übrigens: Das Sade-Kapitel (»Un homme de lettres«) erschien schon 1952 in einer deutschen Übersetzung: »Ein Literat. Über den Marquis de Sade.« (Merkur 5, S. 454 – 464) Da Albert Camus in Algier immerhin ein philosophisches Studium mit Diplomabschluss absolviert hat, eine weiterführende akademische Qualifizierung bekanntlich nur aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war und er dennoch zwei viel beachtete und diskutierte Schriften praktischer Philosophie veröffentlicht und gegenüber namhaften Philosophietheoretikern verteidigt hat, ist es verständlich, dass Albert Camus »der Philosoph« (wie auch immer seine »Professionalität« auf dem Terrain eingeschätzt wird und die er selbst nie in Anspruch genommen hat) gerade in Deutschland ein so reges Echo gefunden hat. »Absurdität« und »Revolte« (zum Überdruss repetitiv strapaziert in der Sekundärliteratur) sind schon vor und noch nach den philosophischen Hauptwerken – und nicht nur bei Albert Camus (!) – existentielle Leitthemen der Nachkriegszeit. Schon 1976 sprach R. Gay-Crosier in seinem Camus gewidmeten Überblick der Reihe »Erträge der Forschung« verallgemeinernd von »Wiederholungscharakter« und »wissenschaftlich fragwürdigen Arbeitsmethoden« (Gay-Crosier 1976, S. 218). Ob Albert Camus das alles immer verstanden und seine Kenntnisse über die Primärtexte (von Originaltexten kann wegen der unzureichenden Deutschkenntnisse keine Rede sein) erarbeitet hat, ist eine berechtigte Frage, auf die selbst wohlmeinende Kritiker skeptisch reagieren und auf die sein professio-
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
409
nellerer Rivale Sartre – gewiss im Zorn – eine niederschmetternde Antwort gegeben hat. Schon eine Überprüfung der Quellen für seine religionsphilosophische Diplomarbeit M¦taphysique chr¦tienne et N¦oplatonisme (1936) hatte ergeben, dass der Examenskandidat Albert Camus wesentlich mit Sekundärliteratur arbeitet, die er oft ungenau zitiert (Vgl. Pl I, S. 999 – 1081; insbes. den ausführlichen Kommentar des Mitherausgebers der neuen Pl¦iade-Ausgabe, Maurice Weyembergh, der selbst Philosophieprofessor in Brüssel war [S. 1424 – 1430]). Die Diplomarbeit liegt auch in einer deutschen Übersetzung vor: Albert Camus: Christliche Metaphysik und Neoplatonismus. Diplúme d’Etudes Sup¦rieures de Philosophie, 1936. Aus dem Nachlaß herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Michael Lauble (1978), der 1983 an der Universität Mainz eine gründlich recherchierte Dissertation in Katholischer Theologie eingereicht hat: Sinnverlangen und Welterfahrung. Albert Camus’ Philosophie der Endlichkeit. (1984) Die Erwähnung dieser Arbeit hat einen besonderen Grund: Die starke Präsenz großer Namen der europäischen, nicht nur deutschen Philosophie- und Geistesgeschichte im Werk von Albert Camus mag auch eine Erklärung dafür sein, dass die weitaus größte Zahl der an deutschen Universitäten entstandenen Camus-Dissertationen philosophischer Provenienz ist – mit gelegentlichen religionsphilosophischen Akzentuierungen. Nach dieser negativen Bestandsaufnahme, aus der nur wenige philosophische Glanzlichter herausragen, sollten wenigstens zwei Namen genannt werden, die sich in zahlreichen Publikationen bemüht haben, den »Philosophen« Camus zu retten, sozusagen als »philosophe malgr¦ lui«: Heinz Robert Schlette, Professor in Bonn, der wohl beste deutsche Camus-Kenner, und Annemarie Pieper, Philosophieprofessorin in Basel (deren Camus-Monografie in der Beck-Reihe »Große Denker« von 1984 leider vergriffen ist). Ich möchte noch kurz eine semantische Beobachtung anfügen: In vielen Buchtiteln fällt eine binäre Struktur auf, die ja in Camus’ Denken in Polaritäten vorgegeben ist: Licht und Schatten, Natur und Geschichte, Ja und Nein; deutlich schon in dem Frühwerk L’Envers et l’endroit. Hier einige Beispiele: Recht und Solidarität (Stuby 1965); Absurdität und Hoffnung (Tripp 1968); Sinnwidrigkeit und Solidarität (Pfeiffer 1969); Revolte und Resignation (Brockmeier 1975); Welt und Revolte (Schlette 1980); Sinnverlangen und Welterfahrung (Lauble 1984); Absurdität und Revolte (Rath 1984 – oder die genetische Variante, nach dem beliebten, von Camus selbst propagierten Phasenmodell: Von solitaire zu solidaire (Frey 2009). Die Konjunktion, deren traditionell koordinierende Funktion auch einen oppositionellen Wert haben kann, eröffnet ein mehrdeutiges Sinnverständnis. Ein besonders problematischer Aspekt in der deutschen Camus-Rezeption, der von Anfang an ein Irrweg war und bis heute geblieben ist, stellt die gewaltsame
410
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Vereinnahmung Albert Camus’ durch die Theologen dar, vor allem katholischer, weniger evangelischer Provenienz, die an Proselytenmacherei »post mortem« grenzt. Ein korrekter, aufgeklärter Umgang mit »Heiden« fällt vor allem ideologischen oder methodologischen Dogmatikern schwer, die immer wieder versuchen, Albert Camus’ klare atheistisch-humanistische Anthropologie zu »verchristlichen«, obwohl dieser mehrfach und ganz unmissverständlich seine Haltung zum Christentum und dessen Gott bekundet hat. Schon 1964 schrieb Richard Thieberger, einer der Wegbereiter der deutschen Camus-Rezeption: »Ihn nach seinem Tode mehr oder minder deutlich ins kirchliche Lager hinüberzuziehen, ist allerdings nur außerhalb Frankreichs und in Unkenntnis der Sachlage versucht worden.« (Thieberger 1964, S. 136) Das wird auch sehr deutlich durch Bd. 11 der Camus-Serie Camus et la religion (Revue des Lettres Modernes 1982) belegt, der ohne französische Beteiligung auskommen musste. Der einzige Hauptbeitrag stammt von Ingrid Di M¦glio, ein R¦sum¦ (S. 7 – 48) ihrer 416 Seiten umfassenden sehr lesenswerten Saarbrücker Dissertation von 1974: Antireligiosität und Kryptotheologie bei Albert Camus (Bonn 1975). Der Beitrag des Band-Herausgebers, R. Gay-Crosier, ist im wesentlichen eine Sammelrezension weiterer einschlägiger deutscher Publikationen (Neudeck, Rühling, u. a.), was so nicht angekündigt wird. Vorsichtig pessimistisch äußerte sich auch der Philosoph und Theologe Heinz Robert Schlette in seinem vielleicht wichtigsten Buch über Albert Camus: »Die Erwartung, es könne von Camus aus ein neuer Zugang zum Christentum und einer entsprechenden Metaphysik entworfen werden, scheint mir verfehlt.« (Schlette 1980, S. 9) Es ist besonders ärgerlich, wenn ein Verfasser in ritueller Rhetorik ankündigt, Befunde vorzulegen, die bislang von der Camus-Forschung kaum beachtet worden seien. Dieser Ansatz zu säkularisierter Theologie wird möglich, wenn Theologie die harten Glaubenswahrheiten des Christentums ins bloß »Moralische« kippen lässt. Das zeigt sich besonders in religionsphilosophischen Arbeiten, die auch die literarischen Werke Camus’ heranziehen, häufig auf der Basis der deutschen Übersetzung, deren Qualität selten hinterfragt wird. Diese Mängel in der wissenschaftlichen Methodik sind – wie die grundsätzliche Problematik der Zielsetzung der Arbeit, in der Regel nicht nur dem Doktoranden anzulasten, sondern auch dem Themensteller und Betreuer. Wie man dem Reizthema »Camus und die Religion« sachlich und methodisch gerecht werden kann, zeigt auf vorbildliche Weise die von Heinz Robert Schlette betreute Dissertation von Sabine Dramm (Bonn 1997), evangelische Theologin und Direktorin eines Gymnasiums, deren Titel auch die gerade mit Bezug auf Albert Camus ausufernde »Komparatistik« in ihre disziplinären Schranken = Grenzen verweist: Dietrich Bonhoeffer und Albert Camus: Analogien im Kontrast (Gütersloh 1998). Nach seiner Habilitation und einer Tätigkeit als Pfarrer in London wurde Dietrich Bonhoeffer 1936 die Lehrerlaubnis an der Universität in
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
411
Berlin entzogen – mit anschließendem Redeverbot. Seit 1940 beteiligt er sich am politischen Widerstand, der 1944 zu seiner Verhaftung führt. Nach einem kurzen Aufenthalt im KZ Buchenwald wird er in das KZ Flossenbürg (Oberpfalz) abtransportiert, dort in einem Schnellverfahren verurteilt und am 9. April 1945 am Galgen hingerichtet. In ihrer »komparatistischen« Studie offenbart Sabine Dramm »auf verblüffende Weise« (S. 153) situative Übereinstimmungen und textliche Parallelen im Bereich der politischen Ethik mit dem Ergebnis, »daß Menschen divergierender Existenzpositionen zu konvergierender persönlicher Lebensinterpretation, philosophischer Erkenntnis und ethischer Konsequenz gelangen können« (S. 164). Das katholische Gegenstück veröffentlichte vier Jahre später der Schweizer Franziskanerpater, der in Rom Philosophie lehrt, Arnaud Corbic: Camus et Bonhoeffer. Rencontre de deux humanismes, ohne die Arbeit von Sabine Dramm zur Kenntnis genommen zu haben – kein untypisches Beispiel für die mangelnde internationale »Vernetzung« in den Geisteswissenschaften. Im Bereich der deutschsprachigen Literatur stellt Franz Kafka einen Sonderfall negativer Rezeption dar. Seine Hauptwerke erschienen in den dreißiger Jahren in französischer Übersetzung, Le ProcÀs 1933, mit einem Vorwort von Bernhard Groethuysen, einem Schüler Diltheys, und inzwischen naturalisierter Franzose. In Paris, aber auch in der Kolonie Algerien las man mit Begeisterung Kafka; so auch Albert Camus, der schon 1938 einen Essay über »Kafka, romancier de l’espoir« plante, der später in die entstehende philosophische Schrift Le Mythe de Sisyphe integriert werden sollte, deren Veröffentlichung – zeitgleich mit dem Etranger – für 1942 vorgesehen war. Dazu kam es nicht, weil die Kontrollkommission der deutschen Besatzung die Genehmigung zur Veröffentlichung nur unter der Bedingung erteilte, dass das Kapitel über den Juden Franz Kafka entfernt würde. Auf Drängen seines Verlegers, Gaston Gallimard, wurde Kafka durch einen neutralen, themenverwandten Beitrag über Kirilov aus dem Roman Les Poss¦d¦s von Dostojewski ersetzt, mit dem Camus sich früher schon beschäftigt hatte. Der Essay war damit aber nicht verloren: Nachdem er im Sommer 1943 in der »Untergrund«-Zeitschrift L’ArbalÀte erschienen war, wurde der Essay unter dem Titel »L’Espoir et l’absurde dans l’œuvre de Kafka« als Anhang zum Mythe in die Neuausgabe von 1945 aufgenommen. Albert Camus, der ein begehrter »pr¦facier« war, hat 1958 ein Vorwort zur deutschen Ausgabe der Po¦sies seines sehr verehrten Freundes Ren¦ Char (1907 – 1988) verfasst, den er für den größten lebenden Dichter Frankreichs hielt: Po¦sies/ Dichtungen. Hrsg. von Jean-Pierre Wilhelm. (1959) – mit Übertragungen von Paul Celan (1920 – 1970), der seit 1948 in Paris lebte, offensichtlich aber keinen Kontakt zu Camus hatte, während Char – wie Celan – sich in den fünfziger Jahren auch mit Heidegger getroffen hat. (Vgl. dazu auch Paul Celan: Gesammelte Werke. 4. Bd. Übertragungen I. Zweisprachig. 2000, S. 424 – 595)
412
5.
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Albert Camus in den Fängen der Komparatistik
Albert Camus ist wie kaum ein anderer moderner Schriftsteller schon zu Lebzeiten – als Person wie durch sein Werk – »komparatistischer« Bezugspunkt zu anderen Autoren und Werken. Der Vergleich ist – gerade im didaktischen Raum – ein fruchtbarer Ansatz zur Steigerung oder Verdeutlichung von Erkenntnissen und Einsichten: »Wahlverwandtschaften« zwischen zwei Autoren, Doppelgänger-Parallelen, intersemiotische Auffälligkeiten im universalen Arsenal von Themen, Mythen und Bildern usw. Geradezu magnetisch haben Camus’ einzelne Werke und Figuren die Fantasie und Spekulation auf dem Feld der Literaturvergleichung angeregt, die von offensichtlichen oder zufälligen Parallelen oder Analogien über nachgewiesene oder bestätigte Einflüsse und Quellen bis zum massiven Plagiatsvorwurf reicht. Hier sind – gerade im Fall Camus’ – dringend begriffliche Differenzierungen und textliche Präzisierungen erforderlich, um zu verhindern, dass die »Vergleichende Literaturwissenschaft« ihren guten Ruf aufs Spiel setzt. Schon der Masse an einschlägigen Arbeiten wegen werde ich mich im Folgenden auf deutschsprachige Publikationen beschränken – ohne Anspruch auf größtmögliche Vollständigkeit. Ausgeklammert werden im Prinzip die zahlreichen themenzentrierten Studien, in denen auch Albert Camus eine Rolle spielt. Hier nur einige Beispiele für diesen komparatistischen Typus: Heinrich Balz: Aragon, Malraux, Camus. Korrektur am literarischen Engagement (1970) oder Wolf Dietrich Marsch: Philosophie im Schatten Gottes (1973) (Dargestellt werden Fichte, Hegel, Schleiermacher, Marcuse, Bloch und Camus) – oder Peter V. Zima: Der gleichgültige Held. Textsoziologische Untersuchungen zu Sartre, Moravia und Camus (1983) oder Volker Roloff: Der Mörder als Erzähler : Existentialismus und Intertextualität bei Sartre, Camus, Cela und Sbato. (1986) Ausgeklammert bleiben auch alle ausländischen Studien (sie sind vor allem in den USA sehr beliebt … und aus meiner Sicht z. T. fragwürdig), in denen Albert Camus oder eines seiner Werke mit einem deutschen Autor oder einem Werk »verglichen« wird. Eine Ausnahme wird gemacht, wenn zu demselben Thema auch eine deutschsprachige Arbeit vorliegt: So erinnern sich Camus-Kenner vielleicht an die beiden Hölderlin-Mottos, die dem Homme r¦volt¦ und der Essay-Sammlung L’Et¦ vorangestellt sind und beide aus dem Trauerspiel Der Tod des Empedokles stammen (Vgl. auch die Carnets-Eintragungen Pl IV, S. 1084 und 1108). Über gemeinsame Motive und Themen der griechischen Antike bei Camus und Hölderlin informiert der Aufsatz von Süsskind (1969), und Zur Verwandtschaft zentraler Gedanken eines schwäbischen »Theologen« des ausgehenden 18. Jh. und eines franco-algerischen Agnostikers des 20. Jh. (so der umständliche Untertitel) gibt es eine Züricher germanistische Dissertation von Willy Stucky (1980).
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
413
Vom Einfluss Nietzsches und Kafkas, den Camus selbst betont und in seinem Werk dokumentiert hat, war schon die Rede. Marx und Hegel sind nach Camus’ eigenen Worten »les mauvais g¦nies de l’Europe d’aujourd’hui« (Pl Essais 1965, S. 1341) – für Heidegger und Jaspers findet Camus nur kritische Worte. Auch mit jüngeren deutschen Schriftstellern seiner Generation hat es keine Begegnungen gegeben. Günter Grass (Jg. 1927), der von Anfang 1956 bis 1960 in Paris gelebt hat, wo Die Blechtrommel (1959) entstanden ist, scheint Albert Camus auf dem Höhepunkt von dessen Ruhm nicht getroffen zu haben. Überliefert ist sein Geständnis, Camus sei für ihn ein politisches und moralisches Vorbild gewesen, Sisyphos sein »Privatheiliger« (zit. Sändig 2004, S. 239). Auch Hans Magnus Enzensberger (Jg. 1929) hat den Mythos re-kreativ aufgegriffen: In »Anweisung an Sisyphos« (aus seinem ersten Gedichtband Verteidigung der Wölfe« (1957) evoziert er im Bild des alten Mythos das eigene Schreiben als generelles Dilemma des Dichters. Eine Begegnung Camus’ mit dem sehr viel älteren Bertolt Brecht (Vgl. Kohlhases Dissertation im Fach Politische Wissenschaft, 1965) war unter der SED-Herrschaft kaum vorstellbar. Beispielhaft erwähne ich aber andere geistige Begegnungen deutscher Schriftsteller ganz unterschiedlicher »Couleur« mit Albert Camus, über dessen Tod hinaus: In ihrem Essay »Der Fremde« (aus dem Band Zwischen Immer und Nie. Gestalten und Themen der Dichtung, 1971) versuchte Marie Luise Kaschnitz (1901 – 1974), den »tragischen Helden« (219) Meursault als »›Idioten‹ unserer Zeit« (218) »in die Schar der leidenden Helden der Dichtung einzureihen« (213). Über das »Existenzmodell« Der Fremde (in der Essaysammlung Der Gleichgültige, 1963) reflektierte auch Dieter Wellershoff (Jg. 1925), der in einer Fußnote auf einen verheerenden Fehler der ersten deutschen Etranger-Übersetzer hinwies, der leider erst nach 30 Jahren (!), in der Neuübersetzung von 1994 korrigiert worden ist: »Die deutschen Übersetzer Goyert und Brenner haben den Text verfälscht, indem sie ihn ins Imperfekt setzten, wahrscheinlich, weil er ihnen so lebendiger erschien. Ich habe die Übersetzung mit entsprechender Korrektur zitiert.« (Wellershoff 1963, S. 44). Manchmal reicht schon das zeitgleiche Erscheinen (1947) von geistig affinen Romanwerken für eine komparatistische Studie: So verglich der Literaturkritiker Karl Korn Die Pest von Camus mit Die Stadt hinter dem Strom, einem viel diskutierten Roman der unmittelbaren Nachkriegszeit von Hermann Kasack (1896 – 1966). Die detektivische Variante komparatistischer Studien beschäftigt sich retrospektiv mit möglichen Quellen für ein Werk – z. T. mit fantasievollen Spekulationen: So brachte der Germanist Reinhold Grimm eine Erzählung mit dem Titel Die Ursache des heute ziemlich vergessenen Schriftstellers Leonhard Frank (1882 – 1961) ins Spiel, die eine überraschende Ähnlichkeit mit L’Etranger aufweise. Das Original erschien 1916 (Neuausgabe 1991); eine französische Übersetzung unter dem Titel Monsieur Mager 1927; eine deutsche dramatisierte
414
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Fassung 1929: Nach einer französischen Erstveröffentlichung in einer senegalesischen Zeitschrift »›La Cause‹ allemande de ›L’Etranger‹. De Leonhard Frank Albert Camus« (1986) erschien eine ausführlichere deutsche Fassung »Die deutsche Ursache des Camus’schen Fremden« im Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft (ebenfalls 1986). Bemerkenswert ist allerdings, dass weder bei Camus selbst (z. B. in den Tagebüchern), noch bei den mir bekannten Camus-Spezialisten dieser Sachverhalt belegt ist. Im Vorwort zu dem Que sais-je?-Bändchen La Litt¦rature compar¦e von Marius-FranÅois Guyard warnte sein Lehrer und Altmeister der französischen Komparatistik, Jean-Marie Carr¦: »Il ne faut pas comparer n’importe quoi et n’importe quoi, n’importe quand et n’importe o¾.« (Guyard 41965, S. 5) Da Albert Camus, was ich noch näher ausführen werde, zeit seines Lebens – sowohl während der SED-Herrschaft wie der anschließenden DDR-Diktatur – ein totgeschwiegener, verfemter Autor des kapitalistischen Westens war, muss man psychologisch Verständnis aufbringen für die Versuchung, wenigstens einige prominente Schriftsteller der ehemaligen DDR, die auf Distanz zum kommunistischen System gelebt haben und (heimliche) Kontakte zur westlichen Literatur hatten, mit Albert Camus in Verbindung zu bringen. Nach der »Wende« hat Brigitte Sändig diesen Versuch in mehreren Aufsätzen unternommen. Ich erwähne zunächst »Zwei oder drei Fremde. Berührungspunkte zwischen Camus’ L’Etranger und Christoph Heins Der fremde Freund.« (1993); es folgte »Der Krieg ist aus. Das Ende der Pest/des Krieges bei Camus und Fühmann.« (1998) Was Heins Novelle von 1981 angeht, konstatiert Brigitte Sändig »eine verblüffende Übereinstimmung der Texte« (Sändig 2004, S. 211), die ich nicht nachvollziehen kann. Auch der Autor konnte »den Bezug zu Camus nicht bestätigen, aber ich kann ihn auch nicht bestreiten, da er (i. e. Camus [FRW]) zu den Autoren gehört, die mich erzogen haben« (Zit. Sändig, 2004, S. 211) Noch enger, so Brigitte Sändig, seien die Beziehungen zu dem prominenten ehemaligen DDR-Autor Franz Fühmann (1922 – 1984), dessen desolate, widersprüchliche Schriftstellerexistenz und »zerbrochenes Leben« (Selbstzitat Fühmann) man schwerlich mit Camus vergleichen kann. Doch in seinem Werk sieht Brigitte Sändig »explizite Berührungspunkte« (2004, S. 224), ja eine für das Denken und Schreiben beider »konstitutive Übereinstimmung« (S. 224 f.). In diesem Beurteilungsdissens liegt sicher auch das Problem raum-zeitlicher Perspektivität, was ja in Carr¦s Zitat angedeutet war. Auch der von Brigitte Sändig erwähnte Camus-Bezug zum Roman Klassenliebe (1973) von Karin Struck (Jg. 1947 – kam bereits 1953 in die BRD) vermag mich nicht zu überzeugen. Hier wiederholt sich ein Grundübel der Komparatistik: das »Ausfransen« in nicht mehr verifizierbare Randzonen. In doppelter Hinsicht interessant und überzeugend ist der Fall des im Jahr des Einmarschs deutscher Truppen in Paris (1940) geborenen erfolgreichen
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
415
Schriftstellers Uwe Timm. Er hat (nach einem auf dem Zweiten Bildungsweg erreichten Abiturabschluss) 1971 an der Universität München eine philosophische Dissertation mit einem nicht gerade originellen Thema eingereicht: Das Problem der Absurdität bei Albert Camus (Hamburg 1971). Die 2005 erschienene Erzählung Der Freund und der Fremde ist eine dokumentarische »Hommage« an seinen Jugendfreund Benno Ohnesorg, einen großen Kenner der modernen französischen Literatur, und Albert Camus, dessen erster veröffentlichter Roman im Mittelpunkt ihrer Gespräche am Braunschweiger Abendkolleg stand – »mit brüderlichem Gleichsinn und Vertrauen« (Timm 2005, S. 71) hier im Buchtitel vereint. Es sei daran erinnert, dass dieser Benno Ohnesorg bei einer Demonstration anlässlich des Schahbesuchs am 2. Juni 1967 in West-Berlin von einem Zivilfahnder erschossen worden ist (der offensichtlich auch für die Ostberliner STASI arbeitete). Die politischen Folgen dieses tragischen Ereignisses sind bekannt. Lange Zeit schien es unausweichlich, die Werke von Sartre und Camus stets zusammen zu zitieren; Sartre und Camus, das war ein stereotypes Gespann bis in die Literaturgeschichten hinein. Insbesondere nach der Veröffentlichung des Homme r¦volt¦ (1951) hat der sich anschließende unversöhnliche »Federkrieg« über Jahre Stoff geliefert für zahlreiche den beiden Kontrahenten gewidmete Studien, darunter auch komparatistisch schwache, die kaum mehr als eine bloße Aneinanderreihung von zwei selbständigen Arbeiten darstellten. Als Beispiel erwähne ich aus einer renommierten romanistischen Fachzeitschrift »Pathetische Grundzüge im literarisch-philosophischen Werk von Sartre und Camus.« von Christa Schloetke-Schröer (1963). Inzwischen ist der Streit verpufft, und Camus erscheint nicht länger im perspektivischen Gegenbild von Sartre. War nicht Sartres Tod (1980) das frühe Ende seines literarischen Nachruhms, während Camus sich wachsender geradezu »kultischer« Verehrung erfreut?
6.
Camus’ erstes deutsches Publikum
Kriegsbedingt kann von einer öffentlichen, medialen Wahrnehmung Camus’ erst nach 1945 die Rede sein. Dann aber erschienen in weniger als fünf Jahren – zunächst in mutigen kleinen Verlagen – deutsche Übersetzungen von Caligula (1947); L’Etranger (1948); La Peste (1948); Le Mythe de Sisyphe (1950); Noces (1950); Le Malentendu (1950). Eine erste deutsche Begegnung mit Camus – besonderer Art – fand schon während des Krieges, im besetzten Paris statt. Was im Verlag Gallimard publiziert wurde, darüber entschied letztlich nicht das prominent besetzte Comit¦ de lecture (u. a. Jean Paulhan, Andr¦ Malraux, Raymond Queneau, Francis Ponge, Andr¦ Gide), sondern die für die literarische Zensur zuständige Propaganda-Staffel der Besatzungsmacht. Leutnant Gerhard
416
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Heller, der wichtigste Berater der Pariser Verlage auf deutscher Seite, schreibt in seinen Erinnerungen: In einem besetzten Land. NS-Kulturpolitik in Frankreich (frz. Original: Un Allemand Paris [1981]): »Albert Camus bin ich nicht persönlich begegnet, aber an der Veröffentlichung seines Werkes war ich beteiligt.« (Heller 1982, S. 189) Das Manuskript des Etranger habe er an einem Tag mit Begeisterung gelesen, was er Gaston Gallimard sogleich mitgeteilt habe (Vgl. Pl I, S. 1259). Zusätzlich ging es darum, die nötige Menge Papier für den Druck zu beschaffen. Auch Camus’ zweites, gleichzeitig mit dem Etranger erschienenes Werk, der Essay Le Mythe de Sisyphe, fand die Zustimmung der deutschen Zensurbehörde mit der bekannten Änderungsauflage, das Kafka-Kapitel betreffend. Nach 1945, z. T. schon vor den ersten deutschen Übersetzungen erschienen Kritiken zu Albert Camus allgemein (»ein bewunderungswürdiger Moralist« [Krings 1953, S. 353]) und einzelnen Werken in Kulturzeitschriften des geistigen Wiederaufbaus, besser : des moralischen Neubeginns. Schon die weltanschaulichen Titel selbst waren ein klares Programm: Sammlung (1945, 1947, 1948); Wort und Tat (1947); Gegenwart (1948); Merkur (1949, 1950, 1952, 1957); Welt und Wort (1949); Stimmen der Zeit (1950, 1951); Begegnung (1951). Es würde zu weit führen, wenn ich alle Aufsätze aus den Anfängen der deutschen CamusRezeption auflisten wollte. Der bedeutendste und in seiner Wirkung nachhaltigste Vermittler Camus’ im ersten Nachkriegsjahrzehnt war der Tübinger Philosoph und Pädagoge Otto Friedrich Bollnow (1903 – 1991), der in mehreren Folgen »Kleiner philosophischer Aufsätze« (Vgl. den Sammelband Einfache Sittlichkeit [1947]) sich zum Ziel gesetzt hatte, »inmitten einer allgemeinen Verwirrung der moralischen Begriffe die bleibenden elementaren Grundlagen des sittlichen Lebens wieder sichtbar werden zu lassen« (Bollnow 1962, Vorwort S. 6). In diesem Bemühen spielte der französische Nachkriegsexistenzialismus eine besondere Rolle: »Der Existentialismus beschäftigt seit Kriegsende in starkem Maße die deutsche Öffentlichkeit. Aber im Unterschied zu der Existenzphilosophie der zwanziger Jahre handelt es sich hier […] um die Auswirkung des französischen Existentialismus. Der Hunger nach der geistigen Welt des freien Auslands, der uns nach soviel Jahren der Abgeschlossenheit erfüllt, läßt umso williger danach greifen, als der französische Existentialismus […] in einer Zeit äußerster Not, wie der unsrigen, Hilfe oder wenigstens Trost zu geben verspricht.« (Bollnow 1947, S. 654) In Aufsätzen für Die Sammlung nannte er Die Pest einen »für die ethische Situation des heutigen Menschen so aufschlußreiche (n) Roman« (abgedruckt in Einfache Sittlichkeit 21957, 71); später »eine eindringliche Analyse unserer gegenwärtigen Situation« (Abgedruckt bei Schlette 1975, S. 227). In seinen »Bemerkungen« zu Der Mensch in der Revolte lobt er »das neue, unmittelbar an die tiefsten Fragen unsres heutigen Daseins rührende Buch Camus’« (erschienen in einer anderen Nachkriegszeitschrift mit einem
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
417
ebenfalls symbolischen Aufbruch-Titel: Antares [Baden-Baden; Wiederabdruck bei Schlette 1975, S. 265]). Dass über die Kulturzeitschriften hinaus auch die Gründung Französischer Kulturinstitute in der Frankreich zugestandenen Besatzungszone eine besondere Vermittlerrolle gespielt hat, sei ausdrücklich betont. Nachzutragen ist – obwohl ich mich auf die »deutsche« Rezeption Camus’ beschränken will – einer der ersten deutschsprachigen Aufsätze zu Camus: »Albert Camus und die Welt des Absurden« (1946) des bekannten Schweizer Publizisten und Kritikers FranÅois Bondy, der früh die Leser auch mit Der Fremde und den Briefen an einen deutschen Freund vertraut macht. Diese frühen Beiträge zur deutschen Camus-Rezeption sind von Richard Thieberger (1963) und Heinz Robert Schlette (1975) in ihre Sammelbände aufgenommen worden. Erwähnenswert sind auch die Vorbemerkungen »L’Allemagne devant Camus« (Thieberger 1963, S. 13 – 16) sowie die »Einführung« von Schlette (1975, S. 1 – 11). Thieberger resümierte einen historischen Sachverhalt, der für die folgenden Jahre bis heute eine bedauerliche perspektivische Verengung der CamusWahrnehmung bedeutet: »So ist Otto Friedrich Bollnow früh der gewissermaßen ›zuständige‹ Interpret auf deutschem Sprachgebiet geworden.« (Thieberger 1964, S. 141) Ansätze einer kritischen Beschäftigung mit Versäumnissen und einseitigen Inanspruchnahmen Albert Camus’ in Deutschland gab es seit den fünfziger Jahren. Theodore Ziolkowski, Deutschamerikaner am German Department der Yale-University (der 1962 auch einen Beitrag über die geistige Verwandtschaft zwischen Albert Camus und Heinrich Böll veröffentlicht hat [Modern Language Notes 77, S. 282 – 291]), meinte in einem kurzen Artikel für ein Camus gewidmetes Sonderheft aus Anlass des tragischen Unfalltodes 1960, ganz biblisch, der verlorene Sohn habe in Deutschland eine Heimstatt gefunden. »Camus is welcomed warmly and almost emotionally« und fuhr verallgemeinernd fort: »Of all the foreign writers whose works filled the literary vacuum in Germany after World War II, none achieved a greater or more immediate popularity than Albert Camus.« (»Camus in Germany, or the Return of the Prodigal Son.« 1960, S. 132) Im Zusammenhang mit Camus’ wenigen Auslandsreisen habe ich auch seine offizielle USA-Reise von 1946 erwähnt, auf der er u. a. am 28. März im McMillin Theater der Columbia University (New York) einen Vortrag über »La Crise de l’homme« gehalten hat. Eine deutsche Übersetzung liegt nicht vor; ein Redemanuskript (es gibt in der Tat verschiedene, z. T. voneinander abweichende Fassungen) ist erstmals 1996 in der N.R.F. veröffentlicht worden (No 516, S. 8 – 29). Seit 2006 liegt der angebliche »texte original de la conf¦rence« auch in Bd. II der neuen vierbändigen Pl¦iade-Ausgabe vor (S. 737 – 748), mit einem umfangreichen Kommentar zur Textgenese von Philippe Vanney (S. 1364 – 1368). Kurioserweise – so muss man das wohl nennen – erschien bereits 1947 in einer heute kaum noch bekannten Zeitschrift Die Amerikanische Rundschau
418
Franz Rudolf Weller (Bonn)
(Herausgegeben im Auftrag des Informationsdienstes der amerikanischen Militärregierung für Bayern [München]) in Heft 12 (Jg. 3) als erster Beitrag Albert Camus: »Die Krise des Menschen« (S. 3 – 12) mit dem redaktionellen Hinweis: »›Die Krise des Menschen‹ ist der Titel eines in den Vereinigten Staaten gehaltenen Vortrags, der in Twice-a-Year abgedruckt worden ist.« (S. 127) – leider ohne Angabe des Übersetzers und dass es sich um eine mehrfach gekürzte Fassung des Vortrags handelt, der einen eindringlichen Aufruf zu einem Dialog über Nationen und Ideologien hinweg darstellt; eine hochpolitische Rede vor amerikanischem Publikum, das der ehemalige Widerstandskämpfer Albert Camus nicht über sich und sein Werk, nicht über französische Zustände, sondern – in ungewöhnlich breiter Form – über Nazi-Deutschland informiert, über Hitler (wie er zur Macht kam), über München (1938), über die Konzentrationslager, über prügelnde und folternde SS-Männer, über die negativen Auswirkungen deutscher Geschichtsphilosophie (Hegel), über seine negative Einschätzung der Rolle der Politik (mit deutlichen Anklängen an Themen des Homme r¦volt¦, an dem Camus gerade arbeitete). Er schließt seinen Vortrag mit einem eindringlichen Appell zu solidarischem Handeln, einer pathetischen Aufforderung zur kollektiven Rebellion (»Revolte«) gegen politische Ideologien und für den Aufbau einer Moral der Freiheit und Aufrichtigkeit. Es ist verständlich, dass der ökonomisch arbeitende Autor diese politischen Einlassungen in den Folgejahren mehrfach weiterverwertet hat. Ich habe diesen frühesten mir bekannten deutschsprachigen Camus-Text deshalb etwas ausführlicher kommentiert, weil er ganz und gar nicht auf die existenz- bzw. religionsphilosophische Schiene passt, die im Nachhinein – was die Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945 angeht – als das Produkt eines zeitbedingten Missverständnisses bezeichnet werden muss. Die erste Phase der deutschen Camus-Rezeption war das Produkt eines Missverständnisses, weil der Existentialismus in Deutschland in einem ganz anderen Kontext entstanden war und der deutsche Nachkriegsexistentialismus in einem völlig anderen kultur- und gesellschaftspolitischen Klima funktionierte. Die Stichworte lauten: Niederlage, Verbrechen, Schuld und Flucht ins Religiöse, was Sloterdijk kürzlich die »metanoetische Wandlung der deutschen Kriegsverlierer« genannt hat (2008, S. 38). Zum auch moralischen »Wiederaufbau« kam Albert Camus mit einigen Bestseller-Werken gerade richtig. Es fehlten in dieser ersten, verengten und einseitigen Wahrnehmung des in Frankreich schon berühmten Autors die poetisch-essayistischen Jugendschriften aus Algier (L’Envers et l’endroit, Noces), der Gesamtkomplex Algerien, das politische Engagement des Journalisten Camus sowie seine ersten Dramen (Caligula, Le Malentendu), obwohl das »Schauspiel« – von den Anfängen als Schauspieler und Regisseur im Studententheater von Algier bis zu den späten Übersetzungen und Bearbeitungen ausländischer Vorlagen – sozusagen das Herzstück seines
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
419
künstlerischen Schaffens war. Über die ersten Aufführungen von Caligula und Le Malentendu in Stuttgart, Wuppertal, Celle u. a. gibt es m.W. nur kurze Kritiken in der Tagespresse bzw. in Bühnengazetten (Vgl. immerhin Ernst Heidelberger, »Schwarzes Theater« [1947]).
7.
Albert Camus im Osten Deutschlands
An Albert Camus lässt sich sehr konkret zeigen, wann, wo und wie die »Rezeption« eines Autors, zumal eines ausländischen Schriftstellers, funktionieren kann oder eben nicht funktioniert, wenn wichtige Parameter im Prozess der literarischen Rezeption fehlen – gewollt und gesteuert. Die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen nach 1945 hat insbesondere seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 ein breites Spektrum an binationalen Kommunikations- und Transferaktivitäten ermöglicht, das nur auf der Basis der Liberalität demokratischer Gesellschaften realisierbar ist. In unserem Zusammenhang gehören dazu: – Der freie Import und Export von Büchern ohne Zensurvorgaben; – Ein freies, konkurrierendes Verlagswesen ohne staatliche Kontrolle; – Ein diversifizierendes Fremdsprachenangebot, darunter die jeweiligen Partnersprachen mit der entsprechenden Lehrerausbildung; – Eine von ideologischen Vorgaben freie Forschung und Lehre an Hochschulen; – Eine freie, unzensierte Literaturkritik in den öffentlichen Medien; – Ein reger, auf Eigeninitiative beruhender Schüler-, Studenten- und Lehreraustausch (Studien, Partnerschaften, Stipendien); – Unbegrenzte Reise- und Aufenthaltsmöglichkeiten im Partnerland; – Deutsch-Französische Gesellschaften auf kommunaler Ebene usw. Was ich hier sehr summarisch an Errungenschaften der westdeutschen Aussöhnung und gewachsenen Freundschaft mit Frankreich aufgelistet habe, müsste man in die jeweils grammatische Verneinungsform setzen, um die Verhältnisse hinter dem sog. »Eisernen Vorhang«, im anderen Teil Deutschlands, zu beschreiben. In der sowjetischen Besatzungszone und nach der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1949 bis zum Fall der Mauer 1989 hat es in Ostdeutschland keine wirkliche, freie Camus-Rezeption gegeben. In ihrem zunächst in Frankreich erschienenen Beitrag »Camus en R¦publique D¦mocratique Allemande« (Sändig 1999) schreibt Brigitte Sändig: »Denn Camus war einer der Autoren, die von den Funktionären der ostdeutschen Kulturpolitik und von konformistischen Kritikern am heftigsten abgeurteilt wurden.« (Sändig 2004, S. 247) Zu letzteren gehörte der im Ostblock tonangebende ungarische marxistische Literaturhistoriker Georg Lukcs. Die Verdam-
420
Franz Rudolf Weller (Bonn)
mung Camus’ in der DDR entsprach den gehässigen Verleumdungen in der kommunistischen Presse Frankreichs, auf die Camus z. T. vehement reagiert hat. In einer Tagebucheintragung von 1949 verhöhnt er die PCF-hörigen Genossen von der anderen Seite: La plupart des litt¦rateurs manqu¦s vont au Communisme. C’est la seule position qui leur permet de juger de haut les artistes. De ce point de vue, c’est le parti des vocations contrari¦es. Gros recrutement, on s’en doute. (Pl IV, S. 1006)
Die Beziehungen zwischen der SED und der PCF waren durchaus gespannt; ja, ihr Organ Les Lettres FranÅaises wurde von der deutschen Bruderpartei geradezu unterdrückt und brachte ihren Herausgeber, Louis Aragon (1897 – 1982) immer wieder in Schwierigkeiten, was ihn andererseits nicht daran hinderte, den DDRGenossen zu raten, Camus nicht zu drucken. Camus ist nie in Russland gewesen – wie andere prominente Schriftsteller Frankreichs, die z. T. desillusioniert zurückgekehrt sind und sich vom stalinistischen Kommunismus distanziert haben wie z. B. Andr¦ Gide, der jahrzehntelang im östlichen Lager völlig diskreditiert war, wie Brigitte Sändig in ihrem Beitrag »Andr¦ Gide in der früheren DDR« gezeigt hat (Sändig in Siepe/Theis 1992, S. 233 – 239). Albert Camus selbst sah Ende der 40er Jahre die Bedrohung durch Deutschland als sekundäres Problem an und machte in Moskau den neuen gemeinsamen Feind aus. Aus Anlass des Arbeiteraufstands in Ostberlin vom 17. Juni 1953 protestiert Camus in einer Ansprache am 30. Juni auf einem »Solidaritätsmeeting« in der Pariser »Salle de la mutualit¦« gegen die kommunistischen Machthaber ; er übt aber auch Kritik an der diesbezüglichen Berichterstattung in der französischen Tagespresse. Eine auf Deutschland bezogene Auswertung der inzwischen vollständig (?) publizierten privaten Aufzeichnungen der Carnets steht leider noch aus. Wie bekannt fand die »Sowjetisierung« der DDR erst durch den Kollaps des Staatssozialismus 1989 ihr Ende. Das intellektuelle Leben war befreit von den Fesseln einer rigiden Parteizensur ; befreit von der »inneren Gespaltenheit« zwischen östlichen, insbesondere sowjetischen Abhängigkeiten und westlichen Herausforderungen; befreit von der »Sprache der Zensur« der DDR-Kulturfunktionäre, für die Camus ein »politisch diskreditierter Autor« war (Sändig 2004, S. 253); im Land des sozialistischen Realismus, im Negativurteil sozialistischer Literaturwissenschaft ein dekadenter Vertreter der nihilistischen Verzweiflung. Die subversive Kraft der Literatur hatte das SED-Regime richtig erkannt und entsprechend über willfährige Helfer gehandelt. Zur Lage ab Ende der fünfziger Jahre schrieb eine betroffene Zeitzeugin: »Personen, deren oberstes Gebot SED-Loyalität und Amtserhalt war, die damit divergierende bildungspolitische Auffassungen unterdrückten, bestimmten weitgehend die verantwortlichen Ebenen im bildungspolitischen Bereich in den folgenden dreißig Jahren.« (Röseberg 1999, S. 130)
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
421
Der Besitz von Büchern Camus’, die nicht in der DDR verlegt worden waren, galt als Straftatbestand. Von verheerender Auswirkung auf die klassischen Vermittlungsinstanzen auf dem Feld literarischer Rezeption erwies sich die rigorose auf die Rolle des Russischen als erste Fremdsprache ausgerichtete Fremdsprachenpolitik, die das Erlernen »westlicher Fremdsprachen«, also der Sprachen des politisch-ideologischen Gegners in den Schulen und Hochschulen ver- oder behinderte. Die politische Einflussnahme auf die gesamte Lehrerausbildung, auf die Unterrichtswerke und –materialien usw. degradierte die einst blühende ostdeutsche Romania zu einem »Schattendasein der Romanistik in der DDR« (Pfeil 2004, S. 343), wo einige ihrer Vertreter zwischen 1945 und 1989 eine zwielichtige Rolle spielten. Eine Französischlehrerausbildung war überhaupt nur an einigen Universitäten möglich. Z.T. wurden Schüler und Schülerinnen diskriminiert, wenn sie Französisch als fakultative Fremdsprache wählten (Vgl. Pfeil 2004, S. 352 – 371; Röseberg 1999, S. 102 f. und den geschönten Beitrag von Utermark 1991). Der Fremdsprachenunterricht diente als Kampfinstrument gegen die westlichen Klassenfeinde, was einherging mit einer rigorosen Zurückdrängung der literarischen Komponente (im einzigen Lehrwerk für den Französischunterricht: Ici la France [1951/52]; später Bonjours les Amis/Bonjour, chers amis (1968/71). Die fächerübergreifende Erziehung zum sozialistischen Patriotismus führte zu einem radikalen Funktionswandel des Französischunterrichts, der lt. Richtlinien die Erziehung zum Hass gegenüber den französischen Imperialisten, explizit dem Faschisten de Gaulle zu vermitteln hatte (Vgl. Röseberg in Oster/Lüsebrink 2008, S. 281): »Frankreich und Französisch werden instrumentalisiert und in den Dienst der Ideologie gestellt.« (Bertrand in Röseberg 1999, S. 147) Das schwierige Verhältnis zwischen Frankreich und dem »anderen Deutschland« ist vielfach dokumentiert und dargestellt worden (Vgl. neben den bereits zitierten Arbeiten die aus der DDRPerspektive verfasste Dissertation von Daniella Risterucci-Roudnicky [1999]). Unter der SED-Herrschaft waren die westlichen Fremdsprachen ideologisch dermaßen stigmatisiert, dass auch für die Wahrnehmung »westlicher« Literatur nur wenig Spielraum bestand. Insofern überrascht die Ansicht Brigitte Sändigs, dass ein »in den fünfziger Jahren rückhaltlos verdammter Autor« wie Camus (Sändig 2004, S. 255) trotz des über ihn gesprochenen und kontrollierten Verdikts moralisches Idol in regimekritischen intellektuellen Kreisen der DDR sein konnte. Natürlich gibt es die berühmte Ausnahme von der Regel, frei nach Brechts bitter ironischem Lehrstück von 1930. Wie hat es eine 1944 in Dresden geborene engagierte Romanistin, die sich für moderne französische Literatur, besonders Gide und Camus interessierte, geschafft, trotz langjähriger durch die Einheitspartei den Menschen eingebrannte Denkweise sich für eine »nichtkonforme Intellektuelle« (Sändig 2004, S. 276) zu halten, mit dem schwierigen »Versuch, in
422
Franz Rudolf Weller (Bonn)
der Wahrheit zu leben«, zumindest in der Wahrheit leben zu wollen (Vgl. Sändig 2004, S. 276 Anm. 21)? Nach ihrer unveröffentlichten Dissertation Zum Verhältnis von Individuum und Gesellschaft bei Albert Camus (Leipzig 1973) war sie bis zur »Wende« am Zentralinstitut für Literaturgeschichte (Berlin) tätig und mit fachlichen, nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Gutachten tätig, was sowohl »ideologisches Wohlverhalten« als auch »ideologisch bedingte Selbstzensur« erforderte, was sie in Publikationen nach der »Wende« immer wieder eingeräumt hat. In einem gewiss schwierigen Akt »lautloser Selbstzensur« (Fühmann) ist Brigitte Sändig (verh. Schmidt) ihren beiden Haus»penaten« Gide und Camus treu geblieben, so dass ihr »beruflicher Werdegang unlösbar mit der Rezeptionsgeschichte dieser beiden Autoren verbunden war und ist« (Sändig in Siepe/Theis 1992, S. 233). In die Zeit ihres ersten beruflichen Lebens fällt auch eine Monografie Camus’ von 1983: Albert Camus. Ein Einführung in Leben und Werk (Leipzig: Reclam). Eine 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage erschien 1988; schließlich – nach der »Wende« – 1992, die 3., erneut »überarbeitete« Auflage, mit zahlreichen Kürzungen und Streichungen von Passagen, die in den früheren Ausgaben zum obligaten antifaschistischen DDR-Jargon gehörten. Leider wird in vielen Arbeiten zu Camus immer nur aus einer der drei Auflagen zitiert, in Unkenntnis der ideologischen Implikationen, die zusammen eine interessante Dokumentation der Entwicklung des Camus-Bildes in der DDR von 1983 bis 1992 darstellen. Zu den beiden DDR-Ausgaben von 1983 und 1988 bemerkte einer ihrer Kritiker : »Sändigs damalige Veröffentlichung kann dennoch als das Maximum dessen betrachtet werden, was in der DDR über Camus publiziert werden konnte.« (Marin 1998, S. 187) Nach dem Fall der Mauer, die in einigen Köpfen assoziativ-psychologisch fortbesteht, hat Brigitte Sändig als endlich »arrivierte« Professorin in Potsdam eine ganze Serie von Aufsätzen für westdeutsche und französische Periodika publiziert, zahlreiche Vorträge auf Tagungen und Kongressen gehalten, die ganz verschiedene Aspekte aus dem Leben und Werk von Albert Camus thematisieren, womit sie sich als die derzeit beste deutsche Camus-Forscherin profiliert hat, was auch in Frankreich Anerkennung gefunden hat. Der größte Teil ihrer Camus-Studien liegt seit 2004 auch in einem Sammelband vor: Albert Camus. Autonomie und Solidarität (Würzburg) mit 24 Beiträgen: 3 aus der DDR-Zeit (1975, 1986, 1988); die Mehrzahl zwischen 1991 und 2002; schließlich unveröffentlichte Arbeiten. Diese staunenswerte Produktionsfülle in kaum mehr als einem Jahrzehnt wird von keinem anderen deutschen Romanisten erreicht oder gar übertroffen.
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
8.
423
Der Beitrag der Romanistik und der Fachdidaktik
Ich hatte eingangs schon darauf hingewiesen, dass sich die universitäre Romanistik relativ spät, später als die Philosophen, Theologen, Publizisten/Feuilletonisten und Französischdidaktiker, dem Werk Camus’ zugewandt hat. Dafür gibt es verschiedene Gründe, zumindest Mutmaßungen, auf die ich hier nicht eingehen will. Die folgende Übersicht stellt eine repräsentative Auswahl von Camus-Studien dar, aus Gründen der besseren Übersicht in thematischer, also objektbezogener Gliederung. Unberücksichtigt bleiben die Überblicksdarstellungen in Lexika, Sammelwerken, Loseblattausgaben, Literaturgeschichten und -handbüchern usw. Vollständigkeit wurde nicht angestrebt, zumal die Flut an Camus gewidmeten Dissertationen und Diplomarbeiten kaum noch zu erfassen ist. Die in anderen Zusammenhängen zitierten Camus-Veröffentlichungen werden hier nicht wiederholt. Am Anfang der romanistischen Beiträge zur deutschen Camus-Forschung nach 1945 stand nach meiner Kenntnis eine persönliche Begegnung des Würzburger Romanisten Franz Rauhut mit Albert Camus in Paris 1951, veröffentlicht 1957: »Albert Camus oder der Nihilismus zwischen Maß und Menschlichkeit« (Wieder abgedruckt in Thieberger 1963, S. 17 – 40).
Allgemeine Darstellungen 1958 »Der Atheismus in der Sicht von Albert Camus.« (Paepcke) 1960 »Albert Camus und der Friede.« (Paepcke) 1961 »Albert Camus und das literarische Phänomen des Schweigens.« (Pollmann) 1965 »Albert Camus: Ein Versuch zum Verständnis seines dramatischen Werkes.« (Mönch) 1967 »Sartre und Camus: Literatur und Existenz.« (Pollmann) 1973 Das Absurde und die Autonomie des Ästhetischen bei Albert Camus. Diss. (Bastian Amor) 1973 »Zur Bedeutung der griechischen Mythologie für Albert Camus.« (Scheel) 1974 »Hauptetappen der literarischen Entwicklung Albert Camus’ unter besonderer Berücksichtigung des Rezeptionsaspektes.« (Schmidt, d.i. Sändig) 1975 »Revolte und Resignation. Zum Werk Albert Camus’.« (Brockmeier) 1975 »Albert Camus’ Auffassung von der Funktion der Kunst und des Künstlers.« (Schmidt, d.i. Sändig) 1989 »Se taire, parler, agir dans la pens¦e de Camus.« (Sändig) 1995 Die Symbolik von Licht und Schatten bei Albert Camus. (Trageser-Rebetez)
424
Franz Rudolf Weller (Bonn)
»Camus’ Geschichte von Europas Hochmut.« (Sändig) »Camus und sein erster Lehrer.« (Sändig) »Camus im Deutschland des Jahres 1945.« (Sändig) »R¦ception de l’œuvre de Camus en R.D.A.« (Sändig) »›…etwas Stärkeres als alle Rechtsprechung‹. – Camus und die Todesstrafe.« (Sändig) 2000 »Marie, Martha, la mÀre – Die Frauengestalten Camus’.« (Sändig) 2000 Camus im Osten. Zeugnisse der Wirkung Camus’ zu Zeiten der Teilung Europas. (Sändig) 2002 Albert Camus. Kunst und Moral. (Wittmann)
1995 1996 1999 1999 2000
Einzelne Werke Frühe Schriften/Ecrits posthumes 1979 »La Maison mauresque und Le Livre de M¦lusine.« (Hirdt) 1986 Albert Camus. Zwischen Ja und Nein. Die frühen Schriften. (Sändig) L’Etranger 1963 »Erzähler und Welt in L’Etranger von Albert Camus.« (Coenen-Mennemeier) 1963 »Absurdität und Epik als ästhetisches Problem in Camus’ Etranger.« (Noyer-Weidner) 1970 »Zur Struktur des Etranger.« (Krauss) 1974 »Trivialroman und Kunstroman.« (Pollmann) 1975 »Albert Camus. L’Etranger.« (Noyer-Weidner) 1980 »Structure et sens de L’Etranger.« (Noyer-Weidner) 1980 »Indifferenz und verdinglichte Kausalität.« (Zima) 1983 »Camus’ Fremder ein Identifikationsangebot für junge Leser? Ein empirisches Rezeptionsprotokoll.« (Heitmann) 1996 »Der Prozess gegen den Fremden.« (Mölk) 2000 »Der konditionierte Fremde. Anmerkungen zu Selbst- und Fremdbetrachtungen in Camus’ L’Etranger.« (Rings) 2005 Albert Camus. L’Etranger. Dokumentation der Erfolgsgeschichte eines »Schulklassikers«. (Weller)
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
425
La Mort heureuse 1974 »La Mort heureuse von Albert Camus.« (Hirdt) 1993 »Albert Camus: La Mort heureuse. (1938) – Mit einem Ausblick auf L’Etranger (1942).« (Sändig) La Peste 1958 »Das Formproblem der Pest von Albert Camus.« (Noyer-Weidner) Le premier Homme 1997 »Das Mysterium der Armut. Dichtung und Wahrheit bei Albert Camus.« (Coenen-Mennemeier) 1997 »Camus und Algerien – ›Erster Mensch‹ oder ›Gast‹?« (Sändig) La Chute 1956 »Die Tragödie Camus. Vom kurzen Atem eines Moralisten: La Chute.« (Heist) 1958 »Albert Camus’ Rückkehr zum Sisyphus.« (Theis) 1984 »La Chute« von Albert Camus. Ansätze zu einer Interpretation. (Yadel) 1999 »Kalkulierte Konfession. Camus’ La Chute im Kontext.« (Schlüter) L’Exil et le royaume 1960 »Albert Camus im Stadium der Novelle. (L’Exil et le royaume).« (NoyerWeidner) 1970 »›Le Ren¦gat‹. Die Funktion des Innenmonologs.« (Pelz) 1973 Die Novellen von Albert Camus. Interpretationen. (Pelz) 1976 »L’Húte. Jonas ou L’Artiste au travail.« (Hirdt) 1998 »Un thÀme de la nouvelle contemporaine: l’aporie de l’artiste.« (Schoell) 2006 »Die Novelle Jonas von Albert Camus und das biblische Buch Jona.« (Mölk) Le Mythe de Sisyphe 1961 »Sisyphos und der neue Humanismus.« (Mennemeier) 1996 »Albert Camus und die Intertextualität. ›Le Mythe de Sisyphe‹ und ›La Pierre qui pousse‹.« (Witt) L’Homme r¦volt¦ 1952 »Albert Camus – Bild einer geistigen Existenz.« (Jeschke) 1962 »Maß und Revolte. Zum polititschen Ethos von Albert Camus.« (Paepcke) 1991 Ich revoltiere, also sind wir. Albert Camus – 40 Jahre »Der Mensch in der Revolte«. (Sändig)
426
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Caligula 1949 »Caligula.« (Kuechler) 1966 »Die Demonstration des Absurden: Camus’ Caligula.« (Coenen-Mennemeier) 1971 »Freiheit und Faktizität in Camus’ Caligula.« (Coenen-Mennemeier) 1991 »Maß und Maßlosigkeit: Die beiden Versionen des Caligula-Dramas.« (Sändig) Le Malentendu 1971 »Camus’ Malentendu und Doderers ›Zwei Lügen‹« (Knust) Les Justes 1961 »Die Tragödie der Gerechten.« (Mennemeier) 1962 Albert Camus. Les Justes. (Lausberg) L’Enigme (aus: L’Et¦) 2003 »›Bien entendu, je ne vous ai pas dit mon vrai nom‹. Negative Theologie und Arbeit am Mythos bei Albert Camus.« (Lepper)
Komparatistische Arbeiten 1994 »Zwei oder drei Fremde. Berührungspunkte zwischen Camus’ L’¦tranger und Christoph Heins Der fremde Freund.« (Sändig) 1995 »Constant und Camus und die absolute Macht.« (Sändig) 1998 »Der Krieg ist aus. Das Ende der Pest/des Krieges bei Camus und Fühmann.« (Sändig) 2003 »Reflets de Camus dans deux ¦critures allemandes: Günter Grass et Christoph Hein.« (Sändig)
Landeskundliche/kulturkundliche Aspekte 1990 Albert Camus und der Algerienkrieg. Die Auseinandersetzung der algerien-französischen Schriftsteller mit dem ›directeur de conscience‹ im Algerienkrieg (1954 – 1962). (Albes) 1997 »Albert Camus et l’Alg¦rie.« (Jurt) 1998 »Zweimal algerische Kolonialgeschichte – Kateb Yacine: Nedjma, Albert Camus: Le premier Homme.« (Sändig)
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
427
Dieser beeindruckenden Zahl überwiegend literaturwissenschaftlicher Studien zum Werk von Albert Camus steht auf linguistischer Seite leider nur Vereinzeltes gegenüber : Der Stil von Albert Camus (Barrera-Vidal, Diss. Frankfurt/M. 1963); »Kohärenz und Delimitation: Zur Struktur des Absatzes (am Beispiel von Camus’ Le Mythe de Sisyphe (Stammerjohann 1976). Am Themenheft »Langue et langage« (Camus 2) der Zeitschrift Revue des Lettres modernes (1969) war kein deutscher Linguist beteiligt. Bei großzügiger Auslegung des Begriffs könnte auch die seinerzeit beachtliche Konkordanz zu den Romanen und Erzählungen, herausgegeben von dem verstorbenen Manfred Sprissler (2 Bde 1988) erwähnt werden, die den gesamten Wortformenbestand nicht-lemmatisiert im Kontext erfasste, aber heute leider sachlich und methodologisch überholt ist. Bekannt, ja berühmt geworden in didaktischen Kreisen ist das Kapitel zum Tempussystem des Etranger, das Harald Weinrich 1964 in seinem Buch Tempus. Besprochene und erzählte Welt (S. 262 – 270) vorgelegt hat. Sein Lehrer Heinrich Lausberg hatte Jahre zuvor eine rhetorisch perfekte Interpretation des Dramas Les Justes verfasst (1962). Auch die Münsteraner Dissertation von Rolf Massin Das »oui« und das »non«. Eine Untersuchung über Affirmationen und Negationen im Werk von Albert Camus (1972) ist philologisch-linguistisch angelegt. Summa summarum muss man der romanistischen Linguistik bis heute ein deutliches Desinteresse an Camus attestieren, so als ob es lexikalisch und grammatisch, stilistisch und rhetorisch, sprachkombinatorisch und translatorisch an den Werken Camus’ nichts zu untersuchen gäbe! Insofern ist auch das Bonner Camus-Symposium ein getreues Spiegelbild dieser Sachlage. Traditionell ist die Schule ein wichtiges breitenwirksames Rezeptionsfeld. Das gilt sowohl für den muttersprachlichen wie den fremdsprachlichen Literaturunterricht. Gerade für letzteren war das deutsche Gymnasium immer eine wichtige Kanonisierungsinstanz. Ihr ist es zu verdanken, dass Albert Camus der bedeutendste französische Schriftsteller nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland geworden ist. Camus war der größte französische Schulklassiker nach MoliÀre in den sechziger bis achtziger Jahren, die unangefochtene Nr. 1 der französischen Schullektüre im neusprachlichen Gymnasium. Camus wurde ein bisher einmaliges Rezeptionsphänomen insofern, als er der einzige französische Schriftsteller ist, dessen fiktionales Werk fast vollständig in deutschen Schulausgaben erschienen ist. Noch in den siebziger Jahren war Camus mit einem halben Dutzend Werken in sog. Schulausgaben vertreten (z. T. leider nur in gekürzter oder bearbeiteter Fassung). Dass die philosophischen Texte eine geringere Rolle spielten, hängt natürlich auch mit der unterschiedlichen Rolle des Philosophieunterrichts im Fächerkanon beider Länder zusammen. Dass der letzte zu Lebzeiten des Autors publizierte Roman, La Chute, kein Werk für die Schule war, leuchtet jedem Literaturdidaktiker ein. Dass der erst 1994 aus dem Nachlass veröffentlichte unvollendet gebliebene stark autobio-
428
Franz Rudolf Weller (Bonn)
grafische Roman Le premier Homme, in ca. 30 Einzelstücken (mit vielen Kürzungen, Auslassungen und neuen Zwischentiteln des Herausgebers) in einer preiswerten Ausgabe auf den Markt gekommen ist, ist. m. E. eine bedauerliche Entscheidung des Verlags (Reclam 2008). Dass aus der Novellensammlung L’Exil et le royaume ein Text bisher nicht in einer Schulausgabe erschienen ist, kann nur als psychopädagogisches Sonderproblem des bürgerlichen Gymnasiums erklärt und verstehbar gemacht werden. Die mystisch-erotische Selbsterfahrung einer verheirateten, kinderlosen Frau in einer nächtlichen Vereinigung auf den »remparts« der Wüstenoase, die in einem ekstatischen »Ehebruch« mit dem Kosmos gipfelt, bevor die Frau schlussendlich ins gemeinsame Hotelzimmer zu ihrem Ehemann zurückkehrt, musste als »Schullektüre« schon am Titel scheitern, der ja auch Noces hätte lauten können. Ob das auch heute in der Schule so gesehen würde, wage ich zu bezweifeln, wenn auch weiterhin, wie ich weiß, zu bedenken ist, dass die französische Literatur infolge ihrer latenten Negativität und erotistischen Meisterschaft ohnehin kontroversen Urteilen ausgesetzt ist. Aber leider gibt es, was den französischen Literaturunterricht in der Schule angeht, ein sehr viel ernsteres, allgemeineres Problem, das man ehrlicherweise als Krise bezeichnen muss. Die euphorische Rhetorik, die sich an Festtagen und bilateralen Großereignissen rituell wiederholt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dem Französischunterricht in Deutschland schlecht geht (vom Zustand des Deutschunterrichts in Frankreich hört man ganz Ähnliches). Die Oberstufenreform Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bedeutete das Ende des neusprachlichen Gymnasiums. In Verbindung mit der Diskussion über die Zahl und Qualität der Fremdsprachen bis zum Abitur bedeutete die neu eingeführte Fächerwahl, d. h. auch –abwahl zu Beginn der Oberstufe eine weitere Einbuße an Fremdsprachen. Die Aufteilung des Unterrichts in Grund- und Leistungskurse hatte zur Folge, dass jene leicht abwählbar sind und letztere an vielen Gymnasien im Fach Französisch erst gar nicht zustande kommen. Das sind einige der Hintergründe für eine fremdsprachenpolitische Situation, die zum Niedergang des schulischen Literaturunterrichts, vor allem im Fremdsprachenunterricht, beigetragen hat. Es ist fraglich, ob überhaupt noch in größerem Umfang kanonisierte Literatur gelesen wird, seitdem das sogenannte Zentralabitur verbindliche Autoren und Werke vorschreibt. Nach meinem Eindruck ist der französischsprachliche Literaturunterricht an deutschen Gymnasien am Ende seiner Zeit, wobei Camus und Sartre nur noch die sich auflösende Nachhut bilden. Über dieses Problem habe ich 2000 eine vom Kultusministerium des Landes NRW unterstützte größere empirische Studie zum Lektüre»kanon« im Französischunterricht der Leistungskurse veröffentlicht. Sie bestätigte die vermutete fortschreitende Gefahr einer Banalisierung, ja Trivialisierung des Literaturunterrichts: Im Seichten kann man bekanntlich
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
429
nicht ertrinken. Das letzte mir bekannte Lese- und Übungsbuch für die Sekundarstufe II (Mots de passe, Diesterweg 1995) enthält kaum noch literarische Texte. Der Name Camus ist verschwunden (auch MoliÀre, Voltaire, Balzac, Sartre). Mit einem langen Auszug (12 Seiten) ist der algerische Autor Azouz Begag mit seinem autobiografischen Roman Le Gone du Chaba (1986) vertreten. In den siebziger und noch achtziger Jahren waren gerade die französischen Oberstufenlesebücher ein wichtiges Instrument der Vermittlung literarischen Wissens (im Überblick). Die einst imponierende Palette an Schulbuchverlagen mit eigenem Programm an fremdsprachlichen Lektüretiteln ist auf wenige zusammengeschrumpft, die sich leider auf billigere Lizenzausgaben mit Cover-Kosmetik eingestellt haben, wenn nicht auf noch billigere Adaptationen »en franÅais facile«, die seit Jahren unbedenklich aus Frankreich importiert werden. Immerhin gibt es zur Zeit drei konkurrierende Schulausgaben des Etranger (Diesterweg, Reclam, Klett), der in Auszügen bereits 1957 bekannt war. Über die Erfolgsgeschichte dieses »Schulklassikers« habe ich 2005 eine Dokumentation veröffentlicht (Vgl. Weller 2005). Die zum Etranger vorliegenden didaktisch-methodischen Handreichungen hat Lieselotte Steinbrügge einer kritischen Querschnittanalyse unterzogen (»L’Etranger von Albert Camus. Über die Haltbarkeit eines Schulklassikers« 2008). Aus Umfangsgründen soll hier darauf verzichtet werden, auch alle fachdidaktisch relevanten Arbeiten zu Camus aufzulisten, die mengenmäßig in etwa dem fachwissenschaftlichen Ertrag entsprechen. Die schulische Erfolgsgeschichte Camus’ begann Ende der 50er Jahre und beruhte wesentlich auf werkexternen Faktoren wie Integrität und Vorbildlichkeit der Persönlichkeit des Schriftstellers, seiner geistig-moralischen Redlichkeit und mitmenschlichen Solidarität; kurz: Camus’ gelebtem und in seinen Werken übermittelten modernen Humanismus. Dieser damals pädagogisch vermittelbare Transfer auf die eigene Lebenssituation funktioniert heute nicht mehr. Dass die literarische Konstruktion eines schwachen, total indifferenten »Helden«, eines bedingungslosen Entlarvers falschen Scheins als Existenzmodell immer noch das Lebensgefühl jugendlicher Leser und darüber hinaus anspricht, bleibt ein rezeptions-geschichtliches Ereignis des Fremden auch nach 70 Jahren. L’Etranger, der Prototyp literarischen Welterfolgs, bleibt der Schulklassiker Nr. 1 par excellence. In zwei Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, BadenWürttemberg) war der Roman 2006 bzw. 2007 Schwerpunktthema für das Abitur, d. h. landesweit verbindliche einheitliche Vorgabe für den französischen Leistungskurs. Nicht zuletzt deshalb liegt L’Etranger in drei vollständigen »Schulausgaben« vor (Diesterweg, Klett, Reclam). Ich erlaube mir zu erwähnen, dass von meiner 1963 erstmals bei Diesterweg erschienenen kommentierten Ausgabe bis heute ca. 266.000 Exemplare verkauft worden sind.
430
9.
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Deutsche Juristen zeigen Interesse an literarischen Rechtsfällen im Werk von Albert Camus
Dass die Camus-Rezeption in (West)Deutschland z. T. eigene Wege gegangen und eher nationalen, »einheimischen« Einstellungen und Wahrnehmungen gefolgt ist, habe ich bereits mehrfach zu zeigen versucht. Ein weiterer, eher unerwarteter Blickpunkt auf Camus und sein Werk, für den es in Frankreich keine Parallele gibt, ist das auffällige Interesse deutscher Juristen, insbesondere von Strafrechtlern an literarischen Rechtsfällen im Werk von Albert Camus. Gewiss! Jeder Camus-Leser weiß, welche Rolle Recht und Gerechtigkeit, die juristische Thematik und die Fachsprache der Justiz in seinem Leben und in seinem Werk spielen. Seit seiner journalistischen Arbeit als Gerichtsreporter für die algerischen Tageszeitungen der dreißiger Jahre (Alger r¦publicain, Le Soir r¦publicain) bis zu den juristischen Leitartikeln und Kolumnen im Pariser Combat hat Albert Camus in Situationen von Unrecht, Machtmissbrauch und Verbrechen Flagge gezeigt. Noch 1945 hat er am Prozess gegen Marschall P¦tain teilgenommen. »Justice« ist aber auch ein thematischer Schlüsselbegriff in den meisten seiner fiktionalen und philosophischen Werke. Die komparatistische Beschäftigung mit literarischen Rechtsfällen ist ein altes Thema in der Literaturwissenschaft. Ich nenne einige Beispiele: Zum Problem des Mordes in der zeitgenössischen französischen Literatur, insbesondere im Rahmen des Existentialismus (Grünwald, Diss. Tübingen 1955); ferner : Der absurde Mord in der modernen deutschen und französischen Literatur (Zoll Diss. Frankfurt/M. 1962). Die französischen Beispiele sind L’Etranger und Le Malentendu. Ferner : Der Justizirrtum als literarische Problematik. Vergleichende Analyse eines erzählerischen Themas (Holdheim 1969). Der seinerzeit in den USA lehrende Komparatist behandelte als Beispiele Die Brüder Karamasoff (Dostojewski), L’Etranger/Der Fremde (Camus) und Die Panne (Dürrenmatt). Besondere Erwähnung verdient Literatur und Recht. Literarische Rechtsfälle von der Antike bis in die Gegenwart, herausgegeben von Ulrich Mölk (1996), der selbst mit der Analyse des Etranger beteiligt ist (S. 395 – 405), die in den »Betrachtungen zum Prozess gegen den Fremden« von Heike Jung (S. 406 – 416) eine juristisch beachtenswerte Ergänzung findet, womit ich überleiten möchte zu den Beiträgen deutscher Juristen zu ihrem Verständnis Camus’. Als juristischer Laie beschränke ich mich auf eine informelle Wiedergabe einiger Aufsätze, wobei L’Etranger verständlicherweise eine besondere Rolle spielt. Der älteste mir bekannte juristische Beitrag zu Camus stammt von dem ehemaligen Mainzer Juristen Peter Schneider mit dem Titel »Maß und Gerechtigkeit. Zu Albert Camus’ Rechts- und Staatsauffassung« (Festgabe für Carlo Schmid, 1962), in dem er die Problematik an drei Dramen untersucht: Caligula, Etat de siÀge, Les Justes.
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
431
(Wiederabdruck 1. in französischer Übersetzung bei Thieberger 1963, 101 – 124; 2. im Sammelband Schlette 1975, S. 132 – 157) Auch die Freiburger Dissertation (1963) von Gerhard Stuby Recht und Solidarität im Denken von Albert Camus (Frankfurt 1965) behandelte das Thema werkübergreifend aus rechts- und staatswissenschaftlicher Sicht. Dabei erscheint das Kapitel »Die absurde Rechtsprechung im ›Etranger‹« (S. 63) aus der Feder eines Juristen besonders interessant. Dem Beitrag des Hamburger Emeritus Eberhard Schmidhäuser Vom Verbrechen zur Strafe. Albert Camus ›Der Fremde‹. Ein Weg aus der Absurdität menschlichen Daseins (1992) merkt der Camus-Kenner an, dass es sich um einen hurtig formulierten Vortrag für eine Vorlesungsreihe handelt, der nicht hätte gedruckt werden sollen. Juristisch ist der Text nicht sonderlich ergiebig. Schlimmer ist, dass der Autor aus der alten Übersetzung von 1961 zitiert; die neue von 1994 scheint er nicht zu kennen. Schlimm ist auch, dass der Autor den Sinn dieses Romans, vor allem die Hauptfigur Meursault nicht verstanden hat. Dass es am Schluss des Romans einen »Ausweg aus der Isolation eines absurden Lebens« gebe (Schmidhäuser 1992, S. 35) ist eine Erfindung des renommierten Strafrechtlers. In einen größeren rechtsphilosophischen Zusammenhang (Kant, Schopenhauer, Marx u. a.) stellt der Freiburger Jurist Ulrich Vosgerau »Normalität und Willensfreiheit als rechtsnotwendige Fiktionen: rechtstheoretische Aspekte in Albert Camus’ L’Etranger« (2000). (Ist es ein Versehen, dass der Autor durchgängig ›Mersault‹ schreibt?) Auch Vosgerau zitiert nach der alten Übersetzung von 1961, die er kritisiert, ohne zu wissen, dass es seit 1994 eine Neuübersetzung des Etranger gibt. Das auffällige Interesse deutscher Juristen, insbesondere von Strafrechtlern, an Camus, speziell am absurden Prozessgeschehen in L’Etranger, bestätigt auch der jüngste mir bekannte Beitrag: 2004 veröffentlichte Dr. Sven Thomas, der in den neunziger Jahren als Anwalt in einem spektakulären Wirtschaftsprozess (Mannesmann/Vodafone) mediale Publizität erlangt hat, in der Neuen Juristischen Wochenschrift einen Aufsatz »Mandant und Verteidiger – Eine Skizze anhand des Romans ›Der Fremde‹ von Albert Camus.« Es geht dem Autor um das gesetzlich nicht geregelte Innenverhältnis von Mandant = Angeklagter und Verteidiger, ganz konkret um die Frage, ob sich ein Mandant jeder, auch der Pflichtverteidigung verweigern darf. Im Roman lehnt Meursault es bekanntlich ab, mit einem ihm aufgezwungenen Pflichtverteidiger zu kommunizieren, was, so Thomas, mit »dem Selbstverständnis des Verteidigers von seiner Profession« deutlich kollidiert (Thomas 2004, S. 556). Es geht also genauer um das Individualrecht Meursaults, um »seinen Wunsch nach Verteidigerfreiheit« und damit um »die Aufhebung der Legitimation des Verfahrens« (ebda. S. 556) mit seiner prozessualen »Systemlogik«. Im Prozess sind die Journalisten die eigentlichen Partner des Verteidigers, der in seinem Schlussplädoyer zur Verwunderung
432
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Meursaults über den Vorwurf der Anklage wie von seiner eigenen Tat rede, also in der Ichform, womit er ihm »seine Identität und Autonomie« (ebda. S. 557) nehme. Dieser »Verrat am Mandanten« (ebda. S. 557) – deutlich im Pflichtverteidigergespräch (in II, S. 1) – sei unter dieser Prämisse zu interpretieren. Was der Anwalt Thomas den »Verrat am Mandanten« (Thomas 2004, S. 557) als Teil der prozessualen »Systemlogik« bezeichnet, korrespondiert mit der Grundthese in Heike Jungs »Betrachtungen zum Prozess gegen den Fremden« (1996), der »sich geradezu als ›Musterprozeß‹ zur Bestätigung aller Kritik an der Kommunikationsstruktur des Verfahrens [erweist]« (Jung 1996, S. 412). Camus habe den Prozess offensichtlich bewusst als »absurdes Theater« konzipiert. Die hier kurz resümierten juristischen »Einlassungen« zu Camus ergänzen im günstigen Fall die literaturwissenschaftliche Hermeneutik, offenbaren aber auch eine »deutsche« Sicht der Dinge, eine »deutsche« Einstellung zu Rechts- und Lebensfragen, die möglicherweise kollidieren mit dem algerisch-kolonialen Rechtssystem und der Sanktionspraxis in den 30er Jahren, die Albert Camus als junger »FranÅais d’Alg¦rie« hautnah erlebt hat.
10.
Kurzer Ausblick
Ist es erlaubt, in einem panoramatischen Überblick über die Camus-Rezeption in Deutschland nicht auch seine Kritiker, ja Feinde – hier im Westen – zu Wort kommen zu lassen? Der früh einsetzende Nachruhm und die seit dem tragischen Unfalltod 1960 immer wieder bekräftigte Aktualität seines Werkes haben bis heute Ansätze des Vergessens gar nicht erst aufkommen lassen, und eine organisierte Opposition von Camus-Gegnern ist bis heute nicht zustande gekommen, was auch daran liegen kann, dass ihr Chefideologe Jean-Paul Sartre seit 1980 als Wortführer ausfiel. Es ist ja kein Geheimnis, dass die meisten Camus-Kritiker = Gegner »Sartrianer« waren oder noch sind. In die erste Phase der deutschen Camus-Rezeption nach 1945 fallen einige kritische Kommentare von Walter Heist, einem E.-R. Curtius-Schüler, der in den Frankfurter Heften und in der Deutschen Universitätszeitung thematische und künstlerische Schwächen in einigen Werken zu erkennen glaubte, die er als bekennender »Sartrianer« dennoch fair und vorurteilsfrei formulierte: »Albert Camus und der Neofaschismus« (1953) – wieder abgedruckt in Schlettes Sammelband 1975 (S. 15 – 27); »L’Equivoque politique« im Sammelband von Thieberger (1962) – die deutsche Fassung erschien wenig später in den Frankfurter Heften (1963); »Das Fragwürdige an Albert Camus. Über den politischen Aspekt seines Werkes.« – nachgedruckt ebenfalls in Schlettes Sammelband 1975 (S. 158 – 175).
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
433
Allenfalls eine kurze Erwähnung verdient das polemisch-gehässige Pamphlet gegen Camus, das die Süddeutsche Zeitung in ihrer Feuilletonbeilage am Wochenende 8./9. Juni 1996 dem Essayisten und Frankreichkritiker Lothar Baier gestattet hat: »Sankt Albert. Der Mythos von Camus’ Größe – vom Entstehen einer modernen Heiligenlegende.« Dem eingefleischten »Sartrianer«, der aus seiner Abneigung gegenüber Camus keinen Hehl macht, muss es schwerfallen, ohne gemeine Hintergedanken etwas Positives über den guten Menschen von Lourmarin zu schreiben. Es lohnt sich, dem die Würdigung Camus’ entgegenzuhalten, die ein anderer Frankreichkenner, Karl-Heinz Götze, im FAZ-Magazin vom 25. November 1988 verfasst hat: »Auf der Suche nach Albert Camus.«, eine persönliche Liebeserklärung an Lourmarin, das stille Dorf in der Provence, wo er hoffentlich begraben bleibt und nicht den Weg in den Ruhmestempel der Nation antreten muss. Es ist von einer »Renaissance« Camus’ in den achtziger Jahren die Rede gewesen; von einer »Wiederbelebung«, einem »Neubeginn« in den neunziger Jahren. Gewiss: Es gab temporäre Schwankungen in seiner Wahrnehmung und Wertschätzung, wenn z. B. wichtige Kanonisierungsinstanzen wie die Schule, die Lehrerausbildung u. a. wegbrechen. Heinz Robert Schlette, der Altmeister der deutschen Camus-Forschung, betonte dennoch immer wieder »die außerordentlich große Wirkung, die nach wie vor von dem Werk Camus’ ausgeht« (Schlette 1995, S. 5). Schon in der Einleitung zu seiner Pionierleistung Wege der Forschung von 1975 war er von der »bleibenden Aktualität der Camusschen Position und Fragestellung« überzeugt (1975, S. 8). Kein Romanist oder Literaturwissenschaftler, sondern Philosophieprofessor und Theologe hier in Bonn, veröffentlichte er die ersten Aufsätze über Camus »den Philosophen«, Camus den »Denker der Freiheit« zwischen 1959 und 1961 in der Zeitschrift Hochland, einer seit 1946 wieder erscheinenden katholisch orientierten Kulturzeitschrift. Seitdem hat er zahlreiche Aufsätze über Camus mit überwiegend philosophischtheologischer Thematik veröffentlicht und Sammelbände herausgegeben, die auf Tagungen, Kolloquien, Akademien usw. beruhen, die er selbst organisiert hat: Helenas Exil (1991); Die Gegenwart des Absurden (1992); Der Sinn der Geschichte von morgen (1995); Mein Reich ist von dieser Welt (2000). Es würde zu weit führen, alle Camus-Veröffentlichungen von Heinz Robert Schlette hier aufzuführen. Aber er ist einer der wenigen deutschen Camus-Forscher, die auch im Ausland wahrgenommen werden. Er hat es auch hochschuldidaktisch verstanden, für wissenschaftlichen Camus-Nachwuchs zu sorgen, z. B. die bereits erwähnte Sabine Dramm und der durch das Komitee Cap Anamour weltbekannt gewordene Rupert Neudeck, der 1975 in Münster eine Dissertation Die politische Ethik bei Jean-Paul Sartre und Albert Camus eingereicht hat. Heinz Robert Schlette hat in seinen Veröffentlichungen immer wieder auf Missverständnisse und Fehldeutungen gerade in Publikationen seiner eigenen Zunft hingewiesen,
434
Franz Rudolf Weller (Bonn)
insbesondere wiederholt die Frage gestellt, »ob und inwiefern die Camus-Rezeption, speziell die deutsche, einseitig, ja irreführend verlaufen ist« (Schlette 1995, S. 15). Fachwissenschaftlich und -didaktisch kann sich die deutsche Camus-Forschung sehen lassen, wenn es auch unbestreitbar Themen und Aspekte des Werkes gibt, die bisher vernachlässigt worden sind: der politische Camus; der frühe algerische Camus; die Tagebücher, der Briefwechsel sowie die journalistischen Arbeiten. In seinem Beitrag »Remarques sur la r¦ception des id¦es politiques de Camus en RFA.« für den von Jeanyves Gu¦rin herausgegebenen Kongressband Camus et la politique (1985) hieß es lapidar »qu’il n’existe pas de r¦ception des id¦es politiques de Camus en RFA et a fortiori en RDA« (Schlette 1967, S. 61). Gewiss: Vieles ist bisher nicht ins Deutsche übersetzt worden; anderes erst durch die neue vierbändige Pl¦iade-Ausgabe bekannt und leicht zugänglich geworden, mit einem sehr informativen Kommentarteil der Equipe von zehn Mitherausgebern. Eine wenig bekannte (vielleicht auch unterdrückte) Seite, die Leben und Werk Camus’ mitbestimmenden libertär-republikanischen, anarcho-syndikalistischen Ideen und Aktivitäten hat Lou Marin in einer umfassenden Studie aufgearbeitet: Ursprung und Revolte. Albert Camus und der Anarchismus (1998), mit einem gut dokumentierten Überblick im Kapitel »Rückkehr zum Ursprung der Revolte. Camus und der Anarchismus in der internationalen und deutschsprachigen Camus-Rezeption« (S. 177 – 237). Ist Albert Camus tatsächlich »der Philosoph der Stunde« (Radisch) – in einem allgemeinen Wortsinn verstanden? Nicht nur die großen Forschungstitel, die spezialisierten internationalen Kongresse, die akademischen Gesellenstücke konstituieren die weltliterarische Berühmtheit Camus’, sondern ein literatursoziologisches Phänomen der Moderne: das breitenwirksame Rezeptionsinstrument des Taschenbuchs in Verbindung mit den Vertriebsstrategien von Großverlagen. Camus ist in Frankreich wie in Deutschland der erfolgreichste Taschenbuchliterat. Es kommt hinzu, was die deutsche Rezeption betrifft, dass er nicht nur – in Übersetzung – gelesen wird; die literaturdidaktisch beliebte Gattung »EINFÜHRUNG« ist im Falle Camus’ auffällig stark vertreten: Der in der Reihe »Große Denker« des Beck-Verlags erschienene Albert Camus von Annemarie Pieper ist leider vergriffen. Eine aktualisierte Neuausgabe sollte die Basler Philosophieprofessorin ins Auge fassen. Brigitte Sändigs noch bei Reclam (Leipzig) erschienene Einführung in Leben und Werk (1983; 21988; 31992) ist vergriffen. Ihre Darstellung Camus’ in der Reihe »rowohlts monographien« (1995c) liegt seit 2000 in einer 3. überarbeiteten Neuausgabe vor. Sie galt als Nachfolgerin der außerordentlich erfolgreichen »bildmonographie« von Morvan Lebesque aus dem Todesjahr von Albert Camus (1960; 26 Nachdrucke bis 1995). Eine besondere Erwähnung verdient der in der Reihe »dtv portrait« er-
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
435
schienene Band Albert Camus von Marie-Laure Wieacker-Wolff (2003). Auf zwei einfachere, schlicht nacherzählende Biografien soll wenigstens hingewiesen werden: Paris, Algier – Die Lebensgeschichte des Albert Camus (1991; 21998) von Heiner Feldhoff und Albert Camus zur Einführung (1999) von Asa A. SchillingerKind. Schließlich ist auch erwähnenswert, dass die beiden voluminösen CamusBiografien von Lottman und Todd 1986 bzw. 1999 in deutscher Übersetzung bzw. Bearbeitung bei Rowohlt erschienen sind. Man darf darauf gespannt sein, wie das Gedächtnis des 100. Geburtstags von Albert Camus im Jahre 2013 in Deutschland wahrgenommen wird.
Anmerkung Die Werke Camus’ wurden in der Regel nach der neuen vierbändigen Pl¦iadeAusgabe (2006, 2008) zitiert (Sigel: Pl I, II, III, IV + Seitenangabe); in wenigen Ausnahmefällen nach der älteren zweibändigen Ausgabe (1962, 1965) mit dem Sigel Pl Essais z. B.
Nachtrag Im Anschluss an meinen Vortrag verwies die Potsdamer Kollegin Brigitte Sändig auf eine Publikation aus 2008, die ich hier in Abschnitt 9 leider nicht mehr berücksichtigen konnte: Albert Camus. Der Fall. Mit Kommentaren von Brigitte Sändig und Sven Grotendiek. Berliner Wissenschaftsverlag (Reihe: Juristische Zeitgeschichte Abt. 6. Recht in der Kunst – Kunst im Recht, Bd. 34).
Literaturverzeichnis Albes, Wolf-Dietrich (1990): Albert Camus und der Algerienkrieg. Diss. Augsburg. Tübingen: Niemeyer. Baier, Lothar (1996): »Sankt Albert. Der Mythos von Camus’ Größe – Vom Entstehen einer modernen Heiligenlegende«. Süddeutsche Zeitung. SZ am Wochenende Nr. 130, 8./ 9. Juni. Balz, Heinrich (1970): Aragon, Malraux, Camus. Korrektur am literarischen Engagement. Stuttgart: Kohlhammer. Barrera-Vidal, Albert (1963): Der Stil von Albert Camus. Diss. Frankfurt/M. Bastian Amor, Gabriele (1973): Das Absurde und die Autonomie des Ästhetischen bei Albert Camus. Diss. Berlin. Bertrand, FranÅoise (1999): »Bonjour les amis und Bonjour, chers amis. Frankreich in den Lehrwerken für den Französischunterricht der DDR.« In: Röseberg (Hrsg.), 135 – 172.
436
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Bieber, Konrad (1954): L’Allemagne vue par les ¦crivains de la R¦sistance franÅaise. Genf: Droz. Bollnow, Otto Friedrich (1962): Maß und Vermessenheit des Menschen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Bondy, FranÅois (1946): »Albert Camus und die Welt des Absurden.« Schweizer Annalen 3, 150 – 159. Bondy, FranÅois (1968): »Albert Camus’ Gegenwart.« Universitas 11, 1157 – 1162. Brockmeier, Peter (1975): »Revolte und Resignation. Zum Werk Albert Camus’.« In: Bürger, Peter (Hrsg.): Vom Ästhetizismus zum Nouveau Roman. Versuche kritischer Literaturwissenschaft. Frankfurt/M.: Athenaion, 92 – 120. Buber, Martin (1975): Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten. Bd. III: 1938 – 1965. Heidelberg: Lambert Schneider. Camus, Albert. L’Húte. Le premier Homme. Extraits d’un roman inachev¦. Hrsg. v. Karl Stoppel (2008). Stuttgart: Reclam. (Fremdsprachentexte) Celan, Paul (2000): Gesammelte Werke. 4. Band: Übertragungen I. Zweisprachig. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Char, Ren¦ (1959): Po¦sies/Dichtungen. Ed. J.P. Wilhelm. Frankfurt/M.: Fischer. Coenen-Mennemeier, Brigitta (1963): »Erzähler und Welt in L’Etranger von Albert Camus.« Praxis des neusprachlichen Unterrichts 10, 143 – 149. Coenen-Mennemeier, Brigitta (1966): »Die Demonstration des Absurden. Camus’ Caligula.« In: Dies.: Einsamkeit und Revolte. Französische Dramen des 20. Jahrhunderts. Dortmund: Lensing, 42 – 79. Coenen-Mennemeier, Brigitta (1997): »Das Mysterium der Armut. Dichtung und Wahrheit bei Albert Camus.« In: Schumacher, Ferdinand (Hrsg.): Albert Camus. Der erste Mensch. Literarische, philosophische und religiöse Aspekte. Beiträge der Akademie Franz Hitze Haus. Münster, 6 – 17. Corbic, Arnaud (2003): Camus et Bonhoeffer. Rencontre de deux humanismes. GenÀve: Labor et Fide. Di M¦glio, Ingrid (1975): Antireligiosität und Kryptotheologie bei Albert Camus. Diss. Saarbrücken: Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann. Dramm, Sabine (1998): Dietrich Bonhoeffer und Albert Camus: Analogien im Kontrast. Diss. Bonn 1997. Gütersloh: Kaiser/Gütersloher Verlagshaus. Dröge, Christoph (1991): »Wieder gelesen: ein ›freier Europäer‹ im Widerstand. Albert Camus: Briefe an einen deutschen Freund.« Dokumente 47, H. 3, 227 – 232. Enzensberger, Hans Magnus (1957): Verteidigung der Wölfe. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Feldhoff, Heiner (1991): Paris, Algier – Die Lebensgeschichte des Albert Camus. Weinheim/Basel: Beltz & Gelberg (2. Aufl. 1998). Fricke, Dietmar (1983): »Die Literatur der R¦sistance und Kollaboration im Französischunterricht. Die Neueren Sprachen 82 Teil I, 2, 130 – 150; Teil II, 5/6, 425 – 458. Gay-Crosier, Raymond (1976): Camus. Erträge der Forschung, Bd. 60. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Gerritsen, Sylvia/Ragi, Tariq (1998): Pour une Sociologie de la r¦ception: Lecteurs et lectures de l’œuvre d’Albert Camus en Flandre et aux Pays-Bas. Paris/Montr¦al: L’Harmattan. Grimm, Reinhold (1986): »›La Cause‹ allemande de ›L’Etranger‹. De Leonhard Frank Albert Camus.« Etudes germano-africaines (Dakar) 4, 111 – 126. Detailliertere Fas-
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
437
sung: »Die deutsche Ursache des Camusschen Fremden.« Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 30 (1986), 594 – 639. Grünwald, Werner (1955): Zum Problem des Mordes in der zeitgenössischen französischen Literatur, insbesondere im Rahmen des Existentialismus. Diss. Tübingen. Guyard, Marius-FranÅois (1965): La Litt¦rature compar¦e. Pr¦face de Jean-Marie Carr¦. Paris (»Que sais-je?« No 499). Heidelberger, Ernst (1947): »Schwarzes Theater. Le Malentendu. Caligula.« Umschau 2, 442 – 449. Heist, Walter (1953): »Albert Camus und der Nachfaschismus.« Frankfurter Hefte 8, 296 – 303. Wieder abgedruckt in Schlette 1975, 15 – 27. Heist, Walter (1956): »Die Tragödie Camus. Vom kurzen Atem eines Moralisten: La Chute.« Deutsche Universitätszeitung 15/16, 26 – 27. Heist, Walter (1963): »Das Fragwürdige an Albert Camus. Über den politischen Aspekt seines Werkes.« Frankfurter Hefte 18, 19 – 29. Wieder abgedruckt in Thieberger unter dem Titel »L’Equivoque politique« 1963, 125 – 144 u. in Schlette 1975, 158 – 175. Heitmann, Klaus (1983): »Camus’ Fremder ein Identifikationsangebot für junge Leser? Ein empirisches Rezeptionsprotokoll.« Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 7, 3/4, 487 – 506. Heller, Gerhard (1982): In einem besetzten Land. NS-Kulturpolitik in Frankreich. Erinnerungen 1940 – 1944. Köln: Kiepenheuer & Witsch. Hirdt, Willi (1974): »La Mort heureuse von Albert Camus.« Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen CCXI, 334 – 349. Hirdt, Willi (1976): »Camus, L’Húte. Jonas ou L’Artiste au travail.« in: Krömer, Wolfram (Hrsg.): Die französische Novelle: Düsseldorf: Bagel, 272 – 290; 378 – 380. Hirdt, Willi (1979): »›La Maison mauresque‹ und ›Le Livre de M¦lusine‹ von Albert Camus.« In: Lauble, Michael (Hrsg.): Der unbekannte Camus. Zur Aktualität seines Denkens. Düsseldorf: Patmos 13 – 35. Hoffmeister, Barbara (Hrsg.) (2003): Albert Camus. Ein Lesebuch mit Bildern. Reinbek: Rowohlt. Holdheim, Wolfgang W. (1969): Der Justizirrtum als literarische Problematik. Vergleichende Analyse eines erzählerischen Themas. Berlin: de Gruyter. Jeschke, Hans (1952): »Albert Camus. – Bild einer geistigen Existenz.« Die Neueren Sprachen NF 1, 459 – 473. Jung, Heike (1996): »Betrachtungen zum Prozess gegen den Fremden.« In: Mölk (Hrsg.), 406 – 416. Jurt, Joseph (1997): »Albert Camus et l’Alg¦rie.« In: Ders. (Hrsg.): Alg¦rie – France – Islam. Paris/Montr¦al: L’Harmattan, 97 – 109. Kaiser, Gerhard R. (2005): »Symbolische Konstruktion des Deutschen: Albert Camus, Lettres un ami allemand.« Literaturwissenschaftliches Jahrbuch 46, 277 – 301. Kaschnitz, Marie Luise (1971): »Der Fremde von Camus.« In: Dies.: Zwischen Immer und Nie. Gestalten und Themen der Dichtung. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 212 – 220. Knust, Herbert (1971): »Camus’ Malentendu und Doderes ›Zwei Lügen‹.« Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 208, 23 – 34. Küchler, Walter (1949): »Caligula.« Neuphilologische Zeitschrift 1, 17 – 24. Kohlhase, Norbert (1965): Dichtung und politische Moral. Eine Gegenüberstellung von Brecht und Camus. München: Nymphenburger Verlagshandlung (Diss. Berlin).
438
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Korn, Karl (1949): »Allegorien der Existenz. Zu Romanen von Camus (La Peste) und Kasack (Stadt hinter dem Strom).« Merkur 3, 90 – 97. Krauss, Hennig (1970): »Zur Struktur des Etranger.« Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 80, 210 – 229. Krings, Hermann (1953): »Albert Camus oder die Philosophie der Revolte.« Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 62, 347 – 358. Lauble, Michael (Hrsg.) (1979): Der unbekannte Camus. Zur Aktualität seines Denkens. Düsseldorf: Patmos. Lauble, Michael (1984): Sinnverlangen und Welterfahrung. Albert Camus’ Philosophie der Endlichkeit. Diss. Mainz 1983. Düsseldorf: Patmos. Lausberg, Heinrich (1962): Das Stück Les Justes von Albert Camus. Interpretationen dramatischer Dichtungen, Bd. I. München: Hueber. Lebesque, Morvan (1960): Albert Camus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. (rowohlts monographien 50). Reinbek: Rowohlt. Lepper, Marcel (2003): »›Bien entendu, je ne vous ai pas dit mon vrai nom‹. Negative Theologie und Arbeit am Mythos bei Albert Camus.« Germanisch-Romanische Monatsschrift 53, 4, 463 – 475. Lottman, Herbert (1986): Camus. Eine Biographie. Reinbek: Rowohlt (Gekürzte Übersetzung des amerikanischen Originals). Lubrich, Oliver (2008): »Über die Grenze der Bedeutung. Albert Camus in NaziDeutschland.« In: Blaschke, Bernd et al. (Hrsg.): Umwege: Ästhetik und Poetik exzentrischer Reisen. Bielefeld: Aisthesis, 227 – 248. Lüders, E.M. (1949/50): »Über den Umgang mit Heiden.« Stimmen der Zeit 146, 180 – 190. Lüders, E.M. (1950/51): »Alles oder nichts. Zur Weltansicht Albert Camus’.« Stimmen der Zeit 147, 105 – 117. Mairhofer, Elisabeth (1999): Das Absurde und die Würde des Menschen: Albert Camus’ Denken im rechtsphilosophischen Zusammenhang. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft). Marin, Lou (1998): Ursprung der Revolte. Albert Camus und der Anarchismus. Heidelberg: Verlag Graswurzelrevolution. Marsch, Wolf-Dieter (1973): Philosophie im Schatten Gottes. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn. Massin, Rolf (1972): Das »oui« und das »non«. Eine Untersuchung über Affirmationen und Negationen im Werk von Albert Camus. Diss. Münster. Mennemeier, Franz Norbert (1961): »Albert Camus. Sisyphus und der neue Humanismus, Die Tragödie der Gerechten.« In: Ders.: Das moderne Drama des Auslandes. Düsseldorf: Bagel, 193 – 217. Mölk, Ulrich (1996): »Der Prozess gegen den Fremden.« In: Ders. (Hrsg.): Literatur und Recht. Literarische Rechtsfälle von der Antike bis in die Gegenwart. Göttingen: Wallstein, 395 – 405. Mönch, Walter (1965): »Albert Camus: Ein Versuch zum Verständnis seines dramatischen Werkes.« Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 75, 289 – 308. Mots de passe. (1995) Lese- und Übungsbuch für die Sekundarstufe II. Hrsg. v. A. Schumann, H. Schwartz, S. Vogel. Frankfurt/M.: Diesterweg. Münz, Erwin K. (1950): »Albert Camus, der Afrikaner.« Begegnung 5, 179 – 183.
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
439
Neudeck, Rupert (1975): Die politische Ethik bei Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Diss. Münster 1973. Bonn: Bouvier Herbert Grundmann. Neudeck, Rupert (1976): »Wider das ›Goldene Kalb des Realismus‹. Die politische Wirksamkeit des Albert Camus.« Frankfurter Hefte 31, H. 10, 57 – 64. Noyer-Weidner, Alfred (1960): »Albert Camus im Stadium der Novelle.« Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur 70, 1 – 38. Noyer-Weidner, Alfred (1963): »Absurdität und Epik als ästhetisches Problem in Camus’ Etranger.« Annales Universitatis Saraviensis. Abt. Philosophie. X, 257 – 295. Noyer-Weidner, Alfred (1975): »Albert Camus. L’Etranger.« In: Heitmann, Klaus (Hrsg.): Der französische Roman vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Bd. 2. Düsseldorf: Bagel, 239 – 260. Noyer-Weidner, Alfred (1980): »Structure et sens de L’Etranger.« In: Gay-Crosier (Hrsg.): Albert Camus 1980. Second International Conference February 21 – 23, 1980 The University of Florida Gainesville. Gainesville: Univ. Presses of Florida, 72 – 86. Paepcke, Fritz (1958): »Der Atheismus in der Sicht von Albert Camus.« Eckart-Jb. 27, 278 – 283. Wieder abgedruckt in Schlette (Hrsg.) 1975, 45 – 54. Paepcke, Fritz (1960): »Albert Camus und der Friede.« Eckart-Jb. 29, 7 – 21. Wieder abgedruckt (mit leichten Veränderungen) in Schlette (Hrsg.) 1975, 88 – 115. Pelz, Manfred (1961): Das Novellenwerk von Albert Camus. Form und Problemdarstellung. Diss. Tübingen. Pelz, Manfred (1970): »Albert Camus: Le Ren¦gat. Die Funktion des Innenmonologs.« Die Neueren Sprachen 9, 462 – 472. Pelz, Manfred (1973): Die Novellen von Albert Camus. Interpretationen. Freiburg: Becksmann. Pfeiffer, Johannes (1969): Sinnwidrigkeit und Solidarität. Beiträge zum Verständnis von Albert Camus. Berlin: Verlag DIE SPUR Herbert Dorbrandt. Pfeil, Ulrich (2004): Die »anderen« deutsch-französischen Beziehungen. Die DDR und Frankreich 1949 – 1990. Köln (u. a.): Böhlau. Pieper, Annemarie (1984): Albert Camus. München: Beck. Pieper, Annemarie (1991): »Camus und Nietzsche.« In: Schlette/Klehr (Hrsg.), 63 – 78. Pieper, Annemarie (Hrsg.) (1994): Die Gegenwart des Absurden. Studien zu Albert Camus. Tübingen/Basel: Francke. Politzer, Heinz (1959): »Der wahre Arzt. Franz Kafka und Albert Camus.« Monat 1, 3 – 13. Pollmann, Leo (1961): »Albert Camus und das literarische Phänomen des Schweigens.« Die Neueren Sprachen 11, 524 – 533. Pollmann, Leo (1967): Sartre und Camus. Literatur und Existenz. Stuttgart: Kohlhammer (2. Aufl. 1971). Pollmann, Leo (1974): »Trivialroman und Kunstroman.« Neusprachliche Mitteilungen 27, 101 – 110. Radisch, Iris (2009): »Der Zeitgenosse unserer Träume.« DIE ZEIT Nr. 1, 30.12. 1972. Rath, Matthias (1984): Albert Camus. Absurdität und Revolte: eine Einführung in sein Werk und die deutsche Rezeption. Frankfurt/M.: Haag & Herchen. Rehbein, Jürgen (1978): Albert Camus. Vermittlung und Rezeption in Frankreich. Über Bedingungen literarischen Erfolgs. Diss. Düsseldorf 1975. Heidelberg: Winter. Rings, Guido (2000): »Der konditionierte Fremde. Anmerkungen zu Selbst- und Fremd-
440
Franz Rudolf Weller (Bonn)
betrachtungen in Camus’ L’Etranger.« Germanisch-Romanische Monatsschrift 50, 479 – 500. Rauer, Monika (2005): Interkulturelle Aspekte im Schaffen von Albert Camus: Der Spanienbezug. Wien: LIT Verlag. Rauhut, Franz (1957): »Albert Camus oder Vom Nihilismus zu Maß und Menschenliebe.« Deutschland-Frankreich. Ludwigsburger Beiträge zum Problem der deutsch-französischen Beziehungen. Bd. II, 189 – 205. Wieder abgedruckt in Thieberger 1963, 17 – 40 (französische Fassung). Risterucci-Roudnicky, Danielle (1999): France – RDA. Anatomie d’un transfert litt¦raire 1949 – 1990. Bern u. a.: Lang. Röseberg, Dorothee (Hrsg.) (1999): Frankreich und »Das andere Deutschland«. Analysen und Zeitzeugnisse. Tübingen: Stauffenburg. Röseberg, Dorothee (2008): »Ici la France – eine transnationale Stimme in den Gründerjahren der DDR.« In: Oster, Patricia/Lüsebrink, Hans-Jürgen (Hrsg.): Am Wendepunkt. Deutschland und Frankreich um 1945 – Zur Dynamik eines ›transnationalen‹ kulturellen Feldes. Bielefeld: transcript verlag, 261 – 282. Roloff, Volker (1986): »Der Mörder als Erzähler : Existentialismus und Intertextualität bei Sartre, Camus, Cela und Sbato.« Romanische Zeitschrift für Literaturgeschichte 10/ 1 – 2, 197 – 218. Rühling, Alfred (1974): Negativität bei Albert Camus. Eine wirkungsgeschichtliche Analyse des Theodizeeproblems. Diss. Münster. Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann. Sändig, Brigitte (1983): Albert Camus. Eine Einführung in Leben und Werk. 2. Aufl. 1988; 3. Aufl. 1992. Leipzig: Reclam. Sändig, Brigitte (Hrsg.) (1986): Albert Camus, Zwischen Ja und Nein. Frühe Schriften. 2. Aufl. 1992. Leipzig/Weimar : Kiepenheuer. Sändig, Brigitte (1989): »Se taire, parler, agir dans la pens¦e de Camus.« Beiträge zur Romanischen Philologie XXVIII, 73 – 76. Sändig, Brigitte (1991): »Maß und Maßlosigkeit: Die beiden Versionen des CaligulaDramas.« In: Schlette/Kehr (Hrsg.), 43 – 61. Sändig, Brigitte/Graupner, Rainer (Hrsg.) (1991): Ich revoltiere, also sind wir. Albert Camus – 40 Jahre »Der Mensch in der Revolte«. Berlin 1991. Sändig, Brigitte (1992): »Andr¦ Gide in der früheren DDR.« In: Siepe, H.T./Theis, R. (Hrsg.): Andr¦ Gide und Deutschland. Düsseldorf: Droste, 233 – 239. Sändig, Brigitte (1993): »Albert Camus: La Mort heureuse (1938) – Mit einem Ausblick auf L’Etranger (1942).« In: Reichel, E./Thoma, H. (Hrsg.): Zeitgeschichte und Roman im Entre-deux-guerres. Bonn: Romanistischer Verlag, 209 – 219. Sändig, Brigitte (1994): »Zwei oder drei Fremde. Berührungspunkte zwischen Camus’ L’Etranger und Christoph Heins Der fremde Freund.« In: Pieper, Annemarie (Hrsg.), 37 – 51. Sändig, Brigitte (1995a): »Camus’ Geschichte von Europas Hochmut.« In: Klein, Wolfgang/Naumann-Beyer, Waltraud (Hrsg.): Nach der Aufklärung? Beiträge zum Diskurs der Kulturwissenschaften. Berlin: Akademie Verlag, 171 – 179. Sändig, Brigitte (1995b): »Constant und Camus und die absolute Macht.« Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 19, 82 – 97.
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
441
Sändig, Brigitte (1995c): Albert Camus. rowohlts monographien. 3. überarb. Neuausgabe 2000. Reinbek: Rowohlt. Sändig, Brigitte (1996): »Camus und sein erster Lehrer.« Neue Sammlung 36, 217 – 222. Sändig, Brigitte (1997): »Camus und Algerien – ›Erster Mensch‹ oder ›Gast‹?« In: Klehr, Franz/Schlette, Heinz Robert (Hrsg.): Der Camus der fünfziger Jahre. Stuttgart, 83 – 94. Sändig, Brigitte (1998): »Der Krieg ist aus. Das Ende der Pest/des Krieges bei Camus und Fühmann.« In: Schlette (Hrsg), 115 – 134. Sändig, Brigitte (1998): »Zweimal algerische Kolonialgeschichte – Kateb Yacine: Nedjma, Albert Camus: Le premier Homme.« In: Arend, Elisabeth/Kirsch, Fritz Peter (Hrsg.): Der erwiderte Blick. Literarische Begegnungen und Konfrontationen zwischen den Ländern des Maghreb, Frankreich und Okzitanien. Würzburg: Königshausen & Neumann, 29 – 38. Sändig, Brigitte (1999): »Camus im Deutschland des Jahres 1945.« Dokumente 55, H. 3, 229 – 235. Sändig, Brigitte (1999): »R¦ception de l’œuvre de Camus en R.D.A.« Camus 18. La r¦ception de l’œuvre de Camus en U.R.S.S. et en R.D.A. La Revue des Lettres modernes. Paris/Caen: Minard, 39 – 60. Sändig, Brigitte (2000): »…etwas Stärkeres als alle Rechtsprechung« – Camus und die Todesstrafe.« Orientierung 64, 215 – 219. Sändig, Brigitte (Hrsg.) (2000): Camus im Osten. Zeugnisse der Wirkung Camus’ zu Zeiten der Teilung Europas. Potsdam: Universitätsbibliothek. Sändig, Brigitte (2000): »Marie, Martha, la mÀre – Die Frauengestalten Camus’.« In: Schlette/Herzog (Hrsg.), 89 – 106. Sändig, Brigitte (2003): »Reflets de Camus dans deux ¦critures allemandes: Günter Grass et Christoph Hein.« In: Brodziak, Sylvie et al. (eds.): Albert Camus et les ¦critures du XXe siÀcle. Arras: Artois Presses Universit¦, 229 – 238. Sändig, Brigitte (2004): »Wahrheitsstreben als Kulturleistung oder : Camus’ Rolle für den Osten.« In: Jünke, Claudia/Zaiser, Rainer/Geyer, Paul (Hrsg.): Romanistische Kulturwissenschaft. Würzburg: Königshausen & Neumann, 245 – 255. Sändig, Brigitte (2004): Albert Camus. Autonomie und Solidarität. Würzburg: Königshausen & Neumann. (Die meisten hier einzeln, vor 2004 erschienenen Arbeiten sind in diesem Sammelband wieder abgedruckt). Sändig, Brigitte (2006): »L’immunit¦ envers la ›pens¦e captive‹.« In: Spiquel, AgnÀs/ Schaffner, Alain (eds.): Albert Camus: l’exigence morale. Hommage Jacqueline L¦viValensi. Paris: Le Manuscrit, 245 – 257. Scheel, Hans Ludwig (1973): »Zur Bedeutung der griechischen Mythologie bei Albert Camus.« In: Heitmann, Klaus/Schroeder, E. (Hrsg.): Renatae Literae. Studien zum Nachleben der Antike und zur europäischen Renaissance. FS August Buck. Frankfurt/ M.: Athenäum, 299 – 317. Schillinger-Kind, Asa A. (1999): Albert Camus zur Einführung. Hamburg: Junius. Schimmang, Jochen (1993): »Der zärtliche Gleichgültige. Zur Renaissance von Albert Camus.« Merkur 47, 542 – 550. Schlette, Heinz Robert (Hrsg.) (1975): Wege der deutschen Camus-Rezeption. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Schlette, Heinz Robert (1980): Albert Camus – Welt und Revolte. Freiburg/München: Karl Alber.
442
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Schlette, Heinz Robert (1986): »Remarques sur la r¦ception des id¦es politiques de Camus en RFA.« In: Gu¦rin, Jeanyves (ed.): Camus et la politique. Actes du Colloque de Nanterre 5 – 7 juin 1985. Paris: L’Harmattan, 61 – 67. Schlette, Heinz Robert/Klehr, F.-J. (Hrsg.) (1991): »Helenas Exil.« Albert Camus als Anwalt des Griechischen in der Moderne. Stuttgart: Akademie der Diözese Rottenburg. (Hohenheimer Protokolle. 36). Schlette, Heinz Robert (1995): »Der Sinn der Geschichte von morgen.« Albert Camus’ Hoffnung. Frankfurt/M.: Josef Knecht. (= Sammlung eigener Arbeiten [9]) Schlette, Heinz Robert (Hrsg.) (1998): Erkenntnis und Erinnerung. Albert Camus’ PestChronik. Interpretation und Aktualität. Bonn: Djre. Schlette, Heinz Robert (1999): »Rejoindre les Grecs: Griechen und Christen bei Albert Camus.« Jahrbuch für Antike und Christentum 42, 5 – 19. Schlette, Heinz Robert/Herzog, Markwart (Hrsg.) (2000): »Mein Reich ist von dieser Welt.« Das Menschenbild Albert Camus’. Stuttgart: Kohlhammer. Schloetke-Schröer, Christa (1963): »Pathetische Grundzüge im literarisch-philosophischen Werk von Sartre und Camus.« Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur LXXIII, 17 – 50. Schlüter, Gisela (1990): »Kalkulierte Konfession. Camus’ La Chute im Kontext.« Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 23, H. 1 – 2, 133 – 143. Schmidhäuser, Eberhard (1992): Vom Verbrechen zur Strafe. Albert Camus’ ›Der Fremde‹. Ein Weg aus der Absurdität menschlichen Daseins. Heidelberg: Müller Juristischer Verlag. Schmidt (d.i. Sändig), Brigitte (1974): »Hauptetappen der literarischen Entwicklung Albert Camus’ unter besonderer Berücksichtigung des Rezeptionsaspektes.« Beiträge zur Romanischen Philologie XIII, H. 1 – 2, 127 – 159. Schmidt (d.i. Sändig), Brigitte (1975): »Albert Camus’ Auffassung von der Funktion der Kunst und des Künstlers.« Beiträge zur Romanischen Philologie XIV, H. 2, 259 – 279. Schneider, Peter (1962): »Maß und Gerechtigkeit: Zu Albert Camus’ Rechts- und Staatsauffassung.« Festgabe für Carlo Schmid zum 65. Geburtstag. Tübingen: J.C. Mohr, 171 – 191. Wieder abgedruckt in: Thieberger 1963, 101 – 124 (frz. Übersetzung) u. in Schlette 1975, 132 – 157. Schoell, Konrad (1998): »Un thÀme de la nouvelle contemporaine: l’aporie de l’artiste.« Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 22, 3 – 4, 391 – 403. Siepe, Hans T. (2008): »Besetztes Paris, besetztes Deutschland – ein doppelter Blick von Albert Camus.« In: Oster, Patricia/Lüsebrink, Hans-Jürgen (Hrsg.): Am Wendepunkt. Deutschland und Frankreich um 1945 – Zur Dynamik eines ›transnationalen‹ kulturellen Feldes. Bielefeld: transcript verlag, 153 – 166. (Jahrbuch des Frankreichzentrums der Universität des Saarlandes. Bd. 7). Sloterdijk, Peter (2008): Theorie der Nachkriegszeiten. Bemerkungen zu den deutschfranzösischen Beziehungen seit 1945. Frankfurt/M.: suhrkamp. Sprissler, Manfred (Hrsg.) (1988): Albert Camus – Konkordanz zu den Romanen und Erzählungen. 2 Bde. Hildesheim/New York: Olms. Stammerjohann, Harro (1976): »Kohärenz und Delimitation: Zur Struktur des Absatzes (am Beispiel von Camus’ Le Mythe de Sisyphe).« Folia Linguistica 9, 367 – 392. Steinbrügge, Lieselotte: »L’Etranger von Albert Camus. Über die Haltbarkeit eines Schulklassikers.« Lendemains 33, Nr. 130 – 131, 77 – 93.
Aspekte der Camus-Rezeption in Deutschland nach 1945
443
Stuby, Gerhard (1965): Recht und Solidarität im Denken von Albert Camus. Diss. Freiburg. Frankfurt/M.: Klostermann. Stucky, Willy (1980): Friedrich Hölderlin und Albert Camus. Zur Verwandtschaft zentraler Gedanken eines schwäbischen »Theologen« des ausgehenden 18. Jahrhunderts und eines franco-algerischen Agnostikers des 20. Jahrhunderts. Diss. Zürich. Zürich: ADAG Administration & Druck AG. Süsskind, Alexander J. (1969): »Hölderlin et Camus.« Revue de Litt¦rature compar¦e 4, 489 – 504. Theis, Raimund (1958): »Albert Camus’ Rückkehr zum Sisyphus.« Romanische Forschungen 70, 66 – 90. Thieberger, Richard (1959): »Albert Camus, sein Werk und sein Künstlertum.« Universitas 14, 21 – 30. Thieberger, Richard (1960): Albert Camus. Eine Einführung in sein dichterisches Werk. Frankfurt/M.: Diesterweg (Beiheft 8 der Neueren Sprachen). Thieberger, Richard (Hrsg.) (1963): Configuration critique d’Albert Camus II. Camus devant la critique de langue allemande. Paris: M.J. Minard. Lettres Modernes. Thieberger, Richard (1964): »Albert Camus seit seinem Tod.« Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur. 74, H. 2, 130 – 145. Thomas, Sven (2004): »Mandant und Verteidiger. Eine Skizze anhand des Romans ›Der Fremde‹ von Albert Camus.« Neue Juristische Wochenschrift H. 9, 555 – 559. Timm, Uwe (1971): Das Problem der Absurdität bei Albert Camus. Diss. München. Hamburg: Hartmut Lüdke. Timm, Uwe (2005): Der Freund und der Fremde. Eine Erzählung. Köln: Kiepenheuer & Witsch. Todd, Olivier (1996): Albert Camus, une vie. Paris: Gallimard. ¦d. revue 1999. Trageser-Rebetez, FranÅoise (1995): Die Symbolik von Licht und Schatten bei Albert Camus. Paradigmenanalyse im Spannungsfeld der Polarität Natur – Geschichte. Diss. Köln. GenÀve: Droz. Utermark, Gisela (1991): »Der Französischunterricht in der ehemaligen DDR.« französisch heute 22/1, 1 – 11. Vosgerau, Ulrich (2000): »Normalität und Willensfreiheit als rechtsnotwendige Fiktionen: rechtstheoretische Aspekte in Albert Camus’ L’Etranger.« Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ArSp) 86, 232 – 251. Weinrich, Harald (1971): Tempus. Besprochene und erzählte Welt. 2. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer. Weller, Franz Rudolf (2000): »Literatur im Französischunterricht heute. Bericht über eine größere Erhebung zum Lektüre-›Kanon‹.« französisch heute 31, 138 – 159. Weller, Franz Rudolf (2005): Albert Camus. L’Etranger. Guide p¦dagogique. Dokumentation der Erfolgsgeschichte eines »Schulklassikers«. Materialien und didaktische Analysen. Braunschweig: Diesterweg. Wellershoff, Dieter (1963): Der Gleichgültige. Versuche über Hemingway, Camus, Benn und Beckett. Köln: Kiepenheuer & Witsch. Wieacker-Wolff, Marie-Laure (2003): Albert Camus. dtv portrait: München: Dt. Taschenbuch Verlag. Witt, Maren (1996): »Albert Camus und die Intertextualität. ›Le Mythe de Sisyphe‹ und ›La Pierre qui pousse‹.« französisch heute 27/1, 29 – 35.
444
Franz Rudolf Weller (Bonn)
Wittmann, Heiner (2002): Albert Camus. Kunst und Moral. Frankfurt/M.: Peter Lang. Zima, Peter V. (1980): »Indifferenz und verdinglichte Kausalität: Albert Camus’ ›L’Etranger‹.« Germanisch-Romanische Monatsschrift 61, 169 – 190. Zima, Peter V. (1983): Der gleichgültige Held. Textsoziologische Untersuchungen zu Sartre, Moravia und Camus. Stuttgart: Metzler. Ziolkowski, Theodore (1960): »Camus in Germany, or the Return of the Prodigal Son.« Yale French Studies 25, 132 – 137. Zoll, Rainer (1962): Der absurde Mord in der modernen deutschen und französischen Literatur. Diss. Frankfurt/M.
Maurice Weyembergh (Bruxelles)
Camus et Dostoïevski. La Légende du Grand Inquisiteur et ses interprétations
Dans le cadre du pr¦sent colloque, »Camus revisit¦«, je voudrais revenir sur les rapports combien complexes et divers que Camus entretient avec l’¦crivain russe. Mon expos¦ sera divis¦ en deux parties. Dans la premiÀre, l’introduction, je rappellerai quelques ¦l¦ments de ces rapports, sans aucunement viser Þtre exhaustif. Dans la seconde, plus ¦tendue, j’analyserai l’interpr¦tation que propose Camus de la »L¦gende du Grand Inquisiteur« dans L’Homme r¦volt¦ et la comparerai quelques autres interpr¦tations qui me semblent topiques, celles de Max Weber, de Romano Guardini, de Hannah Arendt, de Ren¦ Girard et la discussion sur la th¦ologie politique et l’apocalypse entre Carl Schmitt et Jacob Taubes1. Avant de passer la premiÀre partie, une remarque qui doit rester pr¦sente l’esprit tout au long de l’expos¦: Dostoevski est chr¦tien et croyant, habit¦ par la figure du Christ et ses possibles imitations, tourment¦ par les problÀmes th¦ologiques, par exemple par le problÀme du mal et de l’immortalit¦; Camus est incroyant et agnostique, chr¦tien culturel, sensible au sacr¦, surtout de conception hell¦nique, mais r¦ceptif au problÀme du mal; la figure du Christ l’¦meut profond¦ment, il le dit et le r¦pÀte et fait de sa mÀre »un Muichkine ignorant«2, en somme une »figura Christi«, mais il ne croit pas l’immortalit¦ et la r¦surrection. A cela s’ajoute qu’ l’¦poque du Mythe de Sisyphe et de la logique de l’absurde, il note que si certains personnages de Dostoevski sont absurdes, comme Ivan dans Les FrÀres Karamazov, Kirilov ou Stavroguine dans Les Poss¦d¦s, ses ouvrages ne le sont pas, car l’auteur choisit en d¦finitive pour des 1 Je n’ai pas inclus l’ouvrage de Nicolas Berdiaev sur Dostoevski, Dostoievski. An Interpretation (Sheed and Ward, London, 1936; je n’ai pu disposer de la traduction franÅaise, L’Esprit de Dostoevsky, St-Michel, Paris, 1929), dont l’avant-dernier chapitre est consacr¦ la l¦gende, pour des raisons d’espace. Camus a lu attentivement le livre et en a not¦ des extraits dans ses Carnets en 1954 au moment o¾ il travaillait l’adaptation des Poss¦d¦s (IV, p. 1183 – 1184, 1198). On trouvera les textes de Berdiaev not¦s par Camus p. 29, 42 – 43, 136 – 137, 150, 166 de la version anglaise. 2 IV, Le Premier homme, p. 931. Et p. 925: »Sa mÀre est le Christ«.
446
Maurice Weyembergh (Bruxelles)
personnages positifs, par exemple pour le starets Zosime ou pour Aliocha dans Les FrÀres Karamazov. Camus remarque, la suite de Gide3, que mÞme si Dostoevski semble avoir eu plus de peine ¦crire les parties positives de ses romans que les parties n¦gatives et si celles-ci semblent moins fortes, il finit du cút¦ affirmatif4. Vu de l’absurde en effet, tel que Camus le comprend, le point d’arriv¦e de Dostoevski est paradoxal: Kirilov et Stavroguine, personnages absurdes5, se suicident, alors que la logique absurde exclut pr¦cis¦ment le suicide. Le Camus ult¦rieur, critique de la logique absurde, acceptera mieux certaines conclusions de l’¦crivain russe: le nihilisme des poss¦d¦s peut conduire au suicide et il invite certainement au meurtre.
I.
Introduction6
Dostoevski est pr¦sent aussi bien dans les essais que dans la fiction, et des moments charniÀres de ces ¦crits. Cette pr¦sence de l’¦crivain russe d’ailleurs est tellement pr¦gnante que Camus a fini par se mettre son service: il a adapt¦ Les Poss¦d¦s la scÀne. A cette occasion, il s’est exprim¦ sur les raisons de son admiration7. Je traiterai fort briÀvement les grands essais, les fictions principales et l’adaptation en me limitant rappeler ce qui me semble indispensable la mise en perspective de la »L¦gende du grand Inquisiteur«. Dans Le Mythe de Sisyphe, Camus illustre la »cr¦ation absurde« partir de Dostoevski, essentiellement partir de l’analyse de l’attitude de Kirilov dont il r¦duit le raisonnement qui mÀne au »suicide logique«, un syllogisme classique: »Si Dieu n’existe pas, Kirilov est dieu. Si Dieu n’existe pas, Kirilov doit se tuer. Kirilov doit donc se tuer pour Þtre dieu«8. Kirilov ne croit pas l’existence de Dieu et la r¦surrection et prend la place laiss¦e vacante. Mais il ne peut montrer qu’il est dieu qu’en manifestant sa libert¦ (son ind¦pendance) souveraine et seul son suicide est mÞme d’en administrer la preuve: il devient ainsi l’homme-dieu. Par son suicide »p¦dagogique«9, il ouvre la voie la libert¦ humaine: »Kirilov se sacrifie donc«10. 3 Voir I, la note * p. 296. L’¦tude de Gide est intitul¦e Dostoevski et fut publi¦e en 1923. Elle est reprise dans Essais critiques, Gallimard, Pl¦iade, Paris, 1999, p. 559 – 655. La remarque sur la polygamie se trouve la page 607. 4 I, 294 – 296; il le r¦pÀte plus tard, IV, p. 545; voir Gide, Dostoevski, p. 637 – 638. 5 »Kirilov est donc un personnage absurde – avec cette r¦serve essentielle cependant qu’il se tue« (I, p. 292). 6 Pour plus de d¦tails, voir le livre de Peter Dunwoodie, Une Histoire ambivalente: le dialogue Camus-Dostoevski (Nizet, Paris, 1996), qui comprend aussi une biographie (p. 235 – 240). 7 IV, p. 536 – 552, 589 – 591. 8 I, p. 292. 9 I, p. 293.
Camus et Dostoïevski
447
Le traitement que Camus r¦serve Kirilov est bref et clarifiant mais au premier abord seulement, car la complexit¦ et l’opacit¦ du personnage sont ¦vacu¦es. L’analyse de Gide dans Dostoevski que Camus connat, puisqu’il s’y r¦fÀre, est beaucoup plus ¦labor¦e – elle est ¦videmment plus longue – et met notamment l’accent sur le rapport de Kirilov au temps et au bonheur, qui est en quelque sorte le rapport au Royaume de Dieu, sur la relation entre le dieu-homme et l’hommedieu, sur le lien entre le sacrifice de Kirilov et celui de J¦sus11. Camus est n¦anmoins sensible la relation du prince Muichkine au temps: »Malade, ce dernier vit dans un perp¦tuel pr¦sent, nuanc¦ de sourires et d’indiff¦rence et cet ¦tat bienheureux pourrait Þtre la vie ¦ternelle dont parle le prince«12, ce que Gide souligne d’ailleurs ¦galement13. Le thÀme g¦n¦ral de L’Homme r¦volt¦ s’inscrit dans le prolongement de la probl¦matique de Dostoevski, mÞme si la solution apport¦e par l’¦crivain franÅais, les valeurs d¦couvertes dans l’acte de la r¦volte, lui est personnelle. Ce thÀme g¦n¦ral est r¦sum¦ par les notions de r¦volte, de nihilisme et d’orgueil et leurs cons¦quences, le meurtre justifi¦ id¦ologiquement, le terrorisme, la lutte pour le pouvoir, au besoin en instituant le chaos, l’autod¦ification de l’homme. Tout cela au nom de l’homme nouveau, de sa grandeur ou de son bonheur. Ivan est le prototype du r¦volt¦ et Guardini intitule d’ailleurs le chapitre qu’il lui consacre »Empörung«14 ; les poss¦d¦s, les ¦lÀves de Stepan Trophimovitch, qu’anime une admiration sans borne pour Stavroguine, sont les prototypes des terroristes venir : Piotr Trophimovitch, le fils de Stepan, est responsable du meurtre de Chatov, ce qui renvoie au meurtre de l’¦tudiant Ivanov par Netchaiev. Camus intitule d’ailleurs un chapitre de L’Homme r¦volt¦ »Trois poss¦d¦s«, dans lequel il analyse le comportement et la pens¦e de Pisarev, Bakounine et Netchaiev. L’¦crivain franÅais voit dans le devenir de la r¦volte et de la r¦volution une perversion laquelle il tente de trouver une solution, alors que pour Dostoevski r¦volte et r¦volution sont par essence vou¦es la destruction: vouloir remplacer le dieu-homme par l’homme-dieu ne peut mener qu’ la catastrophe. Je rappelle combien le thÀme du nihilisme est central dans l’essai de Camus et que sa derniÀre section s’intitule »Au-del du nihilisme«15. 10 11 12 13 14
I, p. 293. Dostoevski, p. 623 – 625, 640 – 643, 647 – 650. I, p. 295. Dostoevski, p. 623, 640 – 641. Religiöse Gestalten in Dostojewskis Werk. Studien über den Glauben, Matthias Grünewald Verlag, Mainz; Verlag Ferdinand Schoningh, Paderborn, 1989, p. 129 – 179. Le titre original ¦tait Der Mensch und der Glaube. Versuche über die religiöse Existenz in Dostojewskis großen Romanen, Hegner, Leipzig, 1933. L’ouvrage a ¦t¦ traduit en franÅais sous le titre L’Univers religieux de Dostoevski (Seuil, Paris, 1947) et Camus y renvoie d’ailleurs dans ses Carnets en 1954 (IV, p. 1184). Le chapitre »Empörung« est traduit par »Les r¦volt¦s« (p. 125 – 171). 15 III, p. 320 – 324. »Pour moi, Dostoevski est d’abord l’¦crivain qui, bien avant Nietzsche, a su
448
Maurice Weyembergh (Bruxelles)
Quelques mots sur la fiction. L’Etranger, on l’a dit, est, comme Les FrÀres Karamazov, un roman policier qui se termine au tribunal avec les plaidoiries de l’accusation et de la d¦fense. Je signale que Nabokov dans ses Lectures on Russian Literature16 est fort peu respectueux de Dostoevski et plutút m¦prisant pour le genre. On a montr¦ que l’auteur de L’Etranger connaissait fort bien le texte de l’¦crivain russe17. Meursault, dont Camus a dit dans la pr¦face l’¦dition universitaire am¦ricaine L’Etranger, qu’il ¦tait »le seul christ que nous m¦ritions«18, vit au ras des sensations, un peu comme le prince Muichkine. Est-ce la condition, en mÞme temps que le refus de mentir, pour Þtre proche du Royaume de Dieu? Je rappelle que dans une version ant¦rieure du roman, c’¦tait le prince qui tuait Nastasia Philippovna et non Rogojine. J’ajoute que Dmitri Karamazov est accus¦ du meurtre de son pÀre et d’insensibilit¦ son ¦gard, comme Meursault est accus¦ par le procureur d’avoir tu¦ moralement sa mÀre19. De La Peste je rappellerai simplement qu’il s’agit d’un roman polyphonique, pour reprendre l’expression de Bakhtine, dans la mesure o¾ diff¦rents points de vue sur les ¦v¦nements sont confront¦s les uns aux autres, par exemple ceux de Rieux, Tarrou, de Rambert, de Grand, du pÀre Paneloux, etc. et que les dialogues entre ces points de vue constituent, avec le d¦veloppement du fl¦au, la dynamique de la chronique. On peut se demander si le propos de Dostoevski d’essayer »de repr¦senter un homme absolument excellent« (lettre sa niÀce Ivanova du 1/13 janvier 1868)20 dans L’Idiot – et cela dans le prolongement de l’exemple du Christ – ne trouve pas un ¦cho dans l’id¦al de Tarrou d’arriver la »saintet¦ sans Dieu«. Je reviendrai sur ce problÀme de la repr¦sentation de la bont¦ propos des commentaires de Hannah Arendt. Quant La Chute, la technique litt¦raire utilis¦e – le monologue qui donne au lecteur le sentiment d’un dialogue et le cút¦ inattendu voire surprenant et saugrenu du personnage principal et de ses saillies – n’est pas sans ressemblance avec le Sous-sol de Dostoevski21. Gide considÀre ce petit ¦crit de l’¦crivain russe
16 17 18 19 20 21
discerner le nihilisme contemporain, le d¦finir, pr¦dire ses suites monstrueuses, et tenter d’indiquer les voies du salut« (IV, »Pour Dostoevski«, p. 590). Berdiaev note ce propos: »Nihilism has appeared among us because we are all nihilists«, wrote Dostoievski in his diary, and it is this nihilism that he probed to the bottom, a nihilism, I repeat, that is only an inverted apocalypsism« (op. cit., p. 17). Weidenfeld and Nicolson, London, 1982, p. 131 – 132. Voir P. Dunwoodie, op. cit., »D’un procÀs l’autre«, p. 35 – 80. I, p. 216. Alors que le juge charg¦ de l’instruction l’appelle »monsieur l’Ant¦christ« (I, p. 182). I, p. 200. Introduction de Pierre Pascal L’Idiot, Les Carnets de L’Idiot, Humili¦s et offens¦s, Pl¦iade, Gallimard Paris, 2004 (19531), p. XIV. Comme pr¦d¦cesseurs dans cette tentative, Dostoevski cite CervantÀs (Don Quichotte), Dickens (Le Pickwick) et Hugo (Jean Valjean). Et plus largement avec les ¦crits qu’on classe sous la rubrique de L’Homme souterrain, qui comprend aussi Le Double et Le RÞve d’un homme ridicule.
Camus et Dostoïevski
449
comme peut-Þtre le sommet de son art22. Chestov, dont Camus analyse la pens¦e dans Le Mythe de Sisyphe, en a fait le pivot de son analyse dans Les R¦v¦lations de la mort23. Girard dans Mensonge romantique et v¦rit¦ romanesque et surtout dans Critique dans un souterrain lui consacre beaucoup de place24 : le triste h¦ros est le prototype du mim¦tisme rivalitaire et, en somme, au sein de ce que l’auteur appelle la »m¦diation interne«, de l’homme moderne. Il pr¦figure certains aspects de Clamence. De l’adaptation des Poss¦d¦s la scÀne, qui a demand¦ tellement de travail Camus, je me contenterai de dire que celui-ci souligne, comme Nabokov25, combien le roman est d¦j, de par ses dialogues et les rencontres constantes de plusieurs personnages – Bakhtine dirait par son cút¦ polyphonique et carnavalesque – presque du th¦tre26. En pr¦sentant son adaptation, l’¦crivain franÅais note: »On a longtemps cru que Marx ¦tait le prophÀte du XXe siÀcle. On sait maintenant que sa proph¦tie a fait long feu. Et nous d¦couvrirons que le vrai prophÀte ¦tait Dostoevski. Il a proph¦tis¦ le rÀgne des Grands Inquisiteurs et le triomphe de la puissance sur la justice«27.
II.
La légende du Grand Inquisiteur
L’analyse des propos d’Ivan et de la l¦gende, se situe dans la partie consacr¦e la r¦volte m¦taphysique, plus pr¦cis¦ment dans la section de L’Homme r¦volt¦ intitul¦e »Le refus du salut«. Ivan se r¦volte au d¦part non contre le cr¦ateur mais contre sa cr¦ation o¾ des Þtres innocents, les enfants, sont condamn¦s souffrir et mourir. Au nom de la justice, il r¦cuse cette cr¦ation, mÞme si la souffrance est le prix qu’il faut payer pour l’immortalit¦ et les b¦atitudes de l’au-del. Au nom de la justice donc, il refuse le salut ou la grce et il maintient ce refus mÞme s’il a tort. Son problÀme, note Camus, est alors de savoir comment vivre sa r¦volte, comment s’y comporter, car si Dieu est rejet¦ et finalement ni¦, il n’y a plus de fondement au jugement moral ou la justice, »Tout est permis«, et la haine que les frÀres Karamazov ¦prouvent l’¦gard de la vilenie de leur pÀre est justifi¦e. Ivan laissera Smerdiakov tuer son pÀre et s’absentera pour faciliter le meurtre, quitte 22 Dostoevski, p. 612, 631. 23 Paris, Plon, 1923. Selon Chestov, Dostoevski aurait reÅu de l’Ange de la mort une autre vision que la vision naturelle, vision nouvelle qui »forme le thÀme de la Voix souterraine« (p. 16). 24 Respectivement: Grasset, Pluriel, Paris, 1978 (19611), p. 56 – 67, 289 – 302; Grasset, Livre de Poche, 1983 (19761; la partie consacr¦e Dostoevski avait ¦t¦ publi¦e ant¦rieurement chez Plon en 1963), p. 54 – 74. 25 Nabokov parle en fait des romans de Dostoevski en g¦n¦ral (op. cit., p. 104, 130) 26 IV, p. 537, 541. 27 IV, »Albert Camus nous parle de son adaptation des Poss¦d¦s«, IV, p. 536.
450
Maurice Weyembergh (Bruxelles)
se sentir coupable d’avoir laiss¦ agir Smerdiakov, ¦prouver du remords tout en ¦tant furieux d’y Þtre sensible: il sombrera dans la maladie, la »fiÀvre chaude«, aura des hallucinations o¾ il lui semblera se disputer avec le diable. Selon Camus, Ivan sombrera dans la folie. On ne sait, en fait, s’il survivra. C’est au cours d’une conversation avec Aliocha qu’Ivan lui raconte l’histoire du Grand Inquisiteur qui doit illustrer, contre la foi du frÀre cadet, sa r¦volte. Les deux chapitres o¾ les propos d’Ivan sont rapport¦s sont intitul¦s respectivement »R¦volte« et »Le Grand Inquisiteur« et ils figurent dans le livre V de la deuxiÀme partie, dont le titre n’est pas par hasard, »Pro et contra«. L’argument du poÀme lui-mÞme est bien connu: J¦sus revient S¦ville au XVIe siÀcle, est reconnu et bien accueilli par les habitants, mais arrÞt¦ par le Grand Inquisiteur qui exerce l’autorit¦ dans la ville. Le moment dramatique est le monologue de l’Inquisiteur qui s’est rendu dans la cellule o¾ J¦sus est d¦tenu et lui reproche d’avoir prÞch¦ aux hommes une libert¦, celle de distinguer entre le bien et le mal28, qui d¦passe la plupart d’entre eux et de les avoir rendus malheureux en exigeant trop d’eux. Comme le dit Camus, J¦sus n’est pas sensible l’exigence d’Ivan, »Tous ou personne«, et au rejet de l’aristocratisme de la libert¦. En refusant de succomber aux tentations de l’Esprit du Mal, qui lui avait propos¦ jadis au d¦sert le miracle, le mystÀre et l’autorit¦ pour assurer son pouvoir, J¦sus choisit contre le bonheur du grand nombre qui se contente du pain de la terre et n’a que faire du pain du ciel. Dans le poÀme, J¦sus reste silencieux mais finit par embrasser l’Inquisiteur qui, plutút que de le faire brler, le laisse quitter la ville en lui disant: »Va-t-en et ne reviens plus … plus jamais !«29. Cette expression devra nous retenir. Camus commente: »Ce sont les Grands Inquisiteurs qui emprisonnent le Christ et viennent lui dire que sa m¦thode n’est pas la bonne, que le bonheur universel ne peut s’obtenir par la libert¦ imm¦diate de choisir entre le bien et le mal, mais par la domination et l’unification du monde. Il faut r¦gner d’abord, et conqu¦rir. Le royaume des cieux viendra, en effet, sur terre, mais les hommes y r¦gneront, quelques-uns d’abord qui seront les C¦sars, ceux qui ont compris les premiers, et tous les autres ensuite, avec le temps. L’unit¦ de la cr¦ation se fera, par tous les moyens, puisque tout est permis. Le Grand Inquisiteur est 28 Berdiaev consacre tout un chapitre (op. cit, p. 67 – 88) l’analyse de la notion de libert¦ qui joue chez l’¦crivain russe un rúle central. Ivan, le Grand Inquisiteur et tous les contempteurs de Dieu et du Christ r¦cusent la libert¦ de choisir entre le bien et le mal, qui cause en effet des souffrances, et lui substituent la volont¦ individuelle, l’auto-affirmation qui mÀne prendre la place de Dieu, l’autod¦ification. Une telle volont¦ tourne l’obsession, par exemple sur le plan individuel, chez Kirilov, qui est pourtant une espÀce de »saint without grace« (p. 81), et d¦truit la personnalit¦ et la spiritualit¦. Le Grand Inquisiteur et Chigalev d¦truisent la libert¦ sur le plan collectif et la remplacent au nom du bonheur par la contrainte et la n¦cessit¦. L’homme-dieu qui usurpe la place du dieu-homme est l’Ant¦christ. 29 Les FrÀres Karamazov, p. 284.
Camus et Dostoïevski
451
vieux et las, car sa science est amÀre… Il a piti¦, une piti¦ froide, de ce prisonnier silencieux que l’histoire d¦ment sans trÞve… Le prisonnier, depuis lors, a ¦t¦ ex¦cut¦«30.
Dans le roman, le livre Vo¾ figure la l¦gende et o¾ Aliocha r¦pond son frÀre »Ton poÀme est un ¦loge de J¦sus et non un blme…«31, appelle le livre suivant intitul¦ »Un religieux russe« et qui est une biographie du starets Zosime et de son enseignement rassembl¦ par Aliocha. Cette biographie constitue en quelque sorte une r¦ponse aux propos critiques d’Ivan. Avant de passer d’autres interpr¦tations, il me semble clarifiant d’indiquer les points o¾ les diff¦rences d’accent sont susceptibles de se manifester. Le lieu religieux ou politique occup¦ par le commentateur, sa vision du monde et ses outils conceptuels balisent ¦videmment sa perception du texte. Les interprÀtes lisent aussi autrement les relations entre les personnages, soit qu’ils privil¦gient les relations entre J¦sus et le Grand Inquisiteur, soit celles existant entre Ivan et Aliocha, soit celles qui lient Ivan, J¦sus et le Grand Inquisiteur. Camus souligne que dans la relation d’Ivan Aliocha l’an¦ reste sur le plan de la pens¦e et de la sp¦culation, alors que si le cadet perdait la foi, il se ferait socialiste: Aliocha a l’esprit pratique et est tourn¦ vers l’action. La pens¦e d’Ivan, appliqu¦e l’action, inspirera la r¦volution c¦sarienne que l’¦crivain franÅais condamne. Camus ne se prononce pas sur le christianisme qu’Ivan et le Grand Inquisiteur imputent J¦sus, mais il me semble ¦vident qu’il approuve la libert¦ qui mÀne la difficile tche de distinguer le bien et le mal. Quant la vision g¦n¦rale sous-jacente L’Homme r¦volt¦, Camus considÀre que le XIXe siÀcle a abandonn¦ la grce (le salut) au nom de la justice, mais que le XXe s’est retrouv¦ la fois sans grce et sans justice32. J’en viens Max Weber qui ¦voque la l¦gende dans sa fameuse conf¦rence de 1920 Politik als Beruf33. Le climat est celui de la d¦faite allemande et pour certains d’un subit pacifisme que le sociologue juge politiquement irresponsable. La politique a des exigences propres qui doivent Þtre prises en compte par celui qui choisit d’en faire. Le cadre g¦n¦ral de la r¦flexion w¦b¦rienne est celui de la rationalisation sp¦cifique au monde occidental et du d¦senchantement, la fameuse Entzauberung, qui l’accompagne. Weber a distingu¦ ainsi deux formes de rationalit¦, la Wertrationalität et la Zweckrationalität, la rationalit¦ axiologique 30 III, p. 112. 31 Les FrÀres Karamazov, p. 282. 32 »Comment vivre sans la grce, c’est la question qui domine le xixe siÀcle. »Par la justice«, ont r¦pondu tous ceux qui ne voulaient pas accepter le nihilisme absolu… La question du xxe siÀcle, dont les terroristes de 1905 sont morts et qui d¦chire le monde contemporain, s’est peu peu pr¦cis¦e: comment vivre sans grce et sans justice?« (III, L’Homme r¦volt¦, p. 255). 33 In Gesammelte politische Schriften, herausgegeben von J. Winckelmann, Mohr (Siebeck), Tübingen, 1958 (19201), p. 493 – 548; Le M¦tier et la vocation d’homme politique, dans Le Savant et le politique. Introduction par Raymond Aron, Plon, Paris, 1959, p. 99 – 185.
452
Maurice Weyembergh (Bruxelles)
et la rationalit¦ finale, et deux types d’¦thique, la Gesinnungsethik et la Verantwortungsethik, l’¦thique de la conviction et l’¦thique de la responsabilit¦. L’¦thique de la responsabilit¦ tient compte des valeurs qui inspirent les actes, des moyens qui permettent de r¦aliser les buts choisis, mais aussi des cons¦quences: elle est prÞte modifier jusqu’ un certain point ses actes pour ¦viter des cons¦quences qui seraient catastrophiques et en contradiction avec les buts poursuivis. L’¦thique de la conviction est une ¦thique de la puret¦, qui respecte avant tout les valeurs qui inspirent l’action et impute les cons¦quences n¦gatives la bÞtise, l’irrationalit¦ morale du monde. J’ajoute que Weber qui est d’origine protestante et huguenote par sa mÀre et l’auteur d’une sociologie des religions c¦lÀbre, se disait religiös unmusikalisch. Et qu’il pratiquait et exigeait des hommes de sciences la Wertneutralität, la neutralit¦ axiologique. Son commentaire sur la l¦gende se situe l’int¦rieur de l’¦thique de la conviction et de sa conception du charisme propre au virtuose religieux: J¦sus est pour lui l’exemple par excellence de la personnalit¦ charismatique, du virtuose religieux. Le Grand Inquisiteur a ¦t¦ un tel virtuose, mais il ne peut plus supporter les exigences de l’¦thique de la conviction qui l’inspirait jusque l. Il s’est rendu compte que du bien, par exemple de la libert¦, peut sortir le mal, la souffrance: Weber appelle ce fait »die ethische Irrationalität der Welt«, l’irrationalit¦ ¦thique du monde. Cette d¦couverte pousse le Grand inquisiteur et souvent le Gesinnungsethiker, qui est »kosmisch-ethischer Rationalist« et croit donc que du bien ne peut sortir que le bien et du mal le mal, la r¦volte34. En somme, le Grand Inquisiteur reproduit le comportement d’Ivan: en renonÅant la saintet¦, l’aristocratisme du virtuose religieux, il accepte le mal et le cynisme pour rendre les hommes heureux. Pens¦e en termes politiques, la difficult¦ est la suivante: l’¦thique de la conviction qui n¦glige les cons¦quences risque de mener l’irresponsabilit¦, l’¦thique de la responsabilit¦ qui se soucie par trop des cons¦quences et oublie ses convictions, finit par devenir ¦thique du succÀs, Erfolgsethik. Gide parle bien sr d’Ivan et d’Aliocha, mais, curieusement, il passe sous silence la l¦gende du Grand Inquisiteur elle-mÞme. Le livre de Romano Guardini, Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk. Studien über den Glauben parat dix ans aprÀs celui de Gide. Camus en connat la traduction franÅaise laquelle il renvoie dans ses Carnets, mais il l’a lue bien aprÀs la r¦daction de L’Homme r¦volt¦35. Il a consult¦ le livre lors de l’adaptation des Poss¦d¦s, auquel le sixiÀme chapitre, »Gottlosigkeit« est consacr¦36. Le chapitre pr¦c¦dent analyse Les FrÀres Karamazov37 et sa premiÀre partie traite de la l¦gende du Grand Inquisiteur. 34 35 36 37
Politik als Beruf, p. 541; Le M¦tier et la vocation d’homme politique, p. 174 – 175. Carnets, IV, p. 1184. R. Guardini, op. cit., p. 183 – 261; dans la traduction franÅaise: »Les ath¦es«, p. 173 – 254. R. Guardini, op. cit., p. 129 – 179; dans la traduction franÅaise: 125 – 171.
Camus et Dostoïevski
453
Guardini est un J¦suite et l’on sait – Ivan et Aliocha y font allusion38 – que le Grand Inquisiteur repr¦sente l’Eglise catholique, dont les J¦suites constituent l’arm¦e et le pape le monarque. Guardini qui ne nie pas certains travers de l’organisation catholique que la l¦gende critique, considÀre n¦anmoins que la vision de l’Eglise catholique et surtout la vision qu’a le Grand Inquisiteur de la personnalit¦ et du message du Christ sont tronqu¦es: ses yeux elles sont sp¦cifiques Ivan, c’est-dire un incroyant et un nihiliste. Le Grand Inquisiteur est lui aussi une caricature. Alors que le Christ du r¦cit est coup¦ de la r¦alit¦ et du monde et qu’il ne correspond pas la figure des Evangiles, l’Inquisiteur qui pr¦tend corriger le tir, va trop loin dans le souci exclusif des realia. L’essentiel du contenu de la l¦gende est ailleurs: celle-ci aurait pour tche de r¦v¦ler et de justifier la personnalit¦ d’Ivan et son rapport Dieu39. Le chapitre a d’ailleurs pour titre, je le rappelle, »Empörung«, »Les r¦volt¦s«40. Guardini analyse alors la figure d’Ivan, sa relation d’autres personnages, Smerdiakov surtout, et son rapport trouble au d¦moniaque. Le procÀs fait Rome dans la l¦gende reste la surface des choses41, le sens r¦el du r¦cit est de permettre de comprendre plus profond¦ment l’homme Ivan et les siens, les risques li¦s ses propos, la tentation du mal, ce que Dostoevski appelait la liquidation du dieu-homme au profit de l’homme-dieu. Nous avons vu que Dostoevski voulait repr¦senter la bont¦, »l’homme excellent«, et qu’il s’y est essay¦ avec L’Idiot. Guardini lui consacre un admirable chapitre, »Ein Christussymbol«, »Un symbole du Christ«42, le dernier du livre. L’¦crivain russe note que CervantÀs et Dickens ont tent¦ l’aventure, mais avec une pr¦caution: ils ont rendu leur h¦ros quelque peu ridicule. Dostoevski l’a rendu malade: Guardini, qui fait du prince une figura Christi, remarque qu’un homme ne peut jouer ce rúle sans d¦faillance ou effondrement43. Je vais revenir sur le problÀme de la bont¦. 38 Les FrÀres Karamazov, p. 282 – 283. 39 R. Guardini, op. cit., p. 137; dans la traduction franÅaise: p. 133. 40 »Der Großinquisitor ist Iwan selbst, sofern er die Welt ablehnt und sie Gott aus der Hand abnehmen will, da Er sie falsch gemacht habe, mit dem Anspruch, anders und besser anzuordnen als der Urheber…« (p. 143). »Le Grand Inquisiteur, c’est Ivan lui-mÞme, en tant qu’il repousse le monde et veut l’arracher des mains de Dieu, puisqu’il l’a mal fait, avec la pr¦tention de l’ordonner autrement et mieux que le premier auteur…« (p. 139). 41 Berdiaev considÀre que le Grand Inquisiteur est aussi d’une certaine maniÀre le porte-parole du socialisme et de la r¦volution et il consacre tout un chapitre de son livre au problÀme (»Revolution, Socialism« p. 133 – 159). Les r¦volutions sont des moyens de »corriger la cr¦ation« et comme tels l’œuvre de l’Ant¦christ: l’entreprise mÀne la catastrophe. Dostoevski n’est ni r¦volutionnaire ni contre-r¦volutionnaire au sens traditionnel: »His hostility against revolution was not that of a man with a stale mind who takes some interest or other in the old social organization, but the hostility of an apocalyptic being who takes the side of Christ in his supreme struggle with Antichrist« (p. 135). 42 R. Guardini, op. cit., p. 265 – 310; dans la traduction franÅaise: p. 255 – 301. 43 R. Guardini, op. cit., p. 305 – 307; dans la traduction franÅaise: p. 296 – 299.
454
Maurice Weyembergh (Bruxelles)
C’est dans On Revolution44, o¾ Hannah Arendt s’interroge sur le devenir des r¦volutions et sur les diff¦rences entre les R¦volutions am¦ricaine et franÅaise, qu’elle constate que deux auteurs ont au XIXe siÀcle os¦ mettre en scÀne le retour de J¦sus, Melville de maniÀre indirecte dans Billy Budd et Dostoevski dans la »L¦gende du Grand Inquisiteur«45. Camus et Arendt se connaissaient – je ne reviens pas sur les points qui leur sont communs – et j’ajoute que l’¦crivain franÅais vouait la mÞme admiration Melville qu’ Dostoevski. Arendt situe les deux textes dans le sillage des R¦volutions, de Rousseau et de Robespierre et de l’affirmation de ces derniers que l’homme naturel est bon, que la corruption vient de la soci¦t¦. Melville imagine que Billy Budd, qui n’a ¦t¦ corrompu par aucune soci¦t¦ et est un marin sur le navire command¦ par le capitaine Vere, est la bont¦ naturelle, au-del de toute vertu, laquelle est le r¦sultat de la vie en soci¦t¦. Billy est compromis par Claggart, qui repr¦sente le mal au-del du vice, et contre les insinuations duquel il ne peut se d¦fendre, lui qui ne parle que difficilement et b¦gaye, qu’en lui portant un coup mortel. Le capitaine, qui repr¦sente la vertu, condamne Billy la pendaison, malgr¦ la compassion qu’il ¦prouve son ¦gard: la violence et le meurtre, fussent-ils l’œuvre de la bont¦, n’ont pas leur place dans la soci¦t¦ qui a besoin de rÀgles et d’institutions et n’est pas au-del de la vertu ou du vice. Arendt y lit la r¦ponse de Melville la chimÀre de l’homme naturellement bon: suivre cette hypothÀse, ce ne serait plus Can qui tuerait Abel, mais Abel qui supprimerait Can46. L’interpr¦tation qu’elle propose de la l¦gende repose sur une diff¦rence entre la compassion et la piti¦, sur le rapport donc entre J¦sus et le Grand Inquisiteur. Le charisme de J¦sus est la compassion, le don de souffrir de la souffrance des autres sans rien enlever son caractÀre singulier47; la singularit¦ en est telle qu’elle rend les discours quasi impossibles. L’Inquisiteur ne connat que la piti¦, laquelle ne maintient rien de la singularit¦ de la souffrance et est donc abstraite et g¦n¦ralisable: il est dÀs lors possible d’exalter la piti¦ pour le peuple et d’en faire une arme politique, ce qui est exclu avec la compassion. Arendt parle de la »loquacity of pity«48. J¦sus ¦coute le discours de l’Inquisiteur avec compassion, ce qui explique son silence et qu’il ne r¦ponde que par un geste, un baiser, et non par des mots49. La bont¦ naturelle et la compassion sont incapables de tenir des discours logiques ou argumentatifs. Elles abolissent la distance, le in-between, le Penguin Books, Harmonds Worth, 1984 (19631). On Revolution, p. 82 – 83. Ibidem, p. 87. »To Dostoievski, the sign of Jesus’s divinity clearly was his hability to have compassion with all men in their singularity, that is, without lumping them together into some such entity as one suffering mankind« (p. 85). 48 Ibidem, p. 85. 49 »The intensity of this listening transforms the monologue into a dialogue, but it can be ended only by a gesture, the gesture of the kiss, not by words« (p. 86).
44 45 46 47
Camus et Dostoïevski
455
inter-esse, le lieu des affaires humaines: elles sont donc politiquement non relevantes. Arendt constate que les r¦volutionnaires franÅais ont ¦t¦ beaucoup plus sensibles que les r¦volutionnaires am¦ricains la piti¦: c’est pourquoi ils ont r¦clam¦ l’¦galit¦ et n¦glig¦ la libert¦, alors que les r¦volutionnaires am¦ricains qui disposaient d’un pays neuf et sans aristocratie ont surtout mis l’accent sur la libert¦. Girard a montr¦ dans Mensonge romantique et v¦rit¦ romanesque que Dostoevski a ¦t¦ plus loin que Flaubert, Stendhal ou Proust dans la r¦v¦lation des m¦canismes du mim¦tisme rivalitaire: le sujet ne connat pas, comme Freud le croit, l’objet de son d¦sir, qui doit lui Þtre d¦sign¦ par un modÀle ou un m¦diateur qui dispose, aux yeux du sujet, de la pl¦nitude ontologique ou m¦taphysique. Dans la m¦diation externe, le modÀle est hors d’atteinte: le Christ est par exemple le modÀle imiter, mais son charisme est tel que personne ne le ressent comme rival. Dans la m¦diation interne, typique de la soci¦t¦ d¦mocratique o¾ les Þtres sont en principe ¦gaux, le sujet qui d¦sire le mÞme objet que son modÀle, devient son rival. Dostoevski a d¦crit les m¦canismes de cette rivalit¦ avec une extraordinaire perspicacit¦: le sujet moderne s’imagine Þtre autonome, auto-suffisant, c’est le mensonge romantique, le trompe-l’œil. En r¦alit¦, l’imitation de Stavroguine, dont Girard fait un »messie n¦gatif«, dans Les Poss¦d¦s, est une des clefs du livre50. L’imitation de la vraie transcendance, du dieu-homme, fait place l’imitation d’une fausse transcendance, que Girard appelle la transcendance d¦vi¦e51, le culte de l’homme-dieu auquel Ivan participe et qui mÀne la catastrophe. Camus d¦crit dans L’Homme r¦volt¦ les perversions de la r¦volte et de la r¦volution qui sont autant d’¦tapes sur le chemin de l’autod¦ification de l’homme et de son orgueil. Quant la l¦gende et l’opposition du Grand Inquisiteur J¦sus, Girard y voit comme un redoublement de l’opposition d’Ivan Aliocha (Zosime): lorsque le cadet embrasse l’an¦, comme J¦sus avait embrass¦ l’inquisiteur, Ivan l’accuse d’ailleurs de plagiat52. Au poÀme d’Ivan et au d¦sespoir qu’il exprime correspondent la biographie du starets, son enseignement qu’Aliocha recueille et l’attente de la r¦surrection sur laquelle l’ouvrage se termine. Le silence de J¦sus et le presque silence d’Aliocha manifestent en effet la difficult¦ d’exprimer l’affirmatif, la pens¦e du salut et une vie qui s’oriente l’imitation du Christ: »L’art de l’extrÞme n¦gation est peut-Þtre, (…), le seul art chr¦tien adapt¦ notre temps, le seul digne de lui (…). Dostoevski ne pr¦tend pas ¦chapper au souterrain; il s’y enfonce au contraire, si profond¦ment, que c’est de l’autre cút¦ que lui vient sa 50 Critique dans un souterrain, Grasset, Livre de Poche, 1983, p. 88. »L’homme qui se r¦volte contre Dieu pour s’adorer lui-mÞme finit toujours par adorer l’Autre, Stavroguine«, p. 91. 51 Mensonge romantique et v¦rit¦ romanesque, p. 75 – 79. 52 Les FrÀres Karamazov, p. 286.
456
Maurice Weyembergh (Bruxelles)
lumiÀre«53. Girard fait de la l¦gende le modÀle de l’art de la tentation: dans le roman presque tous les personnages sont des tentateurs d’Aliocha54. Girard insiste d’autre part sur la signification des derniers mots de l’Inquisiteur J¦sus: »Va-t-en et ne reviens plus … plus jamais!«55. Il souligne que les premiers chr¦tiens avaient l’habitude de se saluer avec la formule »Marana Tha«, ce qui en aram¦en signifie »Viens, Seigneur !«, comme dans la premiÀre Eptre aux Corinthiens de Paul, et il ajoute que le dernier texte du Nouveau Testament, L’Apocalypse de Jean, se termine pr¦cis¦ment par cette formule, en grec cette fois56. Dostoevski, qui connat ces textes – Kirilov lit L’Apocalypse et Lebedev la commente dans L’Idiot –, ne pourrait mieux souligner combien le Grand Inquisiteur est loin du message chr¦tien. Berdiaev en fait mÞme l’Ant¦christ57. J’ajoute que la pens¦e de Girard est apocalyptique, mais je ne puis d¦velopper cela ici. Je voudrais terminer l’¦vocation de ces quelques interpr¦tations en pr¦sentant de maniÀre fort brÀve une confrontation retentissante sur la th¦ologie politique. La th¦ologie politique est fort la mode pour le moment en France, mais la confrontation laquelle je fais allusion a eu lieu en Allemagne: il s’agit de la fameuse confrontation entre Carl Schmitt et Jacob Taubes. Schmitt est un des grands juristes et penseurs politiques, se r¦clamant du catholicisme, mais du catholicisme de droite; largement compromis avec le nazisme et l’antis¦mitisme, c’est un personnage trÀs controvers¦, auteur e.a. du c¦lÀbre Der Begriff des Politischen. Taubes est fils de rabbin, d’origine autrichienne, lui-mÞme sp¦cialiste des ¦tudes juives, professeur l’Universit¦ de Berlin, ¦lÀve de Gershom Sholem avec lequel il s’est d’ailleurs disput¦. Il est l’auteur e.a. de Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügung (En Divergent accord)58. Leur correspondance, dont l’histoire est curieuse, doit Þtre incessamment publi¦e. Le choix de cette confrontation montre que le terme de grand Inquisiteur n’a rien perdu de son actualit¦, ce dont t¦moignent deux livres r¦cents, l’un en franÅais de Th¦odore Pal¦ologue, Sous l’Œil du Grand Inquisiteur59, l’autre en allemand, de Alfons Motschenbacher, Katechon oder Großinquisitor? Eine Studie zu Inhalt und Struktur der politischen Theologie Carl Schmitts60. Taubes et Schmitt sont des Apokalyptiker, ils envisagent l’histoire la lumiÀre de sa fin, ce qui explique 53 54 55 56 57
Critique dans un souterrain, p. 130 – 131. Ibidem, p. 129. Les FrÀres Karamazov, p. 284. Critique dans un souterrain, p. 128. Dostoievski. An Interpretation, p. 189. »Dostoievski [, … ,] belonged to the new era that was sensible of change and looked for its religion in the Book of the Apocalypse« (p. 170). 58 Merve Verlag, Berlin, 1987; Rivage Poche, Payot, Petite BibliothÀque, 2003. 59 Le Cerf, Paris, 2004. 60 Tectum Verlag, Marburg 2000.
Camus et Dostoïevski
457
l’»accord« du titre du livre de Taubes, mais, selon lui, le juriste est un apocalyptique de la contre-r¦volution, alors que lui-mÞme est un apocalyptique de gauche, ce qui explique la »divergence« du titre. Et Schmitt, qui d¦sire diff¦rer l’apocalypse, recourt une notion paulinienne, qui a son origine dans la seconde Eptre aux Thessaloniciens, le katechon, terme grec qui signifie ce qui retient, retarde. Un Etat fort, des institutions fortes par exemple sont susceptibles, selon le juriste, de retarder le d¦sordre, le chaos qui selon la tradition accompagne l’apocalypse. Deux citations marqueront bien les diff¦rences: la premiÀre extraite du journal de Schmitt, Glossarium, tenu de 1947 1951, o¾ le juriste dit, comme on pouvait s’y attendre, sa pr¦f¦rence pour le Grand Inquisiteur ; dans la seconde Taubes associe la pens¦e du juriste celle du terrible vieillard de la l¦gende: »Hobbes exprime et fonde scientifiquement ce que le Grand Inquisiteur de Dostoevski fait: rendre l’influence du Christ inoffensive dans le domaine social et politique; d¦sanarchiser le christianisme, lui laisser cependant une fonction l¦gitimante l’arriÀreplan et en tout cas ne pas y renoncer. Un tacticien habile ne renonce rien, moins que ce ne soit totalement inutilisable61«. »J’avais tút d¦j suppos¦ en Carl Schmitt une incarnation du »Grand Inquisiteur« de Dostoevski. En effet, au cours d’une conversation tumultueuse Plettenberg en 1980, il me d¦clara ce qui suit: »Quand on ne saisit pas que le ›Grand Inquisiteur‹ a tout bonnement raison vis--vis des exaltations d’une pi¦t¦ inspir¦e de J¦sus, on n’a pas compris ni ce que signifie l’Eglise ni ce que Dostoevski – contre sa propre conviction – a ›transmis v¦ritablement, contraint et forc¦ par la puissance de la probl¦matique‹«62.
Il est temps de r¦sumer et de conclure. Camus partage avec Guardini et Girard la critique de l’orgueil humain qui mÀne l’autod¦ification. Ivan et le Grand Inquisiteur visent dans cette perspective remplacer le dieu-homme par l’hommedieu. Mais l’¦crivain franÅais n’a pas la foi du J¦suite allemand ou de Girard, mÞme si le problÀme du mal le retient. Avec Arendt, Camus est attentif au devenir des r¦volutions et leurs perversions totalitaires. Il utilise comme elle le mot piti¦ pour caract¦riser l’attitude du Grand Inquisiteur l’¦gard du peuple, mais ne l’oppose pas la compassion ¦prouv¦e par J¦sus. Mais tous deux sont sensibles au rúle politique de l’Inquisiteur et choisissent, la limite, la libert¦ et non l’¦galit¦. Weber analyse l’aide de la l¦gende et dans le cadre de la rationalisation et du d¦senchantement sp¦cifiques l’Occident les antinomies des deux ¦thiques. Sans disposer du cadre conceptuel de Weber, Camus n’ignore pas les antinomies qui 61 Duncker und Humblot, Berlin, 1991, p. 243. »Hobbes spricht aus und begründet wissenschaftlich, was Dostojewskis Großinquisitor tut: die Wirkung Christi im sozialen und politischen Bereich unschädlich machen; das Christentum ent-anarchisieren, ihm aber im Hintergrunde eine gewisse legitimierende Wirkung zu belassen und jedenfalls nicht darauf zu verzichten. Ein kluger Taktiker verzichtet auf nichts, es sei denn restlos unverwertbar«. J’ai traduit moi-mÞme le texte. 62 En Divergent accord, p. 36.
458
Maurice Weyembergh (Bruxelles)
sont attach¦es au conflit des valeurs, ce que Weber appelait la Wertkollision: c’est un des thÀmes de L’Homme r¦volt¦. Schmitt, en qui d’aucuns ont vu l’h¦ritier l¦gitime ou ill¦gitime de Weber, entend, ce qui l’oppose Taubes, retarder l’apocalypse en mobilisant les ressources cat¦chontiques de l’Etat et du droit: ce faisant, il choisit le camp du Grand Inquisiteur, le camp des C¦sars selon Camus, ce que confirme son choix de 1933. Introduire en politique la notion d’apocalypse – Camus r¦cusait ce niveau toute notion de messianisme – ne va pas sans danger : tout choix politique est alors un choix entre Dieu et le diable (l’Ant¦christ) et l’ennemi risque d’Þtre diabolis¦. Ce choix n’est pas confondre avec le choix des valeurs (qui peut Þtre li¦ la politique) dont parle Weber : si ce choix qui r¦sulte des conflits inh¦rents la rationalit¦, peut Þtre tragique et opposer les hommes entre eux et s’il r¦sulte en effet en derniÀre instance d’une d¦cision (Entscheidung), la discussion rationnelle et raisonnable peut accompagner tout le processus jusqu’ la d¦cision. C’est ce qui se passe, comme le rappelle Hermann Lübbe63, au Parlement: on discute jusqu’au moment o¾ l’on vote. En somme, le mystÀre et la fascination de cette fameuse »L¦gende« sont attach¦s, outre son caractÀre dramatique, au fait qu’elle lie de maniÀre inextricable foi et action, th¦ologie et politique, de sorte qu’elle condamne les commentateurs faire de la th¦ologie politique, alors mÞme qu’ils pr¦f¦reraient peutÞtre l’¦viter.
63 »Zur Theorie der Entscheidung«, in Theorie und Entscheidung. Studien zum Primat der praktischen Vernunft, Rombach, Freiburg, 1971, p. 7 – 31.
Die Autoren – Les Auteurs
Rodion Ebbighausen ist Herausgeber, Verleger und freier Journalist in Odenthal. Dorothee Gall ist Professorin für Klassische Philologie (Latein) an der Universität Bonn. Jeanyves Guérin ist Professor für französische Literatur an der Universit¦ Sorbonne Nouvelle. Christoph Hoch ist Lehrer und Fachleiter (Italienisch, Französisch) am Studienseminar Aachen. Willi Jung ist Akademischer Direktor (Französische und Italienische Literaturwissenschaft) an der Universität Bonn. Christoph Kann ist Professor für Philosophie an der Universität Düsseldorf. Michela Landi ist Ricercatrice für französische Literatur an der Universität Florenz. Frank Reza Links ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bonn. Lou Marin ist Buchautor, Übersetzer und Redakteur in Marseille. Helmut Meter ist emeritierter Professor für Romanische Philologie (Französische und Italienische Literaturwissenschaft) an der Universität Klagenfurt. Rupert Neudeck ist promovierter Theologe und Journalist, Gründer des deutschen Not-Ärzte-Komitees Cap Anamur und Vorsitzender von Grünhelme.
460
Die Autoren – Les Auteurs
Hans-Joachim Pieper ist apl. Professor für Philosophie an der Universität Bonn. Anne-Kathrin Reif ist Kulturredakteurin beim Remscheider General-Anzeiger. Pierre-Louis Rey ist emeritierter Professor für französische Literatur an der Universit¦ Sorbonne Nouvelle. Brigitte Sändig ist emeritierte Professorin für Romanische Literatur/Französisch an der Universität Potsdam. Elmar Schmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bonn. Thomas A. Schmitz ist Professor für Klassische Philologie (Griechisch) an der Universität Bonn. B¦n¦dicte vauthier ist Professorin für Spanische Literatur an der Universität Bern. Franz Rudolf Weller ist Honorarprofessor für Fremdsprachendidaktik und Studiendirektor i.R. an der Universität Bonn. Knut Wenzel ist Professor für systematische Theologie/Fundamentaltheologie und Dogmatik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Maurice Weyembergh ist emeritierter Professor für Philosophie an der Universit¦ libre de Bruxelles. Heiner Wittmann ist Koordinator der Internetaktivitäten des Klett Verlages und Lehrbeauftragter an der Universität Stuttgart.
Französische Almanachkultur
Hans-Jürgen Lüsebrink / York-Gothart Mix (Hg.) Französische Almanachkultur im deutschen Sprachraum (1700–1815) Gattungsstrukturen, komparatistische Aspekte, Diskursformen In Zusammenarbeit mit Jan Fickert und Bianca Weyers Deutschland und Frankreich im wissenschaftlichen Dialog, Band 3 318 Seiten gebunden ISBN 978-3-89971-892-8 Dieser Band analysiert das umfassende Korpus französischsprachiger Almanache aus literatur-, kultur- und medienwissenschaftlicher Perspektive. In 13 Einzelstudien wird deutlich, dass es sich bei den auf ein Elitenpublikum zielenden frankophonen Almanachen um inhaltlich breit gefächerte und in genrespezifischer Hinsicht hoch differenzierte, transkulturell orientierte Periodika handelt. Die Untersuchungen dieses frankophonen Alltagsmediums im deutschsprachigen Raum dokumentieren zudem die Mehrsprachigkeit der Aufklärung und offenbaren ein differenziertes Interesse für die Kultur der Nachbarnationen.
Leseproben und weitere Informationen unter www.vr-unipress.de Email: [email protected] | Tel.: +49 (0)551 / 50 84-301 | Fax: +49 (0)551 / 50 84-333




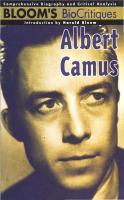

![Albert Camus [1 ed.]
9781780235332, 9781780234939](https://ebin.pub/img/200x200/albert-camus-1nbsped-9781780235332-9781780234939.jpg)


