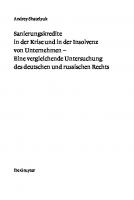Der Steinkohlenbergbau in Boom und Krise nach 1945: Transformationsprozesse in der Schwerindustrie am Beispiel des Ruhrgebiets 9783110729979, 9783110734775
This volume presents the papers from the conference "Coal Mining in Boom and Crisis since 1945: The Ruhr Region as
275 129 1MB
German Pages 226 Year 2021
Inhalt
Die Geschichte des Steinkohlenbergbaus an der Ruhr nach 1945 und ihre Erforschung. Einleitende Bemerkungen
Vom „eigenverantwortlichen Bergmann“ zum „Individualfaktor“. Präventionspraxen der Silikose- und Staubbekämpfung im Ruhrkohlenbergbau 1950–1970
„Richtig Führen im Bergbau“. Zur Verwissenschaftlichung des Steinkohlenbergbaus nach 1945
Grubenwarten ohne ROLF – (K)Eine Automatisierung im britischen und westdeutschen Steinkohlenbergbau?
„Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“ Mikroelektronik, Arbeitsorganisation und die DGB-Gewerkschaften in den 1970er und 1980er Jahren
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“. Die Computerisierung der Druckindustrie und der Wandel der industriellen Beziehungen in transnationaler und lokaler Perspektive
Von der Bergwerksgesellschaft zum diversifizierten Konzern. Die Bergwerksgesellschaft Hibernia AG 1951–1968 – Eine Skizze
Die Organisation des Ruhrkohlen-Absatzes zwischen Alliierter Hoher Kommission und Montanunion aus Sicht des Ruhrbergbaus
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise. Das Fallbeispiel Rheinmetall in vergleichender Betrachtung
Anhang
Abbildungsnachweis
Die Autorinnen und Autoren
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Juliane Czierpka (editor)
- Lars Bluma (editor)
File loading please wait...
Citation preview
Juliane Czierpka, Lars Bluma (Hrsg.) Der Steinkohlenbergbau in Boom und Krise nach 1945
Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum
Band 241
Juliane Czierpka, Lars Bluma (Hrsg.)
Der Steinkohlenbergbau in Boom und Krise nach 1945
Transformationsprozesse in der Schwerindustrie am Beispiel des Ruhrgebiets
Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Nr. 241 = Schriften des Montanhistorischen Dokumentationszentrums, Nr. 41 gefördert von der RAG-Stiftung, Essen
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen stets das generische Maskulinum verwendet. Soweit aus dem Kontext nichts Anderes hervorgeht, sind jedoch immer alle Geschlechter gemeint. Redaktion: Chris Buchholz, Michael Farrenkopf
ISBN 978-3-11-073477-5 e-ISBN (PDF) 978-3-11-072997-9 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-073005-0 ISSN 1616-9212 Library of Congress Control Number: 2021937482 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Coverabbildung: Fördergerüst, Schachthalle und Fördermaschinengebäude des Steinkohlenbergwerks Prosper-Haniel, Schacht 10 (= Prosper V), in Bottrop-Kirchhellen, 1987; Copyright: RAG Aktiengesellschaft (DBM/montan.dok 024901872051) Satz/Datenkonvertierung: bsix information exchange GmbH, Braunschweig Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com
Inhalt Juliane Czierpka, Lars Bluma Die Geschichte des Steinkohlenbergbaus an der Ruhr nach 1945 und ihre Erforschung. Einleitende Bemerkungen 1 Daniel Trabalski Vom „eigenverantwortlichen Bergmann“ zum „Individualfaktor“. Präventionspraxen der Silikose- und Staubbekämpfung im Ruhrkohlenbergbau 1950–1970 15 Martha Poplawski „Richtig Führen im Bergbau“. Zur Verwissenschaftlichung des Steinkohlenbergbaus nach 1945 35 Nikolai Ingenerf Grubenwarten ohne ROLF – (K)Eine Automatisierung im britischen und westdeutschen Steinkohlenbergbau? 69 Moritz Müller „Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“ Mikroelektronik, Arbeitsorganisation und die DGB-Gewerkschaften in den 1970er und 1980er Jahren 95 Karsten Uhl Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“. Die Computerisierung der Druckindustrie und der Wandel der industriellen Beziehungen in transnationaler und lokaler Perspektive 117 Daniel Dören Von der Bergwerksgesellschaft zum diversifizierten Konzern. Die Bergwerksgesellschaft Hibernia AG 1951–1968 – Eine Skizze 143 Juliane Czierpka Die Organisation des Ruhrkohlen-Absatzes zwischen Alliierter Hoher Kommission und Montanunion aus Sicht des Ruhrbergbaus 165
VI Inhalt
Stefanie van de Kerkhof Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise. Das Fallbeispiel Rheinmetall in vergleichender Betrachtung 185
Anhang Abbildungsnachweis 213 Die Autorinnen und Autoren 215
Juliane Czierpka, Lars Bluma
Die Geschichte des Steinkohlenbergbaus an der Ruhr nach 1945 und ihre Erforschung. Einleitende Bemerkungen Fallen im Zusammenhang mit der Geschichte der jungen Bundesrepublik die Worte „Boom“ und „Krise“, schiebt sich sofort das sogenannte Wirtschaftswunder vor das geistige Auge. Diese Phase wirtschaftlicher Prosperität begann in den frühen 1950er Jahren und wurde spätestens durch die dem Ölpreisschock von 1973 folgende Krise beendet. Die Historiographie der Bundesrepublik Deutschland in den ersten zwei Nachkriegsdekaden wird diesen Entwicklungslinien folgend zu einem Erfolgsnarrativ. Nicht nur der starke ökonomische, zum Wirtschaftswunder verklärte Aufschwung, auch der Stolz auf den schnellen Wiederaufbau, die Demokratisierung der Gesellschaft und die deutsche Rolle in der Europäischen Integration bestimmen das Bild der 1950er- und 1960er-Jahre. Verengt man diesen Fokus, wechselt auf eine regionale Ebene und konzentriert sich auf die Entwicklung des Steinkohlenbergbaus, führen die Kategorien „Boom“ und „Krise“ zu einer abweichenden Periodisierung. Verglichen mit den übrigen Industrien Westdeutschlands partizipierte der Bergbau erst verhältnismäßig spät an dem wirtschaftlichen Aufschwung. Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften über die Folgen des Raubbaus in der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu der, nach der Beschlagnahme des Zechenbesitzes durch die Besatzungsmächte entstandenen und bis in die 1950er Jahre hinein ungeklärten Eigentumsfrage im Ruhrbergbau. Erst nach Überwindung dieser Schwierigkeiten kam es im Steinkohlenbergbau an der Ruhr zu einer Phase des Wachstums. Die prosperierende Wirtschaft in Deutschland und den europäischen Nachbarländern führte zu einer so starken Nachfrage nach Brennstoffen, dass die Steinkohlen – ebenso wie im Krieg und der unmittelbaren Nachkriegszeit – ein knappes Gut blieben. Den Zechenunternehmen gelang es in dieser Zeit, ihre über- und untertätigen Anlagen zu modernisieren und die Gewinnung der Steinkohlen zu rationalisieren. Der zum größten Teil an der Ruhr konzentrierte deutsche Steinkohlenbergbau erlebte in der Folge eine wirtschaftliche Hochphase. Auch die krisenhaften Veränderungen im Steinkohlenbergbau lassen sich nicht mit der gesamtwirtschaftlichen Schablone abbilden. So verfuhren die Bergleute im Ruhrgebiet bereits im Februar 1958 erste Feierschichten. Gründe für die sinkende Nachfrage nach Steinkohle waren der Siegeszug des Öls, welhttps://doi.org/10.1515/9783110729979-001
2 Juliane Czierpka, Lars Bluma
ches der bis dahin dominanten Steinkohle Anteile auf dem Energiemarkt abnehmen konnte, und die Kohlenimporte. Aufgrund der stark fallenden Transportpreise und der ungleich günstigeren Abbaubedingungen wurde vor allem die US-amerikanische Steinkohle zu einem starken Konkurrenten auf dem bundesdeutschen Markt. Aus heutiger Sicht war der Anfang der Kohlenkrise zugleich der erste Akt des Untergangs der Steinkohle. Dieser Wandel auf dem Energiemarkt führte zu Transformationsprozessen im Steinkohlenbergbau und im Ruhrgebiet, wo Identität und Wohlstand der Bevölkerung eng mit dem Bergbau verbunden waren. Zugleich wurde mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl eine Institution geschaffen, welche die Montanindustrien der sechs Mitgliedsstaaten unter ein gemeinsames Dach stellte. Hierdurch ergaben sich Möglichkeiten für Subventionen und technische Zusammenarbeit, aber auch neue gesetzliche Regelungen, die einen Prozess der Anpassung unter den Akteuren im Ruhrbergbau notwendig machten. Diese vielfältigen Entwicklungen standen im Mittelpunkt des von 2015 bis 2018 laufenden Forschungsprojektes Vom Boom zur Krise: Der deutsche Steinkohlenbergbau nach 1945 am Deutschen Bergbau-Museum Bochum (DBM). Dank der großzügigen Förderung durch die RAG-Stiftung erforschten hier in der ersten Förderphase zwei promovierte Historiker*innen und fünf Promovierende nicht nur die Geschichte des Ruhrbergbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Strukturiert war dieses Forschungsprojekt durch zwei Themenlinien mit jeweils unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen.1 In der Themenlinie „Innovationskulturen im Wandel nach 1945“ wurden die bergbauspezifischen Innovationsleistungen in den Feldern Technik, Wissenschaft und Unternehmensorganisation/-strategie untersucht. In der zweiten Themenlinie „Transformation von Industrielandschaften“ lag der Schwerpunkt auf den Konversionsprozessen montanindustriell geprägter Industriereviere unter vorrangig politischen und ökonomischen Gesichtspunkten sowie den daraus abgeleiteten Strategien der (industrie-)kulturellen In-Wert-Setzung. Die in diesem Sammelband vorgestellten Beiträge gehen auf eine im März 2017 im Rahmen der Themenlinie „Innovationskulturen im Wandel nach 1945“ veranstalteten Tagung Der Steinkohlenbergbau in Boom und Krise nach 1945. Das Ruhrgebiet als Vergleichsfolie für Transformationsprozesse in der Schwerindustrie zurück. Vor dem Hintergrund der geschilderten Inkongruenz der wirtschaftlichen Entwicklung auf regionaler und nationaler Ebene sowie der spezifischen Rolle des Ruhrgebiets stellte sich die Frage nach der Eignung des die Re1 Zur Projektbeschreibung siehe https://www.bergbaumuseum.de/index.php/de/forschung/ projekte/sgm-boom-krise (letzter Abruf am 25.05.2020).
Die Geschichte des Steinkohlenbergbaus an der Ruhr nach 1945
3
gion dominierenden Ruhrbergbaus als Vergleichsfolie für transformative Prozesse in der Schwerindustrie. Die erste der im Rahmen des Projektes durchgeführten Konferenzen richtete sich dabei vor allem an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler. Wenige Wochen später folgte die Auftakttagung der Themenlinie „Transformation von Industrielandschaften“ im sächsischen Freiberg, auf der das industriekulturelle Erbe des Steinkohlenbergbaus und weiterer Branchen im Hinblick auf dessen Authentizität diskutiert wurde. Die Ergebnisse dieser in Kooperation mit dem Forschungsverbund Historische Authentizität der Leibniz-Gemeinschaft veranstalteten Konferenz finden sich in einem bereits erschienenen Band des Forschungsprojekts.2 Die internationale Tagung „Boom – Crisis – Heritage. King Coal and the Energy Revolutions after 1945“ schloss sich im März 2018 an. Sie integrierte beide Themenlinien und ergänzte sie um multinationale Perspektiven. Die nun vorliegende Veröffentlichung zur ersten Tagung Der Steinkohlenbergbau in Boom und Krise nach 1945. Das Ruhrgebiet als Vergleichsfolie für Transformationsprozesse in der Schwerindustrie erscheint in der Reihe des DBM, in welcher auch bereits der Band der Tagung der zweiten Themenlinie erschienen ist und in welcher neben dem dritten Tagungsband auch die Monografien der Teilprojekte erscheinen sollen. Die Resonanz auf den Call for Paper für die Tagung zeigte, dass es im Bochumer Raum eine Vielzahl junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die sich mit der Geschichte der lokalen Montanindustrie auseinandersetzen; sich die Erforschung der Montangeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch außerhalb des Forschungsnetzwerks von DBM, Ruhr-Universität Bochum und dem Institut für soziale Bewegungen keiner großen Beliebtheit zu erfreuen scheint. Entsprechend dominierten Bochumer Forscherinnen und Forscher das Tagungsprogramm, zudem fungierte die Region Ruhrgebiet in den angebotenen Vorträgen weniger als Vergleichsfolie, wie es der Tagungstitel intendiert, sondern eher als singuläres, für sich stehendes Untersuchungsobjekt. Auch wenn zu erwarten war, dass das Ruhrgebiet im Rahmen einer Tagung über die Schwerindustrie nach 1945 eine Hauptrolle spielen würde, überraschte die Abwesenheit von Bewerbungen aus oder über andere Regionen die Organisatoren der Tagung und führte zu internen Diskussionen über den Grund für diese Dominanz und die Folgen einer solchen lokalen Begrenzung der Forschung zu einem Thema von überregionaler Relevanz. Aus diesen Diskussionen entstand die Idee, die Position der Bergbaugeschichte in der modernen Wirt2 Farrenkopf, Michael/Meyer, Torsten (Hg.): Authentizität und industriekulturelles Erbe. Zugänge und Beispiele (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 233/ Schriften des Montanhistorischen Dokumentationszentrums 36), Berlin/Boston 2020.
4 Juliane Czierpka, Lars Bluma
schafts-, Sozial- und Technikgeschichte sowie die Vor- und Nachteile ihrer starken regionalen Konzentration auf der Tagung zu thematisieren. Hierfür stellten sich Dr. Lars Bluma, damals Leiter des Forschungsbereichs Bergbaugeschichte am DBM, Dr. Michael Farrenkopf, Leiter des Montanhistorischen Dokumentationszentrums am DBM und Prof. Dr. Dieter Ziegler, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte am Historischen Institut der RuhrUniversität Bochum, als Podiumsgäste den Fragen von Dr. Torsten Meyer, Mitarbeiter im Forschungsprojekt Vom Boom zur Krise: Der deutsche Steinkohlenbergbau nach 1945 am DBM. Spätestens mit der Öffnung der Diskussion für die anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer entstand eine lebhafte Debatte nicht nur über die Zukunft der montanhistorischen Forschung in Bochum, sondern auch über die Rolle der Bergbaugeschichte als Teil der Disziplinen Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte. Als Hauptgrund für das Entstehen eines solch starken Forschungsclusters in Bochum führte Dieter Ziegler die einzigartige Archivsituation in der Region an, die über mehrere große Archive mit umfangreichen Beständen zur montanindustriellen Vergangenheit des Ruhrgebiets verfügt. Diese hervorragende Quellenbasis dient verschiedenen Teildisziplinen der Geschichtswissenschaft als Grundlage für ihre Forschung, so dass sich Wirtschafts-, Technik-, Sozial-, Kultur- und Umwelthistoriker demselben Gegenstand auf unterschiedlichen methodischen Wegen und mit variierender Schwerpunktsetzung nähern. Insofern kommt, dies betonten alle Diskutanten, der Montangeschichte eine transdisziplinäre Brückenfunktion zu. Für die Studierenden des Historischen Instituts der Ruhr-Universität Bochum halten die Bestände der regionalen Archive ein unvergleichliches Angebot möglicher Themen für Abschlussarbeiten bereit. Die entsprechend starke Auseinandersetzung mit der Montangeschichte des Ruhrgebiets im Studium führe dann, so Dieter Ziegler, dazu, dass die Bochumer Studierenden sich bei der Bewerbung um offene Stellen in der Regel gegen die Konkurrenz von anderen Universitäten durchsetzen könnten. Eine mögliche Gefährdung der Innovationsfähigkeit des Bochumer Forschungsnetzwerks durch dieses sich selbst reproduzierende System sahen die Diskutanten allerdings nicht. Die Akkumulation montanhistorischer Forschung verschiedenster Couleur im Bochumer Raum ermögliche es vielmehr, so Michael Farrenkopf, hier Tagungen durchzuführen, die die große thematische Breite einer modernen Bergbaugeschichte widerspiegeln. Verwunderlich ist, dass sich ungeachtet der Vielzahl von Historikerinnen und Historikern, die sich mit der Geschichte des Bergbaus im weitesten Sinne beschäftigen, bisher keine nationale Vereinigung von Bergbauhistorikerinnen und -historikern in Deutschland etablieren konnte. Im Kanon der historischen Subdisziplinen blieb die Bergbaugeschichte, so Lars Bluma, eine „unvollendete Disziplin“. Dies mag an der starken Verknüpfung mit der Wirtschafts-, Sozial- und Technikge-
Die Geschichte des Steinkohlenbergbaus an der Ruhr nach 1945
5
schichte liegen, welche der Bergbaugeschichte auch ohne eigene Organisation eine Stimme in der scientific community sichert. Dieter Ziegler sieht als Wirtschafts- und Unternehmenshistoriker die Zukunft der Bergbaugeschichte vor allem in der Erforschung des 20. Jahrhunderts – also dort, wo auch die Wirtschaftsgeschichte aktuell ihre größte Stärke zeigt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Stärke des Forschungsschwerpunkts für die Teilnehmer auf dem Podium auf die gute Archivsituation, die Dichte der forschenden Institutionen und die enge Verzahnung der außeruniversitären Einrichtungen mit der Ruhr-Universität Bochum zurückzuführen ist. Das montanhistorische Forschungsnetzwerk als Ganzes fördere die Ausbildung einer großen Zahl montanhistorisch beschlagener Studierender, von denen ein Teil dem Cluster später als Doktorandinnen und Doktoranden erhalten bleibt. Es bleibt zu hoffen, dass die optimistische Sicht der Diskutanten auf den autopoietischen Charakter des Bochumer Forschungsschwerpunktes zur Bergbaugeschichte gerechtfertigt ist, und die mangelnde personale Offenheit des Systems nicht zu einer methodischen und thematischen Verengung desselben führt. Immerhin zeigte die große Resonanz auf die folgende internationale Tagung „Boom – Crisis – Heritage“, dass die Fragestellungen und Perspektiven des Forschungsprojektes „Vom Boom zur Krise“ am DBM international anschlussfähig und impulsgebend sind. So diskutierten Expertinnen und Experten aus insgesamt elf Ländern, unter anderem aus der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Polen und anderen europäischen Ländern, die Transformation des Steinkohlebergbaus vor dem Hintergrund des sich wandelnden Energiemarkts. Supranationale Institutionen standen dabei ebenso im Fokus wie postindustrielle Landschaften und Industriedenkmale.3 Für die von Dieter Ziegler vorgeschlagene vertiefende Beschäftigung mit der Geschichte des Bergbaus im 20. Jahrhundert spricht auch die Forschungslage. Gerade die Historiographie des Ruhrbergbaus in der Bundesrepublik weist große Lücken in der bisherigen Forschung auf. So bieten zwar die bereits in den 1980er-Jahren veröffentlichte Untersuchung von Werner Abelshauser4 und der erst kürzlich erschienene Beitrag von Michael Farrenkopf in dem vierbändigen Handbuch des Deutschen Bergbaus5 einen guten Überblick über die Entwick3 Boom – Crisis – Heritage. King Coal and the Energy Revolutions after 1945, 14.03.2018– 16.03.2018 Bochum, in: H-Soz-Kult, 05.11.2017 (https://www.hsozkult.de/event/id/termine35565, letzter Abruf am 07.07.2020). 4 Abelshauser, Werner: Der Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung, München 1984. 5 Farrenkopf, Michael: Wiederaufstieg und Niedergang des Bergbaus in der Bundesrepublik, in: Dieter Ziegler (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 183–302.
6 Juliane Czierpka, Lars Bluma
lung des Ruhrbergbaus in der Bundesrepublik, vertiefende empirische Studien zu wirtschafts-, unternehmens-, sozial-, wissenschafts- und technikhistorischen Aspekten der Geschichte des Ruhrbergbaus liegen jedoch bisher nur vereinzelt vor. Hier stimmen die auf der Tagung vorgestellten Beiträge jedoch optimistisch, zeigen sie doch, dass es eine Vielzahl junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die sich der Desiderate der jüngeren deutschen Bergbaugeschichte des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet annehmen und dabei insbesondere eine Anschlussfähigkeit der Bergbaugeschichte an die allgemeine Geschichtswissenschaft anstreben. Sie dokumentieren somit die Relevanz einer sich methodisch und inhaltlich öffnenden modernen Bergbaugeschichte für aktuelle Debatten in der allgemeinen Geschichtswissenschaft. Die lange Zeit als konservativ und verstaubt verpönte Bergbaugeschichte scheint, so ein vorsichtiges Fazit der Tagung, wieder eine innovative Dynamik zu gewinnen, die mehr als begrüßenswert ist.6 So beschäftigt sich der Beitrag von Nikolai Ingenerf mit den Automatisierungsbestrebungen im deutschen Steinkohlenbergbau, welche er mit den entsprechenden Initiativen im britischen Bergbau vergleicht. Hiermit greift Ingenerf ein besonderes Charakteristikum des deutschen Steinkohlenabbaus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nämlich die intensiven Bestrebungen zur vollständigen Mechanisierung der Gewinnung, auf.7 Während der Transport der Steinkohle durch den Einsatz von elektrischen und pneumatischen Antrieben, die anders als die großen Dampfmaschinen variabel unter Tage einsetzbar waren, Schüttelrutschen, Transportbänder und Mitnehmerrutschen in den engen Abbaufronten des Ruhrbergbaus ermöglichten, blieb der Mechanisierungsgrad beim Abbau gering. Die letzte bedeutsame Innovation in diesem Bereich war der pneumatische Abbauhammer, der sich seit den 1920er-Jahren durchsetzte. Da die Mann-Schicht-Leistung stagnierte konnte die Fördermenge nur durch erhöhten Personaleinsatz gesteigert werden. Eine technische Lösung dieses „Flaschenhalses“ bei der Gewinnung bot seit den 1950er-Jahren die inzwischen ausgereifte und leistungsfähige schälende Gewinnung, das heißt der Einsatz von Kohlenhobeln. Diese vollmechanische Abbaumethode verdrängte die personalintensive Gewinnung mit dem Abbauhammer in den nächsten Jahrzehnten sukzessive. Anfang der 1980er-Jahre war der Anteil der Gewinnung mit Abbauhämmern auf weit unter 1 % gefallen, und dieser wurde nur noch in steiler Lagerung 6 Vgl. auch Bluma, Lars: Moderne Bergbaugeschichte, in: Der Anschnitt. Zeitschrift für Montangeschichte 69 (2017:3–4), S. 138–151. 7 Vgl. Bleidick, Dietmar: Bergtechnik im 20. Jahrhundert. Mechanisierung in Abbau und Förderung, in: Ziegler (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel, S. 355–411, hier S. 387–401.
Die Geschichte des Steinkohlenbergbaus an der Ruhr nach 1945
7
eingesetzt, in der der Einsatz von Kohlehobeln nicht möglich war. Dieser Prozess der maschinellen Steinkohlegewinnung, der Anfang der 1950er-Jahre begann, wurde auch nach dem Beginn der Kohlekrise 1957/58 intensiv weiterverfolgt. Im staatlich subventionierten Steinkohlenbergbau stand nun aber nicht mehr die Erhöhung der Förderung im Vordergrund, sondern die Senkung der Abbaukosten bei gleichzeitiger Senkung der Fördermengen. Der Jahrzehnte dauernde Niedergang des deutschen Steinkohlenbergbaus war somit aufs engste verbunden mit einer forcierten technischen Modernisierung. Nikolai Ingenerf befasst sich vor diesem Hintergrund mit den bereits früh diskutierten Möglichkeiten der Automatisierung. In Großbritannien wurden Anfang der 1960er-Jahre technische Maßnahmen erprobt, um zu einem vollautomatischen Abbaubetrieb zu kommen. Hier konnte früh an die schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende intensive Mechanisierung angeknüpft werden. Während auf den britischen Zechen Ormonde und Newstead das von der Presse euphorisch gefeierte automatische Abbausystem R. O. L. F. (Remotely Operated Longwall Faces) in Betrieb ging, war der deutsche Steinkohlenbergbau noch dabei, den Rückstand in der Mechanisierung unter Tage aufzuholen. Von Automatisierung war Anfang der 1960er-Jahre weder an Ruhr noch Saar die Rede. Aber auch die Euphorie auf der britischen Insel für die „push-button-mine“ kühlte bald ab. Die Großversuche wurden als gescheitert betrachtet, und in der deutschen Wahrnehmung galt der britische Weg zur Vollautomatisierung des Steinkohlenbergbaus als nicht realistisch. In Deutschland ging der Steinkohlenbergbau einen anderen Weg: Mit der Grubenwarte als zentrale Kontroll- und Steuerinstanz identifiziert Ingenerf ein technisches Dispositiv, welches hier prägend wurde. Statt Vollautomatisierung rückte nun die Prozesssteuerung in den Mittelpunkt. Die Rationalisierungsmaßnahmen im deutschen Steinkohlenbergbau beschränkten sich jedoch nicht nur auf technische Maßnahmen, sondern umfassten auch arbeitsorganisatorische Handlungsfelder auf betrieblicher Ebene. Vorläufer dazu finden sich in den 1920er-Jahren, in denen neben vielen anderen Branchen auch der Steinkohlenbergbau im Hinblick auf die so genannte Arbeitsleistung und den diese beeinflussenden Wirkfaktoren wissenschaftlich untersucht wurde.8 Die betriebssoziologischen Studien der Nachkriegszeit weiteten allerdings den Blick auf die Arbeitsverhältnisse im Bergbau. Dies war notwendig geworden, da die technischen und organisatorischen Rationalisierungs8 Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft: Verhandlungen und Berichte des Unterausschusses für Arbeitsleistung (IV. Unterausschuß), Bd. 2. Die Arbeitsverhältnisse im Steinkohlenbergbau in den Jahren 1912 bis 1926, Berlin 1928.
8 Juliane Czierpka, Lars Bluma
maßnahmen sowie die Anstellung ausländischer Arbeiter, mithin die Ausdifferenzierung der Qualifikations- und Berufsprofile das soziale Gefüge in den bergbaulichen Betrieben massiv veränderten. Martha Poplawski zeigt in ihrem Beitrag, wie diese Transformation zu einer Herausforderung des „richtigen Führens“ wurde. Dies betraf vor allem das mittlere Management auf den Zechen, also die Ebene der Steiger, die sich bis dato als privilegierter Stand verstanden und auch so handelten.9 Der gegenüber den einfachen Arbeitern angewandte autoritäre Führungsstil der Steiger, auch gerne Grubenmilitarismus genannt, überdauerte bis weit in die Nachkriegsjahre hinein. Allerdings geriet unter den sich schnell wandelnden technischen und sozialen Verhältnissen des Steinkohlenbergbaus dieser noch auf Privilegien beruhende Führungsstil schnell in die Kritik. Allenthalben wurde eine Krise der Betriebsführung im Steinkohlenbergbau konstatiert. Dieser Anpassungsdruck führte zu einer Reihe von betriebssoziologischen und arbeitswissenschaftlichen Studien, die Poplawski als einen Verwissenschaftlichungsprozess interpretiert, in dem vor allem die Integration externen Expertenwissens stattfand. Ziel dieses Verwissenschaftlichungsprozesses war es, die Beherrschbarkeit der sich wandelnden sozialbetrieblichen Herausforderungen für das Betriebsmanagement zu gewährleisten. Daniel Trabalski bündelt in seinem Beitrag Probleme der Wissenschaftsgeschichte und der Geschichte des modernen Sozialstaates in der BRD am Beispiel der Silikoseprävention im Steinkohlenbergbau und eröffnet dadurch neue Perspektiven in der Geschichte der Arbeitsmedizin. Obwohl das Bild des siechenden, hustenden Bergmanns seit jeher bekannt war, führten die Ausweitung und Mechanisierung des Steinkohlenabbaus seit den 1920er-Jahren zu einem dramatischen Anstieg von Staublungenerkrankungen. Für die modernen westlichen Wohlfahrtsstaaten tat sich insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg der Abgrund der drängenden medizinischen, technischen und letztlich sozialen Frage nach der Vergesellschaftung dieses beruflichen Risikos auf. Auch in der Silikosebekämpfung nach dem Zweiten Weltkrieg kann ähnlich wie im Fallbeispiel von Martha Poplawski von einem Verwissenschaftlichungsprozess gesprochen werden, der hier allerdings aufs engste verknüpft ist mit einem Prozess der sozialstaatlichen Expansion. Damit stellt sich zugleich die Frage nach dem Wechselverhältnis von Wissenschaft und Sozialpolitik im Rahmen der sozialpolitischen und kulturellen Umbrüche nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich nicht nur das Verständnis von Gesundheit und Krankheit, die Einstellung der Akteure zu (Berufs-)Risiken und die sozialstaatlichen Ansprüche an den westdeutschen Wohl9 Trischler, Helmuth: Steiger im deutschen Bergbau. Zur Sozialgeschichte der technischen Angestellten 1815–1945, München 1988.
Die Geschichte des Steinkohlenbergbaus an der Ruhr nach 1945
9
fahrtsstaat wandelten, sondern auch die Rolle der medizinisch-wissenschaftlichen Experten. Zudem veränderten sich die Partizipationsmöglichkeiten der einzelnen Akteure und auch ihr Selbstverständnis im Rahmen eines demokratischen Wohlfahrtsstaates in den drei Jahrzehnten nach Gründung der BRD erheblich. Welche Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten erhielten die einzelnen Akteursgruppen und wie wurden die Partizipationsmöglichkeiten innerhalb dieses Akteursnetzwerks aus Versicherungsinstitutionen, Politik, Unternehmen, medizinisch-wissenschaftlichen Experten und Versicherten ausgehandelt und in der Praxis gelebt? Die Partizipation der Bergarbeiter bei der Silikosebekämpfung erscheint, so das Fazit von Trabalski, ambivalent. Deren grundsätzlich gestärkte persönliche Eigenverantwortung im Betrieb wurde in Bezug auf die Silikose in den 1960er-Jahren durch den Ausbau des medizinischwissenschaftlichen Präventionsdispositivs zu Gunsten von technischen und betriebsorganisatorischen Automatismen eingeschränkt, in denen das Individuum immer mehr als „Unsicherheitsfaktor“ angesehen wurde. Die Kohlekrise seit den ausgehenden 1950er-Jahren war die erste tiefgreifende Strukturkrise einer ganzen Branche, die öffentlich sichtbar machte, dass das westdeutsche Wirtschaftswunder nicht nur Gewinner produzierte, sondern auch Verlierer. Weitere branchenweite Krisen sollten in den nächsten Jahrzehnten folgen. Fragen, die sich hieran anschließen, sind, ob die Kohlekrise einen Erfahrungsraum schuf, der für die Akteure späterer Branchenkrisen eine Relevanz besaß. Oder ist die Kohlekrise sowohl in Ursachen, Verlauf und Bekämpfung eher als Solitär zu betrachten, der keineswegs für die Krisenbewältigung späterer Branchenkrisen als Prototyp oder Mustervorlage herangezogen wurde? Insbesondere interessiert hier, wie sich das Akteursnetzwerk aus Staat, Unternehmen und Gewerkschaften in den 1950er- bis 1970er-Jahren in diesen Krisen wandelte. Karsten Uhl betrachtet in seinem Artikel die Computerisierung der Druckindustrie, die als radikaler technologischer Wandel wahrgenommen wurde, Mitte der 1970er-Jahre die industriellen Beziehungen erheblich belastete und in monatelangen Tarifauseinandersetzungen mündete, an deren Ende die Arbeitskämpfe von 1978 standen. Diese harten Auseinandersetzungen in der Druckbranche um die Einführung rechnergestützter Textsysteme war nicht nur ein westdeutsches, sondern ein international zu beobachtendes Phänomen. Uhl beschränkt sich in seinem Ansatz nicht auf eine international vergleichende Betrachtung, sondern stellt die Frage, inwieweit eine transnationale Verzahnung von Unternehmern und Gewerkschaften die industriellen Beziehungen in dieser Krisenphase veränderten, in der sich die zuvor national organisierte Druckbranche hin zu einer global und multinational organisierten Medienbranche entwickelte. Auf der anderen Seite nahm aber ebenfalls die Rolle der lokalen, betrieblichen Ebene für die Gestaltung des Modernisierungsprozesses und der
10 Juliane Czierpka, Lars Bluma
Verschiebungen im Gefüge der industriellen Beziehungen zu. Uhl sieht als eine Konsequenz der Branchenkrise der Druckindustrie eine „Vertrieblichung“ der industriellen Beziehungen, die die einzige Möglichkeit darstellte, den technologischen Wandel zu gestalten. Die Einführung von Computern in Unternehmen wurde in den 1970er-Jahren vor allem für die Gewerkschaften eine immense Herausforderung. Wie der Beitrag von Moritz Müller zeigt, galt der Computer gerade in einer Phase, in der die Gewerkschaften klagten, dass ihr Handlungsspielraum auf Grund der nachlassenden Prosperität sich immer mehr einschränkte, als Paradebeispiel dafür, dass technischer Wandel zu sozialem Rückschritt führen könne. Allerdings wurde der durch den Computer ausgelöste Wandel der Arbeitswelt von den Gewerkschaften intensiv analysiert. Müller rekonstruiert die Rezeption dieses technologischen Wandels am Beispiel der Industriegewerkschaft Metall (IGM), der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) sowie der Industriegewerkschaft Druck und Papier (IG DruPa). Dabei stellt er fest, dass es keineswegs zu einer einheitlichen Beurteilung der Wandlungsprozesse kam. Zwar ging für alle Akteure die Gleichung technischer Fortschritt = Wachstum = Arbeitsplätze nicht mehr so eindeutig auf, wie zuvor, die Einzelgewerkschaften kamen jedoch zu deutlich unterschiedlichen Einschätzung bezüglich der Durchsetzung des Computers und der Mikroelektronik in den 1970er- und 1980er Jahren. Das galt sowohl für die Frage, ob der technologische Wandel die gewerkschaftliche Interessenvertretung allgemein schwächen würde, als auch für die grundsätzliche Debatte, ob und wie dieser durch die Gesellschaft (und mithin durch die Gewerkschaften) gestaltbar sei. Der Computer warf für die Gewerkschaften also auch grundlegend Fragen ihres eigenen Selbstverständnisses auf. Allerdings, so Müller, änderte auch der tiefgreifende Pessimismus der Gewerkschaften bezüglich der Folgen des Computereinsatzes nichts an deren Glauben, dass Wirtschaft und Gesellschaft gestaltbar und planbar seien. Daniel Dören und Juliane Czierpka stellen in ihren Beiträgen das Verhältnis zwischen den Akteuren in den Bergbauunternehmen und den Akteursgruppen auf staatlicher Ebene in den Vordergrund. So zeigt Daniel Dören am Beispiel der Hibernia AG, einer Tochter der staatseigenen VEBA, wie die Unternehmen des Ruhrbergbaus mit der sich stark wandelnden Nachfrage nach Steinkohle in den 1950er- und 1960er-Jahren umgingen. Hierbei nutzt Dören eine unternehmenshistorische Herangehensweise und stützt sich bei seiner Untersuchung auf Vorstandsprotokolle, anhand derer er die Strategien des Staatsunternehmens analysiert. Diese zeigen, dass die unternehmerischen Entscheidungen der Hibernia AG nicht von staatlichen Stellen beeinflusst wurden, wie die Diversifikation des Unternehmens in die Ölherstellung vielleicht vermuten ließe. Die Strategie geht vielmehr auf politische Entscheidungen in den 1930er-Jahren zurück,
Die Geschichte des Steinkohlenbergbaus an der Ruhr nach 1945
11
als die Autarkiebestrebungen der nationalsozialistischen Machthaber sich in der Förderung von Anlagen zur synthetischen Ölproduktion niederschlugen. Diese Anlagen bildeten dann in den frühen 1950er-Jahren den Grundstock für die Ölsparte der Hibernia AG. Bildete diese anfangs lediglich eine kleine Ergänzung der Bergbausparte, wurde das Öl spätestens mit der Kohlenkrise zum Zugpferd der Hibernia AG, die mit den Gewinnen aus dem Ölgeschäft den defizitären Bergbau ausgleichen konnte. Hiermit schneidet Dören auch die Frage nach der Rolle der Bergbauunternehmen im Ölgeschäft an, so war die Hibernia nur eines von mehreren Unternehmen des Ruhrbergbaus, welches an dem Erstarken des Öls partizipierte. Diese „Zebras“ – Unternehmen mit Interessen im Bergbau und im Öl – sind trotz ihrer spannenden Position zwischen den in dieser Zeit diametral ausgerichteten Interessen der Bergbauseite und denen der Mineralölwirtschaft bisher kaum erforscht. Juliane Czierpka erweitert diese Ebene zweifach, indem sie sich den übergeordneten Verbänden des Ruhrbergbaus und deren Beziehung zu der Bundesregierung und der neu geschaffenen supranationalen Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) zuwendet. Das in diesem politischen Mehrebenensystem entstehende Beziehungsgeflecht untersucht sie am Beispiel der Entwicklung der Absatzorganisationen für Ruhrkohle in den frühen 1950er Jahren – also der Gründungsphase der EGKS. Die Diskussion um die organisatorische Ausgestaltung des Verkaufs von Ruhrkohlen vollzog sich in einem Spannungsfeld zwischen alliierter Neuordnung und Verhandlungen über den Schuman-Plan. Der Gemeinschaftsverkauf war ein besonders hart umkämpfter Punkt in diesen Verhandlungen. So sehr der Ruhrbergbau auf der Beibehaltung dieser Institution beharrte, so vehement verlangten vor allem Frankreich und die US-Amerikaner, die die Verhandlungen eng begleiteten, die Abschaffung des kartellierten Kohlenverkaufs. Der Beitrag von Czierpka zeigt, wie die deutschen Regierungsstellen zwischen dem Druck der alliierten Stellen einerseits und der Bergbauvertretungen andererseits standen und der Ruhrbergbau schließlich eine Kompromisslösung erreichen kann. Neben dieser Analyse der Machtverhältnisse in den ersten Jahren der Nachkriegszeit bietet Czierpkas Beitrag auch eine revidierte Perspektive auf die oft verklärte Geschichte der Anfänge der Europäischen Union, deren erste Schritte nicht so sehr der Vision eines geeinten Europas folgten, sondern vielmehr machtpolitisch motiviert waren – ein Umstand, der in der Forschung zwar nicht umstritten ist, jedoch bisher empirisch weder aus unternehmensnoch aus montanhistorischer Perspektive belegt wurde.10
10 Vgl. zu dem Mangel an wirtschafts- und unternehmenshistorischen Studien zur Europäischen Integration Hohls, Rüdiger/Kaelble, Hartmut: Einleitung. Historische Perspektiven auf
12 Juliane Czierpka, Lars Bluma
Stefanie van de Kerkhofs Beitrag führt wieder zurück auf die unternehmenshistorische Ebene, wo sie sich in ihrer Studie über Rheinmetall mit der Rüstungsindustrie beschäftigt und damit der Entwicklung des Bergbaus nach 1945 die Entwicklung einer anderen Branche, die ebenso stark im Fokus der Politik stand, entgegensetzt. Ähnlich wie die Erforschung des Ruhrbergbaus, weist auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit der bundesrepublikanischen Rüstungsindustrie noch größere Lücken auf, deren Bearbeitung sich jedoch aufgrund der Sensibilität der Akten und der damit verbundenen langen Sperrfristen ungleich schwieriger gestaltet als im Fall des Steinkohlenbergbaus an der Ruhr. Dort kann zumindest für die Zeit bis zur Gründung der Ruhrkohle AG auf archivalische Hinterlassenschaften von Verbänden, Gewerkschaften, Politik und Unternehmen zugegriffen werden. Van de Kerkhof arbeitet in ihrem Beitrag die krisenhaften Entwicklungen der eng mit der Schwerindustrie verflochtenen Rüstungswirtschaft heraus und zeigt, dass Ende der 1960er-Jahre die mit dem Erstausrüstungsboom der Bundeswehr verbundene hohe Nachfrage sinkt, sich krisenhafte Entscheidungen jedoch vor allem im Verlauf der Ölpreisschocks und der Kritik durch die Friedensbewegungen entwickelten. Der Vergleich mit der Rüstungsindustrie zeigt, dass auch diese – ebenso wie der Ruhrbergbau – vergleichsweise spät ein starkes Wachstum realisieren konnte, dafür jedoch auch mit einem zeitlichen Versatz in eine Krise eintauchte, während der Ruhrbergbau im Vergleich mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sehr früh vom Boom in die Krise rutschte. Ob der Steinkohlenbergbau an der Ruhr tatsächlich eine geeignete Vergleichsfolie für die wirtschaftlichen Transformationsprozesse der Nachkriegsjahrzehnte liefert, muss in dieser Einleitung offenbleiben. Einerseits legen die hier vorgestellten Fallstudien zumindest nahe, dass der Steinkohlenbergbau bezüglich Ursachen, Verlauf und Ergebnissen ihres Wandels nur begrenzt als Blaupause späterer branchenweiter Veränderungsprozesse gelten kann. Gründe hierfür sind die spezifische Rolle des Ruhrbergbaus in der Energiewirtschaft und die hohe wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Bergbaus innerhalb der Region an sich, aber auch hieraus resultierende Entwicklungen deuten auf Schwierigkeiten bei einer vergleichenden Betrachtung. So gab es für andere Branchen weder einen gesellschaftlichen Konsens darüber, den wirtschaftlichen Niedergangsprozess mit Hilfe massiver staatlicher Subventionen sozialverträglich zeitlich zu strecken, noch sind die jeweiligen Wirkfaktoren von Boom, Krise, technologischem Wandel und Restrukturierung der industriellen Beziehungen ohne weiteres auf andere Industriezweige abbildbar. die Europäische Integration, in: Dies. (Hg.): Geschichte der europäischen Integration bis 1989 (Europäische Geschichte in Quellen und Essays 1), Stuttgart 2016, S. 11–23.
Die Geschichte des Steinkohlenbergbaus an der Ruhr nach 1945
13
Andererseits zeigen die Ausblicke in die Rüstungs- oder Druckindustrie Gemeinsamkeiten auf, deren Untersuchung fruchtbar erscheint: So lockt die vertiefende Betrachtung der spezifischen politischen Bedeutung der Bereiche Rüstung und Energie und die Analyse der Folgen der jeweiligen Sonderrolle für die Krisenbewältigung. Auch die Stellung der Gewerkschaften in sterbenden Branchen bietet eine Vergleichsebene. Letztendlich, so muss an dieser Stelle konstatiert werden, fehlt es aber an weiteren, detaillierten Vergleichsstudien, deren Fehlen unter Umständen den Blick auf vergleichbare Entwicklungsmuster verstellt und die Kontextualisierung der Entwicklung des Ruhrbergbaus und des Ruhrgebiets vor dem Hintergrund der nationalen Entwicklung erschwert.
Quellenverzeichnis Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft: Verhandlungen und Berichte des Unterausschusses für Arbeitsleistung (IV. Unterausschuß), Bd. 2. Die Arbeitsverhältnisse im Steinkohlenbergbau in den Jahren 1912 bis 1926, Berlin 1928.
Literaturverzeichnis Abelshauser, Werner: Der Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung, München 1984. Bleidick, Dietmar: Bergtechnik im 20. Jahrhundert. Mechanisierung in Abbau und Förderung, in: Dieter Ziegler (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 355–411. Bluma, Lars: Moderne Bergbaugeschichte, in: Der Anschnitt. Zeitschrift für Montangeschichte 69 (2017:3–4), S. 138–151. Farrenkopf, Michael/Meyer, Torsten (Hg.): Authentizität und industriekulturelles Erbe. Zugänge und Beispiele (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 233/Schriften des Montanhistorischen Dokumentationszentrums 36), Berlin/ Boston 2020. Farrenkopf, Michael: Wiederaufstieg und Niedergang des Bergbaus in der Bundesrepublik, in: Dieter Ziegler (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 183–302. Hohls, Rüdiger/Kaelble, Hartmut: Einleitung. Historische Perspektiven auf die Europäische Integration, in: Dies. (Hg.): Geschichte der europäischen Integration bis 1989 (Europäische Geschichte in Quellen und Essays 1), Stuttgart 2016, S. 11–23. Trischler, Helmuth: Steiger im deutschen Bergbau. Zur Sozialgeschichte der technischen Angestellten 1815–1945, München 1988.
Daniel Trabalski
Vom „eigenverantwortlichen Bergmann“ zum „Individualfaktor“. Präventionspraxen der Silikose- und Staubbekämpfung im Ruhrkohlenbergbau 1950–1970 Einleitung Die Gefahren industrieller Arbeit für Leib und Leben der Beschäftigten und wie mit ihnen umzugehen sei, waren ein zentrales Konfliktfeld des 19. sowie 20. Jahrhunderts. In Deutschland sollten die sozialen Folgen mit Einführung der Sozialversicherungen in den 1880er Jahren zunächst kompensatorisch gemildert werden. Die beharrliche Zunahme der Schattenseiten der industriell befeuerten Prosperität, wie Unfälle mit schweren Maschinen und branchenspezifische Berufskrankheiten, zwangen aber zu einem Umdenken. Ab etwa Mitte der 1920er Jahre gewann der Vorsorgegedanke an Einfluss in der Sozialversicherung und der (Gewerbe-) Hygiene.1 Die praktischen Fragen der Prävention am industriellen Arbeitsplatz beschäftigten eine wachsende Zahl von Experten aus der Medizin, aus dem Versicherungs- und aus dem Ingenieurswesen, in deren wissenschaftliche Kompetenz zur Lösung sozialer Probleme vor allem in den ersten dreißig Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg großes Vertrauen bestand. Interventionen in den industriellen Arbeitsplatz mussten dabei auch immer die dort arbeitenden Menschen einbeziehen und machten dabei ihr Verhalten und ihre Verantwortung zum Gegenstand der Präventionspraxis. An Hand der Staublunge, die als tödlichste Berufskrankheit in Deutschland gilt,2 und ihrer Bekämpfung im Ruhrkohlenbergbau untersucht diese Fallstudie die sich wandelnde Einbindung der von der 1 Bluma, Lars: Der Körper des Bergmanns in der Industrialisierung. Biopolitik im Ruhrkohlenbergbau 1890–1980, in: Ders./Uhl, Karsten (Hg.): Kontrollierte Arbeit – disziplinierte Körper? Zur Sozial- und Kulturgeschichte der Industriearbeit im 19. und 20. Jahrhundert (transcript Histoire), Bielefeld 2012, S. 35–72, hier S. 62. 2 Dies gilt auch für zahlreiche andere Industrieländer, beispielhaft zu nennen sind hier Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten. Vgl. dazu McIvor, Arthur/Johnston, Ronald: Miners’ Lung. A History of Dust Disease in British Coal Mining (Studies in Labour History), London/New York 2007; Rosental, Paul-André: De la silicose et des ambiguïtés de la notion de „maladie professionnelle“, in: Revue d’histoire moderne et contemporaine 56 (2009:1), Notiz: Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – 322685540. https://doi.org/10.1515/9783110729979-002
16 Daniel Trabalski
Staublunge bedrohten Arbeiter in die medizinischen und technischen Präventionsbemühungen im Betrieb nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Umgang mit industriellen Pathologien nach 1945 ist bislang noch wenig erforscht. In einem jüngeren Sammelband zum „Körper des Bergmanns“ zeigt Lars Bluma Perspektiven auf die Biopolitik des Ruhrkohlenbergbaus auf und weist darin auf die Ambivalenzen im betrieblichen Arbeitsschutz hin.3 Den Ursprüngen und dem Wandel sozialstaatlicher Risikopolitik, auch am Beispiel der Staublunge, widmet sich Martin Lengwiler für den Fall der Schweiz bis 1970,4 und betont dabei auch die transnationalen Dimensionen dieses Prozesses.5 Zur Silikose in Deutschland liegt eine 2010 erschienene Dissertation Christian Schürmanns vor. Im Mittelpunkt stehen dabei einander ablösende „Regulierungsregime“, die vorwiegend an Hand legislativer Eingriffe und deren Durchsetzung und Überwachung durch den Staat beschrieben werden.6 Tiefergehende Untersuchungen auf der Mikro- und Mesoebene sind indes noch rar. In einem bereits 1988 erschienenen Aufsatz hat Helmuth Trischler die Bedeutung der spezifischen Konstellation der Akteure für die Versicherungs- und Präventionspraxis bergbaulicher Unfälle und Berufskrankheiten herausgestellt.7 Dem Gewicht der Akteursverflechtungen in der Entstehung und Entwicklung des allgemeinen betrieblichen Arbeitsschutzes aus Unternehmersicht trug jüngst Nina Kleinöder in ihrer Dissertation über die westdeutsche Eisen- und Stahlindustrie auch für die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg Rechnung.8 S. 83–96; Rosner, David/Markowitz, Gerald E.: Deadly Dust. Silicosis and the Ongoing Struggle to Protect Worker’s Health (Conversations in Medicine and Society), Ann-Arbor 2006. 3 Bluma: Der Körper des Bergmanns. 4 Lengwiler, Martin: Risikopolitik im Sozialstaat. Die schweizerische Unfallversicherung 1870– 1970 (Industrielle Welt 69), Köln u. a. 2006. 5 Lengwiler, Martin/Beck, Stefan: Historizität, Materialität und Hybridität von Wissenspraxen. Die Entwicklung europäischer Präventionsregime im 20. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft 34 (2008), S. 489–523; Lengwiler, Martin: Internationale Expertennetzwerke und nationale Sozialstaatsgeschichte. Versicherung der Silikose in Deutschland und der Schweiz (1900–1945), in: Journal of Modern European History 7 (2009:2), S. 197–218. 6 Schürmann, Christian: Die Regulierung der Silikose im Ruhrkohlenbergbau bis 1952. Staat, Unternehmen und die Gesundheit der Arbeiter (Research in Management Accounting & Control), Wiesbaden 2011. 7 Trischler, Helmuth: Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Bergbau 1851 bis 1945. Bergbehördliche Sozialpolitik im Spannungsfeld von Sicherheit und Produktionsinteressen, in: Archiv für Sozialgeschichte 28 (1988), S. 111–151. 8 Kleinöder, Nina: Risikoregulierung am Arbeitsplatz – zwischen Rationalisierung und Gesundheitsschutz. Ein Problemaufriss zur Geschichte des Arbeitsschutzes am Beispiel der Eisenund Stahlindisutrie zum Ende des 20. Jahrhunderts, in: Bluma, Lars/Uhl, Karsten (Hg.): Kontrollierte Arbeit – disziplinierte Körper? Zur Sozial- und Kulturgeschichte der Industriearbeit im 19. und 20. Jahrhundert (transcript Histoire), Bielefeld 2012, S. 163–194; Kleinöder, Nina: Unter-
Vom „eigenverantwortlichen Bergmann“ zum „Individualfaktor“
17
Die Geschichte der Berufskrankheiten-Prävention liegt für die Zeit nach 1945 noch weitgehend im Dunkeln. In diesem Aufsatz soll das Schlaglicht deshalb auf der praktischen Seite der Entwicklung der eng miteinander gekoppelten medizinischen und technischen Strategien der Silikoseverhütung nach dem Zweiten Weltkrieg liegen. Der Blick richtet sich dabei vor allem auf deren Implementierung im spezifischen Umfeld der Steinkohlenbergbaubetriebe des Ruhrgebiets. Im Mittelpunkt stehen die Bergleute als Wissensobjekte der Silikoseexperten sowie als handelnde Subjekte innerhalb ihrer Arbeitswelt. Ein Fluchtpunkt dieser Untersuchung ist der 1996 erschienene programmatische Aufsatz Lutz Raphaels über den Prozess der „Verwissenschaftlichung des Sozialen“,9 dessen praktische Ausformung diese Arbeit in den Blick nimmt. An die wachsende Bedeutung von Experten und der Abhängigkeit von ihrer Expertise anknüpfend gehe ich der Frage nach der sich wandelnden Rolle der Bergleute nach, über deren Körper und Verhaltensweisen Wissen erzeugt wurde, das die Grundlage präventiven Handelns bilden sollte. Inwieweit wurden die von der Staubgefahr betroffenen Arbeiter im Steinkohlenbergbau als verantwortungsvoll handelnde Subjekte konstituiert und inkorporierten präventive Verhaltensweisen, wie es die Thesen Martin Lengwilers zur Evolution des Vorsorgegedankens nahelegen?10 Demnach habe es im Verlauf des 20. Jahrhunderts eine Entwicklung hin zu einem „individualistischen Leitbild des präventiven Selbst“ gegeben, das sich als rationales Subjekt selbst diszipliniere.11 An der Regulierung der Silikose im westdeutschen Steinkohlenbergbau zeigt sich dagegen, so die hier vertretene gegenläufige Hypothese, dass die einzelnen Gefährdeten im medizinisch-technischen Präventionsdiskurs in den Jahren bis etwa 1970 und darüber hinaus im Gegenteil immer seltener als präventiv handelnde Subjekte adressiert wurden, sondern mit Hilfe von Automatismen der eingesetzten Arbeitsmittel und der Arbeitsorganisation in ihrer Autonomie beschnitten wurden. Die Praxis der Silikoseprävention beruhte damit nicht auf
nehmen und Sicherheit. Strukturen, Akteure und Verflechtungsprozesse im betrieblichen Arbeitsschutz der westdeutschen Eisen- und Stahlindustrie nach 1945 (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 234), Stuttgart 2015. 9 Raphael, Lutz: Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und konzeptionelle Herausforderung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, in: Geschichte und Gesellschaft 22 (1996:2), S. 165–193. 10 Lengwiler/Beck: Historizität, Materialität und Hybridität, S. 513 ff. 11 Lengwiler, Martin/Madarász, Jeannette: Präventionsgeschichte als Kulturgeschichte der Gesundheitspolitik, in: Dies. (Hg.): Das präventive Selbst. Eine Kulturgeschichte moderner Gesundheitspolitik Gesundheitspolitik (VerKörperungen / MatteRealities. Perspektiven empirischer Wissenschaftsforschung 9), Bielefeld 2010, S. 11–28, hier S. 24; Rose, Nikolas: The Politics of Life Itself, in: Theory, Culture & Society 18 (2001:6), S. 1–30.
18 Daniel Trabalski
der Stärkung des „präventiven Selbst“, sondern vielmehr auf einer Umgehung individueller Verantwortlichkeit durch technische und organisationale Mittel.
Die Ausgangslage: Silikose als Versicherungsund Wissensgegenstand Die Silikose war in Deutschland seit 1929 anerkannte Berufskrankheit und berechtigte in schweren Fällen zu einer Unfallversicherungs-Rente. Dennoch markierte die unmittelbare Nachkriegszeit eine wichtige Zäsur. In der Zeit des Nationalsozialismus, insbesondere in den Kriegsjahren, war die zur Verhütung von Silikosen so wichtige Staubbekämpfung vernachlässigt worden. Auch die gesundheitliche Überwachung war nicht mehr flächendeckend aufrechterhalten worden. Die Bergbau-Berufsgenossenschaft als Trägerin der Unfallversicherung im Bergbau sah sich nach dem Krieg dazu veranlasst, durch massenhafte klinische und radiologische Untersuchungen der Bergleute wieder einen Überblick über das Ausmaß der Berufskrankheit zu erlangen. Damit war schließlich ein rapider Anstieg der Neumeldungen verbunden: Im Gründungsjahr der Bundesrepublik 1949 wurden insgesamt 27 600 Silikosen gemeldet. Das waren doppelt so viele wie im Jahr 1929. In 6 200 Fällen kam es zu einer Rente. Die meisten davon entfielen auf den Steinkohlenbergbau.12 Die konkreten Maßnahmen seitens der gewerblichen Aufsichtsbehörden wurden in der Folge intensiviert, um entschiedener gegen die ausufernde Staublungenproblematik im Bergbau vorzugehen. Zum 1. Januar 1951 wurden Maßnahmen zur Staubbekämpfung unter Tage von der Bergbehörde verbindlich vorgeschrieben. Zugleich wurde das Netz der gesundheitlichen Überwachung engmaschiger, indem die Untersuchungspflicht der Bergleute verstärkt wurde.13 Neben der Anlegeuntersuchung bei einer Neueinstellung wurden auch Nachfolgeuntersuchungen verpflichtend. Das Vertrauen der Belegschaften in die untersuchenden Ärzte sollte gewonnen werden, indem die Industriegewerkschaft Bergbau und Energie (IGBE) an ihrer Zulassung beteiligt wurde.14
12 Dietrich, Gerhilt: Berufskrankheiten in der gesetzlichen Unfallversicherung 1911–1965, München 2001, S. 309 und S. 342. 13 Schürmann: Regulierung der Silikose, S. 238; Oberbergamt Bonn (Hg.): Bergpolizeiverordnung für alle der bergpolizeilichen Aufsicht unterstehenden Betriebe im Verwaltungsbezirk des Oberbergamts Bonn zum Schutze der Gesundheit gegen Staubschäden vom 19. April 1950, Bonn 1950. 14 Archiv für soziale Bewegungen am ISB (ASB), Bestand IGBE (IGBE), Nr. 759.
Vom „eigenverantwortlichen Bergmann“ zum „Individualfaktor“
19
Die Mitbestimmung der Arbeiter wurde noch darüber hinaus ausgeweitet. Mit dem Montan-Mitbestimmungsgesetz veränderte sich im Jahr 1951 das Machtgefüge innerhalb der Unfallversicherung zugunsten der Beschäftigten.15 Indessen wurde mit dem Gesetz zur Wiederherstellung der Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger auch in der Unfallversicherung eine Parität zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hergestellt.16 Im Jahr 1952 wurde mit dem Betriebsverfassungsgesetz die Mitbestimmung in den Betrieben verbessert, und der Betriebsrat wurde zumindest formell in die Fragen der Arbeitssicherheit und des betrieblichen Gesundheitsschutzes eingebunden.17 Die Deutsche Kohlenbergbau-Leitung bezog in ihren 1951 geschaffenen Ausschuss für Staub- und Silikosebekämpfung indes Vertreter der Industriegewerkschaft Bergbau ein, gleichwohl sie nach bisheriger Einschätzung nur geringen Einfluss besaßen.18 Überdies ist festzustellen, dass sich die Arbeit der Gewerkschaften über die Betriebsräte hauptsächlich darauf konzentrierte, bessere Leistungen für bereits Erkrankte zu erstreiten,19 oder Verdienstverluste auf Grund erzwungener Arbeitsplatzwechsel zu verhindern oder gering zu halten.20 Eine erschöpfende Auswertung betrieblicher und gewerkschaftlicher Unterlagen, um die Einbindung der Arbeitnehmervertretungen in die Implementierung von Staubverhütungs- und Silikosebekämpfungsmaßnahmen abschließend zu beurteilen, steht aber indessen noch aus. Die genaue Ursache und Pathogenese der Erkrankung galt zwar in den fünfziger Jahren noch nicht als eindeutig geklärt, grundsätzlich war es aber Konsens, dass ultrafeiner Quarzstaub, der beim Einatmen bis in die Lungenbläschen einzudringen vermag und sich dort festsetzt, langfristig zu einer Veränderung des Lungengewebes führe, zur so genannten Lungenfibrose. Das veränderte Gewebe erfüllt nicht mehr die Aufgabe des Luftaustauschs in der Lunge, die effektive Lungenfläche schrumpft, und ist dieser Prozess weit genug vorangeschritten, werden die Symptome für den Betroffenen spürbar. Beständiges Husten, voranschreitende Kurzatmigkeit und Kreislaufprobleme kennzeichneten die Erkrankung.21 Auch wenn keine Exposition gegenüber schädlichem Feinstaub mehr besteht, schreitet die Erkrankung voran. Die Herausnahme von 15 Schürmann: Regulierung der Silikose, S. 228. 16 Ebd., S. 217. 17 Ebd., S. 228. 18 Ebd., S. 229 f. 19 ASB/IGBE, Nr. 19081. 20 ASB/IGBE, Nr. 19116, Bl. 396–398 u. 403ff; ASB/IGBE, Nr. 391. 21 Vgl. zum damaligen Wissensstand über die Symptomatik der Erkrankung vgl. beispielhaft Landwehr, Martin: Was der Bergmann von der Staublungen-Erkrankung (Silikose) und den Möglichkeiten zu ihrer Bekämpfung wissen muß, Bochum 21948.
20 Daniel Trabalski
Arbeitern mit beginnenden Anzeichen einer Silikose aus dem staubgefährlichen Arbeitsplatz schützte deshalb nicht immer vor einer Verschlimmerung der Krankheit. Technische Staubbekämpfung und Staubvermeidung blieben unumgänglich. Wasser kam dabei eine zentrale Bedeutung zu, da seine Fähigkeit zur Staubbindung bereits bekannt und erprobt war. In den frühen Nachkriegsjahren fehlte es vielen Betrieben aber an den notwendigen Investitionsmitteln, um die bislang entwickelten Gerätschaften in ihren Zechen einzuführen. Dazu zählten in erster Linie Hohlbohrer, die den Bohrstaub bei seiner Entstehung mit Wasser binden sollten, sowie Wasserdüsen und Schläuche, um das Gestein und das Haufwerk nass zu halten. In den allermeisten Zechen existierte aber noch nicht einmal die notwendige Infrastruktur in Form flächendeckender Wasserrohrleitungen. Die Ausgabe von Staubmasken sollte Abhilfe schaffen, wie gut sie wirklich schützen konnten, war aber umstritten. Denn über das physikalische und chemische Verhalten des gefährlichen Feinstaubes war wenig bekannt, und über die Details der Pathogenese und die (Differential-) Diagnostik der Silikose herrschten noch große Unklarheiten.22 Die Umweltbedingungen des bergmännischen Arbeitsplatzes sowie der bergmännische Körper selbst waren damit die zentralen Wissensobjekte, mit denen sich die Silikoseexperten auseinanderzusetzen hatten. Medizinisches und physikalisch-chemisches sowie technisches Wissen wurde bei den darauffolgenden Forschungsbemühungen eng miteinander verschränkt. Diese Verzahnung wurde vor allem bei der Beurteilung der Staubgefährlichkeit an den untertägigen Arbeitsplätzen deutlich. In einem 1953 im „Ausschuss für Staub- und Silikosebekämpfung“ der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung gehaltenen Vortrag über die laufenden Staubmessungen in Betrieben und deren Auswertung machte das referierende Ausschussmitglied Schulte die drei großen Unbekannten bei der Beurteilung der Staubgefährlichkeit aus: Dies seien die genaue mineralogische Beschaffenheit des Gesteins in den Ruhrzechen, das Verhalten des lungengängigen Feinstaubs in der menschlichen Lunge, sowie, als unbekanntester Faktor von allen, „die verschiedenartige Disposition der einzelnen Leute“.23 Dieser Faktor sei wiederum nur durch die genaue Erfassung der Staubbelastung besser zu verstehen. Der bergmännische Körper als medizinischer, sowie die untertägige Umwelt in ihrer mineralogischen Komplexität als technischer Gegenstand waren somit nicht voneinander zu trennen. Mit der Er22 Einen guten Überblick bieten hierfür die vom Bergassessor Schulte in den Sitzungen des Ausschusses für Staub- und Silikosebekämpfung der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung gehaltenen Vorträge zum Stand der Dinge in den frühen 1950er Jahren; siehe Archiv des Instituts für Gefahrstoff-Forschung (IGF), H0072. 23 IGF, H0072, „Vortrag über betriebliches Meßverfahren und Auswertung der Meßergebnisse“, 10.06.1953, S. 6.
Vom „eigenverantwortlichen Bergmann“ zum „Individualfaktor“
21
forschung der Silikose beschäftigte Institute zeugten institutionell von dieser engen Kollaboration: Das 1948 neu aufgestellte Silikose-Forschungsinstitut – bislang allgemein mit der „Staubbekämpfung“ beauftragt – wurde um die Forschungsgebiete Physik, Chemie und Mineralogie erweitert, erhielt im Jahr darauf eine eigene Medizinische Abteilung und 1955 eine eigens errichtete Klinik. Zugleich wurde die Zusammenarbeit mit Institutionen der Arbeitssicherheit vertieft.24 Hieran verdeutlicht sich die große Heterogenität derer, die sich als Experten für die Silikose- und Staubbekämpfung verstanden, und auch als solche wahrgenommen und mit der Forschung beauftragt wurden.25 Während die genauere Untersuchung des Feinstaubes und die Entwicklung besserer Messmethoden noch in der Grundlagenforschung steckten, mussten praktische Maßnahmen zur Eindämmung der Silikose im Bergbau sofort erfolgen. Hierzu gehörte die Staubbekämpfung mit den verfügbaren Mitteln, allen voran der Einsatz von Wasser, Schaum oder Absaugern beim Bohren und Schießen (Sprengen) sowie von Wasser in Verbindung mit Zusätzen, z. B. Salz, zur Niederschlagung und Bindung des unter Tage schwebenden und liegenden Staubes.26 Doch selbst die Durchführung dieser basalen Techniken war noch lange nicht flächendeckend eingeführt. In vielen Betrieben wurde in den frühen 1950er Jahren noch trocken und ohne jeden Staubschutz gebohrt. Insbesondere die staubbindende Berieselung des abgebauten Gesteins an Übergabepunkten, wo besonders viel Staub neu aufgewirbelt wurde, war vielerorts noch nicht vorzufinden. Die einzige Möglichkeit, mit sofortigen Maßnahmen alle Bergleute zu erreichen, war deshalb die medizinische Überwachung aller Belegschaften durch radiologische und klinische Anamnesen, um beginnende Staublungen oder vermeintlich vorbelastete oder anfällige Arbeiter frühzeitig zu erkennen und aus der staubgefährlichen Arbeit herauszunehmen.27
24 IGF, H1084, „Anlage 1 zur Niederschrift über die 9. Sitzung des Fachausschusses ‚Staubbekämpfung und Pneumokonioseverhütung‘. Besichtigung der Medizinischen Abteilung des Silikose-Forschungsinstitutes der Bergbau-BG am 28. Mai 1980 in Bochum“. 25 Auch das nordrhein-westfälische Parlament ließ keinen Zweifel daran, dass es den Forschern der Silikose- und Staubinstitute der Berufsgenossenschaft, der Universitätskliniken und der Verbände oblag, Ursachen und Vorsorgemechanismen des Silikoseproblems zu suchen; vgl. dazu Landtag Nordrhein-Westfalen (Hg.): Plenarprotokoll. Stenographischer Bericht der 31. Sitzung der 3. Wahlperiode am 7. Juni 1955, S. 664 ff. 26 Den in diesem Aufsatz geschilderten technischen und medizinischen Wissensstand entnehme ich überwiegend den gesammelten Beiträgen in Lange, Fritz (Hg.): Bekämpfung der Silikose. Forschungsarbeiten 1, Essen 1955; sowie Lange, Fritz (Hg.): Bekämpfung der Silikose. Forschungsarbeiten 2, Essen 1956. 27 Zu den Eigenheiten des radiologischen Befunds, auf die ich an dieser Stelle nicht tiefer eingehen kann, verweise ich auf Martin, Michael: Spuren der Arbeit. Zur Beweiskraft des Rönt-
22 Daniel Trabalski
Die Datengewinnung über die örtliche Staubbelastung durch die bislang verfügbaren Messgeräte und über den gesundheitlichen Zustand der Arbeiter, insbesondere ihrer Lungen, durch klinische und Röntgen-Diagnostik waren neben der intensivierten Silikoseforschung die ergiebigsten Lieferanten für die frühe Wissensbildung, auf deren Grundlage präventive Maßnahmen ergriffen werden sollten. Messtrupps der Hauptstelle für Staub- und Silikosebekämpfung nahmen die betrieblichen Messungen zunächst vor. Um eine effiziente flächendeckende Messung in allen Betrieben und allen relevanten Betriebspunkten zu erreichen, sollte die Kompetenz für die Staubmessungen aber auf die Betriebe selbst übertragen werden. Das gleiche galt für die medizinische Untersuchung der Bergleute. Indem eine Änderung der Bergpolizeiverordnung durch die Oberbergämter Dortmund und Bonn die Einstellungs- und Nachuntersuchungen zur Pflicht erklärt hatten, ging die Verantwortung für die Untersuchung auf die Betriebe über, die zu diesem Zwecke Werksärzte einstellten.28 Träger der auf diese Weise gewonnenen Informationen sollten Staubkarteikarten sein, die nicht mehr nur wie die bisherigen Gesundheitskarteien den physiologischen Zustand der Arbeiter dokumentierten.29 Medizinische Gesundheits- und technische Messdaten sollten in der Staubkartei zusammenlaufen und den Betrieben eine Grundlage geben, über den Arbeitsplatzwechsel gefährdeter Arbeiter zu entscheiden.30 Mit Rücksicht auf die angenommene individuelle körperliche Veranlagung sollten die Ärzte darüber befinden, ob und wann dieser notwendig sei.31 Der durchzuführende Wechsel an einen staubärmeren Arbeitsplatz scheiterte jedoch in den 1950er Jahren häufig daran, dass es weniger solcher Arbeitsplätze gab als Arbeiter, die hätten versetzt werden sollen.32
genbildes bei der Anerkennung der Silikose als Berufskrankheit, in: Westfälische Forschungen 64 (2014), S. 223–243. 28 IGF, H0072, „Vortrag über Aufgaben der Hauptstelle für Staub- und Silikosebekämpfung“, 22.04.1953, S. 7 ff. 29 Archiv der Dokumentations- und Forschungsstelle der Sozialversicherungsträger (sv:dok), Bestand 15, Nr. 835, „Niederschrift über die 5. Sitzung des Ausschusses für Staub- und Silikosebekämpfung am 29. Mai 1953“, S. 4 f. 30 Ebd., S 9. 31 Lange (Hg.): Bekämpfung der Silikose. Forschungsarbeiten 1, S. 27 ff. 32 IGF, H0084, „Bericht über den Stand der Silikose und ihre Bekämpfung“, 10 1949, S. 7.
Vom „eigenverantwortlichen Bergmann“ zum „Individualfaktor“
23
Technische Interventionen am Körper und an der Umwelt Die Erfassung der laufenden Staubbelastung am Betriebspunkt und der kumulativen Staubbelastung der einzelnen Belegschaftsmitglieder allein reichte also nicht aus. Erschwerend kam hinzu, dass die Staublungenerkrankung auch mit dem Ende der unmittelbaren Staubexposition bis zur Invalidisierung des Betroffenen voranschreiten konnte. Da die Entwicklung effektiver technischer Staubbekämpfungsmaßnahmen noch andauerte und die betriebliche Implementierung vorhandener Techniken schleppend verlief,33 war die Lunge nach Auffassung der Silikoseexperten durch die unmittelbare Intervention am bergmännischen Körper selbst vor dem Feinstaub zu schützen. Die verbreitetste und günstigste Maßnahme war der Einsatz von Atemmasken. Hierbei stellten sich allerdings zwei wesentliche Probleme. Das erste war die Stärke der Filterleistung. Sie musste den sehr feinen pathogenen Staub auffangen können, aber gleichzeitig ausreichend Atemluft hindurchlassen. Dies führte notwendigerweise zum zweiten Problem – die Bergleute beklagten unter den widrigen Bedingungen der schweren körperlichen Arbeit an den heißen und feuchten Betriebspunkten den schlechten Komfort der Masken, den zu großen Atemwiderstand, oder verzichteten aus anderen Gründen ganz darauf, die Masken zu tragen.34 Ohnehin ließ sich die Verwendung solcher Masken nur schwer kontrollieren, war sie doch ganz der persönlichen Entscheidung des Einzelnen oder kleiner autonomer Gruppen unterworfen. Neuere Forschungen zur bergmännischen Arbeitskultur legen dabei nahe, dass der untertägigen spezifischen Männlichkeitskultur bergmännischer Gruppen eine Gefahrenverachtung zu eigen war, die zum bewussten Verzicht auf die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung führen konnte.35 Dennoch wurde unter Experten die Erwartung geäußert, dass der Bergmann durch sein Verhalten einen Beitrag zum Kampf gegen die Silikose zu leisten im Stande sei. Angesichts unvollkommener Techniken zur effektiven Eliminierung des Feinstaubes aus der Grubenluft sei die Nasenatmung von größter Bedeutung, immerhin sei die „Immunität der Wüstenvölker gegen Silikose“ darauf zu33 Schürmann, Die Regulierung der Silikose, S. 204. 34 Der häufige Verzicht auf die Masken gerade bei schwerer Arbeit war den Silikoseexperten bekannt, wie aus den entworfenen Richtlinien für die Merkblätter für die Staubbekämpfung hervorgeht; vgl. dazu u. a. IGF, H0922. 35 Sehr anschaulich schildern dies Arthur McIvor und Ronald Johnston im Ergebnis ihres umfangreichen Oral History-Projekts: McIvor/Johnston: Miners’ Lung; daran anknüpfend für den Fall des Ruhrkohlenbergbaus vgl. Bluma: Der Körper des Bergmanns, S. 50 f.
24 Daniel Trabalski
rückzuführen, dass sie mit Hilfe ihres Wüstentuchs selbst bei schweren Sandstürmen weiter ausschließlich durch die Nase atmeten.36 Es sei nun abhängig „von der Einsicht des einzelnen Mannes“, diesem Beispiel zu folgen und damit die Prophylaxe gegen die Silikose zu verbessern. Die technische Verbesserung der Arbeitsverfahren ließe dies bereits zu, da sich der Kraftaufwand beim Bohren verringert habe, und die Arbeit für die Bergleute deshalb körperlich weniger anstrengend sei als zuvor. Aus Sicht der Zechenleitungen würden sie deshalb seltener zu der Bequemlichkeit verleitet, durch den geöffneten Mund zu atmen. Solange sich die Grubenluft nicht frei von schädlichen Feinstäuben halten ließe, war es aus Sicht der Unternehmer also an den Bergleuten selbst, sich zu schützen. An die große Eigenverantwortung des Bergmanns appellierte auch die Ende Juni 1955 von einem Bergbaubetrieb initiierte und auf mehreren ihrer Zechen durchgeführte „Silikosebekämpfungswoche“. Deren Veranstalter waren sich sicher, dass die Anwendung der Verfahren der Staubbekämpfung „von der Einsicht und dem guten Willen der Aufsichtspersonen und der Bergleute“ abhänge.37 Staubbekämpfung sei demnach „nicht nur eine technische, sondern weithin auch eine erzieherische Aufgabe“.38 Man sah sich in der Pflicht, die gesamte Belegschaft in die Verantwortung zu nehmen und sie vom Ziel und Erfolg der Silikosebekämpfung zu überzeugen: „Von einer richtig durchgeführten Silikosebekämpfungswoche kann daher erwartet werden, daß sie bei den Bergleuten aller Grade die Einsicht von der Notwendigkeit der aktiven Mitarbeit jedes einzelnen Mannes bei der Staubbekämpfung vertieft. Darüber hinaus vermag sie aber auch der immer noch anzutreffenden Anschauung entgegenzuwirken, daß die Silikose unausweichliches Schicksal jedes Bergmanns sei. Diese pessimistische Auffassung stellt, weil sie die Bereitschaft zum Kampf gegen die Silikose schwächt, und sich nachteilig auf die Nachwuchswerbung auswirkt, eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar, der nachdrücklich entgegengetreten werden muß.“ Adressiert wurde deshalb der Wert der eigenen Unversehrtheit – „Es geht um Deine Gesundheit!“, „Der Staub ist Dein ärgster Feind! Wenn Du gesund bleiben willst, dann bekämpfe ihn!“ – sowie die kameradschaftliche gegenseitige Verantwortung: „Wer Einrichtungen zur Staubbekämpfung mutwillig […] entfernt, versündigt sich an der Gesundheit seiner Arbeitskameraden“, wie es anlässlich der Woche auf in den Betrieben angebrachten Transparenten hieß.39
36 Lange (Hg.): Bekämpfung der Silikose. Forschungsarbeiten 1, S. 16. 37 IGF, H0090, „Erfahrungsbericht über Planung und Durchführung der Silikosebekämpfungswoche der Bergbau-AG. Neue Hoffnung“, S. 1. 38 Ebd. 39 Ebd., S. 5.
Vom „eigenverantwortlichen Bergmann“ zum „Individualfaktor“
25
Aus betrieblicher Sicht schien zumindest die Größenordnung des Silikoseproblems in erster Linie auf die bisweilen vorherrschende Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit und Schicksalsgläubigkeit der Arbeiter zurückzuführen zu sein. Die Mitarbeit aller Bergleute war insofern von Bedeutung, dass der persönliche Staubschutz an bestimmten Betriebspunkten zwar als kritisch erachtet wurde, dass aber einmal entstandener Feinstaub sich überall unter Tage verbbreiten, und dass dieser schwebende Staub bereits langfristig zu Staubveränderungen in der Lunge führen konnte, wie man wusste.40 Indessen drängte das Oberbergamt Dortmund 1955 darauf, dass nur noch Abbauhämmer eingesetzt werden sollten, die zwangsläufig nass arbeiteten, d. h. nur bei angeschlossenem Wasserschlauch eingesetzt werden konnten. Auch die wissenschaftlichen Experten sprachen offen aus, dass Atemmasken eher als einen Notbehelf anzusehen waren und auf technisch zwangsläufige Maßnahmen zurückgegriffen werden müsse.41 1955 waren solche Hämmer aber noch in der Entwicklung und wegen der unsteten Wasserversorgung unter Tage bestanden von Seiten der Unternehmen bedenken, dass ein Ausfall die Förderung unterbrechen könnte.42 Der Trend hin zu Maßnahmen, deren Durchführung nicht von der Kollaboration der Arbeiter abhing, ließ sich an diesem Vorstoß aber bereits ablesen.43 Auch die Anpassung der Wetterführung war der alltäglichen Arbeit der Bergleute entzogen. Die Zwangsläufigkeit der Staubbekämpfungstechniken wurde so zum Grundprinzip, und damit sank auch die Bedeutung moralischer Appelle an die Gesamtbelegschaft. Im Verlauf der fünfziger Jahre wurde auf Grundlage aktuellster Forschung eine neue Technologie eingeführt, die direkt am Körper des Bergmanns wirken sollte, deren Anwendung aber nur noch bedingt von der situativen Mitarbeit der Belegschaft abhängig war. Die großangelegte therapeutische und prophylaktische Inhalation von Aerosolen, Luft-Stoff-Gemischen, die auf die Lunge selbst bzw. auf den eingelagerten Staub einwirken sollten, um diesen unschädlich zu machen, war ein medizinisches Novum, auf dem große Hoffnungen ruh-
40 IGF, H0084, „Merkblätter für die Staubbekämpfung“ (1949), S. 4. 41 Vgl. dazu die Äußerungen in der Diskussion über den Einsatz von Staubmasken in IGF, H0091, „Niederschrift über die 10. Sitzung des Ausschusses für Staub- und Silikosebekämpfung“, 15.05.1957, S. 6. 42 IGF, H0090, „Niederschrift über die 7. Sitzung des Ausschusses für Staub- und Silikosebekämpfung am 13.12.1954“, S. 4. 43 Der Trend setzte sich in den darauffolgenden Jahren sukzessive fort. Ab Ende der 1960er Jahre wurden die Bedüsungsanlagen zur Staubniederschlagung stärker automatisiert, sodass sie so wenig wie möglich durch die Arbeiter überwacht und gewartet werden mussten. Vgl. dazu IGF, H0322, „Vermerk“ (22.09.1967), S. 1.
26 Daniel Trabalski
ten.44 Schon 1946 wurden die bereits in den dreißiger Jahren in geringem Umfang praktizierten Einzelinhalationsexperimente durch das spätere Silikose-Forschungsinstitut der Bergbau-Berufsgenossenschaft wiederaufgenommen.45 In diesen frühen Erprobungen der Inhalation mutmaßlich prophylaktischer Aerosole floss bereits technisch gewonnenes Wissen über das physikalisch-chemische Verhalten des Staubes in den medizinischen Ansatz der Silikosebekämpfung ein, denn zur Erzeugung der physiologisch wirkenden Aerosole brauchte es technisches, chemisches und physikalisches Wissen. Die Teilnahme an der Inhalation war in der Regel freiwillig. Um in der experimentellen Frühphase überhaupt eine gewisse Resonanz bei den Bergleuten zu wecken, mussten die Teilnahmehürden möglichst niedrig gehalten, zum Teil sogar gezielte Anreize gesetzt werden. Im Hinblick auf die experimentellen Einzelinhalationen in den Betrieben nach Schichtende klagte der Leiter des SilikoseForschungsinstituts, dass „für alle Beteiligten ein gewisser Zwang bestehen [müsse], den einmal aufgenommenen Versuch nicht ohne zwingenden Grund abbrechen zu können“.46 Dazu kam es aber nicht. Ein Werksarzt der Zeche Osterfeld hatte die dortige Leitung im selben Jahr darin bestärkt, dass die Inhalationen „zwecklos“ seien. Die freiwilligen Teilnehmer empfanden die eingeatmeten Substanzen oft als unangenehm und deshalb schädlich, zum Teil gar als die Lunge schädigende „Fremdkörper“.47 Diese frühen Rückschläge machten deutlich, dass der erfolgreiche Einsatz der Inhalationsprophylaxe nicht nur von den im Labor erprobten biochemischen Reaktion abhing, sondern auch von der Akzeptanz der Bergleute, die den Versuchen ausgesetzt wurden. Erst der Einsatz von Luft-Stoff-Gemischen, die von den Arbeitern als wohltuend empfunden wurden, gewann das Vertrauen der Belegschaften in die Inhalation wieder zurück. Noch in den frühen 1950er Jahren entstanden auf den Zechen des Ruhrgebiets rasch ganze Inhalationsräume sowie erste Inhalationsgänge. Damit wurden auch die Hürden für eine Teilnahme an den Inhalationen herabgesetzt, da die Kapazitäten gegenüber einzelnen Inhalationsplätzen deutlich zunahmen. Bergleute konnten auf einigen Zechen beim Warten auf ihre Seilfahrt in den Inhalationsräumen verweilen,48 oder ohne nennenswerte Ver44 Gärtner, H.: Über die Grundlagen der bisherigen Leitstaubbehandlung, in: Ders./Jötten. K. W. (Hg.): Die Staublungenerkrankungen 1 (Bericht über die Staublungen-Tagung des Staatsinstitutes für Staublungenforschung beim Hygienischen Institut der Universität Münster/W. vom 19.-21. November 1949), Darmstadt 1950, S. 271–277. 45 sv:dok, Bestand 15, Nr. 618. 46 sv:dok, Bestand 15, Nr. 618, „Bericht über die Inhalationsversuche auf den Zechen Osterfeld und Jakobi bis Ende März 1950“ (29.04.1950). 47 Ebd., S. 5 f. 48 Lange (Hg.): Bekämpfung der Silikose. Forschungsarbeiten 1, S. 33.
Vom „eigenverantwortlichen Bergmann“ zum „Individualfaktor“
27
zögerung auf dem Weg in die Zeche hinein und aus der Zeche heraus einen Inhalationsgang durchschreiten.49 Im Sommer 1953 waren im Ruhrgebiet bereits 39 solcher Aerosolanlagen in Betrieb und weitere waren in Planung.50 Die rasche Verbreitung dieser Inhalationsstätten war weniger der Gewissheit geschuldet, dass sich die Silikose damit tatsächlich verhindern oder therapieren ließ, denn dazu fehlte es an Langzeiterfahrungen. Vielmehr war es die Verbesserung der bei frühen Staublungen typischen Symptome, insbesondere der Hustenreiz, und die damit verbundene Anhebung des „allgemeinen Wohlbefindens“.51 Man sah sich mit der neuen prophylaktischen Technik auf einem guten Wege, es fehlte lediglich „ein noch zu bestimmender Schutzstoff“.52 Doch dessen Entdeckung ließ auf unbestimmte Zeit auf sich warten. So galt die Bekämpfung des Staubes, noch bevor er die Atemapparate der Arbeiter erreichte, nach wie vor als der gewissere Weg. Nasses Bohren sowie die Tränkung der Kohle mit Wasser waren probate Mittel, um den Staub bereits dort zu binden, wo er entstand. Bis Anfang der 1950er Jahre scheiterte dies aber häufig am Reifegrad der mit solchen Mitteln ausgestatteten Maschinen, oder an der grundsätzlichen Verfügbarkeit von Wasserrohren sowie der Investitionsbereitschaft der Zechenbetreiber.53 In den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs des Steinkohlenbergbaus in den fünfziger Jahren war jedoch eine immer stärkere Verzahnung der technischen Staubbekämpfungsmaßnahmen, allen voran solche durch Wasser, Absaugung und Wetterführung, mit der untertägigen Abbau- und Fördertechnik im Zuge der zunehmenden Rationalisierung durch Mechanisierung zu beobachten.54 Waren die frühen Hohlbohrer mit Wasseranschluss noch davon abhängig, dass der einzelne Bergmann ihn auch in dieser Weise einsetzte und der Ausbau der Rohrleitungen bis an seinen 49 Vgl. dazu u. a. sv:dok, Bestand 15, Nr. 816, „Einrichtung von Inhaliergängen“ (10.11.1954). 50 IGF, H0090, „Vermerk über aus Auswertung des Rundschreibens vom 17. August d. J. über die im Ruhrgebiet vorhandenen Aerosolanlagen“ (1953). 51 Lange (Hg.): Bekämpfung der Silikose. Forschungsarbeiten 1, S. 34. 52 Ebd., S. 41. 53 IGF; H0066, „Niederschrift über die Besprechung der Sicherheits- bzw. Staubbeauftragten am Donnerstag, dem 14. Februar 1952“; sv:dok, Bestand 15, Nr. 454, „Rundschreiben Nr. 4/49 an die Zechenverwaltungen“, 23.05.1949. 54 Zur Mechanisierung im Steinkohlenbergbau vgl. Bleidick, Dietmar: Bergtechnik im 20. Jahrhundert. Mechanisierung in Abbau und Förderung, in: Ziegler, Dieter (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 355–411, hier S. 396 f. Etwa Mitte der 1960er Jahre war diese so weit vorangeschritten, dass Bohrhämmer auf den meisten Zechen nur noch in Ausnahmefällen zum Einsatz kamen; zum wirtschaftlichen Aufschwung des Ruhrkohlenbergbaus vgl. Abelshauser, Werner: Der Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung, München 1984, S. 84.
28 Daniel Trabalski
Betriebspunkt reichte, wurde die Wasserbedüsung größerer Abbau- und Vortriebmaschinen in deren Aufbau integriert, gleichwohl sich auch hier immer wieder technische Schwierigkeiten aufzeigten. Zwangsläufige Staubbekämpfungstechniken erreichten dennoch in immer größerer Zahl Serienreife und Praxistauglichkeit.55 In Verbindung mit den Maßnahmen zur Wetterführung, also der besseren Belüftung des Bergwerks, und anderen Mitteln wie der Vernebelung beim Schießen (Sprengen) zeitigten die Bemühungen bald messbare statistische Erfolge. Nach ihrem Höchststand im Jahr 1954 nach der Fünften Berufskrankheiten-Verordnung (5. BKVO), welche die Entschädigungspflicht auf alle Schweregrade der Silikose ausgeweitet hatte, mit über 30 000 Neumeldungen, sank diese Zahl ab 1955 kontinuierlich. Die Mitte der 1950er Jahre markierten damit bereits die Trendwende. Von 1957 bis 1965 sank die Zahl von etwa 10 000 auf knapp 6 000, blieb damit aber unter den in der Bundesrepublik anerkannten Berufskrankheiten nach wie vor Spitzenreiter.56 Im selben Zeitraum schrumpfte zwar allein im Ruhrkohlenbergbau die Zahl der unter Tage Beschäftigten um fast die Hälfte,57 allerdings ist dabei die lange Latenz der Silikose zu berücksichtigen: Während die hohen Ziffern in der unmittelbaren Nachkriegszeit vor allem auf die dreißiger und vierziger Jahre zurückzuführen waren, spiegeln sich in den Erkranktenziffern der sechziger Jahre die Beschäftigungsverhältnisse der fünfziger Jahre, in denen die Zahl der Bergleute wieder besonders hoch war, während die gesundheitliche Überwachung wieder verbessert und die Staubbekämpfung ausgeweitet wurde.
Von der Arbeitseinsatzlenkung zur Risikokalkulation Die technische Staubbekämpfung schien also achtbare Erfolge zu verzeichnen, die allgemeine Staubbelastung unter Tage zu senken. Aber der pathogene Feinstaub konnte nie vollständig beseitigt, sondern immer nur verringert werden. Es bestand deshalb weiterhin das Risiko einer Silikose, insbesondere für jene Bergleute, die an den besonders belasteten Betriebspunkten arbeiteten. Gerade dort wurde der Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen gegen das Einatmen des Feinstaubs weiterhin besonders angemahnt. Da man neben deren prakti55 Vgl. dazu IGF, H0075, „Rückschau über die Tätigkeit und den Erfolg des Ausschusses“ (1970). 56 Dietrich: Berufskrankheiten, S. 342. 57 Abelshauser: Ruhrkohlenbergbau seit 1945, S. 152.
Vom „eigenverantwortlichen Bergmann“ zum „Individualfaktor“
29
schen Unzulänglichkeiten aber auch von einer nachlässigen Verwendung durch die Bergleute ausging, brauchte es Verantwortliche vor Ort, welche ein Auge auf die Instandhaltung und Verwendung der Atemmasken hatten. Hierzu wurde bereits seit Ende der vierziger Jahre, als Atemmasken in manchen Betrieben noch das einzige Mittel gegen den Staub waren, die Ernennung und Ausbildung von „Silikosebeauftragten“ diskutiert. In der Unfallverhütung gab es schon „Sicherheitsbeauftragte“ aus den Reihen der Belegschaften, die auf die Umsetzung der Vorschriften achten sollten und der Unfallversicherung als Ansprechpartner dienten. Da die Zechengesellschaften nur zögerlich solche „Aufseher für Staubbekämpfungsmaßnahmen“ ernannten und zu den vom Silikose-Forschungsinstitut der Bergbau-Berufsgenossenschaft angebotenen Lehrgängen schickten, wurden die ohnehin vorhandenen Sicherheitsbeauftragten zunächst miteinbezogen.58 Erst in den 1950er Jahren nahm dieser Vorstoß in ganzer Breite Form an. Inzwischen war die Rede von einem „Staubbeauftragten“ aus den Reihen der erfahrenen Bergleute, der als Bindeglied zwischen den Betrieben und den auf sie einwirkenden technischen und wissenschaftlichen Instituten fungieren sollte.59 Neben Staubbeauftragten bildete die Hauptstelle für Staub- und Silikosebekämpfung des Steinkohlenbergbauvereins auch betriebseigene Messtechniker aus, die die untertägigen Staubmessungen vornehmen sollten.60 Die Aufgabe der Messtechniker war es, die Daten zu liefern, mit denen die weiter oben beschriebene Karteikarte über den jeweiligen Betrieb und die Staubbelastung an verschiedenen untertägigen Arbeitsplätzen dokumentieren werden sollte. Die von jedem Untertagearbeiter zu führende Karte „Tätigkeitsnachweis und Staubbelastung“ sollte aufzeigen, wie stark die einzelnen Arbeiter an solchen Betriebspunkten exponiert gewesen waren, und wie es um die in den Anlege- und Nachuntersuchungen ermittelte Gesundheit bestellt war. Auf Grundlage dieses in den Karteien verdichteten Wissens sollte es in Zukunft möglich werden, die Gesamtbelastung des Einzelnen durch einen als zumutbar geltenden Grenzwert zu deckeln. Die Karteikarte sollte es nun ermöglichen, den „Staubsummenwert“, das ist die Menge Staubes, der ein Bergmann in einem bestimmten Zeitraum ausgesetzt gewesen war, zu kontrollieren. Mit Hilfe einer solchen „Arbeitseinsatzlenkung“ sollte verhindert werden, dass einzelne Arbei58 IGF, H0066, „Silikosebeauftragte“ (06.07.1948). 59 IGF, H0073, „Bericht über die bisherige Tätigkeit des Kohlenstaubbekämpfungs-Ausschusses, des Ausschusses für die Bekämpfung von Berufskrankheiten und des Fachausschusses für Grubensicherheit sowie über die von dem neuen Ausschuß noch zu behandelnden Fragen auf dem Gebiete der Staubbekämpfung“ (25.04.1951), S. 17. 60 IGF, H0090, „Bericht. Bergassessor Schulte in der Sitzung des Ausschusses für Staub- und Silikosebekämpfung über die Tätigkeit der Unterausschüsse und der Hauptstelle für Staubund Silikosebekämpfung“ (13.12.1954), S. 2.
30 Daniel Trabalski
ter überhaupt erst einer zu großen, also pathogenen Staubmenge ausgesetzt wurden.61 Die Führung der Karteikarte wurde im Ruhrkohlenbergbau mit der Änderung der Bergpolizeiverordnung vom 1. Juli 1953 für alle Betriebe verbindlich. Die Eintragung darüber, an welchen Betriebspunkten gearbeitet worden war, sollte monatlich vom Steiger vorgenommen werden, auch die Staubbeauftragten wurden in die Überwachung der Karteikartenführung eingebunden.62 Die Dokumentation der Gesundheit erfolgte durch die werksärztlichen Untersuchungen. In den darauffolgenden zehn Jahren wurden die auf diese Weise akquirierten numerischen Daten statistisch ausgewertet und verliehen den Karteikarten eine völlig neue Bedeutung. Örtliche Staubgehalte und gesundheitliche Anamnese konnten nun besser korreliert werden. Ab den sechziger Jahren fand der Begriff der Wahrscheinlichkeit oder der Probabilität vermehrt Eingang in die Arbeit der Staublungenbekämpfung, und wurde zur methodischen Grundlage der Arbeitseinsatzlenkung.63 Erklärtes Ziel dieses Instruments war die Risikominimierung einer Silikose unter den jeweils herrschenden Staubbelastungen in den Ruhrbergbaubetrieben. Je mehr das auf statistischer Evidenz fußende Wissen wuchs, desto geringer schienen die Unsicherheiten der bislang eher auf Erfahrungswerten beruhenden Heuristik der Staubgefahr zu weichen, und einer zukunftsgerichteten Risikoregulierung das Feld zu räumen. Aus den über Jahre gewonnenen Daten wurde aus den gemessenen „Staubsummen“ die jeweilige Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Silikosestadien auf Basis gestaffelter „Staubbelastungsstufen“ nach Betriebspunkten errechnet.64 Diese musste mitnichten null betragen, wie im Rahmen der Festsetzung von Grenzwerten für die „Maximale Arbeitsplatz-Konzentration“ (MAK) ab Ende der 1960er Jahre deutlich wurde. Im Wortlaut hieß das: „Die angeführten Kriterien – 35 Jahre Berufstätigkeit mit einem 3 %igen Risiko für eine Staublungenveränderung der Kategorie 2 – könnten der Festlegung des MAK-Wertes der Feinstaubkonzentration zugrundegelegt werden. Dabei ist zu bemerken, daß die Kategorie 2 dem Stadium „leicht bis mittel“ […] entspricht, bei welchem in der Bundesrepublik Deutschland im allgemeinen noch keine rentenpflichtige Erwerbsminderung gegeben ist.“65
61 Zur hier erläuterten Thematik der Karteikarte vgl. insbes. IGF, H0090. 62 Ebd., „Erläuterungen zur Karte ‚Tätigkeitsnachweis und Staubbelastung‘“, S. 2 f. 63 IGF, H0076, „Karteikarte ‚Tätigkeitsnachweis und Staubbelastung‘“ (10.02.1965). 64 IGF, H0074, „Zweifel am Staubsummenwert“ (08.05.1967); IGF, H0934, „Gutachten zur Arbeitseinsatzlenkung im Steinkohlenbergbau“ (1966). 65 IGF, H0288, „Überlegungen zur Festlegung eines MAK-Wertes für die Konzentration des Feinstaubes (respirable dust) im Steinkohlenbergbau der Bundesrepublik Deutschland“, S. 3.
Vom „eigenverantwortlichen Bergmann“ zum „Individualfaktor“
31
Die Implikationen dieses probabilistischen Ansatzes fanden Eingang in die am 1. Januar 1965 in Kraft getretenen Bergpolizei-Verordnung der Bergämter Bonn und Dortmund, in der maximal zulässige Staubbelastungen festgeschrieben wurden, von denen man sich ein minimiertes Risiko einer Silikose versprach. Dies war die Grundlage für die betriebliche Arbeitseinsatzlenkung.66 Man verließ sich dabei nicht mehr auf das Urteil eines Werksarztes über den jeweiligen Einzelfall, sondern hatte ein probabilistisches Programm, das sich auf alle anwenden ließ und dennoch gesicherte Erwartungen an die Zahl zukünftiger Krankheitsfälle versprach. Die individuelle Disposition ging im „Individualfaktor“ und damit in der szientistisch ermittelten und gesteuerten Silikosewahrscheinlichkeit auf.
Schluss Die Einbindung der Bergarbeiter in die Bekämpfung und Verhütung der Silikose erscheint ambivalent. Erstens lässt sich festhalten, dass die Distanz zwischen Arbeiternehmern, Arbeitgebern und Experten in der Frühphase der Bundesrepublik verringert wurde, indem die Mitbestimmung der Bergarbeiter in den Betrieben, in der Unfallversicherung und bei der Zulassung gutachterlicher Ärzte gestärkt wurde. Über die Einbindung in den technischen Ausschüssen der Unternehmerseite bestand trotz der eher marginalen Beteiligung der Mitglieder aus den Reihen der Gewerkschaft zumindest eine formelle Partizipation in die Debatten über die Silikoseprävention. Die Staublunge wurde dabei als rein technisch-medizinisches Problem thematisiert. Es kam zu keinem Zeitpunkt zu organisiertem Widerstand gegen die vorherrschende Praxis.67 Die gesetzlichen Grundsteine für die Staubbekämpfung im Steinkohlenbergbau, die ihre letzte maßgebliche Änderung in den Jahren 1951 und 1952 erfuhren, blieben in den darauffolgenden Jahrzehnten weitgehend unangefochten. In der Präventionspraxis zeigt sich zweitens eine klare Verlagerung von den moralischen Appellen an die Mitverantwortung der Belegschaften, z. B. durch die Anwendung persönlicher Schutzausrüstungen und nicht-automatischer Techniken der Staubbekämpfung, hin zu einer Anpassung der präventiven Techniken und der Arbeitsorganisation. Ein wichtiger Grund dafür war die man66 IGF, H0076, „Auftrag für ein Gutachten über die derzeitig möglichen Methoden zur Arbeitseinsatzlenkung im Steinkohlenbergbau“, S. 2. 67 Das Gegenbeispiel bilden die Vereinigten Staaten, in denen Vernachlässigung des Silikoseproblems zu militantem Widerstand der Steinkohlenbergarbeiter in den 1960er Jahren führte, vgl. dazu Rosner/Markowitz: Deadly Dust.
32 Daniel Trabalski
gelhafte Überwachbarkeit des individuellen Verhaltens vor Ort: Steiger und insbesondere eigens ausgebildete Staubbeauftragte sollten fortan zwar die Verfügbarkeit von Staubmasken und anderen Maßnahmen in ihren Betrieben im Auge behalten und Mängel anmahnen, mit der Einführung der Betriebs- und Staubkarteikarten wurden sie aber stärker in die Datenerfassung einbezogen, auf deren Grundlage ein für die Experten quantifizierbares System der zwangsweisen sowie automatischen Staubbekämpfung (Bohrhämmer nur mit Wasseranschluss, automatische Bedüsung der Maschinen und Transportbänder) und Messung entstand. Hieraus ging wiederum die Arbeitseinsatzlenkung hervor, mit deren Hilfe die Staubbelastung des Einzelnen auf die Gesamtheit der Arbeiter gestreut wurde. Es wurden nicht mehr länger nur bereits Erkrankte aus der staubgefährlichen Arbeit entfernt, sondern eine Entstehung von Krankheitssymptomen sollte bereits vorausschauend verhindert, d. h. das Risiko sollte kalkuliert und gesteuert werden. Obwohl die Karteikarten über die Staubbelastung und die Gesundheit der Arbeit ursprünglich Aufschluss über unterschiedliche Veranlagungen geben und dem Werksarzt als Entscheidungsgrundlage dienen sollten, speisten die darin gesammelten Daten letztlich einen regulativen Automatismus, in dem quantifiziertes Wissen seriell verarbeitet werden konnte.68 So driftete die Verantwortlichkeit für Entscheidungen der Gesunderhaltung aus dem Handlungshorizont der einzelnen Subjekte, und hin zu einem vom Wissen zahlreicher Spezialdisziplinen durchdrungenen System der Silikosebekämpfung. Dessen hergestellte Evidenz zeigte steigende oder fallende Staubsummen und Silikoserisiken an, empfahl wirksame und wirkungslose Maßnahmen, und blieb dem Einblick und Einfluss der Bergleute entzogen. Anstatt, wie in den fünfziger Jahren, der Eigenverantwortung der Arbeiter für die Nutzung der persönlichen Ausrüstung und örtlichen Staubbekämpfungsmaßnahmen wurden ab Mitte der sechziger Jahre eher Messmethoden, zulässige Grenzwerte und Wahrscheinlichkeiten von hochspezialisierten Experten aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und Medizin diskutiert. Die Maßnahmen zur Durchführung hingen in immer geringerem Maße von den Bergleuten ab. Deren Handlungsfeld verkleinerte sich, weil Automatismen in die Technik und in die Betriebsorganisation inkorporiert wurden. Stattdessen flossen Erfahrungen über das Verhalten der Bergarbeiter in die präventiven Techniken ein, z. B. über die Nutzung von Staubmasken. Exemplarisch lässt sich dies auch an der Entwicklung der prophylaktischen Inhalation ablesen, die sich bereits im Verlauf der 1950er Jahre von der schlecht angenommenen Einzelinhalation außerhalb 68 Bei der Verarbeitung und Auswertung der Karteikartendaten kamen in den sechziger Jahren computerisierte Lochkartensysteme zum Einsatz; vgl. IGF, H0932, „Arbeitseinsatzlenkung, Pneumokoniose und Umgebungsfaktoren, Frühdiagnose, Statistik“ (19.09.1967), S. 17.
Vom „eigenverantwortlichen Bergmann“ zum „Individualfaktor“
33
der Arbeitszeit nach Schichtende zu beiläufig durchschreitbaren Inhaliergängen am Zecheneingang entwickelten. Kern der Silikosebekämpfung war damit nicht eine Stärkung des „präventiven Selbst“. Die bergmännischen Subjekte wurden zum „Individualfaktor“, und damit zum problematischen letzten Unsicherheitsfaktor der technischen Regulierung. Sein nomineller Einfluss auf das Silikoserisiko im Bergbau war durch technische und organisationale Steuerung aller anderen Faktoren kleinzuhalten. Dieser Prozess verdeutlicht letztlich die Vielschichtigkeit und Ambivalenz der Geschichte der Prävention im 20. Jahrhundert, dessen historischer Wandel nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen gleich verlief, sondern – wie diese Fallstudie nahelegt – durch landes-, branchen- und gruppenspezifische Ungleichzeitigkeiten oder Gegenentwicklungen gekennzeichnet war.
Quellenverzeichnis Archiv der Dokumentations- und Forschungsstelle der Sozialversicherungsträger (sv:dok): Bestand 15 (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie) Archiv des Instituts für Gefahrstoff-Forschung (IGF): Bestand Silikose-Forschungsinstitut (SFI) Archiv für soziale Bewegungen: Bestand Industriegewerkschaft Bergbau und Energie (IGBE)
Literaturverzeichnis Abelshauser, Werner: Der Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung, München 1984. Bleidick, Dietmar: Bergtechnik im 20. Jahrhundert. Mechanisierung in Abbau und Förderung, in: Ziegler, Dieter (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 355–411. Bluma, Lars: Der Körper des Bergmanns in der Industrialisierung. Biopolitik im Ruhrkohlenbergbau 1890–1980, in: Ders./Uhl, Karsten (Hg.): Kontrollierte Arbeit – disziplinierte Körper? Zur Sozial- und Kulturgeschichte der Industriearbeit im 19. und 20. Jahrhundert (transcript Histoire), Bielefeld 2012, S. 35–72. Dietrich, Gerhilt: Berufskrankheiten in der gesetzlichen Unfallversicherung 1911–1965, München 2001. Gärtner, H.: Über die Grundlagen der bisherigen Leitstaubbehandlung, in: Ders./Jötten, K. W. (Hg.): Die Staublungenerkrankungen 1 (Bericht über die Staublungen-Tagung des Staatsinstitutes für Staublungenforschung beim Hygienischen Institut der Universität Münster/ W. vom 19.-21. November 1949), Darmstadt 1950, S. 271–277.
34 Daniel Trabalski
Kleinöder, Nina: Risikoregulierung am Arbeitsplatz – zwischen Rationalisierung und Gesundheitsschutz. Ein Problemaufriss zur Geschichte des Arbeitsschutzes am Beispiel der Eisen- und Stahlindisutrie zum Ende des 20. Jahrhunderts, in: Bluma, Lars/Uhl, Karsten (Hg.): Kontrollierte Arbeit – disziplinierte Körper? Zur Sozial- und Kulturgeschichte der Industriearbeit im 19. und 20. Jahrhundert (transcript Histoire), Bielefeld 2012, S. 163– 194. Kleinöder, Nina: Unternehmen und Sicherheit. Strukturen, Akteure und Verflechtungsprozesse im betrieblichen Arbeitsschutz der westdeutschen Eisen- und Stahlindustrie nach 1945 (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 234), Stuttgart 2015. Landwehr, Martin: Was der Bergmann von der Staublungen-Erkrankung (Silikose) und den Möglichkeiten zu ihrer Bekämpfung wissen muß, Bochum 21948. Lange, Fritz (Hg.): Bekämpfung der Silikose. Forschungsarbeiten 1, Essen 1955. Lange, Fritz (Hg.): Bekämpfung der Silikose. Forschungsarbeiten 2, Essen 1956. Lengwiler, Martin: Internationale Expertennetzwerke und nationale Sozialstaatsgeschichte. Versicherung der Silikose in Deutschland und der Schweiz (1900–1945), in: Journal of Modern European History 7 (2009:2), S. 197–218. Lengwiler, Martin: Risikopolitik im Sozialstaat. Die schweizerische Unfallversicherung 1870– 1970 (Industrielle Welt 69), Köln u. a. 2006. Lengwiler, Martin/Beck, Stefan: Historizität, Materialität und Hybridität von Wissenspraxen. Die Entwicklung europäischer Präventionsregime im 20. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft 34 (2008), S. 489–523. Lengwiler, Martin/Madarász, Jeannette: Präventionsgeschichte als Kulturgeschichte der Gesundheitspolitik, in: Dies. (Hg.): Das präventive Selbst. Eine Kulturgeschichte moderner Gesundheitspolitik (VerKörperungen / MatteRealities. Perspektiven empirischer Wissenschaftsforschung 9), Bielefeld 2010, S. 11–28. Martin, Michael: Spuren der Arbeit. Zur Beweiskraft des Röntgenbildes bei der Anerkennung der Silikose als Berufskrankheit, in: Westfälische Forschungen 64 (2014), S. 223–243. McIvor, Arthur/Johnston, Ronald: Miners’ Lung. A History of Dust Disease in British Coal Mining (Studies in Labour History), London/New York 2007. Oberbergamt Bonn (Hg.): Bergpolizeiverordnung für alle der bergpolizeilichen Aufsicht unterstehenden Betriebe im Verwaltungsbezirk des Oberbergamts Bonn zum Schutze der Gesundheit gegen Staubschäden vom 19. April 1950, Bonn 1950. Raphael, Lutz: Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und konzeptionelle Herausforderung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, in: Geschichte und Gesellschaft 22 (1996:2), S. 165–193. Rose, Nikolas: The Politics of Life Itself, in: Theory, Culture & Society 18 (2001:6), S. 1–30. Rosental, Paul-André: De la silicose et des ambiguïtés de la notion de „maladie professionnelle“, in: Revue d’histoire moderne et contemporaine 56 (2009:1), S. 83–96. Rosner, David/Markowitz, Gerald E.: Deadly Dust. Silicosis and the Ongoing Struggle to Protect Worker’s Health (Conversations in Medicine and Society), Ann-Arbor 2006. Schürmann, Christian: Die Regulierung der Silikose im Ruhrkohlenbergbau bis 1952. Staat, Unternehmen und die Gesundheit der Arbeiter (Research in Management Accounting & Control), Wiesbaden 2011. Trischler, Helmuth: Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Bergbau 1851 bis 1945. Bergbehördliche Sozialpolitik im Spannungsfeld von Sicherheit und Produktionsinteressen, in: Archiv für Sozialgeschichte 28 (1988), S. 111–151.
Martha Poplawski
„Richtig Führen im Bergbau“. Zur Verwissenschaftlichung des Steinkohlenbergbaus nach 1945 Die Anpassung und Optimierung des Verhältnisses zwischen Mensch und Arbeit durch externe Berater und Experten ist gegenwärtig in einem breiten Ausmaß in der Arbeitswelt enthalten. Ob in der Unternehmensführung, der Betriebsleitung oder der Arbeitsplatzgestaltung, die Integration externen Wissens in Unternehmen wird als eine probate Handlungs- und Lösungsstrategie angesehen, um Probleme, Herausforderungen oder Neukonzeptionierungen in den Betrieben zu meistern. Dabei stellt diese Handlungs- und Lösungsstrategie kein neuartiges Phänomen dar, sondern ist vielmehr ein Bestandteil des historisch gewachsenen Verwissenschaftlichungsprozesses von Betrieb und Arbeit, der im Zuge arbeitsorganisatorischer Rationalisierungsstrategien zunehmend an Bedeutung gewann. Die in diesem Prozess hinzugezogene wissenschaftliche Expertise diente vorrangig der Anpassung und Optimierung von Arbeitsprozessen und einer daraus resultierenden Leistungssteigerung. Auch der westdeutsche Steinkohlenbergbau wurde von einer Anpassungsund Optimierungswelle erfasst. Hier bildete die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ein enges Bündnis, welches dazu beitragen sollte, unterschiedliche betriebliche Probleme zu lösen und die ökonomisch-sozialen Herausforderungen mit Hilfe von externem Wissen und alternativen Handlungsoptionen zu überwinden. So verhielt es sich auch zu Beginn der 1950er Jahre, als eine seit 1945 anhaltende Arbeitskräfte- und Fluktuationsproblematik den Auftakt für den Bedarf an externen wissenschaftlichen Fachkenntnissen im Steinkohlenbergbau bildete. Um die Ursachen für die hohe Fluktuation zu ergründen, wurde zu Beginn der 1950er Jahre das Institut Sozialforschungsstelle Dortmund (SFS) damit beauftragt, eine betriebssoziologische Untersuchung durchzuführen. Die daraus entstandene Studie „Bergmann und Zeche“1 bildete den Auftakt für eine langanhaltende Verbindung zwischen bergbaulicher Arbeitswelt und betriebssoziologischer Wissenschaft, von der beide nachhaltig profitierten.
1 Jantke, Carl: Bergmann und Zeche. Die sozialen Arbeitsverhältnisse einer Schachtanlage des nördlichen Ruhrgebiets in der Sicht der Bergleute, Tübingen 1953. https://doi.org/10.1515/9783110729979-003
36 Martha Poplawski
Im Verlauf der 1960er Jahre wandelten sich die Herausforderungen in der Arbeitswelt der Steinkohlenbergbaubetriebe. Durch technische (Weiter-) Entwicklungen, zahlreiche Zechenzusammenlegungen sowie die Anstellung ausländischer Arbeiter, veränderte sich das betriebliche Sozialgefüge unter Tage und bedingte eine gewandelte Einstellung der Bergarbeiter zum Betrieb und ihrer Arbeit. Unterdessen bewirkte die fortschreitende technische Entwicklung der untertägigen Anlagen eine höhere Qualifikation der Bergarbeiter sowie eine zunehmende Ausdifferenzierung der Berufsprofile. Auch das mittlere Management – hierzu zählten im Wesentlichen die Steiger – wurde dadurch vor neue Herausforderungen gestellt, die insbesondere im sozialen Umgang mit den Bergarbeitern auftraten. Die an den technischen Wandel angepassten Qualifikationen und Arbeiterprofile machten gleichzeitig eine Anpassung der Betriebsführung seitens der Steiger erforderlich. Jedoch konnte die Anpassung der Betriebsführung mit der schnellen technischen und qualifikatorischen Entwicklung nicht Schritt halten, so dass vermehrt auf etablierten Formen der Betriebsführung zurückgegriffen wurde und diese stark in Kritik gerieten. Unter diesen Umständen bedienten sich die Zechengesellschaften erneut externer wissenschaftlicher Expertise. Im Auftrag der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) wurde das Münchener Institut Mensch und Arbeit zu Beginn der 1960er Jahre mit einer Untersuchung zur Betriebsführungsproblematik in den Zechenbetrieben beauftragt. Ziel dieser Untersuchung war es, die Ursachen für das fehlerhafte Führungsverhalten der Steiger herauszuarbeiten und dieses an die zeitgenössischen sozialbetrieblichen Entwicklungen anzupassen. Erweiterte Rationalisierungsmaßnahmen und eine zunehmende Technisierung der Arbeitsprozesse beförderten in den 1970er Jahren eine gesamtgesellschaftlich umfangreiche Debatte zur Qualität und Zukunft industrieller Arbeit. Auch im westdeutschen Steinkohlenbergbau wurden solche Problematiken und die damit einhergehenden Herausforderungen wahrgenommen. Hier hatte der erhöhte Mechanisierungsgrad zwar dazu beigetragen, dass bestimmte Formen körperlicher Schwerarbeit abgebaut wurden. Dafür aber psychische Belastungen durch einen vermehrten Verantwortungs- und Leistungsdruck zunahmen, wodurch die Problembereiche lediglich verlagert, jedoch nicht beseitigt wurden.2 Im Kontext dieser bergbaulichen Entwicklungen trat das bundesdeutsche Aktions- und Forschungsprogramm „Humanisierung des Arbeitslebens“ (HdA) 2 Sauer, Dieter u. a.: Einige Thesen zur Entwicklung von Rationalisierung und „Humanisierung“ im Bergbau, in: Fronz, Manfred/Peter, Gerd/Pöhler, Willi (Hg.): Neueste Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Forschung im Steinkohlenbergbau, Tagungsbericht, Bochum 1981, S. 113–127, hier S. 119.
„Richtig Führen im Bergbau“
37
zu Tage. Finanziert wurde das Programm vom Bundesministerium für Forschung und Technologie. Innerhalb des Programms beschäftigten sich seit 1974 bundesweit staatliche, wirtschaftliche und wissenschaftliche Akteure unter dem Vorsitz des Bundesarbeits- und Forschungsministeriums mit den Arbeitsverhältnissen und dem Einfluss physischer und psychischer Belastungen auf den arbeitenden Menschen in unterschiedlichen Industriebranchen. Mit dem Programm verfolgte die Bundesregierung unterschiedliche Ziele: Durch die Verbreitung und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse sollte die Arbeitskraft geschützt und damit eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsverhältnisse erzielt werden. Zudem bezweckte das Programm eine allgemeine Entfaltung der Produktivkraft Arbeit und damit einhergehend eine Verbesserung der gesellschaftlichen Situation.3 Mit 91 Forschungsvorhaben bis 1984 war die Förderung der Forschung im Steinkohlenbergbau sehr umfangreich strukturiert.4 Im Rahmen arbeitswissenschaftlicher Studien widmeten sich unterschiedliche Institute5 der Untersuchung von Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen, der Arbeitsorganisation sowie der Verbesserung der Arbeitsbedingungen.6 Gleichzeitig wurden die wissenschaftlich erarbeiteten Kenntnisse und Ergebnisse im Rahmen von Fachtagungen und Projektgruppen an die innerbetrieblichen Akteure herangetragen bzw. in die Praxis der Arbeitswelt übertragen. Für den westdeutschen Steinkohlenbergbau hatte es die Westfälische Berggewerkschaftskasse übernommen, die wissenschaftlich erarbeiteten Erkenntnisse zur Verbesserung der Arbeitsqualität und der Beseitigung von Belastungen am Arbeitsplatz zu dokumentieren und in die betriebliche Praxis zu transferieren.7 Die Zielsetzungen des HdA lagen dabei auf der Verbesserung des Arbeitsschut3 Pöhler, Willi: Fünf Jahre Humanisierungsprogramm im Bereich des Bundesministers für Forschung und Technologie, in: Ders. (Hg.): …damit die Arbeit menschlicher wird. Fünf Jahre Aktionsprogramm Humanisierung des Arbeitslebens, Bonn 1979, S. 9–37, hier S. 11 f. 4 Stams, Joachim: Übertragung von Ergebnissen der HdA-Forschung in den Steinkohlenbergbau, in: Bergbau 1 (1984), S. 20–25, hier S. 20. 5 Folgende Institute waren unter anderem mit Studien beteiligt: Das Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund, das Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e. V. aus Saarbrücken, die Gesellschaft für Arbeitsschutz- und Humanisierungsforschung mbH aus Dortmund, das Institut zur Erforschung sozialer Chancen aus Köln oder das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e. V. aus München; vgl. Fronz/Peter/Pöhler: Neueste Ergebnisse. 6 Dazu gehörten insbesondere Studien zur Unfallverhütung, zur Staubbekämpfung, zur Klimatisierung, zur Lärm- und Vibrationsminderung, der Verbesserung der Sichtverhältnisse, dem Katastrophenschutz, dem Brandschutz und der Gebirgsschlagbekämpfung. Hudewentz, Dietrich: Humanisierung der Arbeit (Vorgetragen auf der Betriebsrätekonferenz der EschweilerBergwerks-Verein am 11.03.1981), in: Bergbau 8 (1981), S. 551–555, hier S. 552. 7 WBK Projektgruppe HdA-Transfer: Transfer von HdA-Ergebnissen in den Steinkohlenbergbau, Essen 1984.
38 Martha Poplawski
zes, dem Abbau von Belastungen, einer Verbesserung der Arbeitsqualität sowie einer Steigerung der Attraktivität des Bergmannsberufes.8 Vor dem Hintergrund dieser kontextuellen Entwicklungen und Ursachen widmet sich der Beitrag folgenden Fragen: 1. Welche innerbetrieblichen Transformationsprozesse bildeten im westdeutschen Steinkohlenbergbau von 1945 bis 1989 die Ursachen für den Bedarf an arbeitswissenschaftlich orientierteren Problemlösungen? 2. Welche Institute und Wissenschaftler führten die Studien durch und was waren ihre Ziele? 3. Welche Inhalte wählten die Arbeitswissenschaftler in ihren Studien aus und welche Analysegegenstände wurden von ihnen problematisiert? 4. Erfolgte in den Studien eine Konstruktion spezieller Machtdiskurse und Machtzuweisungen an bestimmte Akteure? Zur Beantwortung dieser Fragen werden im Folgenden die drei oben eingeführten arbeitswissenschaftlichen Studien9 nach ihrer kontextuellen Entstehung und ihren Inhalten analysiert.10 Die drei Studien werden je einen Zeitraum zugeordnet, der sich anhand der betriebssozialen Entwicklungen im Steinkohlenbergbau strukturiert und im Folgenden der zeitlichen sowie inhaltlichen Abgrenzung dient. Mit Hilfe der veröffentlichten Studien und weiterem unveröffentlichten Quellenmaterial wird somit erstens, die Entwicklung innerbetriebli8 Beer, Walter: Vorwort, in: Fronz/Peter/Pöhler: Neueste Ergebnisse, S. 7–7, hier S. 7. 9 Im Folgenden werden die hier analysierten Studien als arbeitswissenschaftliche Studien bzw. unter dem Begriff der Arbeitswissenschaften zusammengefasst. Sie sind als Subsumption sozialwissenschaftlich arbeitender Disziplinen zu verstehen, die empirische Forschung in Industrieunternehmen betrieben und/oder zu Themen arbeiteten, die die Entwicklung von industrieller Arbeit und Management betrafen. Die Verwendung des Begriffes der Arbeitswissenschaften dient hierbei dazu, den Zugriff dieser verschiedenen Fachdisziplinen auf den gemeinsamen Gegenstand – hier den Steinkohlenbergbau – zusammenzufassen, auch wenn sich die disziplinären und institutionellen Kontexte unterschieden. 10 Mit der historischen Analyse zur Verwissenschaftlichung von Arbeit und Industrie geht gleichzeitig ein Hinweis auf die Notwendigkeit der methodischen Reflektion zeitgenössischer sozialwissenschaftlicher Studien einher. Die im Rahmen wissenschaftlicher Forschungsprojekte entstandenen Untersuchungen, Studien, Zwischen- und Abschlussberichte dienten Zeithistorikern zumeist als ergiebige Quellen zur Erforschung von Arbeitsverhältnissen und Betriebsstrukturen, wurden hinsichtlich ihrer Entstehung und Wirkung nur selten historisch kritisch hinterfragt. Erst in Folge der Überlegungen von Benjamin Ziemann und Rüdiger Graf zum Umgang mit sozialwissenschaftlichen Studien und Analysen als historische Quellen, entwickelte sich eine ausgeprägte Sensibilität gegenüber dieser Quellenart und der darin verwendeten methodischen Konzepte, Begriffe und Theorien. Vgl. dazu: Graf, Rüdiger/Priemel, Kim Christian: Zeitgeschichte in der Welt der Sozialwissenschaften. Legitimität und Originalität einer Disziplin, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 59 (2011:4), S. 479–508.
„Richtig Führen im Bergbau“
39
cher Herausforderungen und Problemfelder des westdeutschen Steinkohlenbergbaus von 1945 bis 1989 beleuchtet. Zweitens, der unternehmerische Entschluss, diese Problemfelder mit Hilfe arbeitswissenschaftlicher Studien zu bewältigen ergründet. Sowie drittens, die Form der Problematisierung in den arbeitswissenschaftlichen Studien erarbeitet. Dabei wird die Hinwendung der unternehmerischen Akteure zur (arbeits-) wissenschaftlichen Expertise als Strategie angesehen, die – in Anlehnung an Lutz Raphaels Konzept der Verwissenschaftlichung des Sozialen11 – als ein Bestandteil des Verwissenschaftlichungsprozesses im 20. Jahrhundert aufgefasst wird, in dem die Deutungsmacht der Wissenschaft eine zunehmende Wirkung im sozialen Handlungsraum des Betriebs entfaltete. Neben Lutz Raphael bilden Margit Szöllösi-Janzes Überlegungen zum Wissenschaftler als Experten einen weiteren Bezugsrahmen für die historische Analyse des Verwissenschaftlichungsprozesses.12 Ähnlich wie Lutz Raphael argumentiert Szöllösi-Janze, dass sich die moderne Gesellschaft im 20. Jahrhundert zu einer Wissensgesellschaft entwickelte. In Folge der rasanten Entfaltung von wissensproduzierenden Institutionen wie Universitäten und Forschungseinrichtungen, ging gleichzeitig eine Zunahme wissensfundierter Berufe und Berufsgruppen einher, die als Experten, Ratgeber und Berater eine zentrale Rolle in der Gestaltung und Vermittlung wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Prozesse einnahmen.13 Ihre Aufgabe bestand in der Erarbeitung und Vermittlung spezieller Wissensinhalte an jene wirtschaftlichen Akteure, die selbst nicht darüber verfügten.14 Die wissenschaftlichen Experten traten dabei als Wissensträger, -vermittler oder -produzenten auf. Mit der Integration spezieller Wissensinhalte in wirtschaftliche Entscheidungen und Entwicklungen gewannen die Experten an Einfluss. Diesen konnten sie stetig erweitern, indem sie relevante Probleme und Konfliktfelder in erheblichem Maße mit definierten, um sie nachfolgend mit Hilfe ihrer Expertise und ihres Wissensrepertoires zu lösen und somit erneut als Experte zu Rate gezogen zu werden.15 Ausgehend von den Ausführungen Lutz Raphaels und Margit Szöllösi-Janzes wird für die nachfolgende Analyse und Argumentation die These aufge11 Vgl. dazu: Raphael, Lutz: Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und konzeptionelle Herausfordeung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, in: Geschichte und Gesellschaft 22 (1996), S. 165–193, hier S. 165. 12 Szöllösi-Janze, Margit: Der Wissenschaftler als Experte. Kooperationsverhältnisse von Staat, Militär, Wirtschaft und Wisssenschaft, 1914–1933, in: Kaufmann, Doris (Hg.): Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus. Bestandsaufnahme und Perpektiven der Forschung, Göttingen 2000, S. 46–64. 13 Ebd., S. 47. 14 Ebd. 15 Ebd., S. 48.
40 Martha Poplawski
stellt, dass die Zechenbetriebe des westdeutschen Steinkohlenbergbaus seit 1945 als ein Experimentierfeld der Verwissenschaftlichung des Betriebes fungierten, um unterschiedliche arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse, Forschungsansätze und Methoden zu erproben und auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. Der Aufsatz gliedert sich in fünf Abschnitte: Zunächst wird ein Überblick über die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft von den 1920er Jahren bis 1945 gegeben (1). Mit Hilfe dieses Überblicks wird die historische Pfadabhängigkeit der Arbeitswissenschaften dargestellt und gezeigt, wie Arbeitsanpassung und Leistungsoptimierung in jener Zeit diskutiert wurden. Unter Berücksichtigung der sozialökonomischen Entwicklungen im westdeutschen Steinkohlenbergbau werden nachfolgend die drei ausgewählten Studien chronologisch beleuchtet. Die Studie „Bergmann und Zeche“ wird im Kontext der bergbaulichen Problemfelder in der Anwerbung, Integration und Bindung neuer Bergarbeiter analysiert (2). Mit den Untersuchungen des Instituts Mensch und Arbeit wird die zeitgenössische Vorstellung von „richtiger Betriebsführung“ im Steinkohlenbergbau vorgestellt (3). Nachfolgend wird das Forschungsprogramm „Humanisierung des Arbeitslebens“ im Kontext gesellschaftlicher Diskurse und Wahrnehmungen der 1970er Jahre beleuchtet (4). In einer abschließenden Zusammenfassung wird auf die oben genannten Fragen eingegangen (5). Somit hat der Beitrag das Ziel, die Verflechtungsgeschichte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft im westdeutschen Steinkohlenbergbau zu erörtern. Dabei trägt er sowohl zur Geschichte der Verwissenschaftlichung, als auch zur Geschichte der Arbeit im westdeutschen Steinkohlenbergbau nach 1945 bei.
Wissensproduktion für Industrie und Arbeit – Ein Überblick Die erste und maßgeblich prägende Phase wissenschaftlicher Wissensproduktion für den industriellen Betrieb kann in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts verortet werden. Beeinflusst von fordistischen und tayloristischen Idealen der Arbeitsgestaltung, setzten betriebssoziologisch arbeitende Forscher den Grundstein für eine Auseinandersetzung mit der Optimierung und Anpassung betrieblicher Strukturen.16 Die Ursache für diese Entwicklung lag in einem dynamischen Zusammenspiel aus fortschreitenden technischen Veränderungen 16 Luks, Timo: Der Betrieb als Ort der Moderne. Zur Geschichte von Industriearbeit, Ordnungsdenken und Social Engineering im 20. Jahrhundert (Histoire 14), Bielefeld 2010, S. 90.
„Richtig Führen im Bergbau“
41
und den ökonomischen Zielsetzungen der Unternehmen. Daraus erfolgte eine Intensivierung und Rationalisierung der Produktionsabläufe sowie die Zielsetzung, sämtliche Arbeitsbereiche optimal auszunutzen und vermeintliche Störfaktoren zu beseitigen. Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen, wie der Sozial- oder der Ingenieurswissenschaft erlangten fortan einen zunehmenden Einfluss und eine anwachsende Deutungshoheit über die Gestaltung der betrieblichen Abläufe. Dabei hatten sie nicht nur die optimale Auslastung der Maschinen zum Ziel, sondern bezogen auch die Arbeiter und Arbeiterinnen in ihre Kalkulationen mit ein.17 Eine an diesem Prozess beteiligte Disziplin waren die Arbeitswissenschaften, die sich mit der Gründung des Kaiser-Wilhelm-Institutes für Arbeitsphysiologie im Jahr 1913 erstmalig im deutschen Raum institutionell etablierten und seit der Weimarer Republik als Teil des Lehrangebots an Universitäten und Technischen Hochschulen vertreten waren.18 Das interdisziplinär aufgestellte Fach verstand sich seinen Inhalten nach, als Wissenschaft von der menschlichen Arbeit unter dem speziellen Gesichtspunkt des Zusammenwirkens von Menschen, Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenständen.19 Mit der Untersuchung von Arbeitsbedingungen sowie der Wirkung von Arbeit auf den Menschen und seine Leistungsfähigkeit, verfolgten die Arbeitswissenschaften das Ziel, eine systematische Analyseform zu konstruieren, mit der die technischen, organisa17 Zur Geschichte der Rationalisierung kann auf eine Vielzahl historischer Abhandlungen verwiesen werden, weshalb hier lediglich folgende erwähnt seien: Uhl, Karsten: Humane Rationalisierung. Die Raumordnung der Fabrik im fordistischen Jahrhundert (Histoire 62), Bielefeld 2014; Luks, Timo: Die „psychognostische Schwierigkeit der Beobachtung“. Industriebetriebliches Ordnungsdenken und social engineering in Deutschland und Großbritannien in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, in: Etzemüller, Thomas (Hg.): Die Ordnung der Moderne. Social Engineering im 20. Jahrhundert (Histoire 9), Bielefeld 2009, S. 87–108; König, Wolfgang: Kontrollierte Arbeit = optimale Arbeit? Frederik Winslow Taylors Programmschrift der Rationalisierungsbewegung, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 6 (2009:2), S. 1–5. 18 Die interdisziplinär arbeitenden Arbeitswissenschaften bedienten sich für ihre Untersuchungen der Erkenntnisse anderer Disziplinen, wie zum Beispiel der der Medizin, den Betriebswissenschaften, der Arbeitsphysiologie und Arbeitspsychologie, der Sozialpsychologie und der empirischen Soziologie. Eine enge Beziehung bestand zudem zu den Ingenieurwissenschaften und zum Arbeitsrecht. Vgl. dazu: Bullinger, Hans-Jörg/Braun, Martin: Arbeitswissenschaft in der sich wandelnden Arbeitswelt, in: Ropohl, Günter (Hg.): Erträge der Interdisziplinären Technikforschung. Eine Bilanz nach 20 Jahren, Berlin 2001, S. 109–124, hier S. 109; Uhl, Karsten: Die Geschlechterordnung der Fabrik. Arbeitswissenschaftliche Entwürfe von Rationalisierung und Humanisierung 1900–1970, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenchaften 21 (2010:1), S. 93–117, hier S. 96. 19 Bullinger/Braun: Arbeitswissenschaft, S. 110; Raehlmann, Irene: Arbeitswissenschaft im Nationalsozialismus. Eine wissenschaftssoziologische Analyse, Wiesbaden 2005.
42 Martha Poplawski
torischen und sozialen Bedingungen von Arbeitsprozessen geordnet und optimiert werden konnten. Dazu befassten sie sich mit betrieblichen Handlungsfeldern, wie der Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung sowie mit Strategien zur Personalgewinnung, -entwicklung und –bindung. Die dabei entstandene Bündnispartnerschaft zwischen Industrie und Wissenschaft diente allen an diesem Prozess beteiligten Akteursgruppen, die fortan wechselseitig voneinander profitierten. So erhielten die wissenschaftlichen Akteure durch die Kooperation die Möglichkeit, politische, soziale oder gesellschaftliche Problemfelder zu untersuchen und ihre Lösungs- und Optimierungsstrategien praktisch anwenden zu lassen. Zudem schufen bzw. verfestigten sie mit der Erarbeitung dieser Optimierungs- und Problembereiche ihre eigene Arbeitsgrundlage, wodurch sie wiederum Aufmerksamkeit, Ressourcen und eine anwachsende Legitimation ihrer Tätigkeit erlangten.20 Die wirtschaftlichen Akteure hingegen, nutzten die Ergebnisse der Wissenschaftler zu ihren Zwecken, indem sie die wissenschaftlich erarbeiteten Informationen und Handlungsempfehlungen annahmen und nach eigenem Ermessen umsetzten. So gewann die Aneignung und Implementierung wissenschaftlich erarbeiteter Handlungsalternativen in den industriellen Betrieben zu Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung und bot ein empirisch-analytisches Instrument zur Optimierung betrieblicher Abläufe und somit auch zur Erlangung rationaler und ökonomischer Zielsetzungen in den Unternehmen. Eine solche Form der Verwissenschaftlichung des Betriebes setzte zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch im deutschen Steinkohlenbergbau ein. In einer Studie des Enquete-Unterausschusses zur Untersuchung der Arbeitsverhältnisse im Steinkohlenbergbau von 1912 bis 192621 wurden neun deutsche Zechenbetriebe22 im rheinisch-westfälischen und im oberschlesischen Revier auf ihre Optimierungsmöglichkeiten hin untersucht. Ziel dieser Studie war es, die kausalen Zusammenhänge zwischen Arbeitszeit, Lohn und Leistung zu erkennen und etwaige leistungshemmende Ursachen herauszuarbeiten. Mit Hilfe statistischer 20 Adamski, Jens: Ärzte des sozialen Lebens. Die Sozialforschungsstelle Dortmund 1946–1969 (Veröffentlichungen des Instituts für soziale Bewegungen – Schriftenreihe A: Darstellungen 41), Essen 2009, S. 11. 21 Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft (Hg.): Die Arbeitsverhältnisse im Steinkohlenbergbau in den Jahren 1912–1926, Berlin 1928. 22 Die Auswahl der Zechenbetriebe erfolgte unter dem Gesichtspunkt der bestmöglichen Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Arbeitszeit und Lohnverhältnissen. So sollten in den ausgewählten Betrieben erhebliche Änderungen der Arbeitszeit und Lohnverhältnisse stattgefunden haben, die Produktionseffekte erheblichen Schwankungen ausgesetzt gewesen sein sowie die natürlichen Abbauverhältnisse und Abbautechnik verhältnismäßig konstant geblieben sein, vgl. dazu: Ebd., S. 5 f.
„Richtig Führen im Bergbau“
43
Methoden sowie der Hinzunahme von Befragungen und Beobachtungen23 wurde neben dem Umgang mit neu eingeführten Maschinen und Arbeitsgeräten24 und der Problematik der Gedingesetzung25, ein besonderes Augenmerk auf die psychische Belastung der Arbeiter gelegt. Letzteres, so arbeitete der EnqueteAusschuss heraus, stand in einem direkten Zusammenhang zum Leistungswillen der Bergarbeiter und wurde durch ihre subjektive Einstellung zum Betrieb und zum Vorgesetzten beeinflusst. Der Ausschuss stellte heraus, dass die subjektive Einstellung einzelner Bergarbeiter eine zunehmende negative Entwicklung erfuhr. Begründet wurde diese Entwicklung mit der verstärkten Mechanisierung der Zechenbetriebe, der daraus resultierenden Betriebskonzentration sowie der Steigerung der Abbaugeschwindigkeit, die wiederum die Arbeitsbelastung der Bergarbeiter und Steiger erhöhte und vermehrt zu Anspannungen und Unwillen führte. Die aus dem technischen Fortschritt entstandenen sozialen Probleme unter Tage wurden von den Wissenschaftlern als zentrale Ursache für den Leistungsabfall angesehen.26 Kritik erfuhren dabei vorrangig die älteren Bergarbeiter, denen eine fehlende Anpassungsfähigkeit zugesprochen wurde. Grundsätzlich, so stellten die Wissenschaftler fest, standen die älteren Bergarbeiter der Maschine feindlich gegenüber, da sie der Auffassung waren, dass diese den Arbeiter verdränge und sie zudem an der erzielten Steigerung des Ertrages nicht ausreichend beteiligt wären, obwohl sie ihre Arbeit schneller und kontrollierter vollrichten mussten. Somit wurde der Zechenbetrieb im arbeitswissenschaftlichen Diskurs dieser Studie als ein technisches Gebilde aufgefasst, an dessen Struktur die Bergarbeiter angepasst werden sollten. Durch die Angleichung der Arbeitsleistung der Bergarbeiter an das Maschinentempo, die neuen, technisch determinierten Arbeitsabläufe sowie die Herstellung kausaler Zusammenhänge zwischen subjektiver Einstellung und Leistungswille, entsprachen die Beobachtungen und Ergebnisse dieser Studie den etablierten Optimierungs- und Anpassungsdiskursen der 1920er Jahre.27 Ab 1933 wurde die arbeitswissenschaftliche Zielsetzung zugunsten einer völkisch-rassistischen und dem Nationalismus dienenden Wissenschaft umgewandelt.28 Es standen zwar weiterhin Fragen der Anpassung des Ar23 Ebd., 56 f. 24 Dabei handelte es sich um Schüttelrutschen, Abbauhämmer und Schrämmaschinen. 25 Beim Gedinge handelt es sich um eine bergbautypische Form des Akkordlohns. 26 Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft (Hg.): Die Arbeitsverhältnisse, S. 268 f. 27 Vgl. dazu die Erläuterung Karsten Uhls, der darauf verweist, dass die deutsche Arbeitswissenschaft davon ausging, dass Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleitung unlösbar zusammenhingen: Uhl: Humane Rationalisierung, S. 141. 28 Raehlmann: Arbeitswissenschaft im Nationalsozialismus, S. 33.
44 Martha Poplawski
beiters sowie der Optimierung der Arbeitsverfahren im Vordergrund, jedoch wurden diese fortan unter der Prämisse nationalsozialistischer Richtlinien thematisiert, die den Betrieb im Sinne der „Betriebsgemeinschaft“ betrachteten.29 Die Erforschung betrieblicher und sozialer Anpassungs- und Optimierungsbestrebungen erfolgte demgemäß unter nationalsozialistischen Vorgaben und diente den völkischen, rassistischen und expansionistischen Herrschafts- und Leistungsansprüchen der nationalsozialistischen Machthaber. Gleichzeitig führten personelle und organisatorische Veränderungen seit 1933 zu einem tiefgründigen Umbau des Wissenschaftssystems nach nationalsozialistischen Grundsätzen30, unter dem auch die Arbeitswissenschaften einer Neugestaltung gegenüberstanden. Ab 1935 wurde die arbeitswissenschaftliche Forschung durch das Arbeitswissenschaftliche Institut (AWI) der Deutschen Arbeitsfront (DAF) weitergeführt. Das Institut fungierte als eine Art wissenschaftlicher Dienstleister, indem es den politischen Dienststellen der DAF vermeintlich objektives Material für den Umgang mit betrieblichen Problemen zur Verfügung stellte.31 Die Schwerpunkte der Forschungsarbeitet richteten sich nach den jeweiligen zeitgenössischen Problembereichen der (kriegs-) wirtschaftlichen Entwicklung. So rückten mit der Vollbeschäftigung und dem Arbeitskräftemangel ab 1937 Studien zu Arbeitseinsatz, Arbeitszeit und Lohnsteuerung in den Fokus. Ein Hauptgebiet der Forschung bildeten außerdem Untersuchungen zur Optimierung und Rationalisierung von Arbeitsprozessen, zur Motivationssteigerung der Arbeiter, zu Fragen der Lohnpolitik sowie zur Arbeitsplatzgestaltung.32 Es lässt sich demnach eine deutliche Kontinuität zu den behandelten Themenfeldern und Inhalten der 1920er Jahre feststellen, wenngleich einzelne personelle und institutionelle Brüche aber auch starke Kontinuitäten die Kennzeichen dieses Zeitraums darstellten.33 Unter den oben genannten institutionellen Entwicklungen und dem Einfluss der nationalsozialistisch-rassistischen Ideologie wurde auch im deutschen Steinkohlenbergbau versucht, leistungssteigernde Ziele durch eine Reihe an die DAF angegliederter „Sonderkommissare“, wissenschaftlicher Institute und poli29 Ebd. 30 Tradierte, partizipative Strukturen innerhalb der Wissenschaftslandschaft wurden durch das sogenannte Führerprinzip ersetzt. Die Neugestaltung nach dem Führerprinzip bedeutete eine Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse von Hochschulen zur Staats- und Parteibürokratie sowie die partielle Entmachtung der ordentlichen Professoren, vgl. dazu: Ebd., S. 29. 31 Schneider, Michael: Unterm Hakenkreuz. Arbeiter und Arbeiterbewegung 1933 bis 1939 (Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in Deutschland seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 12), Bonn 1999, S. 199. 32 Ebd., S. 200. 33 Genaue Auflistungen zu den personellen und institutionellen Kontinuitäten sind zu finden bei: Raehlmann: Arbeitswissenschaft im Nationalsozialismus, S. 51 ff.
„Richtig Führen im Bergbau“
45
tischer Ämter zu erfüllen. Der tatschliche Einfluss der DAF war hier allerdings gering und drehte sich vielmehr um Machtfragen als um konkrete Inhalte.34 Dies war einerseits eine Folge des Widerstands der privatwirtschaftlichen Zechenunternehmer gegen eine externe Einflussnahme, andererseits verfügten die Zechengesellschaften bereits über eine umfangreiche sozialpolitische Struktur, die die Maßnahmen der DAF hinfällig machte.35 Dennoch gab es Seitens der DAF-Funktionäre unterschiedliche Versuche, mit dem Steinkohlenbergbau zu kooperieren, um Kampagnen und Maßnahmen im „gemeinschaftserziehenden“ Sinne durchzuführen.36 Ursächlich waren dafür zwei Entwicklungen: Erstens, die zunehmende Abwanderung der Bergarbeiter in andere Industriebranchen, wie die Stahl- und Eisenindustrie sowie zweitens, der vorherrschende Grubenmilitarismus in den Zechenbetrieben unter Tage. Letzteres stand für die DAF an oberster Stelle ihrer sozialpolitischen Bemühungen, galt es doch, das Ideal der „Betriebsgemeinschaft“ in den Zechenbetrieb einzuführen, wozu speziell die Wertschätzung der Bergarbeiter gehören sollte.37 Eine besondere Berücksichtigung fand dabei die Problematik der Leistungssteigerung, die in einen kausalen Zusammenhang mit den sozialen Bedingungen im Zechenbetrieb gebracht wurde. Maßnahmen, die von der DAF initiiert wurden, um primär die Ideologie der „Betriebsgemeinschaft“ und sekundär die Förderleistung der Bergarbeiter zu steigern, konzentrierten sich vornehmlich auf die Verbesserung der „betrieblichen Menschenführung“. Mit diesen Maßnahmen verfolgte man das Ziel, dem Führungspersonal einen modernen, auf volksgemeinschaftlicher Kameradschaft basierenden Führungsstil zu vermitteln, um den Grubenmilitarismus zu beseitigen oder Alternativen zum traditionellen autoritär-disziplinierenden Führungsstil zu propagieren.38 Diese Maßnahmen wurden jedoch nur in Ansätzen und lediglich vereinzelt im fiskalischen Steinkohlenbergbau durchgesetzt. Hier wurde nach der Berufung Erich Winnackers39 zum Oberberghauptmann die Ein34 Seidel, Hans-Christoph: Arbeitsbeziehungen und Sozialpolitik im Bergbau. Vom Nationalsozialismus bis zum Ende der alten Bundesrepublik, in: Ziegler, Dieter (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 446–514, hier S. 448 ff. 35 Versuche der Einflussnahme der DAF scheiterten besonders in den Bereichen Lehrlingsausbildung, Fortbildung, Unfallschutz, betriebliche Gesundheitspolitik, vgl. dazu: Ebd., S. 454. 36 Zu den Maßnahmen zählten Jubilarfeiern, Kameradschaftsabende, Betriebsappelle, Berufsund Sportwettkämpfe; Sammlungen für das Winterhilfswerk und Aktionen, die das bergmännische Brauchtum befördern sollten. All diese Maßnahmen sollten zur Förderung von Berufsstolz und Arbeitsethos beitragen, vgl. dazu: Ebd., S. 452 f. 37 Ebd. 38 Ebd. 39 Erich Winnacker trat 1932 der NSDAP bei, 1933 wurde er zum Nachfolger Ernst Flemmings als Oberberghauptmann berufen, vgl. dazu: Trischler, Helmuth: Steiger im deutschen Bergbau.
46 Martha Poplawski
flussnahme arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse und der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für technische Arbeitsschulung (DINTA), dem späteren Amt für Berufserziehung und Betriebsführung die Schulung des Führungspersonals insbesondere zu Fragen den „Menschführung“ ausgeweitet.40 Zahlreiche Zurück- und Abweisungsversuche der Bergwerksgesellschaften führten jedoch dazu, dass der Einfluss der DAF- und DINTA-Funktionäre auf den Steinkohlenbergbau gering gehalten wurde.41 Auch konnte das Ideal der „Betriebsgemeinschaft“ nicht durchgesetzt werden, da die kriegsbedingte Erhöhung der Fördermengen die Belastungen im Zechenbetrieb ansteigen ließ und der bestehende Grubenmilitarismus sogar verstärkt wurde, wodurch die Vorstellung von der „Betriebsgemeinschaft“ im Steinkohlenbergbau ad absurdum geführt wurde.42 Nach 1945 wurde die Entwicklung der Arbeitswissenschaften von zwei stereotypen Selbstzuweisungen arbeitswissenschaftlicher Forscher begleitet.43 Sie beruhten auf der These, dass die sozialwissenschaftliche Forschung im Nationalsozialismus entweder nicht existiert habe oder von den NS-Funktionären unterdrückt, liquidiert bzw. ausgetrieben wurde.44 In dem selbsthistorisierenden Narrativ der Wissenschaftler wurde zumeist auf die Traditionen der arbeitswissenschaftlichen Konzepte und Inhalte der 1920er Jahre verwiesen und die Zeit des Nationalsozialismus herausgelöst.45 Das Jahr 1945 wurde demnach als Nullpunkt angesehen, wodurch die unmittelbare Nachkriegsphase folglich zur Neubegründungs- bzw. Wiederbelebungszeit ernannt wurde. Dass es sich bei dieser Darstellung um ein Defizit in der Geschichtsschreibung zu den inhaltlichen und personellen Kontinuitäten einzelner Akteure im Nationalsozialismus handelte,
Zur Sozialgeschichte der technischen Angestellten 1815–1945 (Bergbau und Bergarbeit), München 1988, S. 324. 40 An der Bergakademie Clausthal wurde eigens eine Professur für „Menschenführung“ eingerichtet, die der Sozialpsychologie Adolf Friedrich bis 1939 innehatte, vgl. Ebd., S. 325. 41 Vgl. Ebd., S. 327 ff. 42 Seidel: Arbeitsbeziehungen und Sozialpolitik, S. 452. 43 Obwohl Helmut Schelsky bereits zu Beginn der 1950er Jahre auf die Existenz der Soziologie im Nationalsozialismus hingewiesen hatte und diese auch kritisierte, setzte sich in der Geschichtsschreibung der Sozialwissenschaftler ein alternatives, zurückweisendes Narrativ durch, vgl. dazu: Weyer, Johannes: Westdeutsche Soziologie 1945–1960. Deutsche Kontinuitäten und nordamerikanischer Einfluss, Berlin 1984, S. 23 f. 44 Ebd., S. 24. 45 Luks, Timo: Heimat – Umwelt – Gemeinschaft. Diskurse um den Industriebetrieb im 20. Jahrhundert, in: Andresen, Knud u. a. (Hg.): Der Betrieb als sozialer und politischer Ort. Studien zu Praktiken und Diskursen in den Arbeitswelten des 20. Jahrhunderts (Politik- und Gesellschaftsgeschichte 98), Bonn 2015, S. 73–98, hier S. 91.
„Richtig Führen im Bergbau“
47
wurde erst in den 1970er aufgearbeitet.46 Bis zu dieser Aufarbeitung und Revision der historischen Entwicklungen einzelner Akteure und Institute stand in den 1950er Jahren zunächst die Wiederaufnahme der deutschen sozial- bzw. arbeitswissenschaftlichen Forschung im Fokus zahlreicher Wissenschaftler, wie Helmut Schelsky oder Gunter Ipsen. Beeinflusst von sozialpolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, der Einflussnahme amerikanischer und britischer Forschungsansätze und Methoden47, zahlreichen Konflikten innerhalb der Wissenschaftscommunity aber auch der Erfordernis eines erneuten Auflebens der wissenschaftlichen Infrastruktur, wurden die Bestrebungen einzelner Wissenschaftler zu Beginn der 1950er Jahre stärker in Richtung Professionalisierung und Institutionalisierung gelenkt.48 Mit dieser Zielsetzung erhielt die Arbeitswissenschaft einen zunehmenden Auftrieb. Obwohl sie kontroversen Diskussionen zur methodologischen Ausrichtung unterlag, formierten und etablierten sich einzelne Institute, wie die Gesellschaft Sozialforschungsstelle an der Universität Münster, Sitz zu Dortmund e. V. oder auch das Frankfurter Institut für Sozialforschung, um mitunter der Frage nach der Entwicklung von Arbeit nachzugehen.49 Wissenschaftler, wie Carl Jantke50 (Sozialforschungsstelle Dort46 Ausschlaggebend war dafür die fachgeschichtliche „Zwischenbilanz der Soziologie“ von M. Rainer Lepsius auf dem 17. Soziologentag und die darauffolgende Auseinandersetzung der Soziologie mit ihrer eigenen Geschichte im Rahmen der darauffolgenden Debatte, vgl. dazu: Weyer: Westdeutsche Soziologie, S. 22. 47 Die Integration britischer und amerikanischer Methoden darf hierbei nicht als ein geradliniger Transferprozess verstanden werden. Die kritische Auseinandersetzung mit den amerikanischen Methoden stieß besonders in den frühen 1950er Jahren auf rege Diskussionen und Kritik, vgl. dazu: Ebd., S. 102 ff. 48 Ebd., S. 86 f. 49 Bei der Sozialforschungsstelle Dortmund beschäftigten sich u. a. Heinrich Popitz mit dem Gesellschaftsbild des Arbeiters, Ernst Petry mit der industriellen Verflechtung Ostwestfalens oder auch Wilhelm Tebbe mit der geistig seelischen Entwicklung des Schulkindes. Am Frankfurter Institut für Sozialforschung beschäftigte sich Friedrich Pollock mit den ökonomischen und sozialen Folgen der Automation, Georges Friedmann mit den Grenzen der Arbeitsteilung und Ludwig von Friedburg mit der Altersvorsorge von Arbeitern und Angestellten. 50 Carl Jantke wurde 1909 in Elbling (Westpreußen) geboren. Nach seiner Banklehre studierte er von 1929 bis 1939 Nationalökonomie, Geschichte und Soziologie in Freiburg, Berlin, Leipzig und Heidelberg. Jantke war seit 1931 Mitglied der NSDAP. Er promovierte 1934 in Heidelberg bei Arnold Bergstraesser mit einer Arbeit über den grundbesitzenden Adel im Preußen des 18. Jahrhunderts. Nach einer Anstellung als Assistent am Institut für Sozial- und Staatswissenschaften in Heidelberg, wechselte er an das Staatswissenschaftliche Institut der Universität Königsberg (Institut für Ostdeutsche Wirtschaft), wo er sich im Jahre 1939 mit der Arbeit „Preußen, Friedrich der Große und Goethe in der Geschichte des deutschen Staatsdenkens“ habilitierte. 1941 wurde Jantke als Gefreiter der Wehrmacht zum Kriegsdienst eingezogen. Nachdem einem Lazarettaufenthalt in den Jahren 1942 und 1943, wurde er 1944 aus der Wehrmacht entlassen und kehrte nach Königsberg zurück. 1945 gelangte Jantke als ziviler Flüchtling zunächst nach Vor-
48 Martha Poplawski
mund) oder Ludwig von Friedeburg51 (Institut für Sozialforschung Frankfurt) erforschten in unterschiedlichen Vorhaben den Einfluss technisch und wirtschaftlich bedingter Veränderungen auf den Betrieb sowie die darin arbeitenden Akteure. Konzeptionell orientierten sich die Institute an der empirischen Fallstudienforschung, die seit den späten 1940er Jahren die führende Methode in den Arbeitswissenschaften darstellte. Wesentliches Merkmal der empirischen Fallstudienforschung war die Kombination verschiedener Erhebungs- und Auswertungsverfahren die den Forschern ermöglichte, im Verlauf ihrer Untersuchungen flexibel auf neue oder veränderte Ereignisse reagieren zu können.52 Gleichzeitig erfuhr die betriebliche Organisation deutscher Industrieunternehmen in der Nachkriegszeit eine rasante Entwicklung, die zahlreiche neue Anforderungen an Unternehmer und Arbeiter stellte. Diese umfassen mitunter die Modernisierung der Arbeits- und Produktionsprozesse, eine neue Personalpolitik und eine auf Effizienz ausgerichtete Normenbildung. Ferner eröffnete sich ein neuer Gestaltungsspielraum durch politische und ökonomische Veränderungen im Zuge des Wiederaufbaus und der daran anschließenden Prosperitätsphase in den 1950er Jahren. Unterdessen nahm seitens der Unternehmer das Bewusstsein zu, dass die Anpassung des Arbeiters an die Bedingungen der industriellen Entwicklung und insbesondere die Steigerung seiner Leistungsfäarlberg und nachfolgend nach Frankfurt am Main, wo er zunächst am Soziographischen Institut arbeitete. 1949 erfolgte Jantkes Berufung an die neu begründete Sozialforschungsstelle Dortmund, bei der er bis 1953 als Leiter der Abteilung für Wirtschafts- und Sozialgeschichte fungierte und zusammen mit Otto Neuloh die Studie „Bergmann und Zeche“ erarbeitete. Grüttner, Michael: Art. Jantke, Carl, in: Biographisches Lexikon zur nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik (Studien zur Wissenschafts- und Universitätsgeschichte 6), Heidelberg 2004, S. 84; Adamski: Ärzte des sozialen Lebens, S. 113. 51 Ludwig von Friedeburg wurde 1924 in Wilhelmshaven geboren. Als Sohn eines kommandierenden Admirals diente von Friedeburg im Zweiten Weltkrieg in der Marine als U-Bootkommandant. 1945 geriet er in alliierte Gefangenschaft und verblieb dort bis 1947. Nachfolgend studierte von Friedeburg Psychologie in Kiel und Freiburg im Breisgau. Nach seinem Aufenthalt am Institut für Demoskopie Allensbach, wechselte er 1955 an das Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main. 1960 habilitierte er sich bei Theodor W. Adorno mit einer Arbeit über die Soziologie des Betriebsklimas. 1962 wurde Ludwig von Friedeburg Professor für Soziologie und dann auch Direktor des Instituts für Soziologie an der Freien Universität Berlin. Von 1966 an, war er neben Theodor W. Adorno und Max Horkheimer dritter Direktor. „Friedeburg, Ludwig Ferdinand Heinrich Georg Friedrich von“, in: Hessische Biografie, (letzter Zugriff: 20.01.2018); Platz, Johannes: Die Praxis der kritischen Theorie. Angewandte Sozialwissenschaft und Demokratie in der frühen Bundesrepublik 1950–1960, Trier 2012, S. 26. 52 Pflüger, Jessica/Pongratz, Hans J./Trinczek, Rainer: Methodische Herausforderungen arbeits- und industriesoziologischer Fallstudienforschung, in: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Hg.): Industrie- und Betriebssoziologie, Bonn 2010, S. 5–13, hier S. 6.
„Richtig Führen im Bergbau“
49
higkeit nicht mehr allein über ökonomische Zwänge oder disziplinierende Maßnahmen erreicht werden konnte. Diese neuen Erkenntnisse und Herausforderungen bedingten eine gewandelte Form der Konzeptionierung von Lösungsstrategien und eine erneute Hochphase der Implementierung wissenschaftlichen Expertenwissens in die Problemfelder von Unternehmen und Industrie. Auch im westdeutschen Steinkohlenbergbau bedingten Inner- und außerbetriebliche Umbrüche die Suche nach Orientierungswissen und Handlungsoptionen, um sich den zeitgenössischen Problemen und Herausforderungen nach 1945 zu stellen.
Die Anpassung des Bergarbeiters an den Betrieb Den ursächlichen Auftakt für die Implementierung arbeitswissenschaftlicher Fachkenntnisse in die Zechenbetriebe des westdeutschen Steinkohlenbergbaus bildete die seit 1945 anhaltende Arbeitskräfteproblematik.53 Diese stellte sich im Zuge der wirtschaftlichen Expansion des Steinkohlenbergbaus in den 1950er Jahren als zentrales Problem der Zechenunternehmen heraus, da der Bedarf an Steinkohle seit Ausbruch des Koreakrieges und dem damit einhergehenden Rüstungsboom kontinuierlich anstieg.54 Die erforderliche Fördersteigerung – insbesondere in der „Boom-Phase“ des Steinkohlenbergbaus (1951–1958) – konnte auf Grund der seit den 1930er Jahren stagnierenden Mechanisierung55 ausschließlich über zwei Maßnahmen erreicht werden: Ersten, über die Leistungssteigerung des einzelnen Bergarbeiters56 und zweitens, über die Erhöhung der Belegschaftszahlen.57 Letzteres stellte sowohl die Zechenleitungen als auch die Deutsche Kohlenbergbauleitung (DKBL) vor beträchtliche Herausforderungen. 53 Abelshauser, Werner: Der Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung, München 1984, S. 46 ff. 54 Farrenkopf, Michael: Wiederaufstieg und Niedergang des Bergbaus in der Bundesrepublik in: Ziegler (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel, S. 183–302, hier S. 197 und S. 211. 55 Ebd., S. 198. 56 Bereits 1948 wurde anhand eines Leistungsvergleichs der Jahre 1938 und 1947 diagnostiziert, dass die Ursache der geringen Fördermengen „fast ausschließlich auf die geringe Leistung des einzelnen Bergmanns“ zurückzuführen war, vgl. dazu: Brief von Bergassessor Brückmann der Zeche Viktoria in Lünen an Mr. Gustavsen der UK/US Coal Control Group vom 31.01.1948, in: WWA, DO: K1, Nr. 3067. 57 Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok) beim Deutschen Bergbau-Museum Bochum/Bergbau-Archiv Bochum (BBA), BBA 12/210, Pressebericht der DKBL: Technische und menschliche Probleme im Bergbau. Förderleistung durch gesteigerte Mechanisierung, 19.02.1952.
50 Martha Poplawski
In Folge der zahlreichen Abgänge qualifizierter Bergarbeiter durch den Einzug in die Wehrmacht zum Ende des Zweiten Weltkriegs sowie die Befreiung von Fremd- und Zwangsarbeitern nach Kriegsende, herrschte seit 1945 ein enormer Belegschaftsmangel in den westdeutschen Steinkohlezechen vor58. Um das Arbeitskräftedefizit auszugleichen, bedienten sich die Zechenleitungen unter den Vorgaben der DKBL unterschiedlicher Anwerbungsstrategien, um neue Arbeitskräfte für den Steinkohlenbergbau zu gewinnen. Beispielsweise richtete die DKBL in Kooperation mit den Arbeitsämtern deutschlandweit Patenbezirke für einzelne Bergwerksgesellschaften ein, um dort regelmäßig Informationsveranstaltungen durch abgesandte Bergwerksmitarbeiter abhalten zu lassen, die über das Berufsbild des Bergarbeiters informierten und dadurch neue Arbeitskräfte gewannen.59 Bei den angeworbenen Bergarbeitern handelte es sich hauptsächlich um politische Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten sowie der Tschechoslowakei. Ein Großteil von ihnen war ohne jegliche bergbauliche Erfahrung ins Steinkohlenrevier gekommen.60 Das Arbeitskräftedefizit konnte durch die neu angeworbenen Bergleute61 zwischenzeitig ausgeglichen werden. Doch entstanden dabei auch neue Problemfelder und Herausforderungen, die insbesondere in den Bereichen Integration und im innerbetrieblichen Umgang zu Tage traten. Insbesondere die Umstände unter denen die Neuund Jungbergleute in den betrieblichen Ablauf unter Tage integriert wurden, gestalteten sich nicht gemäß ihrer Vorstellungen. Während die Leistung und Förderung zu Beginn der bergbaulichen Boom-Phase stetig zunahm, mehrten sich die Berichte über sozial bedingte Spannungen in den Zechenbetrieben und die raue Behandlung der Neu- und Jungbergleute durch autoritäre Vorgesetzte.62 Die Unzufriedenheit der Neu- und Jungbergleute zeigte sich besonders
58 Farrenkopf: Wiederaufstieg und Niedergang, S. 198. 59 Westfälisches Wirtschaftsarchiv Dortmund (WWA) F79, 985, Mitteilung des Magistrats von Berlin, Abteilung Sozialwesen an die Direktion der Zeche Gneisenau am 27.10.1950. 60 WWA F79, NR. 985, Rundschreiben Nr. 84, Unternehmensverband Ruhrbergbau an alle Mitgliedsgesellschaften und Zechen, Betr.: Anwerbung von Ostzonenflüchtlingen und Volksdeutschen für den westdeutschen Steinkohlenbergbau. 61 Durch diese Zusammenarbeit stieg der Rekrutierungsfaktor um das Dreifache auf 9 199 eingestellte Neubergleute bis 1951. Bis 1953 konnten die Zechen durch die sogenannten „Großbedarfsträger“-Programme mit zusätzlichen Arbeitskräften versorgt werden. Insgesamt wurden in den Jahren 1948 bis 1953 pro Monat durchschnittlich zwischen 5 000 und 6 000 neue Bergleute angelegt und die Belegschaft unter Tage um insgesamt 391 000 Neuzugänge erweitert. Vgl. dazu: Abelshauser: Ruhrkohlenbergbau, S. 34 und S. 66 ff.; Kift, Dagmar: Aufbau West. Neubeginn zwischen Vertreibung und Wirtschaftswunder, Essen 2005, S. 85 ff. 62 montan.dok/BBA 12/210, Rundschreiben der DKBL an alle Bergwerksgesellschaften und Zechen, 02.12.1950: Sensationsartikel über die Behandlung der Neubergleute in „Rhein-
„Richtig Führen im Bergbau“
51
deutlich in der steigenden Abkehr vom Bergbau und der Fluktuation.63 Die anhaltende Abkehr- und Fluktuationsproblematik konnte durch zahlreiche Initiativen seitens der Zechengesellschaften nicht behoben werden. Soziale Maßnahmen, wie die Koppelung der Werkswohnung an den Arbeitsplatz oder kulturelle Angebote für Bergmannsfrauen und Kinder erreichten nicht das gewünschte Ziel; den Erhalt einer Stammbelegschaft.64 Auch monetären Maßnahmen, wie das Haushaltsgeld oder die Erstattung von Heimreisen65 trugen nicht dazu bei, der Abkehr effektiv entgegenzuwirken.66 Sogar die von der Industriegewerkschaft Bergbau (IGB) erkämpften Lohnerhöhungen führten nicht zur Stabilisierung der Arbeitnehmerzahlen und zur damit erhofften Leistungssteigerung.67 Im Laufe der 1950er Jahre nahm die Arbeitskräfte- und Betriebsklimaproblematik in den Zechen ihren Fortgang und die in der „Boom-Phase“ des Steinkohlenbergbaus erforderliche Leistungssteigerung beförderte weiterhin die Befehlund Gehorsamsattitüden seitens der Betriebsführung. Die Fluktuation entwickelte sich im Laufe der 1950er Jahre zur sozialbetrieblichen Hauptproblematik und bedingte eine fortlaufende Forderung nach verbesserten Formen der Betriebsführung.68 Verstärkt wurde diese Forderung durch die gewerkschaftlichen Errungenschaften dieser Zeit. Insbesondere das Montanmitbestimmungsgesetz (1951), zielte auf eine neue soziale Ordnung in den Betrieben ab und hatte außerdem das Ziel, die „Menschen in den Mittelpunkt des Geschehens“ zu stellen.69 Eine Folge des Montanmitbestimmungsgesetztes waren einerseits strukturelle Veränderungen, wie die Arbeitnehmerbeteiligung in den Aufsichtsräten Echo“, Düsseldorf (23.10.1950), „Freie Presse“, Bielefeld (23.10.1950) und „Rheinische Zeitung“, Köln (31.10.1950). 63 Allein in den Jahren 1946 bis 1951 kehrten auf der Zeche Gneisenau in Dortmund Derne 2 285 Neu- und Jungbergleute wieder ab, nachdem 4269 angelegt worden waren, vgl. WWA F79, Nr. 985, Übersicht über die Fluktuation in der Zeche Gneisenau am 29.04.1952. 64 montan.dok/BBA 12/210, Bericht für die Presse: Kohlennotstand erfordert Leistungs- und Produktionserhöhung – Eine Stellungnahme des Generaldirektors der DKBL. 65 Erstattet wurde die Heimreise je nach Inanspruchnahme. Alle zwei Monate mit 6 DM, alle drei Monate mit 9 DM und alle vier Monate mit 12 DM. 66 WWA F79, Nr. 984, Merkblatt für Neubergleute. 67 Seidel: Arbeitsbeziehungen und Sozialpolitik, S. 478. 68 Gerhard, Ludwig: Der Wandel in der Zusammensetzung der Grubenbelegschaft seit dem Kriegsende und die hieraus auf einer Schachtanlage des Ruhrreviers gezogene praktische Folgerung, in: Glückauf (1948), S. 625, hier S. 625. 69 E. Bühring auf dem Außerordentlichen Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes 22./23.06.1951 in Essen, zitiert nach: Hülsdünker, Josef: Praxisorientierte Sozialforschung und gewerkschaftliche Autonomie. Industrie- und betriebssoziologische Beiträge des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts des DGB zur Verwissenschaftlichung der Gewerkschaftspolitik von 1946 bis 1956 (Die Entstehung der westdeutschen Industriesoziologie 2), Münster 1983, S. 394 f.
52 Martha Poplawski
und Vorständen der Bergbauunternehmen sowie die Bestellung von Arbeitsdirektoren in die Vorstände, die speziell mit Personal- und Sozialangelegenheiten betraut wurden. Andererseits nahm die Bestrebung zu, alternative Maßnahmen im Umgang mit den Arbeitnehmern innerhalb des Sozial-, Personal- und Ausbildungswesen umzusetzen. Unter den strukturellen Umständen von Abkehr, Fluktuation und Leistungsbedarf nahm sich die Sozialforschungsstelle Dortmund der sozialen Probleme und Herausforderungen des Bergbaus im Rahmen der industriesoziologischen Studie „Bergmann und Zeche“70 an. Die als Pilot-Studie der Betriebssoziologie bekannt gewordene Untersuchung beruhte auf einer umfangreichen Ansammlung empirischer Befragungen von 116 Bergarbeitern, innerbetrieblichen Beobachtungen sowie zahlreichen Gruppeninterviews, die zum Verständnis über die sozialen Arbeitsverhältnisse und Problembereiche unter Tage beitragen sollten. Die Veröffentlichung der Studienergebnisse erfolgte 1953 und fiel damit in die sogenannte „Boom-Phase“71 des westdeutschen Steinkohlenbergbaus. Eine finanzielle und wissenschaftlich kooperative Unterstützung erfuhren die Dortmunder Wissenschaftler von der Rockefeller Foundation, die das Ruhrgebiet als Schlüsselregion ansah und entsprechend den Vorgaben der Besatzungsmächte ein großes Interesse an einer schnellstmöglichen Leistungssteigerung hatte.72 Während die finanzielle Projektförderung von 25 000 Dollar im Vergleich zu anderweitigen Unterstützungsgeldern, wie jene des Landes Nordrhein Westfalen oder der Stadt Dortmund einen geringeren Stellenwert einnahm73, war die Beteiligung des amerikanischen Anthropologen Conrad Arensberg ein äußerst wichtiger Gesichtspunkt innerhalb der Projektgestaltung.74 Arensberg führte die Dortmunder Wissenschaftler in die amerikanischen Forschungsmethoden ein, indem er spezielle Interviewtechniken, wie die „teilneh70 Jantke: Bergmann und Zeche. 71 Die Boom-Phase kann im Zeitraum von 1951 bis 1958 verortet werden. Einen signifikanten Anstieg der Steinkohle Fördermengen kann im Jahr 1951 verzeichnet werden, in dem die Jahresförderung im Jahr 1950 an der Ruhr von 103 328 tausend Tonnen auf 110 630 tausend Tonnen im Jahr 1951 anstieg. Vgl. dazu: Jahresergebnisse des Stein- und Braunkohlebergbaus der Bundesrepublik 1960, in: Glückauf 97 (1961:2), S. 115. 72 Kändler, Ulrike: Entdeckung des Urbanen. Die Sozialforschungsstelle Dortmund und die soziologische Stadtforschung in Deutschland, 1930 bis 1960 (Histoire 58), Bielefeld 2016, S. 128. 73 Vgl. dazu: Adamski: Ärzte des sozialen Lebens, S. 59; Kändler: Entdeckung des Urbanen, S. 128. Sowohl Adamski als auch Kändler verweisen darauf, dass die Aufstellung der Finanzierungen nicht ausreichend überliefert sei und andere Finanzierungen, wie Fördermittel der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft von 100 000 DM mit einkalkuliert werden müssten sowie der Aufenthalt der amerikanischen Forscher in Dortmund, der auf 23 000 Dollar geschätzt wurde. 74 Ebd.
„Richtig Führen im Bergbau“
53
mende Beobachtung“ erläuterte.75 Den Forschern der Sozialforschungsstelle dienten die amerikanischen Methoden und Projektkonzeptionen nicht nur als Erweiterung ihrer Forschungskompetenzen, sondern verdeutlichten insbesondere den modernen Zugang der Sozialforschungsstelle nach außen, um sich in der sozial- und arbeitswissenschaftlichen Community zu positionieren.76 Die praktische Anwendung der „teilnehmenden Beobachtung“ erfolgte in der Studie „Bergmann und Zeche“. Gegenstand der Untersuchung waren die sozialen Bedingungen der im Steinkohlenbergbau tätigen Bergarbeiter auf der Zeche Emscher-Lippe in Datteln. Durch teilnehmende Beobachtungen unter Tage, Fragebögen und Interviews gingen die Sozialforscher aus Dortmund den Problemen zur Abkehr, Fluktuation und Integration der Neubergleute nach. Ergänzend wurden die Bergarbeiter systematisch über die Wirkungen der Gedingeformen, die Beziehungen zu den Vorgesetzten, über Unfallursachen, Berufskrankheiten und Versorgungsprobleme sowie ihre Meinungen zum Betriebsrat bzw. der Gewerkschaften befragt.77 Als Ergebnis der Befragungen und Beobachtungen präsentierten die Dortmunder Forscher Carl Jantke und Otto Neuloh78 zwei 75 Adamski: Ärzte des sozialen Lebens, S. 41. 76 Ebd., 58. 77 Jantke: Bergmann und Zeche. 78 Otto Neuloh wurde 1902 in Wanne-Eickel geboren. Während seiner pharmazeutischen Lehre arbeitete er gleichzeitig in der Verwaltung der Zeche Shamrock in Herne. Ab 1923 studierte Neuloh Volkswirtschaftslehre in Münster, München, Königsberg und Berlin. Er promovierte 1928 in Münster bei Heinrich Weber mit der Dissertation „Arbeiterbildung im neuen Deutschland“. 1927 erhielt er eine Stelle als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter in der Arbeitsverwaltung beim Landesarbeitsamt Westfalen in Münster und Dortmund. Von 1931 bis 1938 war er als Abteilungsleiter für Berufsberatung des Arbeitsamtes Hagen tätig. Von 1938 bis 1939 arbeitete er als Referent für Berufsberatung in der Zweigstelle Wien des Reichsarbeitsministeriums und ab 1939 als Amtsdirektor des Arbeitsamtes in Eisenstadt. Zuletzt war Neuloh von 1941 bis zum Kriegsende 1945 als Abteilungsleiter des Landesarbeitsamtes des Sudetenlandes in Reichenberg tätig. Jens Adamski verwies in seiner Studie zur Sozialforschungsstelle Dortmund auf Neulohs pragmatische Anpassungsbereitschaft an das herrschende politische System. Bis 1931 war er Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und verstand sich als Fürsprecher der Weimarer Republik. 1933 trat er in die SA ein und meldete sich freiwillig zur militärischen Ausbildung innerhalb derer er bis zum Offiziersgrad aufstieg. Gleichzeitig engagierte er sich in der Berufsberatung bei der Hitlerjugend und setzte sich für diese die Schaffung von Lehrlingsheimen durch. In diesem Zeitraum veröffentlichte Neuloh pragmatische Aufsätze in Zeitschriften, wie Das Junge Deutschland oder in Der Erzieher im Donauland. Darin vertrat er die nationalsozialistisch-konforme Auffassung der Anpassung der Berufswahl an den Bedarf der propagierten „Volksgemeinschaft“. 1945 floh Neuloh aus dem Sudetenland zunächst nach Thüringen und dann nach Dortmund, wo er seine Stelle als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter in der Arbeitsverwaltung fortsetzte. Seine Zielsetzung, sozialwissenschaftliche Forschung im Ruhrgebiet zu institutionalisieren, erreichte er 1946 mit der Gründung der Sozialforschungsstelle an der Universität Münster zu Dortmund e. V., vgl. Adamski: Ärzte des sozialen Lebens, S. 31 ff.;
54 Martha Poplawski
entscheidende soziale Probleme des Betriebslebens im Steinkohlenbergbau: Die zunehmende Entpersönlichung der Arbeit und die gleichzeitige Forderung nach einer Anpassung der bergbaufremden Arbeiter an den Arbeitsablauf unter Tage. In Folge dieser Erkenntnis und dem Bewusstsein dafür, dass eine Steigerung der Fördermengen nur durch eine höhere Leistungsbereitschaft der Bergarbeiter erzielt werden konnte, entwickelte sich die soziale Betriebsgestaltung zum Hauptuntersuchungsfeld der Arbeitswissenschaften im Steinkohlenbergbau. Die beiden Forscher der Sozialforschungsstelle Dortmund, Carl Jantke und Otto Neuloh, waren hinsichtlich der Problemlage im Steinkohlenbergbau der Meinung, dass die etablierte Ansicht vom Arbeitnehmer als „Faktor Mensch“ verschiedene Konsequenzen mit sich brachte, die einer arbeitswissenschaftlichen Analyse unterzogen werden mussten. Sie waren der Auffassung, dass es sich beim Steinkohlenbergbau um einen Industriezweig handelte, in dem der Beruf des Bergarbeiters in einem Spannungsfeld zwischen Tradition und Fortschritt stand. Diese Erkenntnis, so Carl Jantke, verursachte Unklarheit und Unsicherheit sowohl bei den Bergarbeitern, als auch bei der Betriebsführung.79 Eine Anpassung der Betriebsführung an die neuen Verhältnisse stellte die zentrale Problemquelle dar. Die im Bergbau tätigen Arbeits- und Vorgesetztengruppen, so Otto Neuloh, befanden sich in ihrem Bewusstsein in veralteten, hierarchischen Strukturen und unterstanden der „Schwierigkeit der Anpassung an neue Verhältnisse“.80 Es bedurfte demnach eines anderen Zugangs, um geeignete Lösungsansätze für den Steinkohlenbergbau zu prognostizieren, um die bestehenden Spannungen in den Betrieben aufzulösen und eine Verbesserung des Betriebsklimas zu erreichen. Obwohl innerhalb der Studie und in den begleitend erscheinenden Beiträgen der Sozialen Welt – der hauseigenen Fachzeitschrift der Sozialforschungsstelle Dortmund – keine direkten Lösungsstrategien angeboten wurden, kann unter Berücksichtigung einzelner Aufsätze, die im Umfeld der „Bergbau-Studie“ erschienen, die deutliche Tendenz zu einer indirekten Problembewältigungsstrategie erkannt werden. Zunächst sahen die Wissenschaftler der Sozialforschungsstelle die Integration arbeitswissenschaftlichen Wissens in den Handlungsraum des Zechenbetriebes als Voraussetzung an. Vor dem Hintergrund der Leistungssteigerungsproblematik und der sozialen Herausforderungen, diagnostizierten die Forscher der Sozialforschungsstelle, dass es in den Zechenbetrieben an „Ordnung“81 Kaesler, Dirk: Art. Neuloh, Otto, in: Otto zu Stolberg-Wernigerode (Hg.): Neue deutsche Biographie, Berlin 1999, S. 131–132. 79 Jantke: Bergmann und Zeche, S. 1 ff. 80 Neuloh, Otto: Zur sozialen Ordnung der Mittelschicht des Ruhrbergbaus, in: Soziale Welt 2 (1951:2), S. 124–141, hier S. 133. 81 Die „Herstellung von Ordnung“ war eine von den amerikanischen Sozialwissenschaften eingeführte Kategorie, welche im Rahmen der amerikanischen „Reorientierungs“-Politik in
„Richtig Führen im Bergbau“
55
mangelte und die „Leistung“ eines einzelnen Bergarbeiters durch spezifische Maßnahmen gesteigert werden sollte. Durch die Stiftung von „Ordnung“ im Betrieb, so die Wissenschaftler, konnten die „richtigen Strukturen und Beziehungen“ gefördert werden.82 Ausgehend von den kontextuellen Bedingungen, wie der Fluktuation und dem Arbeitskräftemangel beinhaltete der Begriff „Ordnung“ einerseits die Durchsetzung ordnungsstiftender Strukturen, wie Pünktlichkeit, ein ordentlicher Arbeitsplatz, die sorgfältige Ausführung der Arbeit oder eine pflegliche Behandlung der Betriebseinrichtung. Andererseits implizierte „Ordnung“ die Bereitstellung eines gestaltbaren Handlungsraums, um die planerischen Vorhaben der Arbeitswissenschaftler zu implementieren und zu erhalten. „Ordnung“ war demnach eine Grundbedingung für wissenschaftlich erarbeitete Planungen und Handlungsanweisungen. Das Instrument zur Einhaltung dieser „Ordnung“ waren die Vorgesetzten bzw. Steiger, in denen Otto Neuloh eine Schlüsselstellung erkannte.83 Gleichzeitig sprach Neuloh dem Steiger eine soziale Funktion zu, indem er als Bindeglied zwischen Belegschaft und Management zur Erhaltung des sozialen Gleichgewichtes beitragen sollte. Offensichtlich erkannte Otto Neuloh die Notwendigkeit der Einhaltung etablierter Hierarchien an, um die Autorität des Steigers aufrechtzuerhalten, da dieser in unmittelbarer Verantwortung für den Betriebsablauf stand.84 Während der Begriff der „Ordnung“ innerhalb der arbeitswissenschaftlichen Diskurse vorwiegend im mikrosozialen Raum des Betriebes stattfand, weitete sich die Analyse zur „Leistung“85 räumlich in den privaten und sozialen Lebensbereich des Bergarbeiters aus. Deutlich wurde dies in einem Aufsatz von Rosemarie Pichler-Frantzen, die 1950 im Auftrag der Sozialforschungsstelle Dortmund die Rolle der Werksfürsorgerinnen86 beschrieb und auf ihre Relevanz
das Methodenarsenal aufgenommen wurde. Der Ordnungsbegriff diente als Analyseinstrument, um Prozesse zu erkennen, die nicht Gegenstand von Erfahrung sein konnten. Vgl. dazu: König, René: Einleitung, in: Ders. (Hg.): Handbuch der Empirischen Sozialforschung, Stuttgart 1967, S. 3–17, hier S. 3. 82 Jantke, Carl: Industriebetriebsforschung als soziologische Aufgabe, in: Soziale Welt 1 (1950:2), S. 14–23, hier S. 15. 83 Neuloh: Ordnung der Mittelschicht, S. 125. 84 Ebd. 85 Die „Leistung“ eines jeden Arbeiters war ein bedeutendes Phänomen, da sie nicht nur für den erfolgreichen Betriebsablauf entscheidend war, sondern zudem als Schlüsselgedanke und als Kennzeichen für die Prosperität der deutschen Wirtschaftsentwicklung angesehen wurde. 86 Die Implementierung von Werkfürsorge nahm in der Essener Zeche Zollverein ihren Anfang. Sie wurde allgemein als Einrichtung und Maßnahme zur sozialen Betreuung von Werksangehörigen und ihren Familien verstanden.
56 Martha Poplawski
bzw. deren Aufgaben aufmerksam machte.87 In ihrem Beitrag verwies PichlerFrantzen darauf, dass die Verbindung zwischen der Leistungsfähigkeit des Bergarbeiters und seinen familiären Verhältnissen wesentlich sei und es dabei besonders auf die Rolle der Ehefrau des Bergarbeiters ankäme. Für PichlerFrantzen lag die Möglichkeit der Herstellung einer solchen Verbindung in der Schaffung eines milieukonformen Umfeldes unter der Einflussnahme der Bergwerksgesellschaften. Diese sollten durch verschiedene Angebote, wie zum Beispiel den Einsatz von Werksfürsorgerinnen in den Familien, Handwerkskurse oder Mütterberatungsstellen der Frau des Bergmanns die Möglichkeit bieten, sich in Ihrer Rolle weiterzuentwickeln und dadurch die familiären Strukturen aufzuwerten.88 Vordergründig waren dabei zwei Aspekte: Erstens, dass ein Bergmann nur dann die volle Leistung erbringe, wenn er in seinem privaten Lebensbereich normative bzw. milieu-entsprechende Verhältnisse vorfände. Und zweitens, dass die Bergmanns-Familie sich als integraler Bestandteil der Belegschaft sehe.89 „Eine systematisch aufgebaute Werkfürsorge scheint […] einer der unentbehrlichen Faktoren zu sein, die zu einem wohlgeordneten betrieblichen Leben und zum betrieblichen Erfolg führen“90. Unmissverständlich wurde darauf verwiesen, dass die Leistungsfähigkeit des Bergarbeiters und seine soziale und familiäre Lebenssituation in einem zentralen Verhältnis zueinanderstanden. Die Betrachtung der Studie „Bergmann und Zeche“ und der zeitgleich entstandenen Begleitliteratur zeigt, dass der Analyseschwerpunkt der Arbeitswissenschaftler in den 1950er Jahren beim einzelnen Bergarbeiter, seinem sozialen Umfeld und seiner Persönlichkeit lag. Die arbeitswissenschaftlichen Prognosen bezogen sich weniger auf betriebswirtschaftliche oder technische Produktionsmethoden, sondern auf den Arbeiter, seine Integration in die Ordnung des Betriebes und des sozialen Umfeldes.91 Es galt, „Ordnung“ zu stiften, um Leistung zu erhalten. Mit der Forderung nach der Einhaltung einer ordnungsstiftenden Struktur entsprachen die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse der Vorstellung eines anzupassenden Objektes, wie es bereits in den Hochphasen von Fordismus und Social Engineering gefordert wurde. Auch die Leistungsherstellung 87 Pichler-Frantzen, Rosemarie: Werksfürsorge im Ruhrkohlenbergbau, in: Soziale Welt 1 (1950:3), S. 51–60. 88 montan.dok/BBA 12/210, Soziale Einrichtungen im Bergbau. 89 Pichler-Frantzen: Werksfürsorge, S 60. 90 Ebd. 91 Carl Jantke stellte sich jedoch beim Deutschen Soziologentag 1956 vehement gegen seine eigene Behauptung aus dem Jahre 1951 in seiner Analyse „Bergmann und Zeche“. Das in dieser Studie vertretene Konzept der Anpassung des Menschen an die Erfordernisse des technischen Fortschritts und die dabei an Relevanz zunehmende Rolle der Sozialwissenschaften, sollten kritischer betrachtet werden, vgl. dazu: Weyer: Westdeutsche Soziologie, S. 101.
„Richtig Führen im Bergbau“
57
durch werksfürsorgliche Maßnahmen entsprach einer humanen Form der Rationalisierung.92 Folglich wiesen die Arbeitswissenschaftler den Unternehmen die Macht zu, durch die Stiftung von Ordnung und durch soziale Rationalisierungsmaßnahmen die Kontrolle über die Arbeiter und den Arbeitsprozess wiederzuerlangen, um dadurch die Abkehr und Fluktuation abzumindern.
Von der Anpassung der Arbeiter zur Anpassung der Vorgesetzten Mit Beginn der Bergbaukrise im Jahr 1958 setzten in den Betrieben des westdeutschen Steinkohlenbergbaus unterschiedliche Entwicklungen ein. Zechen wurden geschlossen, Belegschaften reduziert oder zusammengelegt. Gleichzeitig erfolgten innerbetriebliche Rationalisierungen durch organisatorische Verbesserungen der Arbeitsvorgänge, die eine erhöhte Ausnutzung der vorhandenen Anlagen ermöglichten. Zudem konnten durch die Weiterentwicklung und Verbesserung der Bergtechnik sowie die zunehmende Mechanisierung größerer Betriebseinheiten gebildet werden, wodurch die geologischen Bedingungen und Betriebsmittel besser ausgenutzt wurden.93 Mit der Rationalisierung, der technischen Weiterentwicklung der Kohleförderung und des Streckenausbaus94 und einer veränderten Zusammenstellung der Belegschaften95 ging ein gewandeltes Qualifikationsprofil der Bergarbeiter einher, welches auch die Anforderungen an die Vorgesetzten veränderte und nach einer kooperativeren Form der Betriebsführung verlangte. Nicht mehr die physische Leistungsfähigkeit des Einzelnen, sondern die Qualität der ausgebildeten Arbeiter unter Tage entschied über die Fördermengen und den ökonomi-
92 Vgl. dazu: Uhl: Humane Rationalisierung. 93 montan.dok/BBA 5/370, Prof. Dr. Ing. Adler, F.: Gutachtliche Stellungnahme über die Möglichkeiten für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Steinkohlenbergbau der Reviere Ruhr und Aachen im Hinblick auf eine weitere Rationalisierung und Kostensenkung im Grubenbetrieb unter Tage. Angefordert vom Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Berlin 29.01.1966. 94 Vgl. Beitrag von Nikolai Ingenerf zur Automatisierung im britischen und westdeutschen Steinkohlenbergbau in diesem Sammelband. 95 Trotz des Arbeitsplatzabbaus in den 1960er Jahren erhöhte sich die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer im westdeutschen Steinkohlenbergbau. Nach Abschluss des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens 1961 nahm die Anzahl der türkischen Bergarbeiter zu, vgl. dazu: Seidel: Arbeitsbeziehungen und Sozialpolitik, S. 497.
58 Martha Poplawski
schen Erfolg des Zechenbetriebes.96 Die Zechengesellschaften bemühten sich um qualifizierte und qualifizierungswillige Arbeiter, die für eine optimale Ausnutzung der untertägigen Anlagen und Maschinen sorgen sollten. Langfristig, so erkannten es die Zechenunternehmer, würde dies nur mit Hilfe betrieblicher Weiterentwicklungen und Qualifizierung aller Belegschaftsmitglieder gewährleistet werden.97 Die technischen und qualifikatorischen Veränderungen wirkten auf verschiedenen Ebenen auf das betriebliche Sozialgefüge ein. Dabei entstanden vor allem neue Anforderungen an die Vorgesetztenebene, da die Betriebseinheiten vergrößert wurden und die Steiger mehr Verantwortlichkeit zugesprochen bekamen.98 Diese konnten mit der schnellen Entwicklung zumeist nicht Schritt halten und griffen auf die etablierten Befehl- und GehorsamMaßnahmen zurück, wodurch die nicht erst seit 1945 kritisierten Autoritätsstrukturen erneut in Kritik gerieten. Der Situation wurde seitens der Zechengesellschaften Rechnung getragen. Angesichts der Entwicklungen forderten die Unternehmensleitungen eine Anpassung der Führungsmethoden an die technischen Neuerungen und das fachliche Können aller Mitarbeiter.99 Um dieses Ziel zu erreichen, griffen die Unternehmer des Bergbaus erneut auf die externe Expertise der Arbeitswissenschaften zurück. Diese hatten in den 1960er Jahre ihren Platz innerhalb der Wissenschaftslandschaft institutionell als auch inhaltlich verfestigt, wenngleich einige Institute dem mikrosozialen Untersuchungsgegenstand des Betriebes bereits den Rücken zugekehrt hatten.100 Der unternehmerische Bedarf an externer arbeitswissenschaftlicher Expertise war jedoch weiterhin vorhanden. So auch im westdeutschen Steinkohlenbergbau, wo ein privatwirtschaftliches arbeitswissenschaftliches Institut beauftragt wurde, um das mittlere Management mit „modernen Methoden der Menschenführung“ auszustatten 101 und an die zeitgenössischen Erfordernisse anzupassen. Die Hohe Behörde der EGKS beauftragte zu Beginn der 1960er Jahre das Institut Mensch und Arbeit aus München damit, dem mittleren Bergbau-
96 montan.dok/BBA 5/357, Werks-Nachrichten. Dortmunder Bergbau AG und Hansa Bergbau AG, Februar 1964, H.2, Jh. 14, S.29. 97 Ebd., S. 30. 98 Seidel: Arbeitsbeziehungen und Sozialpolitik, S. 496. 99 montan.dok/BBA 160/758, Rundschreiben des Eschweiler Bergwerks-Vereins anlässlich des Erscheinens der Broschüre Richtig führen im Bergbau I. Führen braucht Methode, September 1965. 100 Weyer: Westdeutsche Soziologie, S. 184 f. 101 montan.dok/BBA 160/758, Broschüre Richtig Führen im Bergbau I. Führen braucht Methode.
„Richtig Führen im Bergbau“
59
management die erforderlichen Instrumente zu einer idealen Form der Betriebsführung zur Verfügung zu stellen.102 In unterschiedlichen betriebspsychologischen Untersuchungen widmeten sich die Arbeitswissenschaftler der Rolle der Steiger im Verhältnis zu sowie im Umgang mit ihren Mitarbeitern. Das Ziel der Münchener Wissenschaftler war es, dem mittleren Management „grundsätzliche Führungsmaßnahmen“ näher zu bringen.103 Inhaltlich richteten sich die Maßnahmen an konkrete Handlungen, wie die Einarbeitung neuer Arbeitskräfte in den Betrieb, eine umfangreiche Informationspolitik über die Unternehmensstrukturen und Arbeitsprozesse, eine konstruktive Form der Gesprächsführung im Zuge von Mitarbeitergesprächen, angemessene Weisungsformen sowie eine gerechte Verteilung von Kritik und Anerkennung.104 Der Transfer der arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis der Betriebsführung erfolgte auf zwei Arten: Einerseits durch die Veröffentlichung von vier Broschüren, die unter dem Titel „Richtig Führen im Bergbau“ in den Betrieben verteilt werden sollten.105 Andererseits in Form von Lehrgängen, bei denen das neue Wissen zur Betriebsführung in die Praxis transferiert werden sollte. Ähnlich gingen die Dortmunder Bergbau AG sowie die Hansa Bergbau AG vor. Um ihr mittleres Management auf den richtigen Umgang mit ihren Mitarbeiter hinzuweisen und vorzubereiten, ordneten sie 248 Mitarbeiter aus allen Betriebsstellen ab, um sie an Lehrgängen zur „modernen Führungspraxis“ teilnehmen zu lassen.106 Ziel dieser Veranstaltungen war es, die dabei gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis anzuwenden, um eine verbesserte Arbeitsstruktur in den jeweiligen Arbeitsbereichen zu erzielen. Die Schwerpunkte bildeten die Themen Verantwortung und Vertrauen: Durch die Ausweitung des Aufgabenbereichs der Vorgesetzten stieg die Verantwortung des Einzelnen kontinuierlich an. Um den reibungslosen Ablauf im Zusammenspiel von Arbeit und Technik zu gewährleisten, verwiesen die Arbeitswissenschaftler auf den Mehrwert einer „planvoll durchdachten und erfolgreichen“ Führungsmethode. Demnach oblag es dem Steiger, den Arbeitsablauf durch „verantwortungsvolle Kontrolle“ zu strukturieren und etwaigen Problemen vorzubeugen.107 Gleichzeitig verwiesen die Arbeitswissenschaftler auf eine erforderliche Veränderung der persönli102 montan.dok/BBA 160/758. 103 montan.dok/BBA 160/758, Broschüre Richtig Führen im Bergbau I. Führen braucht Methode. 104 Vgl. dazu: Pfützner, Robert: Taschenbuch Mensch und Arbeit. Für Führungskräfte im Betrieb, München 1966. 105 montan.dok/BBA 160/758, Broschüre Richtig Führen im Bergbau I-IV. Führen braucht Methode. 106 montan.dok/BBA 5/357, S. 30. 107 montan.dok/BBA 160/758, Broschüre Richtig Führen im Bergbau I.
60 Martha Poplawski
chen Eigenschaften des Steigers, welche ihn befähigen sollten, die Zusammenarbeit im Betrieb sozialer zu gestalten.108 Durch den Verweis auf seine Vorbildfunktion wurde deutlich gemacht, dass sein Aufgabenbereich nicht mehr nur die Kontrolle und Fehlerkorrektur umfasste. Vielmehr sollte er durch Verständnis und Gerechtigkeitsbewusstsein mit dem Arbeitnehmer interagieren, um ihm bei etwaigen Problemen seine Hilfe und Expertise anzubieten und dadurch einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten.109 Die Darstellung der Untersuchungen zur Betriebsführung durch das Institut Mensch und Arbeit zeigt, dass sich die arbeitswissenschaftliche Problematisierung der bergbaulichen Herausforderungen in den 1960er Jahren von dem anzupassenden Arbeiter zum anzupassenden Vorgesetzten verlagerte. Ziel der arbeitswissenschaftlichen Maßnahmen war es, das Wissen der Steiger zu mehren, um sie an die stets wachsenden Anforderungen anzupassen. Die Implementierung neuer Wissensinhalte in die Betriebsführung erweiterte die Funktionen des Steigers und machte ihn zu einem Wissensobjekt. Dadurch sollten moderne Führungskonzepte in die Arbeitsprozesse des Steinkohlenbergbaus getragen werden, um mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten.
„Humanisierung des Arbeitslebens“ im Kontext gesellschaftlicher Diskurse und der betrieblichen Praxis des westdeutschen Steinkohlenbergbaus Die 1970er Jahre stellten für die Arbeitswissenschaften eine Dekade dar, in der sie zu alten Themengebieten und Untersuchungsgegenständen zurückfanden, während sich vor dem Hintergrund verschärfter Rationalisierungsmaßnahmen und Arbeitsintensivierung eine öffentliche Debatte über Arbeit und Arbeitsqualität entfaltete.110 Befördert wurde diese Debatte von einer Entwicklung, die in sozialwissenschaftlichen Bestandsaufnahmen der 1970er unter dem Postulat des „Wertewandels“111 Eingang fand. Monotone Arbeitsabläufe, hohe Leistungs108 Ebd. 109 Ebd. 110 Deppe, Frank/Dörre, Klaus: Klassenbildung und Massenkultur im 20. Jahrhundert, in: Tenfelde, Klaus (Hg.): Arbeiter im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1991, S. 726–745, hier S. 732. 111 Unter dem Begriff des Wertewandels wird gemeinhin eine Feststellung der Sozialwissenschaften in den späten 1960er und 1970er Jahren verstanden, wonach sich die gesellschaftlichen und sozialen Werte innerhalb eines bestimmten Zeitraums eklatant verändert haben. Wertewandel besagt demnach für die hier untersuchte Thematik, dass der steigende gemeingesellschaftliche Wohlstand eine zunehmende Diskrepanz zwischen dem privaten Lebensstan-
„Richtig Führen im Bergbau“
61
forderungen, eine zunehmende Mechanisierung sowie gewandelte Qualifikationsanforderungen wurden dabei als die Ursachen für die Kritik an den Arbeitsumständen in vielen bundesdeutschen Betrieben angesehen.112 Im Zuge dieser Entwicklung wurde das Programm „Humanisierung des Arbeitslebens“ zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen ausgearbeitet. Das 1974 vom Bundesarbeits- und Forschungsministerium initiierte Gemeinschaftsprojekt hatte zum Ziel, arbeitswissenschaftliche Ergebnisse herzustellen und die daraus erfolgten Erkenntnisse in der Praxis der Arbeitswelt anzuwenden, um eine allgemeine Verbesserung der Arbeitssicherheit und der Arbeitsgestaltung zu bewirken.113 Die Integration des Steinkohlenbergbaus in das HdA-Programm erfolgte in Zusammenarbeit mit der Ruhrkohle AG, der Eschweiler Bergwerksverein AG, der Gewerkschaft Auguste Victoria, der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie sowie der Westfälischen Berggewerkschaftskasse. Anders als in den vorherigen Studien, diente das HdA-Programm der eindringlichen Zielsetzung, die erforschten Ergebnisse zur „Humanisierung“ in die Praxis des Steinkohlenbergbaus zu transferieren und einem großen Kreis von Mitarbeitern zu vermitteln.114 Ein besonderer Schwerpunkt lag innerhalb der Programmdurchführung auf dem Erfahrungsaustausch zwischen Arbeitnehmern, Vorgesetzten und Ingenieuren, der im Rahmen von Kurzseminaren, Betriebsseminaren und Ingenieursgesprächen umgesetzt wurde. Neben Fragen zur Unfall- und Staubbekämpfung, der Verbesserung der Klimatisierung und der Sichtverhältnisse, wurde auf Themenfelder zur psychischen und physischen Arbeitsbelastung sowie auf die Arbeitsstrukturierung und Arbeitsorganisation eingegangen. Besonders hervorgehoben wurde dabei der Aspekt der „geistigen Wertschätzung des Einzelnen“. Dazu zählten die gewissenhafte Anerkennung der geleisteten Arbeit durch den Vorgesetzten, die kommunikative Verständigung über Mängel und Verbesserungsmöglichkeiten sowie der Austausch und die Weitergabe von Wis-
dard und dem Standard der Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisation beförderte. Für einen Überblick über die Wertewandelforschung, besonders zur historischen Wertewandelforschung, siehe: Dietz, Bernhard/Neumaier, Christopher: Vom Nutzen der Sozialwissenschaften für die Zeitgeschichte. Werte und Wertewandel als Gegenstand historischer Forschung, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 60 (2012:2), S. 293–304. 112 Sauer, Dieter: Permanente Reorganisation. Unsicherheit und Überforderung in der Arbeitswelt, in: Doering-Manteuffel, Anselm/Raphael, Lutz/Schlemmer, Thomas (Hg.): Vorgeschichte der Gegenwart. Dimensionen des Strukturbruchs nach dem Boom, Göttingen 2016, S. 37–55, hier S. 39. 113 Sauer, Dieter: Von der „Humanisierung der Arbeit“ zur „Guten Arbeit“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 15 (2011), S. 18–24, hier S. 19. 114 Sauer u. a.: Einige Thesen zur Entwicklung von Rationalisierung und „Humanisierung“.
62 Martha Poplawski
sen und Erfahrungen.115 Darüber hinaus bestand eine weitere Aufgabe des Vorgesetzten darin, die Fähigkeiten des Arbeitnehmers zu erkennen, ihm potentielle Möglichkeiten für die Umsetzung seiner Fähigkeiten aufzuzeigen und ihn zu selbstverantwortlichem Arbeiten zu motivieren. Inhaltlich standen in diesem Programm die Selbstverantwortlichkeit des Arbeiters an erster und ein Appell an die Betriebsführung in Form neuer Managementmodelle an zweiter Stelle. Das Modell der Selbstverantwortlichkeit ging von der Annahme aus, dass ein Arbeitnehmer am effizientesten und sichersten arbeitete, wenn er nicht nach hierarchischen Strukturen und Vorgaben agieren müsste, sondern selbständig darüber entscheiden könnte, welche Form der Arbeitsgestaltung am effektivsten sei. Durch die selbstverantwortliche Arbeit sollte nicht nur die Motivation zur sichereren und effizienteren Arbeitsweise gefördert, sondern zudem die Arbeitszufriedenheit und das Wertgefühl gesteigert werden.116 Der Transfer amerikanischer arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden beförderte innerhalb des HdA-Programms eine zunehmende Hinwendung zur selbstverantwortlichen und hierarchieaufbrechende Betriebsstruktur, die einen Wandel der Personalführungsmethoden zur Folge hatte.117 Diese verschoben sich von einer direkten autoritären Führungsform hin zu einer indirekt (selbst-)motivierenden Form. Diese Art der Führung sollte den Arbeiter dazu anleiten, autonom auf neue Herausforderungen und Aufgaben zu reagieren. Zusammenfassend kann für das HdA-Programm betont werden, dass sich die Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Betriebsführung und dem Umgang mit den Arbeitnehmern darauf stützten, den Arbeitnehmer in den Prozess der Verbesserung zu integrieren, seine Erfahrungen zu nutzen und das gesammelte Wissen selbständig zu reproduzieren. Anders als in den 1950er Jahren galt es nun nicht mehr „Ordnung“ zu stiften, um „Leistung“ zu erhalten, sondern ein motivierendes Umfeld zu schaffen. Diese Ansichten stellten gewandelte Anforderungen an den bis dato vorherrschenden Führungsstil. Der Steiger sollte nicht – wie in den 1960er Jahren – das Wesen des Arbeiters erkennen und die Arbeit nach ihm ausrichten. Vielmehr sollten das betriebliche Umfeld und der „neue Führungsstil“ den Handlungsraum so strukturieren, dass der Arbeiter eigenständig zur Effizienz motiviert wurde und diese Fähigkeit selbständig re-
115 Deiß, Manfred u. a. (Hg.): Öffentliche Maßnahmen als Bedingungen betrieblicher Aktivitäten zur menschengerechten Gestaltung des Arbeitslebens 2, HdA-Projekt 01 HA 068, München 1980, S. 325 ff. 116 Altmann, Norbert/Düll, Klaus/Lutz, Burkart: Forschungsverbund: Humanisierungsrelevante Veränderungen in der Arbeitswelt. Ein Gutachten, München 1985, S. 17. 117 Kaste, Hermann: Arbeitgeber und Humanisierung der Arbeit. Eine exemplarische Analyse (Forschungstexte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), Opladen 1981, S. 25 f.
„Richtig Führen im Bergbau“
63
produzierte. Die Integration neuer Wissensinhalte und die Reproduktion dieser bedingten die Ausformung des Arbeiters zu einem sich selbst führenden Subjekt.
Zusammenfassung Der Wandel der Arbeit im Zechenbetrieb des Steinkohlenbergbaus des 20. Jahrhundert war keine zufällige Entwicklung, sondern von den Mechanismen des Verwissenschaftlichungsprozesses beeinflusst. Die Veränderungen auf betrieblicher und personeller Ebene entwickelten sich stets durch neue Herausforderungen, denen sich die Zechengesellschaften stellen mussten. Dazu gehörten konflikthafte Situationen, wie neu angeworbene bergbaufremde Arbeiter, Vorgesetztenproblematiken sowie neue technologische und betriebsorganisatorische Anforderungen. Der Einsatz externer Arbeitswissenschaftler und die Durchführung der arbeitswissenschaftlichen Studien im westdeutschen Steinkohlenbergbau dienten einerseits der Diagnose von Fehlerquellen und andererseits der Beherrschbarkeit sozialbetrieblicher Herausforderungen. Dabei waren es nicht die Bergbauunternehmen, die den Anstoß zu dieser Implementierung der Arbeitswissenschaftler eigenständig einforderten, sondern vielmehr externe Initiatoren, wie die DKBL oder die Hohe Behörde der EGKS. Die hier exemplarisch vorgestellten Studien unterschieden sich inhaltlich stark voneinander: Innerhalb der ersten arbeitswissenschaftliche Untersuchung „Bergmann und Zeche“ richtete sich der Fokus auf den Bergarbeiter als das anzupassende Subjekt, um die optimale Leistung zu erhalten. Beeinflusst von Optimierungsbestrebungen und Ordnungsdenken fordistischer Prägung erarbeiteten die Arbeitswissenschaftler der Sozialforschungsstelle Dortmund ein Analysekonstrukt, welches nicht nur die innerbetriebliche Welt umfasste, sondern den Betrieb um den sozialen Raum der privaten Lebenswelt erweiterte. Der zweite Untersuchungsgegenstand, die Studien des Institutes Mensch und Arbeit zeigten eine deutliche Verschiebung des arbeitswissenschaftlichen Untersuchungsfeldes. Nicht mehr der Bergarbeiter war das zu untersuchende Objekt, sondern der Vorgesetzte und dessen Arbeitsweise. Der technische Denkstil eines „optimierten Subjektes“, welches in die Strukturen der betrieblichen Welt integriert werden sollte, verschwand zusehends und wich der Hinwendung zu einer funktionalen, an Verhaltensnormen angepassten Gestaltungsform von Betrieb und Praxis. Innerhalb des Forschungsprojektes „Humanisierung des Arbeitslebens“ wurde ein ganzheitliches Konzept des „zusammen arbeitenden Betrie-
64 Martha Poplawski
bes“ entwickelt. Es zielte darauf ab, den Austausch und die Weitergabe von Wissen zu befördern und dadurch eine selbständige bzw. automatische Reproduktion von „sich selbst optimierenden Mitarbeitern“ zu erhalten. Die arbeitswissenschaftlichen Experten hatten jedoch nicht die Legitimation, Entscheidungen zu treffen. Sie dienten vornehmlich als Berater und Beobachter, die ihr Wissen an diejenigen weitergaben, die machtbefugt waren. Dennoch profitierten die Arbeitswissenschaftler von ihrer Tätigkeit für den Steinkohlenbergbau. Das Experimentierfeld Steinkohlenbergbau eröffnete ihnen Möglichkeit, an den Schnittstellen zwischen Staat, Wirtschaft und Wissenschaft ihre eigene Position zu stärken und nicht zuletzt finanzielle und personelle Ressourcen für die Wissenschaft zu mobilisieren. Als wissenschaftliche Akteure trieben sie die Verwissenschaftlichung des Steinkohlenbergbaus nach 1945 entschieden voran und verstärkten dadurch sogar den Bedarf nach wissenschaftlicher Expertise. Ausblickend lässt das Themengebiet noch einige Fragen offen. So konnte die Frage nach der praktischen Umsetzung der arbeitswissenschaftlichen Handlungsempfehlungen in diesem Aufsatz noch nicht beantwortet werden. Da sie allerdings die zweite Seite der Medaille darstellt und zahlreiche interessante Erkenntnisse bereithält, wird sie in der zukünftigen Forschung zur Verwissenschaftlichung im Steinkohlenbergbau eine entscheidende Rolle einnehmen.
Quellenverzeichnis a) Unveröffentlichte Quellen Westfälisches Wirtschaftsarchiv, Dortmund (WWA, DO) Bestand F 79 (Schachtanlage Gneisenau) Bestand K 1 (Industrie und Handelskammer zu Dortmund) Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok) beim Deutschen Bergbau-Museum Bochum/Bergbau-Archiv Bochum (BBA) Bestand 5/370 (Bundesminister für Forschung und Technologie) Bestand 5/357 (Schachtanlage Zoller, Germania) Bestand 12/210 (Deutsche Kohlenbergbau Leitung) Bestand 160/758 (Eschweiler Bergwerks-Verein AG, Rheinland) b) Zeitschriften und Zeitungen Glückauf. Berg- und Hüttenmännische Zeitschrift Werks-Nachrichten. Dortmunder Bergbau AG und Hansa Bergbau AG
„Richtig Führen im Bergbau“
65
Literaturverzeichnis Abelshauser, Werner: Der Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung, München 1984. Adamski, Jens: Ärzte des sozialen Lebens. Die Sozialforschungsstelle Dortmund 1946–1969 (Veröffentlichungen des Instituts für soziale Bewegungen – Schriftenreihe A: Darstellungen 41), Essen 2009. Altmann, Norbert/Düll, Klaus/Lutz, Burkart: Forschungsverbund: Humanisierungsrelevante Veränderungen in der Arbeitswelt. Ein Gutachten, München 1985. Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft (Hg.): Die Arbeitsverhältnisse im Steinkohlenbergbau in den Jahren 1912–1926, Berlin 1928. Beer, Walter: Vorwort, in: Fronz, Manfred u. a. (Hg.): Neueste Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Forschung im Steinkohlenbergbau, Tagungsbericht, Bochum 1981, S. 7. Bullinger, Hans-Jörg/Braun, Martin: Arbeitswissenschaft in der sich wandelnden Arbeitswelt, in: Ropohl, Günter (Hg.): Erträge der Interdisziplinären Technikforschung. Eine Bilanz nach 20 Jahren, Berlin 2001, S. 109–124. Deiß, Manfred/Döhl, Volker/Sauer, Dieter/Böhle, Fritz/Altmann, Norbert (Hg.): Öffentliche Maßnahmen als Bedingungen betrieblicher Aktivitäten zur menschengerechten Gestaltung des Arbeitslebens 2, HdA-Projekt 01 HA 068, München/Hannover 1980. Deppe, Frank/Dörre, Klaus: Klassenbildung und Massenkultur im 20. Jahrhundert, in: Tenfelde, Klaus (Hg.): Arbeiter im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1991, S. 726–745. Dietz, Bernhard/Neumaier, Christopher: Vom Nutzen der Sozialwissenschaften für die Zeitgeschichte. Werte und Wertewandel als Gegenstand historischer Forschung, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 60 (2012:2), S. 293–304. Farrenkopf, Michael: Wiederaufstieg und Niedergang der Bergbaus in der Bundesrepublik, in: Ziegler, Dieter (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 183–302. Fronz, Manfred u. a.: Neueste Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Forschung im Steinkohlenbergbau. Tagungsbericht, Bochum 1981. Gerhard, Ludwig: Der Wandel in der Zusammensetzung der Grubenbelegschaft seit dem Kriegsende und die hieraus auf einer Schachtanlage des Ruhrreviers gezogene praktische Folgerung, in: Glückauf (1948), S. 625. Graf, Rüdiger/Priemel, Kim Christian: Zeitgeschichte in der Welt der Sozialwissenschaften. Legitimität und Originalität einer Disziplin, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 59 (2011:4), S. 479–508. Grüttner, Michael: Jantke, Carl, in: Biographisches Lexikon zur nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik (2004), S. 84. Hudewentz, Dietrich: Humanisierung der Arbeit (Vorgetragen auf der Betriebsrätekonferenz der Eschweiler-Bergwerks-Verein am 11.03.1981), in: Bergbau 8 (1981), S. 551–555. Hülsdünker, Josef: Praxisorientierte Sozialforschung und gewerkschaftliche Autonomie. Industrie- und betriebssoziologische Beiträge des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts des DGB zur Verwissenschaftlichung der Gewerkschaftspolitik von 1946 bis 1956 (Die Entstehung der westdeutschen Industriesoziologie 2), Münster 1983. Jantke, Carl: Bergmann und Zeche. Die sozialen Arbeitsverhältnisse einer Schachtanlage des nördlichen Ruhrgebiets in der Sicht der Bergleute, Tübingen 1953.
66 Martha Poplawski
Jantke, Carl: Industriebetriebsforschung als soziologische Aufgabe, in: Soziale Welt 1 (1950:2), S. 14–23. Kaesler, Dirk: Otto Neuloh, in: Otto zu Stolberg-Wernigerode (Hg.): Neue deutsche Biographie, Berlin 1999, S. 131–132. Kändler, Ulrike: Entdeckung des Urbanen. Die Sozialforschungsstelle Dortmund und die soziologische Stadtforschung in Deutschland, 1930 bis 1960 (Histoire 58), Bielefeld 2016. Kaste, Hermann: Arbeitgeber und Humanisierung der Arbeit. Eine exemplarische Analyse (Forschungstexte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), Opladen 1981. Kift, Dagmar: Aufbau West. Neubeginn zwischen Vertreibung und Wirtschaftswunder, Essen 2005. König, René: Einleitung, in: Ders. (Hg.): Handbuch der Empirischen Sozialforschung, Stuttgart 1967, S. 3–17. König, Wolfgang: Kontrollierte Arbeit = optimale Arbeit? Frederik Winslow Taylors Programmschrift der Rationalisierungsbewegung, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 6 (2009:2), S. 1–5. Luks, Timo: Der Betrieb als Ort der Moderne. Zur Geschichte von Industriearbeit, Ordnungsdenken und Social Engineering im 20. Jahrhundert (Histoire 14), Bielefeld 2010. Luks, Timo: Die „psychognostische Schwierigkeit der Beobachtung“. Industriebetriebliches Ordnungsdenken und social engineering in Deutschland und Großbritannien in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, in: Etzemüller, Thomas (Hg.): Die Ordnung der Moderne. Social Engineering im 20. Jahrhundert (Histoire 9), Bielefeld 2009, S. 87–108. Luks, Timo: Heimat – Umwelt – Gemeinschaft. Diskurse um den Industriebetrieb im 20. Jahrhundert, in: Andresen, Knud u. a. (Hg.): Der Betrieb als sozialer und politischer Ort. Studien zu Praktiken und Diskursen in den Arbeitswelten des 20. Jahrhunderts (Politik und Gesellschaftsgeschichte 98), Bonn 2015, S. 73–98. Neuloh, Otto: Zur sozialen Ordnung der Mittelschicht des Ruhrbergbaus, in: Soziale Welt 2 (1951:2), S. 124–141. Pflüger, Jessica u. a.: Methodische Herausforderungen arbeits- und industriesoziologischer Fallstudienforschung, in: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Hg.): Industrie- und Betriebssoziologie, Bonn 2010, S. 5–13. Pfützner, Robert: Taschenbuch Mensch und Arbeit. Für Führungskräfte im Betrieb, München 1966. Pichler-Frantzen, Rosemarie: Werksfürsorge im Ruhrkohlenbergbau, in: Soziale Welt 1 (1950:3), S. 51–60. Platz, Johannes: Die Praxis der kritischen Theorie. Angewandte Sozialwissenschaft und Demokratie in der frühen Bundesrepublik 1950–1960, Trier 2012. Pöhler, Willi: Fünf Jahre Humanisierungsprogramm im Bereich des Bundesministers für Forschung und Technologie in: Ders. (Hg.): …damit die Arbeit menschlicher wird. Fünf Jahre Aktionsprogramm Humanisierung des Arbeitslebens, Bonn 1979, S. 9–37. Raehlmann, Irene: Arbeitswissenschaft im Nationalsozialismus. Eine wissenschaftssoziologische Analyse, Wiesbaden 2005. Raphael, Lutz: Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und konzeptionelle Herausfordeung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, in: Geschichte und Gesellschaft 22 (1996), S. 165–193. Sauer, Dieter: Permanente Reorganisation. Unsicherheit und Überforderung in der Arbeitswelt, in: Doering-Manteuffel, Anselm u. a. (Hg.): Vorgeschichte der Gegenwart. Dimensionen des Strukturbruchs nach dem Boom, Göttingen 2016, S. 37–55.
„Richtig Führen im Bergbau“
67
Sauer, Dieter: Von der „Humanisierung der Arbeit“ zur „Guten Arbeit“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 15 (2011), S. 18–24. Sauer, Dieter u. a.: Einige Thesen zur Entwicklung von Rationalisierung und „Humanisierung“ im Bergbau, in: Fronz, Manfred u. a. (Hg.): Neueste Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Forschung im Steinkohlenbergbau, Tagungsbericht, Bochum 1981, S. 113–127. Schneider, Michael: Unterm Hakenkreuz. Arbeiter und Arbeiterbewegung 1933 bis 1939 (Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in Deutschland seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 12), Bonn 1999. Seidel, Hans-Christoph: Arbeitsbeziehungen und Sozialpolitik im Bergbau. Vom Nationalsozialismus bis zum Ende der alten Bundesrepublik, in: Ziegler, Dieter (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 446–514. Stams, Joachim: Übertragung von Ergebnissen der HdA-Forschung in den Steinkohlenbergbau, in: Bergbau 1 (1984), S. 20–25. Szöllösi-Janze, Margit: Der Wissenschaftler als Experte. Kooperationsverhältnisse von Staat, Militär, Wirtschaft und Wisssenschaft, 1914–1933, in: Kaufmann, Doris (Hg.): Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus. Bestandsaufnahme und Perpektiven der Forschung, Göttingen 2000, S. 46–64. Trischler, Helmuth: Steiger im deutschen Bergbau. Zur Sozialgeschichte der technischen Angestellten 1815–1945 (Bergbau und Bergarbeit), München 1988. Uhl, Karsten: Die Geschlechterordnung der Fabrik. Arbeitswissenschaftliche Entwürfe von Rationalisierung und Humanisierung 1900–1970, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenchaften 21 (2010:1), S. 93–117. Uhl, Karsten: Humane Rationalisierung. Die Raumordnung der Fabrik im fordistischen Jahrhundert (Histoire 62), Bielefeld 2014. Weyer, Johannes: Westdeutsche Soziologie 1945–1960. Deutsche Kontinuitäten und nordamerikanischer Einfluss, Berlin 1984.
Nikolai Ingenerf
Grubenwarten ohne ROLF – (K)Eine Automatisierung im britischen und westdeutschen Steinkohlenbergbau? Einleitung In den 1950er Jahren dominierten die Schlagwörter Atomkraft und Automatisierung die öffentlichen Diskurse zu zeitgenössischen Entwicklungstendenzen der industriellen Produktionstechnik. Solche technologischen Schlagwörter konnten gleichzeitig für euphorische Utopien und deprimierende Dystopien stehen. So standen der Hoffnung auf unendliche Energiereserven existenzielle Ängste vor dem Atomtod gegenüber.1 Ähnliches lässt sich mit Blick auf die aufkommende industrielle Anwendung automatischer Maschinen feststellen. Automatisierung stand auf der einen Seite für eine neue Arbeitswelt, die die Entlastung des Menschen von ermüdender und kräftezehrender Arbeit versprach. Auf der anderen Seite stand die Sorge vor Massenarbeitslosigkeit und einer „Herrschaft der Maschinen“.2 Viele Gründe sind vorstellbar, warum die Automatisierungseuphorie der 1950er Jahre auch im westdeutschen Steinkohlenbergbau hätte aufgegriffen werden können: eine geringere Unfallgefahr, niedrigere Personalkosten oder die Erwartung einer Produktivitätssteigerung. Doch nichts dergleichen geschah. Weder wurden Utopien paradiesischer Arbeitszustände verkündet, noch hatten Bergleute Angst, dass „Roboter“ schon bald ihren Platz einnehmen würden.3 Die Automatisierung des Grubenbetriebes blieb im deutschen Steinkohlenberg1 Prägnant zusammengefasst bei Renger-Berka, Peggy: Transzendenzbezüge und Gemeinsinnsbehauptungen im Reden vom „Atomzeitalter“ in der Bundesrepublik der 1950er Jahre, in: Dresdener Beiträge zur Geschichte der Technikwissenschaften 33 (2012), S. 69–81. 2 Zu den Diskursen um die Automatisierung: Heßler, Martina: Die Ersetzung des Menschen? Die Debatte um das Mensch-Maschinen-Verhältnis im Automatisierungsdiskurs, in: Technikgeschichte 82 (2015), S. 109–136; Schuhmann, Annette: Der Traum vom perfekten Unternehmen. Die Computerisierung der Arbeitswelt in der Bundesrepublik Deutschland (1950er bis 1980erJahre), in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 9 (2012), S. 231–256; Schwarz, Martin: Fabriken ohne Arbeiter, in: Fraunholz, Uwe/Wölfel, Sylvia (Hg.): Ingenieure in der technokratischen Hochmoderne. Thomas Hänseroth zum 60. Geburtstag, Münster 2012, S. 167–178; Bluma, Lars: Norbert Wiener und die Entstehung der Kybernetik im Zweiten Weltkrieg (Kritische Informatik 2), Münster 2005, S. 165–177. 3 Zur Angst vor Arbeitsplatzverlusten siehe auch den Beitrag von Moritz Müller in diesem Band. https://doi.org/10.1515/9783110729979-004
70 Nikolai Ingenerf
bau bis weit in die 1980er Jahre hinein ein Nischenthema. Nicht so in Großbritannien: Hier schien zu Beginn der 1960er Jahre die Einführung mannloser Abbaubetriebe unmittelbar bevorzustehen. Entsprechende Entwicklungen wurden vorangetrieben und Prototypen in Bergwerken getestet. Nach knapp zehn Jahren wich diese kurze Euphorie allerdings der nüchternen Erkenntnis, dass Vollautomatisierung ohne einen Ausbau der Erfassung und Verarbeitung von Messdaten nicht zu erreichen war. Projekte zur Datenerfassung und -verarbeitung wiederum standen auf den Schachtanlagen an Ruhr, Wurm und Saar schon länger im Mittelpunkt von Versuchen und Investitionen. Der Beitrag stellt diese Diskrepanz in den Mittelpunkt. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen britischer und deutscher Entwicklungsarbeiten in den Blick genommen und nach den Bedingungen gefragt, unter welchen in den jeweiligen Revieren Automatisierung bewertet und angewendet bzw. nicht angewendet wurde. Welche Erwartungen waren auf der britischen Insel mit der neuen Technologie verbunden? Warum bewerteten die deutschen Reviere automatische Steuerungen dagegen eher zurückhaltend? Welche Lehren wurden aus den Versuchen des jeweils anderen gezogen? Zur Beantwortung dieser Fragen skizziert der Beitrag grundlegende Entwicklungslinien und Projekte im britischen und westdeutschen Steinkohlenbergbau.4 Ziel ist es, sowohl die spezifischen Entwicklungslinien bundesdeutscher und britischer Bergbautechnik nachzuzeichnen, als auch einen Beitrag zur Frage zu liefern, wie und was sich hinter dem Begriff der Automatisierung auf betrieblicher Ebene verbirgt.5 Grundlage dieser Darstellung ist eine umfassende Auswertung der fachspezifischen Literatur. Dabei wurden die jeweiligen nationalen Fachzeitschriften ebenso berücksichtigt wie publizierte Tagungsberichte und Forschungsprogramme. Eine besondere Herausforderung dieser Quellengattungen ist es, die Projekte in ihrer Wirkung auf die betrieblichen Praktiken zu bewerten. Die meist von den Projektleitern verfassten Berichte beschreiben in der Regel erfolgreiche 4 Zur Methode des Vergleichs siehe zusammenfassend Haupt, Heinz-Gerhard/Kocka, Jürgen: Historischer Vergleich: Methoden, Aufgaben, Probleme. Eine Einleitung, in: Dies. (Hg.): Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung, Frankfurt (Main) 1996, S. 9–45. 5 Bisher haben sich nur wenige Arbeiten der technische Umsetzung von Automatisierungsvorhaben gewidmet, vgl. Noble, David F.: Forces of Production. A Social History of Industrial Automation, New York 1984; Kaiser, Walter: Technisierung des Lebens seit 1945, in: Ders./ Braun, Hans-Joachim (Hg.): Energiewirtschaft, Automatisierung, Information, Berlin 1992, S. 283–529; Hounshell, David A.: Planning and Executing ‚Automation‘ at Ford Motor Company 1945–65. The Cleveland Engine Plant and Its Consequences, in: Shiomi, Haruhito/Wada, Kazuo (Hg.): Fordism Transformed. The Development of Production Methods in the Automobile Industry, Oxford 1995, S. 49–86; Schuhmann: Traum.
Grubenwarten ohne ROLF
71
Versuche oder weisen eine tendenziell erfolgversprechende Prognose auf. Vergleichbar detaillierte Ausführungen zu gescheiterten Automatisierungsprojekten sind, aus nachvollziehbaren wie für Historiker:innen bedauernswerten Gründen, nicht zu finden. Veröffentlichten Forschungsberichten haftet eine vergleichbare Problematik an. Mit Hinblick auf eine kritische Bewertung der Versuche haben sich hingegen die von der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl herausgegebenen Tagungsberichte als ergiebiger erwiesen. Die Skizze beschreibt zunächst jeweils die Situation des deutschen und britischen Bergbaus zum Ende der 1950er Jahre, jenem Zeitraum, in dem die ersten großindustriellen Anwendungen (teil-)automatisierter Prozesse für großes Aufsehen sorgten.6 Anschließend werden die zeitgenössisch populären britischen Projekte zur Automatisierung des Abbaus in den Blick genommen, bevor sich der Beitrag jenen Projekten widmet, die im westdeutschen Steinkohlenbergbau unter dem Stichwort „Automatisierung“ diskutiert wurden. Dabei wird deutlich, dass die im britischen Bergbau verfolgten Automatisierungsbemühungen sich signifikant sowohl in der Herangehensweise als auch in der Umsetzung von jenen in der Bundesrepublik unterschieden.
Schwierigkeiten des Automatisierungsbegriffes Mit dem Automatisierungsbegriff zu arbeiten bedeutet, sich auf einen äußerst unscharf konturierten Begriff einzulassen. Wie schwer sich auch technikwissenschaftliche Fachpublikationen mit einer Definition des Begriffes taten, lässt sich exemplarisch an einer tautologischen Definition eines zeitgenössisches Überblickswerkes für Ingenieurinnen und Ingenieure zeigen: „Mit dem Wort ‚Automatisierungstechnik‘ werden Aufgaben des Ingenieurs beim Bau und bei der Anwendung von Automaten umrissen.“7 Während der Begriff „Automat“8 ungebrochen aus dem 18. Jahrhundert übernommen wurde, teilte Prieur das Feld der Automatisierungstechnik in die drei Bereiche „Detroit-Automation“ (Automatisierung von Kraftmaschinen und Produktionstechnik), „Office-Automation“ (Automatisierung der Informationsverarbeitung) und „Instrumentation“ (Automatisierung physikalisch-chemischer Verfahrensabläufe) auf.9 Diese 6 N. N.: Die Revolution der Roboter, in: Der Spiegel 9 (1955:31), S. 20–30. 7 Prieur, Hans J.: Taschenbuch – Automatisierungstechnik. Für Planung, Beschaffung und Betrieb, München 1968, S. 11. 8 „Automat ist im weiteren Sinne jede durch ‚verborgene‘ Kraftmittel in Bewegung gesetzte Vorrichtung, welche die Tätigkeit eines Menschen oder Tieres nachahmt.“ Vgl. ebd. 9 Ebd.
72 Nikolai Ingenerf
Unschärfe ist ein Charakteristikum, das sich der Automatisierungsbegriff beibehalten hat.10 Damals wie heute war dieser Umstand Gegenstand zeitgenössischer Kritik.11 Definitorische Unschärfen machen es notwendig, nach den spezifischen Automatisierungsverständnissen innerhalb einer fachlich oder thematisch verbundenen Gruppe zu fragen. Als hilfreich erweist sich dabei der grundsätzliche Konsens, Automatisierung als ein Querschnittsthema zu begreifen, bei dem sich verschiedene Technologien und Forschungsfelder miteinander überschneiden. Ohnehin erweist sich ein enges Verständnis und Suche nach der wörtlichen Begriffsverwendung „Automatisierung“ beim Blick auf den westeuropäischen Steinkohlenbergbau als wenig hilfreich. In bergmännischen Fachzeitschriften von den 1950er Jahren bis in die 1970er Jahre wurde Automatisierung eher selten verwendet.12 Hieraus abzuleiten, dass das Thema in dieser Branche keine Rolle gespielt habe, wäre jedoch ein Fehlschluss. Zwar gelang es im westeuropäischen Bergbau nirgends, Systeme einzusetzen, die dem engeren Leitbild weitgehend autonom, mithin von Menschen unabhängig agierender Maschinen entsprachen. Gleichwohl lassen sich viele Projekte identifizieren, deren mittelbares Ziel teil- oder vollautomatisch arbeitende Systeme waren. Anstelle von Automatisierung wurden diese Entwicklungsarbeiten aber unter den Stichwörtern Fernwirktechnik, Fernsteuerung, Prozesssteuerung oder auch (vereinzelt) Kybernetik geführt. In diesem Kontext erweist sich der Konsens von Automatisierung als Querschnittsthema verschiedener technikwissenschaftlicher Teilbereiche als hilfreich. Er bietet eine geeignete, weil praxisnahe Grundlage für die Suche nach entsprechenden Vorhaben im Steinkohlenbergbau. Mit ihm lassen sich Projekte identifizieren, die in den Quellen nicht als Automatisierung bezeichnet wurden. Daher rücken im Folgenden solche Projekte in den Fokus, die
10 Unter Verweis auf die Norm DIN 19233 in einem aktuellen Lehrbuch zur Automatisierungstechnik „[…] bedeutet Automatisieren[,] künstliche Mittel einzusetzen, damit ein Vorgang selbsttätig abläuft.“ Im weiteren Verlauf beschreibt das besagte Handbuch Automatisierungstechnik als eine Querschnittsdisziplin, zu der, neben Anlagen- und Maschinenbau, unter anderem Sensor-, Steuer-, Roboter-, Rechner-, Informations- und Managementtechnik zählen. Vgl. Langmann, Reinhard (Hg.): Taschenbuch der Automatisierungstechnik, München 2010, S. 19 f. 11 Heßler, Martina: Einleitung. Herausforderungen der Automatisierung: Forschungsperspektiven, in: Technikgeschichte 82 (2015), S. 99–108, hier S. 104. Zur zeitgnössischen Kritik siehe: Roeper, Hans: ‚Automation‘ oder ‚Automatisierung‘? Die Übernahme des englischen Ausdrucks führt im Deutschen zu einer Begriffsverwirrung, in: automatik 5 (1960:3), S. 91–92. 12 Auch konzentrierte sich die Automatisierungsdiskussion vornehmlich auf den Bereich der klassischen Güterproduktion, vgl.: Dolezalek, Carl Martin: Grundlagen und Grenzen der Automatisierung, in: VDI Zeitschrift 98 (1956:12), S. 564–569.
Grubenwarten ohne ROLF
73
eine stärkere räumliche und funktionale Trennung von Menschen und Maschinen zum Ziel hatten. Hierbei steht vor allem das Feld der Fernwirktechnik oder Remote Control im Mittelpunkt. Die Fernwirktechnik umfasste sowohl Methoden zur Fernüberwachung als auch, darauf aufbauend, zur Fernsteuerung von Maschinen. Obgleich semantisch getrennt, wurden Themen der Fernwirktechnik und der Automatisierung in der Regel gemeinsam diskutiert. Beispielsweise unterschied der Ausschuss Fernwirktechnik des Steinkohlenbergbauvereins zwar dezidiert zwischen Fernwirktechnik und Automatisierung, rechnete aber in einer Übersicht zur Fernwirktechnik im Steinkohlenbergbau „selbsttätige Abläufe […] aus zweckmäßigkeitsgründen“ hinzu.13 Doch schon im Laufe der 1960er Jahre begannen sich die Begriffe Fernwirktechnik und Automatisierung zunehmend zu überschneiden, weshalb in diesem Beitrag auf eine begriffliche Trennung verzichtet wird.14
Mechanisierung im westdeutschen Steinkohlenbergbau Zur Automatisierung bedarf es Maschinen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der westdeutsche Steinkohlenbergbau weit davon entfernt, diese vermeintlich simple Bedingung zu erfüllen. Die Zechen der Westzonen gaben nach Kriegsende ein ambivalentes Bild ab: Mochten die zerstörten Tagesanlagen den Eindruck vermitteln, in den Revieren an der Ruhr, um Aachen und auch an der Saar würde in absehbarer Zeit kein leistungsfähiger Abbau mehr möglich sein, so waren die Anlagen unter Tage von den Angriffen weitgehend unbeschädigt. Wenn auch kriegsbedingt heruntergewirtschaftet, waren die untertägigen Grubengebäude der Zechen zusammen mit dem zwar in der Anzahl geringen, aber gut ausgebildeten Arbeiterstamm, das eigentliche Kapital der Zechen. Folglich 13 Repetzki, Kurt: Fernwirktechnik im Steinkohlenbergbau. Herausgegeben vom Ausschuß Fernwirktechnik beim Steinkohlenbergbauverein (Glückauf-Betriebsbücher 8), Essen 1962, S. 15. 14 Staudt, Erich/Schmeisser, Wilhelm: Automation, in: Ott, Erich/Boldt, Alfred (Hg.): Handbuch zur Humanisierung der Arbeit, Bremerhaven 1985, S. 431–462, hier S. 433. Diese Entwicklung lässt sich auch institutionell nachzeichnen: Der Fachausschuss „Fernwirktechnik“ der Bergbau-Forschung GmbH, der zentralen Forschungs- und Entwicklungsinstitution des bundesdeutschen Steinkohlenbergbaus, wurde 1967 in „Automatisierungs- und Fernwirktechnik“ umbenannt, vgl. N. N.: 20 Jahre Forschung und Entwicklung im Geschäftsbereich Bergtechnik der Bergbau-Forschung GmbH, Essen 1982, S. 2.
74 Nikolai Ingenerf
konnte die Förderung vielerorts nach einer kurzen Aufbauzeit wieder aufgenommen werden, wenn auch an der Ruhr und im Aachener Revier deutlich unter dem Niveau von 1936.15 Mit Kriegsende in Europa bestand auf allen Seiten ein großes Interesse, die Steinkohlenförderung an der Ruhr nicht nur wieder aufnehmen zu können, sondern auch die Fördermengen wieder auf Vorkriegsniveau anzuheben. Der mit Beginn des Koreakrieges 1950 einsetzende Boom in der deutschen Montanindustrie sorgte für einen weitreichenden Energiemangel, für dessen Abhilfe die Steinkohlenförderung weiter ausgebaut werden musste. Vor diesem Hintergrund wurden mit staatlicher und privatwirtschaftlicher Unterstützung in den 1950er Jahren zahlreiche Schachtanlagen zwischen Rhein und Ruhr sowie im Aachener Revier modernisiert.16 Dabei entstanden bis 1957 an der Ruhr 50 neue Schächte. Gleichzeitig wurde die Förderung von 37 Schachtanlagen auf 14 neuen Zentralschachtanlagen zusammengelegt sowie zwei vollkommen neue Bergwerke geplant und ihr Bau begonnen.17 Auch viele kleinere Zechen wurden modernisiert. Insgesamt konzentrierten sich die Rationalisierungsmaßnahmen der 1950er Jahre auf den Ausbau und die Modernisierung der Tagesanlagen und die Erschließung neuer Lagerstätten. Hatten sich viele Schachtanlagen über Tage durch die neuen Förder- und Aufbereitungsanlagen sichtbar verändert, so war das Bild unter Tage seit dem Ende der 1920er Jahre in weiten Teilen unverändert geblieben. Der Abbau erfolgte zu einem Großteil mit den bekannten Abbauhämmern, für den Ausbau, also zum Stützen des Deckgebirges, standen per Hand zu versetzende Reibungs- später auch Hydraulikstempel aus Stahl zur Verfügung. Lediglich der Abtransport der Kohle erfolgte mechanisch mit Hilfe von Schüttelrutschen und Förderwagen, die von Diesel- oder Elektrolokomotiven gezogen wurden.18 15 Abelshauser, Werner: Der Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung, München 1984, S. 44 f. Zur Entwicklung der Förderzahlen in den einzelnen Revieren: N. N.: Der Kohlenbergbau Deutschlands im Jahre 1936, in: Glückauf 73 (1937:11), S. 246–247; N. N.: Zur Lage im Kohlenbergbau, in: Glückauf 85 (1949:13/14), S. 241–244; N. N.: Die Energiewirtschaft des Saargebietes im Jahre 1948, in: Glückauf 85 (1949:49/50), S. 913–915. 16 Mit dem Investitionshilfegesetz wurde ab 1951 ein staatlich koordinierter und privatwirtschaftlich finanzierter Fonds eingerichtet, mithilfe dessen die notwendigen Investitionen im Steinkohlenbergbau finanziert wurden. Vgl. Abelshauser: Ruhrkohlenbergbau, S. 77. 17 Farrenkopf, Michael: Wiederaufstieg und Niedergang des Bergbaus in der Bundesrepublik, in: Ziegler, Dieter (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der Deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 183–302, hier S. 212. 18 Bleidick, Dietmar: Bergtechnik im 20. Jahrhundert. Mechanisierung in Abbau und Förderung, in: Ziegler, Dieter (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 355–411, hier S. 393 f.
Grubenwarten ohne ROLF
75
Um die Förderung zu erhöhen, wurde in erster Linie auf traditionelle Strategien zurückgegriffen: Ausbau der Belegschaftszahlen statt Investitionen in den untertägigen Maschinenpark.19 Am Ende dieser ersten Modernisierungsphase wurde zwar rund ein Drittel der gesamten Kohlenförderung maschinell gewonnen, aber gleichzeitig bestand die maschinelle Ausstattung von mehr als der Hälfte aller Abbaubetriebspunkte lediglich aus Abbauhämmern. Der Anteil vollmechanisierter Förderung, bei der der überwiegende Teil der anfallenden Arbeiten mit Maschinentechnik umgesetzt wurde, betrug zum Beginn der 1958 einsetzenden Kohlenkrise lediglich 25,5 %.20 Zu diesem Zeitpunkt setzte die existenziell bedrohliche Kohlenkrise ein und der Steinkohlenbergbau fuhr seine Investitionen zunächst zurück. Unter den unsicheren Perspektiven, die die erste Hälfte der 1960er Jahre kennzeichneten, waren Schließungen und die Zusammenlegung benachbarter Zechen die bevorzugten Mittel der Wahl. Unrentable und vergleichsweise kleine Schachtanlagen wurden stillgelegt oder zusammengeschlossen. Das ab September 1963 wirksame Rationalisierungsgesetz stellte den Bergbauunternehmen rund 1,5 Mrd. DM für nicht weiter definierte Rationalisierungsmaßnahmen zur Verfügung. Damit konnten auch negative Rationalisierungsmaßnahmen in Form einer so genannten Stilllegungsprämie vergütet werden, was eine weitere Stilllegungswelle zur Folge hatte.21 Nichtsdestotrotz fanden einige dieser Mittel auch für eine weitere Modernisierung des Ruhrbergbaus Verwendung. Angesichts der anhaltend rückläufigen Nachfrage und dem damit verbundenen Preisverfall von Steinkohle wurden in den 1960er Jahren die steigenden Lohnkosten zum Ziel von Kostensenkungen. Damit wurde die auf den Personalausbau der 1950er Jahre zurückzuführenden großen Belegschaften zu einem Problem. Dennoch stieg im Laufe der 1960er Jahre die Gesamtproduktivität des Steinkohlenbergbaus merklich: Waren 1970 deutschlandweit über 60 % der Schachtanlagen von 1958 stillgelegt, verringerte sich die Förderung lediglich um rund 25 %.22
19 Burghardt, Uwe: Mit der Vollmechanisierung gegen den Niedergang. Der Steinkohlenbergbau in Nordfrankreich und Westdeutschland in der Nachkriegsepoche, in: Technikgeschichte 61 (1994:2), S. 83–109; Danielzig, Hellmut: Der Altersaufbau der Belegschaften im Steinkohlenbergbau unter dem Einfluß des Arbeiterrückganges, in: Glückauf 97 (1961:3), S. 159–167, hier S. 159. 20 Abelshauser: Ruhrkohlenbergbau, S. 197. 21 Farrenkopf: Wiederaufstieg und Niedergang, S. 220. 22 N. N.: Der Kohlenbergbau der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1971, in: Glückauf 108 (1972:7), S. 264–271, hier S. 265.
76 Nikolai Ingenerf
Möglich wurde das, neben organisatorischen Veränderungen (Zusammenlegen benachbarter Schachtanlagen) durch eine intensive Mechanisierung des Abbaus innerhalb von rund zehn Jahren. Dies war zugleich der personalintensivste Bereich eines Bergwerkes. 1960 wurden hier für 100 t verwertbarer Förderung 22 Schichten verfahren. In der Hauptstreckenförderung, also dem Transport der Kohle vom Gewinnungsort zum Schacht, wurden dagegen nur vier Schichten benötigt.23 Im Zentrum der Mechanisierungsbemühungen stand dabei der Ort der unmittelbaren Kohlegewinnung, bergmännisch Streb genannt. Die dortigen Abläufe und dafür notwendigen Ausrüstungen lassen sich in drei Bereiche unterteilen: den Ausbau, also das Abstützen des Deckgebirges, die eigentliche Gewinnung der Kohle und schließlich ihr Abtransport. Jeder dieser Bereiche konnte getrennt mechanisiert werden, als vollmechanisiert galt die Kohleförderung allerdings erst, wenn alle drei mechanisch betrieben wurden.24 An die vereinzelten Mechanisierungsbemühungen der 1950er Jahre anknüpfend, erfolgte so die Einführung von Maschinen, die die manuellen Arbeiten im Streb Schritt für Schritt auf die Steuerung der einzelnen Bauteile reduzierten.25 Ein Jahr nach Gründung der Ruhrkohle kamen 1970 über 90 % der Gewinnung aus Streben mit mechanischen Gewinnungsverfahren. Beim Ausbau lag die Mechanisierungsquote bei rund 40 %, sodass insgesamt von einer ebenso hohen Vollmechanisierungsquote im Steinkohlenbergbau ausgegangen werden kann.26 Ein Projekt, das die manuellen Steuerungen durch automatische Abläufe zu ersetzen versuchte, waren allerdings weder an der Ruhr noch in anderen westdeutschen Revieren zu finden.
23 Hierbeit handelt es sich um einen im Bergbau üblichen statistischen Wert, vgl. Adler, Friedrich: Gutachterliche Stellungnahme über die Möglichkeiten für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Steinkohlenbergbau der Reviere Ruhr und Aachen im Hinblick auf eine weitere Rationalisierung und Kostendeckung im Grubenbetrieb untertage, Berlin 1966, S. 3. 24 Hier und im Folgenden: Bleidick: Bergtechnik im 20. Jahrhundert, S. 387–400. 25 Ebd., S. 396–399. 26 Heiermann, Heinrich: Von der Mechanisierung zur Automatisierung. Bergtechnik bei der Ruhrkohle AG, Essen 1989, S. 27 f.
Grubenwarten ohne ROLF
77
Abb. 1: Anteil nicht-, teil- und vollmechanischer Streben an der Fördermenge im bundesdeutschen Steinkohlenbergbau. Grundvoraussetzung für eine automatisierte Kohlegewinnung waren vollmechanische Streben, deren verhältnismäßig geringer Anteil unten rechts erkennbar ist. Grafik aus: Kundel, Heinz: Gewinnungs- und Ausbautechnik im deutschen Steinkohlenbergbau im Jahre 1972, in: Glückauf 109 (1973:15), S. 759.
Auf Knopfdruck ROLF Ein Blick auf die britische Insel zeigt ein anderes Bild. Dem deutschen Steinkohlenbergbau vergleichbar, arbeitete der britische Bergbau nach dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls auf Verschleiß. Die zahlreichen überalterten Anlagen von höchst unterschiedlicher Betriebsgröße hatten sich in den Kriegsjahren ausschließlich an einer möglichst hohen Förderung orientiert und es war kaum investiert worden. Tiefgreifende Modernisierungen waren für einen Großteil der
78 Nikolai Ingenerf
Bergwerke nicht finanzierbar.27 Doch mit der Verstaatlichung der Steinkohlenzechen 1947 und der damit verbundenen Gründung des National Coal Board (NCB) ging ein enormer Investitionsschub einher. Auch waren die untertägigen Anlagen in Großbritannien nicht kriegsbedingt zerstört worden, sodass die Produktivität hier 1946 schon beinahe auf dem Vorkriegsstand von 1938 angelangt war.28 Ein mechanischer Bergbau wurde in Großbritannien innerhalb weniger Jahre zum Standard, rund zehn Jahre früher als in der Bundesrepublik. Das hatte auch mit den in Teilen unterschiedlichen geologischen Verhältnissen der Lagerstätten zu tun. Zwar unterschieden sich die britischen Reviere hinsichtlich der Flözmächtigkeiten, also der Dicke der Kohlenschichten, kaum von den deutschen. Doch insbesondere die ergiebigen Flöze in den East Midlands waren flach gelagert und damit gut mechanisierbar.29 Während in der Bundesrepublik der Anteil an Maschinen unter Tage erst langsam zunahm, wurde 1962 auf den Zechen Ormonde und Newstead die ersten automatisch arbeitenden Streben in Verhieb genommen. Geradezu euphorisch berichtete die britische Fachpresse über die beiden ersten ferngesteuerten und weitgehend automatisch arbeitenden Streben der Welt.30 Unter dem einprägsamen Namen ROLF (Remotely Operated Longwall Faces; Ferngesteuerte Langfrontstreben, N. I.) waren hier auf rund 150 m Länge Ausbau, Förderer und Gewinnungsmaschine mechanisch und steuerungstechnisch miteinander verbunden. Besonderes Augenmerk wurde auf eine weitgehend automatische Steuerung des Ausbaus gelegt, da für dessen Umsetzen noch ein hoher Personalaufwand nötig war. Gesteuert wurde das ROLF-System über einen Steuerstand in einer der Abbaubegleitstrecken. Mit diesem Projekt wollte das NCB demonstrieren, dass insbesondere die schwierig zu gewinnenden geringmächtigen Flöze ohne großen Personalaufwand abgebaut werden konnten. Darüber hinaus sollte durch den Einsatz automatischer Steuerungen einer der unfallträchtigsten Arbeitsplätze im Bergwerk entschärft werden, indem er weitgehend abgeschafft wurde.31
27 Ashworth, William/Pegg, Mark: 1946–1982. The Nationalized Industry (The History of The British Coal Industry 5), Oxford 1986, S. 63. 28 Abelshauser: Ruhrkohlenbergbau, S. 69. 29 Ashworth/Pegg: Nationalized Industry, S. 66. 30 N. N.: First Step To Automation. Conventional Machinery Controlled from the Gate, in: Steel & Coal 187 (1963:12), S. 68–74. 31 N. N.: Remotely Operated Longwall Faces. A World First For British Mining Engineers, in: Colliery Engineering 40 (1963:8), S. 312–323.
Grubenwarten ohne ROLF
79
Abb. 2: Schematische Darstellung des ROLF-Systems; die Bedienung erfolgt durch eine Person aus einer der Abbaubegleitstrecken (links unten). Aus: Jackson, H.: Installation of Rolf II At Ormonde Colliery: Operation Problems, in: Colliery Guardian 212 (1966:13), S. 605.
Die ROLF-Versuche waren der Auftakt einer groß angelegten Initiative des NCB, automatische (Fern-)Steuerungen im Bergbau zur Anwendung zu bringen. Zwei Jahre später fiel der Entschluss, die sich gerade im Bau befindliche Zeche Bevercotes mit einem System auszustatten, das eine hohe Integration und Fernsteuerung der hier verbauten Maschinen ermöglichte. Die auch als „push-button mine“ beworbene Schachtanlage sollte zu einem Vorzeigeprojekt für automatisierte Bergwerke werden und mit einer Belegschaft von rund 770 Bergleuten 1,1 Mio. t pro Jahr fördern.32 Daraus ergab sich eine erwartete Mann-SchichtLeistung von 8 t, was das Vierfache der damals in der Bundesrepublik üblichen etwa 2,5 t/ms (Mann-Schicht) war.33 Auch die angepeilte Belegschaftsstärke sollte beeindrucken: An der Ruhr benötigten Schachtanlagen mit vergleichbarer Jahresförderung von rund 2500 Tonnen über drei Mal so viele Beschäftigte.34 Doch nachdem Bevercotes 1967 offiziell eröffnet worden war, kam die Förderung nie wirklich in Gang. Schon zwei Jahre später stand das Projekt kurz vor seinem Ende. Technische und unerwartete geologische Probleme machten 32 N. N.: Remote Control Mining – II, in: Colliery Engineering 42 (1965:8), S. 340–350, hier S. 340. 33 N.N: Kohlenbergbau der Bundesrepublik, S. 267. 34 Zum Vergleich siehe die Zechen Sachsen, Pluto und Vereinigte Pörtingsiepen/Carl Funke, vgl. Reintges, Heinz u. a. (Hg.): Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Essen 1969.
80 Nikolai Ingenerf
Schwierigkeiten. Ab 1971 förderte Bevercotes wieder als eine konventionell betriebene, vollmechanisierte Schachtanlage mit einer Belegschaft von 1200 Personen.35 Damit waren die britischen Versuche, automatisch betriebene Bergwerke zu betreiben, vorerst beendet.36 Ein Jahr später präsentierte der stellvertretende Direktor der Forschungsabteilung des National Coal Board, Albert Edward Bennett, die Probleme, die sich beim ROLF-System ergeben hatten. Anlass war eine 1972 von der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) veranstaltete Tagung zur Automatisierung im Steinkohlenbergbau, an der auch deutsche Bergingenieure teilnahmen.37 Vor seinen europäischen Kollegen räumte er ein, „daß sowohl die Konstruktion der Steuervorrichtungen als auch die Theorie des Systems grundlegende Fehler aufwiesen.“38 Lediglich die Fernsteuerung des Ausbaus sei „zweifellos ein Erfolg“ gewesen. Die konkreten Probleme waren vielschichtig. Zum einen hatte es sich als problematisch erwiesen, dass die räumliche Lage des Systems im Kohlenflöz nicht gemessen und damit nicht erfasst werden konnte. Folglich war es nicht möglich, dem Verlauf des Flözes ferngesteuert zu folgen. Des Weiteren stellte sich heraus, dass die Steuereinrichtung für die Gewinnungsmaschine im Streb nicht optimal angeordnet war. Aus diesem Grund mussten zahlreiche Steuerkabel und -schläuche verlegt werden, die im rauen Betriebsalltag oft beschädigt oder zerstört wurden.39 Zu guter Letzt blieb die Grenze zwischen Kohle und Gestein ein immerwährendes Problem. Bei einer vollständig manuellen Steuerung identifizierte die Belegschaft vor Ort diese Grenze und ein Bergmann steuerte die Gewinnungsmaschine entsprechend. Für einen automatischen Betrieb war es daher zwingend notwendig, dass die Maschine diese Grenze von Kohle und Gestein selbsttätig mittels eines geeigneten Sensors erkennen konnte. Entsprechende Versuche mit radioaktiven Isotopensonden scheiterten unter anderem an der langsamen Datenübertragung, sodass die Maschinen letztlich zu spät reagierten und unbrauchbares Gestein mitschnitten.40 35 N. N.: Bevercotes Resurgent?, in: Colliery Guardian 221 (1973:2), S. 35–36; Ashworth/Pegg: Nationalized Industry, S. 101. 36 Ashworth/Pegg: Nationalized Industry, S. 71. 37 Bennett, Albert Edward: Die automatische Steuerung von Anderton-Walzenschrämladern im Flözhorizont (Automatic Control of the Cutting Horizon of Anderton Shearers), in: Generaldirektion „Wissenschaftliche und Technische Information und Informationsmanagement“ (Hg.): Automatisierung im Steinkohlenbergbau. Informationstagung Luxemburg, 29. – 31. Mai 1972, Luxemburg 1973, S. 120–143. 38 Ebd., S. 121. 39 Jackson, H.: Installation of Rolf II At Ormonde Colliery. Operation Problems, in: Colliery Guardian 212 (1966:13), S. 605–609. 40 Bennett: Steuerung von Anderton-Walzenschrämladern, S. 121.
Grubenwarten ohne ROLF
81
Die gemachten Erfahrungen führten dazu, dass sich die Entwicklungstätigkeit des NCB verlagerte. Nicht mehr die menschenleere Grube stand im Mittelpunkt, vielmehr galt es nun, den Ausnutzungsgrad der teuren Maschinen unter Tage zu erhöhen. Mit dem Ziel, eine verbesserte Zustands- und Fehleranalyse betreiben zu können, gerieten neue Themen wie die Datenerfassung in den Fokus.41 Ab Mitte der 1970er Jahre fand deshalb neuartige Sensor- und Computertechnik Einzug in den britischen Bergbau. Einrichtungen zur Überwachung und Steuerung von Förderbändern sowie untertägige Bunkersysteme zur Zwischenlagerung von Rohkohle wurden entwickelt. Ab 1977 fand das so genannte Mine Operating System (MINOS) Eingang in britische Bergwerke. Es bestand aus verschiedenen Bausteinen, die einzelne Bereiche des Grubenbetriebs zentral überwachen und in geringem Umfang auch steuern konnten. Dazu gehörten die Strebüberwachung (nicht Steuerung), Förderbandsysteme, Grubenwetterüberwachung sowie für die Betriebsleitung angefertigte Langzeitanalysen des Gesamtbetriebs mittels aggregierter Stillstands- und Förderdaten. 1982 hatten 27 Schachtanlagen mindestens einen Baustein dieses Systems eingeführt.42 Doch was in Großbritannien nach den aufwendigen Großversuchen der 1960er Jahre einem Paradigmenwechsel gleich kam, entsprach in gewisser Weise einer Entwicklungslinie, die im bundesdeutschen Steinkohlenbergbau schon seit den 1950er Jahren verfolgt wurde.
England – (k)ein Vorbild? Die ambitionierten britischen Versuche blieben in Kontinentaleuropa nicht unbemerkt. Anerkennend wurde in bergbaulichen Fachzeitschriften über die ROLF-Streben berichtet und auch im westdeutschen Steinkohlenbergbau wurden die Projekte diskutiert. Allerdings riefen insbesondere die prognostizierten Personaleinsparungen schnell Zweifel hervor. Rund zwei Jahre nach Inbetriebnahme der ROLF-Systeme befasste sich Hermann Irresberger43 mit den Potentialen dieses Systems mit Blick auf die Verhält41 Ashworth/Pegg: Nationalized Industry, S. 103. 42 Ebd., S. 102. 43 Zu diesem Zeitpunkt war Hermann Irresberger (geb. 1928) Sachbearbeiter für Strebausbau im Hauptausschuss für Bergtechnik des Steinkohlenbergbauvereins. Er promovierte 1966 und wurde 1980 Geschäftsführer des Fachausschusses Grubenausbau und Gebirgsmechanik beim Steinkohlenbergbauverein. Bis zu seinem Ruhestand 1991 leitete er das 1990 aus der Auflösung der Bergbau-Forschung GmbH hervorgegangene Institut für Gebirgsbeherrschung und Hohlraumverfüllung der DMT Gesellschaft für Forschung und Prüfung mbH, vgl. Schorn, Paul/
82 Nikolai Ingenerf
nisse in deutschen Bergwerken. Dabei verwies er zunächst auf die spezifische Abbauphilosophie des britischen Bergbaus, die für die Fernsteuerung und Automatisierung der Streben bessere Voraussetzungen böte. Um das Hangende besser beherrschen zu können, war es in Großbritannien vielerorts üblich, eine dünne Restschicht Kohle am Hangenden und Liegenden stehen zu lassen. Auf dieser Bedingung basierte die bereits erwähnte Idee, die Gewinnungsmaschinen mit einer radioaktiven Isotopenmessgerät auszustatten, um einen zuvor definierten Bereich innerhalb der Kohle automatisch abbauen zu können. Da in deutschen Bergwerken die Flöze vollständig gewonnen wurden, fehlten die für die Isotopensonde notwendigen Umgebungsbedingungen.44 Darüber hinaus hatte die britische Abbauphilosophie den Vorteil, das Deckgebirge besser beherrschen zu können. Auch der auf die Ausbautechnik im Streb spezialisierte Irresberger war in erster Linie an einem sicheren Ausbau der ausgekohlten Bereiche interessiert. Für ihn hatte ein integriertes System aus Ausbau, Förderer und Gewinnungsmaschine das Potential, das beim Abbau freigelegte Deckgebirge besser und schneller zu sichern sowie die nachfallenden Kohlenstöße beherrschbar zu machen. In diesem Zusammenhang böte die automatische Ausbausteuerung von ROLF die Möglichkeit, weitgehend ohne Verzögerung die Ausbaueinheiten vorzuziehen, nachdem die Gewinnungsmaschine vorbei gefahren war. Auf diese Weise könnten gefährliche Ausbrüche des Deckgebirges verhindert und damit eine der größten Gefahren für die Strebmannschaften gemindert werden.45 Der Blick auf die finanziellen Aspekte machte ihm die praktischen Grenzen des ROLF-Systems bewusst, wobei er die Frage aufwarf, welchen grundsätzlichen Mehrwert automatische Abbaubetriebe überhaupt hätten. Erneut verwies er auf die Spezifika britischer Bergbauparadigmen. Er betonte, dass vor allem bei Flözen von geringer Mächtigkeit „die Wirtschaftlichkeit der Automatisierung des Ausbaus nach britischer Ansicht oft von untergeordneter Bedeutung ist, wenn nur der Abbau dieser Flöze mit hohem Abbaufortschritt möglich wird. Für den Abbau mächtiger Flöze, in denen der Bedienungsmann der Gewinnungsmaschine ohne Schwierigkeiten folgen kann, stellt sich jedoch die Frage, ob Schrödter, Emil/Willing, Hans-Gerhard (Hg.): Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Essen 1964, S. 699; N. N.: Persönliches, in: Glückauf 129 (1993:2), S. 84. 44 In deutschen Revieren wurde stets bis zur unregelmäßigen Grenzschicht von Kohle und Begleitgestein abgebaut, vgl.: Spruth, Fritz: Die Fernsteuerung der Gewinnung und des schreitenden Ausbaus auf den britischen Gruben Newstead und Ormonde, in: Glückauf 99 (1963:22), S. 1236–1238, hier S. 1236. Etwas ausführlicher bei Irresberger, Hermann: Der automatische Strebausbau in Großbritannien und seine Anwendbarkeit im deutschen Steinkohlenbergbau, in: Glückauf 101 (1965:12), S. 715–720, hier S. 718. 45 Irresberger: Strebausbau, S. 718.
Grubenwarten ohne ROLF
83
der Übergang zum mannlosen Streb bei den heute üblichen Abbaufortschritten und Streblängen sinnvoll ist.“46
Auf der Grundlage der Kosten der britischen Prototyp-Streben errechnete er, dass die Einsparungen an Personal die hohen Anschaffungskosten von etwa 2,4 Mio. DM pro Strebausrüstung nicht würden einsparen können. Erst bei einem Abbaufortschritt von über 12 m pro Tag sei dieses System wirtschaftlich einsetzbar. Solche Abbaufortschritte waren damals absolute Ausnahmen (üblich waren rund 3 m pro Tag) und für lange Streben undenkbar.47 Angesichts der hohen Kosten schien damit Mitte der 1960er Jahre ein Einsatz von ROLF im Ruhrgebiet auf mittlere Sicht wirtschaftlich nicht praktikabel.48 Unterstützt wurde diese Absage aus der akademischen Forschung. 1966 verfasste der Direktor des Institutes II für Bergbaukunde an der TU Berlin, Fritz Adler49, ein Gutachten für das Wirtschafts- und Verkehrsministerium des Landes NRW. Vor dem Hintergrund der als chaotisch und planlos kritisierten Reaktionen auf die Kohlenkrise50 wollte Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Gerhard Kienbaum dieses Gutachten als Grundlage für die „Erarbeitung eines integrierten bergbaulichen Forschungs- und Entwicklungsplans“ verstanden wissen. Ziel des Gutachtens war es, diejenigen Forschungs- und Entwicklungsbereiche zu identifizieren, deren Umsetzung die größten Einsparpotentiale im Bergbau versprachen. Der prospektiv betrachtete Zeitraum wurde auf das Jahr 1975 festgelegt.51 Zu den vergleichsweise kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen zählte er, neben strukturellen Veränderungen von Schachtanlagen, die bessere Ausnutzung des eingesetzten Maschinenparks unter Tage. Selbststeuerungselemente bei einzelnen Maschinen könnten zwar Abhilfe schaffen, aber wirkungsvoller sei vor allem die „Verbesserung der Betriebsorganisation durch intensive Planung 46 Ebd., S. 719. 47 Ebd., S. 720. 48 Kranefuss, Helmut: Die Steigerung des Abbaufortschritts von Hobelbetrieben in dünnen Flözen. Erfahrungen und Ergebnisse der Grube Sophia-Jacoba, in: Glückauf 100 (1964:1), S. 2–9, hier S. 2. 49 Friedrich Adler (1916–1996) leitete von 1958 bis 1964 das Bergwerk Walsum in Duisburg und wechselte im gleichen Jahr von dort an den neu geschaffenen Lehrstuhl Bergbaukunde II der TU Berlin, vgl.: Wilke, F. Ludwig: Ohne Titel, in: Erzmetall 49 (1996:7/8), S. 487f; Böse, Christian/Farrenkopf, Michael: Zeche am Strom. Die Geschichte des Bergwerks Walsum (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 199), Bochum 22015, S. 480. 50 Goch, Stefan: Eine Region im Kampf mit dem Strukturwandel. Bewältigung von Strukturwandel und Strukturpolitik im Ruhrgebiet (Schriften des Instituts für Stadtgeschichte, Beiträge 10), Essen 2002, S. 188 f. 51 Adler: Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, S. 54.
84 Nikolai Ingenerf
und Überwachung der Abbaureviere“52, um die vorhandenen Kapazitäten besser auszulasten. Als Mittel hierzu verwies er auf die Einrichtung von Grubenwarten sowie eine intensivere „technische und kostenmäßige Planung unter Nutzung moderner Planungsmethoden der Verfahrensforschung“.53 Hinweise auf eine anstehende Automatisierung des bundesdeutschen Bergbaus im Stile der britischen Großprojekte wie ROLF oder die inzwischen im Aufbau befindliche Schachtanlage Bevercotes waren im Gutachten nicht zu finden. Vielmehr wurde Adler rund drei Jahre später gebeten, zu dieser Thematik ein eigenes Gutachten zu verfassen.54 Darin beschrieb er detailliert den zeitgenössischen Stand der Technik in Bezug auf Automatisierung von Ausbau, Gewinnung und Förderung. Deutlicher noch als im ersten Gutachten erteilte er einer Vollautomatisierung ganzer Schachtanlagen nach britischem Vorbild eine Absage. Ähnlich wie Irresberger führte er sowohl geologische als auch finanzielle Gründe an, die eine vergleichbar umfassende Automatisierung der Schachtanlagen in Nordrhein-Westfalen nicht zuließen. In der oftmals unberechenbaren Umgebung des Abbaus gab es für Adler kein Potential zur Automatisierung. Allerdings räumte er den so genannten nachgeordneten Bereichen größere Chancen ein. Vor allem der Transport des anfallenden Fördergutes durch Züge und Förderbänder sowie die Steuerung dieser Transportströme waren für ihn potentielle Automatisierungskandidaten. Gleiches attestierte er der Grubenwasserhaltung und der Schachtförderung. Grundsätzlich orientierte er sich jedoch an bereits etablierten Technologien, die sich bereits seit einigen Jahren im Betrieb bewährt hatten.55 Wie schon in seinem ersten Gutachten drei Jahre zuvor räumte er den neu aufkommenden Prozesssteuerungen ebenfalls Chancen zur praktischen Umsetzung ein, wenngleich er unabdingbare Vorbedingungen (z. B. ausreichende Bunkerkapazitäten unter Tage) noch nicht erfüllt sah und auch ihre Wirtschaftlichkeit in Frage stellte.56 52 Ebd., S. 25. 53 Ebd. 54 Adler, Friedrich/Stolte, G.: In welchen Betriebsbereichen des Grubenbetriebes untertage im Steinkohlenbergbau des Ruhrreviers ist eine Automatisierung bzw. Teilautomatisierung der Betriebsvorgänge in absehbarer Zeit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar und welche Auswirkungen sind durch sie auf die Kostenstruktur zu erwarten? Untersuchung im Auftrage des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Berlin 1969. 55 Repetzki: Fernwirktechnik. 56 Auch waren die Materialförderung und die Personenfahrung noch nicht ausreichend voneinander getrennt, was als ein erhebliches Sicherheitsproblem gesehen wurde. Angesichts der hochgradig durchmischten Kohlequalitäten langer Streben lohne sich auch eine durch Prozessrechner gesteuerte Trennung des Fördergutes nicht; vgl. Adler/Stolte: Automatisierung, S. 50.
Grubenwarten ohne ROLF
85
Automatisierungsmaßnahmen galten im Steinkohlenbergbau nicht als jene Bereiche, die die größten Einsparungseffekte versprachen. Die staatliche Förderung der bergbaulichen Forschung und Entwicklung sollte sich stattdessen auf eher klassische bergtechnische Themen konzentrieren.57 Eine Automatisierung nach englischem Vorbild war für den deutschen Steinkohlenbergbau daher weder in naher noch in mittelbarer Zukunft eine realistische Option.
Kontrolle statt Automatisierung – SIGUT statt ROLF Auch wenn die britischen Versuche in der Bundesrepublik als ungeeignet für die heimischen Reviere erachtet wurden, greift es zu kurz, ein Interesse an Automatisierung im westdeutschen Steinkohlenbergbau völlig zu verneinen. Das gilt insbesondere mit Blick auf die Versuche und Entwicklungen verschiedener Schachtanlagen, die nicht durch ein prägnantes Akronym wie ROLF bekannt wurden. Wie beim Adler’schen Gutachten bereits angedeutet, lassen sich zumindest für einige wenige Bereiche westdeutscher Bergwerke Automatisierungsprojekte identifizieren. In der ersten Hälfte 1960er Jahren etablierten sich automatische Schachtförderungen58 und Wasserhaltungen59. Im Gegensatz zu den aufwendigen Abbausystemen in der Kohle, die in einer sich durch den Gebirgsdruck permanent verändernden Umgebung eingesetzt wurden, zeichneten sich Schachtförderung und Wasserpumpen durch einen gleichmäßigen und berechenbaren Ablauf aus. Sie entsprachen damit in technischer Hinsicht am ehesten den Bedingungen, unter denen eine Automatisierung nach zeitgenössischem technikwissenschaftlichen Standpunkt als praktikabel galt.60 Hinzu kam, dass es sich in beiden Fällen um Vorgänge handelte, deren Automatisierung auch in der produzierenden Industrie oder im Alltag bereits in abgewandelter Form etabliert war – hier sei auf Fahrstuhlsteuerungen verwiesen.61 57 Ebd., S. 58. 58 Guntermann, A.: Rationalisierung der Förderung im Steinkohlenbergbau. Automatische Gestellförderung setzt sich durch, in: Gewerkschaftliche Rundschau für die Bergbau- und Energiewirtschaft 16 (1963:2), S. 103–106. 59 Olaf, Jörn: Der Stand der Automatisierung unter Tage im deutschen Steinkohlenbergbau, in: Glückauf 103 (1967:13), S. 631–636, hier S. 634. 60 Dolezalek: Automatisierung, S. 565. 61 Ernst, Dietrich/Mücher, Werner: Seilfahrt im Blindschacht mit Selbstfahrersteuerung, in: Glückauf 102 (1966:14), S. 724–725.
86 Nikolai Ingenerf
Unter Automatisierungsgesichtspunkten ebenfalls mit der restlichen Industrie vergleichbar war der Transport der Kohle vom Streb zum Förderschacht. Theoretisch waren auch hier die für eine Automatisierung notwendigen Voraussetzungen vorhanden oder konnten zumindest geschaffen werden. Konstante Abläufe und Wege gab es hier ebenso wie den intensiven Einsatz von Maschinen in Form von Lokomotiven und Förderbändern. Seit Beginn der 1960er Jahre wurden deshalb Versuche unternommen, beide Transportsysteme durch elektrische Schaltungen, Steuerungen und Fernüberwachung mit weniger Personal betreiben zu können. Auch wenn die Bandförderung theoretisch äußerst günstige Voraussetzungen für eine Automatisierung bot, machte sie noch Mitte der 1970er Jahre lediglich 9 % der Streckenförderung aus.62 Angesichts dessen verwundert es nicht, wenn in der Fachliteratur Versuche mit automatischen Zügen intensiver als ein automatischer Abbau diskutiert wurden. Im Mittelpunkt stand dabei ein Projekt, bei dem zwei weit voneinander entfernt liegende Bergwerke durch eine in 700 m Teufe verlaufende Strecke miteinander verbunden wurden. Ziel war es, die Kohle von einem veralteten Bergwerk auf der gerade erst modernisierten Zentralschachtanlage eines acht Kilometer entfernten anderen Bergwerkes zu heben und dort aufzubereiten. Der Transport der Kohle in der Verbindungsstrecke wurde durch automatisch fahrende Züge abgewickelt. Erst am Übergabebahnhof zum Förderschacht übernahmen Bergleute die Züge.63 Im November 1967 wurde der automatische Förderbetrieb aufgenommen und offenbarte einige unerwartete Schwierigkeiten. Die automatische Steuerung sorgte anfänglich für einen erhöhten Verschleiß beim Wagenmaterial, was auf die recht unsanfte Fahrweise der jetzt führerlos fahrenden Lokomotiven und den unzureichenden Gleisbau zurückzuführen war. Nach rund einjähriger Vorlaufzeit konnte die für den Betrieb notwendige Belegschaftsstärke in diesem Bereich des Bergwerks von 63 auf 40 Personen reduziert werden.64 Es stellte sich allerdings heraus, dass ein solches System sich erst rentierte, wenn die Streckenlänge mindestens 5 km betrug und keine Abzweigungen aufwies. Solche Bedingungen 62 Claes, Fritz: Abgrenzung zwischen Gurtband- und Wagenförderung im Steinkohlenbergbau, in: Glückauf 109 (1973:13), S. 671–675, hier S. 672. 63 Nehrdich, Jürgen/Zimmermann, Dietrich: Ausrüstung und Betrieb der vollautomatischen Verbindungsstrecke der Zeche General Blumenthal, in: Glückauf 104 (1968:22), S. 1005–1015; Paul, Hans: Rationalisierung des Förderbetriebes auf dem Verbundbergwerk BergmannsglückWesterholt, in: Glückauf 105 (1969:9), S. 389–396; Rahn, Herbert/Schöffel, Helmut: Indafo 20. Eine automatische Zugolfgensteuerung für Industrie- und Grubenbahnen, in: BBC-Nachrichten 52 (1970:3/4), S. 73–79. Auch international wurde diesem Projekt einige Beachtung geschenkt: N. N.: Automation and Remote Control in the UK and in the ECSC, in: Colliery Guardian 217 (1969:8), S. 443–449; Rushton, J.: Impressions of the German Mining Industry, in: The Mining Engineer 130 (1971), S. 473–489. 64 Nehrdich/Zimmermann: Verbindungsstrecke, S. 1014.
Grubenwarten ohne ROLF
87
Abb. 3: Eine der ersten Grubenwarten im Ruhrgebiet auf der Zeche Monopol in Kamen. Gut erkennbar sind die Zählwerke zur Erfassung von Betriebsdaten, die vom Grubenwart abgelesen und schriftlich dokumentiert werden mussten. Direkte Einflussmöglichkeiten auf den untertägigen Betrieb waren hier noch nicht explizit vorgesehen. montan.dok BBA 16/1387.
stellten jedoch eine absolute Ausnahme dar, weshalb die automatische Zugförderung jenseits dieses Pilotprojektes keine weitere Verwendung fand.65 Parallel zu den angesprochenen Einzelprojekten tat sich gegen Ende der 1950er Jahre eine andere Entwicklungslinie auf. Sie sollte den westdeutschen Steinkohlenbergbau weitaus stärker prägen als die Versuche, selbsttätig arbeitende Maschinen einzuführen. Mit dem Aufbau von Grubenwarten wurde im übertägigen Bereich der Bergwerke eine Einrichtung geschaffen, in der die zentralen In65 Nehrdich, Jürgen: Die automatische Hauptstreckenförderung und ihre Abgrenzung zur Bandförderung, in: Glückauf 109 (1973:3), S. 187–190, hier S. 190.
88 Nikolai Ingenerf
formationen über den untertägigen Grubenbetrieb zusammenliefen. Zunächst als reine Störungserfasser konzipiert, entwickelten sie sich zur zentralen Kontrollund Steuerinstanz eines Bergwerkes. Sie entsprangen dem Wunsch, insbesondere den im wahrsten Sinne verborgenen Grubenbetrieb für die über Tage sitzende Leitungsebene sichtbar zu machen. Registriert wurden zunächst vor allem Stillstands- und Störungsmeldungen, um die Auslastung des neuen und teuren Maschinenparks unter Tage besser feststellen zu können.66 1973 waren in der Bundesrepublik 58 Grubenwarten in Betrieb, sodass jeder Grubenbetrieb durch eine Warte überwacht wurde. Die Datenerfassung der Warten wurde systematisch ausgeweitet und umfasste neben den Maschinendaten aus Abbau und Förderung auch die Überwachung der Wasser-, Strom- und Druckluftnetze sowie die Wasserhaltung und Bewetterung der Grube. Damit lief praktisch die gesamte Grube an einer zentralen Stelle zusammen. Von diesen Warten aus war noch keine Steuerung einzelner Bereiche oder Betriebe möglich.67 Die Vision, gleichsam als Vorstufe eines vollautomatischen Bergwerks von den Grubenwarten ausgehend Maschinen und Abläufe fernsteuern zu können, lag jedoch in weiter Ferne. Vielmehr entwickelte sich das Speichern und die anschließende Auswertung der anwachsenden Datenmengen Anfang der 1970er Jahre zu einem zentralen Problem.68 So blieb die Fernsteuerung des Grubenbetriebes auch nach der erfolgreichen Einführung von Grubenwarten nur ein untergeordnetes Thema. Ein Blick in das 1971 formulierte „Forschungs- und Entwicklungsprogramm des deutschen Steinkohlenbergbaus“, aufgestellt von der Bergbau-Forschung GmbH, zeigt die zeitgenössischen Perspektiven auf die Automatisierung als „Zukunftsprojekte für Teilbereiche der Bergtechnik“.69 Mit Verweis auf die wenig erfolgreichen britischen Projekte standen auch hier die „bewährten bergtechnischen Verfahren“ im Mittelpunkt. Automatisierung wurde hier, ebenfalls im Gegensatz zum britischen Großversuch, als ein stufenweise zu realisierender Prozess gedacht, bei dem zuvor erst viele kleinere Einzelbereiche realisiert werden müssten. Ein Kernelement dieser Überlegung blieb die Einführung einer den gesamten Grubenbetrieb erfassenden Prozesssteuerung, wenngleich der automati66 Hegermann, Günter/Weber, Wolfhard: Bergbautechnik nach 1945, in: Farrenkopf, Michael u. a. (Hg.): Glück auf! Ruhrgebiet. Der Steinkohlenbergbau nach 1945, Bochum 2009, S. 330– 341; Wendt, Ewald: Die Betriebsfernüberwachung bei der Monopol Bergwerks-GmbH, in: Glückauf 95 (1959:18), S. 1129–1135. 67 Olaf, Jörn/Rätz, Walter/Daus, Jürgen: Fernüberwachung von Grubenbetrieben, in: Glückauf 110 (1974:14), S. 561–566, hier S. 561, 566. 68 Steudel, Joachim: Automatische Erfassung und Auswertung von Grubenwartendaten, in: Glückauf 107 (1971:4), S. 128–131. 69 N. N.: Forschungs- und Entwicklungsprogramm des deutschen Steinkohlenbergbaus. Textband, ohne Ort 1971, S. 8 f.
Grubenwarten ohne ROLF
89
sche Betrieb von Gewinnungs- und Ausbaumaschinen sowie Transportsystemen als „in einigen Jahren“ realisierbar beschrieben wurde.70 Doch schon drei Jahre später war von diesen Prognosen lediglich die Prozesssteuerung übrig geblieben. Das als Reaktion auf den Ölpreisschock vom Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) geförderte Forschungsvorhaben „Steinkohlenbergwerk der Zukunft. Fortschreibung der Bergtechnik“ orientierte sich 1974 ausgesprochen eng an bereits verfügbaren Technologien und bestehenden Forschungsvorhaben.71 Automatische Streben oder Streckenförderungen kamen in dieser Analyse des mittelfristigen Forschungsbedarfs nicht mehr vor. Ganz im Sinne eines weitgehend integrierten und damit steuerbaren Grubenbetriebes entwickelte die Bergbau-Forschung GmbH stattdessen die „Simulation des Grubenbetriebes unter Tage (SIGUT)“. Basierend auf einem zuvor entwickelten Modell zur Berechnung von Förderströmen, der BABSUM (Band-Bunker-Simulation), bot dieses Programm die Möglichkeit, auf der Grundlage realer Daten Planspiele bezüglich kurz- und langfristigen Veränderungen des Betriebes zu ermöglichen.72 Mit den britischen Visionen eines teil- oder vollautomatisierten Bergwerkes hatten diese Projekte jedoch nichts mehr zu tun.
Fazit Hohe Lohnkosten und geringe Kohlepreise zwangen Ende der 1950er Jahre sowohl den britischen als auch den deutschen Bergbau zu intensiven Investitionsmaßnahmen. Vor dem Hintergrund eines öffentlichen Diskurses um das Schlagwort Automatisierung wurden daher im britischen Bergbau aufwendige Versuche mit weitgehend ferngesteuert oder selbsttätig arbeitenden Abbausystemen durchgeführt. Der westdeutsche Steinkohlenbergbau hingegen war weniger affin für derartige Großprojekte. Mangels Maschinen war zu Beginn der 1960er Jahre an eine wie auch immer gestaltete Automatisierung des Untertagebetriebes nicht zu denken – von einer mit dem britischen Bergbau vergleichbaren Euphorie ganz zu schweigen. Während in Großbritannien nach zunächst als erfolgreich bewerteten Versuchen im Bereich des Abbaus schon das vollautomatische Bergwerk projektiert und eingerichtet wurde, blieben die Bedenken im deutschen Bergbau trotz eines enormen Mechanisierungsschubs in den 1960er 70 Ebd., S.11. 71 Claes, Fritz: Steinkohlenbergwerk der Zukunft. Fortentwicklung der Bergtechnik, Essen 1978. 72 Redling, G.: Simulation des Grubenbetriebes unter Tage (SIGUT), in: Kurznachrichten aus Bergtechnik und Kohlenveredelung 97 (1976), S. 4.
90 Nikolai Ingenerf
Jahren bestehen. Nach knapp zehn Jahren wurden die britischen Versuche jedoch zu Beginn der 1970er Jahre letztlich erfolglos eingestellt. Es hatte sich gezeigt, dass es nicht allein ausreichte, vorhandene Maschinen lediglich um eine passende automatische Steuerung zu ergänzen. Neben mechanischen und geologischen Hindernissen war ein weiteres Problemfeld zu Tage getreten: die Notwendigkeit, Messdaten in passender Art und Menge zu erfassen und mit geringer Zeitverzögerung auswerten zu können. Unabhängig davon hatten sich deutsche Bergingenieure seit Ende der 1950er Jahre Gedanken darüber gemacht, wie der (langsam) wachsende Maschinenpark unter Tage besser ausgelastet werden könne. Gleichzeitig nahm die räumliche Ausdehnung der Grubengebäude zu. Um die entsprechenden Problemstellen identifizieren zu können, begannen die Steinkohlenzechen in der Bundesrepublik, sich mit Fragen der Datenerfassung und -auswertung zu beschäftigen. Zentrale Grubenwarten sollten das Informationsdefizit der Werksleitung beheben und ein wachsendes Steuerungs- und Koordinierungsbedürfnis befriedigen. Die britischen Großversuche wurden dabei zwar interessiert zur Kenntnis genommen, spielten aber weder bei anstehenden Investitionsplanungen, noch bei längerfristigen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen eine entscheidende Rolle. Vielmehr bildeten die Grubenwarten die Grundlage für die Einführung von Prozessleitsystemen in den 1970er Jahren, die nicht nur Teile der Grube überwachen konnten, sondern auch kontinuierliche Abläufe wie Förderströme steuerten. Mitte der 1970er Jahre fanden auch in Großbritannien derartige Systeme Anwendung. Sie waren eine Reaktion auf das unter anderem an den (fehlenden) Datenmengen gescheiterte Automatisierungsprojekt ROLF. Insbesondere die deutsche Entwicklung erscheint daher als ein zum Ende der 1950er Jahre eingeschlagener Technologiepfad, auf den schließlich auch Großbritannien einschwenkte. Ob sich aus diesen Entwicklungen ein spezifisches Charakteristikum deutscher oder schließlich gar westeuropäischer Bergbautechnologie ableiten lässt, müssen weitere Forschungen zeigen. Die divergenten Entwicklungslinien verweisen zusätzlich auf eine zurückhaltende Einstellung westdeutscher Bergingenieure gegenüber allzu ambitionierten Entwicklungsprojekten. Zwar ist diese Zurückhaltung auch auf einen offenkundigen Mangel an Maschinen zurückführbar, gleichzeitig stärkt sie die These einer grundsätzlichen Vorsicht in der deutschen Nachkriegswirtschaft gegenüber neuen Technologien.73
73 Radkau, Joachim: „Wirtschaftswunder“ ohne technologische Innovation? Technische Modernität in den 50er Jahren, in: Schildt, Axel/Sywottek, Arnold (Hg.): Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, Bonn 1998, S. 129–154.
Grubenwarten ohne ROLF
91
Literaturverzeichnis Abelshauser, Werner: Der Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung, München 1984. Adler, Friedrich: Gutachterliche Stellungnahme über die Möglichkeiten für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Steinkohlenbergbau der Reviere Ruhr und Aachen im Hinblick auf eine weitere Rationalisierung und Kostendeckung im Grubenbetrieb untertage, Berlin 1966. Adler, Friedrich/Stolte, G.: In welchen Betriebsbereichen des Grubenbetriebes untertage im Steinkohlenbergbau des Ruhrreviers ist eine Automatisierung bzw. Teilautomatisierung der Betriebsvorgänge in absehbarer Zeit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar und welche Auswirkungen sind durch sie auf die Kostenstruktur zu erwarten? Untersuchung im Auftrage des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Berlin 1969. Ashworth, William/Pegg, Mark: 1946–1982. The Nationalized Industry (The History of The British Coal Industry 5), Oxford 1986. Bennett, Albert Edward: Die automatische Steuerung von Anderton-Walzenschrämladern im Flözhorizont (Automatic Control of the Cutting Horizon of Anderton Shearers), in: Generaldirektion „Wissenschaftliche und Technische Information und Informationsmanagement“ (Hg.): Automatisierung im Steinkohlenbergbau. Informationstagung Luxemburg, 29. – 31. Mai 1972, Luxemburg 1973, S. 120–143. Bleidick, Dietmar: Bergtechnik im 20. Jahrhundert. Mechanisierung in Abbau und Förderung, in: Ziegler, Dieter (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 355–411. Bluma, Lars: Norbert Wiener und die Entstehung der Kybernetik im Zweiten Weltkrieg (Kritische Informatik 2), Münster 2005. Böse, Christian/Farrenkopf, Michael: Zeche am Strom. Die Geschichte des Bergwerks Walsum (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 199), Bochum 22015. Burghardt, Uwe: Mit der Vollmechanisierung gegen den Niedergang. Der Steinkohlenbergbau in Nordfrankreich und Westdeutschland in der Nachkriegsepoche, in: Technikgeschichte 61 (1994:2), S. 83–109. Claes, Fritz: Abgrenzung zwischen Gurtband- und Wagenförderung im Steinkohlenbergbau, in: Glückauf 109 (1973:13), S. 671–675. Claes, Fritz: Steinkohlenbergwerk der Zukunft. Fortentwicklung der Bergtechnik, Essen 1978. Danielzig, Hellmut: Der Altersaufbau der Belegschaften im Steinkohlenbergbau unter dem Einfluß des Arbeiterrückganges, in: Glückauf 97 (1961:3), S. 159–167. Dolezalek, Carl Martin: Grundlagen und Grenzen der Automatisierung, in: VDI Zeitschrift 98 (1956:12), S. 564–569. Ernst, Dietrich/Mücher, Werner: Seilfahrt im Blindschacht mit Selbstfahrersteuerung, in: Glückauf 102 (1966:14), S. 724–725. Farrenkopf, Michael: Wiederaufstieg und Niedergang des Bergbaus in der Bundesrepublik, in: Ziegler, Dieter (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 183–302. Goch, Stefan: Eine Region im Kampf mit dem Strukturwandel. Bewältigung von Strukturwandel und Strukturpolitik im Ruhrgebiet (Schriften des Instituts für Stadtgeschichte, Beiträge 10), Essen 2002.
92 Nikolai Ingenerf
Guntermann, A.: Rationalisierung der Förderung im Steinkohlenbergbau. Automatische Gestellförderung setzt sich durch, in: Gewerkschaftliche Rundschau für die Bergbau- und Energiewirtschaft 16 (1963:2), S. 103–106. Haupt, Heinz-Gerhard/Kocka, Jürgen: Historischer Vergleich: Methoden, Aufgaben, Probleme. Eine Einleitung, in: Dies. (Hg.): Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung, Frankfurt (Main) 1996, S. 9–45. Hegermann, Günter/Weber, Wolfhard: Bergbautechnik nach 1945, in: Farrenkopf, Michael u. a. (Hg.): Glück auf! Ruhrgebiet. Der Steinkohlenbergbau nach 1945, Bochum 2009, S. 330– 341. Heiermann, Heinrich: Von der Mechanisierung zur Automatisierung. Bergtechnik bei der Ruhrkohle AG, Essen 1989. Heßler, Martina: Die Ersetzung des Menschen? Die Debatte um das Mensch-MaschinenVerhältnis im Automatisierungsdiskurs, in: Technikgeschichte 82 (2015), S. 109–136. Heßler, Martina: Einleitung. Herausforderungen der Automatisierung: Forschungsperspektiven, in: Technikgeschichte 82 (2015), S. 99–108. Hounshell, David A.: Planning and Executing „Automation“ at Ford Motor Company 1945–65. The Cleveland Engine Plant and Its Consequences, in: Shiomi, Haruhito/Wada, Kazuo (Hg.): Fordism Transformed. The Development of Production Methods in the Automobile Industry, Oxford 1995, S. 49–86. Irresberger, Hermann: Der automatische Strebausbau in Großbritannien und seine Anwendbarkeit im deutschen Steinkohlenbergbau, in: Glückauf 101 (1965:12), S. 715–720. Jackson, H.: Installation of Rolf II At Ormonde Colliery. Operation Problems, in: Colliery Guardian 212 (1966:13), S. 605–609. Kaiser, Walter: Technisierung des Lebens seit 1945, in: Ders./Braun, Hans-Joachim (Hg.): Energiewirtschaft, Automatisierung, Information, Berlin 1992, S. 283–529. Kranefuss, Helmut: Die Steigerung des Abbaufortschritts von Hobelbetrieben in dünnen Flözen. Erfahrungen und Ergebnisse der Grube Sophia-Jacoba, in: Glückauf 100 (1964:1), S. 2–9. Langmann, Reinhard (Hg.): Taschenbuch der Automatisierungstechnik, München 2010. N. N.: Der Kohlenbergbau Deutschlands im Jahre 1936 in: Glückauf 73 (1937:11), S. 246–247. N. N.: Die Energiewirtschaft des Saargebietes im Jahre 1948, in: Glückauf 85 (1949:49/50), S. 913–915. N. N.: Zur Lage im Kohlenbergbau, in: Glückauf 85 (1949:13/14), S. 241–244. N. N.: Die Revolution der Roboter, in: Der Spiegel 9 (1955:31), S. 20–30. N. N.: First Step To Automation. Conventional Machinery Controlled from the Gate, in: Steel & Coal 187 (1963:12), S. 68–74. N. N.: Remotely Operated Longwall Faces. A World First For British Mining Engineers, in: Colliery Engineering 40 (1963:8), S. 312–323. N. N.: Remote Control Mining – II, in: Colliery Engineering 42 (1965:8), S. 340–350. N. N.: Automation and Remote Control in the UK and in the ECSC, in: Colliery Guardian 217 (1969:8), S. 443–449. N. N.: Forschungs- und Entwicklungsprogramm des deutschen Steinkohlenbergbaus. Textband, ohne Ort, 1971. N. N.: Der Kohlenbergbau der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1971, in: Glückauf 108 (1972:7), S. 264–271. N. N.: Bevercotes Resurgent?, in: Colliery Guardian 221 (1973:2), S. 35–36.
Grubenwarten ohne ROLF
93
N. N.: 20 Jahre Forschung und Entwicklung im Geschäftsbereich Bergtechnik der BergbauForschung GmbH, Essen 1982. N. N.: Persönliches, in: Glückauf 129 (1993:2), S. 84. Nehrdich, Jürgen: Die automatische Hauptstreckenförderung und ihre Abgrenzung zur Bandförderung, in: Glückauf 109 (1973:3), S. 187–190. Nehrdich, Jürgen/Zimmermann, Dietrich: Ausrüstung und Betrieb der vollautomatischen Verbindungsstrecke der Zeche General Blumenthal, in: Glückauf 104 (1968:22), S. 1005– 1015. Noble, David F.: Forces of Production. A Social History of Industrial Automation, New York 1984. Olaf, Jörn: Der Stand der Automatisierung unter Tage im deutschen Steinkohlenbergbau, in: Glückauf 103 (1967:13), S. 631–636. Olaf, Jörn/Rätz, Walter/Daus, Jürgen: Fernüberwachung von Grubenbetrieben, in: Glückauf 110 (1974:14), S. 561–566. Paul, Hans: Rationalisierung des Förderbetriebes auf dem Verbundbergwerk BergmannsglückWesterholt, in: Glückauf 105 (1969:9), S. 389–396. Prieur, Hans J.: Taschenbuch – Automatisierungstechnik. Für Planung, Beschaffung und Betrieb, München 1968, S. 11. Radkau, Joachim: „Wirtschaftswunder“ ohne technologische Innovation? Technische Modernität in den 50er Jahren, in: Schildt, Axel/Sywottek, Arnold (Hg.): Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, Bonn 1998, S. 129–154. Rahn, Herbert/Schöffel, Helmut: Indafo 20. Eine automatische Zugolfgensteuerung für Industrie- und Grubenbahnen, in: BBC-Nachrichten 52 (1970:3/4), S. 73–79. Redling, G.: Simulation des Grubenbetriebes unter Tage (SIGUT), in: Kurznachrichten aus Bergtechnik und Kohlenveredelung 97 (1976), S. 4. Reintges, Heinz u. a. (Hg.): Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Essen 1969. Renger-Berka, Peggy: Transzendenzbezüge und Gemeinsinnsbehauptungen im Reden vom „Atomzeitalter“ in der Bundesrepublik der 1950er Jahre, in: Dresdener Beiträge zur Geschichte der Technikwissenschaften 33 (2012), S. 69–81. Repetzki, Kurt: Fernwirktechnik im Steinkohlenbergbau. Herausgegeben vom Ausschuß Fernwirktechnik beim Steinkohlenbergbauverein (Glückauf-Betriebsbücher 8), Essen 1962. Roeper, Hans: ‚Automation‘ oder ‚Automatisierung‘? Die Übernahme des englischen Ausdrucks führt im Deutschen zu einer Begriffsverwirrung, in: automatik 5 (1960:3), S. 91–92. Rushton, J.: Impressions of the German Mining Industry, in: The Mining Engineer 130 (1971), S. 473–489. Schorn, Paul/Schrödter, Emil/Willing, Hans-Gerhard (Hg.): Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Essen 1964. Schuhmann, Annette: Der Traum vom perfekten Unternehmen. Die Computerisierung der Arbeitswelt in der Bundesrepublik Deutschland (1950er bis 1980er-Jahre), in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 9 (2012), S. 231–256. Schwarz, Martin: Fabriken ohne Arbeiter, in: Fraunholz, Uwe/Wölfel, Sylvia (Hg.): Ingenieure in der technokratischen Hochmoderne. Thomas Hänseroth zum 60. Geburtstag, Münster 2012, S. 167–178. Spruth, Fritz: Die Fernsteuerung der Gewinnung und des schreitenden Ausbaus auf den britischen Gruben Newstead und Ormonde, in: Glückauf 99 (1963:22), S. 1236–1238.
94 Nikolai Ingenerf
Staudt, Erich/Schmeisser, Wilhelm: Automation, in: Ott, Erich/Boldt, Alfred (Hg.): Handbuch zur Humanisierung der Arbeit, Bremerhaven 1985, S. 431–462. Steudel, Joachim: Automatische Erfassung und Auswertung von Grubenwartendaten, in: Glückauf 107 (1971:4), S. 128–131. Wendt, Ewald: Die Betriebsfernüberwachung bei der Monopol Bergwerks-GmbH, in: Glückauf 95 (1959:18), S. 1129–1135. Wilke, F. Ludwig: Ohne Titel, in: Erzmetall 49 (1996:7/8), S. 487 f.
Moritz Müller
„Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“ Mikroelektronik, Arbeitsorganisation und die DGB-Gewerkschaften in den 1970er und 1980er Jahren Im Sommer 1971 hielt der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Heinz Oskar Vetter, eine Rede in der Evangelischen Akademie Bad Boll, in der er die tayloristischen Prinzipien folgende Arbeitsorganisation kritisierte. Er fragte das Auditorium: „Haben wir uns schon einmal überlegt, mit welcher Verkümmerung menschlicher Fähigkeiten ein solches System der Zerstückelung in kleinste Arbeitseinheiten erkauft wird? Welche menschlichen Qualitäten durch die Monotonie solchen Arbeitsvollzugs verschüttet werden? Daß eine volle menschliche Entfaltung des Arbeitnehmers – auch seiner Produktivkräfte in der Wirtschaft – unmöglich wird?“1 Diese Aussage stellt nicht nur ein Kernelement der gewerkschaftlichen Kritik an der Organisation der Industriearbeit dar, sondern verdeutlicht, dass sich die westdeutschen Gewerkschaften in den 1970er Jahren stärker und kritischer als zuvor mit den Themen Automatisierung und Rationalisierung auseinandersetzten.2 Infolgedessen kritisierten die Gewerkschaften die technisch-soziale Organisation der Arbeit nicht bloß – wie bereits in den 1960er Jahren – als unmenschlich, sondern beharrten darauf, die Arbeitswelt werde nicht nur und nicht vorrangig durch vermeintliche Sachzwänge bestimmt – und sei folglich gestaltbar.3 Mitte der 1970er Jahre verschlechterten sich die Rahmenbedingungen gewerkschaftlichen Handelns im Zuge des nachlassenden Wirtschaftswachstums jedoch.4 Massenarbeitslosigkeit wurde erneut zur gesellschaftlichen Realität und ließ Arbeitsplatzsicherung 1 Vetter, Heinz Oskar: Die Sozialpolitik als Herausforderung an die Industrienationen, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 23 (1972:4), S. 201–211, hier S. 204. 2 Hachtmann, Rüdiger: Gewerkschaften und Rationalisierung. Die 1970er-Jahre – ein Wendepunkt?, in: Andresen, Knud/Bitzegeio, Ursula/Mittag, Jürgen (Hg.): Nach dem Strukturbruch? Kontinuität und Wandel von Arbeitswelten (Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe 1197), Bonn 2011, S. 181–209, hier S. 198. 3 Vetter: Sozialpolitik, S. 205. 4 Vgl. Helfert, Mario: Ökonomische Entwicklung und gewerkschaftliche Auseinandersetzung mit technischem Fortschritt, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 31 (1980:4), S. 242–250, hier S. 247–248. https://doi.org/10.1515/9783110729979-005
96 Moritz Müller
zum zentralen Thema für die Gewerkschaften werden. Damit war nicht nur der kurze „Traum immerwährender Prosperität“ ausgeträumt;5 auch realisierten die Gewerkschaften, dass die Zeiten des Reformeifers im Windschatten von Willy Brandts Parole „Wir wollen mehr Demokratie wagen“ vorbei waren. Im Vergleich zum Ende der 1960er Jahre konstatierte Vetter gegen Ende seiner Amtszeit, dass Reformen zur Utopie geworden seien und selbst das Erreichte nicht länger sicher scheine. „No Future – keine Zukunft“ wurde zu einem Motto der Zeit.6 Dass sich die Lage für die Gewerkschaften angesichts der neuen Technologien verschlechterte, konstatierte auch Vetters Nachfolger Ernst Breit im Jahr 1985. Er stellte fest, dass sozialer Rückschritt infolge technischen Fortschritts gegen die Gewerkschaften durchgesetzt werden könne und dies auch versucht werde.7 Der vorliegende Text zeichnet nach, wie die DGB-Gewerkschaften – am Beispiel der Industriegewerkschaft Metall (IGM), der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) sowie der Industriegewerkschaft Druck und Papier (IG DruPa) – den technisch-organisatorischen Wandel der Arbeitswelt in den 1970er und 1980er Jahren rezipierten. Dabei zeigt sich, dass die Gewerkschaften ähnliche Hoffnungen und Bedenken äußerten, es zugleich jedoch beträchtliche Unterschiede in der gewerkschaftlichen Rezeption gab. Die verschiedenen Positionen lassen sich gerade nicht erschöpfend unter Begriffen wie „Fortschrittsgläubigkeit oder Maschinenstürmerei“ subsummieren.8 Anschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung auf die Strukturbruchthese von Anselm Doering-Manteuffel und Lutz Raphael bezogen und da-
5 Lutz, Burkart: Der kurze Traum immerwährender Prosperität. Eine Neuinterpretation der industriell-kapitalistischen Entwicklung im Europa des 20. Jahrhunderts (Reihe Campus 1026), Frankfurt (Main)/ New York 1989. 6 Vetter, Heinz Oskar: Am Ende einer Amtszeit. Aussichten, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 33 (1982:5), S. 257–265, hier S. 263. 7 Breit, Ernst: Fortschritt – gegen, ohne oder durch die Gewerkschaften?, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 36 (1985:1), S. 1–19, hier S. 16. 8 Uhl, Karsten: Maschinenstürmer gegen die Automatisierung? Der Vorwurf der Technikfeindlichkeit in den Arbeitskämpfen der Druckindustrie in den 1970er und 1980er Jahren und die Krise der Gewerkschaften, in: Technikgeschichte 82 (2015:2), S. 157–179, hier S. 161–162; vgl. Lompe, Klaus: Gewerkschaftliche Politik in der Phase gesellschaftlicher Reformen und der außenpolitischen Neuorientierung der Bundesrepublik 1969 bis 1974, in: Hemmer, Hans-Otto/ Schmitz, Kurt Thomas (Hg.): Geschichte der Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Von den Anfängen bis heute, Köln 1990, S. 283–338, hier S. 304–305. Eine Lesart, wonach die Gewerkschaften zwischen unkritischem Fortschrittsglauben und „Endzeitstimmung“ changierten, findet sich beispielsweise bei Schneider, Michael: Kleine Geschichte der Gewerkschaften. Ihre Entwicklung in Deutschland von den Anfängen bis heute, Bonn ²2000, S. 400.
„Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“
97
nach gefragt, wie die von den Autoren ausgemachten Tendenzen in Bezug auf die westdeutschen Gewerkschaften zu bewerten sind.9
Die Folgen von Rationalisierung und Taylorisierung im Dienstleistungssektor aus Sicht der HBV Einen Grund dafür, weshalb die DGB-Gewerkschaften dem technischen Wandel in den 1970er Jahren kritischer gegenüber standen als zuvor, stellt die Rationalisierung des Dienstleistungssektors dar.10 So berichtete beispielsweise der HBV-Vorsitzende Heinz Vietheer, dass Angestellte seit Mitte der 1970er Jahre verstärkt zum Ziel EDV-basierter Rationalisierungsmaßnahmen würden. Diese zielten darauf ab, Arbeitsplätze überflüssig zu machen; außerdem sei der Dienstleistungssektor nicht länger in der Lage, in anderen Sektoren freigesetzte Beschäftigte aufzufangen. Die HBV gelange vor dem Hintergrund dieser neuen Erfahrungen an einen Punkt, an dem die „als notwendig für Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftswachstum geforderte Hinwendung zur weiteren Automation und Rationalisierung nicht mehr stillschweigend“ hingenommen werden könne, da infolge der Rationalisierungsmaßnahmen eine „Auflösung der gesellschaftlichen Struktur“ drohe.11 Dass diese Einschätzung der technischen Entwicklung ein Novum für die Gewerkschaften darstellte, verdeutlichte auch Dieter Noth, der Leiter der Abteilung Gesellschaftspolitik beim Hauptvorstand der HBV. In einem gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen anderer gewerkschaftlicher und gewerkschaftsnaher Organisationen verfassten Artikel stellte er fest, dass die Gewerkschaften Rationalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen zum Zweck der Steigerung von Produktivität und Wirtschaftswachstum solange bejaht hätten, wie sie vor dem Hintergrund der Vollbeschäftigung stattgefunden hätten.12
9 Vgl. Doering-Manteuffel, Anselm/Raphael, Lutz: Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen 2008. 10 Vgl. Andresen, Knud u. a.: Arbeitsbeziehungen und Arbeitswelt(en) im Wandel. Problemfelder und Fragestellungen, in: Ders. u. a. (Hg.): Nach dem Strukturbruch?, S. 7–23, hier S. 15. 11 Vgl. Vietheer, Heinz: Gewerkschaften müssen Motor sein. Zum DGB-Grundsatzprogramm, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 27 (1976:7), S. 412–419, hier S. 415. 12 Noth, Dieter u. a.: Angestellte – bevorzuge Objekte der neuen Rationalisierungswelle, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 28 (1977:6), S. 359–368, hier S. 359.
98 Moritz Müller
Doch nicht nur Arbeitslosigkeit, auch die Arbeitsorganisation im Dienstleistungssektor wurde seitens der HBV als Problem identifiziert. Noth argumentierte, dass die aus der Industrie bereits bekannten Rationalisierungswellen in den Dienstleistungssektor „übergeschwappt“ seien, so dass es nun auch hier zu Leistungsintensivierung, Kostensenkungen und tayloristischer Arbeitsorganisation komme.13 Schließlich werde die Arbeit der Angestellten durch die Rationalisierungsmaßnahmen nicht etwa erleichtert oder mit größeren Gestaltungsspielräumen versehen, sondern zunehmend in kleinere Teilschritte zerlegt. Aus der Industrie bekannte Phänomene wie extreme Arbeitsteilung, wenig Autonomie in der Arbeit, hohe Kontrolldichte, geringe Arbeitsinhalte (die zur Erfüllung einer Arbeit nötigen Tätigkeiten) sowie schwere Belastungen durch Arbeitsumgebung und -mittel würden nun auch die Arbeit im Dienstleistungssektor kennzeichnen. Am Beispiel elektronischer Scanverfahren (1977 wurde die erste Scannerkasse in Deutschland eingesetzt) schilderte Noth, wie diese Technologien scheinbar zu einem Abbau körperlicher Belastungen führen, durch höheres Arbeitstempo und zunehmende Monotonie jedoch eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bewirken würden.14 Die Konsequenz für den HBV-Funktionär bestand jedoch nicht etwa darin, den technischen Wandel aufzuhalten, sondern seitens der Gewerkschaften möglichst stark Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung von Rationalisierungsmaßnahmen zu nehmen, um diese im Sinne der Beschäftigten zu gestalten.15 Technikfeindlichkeit oder Aufrufe zum Maschinensturm waren nicht im Sinne der HBV-Funktionäre. Sie kämpften für eine „soziale Nutzung der neuen Techniken“,16 die im Falle breiter Aufklärung über Chancen und Risiken – unter anderem durch den Ausbau technologieorientierter Sozialforschung sowie der Mitbestimmung – für möglich erachtet wurde.17 Als irrational bezeichnete Reaktionen im Sinne einer grundsätzliche Ablehnung neuer Technologien wurden von der HBV zurückgewiesen, da an derartigen Positionen „im Interesse des gesellschaftlichen Fortschritts keinem gelegen sein“ dürfe.18 Vor eine besondere Herausforderung sahen sich die Funktionäre der HBV gestellt, da sie es als Angestelltengewerkschaft mit einer „große[n] Anzahl von indifferenten und den Gewerkschaften ablehnend gegenüberstehenden Arbeit13 Ebd., S. 364. 14 Ebd., S. 364–365. 15 Ebd. 16 So der spätere Vorsitzende der HBV. Volkmar, Günter: Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV). Die soziale Nutzung der neuen Techniken ermöglichen, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 34 (1983:6), S. 382–385, hier S. 382. 17 Ebd., S. 383–384. 18 Ebd., S. 384.
„Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“
99
nehmern“ zu tun habe.19 Zwar seien die Zeiten der relativen Privilegierung der Angestellten vorbei, dennoch herrsche unter ihnen – bedingt durch ein auf Beschäftigtenseite vermeintlich vorhandenem Kosten-Nutzen-Kalkül – ein geringer Organisationsgrad. Nach wie vor sei für Angestellte der individuelle Vorteil und weniger die „Solidarität der Arbeitnehmer“ ausschlaggebend.20 Angesichts des Vordringens der neuen Technologien in Bereiche mit niedrigem Organisationsgrad konstatierte ein Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands der HBV, Lorenz Schwegler, sogar, dass die Unternehmer die durch die neuen Technologien flexibilisierten Formen der Arbeitsorganisation dazu nutzen würden, „sich unter dem und um den Betriebsrat herum alle möglichen Organisationsformen, […] eine Klaviatur“ zu schaffen, „auf der sie virtuos spielen.“21 Durch scheinbar flache Hierarchien, die Durchführung akzeptanzfördernder Maßnahmen sowie die Mobilisierung von „Eigenverantwortlichkeiten aller Art“ sei es den Unternehmern möglich, die traditionellen Interessenvertretungsinstitutionen – Gewerkschaften und Betriebsräte – auszubooten und nicht zuletzt dadurch die Durchsetzungschancen ihrer eigenen arbeitspolitischen Ziele zu verbessern.22 Für die HBV wurden die auf der Mikroelektronik basierenden Technologien folglich erst ab dem Zeitpunkt zu einem Problem, als der von ihnen organisierte und zuvor für relativ rationalisierungssicher gehaltene Dienstleistungssektor zum Gegenstand von Prozessen der Taylorisierung der Arbeit wurde, wie sie bereits aus der Industrieproduktion bekannt waren. Allerdings wurde der Organisationsbereich der HBV von den neuen Technologien nicht so stark wie derjenige anderer Gewerkschaften getroffen, sodass es zu keiner grundsätzlichen Debatte über das vermeintliche Wesen oder die Neutralität der Technologie kam. Dies war hingegen sowohl in der IG DruPa als auch in der IGM der Fall.23
19 Vietheer: Motor, S. 217. 20 Ebd. 21 N. N.: Mehr Wert auf die Bewegung legen. Ein Gespräch über Formen und Perspektiven der Mitbestimmung zwischen Horst Föhr, Lorenz Schwegler, Karl-Heinz Stommel und Fritz Vilmar, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 36 (1985:3), S. 161–180, hier S. 172. 22 Ebd. 23 Dies ist zugleich der Grund dafür, dass die vorliegenden Kapitel in ihrem Umfang deutlich variieren: Während grundsätzliche Debatten über die Folgen und Gestaltbarkeit der Technologien in der HBV generell wenig Platz einnahmen, wurde in der IG DruPa – und erst recht in der IGM – auf Konferenzen, Tagungen sowie in unzähligen Publikationen ausgiebig über grundsätzliche Einschätzungen der neuen Technologien sowie die richtige gewerkschaftliche Strategie im Umgang mit selbigen gestritten. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass IGM und IG DruPa von den Entwicklungen der Mikroelektronik für ihre Klientel deutlich negativere Folgen erwarteten, als die HBV.
100 Moritz Müller
Der Diskurs um die soziale Neutralität und Gestaltbarkeit der Technik in der IG DruPa Während in der HBV – für die Rationalisierungsprozesse ein neues Phänomen darstellten – nicht die Forderung laut wurde, die Technisierung der Arbeitswelt grundsätzlich abzulehnen, da man an die Neutralität der Technik glaubte und ihre soziale Nutzung propagierte, wurde die Annahme der Gestaltbarkeit der Technik in der IG DruPa stärker in Zweifel gezogen. Viele Funktionäre der Gewerkschaft waren der Technisierung der Arbeit gegenüber deutlich skeptischer eingestellt, da sie und ihre Klientel stärker als die der HBV von negativen Rationalisierungsfolgen betroffen waren.24 Joachim Müller von der Abteilung Tarifpolitik der IG DruPa kritisierte beispielsweise die Art und Weise, wie die gesellschaftliche Debatte über Rationalisierungen geführt werde: Rationalisierungsmaßnahmen und technische Entwicklungen würden entweder „völlig abstrakt in einen Begründungszusammenhang von Arbeitslosigkeit, Beschäftigungskrise und Strukturveränderung gebracht oder sie dienen als ein Fortschrittsargument in der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Diskussion.“25 Der einzelne Beschäftigte und sein Arbeitsplatz, also derjenige, dem Rationalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen eigentlich zu dienen hätten, fänden in der Debatte hingegen kaum einen Platz.26 Müller erläuterte, die Druckindustrie sei ein Paradebeispiel dafür, wie ein auf den ersten Blick faszinierender Entwicklungsschub der Technik für die Beschäftigten dramatische Folgen habe. Schließlich habe der Computer das Ende der „Bleizeit“, des Zeitalters der Produktion von Druckerzeugnissen mit24 Im Organisationsbereich der IG DruPa führte die Einführung elektronischer Druckverfahren zum Aussterben des Berufs des Drucksetzers und zu einer erheblichen Schrumpfung der erwerbstätigen Mitgliedschaft. Dieser Prozess führte dazu, dass die IG DruPa im Jahr 1992 mit der IG Kunst zur IG Medien fusionierte. Vgl. Schneider: Kleine Geschichte, S. 407; Deppe, Frank: Gewerkschaften in der Großen Transformation. Von den 1970er Jahren bis heute. Eine Einführung (Neue Kleine Bibliothek 184), Köln 2012, S. 57–58; Hemmer, Hans-Otto u. a.: Gewerkschaftliche Politik unter der konservativ-liberalen Regierung seit 1982, in: Ders. u. a. (Hg.): Geschichte der Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Von den Anfängen bis heute, Köln 1990, S. 415–458, hier S. 457; Uhl: Maschinenstürmer, S. 158. So gab etwa Erwin Ferlemann, Mitglied des Hauptvorstands der IG DruPa, an, dass in der Druckindustrie binnen einer Dekade rund 40 000 Menschen – vorwiegend Facharbeiter – ihren Arbeitsplatz verloren hätten. Vgl. Ferlemann, Erwin: Rationalisierung oder Humanisierung. Unauflösbarer Widerspruch oder gewerkschaftliche Aufgabe?, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 31 (1980:4), S. 268–270, hier S. 268. 25 Müller, Joachim: Rationalisierungen in der Druckindustrie. Das Beispiel Bildschirmarbeit, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 28 (1977:6), S. 399–403, hier S. 399. 26 Ebd.
„Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“
101
tels Bleisatz, eingeläutet und so binnen fünf Jahren nahezu jeden fünften Arbeitsplatz vernichtet.27 Diese Entwicklung lasse die Unternehmer frohlocken, während viele Beschäftigte dequalifiziert und „Schriftsetzer, Abzieher, Metteure, Korrektoren und Stereotypeure“ zu Opfern „dieser Form des technischen Wandels“ würden.28 Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung stellten sich der gewerkschaftlichen Tarifpolitik laut Müller neue Aufgaben. Es gehe verstärkt darum, negative Rationalisierungsmaßnahmen abzuwehren, sich zugleich jedoch an der Entwicklung neuer Tätigkeitsfelder und der Gestaltung künftiger Sozialbeziehungen in der Arbeitswelt zu beteiligen. Dies sei möglich, da die von Müller infolge der Rationalisierungsmaßahmen erwartete Reduktion menschlicher Arbeit auf Tätigkeiten von „roboterhafte[r] Einfachheit“ kein Naturgesetz, sondern eine Frage der konkreten Arbeitsorganisation und -gestaltung sei. Da es ebenso möglich sei, neue Arbeitsplätze mit Mindestinhalten zu versehen und Beschäftigte entsprechend zu qualifizieren, könnten die Gewerkschaften auf den technischen Wandel nicht verzichten.29 Hier argumentierte Müller ähnlich wie die Funktionäre der HBV. Auch der Vorsitzende der IG DruPa, Leonhard Mahlein, betonte nachdrücklich, dass seine Gewerkschaft keine fortschritts- oder technikfeindliche Politik betreibe. Allerdings werde dieser Vorwurf an die Gewerkschaften gerichtet, um sie zu schwächen und ihnen die Abwehr unsozialer Folgen der Technik zu erschweren. Die Gewerkschaften hätten es, so Mahlein, mit einer „doppelten Irrlehre“ zu tun, die einerseits das „Unternehmerinteresse zum ‚Fortschritt‘ machen will, und zum anderen die Forderung nach sozialer Ausrichtung als Kampf gegen den Fortschritt diffamiert.“30 Grundsätzlich, so der Vorsitzende, seien technische Neuerungen jedoch auch im Sinne der Erleichterung der Arbeitsbedingungen und einer Verkürzung der Arbeitszeit nutzbar. Jedoch schränkte er ein, dass unter dem Primat der Profitmaximierung das emanzipatorische Potential der Technik kaum ausgeschöpft werden könne, da es dem Ziel „extremer Gewinnsteigerung und Kostensenkung“ untergeordnet bleibe. Aufgrund des Mangels an gewerkschaftlichen Mitteln, auf diesen Prozess Einfluss zu nehmen, hielt Mahlein die Technisierung der Arbeitswelt nur unter bestimmten Voraussetzungen und in einem begrenzten Rahmen für gestaltbar.31
27 Ebd., S. 400. 28 Ebd., S. 401. 29 Ebd., S. 402. 30 Mahlein, Leonhard: Industriegewerkschaft Druck und Papier. Weitere Arbeitsplätze gefährdet, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 34 (1983:6), S. 370–373, hier S. 372. 31 Mahlein, Leonhard: Streik in der Druckindustrie. Erfolgreicher Widerstand, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 29 (1978:5), S. 261–271, hier S. 262–263.
102 Moritz Müller
Allerdings gab es in der IG DruPa auch Funktionäre, welche die technische Entwicklung nicht als eine Notwendigkeit ansahen und betonten, es gebe diverse Technologien, die aufgrund ihrer spezifischen Konstruktion und den ihnen immanenten Zwecken nicht sozial gestaltbar seien. So wandte sich etwa Detlef Hensche, der 1983 zum stellvertretenden Vorsitzenden der IG DruPa gewählt wurde,32 gegen den von ihm konstatierten „gesellschaftlichen Grundkonsens“ in Fragen der technologischen Entwicklung. Dieser sei durch das „allgemeine Bekenntnis zum technischen Fortschritt“ geprägt und gehe von einer teleologischen Entwicklung in Richtung des Fortschritts aus. Diese Vorstellung diene letztlich dazu, technische Veränderungen gegen jede Form der Kritik zu immunisieren; schließlich liefere sich niemand freiwillig der Gefahr aus, den Nimbus der Fortschrittsfeindlichkeit zu tragen. Hensche betonte, die Debatte über die Technisierung gehe von völlig falschen Prämissen aus und wandte ein: „Technik schreitet nicht, sie schreitet auch nicht fort. Es sind vielmehr Menschen, die jeden Prozeß der technologischen Entwicklung vorwärts treiben. Sie tun dies nicht um der Technik willen, sondern um Interessen zu befriedigen, in ‚der Wirtschaft‘ das Interesse am höchstmöglichen Gewinnen.“33 Da auch staatliche Forschungs- und Technologieförderung dazu diene, den Unternehmen bei der Verfolgung dieses Ziels zu helfen, sei es ein Ausdruck von Realitätsverlust, werde wiederholt der Eindruck erweckt, die Gesellschaft stünde „vor einem unaufhaltbaren Zug der Technik, der gleichsam aus dem Nichts daherkommt, und auf den man nur noch schleunigst aufzuspringen habe, um wenigstens mitgestalten zu können“.34 Mit diesen Ausführungen wandte sich Hensche gegen die auch in den westdeutschen Gewerkschaften verbreitete Vorstellung einer weitgehenden politischen Steuerbarkeit der Technik. Diese sei ein Irrglaube, da der Entwicklung und Einführung von Technologien bereits im Planungsprozess die Gewinnorientierung als Steuerungsmoment zugrunde liege – und damit eine Form der Steuerung, die nicht im Interesse der Beschäftigten sei.35 Allerdings sprach sich auch Hensche nicht für eine Boykottpolitik der Gewerkschaften gegenüber technischen Entwicklungen aus, sondern forderte ihre „soziale Beherrschung“ ein. Diese Haltung, so folgerte er, müsse sich in Formeln wie „ja, aber“ oder „nein, wenn nicht“ ausdrücken. Jedoch würden derar32 1992 wurde Hensche erster Vorsitzender der im Jahr 1989 aus der IG DruPa sowie der IG Kunst hervorgegangenen IG Medien. Vgl. Schneider: Geschichte, S. 469 sowie Deppe: Große Transformation, S. 57. 33 Hensche, Detlef: Es wird Zeit, auch einmal nein zu sagen. Wo soziale Beherrschbarkeit zur Lebenslüge werden kann, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 36 (1985:9), S. 554–562, hier S. 554. 34 Ebd., S. 555. 35 Ebd., S. 556.
„Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“
103
tige Aussagen bloße Verbalakrobatik bleiben, wenn keine wirkliche Gegenwehr von Seiten der Gewerkschaften stattfinde.36 Zunächst, so Hensche, müsse nämlich gefragt werden, ob und inwiefern bestimmte Technologien überhaupt beherrschbar seien. Schließlich seien gewisse Technologien derart „systemverwoben und ausschließlich durch ihren Zweck der Kapitalverwertung bestimmt“, dass sich die Frage nach einer alternativen Nutzung überhaupt nicht stelle. Deshalb bezeichnete Hensche die Vorstellung von der Neutralität der Technik als „nur die halbe Wahrheit“37 und verdeutlichte dies durch das „Bild vom Messer, das in der Hand des Arztes Segensreiches bewirkt, in der Hand des Mörders jedoch zur tödlichen Waffe wird.“ Diese Vorstellung fuße darauf, dass die Technik an sich als neutral aufgefasst werde und man nur eine Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für notwendig erachte. Dieselbe Technologie könne nach dieser Vorstellung entweder „zur Geißel“ oder unter anderen Rahmenbedingungen „zum Segen“ für die abhängig Beschäftigten werden. Dagegen wandte Hensche jedoch ein: „Der einfache Gebrauchsgegenstand, das einfache Werkzeug, lassen sich in der Tat vielfältig nutzen. Beim Messer ist es zulässig, das Instrument vom Zweck zu trennen. Beim Panzer beispielsweise nicht; er dient nur einem Zweck: dem Töten und Vernichten.“ 38 Sein Plädoyer schloss Hensche mit der Warnung, die Probleme der Gewerkschaften seien nicht dadurch lösbar, dass gegen die Interessen(vertretung) der Beschäftigten gerichtete Entwicklungen bejaht und offensichtliche Gefahren ignoriert oder als vermeintliche Sachzwänge akzeptiert würden.39 Stattdessen sollten die Gewerkschaften positiv aufzeigen, „für welche Welt wir kämpfen, welches Leben, welche Gesellschaft wir für uns und unsere Kinder verwirklichen wollen.“ Statt der Prämisse der Neutralität der Technik sei eine „konkrete Utopie“ gefragt, die auch als „Leitbild des gewerkschaftlichen Umgangs mit der Technik“ fungieren könne und Alternativen zur bestehenden Technikanwendung formuliere.40 Deutlich unterschieden sich die in der IG DruPa geführten Debatten von jenen in der HBV. Während für die Funktionäre der Dienstleistungsgewerkschaft der Umstand prägend war, die Beschäftigten eines Sektors zu organisieren, für die Phänomene tayloristischer Arbeitsorganisation – hohe Kontrolldichte am Arbeitsplatz, starke Arbeitsteilung und geringe Arbeitsinhalte – neuartige Probleme darstellten, während eine Debatte über die grundsätzliche Gestaltbarkeit
36 37 38 39 40
Ebd., Ebd., Ebd., Ebd., Ebd.,
S. S. S. S. S.
557. 558. 558. 560. 561–562.
104 Moritz Müller
der Technologien nicht aufkam, verhielt es sich in der IG DruPa gänzlich anders. Hier fand eine ausgedehnte Debatte über die Frage der Gestaltbarkeit und der Neutralität der Technik statt, anhand derer eine große Bandbreite von Positionen identifiziert werden kann. Haltungen, die den technischen Fortschritt unisono ablehnten und zum Maschinensturm aufriefen, waren in der IG DruPa nicht präsent. Allerdings gab es auf der einen Seite Funktionäre wie Leonhard Mahlein und Joachim Müller, die von der grundsätzlichen Gestaltbarkeit der neuen Technologien ausgingen und betonten, dass diese – wenn auch unter kapitalistischen Bedingungen nur unter großen Anstrengungen – auch im Interesse der Beschäftigten verwendet werden können. Mit Detlef Hensche befand sich jedoch auch ein Funktionär in den Reihen der IG DruPa, der die auch in der westdeutschen Gewerkschaftsbewegung verbreitete Vorstellung von der Neutralität der Technik entschieden kritisierte und dieser entgegenhielt, Technologien seien nicht beliebig gestaltbar, sondern an bestimmte Zwecke gebunden, von denen sie nicht zu trennen seien. Am Beispiel der IG Metall lässt sich aufzeigen, dass hier sowohl die in der HBV als auch der IG DruPa präsenten Diskussionen ebenfalls geführt wurden. Dabei war und ist die IG Metall die Gewerkschaft in der Bundesrepublik, in der die Debatte über die Chancen und Risiken technologischen Fortschritts nicht nur die längste Tradition aufweist, sondern auch den größten Raum einnahm.
Die IG Metall und der „Arbeitsplatzkiller“ Mikroelektronik Auch und gerade in der IGM wurde Anfang der 1970er Jahre Abstand von einer deterministischen Auffassung von Technik und Arbeitsorganisation genommen.41 Beispielsweise erklärte der 1972 zum Ersten Vorsitzenden der IGM gewählte Eugen Loderer die Verbesserung der Qualität der Arbeit zu einer „Macht41 Innerhalb des DGB war die IGM Eisbrecher in Sachen qualitativer Tarifpolitik, sie befasste sich mit Fragen der Automatisierung und Rationalisierung bereits deutlich früher und in einem größeren Umfang, als die anderen westdeutschen Gewerkschaften. Vgl. Müller-Jentsch, Walther: Gewerkschaftliche Politik in der Wirtschaftskrise II. 1978/1979 bis 1982/83, in: Hemmer/ Schmitz (Hg.): Geschichte der Gewerkschaften, S. 377–412, hier S. 402–403; Heßler, Martina: Die Ersetzung des Menschen? Die Debatte um das Mensch-Maschinen-Verhältnis im Automatisierungsdiskurs, in: Technikgeschichte 82 (2015:2), S. 109–136, hier S. 120; Hachtmann, Rüdiger/von Saldern, Adelheid: „Gesellschaft am Fließband“. Fordistische Produktion und Herrschaftspraxis in Deutschland, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 6 (2009:2), S. 186–208, hier S. 186.
„Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“
105
frage“, d. h. einer politisch gestalt- und lösbaren Frage.42 Einer seiner Nachfolger, Franz Steinkühler, postulierte noch 1985, dass die Technik „in ihrer jeweiligen historischen Ausprägung den Interessen derjenigen“ entspreche, „die die Technikentwicklung und -gestaltung beherrschen.“43 Es wird deutlich, dass die IGM Technik und die Gestaltung von Arbeit als gewerkschaftliches Kampffeld konzipierte, auf dem die Gewerkschaft sich und ihre Interessen durchzusetzen habe.44 Seit den 1970er Jahren beschäftigten sich die Funktionäre der IG Metall in unzähligen Publikationen mit der Durchsetzung der Mikroelektronik in der Industrieproduktion und möglichen Auswirkungen auf die Arbeitswelt.45 Nicht zuletzt Günter Friedrichs, Leiter der Abteilung Automation beim IGMVorstand und verantwortlich für die Ausrichtung der Automationstagungen der IGM in den 1960er Jahren, fungierte als Stichwortgeber für die Automatisierungspolitik der größten Gewerkschaft der Bundesrepublik.46 Zwar konstatierte er, der Computer habe Arbeitsplätze zerstört, verbliebene Tätigkeiten intensiviert und zugleich einige „der schlimmsten Arbeitsplätze, die bekannt sind, geschaffen“; zugleich betonte er jedoch die potentielle Rolle technischer Innovationen für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der abhängig Beschäftigten. Für ihn hingen Wohlstand und technischer Wandel untrennbar zusammen, wobei die „Rechnung für solche Fortschritte“ stets von denjenigen Beschäftigten bezahlt werde, die mittel- oder unmittelbar von diesem Wandel betroffen
42 Loderer, Eugen: Reformprogramme und Lebensqualität, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 23 (1972:10), S. 610–616, hier S. 616. 43 Steinkühler, Franz: Gewerkschaftliche Positionen zur sozialen Beherrschbarkeit der Technik, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 36 (1985:9), S. 563–570, hier S. 564. 44 Ebd. 45 Heßler, Martina: Zur Persistenz der Argumente im Automatisierungsdiskurs, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 18–19 (2016), S. 17–24, hier S. 20; vgl. Müller, Moritz: Die IG Metall im Diskurs um die Humanisierung des Arbeitslebens, in: Kleinöder, Nina/Müller, Stefan/Uhl, Karsten (Hg.): „Humanisierung der Arbeit“ Aufbrüche und Konflikte in der rationalisierten Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts (Histoire 150), Bielefeld 2019, S. 255–275; ders.: Von Job-Killern, Roboterkollegen und feuchten Augen. Die Mikroelektronik und die IG Metall als emotional community, in: Heßler, Martina (Hg.): Technikemotionen (Geschichte der technischen Kultur 9), Paderborn 2020, S. 108–127; ders.: „Hilfe zur Selbsthilfe“? Die Entstehung und das (vorläufige) Scheitern eines Gestaltungsansatzes der IG Metall in den 1970er und 1980er Jahren, in: Hoffmann, Dierk/ Brunnbauer, Ulf (Hg.): Transformationen als soziale Praxis. Mitteleuropa seit den 1970er Jahren (Zeitgeschichte im Gespräch 32), Berlin 2020, S. 65–79; ders.: „Die Robbys kommen“. Die IG Metall und die Durchsetzung der Mikroelektronik in den 1970er und 1980er Jahren, Dissertation, Bochum 2020; ders.: „Job Killer“ oder „Kollege Roboter“? Soziotechnische Risiko- und Gestaltungszukünfte des Mensch-Maschinen-Verhältnisses im Industrieroboter-Diskurs der IG Metall, in: Technikgeschichte 88 (2021:1), S. 11–42. 46 Helfert: Ökonomische Entwicklung, S. 247.
106 Moritz Müller
seien.47 Friedrichs prognostizierte, dass die Mikroelektronik aufgrund ihrer vielseitigen Anwendbarkeit alle Wirtschaftsbereiche und Sektoren betreffe, sich aufgrund ihres relativ geringen Preises schnell durchsetzen und auch in der Produktion kleiner und mittlerer Serien zu Automatisierungsschüben führen werde.48 Der Automatisierungsexperte befürchtete, dass die von ihm erwartete Neuentstehung von Arbeitsplätzen in den Wachstumsbranchen nicht annähernd die Masse der Arbeitsplätze kompensieren könne, die infolge der neuen Rationalisierungswelle verloren gehen würden – ein weiterer Anstieg der Sockelarbeitslosigkeit sei deshalb zu erwarten.49 Derartige Gedanken aufgreifend, bezeichnete der IGM-Vorsitzende Loderer den Prozess der Durchsetzung der Mikroelektronik als „dritte industrielle Revolution“.50 Für die Beschäftigten sei dabei klar, welche weitreichenden Folgen die Anwendung von Mikrochips habe: Für sie sei die Mikroelektronik ein „Arbeitsplatzkiller“ und der Mikrochip der „Chip, der Arbeitsplätze frißt“.51 Vom Siegeszug der Mikroelektronik, im Organisationsbereich der IGM beispielsweise in Form numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen und Industrieroboter, erwartete der Vorsitzende in Zukunft die Substitution wichtiger menschlicher Denkleistungen im Arbeitsprozess. Zwar könne diese Entwicklung potentiell auch einen Fortschritt für die abhängig Beschäftigten bedeuten, in Anbetracht der gesellschaftlichen Machtverhältnisse und der ökonomischen Situation sei es jedoch wahrscheinlicher, dass die Mikroelektronik Arbeitsplätze wie „Schnee in der Sonne“ schmelzen lasse – schließlich werde pro fünf vernichteter Arbeitsplätze im Zuge der Einführung der Mikroelektronik lediglich ein neuer geschaffen.52 Der Werkzeugmaschinenbau und die Automobilindustrie waren zwei Industriebranchen, für welche die IGM-Funktionäre im Zuge der Durchsetzung der Mikroelektronik besonders einschneidende Veränderungen befürchteten. Im Werkzeugmaschinenbau, einer durch Facharbeit und klein- sowie mittelgroße Serienproduktion geprägten Branche, den die IGM gern als das „technologische Gehirn“ der westdeutschen Industrie bezeichnete,53 erwarteten einige IGM47 Friedrichs, Günter: Mikroelektronik. Eine neue Dimension von technischem Wandel und Automation, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 31 (1980:4), S. 277–289, hier S. 278. 48 Ebd., S. 278–279. 49 Ebd., S. 284. 50 Loderer, Eugen: Strukturelle Arbeitslosigkeit durch technologischen Wandel, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 28 (1977:7), S. 409–417, hier S. 410. 51 Ebd. 52 Loderer: Strukturelle Arbeitslosigkeit., S. 411. 53 Hinz, Horst: Eine branche blutet aus, in: Der Gewerkschafter 32 (1984:2), S. 46–47, hier S. 46. Die IGM-Funktionärszeitschrift „Der Gewerkschafter“ erschien in den 1970er und 1980er Jahren zeitweise in Kleinschreibung, weshalb in diesem Text in die wörtlichen Zitate nicht eingegriffen wird.
„Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“
107
Funktionäre und Sekretäre beispielsweise einen Arbeitsplatzabbau von etwa 50 Prozent. Aus diesem Grund laufe der Werkzeugmaschinenbau Gefahr, zur „uhrenindustrie der 80er jahre“ zu werden.54 Allerdings könnten, so argumentierte beispielsweise der IGM-Ökonom Horst Hinz, computernumerisch gesteuerte (CNC)-Werkzeugmaschinen auch zu einer höheren Qualifizierung der Facharbeiter führen. Dies setze jedoch voraus, dass die Programmierung der Werkzeugmaschinen auch in der Werkstatt selbst geschehe. Zumeist, so befürchteten viele Funktionäre und Sekretäre, gehe der Trend jedoch dahin, die Programmierung der Maschinen von der Werkstatt in die zentrale Arbeitsvorbereitung zu verlagern. Für die Facharbeiter habe dies zur Folge, dass sie die Maschinen nur noch zu bedienen hätten, was sich negativ auf Einkommen und Qualifikation auswirken könne.55 Da der Trend in der Arbeitswelt dahin gehe, „Routinefunktionen“ menschlicher Arbeit durch Maschinen zu ersetzen, forderte Loderer die Rückbesinnung auf genuin menschliche Fähigkeiten, die nicht von Robotern erledigt werden könnten und sprach sich für die „Förderung menschlicher Eigenschaften wie Flexibilität und Kreativität, wie Lern- und Entscheidungsfähigkeit, wie Mobilität und schöpferische Phantasie“ aus. So sei es möglich, Arbeitskräfte immer weiter zu qualifizieren und ihr kreatives Potential abzurufen.56 Grundsätzliche Befürchtungen äußerte der IGM-Vorsitzende hinsichtlich der Möglichkeit, die abhängig Beschäftigten durch die Mikroelektronik einer permanenten Leistungskontrolle und Überwachung auszusetzen. Außerdem befürchteten Loderer und andere Funktionäre eine Auflösung des betrieblichen Sozialzusammenhangs und damit eine Schwächung der eigenen Organisation in den Betrieben. Diese Gefahr resultiere daraus, dass zwischenmenschliche Kommunikation im Arbeitsprozess zunehmend durch die Interaktion zwischen Menschen und Computern abgelöst werde. Dies könne dazu führen, die Beschäftigten voneinander sowie von der Organisation zu entfremden und kollektive Formen der Interessenvertretung zu erschweren.57 Dass die Frage, ob es der IGM gelingen würde, die 54 Hinz, Horst: Elektronik revolutioniert den maschinenbau, in: Der Gewerkschafter 24 (1976:12), S. 34–35, hier S. 34. In den 1970er Jahren wurden in der IGM-Funktionärszeitschrift „Der Gewerkschafter“ zeitweise alle Artikel in Kleinschrift verfasst (siehe auch vorige Fußnote). 55 Hinz, Horst: Unternehmens-management auf dem prüfstand, in: Der Gewerkschafter 29 (1981:11), S. 42–43. 56 Ebd., S. 413. Angesichts der Tatsache, dass in den 1980er Jahren die Grenzen der Automatisierung offenbar wurden, zeugt dieser Beitrag Loderers von Weitsicht. Vgl. Heßler, Martina: Die Halle 54 bei Volkswagen und die Grenzen der Automatisierung. Überlegungen zum Mensch-Maschine-Verhältnis in der industriellen Produktion der 1980er-Jahre, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 11 (2014:1), S. 56–76, hier S. 73–74. 57 Loderer, Eugen: Industriegewerkschaft Metall. „Neue Heimarbeit“ durch Informations- und Kommunikationstechniken, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 34 (1983:6), S. 385–387, hier
108 Moritz Müller
auf der Mikroelektronik basierenden neuen Technologien im Sinne der Gewerkschaft und der abhängig Beschäftigten zu beeinflussen, zu der gewerkschaftlichen Existenzfrage der 1980er Jahre wurde, verdeutlicht auch folgendes Zitat von Wolfgang Mazurek, einem Sekretär des gewerkschaftseigenen Beratungsprojekts zur Humanisierung des Arbeitslebens (HdA) bei der Automationsabteilung der IGM.58 Dieser sprach auf einer Arbeitstagung der IGM zu den Themen Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM): „Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“59 Trotz dieser endzeitlich anmutenden Rhetorik war auch er davon überzeugt, dass Computersysteme als die „variabelsten Instrumente, die der Mensch als Arbeitsmittel erfunden hat“, ein erhebliches Potential zur Beeinflussung und Gestaltung seitens der Gewerkschaften aufweisen würden.60 Andere IGM-Funktionäre wie Karl-Heinz Janzen, von 1986 bis 1989 zweiter Vorsitzender der IGM, thematisierten verstärkt die Rolle des Staates bei der Entwicklung neuer Formen der Technik und der Arbeitsorganisation.61 Dabei kritiS. 386–387. Rückblickend konstatiert das heutige Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der IGM, Hans-Jürgen Urban, dass genau dieser Fall eingetreten sei: „Die mikroelektronische Durchdringung des Arbeitsprozesses und der Strukturwandel in Richtung einer Dienstleistungsökonomie beförderte die Auflösung traditioneller Klassenmilieus (‚Individualisierung‘) und der Verlust an gemeinsamen Klassenerfahrungen die Herausbildung neuer Werte- und Bewusstseinsmuster (‚Enttraditionalisierung‘).“ Urban, Hans-Jürgen: Arbeiterbewegung heute. Wandel der Arbeit – Wandel der Bewegung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 40–41 (2013), S. 41–46, hier S. 42. 58 Zum HdA-Programm sowie dem Konzept der Humanisierung der Arbeit vgl. die Beiträge in Kleinöder/Müller/Uhl (Hg.): Humanisierung. 59 Mazurek, Wolfgang: CAD/CAM-Strategien aus Sicht der Gewerkschaften, in: Industriegewerkschaft Metall für die Bundesrepublik Deutschland (Hg.): CAD/CAM und Humanisierung. Arbeitstagung der IG Metall 30.11./01.12.1983, Kirchheim (Hessen), Materialien zur Humanisierung des Arbeitslebens, Frankfurt (Main) 1984, S. 41–58, hier S. 58. 60 Ebd., S. 56. 61 Kempter, Klaus: Zur Biografie von Eugen Loderer (1920–1995). Ein Bericht, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 55 (2004:3), S. 144–151, hier S. 149. Interessant ist, dass die IGM in einem Nachruf auf den 2017 verstorbenen Janzen eine Verbindungslinie zwischen seinem Engagement, den „technischen Wandel für und mit den Beschäftigten zu gestalten“ und dem aktuellen Engagement der IGM in Sachen Wandel der Arbeitswelt zieht. Hier formuliert die IGM selbst, weshalb eine Beschäftigung mit der Geschichte der gewerkschaftlichen Technologiepolitik auch aus heutiger Warte lohnenswert ist: „Damals ging es wie heute um die Frage, wie der Einzug von Automatisierung und Kommunikationstechnologien Arbeitsplätze verändert oder ob sie dadurch sogar vernichtet werden. Damals waren es die Roboter, heute ist es die digitale Vernetzung. Die technischen Möglichkeiten haben sich geändert, aber damals wie heute geht es um gute Arbeit und gutes Leben.“ IG Metall: Karl-Heinz Janzen im Alter von 90 Jahren gestorben (https://www.igmetall.de/karl-heinz-janzen-im-alter-von-90-jahren-gestorben-21211.htm, letzter Abruf am 24.04.2017).
„Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“
109
sierte Janzen die Bundesregierung nicht wegen der Förderung der Entwicklung neuer Technologien als solcher. Ihm ging es vor allem darum, dass die Regierung Projekte zur Entwicklung der Mikroelektronik, der Datenverarbeitung, der Informations- und Kommunikationstechnologien, der Fertigungstechnik etc. losgelöst von dem Anspruch fördere, die Arbeitsverhältnisse in den betroffenen Bereichen humaner zu gestalten. Leider, monierte er, hätten Gewerkschaften und abhängig Beschäftigte auf die Ausrichtung derartiger Projekte kaum Einfluss; dabei seien sie diejenigen, denen die Folgekosten solcher Politik aufgebürdet würden: „Techniker basteln vor sich hin. Wenn ihre Entwicklungen fertig sind und auf den Markt kommen, verlangt man von den Arbeitnehmern, sich anzupassen. Hinterher kommt ein Humanisierungsprojekt, das wieder reparieren soll, was ein technokratisch gestaltetes Technologieprojekt versäumt hat.“62 Damit bemängelte Janzen nicht nur, dass Gewerkschaften, Betriebsräte und Beschäftigte auf Distanz zu den Schalthebeln staatlicher Technologiepolitik gehalten würden, sondern kritisierte zugleich, das staatlich geförderte Projekt zur Humanisierung des Arbeitslebens diene vorrangig dazu, technokratische Verfehlungen im Nachhinein auszubügeln.63
Die westdeutschen Gewerkschaften und die Strukturbruchthese – ein Fazit In ihrem erstmals 2008 erschienenen Werk „Nach dem Boom“ stellen Anselm Doering-Manteuffel und Lutz Raphael die These auf, dass sich die Arbeitswelt im Übergang von den 1970er zu den 1980er Jahren derart verändert habe, dass von einem „sozialen Wandel von revolutionärer Qualität“ und einem „Strukturbruch“ gesprochen werden könne.64 Im Verlauf ihres Essays postulieren sie,
62 Janzen, Karl-Heinz: Technologiepolitik und Gewerkschaften, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 31 (1980:4), S. 256–262, hier S. 260. Zur staatlichen Förderung der Entwicklung und Anwendung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien vgl. Abelshauser, Werner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte von 1945 bis zur Gegenwart (Beck’sche Reihe 1587), München ²2011, S. 458. 63 So vertritt auch Lompe die Ansicht, das Projekt zur Humanisierung des Arbeitslebens sei „als soziale Abfederung des politischen Konzepts der Modernisierung der Volkswirtschaft“ konzipiert gewesen. Lompe: Gewerkschaftliche Politik, S. 306. Zur Haltung der IGM gegenüber dem HdA-Programm vgl. Müller, Moritz: Die IG Metall. 64 Doering-Manteuffel/Raphael: Nach dem Boom, S. 10–11. Doering-Manteuffel datiert das Ende des 20. Jahrhunderts aufgrund des Siegeszugs der Mikroelektronik sogar auf die Jahre um 1980, vgl. Doering-Manteuffel, Anselm: Einleitung. Strukturmerkmale der deutschen Ge-
110 Moritz Müller
dass fordistische Arrangements und die mit ihnen verknüpften Hoffnungen auf anhaltende Stabilität sowie der Glaube an die Plan- und Gestaltbarkeit gesellschaftlichen Wandels in den 1970er zunehmend erodierten, so dass in den 1980er Jahren schließlich niemand mehr von Fortschritt habe sprechen wollen.65 Schließlich, so folgern die Autoren, habe sich im Zuge des von ihnen ausgemachten Strukturbruchs die „Vergeblichkeit der großen Planungs- und Steuerungskonzepte“ der 1960er und frühen 1970er Jahre offenbart.66 Bezieht man die im Laufe der Analyse gewonnenen Ergebnisse auf die Strukturbruchthese sowie den auf sie folgenden wissenschaftlichen Diskurs, kann Folgendes festgestellt werden: Tatsächlich reifte im Zuge der Auflösung des „wachstumsbasierten Klassenkompromisses“ in den 1970er Jahren innerhalb der westdeutschen Gewerkschaften die Erkenntnis,67 dass die Rechnung „Wachstum = Arbeitsplätze“ nicht länger aufging.68 Im Zuge grassierender Arbeitslosigkeit, negativer Rationalisierungsfolgen und Belastungen in der Arbeitswelt sowie des Umstands, dass im Industriesektor abgebaute Arbeitsplätze nicht länger durch Arbeitsplatzaufbau im Dienstleistungssektor kompensiert wurden, erkannten die Gewerkschaften in der Bundesrepublik nun auch ganz praktisch, dass technischer Fortschritt nicht automatisch zu sozialem Fortschritt führt. Ebenso gut konnte und kann dieser zu erheblichen sozialen Verwerfungen führen.69 Deutlich wurde, dass die Gewerkschaften im Zuge der Durchsetzung der Mikroelektronik von deterministischen Auffassungen über das Verhältnis von Technik und Arbeitsorganisation Abstand nahmen und beide zu gestaltbaren Variablen erklärten.70 Allerdings finden sich in den Beiträschichte des 20. Jahrhunderts, in: Ders. (Hg.): Strukturmerkmale der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts (Schriften des Historischen Kollegs 63), München 2006, S. 1–17, hier S. 5. 65 Doering-Manteuffel/Raphael: Nach dem Boom, S. 21, S. 70. 66 Ebd., S. 91. 67 Eversberg, Dennis: Destabilisierte Zukunft. Veränderungen im sozialen Feld des Arbeitsmarkts seit 1970 und ihre Auswirkungen auf die Erwartungshorizonte der jungen Generation, in: Doering-Manteuffel, Anselm u. a. (Hg.): Vorgeschichte der Gegenwart. Dimensionen des Strukturbruchs nach dem Boom, Göttingen 2016, S. 451–474, hier S. 459. 68 Engeln, Ralf/Lupa, Markus: Essens Metaller im Strukturwandel 1946–1996, in: IG Metall Verwaltungsstelle Essen (Hg.): Im Wandel gestalten. Zur Geschichte der Essener Metallindustrie 1946–1996, Essen 1996, S. 11–50, hier S. 15. 69 Seibring, Anne: Die Humanisierung des Arbeitslebens in den 1970er Jahren. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, in: Andresen, Knud/Bitzegeio, Ursula/Mittag, Jürgen (Hg.): Nach dem Strukturbruch? Kontinuität und Wandel von Arbeitswelten (Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe 1197), Bonn 2011, S. 107–126, hier S. 123. 70 Schönhoven, Klaus: Geschichte der deutschen Gewerkschaften. Phasen und Probleme, in: Schroeder, Wolfgang (Hg.): Handbuch Gewerkschaften in Deutschland, Wiesbaden ²2014, S. 59–83, hier S. 73. Vgl. Sauer, Dieter: Von der „Humanisierung der Arbeit“ zur „Guten Arbeit“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (2011:15), S. 18–24, hier S. 20.
„Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“
111
gen der Funktionäre der HBV, der IG DruPa sowie der IGM unterschiedliche Einschätzungen des technischen Wandels auf der Grundlage der Durchsetzung der Mikroelektronik. Während in den Beiträgen aus den Reihen der HBV – deren Organisationsbereich bis in die 1970er Jahre als relativ rationalisierungssicher und als Auffangbecken für in der Industrie freigesetzte Arbeitskräfte galt – die Sorge dominierte, dass Angestellte eine Taylorisierung ihrer Arbeitsbedingungen erfahren würden und es im Zuge scheinbar flacher Hierarchien zu einer weiteren Entfremdung der Beschäftigten von den Gewerkschaften und der betrieblichen Interessenvertretung komme, standen in der IG DruPa und der IGM andere Probleme im Vordergrund. Zwar befürchteten auch die Funktionäre dieser Gewerkschaften, dass die Mikroelektronik einer weiteren Taylorisierung Vorschub leisten und die Gewerkschaften schwächen könne, allerdings stand hier die Furcht vor massenhaftem Arbeitsplatzabbau und Dequalifizierung in großem Maßstab im Fokus. Zudem wurde in der IG DruPa und der IGM intensiv darüber diskutiert, inwiefern die neuen Technologien überhaupt gestaltbar seien. In beiden Gewerkschaften wurde von der Vorstellung der Neutralität der Technik Abstand genommen: Während in der IGM betont wurde, dass die Gestaltung der Technologien eine Frage der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und ein gewerkschaftliches Kampffeld darstelle, wurde in der IG DruPa – zumindest von einigen Funktionären – genereller Zweifel daran angemeldet, dass Technologien beliebig gestaltbar seien, da diese nicht von ihren gesellschaftlichen Zwecken getrennt werden könnten. Trotz aller Skepsis hinsichtlich des – vermeintlichen – technischen Fortschritts blieben Aufrufe zum Maschinensturm jedoch in allen drei Gewerkschaften aus. Die These von Anselm Doering-Manteuffel und Lutz Raphael, wonach in den 1980er Jahren niemand mehr ein Befürworter „geplanter, gesteuerter Veränderung in Form von Demokratisierung, Emanzipation und Modernisierung“ gewesen sei,71 muss angesichts der gewerkschaftlichen Debatten eingeschränkt werden. In den westdeutschen Gewerkschaften blieb der Glaube an die Gestaltbarkeit von Wirtschaft und Gesellschaft erhalten. Daran änderten auch die Folgen der mikroelektronischen Revolution nichts. Es wurde an dem Ziel festgehalten, die Arbeitswelt durch Demokratisierung und Humanisierung zugunsten der abhängig Beschäftigten zu gestalten. Allerdings wurden die Funktionäre nicht müde zu betonen, sei zu diesem Zweck ein Ausbau der Mitbestimmung und der Einflussmöglichkeiten der Gewerkschaften sowie der Beschäftigten vonnöten – ein Gedanke, der angesichts der aktuellen Entwicklungen und Debatten um die
71 Doering-Manteuffel/Raphael: Nach dem Boom, S. 118.
112 Moritz Müller
Digitalisierung unter Chiffren wie Arbeit- und Industrie 4.0 erneut an Aktualität gewinnt.72
Quellenverzeichnis Breit, Ernst: Fortschritt – gegen, ohne oder durch die Gewerkschaften?, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 36 (1985:1), S. 1–19. Ferlemann, Erwin: Rationalisierung oder Humanisierung. Unauflösbarer Widerspruch oder gewerkschaftliche Aufgabe?, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 31 (1980:4), S. 268–270. Friedrichs, Günter: Mikroelektronik. Eine neue Dimension von technischem Wandel und Automation, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 31 (1980:4), S. 277–289. Hensche, Detlef: Es wird Zeit, auch einmal nein zu sagen. Wo soziale Beherrschbarkeit zur Lebenslüge werden kann, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 36 (1985:9), S. 554–562. Hinz, Horst: Eine branche blutet aus, in: Der Gewerkschafter 32 (1984:2), S. 46–47. Hinz, Horst: Elektronik revolutioniert den maschinenbau, in: Der Gewerkschafter 24 (1976:12), S. 34–35. Hinz, Horst: Unternehmens-management auf dem prüfstand, in: Der Gewerkschafter 29 (1981:11), S. 42–43. IG Metall: Karl-Heinz Janzen im Alter von 90 Jahren gestorben (https://www.igmetall.de/karlheinz-janzen-im-alter-von-90-jahren-gestorben-21211.htm, letzter Abruf am 24.04.2017). Janzen, Karl-Heinz: Technologiepolitik und Gewerkschaften, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 31 (1980:4), S. 256–262. Loderer, Eugen: Reformprogramme und Lebensqualität, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 23 (1972:10), S. 610–616. Loderer, Eugen: Strukturelle Arbeitslosigkeit durch technologischen Wandel, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 28 (1977:7), S. 409–417. Loderer, Eugen: Industriegewerkschaft Metall. „Neue Heimarbeit“ durch Informations- und Kommunikationstechniken, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 34 (1983:6), S. 385–387. Mahlein, Leonhard: Streik in der Druckindustrie. Erfolgreicher Widerstand, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 29 (1978:5), S. 261–271. Mahlein, Leonhard: Industriegewerkschaft Druck und Papier. Weitere Arbeitsplätze gefährdet, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 34 (1983:6), S. 370–373. Mazurek, Wolfgang: CAD/CAM-Strategien aus Sicht der Gewerkschaften, in: Industriegewerkschaft Metall für die Bundesrepublik Deutschland (Hg.): CAD/CAM und Humanisierung. Arbeitstagung der IG Metall 30.11./01.12.1983, Kirchheim (Hessen). Materialien zur Humanisierung des Arbeitslebens, Frankfurt (Main) 1984, S. 41–58. Müller, Joachim: Rationalisierungen in der Druckindustrie: Das Beispiel Bildschirmarbeit, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 28 (1977:6), S. 399–403.
72 Vgl. Nettelstroth, Wolfgang/Schilling, Gabi: Mitbestimmung 4.0: Die digitale Arbeit menschenwürdig gestalten, in: Maier, Günter W./Engels, Gregor/Eckhard, Steffen (Hg.): Handbuch Gestaltung digitaler und vernetzter Arbeitswelten, Berlin 2018, S. 1–23.
„Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“
113
Nettelstroth, Wolfgang/Schilling, Gabi: Mitbestimmung 4.0. Die digitale Arbeit menschenwürdig gestalten, in: Maier, Günter W./Engels, Gregor/Eckhard, Steffen (Hg.): Handbuch Gestaltung digitaler und vernetzter Arbeitswelten, Berlin 2018, S. 1–23. N. N.: Mehr Wert auf die Bewegung legen. Ein Gespräch über Formen und Perspektiven der Mitbestimmung zwischen Horst Föhr, Lorenz Schwegler, Karl-Heinz Stommel und Fritz Vilmar, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 36 (1985:3), S. 161–180. Noth, Dieter/Oehl, Werner/Trautwein-Kalms, Gudrun: Angestellte. Bevorzugte Objekte der neuen Rationalisierungswelle, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 28 (1977:6), S. 359– 368. Steinkühler, Franz: Gewerkschaftliche Positionen zur sozialen Beherrschbarkeit der Technik, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 36 (1985:9), S. 563–570. Urban, Hans-Jürgen: Arbeiterbewegung heute. Wandel der Arbeit – Wandel der Bewegung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 63 (2013:40–41), S. 41–46. Vetter, Heinz Oskar: Die Sozialpolitik als Herausforderung an die Industrienationen, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 23 (1972:4), S. 201–211. Vetter, Heinz Oskar: Am Ende einer Amtszeit. Aussichten, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 33 (1982:5), S. 257–265. Vietheer, Heinz: Gewerkschaften müssen Motor sein. Zum DGB-Grundsatzprogramm, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 27 (1976:7), S. 412–419. Volkmar, Günter: Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV). Die soziale Nutzung der neuen Techniken ermöglichen, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 34 (1983:6), S. 382–385.
Literaturverzeichnis Abelshauser, Werner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte von 1945 bis zur Gegenwart (Beck’sche Reihe 1587), München ²2011. Andresen, Knud/Bitzegeio, Ursula/Mittag, Jürgen: Arbeitsbeziehungen und Arbeitswelt(en) im Wandel: Problemfelder und Fragestellungen, in: Dies. (Hg.): Nach dem Strukturbruch? Kontinuität und Wandel von Arbeitswelten (Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe 1197), Bonn 2011, S. 7–23. Deppe, Frank: Gewerkschaften in der Großen Transformation. Von den 1970er Jahren bis heute. Eine Einführung (Neue Kleine Bibliothek 184), Köln 2012. Doering-Manteuffel, Anselm/Raphael, Lutz: Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen 2008. Doering-Manteuffel, Anselm: Einleitung: Strukturmerkmale der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, in: Ders. (Hg.): Strukturmerkmale der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts (Schriften des Historischen Kollegs 63), München 2006, S. 1–17. Engeln, Ralf/Lupa, Markus: Essens Metaller im Strukturwandel 1946–1996, in: IG Metall Verwaltungsstelle Essen (Hg.): Im Wandel gestalten. Zur Geschichte der Essener Metallindustrie 1946–1996, Essen 1996, S. 11–50. Eversberg, Dennis: Destabilisierte Zukunft. Veränderungen im sozialen Feld des Arbeitsmarkts seit 1970 und ihre Auswirkungen auf die Erwartungshorizonte der jungen Generation, in: Doering-Manteuffel, Anselm/Raphael, Lutz/Schlemmer, Thomas (Hg.): Vorgeschichte der
114 Moritz Müller
Gegenwart. Dimensionen des Strukturbruchs nach dem Boom, Göttingen 2016, S. 451– 474. Hachtmann, Rüdiger/von Saldern, Adelheid: „Gesellschaft am Fließband“. Fordistische Produktion und Herrschaftspraxis in Deutschland, in: Zeithistorische Forschungen/ Studies in Contemporary History 6 (2009:2), S. 186–208. Hachtmann, Rüdiger: Gewerkschaften und Rationalisierung. Die 1970er-Jahre – ein Wendepunkt?, in: Andresen, Knud/Bitzegeio, Ursula/Mittag, Jürgen (Hg.): Nach dem Strukturbruch? Kontinuität und Wandel von Arbeitswelten (Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe 1197), Bonn 2011, S. 181–209. Helfert, Mario: Ökonomische Entwicklung und gewerkschaftliche Auseinandersetzung mit technischem Fortschritt, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 31 (1980:4), S. 242–250. Hemmer, Hans-Otto/Milert, Werner/Schmitz, Kurt Thomas: Gewerkschaftliche Politik unter der konservativ-liberalen Regierung seit 1982, in: Hemmer, Hans-Otto/Schmitz, Kurt Thomas (Hg.): Geschichte der Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Von den Anfängen bis heute, Köln 1990, S. 415–458. Heßler, Martina: Die Halle 54 bei Volkswagen und die Grenzen der Automatisierung. Überlegungen zum Mensch-Maschine-Verhältnis in der industriellen Produktion der 1980erJahre, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 11 (2014:1), S. 56–76. Heßler, Martina: Die Ersetzung des Menschen? Die Debatte um das Mensch-MaschinenVerhältnis im Automatisierungsdiskurs, in: Technikgeschichte 82 (2015:2), S. 109–136. Heßler, Martina: Zur Persistenz der Argumente im Automatisierungsdiskurs, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 18–19 (2016), S. 17–24. Kempter, Klaus: Zur Biografie von Eugen Loderer (1920–1995). Ein Bericht, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 55 (2004:3), S. 144–151. Kleinöder, Nina/Müller, Stefan/Uhl, Karsten (Hg.): „Humanisierung der Arbeit“. Aufbrüche und Konflikte in der rationalisierten Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts (Histoire 150), Bielefeld 2019. Lompe, Klaus: Gewerkschaftliche Politik in der Phase gesellschaftlicher Reformen und der außenpolitischen Neuorientierung der Bundesrepublik 1969 bis 1974, in: Hemmer, HansOtto/Schmitz, Kurt Thomas (Hg.): Geschichte der Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Von den Anfängen bis heute, Köln 1990, S. 283–338. Lutz, Burkart: Der kurze Traum immerwährender Prosperität. Eine Neuinterpretation der industriell-kapitalistischen Entwicklung im Europa des 20. Jahrhunderts (Reihe Campus 1026), Frankfurt (Main)/ New York 1989. Müller-Jentsch, Walther: Gewerkschaftliche Politik in der Wirtschaftskrise II. 1978/1979 bis 1982/83, in: Hemmer, Hans-Otto/Schmitz, Kurt Thomas (Hg.): Geschichte der Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Von den Anfängen bis heute, Köln 1990, S. 377–412. Müller, Moritz: Die IG Metall im Diskurs um die Humanisierung des Arbeitslebens, in: Kleinöder, Nina/Müller, Stefan/Uhl, Karsten (Hg.): „Humanisierung der Arbeit“. Aufbrüche und Konflikte in der rationalisierten Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts, Bielefeld 2019 (Histoire 150), S. 255–275. Müller Moritz: „Die Robbys kommen“. Die IG Metall und die Durchsetzung der Mikroelektronik in den 1970er und 1980er Jahren, Dissertation, Bochum 2020. Müller, Moritz: „Hilfe zur Selbsthilfe“? Die Entstehung und das (vorläufige) Scheitern eines Gestaltungsansatzes der IG Metall in den 1970er und 1980er Jahren, in: Hoffmann, Dierk/
„Entweder wir werden mit den Technologien fertig oder sie mit uns.“
115
Brunnbauer, Ulf (Hg.): Transformationen als soziale Praxis. Mitteleuropa seit den 1970er Jahren (Zeitgeschichte im Gespräch 32), Berlin 2020, S. 65–79. Müller, Moritz: Von Job-Killern, Roboterkollegen und feuchten Augen. Die Mikroelektronik und die IG Metall als emotional community, in: Heßler, Martina (Hg.): Technikemotionen (Geschichte der technischen Kultur 9), Paderborn 2020, S. 108–127. Müller, Moritz: „Job Killer“ oder „Kollege Roboter“? Soziotechnische Risiko- und Gestaltungszukünfte des Mensch-Maschinen-Verhältnisses im Industrieroboter-Diskurs der IG Metall, in: Technikgeschichte 88 (2021:1), S. 11–42. Sauer, Dieter: Von der „Humanisierung der Arbeit“ zur „Guten Arbeit“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (2011:15), S. 18–24. Schneider, Michael: Kleine Geschichte der Gewerkschaften. Ihre Entwicklung in Deutschland von den Anfängen bis heute, Bonn ²2000. Schönhoven, Klaus: Geschichte der deutschen Gewerkschaften. Phasen und Probleme, in: Schroeder, Wolfgang (Hg.): Handbuch Gewerkschaften in Deutschland, Wiesbaden ²2014, S. 59–83. Seibring, Anne: Die Humanisierung des Arbeitslebens in den 1970er Jahren. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, in: Andresen, Knud/Bitzegeio, Ursula/Mittag, Jürgen (Hg.): Nach dem Strukturbruch? Kontinuität und Wandel von Arbeitswelten (Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe 1197), Bonn 2011, S. 107–126. Uhl, Karsten: Maschinenstürmer gegen die Automatisierung? Der Vorwurf der Technikfeindlichkeit in den Arbeitskämpfen der Druckindustrie in den 1970er und 1980er Jahren und die Krise der Gewerkschaften, in: Technikgeschichte 82 (2015:2), S. 157–179.
Karsten Uhl
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“. Die Computerisierung der Druckindustrie und der Wandel der industriellen Beziehungen in transnationaler und lokaler Perspektive Nach monatelangen Tarifauseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Einführung des Computerschriftsatzes – der „rechnergesteuerten Textsysteme“, wie es zeitgenössisch hieß – ging der Arbeitskampf der Industriegewerkschaft Druck und Papier im März 1978 in seine entscheidende Phase. Bundesweite Schwerpunktstreiks trafen vor allem Zeitungsverlage und dünnten zeitweise die Auslage der Zeitungskioske aus. Während die Streiks an einigen Tagen den Druck vieler Tageszeitungen verhinderten – am 15. März erschienen nur 23 von 350 Zeitungen in der Bundesrepublik –1, wurden einige Ausgaben eines anderen Genres publiziert: „Streikzeitungen“ oder „Notzeitungen“.2 Eine solche von der IG Druck und Papier herausgegebene „Notzeitung“ berichtete am 6. März 1978 von einer Straßenszene während der Streikkundgebungen in Wuppertal. Unabhängig davon, inwieweit diese Darstellung fiktive Glättungen enthält, gibt sie doch Zeugnis von der Selbstdarstellung und der Selbstwahrnehmung der Streikenden: Ein Arbeiter aus einer anderen Branche, ein Modellschreiner, habe den Streikposten der IG Druck und Papier verwundert gefragt, was die streikenden Druckarbeiter nur gegen die neue Technik hätten. Diese Frage wurde zu dieser Zeit im Kontext der angespannten industriellen Beziehungen in der Druckbranche häufig gestellt; sie drängte sich auf den ersten Blick durchaus 1 Vgl. Müller-Jentsch, Walther: Technik als Bedrohung? Fotosatz und Computertechnologie in der Druckindustrie, in: Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): Hauptsache Arbeit. Wandel der Arbeitswelt nach 1945, Bielefeld 2009, S. 94–101, hier S. 100. Der vorliegende Beitrag ist Teil eines Forschungsvorhabens zur Computerisierung als Herausforderung der Gewerkschaftsbewegung. Das Forschungsprojekt wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – UH 229/2–1. 2 In Nordrhein-Westfalen erschienen während der Auseinandersetzung im Druckgewerbe 1978 insgesamt sieben Ausgaben einer gewerkschaftlichen Notzeitung; die Auflagenhöhe schwankte zwischen 20 000 und 190 000, vgl. IG Druck und Papier NRW: 12. Tätigkeitsbericht, in: IG Medien, Druck und Papier, Publizistik und Kunst/Landesbezirk Nordrhein-Westfalen (Hg.): 50 Jahre Mediengewerkschaft in Nordrhein-Westfalen 1947–1997. Ausgewählte Dokumente, Recklinghausen 1997, S. 117–124, hier S. 122. https://doi.org/10.1515/9783110729979-006
118 Karsten Uhl
auf, da die deutsche Gewerkschaftsbewegung und insbesondere die Drucker und Schriftsetzer eine lange Tradition der Technikfreundlichkeit und Fortschrittsgläubigkeit besaßen. Nun schienen sie einen Arbeitskampf gegen die neue Technologie zu führen, was ihnen nicht selten den Vorwurf der Maschinenstürmerei einbrachte.3 Der in der „Notzeitung“ geschilderte Dialog wird fortgeführt, indem der Streikposten, ein Vertrauensmann der Gewerkschaft, dem skeptischen Schreiner entgegnete: „Stellen Sie sich vor, ein neues Werkstück wird gebraucht und die frechen rechnergesteuerten Systeme sind auch in Ihrem Bereich vorhanden. Sie nehmen dann nur noch das Holz, den Leim und die Zeichnung des Modellstücks, geben das in den Computer, das fertige Stück kommt heraus. Den entsprechenden Knopfdruck brauchen Sie auch nicht mehr zu machen, das macht ein anderer für Sie. Wie gefällt Ihnen das?“ – Der Schreiner habe geschockt reagiert – „Um Gottes Willen, so geht das doch nicht“ – und fünf Mark für die Streikkasse gespendet.4 Diese Schilderung verdeutlicht, als wie neuartig und radikal der technologische Wandel in der Druckindustrie wahrgenommen wurde, der in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre in der Bundesrepublik angekommen war. Der Streikposten beschrieb dem fragenden Schreiner einen technologischen Transformationsprozess, der bei weitem mehr als nur die nächste Phase der Rationalisierung oder Automatisierung darstellte. Übertragen auf das Handwerk des Schreiners hätten wir es nicht mit einer graduellen technologischen Entwicklung zu tun – deren Ablehnung aus der Tradition der deutschen Arbeiterbewegung nur schwer zu begründen gewesen wäre –, sondern mit einer neuen Qualität, die androhte, die Arbeitswelt vollständig zu verändern. Aus der heutigen Perspektive des frühen 21. Jahrhunderts entwarf der Streikposten die Skizze eines 3D-Druckers avant la lettre; eines 3D-Druckers freilich, der anders als die tatsächlichen Exemplare unserer Gegenwart sogar geeignet für den breiten industriellen Einsatz zu sein schien. In diesem Beitrag werde ich die Prozesse, die die Druckbranche in den 1970er und 1980er Jahren erschütterten, als ein besonders tiefgreifendes Beispiel für die industriellen Transformationsprozesse in dieser Phase untersuchen.5 Im Zentrum wird die Frage stehen, inwieweit der technologische Wandel 3 Vgl. Uhl, Karsten: Maschinenstürmer gegen die Automatisierung? Der Vorwurf der Technikfeindlichkeit in den Arbeitskämpfen der Druckindustrie in den 1970er und 1980er Jahren, in: Technikgeschichte 82 (2015:2), S. 157–179. 4 Archiv für soziale Bewegungen, Bochum (AfsB), Sign. MüJe 140, IG Druck und Papier: Notzeitung, 6.3.1978. 5 Stein hat diese Umbruchphase der Druckindustrie für Australien untersucht, Dommann hat erste Überlegungen zur Entwicklung in der Schweiz veröffentlicht. Cockburns ältere Untersu-
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“
119
und eine zunehmende transnationale Verzahnung sowohl der Unternehmen als auch der Gewerkschaften die industriellen Beziehungen in der bundesdeutschen Druckbranche veränderten. Der transnationale Einfluss auf die industriellen Beziehungen wurde dabei generell bisher von der historischen Forschung vernachlässigt.6 Dieser Beitrag will darüber hinaus versuchen, nicht bei der transnationalen Organisationsgeschichte stehen zu bleiben. Vielmehr geht es mir im Folgenden darum, transnationale Prozesse im Kontext lokaler Veränderungen in den Blick zu nehmen, also die Betriebsebene ebenfalls zu analysieren.
Der technologische Wandel, die Tarifparteien und der Streik von 1978 Das Verhältnis von Computerisierung und Arbeitsauseinandersetzungen der Druckindustrie lässt sich nicht auf eine Geschichte der Technikfolgen reduzieren. Zwar erfolgten die Streiks 1978 in Folge schwieriger Tarifverhandlungen bei der Einführung des Computerschriftsatzes, aber die längere Geschichte des technologischen Wandels in der Druckindustrie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs offenbart eine wechselseitige Beziehung zwischen den industriellen Beziehungen und technologischen Innovationen. In den USA unternahmen Zeitungsverlage während einiger größerer Streiks in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre technologische Experimente, die ihnen eine Produktion der Zeitungen ohne die streikenden Facharbeiter ermöglichte. Zunächst handelte es sich dabei um die relativ einfache Technik der Fotogravur, mit der sich zwar die erwünschten Qualitätsstandards kaum halten ließen, die sich während akuter Arbeitskämpfe aber als wirkungsvolle Waffe gegen die streikenden Gewerkschafter erwies. Dieser Technik war also kein breiter allgemeiner Einsatz beschieden, die Streikwelle der Nachkriegszeit stimulierte jedoch weitere Forschungen in den Bereichen Druck und Schriftsatz.7 chung der britischen Druckindustrie ist immer noch zu empfehlen, vgl. Cockburn, Cynthia: Brothers. Male Dominance and Technological Change, London 1983; Stein, Jesse Adams: Hot Metal. Material Culture and Tangible Labour (Studies in Design and Material Culture), Manchester 2016; Dommann, Monika: Umbrüche am Ende der Linotype, in: Nach Feierabend. Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte 12 (2016), S. 219–233. 6 Vgl. Fetzer, Thomas: Industrial Relations History in Transnational Perspective. A Review Essay, in: History Compass 10 (2012:1), S. 56–69, hier S. 61. 7 Vgl. Davies, David R.: The Postwar Decline of American Newspapers, 1945–1965 (The History of American Journalism 6), Westport (Connecticut)/London 2006, S. 10–12.
120 Karsten Uhl
Der Bleisatz blieb vorerst dominant, seine Leistungsfähigkeit wurde allerdings ab 1950 – in der Bundesrepublik fünf Jahre später – durch lochbandgesteuerte Setz-und-Gießmaschinen, die Teletypesetter (TTS), erheblich erhöht.8 Auch der Beginn der Computerisierung in der Branche fand noch auf der Basis von Bleisatz statt: Zunächst wurden in den USA seit den frühen 1960er Jahren Computer als Satzrechner zum automatischen Zeilenumbruch von TTS-Lochkarten eingesetzt. Experten erschien jedoch schon zu diesem Zeitpunkt der Weg zu einem vollautomatischen Schriftsatz nur noch eine Frage von einigen Jahren zu sein.9 Auch diese Entwicklung setzte in den USA früher als in Europa ein. Mitte der siebziger Jahre wurden in den USA bereits keine Bleisatzmaschinen mehr hergestellt, der Umstieg auf rechnergestützten Fotosatz und den für die mit dieser neuen Satztechnik hergestellten Druckvorlagen geeigneten Offsetdruck war vielerorts bereits vollzogen. Europäische Branchenexperten waren über diese Entwicklungen frühzeitig umfassend informiert. Beispielsweise veröffentlichte die britische königliche Kommission für das Pressewesen die Studie eines Journalisten, die auf Basis einer Forschungsreise durch die USA entstanden war. Ein Hauptaugenmerk seiner Untersuchung lag darin, wie es möglich sein könne, die neuen Technologien ohne große Streiks und Störungen der industriellen Beziehungen im eigenen Land einzuführen.10 Das amerikanische Beispiel einiger Zeitungsverlage, die nach dem Vorbild eines Verlages aus Virginia während eines Streiks im Jahr 1971 die alten Bleisatzmaschinen aus dem Werk abtransportieren, neue Fotosatzmaschinen aufstellen ließen und dann mit schnell angelernten Arbeitskräften eine Zeitung produzierten, während die meisten der ehemaligen Facharbeiter diesen Betrieb nie wieder betraten, konnte bei anderen arbeitsrechtlichen Grundlagen in Europa nicht als Folie dienen.11 Während der Auseinandersetzung um die Tarifierung der rechnergestützten Textsysteme in der Bundesrepublik im Frühjahr 1978 verwies dann die IG Druck und Papier in einer Presseinformation auf Tarifverträge in anderen europäischen Ländern. Seit 1976 war in Belgien, den Niederlanden und den skandinavischen Staaten tarifvertraglich festgehalten worden, dass die Texterfassung und -verarbeitung an den Bildschirmterminals der rechnergesteuerten Systeme ausschließlich von Facharbeitern der Druckindustrie verrichtet werden dürfe.
8 Vgl. Reske, Christopher: Die Ablösung des Bleisatzes durch den Fotosatz. Das Ende einer Ära, in: Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte 14 (2005), S. 79–108, hier S. 84 f. 9 Vgl. Davies: Postwar Decline, S. 122 f. 10 Vgl. Winsbury, Rex: New Technology and the Press. A Study of Experience in the United States, London 1975, S. 7. 11 Vgl. ebd., S. 24.
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“
121
Ähnliche Regelungen wurden in großen französischen und britischen Betrieben getroffen. Aus Sicht der deutschen Gewerkschaft drohte die Bundesrepublik „Schlusslicht“ im internationalen Vergleich zu werden, sofern nicht auch hier ein entsprechender Vertrag geschlossen werde.12 Die IG Druck und Papier hatte die technologische Entwicklung durchaus schon zuvor erkannt, die Bemühungen um eine Tarifierung der neuen Technik gestalteten sich aber außerordentlich kompliziert: zum einen aufgrund der neuartigen Notwendigkeit einer umfassenden Abstimmung zwischen verschiedenen Gewerkschaften, zum anderen wegen schwieriger Verhandlungen mit den Unternehmerverbänden. Bereits 1974 forderte ein Antrag auf dem Gewerkschaftstag der IG Druck und Papier tarifliche Maschinenbesetzungsvorschriften für den Fotosatz, der offensichtlich die „am schnellsten wachsende Technologie“ im Schriftsatzbereich darstellte. Dieser Antrag wurde an die Tarifkommission der Gewerkschaft überwiesen.13 Im September 1975 forderte dann der Hauptvorstand der IG Druck und Papier den Unternehmerverband Bundesverband Druck (BVD) zu Verhandlungen über die Arbeit an Bildschirmterminals und OCR-Geräten (optical character recognition, bereits zeitgenössisch auch als „Scanner“ bezeichnet) auf. Die Unternehmer verwiesen auf mangelnde betriebliche Erfahrungen mit den neuen Techniken und sahen zunächst keine Notwendigkeit zu derartigen Vereinbarungen.14 Stattdessen kam es im Frühjahr 1976 in der Druckbranche zu einem Arbeitskampf, der sich auf die Lohnfrage konzentrierte. Die IG Druck und Papier bezeichnete ihn durchaus mit Stolz im eigenen Geschäftsbericht als den „härteste[n] und längste[n] bundesweite[n] Streik in der Geschichte der Bundesrepublik“.15 Nach 13 Tagen Arbeitskampf wurde statt der geforderten Lohnerhöhung von neun Prozent eine Erhöhung von knapp unter sieben Prozent erreicht. Vor allem aber konnte die Gewerkschaft, wie der Vorsitzende Leonhard Mahlein direkt nach dem Streik betonte, ihre Stärke demonstrieren, was in Hinblick auf die anstehenden Auseinandersetzungen um die neuen Technologien von großer Wichtigkeit gewesen sei.16 Die ersten Gespräche zwischen der IG Druck und Papier und dem BVD über die neue Technik fanden im September 1976 statt. Dabei stellte sich rasch he12 Archiv der sozialen Demokratie, Bonn (AdsD), Sign. 5/MEDA 114437, IG Druck und Papier: Presseinformation. Soll die Bundesrepublik Schlusslicht werden?, undat. [März 1978]. 13 IG Druck und Papier, Hauptvorstand: Zehnter Ordentlicher Gewerkschaftstag Industriegewerkschaft Druck und Papier, Hamburg 1974. Protokoll, Stuttgart 1974, S. 98 (Antrag Nr. 210). 14 IG Druck und Papier NRW: 12. Tätigkeitsbericht, S. 117. 15 IG Druck und Papier, Hauptvorstand: Geschäftsbericht 1974 bis 1977 zum Elften Ordentlichen Gewerkschaftstag, Stuttgart 1977, S. 84. 16 Vgl. Güther, Bernd/Pickshaus, Klaus: Der Arbeitskampf in der Druckindustrie im Frühjahr 1976, Frankfurt (Main) 1976, S. 57 und S. 62.
122 Karsten Uhl
raus, dass zum einen über den Verband der Druckunternehmer hinausgehend Verhandlungen mit den Verbänden der Zeitungs- und Zeitschriftverleger geführt werden mussten. Zum anderen bemühten sich parallel zur IG Druck und Papier weitere Gewerkschaften um eine Tarifierung der neuen Technik: der Deutsche Journalisten-Verband (DJV), die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) sowie die Deutsche Angestelltengewerkschaft (DAG).17 Der IG Druck und Papier gelang es, sich rasch mit dem DJV abzustimmen, so dass im Oktober 1976 ein erster gemeinsamer Tarifvertragsentwurf entstand.18 Diese Einigung war keineswegs selbstverständlich, da in der Nachkriegszeit Gespräche über einen etwaigen Anschluss des DJV an den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) gescheitert waren. In diesem Sinne stellte der DJV eine direkte Konkurrenzorganisation zur Deutschen Journalisten-Union (dju) dar, die ihrerseits in der IG Druck und Papier (und somit im DGB) organisiert war.19 Sowohl Gewerkschaften als auch Unternehmerverbände kamen zu dem Schluss, dass mit der Computerisierung des Schriftsatzes strukturelle Veränderungen in der Branche einhergingen: Die bisherige klare Abgrenzung zwischen einzelnen Berufen wurde genauso obsolet wie es bilaterale Verhandlungen zwischen der IG Druck und Papier und dem BDV wurden.20 Folglich kam es Ende November zu einem ersten Gespräch in großer Runde: mit allen erwähnten Gewerkschaften auf der einen (IG Druck und Papier/dju, DJV, HBV und DAG) und drei Unternehmerverbänden auf der anderen Seite (BVD, Bundesverband deutscher Zeitungsverleger – BVDZ und Verband deutscher Zeitschriftenverleger – VDZ). Der BVDZ hatte dieses Treffen aufgrund des „grenzüberschreitenden Charakters der neuen Zeitungssysteme“ initiiert, weil die Forderungen der Gewerkschaften über den Bereich des BVD hinausgehend Arbeitsplätze in den Verlagen betrafen.21 In dieser Zusammensetzung wurden ab Januar 1977 Tarifverhandlungen geführt, die im September 1977 abgebrochen wurden und – als auch die Schlichtungsverhandlungen im November 1977 ohne Ergebnis blieben – zunächst scheiterten.22 17 Vgl. AfsB, Sign. MüJe 8, Hauptvorstand der IG Druck und Papier: Protokoll der 9. Sitzung der Tarifkommission für die Druckindustrie am 27./28.9.1976 in Stuttgart, Bl. 4. 18 Vgl. IG Druck und Papier NRW: 12. Tätigkeitsbericht, S. 117. 19 Zur dju und zum DJV vgl. Betz, Klaus: Vom Berufsverband in der Gewerkschaft Kunst zur Berufsgruppe in der IG Druck und Papier, in: Publizistik & Kunst 40 (1991:4) [http://dju.verdi. de/ueber_die_dju/50_jahre_dju/geschichte, letzter Aufruf am 04.05.2017]. 20 Vgl. Industriegewerkschaft Druck und Papier, Hauptvorstand: Geschäftsbericht 1974 bis 1977, S. 135; AfsB, Sign. MüJe 13, Bundesverband deutscher Zeitungsverleger: Jahresbericht 1977, S. 18. 21 Ebd. 22 IG Druck und Papier NRW: 12. Tätigkeitsbericht, S. 117.
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“
123
Der Knackpunkt war die bereits erwähnte Forderung der Gewerkschaften nach Besetzungsregelungen. Die Unternehmerverbände stellten dabei zu ihrer Verwunderung fest, dass vermeintliche Interessenunterschiede zwischen den einzelnen Gewerkschaften – vor allem bezüglich der Frage danach, ob die (zukünftigen) Beschäftigten an den Bildschirmterminals als Facharbeiter oder als Angestellte eingestuft werden würden – bei den Verhandlungen „kaum sichtbar“ gewesen seien. Überraschenderweise habe der DJV sogar den Besetzungsregelungsforderungen der IG Druck und Papier „Flankenschutz“ gewährt.23 Die internen Diskussionen der IG Druck und Papier zeigen hingegen auf, wie fragil diese vermeintliche Einigkeit der Arbeitnehmervertretung war: Dem DJV war noch 1977 „spalterische[s] Verhalten“ vorgeworfen worden,24 bis er im Januar 1978 dann als zuverlässig eingestuft wurde, wohingegen auf die DAG und die HBV weiterhin „kein Verlass“ habe sein können.25 Die – nicht im DGB organisierte – DAG beteiligte sich dann auch nicht am Arbeitskampf des Frühjahres 1978.26 Eine ähnliche Überschätzung der vermeintlichen Einigkeit auf der anderen Seite des Verhandlungstisches zeigte sich auch bei der IG Druck und Papier: Vertreter der Gewerkschaftsspitze warnten intern eindringlich vor der „geballten Macht der Unternehmer“.27 Vor den Streiks wurde befürchtet, dass bei dieser Auseinandersetzung die „Solidarität der Unternehmer […] größer sein“ werde als diejenige der Arbeitnehmer.28 Auch diese Fassade der Solidarität bröckelte, wenn man ihr näher trat. So klagte nach dem Ende der Auseinandersetzungen und Abschluss des Tarifvertrages über die rechnergesteuerten Textsysteme (RTS-Tarifvertrag) das Zentralorgan des BVD Deutscher Drucker über die „mangelnde Solidarität“ der Unternehmer.29 Aus der geringen Bereitschaft, sich 23 AfsB, Bochum, Sign. MüJe 13, Bundesverband deutscher Zeitungsverleger: Jahresbericht 1977, S. 18 und S. 20. 24 IG Druck und Papier, Hauptvorstand: Geschäftsbericht 1974 bis 1977, S. 86. 25 AfsB, Sign. MüJe 8, Protokoll der 2. Sitzung der Tarifkommission Druckindustrie, 18./ 20.1.1978, Frankfurt (Main), Bl. 13. 26 Vgl. Ferlemann, Erwin: Rationalisierung oder Humanisierung. Unauflösbarer Widerspruch oder gewerkschaftliche Aufgabe?, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 31 (1980:4), S. 268–270, hier S. 269. 27 AfsB, Sign. MüJe 8, Protokoll der gemeinsamen Arbeitstagung von Tarifkommission Druckindustrie und Hauptvorstand der IG Druck und Papier am 19./20. Februar 1978, Frankfurt (Main), Bl. 13. 28 AfsB, Sign. MüJe 8, Protokoll der 2. Sitzung der Tarifkommission Druckindustrie, 18./ 20.1.1978, Bl. 13. 29 Anonym: „Statt Kollegen – egoistische Konkurrenz …“. Harte Kritik an der mangelnden Solidarität der Druckerei-Unternehmer, in: Deutscher Drucker 14 (1978:15), 11.5.1978, S. I u. XII. Der Soziologe Müller-Jentsch verwies bereits zeitgenössisch auf diese innerverbandlichen
124 Karsten Uhl
an der vom Verband beschlossenen Aussperrung zu beteiligen, wurde gar geschlossen, dass sich „das unternehmerische Denken in einer Krise“ befinde. An die Stelle des marktwirtschaftlichen Leistungswettbewerbs sei der reine Preiskampf getreten.30 Im Hintergrund stand auch hier ein Interessenunterschied, der direkt mit der neuen Technik zusammenhing. Insbesondere viele kleine Druckereien nahmen nicht an den Aussperrungen teil, weil für sie die Frage der Computerisierung des Schriftsatzes weder in der Gegenwart noch in der näheren Zukunft anstehe; das „tarifpolitische Kampfthema“ betraf sie aus ihrer Sicht also gar nicht.31 Den im April 1978 zwischen den drei Unternehmerverbänden einerseits und der IG Druck und Papier (samt dju) und DJV andererseits abgeschlossenen „Tarifvertrag über die Einführung und Anwendung rechnergesteuerter Textsysteme“ bezeichnete der Vorsitzende der IG Druck und Papier Mahlein als Erfolg der Gewerkschaft.32 In der Tat wurde in § 2 des Vertrags eine Arbeitsplatzsicherung vereinbart. Es wurde festgehalten, dass Gestaltungs- und Korrekturarbeiten im rechnergesteuerten Textsystem „durch geeignete Fachkräfte der Druckindustrie, insbesondere Schriftsetzer,“ auszuüben seien. Diese Festlegung galt für einen Zeitraum von acht Jahren nach der jeweiligen Einführung der neuen Technik in einem Betrieb.33 Neben der zeitlichen Befristung mussten die Gewerkschaften den Unternehmerverbänden zugestehen, dass von dieser Besetzungsregelung abgewichen werden dürfe, sofern „geeignete Fachkräfte der Druckindustrie am Arbeitsmarkt nicht verfügbar“ seien.34 Außerdem durfte von Redakteuren zwar nicht die Eingabe fremder Texte verlangt werden, es wurde allerdings nicht verhindert, dass Redakteure diese eigentlich den Schriftsetzern zugedachte Tätigkeit freiwillig ausführten.35 Auf diese Weise wurde letztlich durch die neuen Techniken und den RTSTarifvertrag die betriebliche Ebene gestärkt. Das ist bemerkenswert, da Mahlein während der Tarifauseinandersetzungen in einer internen Diskussion betont
Auseinandersetzungen, vgl. Müller-Jentsch, Walther: Der Arbeitskampf in der Druckindustrie 1978, in: Ders./Jacobi, Otto/Schmidt, Eberhardt (Hg.): Kritisches Gewerkschaftsjahrbuch 1978/ 79, Berlin 1979, S. 10–23, hier S. 19. 30 Anonym: Der unpolitische Unternehmer als Verbandsmitglied, in: Deutscher Drucker 14 (1978:16), 18.5.1978, S. IXf., hier S. X. 31 Anonym: „Statt Kollegen – egoistische Konkurrenz …“, S. XII. 32 Mahlein, Leonhard: Streik in der Druckindustrie. Erfolgreicher Widerstand, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 29 (1978:5), S. 261–271. 33 IG Druck und Papier u. a.: Tarifvertrag „Neue Technik“ in der Druckindustrie 1978, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 29 (1978:5), S. 310–316, hier S. 311. 34 Ebd. 35 Ebd., S. 315 (§ 15).
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“
125
hatte, dass Betriebsvereinbarungen für die Lösung struktureller Probleme, wie der Computerisierung der Druckbranche, ein untaugliches Mittel darstellten.36 Überhaupt war die Furcht vor einem „Betriebsegoismus“, der übergeordnete gewerkschaftliche Strategien vernachlässigte, zu dieser Zeit in der gewerkschaftlichen Diskussion sehr präsent.37 Nun kam den Betriebsräten zunächst die wichtige Rolle zu, die betriebliche Umsetzung des Tarifvertrages zu kontrollieren, weil dieser die Möglichkeit offen ließ, nicht im Sinne der Gewerkschaft zu wirken. In einem Kommentar zum Tarifvertrag schärfte die IG Druck und Papier den Betriebsräten ein, auf keinen Fall die Einstellung von Schreibkräften zu akzeptieren, falls im Unternehmen parallel mit der alten Technik weiterproduziert werde – was häufig vorkam – und folglich keine Facharbeiter für eine Tätigkeit an den Bildschirmterminals zur Verfügung standen. Andernfalls seien die entsprechenden Arbeitsplätze endgültig „für die Fachkräfte der Druckindustrie verloren“.38 Um zu verhindern, dass Redakteure freiwillig fremde Texte in das System eingäben, wurde den Betriebsräten „Aufklärungsarbeit“ empfohlen.39 Über solche defensiven Aufgaben hinausgehend ermöglichte der § 20 des Tarifvertrags explizit „ergänzende oder weitergehende Betriebsvereinbarungen“, wirkte also als Öffnungsklausel.40 Die IG Druck und Papier sah hier eine Möglichkeit, die betriebliche Mitbestimmung auf die Einführung neuer Techniken auszudehnen. Gesetzlich war lediglich fixiert, dass der Betriebsrat über neue Techniken informiert werden musste. Die Betriebsräte sollten nun versuchen, auf die „Auswahl und Planung“ des neuen Systems Einfluss zu nehmen.41 Unterschiedliche Beispiele für betriebliche Regelungen werden weiter unten zu besprechen sein.
36 Vgl. AfsB, Sign. MüJe 8, Protokoll der zentralen Tagung mit den Mitgliedern des erweiterten Vorstandes der IG Druck und Papier, der Tarifkommission Druckindustrie und Kolleginnen und Kollegen aus Zeitungs- und Zeitschriftenbetrieben am 10. Dezember 1977 in Frankfurt, Bl. 8. 37 Vgl. Kotthoff, Hermann: Zum Verhältnis von Betriebsrat und Gewerkschaft. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, in: Bergmann, Joachim (Hg.): Beiträge zur Soziologie der Gewerkschaften (Bibliothek Suhrkamp 905), Frankfurt 1979, S. 298–325. 38 IG Druck und Papier, Hauptvorstand/Deutsche Journalisten-Union (Hg.): Tarifvertrag über Einführung und Anwendung rechnergesteuerter Textsysteme. Handlungsanleitungen und Erläuterungen für die Praxis, Stuttgart 1979, S. 9. 39 Ebd., S. 75. 40 IG Druck und Papier u. a.: Tarifvertrag „Neue Technik“, S. 316. 41 IG Druck und Papier, Hauptvorstand/Deutsche Journalisten-Union (Hg.): Tarifvertrag, S. 69.
126 Karsten Uhl
Der Arbeitskampf der Times, transnationale Gewerkschaftspolitik und die Internationale Grafische Föderation Der Blick musste also zum einen auf das Nahe gerichtet sein, auf die lokale betriebliche Umsetzung der Computerisierung, gleichzeitig musste die IG Druck und Papier aber auch in die Ferne schauen: Die neuen Techniken machten eine Verlagerung der Produktion an einen anderen Standort, auch außerhalb der bestreikten Bundesrepublik, recht einfach möglich. Während der Streiks 1978 gab es einen Transfer der Zeitungs- oder Zeitschriftenherstellung in die Niederlande und die Schweiz, sowie nach Belgien, Dänemark, Österreich und Italien. Die Kommunikation der jeweiligen Gewerkschaftsorganisationen führte dabei zumeist zu Solidaritätsaktionen vor Ort und einer Verhinderung der Produktion, die von den Gewerkschaften als Streikbruch angesehen wurde.42 Bereits während des Streiks 1976 hatten die französischen Gewerkschaftskollegen die Übernahme deutscher Druckaufträge verhindert.43 Ähnliche Solidaritätsaktionen gab es in den Niederlanden, der Schweiz und Großbritannien.44 Schon 1959 hatte umgekehrt die IG Druck und Papier während eines Streiks in Großbritannien die Ausführung des Drucks in der Bundesrepublik verhindert.45 Die Verlagerung der Produktion war also nichts völlig Neues, wohl aber vereinfachten die neuen Techniken ein solches Vorhaben. Mitte der siebziger Jahre experimentierte der Verlag des Wallstreet Journal bereits mit der Datenübermittlung per Satellit, um mit dezentralen über die USA verteilten Druckereien Transportkosten zu sparen. Die International Herald Tribune übertrug zu dieser Zeit Daten per Funk und Ka-
42 Vgl. Hindrichs, Wolfgang/Mäulen, Claus/Scharf, Günter: Neue Technologien und Arbeitskampf. (Mensch und Technik. Sozialverträgliche Technikgestaltung – Materialien und Berichte 9), Opladen 1988, S. 305. 43 Vgl. AfsB, Sign. MüJe 12, Informations-Dienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten, Nr. 124 (8.5.1976), S. 6. 44 Vgl. o. A.: Internationale Solidarität, in: Druck und Papier (1976:8), S. 2; o. A.: Internationale Solidarität, in: Druck und Papier (1976:9), S. 3. 45 Vgl. Priemel, Kim Christian: Gewerkschaftsmacht? Britische und westdeutsche Gewerkschaften im Strukturwandel, in: Raithel, Thomas/Schlemmer, Thomas (Hg.): Die Rückkehr der Arbeitslosigkeit. Die Bundesrepublik im europäischen Kontext 1973 bis 1989 (Zeitgeschichte im Gespräch 5), München 2009, S. 107–120, hier S. 111. Das Arbeitsgericht Wuppertal verpflichtete 1959 allerdings die deutsche Gewerkschaft zur Leistung von Schadensersatz, vgl. Bulla, Werner: Solidaritätsstreiks nur mit Einschränkungen zulässig, in: Druckwelt Nr. 11 (1.6.1979), S. 738–744, hier S. 744.
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“
127
bel von ihrem Redaktionssitz in Paris nach London, um dort die britische und die skandinavische Ausgabe zu drucken.46 Im Kontext dieser neuen technologischen Möglichkeiten kehrte der Zeitungsstreik ein Jahr nach Abschluss des RTS-Tarifvertrags unvermutet für eine kurze Zeit und lokal begrenzt nach Deutschland zurück. Die vielleicht bekannteste Zeitung der Welt, die Londoner The Times, war seit Dezember 1978 nicht mehr erschienen, weil der Verlag in einem zähen und langwierigen Arbeitskampf um die Einführung des Computersatzes die Herstellung auf unbestimmte Zeit einstellte.47 Für Ende April 1979, just vor der Unterhauswahl in Großbritannien, plante der Verlag die Produktion einer Wochenzeitung, die ebenfalls unter dem Namen The Times (mit dem Zusatz International Weekly Edition) in einer Auflagenhöhe von 35 000 Exemplaren auf dem europäischen Kontinent und in Nordamerika erscheinen sollte.48 Die gewerkschaftlich organisierten Journalisten und Journalistinnen der Times hatten mit knapper Mehrheit einer Mitarbeit an diesem Vorhaben zugestimmt.49 Die britische Gewerkschaft National Graphical Association (NGA) hatte von diesen Plänen erfahren und in der Annahme, die Bundesrepublik sei ein mögliches Ziel der Produktionsverlagerung, die deutsche Schwestergewerkschaft aufgefordert, einen etwaigen Versuch der Zeitungsproduktion zu verhindern.50 Funktionäre der IG Druck und Papier wiesen später darauf hin, dass sie zum einen durch die Satzung der Internationalen Graphischen Föderation (IGF) dazu verpflichtet waren, bei internationalen Streiks Auftragsverlagerungen außer Landes zu unterbinden,51 und dass sie eine solche Aktion zum anderen als
46 Vgl. Winsbury: New Technology, S. 53. Ab September 1980 übertrug die Pariser Druckerei der International Herald Tribune Faksimile der Druckseiten per Satellitenverbindung nach Hongkong, vgl. AdsD, Bestand IGF, Sign. 367, Heinz Deckert: Einführungsreferat des Präsidenten des Ständigen Komitees der Gewerkschaften der Grafischen Industrie zur V. Internationalen Konsultativkonferenz der Gewerkschaften der grafischen Industrie vom 12. bis 14. Mai 1981 in Budapest, Bl. 44. 47 Vgl. Stewart, Graham: The History of the Times, Vol. VII: 1981–2002. The Murdoch Years, London 2005, S. 2 und S. 13. 48 O. A.: „Times“-Wochenausgabe erschien doch nicht, in: Deutscher Drucker Nr. 14 (3.5.1979). 49 Vgl. AdsD, Sign. 5/MEDA 119006, dpa-Meldung vom 25.4.1979: „Times“ in Zeppelinheim gedruckt – Proteste und Demonstrationen. 50 Vgl. AfsB, Sign. MüJe 142, Schreiben des Rechtsanwalts Gebhard Ohnesorge an den Deutschen Presserat, Beschwerdeausschuss, Frankfurt, 31.5.1979, Bl. 2. Ohnesorge vertrat den Verlag Times Newspaper Limited, zudem war er seit 1969 Geschäftsführer des Verbandes hessischer Zeitungsverleger. 51 Vgl. o. A.: „Times“-Auseinandersetzung. Hensche: Solidaritätsstreik ist rechtlich unumstritten, in: Handelsblatt (3.5.1979).
128 Karsten Uhl
selbstverständliche „Dankesschuld“ gegenüber den „europäischen Brüdergewerkschaften“ wegen deren Unterstützung während des deutschen Arbeitskampfs 1978 verstanden.52 Die tatsächliche Produktionsverlagerung beschrieb die Bonner Times-Korrespondentin Patricia Clough rückblickend wie folgt: Am 22. April 1979 seien fünf Mitglieder der Londoner Redaktion per Anruf aufgefordert worden, umgehend nach Frankfurt zu fliegen und Schweigen zu wahren. Im nahen Darmstadt wurde dann die Zeitung just mit jener Technik – computergestützten Fotosatz – gesetzt, um die in London der Arbeitskampf tobte. Die redigierten Manuskripte wurden aus London per Kurier nach Darmstadt geschickt, dort wurden sie gesetzt und korrigiert. Vorgesehen war, dass diese Produktionsweise „eine ständige Einrichtung“ werden sollte.53 Die Times hatte für dieses Vorhaben die kleine Setzerei Otto Gutfreund und Sohn ausgewählt, die mit nur 20 Beschäftigten diese Aufgabe umsetzen konnte. Vor allem sprach aber für Gutfreund, dass nur zwei Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert waren, die IG Druck und Papier also nicht die Möglichkeit besaß, einen Streik auszurufen.54 Der Hauptvorstand der IG Druck und Papier erfuhr den Produktionsstandort erst, als die Zeitung vermeintlich bereits gesetzt – aber noch nicht gedruckt – war. Gutfreund hatte gegenüber der Gewerkschaft freilich etwas übertrieben: Vollständig war die Arbeit am Schriftsatz noch nicht abgeschlossen, beispielsweise fehlten noch die aktuellen Fußballergebnisse. Der Hauptvorstand der Gewerkschaft ließ sich allerdings täuschen und konzentrierte sich nun auf die Möglichkeit, den Druck der Zeitung zu unterbinden. Folglich bat der Vorstand in einer Mitteilung vom 25. April alle Landesbezirke um Hinweise auf den Druckort. Gleichzeitig wurden Solidaritätsmaßnahmen beschlossen, um die Fertigstellung des Blattes doch noch zu verhindern.55 Am gleichen Tag wurde dann bereits bekannt, dass die Zeitung im sehr nahe gelegenen Neu-Isenburg am Rande Frankfurts gedruckt werden sollte. Es handelte sich wiederum um einen kaum gewerkschaftlich organisierten Betrieb, nämlich das Unternehmen TER-Druck, das die Deutsch-
52 Fritz, Hans-Georg: Leserbrief, in: Frankfurter Rundschau (4.5.1979). Fritz war Bezirksvorsitzender der IG Druck und Papier in Frankfurt. 53 Vgl. Clough, Patricia: Wie die deutschen Gewerkschaften der „Times“ den Mund verboten, in: Die Welt (2.5.1979). 54 Vgl. Bechthold, Albert: Die Auslandsausgabe einer britischen Zeitung und die Pressefreiheit hierzulande, in: Stuttgarter Nachrichten (3.5.1979); Borgmann, Wolfgang: Der Kampf um die „Times“ wird auch in Darmstadt geführt, in: Stuttgarter Zeitung (26.4.1979). 55 AdsD, Sign. 5/MEDA 119007, IG Druck und Papier, Hauptvorstand: Mitteilung an alle Landesbezirke, 25.4.1979; Jacobs, Eric: Stop Press. The Inside Story of the Times Dispute, London 1980, S. 97.
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“
129
land-Ausgabe der faschistischen türkischen Zeitung Tercüman produzierte und hauptsächlich türkische Migranten beschäftigte.56 Vom 27. bis zum 29. April, also das gesamte Wochenende, fand vor TERDruck eine Solidaritätsaktion von transnationaler Bedeutung statt: Der NGASekretär John Willats forderte vor Ort eine Gruppe von deutschen Gewerkschaftern, Mitgliedern verschiedener linker Gruppen und Mitgliedern unterschiedlicher türkischer Arbeitervereine („Vereinigung der Arbeiter aus der Türkei“, das „Türkische Volkshaus“ und „Verein türkischer Jugendlicher“) auf, in Leistung internationaler Solidarität die als Streikbruch angesehene Produktionsverlagerung zu verhindern. Am dritten Tag der Blockade verzichteten schließlich TERDruck und die Times am Sonntag auf die Fortsetzung des Drucks.57
Abb. 1: Protestaktion des Türkischen Volkshauses Frankfurt gegen TER-Druck, Neu-Isenburg, April 1979. Dokumentationszentrum und Museum für die Migration in Deutschland (Domid), Köln, Sign. A000058. 56 Vgl. Borgmann: Kampf. 57 Vgl. o. A., Neu-Isenburg: Gegen Druck der „Times“, in: Frankfurter Rundschau (28.4.1979); Bulla: Solidaritätsstreiks, S. 738. Um die Rechtmäßigkeit und einen etwaigen gewalttätigen und strafbaren Charakter der Gewerkschaftsaktion wurde dann noch mehrere Jahre vor Gericht gestritten, vgl. o. A.: Flaggschiff blockiert, in: Der Spiegel Nr. 13 (22.3.1981), S. 90–92.
130 Karsten Uhl
Ende Mai 1979 wurden dann konkrete Pläne zum Druck der wöchentlichen Auslandsausgabe der Times in Portugal von den dortigen Gewerkschaften verhindert.58 Auch Überlegungen zur Verlagerung der Zeitungsherstellung nach Griechenland oder in die Schweiz trafen auf den Widerstand der jeweiligen nationalen Gewerkschaften.59 Die IGF, deren Präsident der Vorsitzende der IG Druck und Papier Mahlein war, beschloss bereits Mitte Mai in direkter Bezugnahme zur deutschen Solidaritätsaktion gegen die Times die Gründung eines internationalen Solidaritätsfonds für die Arbeiter der grafischen Industrie.60 Für die Beschäftigten bei der Times in London schien der Arbeitskampf zunächst erfolgreich zu sein: Rupert Murdochs Konzern übernahm Anfang 1981 die Zeitung und schloss einen Kompromiss mit den Gewerkschaften, der eine starke Reduzierung der Setzerei – allerdings unter Verzicht auf Entlassungen – und eine Besetzungsreglung an den neuen Bildschirmterminals vorsah, die ausschließlich Schriftsetzern deren Bedienung genehmigte.61 Der optimistische Ausruf des Präsidenten der NGA – „Wir haben die Schlacht um die neue Technologie gewonnen“ – war jedoch verfrüht.62 Fünf Jahre später wurden die traditionellen Verlagsräume in der Londoner Fleet Street verlassen: Der neue Redaktionssitz samt Druckzentrum im Hafenviertel Wapping wurde mit modernsten Computern ausgestattet. Die nun neueste Technik des Desktop Publishing machte es möglich, dass vollständig auf die ehemaligen Schriftsetzer verzichtet werden konnte, deren Tätigkeit nun überflüssig geworden war.63 Insgesamt stieg in dieser heißen Phase der Computerisierung der Druckindustrie, also in den Jahren um 1980, die Bedeutung der transnationalen Gewerkschaftspolitik. Global kam es in vielen kapitalistischen Staaten zu ähnlichen Arbeitskämpfen wie in der Bundesrepublik und Großbritannien.64 Dabei fand auch auf internationaler Ebene eine Annäherung der grafischen Gewerkschaften und der Journalistengewerkschaften statt. Im November 1978 disku58 Vgl. Mayer, Gisela: Erfolgreiche Solidaritätsaktion zeigt auch in England Wirkung, in: Nachrichten zur Wirtschafts- und Sozialpolitik (1979:6), S. 21. 59 Vgl. AdsD, Sign. 5/MEDA 119006, dpa-Meldung vom 30.5.1979: Griechische Presse-Gewerkschaften gegen „Times“-Druck in Griechenland (dpa 082 pl/m); vgl. Zentralsekretariat des Schweizer Typographenbundes (STB): Times-Konflikt, in: Helvetische Typographia (23.5.1979), S. 1 f., hier S. 1. 60 Vgl. AdsD, Sign. 5/MEDA 119006, Internationale Grafische Föderation: Zirkular 679 (22.5.1979). 61 Vgl. o. A.: Kompromiß sichert Fortbestand der „Times“, in: Druck und Papier (1981:4), S. 4. 62 Vgl. Zoller, Helga: Les Dixon: „Wir haben die Schlacht um die neue Technik gewonnen“, in: Druck und Papier (1979:25), 3.12.1979, S. 11–14, hier S. 11. 63 Vgl. Stewart: History of the Times, S. 219 ff. 64 Vgl. AdsD, Bestand IGF, Sign. 367, Deckert: Einführungsreferat, Bl. 7. Deckert verwies auf Entwicklungen in Japan, Indien, Australien, Peru, Panama und Venezuela.
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“
131
tierten im Rahmen einer von den beiden Berufssekretariaten Internationale Journalisten-Föderation (IJF) und IGF organisierten Berliner Tagung zum Thema „Neue Technologie“ erstmals Gewerkschaftsvertreter beider Branchen auf europäischer Ebene miteinander. Die IG Druck und Papier bezeichnete diese Konferenz als eine „erste Antwort auf die immer stärkere Zusammenarbeit der Medienunternehmen im europäischen Raum“.65 Der IGF, der 1982 insgesamt 39 nationale Gewerkschaften mit mehr als 700 000 Mitgliedern angehörten,66 stellte sich neben dieser Ausweitung der Kooperation mit der IJF eine weitere zentrale Aufgabe: Im Kalten Krieg war die Gewerkschaftsbewegung gespalten. Während in der IGF die sozialdemokratischen Gewerkschaften des Internationalen Bundes freier Gewerkschaften organisiert waren, vertrat das Ständige Komitee der Gewerkschaften der Grafischen Industrie (SKGGI) die kommunistischen Gewerkschaften des Weltgewerkschaftsbundes. Als Ergebnis einer langjährigen Annäherungspolitik wurde schließlich 1985 in Wien eine gemeinsame Konferenz abgehalten, bei der ebenfalls die Folgen des technologischen Wandels im Zentrum der Diskussion standen.67 Einige Mitgliedsgewerkschaften der IGF vollzogen in Folge des technologischen Strukturwandels eine organisatorische Veränderung von der Berufsgewerkschaft – also beispielsweise der Schriftsetzer oder Drucker – hin zur Industriegewerkschaft für die gesamte Branche. Entsprechende Zusammenschlüsse gab es um 1980 in Großbritannien, der Schweiz und den Niederlanden.68 Solche Vergrößerungen und Stärkungen der Gewerkschaften auf nationaler Ebene sollten durch eine Verstärkung der internationalen Abstimmung ergänzt werden. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe von IGF und IJF betonte 1982, es sei entscheidend, einen „einheitlichen Standpunkt“ zur gewerkschaftlichen Technologie- und Ausbildungspolitik zu entwickeln. Dazu müsse auch die Bereitschaft zählen, die neuen Technologien in einzelnen Bereichen strategisch abzulehnen.69 Darunter wurde aber keinesfalls eine generelle Ablehnung des technologischen Wandels verstanden; es ging vielmehr darum, auf die konkrete 65 AdsD, Sign. 5/MEDA 119006, Presseinformation der IG Druck und Papier, Hauptvorstand: Detlev Hensche, September 1978. 66 Vgl. Mahlein, Leonhard: Gewerkschaften international. Im Spannungsfeld zwischen Ost und West, Frankfurt (Main) 1984, S. 35. 67 Vgl. Uhl, Karsten: Computerisierung, deutsch-deutsche Gewerkschaftsgeschichte und europäische Vernetzung im Kontext des Kalten Krieges. Die Arbeitskämpfe in der bundesdeutschen Druckindustrie in den 1970er- und 1980er-Jahren, in: Buschak, Willy (Hg.): Solidarität im Wandel der Zeiten. 150 Jahre Gewerkschaften, Essen 2016, S. 277–302. 68 Vgl. Internationale Grafische Föderation (Hg.): Tätigkeitsbericht vom 1. Januar bis 31. Dezember 1981, Bern o. J., S. 8. 69 AdsD. Bestand der IGF, Sign. 138, Protokoll der Sitzung der IJF/IGF Arbeitsgruppe (25.5.1982, Bern), Bern, 30.6.1982, Bl. 3.
132 Karsten Uhl
Gestaltung der Veränderungen im Sinne der Beschäftigten einwirken zu können, wofür eine internationale Abstimmung als unverzichtbar betrachtet wurde.70 Das Protokoll einer IGF-Arbeitsgruppe von 1984 gibt allerdings einen Hinweis darauf, dass die Appelle an die internationale Solidarität und einige erfolgreiche Solidaritätsaktionen zur Verhinderung von Produktionsverlagerungen wie im Falle der Times kein vollständiges Bild der tatsächlichen internationalen Gewerkschaftskooperation geben: In dieser internen Besprechung wurde nämlich explizit darauf hingewiesen, dass es schwer war, die jeweiligen Gewerkschaftsmitglieder zur Unterstützung ausländischer Schwestergewerkschaften zu mobilisieren.71 Ein zusätzliches Problem bestand in der Auftragsverlagerung durch multinationale Unternehmen in sozialistische Staaten wie Ungarn, die als „Billiglohnländer“ fungierten und vom Devisentransfer abhängig waren.72
Verbetrieblichung der Tarifpolitik Die transnationale Ebene ist ausgesprochen wichtig zur Einordnung der Transformation in der Druckindustrie, für die Beschäftigten selbst schien aber zunächst die jeweilige lokale Entwicklung entscheidend zu sein. Aus der Perspektive des fortgesetzten technologischen Wandels nach dem vollzogenen Umbruch in der Druckindustrie stellte der Sozialwissenschaftler Weinert 1987 über diese Branche hinausgehend für die gesamte Gewerkschaftspolitik fest, dass die Betriebsräte zur „zentrale[n] Instanz“ für die „gewerkschaftliche Forderung nach der sozialen Beherrschbarkeit des technologischen Wandels“ geworden seien.73 Zu Beginn der Computerisierungsphase in der Druckindustrie war dieser lokale Fokus auf den jeweiligen Betrieb noch stärker ausgeprägt, weil der technologische Wandel in sehr unterschiedlichen Tempi stattfand. Zu den frühen Anwendern der neuen Technik in der Bundesrepublik gehörte M. DuMont Schauberg in Köln. Bereits im Herbst 1973 setzte der Vorsitzende 70 Vgl. AdsD. Bestand der IGF, Sign. 138, Protokoll der Sitzung der IGF-Arbeitsgruppe Aktionsprogramm (2.2.1984 in Bern), Bern, 6.3.1984, Bl. 3. 71 Vgl. ebd., Bl. 4. Der Vorsitzende der IG Druck und Papier, Leonhard Mahlein, zweifelte schon 1978, ob es weiterhin gelingen würde, Auslandsverlagerungen in internationaler Solidarität zu verhindern, vgl. AfsB, Sign. MüJe 8, IG Druck und Papier, Hauptvorstand: Protokoll der 2. Sitzung der Tarifkommission Druckindustrie, 18./20.1.1978, Bl. 8. 72 AdsD, Bestand der IGF, Sign. 138, Protokoll der Sitzung der IGF/SKGGI Studiengruppe (23.26.11.1983 in Birkenstein, BRD), o. O., 16.1.1986, Bl. 3.; vgl. AdsD, Bestand IGF, Sign. 367, Deckert: Einführungsreferat, Bl. 4 f. 73 Weinert, Rainer: Kooperative Konfliktverarbeitung in der Krise?, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 38 (1987:5), S. 298–305, hier S. 304.
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“
133
der Geschäftsführung Alfred Neven DuMont eine Planungskommission für die neue Technik ein, die einen Fünf-Jahres-Plan für den Umstieg entwickelte. Technisch erschien der Unternehmensleitung die Umstellung auf computerisierten Fotosatz durchaus schneller möglich zu sein, sie wollte jedoch etwaige betriebliche Auseinandersetzungen weitgehend vermeiden und ein Betriebsklima des Vertrauens schaffen. Folglich wurde der Betriebsrat über die gesetzlichen Mitbestimmungsrechte hinausgehend in die Planungen einbezogen und die Belegschaft regelmäßig über den Stand der Planung informiert. Weiterhin wurde ein zusätzliches Betriebsratsmitglied von der Arbeit freigestellt, um sich ausschließlich mit Fragen der neuen Technik beschäftigen zu können. Der Betriebsratsvorsitzende betonte dabei, dass die Interessensunterschiede zwischen dem Unternehmen und dem Betriebsrat keinesfalls ausgeblendet worden seien. Vielmehr sei die Zusammenarbeit von harten Auseinandersetzungen geprägt gewesen.74 Der Betriebsrat bei M. DuMont Schauberg war durchaus der Gewerkschaftsspitze verbunden und betonte im März 1977 in einer Broschüre, dass Betriebsvereinbarungen generell vor Abschluss dem Hauptvorstand der IG Druck und Papier vorgelegt werden sollten.75 Gleichzeitig stellte der Betriebsrat aber auch eine „Kompetenzverlagerung in tarifpolitischen Fragen“ fest. Der lokal sehr unterschiedliche Stand bei der Einführung der neuen Technik mache vor einer bundesweiten tariflichen Lösung zunächst Betriebsvereinbarungen notwendig. Hierin bestehe vorerst die einzige Möglichkeit, „gezielt in die Gesamtproblematik einzusteigen und sie zu beeinflussen“.76 In diesem Sinne positionierte sich der Betriebsrat also nicht in Konkurrenz zur Gewerkschaftsspitze, sondern sah Betriebsvereinbarungen als notwendige Vorarbeit an, um auf die konkrete soziale Gestaltung der neuen Technologien einwirken zu können. Ohne diese lokale Beeinflussung erschien in dieser Perspektive ein späterer Tarifabschluss wenig erfolgversprechend, weil dann die Unternehmen unter Umständen bereits vollendete Tatsachen hätten schaffen können. Die im März 1977 geschlossene Betriebsvereinbarung, die am 1.4.1977 in Kraft trat, hielt dann auch eine weitgehende Mitwirkung des Betriebsrats bei der Einführung neuer Technologien mit dem Recht auf „rechtzeitige und umfassende Information“ fest. Im Sinne der Vereinbarung war der Betriebsrat ein „mit gleichem Wissensstand ausge-
74 Vgl. Michaels, Heinz: „Besser geht’s nicht“. Wie sich der Kölner Stadt-Anzeiger auf die neue Technik einstellt, in: Die Zeit Nr. 12 (24.3.1978). 75 Vgl. AfsB, Sign. MüJe 11, Betriebsrat M. DuMont Schauberg/ Manfred Dullin: Neue Technik in der Druckindustrie. Ihre Entwicklung. Was bleibt? Was tun?, Broschüre, Köln, März 1977, S. 19. 76 Ebd., S. 18.
134 Karsten Uhl
statteter Partner der Unternehmensleitung“.77 Wie bereits dargestellt, gelang es der IG Druck und Papier nicht, dermaßen weitgehende Bestimmungen in den RTS-Tarifvertrag einzubauen, der ein Jahr später in Kraft trat. Der Öffnungsklausel für weitergehende betriebliche Regelungen kam also tatsächlich entscheidende Bedeutung zu. Die angesprochene Kompetenzverlagerung hin zur betrieblichen Ebene zeigte sich auch bei Gruner + Jahr in Hamburg. Die Betriebsrätin Heike Issaias stand allerdings deutlich kritischer zur Gewerkschaftsspitze als die Kölner Kollegen von M. DuMont Schauberg. Der RTS-Tarifvertrag zeuge teilweise von einem gewissen „Mangel an Kenntnis über die neue Technik“.78 Ähnlich wie in Köln wurde auch in Hamburg die neue Technik behutsam eingeführt: Zunächst erzeugten 14 Bildschirmgeräte Lochstreifen zur Steuerung von Bleisatzmaschinen, auf elektronischen Lichtsatz wurde erst Ende 1979 umgestellt. Trotzdem waren die Auseinandersetzungen in Hamburg ungleich härter als beim Kölner Unternehmen; sie wurden sogar von arbeitsgerichtlichen Prozessen geprägt.79 Erst eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Hamburg verpflichtete Gruner + Jahr im Dezember 1976 dazu, den Betriebsrat über die geplante Einführung eines rechnergestützten Textsystems zu informieren.80 In der Folge wurde auch in diesem Betrieb eine Betriebsvereinbarung im Jahr 1977 geschlossen. Hierbei handelte es sich um ein klassisches Rationalisierungsschutzabkommen, das den Schriftsetzern eine Versetzung in die Schlussredaktion zusicherte.81 Weitergehend war eine zweite Betriebsvereinbarung über die rechnergestützten Textsysteme im Jahr 1980. Betriebsrat und Management waren sich bezüglich ihrer Kritik am RTS-Tarifvertrag darin einig, dass dieser „für den Alltag ungeeignet“ sei, weshalb diese betriebliche Regelung von beiden Seiten für notwendig erachtet wurde.82 Deutlich über diesen Tarifvertrag hinaus ging vor allem die Einführung eines Rotationsprinzips: Da in Hamburg parallel zu den Bildschirmter77 AfsB, Sign. MüJe 11, Betriebsvereinbarung über die Einführung und Anwendung eines neuen Zeitungssystems (GPA) zwischen der Firma M. DuMont Schauberg, Köln, und dem Betriebsrat der Firma M. DuMont Schauberg, Köln, 17.3.1977, Bl. 5. 78 Gaul, Richard: Richter als Schlichter. Computer am Arbeitsplatz: Beim Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr rollte eine Lawine von Prozessen zwischen Betriebsrat und Management, in: Die Zeit Nr. 4 (19.1.1979), S. 19. 79 Vgl. ebd. 80 Vgl. Duhm, Rainer/Mückenberger, Ulrich: Unsere Utopie: daß alle alles machen, in: Jacobi, Otto/Schmidt, Eberhard/Müller-Jentsch, Walther (Hg.): Kritisches Gewerkschaftsjahrbuch 1981/ 82, Berlin 1981, S. 66–83, hier: S. 68. 81 Vgl. Issaias, Heike: Unsere Idee. Alle machen alles. Rotation in der Gruppe bei Gruner und Jahr, in: Roth, Siegfried/Kohl, Heribert (Hg.): Perspektive. Gruppenarbeit, Köln 1988, S. 115– 122, hier: S. 115. 82 Vgl. Gaul: Richter, S. 19.
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“
135
minals auch noch mit Bleisatz gearbeitet wurde, hielt diese Regelung fest, dass alle Beschäftigten in den neuen Technologien ausgebildet werden sollten, nach Beendigung dieser Schulung aber „ins Blei zurück“ mussten, um damit die Spaltung der Belegschaft zu verhindern und eine allgemeine Qualifizierung auch in den neuen Methoden zu sichern. Im Rückblick zeigte sich 1988 jedoch, dass eine Ausnahmeregelung in der Betriebsvereinbarung als Pferdefuß wirkte: Nach acht Jahren bestand die Belegschaft jeweils zur Hälfte aus Rotierern und Nichtrotierern.83 Es soll nicht der Eindruck entstehen, als wäre der Abschluss von Betriebsvereinbarungen, die im Sinne des Betriebsrats und der Gewerkschaft weit über den RTS-Tarifvertrag hinausgingen, die betriebliche Normalität gewesen. So war beispielsweise beim Unternehmen Mohndruck in Gütersloh, das ebenso wie Gruner + Jahr zum Bertelsmann-Konzern gehörte, der Einfluss der Gewerkschaft äußerst gering; während der Tarifauseinandersetzungen 1978 nahmen die Beschäftigten nicht am Streik teil.84 Der Konzernchef Reinhard Mohn hatte ein enges Verhältnis zu den langjährigen Betriebsratsvorsitzenden, hielt aber wenig von Gewerkschaftsfunktionären wegen deren vermeintlich fehlender fachlicher Qualifikation.85 Mohndruck gehörte ebenfalls zu den frühesten deutschen Anwendern der neuen Satztechnik, 1969 nahm das Unternehmen sogar die erste rechnergesteuerte Fotosatzanlage in der Bundesrepublik in Betrieb.86 Ähnlich wie bei DuMont und Gruner + Jahr gab es noch eine längere Übergangsphase mit Parallelbetrieb von alter und neuer Technik, bis die Bleisatzära 1980 endgültig in Gütersloh beendet war.87 Anfang der achtziger Jahre war Bertelsmann dann mit Mohndruck und mit dem Taschenbuchdruck in einem Berliner Unternehmensteil weltweit führend bei der Automatisierung des Buchdrucks;88 der technologische Wandel war also keineswegs auf den Schriftsatz beschränkt – die Setzer spürten nur als erste in der Branche seine Auswirkungen.89 83 Vgl. Issaias: Idee, S. 117 f. 84 Vgl. Deutscher Drucker Nr. 11 (6.4.1978), S. II. 85 Vgl. Wischermann, Clemens: Unternehmenskultur bei Bertelsmann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Bertelsmann AG (Hg.): 175 Jahre Bertelsmann. Eine Zukunftsgeschichte, Gütersloh 2010, S. 238–281, hier S. 255. 86 Vgl. Büchner, Rudolf: Chronik Bertelsmann Industrie 1824–1991, Gütersloh 41992, S. 81. 87 Vgl. ebd., S. 137. 88 Vgl. Gilson, Norbert: Dienstleistungen in einer digitalisierten Gesellschaft. Die Arvato AG, in: Bertelsmann AG (Hg.): 175 Jahre Bertelsmann, S. 330–371, hier S. 356 f. 89 Stein hat darauf hingewiesen, dass der Wandel im Druckbereich anders als der Umbruch im Schriftsatz deutlich weniger stark von der Forschung wahrgenommen wurde, vgl. Stein, Jesse Adams: Masculinity and Material Culture in Technological Transitions. From Letterpress to Offset-Lithography, 1960s-1980s, in: Technology & Culture 57 (2016:1), S. 24–53.
136 Karsten Uhl
Aus gewerkschaftlicher Perspektive wurde Mohndruck vorgeworfen, die Werksgemeinschaftsstrategie der zwanziger Jahre in neuer Form anzuwenden. Der Betriebsrat werde gegen die Gewerkschaft ausgespielt und ließe sich für die Zwecke der Unternehmensleitung einspannen.90 In der Tat hatte die Unternehmensspitze bereits während der Diskussion um die Ausweitung betrieblicher Mitbestimmung Mitte der siebziger Jahre betont, dass es ihr keinesfalls um eine Demokratisierung des Betriebes, sondern um eine „Mitsprache am Arbeitsplatz“ gehe. Während 1974 noch Planungen eine „Mitbestimmungsmodells“ bei Mohndruck entwickelt wurden, verschwand bis 1976 der Begriff „Mitbestimmung“ aus der betrieblichen Diskussion und wurde durch das unverbindliche „Mitsprache“ ersetzt.91 Eine Mischung aus übertariflichen Löhnen und regelmäßigen Mitarbeiterbesprechungen schuf ein Betriebsklima, in dem auch bei der mit der Umstellung auf Fotosatz einhergehenden Reduzierung der Mitarbeiterzahl keine Unruhen aufkamen.92
Fazit Wie haben sich nun die „frechen rechnergesteuerten Systeme“, die in der Streikzeitung 1978 geradezu zu historischen Akteuren erhoben wurden, auf die Gestaltung der industriellen Beziehungen in der bundesdeutschen Druckindustrie ausgewirkt? Anders als der britische Beobachter bei seinem Besuch in den USA 1975 gehofft hatte, wurde der technologische Umbruch in Großbritannien wie in der Bundesrepublik und den anderen europäischen Staaten von großen Arbeitskämpfen begleitet. Die monatelangen harten Auseinandersetzungen bei der Times markierten die Spitze, aber zähe Tarifverhandlungen mit mehrtägigen 90 Vgl. AdsD, Sign. 5/MEDA 423059, Dr. Herbert Kubicek, Sie haben die Seele gefunden! Neue Führungstechniken als unternehmerische Strategie zur Arbeitsintensivierung und Herrschaftssicherung. Manuskript des Referats auf dem 10. Bundes-Angestelltentag des DGB, Okt. 1981, AG IV. Darin: Übersicht 6: Führungsgrundsätze. Das Beispiel Bertelsmann, Bl. 1. 91 Vgl. Wischermann: Unternehmenskultur, S. 253. 92 Jungblut, Michael: Vetorecht für Mitarbeiter. Beispiel Mohndruck: Auch im Unternehmen können Entscheidungen demokratisch vorbereitet werden, in: Die Zeit Nr. 42 (8.10.1976). Anders als die Überschrift des Zeit-Artikels verheißt, gab es bei Mohndruck kein Vetorecht für Mitarbeiter im eigentlichen Sinne. Die Mitarbeiter konnten eine von ihnen nicht gutgeheißene Entscheidung ihres Abteilungsleiters auf der Mitarbeiterbesprechung zur Abstimmung stellen. Falls sich eine Zweidrittelmehrheit für die Ablehnung der Vorgesetztenentscheidung fand, musste der nächsthöhere Vorgesetzte eine endgültige Entscheidung treffen, vgl. ebd. Es handelte sich also vielmehr um eine Ausweitung der Entscheidungskontrolle, nicht um ein verhinderndes Vetorecht.
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“
137
Streiks waren aufgrund der großen Interessenunterschiede offenbar nahezu unabwendbar, bevor dann doch Kompromisse möglich wurden. Die Transformation der Branche war unübersehbar, Berufsgrenzen – und damit auch die Zuständigkeit verschiedener Gewerkschaften – wurden uneindeutig. Während einige europäische Spartengewerkschaften zunächst den Zusammenschluss zur Industriegewerkschaft suchten, bereitete die bundesdeutsche IG Druck und Papier bereits den Weg zur Mediengewerkschaft vor.93 Die Computerisierung der Branche wurde von einer Globalisierungsbewegung begleitet: Zum einen wuchsen multinationale Medienkonzerne rasant zu Global Playern, zum anderen nahm die internationale Kooperation verschiedener Medienunternehmen zu. Sie machte nicht am Eisernen Vorhang Halt und konnte außerdem auch Kleinunternehmen wie eine Darmstädter Maschinensetzerei in ein internationales Netzwerk einflechten. Die Gewerkschaften reagierten mit einer verstärkten Europäisierung ihrer Politik. Dabei konnten sie auf eine lange Tradition zurückgreifen, der erste Vorgänger der IGF wurde beispielsweise im 19. Jahrhundert gegründet.94 Die internationale Abstimmung der Gewerkschaftspolitik und die transnationale Organisation der IGF als Verbindungsstelle bekamen jedoch durch die von Computerisierung und Globalisierung geschaffenen neuen Möglichkeiten zur grenzüberschreitenden Produktionsverlagerung eine neue Bedeutung. Die nationale Tarifpolitik der IG Druck und Papier musste neben der internationalen auch die lokale Perspektive stärker berücksichtigen. Der RTS-Tarifvertrag wirkte zumindest für den begrenzten Zeitraum von acht Jahren als Rationalisierungsschutzabkommen. Weitergehende Ziele, vor allem die Ausdehnung der betrieblichen Mitbestimmung auf die Einführung neuer Technik, konnte nur auf betrieblicher Ebene umgesetzt werden, weshalb die Gewerkschaft die diesbezügliche Schulung der Betriebsräte intensivierte. Jeweils unterschiedliche Geschwindigkeiten des technologischen Wandels in verschiedenen Betrieben führten zu lokalen Technikaneignungen. Auch die Interessen einzelner Unternehmer polarisierten sich und waren deutlich abhängig davon, ob und wann sie eine Einführung der neuen Technik planten. Letztlich kann von einer Verbetrieblichung der industriellen Beziehungen gesprochen werden, auf die zumeist der zeitgenössisch diskutierte Vorwurf des 93 Der Vorsitzende der IG Druck und Papier drängte bereits Mitte der siebziger Jahre auf eine Umformung zur Mediengewerkschaft, vgl. AfsB, Sign. MüJe 12, Thomas Münzer [plakat-Gruppe]: Vielfacher Druck in der Druckindustrie. Analyse und Erfahrungen vom Tarifkonflikt im graphischen Gewerbe. Broschüre, verlegt bei „plakat“, Stuttgart o. J. [1976], S. 4. 94 Vgl. Dreyfus, Michel: The Emergence of an International Trade Union Organization (1902– 1919), in: Carew, Anthony u. a. (Hg.): The International Confederation of Free Trade Unions (International and Comparative Social History 3), Bern 2000, S. 25–71, hier S. 40.
138 Karsten Uhl
„Betriebsegoismus“ nicht zutraf. Beim Beispiel M. Dumont Schauberg konnte ein der Gewerkschaftsspitze nahestehender Betriebsrat mit einer Betriebsvereinbarung eine erste Vermessung der politischen Möglichkeiten vornehmen, die sich als notwendige Vorbereitung der nationalen Tarifverhandlungen verstehen lässt. Bei Gruner + Jahr hingegen konnte ein gewerkschaftlich organisierter Betriebsrat, der der Technologiepolitik des Hauptvorstands der IG Druck und Papier kritisch gegenüber stand,95 mit einer nachträglichen Betriebsvereinbarung den RTS-Tarifvertrag deutlich ergänzen. Strukturelle und personelle Beziehungen sorgten insgesamt dafür, dass die technologische Transformation der Branche nicht zu einer völligen Umwälzung der industriellen Beziehungen führte: Die internationale Abstimmungsarbeit bei der IGF wurde von deren Präsidenten Mahlein geleitet, der gleichzeitig Vorsitzender der bundesdeutschen Branchengewerkschaft war. Eine Stärkung der internationalen Gewerkschaftspolitik musste also nicht zwingend als Schwächung der nationalen Organisation verstanden werden. Auf der betrieblichen Ebene wiederum waren viele wichtige Betriebsratsmitglieder Gewerkschaftsmitglieder (oder sogar -funktionäre auf Orts-, Bezirks- oder Landesebene), außerdem verstand der Hauptvorstand der IG Druck und Papier frühzeitig, dass eine Stärkung der betrieblichen Vertretung keine Konkurrenz zum nationalen Tarifvertrag sein musste, sondern unter den gegebenen Umständen die einzige Möglichkeit zu weitergehenden Ergebnissen bot.
Quellenverzeichnis Archivbestände Archiv für soziale Bewegungen, Bochum. Sammlung Müller-Jentsch - MüJe 8, Hauptvorstand der IG Druck und Papier: Protokoll der 9. Sitzung der Tarifkommission für die Druckindustrie am 27./28.9.1976 in Stuttgart. - MüJe 8, Protokoll der zentralen Tagung mit den Mitgliedern des erweiterten Vorstandes der IG Druck und Papier, der Tarifkommission Druckindustrie und Kolleginnen und Kollegen aus Zeitungs- und Zeitschriftenbetrieben am 10. Dezember 1977 in Frankfurt. - MüJe 8, Protokoll der 2. Sitzung der Tarifkommission Druckindustrie, 18./20.1.1978, Frankfurt (Main). - MüJe 8, Protokoll der gemeinsamen Arbeitstagung von Tarifkommission Druckindustrie und Hauptvorstand der IG Druck und Papier am 19./20. Februar 1978, Frankfurt (Main). 95 Vgl. Duhm/Mückenberger: Utopie, S. 72.
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“
139
- MüJe 11, Betriebsrat M. DuMont Schauberg/Manfred Dullin: Neue Technik in der Druckindustrie. Ihre Entwicklung. Was bleibt? Was tun?, Broschüre, Köln, März 1977. - MüJe 11, Betriebsvereinbarung über die Einführung und Anwendung eines neuen Zeitungssystems (GPA) zwischen der Firma M. DuMont Schauberg, Köln, und dem Betriebsrat der Firma M. DuMont Schauberg, Köln, 17.3.1977. - MüJe 12, Informations-Dienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten, Nr. 124 (8.5.1976). - MüJe 12, Thomas Münzer [plakat-Gruppe]: Vielfacher Druck in der Druckindustrie. Analyse und Erfahrungen vom Tarifkonflikt im graphischen Gewerbe. Broschüre, verlegt bei „plakat“, Stuttgart o. J. [1976]. - MüJe 13, Bundesverband deutscher Zeitungsverleger: Jahresbericht 1977. - MüJe 140, IG Druck und Papier: Notzeitung, 6.3.1978. - MüJe 142, Schreiben des Rechtsanwalts Gebhard Ohnesorge an den Deutschen Presserat, Beschwerdeausschuss, Frankfurt, 31.5.1979
Archiv der sozialen Demokratie, Bonn. Bestand IG Medien - 5/MEDA 114437, IG Druck und Papier: Presseinformation. Soll die Bundesrepublik Schlusslicht werden?, undat. [März 1978]. - 5/MEDA 119006, dpa-Meldung vom 25.4.1979: „Times“ in Zeppelinheim gedruckt – Proteste und Demonstrationen. - 5/MEDA 119006, dpa-Meldung vom 30.5.1979: Griechische Presse-Gewerkschaften gegen „Times“-Druck in Griechenland (dpa 082 pl/m). - 5/MEDA 119006, Internationale Grafische Föderation: Zirkular 679 (22.5.1979). - 5/MEDA 119006, Presseinformation der IG Druck und Papier, Hauptvorstand. Detlev Hensche, September 1978. - 5/MEDA 119007, IG Druck und Papier, Hauptvorstand: Mitteilung an alle Landesbezirke, 25.4.1979. - 5/MEDA 423059, Dr. Herbert Kubicek, Sie haben die Seele gefunden! Neue Führungstechniken als unternehmerische Strategie zur Arbeitsintensivierung und Herrschaftssicherung. Manuskript des Referats auf dem 10. Bundes-Angestelltentag des DGB, Okt. 1981, AG IV. Darin: Übersicht 6: Führungsgrundsätze. Das Beispiel Bertelsmann.
Archiv der sozialen Demokratie, Bonn. Bestand Internationale Grafische Föderation (IGF) - Sign. 138, Protokoll der Sitzung der IJF/IGF Arbeitsgruppe (25.5.1982, Bern), Bern, 30.6.1982. - Sign. 138, Protokoll der Sitzung der IGF/SKGGI Studiengruppe (23.-26.11.1983 in Birkenstein, BRD), o. O., 16.1.1986. - Sign. 367, Heinz Deckert: Einführungsreferat des Präsidenten des Ständigen Komitees der Gewerkschaften der Grafischen Industrie zur V. Internationalen Konsultativkonferenz der Gewerkschaften der grafischen Industrie vom 12. bis 14. Mai 1981 in Budapest.
140 Karsten Uhl
Publizierte Quellen Bechthold, Albert: Die Auslandsausgabe einer britischen Zeitung und die Pressefreiheit hierzulande, in: Stuttgarter Nachrichten (3.5.1979). Borgmann, Wolfgang: Der Kampf um die „Times“ wird auch in Darmstadt geführt, in: Stuttgarter Zeitung (26.4.1979). Bulla, Werner: Solidaritätsstreiks nur mit Einschränkungen zulässig, in: Druckwelt Nr. 11 (1.6.1979), S. 738–744. Clough, Patricia: Wie die deutschen Gewerkschaften der „Times“ den Mund verboten, in: Die Welt (2.5.1979). Duhm, Rainer/Mückenberger, Ulrich: Unsere Utopie: daß alle alles machen, in: Jacobi, Otto/ Schmidt, Eberhard/Müller-Jentsch, Walther (Hg.): Kritisches Gewerkschaftsjahrbuch 1981/82, Berlin 1981, S. 66–83. Ferlemann, Erwin: Rationalisierung oder Humanisierung. Unauflösbarer Widerspruch oder gewerkschaftliche Aufgabe?, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 31 (1980:4), S. 268–270. Fritz, Hans-Georg: Leserbrief, in: Frankfurter Rundschau (4.5.1979). Gaul, Richard: Richter als Schlichter. Computer am Arbeitsplatz: Beim Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr rollte eine Lawine von Prozessen zwischen Betriebsrat und Management, in: Die Zeit Nr. 4 (19.1.1979), S. 19. Güther, Bernd/Pickshaus, Klaus: Der Arbeitskampf in der Druckindustrie im Frühjahr 1976, Frankfurt (Main) 1976. IG Druck und Papier NRW: 12. Tätigkeitsbericht, in: IG Medien, Druck und Papier, Publizistik und Kunst, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen (Hg.): 50 Jahre Mediengewerkschaft in Nordrhein-Westfalen 1947–1997. Ausgewählte Dokumente, Recklinghausen 1997, S. 117– 124. IG Druck und Papier u. a.: Tarifvertrag „Neue Technik“ in der Druckindustrie 1978, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 29 (1978:5), S. 310–316. IG Druck und Papier, Hauptvorstand: Geschäftsbericht 1974 bis 1977 zum Elften Ordentlichen Gewerkschaftstag, Stuttgart 1977. IG Druck und Papier, Hauptvorstand: Zehnter Ordentlicher Gewerkschaftstag Industriegewerkschaft Druck und Papier, Hamburg 1974. Protokoll, Stuttgart 1974. IG Druck und Papier, Hauptvorstand/Deutsche Journalisten-Union (Hg.): Tarifvertrag über Einführung und Anwendung rechnergesteuerter Textsysteme. Handlungsanleitungen und Erläuterungen für die Praxis, Stuttgart 1979. Internationale Grafische Föderation: Tätigkeitsbericht vom 1. Januar bis 31. Dezember 1981, Bern o. J. Issaias, Heike: Unsere Idee. Alle machen alles. Rotation in der Gruppe bei Gruner und Jahr, in: Roth, Siegfried/Kohl, Heribert (Hg.): Perspektive. Gruppenarbeit, Köln 1988, S. 115–122. Jungblut, Michael: Vetorecht für Mitarbeiter. Beispiel Mohndruck: Auch im Unternehmen können Entscheidungen demokratisch vorbereitet werden, in: Die Zeit Nr. 42 (8.10.1976). Mahlein, Leonhard: Gewerkschaften international. Im Spannungsfeld zwischen Ost und West, Frankfurt (Main) 1984. Mahlein, Leonhard: Streik in der Druckindustrie. Erfolgreicher Widerstand, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 29 (1978:5), S. 261–271. Mayer, Gisela: Erfolgreiche Solidaritätsaktion zeigt auch in England Wirkung, in: Nachrichten zur Wirtschafts- und Sozialpolitik (1979:6), S. 21.
Die „frechen rechnergesteuerten Systeme“
141
Michaels, Heinz: „Besser geht’s nicht“. Wie sich der Kölner Stadt-Anzeiger auf die neue Technik einstellt, in: Die Zeit Nr. 12 (24.3.1978). O. A., Neu-Isenburg: Gegen Druck der „Times“, in: Frankfurter Rundschau (28.4.1979). O. A.: „Statt Kollegen – egoistische Konkurrenz …“. Harte Kritik an der mangelnden Solidarität der Druckerei-Unternehmer, in: Deutscher Drucker 14 (1978:15), 11.5.1978, S. I u. XII. O. A.: „Times“-Auseinandersetzung. Hensche: Solidaritätsstreik ist rechtlich unumstritten, in: Handelsblatt (3.5.1979). O. A.: „Times“-Wochenausgabe erschien doch nicht, in: Deutscher Drucker Nr. 14 (3.5.1979). O. A.: Der unpolitische Unternehmer als Verbandsmitglied, in: Deutscher Drucker 14 (1978: 16), 18.5.1978, S. IXf. O. A.: Flaggschiff blockiert, in: Der Spiegel Nr. 13 (22.3.1981), S. 90–92. O. A.: Internationale Solidarität, in: Druck und Papier (1976:8), S. 2. O. A.: Internationale Solidarität, in: Druck und Papier (1976:9), S. 3. O. A.: Kompromiß sichert Fortbestand der „Times“, in: Druck und Papier (1981:4), S. 4. Winsbury, Rex: New Technology and the Press. A Study of Experience in the United States, London 1975. Zentralsekretariat des Schweizer Typographenbundes (STB): Times-Konflikt, in: Helvetische Typographia (23.5.1979), S. 1 f.
Literaturverzeichnis Betz, Klaus: Vom Berufsverband in der Gewerkschaft Kunst zur Berufsgruppe in der IG Druck und Papier, in: Publizistik & Kunst 40 (1991:4) [http://dju.verdi.de/ueber_die_dju/ 50_jahre_dju/geschichte, letzter Aufruf am 04.05.2017]. Büchner, Rudolf: Chronik Bertelsmann Industrie 1824–1991, Gütersloh 41992. Cockburn, Cynthia: Brothers. Male Dominance and Technological Change, London 1983. Davies, David R.: The Postwar Decline of American Newspapers, 1945–1965 (The History of American Journalism 6), Westport (Connecticut)/ London 2006. Dommann, Monika: Umbrüche am Ende der Linotype, in: Nach Feierabend. Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte 12 (2016), S. 219–233. Dreyfus, Michel: The Emergence of an International Trade Union Organization (1902–1919), in: Carew, Anthony u. a. (Hg.): The International Confederation of Free Trade Unions (International and Comparative Social History 3), Bern 2000, S. 25–71. Fetzer, Thomas: Industrial Relations History in Transnational Perspective. A Review Essay, in: History Compass 10 (2012:1), S. 56–69. Gilson, Norbert: Dienstleistungen in einer digitalisierten Gesellschaft. Die Arvato AG, in: Bertelsmann AG (Hg.): 175 Jahre Bertelsmann. Eine Zukunftsgeschichte, Güterloh 2010, S. 330–371. Hindrichs, Wolfgang/Mäulen, Claus/Scharf, Günter: Neue Technologien und Arbeitskampf (Mensch und Technik. Sozialverträgliche Technikgestaltung – Materialien und Berichte 9), Opladen 1988. Jacobs, Eric: Stop Press. The Inside Story of the Times Dispute, London 1980.
142 Karsten Uhl
Kotthoff, Hermann: Zum Verhältnis von Betriebsrat und Gewerkschaft. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, in: Bergmann, Joachim (Hg.): Beiträge zur Soziologie der Gewerkschaften (Bibliothek Suhrkamp 905), Frankfurt 1979, S. 298–325. Müller-Jentsch, Walther: Der Arbeitskampf in der Druckindustrie 1978, in: Ders./Jacobi, Otto/ Schmidt, Eberhardt (Hg.): Kritisches Gewerkschaftsjahrbuch 1978/79, Berlin 1979, S. 10– 23. Müller-Jentsch, Walther: Technik als Bedrohung? Fotosatz und Computertechnologie in der Druckindustrie, in: Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): Hauptsache Arbeit. Wandel der Arbeitswelt nach 1945, Bielefeld 2009, S. 94–101. Priemel, Kim Christian: Gewerkschaftsmacht? Britische und westdeutsche Gewerkschaften im Strukturwandel, in: Raithel, Thomas/Schlemmer, Thomas (Hg.): Die Rückkehr der Arbeitslosigkeit. Die Bundesrepublik im europäischen Kontext 1973 bis 1989 (Zeitgeschichte im Gespräch 5), München 2009, S. 107–120. Reske, Christopher: Die Ablösung des Bleisatzes durch den Fotosatz. Das Ende einer Ära, in: Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte 14 (2005), S. 79–108. Stein, Jesse Adams: Hot Metal. Material Culture and Tangible Labour (Studies in Design and Material Culture), Manchester 2016. Stein, Jesse Adams: Masculinity and Material Culture in Technological Transitions. From Letterpress to Offset-Lithography, 1960s-1980s, in: Technology & Culture 57 (2016:1), S. 24–53. Stewart, Graham: The History of the Times, Vol. VII: 1981–2002. The Murdoch Years, London 2005. Uhl, Karsten: Computerisierung, deutsch-deutsche Gewerkschaftsgeschichte und europäische Vernetzung im Kontext des Kalten Krieges. Die Arbeitskämpfe in der bundesdeutschen Druckindustrie in den 1970er- und 1980er-Jahren, in: Buschak, Willy (Hg.): Solidarität im Wandel der Zeiten. 150 Jahre Gewerkschaften, Essen 2016, S. 277–302. Uhl, Karsten: Maschinenstürmer gegen die Automatisierung? Der Vorwurf der Technikfeindlichkeit in den Arbeitskämpfen der Druckindustrie in den 1970er und 1980er Jahren, in: Technikgeschichte 82 (2015:2), S. 157–179. Wischermann, Clemens: Unternehmenskultur bei Bertelsmann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Bertelsmann AG (Hg.): 175 Jahre Bertelsmann. Eine Zukunftsgeschichte, Gütersloh 2010, S. 238–281.
Daniel Dören
Von der Bergwerksgesellschaft zum diversifizierten Konzern. Die Bergwerksgesellschaft Hibernia AG 1951–1968 – Eine Skizze Einleitung Als im Jahr 2018 das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop seine Förderung einstellte, bedeutete dies zugleich das Ende des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet und in der Bundesrepublik Deutschland (BRD). Mit der Schließung dieses Bergwerkes fand der Prozess der Zechenschließungen, der mit der Kohlenkrise von 1958 seinen Anfang nahm, ein Ende. Auch wenn diese Industrie heute für die deutsche Volkswirtschaft bedeutungslos ist, war sie gerade unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 1950er und 60er Jahren von enormer Bedeutung, hing von niedrigen und stabilen Energiepreisen doch die wirtschaftliche Stabilität der frühen BRD ab. Es überrascht daher wenig, dass der Bergbau bereits in den 1980er Jahren erstmals das Interesse der historischen Forschung auf sich zog. In seinem wirtschaftshistorischen Überblickswerk über den Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet sowie in seinem umfassenden Werk über die deutsche Wirtschaftsgeschichte nach 1945 betont Werner Abelshauser die Bedeutung des korporativen Handlungsrahmens für die Entwicklung des Bergbaus und der Bewältigung der Kohlenkrise seit 1958. Die entscheidenden Akteure bei der Entwicklung des Steinkohlenbergbaues seien dabei die Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und der Staat gewesen, die die Entwicklung der Branche maßgeblich beeinflussten.1 Neben Abelshauser betonen auch andere Autoren die Bedeutung des korporativen Ordnungsrahmens auf nationaler und supranationaler Ebene.2 Christoph Nonn widmet sich in seiner Studie über die Krise des 1 Abelshauser, Werner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Von 1945 bis zur Gegenwart (beck’sche Reihe 1587), München 22011, S. 168–172; Abelshauser, Werner: Der Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung, München 1984. 2 Siehe dazu die Arbeiten von Parnell, Martin F.: The German Tradition of Organized Capitalism. Self-Government in the Coal Industry (Government-Industry Relations 7), Oxford 1994; Jörnmark, Jan: Coal and Steel in Western Europe 1945–1993. Innovative Change and Institutional Adaption (Publications of the Institute of Economic History of Gothenburg University 67), Göteborg 1993; Röndigs, Uwe: Globalisierung und europäische Integration. Der Strukturwandel des Energiesektors und die Politik der Montanunion 1952–1962 (Nomos Universitätsschriften Geschichte 11), Baden-Baden 2000. https://doi.org/10.1515/9783110729979-007
144 Daniel Dören
Ruhrbergbaus seit 1958 in einer politischen Sozialgeschichte der Bewältigung des Deindustrialisierungsprozesses im Ruhrgebiet.3 Nonn operiert dabei mit dem Instrument der Netzwerkanalyse, das im Vergleich zu dem korporativen Ansatz von Abelshauser sich nicht auf die drei Akteure Staat, Unternehmensverbände und Gewerkschaften beschränke, sondern weitere Akteure, wie Landes- und Kommunalregierungen, weitere Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände miteinbeziehe.4 Auch der jüngste, zum Steinkohlenbergbau verfasste Handbuchartikel von Michael Farrenkopf konzentriert sich auf das Handeln von Staat, Gewerkschaften und Bergbauverbänden.5 Wenn sich die bisher zum Ruhrbergbau verfassten Studien methodisch unterscheiden, weisen sie doch einige inhaltliche Gemeinsamkeiten auf: Im Fokus der Untersuchungen stehen Körperschaften wie Unternehmerverbände, Gewerkschaften und Regierungen und deren wichtigste Vertreter. Die Studien ähneln sich auch in ihrem wirtschaftshistorischen Narrativ. Bis 1958 wurde die Belieferung der deutschen Teilenergiemärkte – Wärmeversorgung, Elektrizität, Rohstoff für die Koksherstellung – von der an der Ruhr geförderten Steinkohle dominiert. Dabei war ein Energie- und Kohlenmangel, der aus dem schlechten Zustand der deutschen Bergwerke und dem jährlich wachsenden Energiehunger der sich im sogenannten Wirtschaftswunder befindlichen BRD resultierte bis 1958 allgegenwärtig. Seit der Kohlenkrise 1958 setzte dann ein Rückgang der Nachfrage nach deutscher Steinkohle und ein Verdrängungswettbewerb auf dem Wärmemarkt ein, der letzten Endes zum Niedergang des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet und der BRD.6 Bisherige Arbeiten stellten heraus, dass der Steinkohlenbergbau der Konkurrenz des Öls als neuem Rohstoff unterlegen war, was zu seinem Niedergang führte. Doch waren es gerade die diversifizierten Unternehmen des Ruhrbergbaus – die so genannten Zebras – die neben dem Bergbaugeschäft auch in der Ölverarbeitung und im Heizölhandel tätig waren. Zusammen machte der Anteil der Zebras an der gesamten Steinkohlenförderung rund 31 % im Jahr 1967 aus.7
3 Nonn, Christoph: Die Ruhrbergbaukrise. Entindustrialisierung und Politik 1958–1969 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 149), Göttingen 2001, S. 16. 4 Ebd., S. 18. 5 Farrenkopf, Michael: Wiederaufstieg und Niedergang des Bergbaus in der Bundesrepublik, in: Ziegler, Dieter (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der Deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 183–302, hier S. 210–231. 6 Abelshauser: Ruhrkohlenbergbau, S. 75–109 und S. 118–139; Nonn: Die Ruhrbergbaukrise, S. 26–51; Farrenkopf: Wiederaufstieg und Niedergang, S. 210–231. 7 Berechnet nach Abelshauser: Ruhrkohlenbergbau, S. 196 f. In die Berechnung einbezogen wurden folgende Unternehmen: Hibernia AG, Gelsenkirchener Bergwerks AG, Klöckner Bergbau-AG und Mathias Stinnes AG.
Von der Bergwerksgesellschaft zum diversifizierten Konzern
145
Bei diesem Befund drängt sich die Frage auf, ob der Bergbau lediglich ein „Opfer“ des vordringenden Mineralöls wurde oder ob er nicht selbst – wenn auch nur zum Teil – den Wandel auf dem Energiemarkt selbst gefördert hat. Über die Zebras ist in der Forschung bisher wenig bekannt, da es für die Zeit nach 1945 über den Ruhrbergbau kaum unternehmenshistorische Studien gibt. Um aber zu begreifen, welche Rolle der Bergbau im Wandel auf dem deutschen Energiemarkt einnahm, ist eine solche dringend erforderlich. In diesem Aufsatz wird die Entwicklung der diversifizierten und staatseigenen Bergwerksgesellschaft Hibernia AG skizziert. Bei Betrachtung der Entwicklung auf dem deutschen Energiemarkt – weg von einer Kohle-, hin zu einer Ölökonomie8 – soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit eine Expansion in den beiden Geschäftsbereichen Steinkohlenbergbau und Mineralölverarbeitung miteinander vereinbar waren. Des Weiteren soll anhand des Investitionsvolumens, das die Hibernia AG vor der Kohlenkrise in den Bereich Bergbau investiert hatte, gezeigt werden, weshalb das Unternehmen trotz eines seit der Kohlenkrise zunehmend defizitären Geschäftsbereiches Steinkohlenbergbau weiter an diesem festhielt. Dazu wird zunächst kurz auf die Ausgangssituation 1951 und die Entwicklung der Hibernia AG zu einem diversifizierten Unternehmen eingegangen und dann anhand archivalischer Quellen aus dem BergbauArchiv und dem Bundesarchiv das unternehmerische Handeln der Hibernia AG vor und nach der Kohlenkrise von 1958 beschrieben.
Die Vorgeschichte der Hibernia AG und die Ausgangssituation Anfang der 1950er Jahre Da die Hibernia AG schon vor 1945 eine so genannte freie Zechengesellschaft war, die ihre Kohlen nicht direkt an ein Hüttenwerk absetzen konnte, musste sie sich andere gesicherte Absatzwege für ihre Steinkohle suchen, welche sie seit den 1920er Jahren in der Weiterverarbeitung von Kokereigasen zu Stickstoff in der chemischen Industrie fand. Als Folge dieser Entwicklung nahm das Unternehmen in den 1930er Jahren im Zuge des Vierjahresplanes die Kraftstoffherstellung durch Kohlehydrierung auf. Ein weiterer wichtiger Konzernbereich war die Stromerzeugung. Die Hibernia AG ist damit geradezu ein Lehrbuchbeispiel für ein diversifiziertes Unternehmen schumpeterscher Prägung. Bei dieser Art der Diversifika8 Streb, Jochen: Energiewenden aus historischer Perspektive, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook 56 (2015:2), S. 587–608, hier S. 595 f.
146 Daniel Dören
tion gliedert sich ein Unternehmen in einer pfadabhängigen Entwicklung neue Bereiche in seiner „unmittelbare[n] technologische[n] und ökonomische[n] Nachbarschaft“9 an. Die schumpetersche Diversifikation umfasst daher zum einen die vertikale Diversifikation, bei der ein Unternehmen sich vor- und nachgelagerte Produktionsstufen angliedert, als auch die horizontale Diversifikation, bei der ein Unternehmen neue Produkte aufnimmt, die die gleiche Bedürfnisse der Kunden befriedigen sollen.10 Organisatorisch war die Hibernia AG als 100 %iges Tochterunternehmen Teil der Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks AG (VEBA), deren gesamte Aktien sich in Bundesbesitz befanden. Die VEBA agierte jedoch nur als Holding, die ihre Tochtergesellschaften mit Kapital ausstatten sollte. Auf die unternehmerischen Entscheidungen nahm sie keinen Einfluss; als einzige Aktionärin stellte sie nicht einmal den Vorsitzenden des Aufsichtsrates.11 Diese Aufgabe übernahm vielmehr der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Ludger Westrick als Vertreter der Eigentümerin der VEBA. Wie auch die anderen Vertreter des Bundes hielt sich Westrick als Vertreter des federführenden Bundeswirtschaftsministeriums im Aufsichtsrat der Hibernia AG jedoch größtenteils bei unternehmerischen Entscheidungen zurück und überließ diese dem Vorstand. Der Bund übte demnach nur eine „formelle Rechtsaufsicht“12 über seine Unternehmen aus. Unter den für die bundeseigenen Unternehmen zuständigen Ministern bestand ein Konsens darüber, dass bundeseigene Unternehmen nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen seien, wenn sie auf dem Markt mit anderen privaten Unternehmen konkurrieren.13 Das Bild der Hibernia AG war 1952 immer noch geprägt von der Dominanz der Steinkohle und ihrer nachgelagerten Produktionsstufen (Abbildung 1). Das Unternehmen förderte rund 10 Millionen Tonnen Steinkohle und erwirtschaftete damit einen Umsatz von 561 Mio. DM. Allein der direkte Verkauf der Steinkohle über die vom Ruhrbergbau gemeinschaftlich organisierten Verkaufsgesellschaften an die Verbraucher machte 51 % des Umsatzes aus. Weitere 24 %
9 Zur schumpeterschen Diversifikation, siehe Streb, Jochen: Staatliche Technologiepolitik und branchenübergreifender Wissenstransfer. Über die Ursachen der internationalen Innovationserfolge der deutschen Kunststoffindustrie im 20. Jahrhundert (Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 4), Berlin 2003, S. 28 f. 10 Wöhe, Günter: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, München 252013, S. 247 f. 11 BArch, B 115/3259, Bericht über die Geschäftstätigkeiten der VEBA (Schreiben von VEBA an Bundesfinanzministerium, 08.02.1952). 12 Ambrosius, Gerold: Der Staat als Unternehmer. Öffentliche Wirtschaft und Kapitalismus seit dem 19. Jahrhundert (Kleine Vandenhoeck-Reihe), Göttingen 1984, S. 135 f. 13 Ebd., S. 135 f.
Von der Bergwerksgesellschaft zum diversifizierten Konzern
147
des Umsatzes (134 Mio. DM) wurden durch die Weiterverarbeitung der Steinkohle zu Koks erzielt. Somit betrug der Anteil der Kohle und des Kokses, die am Brennstoffmarkt abgesetzt wurden rund 75 %. Die restliche Kohle wurde zur Stickstoffsynthese, zur Erzeugung von Kohlenwertstoffen (Rohteer, Ammoniak und Rohbenzol) und zur Verstromung genutzt.14 Was das Kerngeschäft der Hibernia AG angeht, so lässt sich zunächst konstatieren, dass für das Unternehmen eine starke Abhängigkeit auf dem Markt für feste Brennstoffe (Kohle und Koks) bestand, eben genau jenem Marktsegment, das während der Kohlenkrise seit 1958 zunehmend unter starken wirtschaftlichen Druck des Mineralöls geriet. Dennoch wurden bereits 1952 ca. 25 % des von der Hibernia AG erwirtschafteten Umsatzes durch die Veredelung von Kokereigasen zu Kohlenwertstoffen und durch die Veredelung von Steinkohle zu Strom generiert. Verstromung 5%
Sonstige 1%
Kohlenwertstoffe 19% Verkauf 51% Kokereien 24%
Abb. 1: Verwendung der geförderten Kohle gemessen am Umsatz 1952 Quelle: montan. dok/BBA 32/517.
Doch im Zuge des Vordringens des Erdöls als Primärenergieträger auf dem deutschen Markt wurde der gesamte Steinkohlenbergbau vor eine existenzbedrohende Herausforderung gestellt, da sie zunehmend Marktanteile an den neuen Energieträger verloren. Da die Hibernia AG als diversifiziertes Unternehmen abseits des Kerngeschäftes Steinkohlenförderung noch über andere Geschäftsbereiche verfügte, war sie nicht auf den Verkauf von Steinkohle als festen Brenn-
14 Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok) beim Deutschen Bergbau-Museum Bochum/Bergbau Archiv Bochum (BBA), BBA 32/517, Verwendung der Kohlenförderung der Hibernia AG 1952.
148 Daniel Dören
stoff beschränkt, sondern konnte sich auf anderen Geschäftsfeldern und Märkten betätigen und die betreffenden Unternehmenssparten ausbauen.
Das traditionelle Kerngeschäft – Die Grubenbetriebe der Hibernia AG 1951–1957 Von 1951 bis zum Beginn der Kohlenkrise im Jahr 1958 war Steinkohle ein stark nachgefragter Rohstoff, dessen Bedarf durch die einheimische Förderung nicht ausreichend gedeckt werden konnte. Zur ausreichenden Deckung des nationalen Energiebedarfs musste Kohle zusätzlich importiert werden. Dass Kohle in Deutschland ein knapper Rohstoff war, lag nicht zuletzt an der geringen Produktivität der deutschen Steinkohlenbergwerke, die auf ausgebliebene Rationalisierungsmaßnahmen während der Zeit des Nationalsozialismus und vor Allem im Zweiten Weltkrieg zurückzuführen war.15 Die deutschen Bergwerksunternehmen hatten auf dem einheimischen Energiemarkt wegen der großen Nachfrage nach Energie keine Schwierigkeiten, ihre Förderung abzusetzen. Der vollen Ausnutzung dieses Nachfrageüberhangs nach Steinkohle standen jedoch nicht nur die aus fehlender technischer Ausstattung resultierende schlechte Produktivität der Bergwerke gegenüber, sondern auch das Bestreben der deutschen Energiepolitik nach niedrigen Energiekosten, die sich durch staatlich festgesetzte Höchstpreise auszeichnete.16 Damit bildete der Bergbau einen Gegensatz zu der übrigen Wirtschaft, die nach der Währungsreform Wachstumsraten von rund 7 % erreichte.17 Um aber eine dauerhafte Versorgung der BRD mit Energie sicherstellen zu können, bedurfte es einer Steigerung der deutschen Steinkohlenförderung und einer Verbreiterung der Rohstoffbasis, zum Beispiel durch Mineralöl. Mit Ausbruch der Korea-Krise wurde den Beteiligten – der Bundesregierung, den Verbrauchern und den Bergwerksunternehmen – vor Augen geführt, dass der Bergbau im Vergleich zu anderen Industrien ein viel geringeres Anwachsen seiner Produktivität zu verzeichnen hatte und dass seine Kapazitäten bis dahin kaum ausgeweitet wurden. Dies sowie zu hohe Energiekosten wurde vor allem vom
15 Siehe Farrenkopf: Wiederaufstieg und Niedergang, S. 198. Für eine zusätzliche Verknappung der Steinkohle sorgte unter anderem auch der Raubbau. 16 Abelshauser: Ruhrkohlenbergbau, S. 86. 17 Spoerer, Mark/Streb, Jochen: Neue Deutsche Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 2013, S. 229.
Von der Bergwerksgesellschaft zum diversifizierten Konzern
149
Bundeswirtschaftsministerium als eine Gefahr für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der noch jungen BRD angesehen.18 Infolge des Kriegsausbruches in Korea kam es 1951 in Deutschland zu einer weiter steigenden Nachfrage nach Steinkohle und Steinkohlenkoks, was bedingt durch die unzureichende Förderleistung und technische Ausstattung der deutschen Bergwerke zu einer Versorgungskrise führte.19 Der Kern der Problematik bei der Versorgung der BRD mit ausreichend Energie bestand darin, dass Verbraucher und die Bundesregierung darin bestrebt waren, die Energiepreise niedrig zu halten und die Bundesregierung dies auch durch Höchstpreise durchsetzte. Für die Bergbaubetriebe bedeutete dies aber gleichzeitig, dass sie die notwendigen Mittel nicht selbst erwirtschaften konnten, um die Produktivität ihrer Anlagen zu erhöhen. Bis 1951 wurden zudem langfristige Investitionen in den Ruhrbergbau vor allem dadurch verhindert, dass die Unternehmen immer noch unter alliierter Kontrolle standen und die zukünftigen Eigentumsverhältnisse somit nicht eindeutig abzusehen waren.20 Als ein Großteil der Bergwerke im Sommer 1951 aus der alliierten Kontrolle entlassen wurde und wieder frei über sein Eigentum verfügen konnte, war ein erster Schritt in Richtung Produktivitätssteigerung getan, da viele Unternehmen wieder nun zukunftssicher planen konnten. Die für die Produktionssteigerung notwendigen finanziellen Mittel wurden den Bergbauunternehmen durch das Investitionshilfegesetz von 1952 als Reaktion auf die Versorgungslücke während der Korea-Krise bereitgestellt.21 Die seit 1945 anhaltende unzureichende Energieversorgung der BRD, die Wiedererlangung der Kontrolle des Ruhrbergbaus über seine Unternehmen sowie das Investitionshilfegesetz schafften für die Unternehmen des Ruhrbergbaus ein investitionsfreundliches Klima. Vor allem das Investitionshilfegesetz von 1952 brachte den gewünschten Erfolg: Von Inkrafttreten des Gesetzes bis 1957 wurden in der BRD 50 neue Schächte abgeteuft.22 Die Bergwerke konnten nun modernisiert und dadurch ihre Produktivität weiter gesteigert werden. Eine „natural protection“23 gegen die in den USA günstiger zu fördernde Steinkohle 18 Abelshauser: Deutsche Wirtschaftsgeschichte, S. 156 f. 19 Siehe Farrenkopf: Wiederaufstieg und Niedergang, S. 211; Abelshauser: Ruhrkohlenbergbau, S. 71 f.; Abelshauser: Deutsche Wirtschaftsgeschichte, S. 157–159; Temin, Peter: The „Koreaboom“ in Westgermany. Fact or Fiction?, in: The Economic History Review 48 (1995:4), S. 737–753. 20 Siehe Abelshauser: Ruhrkohlenbergbau, S. 66–68. 21 Siehe Farrenkopf: Wiederaufstieg und Niedergang, S. 207–211. 22 Farrenkopf: Wiederaufstieg und Niedergang, S. 212. Daneben war der Ausbau der Belegschaften ein wichtiges Mittele zur Förder- und Produktivitätssteigerung, S. 202. 23 Jörnmark: Coal and Steel, S. 95.
150 Daniel Dören
bildeten die bis dahin hohen Transportkosten. Für zukünftige Planungen gingen die Unternehmen, wie auch die Verbraucher und Energiepolitiker von einem stetig wachsenden Energiebedarf an Steinkohle in der BRD – auch schon bereits in der nahen Zukunft – aus.24 Vor diesem Hintergrund nahm die Hibernia AG die Gelegenheit war, ihre Bergwerke technisch und durch organisatorische Rationalisierungsmaßnahmen zu modernisieren. In einem 1953 aufgestellten Investitionsprogramm wurden vom Vorstand der Hibernia AG die Ausgaben für die nächsten sieben Jahre beziffert. Die Grubenbetriebe erforderten finanzielle Mittel in Höhe von 100 Mio. DM.25 Diese Summe sollte sich jedoch als zu gering erweisen, da allein die ersten beiden Großprojekte, der Neubau der Schachtanlage Westerholt-Polsum und die Zusammenlegung der Zechen Shamrock 1/2 und 3/4, eine Summe von 145 Mio. DM erforderten. Das Neubauprojekt Westerholt-Polsum begann 1956 und wurde in drei Ausbaustufen durchgeführt: In der ersten Ausbaustufe sollten 8 000 t, in der zweiten 10 000 t und in der dritten 12 000 t Steinkohlen pro Tag gefördert werden. Die Kosten für den Neubau der Anlage wurden mit 67 Mio. DM kalkuliert. Innerhalb der folgenden fünf Jahre sollte das Geld für das Teufen, die Ausrichtung und den Bau der Förder- und aufbereitungsanlagen verwendet werden.26 Der Gewinn pro Tonne, der mit der neuen Anlage erzielt werden sollte, wurde für die ersten beiden Jahre mit 1 DM, für die beiden Folgejahre mit 2 DM und ab dem fünften bis zum zehnten Jahr mit 3 DM kalkuliert. Die Zahlen seien dabei „mit der notwendigen Vorsicht ermittelt [worden]“.27 Nach zehn Jahren sollte sich die Anlage amortisiert haben. Die Stellungnahmen der Abteilungen Rechnungswesen und des betriebswirtschaftlichen Ausschusses der Hibernia AG bestätigten die Wirtschaftlichkeit des Projekts und empfahlen den sofortigen Beginn des Neubaus.28 Mit der Entscheidung zum Neubau der Anlage expandierte die Hibernia AG im Geschäftsbereich Grubenbetriebe, da die Förderkapazität der Bergwerke durch den Neubau bereits in der ersten Ausbaustufe, um 1 500 Tonnen Förderung pro Tag erhöht wurde.
24 Ebd. 25 montan.dok/BBA 32/515, „Finanzvorschau für 1953–1960“, 07.01.1953. Des Weiteren wurden für Kraftwerke und das Ringnetz Investitionen von 70 Mio. DM, für die Kokereien 38 Mio. DM, für das Stickstoffwerk 11 Mio. DM und für den Wohnungsbau 38,5 Mio. DM benötigt. Für weitere Kleininvestitionen wurden 39 Mio. DM veranschlagt. 26 montan.dok/BBA 32/525, Vorstandsvorlage zum Neubau der Schachtanlage Westerholt-Polsum an den Aufsichtsrat, 19.03.1956. 27 Ebd. 28 Ebd.
Von der Bergwerksgesellschaft zum diversifizierten Konzern
151
Ein paar Monate später startete die Hibernia AG mit der Zusammenlegung der Zechen Shamrock 1/2 und Shamrock 3/4 das zweite Großprojekt. Anstelle der Förderung in zwei unterschiedlichen Schachtanlagen entstand eine neue Zentralschachtanlage auf dem Gelände der Zeche Shamrock 3/4 mit einer Jahresförderung von ca. 2 Mio. t, wofür insgesamt 78 Mio. DM benötigt wurden. Durch diese Maßnahme sollte nicht nur die jährliche Fördermenge gesteigert, sondern die Betriebsdauer des Standortes auch um 17 Jahre verlängert werden. Die Ersparnis bei den Förderkosten im Vergleich zu der Alternative – dem Betrieb in zwei getrennten Anlagen – wurde mit durchschnittlich 2,50 DM pro Tonne kalkuliert. So sollten jährlich 4,5 Mio. DM eingespart werden.29 Ein wichtiger Faktor bei der Errichtung der beiden neuen Bergwerksanlagen war es, die vorhandenen Grubenfelder durch organisatorische Rationalisierungsmaßnahmen, wie der Zentralschachtförderung beim Neubau WesterholtPoslum und bei den Shamrock Zechen, kosteneffizienter auszunutzen. Die Vorrangigkeit der Kosteneinsparung, die sich bei einer Großschachtanlage ergibt, gegenüber einer noch stärkeren Fördermengensteigerung durch eine Belegschaftserhöhung wurde vom Vorstand der Hibernia AG bereits Anfang 1954 festgelegt, da die vorhandenen Absatzmöglichkeiten für Steinkohle und Koks am Wärmemarkt in Folge eines leichten Konjunkturrückganges zu diesem Zeitpunkt ausgeschöpft waren.30 Die moderate Steigerung der Fördermenge bei den Neuanlagen war jedoch nötig, um die gewünschte Kostendegression bei der Förderung erreichen zu können. Die durchgeführten Rationalisierungsmaßnahmen konnten das kalkulatorische Betriebsergebnis des Unternehmens vorerst verbessern. Betrug der kalkulatorische Verlust für die Grubenbetriebe im Jahr 1953 noch 29 Mio. DM, so konnte diese Summe bis zum Jahr 1956, in dem die Fördermenge der Bergbauunternehmen im Ruhrgebiet ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte31, auf ein Defizit von 8 Mio. DM reduziert werden.32 Das Unternehmen war bis zu diesem Zeitpunkt also auf einem guten Weg, sich zu sanieren, jedoch sollten sich die großen Mengen aufgenommenen Fremdkapitals in der weiteren Entwicklung als schwere Hypothek erweisen.
29 montan.dok/BBA 32/528, Vorstandsvorlage über die Zusammenlegung der Shamrock Zechen an den Aufsichtsrat, 03.12.1956. 30 montan.dok/BBA 32/518, Lagebericht des Vorstandes an den Aufsichtsrat, 04.03.1954. 31 Farrenkopf: Wiederaufstieg und Niedergang, S. 214 f. 32 Für das kalkulatorische Betriebsergebnis des Jahres 1953 siehe montan.dok/BBA 32/524 und für das Jahr 1956 montan.dok/BBA 32/533. In dem Ergebnis sind die Neubauprojekte Westerholt-Polsum und die Zusammenlegung der Shamrock Zechen noch nicht mit eingerechnet.
152 Daniel Dören
Konsolidierung des Kerngeschäfts Steinkohle 1958–1968 Die krisenhaften Entwicklungen auf dem deutschen Steinkohlenmarkt seit 1958 machten eine Amortisation der neu errichteten Anlagen unmöglich, da ihre Fertigstellung mitten in die Kohlenkrise fiel. Die bis dahin auf dem Energiemarkt dominierende Steinkohle bekam auf den Teilenergiemärkten Wärmeversorgung, Elektrizitätserzeugung und bei der Verwendung als Kraftstoff für Dampflokomotiven von anderen Primärenergieträgern Konkurrenz. Bei der Wärmeversorgung verlor sie immer mehr Marktanteile an Erdgas und Heizöl. Auf dem Elektrizitätsmarkt wurde der Druck des Energieträgers Braunkohle – auch wenn die Steinkohle hier ihre Marktanteile länger halten konnte – erhöht. Die Erzeugung von Elektrizität in Atomkraftwerken spielte zu diesem Zeitpunkt für den Vorstand der Hibernia AG nur eine untergeordnete Rolle, da die Technik zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgereift war und die Anlagekosten für Atomkraftwerke die für Steinkohlekraftwerke übertrafen.33 Weiterhin verlor die Steinkohle durch die Elektrifizierung von Lokomotiven Anteile an der Versorgung der Bundesbahn im Verkehrssektor.34 Zudem führten technische Innovationen zur Verbesserung der Effizienz in der Hochofen- und Kokereitechnologie, was wiederum eine Einsparung und Bedarfsreduktion für Steinkohle in diesem Marktsegment nach sich zog.35 Die als sicher empfundenen Marktanteile konnten nicht gehalten werden. Somit drohte bei den Grubenbetrieben aufgrund der hohen Aufnahme von Fremdkapital bei gleichzeitigem Rückgang fest etablierter Absatzmärkte der Verlust von unternehmerischer Substanz durch einen steigenden Verschuldungsgrad: Die für die Rückzahlung des Fremdkapitals fest kalkulierten Beträge konnten nicht mehr erwirtschaftet werden. Die Kohlenkrise kam für die meisten Unternehmen des deutschen Steinkohlenbergbaus überraschend. Der leichte Absatzrückgang, der bereits 1957 einsetzte, wurde zunächst nicht als bedrohlich, sondern weitgehend als eine normale konjunkturelle Schwankung wahrgenommen, da noch keine wesentlichen Mengen an Kohle auf Halde gelegt werden mussten.36 In der Zeit, als die Hibernia AG ihre Grubenbetriebe ausbaute und Förderkapazität erhöhte und zu die-
33 die 34 35 36
montan.dok/BBA 32/538, Bericht der Abteilung Energiewesen in der Vorstandsvorlage über Erweiterung des Kraftwerks Westerholt an den Aufsichtsrat, 20.11.1959. Siehe Farrenkopf: Wiederaufstieg und Niedergang, S. 215 f. Ebd. Siehe Abelshauser: Ruhrkohlenbergbau, S. 87.
Von der Bergwerksgesellschaft zum diversifizierten Konzern
153
sem Zweck große Mengen an Fremdkapital aufnahm, um neue Anlagen zu bauen und alte Anlagen zu modernisieren, deutete noch nichts auf den drastischen und vor allem dauerhaften Rückgang der Kohlennachfrage ab 1958 hin. Die ersten Anzeichen dafür, dass der Absatzrückgang nicht bloß konjunkturell bedingt war, wurde dem Hibernia-Tochterunternehmen im Kohlenhandel Strohmeyer bereits Anfang 1957 sichtbar. Der Koksabsatz ging nach dem Bericht des Vorstandes „fühlbar“37 zurück. Die Ursache dafür sei „nicht nur in der augenblicklichen Marktlage zu suchen; es handelt sich auch um erste Anzeichen einer strukturellen Veränderung der Absatzchancen durch das Vordringen des Heizöls.“38 Der Vorstand der Hibernia AG entwickelte demnach noch vor dem eigentlichen Beginn der Kohlekrise ein Gefühl dafür, dass es zu einer „strukturelle Veränderung“39 auf dem Kohlenmarkt kommen könne. Wurden die strukturellen Ursachen der Kohlenkrise als solche zwar erkannt, war das Ausmaß, das sie relativ schnell erreichen sollte, den Beteiligten diesem frühen Stadium der Krise in keiner Weise klar. In der Mitte des Jahres 1958 ging der Vorstand noch davon aus, dass die wirtschaftliche Lage im Allgemeinen nicht schlecht und nicht mit einer weiteren Verschärfung des Absatzrückganges zu rechnen sei. Den zeitweiligen Einbruch im Kohlenabsatz führte der Vorstand auf überhöhte Verbraucherbestände zurück und ging davon aus, dass sich der Absatz in unmittelbarer Zukunft wieder stabilisieren würde.40 Gegen Ende des Jahres 1958 musste der Vorstand jedoch einsehen, dass die Konkurrenz des billigeren Heizöls auf dem Wärmemarkt für die Steinkohle sich schneller und schärfer entwickelte als zunächst angenommen. Dennoch glaubte man dort noch, dass durch gezielte energiepolitische Maßnahmen, wie z. B. einer Besteuerung des Heizöls, der rasant fortschreitende strukturelle Wandel auf dem Wärmemarkt verlangsamt werden könne. Beklagt wurde dabei vor allem das Fehlen einer protektionistischen Einfuhrpolitik gegen Heizöl seitens der
37 montan.dok/BBA 32/533, Vorstandsbericht zur Lage der Tochtergesellschaften an den Aufsichtsrat, 24.03.1957. 38 Ebd. 39 In der Forschung wird in der Beurteilung der Kohlenkrise im Allgemeinen davon ausgegangen, dass den Bergbauunternehmen die strukturellen Ursachen der Kohlenkrise erst in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre bewusstgeworden sind. Siehe dazu den Handbucheintrag von Farrenkopf: Wiederaufstieg und Niedergang, S. 215 und die dort angegebene Literatur. Werner Abelshauser betont, dass die Gewerkschaften bereits sehr früh ein Verständnis dafür entwickelten, dass die Krise des Bergbaus struktureller Natur war. Siehe Abelshauser: Ruhrkohlenbergbau, S. 94. 40 montan.dok/BBA 32/534, Vorstandsbericht zur Lage des Unternehmens an den Aufsichtsrat, 09.05.1958.
154 Daniel Dören
Bundesregierung.41 Spätestens jetzt war dem Vorstandsvorsitzenden der Hibernia AG, Hans Werner von Dewall, klar, dass bei einer Fortführung der Energiepolitik der Bundesregierung, die einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Energieträgern forcierte, der deutsche Steinkohlenbergbau in seiner damaligen Form nicht konkurrenzfähig sein könnte und die strukturellen Nachteile der Steinkohle sich verschärfen würden: „Herr von Dewall schließt diesen Teil seiner Ausführungen mit dem nachdrücklichen Hinweis darauf ab, daß alle geplanten Maßnahmen zur Behebung der Krise nur dann sicheren Erfolg haben werden, wenn es gelingt, die Energiewirtschaft in der Bundesrepublik zu koordinieren. Eine Strukturwandelung des Bergbaus mit der unausweichlichen folgenden Verringerung seiner Kapazität werde eintreten, wenn das Vordringen des Öls, bedingt durch fortwährenden ungleichen Wettbewerb, nicht aufgehalten werden kann.“42
Mit einer gegenüber dem Öl restriktiven Energiepolitik der Bundesregierung war jedoch aufgrund des Energiemangels in der BRD bis 1957, der die Energiepolitik auch darüber hinaus beeinflusste ebenso wenig zu rechnen wie mit einer Intervention der EGKS, da ihre Kompetenzen nicht in den Mineralölsektor reichten.43 Auch zeigte sich bereits im Folgejahr 1959, dass der Geschäftsbereich Grubenbetriebe sehr schnell an Substanz verlor. 1959, im ersten vollen Geschäftsjahr seit der Kohlenkrise betrug der kalkulatorische Verlust der Grubenbetriebe 49 Mio. DM.44 Der Unternehmensleitung der Hibernia AG musste somit klar sein, dass sie die Anteile, die das Unternehmen auf dem Wärmemarkt hielt, auf Dauer an den billigeren Energieträger Heizöl verlieren würde; sie stand nun vor der Herausforderung, sich abseits des Wärmemarktes gesicherte Absatzkanäle für die von ihr geförderte Steinkohle zu sichern.
Vertikale Diversifikation im Geschäftsbereich Steinkohle – Die Kraftwerke der Hibernia AG Bereits vor der Kohlenkrise war die Hibernia AG bestrebt, durch vertikale Vorwärtsdiversifikation neue Kraftwerke zu errichten und zu betreiben, um sich so 41 montan.dok/BBA 32/535, Vorstandsbericht zur Lage des Unternehmens an den Aufsichtsrat, 17.11.1958: „Die beim Heizöl manipulierten Preise hindern einen echten Wettbewerb der Kohle.“ 42 montan.dok/BBA 32/535, Protokoll über die Aufsichtsratssitzung der Hibernia AG am 17.11.1958. 43 Röndigs: Montanunion, S. 422 und Farrenkopf: Wiederaufstieg und Niedergang, S. 220. 44 montan.dok/BBA 32/543.
Von der Bergwerksgesellschaft zum diversifizierten Konzern
155
als freie Zechengesellschaft gesicherte Abnehmer für ihre Steinkohle zu schaffen. Ein weiteres Ziel der Vorwärtsdiversifikation in den Elektrizitätsmarkt war es, den Rohstoff Steinkohle zu Strom zu veredeln, um so einen höheren Ertrag erwirtschaften zu können und somit zusätzlich das unternehmerische Risiko, das sich auf dem Wärmemarkt durch konjunkturelle Schwankungen ergab, zu streuen. Zudem wollte das Unternehmen gegenüber den Konkurrenten bei der Elektrizitätserzeugung durch den Bau moderner Kraftwerke mit einem hohen Wirkungsgrad technologisch nicht ins Hintertreffen geraten. Den Auftakt zum Bau neuer Kraftwerke bildete das Jahr 1957, als mit dem Bau eines neuen 150MW Kraftwerk in Westerholt begonnen wurde.45 Der Vorteil, den das neue Kraftwerk gegenüber den älteren, meist vor oder während des Krieges gebauten Kraftwerken hatte, war, dass es neben Kohle auch alle Ballaststoffe restlos verfeuern konnte. Zudem wurden die bis 1954 üblichen Kraftwerke mit Kapazitäten von bis zu 30MW zunehmend durch neue und leistungsstärkere Großkraftwerke mit einer Leistung von 100 bis 150MW abgelöst, deren Kessel über einen höheren Wirkungsgrad verfügten und daher effizienter zu betreiben waren. Der finanzielle Aufwand für das Projekt bezifferte sich auf rund 63 Mio. DM. Bei einer reinen Abgabe der erzeugten elektrischen Leistung an das öffentliche Netz hätte sich aber lediglich ein kalkulierter Gewinn von ca. 188 000 DM pro Jahr ergeben. Für eine derart hohe Investitionssumme ist der errechnete Gewinn jedoch viel zu niedrig gewesen und hätte eine solch große Investition nicht gerechtfertigt. Der eigentliche Vorteil dieses Vorhabens war ein zu erzielender Verlagerungsgewinn, der erreicht wurde, indem die alten kostenintensiveren, da ineffizienteren Kraftwerke zu Spitzenzeiten gedrosselt wurden, um so die benötigte Menge allein durch das neue, wirkungsgradstärkere Kraftwerk bereitzustellen: „Dadurch, dass es möglich wird, eine Strommenge von rd. 400 Mio. kWh/Jahr nicht mehr durch die alten Kraftwerke, sondern durch das neue Kraftwerk mit einem um 37 % niedrigeren Wärmeverbrauch erzeugen zu lassen, ergibt sich ein Gewinn von DM 5[…] Mio/Jahr.“46 Im Zuge der Kohlenkrise plante das Unternehmen 1959 den Ausbau des Kraftwerks. Für die zukünftigen Absatzmöglichkeiten für elektrischen Strom war die Prognose günstig: Kraftwerksbetreiber, Politik und Bergwerksunternehmen rechneten mit einer Verdopplung des Stromverbrauches in den kommenden zehn Jahre.47 In Anbetracht der seit 1958 wachsenden Kohlen- und Kokshal-
45 montan.dok/BBA 32/530, Vorstandsvorlage über den Neubau des Kraftwerks Westerholt an den Aufsichtsrat, 19.07.1957. 46 Ebd. 47 montan.dok/BBA 32/538, Bericht der Abteilung Energiewesen in der Vorstandsvorlage über die Erweiterung des Kraftwerks Westerholt an den Aufsichtsrat, 20.11.1959.
156 Daniel Dören
den wurde der zweite Kraftwerksblock so konzipiert, dass er technisch dazu in der Lage war, sowohl Kohle als auch Koks als Einsatzstoff verbrennen zu können, um je nach Marktlage den Brennstoff zu wechseln: Kohle, die das Unternehmen nicht am Markt hätte absetzen können, konnte auf diese Weise doch noch verwendet werden.48 In der Kalkulation wurde auf dieser Grundlage ein Jahresgewinn von rund 1,5 Mio. DM errechnet.49 Wenn mit der Elektrifizierung von Bahnstrecken seit den späten 1950er Jahren ein traditioneller Absatzmarkt für Steinkohle wegfiel, ergab sich gleichzeitig die Chance für die Hibernia AG mit ihrer Kraftwerkssparte die Möglichkeit, den Rohstoff Steinkohle zu Bahnstrom zu veredeln. Zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft, der Bergwerksgesellschaft Emscher-Lippe, plante der Hibernia-Vorstand Ende des Jahres 1961 den Bau eines weiteren 154MW-Kraftwerkes in Datteln. Die Finanzierung des Projekts erfolgte dabei anteilig an der Kraftwerksleistung. Von der Kraftwerksleistung entfielen auf die Hibernia AG 124MW; der Rest entfiel auf Emscher-Lippe. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung ermittelte einen Gewinn von rund 200 000 DM: einen relativ kleinen Gewinn. Im Vordergrund stand jedoch nicht der monetäre Gewinn, sondern die sichere Verwendung von 224 000 t Steinkohle pro Jahr.50 Die Kraftwerkssparte der Hibernia AG konnte während der Kohlenkrise einen Gewinn von 4 Mio. DM aufweisen51 und bildete damit auf betriebswirtschaftlicher Ebene eine erfolgreiche Unternehmenssparte. Doch waren es nicht die Kraftwerke, die den erfolgreichsten Geschäftsbereich der Hibernia AG nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere seit der Kohlenkrise bildeten. Vielmehr noch als der Veredlung von Steinkohle zu elektrischem Strom wendete sich das Unternehmen der Mineralölverarbeitung zu.
48 Ebd.: „Die vorerwähnten Maßnahmen setzen unsere Gesellschaft damit in die Lage, die bei Verkauf einen Nettoerlös von DM/t 54erbringen würde, bei der augenblicklichen Marktsituation jedoch überhaupt nicht oder nur mit beträchtlichen Preisabschlägen verkäuflich ist, mit einem Wert von DM/t 57 bzw. DM/t 61 über die Veredelung in Strom auf den Markt zu bringen.“ Die beiden unterschiedlichen Preise bei der Veredelung resultierten daher, dass Preise für zwei unterschiedliche Steuersätze kalkuliert wurden. 49 Ebd. 50 montan.dok/BBA 32/545, Vorstandsvorlage zum Bau eines neuen Kraftwerks in Datteln an den Aufsichtsrat, 24.11.1961. 51 montan.dok/BBA 32/543.
Von der Bergwerksgesellschaft zum diversifizierten Konzern
157
Horizontale Diversifikation – Die zunehmende Dominanz der Mineralölverarbeitung War die Steinkohle bis 1945 als Energieträger in Deutschland nahezu konkurrenzlos, geriet sie nach dem Zweiten Weltkrieg unter einen zunehmend starken Druck des Mineralöls. Diese Veränderung bot für die Hibernia AG aber gleichzeitig die Möglichkeit, sich auf diesem wachsenden Markt zu betätigen, da sie über dementsprechende Anlagen verfügte. Die Herstellung von Kraftstoffen war ursprünglich nicht das Ergebnis einer horizontalen, sondern einer vertikalen Diversifikationsmaßnahme. Das Hydrierwerk in Scholven wurde im Rahmen der Vierjahresplanung errichtet und hydrierte Steinkohle, d. h. verflüssigte den Rohstoff unter hohem Druck zu Kraftstoffen.52 Das Unternehmen hatte bereits vor 1933 die Einführung der Kraftstoffherstellung nach dem Hydrierverfahren in Betracht gezogen. Zum Bau entschloss sich die Geschäftsführung aber erst nach den 1933/34 mit dem Deutschen Reich begonnenen – und schließlich erfolgreichen – Verhandlungen über einen Wirtschaftlichkeitsgarantievertrag.53 Als das Hydrierwerk errichtet wurde, gab es bereits Pläne für den Fall, dass das Mineralöl der Steinkohle Konkurrenz machen würde, indem die Kraftstoffherstellung auf Mineralölbasis in Betracht gezogen wurde. So war es für den Fall, dass das Erdöl als Ausgangsstoff für die Kraftstoffherstellung dauerhaft billiger gewesen wäre als Steinkohle mit rund 20 % der ursprünglichen Investitionssumme möglich, das Hydrierwerk auf Ölbasis umzustellen.54 Somit erscheinen die Pläne der Hibernia AG, das Hydrierwerk ihrer Tochter Scholven AG nach dem Krieg auf Erdölbasis umzustellen nicht als gänzlich neue Unternehmensstrategie, sondern als die Weiterverfolgung unternehmerischer Überlegungen, die bereits während der Zeit des Nationalsozialismus angestellt worden waren. Nach dem Krieg verfügte die Scholven AG daher bereits sowohl über Pläne als auch die Ausstattung, um Kraftstoffe auch auf Mineralölbasis herstellen zu können, um somit horizontal in die Mineralölverarbeitung zu diversifizieren. Zudem bot der Markt für Mineralölprodukte im Vergleich zum Markt für den festen Brennstoff Steinkohle neue Möglichkeiten: Im Gegensatz zu den Kohlenpreisen wurde das Mineralöl bereits 1951 von der staatlichen Preiskontrolle 52 Scherner, Jonas: Die Logik der Industriepolitik im Dritten Reich. Die Investitionen in die Autarkie- und Rüstungsindustrie und ihre staatliche Förderung (Vierteljahrshefte für Sozialund Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 174), Stuttgart 2008, S. 109. 53 Ebd., 133 f. Die Hibernia AG hatte jedoch bereits vor der 1933 ihr Interesse an dem Verfahren bekundet, um minderwertige Kohlensorten, die bei der Förderung anfielen, im Hydrierverfahren veredeln zu können, um sich somit einen sicheren Kanal für jene Kohlensorten zu schaffen. 54 Ebd., S. 134 f.
158 Daniel Dören
befreit, stellte aber als Ausgangsstoff für Heizöl in der BRD noch keine Alternative für den primären Energieträger Steinkohle auf dem Wärmemarkt dar.55 Zwischen 1950 und 1955 war es vor allem der Markt für Kraftstoffe, der expandierte: Der Benzinverbrauch erhöhte sich um den Faktor 2,7, der von Diesel um den Faktor 3,2.56 Nachdem eine Demontage des Werkes 1949 nicht mehr zur Debatte stand und alle Produktionsbeschränkungen 1951 aufgehoben wurden,57 begann die Verarbeitung von Erdöl in den ehemaligen Kohlehydrieranlagen der Scholven AG mit einer Jahreskapazität von 200 000 t Erdöldurchsatz. Im folgenden Jahr 1953 sollte zusätzlich eine neue katalytische Crackanlage in Betrieb genommen werden, die den Jahresdurchsatz verdoppeln sollte.58 Da die Herstellung von Benzin aus Erdöl in Hydrierkammern technisch aufwendiger und teurer ist als bei herkömmlichen Destillationsverfahren, war eine rentable Herstellung nur dann möglich, wenn das Benzin, das in den Hydrierwerken hergestellt wurde, subventioniert wurde. Die Unternehmen, die Hydrierwerke betrieben, forderten eine im Vergleich zu der Herstellung von Benzin aus Leichtölen in Raffinerien eine geringere Steuerbelastung von ca. 130 DM pro Tonne für Benzin, um gegenüber den Raffinerien konkurrenzfähig zu sein.59 Die geforderten Steuerbegünstigungen wurden den Betreibern der Hydrierwerke von der Bundesregierung gewährt, um bei der Kraftstoffbeschaffung Devisen einzusparen.60 In der so genannten Hydrierpräferenz61 in der ersten Fassung des Mineralölsteuergesetzes vom 21. Mai 1953 wurde Benzin aus der Herstellung mit Leichtölen mit 27 DM je 100kg, Benzin aus der Herstellung von Hydrieranlagen mit 14,85 DM besteuert.62 Umgerechnet auf eine Tonne Benzin entstand so eine Steuervergünstigung von 121,50 DM je Tonne. Die Vergünstigung entsprach also fast genau der Höhe, welche die Unternehmen mit Hydrierwerken gefordert hatten. Das rasche Wachstum auf dem Treibstoffmarkt in Deutschland forderte von der Scholven Chemie AG eine Kapazitätserweiterung der Verarbeitungsanlagen; zudem erkannte das Unternehmen, dass das Heizöl für die Energieversorgung auf dem Wärmemarkt in Zukunft eine größere Bedeutung erfahren würde, und
55 Siehe: Karlsch, Rainer/Stokes, Raymond G.: Faktor Öl. Die Mineralölwirtschaft in Deutschland 1859–1974, München 2003, S. 277. 56 Ebd., S. 278. 57 Ebd., S. 285 f. 58 montan.dok/BBA 32/514, Vorstandsbericht zur Lage bei Scholven Chemie an den Aufsichtsrat, 26.07.1953. 59 montan.dok/BBA 32/514, Vorstandsbericht zur Lage bei Scholven Chemie an den Aufsichtsrat, 26.07.1953. 60 Ebd., S. 275. 61 Ebd., S. 288. 62 Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1953, Teil I, Nr. 23, S. 234 f.
Von der Bergwerksgesellschaft zum diversifizierten Konzern
159
plante daher die Aufnahme der Heizölherstellung. Dabei orientierte sich das Unternehmen an den von der Bundesregierung aufgestellten Energiebedarfsprognosen.63 Diese gingen von einem Anstieg der Heizölversorgung auf ca. 15 bis 16 Mio. t pro Jahr für 1965 aus. Doch auch die Zunahme der Bedeutung des Heizöls auf dem Energiemarkt bis zum Jahr 1956 wurde als beträchtlich eingestuft. Wurde im Jahr 1954 noch ca. eine Mio. t Heizöl verfeuert, so stieg der Verbrauch 1955 auf rund 2 Mio. t. Für 1956 wurde bereits mit einer Zunahme auf ca. 4,5 Mio. t geschätzt.64 Da auch der Treibstoffverbrauch erheblich steigen würde und die Konkurrenz-Raffinerien ihrerseits die Kapazitäten erhöhten, sah sich die Scholven AG unter Zugzwang, wollte man ebenfalls eine Kostendegression bei der Mineralölverarbeitung erreichen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher sollte die vorhandene Kapazität auf rund 2 Mio. Jahrestonnen Rohöldurchsatz erhöht werden. Der Vorstand betrachtete diese Kapazität als zukünftige Untergrenze, um wettbewerbsfähig zu bleiben.65 Die Aufnahme der Mineralölverarbeitung als horizontale Diversifikationsmaßnahme änderte das Konzernbild grundlegend. Durch den Ausbau des Geschäftsbereiches Mineralölverarbeitung nahm dessen Bedeutung innerhalb des Gesamtkonzerns zu. Gleichzeitig kam es seit der Kohlenkrise zu einer Konsolidierung im Bereich der Grubenbetriebe. Da die geplanten Einsparungen in den folgenden Jahren bei den Bergwerken hinter den Erwartungen zurück blieben66 und nur noch durch Subventionen, die dazu dienten, soziale Spannungen vom Bergbau abzuwenden67, aufrecht erhalten werden konnte, schwand die Bedeutung dieses Geschäftsbereiches weiter. Bereits im Jahr 1962 überstieg der Anteil der Chemie, deren Großteil der Erdölverarbeitung zuzurechnen ist, mit 37 % den der Grubenbetriebe und Kokereien am Gesamtumsatz um gut 10 %. Im Jahr 1968 betrug der Vorsprung bereits 33 %, wobei sich der Anteil der Bereiche Chemie, auf 47 % steigern konnte, wohingegen der Umsatzanteil der Grubenbetriebe am Gesamtergebnis lediglich noch 14 % betrug (Tabelle 1).68 63 BArch B 102/22079, Schreiben von Scholven Chemie AG an Bundeswirtschaftsministerium, 04.08.1956. 64 montan.dok/BBA 32/528, Vorstandsvorlage 8-IV-1956 zur Erhöhung des Grundkapitals der Scholven AG an den Aufsichtsrat, 03.12.1956. 65 Ebd. 66 montan.dok/BBA 32/540, Anlage 4 „Voll- und teilmechanisierte Streben, WestdeutschlandHibernia“ zum Bericht über den Stand der Grubenbetriebe, 05.07.1960. Die Hiberina AG lag im März 1960 bei der mechanisierten Förderung gegenüber dem bundesdeutschen Durchschnitt mit 43,5 % gegenüber 51 % merklich im Hintertreffen. 67 Ahrens, Ralf: Sectoral Subsidies in West German Industrial Policy. Programmatic Objectives and Pragmatic Applications from the 1960s to the 1980s, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook 58 (2017:1), S. 59–82, hier S. 64. 68 montan.dok/BBA 32/473 und montan.dok/BBA 32/475.
160 Daniel Dören
Tab. 1: Anteil der einzelnen Hibernia-Konzernsparten am Gesamtkonzernumsatz 1961 und 1968 Quelle: montan.dok/BBA 32/473 und montan.dok/BBA 32/475. Sparte
1961
1968
Kohlen, Koks, Briketts
27 %
14 %
5%
6%
37 %
47 %
Logistik
7%
5%
Handel
23 %
27 %
1%
1%
Energie (Strom, Druckluft, Dampf) Chemische Erzeugnisse (Rohölverarbeitung und Kohlenwertstoffe)
Sonstige
Die Zunahme der Bedeutung der Rohölverarbeitung wird nicht nur anhand der Anteile am Gesamtkonzernumsatz deutlich, sondern spiegelt sich auch in der Entwicklung der Förderzahlen bzw. im Rohöldurchsatz wider. Abbildung 2 zeigt den Vergleich zwischen der jährlichen Förderung und der Menge an verarbeitetem Rohöl der Hibernia AG im Zeitraum von 1949 bis 1968. Während die Förderung von Steinkohle einen Anstieg von rund acht Mio. t im Jahr 1949 auf rund elf Mio. Jahrestonnen im Jahr 1956 verzeichnen konnte, ist die Verarbeitung von Rohöl von 1953 bis 1958 in absoluten Zahlen kaum relevant gestiegen.69 In den auf den Beginn der Kohlenkrise folgenden zwei Jahren sollte sich das Bild jedoch stark wandeln. Während die Verarbeitungskapazität von Rohöl sich von 1958 innerhalb eines Jahres von ca. einer. Mio. Jahrestonnen auf zwei Mio. Jahrestonnen verdoppelte und tendenziell weiter stieg, wurde die jährliche Steinkohlenfördermenge im Zeitraum von 1958 bis 1961 um die gleiche Menge (eine Mio. Jahrestonnen) zurückgefahren. Diese Entwicklung setzte sich mit der verschärfenden Kohlenkrise fort. Während die Steinkohlenförderung bis 1965 relativ konstant gehalten werden konnte verzeichnete der Geschäftsbereich Erdölverarbeitung jährlich steigende Verarbeitungsmengen, bis die Differenz zwischen beiden Werten im Jahr 1969 lediglich noch rund eine Mio. Jahrestonnen betrug. Somit wurde zwar in absoluten Zahlen immer noch mehr Kohle gefördert als Rohöl verarbeitet. Da Mineralöl einen höheren Energiegehalt als Steinkohle aufweist, überstieg die Verarbeitung von Mineralöl, ausgedrückt in Steinkohleneinheiten 1967 erstmals die Förderung und Verarbeitung von Steinkohle.
69 Auf eine Umrechnung in relatives Wachstum wurde aufgrund des niedrigen Ausgangswertes bei der Mineralölverarbeitung zunächst aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit verzichtet.
Von der Bergwerksgesellschaft zum diversifizierten Konzern
161
Jahresproduktion bzw. -förderung Vergleich Steinkohle/Rohöl 12000
10000
8000
6000
4000
2000
0 1949 1950 1951
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Kohleförderung
Rohöleinsatz
Rohöl, korregiert in Steinkohleneinheiten
Abb. 2: Vergleich der Jahresförderung von Steinkohle im Vergleich zum Rohöldurchsatz von 1949–1968 Quelle: montan.dok/BBA 32/473, montan.dok/BBA 32/475 und montan.dok/BBA 32/517–539.
Die Verarbeitung von Mineralöl zu Kraftstoffen und Heizöl entwickelte sich also spätestens seit Beginn der 1960er Jahre zu der dominierenden Unternehmenssparte im Konzern. Das brachte dem Mutterkonzern einerseits Gewinne, die zur Konsolidierung des Steinkohlensektors dringend benötigt wurden. Andererseits partizipierte das Tochterunternehmen Scholven gleichzeitig am Aufstieg des Mineralöls als Energieträger in der BRD und trug damit gleichzeitig auch zu der Verschärfung der Krise des Steinkohlenbergbaus, der zu Beginn der 1950er Jahre noch den Großteil der Geschäftstätigkeit und des Umsatzes der Hibernia AG ausmachte bei. Diese auf den ersten Blick durchaus ambivalente Situation spiegelte sich auch in den Sitzungen des Aufsichtsrates der Hibernia AG zu Beginn der Kohlenkrise wider: Während der Vorstandsvorsitzende Hans-Werner von Dewall in der Sitzung am 17.11.1958 im Tagesordnungspunkt Nr. 1 die Mitglieder des Aufsichtsrates immer wieder vor dem Vordringen des Öls auf den deutschen Energiemarkt und der daraus resultierenden Gefahr für die deutsche Steinkohle warnte, verkündete er im Tagesordnungspunkt Nr. 2 bei der Rohölverarbeitung
162 Daniel Dören
eine Umsatzsteigerung um 8 % und die weiteren Expansionspläne für die Scholven AG im Mineralölsektor.70 Bei von Dewalls Aussage muss allerdings beachtet werden, dass er sie in einem paritätisch besetzten Aufsichtsrat, bei dem die Hälfte der Mitglieder durch Bergbau-Arbeitnehmervertreter gestellt wurde, äußerte und er nicht das Missfallen der Arbeitnehmerseite auf sich ziehen wollte. Die Kohleförder- bzw. Rohölverarbeitungsmengen zeigen jedoch, dass das Unternehmen längst auf dem Weg war, seinen Schwerpunkt in die Mineralölverarbeitung zu verschieben. Dies gelang nicht zuletzt auch deswegen, weil die Konzerntochter Scholven, bei der das Mineralöl verarbeitet wurde nicht vom Montanmitbestimmungsgesetz betroffen war. Die Bergbau-Arbeitnehmer Vertreter hatten also keine Möglichkeit, dem Raffinerieausbau irgendetwas entgegenzustellen. Ein weiterer Aspekt, der darauf hindeutet, dass die Hibernia AG nicht daran dachte, ihre Expansion im Mineralölsektor zu verlangsamen war seit 1959 ihre aktive Beteiligung gegen die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, die Hydrierpräferenz abzuschaffen. Das Unternehmen drohte damit, bei einem Wegfall der Subvention für Hydrierbenzin dazu gezwungen zu sein, den Ausstoß an Heizöl erhöhen zu müssen, womit der Konkurrenzdruck für Steinkohle auf dem Wärmemarkt zu Beginn der Kohlenkrise weiter erhöht worden wäre.71
Fazit Der Wandel auf dem deutschen Energiemarkt hatte weitreichende Auswirkungen auf die Hibernia AG. Während es für das Unternehmen bis zum Beginn der Kohlenkrise kein Problem war, gleichzeitig Steinkohle zu fördern und Rohöl zu verarbeiten, entstand mit der Kohlenkrise eine unternehmerische Zwiespältigkeit, da die seit 1956 aufgenommene Heizölproduktion nun auf dem Wärmemarkt in Konkurrenz zur Steinkohle trat. Nahm die Steinkohlenförderung und -verarbeitung bis zur Kohlenkrise noch die dominierende Rolle im Gesamtbild des Unternehmens ein, sollte sich das nach 1958 grundlegend ändern. Diese Entwicklung brachte das Unternehmen in eine Situation, die durchaus ambivalente Züge aufwies.
70 montan.dok/BBA 32/535, Protokoll über die Aufsichtsratssitzung der Hibernia AG am 17.11.1958. 71 BArch B 102/14072, Schreiben von Gelsenberg Benzin AG, Scholven Chemie AG, Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff AG und Fachverband Kohlechemie an den Bundeswirtschaftsminister, 25.05.1959.
Von der Bergwerksgesellschaft zum diversifizierten Konzern
163
Die unternehmerische Zwiespältigkeit, einerseits auf die Gewinne aus der Mineralölverarbeitung nicht verzichten zu wollen, andererseits das Vordringen des Öls auf den deutschen Markt für den Niedergang des Kerngeschäfts verantwortlich zu machen, kann aus unternehmerischer Sicht mit den großen Investitionen erklärt werden, die das Unternehmen in den 1950er Jahre in beiden Sparten getätigt hatte, als noch nicht abzusehen war, dass das Mineralöl der Steinkohle angestammte Marktanteile streitig machen würde. Die kurz vor der Krise getätigten Investitionen waren zugleich auch ein Grund, den Bergbau weiterzuführen. Da beim Beschluss der Expansion im Steinkohle- und im Mineralölsektor Anfang der 1950er Jahre von einem stabilen Kohlenmarkt ausgegangen wurde, bestand zu diesem Zeitpunkt kein Anlass, sich nicht auch in der Mineralölverarbeitung zu engagieren. Eine gemäßigtere Expansionspolitik im Bereich der Mineralölverarbeitung hätte höchstwahrscheinlich zur Folge gehabt, dass die Scholven AG gegenüber ihren Konkurrenten nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen wäre, was die Rentabilität des Gesamtkonzerns weiter verschlechtert hätte.
Quellenverzeichnis Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok) beim Deutschen Bergbau-Museum Bochum/ Bergbau-Archiv Bochum montan.dok/BBA 32 Bundesarchiv Koblenz BArch B/102 BArch B/115 Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1953, Teil I, Nr. 23.
Literaturverzeichnis Abelshauser, Werner: Der Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung, München 1984. Abelshauser, Werner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Von 1945 bis zur Gegenwart (beck’sche Reihe 1587), München 22011. Ahrens, Ralf: Sectoral Subsidies in West German Industrial Policy. Programmatic Objectives and Pragmatic Applications from the 1960s to the 1980s, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook 58 (2017:1), S. 59–82. Ambrosius, Gerold: Der Staat als Unternehmer. Öffentliche Wirtschaft und Kapitalismus seit dem 19. Jahrhundert (Kleine Vandenhoeck-Reihe), Göttingen 1984.
164 Daniel Dören
Farrenkopf, Michael: Wiederaufstieg und Niedergang des Bergbaus in der Bundesrepublik, in: Ziegler, Dieter (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der Deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 183–302. Jörnmark, Jan: Coal and Steel in Western Europe 1945–1993. Innovative Change and Institutional Adaption (Publications of the Institute of Economic History of Gothenburg University 67), Göteborg 1993. Karlsch, Rainer/Stokes, Raymond G.: Faktor Öl. Die Mineralölwirtschaft in Deutschland 1859– 1974, München 2003. Nonn, Christoph: Die Ruhrbergbaukrise. Entindustrialisierung und Politik 1958–1969 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 149), Göttingen 2001. Parnell, Martin F.: The German Tradition of Organized Capitalism. Self-Government in the Coal Industry (Government-Industry Relations 7), Oxford 1994. Röndigs, Uwe: Globalisierung und europäische Integration. Der Strukturwandel des Energiesektors und die Politik der Montanunion 1952–1962 (Nomos Universitätsschriften Geschichte 11), Baden-Baden 2000. Scherner, Jonas: Die Logik der Industriepolitik im Dritten Reich. Die Investitionen in die Autarkie- und Rüstungsindustrie und ihre staatliche Förderung (Vierteljahrshefte für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 174), Stuttgart 2008. Spoerer, Mark/Streb, Jochen: Neue Deutsche Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 2013. Streb, Jochen: Energiewenden aus historischer Perspektive, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook 56 (2015:2), S. 587–608. Streb, Jochen: Staatliche Technologiepolitik und branchenübergreifender Wissenstransfer. Über die Ursachen der internationalen Innovationserfolge der deutschen Kunststoffindustrie im 20. Jahrhundert (Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 4), Berlin 2003. Temin, Peter: The „Koreaboom“ in Westgermany. Fact or Fiction?, in: The Economic History Review 48 (1995:4), S. 737–753. Wöhe, Günter: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, München 252013.
Juliane Czierpka
Die Organisation des Ruhrkohlen-Absatzes zwischen Alliierter Hoher Kommission und Montanunion aus Sicht des Ruhrbergbaus Einleitung Als der damalige französische Außenminister Robert Schuman am 9. Mai 1950 vor geladenen Journalisten seine Vision eines geeinten friedlichen Europas vorstellte, markierte dies einen Wendepunkt in der französischen Politik gegenüber dem fünf Jahre zuvor besiegten Deutschland. Während die USA bereits Ende der 1940er Jahre ihre westeuropäischen Partner zu einer engeren wirtschaftlichen Kooperation und einer Rücknahme der Kontrollen Deutschlands zugunsten einer Einbindung des ehemaligen Feindes in ein Bündnis europäischer Staaten mit supranationalen Organen ermutigt hatten, hatte die französische Regierung noch im Frühjahr 1949 eine internationale Kontrolle des Ruhrgebiets gefordert. Diese französische Haltung hatte sich auch in der Diskussion um die Schaffung einer Kontrollinstanz für das Ruhrgebiet auf der Londoner Sechsmächtekonferenz im Frühjahr 1948 niedergeschlagen, in welcher die Franzosen eine solche Kontrollbehörde zur Bedingung ihrer Zustimmung zu einer Einbeziehung Deutschlands in andere wirtschaftliche Zusammenhänge gemacht hatten.1 Allerdings zeichnete sich nur ein knappes Jahr nach der Errichtung der Internationalen Ruhrbehörde im April 1949 ab, dass die USA und auch Großbritannien nicht zu einer Aufrechterhaltung ernsthafter Kontrollen der deutschen Wirtschaft bereit waren und ihnen im entstehenden Konflikt mit der Sowjetunion vielmehr an einer Stärkung der westdeutschen Wirtschaft und einer Bindung der jungen Bundesrepublik an die Westmächte gelegen war. Zugleich drängte vor allem der US-amerikanische Hohe Kommissar John McCloy die französische Regierung, eine Führungsrolle in dem von den Amerikanern gewünschten Prozess europäischer Integration zu übernehmen, um notfalls auch ohne britische Beteiligung eine Einbindung der Bundesrepublik in westli-
1 Bührer, Werner: Ruhrstahl und Europa. Die Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie und die Anfänge der europäischen Integration 1945–1952 (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 53), München 1986, S. 143; Dorfey, Beate: Die Internationale Ruhrbehörde im Spannungsfeld britischer, französischer, belgischer, luxemburgischer und niederländischer Interessen, in: Geschichte im Westen 1 (1994), S. 75–83, S. 75; Milward, Alan S.: The Reconstruction of Western Europe 1945–51, Berkeley/Los Angeles 1984, S. 154. https://doi.org/10.1515/9783110729979-008
166 Juliane Czierpka
che wirtschaftliche Bündnisse sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund stellte der Vorschlag Schumans zur Gründung einer westeuropäischen Montanunion eine Änderung in der Strategie, nicht aber den Zielen, der französischen Regierung gegenüber Westdeutschland dar. So diente auch die Zusammenführung der westeuropäischen Kohle- und Stahlindustrien unter dem Dach einer supranationalen Behörde der Befriedigung des französischen Sicherheitsbedürfnisses. Konrad Adenauer, den Schuman kurz vor der offiziellen Verkündung von seinem Plan in Kenntnis gesetzt hatte, begrüßte die vorgeschlagene Montanunion, in welcher er einen Gewinn von Souveränität für die Bundesrepublik sah.2 Die auf Schumans Vorschlag folgenden Verhandlungen zum Schuman-Plan vor dem Hintergrund der Deutschlandpolitiken der westlichen Alliierten waren ebenso Gegenstand historischer Forschung, wie die Position der Eisen- und Stahlindustrie des Ruhrgebiets zu dem verhandelten Montanvertrag.3 Wenig Beachtung fand dagegen bisher die Rolle des Ruhrbergbaus. So existiert bislang keine empirische Untersuchung, welche die Folgen der Verbindung amerikanischer Interessen in Europa mit den Verhandlungen über den Vertrag zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) für die Ausgestaltung der Montanunion aus der Sicht der Akteure des Ruhrbergbaus analysiert. Im Folgenden soll anhand der archivalischen Überlieferungen der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung (DKBL), des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) und des Sachverständigen für Bergbau in der deutschen Delegation zur Verhandlung über den Schuman-Plan, Hans W. von Dewall, untersucht werden, welche Rolle der amerikanische Wunsch nach einer wirtschaftlichen und politischen Integration der Bundesrepublik in die westliche Welt bei der Schaffung der Montanunion spielte. Hierzu wird die Intervention der Alliierten Hohen Kommission (AHK) bei den Verhandlungen über die Organisation des Verkaufs von Ruhrkohlen im Rahmen der EGKS zum Gegenstand einer empirischen Untersuchung gemacht. So wird die Verknüpfung des Gesetzes Nr. 27 der AHK über die „Umgestaltung des deutschen Kohlenbergbaus und der deutschen Stahl- und Eisenindustrie“ mit den Verhandlungen zum Schuman-Plan analysiert und über2 Vgl. zu den Zielen Frankreichs und Deutschlands Brunn, Gerhard: Die europäische Einigung von 1945 bis heute, Stuttgart 2002, S. 70–82. 3 Berghahn, Volker R.: Industriegesellschaft und Kulturtransfer. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen im 20. Jahrhundert (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 182), Göttingen 2010, S. 213–229; Bührer: Ruhrstahl und Europa; Schwabe, Klaus: Fürsprecher Frankreichs? John McCloy und die Integration der Bundesrepublik, in: Herbst, Ludolf/Bührer, Werner/Sowade, Hanno (Hg.): Vom Marshallplan zur EWG. Die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die westliche Welt (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 30), München 1990, S. 517–533.
Die Organisation des Ruhrkohlen-Absatzes
167
prüft, welche Folgen diese für den Ruhrbergbau und die Organisation des Absatzes von Ruhrkohlen hatte. Die Frage nach der Ausgestaltung der Absatzorganisation bietet sich dabei als Untersuchungsgegenstand an, weil die Akteure des Ruhrbergbaus den gemeinschaftlichen Verkauf ihrer Erzeugnisse ebenso kompromisslos und vehement verteidigten, wie er von alliierter Seite abgelehnt wurde. Einleitend wird im Folgenden ein knapper Überblick über die Interessen der Akteure in Bezug auf den gemeinschaftlichen Absatz von Ruhrkohlen gegeben. Auf Seiten der europäischen Verhandlungspartner wird hierbei auf die französische Position fokussiert und damit der dominanten Rolle der gleichzeitigen Besatzungsmacht Rechnung getragen. Die Darstellung der Interessen der bundesdeutschen Akteure differenziert zwischen den Zielen der im Ruhrbergbau verankerten oder diesen nahestehenden Akteure, namentlich der DKBL, der Industriegewerkschaft Bergbau (IGB) und dem Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), und denen der Bundesregierung. Innerhalb dieser zwei Akteursgruppen musste aus Platzgründen auf eine weiter ausdifferenzierende Analyse der Standpunkte verzichtet werden. Nach dieser kurzen Einführung und einer Schilderung der Situation nach den ersten Verhandlungsmonaten folgt die Untersuchung der Verknüpfungen zwischen der alliierten Neuordnung und den Verhandlungen zum Schuman-Plan. Hierzu werden mit dem Memorandum Adenauers aus dem März 1951, der Gründung des DKV-Auschusses im Mai 1951 und dem Erlass von zwei Durchführungsverordnungen zum Gesetz Nr. 27 im Mai 1952 drei Ereignisse aus dem Prozess der Neuordnung des Ruhrbergbaus herausgegriffen und hinsichtlich ihrer Folgen für die Verhandlungen zur Montanunion analysiert.
Die Organisation des Absatzes von Ruhrkohlen zwischen alliierter Neuordnung und SchumanPlan Die Ausgangssituation und der Beginn der Verhandlungen zum Schuman-Plan An den Verhandlungen zum Schuman-Plan waren neben der französischen Regierung und der Bundesregierung die Regierungen Italiens, Belgiens, Luxemburgs und der Niederlande beteiligt. Jedes Land war in den Verhandlungen
168 Juliane Czierpka
durch eine Delegation vertreten, die Leitung der deutschen Delegation war mit Walter Hallstein und Werner Blankenhorn zwei Mitarbeitern des Bundeskanzleramts übertragen worden. Weitere Mitglieder waren Hans C. Boden, damaliger Leiter der Finanzabteilung der Allgemeinen Electricitäts-Gesellschaft, Walter Bauer, der zuvor mit der Entflechtung des süddeutschen Kohlenkontors betraut gewesen war und zwischenzeitlich als Beobachter zur Internationalen Ruhrbehörde gesandt worden war, und das Vorstandsmitglied des DGB Hans vom Hoff. Die Montanindustrie war nur in Person der beiden Generalsachverständigen Hans W. von Dewall, damals Vorstandsmitglied der Hibernia AG, und M. C. Müller in den Verhandlungsrunden vertreten. Werner Bührer sieht in der Zusammensetzung der Delegation den Wunsch Adenauers den Schuman-Plan als politisches Projekt zu betrachten und die unmittelbar betroffenen Industrien so weit wie möglich aus den Verhandlungen herauszuhalten, um die Gründung der Montanunion nicht durch deren partikulare Interessen zu gefährden.4 Eines der Interessen des Ruhrbergbaus, in denen Adenauer vermutlich eine Gefahr für das Zustandekommen der Montanunion sah, war der Gemeinschaftsverkauf für Ruhrkohlen, den die Akteure im Ruhrgebiet für unerlässlich verstanden, während von Seiten der USA und Frankreich die Forderung nach einer Auflösung der bestehenden Verkaufsorganisation zu erwarten war. Der Zusammenschluss der Zechen zum Verkauf und Vertrieb ihrer Erzeugnisse hatte eine gewisse Tradition im Ruhrgebiet, seit die lokalen Bergbauunternehmer 1893 das Rheinisch Westfälische Kohlensyndikat (RWKS) gegründet hatten, welches fortan als alleiniger Anbieter für Ruhrkohlen auftrat. Das RWKS überdauerte den Ersten Weltkrieg und die Zwischenkriegszeit und als Teil der Reichsvereinigung Kohle auch die Zeit des Nationalsozialismus. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verfügte die britische Militärregierung die Liquidation des RWKS und unterstellte die Zechen in ihrer Zone der North German Coal Control (NGCC). Außerdem rief sie die Kohlenverteilungsstelle Ruhr ins Leben, welche im Auftrag der NGCC die Verteilung und den Versand der knappen Steinkohlen organisieren sollte.5 1946 wurde die Kohlenverteilungsstelle Ruhr durch das North German Coal Distribution Office abgelöst, welches nun für Verteilung und Verkauf aller festen Brennstoffe der in der britischen Zone liegenden Reviere zuständig war. Mit der Gründung der Bizone änderten sich auch die Kontroll- und Verteilungsstrukturen im Bereich des Bergbaus erneut. So übernahm die im November 1947 neu geschaffene britisch-amerikanische Coal Control Group (CCG) die Kontroll4 Bührer: Ruhrstahl und Europa, S. 181 f. 5 Vgl. dazu Vogelsang, Heinz: Die deutsche Kohlenverkaufsorganisation in ihrer historischen Entwicklung, München 1957, S. 122f; Abelshauser, Werner: Der Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung, München 1984, S. 15.
Die Organisation des Ruhrkohlen-Absatzes
169
aufgaben der NGCC, deren operative Aufgaben an die neu gegründete DKBL übertragen wurden.6 Im November 1948 wurde der Deutsche Kohlen-Verkauf (DKV) als Tochter der DKBL geschaffen.7 Der DKV war eine zentralisierte Verkaufs- und Vertriebsorganisation für Steinkohlen, die den Versand der Kohlen steuerte, diese auf die zur Verfügung stehenden Transportmittel verteilte und die Abrechnung der Lieferungen sowie den kompletten Zahlungsverkauf übernahm und damit dem RWKS durchaus ähnlich war. Allerdings hatte der DKV, da die Preise für Steinkohlen erst zu einem späteren Zeitpunkt freigegeben wurden, keinerlei Kompetenzen auf dem Gebiet der Preisgestaltung.8 Die Auflösung des DKV zugunsten der Schaffung eines vollständigen Wettbewerbs zwischen den Zechen erschien den Verantwortlichen im Ruhrbergbau weder praktikabel noch durchführbar. Als unerlässlich wurde eine gemeinsame Absatzorganisation für Ruhrkohlen gehalten, um eine sortengerechte Verteilung der Kohlen zu gewährleisten und einen Preiswettbewerb zu verhindern. Dieser würde, so die Argumentation des Ruhrbergbaus, in Zeiten sinkender Nachfrage zu Zechenschließungen führen, die nicht nur die dauerhafte Vernichtung von Abbaukapazitäten zur Folge hätten, vielmehr würden auch die damit einhergehenden Entlassungen zu punktuell sehr hoher Arbeitslosigkeit und damit zu sozialen Spannungen führen. Durch einen zentral koordinierten Absatz hingegen würden die eingehenden Aufträge gleichmäßig verteilt und somit auch die wirtschaftlichen Konsequenzen einer geringen Kohlenachfrage auf alle Ruhrzechen verteilt und somit der geringen Elastizität der Branche Rechnung getragen. Als Argument für die Notwendigkeit einer zentralisierten Absatzorganisation in Zeiten hoher Nachfrage, wurden das Problem einer gerechten Verteilung der knappen Brennstoffe auf die jeweiligen Verbrauchergruppen und die möglichst effiziente Nutzung der Transportinfrastruktur angeführt.9 Unerwähnt blieb, dass der gemeinschaftliche Verkauf der Erzeugnisse auch immer dazu gedient hatte, die Ruhrkohlen auf bestimmten Märkten zu nicht kosten6 Abelshauser, Ruhrkohlenbergbau, S. 50 f. Die CCG wurde im Frühjahr 1949 aufgrund der Aufnahme Frankreichs in Combined Coal Control Group (CCCG) umbenannt. Siehe hierzu auch Farrenkopf, Michael: Wiederaufstieg und Niedergang des Bergbaus in der Bundesrepublik, in: Ziegler, Dieter (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 183–302, S. 199 f. 7 Siehe zur Gründung des DKV N. N.: Militärregierung – Deutschland Amerikanisches Kontrollgebiet. Gesetz Nr. 75. Umgestaltung des deutschen Kohlenbergbaues und der deutschen Eisen- und Stahlindustrie, in: Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes Beilage Nr. 1 (10.11.1948), S. 8. 8 Vgl. hierzu Vogelsang: Deutsche Kohlenverkaufsorganisation, S. 123 f. 9 Vgl. z. B. Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok) beim Deutschen Bergbau-Museum Bochum/Bergbau-Archiv Bochum (BBA), BBA 32/3980, Kost an Adenauer, 11.01.1951.
170 Juliane Czierpka
deckenden Preisen anzubieten, um so andere Anbieter zu unterbieten und die Verluste durch ein Umlageverfahren auszugleichen.10 In den ersten Monaten der Verhandlungen über den Schuman-Plan, sahen die Akteure des Ruhrbergbaus keinerlei Gefahr für das Fortbestehen des DKV oder einer ähnlichen Organisation zum gemeinschaftlichen Verkauf ihrer Erzeugnisse. Selbst als im September 1950 ein Memorandum von Jean Monnet – dem geistigen Vater hinter dem Schuman-Plan und dem Leiter der französischen Verhandlungsdelegation – zirkulierte, in dem dieser die Bedeutung eines Kartellverbots betonte, war man sich im Ruhrgebiet sicher, dass eine gemeinschaftliche Verkaufsorganisation unter die angedachten Ausnahmeregelungen fallen würde und die Ziele des Schuman-Plans nur durch eine zentralisierte Absatzorganisation zu erfüllen seien.11 So gingen die Akteure des Ruhrbergbaus im Herbst 1950 davon aus, dass auch einige der anderen Länder für einen regulierten Wettbewerb eintreten und zweckmäßige Verkaufsorganisationen billigen würden.12 Parallel zu dem Beginn der Verhandlungen über den Schuman-Plan, traf die AHK Maßnahmen zur Neuordnung der deutschen Montanindustrie gemäß dem Gesetz Nr. 27. Bereits im Januar 1950 hatte die Bundesregierung versucht, sich ein Mitspracherecht bei der Umgestaltung der Kohle- und Stahlindustrie, die zu diesem Zeitpunkt noch auf der Grundlage des Gesetzes Nr. 75 aus dem November 1948 erfolgte, zu sichern. Die AHK hatte zwar eine Mitwirkung der Bundesregierung begrüßt, jedoch deutlich gemacht, dass Gesetzesinitiativen von deutscher Seite nicht erwünscht seien, da die Neuordnung ausschließlich den Alliierten vorbehalten sei. Zugleich unterrichtete die AHK die Bundesregierung darüber, dass gerade eine Neufassung des Gesetz Nr. 75 erarbeitet werde.13 Während in dem Gesetz Nr. 75 die Gründung des DKV verfügt worden war, enthielt das Gesetz Nr. 27 keinerlei konkrete Vorgaben bezüglich der DKBL und des DKV. „Organisation und Aufgaben“, so Artikel 3 des Gesetzes, „werden durch Ausführungsbestimmungen oder Anordnungen, die etwa von der Alliierten Hohen Kommission erlassen werden, bestimmt“.14 Vor diesem Hintergrund dräng-
10 Vgl. hierzu Roelevink, Eva-Maria: Organisierte Intransparenz. Das Kohlensyndikat und der niederländische Markt 1915–1932 (Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 26), München 2015, S. 66–69. 11 Vgl. hierzu montan.dok/BBA 32/3980, Bemerkungen zu der Stellungnahme des Herrn Jean Monnet über das Memorandum vom 28. September 1950, 12.10.1950. 12 Ebd.; Bundesarchiv (BArch), B 102/3310 Heft 1, Kost an Adenauer, 01.12.1950. 13 BArch, Kabinettsprotokolle der Bundesregierung online, 55. Kabinettssitzung am 24. März 1950. E. Gesetz Nr. 75. 14 McCloy, John: Gesetz N°27 hinsichtlich der Umgestaltung des deutschen Kohlenbergbaus und der deutschen Stahl- und Eisenindustrie, in: Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission für Deutschland 20 (16.05.1950).
Die Organisation des Ruhrkohlen-Absatzes
171
ten sowohl die Vertreter der Bundesregierung als auch die des Ruhrbergbaus auf ein schnelles Voranschreiten der Neuordnung des Ruhrkohlenbergbaus, um diese zum Abschluss zu bringen und anschließend die zukünftige Organisation der Montanwirtschaft als gleichberechtigter Verhandlungspartner mit den übrigen fünf Ländern der geplanten EGKS auszuhandeln. Mit Jahresbeginn 1951 wuchs im Ruhrgebiet erstmals die Sorge, dass das Beibehalten einer Absatzorganisation wie dem DKV im Rahmen der Montanunion zu einem strittigen Punkt werden und von Seiten der anderen beteiligten Länder eine Abschaffung des Gemeinschaftsverkaufs für Ruhrkohlen gefordert werden könnte. Im Dezember 1950 wandte sich der Generaldirektor der DKBL, Heinrich Kost, an den Bundeskanzler und berichtete diesem, dass die amerikanischen Vertreter in der AHK nicht nur die von der CCCG geforderte Umwandlung des DKV in eine Verkaufsorganisation für Ruhrkohlen blockierten, sondern auch versucht hätten, die Aufnahme eines Paragraphen zum Verbot aller gemeinschaftlichen Verkaufsorganisation in den Vertrag über die Montanunion durchzusetzen15 Im Januar 1951 wies Kost den Bundeskanzler erneut auf die sich nun konkretisierende Gefahr hin, dass eine Abschaffung von Verkaufsorganisationen für Ruhrkohle gefordert werden könne. Als treibende Kraft hinter diesem Vorhaben identifizierte Kost den französischen Verhandlungsführer Jean Monnet, der stark von den US-Amerikanern gestützt werde, die sich dabei auf das Gesetz Nr. 27 beriefen. Kost teilte Adenauer weiterhin mit, dass der Ruhrbergbau dem Schuman-Plan unter diesen Voraussetzungen nicht zustimmen könne.16 In den folgenden Wochen versuchten die DKBL und die IGB, durch eine offensive Kampagne die Öffentlichkeit und die Bundesregierung von der Notwendigkeit des Erhalts eines gemeinschaftlichen Verkaufs zu überzeugen.17 Hierbei hoben DKBL und IGB den Nutzen einer gemeinsamen zentralisierten Absatzorganisation hervor und argumentierten damit, dass ohne den gemeinschaftlichen Verkauf die Versorgung Deutschlands und Europas mit Kohle nicht sichergestellt werden könne und der Schuman-Plan ohne eine zentralisierte Absatzorganisation für Ruhrkohle von vornherein zum Scheitern verurteilt sei.18 Während die AHK in den darauf folgenden Wochen durchaus auf die 15 (BArch), B 102/3310 Heft 1, Kost an Adenauer, 01.12.1950. 16 (BArch), B 102/3310 Heft 1, Kost an Adenauer, 11.01.1951; montan.dok/BBA 32/3980, Kost an Adenauer, 23.01.1951; BArch, B 102/3310 Heft 1, Kost an Adenauer, 23.01.1951. 17 Vgl. hierzu exemplarisch montan.dok/BBA 32/3980, DKBL an Adenauer, 07.02.1951; montan.dok/BBA 32/3980, Kost an Hallstein, 08.02.1951; montan.dok/BBA 12/290, Kost an Adenauer, 28.02.1951; montan.dok/BBA 12/210, Presseverlautbarung der DKBL, 07.02.1951; montan.dok/BBA 12/210, Presseverlautbarung der DKBL, 16.02.1951. 18 montan.dok/BBA 32/3980, DKBL an Adenauer, 07.02.1951; montan.dok/BBA 12/290, Kost an Adenauer, 28.02.1951.
172 Juliane Czierpka
angeführten Probleme einging und vorschlug, der Hohen Behörde den Auftrag zu erteilen, sich mit den aus der Liquidation des DKV entstehenden Problemen zu beschäftigen, beharrten die Vertreter des Ruhrbergbaus weiterhin darauf, dass die entstehenden Probleme nur durch eine zentralisierte Absatzorganisation zu lösen seien.19
Das Memorandum Adenauers vom 15. März 1951 In dieser Situation übte die AHK Druck auf die Bundesregierung aus, ein Memorandum bezüglich des Ablaufs der Neuordnung der Montanindustrie zu verfassen. In diesem von Adenauer unterzeichneten und der AHK am 14. März 1951 überreichten Schreiben erkannte die Bundesregierung einleitend an, dass der DKV im Rahmen des Gesetzes Nr. 27 aufzulösen sei und auch in der zu schaffenden Montanunion „alle monopolistischen Einkaufs- und Verkaufs-Syndikate innerhalb des gemeinsamen Marktes aufzulösen“ 20 seien. Nach Auffassung der Bundesregierung stellte die Beschäftigung der Hohen Behörde mit den sich aus der Liquidierung des DKV ergebenden Problemen eine Vorbedingung für die Auflösung des DKV dar. So sollte die Hohe Behörde geeignete Maßnahmen treffen, die das Sortenproblem lösen, die Förderkapazitäten aufrechterhalten und eine gleichmäßige Auslastung der Zechen sicherstellen würden. Im weiteren Verlauf des Memorandums unterbreitete die Bundesregierung der AHK Vorschläge zum Vorgehen bei der Auflösung des DKV und der DKBL. Die Auflösung der DKBL sollte innerhalb von drei Monaten nach dem Abschluss der Reorganisation des Kohlenbergbaus gemäß Gesetz Nr. 27 erfolgen. Der DKV hingegen, so Adenauers Vorschlag, solle am 1. Juli 1951 in Liquidation treten, die durch einen von der Bundesregierung ernannten Beauftragten durchzuführen sei. Die Weisungsbefugnis gegenüber diesem Beauftragten sollte beim Bundesministerium für Wirtschaft liegen, bis die Hohe Behörde ihre Tätigkeit aufgenommen sowie den Beauftragten bestätigt habe und damit die Weisungsbefugnis auf die Hohe Behörde übergehen könne. Aufgabe des Beauftragten sollte es sein, alle Schritte zu unternehmen, „um den freien Wettbewerb im Verkauf von Ruhrkohlen herbeizuführen“. Zu diesem Zweck sollte der Beauftragte vor allem schnellstmöglich den „Zentral-Kohlenabsatz“ beenden. Nach dem Beginn der Liquidation sollte die Teilnahme am DKV freiwillig werden und damit sowohl Verkäufer als auch Käufer frei entscheiden können, ob sie ihre Brennstoffe über die DKV kaufen oder verkaufen. Anschließend sollten schrittweise immer weniger Verbrau19 montan.dok/BBA 32/3984, Kost an McCloy, 13.03.1951. 20 montan.dok/BBA 32/3980, Adenauer an AHK, 14.03.1951.
Die Organisation des Ruhrkohlen-Absatzes
173
cher vom DKV beliefert werden dürfen, bis die Auflösung am 1. Oktober 1952 abgeschlossen sein sollte und damit auch „alle weitere direkte oder indirekte zentrale Verkaufsbetätigung aufhören“ sollte.21 In den Kreisen des Ruhrbergbaus führte das Memorandum zu großem Protest. Nicht nur die grundlegende Zustimmung zur Auflösung des DKV im Rahmen des Gesetz Nr. 27, welches nach Meinung der Akteure des Ruhrbergbaus keine Grundlage für eine Liquidation der Absatzorganisation bot, sondern auch die Angabe fixer Termine wurden stark kritisiert. Nach Meinung der DKBL war Adenauer mit der Nennung eines festen Zeitplans über die zuvor getroffenen Zusagen und Absprachen mit der AHK, die ein Fortführen des DKV bis zum Inkrafttreten des EGKS-Vertrags vorgesehen hatten, hinausgegangen. Die gesetzten Fristen könnten, so die Befürchtung von der DKBL und den Gewerkschaften, dazu führen, dass der DKV aufgelöst würde, bevor die Hohe Behörde eine Lösung für die durch die Beendigung des zentralisierten Verkaufs entstehenden Probleme, gefunden haben könnte. Durch dieses Vakuum bestünde die Gefahr des Abbaus von Kapazitäten und des Entstehens sozialer Spannungen durch eine regional ungleich verteilte Auslastung der Zechen und der damit verbundenen Arbeitslosigkeit. Außerdem wäre in dieser Zeit die Lösung des Sortenproblems nicht gewährleistet.22 So führte das Memorandum auch – wie es DKBL und IGB unisono wiederholt betonten – zu Unsicherheit in der Bergarbeiterschaft. Die DKBL fuhr im Folgenden fort, die in- und ausländische Presse gezielt über Sinn und Nutzen des Gemeinschaftsverkaufs zu informieren und verschiedenen Regierungsstellen, vor allem dem BMWi und dem Bundeskanzleramt, Brandbriefe zu schreiben und Argumentationshilfen zukommen zu lassen. DGB und IGB verfuhren ähnlich und es gelang ihnen auch häufig in Gesprächen mit der AHK ihre Sorgen über die Folgen einer Abschaffung des DKV zum Ausdruck bringen.23 Nach der Auffassung Heinrich Kosts hatte der Bundeskanzler mit dem Memorandum „freiwillig in einem alliierten Gesetz zugestanden, was wir im Wege freier Vereinbarung unter dem Schumanplan niemals konzedieren wollten.“24 21 montan.dok/BBA 32/3980, Adenauer an AHK, 14.03.1951. 22 Vgl. hierzu montan.dok/BBA 32/3980, Kost an Erhard, 07.04.1951; montan.dok/BBA 32/ 3983, Amt des Hohen Kommissars der Vereinigten Staaten: Memorandum über den Ausschuss für Kohlenverteilungsfragen im Zusammenhang mit der Auflösung des DKV, 27.08.1951; BArch, B 102/3310 Heft 1, Kost an Adenauer, 15.03.1951. 23 Vgl. hierzu montan.dok/BBA 32/3983, Amt des Hohen Kommissars der Vereinigten Staaten: Memorandum über den Ausschuss für Kohlenverteilungsfragen im Zusammenhang mit der Auflösung des DKV, 27.08.1951; montan.dok/BBA 12/210, Presseverlautbarung der DKBL, 24.03.1951. 24 montan.dok/BBA 32/3980, Kost an von Dewall, 14.03.1951.
174 Juliane Czierpka
Von Regierungsseite wurde das Memorandum zwar offiziell als das Ergebnis von Verhandlungen mit der AHK bezeichnet, 25 Wirtschaftsminister Erhard rekapitulierte jedoch in einem Schreiben an Adenauer, dass das Memorandum „von den Wünschen der amerikanischen Verhandlungspartner fast ultimativ beeinflusst worden“ sei.26 Das Ziel der Vertreter der USA in der AHK war es das Zustandekommen der von Ihnen politisch gewünschten Montanunion nicht durch die Auseinandersetzung um die Fortführung des Gemeinschaftsverkaufs für Ruhrkohle zu gefährden. Durch die Liquidierung des DKV im Rahmen des Gesetz Nr. 27 sollte der Streitpunkt aus den Verhandlungen zum Schuman-Plan herausgelöst und auf die Ebene der Neuordnung gezogen werden, wo die Bundesregierung nicht als gleichberechtigter Verhandlungspartner auftreten konnte.27 Allerdings hatte durchaus auch zwischen AHK und Bundesregierung ein Konsens darüber bestanden, dass ein Vakuum zwischen Liquidierung des DKV und der Prüfung des Sachverhalts durch die Hohe Behörde zu vermeiden sei. Allerdings kam es bei der Erstellung des Memorandums aufgrund des hohen Zeitdrucks unter welchem der Text entstanden sei – so Erhard – zu sprachlichen Ungenauigkeiten, so dass „nach dem Wortlaut des Memorandums trotz gegenteiliger Absicht der Verhandlungspartner die Möglichkeit des Auftretens eines Vakuums gegeben“ sei.28 Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass sich die AHK den Sorgen der Akteure des Ruhrbergbaus gegenüber aufgeschlossen zeigte und im Mai 1951 den Ausschuss zum Studium der Probleme der Kohlenverteilung im Zusammenhang mit der Auflösung des DKV, kurz DKV-Ausschuss, ins Leben rief.29
Der DKV-Ausschuss Der DKV-Ausschuss sollte bis spätestens zum 1. September 1951 einen Bericht mit Vorschlägen für eine praktikable Methode zur Verteilung der deutschen Kohlen vorlegen. Der unterbreitete Vorschlag sollte das Sortenproblem und die Durchführung der deutschen Exportverpflichtungen für Koks und Kohlen berücksichtigen und sicherstellen, dass der Bedarf der Besatzungsmächte und 25 BArch, B 102/3310 Heft 1, BMWi an Kost, 19.05.1951. 26 BArch, B 102/3310 Heft 1, Erhard an Adenauer, 09.04.1951. 27 Nach Schwabe sah McCloy sich selbst als eine Art Katalysator, der Frankreich und Deutschland bei der Einigung unterstützte. Vgl. Schwabe: McCloy, S. 522 f. 28 BArch, B 102/3310 Heft 1, Erhard an Adenauer, 09.04.1951. 29 Siehe montan.dok/BBA 32/3983, Ausschuss zum Studium der Probleme der Kohleverteilung im Zusammenhang mit der Auflösung des DKV, 16.06.1951.
Die Organisation des Ruhrkohlen-Absatzes
175
Berlins gedeckt wird. Hierbei hatte der Ausschuss zu berücksichtigen, dass keine zentrale Organisation geschaffen werden durfte, welche selbst den Verkauf von Kohle durchführt, die freie Wahl der Kunden durch Lieferanten und vice versa nicht gefährdet werden dürfe und die geplanten Organisationen und Mechanismen mit dem Montanvertrag zu vereinbaren sein müsse, um nach Gründung der EGKS beibehalten werden zu können. Durch die vorzuschlagende Lösung sollten bis zu dem Zeitpunkt der Konstituierung der Hohen Behörde Stilllegungen und eine ungleiche Verteilung abzubauender Arbeitsplätze in Zeiten sinkender Nachfrage vermieden werden. Zur Erarbeitung des Vorschlags sollte der Ausschuss regelmäßig alle an der deutschen Kohlenindustrie interessierten Gruppen anhören, einige dieser Gruppen waren auch berechtigt, Vertreter zur Teilnahme an den Beratungen des Ausschusses zu bestimmen. Zugleich waren die diese interessierten Gruppen auch zur Unterbreitung eigener Vorschläge an den Ausschuss berechtigt. Zudem wurde der Termin für die Liquidierung des DKV auf den 1. Oktober 1951 verschoben, um dem Ausschuss genug Zeit zur Arbeit zu geben. 30 Im Vorfeld der Konstituierung des Ausschusses kam es zu einigen Unstimmigkeiten über dessen Zusammensetzung und die für den Ausschuss aufgestellten Richtlinien. So hatte die deutsche Regierung ursprünglich die Information erhalten, dass die Hälfte des Ausschusses aus Vertretern der Deutschen bestehen solle. Trotz des Protestes von den Gewerkschaften, DKBL und Regierungsstellen, wurde der DKV-Ausschuss letztendlich mit sechs Vertretern der Alliierten (Zwei US-Amerikaner, zwei Briten, zwei Franzosen) und zwei Deutschen besetzt.31 Anders als in die Verhandlungen über den Schuman-Plan, entsandte die Bundesregierung mit Hermann Dehnen, dem stellvertretenden Generaldirektor der DKBL, und Franz Grosse, dem Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung der IGB, zwei Vertreter der unmittelbar betroffenen Interessengruppen in den DKV-Ausschuss. Ende August legten die französischen Vertreter im DKV-Ausschuss einen Vorschlag zur Organisation des Kohlenabsatzes vor. Dieser sah die Errichtung von sechs Verkaufsgesellschaften mit einer übergeordneten zentralen Koordinierungsstelle vor, die jedoch nur beratende Funktion hatte und lediglich in einzelnen Ausnahmefällen von der Bundesregierung ermächtigt werden konnte, den Verkaufsgesellschaften Anweisungen zu erteilen. Die deutschen Vertre-
30 Ebd. 31 BArch, B 102/3310 Heft 1, Kost an Westrick, 28.05.1951; BArch, B 102/3310 Heft 1, Kellermann: Vermerk. Betrifft Liquidation des DKV, 12.06.1951; BArch, B 102/3310 Heft 1, FrancoisPoncet an Adenauer, 29.06.1951; BArch, B 102/3310 Heft 2, vom Hoff und Fette an Adenauer, 02.07.1951.
176 Juliane Czierpka
ter Dehnen und Grosse legten wenige Tage später einen eigenen Vorschlag vor, welcher die Errichtung einer zentralisierten Organisation zum Verkauf der Ruhrkohlen, jedoch ohne Kompetenzen im Bereich Preisfestsetzung, Zuteilung oder dem Festsetzen allgemeiner Zahlungs- und Lieferbedingungen, vorsah. Noch am selben Tag wandte sich der Amerikanische Hohe Kommissar John McCloy an den Bundeskanzler und beklagte, dass sich die deutschen Vertreter im DKV-Ausschuss von Beginn an wenig kooperativ gezeigt hätten und ihre Einstellung nicht mit den Richtlinien des Ausschusses zu vereinbaren sei. Außerdem würden die beiden Deutschen den Inhalt des Memorandum Adenauers nicht anerkennen und sich an dieses nicht gebunden fühlen, da die Bundesregierung sich vor dessen Abfassung weder mit den Gewerkschaften noch den Zechenunternehmern beraten habe. McCloy warnte Adenauer weiter, dass das Verhalten der deutschen Vertreter und der von ihnen vorgebrachte Vorschlag den Schuman-Plan gefährden würden und drohte damit, dass die AHK im Zweifel erforderliche Maßnahmen zur Auflösung zentraler Verkaufsorganisationen für Ruhrkohle auch ohne Rücksprache mit der Bundesregierung ergreifen würde. Hierdurch würde sich die Position der Deutschen gegenüber den anderen Ländern jedoch stark verschlechtern.32 Nach einigem Hin und Her und weiteren gegenseitigen Vorwürfen und Begründungen von deutscher Seite, warum der eigene Vorschlag nicht den Vorgaben widerspräche, übergab der Ausschuss dann am 18. Oktober 1951 der AHK einen Bericht, in welchem der französische Vorschlag als beste Lösung empfohlen wurde. Unterzeichnet war die Empfehlung auch von den deutschen Vertretern im DKV-Ausschuss, die ihre Unterschriften jedoch unter dem großen Druck der übrigen Ausschussmitglieder – die ihnen bei Verweigerung der Anerkennung des französischen Vorschlags die Verantwortung für ein Scheitern des Schuman-Plans zuschrieben – ohne Rückendeckung der Bundesregierung und gegen ihre eigene Überzeugung geleistet hatten. Dehnen und Grosse hatten den französischen Vorschlag zwar als grundsätzlich „workable“ bezeichnet, hielten das geplante Konstrukt aber für zu schwerfällig und kompliziert und standen der Errichtung mehrerer Verkaufsgesellschaften ebenso ablehnend gegenüber, wie die meisten Akteure des Ruhrbergbaus.33 Nach einer letzten Besprechung 32 montan.dok/BBA 32/3983, Amt des Hohen Kommissars der Vereinigten Staaten: Memorandum über den Ausschuss für Kohlenverteilungsfragen im Zusammenhang mit der Auflösung des DKV, 27.08.1951. 33 montan.dok/BBA 32/3983, Anmerkungen zu Schreiben der AHK, 30.08.1951; montan.dok/ BBA 32/3983, Amt des Hohen Kommissars der Vereinigten Staaten: Memorandum über den Ausschuss für Kohlenverteilungsfragen im Zusammenhang mit der Auflösung des DKV, 27.08.1951; montan.dok/BBA 32/3983, Ausschuss zur Prüfung der Frage der Kohlenverteilung im Zusammenhang mit der Auflösung des Deutschen Kohlen-Verkaufs: Bericht an die Hohe
Die Organisation des Ruhrkohlen-Absatzes
177
im DKV-Ausschuss hatten Dehnen und Grosse um eine Unterbrechung der Sitzung bis zum kommenden Tag gebeten, um Rücksprache mit dem BMWi halten zu können. Dieser Wunsch war ihnen jedoch nicht gewährt worden, so dass sie telefonisch Kontakt zum Wirtschaftsministerium aufgenommen und um eine Handlungsanweisung gebeten hatten. Ludger Westrick, Staatssekretär im BMWi, hatte sich jedoch geweigert, eine offizielle Anweisung zur Unterschrift zu erteilen, ohne nicht zuvor die gerade erarbeitete Version des Vorschlags geprüft zu haben.34 Entsprechend groß war das Entsetzen in der Bundesregierung und im Ruhrgebiet, als bekannt wurde, dass der DKV-Ausschuss der AHK einstimmig die Durchführung des französischen Vorschlags empfohlen und diese sich dazu entschlossen hatte, diese Empfehlung anzunehmen. Während die DKBL und die IGB die Bundesregierung – in welcher Unsicherheit darüber herrschte, inwieweit die Unterschriften zweier Sachverständiger für eine Regierung binden sein könnten – dazu drängte die Verhandlungen mit der AHK über die Zukunft des zentralisieren Verkaufs für Ruhrkohlen von vorn zu beginnen, wurde im Kabinett beschlossen, mit der AHK über punktuelle Modifikationen des Vorschlags zu verhandeln.35 Diese Verhandlungen, in denen das BMWi durchaus einige der deutschen Wünsche bezüglich einer Vergrößerung der Macht der Dachorganisation über den Verkaufsgesellschaften erreichen konnte, waren im Februar 1952 abgeschlossen.36 Die Bundesregierung hatte sich in diesen Gesprächen erneut mit der Liquidierung des DKV einverstanden erklärt, aber auch verlangt, dass diese bis mindestens zum Frühjahr 1953 hingezogen werde, um in den Wintermonaten die Versorgung der Bevölkerung mit Brennstoffen sicherstellen zu können.37
Die Durchführungsverordnungen Nr. 17 und Nr. 20 zum Gesetz Nr. 27 Als Ergebnis der Verhandlungen mit der Bundesregierung, erließ die AHK im Mai 1952 die Durchführungsverordnung Nr. 17 zum Gesetz Nr. 27, bei der es sich im Grunde um eine Umsetzung des Vorschlags des DKV-Ausschusses handelte, Kommission des Ausschuss zur Prüfung der Frage der Kohlenverteilung im Zusammenhang mit der Auflösung des Deutschen Kohlen-Verkaufs, 18.10.1951. 34 montan.dok/BBA 32/3983, Grosse an Westrick, 05.11.1951. 35 Ebd.; BArch, Kabinettsprotokolle der Bundesregierung online, 182. Kabinettssitzung am 26. Oktober 1951. TOP [B:] D[eutscher] K[ohlen] V[erkauf]. 36 Vgl. zu den Verhandlungen montan.dok/BBA 32/3984, Westrick: Vermerk, Betr.: DKV, 12.02.1952; montan.dok/BBA 32/3984, Vert: Änderung des Absatzes III B 2 d, 13.03.1952. 37 montan.dok/BBA 32/3984, Adenauer an McCloy, 30.05.1952.
178 Juliane Czierpka
die aber auch den sofortigen Beginn der Liquidation des DKV anordnete.38 Die Durchführungsverordnung Nr. 17 widersprach nach Auffassung der Bundesregierung nicht nur inhaltlich den Verhandlungsergebnissen, sondern ging der Bundesregierung auch erst, obwohl auf den 17. Mai 1952 datiert, am 20. Mai 1952 zu, bevor sie am 24. Mai im Amtsblatt der AHK veröffentlicht wurde. In einem Schreiben an die AHK protestierte die Bundesregierung gegen die nach ihrer Meinung erfolgten inhaltlichen Änderungen und die nicht gegebene Möglichkeit zu einer Stellungnahme vor der Veröffentlichung. Adenauer teilte der AHK mit, dass die Bundesregierung sich mit dieser Durchführungsverordnung nicht einverstanden erklären könne und um eine Abänderung bitte.39 Diesem Schreiben des Bundeskanzlers folgten zwei Briefe von französischer Seite. Zum einen erinnerte Robert Schuman Adenauer daran, dass zwischen französischer und deutscher Regierung ein Konsens darüber bestanden habe, dass die Neuordnung vor dem Inkrafttreten des Schuman-Plans abgeschlossen sein solle und dies auch eine der Bedingungen für die Zustimmung des französischen Parlaments zu der Unterzeichnung der Verträge gewesen sei. Gerade die Auflösung des DKV sei bereits vor langer Zeit beschlossen worden und eine Weigerung der Anerkennung des in dem DKV-Ausschuss gefundenen Lösungsvorschlags würde der Verweigerung einer Liquidation des DKV gleichkommen. Das wiederum würde alle bisherigen Vereinbarungen in Frage stellen. Schuman bat Adenauer in dem fast vierseitigen Schreiben inständig, die weitreichenden Konsequenzen seiner Weigerung einer Zustimmung zu der Durchführungsverordnung zu bedenken.40 Zum anderen wandte sich Jean Monnet als Führer der französischen Verhandlungsdelegation an seinen deutschen Kollegen Walter Hallstein. Genau wie Schuman betonte auch Monnet, wie wichtig es sei, die ohnehin schon seit langem geklärten Probleme vor der Inkraftsetzung des Vertrages über die EGKS zu lösen, vor allem die Auflösung des DKV sei hierbei von höchster Bedeutung. Monnet verwies im Folgenden darauf, dass die Alliierten sich wirklich bemüht hätten, Lösungen für alle von den Deutschen vorgetragenen Probleme zu finden und dass die Bundesregierung in die Formulierung der Durchführungsverordnung eingebunden gewesen sei. Der Vorwurf, dass die Verordnung von den Empfehlungen des DKV-Ausschuss abweiche, entbehre jeder Realität. Dass die Bundesregierung jetzt ihre Mitarbeit bei der Durchführung der Verordnung ab-
38 Slater, J. E./Alliierte Hohe Kommission (Hg.): Durchführungsverordnung Nr. 17 (Auflösung des Deutschen Kohlenverkaufs und Umgestaltung des Kohlenvertriebsssystems) zum Gesetz Nr. 27 (Umgestaltung des Deutschen Kohlenbergbaues und der Deutschen Stahl- und Eisenindustrie), 17.05.1952. 39 montan.dok/BBA 32/3984, Adenauer an McCloy, 30.05.1952. 40 montan.dok/BBA 32/3984, Schuman an Adenauer, Juni 1952.
Die Organisation des Ruhrkohlen-Absatzes
179
lehne, sei nicht gerechtfertigt und werde Konsequenzen für die Errichtung der EGKS haben.41 Gleichzeitig begann das BMWi mit der AHK über die Abänderung der Durchführungsverordnung Nr. 17 zu verhandeln und bereits im Juli 1952 wurde eine Einigung über die Abänderung der Durchführungsverordnung erzielt. Die Verhandlungsergebnisse flossen in die im September 1952 veröffentlichte Durchführungsverordnung Nr. 20 ein, die sich von ihrer Vorgängerin im Wesentlichen in zwei Punkten unterschied. So wurde die Liquidierung des DKV nicht mehr an einen fixen Termin, sondern an die Aufnahme der Tätigkeit der Hohen Behörde gebunden. Zudem wurde ein Artikel ergänzt, welcher der Bundesregierung das Recht auf die Beantragung einer Änderung der neu zu schaffenden Organisation zusicherte, für den Fall, dass sich durch die neue Absatzorganisation ernste Nachteile für die deutsche Volkswirtschaft ergäben. Die Aufnahme eines solchen Artikels hatte das BMWi eigentlich schon im März 1952 gefordert, die AHK hatte eine Aufnahme in die Durchführungsverordnung Nr. 17 jedoch verweigert, da man sich zwar in der Sache einig sei, das Einfügen einer Revisionsbedingung in eine Verordnung jedoch unüblich sei.42 Auf Basis der Durchführungsverordnung Nr. 20 stellte der DKV am 31. März 1953 – also über sieben Monate nachdem die Hohe Behörde im August 1952 die Arbeit aufgenommen hatte – seine Tätigkeit ein, so dass die neu gegründete Gemeinschaftsorganisation Ruhrkohle mit ihren sechs Verkaufsgesellschaften am 1. April 1953 die Organisation des Absatzes von Ruhrkohlen übernehmen konnte.
Fazit Die Betrachtung des Verhandlungsverlaufs zeigt, dass die Neuordnung durch die Alliierten und die Verhandlungen zur Montanunion in Bezug auf die Frage der Absatzorganisation für Ruhrkohlen bis Anfang des Jahres 1951 unabhängig voneinander zu laufen schienen. Aus deutscher Sicht handelte es sich um zwei getrennt voneinander ablaufende Prozesse, wobei man sich bei dem einen als Befehlsempfänger mit Mitspracherecht und bei dem anderen als gleichberechtigten Verhandlungspartner sah. Zu dieser Zeit forderte die deutsche Seite einen schnellen Abschluss der Neuordnung, um anschließend mit den Verhandlungen zum Schuman-Plan fortfahren zu können.
41 montan.dok/BBA 32/3984, Monnet an Hallstein, 08.06.1952. 42 montan.dok/BBA 32/3984, Vert an Erhard, 21.03.1952.
180 Juliane Czierpka
Die Situation änderte sich im Januar 1951 als es den Akteuren des Ruhrbergbaus erstmals dämmerte, dass eine gemeinschaftliche Absatzorganisation nach den eigenen Vorstellungen eventuell im Rahmen des EGKS-Vertrages verboten werden könnte. Ab diesem Moment wurden auch Vorwürfe und Warnungen der Vertreter des Ruhrbergbaus laut, dass hinter dem im Vertrag lauernden Verbot die US-Amerikaner stecken würden, die ja zeitgleich begannen im Rahmen des Gesetzes Nr. 27 für eine Liquidierung des DKV einzutreten. Die für die Akteure des Ruhrbergbaus greifbare Verbindung zwischen beiden Verfahren stellte dann die AHK her, als sie Druck auf die Bundesregierung ausübte, die Notwendigkeit der Liquidierung des DKV anzuerkennen, um durch den Fortbestand der zentralisierten Verkaufsorganisation die Verhandlungen zum Schuman-Plan nicht zu gefährden. Hierdurch verlagerte die AHK die Frage nach der Gestalt oder der Existenz einer zukünftigen Absatzorganisation für Ruhrkohlen auf eine Ebene, auf welcher die AHK sich zwar in der Regel gesprächsbereit und offen für die Wünsche der Bundesregierung und der deutschen Interessengruppen zeigte, jedoch zugleich deutlich klarstellte, dass bestimmte Punkte notfalls auch gegen die Interessen der deutschen Seite durchgesetzt würden. Das Memorandum des Bundeskanzlers ist ein Resultat dieser amerikanischen Politik. Der Text des Memorandums wurde, so Erhard, stark von den Wünschen der Amerikaner beeinflusst und den deutschen Vertretern in der Folge in jedem Ausschuss und jeder Verhandlungsrunde vorgelegt und bereits jede Verschiebung des Liquidationstermins als großes Entgegenkommen gewertet. Das Memorandum schwächte damit die deutsche Verhandlungsposition in Bezug auf die Ausgestaltung der Absatzorganisation für Ruhrkohlen nachhaltig. Sowohl diese geschwächte Verhandlungsposition, als auch die Bereitschaft der AHK bestimmte Positionen notfalls gegen die Forderungen der deutschen Stellen durchzusetzen, spiegelte sich auch in den Vorgängen rund um den DKV-Ausschuss. So ist die Einberufung des DKV-Ausschusses ein Indiz für die Bereitschaft der AHK zum Dialog, in der Debatte um die Besetzung des Ausschusses zeigte sich aber auch der Wunsch, den Prozess zu bestimmen und den deutschen Vertretern keine paritätische Besetzung zuzugestehen. Die Diskussion innerhalb des DKV-Ausschusses wurde auf Basis der im Memorandum festgehaltenen und in den Richtlinien des Ausschusses wiederholten Bedingungen geführt. Auf dieser Basis rechtfertigten die alliierten Ausschussmitglieder auch die Zurückweisung des deutschen Vorschlags. Die Bedeutung der AHK für die Gründung der EGKS zeigte sich auch in der Auseinandersetzung über die Durchführungsverordnung Nr. 17 zum Gesetz Nr. 27. Hier wurde deutlich, dass die Intervention der AHK, durch welche die Auflösung des DKV erzwungen wurde, von der französischen Regierung als unerlässlich für das Zustandekommen der EGKS gesehen wurde.
Die Organisation des Ruhrkohlen-Absatzes
181
Die Drohungen, Apelle und Bitten der Akteure des Ruhrbergbaus verhallten zwar weder bei der AHK noch bei der Bundesregierung ungehört, die Möglichkeit eine zentralisierte Organisation für den Absatz von Ruhrkohlen beizubehalten, wurde jedoch durch das Memorandum Adenauers minimiert. Die Bemühungen von DKBL und IGB führten lediglich dazu, dass die Hohe Behörde vertraglich zu einer Beschäftigung mit den aus der Liquidation des DKV resultierenden Problemen verpflichtet wurde. Erfolgreich verhindern konnte der Ruhrbergbau lediglich das Entstehen eines Vakuums zwischen dem Abschluss der Neuordnung nach dem Gesetz Nr. 27 und der Konstituierung der Hohen Behörde. Das für diese Übergangszeit geschaffene Konstrukt – welches, dem französischen Vorschlag im DKV-Ausschuss folgend, aus sechs Verkaufsorganisationen und einer koordinierenden Dachorganisation bestand – entsprach jedoch nicht den Vorstellungen der Akteure des Ruhrbergbaus. Die AHK war also die maßgeblich verantwortliche Instanz für die Auflösung des DKV und dadurch, dass diese als Bedingung für die Schaffung der Montanunion gesehen wurde, auch stark in die Verhandlungen über den SchumanPlan involviert. Diese Auffassung deckt sich auch mit den Ergebnissen Volker Berghahns, der in seiner Untersuchung über die Rolle der US-Amerikaner in den Verhandlungen zur Montanunion festhält, dass diese in bestimmten Punkten zu Zugeständnissen bereit waren, jedoch gerade in der von dem Ruhrbergbau als so wichtig erachteten Kartellfrage „massiv eingriffen“, die Bundesregierung zu Kompromissen zwangen und so ein Scheitern der EGKS verhinderten.43 Diese Intervention der AHK setzte die Bundesregierung, die eine Mitgliedschaft in der EGKS ja bereits aus eigenem Antrieb stark anstrebte, zusätzlich unter Druck, den Forderungen des Ruhrbergbaus nicht nachzugeben. Zugleich bot die von der AHK durchgesetzte Liquidierung des DKV der Bundesregierung die Möglichkeit auf die von der AHK erzeugten Zwänge zu verweisen und sich hinter diesen zu verstecken. Die Analyse der Folgen der Verbindung der Neuordnung des Ruhrreviers nach dem Gesetz Nr. 27 mit den Verhandlungen zum Schuman-Plan für den Ruhrbergbau zeigt, dass die Interessen der Akteure des Ruhrbergbaus nicht berücksichtigt wurden und der Vertrag über die EGKS gegen den Widerstand der Unternehmen sowie Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände an der Ruhr durchgesetzt wurde. Durch die zeitgleich ablaufende Neuordnung konnte die AHK die Auflösung des DKV erzwingen und so ein Scheitern der Vertragsverhandlungen abwenden. Dies hatte zur Folge, dass es den Akteuren des Ruhrbergbaus trotz der hohen Bedeutung der Steinkohle für die deutsche Volkswirtschaft, einer breiten Unterstützung aus der Öffentlichkeit und einer guten Ver43 Berghahn: Industriegesellschaft und Kulturtransfer, S. 228 f.
182 Juliane Czierpka
netzung mit den relevanten politischen Stellen nicht gelang, ihre Interessen gegenüber der Bundesregierung durchzusetzen. Auch gegenüber den übrigen Mitgliedsstaaten konnte der Ruhrbergbau seine Dominanz über die übrigen westeuropäischen Kohleerzeuger nicht ausspielen, da Exit-Drohungen durch das Agieren der AHK sofort unterbunden wurden. Hier muss weitere Forschung zeigen, wie sich die Ablehnung des Vertragswerkes durch die Akteure des Bergbaus an der Ruhr im weiteren Verlauf auswirkte. Hier ist zum einen das weitere Verhalten von Unternehmen und Gewerkschaft zu untersuchen, zum anderen aber auch zu überprüfen, ob sich das Verhalten der Bundesregierung nach der Gründung der EGKS und der Möglichkeit den übrigen Mitgliedsstaaten nun wirklich als gleichberechtigter Partner gegenüberzustehen, wandelte.
Quellenverzeichnis Bundesarchiv Bundesarchiv, >Kabinettsprotokolle der Bundesregierung< online, 55. Kabinettssitzung am 24. März 1950. E. Gesetz Nr. 75, 24.03.1950. Bundesarchiv, B 102/3310 Heft 2, DGB an Adenauer, Betr.: Schuman-Plan ./. DKV, 02.07.1951. Bundesarchiv, B 102/3310 Heft 1, AHK an Adenauer, 29.06.1951. Bundesarchiv, B 102/3310 Heft 1, Vermerk. Betrifft Liquidation des DKV, 12.06.1951. Bundesarchiv, B 102/3310 Heft 1, Kost an Westrick. Betr.: DKV-Kommission, 28.05.1951. Bundesarchiv, B 102/3310 Heft 1, BMWi an Kost. Betrifft: Liquidation des Deutschen KohlenVerkaufs. Entwurf, 19.05.1951. Bundesarchiv, B 102/3310 Heft 1, Erhard an Adenauer, 09.04.1951. Bundesarchiv, B 102/3310 Heft 1, Fernschreiben Kost an Adenauer, Betr. Schumanplan – Gemeinschaftsverkaufsorganisation für Ruhrkohle [Z. K. für BMWi], 11.01.1951. Bundesarchiv, B 102/3310 Heft 1, Kost an Adenauer, 23.01.1951. Bundesarchiv, B 102/3310 Heft 1, Kost an Adenauer, 15.03.1951. Bundesarchiv, B 102/3310 Heft 1, Kost an Adenauer, 01.12.1950. Bundesarchiv, >Kabinettsprotokolle der Bundesregierung< online, 182. Kabinettssitzung am 26. Oktober 1951. TOP [B:] D[eutscher] K[ohlen] V[erkauf], 26.10.1951.
Die Organisation des Ruhrkohlen-Absatzes
183
Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok) beim Deutschen Bergbau-Museum Bochum/Bergbau-Archiv Bochum (BBA) montan.dok/BBA 12/210, Betr.: Behandlung des DKV in der Auslandspresse, 24.03.1951. montan.dok/BBA 12/210, Pressenotiz. Gefährdung der Ruhrwirtschaft durch einengende Bestimmungen im Schumanplan. Bedenkliche Konsequenzen bei einer Auflösung von DKV, 16.02.1951. montan.dok/BBA 12/210, Pressenotiz. Gefährdung des westdeutschen Kohlenbergbaus bei Verbot des Gemeinschaftsverkaufs, 07.02.1951. montan.dok/BBA 12/290, Fernschreiben Kost an Adenauer [Abschrift], 28.02.1951. montan.dok/BBA 32/3984, Monnet an Hallstein [Abschrift], 08.06.1952. montan.dok/BBA 32/3984, Botschaft Schuman an Adenauer [Abschrift], [Juni 1952]. montan.dok/BBA 32/3984, Adenauer an McCloy [Telefonische Durchgabe], 30.05.1952. montan.dok/BBA 32/3984, Alliierte Hohe Kommission in Deutschland, Wirtschafts- und Finanzausschuss, Vert an Erhard [Vorläufige Übersetzung], 21.03.1952. montan.dok/BBA 32/3984, Änderung des Absatzes III B 2 d [Übersetzung], 13.03.1952. montan.dok/BBA 32/3984, Kost an McCloy [Abschrift], 13.03.1951. montan.dok/BBA 32/3984, Vermerk, Betr.: DKV [Abschrift], 12.02.1952. montan.dok/BBA 32/3983, Grosse an Westrick [Abschrift], 05.11.1951. montan.dok/BBA 32/3983, Bericht an die Hohe Kommission des Ausschuss zur Prüfung der Frage der Kohlenverteilung im Zusammenhang mit der Auflösung des Deutschen KohlenVerkaufs [noch nicht redigierte Übersetzung], 18.10.1951. montan.dok/BBA 32/3983, Memorandum über den Ausschuss für Kohlenverteilungsfragen im Zusammenhang mit der Auflösung des DKV [Abschrift], 27.08.1951. montan.dok/BBA 32/3983, [Ohne Titel] [Abschrift einer Abschrift], 30.08.1951. montan.dok/BBA 32/3983, Ausschuss zum Studium der Probleme der Kohleverteilung im Zusammenhang mit der Auflösung des DKV [Abschrift], 16.06.1951. montan.dok/BBA 32/3980, Anlage zum Schreiben vom 7.4.1951 an den Herrn Bundesminister für Wirtschaft, Bonn, 07.04.1951. montan.dok/BBA 32/3980, Kost an von Dewall, 14.03.1951. montan.dok/BBA 32/3980, Adenauer an AHK, Betrifft: Durchführung des Gesetzes Nr. 27 der Alliierten Hohen Kommission an Vorsitzenden der Alliierten Hohen Kommission [Abschrift], März 1951 [14.03.1951]. montan.dok/BBA 32/3980, Bemerkungen zu der Stellungnahme des Herrn Jean Monnet über das Memorandum vom 28. September 1950, abgefasst mit Datum vom 5. Okt. 1950, 12.10.1950. montan.dok/BBA 32/3980, Generaldirektor DKBL [Kost] an Staatssekretär Hallstein 08.02.1951. montan.dok/BBA 32/3980, Schreiben DKBL an Adenauer [Abschrift], 07.02.1951. montan.dok/BBA 32/3980, Fernschreiben Kost an Adenauer [Abschrift], 23.01.1951.
184 Juliane Czierpka
Literaturverzeichnis Abelshauser, Werner: Der Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung, München 1984. Berghahn, Volker R.: Industriegesellschaft und Kulturtransfer. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen im 20. Jahrhundert (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 182), Göttingen 2010. Brunn, Gerhard: Die europäische Einigung von 1945 bis heute, Stuttgart 2002. Bührer, Werner: Ruhrstahl und Europa. Die Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie und die Anfänge der europäischen Integration 1945–1952 (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 53), München 1986. Dorfey, Beate: Die Internationale Ruhrbehörde im Spannungsfeld britischer, französischer, belgischer, luxemburgischer und niederländischer Interessen, in: Geschichte im Westen 1 (1994), S. 75–83. Farrenkopf, Michael: Wiederaufstieg und Niedergang des Bergbaus in der Bundesrepublik, in: Ziegler, Dieter (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4), Münster 2013, S. 183–302. Milward, Alan S.: The Reconstruction of Western Europe 1945–51, Berkeley/Los Angeles 1984. Roelevink, Eva-Maria: Organisierte Intransparenz. Das Kohlensyndikat und der niederländische Markt 1915–1932 (Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 26), München 2015. Schwabe, Klaus: Fürsprecher Frankreichs? John McCloy und die Integration der Bundesrepublik, in: Herbst, Ludolf/Bührer, Werner/Sowade, Hanno (Hg.): Vom Marshallplan zur EWG. Die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die westliche Welt (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 30), München 1990, S. 517–533.
Stefanie van de Kerkhof
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise. Das Fallbeispiel Rheinmetall in vergleichender Betrachtung Einleitung: Der Wiederaufstieg nach 1945 Die Unternehmen der westdeutschen Rüstungsbranche im engeren Sinne, der Wehr- oder Heerestechnik, vollzogen im Vergleich zum Steinkohlenbergbau vom Ende der 1940er Jahre bis zur Gegenwart einen beinahe kometenhaften Aufstieg. Dieser bis in die Gegenwart anhaltende positive Trend von einer Branche in Trümmern zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt wurde nur durch wenige Krisen unterbrochen.1 Wie gelang den Waffenherstellern, die ja durch Vorprodukte und Unternehmensverflechtungen enge Bezüge zur Schwer- und Montanindustrie aufweisen, diese im Gegensatz zum deutschen Steinkohlenbergbau anhaltende Expansion auf nationalen und internationalen Märkten? Waren es die technologisch überragenden Produkte, die Unternehmensorganisation, die Struktur dieser Märkte oder neue Absatzstrategien im Kalten Krieg? Gab es auch für die Waffenproduzenten krisenhafte Einbrüche in der Nachkriegszeit, und wie wurden sie in den Unternehmen wahrgenommen und behandelt? Diese Fragen sind nicht einfach zu beantworten, denn die Geschichte der Rüstungsproduktion stellt ein großes Desiderat der wirtschafts-, technik- und unternehmenshistorischen Forschung dar, und zwar nicht nur in Deutschland, wie schon Michael Geyer 1981 und der von Dieter H. Kollmer vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr herausgegebene Band über den Military-Industrial Complex in Europa unlängst bemängelten.2 1 Vgl. ausführlich van de Kerkhof, Stefanie: Waffen und Sicherheit im Kalten Krieg. Das Marketing der westdeutschen Rüstungsindustrie 1949–1990 (Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 24), Berlin/Boston 2019; Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode (Hg.): Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahr 2009 (Rüstungsexportbericht 2009), Drucksache 17/4200, 16.12.2010 (http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/042/1704200.pdf, letzter Abruf am 15.10.2018); Anonym: „Deutschland exportiert deutlich mehr Waffen“, in: Rheinische Post, 07.12.2011. 2 Geyer, Michael: Deutsche Rüstungspolitik 1860–1980 (edition suhrkamp 1246), Frankfurt (Main) 1981, v. a. S. 242; Kollmer, Dieter H. (Hg.): Militärisch-Industrieller Komplex? Rüstung in Europa und Nordamerika nach dem Zweiten Weltkrieg, Freiburg 2015. https://doi.org/10.1515/9783110729979-009
186 Stefanie van de Kerkhof
Zwar gab es in den letzten Dekaden wegweisende Fortschritte in der unternehmenshistorischen Forschung, vor allem der Unternehmen in der nationalsozialistischen Rüstungspolitik.3 Doch Lücken blieben vor allem in der Untersuchung der traditionellen deutschen Waffenschmieden wie Rheinmetall, KraussMaffei, Mauser, IWKA oder Diehl und beim Rüstungsgeschäft von diversifizierten Großkonzernen wie Daimler-Benz, Siemens, Thyssen oder Krupp. Zur bundesdeutschen Rüstungsindustrie liegen vor allem politologische Studien und Arbeiten vor, die finanzwissenschaftliche Aspekte von Militärbudgets betrachten oder die Luft- und Raumfahrtproduktion genauer untersuchten.4 Es fehlt aber an Marktanalysen nicht nur der Eisen- und Stahlindustrie, deren Anteil an der Produktion von Rüstungsgütern aufgrund der dual-use-Problematik, also der militärisch oder zivilen Verwendung, bislang kaum einzuschätzen ist, sondern auch der Maschinenbauindustrie, Sprengstoff-, Chemie- und Elektronikbranche. Zudem herrscht ein eklatanter Mangel an historischen Studien, die sich z. B. mit dem internationalen Absatz und Handel von Waffen sowie mit der sektoralen Verteilung von Rüstungsunternehmen und Standortfragen dieser Wachstumsbranchen nach 1945 eingehender beschäftigen.5 Auch neuere Veröffentlichungen über die Geschichte diversifizierter Konzerne wie Krupp, Quandt, Daimler AG und Siemens nach 1945, streifen die Waffenproduktion höchstens am Rande.6 Dies gilt auch für die wichtigen Überblickswerke von Werner Abelshauser und Barry Eichengreen zur Wirtschaftsgeschichte der BRD, zum Wieder-
3 Banken, Ralf: Der Nationalsozialismus in der Unternehmensgeschichte. Hinterlässt die Sonderkonjunktur Spuren?, in: Akkumulation 20 (2004), S. 1–18; van de Kerkhof, Stefanie: Rüstungsindustrie und Kriegswirtschaft, in: Kühne, Thomas/Ziemann, Benjamin (Hg.): Was ist Militärgeschichte? (Krieg in der Geschichte 6), Paderborn 2000, S. 175–194. 4 Zdrowomyslaw, Norbert/Bontrup, Heinz-J.: Die deutsche Rüstungsindustrie. Vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik, Heilbronn 1988; Köllner, Lutz: Militär und Finanzen. Zur Finanzgeschichte und Finanzsoziologie von Militärausgaben in Deutschland, München 1982; Zdrowomyslaw, Norbert: Wirtschaft, Krise und Rüstung. Die Militärausgaben in ihrer wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Bedeutung in Deutschland von der Reichsgründung bis zur Gegenwart, Bremen 1985; Andres, Christopher Magnus: Die bundesdeutsche Luft- und Raumfahrtindustrie 1945–1970. Ein Industriebereich im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft und Militär (Münchener Studien zur neueren und neuesten Geschichte 15), Frankfurt (Main) u. a. 1996. 5 Ausnahmen sind: Hummel, Hartwig: Rüstungsexportbeschränkungen in Japan und der Bundesrepublik Deutschland, Hamburg/Münster 1991; Schmidt, Dorothea: Denn sie wissen, was sie tun. Das Geschäft mit Kleinwaffen, in: Prokla 36/143 (2006), S. 185–202; Dies.: Kleinwaffen in „alten“ und „neuen“ Kriegen, in: Prokla 31/127 (2002), S. 271–295. 6 Vgl. etwa Gall, Lothar (Hg.): Krupp im 20. Jahrhundert. Die Geschichte des Unternehmens vom Ersten Weltkrieg bis zur Gründung der Stiftung, Berlin 2002, v. a. S. 446–589; Scholtyseck, Joachim: Der Aufstieg der Quandts. Eine deutsche Unternehmerdynastie, München 2011, S. 809–817.
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise
187
aufbau und „Wirtschaftswunder“.7 Besonders hilfreich für die unternehmenshistorische Erforschung der Krisenjahre nach dem „Wirtschaftswunder“ der 1950er und 1960er Jahre haben sich dagegen Netzwerk-Ansätze erwiesen, die erstmals in zwei Sammelbänden behandelt wurden.8 Daneben sind die für die Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte der Jahre nach dem „Wirtschaftswunder“ programmatischen Studien von Anselm Doering-Manteuffel, Lutz Raphael und Werner Plumpe hervorzuheben.9 Eine genauere empirische Untersuchung der mit der Chiffre „1968“ verbundenen Frage nach Veränderungen im deutschen Produktionssystem am Ende des Booms erscheint sinnvoll, um Branchentrends wie Sonderkonjunkturen und allgemeine sozioökonomische Entwicklung wie die Ölkrisen und den Wandel von Verkäufer- zu Käufermärkten stärker differenzieren zu können. Dieses Ziel wird hier mithilfe von ausgesuchten Quellen vor allem aus Unternehmensarchiven anvisiert, denn der Zugang zu staatlichen Akten dieser Zeit ist aus Gründen der Sperrfrist und Sicherheitsinteressen derzeit noch erschwert. Mit der Rheinmetall Berlin AG bzw. der Rheinmetall AG wurde ein Unternehmen ausgewählt, das gegenwärtig definitiv eine marktbeherrschende Position erlangt hat. Rheinmetall war seit den frühen 1970er Jahren, sieht man von der breit diversifizierten Luftfahrtindustrie ab, der größte deutsche Rüstungskonzern.10 In der Gegenwart ist der Konzern weltweit auf Platz 31 und europäischer Marktführer im Bereich Heerestechnik11, was die Forschung bis auf eine zweibändige Festschrift des langjährigen Konzernarchivars Dr. Christian Leitzbach,
7 Abelshauser, Werner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945 (beck’sche Reihe 1587), München 2004; Ders.: Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. 1945–1980 (Neue Historische Bibliothek), Frankfurt (Main) 71993; Eichengreen, Barry: The European Economy since 1945. Coordinated Capitalism and Beyond (The Princeton Economic History of the Western World), Princeton/Oxford 2007. 8 Reitmayer, Morten/Rosenberger, Ruth (Hg.): Unternehmen am Ende des „goldenen Zeitalters“. Die 1970er Jahre in unternehmens- und wirtschaftshistorischer Perspektive (Bochumer Schriften zur Unternehmens- und Industriegeschichte 16), Essen 2008; Berghoff, Hartmut/Sydow, Jörg (Hg.): Unternehmerische Netzwerke. Eine historische Organisationsform mit Zukunft?, Stuttgart 2007. 9 Doering-Manteuffel, Anselm: Nach dem Boom. Brüche und Kontinuitäten der Industriemoderne seit 1970, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 55 (2007), S. 559–581; Ders./Raphael, Lutz: Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen 32012; Plumpe, Werner: 1968 und die deutschen Unternehmen. Zur Markierung eines Forschungsfeldes, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 49 (2004), S. 44–65. 10 Anonym: Rüstung. „Da tummelt sich die Elite“, Der SPIEGEL Nr. 28 (1972), S. 30–49. 11 Faust, Ingo: Rheinmetall setzt in der Krise auf Rüstung, in: Westdeutsche Zeitung vom 26.3.2009, S. 16.
188 Stefanie van de Kerkhof
kaum gewürdigt hat.12 Dies könnte mit der Verschwiegenheit der früheren Haupt-Aktionäre zusammenhängen; bis heute sind die Akten der Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke GmbH, der heutigen Industrieverwaltung Röchling, Mannheim, unzugänglich.13 Für die diesem Beitrag zugrundeliegende größere Studie konnten erstmals bedeutendere Quellenbestände aus dem Archiv der Rheinmetall AG (vormals Rheinmetall Berlin AG) und der Bestand KraussMaffei im Bayerischen Wirtschaftsarchiv München unabhängig von den Unternehmen ausgewertet werden. Es handelt sich in der Regel um Geschäftsakten, die nicht von Sicherheitsbelangen tangiert waren oder sind.14 Weitere Bestände wurden in beschränktem Umfang in staatlichen Archiven eingesehen, beispielsweise die für diese Zeit schon zugänglichen Akten des Auswärtigen Amtes. Daneben stellen Zeitungen, Zeitschriften und insbesondere Militaria-Fachzeitschriften eine wichtige Quelle für durch Sperrfristen fehlende Zugangsmöglichkeiten dar, wie etwa „Soldat und Technik“ oder „Wehrtechnik“. Diese staatlich überwachten Medien konstituieren einen öffentlichen Interaktionsraum, der Fachleute aus Militär, Militär-Verwaltung und Rüstungsindustrie dezidiert anspricht, aber auch andere Interessentengruppen wie Politik, Unternehmen, Medien, Reservisten sowie militär- und technikbegeisterte Laien integriert und damit Lücken in der Überlieferung schließen hilft.15 Denn auch international existieren keine validen Statistiken über Produktion und Handel, es dominieren Schätzungen, vor allem für Exporte,16 wie ich in meiner umfassenderen Studie zum Rüstungsmarketing im Kalten Krieg ausführlicher diskutiert habe.17 Diese 12 Leitzbach, Christian: Rheinmetall. Vom Reiz, im Rheinland ein großes Werk zu errichten, 2 Bde., Köln 2014. Das Werk erschien unterstützt durch den Konzern und bietet eine informative Unternehmenschronik ohne Quellennachweise, lediglich grobe Bestandsangaben im Anhang. Ähnlich Seibold, Gerhard: Röchling. Kontinuität im Wandel, Stuttgart 2001; unveröffentlicht im Rheinmetall-Archiv: Rheinmetall GmbH (Hg.): 100 Jahre Rheinmetall 1889–1989, Düsseldorf 1989. 13 Bislang war ihr Archiv nur Gerhard Seibold zugänglich, der für die Familie die o. g. Festschrift verfasst hat. 14 Eingesehen wurden alle Geschäftsberichte und Wirtschaftsprüfungsprotokolle, MarketingQuellen, Berichte einzelner Geschäftsfelder. 15 Vgl. van de Kerkhof, Stefanie: Militärfachzeitschriften als Quellen einer Marketinggeschichte der europäischen Rüstungsindustrie im Kalten Krieg, in: Pöhlmann, Markus (Hg.): Deutsche Militärfachzeitschriften im 20. Jahrhundert (Potsdamer Schriften zur Militärgeschichte 17), Paderborn 2012, S. 71–91. 16 Wulf, Herbert: Waffenexport aus Deutschland. Geschäfte mit dem fernen Tod, Reinbek 1989, S. 106. 17 Die Daten des internationalen Forschungsinstituts SIPRI und der US-Behörde ACDA gelten dabei als die verlässlichsten Schätzungen, sind aber mit einigen Unsicherheiten bzw. definitorischen Schwächen belastet. Vgl. ebd., S. 156 f. und van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit im Kalten Krieg.
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise
189
Problematik betrifft den gesamten Untersuchungszeitraum, der zunächst chronologisch und dann mithilfe eines Fallbeispiels vom Beginn bundeseigener Rüstungsproduktion bis zu den ersten Krisenerscheinungen seit 1967 und den Unternehmensreaktionen darauf behandelt werden soll.
Rüstungsproduktion vom Wiederaufbau zum Erstausstattungsboom Der Aufbau einer eigenen bundesdeutschen Rüstungsproduktion setzte in der ersten Phase aufgrund gesetzlicher Restriktionen der Alliierten von 1949 bis 1956 erst langsam wieder ein. Nicht nur mit der Konferenz von Jalta 1945, sondern auch verstärkt durch das Gesetz Nr. 52 der Westalliierten bzw. den Befehl Nr. 124 der Sowjetischen Militäradministration war in Deutschland 1949 ein strenges Verbot der Waffenproduktion verfügt worden, um eine Entwaffnung Deutschlands und eine Vernichtung seiner Rüstungsindustrie zu erreichen.18 Zwar verhinderte dies den Beginn einer nennenswerten deutschen Rüstungsproduktion in den 1940er Jahren, insbesondere auch durch die Abwanderung von Rüstungsspezialisten in die USA, nach Frankreich, England, Portugal, Spanien und Südamerika.19 Doch mit den fortschreitenden Konflikten der Systemkonfrontation zwischen Ost und West, insbesondere der Berlin-Blockade 1948 und dem Korea-Krieg 1950 bis 1953 lässt sich der Beginn des bundesdeutschen Rüstungsbooms und der Re-Militarisierung festmachen.20 Bezeichnend waren die Diskussionen in verschiedenen Security Communities um den ersten Verteidigungsminister Theodor Blank und Bundeskanzler Adenauer, die sogenannte Himmeroder Denkschrift mit Detailplanungen der Wiederaufrüstung im Herbst
18 Siehe etwa Rheinmetall GmbH (Hg.): 100 Jahre Rheinmetall, S. 49 f. und Leitzbach, Christian: Das Archiv der Rheinmetall AG und seine Bestände, in: Archiv und Wirtschaft 32 (1999:2), S. 57–69, hier S. 58. 19 Scholtyseck: Der Aufstieg der Quandts, S. 775, S. 777 und S. 811; Seel, Wolfgang: Mauser. Von der Waffenschmiede zum Weltunternehmen, Dietikon-Zürich 1986, S. 129 ff. 20 Thoß, Bruno: Der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur WEU und NATO im Spannungsfeld von Blockbildung und Entspannung (1954–1956), in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.): Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik Bd. 3, München 1993, S. 1–234; Greiner, Christian: Die militärische Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die WEU und die NATO 1954 bis 1957, in: Ebd., S. 561–850; Abelshauser, Werner: Wirtschaft und Rüstung in den Fünfziger Jahren, in: Ebd. Bd. 4/1, München 1997, S. 1–185, hier S. 10 und S. 13 ff.; Mai, Gunther: Westliche Sicherheitspolitik im Kalten Krieg. Der Korea-Krieg und die deutsche Wiederbewaffnung 1950, Boppard 1977.
190 Stefanie van de Kerkhof
1950 und der frühe NATO-Beitritt der BRD 1954, noch bevor ein neues Militär installiert worden war.21 Zwar gilt das Jahr 1956 mit der Gründung der Bundeswehr als offizieller Beginn einer eigenen westdeutschen Rüstungsfertigung.22 Aber schon zuvor gab es seit mindestens 1952 offizielle Rüstungsexporte deutscher Unternehmen (z. B. der Werften Abeking & Rasmussen, Lürssen, Schürenstedt u. a. nach Ecuador, Kolumbien und Indonesien) und erste Waffenaufträge in der BRD unter Beachtung von EVG- und Truppenvertrag (1951/54).23 Bereits seit 1948 waren der Bundesgrenzschutz (BGS) und die sogenannten Dienstgruppen, über 150 000 bewaffnete Ordnungskräfte, mit Waffen teils durch Importe der Westalliierten mit den rüstungswirtschaftlichen Investitionsprogrammen des Marshall-Plans wie der Mutual Security Agency (MSA, Behörde zur Verwaltung der rüstungswirtschaftlichen Marshallplan-Gelder) und des Mutual Defense Assistance Programs (MDAP), teils durch eigene geheime Waffenproduktion ausgestattet worden.24 21 Seit November 1945 gehörten den Kreisen, die die Wiederaufrüstung der BRD planten, laut Detlef Bald ca. 3.000 ehemalige Offiziere an, die 1947 und 1948 mit ersten Memoranden in engem Austausch mit Bundeskanzler und Bundespräsident standen. Die Debatten mündeten auf Anregung Adenauers in der „Denkschrift des militärischen Expertenausschusses über die Aufstellung eines Deutschen Kontingents…“ vom 9.10.1950. Abgedruckt in: Rautenberg, H.-J./ Wiggershaus, N.: Die „Himmeroder Denkschrift“ vom Oktober 1950. Politische und militärische Überlegungen für einen Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zur westeuropäischen Verteidigung, Karlsruhe 1985, S. 13 f. (S. 145 f.); Steininger, Rolf: Die Entscheidung für einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag. Adenauer und die Westmächte 1950. Eine Darstellung auf der Grundlage unveröffentlichter britischer und amerikanischer Akten, Erlangen 1989; Foerster, Roland G.: Innenpolitische Aspekte der Sicherheit Westdeutschlands 1947–1950, in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.): Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik Bd. 1, München 1982, S. 405–575; Bald, Detlef: Die Bundeswehr. Eine kritische Geschichte 1955–2005 (Beck’sche Reihe), München 2005, S. 29–35. 22 So etwa bei Berghahn: Unternehmer und Politik in der Bundesrepublik (Neue Historische Bibliothek), Frankfurt (Main) 1985, S. 275. 23 Vgl. van de Kerkhof, Stefanie: Waffen und Sicherheit. Statistische Übersicht Kriegsschiffexporte deutscher Werften seit 1954 [de facto 1952], in: Wehrtechnik 2 (1978), S. 18; vgl. Krüger, Dieter: Das Amt Blank. Die schwierige Gründung des Bundesministeriums für Verteidigung (Einzelschriften zur Militärgeschichte 38), Freiburg 1993, S. 79 ff.; zum EVG-Vertrag Maier, Klaus A.: Die internationalen Auseinandersetzungen um die Westintegration der Bundesrepublik Deutschland und um ihre Bewaffnung im Rahmen der europäischen Verteidigungsgemeinschaft, in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.): Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik Bd. 2, München 1990, S. 1–234; Volkmann, Hans-Erich: Die innenpolitische Dimension Adenauerscher Sicherheitspolitik in der EVG-Phase, in: Ebd., S. 235–604; Meier-Dörnberg, Wilhelm: Die Planung des Verteidigungsbeitrages der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der EVG, in: Ebd., S. 605–756. 24 Abelshauser: Wirtschaft und Rüstung, S. 113–120 und S. 162; Kollmer, Dieter H.: Rüstungsgüterbeschaffung in der Aufbauphase der Bundeswehr. Der Schützenpanzer HS 30 als Fallbei-
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise
191
Dies war verbunden mit den im Hintergrund verfolgten Bestrebungen von Unternehmen und ehemaligen Generälen der Wehrmacht, die Rüstungsfertigung möglichst schnell und leistungsfähig wieder aufzunehmen.25 Nicht nur die Einbindung der Bundesrepublik in die Sicherheits- und Militärpolitik der westlichen Besatzungsmächte, sondern auch der schnelle organisatorische „Neubeginn“ mit der Gründung des Amts Blank als Vorläufer des Bundesverteidigungsministeriums spielte dabei eine gewichtige Rolle, auch wenn personell stark auf Kräfte aus der NS-Zeit zurückgegriffen wurde. 26 Denn je nach Besatzungszone und Umgang der Besatzungsmächte mit der Vergangenheit der Unternehmen im Nationalsozialismus konnten erste Rüstungsunternehmen relativ früh nach Kriegsende mit der Waffenfertigung starten. Während die Demontagen von Rüstungsbetrieben in der französischen und sowjetischen Besatzungszone eher strikt gehandhabt wurden, erfolgten sie in der Bi-Zone teils zögernd und zufällig.27 Die Entnazifizierung der Wirtschaft endete hier im Januar 1951 mit einer Amnestie, ebenso wurde die Entflechtung der Konzerne in den frühen 1950er Jahren gestoppt. Die Zerstörung der Waffenproduktion in der Bi-Zone war nicht nur inkonsequent, sondern sehr zurückhaltend, z. B. wurden in der britischen Zone nur 7 % der Rüstungsbetriebe liquidiert.28 Dies erklärt auch die schnelle Expansion der Rüstungsproduktion im Erstausrüstungsboom der Bundeswehr in den 1950er Jahren, die ohne vorhandene Kapazitäten bzw. vorbereitende Planungen sicherlich nicht so rasch hätte vonstattengehen können. Betrachtet man die Ausgaben des BMVg für militärische Beschaffungen, Forschung und Entwicklung (F&E) sowie Materialerhalt (vgl. S. 192 Abb. 1 und S. 203 Tab. 1 im Anhang), so wird deutlich, dass ab 1956 enorme Beschaffungsaufträge für Rüstungsgüter erteilt wurden, die vor allem an deutsche Produzenten gingen. Dagegen erreichten Forschung, Entwicklung und Materialerhaltung erst in den 1960er Jahren einen höheren Stellenwert. Insbesondere in den ersten beiden Jahren seit Bestehen der Bundeswehr verdoppelten sich die Zahlungen spiel (1953–1961) (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 93), Stuttgart 2002, S. 88 f. Dort auch die Aufstellung der Nash-Liste mit ausgemusterten US-Rüstungsgütern für den Export in die BRD. 25 Siehe van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit; vgl. o. A.: Waffenproduktion. Die neuen Hoflieferanten, in: Der SPIEGEL 45/1956 (7.11.56), S. 19–23; Bericht über die ersten Flugzeuglizenzen an Dornier und Willy H. Schlieker in: Der SPIEGEL 39/1956. 26 Krüger: Das Amt Blank; vgl. Bald: Bundeswehr. 27 Berghahn, Volker: Unternehmer, S. 69 ff.; Benz, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik. Stationen einer Staatsgründung 1946–1949 (Fischer Bücherei 4311), Frankfurt (Main) 1989; Ders. (Hg.): Deutschland unter alliierter Besatzung. Ein Handbuch, Berlin 1999, S. 21–72. 28 Diedrich, Torsten: Art. Entmilitarisierung, in: Benz (Hg.): Deutschland unter alliierter Besatzung, S. 342–346, hier S. 344.
192 Stefanie van de Kerkhof
an Rüstungsunternehmen von etwa 2 auf 4 Mrd. DM nahezu, wenn man Materialerhaltung und F&E als rüstungswirtschaftliche Posten, die an private Unternehmen gingen, einbezieht. Danach sind die Steigerungsraten bei den Ausgaben nicht mehr ganz so rasant, die Grenze von 8 Mrd. DM wurde für diese drei Ausgabenposten beispielsweise erst 1962 erreicht. Bis zu diesem Zeitpunkt stiegen auch die Ausgaben für F&E und militärische Erprobung deutlich an, danach ist ein leicht abgeschwächtes Wachstum zu verzeichnen. Deutlichere Veränderungen traten erstmals nach der krisenhaften Entwicklung am Ende des Booms ein.
25000 Gesamt materielle Rüstung
20000
Personal Personal
15000 8000
milit. Beschaffungen Beschaffungen milit.
10000 6000
F&E F&E Materialerhaltung
4000 5000 2000 1967 1968 1968 1969
Materialerhaltung 1955 1956 1957 1957 1958 1958 1959 1959 1960 1960 1961 1961 1962 1962 1963 1963 1964 1964 1965 1965 1966 1966 1967
00
Abb. 1: Einzelplan 14 von 1969 bis 1987 in Mio. DM (Materielle Ausgaben des BMVg) Quelle: Bontrup/Zdrowomyslaw: Rüstungsindustrie, S. 37f.
Nach der ersten Nachkriegsrezession 1966/67 gab es wieder eine rasante Zunahme, ebenso wie ab 1983 nach der konservativen „Wende“, dem Regierungswechsel zur CDU-FDP-Koalition, wieder ein deutlicher Anstieg zu sehen ist (vgl. S. 197 Abb. 2 und S. 203 Tab. 1). Insgesamt stieg dieser Ausgabenbereich von 1956 bis 1987 zunächst drastisch, dann kontinuierlich langsam weiter an und erreichte 1987 einen mehr als verzehnfachten Wert im Vergleich zu 1960 (244 Mio. zu 2,8 Mrd. DM). Betrachtet man noch den größten Ausgabenposten, die militärischen Beschaffungen von Waffen und anderen Rüstungsgütern, so ist auch hier bis 1963 ein Ansteigen der Ausgaben festzustellen, danach bis 1968 ein leichter Rückgang und in den Jahren der Ölkrise von 1970 bis 1973 ein starker Rückgang. Anschließend findet ein kontinuierlicher Anstieg mit einer deutlichen Steigerung im Jahr 1981 von 8,8 auf über 10 Mrd. DM statt. Erst ab 1985 ist ein leichter Rückgang in den Ausgaben für militärische Beschaffungen
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise
193
zu verzeichnen. Interessant sind auch die Werte für die Materialerhaltung, die seit 1960 einen immer größeren Ausgabenposten bildeten. Innerhalb von drei Jahren, nämlich von 1960 bis 1963, verdoppelten sich diese Ausgaben auf über 1,6 Mrd. DM und stiegen danach bis 1964 weiter an.29 Diese quantitative Entwicklung demonstriert damit einerseits, dass die Rüstungsunternehmen nicht nur konjunkturelle Schwankungen, sondern auch Produktionszyklen mit Auslaufen von größeren Projekten in ihren Planungen berücksichtigen mussten, andererseits dass mit längeren Laufzeiten von Waffensystemen und Geräten der Stellenwert der Materialerhaltung deutlich stieg. Obwohl die Interessenvertreter der deutschen Wirtschaft im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHT) in den 1950ern nach außen zurückhaltend gegenüber großen Waffenaufträgen mit Verweis auf den Koreaboom auftraten, wurde aber intern schon 1953 ein Ausschuss für verteidigungspolitische Fragen im BDI mit mehreren Untergruppen für einzelne Waffentypen gegründet. Er agierte als Rüstungslobby v. a. bei der CDU-CSU-Fraktion.30 Diese ambivalente Positionierung erklärt sich einerseits durch den öffentlichen Widerstand der Bevölkerung gegen die Wiederaufrüstung, wie er etwa in der „Ohne mich-Bewegung“ mit Massendemonstrationen deutlich zu Tage trat.31 Andererseits trachteten Unternehmen und Verbände am Ende des durch den Korea-Krieg hervorgebrachten Booms in der Eisen- und Stahlindustrie danach, durch Aufnahme der Rüstungsproduktion weiterhin die Auslastung der Produktionsanlagen zu erhalten und dem in zukünftigen Boom-Phasen durch Abwanderung drohenden Arbeitermangel entgegenzuwirken.32 Dies bietet auch eine tragfähige Erklärung dafür, dass seit 1953 erste Vorgespräche erfolgten und sich bis Ende 1956 ca. 400 deutsche Un29 Bontrup/Zdrowomyslaw: Die deutsche Rüstungsindustrie, S. 37 f. Der Einzelplan 14 stellt den quantitativ größten Teil des deutschen Rüstungsbudgets und damit die Inlandsnachfrage dar, wenn auch im Bundesministerium des Innern und anderen Ministerien ebenfalls Beschaffungsaufträge für Waffen in nennenswerter Höhe getätigt wurden und werden, z. B. für Polizeikräfte. 30 Abelshauser: Wirtschaft und Rüstung, S. 160 f. und S. 171–178. Detaillierter zur Politik des BDI und Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) in der Rüstungsfrage auch ebd., S. 146–156; o. A.: Waffenproduktion. Die neuen Hoflieferanten, S. 19; vgl. Berghahn: Unternehmer, S. 276 f. 31 Zur Kritik an der Wiederaufrüstung der BRD: Bald, Detlef/Wette, Wolfram (Hg.): Alternativen zur Wiederbewaffnung. Friedenskonzeptionen in Westdeutschland 1945–1955 (Frieden und Krieg – Beiträge zur Historischen Friedensforschung 11), Essen 2008; Lipp, Karlheinz u. a.: Frieden und Friedensbewegungen in Deutschland 1892–1992. Ein Lesebuch (Frieden und Krieg – Beiträge zur historischen Friedensforschung 16), Essen 2010. 32 Abelshauser: Wirtschaft und Rüstung, S. 168f; vgl. Erker, Paul/Pierenkemper, Toni (Hg.): Deutsche Unternehmer zwischen Kriegswirtschaft und Wiederaufbau. Studien zur Erfahrungs-
194 Stefanie van de Kerkhof
ternehmen schriftlich beim BMWi oder BMVg für eine Aufnahme der Waffenproduktion bereit erklärten.33 Unterstützt wurden sie durch Forderungen der „Arbeitsgemeinschaft für Wehrtechnik“ bzw. der späteren „Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik“, die in den 1950er Jahren die Wiederaufrüstung massiv propagierte.34 Führende Positionen nahmen in dieser illustren industriell-militärischen Lobby etwa der ehemalige Chef des Heereswaffenamts General Leeb und führende Mitarbeiter wie Walter Rau ein. Auch die Rheinmetall-Direktoren Otto Caesar und Ernst Blume taten sich hier hervor und wurden intern sogar als „Motor der Wiederaufrüstung“ bezeichnet.35 Doch wie kam es zu dieser prominenten Position Rheinmetalls?
Rheinmetall vom Erstausrüstungsboom bis zur Krise Der Düsseldorfer Rüstungsspezialist Rheinmetall AG, schon bei seiner Gründung 1889 als Rheinische Metallwarenfabrik AG für seine Waffen und Waffensysteme in der militärischen Fachwelt bekannt und geschätzt, expandierte mit Rüstungsgütern und Vorprodukten insbesondere in beiden Weltkriegen (Höchstzahl 48 000 Beschäftigte im Ersten Weltkrieg, 85 000 im Zweiten Weltkrieg). Das mit dem Eisenbahnhersteller und Maschinenbauer Borsig zur Rheinmetall-Borsig AG fusionierte Unternehmen wuchs bis 1937 zum zweitgrößten Rüstungskonzern Deutschlands. Es verfolgte eine beständige Strategie der Innovation in der Waffenentwicklung und Expansion des Absatzes.36 Das Kriegsende war durch die Verlagerung von Betrieben und die Intensivierung des Auslandsgeschäfts gekennzeichnet, bis ein Produktionsstopp die Blüte des Rüstungsgebildung von Industrie-Eliten (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 39), München 1999. 33 O. A.: Waffenproduktion. Die neuen Hoflieferanten, S. 19 ff. 34 O. A.: Jubilatio Schneider, in: Wehrtechnik 8 (1969), S. 284; vgl. Stieler von Heydekampf, Gerd, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik: Jubilatio Generalleutnant a. D. Dipl.-Ing. Erich Schneider 80 Jahre, in: Wehrtechnik 8 (1974), S. 280; Tetzlaff, Walter: Zum militärisch-industriellen Komplex, in: Ebd., S. 281–283. 35 Schneider, Erich: Nachruf auf Präsident Ernst Blume, in: Wehrtechnik 12 (1974), S. 465. 36 van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit; Dies.: „It’s good to have a reliable navy!“ Zur Rolle von Vertrauen und Sicherheit im Marketing deutscher Rüstungsunternehmen, in: Hillen, Christian (Hg.): „Mit Gott!“ Zum Verhältnis von Vertrauen und Wirtschaftsgeschichte (Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte 46), Köln 2007, S. 107–124; Leitzbach: Rheinmetall. Vom Reiz; vgl. als Quelle auch den ersten Leiter Rheinmetalls Ehrhardt, Heinrich: Hammerschläge, Leipzig 1922.
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise
195
schäfts beendete. Zum 30. Juni 1945 wurde die gesamte Belegschaft gekündigt, obwohl die Kriegsschäden im Werk Düsseldorf etwa 60 bis 70 % betrugen und ein Wiederbeginn der Produktion also durchaus gut möglich war.37 Die verbliebenen Manager und Arbeitskräfte begannen auch in allen Zonen in West und Ost direkt nach Kriegsende damit, eine Aufnahme ziviler Produktion und der Aufräumarbeiten voranzutreiben. Die Demontagen in den meisten RheinmetallWerken waren insgesamt recht verhalten. Erste Entwicklungen neuer ziviler Produkte begannen daher schon im Jahr 1950, zuvor versuchte man an das traditionelle zivile Produktionsprogramm bestehend aus Büro- und Rechenmaschinen wieder anzuknüpfen. Das Werk Düsseldorf erhielt zu dieser Zeit die offizielle Arbeitserlaubnis der englischen Besatzungsmacht, aber begann mit einer nur geringfügigen Produktion mit 232 (1951) bzw. 440 (1952) Arbeitskräften.38 Dass das Unternehmen schon früh in die Wiederaufrüstungspläne eingespannt war, zeigen fortschreitende Planungen zur Rüstungsproduktion, etwa mit der Einstellung eines entsprechenden Lobbyisten 1951 oder der Sammlung von militärisch nutzbaren Konstruktionsplänen.39 Dies erklärt auch, dass seit 1954 beim Bund als juristischem Nachfolger des Reichs und Inhaber verschiedene ehemalige oder aktuelle Rüstungsgrößen aus Deutschland und der Schweiz ihre Kaufinteressen anzeigten. Dazu gehörten z. B. Phoenix Rheinrohr, Krupp, Hoesch, DEMAG, Mannesmann, Hispano Suiza und Oerlikon.40 Dass im Jahre 1955 die Vorproduktion von Waffen bei den Hessischen Industriewerken (HIW), die im Besitz der Familie Röchling waren, begann, war ein Vorbote der kommenden Jahre. Denn 1956 wurde die teil-entflochtene Rheinmetall Berlin AG endgültig zum Röchling-Tochterunternehmen, nachdem schon vorsorglich im April 1955 wichtige Patente für das im Zweiten Weltkrieg weiter entwickelte Maschinengewehr MG 42 in Höhe von 1,55 Mio. DM erworben worden waren. Obwohl der 1955 verstorbene Unternehmens-Patriarch Hermann Röchling, sein Neffe Ernst Röchling und sein Schwiegersohn im Rastatter Prozess von der französischen Militärgerichtsbarkeit noch wenige Jahre zuvor als Kriegsverbrecher verurteilt worden waren, wurden 1956 nach zähem Ringen mit anderen Kaufinteressenten die Mehrheitsanteile des Bundes an Röchling verkauft.41 37 Ebd. und Rheinmetall-Archiv (RA) B 300/16, Rheinmetall-Borsig AG 1938–1951, Bericht 1945. 38 Ebd. 39 van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit, Kapitel 2.1; Leitzbach: Rheinmetall. Vom Reiz, Bd. 1, S. 429–480, allerdings ohne nähere Quellenangabe. 40 Ausführlicher van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit. Vgl. Leitzbach: Rheinmetall. Vom Reiz, Bd. 1, S. 470–493. 41 Ferencz, Benjamin B.: Lohn des Grauens. Die verweigerte Entschädigung für jüdische Zwangsarbeiter. Ein Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte, Frankfurt (Main)/New York
196 Stefanie van de Kerkhof
Die Waffengeschäfte florierten schnell im Erstausrüstungsboom der Bundeswehr: im Jahre 1956 begann die eigene Rüstungsproduktion bei Rheinmetall mit dem Gewehr G 3 und dem Maschinengewehr MG 3 mit über 16 400 Stück. Auch die Maschinenkanonen des ersten Bundeswehr-Schützenpanzers von Hispano-Suiza HS 820, ein Auftrag im Wert von 250 Mio. DM, wurden bei Rheinmetall in Lizenz gebaut.42 Eine allzu große öffentliche Anteilnahme an diesen Erfolgen verhinderte 1957 die Umwandlung der Wehrtechnik-Sparte in eine GmbH, die nicht mehr öffentlich rechenschaftspflichtig war. Schon kurz nach der Gründung der Bundeswehr mussten also keine Geschäftsberichte mehr publiziert werden, auch wenn erst 1960 die erste Phase der großen Investitionen beendet war und die erste Dividendenzahlung nach dem Krieg verbucht wurde.43 Der Einstieg in die Produktion schwerer Waffen erfolgte dann 1964 mit Geschützen und Waffenanlagen. Nach langen Vorbereitungen bei den in enger militärisch-industrieller Kooperation organisierten Entwicklungsverfahren startete 1978 die Serienfertigung der innovativen Feldhaubitze FH 70 bzw. FH 155 als trilaterales NATO-Projekt mit der italienischen Oto Melara und der britischen Vickers AG.44 Zudem beteiligte sich Rheinmetall zusammen mit Krauss-Maffei als Generalunternehmer an der Produktion des neuen Standardpanzermodells Leopard 2, der 1979 ausgeliefert wurde.45 Mit dieser beständigen Ausweitung des Geschäfts in immer größere und komplexere, sogar international entwickelte und gefertigte Waffensysteme stieg auch die Beschäftigtenzahl von 431 (1956) auf 1103 (1957), 2350 (1959) und sogar 3080 (1960) rasant schnell an.46
1979, S. 171; Leitzbach: Rheinmetall. Vom Reiz, Bd. 2, u. a. S. 506 und S. 524 f.; vgl. Priemel, Kim C./Stiller, Alexa (Hg.): Reassessing the Nuremberg Military Tribunals. Transitional Justice, Trial Narratives, and Historiography (Studies on War and Genocide), Oxford/New York 2012. 42 Bundeswehr-Vertrag über 16 400 Stück MG im Jahr 1956, über 7 300 Stück mit Zusatz 1964; 1957–1975 rund 170 000 produziert, davon 50 000 exportiert. Vgl. van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit und o. A.: Wirtschaft – Rheinmetall. Vom MG bis zur Haubitze, in: Wehrtechnik 12 (1975), S. 692–694; Flume, Wolfgang/Witzke, Heinz-Jürgen: WT Industrieporträt: Rheinmetall. Waffe und Munition aus einem Guß, in: Wehrtechnik 6 (1977), S. 72–78. 43 Siehe nun ausführlicher van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit. 44 Ebd.; Leitzbach: Rheinmetall. Vom Reiz, Bd. 2, S. 584 f.; vgl. auch o. A.: Heer erhielt Feldhaubitze 155–1, in: Wehrtechnik 12 (1978), S. 40 und Flume, Wolfgang/Witzke, Heinz-Jürgen/ Pieper, Hans-Ulrich: WT Firmenporträt: Rheinmetall GmbH. Das breite Spektrum bleibt erhalten, in: Wehrtechnik 8 (1980), S. 74–79, mit Abb. Übergabe. 45 Frankfurter Rundschau vom 18. Februar 1985. Vgl. auch RA B 51, Wehrtechnik Nr. 13. 46 Siehe van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit; vgl. Leitzbach: Rheinmetall. Vom Reiz, Bd. 1, S. 439 ff.
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise
197
1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
Rheinmetall GmbH
Rheinmetall Berlin AG
Gesamt
Abb. 2: Umsatz Rheinmetall, 1967–1989 in TDM Quelle: Rheinmetall-Archiv A 21, Wirtschaftsprüfungsberichte 1967–1989.
Mit der Ausweitung der Rüstungsproduktion von leichten auf schwere Waffen ging aber nicht nur ein Anstieg des Umsatzes im militärischen Bereich einher. Die Rheinmetall Berlin AG versuchte nun auch im Gegenzug, sich zivil zu erweitern und damit zu diversifizieren. Der Konzern erwarb allerdings nur Tochterunternehmen oder Beteiligungen sofern sie dual-use-fähig waren oder sogar einen waffentechnischen Zusatznutzen versprachen. Im sogenannten Revolving buying-Verfahren wurden von Rheinmetall in den Jahren 1958 bis 1973, also kurz nach Beginn des Erstausrüstungsbooms der Bundeswehr, mehr als zwei Dutzend zivile Maschinenbauer oder Zulieferfirmen erworben bzw. neu gegründet.47 In den Jahren 1974/75 begann dann die Internationalisierung mit der Beteiligung an der Auto Precision Group Ltd. und der Bristol Packaging Machines Ltd., Metalúrgica Mauá S. A. in Belo Horizonte und der Nederlandsche Wapen Maatschapij (NWM) de Kruithoorn B. V. in s.-Hertogenbosch.48 Die Auswirkungen der Expan47 Dies waren 1958/60 die Tornado GmbH und Tornado GmbH & Co. in Lintorf, 1962 Benz & Hilgers Düsseldorf oHG, 1964 Rheinmetall Schmiede- und Presswerk Trier GmbH, 1966 Alkett Maschinenbau GmbH, Berlin, 1968/73 Société Plastimécanique S. A., Paris, 1968/9 Ludwig Grefe Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Lüdenscheid, Elan-Schaltelemente GmbH Kurt Maecker in Düsseldorf und Laeis Werke AG in Trier, 1969 Benhil Verpackungsmaschinen GmbH Düsseldorf gegründet und 1970–73 Ankauf weiterer Maschinenfabriken in Düsseldorf, Köln, Pforzheim und Karlsruhe. Ausführlich dazu van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit; Dies.: Auf dem Weg vom Konzern zum Netzwerk? Organisationsstruktur der Rheinmetall Berlin AG im Kalten Krieg. 1956–1989, in: Reitmayer/Rosenberger (Hg.): Unternehmen am Ende des „goldenen Zeitalters“, S. 67–89. 48 Ebd.
198 Stefanie van de Kerkhof
sionsphase mit beständigen Zukäufen von Unternehmen und Beteiligungen lassen sich auch gut am beständig gestiegenen Umsatz insbesondere des Konzerns erkennen, der teils noch deutlichere Steigerungen als der wehrtechnische Konzernzweig, die Rheinmetall GmbH, verzeichnen konnte. Dagegen hatte die Rheinmetall Berlin AG als Holdinggesellschaft nur eine operative Funktion als Hülle, wie man an den niedrigen Umsatzzahlen deutlich sehen kann. Vergleicht man diese Entwicklung mit anderen NS-Rüstungsgrößen, so ist festzustellen, dass Rheinmetall beileibe keine Ausnahme darstellte. Auch andere Unternehmen wie Flick, die Degussa und Mannesmann begannen mit der Vorbereitung der Nachkriegszeit schon 1944/45, indem sie erst Produktionsbetriebe verlagerten, dann Patente, Lizenzen, Baupläne, Mitarbeiter und Manager nach Westdeutschland teils klandestin verbrachten.49 Ähnlich wie die verbliebenen Düsseldorfer Mitarbeiter versuchten auch andere Unternehmen seit Beginn der 1950er Jahre sich an Waffenaufträgen des BGS, der Besatzungsbehörden oder der Bundeswehr zu beteiligen. Seit 1951 erfolgten z. B. erste Waffenlieferungen der neu gegründeten HEKO, die v. a. Mauser-Entwickler beschäftigte, an den neuen BGS, der partiell militärische Aufgaben übernahm. Schnell folgten weitere Waffenentwicklungen. Die Firma Walther als bekannter Hersteller leichter Schusswaffen für Polizei und Militär erhielt vor 1956 einen Auftrag über 40 000 Pistolen vom Kaliber 7,65 Millimeter.50 Zum selben Zeitpunkt begannen die ersten Lobbyisten, wie etwa Emil Leeb, General a. D. der Artillerie, oder General a. D. Bernhard Heydenreich, NS-Sonderbeauftragter für Zünderfragen, für das Familienunternehmen Diehl tätig zu werden.51 Nur zwei Jahre später, am Ende des Korea-Krieges, zeigten Henschel, Hanomag und Bosch bereits Interesse für die Panzerproduktion in Lizenz bei Hispano Suiza. Seit 1953 produzierte Diehl bei der Manusaar erste Waffen, seit 1954 begann die Waffenproduktion bei HEKO, seit 1955 bei Wegmann und seit 1956 bei Thyssen, ähnlich wie bei der Quandt-Tochter IWK und Dräger.52 Im Jahr 1955 bekundeten auch ehemalige Rüstungsproduzenten wie Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD), Stinnes und
49 Ausführlich dazu Frei, Norbert u. a.: Flick. Der Konzern, die Familie, die Macht, München 2009, S. 484 ff. v. a. für die SBZ und S. 463 f. für die Westzonen. 50 Kersten, Manfred/Schmid, Walter: HK Heckler & Koch. Die offizielle Geschichte der Oberndorfer Firma Heckler & Koch. Einblicke in die Historie – Beschreibung der Waffenmodelle – Darstellung der Technik, Wuppertal 1999, S. 20–24; o. A.: Waffenproduktion. Die neuen Hoflieferanten, S. 19. 51 Schöllgen, Gregor: Diehl. Ein Familienunternehmen in Deutschland. 1902–2002, Berlin/ München 2002, S. 137–146. 52 Berghahn: Unternehmer, S. 276 f.; vgl. o. A.: Waffenproduktion. Die neuen Hoflieferanten; Leitzbach: Rheinmetall. Vom Reiz, Bd. 1, S. 429–455; o. A.: Thyssen. Moderne Technik für sicheren Einsatz, in: Wehrtechnik 8 (1984), großformatige Werbeanzeige, Umschlagseite innen.
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise
199
Krupp, Heinkel, Messerschmitt, Dornier (Süd-Gruppe) und Blohm & Voss, Henschel, Focke-Wulf u. a. (Nord-Gruppe) ihr großes Interesse an Rüstungsaufträgen für Bund und NATO-Bündnis.53
Erste Krisensymptome und neue Strategien In der ersten Phase der westdeutschen Wiederaufrüstung im Boom bis Anfang der 1960er Jahre hatte sich damit eine Spezifik der bundesdeutschen Rüstungsindustrie herausgebildet, die auf der Rüstungsproduktion privater Unternehmen, die sowohl militärisch als auch zivil produzierten, basierte. Dazu zählten sowohl Familienunternehmen wie Diehl als auch bereits stark diversifizierte Konzerne wie Daimler-Benz, AEG oder Siemens.54 Waren schon seit Beginn der 1960er Jahre die Ausgaben für militärische Beschaffung des BMVg kontinuierlich zurückgegangen (Abb. 1), so waren mit der Rezession und dem Ende des ersten Nachkriegszyklus’ 1966/67 auch gleichzeitig tiefere Einschnitte im Rüstungsbudget verbunden. Sie markierten damit auch das Ende der Erstausrüstungsphase der Bundeswehr und einen erheblichen Nachfragerückgang an Waffen im Inland. In den 1970er Jahren traten zu dieser Nachfragekrise noch die allgemeinen konjunkturellen Schwankungen im Zuge der beiden Ölkrisen sowie eine tief gehende Vertrauens- und Legitimitätskrise der Waffenproduktion hinzu. Rüstungskritik manifestierte sich nun vor allem in den Neuen Sozialen Bewegungen wie der Friedens- und Anti-Atomkraft-Bewegung mit bis zu 300 000 Demonstranten.55 Diese tiefe Vertrauenskrise wurde in den Unternehmen, sowohl bei Rheinmetall, MBB und Diehl, durchaus wahrgenommen und diente als Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Marketinginstrumente.56 Als weitere Mittel zur Bekämpfung dieser Krisen boten sich generell für die Unternehmen neben Internationalisierung und Ausweitung der Rüstungsexporte etwa Diversifizierung oder Nischenstrategien als strategische Antwort an. 53 Abelshauser: Wirtschaft und Rüstung, S. 168 f.; vgl. Erker, Paul: Ernst Heinkel. Die Luftfahrtindustrie im Spannungsfeld von technologischem Wandel und politischem Umbruch, in: Ders./Pierenkemper (Hg.): Deutsche Unternehmer, S. 217–290. 54 Hummel: Rüstungsexportbeschränkungen, S. 292 ff.; van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit. 55 Vgl. etwa Becker-Schaum, Christoph u. a. (Hg.): „Entrüstet Euch!“ Nuklearkrise, NATODoppelbeschluss und Friedensbewegung, Paderborn 2012; Gassert, Philipp u. a. (Hg.): Zweiter Kalter Krieg und Friedensbewegung. Der NATO-Doppelbeschluss in deutsch-deutscher und internationaler Perspektive (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte), München 2011. 56 Ausführlich dazu van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit; Dies.: „It’s good to have…“.
200 Stefanie van de Kerkhof
Wie deutlich wurde, setzten Unternehmen wie Rheinmetall schon seit den 1950er auf Diversifikation in zivile, aber dual-use-fähige Märkte, da der Beschaffungsprozess von Rüstungsgütern im Inland in aller Regel durch ein System der Maßschneiderei auf die jeweiligen Teilstreitkräfte oder NATO-Bündnispartner mit langen Entwicklungszyklen von 10 bis 20 Jahren und kurzen Produktionszyklen von maximal 10 Jahren gekennzeichnet war.57 Dies erklärt auch die Entwicklung der Diversifikationsstrategien, um den systemisch angelegten Krisenmechanismen beizukommen. Westdeutsche Rüstungsunternehmen wie die Rheinmetall Berlin AG setzten auf Revolving Buying, um der krisenhaften Entwicklung seit Ende der 1960er Jahre zu begegnen. Doch dieses System geriet nach der ersten Ölkrise und einem Generationswechsel an der Spitze des Konzerns in der Mitte der 1970er Jahre intern massiv in die Kritik.58 Die generelle Problematik des Fokus auf die Wehrtechnik als profitträchtigstem Unternehmensbereich zeigt ein Zitat des neuen Rheinmetall-Vorstands Mitte des Jahres 1976: „Soll man durch Diversifikation wachsen? Diversifikation mindert das Risiko von Monokulturen: mehrere Gäule vor dem Karren sichern dessen Vorwärtsbewegung besser als nur ein Gaul. Dies war die typische Ausgangsüberlegung bei Rheinmetall, die zum Aufbau des Zivilbereichs führte. Die Erfahrung bei Rheinmetall zeigt aber, dass das angestrebte Ziel bisher nicht erreicht worden ist. Rheinmetall hat keinen Stabilisator gegen die Risiken der Wehrtechnik aufgebaut; im Gegenteil: die Wehrtechnik zieht nicht nur den Gesamtkarren, sondern noch zusätzlich die hinzugekauften Gäule mit.“59
Er setzte die Reihe bildhafter Vergleiche fort, indem er das in deutschen Konzernen in den 1960er Jahren bevorzugt verwendete System der Diversifikation per Revolving Buying deutlich kritisierte: „Es hat überhaupt keinen Sinn, in einer Art Schneeballsystem durch ständigen weiteren Zukauf von Firmen den Eindruck zu erwecken, als ob der Gesamtbereich sich auf einer Linie aufsteigender Entwicklung befände. Ein solches System bricht unweigerlich zusammen, wenn man aufhören muß, weitere Firmeneinheiten zu erwerben. Das Revolving buying ist bei Rheinmetall in vielen Fällen dadurch akzentuiert worden, dass zusammen mit dem Firmenerwerb jeweils Gewinne mitgekauft und ausgewiesen wurden. Solange man weitere Gewinne dazukauft und solange man sich nur die Summe der Beteiligungserträge ansieht, entsteht beim Betrachter ein Bild gesunden Ertragswachstums. Dieses Bild ändert sich völlig, wenn man nur die echt erwirtschafteten Ergebnisse der Firmen [betrachtet].“60
57 58 59 60
Ebd. Ausführlich dazu van de Kerkhof: Auf dem Weg vom Konzern zum Netzwerk. Ebd. und van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit. Ebd.
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise
201
Dieser Kritik folgte nach harten internen Kämpfen mit den im Aufsichtsrat vertretenen Vorgängern im Vorstandsamt und einer eingehenden Bewertung der Konzernstruktur relativ zügig die Entwicklung neuer Strategien in den Jahren 1976 bis 1983. Interessant daran war, dass der neue Vorstand nicht nur das Produktionsprogramm im zivilen Bereich einschränkte und damit die dual-use-Planungen modifizierte, sondern auch die Bereinigung und Integration der zugekauften Unternehmen und Straffung in drei homogene Gruppen vornahm. Damit verbunden war eine Beschränkung von Fixkosten, aber auch der hohen Produkt- und Standortdiversifikation. Bei den drei neu zu schaffenden Teilen des Konzerns wurde in den Jahren 1981 bis 1986 auch auf Neuerwerbung gesetzt, die mit WMF, Jagenberg AG und Pierburg GmbH angestrebt, aber im Fall von WMF aufgrund wettbewerbsrechtlicher Bedenken des Bundeskartellamts nicht völlig realisiert werden konnte. Die neuen Konzerntöchter sollten allesamt einer Marktführerstrategie unterworfen sein und im Falle des Scheiterns recht zügig veräußert werden, was in den Jahren 1999 bis 2003 mit der Maschinenbausparte Jagenberg auch tatsächlich eingehalten wurde.61 Rheinmetall kann auch hier wieder als beispielhaft für die Branche angesehen werden, denn auch andere Rüstungsgrößen wie der Flick-Konzern waren in den 1970er Jahren durch ihre Diversifizierungs-Strategie in eine krisenhafte Situation geraten, die im Fall von Flick noch mit illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Steuererleichterungen verbunden waren. Kim Priemel sieht die Ursache neben dem konjunkturellen Hintergrund auch in den Investitionen in Tochterunternehmen und Beteiligungen, „die sich in den Mainstream zeitgenössischer Diversifizierungsstrategien fügten“, da die Flick-Manager wie andere Führungskräfte der Zeit „weniger Pioniere als Plagiatoren“ gewesen seien. 62 Eine weitere entscheidende Strategie zur Überwindung der Krisen nach dem Boom war – ähnlich wie in der Automobilindustrie von Ingo Köhler gezeigt werden konnte – der Ausbau des betrieblichen Marketings, der schon Ende der 1960er Jahre mit einer Werbeabteilung begonnen hatte und sich in den 1970er und 1980er Jahren mit einem konzern-eigenen Werbeunternehmen der Rheinmetall Industriewerbung GmbH (riw) und später in einer Stabsabteilung für Öffentlichkeitsarbeit in verschiedenen Marketing-Studien äußerte.63 In den Stu61 Ebd. 62 Priemel, Kim C.: Industrieunternehmen, Strukturwandel und Rezession. Die Krise des FlickKonzerns in den siebziger Jahren, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 57 (2009), S. 1–34, hier v. a. S. 28 f. und S. 14 ff., Zitate S. 28 f. Zum Flick-Skandal siehe insbesondere Kilz, Hans Werner/Preuss, Joachim: Flick. Die gekaufte Republik, Reinbek 1983; Schily, Otto: Politik in bar. Flick und die Verfassung unserer Republik, München 1986. 63 Köhler, Ingo: Overcoming Stagflation. Innovative Product Policy and Marketing in the German Automobile Industry of the 1970s, in: Business History Review 84 (2010), S. 53–78; Ders.:
202 Stefanie van de Kerkhof
dien war ein breiter Marketing-Mix vorgesehen, der von der Beeinflussung einer zunehmend kritischen Öffentlichkeit, über Lobbyarbeit, auch für Waffenexporte bis hin zur Berücksichtigung sämtlicher interner und externer Medienkanäle und gezielten Erforschung der Absatzmärkte, also möglicher gewaltsamer Konflikte in aller Welt, reichte. Zudem wurden wie in vielen westdeutschen Großunternehmen neue Planungs- und Kontrollsysteme eingeführt, z. B. ein Planungsund Berichtssystem für die AG, und auch Operations und Market Research kamen zur Anwendung.64 Erst nach dem Ende des Kalten Krieges entschied sich Rheinmetall mit Outsourcing und der Konzentration auf das Kerngeschäft Rüstungsproduktion (Defense) dafür, neue Strategien in der Krisenbekämpfung zu erproben.
Fazit Insgesamt wurde deutlich, dass die Rüstungsindustrie erst vergleichsweise spät in der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik mit Krisensymptomen zu kämpfen hatte. Zwar wurden schon sehr früh nach Kriegsende von Unternehmen und Militärs erste Pläne für die Wiederaufrüstung verfasst, ein Rüstungsboom erfolgte aber erst nach dem Korea-Krieg und beschleunigte sich ab Mitte der 1950er bis Anfang der 1960er Jahre. Die private Waffenproduktion in der BRD, aber auch internationale Importe im Rahmen des Marshallplans erfolgten seit Ende der 1940er Jahre, die bundesdeutschen Unternehmen exportierten Waffen, teils im Rahmen von Militärhilfe seit Beginn der 1950er Jahre. Grundlage dafür war insbesondere die internationale Entwicklung hin zum Kalten Krieg, der dazu führte, dass die Entmilitarisierung von den West-Alliierten seit 1954 völlig aufgegeben wurde, aber auch schon zuvor von ihnen kein Protest gegen Forderungen Adenauers nach Wiederbewaffnung aufkam. Dazu kam, dass die Demontagen teils strikt, teils zögernd und zufällig vor allem in der stark industrialisierten Bi-Zone vorgenommen wurden. Insgesamt wurde deutlich, dass es für die bundesdeutsche Rüstungsindustrie keine „Stunde Null“ gab. Früh versuchten die Unternehmen, an Waffenaufträgen im In- und Ausland beteiligt zu werden und ihre traditionellen Produktionslinien in leichter und schwerer Waffenfertigung wieder aufzunehmen – und zwar noch bevor Marketing als Krisenstrategie. Die deutsche Automobilindustrie und die Herausforderungen der 1970er Jahre, in: Berghoff, Hartmut (Hg.): Marketinggeschichte. Die Genese einer modernen Sozialtechnik, Frankfurt (Main)/New York 2007, S. 259–295; van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit; Dies.: „It’s good to have…“; Dies.: Auf dem Weg vom Konzern. 64 van de Kerkhof: Waffen und Sicherheit.
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise
203
eine gesetzliche Freigabe erfolgt war. Zu den Möglichkeiten, den Absatz auf halb-legalem oder illegalem Weg auszuweiten, gehörten auch Waffenexporte, Waffenschmuggel und Lizenzen für Waffenfertigung oder Bau ganzer Fabriken im Ausland, v. a. in Konfliktregionen und Spannungsgebieten. Sie können hier aus Beschränkungsgründen nicht näher betrachtet werden, doch die illegalen Exporte sind durch die öffentliche Skandalisierung aber teils gut erforscht.65 Die Ausfuhr von Waffen galt v. a. als wichtiges Mittel zur Überwindung der Krisen nach dem Ende der Bundeswehr-Erstausrüstung. Die 1970er Jahre läuteten dann eine generelle Wende ein, denn mit den bis in die frühen 1980er Jahre wirksamen Konjunktur- und Vertrauenskrisen stand auch die Diversifikation der 1950er und 1960er Jahre bei Rheinmetall auf dem Prüfstand. In der anhaltenden Krisensituation wurden wie in anderen Branchen insbesondere neue Kontroll- und Planungsinstrumente eingeführt, aber auch betriebliches Marketing ausgeweitet,66 was wegweisend für die kommenden Jahrzehnte wurde. Tab. 1: Langfristige Entwicklung des Einzelplans 14, 1955 bis 1987 in Mio. DM Materialerhaltung 1955
F & E, Erprobung
militärische Beschaffungen
Personalausgaben
1
13
25
1956
10
9
2.067
407
1957
113
32
2.869
891
1958
267
111
3.519
1.253
1959
617
156
3.803
1.544
1960
861
244
4.356
1.953
1961
820
381
4.478
2.571
1962
1.246
409
6.411
3.151
1963
1.616
546
7.562
3.739
1964
2.020
646
6.539
4.244
65 Neben van de Kerkhof, Stefanie: Rüstungsexporte in Spannungsgebiete – Die Außenwirtschaftsbeziehungen westdeutscher Waffenhersteller zum Nahen Osten, in: Kleinschmidt, Christian/Ziegler, Dieter (Hg.): Dekolonisierungsgewinner. Deutsche Außenpolitik und Außenwirtschaftsbeziehungen im Zeitalter des Kalten Krieges, Berlin 2018, S. 103–126 auch Wulf: Waffenexport; Hummel: Rüstungsexportbeschränkungen auch in: Stiftung Haus der Geschichte der BRD (Hg.): Skandale in Deutschland nach 1945, Bonn u. a. 2007, S. 76–85, S. 115–119; Szandar, Alexander: Die Rüstungslobby. Korruption und Skandale im militärisch-industriellen Komplex, in: Pötzl, Norbert F./Traub, Rainer (Hg.): Der Kalte Krieg. Wie die Welt den Wahnsinn des Wettrüstens überlebte, München 2009, S. 283–291. 66 Vgl. Rennert, Kornelia: Wettbewerber in einer reifen Branche. Die Unternehmensstrategien von Thyssen, Hoesch und Mannesmann 1955 bis 1975 (Klartext Wissenschaft), Essen 2015.
204 Stefanie van de Kerkhof
Fortsetzung Tabelle 1 Materialerhaltung
F & E, Erprobung
militärische Beschaffungen
Personalausgaben
1965
1.974
699
5.367
4.857
1966
1.877
755
4.654
5.680
1967
1.930
963
5.446
6.021
1968
1.771
979
4.046
6.175
1969
1.752
1.054
5.029
6.979
1970
1.898
1.144
3.910
7.966
1971
2.272
1.230
3.544
9.299
1972
2.739
1.302
4.173
10.540
1973
2.953
1.371
4.833
11.805
1974
2.977
1.405
5.370
13.500
1975
3.068
1.449
5.711
14.049
1976
3.134
1.606
6.373
14.426
1977
3.267
1.595
6.641
15.090
1978
3.407
1.712
7.216
15.799
1979
3.477
1.819
7.963
16.528
1980
3.536
1.666
8.839
17.596
1981
3.790
1.525
10.646
18.710
1982
4.179
1.664
11.089
18.821
1983
4.338
1.826
11.940
19.418
1984
4.272
1.948
12.128
19.835
1985
4.296
2.461
11.605
20.616
1986
4.338
2.580
11.946
20.901
1987
4.582
2.802
11.987
21.604
Einzelplan 14 enthält keine Pensionen, keine auswärtige Militärhilfe (Einzelplan 05 des AA), keine Berlin-Ausgaben, keine Stationierungs- und Besatzungskosten. 1960 Haushaltsjahr von 9 Monaten auf 12 Monate hochgerechnet. 1986 +1987 = Sollzahlen. 1977 D = inkl. 330 Mio. DM aus früheren Transferzahlungen nach den USA. Quelle: Bontrup/Zdrowomyslaw: Rüstungsindustrie, S. 37 f.
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise
205
Quellenverzeichnis „Denkschrift des militärischen Expertenausschusses über die Aufstellung eines Deutschen Kontingents…“ vom 9.10.1950, abgedruckt in: Rautenberg, H.-J./Wiggershaus, N.: Die „Himmeroder Denkschrift“ vom Oktober 1950. Politische und militärische Überlegungen für einen Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zur westeuropäischen Verteidigung, Karlsruhe 1985, S. 13 f. (S. 145 f.). Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode (Hg.): Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahr 2009 (Rüstungsexportbericht 2009), Drucksache 17/4200, 16.12.2010 (http://dip21. bundestag.de/dip21/btd/17/042/1704200.pdf, letzter Abruf am 15.10.2018). Ehrhardt, Heinrich: Hammerschläge, Leipzig 1922. Flume, Wolfgang/Witzke, Heinz-Jürgen: WT Industrieporträt: Rheinmetall. Waffe und Munition aus einem Guß, in: Wehrtechnik 6 (1977), S. 72–78. Flume, Wolfgang/Witzke, Heinz-Jürgen/Pieper, Hans-Ulrich: WT Firmenporträt: Rheinmetall GmbH. Das breite Spektrum bleibt erhalten, in: Wehrtechnik 8 (1980), S. 74–79. Frankfurter Rundschau vom 18. Februar 1985. O. A.: Bericht über die ersten Flugzeuglizenzen an Dornier und Willy H. Schlieker in: Der SPIEGEL 39/1956. O. A.: Heer erhielt Feldhaubitze 155–1, in: Wehrtechnik 12 (1978), S. 40. O. A.: Waffenproduktion. Die neuen Hoflieferanten, in: Der SPIEGEL 45/1956 (7.11.56), S. 19– 23. O. A.: Jubilatio Schneider, in: Wehrtechnik 8 (1969), S. 284. O. A.: Thyssen. Moderne Technik für sicheren Einsatz, in: Wehrtechnik 8/1984, großformatige Werbeanzeige, Umschlagseite innen. O. A.: Wirtschaft – Rheinmetall. Vom MG bis zur Haubitze, in: Wehrtechnik 12 (1975), S. 692– 694. O. A.: Rüstung. „Da tummelt sich die Elite“, Der SPIEGEL Nr. 28 (1972), S. 30–49. Rheinmetall GmbH (Hg.): 100 Jahre Rheinmetall 1889–1989, Düsseldorf 1989 (unveröffentlicht, Rheinmetall-Archiv). Schneider, Erich: Nachruf auf Präsident Ernst Blume, in: Wehrtechnik 12 (1974), S. 465. Statistische Übersicht Kriegsschiffexporte deutscher Werften seit 1954 [de facto 1952], in: Wehrtechnik 2 (1978), S. 18. Stieler von Heydekampf, Gerd, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik: Jubilatio Generalleutnant a. D. Dipl.-Ing. Erich Schneider 80 Jahre, in: Wehrtechnik 8 (1974), S. 280. Tetzlaff, Walter: Zum militärisch-industriellen Komplex, in: Wehrtechnik 8 (1974), S. 281–283.
206 Stefanie van de Kerkhof
Literaturverzeichnis Abelshauser, Werner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945 (beck’sche Reihe 1587), München 2004. Ders.: Wirtschaft und Rüstung in den Fünfziger Jahren, in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.): Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik Bd. 4/1, München 1997, S. 1–185. Ders.: Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. 1945–1980 (Neue Historische Bibliothek), Frankfurt (Main) 71993. Andres, Christopher Magnus: Die bundesdeutsche Luft- und Raumfahrtindustrie 1945–1970. Ein Industriebereich im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft und Militär (Münchener Studien zur neueren und neuesten Geschichte 15), Frankfurt (Main) u. a. 1996. Banken, Ralf: Der Nationalsozialismus in der Unternehmensgeschichte. Hinterlässt die Sonderkonjunktur Spuren?, in: Akkumulation 20 (2004), S. 1–18. Bald, Detlef: Die Bundeswehr. Eine kritische Geschichte 1955–2005 (Beck’sche Reihe), München 2005. Ders./Wette, Wolfram (Hg.): Alternativen zur Wiederbewaffnung. Friedenskonzeptionen in Westdeutschland 1945–1955 (Frieden und Krieg – Beiträge zur Historischen Friedensforschung 11), Essen 2008. Becker-Schaum, Christoph u. a. (Hg.): „Entrüstet Euch!“ Nuklearkrise, NATO-Doppelbeschluss und Friedensbewegung, Paderborn 2012. Benz, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik. Stationen einer Staatsgründung 1946–1949 (Fischer Bücherei 4311), Frankfurt (Main) 1989. Ders. (Hg.): Deutschland unter alliierter Besatzung. Ein Handbuch, Berlin 1999. Berghahn, Volker: Unternehmer und Politik in der Bundesrepublik (Neue Historische Bibliothek), Frankfurt (Main) 1985. Berghoff, Hartmut/Sydow, Jörg (Hg.): Unternehmerische Netzwerke. Eine historische Organisationsform mit Zukunft?, Stuttgart 2007. Diedrich, Torsten: Art. Entmilitarisierung, in: Benz, Wolfgang (Hg.): Deutschland unter alliierter Besatzung. Ein Handbuch, Berlin 1999, S. 342–346. Doering-Manteuffel, Anselm: Nach dem Boom. Brüche und Kontinuitäten der Industriemoderne seit 1970, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 55 (2007), S. 559–581. Ders./Raphael, Lutz: Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen 32012 Eichengreen, Barry: The European Economy since 1945. Coordinated Capitalism and Beyond (The Princeton Economic History of the Western World), Princeton/Oxford 2007. Erker, Paul/Pierenkemper, Toni (Hg.): Deutsche Unternehmer zwischen Kriegswirtschaft und Wiederaufbau. Studien zur Erfahrungsbildung von Industrie-Eliten (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 39), München 1999. Erker, Paul: Ernst Heinkel. Die Luftfahrtindustrie im Spannungsfeld von technologischem Wandel und politischem Umbruch, in: Ders./Pierenkemper, Toni (Hg.): Deutsche Unternehmer, S. 217–290. Faust, Ingo: Rheinmetall setzt in der Krise auf Rüstung, in: Westdeutsche Zeitung vom 26.3.2009, S. 16. Ferencz, Benjamin B.: Lohn des Grauens. Die verweigerte Entschädigung für jüdische Zwangsarbeiter. Ein Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte, Frankfurt (Main)/ New York 1979.
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise
207
Foerster, Roland G.: Innenpolitische Aspekte der Sicherheit Westdeutschlands 1947–1950, in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.): Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik Bd. 1, München 1982, S. 405–575. Frei, Norbert u. a.: Flick. Der Konzern, die Familie, die Macht, München 2009. Gall, Lothar (Hg.): Krupp im 20. Jahrhundert. Die Geschichte des Unternehmens vom Ersten Weltkrieg bis zur Gründung der Stiftung, Berlin 2002. Gassert, Philipp u. a. (Hg.): Zweiter Kalter Krieg und Friedensbewegung. Der NATO-Doppelbeschluss in deutsch-deutscher und internationaler Perspektive (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte), München 2011. Geyer, Michael: Deutsche Rüstungspolitik 1860–1980 (edition suhrkamp 1246), Frankfurt (Main) 1981. Greiner, Christian: Die militärische Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die WEU und die NATO 1954 bis 1957, in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.): Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik Bd. 3, München 1993, S. 561–850. Hummel, Hartwig: Rüstungsexportbeschränkungen in Japan und der Bundesrepublik Deutschland, Hamburg/Münster 1991. van de Kerkhof, Stefanie: Waffen und Sicherheit im Kalten Krieg. Das Marketing der westdeutschen Rüstungsindustrie 1949–1990 (Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 24), Berlin/ Boston 2019. Dies.: Rüstungsexporte in Spannungsgebiete – Die Außenwirtschaftsbeziehungen westdeutscher Waffenhersteller zum Nahen Osten, in: Kleinschmidt, Christian/Ziegler, Dieter (Hg.): Dekolonisierungsgewinner. Deutsche Außenpolitik und Außenwirtschaftsbeziehungen im Zeitalter des Kalten Krieges, Berlin 2018, S. 103–126 Dies.: Militärfachzeitschriften als Quellen einer Marketinggeschichte der europäischen Rüstungsindustrie im Kalten Krieg, in: Pöhlmann, Markus (Hg.): Deutsche Militärfachzeitschriften im 20. Jahrhundert (Potsdamer Schriften zur Militärgeschichte 17), Paderborn 2012, S. 71–91. Dies.: Auf dem Weg vom Konzern zum Netzwerk? Organisationsstruktur der Rheinmetall Berlin AG im Kalten Krieg. 1956–1989, in: Reitmayer, Morten/Rosenberger, Ruth (Hg.): Unternehmen am Ende des „goldenen Zeitalters“. Die 1970er Jahre in unternehmens- und wirtschaftshistorischer Perspektive (Bochumer Schriften zur Unternehmens- und Industriegeschichte 16), Essen 2008, S. 67–89. Dies.: „It’s good to have a reliable navy!“ Zur Rolle von Vertrauen und Sicherheit im Marketing deutscher Rüstungsunternehmen, in: Hillen, Christian (Hg.): „Mit Gott!“ Zum Verhältnis von Vertrauen und Wirtschaftsgeschichte (Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte 46), Köln 2007, S. 107–124. Dies.: Rüstungsindustrie und Kriegswirtschaft, in: Kühne, Thomas/Ziemann, Benjamin (Hg.): Was ist Militärgeschichte? (Krieg in der Geschichte 6), Paderborn 2000, S. 175–194. Kersten, Manfred/Schmid, Walter: HK Heckler & Koch. Die offizielle Geschichte der Oberndorfer Firma Heckler & Koch. Einblicke in die Historie – Beschreibung der Waffenmodelle – Darstellung der Technik, Wuppertal 1999. Kilz, Hans Werner/Preuss, Joachim: Flick. Die gekaufte Republik, Reinbek 1983. Köhler, Ingo: Overcoming Stagflation. Innovative Product Policy and Marketing in the German Automobile Industry of the 1970s, in: Business History Review 84 (2010), S. 53–78. Ders.: Marketing als Krisenstrategie. Die deutsche Automobilindustrie und die Herausforderungen der 1970er Jahre, in: Berghoff, Hartmut (Hg.): Marketinggeschichte. Die Genese einer modernen Sozialtechnik, Frankfurt (Main)/ New York 2007, S. 259–295.
208 Stefanie van de Kerkhof
Köllner, Lutz: Militär und Finanzen. Zur Finanzgeschichte und Finanzsoziologie von Militärausgaben in Deutschland, München 1982. Kollmer, Dieter H. (Hg.): Militärisch-Industrieller Komplex? Rüstung in Europa und Nordamerika nach dem Zweiten Weltkrieg, Freiburg 2015. Kollmer, Dieter H.: Rüstungsgüterbeschaffung in der Aufbauphase der Bundeswehr. Der Schützenpanzer HS 30 als Fallbeispiel (1953–1961) (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 93), Stuttgart 2002. Krüger, Dieter: Das Amt Blank. Die schwierige Gründung des Bundesministeriums für Verteidigung (Einzelschriften zur Militärgeschichte 38), Freiburg 1993. Leitzbach, Christian: Rheinmetall. Vom Reiz, im Rheinland ein großes Werk zu errichten, 2 Bde, Köln 2014. Ders.: Das Archiv der Rheinmetall AG und seine Bestände, in: Archiv und Wirtschaft 32 (1999:2), S. 57–69. Lipp, Karlheinz u. a.: Frieden und Friedensbewegungen in Deutschland 1892–1992. Ein Lesebuch (Frieden und Krieg – Beiträge zur historischen Friedensforschung 16), Essen 2010. Mai, Gunther: Westliche Sicherheitspolitik im Kalten Krieg. Der Korea-Krieg und die deutsche Wiederbewaffnung 1950, Boppard 1977. Maier, Klaus A.: Die internationalen Auseinandersetzungen um die Westintegration der Bundesrepublik Deutschland und um ihre Bewaffnung im Rahmen der europäischen Verteidigungsgemeinschaft, in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.): Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik Bd. 2, München 1990, S. 1–234. Meier-Dörnberg, Wilhelm: Die Planung des Verteidigungsbeitrages der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der EVG, in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.): Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik Bd. 2, München 1990, S. 605–756. Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.): Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik, 4 Bde., München 1982–1997 (Bd. 1: Von der Kapitulation bis zum Pleven-Plan, München/Wien 1982; Bd. 2: Die EVG-Phase, München 1990; Bd. 3: Die NATO-Option, München 1993; Bd. 4: Wirtschaft und Rüstung – Souveränität und Sicherheit, München 1997). O. A.: „Deutschland exportiert deutlich mehr Waffen“, in: Rheinische Post, 7.12.2011. Plumpe, Werner: 1968 und die deutschen Unternehmen. Zur Markierung eines Forschungsfeldes, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 49 (2004), S. 44–65. Priemel, Kim C.: Industrieunternehmen, Strukturwandel und Rezession. Die Krise des FlickKonzerns in den siebziger Jahren, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 57 (2009), S. 1– 34. Ders./Stiller, Alexa (Hg.): Reassessing the Nuremberg Military Tribunals. Transitional Justice, Trial Narratives, and Historiography (Studies on War and Genocide), Oxford/New York 2012. Reitmayer, Morten/Rosenberger, Ruth (Hg.): Unternehmen am Ende des „goldenen Zeitalters“. Die 1970er Jahre in unternehmens- und wirtschaftshistorischer Perspektive (Bochumer Schriften zur Unternehmens- und Industriegeschichte 16), Essen 2008. Rennert, Kornelia: Wettbewerber in einer reifen Branche. Die Unternehmensstrategien von Thyssen, Hoesch und Mannesmann 1955 bis 1975 (Klartext Wissenschaft), Essen 2015. Schily, Otto: Politik in bar. Flick und die Verfassung unserer Republik, München 1986. Schmidt, Dorothea: Denn sie wissen, was sie tun. Das Geschäft mit Kleinwaffen, in: Prokla 36/ 143 (2006), S. 185–202. Dies.: Kleinwaffen in „alten“ und „neuen“ Kriegen, in: Prokla 31/127 (2002), S. 271–295.
Die westdeutsche Rüstungsindustrie zwischen Wiederaufbau, Boom und Krise
209
Schöllgen, Gregor: Diehl. Ein Familienunternehmen in Deutschland. 1902–2002, Berlin/ München 2002. Scholtyseck, Joachim: Der Aufstieg der Quandts. Eine deutsche Unternehmerdynastie, München 2011. Seel, Wolfgang: Mauser. Von der Waffenschmiede zum Weltunternehmen, Dietikon-Zürich 1986. Seibold, Gerhard: Röchling. Kontinuität im Wandel, Stuttgart 2001. Steininger, Rolf: Die Entscheidung für einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag: Adenauer und die Westmächte 1950. Eine Darstellung auf der Grundlage unveröffentlichter britischer und amerikanischer Akten, Erlangen 1989. Stiftung Haus der Geschichte der BRD (Hg.): Skandale in Deutschland nach 1945, Bonn u. a. 2007. Szandar, Alexander: Die Rüstungslobby. Korruption und Skandale im militärisch-industriellen Komplex, in: Pötzl, Norbert F./Traub, Rainer (Hg.): Der Kalte Krieg. Wie die Welt den Wahnsinn des Wettrüstens überlebte, München 2009, S. 283–291. Thoß, Bruno: Der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur WEU und NATO im Spannungsfeld von Blockbildung und Entspannung (1954–1956), in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.): Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik Bd. 3, S. 1–234. Volkmann, Hans-Erich: Die innenpolitische Dimension Adenauerscher Sicherheitspolitik in der EVG-Phase, in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.): Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik Bd. 2, S. 235–604. Wulf, Herbert: Waffenexport aus Deutschland. Geschäfte mit dem fernen Tod, Reinbek 1989. Zdrowomyslaw, Norbert: Wirtschaft, Krise und Rüstung. Die Militärausgaben in ihrer wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Bedeutung in Deutschland von der Reichsgründung bis zur Gegenwart, Bremen 1985. Ders./Bontrup, Heinz-J.: Die deutsche Rüstungsindustrie. Vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik, Heilbronn 1988.
Anhang
Abbildungsnachweis Nikolai Ingenerf Abb. 1: Grafik aus: Kundel, Heinz: Gewinnungs- und Ausbautechnik im deutschen Steinkohlenbergbau im Jahre 1972, in: Glückauf 109 (1973:15), S. 757–768, hier: S. 758 Abb. 2: Grafik aus: Jackson, H.: Installation of Rolf II At Ormonde Colliery: Operation Problems, in: Colliery Guardian 212 (1966:13), S. 605–609, hier: S. 605 Abb. 3: montan.dok BBA 16/1387
Karsten Uhl Abb. 1: Dokumentationszentrum und Museum für die Migration in Deutschland (Domid), Köln, Sign. A000058
Daniel Dören Abb. 1: montan.dok/BBA 32/517 Abb. 2: montan.dok/BBA 32/473, montan.dok/BBA 32/475 und montan.dok/BBA 32/517–539
Stefanie van de Kerkhof Abb. 1: Zdrowomyslaw, Norbert/Bontrup, Heinz-J.: Die deutsche Rüstungsindustrie. Vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik, Heilbronn 1988, S. 37 f. Abb. 2: Rheinmetall-Archiv A 21, Wirtschaftsprüfungsberichte 1967–1989
https://doi.org/10.1515/9783110729979-010
Die Autorinnen und Autoren Dr. Lars Bluma studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum. Dort war er mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Technikgeschichte und am Medizinhistorischen Institut beschäftigt. 2004 wurde er mit einer Arbeit zur Geschichte der Kybernetik promoviert. Von 2012 bis 2018 leitete er den Forschungsbereich Bergbaugeschichte am Deutschen Bergbau-Museum Bochum. Seit Mai 2018 ist er Leiter des Zentrums für Stadtgeschichte und Industriekultur Wuppertal. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Industrialisierungs- und Bergbaugeschichte sowie in der Medizin- und Körpergeschichte. Zu seinen letzten Veröffentlichungen zählen: – Friedrich Engels. Ein Gespenst geht um in Europa, Remscheid 2020. – The History of Medicine Meets Labour History. Miners’ Bodies in the Age of Industrialization, in: German History 37 (2019:3), S. 345–358. – Moderne Bergbaugeschichte, in: Der Anschnitt. Zeitschrift für Montangeschichte 69 (2017:3), S. 138–151. Jun.-Prof. Dr. Juliane Czierpka studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Modern History an der Ruhr-Universität Bochum und der University of Birmingham. 2013 wurde sie an der Bochumer Fakultät für Geschichtswissenschaften mit einer vergleichenden Arbeit über die Regionale Industrialisierung in Europa promoviert. Nach Einreichung der Dissertation trat sie eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Georg-August-Universität Göttingen an. Nach einem sechsmonatigen Aufenthalt am German Historical Institute in Washington, DC im Winter 2014/2015, kehrte sie im November 2015 aus Göttingen in das Ruhrgebiet zurück, um am Deutschen Bergbau-Museum Bochum im Forschungsbereich Bergbaugeschichte zum deutschen Steinkohlenbergbau nach 1945 zu forschen. Im Februar 2018 wurde sie zur Juniorprofessorin für Montangeschichte am Historischen Institut der Ruhr-Universität Bochum ernannt. Zu ihren wichtigsten Publikationen zählen: – Montanindustrielle Führungsregionen der frühen europäischen Industrialisierung im Vergleich. Das Black Country und das Borinage, Stuttgart 2017.
https://doi.org/10.1515/9783110729979-011
216 Die Autorinnen und Autoren
–
mit Oerters, Kathrin und Thorade, Nora (Hg.): Regions, Industries and Heritage. Perspectives on Economy, Society and Culture in Modern Western Europe, Basingstoke 2015.
Daniel Dören, M. A. studierte von 2008–2011 nach einer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann (2001–2004) und dem Abitur auf dem zweiten Bildungsweg (2005– 2007) Geschichte und Archäologische Wissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts an der Ruhr-Universität Bochum. Von 2011 bis 2015 absolvierte er ein Masterstudium mit den Schwerpunkten Wirtschafts-, Unternehmens- und Technikgeschichte und schloss es mit einer Arbeit über Krupp und den USamerikanischen Markt 1851–1914 ab. Von 2015 bis 2019 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem Forschungsprojekt „Vom Boom zur Krise. Der deutsche Steinkohlenbergbau nach 1945“ und begann dort ein Dissertationsvorhaben mit dem Arbeitstitel „Die Unternehmensstrategien der staatlichen Bergwerksgesellschaft Hibernia AG 1951–1968“. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte, Energiegeschichte, Globalisierungsgeschichte und Bergbaugeschichte. Bisherige Publikation: – „Also nur die technische Sicherheit und das baare Geld“. Die Absatzorganisation der Firma Krupp in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau 68 (2016), Heft 1–2, S. 35–44. Nikolai Ingenerf, M. A. studierte von 2008 bis 2015 Geschichte und Sozialwissenschaften an der RuhrUniversität Bochum. Seit 2015 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt „Vom Boom zur Krise. Der deutsche Steinkohlenbergbau nach 1945“ im Forschungsbereich Bergbaugeschichte am Deutschen Bergbau-Museum Bochum. Seit 2020 ist er wissenschaftlicher Volontär am LWL-Industriemuseum Zeche Zollern. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der Technik-, Wissenschafts-, Umwelt- und Wirtschaftsgeschichte. Bisherige Publikationen: – mit Meyer, Torsten und Asrih, Lena: Bergbau als techno-naturales System. Ein Beitrag zur modernen Bergbaugeschichte, in: Der Anschnitt 71 (2019:1), S. 2–18. – mit Müller, Moritz und Thorade, Nora: Wo ist der Mensch in der automatisierten Produktion? Eine aktuelle Frage aus historischer Perspektive, in: Ahner, Helen u. a. (Hg.): Von Menschen und Maschinen. Interdisziplinäre
Die Autorinnen und Autoren
–
217
Perspektiven auf das Verhältnis von Gesellschaft und Technik in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (INSIST-Proceedings 3), Karlsruhe 2020, S. 35–54. Abwärts aus der Krise? Die Modernisierung des westdeutschen Steinkohlenbergbaus in den 1970er Jahren, in: Bauer, Reinhold/Burr, Wolfgang (Hg.): Das Ende des Goldenen Zeitalters? Der Strukturwandel der 1970er Jahre, seine Rezeption und Folgen aus interdisziplinärer Perspektive (Kultur und Technik 37), Stuttgart 2021, S. 109–126.
Prof. Dr. Stefanie van de Kerkhof studierte von 1990 bis 1996 an den Universitäten Düsseldorf und Bochum u. a. Neuere Geschichte, Wirtschaftsgeschichte und Kunstgeschichte. Danach wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Geschäftsführerin u. a. an den Universitäten Köln, Bonn, Bochum und Hagen (1997–2011). In Köln wurde sie 2004 in Wirtschaftswissenschaften bei Toni Pierenkemper promoviert. Seit 2011 war sie Professurvertreterin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an den Universitäten Heidelberg, Mannheim und Siegen sowie Gastprofessorin für VWL und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Mannheim. Ihre Habilitation erfolgte im November 2016, seit 2021 ist sie Professorin am Historischen Institut der Universität Mannheim und seit 2018 Leiterin eines Forschungsprojektes zur Industriegeschichte Krefelds in der Weimarer Zeit (finanziert vom LVR und der Stadt Krefeld). Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich der Unternehmens- und Industriegeschichte im 19./20. Jh., in der rheinischen Regionalökonomie und Konsumkultur, Kriegs- und Rüstungswirtschaft, regionalen Industrialisierung, Female Entrepreneurship, Innovationen und Ersatzstoffwirtschaft. Sie war Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Landschaftsverbands Rheinland (Projekt „1914 – Mitten in Europa. Aggression und Avantgarde“), Vorstand (2005–2017) und Vorsitzende (2013–2017) des Arbeitskreises Kritische Unternehmens- und Industriegeschichte e. V. (AKKU), Mitherausgeberin der „Bochumer Schriften zur Industrie- und Unternehmensgeschichte“, Jury des AKKU-Nachwuchspreises. Zu ihren wichtigsten Publikationen zählen: – Waffen und Sicherheit im Kalten Krieg. Das Marketing der westdeutschen Rüstungsindustrie, 1949–1990 (Beihefte des Jahrbuchs für Wirtschaftsgeschichte 24), Berlin 2019. – Aufbruch zu neuen Märkten oder Dauerkrise? Die Krefelder Seiden- und Samtindustrie in der Weimarer Republik, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 222 (2019), S. 351–391.
218 Die Autorinnen und Autoren
–
–
–
Rüstungsexporte in Spannungsgebiete. Die Außenwirtschaftsbeziehungen westdeutscher Waffenhersteller zum Nahen Osten, in: Kleinschmidt, Christian/Ziegler, Dieter (Hg.): Dekolonisierungsgewinner. Deutsche Außenpolitik und Außenwirtschaftsbeziehungen im Zeitalter des Kalten Krieges, Berlin 2018, S. 103–126. Ökonomie und Ethik. Beiträge aus Wirtschaft und Geschichte (Hg. mit Gerd Kollmer-von Oheimb-Loup und Sibylle Lehmann und zwei Beiträge) (Stuttgarter Historische Studien zur Landes- und Wirtschaftsgeschichte 28), Stuttgart 2017. Von der Friedens- zur Kriegswirtschaft. Unternehmensstrategien der deutschen Eisen- und Stahlindustrie vom Kaiserreich bis zum Ende des Ersten Weltkrieges (Bochumer Schriften zur Unternehmens- und Industriegeschichte 15), Essen 2006.
Dr. des. Moritz Müller ist Bildungsreferent im IG Metall Bildungszentrum Sprockhövel. Von 2017 bis 2020 war er Promotionsstipendiat der Hans-Böckler-Stiftung und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Soziologie der digitalen Transformation der RUB. Sein Promotionsprojekt trägt den Titel: „‚Die Robbys kommen.‘ Die IG Metall und die Durchsetzung der Mikroelektronik in den 1970er und 1980er Jahren“. Zu seinen wichtigsten Publikationen zählen: – mit Ole Merkel: Proletarier mancher Länder, vereinigt euch? Der schleichende Niedergang des Internationalismus in der „Kulidebatte“ der II. Sozialistischen Internationale (1883–1910), in: Arbeit – Bewegung – Geschichte 20 (2021:1), S. 12–28. – „Job Killer“ oder „Kollege Roboter“? Soziotechnische Risiko- und Gestaltungszukünfte des Mensch-Maschinen-Verhältnisses im IndustrieroboterDiskurs der IG Metall, in: Technikgeschichte 88 (2021:1), S. 11–42. – Die IG Metall im Diskurs um die Humanisierung des Arbeitslebens, in: Kleinöder, Nina u. a. (Hg.): „Humanisierung der Arbeit“. Aufbrüche und Konflikte in der rationalisierten Arbeitswelt des 20. Jahrhundert, Bielefeld 2019, S. 255–276. – „Die Gewerkschaften machen ihre Zukunft selbst, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken.“ Der DGB und die Flexibilisierung der Arbeit in den 1980er Jahren, in: Henkes, Janina u. a. (Hg.): Ordnung(en) der Arbeit, Münster 2019, S. 248–264.
Die Autorinnen und Autoren
–
219
Von Job-Killern, Roboterkollegen und feuchten Augen. Die Mikroelektronik und die IG Metall als Emotional Community, in: Heßler, Martina (Hg.): Technikemotionen, Paderborn 2020, S. 108–127.
Martha Poplawski, M. A. studierte Geschichtswissenschaft und Komparatistik an der Ruhr-Universität Bochum. Von 2015 bis 2020 war sie im Projekt „Vom Boom zur Krise. Der deutsche Steinkohlenbergbau nach 1945“ als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Im Rahmen ihres Dissertationsprojektes „Arbeitswissenschaftliche Studien und der Betriebsführungsdiskurs im westdeutschen Steinkohlenbergbau von 1945 bis 1989“ erforscht sie die Verwissenschaftlichung der betrieblichen Führungspraxis im westdeutschen Steinkohlenbergbau seit 1945. Seit 2020 ist sie im Bereich Wissenschaftsmanagement und Kommunikation im Forschungszentrum Nachbergbau der Technischen Hochschule Georg Agricola tätig. Bisherige Publikation: – Humanisierung unter Tage? Das HdA-Programm und seine Umsetzung im westdeutschen Steinkohlenbergbau, in: Kleinöder, Nina/Müller, Stefan/ Uhl, Karsten (Hg.): „Humanisierung der Arbeit“. Aufbrüche und Konflikte in der rationalisierten Arbeitswelt, Bielefeld 2019, S. 215–231. Dr. des. Daniel Trabalski studierte von 2007 bis 2015 an den Universitäten Göttingen und Bochum Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Volkswirtschaftslehre. Von 2015 bis 2016 war er Projektmitarbeiter bei der Dokumentations- und Forschungsstelle der Sozialversicherungsträger (sv:dok) und von 2016 bis 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Bergbau-Museum Bochum. 2019 war er Stipendiat des Deutschen Historischen Instituts London. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, insbesondere der Geschichte der Sozialversicherung, und der Kulturgeschichte des Ökonomischen. Bisherige Publikation: – Risikoregulierung als soziale Praxis. Organisationsgeschichtliche Zugänge zur Unfallversicherung, in: Böick, Marcus/Schmeer, Marcel (Hg.): Im Kreuzfeuer der Kritik. Umstrittene Organisationen im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main/New York 2020, S. 351–378.
220 Die Autorinnen und Autoren
PD Dr. Karsten Uhl studierte von 1993 bis 1998 an der Universität Hamburg Geschichte, Psychologie und Politische Wissenschaften. Von 1998 bis 2000 war er Stipendiat im DFGGraduiertenkolleg „Geschlechterdifferenz & Literatur“. 2000 wurde er an der LMU München im Fach Neuere und Neueste Geschichte promoviert. Von 2001 bis 2003 belegte er an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg den Aufbaustudiengang „Museum & Ausstellung“. Von 2003 bis 2006 war er an der KZGedenkstätte Mittelbau-Dora tätig. Von 2007 bis 2020 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt und der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Er habilitierte sich 2012 an der TU Darmstadt, wo er von 2018 bis 2019 die Professur für Technikgeschichte vertrat. Seit 2020 leitet er die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Geschlechter- und Körpergeschichte, der Technikgeschichte sowie der Geschichte der Arbeit und des Nationalsozialismus. Zu seinen wichtigsten Publikationen zählen: – mit Kleinöder, Nina und Müller, Stefan (Hg.): „Humanisierung der Arbeit“. Aufbrüche und Konflikte in der rationalisierten Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts, Bielefeld 2019. – mit Zumbrägel, Christian (Hg.): Themenheft „Technik“ (Body Politics. Zeitschrift für Körpergeschichte 6 (2018:9). – Humane Rationalisierung? Die Raumordnung der Fabrik im fordistischen Jahrhundert, Bielefeld 2014. – Technology in Modern German History: 1800 to the Present (The Bloomsbury History of Modern Germany Series), New York 2021 (i. Dr.).

![Psychotherapie in Zeiten kollektiver Verunsicherung: Therapieschulübergreifende Gedanken am Beispiel der Corona-Krise [1. Aufl.]
9783658309459, 9783658309466](https://ebin.pub/img/200x200/psychotherapie-in-zeiten-kollektiver-verunsicherung-therapieschulbergreifende-gedanken-am-beispiel-der-corona-krise-1-aufl-9783658309459-9783658309466.jpg)

![Großprojekte der Stadtentwicklung in der Krise: Der Abschluss städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen am Beispiel Berlins [1 ed.]
9783428528486, 9783428128488](https://ebin.pub/img/200x200/groprojekte-der-stadtentwicklung-in-der-krise-der-abschluss-stdtebaulicher-entwicklungsmanahmen-am-beispiel-berlins-1nbsped-9783428528486-9783428128488.jpg)




![Der Schutz der Privatsphäre und des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung: am Beispiel des personenbezogenen Datenverkehrs im WWW nach deutschem öffentlichen Recht [1 ed.]
9783428538553, 9783428138555](https://ebin.pub/img/200x200/der-schutz-der-privatsphre-und-des-rechts-auf-informationelle-selbstbestimmung-am-beispiel-des-personenbezogenen-datenverkehrs-im-www-nach-deutschem-ffentlichen-recht-1nbsped-9783428538553-9783428138555.jpg)