Übergabegespräche: Interaktionen im Krankenhaus 9783828205932, 9783110508345
Diese Studie beschäftigt sich mit Übergabegesprächen im Krankenhaus und den Implikationen der Analyse für die Praxis. Üb
338 85 26MB
German Pages 265 [276] Year 2014
Inhalt
Danksagung
Einleitung
Einführung in das Untersuchungsfeld
Annäherungen an das Feld: Die Übergabe als praktisches Problem
Aus konversationsanalytischer Sicht: Die Übergabe als Interaktionsproblem
Konversationsanalytische Respezifikation der praktischen Probleme des Feldes
Kritischer Rückblick
Bibliographie
Verzeichnis der verwendeten Transkriptausschnitte
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Frank Oberzaucher
File loading please wait...
Citation preview
Frank Oberzaucher Ubergabegesprache
Qualitative Soziologie • Band 18 Herausgegeben von Jörg R. Bergmann Stefan Hirschauer Herbert Kalthoff
Die Reihe „Qualitative Soziologie" präsentiert ausgewählte Beiträge aus der qualitativen Sozialforschung, die methodisch anspruchsvolle Untersuchungen mit einem dezidierten Interesse an der Weiterentwicklung soziologischer Theorie verbinden. Ihr Spektrum umfasst ethnographische Feldstudien wie Analysen mündlicher und schriftlicher Kommunikation, Arbeiten zur historischen Sozialforschung wie zur Visuellen Soziologie. Die Reihe versammelt ohne Beschränkung auf bestimmte Gegenstände originelle Beiträge zur Wissenssoziologie, zur Interaktions- und Organisationsanalyse, zur Sprach- und Kultursoziologie wie zur Methodologie qualitativer Sozialforschung und sie ist offen für Arbeiten aus den angrenzenden Kulturwissenschaften. Sie bietet ein Forum für Publikationen, in denen sich weltoffenes Forschen, methodologisches Reflektieren und analytisches Arbeiten wechselseitig verschränken. Nicht zuletzt soll die Reihe „Qualitative Soziologie" den Sinn dafür schärfen, wie die Soziologie selbst an sozialer Praxis teilhat.
Übergabegespräche Interaktionen im Krankenhaus Eine Interaktionsanalyse und deren Implikationen für die Praxis von Frank Oberzaucher
®
Lucius & Lucius • Stuttgart
Anschrift des Autors: Dr. Frank Oberzaucher Universität Konstanz Fachbereich Geschichte und Soziologie Fach Soziologie/Qualitative Methoden D-78457 Konstanz [email protected]
Zgl. Dissertation Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld, 2011
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
ISBN 978-3-8282-0593-2 ISSN 1617-0164
© Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH • Stuttgart • 2014 Gerokstraße 51 • D-70184 Stuttgart • www.luciusverlag.com
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Umschlagentwurf: www.devauxgrafik.de Druck und Einband: Rosch-Buch, Scheßlitz Printed in Germany
Inhalt Einleitung
3
Einführung in das Untersuchungsfeld
6
Annäherungen an das Feld: Die Übergabe als praktisches Problem
19
1.
Die Untersuchung von Übergabegesprächen
25
1.1
Besprechungen im Arbeitskontext
25
1.2
Übergabegespräche als Gegenstand der Interaktionsforschung
28
1.3
Forschungs- und Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie
33
1.4
Der konversationsanalytische Forschungsansatz
36
1.4.1
Ethnomethodologischer Hintergrund
37
1.4.2
Grundannahmen der Konversationsanalyse
43
1.4.3
Relevanz ethnographischer Daten
47
1.4.4
Analytische Mentalität und Maximen
52
Kommunikation im institutionellen Kontext
58
1.5.1
Der Kontext im Gespräch
61
1.5.2
Kontext und lokale Identitäten
65
1.5
Aus konversationsanalytischer Sicht: Die Übergabe als Interaktionsproblem
69
2.
Zur Ökologie der Übergabesituation
69
2.1
Kommunikative Ökologie
69
2.2
Das körperliche Arrangement bei sozialen Ereignissen
74
2.3
Die interaktive Organisation der Aufgabenorientierung
76
2.4
Zusammenfassung
91
3.
Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
93
3.1
94
Die Ablaufstruktur von Übergabegesprächen
Inhalt
vi
3.2
Gesprächseröffnung
95
3.3
Das Vorgespräch und die Herstellung von Bereitschaft zum Einstieg in die Übergabe
97
3.4
Die Berichtphase
105
3.4.1 Der Mechanismus der Redezugabfolge bei Übergabegesprächen
114
3.4.2 Schweigeperioden - ein spezifisches Merkmal zur Identifizierung von vorregulierten Redezügen
119
3.5
Prozess der Gesprächsbeendigung
127
3.6
Zusammenfassung
137
4. Die soziale Organisation von Patientinnen auf der Basis von Mitgliedschafts-Kategorisierungen 4.1
139
Die Verortung des Patienten: „Achtzig im ersten"
146
4.1.1 Hintergründe der Verortung
149
4.1.2 Lokalisierung und Bereichspflege 4.1.3 Lokalisierung und Identifizierung
150 152
4.2
Patientenkarriere - Beschreibungen im Wandel
154
4.3
Zusammenfassung
169
5. Übergabe-Wissen
173
5.1
Das Übergabegespräch als Aushandlungsprozess von Wissen
173
5.2
Erzählen als Kunstfertigkeit des Pflegepersonals
179
5.2.1 Sprecherwechsel und Narration
180
5.2.2 Demonstrierte Wissensvermittlung 5.2.3 Konversationelles Erzählen 5.2.4 Geschichten als Träger von Patientinnenidentitäten
182 185 191
Instruieren als Fertigkeit und Aufgabe
192
5.3.1 Erfahrungsbasierte und explizite Instruktion 5.3.2 Offerierende Instruktion: „Muss man halt zwischendurch gucken"
194
Improvisieren als Kompetenz?
202
5.3
5.4
196
Inhalt
VII
5.5
Unklarheit als lösbares Interaktionsproblem
208
5.6
Zusammenfassung
212
Konversationsanalytische ReSpezifikation der praktischen Probleme des Feldes
215
6. Praktische Folgen der Analyse
215
6.1
Angewandte Gesprächsforschung oder doch lieber ethnomethodologische Indifferenz?
216
Die Konversationsanalyse als Methode der Gesprächssupervision
220
6.3
Anforderungen an eine Datensitzung mit Feldvertreterinnen
223
6.4
Die konkrete Arbeit mit Transkripten und audiovisuellen Mitschnitten
225
6.2
7. Das Konzept der gepflegten Differenz
231
8. Ausblick
237
Kritischer Rückblick
241
Bibliographie
243
Verzeichnis der verwendeten Transkriptausschnitte
264
Danksagung In den letzten Jahren tat ich das, was Sozialforscher so oft für gewöhnlich, selbverständlich und sinnvoll erachten. Sie überschreiten Grenzen, treten ein in fremde Räume, stecken überall ihre Nase hinein, weil sie der Meinung sind, das gehöre zum Wesen einer ordentlichen empirischen Sozialforschung. Für all die Menschen, denen wir im Forschungsfeld begegnen, sind wir, diese neugierigen Nimmersatte, im Grunde die allergrößte Zumutung. Daher weiß ich, wie viel ich all den Menschen, die mir während meiner Untersuchung ihr Vertrauen geschenkt haben, zu verdanken habe. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei all denen, die es mir ermöglicht haben, die Feldforschung durchzuführen, insbesondere die Pflegedienstleitung, die Stationsleitungen, die Mitarbeiterinnen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule sowie das Pflegepersonal auf den Stationen. Dass Soziologen sich für so selbstverständliche und mitunter banal erscheinende soziale Ereignisse wie Übergabegespräche interessieren, ist ihrem Respekt vor der kunstvollen Praxis der Akteurinnen geschuldet. Von ihnen durfte ich lernen, wurde eingeweiht in einen Ausschnitt der Welt des Pflegeberufs und darf um viele Erfahrungen reicher nach Hause gehen und davon berichten. An einigen Stellen wird sich das Praxisfeld wiederfinden, an anderen wiederum ist es aufgefordert, dem fremden Blick des Soziologen auf das Übergabegespräch zu folgen und sich überraschen zu lassen. Eine inspirierende und kreative Tätigkeit in einem empirischen Forschungsprozess ist die gemeinsame Analysepraxis in der Gruppe. Der EMKAArbeitskreis war ein Ort des Grübelns, Tüfteins und Korrigierens und ich bedanke mich bei allen liebgewonnenen Mitgliedern für ihre Unterstützung. Für das Rückenstärken in der Schlussphase möchte ich mich bei Eva Fenn, Stephan Kirchschlager, Sarah Hitzler, Christian Meyer, Claudia Muhl, Martin Larius, Julia Schaub und ganz besonders bei Holger Finke für die langen Diskussionen und vielfältigen Rückmeldungen bedanken. Mein besonderer Dank gilt meinen beiden Betreuern, Jörg Bergmann und Ulrich Dausendschön-Gay für ihr Vertrauen, ihre Geduld und das entscheidende Nachfragen zur rechten Zeit. Zum Abschluss möchte ich mich noch bei meiner Familie und bei Inga für die tatkräftige Unterstützung und ihr liebevolles Zutrauen herzlich bedanken. Im November 2013
Frank Oberzaucher
Einleitung „Komm lass uns Übergabe machen", mit diesen Worten läutet eine Pflegekraft auf der gynäkologischen Station gegenüber ihren Kolleginnen die bevorstehende Abendübergabe ein. Die Durchführung von Übergaben in Krankenhäusern ist ein fixer Bestandteil des Aufgabenfeldes des Pflegepersonals.1 Für die einen ist es ein im Pflegealltag nicht mehr weg zu denkendes arbeitsrelevantes Ritual geworden, für die anderen eine mühevolle und mitunter lästige kommunikative Tätigkeit, die in regelmäßigen Zeitabständen verrichtet werden muss. Während einer meiner ersten Feldkontakte fragte ich eine Pflegerin, die gerade ihre Übergabe beendet und noch einige administrative Tätigkeiten zu erledigen hatte, wie denn so ein Arbeitsalltag auf der Station aussehen würde, wenn auf die Durchführung von Übergabegesprächen verzichtet werden würde. Als Antwort bekam ich einen entgeisterten Blick, den sie anschließend mit den Worten: „Das wäre das absolute Chaos" füllte. Eine Information, die zwar den Stellenwert und die Relevanz dieses Gesprächsereignisses erahnen lässt, aber zur Beantwortung von Fragen nach dem „Wie" dieses Gesprächsereignisses, für die ich mich vorrangig interessierte, wenig beisteuerte. Das „Wie" ließ sich augenscheinlich auch nicht erfragen, sondern erforderte zusätzliche Beobachtungen im Rahmen langfristiger Feldaufenthalte. Ein Forschungsinteresse, das in der Frage nach dem „Wie" eines Übergabegesprächs aufgeht, richtet die Aufmerksamkeit auf die Prozessualität des Ereignisses. Die vorliegende Studie beschäftigt sich aus ethnomethodologisch-konversationsanalytischer Perspektive mit dem kommunikativen Ereignis der Übergabe in Krankenhäusern. Zu diesem Zweck wurden unzählige Stunden auf unterschiedlichen Stationen eines Krankenhauses und in den Schulungsräumen einer Gesundheits- und Krankenpflegeschule in einer mittelgroßen Stadt in Nordrhein-Westfalen zugebracht. Der Feldaufenthalt bzw. die Zusammenarbeit mit dem Forschungsfeld erstreckte sich über mehrere Jahre: die ersten Datenaufzeichnungen wurden im September 2005, die letzten im April 2008 angefertigt. Die Zusammenarbeit mit der an das Krankenhaus angeschlossenen Bildungseinrichtung ging darüber hinaus bis Anfang 2010. Der Zutritt zum Krankenhaus wurde mir auf formell administrativem Wege über die Geschäftsführung und Pflegedienstleitung des Hauses ermöglicht. Im Rahmen
Die männliche und weibliche Form werden in diesem Buch entweder gleichzeitig durch das Binnen-I gekennzeichnet oder sie werden je nach Kontext und Lesbarkeit in nicht systematischer Schreibweise verwendet. 1
4
Einleitung
einer Informationsveranstaltung, zu der die einzelnen Stationsleitungen des Hauses eingeladen wurden, trug ich mein Vorhaben - Übergabegespräche interaktionsanalytisch zu untersuchen - vor. Daraufhin meldeten sich freiwillig einzelne Stationen und die Datengenerierung auf einer der Stationen (Intensivstation) konnte beginnen. Auf den Stationen selbst stellte ich mein Vorhaben teilweise unterschiedlich vor, hauptsächlich stand dabei jedoch das Thema „Kommunikation auf der Station" im Mittelpunkt. Ausgestattet mit einem bei der Pflegedienstleitung des Krankenhauses „ausgefassten" weißen Arztkittel, Stift und Notizblock sowie mit einer Handkamera und einem Audio-Aufnahmegerät und einer Portion Neugierde begab ich mich in eine mir völlig unbekannte Arbeitsumgebung. Die ersten Schritte meiner Feldarbeit bestanden darin, Vertrauen zu den Mitarbeiterinnen aufzubauen, mich an die neue Umgebung zu gewöhnen und dabei bereits den vom Schichtdienst bestimmten Rhythmus kennen zu lernen, an dem das Pflegepersonal sich zu orientieren hatte. Dieser führte mich schließlich zu meinem vorwiegenden Forschungsinteresse, nämlich der Durchführung von Übergabegesprächen. Die meiste Zeit im Feld verbrachte ich mit Beobachten, Zuhören und, soweit es sich vor Ort irgendwie bewältigen ließ, Notizen machen. Erst nach und nach erweiterte ich mein Aufzeichnungsspektrum und fertigte anfangs Audioaufzeichnungen und soweit es die Akteurinnen auf der Station zuließen, ebenfalls Videoaufzeichnungen an. Im Laufe meiner Beobachtungen im Krankenhaus stieß ich auf eine ganze Reihe von Themen und Phänomenen, die sich in der vorliegenden Arbeit wiederfinden lassen. So beschäftige ich mich im zweiten Kapitel mit der für Übergaben charakteristischen ökologischen Situation im Stationszimmer und den Arbeitsnotwendigkeiten, die damit zusammen hängen. Gleich an meinem ersten Tag auf der Geburtshilfestation fiel - was im Nachhinein betrachtet für mich einen Glücksfall darstellte - das EDV-System aus und ich konnte beobachten, wie die Pflegerinnen vor Ort mit dieser für sie unglaublich mühsamen Situation umgehen mussten. Sie retteten sich vorwiegend mit handschriftlichen Notizen über den Tag, die an verschiedensten Stellen im Stationszimmer zu finden waren. Erst viel später im Forschungsprozess, d. h. durch den Vergleich mit den anderen Stationen, fiel mir auf, dass die unzähligen Notizen an Wänden und Türen nicht immer mit einem „Notfall" zu tun haben müssen, sondern grundsätzlich eine Art Gedächtnisfunktion für die Teilnehmerinnen haben. Ein weiterer Aspekt, der mich vor Ort faszinierte, war zum Beispiel der Umgang mit vermeintlichen Versäumnissen bzw. Arbeitsaufträgen, die von Übergeberinnen an den ankommenden Schichtdienst weitergereicht werden mussten. Dabei interessierte ich mich aber nicht, wie anzunehmen wäre, für potenzielle Konfliktherde, sondern ich begab mich an die Seite von weiteren Novizinnen im Feld, den Gesundheits- und Krankenpflegeschülerlnnnen bzw.
Einleitung
5
in Einzelfällen auch jungen Ärztinnen und begleitete sie, soweit es ging, bei der Durchführung ihrer pflegerischen bzw. medizinischen Aktivitäten. Erst durch ihren offenen und zugleich lernenden Blick auf Arbeitsabläufe stellte ich fest, was ein Übergabegespräch ausmachen sollte. Ihnen erging es wie mir, auch sie versuchten herauszufinden, worauf es ankommt, und was eine „gelungene" von einer „weniger gut gelungenen" Übergabe unterscheidet. Während meiner Beobachtungen auf der Station hatte ich häufig die Gelegenheit, die Übergänge zu erleben, von einem alltagsähnlichen Gespräch unter Kolleginnen hin zu einem plötzlich völlig andersartig strukturierten Gesprächstyp sowie dessen Auflösung und Anschluss an weitere Gesprächsformen am Ende der Übergabe. Diese Beobachtung führte mich zu einem Thema, das im dritten Kapitel behandelt wird und so etwas wie das Grundgerüst eines Übergabegesprächs darstellen soll. Dabei geht es um den prinzipiellen Aufbau bzw. die Ablaufstruktur dieses sozialen Ereignisses. Wer eröffnet und beendet dieses Gespräch? Welche thematische Grundstruktur weist die den jeweiligen Patientinnen zugewiesene Informationseinheit auf? Bis auf wenige Ausnahmen finden Übergabegespräche immer unter Ausschluss derjenigen statt, über die gesprochen wird, d. h. eventuelle Rückfragen an die Patientinnen während des Gesprächs sind nicht möglich. Umso interessanter wird es, darauf zu achten, wie die Beteiligten damit umgehen und darüber hinaus eine bestimmte kommunikative Praxis entwickeln, mit der es ihnen gelingt, die Patientinnen auf der Station so zu kategorisieren, dass die Beteiligten daraus eine Fülle von arbeitsrelevanten Schlussfolgerungen ziehen können. Damit werde ich mich im vierten Kapitel auseinander setzen. Die intensive Zusammenarbeit mit Vertreterinnen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule, mit denen ich u. a. mehrere Workshops und weitere Folgeprojekte durchgeführt habe und dabei häufig exemplarische Auszüge von den technisch registrierten Aufzeichnungen bzw. Grobtranskripte einsetzte, hatte wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung eines ganz bestimmten Erkenntnisinteresses. Hier geht es um Überlegungen zu den Verfahren der Generierung von Wissen im Rahmen eines Übergabegesprächs durch die Beteiligten. Durch den bewussten Verzicht auf Befragungen von Expertinnen des Pflegeberufs konnte ich ein auf das Individuum reduziertes Wissenskonzept problemlos überwinden und mich statt dessen an einem methodologischen Konzept orientieren, das bei den Verfahren der Beteiligten ansetzt und mir dadurch die Möglichkeit verschafft, die Hervorbringung und Herstellung von Wissen in der Kommunikation zu untersuchen. So erkläre ich zum Beispiel im fünften Kapitel, das den Titel „Übergabe-Wissen" trägt, den Stellenwert des Erzählens und den Zusammenhang mit der Unterstellung eines bestimmten Wissens. Ich werde zeigen, dass Erzählungen in Übergaben u. a. dann erforderlich werden, wenn das unterstellte Wissen (Routinewissen)
6
Einleitung
fraglich geworden ist und, offenbar aufgrund des für Übergaben typischen Informationsgefälles, neu justiert werden muss. Im Schlussteil der vorliegenden Untersuchung beschäftige ich mich mit den praktischen Folgen der Analyse für das Untersuchungsfeld. Ich hatte mich schon zu Beginn der Untersuchung dem Feld gegenüber verpflichtet, die wie auch immer gearteten Resultate „zurückzuspielen" bzw. für Ausbildungszwecke zur Verfügung zu stellen. Welche Herausforderungen dadurch auf mich zukamen und wie ich sie zu bewältigen hoffte, werde ich in Kapitel sechs und sieben vorstellen. Die vorliegende Arbeit schließt mit einem Ausblick auf zukünftige Untersuchungsfelder und Forschungsfragen (Kapitel acht) sowie einem kritischen Rückblick. Die vorliegende Studie richtet sich vorwiegend an eine soziologische, sprachwissenschaftliche und pflegewissenschaftliche Leserschaft. Bei der Untersuchung von Übergabegesprächen des Pflegepersonals standen anwendungsbezogende und praxisnahe Fragestellungen im Zentrum der Analyse. Deshalb sind die Forschungsergebnisse in Teilen, nach einer praxissensiblen Aufbereitung, selbstverständlich auch für praktizierende Pflegekräfte relevant, etwa im Rahmen von Aus- und Weiterbildungen in Gesundheits- und Krankenpflegeschulen oder Bildungszentren für Pflegeberufe.2
Einführung in das Untersuchungsfeld Das St Martin-Spital Das St. Martin-Spital3 ist ein Akademisches Lehrkrankenhaus und umfasst 9 Fachkliniken mit insgesamt rund 360 Betten. Die Versorgungsschwerpunkte des Hauses liegen in den Bereichen Urologie, Innere Medizin/Internistische Onkologie, Anästhesie, Radiologie, Geburtshilfe und Gynäkologie sowie Allgemein- und Unfallchirurgie. Der Pflegedienstbereich umfasst (einschließlich Ambulanz und Kreißsaal) 15 Pflegestationen. Der Personalstand für medizinisches Personal liegt im Durchschnitt bei 80 und beim Pflegepersonal
Ein Praxishandbuch eigens für praktizierende Pflegekräfte ist in Vorbereitung (Fertigstellung gegen Ende 2014) und soll einen Beitrag zur Professionalisierung des Pflegeberufs leisten. 2
Die Angaben zum Krankenhaus sind aus Anonymisierungsgründen absichtlich knapp gehalten. Die zum Verständnis der Transkripte erforderlichen Informationen zum medizinischen Hintergrund bestimmter Erkrankungen etc. sind den jeweiligen Stellen zu entnehmen.
3
Einleitung
7
bei rund 250 Mitarbeiterinnen und ca. 35 Personen für sonstige Aufgaben, wie etwa der kaufmännische Bereich, technische Abteilung, Seelsorge etc. Zum Lehr- und Forschungsbereich zählen die in der medizinischen Ausbildung üblichen Einheiten, wie Dozenturen und Lehrbeauftragungen, Studentenausbildung etc. Die Ausbildung in anderen Heilberufen umfasst Gesundheitsund Krankenpflegerin. An das Krankenhaus ist zusätzlich ein Aus- und Weiterbildungszentrum mit medizinischer und pflegerischer Schwerpunktsetzung für Kurse und Lehrgänge des eigenen Personals wie für externe Fachkräfte umliegender Krankenhäuser angeschlossen. Der Untersuchung liegen sowohl Audio- als auch Videomaterial zugrunde. Die Audioaufzeichnungen erstrecken sich auf eine Gesamtdauer von ca. 28 Stunden. Der Umfang der Videoaufzeichnungen umfasst knapp 12 Stunden. Zusätzliche Aufzeichnungen, die aus Datenschutzgründen4 nicht in die Studie einbezogen werden konnten, umfassen rund 3 Stunden (Videomaterial/ Herzintensivstation und Privater Pflegedienst), welches aber, ebenso wie das ca. 8 Stunden umfassende Audiomaterial aus der Voruntersuchung (vgl. Oberzaucher 2004) nicht direkt Eingang in die vorliegende Untersuchung gefunden hat, auf das jedoch zu Vergleichszwecken im Verlaufe der Datenanalyse immer wieder zurückgegriffen wurde. Aufbereitung der Aufzeichnungsdaten Zur Aufbereitung der Daten für die spätere Analyse wurden die Aufzeichnungen unmittelbar nach der Aufnahme zunächst gesichtet und ein grobes Gesprächsprotokoll angelegt (Gesprächsinventarliste). Damit konnte ein erster Überblick über den Ablauf eines Übergabegesprächs gewonnen und einzelne Grobverschriftungen markanter Stellen, wie z. B. der Übergang vom Vorgespräch zum eigentlichen Übergabegespräch, Praktiken der Kategorisierung etc., festgehalten werden. Zusätzlich wurden unzählige Notizen im Feldtagebuch festgehalten, insbesondere wurden bei den jeweiligen Übergaben alle nützlichen Informationen, wie die Anfertigung einer Raumskizze, Sitzordnung der Beteiligten, Name und Verantwortungsbereich der Beteiligten, Dauer sowie sonstige Auffälligkeiten notiert. Aus Gründen der Datensicherung wurde das AufZeichnungsmaterial während der ersten „Sichtung" kopiert und getrennt von den Originalaufzeichnungen aufbewahrt. Ein wichtiger Arbeitsschritt in der Datenerhebungsphase war zudem das systematische Anlegen eines Personenverzeichnisses der Beteiligten, die aus Gründen des Datenschutzes anonymisiert wurden.
Vgl. im Kapitel 6, Praktische Folgen der Analyse.
8
Einleitung
Ich hielt es für zielführend, in der ersten Phase des Transkriptionsprozesses zunächst eine Übergabe vollständig z u transkribieren. Die in der Folge durchgeführten
Datenanalysesitzungen 5
setzten
zu
Beginn
an
der
vollständig
transkribierten Übergabe an und w u r d e n nach und nach auf die im weiteren Forschungsprozess aufgezeichneten Sequenzen und Phänomenbereiche
des
gesamten Datenmaterials ausgeweitet. 6
Methodologische forschung7 Die
Entwicklung
Implikationen
der
einer
multimodal
Digitaltechnologie
hat
orientierten
zu
Interaktions-
erheblich
verbesserten
Möglichkeiten der Aufzeichnung wie der Analyse v o n Gesprächsdaten geführt. D a z u gehört, dass Gespräche nicht m e h r nur als auditive Ereignisse untersucht werden,
sondern
ihrem
Entstehungskontext
angemessener
und
daher
im
umfassenden Sinne als leibvermittelte multimodale Kommunikation begriffen werden. Verantwortlich für diesen Wechsel auch über die Disziplingrenzen hinweg w a r e n u n d sind die Arbeiten v o n G o o d w i n (1994, 2007), M o n d a d a (2003, 2007a), H e a t h (1986), Luff et al. (2000) und Streeck (1996). Diesen Arbei-
Gegen Anfang 2006 formierte sich an der Universität Bielefeld eine Gruppe aus Nachwuchs-Interaktionsforscherinnen mit dem Ziel, ihre Qualifizierungsarbeiten innerhalb der Arbeitsgruppe zu diskutieren. Im Laufe der Zeit hat sich daraus ein regelmäßig, d. h. im Semester wöchentlich und in der vorlesungsfreien Zeit in der Regel monatlich zusammentreffendes Arbeitsforum entwickelt, in dem sehr effizient und unter reger Beteiligung die Daten der Teilnehmenden analysiert wurden. Ein bis zweimal im Jahr fanden darüber hinaus zweitägige Analyseworkshops statt, meist zu einem vorweg festgelegten Thema (wie z. B. Identität, Emotion, Kategorisierung etc.). Die Finanzierung der Workshops hat freundlicherweise die Graduiertenschule der Fakultät für Soziologie (IGSS und BGHS) übernommen. 5
6
Detaillierte Angaben zum Transkriptionsmaterial folgen weiter unten.
Die wesentlichen Vorschläge, Konzepte und Ideen dieses Beitrags gehen zurück auf die Diskussionen innerhalb der Arbeitsgruppe GAT2 multimodal. Sie ist eine Untergruppe der Arbeitsgruppe GAT 2, ein Zusammenschluss deutscher Sprachforscherinnen, die sich um die Überarbeitung des nicht mehr zeitgemäßen Notationssystems GAT (vgl. Selting et al. 1998) bemühten. Die Untergruppe knüpft in ihren Vorschlägen an die Transkriptionsprinzipien und -kriterien (Zwiebelprinzip, Lesbarkeit des Transkript, Eindeutigkeit, Relevanz, Ikonizität, Formbezogene Parametrisierung) der aktualisierten Version des Gesprächsanalytischen Transkriptionssystems an (vgl. Selting et al. 2009) und erweitert diesen um die Aspekte der Notation visueller Kommunikation. Die Untergruppe GAT 2 multimodal ist mit der Ausarbeitung noch beschäftigt, die Publikation ist für Ende 2014 vorgesehen (vgl. Vorversionen dazu in Deppermann et al. 2009). 7
Einleitung
9
ten liegt die Einsicht zugrunde, dass viele Gesprächsphänomene ausschließlich auf einer multimodalen8 Datengrundlage, d. h. Videoaufzeichnungen, angemessen zu untersuchen sind. Hierfür sind Konventionen erforderlich, die der Transkription der visuellen, d. h. sichtbaren Kommunikation gerecht werden. Bei der Transkription geht es grundsätzlich darum, dass akustische bzw. audiovisuelle Gesprächsprotokolle nach festgelegten Notationsregeln in einem anderen (graphischen) Medium repräsentiert werden (vgl. Deppermann 2001: 39f.; Bohnsack et al. 2002:15f.) oder nach Wolff (2008) mit einer Reihe von diakritischen Zeichen - d. h. zum Unterscheiden geeigneten - die Art der Äußerungsrealisierung und des Gesprächsablaufs zu erfassen versucht werden. Zu betonen ist allerdings der interpretative Gehalt einer Transkription, d. h. ein Transkript kann und soll nie eine wirklichkeitstreue Abbildung sein, sondern es handelt sich immer um eine Interpretation. Darüber hinaus ist der Zweck, den ein Transkript im jeweiligen Forschungsprozess - grobe Datensichtung zu Anfang gegenüber hoch aufgelösten Phänomenen in Publikationen - zu erfüllen hat, bedeutsam. In Publikationen ist die selektive Verwendung von Transkripten demnach immer als Resultat einer spezifischen Analyse zu begreifen. Für die in der vorliegenden Arbeit verfolgten Fragestellungen sind die mit unterschiedlicher Auflösung gestaltbare parameterbasierte konversationsanalytische Kollektion9 und Teile des aktualisierten Gesprächsanalytischen Notationssystems (vgl. Selting et al. 2009/1998) maßgeblich. Um die Lesbarkeit der in den späteren Kapiteln dargestellten Transkriptionen zu erleichtern, werden die wichtigsten Regeln kurz vorgestellt und im Anschluss daran deren Verwendung unter Aufzählung einiger Beispiele jeweils kurz erläutert. Zunächst jedoch drei entscheidende Merkmale für Analysen mit multimodalen Daten:
Albert Scheflen (1972) gilt als Vorläufer des Konzepts „multimodale Kommunikation", ihm zufolge ist beispielsweise die Körperpositur als eine „modality of communication" zu bezeichnen (ders.: 230f.), vgl. auch Mondada/Schmitt (2010: 23). 8
Zwei prototypische Ansätze eignen sich für Analysen visueller Kommunikation: die holistische Konstitutionsanalyse und die parameterbasierte konversationsanalytische Kollektion. Bei ersterem werden die Daten schrittweise auf der Grundlage einer bestimmten Fragestellung untersucht. Bei diesem Ansatz sind keine Annotationen erforderlich, da keine selektive Fokussierung auf einzelne multimodale Ressourcen stattfindet. Davon zu unterscheiden ist die parameterbasierte konversationsanalytische Kollektion, dabei werden je nach Fragestellung und Datum ein bis zwei multimodale Ressourcen (z. B. Kopf- und Blickbewegung) mit je spezifischen Realisationen und Kodierungen festgelegt. Die Phänomene außerhalb der ausgewählten Modalitäten werden nicht berücksichtigt (vgl. Deppermann et al. 2009). 9
10
Einleitung
1) Einsatz von Standbildern: Die Auswahl der Standbilder ist analytisch betrachtet eine sehr heikle und folgenreiche Entscheidung, von ihr hängt ab, welchen Momenten im Gesprächsprozess vom Analysierenden am meisten Beachtung geschenkt wird. Als Orientierung werden ästhetische Kriterien (z. B. Graphisierung des Standbildes), fragestellungsbezogene Kriterien (d. h. klarer Zusammenhang zwischen Fragestellung, Abbildung und Argumentation im Analysetext) und verlaufsstrukturelle Kriterien (d. h. im Regelfall sind 2 bis 3 Standbilder zu zeigen, um so der Präparation, des Apex und der Retraktion einer Aktivität folgen zu können) empfohlen. 2) Wahl der Transkriptionsstufen:10 Drei Abstufungen stehen zur Auswahl. Das multimodale Minimaltranskript ermöglicht die Zuordnung von Verbaltranskript zu Standbildern, ohne zusätzliche Beschreibung visueller Kommunikationselemente. Das multimodale Basistranskript ist eine Erweiterung des vorangegangenen, d. h. zusätzlich zur Integration von Standbildern wird eine globale Beschreibungszeile für visuelle Kommunikationselemente gebraucht. Die visuellen Aktivitäten werden möglichst alltagsnah beschrieben und mit Angaben ihrer tatsächlichen Realisierung (Anfang, Ende) versehen. Die nächsthöhere Auflösung erlaubt das multimodale Feintranskript,11 also wiederum eine Erweiterung des vorangegangenen. Die Veränderung besteht darin, dass zusätzlich spezialisierte Beschreibungszeilen für mehrere multimodale Ressourcen benutzt werden. 3) Wahl der Modalitäten: Multimodale Kommunikation umfasst neben den bekannten vokalen Äußerungen, wie Verbalität, Prosodie, Interlinear-
Bei der multimodalen Transkription wird die sonst für auditive Ereignisse übliche turnorientierte Darstellungsform zugunsten einer Partiturschreibweise aufgegeben. Den Wechsel auf das Partiturformat machen spätestens Mehrpersonen-Konstellationen mit mehrfach überlappenden Extensionen von Aktivitäten erforderlich (vgl. Deppermann et al. 2009). 10
In der vorliegenden Arbeit wurde aus Darstellungsgründen versucht, auf dieses hohe Auflösungsniveau so weit als möglich zu verzichten. 11
Einleitung
11
Übersetzung bzw. freie Übersetzung eine Reihe verschiedener Modalitäten,12 dazu zählen: Gestik, Kopf- und Blickbewegung, Mimik/Gesichtsausdruck, Körper im Raum und Tätigkeiten und Objektmanipulation.13 Hinweise zur Lesbarkeit und Einbindung von Transkriptausschnitten Fließtext
in den
Den empirischen Beispielen geht meistens eine Kurzbeschreibung der Situation voraus, daneben werden die zusammengestellten Gesprächsausschnitte fragestellungsbezogen ausgewählt und eingeführt. Die jeweiligen Transkriptionsausschnitte sind von einigen Ausnahmen abgesehen den Analysen und Interpretationen vorangestellt. Um ein ständiges Hin- und Herblättern zwischen Analyseteil und Transkriptabschnitt zu vermeiden, werden die betreffenden Passagen im Fließtext nochmals zitiert und sind zur leichteren Identifizierung als Transkriptzitate „durch die Schriftart Courier New" kenntlich gemacht. Die einzelnen Aufzeichnungsausschnitte werden unter Angabe des jeweiligen Kürzels der Aufzeichnung, der sie entnommen sind, zitiert (a). Zur Kennzeichnung der Gesprächsteilnehmerinnen werden einheitlich die Sprechsiglen 'Ü' für Übergebende und 'N' für Übernehmende bzw. 'S' für Schülerinnen und ' F für Forscher geführt (b). Die Verbindung zur Audio- oder
Zur besseren Orientierung bei der Transkription und Analyse schlägt die Arbeitsgruppe folgende Klassifizierung vor (vgl. Deppermann et al. 2009): Gestik: visuelle Äußerungen, insbesondere der Hände/Finger (z. B. Zeigen), der Arme, der Schultern (z. B. Schulterzucken) und des Kopfs (wie z. B. Kopfnicken) oder weiterer Körperteile sowie der gestische Einsatz von Gegenständen; Kopf- und Blickbewegung, Blickkontakt und -richtung sind kommunikativ überaus bedeutsam und ist meistens aber nur indirekt aus der Kopfhaltung und -bewegung zu erschließen; Mimik/Gesichtsausdruck, dazu gehören alle möglichen Aktivitäten oder Bewegungen der Augen, der Brauen, des Mundes, der Nase und der Stirn (z. B. Stirnrunzeln); Körper im Raum, diese Modalitätsebene differenziert sich in Körperhaltung (d. h. Sitzen, Stehen, Hocken, gebeugte oder aufrechte Haltung etc.), Körperbewegung (d. h. Gehen, Laufen, Springen etc.), Körperanordnung (z. B. Sitzen im Kreis, Stehen in einer Reihe etc.), proxemisches Verhalten (Zuwenden, Abwenden , Nähern oder Entfernen etc.); und abschließend Tätigkeiten und Objektmanipulation, dazu gehören alle möglichen Aktivitäten, die von Akteurinnen im spezifischen Kontext ausgeübt werden (z. B. Essen, Trinken, Lesen, Schreiben, Kochen, Arbeit am Patientenbett, Arbeit mit Werkzeugen etc.). 12
Anmerkung: Die Auflistung der Modalitäten beansprucht keineswegs eine Ontologie, sondern sie soll lediglich einen Umriss des Gegenstandsbereiches darstellen (ebd.). 13
12
Einleitung
Videoaufnahme ist in absoluten Zeitwerten {h:mm:sec} im Transkriptkopf angegeben, sowie optional der Beginn der Aufnahme in der ersten Transkriptzeile vor der Zeilennummerierung (c). Die jeweiligen Zeilen der Ausschnitte sind in allen Fällen nummeriert, teilweise auch mit Kleinbuchstaben versehen (wie z. B. 120a), und erleichtern so den Verweis auf bestimmte Textpassagen. Eine ähnliche Funktion erfüllen die angeführten Pfeile (d). An ganz wenigen Stellen sind keine Zeilennummern angeführt, das ist zurückzuführen auf die Formatvorgaben des Verlages (Satzspiegel). Grundsätzlich werden alle Transkriptauszüge im multimodalen Basistranskript dargestellt, unabhängig davon, ob Standbilder zur Unterstützung der analytischen Argumentation erforderlich sind oder nicht. Eine globale Annotatzeile wird für visuelle Kommunikation benutzt, mit 'm?/ abgekürzt, in einer eigenen Zeile geführt und jeweils einem Sprecher zugeordnet (e). Für gewöhnlich werden die verbalen Äußerungen im Unterschied zur Annotation der visuellen Kommunikation fett hervorgehoben. Tonhöhenveränderungen am Ende von Intonationsphrasen werden mittels den Interpunktionszeichen: Komma (,), Punkt (.), Semikolon (;), Bindestrich (-) und Fragezeichen (?) markiert (f). In einfache Klammern gesetzte Äußerungseinheiten, sind nicht eindeutig und daher ist lediglich deren vermuteter Äußerungsinhalt wiedergegeben (g). Die zusätzliche Abbildung der visuellen Kommunikation mittels Standbilder erfordert teilweise pragmatische Lösungen - siehe dazu # 2.
(a)
(c)
# 1: Geburtshilfe / MI / 'nachdem sie sich da n bisschen aufgeregt hatte' ((28:30-29:32)) Ü: Übergeberin; Nl, N2: Übernehmerinnen; S: Schülerin 14 0: 15
4MM
[hm_hm[Kopfnicken
16
°hh° frau baldauf Sectio zweiter tag erstes kind-
17
( — ) hm:: die braucht noch ein bißchen hilfe,
18
(-) is auch ein großes kind über vier kilo gewesen,
19
blutzucker stabIL?
20
°h die hatte eine bein und beckenwehenthrombose,
21
(.) hat sie wohl immer noch,
22
bekommt deswegen
23
die linke warze ist ein bißchen angeknabbert
24
aber noch nicht blutIG- vis-à-vis
(
13 N: MM
[
)da hat er auch eine offene stelle jetzt;
)>
[legt den Zettel wiede[r zurück auf den Schreibt.
R 14
Abb.
15:04,16 fiXte
R
12
10
[hm=hm(3.0)
Noch vor Formulierung der Frage nach dem Eintrag des Patienten im Stixplan blickt Ü zunächst auf, fixiert die Liste, beugt sich leicht nach vorne und hält kurz inne (vgl. Z. 5). Die Übernehmerin verändert daraufhin ebenfalls ihre Körperposition, folgt Üs Blicken, bestätigt Üs Frage (Z. 6), vergleicht die Angaben im Stixplan mit denen in ihrer „Übergabeliste", nimmt den Stixplan in die Hand (Z. 10), macht Vermerke und legt ihn abschließend auf dem Schreibtisch ab (Z. 13). Es ist offensichtlich, wie Ü durch die gewählte Blickrichtung (auf die Stixliste hinter Ns Rücken) und die veränderte Körperposition ihrer Kollegin gegenüber ein „Orientierungsangebot" macht. Auf die verkörperte Zeigegeste folgt einige Augenblicke später der erste Teil eines Äußerungspaares der Übergeberin: 05 Ü: [steht der um zehn uhr da auf dem(stix[plan?) (.) müsste eigentlich-
Sie macht so mit der Frage eine Reaktion der Übernehmerin „konditionell relevant", d. h. auf der Ebene der verbalen Organisation wird Ns Antwort auf Üs Frage eingefordert. Zusammengenommen sind in dieser Kommunikationssequenz neben den sprachlichen Äußerungen und paraverbalen Phänomenen (etwa der Sprechpause, Z. 4) die nonverbalen Elemente, die spezifische Blickorganisation und das veränderte körperliche Arrangement einschließlich der verkörperten Geste, ebenso relevant für die Sinnkonstitution. Bei dieser Form der Interaktionsarbeit wird ersichtlich, wie Sprache und weitere
Die interaktive Organisation der Aufgabenorientierung
81
multimodale Ebenen miteinander verschränkt sind. Der „o-space/vis-à-vis" nach Kendon wird geöffnet, und kurz darauf von den Beteiligten in seiner ursprünglichen Form (vis-à-vis) wiederhergestellt. Zur Bearbeitung einer spezifischen Aufgabe (Überprüfung des Eintrags im Stixplan) ändern die Beteiligten ihr körperliches Arrangement, der ,,o-space/vis-à-vis" wird kurzzeitig geöffnet u n d die Formation an den neuen Aufmerksamkeitsfokus (Stix-Plan) angepasst; erst nachdem die gemeinsame Bearbeitung der „eingeschobenen" Aufgabe abgeschlossen ist, kehren die Akteurinnen wieder zur ursprünglichen Formation zurück. In dieser Sequenz wird deutlich, dass das Konzept der „konditionellen Relevanz" 70 sich nicht auf den Bereich der verbalen Äußerungen beschränkt, sondern ebenso multimodale Erscheinungsformen hat. Wie im empirischen Beispiel zu sehen, kann die verbale Realisierung des ersten Teiles des Äußerungspaares mit ihr vorausgehenden bzw. sie begleitenden nonverbalen Ausdrucksformen kombiniert sein - hier insbesondere auf den Ebenen der Blickorganisation u n d der Ausrichtung der Körperposition bzw. des verkörperten Gestikeinsatzes -, die konstitutiv sind für diese Situation. Der Übergeberin gelingt es hier, gegenüber ihrer Kollegin eine bestimmte Folgehandlung normativ erwartbar zu machen und dabei selbst gleichzeitig als „verkörperte" Interpretationsfolie für den n u n zu produzierenden zweiten Teil des Äußerungspaares zu fungieren, indem sie durch ihre körperliche Reorientierung (als verkörpertes Display für die Reorientierung ihrer Wahrnehmung bzw. ihres Aufmerksamkeitsfokus') den Stixplan als für die Übergabesituation relevanten Gegenstand markiert. Daneben erfüllt diese Art der kommunikativen Realisierung in der Übergabesituation auch die Funktion der Selbstüberprüfung für die Übergeberin (und des Sichtbarmachens dieser Selbstüberprüfung), schließlich ist es ihre Aufgabe, die Einträge in den unterschiedlichen Auftragslisten („Röntgen", „Zucker", „Labor" etc.) regelmäßig zu aktualisieren. Im Vordergrund steht jedoch meines Erachtens der durch die Art und Weise der kommunikativen Aneignung der Interaktionsumgebung etablierte Arbeitsauftrag an die Übernehmerin. Die
70
Das Konzept der „konditioneilen Relevanz" geht ursprünglich zurück auf Sacks (1967), Schegloff (1968) hat es zur Charakterisierung der Abfolge von Äußerungstypen systematisch weiterentwickelt. Bergmann (1988/III: 18f.) weist darauf hin, dass dieses Konzept nicht vorschnell auf sein Erwartungsschema (eine Handlung A macht eine Folgehandlung B eines bestimmten Typs erwartbar) reduziert werden darf, sondern ebenso als Interpretationsfolie für den zweiten Teil eines Äußerungspaares fungiert (Handlung B wird im Lichte der vorangehenden Handlung A gedeutet - z. B. als Antwort auf eine Frage - und Handlung B beeinflusst - bestätigt, modifiziert, problematisiert als mögliches Missverständnis etc. - ihrerseits rückwirkend die intersubjektive Deutung der Handlung A).
82
2. Zur Ökologie der Übergabesituation
Übergeberin appelliert gewissermaßen an die „professional vision"n (Goodwin 1994) ihrer Kollegin, wobei sich hier der professionelle Denk- und Sehstil allerdings weniger auf das kompetente Sehen per se konzentriert, als vielmehr auf den kompetenten Umgang mit im lokalen Kontext verankerten und relevant gemachten Objekten wie z. B. der Stixliste. Ein zentraler Aspekt professionellen Handelns im Rahmen von Übergabegesprächen liegt also darin, „how people use their circumstances
to achieve intelligent action" ( S u c h m a n 1987:
50). Hier zeigt sich die Situiertheit der Sinnkonstitution unter den spezifischen sozialen und materiellen Bedingungen dieser Übergabesituation (Aufgabenorientierung, räumlich-gegenständliche Gegebenheiten bzw. Ressourcen im Schwesternzimmer). Neben der Einbindung von physikalischen Objekten72 (Liste, Tisch, Stift etc.) wird die spezifische Relevanz der Situation von den Beteiligten auch über das stimmliche Klangbild, die Themenorganisation und die Variationen ihrer Körperpositionen in der Interaktion repräsentiert. b) Monitoring und Kooperation Ein typisches Merkmal von Face-to-face-Interaktionen ist, dass sich die Beteiligten prinzipiell wechselseitig in nahezu allen Sinnesmodalitäten wahrnehmen (können). Dadurch können die Beteiligten auf eine große Bandbreite an verfügbaren Ausdrucksbzw. Realisierungsformen zurückgreifen. So stehen zum Beispiel einer Übergeberin neben paralinguistischen auch kinesiologische Darstellungsressourcen zur Verfügung, um das Verstehen und die Interpretationen ihrer Gesprächspartnerlinnen zu unterstützen. Die kommunikative Rolle einer Übernehmerin beschränkt sich wiederum nicht darauf, lediglich anwesend zu sein und passiv an einer kommunikativen Produktion der Übergeberin teilzunehmen, sondern sie zeigt synchron dazu auf nonverbale Art und Weise ihr Verständnis und ihre Interpretation dessen an, was ihr Gegenüber, die Übergeberin, produziert (hat).
In seinem Aufsatz zeigt Goodwin, welche Praktiken des Denkens und Sehens Mitglieder von zwei professionellen Arbeitsfeldern (archäologische Ausgrabungen, Beweisführung bei einer Gerichtsverhandlung) in der Ausübung ihrer Profession einsetzen. „Central to the social and cognitive organization of a profession is its ability to shape events in the world it is focusing its attention upon into the phenomenal objects around which the discourse of the profession is organized, e.g. to find archaeologically relevant events such as post holes in the color stains visible in a patch of a dirt and map them, to locate legally consequential instances of aggression or cooperation in the visible movements of a man's body" (ders.: 626). 71
Auf die Bedeutung verkörperter Referenzpraktiken in Arbeitszusammenhängen haben u. a. auch schon Hindmarsh und Heath (2000) am Beispiel eines „center of coordination" (Suchman) der britischen Telecom (Restoration Control Office) hingewiesen. 72
Die interaktive Organisation der Aufgabenorientierurig
Das heißt das wechselseitige Anzeigen der Beteiligten („display") Konsequenzen für den laufenden Interaktionsprozess, indem z. B. Übergeberin die Schreibaktivitäten der Übernehmerin berücksichtigt, anerkennt und ihre eigenen Formulierungsaktivitäten situativ auf rezeptionsbegleitenden Aktivitäten ihres Gegenübers abstimmt.
83 hat die sie die
Auch im folgenden Beispiel ist, neben dem verbalen Handeln der beiden Pflegekräfte, gleichermaßen das körperliche Verhalten und dessen wechselseitige simultane und sequenzielle Abstimmung bedeutsam. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang der Begriff des „Monitoring" verwendet, für den je nach Schwerpunktsetzung unterschiedliche Definitionsvarianten existieren: Einmal werden darunter Aktivitäten verstanden, mittels derer die Beteiligten einer Interaktion die Verhaltensweisen anderer, sofern sie für die Organisation ihrer Beteiligungsweise entscheidend sind, wechselseitig wahrnehmen und beobachten (Deppermann/Schmitt 2007: 35). Weiterhin verweist Monitoring aber auch auf die Selbstbeobachtung (self-monitoring) und Selbstkontrolle zur Koordination des eigenen Verhaltens (vgl. Sacks 1992 zit. nach Hutchby/Wooffitt 1988: 189). Einen weiteren Ansatz liefert Marjorie Harness Goodwin (1980), die Monitoring als Bestandteil einer interaktiv konstituierten Struktur fasst, mittels derer die Fremdwahrnehmung und Fremdbeobachtung der Interaktionspartnerinnen organisiert wird. Sie beschreibt dabei einen reflexiven Zusammenhang zwischen Sprecher und Hörer und zeigt, wie offen, sensibel und veränderbar die Turnproduktion des Sprechers im Hinblick auf die vom Hörer produzierten Hinweise seiner Beteiligung an der Sinnproduktion im Sinne einer Koproduktion ist. Schließlich ist mit Monitoring in einem erweiterten Sinne auch ein Verfahren gemeint, das in einem engen Zusammenhang mit dem steht, was Garfinkel mit „accountability" bezeichnet hat. Wenn Akteure soziale Wirklichkeit interaktiv herstellen, dann sind sie immer auch damit beschäftigt, ihre Aktivitäten für einander wechselseitig „accountable", also „beobachtbar-und-mittelbar" zu machen (Bergmann 2003). Wichtig ist dabei, dass die Aktivitäten, die zur Bewältigung bestimmter Aufgaben zum Einsatz kommen, mit den Verfahren, mittels derer die Akteure ihre Bearbeitung von und Orientierung an dieser Aufgabe praktisch verständlich machen, identisch sind. Demnach sind die Realisierung einer Handlung und deren praktische Beschreibung, oder besser praktische Erklärung (vgl. Bergmann 1981: 13), ein und derselbe Akt (vgl. Garfinkel 1967: 1). Auf der Grundlage dieses Identitätstheorems sind Sinngebungsprozesse also nichts Privates, das sich im Bewusstsein der Interagierenden vollzieht, sondern stets als öffentliches, transparentes und sozial geteiltes Ereignis zu betrachten. Die konkrete Realisierung dieser permanent mitlaufenden Prozesse der intersubjektiven Abstimmung und Sinnkonstruktion ist angewiesen auf rede- und handlungsbegleitende Monitoring-Aktivitäten im Sinne eines „Beobachtens-während-des-Sprechens".
84
2. Zur Ökologie der Übergabesituation
Auch für die Teilnehmerinnen von Übergabegesprächen ergibt sich die Notwendigkeit, sich hinsichtlich ihres gemeinsamen Handelns und ihrer gemeinsamen Aufgabenorientierung lokal zu koordinieren (vgl. Mondada 2007: 55). Beispielsweise wird also die Herstellung eines geteilten Verständnisses darüber, was hier und jetzt in welcher Weise, unter welchen Bedingungen, mit welchen Ressourcen etc. zu tun ist, selbst zu einer Aufgabe. Die kommunikativen Verfahren, die die Beteiligten zur Lösung dieser Aufgabe einsetzen, sollen im Folgenden näher betrachtet werden. Kooperation und Koordinierung von Aktivitäten Nimmt man Koordinierung vorwiegend als verkörperte Aktivität in den Blick, so lassen sich in der Übergabe eine Reihe solcher Aktivitäten ausmachen, die an der wechselseitigen Ausrichtung der Akteurinnen beteiligt sind: Hierzu zählen etwa das wechselseitige Anzeigen von Verfügbarkeit und Bereitschaft, wie auch die Aushandlung von Aufmerksamkeit über die Wahl der Körperposition und die Gestaltung der Blickorganisation, das Lesen von Handzetteln, Patientenaufzeichnungen und sonstigen in der Interaktionsumgebung angebrachten pflegerischen oder medizinischen Aufzeichnungen, sowie nicht zuletzt das Anfertigen von Notizen und das Verfassen von pflegerischen Aufzeichnungen. Wie Mondada, auch unter Berücksichtigung von Kendon (1990) und Vertreterinnen der „workplace studies" (Suchman 1996, Goodwin 1996), sehr deutlich betont, kommen bei der Koordinierung „ (...) Beziehungen von Simultanität und nicht nur von Sequenzialität ins Spiel; sie trägt also den verschiedenen Dimensionen Rechnung, die bei der Organisation des Sprechens und Handelns zum Tragen kommen" (Mondada 2007: 63). Zwischen der Koordinierung von Aktivitäten der Akteurinnen und ihrer Kooperation bei der Durchführung einer bestimmten Aufgabe besteht ein grundlegender Unterschied. Differenzbildend ist in diesem Fall das, was Dausendschön/Krafft (1991) als „konversationelle Aufgabe" bezeichnet haben. Damit meinen sie, vereinfacht ausgedrückt, eine (implizite oder explizite) Vereinbarung zwischen den Gesprächsbeteiligten darüber, wie es im Gespräch weitergehen soll, also über den Fortgang der Interaktion, sowie über ihren Gegenstand und das damit verfolgte Ziel (vgl. Dausendschön/Krafft 2007: 183f.). Diese Vereinbarung gewährleistet, in den Worten der Autoren, eine Art „Globalsteuerung" für den daran anschließenden Interaktionsverlauf, insbesondere hinsichtlich der bereits erfolgten Selektion bestimmter Aktivitäten und ihrer Beibehaltung im Fortgang des Gesprächs. Die geordnete und aufeinander abgestimmte Fortsetzung von Aktivitäten, wie z. B. das Blicken auf ein Notizbuch und das gleichzeitige Anfertigen von Notizen auf der einen Seite und das freie Referieren bei wechselnder Blickorganisation und gleich
Die interaktive Organisation der Aufgabenorientierung
85
bleibender Körperpositur auf der anderen Seite, ist demnach auf die „Verbindlichkeit" der konversationeilen Aufgabe bzw. der ihr zugrunde liegenden Vereinbarung zurückzuführen. In diesem Fall sprechen die Autoren von „Kooperation". Das Konzept der „Koordinierung" wird demgegenüber in Situationen wirksam und beobachtbar, in denen etwa auf der Ebene der Gesprächsbeteiligung offen ist, welcher der Beteiligten die Verantwortung für den weiteren Verlauf übernehmen wird, so dass erst eine neue konversationelle Aufgabe formuliert werden und dementsprechend eine Aushandlung stattfinden muss. Da die an einem Gespräch beteiligten Personen laut Dausendschön-Gay und Krafft ständig darauf zu achten haben, ob ihre Koordinierungsaktivitäten zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe ausreichend sind oder nicht, stellen die Autoren Koordinierung als Daueraufgabe (dies.: 191) in eine Reihe mit anderen grundlegenden Aufgaben der Interaktion. Dadurch scheint allerdings die meines Erachtens sinnvolle und analytisch fruchtbare Abgrenzung zum Konzept der Kooperation ein wenig zu verblassen. Anhand des im vorigen Abschnitt bereits analysierten Beispiels (Fokussierung auf den Stixplan) lassen sich einige typische Elemente, der „Koordinierung" von Aktivitäten (im engeren Sinn) aufzeigen: Da das Ziel und der Gegenstand der Übergabegesprächs im Sinne der „konversationeilen Aufgabe" grundsätzlich außer Zweifel zu stehen scheinen - die Übergeberin hat z. B. das (vorregulierte) Rederecht inne, führt Themen ein (Themenführerschaft) etc. - besteht die Verständigungsarbeit der beiden Akteurinnen im Beispiel hauptsächlich darin, den Inhalt eines weit außerhalb des üblichen Sichtfeldes befindlichen Objekts zu identifizieren. Das Interaktionsgeschehen erfährt durch die mittels einer Änderung der Blickrichtung, einer verkörperten Geste und anschließender Verbalisierung herbeigeführte Öffnung des Interaktionsraums buchstäblich eine Wendung, die eine Neuaushandlung und Koordinierungsaktivitäten der beiden Beteiligten erforderlich macht. Da die Übernehmerin ihrerseits der Orientierung ihrer Kollegin folgt, kommt die Koordinierung erfolgreich zustande. Betrachtet man hingegen die Übermittlung von Informationen über den aktuellen „Stand der Dinge auf der Station" durch die Übergeberin an die Übernehmerin als Kernaktivität bzw. als eigentliche konversationelle Aufgabe, dann stellt die Öffnung des Interaktionsraums die Beteiligten vor eine zu lösende „konversationelle Nebenaufgabe". Der von der Übergeberin zur Initiierung der Aufmerksamkeitsverschiebung eingesetzte kommunikative Aufwand ist sehr hoch. Die kurzzeitig erforderliche Refokussierung des kommunikativen Geschehens von der Kernaktivität des Übergebens auf das gemeinsame Überprüfen der Aktualität des Stixplans erfolgt in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten: a) Die Intensitäts-
86
2. Zur Ökologie der Übergabesituation
Steigerung wird erreicht durch additiven Aufbau der Modalitäten bzw. Ausdrucksebenen (Blick/Abb. 1, Blick + Körperneigung, Blick + Körperneigung + Verbalisierung/Abb. 2 und 3), b) Die Ausdrucksebenen stehen in einer reflexiven Beziehung zueinander, d. h. die eine Ebene liefert bereits Erklärungen für die nächste Ebene, jede zusätzliche Ausdrucksebene kommentiert und bestätigt gewissermaßen die vorherigen in ihrem Sinngehalt. # 4:
Innere / 'steht der um zehn uhr da auf dem stixplan' ((14:36-15:15)) Ü: Übergeberin (rechts); N: Übernehmerin (links)
01 N:
R
hm_hm
02 Ü:
R
das muss man nur wechseln-
03
°h diabetiker
04
05 Ü:
äh=is er auch,
(2.0)
MM
blickt auf die Wand,
stix£plan?> 06 N:
MM
(.) müsste eigentlich-
[dreht sich um 180° und blickt
Abb. 4
[auf die Wand
Abb. 5
14:47,01
{stix[plan?)
14:48,19
R 07 Ü:
[beugt den Oberkörper nach vorn [steht der um zehn uhr da auf dem
R
R
[§SÜ:*&4[ja steht-
gut (.) dann kriegt (
) dreiundreissigsiebzig-
87
Die interaktive Organisation der Aufgabenorientierung
Im folgenden Transkriptauszug soll es im Unterschied zum vorigen Beispiel um die Kooperation der beiden Teilnehmerinnen gehen, dabei steht das Zusammenspiel von Vokalität, Blickverhalten und der körperlichen Aktivitäten und Objektmanipulation im Zentrum der Analyse. Inhaltliche Kurzbeschreibung: Die Übergeberin (Ü) stellt eine Patientin (Frau „Bünder") in der auch sonst üblichen Weise vor. Sie beginnt mit der Lokalisierung auf der Station und dem Namen der Patientin, referiert die medizinische Vorgeschichte, nennt die gesundheitlichen Beschwerden und berichtet über die getroffenen medizinisch-pflegerischen Maßnahmen. Basierend auf dem geteilten professionellen Fachwissen der Akteurinnen lassen sich implizit aus diesen Informationen zu Eigenschaften, Krankheiten bzw. Beschwerden, aktuellem Zustand und aktueller Versorgung der Patientin der zu erwartende, offenbar hohe Pflegebedarf und damit verbundene Arbeitsaufträge für die Übernehmerin ableiten. So läuft etwa die Infusion noch, d. h. die Übernehmerin ist dafür verantwortlich, das Infusionsbesteck zu überprüfen, den Infusionsständer zu kontrollieren und gegebenenfalls die Tropfgeschwindigkeit der Infusionslösung zu reduzieren. Die Übergeberin schließt mit einem mehr oder weniger expliziten Arbeitsauftrag, indem sie die Übernehmerin - in Form einer konjunktivisch als Empfehlung fomulierten Aufforderung („würde ich...") - anweist, die Körpertemperatur der Patientin zu messen. # 5:
Innere / 'hat ihn wahrscheinlich auch falsch verstanden' ((16:10-16:50)) Ü: Übergeberin (rechts); N: Übernehmerin (links)
01
(1.0)
02 Ü: N:
R
in der vierundachtzig frau bünder,
MM MM
blickt auf eigene Liste auf dem Schoß blickt auf eigene Liste auf dem Schoß, setzt den Stift kurz an, und blickt weiterhin auf die eigene Liste,
03
(0.5)
04 Ü:
R
die is gekomm=mit ner (kara=mazepin) =überdosiex-ung-
MM
blickt auf eigene Liste auf dem Sch[oß
05
(2.0)
N:
MM
[notiert und blickt zu Ü: und senkt den Kopf
0 6 Ü: N: 07 ü: N:
R
das hat=se wohl vom äh: neurologen verschrieben gekriegt
MM
blickt auf eigene Liste auf dem Schoß
MM
blickt auf eigene Liste und notiert
R
(weil die
MM
blickt auf eigene Liste auf dem Schoß
=algIE) (.) und hat [ihn wahrschein=
MM
notiert und blickt auf die Liste
[blickt zu Ü:
88
2. Zur Ökologie der Übergabesituation
08 Ü: R MM N: 09 U:
=lich auch falsch verstanden das is eine=so=ne «p>demente dame> blickt auf eigene Liste auf dem Schoß
MM führt re Hand zum Gesicht und blickt zu Ü: R
.h HAT ne telemetrie um-
MM
blickt auf eigene Liste auf dem Schoß
N: MM blickt auf eigene Liste und notiert 10 Ü:
R
hat äh: übelkeit=schwindel=erbrechen,
MM
blickt auf eigene Liste auf dem Schoß
N: MM blickt auf eigene Liste und notiert 11
(1.0)
Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
16:35,24 im ir.orrsent .s
16:37,02 [blickt zu N:
16:39,21
12 Ü:
R
im moment läuft noch ne infusion mit
MM
blickt auf eigene Liste
N: MM blickt auf eigene Liste und notiert 13 Ü:
R
insgesamt (1.5)
MM
blickt weiterhin auf N:
(enzepedokaze=el?)(2.5) [bückt zu H: [
N: MM blickt auf eigene Liste und notiert Abb. 4
Abb. 5
Abb. 6
• s p spsi pp hhm WSS ffPPPi
Iii j IP a 1^vSsn
~ ¿IL Am
16:40,00 insgesamt
16:41,19 insgesamt
16:42,11 insgesamt
(1.5)
(•5)
u j >
'^täi
Die interaktive Organisation der Aufgabenorientierung
14 Ü: N: 15 Ü: N: 16 Ü: N:
R
fühlt sie sich aber besser m=nich so starke Übelkeit, ahm:
MM
blickt auf N:
MM
blickt auf eigene Liste und notiert
R
(-) heute abend hat(te) sie siebenundreissig=neun da würd
MM
Bl[ick auf Boden und blickt zu N:
MM R
89
[blickt zu 0: ich nochmal nach=messen
MM
blickt zu N : —
MM
blickt auf die eigene Liste und notiert
Wie aus der multimodalen Transkription ersichtlich wird, hat die Übergeberin im ersten Teil der transkribierten Passage zunächst durchgehend keinen Blickkontakt mit der Übernehmerin. Im Anschluss an die listenartig aufgezählten (medizinischen und pflegerischen) Merkmale der Patientin „Telemetrie, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen" (Z. 9-10) weist die Übergeberin auf eine ihre Schicht überdauernde Pflegehandlung hin (Infusion). Erst ab Zeile 12 hebt sie den Blick von ihrer Vorlage und verfolgt - während sie zunächst noch weiterredet - die Schreibaktivitäten ihrer gegenüber sitzenden Kollegin. Diese Reorientierung im Blickverhalten korrespondiert mit einer Zäsur auf der verbalen Ebene, markiert durch ein resümierendes „insgesamt", das von zwei Sprechpausen eingerahmt ist (Z. 12-13). So ergibt sich hier im Zusammenspiel verbaler und körperlicher Interaktionsaktivitäten ein Moment der kooperativen Neu-Abstimmung der Akteurinnen: Während der Redefluss der Übergeberin für einen Augenblick suspendiert ist, hat sie ihren Blick auf das Schreib-Blickfeld ihrer gegenüber sitzenden Kollegin gerichtet, während diese fortfährt, das zuvor Gehörte in Form von Notizen festzuhalten. Die Schreibtätigkeiten der Übernehmerin geraten dadurch buchstäblich in den Fokus der Aufmerksamkeit. Unter dem Gesichtspunkt von Koordination und Kooperation betrachtet, demonstriert diese Sequenz den Einsatz kommunikativer Ressourcen für den erforderlichen simultanen Abstimmungsprozess der Interagierenden. Folgt man hier dem Konzept der Kooperation, dann etabliert sich die „Globalsteuerung" (Dausendschön/Krafft 2007) über den jeweiligen Sinn der von den Teilnehmerinnen simultan vollzogenen Aktivitäten. „Die vereinbarte konversationelle Aufgabe leistet eine Globalsteuerung der folgenden Interaktion, indem sie eine bestimmte Selektion der Aktivitäten fordert (Abweichungen werden gekennzeichnet, oft begründet, sonst sanktioniert) und auch für alle Aktivitäten den Interpretationsrahmen bildet" (dies.: 184).
90
2. Zur Ökologie der Übergabesituation
Im Übergabegespräch zeigt sich die Wirkung des damit verbundenen Arbeitsauftrags an die Beteiligten, das heißt der ihrer Interaktion zugrunde liegenden konversationeilen Aufgabe, in der relativen Gleichförmigkeit und Konstanz des interaktiven Arrangements. Die Übergeberin hält einen Notizzettel in der Hand, blickt darauf und liest vor; die ihr gegenüber sitzende Übernehmerin hat ihren Blick auf die auf ihrem Schoß liegende Schreibunterlage gerichtet und macht zeitgleich Vermerke darin. Dieses zunächst stabile Arrangement von Aktivitäten und Blick- / Körperorientierungen (Abb. 1) ändert sich, als die Übergeberin ihre Blickorientierung verändert und zur Übernehmerin schaut (Abb. 2) und ihre Redeaktivität auf die Schreibaktivität der Übernehmerin abstimmt (Abb. 3). Die Initiative geht dabei ganz klar von der Übergeberin aus, sie ist kooperativ, indem sie das Timing für die Fortsetzung ihrer Patientenbeschreibung am Aktivitäts- bzw. Bereitschaftsstatus ihres Gegenübers ausrichtet, den sie durch ihre visuelle Prüfung ermittelt hat (vgl. Abb. 4-6). Der für die Analyse entscheidende Abschnitt beginnt bereits in der zweieinhalbsekündigen Pause nach '(enzepedokaze=ei?)' in Zeile 12. Die Übergeberin hält ihren Blick auf Ns Schreibunterlagen gerichtet und beobachtet offensichtlich, wie diese ihre Notizen macht. Nachdem sie mit „insgesamt" die Fortsetzung ihres Redezugs eingeleitet hat, zögert sie diesen durch eine weitere Pause von eineinhalb Sekunden hinaus. Diese Form des „Übergebens" hat einen ausgeprägten diktierenden Charakter, womit die Übergeberin wohl auch die Wichtigkeit und Notizwürdigkeit73 der Information zum Ausdruck bringt. Durch die Art und Weise, wie sie ihren Blickfokus auf das Notizblatt der Übernehmerin verlegt und dabei zugleich ihren Sprechrhythmus mit deren Schreibaktivitäten abstimmt, zeigt sie der Kollegin darüber hinaus jedoch gleichzeitig ihre grundsätzliche Verfügbarkeit an. Demonstration von Verfügbarkeit meint hier ein besonderes, auf Kooperation ausgerichtetes Signalisieren von Wahrnehmen-Können seitens der Übergeberin. Sie ist ihrer Kollegin in einer Weise zugewandt, die beiden Kolleginnen gleichzeitig eine wechselseitige Aufmerksamkeit ermöglicht. Postuliert man mit Luhmann, dass die Übergeberin zugleich wahrnimmt, dass sie von ihrer Kollegin wahrgenommen wird, und dass auch ihr Wahrnehmen des Wahrgenommenwerdens wiederum von dieser wahrgenommen wird (vgl. 73
Die Notizwürdigkeit der Information wird von der Übergeberin auch bereits durch die stark ansteigende Intonation bei ' (enzepedokaze=ei? ) ' markiert.
Zusammenfassung
91
Luhmann 1984: 560f.),74 so bildet dies die Grundlage für die oben geschilderte multimodalen Kooperations- bzw. Abstimmungsprozesse. 2.4
Zusammenfassung
Ausgangspunkt dieses Abschnitts bildete der Fokus auf die kommunikative Ökologie der Übergabesituation. Damit sind im Wesentlichen die materiellen und situativen Bedingungen eines Übergabegesprächs, sowie das körperliche Arrangement und die körperlichen Aktivitäten der Beteiligten gemeint. Vereinfacht ausgedrückt, ging es um das Zusammenspiel von Sprache, Interaktion, Gegenständen und Raum im Übergabegespräch. In der vorgestellten Konzeption ist Raum immer auch als Interaktionsraum zu begreifen, dessen Transformation vorwiegend aufgabenzentrierten Anforderungen folgt. In der Absicht, die für Übergaben charakteristische Bandbreite der unterschiedlichen Ausprägungen körperlicher Arrangements aufzuzeigen, aber auch um den in den folgenden Kapiteln vorgestellten empirischen Analysen den Zugang zum spezifisch aufbereiteten Datenmaterial zu erleichtern, wurde ein für Übergaben kennzeichnendes Formationsrepertoire unter Bezugnahme auf Kendon (1990) angelegt und vorgestellt. Die Formationen unterscheiden sich nach der Teilnehmerinnenzahl und der damit zusammenhängenden Verantwortungsreichweite der beteiligten Personen. Vor dem Hintergrund des eingangs erwähnten Forschungsinteresses an der kommunikativen Ökologie der Übergabesituation wurde als weiteres Unterscheidungskriterium das die Übergabe „begleitende" gegenständliche Arrangement vorgeschlagen. Im Mittelpunkt der empirischen Analyse stand in diesem Abschnitt die Absicht, das körperliche und physikalische Arrangement in Übergabe-Situationen in den Blick zu nehmen. Dabei konnte herausgearbeitet werden, wie das raumökologische Setting von den Beteiligten zur interaktiven Organisation der Aufgabenorientierung als vielseitige Ressource genutzt wird. Wie im ersten Beispiel zu sehen war, geschieht dies durch die - analytisch herausgearbeitete körperlich-präsentische Aneignung der Interaktionsumgebung. Demnach dient der lokale Kontext eines Stationszimmers den Beteiligten als jederzeit abrufbarer Speicher von pflegerelevanten Informationen. Es konnte gezeigt
74 „Wenn Alter wahrnimmt, dass er wahrgenommen wird und dass auch sein Wahrnehmen des Wahrgenommenwerdens wahrgenommen wird, muss er davon ausgehen, dass sein Verhalten als darauf eingestellt interpretiert wird; es wird dann, ob ihm das passt oder nicht, als Kommunikation aufgefasst, und das zwingt ihn fast unausweichlich dazu, es auch als Kommunikation zu kontrollieren" (ders.: 561f.).
92
2. Zur Ökologie der Übergabesituation
werden, dass die jeweils spezifische Interaktionsumgebung in Übergaben neben der üblichen „Spickzettel" und handschriftlichen Notizen der Akteur Innen eine Art Gedächtnisfunktion - zur Unterstützung des Sich-Erinnerns und Memorierens - erfüllt. Ein weiterer entscheidender Aspekt der Analyse waren der Zusammenhang zwischen dem verbalen Handeln und dem körperlichen Verhalten der Beteiligten sowie dessen wechselseitige simultane und sequentielle Abstimmung, insbesondere bei der Durchführung der von den jeweiligen Vertreterinnen zu beachtenden Aufgaben. Hierfür wurden zuvor die analytischen Konzepte Monitoring, Kooperation und Koordinierung vorgestellt und auf der Grundlage empirischer Phänomene erläutert. Der zuvor bereits vorgestellte Gesprächsauszug (# 3 'steht der um zehn uhr da auf dem stixplan') wurde neuerlich aufgelistet, diesmal aber unter besonderer Berücksichtigung des Konzepts der Koordinierung (vgl. # 4). Auf der Grundlage dieses Konzepts konnte der kommunikative Mehraufwand für die Beteiligten - insbesondere der Übergeberin - beschrieben werden, der aufgrund der nur partiell feststehenden „konversationellen Aufgabe" (Dausendschön-Gay/Krafft) zusätzliche Koordinierungsaktivitäten der beiden Beteiligten erforderlich gemacht hat. Anhand des dritten und letzten empirischen Beispiels konnte gezeigt werden, dass durch die gezielte Analyse der Kooperation zwischen Übergeberin und Übernehmerin die erforderlichen simultanen Abstimmungsprozesse der beiden Personen deutlich werden. Ausgangspunkt war die Veränderung des zunächst relativ stabilen Arrangements von Schreibaktivitäten sowie Blick- und Körperorientierungen. Im Zentrum stand die Redeaktivität und Blickorientierung der Übergeberin, die ihren „Bericht" auf die Schreibaktivitäten der Übernehmerin abstimmt, indem sie sich am Aktivitäts- bzw. Bereitschaftsstatus ihres Gegenübers orientiert.
3.
Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
Die Übergabe ist ein spezifischer Typus von Interaktionsereignissen, der hier zunächst als Gesprächseinheit mit einem jeweils durch charakteristische Merkmale gekennzeichneten und beschreibbaren Beginn und einem Abschluss gefasst wird. Aus Analyse-strategischer Sicht sind die Eröffnung wie die Beendigung von Übergabegesprächen sinnvolle erste Zugänge für die Untersuchung, da man dabei die Übergänge von einem alltagsähnlichen zu einem institutionellen Gesprächstyp und vice versa in den Blick kommt. Die Art und Weise, wie der Einstieg in ein Übergabegespräch von den daran beteiligten Akteurinnen vollzogen wird, etabliert gleichzeitig situativ relevante Identitäten und Beteiligungsrollen, z. B. als Übergeberln und als Übernehmerln, aber auch - im Hinblick auf nicht als Handelnde an der Interaktion beteiligte Personen, über die jedoch gesprochen wird - als Patient/in, Angehörige/r, behandelnde/r Arzt/in etc. Ebenfalls von Interesse sind an dieser Stelle der thematische Aufbau, die strukturelle Gesprächsorganisation, die Abschnitte und Phasen, in die ein Übergabegespräch von den Teilnehmerinnen unterteilt wird. Hinzu kommen Analyseaspekte auf der Ebene der Gesprächsorganisation, wie die Einführung von Themen, die Organisation des Sprecherwechsels, die Strukturierung der Gesprächsbeiträge und nicht zuletzt der Themenverlauf. Zum Einstieg in die Analyse soll jedoch zunächst die typische Ablaufstruktur einer Übergabe betrachtet werden. Folgende Fragestellungen stehen hierbei im Mittelpunkt: •
In welche gesprächsstrukturelle Phasen lässt sich ein Übergabegespräch einteilen, welche typischen Merkmale weisen diese auf und worin unterscheiden sie sich voneinander? Gibt es auffällige Gleichförmigkeiten oder typische Episoden, die eine Übergabe strukturieren?
•
Wie werden Übergänge realisiert?
•
Mit welchen kommunikativen Mitteln zeigen die Beteiligten einander an, wann es beginnen soll bzw. wann die Übergabe als abgeschlossen betrachtet werden kann? Mit anderen Worten, welche Aktivitäten des Gesprächsbeginns und der Gesprächsbeendigung werden eingesetzt?
•
Wodurch erhält das soziale Geschehen „Übergabe" seinen genuinen Charakter als ein institutionenspezifisches Ereignis?
•
Und abschließend, ganz aus der ethnomethodologischen Tradition kommend: Wie wird die Übergabe (als soziale Tatsache) von den Akteuren kommunikativ hergestellt?
94
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
3.1
Die Ablaufstruktur von Übergabegesprächen
Die folgende Übersicht zeigt den prinzipiellen Aufbau von Übergabegesprächen. Nach der Gesprächseröffnung folgen für sich abgeschlossene Informationsblöcke je nach Patientenzahl, wobei sich jeder Informationsblock auf einen Patienten bzw. eine Patientin bezieht. Die Reihenfolge der Informationsblöcke richtet sich nach den Stationszimmern und den darin jeweils belegten Betten. Im folgenden Beispiel (Innere Station/siehe unten) werden die gesamten Stationszimmer auf zwei Pflegekräfte aufgeteilt (Bereichspflege), dementsprechend übergeben diese ihre Zuständigkeitsbereiche nacheinander. Gesprächseröffnung Infoblock pro Patient/ in Infoblock pro Patient/in Infoblock pro Patient/ in Infoblock pro Patient/in Infoblock pro Patient/in Gesprächsbeendigung Übersicht 1: Typische Struktur eines Übergabegesprächs Der jeweils auf eine/n Patient/in zugeschnittene Informationsblock hat im Regelfall die folgende thematische Ablaufstruktur: •
Lokalisierung (Zimmernummer oder Bettnummer)
•
Anrede / Geschlecht und Name des Patienten / der Patientin
•
Diagnose bzw. durchgeführte / noch durchzuführende medizinische Maßnahme
•
gegenwärtiger Gesundheitszustand
•
besondere medizinische Maßnahmen bzw. Auffälligkeiten
•
bereits durchgeführte bzw. noch bevorstehende empfohlene - pflegerische Maßnahmen
•
Sonstiges
Übersicht 2: Typischer Aufbau des Infoblocks pro Patient/in
-
evtl.
auch
Gesprächseröffnung
95
Auffällig ist die augenscheinlich nach aufgabenorientierten Gesichtspunkten geordnete, aber empirisch noch genauer zu überprüfende thematische Abfolge. Jede in der Übergabe als Patient vorgestellte und beschriebene Person muss zuvor auf der Station lokalisiert werden. Die Lokalisierung eines Patienten geht gleichzeitig einher mit der Lokalisierung - d. h. Abgabe und Zuweisung - von Verantwortlichkeiten. Ein weiteres obligatorisches Element ist die mit der Lokalisierung verknüpfte Nennung des Familiennamens. Erst danach folgen medizinisch relevante Angaben, wie etwa die Diagnose, Medikation usw. Und es mag überraschen, dass bei den Übergaben des Pflegepersonals jene Informationen, die hauptsächlich dessen Aufgabenbereich betreffen, für gewöhnlich erst im letzten Drittel des patientenbezogenen Informationsblocks behandelt werden. Auf den ersten Blick erscheinen Übergaben des Pflegepersonals als sehr „medizinlastig"; worauf dies zurückzuführen ist und welche Bedeutung diese medizinischen Indikatoren für die erfolgreiche Durchführung einer Übergabe haben, gilt es anhand der empirischen Beispiele genauer zu untersuchen. 3.2
Gesprächseröffnung
Analysen zu Eröffnungen haben in der Konversationsanalyse Tradition (exemplarisch dazu Schegloff 1968). Als ausgewählte Beispiele für Arbeiten in institutionellen Kontexten seien hier genannt: Sacks' (1967) Analysen von Anrufen in einem Suizid-Präventions-Zentrum ('suicide prevention centre'), Heath' Arbeiten zur Arzt-Patienten-Kommunikation (1981, 1986) oder die Studien zu Polizeinotrufen (Whalen/Zimmerman 1990; Zimmerman 1992), Feuerwehrnotrufen (Bergmann 1995), Arbeitsbesprechungen (Meier 1997), einer EDV-Software Helpline (Baker/Emmison/Firth 2001) sowie eine Studie aus dem Bereich der Unterrichtskommunikation von Ayaß/Pitsch (2009). Das besondere analytische Interesse von Eröffnungen liegt unter anderem darin begründet, dass die Beteiligten sich an solchen Übergangsstellen zwischen verschiedenen Aktivitäten über die nun anstehende Interaktion abstimmen müssen. Ihr wechselseitig angezeigtes Verständnis von der sozialen Situation, in der sie sich befinden, wird in solchen Phasen für den Forscher besonders gut beobachtbar. Eröffnungen haben darüber hinaus generell auch eine identitätsstiftende Dimension; so zeigen Analysen, dass die Akteure gerade in ihren ersten Redebeiträgen ihre spezifischen Identitäten so aufeinander ausrichten, dass der Fortgang des Gesprächs gewährleistet ist (vgl. Mondada/Schmitt 2010). Dass Gesprächseröffnungen in der Regel mit einem besonderen „kommunikativen Aufwand" verbunden sind, zeigt sich unter anderem an einem für Eröffnungssequenzen typischen Phänomen, den sogenannten VorEröffnungen (,pre-beginnings'). Exemplarische Studien hierzu sind jene von Turner (1972) und Boden (1994). Turners Analyse einer Therapiesitzung zeigt,
96
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
dass die Phase unmittelbar vor dem eigentlichen Beginn der Therapiesitzung von den beteiligten Personen im Sinne einer Prä-Phase dazu genutzt wird, sich auf die anschließende Sitzung auszurichten und dabei Aktivitäten auszuführen, die diese vorbereiten (wie z. B. nacheinander eintreffen, Platz nehmen). Turner ging es darum zu fragen, welche Aktivitäten zur Gruppentherapie gehören und welche als vorgängig und somit als Aktivitäten außerhalb des Therapiegesprächs markiert werden. Der Wechsel von 'Pre-Therapy Talk' zu 'Therapy Talk' ist nämlich eng damit verbunden, wie die beteiligten Personen ihre Äußerungen wechselseitig deuten, schließlich sind die Äußerungen der Personen mit dem Beginn der Therapie keine gewöhnlichen Gesprächsbeiträge mehr, sondern ab dann solche von Patienten, die zum Gegenstand der Analyse des Therapeuten geworden sind. In ähnlicher Weise, jedoch in einem anderen Kontext, hat Boden Eröffnungen von Arbeitssitzungen untersucht, die sie als 'premeeting talk' bezeichnet. Auch hier finden Aktivitäten der Sitzungsteilnehmer vor dem eigentlichen Beginn der Sitzung statt, wie z. B. nacheinander im Sitzungszimmer eintreffen, einen Sitzplatz aufsuchen und währenddessen als ganze Gruppe bzw. in Kleingruppen informelle Gespräche führen. Bodens Analyse zeigt, dass der Übergang vom 'premeeting talk' hin zu einem gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus, einer bestimmten Interaktionsordnung, also zum Beginn der Sitzung z. B. mittels Setzung bestimmter Markierungen (z. B. 'okay', 'Uhm', 'okay', 'so' etc.) initiiert wird (vgl. 1994: 96f). Die bislang vorgelegten Studien zu Übergabegesprächen basieren ausschließlich auf Audiomaterial (Walther 1997, Grosjean 1997/2004, Kelly 1998, Oberzaucher 2004). Die Phase der Gesprächseröffnung war zwar teilweise Gegenstand der Analyse (vgl. Oberzaucher 2004), die Reichweite der Aussagen darüber sind jedoch äußerst begrenzt. Als problematisch hat sich vor allem die Deutung von vermeintlichen Gesprächspausen zu Beginn der Übergaben erwiesen. Hier können sich Forscher zwar mit ethnografischen Skizzen und Notizen durch die Analyse retten, fundierte Aussagen scheinen jedoch eher schwierig. Das vorliegende Videomaterial soll hier Abhilfe leisten. So zeigt etwa Heath (1986: 25f) für den Beginn von Arzt-Patient-Kommunikationen, welche immense Bedeutung der schrittweise Aufbau von Wechselseitigkeit ('recipiency') und Verfügbarkeit ('availability') hat und welche Rolle dabei die wechselseitige Ausrichtung der Körperpositionen, die Blickorganisation und der Einsatz von z. B. Schreibaktivitäten des Arztes spielen. Aus multimodaler Perspektive werden also plötzlich Aktivitäten sichtbar, die im dafür blinden Audiomaterial nicht erkennbar waren oder sich hinter vermeintlichen Gesprächspausen verbergen könnten.
Das Vorgespräch und die Herstellung von Bereitschaft
3.3
97
Das Vorgespräch und die Herstellung von Bereitschaft zum Einstieg in die Übergabe
Bevor wir die für eine Übergabe so charakteristische Ablaufstruktur näher beleuchten, sind zunächst noch einige Bemerkungen zur Eigentümlichkeit der Übergabesituation angebracht. Die Übergaben finden dreimal täglich im 'Stationszimmer' statt: morgens um 6 Uhr, mittags um 13 Uhr und abends gegen 20 Uhr. Eine Übergabe ist eine Schnittstelle zweier Arbeitsschichten (übergebende Schicht, übernehmende Schicht). Charakteristisch für die Übergabesituation ist der latente Zeitdruck, unter dem die Beteiligten stehen. Die einen schließen ihren Arbeitstag mit der Übergabe, und für die anderen beginnt der bevorstehende Dienst mit diesem Kommunikationsereignis. Dementsprechend ist zu vermuten, dass die Vertreterinnen der beiden Schichten unterschiedliche Zeiterwartungen in die Übergabesituation mitbringen. Die Akteure der übergebenden Schicht scheinen gegenüber ihren nachfolgenden Kollegenlnnen so etwas wie eine „Bringschuld" an aufgabenorientierten Informationen erfüllen zu müssen. Ihre Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, die relevanten Informationen aus der Fülle an Ereignissen aus der auslaufenden Schicht herauszufiltern und sie den Kolleginnen in geordneter und nachvollziehbarer Form mitzuteilen. Der Beginn
Wenngleich für jede auf der Station tätige und an der Übergabe teilnehmende Person deren Beginn erwartbar ist, wenn die „Richtzeit" erreicht wurde und der tatsächliche Beginn der Übergabe unmittelbar bevorsteht, so ist dennoch die Abstimmung über den genauen Moment des Einstiegs und die Herstellung und wechselseitige Signalisierung der unmittelbaren Bereitschaft zum Start eine kommunikativ zu bewerkstelligende Aufgabe. Für gewöhnlich werden Übergaben damit eröffnet, dass sich bestimmte Pflegekräfte (ÜG und ÜN) in eine dafür geeignete Räumlichkeit ('Stationszimmer' bzw. gelegentlich auch 'Schwesternzimmer' genannt) zurückziehen, ein bestimmtes (Sitz)Arrangement einnehmen, Schreibmaterial bzw. Notizen zur Hand nehmen und indem dann im Regelfall die mit der Übergabe ihre Schicht quittierende Pflegekraft das Übergabegespräch beispielsweise mit initiierenden Äußerungen und typischen 'boundary markers' ('gut', 'so' etc., vgl. Oberzaucher 2004) verbal eröffnet. Im folgenden Beispiel befinden sich fünf Personen (einschließlich des Forschers) im Raum; drei davon - zwei examinierte Pflegekräfte (Ül, Ü2) und eine Pflegeschülerin (S) - gehören der Nachmittagschicht an, der vierten Pflegekraft (N) steht der Nachtdienst bevor. Ül und N sitzen auf Höckern, Ü2 steht mit dem Rücken zur Kamera und ordnet Unterlagen; S erhält von Ül den
98
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
Auftrag Pflegeberichte zu sortieren und sie anschließend im Archiv abzulegen. S verlässt daraufhin den Raum (Zeile 11). Es folgt eine längere Pause, in der sich die Beteiligten auf einander ausrichten, sich wechselseitig Aufmerksamkeit signalisieren und, nachdem die rechts sitzende Übergeberin den Beginn auch verbal initiiert hat, anschließend einen Moment damit verbringen, jeweils eine für sie angemessene Sitzposition einzunehmen. # 6:
Innere/ 'glaub du warst jetzt länger nich da ne' ((1:03-1:20)) Ül: Übergeberin 1 (rechts), N: Übernehmerin (links), S: Schülerin, F: Forscher
01 Ül:
zusarranntackern und alles zusammen ins archiv (
02 S:
hast du schon alles sortiert;
03 Ül:
hab ich alle sortiert=h,
04 ?:
(
05 F:
((Lachen))
)
06
((unverständlich))
07 Ül:
/\JA:
08 S:
den TAcker de=das is ja der lOcher;
0 9 ?:
((gepresstes Lachen))
10 ?: MM 11 S:
((Sitzhocker-Rücken) dankesch[ön
12 F:
[bitte:
13
(2.0)
13a N: MM
[blickt auf S]
13b Ül: MM
[blickt auf Sl
13c N:
blickt auf Ül
MM
Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
1:13,09
1:14,03
1:16,10
Ül, N blicken auf S
N blickt auf Ül
so £ang=wa An
14 Ül: 15 N: MM
so £ang*wa An [ne[((rückt mit dem Sitzhocker))
16
hm=hm=((grinst) )
17 N: MM
wendet sifch Ül zu (1.0)
)
99
Das Vorgespräch und die Herstellung von Bereitschaft
Abb. 4
• J MIP
ISpjjg? njsfc^ Pdf -.-..^i fegp .
a " ;g fä
Im
i ^ M E a g 1 •I^BbBmI' ' : 1:17,17
1:18,22
wendet si[ch 01 U
Fortsetzung
18
Abb. 6
Abb. 5
Ü:
IT^CJÄ. 33 ? T 19 f ;|§
Y
-wM
[siebenunNEONzig die frau
Ä
^ ü * y^ai
jl
HKmI 1:19,15
[ fgi ebenunNEUNzig [webler;
Das Vorgespräch dreht sich um einen Arbeitsauftrag an S und bereitet indirekt bereits den Einstieg in das Übergabegespräch vor, denn mit dem Abgang der Schülerin tritt etwas „Neues" in den Vordergrund. Unmittelbar im Anschluss folgt die verbale Initiierung der Übergabe durch die Übergeberin 1. Unser Interesse gilt an dieser Stelle dem etwa zehn Sekunden langen Abschnitt zwischen dem Verlassen des Raumes durch S und dem Beginn des ersten Informationsblocks mit der Identifikation und Lokalisierung der Patientin Webler durch Ü1 in Zeile 17: ' [siebenunNEUNzig die frau [webier,-'. Auf der rein verbalen Ebene ist zu beobachten, wie Ü1 das Übergabegespräch in expliziter Form mittels der Formulierung'so fang=wa An [ne-' (Z. 14) initiiert. N ratifiziert dies mit einem zustimmenden Rezipientensignal (Z. 16) und Ü1 startet kurz darauf den Bericht über die erste Patientin. Nimmt man nun in der Analyse dieser Sequenz zum Audiomaterial das visuelle Material hinzu, erweitert also den Blick auf eine leibvermittelte multimodale Kommunikation (vgl. Goodwin 1994, 2000, Mondada 2003, 2007), so kann man sehen, welche wechselseitigen Koordinierungsaktivitäten von den beiden beteiligten Personen zur Bewerkstelligung dieses Übergangs eingesetzt werden. Nach der längeren Gesprächspause in Zeile 13 blicken im Anschluss Ü1 und N zunächst beide in Richtung S (vgl. Abb. 1), die gerade den Raum verlässt. Dann wendet N ihren Blick zu Ü1 (Abb. 2) und diese beginnt, mit ihren in der linken Hand gehaltenen Notizzetteln zu hantieren, senkt ihren Blick und zeigt mit ihrer als TagQuestion formulierten Ansage des Übergabebeginns in Zeile 14 ('so fang=wa An [ne-') zugleich ihre Bereitschaft zum Einstieg in diese neue Aktivität. Ein Blick auf das Material, der neben der verbalen Ebene auch nonverbale Phänomene wie die Bewegungen des Kopfes und die Blickrichtung, die Positionierung und Verlagerung der Körper im Raum sowie gesprächsbegleitende Tätigkeiten und Objektmanipulation (vgl. Deppermann et al 2009)
100
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
mit einbezieht, verdeutlicht die Unzulänglichkeiten einer rein auf die auditive Ebene beschränkten Analyse. Es zeigt sich, dass 1.) Konzepte, die die Interaktionsbeteiligten auf die situativen Rollen des „Sprechers" und des „Hörers" reduzieren, der Komplexität ihrer interaktiven Realisierungen keinesfalls gerecht werden (vgl. kritisch dazu Goffmann 1981). Weiterhin wird deutlich, dass 2.) Vorstellungen, die über die lineare Abfolge von verbalen Äußerungen nicht hinausreichen - eine Beschränkung, die speziell den klassischen, auf Audiomaterial basierenden konversationsanalytischen Studien vorgeworfen wird (vgl. dazu u. a. Deppermann/Schmidt 2007) - ebenfalls an ihre Grenzen stoßen, da Akteure in einer sozialen Situation nicht ausschließlich nacheinander reagieren, sondern vielmehr synchron ihre Aktivitäten koordinieren. Bezogen auf den hier analysierten Ausschnitt manifestiert sich insbesondere auch auf der nonverbalen Ebene die schrittweise gemeinsame Ausrichtung und Fokussierung der Beteiligten auf die nun anstehende Aktivität(en) der Übergabe. Noch bevor Ü1 ihre Aufforderung formuliert, blickt N in Richtung Ü1 (vgl. Abb. 2), ihre Blicke treffen sich jedoch nicht. Gleichzeitig mit Ül' verbalem ,Startsignal' verändert N dann ihre Sitzposition (vgl. Abb. 3 und 4) und wendet sich ihrer Kollegin zu. Simultan dazu nimmt N einen Stift in die rechte Hand, überkreuzt ihre Beine und legt eine Schreibunterlage auf ihren Schoß, hebt den Kopf und blickt in Richtung Ü (vgl. Abb. 5 und 6). Auf diese Weise bringt sie buchstäblich ihre rezeptive Haltung und Bereitschaft zur Aufnahme der nun von Ül erwarteten Übergabeinformationen zum Ausdruck. Halten wir fest: Dem inhaltlichen Einstieg in die Übergabe geht eine Phase der Vorbereitung und Initiierung dieser neuen Gesprächsaktivität voraus, in der zunächst die gemeinsame Bereitschaft zum Start kommunikativ (d. h. auch verkörpert) hergestellt wird. Die Hauptinitiative geht dabei von Ül aus, die in dieser Phase ihre Sitzposition nicht wesentlich verändert, sondern ihre „Bereitschaftsposition" bereits (vorher) eingenommen hat und ihre Arbeitsunterlagen in Händen hält. Ihr Beitrag auf der verbalen Ebene ist gewissermaßen die Signatur ihrer Rolle, ihrer Identität als Übergeberin. Sie ist es, die eine neue Aktivität einleitet, Aufmerksamkeit einfordert und neue Themen einführt. N hingegen wird adressiert und aufgefordert, ihre Aufgabe besteht eher darin, in einer aufmerksamen rezeptiven Haltung der Initiative der Übergeberin zu folgen. Unterbrechung des Beginns
Das nächste Beispiel zum Thema Vorgespräch und kommunikative Herstellung von Bereitschaft stammt aus einer Mittagsübergabe auf der urologischen Station.
Das Vorgespräch und die Herstellung von Bereitschaft
101
Inhaltliche Kurzbeschreibung: Zwei Personen der übernehmenden Schicht (Übernehmerin, Übernehmer) sitzen an einem Arbeitstisch, eine Übergeberin befindet sich auch schon im Stationszimmer, die zweite kommt wenig später hinzu. Eine Übernehmerin (Nl) stellt fest, dass ihr Stift nicht funktioniert und begibt sich innerhalb des Raumes auf die Suche nach einem neuen. Obwohl also N l für alle sichtbar ihren Arbeitstisch verlässt, teilt die Übergeberin (Ül) dem Übernehmer (N2) anhand eines an der Schranktür befestigten Operationsplans die aktuellen Aufnahmen mit (d. h. welche Patienten innerhalb der Fachklinik75 gewechselt sind bzw. welche der Zimmer bzw. Betten frei bzw. unbelegt sind). Kurze Zeit später, nachdem die Übergeberin die für sie wichtigsten Veränderungen im Operationsplan thematisiert hat und zur Identifizierung möglicherweise weiterer wichtiger Vorkommnisse auf der Station ihre Kollegin (Ü2) aus der gemeinsamen Schicht miteinbezieht, wird das Unternehmen Übergabegespräch jedoch für einige Minuten aufgeschoben. Auslöser ist die vom Übernehmer (N2) an die Übergeberin gestellte Frage nach einem noch nicht erschienenen ebenfalls zur übernehmenden Schicht gehörenden Pflegeschüler. Erst nachdem dieser eingetroffen ist, kann die Übergeberin mit der ersten Informationseinheit fortsetzen. # 7:
Urologie / Vorgespräch / 'kommt nich noch der karl' ((8:48- 9:30), Ül, Ü2: Übergeberinnnen (links); Nl: Übernehmerin (rechts); N2: Übernehmer (rechts); S: Pflegeschüler (rechts)
07
(3.0)
08 Nl:
jetzt funktioniert der wieder nich
09 10
ja was sind das für kullis hier MM
( (steht auf, um einen funktionierenden Kugelschreiber
11
zu suchen, 2.5))
12 Ü2:
hallo ((Ü2 betritt das Zimmer))
13
(— )
14 Nl:
jo (-) warte mal (-) da müssen wir doch (.) mann mann
15 Ül:
also kurz vorweg mit den aufnahmen_ähm MM blickt auf OP-Plan
(1.5)
Die urologische Fachklinik ist in zwei Stationen (Ul, U2) aufgeteilt mit jeweils getrennten Verantwortungsbereichen.
75
3. D a s Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
102
Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
09:01
09:02
09:05
blickt auf QP-Plan
irgendwie Üiner is auf
auch geändert^
16
irgendwie einer is auf u=eins gegangen-
17
( — )
18
das hamwer hier aber bestimmt auch geändert^
19
=herr (kanzmann) is auf u=eins (--)
20
die andern sind hier, (--)
21
ein bett hamwer frei auf ach[tzig, (--)
22 N1: MM 23 Ü2:
[nickt ja-
24 Ol:
(
25
hab_ich gema[cht,
25a
MM
) für morgen hamwer bestellt (.) die (de:_pe:_er) [öffnet Lade des mobilen Aktenschranks
26
(0.75)
27 Ül:
joa (-) und sonst (-) war sonst noch was dramatisches-
28 Ol: MM blickt aü£ 02 (1.5)
Abb. 4
Abb. 5
09:16 und sonst
Abb. 6
09:19 blickt auf Ü2
noch
MI
Das Vorgespräch und die Herstellung von Bereitschaft
2 9 N2:
kommt nich noch der
30
(1.4)
31 N1
kar[l]
32 N2 33 N1 34 01
103
[h]einz(-)karl karl[1] [d]er karl kommt noch
35
< — )
36 Nl:
ja karl kommt noch
37
((jemand atmet seufzend aus 0.8s))
38 Ül:
( — ) ja (•) dann warten_wer noch kurz auf karl
Dem Anschein nach initiiert Ü l mit ihrer Äußerung in Zeile 15 den Beginn der Übergabe, nachdem sie zuvor bereits eine der Arbeitsinteraktion angemessene Stehposition hinter dem mobilen Aktenschrank eingenommen hat (vgl. Abb. 1). Diese Position ermöglicht einen Blick-Radius, der die links an der Schranktür befestigten Listen, die Ü l gegenüber sitzenden Vertreterinnen der übernehmenden Schicht und auch die von ihr aus betrachtet rechts befindliche zweite Übergeberin (Ü2) umfasst. Dass eine Teilnehmerin aus der bis dahin noch zweiköpfigen übernehmenden Schicht ihren Platz verlässt und somit die für den Beginn der Übergabe entscheidende und wechselseitig füreinander erkennbar Bereitschaft signalisierende Körperposition wieder verlässt, scheint Ül nicht davon abzuhalten, dennoch in die Übergabe einzusteigen, indem sie sich in Zeile 15ff. zum OP-Plan orientiert und einen für die Übergabe relevanten Hinweis produziert ('also kurz vorweg mit den aufnahmen_ähm irgendwie einer is auf u: eins gegangen') der von ihr wiederum mittels einer (elliptischen) Formulation76 ('also kurz vorweg', etwa im Sinne von 'wir besprechen kurz vorweg') metakommunikativ als (Vorlauf zum) Beginn einer Übergabe gerahmt wird. Die Übergeberin schöpft hier unterschiedliche multimodale Ressourcen aus, um das Rederecht zu „ergreifen". Neben der Vokalität wirken dabei mit: eine Zeigegeste der linken Hand bzw. des Zeigefingers (Abb. 3), die Blickrichtung auf den Operationsplan (Abb. 2-3) und ihre stehende, den übrigen Anwesenden im Raum zugewandte Körperhaltung. Der ihr gegenüber auf dem Hocker sitzende N2 ist hinsichtlich seiner Körperhaltung - er hat den rechten Arm auf dem mobilen Aktenschrank abgelegt, siehe Abb. 2 - der Übergeberin ebenfalls
76 Mit „Formulations" sind insbesondere Äußerungen gemeint, mit denen das was in einer laufenden Interaktion gerade passiert, beschrieben bzw. benannt wird. Das Konzept der Formulations geht zurück auf Garfinkel und Sacks (1970: 351), sie sprechen in diesem Zusammenhang von „saying-in-so-many-words-what-we-are-doing".
104
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
zugewandt und zeigt über seine Blickrichtung - auf die Liste - an, dass er den Aufmerksamkeitsfokus mit seiner Kollegin teilt. Es scheint also, dass damit die Übergabe erfolgreich angelaufen ist. Eine alternative Lesart dieser Situation wäre, dass es sich lediglich um ein Nebengespräch zwischen den beiden Kollegen handelt. Das ist aber eher unwahrscheinlich, da der Hinweis von Ü1 thematisch betrachtet durchaus eine für die nächste Schicht relevante Information transportiert und damit Bestandteil einer Übergabe sein könnte. Das am Schrank befestigte Schriftstück wird von Ül, nach ihrer Kopf- und Blickbewegung zu schließen, scannerartig abgefahren, und diese Bewegung korrespondiert mit ihrer listenartigen, durch Sprechpausen rhythmisierten Nennung der vom OP-Plan abgelesenen Angaben: 16
irgendwie einer is auf u=eins gegangen
17
( — )
18
das hamwer hier aber bestimmt auch geändert=
19
=herr (Zimmermann) is auf u: eins (--)
20
die andern sind hier
21
ein bett hamwer frei auf ach[tzig (--)
22 N1: MM
(—) [(2x Kopfnicken)
N1 bestätigt daraufhin mit mehrmaligem Kopfnicken die Aufnahme der Informationen und folgt auch weiterhin dem Blickverhalten von Ül, die sich in Zeile 19 ihrer Kollegin Ü2 aus der gemeinsamen Schicht zuwendet (siehe Abb. 4 und 5/Ü2 selbst ist nicht sichtbar). Durch dieses „Sich-Führen-Lassen" im Hinblick auf Körper- und Blickorientierungen wirkt N1 aktiv an der Etablierung eines gemeinsamen - von U1 bestimmten - Aufmerksamkeitsfokus als Vorbedingung eines thematisch fokussierten Übergabegesprächs mit. Ü2s Reaktion auf die von Ü l formulierte Frage, ob „sonst noch was Dramatisches" gewesen sei, ist außerhalb des Aufzeichnungswinkels der Kamera, auf der vokalen Ebene ist jedoch kein Laut wahrzunehmen. Vermutlich schüttelt sie verneinend den Kopf, denn dies wäre eine Erklärung für die eineinhalb-sekündige Sprechpause in Zeile 28 und das NichtWeiterverfolgen von Ü l ' Frage an dieser Stelle. Ehe in Zeile 29 der Übernehmer mit der Nachfrage nach dem dritten Mitglied ('kommt nich noch der') den Fortgang der Übergabe „einfriert", ist noch ein leicht zu übersehendes Detail von Bedeutung. In Zeile 25 ist zu erkennen, dass die Übergeberin noch während des letzten Punktes ihrer Aufzählung eine Lade des vor ihr stehenden mobilen
Die Berichtsphase
105
Aktenschranks öffnet.77 Sie bedient sich einer multimodalen Ressource - der Manipulation eines Objekts - die als Vorbereitung für bzw. als Einleitung des Übergangs zur üblichen Aufzählung der jeweiligen Patienteninformationen gedeutet werden kann. Zählt man das oben schon erwähnte Angebot an ihre Kollegin (Ü2) hinzu, sich durch die Nennung weiterer Besonderheiten in der vergangenen Schicht am Zusammentragen von Informationen für die übernehmende Schicht zu beteiligen, so scheinen dies für den Übernehmer ausreichend Anzeichen dafür zu sein, dass die Übernehmerin (und damit die Situation) zielgerichtet auf den inhaltlichen Einstieg in die Übergabe zusteuert. Entsprechend platziert er nun unmittelbar seinen Hinweis darauf, dass die übernehmende Schicht noch nicht vollständig anwesend ist, und stoppt dadurch zunächst erfolgreich diesen Prozess. Die Übergeberin 1 verwendet abermals eine den kommunikativen Prozess selbst beschreibende Formulation, um das vorläufige Aussetzen bzw. den Aufschub der Übergabe bis zum Eintreffen des Kollegen als Entscheidung zu verkünden: 'dann warten_wer noch kurz auf kari' (Z. 38). Durch die zeitliche Spezifizierung „noch kurz" wird dabei der Beginn der Übergabe zugleich als nach wie vor unmittelbar bevorstehend markiert, der Bereitschaftsstatus ist damit nicht gänzlich aufgehoben. Dennoch zeigt sich die Defokussierung im körperlichen Verhalten der Anwesenden: Diese lösen und verändern ihre Körperpositionen, lehnen sich zurück, verlassen teilweise den Raum, ehe 'Karl' gut zwei Minuten später eintrifft (in Min. 11:46) und mit der Übergabe fortgefahren werden kann. 3.4
Die Berichtphase
Diese Phase ist das Herzstück eines Übergabegesprächs und umfasst die Erwähnung aller auf der Station registrierten Patientinnen; das bedeutet jeder Patientin und jedem Patienten ist eine Informationseinheit gewidmet. Diese weist wie oben schon kurz erwähnt allgemein folgende thematische Grundstruktur auf: •
Lokalisierung (Zimmernummer oder Bettnummer)
•
Anrede / Geschlecht und Name des Patienten / der Patientin
•
Diagnose bzw. durchgeführte / noch durchzuführende medizinische Maßnahme
•
77
gegenwärtiger Gesundheitszustand
Diese Aktivität ist nur indirekt den einige Momente später geschnittenen Standbildern (siehe Abb. 4, 5 und 6) zu entnehmen. Auditiv ist das Rollgeräusch jedoch sehr klar erkennbar (vgl. Zeile 24).
106
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
•
besondere medizinische Maßnahmen bzw. Auffälligkeiten
•
bereits durchgeführte bzw. noch bevorstehende - evtl. auch empfohlene - pflegerische Maßnahmen
•
Sonstiges
Übersicht 2: Typischer Aufbau des Infoblocks pro Patient/in Die im vorigen Abschnitt begonnene Analyse des Übergabegesprächs auf der medizinischen Station (# 6) wird im Folgenden fortgesetzt. Drei Personen befinden sich im Stationszimmer, eine Übernehmerin und zwei Übergeberinnen. Die beiden Übergeberinnen führen die Übergabe nicht gemeinsam, sondern nacheinander durch. Dieses Vorgehen entspricht dem auf dieser Station bzw. in diesem Krankenhaus verfolgten Pflegesystem, d. h. der gewählten Arbeitsorganisation für pflegerische Dienstleistungen (vgl. Gesundheits- und Krankenpflege 2009:12). Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Zimmerpflege, eine spezifische Form der Bereichspflege,78 bei der die beiden Kolleginnen ihre Arbeitsbereiche nacheinander vorstellen.79 Zum Verständnis des analysierten Ausschnitts sind vorab noch einige Anmerkungen zu den im Gespräch erwähnten medizinischen Fachbegriffen erforderlich. Die Übergeberin Ü1 berichtet über eine Patientin mit einem Portkatheter (Abk. Port). Ein Port ist ein in der Regel ins Unterhautfettgewebe implantiertes Katheter-System (d. h. Schlauch-System), das u. a. eine schonende Verabreichung von Infusionen ermöglicht. Zu Komplikationen beim Einsatz von Portkathetern kommt es dann, wenn Keime aus der Umgebung in den Port und so in den Blutkreislauf gelangen können. Die Übergeberin (Ül) weist ihre Kollegin auf die zu verwendende Infusionslösung (Kochsalz-Heparin) sowie deren genaue Anwendung und Lagerung hin.
78
„Bei der Bereichspflege wird die Station in Einzelbereiche unterteilt, unabhängig von den Krankheitsbildern. Jedem Bereich wird ein Pflegeteam bzw. eine Pflegeperson zugeordnet, die Einteilung erfolgt durch die Stationsleitung. Formen der Bereichspflege sind die sogenannte Zimmerpflege (die Einteilung erfolgt nach Zimmern) oder die Gruppenpflege (bestimmte Patienten bilden die Gruppe für die Pflegenden)." (ebd. 13) 79
Wie im vorigen Abschnitt anhand der Standbilder zu sehen (vgl. z. B. Abb. 6), ist die mit dem Rücken zur Kameraposition stehende Pflegekraft noch mit administrativen Aufgaben beschäftigt, während die beiden anderen Kolleginnen bereits mit der Übergabe begonnen haben. Die im Vordergrund zu sehenden Akteurinnen Ül und N sitzen sich gegenüber.
107
Die Berichtsphase # 8:
I n n e r e / 'glaub du warst jetzt länger nich da ne' ((1:17-1:49)) Ü l : Übergeberin; (Ü2: Übergeberin); N: Übemehmerin
14 Ül:
so fang=wa An [ne-
15 N:
[((Sitzhocker-Rücken))
16 N: 17
hm=hm=((grinst)) MM
wendet si[ch Ol zu
19 Ül:
[siebenunNEUNzig die frau webler;
20
(.) unverändert also immer noch
21
(em=er=es=e)=keime drin äh: PORT hat=sie,
22
glaub=du=warst jetzt länger nicht da=ne,
23 N:
hm=hm-
24 Ül:
°h die hat PORT=(anop) mit rEstinfusion,
25
°h äh::::=mit (---)
26
kochsalz=heparInspritzen die=sin im kühlschrank
27 28 N: 2 9 Ül:
kannst du nachher abstöpseln wenn es durch ist- (.) aber nur abstöpseln[( ) is aber im zimmer ne, oder=nein[=AlsO:rEIn=spritzen (.)
30
und ab(drehen)=ähm (.)
31
wenn NICHT nimm dir einfach mit is im kühlschrank
32
(— )
33 N:
[hm=hm, ((flüstert
))]
[((schreibt
))]
34 35
MM
(-)
36 Ül:
sonst drEhen (.) un=veränder(t)
37
a(l)so ni=nichts beSONders-
(.)
38 N:
hm_hm
39 Ül:
((schmatzt))«melodisch>auf hunrdert herrman
Nach dem bereits analysierten Vorgespräch startet Ü l mit der Lokalisierung der Patientin auf der Station sowie der Nennung ihres Namens. 8 0 Die
Die Nennung des Namens stellt als minimisierte Referenz eine prototypische Referenzform dar (vgl. Sacks/Schegloff 1978: 151ff). Die personale Referenz kann grundsätzlich mit Hilfe von Nomina und Pronomina, aber auch mit Namensnennungen erfolgen. Sacks und Schegloff postulieren in der Domäne der personalen Referenz zwei Präferenzen, die den Gebrauch von 'erkennbaren Referenzformen' ('recognitials') bedingen: einerseits die Tendenz, personale Referenzen möglichst mit Hilfe einer einzigen Referenzform zu realisieren (Prinzip der Minimisierung), und andererseits eine Orientierung am Empfänger (rezipientenspezifischer Zuschnitt von Äußerungen/ recipient design). 80
108
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
Bezeichnung ' [siebenunNEUNzig' steht für das Zimmer,81 in dem die Patientin liegt. Anschließend fasst Ü1 den aktuellen Status der Patientin mit 'unverändert' zusammen und spezifiziert dies durch den Hinweis auf die Infektionserkrankung und das Portkathetersystem. In Zeile 22 folgt eine Nachfrage an die Übernehmerin, die offenbar vor dem Hintergrund von Ns längerer Abwesenheit82 darauf abzielt zu prüfen, inwieweit diese eine detailliertere Aktualisierung der Patienteninformationen benötigt. Ns bestätigendes Rezipientensignal (Z. 35) führt dazu, dass Ü1 sehr ausführlich die zur Behandlung vorgesehenen Arbeitsschritte beschreibt (Wiederholung des medizinisch bzw. pflegerisch relevanten Hinweises auf das Kathetersystem, Nennung und Lagerung der Infusionslösung). Aus Üs Formulierung' kannst du nachher abstöpseln wenn es durch ist- ( . ) ' (Z. 27) geht hervor, daSS die pflegerische Maßnahme „Anlegen der Infusion" in den Dienst ihrer Kollegin hineinreicht und daher von dieser abgeschlossen werde sollte. Die Übernehmerin vergewissert sich daraufhin noch mit einer Nachfrage über die genaue Pflegehandlung ('aber nur abstöpseln', Z. 28) sowie den Aufbewahrungsort der Infusionslösung. Die Übergeberin konkretisiert daraufhin ihren vorangehenden Hinweis auf das noch zu Erledigende, indem sie ihrer Kollegin eine klare und detailliertere Handlungsanweisung gibt, die von N flüsternd bestätigt und in ihrer Arbeitsvorlage schriftlich vermerkt wird (Z. 33f.). Abgeschlossen wird dieser Informationsblock von der Übergeberin mit der Äußerung' sonst drEhen (.) un=veränder(t) (.) a(l)so ni=nichts beSONders' (Z. 36f.). Was verbirgt sich hinter diesem besonderen Äußerungsformat?
Geht man davon aus, dass Ortsangaben dafür eingesetzt werden, bestimmte Kontext-relevante Schlussfolgerungen zu suggerieren, etwa zur betreffenden Person (Patientin), einschließlich zugehöriger medizinischer wie pflegerischer Abläufe, dann wären ebenfalls denkbare Angaben wie z. B. „hinten links", „gegenüber vom Stationszimmer", „der erste Raum rechts vom südseitigen Aufzug aus gesehen" etc. dem Kontext, dem Ort, der Beziehung der Beteiligten hier nicht angemessen (vgl. Wolff 2001). Denn anders als bei Feuerwehrnotrufen (vgl. Bergmann 1993), wo z. B. die Verlässlichkeit der Angaben des Anrufenden durch die Angabe des jeweiligen Standorts validiert wird, haben Ortsangaben in Übergaben zwei Funktionen: Erstens sind sie als systematische Lösung des Identifizierungsproblems von Patienten (natürlich auch in Verbindung mit deren Namen und Diagnose) zu betrachten und zweitens ist mit der Angabe des Ortes, ob Zimmernummer und/oder Bettnummer, immer auch ein nachträglich rekonstruierbarer Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich verbunden (vgl. Schegloff 1972). 81
Der Abgleich von Wissensunterschieden ist ein Aspekt, der im Kapitel 5, ÜbergabeWissen noch näher untersucht wird.
82
Die Berichtsphase
109
Mit diesem stichwortartigen, rhythmisch gesprochenen Äußerungsformat fasst die Übergeberin die gegenwärtig angemessene und künftig zu erwartende Pflegeintensität knapp und prägnant zusammen. In der Literatur werden solche Formulierungen, die eine nicht-satzförmige syntaktische Einheit darstellen (vgl. Baldauf 2002) und durch Weglassungen von Satzteilen Zustandekommen, als Ellipsen83 bezeichnet (Schwitalla 2006: 102). Sie sind gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Sprachökonomie und Kontextsensitivität; vergleichbare Beispiele finden sich in Telegrammen oder Schlagzeilen. Bei dem telegrammartigen Stil muss das Vorwissen der Rezipienten die aufgrund des Wechseldienstes unvermeidbare Erfahrungslücke kompensieren. Es muss Ressourcen bereitstellen, durch die sich das komprimierte und spärlich Verbalisierte auf bekannte Personen (Patientinnen wie Kolleginnen) und erwartbare Ereignisse beziehen lässt. Dieser Stil evoziert eine (pflegerelevante) Geschichte, eine Lesart, eine Art Ausgangsposition, die bestimmte medizinische und pflegerische Aktivitäten erwartbar machen. Der in diesen zusammenfassenden Abschluss des Informationsblocks eingebaute Hinweis auf das Drehen des Patienten, zur Vorbeugung eines Druckgeschwüres (Dekubitus), verweist eigentlich auf eine standardmäßige und somit erwartbare Pflegepraxis und scheint daher zunächst aus fachlicher Sicht hier nicht zwingend notwendig zu sein. Im Kontext der Übergabe - und vor dem Hintergrund der üblichen Merkmale der sich auf dieser Station befindlichen Patienten - ermöglicht diese Formulierung jedoch zugleich mit minimalen Mitteln eine Kategorisierung der Patientin im Hinblick auf die erwartbaren und von N inferenziell erschließbaren pflegerischen Aktivitäten (vgl. category bound activities/Sacks). Das „Drehen-Müssen" liefert einen handlungs- und aufgabenorientierten Verweis auf einen Typus von Patientinnen, die abgesehen von der zu beachtenden Infusionsgabe keiner über die routinemäßigen pflegerischen Tätigkeiten hinausgehenden Maßnahmen und auch sonst keinerlei Sonderbehandlung bedürfen. Das Äußerungsformat (in Z. 36-37) scheint eine Art „Suchbewegung, die nichts Besonderes mehr findet" darzustellen. Es ist gekennzeichnet durch rhythmisches, mit Pausen durchsetztes Sprechen und erlaubt gleichzeitig ein „gedankliches Abarbeiten" von potentiellen Informationsblockelementen. Ein weiteres Kennzeichen ist das Fehlen von neuen und aufgabenrelevanten Informationen. Zusammengefasst erfüllt diese Äußerung folgende Funktionen: Erstens kennzeichnet sie den Abschluss des Informationsblocks, zweitens steht der Übernehmerin damit genügend Zeit zur Verfügung, ihre Notizen zu vervollständigen und gegebenenfalls Rückfragen zu tätigen, und drittens beinhaltet die
83 Vgl. auch Hoffmann (1998 und 2006).
110
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
aufgabenorientierte Kategorisierung der Patientin zusätzliche Informationen für die Übernehmerin hinsichtlich der erwartbaren Pflegeintensität. Eine wesentliche Kompetenz besteht für die Übernehmerinnen im Allgemeinen daher darin, den Verweisungshorizont solcher Formulierungen zu erkennen, denn aus funktionaler Sicht sind Ellipsen in hohem Maße informative Äußerungen mit besonders geringer Redundanz. Entgegen der Annahme, Ellipsen seien ein Zeichen für Unvollständigkeit (bzw. 'unvollständige Sätze'), gilt die Maxime: „Was gemessen an Strukturerwartungen 'unvollständig' erscheint, ist vielmehr situationsadäquat und wird verstanden. Die entscheidende Frage ist nun nicht: 'Was kann man weglassen?', sondern: 'Was muß unbedingt gesagt werden, damit der Hörer versteht?' Diese Frage kann nur beantworten, wer sprachliches Handeln als Verständigungshandeln auf der Basis von geteiltem und spezifischem Wissen und Situationskenntnis analysiert" (Hoffmann 1998: 4). Auf thematischer Ebene ist die Berichtphase generell dadurch gekennzeichnet, dass die übergebende Person vorwiegend Themen mit medizinischen und pflegerischen Bezügen einführt und je nach Vorwissen ihres Gegenübers entsprechend adressatengerecht entfaltet. Die Mitglieder der übergebenden Schicht scheinen demnach so etwas wie eine Themenführerschaft irtne zu haben. Das situativ angemessene Muster der Themenentfaltung scheint die auf Erfahrung basierende Form des mündlichen Berichts zu sein. Die Themen selbst werden listenförmig84 eingeführt, d. h. der Reihe nach aufgezählt, und die Übergänge zwischen den Themen erscheinen deshalb sehr sprunghaft. Die Listenbildung sowie der Einsatz von elliptischen Konstruktionen sind die zunächst auffälligsten Merkmale, die eine Übergabe zu strukturieren scheinen. Wir verlassen die Medizinische Station, wechseln auf die Geburtshilfestation und rekonstruieren zunächst einen dem Beginn der Morgenübergabe entnommenen Informationsblock. Dabei soll überprüft werden, ob die im vorigen Beispiel beobachteten Struktureigenschaften (Ellipsen, Listenbildung) sich auch in Übergaben auf der Geburtshilfestation wiederfinden lassen. An der Übergabe sind (einschließlich des Forschers) insgesamt 7 Personen beteiligt, eine Person (Ü) beendet ihren Nachtdienst mit der Übergabe, fünf Personen treten mit der Übergabe ihren Frühdienst an, davon sind drei
84
Zur grundlegenden sequenziellen Analyse von Listen siehe Jefferson (1990), die sich insbesondere mit der Präferenz für dreiteilige Listen beschäftigt hat. Mit der besonderen Prosodie von Listen beschäftigte sich z. B. in der Interaktionalen Linguistik Selting (2004).
Die Berichtsphase
111
Personen Pflegeschüler (S) und zwei examinierte Pflegekräfte. Das Gespräch findet im Schwesternzimmer statt und die Teilnehmenden sitzen im Stuhlkreis. Zunächst einige Hinweise zum inhaltlichen Ablauf und den stationsspezifischen Fachbegriffen: Ü eröffnet das Gespräch und beginnt mit einer schwangeren Frau, die nach einem Stationsaufenthalt in der Vergangenheit zunächst wieder nach Hause geschickt worden war und nun, einige Tage später, wieder aufgenommen wurde. Die Kurzbezeichnung „ET" steht für errechneter bzw. erwarteter Geburtstermin, d. h. zum Zeitpunkt der Übergabe (14.9.) sind es noch zwölf Tage bis zum errechneten Geburtstermin (26.9.). Der genaue „Pflegestatus" der Patientin ist zum Zeitpunkt der Übergabe noch relativ unklar bzw. den Umständen entsprechend offen. Da der Blasensprung bereits erfolgte, ist jedoch damit zu rechnen, dass die Geburt unmittelbar bevorsteht. # 9:
Geburtshilfe / 'da sind keinerlei aufkleber' ((00:03-00:47)) Ü: Übergeberin; Nl, N2: Übernehmerinnen
Ol Ü: 02 03 04 Nl: 05 Ü: 06 07 07a
gut ( ) stArten wir (2.0) in ( ) in ziramer EINs steht bei euch ganz hinten, hm frau mechert,
( —) ahm: frau mechert war vor_ne:r guten woche_anderthalb wOchen schon mal hier-
08 N2 : 09 Ü:
hin hm kommt jetzt e=te am sechsunzwanzigsten=nEUnten,
10 11
mit blasensprung- (.) zeit dreiunzwanziguhr,
12
hatte leichte wE:hn,
13 14
(1.5) ist dann erst wieder aufs zimmer gegangen-
15
ist dann aber jetzt im kreissaal-
16 16a
(1.0)
und_die is zwar aufgenommen aber da sind keinerlei aufkleber oder andere Sachen (davon) da-
17 18
(N2:)
19
MM
hm hm (4.0) ( (blättert um) )
Die Ablaufstruktur sowie die thematischen Schwerpunkte auf der Geburtshilfestation sind mit jenen auf der medizinischen Station durchaus vergleichbar, allerdings mit dem Unterschied, dass die Teilnehmerinnen der übernehmenden Schicht in diesem Ausschnitt verbal ausschließlich über Rezeptionssignale in Erscheinung treten. Die Übergeberin eröffnet das Gespräch, führt neue Themen ein, berichtet und bedient sich dabei des Listenformats und schließt am Ende den Informationsblock auch selbst ab.
112
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
Hinsichtlich der Themenbehandlung erfolgt als erstes die Lokalisierung der Frau auf der Station 'in ( — ) IN zimmer EINS', gefolgt von der Namensnennung und dem Hinweis auf einen stationären Aufenthalt in der unmittelbaren Vergangenheit 'ahm: frau mechert war vor_ne:r guten woche_anderthaib_wOchen schon mal hier- '. Der indexikale Hinweis in Zeile 03 '(...) steht bei euch ganz hinten,' meint keinen spezifischen Ort auf der Station, sondern bezieht sich auf das Ende des Dokumentenausdrucks, dem alle auf der Station registrierten Patientinnen zu entnehmen sind. Jene Liste ist in der Regel die Arbeitsgrundlage für alle Teilnehmenden, sie dient den Übernehmenden als Orientierung für die Zuordnung aller in der Übergabe erwähnten Personen. Die Vorstellung und Beschreibung fachmedizinischer und pflegerischer Indikatoren ist ebenfalls vertreten, wenn auch im Hinblick auf den aktuellen Status der Frau (hochschwanger) in einer sehr spezifischen Ausprägung, bei der die zeitliche Entwicklung und der Ablauf der Ereignisse mit Blick auf die bevorstehende Entbindung im Mittelpunkt stehen: ' kommt jetzt e=te am sechsunzwanzigsten= nEUnten, mit blasensprung-
(.) zeit dreiunzwanziguhr,
Die Aufzählung ist gekennzeichnet durch ein szenisches Ellipsenformat. Im eigentlichen Sinne ist die schwangere Frau (noch) keine Patientin, sondern sie befindet sich in einem Zwischenstadium, denn der Haupttätigkeitsbereich des Pflegepersonals auf der Geburtshilfe umfasst im Kern die ganz spezifische Pflegehandlungen für Frauen, die bereits geboren haben. Dazu gehören z. B. Tätigkeiten wie das Anlegen des Neugeborenen an die Mutterbrust, das Wickeln etc., all das sind Aufgaben, die bei einer Schwangeren nicht anfallen können. Die Betreuung der Schwangeren in der Zeit kurz vor der Geburt und bei der Geburt selbst obliegt der Hebamme bzw. dem Entbindungspfleger. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass der Schwangeren seitens der Pflegekräfte nur eine begrenzte Aufmerksamkeit zuteil wird, im Gegenteil, die Übergeberin konstruiert mit ihrem listenartigen Stil und die eingebetteten zeitlichen Verweise ('dann erst wieder', 'dann aber jetzt', Z. 14-15) eine Fallgeschichte (siehe Z. 9-16), die die bevorstehende Dringlichkeit der Situation sehr wohl zum Ausdruck bringt: 'ist dann aber hatte leichte wE:hn,'.
jetzt im kreissaal-
(l.o'(Z. 1 5 ) .
Die abschließende Äußerung
'und_die
is
zwar
aufgenommen
aber
da
sind
möglichen Unklarkeiten vor, etwa hinsichtlich der formalen Richtlinien, die die Eintragung bestimmter Vermerke und Angaben im Pflege-Dokumentationssystem vorsehen, welche in diesem Fall aufgrund der noch fehlenden Unterlagen nicht vorgenommen werden können. Darüber hinaus verweist diese Äußerung keinerlei aufkleber oder andere Sachen
(davon) da'beugt
Die Berichtsphase
113
zugleich aber auch auf die außerordentliche „Aktualität" der berichteten Ereignisse. Denn aus Sicht der Kategorisierungsanalyse 85 etablieren die von der Übergeberin eingesetzten Formulierungen ('ET' für errechneter Geburtstermin, Wehen etc.) sehr differenzierte arbeitsrelevante und aufgabenorientierte Einschätzungen hinsichtlich der zu betreuenden Person bzw. ihres Handelns. Die Formulierungen fungieren als Indikator für eine hochschwangere Frau und verweisen auf die Kategorie 'schwangere Frau'; dies wiederum legt bestimmte angemessene Handlungsweisen nahe, beispielsweise im Hinblick auf die Autonomie der Frau ('ist d a n n e r s t w i e d e r a u f s z i m m e r gegangen-'), und es gibt Hinweise auf die erwartbare Pflegeintensität ('ist d a n n a b e r j e t z t im kreissaai-'). Die übernehmende Schicht ist gewissermaßen vorgewarnt, die Geburtswehen könnten jederzeit eintreten bzw. die Geburt könnte jederzeit eingeleitet werden. Auffällig sind bei der hier untersuchten Übergabe auf der Geburtshilfestation die übermäßigen Redeanteile der Übergeberin gegenüber den wenigen der Übernehmerin. Eine Erklärung für diese Asymmetrie verspricht die Untersuchung jenes Mechanismus, der den Sprecherwechsel bei der Übergabe und im Besonderen in der Berichtsphase reguliert. An dieser Stelle interessiert vor allem, inwiefern die Redezugverteilung es uns ermöglicht, auf die Zugehörigkeit der Beteiligten zu einer bestimmten Arbeitsschicht zu schließen, u n d w i r f o l g e n d a b e i d e r Fragestellung, worin Übergeberinnen und Übernehmerinnen unterscheiden.
sich
die Äußerungen
von
Der nächste Analyseschritt zielt also darauf ab 1) den Mechanismus des Sprecherwechsels an ausgewählten Beispielen im Untersuchungsmaterial kurz vorzustellen und 2) genau jene kommunikativen Merkmale und Eigenschaften im Material ausfindig zu machen, anhand derer sich die soziale Aktivität des Schichtübergebens aus der Sicht der übergebenden und der übernehmenden Schicht r e k o n s t r u i e r e n lässt. Was „tut" eine übergebende Schicht, wenn sie „etwas" übergibt? Und was „tut" eine „übernehmende Schicht", wenn sie dieses „Etwas" übernimmt? Welche kommunikativen Praktiken werden von beiden Akteuren eingesetzt zur gemeinsamen Herstellung dieses Interaktionsereignisses und welche Rolle spielt
dabei der Sprecherwechsel? 3) Abschließend werden wir uns mit der Fülle an Schweigeperioden in Übergaben beschäftigen und anhand von Beispielen im Videomaterial herausarbeiten, inwiefern produziertes Nichtsprechen aus multimodaler Perspektive ebenfalls als ein konstitutives Ordnungselement
85
Mit dem Thema Kategorienbildung und Kategorisierung und ihrer Bedeutung in Übergaben werden wir uns im Kapitel 4, „Die soziale Organisation von Patientinnen auf der Basis von Mitgliedschafts-Kategorisierungen", noch ausführlicher beschäftigen.
114
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
betrachtet werden muss und zusätzlich als Indikator für die Verteilung von Rederechten herangezogen werden kann. 3.4.1
Der Mechanismus der Redezugabfolge bei Übergabegesprächen
Üblicherweise werden in der Literatur institutionelle Kontexte nach ihrem Formalisierungsgrad unterschieden. Heritage und Greatbatch (1991) sprechen in diesem Zusammenhang von 'formal types' und 'non-formal types'. 86 Die Zuordnung basiert im Wesentlichen auf der engen Beziehung zwischen den Rollen, die die Teilnehmenden einnehmen, und den unterschiedlichen Möglichkeiten der Ablauforganisation, in die sie involviert sind. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die jeweils realisierte Organisation des Sprecherwechsels.87 Die Interaktion in Gerichtsverhandlungen (Atkinson/Drew 1979), Nachrichteninterviews (Clayman 1988) und teilweise auch in Bewerbungsgesprächen (Button 1992), all das sind Beispiele für Gesprächstypen, in denen die Redezugverteilung vorreguliert ist,88 d. h. die Akteure haben bestimmte Rechte und Pflichten und folgen dabei institutionsspezifischen Interaktionsmustern (vgl. etwa Frage-Antwort Sequenzen bei der Zeugenvernahme vor Gericht). Dem gegenüber stehen Gespräche, die zwar (ebenfalls) aufgabenorientiert sind, jedoch einen bei weitem loseren Formalisierungsgrad aufweisen und dementsprechend weniger bis gar nicht vorreguliert sind. Beispiele hierfür sind etwa Beratungsgespräche (Peräkylä 1995), Arzt-Patientengespräche (Heath 1992) und Meetings (Boden 1994).
Eine ähnlich gelagerte Unterscheidung stammt von Boden (1994: 83f), die zwischen „formal" und „informal" unterscheidet und dabei betont, dass sich ihre Vorschläge von der Dichotomie der theoretischen Konstrukte ('formal/informal') der Organisationstheoretiker klar abgrenzt. Sie hebt anstatt dessen den Kontext der Realisierung, die Spezifik des jeweils realisierten Sprecherwechsels und, ganz zentral, die Perspektive der Akteure hervor. Ihnen hat der Analytiker zu folgen („My proposed distinction is slightly more elaborate as well as being more of a member's categorization; it is based on a combination of the kind of meeting and setting and (sic) on differences in the turn-taking procedures of these meetings"). 86
„The institutional character of the interaction is embodied first and foremost in its form - most notably in turn-taking systems which depart substantially from the way in which turn-taking is managed in conversation" (ebd. 1991: 95). 87
Atkinson und Drew wählten hierfür den Begriff 'turn-type pre-allocation'. „Turntype pre-allocation means that participants are normatively constrained in the types of turns they may take according to their particular institutional roles" (Hutchby/Wooffitt 2008:141). 88
Die Berichtsphase
115
Wie später noch ausführlicher dargestellt wird, sind Übergabegespräche in der Regel in hohem Maße vorreguliert.89 Die Akteure orientieren sich strikt an ihrem spezifischen 'Turn-Taking'-Format. Bis sich dieser Mechanismus allerdings in Gang gesetzt hat, haben die Beteiligten die Aufgabe, ein bestimmtes Arrangement aus kommunikativer Ökologie, wechselseitiger Aufmerksamkeit und Aufgabenorientierung zu bilden, ehe sie entsprechend ihren Aufgaben und Rollen die „Maschine" anwerfen können. Das genaue Format des für Übergaben typischen Turn-Taking-Systems wird im Folgenden näher beleuchtet. Wenn danach gefragt wird, welche Merkmale und Besonderheiten ein Übergabegespräch hinsichtlich der Organisation des Sprecherwechsels aufweist, so interessiert uns hier die von den Teilnehmerinnen im Vollzug ihrer Äußerungen erreichte methodische Lösung, unkoordiniert durcheinander zu sprechen bzw. längere Schweigephasen in Kauf nehmen zu müssen. Von Alltagsgesprächen wissen wir, dass die Reihenfolge und die Momente des Sprecherwechsels in keiner Weise vorab feststehen (können).90 In der wohl prominentesten Arbeit der Konversationsanalyse beschreiben Sacks, Schegloff und Jefferson (1974) die Verfahrenslogik, nach der die Akteure sowohl die Verteilung des Rederechts organisieren, als auch sich gegenseitig anzeigen, wie sie dabei vorgehen. Demnach beinhaltet dieses System zwei zentrale, eng aufeinander bezogene Aspekte, nämlich die Konstruktion der Redebeiträge und die Verteilung des Rederechts. Kurz zusammengefasst ist die „Turn-TakingOrganisation"91 ein System der lokalen Regulation, in dem Sinne, dass sie von
89
Die Vorstellung einer vorregulierten Verteilung des Rederechts trägt in einem erheblichen Ausmaß zur Herstellung, Aufrechterhaltung und Gestaltung institutioneller Kontexte bei (vgl. Drew/Heritage 1992, Gülich/Mondada 2008; siehe dazu auch Bergmann (1988/III: 52) mit einer Übersicht zahlreicher relevanter Untersuchungen). Eine in diesem Zusammenhang bemerkenswerte Studie zur Glaubwürdigkeit in Strafverfahren stammt von Wolff/Müller (1997). Die Autoren verfolgen u. a. die Frage nach den einzelnen sprachlich-interaktiven Formaten und ihren unterschiedlichen Varianten der Rederechtsverteilung im Kontext von Gerichtsverhandlungen. Eine Möglichkeit, vorregulierte Redezüge in Übergaben zu identifizieren, ist die Beobachtung von Schweigeperioden (vgl. 3.5.2). 90
Letzteres ist ein wesentliches Charakteristikum der Ablauforganisation in Unterhaltungen, vgl. dazu die Ausführungen bei Sacks (1971), „Das Erzählen von Geschichten innerhalb von Unterhaltungen"/„Storytelling in Conversation" (Orig. Sacks 1992b/Part IV/ 222f). Sacks arbeitet dort den Mechanismus heraus, der den Sprecherwechsel in Unterhaltungen regelt, und erläutert dabei auch die Besonderheit und Funktion der Technik von „story prefaces". 91
Für Einführungen und Ergänzungen hierzu siehe Bergmann (1988/III: lff), Psathas (1995: 34ff), Mondada/Gülich (2008: 39ff), Sidnell (2010: 36ff).
116
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseiriheit
Äußerung zu Äußerung, „Zug um Zug", immer nur den jeweils nächsten Wechsel von einem gegenwärtigen zu einem nachfolgenden Sprecher steuert (vgl. Bergmann 1988). Wenngleich die hier beschriebene Organisation des Sprecherwechsels in dieser Form ursprünglich nur für Alltagsgespräche gilt, dient sie bei der Untersuchung institutioneller Kontexte trotzdem als Orientierung bzw. als Vergleichsfolie, zumal ja von bestimmten professionellen Akteuren geradezu erwartet wird, in ihrem Verhalten bestimmte Mechanismen und Spezifika des Alltagsgesprächs außer Kraft zu setzen. Beispiele hierfür wären etwa die Zeugenvernehmung vor Gericht (Wolff/Müller 1997) oder das Arzt-PatientGespräch (Heath 1992), wo der Richter bzw. der Arzt das Rederecht zuweisen und auch die Themenführerschaft innehaben. Grundlegend für das Verständnis der Konstruktion der Redebeiträge ist der rekursive Charakter des Systems (vgl. Bergmann 1988). Das heißt der Zeitpunkt der Übernahme und die Vollendung bzw. Vollständigkeit eines Redebeitrages (turn) stehen nicht von vornherein fest, sondern werden von den Akteuren am möglichen Ende einer Einheit (turn constructional unit/TCU) wechselseitig angezeigt und hergestellt. Die Akteure sind gewissermaßen laufend damit beschäftigt, im Vollzug befindliche Äußerungen daraufhin zu analysieren, ob sie potenziell abgeschlossen sind und ein Sprecherwechsel stattfinden kann. Die Stellen, an denen sie diesen Schritt vollziehen können, werden als 'transition relevance places/TRP', also redeübergaberelevante Stellen bezeichnet (vgl. Sacks/Schegloff/Jefferson 1974: 700ff, Gülich/Mondada 2008: 39). Überprüfen lässt sich diese 'situierte Interpretation' (Gülich/Mondada) der Akteure an Stellen in der Übergabe, an denen Akteure zu einem neuen Redebeitrag ansetzen. Im Mittelpunkt der Analyse steht neben der laufenden wechselseitigen Interpretation der Redebeiträge auch noch die Frage, inwieweit und wie sie den weiteren Prozessverlauf voraussehen bzw. antizipieren. Im folgenden Beispiel richtet sich das Interesse schwerpunktmäßig darauf, wann die Übernehmerin eine Stelle als redeübergabetauglich erachtet und wie sie dies kommunikativ anzeigt. Die Übergeberin beginnt mit dem Informationsblock der Patientin „Frau Webler", stellt der Übernehmerin noch eine kurze Frage und gibt ihr eine Handlungsanweisung, ehe sie von ihrer übernehmenden Kollegin mit einer Rückfrage unterbrochen wird. # 10: Innere / 'glaub du warst jetzt länger nich da ne' ((1:19-1:46)) Ü: Übergeberin; N: Übernehmerin 17 N: 18 MM > 19 U: 20 21
hm=hm=((grinst)) wendet si[ch Ü zu [siebenunNEUNzig die frau webler; (.) unverändert also immer noch (em=er=es=e)=keime drin äh: PORT hat=sie,
Die Berichtsphase
22 > 23 N: 24 0: 25 26 27 > 28 N: > 29 Ü:
117
glaub=du=warst jetzt länger nicht da=ne, hm=hm°h die hat PORT=(anop) mit rEstinfusion, °h äh::::=mit (---) kochsalz-heparlnspritzen die=sin im kühischrank kannst du nachher abstöpseln wenn es durch ist- (.) aber nUr abstöpseln[( ) is aber im zimmer ne, < [=AlsO:rEIn=spritzen (.)
30 31
und ab(drehen)=ähm (.) wenn NICHT nimm dir einfach mit is im kühlschrank-
32 33 N:
[hm=hm,
( ~ )
Im Anschluss an eine Anweisung von Ü ('kannst du nachher abstöpseln wenn es durch ist-') und eine Mikropause (Z. 27) formuliert N eine Rückfrage („aber nur abstöpse in" ..., Z. 28). Im Hinblick auf die Turn-Taking-Organisation behandelt N, indem sie hier mit einem eigenen Redebeitrag einsetzt, diese Stelle als TRP. Ihre Deutung, dass Üs turn an dieser Stelle vollständig ist, könnte sich etwa auf die gleichbleibende Intonation, die syntaktische Form und die inhaltliche Entwicklung von Üs Redebeitrag stützen. Unmittelbar darauf markiert wiederum Ü, die nun kurzzeitig in der Rezipientenrolle ist, eine übergaberelevante Stelle, indem sie an die mit fragender Intonation realisierte Rückfrage Ns 'aber nur abstöpseln [( )' sogleich mit einer Spezifizierung anschließt und erläutert, was „Abstöpseln" in diesem Fall bedeutet. Die Beobachtung, dass Ü hier recht „offensiv" und schnell die erste Gelegenheit zur erneuten Redezugsübernahme nutzt, könnte darauf verweisen, dass dem Vermeiden bzw. schnellstmöglichen Ausräumen von Missverständnissen in diesem Kontext hohe Priorität eingeräumt wird und dass sie sich als Übergeberin in der Pflicht sieht, mit hinreichend präzisen Angaben dazu beizutragen. Analog dazu kann umgekehrt die rasch angeschlossene Rückfrage von N in Zeile 28 als „Einholen" benötigter Präzisierungen interpretiert werden. Anschließend ist zu sehen, dass Überlappungen kein Fehler im System des Sprecherwechsels sein müssen, sondern dass die beiden Akteurinnen wechselseitig die Turnentwicklung verfolgen und durchaus imstande sind, die Vollständigkeit bzw. Unvollständigkeit von turns zu antizipieren. Üs schnell angeschlossene Spezifizierung überlappt mit einer weiteren Rückfrage der Übernehmerin'is aber im zimmer ne,' (Z. 28). Diese Rückfrage wird jedoch von der Übergeberin keinesfalls ignoriert, sondern der zweite Teil ihres Redezugs antwortet darauf, wobei sie mit ihrer elliptischen Formulierung auch sprachlich direkt an die Frage ihrer Kollegin anknüpft ('wenn NICHT nimm dir einfach mit is im kühischrank-') Z. 31). Die hier von beiden Beteiligten kollaborativ bewerkstelligte Präzisierung von Üs Handlungsanweisung führt sehr schön vor Augen, dass ein Gesprächsbeitrag nie vom Sprecher alleine hervorgebracht, sondern immer auch vom Verhalten der Gesprächspartner
118
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
mitgestaltet wird.92 Aus diesem Grund ist aus konversationsanalytischer Sicht die Unterscheidung zwischen 'Sprecher' und 'Hörer/Zuhörer' auch höchst problematisch (vgl. Gülich/Mondada 2008 bzw. Dausendschön-Gay/Krafft 2000:19). Entsprechend empfehlen Dausendschön-Gay/Krafft, für Akteure, die gerade nicht sprachlich aktiv sind, die Bezeichnung „Mitwirker" zu verwenden. Der zweite Aspekt der Organisation des Sprecherwechsels betrifft die Verteilung des Rederechts ('turn-allocational component') und beschäftigt sich mit der Steuerung und Festlegung der Sprecher-Reihenfolge im Sinne der Frage „Wer spricht als nächster?". Nach Sacks, Schegloff und Jefferson93 basiert die Verteilung des Rederechts auf einem Set von für die Gesprächsteilnehmenden verbindlichen Optionen. Auszugehen ist vom aktuellen Sprecher, dieser kann an jeder übergaberelevanten Stelle den nächsten Sprecher auswählen. Im obigen Beispiel ist dies in Zeile 22 zu beobachten, wo die Übergeberin als aktuelle Sprecherin die nächste Sprecherin mit 'giaub=du=warst jetzt langer nicht da=ne,' auswählt. Mit diesem in der Literatur als 'tag question' (vgl. Gülich/Mondada 2008) bekannten Verfahren fordert Ü ihre Kollegin zu einer Reaktion auf, die in Zeile 23 mit einem zustimmenden 'hm=hm-' auch prompt folgt. Wählt der aktuelle Sprecher an einer übergaberelevanten Stelle hingegen niemanden aus, kann ein anderer sich selbst auswählen („self-select"), wie etwa N in Zeile 28. Wenn weder der aktuelle Sprecher einen neuen Sprecher auswählt noch ein neuer Sprecher sich per Selbstwahl das Rederecht nimmt, dann kann (muss aber nicht) der aktuelle Sprecher fortfahren. Dieser Fall zeigt sich etwa in dem weiter oben schon Transkriptausschnitt zur Berichtphase auf der Geburtshilfe:
besprochenen
# 11: Geburtshilfe / 'da sind keinerlei aufkleber' (Auszug) Ü: Übergeberin 0 9 Ü: 10 11
kommt jetzt e=te am sechsunzwanzigsten=nEUnten, mit blasensprung- (.) zeit dreiunzwanziguhr,
Die Aktivitäten des sog. 'Zuhörers' sind für den aktuellen Sprecher in Face-to-faceSituationen im Normalfall einsehbar, der Zuhörer kann aus technischer Sicht seinen turn abwarten und sich auf seinen Einsatz vorbereiten oder auch ganz auf die turnÜbernahme verzichten. Zuhörer sind aber keine 'lethargical dopes', sondern sie zeigen mit verschiedenen sprachlichen (z. B. 'ah', 'hm-hm'), mimischen (z. B. Stirnrunzeln) oder gestischen Beiträgen (z. B. Schulterzucken, Kopfnicken) ihre Aufmerksamkeit und Bereitschaft bzw. ihr Verständnis des sich im Moment entfaltenden turns an und tragen so natürlich auch zur spezifischen Gestaltung des (gemeinsamen) Gesprächsbeitrags bei. 92
93
Vgl. Sacks et al. (1974: 704) bzw. siehe u. a. auch Sidnell (2010: 43).
Die Berichtsphase 12 >
119
hatte leichte wE:hn,
13
(1.5)
14
ist dann erst wieder aufs zimmer gegangen-
Nachdem die Übergeberin Ü eine listenartige Aufzählung abgeschlossen hat, lassen die übrigen Anwesenden die darauf folgende Pause (Z. 13) verstreichen, ohne an dieser potentiell übergaberelevanten Stelle per Selbstwahl das Wort zu ergreifen, und auch die Übergeberin wählt niemanden als nächsten Sprecher aus, sondern setzt ihren Redezug in Zeile 14 mit der Beschreibung der Patientin fort. Ein besonderes Kennzeichen von Gesprächen in institutionellen Kontexten in Abgrenzung zu Alltagsgesprächen ist die Aufgabenorientierung der Akteure, d. h. sie haben in und mit ihrer Interaktion bestimmte Rechte und Pflichten zu erfüllen und folgen dabei institutionsspezifischen Interaktionsmustern. Die Aufgabe der vorliegenden Studie liegt u. a. auch darin, die Spezifik und Eigenlogik von Übergabegesprächen zu untersuchen. Dieser Interaktionstyp ist in einem hohen Maße vorreguliert: Die Akteurinnen der übergebenden Schicht initiieren den Beginn und haben die Themenführerschaft inne, während die Vertreterinnen der übernehmenden Schicht im Verhältnis dazu äußerst äußerst geringe Redeanteile haben. Um dieses asymmetrische Verhältnis aus dem Blickwinkel der Organisation des Sprecherwechsels zu analysieren, bietet es sich an, einen genaueren Blick auf die interaktive Bedeutung von Gesprächspausen zu werfen. 3.4.2
Schweigeperioden - ein spezifisches Merkmal zur Identifizierung von vorregulierten Redezügen
Bei der Betrachtung der bislang vorgestellten Datenausschnitte fällt auf, dass diese verhältnismäßig viele Schweigephasen 94 enthalten, die jedoch in der Analyse zunächst weitgehend ausgespart wurden. Im Folgenden sollen diese Sprechpausen nun gezielt in den Blick genommen werden, geleitet von der Frage, welche Bedeutung(en) das lokal produzierte „Nichtsprechen" in Übergaben hat.
Siehe der Auszug zur Notation von Pausen im gesprächsanalytischen Transkriptionssystem (2009: 391): „ (.) " = Mikropause, geschätzt, bis ca. 0.2 Sek. Dauer; „ (-) " = kurze geschätzte Pause von ca. 0.2-0.5 Sek. Dauer; „ (—) " = mittlere geschätzte Pause von ca. 0.5-0.8 Sek. Dauer; „ ( — ) " = längere geschätzte Pause von ca. 0.8-1.0 Sek. Dauer; „ ( 0 . 5 ) . . . ( 2 . 0 ) " = gemessene Pausen von ca. 0.5 bzw. 2.0 Sek. Dauer (Angabe mit einer Stelle hinter dem Punkt). 94
120
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
Pausen und Schweigephasen in Gesprächen bilden für sich allein genommen nur eine äußerst dürftige Interpretationsgrundlage, und so ist unmittelbar einsichtig, dass Redebeiträge, die einem Schweigen vorausgehen, und Äußerungen, die das Schweigen beenden, zur Analyse von solchen Pausen herangezogen werden (müssen). Bergmann dazu: „Schweigen im Gespräch entsteht dort, wo Reden aufhört. Und es endet dort, wo Reden wieder einsetzt. Schweigen wird also durch Reden begrenzt, und es wird sich zeigen, dass sowohl die Äußerung, die einem Schweigen vorausgeht, wie auch die Äußerung, die auf ein Schweigen folgt (oder genauer: deren Realisierung ein entstandenes Schweigen beendet), für die Interpretation dieses Schweigens eine entscheidende Rolle spielen" (1982:147). Nach der Ordnungsprämisse der Konversationsanalyse ('order at all points') sind Pausen ebenfalls Ordnungselemente und somit gegenüber verbalen oder nonverbalen Äußerungen keinesfalls nachrangig zu behandeln. Schließlich sind alle Ordnungselemente generell auch als Lösungen struktureller Probleme der Interaktionsorganisation zu betrachten und daher analytisch von immenser Bedeutung. Die Aufgabe besteht nun in der Rekonstruktion und Interpretation jener „schweigenden" Augenblicke unter besonderer Berücksichtigung des sprachlichen Kontexts sowie der Platzierung von Pausen. Bergmann (1982) unterscheidet drei Arten von Schweigepausen: 9 5 redezuginterne Pausen (1), freie Pausen (2) sowie das vakante Nichtsprechen bzw. Schweigen (3). 1) Eine redezuginterne Pause kann dadurch entstehen, dass ein Sprecher während der Produktion einer Äußerung an einem Punkt mit dem Sprechen aufhört, an dem der Redebeitrag offensichtlich nicht als abgeschlossen gelten kann und an dem daher keine übergangsrelevante Stelle erreicht ist. Wie oben schon beschrieben, orientieren sich die Akteure grundsätzlich an Momenten, in denen der turn potenziell abgeschlossen ist und ein Sprecherwechsel stattfinden kann. Im folgenden Beispiel von der medizinischen Station ist der Abschnitt zwischen Zeile 3 und 10 von Interesse, insbesondere die beiden redezuginternen Pausen in Zeile 7 und 9. Der Infoblock der Patientin Hermann ist nach dem üblichen oben schon beschriebenen Format strukturiert: Lokalisierung, Name, medizinische Indikatoren bzw. pflegerelevante Hinweis etc. Die am Ende ansteigende Intonationskontur von Üs Äußerungen bei ('hermann,' und 'kam
95
Vgl. dazu Bergmann (1982:149 ff).
Die Berichtsphase
121
mit luftnot,' sowie 'diabetikerin,' stehen für die kennzeichnende Listenbildung. Daneben ist zu beachten, dass der bei Einsetzen des Schweigens (in Zeile 7) erreichte (inhaltliche) Entwicklungsstand der listenartigen Vorstellung der Patientin noch nicht erreicht bzw. noch nicht spezifisch genug ist und in Zeile 8 mit 'mit tabiette aber;' weiter entwickelt wird. Ahnliches gilt auch für die einsekündige Sprechpause in Zeile 9, sie wird ebenfalls von Ü rechtsseitig wieder geschlossen, d. h. Ü nimmt ihre bis dahin (noch nicht ausreichend) entwickelte Patientenbeschreibung wieder auf und führt sie zu ihrem Abschluss. # 12: Infoblock Innere / 'das ist eine dame die alles hat' ((6:40-7:14)) Ü: Übergeberin; N: Übernehmerin 01 Ü: 02 > 03 04 05 06 > 07 08 > 09 > 10 11 12 N: 13 14 Ü: 15 N: 16 Ü: 17 N: 18 Ü: 19 20
da brauchst du theoretisch nichts machen die meldet_ MELDet sich wenn sie was braucht(2.5)
auf zweiundsiebzig hermann, kam mit luftnot, (-) herzprobleme=rückenprobleme das is eine dame die alles hat(.) diabetikerin, (1.5)
mit tabiette aber; (1.0)
und=äh: hat von uns diesen ALTen rollator gekriegt und damit geht sie auch alleine eigentli(ch) auf toilettehm(2.0)
drehen oder auf bettkante setzen macht sie auch alleine; sie (meldet=sich) sie MELdet sich aber auf jeden fallhm_hmzweites bett is noch frei, und am fenster frau nowan, mit hörstürz,
Aus multimodaler Perspektive erscheinen redezuginterne Pausen mehr als ausschließlich auf die Vokalität reduzierte Beiträge, auch wenn vokale Äußerungen eine große Rolle spielen. Betrachtet man die visuellen Kommunikationsanteile des vorigen, nun in ein multimodales Basistranskript übertragenen Beispiels, werden folgende Aktivitäten und zwar nicht nur der Übergeberin, sondern ebenfalls der links sitzenden Übernehmerin von Bedeutimg. Aus den Abbildungen 1-3 (siehe nächste Seite) geht hervor, wie N durchgehend mit Notizen machen beschäftigt ist, ihren Kopf gesenkt hält und ihren Blick offensichtlich auf die am Schoß liegenden Schreibunterlagen gerichtet hat. Die Übergeberin ihrerseits zeigt neben der oben bereits ausgeführten vokalen Erscheinungsformen (insbesondere Intonationskontur und Listenbildung) auf den Ebenen der Kopf- und Blickbewegung und der
122
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
Körperhaltung an, dass die übergangsrelevante Stelle noch nicht erreicht ist, ihr Redebeitrag also noch nicht abgeschlossen zu sein scheint. Interessanterweise haben Übergeberin und Übernehmerin keinen Blickkontakt (vgl. Abb. 1). Die Übergeberin kann vielmehr die für sie beobachtbare Aktivität (Schreiben) der ihr gegenüber sitzenden Kollegin wahrnehmen und könnte sogar die Länge der Pause mit der Dauer der Schreibaktivität abstimmen, d. h. die Sprechpause in Zeile 7 und 7a entsteht durch Üs Wahrnehmung der Schreibtätigkeit ihrer Kollegin (vgl. Abb. 2 und 3). Dies wiederum würde aber die allein auf die Vokalität abgestimmte Interpretation zwar nicht gänzlich in Frage stellen, jedoch deutlich machen, dass der Aktivität des Schreibens der Übernehmerin ein deutlich höheres Gewicht zugeschrieben werden müsste und zumindest in diesem Fall an eine grundsätzliche Gleichwertigkeit der Modalitäten zu denken wäre. Denn schließlich füllen visuelle Kommunikationsanteile die bis dahin schweigenden Lücken mit für die Sinnkonstitution ebenso bedeutsamen Aktivitäten. Oben heißt es, dass eine redezuginterne Pause dadurch entsteht, dass ein Sprecher während der Herstellung einer Äußerung, an einem Punkt mit dem Sprechen aufhört, an dem der Redebeitrag offensichtlich als nicht abgeschlossen gelten kann und daher auch kein Sprecherwechsel stattfinden kann. Eine ergänzende multimodale Perspektive liefert im vorliegenden Fall eine weitere Begründung für das kurzzeitige NichtSprechen der Übergeberin und zwar indem simultane Aktivitäten der Mitwirker (Dausendschön-Gay/Krafft) mit einer redezuginternen Gesprächspause einhergehen können und damit aber den Sonderstatus des Sprechers berechtigterweise in Frage stellt. # 13: Innere / 'diabetikerin' (Auszug) Ü: Übergeberin (rechts); N: Übernehmerin (links)
06:50 0: diabe[|ikerin,
Abb. 2
Abb. 3
06:51
06:52
0: MM [Jieigt' ihn
Ü:ffllftablette aber;
N: MM [notiert mit
123
Die Berichtsphase
05a N: MM 06 Ü: MM >
[notiert mit Blickrichtung auf Notizen diabe[tikerin,
07 N: MM
> 07a ü: MM 08
hebt den Kopf und neigt ihn leicht nach links [(Forts.) notiert mit Blickrichtung auf Notizen [behält Körper- und Kopfhaltung bei
(freeze)
(1.4)
(1.4)
mit tablette aber; MM
behält weiterhin die Körper- und Kopfhaltung bei
2) Ein besonderes Merkmal von freien Gesprächspausen, ist die Tatsache, dass sie an einem Punkt platziert sind, an dem die bis dahin produzierte Äußerung zwar als abgeschlossen betrachtet werden kann, jedoch die Auswahl, wer als nachfolgender Sprecher mit dem Gespräch fortfahren soll, noch nicht getroffen wurde. Ganz allgemein von Bedeutung für die Interpretation von Gesprächspausen ist, wie oben festgestellt wurde, zunächst die Äußerung vor der Schweigephase. Und wesentliche Kriterien zur Analyse dieser Äußerung sind a.) der Typus und b.) der mit dem Einsetzen des Schweigens erreichte Entwicklungsstand der Äußerung. 96 Im folgenden Beispiel aus der Geburtshilfe ist ein Auszug aus einem Infoblock abgebildet, dessen Anfang und Ende für die Analyse primär relevant sind. Die Auslassung in der Mitte beinhaltet lediglich eine Unterbrechung und einige Details zur gesundheitlichen Verfassung der Patientin. Meine Argumentation kreist um die zehnsekündige Pause in Zeile 25. Vorausgegangen sind dieser Pause in den Zeilen 12 bis 21 Erläuterungen der Übergeberin zu bestimmten für die Geburtshilfe relevanten Sachverhalten, Ereignissen und Pflegehandlungen, wie z. B. die Befindlichkeit des Neugeborenen und das Zufüttern. Ihr abschließender Kommentar 'aber mamma war einfach zu müde und zu kaputt um bonding machen' bezieht sich auf das ansonsten übliche und von Pflegekräften zu leistende Kontaktstiften zwischen der Mutter und dem Baby, das jedoch im konkreten Fall auf Grund der Müdigkeit der Patientin unterbleiben musste. Indem die übergebende Schwester diesen Sachverhalt anspricht, weist sie die übernehmenden Schichtmitglieder implizit darauf hin, diese Aktivität in ihrer Schicht nachzuholen oder zumindest zu beachten, dass das „Bonding" als Aufgabe noch geleistet werden muss, und diese Information und Aufgabe notfalls an die folgende Schicht weiterzureichen. Mit Üs Äußerung scheint aber auch der Entwicklungsstand der Patientenbeschreibung abgeschlossen zu sein, und zwar in der Hinsicht, dass
96
Näheres dazu siehe Bergmann (1982:147f)
124
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
die von Ü verfolgte thematische Reihenfolge (Lokalisierung, Name, medizinische und pflegerische Indikatoren, offenen Arbeitsaufträge etc.), in der für gewöhnlich die Patientinnen vorgestellt werden, im Moment der bis dahin produzierten Äußerung keine weiteren Informationen mehr erforderlich zu machen scheint. Mit Beginn des Schweigens in Zeile 10 bestünden nun allerdings grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder führt eine der übrigen an der Übergabe teilnehmenden Personen eine Selbstwahl durch oder aber die Übergeberin setzt wieder ein, was sie in Zeile 26 auch tut mit 'vier im zweiten,' und damit einen neuen Patienteninformationsblock eröffnet. # 14: Geburtshilfe / 'aber mamma war einfach zu müde und zu kaputt' ((3:10-4:16)), Ü: Übergeberin; Nl: Übernehmerin 01
(6.0)
02 Ü: 03
Gü:t im zweitn, bett frau baldauf? ((Baby schreit im Hintergrund))
04
(-)
11 12 Ü: 13 14 15 16 17 18 19 20
((•••)) (1.5) ä:hm das kind war relativ un_ruHig heue nAchtmamma hat_es zweimal angelecht sehr gründlich angelecht(-) un_dann ham_wa versucht noch mit=tee: das war äh: relativ schwierig (1.5) jetzt liegt sie da in bauchlage, (3.0) und dann ging das so so einigermaßen;
21 22 Nl: 23 Ü: 24 > 25 26
(-) hmaber mamma war einfach zu müde und zu kaputt (.) «weinerlich>um bonding machen'7> (10.0) vier im zweiten,
Verknüpft man jetzt das lokale Auftreten von freien Gesprächspausen mit der Frage der Vorregulierung der Sprecherabfolge, so lassen sich im
„Bonding" ist der erste, Bindung stiftende Kontakt zwischen Mutter Neugeborenem gleich direkt nach der Geburt (vgl. Mändle et al. 2007: 314).
97
und
Die Berichtsphase
125
Untersuchungsmaterial trotz der unterschiedlichen Bandbreite98 hinsichtlich der Dauer von freien Gesprächspausen zwischen den einzelnen Informationsblöcken Hinweise finden, die die postulierte These einer vorab regulierten Redezugabfolge auch empirisch beobachten und bestätigen lassen. Ein evidentes Beispiel dafür liefert die Tatsache, wonach die Beendigung der Schweigepausen ausschließlich von Übergeberinnen vollzogen wird und damit ausdrücklich auf das ihnen vorab zugeschriebene, aber immer erst kommunikativ zu realisierende Rederecht verweist. Üblicherweise sind freie Schweigepausen von betont langer Dauer" und die Tatsache, dass die in Übergaben verhältnismäßig kurzen Pausen gerade an den Übergängen zwischen den Informationsblöcke auftauchen, zudem von den Übergeberinnen rechtsseitig geschlossen werden, beweist die Aufgabenorientierung, indem sie das Rederecht für sich beanspruchen. Es ist also weniger die Dauer als die Situierung zu ihrer Interpretation maßgeblich. Der Blick auf das Material zeigt dies sehr deutlich; in allen Beispielen (vgl. # 14 die Zeilen 25-26, # 15 die Zeile 6 sowie # 16 die Zeilen 2 und 13) wird die Gesprächspause jeweils von der Übergeberin mit einem neuen Beitrag, mit der Eröffnung eines weiteren Informationsblocks beendet (vgl. auch # 12 die Zeilen 2-3). # 15: Geburtshilfe / 'so genau hab ich natürlich jetzt nich geguckt' ((2:50-3:13)), Ü: Übergeberin; Nl: Übernehmerin 01 U: 02
so=genau hab ich natürlich=jetzt=nicht geguckt; (2.0)
03 Nl: war das kind angelegt „Ü",
>
04
(— )
05 Ü:
«hauchend>JA: !> (-) mamma hat die ganze nacht BONding gemacht-
07
hat=es gut angelE:cht-
08
(6.0)
09
gu:t im zweiten bett frau baldauf,
10
((Baby schreit im Hintergrund))
Die Pausen zwischen den Informationseinheiten sind durchschnittlich zwei bis drei Sekunden lang. 98
99
Vgl. Bergmann (1982:153 bzw.1988/111: 7f).
126
3. Das Ereignis Übergabe als Gesprächseinheit
# 16: Innere / 'man kann sie auch auf die bettkante setzen' ((6:17-6:45)), Ü: Übergeberin; N: Übernehmerin 01 N: > 02 03 Ü:
hm(2.0) frau hensel am fenster, dialysepatientin,
04
(jetzt) zustand nach (maimtia_ce a-)
05
°h verdacht auf
06
hat tierische schmerzen gehabt hat
07
mittlerweile fünfzig milligramm,
08 09
(1.0) äh_das GEht also man kann sie auch auf die bettkante setzen-
10 11 N:
oder im rollstuhl war heute nachtmittag mit angehörigen, (--) hm hm
(operial_ce_a-) (durogesicpflaster-)
12 Ü: da brauchst du theoretisch nichts machen die meldet 12a MELDet sich wenn sie was braucht> 13 (2.5) 14 auf zweiundsiebzig hermann, 15 kam mit luftnot, (-)
Die dritte, von den übrigen strikt zu trennende Art von Schweigephasen entsteht im Zuge des interaktiven Aufeinandertreffens von z. B. zwei Pflegekräften, wobei eine davon mit einer spezifischen Äußerung erstens den Rezipienten auswählt und zweitens den nachfolgenden Sprecher zu einer Reaktion auf diese Äußerung verpflichtet. Ein sehr eindringliches Beispiel dafür sind Frage-Antwort-Sequenzen. In diesem Zusammenhang kommt die Art der Schweigepause dadurch zustande, dass die Reaktion oder der Redezug, zu dem der Rezipient aufgerufen bzw. verpflichtet wurde, zunächst einmal offen oder eben vakant bleibt. Im folgenden Beispiel ist zu sehen, wie eine der Übernehmerinnen eine Frage Stellt'füttern die beide schon (ersatz) nahrung,' Und ihre Kollegin, hier die Übergeberin zur Übernahme des Redezugs auffordert. Der Typus der Äußerung drückt noch vor Eintritt bzw. mit Beginn der Pause eine Verbindlichkeit für die ausgewählte nächste Sprecherin aus. Die darauf entstehende Schweigephase in Zeile 8 wird daraufhin von der Übergeberin mit ja [jA rechtsseitig wieder geschlossen und zugleich wird in Zeile 9 die von N2 davor gestellte Frage spezifiziert. # 17: Geburtshilfe / 'wie war das jetzt bei der anderen' ((31:28-32:02)) Ü: Übergeberin; Nl, N2: Übernehmerinnen 01 Ü:
« p p X i a s klappt alles>
02
127
ja [jA «dim>die füttern (mittlerweile )> [gestern abend, SOnst (.) [ist da nichts weiter[wie war das jetzt bei der anderen die=die fütterte ([ ) [hm=HM[frau turner pre frau meier HA_a genau; da is sonst nichts weiter mit
02
Ü:
03
frau Kasseler?
04
(0.5) ((Kugelschreiberknipsen))
05
e=te plus zehn,
06
(1.0)
07
das is zustand nach lymphdrüsenkrebs siebenun:
08 09
Nl:
hm-
Ü:
die is wohl gePRIMT worden-
10 11 12 >
«melodischMJND in der EL:F->
13
14
(-) mamma hat die ganze nacht BONding
35 36 37
gemacht hat=es gut angelE:chtMM
nickt
(3x) und blickt in Richtung N2
(6.0)
Frau 'Schöhler' wird von der Übergeberin mit der Angabe der Zimmer- und Bettnummer auf der Station lokalisiert und mit der Nennung des Familiennamens eingeführt. In Zeile 5 beschreibt Ü den von der Frau in der nun auslaufenden Schicht erlebten Statuswechsel von der schon wesentlich über dem errechneten Geburtstermin liegenden Schwangerschaft, hin zu einer kürzlich entbundenen Frau 'sie war ursprünglich e=te=plus sieben hat dann entbundn=gestern abend,'. D. h es hat eine für die gegenwärtige (Übergabe-) Situation maßgebliche Veränderung eines Identitätsmerkmals der Frau stattgefunden, das allgemein betrachtet wiederum für die übernehmende Schicht Konsequenzen hat, nämlich hinsichtlich der Formulierungsressourcen zur Identifizierung der Personen. Das Aufgabengebiet der Pflegekräfte hat sich durch die Geburt natürlich erheblich verändert. Die erwarteten Tätigkeiten der Pflegepersonen sind bei Schwangeren eher gering, das ganze Spektrum der geburtshilflichen Pflege kommt im Wesentlichen erst nach der Geburt zum Tragen.
156
4. Die soziale Organisation durch Mitgliedschafts-Kategorisierungen
Die präzise Geburtszeitangabe in der Übergabe drückt die Aktualität des Geburtsereignisses115 aus, schließlich sind eine Reihe von geburtsmedizinischen Untersuchungen und pflegerischen Aktivitäten daran geknüpft, z. B. die Überprüfung der Rhesusunverträglichkeit. Grundsätzlich ist Vorsicht geboten bei einer Rhesuskonstellation Rh-negativ bei Schwangeren und Rh-positiv beim Kind bzw. beim Vater, wenn dieser dem Kind das Rhesus-positive Blutmerkmal vererbt hat, denn in diesem Fall kann es zu einer Antikörperbildung kommen. Im vorliegenden Beispiel ist das jedoch nicht der Fall, der besondere Informationswert liegt darin, dass Mutter wie Neugeborenes ein Rh-negatives Blutmerkmal aufweisen. Damit werden sie in die Nähe eines Sonderfalls gerückt, erfordern dennoch für das Pflegepersonal keine zusätzlichen medizinischen oder pflegerischen Sondermaßnahmen. Ab Zeile 16 berichtet die Übergeberin über die geburtshilfliche Vorgeschichte der Frau, aus der hervorgeht, dass die eben erfolgte Geburt nicht die erste ist. Eine Information, die nur indirekt aus dem Hinweis der Übergeberin auf die angeborene Fehlbildung eines weiteren Kindes der Frau hervorgeht. Die Angabe der Parität, also die Information, ob die Frau erst-, zweit- oder mehrgebärend ist, kann für die übernehmende Schicht deshalb von Belang sein, weil sich durch jene Merkmale jeweils relevante Fähigkeiten und Erfahrungswerte unterstellen lassen. Es lässt sich also bereits an dieser Stelle in der Übergabe ein bestimmter (potenzieller) pflegerischer Aufwand eruieren. Auffällig ist auch, dass die Übergeberin in der Art und Weise, wie sie das Thema Fehlbildung in ihrer Narration einführt, den Verlauf ihrer Kenntnis darüber durch die nachträgliche Einsicht in der (alten) Akte anzeigt (darauf komme ich weiter unten nochmals zurück). Zu den weiteren Merkmalen der Frau gehören mehrere Jahre zurückliegende Bandscheibenprobleme sowie die Angabe von zwei Allergien. Mit dieser Merkmalsbeschreibung der Patientenkategorie zeichnet die Übergeberin die Ausgangsbedingungen, unter denen das Pflegepersonal startet. Der nach der langen Pause in Zeile 24 nochmalige Bezug der Übergeberin auf die auch beim Neugeborenen nicht auszuschließende Fehlbildung ist ein vorsichtig gegenüber ihren Kolleginnen eingeführter Arbeitsauftrag. Die im Anschluss darauf von einer der beiden Übernehmerinnen formulierte Nachfrage nach dem Anlegen des Neugeborenen an die Mutterbrust lässt vermuten, dass die Übernehmerin so kurz nach Erhalt
Der „Geburts-Tag" wird als Tag Null gezählt; erst nach 24 h spricht man vom 1. Lebenstag. Ein weiterer Grund für die minutengenaue Angabe der Geburtszeit ist, dass daran die ersten geburtsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen geknüpft sind (vgl. Kinder-Richtlinien des Bundesausschusses 2009). 115
157
Patientenkarriere - Beschreibungen im Wandel
eines Arbeitsauftrages weitere in Betracht ziehen muss und möglicherweise noch ausstehende Pflegetätigkeiten zu identifizieren versucht. Gerade an dieser Stelle im Transkript wird wieder deutlich, wie die Akteurinnen gemeinsam, also die übergebende wie übernehmende Schicht, an der Kategorisierungsarbeit teilhaben und damit situationsgerechte Schlussfolgerungen im Lichte ihrer Aufgaben als professionelle Pflegekräfte ziehen. Die Äußerung 'war das kind angelegt 'Ü' , ' legt eine pflegerische Tätigkeit offen, die vom Pflegepersonal auf der Geburtshilfestation natürlicherweise erwartet wird. Über die Feststellung situativ relevanter Beschreibungskategorien einer Person, z. B. das Wissen über die nötige Pflegepraxis am ersten Tag nach der Geburt, die fachlichen Kompetenzen der Kollegin oder die üblicherweise auf dieser spezifischen Station von den Akteurinnen zu befolgenden Arbeitsaufgaben, lassen sich so genannte „category predictions",116 also Vorhersagen über die Zugehörigkeit einer Patientin zu einer Kollektion von auf der Station zu pflegenden Personen, machen. Je nach dargestelltem Umfang, Form und Inhalt der erfolgten pflegerischen Tätigkeiten der übergebenden Schicht, haben die Vertreterinnen der übernehmenden Schicht die Aufgabe, über die Mitgliedschaftskategorisierung das Maß der in der Folgeschicht zu erwartenden Pflegeintensität zu bestimmen. Üs Antwort auf N l s Frage (in Zeile 34) nach dem Anlegen des Neugeborenen an die Mutterbrust fällt sehr eindringlich aus, signalisiert durch das gehauchte „Ja" und dem unterstützend eingesetzten mehrmaligen Nicken als Kopfgeste. Die erste Hälfte der Formulierung 'mamma hat die ganze nacht BONding gemacht hat=es gut angeiE: cht-'117 drückt beinahe eine Übererfüllung der Mutterpflichten aus, die zweite verweist auf einen evaluativen Aspekt. Darüber hinaus gibt sie gewissermaßen auch Auskunft über die Beziehung der Mutter mit dem Neugeborenen, ihre psychische Verfassung, ihre Versiertheit im Umgang mit der neuen Situation und, ganz entscheidend für die Ermittlung der Pflegeintensität, die sich dadurch anzeigende Autonomie der Mutter. b) Mittagsübergabe:
Frau 'Schöhler'
In der Mittagsübergabe werden die von den Übergeberinnen morgens übernommenen Frauen bzw. Patientinnen an die Folgeschicht wieder kommunikativ weitergereicht. Aus dem analytischen Blickwinkel ist die Beobachtung der Patientinnenhistorie besonders dann von Interesse, wenn mithilfe der Kategorisierungsanalyse die Veränderung und Aushandlung der
116 Vgl. Wolff (2001). „Bonding" ist der erste, Bindung stiftende Kontakt zwischen Neugeborenem direkt nach der Geburt (vgl. Mändle et al. 2007:314). 117
Mutter
und
158
4. Die soziale Organisation durch Mitgliedschafts-Kategorisierungen
Teilnehmerkategorien (Patientinnen) sowie deren Konsequenzen für die damit verbundenen pflegerelevanten Schlussfolgerungen, insbesondere für die Pflegeintensität, ersichtlich werden. Mit dem Wandel der Kategorien gehen die sich ebenfalls verändernden Implikationen der Kategorien einher. # 25: Geburtshilfe / 'tee mögen wer nich' ((5:42-7:02)) Ü: Übergeberin; Nl, N2: Übernehmerinnen 01
(2.0)
02 ((...)) 03 Ül: °hh 04 dreieins frau schöhler entbindung Erster tag; 05 (3.5) 06 mutter und kind sind übrigens negativ, 07 Nl: hm_hm, 08 Ül: sie hat das dritte kind bekommen; 09 10 11 12
(2.0) zur patientin, die hat=sie hat eine bekannte novalgin und penicillin=allergie darf daru(m) kein meta (.) mizol bekommen,
13 14 15 16 17
°hh erhielt heute morgen wegen starker nachwehen (diclo dispers;) eine tablette- (--) die dürfte sie bei bedarf drei mal kriegen(4.0) das is ügrigens a=auch zusätzlich noch_n zustand nach_n
18 19 20
bandscheibenvorfall(3.0) frau schöhler möchte morgen vorzeitig nach hause gehen,
21
(1.0)
22 is: ne sprechstundenhilfE bei einer kinderärztin 23 und diese kinderärztin wird dann die u=zwei vornehmen24 das wäre morgen sowieso noch zu früh25 Nl: ja26 Ül: "hh ähm: : 27 (2.0) 28 29 30
zu den geschwisterkindern; (-) daS: kind das neunzehnhundertsiebenund=neunzig geboren wurde=hat eine lippenspalte;
Patientenkarriere - Beschreibungen im Wandel
31
°h das weiss ja mamma und sacht das dann auch der kinderärztin-
32
°h das anlegen klAPPT,
33
(0.5)
34
kind is aber teilweise noch unruhig nach dem anlegen,
35
und=öh darum füttert sie bei bedarf-
36
°h sie hat erst tee versucht, (.) te(e) mögen=wer nich (.)
37
jetzt haben wir=s mit dextr[o aufgefrischt- (.) [hm:
38 Nl: 39
159
und das schmeckt
40 Nl: hm-
Die Äußerung der Übergeberin, die den Beginn der Informationseinheit von Frau „Schöhler" markiert, beinhaltet gleich drei unterschiedliche Kategorisierungsformen: die Ortsangabe 'dreieins' steht für das erste Bett im Zimmer mit der Nummer drei, den Familiennamen der Frau und die Angabe der verstrichenen Zeit post partum. Die Formulierung ' entbindung (...) deutet zudem auf eine normale Entbindimg hin. Im Falle einer Schnittentbindung (Kaiserschnitt) würde die Übergeberin dies erwähnen, denn dieser Aspekt ist hinsichtlich des dann höheren pflegerischen Aufwands übergaberelevant. Nach der Rhesuskonstellation folgt die mehrfache Parität der Frau, eine Information, die auf Vorerfahrungen und damit auf eine erhöhte Selbständigkeit schließen lässt. Zu den auch schon in der Morgenübergabe erwähnten (medizinischen) Merkmalen, den beiden Allergien, kommt die Erwähnung des damit zusammenhängenden Verbots der bestimmten Schmerzmittelvergabe (' metamizol ') und des anstatt dessen verordneten Schmerzmittels ('diclo dispers') hinzu. Der Hinweis auf die Bandscheibenprobleme der Frau ist ebenfalls Bestandteil der Mittagsübergabe. Ab der Zeile 20 kündigt sich die durch den von der Frau beabsichtigten vorzeitigen Heimgang eine Veränderimg der Beziehungskonstitution aller Beteiligten an. Die Stunden zuvor entbindende Frau (Schöhler) ist 'mamma' (Z. 31), Patientin (Z. lOf.) und Sprechstundenhilfe bei einer Kinderärztin (Z. 22). Jeder dieser von der Übergeberin der Frau zugeschriebenen Identitätsaspekten erzählt eine eigene Geschichte mit pflegerelevanten Inferenzen. Ein frühzeitiger Heimgang ist grundsätzlich erklärungsbedürftig, insbesondere dann, wenn
160
4. Die soziale Organisation durch Mitgliedschafts-Kategorisierungen
bestimmte Kindervorsorgeuntersuchungen118 nicht durchgeführt werden können, es sei denn, eine medizinisch und pflegerisch überzeugende Alternative steht zur Stelle. Die Teilnehmerkategorien „Sprechstundenhilfe" und „Kinderärztin" bilden ein weiteres (neues) standardisiertes Beziehungspaar, das das bestehende Paar Pflegepersonal/Patientin frühzeitig ablösen wird und gleichzeitig die erforderlichen „Kriterien" zu Durchführung der U2 Neugeborenen-Untersuchung erfüllt. Schließlich kann der auch als Sprechstundenhilfe tätigen Mutter durch ihre berufliche Nähe zur Kinderheilkunde zumindest in Teilbereichen ein zusätzliches (pflegerisches) Wissen unterstellt werden. Sie wird für die restliche Dauer des Aufenthalts zwar weiterhin eine zu pflegende Person bleiben, jedoch mit dem Unterschied, dass sie zusätzlich einer dem Pflegeberuf ähnlichen Gruppe angehört. Ferner übernimmt die Kinderärztin (und Arbeitgeberin) Aufgaben, die im Normalfall das medizinische Fachpersonal auf der Station ausführt und vom Pflegepersonal dabei unterstützt wird. Das heißt durch die professionelle Obhut der Kinderärztin, in die sich die Frau (und Patientin) frühzeitig begeben wird, ist die Arbeitsbeziehung zwischen dem Pflegepersonal und der Patientin zwar absehbar befristet, aber noch nicht vollständig beendet. Vielmehr verweist die Übergeberin ab Zeile 28 auf die Fehlbildung (Lippenspalte) bei einem der Geschwisterkinder, die daher auch beim Neugeborenen separat untersucht werden sollte. Diese Information bedürfte eigentlich keines besonderen Hinweises angesichts des von einer Sprechstundenhilfe und einer Kinderärztin erwartbaren medizinischen Fachwissens. Vermutlich gibt die Übergeberin der Übernehmerin aber damit zu
Die im Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen festgelegten Richtlinien über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres („Kinder-Richtlinien") sehen in den ersten sechs Lebensjahren insgesamt zehn Untersuchungen vor. Davon werden im Regelfall zwei der Untersuchungsstufen (U1 und U2) auf der Geburtsstation durchgeführt (Ausnahmen sind Hausgeburten und solche in Geburtshäusern). Nicht erwähnt, aber trotzdem unmittelbar nach der Geburt ermittelt, wird ein sog. Apgar-Wert, d. h. das Baby wird gemessen, gewogen und das Blut der Nabelschnur untersucht. Die U1 Neugeborenen-Ersfuntersuchung wird im Regelfall ebenfalls unmittelbar nach der Geburt vom leitenden Arzt/der leitenden Ärztin oder der/s Hebamme/Geburtspflegers durchgeführt. Diese Untersuchung hat das Ziel, lebensbedrohliche Zustände zu erkennen und offensichtliche Defekte festzustellen, die umgehendes Handeln erfordern (vgl. Kinder-Richtlinien des Bundesausschusses 2009). Die U2 Neugeborenen-Untersuchung wird für gewöhnlich zwischen dem 3. und 10. Lebenstag durchgeführt und umfasst eingehende Untersuchungen insbesondere der Motorik, des Nervensystems, der Körperhaltung, der Brust-, Bauch- und Geschlechtsorgane sowie der Haut und der Sinnesorgane (vgl. dies.: 5). 118
Patientenkarriere - Beschreibungen im Wandel
161
verstehen, dass sie die Notwendigkeit der genauen Untersuchung des Neugeborenen auf Fehlbildungen ihrer Profession entsprechend zwar erkannte und offensichtlich selbst nicht durchführte, die Information darüber hingegen der Frau, d. h. hier Vamma' (Z. 31) unterstellte. Aus diesem Gesprächsausschnitt geht also nicht hervor, ob die Übergeberin mit der Patientin darüber tatsächlich ein Gespräch führte, dies ist für die Analyse aber auch nicht entscheidend. Was für die übernehmende Schicht von Bedeutung ist, sind die bis zum Heimgang der Patientin potenziell noch anfallenden pflegerischen Tätigkeiten. Die üblicherweise von Pflegekräften auf der Geburtsstation zu beachtende Tätigkeit, die Unterstützung beim Anlegen des Neugeborenen an die Mutterbrust, funktioniert grundsätzlich, die Übergeberin weist darauf hin, dass die Frau zwei Präparate ausprobiert hat und eines davon erfolgreich ('dextro') zugefüttert hat. Das von der Übergeberin beschriebene Patientenbild lässt die übernehmende Schicht also einen äußerst geringen Pflegebedarf erwarten, da die Patientin grundsätzlich selbständig genug ist, um sich selbst zu versorgen. c) Abendübergabe: Frau 'Schöhler' # 26: Geburtshilfe / 'also momentan geht es' ((28:30-29:02)) Ü: Übergeberin; Nl, N2: Übernehmerinnen 01 Ü:
frau schöhler in der DREI, erster tag nach entbindung-
02
(.)(Kugelschreiber knipsen)
03
drittes kind-
04
(2.0)
05
is soweit selb=ständig, die hatte irgendwann mal=ein
06
bandscheibenvorfall,
07
(1.0)
08
verträgt kein novaigln und kein penicillin, und soll deswegen
09
(diclo dispers)nach bedarf haben; dreimal eine aber'
10
hatte sie heut morgen wohl mal eine (--)
11
tablette gehabt seitdem nicht wieder;
12
also momentan geht es; (.)
13
«p>kommt
14
[(Rauschen im Hintergrund - Auto/offenes Fenster)
15 N2 :
steht auf?
16 Ü:
hm hm-
17
[klar>
MM
Kopfnicken
Im Vergleich zur Morgen- und Mittagsübergabe ist die Übergabe am Abend vergleichsweise kurz und knapp. Nach der üblichen Grundkategorisierung, die Ortsangabe, Zeitangabe (Tag post partum) und Parität beinhaltet, folgt gleich die auf eine geringe Pflegeintensität verweisende Schlussfolgerung der Übergeberin, 'is soweit seib=standig'. Die Übergeberin gibt lediglich noch
162
4. Die soziale Organisation durch Mitgliedschafts-Kategorisierungen
Informationen bezüglich einer weit in der Vergangenheit liegenden Erkrankung der Wirbelsäule und der eingeschränkten Medikamentenverträglichkeit (Diclo Dispers anstatt Novalgin und Penicillin) sowie der Medikamentendosierung. Frau „Schöhler", der in der Abendübergabe keine weiteren Identitätsaspekte außer ihres Patientinnendaseins zugeschrieben wurden, bewegt sich auf einen für das Pflegepersonal idealen Patiententypus zu. Dieser besteht darin, dass sie sich annähernd selbst versorgen kann (vgl. in Z. 13 '«p>kommt [kiar>'), darauf verweist auch die abschließende Nachfrage der Übernehmerin knapp vor Ende 'steht auf?', mit der diese auf kooperative Weise das genaue Ausmaß ihrer Selbständigkeit zu erfassen versucht. Die anschließende Zustimmung der Übergeberin meint hier auch eine Bestätigung des von ihr vorab gezeichneten, von der Übernehmerin bestätigten und offensichtlich auch der Übergeberin entsprechenden identifizierten Patientenbildes, das eine äußerst geringe bis keinen Pflegebedarf in der Nachschicht erwarten lässt. Die nächste Patientin verlässt im Gegensatz zur vorherigen nicht vorzeitig die Station, sondern wird aufgrund des erfolgten medizinischen Eingriffs (Schnittentbindung/Kaiserschnitt119) am Folgetag noch nicht nach Hause entlassen werden, stattdessen weitere Tage im Krankenhaus zubringen müssen. Die Patientin teilt sich das Zimmer mit der oben besprochenen Frau 'Schöhler'. d) Morgenübergabe: Frau Baldauf # 27: Geburtshilfe / 'aber matnma war einfach zu müde und zu kaputt' ((3:10-4:16)), Ü: Übergeberin; Nl, N2: Übernehmerinnen (6.0)
01 02
0:
GU:t im zweitn, bett frau baldauf? ((Baby schreit im Hintergrund))
03
(-)
04
KAum sacht man ein wort=
05 06
N2:
hm-
07
Ü:
das ist dieses kind- (-) Sectio zweiter tag,
08
((Baby schreit))
09 10
hat ihr (laxoberal) erhalten,
11
ahm: das is zustand nach beckenvenen und beinvenenthrombose, (-) sie bekommt null=kommafünf äh:
12 13
(—)
Nl :
(klexana)
' hm [ ' hm-
Bei dieser Form der Entbindung wird das Neugeborene auf operativem Wege (Unterbauch-Querschnitt) aus der Gebärmutter der Schwangeren entnommen.
119
163
Patientenkarriere - Beschreibungen im Wandel
14 Ü: 15 Nl: 16 Ü:
ab
[son-
(fraxen125) ah fraxen,
17 N2:
ja
18
okay
19
(— )
20 N2:
hm_hm-
21
(-) °h und ab sonntag null=komma=acht;
(1.5)
22 Ü:
ä:hm das kind war relativ un_ruHig heue nAcht-
23
mamma hat_es zweimal angelecht sehr gründlich angelecht-
24
(-)
25
un_dann ham_wa versucht noch mit=tee:
26
das war äh: relativ schwierig
27 28 29 30
(1.5) jetzt liegt sie da in bauchlage, (3.0) und dann ging das so einigermaßen;
31
(-)
32 Nl:
hm-
33 Ü:
aber mamma war einfach zu müde und zu kaputt
34
« w e i n e r l i c h > u m bonding machen>
35 36
(.)
(10.0) vier im zweiten,
Die Übergeberin führt die nächste zu pflegende Person im üblichen Format ein, beginnend mit der Ortsangabe und dem Familiennamen der Frau. Die Verwendung der Ortskategorie'GU:t im zweitn, bett'impliziert aber auch die Zimmernummer, d. h. die Übergeberin unterstellt offensichtlich das Wissen darüber und kommt dem Anschein nach ohne expliziten Verweis darauf aus. Als Erklärungsressource dient die Konsistenzregel, die hier mit der Verwendung von Ortskategorien in eigentümlicher Weise verschränkt ist. Die Konsistenzregel 121 besagt, dass wenn eine bestimmte Anzahl (Population) von Personen kategorisiert und eine Kategorie dieser membership categorization device gebraucht wurde, um die erste Person zu charakterisieren (Name einer Patientin/ Geburtsstation), dann gilt es die folgenden Kategorisierungen ebenfalls diesem device zugehörig zu verstehen. Das bedeutet in unserem
120
„fraxen" als Abkürzung für „Fraxiparin" (s. o.)
"If some population of persons is being categorized, and if a category from some device's collection has been used to categorize a first Member of the population, then that category or other categories of the same collection may be used to categorize further Members of the population" (Jayyusi 1984: 213; Hervorhebung im Original). 121
164
4. Die soziale Organisation durch Mitgliedschafts-Kategorisierungen
Beispiel, dass die folgenden Kategorisierungen (hier Frau „Baldauf") nicht nur aus der MCD Geburtsstation stammend zu hören sind, sondern auch noch der lokalen Unterkategorie (Zimmer drei) der MCD Geburtsstation zugehörig. Nach der kurzen Unterbrechung durch das Schreien eines Babies im Hintergrund und der Identifizierung als Kind jener Patientin durch die Übergeberin, folgt die Form der Geburt (Schnittentbindung) und die seitdem verstrichene Z e i t s p a n n e in T a g e n ' s e c t i o
zweiter
t a g , ' . M i t der A u f z ä h l u n g
bestimmter Aktivitäten, wie der Medikationsvergabe („Laxoberal"122 in Z. 10), der Nennung einer zusätzlichen Diagnose („Becken-Bein-Venenthrombose" in Z. 11), der Dosierung der Medikation (in Z. 12 und 18) und in der zweiten Hälfte des Informationsblocks des Versuchs, mit Tee ergänzend zum normalen Anlegen zuzufüttern, generiert die Übergeberin u. a. ihre Selbstkategorisierung als Übergeberin. Sie zeigt damit auch an, ob und welche pflegerischen Aktivitäten sie wie ausgeführt hat. Dabei wird ein Abgleich bzw. eine Wissenskorrektur zwischen übergebender und übernehmender Schicht ersichtlich, und zwar wird die Übergeberin der Morgenübergabe von einer der Übernehmerinnen korrigiert. Statt des von Ü genannten „Clexana"123 soll „Fraxiparin"124 bei zunächst gleich bleibender und zwei Tage später sich verändernden Dosierung verabreicht werden. An dieser Stelle wird die Statusdifferenz zwischen dem Pflegepersonal und den Schichtdiensten ersichtlich. Die Morgenschicht gilt der Nachtschicht im Regelfall als übergeordnet; und zwar hinsichtlich der im Vergleich in den jeweiligen Tagesabschnitten zu absolvierenden pflegerischen Aktivitäten. Zusätzlich finden vormittags auch die meisten Zusammentreffen mit Fachkolleginnen verschiedener Berufsgruppen (Medizinisches Personal, Hebammen, Haustechnik, EDV etc.) und externer Personen (Angehörige etc.) statt, die wiederum u. a. (geburtsmedizinische) Entscheidungen nach sich ziehen und vom Pflegepersonal umgesetzt werden sollen. Analytisch betrachtet darf die erwähnte Statusdifferenz aber keinesfalls vorausgesetzt und auch nicht dem Datum achtlos übergestülpt werden, vielmehr muss sie in den Äußerungen der Akteurinnen nachgezeichnet werden können. Jedenfalls nimmt die Übergeberin die Korrektur unwidersprochen an und fügt die offensichtlich unabhängig vom Präparat gleich bleibende Dosierung hinzu. Durch die von der Übernehmerin initiierte Korrektur zeigt sie erstens ihr Fachwissen zur (pflegerischen) Behandlung von Thrombosen an, zweitens ist es
122
Medikament gegen Verstopfung
123
Thrombosemittel
124
Medikament gegen Thrombose
165
Patientenkarriere - Beschreibungen im Wandel
auch denkbar, dass sie mit der Korrektur lediglich an ihren letzten Wissensstand zur betreffenden Patientin anknüpft, über den sie mit Abschluss ihres letzten Dienstes von vor ca. 18 Stunden, d. h. mit Ende der Frühschicht einen Tag zuvor verfügte. Wie Übergeberinnen das Interaktionsproblem lösen, ihre Kolleginnen der Folgeschicht zu informieren, dass ein Teil der von der Übergeberin gegenüber der Patientin anzuleitenden und zu beobachtenden Aktivitäten (Anlegen, Stillen, Bonding) nicht erfolgreich umgesetzt werden konnten, zeigt der folgende Abschnitt. Die Übergeberin schildert, wie sie mit unterschiedlichem Erfolg gemeinsam mit der 'mamma' versucht hat, das Neugeborene zu füttern bzw. anzulegen (Z. 23). Dass das Kind in der vergangenen Nacht 'relativ un ruHig' war, ist ein Attribut, das sowohl sie als Pflegekraft, als auch die von ihr zu pflegende Person und Mutter betrifft. Die Mutter hat die von ihr erwartete Aufgabe, das Baby anzulegen, offensichtlich gut erfüllt (vgl. in Z. 23 'sehr gründlich angelecht-'). Dennoch zeigt die Äußerung und das in der 1. Person Plural gebrauchte Personalpronomen'un dann ham_wa versucht noch mit=tee:', dass die Übergeberin sie dabei unterstützen und sogar Versuche, mit Tee zuzufüttern, unternehmen musste. Die Schilderung der (scheinbar) einzigen von der Patientin erträglichen Körperposition (Bauchlage) deutet auf die pflegerische Ernsthaftigkeit der Situation hin. Mit ihrer gewählten finalen Formulierung, die die erhöhte Pflegeintensität und das begründete Ausbleiben einer Pflegeaktivität (signalisiert durch das „aber" und die inszenierte Form der B e f i n d l i c h k e i t s w i e d e r g a b e ) a n z e i g t (' aber mamma war einfach
zu müde und zu
gibt die Übergeberin ihren Kolleginnen zu verstehen, dass sie die von ihr erwarteten Aufgaben zwar ordnungsgemäß bedacht hat, sie aber aus genannten Gründen nur teilweise erfolgreich ausführen konnte. Die übernehmende Schicht kann daraus einen erhöhten Pflegebedarf schlussfolgern. kaputt
(.)
«mitleidend>um
bonding
machen'),
e) Mittagsübergabe: Frau 'Baldauf' # 28: Geburtshilfe / 'ich hab ihr das genau gezeigt' ((07:03-07:52)) Ü: Übergeberin; Nl, N2: Übernehmerinnen 01 Ül:
dreizwei frau baldauf-
02
Sectio zwoter tag;
03
04
(1.5) zustand nach becken und beinvenenthrombose;
05
(2.5)
06
darum bekommt patientin, ab heutE null komma vier
07
(1.0)
08
ab sonntag null komma acht-
(fraxi)
166
4. Die soziale Organisation durch Mitgliedschafts-Kategorisierungen
09
10
11 12 13 14 15
16 17
18 19
20
[((Hintergrundgeräusch))
21
hat aber schon wunde brustwarzen und macht (offene pflege;)
22
( —) ich hab ihr das genau gezeigt [wie das funktioniert-
23 24
N1
25
02
26 Ol
((Sesselrücken)) °hh vierzwei frau (...)
In der Mittagsübergabe bestehen die wesentlichen Veränderungen gegenüber der Morgenübergabe darin, dass sich der Zustand der Patientin offensichtlich verbessert hat. Jedoch hat sie durch die bislang in den Schichten zuvor nur mäßig erfolgreichen Anlegeversuche wunde Brustwarzen bekommen, was eine gesonderte Behandlung seitens der Übergeberin erforderlich machte. Das von der Übergeberin gewählte Kategorisierungsformat der Patientin beinhaltet die Lokalisierung125 und den Familiennamen, die Art der Geburt einschließlich der verstrichenen Tage post partum, die Diagnose der Thrombose sowie die zwei Dosierungen der Medikation, die Einschätzung des Gesundheitszustandes und die Parität der Frau. Daneben gibt sie erfolgte Pflegeaktivitäten wieder, wie die Entfernung des Wundverbandes (aufgrund der sectio), den Neubezug des Bettes und die von ihr durchgeführten Anleitung zur entsprechenden Pflege
125
'dreizwei' ist eine Kurzbezeichnung und steht für das zweite Bett im Zimmer mit der Nummer drei auf der Geburtsstation, im Unterschied zur Morgenübergabe derselben Patientin, während der die Ortsangabe ausschließlich mit der Nennung des bestimmten Bettes (vgl. 'GU:t im zweitn, bett frau baldauf?') erfolgte. Ohne des Zusatzes „Bett" wäre diese aber missverständlich gewesen. Würde die Übergeberin in der Mittagsübergabe mit „zwei" beginnen, wäre dies mindestens mehrdeutig, denn damit könnte auch das Zimmer zwei gemeint sein und würde unter Umständen eine Rückfrage hervorrufen. Die aber immer noch ökonomische und gleichzeitig sinnhafte Ortsangabe „dreizwei" erfüllt ihren Zweck.
Patientenkarriere - Beschreibungen im Wandel
167
der wunden Brustwarzen. Durch die von der Übergeberin vorgenommene Kategorisierung von Frau 'Baldauf' und die Schilderung der Pflegeaktivitäten und Zustände entwickelt sie das standardisiertes Beziehungspaar (SRP-ÜG-Pat) Übergeberin/Patientin. Gleichzeitig hält sie diese SRP-ÜG-Pat für das zwischen ihr und der Übernehmerin auch bestehende und aufeinander bezogene standardisierte Beziehungspaar (SRP-Pflege) aufrecht und kommunikativ anschlussfähig. Denn die Mechanismen dieser Beziehungskonstitution, insbesondere über die Aktivierung einer Kategorie (z. B. ein bestimmtes Patientenbild durch die Übergeberin), rufen situativ relevante Unterstellungen und Erwartungen ab, die so die für die Folgeschicht pflegerelevanten Schlussfolgerungen erst hervorbringen. Die übernehmende Schicht hat es infolge dessen mit einer Patientin zu tun, die nach einer Schnittentbindung und einer Nebenerkrankung einer vermehrten pflegerischen Zuwendung bedarf, gleichzeitig aufgrund der Parität noch keine Vorerfahrungen mitbringt und infolgedessen in alle grundlegenden Maßnahmen vom Pflegepersonal nach und nach eingeführt werden muss. f) Abendübergabe: Frau 'Baldauf # 29: Geburtshilfe / 'nachdem sie sich da=n bisschen aufgeregt hatte' ((28:30-29:32)), Ü: Übergeberin; Nl, N2: Übernehmerinnen; S: Schülerin 14 Ü: 15
hm_hmMM
Kopfnicken
16
°hh° frau baldauf sectio zweiter tag erstes kind-
17
( — ) hm: : die braucht noch ein bißchen hilfe,
18
(-) is auch ein großes kind über vier kilo gewesen,
19
blutzucker stabIL?
20
°h die hatte eine bein und beckenwehenthrombose,
21
(.) hat sie wohl immer noch,
22
bekommt deswegen (fraxi) hat sie aber alles gehabt- °h
23
die linke warze ist ein bißchen angeknabbert aber noch nicht
24
blutIG- die hat sie jetz mal kurz' äh: jetz heut nachmittag
25
ausgesetzt, nachher eventuell wieder anlegen oder halt mal
26
pumpen; das is=n scheiss hier also die brüst is ja noch sehr
27
weich- und rechts (.) ging aber mit hilfe nachdem sie sich
28
da=n bisschen ( — ) aufgeregt hatte gings dann aber auch;
29
((Telefon läutet))
30 31 S:
hmMM
((steht auf und geht zur SL-Feststation, nimmt das Headset))
32 ü:
hm_hm
33
[abgeführt hat sie-
34
[((Telefon läutet))
168
35 S: 36 Ü: 37
4. Die soziale Organisation durch Mitgliedschafts-Kategorisierungen
(( [ )) [in der vier frau ferden im hinteren bett ist in der dreiunddreißigsten woche,
Die Lokalisierung von Frau 'Baldauf' auf der Geburtsstation bleibt in der Abendübergabe aufgrund der Konsistenzregel ausschließlich implizit. Die Übergeberin beginnt mit dem Familiennamen, der Art der Geburt und erwähnt - diesmal schon im ersten Drittel des Informationsblocks - die Parität der Mutter. Die nach einer kurzen Gesprächspause in Zeile 17 formulierte Feststellung ' hm: : die braucht noch ein bißchen hilfe,' ist einerseits eine folgerichtige Inferenz aus den beschriebenen Ausgangsbedingungen (Schnittentbindung zweiter Tag und erstgebärend) und andererseits eine offensichtlich auf Erfahrungswerten gestützte Information für ihre Kolleginnen, die damit die Hilfsbedürftigkeit der Patientin als ein ihr zuordenbares Merkmal übernehmen können. Die in der Folgezeile nachgeschobene Erklärung 'is auch ein großes kind über vier kilo gewesen,' ist Vermutlich ein Indiz für die Schwere der verlaufenen Geburt, das demnach die erforderliche Unterstützung durch das Pflegepersonal noch zusätzlich unterstreicht. Die in den Gesprächsbeiträgen der Übergeberin erkennbaren Kategorien, gebunden an (pflegerische) Aktivitäten und Zustände (vgl. 'biutzucker stabiL?' in Z. 19, bekommt deswegen
(fraxi) hat sie aber alles gehabt-
i n Z . 2 2 , ' die linke
in Z. 23f. SOWie in Z. 33 gegen Ende 'abgeführt hat sie- '), machen deutlich, was sie in der nun ausklingenden Schicht als relevante Beschreibungen von ausgeführten Pflegehandlungen erachtet. Gleichzeitig kategorisiert sie sich damit selbst, die Patientin und die kommunikativ dargestellte Beziehung dienen der übernehmenden Schicht als Interpretationsressource. warze ist ein bißchen angeknabbert aber noch nicht blutIG-'
Analytisch von zusätzlichem Interesse ist die Ausführlichkeit, mit der die Übergeberin das Thema „Anlegen" bearbeitet, aus diesem Szenario gehen für alle Beteiligten wichtige Informationen hervor. Hinter allem steht die geburtsmedizinische und -hilfliche Aufgabe, dass das Neugeborene in erster Linie mit Muttermilch gesäugt werden126 und eine Zufütterung nur nach vorherigem Anlegen des Kindes und nach Abpumpen, „wenn immer möglich, mit der Milch der eigenen Mutter", (Leitlinien DGGG 2008: 4) ausgeführt werden soll. Die häufigste Ursache für wunde Brustwarzen sind das nicht 126
Vgl. Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. für die Betreuung des gesunden Neugeborenen im Kreißsaal und während des Wochenbettes der Mutter, Stand 2008, Abschnitt 3.2. Ernährung des Neugeborenen, S. 4 f.
Zusammenfassung
169
korrekte Positionieren des Kindes beim Stillen und das nicht korrekte Saugen des Kindes. 127 Aus Üs Schilderung geht auch hervor, dass die (nach Geburten ohnehin angespannte) psychische Verfassung der Patientin nach den offenbar nicht erfolgreichen Anlegeversuchen nicht sonderlich gut war und sich erst nach erfolgter pflegerischer Unterstützung und Anleitung besserte. Dies stellt eine für die Folgeschicht unentbehrliche Information dar, da die Übergabe so den Charakter eines kommunikativ hergestellten Frühwarnsystems bekommt. Der Übergeberin gelingt es trotz oder gerade durch die Vagheit ihrer Formulierungen, wie (...) 'ist ein bißchen angeknabbert aber noch nicht blutIG-' in Z. 23f. und wenig später in Z. 27f. ' nachdem sie sich da=n bißchen (--) aufgeregt hatte ', ein Bild der Patientin zu zeichnen, das dem gegenwärtig gültigen Entwicklungsstand der Mutter am ehesten gerecht wird und der übernehmenden Schicht als sinnvolle Arbeitsgrundlage dient, nach der sie ihre bevorstehenden und von ihnen erwarteten Pflegeaktivitäten ausrichten können. 4.3
Zusammenfassung
Bei den vorangehenden Überlegungen ging es darum herauszuarbeiten, wie in Übergabegesprächen Kategorien und Kategorisierungen eingesetzt und verstanden werden. Als analytischer Ansatz wurde auf das begriffliche Instrumentarium der Kategorisierungsanalyse, ein der Konversationsanalyse nahe stehendes Verfahren, zurückgegriffen. Die analytische Vorgehensweise wurde zunächst anhand Sacks' Beispiel der berühmt gewordenen Äußerung eines k n a p p dreijährigen Mädchens expliziert („The baby cried. The mommy picked it up") und anschließend auf das Übergabegespräch übertragen. Demgemäß wurde dieses soziale Geschehen nicht anhand vorgefasster Kategorien beschrieben, sondern es wurde nach solchen Kategorien und
127
Wunde Brustwarzen stellen für die Mütter ein erhöhtes Infektionsrisiko dar und führen sehr oft zu Mastitis (bakterielle Brustentzündung), (vgl. Empfehlungen der nationalen Stillkommission 2007 des Bundesinstituts für Risikobewertung).
Verstehensressourcen gesucht, an denen sich die Akteurinnen auf der Station in ihrem Handeln beobachtbar orientierten. Entsprechend der für Übergaben besonderen Beteiligungsrollen, wonach Personen der übergebenden ihren Kolleginnen der übernehmenden Schicht begegnen und dabei im Wesentlichen eine Interaktion über abwesende Dritte (Patientinnen) führen, wurde dieses „Beziehungsdreieck" für die anschließende Analyse in den Vordergrund gerückt. Die ausgewählten empirischen Beispiele beschäftigten sich mit zwei unterschiedlichen und für Übergaben konstitutive
170
4. Die soziale Organisation durch Mitgliedschafts-Kategorisierungen
Themenfelder: Zum einen ging es darum, Überlegungen anzustellen, die der regelmäßigen Verwendung von Ortsangaben zu Beginn einer jeden Informationseinheit auf den Grund gehen. Zum anderen wurde die Entwicklung, die Patientinnenbeschreibungen über mehrere Übergaben hinweg zeigen, am Beispiel von zwei ausgewählten Patientinnen im Detail nachgezeichnet. Hinsichtlich der Ortskategorisierung lässt sich sagen, dass das Pflegepersonal über ein stationsspezifisches geografisches Alltagswissen verfügt. Die in den Übergaben verwendeten Ortsformulierungen stehen daher grundsätzlich außer Frage, sie beinhalten vielmehr zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel die Standorte der jeweiligen Zimmer auf der Station, die genaue Bettenanzahl in Zimmer „77" oder auch die für Privatpatientinnen reservierten Bereiche auf der Station. Darüber hinaus erfüllen einheitliche und gleich bleibende Ortsangaben in Übergaben für die Beteiligten eine mnemotechnische Funktion, mit der es gelingt, unterschiedliche pflegerische Aktivitäten einzelnen Patientinnen, sowie diese bestimmten Stationszimmern bzw. den darin angeordneten Betten zuzuordnen. Es hat sich gezeigt, dass aufgrund des Schichtbetriebs und der gleichzeitig relativ hohen Patientinnen-Fluktuation die namentliche Identifizierung der Patientinnen eher zu Verwechslungen führen kann und daher die zusätzliche ortsspezifische „Markierung" dem vorbeugt. Als Ergebnis der Analyse der Patientenkarriere zweier Patientinnen zeichnen sich für Übergabegespräche relevante Schlussfolgerungen ab, die durch folgende Eckpunkte charakterisiert sind: Einzelne Identitätsmerkmale der Patientinnen, wie zum Beispiel die Parität, Heilungsverlauf etc. können sich von Schichtdienst zu Schichtdienst verändern. Gleichzeitig liefern die von den Beteiligten kommunikativ ausgehandelten Veränderungen bestimmter Identitätsmerkmale pflegerelevante und aufgabenzentrierte Informationen, z. B. hinsichtlich des für die Folgeschicht zu erwartenden pflegerischen Aufwands. Die Tatsache, dass die Akteurinnen gemeinsam an der Kategorisierungsarbeit teilhaben, ruft in der jeweiligen Situation angemessene Inferenzen hervor und ermöglicht diese gegebenenfalls gemeinsam auszuhandeln, zu aktualisieren bzw. zu bestätigen. Von ganz entscheidender Bedeutung ist die Kategorisierungsarbeit auf der Station für Situationen, die es erfordern, mithilfe der durch die Kategorisierungspraxis gleichzeitig bei den Übernehmerinnen mit aufgerufenen Verstehensressourcen, offensichtliche Informationslücken zu überbrücken, wie zum Beispiel nach längerer Abwesenheit einer Übernehmerin. Informationslücken dieser Art werden auf der Basis von meist auch impliziten „Lesarten" einer in der Übergabe von einer Übergeberin skizzierten typischen Fallgeschichte geschlossen. Jene Lesarten sind Teil des Routinewissens und beinhalten Arbeitsverläufe, die in Bezug auf sog. typischen
Zusammenfassung
171
Fälle üblicherweise eingesetzt werden. Ferner illustrieren diese Analysen der Kategorisierungsarbeit, dass sich die Beteiligten a) daran orientieren, b) darüber idealtypische „Patientinnenbilder" und der damit verknüpften - für die Folgeschicht potenziell zu erwartenden - Pflegeintensität generieren lassen. Die empirischen Beispiele haben die immense Bedeutung erkennen lassen, mit der das ganze Spektrum der Kategorisierungsarbeit von den Akteurinnen zur allgegenwärtigen Prozedur der Sinnexplikation und Sinndeutung aufgabenzentriert eingesetzt wird.
5. 5.1
Übergabe-Wissen Das Übergabegespräch als Aushandlungsprozess von Wissen
Im Zentrum dieses Abschnitts stehen Überlegungen zu den Verfahren der Generierung von Wissen durch die Beteiligten eines Übergabegesprächs, also Hervorbringung und Herstellung von Wissen in der Kommunikation. Die Prozesse der Wissensgenerierung bei Übergaben unterscheiden sich sehr stark von Formaten wie z. B. der Arzt-Patientenkommunikation, wo die gemeinsame Wissensbasis zuvor hergestellt werden muss und die Überwindung des NichtWissens oft einen Aushandlungsprozess mit ungewissem Ausgang darstellt (vgl. Koerfer et al. 2010). Die Beteiligten einer Übergabe hingegen haben üblicherweise eine gemeinsame Interaktionsgeschichte mit einem geteilten Wissensvorrat (z. B. über die inhaltliche Struktur, den Umfang oder auch die Dauer einer Übergabe) und können darauf gleichzeitig aufbauen. Das üblicherweise für Experten-LaienKommunikation geltende Merkmal der manifesten Wissensdivergenzen zwischen den Akteurinnen und deren Umgang mit Divergenz und Asymmetrie (vgl. Dausendschön-Gay et al. 2010: 3) gilt für Übergaben ebenfalls nur bedingt. Die Vertreterinnen beider Schichten sind jeweils Expertinnen, wenn auch mit unterschiedlichen Wissenshorizonten und Erfahrungswerten, und müssen diese „epistemischen" Bedingungen jeweils situationsangemessen bewältigen und gegebenenfalls bearbeiten. Es gilt, die für Übergaben typische Asymmetrie der unterschiedlichen Erfahrungsinhalte kommunikativ zu bearbeiten. Formen, damit kommunikativ umzugehen, sind z. B. für die übergebenden Akteurinnen die Wiedergabe von pflegerelevanten Episoden aus der vergangenen Schicht, die Formulierung von Instruktionen, Empfehlungen und dergleichen, sowie auf Seiten der Übernehmerinnen z. B. die Explikation von Schlussfolgerungen auf Patientlnnenlbeschreibungen ihrer übergebenden Kolleginnen. Die analytische Beschäftigung mit Fragen zur Wissensgenerierung erfordert jedoch zuvor einige methodologische Klarstellungen. Methodologische
Hinweise
Eine ethnomethodologisch orientierte Wissensforschung untersucht die Prozesse der Erkenntnisgenerierung und -produktion in der Interaktion und lässt so ein auf das Individuum reduziertes Wissenskonzept hinter sich. Vielmehr werden Wissenserwerb und Wissenskonstruktion „(...) nicht als Aufgaben des Individuums, sondern als Ereignisse in einer soziokulturellen Praxis konzipiert, in der mediatisierte Austauschprozesse zwischen dem Individuum und seiner Umwelt (einschließlich der Objekte und Artefakte) die konstitutiven
174
5. Übergabe-Wissen
Bedingungen für jede Art des Handelns sind" (Dausendschön-Gay et al. 2010: 2). Hinzu kommt die betont erkenntniskritische Haltung der Ethnomethodologie, nach der „Wissen" 1.) nicht direkt beobachtbar ist und 2.) schon gar nicht „reflexhaft" im Rahmen von Interviewstudien abgefragt werden kann. 128 Die Unzugänglichkeit bzw. die „Intransparenz des Fremdbewusstseins" (Bergmann/ Quasthoff 2010) ist weniger ein sozialwissenschaftliches (methodisches) Problem als ein alltagspraktisches und „unproblematisches" und zugleich lösbares Problem der Akteurinnen. Sie sind gewissermaßen kompetent im Umgang mit diesem Problem und haben so einen Fundus an routinemäßigen Lösungsstrategien angelegt. Demnach hat eine empirische Analyse auch an dieser Stelle anzusetzen. Bergmann und Quasthoff unterstreichen dies, wenn sie sagen: „[Zu] dem, was der Andere denkt, weiß oder beabsichtigt, gibt es im Alltag keinen direkten Zugang, es muss indirekt aus Manifestationen Äußerungen und Verhalten - erschlossen werden" (dies.: 22). Für die Untersuchung von Übergabegesprächen stellt sich somit die Frage, wie - wenn der direkte Zugriff auf die kognitiven Prozesse nicht möglich ist - es die Akteurinnen auf der Station bewerkstelligen, mit diesem „unproblematischen Problem" kommunikativ umzugehen und sich indirekt 129 Zugang zum Fremdbewusstsein zu verschaffen. Für die im Folgenden vorgestellten empirischen Beispiele stehen nachstehende Fragestellungen im Mittelpunkt: Aufweiche routinemäßigen Lösungsstrategien greifen die Beteiligten von Übergaben zur Bewältigung dieses sozialen Ereignisses zurück? Welche Bedeutung haben etwa in diesem Zusammenhang spezifische Äußerungsformate der übergebenden Schicht, die insbesondere narrative Strukturen und Instruktionen bzw. konkrete Handlungsanweisungen beinhalten ? Oder wie verändert sich der Gesprächsverlauf in Übergaben, wenn die Beteiligten den Präzisionsgrad der generierten Informationen erst aushandeln müssen? Und aus der Perspektive der übernehmenden Schicht betrachtet, welche stationsspezifischen Inferenzschemata werden eingesetzt und gegebenenfalls modifiziert?
128 Die von den Akteuren als selbstverständlich hingenommenen, spezifischen (epistemischen) Praktiken zur Hervorbringung von sozialer Wirklichkeit werden im Alltag zwar gesehen, wie Garfinkel ausführt, bleiben aber unbemerkt ('seen but unnoticed'), vgl. Garfinkel (1967) bzw. Bergmann (2006). 129
Vgl. Bergmann/Quasthoff (2010: 26) unter Bezug auf Berger/Luckmann (1967).
Das Übergabegespräch als Aushandlungsprozess von Wissen
175
Aus methodologischer Perspektive führen die mangelnde Beobachtbarkeit von Wissen zum einen und das Faktum der nicht direkten Zugänglichkeit zum anderen keineswegs dazu, dass Wissenspraktiken grundsätzlich nicht zum Gegenstand empirischer Studien werden können. Es sind lediglich die Perspektive zu verändern und anstatt dessen Kompensationsmaßnahmen in den Blick zu nehmen, um so Wissen zu einem Objekt intersubjektiver Verständigung und Sinngebung zu machen (vgl. dies.: 23ff.). Im Zentrum stehen die von Bergmann und Quasthoff vorgeschlagenen und im Folgenden vorgestellten Kompensationstechniken Wissensunterstellung, Beobachtung und Interpretation von Verhalten und accounting practices. Wissensunterstellung „Handeln geschieht immer auf der Grundlage von Unterstellungen über das Wissen des anderen" (dies.: 24). Die Unterstellung von Wissen kommt daher, dass wir als kompetente Mitglieder der eigenen Kultur prinzipiell über Wissensbestände verfügen, die kulturell geteilt sind und zumindest eine Idee oder Vorstellung davon haben, was jemand typischerweise weiß. Es gibt z. B. medizinische Sachverhalte und Pflegehandlungen auf der Station, zu denen eine Nachschwester typischerweise über Wissen verfügt. Die Aufgabe ihrer Kolleginnen besteht während einer Abendübergabe nicht darin, dieses Wissen zu erfragen oder zu überprüfen, sondern es zu unterstellen und damit „kommunizierbar" zu machen. Demnach wird der aufgrund des Wechseldienstes für die ankommenden Schichtvertreter konstitutive Wissensrückstand durch diese kommunikative Kompensationspraxis erfolgreich entproblematisiert. Erst die wechselseitige Unterstellung von Wissen sorgt also dafür, dass der kommunikative Prozess der Wissensgenierung in Gang gesetzt werden kann. Die Wissensunterstellung verstanden als eine Art „Behelfskonstruktion" ist generell nicht von Dauer und erfordert ständige Nachjustierungen seitens der Beteiligten. Das ist dann der Fall, wenn etwa die Übergeberin zu Beginn der Abendübergabe, nach der üblichen Nennung der Zimmernummer und des Namens der Patientin, ihre gegenüber sitzende Nachtschwester fragt: 'glaub=du=warst jetzt länger nicht da=ne,',130 diese verneint Und die Übergeberin daraufhin die komplette medizinisch wie pflegerische Vorgeschichte der Patientin aufrollt. Zum Einen werden hier bestimmte Wissensbestände, wie etwa die diagnoseabhängige standardmäßige pflegerische Aktivität, unterstellt und zum Anderen erfordert gerade die
130
Näheres dazu siehe unten # 1.
176
5. Übergabe-Wissen
prinzipielle Einzigartigkeit und Einmaligkeit eines sozialen Ereignisses (vgl. haecceitas/Gaiimkel 2002) immer auch eine situationsangemessene Feinjustierung des unterstellten Wissens. Beobachtung und Interpretation von Verhalten Hierunter ist die Verschränkung eines beobachteten Verhaltens mit dem Interaktionsgeschehen zu verstehen, in das ein bestimmter Akt eingebettet ist, dessen isolierte Betrachtung alleine nicht ausreicht. So ist gerade die sequenzielle Einbettung einer Äußerung der Übergeberin (wie z. B. „hundert eins? ( — ) nichts mit") bei der Morgenübergabe für die Interpretation der Akteurinnen zentral. Durch die wechselseitige Beobachtung und Interpretation des Verhaltens rückt die Prozessualität eines Ereignisses und damit die Verlaufsstruktur stärker in den Mittelpunkt. Die Art und Weise, wie etwa eine Übergeberin bestimmte Vorkommnisse (aus der nun auslaufenden Schicht) mit Patientin X in Zimmer Y schildert und zugleich Zeugenschaft ablegt bzw. Auskunft gibt über den Status ihrer Informationen, eröffnet auf der anderen Seite der Übernehmerin die Möglichkeit, die der Beschreibungssituation angemessene Gefühlsexpression, wie z. B. Klage, Sorge, Mitleid, Kummer oder professionelle Distanziertheit zu erschließen. 131 Zusätzlich nehmen die Autoren wieder das Alltagswissen der Akteurinnen in den Blick, wenn sie die These formulieren: „Erwartungsmuster und Inferenzschemata machen die interpretative Verknüpfung von Verhalten und Wissen möglich und sind deshalb von zentraler Bedeutung für den Umgang mit der Unbeobachtbarkeit von Wissen" (dies.: 25). Darunter fallen z. B. die für den Stationsalltag relevanten Typisierungen, Kategorisierungen und Positionierungen von Patientinnen, sowie deren jeweils an die entsprechenden Kategorien gebundenen Aktivitäten (category bound activities). Mit der kategorialen Identifizierung gehen also immer jeweils spezifische und entsprechende institutionalisierte Erwartungsmuster einher. Die Konversationsanalyse hat sich schon in ihren Anfängen mit diesem Themenbereich beschäftigt, woraus bekanntlich die Kategorisierungsanalyse als Ableger hervorgegangen ist (vgl. Sacks 1967, 1972, 1992a/ b). Die
Zur Bedeutung der prosodischen Ausdrucksweise von Gefühlen - aus einem ähnlichen institutionellen Kontext - ist in diesem Zusammenhang die Arbeit von Svenja Sachweh (1999) zu erwähnen, die sich u. a. mit dem ganz besonders schrillen „Babytalk" der Pflegerinnen bei der Durchführung von Pflegehandlungen in der Altenpflege beschäftigt hat. 131
Das Übergabegespräch als Aushandlungsprozess von Wissen
177
Kategorisierungsanalyse zielt darauf ab, die von sozialen Akteurinnen ständig zur allgegenwärtigen Prozedur der Sinnexplikation und Sinndeutung eingesetzten Kategorien zu rekonstruieren. Dabei hat der Gebrauch der Kategorien selbst seinen Ursprung nicht in verborgenen psychischen Dispositionen, sondern verweist auf kulturelle Ressourcen, die öffentlich, sozial geteilt und transparent sind, aber auch abhängig vom spezifischen Kontext ihrer Realisierung. Neben dem Inhalt der Kategorien interessieren hier die ihnen zugrunde liegenden methodischen Prozeduren, durch welche sie eingesetzt und verstanden werden. Nach Sacks beruht die Tatsache, dass die Akteurinnen wechselseitig ihre wie auch immer produzierten Beiträge weitestgehend ähnlich auffassen bzw. aushandeln, auf dem Einsatz ganz spezifischer institutionalisierter Kategorisierungs- und Schlussfolgerungsregeln, die er als „membership categorization device" bezeichnet (1992a: 41). Wenn z. B. eine übergebende Pflegekraft durch die spezifische Art und Weise, wie sie einen Patienten beschreibt, ihn damit gleichzeitig kategorisiert, unterstellt sie insgeheim ihren Kolleginnen auch, dass eine für die in der Pflege im Allgemeinen „übliche" und standardmäßige pflegerische Aktivität entsprechend der Kategorisierung erfolgen kann. Inferenzschemata spielen gerade bei Interaktionen in institutionellen Kontexten eine ganz entscheidende Rolle. Die von den Akteurinnen unter Ausübung ihrer Rollen und Aufgaben hervorgebrachten Arten der Bedeutungszuschreibung und des Schlussfolgerns sind Merkmale der institutionellen Interaktion und werden als institutionalisierte, im Sinne von bewährten und daher auch erwartbaren Beurteilungsfolien eingesetzt. Accounting practices Accounting practices sind das Kernstück ethnomethodologisch begründeter Sozialität. Für die Ethnomethodologie ist Sinngebung nichts Privates, kein z. B. auf das Fremdbewusstsein begrenzter Vorgang, sondern immer schon ein sozialer und öffentlicher. „Weil 'accounting practices' für die Handlung, in die sie verwoben sind, Deutungshinweise jeweils lokal verankert liefern, eröffnen sie auch einen Zugang zum Wissen dessen, der diese Handlung ausführt und ausgeführt hat" (Bergmann/Quasthoff 2010: 26). Die Beteiligten eines Übergabegesprächs liefern einander demnach im Vollzug immer schon praktische Erklärungen und Deutungen mit. Die Durchführung
178
5. Übergabe-Wissen
einer Handlung und deren Beschreibung ist ein und derselbe Akt,132 die Aktivitäten zur Bewältigung der Alltagsangelegenheiten sind identisch mit jenen Verfahren, mittels derer dieselben Alltagsangelegenheiten praktisch verständlich gemacht werden. Die lokal verankerten Deutungshinweise sind Sinnindikationen und haben den Charakter eines Versprechens. Eine berichtende Übergeberin ist z. B. gleichzeitig damit beschäftigt, auf die Verstehbarkeit, Plausibilität und Evidenz ihrer Darstellung zu achten. Eine empirische Analyse hat sozusagen genau jene „objektivierte Wissensdemonstration" zum Ausgang zu nehmen und an den von den Beteiligten einer Übergabe eingesetzten Praktiken etwa zur Formulierung von Instruktionen, Prognosen, Zweifeln, Rechtfertigungen, Legitimierungen, Kanonisierungen, Rekursierungen und nicht zuletzt Autorisierungen anzusetzen. Im Zentrum der nachfolgenden Analysen stehen also die epistemischen Praktiken der Beteiligten von Übergaben. In Übergabegesprächen werden vergangene Ereignisse rekonstruiert, zukünftige ausgehandelt und gleichzeitig Prognosen abgegeben. Der Besonderheit dieser sozialen Situation ist es geschuldet, dass eine Hälfte der beteiligten Akteurinnen mit überwiegenden Redeanteilen ausgestattet ist und die Rekonstruktion ihrer Erfahrungen aus der mit der Übergabe ausklingenden Schicht auf eine für ihre Kolleginnen nachvollziehbare Art und Weise gestalten muss. Das führt mich zu der Annahme, dass narrative Strukturen, die kommunikative Herstellung von Erzählungen, bei der Überwindung der für Übergaben konstitutiven Wissensasymmetrie eine ganz entscheidende Rolle spielen. Auf welch vielfältige Weise Erzählungen empirisch untersucht worden sind, wie eine konversationsanalytisch begründete Beschäftigung mit Erzählungen in (Übergabe-) Gesprächen aussehen kann, und warum „pflegerelevantes" Erzählen eine taugliche kommunikative Praxis erfordert, wird im Folgenden vorgestellt.
132
Garfinkels Devise lautet: „Their central recommendation is that the acticities whereby members produce and manage settings of organized everyday affairs are identical with members' procedures for making those settings 'account-able'. The 'reflexive' or 'incarnate' character of accounting practices and accounts makes up the crux of that recommendation" (1967:1).
Erzählen als Kunstfertigkeit des Pflegepersonals
5.2
179
Erzählen als Kunstfertigkeit des Pflegepersonals
Erzählen hat in unterschiedlichen Formen und Kontexten von Gesprächen verschiedene Funktionen.133 So kann etwa jemand in einem Alltagsgespräch mit der Erzählung einer selbsterlebten Geschichte über jemanden klatschen (Bergmann 1987), eine Argumentationslinie belegen (Pomerantz 1984) oder in institutionellen Zusammenhängen, wie z. B. vor Gericht, eine Zeugenaussage machen (Wolff/Müller 1997; Hoffmann 1980; Scheffer 2010), in einem ArztPatienten-Gespräch Ängste thematisieren (Gülich/Lindemann/Schöndienst 2010) bzw. in therapeutischen Zusammenhängen inszenierende Darstellungen einsetzen (vgl. Streeck 2000). Den wesentlichsten methodologischen Beitrag bei der Untersuchung von Narrationen oder narrativen Strukturen im Allgemeinen lieferten die Arbeiten der ethnomethodologischen Konversationsanalyse (Sacks 1971; 1972; 1992a/b), der Ethnographie des Sprechens (Gumperz/Hymes 1972), sowie die verschiedenen Formen der linguistischen Diskursanalyse (van Dijk 1993, Wodak et al. 1998, Potter/Wetherell 1987). Unter dem starken Einfluss dieser Ansätze verschwand auch allmählich die prädominante Stellung des Erzählers, dessen vorwiegend ihm zugeschriebene Bedeutung lange zum Gegenstand linguistischer Erzählforschung gezählt hat (Labov/Waletzky 1967). Aus konversationsanalytischer Perspektive ist Erzählen hingegen immer schon eine gemeinsame Aktivität aller Gesprächsteilnehmerinnen. Nach Schegloff ist das Erzählen von Geschichten „a coconstruction, an interactional achievement, a joint production, a collaboration, and so forth" (1997: 97). Die Konversationsanalyse hat „den einzelnen Erzähler" frühzeitig vom Podium vertrieben, stattdessen sein Gegenüber von Anfang an mit einbezogen und so dafür gesorgt, dass eine Narration als ein interaktives Produkt aller daran beteiligten Akteure zu betrachten ist. Ein der Konversationsanalyse nahestehendes Konzept, welches sich mit „Erzählungen" im weitesten Sinne beschäftigt, ist das der „kommunikativen Gattungen" (Luckmann 1986, 1988). Erzählungen wiederum gehören zu den untergeordneten „rekonstruktiven Gattungen". Dieser Begriff geht zurück auf Bergmann und Luckmann, die die 133 £)ie Narrationsforschung umfasst ein sehr breites Feld. Am nachhaltigsten beeinflusst durch die Arbeiten von Labov und Waletzky (1967), suggerierte der Begriff „Erzählung" trotz der vielfältigen im Anschluss diskutierten theoretischen Konzepte eine Einheitlichkeit, die die systematischen, semantischen, strukturellen und funktionellen Verschiedenheiten vollkommen ausblendeten (vgl. Quasthoff 2001: 1295). Ein gelungener Versuch, die Hypostasierung des Erzählbegriffs aufzulösen, ist das Konzept der „rekonstruktiven Gattungen" (Bergmann/Luckmann 1995), hierauf werde ich an späterer Stelle noch kurz eingehen.
180
5. Übergabe-Wissen
klassischen Konzepte der Narrationsforschung, wie „story telling" oder „narration" für nachteilig bzw. vorbelastet erachten (1995: 294f.)134 Der Kerngedanke dabei ist, dass das (narrative) Rekonstruieren vergangener Ereignisse übergeordneten Mustern folgt, dahinter wiederum steht die Annahme, dass „kommunikative Gattungen" „routinisierte und mehr oder weniger verpflichtende Lösungen für bestimmte kommunikative Probleme" darstellen und im gesellschaftlichen Wissensvorrat verfügbar sind (Luckmann 1988: 282 bzw. Bergmann/Luckmann 1995: 289). Bei Übergabegesprächen ist das Pflegepersonal ebenfalls vor kommunikative Rekonstruktionsaufgaben gestellt. Die Beteiligten - vorwiegend die Übergebenden - sind damit beschäftigt vergangene Ereignisse in einer bestimmten Art und Weise zu rekonstruieren. In den folgenden Überlegungen wird zunächst ein bestimmter analytischer Zugang zur Identifizierung von Narrationen verfolgt, dieser wird benötigt, um im Anschluss an einem empirischen Beispiel den Zusammenhang von narrativen Strukturen und den Prozessen der Wissensgenerierung explizieren zu können. 5.2.1
Sprecherwechsel und Narration
Weniger als eine Lösung denn als eine Systematik, stellt die Organisation des Sprecherwechsels einen Zugang zur Analyse von Rekonstruktionen vergangener Ereignisse bereit. Die Arbeiten der frühen Konversationsanalyse galten der Organisation des Sprecherwechsels (vgl. Sacks/Schegloff/Jefferson 1974), weshalb es nahe liegt, wie Harvey Sacks (1971,2000) diese Systematik auf Erzählungen zu übertragen. Seine Leitfrage lautet: Wie ist es möglich, dass ein Sprecher, vor dem Hintergrund der Verteilung der Rederechts, einen längeren Gesprächsbeitrag produzieren kann, wie z. B. Geschichten innerhalb von Unterhaltungen, ohne dass andere Akteure das Rederecht für sich beanspruchen? Das Grundprinzip ist relativ einfach: erst ein kalkulierter und vorübergehender Verzicht auf das Wort erhöht die Wahrscheinlichkeit und nährt die Hoffnung, das Wort zurückzubekommen mit dem Auftrag oder mit der Aufforderung, die
„But in order to comprehend the entire spectrum of reconstructive forms and subforms that are found in everyday communication we need another, less prejudicial concept than 'narration'. This was our main motive to speak of 'reconstructive genre"'(dies: 295). 134
Erzählen als Kunstfertigkeit des Pflegepersonals
181
Geschichte zu erzählen. Ein Gesprächsbeispiel eines Kindes mit seinen Eltern soll dies verdeutlichen (vgl. Quasthoff 2001:1297 1 3 5 ): Kind:
weißt du was?
Mutter:
hm_hm
Kind:
der Ingolf hat mir in der Schule gegen den Kopf gehauen
Vater: was? warum das denn? Das Kind stellt eine Frage, die im Sinne der Paarsequenzlogik eine Antwort erwartbar macht. Das Kind wählt damit den nächsten Sprecher aus und gibt sein Rederecht freiwillig ab. Es folgt ein verneinendes „hm_hm" der Mutter, die damit ihr Wissensdefizit einräumt und gleichzeitig ihr Interesse an der Aufklärung anzeigt und ihr Rederecht abgibt, woraufhin das Kind seine bereits im ersten Teil (mit der Frage an die Mutter) eingeleiteten Geschichte beginnen kann, die darauf folgend auch vom Vater ratifiziert wird. Nach Sacks (1971/2000) sind zur Beschreibung von Erzählsequenzen in Unterhaltungen drei wesentliche miteinander verbundene strukturelle Komponenten maßgeblich: die Einleitungssequenz (preface sequence), die Erzählung (telling sequence) und die Antwort- oder Evaluationssequenz (response sequence). Die Einleitungssequenz umfasst konversationelle Beiträge, die den Übergang zur Erzählung kennzeichnen und mit denen es gelingt, die Systematik des Sprecherwechsels vorübergehend (und zum Wohle des Erzählers) außer Kraft zu setzen. Eine Technik, mit der sowohl das Wort über mehrere Sätze hinaus gesichert, als auch für die erforderliche Aufmerksamkeit gegenüber den potenziellen Zuhörerlnnen gesorgt wird, und die zudem die Erlaubnis zum Erzählen einer Geschichte evoziert, ist der Gebrauch von „GeschichtenEinleitungen" {story prefaces136). Sie kündigen eine Erzählung an und strukturieren diese vor. Zwei besondere Merkmale dieser Einleitungen sind,
135 Quasthoffs Beispiel wurde hier aus Darstellungsgründen vereinfacht und leicht abgewandelt. Die grundlegende Entscheidung darüber, dass Gesprächsteile eine Geschichte darstellen, hängt davon ab, ob ein Identifizierungsprozess stattgefunden hat zwischen denen, die eine produzieren und denen, die sie erkennen. Das heißt Darstellungen haben dann den Status einer Geschichte, wenn dieser von den Teilnehmenden auch zuerkannt wird. Wenn Geschichten mehr als einen Redebeitrag erfordern, ist es die Aufgabe der Zuhörenden, herauszufinden, dass eine Geschichte erzählt wird (vgl. Sacks 1971/2000: 227). Vgl. Sacks 1992b: 17ff. (a.a.O.).
182
5. Übergabe-Wissen
dass sie Informationen darüber enthalten, was zur Beendigung der vorgeschlagenen Geschichte erforderlich ist, und Informationen darüber enthalten, was Zuhörerlnnen zu tun haben, wenn sie deren Ende erkennen, wie z. B. Lachen bei einem zuvor angekündigten scheinbar lustigen Ereignis („Heute ist mir etwas Lustiges passiert") oder Staunen bei einer mit „Heute habe ich etwas Schönes gehört" eingeleiteten Erzählung (vgl. Sacks 1992b: 19). Die Erzählsequenz beinhaltet die eigentliche narrative Rekonstruktionsarbeit, die eigentliche Erzählung (vgl. Gülich/Mondada 2008:105). Im Beispiel oben ist es „der ingolf hat mir in der schule gegen den köpf gehauen". Obwohl die eigentliche narrative Rekonstruktion üblicherweise von einem Sprecher geleistet wird, zeigen gerade multimodale Analysen, dass durch die Aktivitäten der Zuhörer, wie Rezeptionssignale abgeben oder nonvokale Mittel wie Blickrichtung, Körperhaltung und Aktivitäten wie z. B. Notizen machen, Erzählsequenzen immer von allen Beteiligten gemeinsam, also auch von den Zuhörern, hervorgebracht werden (vgl. dies.: 108; siehe auch Schegloff 1997). In der Antwort- oder Evaluationssequenz reagieren die Zuhörer auf den Inhalt der Erzählung, kommentieren und bewerten diesen und bereiten so auch die Rückkehr zum turn-by-turn-talk vor 137 (Gülich/Mondada 2008: 107). Vergleicht man die Abfolge von Erzählsequenzen in Übergaben mit den strukturellen Komponenten, die Sacks vorschwebten, ist Folgendes festzustellen: Die Ankündigung einer Erzählung (preface) zum Zwecke der Rederechtsicherung scheint in Übergaben nicht erforderlich zu sein. Sie sind üblicherweise vorreguliert und insofern fällt das Rederecht im Regelfall der übergebenden Person wieder zu, sobald der Beitrag des Übernehmers abgeschlossen ist und die Entwicklung des Gesprächsverlaufs dies zulässt.
5.2.2
Demonstrierte Wissensvermittlung
Im nachfolgenden empirischen Beispiel aus einer Abendübergabe auf der medizinischen Station geht es darum zu zeigen, wie der Wissensunterstellung selbst Grenzen gesetzt sind und das Ausmaß der Unterstellung zum Gegenstand kommunikativer Aushandlung werden kann. Die beiden Akteurinnen haben aufgrund der längeren Abwesenheit der Übernehmerin eine ungleiche Interaktionsvorgeschichte, die im Gespräch thematisiert und anschließend konversationell bearbeitet wird, so dass gleichzeitig eine gemeinsame Gesprächsgrundlage geschaffen wird. Der Wissenserwerb und die
1 3 7 Ein Anstoßen weiterer Einzelgeschichten durch Erzählungen und der damit einhergehenden Abwechslung der Erzählerund Zuhörerrollen ist bei Alltagsgesprächen häufig zu beobachten (vgl. Schegloff 1997:103)
183
Erzählen als Kunstfertigkeit des Pflegepersonals
Wissenskonstruktion beruhen entwickelten Erzählformats.
auf
der Basis des von den
Beteiligten
# 30: Innere / 'glaub du warst jetzt länger nicht da ne' ((1:19-1:46)) Ü: Übergeberin (rechts); N: Übernehmerin (links) 16 N: 17
hm=hm=((grinst)) MM
verä[ndert Sitzposition
19 Ü:
[siebenunNEUNzig die frau webler;
20
(.) unverändert also immer noch
21
(em=er=es=e)=keime drin äh: PORT hat=sie,
22
glaub=du=warst jetzt länger nicht da=ne,
23 N:
hm=hm-
> 24 Ü:
"h die hat PORT=(anop) mit rEstinfusion,
25
°h äh::::=mit (
26
kochsalz=heparInspritzen die=sind im kühlschrank
27
kannst du nachher abstöpseln wenn es durch ist- (.)
> 28 N:
)
aber nur abstöpseln[(
2 9 Ü: 30
MM
31 32
MM
[Illustrieren einer Spritzhandlung wenn [NICHT nimm dir einfach mit is im kühlschrank-
MM
35
[zeigt mit Zeigefinger zum Kühlschrank (—)
36 N: >37
[Kopfnicken 2x, re Hand angehoben und [und ab (drehen) =ähm (.)
33 34 N:
) is aber im zimmer ne, oder=nein-
[=AlsO:rEIn=spritzen (.)
[hm=hm, MM
[notiert
Abb. 1
1:37,1 AlsO:rEIn
Abb. 2
1:38,20 =Jpritzen
Abb. 3
184
5. Übergabe-Wissen
Abb. 4
Abb. 6
1:41,02 wenn IJMÄ?
1:42, 04 ir.it is im kühl
WÈÈÊÊÊÊÊÊÈÊÊËËÊM
Die Übergeberin „Ü" beginnt in dem üblichen Format mit Lokalisierung, Namensnennung und der Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes (bzw. der laufenden Indikation) 'unverändert also immer noch (em=er=es=e) =keime drin ah: P O R T hat=sie', es folgt der Einschub einer Frage an die Übernehmerin: glaub=du=warst jetzt länger nicht da=ne'.
Mit dieser Frage zielt sie offenbar auf das von ihr vermutete Wissensdefizit der Übernehmerin, aufgrund deren längeren Abwesenheit. Augenscheinlich kündigt sie damit auch eine Erzählung mit relevanten Informationen an. Nach Ns Verneinung folgt ab Zeile 24 Üs Erzählung:'°h die hat P0RT=(anop) mit rEstinfusion,
°h
äh::::=mit
(
)kochsalz=heparInspritzen
die=sind
im
kühlschrank kannst du nachher abstöpseln wenn es durch ist- (.)'.
Die Erzählsequenz (ab Zeile 24) ist interessanterweise nicht gekennzeichnet durch die Rekonstruktion von etwas Vergangenem. Vielmehr wählt die Übergeberin als sprachliche Differenzierungsform hierfür den auf die gegenwärtig gültige Erfordernis abzielenden Präsens („die hat", „die sind", „kannst du") in Verbindung mit einem Zeitadverb („nachher"). Hier kommt ein weiterer für die Untersuchung von Narrationen ganz entscheidender Aspekt zum Tragen, nämlich wie die Beteiligten die Erzählwürdigkeit prozesshaft herstellen und daran anschließend die Erzählung konversationell bearbeiten. Es scheint einen engen Zusammenhang zu geben zwischen der inhaltlichen Relevanzsetzung und der Adressatenorientierung. 138 Denn die Erzähleinleitung mit dem Verweis auf die Wissensdifferenz unterstreicht die Relevanz und den Zuschnitt der darauf folgenden Erzählung auf das Gegenüber ( r e c i p i e n t d e s i g n ) . Die Erzählwürdigkeit liegt demnach in der teilweise aufgehobenen Wissensunterstellung begründet. Die Vorgeschichte eines Patienten und die
138
Vgl. Sacks 1992b, P. I, Lecture 2 und P. IV, Lecture 3; Gülich/Mondada 2010:111.
Erzählen als Kunstfertigkeit des Pflegepersonals
185
damit zusammenhängenden Pflegemaßnahmen sind nämlich üblicherweise bekannt und werden so generell Teil der Wissensunterstellung des Pflegepersonals. Die in Zeile 28 beginnende konversationelle Bearbeitung der Erzählung erfolgt durch eine von N schlussfolgernd gewonnene pflegerische Aktivität mit Vorschlagscharakter 'aber nur abstöpseln[( ) is aber im zimmer ne, oder=neinund N kommentiert damit zunächst Us Hauptinformation.139 Ns Äußerung ruft daraufhin eine Instruktion hervor. Der typischerweise in Anweisungszusammenhängen eingesetzte Infinitiv „reinspritzen", „abdrehen" und die im Imperativ formulierte Äußerung „nimm dir" (vgl. Jaskolka 2000: 87ff.), sowie die zusätzlich mit der rechten Hand gestisch illustrierten Spritzhandlung (vgl. Abb. 1-3), zeigen sehr deutlich, wie in diesem Ausschnitt sowohl pflegerisch relevantes Wissen generiert, als auch dessen Deutung oder, wenn man so will, dessen Erwerb ein öffentliches soziales Geschehen wird. Schließlich zeigt die Übernehmerin verbal, gestisch (Abb. 4-6) und durch das Mitschreiben (vgl. Zeile 37) ihre mentale Orientierung an. Abschließend möchte ich noch festhalten, dass offenbar Üs nonverbal sehr aufwendig durchgeführte Explikation der spezifischen pflegerischen Aktion (Spritzhandlung), die unter „normalen" Umständen, also bei ausreichender Kenntnis der Übernehmerin, unterstellte Inferenz offen legt. 5.2.3
Konversationelles Erzählen
Das folgende empirische Beispiel aus der medizinischen Station beschäftigt sich mit konversationellem Erzählen, einer Erzählform, an dem mehr als ein Erzähler beteiligt ist, die also faktisch von allen Beteiligten hergestellt wird (vgl. Quasthoff 2001: 1294). Im Mittelpunkt steht daher nicht der Erzähler alleine, sondern auch die sonst noch mitwirkende Person. Übertragen auf Übergabegespräche interessiert hier vor allen Dingen die Frage, was während des Erzählprozesses passiert. Wie macht etwa die Zuhörerin ihre Anwesenheit und Anteilnahme am Gespräch deutlich und welche Rolle haben dabei die Blickrichtung bzw. die Körperhaltung? Wie synchron dazu die Übergeberin das Erzählenswerte durch Redewiedergabe markiert und schließlich, wie zeichnen beide Akteurinnen gemeinsam in ihrer
Ein im Vergleich dazu in Alltagsgesprächen häufig zu beobachtendes Anstoßen weiterer Geschichten (second stories) auf first stories und der damit einhergehenden Abwechslung der Erzähler- und Zuhörerrollen (vgl. Sacks 1992a: 3ff„ 249ff.) ist durch Ns Beitrag in Zeile 28 nur insofern gegeben, als dass sie ihre Annahmen offen legt und die Schlussfolgerungen der Geschichte als noch nicht zufriedenstellend erfasst markiert. 139
5. Übergabe-Wissen
186
„rückschauenden Patientin?
Vorschau" ein bestimmtes fiir die Pflege relevantes Bild einer
Im Fokus der Analyse stehen die Aktivitäten der Übernehmerin, während die Übergeberin von einer Patientin berichtet. Aus multimodaler Perspektive sind hauptsächlich die Blickorientierung, die Körperhaltung, sowie die Schreibaktivitäten zentral, denn vor dem Hintergrund der Organisation des Erzählprozesses wird untersucht, inwiefern die genannten multimodalen Aspekte eine erzählfördernde Wirkung entfalten können. # 31: Innere / 'muss immer ne weiße vorläge haben' ((17:32-19:40)) Ü: Übergeberin (rechts); N: Übernehmerin (links) 01 Ü:
fü(nf)=undachtzig frau kreuzmann,
02
ahm: (.) ja die is glaub ich schon einun=neunzig,
03
(.) aus=m heim mit harnwegsinfekt
04
kriegt äh: viermal
05
um (.) vi[erunzwanzig uhr,
05a
MM
05b
(noch=mal) anhängen,
[steht auf und blickt auf eine Liste und setzt sich
> 0 6 N:
[wieder [hm=hm, (.) und dann morgen früh um SEchs
0 6b
wahr=SCHeinlich ne, « p > ( d i e erste
07 Ü:
[(dann mach ich das fertig hm,
09
(— )
10
aber sie soll das nochmal kriegen-
11 Ü:
ja- das is [nur (
> 12 N: [ un=DASS ach=ja vierunzwanzig uhr (.) hm=hia,
MM
[macht Vermerke in ihrer Vorlage
MM
lässt den Markier[stift fallen
14 Ü:
[j=A: ansonsten,
16 17
)=hm=hm hm=hm-
[aber i=VAU ne, nich ORAL ne, hm=hm,
13
15 N:
)>
JA das war ganz [schön sie wird um zehn entlassen
08 N:
13a
(1.0) obstipation
(ciemage=nyst)
[(huh=ala) (1.5)
187
Erzählen als Kunstfertigkeit des Pflegepersonals
> 18 Ü: 19
a(l)so man muss sie auf toilette führen sie hat bettgitter beidseits und sie meldet sich aber dann
20
.h weil der oberarzt ihr verboten hat allein aufzustEhen,
21
«lächelnd>und dass is auch so ganz gut> weil sie schoN (.)
21a 22 N: 23 Ü:
sieben mal gestürzt ish[h, (.) a: : : [ungefähr;
24
JA und da hält sie sich aber auch dran dann kann=se
25
äh: stell=ste ihr den gehwagen davor dann
26
kann=ste mit de (m) gehwagen sie auf toilette äh: begleitenAbb. 4
Abb. 3.1
18:37,1 ftit de(m) >27
18:37,21 ¡¡¡¡¡wagen
18:41 ne weiß% vorläge
hh äh: muss immer «schmunzelnd>ne weiße vorläge haben,>
28 N:
hm-
29 Ü: 30 N:
((lächelt))=.h [es is auch so (aus_m) heim=gewohnt=((lachen)) [( aus_m heim gewohnt)=((lachen))
188
5. Übergabe-Wissen
Abb. 5.22
18:44,2 31 32 Ü:
((lächelt)}=.h
18:46,17 heim
ha[t sie den welche schon im zimmer, [ja-
33
(— )
34
diese [zum klE=ben, oder diese grO=ßen-
35 Ü: 36 N:
[äh:: JA=GENAU zu kleben liegen im zimmer hm=hm, hm-
Die Übergeberin beginnt die Fallgeschichte mit der üblichen Lokalisierung auf der Station, der Namensnennung und der zusätzlichen Charakterisierung der Patientin (Alter, Altersheim). Anschließend folgen die medizinische Vorgeschichte bzw. die Hinweise zur Medikation. Daraufhin findet eine kurze Aushandlung mit der Übernehmerin statt, die die Zeitpunkte und die Art der Medikationsvergabe betreffen, da die Patientin am darauf folgenden Tag entlassen werden soll. Es folgen zwei Rückfragen der Übernehmerin (Z. 6 und Z. 12) und mehrere, offenbar der Selbstvergewisserung dienende, sehr leise gesprochene Kommentare, während sie Notizen aufnimmt. In Zeile 18 setzt die Übergeberin ihren Redebeitrag fort mit der Merkmalsbeschreibung der Patientin. Sie beschreibt Ereignisse und pflegerische Vorkehrungen aus der Vergangenheit, die in die Gegenwart und darüber hinaus zu reichen scheinen. In der Aufzählung von pflegerisch relevanten Merkmalen der Patientinnen und zusätzlich durch die gewissermaßen medizinisch vom Oberarzt autorisierte Begründung für diese Merkmale, wird der Zusammenhang von narrativen Strukturelementen und an die Patientenkategorie gebundene Merkmale deutlich, weil damit erwartbare pflegerische Vorkehrungen von der Übernehmerin antizipiert werden können. Die Erzählsequenz ist gekennzeichnet von den im resultativen Präsens formulierten Äußerungen ('man muss sie auf toilette führen', 'sie hat bettgitter', 'sie meidet sich aber dann'), die, stichwortartig vorgetragen, jeweils eine eigene Pflegegeschichte aufrufen und schlussendlich in der vermutlich etwas überzogenen Darstellung der Sturzhäufigkeit der Patientin
Erzählen als Kunstfertigkeit des Pflegepersonals
189
münden. Dieser Beitrag wird daran anschließend von N mit lautem Ausatmen und gedehntem offenen a-Laut kommentiert. Wie in Abb. 1 zu sehen blickt die Übernehmerin auf ihre Vorlage, hält auch ihren Stift bereit und macht Vermerke. Ihre Körperhaltung behält sie bei, verändert diese erst, wie in Abb. 3 zu sehen, indem sie ihre übereinander geschlagenen Beine von rechts oben auf links oben wechselt. Zwischen Abbildung 1 und 4 hat bislang kein Blickkontakt stattgefunden, dieser erfolgt erst in Minute 18:41 (Abb. 4) und hält auch für einige Sekunden an (siehe Abb. 5). Mit der Art und Weise, wie die Übergeberin in Zeile 27 eine weitere Eigenart der Patientin einführt: hh äh: muss immer ', kündigt sie damit eine weitere Geschichte mit vermutlich lustigem Inhalt an. Dem folgt zunächst ein Rezeptionssignal der Übernehmerin, ehe die Übergeberin fortsetzt und zur Pointe ausholt. Interessanterweise ist es nicht sie alleine, die die Geschichte um den Spleen der Patientin erweitert. Die Übernehmerin erschließt gemeinsam mit der Übergeberin den Kern der Aussage (' (... ausm heim gewohnt) = ( (lachen))'), es handelt sich dabei um eine besonders „einstimmige" und simultane Form objektivierter Verständigung. Der mit der Einführung der Übergeberin gleichzeitig mit transportierte, moralische Gehalt der Information wird mit dem gemeinsamen Lachen bestätigt. Aufgrund der Nichtanwesenheit des Frotzelobjekts handelt es sich dabei jedoch um keine Frotzelaktivität im Sinne von Günthners Untersuchung von Alltagsinteraktionen (1999: 303). Ebenso wenig ist es vergleichbar mit dem SichMokieren über abwesende Dritte (vgl. Christmann 1999: 276). Und es ist ebenfalls kein wirkliches Klatschen (vgl. Bergmann 1987: 195). Die Beteiligten der Übergabe äußern sich nicht in missbilligender Weise über ein offensichtlich abweichendes Verhalten. Die von N in Zeile 22 mit dem gedehnten a-Laut als mitfühlend interpretierte Vorgeschichte zur Patientin weist eher in die entgegengesetzte Richtung. Es ist nicht die Verfehlung der Patientin, die zum Klatsch führen könnte, sondern die Angst vor drohendem Gesichtsverlust der Beteiligten (vgl. ders.: 196). Es gebietet sich gerade nicht, sich über eine gut neunzigjährige alte Patientin mit leicht verzeihlichen persönlichen Eigenarten lustig zu machen. Der beschränkten Autonomie und Immobilität der Patientin und damit verbundenen Fehltritten wird mit mitfühlender Nachsichtigkeit begegnet (durchaus vergleichbar mit der Großherzigkeit mancher Eltern gegenüber ihren Sprösslingen und von ihnen herbeigeführten kleinen Katastrophen). Es greift gewissermaßen das Tabu, bei der Ausübung der professionellen Tätigkeit des Übergebens über Patientinnen in unangemessener Weise zu sprechen, um nicht selbst zum potenziellen Klatschobjekt zu werden. Die
190
5. Übergabe-Wissen
Übernehmerin bleibt ganz im Modus professioneller Kommunikation, indem sie sich danach erkundigt, ob sich bereits Bettvorleger im Zimmer der Patientin befinden und wenn ja, welche zwei verschiedenen Arten dafür verwendet werden sollen. Sie vermeidet offensichtlich eine Dramatisierung und Hochstufung der Information („sie muss immer eine weiße Vorlage haben"), z. B. in Form von echauffierenden Äußerungen, zugunsten einer aufgabenorientierten Kategorisierungsarbeit, d. h. adäquate Inferenzbildung ('diese [zum klE=ben, oder diese großen-'). Dieser Gesprächsabschnitt beinhaltet zwar scherzhafte Elemente und rahmt diesen Abschnitt auch, ein tatsächlicher Modalitätswechsel in eine Scherzkommunikation findet hingegen nicht statt. # 32: Innere / 'muss immer ne weiße Vorlage haben' ((Fortsetzung)) Ü: Übergeberin; N: Übernehmerin >37
U:
38
« p p > ( d a musst du was machen mit)> is auch diabetikerin, < — )
39 N:
die sagt dir das wahrschein[lieh- ne, ganz klar
40 Ü: 41 Ü: 42 N: 43 Ü:
[«lächelnd>DIE SAGT dir das alles ganz genau die> weiss es ganz genau((kichert)) die kriegt auch (vibrax) jetzt äh: von uns und ähm:
44
äh=da hab ich gesagt ja dann GEHen wir Erst auf toilette?
45
und dann äh: mach ich gleich « d i m > d e n
46
JA=JA ICH WEISS=«lachend>da
4 7 N: 48 Ü: 49
N:
(vibrax weg) >
[hat=se schon darauf gewartet-» [ach=so (.) a=ha-
« p > g e f ä l l t ihr so gut> (
[
)
Die Übergeberin fährt in Zeile 37 fort mit einem neuen Thema und nennt ein weiteres, diesmal medizinisches Merkmal der Patientin 'is auch diabetikerin'. Bezeichnenderweise nutzt N diese Information, um an ihrer Vorstellung über Frau Kreuzmann zu arbeiten und potenzielle Ereignisse, z. B. während der Ausführung bestimmter Pflegemaßnahmen, zu prognostizieren 'die sagt dir das wahrschein [lieh- ne, ganz klar'. Diese Schlussfolgerung wird wiederum von der Übergeberin bestätigt:'DIE SÄGT dir das alles ganz genau die> weiss es ganz genau- '. Wie sowohl die Initiierung von Themen bzw. Geschichten bei Übergaben grundsätzlich von der Übergeberin ausgehen, ist das Erzählen dieser Geschichten über Patientinnen keineswegs diesen Personen allein vorbehalten. Wie im Beispiel zu sehen, findet im Gesprächsverlauf eine allmähliche Verfertigung eines Patientinnenbildes unter Beteiligung beider Seiten statt. Die Konstruktion einer (wiedererkennbaren) Patientenkategorie beruht auf der Basis rekonstruierender Äußerungen einerseits und prognostizierender Äußerungen andererseits.
Instruieren als Fertigkeit und Aufgab
191
Die zuvor von der Übernehmerin antizipierte Verhaltensprognose regt die Übergeberin an, ein dazu passendes Ereignis aus ihrer persönlichen, mit der Patientin gemeinsam erlebten Pflegehistorie wiederzugeben.140 Mit der kurzen ergänzenden Episode (Z. 43-48) bestätigt die Übergeberin beispielhaft das zuvor von der Übernehmerin mzfkonstruierte Patientinnenbild. Mittels der mehrstimmigen Redewiedergabe141 in der Geschichte, also die ihrer eigenen ('ja dann GEHen wir Erst auf toilette? und dann äh: mach ich gleich') und jener der Patientin ('JA=JA
ICH WEISS'), markiert sie die Erzählwürdigkeit
und
Relevanz der Geschichte für die Folgeschicht. Die Redewiedergabe der Patientin hebt sich dabei durch die expressive Darstellung (relative Lautstärkenveränderung, Mimik der Augen) der Übergeberin vom vorigen Kontext ab. Zum Abschluss dieser Patienteneinheit gibt die Übergeberin zwei weitere Instruktionen, über die an späterer Stelle noch gesprochen wird. Zusammenfassend möchte ich festhalten: Konversationelles Erzählen generiert gemeinsam konstruierte Patientinnenidentitäten oder Patientinnenbilder, die eine jeweils spezifische pflegerische Aufmerksamkeit erfordern. Die Kunstfertigkeit des konversationeilen Erzählens bei Übergaben besteht für die Beteiligten darin, „eine Geschichte" so wiederzugeben, dass sich pflegerisch relevante Schlussfolgerungen antizipieren lassen. 5.2.4
Geschichten als Träger von Patientinnenidentitäten
Die Durchführung einer Übergabe impliziert ebenfalls die Erfüllung rhetorischer Aufgaben. Der verbreitete Einsatz von Ellipsen und Geschichten in Übergaben rücken den rhetorischen Charakter dieses Gesprächsereignisses in den Vordergrund. Geschichten über Patientinnen und Ereignisse aus der vergangenen Schicht sind zunächst einmal immer Rekonstruktionen von vergangenen Ereignissen. Das Erzählen von Geschichten in Übergaben ermöglicht dem Pflegepersonal Erfahrungen zu teilen, sie aber auch auszuhandeln und gegebenenfalls umzuschreiben, etwa durch die während der Durchführung einer Übergabe zusätzlich generierten episodischen Beiträge insbesondere der übernehmenden Schichtvertreterinnen. Aus relevanten Einzelereignissen der vergangenen Schicht werden so in die Zukunft
Es ist unerheblich, ob dieses Ereignis in der mit der Übergabe ausklingenden Schicht stattgefunden hat oder schon in den Schichtdiensten zuvor. 140
141 Das Konzept der Vielstimmigkeit ist eine Form der Redewiedergabe (vgl. Bakhtin 1979; 1981). Unter Bezug auf literarische Texte beschreibt er in seinem Konzept der Polyphonie die spezifische Art der Überlagerung von Stimmen (vgl. Günthner 1999). Die Grenze zwischen dem Erzähler und den zitierten Figuren können dabei verschwimmen, der Erzähler ist gewissermaßen Marionette und Marionettenspieler.
192
5. Übergabe-Wissen
verweisende Episoden und potenzielle Ereignisverläufe. Die in Übergabegesprächen generierten Geschichten behandeln grundsätzlich nichts Triviales, sondern immer etwas die Aufgabenorientierung der Beteiligten betreffend Erzählbares. Durch die Wiedergabe eines Ereignisses in der Übergabe wird das Ereignis erst zu einem potenziell für die Pflege bedeutsamen. Angesichts der eingangs dieses Kapitels vorgestellten methodologischen Hinweise zur prinzipiellen Unbeobachtbarkeit von Wissen, ist in diesem Zusammenhang das Erzählen in Übergaben insofern bemerkenswert, als dass die „Er zähl Würdigkeit" von Ereignissen in einem engen Zusammenhang steht mit z. B. auf der Station vorherrschenden Erwartungen. Häufig rufen nämlich gerade Abweichungen in einem ansonsten als normal und erwartbar unterstellten (Wissens-) und Arbeitsprozess Erzählungen hervor. Daneben stellte sich heraus, dass Geschichten in Übergaben das Potenzial und die Funktion zu haben scheinen, pflegerisch potenziell bedeutsames Wissen für die Folgeschicht zu generieren. Die Art und der Inhalt der Erzählung sind abhängig vom Zeitpunkt der Übergabe und vom jeweiligen Gegenüber. Im Gegensatz zu biographischen Geschichten in Alltagsgesprächen ist das Übergabegespräch ein ganz spezifischer Typus institutioneller Kommunikation und es ist klar geworden, dass die vorgestellten narrativen Formate wesentliche arbeitsrelevante Funktionen ausüben. Geschichten ermöglichen in Übergaben eine konturierte Darstellung und Identitätsbildung von abwesenden Dritten (vgl. Bamberg 1997; Widdicombe 1998). Mit der Wiedergabe von Episoden aus der Schicht können ganz unterschiedliche Aspekte der für das Übergabepersonal relevanten Patientinnenidentität aufgerufen werden, d. h. die in der Geschichte über den Patienten dargestellten Eigenschaften (wie z. B. 'er (der Patient) kann mehr helfen (beim Lagern) als du denkst, sags ihm nur'), werden so Teil eines Patientinnenbildes, das wiederum den verantwortlichen Personen, die die darauf folgenden Pflegemaßnahmen durchzuführen haben, Orientierung gibt. Die so skizzierten Geschichten über Patientinnen zeichnen für die Folgeschicht ein Bild, das implizite wie explizite Handlungsanleitungen transportiert und für Übernehmerinnen erschließen lässt. Damit zusammenhängend reproduzieren sie institutionalisierte Erwartungen, bilden Prognosen für die Folgeschicht und helfen Unerwartetes erwartbar zu machen bzw. potenzielle Abweichungen antizipieren zu können (z. B. bei der Patientinnenführung). 5.3
Instruieren als Fertigkeit und Aufgabe
Beim Versuch, die von den Akteurinnen bei der Durchführung dieser speziellen Interaktionsaufgabe abverlangten Fertigkeiten bei der Wissensgenerierung herauszuarbeiten, empfiehlt es sich, „Wissen" in kommunikative Aktivitäten aufzulösen, denn nur so lässt sich gewissermaßen „objektiviertes
Improvisieren als Kompetenz?
193
Wissen" beobachten und empirisch untersuchen. Dass in Arbeitszusammenhängen accounts vergangener Aktivitäten richtungsweisend für die Aushandlung bevorstehender Arbeitspraxis sein können, wurde im vorigen Abschnitt herausgearbeitet und wird auch von Middleton unterstrichen: „(...) talk by team members about their work is of interest because as „situated action" (Suchman, 1987) it is used both to construct versions of what the team is currently doing and constitutes ways to act that respond to those versions. Accounts of past practice in the present become a resource in defining future practice" (1998: 236). Nun ist der überwiegende Anteil der Beschreibungen der Übergebenden zwar auf vergangene Aktivitäten ausgerichtet, also mit Vergangenheitsmarkierungen versehen, dennoch besteht ein nicht unerheblicher Teil ihrer Beiträge aus Instruktionen, konkreten Arbeitsanweisungen und Empfehlungen. Im Hinblick auf die in Übergaben mit kommunikativen Mitteln zu bearbeitende Wissensasymmetrie stehen im Folgenden nach den oben vorgestellten narrativen Formen im Folgenden Redebeiträge im Mittelpunkt, die a) Instruktionen, Anweisungen und Empfehlungen beinhalten, b) dazu aufrufen zu improvisieren und c) die situative Bearbeitung von zweifelhaftem Wissen zum Gegenstand haben. Mit Instruktionen sind Formulierungen der Übergeberinnen gemeint, die z. B. Arbeitsaufträge explizit benennen, wie etwa: „Das Bett von Frau Hauser sollte unbedingt frisch überzogen werden". Andere wiederum bleiben vorwiegend implizit, d. h. unausgesprochen, etwa dann, wenn durch die Art und Weise der Kategorisierung eines Patienten durch die übergebende Schicht der Erfahrungsund Wissensbestand der übernehmenden Akteur Innen lediglich „aufgerufen" wird. Situativ relevante Handlungsanweisungen werden ausschließlich als unterstelltes Wissen implizit mitgeliefert. Unterstelltes Wissen bleibt jedoch weiterhin tendenziell unbeobachtbar und führt so offensichtlich zu einem ausweglosen Dilemma. Wenn da nicht die beteiligten Akteurinnen, insbesondere die übernehmende Schicht, Implikationen ausformulieren würden und beispielsweise Vermutungen über den Grad der Pflegeintensität anstellen, und somit pflegerelevantes Wissen zum Gegenstand des Gesprächs machen. Es sind nämlich gerade jene ausgesprochenen Schlussfolgerungen, die zumindest einen sprachlichen Wissenstransfer im Sinne einer Deutung möglich machen. Wenn z. B. eine Pflegekraft aus ihrem Urlaub zurückkehrt und die Patientinnen nicht mehr kennt, wird sie auf Praktiken zurückgreifen, die es ihr ermöglichen, das Problem des Nichtwissens zumindest kommunikativ zu lösen. Sie wird Schlussfolgerungen anstellen und dabei auf Routinewissen zurückgreifen, d. h. durch diese kommunikative Praxis wird gewissermaßen typisiertes Routinewissen an die Oberfläche gespült.
194
5. Übergabe-Wissen
5.3.1
Erfahrungsbasierte und explizite Instruktion
Das im folgenden Beispiel von der Übergeberin bei der Mittagsübergabe eingesetzte Beschreibungsformat ist insofern bemerkenswert, als dass sie neben der konkreten Pflegeanweisung „Verband bzw. Tupfer auflegen" gleichzeitig auch Auskunft gibt über den Status der Quelle, die der Information - in diesem Fall der Handlungsanweisung - zugrunde liegt. Die Übergeberin markiert die Wahrhaftigkeit der Information mittels ihres „first hand" (vgl. Pomerantz 1984: 624), in der vergangenen Schicht erworbenen, Erfahrungswissens. # 33: Geburtshilfe / 'wir nehmen diese großen tupfer' ((09:34-10:38)), Ü und Ü2: Übergeberinnen; Nl: Übernehmerin 01 Ü: 02 03 04 05 06 07 08 09 > 10 11
12 13 14 > 15 16 17
.hh im DRITTen bett frau: amrasectiodritter tachhat (--) erhöhte blutdruckwerte, der bauch is ro:t und heiss ( ) machen=wa zweistündlich (rivanol) drauf, ab eben da is=sie jetzt wieder um halb drei dran.h ich habe=(ihr)=gesagt sie soll so=n bisschen selbst mit drauf [achten ob=wir das=
?:
Nl: Ü:
Nl Ü:
18
19 20 21
22
23 Nl: 24 0: 25 26
> 27 28 Nl: 29 30 Ü2:
tun=da richtig schön NETZEN mit (rivanol) das is SO= =ein Grosses feld, (•) (das) is jetzt schon rot und äh: (heiss) is- .hh heut morgen war=s erst nur SOda wUsst man nicht ob das von [(—) vo=den [ja(desinfektionsmittel) kommt vom bauch her ne, oder ob=eS schon was anfing war auch nich hEIss aber jetz; [siehts echt nicht schön aus[hm_ (-) (rei[chen )
195
Improvisieren als Kompetenz?
Der Informationsblock zur Patientin Amra beginnt mit der üblichen Lokalisierung im Zimmer 'DRiTTen bett', Namensnennung, Art der Entbindung (sectio, d. h. Kaiserschnitt/Schnittentbindung), Anzahl der Tage seit der Angaben Geburt, sowie den besonderen medizinisch relevanten (Blutdruckwerte) und dem für die Pflege bedeutsamen Hinweis, wonach die Wunde im Zweistunden-Rhythmus versorgt werden sollte. Anschließend unterrichtet die Übergeberin ihre Kollegin über die während ihres Dienstes mit der Patientin mündlich ausgehandelte Verantwortungsdelegation. Ab Zeile 10 erfolgt der Wechsel vom singulären zum pluralen Personalpronomen („ich" - „wir"), weitergeführt durch eine „Weil-Konstruktion", mit der die Sprecherin argumentativ die für den Schichtbetrieb durchaus verständlichen Versäumnisse entschuldigt und dafür die Patientin präventiv als Erinnerungsgeberin einsetzt. In Zeile 15 ('WIR NEHMEN diese GROSSEN tupfer da vorne') beginnt nun die sich bis in Zeile 27 ('siehts echt nicht schön aus-') erstreckende explizite Instruktion. Das Pronomen „wir", welches sich auf alle auf der Station für diese besondere Pflegetätigkeit verantwortlichen Personen bezieht, spezifiziert durch die im Präsens formulierten genauen Aktivitäten ('NEHMEN', 'legen', 'schön NETZEN'), nach denen die Pflegehandlung auszuführen ist, der Verweis auf eine noch zu Beginn ihrer eigenen Schicht bestandenen Unklarheit hinsichtlich der Ursache für die vermutlich stark entzündete Wunde sowie die finale Äußerung '[siehts echt nicht schon aus-' rahmen die Anweisimg als eine dezidiert auf Erfahrung gestützte. # 34: Geburtshilfe / 'wir nehmen diese großen tupfer' ((Fortsetzung)), Ü, Ü2: Übergeberinnen; Nl: Übernehmerin 30 > 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
02:
(rei[chen ) [DIE mamma Soll vIEl lIE:gen [WEil (.) wenn sie sitzt=
Ü: Nl: Ü:
=die [war auch (
02: Ü:
[reichen dreimal temperatUr=kontrolle ja=ne, die=hat keine temperatur;
02: Ü:
ja, ((blätt[ert um))
02: Ü:
JA: würd ich sAg[en (--) wir müssen ja sowieso dreimal=
Nl: 0: 02: 0: Nl:
[ja-
[(
)
)
[man wollt ja (sowieso =er=er [machen dann= [sectio =können wir=auch tempera[tur machen; [hm(1.0)
)
196
5. Übergabe-Wissen
Ergänzend zur genauen Anweisung der Wundpflege formuliert „Ü" in Zeile 31f. eine weitere Anweisung an ihre Kollegin '[DIE mamma soll VIEI IIE:gen [WEii (.) wenn sie sitzt=' und die von dieser auch m i t ' [ ja-' bestätigt wird. Bei dieser Äußerung wird ersichtlich, wie und an welcher Stelle die Übergeberin Hintergrundwissen unterstellt und gleichzeitig den Verweis auf den Anweisungsgeber mitführt. Interessanterweise muss die Anweisung nur angedeutet werden, denn offensichtlich reicht dieser Hinweis für die Übernehmerin vollkommen aus, um zu erschließen worum es hier geht. Die Übergeberin unterstellt N1 ein bestimmtes Hintergrundwissen, dass zur informierten Durchführung der Anweisung benötigt wird. Des Weiteren gibt die Übergeberin mit dieser Äußerung eine bestimmte Anweisung weiter, die, im Unterschied zur vorigen, eine implizit bleibende personale Referenz des Anweisungsgebers mitführt. Die ausdrückliche Nennung desjenigen, der die Instruktion möglicherweise angeordnet hat (z. B. Dr. X oder „der Oberarzt sagte, dass"), bleibt aus, dennoch scheint die Anweisung von Vertreterinnen des medizinischen Stabs zu stammen. Als mögliche Erklärung dient ein Rückgriff auf das Konzept der Kategorisierungsanalyse (vgl. Wolff 2006, Sacks 1992a/b), wonach Anordnungen wie z. B. „Frau X soll viel liegen", also das Verordnen einer Bettruhe, in diesem Kontext zu den natürlicherweise von Vertreterinnen des medizinischen Personals durchgeführten Aktivitäten (category bound activities) gehören. Die von der Übergeberin vermutlich selbst entgegengenommene Anweisung wird von ihr transformiert, indem sie anstatt des Namens der Patientin die durch die Geburt sich veränderte Parität der Frau, die Bezeichnung 'DIE Mamma', gebraucht. Dadurch bekommt die Beschreibung auch noch eine verniedlichende Färbung und unterstreicht die erforderliche Fürsorge und Notwendigkeit der pflegerisch relevanten Zuwendung. Die Referenz auf die, wenn schon nicht explizite, aber zumindest außerhalb des Pflegebereichs anzusiedelnde Urheberschaft der Instruktion, macht die Übergeberin mehr zu einer Botin als zu einer Produzentin von Anweisungen. Beendet wird der Informationsblock mit der Frage der zweiten Übergeberin nach der Anzahl der erforderlichen Temperaturkontrollen. 5.3.2
Offerierende Instruktion: „Muss man halt zwischendurch gucken"
Eine weitere Variante, Instruktionen zu geben, besteht darin, offensichtlich bewährte Bewältigungsstrategien mitzuteilen. Darunter fallen etwa Beispiele, in denen die Pflegekräfte einander ihre Kniffe und persönlich erfolgreichen Strategien beschreiben. Wobei im eigentlichen Sinne nicht von einer Handlungsanweisung gesprochen werden kann, sondern eher von einer
197
Improvisieren als Kompetenz?
besonders kollegialen Haltung, wenn Übergebende auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrung in der nun ausklingenden Schicht ihre Kolleginnen bei der Antizipation potenziell eintretender Ereignisse oder Verhaltensweisen der Patientinnen unterstützen. Die Instruktion bekommt dadurch einen Vorschlagscharakter. Im Zentrum der nachfolgenden Analyse steht eine Äußerung der Übergeberin, die gegen Ende ihres Infoblocks über einen für das Pflegepersonal offenbar „heiklen Fall" berichtet. Im Hinblick auf die Frage nach der Wissensgenerierung legt das folgende Beispiel eine Vorgehensweise offen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Übergeberin keine konkreten Hilfestellungen oder gar Anweisungen zur Bewältigung der Aufgabe formuliert, stattdessen besteht ihre „Anweisung" allein in der Referenz auf das allen Pflegekräften prinzipiell zugängliche Routinewissen. Die Übergeberin stellt einen Patienten vor, der von der sonst üblichen Betreuungsintensität des Pflegepersonals abweicht. Die Ausübung der Pflegehandlungen ist durch die eingeschränkten Sprachkenntnisse des Patienten nur begrenzt und vorwiegend vermittelt über die häufig anwesenden Angehörigen möglich. Die wesentliche Information der Übergeberin besteht 1) in der typisierten Beschreibung des Patienten und der damit erzählten - also inferenziell erschließbaren - Pflegegeschichte und 2) im Appell an das Routinewissen der Kolleginnen. # 35: Urologie / 'muss man halt zwischendurch kucken' ((16:39-17:41)) Ü: Übergeberin; Ü2: Übergeberin 2; Nl: Übernehmerin 33
(3.8)
34 Ü:
achtzich im ersten herr punser,
35
das war zustand nach te:_u:_er_pe:
36
heute der (.) vierte tag-
37
Spülung zwischendurch immer noch blutig,
38
(
) (—)
(—)
(2.0)
39
ahm herr punser spricht so gut wie eigentlich gar kein
40
deutsch, versteht nur so einiges
41
die_ähm familie kümmert sich mit um ihn
42
is auch zustand nach apoplex, (-)
43
deshalb halt auch noch erschwert-
44
er kann aufstehen
45
hat so ein sicherheitbettgitter (-)
46
die meiste zeit oben.
47
(1.8)
(.) aber wenig (--)
(—)
(—)
198
5. Übergabe-Wissen
Die Kategorisierung des Patienten beginnt über die Lokalisierung im Zimmer 'achtzich im ersten', der Namensnennung 'herr punser', dem erfolgten operativen Verfahren (TUR-P) 'zustand nach te:_u:_er_pe:', der seither verstrichenen Zeitspanne 'heute der (.) vierte tag' und der gegenwärtig gültige Gesundheitszustand'spülung zwischendurch immer noch blutig'. Daraus lässt sich ein - fachmedizinisch betrachtet - zunächst typischer (Patienten-) Fall erschließen. Eine pflegerisch aber relevante Information ist der Hinweis auf die mangelnden Sprachkenntnisse, die von anwesenden Angehörigen (möglicherweise) kompensiert werden und die zusätzliche Vorerkrankung des Patienten (Apoplex/Schlaganfall). Daran ist vermutlich ein erhöhter Pflegebedarf geknüpft, der aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse gegebenenfalls über Dritte (Angehörige) vermittelt werden muss. Die dem Patiententyp zugehörigen Merkmale und Verhaltensweisen, wie Z.B. 'versteht
nur
so
einiges
(.) aber
wenig',
sich mit um ihn' , 'is auch zustand nach apoplex
'die_ähm
familie
kümmert
(-)deshalb halt auch noch
erschwert' bzw. 'er kann aufstehen', rufen (im Sinne von Sacks' wechselseitigem Verweisungszusammenhang zwischen Teilnehmerkategorien und der Aktivitäten und sozial erwartbaren Handlungsweisen 142 ) bei den Akteurinnen ein bestimmtes Patientenbild hervor, das situativ angemessene Bewältigungsstrategien erforderlich macht.
# 36: Urologie/ 'muss man halt zwischendurch kucken' ((Fortsetzung)) Ü: Übergeberin; Ü2: Übergeberin 2; Nl: Übernehmerin > 48 Ü: 49 50
de: ka: sollte schon=ma raus_aber (-) es is jetzt eigentlich noch drin weils noch zu dunkel is zwischendurch(-)
51
kriegt (boscopan) (.) tabletten noch dazu
52
markumarpause
(
)
53
ja_er war heut morgen am waschbecken_hat ihm der söhn
54
mit geholfen
> 55
muss man halt zwischendurch gucken
56
mal hat_er auch so (rerige) phasen
57
dann lässt er mal gar nichts machen (--)
58
aber gott sein dank sind da halt immer viele
59
angehörige da dass man dann so jemanden (.) zum
60
dolmetschen hat (--)
61
dann war noch die frage ob_er abgeführt hat=
Dieser wechselseitige Verweisungszusammenhang gründet nach Sacks (1992a: 179f.) in der stillschweigenden Zuordnung von Aktivitäten („aufheben", „weinen") zu spezifischen sozialen Kategorien („Mutter", „Baby") - siehe auch noch in Kapitel 4. 142
Improvisieren als Kompetenz?
62 63 64 65
199
=hat er jetzt aber (3.0) na schaun wies da weiter geht (1.8)
Wie ab Zeile 48 zu sehen, unterscheidet die Übergeberin zwischen den oben beschriebenen persönlichen Merkmalen bzw. Verhaltensweisen des Patienten und medizinisch-pflegerischen Merkmalen (Medikation). Der Verweis auf den Dauerkatheder ('de: ka:') zeigt an, dass dieser unter Umständen in der Folgeschicht entfernt wird oder gegebenenfalls mit weiteren Spülungen (also weiteren Pflegeaktivitäten) zu rechnen ist. Der Patient weicht durch Üs Art der Darstellung merklich von der Normalform ab. Die meiner Ansicht nach entscheidende Prägung erfährt die Beschreibung des Patienten gegen Ende des Informationsblocks durch Üs Äußerung in Zeile 55: ' muss man halt zwischendurch gucken . Die Übergeberin hat den Patienten „Punser" sowohl mit seinen medizinsch-pflegerischen, als auch mit seinen persönlichen Merkmalen kategorisiert, was wiederum für die Beteiligten der Folgeschicht ein bestimmtes Maß an Pflegeaufwand erwartbar macht. Die tatsächliche „Pflegbarkeit" des Patienten scheint jedoch nicht immer bzw. nur unter bestimmten Bedingungen (Hilfestellung durch Angehörige) möglich zu sein. In der Äußerung „muss man halt zwischendurch gucken" zeigt die Übergeberin dies an, darüber hinaus teilt sie noch etwas Weiteres und Entscheidendes mit, und zwar gehört zum professionellen Betätigungsfeld einer versierten Pflegekraft die laufende Beobachtung des Patienten sowie das Erkennen einer die üblicherweise zu verrichtenden Pflegeaktivitäten (Abführen, Lagern, Waschen etc.) ermöglichenden Situation. Die Übergeberin gibt den Übernehmenden damit zu verstehen, dass sie unter den geschilderten Bedingungen (d. h. Patientenbildes) so verfahren sollen, wie sie (die Pflege im Allgemeinen) in einem solchen Fall immer vorgehen, d. h. auf bewährtes Routinewissen zurückgreifen. Die Explikation des Routinewissens ist dafür selbst nicht erforderlich, es reichen der Verweis und deren Unterstellung (vgl. Bergmann/Quasthoff 2010: 24). Die in dieser Übergabe mitgeteilte Bewältigungsstrategie zur Bewältigung der möglicherweise wieder auftretenden Situation mit dem Patienten besteht also in der verbal markierten Referenz auf das Routinewissen. Im Unterschied zu den vorigen Beispielen, wo sowohl die explizite Formulierung einer Pflegeanweisung unter Verweis auf eine medizinische Autorität, als auch ein Instruktionsformat im Mittelpunkt standen, das weniger durch seine Explizitheit, als durch den Verweis auf bewährtes Routinewissen hervorgestochen ist, soll im nächsten Beispiel ebenfalls die Formulierung von Instruktionen durch Übergeberinnen behandelt werden und zwar in der Art
200
5. Übergabe-Wissen
und Weise wie auf Wissen referenziert wird, in diesem Fall insbesondere auf das Erfahrungswissen der Übergeberin. Ausgangspunkt der Analyse ist die Formulierung mit dem besonders eindringlichen Vorschlagscharakter in Zeile 54: „Und sie würd ich schon drehen in der Nacht". # 37: Innere / 'und sie würd ich schon drehen in der nacht' ((19:28-19:42)) Ü: Übergeberin; Nl, N2: Übernehmerinnen > 54 Ü:
und sie würd ich schoN: drehen in der nacht-
55 56 N:
(•) MM
macht
57 Ü:
[Notizen [tagsüber is=(sie) auch viel am tisch und-
58
(-)
59 N:
das schafft=se
> 60 Ü:
> 61
[aber=(
also das musst du (ihr) auch nur mal sagen dass es
62
[(sie mal gehen soll)=hm=hm,
63 N:
[ACH=SO: Ach ja-
64
(•) h[m: ,
65 66 Ü:
)
[auf toilette begleiten und so äh:
[frau hanke
Obwohl es grundsätzlich zu den Routineaufgaben des Pflegepersonals gehört, die Dekubitusgefährdung von einzelnen Patientinnen selbst einzuschätzen, sind diesbezügliche Hinweise der übergebenden Schicht üblich und hilfreich. „Drehen" ist gleichbedeutend mit „Lagern"/„Lagerung", darunter ist in der Pflege eine pflegerische Maßnahme zu verstehen, bei der die meist liegende Körperhaltung des Patienten zur Dekubitusprophylaxe (Vorbeugung eines Druckgeschwüres) in regelmäßigen Zeitabschnitten verändert wird. Im konkreten Fall ist die Notwendigkeit dieser Arbeitshandlung sinnvollerweise auch vor dem Hintergrund des bislang gezeichneten Patientenbildes zu betrachten (siehe oben # 2). Denn anhand des zuvor in der Übergabe von beiden Akteurinnen interaktiv objektivierten Patientenbildes scheint die Pflegeaktivität „Lagern" für die Übernehmerin nicht unbedingt erwartbar bzw. erschließbar - oder zumindest klärungswürdig zu sein. Ü justiert mit dieser Äußerung das Bild der Patientin ein wenig nach. Frau Kreuzmann wäre demnach ein Fall von „X" und nicht von „Y" und erfordert eine zum Typ „X" passende Aktivität („Lagern"). Aus Sicht der Kategorisierungsanalyse findet hier ein Aushandlungsprozess statt, in dem Korrekturen und Nachbesserungen an dem Verhältnis zwischen Teilnehmerkategorien und Kategorie gebundenen Aktivitäten vorgenommen werden. Solche Teilnehmerkategorien (Patientenbilder) sind grundsätzlich höchst fragile und interaktive mit Wissenselementen
201
Improvisieren als Kompetenz?
angereicherte Gebilde, an denen ununterbrochen gearbeitet wird. Für die Analyse von Interesse sind nun die dazu von beiden Akteurinnen eingesetzten sprachlichen Mittel. Das Wissen der Übergeberin über die Patientin, das sie sich durch ihre Dienste in der Vergangenheit und auch im nun auslaufenden Dienst angeeignet hat, dient ihr als Referenz für die Einschätzung, lässt dabei der Übernehmerin dennoch Handlungsoptionen offen. Ihre Art der Beschreibung ist weniger eine Anweisung als ein Vorschlag. Was macht nun die Übernehmerin mit diesem Vorschlag und wie reagiert die Übergeberin darauf? N macht Notizen in ihrer Vorlage. Was sie notiert, ist nicht ersichtlich und liegt auch nicht als ergänzendes Datum vor. Nahezu gleichzeitig setzt die Übergeberin wieder ein '[tagsüber is=(sie) auch viel am tisch und-', berichtet über eine Aktivität der Patientin und zeichnet gleichzeitig gewissermaßen den Mobilitätsradius der Patientin. Mit dieser Äußerung stellt Ü die eingeschränkte Autonomie von Frau Kreuzmann in den Nachtstunden einer partiellen Selbständigkeit und folglich geringeren Pflegeintensität gegenüber. Im Anschluss bestätigt die Übernehmerin diese Gegenüberstellung. Das zuvor im Gespräch entwickelte Patientenbild ließ eher auf ein Bild der Patientin schließen, das diese als Person mit geringem bis keinem Aktionsradius erscheinen ließ und daher auch das Drehen erforderlich machen würde. Nun aber ändert sich dieses Bild:'das schafft=se [aber=( )', woraufhin die Übergeberin in der nächsten Zeile (60) den Mobilitätsradius um eine weitere Aktivität der Patientin erweitert ('[auf toiiette begleiten und so ah:)'. Die Patientin erscheint demnach aktiver und selbständiger zu sein. Gleich darauf erläutert die Übergeberin, wie ihre Kollegin vorgehen sollte: 'Also das musst
du
(ihr) auch
nur mal
sagen
dass es[(sie
mal gehen
soll)=hm=hm'
(Zeile 61-62), was von der Übernehmerin etwas verwundert m i t ' [ACH=SO: Ach ja-' kommentiert wird. Ihre Instruktion ist gekennzeichnet durch die Verwendung des Modalverbs „müssen", die gewählte Formulierung lässt im Vergleich zur vorigen mit Vorschlagscharakter weniger Handlungsoptionen zu. Es scheint, dass Ü N damit zu verstehen gibt, dass die Befolgung dieser Instruktion für das Gelingen der Kooperation mit der Patientin insgesamt von großer Bedeutung sei (vgl. Jaskolka 2000: 80). N's Antwort legt rückwirkend ihre zuvor gemachten Schlussfolgerungen offen, d. h. scheinbar war ihr das genaue Ausmaß der Autonomiefähigkeit von Frau Kreuzmann nicht klar und verständlich. Oder um nochmals mit dem Konzept der Kategorisierungsanalyse zu argumentieren, zeigt die Übernehmerin damit, dass sie die nun gültige Teilnehmerkategorie einschließlich der ihr zugehörigen und im Gesprächsverlauf noch präzisierten Kategorie gebundenen Aktivitäten erkennt und offensichtlich revidiert hat.
202
5.4
5. Übergabe-Wissen
Improvisieren als Kompetenz?
Wie gestaltet sich der Umgang mit Versäumnissen und nicht erfüllten Erwartungen? Wie gehen Mitarbeiterinnen auf einer Station miteinander um, wenn, aus welchen Gründen auch immer, bestimmte Arbeitsaufgaben nicht ausgeführt werden konnten? Wenn hier von Versäumnissen die Rede ist, dann sind in der Regel von Übergeberinnen nicht oder nur teilweise ausgeführte Aufgaben gemeint. Die Übergeberinnen sind es auch, die jene unbearbeiteten oder zumindest offen gebliebenen Aufgaben in den Übergaben thematisieren. Im folgenden Transkriptausschnitt ist zu sehen, wie kompetent beide Seiten mit Versäumnissen umgehen. Die Kompetenz besteht auf der Übergeberinnenseite in der (gezielten) Thematisierung der unterlassenen Tätigkeit aus Gründen der Professionalität und auf der Übernehmerinnenseite im Verzicht, die moralischen Implikationen des Versäumnisses zu thematisieren. Schließlich bestünde für die Übernehmenden die Möglichkeit, moralisch zu werden und z. B. die nun anfallenden Mehraufgaben zu beklagen. # 38: Geburtshilfe / 'sollte von uns heut morgen blutzucker kriegen' ((12:12—13:37)) Ü: Übergeberin; Nl, N2: Übernehmerinnen; S: Pflegeschülerin 01 Ü:
im hinteren bett turner,
02
is=ne' (.) entbindung am zweiten tag?
03
hat=s zweite kind bekomm,
04
da=i is abgestillt,
05
(1.0)
0 6 N2:
ab-
C7 Ü:
hm_hm-
23
ähm: [da hab ich [heut leider (also) da
((...)) 24
(hat=sich=auch=nicht)
[((Telefon 1[äutet))
25 S:
[(
)
26 U:
=dran=gehalten sollte von uns heute nochmal um siebzehn uhr
27
blutzucker kriegen-
28
(.)
2 9 Nl:
die frau-
30 Ü:
ja-
> 31
und sie=wusste=(eigentlich) und sollte uns und hat=uns aber=
32
=nicht (dann)=hatte se=schon das abendbrot und hatte das
33
jetzt geGESSen ich meine entweder (.)
34
wir machen ü=zwa o=das zu morgen
35
früh weil um sieben [soll (da mal')
36 S: 37 Ü:
[ich gibs Sie Ihnen mal grade ja, MM
blickt in Richtung S
203
Improvisieren als Kompetenz?
38 Ü:
deswegen also-
39
wie=gesagt sie hatte es dann auch vergessen
40
dann hatte=se schon mal gegessen dann war es auch=
41
MM
42
offene Geste mit beiden Armen =zu [spät;
Der Informationsblock beginnt mit der Lokalisierung im Zimmer, der Nennung des Namens, Art der Geburt, Tag post partum, Parität und Stillverhalten. Nach einer (hier ausgesparten) Klärung der bei der Frau im Pflegebericht vermerkten Ersatznahrung, eröffnet Ü in Zeile 23 ein neues Thema und beginnt mit der Einleitung zur Beschreibung des Versäumnisses. Das Versäumnis besteht darin, dass die Übergeberschicht die ursprünglich noch vor dem Abendessen vorgesehene Blutzuckermessung bei der Frau nicht durchgeführt hat. Die mehrteilige Verantwortungsallokation beginnt Ü zunächst bei sich 'da hab ich [heut leider (also)', und bezieht aber auch die Frau mit ein 'da (hat= sich=auch=nicht)=dran=gehalten uhr
sollte von uns heute
nochmal
um
siebzehn
blutzucker kriegen-'.
Das heißt, die Übergeberin positioniert sich selbst nicht als alleinige Verantwortliche für das Vergehen, sondern führt als zusätzliche entschuldigende Erklärung die Mitwisserschaft von Frau Turner an. Diese sollte demnach auch selbst darauf achten und scheinbar das Pflegepersonal an die durchzuführende Messung des Blutzuckers erinnern. Ab Zeile 31 präzisiert Ü zunächst den Vorwurf gegenüber der Frau ' u n d sie=wusste= (eigentlich) und sollte uns und hat=uns aber=nicht
(dann)=hatte se=schon das abendbrot und
( . ) ' - gibt aber auch gleich im Anschluss erste Anzeichen, wie das Problem gelöst werden könnte 'wir machen ü=zwa o=das zu morgen früh weil um sieben [soll (da mal')'. U reformuliert darauf die Verantwortungszuweisung und nimmt nochmals Bezug auf die hatte das jetzt geGESSen ich meine entweder
F o l g e n ' d a n n war es auch=zu
[spät;'.
# 39: Geburtshilfe / 'sollte von uns heut morgen blutzucker kriegen' ((Forsetzung)) Ü: Übergeberin; Nl, N2: Übernehmerinnen; S: Pflegeschülerin 42 Ü:
=zu [spät;
4 3 N?: >44
Ü:
45
richtigen diabetis;
4 6 N?: >47
[hm=hm, die hatte wohl ma=auf' fällige (.) wERte gehabt, aber keinen
U:
achsoun=die blutzucker vom kind waren im stabil also is nichts
48
gravierendes gewesen;
49
(— )
204
5. Übergabe-Wissen
> 50
also entweder vielleicht könnt ihr ja um zweiundzwanzig uhr
51
eventuell no=mal einen machen bis da=(hin) hat=sie=ja das
52
[abendbrot oder so=n bißchen-
53
MM
[Kreisbewegungen mit dem rechten Arm
54 Nl:
bei der frau jetz-
55 Ü:
JA und MORgen früh um sieben aber das' wei(l) morgen früh
56
ja ähm: astrid und Uta kommt
57
dass die dann halt morgen früh um sieben uhr auf jeden fall
58
noch=mal einen machen sollen mit-
59
(—)
((Sesselrücken))
60
ABER SOnst kommt die klar kind trinkt und
61
« p p > d a s klappt alles>
Anschließend folgt aber ein für die Spezifik professioneller Kommunikation offensichtlich bedeutsames Formulierungsmuster. Zunächst liefert die Übergeberin zwei accounts, die zur Entdramatisierung und gleichzeitig zur Entmoralisierung der Situation beitragen:'die hatte wohl ma=auf' fällige (.) wERte
gehabt' b z w . un=die
blutzucker
vom
kind
waren
im
stabil
also
is
(siehe Zeile 44 und 47f.). Dann geht sie über in einen Modus, der auf die kollektive Verantwortung und professionelle Haltung abzielt. Charakteristisch dafür ist Üs sehr defensiv im Modus der Möglichkeit ('könnt ihr ja') formulierter und durch entsprechende Adverbien („vielleicht", „eventuell") abgeschwächter Appell an die Kolleginnen in Zeile 50ff. Kurz darauf macht sie die Übernehmerinnen noch auf die Dringlichkeit der Blutzuckermessung in der Morgenschicht am darauf folgenden Tag aufmerksam. Dem Nachdienst wird hierdurch die Verantwortung übertragen, diese Information am nächsten Morgen ihren Übernehmenden zu übertragen nichts gravierendes gewesen;'
dass
die
dann
halt morgen
früh
um
sieben
uhr
auf
jeden
fall
noch=mal
Der Übergeberin gelingt es, den Kolleginnen der Nachtschicht das Ausgleichen eines Versäumnisses so mit auf den Weg zu geben, ohne dass sie darum bitten müsste. Jegliche Abwehrreaktion seitens der Übernehmenden wäre im Übrigen vollkommen unpassend. Offensichtlich appelliert die Übergeberin an den Corpsgeist, ihren Kolleginnen des Tagdienstes aus der Patsche zu helfen. Das nicht erforderliche Bitten ist kein Mangel an Höflichkeit, es ist vielmehr ein impliziter Verweis auf einen berufsethischen Imperativ, schließlich könnte jeder Schicht, jedem Schichtmitglied ein ähnliches Vergehen unterlaufen. Und so verlangt das gemeinsame Berufsethos einen bestimmten Umgang mit vermeintlichen Versäumnissen. einen machen
sollen
mi t'.
Improvisieren als Kompetenz?
205
„Dann hätt ich die Bitte" Das folgende Beispiel aus der Geburtsstation zeigt, wie nach einem vermeintlichen Ende der Übergabe, nach einer längeren Pause, die „Gesprächsmaschine" plötzlich wieder Fahrt aufnimmt,143 als die Übergeberin noch eine Bitte an ihre Kolleginnen formuliert. Offenbar handelt es sich hier um einen Arbeitsauftrag, den sie nicht zu Ende geführt hat (führen konnte). Im vorgestellten Transkriptausschnitt werden die Übernehmerinnen hinsichtlich ihrer Bereitschaft zur Durchführung einer von der übergebenden Schicht „nur" provisorisch ausgeführten pflegerelevanten Tätigkeit gehörig auf die Probe gestellt. Im Hinblick auf die in kommunikative Aktivitäten aufgelösten Wissensprozesse haben die Übernehmenden die Aufgabe, ein Provisorium als „professionelles Gut" zu schätzen. Auf der anderen Seite hat die Übergeberin das kommunikative Problem zu lösen, ein auf den ersten Blick vermeintliches Versäumnis richtigerweise so darzustellen, dass es der Aufgabenorientierung, d. h. vollständigen Verantwortungsübernahme, gerecht wird. # 40: Geburtshilfe / 'dann hätt ich die bitte' ((11:57-13:01)) Ü: Übergeberin; Nl, N2: Übernehmerinnen; Sl, S2, S3: Pflegeschüler 01
(2.0)
02 Ü:
«melodisch>UND in er EL:F->
03
frau Kasseler?
11 Ü:
die is wohl gePRIMT worden-
((...)) (1.0)
12
> 13
hat sich dann auch nicht weiter gemeldet;
14 15
(4.0)
(N2:)
(ja)
16 Ü: MM
((Durchsicht der Unterlagen))
17 Nl:
gut-
> 18
MM
klopft mit dem Kugelschreiber lx auf den Tisch
19 ?:
(
20 U:
das wars
> 21 N2: 22
)
danke, (3.0)
Dieses Beispiel zeigt auch eindrucksvoll, wie offen und vage die weitere Entwicklung eines Gesprächs im Grunde ist, d. h. die Eröffnung der Gesprächsbeendigung ist für die Teilnehmerinnen offensichtlich nicht verbindlich, sondern sie kann jederzeit modifiziert werden. 143
206
>23
5. Übergabe-Wissen
Ü:
dann hätt ich die bitte wei' (.) Wer vorne in dem
24
bereich ist- zimmer drEI äh da müsste das bett am fenster
25
einmal frisch bezogen werden-
26
da hab ich jetzt nur (steck)=laken drübergemacht;
Es handelt sich um den Bericht des letzten Gliedes der Übergabereihe. Ab Zeile 13 leitet die Übergeberin die Endphase des Gesprächs ein, die viersekündige Pause lassen die Ubernehmenden verstreichen. Nls Klopfen in Zeile 18, Üs 'das wars', sowie das Bedanken der zweiten Übernehmerin lassen die Beendigung der letzten Informationseinheit, die gleichzeitig auch den Abschluss des Ubergabegesprächs meint, als eine gemeinsam kommunikativ erfolgreich bewerkstelligte Aufgabe erscheinen. Das Formulieren einer Bitte ist generell mit Risiken wie z. B. Gesichtsverlust verbunden, da darauf weniger bevorzugte Redebeiträge folgen können, die unerwartete Antworten oder eine Ablehnung beinhalten. Die Bitte stellt den ersten Teil einer Paarsequenz (adjacency pairs)144 dar, der bevorzugte zweite Teil ist das häufig einfach strukturierte und ohne Verzögerungen geäußerte Gewähren dieser (vgl. Levinson 2000: 362f.; Atkinson/Drew 1979: 58ff.). Nach dem vermeintlichen Erreichen des Endes der Übergabe in Zeile 21 verlängert sich diese durch eine vorsichtig vorgetragene Bitte der Übergeberin in Zeile 23:'dann hätt ich die bitte wei' (.) '. Vorsichtig deshalb, weil sie erstens die Person, an die die Bitte gerichtet ist, nur indirekt über die Formulierung Wer vorne in dem bereich ist-' anspricht. Im Hinblick auf die Bereichspflege macht sie die Adressierung der Bitte von der unter den Vertreterinnen der Folgeschicht grundsätzlich selbstständig vorgenommenen Bereichseinteilung, d. h. auch Verantwortungsmarkierung, abhängig. Zweitens zeigt sie durch den von ihr nur provisorisch hinterlassenen spezifischen Arbeitsbereich an, ('da hab ich jetzt nur (steck) =laken drübergemacht; ), dass sie womöglich nichts unversucht ließ, selbst einen Beitrag zu leisten. Dieser reicht jedoch verständlicherweise nicht aus und sollte daher von den Kolleginnen fachgerecht zu Ende geführt werden. Zusätzlich verweist das
Paarsequenzen wird eine grundlegende Funktion zur Strukturierung von Gesprächen zugeschrieben. Die von Schegloff und Sacks (1973) stammende Definition lautet: „Paarsequenzen sind Sequenzen von zwei Äußerungen, die (i) benachbart sind, (ii) von verschiedenen Sprechern erzeugt werden, (iii) in einen ersten Teil und einen zweiten Teil aufgegliedert werden können, (iv) zu bestimmten Gruppen gehören, so daß (sie) ein bestimmter erster Teil einen bestimmten zweiten Teil (oder einen von mehreren möglichen zweiten Teilen) verlangt; so verlangt ein Angebot Annahme oder Zurückweisung, ein Gruß verlangt einen Gegengruß usw." (Levinson 2000: 330, Hervorhebung im Original). 144
207
Unklarheit als lösbares Interaktionsproblem
auf eine im Moment der (nur provisorischen) Ausführung anstehende Dringlichkeit, d. h. neben den zusätzlich anstehenden Aktivitäten war die Verwendung des Stecklakens die einzig mögliche. Die Übergeberin betreibt zusammenfassend einen relativ großen Aufwand, um die weniger bevorzugte Reaktion auf die Bitte zu vermeiden. 'jetzt'
# 41: Geburtshilfe / 'dann hätt ich die bitte' ((Fortsetzung)) Ü: Übergeberin; Nl, N2: Übernehmerinnen; Sl, S2, S3: Pflegeschüler > 2 6 Nl: 27 Ü:
wars schmutzig? ja=n (bißchen
)
28
((Kugelschreiber knipsen))
2 9 N2:
bett zwei [(ne,)
30 ?:
[(ausgeworfen-)
31 N2:
bett zwei,
32 Ü:
ne jA: am fen[ster
33 Nl: > 34
[JAA: die haben wir gestern auch gemacht;
35
((Rascheln))
36 Ü:
ja aber das is jetzt das bett von (
37 Nl:
« p > J A is klar>
38
a=so ja (
> 39 N2:
)
machen=wa-
40
((Kugelschreiber knipsen))
41 ?:
gut-
42 N2:
Nl wie teilen wir uns auf,
43
welchen bereich (möchst) du machen,
44 Nl:
( )
45 ?:
((räuspert sich))
46
)
(1.0)
47 Nl:
kann ich den Unten machen ich kann den Oben machen
48 N2:
JA! machst du ZWEI dann mach ich eins-
4 9 Ü:
((zerreißt Notizvorlage))
50 Nl:
ja
51 N2:
gut
52
((Notizen werden gemacht, Zimmer durchgezählt))
Eine der Übernehmerinnen reagiert in Zeile 26 zunächst mit einer Gegenfrage 'wars schmutzig?' und erwirkt damit zumindest eine Verzögerung. Denn würde Nl der Bitte Folge leisten, könnte sie z. B. mit „ja kein Problem" antworten und falls erforderlich notwendige Details, die sie zur Ausführung benötigt, erfragen. Das unterlässt sie aber. Die Gegenfrage an sich stellt noch keine Ablehnimg dar, allerdings scheint sie an dieser Stelle zumindest eine latente Dispräferenz gegenüber bestimmten, in die Folgeschicht reichende pflegerische Aktivitäten,
208
5. Übergabe-Wissen
zum Ausdruck zu bringen. Die Übergeberin bejaht die Rückfrage, dann schaltet sich die zweite Übernehmerin ein mit 'bett zwei [ (ne,)' (erneut in Zeile 31) und fordert so offensichtlich zusätzliche Informationen ein bzw. vergewissert sich, so dass sie damit ihre Bereitschaft z u m Ausdruck bringt, die Bitte zu erfüllen. Die erste Übernehmerin (Nl) scheint davon weniger begeistert zu sein, mit ihrer Äußerung:'[ J A A : die haben wir gestern auch gemacht;' bringt sie ihren Vorwurf mit Blick auf die aus ihrer Sicht offenbar dispräferierten Aufgaben klar zum Ausdruck (Zeile 34). Diesem offen ausgesprochenen Vorwurf begegnet die Übergeberin mit dem Verweis auf die diesem Bett zugeordnete Patientin, die offenbar einen besonders pflegeaufwendigen Fall darstellt. N l gibt daraufhin nach und stimmt schlussendlich zu. Unterstützt wird sie dabei von N2, die das Gewähren der Bitte ein zweites Mal mit 'machen=wa-' markiert (Z. 39). Das tatsächliche Ende dieser Übergabe erfolgt einige Zeilen später, wenn die Übernehmerinnen ihre Verantwortungsübernahme u n d ihre jeweiligen Zuständigkeitsbereiche einander anzeigen mit'wie teilen wir uns auf', bzw. kurze Zeit später m i t ' J A ! machst du ZWEI dann mach ich eins-'. Das kollegiale Aufgreifen des „Zepters" drücken sie aus mit der demonstrativen Verwendung des Personalpronomens „wir". Die Anforderung in Übergaben gegebenenfalls auch improvisieren zu müssen, stellt für die Akteurinnen ebenfalls eine besondere Kompetenz dar. Ihr Gelingen hängt vorwiegend davon ab, wie im Falle von „potenziellen" Versäumnissen in der, vergangenen Schicht, dass ein ganz bestimmtes unterstelltes Professionswissen (wie z. B. der Chorpsgeist) in diesem besonderen Fall von den Übernehmenden auch akzeptiert wird. 5.5
Unklarheit als lösbares Interaktionsproblem
Die in den vorigen Abschnitten beschriebenen Wissensprozesse hinterlassen womöglich den Eindruck, dass ein Übergabegespräch frei von Zweifeln, Unklarheiten oder, u m im Wissenskontext zu bleiben, frei von Nicht-Wissen ist. Dem ist keinesfalls so. Aus einer Reihe von Beispielen geht hervor, wie Beschränkungen, Unklarheiten etc. von den Beteiligten kommunikativ bearbeitet und markiert werden. Im Mittelpunkt dieser Analyse steht die Unterscheidung zwischen problematischem und unproblematischem Nichtwissen. Üblicherweise beginnen Übergaben mit der Verortung auf der Station, bei Mehrbettzimmern wird zusätzlich die Bettnummer erwähnt. Im folgenden Infoblock einer Mittagsübergabe geht es u m die Feststellung der gültigen Lokalisierung des Patienten. Ein Patient wird zwar einem Zimmer und einem Bett zugeordnet, es stellt sich jedoch relativ bald nach Beginn heraus, dass der tatsächliche Aufenthaltsort des Patienten ungewiss ist u n d nicht klar bestimmt werden kann. Wie die Beteiligten des Gesprächs damit kommunikativ
209
Unklarheit als lösbares Interaktionsproblem
umgehen und welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen, soll im Folgenden genauer untersucht werden. Das Besondere an diesem Beispiel ist die Beobachtung, dass die Beteiligten scheinbar Nichtwissen bzw. Ungewissheit auf eine Art und Weise bearbeiten, die die Gesprächssituation gleichzeitig entproblematisiert. Zur Übergabesituation: Die Mittagsübergabe findet im Stationszimmer statt und es sind insgesamt 5 Personen aktiv daran beteiligt. Davon gehören zwei Personen zur übergebenden und drei Personen zur übernehmenden Schicht. Die Station wird bereichsweise übergeben, d. h. die beiden Übergeberinnen haben unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche und wechseln einander deshalb gegen Mitte des Gesprächs ab. Im vorliegenden Fall hat der Bereichswechsel kurz vorher stattgefunden. Die Übergeberin sitzt auf einer Arbeitsfläche vor einem Rollschrank, aus dem sie nach und nach die betreffenden Patientinnenmappen herauszieht und bespricht. Ihr schräg gegenüber sitzt die übernehmende Schicht, davon sind zwei aktiv an der Übergabe beteiligt, d. h. sie machen sich Notizen und stellen gegebenenfalls Nachfragen. Die Übernehmerin (Nl) und der Pflegeschüler (S) haben Sichtkontakt zur Übergeberin, N2 jedoch wendet der Übergeberin den Rücken zu. # 42: Urologie/ 'das kann ich dir garantiert jetzt nicht sagen' ((34:10-35:01)) Ü: Übergeberin; Nl: Übernehmerin; N2: Übernehmer 1 Ü: 2
3 4 5 6
7 8
MM
9 Nl: 10
blickt auf die Liste also (.) da steht
0:
11
> 13 Ü: 14 > 15
[da hab_ich nur herrn schaller und herrn rovski stehn; herr kasbig is AU:ch noch drin= es sei denn::-
(—)
die intensiv hat ihn rAUS geholt;=
16 Nl:
=(der ist da mit drin-) (-)
17
wenn er hier nicht mehr stEHT, (-)
> 18 Ü:
)]
in dreiundsech[zig im ERSTen,]
> 12 Nl: 12a
[dreiundsechzig;=DREIundsechzig?] [irgendwer in (
«zögernd>das könnte ja sein.>
19
auf jeden fall,=
20 Nl:
=der is auf intensiv;
210
> 21 Ü: 22
23 N2: 24 Nl: 25 N2: > 26 Ü: 27 N2:
5. Übergabe-Wissen
och (.) das: kann ich dir (garantiert) jetzt NICHt sa[gen;] [was ] [ja
]
hat er den gekrIECHT heute; er hatte PE:_en_el: heute gehabt; na dann.
28 Nl:
dann wird_er- (
29 Ü:
wa:r_ö:hm (.) NICH vorgesehen;=dass er auf intensiv geht,
30
aber mein gott,
31 Nl:
hm_hm (
> 32 Ü: 33
)
)
°hh hh° is irgendwas passIERT wahrscheinlich. (-)
SO.
34
jedenfalls is das_äh SEIN_äh bett da;=
35
=anSONSten war der patient relativ fit-.
38
(1.8)
Die Übergeberin beginnt mit der Nennung der Zimmer- und Bettnummer sowie des Patientennamens. Die von ihr begonnene Ankündigung in Zeile 5 'herr kasbig kriecht HEute,' unterscheidet sich intonatorisch von der Eingangssequenz und ist mit einer Frageintonation versehen. Offensichtlich hat sie Formulierungsschwierigkeiten und fordert die Kolleginnen zur Mithilfe auf. Gleichzeitig beugt sie ihren Oberkörper über den Rollschrank und blickt auf die ca. zwei Meter entfernte OP-Liste. Das Hilfegesuch wird von N l und von N2 wahrgenommen, indem sie beinahe gleichzeitig auf die vor ihnen vorliegenden Listen blicken und N l in Zeile 12 die Namen derer vorliest, die laut Patientinnenbestandsliste im genannten Zimmer sein müssten. Daraufhin ergänzt die Übergeberin, dass der von ihr eingeführte Patient ebenfalls im betreffenden Zimmer liegt 'herr kasbig is AU : ch noch drin=', schiebt aber gleichzeitig eine relativierende Information nach, die den gegenwärtigen Verbleib erklären würde, falls sich der Patient nicht (mehr) auf der urologischen Station befinden sollte 'es sei denn::- (-) die intensiv hat ihn rAUS geholt; ='. D i e B e z e i c h n u n g ' d i e
intensiv hat ihn
rAus geholt; =' in Zeile 15 steht für eine Veränderung der Verantwortlichkeiten, gleichzeitig gibt die Übergeberin damit Auskunft über ihre begrenzte Zeugenschaft. Sie war offensichtlich nicht dabei, als der Patient (von Mitarbeiterinnen der Intensivstation) auf eine andere Station verlegt worden ist. Für die übernehmende Schicht ist diese Situation unbefriedigend und N l beginnt mit der Erklärungssuche in Zeile 16f.'= (der ist da mit drin-) (-) wenn er hier nicht mehr stEHT,'. Demnach folgert sie aus den Eintragungen
der Patientenbestandsliste eine veränderte Patientenbelegung. Die Eintragungen werden von ihr nicht als Fehler oder Irrtum behandelt, vielmehr
Unklarheit als lösbares Interaktionsproblem behandelt sie sie als sinnhafte und für die eigene Tätigkeit Informationen.
211 relevante
Die Übergeberin antwortet auf N l s Schlussfolgerung nur sehr zögerlich und verhalten. Aus einem relativ bestimmten „Herr Kasbig ist auch noch drin" in Zeile 13 wird Augenblicke später ein zögerndes „das könnte ja sein" in Zeile 18, nachdem eine Übernehmerin Mutmaßungen über den Verbleib des Patienten angestellt hat. Die Übernehmerin setzt noch einmal nach und schließt feststellend mit fallender Intonation '=der is auf intensiv,-'. Auch diesem Verifizierungsversuch N l s entzieht sich die Übergeberin. Sie bleibt, wie in Zeile 21f. Z U sehen ('och (.) das: k a n n i c h d i r (garantiert) j e t z t N I C H t sa [gen; ]'), bei ihrer vagen Einschätzung. Dies wiederum führt dazu, dass sich die zweite übernehmende Person (N2) ebenfalls einschaltet und die Übergeberin nach der im Tagdienst möglicherweise verabreichten Medikationen oder medizinischen Eingriffen fragt'hat er d e n g e k r i E C H T heute,-'. Die Frage des zweiten Übernehmers zielt also auf Ereignisse während des Tagdienstes ab, der eine Verlegung auf die Intensivstation plausibel machen würde. Üs Hinweis auf die erfolgte Operation (PNL) 145 in Zeile 26 'er h a t t e P E : _ e n _ e l : h e u t e g e h a b t ; ' reicht der übernehmenden Schicht offensichtlich. Sowohl N2 mit 'na dann' als auch N1 mit 'dann w i r d er-' ziehen daraus ihre Schlüsse, indem sie augenscheinlich ihr Routinewissen einsetzen und einen Begründungszusammenhang zwischen der erfolgten Operation und dem gegenwärtigen Verbleib des Patienten herstellen. Interessanterweise nimmt kurz darauf die Vagheit, mit der die Übergeberin über den Patienten und dessen Verbleib spricht, wieder merklich ab. Nun scheint der Patient also doch (wieder) auf der Intensivstation gelandet zu sein. Halten wir fest: die Übergeberin hat anfangs eine Verlegung auf die Intensivstation nicht ausgeschlossen, eine definitive Bestätigung und genaue Verortung des Patienten war ihr aber nicht möglich. Erst durch die Beiträge der beiden Übernehmerinnen und die gemeinsame Aushandlung mit ihren Kolleginnen wandelte sich ihre Beschreibung und die Verlegung auf eine andere Station wurde plötzlich zu einem sozialen Faktum. In diesem Beispiel geht es m. E. nicht bloß darum zu zeigen, dass die Übergeberin ihre Position geändert hätte oder über kein „rechtes" Wissen verfügte, vielmehr sollte deutlich geworden sein, wie aus einer anfänglichen Vagheit der Übergeberin im Rückblick eine plausible und nachvollziehbare Geschichte rekonstruiert wird °hh hh° is i r g e n d w a s p a s s I E R T w a h r s c h e i n l i c h . ( - ) ' (Zeile 32).
145 PNL steht für Perkutane Nephrolithotomie; bei dieser Art der Operation wird über die Haut der Flanke ein Zugangstrakt zur Niere geschaffen (vgl. Sökeland 1993:138).
5. Übergabe-Wissen
212
5.6
Zusammenfassung
Ausgangspunkt in diesem Abschnitt war der Verzicht, mit einem auf das Individuum reduzierten Wissenskonzept zu argumentierten und anstatt dessen die erkenntniskritische Haltung der Ethnomethodologie einzunehmen, nach der Wissen zwar nicht direkt beobachtbar ist, dafür jedoch die Kompensationsmaßnahmen der Akteurinnen in den Blick genommen werden können. Es ging darum zu zeigen, wie die Akteurinnen unter besonderer Berücksichtigung der Hervorbringung und Herstellung von übergaberelevantem Wissen die für Übergaben typische Asymmetrie der unterschiedlichen Erfahrungsinhalte bewältigen. Anhand von empirischen Analysen wurden insbesondere die Bedeutung von Rekonstruktionen in Übergaben, das von allen Beteiligten gemeinsame Konstruieren von Geschichten über Patientinnen, die unterschiedlichen Arten von Instruktionen, sowie die herausragende Bedeutung von der Fähigkeit und Bereitschaft im Übergabegespräch zu improvisieren, herausgearbeitet. Zusätzlich wurde gezeigt, wie das Pflegepersonal mit in Übergabegesprächen auftretenden Unklarheiten bzw. „Wissenslücken" kommunikativ umgeht und welche Versuche dabei unternommen werden, um solche Fragwürdigkeiten zu entproblematisieren. Ein Kennzeichen von Übergabegesprächen ist, dass besonders die Übergebenden vor Rekonstruktionsaufgaben von vergangenen Ereignissen gestellt sind. Sie sind es, die Unterscheidungen treffen müssen, schließlich muss nicht jedes beliebige Detail vergangener Aktivitäten auf der Station im Zusammenhang mit einem Patienten rekonstruiert werden, sondern es ist gleichzeitig erforderlich, die Erzählwürdigkeit bestimmter Ereignisse kommunikativ zu markieren. Die Erzählwürdigkeit ist im Regelfall abhängig vom unterstellten Wissen. Erzählungen werden in Übergaben insbesondere dann erforderlich, wenn die Unterstellung eines bestimmten Wissens, aus welchen Gründen auch immer, fraglich geworden ist. Somit erfüllen Erzählungen in Übergaben mitunter die Funktion, ein bestimmtes unterstelltes Wissen neu zu justieren oder zu aktualisieren. Unter Verweis auf das Konzept des konversationellen Erzählens konnte gezeigt werden, wie alle Beteiligten - also nicht nur die übergebende Person - am Erzählprozess beteiligt sind. Durch die Erweiterung des „Blickfeldes" wurde der besondere Stellenwert deutlich, den die Aktivitäten der Übernehmenden während des Erzählprozesses einnehmen. Darüber hinaus tragen die Schlussfolgerungen der Übernehmenden bezüglich der narrativen Darstellungen der Patientinnen-Informationen der Übergebenden dazu bei, dass ein von beiden Schichtvertreterinnen gemeinsam hergestelltes Patientenbild generiert wird. Die für das Rekonstruieren von bestimmten Ereignissen auf der Station erforderliche kommunikative Fertigkeit liegt darin,
Zusammenfassung
213
vergangene Ereignisse auf eine solche Art und Weise wiederzugeben, dass sich daraus für die Übernehmenden anschlussfähige Schlussfolgerungen ziehen lassen. In Übergaben generierte Geschichten beinhalten u. a. Aktivitäten, Merkmale oder Zuschreibungen von Patientinnen und ermöglichen damit dem verantwortlichen Pflegepersonal, die entsprechenden pflegerischen Maßnahmen in die Wege zu leiten. Des Weiteren konnten unterschiedliche Arten von Handlungsanweisungen identifiziert werden. Eine Form von Anweisungen erfolgt explizit, wird als Arbeitsauftrag formuliert - unter Angabe der hierfür erforderlichen Instrumente bzw. „Werkzeuge" - und wird meist auch an eine bestimmte Person der übernehmenden Schicht adressiert. Eine weitere Form von Anweisungen ist durch ihren Andeutungscharakter gekennzeichnet, sie muss lediglich „angesprochen" oder angedeutet werden. Das „Ansprechen" eines Sachverhalts reicht im Regelfall aus, um zum Beispiel auf ein bestimmtes Hintergrundwissen oder Routinewissen zu verweisen, das zur Lösung oder Bewältigung eines bestimmten Sachverhalts empfohlen wird. In einem weiteren empirischen Beispiel wurde der Frage nach der Relevanz des Improvisationsvermögens bzw. der Bereitschaft zu improvisieren, insbesondere der Übernehmenden, nachgegangen. Improvisation wurde als spezifische kommunikative Kompetenz gefasst, nach der unvorhergesehene Ereignisse o. Ä. eine gesonderte Beschäftigung im Übergabegespräch erforderlich machen. Wie die Analyse zeigt, sind die Beteiligten dieses Gesprächs insofern kommunikativ höchst kompetent, als dass es ihnen gelingt, potenzielle Versäumnisse aus der übergebenden Schicht - meist erkennbar über die in der Übergabe „weitergereichten" Arbeitsaufträge - in erster Linie nicht dem persönlichen Unvermögen einzelnen Kolleginnen zuzuschreiben, sondern die Erklärungen hierfür gerade nicht eingefordert werden. Die besondere Kompetenz liegt gewissermaßen auch darin, ein Vergehen zu dulden und beispielsweise an den Corpsgeist der Mitarbeiterinnen zu appellieren.
Konversationsanalytische Respezifikation der praktischen Probleme des Feldes 6.
Praktische Folgen der Analyse
Qualitative Forscherinnen im Allgemeinen und ganz besonders solche, die gesprächsanalytische Resultate produzieren, stehen dem Feld gegenüber im Regelfall in der Pflicht, wie auch immer geartete Rückmeldungen über die Ergebnisse der abgeschlossenen Studie zu geben. Die Bandbreite an denkbaren Formen von Rückmeldungen ist sehr vielfältig. Häufig sind es mündliche oder schriftliche Berichte, Vorträge, aus der Studie hervorgegangene Publikationen und gelegentlich auch Workshops und beratungsähnliche Formate. Die berechtigte Erwartungshaltung des Feldes ist zurückzuführen auf die vom Feld gegenüber den Forscherinnen erteilte Erlaubnis, Zugang zu mitunter hochsensiblen Informationen zu erhalten. Der zu Beginn bei Forschungsprojekten zu beobachtende und durchaus verständlichen Reserviertheit von Feldvertreterinnen gegenüber Feldforscherinnen begegnen diese häufig mit Versprechungen, Ankündigungen und im Nützlichkeitsjargon vorgetragenen Argumenten. Bei Interaktionsanalysen auf der Basis von authentischem Datenmaterial können die Aufzeichnungen z. B. als Instrument der Supervision, Beratung und Aus- und Weiterbildung eingesetzt zu werden und so möglicherweise zu einer Verbesserung der Interaktion in der betreffenden Einrichtung beitragen. Dies wiederum kann die Mitarbeiterinnenbindung stärken, die Zufriedenheit steigern und die Motivation der Beschäftigten erhöhen, die Fehlzeiten vermindern und nicht zuletzt die Rekrutierung von Personal erleichtern.146 Die Gefahr, dass solche Versprechen gegenüber dem Feld das Forschungsinteresse unterlaufen können, ist nicht gänzlich auszuschließen. Trotzdem bin ich als Forscher auf die Kooperation des Feldes angewiesen und muss idealerweise einen Mittelweg schaffen, der beiden
146
Diese Beispiele gehen vorwiegend zurück auf organisationspsychologische Perspektiven (vgl. Spieß/Rosenstiel 2010), tauchen vereinzelt aber auch in den Arbeiten der angewandten Gesprächsforschung auf: als Gesprächsanalyse in der betrieblichen Praxis (Härtung 2004a) bzw. als Methode in der Personal- und Organisationsentwicklung (ders.: 2004). Des Weiteren sind hier die Beiträge im Abschnitt IV (Kommunikation und Kommunikationstraining in verschiedenen Handlungsfeldern und Praxisbereichen) des Sammelbands „Angewandte Diskursforschung" (Brünner et al. 2002) zu nennen, weiter zur Organisationskommunikation Menz/Müller/Götz (2008) oder zur systemischen Beratung Habscheid (2003), zur Ethnographie der Unternehmenskommunikation Müller (2006) oder zu Interkulturalität in Training und Coaching Nazarkiewicz/Krämer (2012), Nazarkiewicz (2013).
216
6. Praktische Folgen der Analyse
Interessen gerecht wird. Solche Interessenskonflikte können für empirisch Forschende eine große Herausforderung darstellen, denn sie fordern insgeheim dazu auf, Stellung zu beziehen hinsichtlich des Nutzens und der Verantwortung gegenüber den Feldvertreterinnen. „Soziologie hat nicht die Aufgabe, einen bestimmten Sinn zu vermitteln. Aber sie kann die Bedingungen, unter denen das Denken und Handeln der Menschen Sinn macht oder fragwürdig geworden ist, aufzeigen. Weber hat genau das wohl auch gemeint, als er sagte, dass Politiker ihre Worte als Schwerter gegen die Gegner einsetzen, dass die Soziologie ihre Argumente dagegen als 'Pflugscharen zur Lockerung' des Denkens verwendet" (vgl. Weber 1919a: 497; zit. n. Abels 2009: 58). Aber nicht jede soziologische Forschungspraxis kann und will von vornherein den „Menschen" ihre Resultate aufzwingen oder auch nur zur Verfügung stellen, um etwas Vermeintliches besser, richtiger und schneller zu machen. Was also ist zu tun? Diese Frage stellt sich vor allem dann, wenn bereits vor Erhebung der ersten Daten den Feldvertreterinnen Zugeständnisse gemacht worden sind. 6.1
Angewandte Gesprächsforschung oder doch lieber ethnomethodologische Indifferenz?
Werturteile über die soziale Praxis der Untersuchungsteilnehmerinnen abzugeben ist für Sozialwissenschaftlerlnnen und erst recht für ethnomethodologisch orientierte Forscherinnen eine gefährliche Fehlerquelle und ein äußerst heikles Unterfangen, da sie immer auch eine parteiische Beobachtung und eine aus welcher Sicht auch immer einseitige („richtige") Auslegung der Praktiken des Untersuchungsfelds zur Folge haben (können). Wer darf über die Praktiken der Akteurinnen urteilen? Welche theoretischen und bestenfalls soziologischen Modelle stellen uns Regelwerke zur Verfügung, die wir bei Bedarf abrufen können? Wir erinnern uns daran, dass die Ethnomethodologie vom Herstellungscharakter gesellschaftlicher Tatbestände ausgeht, die soziale Wirklichkeit von den Akteurinnen also methodisch, unter Rückgriff auf formale und beschreibbare Verfahrensweisen, hergestellt wird. Darüber hinaus wird auf die Bewertung von Handlungen gänzlich verzichtet, die Ethnomethodologie verhält sich also gegenüber Aussagen, Formulierungen etc. gleichgültig, so dass die oben gestellten Fragen auch nicht beantwortet werden müssen. Sie werden von Ethnomethodologen auch nicht gestellt, stattdessen berufen sie sich auf den Grundsatz der „Indifferenz". Damit ist bekanntlich eine Gleichgültigkeit bzw. Uninteressiertheit gegenüber den praktischen Fragen und Interessen der Alltagshandelnden gemeint, aber auch gegenüber der in der traditionellen Soziologie („analytic sociology") verfolgten Praxis, theoretische Modelle und
Angewandte Gesprächsforschung oder ethnomethodologische Indifferenz?
217
Kategorien einzuführen, um nach der Validität und Zuverlässigkeit von soziologischen Beschreibungen und Erklärungen bzw. Messungen zu fragen (vgl. Lynch 1993: 141f.; siehe auch Bergmann 1974: 146f.). Letzteres impliziert auch eine Gleichgültigkeit gegenüber vorgängigen, den eigenen Untersuchungsgegenstand bzw. die eigene Disziplin betreffende Erklärungen, d. h. die Ethnomethodologie selbst ist davon nicht befreit und ausgenommen. In einem sehr frühen Text beschreiben Garfinkel und Sacks: „Ethnomethodological studies of formal structures ... [seek] to describe members' accounts of formal structures wherever and by whomever they are done, while abstaining from all judgements of their adequacy, value, importance, necessity, practicality, success, or consequentiality. We refer to this procedural policy as 'ethnomethodological indifference' " (1970: 345f.; zit. n. Lynch 1993:142). Die Aufgabe des Forschers liegt also gerade nicht darin, Urteile über die beobachteten Praktiken der Akteurinnen zu fällen. Dieser Grundsatz geht einher mit den analytischen Maximen der Konversationsanalyse und sorgt im Analyseprozess dafür, dass 1) keine noch so gut gemeinten sozialkritischen Perspektiven147 den Blick auf die tatsächliche Methodizität eines sozialen Ereignisses verstellen und bestimmte interpretative „Räume" ausblenden, 2) vorgängige Gewissheiten in Form von Modellen, Kategorien und Werten dem vorliegenden Material zwar regelgerechte Ergebnisse abtrotzen, diese aber nicht notwendigerweise zutreffen müssen. Im Mittelpunkt steht daher „das Was und Wie des sozialen Handelns; jede Norm hat abstrakten, idealisierten Charakter und kann deshalb nie auf spezifische Situationen angewandt werden, in welchen sich Handeln konkret ausgestalten muss" (vgl. Hitzler 2012: 279), und 3) sich der Forscher immer von Neuem auch seinen persönlichen unterstellten Wahrheiten, Annahmen und Vorstellungen über die Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit der beobachteten Praktiken klar werden muss und sie gewissermaßen im Sinne der phänomenologischen Epoche forschungspraktisch wendet (vgl. Bergmann 1974:147).
147
Mit der bereits von Bergmann (1974) monierten und entgegen der von Schütze et al. (1973) vertretenen Annahme, die Ethnomethodologie hätte sich einer praktischsozialkritischen Aufklärung verschrieben, ist die Ethnomethodologie weit davon entfernt und hat bereits in ihren Anfängen die Haltung der Indifferenz eingenommen.
218
6. Praktische Folgen der Analyse
Dem gegenüber steht die Angewandte Gesprächsforschung: Sie ist eine Teildisziplin der Linguistik und verfolgt zum Teil ganz offen den normativen Anspruch einer Verbesserung der Kommunikation (vgl. BeckerMrotzek/ Brünner 2004). Der Untersuchungsgegenstand ist das sprachliche Handeln in hauptsächlich kommunikationsintensiven gesellschaftlichen Institutionen, hier insbesondere das Schulwesen, die öffentliche Verwaltung, die Wirtschaft und nicht zuletzt Gespräche im medizinischen und pflegerischen Kontext. Die Vertreterinnen dieser Richtung propagieren sowohl die Notwendigkeit, als auch die Suche nach Möglichkeiten der Didaktisierung gesprächsanalytischer Daten zu Fortbildungszwecken (vgl. Meer 2007). Die verstärkte Anwendung der Gesprächsforschung in Beratungsprozessen insbesondere der Kommunikationsberatung stellt jedoch auch eine Einschränkung und Spezialisierung ihres Erkenntnisinteresses dar. Ihr Fokus hat sich dadurch von den Organisationsprinzipien und Regularitäten verstärkt auf die Sprach- und Kommunikationsprobleme verlagert (vgl. Fiehler 2001: 1707). Ähnlich sind auch gesprächsanalytisch fundierte Aus- und Fortbildungskonzepte zugeschnitten. Nach Meer und Spiegel bewegen sich die Kursteilnehmerinnen wie deren Kursleitung bei der Zusammenstellung von Ausbildungslehrgängen und Fortbildungen sowie bei deren Durchführung kontinuierlich zwischen den Polen der deskriptiven Bestimmung der zentralen Problembereiche und der normativ orientierten Entwicklung konkreter Handlungsanweisungen bzw. -empfehlungen (2009: 3). Die Autorinnen sehen in diesem Vorgehen den Vorteil, dass dabei die tatsächlichen Schwierigkeiten der Beteiligten und die Entwicklung von brauchbaren Lösungsperspektiven vor dem Hintergrund des jeweiligen institutionellen Umfelds unter Rückgriff auf reale Gesprächsmitschnitte im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus ermöglichen die technische Aufzeichnung und die Verwendung von Transkripten eine „entschleunigte Betrachtung und Bearbeitung" (ebd.) und eine detaillierte Analyse von relevanten Kommunikationsproblemen. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit authentischem Material, das Einbeziehen der Beteiligten zur Entwicklung von Lösungsperspektiven, die gleichermaßen situationsangemessen und praktisch umsetzbar sind. Denn dieses Vorgehen bewahrt vor der Verkündung idealisierter Maximen und unterkomplexer Modelle, wie sie vor allem aus der kommunikationspsychologisch orientierten Forschung bekannt sind (vgl. Schulz von Thun 1981,1989). Innerhalb der Angewandten Gesprächsforschung mehren sich jedoch auch kritische Stimmen, die auf die Gefahren eines allzu sorglosen Umgangs mit Handlungsanweisungen und -empfehlungen hinweisen. Offenbar zeichnet sich auch hier ein Trend ab hin zu einer kontextsensitiven Interpretation der Daten, und es wird erkannt, dass letztlich die Vertreterinnen des Feldes darüber zu entscheiden haben, ob ein bestimmtes Gesprächsverhalten verbesserungswürdig ist (vgl. Bendel 2004). Zusammengefasst ist die Angewandte
Angewandte Gesprächsforschung oder ethnomethodologische Indifferenz?
219
Gesprächsforschung also grundsätzlich an einer Verbesserung der Kommunikation interessiert und setzt dabei an den Kompetenzen der Beteiligten an. Im Gegensatz dazu ist eine ethnomethodologisch informierte Konversationsanalyse der methodologisch begründeten distanzierten Haltung gegenüber den Gesprächsbeiträgen der Beteiligten verpflichtet. Die vorliegende Studie zu Übergabegesprächen hat sich in ihrer Umsetzung sehr stark an der Tradition der ethnomethodologischen Konversationsanalyse orientiert. Der Forschungsprozess hat jedoch einen Verlauf genommen, der den Forscher herausforderte, nach Alternativen insbesondere der Darstellung und Vermittlung von vorläufigen Analyseergebnissen zu suchen. Die Herausforderung bestand darin, die analytischen Maximen der Ethnomethodologie nicht voreilig über Bord zu werfen und gleichzeitig den Erwartungen des Forschungsfeldes hinsichtlich der Rückmeldungen gerecht werden zu können. Schon relativ früh im Forschungsprozess, nach der ersten Datengewinnungsphase, wurde der Forscher von Vertreterinnen des Feldes gebeten, die ersten Ergebnisse in Form eines Vortrages einem hausinternen Publikum aus Managementvertreterinnen und Pflegepersonal mit größtenteils Leitungsaufgaben vorzustellen. Das geschah zu einem Zeitpunkt, als die analytische Durchdringung der Daten noch nicht allzu weit gediehen war. Glücklicherweise konnte ich teilweise auf die Ergebnisse meiner Diplomarbeit zurückgreifen und so den ersten Ergebnishunger des Feldes stillen. Bei diesem und den darauf folgenden Zusammentreffen mit dem Feld stellte sich zur Überraschung des Forschers jedoch heraus, dass ihm durchaus einiges an Spielraum zur Verfügung stand, und zwar in der Art und Weise, wie er die Daten, d. h. die Transkripte und Gesprächsausschnitte, aufbereitete und gemeinsam mit den Beteiligten des Feldes, insbesondere den Mitarbeiterinnen der Pflegestationen, bearbeitete. Ganz im Sinne der ethnomethodologischen Indifferenz hat der Autor es bei der Vorstellung der Daten tunlichst unterlassen, „richtige" von „falschen" oder fehlerhaften Übergaben zu unterscheiden und hat anstatt dessen vermehrt auf Übungen mit Transkripten zurückgegriffen. So konnte der Forscher das bei Laien häufig zu beobachtende Erstaunen beim Anblick eines im mittleren Auflösungsniveau transkribierten Übergabegesprächs dazu nutzen, die (teilweise auch diffusen) Erwartungen des Feldes zufrieden zu stellen. Die Funktion der Übungen bestanden zu diesem Zeitpunkt des Forschungsprozesses in erster Linie darin, den Beteiligten einen Eindruck über eine ansonsten nur flüchtige soziale Praxis zu vermitteln und die Auseinandersetzung mit den Transkripten reichte oftmals über eine grobe Themenanalyse nicht hinaus. Anfragen zu Handlungsempfehlungen oder konkreten Verbesserungsvorschlägen seitens der Beteiligten wurden glücklicherweise keine gestellt und so kam der Forscher auch nicht in die Versuchung, wohlfeile Ratschläge zur Verbesserung der Gesprächskompetenz zu erteilen.
220
6. Praktische Folgen der Analyse
Diese in der Rückschau betrachtet durchaus heikle Phase im Forschungsprozess war vergleichbar mit einer Bewährungsprobe, bei der allerdings scheinbar weniger die Ergebnisse, als die Authentizität des Forschers und seines Vorgehens überprüft wurden. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil daran weitere Erhebungen und Feldaufenthalte geknüpft waren. Dennoch hinterließ dieser (zunächst ungeplante) sehr frühe Austausch mit dem Feld beim Forscher einen außerordentlich positiven Eindruck, schließlich sind 1.) solche Begegnungen während qualitativen Studien keinesfalls als lästige Zusatzaufgaben zu betrachten, sondern bieten Forschenden hervorragende Möglichkeiten, Orientierungs- und Teilnehmerwissen zu generieren oder, mit anderen Worten, „Kenntnisse über das Forschungsfeld" zu erwerben, 2.) erkannte der Forscher dabei das forschungspraktische Potenzial des frühzeitigen Einsatzes von Transkription im Austausch mit den Teilnehmerinnen des Feldes. In späteren Phasen der Forschung griff der Forscher daher immer wieder auf diese Praxis zurück und setzte sie bei den aus der Zusammenarbeit hervorgegangenen Projekten „Stationsleiterinnenschulung", „Modellprojekt - Übergabe am Patientenbett" und der „Datensitzungsgruppe Urologie" auch regelmäßig ein. Abschließend lässt sich also festhalten, dass sich trotz der ethnomethodologisch begründeten Selbstbeschränkung einerseits und der offensichtlich gegenläufigen Ausrichtung der Angewandten Gesprächsforschung anderseits, eine für den Fortgang der Studie höchst positive Entwicklung abzeichnete. Im Folgenden wird eine Verfahrensweise vorgestellt, deren Einsatz sich in der vorliegenden Studie bewährt hat. 6.2
Die Konversationsanalyse als Methode der Gesprächssupervision
Die Durchführung von Übergabegesprächen, sowie Gesprächsereignisse zwischen Pflegepersonal und Patientinnen im Allgemeinen, gelten unter Praktikerinnen als heikel und mitunter lästig. Die einen beherrschen es, für die anderen ist es eine gelegentlich mühevolle Zusatzaufgabe neben der pflegerischen Tätigkeit auf der Station. Insbesondere Pflegeschülerinnen sind solchen Gesprächssituationen oft hilflos ausgeliefert, werden sie doch im Rahmen ihrer Ausbildung nur teilweise oder unzureichend darauf vorbereitet (vgl. Zegelin-Abt 1998). Auch wenn diese Thematik mittlerweile in den Lehrbüchern auftaucht, genießt sie leider immer noch ein Nischendasein. Konversationsanalytische Studien könnten hier wertvolle Abhilfe leisten, würden z. B. deren Ergebnisse in die Lehrpläne der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen aufgenommen werden.
221
Die Konversationsanalyse als Methode der Gesprächssupervision
In
Anlehnung
innerhalb
an
Meier/Wolff
(1997)
wurde
die
Konversationsanalyse
des Forschungsprozesses als eine spezifische F o r m der Supervisión
eingesetzt. 1 4 8 Dafür spricht die prinzipielle Praxisrelevanz der Konversationsanalyse u n d z w a r in der Weise, dass technisch registrierte soziale Ereignisse unter bestimmten Voraussetzungen den professionellen Akteurinnen sichtbar und zugänglich g e m a c h t w e r d e n können. 1 4 9 Vergleichbare Konzepte aus d e m Bereich der Unternehmensberatung (vgl. Krizanits 2009) oder d e m Coaching (vgl. Heitger et al. 2004) w ä r e n z w a r grundsätzlich ebenfalls denkbar, für die erwähnten
Projekte
(„Stationsleiter-Innenschulung"
und
„Modellprojekt
-
Übergabe a m Patientenbett") sind sie jedoch allein schon deshalb weniger geeignet,
weil
d e m Forscher
vom
Management
des Krankenhauses
kein
Beratungsauftrag erteilt wurde. Die
konversationsanalytische
Supervisión
bietet
den
Beteiligten
die
Möglichkeit, die in den Daten rekonstruierten Praktiken und Verfahren in
148 Ähnlich betrachten Gülich und Krämer (2009) die transkriptgestützte linguistische Bearbeitung von Gesprächen als eine Methode der Supervision. In ihrem Beitrag berichten sie über die Arbeit mit Fortbildungsgruppen in der „TelefonSeelsorge".
Hinsichtlich der Verwendungsweise kommt der Konversationsanalyse in bestimmten Forschungszusammenhängen mit Praxisbezügen nach Peräkylä und Vehviläinen (2003: 747) auch noch folgende Bedeutung und Aufgabe zu: „CA has a critical task in pointing out the simplified or empirically unsustainable assumptions of the SIKs. However, it also has a complementary task in providing more detailed or concrete descriptions of known practices and in showing new practices or functions. Accomplishing these tasks does not compromise the strictly empirical stance of CA studies, but it may be vital for the wider social relevance of the CA enterprise." Sog. „SIK", d. h. „professional stocks of interactional knowledge" werden beispielsweise in Beratungskontexten oder therapeutischen Zusammenhängen eingesetzt. Dabei handelt es sich um Interaktionsmodelle und Quasi-Theorien mit ausgeprägtem Instruktionscharakter. Meines Wissens existieren keine nennenswerten Interaktionsmodelle, die explizit auf Übergabegespräche Bezug nehmen. Das besondere Anregungspotenzial für das Praxisfeld in konversationsanalytischen Studien wird aber auch an diesem spezifischen Zuschnitt deutlich. 149 Noch programmatischer im Hinblick auf die Praxisrelevanz sind die „Studies of Work" ausgerichtet. Die bei ethnomethodologischen Studien häufig zu beobachtende Nähe zu Praxisfeldern und Arbeitskontexten (vgl. Bergmann 2005), beispielsweise zur Analyse von realen Arbeitsvollzügen und zur Identifzierung der wesentlichen Bestandteile des Kompetenzsystems eines Berufs- und Arbeitsfeldes, geht sogar soweit, dass Forschende sich mit dem Praxisfeld „hybridisieren" sollen („Do Hybrid Studies", vgl. Lindwall/Lymer 2005). Das erklärte Ziel von „Hybrid Studies" sollte nach Craptree (2004) lauten: „[...] to inform the ongoing professional development of occupational practices whose workaday objects are under 'praxiological' study."
222
6. Praktische Folgen der Analyse
einem vom Forscher angeleiteten zusätzlichen Arbeitsprozess gemeinsam aufzuarbeiten und damit zum Ausgangspunkt für Selbstbeobachtung, Selbstreflexion und Veränderungsprozessen zu machen. Im Gegensatz zur Vorstellung der Angewandten Gesprächsforschung, die persönlichen Gesprächskompetenzen der Beteiligten zu verbessern, enthält sich die konversationsanalytische Supervision einer Beurteilung und Bewertung der Gesprächskompetenzen. Umgekehrt können die Beteiligten aus dem Forschungsfeld durch ihren Expertinnenstatus dem Forscher wertvolle Dienste erweisen, etwa bei der Rekonstruktion der Aufzeichnungen. Ansatzpunkt konversationsanalytischen Vorgehens ist die Annahme, dass soziale Tatsachen grundsätzlich als interaktive Leistung der Beteiligten zu begreifen sind. Dieser Vorgang der sinnvermittelten Wirklichkeitserzeugung erfolgt methodisch, d. h. er weist formale und als solche beschreibbare Strukturmerkmale auf (vgl. Bergmann 1994: 5f.). Die zentrale Aufgabe der KA besteht nun darin, jene generativen Prinzipien und Verfahren zu bestimmen, mittels derer das Pflegepersonal z. B. in einem Übergabegespräch in und mit ihren Äußerungen und Handlungen die spezifischen Strukturmerkmale und die „gelebte Geordnetheit" hervorbringen (ders.: 7). Die eigentliche Analysepraxis (nach erfolgreicher Datengewinnung, Transkription ausgewählter Abschnitte und Auswahl potentieller Ordnungselemente) beginnt mit der Rekonstruktion der Geordnetheit, d. h. wie die z. B. am Übergabegespräch beteiligten Pflegekräfte die beobachtete Regelmäßigkeit und Geordnetheit interaktiv erzeugen (vgl. Meier/Wolff 1997: 164). Doch damit ist die Analyse nicht abgeschlossen, denn jene Geordnetheit wird nach Bergmann im Sinne der allgemeinen Hermeneutik verstanden als „Antwort auf eine vorgängige Frage", d. h. als Resultat der methodischen Lösung eines strukturellen Problems der Interaktionsorganisation. Die identifizierte Geordnetheit im Transkript ist gewissermaßen die zu bearbeitende Oberfläche, über die im nächsten Schritt Aussagen über das dem Übergabegespräch zugrunde liegende strukturelle Problem zu machen sind (vgl. Bergmann 1994: 14). Dieses strikte analytische Vorgehen ist ebenso grundlegend für die Umsetzung der Konversationsanalytischen Supervision, im Mittelpunkt steht die konsequente Arbeit mit dem Aufzeichnungsmaterial, insbesondere mit Transkripten. Eine konversationsanalytische Supervision kann eine unter bestimmten Bedingungen stattfindende Datensitzung mit Feldvertreterinnen sein, dabei ist ihr eigentliches Analyseziel im Sinne der Konversationsanalyse grundsätzlich beizubehalten und gleichzeitig den Beteiligten des Feldes eine Arbeitsfläche zur Selbstbeobachtung und Selbstreflexion zur Verfügung zu stellen. Durch die Arbeit mit dem Untersuchungsmaterial können folgende unterschiedliche und sich teilweise ergänzende Ziele bedient werden: An erster Stelle steht der über die Feldforschung hinausgehende Erwerb des auch für die Analyse bedeutsamen Orientierungs- bzw. Teilnehmerwissens,
Anforderungen an eine Datensitzung mit Feldvertreterinnen
223
dann folgt die Validierung der aufgestellten Hypothesen über das dem Übergabegespräch zugrunde liegende strukturelle Problem der Interaktionsorganisation. Des Weiteren können gegebenenfalls Handlungsalternativen entwickelt und vermittelt werden, insbesondere wenn zuvor bei der Sinninterpretation Kontingenzräume erschlossen worden sind, wie zum Beispiel bei der Bildung von Lesarten, wo nicht realisierte Optionen als bedeutungskonstitutive Elemente identifiziert worden sind. 6.3
Anforderungen an eine Datensitzung mit Feldvertreterinnen
Für gewöhnlich finden Datensitzungen zu Forschungs- und Fortbildungszwecken unter Beteiligung wissenschaftlicher Kolleginnen in wissenschaftlichen Einrichtungen statt (Forschungsinstitute, Universitäten). Die Interpretationsarbeit von Gesprächsdaten unter Beteiligung von Mitgliedern aus dem Forschungsfeld hingegen stellt eher eine Ausnahme dar, was dadurch begründet ist, dass Forschende keinen Kontakt mehr zu den Verantwortlichen im Forschungsfeld haben, die Aufnahmen schon mehrere Jahre zurückliegen und eine Kontaktaufnahme daher wenig ergiebig wäre oder einfach weil von Seiten der Verantwortlichen des Feldes diesbezüglich kein Interesse besteht. Man könnte diese Form der Interpretationsarbeit auch außerwissenschaftliche Datensitzung nennen. Sie soll die typisch wissenschaftliche Datensitzung jedoch in keiner Weise ersetzen, sondern höchstens ergänzen, schließlich können und sollen mittels dieser Arbeitsform Erkenntnisse gewonnen werden, die die Rekonstruktion des Datenmaterials bei der wissenschaftlichen Analyse erleichtern und unterstützen. Der Forscher kann z. B. erforderliches Orientierungswissen generieren, seine Hypothesen über die Ablaufstruktur prüfen und ggf. Annahmen über die Kontextbedingungen in diesem Rahmen zu Diskussion stellen. Diese Form der Zusammenarbeit ist als spezifische Praxis der Gesprächssupervision gedacht, die nach bestimmten Prinzipien umgesetzt werden kann. Für die Entwicklung einer Konversationsanalytischen Supervision ist bedeutend, dass a) eine Arbeitsform entwickelt wird, die von den bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgeht, nach Möglichkeit mit ihrem wissenschaftstheoretischen Hintergrund vereinbar ist und aber gleichzeitig eine didaktische Komposition des Arbeitsprozesses zulässt. Der ausgewogene Einsatz von Kleingruppen-, Partner- und Plenumsarbeit sorgt für ganz entscheidende gruppendynamische Effekte (vgl. auch Meer 2009a), b) nicht alles, was konversationsanalytisch relevant ist, für den Arbeitsprozess mit den Beteiligten von Bedeutung sein muss; die Teilnehmerinnen der Datensitzung müssen z. B. nicht in die Grundlagen der Ethnomethodologie eingewiesen werden. Ebenso zweitrangig sind Verweise
224
6. Praktische Folgen der Analyse
auf Vertreterinnen und bisherige empirische Arbeiten. Die Gründe liegen im zumeist knapp bemessenen Zeitbudget und an der ansonsten drohenden inhaltlichen Überfrachtung, sowie der in der Regel schwer zugänglichen wissenschaftlichen Thematik. Wie oben bereits erwähnt, handelt es sich bei den Teilnehmenden überwiegend um gesprächsanalytische Novizen, die Transkripte sollten daher ein niedriges Auflösungsniveau haben und in Kombination mit Audio- und Videodaten eingesetzt werden. Bei der Organisation der Datensitzung mit Feldvertreterinnen wurde insbesondere auf die Einhaltung folgender analytischer Maxime Wert gelegt, die als Empfehlungen formuliert den Workshops vorausgingen: Sequenzialität: Die Analyse sollte sich am Prozesscharakter von sozialen Ereignissen orientieren bzw. die zeitliche Abfolge berücksichtigen, d. h. sie soll analog zum Prozess des Vollzugs von sozialer Wirklichkeit erfolgen. Eine retrospektive „Ausbeutung" des Datums sollte vermieden werden. Kontextgebundenheit: Da soziale Interaktionen immer kontextgebunden sind, darf die Analyse weder ausschließlich losgelöst von diesem durchgeführt werden, noch sollen ausschließlich kontextferne Informationen in die Analyse importiert werden. Bei der Durchführung der Datensitzungen unter Beteiligung von Vertreterinnen aus dem Forschungsfeld hat sich jedoch gezeigt, dass die getreue Einhaltung dieser Maxime dem Nutzen und Gewinn der Analyse eher zuwiderläuft, weil manche Teilnehmerinnen in der Regel ihr umfassendes Expertinnenwissen einfließen lassen. Sie liefern Hintergrundwissen zu vielerlei explizit außerhalb der Situation liegenden Erklärungen. Obwohl es paradox klingt, ist der Forscher manchmal genau auf solche Informationen angewiesen und kann so vor Fehlschlüssen, z. B. hinsichtlich irrtümlich vom Forscher ausgebildeter Lesarten bei der Rekonstruktion der Daten, bewahrt werden. Geordnetheitsmaxime: Die analytische Rekonstruktion sollte das gesamte Material einbeziehen. Kein noch so banal oder irrelevant erscheinendes Detail des Gesprächs darf vernachlässigt oder eingeklammert werden. Keine Motivunterstellung: Die Übergabe als soziale Tatsache ist grundsätzlich als interaktive Leistung der Akteurinnen zu betrachten. Der Herstellungscharakter ist zu würdigen, indem zum einen keinerlei im Hintergrund verborgenen Kräfte z. B. für die Strukturiertheit des Gesprächs verantwortlich gemacht und
Die konkrete Arbeit mit Transkripten und audiovisuellen Mitschnitten
225
zum anderen auch nicht in den Köpfen der Beteiligten über die Unterstellung von Motiven, lokalisiert werden.150 6.4
Die konkrete Arbeit mit Transkripten und audiovisuellen Mitschnitten
Folgt man Meer und Spiegels (2009: 4) Konzeption von Trainings- oder Fortbildungskonzepten, so ist es ihrer Ansicht nach ratsam, zu Beginn das Expertinnenwissen der Beteiligten zu aktivieren und unter Bezugnahme auf ausgewählte Gesprächsauszüge die für die Beteiligten drängenden kommunikativen Problemlagen zu benennen. Dieses Vorgehen bündelt die Erwartungen der Teilnehmenden und strukturiert zudem den Arbeitsablauf. Gelegentlich finden auch noch Kombinationen mit Übungen aus der Erwachsenenbildung Verwendung, wie z. B. Rollenspiele, Moderation und gruppendynamische Übungen (vgl. Königswieser et al. 1995). Im Folgenden noch einige Hinweise, die bei der Arbeit mit Transkripten berücksichtigt werden sollten, sowie eine detaillierte Beschreibung zweier Übungsanordnungen, wie sie im Rahmen der Konversationsanalytischen Supervision in der vorliegenden Studie zum Einsatz gekommen sind. Transkripte sind ein Werkzeug, mit dem Gesprächsforscherinnen ihre tägliche Arbeit verrichten. Ändern sich jetzt der Teilnehmerinnenkreis und die Rahmenbedingungen der gemeinsamen Analyse, so ist dies bei der Konzeption des Ablaufs zu berücksichtigen (vgl. Spiegel 2009). Die Teilnehmerinnen verfügen in der Regel über keinerlei Vorwissen über Notationssysteme, Gesprächsstrukturen und Interpretationsmaximen. Allein die Anfertigung eines Transkripts sowie die Aufhebung der Flüchtigkeit und die Thematisierung dieser sind für Anfängerinnen absolutes Neuland und müssen dementsprechend sorgfältig eingeführt werden. Ebenfalls zu beachten ist die Auswahl einer angemessenen Transkriptionsstufe. Eine nach GAT 2 (vgl. Selting et al. 2009) erfolgte Transkription sollte für diese Zwecke nicht über das Minimaltranskript hinausgehen. Der Einsatz von höheren Ausbaustufen (Basisbzw. Feintranskript) sind absolut ungeeignet, außer der Forscher möchte gegenüber dem Feld seinen Expertenstatus anhand einiger Ausschnitte demonstrieren. Noch bevor mit der Arbeit am Transkript begonnen wird, empfiehlt es sich, die Teilnehmerinnen auf den Unterschied zwischen geschriebener und
Diese Liste könnte zwar noch um einige Begriffe erweitert werden, aus Vereinfachungsgründen gegenüber den Teilnehmenden beließ der Forscher es jedoch bei den vorgestellten. 150
226
6. Praktische Folgen der Analyse
gesprochener Sprache aufmerksam zu machen (vgl. Schwitalla 2006: 13). „Man sollte mitstenographieren", heißt es bei Tucholsky. „Und das so Erraffte dann am besten in ein Grammophon sprechen, es aufziehen und denen, die gesprochen haben vorlaufen lassen. Sie wendeten sich mit Grausen" (...) (vgl. 1961 [1927]: 713f.). Die Teilnehmerinnen, die ihre eigenen Worte in verschriftlichter Form vor sich liegen haben, sind oft anfangs geschockt ob der scheinbar holprigen Ausdrucksweise, den vielen Wort- und Satzabbrüchen und nicht zuletzt ob der von vielen Teilnehmerinnen empfundenen sprachlichen Patzern. Gesprochene Sprache wird von Laien generell als fehlerhaft und unpräzise empfunden. Umso beeindruckender ist es für die Teilnehmerinnen, gemeinsam festzustellen, dass es offensichtlich trotzdem ausreicht, die kommunikativen Aufgaben des Alltags auf diese Weise bewältigen zu können. Darüber hinaus ist zu überlegen, in welchem Umfang zusätzlich visuelles Datenmaterial eingesetzt wird. Möglicherweise sind auch die abgebildeten Personen anwesend, dann ist es die Aufgabe der Kursleitung, jene Personen vor allzu harscher Kritik der Kolleginnen zu schützen. Trifft die Arbeitsgruppe jedoch öfters zusammen, stellen gruppendynamische Prozesse keine allzu großen Hindernisse mehr für den weiteren Arbeitsprozess dar, Videoausschnitte können dann in geringen Dosen durchaus eingesetzt werden. Das Abspielen der Audiospur ist hingegen grundsätzlich unproblematisch. Egal ob Training, Workshop oder konversationsanalytische Supervision, neben der wissenschaftlichen Fachkompetenz (Konversationsanalyse) ist außerdem ein Vorwissen über die didaktische Anlage der Veranstaltungen erforderlich. Nur eine dem Veranstaltungstyp angemessene Lehr-/Lernsituation in Verbindung mit ausgewählten Methoden der Erwachsenenbildung sorgt für die nötige Kursarchitektur. Es soll nochmals betont werden, dass die im Folgenden vorgestellten Übungen originär nicht das Ziel verfolgen, basale kommunikative Kompetenzen oder bestimmte kommunikative Techniken (z. B. Grundlagen der Rhetorik oder Bereiche aus der Sprechwissenschaft, wie Sprechbildung, Sprechkunst etc.) zu vermitteln. Die Übungsariordnungen beziehen sich in unterschiedlicher Weise auf das vorliegende Datenmaterial. Bei manchen Übungen wird auf den zusätzlichen Einsatz des Audio- oder Videomaterials aus Gründen der Anonymisierung verzichtet. Üblicherweise wird jedoch bei der Transkriptarbeit zunächst die Tonaufzeichnung ohne Transkriptvorlage abgespielt und erst im zweiten Durchgang werden das Anhören der Aufzeichnung und das Mitlesen des Transkripts miteinander verknüpft. Übung 1: Sensibilisierung - Grundlagen der Interpretation Dieses Format ist besonders für den Beginn der Zusammenarbeit und für gesprächsanalytisch unerfahrene Personen geeignet. Transkriptauszüge werden verteilt und einige Teilnehmerinnen ausgewählt, um einen ca. zweiminütigen
Die konkrete Arbeit mit Transkripten und audiovisuellen Mitschnitten
227
Auszug (z. B. den Beginn oder einen relativ kurzen Informationsbeitrag pro Patientin) eines Übergabegesprächs mit verteilten Rollen (Übergeberln, Übernehmerln, sonstige Personen) im Plenum ein- bis zweimal vorzustellen. Anschließend folgt eine ca. 5 - 15minütige Kleingruppenarbeit (2-3 Personen) mit der Aufgabe, alle möglichen Auffälligkeiten, Hinweise, Fragen etc. zu notieren. Wie in diesem Zusammenhang auch schon Meer (vgl. 2009a: 41) bei der Konzeption von Schulungen zu universitären Prüfungsgesprächen feststellte, werden solche Übungen gerade zu Beginn gelegentlich auch als Auftrag zum verordneten Moralisieren verstanden, gerade so, als ginge es um die Unterscheidung von richtigem gegenüber falschem Sprechen. Die Beiträge der Teilnehmenden wurden im Rahmen der Übung gesammelt und beinhalten z. B. Äußerungen wie: „ja genau so machen wir das", „die Übernehmerin redet zu viel und ist trotzdem unklar", „der Patient als Mensch taucht nicht auf, was hat die (Übergeberln, F.O.) für ein seltsames Menschenbild" etc. Das Besondere an dieser Übung ist, dass nach der Beitragssammlung aufgezeigt werden kann, dass die Beobachtung an konkreten Transkriptstellen deutlich zu machen ist und sich nicht in Motivzuschreibungen verlieren sollte. Oft kommt es in diesem Zusammenhang immer wieder zu kontrovers geführten Diskussionen zur Rekonstruktion des ausgewählten Transkriptauszugs hinsichtlich einer mehrheitlich geteilten Lesart des Ereignisses. Dabei greifen die Teilnehmenden häufig auf ihre Erfahrungen zurück, die sie entweder durch die Beobachtung ihrer Kolleginnen gewonnen oder selbst erlebt haben und sich in Ansätzen auch im vorliegenden Transkript wieder finden lassen. Entscheidend ist, dass der Forscher durch diese Aufgabe auf recht spielerische Weise sowohl Teilnehmer- bzw. Orientierungswissen generieren kann und zugleich die Teilnehmenden angeregt werden, ihr eigenes kommunikatives Verhalten zu reflektieren. Übung 2: Rollenspiel151 - Simulation auf der Grundlage einer vorliegenden Krankenakte Diese Übung kam zu einem späteren Abschnitt der Zusammenarbeit zwischen Forscher und Beteiligten im Feld zum Einsatz. Mit dieser Übung werden die Teilnehmenden insbesondere angeregt, gegebenenfalls erforderliche Handlungsalternativen zu erarbeiten bzw. zu erproben. Daher ist es zweckmäßig, die Teilnehmenden zuvor mit den verschiedensten Themen, wie z. B. der Grundstruktur der Übergabe (Lokalisierung, Diagnose, pflegerelevante Informationen etc.), Hierarchie der Themen, Dokumentation u. a. m. vertraut
151
Zum Einsatz von Rollenspielen in Trainingszusammenhängen siehe auch Schmitt
(1999).
228
6. Praktische Folgen der Analyse
gemacht zu haben. In der vorliegenden Untersuchung wurde diese Übung beim Projekt „Modell - ÜG am Patientenbett" in unterschiedlichen Variationen mehrfach eingesetzt. Nachdem die Teilnehmenden auf Basis von authentischen Daten im ersten Schritt die Struktur einer Übergabe ohne Patientenbeteiligung auf der urologischen Station unter Anleitung des Forschers ausarbeiteten, wurde diese auf die Anforderungen einer ÜG am Patientenbett versuchsweise zugeschnitten und im Rahmen eines Mitarbeiterinnentreffens (an dem 12 von 16 Mitarbeiterinnen der urologischen Station teilgenommen haben) in Form eines Rollenspiels simuliert. Der Simulation lagen weder Transkripte authentischer Daten, noch sonstige fiktive Unterlagen zugrunde. Anstatt dessen wurde eigens eine Krankenakte eines sich zum damaligen Zeitpunkt auf der urologischen Station befindlichen Patienten herangezogen. Zwei Personen simulierten daraufhin die Übergabe nach Maßgabe der von der Kerngruppe152 (vorab ausgearbeiteten) beabsichtigten Änderungen. Im Anschluss wurden die Teilnehmerinnen des Arbeitstreffens, denen die beabsichtigten Änderungen nicht im Detail bekannt waren, gebeten, ihre Eindrücke und Auffälligkeiten in einer Feedbackrunde zu formulieren. Die Rückmeldungen wurden gesammelt und anschließend mit den von der Kerngruppe ausgearbeiteten Vorgaben kontrastiert und im Plenum diskutiert. Ein aus analytischer Perspektive überaus bedeutsamer Zweck dieser, wie auch mit Einschränkungen der übrigen Übungen, ist, dass damit dem Forscher eine Fülle an Teilnehmer- bzw. Orientierungswissen zugänglich gemacht wird. Ein Wissen, das für die erfolgreiche Durchführung einer (akademischen) Datensitzung und vor dem Hintergrund des institutionellen Kontexts (Krankenhaus) unabdingbar ist. Zum Abschluss noch einige Anmerkungen zum besonderen Nutzen einer Supervision mit Hilfe der Konversationsanalyse, diesmal aus der Sicht der Teilnehmenden. Dieses Thema wurde zum Ende der Zusammenarbeit in einer Gruppendiskussion behandelt. Unter den Teilnehmenden bestand kein Zweifel, dass gerade durch die fixiert vorliegenden Gesprächsausschnitte (Transkripte, Aufzeichnungen) eine hervorragende Basis geschaffen wurde, auf die in der Diskussion, in der Kleingruppenarbeit oder in Ausnahmefällen auch beim
Die Kerngruppe entstand auf freiwilliger Initiative einiger Mitarbeiterinnen und bestand aus sechs Personen, die allesamt auf der Station beschäftigt sind. Ihre Aufgabe bestand darin, nach eingehender Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsmaterial zu Übergaben ohne Patientenbeteiligung, Vorschläge für eine Konzeption der Übergabe am Patientenbett zu erarbeiten. Diese wurden den übrigen Mitarbeiterinnen vorgestellt, probeweise auf der Station eingesetzt und anschließend evaluiert, um sie dann gegebenenfalls zu modifizieren und bei Entsprechung ganz zu etablieren. 152
Die konkrete Arbeit mit Transkripten und audiovisuellen Mitschnitten
229
Rollenspiel, immer wieder zurückgegriffen werden konnte. Anfangs fiel es Ihnen sehr schwer, sich von dem „Zwang", richtige von falschen Übergaben zu unterscheiden, zu lösen. Nach und nach erkannten sie jedoch den Gewinn einer transkriptgestützten Interpretationsarbeit, was in einem ausgeprägten Interesse an Selbstbeobachtung und Selbstwahrnehmung mündete.153 Auch wenn die Transkripte für viele anfänglich schwer lesbar waren, war es ihnen nach einigen Übungen dennoch möglich, bestimmte Phänomene oder Gesprächsmerkmale (Überlappungen, Wiederholungen, thematische Strukturierung, Fachsprache, Kategorisierung bzw. Lokalisierung, Gesprächsführung usf.) sowie deren Konsequenzen auf den darauf folgenden Gesprächsverlauf zu erkennen. Einen weiteren Gewinn sahen sie in den vielfältigen Einsatzmöglichen der Transkripte in der Aus- und Weiterbildung. Die Akteurinnen hatten erstmals die Möglichkeit, mit authentischen Daten zu arbeiten. Sie konnten gewissermaßen beobachtend neben ihre eigene Praxis treten und dabei einerseits einen Eindruck von der Professionalität ihres eigenen sozialen Handelns gewinnen, sowie andererseits möglichen Veränderungsbedarf erkennen. Sie konnten aber auch neue Strategien und „Best Practices" entdecken, die sie in ihrem Arbeitskontext unmittelbar umsetzten. Ferner kann ein Transkript bei noch unerfahrenen Kräften dafür eingesetzt werden, z. B. aus einem Bericht einer Übergeberin über einen bestimmten Patienten die möglicherweise darin enthaltenen impliziten Arbeitsaufträge inferenziell erschließen lernen zu helfen und so gewissermaßen die Folgehandlungen einer Übernehmerin simulieren. Zusammengefasst erachteten die Teilnehmenden die Arbeit mit den Transkripten als außerordentlich hilfreiches Instrument in dieser für sie außerplanmäßig durchgeführten Form der Weiterbildung. Dadurch hatten sie die Möglichkeit, die erforderliche Sensibilität für typische Gesprächsprozesse in Übergaben zu entwickeln und die kommunikativen Anteile ihrer pflegerischen Tätigkeiten auf der Station zu reflektieren.
153
Ähnliches wissen auch Gülich und Krämer (2009) zu berichten.
7.
Das Konzept der gepflegten Differenz
Im Mittelpunkt des folgenden Abschnitts steht die Annahme, dass durch Sozialforschung produziertem Wissen über ein bestimmtes Praxisfeld nicht der Status eines besseren oder „überlegenen" Wissens zuerkannt werden sollte. Hintergrund dieser von Stephan Wolff vertretenen Ansicht ist die These, dass sich die „Praxissensibilität der Wissenschaft nur als gepflegte Differenz realisieren läßt" (2008: 237). Damit ist gemeint, dass die Perspektivendifferenz zwischen Wissenschaft und Praxis aufrecht erhalten und nicht zugunsten einer „gut gemeinten" Praxisnähe aufgegeben werden sollte. Eine praxissensible qualitative Sozialforschung ist demnach nicht zu verwechseln mit besonderer Praxisfreundlichkeit oder Praxisrelevanz (ders.: 253). Wolff spricht in diesem Zusammenhang lieber von einer „Forschungskultur der Achtung", die den kunstvollen Charakter der Praxis sowie die Kompetenzen der Praxisteilnehmerinnen in den Blick nimmt.154 Die hier angesprochene zu pflegende Differenz auf der Grundlage einer Forschungskultur der Achtung bedeutet für die vorliegende Untersuchung, dass die vorwiegend im ersten Kapitel eingeführten Probleme und Herausforderungen des Praxisfeldes im Zusammenhang mit der Durchführung von Übergabegesprächen („Die Übergabe als praktisches Problem") als Orientierung für die darauf aufbauenden weiteren Arbeitsschritte dienen. Die sogenannten „praktischen Probleme" des Feldes werden im Rahmen der Analyse in den Kapiteln zwei, drei, vier und fünf wieder aufgegriffen, jedoch soziologisch re-spezifiziert. Eine soziologische Respezifizierung wird in der vorliegenden Studie erreicht, indem das soziale Ereignis Übergabe aus konversationsanalytischer Perspektive als Interaktionsproblem konzipiert wird. Durch den methodologischen „Überbau" bzw. die andere Beschreibungsebene der Konversationsanalyse bildet sich eine, wie Wolff es nennt, gepflegte Differenz heraus. Der oben schon diskutierte Vorschlag, die Konversationsanalyse als Methode der Supervision einzusetzen, ist eine Variante, diese Differenzbildung auf der Basis von technisch registrierten Gesprächsdaten für die Praxis bzw. die Aus- und Weiterbildung nutzbar zu machen. Die Differenzbildung zwischen wissenschaftlicher und praktischer Perspektive mündet schließlich in einen dritten und letzten Arbeitsschritt, in dem die konversationsanalytisch respezifizierten praktischen Probleme des
Diese Position geht ursprünglich zurück auf Garfinkel und den von ihm formulierten Grundsatz der Indifferenz, der bekanntlich gekennzeichnet ist durch die indifferente Haltung des Forschers gegenüber den praktischen Fragen und Interessen des Feldes. Er impliziert aber ebenso die Achtung der Kunstfertigkeit der Akteure bei ihrer Hervorbringung von sozialer Wirklichkeit. 154
232
7. Das Konzept der gepflegten Differenz
Feldes unter Bezugnahme auf die erzielten Resultate aufbereitet und diskutiert werden. Im Folgenden möchte ich einige Phänomene und Besonderheiten aus dem Forschungsfeld beschreiben und basierend auf den bereits vorgestellten, konversationsanalytisch generierten Resultaten der vorliegenden Untersuchung dazu Stellung nehmen. Auf welche Art und Weise diese Kontrastierung dem Praxisfeld dienlich ist, soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden und muss auch offen bleiben, wenn das Konzept der gepflegten Differenz konsequent zu Ende geführt wird. Personalplanung und unterstelltes Wissen Ein Merkmal von Übergaben besteht darin, dass mit ihrer Durchführung die Herstellung von Kontinuität verbunden ist. Eine Diensteinteilung der Stationsleitung, die dem unterschiedlichen Ausbildungs- und Erfahrungsstand der Mitarbeiterinnen nicht gerecht wird, läuft Gefahr den erforderlichen Informationsfluss zwischen den Schichtdiensten zu behindern. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn Übergeberinnen an Kolleginnen der übernehmenden Schicht übergeben müssen, die z. B. als „Springer" eingesetzt werden, also ursprünglich einer anderen Arbeitseinheit oder Station zugeordnet sind. Versteht man das Übergabegespräch als Aushandlungsprozess von Wissen und legt das Augenmerk auf die Prozesse der Wissensgenerierung, wird die Beobachtung verständlich, dass die Übergaben dann länger dauern, weil nicht nur die jeweilige Vorgeschichte der Patientinnen in der Regel wieder aufgerollt werden muss, sondern weil zudem die „neue" Mitarbeiterin auch in die Arbeitsgepflogenheiten auf der „neuen" Station kommunikativ eingeweiht werden muss. Wie im Abschnitt „ÜbergabeWissen" herausgearbeitet wurde, besteht offenbar ein Zusammenhang zwischen dem Erzählbedarf und dem für Übergaben ebenfalls konstitutiven Aspekt des unterstellten Wissens. In solchen Situationen einer organisatorisch mitbedingten „verschärften" Wissensasymmetrie wird die Unterstellung von Wissen brüchig, Dinge, die „jeder" auf der Station normalerweise weiß, müssen plötzlich explizit gemacht werden. Dies führt wiederum häufig zu Kompetenzkonflikten, die ein klares „handover" im Sinne einer Verantwortungsübertragung be- oder sogar verhindern. Handeln impliziert stets und überall Unterstellungen über das Wissen des anderen (vgl. Bergmann/Quasthoff 2010), wenn jedoch der kommunikative Umgang mit dieser Unterstellung selbst fragwürdig geworden ist, kann dies bei Übergabegesprächen zu der paradoxen Situation führen, dass der Informationsfluss ins Stocken gerät, weil er bildlich gesprochen durch die Offenlegung der Wissensbestände, also durch das Übermaß an Informationen
7. Das Konzept der gepflegten Differenz
233
über die Ufer tritt. Eine wohl überlegte Auswahl des Pflegepersonals bei der Zusammenstellung der Diensteinteilung könnte hier erfolgreich Abhilfe leisten. Ökologie der Übergabesituation und Gedächtnis Eine wesentliche Aufgabe der Beteiligten von Übergabegesprächen besteht in der Bewältigung der Wissensasymmetrie bzw. des Informationsgefälles. Der Forscher konnte im Untersuchungsfeld die unterschiedlichen raumökologischen Bedingungen beobachten, unter denen die jeweiligen Übergaben auf den Stationen stattfinden. Wie die empirischen Analysen zeigen, müssen speziell die Übergeberinnen die pflegerelevanten Informationen aus dem Gedächtnis abrufen, adressatengerecht wiedergeben und gegebenenfalls mit Vertreterinnen der übernehmenden Schicht aushandeln. Ein Blick auf die kommunikative Ökologie der Übergabesituation hat deutlich gemacht, dass die körperliche Aktivität der Beteiligten sowie das gegenständliche Arrangement für die interaktive Hervorbringung des Interaktionsraums konstitutiv sind. Die Beteiligten gehen in einer höchst kreativen Art und Weise mit der physikalischen Interaktionsumgebung um und diese wird von ihnen als Gedächtnisressource genutzt. Zu den in diesem Sinne verwendeten Objekten gehören an verschiedenen Stellen im Stationszimmer angebrachte Listen, Zeichnungen und nicht zuletzt die von der Stationsleitung ungern gesehenen Spickzettel. Diese Ressourcen werden von einigen Verantwortlichen, insbesondere von der Stationsleitung, häufig nicht als solche (an)erkannt, sondern eher als „Zettelchaos" betrachtet und schlimmstenfalls entfernt. Eine Übergabesituation, die den tatsächlichen Arbeitsnotwendigkeiten der übergebenden wie der übernehmenden Schicht gerecht werden will, sollte jedoch meines Erachtens die gerade an solchen materiellen Manifestationen ablesbaren kommunikativen Kompetenzen der Akteurinnen würdigen und anerkennen, dass diese kommunikativ genutzten Ressourcen ganz wesentlich dazu beitragen, das Informationsgefälle in Übergaben zu bewältigen. Dokumentation und Übergabe Zu den grundlegenden Aufgaben des Pflegepersonals auf der Station gehören neben den pflegerischen Aktivitäten die Durchführung von Übergabegesprächen sowie die Umsetzung der Pflegedokumentation. Obwohl in der vorliegenden Untersuchung der Aspekt der Pflegedokumentation aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht näher untersucht werden konnte, möchte ich im Folgenden noch auf ein beobachtetes „textförmiges" Phänomen hinweisen, das in einem engen Zusammenhang mit der Durchführung von Übergabegesprächen zu stehen scheint. Dabei handelt es sich um die handschriftlichen Notizen, die vom Pflegepersonal insbesondere zur Unterstützung von Übergabegesprächen eingesetzt werden. Diese Notizen sind
234
7. Das Konzept der gepflegten Differenz
vergleichbar mit Spickzetteln und da sie, wenn überhaupt nur indirekt in die Pflegedokumentation (Pflegebericht, Pflegeplanung) eingehen, haben sie den Status von „grauen" Informationsquellen. Der Einsatz solcher Notizen wird von den Verantwortlichen (der Stationsleitung) höchst zwiespältig gesehen, ausgehend von der Annahme, dass die gewissenhafte Durchführung der vom Pflegepersonal vorzunehmenden offiziellen Pflegedokumentation gefährdet ist bzw. dass diese in ihrer Genauigkeit beeinträchtigt wird. Diese Notizen sind grundsätzlich nicht für Kolleginnen bestimmt, sondern werden hauptsächlich als eigene Gedächtnisstütze eingesetzt. Die Notizen werden häufig nach Ende des Dienstes im Stationszimmer aufbewahrt und mit Beginn des nächsten Dienstes wieder hervorgeholt und weiter verwendet.155 Wie aus den empirischen Beobachtungen hervorgegangen ist, steigt der Aufzeichnungsumfang insbesondere nach längerer Abwesenheit von der Station (durch Krankheit, Urlaub etc.), und er reduziert sich, wenn die Pflegekraft, die die Informationen über alle Patientinnen aus ihrem Verantwortungsbereich in der erforderlichen Informationsdichte mehr oder weniger aus ihrem Gedächtnis abrufen kann. Offenbar ist also die kommunikative Fähigkeit, eine pflegerelevante Patientinnenhistorie zu rekonstruieren, eng verknüpft mit der Sammlung und Aufbereitung der für die Übergabe benötigten Informationen. Letztlich bleibt aber der spezifische Zusammenhang von Pflegedokumentation und Übergabe in der vorliegenden Untersuchung ungeklärt und müsste noch genauer untersucht werden. Feststellung der Pflegeintensität Die Beteiligten eines Übergabegesprächs haben die kommunikative Aufgabe zu bewältigen, das Ausmaß der bevorstehenden Pflegeintensität festzustellen. Hinsichtlich der Übergaben kennzeichnenden Beteiligungsrollen, übergebende auf der einen und übernehmende auf der anderen Seite, bildet dabei zusätzlich das Sprechen über abwesende Dritte (Patientinnen) ein „Beziehungsdreieck", das schichtaktuelle „Momentaufnahmen" von Patientinnen generiert. Vor dem Hintergrund des Konzepts der Kategorisierungsanalyse und die Überlegung, Herstellung und Generierung von Wissen in der Kommunikation zu verorten, geht die zu ermittelnde Pflegeintensität, für die jeweiligen Schichtvertreterinnen, mit unterschiedlich gelagerten kommunikativen Aufgaben einher: Übergebende sollten in ihrer Rückschau sowie in der damit zusammenhängenden Vorschau auf die Folgeschicht, eine kommunikative
155 Siehe dazu zum Beispiel den Transkriptauszug # 19, Abbildung 3: Die noch am Schreibtisch sitzende Übergeberin hebt die Schreibtischunterlage hoch, um darunter ihre Notizen als Arbeitsgrundlage für ihren nächsten Dienst zu hinterlegen.
7. Das Konzept der gepflegten Differenz
235
Form wählen, die es ihren Kolleginnen auf der Übernehmerinnenseite auch möglich macht, aus den dargestellten Beschreibungen und Einschätzungen, sinnvolle, nachvollziehbare und anschlussfähige Schlussfolgerungen hinsichtlich der potenziell erwartbaren pflegerischen Aktivitäten zu ziehen. Aus den Analysen der Kategorisierungspraxis auf der Basis einer PatientinnenHistorie geht hervor, dass sich die Beteiligten zum einen an dieser kommunikativen Praxis orientieren und dass diese Praxis ganz wesentlich ist zur allgegenwärtigen Prozedur der Sinnexplikation und Sinndeutung. Die schlussendlich relevante Pflegeintensität beruht im Wesentlichen darauf, dass ein kommunikativ gezeichnetes „Patientinnenbild" gleichzeitig für die Ausübung der pflegerischen Tätigkeit ganz spezifische Schlussfolgerungen evoziert und somit ganz entscheidend dazu beiträgt das für Übergaben charakteristische Informationsgefälle zu überbrücken.
8.
Ausblick
Als Ausblick lässt sich sagen, dass die vorgelegte Studie trotz ihres verhältnismäßig engen forschungsgegenständlichen Zuschnitts eine Vielzahl an Fragestellungen hervorgebracht hat, die es weiter zu verfolgen lohnt. Bleibt man innerhalb des medizinisch-pflegerischen Kontexts, sind m. E. folgende Themenfelder von entscheidender Bedeutung: 1) Die digitale Übergabe sowie die Übergabe am Patientinnenbett, 2) Case Management in der Pflege sowie 3) die Fallbesprechung des medizinischen Fachpersonals. Schaut man über die Grenzen dieses Kontexts hinaus, dann sind 4) Handlungsfelder von Interesse, in denen infolge von Schichtdienst Übergabe-ähnliche Gesprächsformate, zum Einsatz kommen. Ein ganz besonderer Reiz liegt zum Beispiel in der Verknüpfung der vom Pflegepersonal grundsätzlich zu verrichtenden Pflegeplanung und -dokumentation und des 'hand-over' beim Schichtwechsel, vor allen Dingen, wenn die Beteiligten während der Übergabe auf ein digitales Patientinnenverarbeitungsprogramm zugreifen. Aktuelle Untersuchungen zur elektronischen Aktenführung in der Medizin sind rar, eine Ausnahme ist jedoch Lara Varpio (2006), die die ,,[I]nteraction[s] between oral, paper, and electronic forms of communication" im medizinischen Kontext untersucht und es ist zu erwarten, dass Studien zu dieser Thematik zunehmen werden. Diese spezifische Form der „digitalen" Übergabe (1) konnte der Forscher auf einer nicht zum Forschungsfeld Krankenhaus gehörenden Herzintensivstation beobachten; 156 sie lässt sich folgendermaßen charakterisieren: •
Übergebende und Übernehmende führen die Übergabe im Zimmer des Patienten durch;
•
der Bildschirm dient Aufmerksamkeitsfokus;
•
und die Beteiligten können über die Bedienung der Tastatur (und des Monitors) auf alle medizinisch bzw. pflegerisch situativ relevanten Informationen per Knopfdruck zugreifen.
den
Beteiligten
als
gemeinsamer
156 Im letzten Drittel des Forschungsprozesses hatte der Forscher im Rahmen einer Stationsleiterinnen-Schulung, des an das Krankenhaus angeschlossenen Fortbildungszentrums die Gelegenheit, drei Übergaben auf einer Herzintensivstation und drei Übergaben in einer Einrichtung des privaten Pflegedienstes audiovisuell aufzuzeichnen. Das Aufzeichnungsmaterial wurde jedoch nicht in die vorliegende Untersuchung einbezogen und war ausschließlich für die Weiterbildung bestimmt.
238
8. Ausblick
Die Tatsache, dass die Übergabe im Zimmer des Patienten stattfindet, hat vermutlich ebenfalls gravierende Auswirkungen auf den Ablauf der Übergabe, insbesondere dann, wenn der Patient potenziell ansprechbar ist. Aus einem Gespräch über abwesende wird ein Gespräch mit anwesenden Dritten, das den Vertreterinnen beider Schichten u. a. besondere Gesprächsführungskompetenzen abverlangt. Im Hinblick auf die Ökologie dieser spezifischen Übergabesituation ist zu beobachten, wie die dabei entstehenden kommunikativen Ressourcen von den Beteiligten genutzt werden. Durch die Kombination aus der körperlichen Aktivität der Beteiligten auf der einen Seite (Stehen, Zeigeaktivitäten, Blickorientierung auf den Bildschirm sowie auf den Patienten etc.) und der teilweise hochtechnisierten physikalischen Umgebung auf der anderen Seite (Monitor, Tastatur, Patientenbett, Apparaturen, Schläuche etc.) ist zu vermuten, dass dabei Zeigeaktivitäten zur Herstellung des Interaktionsraums bzw. im situativen eingebetteten Sinngebungsprozess eine ganz entscheidende Rolle spielen, beispielsweise indem eine der beteiligten Personen auf eine Fieberkurve am Bildschirm oder auf das Beatmungsgerät oberhalb des Patienten verweist. Gleichzeitig eröffnet eine digitale Krankenakte den Pflegekräften einen flexibleren Abgleich mit den tatsächlichen Befindlichkeiten der Patientinnen und diese können gegebenenfalls (für Kolleginnen nachvollziehbar) korrigiert werden. Eine systematische Untersuchung der Übergabe am Patientinnenbett könnte auf der Basis der vorliegenden Ergebnisse zur Übergabe im Stationszimmer ebenfalls vorangetrieben werden. Übergaben unter Beteiligung von Patientinnen stellen das beteiligte Pflegepersonal möglicherweise vor zusätzliche kommunikative Anforderungen. In diesem Fall wäre vermutlich im Unterschied zur üblichen Schichtübergabe im Stationszimmer eine klarere und stärker ausgeprägte Gesprächsführung der übergebenden Person zu beobachten. Vor dem Hintergrund des Konzepts der Beteiligungsrollen (vgl. Levinson 1988, Goffman 1981) können Übergaben in Mehrbettzimmern beispielsweise daraufhin untersucht werden, wie die Beteiligten - einschließlich der zusätzlich noch anwesenden Personen (Patienten, Besucher, pflegerisches Personal) - die situativ möglichen Interaktions-konstellationen herstellen und aushandeln (z. B. Ausschluss bestimmter Personen aus der Interaktion, Bildung von Koalitionen, Mehrfachadressierung bzw. Adressaten-gerechter Zuschnitt der Rede). Im Sozial- und Gesundheitswesen hat sich in den letzten Jahren der berufsübergreifende Ansatz des „Case Management" bzw. die zugehörige Rolle des/der „Case Managerin" etabliert (2). Ein Case Manager arbeitet interdisziplinär, was im Kontext von Krankenhaus bedeutet, dass sein Handlungsfeld fachbereichsübergreifend ist, indem alle erforderlichen pflegerischen Aktivitäten und Fachkliniken einbezogen werden. Solche Case Manager sind sowohl Ansprechpartner für Patienten und das interdisziplinäre
8. Ausblick
239
Team als auch für Angehörige. Zu ihren zentralen Aufgaben gehören die Aufnahme- und Entlassungssteuerung, die Phasierung und Terminierung des Krankenhausaufenthaltes, Lokalisierung und Prozessbegleitung sowie die Patientinnenbegleitung (vgl. Bostelaar et al. 2008). Hinter diesem Ansatz steht vereinfacht ausgedrückt die Absicht, den Dokumentationsaufwand zu reduzieren und Doppelgleisigkeiten zu verhindern. Vor dem Hintergrund der Fallgeschichte, die ein Patient von seiner Aufnahme bis zur Entlassung in den Krankenakten hinterlässt, sollten der möglicherweise stufenartige Kategorisierungsprozess und die damit einhergehenden Transformationen einzelner Kategorien genauer untersucht werden. Je nachdem, auf welcher Stufe sich ein Patient im Arbeitsprozess einer Profession (Erstversorgung, Labor, OP etc.) befindet, werden jeweils entsprechende medizinische oder pflegerische Aktivitäten erforderlich und fließen schlussendlich in die Aktenführung mit ein. Angesichts der Tatsache, dass die Arbeit des medizinischen Personals im Krankenhaus ebenfalls im Schichtbetrieb organisiert ist, können die Ergebnisse der vorliegenden Studie unter Berücksichtigung der professionsspezifischen Eigenheiten ebenfalls Anregungen für die Untersuchung ähnlich gelagerter Kommunikationsereignisse unter Ärztinnen liefern (3), insbesondere hinsichtlich der kommunikativen Wissensgenerierung und -distribution sowie der Kategorisierungspraxis. Im Zentrum stehen dabei intraprofessionelle Gespräche157 wie zum Beispiel die häufig von der Leitung der Fachklinik geleitete Morgenbesprechung (Fallbesprechung). Diese spezifische professionelle Praxis besteht im Wesentlichen darin, Fälle zu bearbeiten und ganz gezielt „Kategorisierungakte" zu setzen, die jeweils Konsequenzen auf medizinische und pflegerische Aktivitäten haben. Gleichzeitig könnte das Untersuchungsinteresse darauf gerichtet sein, wie ein „Patienten-Fall" im professionellen Handeln von Ärztinnen konstituiert wird und welche epistemischen, interaktiven und institutionellen Funktionen und Folgen die Ausrichtung auf den jeweiligen Fall für das professionelle Handeln hat (vgl. Bergmann / Dausendschön-Gay / Oberzaucher 2014) ,158 Auch wenn ein Krankenhaus auf den ersten Blick mit einem Kernkraftwerk, mit dem Polizeidienst oder militärischen Einrichtungen scheinbar wenig
157
Vgl. hierzu die Untersuchung der 'daily case conference' von Ikeya et al. (2007).
Mit dieser Frage beschäftigte sich die von Jörg Bergmann (Bielefeld), Ulrich Dausendschön-Gay (Bielefeld), Ludger Hoffmann (Dortmund), Thomas-Michael Seibert (Frankfurt/Main) und Ulrich Streeck (Rosdorf) geleitete und vom Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld geförderte ZiF-Kooperationsgruppe 2008: "Der Fall als Fokus professionellen Handelns" von Oktober 2008 - März 2009. 158
240
8. Ausblick
gemeinsam hat, sind dennoch im Übergabegespräch im Krankenhaus identifizierte Strukturelemente auf diese obschon sehr heterogenen Handlungsfelder übertragbar (4). Dabei sollte es in erster Linie aber nicht nur darum gehen, diese Strukturprinzipien in diesen Feldern wiederzufinden, sondern vielmehr ihre einzigartige Realisierung in dem jeweiligen Kontext genauer zu betrachten. Diese Studie zielte darauf ab, das Musterhafte, die grundlegenden Charakteristika der Interaktionsdynamik herauszuarbeiten, die diesen Gesprächstyp kennzeichnen und die immer auch, wenn man so will, eines Hintergrundes bedürfen, vor dem diese Strukturelemente in Erscheinung treten können.
Kritischer Rückblick Die vorliegende Arbeit widmete sich der Untersuchung einer gezielt ausgewählten kommunikativen Praxis im Krankenhaus. In erster Linie ging es mir darum, die gesprächsstrukturellen Bedingungen herauszuarbeiten, denen das Pflegepersonal bei Durchführung von Übergabegesprächen unterworfen ist, und zu zeigen, wie die Beteiligten jeweils mit diesen Bedingungen umgehen. Eine ethnografische Studie ist vor Fehlern und Irrtümern nicht gefeit. Die Perspektive, unter der ich diese kommunikative Praxis auf der Station beobachtete, ist trotz des ethnografischen Zugangs zum Feld letzten Endes nur die eines aufmerksamen Außenseiters. Ich habe den Beruf des Gesundheitsund Krankenpflegers nie erlernt und obwohl sich die Zusammenarbeit mit dem Forschungsfeld über mehrere Jahre erstreckte und ich während dieser Zeit viel über dieses Praxisfeld lernen durfte, müssen mir bestimmte Zusammenhänge auch weiterhin verborgen bleiben. Eine entscheidende Frage, auf die ich in der vorliegenden Arbeit nicht ausführlich eingehen konnte, war der Zusammenhang zwischen dem Übergabegespräch und der Pflegedokumentation, die im Arbeitsalltag auf der Station einen hohen Stellenwert einnimmt. Zwar bot sich mir vereinzelt die Möglichkeit, einen Blick auf die Unterlagen zu werfen, aus datenschutzrechtlichen Gründen konnte ich diese Dokumente jedoch nicht nutzen. Die Beantwortung der genannten Frage würde eine umfassende Textanalyse von ausgewählten Krankenakten erfordern und möglicherweise auch einen ungehinderten Zugang zu Archivmaterial voraussetzen. Epilog Inwiefern das Praxisfeld aus den Resultaten dieser Untersuchung einen Nutzen ziehen kann, wird sich weisen, ebenso, ob es der Mühe Wert war, so viel Aufhebens um ein Übergabegespräch zu machen. Die komplexen und stellenweise gewiss auch ambigen Beziehungen zwischen dem (ethnographischen / konversationsanalytischen) Forscher, seinen Untersuchungsergebnissen und dem „Feld" bzw. den untersuchten Praktikern als Gegenstand der Untersuchung, aber auch als mögliche Nachfrager von ergebnisgestütztem Feedback, können an dieser Stelle sicherlich nicht erschöpfend diskutiert werden. Schließen möchte ich stattdessen mit einer Kurzgeschichte des weisen Narren Mulla Nasruddin, die diesbezüglich zumindest als Denkanstoß und Angebot eines Perspektivenwechsels dienen mag:159
159
Mulla Nasruddin, Lebensphilosophie vom weisen Narren (vgl. Günther 2005:101).
242
Kritischer Rückblick
Die Rettung des Mondes Als Mulla Nasruddin noch ein Kind war, saß er einmal an einem schönen Sommerabend still vor der Tür seines Elternhauses. Der volle Mond stand am Himmel und tauchte die Erde in ein mildes Licht. Da fiel ihm plötzlich ein, dass Aram, der Esel, noch kein Wasser bekommen hatte. Der arme Aram! Er hatte den ganzen Tag in der glühenden Hitze schwere Säcke getragen. Schnell sprang Nasruddin auf, ergriff einen Eimer und eilte in den Garten zum Brunnen. Doch als er sich über den Rand des Wasserbeckens neigte, um den Eimer hinunterzulassen, erfasste ihn ein jäher Schreck: Unten in der Tiefe des Brunnens lag der Mond. „Zu Hilfe!", schrie er, so laut er konnte. „Zu Hilfe! Der Mond ist in den Brunnen gefallen!" Da ihm niemand zu Hilfe kam, beschloss Nasruddin, den Mond allein zu retten. Er holte ein langes Seil, an dessen Ende ein Eisenhaken befestigt war. Ohne zu zögern, ließ er ihn in die Tiefe hinab, wo der Mond immer noch im Wasser zitterte. Dann begann er an dem Seil zu ziehen, zunächst vorsichtig, damit der Haken den Mond richtig zu fassen bekäme. Endlich war ein Widerstand zu spüren, da das Eisen sich in der Brunnenwand verklemmt hatte. Nasruddin aber meinte, dass der Mond nun fest am Haken hinge, und begann jetzt aus Leibeskräften zu ziehen. Er ächzte und stöhnte. Da gab es plötzlich einen Knall. Das Seil war gerissen und schoss mit seinem Ende aus dem Brunnen heraus und zum Himmel empor. Nasruddin fiel dabei so derb auf den Rücken, dass er vor Schmerz die Augen schloss. Als er sie nach kurzer Zeit wieder öffnete, da stand der Mond am Himmel und leuchtete so freundlich wie zuvor. „Allah sei gelobt!", murmelte Nasruddin glücklich, humpelte zufrieden ins Haus und legte sich schlafen.
Bibliographie Abels, Heinz (2009): Einführung in die Soziologie. Band. 2. Die Individuen in ihrer Gesellschaft. Hagener Studientexte zur Soziologie. Wiesbaden: VS. Asmuß, Birte/Svennevig, Jan (2009): Meeting Talk: An Introduction. In: Journal of Business Communication, 46, 3-22. Atkinson, John M. (1982): Understanding Formality. Notes on the Categorization and Production of Formal Interaction. In: British Journal of Sociology, 33, 86-117. Atkinson, Maxwell J./Cuff, E. C./Lee, R. E. (1978): The Recommencement of a Meeting as Member's Accomplishment. In: Schenkein, Jim (Hrsg.): Language, Thought and Culture: Advances in the Study of Cognition. London: Academic Press, 133-154. Atkinson, Maxwell J./Drew, Paul (1979): Order in Court: The Organization of Verbal Interaction in Judicical Settings. London: Macmillan. Atkinson, Paul/Heath, Christian (Hrsg.) (1981): Medical Work: Realities and Routines. Farnborough: Gower. Auer, Peter (1981): Zur indexikalitätsmarkierenden Funktion der demonstrativen Artikelform in deutschen Konversationen. In: Hindelang, Götz (Hrsg.): Verstehen und Handeln. Akten des 15. linguistischen Kolloquiums. Tübingen: Niemeyer, 301-310. Ayaß, Ruth/Pitsch, Karola (2008): Gespräche in der Schule. Interaktion im Unterricht als multimodaler Prozess. In: Willems, Herbert (Hrsg.): Lehr(er)buch Soziologie. Für die pädagogischen und soziologischen Studiengänge. Band 2. Wiesbaden: VS, 959-982. Baker, Carolyn (2002): Ethnomethodological Analyses of Interviews. In: Gubrium, Jaber F./Holstein, James A. (Hrsg.): Handbook of Interview Research. Context & Method. London: Sage, 777-796. Baker, Carolyn/Emmison, Mike/Firth, Alan (2001): Discovering Order in Opening Sequences: Calls to a Software Helpline. In: McHoul, Alec/Rapley, Mark (Hrsg.): How to Analyse Talk in Institutional Settings: A Casebook of Methods. London: Continuum, 41-56. Bakhtin, Mikhail M. (1979): The Problem of Speech Genres. In: Emetson, C./Flolquist, M. (Hrsg.): Speech Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas Press, 60-102. Bakhtin, Mikhail M. (1981): The Dialogic Imagination. Austin:University of Texas Press. Baldauf, Heike (2002): Knappes Sprechen. Tübingen: Niemeyer.
244
Bibliographie
Bamberg, Michael (1997): Positioning Between Structure and Performance. In: Journal of Narrative and Life History, 7,335-342. Bargiela, Francesca (1994): Native Request Strategies in Italian and British Meetings. Sprak og Marked, 11, 21-28. Bargiela-Chiappini, Francesca/Harris, Sandra J. (1995): Towards the Generic Structure of Meetings in British and Italian Managements, 15,4, 531-560. Bar-Hillel, Yehoshua (1954): Indexical Expressions. In: Mind, 63,359-379. Barnes, Rebecca (2007): Formulations and the Facilitation of Common Agreement in Meetings Talk. In: Text & Talk, 27,3,273-296. Becker-Mrotzek, Michael (1992): Diskursforschung und Kommunikation in Institutionen. Heidelberg: Julius Groos. Becker-Mrotzek, Michael/Brünner, Gisela (2004): Der Erwerb kommunikativer Fähigkeiten: Kategorien und systematischer Überblick. In: Dies. (Hrsg.): Analyse und Vermittlung von Gesprächskompetenz. Radolfzell: Verlag für Gesprächsforschung, 29-45. Bendel, Sylvia (2004): Gesprächskompetenz vermitteln - Angewandte Forschung? In: Becker-Mrotzek, Michael/Brünner, Gisela (Hrsg.): Analyse und Vermittlung von Gesprächs- kompetenz. Radolfzell: Verlag für Gesprächsforschung, 67-85. Berg, Eberhard/Fuchs, Martin (Hrsg.) (1993): Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der ethnographischen Repräsentation. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Bergmann, Jörg R. (1974): Der Beitrag Harold Garfinkeis zur Begründung des ethnomethodologischen Forschungsansatzes. Manuskript. Universität Konstanz. Bergmann, Jörg R. (1981): Ethnomethodologische Konversationsanalyse. In: Schröder, Peter/ Steger, Hugo (Hrsg.): Dialogforschung. Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache. Band 54. Düsseldorf: Schwann, 9-52. Bergmann, Jörg R. (1982): Schweigepausen im Gespräch - Aspekte ihrer interaktiven Organisation. In: Söffner, Hans-Georg (Hrsg.): Beiträge zu einer empirischen Sprachsoziologie. Tübingen: Narr, 143-185. Bergmann, Jörg R. (1985): Flüchtigkeit und methodische Fixierung sozialer Wirklichkeit: Aufzeichnungen als Daten der interpretativen Soziologie. In: Bonß, Wolfgang/Hartmann, Heinz (Hrsg.): Entzauberte Wissenschaft. Sonderheft 3 der "Sozialen Welt". Göttingen: Schwarz, 299-320. Bergmann, Jörg R. (1987): Klatsch. Zur Sozialform der diskreten Indiskretion. Berlin/New York: de Gruyter. Bergmann, Jörg R. (1988): Ethnomethodologie und Konversationsanalyse. Studienbrief mit 3 Kurseinheiten. FernUniversität GHS Hagen.
Bibliographie
245
Bergmann, Jörg R. (1992): Veiled Morality: Notes on Discretion in Psychiatry: In: Drew, Paul/Heritage, John (Hrsg.): Talk at Work. Cambridge: Cambridge University Press, 137-162. Bergmann, Jörg R. (1993): Alarmiertes Verstehen: Kommunikation in Feuerwehrnotrufen. In: Jung, Thomas/Müller-Doohm, Stefan (Hrsg.): Wirklichkeit im Deutungsprozeß: Verstehen und Methoden in den Kulturund Sozialwissenschaften. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 283-328. Bergmann, Jörg R. (1994): Ethnomethodologische Konversationsanalyse. In: Fritz, Gerd/Hundsnurscher, Franz (Hrsg.): Handbuch der Dialoganalyse. Tübingen: Niemeyer. Bergmann, Jörg R. (1999): Diskretion in der psychiatrischen Exploration Beobachtungen über Moral in der Psychiatrie. In: Psychotherapie und Sozialwissenschaft, 1,4, 245-264. Bergmann, Jörg R. (2000): Reinszenierungen in der Alltagsinteraktion. In: Streeck, Ulrich (Hrsg.): Erinnern, Agieren und Inszenieren. Enactments und szenische Darstellungen im therapeutischen Prozess. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 203-221. Bergmann, Jörg R. (2005): Studies of Work. In: Rauner, Felix (Hrsg.): Handbuch Berufsbildungsforschung. Bielefeld: Bertelsmann, 639-646. Bergmann, Jörg R. (2006): Qualitative Methoden der Medienforschung Einleitung und Rahmung. In: Ayaß, Ruth/ders. (Hrsg.): Qualitative Methoden der Medienforschung. Reinbek: Rowohlt, 13-41. Bergmann, Jörg R. (2007): Flüchtigkeit und methodische Fixierung sozialer Wirklichkeit: Aufzeichnungen als Daten der interpretativen Soziologie. In: Hausendorf, Heiko (Hrsg.): Gespräch als Prozess. Tübingen: Narr, 33-68. Bergmann, Jörg R./Luckmann, Thomas (1995): Reconstructive Genres of Everyday Communication. In: Quasthoff, Uta (Hrsg.): Aspects of Oral Communication. Berlin/New York: de Gruyter, 289-304. Bergmann, Jörg R./Luckmann, Thomas (1999): Moral und Kommunikation. In: dies. (Hrsg.): Kommunikative Konstruktion von Moral. Band 1: Struktur und Dynamik der Formen moralischer Kommunikation. Opladen: Westdeutscher Verlag, 13-36. Bergmann, Jörg R./Quasthoff, Uta (2010): Interaktive Verfahren der Wissensgenerierung - Methodische Problemfelder. In: DausendschönGay, Ulrich/Ohlhus, Sören/Domke, Christine (Hrsg.): Wissen in (Inter-) Aktion. Berlin/New York: de Gruyter, 21-36. Bergmann, Jörg R./Dausendschön-Gay, Ulrich/Oberzaucher, Frank (Hrsg.) (2014): Der Fall - Studien zur epistemischen Praxis professionellen Handelns, Bielefeld: transcript Verlag.
246 Boden, Deidre (1994): The Business Cambridge: Polity Press.
Bibliographie
of Talk. Organisations
in
Action.
Böhringer, Daniela et al. (2012): Den Fall bearbeitbar halten - Gespräche in Jobcentern mit jungen Menschen. Opladen/Berlin/Toronto: Verlag Barbara Budrich. Bora, Alfons/Hausendorf, Heiko (2006): Communicating Citizenship and Social Positioning: Theoretical Concepts. In: dies. (Hrsg.): Analysing Citizenship Talk: Social Positioning in Political and Legal Decision-Making Processes. Amsterdam: Benjamins, 23-49. Bostelaar, René A./Pape, Rudolf et al. (Hrsg.) (2008): Case Management im Krankenhaus - Das Kölner Modell in Theorie und Praxis. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft. Brünner, Gisela/Fiehler, Reinhard/Kindt, Walther (Hrsg.) (2002): Angewandte Diskursforschung. Band 1 und 2. Rudolfzell: Verlag für Gesprächsforschung. Bundesinstitut für Risikobewertung (2007): Empfehlungen der nationalen Stillkommission, [online] URL: http://www.bfr.bund.de/cm/207/ wunde_brustwarzen_in_der_stillzeit_ursachen_praevention_und_therapie .pdf [Stand 30.11.2013) Büscher, Monika (2005): Social Life Under the Microscope? Sociological Research Online, 10, 1. URL: http://www.socresonline.org.Uk/10/l/ buscher. html Button, Graham (1990): On Varieties of Closing. In: Psathas, George (Hrsg.): Interaction Competence. Washington: University Press of America, 93-149. Christmann, Gabriele B. (1999): Umweltschützer mokieren sich. In: Bergmann, Jörg R./Luckmartn, Thomas (Hrsg.): Kommunikative Konstruktion von Moral. Band 1: Struktur und Dynamik der Formen moralischer Kommunikation. Opladen: Westdeutscher Verlag, 275-299. Clayman, Steven E. (1988): Displaying Neutrality Interviews. In: Social Problems, 35,4,474-492.
in Television
News
Clayman, Steven E. (1992): Footing in the Achievement of Neutrality: The Case of News Interview Discourse. In: Drew, Paul/Heritage, John (Hrsg.): Talk at Work. Cambridge: Cambridge University Press, 163-198. Clifford, James (1988): The Predicament of Culture. Twentieth Century Ethnography, Literature and Art. Cambridge: Harvard University Press. Clifford, James/Marcus, George E. (1986): Writing Culture. The Poetics and Politcs of Ethnography. Berkeley: University of California Press.
Bibliographie
247
Crabtree, Andy (2004): Taking Technomethodology Seriously: Hybrid Change in the Ethnomethodology-Design Relationship. European Journal of Information Systems, 13 (3), 195-209. Cuff, E. C./Sharrock, Wes (1985): Meetings. In: van Dijk, Teun (Hrsg.): Handbook of Discourse Analysis. Vol. 3: Discourse and Dialogue. London: Academic Press, 149-159. Dahrendorf, Ralf (1965): Homo Sociologicus: ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle. Opladen: Westdeutscher Verlag. Dausendschön-Gay, Ulrich/Domke, Christine/Ohlhus, Sören (Hrsg.) (2010): Wissen in (Inter-) Aktion. Verfahren der Wissensgenerierung in unterschiedlichen Praxisfeldern. Berlin/New York: de Gruyter. Dausendschön-Gay, Ulrich/ Krafft, Ulrich (1991): Tache Conversationelle et Organisation du Discours. In: dies./Gülich, Elisabeth (Hrsg.): Linguistische Interaktionsanalyse. Beiträge zum 20. Romanistentag 1987. Tübingen: Niemeyer, 131-151. Dausendschön-Gay, Ulrich/Krafft, Ulrich (2000): Online-Hilfe für den Hörer: Verfahren zur Orientierung der Interpretationstätigkeit. In: Wehr, Barbara/Thomaßen, Helga (Hrsg.): Diskursanalyse. Untersuchungen zum gesprochenen Französisch. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 17-55. Dausendschön-Gay, Ulrich/Krafft, Ulrich (2002): Text und Körpergesten. Beobachtungen zur holistischen Organisation der Kommunikation. In: Psychotherapie und Sozialwissenschaft, 1,4,30-60. Dausendschön-Gay, Ulrich/Krafft, Ulrich (2007): Prozesse interpersoneller Koordination. In: Schmitt, Reinhold (Hrsg.): Koordination. Analysen zur multimodalen Interaktion. Tübingen: Narr, 167-194. Davies, Bronwyn/Harre, Rom (1990): Positioning. The Discursive Production of Selves. In: Journal for the Theory of Social Behaviour, 20,1,43-63. Deppermann, Arnulf (2001): Gespräche analysieren. Eine Einführung. Opladen: Leske + Budrich. Deppermann, Arnulf et al. (2009): Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem Multimodal (GAT 2/MM). Manuskript. Mannheim/Bielefeld/Freiburg. Deppermann, Arnulf/Schmitt, Reinhold (2007): Koordination. Zur Begründung eines neuen Forschungsgegenstandes. In: Schmitt, Reinhold (Hrsg.): Koordination. Analysen zur multimodalen Interaktion. Tübingen: Narr, 15-54. Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. (2008): Leitlinien für die Betreuung des gesunden Neugeborenen im Kreißsaal und während
248
Bibliographie
des Wochenbettes der Mutter [online] URL: http://www.dggg.de/leitlinien/aktuelle-leitlinien [Stand 30.11.2013], Dingwall, Robert (1980): Orchestrated Encounters: An Essay in the Comparative Analysis of Speech-exchange Systems. In: Sociology of Health & Illness, 2, 151-173. Dittmar, Norbert (2002): Transkription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien. Opladen: Leske + Budrich. Domke, Christine (2006): Besprechungen als organisatorische Entscheidungskommunikation. Berlin: deGruyter. Drew, Paul/Heritage, John (1992): Analyzing Talk at Work. An Introduction. In: dies. (Hrsg.): Talk at Work. Interaction in Institutional Settings. Cambridge: Cambridge University Press, 3-65. Drew, Paul/Sorjonen, Marja-Leena (1997): Institutional Discourse. In: van Dijk, Teun A. (Hrsg.): Discourse Analysis: A Multidisciplinary Introduction. Vol.2. London: Sage, 92-118. Duranti, Alessandro/Goodwin, Charles (1992): Rethinking Context. Language as an Interactive Phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press. Eberle, Thomas (1997): Ethnomethodologische Konversationsanalyse. In: Hitzler, Ronald/Honer, Anne (Hrsg.): Sozialwissenschaftliche Hermeneutik. Opladen: Leske & Budrich, 245-281. Elwert, Georg et al. (Hrsg.) (2003): Feldforschung - Orientierungswissen und kreuzperspektivische Analyse, Berlin: Hans Schiler. Enfield, Nick J. (2003): Producing and Editing Diagrams Using Co-Speech Gesture. Spatializing Nonspatial Relations in Explanations of Kinship in Laos. In: Journal of Linguistic Anthropology, 13,1, 7-50. Engeström, Yrjö/Middleton, David (1996): Cognition and Communication at Work. Cambridge: Cambridge University Press. Erickson, Frederick (1988): Ethnographie Description. In: Arnmon, Ulrich (Hrsg.): Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society. Berlin/New York: de Gruyter, 1081-1095. Express Pflegewissen (2009): Gesundheits- und Krankenpflege. Stuttgart: Georg Thieme. Fiehler, Reinhard (2001): Gesprächsanalyse und Kommunikationstraining. In: Brinker, Klaus et al. (Hrsg.): Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. 2. Halbband: Gesprächslinguistik. Berlin/New York: de Gruyter, 1697-1710. Flick, Uwe (2002): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbeck: Rowohlt.
249
Bibliographie
Flick, Uwe/von Kardorff, Ernst/Steinke, Ines (Hrsg.) (2000): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek: Rowohlt. Garfinkel, Harold (1967): Studies in Ethnomethodology. New Jersey: PrenticeHall. Garfinkel, Harold (2002): Ethnomethodology's Program. Durkheim's Aphorism. Lanham: Rowman & Littlefield.
Working
out
Garfinkel, Harold/Sacks, Harvey (1970): On Formal Structures of Practical Actions. In: McKiriney, John/Tiryakan, Edward, A. (Hrsg.): Theoretical Sociology. Perspectives and Developments. New York: Appleton-Century Crofts, 337-366. Garfinkel, Harold/Sacks, Harvey (1976): Über formale Strukturen praktischer Handlungen. In: Weingarten, Elmar et al. (Hrsg.): Ethnomethodologie. Beiträge zu einer Soziologie des Alltagshandelns. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Garfinkel, Harold/Wieder, Lawrence, D. (1992): Two Incommensurable Asymmetrically Alternate Technologies of Social Analysis. Watson, Graham/Seiler, Robert (Hrsg.): Text in Context: Contributions to Ethnomethodology. London: Sage, 175-206. Geertz, Clifford (1990): Die künstlichen Wilden. Der Anthropologe als Schriftsteller. München: Hanser. Girtler, Roland (1984): Methoden Wien/Köln/Graz: UTB.
der
qualitativen
Sozialforschung.
Goffman, Erving (1971): The Territories of the Self. In: ders. (Hrsg.): Relations in Public. Microstudies of the Public Order. New York: Basic Books, 28-61. Goffman, Erving (1981): Footing. In: ders. (Hrsg.): Forms of Talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 124-159. Goffman, Erving (1996): Über Feldforschung. In: Knoblauch, Hubert (Hrsg.): Kommunikative Lebenswelten. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz, 261-269. Göll,
Michaela (2002): Arbeiten im Netz. Kommunikationsstrukturen, Arbeitsabläufe, Wissensmanagement. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Goodwin, Charles (1994): Professional Vision. In: American Anthropologist, 96, 3, 606-633. Goodwin, Charles (2000): Action and Embodiment within Situated Human Interaction. In: Journal of Pragmatics, 32,1489-1522. Goodwin, Charles (2007): Participation, Stance and Affect in the Organization of Activities. In: Discourse Society, 18,1,53-73.
250
Bibliographie
Goodwin, Charles/Heritage, John (1990): Conversation Analysis. In: Annual Review of Anthropology, 19, 283-307. Goodwin, Marjorie H. (1980): Processes of Mutual Monitoring Implicated in the Production of Description Sequences. In: Sociological Inquiry, 50, 3/4, 303317. Goodwin, Marjorie H./Goodwin, Charles (1996): Seeing as Situated Activity: Formulating Planes. In: Engström, Y./Middleton, D. (Hrsg.): Cognition and Communication at Work. Cambridge: Cambridge University Press, 61-94. Greschke, Heike M. (2007). Daheim in www.cibervalle.com - Ethnographie einer globalen Lebenswelt. MS Dissertationsschrift. Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld. Grosjean, Michèle (2003): Communication within Groups. How it Reveals the Nature of Organizational Culture in Hospitals. In: Kieser, Alfred/Müller, Andreas P. (Hrsg.): Communication in Organizations. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 185-200. Grosjean, Michèle (2004): From Multi-participant Talk to Genuine Polylogue: Shift Change Briefing Sessions at the Hospital. In: Journal of Pragmatics, 36,25-52. Gülich, Elisabeth/Krämer, Antje (2009): Transkriptarbeit und Psychodrama in Fortbildung und Supervision in der Telefonseelsorge - ein Praxisbericht. In Birkner, Karin/Stukenbrock, Anja (Hrsg.): Die Arbeit mit Transkripten in Fortbildung, Lehre und Forschung. Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung, 26-68. Gülich, Elisabeth/Lindemann, Katrin/Schöndienst, Martin (2010): Interaktive Formulierung von Angsterlebnissen in Arzt-Patient-Gesprächen. Eine Einzelfallstudie. In: Dausendschön-Gay, Ulrich/Domke, Christine/Ohlhus, Sören (Hrsg.): Wissen in (Inter-)Aktion. Berlin/New York: de Gruyter, 135-160. Gülich, Elisabeth/Mondada, Lorenza (2008): Konversationsanalyse. Eine Einführung am Beispiel des Französischen. Tübingen: Max Niemeyer. Gumperz, John Joseph (1982): Contextualization Conventions. In: ders. (Hrsg.): Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press, 130-152. Gumperz, John Joseph/Hymes, Dell (1964): The Ethnography Communication. In: American Anthropologist, 66, 6,1-34.
of
Gumperz, John Joseph/Hymes, Dell (1972): Directions in Sociolinguistics. The Ethnography of Communication. New York: Holt. Günther, Michael (Hrsg.) (2005): Mulla Nasruddin: Lebensphilosophie vom weisen Narren. München: AT Verlag.
Bibliographie
251
Günthner, Susanne (1999): Polyphony and the 'Layering of Voices' in Reported Dialogues. An Analysis of the Use of Prosodic Devices in Everyday Reported Speech. In: Journal of Pragmatics, 31, 685 - 708. Habscheid, Stephan (2003): Sprache in der Organisation. Sprachreflexive Verfahren im systemischen Beratungsgespräch. Berlin/New York: de Gruyter. Hammersley, Martyn/Atkinson, Paul (1995): Ethnography. Principles in practice. London/ New York: Routledge. Harper, Richard /Hamill, Lynne (2005): Kids will be Kids: The Role of Mobiles in Teenage Life. In: Hamill, Lynne/Lasen, Amparo (Hrsg.): Mobile World: Past, Present and Future. Springer-Verlag. Härtung, Martin (2004): Gesprächsanalyse als Methode in Personal- und Organisationsentwicklung. In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis, 27, 1, 35-49. Härtung, Martin (2004a): Gesprächsanalyse in der betrieblichen Praxis. In: Knapp, Karlfried et. al. (Hrsg.): Angewandte Linguistik. Ein Lehrbuch. Tübingen: A. Francke, 299-319. Heath, Christian (1982): Interactional Participation: The Coordination of Gesture, Speech and Gaze. In: D'Urso, Valentina/Leonardi, Paolo (Hrsg.): Discourse Analysis and Natural Rhetorics. Padua: Cleup, 85-97. Heath, Christian (1986): Body Movement and Speech in Medical Interaction. Cambridge: Cambridge University Press. Heath, Christian (1992): The Delivery and Reception of Diagnosis in the General Practice Consultation. In: Drew, Paul/Heritage, John (Hrsg.): Talk at Work. Cambridge: Cambridge University Press, 235-267. Heath, Christian/ Atkinson, Paul (Hrsg.) (1981): Medical Work: Realities and Routines. Farnborough: Gower. Heath, Christian/Luff, Paul (1992): Collaboration and Control: Crisis Management and Multimedia Technology in London Underground Line Control Rooms. In: CSCW Journal, 1,1-2, 69-94. Heitger, Barbara/Krizanits, Joana/Hummer, Cornelia (2004): Coaching in Veränderungsprozessen. In: Boos, Frank/ Heitger, Barbara (Hrsg.): Veränderung - systemisch. Management des Wandels - Praxis, Konzepte und Zukunft. Stuttgart: Klett-Cotta, 219-243. Heritage, John (1984): Garfinkel and Ethnomethodology. Oxford: Polity Press. Heritage, John (1997): Conversation Analysis and Institutional Talk. Analyzing Data. In: Silverman, David (Hrsg.): Qualitative Research: Theory, Method and Practice. London: Sage, 161-181.
252
Bibliographie
Heritage, John/Greatbatch, David (1991). On the Institutional Character of Institutional Talk: The Case of News Interview Interaction. Boden, Deirdre/Zimmerman, Don (Hrsg.): Talk and Social Structure. Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press, 93-137. Heritage, John/Maynard, Douglas W. (2006): Problems and Prospects in the Study of Physician-Patient Interaction: 30 Years of Research. In: Annual Review of Sociology, 32,351-374. Hester, Stephan/Eglin, Peter (1997): Membership Categorization Analysis: An Introduction. In: Hester, Stephan (Hrsg.): Culture in Action. Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis. Washington, D.C.: University Press of America, 1-23. Hester, Stephan/Eglin, Peter (2003): The Montreal Massacre: A Story of Membership Categorization Analysis. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press. Hester, Stephan/Francis, David (2000): Ethnomethodology, Conversation Analysis, and 'Institutional Talk'. In: Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse, 20,3, 391-413. Hillmann, Karl-Heinz (2007): Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart: Alfred Kröner. Hindmarsh, Jon/Heath, Christian (2000): Embodied Reference: A Study of Deixis in Workplace Interaction. In: Journal of Pragmatics, 32,1855-1878. Hirschauer, Stefan (2001): Ethnografisches Schreiben und die Schweigsamkeit des Sozialen. Zu einer Methodologie der Beschreibung. In: Zeitschrift für Soziologie, 30, 6, 429-451. Hirschauer, Stefan/Amann, Klaus (1997): Die Befremdung der eigenen Kultur. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Hitzler, Sarah (2012): Aushandlung ohne Dissens? Praktische Dilemmata der Gesprächsforschung im Hilfeplangespräch. Wiesbaden: VS-Verlag. Hoffmann, Ludger (1980): Zur Pragmatik von Erzählformen vor Gericht. In: Ehlich, Konrad (Hrsg.): Erzählen im Alltag. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2863. Hoffmann, Ludger (1998): Ellipse und Analepse. In: Rehbein, Jochen/Redder, Angelika (Hrsg.): Grammatik und mentale Prozesse. Tübingen: Stauffenburg, 69-91. Hoffmann, Ludger (2006): Ellipse im Text. In: Blühdorn, Hardarik (Hrsg.): Grammatik und Textverstehen. Berlin/New York: de Gruyter, 90-108.
Bibliographie
253
Hopf, Christel (2005): Qualitative Interviews - ein Überblick. In: Flick, Uwe/von Kardorff, Ernst/Steinke, Ines (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek: Rowohlt, 349-360. Huisman, Marjan (2001): Decision-making in Meetings as Talk-in-Interaction. In: International Studies of Management and Organisation, 31, 3, 69-90. Humphrey, Laud (1970): Tearoom Trade. A Study of Homosexual Encounters in Public Places. Chicago: Duckworth. Hutchby Ian/Woffitt, Robin (1988): Conversation Cambridge/Maiden: Polity Press & Blackwell.
Analysis.
Hutchby, Ian/Woffitt, Robin (2008): Conversation Analysis. 2. Auflage. Cambridge: Polity Press. Ikeya, Nozomi/Okada, Mitsuhiro (2007): Doctors' Practical Management of Knowledge in the Daily Case Conference. In: Hester, Stephan/Francis, David (Hrsg.): Orders of Ordinary Action: Respecifying Sociological Knowledge. Hampshire: Ashgate, 69-89. Jalbert, Paul L. (Hrsg.) (1999): Media Studies. Ethnomethodological Approaches. Lanham/New York/Oxford: University Press of America. Jaskolka, Silke (2000): Mündliche Instruktionen. In: Zeitschrift für Angewandte Linguistik, 32, 77-104. Jayyusi, Lena (1984): Categorization and the Moral Order. Boston: Routledge, Kegan and Paul. Jefferson, Gail (1990): List Construction as a Task and Interactional Resource. In: Psathas, George (Hrsg.): Interactional Competence. Lanham: University Press of America. Jefferson, Gail/Schenkein, Jim (1978): Some Sequential Negotiations in Conversation. Unexpanded and Expanded Versions of Projected Action Sequences. In: Schenkein, Jim (Hrsg.): Studies in the Organization of Conversational Interaction. New York: Academic Press, 155-172. Kalthoff, Herbert (2006): Beobachtung und Ethnographie. In: Ayaß, Ruth/Bergmann, Jörg R. (Hrsg.): Qualitative Methoden der Medienforschung. Reinbek: Rowohlt, 146-182. Kelly, Russell (1998): Nurses Talking: A Radical Policy, Ethnomethodology, for Researching Critical Care Nursing. In: Nursing in Critical Care, 3,41-46. Kelly, Russell (1999): Goings on in a CCU: An Ethnomethodological Account of Things That Go on in a Routine Hand-over. In: Nursing in Critical Care, 4, 85-89. Kendon, Adam (1990/2009): Conducting Interaction. Patterns of Behavior in Focused Encounters. Cambridge: Cambridge University Press.
254
Bibliographie
Kinder-Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen (2009) [online] URL: http://www.g-ba.de/downloads/62-492-379/RL_Kinder_ 2009-06-18_2.pdf. Kirchschlager, Stephan (2013): 'Natürlich is=es vorsondiert'. Eine konversationsanalytische Studie zu Vorgesprächen in Organisationen. Reihe Qualitative Soziologie. Stuttgart: Lucius & Lucius. Knoblauch, Hubert (2001): Fokussierte Ethnografie. In: Sozialer Sinn, 1,123-141. Koerfer, Armin et al. (2010): Narrative Wissensgenerierung in einer biopsychosozialen Medizin. In: Dausendschön-Gay, Ulrich/Domke, Christine, Ohlhus, Sören (Hrsg.): Wissen in (Inter-) Aktion. Verfahren der Wissensgenerierung in unterschiedlichen Praxisfeldern. Berlin/New York: de Gruyter. Königswieser, Roswitha/Exner, Alexander (2008): Systemische Intervention: Architekturen und Designs für Berater und Veränderungsmanager. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. Krizanits, Joana (2009): Die systemische Organisationsberatung - wie sie wurde was sie wird. Eine Einführung in das Professionsfeld.Wien: Facultas. Labov, William/Waletzky, Joshua (1967): Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience. In: Helm, J. (Hrsg.): Essays on the Verbal and Visual Arts. Seattle/London. Latour, Bruno/Woolgar, Steve (1986): Laboratory Life. The Anthropology of Scientific Facts. Princeton: Sage. Lee, John (1984): Innocent Victims and Evil Doers. In: Women's Studies Int. Forum, 7,1, 69-73. Lepper, Georgia (2000): Categories in Text and Talk. A Practical Intoduction to Categorization Analysis. London: Sage. Levinson, Stephen C. (1988): Putting Linguistics on a Proper Footing: Explorations in Goffman's Concept of Participation. In: Paul, Drew/Anthony, Wootton (Hrsg.): Erving Goffman. Exploring the Interaction Order. Cambridge, Polity Press, 161-227. Levinson, Stephen C. (2000): Pragmatik. Tübingen: Niemeyer. Liberman, Kenneth B. (2004): Dialectical Practice in Tibetan Philosophical Culture: An Ethnomethodological Inquiry Into Formal Reasoning. Lanham: Rowman & Littlefield. Linde, Charlotte (1991): What's next? The Social and Management of Meetings. In: Pragmatics, 1, 3, 297-317.
Technological
Lindner, Rolf (1990): Die Entdeckung der Stadtkultur. Soziologie aus der Erfahrung der Reportage. Frankfurt a. M.: Campus.
255
Bibliographie
Lind wall, Oskar/Lymer, Gustav (2005): Vulgar Competence, Ethnomethodological Indifference and Curricular Design. International Society of Learning Sciences. CSCL 2005: 388-397. Lofland, John (1971): Analyzing Social Settings. A Guide to Qualitative Observation and Analysis. Beimond: Wadsworth. Lucius-Hoene, Gabriele/Deppermann, Arnulf (2004): Narrative Identität und Positionierung. In: Gesprächsforschung, 5,166-183. Luckmann, Thomas (1981): Zum Hermeneutischen Problem der Handlungswissenschaften. In: Fuhrmann, Manfred (Hrsg.): Text und Applikation. Theologie, Jurisprudenz und Literaturwissenschaft im hermeneutischen Gespräch. München: Fink, 513-523. Luckmann, Thomas (1986): Grundformen der gesellschaftlichen Vermittlung des Wissens: Kommunikative Gattungen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 27,191-211. Luckmann, Thomas (1988): Kommunikative Gattungen im kommunikativen Haushalt einer Gesellschaft. In: Smolka-Koerdt, Gisela/Spangenberg, Peter/Tillman-Bartylla, Dagmar (Hrsg.): Der Ursprung von Literatur. München: Fink, 279-288. Luckmann, Thomas/Schütz, Alfred (2003): Strukturen Konstanz: Universitätsverlag Konstanz.
der
Lebenswelt.
Luff, Paul/Hindmarsh, Jon/Heath, Christian (Hrsg.) (2000): Workplace Studies. Recovering Work Practise and Informing System Design. Cambridge: Cambridge University Press. Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Luhmann, Niklas (1988): Organisation. In: Küpper, Willi/Ortmann, Günther (Hrsg.): Mikropolitik: Rationalität, Macht und Spiele in Organisationen. Opladen: Westdeutscher Verlag, 165-185. Lynch, Michael (1985): Art and Artifact in Laboratory Science: A Study of Shop Work and Shop Talk in a Research Laboratory. London: Routledge & Kegan Paul Lynch, Michael (1993): Scientific Practice and Ordinary Action. Ethnomethodology and Social Studies of Science. Cambridge: Cambridge University Press. Lynch, Michael (2000): Response to Wes Sharrock. In: Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse. 20,4,541-544. Lynch, Michael/Livingston, Eric/Garfinkel, Harold (1985): Zeitliche Ordnung in der Arbeit des Labors. In: Bonß, Wolfgang/Hartmann, Heinz (Hrsg.):
256
Bibliographie
Zur Relativität und Geltung soziologischer Forschung. Schwartz, 179-206.
Göttingen:
Mändle, Christine/Opiz-Kreuter, Sonja/Wehling, Andrea (2007): Das Hebammenbuch: Lehrbuch der praktischen Geburtshilfe. Stuttgart: Schattauer Verlag. Meer, Dorothee (2007): "ich wollte ja eigentlich mittagessen" - Zur Notwendigkeit und den Möglichkeiten der Didaktisierung gesprächsanalytischer Daten für Fortbildungszwecke. In: Gesprächsforschung. Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion, 8, 117159. URL: http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2007/agmeer.pdf Meer, Dorothee (2009a): "ich muss ja zugeben, dass ich das häufig genauso mach" - mit Transkripten in gesprächsanalytisch fundierten Fortbildungen. In: Birkner, Karin/ Stukenbrock, Anja (Hrsg.): Die Arbeit mit Transkripten in Lehre und Fortbildung. Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung, 16-25. Meer, Dorothee/Spiegel, Carmen (Hrsg.) (2009): Kommunikationstrainings im Beruf. Erfahrungen mit gesprächsanalytisch fundierten Fortbildungskonzepten. Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung. Meier, Christoph (1997): Arbeitsbesprechungen. Interaktionsstruktur, Interaktionsdynamik und Konsequenzen einer sozialen Form. Opladen: Westdeutscher Verlag. Meier, Christoph/Wolff, Stephan (1997): Konversationsanalyse als Supervision. In: Jakob, Gisela/von Wensierski, Hans-Jürgen (Hrsg.): Rekonstruktive Sozialpädagogik. Konzepte und Methoden sozialpädagogischen Verstehens in Forschung und Praxis. Weinheim/München: Juventa, 161176. Menz, Florian/Müller, Andreas P./Götz, Klaus (Hrsg.) (2008): Organisationskommunikation. Grundlagen und Analysen der sprachlichen Inszenierung von Organisation. Managementkonzepte Bd. 34. München/Mering: Hampp Verlag. Meyer, Christian (2010): Self, sequence, and the senses. Universal and culturespecific aspects of conversational organization in a Wolof social space. Unveröffentlichte Habilitationsschrift, Universität Bielefeld. Meyer, Christian/Oberzaucher, Frank (2009): Positionierungsund Kategorisierungsanalyse. Zwei Verfahren zur Untersuchung von Text und Interaktion. Manuskript. Universität Bielefeld. Mondada, Lorenza (2003): Working with Video: How Surgeons Produce Video Records of their Actions. In: Visual Studies, 18,1,58-72.
257
Bibliographie
Mondada, Lorenza (2007): Interaktionsraum und Koordinierung. In: Schmitt, Reinhold (Hrsg.): Koordination. Analysen zur multimodalen Interaktion. Tübingen: Narr, 55-94. Mondada, Lorenza (2007a): Turn Taking in multimodalen und multiaktionalen Kontexten. In: Hausendorf, Heiko (Hrsg.): Gespräch als Prozess. Tübingen: Narr, 237-276. Mondada, Lorenza/ Schmitt, Reinhold (2010): Zur Multimodalität in Situationseröffnungen. In: dies. (Hrsg.): Situationseröffnungen. Zur multimodalen Herstellung fokussierter Interaktion. Tübingen: Narr, 7-52. Müller, Andreas P. (2006): Sprache und Arbeit. Aspekte einer Ethnographie der Unternehmenskommunikation. Tübingen: Narr. (Reihe: Forum für Fachsprachenforschung, Bd. 71). Nazarkiewicz, Kirsten (2013): Interkulturalität als immanenter Faktor in Coaching und Training - konzeptionelle Überlegungen, in: Interculture Journal 12 (20), 47-68. Nazarkiewicz, Kirsten/Krämer, Gesa (2012): Handbuch Interkulturelles Coaching. Konzepte - Methoden - Kompetenzen für kulturreflexive Begleitung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Oberzaucher, Frank (2004): Dienstübergabegespräche Manuskript/Diplomarbeit. Universität Wien.
im
Krankenhaus.
Oberzaucher, Frank (2011): »Komm lass uns Übergabe machen«. Eine konversationsanalytische Untersuchung von Übergabegesprächen im Krankenhaus und die praktischen Folgen der Analyse. Unveröffentlichte Dissertation. Bielefeld. Oberzaucher, Frank/Dausendschön-Gay, Ulrich (2014): »Kategorisieren«, in Jörg Bergmann/Ulrich Dausendschön-Gay/Frank Oberzaucher (Hg.), Der Fall - Studien zur epistemischen Praxis professionellen Handelns, Bielefeld: transcript Verlag. Olson, Gary M. et al. (1992): Small Group Design Meetings: An Analysis of Collaboration. In: Human-Computer Interaction, 7, 347-374. Park, Robert E./Burgess, Ernest W./McKenzie, Roderick D. (1967): The City. Chicago: University of Chicago Press. Pelikan, Jürgen M./Wolff, Stephan (Hrsg.) (1999): Das gesundheitsfördernde Krankenhaus. Konzepte und Beispiele zur Entwicklung einer lernenden Organisation. Weinheim/München: Juventa. Peräkylä, Anssi (1995): AIDS Counselling: Institutional Interaction and Clinical Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
258
Bibliographie
Peräkylä, Anssi/ Vehvilfinen, Sanna (2003): Conversation Analysis and the Professional Stocks of Interactional Knowledge. Discourse Society, 14, 727750. Pitsch, Karola (2006): Sprache, Körper, Intermediäre Objekte: Zur Multimodalität der Interaktion im bilingualen Geschichtsunterricht. Stuttgart: Lucius & Lucius. Pomerantz, Anita (1984): Giving a Source or Basis: The Practice in Conversation of Telling "How I know". In: Journal of Pragmatics, 8, 607-625. Potter, Jonathan/Wethereil, Margaret (1987): Discourse and Social Psychology. Beyond Attitudes and Behavior. London: Sage. Psathas, George (1995): Conversation Analysis. The Study of Talk-inInteraction. Thousand Oaks: Sage. Quasthoff, Uta M. (2001): Erzählen als interaktive Gesprächsstruktur. In: Antos, Gerd et al. (Hrsg.): Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Berlin/New York: de Gruyter. Sachweh, Svenja (1999): "Schätzle hinsitze!". Altenpflege. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
Kommunikation
in
der
Sacks, Harvey (1967): The Search for Help: No One to Turn to. In: Shneidman, Edwin S. (Hrsg.): Essays in Self-Destruction. New York: Science House, 203-223. Sacks, Harvey (1971): Das Erzählen von Geschichten innerhalb von Unterhaltungen. In: Kjolseth, Rolf/Sack, Fritz (Hrsg.): Soziologie der Sprache. Sonderheft 15 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Opladen: Westdeutscher Verlag, 307-314. Sacks, Harvey (1972): On the Analyzability of Stories by Children. In: Gumperz, John, J./Hymes, Dell (Hrsg.): Directions in Sociolinguistics. The Ethnography of Communication. New York: Rinehart & Winston, 325-345. Sacks, Harvey (1984): Notes on Methodology. In: Atkinson, John M./Heritage, John (Hrsg.): Structures of Social Action. Studies in Conversation Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 21-27. Sacks, Harvey (1992a): Lectures on Conversation, Vol. I. Oxford: Basil Blackwell. Sacks, Harvey (1992b): Lectures on Conversation, Vol. II. Oxford: Basil Blackwell. Sacks, Harvey/Schegloff, Emanuel A. (1973): Opening up Closings. In: Semiotica. Journal of the International Association for Semiotic Studies, 8, 4, 289-327.
Bibliographie
259
Sacks, Harvey/Schegloff, Emanuel A. (1978): Zwei Präferenzen in der Organisation personaler Referenz in der Konversation und ihre Wechselwirkung. In: Quasthoff, Uta (Hrsg.): Sprachstruktur & Sozialstruktur. Königstein, Ts.: Scriptor, 150-157. Sacks, Harvey/Schegloff, Emanuel A./Jefferson, Gail (1974): A Simplest Systematics for the Organization of Turn-taking for Conversation. In: Language, 50,4, 696-735. Samra-Fredericks, Dalvir (2005): Strategic Practice, 'Discourse' and the Everyday Interactional Constitution of 'Power Effects'. In: Organization, 12, 6,803-841. Scheffer, Thomas (2010): Adversarial Case-Making. An Ethnography of the English Crown Court. Amsterdam: Brill. Scheflen, Albert E. (1972): Body Language and Social Order: Communication as Behavioral Control. New Jersey: Englewood Cliffs. Schegloff, Emanuel A. (1968): Sequencing in Conversational Openings. In: American Anthropologist 70, 6,1075-1095. Schegloff, Emanuel A. (1991): Reflections on Talk and Social Structure. In: Boden, Deirdre/Zimmerman, Don (Hrsg.): Talk and Social Structure. Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press, 44-70. Schegloff, Emanuel A. (1992): In Another Context. In: Duranti, Alessandro/Goodwin, Charles (Hrsg.): Rethinking Context. Language as an Interactive Phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press, 191227. Schegloff, Emanuel A. (1992a). On Talk and its Institutional Occasions. In: Drew, Paul/Heritage, John (Hrsg.): Talk at Work. Interaction in Institutional Settings. Cambridge: Cambridge University Press, 101-136. Schegloff, Emanuel A. (1996): Issues of Relevance for Discourse Analysis: Contingency in Action, Interaction and Co-Participant Context. In: Hovy, Eduard H. (Hrsg.): Computational and Conversational Discourse. Burning Issues - an interdisciplinary account. Heidelberg: Springer, 3-38. Schegloff, Emanuel A. (1997): Whose text? Whose context? In: Discourse & Society, 8,165-187. Schegloff, Emanuel, A. (1972): Notes on an Conversational Practice. Formulating Place. In: Giglioli, Pier Paolo (Hrsg.): Language and Social Context. Harmondsworth: Penguin Books, 95-135. Schmitt, Reinhold (1999): Rollenspiele als authentische Gespräche. Überlegungen zu deren Produktivität im Trainingszusammenhang. In:
260
Bibliographie
Brünner, Gisela et al. (Hrsg.): Angewandte Diskursforschung. Band 2. Rudolfzell: Verlag für Gesprächsforschung, 81-99. Schneider, Wolfgang L. (2002): Grundladen der soziologischen Theorie. Weber - Parsons - Mead - Schütz. Band 1. Wiesbaden: VS. Schulz von Thun, Friedemann (1981): Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen. Reinbek: Rowohlt. Schulz von Thun, Friedemann (1989): Miteinander reden 2. Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung. Reinbek: Rowohlt. Schütz, Alfred (1962): Collected Papers I. Den Haag: Martinus Nijhoff. Schütz, Alfred (1971): Gesammelte Aufsätze. Band 1: Das Problem der sozialen Wirklichkeit. Den Haag: Nijhoff. Schütz, Alfred (1993): Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Schütz, Alfred/Parsons, Talcott (1977): Zur Theorie sozialen Handelns: Ein Briefwechsel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Schütze, Fritz et al. (1973): Grundlagentheoretische Voraussetzungen methodisch kontrollierten Fremdverstehens. In: Arbeitskreis Bielefelder Soziologien (Hrsg.): Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit 1. Symbolischer Interaktionismus und Ethnomethodologie. Reinbek: Rowohlt, 433-495. Schwartzman, Helen B. (1989): Meetings. Gatherings in Organizations and Communities. New York: Plenum. Schwitalla, Johannes (2006): Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt. Selting, Margret (2004): Listen: Sequenzielle und prosodische Struktur einer kommunikativen Praktik - eine Untersuchung im Rahmen der Interaktionalen Linguistik. In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft, 23,1-46. Selting, Margret et al. (1998): Gesprächsanalytisches Transkriptions- system (GAT). In: Linguistische Berichte, 173, 91-122. Selting, Margret et al. (2009): Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem (GAT 2). In: Gesprächsforschung. Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion, 10,353-402. [online] URL: www.gespraechsforschung-ozs.de Sharrock, Wes/Anderson, Bob (1987): Work Flow in a Pediatric Clinic. In: Button, Graham/Lee, John R. E. (Hrsg.): Talk and Social Organisation. Clevedon: Multilingual Matters, 244-260. Sidnell, Jack (2010): Conversation Analysis: An Introduction West Sussex: John Wiley & Sons.
Bibliographie
261
Silverman, David (1998): Harvey Sacks. Social Science and Conversation Analysis. Oxford: Oxford University Press. Silverman, David (2007): Interpreting Qualitative Data. Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction. London: Sage. Silverman, David/Gubrium, Jaber F. (1994): Competing Strategies for Analyzing the Contexts of Social Interaction. In: Sociological Inquiry, 64, 179-198. Sökeland, Jürgen (1993): Urologie. Stuttgart: Georg Thieme. Spiegel, Carmen (2009): Transkripte als Arbeitsinstrument: Von der Arbeitsgrundlage zur Anschauungshilfe. In: Birkner, Karin/Stukenbrock, Anja (Hrsg.): Die Arbeit mit Transkripten in Fortbildung, Lehre und Forschung. Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung, 7-15. Spieß, Erika/von Rosenstiel, Lutz (2010): Organisationspsychologie. Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder. München: Oldenbourg. Spittler, Gerd (2001): Teilnehmende Beobachtung als Dichte Teilnahme. In: Zeitschrift für Ethnologie, 126,1-25. Streeck, Jürgen (1996): How to Do Things with Things: Objets Trouvés and Symbolization. In: Human Studies, 19, 365-384. Suchman, Lucy (1987): Plans and Situated Actions. The Problem of Humanmachine Communication. Cambridge: Cambridge University Press. Suchman, Lucy (1996): Constituting Shared Workspaces. Engeström, Y./Middleton, D. (Hrsg.): Cognition and Communication at Work. Cambridge: Cambridge University Press, 35-60. Sudnow, David (1967): Passing On. The Social Organization of Dying. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Sudnow, David (1978): Ways of the Hand: The Organization of Improvised Conduct. London: Routledge & Kegan Paul. ten Have, Paul (2007): Doing Conversation Analysis: A Practical Guide. 2. Auflage. London: Sage. Tucholsky, Kurt (1961): Gesammelte Werke. Band 2. Reinbek: Rowohlt. Turner, Roy (1972): Some Formal Properties of Therapy Talk. In: Sudnow, David (Hrsg.): Studies in Social Interaction. New York: Free Press, 367-396. Varpio, Lara (2006): Mapping the Genres of Healthcare Information Work. Interactions Between Oral, Paper, and Electronic Forms of Communication. Dissertation, University of Waterloo. van Dijk, Teun (1993): Principles of Critical Discourse Analysis. In: Discourse and Society, 4, 249- 283.
262
Bibliographie
Walther, Sabine (1997): Im Mittelpunkt der Patient? Übergabegespräche im Krankenhaus. Stuttgart: Georg Thieme. Walther, Sabine (2003): Sprache und Kommunikation in der Pflege. Forschungsarbeiten und Publikationen zur mündlichen und schriftlichen Kommunikation in der Pflege. Eine kommentierte Bibliographie. Duisburg: Gilles & Francke. Watson, Rod (2000): The Character of 'Institutional Talk1: A response to Hester and Francis. In: Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse, 20, 3, 377-390. Weber, Max (2002): Wissenschaft als Beruf. In: Kaesler, Dirk (Hrsg.): Max Weber. Schriften von 1894-1922. Stuttgart: Kröner, 474-511. Whalen, Jack/Zimmerman, Don H. (1990): Describing Trouble. Practical Epistemology in Citizen Calls to the Police. In: Language in Society, 19, 465-92. Whyte, William F. (1943): Street Corner Society. Chicago: The University of Chicago Press. Widdicombe, Sue (1998): Identity as an Analysts' and a Participants' Resource. In: Antaki, Charles/dies. (Hrsg.): Identities in Talk. London: Sage, 191-206. Wilson, Thomas P. (1970): Normative and Interpretive Paradigms in Sociology. In: Douglas, Jack D. (Hrsg.): Understanding Everyday Life. Toward the Reconstruction of Sociological Knowledge. Chicago: Aldine, 57-79. Wiswede Günter (1977): Rollentheorie. Stuttgart: Kohlhammer. Wodak, Ruth et al. (1998): Zur diskursiven Konstruktion nationaler Identität. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Wolff, Stephan (1999): Organisationswissenschaftliche Grundlagen: Das Krankenhaus als Organisation. In: Pelikan, Jürgen M./ders. (Hrsg.): Das gesundheitsfördernde Krankenhaus. Weinheim/München: Juventa, 37-50. Wolff, Stephan (2001): Kategorisierungsanalyse. Manuskript.' Universität Wien. Wolff, Stephan (2006): Textanalyse. In: Ayaß, Ruth/Bergmann, Jörg (Hrsg.): Qualitative Methoden der Medienforschung. Reinbek: Rowohlt, 245-273. Wolff, Stephan (2008): Wie kommt die Praxis zu ihrer Theorie? Über einige Merkmale praxissensibler Sozialforschung. In: Kalthoff, Herbert/Hirschauer, Stefan/Lindemann, Gesa. (Hrsg.): Theoretische Empirie. Zur Relevanz qualitativer Forschung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 234-259. Wolff, Stephan/Müller, Hermann (1997): Kompetente Skepsis. Eine konversationsanalytische Untersuchung von Glaubwürdigkeit in Strafverfahren. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Bibliographie
263
Zegelin-Abt, Angelika (1998): Die Übergabe - ein überflüssiges Relikt? In: Heilberufe, 50,1. Zimmerman, Don H. (1992) The Interactional Organization of Calls for Emergency. In: Drew, Paul/Heritage, John (Hrsg.): Talk at Work: Interaction in Institutional Settings. Cambridge: Cambridge University Press, 418-469.
Verzeichnis der verwendeten Transkriptausschnitte # 1: # 2: # 3: # 4: # 5: # 6: # 7: # 8: # 9: # 10: # 11: # 12: # 13: # 14: # 15:
Geburtshilfe / MI / 'nachdem sie sich da=n bisschen aufgeregt hatte' ((28:30-29:32)) 12 Innere / 'hat ihn wahrscheinlich auch falsch verstanden' ((16:10-16:50)) 13 Innere / 'steht der um zehn uhr da auf dem stixplan' ((14:36-15:15)) 78 Innere / 'steht der um zehn uhr da auf dem stixplan' ((14:36-15:15)) 86 Innere / 'hat ihn wahrscheinlich auch falsch verstanden' ((16:10-16:50)) 87 Innere / 'glaub du warst jetzt länger nich da ne' ((1:03-1:20)) 98 Urologie / Vorgespräch / 'kommt nich noch der karl' ((8:48- 9:30) 101 Innere / 'glaub du warst jetzt länger nich da ne' ((1:17-1:49)) 107 Geburtshilfe / 'da sind keinerlei aufkleber' ((00:03-00:47)) 111 Innere / 'glaub du warst jetzt länger nich da ne' ((1:19-1:46)) 116 Geburtshilfe / 'da sind keinerlei aufkleber' (Auszug) 118 Infoblock Innere / 'das ist eine dame die alles hat' ((6:40-7:14)) 121 Innere / 'diabetikerin' (Auszug) 122 Geburtshilfe / 'aber mamma war einfach zu müde und zu kaputt' ((3:10-4:16)) 124 Geburtshilfe / 'so genau hab ich natürlich jetzt nich geguckt'
((2:50-3:13)) Innere / 'man kann sie auch auf die bettkante setzen' ((6:17-6:45)) Geburtshilfe / 'wie war das jetzt bei der anderen' ((31:28-32:02)) Geburtshilfe / 'dann hätt ich die bitte' ((11:57-13:01)) Urologie / 'und das warn se' ((05:35-07-18)) Urologie / 'herr punser' ((16:39-16:44)) Urologie / 'herr punser' ((16:39-16:49)) Innere / 'frau kreuzmann' ((17:32-19:40)) Geburtshilfe / 'frau kasseler' ((11:57-12:05)) Geburtshilfe / 'so genau hab ich natürlich jetzt nicht geguckt' ((1:39-3:09)) # 25: Geburtshilfe / 'tee mögen wer nich' ((5:42-7:02)) # 26: Geburtshilfe / 'also momentan geht es' ((28:30-29:02)) # 16: # 17: # 18: # 19: # 20: # 21: # 22: # 23: # 24:
125 126 126 128 132 146 151 152 153 154 158 161
Verzeichnis der verwendeten Transkriptausschnitte
# 27: Geburtshilfe / 'aber mamma war einfach zu müde und zu kaputt' ((3:10-4:16)) # 28: Geburtshilfe / 'ich hab ihr das genau gezeigt' ((07:03-07:52)) # 29: Geburtshilfe / 'nachdem sie sich da=n bisschen aufgeregt hatte' ((28:30-29:32)) # 30: Innere / 'glaub du warst jetzt länger nicht da ne' ((1:19-1:46)) # 31: Innere / 'muss immer ne weiße vorläge haben' ((17:32-19:40)) # 32: Innere / 'muss immer ne weiße Vorlage haben' ((Fortsetzung)) # 33: Geburtshilfe / 'wir nehmen diese großen tupfer' ((09:34-10:38)) # 34: Geburtshilfe / 'wir nehmen diese großen tupfer' ((Fortsetzung)) # 35: Urologie / 'muss man halt zwischendurch kucken' ((16:39-17:41)) # 36: Urologie/ 'muss man halt zwischendurch kucken' ((Fortsetzung)) # 37: Innere / 'und sie würd ich schon drehen in der nacht' ((19:28-19:42)) # 38: Geburtshilfe / 'sollte von uns heut morgen blutzucker kriegen' ((12:12-13:37)) # 39: Geburtshilfe / 'sollte von uns heut morgen blutzucker kriegen' ((Forsetzung)) # 40: Geburtshilfe / 'dann hätt ich die bitte' ((11:57-13:01)) # 41: Geburtshilfe / 'dann hätt ich die bitte' ((Fortsetzung)) # 42: Urologie / 'das kann ich dir garantiert jetzt nicht sagen' ((34:10-35:01))
265
162 165 167 183 186 190 194 195 197 198 200 202 203 205 207 209
Qualitative Soziologie Jörg R. Bergmann, Stefan Hirschauer, Herbert Kalthoff (Hrsg.) Band 17: Stephan Kirchschlager
,Natürlich is=es vorsondiert'
Eine konversationsanalytische Studie zu Vorgesprächen in Organisationen 2013. X/250 S., kt. € 44,-. ISBN 978-3-8282-0592-5
Vorgespräche zählen zu den Interaktionen, die weder im Formalprogramm von Organisationen niedergelegt sind, noch ausschließlich informell gehandhabt werden. Dieses Buch fragt aus der Forschungsperspektive der ethnomethodologischen Konversationsanalyse nach den konstitutiven Strukturmerkmalen der weit verbreiteten sozialen Form „Vorgespräch". Der Autor identifiziert, beschreibt und analysiert auf der Basis transkribierter Gespräche diejenigen Praktiken, durch die das Phänomen in methodischer Art und Weise im Organisationsalltag hergestellt wird. Ihren Fluchtpunkt wählt die Studie in dem vorwissenschaftlichen Erfahrungswissen, so wie es in den pragmatischen Formulierungen und Handlungsweisen der Praktiker/innen zum Ausdruck kommt. Der Autor zeigt, dass Vorgespräche eine in mehrfacher Hinsicht paradoxale Struktur aufweisen und kategorial gesehen nur unscharf von anderen Besprechungsformen unterschieden werden können, wie Organisationsmitglieder diese Grenzdurchlässigkeit situativ auszunutzen wissen und welche antizipatorischen, präventiven aber nur schwer zu instrumentalisierenden Qualitäten Vorgespräche auszeichnen.
Band 16: Tobias Röhl
Dinge des Wissens
Schulunterricht als sozio-materielle Praxis 2013. VIII/342 S., kt. € 38,-. ISBN 978-3-8282-0586-4
Wandtafel, Experiment und andere Dinge sind fester Bestandteil des Unterrichts und tragen zum Gelingen der schulischen Wissensvermittlung bei. Mit seiner ethnographischen Studie zum mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht eröffnet Tobias Röhl der Forschung einen Zugang zu dieser bislang vernachlässigten Dimension der Bildung. Die Studie verdeutlicht, dass die Leistung schulischer Dinge darin besteht, die Schüler zu angemessenen Rezeptionsweisen aufzufordern. Die sinnliche Gestaltung der Dinge und ihr Gebrauch treten dabei in ein Zusammenspiel. Damit sich an den Dingen etwas zeigen lässt, müssen die Lehrer sie als didaktische Objekte einführen und rahmen. Die Lehrer arbeiten hierzu an einer Vereindeutigung prinzipiell vieldeutiger Dinge und führen ihre Schüler so in die selektive Wahrnehmung einer Disziplin ein. Mit dieser Disziplinierung des Blicks härten sie zugleich eine Weltsicht, in der kulturelle Subjekte und materielle Objekte deutlich voneinander unterschieden sind.
L U C I U S
ruümi
«S>
Sfutfsart
Qualitative Soziologie Jörg R. Bergmann, Stefan Hirschauer, Herbert Kalthoff (Hrsg.) Band 15: Monika Falkenberg
Stumme Praktiken
Die Schweigsamkeit des Schulischen
2013. VI/314 S„ kt. € 39,-. ISBN 978-3-8282-0586-4
Was passiert, wenn man dem Geschehen in einer Schulklasse den Ton abdreht? Man sieht in ungewohnter soziologischer Schärfe das Kippeln gegen die Disziplin des Stillsitzens, überflüssige oder hochpräsente Körper, beschäftigte Hände und kompetente Blikke, die zielgenau die richtige Stelle im Nachbarheft treffen. Unterhalb des Unterrichtsgesprächs zeigen sich stumme Praktiken und eigensinnige Körper. Diese ethnografische Studie zum körperlichen Fundament sozialer Praxis ist auf eine gänzlich neue Weise gegen den Blick der scholastischen, diskurszentrierten Institution gestellt, die sie untersucht: nicht durch eine Fokussierung der peer culture jenseits schulischer Hierarchien, sondern durch die Betrachtung eines leicht übersehenen ,Gegenparts des Diskursiven' - die Schweigsamkeit des Schulischen. Die Studie von Monika Falkenberg will für die Soziologie verstehen, was ein Schüler zu sein - und gewesen zu sein - für einen Körper bedeutet. Sie rekonstruiert die körperlichen Bedingungen eines körperlosen Blicks auf die Welt, wie ihn die Schule einübt - und die Wissenschaft elaboriert.
Band 14: Elke Wagner
Der Arzt und seine Kritiker
Zum Strukturwandel medizinkritischer Öffentlichkeiten am Beispiel klinischer Ethik-Komitees 2011. VII/293 S., kt. € 4 6 , - . ISBN 978-3-8282-0551-2
Die Kritik am Arzt ist so alt wie die Medizin. Doch haben sich die Plausibilitäten des Kritischen gewandelt. Elke Wagner zeigt in ihrer Studie, wie sich im Fall der Medizin Formen des Kritischen einstellen, die sich nicht mehr länger auf den bürgerlichen Meinungsstreit begrenzen lassen, den Habermas in seiner Öffentlichkeitssoziologie vorgestellt hat. Die Sprache der Kritik orientiert sich nun nicht nur an besseren Argumenten sondern an Gefühlen und dem authentischen Erleben eines Krankenhausalltages. In diese Form der Rede wird schließlich auch der Arzt involviert, wenn er an dem ethisierten Kritiker-Diskurs partizipiert. Die Studie erarbeitet historisch und anhand aktueller medizinkritischer Debatten einen instruktiven Blick auf die Diskussion um den Arzt und die medizinische Entscheidungsfindung.
'Lucius
s ttsld
"-
Qualitative Soziologie Jörg R. Bergmann, Stefan Hirschauer, Herbert Kalthoff (Hrsg.) Vorschau Band 19: Stefan Hirschauer, Birgit Heimerl, Anika Hoffmann, Peter Hofmann
Soziologie der Schwangerschaft Explorationen pränataler Sozialität 2014. VI/305 S„ kt. ca. € 22,80. ISBN 978-3-8282-0606-9
Eine Soziologie der Schwangerschaft gibt es nicht. Dieses Buch will sie ins Leben rufen. Es begreift das Schwangersein als einen grundlegenden sozialen Prozess: als eine kommunikative Tatsache, die festgestellt wird und sich herumspricht, als Beziehungsgeflecht zwischen Ungeborenen, Austragenden, Ko-Schwangeren und Publikum, sowie als kollektiven Erwartungszustand, in den Frauen durch eine soziale Schwängerung hineingeraten. Das Buch verfolgt diesen Prozess auf der Basis einer langjährigen explorativen Studie: die soziale Geburt einer Schwangerschaft in der Entdeckung durch Paare und deren Coming Out als werdende Eltern, die Herstellung eines inwändigen Anderen in den visuellen Kontakten des Ultraschalls und den leiblichen Sondierungen der Kindsregungen, sowie die Formierung des Ungeborenen als Person durch Geschlechtszuschreibung und Namensgebung. Ein erwartetes Kind wird zur Person, indem mit der organischen Teilung von Körpern zugleich eine soziale Bindung konstituiert wird.
Inhaltsübersicht 1. Einleitung: Neuland Schwangerschaft Die soziale Geburt der Schwangerschaft
2. Entdeckungen und Feststellungen: Zeichen im Erwartungskontext 3. Coming Out: Die Herstellung des Schwangerschaftspublikums Die Konstitution eines inwändigen Anderen
4. Visuelle Sondierungen: Apparativ vermittelte Sichtkontakte 5. Leibliche Sondierungen: Kindsregungen und Körperkontakte Die Formierung der Person
6. Geschlechtliche Fixierungen: Das Gendering des Ungeborenen 7. Sprachliche Fixierungen: Die pränatale Namensfindung 8. Schluss: Soziale Schwangerschaft und inwändige Personen Literatur
Lucius
®
^

![Arbeitsrecht im Krankenhaus [2. neu bearbeitete Auflage]
9783504381882](https://ebin.pub/img/200x200/arbeitsrecht-im-krankenhaus-2-neu-bearbeitete-auflage-9783504381882.jpg)
![Die Ausstellung verhandeln: Von Interaktionen im musealen Raum [1. Aufl.]
9783839429884](https://ebin.pub/img/200x200/die-ausstellung-verhandeln-von-interaktionen-im-musealen-raum-1-aufl-9783839429884.jpg)
![Interaktionen in Kindertageseinrichtungen: Theorie und Praxis im interdisziplinären Dialog [1 ed.]
9783666702259, 9783525702253](https://ebin.pub/img/200x200/interaktionen-in-kindertageseinrichtungen-theorie-und-praxis-im-interdisziplinren-dialog-1nbsped-9783666702259-9783525702253.jpg)
![Führen im Krankenhaus: Betriebswirtschaft, Recht, Organisation, Kommunikation für Leitende Ärzte [1. Aufl.]
9783662609811, 9783662609828](https://ebin.pub/img/200x200/fhren-im-krankenhaus-betriebswirtschaft-recht-organisation-kommunikation-fr-leitende-rzte-1-aufl-9783662609811-9783662609828.jpg)
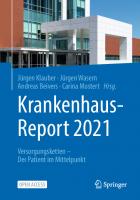
![Patientenorientierte Digitalisierung im Krankenhaus: IT-Architekturmanagement am Behandlungspfad [1. Aufl.]
9783658267865, 9783658267872](https://ebin.pub/img/200x200/patientenorientierte-digitalisierung-im-krankenhaus-it-architekturmanagement-am-behandlungspfad-1-aufl-9783658267865-9783658267872.jpg)


